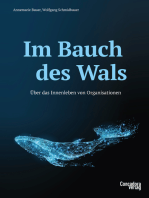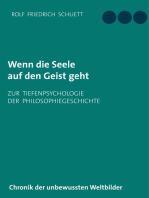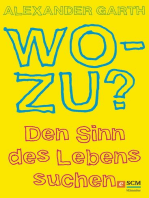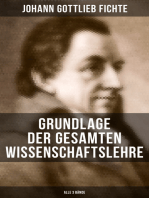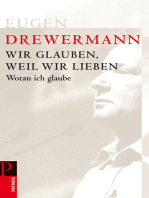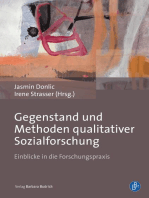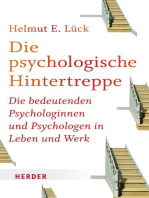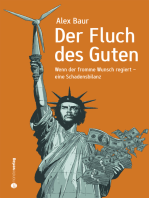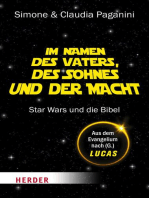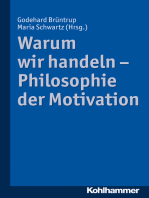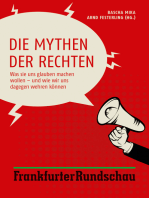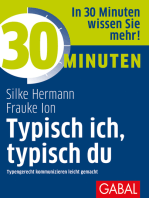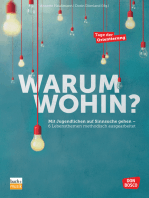Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Schonpflug Psychologie SeelenlehreKapitel 3 PDF
Schonpflug Psychologie SeelenlehreKapitel 3 PDF
Hochgeladen von
Axel Voss0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
30 Ansichten33 SeitenOriginaltitel
Schonpflug-Psychologie-SeelenlehreKapitel-3.pdf
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
30 Ansichten33 SeitenSchonpflug Psychologie SeelenlehreKapitel 3 PDF
Schonpflug Psychologie SeelenlehreKapitel 3 PDF
Hochgeladen von
Axel VossCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 33
3 Seelenlehren in Metaphysik,
Natur- und Kulturwissenschaften
Die Stellung der Psychologie
unter den wissenschaftlichen Disziplinen
Land pflegt man genau zu vermessen. Man teilt es in Stcke; jedes Stck wird einem rechtmigen
Besitzer zugewiesen. Auch Wissensgebiete werden aufgeteilt. Man kann jedes Wissensgebiet einer
btstimmten Wissenschaft zuordnen. Eine und nur eine Gruppe von Wissenschaftlern ist dann fr
je?es Wissensgebiet zustndig. Nach diesem Denkmuster knnte man behaupten: Das Wissensgebiet
derSeele geh?rt der Psychologie, und zwar ganz und ausschlielich. Doch so einfach ist es nicht. Das
"weite Land der Seele" (Schnitzler, 1997) ist weder leicht zu vermessen noch eindeutig zu teilen. So
sirldes Vertreter verschiedener Wissenschaften, die es besetzen undpflegen- nicht nur Psychologen.
eine Einzeldisziplin ist, welche allein Lehre und Forschung ber die Seele
Erscheinungen (s. Kap. 1) betreibt, wirft eine Reihe von Fragen auf: Warum besitzt Psycho-
die alleinige Zustndigkeit? Mit welchen anderen DisziplineJ) teilt sie ihre Fragestellungen
und Erkenntnisse? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede bestehen zwischen der Psy-
chologi.e undihten Nachbarn? Warum existieren berhaupt verschiedene Wissenschaften, die sich
mit den gleichenoder hnlichen Problemen befassen? Wie arbeiten sie zusammen? Und wre es
nichtbesset, sie Wrden ihre Teilung berwinden und sich zusammenschlieen zu einer umfassen-
derfSeelen-und Lebenswissenschaft?
Wer wissen will:Was ist Psychologie?, sollte also nicht versumen, seinen.Blick auch auf die ihr
verwandten Disziplinen zu werfen. Diese werden im folgenden in drei Gruppen vorgestellt:
".Metaphysik,
"Naturwissenschaften,
..... Klllturwissenschaften.
Metaphysik behandelt das Leben in jenseitigen, d.h. bernatrlichen Welten und Ordnungen jen-
seit$der unmittelbaren Erfahrung. Natur- und Kulturwissenschaften betrachten das Leben in der als
diesseitig erfahrenen Welt. Dabei untersuchen die Naturwissenschaften vorzugsweise das Leben der
lrtdividuen, wie es sich naturgegeben und ohne Umgestaltung durch den Menschen vollzieht. Die
Ktilturwissenschaften befas$en sich dagegen mit den Schpfungen des Menschen - einschlielich
der menschlichen Gesellschaft selbst. Der Begriff der Kulturwissenschaft fasst dabei zwei gebruch-
lichere Begriffe zusammen: Geistes- und Sozialwissenschaften.
Dievergleichende Betrachtung wird ergeben: Die gegenwrtige Psychologie erstreckt sich sowohl
indieNaturwissenschaften als auch in die Kulturwissenschaften. Von der Metaphysik hat sich Psy-
chologie als moderne Wissenschaft weitgehend abgewandtj gleichwohl sind einige Verbindungen
geblieben. Wer die Vielfalt miteinander vernetzter Disziplinen fr eine Zersplitterung hlt, wird
nach grerer Einheit in der Wissenschaft rufen. Dann bietet sich Psychologie als bergreifende
Lebenswissenschaft an, welche verwandte Disziplinen integriert. Doch die Vielfalt der Disziplinen
hat einen guten Grund: Sie bringt Leistungsvorteile durch Spezialisierung. Durch Spezialisierung
suchen auch Vertreter der Psychologie ihr eigenes Fach leistungsfhiger zu machen. Sie gliedern die
Psychologie nach dem Vorbild benachbarter Disziplinen. Zum einen bilden sie Schwerpunktfcher,
zum anderen natur-, geistes- und sozialwissenschaftliehe Richtungen.
3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften I 67
3.1 Psychologie am Scheideweg
zwischen Metaphysik und
Naturlehre
3.1.1 Psychologie und Religion
Metaphysik im ersten Sinne: Lehren von berna-
trlichen Welten. Eine durch ihr Alter ehrwrdige
und weit verbreitete Seelenlehre lautet: Alle Men-
schen mssen sterben. Eines Tages wird die ge-
samte Welt enden. Doch am Weltende werden
die Toten auferstehen, und in einer neuen Welt
werden die Guten ein ewiges und glckseliges
Leben genieen. berliefert ist eine Vision des
christlichen Apostels Johannes, die das Weltende
schildert, als sei es bereits Ereignis: "Und das
Meer gab die Toten heraus ... und der Tod und
sein Reich gaben die Toten heraus ... ; und sie
wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken."
Wer die Prfung besteht, wird aufgenommen in
"einen neuen Himmel und eine neue Erde." Und
er wird zu denen gehren, denen die Offen-
barung verspricht: "Gott wird abwischen alle
Trnen von ihren Augen und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein" (Lutherbibel, 1994,
S.304f.).
Vier Annahmen weisen die Auferstehungs-
lehre als eine Lehre vom bernatrlichen Leben
aus:
Es existiert eine Welt auerhalb des natr-
lichen Lebensraums und der natrlichen Le-
benszeit.
In dieser Welt leben bernatrliche Wesen.
In dieser Welt herrschen Weisheit und Macht,
die alle natrlichen Fhigkeiten bersteigen.
In dieser Welt vollziehen sich bernatrliche
Ereignisse und Handlungen.
Es gibt kaum eine Kultur ohne Glauben an ber-
natrliche Wesen. Solche Wesen sind oft Natur-
gottheiten mit Macht ber Naturerscheinungen -
wie Regen-, Meeres- und Sonnengtter - sowie
Schutzgtter fr Sippen und Vlker. Manche
der Wesen tragen deutliche Zge irdischer Men-
sehen - z.B. lebt das germanische Gtterpaar
Wotan und Fricka im Ehestand und leidet unter
familirem Zwist.
Lehren von bernatrlichen Welten, Wesen
und Ereignissen haben in der Wissenschaft eine
lange Tradition. Man bezeichnet sie - einer Be-
griffsbildung aus der Antike folgend - als Meta-
physik (griech. ta meta ta physika: was nach der
Naturkunde kommt). Die Lehren vom berna-
trlichen werden somit getrennt von der Natur-
lehre, die als Physik (griech. physike theoria: Na-
turbetrachtung) bezeichnet wird.
Religion, Seelsorge, Pastoralpsychologie. Lehren
von berirdischen Welten und Wesen sind meist
mehr als unverbindliche Erzhlungen. Sie werden
zu Glaubensgewissheiten von Gemeinden, ja von
Vlkern. Zu dem Glauben an berirdische Wesen
gehren Furcht vor ihrer Macht und Hoffnung
auf ihre Hilfe. Aus beiden Grnden genieen
berirdische Verehrung; Glubige rufen sie in
Gebeten an. Mit dem Glauben geht somit ein
Kult einher. Die Verbindung von Gottesglauben
und Kult nennt man Religion (lat. religio: Gottes-
furcht).
Fortgeschrittene Religionen - zu ihren dauer-
haftesten und mchtigsten gehren neben dem
Juden- und Christentum der Islam, der Buddhis-
mus und der Hinduismus - zeichnen sich durch
eigene, bestndige Organisationen aus, durch
Bekennergemeinden. Die Gemeinden unterhalten
in der Regel Priestermter. Die Fhrer der Reli-
gionen sorgen fr die Dokumentation der Lehren
(z.B. den Druck von Bibeln mit den magebli-
chen Grndungsschriften des Juden- und Chris-
tentums, dem Alten und dem Neuen Testament)
und fr die Verbreitung ihrer Lehren im Unter-
richt.
Zur Pflege der Religion finden Gottesdienste
mit symboltrchtigen und kunstsinnigen Ritualen
statt. Innerhalb wie auerhalb der Gottesdienste
betreiben kirchliche Organisationen Seelsorge.
berhaupt sind Glaube und Kult mchtige Krf-
te; sie vermitteln Hoffnung und Furcht, sie kn-
68 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
nen Gesundheit frdern, aber auch Krankheit
erzeugen. Seelsorge zielt nicht nur auf jenseitiges
Heil. Sie will auch zum irdischen Glck beitragen
und den sozialen Frieden frdern. So leisten Ge-
meindepriester und ihre Helfer Erziehungs-,
Lebens- und Krisenberatung.
Die kirchliche Seelsorge weist betrchtliche
bereinstimmungen mit fachpsychologischer Be-
ratung und Therapie auf. Die Beichtgesprche in
christlichen Kirchen sind mit psychologischen
Therapiegesprchen zu vergleichen - als WIr-
kungsvolle Manahmen zur Befreiung von
Schuldgefhlen. In Katastrophenfllen - Z.B.
nach Flugzeug- und Eisenbahnunglcken - pfle-
gen Priester und Fachpsychologen gemeinsam die
Betreuung von berlebenden sowie von Angeh-
rigen der Opfer zu bernehmen. So entstehen
ber praktische Aufgaben Brcken zwischen
Psychologie und Religion. Die rechte Behandlung
von Gemeindemitgliedern, die praktische Seel-
sorge sowie die Beratung und Untersttzung in
individuellen bergangs- und Notsituationen
wird damit zu einem der Psychologie zugeordne-
ten Lehr- und Wissensgebiet. Man bezeichnet es
als Pastoralpsychologie (lat. pastor: Hirte). Das
Fach Pastoralpsychologie ist in der Aus- und
Weiterbildung von Priestern und Gemeindehel-
fern angesiedelt.
Theologie, Religionswissenschaft. Die Auslegung
und Fortentwicklung religiser Lehren, ihre hu-
fige Strittigkeit stellen Herausforderungen fr
Gelehrte dar. Sie unternehmen Erklrungen fr
schwer Verstndliches, treffen mitunter sogar Ent-
scheidungen in Streitfragen. Ihre Lehrmeinungen
bilden die Disziplin der Theologie (griech. theos:
Gott).
Wichtige Einrichtungen der Theologie sind
Bibliotheken, in denen die zentralen Lehrschrif-
ten (wie die christlichen Evangelien) aufbewahrt
und deren Auslegungen dokumentiert werden. In
Zentren fr religise Studien widmen sich Ge-
lehrte den schwierigsten und aktuellsten Proble-
men ihrer Religion. Theologische Einrichtungen
sind in der Regel Glaubensgemeinschaften zuge-
ordnet. Ein wichtiger Grund hierfr: Sie sind fr
die Ausbildung der Priester jener Gemeinschaften
zustndig. Dies verpflichtet freilich zu Rechtglu-
bigkeit und Kirchentreue, und diese schrnken
die wissenschaftliche Freiheit ein.
Dem Bedrfnis nach Unabhngigkeit von
Kirchen verdankt eine andere Disziplin ihre Exis-
tenz: die Religionswissenschaft. Religionswissen-
Knnen moderne Psychologen glubige Chris-
ten, Juden, Muslime o.. sein?
Nicht wenige naturwissenschaftlich arbeitende
Psychologen sind glubige Christen oder Ange-
hrige anderer Religionsgemeinschaften. Wis-
senschaft mit ihrer Zuwendung zum Diesseits
und die auf das Jenseits gerichtete Religion sind
fr sie wohl zu trennende Bereiche. In dem
einen Bereich herrschen die Methoden der
strengen Beobachtung und der vernunftgelei-
teten Begrndung, in dem anderen der Glaube
und das Einverstndnis mit Glaubensgenossen.
Wissenschaftliche und religise Identitt wei-
chen in solchen Fllen voneinander ab. Die
Doppelidentitt, die somit entsteht, braucht die
Betroffenen freilich nicht zu belasten (zur Frage
der Mehrfachidentitt s. Kap. 1.3).
Die Religiositt von Fachkollegen erregt in
der heutigen Psychologie weder Aufsehen
noch Ansto. Denn so wenig wissenschaftliche
Beobachtungen zum Nachweis einer metaphy-
sischen Seele und eines Jenseits geeignet sind,
so wenig strenge Beweise gibt es fr ihre
Nichtexistenz. Mit naturwissenschaftlichen
Methoden liee sich ber ein Jenseits, falls
es dieses gbe, kaum Wissen erwerben. Wis-
senschaft kann Jenseitslehren weder anerken-
nen noch ablehnen. Deshalb verhalten sich
moderne Psychologen meist schweigsam ge-
genber religisen Bekenntnissen und ber-
haupt gegenber metaphysischen Seelen-
lehren.
3.1 Psychologie am Scheideweg zwischen Metaphysik und Naturlehre I 69
earl Gustav Jung
(1875-1961) wirkte als
Psychiater in Zrich und
lehrte als Professor an der
dortigen Universitt (mehr
ber Jung in Kap. 8.3.1)
Karoly n ~ n y i (1897-
1973) war seit 1936 Pro-
fessor fr Religionswissen-
schaft an der Universitt
Fnfkirchen (Ungarn);
seit 1948 widmete er sich
am c.-G.- Jung-Institut
(s. wieder Kap. 8.3.1) der
Erforschung der griechi-
schen Mythologie
Das Urbild des "gttlichen Kindes" - eine der grundlegenden sozialen Kognitionen
Zur menschlichen Existenz gehren Geburt und Tod, Mutter, Vater, Bruder und Schwester. Das
menschliche Leben begleiten Sonne und Mond, Blitz und Donner. Haben sich solche Erfahrungen
den Menschen tief eingeprgt? Gehren sie zu den bevorzugten Gesprchsgegenstnden? Werden sie
von Generation zu Generation weitergegeben - durch Unterweisung oder sogar durch Vererbung?
Manche Forscher nehmen an: Menschen teilen Grunderfahrung. Diese Grunderfahrung braucht
ihnen nicht bewusst zu werden. Doch sie taucht in den Mythen, den Erzhlungen, und den bild-
lichen Darstellungen auf, welche Kulturen hervorbringen und erhalten. Auch religise Geschichten
und Bilder enthalten also Urthemen und Urbilder, deren Analyse fr die psychologische Forschung
ergiebig ist. Psychologische Analyse und theologische Exegese treffen sich demnach bei der Unter-
suchung der religisen berlieferung.
earl Gustav Jung und Karoly n ~ n y i haben gemeinsam nach Urbildern in der Kulturgeschichte
gesucht und sind dabei auf das Thema des Gottes in Gestalt eines Knaben, des "Urkindes in der
Urzeit" gestoen. Jung und Kerenyi (1941, S. 124ff.) fhren dazu aus:
Das "Kind" hat bald mehr den Aspekt der Kindgottheit, bald den des jugendli-
chen Helden. Beide Typen haben die wunderbare Geburt und die ersten Kind-
heitsschicksale, die Verlassenheit und die Gefhrdung durch Verfolger gemeinsam.
Der Gott ist reine bernatur, der Held hat menschliches, aber bis zur Grenze der
bernatur gesteigertes Wesen ("Halbgttlichkeit"). Whrend der Gott, nament-
lich in seiner intimen Beziehung zum symbolischen Tier, das noch nicht in
menschliches Wesen integrierte, kollektive Unbewusste personifiziert, begreift der
Held in seiner bernatrlichkeit menschliches Wesen ein und stellt daher eine
Synthese des ("gttlichen", d.h. des noch nicht humanisierten) Unbewuten und
des menschlichen Bewutseins dar. Er bedeutet mithin eine potentielle Vorweg-
nahme einer der Ganzheit sich annhernden Individuation.
Die "Kind"-Schicksale drfen daher als Darstellungen jener psychischen Ereig-
nisse, welche sich bei der Entelechie oder Entstehung des "Selbst" abspielen, be-
trachtet werden. Die"wunderbare Geburt" versucht die Art des Entstehungser-
lebnisses zu schildern. Da es sich um eine psychische Entstehung handelt, so mu
alles in unempirischer Weise geschehen, also z.B. durch jungfruliche Geburt
oder durch wunderbare Zeugung oder durch Geburt aus unnatrlichen Organen. Das Motiv der
" Unansehnlichkeit", des Ausgeliefertseins, der Verlassenheit, der Gefhrdung usw. versucht die pre-
kre psychische Existenzmglichkeit der Ganzheit, d.h. die enorme Schwierigkeit, dieses hchste Gut
zu erringen, darzustellen. Ebenso wird damit auch die Ohnmacht und Hilflosigkeit jenes Lebens-
dranges charakterisiert, welcher alles Wachsende unter das Gesetz der mglichst vollstndigen Selbst-
erfllung zwingt, wobei die Umwelteinflsse in mannigfaltigster Form jeder Individuation die gr-
ten Hindernisse in den Weg legen. Besonders die Bedrohung der Selbsteigenheit durch Drachen und
Schlangen weist auf die Gefahr hin, da die Bewutseinserwerbung von der Instinktseele, dem Un-
bewuten, wieder verschluckt wird. . , .
Das Motiv "kleiner als klein, doch grer als gro" fgt zur Ohnmacht die ergnzenden, ebenso
wunderbaren Taten des "Kindes". Diese Paradoxie gehrt zum Wesen des Helden und zieht sich wie
ein roter Faden durch sein ganzes Lebensschicksal. Der grten Gefahr ist er gewachsen und geht am
70 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
"Unansehnlichen" doch schlielich zugrunde, Baldur an der Mistel, Maui am Lachen eines kleinen
Vogels, Siegfried an der einen verwundbaren Stelle, Herakles am Geschenk seiner Frau, andere durch
gemeinen Verrat usw.
Die Haupttat des Helden ist die berwindung des Dunkelheitsungeheuers; es ist der erhoffte und
erwartete Sieg des Bewutseins ber das Unbewute. Tag und Licht sind Synonyme des Bewutseins,
Nacht und Dunkel die des Unbewuten. Die Bewutwerdung ist wohl das erste urzeitliche Erlebnis,
denn damit ist die Welt geworden, von deren Existenz vorher Niemand etwas wute. "Und Gott
sprach: Es werde Licht!" ist die Projektion jenes vorzeitlichen Erlebnisses der vom Unbewuten sich
trennenden Bewutheit. ... Darum zeichnet sich schon das "Kind" durch Taten aus, welche aufdie-
ses Ziel der Dunkelheitsbesiegung hinweisen.
Jung, c. G. & Kereny, K. (1941). Einfhrung in das Wesen der Mythologie. Amsterdam: Pantheon.
Abbildung 3.1. Die Geburt des Dionysos (Ausschnitt aus
griechischer Vasenmalerei, ca. 410 v. Chr.). Dionysos gilt
in der griechischen Mythologie als Gott der Fruchtbar-
keit, des Weines und der Ekstase. Nach der Legende hat
ihn sein Vater Zeus bis zur Geburt in seinem Schenkel
getragen; denn seine Mutter, die Nymphe Semeie, sei
unter den Strahlen des Zeus verbrannt. Auf der Vase
"entbindet" ein Hirte den Neugeborenen aus dem
Schenkel des Vaters
Abbildung 3.2. Jesus mit Maria sowie Knigen aus dem
Morgenland (dt. Buchmalerei, 15. Jahrhundert). Nach
christlicher berlieferung ist Jesus der Sohn Gottes.
Seine Mutter Maria hat ihn unmittelbar vom Heiligen
Geiste empfangen. Die Geburt Jesu ereignet sich in ei-
nem Stall. Auf wunderbare Weise wird die Ankunft des
Kindes bekannt. Ein Stern fhrt drei Knige aus dem
Morgenland zu dem Kinde
3.1 Psychologie am Scheideweg zwischen Metaphysik und Naturlehre I 71
I
schaft betrachtet den Jenseitsglauben und kirch-
liche Praxis als geistige und soziale Erscheinun-
gen. Dabei stellt sie oft Vergleiche zwischen ver-
schiedenen religisen Richtungen an. Sofern sie
konfessionell ungebunden betrieben wird, zhlt
Religionswissenschaft zu den Kulturwissenschaf-
ten (s. Kap. 3.4).
Religionspsychologie. Erneut ist darauf hinzu-
weisen: Psychologie als moderne Disziplin steht
im Gefolge der Aufklrung. Daher macht sie sich
weder religise Lehren zu eigen noch unterwirft
sie sich der Macht von Kirchen (s. Kap. 1.2.1 und
2.1.1). Gleichwohl: Religionen sind ein Stck der
kulturellen Wirklichkeit. Ihre Glaubenslehren -
bei fortgeschrittenen Religionen scharf- und
tiefsinnig gestaltet - sind hervorragende Denk-
leistungen. Sie ziehen das Interesse der Theoreti-
schen Psychologie an (s. Kap. 2.2).
Auch wer den Wahrheitsgehalt von Jenseitsleh-
ren bestreitet, wer zumindest vom wissenschaftli-
chen Standpunkt aus nicht zu deren Richtigkeit
Stellung nehmen will, wird doch deren Bedeu-
tung im menschlichen Denken anerkennen. Gt-
ter, Engel, Verdammnis, Erlsung usw. sind In-
halte der menschlichen Vorstellung, fllen das
Gedchtnis, werden begrifflich geordnet und
Schlussprozessen unterworfen; es sind Kognitio-
nen. Und da Personen, Ereignisse und Erklrun-
gen aus religisen Lehren von vielen Glubigen
geteilt, in kirchlichen Organisationen gepflegt
und ber Generationen weitergegeben werden,
zhlt man sie zu den sozialen Kognitionen.
Zum Weiterlesen
Religions und Pastoralpsychologie
Einfhrungen in die Religions- und Pastoralpsycholo-
gie sind:
Utsch, M. (1998). Religionspsychologie. Vorausset-
zungen, Grundlagen, Forschungsberblick. Stutt-
gart: Kohlhammer.
Scharfenberg, J. (1994). Einfhrung in die Pastoral-
psychologie. Gttingen: Vandenhoek & Ruprecht.
Als soziale Kognitionen verstanden, sind religise
Inhalte mit den Mitteln der naturwissenschaftlich
orientierten Psychologie zu erfassen. Man kann
ihre Verbreitung feststellen (z.B. "Wie viele Men-
schen glauben an Gott?") sowie ihre Wirkungen
(z.B. "Sind glubige Menschen glcklicher?").
Man kann ihrer Herkunft nachgehen (z.B. "Wie
wichtig ist das Vorbild der Eltern fr den Glau-
ben?"). berhaupt ist die Frage aufzuwerfen:
Welche Rolle spielt Religion im Leben der Men-
schen? Und man kann dabei sogar Vergleiche
zwischen verschiedenen Religionen anstellen.
Solchen Studien dient eine eigene Richtung der
Psychologie, die Religionspsychologie.
Parapsychologie. Man braucht nicht Anhnger
einer Religionsgemeinschaft zu sein, um an die
Existenz von Geistern, an das Weiterleben der
Seelen Verstorbener sowie an das Wirken geisti-
ger Krfte zu glauben. Es gibt auch konfessionell
ungebundene Menschen, die reine Geister und
geistige Krfte fr mglich halten, welche der
natrlichen Welt angehren. Es sei dies eben ein
bisher nur unzureichend erforschter Teil der
Natur. So betrachtet, steht die angenommene
Geisterwelt nicht auerhalb dieser Welt, sondern
allenfalls auerhalb der gewhnlichen sinnlichen
Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnis.
Man hat sie ebenfalls als "bernatrlich" be-
zeichnet; gemeint ist damit jedoch nur "bersinn-
lich", nicht "berirdisch".
Die moderne Psychologie hat Lehren ber
Geistwesen (wie Engel, Seelen Verstorbener),
geistige Krfte (wie Energien, die entfernte Ge-
genstnde in Bewegung setzen) sowie durch Ver-
nunft auszuschlieende Erkenntnisse (wie die
Vorausschau zuknftiger Ereignisse) berwie-
gend als Aberglauben oder als berbleibsel ber-
holter religiser Vorstellungen abgelehnt. Nur
wenige anerkannte psychologische Forscher schenk-
ten ihnen weiterhin Aufmerksamkeit.
Doch tauchten stets neue Berichte ber erfah-
rungswidrige, "bersinnliche" Erscheinungen auf,
darunter solche, deren Glaubwrdigkeit nicht zu
72 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
erschttern ist und die deshalb eme Erklrung
verdienen. Max Dessoir (1917) hat vorgeschla-
gen, ihre Erforschung nicht vllig zu unterlassen,
sondern ihnen wenigstens einen Platz "neben der
Psychologie" einzurumen. Seitdem trgt das Ge-
biet den Namen "Parapsychologie" (griech. para:
neben).
Neuere Vertreter der Parapsychologie wie Wal-
ter von Lucadou (1995) sehen ihre Aufgabe darin,
erfahrungswidrige Phnomene, soweit sie auf
Selbsttuschung oder Betrug beruhen, als solche
aufzuklren. Im brigen seien aber die Fort-
schritte der modernen Physik zu nutzen, um
bisher Unerklrbares als natrlich zu erklren.
Zum Weiterlesen
Parapsychologie
Ist die Parapsychologie als Wissenschaft ernst zu neh-
men? Welche ihrer Probleme verdienen die Mhe der
weiteren Untersuchung? Diese Fragen behandelt ein
Buch, dessen Autor den einzigen Lehrstuhl fr Para-
psychologie an einer deutschen Universitt inne hatte:
Bender, H. (1980). Parapsychologie. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Die Parapsychologie muss sich vor Lgnern und Be-
trgern schtzen. Zudem beruhen manche unge-
whnliche Erscheinungen auf Selbsttuschung.
Tuschungsflle hat ein Schler Benders zusammen-
gestellt:
Mller, 1. (1980). Para, Psi und Pseudo. Berlin:
Ullstein.
3.1.2 Psychologie und Transzendental-
philosophie
Metaphysik im zweiten Sinne: Lehren vom Jen-
seits der Erfahrung. Ein Junge erhlt als Ge-
schenk ein Fahrrad, und er freut sich. Ein Stein
fliegt gegen eine Glasscheibe, und das Glas zer-
bricht. In beiden Fllen gibt es einen Grund (Ge-
schenk, Stein) und eine Folge (Freude, Glas-
bruch). Beides sind Flle von Verursachung, von
Kausalitt. Wie kommt die Kausalitt in diese
Welt? Wie ist es mglich, dass Menschen Kausali-
tt wahrnehmen, an Kausalitt denken? Man
kann nun argumentieren: Kausalitt muss als
Mglichkeit vorgegeben sein, damit sich auf die-
ser Welt Grund-Folge-Beziehungen verwirkli-
chen. Und Menschen mssen den Begriff der
Kausalitt bereits besitzen, bevor sie ihn anwen-
den knnten; sonst wrden sie nmlich Grund
und Folge lediglich als Nacheinander erfahren.
Ebenso als Mglichkeit dem Denken vorgege-
ben: der Begriff der Zeit. Im Besitz des Zeitbe-
griffs wird als stetiger Fluss aufgefasst, was sonst
nur als Nacheinander von Ereignissen erfahrbar
wre. Weitere vorgegebene Mglichkeiten dieser
Welt: Zahlen sowie mathematische und geomet-
rische Gesetze. Die Zahl 12, dass die Zahlen 3 und
5 ein Produkt von 15 bilden, dass im Dreieck die
Summe aller Innenwinkel 180
0
betrgt. Immer
wieder die These: Dem Denken muss die Mg-
lichkeit, sie zu begreifen, vorgegeben sein, bevor
sie in der Wirklichkeit erkannt werden (z.B. beim
Zhlen von Personen, beim Berechnen von
Grundstcken). Selbst moralische Begriffe wer-
den der Welt der Mglichkeiten zugeordnet - vor
allem der Begriff des Guten als Voraussetzung fr
Urteile ber Recht und Sitte.
Nach solchen berlegungen kann man ein
Jenseits der Erfahrung entwerfen: Grundbegriffe,
Grundgesetze, Grundwerte. Sie stellen Vorgaben
dar fr die Erkenntnis. Allein Vernunft vermag
diese Vorgaben zu erschlieen. Dabei ist die Ver-
nunft auf sich allein gestellt; sie muss die Erfah-
rung berschreiten, transzendieren (lat. trans-
cendere: berschreiten). Aufgabe der kritischen
Vernunft ist es, die Welt der Wahrheit und des
Werts zu erkunden, auf die sich Erkenntnis und
Moral grnden. Die Richtung, welche sich diesem
Programm verschrieben hat, nennt man Trans-
zendentalphilosophie.
Die Transzendentalphilosophie setzt auf die
Kraft der Vernunft. Sie hat mit dem Werk des
Philosophen Kant (vor allem Kant, 1968) der
Aufklrung starke Impulse gegeben. Die Welt der
Mglichkeiten, die sie durch Vernunft erschlie-
en wollte, hat sie von der durch sinnliche Erfah-
3.1 Psychologie am Scheideweg zwischen Metaphysik und Naturlehre I 73
l
Esoterik, Okkultismus, Mystik
Die Metaphysik hat mit ihren khnen Ideen
hohe Mastbe fr die Wissenschaft gesetzt. Mit
einer Mischung aus abstraktem Denken und
anschaulichen Bildern hat sie viele Anhnger
angezogen. Licht und Schatten, Hhe und Tiefe
- das waren zwei Gegensatzpaare, mit denen sie
beeindruckte. Damit schuf sie fr Wissenschaft
ein doppeltes Motto: "In lichte Hhen" und
"Hinab in die Tiefe, den Dingen auf den Grund
gehen". Das bedeutete einerseits Eindringen in
hhere Welten, wo der allwissende Geist waltet
und Geheimnisse offenbart. Andererseits bedeu-
tet es, in die Tiefe der Erde, des Menschen, des
Lebens und des Seins berhaupt einzudringen,
um Licht dorthin zu bringen, d.h., die dort
schlummernden Geheimnisse aufzudecken.
Unter diesem doppelten Motto ist Aufklrung
gelungen. Es hat aber auch Verblendung und
Aberglauben genhrt. So haben sich aus der
Metaphysik mehrere, bis in die Gegenwart an-
haltende Traditionen gebildet, deren Aussagen
umstritten sind.
Esoterik. Lehren und Forschungen zu ange-
nommenen hheren Lichtwelten bilden den
Kern der Esoterik. Esoterik (griech. esoterikos:
innerlich) heit eigentlich: Lehre fr einen Kreis
von Eingeweihten. Zu den bevorzugten Themen
der Esoterik gehren: Geister von Verstorbenen
und erdnahe Geistwesen (Gespenster) mit ihren
Handlungen (Wunder, Spuk); Einfluss der Ge-
stirne auf das Schicksal (Astrologie); geistige
Energie, z.B. geistige Krfte, die Krper durch
den Raum bewegen (Psychokinese) sowie im
Menschen selbst wirken (Bioenergie).
Esoterische Gruppen haben teilweise die Aus-
lese ihrer Mitglieder betrieben, weil sie glaubten,
der Zugang zur Geisterwelt erfordere eine be-
sondere Begabung - z.B. die Fhigkeit als Me-
dium. Teilweise haben sich esoterische Gruppen
abgesondert, weil sie ihre Erlebnisse nur mit
Gleichgesinnten teilen wollten oder sich von
anderen verfolgt fhlten. So ist Esoterik in den
Ruf einer Geheimwissenschaft gekommen. Doch
viele Vertreter der Esoterik teilen der ffentlich-
keit ihre Erfahrungen mit und werben fr ihre
Ideen - in Vortrgen und Demonstrationen, in
Zeitschriften und Bchern. Die Naturwissen-
schaften haben fr esoterische Forschungen stets
eine Nische offengehalten. Denn zu den Erfolgs-
rezepten naturwissenschaftlicher Forschung ge-
hrt ja die Offenheit fr rtselhafte, unerklr-
liche Erscheinungen. Zum Beispiel zhlte die
Elektrizitt anfangs zu den kuriosen Erscheinun-
gen, bevor erfolgreiche Forschung schlssige
Theorien und erfolgreiche Anwendungen der
Elektrizitt entwickelt hat.
Okkultismus. Weitgehend austauschbar mit dem
Begriff der Esoterik ist der Begriff "Okkultis-
mus". Okkultismus (lat. occultus: geheim) will
die Geheimnisse der Natur aufklren und wid-
met sich vorzugsweise dem Thema der bersinn-
lichen, auerirdischen Geister und Krfte. Ge-
genwrtig wirkende okkultistische Vereinigun-
gen - z.B. der Orden des Rosenkreuzes und die
New-Age-Bewegung - knpfen zwar an ltere
Traditionen an, nehmen aber auch moderne
Themen wie kologie und Feminismus auf.
Mystik. Als Mystik bezeichnet man eine Gruppe
von Lehren, die einen Gegensatz von einer Licht-
und einer Dunkelwelt annimmt. Dem Dunkel zu
entgehen und zum Licht zu gelangen ist ihr Ziel.
Dies soll durch Verinnerlichung bzw. durch Ab-
kehr von der irdischen Welt sowie durch Vertie-
fung in eine Welt des Geistes und des Glaubens
geschehen. In der christlichen Tradition leitet
Mystik ihren Namen vom Begriff der geheimnis-
vollen Vereinigung (lat. unio mystica) von Gott
und Mensch ab. Die unmittelbare Begegnung
mit Gottes Geist erschliet alle Geheimnisse -
die hchsten wie die tiefsten.
Aufgrund ihres gemeinsamen Ursprungs aus
der Metaphysik berschneiden sich Esoterik,
74 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
Okkultismus und Mystik. Die Psychologie wird
von Manchen als Partner dieser Gruppierungen
gesehen. Die meisten Vertreter der modernen
Psychologie legen jedoch Wert auf die Feststel-
lung, dass ihre Disziplin die Trennung von Eso-
terik, Okkultismus und Mystik vollzogen hat.
Andere halten es fr unklug, die Beziehung zu
diesen Richtungen ganz abzubrechen, da in
rung zu erschlieenden Welt abzugrenzen ver-
sucht. Die Lehre von der Welt der Erfahrung
wurde Physik genannt, die Lehre von der Welt
der Vernunft aber - nun in einem neuen Sinne
(vgl. dagegen Kap. 3.1.1) - Metaphysik.
Gegen ein Jenseits der Erfahrung. Vorgegebene
Wahrheiten und vorgegebene Werte nachzuwei-
sen - dieses Unternehmen beeindruckte zwar als
hohe Schule der Vernunftkritik. Doch waren die
Ergebnisse dieser Bemhungen keinesfalls fr alle
berzeugend und einvernehmlich. Kritiker verur-
teilten die Transzendentalphilosophie teils als
inhaltsleer, teils als willkrlich. Das Gegenpro-
gramm war: Erkenntnis und Moral aus Erfahrung
herzuleiten. Begriffe wie Kausalitt, Zeit oder
Zahl lieen sich als natrliche Sachverhalte auf-
fassen, die sich die Kognition durch Erfahrung
und nur durch Erfahrung aneignet. Entsprechend
lsst sich der Begriff des Guten aus dem Erleben
von Lust und Unlust ableiten.
Gerade innerhalb der Psychologie sammelten
sich Forscher, die sichere Erkenntnis auf Beo-
bachtung grnden wollten. Sie erklrten das
Nachdenken ber ein Vorab und Jenseits der
Erfahrung zu einer unergiebigen Spekulation. In
diesem Sinne suchten sie ihr neues Fach von Me-
taphysik abzugrenzen.
Nativismus: Vershnung mit der Transzenden-
talphilosophie? Bei den scharfsinnigen Ausei-
nandersetzungen ber Vorbedingungen mensch-
licher Erfahrung und Moral sind Vertreter der
Psychologie eher Zaungste geblieben. Doch in
ihren Untersuchungen sind sie immer wieder auf
ihnen noch ein wissenschaftlich ungenutztes
Potential stecke. Zudem stoen Esoterik, Okkul-
tismus und Mystik in der ffentlichkeit auf an-
haltendes Interesse. Die Wissenschaft mge sich
doch mit ihnen auseinandersetzen, erwarten
Viele. Psychologie hat sich dieser Erwartung
nicht durchweg entzogen.
ein Problem gestoen, das in diesen Auseinander-
setzungen eine zentrale Rolle spielt: Das Auftre-
ten angeborener Kognitionen. Einschlgige Bei-
spiele lieferte die Beobachtung von instinktivem
Verhalten. So reagieren Kinder und Erwachsene
mit Angst-, Flucht- und Abwehrreaktionen auf
den Anblick von Schlangen, selbst wenn sie noch
keine Erfahrung mit Schlangen und deren Biss
besitzen. Sollten sie das Bild der Schlange mit
dem zugehrigen Reaktionsprogramm bereits
von Geburt an kennen? Oehman und Mineka
(2003) haben Belege fr die Annahme gesammelt:
Das junge Gehirn wird sogleich bei seiner Entste-
hung mit dem Bild der Schlange und dem zuge-
hrigen Schutzprogramm ausgestattet. Eine sol-
che Erklrung steht in klarem Gegensatz zu der
Auffassung, jedes Individuum erwerbe sein Wis-
sen und Knnen im Laufe seines Lebens durch
eigene Erfahrung.
Den Standpunkt, Erfahrung bilde die Quelle
des Wissens und Knnens, nennt man Empiris-
mus; den Gegenstandpunkt, der Wissen und
Knnen fr angeboren hlt, bezeichnet man als
Nativismus (lat. nativus: angeboren). Den neu-
zeitlichen Nativismus kann man als Nachfolger
der Transzendentalphilosophie betrachten. Auch
Nativismus unterstellt ein Jenseits der Erfahrung;
doch er beschrnkt seine Aussagen ausdrcklich
auf das Individuum. Die Vorkenntnis, welches er
annimmt, ist jenseits der individuellen Erfahrung.
Und diese Vorkenntnis schwebt nicht in einem
Ideenhimmel, sondern ist eingekerbt in den
Hirnstrukturen, welche frhere Generationen an
3.1 Psychologie am Scheideweg zwischen Metaphysik und Naturlehre I 75
folgende weitergegeben. Was zunchst als Meta-
physik erklrt wurde, wird nunmehr als Naturer-
scheinung gedeutet.
Starke Impulse fr das nativistische Denken in
der Psychologie hat der Linguist Noam Chomsky
(1969) gegeben. Er vertritt die Meinung, alle ge-
sprochenen Sprachen beruhten auf gleichen lexi-
kalischen Einheiten und grammatikalischen Re-
geln (z.B. Nomina und Verben, Gegenwarts- und
Vergangenheitsformen). Alle Grundkategorien
und -regeln der Sprache innerhalb weniger Jahre
neu herauszufinden - das knnen Kinder nicht
leisten. Also - meint Chomsky - besitzen sie ein
angeborenes Sprachlernmodell mit den linguisti-
schen Universalien. Dieses befhigt sie, in ver-
gleichsweise kurzer Zeit die Sprache ihrer jeweili-
gen Umgebung zu erlernen (s. vor allem Chom-
sky, 1969, S. 79).
Zusammenfassung
(1) Metaphysik im ersten Sinne ist die Lehre von
bernatrlichen Welten. Dazu zhlen Reli-
gionen. Die wissenschaftliche Behandlung
der Religionen obliegt der Theologie sowie
der Religionswissenschaft.
(2) Die moderne Psychologie versteht sich vor-
zugsweise als Lehre vom naturgegebenen
Leben. Sie grenzt sich daher von Religions-
lehren ab.
(3) Religionen kann man als Erscheinungen des
menschlichen Denkens betrachten. Insofern
werden ihre Inhalte zum Gegenstand der Re-
ligionspsychologie.
(4) Praktische Seelsorge in Religionsgemeinschaf-
ten weist Gemeinsamkeiten mit Psychothera-
pie sowie mit fachpsychologischer Lebens-
und Krisenberatung auf. Die psychologische
Betrachtung der Seelsorge in Religions-
gemeinschaften bezeichnet man als Pastoral-
psychologie.
An Widerspruch zu der These von der angebore-
nen Fhigkeit zum Spracherwerb hat es nicht
gefehlt. Doch spricht dafr der Befund, dass of-
fenbar Kinder in aller Weh Sprache auf hnliche
Weise erlernen (Gleitman & Newport, 1996).
Und da im Gehirn spezialisierte Sprachzentren
nachgewiesen sind, ist die Erwartung durchaus
berechtigt, diese Zentren seien schon bei der Ge-
burt zur Darstellung gngiger lexikalischer Ein-
heiten und grammatischer Regeln vorbereitet.
So ist Psychologie, obwohl traditionell empiris-
tisch gesonnen, dem Nativismus durchaus offen.
Und damit nhert sie sich mit einigen ihrer Ver-
treter - durchaus auch empirisch - wiederum
Fragen nach vorgegebenen Grundlagen von
Wahrheit und Sittlichkeit, die sie als spekulativ
verworfen hat, so lange sie ihr als Beitrag der
Metaphysik begegneten.
(5) Metaphysik im zweiten Sinne ist die Lehre
von den Voraussetzungen der Erkenntnis
und der Sittlichkeit, die jenseits der Erfah-
rung liegen (Transzendentalphilosophie).
(6) In der modernen Psychologie gibt es die
Tendenz, alles Wissen und Knnen auf indi-
viduelle Erfahrung zurckzufhren (Empi-
rismus); danach ist Metaphysik auch im
zweiten Sinne abzulehnen.
(7) Daneben ist in der Psychologie auch eine
Richtung vertreten, die angeborenes Wissen
und Knnen annimmt (Nativismus); indem
sie angeborenes Wissen als Voraussetzung
fr Erfahrung deutet, nhert sie Psychologie
der Metaphysik im zweiten Sinne an.
(8) Man trifft zudem die Auffassung: Es gibt
Geistwesen und geistige Krfte; diese sind
natrliche Erscheinungen, welche noch
nicht ausreichend erforscht sind. Der Kl-
rung dieser Auffassung widmet sich die
Parapsychologie.
76 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
I
3.2 Naturwissenschaften und
Kulturwissenschaften (Geistes-
und Sozialwissenschaften)
3.2.1 Natur und Kultur
Natur - unberhrt von der Hand des Menschen?
Natur (lat. natura: Geburt) ist zunchst als jener
Teil der Wirklichkeit zu verstehen, der seinen
Ursprung bewahrt hat - ohne Vernderung
durch den Menschen. So spricht man von Natur-
landschaften, welche ihre Ursprnglichkeit be-
wahrt haben und nicht durch menschliche Sied-
lungen umgestaltet wurden. Man spricht von
Naturstoffen, die unmittelbar aus dem Boden
oder aus Pflanzen gewonnen werden, ohne durch
Zustze oder Bearbeitung ihre ursprngliche
Beschaffenheit zu verlieren.
Ebenso kann man annehmen: Es gibt einen
Naturmenschen sowie ein natrliches Leben. Im
Einzelnen: Es gibt Leistungen, Eigenschaften,
Fertigkeiten und Verhaltensweisen, die dem
Menschen natrlich zugewachsen sind und durch
dessen Zutun keine nderung erfahren haben.
Das sind Leistungen wie das Wahrnehmen von
Formen und Farben, die Orientierung in Raum
und Zeit, das Erinnern, vielleicht auch das Tru-
men. Zu den Eigenschaften, die dem Menschen
"von Natur aus" zukommen, knnten Freund-
lichkeit oder Gehssigkeit, Faulheit oder flei
zhlen. Bezglich natrlicher Fertigkeiten und
Verhaltensweisen ist zu fragen: Kann der Mensch
"von Natur aus" singen? Gibt es eine natrliche
Geburt, eine natrliche Ernhrung, ein natrli-
ches Lernen?
Kultur - des Menschen zweite Natur? Wo gibt es
noch die vom Menschen unberhrte Natur?
Stadt-, Industrie-, Handels- und Erholungsland-
schaften haben die Naturlandschaften zurckge-
drngt. Pflanzenarten sind neu gezchtet, Tierar-
ten domestiziert. Ja, die Menschen selbst haben
ihre Ursprnglichkeit abgelegt. Mit ihrer neuen
Lebenswelt haben sie ihr Aussehen, ihr Denken
und ihr Verhalten gendert. Ihr Tag-Nacht-
Rhythmus folgt eher den Unterhaltungspro-
grammen ffentlicher Fernsehsender als dem
Lauf der Sonne; sie kommunizieren ber Medien
und weltweite Sprechverbindungen, ihr Zusam-
menleben vollzieht sich in einer ffentlichen
Ordnung mit Gesetzen, Verwaltungsvorschriften
und Wirtschaftsnormen. Beides zugleich hat der
Mensch betrieben: Die Umgestaltung der Natur
und seine eigene Fortentwicklung. So ist Kultur
(lat. cultura: Pflege) zum neuen Lebensraum
geworden. Der Mensch ist zu einem Kulturwesen
geworden, sein Leben zum Kulturleben.
Die Einschtzung des Wertes der Kultur ist
umstritten. Auf der einen Seite steht der Kultur-
pessimismus. Er wertet Kultur als Verschlimme-
rung natrlicher Lebensumstnde und Lebens-
weisen; Kultur verbildet den Menschen und
vernichtet sein Glck. Der Kulturoptimismus
behauptet dagegen: Kultur verbessert die Welt; sie
vervollkommnet den Menschen und vermehrt
seine Wohlfahrt. Der Kulturpessimismus sieht
einen Gegensatz, mitunter gar eine Feindschaft
zwischen Natur und Kultur. Er weist auf Fehler
der Kulturentwicklung hin und fordert die Rck-
kehr zur Natur - etwa durch Renaturierung von
Flusslandschaften, durch Anwendung von Na-
turheilmethoden oder durch Rckgewinnung
historischer Formen des Wohnens und Wirt-
schaftens.
Der Kulturoptimismus sieht die Kulturent-
wicklung in der Nachfolge der Naturentwicklung.
Welt und Leben sind in stndigem Fortschreiten
begriffen. Der Natur selbst wohnt ein Optimie-
rungsdrang inne; Leben und Lebewesen will sie
stndig verbessern. Nachdem die Natur den Men-
schen hervorgebracht hat, ist dieser zu ihrem
Agenten der Fortentwicklung geworden. Aus
dieser Sicht geht Kultur aus Natur hervor. Fort-
schritte der Kultur sind gleichzeitig Fortschritte
der Natur. Kultur ist eine zweite Natur.
Vertreter der Wissenschaften sind in ihrer
Haltung zur Kultur gespalten. Doch weit ber-
3.2 Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften I 77
wiegend haben sich Wissenschaftler zum Dienste
an der Kulturentwicklung bekannt. Insbesondere
mit ihren naturwissenschaftlichen Forschungen
(z.B. zur Nachrichtenbertragung, zur Bekmp-
fung von Krankheiten, zur Geburtenkontrolle)
haben sie die Voraussetzungen fr einen weit
reichenden technischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Wandel geschaffen. Der Stolz ber solche
Leistungen hat den Kulturoptimismus innerhalb
der Wissenschaft gestrkt. Auf der anderen Seite
waren es gerade erfolgreiche Forschungszweige,
welche Kritik auf sich gezogen haben. Denn mit
Fortschritten sind auch Risiken gewachsen (z.B.
bei der Energieerzeugung, der Gentechnik). Fort-
schritte knnen durchaus mit Nachteilen einher-
gehen (z.B. nehmen in der mobilen Gesellschaft
u.a. Herz- und Kreislaufkrankheiten zu).
3.2.2 Zwei Gruppen von Wissenschaften
Naturwissenschaften. Entsprechend der Unter-
scheidung von Natur und Kultur lassen sich Na-
tur- und Kulturwissenschaften trennen. For-
schung zur Natur widmet sich berwiegend der
Aufgabe, die Welt in ihrer Ursprnglichkeit zu
ergrnden. Naturwissenschaften befassen sich da-
her vorzugsweise mit
Ablufen und Mechanismen in der unbelebten
Natur (z.B. Schwerkraft, Aufbau von Molek-
len),
elementaren Bestandteilen und Aktivitten in
belebten Krpern (z.B. Krperzellen, Stoff-
wechsel),
komplexen Krperorganen (wie Auge und
Hand) und Verhaltensweisen (wie Revierver-
teidigung) von Gattungen von Lebewesen
(z.B. Fischen, Affen, Menschen) - sofern sie
als naturgegeben anzunehmen sind.
Kulturwissenschaften (Geistes und Sozialwis
senschaften). Kulturwissenschaften konzentrieren
sich auf die Errungenschaften der fortgeschrit-
tenen Menschheit. Ihre Forschungen richten sich
vor allem auf
komplexe, insbesondere ideelle Hervorbrin-
gungen gesellschaftlicher Organisationen (wie
Sprache, Gesetze),
Aufbau von und Ablufe in gesellschaftlichen
Organisationen (wie Familien, Vlker).
Es ist gebruchlich, die Wissenschaften nach den
beiden soeben genannten Forschungsbereichen in
zwei Gruppen einzuteilen: Geistes- und Sozial-
wissenschaften.
Zwei Fchergruppen genieen unter den mo-
dernen Geisteswissenschaften eine Vorrangstel-
lung: die Sprach- und die Geschichtswissenschaf-
ten. Sprach- und Geschichtsbetrachtung sollen
einen universellen Zugang zum menschlichen
Geist und seinen Schpfungen erffnen. In der
Sprache - ist anzunehmen - spiegelt sich die Flle
menschlichen Wissens und Verstehens. Die histo-
rische Perspektive erffnet darber hinaus den
Zugang zu einer schier unbegrenzten Menge von
Produkten des Menschengeistes: Religion und
Kunst, Verwandtschaftsbeziehungen und Sied-
lungsformen, Staat und Staatengemeinschaft -
berhaupt alle Kulturleistungen, einschlielich
der Wissenschaft selbst.
Sozialwissenschaften behandeln dagegen den
Aufbau von Kollektiven (wie Staat, Verbnde,
regionale Gesellschaften) sowie deren Ttigkeiten
und Wirkungen (wie Machtzuteilung, Kommu-
nikationsfluss). Den Sozialwissenschaften werden
im Folgenden auch die Wirtschafts- und Rechts-
wissenschaften zugeschlagen, die wegen ihrer
praktischen Ausrichtung und ihrer berragenden
Bedeutung fr berufliche Bildung oft eine Son-
derstellung genieen.
Der Begriff der Kulturwissenschaften sucht die
Trennung von Geistes- und Sozialwissenschaften
aufzuheben. Befrwortet wird dies mit dem Ar-
gument, kollektives Bewusstsein und kollektive
Schpfungen seien ohne Kenntnis der Organisa-
tionen, die sie hervorgebracht haben, nicht zu
verstehen; ebenso wenig drfe man bei der Un-
tersuchung von Organisationen deren kollektives
Bewusstsein und deren Schpfungen ausgrenzen.
78 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
Der Begriff der Kulturwissenschaft beginnt sich
allerdings erst neuerdings durchzusetzen.
psychologie - Einzeldisziplin und zugleich trans-
disziplinre Lebenswissenschaft. Psychologie ist
eine eigenstndige Wissenschaft, eine selbstndi-
ge Einzeldisziplin. Sie hat sich in ihrer Gesamtheit
weder den Naturwissenschaften noch den Kul-
turwissenschaften angeschlossen. Vielmehr haben
sich in ihr natur- und kulturwissenschaftlich
orientierte Richtungen gebildet. Als moderne
Wissenschaft befasst sie sich mit den Formen des
natrlichen wie des kulturellen Lebens.
Andere Wissenschaften, mit denen die Psycho-
logie in Beziehung steht, haben sich dagegen ein-
geordnet - in die Reihe der Natur- oder der Kul-
turwissenschaften (bzw. der Geistes- und So-
zialwissenschaften). So stehen in der Wissen-
schaftslandschaft nebeneinander: Eine Vielzahl
von Einzeldisziplinen, die sich - teils gesondert,
teils vernetzt - mit ausgewhlten Bereichen des
natrlichen oder des kulturellen (geistigen und
sozialen) Lebens befassen. Und eine Wissenschaft
- eben die Psychologie - mit dem Anspruch,
Lebenswissenschaften
Diese Einfhrung bezeichnet die Psychologie
beharrlich als Lebenswissenschaft. Dieser Begriff
beflgelt seit der Wende zum neuen, zum dritten
Jahrtausend die Diskussion ber die Zukunft des
Wissens. Der Begriff der Lebenswissenschaften
(auch Biowissenschaften, engl. life sciences, bio-
sciences) wird meist im Plural gebraucht. Das
bringt zum Ausdruck: Lebenswissenschaft ist als
Gemeinschaftsunternehmung gedacht; mehrere
bislang getrennt arbeitende Disziplinen sollen
sich daran beteiligen. Was hier gemeinschaftlich
erforscht werden soll, umfasst
Makrosysteme, Lebensrume im Mastab von
Regionen, der gesamten Erde, ja sogar extrater-
restrischer Gebiete,
Mikrosysteme, kleinteilige Mechanismen wie
Zellen und Nukleinsuren.
Leben in semer ganzen Breite zu erfassen. Das
kommt einer Verdoppelung der wissenschaft-
lichen Betrachtung gleich. Die Disziplin der Psy-
chologie behandelt Vieles, was auch den Gegen-
stand anderer Disziplinen darstellt. So ziehen sich
psychologische Themen durch smtliche Diszip-
linen, die sich mit Aspekten des Lebens befassen.
In diesem Sinne ist Psychologie eine bergreifen-
de Disziplin, sie ist transdisziplinr (s. Kap.
2.3.1).
Dass Psychologie gleichzeitig als Einzeldisziplin
und transdisziplinr auftritt, ist zu erklren mit
der Begrenztheit des menschlichen Erkennens,
Forschens und Lehrens. Wie wnschenswert wre
doch Folgendes: Sachkundig, tiefsinnig und in
allen Einzelheiten nach dem neuesten Stand der
Forschung doziert eine Professorin ber den
Aufbau von Nervenzellen und die Ausschttung
von Hormonen, ber Gedchtnis, Logik und
Leistungsmotive, ber Koalitionen in kleinen
Gruppen, ber Zahlensysteme und indogermani-
sche Sprachen, ber asiatische Jenseitsvorstellun-
gen, Konjunkturzyklen und die Gewaltenteilung
Naturwissenschaften nehmen hervorragende
Pltze unter den Lebenswissenschaften ein. Der
traditionelle Verbund aus Botanik und Zoologie
wird schon lngst als Biologie bezeichnet. Die
traditionelle Biologie hat durch zahlreiche Koa-
litionen mit anderen Naturwissenschaften neue
Disziplinen hervorgebracht - wie die Biochemie,
die Biophysik und die Bioinformatik.
Kulturwissenschaften fallen im Verbund der
Lebenswissenschaften ebenfalls wichtige Aufga-
ben zu. Doch sie schlieen sich diesem Verbund
bisher nur zgerlich an. Entsprechend unein-
heitlich verhlt sich die Psychologie; zu den
Lebenswissenschaften bekennt sie sich strker
mit ihren naturwissenschaftlichen als mit ihren
geistes- und sozialwissenschaftlichen Anst-
zen.
3.2 Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften I 79
Cambridge, USA
Abbildung 3.3.
Edward O. Wilson
Edward O. Wilson, gebo-
ren 1929, ist Professor am
Department of Biology der
Harvard-Universitt in
Einheit der Lebenswissenschaften: Fhrungsrolle der Psychologie?
Die Sprach-, Geschichts- und Kulturwissenschaften, die Sozial-, Rechts- und Gesellschaftswissen-
schaften, Biologie und Medizin, Informatik und Technikwissenschaften haben sich in eigene For-
schungsinstitute, Studiengnge und wissenschaftliche Gesellschaften aufgegliedert. Dies hat ihnen
Leistungs- und Organisationsvorteile gebracht. Zugleich ist dadurch die Zersplitterung einer Wissen-
schaftslandschaft eingetreten, die nicht nur von ffentlichkeit und Politik, sondern auch von betrof-
fenen Wissenschaftlern selbst bedauert worden ist. In dieser Situation hat Psychologie viel Anerken-
nung und Zuspruch gefunden. Obwohl in vielem Spezialwissen unterlegen und auf Untersttzung
durch verwandte Wissenschaften angewiesen, hat sie doch die Idee des Zusammenhangs verkrpert
und zu deren Austausch beigetragen.
Gerade die starke Spezialisierung von Forschung und Lehre hat die Forderung nach mehr Aus-
tausch und Zusammenarbeit verstrkt. Interdisziplinre Zusammenarbeit verspricht wirkungs-
vollere Forschung, schnellere Verbreitung von Wissen und grere Wirtschaftlichkeit durch Ver-
meidung von unfruchtbarer Parallelforschung und Bndelung von Forschungs-
mitteln. Da kehrt er dann wieder: der Traum von der Einheit der Wissenschaf-
ten. In diesem Traum fllt der Psychologie eine zentrale Rolle zu. Natur-, Geis-
tes- und Sozialwissenschaft zugleich, transdisziplinr angelegt, knnte sie
das Verbindungsglied zwischen bisher getrennten Spezialdisziplinen dar-
stellen.
In jngerer Zeit hat ein international bekannter Gelehrter die Vision einer
Einheit des Wissens (engl. consilience) erneuert. Der Soziobiologe Edward
O. Wilson hat schon mehrfach zu einer Bndelung wissenschaftlicher Anstren-
gungen aufgerufen, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden
- Armut, Gewalt, Umweltzerstrung. Wie die Zeitschrift "Monitor" in ihrer
Ausgabe vom September 1999 berichtet, warb Wilson beim Jahreskongress
der American Psychological Association in Boston vor einem dicht gedrng-
ten Auditorium fr seine Idee einer Wissenschaft ohne Fachgrenzen, und er
rief die versammelten Psychologinnen und Psychologen auf, bei der Integra-
tion von Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften die Fhrung zu berneh-
men.
Wilsons Pldoyer fr die Vernetzung der Erkenntnisse ber das Leben ist auch in deutscher Sprache
erschienen. In seinem Buch "Die Einheit des Wissens" entwirft er eine Wissenschaft, die Umweltpoli-
tik, Sozialwissenschaften, Ethik und Biologie nicht trennt, sondern in konzentrischen Kreisen vereinigt.
Von einem gemeinsamen Schnittpunkt aus soll sich Lebenswissenschaft konzentrisch in die Berei-
che der Umweltpolitik, Sozialwissenschaften, Ethik und Biologie ausdehnen. Wilson (2000, S. 19f.)
glaubt:
Nie gab es eine bessere Zeit fr die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern ... als heute, vor allem na-
trlich dort, wo sie sich lngst begegnet sind, nmlich in den Grenzbereichen von Biologie, Sozialwis-
senschaften und Geisteswissenschaften. Wir nhern uns einem neuen Zeitalter der Synthese, in dem
die grte aller intellektuellen Herausforderungen die Erprobung von Vernetzung sein wird. ... Wenn
die Funktionsweisen der Welt tatschlich zur Konziliation von Wissen auffordern, dann glaube ich,
dass sich frher oder spter auch das Unternehmen Kultur in die Wissenschaften eingliedern wird -
80 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
womit ich die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften, darunter vor allem den Kunst-
bereich meine. Diese Domnen werden sich zu den groen Wissensgebieten des 21. Jahrhunderts
entwickeln. ... Grundstzlich werden die Sozialwissenschaften natrlich weiterhin bestehen, aber in
radikal vernderter Form. Im Laufe dieses Prozesses werden sich die Geisteswissenschaften - von der
Philosophie ber die Geschichte bis hin zur Ethik, den vergleichenden Religionswissenschaften und
der wissenschaftlichen Kunstinterpretation - den Naturwissenschaften immer mehr annhern und
zum Teil mit ihnen zusammenschlieen. ...
Ich gebe zu, dass das Selbstvertrauen von Naturwissenschaftlern oft anmaend wirkt. Aber die Na-
turwissenschaften bieten in der Tat die khnste Metaphysik unseres Zeitalters. ... Der britische Neu-
robiologe Charles Sherrington nannte . .. das Gehirn einen zauberischen Webstuhl, welcher unauf-
hrlich die Bilder der Auenwelt ineinander verwebt, wieder auflst, neu verwebt und dabei stndig
andere Welten erfindet und ein eigenes Miniaturuniversum erschafft. Der gemeinschaftliche Geist
von gebildeten Gesellschaften - die Weltkultur also - ist ein noch unermesslich viel grerer Web-
stuhl. Mit den Mitteln der Wissenschaft erwirbt er die Fhigkeit, uere Realitten weit jenseits
der Reichweiten eines einzelnen Geistes zu erkennen, und mit den Mitteln der Kunst konstruiert er
Geschichten, Bilder und Rhythmen, die weit mannigfaltiger sind, als es die Produkte eines einzelnen
Genies je sein knnen.
Der Webstuhl fr Wissenschaft oder Kunst ist ein und derselbe. Sein Ursprung und seine Natur
knnen prinzipiell erklrt werden und damit auch die Conditio humana, von der archaischen Ge-
schichte der genetischen Evolution bis zur modernen Kultur.
Wilson, E.O. (2000). Die Einheit des Wissens, bersetzt von Y. Badal. Mnchen: Goldmann.
m demokratischen Staatsformen. Studierende
hren zu und werden dadurch Experten in allen
Fragen des Lebens. Eine solche Wunschvorstel-
lung lsst sich nicht verwirklichen, seitdem die
Flle des Wissens die Aufnahmefhigkeit des
Einzelnen so betrchtlich bersteigt. Allein die
Lehre so vieler Gegenstnde wrde - die bliche
Sprech- und Lesegeschwindigkeit vorausgesetzt -
jede vertretbare Ausbildungszeit bersteigen.
Angesichts der Begrenztheit ihrer Arbeitszeit
und ihres Auffassungsvermgens haben sich Wis-
senschaftler Schwerpunktprogrammen verschrie-
ben und zu berschaubaren Wissenschaftlerge-
meinden zusammengeschlossen (s. Kap. 2.1.2).
So sind sie Biologen geworden (oder - noch wei-
ter spezialisiert - Ptlanzenbiologen, Verhaltens-
biologen) oder Linguisten, Mathematiker, Sozio-
logen oder Ethnologen. Die Psychologie als
Einzeldisziplin hat sich immer wieder gegen eine
derart weit gehende Spezialisierung gestrubt.
Ihrer Grndungsidee nach ist sie eine umfassende
Lebenswissenschaft (s. Kap. 2.1.1). Und gerade in
ihren feierlichsten Stunden ertnt die Mahnung,
sie mge ihrer Grndungsidee treu bleiben.
Freilich ist ebenfalls richtig: Die Gesamtbe-
trachtung des Lebens ist zwar Programm fr die
Psychologie als Ganze geblieben. An Studienord-
nungen erkennt man noch die Breite ihres Pro-
gramms. Gleichwohl muss auch die Zunft der
Psychologen um der Qualitt von Forschung,
Lehre und Praxis willen Spezialisierungen dulden.
So bilden sich innerhalb der Psychologie ver-
schiedene Wissenschaftlergemeinden. Psycholo-
gen teilen sich u.a. in Fachgruppen fr Ent-
wicklungs- und Sozialpsychologie, fr Klinische
Psychologen und Forensische Psychologen (ber
Disziplinen innerhalb der Psychologie und psy-
chologische Berufsfelder s. Kap. 4 und 5).
3.2 Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften I 81
Mit ihrer Arbeitsteilung folgen Psychologen oft
den gleichen Spezialisierungen wie die ihnen
verwandten Disziplinen. Die Folge sind so ge-
nannte Bindestrichpsychologien: Biopsychologie
bzw. Biologische Psychologie, Sprachpsychologie
bzw. Psycholinguistik, Wirtschaftspsychologie
und viele andere (mehr im weiteren Verlauf die-
ses Kapitels).
Darber hinaus hat sich in der Psychologie die
Trennung nach Wissenschaftsklassen eingebr-
gert. So unterscheidet man eine naturwissen-
schaftliche, eine geisteswissenschaftliche und eine
sozialwissenschaftliche Psychologie.
3.3 Psychologie und Naturwissen-
schaften
3.3.1 Lehren ber Gattungen von Lebe-
wesen und ihre Verhaltensweisen
Zoologie, Anthropologie. Zoologie ist die Lehre
von den Tieren (griech. zoon: Lebewesen, Tier).
Zu ihren klassischen Leistungen gehrt die
Bestimmung und systematische Ordnung der
Tierarten. Die Ordnung erfolgt nach Gattungen
(Insekten, Fische, Sugetiere u.a.). Die Abstam-
mungsforschung hat belegt, dass Tierarten sich
auf der Erde im Laufe von 600 Millionen Jahren
entwickelt haben. Aus ihrer Reihe ist in den letz-
ten 500000 Jahren die gegenwrtig lebende Gat-
tung Mensch hervorgegangen. Wie Urmenschen
sich zu modernen Menschen gewandelt haben
und wie sie sich ber die Erdteile verbreiteten,
untersucht die biologische Anthropologie (griech.
anthropos: Mensch).
Ein wichtiges Anliegen der biologischen An-
thropologie ist die Messung des Krperbaus (Sch-
delform, Gre u..) zu verschiedenen Epochen
(z.B. Steinzeit, Neuzeit) und in verschiedenen
Lebensrumen (z.B. Westafrika, Mitteleuropa).
Dabei sind zahlreiche Unterschiede in Krperbau,
Hautfarbe und anderen krperlichen Erschei-
nungen festzustellen. In verschiedenen Erdteilen
entwickeln sich genetisch unterschiedliche Popu-
lationen von Menschen, Menschenrassen (franz.
race: Stamm) - vor allem die Europiden, Mongo-
liden und Negriden.
Im Rckblick auf die Epochen der Mensch-
heitsgeschichte sucht Anthropologie anhand von
archologischen Funden auch Lebensformen zu
erkunden (z.B. Werkzeuggebrauch, Siedlungsty-
pen). Dabei lassen sich Beziehungen herstellen.
Wenn etwa im Laufe der Stammesgeschichte
Schdelgre und Hirnmasse zunehmen, zu-
gleich immer kunstvollere Werkzeuge hergestellt
werden, so kann man auf wachsende Intelligenz
schlieen.
Verhaltensbiologie, Ethologie. Jede Tierart -
Vgel, Fische usw. - besitzt ihren eigenen Kr-
perbau und fhrt gem ihrer krperlichen Aus-
stattung eigenes Verhalten aus. Dabei passen sich
Krperbau und Verhalten der Umgebung an, in
welcher die Tierarten bevorzugt leben. Ange-
passtheit erlaubt eine wirkungsvollere Befriedi-
gung von individuellen Bedrfnissen und eine
hhere Zahl von Nachkommen. Beispiele ange-
passten, arteigenen Verhaltens sind das Schwim-
men der Fische, der Nestbau der Vgel in Wl-
dern und das Eierlegen von Schildkrten an
Strnden. Mit der krperlichen Ausstattung ver-
erben sich auch Verhaltensmuster und -neigun-
gen. Ein Teil des Verhaltens ist also angeboren.
Angeborenes Verhalten braucht allerdings nicht
sogleich nach der Geburt aufzutreten. Wie der
Krper heranwchst, so entfaltet sich auch ange-
borenes Verhalten oft erst in spteren Lebenspha-
sen. Zum Beispiel setzen sexuelle Triebe und
Verhaltensweisen die krperliche Geschlechtsreife
voraus.
ber das angeborene Verhalten hinaus erwer-
ben Tiere und Menschen weitere Gewohnheiten
und Fertigkeiten. Freilich sind dem individuellen
Erwerb neuer Fertigkeiten durch die arteigene
Ausstattung Grenzen gesetzt. So sind die Sprn-
ge, die Menschen selbst nach eifriger bung ge-
lingen, nur kurz; Katzen bertreffen Menschen
82 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
im Springen bei weitem. Gar mit Hilfe ihrer Ar-
me durch die Luft fliegen zu knnen wie Vgel
mit ihren Flgeln, ist fr Menschen ein unerfll-
barer Wunsch.
Die Bestimmung arteigenen Verhaltens und
dessen Anpassung an die Umgebung bildet ein
eigenes Forschungsgebiet. Diesem widmet sich
vorzugsweise die Verhaltensbiologie, auch Etho-
logie (griech. ethos: Lebensweise) genannt. Ihr
Schwerpunkt liegt bei den Tieren. Doch bezieht
sie auch die Gattung Mensch in ihre Untersu-
chungen ein. Dadurch ergeben sich Hinweise auf
die Einzigartigkeit des Menschen, jedoch auch
Einblicke in Gemeinsamkeiten zwischen Mensch
und Tier. Insbesondere wirft die Ethologie die
Frage auf: Gibt es Instinkte, d.h. Kombinationen
von Antrieben und Verhaltensweisen, die, aus der
Naturgeschichte herrhrend, auch den modernen
Menschen bewegen - wie Hass und Kampf, Kin-
derliebe und Frsorge. Wenn der Mensch "von
Natur aus" mit solchen Instinkten ausgestattet
wre: Sind dann Krieg und Gewalt unabnder-
liches Menschenschicksal? Und welche Entbeh-
rung erleiden Menschen ohne Kinder?
Tierpsychologie. Vergleichende Psychologie. Die
Fragestellungen der Ethologie sind zugleich Pro-
bleme der Psychologie. Vergleiche zwischen ver-
schiedenen Tierarten, zwischen Menschen und
Tieren, zwischen Menschen aus verschiedenen
Regionen erweisen sich als psychologisch frucht-
bar. Insbesondere die Frage der Naturgeschichte
menschlicher Instinkte und menschlicher Intelli-
genz bewegt die psychologische Fachdiskussion.
Zum Weiterlesen
Biologie des Verhaltens
Franck, D. (1996). Verhaltensbiologie. Stuttgart:
Thieme.
Eine allgemeine Einfhrung in die Ethologie. Das Buch
behandelt die Vielfalt der Arten.
Eibl-Eibesfeldt,1. (1997). Die Biologie des mensch-
lichen Verhaltens. Mnchen: Piper.
Eine Einfhrung in die Humanethologie. Das Buch
behandelt speziell menschliches Verhalten.
Abbildung 3.4. Meisenjunge (parus major) aus der
Untersuchung von Lubjuhn et al. (1999). Die Tiere
leben frei in einem vom Institut fr Vogelforschung
"Vogelwarte Helgoland" wissenschaftlich betreuten
Forstgebiet bei Bahrdorf in Niedersachsen. (Das Bild
hat freundlicherweise Prof. Thomas Lubjuhn, Bonn,
zur Verfgung gestellt.)
Vaterschaft - ein Problem aus der ethologischen Forschung
Meisen leben in Paaren, die gemeinsam Junge auf-
ziehen. Durch Blutproben lsst sich die Vater-
schaft feststellen. Das Ergebnis einer fnfjhrigen
Studie von Lubjuhn et al. (1999): In etwa einem
Drittel der Nester befinden sich Junge eines "au-
erpaarigen" Erzeugers. Knapp ein Zehntel der
Jungen ist "auerpaariger" Herkunft. Die Forscher
hatten eine Hypothese: das Streben nach "guten
Genen". Das bedeutet: Die weiblichen Tiere wol-
len ihren Nachwuchs mit guten Erbanlagen aus-
statten. Deshalb wWen sie manchmal Erzeuger,
die ihrem Dauerpartner genetisch berlegen sind.
Doch die Hypothese bewhrt sich nicht. Denn die
genaue Beobachtung ergibt: Vter mit "fremden"
Jungen leben genau so lange wie Vter, die nur
eigene Jungen im Nest haben. Und Junge aus dem
Nest ihres Erzeugers leben ebenso lange wie ihre
Geschwister "auerpaariger" Herkunft.
3.3 Psychologie und Naturwissenschaften I 83
Einige Zweige der wissenschaftlichen Psychologie
schenken solchen Themen anhaltende Aufmerk-
samkeit. Eine unmittelbare Brcke zur Verhal-
tensbiologie schlgt die Tierpsychologie, die auch
den Namen "Vergleichende Psychologie" trgt.
berschneidungen bestehen weiterhin mit der
Differentiellen Psychologie, der Psychologie indi-
vidueller Unterschiede. Wie weit sind Unter-
schiede zwischen Personen naturbedingt? Ein
Ansatz ist die Beschftigung mit Menschenrassen.
Allerdings ist gerade in Deutschland der Begriff
der Rassenpsychologie in Verruf geraten. Sind
doch whrend des Nationalsozialismus einige
Vertreter der Psychologie durch eine unverant-
wortliche Rassentheorie an der Verfolgung von
Volksgruppen und der Ermordung ihrer Angeh-
rigen schuldig geworden.
3.3.2 Lehren ber das Innenleben
Anatomie, Physiologie, Hirnforschung. Je nach
Standpunkt ist der Krper Werkzeug der Seele
oder Trger der seelisch genannten Funktionen
Einrichtungen zur Beobachtung von Tieren
Zoologische Forschungsinstitute besitzen in der
Regel Laboratorien oder Gehege zur Haltung
und Untersuchung von Tieren. Wissenschaft-
liche Beobachtungen werden zudem an Tieren
in zoologischen Grten angestellt. Affen, ins-
besondere den dem Menschen in der Entwick-
lungsreihe nahe stehenden Primaten (Orang-
Utans, Gorillas, Schimpansen u.a.), gebhrt aus
der Sicht der Humanpsychologie ein besonderes
Interesse. Fr deren Untersuchung sind groe
Forschungszentren eingerichtet worden. Ein
fhrendes Zentrum in den USA ist das Yerkes
Regional Primate Center der Emory University
in Atlanta, Georgia; es ist nach seinem Grnder,
dem Psychologen Robert Yerkes, benannt. Eine
vergleichbare Einrichtung in Europa ist das
Deutsche Primatenzentrum in Gttingen.
(s. Kap. 1.2.2 zum Leib-Seele-Problem). Doch wie
ist der Krper beschaffen? Welches sind seine
Funktionen?
Die Wissenschaft vom Krperbau der Lebewe-
sen nennt man Anatomie (griech. anatome: Zer-
schneiden). Ihr Name erinnert daran, dass diese
Disziplin ursprnglich ihre Kenntnisse durch
Aufschneiden des toten Krpers gewonnen hat.
Schon mit bloem Auge lsst sich die Gliederung
des Krpers in Organe, Gefe u.. erkennen
sowie der Aufbau einzelner Organe (z.B. die
Kammern und Klappen des Herzens). Mit Hilfe
mikroskopischer und biochemischer Methoden
ist die Anatomie inzwischen zur Untersuchung
der Struktur von Geweben, ja sogar von Krper-
zellen fortgeschritten.
Die Wissenschaft von der Arbeitsweise des
Krpers nennt man Physiologie (griech. physis:
Natur). Die Physiologie betrachtet die Arbeit der
Organe in ihrer natrlichen Umgebung - z.B.
die Atmung und das Zusammenspiel von Herz
und Lunge bei der Sauerstoffversorgung der
Muskeln.
Durch ihre Intelligenz und durch ihr Sozialver-
halten sind neben den Primaten auch andere
Tierarten aufgefallen. Dazu gehren Delfine. Sie
sind im Freien zu beobachten, knnen aber auch
zu Forschungszwecken in knstlichen Becken
gehalten werden, wie dies im Dolphin Institute
an der University ofHawaii in Honolulu ge-
schieht.
Das Yerkes Regional Primate Center, das Deut-
sche Primatenzentrum sowie das Dolphin Insti-
tute in Hawai stellen sich im Internet unter fol-
genden Adressen dar:
http://www.emory.edu/WHSC/YERKES
http://www.dpz.gwdg.de
http://www.dolphin-institute.com
84 I 3 SeelenJehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
Je hher Lebewesen entwickelt sind, desto deutli-
cher sind ihre End- und Steuerungsfunktionen
getrennt. Als Endfunktionen werden hier die
letztlich wirksamen Leistungen bezeichnet (z.B.
der Vollzug von Bewegungen, der Blutdruck als
Folge des Herzschlags). Alle diese Endfunktionen
werden ber ein verzweigtes Nervensystem ge-
steuert. Dieses vereinigt sich zu einem zentralen
Schalt- und Steuerungsorgan, dem Gehirn.
Bei den Wirbeltieren, insbesondere beim Men-
schen weist das Gehirn eine groe Differenzie-
rung und Leistungsfhigkeit auf. ber ein Sinnes-
system (sensorisches Nervensystem) vermag es
einerseits Zustnde der Umgebung (z.B. Hellig-
keit, Schall, Auentemperatur) abzubilden, ande-
rerseits Zustnde im Krper selbst (z.B. Druck,
Schmerz, Hunger, Mdigkeit). ber ein Bewe-
gungssystem (motorisches Nervensystem) steuert
es die Muskelttigkeit und koordiniert dabei auch
komplexe, zielgerichtete Handlungen (z.B. Ab-
fahrtslauf auf Skiern). Ein weiterer Teil des Ner-
vensystems (vegetatives Nervensystem) reguliert
die Funktionen der Lebenserhaltung (wie At-
mung' Verdauung, Wrmehaushalt). Doch auch
vegetative Funktionen werden vom Gehirn aus
reguliert. Dem Gehirn in seiner berragenden
Bedeutung widmet sich ein eigener Forschungs-
zweig, die Hirnforschung.
Biochemie, Endokrinologie. Feiner, als das bloe
Auge dies zu erkennen vermag, ist der Aufbau
von Muskeln, Nerven, Drsen und anderen Kr-
perorganen. Unter dem Elektronenmikroskop,
das sie in bis zu dreihunderttausendfacher Ver-
grerung wiedergibt, entdeckt man ihre Zu-
sammensetzung aus Zellen, Fasern und Blschen,
begrenzende Membranen und verbindende Endi-
gungen. Chemische Analysen zeigen: In kleintei-
ligen Funktionseinheiten des Krpers ereignet
sich ein Austausch chemischer Substanzen. So
kommt es einerseits zur Aktivierung von Funkti-
onen, andererseits zu deren Hemmung. Wer dies
als Grundlage von Erkennen und Verhalten be-
trachtet, wird die Erzeugung und Ausschttung
chemischer Substanzen vor allem in zwei Krper-
systemen verfolgen: im Nervensystem und im
endokrinen System.
Das Nervensystem besteht aus Bndeln von
Nervenfasern. Oft sind mehrere Nerven hinter-
einander geschaltet. Manchmal enden Nerven an
Muskeln oder Drsen. Die Verbindung zwischen
einem Nerv und der ihm nachgeschalteten Ein-
heit nennt man Synapse. ber Synapsen wird
Erregung bertragen; eine Hemmung an der
Synapse ist ebenfalls mglich. Erregungsbertra-
gung wie Hemmung geschieht durch Freisetzung
von Substanzen wie Adrenalin und Noradrenalin,
die in den Nervenendungen vor den Synapsen
gelagert sind. Die Vorgnge an der Synapse ereig-
nen sich mit vergleichsweise hoher Geschwindig-
keit - jeweils in wenigen Millisekunden.
Bedeutend langsamer vollziehen sich die Ver-
nderungen im endokrinen System. Sie erstre-
cken sich oft ber mehrere Minuten, ja Stunden
und Tage. Die Wirkstoffe im endokrinen System,
die Hormone (griech. horman: drngen), werden
in eigenen Produktionssttten wie der Schilddr-
se, den Hoden oder der Nebennierenrinde er-
zeugt und ber die Blutbahn oder andere Krper-
flssigkeiten zu den Endorganen gebracht. Dort
regen die Hormone nicht nur Wachstum an,
sondern steigern auch die Erregbarkeit; dies fhrt
zu Erscheinungen wie Euphorie, Aggressivitt
und Sexualitt.
Die chemische Betrachtung des tierischen (und
menschlichen) Krpers wird als Biochemie be-
zeichnet. Als Teilgebiet der Biochemie hat sich
die Analyse des Hormonhaushalts, seiner Aus-
wirkungen und seiner Strungen, verselbstndigt.
Dieses Spezialgebiet trgt den Namen Endokrino-
logie.
Genetik. Genetik (griech. genesis: Entstehung,
genos: Gattung) ist die Lehre von der Vererbung,
der bertragung von Merkmalen und Fhigkei-
ten ber Generationen. Die Genetik hat zunchst
von ueren Eigenschaften, Phnotypen (griech.
phainomenon: Erscheinung) genannt, auf die
3.3 Psychologie und Naturwissenschaften I 85
ihnen zugrunde liegenden Erbanlagen, Genoty-
pen genannt, geschlossen. So lieen sich sowohl
die Erblichkeit als auch der Erbgang von krper-
lichen Merkmalen wie Haarfarbe, Handform und
Blutgruppe nachweisen. Inzwischen ist es gelun-
gen, die Gene, d.h. die Trger der Erbanlagen
sichtbar zu machen. Es sind Molekle, die inner-
halb der Krperzellen in eigenen Trgern, Chro-
mosomen genannt, angeordnet sind. Der Aufbau
der Molekle stellt einen Plan dar, nach welchem
das zugehrige Individuum gestaltet ist. Anders
ausgedrckt: In den Krperzellen ist die gesamte
Erbinformation verzeichnet; sie enthalten den
genetischen Code.
Das menschliche Erbgut ist inzwischen weitge-
hend entschlsselt. Das ist das Ergebnis eines
internationalen Projekts, des "Human Genome
Project". (Die Organisation und die Ergebnisse
des 2003 abgeschlossenen "Human Genome
Project" ist ersichtlich 1m Internet unter
www.ornl.gov/sci/technresources/Human_Geno
me/home.shtml.) Dieser Aufsehen erregende Er-
folg hat zwei weitere Fortschritte angebahnt:
Einerseits die Gendiagnostik, andererseits Eingrif-
fe in das Genom.
Biologische Psychologie, Neuropsychologie, Psy
choendokrinologie. In der Psychologie werden
die Fortschritte der Anatomie, Physiologie und
Biochemie mit Bewunderung und Interesse ver-
folgt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht das
Nervensystem - insbesondere das nervse Zent-
ralorgan, das Gehirn. Immer grer wird inner-
halb der Psychologie die Zahl der Arbeitsgrup-
pen, die sich an der physiologischen und bio-
chemischen Forschung beteiligen, insbesondere
an der Hirnforschung. So hat sich eine Richtung
gebildet, fr welche die Bezeichnungen "Biologi-
sche Psychologie" und "Neuropsychologie" am
gebruchlichsten sind. Psychologische Forschun-
gen mit biochemischem Schwerpunkt - vor allem
den Hormonhaushalt betreffend - werden spe-
ziell unter der Bezeichnung "Psychoendokrinolo-
gie" zusammengefasst (s. Kap. 4.6).
Stellte Biologische Psychologie zunchst eine
Spezialisierung innerhalb der Psychologie dar, so
knnte sie sich nunmehr auf dem Wege zu einem
eigenstndigen, die psychologischen Spezialgebie-
te bergreifenden Ansatz befinden. Das belegt
eine im Jahre 2000 einsetzende Debatte in der
auflagenstrksten deutschsprachigen Fachzeit-
schrift "Psychologische Rundschau". Die Debatte
erffneten Jan Born, Onur Gntrkin und Rainer
Schwarting mit einem Artikel, der den Titel trug:
"Biologische Psychologie - Fach in der Psycholo-
gie?" Zwei Antworten stellten die Autoren zur
Wahl: Ja - Biologische Psychologie ist zu einem
fhrenden Fach der Psychologie herangewachsen.
Dann msse das Fach aber innerhalb der Psycho-
logie mit reichlicheren Mitteln gefrdert werden.
Falls dies nicht geschehe, werde die Antwort bald
lauten: Nein - Biologische Psychologie ist kein
Medizin oder Biologie?
Anatomie und Physiologie, Biochemie und En-
dokrinologie gehren zum traditionellen Be-
stand der Medizin; sie werden an medizinischen
Forschungseinrichtungen betrieben und sind
Gegenstand der Medizinerausbildung. Dabei
verfolgt Medizin letztlich das Ziel, die Entste-
hung von Krankheiten zu erkunden und Wege
zu ihrer Vorbeugung und Heilung zu finden.
Die genannten Fcher sind allerdings auch
in Lehre und Forschung der Biologie vertreten.
Verglichen mit der Medizin drfte in der Bio-
logie der Untersuchung von Tieren und Pflan-
zen ein hheres Gewicht zukommen als die
Untersuchung von Menschen. Aber da zahlrei-
che elementare Lebensprozesse bei Menschen
und Tieren recht hnlich sind und zu ihrer
Untersuchung die gleichen Methoden ange-
wandt werden, gibt es keine Unterschiede in
den einschlgigen Theorien der Mediziner und
Biologen. Die Verdoppelung der Forschung
ergibt sich lediglich aus den unterschiedlichen
Berufsbildern von Medizinern und Biologen.
86 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
Fach der Psychologie mehr. Sie ist abgewandert in
die Familie anderer neurowissenschaftlicher Dis-
ziplinen; dort ist sie gar nicht mehr als Teil der
Psychologie ausgewiesen.
Die Debatte lie keinen Zweifel an den metho-
dischen Fortschritten der Biologischen Psycholo-
gie, ihrem starken internationalen Wachstum
sowie an ihrer Frderwrdigkeit. Doch erhebliche
Bedenken wurden geuert gegen zwei ihrer Ten-
denzen. Das eine ist die Tendenz, psychische
Vorgnge stets auf nervse Prozesse zu reduzie-
ren. Denken und Gedchtnis, Emotion und Mo-
tivation, das Erlebnis des Selbst und der Aufbau
der Persnlichkeit - sie knnen Phnomene eige-
ner Art sein und nicht blo Funktionen der Ner-
venttigkeit. Jedenfalls reichten die bisherigen
Befunde der Hirnforschung fr eine so weit rei-
chende Annahme nicht aus. Damit ist auch der
zweiten Tendenz der Biologischen Psychologie
entgegen zu treten, Psychologie in allen ihren
Teilen der Neurowissenschaft zuzufhren - also
etwa ein Gebiet wie die Entwicklungspsychologie
nur noch neurowissenschaftlich zu betreiben.
Andere Zugnge seien ebenfalls wissenschaftlich
fruchtbar.
Zusammenfassung
(1) Natur nennt man den von Menschen unbe-
einflusst gebliebenen Teil der Welt. Die leb-
lose und lebende Natur ist Gegenstand der
Naturwissenschaften. Naturwissenschaftlich
orientierte Psychologie untersucht (meist an
Individuen) grundlegende Funktionen (wie
Sinnesempfindungen), die im sozialen Leben
vergleichsweise wenig berformt wurden.
(2) Wichtige Partner der Psychologie unter den
Naturwissenschaften sind: (Biologische)
Anthropologie, Zoologie, Ethologie (Verhal-
tensbiologie), Anatomie, Physiologie, Hirn-
forschung, Biochemie, Endokrinologie, Gene-
tik. Zoologie befasst sich insbesondere mit
Genetische Psychologie. Dass krperliche Merk-
male ber Erbanlagen von Eltern an Kinder
weitergegeben werden, dass dabei auch Behinde-
rungen und Krankheiten von Vorfahren auf
Nachkommen bergehen, ist ein naturbedingtes
Schicksal. Doch wie steht es mit psychischen
Eigenschaften, Fhigkeiten und Verhaltenswei-
sen? Einige von diesen scheinen ebenfalls gene-
tisch geprgt zu sein: Intelligenz und Musikalitt,
Erregbarkeit und Stimmung, Sprachbegabung
und Raumorientierung. Jedenfalls hat die Erbfor-
schung Belege hierfr geliefert. Der Untersu-
chung genetischer Faktoren in Persnlichkeit und
Verhalten widmet sich eine weitere spezialisierte
Richtung. Frher nannte man sie Erbpsychologie.
In den letzten Jahren ist dieser Name aus der
Fachsprache weitgehend verschwunden. Man
benutzt heute an seiner Stelle die Bezeichnungen
Genetische Psychologie und Verhaltensgenetik
(mehr dazu in Kap. 4.6.2).
Die Genetische Psychologie war vielfach dem
Verdacht der Ideologie ausgesetzt. Vor allem
wurde gemutmat, sie vernachlssige frderliche
und hemmende Einflsse aus der Umgebung,
insbesondere die Wirkungen der Erziehung. Der
Gattungen von Lebewesen, Ethologie mit
dem arteigenen Verhalten, Anatomie mit
dem Aufbau des Krpers und seinen Orga-
nen, Physiologie mit deren Arbeit. Endo-
krinologie, ein Gebiet der Biochemie, be-
schftigt sich mit dem Hormonsystem.
(3) Zweige der Psychologie, welche ausdrck-
lich Brcken zu den Naturwissenschaften
schlagen, sind: Tierpsychologie (Verglei-
chende Psychologie), Biologische Psycho-
logie, Psychoendokrinologie, Genetische
Psychologie (Verhaltensgenetik) . Eng ver-
flochten sind Neuropsychologie und Hirn-
forschung.
3.3 Psychologie und Naturwissenschaften I 87
Widerstand steigerte sich zeitweise zur Polemik:
Die Theorie einer genetischen Determination
psychischer Eigenschaften stehe im Dienst einer
politischen Ideologie. Diese wolle gesellschaftlich
bedingte Abhngigkeitsverhltnisse und Unge-
rechtigkeiten als naturbedingte Normalzustnde
rechtfertigen. Vor allem verstrkten sie Vorurteile
gegenber ethnischen Gruppen (indem sie etwa
Schwarzhutigen eine geringere intellektuelle Be-
gabung zuerkannten) sowie Benachteiligungen
von Frauen (etwa mit der Behauptung, Frauen
seien aufgrund ihrer Erbausstattung emotional
labiler als Mnner). Ein besonderer Streitpunkt
wurde die Herkunft der Intelligenz: Hngt sie
wirklich mehr von der Begabung der Vorfahren
ab oder von einer guten Erziehung? Sind Theo-
rien der genetischen Bestimmung der Intelligenz
nicht sozial schdlich, weil sie zum Verzicht auf
ffentliche Schulprogramme fr Benachteiligte
fhren?
3.4 Psychologie und die Kultur-
wissenschaften
3.4.1 Philosophie - Wiege der Psychologie
Anthropologie, Ethik. Philosophie (griech. phil-
ein, sophia: lieben, Wissen) war ursprnglich eine
Bezeichnung fr Wissenschaft schlechthin. Und
es konnte nicht ausbleiben, dass der Mensch als
Betreiber von Wissenschaft selbst zu ihrem Ge-
genstand wurde. So entstand ein Gebiet, das aus-
drcklich als Menschenkunde, Anthropologie
(griech. anthropos: Mensch) bezeichnet wurde.
Zur Anthropologie gehrten Fragen nach der
Herkunft des Menschen und dem Sinn seines
Lebens. Was ist der Mensch eigentlich? Was ist
seine Stellung in der Welt? Und wofr lebt er?
Zur Freude an seinem Leben? Zur Erfllung sei-
ner Pflichten? Anthropologie entwickelte sich
demnach in zwei Richtungen:
Beschreibung des menschlichen Wesens in
allen seinen Erscheinungen,
Ethik (griech. ethikos: sittlich), d.h. Lehre vom
richtigen Leben, guten Sitten.
Die Beschreibung des Menschen umfasst seinen
Leib und krperliche Leistungen, weiterhin das
Bewusstsein einschlielich des Willens (z.B. Sin-
nesempfindungen, Wahlentscheidungen). Auch
die Verschiedenheit der Menschen schildert die
Philosophische Anthropologie - Besonderheiten
der Geschlechter, der Persnlichkeiten, der Ras-
sen, der Lebensalter. Gerade die Betrachtung
dieser Probleme hat sich jedoch spezialisiert.
Anatomie und Physiologie haben mit neuen,
leistungsfhigen Methoden die Untersuchung des
Krpers bernommen, die Psychologie die Un-
tersuchung von Bewusstsein und Willen. Eben-
falls zur Domne der Psychologie geworden sind
die individuellen Unterschiede. Die Biologische
Anthropologie (vgl. dazu Kap. 3.2.1) konzentriert
sich auf die krperlichen Unterschiede von Men-
schen in verschiedenen Regionen. Die beschrei-
bende Anthropologie hat sich in neuen, speziali-
sierten Disziplinen verselbstndigt. Der Philo-
sophie selbst sind nur die Grundsatzfragen der
menschlichen Existenz geblieben.
Anders steht es mit der Ethik. Sie ist eine Sule
der Philosophie geblieben. Die Umwlzungen der
Naturwissenschaften und der Technik haben ihr
sogar vllig neuartige Probleme von hchster
Bedeutung bereitet. Es geht nicht mehr nur um
Freundschaft und Liebe, Reden und Schweigen
und hnliche Fragen zur rechten Gestaltung des
brgerlichen Lebens. Es geht um Fragen, die sich
als existentiell fr das berleben und die Wrde
der Menschheit erweisen knnten - die Erhaltung
der Natur, die Verantwortung fr kommende
Generationen, die Zulssigkeit von Eingriffen in
das Erbgut. Und ber allen praktischen Fragen
steht die Suche nach den theoretischen und me-
thodischen Grundlagen der Ethik: Was ist eigent-
lich das Gute? Und wie kann man Gutes erken-
nen?
Bleibt hinzuzufgen: Die moderne Anthropo-
logie hat sich zunehmend darauf verstndigt, den
88 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
Menschen als Kulturwesen zu behandeln. Was
der Mensch ist und wie er sich verhalten sollte, ist
demnach zu erklren aus seiner Geschichte, aus
seinen regionalen Lebensbedingungen, seinen
gesellschaftlichen Wertvorstellungen, Einrichtun-
gen und Gebruchen. Fr diesen Ansatz steht der
Begriff der Kulturanthropologie.
Zum Weiterlesen
Anthropologie, Ethik, Erkenntnistheorie
Gehlen, A. (1997). Der Mensch. Seine Natur und
seine Stellung in der Welt. Heide1berg: Quelle &
Meyer.
Jonas, H. (1989). Das Prinzip Verantwortung. Ver-
such einer Ethik fr die technologische Zivilisation.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Zwei klassisch zu nennende Werke moderner Autoren.
Chalmers, A.F. (2001). Wege der Wissenschaft.
Berlin: Springer.
Eine erkenntnistheoretische Schrift. Ihr Untertitel
lautet: Eine Einfhrung in die Lehre von der wissen-
schaftlichen Erkenntnis.
Logik, Erkenntnistheorie. Was ist Wahrheit? Und
wie gelangt man zur Wahrheit? Dies sind zwei
Grundfragen der Wissenschaft. Man ordnet ihre
Behandlung vorzugsweise der Philosophie zu.
Unter den Begriff der Logik (griech. logike tech-
ne: Kunst des Denkens) fallen Regeln zur Be-
griffs- und Urteilsbildung. Zentrales Problem der
Begriffsbildung ist die Bestimmung von Klassen -
und ihre Aufgliederung in Unterklassen. Urteils-
bildung umfasst verschiedene Arten des Schluss-
folgerns, d.h. des Ableitens eines Schlusses, d.h.
einer begrndeten neuen Aussage, aus Prmissen,
d.h. vorgegebenen Aussagen (z.B. Prmisse 1: Der
Mrder fuhr einen BMW. Prmisse 2: Stefan S.
fhrt einen BMW. Die Schlussfolgerung daraus:
Stefan knnte der Mrder sein).
Unter dem Begriff der Erkenntnistheorie be-
handelt man die Gewinnung und Rechtfertigung
von Aussagen. Ein zentrales Problem der Er-
kenntnistheorie ist das Verhltnis von Erfahrung
und Denken (s. Kap. 3.1.2 zur Transzendental-
philosophie). Kann man nur denken, was man
vorher mit seinen Sinnen erfahren hat? Oder
bersteigt Denken in seinen fortgeschrittenen
Formen die sinnliche Erfahrung? Wie kann man
durch Beobachtung theoretische Aussagen falsifi-
zieren, d.h. sie aus der Menge vertretbarer Aussa-
gen ausscheiden? Ist es berhaupt mglich, Theo-
rien durch Beobachtung zu verifizieren, d.h. als
richtig zu besttigen? Angewandt auf Wissen-
schaften wird die Erkenntnistheorie auch als Wis-
senschaftstheorie bezeichnet.
Zur Logik und Erkenntnistheorie hat die Psy-
chologie eine doppelte Beziehung. Zum einen
untersucht sie die Wahrnehmungs- und Denk-
leistungen der Menschen; dabei kann sie Wahr-
nehmungsprozesse, Begriffs- und Urteilsbildung,
wie sie unmittelbar zu beobachten sind, mit An-
nahmen der allgemeinen Erkenntnistheorie ver-
gleichen. Zum anderen unterzieht Psychologie
ihre Untersuchungsmethoden und ihre Theo-
rienbildung einer bestndigen Prfung; dabei
wendet sie die allgemeine Wissenschaftstheorie
auf sich selbst an.
3.4.2 Philologisch-historische Wissen-
schaften - Kern der Geisteswissen-
schaften
Sprachwissenschaft. Sprachwissenschaft beschf-
tigt sich einerseits mit den Bestandteilen von
Sprachen: Phoneme (Lauteinheiten), Morpheme
(kleinste Sinneinheiten wie Wortstmme und
-endungen), Wrter, Stze und Texte. Anderer-
seits ermittelt sie die Regeln, nach denen Bestand-
teile zusammengesetzt werden: Laute zu Worten,
Worte zu Stzen, Stze zu Geschichten. Zusam-
mensetzregeln bezeichnet man als Grammatik
oder als Syntax (entsprechend: Satzgrammatik,
Geschichtengrammatik u..). Dabei gliedert sich
die Sprachwissenschaft in zwei Richtungen:
die Philologien,
die Allgemeine Sprachwissenschaft oder Lin-
guistik (lat.lingua: Sprache).
3.4 Psychologie und die Kulturwissenschaften I 89
II.
DIE SKULARISIERUNG DES ANDENKENS -
MEMOR1A, FAMA, HISTORIA
1. Gedchtniskunst und Totenmemoria
Das kulturelle Gedchtnis hat seinen anthropologischen Kern im To-
tengedchtnis. Damit ist die Verpflichtung der Angehrigen gemeint, die
Namen ihrer Toten im Gedchtnis zu behalten und gegebenenfalls der
Nachwelt zu berliefern. Das Totengedchtnis hat eine religise und ei-
ne weltliche Dimension, die sich als <Pietas} und (Fama) einander ge-
genberstellen lassen. Piett meint die Pflicht der Nachkommen, das eh-
rende Andenken der Verstorbenen aufrechtzuerhalten. Piett knnen
immer nur die anderen, die Lebenden flir die Toten aufbringen. Fr Fa-
ma, d. h. flir ein ruhmreiches Andenken, kann dagegen jeder zu einem
gewissen Grade selber zu Lebzeiten Vorsorge treffen. Fama ist eine s-
kulare Form der Selbstverewigung, die viel mit Selbstinszenierung zu
tun hat. Das Christentum des Mittelalters hat mit seiner Sorge um das
Seelenheil imJngsten Gericht die antike Sorge um ruhmreiches An-
denken in der Nachwelt weitgehend berdeckt.
Das Gedchtnis ist der Tummelplatz der Erfahrungen. Die
Spuren der Ereignisse, die das Gedchtnis prgten, bleiben
lebendig - sie wirken, weben und leben unbedacht und wir-
ken auf den Geist zurck. Die Intensitt der Erfahrungen
und die Sorge, alle Erfahrungen ertragen zu mssen, ohne zu
wissen, wie das geschehen soll, macht die Not des Gedcht-
nisses aus. Dieser konomiezwang des Gedchtnisses pro-
voziert die semantischen Kmpfe der Erinnerungen. Des-
halb zeigen sich Blockaden, Neurosen, Psychosen, die die
semantischen Machtbereiche imBegriffskampf signalisieren.
Ziel dieses Kampfes ist es, die Gewalt der Erfahrung ertrg-
lich zu machen, die Gedchtnisinhalte zu domestizieren, Wo
das gelingt, sind Begriffe und Erinnerungen verfgbar, wo
nicht, entsteht, bleibt die Not des Erinnerns.
Abbildung 3.5. Gedchtnis und Erinnern gehren zu den zentralen Problemen der Anthropologie. Die moderne Psy-
chologie hat aus ihrer Untersuchung eines ihrer fruchtbarsten Forschungsgebiete gemacht. Doch ist die Psychologie
nicht die einzige Disziplin, welche dieses Thema aufgegriffen hat. Alle Kulturwissenschaften nehmen Anteil daran. Der
links wiedergegebene Text ber das Gedchtnis stammt von dem Philosophen Schmidt- Biggemann (1992, S. 16 f,
Faksimile). Der Autor hat ihn aufgeschrieben als "philosophischen Reisebericht", als Mitteilung der "Erfahrungen des
flanierenden Geistes in philosophischen Sinnlandschaften" (Schmidt-Biggemann, 1992, S. 9). Den rechts wiedergegebe-
nen Text hat die Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann (1999, S. 33, Faksimile) verfasst. Er ist Teil ihrer Abhand-
lung ber Formen und Wandlungen des kulturellen Gedchtnisses, in welchem sie "Erinnerungsrume" behandelt-
Archive und Medien, Denkmler und Gedenkorte
Philologien lehren die Besonderheiten von
Sprachsystemen unterschiedlicher Herkunft und
verschiedenen Alters - z.B. Germanistik die ger-
manischen Sprachen (Deutsch, Niederlndisch
u..), Romanistik die romanischen Sprachen
(Franzsisch, Italienisch u..), Sinologie das Chi-
nesische, Latinistik das antike Latein. Zugleich
befassen sie sich mit dem Sprachwandel, d.h. der
nderung von Wortbedeutungen und syntakti-
schen Regeln ber lngere Zeiten.
Die Allgemeine Sprachwissenschaft oder Lin-
guistik sucht nach Theorien, welche einzelne
Sprachsysteme sowie einzelne Epochen bergrei-
fen; sie behandelt die Struktur der (gesproche-
nen) Sprache berhaupt. So schafft sie Grundla-
gen fr die oben getroffenen Unterscheidungen
von sprachlichen Einheiten und gibt Antworten
auf Fragen wie: Was ist ein Morphem? Was ist ein
Satz? Weiterhin bestimmt sie die Regelungen der
Syntax bzw. Grammatik - z.B. die Deklination
von Wrtern nach ihrer Rolle im Satz (1. Fall
oder Nominativ fr die Rolle des Handelnden,
2. Fall oder Genitiv fr die Rolle des Besitzenden
usw.). Die Sprachwissenschaft hat sich ber ver-
schiedene Zweige ausgedehnt. So untersucht der
Zweig der Pragmalinguistik (griech. pragma:
Handlung) die Beziehung der Sprache zur
Sprechsituation bzw. den Absichten des Spre-
chers. Sprachliche uerungen werden dann als
(Sprech)handlungen gedeutet, mit denen ein
Sprecher seine Ziele erreichen will: als Bitte, die
ein Entgegenkommen des Partners anstrebt, als
Versprechen, das ein Entgegenkommen des Spre-
chers zusichert, u..
Sprachpsychologie. Sprache ist auch fr die Psy-
chologie ein magebliches, unverzichtbares und
unerschpfliches Thema. Mindestens vier Grn-
de fr die psychologische Bedeutsamkeit der
Sprachanalyse sind zu nennen. Erstens, stellen
sich Inhalte des Bewusstseins bevorzugt IJ1
sprachlicher Form dar. Phantasievorstellungen,
Gefhle u.. lsst sich der Untersucher am ein-
90 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
fachsten von dem Betroffenen berichten. Zwei-
tens sind geistige Leistungen oft unmittelbar an-
hand von Aussagen zu berprfen - z.B. das Er-
kennen von Bildern durch deren Benennung, das
Erinnern von Ereignissen durch deren Beschrei-
bung. Drittens erfolgt ein Groteil der zwischen-
menschlichen Kommunikation mit Hilfe der
Sprache - in Dialogen, Briefen, Gebrauchsanwei-
sungen u.. Und viertens, ist das Verstehen von
Sprache (beim Hren oder Lesen) sowie das Er-
zeugen von Sprache (durch Sprechen oder Schrei-
ben) selbst ein psychischer Vorgang, der brigens
zahlreiche grundlegende Prozesse einschliet:
Wahrnehmung, Schlussfolgerung, Begriffsbildung,
Gedchtnis, Bewegung und Handlung.
Vor allem der zuletzt aufgefhrte Grund hat zu
der Einrichtung eines eigenen, speziell der Spra-
che zugewandten Bereichs der Psychologie ge-
fhrt, der Psycholinguistik. Die Psycholinguistik
steht der Allgemeinen Sprachtheorie, der Linguis-
tik, nher als den auf regionale Sprachen kon-
zentrierten Philologien. Insofern kann die Psy-
cholinguistik mit dem Sprachreichtum der Philo-
logen nicht mithalten. Jedoch hat sie ausgefeilte,
die Einzelsprachen bergreifende Theorien zur
Sprachproduktion und zum Sprachverstndnis
vorgelegt.
Geschichtswissenschaft. Die Geschichtsbetrach-
tung wendet die Aufmerksamkeit von der Gegen-
wart auf vergangene Epochen - bis hin zu Mittel-
alter, Altertum, Vor- und Frhgeschichte. Bei der
Rekonstruktion der Vergangenheit sttzt sie sich
auf Dokumente und andere Artefakte wie Statuen
und Mnzen. Sie ermittelt gesellschaftliche, wirt-
schaftliche, religise u.a. Strukturen (z.B. Herr-
schaftsformen und Besitzverhltnisse, Verbrei-
tung religiser Bekenntnisse) sowie deren Wandel
im Laufe der Zeit. Ein vorherrschendes Thema ist
die Biographie von Persnlichkeiten - ihre Her-
kunft und Bildung, ihr Schicksal, ihre Leistungen,
ihre Untaten. Doch oft ist es auch die Geschichte
von Gemeinschaften, etwa Familien und Vlkern,
die rekonstruiert wird.
Politik - nicht zuletzt Auseinandersetzungen
zwischen Brgern, Machtkmpfe, Kriege zwi-
schen Vlkern - nimmt in der Geschichtswissen-
schaft einen breiten Raum ein. Doch historische
Lehren behandeln auch Kunst und Religion, All-
tags- und Festtagsbruche, Wirtschaft, Technik
und Verkehr. Wenn Historiker Biographien oder
den Wandel sozialer Verhltnisse deuten, kann
man sie als kundige Psychologen bewundern. Wie
Psychologen errtern sie Geist und Verhalten der
Menschen. Sie stellen Motive fr Handlungen
fest, Fhigkeiten, Einstellungen, Irrtmer (z.B.
Machthunger, militrische Begabung, Glauben an
die eigene berlegenheit, Fehleinschtzungen der
Gegner). Sie erklren die Einflsse von Zustnden
und Ereignissen auf das Leben der Menschen
(z.B. Kinderreichtum aufgrund protestanti-
scher Familienmoral, Aufstnde nach Unterdr-
ckung).
Geschichtspsychologie. Innerhalb der Psycholo-
gie hat es Anregungen gegeben, einen eigenen
Zweig der Geschichtspsychologie zur Deutung
der Vergangenheit zu begrnden. Tatschlich
geschieht es selten, dass Fachpsychologen sich
rckblickend zu Personen und Ereignissen der
Geschichte uern. Mitunter vermisst man gera-
dezu in aktuellen historischen Diskussionen (z.B.
ber Nationalsozialisten und ihre Gewalttaten,
die Vergleichbarkeit von Bolschewismus und
Nationalsozialismus) die Stimme von Fachpsy-
chologen. Dabei gibt es ein Anwendungsfeld, in
welchem Psychologen regelmig die Retrospek-
tive pflegen: die Kognitive Psychotherapie (s.
Kap. 7.4.2). Zur grndlichen Untersuchung eines
Klienten mit psychischen Beschwerden gehrt
eine sog. Anamnese, d.h. eine Rckschau auf sein
Leben. Die Anamnese soll die Entstehung der
Beschwerden aufdecken; einige therapeutische
Richtungen versprechen sich bereits von der be-
wussten Rekonstruktion der Entstehung psychi-
scher Leiden deren Heilung. So bleibt es nicht
aus, dass manchmal auch von der Geschichtsfor-
schung therapeutische Effekte erwartet werden;
3.4 Psychologie und die Kulturwissenschaften I 91
Abbildung 3.6.
Odo Marquard
Odo Marquard, geboren
1928, ist Professor fr Phi-
10sophie an der Universitt
Gieen
'1
Geisteswissenschaften - Auslaufmodell oder unverzichtbar?
Gehrt die Zukunft allein den Naturwissenschaften? Werden die Naturwissenschaften die Geistes-
wissenschaften auf Dauer verdrngen? Der Philosophieprofessor Odo Marquard ist zuversichtlich:
Ohne Geisteswissenschaften geht es nicht. Diese Einschtzung hat er in einem Vortrag vor der West-
deutschen Rektorenkonferenz (1985, S. 47f.) begrndet:
Je moderner die moderne Welt wird, desto unvermeidlicher werden die Geisteswissenschaften. ... Das
Vorurteil, das ich ... dementieren mchte, ... lautet folgendermaen: die Geisteswissenschaften wer-
den durch die Modernisierung unserer Welt zunehmend obsolet; denn zur modernen Welt gehrt die
Geburt und Expansion der harten - der experimentierenden - Wissenschaften (also mageblich der
Naturwissenschaften, aber auch der messenden Humanwissenschaften) ., .. Dieses Vorurteil lebt von
folgender historischer Annahme: erst waren - als die alten Wissenschaften - die Geisteswissenschaften
da; dann kamen - als die neuen Wissenschaften - die experimentellen Wissenschaften. Aber diese . ..
Annahme ist falsch. ... Es verhlt sich nmlich genau umgekehrt: erst waren die experimentellen Na-
turwissenschaften da; dann kamen die Geisteswissenschaften. Die Geisteswissenschaften sind jnger
als die Naturwissenschaften.
. .. die durchschnittliche Etablierungsverzugszeit der Geisteswissenschaften
gegenber den experimentellen Naturwissenschaften ... betrgt ... ungefhr ...
100 Jahre. Symptomatisch dafr ist schon der Zeitabstand der beiden philoso-
phischen Programmschriften, jener, die aufdie Naturwissenschaften hinauswill,
und jener, die auf die Geisteswissenschaften hinauswill: Descartes' "Discours
de la methode" erscheint 1637, Vicos "Scienza Nuova" erscheint 1725.... In
symptomatisch hnlichem Abstand tauchen die Namen beider Wissenschafts-
gruppen auf der Terminus "Naturwissenschaften" wird ab 1703 gebruchlich,
der Terminus "Geisteswissenschaften" ab 1847 .... Der entscheidende Durch-
bruch der Naturwissenschaften (zunchst der Physik und Chemie) zur Exakt-
heit - man denke an Galilei, Torricelli, Boyle, Newton, Lavoisier, usf - war
das 17. und 18. Jahrhundert; der entscheidende Durchbruch der Geisteswissen-
schaften (der "betrachtenden" ... also zunchst der Altertumskunde, dann der
Geschichte, der Sprach-, Literatur- und Kunstwissenschaften) zu ihrem eigenen
Weg- man denke an Winckelmann, ... Herder, Grimm, Bopp, Niebuhr,
Ranke ... - war das 18. und 19. Jahrhundert. ...
Was ... bedeutet das? Doch wohl dieses: wenn die Geisteswissenschaften "nach" den experimentel-
len Wissenschaften entstehen, kann es nicht stimmen, dass sie durch die experimentellen Wissen-
schaften berflssig werden. ... Die Genesis der experimentellen Wissenschaften ist nicht die Todes-
ursache, sondern die Geburtsursache der Geisteswissenschaften. ... experimentelle Wissenschaften
mssen die geschichtlichen Herkunftswelten ihrer Wissenschaftler neutralisieren. ... Das aber halten
die Menschen nicht in beliebigem Umfang aus: darum kompensieren sie die Neutralisierung ihrer
geschichtlichen Herkunftswelten durch die Rettung ihrer Prsenz die - durch die experimen-
tellen Wissenschaften vorangetriebene - Modernisierung verursacht lebensweltliche Verluste, zu
deren Kompensation die Geisteswissenschaften beitragen. ...
Wer berprjbar experimentieren will, mu die Experimentierer austauschbar machen. Die Ex-
perimentierer aber sind Menschen, und Menschen sind eben nicht einfachhin austauschbar: ... weil
92 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
die Menschen primr tatschlich verschieden sind, nmlich - noch vor aller Individualitt- funda-
mental mindestens dadurch, da sie in verschiedenen Traditionen sprachlicher, religiser, kultureller,
familirer Art stecken . ... Darum mu man die Menschen experimentierfhig - d. h. austauschbar-
erst kunstvoll machen; justament das geschieht in den modernen experimentellen Wissenschaften ....
Der Mensch wird nun auch lebensweltlich zum Sachverstndigen und das, was ist, zur Sache: zum
exakten Objekt, zum technischen Instrument, zum industriellen Produkt, zur konomisch kalkulier-
baren Ware, wobei all dieses - weil es zur Globalisierung drngt - die Lebenswelten weltweit unifor-
misiert ....
Das bedeutet: Immer weniger von dem, was Herkunft war, scheint Zukunft bleiben zu knnen; die
geschichtlichen Herkunftswelten geraten zunehmend in die Gefahr der Veraltung: das aber wre-
unkompensiert - ein menschlich unaushaltbarer Verlust, weil ... der ... Bedarf der Menschen nicht
mehr gedeckt wre, in einer farbigen, vertrauten und sinnvollen Welt zu leben. ... Dieser Verlust ruft
also nach Kompensation; und die Kompensationshelfer sind die Geisteswissenschaften, die darum
gerade jetzt - modern - erst entstehen.
Marquard, O. (1985). ber die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften. In: Westdeutsche
Rektorenkonferenz (Hrsg.), Anspruch und Herausforderung der Geisteswissenschaften. Dokumente
zur Hochschulreform, 56, S. 47-67.
die Aufklrung von frherer Schuld und frhe-
rem Leid soll Beteiligte von Schuld- und Trauer-
gefhlen befreien. Umgekehrt heben Berichte
ber Erfolge und Wohltaten frherer Generatio-
nen oft das Selbstbewusstsein und das Wohlbe-
finden der Nachkommen.
Literatur- und Kunstgeschichte. Smtliche Kunst-
werke - Erzhlungen und Gedichte, Lieder, Tnze
und Instrumentalmusik, Gemlde und Plastiken
- werden als Zeugnisse von Kulturen gepflegt, in
Erinnerung gehalten und Deutungen unterwor-
fen. Wissenschaft spielt in der Dokumentation
und Deutung von Kunst eine bedeutende Rolle,
wobei verschiedene Zweige sich unterschiedlicher
Arten von Kunstwerken annehmen. Schwerpunk-
te in der Literatur- und Kunstbetrachtung sind
Topik (griech. topos: Thema) und Struktur von
Kunstwerken (z.B. Liebe als Thema von Roma-
nen, das Sonett als Versform), deren Wandel
ber Epochen (z.B. Entwicklung der Malerei vom
Klassizismus bis zum Impressionismus), ihre
Beziehung zu ihren Autoren sowie deren Umfeld
(z.B. ob Verdi sein Requiem in Erwartung seines
eigenen Todes schrieb).
Knstler gelten oft als geniale Psychologen;
ihre Charakterisierung von Personen, ihre Ent-
wrfe von Situationen und Handlungen enthl-
len oft tiefe und originelle Erkenntnis der
menschlichen Natur und kultureller Eigenarten.
Literatur- und Kunstwissenschaftier, die ihre
Werke analysieren, stehen Knstlern an Men-
schenkenntnis nicht nach, ja suchen sie sogar
noch zu bertreffen. Macht Kunstbetrachtung
also Psychologie entbehrlich? Wissenschaftliche
Psychologie weist zumindest zwei Vorzge auf:
Realittsnhe und Systematik. Realittsnhe: Ihre
Untersuchungen erstrecken sich unmittelbar auf
lebende Personen, whrend die Kunst freie
Nachbildungen der Wirklichkeit, mitunter sogar
Erfindungen der Phantasie, Fiktionen, pflegt.
Systematik: Kunst stellt in der Regel Einzelflle
dar. Die knstlerische Darstellung muss offen
lassen, wie verbreitet solche Einzelflle sind und
unter welchen Bedingungen sie zustande kom-
3.4 Psychologie und die Kulturwissenschaften I 93
Hochkultur und volkskultur
Unter Kultur versteht man manchmal nur die
herausragenden, neue Wege weisenden Leistun-
gen einer Epoche: Heldentaten, umwlzende Er-
findungen und eindrucksvolle Einsichten. Zu
diesen Spitzenleistungen zhlen Werke genialer
Knstler. Helden, Reformer, weitblickende
Staatsmnner, groe Philosophen, Maler und
Dichter werden zu den bevorzugten Gegenstn-
den fr viele Historiker. Ihr Blick richtet sich
auf das, was sie fr vorbildlich halten, auf das
Unbertroffene, das Fortschrittlichste und
Denkwrdigste aus den jeweiligen Epochen.
Zum Leitthema ihrer Betrachtung werden die
hchsten Errungenschaften der Kultur, die
Hochkultur. Wissenschaften machen die Hoch-
kultur gern zu ihrem Gegenstand.
Eine Hochkultur wird nur von wenigen Mit-
gliedern einer Gesellschaft getragen, nur von eli-
tren Gruppen. Viele Zeitgenossen haben daran
keinen Anteil- das Volk. Doch auch, wer nicht
zur Elite gehrt, fhrt ein epochenspezifisches
Leben. Die Arbeit auf dem Acker und in der
Fabrik trgt unverwechselbare Zge. Es sind
viele Menschen, die Kriege erleben; sie alle sin-
gen die gleichen Lieder und hren die gleichen
Erzhlungen. Auf Fortschritte hat das Volk oft
gedrngt; doch hufig folgt es der Gewohnheit,
der Tradition. Gelehrsamkeit wie Knstlerturn
genieen im Volk viel Respekt, finden aber bei
ihm nur schwer Verstndnis. So bildet sich eine
Kultur eigener Art: die Volkskultur.
Geschichts-, Sprach- und Kunstwissenschaft
hat in der Volkskultur ebenfalls lohnende The-
men gefunden. Sie entdeckt darin eigenstndi-
ges, regional gebundenes und nach Epochen
wechselndes Denken und Fhlen, eigene Stile
der Lebensgestaltung. Es geht dabei nicht um
herausragende Persnlichkeiten, mehr um die
Vielen, deren Namen vergessen sind. Selten geht
es um Spitzenleistungen und -ereignisse, mehr
um den Alltag und um typische Schicksale.
Volkskultur hat sich in der Moderne beson-
ders gewandelt durch massenhafte Verbreitung
von Konsumgtern und Kunstwerken. Der So-
zialphilosoph Walter Benjamin (1972, S. 14f.)
schildert die Ausbreitung einer Massenkultur, in
welcher Kunst durch Techniken der Reproduk-
tion zum Konsumgut wird: "Der einzigartige
Wert des echten Kunstwerks hat seine Fundierung
im Ritual, in dem es seinen originren und ersten
Gebrauchswert hatte.... die technische Reprodu-
zierbarkeit des Kunstwerkes emanzipiert dieses
zum ersten Mal in der Weltgeschichte von seinem
parasitren Dasein am Ritual."
In ihren Anfngen ist die Hochkultur mit der
Oberschicht (Adel, Kirche) verbunden, die Volks-
kultur mit der Unterschicht (Bauern, Handwer-
ker). Seit dem 19. Jahrhundert wird das Brger-
tum zur magebenden Schicht. Dichtung und
Musik entstehen zunehmend fr die Familie im
Brgerhaus, fr ffentliche Theater und Konzert-
sle. Das Brgertum bringt eine neue Hochkultur
hervor und zugleich eine durch Massenkonsum
gesttzte Richtung, deren Qualitt den Mast-
ben der Hochkultur nicht gerecht wird. Beispiele
aus der brgerlichen Hochkultur sind die Dramen
Schillers (1759-1805) und Symphonien Beet-
hovens (1770-1827).
Eine Gattung, die als Konsumware weite Ver-
breitung, aber nicht den Beifall der an der Hoch-
kultur orientierten Kunstkritiker gefunden hat, ist
der sog. Kitschroman. Beispiele sind die Romane
von Hedwig Courths-Mahler (1867-1950). Der
Germanist Walther Killy (1962, S. 22 f.) urteilt
ber den Kitschroman: "Der schlechte Schreiber
gebraucht die Dinge um ihrer Anwendbarkeit wil-
len; er whlt sie, wenn er sie als Vehikel drftigen
Tiefsinns fr geeignet hlt. Der Dichter erzhlt
von Dingen, weil sie nur so und nicht anders er-
scheinen knnen: es gibt auch eine Notwendigkeit
der Imagination, die der Notwendigkeit des Le-
bens entspricht. ... Der Stil solcher [schlechter]
Autoren ... ist auf den momentanen Effekt gerich-
tet ... die Tendenz des Kitsches [ist] unrealistisch,
denn die Verhltnisse, sie sind nicht so. Angesichts
dieses unbestreitbaren Sachverhalts pflegt man
den Kitsch als verlogen zu bezeichnen und seine
Mischung von Reiz und Unwahrheit als bse.... "
94 : 3 Scelcnlehren in MetJplwsik, NJtur- und KulturwissenschaftcJ1
men. Die Abschtzung der Reprsentativitt von
Beobachtungen sowie der Aufklrung ihres Ent-
stehens ist dagegen die Strke der wissenschaft-
lichen Analyse.
Kunstpsychologie. Der Analyse der Persnlich-
keit und Biographie von Knstlern, der Entste-
hung von Kunstwerken sowie deren Wirkung auf
Leser, Hrer, Betrachter hat sich ebenfalls die
Kunstpsychologie verschrieben. (Gelegentlich wird
als gesonderter Ansatz eine Literaturpsychologie
vertreten.) Insbesondere die Empfindungen des
Schnen und Hsslichen, sowie deren Auslser
sucht eine Richtung zu erforschen, die man als
Psychologische sthetik bezeichnet. Die Psycho-
logische sthetik betrachtet als Auslser von
Wohlgefallen und Abscheu nicht nur Kunstwer-
ke, auch alltgliche und natrliche Gegenstnde
wie Haushaltsgerte, Familienfotos und Pflanzen,
darber hinaus Wohnrume, Landschaften u..
3 4 3 Sozialwissenschaften
Soziologie. Die Soziologie ist mit den modernen
sozialen Einrichtungen gewachsen, mit der Kom-
plexitt sozialer Prozesse und Beziehungen. So
befasst sie sich mit Organisationen (wie Wirt-
schaftsverbnden, Gewerkschaften, Stadtverwal-
tungen), mit Gruppierungen (wie Jugendlichen,
Religionsangehrigen, Auslndern), mit sozialen
Einstellungen (u.a. zur Demokratie, zur Alters-
versorgung), sozialen Ablufen (wie Kommuni-
kationsfluss, Machtausbung) und sozialen Ord-
nungen (wie Arbeitsteilung, Rangverteilung).
Soziologie erforscht nicht nur groe Organisatio-
nen - wie die Bundeswehr - sondern auch kleine
- wie die Familie. So entstehen Lehren, die auf
besondere gesellschaftliche Bereiche zugeschnit-
ten sind - wie Medien-, Jugend- und Medizinso-
ziologie. Diese bilden zusammen die Spezielle
Soziologie. Als Grundlage der Speziellen Soziolo-
gie konzipiert ist die Allgemeine Soziologie. Sie
widmet sich den Gemeinsamkeiten soziologischer
Theorien, insbesondere Theorien des Aufbaus
und Wandels von Gesellschaften, der Struktur
von sozialen Institutionen sowIe des sozialen
Handeins.
Staats, Rechts, Wirtschaftswissenschaften. Staat,
Recht und Wirtschaft sind zentrale Bereiche in
modernen Kulturen. Morallehren begrnden ihre
Grundstze - vor allem den Grundsatz der Ge-
rechtigkeit. Was ist gerechte Herrschaft, gerechte
Strafe, der gerechte Preis? Speziallehren liefern
sachkundige Analysen sowie praktische Anleitun-
gen. Die Staatslehre vermittelt Kenntnis von m-
tern und Verwaltungen, von Steuern und deren
Verwendung im Staatshaushalt. Die Rechtslehre
unterrichtet ber Gesetze, Gerichtswesen und
Gerichtsverfahren, und die Wirtschaftslehre be-
schftigt sich mit der Produktion von Gtern auf
dem Lande, in Werksttten und Fabriken, der
Preisgestaltung und Buchhaltung sowie dem
Handel mit Gtern und Finanzmitteln.
Man knnte Staats-, Rechts- und Wirtschafts-
lehren zu Spezialgebieten der Soziologie erklren,
und in der Tat hat die Spezielle Soziologie (s.o.)
fr sie eigene Lehr- und Forschungsgebiete aus-
gewiesen - Politikwissenschaft, Rechts- und Wirt-
schaftssoziologie. Doch erlangen die drei Diszip-
linen im System der Wissenschaften aus zwei
Grnden Eigenstndigkeit und eine starke Stel-
lung obendrein: Sie pflegen ein unberbotenes
Spezialwissen ber Institutionen (z.B. Parlamen-
te, Banken, Gerichte) und deren Verfahrensre-
geln. Ihre starke Stellung verdanken sie zudem
ihrer engen Verknpfung mit traditionellen und
geachteten Berufen. Insbesondere obliegt ihnen
die Ausbildung von Verwaltungsbeamten, Rich-
tern und Rechtsanwlten sowie von Verantwort-
lichen in Wirtschaftsunternehmen.
Gesellschaft, Wirtschaft, Recht in der Psycholo-
gie. Das Leben der Gesellschaft ist auch ein wich-
tiges Themen aus der Sicht der Psychologie. In
der Tat hat die Psychologie unter dem Namen
Sozialpsychologie einen bedeutsamen Zweig ent-
wickelt, der sich speziell mit Gruppen, zwischen-
menschlichen Prozessen sowie dem Einfluss des
sozialen Umfeldes auf Individuen befasst (mehr
3.4 Psychologie und die Kulturwissenschaften I 95
ber Sozialpsychologie in Kap. 4.1.3 und 4.4).
Wenn sich die Sozialpsychologie in ihrem Ansatz
mit der Soziologie deckt, ist zu fragen, weshalb die
beiden Disziplinen berhaupt getrennt auftreten.
Der Grund fr die Trennung drfte der folgende
sein: In der Soziologie vereinigt sich enormes
Sachwissen ber formelle Organisationen und
groe Gruppen. Wer etwa den Aufbau und die
Entscheidungsprozesse in Wirtschaftsverbnden,
politischen Parteien u.. genauer kennen lernen
will, wer tiefere Einsichten ber die Meinung und
die Lage von groen Bevlkerungsgruppen (z.B.
Jungwhlern, Rentnern), berhaupt ber gesell-
schaftliche Fragen sucht, wird vor allem von
soziologischen Forschern fundierte Ausknfte
erhalten. Sozialpsychologen konzentrieren sich
dagegen mehr auf berschaubare, informelle
Gruppen und ihre Mitglieder - Eltern und Kinder,
Liebespaare, Diskussionszirkel u.. Wenn Psycho-
logen die Meinung und die Lage von Personen
erkunden, beziehen sie sich eher auf deren nhe-
res Umfeld (Familie, Arbeitsplatz u..). Soziolo-
gie richtet sich somit strker auf das ffentliche
Sozialleben, Sozialpsychologie auf das private.
Staats-, Rechts- und Wirtschaftslehren besitzen
ebenfalls einen erheblichen psychologischen Ge-
halt; dem trgt die Psychologie in ihren Spezial-
gebieten der Politischen Psychologie, der Rechts-
und Wirtschaftspsychologie Rechnung (mehr
dazu in Kap. 5.4 und Kap. 5.6). Gleichwohl haben
Staats-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
gegenber Zweigen der Psychologie einen gewal-
tigen Vorsprung als eigenstndige Fachrichtun-
gen. Von der Psychologie heben sie sich aus den-
selben Grnden ab wie von der Soziologie: Ihr
enormes Spezialwissen und ihre traditionelle
Stellung in der Fachausbildung.
Pdagogik und Erziehungspsychologie. Pdago-
gik (griech. paidagogos: Kinderbetreuer) befasst
sich mit Erziehungszielen und Erziehungsmitteln.
Gegenstand der Pdagogik ist nicht allein das
Lernen in Schulen fr Kinder und Jugendliche.
Vielmehr versteht sie sich als Wissenschaft fr
Bildung und Ausbildung im weitesten Sinne.
Erweitert um Kleinkind- und Erwachsenenpda-
gogik betrachtet sie lebenslanges Lernen. ber
das Lernen in der Schule hinaus befasst sie sich
mit Volksbildung, mit betrieblicher Aus- und
Weiterbildung sowie den auerschulischen Ein-
flssen auf Bildung, wie sie Familie, Altersgenos-
sen, ffentliche Medien u.a. ausben.
Psychologie und Pdagogik hneln sich in der
Breite ihrer Zielsetzung. Versuche, den beiden
Disziplinen getrennte Aufgaben zuzuweisen - z.B.
der Psychologie die Lehre von der menschlichen
Entwicklung, der Pdagogik die Theorie der
altersspezifischen Erziehungsziele -, berzeugen
nicht recht. Vollends erschwert ist die Unter-
scheidung zwischen Pdagogik und der auf Erzie-
hungsprobleme spezialisierten Psychologie, der
Pdagogischen Psychologie oder Erziehungspsy-
chologie. Gleichwohl stellt man erhebliche Unter-
schiede zwischen den beiden Disziplinen fest.
Ungeachtet der Anstrengungen einiger ihrer Ver-
treter, ber den Rahmen des ffentlichen Bil-
dungswesens hinauszugehen, hat die Pdagogik
sich vorwiegend auf die Probleme der Schulpraxis
eingestellt. Die wichtigste Folge war wohl diese:
Pdagogik hat sich vorwiegend als Geistes- und
Sozialwissenschaft verstanden und keinen starken
naturwissenschaftlich geprgten Zweig unterhal-
ten. Im Vergleich dazu hat sich die Erziehungs-
psychologie breiter entwickelt - etwa durch die
Einbeziehung der Probleme der familiren Erzie-
hung und der Vermittlung von Kompetenzen wie
dem Gesundheitsverhalten, die im Lehrplan der
Schulen seltener enthalten sind (mehr zur Erzie-
hungspsychologie in Kap. 5.3).
Ethnologie und Kulturvergleichende psychologie.
Ethnologie, auch als Vlkerkunde (griech. ethnos:
Volk) bezeichnet, erforscht die Lebensweise un-
terschiedlicher Kulturen (Ethnien). Alles, was das
Leben kultureller (ethnischer) Gemeinschaften
kennzeichnet, kann zum Gegenstand der Ethno-
logie werden: Siedlungsformen und Ernhrung,
Mythen und Religionen, Gesnge und Gebru-
96 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
che, Familie und Erziehung, Recht, Besitz und
vieles andere. Manche Ethnologen beschrnken
ihre Untersuchung auf eine einzige Kultur. Ande-
re stellen Vergleiche zwischen verschiedenen
Kulturen an und ermitteln dabei Unterschiede
wie Gemeinsamkeiten. Nach dem Grundsatz der
Gleichwertigkeit smtlicher Menschen sind alle
Vlker gleichermaen Gegenstand ethnologischer
Betrachtung. Tatschlich befassen sich Ethnolo-
gen bevorzugt mit fremden Vlkern, die fern von
den Lndern mit hoch entwickelter Wissenschaft,
Industrie und Versorgung leben. Man nennt
diese Vlker Naturvlker wegen ihres einfachen
Wissens und ihrer schlichten Techniken.
Die Untersuchung sog. Naturvlker war zu-
nchst von dem Bestreben bestimmt, Ursprnge
menschlicher Lebensformen zu entdecken. Dieses
Streben entstammte den widersprchlichen Ein-
stellungen des Kulturpessimismus und des Kul-
turoptimismus (s. Kap. 3.2.1). Kulturpessimis-
mus steht den Errungenschaften von Wissen-
schaft, Technik und Politik kritisch gegenber.
Vom kulturpessimistischen Standpunkt aus er-
hoffte man von Ethnologie Einsichten in ein na-
trliches und einfaches Leben voller Glck, Frie-
den und Gesundheit. Im Gegensatz dazu be-
hauptet der Kulturoptimismus die befriedende,
existenzsichernde und aufklrende Wirkung sozi-
aler Errungenschaften. Von seinem Standpunkt
hilft Ethnologie, die primitiven Ursprnge des
Menschen zu erkennen, die in der Kulturge-
schichte zu berwinden waren und immer aufs
Neue der berwindung bedrfen - Grausamkeit
und Unterdrckung, Aberglaube und Unwissen-
heit.
Auf der Suche nach fremden Vlkern haben
sich Ethnologen in abgelegene Lnder begeben -
wie Neuguinea oder Alaska. Die Beobachtungen
in fremden Kulturen verlangten enorme Anpas-
sungsleistungen - Erwerb vllig fremder Spra-
chen, Respektierung ungewohnter, ja oft der
eigenen Erziehung zuwider laufender Sitten. Fern
von der Zivilisation kamen Unbequemlichkeiten
sowie gesundheitliche Risiken hinzu. Qualifizierte
Ethnologie wurde damit ein Spezialgebiet fr die
wenigen Forscher, die sich den Mhen der Frem-
de auszusetzen bereit waren.
Zum Weiterlesen
Sprach- und Sozialwissenschaften
Philologische und historische Gebiete sollten bereits
aus dem Schulunterricht bekannt sein; entsprechender
Leseempfehlungen bedarf es hier also nicht mehr.
Zum Kennenlernen weiterer Gebiete aus der Sprach-
und Sozialwissenschaft eignen sich:
Bartsch, R. & Vennemann, Th. (1982). Grundzge
der Sprachtheorie. Tbingen: Niemeyer.
Endruweit, G. (Hrsg.). (1993). Moderne Theorien
der Soziologie. Stuttgart: Lucius & Lucius.
Kohl, K.H. (1993). Ethnologie. Die Wissenschaft
vom kulturell Fremden. Mnchen: Beck.
Von den brigen Sozialwissenschaften spaltete
sich Ethnologie damit ab. Dies gilt auch fr die
Psychologie. Freilich besteht zwischen Ethnologie
und Psychologie ein erhebliches wechselseitiges
Interesse. Waren Psychologen oft begierig, mehr
ber menschliches Denken und Verhalten auer-
halb der komplexen, hoch entwickelten Kulturen
zu erfahren, nutzten Ethnologen gern Theorien
der Psychologie zur Erklrung ihrer Befunde.
Als Brcke zwischen Ethnologie und Psycholo-
gie dient gegenwrtig eine Richtung, die man
meist Kulturvergleichende Psychologie, seltener
Ethnopsychologie nennt. Kulturvergleichende Psy-
chologie benutzt gegenwrtig vier Forschungs-
anstze:
Vergleich von Angehrigen verschiedener
Kulturen in verschiedenen Regionen (z.B. Ja-
paner in Japan und Deutsche in Deutschland).
Akkulturation von Migranten in ihrem Gast-
land (z.B. Vergleich japanischer Migranten der
ersten, zweiten, dritten Generation m
Deutschland).
Vergleich von Migranten m ihrem Gastland
(z.B. Japaner in Deutschland) mit Personen
3.4 Psychologie und die Kulturwissenschaften I 97
gleicher Herkunft in ihrem Ursprungsland
(z.B. Japaner in Japan).
Vergleich von Migranten in ihrem Gastland
(z.B. Japaner in Deutschland) mit dessen nicht
eingewanderten Bewohnern (z.B. Deutsche in
Deutschland).
Die kulturvergleichende Forschung hat inzwi-
schen eine Flle von Beobachtungen zur Kul-
turspezifitt von Fhigkeiten und Einstellungen
erbracht. Wenn etwa in Lndern der Dritten Welt
Kinder frhzeitig ihren Eltern bei der Arbeit hel-
fen, dann verhilft ihnen das zu praktischen Fer-
tigkeiten, wie man sie bei europischen und
nordamerikanischen Kindern mit lngerer Schul-
pflicht seltener findet. Mexikanische Kinder, die
in der Tpferwerkstatt ihrer Eltern beschftigt
sind, entwickeln z.B. ein besonders gutes Verm-
gen zum Abschtzen von Volumina (Price-
Williams, Gordon & Ramirez, 1969). Zehn- bis
zwlfjhrige Kinder in Zimbabwe, die ihre Eltern
auf den rtlichen Markt begleiten, sind im Ver-
Zusammenfassung
(1) Unter Kultur versteht man die von Men-
schen geschaffene Welt. Dem Menschen
zugeschrieben werden dabei geistige und
soziale Errungenschaften wie Sittlichkeit
und Erkenntnis, Sprache und Kunst, Staat,
Wirtschaft und Recht, Erziehung und ber-
haupt gesellschaftliche Ordnung.
(2) Wissenschaften, die geistige und soziale Er-
scheinungen erforschen, trennt man in Geis-
tes- und Sozialwissenschaften. Oft werden
sie neuerdings als Kulturwissenschaften zu-
sammengefasst. Psychologie, die sich jenen
Wissenschaften anschliet, wird entspre-
chend als geistes-, sozial- oder kulturwissen-
schaftlich bezeichnet.
(3) Geisteswissenschaften behandeln die Pro-
dukte menschlicher Intelligenz. Wichtige
Partner der Psychologie unter den Geistes-
wissenschaften sind: Philosophie (Anthro-
stndnis von wirtschaftlichen Begriffen gleichalt-
rigen europischen Kindern berlegen (Jahoda,
1982). hnlich steht es mit Einstellungen wie
Egozentrismus oder Ethnozentrismus.
Eine wichtige Rolle fr die Entwicklung spielen
Institutionen, insbesondere solche, die sich aus-
drcklich der Erziehung widmen (wie Familie
und Schule). Theorien des Kulturvergleichs kon-
zentrieren sich in der Regel auf einzelne dieser
Institutionen. Trommsdorff (1993) betont dage-
gen die Wirkung multipler Kontexte in einer
Kultur - etwa das Zusammenwirken von Familie
und Schule, Wirtschaft und Religion. Als zuneh-
mend wichtiges Thema der Kulturvergleichen-
den Psychologie nennt Trommsdorf weiterhin die
multikulturellen Kontexte. Multikulturelle Zu-
sammenhnge entstehen einerseits durch Mi-
schung unterschiedlicher Kulturen im Leben von
Individuen, andererseits als Nebeneinander un-
terschiedlicher Kulturen im gleichen Lebens-
raum.
pologie, Logik, Erkenntnistheorie), Sprach-
wissenschaft (Linguistik, alte und neue
Sprachen), Geschichtswissenschaft, Kunst-
wissenschaft (Literatur, Malerei u.a.).
(4) Soziale Institutionen (Familie, Verbnde,
Staat, Wirtschaft) werden in den Sozialwis-
senschaften erforscht. Wichtige Partner der
Psychologie unter den Sozialwissenschaften
sind: Soziologie, sowie - auf zentrale Berufs-
felder zugeschnitten - die Staats-, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften. Pdagogik (Erzie-
hungswissenschaft) und Ethnologie (Vlker-
kunde) werden hier ebenfalls den Sozialwis-
senschaften zugerechnet.
(5) Die Psychologie unterhlt Brckenfcher zu
zahlreichen sozialwissenschaftlichen Diszip-
linen. Als wichtige Beispiele sind zu nennen:
Sprachpsychologie (Psycholinguistik), So-
zialpsychologie und Kulturvergleichende
98 I 3 Seelenlehren in Metaphysik, Natur- und Kulturwissenschaften
Psychologie, Pdagogische Psychologie,
Kunstpsychologie, Wirtschafts- und Rechts-
psychologie.
(6) Die Zersplitterung von geistes-, sozial- und
naturwissenschaftlichen Anstzen ist aus zwei
Grnden beklagt worden: Sie fhrt zu einer
Entfremdung zwischen wissenschaftlichen
Disziplinen sowie zu unkonomischer Paral-
lelforschung. Der Ruf nach einer Zusam-
menfhrung getrennter Anstze ist daher
laut geworden. Der Psychologie, die
bemerkenswert viele Brcken zu anderen
Fchern unterhlt, wurde dabei eine integra-
tive Rolle zugedacht.
3.4 Psychologie und die Kulturwissenschaften I 99
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Schuld, Scham und das Gewissen: aus theologisch-religiösen und ethischen PerspektivenVon EverandSchuld, Scham und das Gewissen: aus theologisch-religiösen und ethischen PerspektivenNoch keine Bewertungen
- Vertreibung, Flucht, Asyl: Journal für politische Bildung 2/2016Von EverandVertreibung, Flucht, Asyl: Journal für politische Bildung 2/2016Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)
- Geistliche Begleitung in evangelischer Perspektive: Modelle und Personen der KirchengeschichteVon EverandGeistliche Begleitung in evangelischer Perspektive: Modelle und Personen der KirchengeschichteNoch keine Bewertungen
- Im Bauch des Wals: Über das Innenleben von OrganisationenVon EverandIm Bauch des Wals: Über das Innenleben von OrganisationenNoch keine Bewertungen
- Hans Küngs Projekt Weltethos interkulturell gelesenVon EverandHans Küngs Projekt Weltethos interkulturell gelesenNoch keine Bewertungen
- Wenn die Seele auf den Geist geht: Zur Tiefenpsychologie der PhilosophiegeschichteVon EverandWenn die Seele auf den Geist geht: Zur Tiefenpsychologie der PhilosophiegeschichteNoch keine Bewertungen
- Jüdisches Leben in Tirol im 16. und 17. Jahrhundert: Jüdisches Leben im historischen TirolVon EverandJüdisches Leben in Tirol im 16. und 17. Jahrhundert: Jüdisches Leben im historischen TirolNoch keine Bewertungen
- Häusliche Gewalt, Trauma und Prävention: Zehn Jahre Anti-Gewalt-Training in LüneburgVon EverandHäusliche Gewalt, Trauma und Prävention: Zehn Jahre Anti-Gewalt-Training in LüneburgNoch keine Bewertungen
- Kampf oder Untergang!: Warum wir gegen die Herren der Menschheit aufstehen müssenVon EverandKampf oder Untergang!: Warum wir gegen die Herren der Menschheit aufstehen müssenNoch keine Bewertungen
- Ein staatsfernes, freiheitliches Christentum: Die quellennah andere Geschichte des Katholizismus und US-Protestantismus Was die linken Theologiebeamten in Deutschland verfälschenVon EverandEin staatsfernes, freiheitliches Christentum: Die quellennah andere Geschichte des Katholizismus und US-Protestantismus Was die linken Theologiebeamten in Deutschland verfälschenNoch keine Bewertungen
- Wissen sichtbar machen: Elemente und Rahmenbedingungen einer epistemisch orientierten SchreibdidaktikVon EverandWissen sichtbar machen: Elemente und Rahmenbedingungen einer epistemisch orientierten SchreibdidaktikNoch keine Bewertungen
- JETZT ist die Zeit für den Wandel: Nachhaltig leben - für eine gute ZukunftVon EverandJETZT ist die Zeit für den Wandel: Nachhaltig leben - für eine gute ZukunftBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Kirche plural: Theologisch-praktische Quartalschrift 2/2021Von EverandKirche plural: Theologisch-praktische Quartalschrift 2/2021Noch keine Bewertungen
- Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (Alle 3 Bände): Der Grund der Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis (Eines der zentralen Werke im nachkantischen Idealismus)Von EverandGrundlage der gesamten Wissenschaftslehre (Alle 3 Bände): Der Grund der Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis (Eines der zentralen Werke im nachkantischen Idealismus)Noch keine Bewertungen
- Subsidiarität: Tragendes Prinzip menschlichen ZusammenlebensVon EverandSubsidiarität: Tragendes Prinzip menschlichen ZusammenlebensNoch keine Bewertungen
- Strafen, prügeln, missbrauchen: Gewalt in der PädagogikVon EverandStrafen, prügeln, missbrauchen: Gewalt in der PädagogikNoch keine Bewertungen
- Gegenstand und Methoden qualitativer Sozialforschung: Einblicke in die ForschungspraxisVon EverandGegenstand und Methoden qualitativer Sozialforschung: Einblicke in die ForschungspraxisNoch keine Bewertungen
- Die psychologische Hintertreppe: Die bedeutenden Psychologinnen und Psychologen in Leben und WerkVon EverandDie psychologische Hintertreppe: Die bedeutenden Psychologinnen und Psychologen in Leben und WerkBewertung: 1 von 5 Sternen1/5 (1)
- Der Fluch des Guten: Wenn der fromme Wunsch regiert – eine SchadensbilanzVon EverandDer Fluch des Guten: Wenn der fromme Wunsch regiert – eine SchadensbilanzNoch keine Bewertungen
- Neue Stimmen der Phänomenologie, Band 2: Das Andere. AisthesisVon EverandNeue Stimmen der Phänomenologie, Band 2: Das Andere. AisthesisMatthias FlatscherNoch keine Bewertungen
- Wie man glücklich wird und dabei die Welt rettet: Wegweiser zum GlückVon EverandWie man glücklich wird und dabei die Welt rettet: Wegweiser zum GlückNoch keine Bewertungen
- Die persönliche Zukunftsplanung im Bundesteilhabegesetz. Entspricht das Umsetzungsvorhaben der Sozialpolitik den individuellen Wünschen der betroffenen Menschen?Von EverandDie persönliche Zukunftsplanung im Bundesteilhabegesetz. Entspricht das Umsetzungsvorhaben der Sozialpolitik den individuellen Wünschen der betroffenen Menschen?Noch keine Bewertungen
- Das Dilemma unseres Daseins: Kann Philosophie helfen?Von EverandDas Dilemma unseres Daseins: Kann Philosophie helfen?Noch keine Bewertungen
- Im Namen des Vaters, des Sohnes und der Macht: Star Wars und die BibelVon EverandIm Namen des Vaters, des Sohnes und der Macht: Star Wars und die BibelNoch keine Bewertungen
- Blickrichtungswechsel: Lernen mit und von Menschen mit DemenzVon EverandBlickrichtungswechsel: Lernen mit und von Menschen mit DemenzNoch keine Bewertungen
- Brainwash und Einsichtsfalle: Indirekt direktive Kommunikation mit jungen Menschen in MaßnahmenVon EverandBrainwash und Einsichtsfalle: Indirekt direktive Kommunikation mit jungen Menschen in MaßnahmenNoch keine Bewertungen
- Weltordnungskrieg: Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der GlobalisierungVon EverandWeltordnungskrieg: Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der GlobalisierungNoch keine Bewertungen
- Die Säkularisierung des Exodus: Zur Narration von politischer Emanzipation bei Sigmund Freud, Thomas Mann, Michael Walzer und Paolo VirnoVon EverandDie Säkularisierung des Exodus: Zur Narration von politischer Emanzipation bei Sigmund Freud, Thomas Mann, Michael Walzer und Paolo VirnoNoch keine Bewertungen
- Die Welt als Vernichtungslager: Eine kritische Theorie der Moderne im Anschluss an Günther Anders, Hannah Arendt und Hans JonasVon EverandDie Welt als Vernichtungslager: Eine kritische Theorie der Moderne im Anschluss an Günther Anders, Hannah Arendt und Hans JonasNoch keine Bewertungen
- Soziale Arbeit im Gesundheitswesen: Aufgaben und PotenzialeVon EverandSoziale Arbeit im Gesundheitswesen: Aufgaben und PotenzialeNoch keine Bewertungen
- Präödipale Helden: Neuere Männlichkeitsentwürfe im Hollywoodfilm. Die Figuren von Michael Douglas und Tom CruiseVon EverandPräödipale Helden: Neuere Männlichkeitsentwürfe im Hollywoodfilm. Die Figuren von Michael Douglas und Tom CruiseNoch keine Bewertungen
- MitLeben: Sozialräumliche Dimensionen der Inklusion geistig behinderter MenschenVon EverandMitLeben: Sozialräumliche Dimensionen der Inklusion geistig behinderter MenschenNoch keine Bewertungen
- Politische Talkshows über Flucht: Wirklichkeitskonstruktionen und Diskurse. Eine kritische AnalyseVon EverandPolitische Talkshows über Flucht: Wirklichkeitskonstruktionen und Diskurse. Eine kritische AnalyseNoch keine Bewertungen
- Frei Sein : Raus aus der Box - Die Methode samt 99 ÜbungenVon EverandFrei Sein : Raus aus der Box - Die Methode samt 99 ÜbungenNoch keine Bewertungen
- Demokratie und Emotion: Was ein demokratisches Wir von einem identitären Wir unterscheidetVon EverandDemokratie und Emotion: Was ein demokratisches Wir von einem identitären Wir unterscheidetNoch keine Bewertungen
- Der Mensch als antwortendes Wesen: Gedanken zur gegenwärtigen Verantwortungsethik. Mit einem Vortrag von H. Richard NiebuhrVon EverandDer Mensch als antwortendes Wesen: Gedanken zur gegenwärtigen Verantwortungsethik. Mit einem Vortrag von H. Richard NiebuhrNoch keine Bewertungen
- Die geheimen Spielregeln der Macht: und die Illusionen der GutmenschenVon EverandDie geheimen Spielregeln der Macht: und die Illusionen der GutmenschenNoch keine Bewertungen
- Geschichte, Pädagogik und Psychologie der geistigen BehinderungVon EverandGeschichte, Pädagogik und Psychologie der geistigen BehinderungNoch keine Bewertungen
- Ästhetisches Verstehen und Nichtverstehen: Aktuelle Zugänge in Literatur- und MediendidaktikVon EverandÄsthetisches Verstehen und Nichtverstehen: Aktuelle Zugänge in Literatur- und MediendidaktikHendrick HeimböckelNoch keine Bewertungen
- Die Mythen der Rechten: Was sie uns glauben machen wollen – und wie wir uns dagegen wehren könnenVon EverandDie Mythen der Rechten: Was sie uns glauben machen wollen – und wie wir uns dagegen wehren könnenBewertung: 1 von 5 Sternen1/5 (1)
- 30 Minuten Typisch ich, typisch du: Typengerecht kommunizieren leicht gemachtVon Everand30 Minuten Typisch ich, typisch du: Typengerecht kommunizieren leicht gemachtNoch keine Bewertungen
- Warum wohin?: Mit Jugendlichen auf Sinnsuche gehen – 6 Lebensthemen methodisch ausgearbeitetVon EverandWarum wohin?: Mit Jugendlichen auf Sinnsuche gehen – 6 Lebensthemen methodisch ausgearbeitetNoch keine Bewertungen