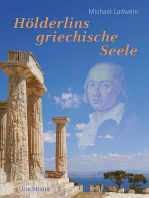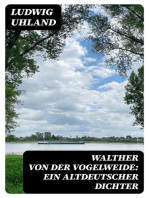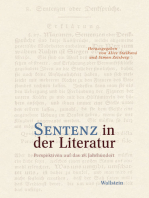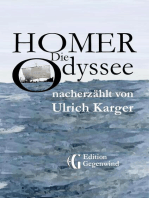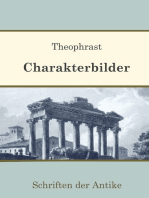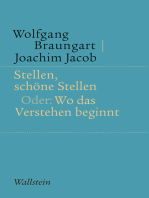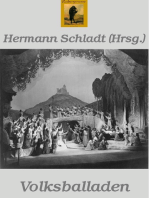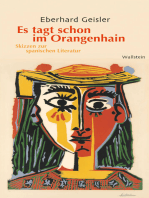Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Dornseiff 1921 Pindars Stil PDF
Hochgeladen von
Elena Cristóbal RodríguezOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Dornseiff 1921 Pindars Stil PDF
Hochgeladen von
Elena Cristóbal RodríguezCopyright:
Verfügbare Formate
^
CT)
im
PINDARS STIL
VON
FRANZ DORNSEIFF
1
Am
BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1921
Altenburg
Fierersdie
Hofbuchdruckerei
Stephan Geibel & Co.
Germaa>
Vorrede.
Unter dem Stil eines Schriftstellers soll hier mglichst das
verstanden werden, was die neuere Geschichte der bildenden
Kunst Stil nennt (Kontur, Physiognomie), und nicht ausschlielich
das, was in der Sprachlehre den Gegenstand der Stilistik bildet.
Bis der Stil altgriechischer Dichtung, so als Sprachgebrde aufgefat,
beschrieben ist, und zwar unter Wahrung der Rechte der ver-
schiedenen Zeiten und Typen, ist noch viel zu tun. Es gibt fr
viele griechische Dichter Arbeiten de genere dicendi, Programme
ber einzelne Tropen und Figuren. Aber mit der Menge des noch
zu Leistenden verglichen, liegt fr altgriechische Semasiologie,
Synonymik und Stilistik wenig Gedrucktes vor, und es wre sehr
zu begren, wenn mehr Krfte sich diesen vernachlssigten Ge-
bieten zuwenden wrden. Man begngte sich ferner bisher oft
mit dem Sammeln von Belegen oder gab die Ergebnisse blo im
Rahmen von Kommentaren (Wilamowife zu Euripides' Herakles,
Norden zu Vergils Aeneis VI, um die besten Bcher zu nennen).
Bei den monographischen Stilstudien fehlte zudem die Verbindung
zu der eigentlichen Literaturgeschichte. Diese wendet den Ent-
wicklungsbegriff auf das Schrifttum an durch Feststellen von Ein-
flssen und Entlehnungen, von Individuellem und Konventionellem,
von Zeitstrmungen philosophischer Art und luft damit Gefahr,
Dichtungen lediglich als Biographica, Subjektivittszeugnisse, Be-
kenntnis, Stoffverwertung und -umdeutung, Niederschlag einer
Denkweise zu behandeln. Das beste Mittel gegen diese Gefahr
ist eine Verbindung von Literaturgeschichte und Stilphysiognomik.
Meine Arbeit ist ein Versuch, zwischen beiden Betrachtungsarten
in dieser Richtung eine Brcke zu schlagen, von der Fragestellung
ausgehend: Was ist archaische Literatur?
Gleichzeitig mit dieser Beschreibung von Pindars Stil ver-
suchte ich Pindar in deutsche Prosa zu bertragen (Inselverlag,
IV
Vorrede.
Leipzig 1921). Den Ansto zu beidem gab mir die Verffent-
lichung der Pindarbertragungen Hlderlins
(herausgegeben von
Norbert von Hellingrath, Verlag der Bltter fr die Kunst, Berlin
1910). Diesem seltsam ergreifenden Sptwerk eines der grten
deutschen Dichter und den sich daran knpfenden Fragen kann
aber hier nicht nachgegangen werden. Manche Anregung gab
mir Prof. Franz Boll-Heidelberg ; ich bin ihm fr einige Hinweise
verpflichtet. Ebenso verdanke ich einer Pindar
-
Vorlesung von
V. Wilamowitj Belehrung.
Inhalt.
Seite
Einleitung: Die griechische Chordichtung im allgemeinen 1
1. Die Sprache.
A. Grundsfeliches ber 11 terargeschi cht liehe Stil-
beschreibung 11
B. Die Behandlung des Wortsinns 14
1. Gehobene Sprache:
Altertmliche Wrter 17
Simplex
18
Allgemeinere Begriffe 19
Mehrzahl 21
Beigesetzter Gattungsbegriff 25
Ev 8id 5'jotv 26
Gewhlte Synonymik 27
Umschreibung 28
Kenning 32
Beiwort 34
2. Bildlichkeit:
Belebung 46
Naturgefhl
47
Personifikation
50
Der Bilderbereich 54
Vergeistigung und Vermischung der Bilder 66
3. Sinnbild:
Lieblingswrter
69
4. Abstufung der Strke:
Emphase
76
Doppelte Verneinung
77
Superlativ
78
Milderung
80
Lobworte
80
5. Das chorlyrische Ich 81
C. DieSatzfgung 85
1. Harte Fgung:
Nominaler und verbaler Ausdruck 85
Apposition
89
Farblose Zeitwrter 94
2. Das Beiordnen:
Vergleich ohne ,wie* 97
Priamel
97
VI
* Inhalt
Seite
3. Wortstellung:
Asymmetrie 103
iizo xoivo 105
Zeugma 106
Enjambement 108
II. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
1. Der Lobpreis 113
2. Die Mythen 117
Herkunft des Mythenteils im Chorlied 121
Sagenberichtigungen 126
3. Die Spruchweisheit 130
Namen und Sachen 135
Stellen
135
PINDARS STIL
Einleitung.
Die griechische Chordichtung im allgemeinen.
W'^er
zum erstenmal auf Pindars Gedichte trifft, wird einen fremd-
artigen Eindruck empfangen. Ein seltsames Nebeneinander
von Ring- und Faustkampf, Pferderennen, Spruchweisheit, griechi-
scher Heldensage und Hymnik wird vorgetragen mit wortkarger
Gemessenheit und gedrungener Wrde. Dabei ist die Sprache oft
mit den gesteigertsten Bildern geschmckt, deren naive Khnheit
mitunter bis zum Unverstndlichen geht. Die dunkle und weglassende
Weise zu reden hat wenig damit zu tun, ob das, was Pindar aus-
drcken will, tief oder naheliegend ist Dazu fehlt hufig der erkenn-
bare Zusammenhang zwischen den Teilen, ein nicht weiter vorbe-
reiteter Leser etwa von N 4 gert ohne ersichtlichen Grund von
irgendwelchen Wettspielen in Kmpfe vor Troia, dann bricht es
seltsam ab, befremdliche Bilder (Wendehals, Meeresflut), pltzlich
ist man wieder auf der Hochzeit des Peleus und der Thetis usw,
Es war sehr schwer, sich da zurechtzufinden. Erst seit 1886
(Wilamowitz' Isyllos von Epidauros mit der Erklrung von Olympie
6)
hat man es unterlassen, Pindar dunkler und tiefer zu deuten, als er
ist. A. B. Drachmann hat 1891 ^) endgltig das Hineingeheimnissen
beseitigt. 1897 wurde Bakchylides gefunden, der lebenslngliche
=^)
Nebenbuhler Pindars. Bei einer Vergleichung Pindars mit Bakchy-
lides und den brigen schon lnger bekannten Stcken griechischer
Chordichtung fllt nun eine starke Gleichfrmigkeit auf ber all
diesen Gedichten liegt eine gewisse archaische Strenge und Steifheit.
Feste berlieferung scheint zu regeln, wie die Rede zu schmcken,
wie ein Gedicht zu gliedern ist, in welchem Ton Geschichten zu
erzhlen sind und wie der gottbegnadete Dichter, der (To<p6(;, durch
den Mund des Chores das Volk belehren und unterweisen soll Dieser
Eindruck wird dadurch erweckt, da eine Reihe von Ausdrucks-
Moderne Pindarfortolkning, Kopenhagen 1891.
'-')
Krte, Hermes 53 (1918) 113ff.
Dornsciff, Pindars Stil.
Einleitung.
mittein hufig genug wiederkehrt, um der Dichtung
ein eigentm-
liches Geprge zu verleihen, gewisse formelhafte
Bestandteile, die
man sich gewhnt hat, tottoi zu nennen.
Die TOToi gibt es im sprachhchen Ausdruck und in der Gliederung
der Teile. Um die Formeln des Ausdrucks festzustellen,
drfen wir
auch die chorischen Teile der Tragdie und Komdie ohne
weiteres
heranziehen, ja auch Dialogstcke, die im hohen Ton
gehalten sind.
Fr Fragen der Gliederung scheiden diese Chre grtenteils aus,
weil sie keine in sich abgeschlossenen Gedichte bilden, sondern Teile
eines greren Ganzen, das blo in seinen ersten Anfngen einem
Paian oder Dithyrambos nicht sehr ferngestanden hat. Die Chorlyrik
enthlt das Drama im Keim, sie ist selbst schon eine Art Auffhrung.
Aber selbst die lteste der erhaltenen Tragdien, die kantatenartigen
Schutzflehenden des Aischylos, ist von einem typischen Chorlied
bereits durch eine lange Entwicklung getrennt. Sie gehren schon
verschiedenen Gattungen an.
Von
TOTTot kann nur die Rede sein in einer Literatur, die in
Gattungen gesondert ist. Das yevo^, die Gattung, ist im Altertum
ungefhr so auerhalb jedes Streites wie die Art, sich zu kleiden
oder der Gebrauch der Muttersprache. Die Gattungen sind seiende
Formen und Gter des Griechentums, die von dem Begrnder ein
fr allemal aufgefunden wurden. Diese Behlter wegzuschieben,
zu sprengen oder durch etwas anderes zu ersetzen, etwa weil man
eine anders geartete Persnlichkeit" war, ist keinem antiken Menschen
ein gefallen 1). In der lteren Zeit zumal sind die Gattungen durchaus
gefllt und zureichend, von einem Zwiespalt ist nichts zu spren.
In den Gattungen ist der Dichter unter anderm auch individuell.
Aber es wrde seiner eignen Wertskala wie der seiner Hrer durchaus
widersprechen, wenn man die Strke und Deutlichkeit des persn-
lichen Tones als Mastab anlegte. Der antike Dichter will eben die
Mglichkeiten und Vorschriften seiner Gattung erfllen, in der Reihe
^) Eine kluge Beleuchtung des Unterschiedes zwischen antiker und mo-
derner Literatur in dieser Beziehung gibt undolf, Goethe S. 17. Was da-
gegen dort ber die religis-magische Tnung dieser vom antiken Menschen
als selbstverstndlich angesehenen Traditon" gesagt wird, ist bertrieben.
Gewi ist die Gottheit fr den antiken Menschen nicht unbedingt jenseitig
und die Begriffe irdisch, Welt der bloen Materie haben infolgedessen nicht
unsern nachchristlichen gottentleerten und antigttlichen Sinn. Darum ist
aber etwas, was die Griechen als naturgegeben und selbstverstndlich an-
sahen, noch nicht heilig und religis. Das bringt etwas zu Weihevolles hinein.
Die griechische Chordichtung im allgemeinen.
bleiben, wie der romanische Dichter und Knstler, proprie communia
dicere (Horaz ars 128).
Die Romanen wie die Griechen haben die
ntige Ausgeglichenheit von Geist, Instinkt und Leib, um Formen,
feste berlieferungen in Kunst und Lebenshaltung zu schaffen und
immer von neuem zu genieen und zu pflegen. Sie haben eine ge-
meinsame breite Mitte, wo gewissermaen die seelische Ruhelage
der Gesellschaft, das Lebensgefhl der Nation, zum Ausdruck kommt.
Viel gute Kunst und Literatur zweiten Ranges gibt es bei ihnen,
der eine schne menschliche oder dekorative Konvention entstrmt,
die in der Welt am sichtbarsten ist und ihnen den Ruf der Trger
von Zivilisation (im weitesten Sinn), Schnheit und Kunst sichert.
Wir haben die wenigen ganz Groen und viele schwierige Flle.
Die antiken Dichter sind keine nicht zur Tat gelangten Sprenger
der Dichtungsgattungen oder passen nur gezwungen ihr Ich diesen
an
den einzigen Euripides ausgenommen, in dem die in jeder
Kultur einmal unwiderruflich eintretende Emprung des Intellekts
gegen die ltere Seelenform den starken dichterischen Ausdruck
findet. Aber auch er denkt nicht daran, die Form der Tragdie zu
verlassen.
Damit, da Pindar zur Chorlyrik gehrt, ist mancherlei gegeben,
was nicht immer gengend hervorgehoben wird. Chorlyrik ist keine
Dichtungsgattung, die irgendein griechischer Dichter
etwa als
Steigerung der Einzellyrik
einmal erfunden hat^). Sie ist vielmehr
mit die lteste Dichtung berhaupt 2), ein Zweig der Dichtung, der
sich von den niedrigsten und frhesten Kulturstufen an berall
in der Welt verfolgen lt und in den verschiedenen Literaturen
eine verschiedene Ausbildung erfahren hat. Bei den Wilden finden
die Forscher den Heiltanz, den Shnereigen, das Arbeitslied, das
Kampflied, die Totenklage, Fruchtbarkeitsgesnge u. dgl. Entweder
singt der Chor alles oder den Kehrreim Meist ist es zunchst be-
gleitender Gesang zu llandlungen, Handlungen rehgiser oder welt-
licher Art. Bei den Juden hat das zu den chorischen Psalmen und
zur Qina gefhrt, bei uns z, B. ist diese Gattung der Literatur auch
vorhanden, aber nicht hher gediehen als zum Choral, Kirchenhed
^) Wie es sich die Griechen so gern vorstellten
die xardaToot; des
Thaletas.
-) Darauf hat zuerst Mllenhoff hingewiesen, De antiquissima Germa-
norum poesi thorica 1847; Erich Schmidt, in Hinnebergs Kultur der
Gegenwart", Die orientalischen Literaturen. Leipzig 1906 S. 7ff.
1*
Einleitung.
(als spter Nachkomme der Psalmen und mittelalterlichen Hymnen),
Liedertafel, Kommersbuch, auf der andern Seite Oratorium.
Diese Analogie lehrt, da es sich nicht um Lyrik im eigentlichen
Sinne handelt, d. h. um Bekenntnis und Monolog eines Einzelnen,
der mehr sieht, hrt, ahnt als die andern, Sprachwerdung des Er-
lebnisses selbst, sondern um eine ganz bestimmte Art von Zweck-
und Gelegenheitsdichtung. Man mu fr die griechische Chorlyrik
alles aus seinem Gedchtnis ausschalten, was psalmistisch, nach-
christlich, nachaugustinisch, Buchdichtung ist. Chorlyrik ist vor-
persnhch, rehgis, Stimme einer Gruppe, Zunft, Kaste, Gemeinde,
Phyle und noch mit Tanz verbunden. Nur fr eine frhe Gesellschaft,
die in Geschlechtern, Stnden oder sonstwie gebunden und abgesondert
ist, ist der Chor ein angemessenes Ausdrucksmittel. Er verfllt berall,
wo diese Schranken durchbrochen werden.
Der praktische Zweck spielt neben dem knstlerischen Wollen
seine Rolle. Beim Choral und dem Trinklied liegt der auerknstle-
rische erbauliche oder geseUige Zweck auf der Hand. Ebenso: was
beim Epinikos nicht Kunst, Lyrik ist, ist Gebet, Predigt, Lobrede.
Was beim Paian nicht Lyrik ist, ist Heiltanz, Kultpoesie usw. Ein
Festlied
denn Auffhrung bei einem Fest ist das allen Gattunge i
der Chorlyrik Gemeinsame
ist bestimmt, die Erregung einer
Gesamtheit auszudrcken und einzuflen, die bei der Feier einer
Hochzeit herrscht oder bei einem Bittgang oder bei der Trauer um
einen Toten oder der Freude am Sieg, irgendein allgemeines
Gefhl,
das fr einen Augenblick eine Gesamtheit
sei es eine Gemeinde
oder ein Publikum"
ber sich hinaushebt
i).
Es wird eine Massen-
wirkung angestrebt mit einfachen groen Dingen, die sich mit wenig
Worten sagen heen. Das Ursprnghche war meist der kurze kunst-
lose Satz, der spter nur den Kehrreim bildet, wie atXive, iyjis Hatav,
& Tv ''AScoviv, der Klageruf im Threnos, das tyj im Jalemos
oder das TrjvsXXa xaXXtvixs: im Epinikos, d) SL0upa^s
(Hephaest
p. 72, 14 Westphal), a^ts raups, u(jly)v 6} u^evais.
Solche Schreie wurden ursprngUch stndig wiederholt, um den
Gott zu bezaubern und zu beschwren wie ein groes wildes Tier,
oder um die Gemeinde zu hypnotisieren. Der kultische Dichter,
der ausfhrlichere Texte zu diesen Begehungen verfat, fhlt sich
als vates,
709 6<;, iSioc, Iv xolvw gtoO^zic, (Pindar O 13, 49),
was
') Sainte-Beuve, Lebrun, Causeries du lundi
5, 118.
Die griechische Chordichtung im allgemeinen.
er gibt, sind SafxcopLaTa (Stesichoros, Oresteia fr. 37). Auch wenn
der primitive Zustand des halbmagischen Kultgesanges berschritten
ist, wenn die Dichter erbauen, mahnen und belehren sollen und
knstlerische Beschaffenheit der Gedichte als Selbstzweck gefordert
und genossen wird, so wird der Sinn solcher Dichtung nicht leicht
Ausdruck eines inneren Mu sein. Es bilden sich vielmehr feste
Formen in Ausdruck und Stoffgliederung, denen sich die Dichter
anzupassen haben und die sie meist auch gar nicht verlassen wollen.
Steigen die literarischen Ansprche der Auftraggeber, verlangt man
von den Gedichten Neuheit, Mannigfaltigkeit, hheren geistigen
Gehalt, so mssen die Dichter entweder zu rhetorischen Mitteln
greifen oder neue Stoffe einbeziehen. Beides ist bei den Griechen
in weitem Mae geschehen.
Die beste literargeschichlliche Analogie ist wohl die Sequenz
und der Leich in unserm Mittelalter: auch da eine ausfhrlichere
kultische gottesdienstliche Dichtung in erweiternder Ausgestaltung
der primitiven Rufe Kyrie eleison und Hallelujah, stark archaisch
in der Form, und auch sie hlt sich nicht dauernd.
Leider wei man nicht recht, wie der Weg der Entwicklung von
jenen Anfngen zur vollen Entfaltung der griechischen Chorpoesie
bei Pindar und Bakchylides
oder vielleicht war bei Simonides
die klassische Vollendung
gewesen ist. M''ir haben blo Bruch-
stcke und sprliche antike Bemerkungen ber die Dichter und die
Gattungen der Chorpoesie. Unter den Gattungen
i)
heben sich zwei
Gruppen heraus. Die eine gilt dem Gtterkult: Hymnos, Proshodion,
Paian, Hyporchema, Dithyrambos; dazu kmen noch die Partheneia
fr Mdchenchre, die bei besonderen Kulten auftreten, z. B. bei
der Daphnephoria, und auch ihre eignen Feste innerhalb der Zunft
der Frauen feiern, wobei Dichterinnen auftreten knnen (Sappho,
Korinna). Die zweite Gruppe ist weltlicher Art: Threnos fr Be-
stattungen, Epithalamion, Epinikos, Enkomion. Diese Gattungen
sind in ihrer Urform sehr alt, einen Paian singen z. B. die
Griechen nach der Erschlagung Hektors Ilias X 391.
Bei andern Gattungen sind Spuren ihrer erst spter einsetzenden
Entwicklungsgeschichte zu sehen. Die Nachricht, da Lasos von
Hermione der Begrnder des kunstmigen balladenhaflen Dithy-
1) Darber die brauchbarste Darstellung bei Herbert Weir Smyth,
Greek melic poets, London 1Q06 XXV ff. Deubner, Paian, Neue Jahr-
bcher 43
(1919) 385 ff.
Einleitung.
rambos gewesen sei, erscheint durchaus glaublich. Archilochos rhmt
sich fr. 74:
olSa StOupaixov, otvco CTuyxspauvcoOel^ 9p|va<;.
Aristoteles' Poetik leitet die Tragdie, deren Anfnge nicht weit
vor 534 liegen knnen, her octt tcov l^apydvTWv t6v SiOupaaov.
Da ist der Dithyrambos also sicher noch keine strophische Chor-
ballade; denn bei einer solchen wre fr das l^apxetv
eines einzelnen
Stegreifdichters und ein Einfallen der brigen Snger mit dem Kehr-
reim kein Platz.
Ebenso ist es sicher, da der Epinikos zur Zeit des Archilochos
noch auf der Stufe des Stegreifgesanges von l^apxovTsc; gewesen
ist, sonst knnte es nicht bei Pindar O 9, Iff. heien:
T^ (x?v 'ApyiXoyou fxeXor;
|
(pwvaev 'OXuiJLTcCa, xaXXtvLXO^ 6 TpiTcXoo^
xeyXaSci)^
I
apxsas usw. dXXa vuv . . .
Die Tuschverse, fr. 113, werden schon von dem reisigen antiken
Sirventesdichter sein, das s^ap^ai stuivlxov wird ihm ebenso gelegen
haben wie das l^ap^ai SLiScajxov^). Auch spter ist ein kleiner
Epinikos wie Pind. 14, P 7, N 2, O 11 Bakchyl. 24, 6 inhaltUch
fast ein Nichts, aber ansprechend stilisiert, ein archaischer Toast.
Was das Wachsen der Kunstform und die Leistungen der einzelnen
Dichter betrifft, so haben wir nur Punkte, nicht die Reihe. Im 7. Jahr-
hundert fhrt ein lydischer Aulosspieler Alkman in Sparta ein Parthe-
nion auf. Das zeigt schon eine lyrische Gemeinsprache aus ver-
schiedenen Mundarten gemischt, strophischen Bau und das bei den
spteren gewohnte Nebeneinander von Aktuellem (Enkomiastischem),
Mythischem und glossierender warnender Spruchweisheit. Die grie-
chische kunstmige Chorlyrik ist da bereits fertig, syst ttjv eauTou
Die nchsten Punkte sind Jonier aus den unteritalischen und
sizilischen Tochterstdten von Chalkis auf Euboia: Stesichoros von
Himera, Ibykos von Rhegion. Und in der nchsten Nhe von Chalkis
liegt Keos mit den Dichtern Simonides und Bakchylides. Stesichoros
bt bereits wie Pindar ein frommes Mythenberichtigen (in der Helen
a-
Palinodie). Aber weder bei all diesen (Bakchylides ausgenommen)
') Sitzler, Wochenschr. f. kl. Philol. 1912 S. 220ff. Fraustadt, En-
comiorum historia. Leipz. Dissert. 1909 S. 23 ff.
Die griechische Chordichtung im allgemeinen.
noch bei Pindars Lehrer Lasos von Hermione haben wir ein Bild
davon, was ihre Dichtung im ganzen gewesen ist. Was wir von den
Menschen Lasos und Simonides wissen, mahnt an die Nhe der
Sophistik : sie sind geistreich, witzig, man sammelt ihre Apophthegmen,
Simonides' Skolion an Skopas ist, soweit erhalten, ein gesungener
aocptcjTixo? eXeyxo?.
Aber die Danae im Kasten ist wieder nicht
sophistisch. Wir haben zu wenig.
Die griechische Chorlyrik um 500 setzt eine gute Gesellschaft*'
voraus und pflegt mit emsigem Stolz die alte feine gezierte Kunst,
d^e iliren Hrern viele, wenn nicht alle literarischen Bedrfnisse
zu stillen hat. In der Literaturentwicklung ist man erst sehr all-
mhlich zum Spezialistentum gelangt, wie auf den brigen Lebens-
gebieten. Wenn man die alten Epen
nicht blo die griechischen
als Weltkunde
-f
Bibel
+
Zeitung
+
Geschichtswerk bezeichnen
kann, wenn Faguet^) von der aristophanischen Komdie schreibt,
sie sei komischer Roman, Posse, Pantomime, Opera buffa, Ballett,
Feerie, politische Satire, Pasquill, Parodie, Operette, so kann man
vom pindarischen Chorlied sagen, es ist Ballade, Festrede, Hymnus,
offener Brief, politische Flugschrift, Kantate, moralisches Lehr-
gedicht als das lteste Gef der Sittenlehre, Diatribe.
In der archaischen Zeit von 700480 etwa hatte sich eine adelige
Oberschicht herausgebildet, die ihre reichen Mittel
bis zum Perser-
krieg
war oft lange Frieden
zum groen Teil in Tempelbauten
steckte: Olympia, Aigina, Paestum, Girgenti, Selinus. Wie bei
Delphi besonders deutlich wird, liegen hier die Anfnge eines greren
geldlichen Unternehmertums bei den Griechen. Zu den neuen Tempeln
werden neue knstlerische Gtterbilder in Auftrag gegeben in Bronze,
Marmor, Goldelfenbein, die die Onatas, Hageladas, Kanachos, Pytha-
goras, Polyklet usw. machen. Ein bunter mittelalterlicher Schmuck
wird so dem Lande angelegt, er entspricht ungefhr der Stufe des
aufkommenden romanischen steinernen Gewlbebaus, worber der
franzsische Chronist Raoul Glaber
(f
1050) an einer berhmten
Stelle schreibt: Man hat gesagt, df^ die Welt ihre alten Lumpen
abschtteln und berall das weie Kleid der Kirchen anziehen wolle ^).
Denselben archaisch-bunten Schmuck wie diese Bauten weisen
nun die Chorlieder auf, die diese adehgen Herren sich tr ihre Feste
zu Ehren der Gtter und Sportsiege bestellten. Die Form des Chor-
^) Drame antique et moderne. Paris 1864
p. 114.
5^)
Sal. Reinach, Allg. Kunstgesch. Leipzig 1911 S. 103.
8
Einleitung.
gesanges ist etwas storr und setzt der Entwicklung bestimmte Schran-
ken. Mag die Chorpoesie noch so kunstvoll ausgebildet sein, sie bleibt
ein berbleibsel aus alter Zeit^), etwas Altertmliches. Gerade dahin
ging wohl der Geschmack der Auftraggeber. Diese reichen kon-
servativen Herren wnschten pompse Lieder im alten hieratischen
Stil. Es gibt kaum etwas, um den Unterschied der athenischen demo-
kratischen Entwicklung gegenber dem bewahrenden Festhalten am
Alten in dem unter AdeLherrschaft bleibenden Teil des Mutter-
landes und im itahschen und sizilischen Westen zu veranschauHchen
als eine Vergleichurg etwa der Orestie mit einem groen Stck
Chorpoesie wie Pythia 4. Zeit (458 und 462 v. Chr.) und literar-
geschichtliche Vorbedingungen sind gleich, Entfernung AthenTheben
etwa 60 km. Al<er
von Inhalt und Geist ganz abgesehen
: in
Athen eine groe neue Kunstform, die Sprache beredt, strmend,
alle Schlacken durchglht, eine tiefe Erregtheit trgt alle Worte,
der heihge Wahn des harten Dionysos, alles strebt auf ein groes
tragisches Ziel hin,
in Theben und Kyrene ein Monstrum von Form,
in fast barocker Weise angeschwollen und lang gezogen, die Sprache
knstlich, mhsam ein Glanzstck neben das andere gesetzt. Da
ist etwas Zopfartiges, eine bombastische Starrheit.
Es ist festliche kultische Gelegenheitsdichtung. Fr einen be-
stimmten Anla wird gewissermaen eine schne Kulisse aufgestellt,
eine Mischung von Girlande und Dichtung und festlichem Arrange-
ment, der eine starke dekorative Konvention entstrmt. Es ist die
bei Festen und Feiern als selbstverstndlich sich einstellende Dekora-
tion fr eine aristokratische Oberschicht, von ganz bestimmten
Funktionen und stilistisch sehr ausdrucksvollen Eigenschaften,
literarisches Kunstgewerbe, Dichtung als angewandte Kunst ganz
groen Stils. Ein Vergleich mit der gleichzeitigen bildenden Kunst,
der archaischen Plastik liegt daher nahe und ist ergiebig. Zunchst
das Allgemeinste: archaisch sind beide Knste, d. h. die Vorbereitung
und das Versprechen einer Klassik, mit dem ganzen Reiz des Knospen-
haften, Ungelenken, noch nicht ganz Gelsten und Strmenden.
Strenge gebundene Linie, archaisch verschnrkelte Preziositt in
der Ornamentierung der Oberflche, die spter abgelst wird durch
eine freie geklrte strmende Klassik von breit ausladender Gebrde.
Dem dorischen und jonischen Stil der plastischen Darstellung
1) Bethe, Homer. Leipzig 1914 S. 45.
Die griechische Chordichtung im allgemeinen.
des Menschen bis etwa 460 entspricht genau die Malerei der Quattro-
centisten und der Vlamen des 15. Jahrhunderts (CrivelJi und Memling
wren die Jonier) In den Literaturen findet sich ebenso die archaische
Periode der Vorbereitung der Klassik, des bermaes im Rede-
schmuck und der dekorativen Wortkunst. Diese starke Kruselung
der Oberflche tritt in solch auffallendem Umfang ein erstens da,
wo die groen mittelalterlichen Ausdrucksformen innerlich ber-
wunden sind, und das Bedrfnis nach Aufputz, Belebung, mehr
Buntheit und Geist kommt, und zweitens in spteren Stadien, als
barocke bersteigerung, als blumige? Schwulst und spitzfindige
Dunkelheit. Auch hier steht Sptgotik und Barock sich merkwrdig
nahe, so nahe wie Meistersinger und Marinisten. ,,Wenn ein Volk
sich einmal aus der edlen Einfalt in das mehr Schimmernde verloren
hat, so geht, wie ich glaube, der "Weg nach der Einfalt zurck durch
das hchst Affektierte, das mit dem Ekel endigt." (Lichtenberg,
Aphorismen.) Die Preziositt entspringt einer bestimmten mensch-
lichen Geschmacksrichtung und luft oft neben klassischen Tendenzen
her, die die Einzelheiten weniger gewichtig nehmen. Das sthetische
Empfinden fordert dann einen besonderen Schmuck der poetischen
und rhetorischen Darstellung in der Wahl auergewhnl eher
z. T. archaistischer, z. T. mundartlicher, z. T. voller tnender Formen.
Das haben wir einmal in der althebrischen Psalmensprche,
in der arabischen Literatur, bei den Polynesiern
i),
bei den alt-
nordischen Skalden 2), im Minnesarg, dann im barocken Stadium
in den europischen Literaturen des 17. Jahrhunderts.
Die pindarische aperrj-Weltan schauung (s. unten S.
71)
gehrt
zu jenen gleichsam gesellschaftlich organisierten Gefhlsweisen, wie
sie im mittelalterlichen Minnesang, in der franzsischen Hofpoesie
unter Ludwig XIV. und XV. und deren deutschen Nachahmungen,
in der Anakreontik ausgebildet worden sind ^). Da ist berall die
Gefahr des Prezisen gro. Der aristokratische Leser und Hrer
begehrt einen etwas schwierigen Stil, freut sich an Anspielungen,
wnscht von Zeit zu Zeit einige Sportausdrcke,
man denke etwa
an die Verwendung von Ausdrcken der neuesten Kunstkritik in
den Essays unserer Tage^).
*) Eberhard Knig, Die Poesie des Alten Testaments. Leipzig 19073.48.
2) Darber R. M. Meyer, Altgermanische Poesie. Berlin 1S89.
4
Gundolf, Goethe S. 70.
*) R. M. Meyer, Deutsche Stilistik. Mnchen 1906 S. 206.
10
Einleitung. Die griechische Chordiditung im allgemeihen.
Von dem gestelzten Pathos der spteren Skalden, von der pedan-
tischen Weitlufigkeit der Meistersinger, dem bombastischen Schwulst
und der spitzen Antithesensucht des Barock, die als Manier des
Marini, der Euphuisten, des Gongora, der Prezisen und der Schlesi-
schen Schule bekannt ist, ist Pindars archaisch bedchtige Akribie
des Dekorierens ziemlich weit entfernt. Der Salon der Mademoiselle
de Seudery, wo man fr ,,ein Glas Wasser" ein bain interieur, fr
Spieger* conseiller de grace sagte, ist das Gewchs einer durch
und durch rationalistischen Zeit, wo der Verstand in diesen concetti
spielerisch mit seinen eignen Knsten liebelt.
Immerhin tritt auf beiden Seiten ein barockes berwuchern
des Tektonischen durch das Ornamentale zutage. Diese hnlichkeit
erklrt sich daraus, da beide Male eine hnliche Etappe in einer
analogen Entwicklung vom verblassenden mittelalterlichen Epos zu
einer erst erstrebten neuen Klassik erreicht ist. Die alten Helden-
gedichte Homer wie die Chansons de geste haben ihren Zauber ver-
loren und werden als gehaltlos und primitiv empfunden. Diese
bergangsdichter streben nach einem neuen Pathos und verfallen
dabei in ein schillerndes berma des Dekorierens und Drapierens.
Mitunter finden sie noch selber den Weg zur klassischen Form wie
z. B. Aischylos, oft geht die Entwicklung an ihnen vorbei, und sie
bleiben als merkwrdige Denkmler einer notwendigen verstiegenen
Durchgangsstufe liegen. So ist es mit der berentwickelten Chor-
poesie der Pindar und Bakchylides gegangen. Niemand hat mehr
unmittelbar an sie angeknpft, aber im attischen Drama sind sie
im Hegeischen dreifachen Sinne aufgehoben
i).
^) Eine analoge Entwicklung luft im 1. vorchristlichen Jahrhundert in
Rom ab: die Klassik der goldenen Latinitt Ciceros, Caesars, Vergils war
vorbereitet durch das ornamentierende Zuviel des Asianers Hortensius und
der Neoteriker.
I. Die Sprache.
A. Grundstzliches ber literargeschichtliche Stilbetrachtung.
Dichtung
ist, von Genieenden, Aufnehmenden aus gesehen, eine
species des genus Sprache^). Der Rohstoff fr den Dichter ist
die Sprache, der ererbte Niederschlag von vergangenem Leben,
Weisheit, Wissen, Erfahrung, von Apperzeptionsweisen und Emp-
findungen ungezhlter Vorfahren. In sie prgt sich die lebende
Substanz des Dichters, aus den unendlichen bereitliegenden chaoti-
schen Mglichkeiten whlend und ordnend, und wird Werk.
Die Sprache, wie sie der Dichter vorfindet, ist das Material.
Was die Laut- und Formengestalt von Pindars Sprache, seinen
Gebrauch der Kasus, der Nomina, der Tempora, Modi und Genera
des Verbums betrifft, so ist da Folgendes zu sagen: Pindar schreibt
in einer panhellenischen Kunstsprache mit vermutlich individuellen
und landschaftlichen Besonderheiten. Er schreibt die gewhlte,
Dialekte mischende Literatursprache der griechischen Lyriker,
gesprochen hat er wohl boiotisch.
Die gewhlte Literatursprache hlt mundartlich stets eine mittlere
Linie: die der griechischen Lyriker ist mit der mittelhochdeutschen
Dichtersprache zu vergleichen, die ebenfalls temperierend ber den
Mundarten steht.* *Sie erreicht damit ein Doppeltes: sie ist weit
ber die engen Grenzen des Dialekts verstndhch und wahrt sich
auerdem eine ber das Alltgliche herausragende Wrde* ^). Literatur-
denkmler in ganz reiner Ortsmundart gibt es wohl kaum vor der
modernen Heimatkunst.
An der Mundartenmischung sollte man die ganze Entwicklung
der griechischen Chorlyrik ablesen knnen wie eine uralte Pflanzen-
welt an versteinerten Formen. Aber wer die wechselnde wissonschnft-
V)
Kurt Bruchmann, Psychologische Studien zur Sprachgeschichte.
Leipzig 1888 S. 34.
2) Gustav Roethe, Die Reimvorreden des Sachsenspiegels AGG 1899
S. 102.
12
I. Die Spiache.
liehe Behandlung der Mundart, besonders Homers, in unsern Aus-
gaben verfolgt, dem wird es zum Bewutsein kommen, wie heikel
in dieser Beziehung der Umgang mit einer Literatur in fremder,
gar toter Sprache sein mu, die dazu zum groen Teil verloren ist.
Bei uns Modernen sind Mundarten vulgr, komisch, ,, Provinz",
Gau, Scholle, Heimatkunst und nur in entsprechender Absicht
literarisch zu verwerten. Ein Auslnder wird kaum jemals spren,
worauf es ankommt. Ob wir die Nebenwerte einer literarisch ver-
wendeten altgriechischen Mundart wohl richtig empfinden knnen?
Zumal der Chorlyrik, die mit ihrer Mischung aus drei Dialekten
einer Gesangbuchdichtung entspricht, die sich durcheinander der
Wiener, Basler und Hamburger Mundart bedient.
Dazu kommt noch ein anderes: Bei den Griechen waren von
verschiedenen Mundarten aus ernste, hohe Kunstgattungen er-
wachsen, die betreffende Mundart war dadurch literarisch einwand-
freier Bestandteil der Schriftsprache geworden. Eine Wendung,
ein Wort, ja nur eine Beugungsform aus diesem Dialekt lste Er
innerungen aus den jeweiMgen Dichtungsarten aus. Wir besitzen
von der Literatur, deren unbefangene lebendige Kenntnis ein Chor-
lyriker bei seinen Hrern voraussetzen durfte, blo Reste, am meisten
aus dem Epos. Viele Anklnge daran merken wir, anderes entgeht uns.
Wer will sich vermessep, zu sagen, ich fhle, wie eine reichlichere
oder kargere Dosierung mit ol. -otaa, -acrat^, mit
Jon. tj statt a
gemeint war und wirkte. Solange das aber nicht glaubhaft gemacht
werden kann, bleibt diese grammatische Seite eines antiken Dicht-
werks ein Fundort fr sprachgeschichtHche Inventarisierung^), fr
das Wesen des Dichters wird uns Heutigen in den Einzelheiten des
mundartlichen Tonfalls keine charakteristische Linie erkennbar sein.
Man kann mit Wilhelm von Humboldt sagen (Nachgel. Abhandlung,
Zeitschr f. Vlkerpsychologie
13, 1881, 219): Wenn man die Rollen
verwechselt, sich die epische Dichtung in dorischer, die lyrische in
jonischer Mundart denkt, fhlt man sogleich, da nicht Laute, sondern
Geist und Wesen umgetauscht sind." Aber nicht viel mehr.
Das Material der Sprache erscheint nun
ebenfalls vom Be-
schauer aus gesehen
in einem dichterischen Kunstwerk in einer
durch eine 'Technik* vernderten Gestalt. Zu dieser Technik ge-
') Literatur bei Thumb, Handbuch der griechischen Dialekte. Heidel-
berg 1 509 S. 21 5. 1 1 o Ho f f ma n n , Geschichte der griechis chen Sprache I
'-*
Leipzig 1916 S. 112.
A. Grunds^lidies ber literargeschiditlidie Stilbetrachtung.
13
hren einige Punkte, von denen in der antiken Poesie fr uns hnliches
gilt wie vom Dialekt: Sprachmelodik, Versbau, Musik. Eine lebendige
gesicherte Vorstellung von der Aussprache der alten Griechen, vom
Klang ihres 'musikalischen' Wortakzentes haben wir nicht. Noch
weniger wei man genau, wie sie ihre quantitierenden" Versmae
gesprochen haben und wie das geklungen hat ^). In der Metrik ist man
beute so weit, da man beginnt, die antike berlieferte Verslehre
mit unsern aus der Vergleichung verschiedener Literaturen erwachsenen
Forderungen (Verhltnis zwischen volksmigem Liedvers und Kunst-
metrik) in Einklang zu bringen 2). Das bedeutet einen ersten Anfang
lebendigen Verstndnisses, von einem selbstndigen instinktiven
Urteil ber Absicht und Gefhlswert etwa einer bestimmten, von
Pindar angewandten Strophenform kann bei dem heutigen Stand
der Forschung nicht die Rede sein. Auch da kann man blo fest-
stellen, nicht charakterisieren.
Die Chortexte waren ferner zu einer musikalischen Auffhrung
z. T. mit Tanz bestimmt Da die Musiknoten nicht erhalten sind,
so sind wir mit den stummen Texten so bel dran, wie wenn nebst
aller zugehrigen Dramaturgie die Partituren etwa zu den Text-
bchern von Mozartsehen oder Wagnerschen Opern verloren wren.
Mgen wir uns auch damit trsten, da der Tanz der 12 oder 15
Choreuten, ihr Unisono-Gesang mit Begleitung des Aulos oder der
Kithara gegenber einem modernen Oratorium oder einer Oper
(mehr einer Kantate mit Tanz, einem Ballett mit Chorgesang) un-
sglich primitive Dinge waren
vielleicht war es doch sehr schn.
Wer die Ausdruckskraft mittelalterlicher Sequenzenmelodien emp-
funden hat, die aus einer Zeit stammen, die wie die griechische nur
einstimmige Musik kannte, wird diese verklungenen Tne nicht
verachten, zumal die Griechen von ihrer Musik bezaubert wurden
wie nur irgendein Volk. Namentlich im Jahrhundert der Sappho,
des Terpandros hat die Musik im Leben der Griechen eine beherrschende
Rolle gespielt. Aber das ist fr uns alles nur von Hrensagen schn,
hnlich wie die groe griechische Malerei.
Auerdem gehrt zur Technik die Art des Dichters, die Worte
zu whlen, die Wortbedeutungen abzuschatten und den Satz zu bauen
und zu fhren, also das, womit sich Semasiologie, Synonymik und
P. von der Mhll, Der Rhythmus im antiken Vers. Aarau 1918.
'')
V. Wilamowil^, Korkidas SB IQIS,
14
Grunds^liches ber literargeschichtliche Stilbetrachtung.
hhere Syntax abgibt. Diesen Werten und ihrer Ausschpfung soll
hier nachgegangen werden.
Aber auch bei diesem Punkt mu ein schwerwiegendes Bedenken
ausgesprochen werden, das zur Bescheidenheit mahnt. Es ist un-
geheuer schwer, ja wahrscheinlich unmglich fr uns, zu sagen, worin
der eigentliche Sprachzauber in einem antiken lyrischen Stck
besteht. Wir werden nie das instinktive Sprachgefhl haben, das
einen mitlebenden Griechen befhigte, die Notwendigkeit der dichte-
rischen Wortwahl zu empfinden und sagen zu knnen, so ist es schn
und dichterisch, anders nicht. Man tuscht sich leicht ber den welt-
weiten Unterschied zwischen einem durch Gelehrsamkeit ermglichten
Ahnen und dem selbstverstndlichen Genieen der tausend Neben-
werte der Worte bei einem, der seine Muttersprache hrt. Fr diesen
Punkt sei auf die klugen Ausfhrungen von Martin Havenstein,
Die alten Sprachen und die deutsche Bildung, Berlin 1919, 37 ff.,
verwiesen: .,Iphigenie" und Tasso" erschheen sich nicht jedem,
der eine deutsche Amme und deutsche Lehrer gehabt hat. Es gehrt
ein sehr entwickeltes sprachliches, muttersprachhches Empfinden
dazu, um jenes feinste Aroma zu spren und zu wrdigen, das einem
echten Sprachkunstwerk eigen ist und zu allermeist seinen Rang
bestimmt. Um ein Gedicht Verlaines in seiner sprachlichen Schnheit
voll zu erfassen, dazu mu man beinahe zum Franzosen geworden
sein . . . Um sich hierber von aller Selbsttuschung zu befreien,
stelle man sich nur die Frage, ob man es wohl einem sprachlich nicht
ganz zum Deutschen gewordenen Franzosen zutrauen wrde, ein
Gedicht von Rainer Maria Rilke zu beurteilen und Goethes
An
den Mond" so zu verstehen, wie wir es verstehen.*'
Angenommen,
ein deutschlesender Englnder htte die Wahl zwischen den beiden
Zeilen *Uber allen Gipfeln ist Ruh'
i)
und *Auf allen Bergen
herrscht
St lle' und fnde die zweite schner: wer wirft den ersten Stein auf
ihn?
Immerhin lt sich in semasiologischer Beziehung ber antike
Dichtung manches wissen und mit Aussicht auf Erfolg
untersuchen.
B. Die Behandlung des Wortsinns.
1. Gehobene Sprache.
und*rh?io-
^^ ^^^ antiken Poesie wird oft getrennt zwischen solchen Dichtern,
Ausdruck,
die rednerische Ausbildung verraten, also den Dichtern in alexandri-
1) Mit jedem Jahrhundert verliert eine Flur von Dichterblumen ihre
Die Behandlung des Wortsinns.
15
nischer und rmischer Zeit, und den andern, die nicht in dieRhetoren-
schule gegangen sind^). TatschUch ist aber eine ge^\isse Rhetorisie-
rurg der griechischen Poesie wie der Prosa sehr alt. Die griechische
levantinische Wortfreude ist bereits bei Homer in voller Blte, die
Lust an der Antithese, die zum Wortspielen und -klingeln einldt,
ist so alt wie das jjlfv-Ss. Man darf aber nicht alles, wo der Tatbestand
Parechese, Antithese vorliegt, nun fr Rhetorik und Klangspiel
erklren So ist z. . Parmenides 1, 32; 2, 3; 16, 4; 8, 40, 44 durchaus
nicht an sich
^
rhetorisch (d. h. verzierend), wie Diels, Parmenides
1897, 60 sagt. Es handelt sich um emphatisches, nachdrckliches,
pointierendes Wiederaufnehmen, Hin- und Herwenden des gleichen
Wortes
Dergleichen ist entweder fein, klug (Lessing hat es viel) 2)
oder pathetisch: die Sentenzen frohe Tragdie ist voll davon. Stellen
gibt z. B. Lobeck zu tzovoq tcovco tcgvov (psoet Soph Aias866. Ebenso-
wenig sind die von Norden, Kunstprosa S. 18, angefhrten Heraklit-
bruchstcke 25, 114 Klangspiele", sondern Wortoperationen eines
halbasiatischen Weisen, der ber sinrxbildliche orakelhafte Tiefe
und schlagende Drastik verfgt. Heraklit hat Wortspiele und Anti-
thesen als gedrngte Symbole der Gegenstzlichkeit in der Welt,
die er begriffUch noch nicht sagt. Erst bei Nachahmern wie dem
von Norden S. 21 angefhrten Verfasser von Trspl Skxlty)^ wird das
schon ganz gorgianisch ornamentierend und spielerisch, manierhaft,
allzu niedlich und frostig. So wenig wie heraklitische sind pindarische
Wortspiele rhetorisch und klingelnd, P 12, 10 ottots toitov y.UGGZ'j
xaGri.yv7jTav (Jtipoc; IvvaXta . Ssptcpco Xaotct ts fxoipav aycov ein
wuchtiges Pointieren mit dem Doppelsinn von (xoTpa N 2, 12 opstav
ye HeXsLaScov [xv) Ty]X66ev 'Hpicova veiaOat ein aiginetisch lchelnde
steife Zierlichkeit.
Die Chorlyrik mag einem nicht sehr fr sie voreingenommenen Be-
trachter in ihrer ganzen Diktion durch eine Art verkappter Rhetori-
sierupg gekennzeichnet scheinen, durch eine ganz bestimmte Art
Steigerung des Ausdrucks und Kunst der Wahl, Ordnung und GUe-
derung, die berall durchgeht und an Einflu der offenen, die etwa
in der rmischen Elegie Properz, Ovid so einschneidend bestimmt
hat, nicht viel nachsteht.
lebendige blhende Gestalt'ing und vermodert zu toter Materie . . . der Gipfel
schlgt blo durch ein W (Wipfel) wieder krperlich und grnend aus. Jean
Paul, Vorschule der sthetik
32.
Norden, Antike Kunstprosa II S. 883 ff.
'')
Gundolf, Shakespeare und der deutsche Geist. Berlin 1911 S. 149 ff.
16
Die Behandlung des Wortsinns.
Aber was ist berhaupt poetischer, was rhetorischer
Ausdruck?
Otto Ludwig hat einmal vorgeschlagen, die Scheidung von naiver
und sentimentalischer Dichtung durch die Begriffe Dichter
und
Rhetor zu ersetzen. Schiller ist in der Tat an Goethe
gemessen
rhetorisch. Diese Scheidung wrde aber zu weit gehen.
Sentimen
talisch und rhetorisch sind keine sich deckenden Begriffe.
Gorgias
ist durchaus unsentimentalisch, und der sehr sentimentale
Tibull
hat kaum Rhetorisches. Wohl aber wird eine Dichterschule,
die
ihre Schler instandsetzen will, aus dem
sentimentahsehen
Pathos des Preisens und der Hymnik heraus berlieferte Stoffe fr
die Bedrfnisse einer Hrerschaft aus bestimmten Lebenskreisen
nach berlieferten Regeln prunkvoll darzustellen, sich von einer
Schule der Beredsamkeit nicht sehr weit unterscheiden. Vor der
Rhetorenschule der Sophisten war die Dichterschule der Rhapsoden
und vor allem der Komponisten von Chorliedern. Lyrische Dichtung
im weitesten Sinne, im Gegensatz zu erzhlender und dramatischer
Poesie, steht auf der Grenze zwischen Sprachkunst und Dichtkunst.
Dichtung, die in ihren Ursprngen der Magie nahestehende, dem
Erlebnis entspringende Ausdrucksrede, und rhetorische Sprachkunst,
die mit Bildern geschmckte Zweckrede, sind in der alten Zeit viel
miteinander vermischt. Dichterisches Bild und rhetorische Metapher
werden sich auf diesem Boden einander stark nhern. Der 6yy.oc,
TYJ;
TtoiTjo-soic ist ein breites mittleres Gebiet, wo Dichterisches und
Rhetorisches gemeinsam teilhaben. Wenn die Dichtung Zwecken
dient, die nicht in ihr selber liegen
was bei der griechischen Chor-
dichtung der Fall ist , so tritt sie unter die Redeknste. Die Richtung
auf die Rhetorik im engeren tadelnden Sinn, die Phrase, ist jedoch
erst gegeben, wo die leblos ausgeklgelte Zweckrede herrscht, das
Prunkstck bewuten Knnens, Vlrtuosentum oder Koketterie,
wenn der Dichter seine Worte nicht danach whlt, wie sie seinem
andersgearteten reicheren Sehen der Dinge entsprechen, um zu
versinnlichen, sondern wenn er die Rede bewut schmcken und
schwellen will: den unberechtigt affektreichen Stil nennen wir rhe-
torisch. Selbst wo das bei Pindar so aussieht, ist dennoch eine seelische
Notwendigkeit bei ihm durchzufhlen.
Der lyrische Dichter hat zwei groe Mittel, wodurch die Hrer in
seinen Kreis gezogen werden, nmlich die gebundene Form der Rede,
Versma, Reim, d. h. eine musikalische Seelenfhrung, ein Bannen
der Hrer durch Rhythmus, in den sich bei dem geheimnisvollen
Gehobene Sprache.
17
Vorgang des Dichtens Silben und Worte gelegt haben, und zweitens
die poetische Ausdrucksweise, die gehobene Sprache.
Der bergang aus der Prosa in Poesie ist in der antiken Literatur,
wie z. B. auch in der formell davon abhngigen franzsischen, ein
ganz anderer Schritt als in der deutschen. Bei uns fllt der germanische
scharf aushauchende Wortton und Verston stets zusammen: Vers-
rhythmus entsteht durch eine Wortstellung, bei der die Wortakzente
sofort von selbst ins Ohr fallen als schwere Taktteile von %- oder
*/4-Takten Dagegen der antike Wortakzent ist mehr musikalisch,
die Mekunst, die Metrik, braucht sich nicht darum zu kmmern,
ob ihre langen und kurzen Silben auf hoch oder tief gesungene"
(TcpoaoiSta) fallen. Die Verskunst der Romanen steht hier der antiken
nher als unsere, z. B. der sogenannte schwebende Wortakzent der
Franzosen ermglicht einen Versbau, bei dem Silben zur Tliesis
werden, die in Prosa nie den Ton haben, sogar das auslautende
dumpfe e kann schwere Silbe sein.
So ist fr die Antike und die Romanen, nur fr die Antike in
viel hherem Mae, eine strkere Umschaltung des Innern ntig als
fr uns, der Unterschied von der Sprache des Lebens ist weiter,
wenn es aus der Prosa in die Poesie geht. Wenn mit dem Sprechen
von Versen begonnen wird, kommt eine andere Art der Rede, alle
Worte klingen anders als im gewhnlichen Leben, so wie sie seit
Jahrhunderten klangen, wenn Dichter sprachen. Es ist, als ob ein
Snger oder ein Instrument auf eine bestimmte affektbetonte Ton-
hhe festgelegt wre. Naturgem wirkt dieser Zustand stark mit,
um der berlieferung und den einmal entstandenen Formen beherr-
schende Macht zu sichern, er zeigt selber bereits eine sehr konservative
Menschenart.
Es gibt ferner im Griechischen und im Lateinischen eine erstaun-
liche Zahl von Wrtern, die blo 'poetisch' sind, und prosaische
und poetische Texte sind im Altertum in der Wortwahl sehr ver-
schieden. Fr die gute Prosa sind sie streng verpnt. Nur das Eng-
lische lt sich dem vergleichen mit seinem starken Unterschied
des prosaischen und poetischen Wortschatzes. Pindar redet fast
ausschlielich in blo poetischen" Wrtern. .Sieht man sich nach
Entsprechendem in unserer Sprache um, so stellt es sich heraus,
da Wrter, die in der Prosa sich wie Anklnge aus Versen aus-
nehmen, meist altertmlich sind: Lenz, hold, gleiend. Glast, Bronnen,
Schwele, Antlitz, das Na, Minne, fr und fr, ebenso Wortformen
Dornseiff, Pindars Stil. 2
18
Die Behandlung des Wortsinns.
Lande: Lnder, Bande: Br der, Odem: Atem, Mannen: Mnner,
Worte:Wrter, Aar: Adler, ward: wurde. Ferner Ro : Pferd, Haupt:
Kopf, Leib: Krper, Zhre (Saxpu, lacrima): Trne, licht : hell, freien :
heiraten, Knabe: sddeutsch Bub, norddeutsch Junge (dem wrden
fr das Griechische des 6. und 5. Jahrhunderts epische
Wrter ent-
sprechen) ^). Das Anschieen von Seelenstoff ist der wesentliche Punkt
bei der Begrenzung des Knstlerischen, des Dichterischen
berhaupt.
Das erklrt, weshalb ein Ding, das nur der Gegenwart angehrt, fr
diese undichterisch ist "2).
Simplex.
Hohe pathetische Dichtung liebt ferner statt des engeren Com-
positums das ungenauere, weitere, mehrdeutige S'mplex^) (man
denke an Richard Wagner, Stefan George): Seim, sehren, enden
statt beenden oder beendigen, kehren fr zurckkehren, missen ist
edler als vermissen, trunken als betrunken, mehren, zwingen, zeugen
statt erzeugen.
Keller unter jedem Hof, wo siegt
Und im Sand verstrmt der Edelwein
Keiner trinkt ...
George, Stern des Bundes S. 23.
Auch das ist z. T. Wiederaufnahme von Altertmlichem und Rck-
kehr zum Bildhaften, Gefllten der Worte. Man entkleidet sie der
Zusammensetzungen, die ihnen einen kleinlichen, peinlich logischen
Flitter ankleben. Eine Dichtung, die das einzelne Wort so gewichtig
nimmt wie altgriechische Chorlyrik mit ihrer breitschreitenden
Bewegung und ihreni schwerbeladen sich windenden Satzgefge
liebt die Wrter in der Grundbedeutung oder in sinnreich verschobener
Abschattung zu nehmen. TiOevat fr TTaps^stv O 2, 10^ yjL^\icL'z
Xkoiq eyjxev Eurip. Herakl. 221 (vgl. Wilamowitz dazu). Die Pindar-
scholien erlutern solche Simplicia durch Composita: O 1, 56 iXev
dcTav schol: TcpocretXYjcps; 72 octcusv schol: TcpoasxaXeiTo; 4, 17 Tsy^co
schol: xaTaps^o), OLcpe^riGOi; O 10, 76 asiSsTo schol: TusptfjSsTO,
IvcxcofjLia^exo, niima fr deduco, franzs. emmener, Bakchyl. 16, 29;
O 4, 2, N 4, 18; 9, 52, (Mrose, De syntaxi Bacchylidea, Diss. Leipzig
1902, 50).
'
*) Auch anderes wie etwa cTpocTo? fr Volk.
2) Bltter fr die Kunst, Auslese 1898- K04. Berlin 1911, Bondi. S. 18. Vgl.
auch Tobler, Zeitschrift fr Vlkerpsychologie 6 (1869)
S. 385 ff.
^) R. M. Meyer, Stilistik S. 21 ff. Elster, Prinzipien der Literaturwissen-
schaft I S. 219 ff.
Simplex.
Allgemeinere Begriffe.
19
Aus dem Lateinischen z. B.: tendit iter Verg. Aen. I 656, VII 7,
VI 240, contendit iter Cicero pro Roscio Am. 34,
Durch kleine Abstriche knnen selbst gebruchliche Worte anders
scheinen, als sie sind, und verjngen sich, abgegriffener Vorrat wird
umgegossen. Die Worte scheinen auf ihren geheimnisvollen Mutter-
boden zurckgefhrt, wieder aufgefllt und durchgelebt, zum ersten
Male gesprochen. Aber die griechische Chorpoesie geht dem Com-
positum doch nur gelegentlich aus dem Wege, s. S. 134.
Der Typus von hoher Poesie, dem Pindar angehrt, liebt ferner
^^^"^^6
allgemeinere Ausdrcke und Begriffe und zieht das Ganze dem Teil
BegnSe.
vor. Ellenbogen ist weniger edel als Arm, Kniescheibe als Knie,
Kleid ist edler als Rock (siehe unten die Stelle aus Lenau). Man sagt
in gehobener Rede statt Zimmer Raum, glace statt miroir^). Die
mittelbare Benennung hlt den Gegenstand ferner, wirkt feierhcher.
Die fade Begrenztheit der engen eindeutigen tghchen Begriffe wird
verwischt, die gewohnten Umrisse der Dinge verflieen ins Unbe-
stimmte, Allgemeine. Es gibt Obertne, es schwingt allerlei im Aus-
druck mit, was verklrt und vergeistigt, die Dinge erscheinen befreit
von dem Schwrm gemeiner Nebenvorstellungen.
Schopenhauer sagt in Welt als Wille und Vorstellung II,
Buch 3, Kap. 31: Obgleich die eigentmhche und wesenthche Er-
kenntnisweise des Genies die anschauende ist: so machen den eigent-
lichen Gegenstand derselben doch keineswegs die einzelnen Dinge
aus, sondern die in diesen sich aussprechenden platonischen Ideen.
Im Einzelnen stets das Allgemeine zu sehen, ist gerade der Grundzug
des Genies." Nietzsche (Taschenausgabe der Werke II, 367) bemerkt
dazu: siehe Pindar. Es handelt sich bei der starken Verwendung
dieses Hilfsmittels um ein ganz bestimmtes Kunstwollen. Pathetische
Dichtung hebt es, in dieser Weise das yevo^; fr das TupayfJLa zu setzen.
Die Umschreibung, der undeutlichere allgemeinere Begriff gilt als
edler und poetischer gegenber dem gerade Herausgesagten, das
Konkrete ist das Unvollkommene. Der genauere Ausdruck wird
so durch einen ungenaueren im Rahmen der Situation oder in
Richtung der Stimmung vertreten, wenn z. B. fr Sieg im Wett-
kampf steht:
) Jean Paul, Vorschule
18.
20
Die Behandlung des Wortsinns.
TtfjLa: J 1,
66
x^^P
Ttfxav sTTTaTrijXoK; yjaiai te^xovt*.
J 2, 29 tv' ^6avaT0t<; AlvYjCTtSafjLou TratSsi; ev TLfxaic;
J 5, 54 ev S* IpaxsLVo) (jLsXiTt xal TOiaiSe Ttfxal
xaXXtvixov
X^Pf^*
ayaTcdc^ovTL.
O 12, 15 TLpia . . TuoScov.
O 13, 15
x-^
GTTaSiou Ttfxav StauXou ts Bakchyl.
1, 180; 13, 80.
yspac;: P
5, 124 e\jxo[icLi vtv 'OXufXTCta tcouto Sofxev yepa;
Irct BdcTTOU yevet.
P 8, 78 Msyapoig S* exet^ yepa? Bakchyl. 3, 12.
Xapt<;:
J 7, 17 aXXa TuaXaia yap eCSsl
x^^P^^S-
8, 57 xal NsfJiea yap 6(xco(; epeco TatSxav
x^P^^
^
x TrayxpaTLou.
O 1, 19 Ili(7ciLq TS xal Oepsvtxou
X'^P'^-
dtpsTY): O 7, 89 avSpa ts ttil^ apsTav eupovTa.
O 8, 6 [xaiofxsvwv fisyaXav apsTav 6u(xw XasZv.
N 5, 52 eXsLV *E7rtSaijpcp StTrXoav vtxcovT apSTav.
J 5, 17 TLV S' ev 'I<70(xqi SL7cX6a OaXXotd' dpsTa . .
xetrat TrayxpaTtou.
TcXouTO^: J 3, 17 ttXoutou SteaTsixov TeTpaopiav ttovolc;.
dvopea: J 4, 11 dvopeaLc; S' ecrxdTaicrLv otxoOsv aTaXatctv
aTCTOv* 'HpaxXetai^.
N 3, 20 dvopeaic; uTispTaTat; eTcsa.
xaXov
:
P 8, 88 xaXov ti veov Xax^v,
auch 33 vecoTaTOv xaXcov.
P 5, 116 6goli t' eicrlv
Ituix^P^^'^
xaXcov ecroSot.
O 13, 45 S7)pto[JLat TcoXetJtv Tcspl ttXtqsl xaXwv.
J 8, 77 T^av yap oux aTieipov utto
x^^?
xaXwv
8d[JLaC7V.
N 11, 31 oixetcov 7rap(T9aXv xaXcov.
Bakchyl. 9, 101 w tl xaXov 9[pTai tout] atveoi;
2, 3, 96 crOv S' dXaeLa xaXcov.
dXo^;: J 7, 24 {xarpcp
6*
ofJicovijpLcp SeScoxe xotvov 6dXo<;,
epyov: 9, 85 d[jL96Tepoi xpaTv^crav piiav epyov dv* dfxepav.
P 9, 92 cTtyaXov dfjiaxavLav epyco 9uycov.
7, 84 Td T ev 'ApxaSia epya xal 0Y)ai^.
J 3, 7 euxXecov S' epycov ocTcotva.
J 5,
23 ioSoTCov epycov xeXeuOov J 6,
22.
xpdTo;: J 8, 5; 1, 23 und 80.
Allgemeinere Begriffe.
21
Das sind alles im Grunde gleichbedeutende Worte. 'Geschlecl t'
statt *Sohn' P 3, 41 yevo^ ajxov oXeacrai; P 4, 135 Tupou^ epaciiTcXoxa-
jjLou yevzoL, yovo^ fr Sohn 9, 76; 6, 36;
Dithyr. fr. 75, bereits home-
risch O 141, O 175, P 447 alpta fr Nachkommenschaft, N 5, 43
^voq. rieiJXY) 'heit' nach den Wrterbchern *in poetischer Sprache
auch' die Fackel. Neir, es heit nicht Fackel, sondern der Dichter
kann in gehobener Sprache sagen tueuxyj^ Gz'koic, Eurip. Trcad. 298,
ocTTTouCTiv Tueuxa; Or. 1543, und man wei, da die Fackel gemeint
ist, wie ein Katholik vom Priester sagen kann *er hlt das Amt'
fr Messe, Korn kann fr Samen stehen u. dgl. AtopLeva 3s 8at(;
uTTo ^avaiai Tteuxai^ ist nicht anders als deutsch: die leuchtenden
Fackeln am braunen Kien.
Aristoteles poet. 21 (vgl. rhet. III, 11)
nennt das die bertragung
vom yevo^ auf das elSoc;, d. h. das Ungenauere steht fr das Przisere.
Schriftsteller, die diese Forderung ber alles stellen, schreiben einen
Stil, den das PubUkum im allgemeinen rhetorisch nennt, der aber in
Wahrheit pathetisch ist. Nicht der Klangschnheit als solcher,
sondern den Gefhlswerten groer Worte gilt ihre Sorge (vgl. in
der deutschen Literatur Schiller oder Treitschke) ^). Nichts wird
blo den Sinnen, alles zugleich dem Gemt und der Empfindung
geschildert.
Auerdem wirkt in den Ausdrcken fremdsprachlicher und be-
sonders in solchen alter Dichtungen etwas auf uns, was ich nicht
besser sagen knnte, als es schon durch Lazarus Geiger geschehen ist.
Ich setze deshalb die Stelle her, Ursprung und Entwicklung der
menschhchen Sprache und Vernurft 1868, S. 214:
Uns liegt es fern, den Unterschied zwischen can und may, savoir
und pouvoir festzuhalten, den unsere Nachbarvlker machen; die
Sprache der Bibel befindet sich gegen uns in betreff der Begriffe
drfen und knnen in derselben Lage. Wenn dies nun bloe Mangel-
haftigkeit des Ausdrucks wre, so wrde die reichere Sprache einen
solchen Mangel beseitigen und dem beabsichtigten Gedanken zu
Hilfe kommen knnen; allein dies ist so wenig der Fall, da grerer
Reichtum ein vielleicht strkeres Hindernis als grere Armut fr
die Wiedergabe des Gedankens in einer andern Sprache bildet.
Der unbestimmte Ausdruck nhert sich hier mehr dem einen, dort
mehr dem andern unter den trennbaren Begriffen, die er vereinigt.
') R. M. Meyer S. 209.
22
Die Behandlung des Wortsinns.
aber er entspricht niemals einem derselben ausschlielich, sondern
bringt stets ein Gemisch ihrer aller vor die Seele, welche von diesem
Begriffsakkorde eigentmlich erklingt und oft dunkler und mchtiger
zugleich als von jedem seiner Teile bewegt und ergriffen wird. Darum
ist es auch nicht mglich, die vedischen und homerischen Gedichte,
oder auch die Bibel, wirklich zu bersetzen: denn indes wir ihnen
notgedrungen eine Schrfe vereinzelten Gedankens leihen, welche
sie nicht wollen konnten, entschwindet uns die gewaltige Gesamt-
wirkung einer Welt naiv vermischter und ineinander flutender
Stimmungseindrcke und der Schwung durch keine Verstandes-
sonderung gebrochener Gefhle. In der Armut und Einfalt der
Sprache liegt ein Reiz fr uns, der aus der Sehnsucht nach Erlsung
von dem Verstnde selbst entspringt; und wenn sie daher in dem Zu-
stande vlliger Klarheit noch Reste ihrer alten Unfhigkeit des
Unterscheidens erhalten hat, so besitzt sie hierin ein wahres Ver-
mgen, die Gedanken zu verbergen, welches nicht nur fr die Zwecke
teils zart, teils schlau doppelsinniger Feinheit wirksam und wichtig,
sondern auch durch unbestimmte Erregung der Empfindung dichterisch
bedeutsam ist; denn hierdurch entsteht eine Dmpfung der allzu
grellen Helligkeit der Verstandeserkenntnis, welche den des Halb-
lichtes bedrftigen Zauber der Phantasie zerstren wrde. Ab-
sichtliche und knstliche Unbestimmtheit dieser Art bewirkt also
heute nicht sowohl Miverstndnis als die sanfte Spannung der
Ungewiheit oder ein freieres Schwanken der Seele zwischen Mg-
lich keiten, welche ungeschieden in dem Ausdrucke enthalten sind.
Um so mehr mute ohne Zweifel vor aller Entstehung von Unter-
scheidungsmitteln das Vielfache untrennbar zugleich wirkend in
dem ungesonderten Begriffe wie im Keime zusammengeschlossen
liegen."
Alles, was am dichterischen Sprachausdruck beobachtet werden
kann, ist im Grunde dasselbe, was die Bedeutungslehre an der Ent-
wicklung der Sprache des Lebens und der Prosa feststellt, aber auf
anderm Boden (s. unten S. 68 f.). Was bisher genannt ist, entsprche
der Bedeutungsverengerung. Das Wort, die Schrift kann mit der
Zeit
=
Bibel werden, Gesellschaft
=
gute Gesellschaft (nach fraaz.
societ^. Mehr Beispiele gibt Waag^)). Brunst hie ursprnglich
ganz allgemein Brand (vgl. Feuersbrunst). Orare
= reden wird zu
bitten, classis = Aufgebot der Mannschaft zu Flotte.
') Die Bedeutungsentwicklung unsres Wortsdiafees Lahr 1915 S. 22 f.
Allgemeinere Begriffe.
Mehrzahl.
23
In derselben Richtung liegen Mglichkeiten bei der Behandlung
des Artikels. Bald steht er, bald fehlt er, wodurch vieles etwas zwischen
der* und ,ein* und jener bekannte* Schillerndes bekommt. Die
Kenntnis des Gesagten erscheint vorausgesetzt zu werden und doch
auch wieder nicht. P 12, 15 t6 t avayxaiov Xs^o;; N 4, 33 toc [laxpa
vgl. J 7, 43. 8, 38 ol Suo; P
2, 30 al 8uo S'afXTrXaxiat. Die Flle
auffallender Artikelsetzung, die der erstrebten Asymmetrie dienen,
s. unten S. 105. Im allgemeinen verlocken die Partikeln 8s und yap
dazu, den Artikel zu brauchen ^). Vlkernamen haben ihn nie 2).
Die Artikelsetzung bei Eigennamen hnelt dem deutschen Sprach-
gebrauch: man sagt *Hera' ohne Beisatz, aber *die weiarmige
Hera'. Durch das Beiwort wird der Gttername schon etwas enger
eingegrenzt, so da mit dem Artikel gleichsam auf ihn hingezeigt
werden darf ^).
Ein prunkendes Mittel, um den Eindruck der Flle zu erwecken,
aus der der Dichter nur mit Widerstreben zurckhaltend gibt, ist
folgendes: Das letzte Glied einer Aufzhlung erhlt durch ein tk;
oder TcoTE ein Aussehen, als sei es aus einer groen Menge von Dingen
oder Taten leichthin herausgegriffen, die wegen Raummangel nicht
erschpft werden kann.
N 3, 38 xat tuots x^^xoto^ov 'A(JLa2^6v(ov.
O 13, 87 aiv Ss xslvco xat ttot* 'Afjia^oviScov.
N 1, 64 xat TLva ahv TcXaytcp avSpwv ^opc) areiyoyna. . .
N 9, 18 xai ttot' zq kTZTOiiixilouc, 0y)a(;.
Bakchyl. 13, 84 xai iic, u^au^vj^ xopa.
Die Wirkung liegt in derselben Richtung, wie wenn Jesaja 10, 6
von Israel spricht, aber nur sagt ein ruchloses Volk*'. Oder Anchises
bei Vergil Aen. VI excudent alii (== die Griechen). Dergleichen birgt
eine anreizende Unvollstndigkeit, ein irrationales Element, das die
Begrenztheit des gepriesenen Gegenstandes verdeckt, ein Verwischen
der Konturen. Die groen Pathetiker wie Pindar haben die Gabe,
den Wrtern unexakte Bedeutung zu geben.
In diesen Zusammenhang gehrt wohl auch der poetische Pluralis
Mehrahi.
(da er rein poetisch ist, sagt schon Aristot. rhet. 3, 6, 4, et^ y^^o^
') Richard Stein, De articuli apud Pindarum usu, Dissertaon.
Breslau 1868. S. 28.
Dissen zu N 8, 51.
') Mrose, De syntaxi Bacchylidea S. 12.
24
Die Behandlung des Wortsinns.
ir^q Xi^ecdQ vgl. tt. u^^ou^ 23).
Seine auffallend hufige Verwendung
in der pathetischen Chorlyrik wird nicht blo metrische Grnde
haben. Die Mehrzahl hat gegenber der Einzahl dieselben Schnheits-
vorzge wie der allgemeine Ausdruck gegenber dem bestimmten:
er verwischt die nackte Begrenztheit, er abstrahiert und bewirkt
maiestas, umwlbt pomps: Y 268
xP'J^o?
Y^P
ep^>taxe, Scopa Oeoto.
J 5, 39 Xeye Ttve<; Kijxvov, tivs^ "ExTopa
Tce9vov, wo blo von Achilleus die Rede ist.
J 1, 13 x6ve^
vom Hund des Geryoneus.
Die Mehrzahl ist der allgemeir ere Ausdruck und rckt ferner, so braucht
ihn auch der Orakelstil, der manches mit dem hohen Chorton ge-
meinsam hat: P 4, 72 EXiav e^ ayaucov AioXiSav avefjLsv Soph.
OT 1176 xTEveiv viv toi!)? TsxovTa? ^v X6yo(;. Bei Bezeichnung von
Personen, Verwandtschaft und Gattung ist diese verbreiternde, ver-
allgemeinernde, verwischende Kraft der Mehrzahl besonders will-
kommen.
J 8, 35 Ai6(; Tcap' a8eX9eoL(Tiv von Poseidon.
Dithyr. fr. 75 yovov uttoctov TaTepcx)v {xsXttejjlsv yuvatxcov te
KaSfXEtcov.
9, 56 xoupot xopav xal cpEpTcxTcov KpovLav fr die Nachkommen
von Zeus und Protogeneia.
N 5, 7 EX Ztjvo^; . . , (puTzu^ivTcuQ xal octco /puasav NyjpTjL^cov
Aiaxt8a{;.
Die Tragdie hat viel dergleichen. Soph. OT 366, 1007, Elektra 838
1).
2, 93 mit cjuvetolctlv ist Theron persnlich gemeint, ebenso beruht
auf dieser Abschwchung der pluralis modestiae fr den unmittelbar
gelobten Einzelnen 7, 10 oder das gleitende pluralische Nennen des
Siegespreises (N 9, 51 apyupEaKJt (pioCkcniGi; P 3, 74 axEcpavou; fr einen
einzigen Sieg; vgl. 6, 26, P 2, 6 fr die Silberschale aus Sikyon),
das ist im Grund dasselbe, wie wenn ein allgemeinerer Ausdruck,
z. B. apETY), fr Agonsieg steht.
Mitunter berrascht auch ein unerwarteter Singular:
O 7, 19
'
ApyEia ct\jv
olIxm,
N 7, 73 Trplv aXicp yuiov ^[XTusaEZv; P 1, 6
JjXEtav TTTEpuy' d{X90T(:co9v xaXa^ai?.
Ditl yr. Oxyih. pap. XIII
') Maas, Archiv fr lateinische Lexikographie 12 (1902) S. 498. Menge,
De poetarum scaenicorum sermone observationes, Dissertation. Gttingen
1905, S. 25 ff.
Mehrzahl.
Beigese^ter Gattungsbegriff.
25
(1919) atofj^va ts ^cdc, utco ^cnwdcdGi Ticuxai^. Soph. Antig. 345
bietet hnlichen Wechsel. Auch darin liegt etwas Abstrahierendes,
ein pathetisches Zusammennehmen der Einzeldinge zum leicht
symbolhaften Begriff der Sache selbst, vgl. aus deutscher pathetischer
Dichtung:
Klopstock, Dem Erlser.
Doch wohnt ein Unsterbl'cher
Von hoher Abkurft in den Verwesungen
Und denkt Gedanken, da Entzckung
Durch die erschtterte Nerse schauert . . .
berhaupt dieses ganze Gedicht. Oder George, Stern des Bundes 40:
Von goldenen Sulen schlang sich Blumenkette,
Erzbecken rauchte neben Purpurlagern
Dergleichen Verschiedenheiten sind im Formenschatz der Sprache
selber schon vorhanden, die bald mehr begrifflich, bald mehr
anschaulich prgt: wir sagen den Fu auf die Schwelle setzen ^),
der Lateiner pedes Prop. I 18, 12 und pedem Tibull I 3, 92 obvia
nudato Delia curre pede.
Eine dem Hang zum allgemeinen Ausdruck verwandte Eigentm-
lichkeit antiker Rede scheint die, den Gattungsbegriff neben das
Bei-
Einzelexemplar zu stellen, attributiv oder appositioneil. J 4, 45 Gattungs-
ToXfjLoc epipe(jLTav yjpwv Xeovtcov. Bruhn, Sophokles-Anhang S. 8
verzeichnet A 91 avSpa BiYjvopa; S 236 eo^ Zeuc;; H 59 opviCTiv
aiY^TCioiatv; 256 aual xocTcpoicri; vgl. P 21, P 389 Taijpoio co^.
Eurip. Herakles 465 cttoXyjv ts 6Y)p6<; a(X9eaXXe ac5 xapqc Xeovto;;
vg. Wilamowitz zu der Stelle, der noch dazu gibt: Soph. Aias 817
avSpo^ "ExTopo^; Theokr. Hei. 51 ea K^npic;. Vgl. auch P 9, 106
"Ipaaa izpoc, TroXtv.
Darin liegt aber so wenig eine verallgemeinernde Verbreiterung
wie eine Aufhhung, die wir durch die bersetzungen Untier, Held,
groe Gttin, wiedergeben mten, wie Wilamowitz a. a. O. meint,
so wenig wie in avvjp acjiXeiS;, Roma urbs, Rhenus flumen, sondern
das Leere, Vage, was die rein begriffliche Nennung des Wortes Lwe,
Hektor usw. an sich hat, wird eingeengt und ausgefllt. Sprecher
^) Fr die Einzahl im Deutschen bei Auge, Ohr, Fu, Hand Rudolf
Hildebrandt, Beitrge zum deutschen Unterricht. Leipzig 1SQ7 S. 224.
26
Die Behandlung des Wortsinns.
und Hrer verweilen noch einen Augenblick lnger in der Richtung
und Luft des betreffenden Dinges. Der Ausdruck wird dinghcher,
leibhafter, anschaulicher, sinnhcher, will also nicht verallgemeinern
oder verstrken, sondern Tipo 6(X(xaTOv tcolsIv (Aristot. rhet. III
11)
wie ein schmckendes Beiwort oder wie die Metapher und ist ge-
wichtiger, zeremoniser.
dloil'^
stellen diese Punkte der gehobenen Sprache Ausweitungen und
Uberwlbungen des prosaisch, sachlich Notwendigen durch den ge-
hobenen Ausdruck dar, so handelt es sich bei andern um Verschie-
bungen auf ein und derselben Ebene. So z. B. das ev Sia Suoiv, von
der Prosa aus gesehen das Spalten eines Begriffes in zwei fr das
auf das Erhabene eingestellte Gefhlsynonyme, whrend tatschlich
der Dichter zwei Dinge sieht und sagt, die erst durch sprachliche
Logisierung in einen einzigen Begriff zusammengedrrt sind.
Virgil liebt es Aen. I 61 molem et montes altos, Georg. II 192
pateris libamus et auro, auch arma virumque^). Ich mchte dazu stellen
die merkwrdige Stelle N 7, 73 au^sva xal adivoQ. Entweder hat Pindar
da ein yutcov fortgelassen oder
was ich glaube
es ist ev Sia Suolv
statt au^evo; aevo^ (man braucht das blo zu sprechen, um das St-
ben nach Umgehung nachzufhlen). Dieses Iv Sta SuoZv sttzt ohne
weiteres J 8, 1 ff. KXsavSpcp ti^ oCkixicc ts als sehr gewhltes Ausbiegen
statt KXsavSpou aXixta = dem jungen Kleandros. v. Wilamowitz SBB
1909, 809 erklrt: Dem Kleandros und der Knabenriege usw. Aber
die Schar der aXtxs^;, aus deren Mitte der Sieger stammt, und die er
bertroffen hat, wird sonst nie mitgefeiert. Im Gegenteil, Unterlegene
werden mit Worten bedacht, die an Schadenfreude grenzen, ihre
geduckte traurige Heimkehr dient, mit Befriedigung ausgemalt,
zur Erhhung der Siegesfreude (s. 8, 68; P 8, 83). Gewi
brauchte ja von den aXtxsc keiner bei den Isthmien mitgekmpft
zu haben, sondern sie knnen der Kreis des Siegers sein, der
durch ihn als Champion mit zu Ehren kommt. Aber auch dann
') Nahe stehen viele biblische Prgungen wie Judith 6, 3: sterben und
verderben; Jerem. 31, 34: vergeben und vergessen; Gen. 1, 2: wste und
leer; Jer. 50, 43: angst und bange; frisch und gesund; Pracht und Herrlich-
keit; Gnade und Barmherzigkeit; Treu und Glauben; Staub und Asche;
Jer. 32, 44: Brief und Siegel; an Hals und Kragen (synonym vgl. Geizhals
und Geizkragen). Tegge, Studien zur lateinischen Synonymik. Berlin
1886, 368ff.
"Kv 5i<i 5'jriv.
Synonymik.
27
stt die unwahrscheinliche Scheidung zweier Gruppen, veot und
Xixe^, die sich einander ein Stndchen bringen, die veot aufziehend,
die aXtxsc; gleichsam die Damen vom hohen Altane, auf die Schwierig-
keit, da in Vers 65 die xcojxa^ovTsc;, also die vsoi, ausdrcklich aXixe^;
genannt werden. aXtxia ist fr Pindar angesichts eines wettkmpfenden
Knaben ein t^xspo^- betonter Begriff. Dieses aXtxta als hell schim nern-
der Fleck hingesetzt, ist nun die Haupthuldigung fr Kleandros in
diesem Gedicht. Denn der gedankhche Inhalt dieses Stckes geht,
wie V. Wilamowitz zeigt, durchaus von Pindar selbst aus. Es ist fhlbar
persnUch. Bezeichnend dafr, wie wenig es Pindar auf den Knaben-
sieg ankommt, ist das Fehlen eines stehenden tottoc; in diesem Gedicht.
Die Isthmien waren nicht gerade der vornehmste Agon. Daher wird
in allen brigen isthmischen Stcken auf die geschtzteren Wettspiele
Bezug genommen
der Brief J 2 und das nachtrgliche Prco'mion
J 3 scheiden aus
1, 64; 4, 28; 5, 57; 6, 17; 7, 49. So mag das Fehlen
jedes andern Eingehens auf den Knaben ein Anla gewesen sein,
die erste Zeile als TrpoacoTrov TTjXaDys^; in besonders gewhlter Weise
zu formen. Jedenfalls sieht der erste Satz, eine lange schwunglose
Wortkette, nicht danach aus, als ob er zuerst niedergeschrieben sei;
er ist eher zuletzt entstanden. Auch P 6 bietet im ersten Vers eine
sinnreiche Zerlegung einer sonst (Paian 6, 1)
einheithchen Vorstellung
in zwei Begriffe:
^
yap eXLX(07rtSo<; ' Acppo^iTOLQ apoupav t] XapLTC)v
dcvaTToXt^o^ev.
Eine nah verwandte Art der pathetischen oder archaischen Orna-
Gewhlte
Synony-
mentierung ist das beredte Hufen von gleichbedeutenden Wrtern, nuk.
so da das eine vom andern abhngt.
P 253 'ipiq TToXsfxoto; Y 245 ev
\iiaG-fi ucTfxivir) SyjtoTTJTo^;;
Aisch.
Prom. 6 aSajxavTivcov 8e(7p,cov sv appY)XToi<; TusSat^; Pindar N 5, 30
ev XsxTpoK; euva;; Aisch. Pers. 543 XsxTpwv suvaj; apo/iTCOva^;;
P 4, 271 Tpa>[jLav eXxso^;. Friedrich Pfister hat diesen Geretiv der
Inhrenz erlutert und weitere Beispiele zusammengestellt
i).
Er
fgt mit Recht auch nicht streng synonyme, abundierende Ausdrcke
dazu wie N 9, 3 ercecov yXuxijv fjivov; 9, 7 OeorTrsata ettscov aotSa;
O 9, 34 poTsa cycofxaTa OvaaxovTcov; 2, 46 CTTrspfxocToc; pt^av. Man
hat in diesen pleonastischen Umschweifen des Ausdrucks ziemlich
archaische und primitive, leicht gestelzte Schnrkel zu erbhcken.
1) Berliner phil. Wochenschr. 34 (1914) S. 1149, s. ebenda Sp. 477; Uterar.
Zentralblatt. 1914 S. 552. Belege aus Sophokles im Anhang" von E. Bruhn
der Ausgabe von Schneidewin-Nauck. Berlin 1899 S. 117 f.
28
Die Behandlung des Wortsinns.
Ps.-Xenophon *A8. tcoX., der sprachlich manches Volksmige hat,
braucht dergleichen Wendungen. Auerdem werden diese AusfhrUch-
keiten von Verfassern bevorzugt, die das Weihevolle, Gewichtige, Er-
bauliche lieben oder in einer Zeit leben, die so gerichtet ist (also z. B.
rmische Sptzeit). Fr eindringliche, zeremonise Rede, die die ge-
sagten Begriffe auf das Innere auch unkomplizierter Menschen wirken
lassen will, liegt das Schwelgen in diesem berflu des Wortschatzes,
das breite Verweilen aiif solchen Synonymen sehr nahe. Man denke
an biblische Wendungen wie Greuel der Verwstung" Daniel
9, 27
und ihre klangvolle Wirkung in Predigten Pfister a. a. O. verweist
auf Vitruv, Minucius Felix, Gregor von Tours, Jordanes, BoU auf
Firmicus Maternus (bei Pauly-Wissowa S. v. VI 2375). Der hebrische
Superlativ canticum canticorum, vanitas vanitatum, summa summarum
Plaut, trucul.
25. gehrt h'erher.
Gewhlte Synonymik ist berhaupt ein Kennzeichen des hohen
Chorstils, es wimmelt von verstelnden Umbiegungen wie fr. 189
uTTsp TTovTLov "EWxq TTopov Upov = Hcllcspont, vgl. Headlam, Class.
rev. 16 (1902) 434.
Wie V. Wilamowitz, Reden und Vortrge
^
1913, 227 bemerkt, ist
das gemeingriechische Wort fr machen** auch im Sinne von reddo,
rendre in der Literatursprache der Chorlyrik verboten. Statt dessen
steht Ti6svat, auch tsiSxs^^ Od. 16, 198, N 4, 84. Ein besonders
gewhltes Wort fr jede Art Fortbewegung, fr kommen, weitergehen,
schreiten ist epTuco. Alkman fr. 35, P 4, 140, N 4, 44, J 4, 40, Soph.-
OT 1643, Antig. 366 Seivov tl. . . uTiep IXttlS* zyav ttots fiev xaxov,
dcXXoT* 7T* CT0>ov IpTusi; Soph. Ant. 585 oltolq ouSsv eXXetTrst ysveac;
sTcl ttX^Oo^ IpTcov; vgl. 617 und 613: ouSsv epTic vaTcov ioxo)
7ca(i.7roXi(; sxto; oltolc; es steht insbesondere von geistigen Mchten
und Begriffen, wie Saij^wv O 13, 105, xpo^o^'
so da diesem
Wort wohl ursprnglich ein gewisser Schauer eigen gewesen sein
mag. Es sei ferner auf die bereits epischen pompsen Ersatzwerter
fr sein" tusXco, 9\jo[xai, tsXsOw, TrpsTTco und eTTOfjLai
fr gehren
hingewiesen, besonders Aischylos bevorzugt TTpsTico. Vgl. etwa im
Deutschen bilden** fr sein, etwas bildet ein Hindernis, Tp90)
fr
haben oder bekommen.
"Tun^^^"
^s bleibt aber nicht beim Synonymengebrauch, sondern die
Chorlyriker umschreiben. Die Umschreibung tritt da ein, wo es
dem eigentlichen Ausdruck an der erwnschten Gefhlsbetonung
fehlt, whrend sie dem hervorgesuchten uneigentlichen in hinreichen-
Umschreibung.
29
dem Mae zukommt. Das Gefhl soll in hherem Grad angeregt
werden, als es durch die feste begriffliche Vorstellung geschehen
knnte.
Das fngt schon im spteren Epos an, bei Hesiod usw. Dann hat
es die Orakelpoesie, die ganz auf das dunkel raunende Geheimnis-
volle, auf eine nur leicht verhllende, feierlich variierendeUmschreibu ng
gestellt ist. Die Neigung, den umschriebenen Ausdruck dem bestimmten
vorzuziehen (s. oben S. 19 ff.), ist natrlich mit aus den Bedrfnissen
des Orakels zu erklren. Es wird dadurch dem Schicksal mehr Spiel-
raum gelassen, und der Gott ist hinterher nicht blogestellt. Ein
Schauer der unbegreiflichen Gottheit wird aus dem Spruch wehen.
Aristoteles hat mit Behagen bemerkt rhet. 3, 5 xal Sta t6 6Xo<;
eXaTTOv elvai a{xapTY)(xa, 8ta tcov yevcov tou TcpayfxaTO^ Xeyouatv
ol [lolvtzk;. Nehmen wir einmal den bekannten delphischen Orakel-
spruch von 480 (Hdt. 7, 141) mit den hlzernen Mauern:
CTol Ss ToS* OLUTIC; ZTZOC, EpECO (xSajXaVTt TZZkOLGGOLC; ^)
TCOV aXXwv yap aXtaxofjLsvcov oaa Kexpo7co<; opo<;
evTO^
sxet xsufxcov ts Kiaiptovot; ^aeoto
Tzlxoc, TpiToysvsL ^uXtvov SlSol supuoTa Zeu^;
(jLouvov arcopTjTOv TeXesiv usw.
Es handelt sich da nicht blo um die Doppelzngigkeit listiger Priester,
die sich fr jeden Verlauf einen Rckzug sichern wollen, vielmehr
ist die ganz bestimmte Auskunft, der Rat, auf See zu gehen, un-
miverstndlich gegeben, blo mit demjenigen typischen xoyiTzoc,
geformt, den man damals fr eine feierliche dichterische Rede im
Namen des Gottes als richtig empfand. Oder etwa das Bakis-
orakel Herod. 9, 43 'EXXiqvcov ctuvoSov xal apapocpcovov luyyjv
(zwei parallele Begriffe einmal substantivisch, einmal adjektivisch
gesagt). In solchen bedeutungsschwer sich gebenden Umschreibungen
spricht der chorlyrische oyxo; in handwerksmig bescheidener Form.
Aristot. rhetor. III 2 betont, da das xupiov, der gewohnte Eigen-
name einer Sache, diese deutlich macht, whrend ein vernderter
poetischer" Ausdruck sie schmckt, to yap e^aXXa^at Trotet
9atvaat crsfjLvoTepav* wcTTcep yap Trpo^ to6^ ^ivo\j(; ol avOpcoTTOi
xal Tzpoq To^c, TcoXtxa^, to auTo TTaa^ouat xal Tupoc; ty)V Xe^tv. Sto
Set TCOLELV ^evYjv T"y)v StaXexTov aufxacjTal yap twv octcovtwv etatv,
YjStL) Se to aufjLacTTov. Der niedliche Rationalismus dieser Erklrung
Zu diesem Ausdruck s. unten S. 96, zu xer/oc $6Xtvov S. 38, 45.
30
Die Behandlung des Wortsinns.
ist dahin zu berichtigen, da in dichterischer und gehobener Sprache
andere Seiten der Dinge apperzipiert und gesagt werden als gewhnlich.
Es hat sich ferner bei der Behandlung der Eigennamen von Gttern,
Heroen, Orten seit dem Epos etwas gendert. *Y7cspLovo^ 'HsXtoio,
vecpeXT^yepsTa Zsu^, IlTjXTjiaSsa) 'A^iX^o;; usw. das sind xupta,
feste Begriffe, so heien sie ein fr allemal. Dagegen der chorlyrische
Gebrauch von Euxptaiva, 'OpcroTptatva, 'AyXaoTpiatva usw. fr
Poseidon, Kpovou izcdc, (auch gewhlter als ul6c;I), aatXeu; aavocxcov
usw. fr Zeus u. dgl., abgesehen von den aus frommen Rcksichten
eingesetzten festen Kultbeinamen der sog. eTrtxXyjasK; wie Auxato^,
AtTvaio^, *EXXavto<; ist empfindsame Rhetorik. Da zuerst hat man
in der europischen Literatur den Reiz entdeckt, der darin liegt,
wenn man statt Napoleon sagt der groe Korse, statt Kant der Weise
von Knigsberg. Wer heute so redet, macht sich des Brillantenstils
schuldig wie Maximilian Harden. Aber ein Leser Pindars mu sich
in die literarische Lage hineinzufhlen suchen, wo dieser ganze Aus-
drucksbereich noch jungfrulich, unverbraucht und vom Finderglck
der wortfreudigen Griechen verklrt war. Und in der antiken Poesie
hat diese Freude am Wechseln der Benennungen sehr lange vorgehalten,
sie bestimmt die Farbe der hellenistischen und rmischen Dichtungen
wie kaum etwas anderes. Wie she z. B. Vergil aus ohne Achaicus,
Graius, Achivi, Danai, Aeacides, Ausonius, Cytherea, Hesperius,
Maeonia, Teucri? Man vergleiche aus der mhd. Poesie min lip fr
ich oder den Hang vieler Menschen im Leben, den Titel statt des
Namens zu brauchen.
Die Umschreibung geschieht nicht geradezu mit Metaphern,
sondern es herrscht eine gewisse periphrastische Ausdrucksweise
vor, die pathetische oder dekorative Wirkung anstrebt. Die Begriffe
werden, einerlei ob sie innerhalb des Gedankenzusammenhangs
wichtig sind oder nicht, reich mit Zierat behngt oder durch ein
umfangreiches Schmuckstck ersetzt.
Es besteht augenscheinlich die ganz naive Forderung, da alles,
auch das Einfachste, Alltglichste poetisch" sein mu. Ursprnglich
sollen die Chorlieder die Stimme der festlichen Erregung sein, der
Schrei einer Masse, Jubel, Klage, Gebet. Die Texte bewegen sich
inhaltlich auf recht geschlossenem Raum. Man will einfache Dinge
schmcken, variieren, verklren. Ein Epinikos, ein Hyporchem ist
innerhalb der ganzen Feier gleichsam ein Stck dekorativer Kunst,
das den Glanz der Begehung erhhen soll. Begreiflicherweise ist
Umschreibung.
31
dabei nichts so gefrchtet wie die Eintnigkeit: jeder Putz, Schmuck,
alle khnen Schwellungen des Ausdrucks sind erlaubt, damit ein
pompser, glnzender Stil erreicht wird. Die Lieder fr die Begehungen
sollen reich geschmckt sein, emsig gearbeitet aus kstlichen Stoffen
wie die Gtterbilder aus Gold und Elfenbein, bekleidet mit wert-
vollen Gewndern, geschmckt mit reichen bunten Steinen und
teuren Metallen. Der Chordichter ist stolz auf seine Kunst, einen
bunten Hymnus zu flechten O 6, 87 (s. unten S. 59). Pindar will,
ihm soll man nicht nachsagen knnen IpTTs axotvoreveia aoiSa.
Was er so als langatmig und steif empfand und ablehnte, war jedenfalls
die kyklopische Einfalt und Groheit, wie sie das erste Terpandros-
bruchstck zeigt, am Epos andererseits vermite er wohl t6 GTcouSatov.
Mit seinem Stolz auf die Feinheiten der schwierigen Dichtkunst
und seine reiche Spruchweisheit mutet er fast wie ein arabischer
Makamendichter an: derselbe Typus des belehrenden bedchtigen
Wissers, der viel gesehen hat, der wei, da die Dauer alles
Irdischen zweifelhaft ist, dem keiner ber ist in der Kunst des
Dichtens.
Der homerische Sprachgebrauch lepy) t? TTjXefxaxoio, tyj *HpaxXsi7]
kommt in der Chorlyrik verstrkt und vermehrt vor: J 8, 54 Mejx-
vovo^ iav uTcep Oufxov; Aischyl. Eumen. 374 tzo^oc, ax(jLav ; J 8, 41 dxjxav
TcoSciv; O 1, 49 uSaTO^ Trupl ^soiaav axfxav;
P 4, 208 y.ivy]d[i6c, Tuerpav;
P 2, 12 (lOevo^ tnniov; P 4, 144 a^ivoc, asXiou xp'J^eo'^; J 5, 34 opyal
AtaxoO TTatSwv ts; P 6, 36 yepovTO^ ^ovrfizlaoL
9p7)v oacs; N 7,
102
t6 efjLov xeap (nach 11 554 vgl. Schultz, De Pind. sermonis colore
epico
44). P
5, 34 evtecov aevo^. Das ist brigens nicht blo wort-
freudige Umschreibung oder gar wie Alfred Croiset^) meint sans
naivete, savant und raffin6
so ist es in Goethes Natrhcher Tochter
Der prcht'gen Stoffe Gold und Farberglarz, Nun leihe mir der
Perlen sar ftes Licht, auch der Juwelen leuchtende Gewalt"
sondern
personifizierende, Wesen setzende Einfalt.
*
Dadurch wird an einem
Menschen oder einer Sache blo eine einzige Seite Eigenschaft oder
Ttigkeit herausgehoben und erhlt einen ganz eigentmlichen Ton. Es
ist eine Reduzierung auf das Einfache, im Grund eine Art Personifi-
kation wie die Sondergtter, Begriffsgtter. Ganz Personifikation ist
zumal die ocxtI^ ocsXlou Paian 9, 1 die Mutter der Augen 2). Die uere
') La po6sie de Pindare^ Paris 1895. p. 397.
2) Schon hier die schauende Erkenntnis: War* nicht das Auge sonnen-
haft." Goethe, Xenien II, Piaton rp. 508b, Manil. II, 15, Plotin 1, 6, 9. Wila-
32
Die Behandlung des Wortsinns.
Form sieht aus wie eine UmschreibuDg in der Art wie crOsvo^ aeXtou,
aber die Aktis ist als persnliches Wesen gedacht und erscheint in
einer ganz realen Rolle: das Licht der Sonne ist noch da bei der Sonnen-
finsternis, aber das Gestirn, der Himmelskrper Sonne ist verschwun-
den. So kann der axTt<; vorgehalten werden, sie hat sich die Sonne
stehlen lassen. E 524 ocpp* suS-yjai (Xvo<; Bopsao hngt hnlich in
der Schwebe zwischen dieser Umschreibung einer Person und dem
Begriff die Kraft des Nordwinds.
Bei Personen war man diese Umschreibung von Homer her mit-
unter satt. Daher umgeht sie der Chorlyriker wieder P 6, 28
'
AvtiXo^o?
iaToc? ist, wie Ed. Schwartz, Hermes 39 (1904)
637 bemerkt, Ersatz
fr ein nach dem Vorbild von tspyj Iq TyjXsixaxoio zu bildendes l.
t. 'AvTtX6)^oio, ebenso Bakchylides 13, 103.
^
10, 48 'AXqjstoC; Tiopov; ebenso 1, 92; 2, 13; 6, 28 stammt
umgedeutet infolge nur gedchtnismiger Erinnerung aus B 592.
Da ist es Apposition zur Stadt Thryos, bei Pindar steht es statt der
bergangsstelle fr den Flu, ebenso Sophokles Tyro, Hibeh-Pap.
I 3, 39 xaXXipouv In 'AXcpsiou Tuopov. Fr nopoq gilt dasselbe wie
fr die oben S. 20f. erwhnten Wrter. Es heit Durchgang, bergang,
Furt, Brcke, steht aber in der gehobenen Dichtersprache fr den
Durchla" des Flusses, womit sein Bett oder er selbst gemeint ist,
fr den Durchweg** der Strmungen des Meeres, was dann das
Meer bedeutet N 4, 53. Wenn erst Prosaiker, die drei- oder fnfhundert
Jahre spter leben, denselben W^ortgebrauch haben, so hat izopoQ
im 5. Jahrhundert eben nicht Flu und Meer geheien. Das kommt
in der Wortgeschichte Ilopo^, Marburger Dissertation 1912 von
Martin Rudolph, auf deren Stellensammlung ich verweise, nicht
ganz zum Ausdruck. Noch die augusteischen Dichter sagen vada fr
Gewsser, Flu, Meer, Hr. carm. I 3, 24.
Im Eifer des Drapierens gehen die Chordichter bis zu Umschrei-
bungen von uerster steifer Zierlichkeit, stark verschnrkelt und
gekruselt:
O
5, 13 cTTaSLcov aXafjtcov u^'tyuiov olKgoc;
= Strae,
N 5, 6 TEpsivav {jiaTsp' olvavac; oTucopa; = Bartflaum.
Kenning. Die Umnennung von Dingen geht leicht bis zur Kenning. Richard
M. Meyer a. a. O. 158 definiert sie als die Umschreibung mittels
mowi^, Piaton I Berlin 1918 S. 416. Weinreich, Hess. Bltter f. Volks-
kunde 8(1909) S. 168.
Kenning.
33
variierter Appellativa, eine kunstmige systematische Umnennung
der Dinge, die oft wie ein Rtsel wirkt. Vereinzelte Beispiele gibt
es in den vedenartigen alttestamentlichen Stammessprchen Jakobs-
und Mosesegen, Deborahlied z. B. Dornbuschbewohner fr Jahwe.
Dann besonders in der altnordischen Dichtung. Die Edda sagt
Schulternfels oder Burg des Krpers fr Kopf, Fuzweig fr Zehe,
Kinnwald = Bart, Schwertfrber
==
Held. Manche dieser Um-
schreibungen sind in allen Sp'^achen, die ganze Tendenz hat ihre
volkstmhchen Grundlagen. Naturwchsiges und berknsteltes
geht hier Hand in Hand. Aischyl. Agam. 824
*ApYtov 8axo<;, tTCTrou
vo<To6c, a(T7rtS73<p6pO(; Xecix;.
897 (TCOTYJpa vao^ 7T:p6TOvov, u<j^7]X^(; aTeyyj^
CTTuXov TToSyjpT], (xovoysv^^; txvov TraTpC.
Die Orakelsprache liebt die Kenning. Bellerophon, der durch Tempel-
schlaf Bescheid erlangt, wie er den Pegasos fangen kann, wird im
Traum gesagt, er soll einen Starkfu xapTaiTroSa opfern, einen Stier
O 13,
81
1).
Die 'hlzernen Mauern' von Salamis (s. S. 29)
sind
nichts anderes.
Kenning-hnlich ist P 1, 19 xtcov S' oupavCa auv^^st, vk^ozgg'
AtTva, TravexT]^ /tovo^; o^sta^ TtYjva; N 9, 50 yXuxiI>v xwfxou Trpo-
9aTav, ajjLTreXou TiaiSa; Heraklit fr. 28 Atxv] xaTaXYjipSTat ^j^euScov
rixTovoLq xal [xapTUpa<;; Aisch. Agam. 437 6
xP^^*(^Q^^<?
^*
"ApY)(; (TWfxaTOiv xal TaXavTou^^oc; Iv
[lOiXTl
^op<^^; 740 Schilderung
der schnen Helena 9p6v73(xa (xsv vrjvejxou ycfXQL^aLc, aVaeixaiov S'
ya^M-a
7cXo\jtoo
|
(xaXax6v opLfjiaTCv sXoc;
|
^Tj^tOupLov fe'pcoxoc
av6o<;. 824. P 4, 27 evvdlXtov Sopu (auch Aisch. Agam. 1618); 176
cpopjjLiYXTa^ dtotSav TraTYjp.
Solche genealogischen Umschreibungen wie die letzte verwerten die
unten S. 50ff. behandelten teils naturreligis, teils allegorisch als gtt-
liche Wesen gedachten Dinge und Begriffe. Ihr Vorwiegen ist eine
Besonderheit Pindars.
Von hier fhrt eine Linie zu der prezisen
Rtselrede der Timotheos, Lykophron usw., die oft mit den Worten
Versteck spielt; eine zentralere Linie aber geht von da stark sichtbar
durch die ganze antike Dichtung und noch viel weiter in die moderne
hinein: der Hang zur klangvollen und pathetischen Umschreibung.
Das Griechische bleibt gern beim Krper, bei der Substanz. Zu
einem Zeitwort der Funktion, zu einer Bezeichnung der Bewegung
') xapTotfrou; ist allerdings im Kretischen lebendig, wie mir Prof. Jacob
Wackernagel mitteilt. Also die S. 45 besprochene Schwierigkeit.
Dornselff, Pindars Stil.
3
34
Die Behandlung des Wortsinns.
liebt es den betreffenden Krperteil im Dativus instrumenti, im
limitierenden Akkusativ oder mit Prposition hinzuzufgen.
p
27 xpaiTTva ttocjI TTpota^; O 10, 65 ttoctctI Tpej^ov; Theokrit.
7, 153 TzoGGi
x^P^^^'^^l
8> 47 atvet Troatv.
P
3, 57
x^pc^'^
^'
^9^
KpovCcov pi^oiiQ; Soph. Ant. 56 (jiopov . . . xaTstp-
yacravT* in aXXigXoiv ^spoiv; weitere Beispiele in Bruhns
Sophokles-Anhang S. 132 f., vgl. auch die Untersuchungen
von Albert Fulda ber den Pleonasti sehen Gebrauch von
6u(jl6<;, <ppT^v und hnlichen Wrtern'*, Duisburg 1865.
Das ist eine Eigentmlichkeit des Griechischen. Nomina, und zwar
Substantiva und Beiwrter, werden dadurch vermehrt und haben
mehr Gewicht im Satz als die Verba. Die antiken Substantive sind sub-
stanzhaltiger und bieten der Funktion nicht so viele Angriffsflchen
wie spter. Ein besonders lehrreiches Beispiel aus Homer, worauf schon
Fulda, ber die Sprache der homerischen Gedichte, Duisburg 1865, auf-
merksam macht. Homer sagt nie, er dachte, das ist zu unleibUch, zu
rein funktional, bei ihm heit es IL 16, 646 9pa^eTo 6u{xco, ebd. 566
ev 0u[xqj
8'
IaXovTo stco;. Ob der Ade es auch im Leben nicht
sagen konnte, scheue ich mich zu entscheiden. Eine hnliche Rede-
weise ist i 258 ETuecjCTLv dcfxetofxevo; TrpodeetTuov. Nebenbei vermutlich
ist lautloses Denken berhaupt jung, wie auch noch die Kinder und
nicht nur diese
manches sprechen, was sie nur denken wollen,
und wie der Sprache vielfach Sprechen" auch Denken ist, so da
noch nach gegenwrtigem Sprachgebrauche man sich sagt, was man
sich vorstellt, Lazarus Geiger, Ursprung und Entwicklung der mensch-
lichen Sprache und Vernunft, Stuttgart 1868, I 58. Ich verweise
auch auf die Erscheinung des einsamen lauten Lesens und Betens ^).
Beiwort. Auer der Umschreibung dient dem oyxoc; t^(; ttolyjctcco; namentlich
das Beiwort. Die Liebe zum Beiwort ist, wie jeder wei, der ein paar
altgriechische Verse gelesen hat, mit der auffallendste Zug an der
griechischen Dichtung. Das Beiwort ist es, das ihr zum groen Teil
die Anschaulichkeit und Flle des Seins gibt. Im Epos wie in der
Chorlyrik spielt das schmckende Beiwort, der sachch entbehrliche,
aber sthetisch wertvolle Zusatz zu den begrifflichen Trgern der
Aussage 2) eine entscheidende Rolle. Das Beiwort schlechthin kann
als Lieblingsbegriff der griechischen Dichtung angesprochen werden.
1) Norden, Antike Kunstprosa. S. 6, 956 und Anhang. Sudhaus, Arch.
f. Rel. Wiss. 9 (1906)
185ff.
2) Elster, Prinzipien der Literaturwissenschaft II S. 162. Die Mnsterer
Dissertation Paul H. Meyer, Untersuchungen zum schmckenden Beiwort
Beiwort.
35
Die Beiwrter werden als stereotype Versatzstcke der Rede oft
auch an solchen Stellen angebracht, wo sie nach dem ganzen Zusammen-
hang eigenthch nicht geduldet werden sollten, eine Folge der langen
poetischen bung, die das Beiwort mit dem Beziehungswort hat
verwachsen lassen
i).
Die stehenden Beiwrter im Epos dienen von
Haus aus oft blo der Bequemlichkeit. Fr das Gedchtnis der Snger
wie fr das Verstndnis der Zuhrer werden Menschen, Gtter, Dinge
durch stehende, leicht wieder erkennbare Beiwrter bezeichnet. ber-
gnge und Wendungen werden stereotyp. Die schnellsegelnden Schiffe,
das weinblaue Meer, die lautrufenden Herolde
alles hat seinen be-
stimmten Platz, seine feste Aufgabe, es ist eine streng durchgefhrte
Stilisierung, wie sie der Rhapsode liebt, weil die versammelten Vor-
nehmen zu ihrer Unterhaltung immer dieselben anerkannten Bilder
aus der vorbildUchen Heldenwelt verlangten. Wie die konventionellen
Beiwrter in der mhd. Dichtung milt, wise, sinnec, gevege, tugentnch,
edele, getriuwe, hvesch, gebaere, hchgemuot, saelec, seze, erffnen
sie einen tiefen EinbUck in die Vorstellungsweise, die alle Angehrigen
der ritterlichen ma. Gesellschaft in gleichem Mae band 2). Die epi-
schen Beiwrter verherrlichen unterschiedslos und breiten einen
goldenen Schimmer ber die Welt: der heihge Tag, die ambrosische
Nacht, die gttliche Salzflut, die stattlichen Fe ^). Auch die Chor-
lyrik hat ein gehaltenes, stark typisierendes Wohlwollen zu den
Dingen. Und Pindar im besonderen scheint dafr geboren zu sein,
er ist ein Typus der starken Sympathiegefhle, ein Bewunderer,
Verherrlicher, Verklrer, Verschnerer, Lober, ein Artverwandter
Virgils.
Die Beiwrter sind das wichtigste dichterische Mittel der lteren
griechischen Poesie, um Farbe, Flle, Stimmung zu geben. Hugo
von Hofmannsthal sagt in einem wundervollen Aufsatz ber die
Odyssee, Inselalmanach 1913, 73f: Ein kleines Tun, ein alltgliches
Geschehen, ein weidendes Tier, eine Meereswelle, die hereinrollt,
eine Bewegung des Rudernden, eine Waffe, ein Gert, eine Wunde
fr einen Augenbhck ruht ein gttliches Auge auf jedem, und in dem
Blick dieses gtthchen Auges schauen wir mit." Hofmannsthal
in der griechischen Poesie
(1913)
geht mehr rein grammatischen Gesichts^
punkten nach.
1) Elster, ebenda S. 169.
'-)
Ebenda S. 170.
") Paul Cauer, Das Altertum in der Gegenwart'-*. Leipzig 1915. S. 47.
3*
36
Die Behandlung des Wortsinns.
hat mit diesem ruhenden verweilenden Blick, den der Leser in griechi-
schen Versen sprt, etwas genannt, was mit der wichtigste Zug an
der dichterischen Handschrift der alten Griechen ist. Ein gutes
Teil der in diesem Versuch begegnenden dichterischen
Mittel ent-
springt diesem Hang der griechischen Seele zum verweilenden
Schauen: der beigesetzte Gatturgsbegriff, das sog. schmckende
Beiwort, die Apposition, die beschauliche, bedchtige, nicht allzu
tragisch genommene Gnomik. Am deutlichsten wird das, wenn man
den jdischen Erzhlungsstil im Alten Testament daneben hlt. Dar-
ber hrt man am besten den Begrnder der Vlkerpsychologie
Steinthal, Zur Bibel und Religionsphilosophie 1890, 2: Man mchte
sagen: Jede Sache und Vorstellung offenbare sich hier in ihrem
Eigennamen. Demnach erscheint die biblische Erzhlurg in absolut
einfachem Gewnde, absolut schmucklos
-
und dies ist ihr Schmuck
und ihr Ruhm. Vergleicht man sie in dieser Hinsicht mit Homer
wie reich ist er, wie arm sie! Sie kennt keine Gleichnisse, sie kennt
keine schmckenden Beiwrter; sie stellt die Sache hin, und nichts
als die Sache, und so wirkt sie wie die Natur und die Wirklichkeit
selbst und veraltet nicht und schwcht sich nicht, die Kultur mag
steigen, so hoch sie mag. Wie Winter und Frhling, Grab und Hoch-
zeit den Menschen ohne Rcksicht auf Bildung fr immer ergreifen,
so das Bibelwort."
In dem Reichtum der griechischen Dichtung an SinnUchem,
Hellem, Leibhaftem, Klarem ruht ein groer Zauber, der dem der
antiken bildenden Kunst entspricht. Dieses schauende Verweilen,
das Augenhafte, Malende, leiht der griechischen Literatur ihre eigene
Schnheit
das weitgeffnete, unersttliche, groe Kinderauge des
eben geborenen europischen Menschen redet von seinen Wahrnehmun-
gen. Aber es bedeutet wohl auch eine Grenze: das vielberufene
Plastische in der antiken Dichtung. Theodor Alexander Meyer hat
in seinem bedeutenden Buch Das Stilgesetz in der Poesie" 1901
auf der Linie der Grundintuitionen des Lessingschen Laokoon, im
Widerspruch zu dessen zeitbedingten Formulierungen gezeigt, da
der seeUsche Vorgang, den Dichtung auslst, das Hauptvermgen
der Dichtung, nicht im Erregen klarer, sinnlicher, umrissener Vor-
stellungsbilder besteht, sondern die Vorstellungen des Hrers werden
in bestimmter Weise in einen bestimmten Ablauf gebannt. Dem so
in der Zeit verlaufenden Wesen aller Dichtung stemmt sich die antike
Poesie unleugbar mit einem statischen, plastischen, gleichsam rum-
Beiwort.
37
liehen, bildnerischen Ehrgeiz oft bermig entgegen. Daher wird
sie, wenn keine Stcke ersten Rrges vorhegen, mitunter marmorn
und ledern und formelhaft, denn die Einbildungskraft des Hrers
oder Lesers sieht sich durchaus nicht veranlat, sich die blo gesagten
Bilder innerlich auszumalen und die vom mittleren Dichter gewnschten
lebhaften Vorstellungen zu vollziehen. Die dicken goldenen Flgel-
decken der Beiwortdichter, sagt Jean Paul einmal. Die so sehr ge-
sunden Griechen haben ihre dichterische Diktion zu gleichmig
wohl genhrt, die Polyphonie und Instrumentierung des Ausdrucks
ist von einer zu bestndigen mittleren Dicke, als da eine den Hrer
bannende Biegsamkeit, lebendige, federnde Kraft, das Gewohnte auf-
zulsen und aufzuckende Beseeltheit oft wirklich sprche und dazu
zwnge, die alltghche Apperzeptionsweise zu verlassen. Die Lyrik
der antiken Griechen mu wohl jedenfalls hinter der deutschen und
chinesischen zurckstehen. Durch die deutliche, rund umzeichnete
Bestimmtheit sind die Dinge gegen das All begrifflich recht ab-
gedichtet. Urschauer, AusbHcke in das Ganze, Unaussprechliche der
Welt und des Lebens sind erschwert.
In der antiken Poesie ergibt sich somit meist ein Abweichen
von dem oben S. 19 erwhnten Typus des dichterischen Ausdrucks,
der die Dinge nicht zu scharf umzeichnet und eng liebt, ein Typus,
der in der deutschen Dichtung des 19. Jahrhunderts und den von
daher kommenden Begriffen von Dichtung unumschrnkt geherrscht
hat. Darber fhre ich eine Bemerkung Havensteins a. a. S. 46 an
:
Im lyrischen Ergu des Gefhls erscheint uns eine gewisse All-
gemeinheit und Unbestimmtheit des Ausdrucks geboten, da sie der
Innerlichkeit, dem In-sich-Versunkensein der Empfindung einzig
entspricht. Daher werden wir, lyrisch bewegt, unsern Schmerz
immer nur ins Meer oder in die See versenken, nicht in die Nordsee
oder das Adriatische Meer. Horaz dagegen singt carm. I 26:
Musis amicus tristitiam et metus
tradam protervis in mare Creticum
portare ventis."
Nun, die von Havenstein vermite
*
Innerlichkeit' ist als Wort
eine Erfindung von Johann Gottheb Fichte, als Sache in Europa
nachchristlich. Aber bei Pindar wrde Havenstein schon eine An-
nherung an den von ihm geschtzten Typus innerlicher Dichtung
finden. Die sinnlich prnllo oder redselige Form der griecliischiMi
38
Die Behandlung des Wortsinns.
Dichtersprache wird von Pindar weggeschoben durch eine eben auf-
knospende Vergeistigung und ein schillerndes Vermischen der Bilder.
Die Epithese ist sehr mannigfaltiger Tne fhig. Sie kann begriff-
lich, lyrisch, malend, pathetisch, elegisch, satirisch, humoristisch
verwertet sein. Pathetisch z. B.: Schillers Taucher Da strzt mir
aus felsigem Schacht" ^). Die Chorlyrik verfhrt mit dem Beiwort
ganz anders als das Epos. Die epischen Epitheta haben bei ihnen
ihr Gesicht verndert. Dieselben Wendungen in einem andern Zu-
sammenhang bewuter, zugespitzter gebraucht, klingen anders. Das
Unterscheidende ist nicht die Khnheit. Auch das Epos hat khne
Bilder, Homer wird deshalb von den Alten bewundert. Diese Cho"-
dichter wollen etwas Besseres sein als die Rhapsoden, sie wollen ge-
hobener, gewhlter und komplizierter schreiben. Das Epos hat
volkstmlich-primitive, oft stehende Beiwrter, die Chorlyrik liebt
entweder legitimierte oder gesuchte neue, das epithete rare.
Von der Renaissance bis zur Aufklrungszeit sah man Ilias und
Odyssee mit Vergils Aeneis auf einer Ebene, dann kam der Gegensto
der Rousseau- und Herderzeit, und man fate sie als Erzeugnisse
der dichtenden Volksseele auf. Als Rckwirkung dagegen wiederum
ist heute die Neigung vorhanden, an Homer das Ritterliche und
Kunstmige zu betonen. Ihn von der Volkspoesie zu scheiden, ist
sicher berechtigt in betreff der groen Komposition und darin, da
die Rhapsoden nicht fr das niedere Volk, sondern fr die Herren-
klasse schrieben und die alte Kunstberlieferung nicht verleugnen
knnen, in der sie stehen. Fr den vergleichenden Literaturbetrachter
ist Homer trotzdem mittelalterliches Epos etwa in der Mitte zwischen
hfischem und Volksepos, und ist, neben die Dichtung des 5. Jahr-
hunderts gehalten, ein gutes Teil primitiver, naiver, frher, einfacher,
so gut wie das Rolandslied und die Gestes es neben Ronsard und
Jodelle und Racine sind. Die Epitheta werden in der archaischen
Dichtung im Gegensatz zum Epos gern so verwendet, da ein sinn-
reiches Oxymoron dabei herauskommt. ^uXivov rzlyoq P 3,
38
birgt einen solchen kleinen Widerspruch. Ein tsZ/o;
pflegt nicht
aus Holz zu sein 2). Dasselbe finden wir Aisch. Choeph 629 aspfxavxov
EGTiav, yu'JOLixzicK.v axoXfxov aiyjjiav, avy)9ai<7T0V Tuup.
Eine Reihe
weiterer Flle in Bruhns Sophokles-Anhang 129 f. O 9, 11 TcxsposvTa
8'
i^si yXuxiJV IluOcovaS' oI'cttov; frg. 194 TTOtxtXov xocrfxov
auSasvra
^) Elster S. 163. ^) s. oben S. 29.
Beiwort.
3g
X6ywv. Aischylos huft dstere, dumpf schlagende Beiwrter mit
gleichen Anfngen rupvcoda^ orfxocTa crejjLva (Aristoph.) (ran
1014),
oft mit kahlem a privativum Suppl. 143 yafxov aSauaTOv; Pers. 861
(iTu6vou(; oLTZQL^zlq; Ag. 220 avayvov avtepov; Choeph. 55 asa^; S*
jxaxov dSdcfiaTOv aTToXepLov to Trpiv; Eumenid. 352 jxoipo; ocxXyjpoi;.
Soph. Antig. 876 axXauTO^, 9tXo<;, avujJLevatoc; (vgl. S. 27 f. ber
Synonymenhufung).
Dies alles wirkt wie erlesene epithetes rares. Ebenso wirkt das
Herberziehen des Casus. Den Akkusativ und Dativ hat man lieber
als den Genetiv; aber das ist nicht allein der Grund, sondern es gibt
dadurch neue Umdrehungen, der Wortsinn flimmert in unbekanntem
Licht.
N 10, 17 CTTTspfx' aSeifxavTov 9pcov 'HpaxXsoc;.
O 8, 42 Tcd<; yschc, epyaciatc;; 68: ev TSTpaatv 7a(8(ov aTueYjxaTO
ymoiq.
N 1, 15 SixeXiav meipav opOcocistv xopu9aL<; ttoXCcov a9veaLi;
(sehr prunkend verschlungen).
O
1, 48 SaTO^ Tupi ^soiCTav axfxav
(wuchtig).
P
9, 83 XeuxiTTTTOKn KaSjxsicov {jLSTOtxiQcraii; ayutatc; (malerisch
bildhaft).
12, 13 Tsa Tifxa tuoScov.
N 6, 44 OXeioi5vTO(; utc' dayurioL^ peciiv (dazu Wilamowitz zu
Eur. Herakles 468 'nicht die Berge sind uralt, lter als andre,
sondern die Stadt').
P 6, 5 JTuOtvtxoc; Cfivcov Tjaaupo;.
10, 6 ^LsuSscov svLTrav dXtTo^svov: das iJ^euSoi;, d. h. die gebrochene
Zusage wrde den Ehoq beleidigen, nicht der Vorwurf.
O 6, 90 yXux6^ xpaTY)p dya90yxTCOv doiSav.
Soph. Ai. 7 xuvcx; AaxatvTj^ &c; ti^ cuptvot; daii;.
Vgl. etwa lat. Tibull 1, 7 vinctos bracchia capta duces, deutsch
Goethe den besten Becher Weins.
V. Wilamowitz verweist zu Eur. Her. 468 Tocfid TreSta
yyj^
auf deutsche Bildungen wie 'reitende Artilleriekaserne, lederner
Handschuhmacher* (ich setze noch dazu: geheimes Stimmrecht,
klassischer Philolog, franzsische Literaturgeschichte) *). Wir im
Deutschen geben viele Adjektive durch Zusammensetzungen. Aber
1) Mehr Beispiele gibt Eduard Engel, Deutsche Stilkunst. 1912. S. 72.
40
Die Behandlung des Wortsinns.
da 'eine flektierende Sprache kaum anders verfahren knne',
trifft wohl nicht zu. Das Griechische tut es nur im dichterischen
Ausdruck, nicht in der Prosa. Es handelt sich also um ein
variierendes Ausbiegen im hohen Stil, auch unter dem Druck de^
Haufens von Nomina (s. unten S. 87).
Bei Pindar hat man dergleichen Stellen z. T erst durch Heilung
erzielt: J 4, 56 aOuxpTjfxvov (Heyne fr auxpyjfxvou) 7roXta<; aX6<;
l^eupwv svap.
>
Die epischen Beiwrter werden jetzt mit Bewutsein, etwas
empfindsam, ausgesprochen. Die unbefangene Sicherheit der Kaste,
ihr knabenhaftes ungebrochenes Geradezu ist nicht mehr. Die Worte
aus der lteren Dichtung haben bereits ihren mitunter hohen Gefhls-
ton. Die Einbildungskraft, das Sittliche, das innere Auge oder das
innere Ohr verbindet mit diesen Worten ein besonders lebhaftes
Gefhl. So ertsteht eine ganz besondere Pathetik, die in klingenden,
wertverknpften, stimmungsgesttigten Worten schwelgt. Chor-
dichter wie Pindar und die attischen Tragiker nehmen die neuartige
Verwendung des in der Zunft der xopoSiSaaxaXoL Gelernten, das
Umbiegen, Steigern, Verkrzen der geheiligten Wendungen, das Be-
folgen und Umgehen des t0(x6; sehr ernst und wichtig. Bakchylides
auf der einen Seite, Pindar und die Tragiker auf der andern unter-
scheiden sich gleichsam wie belehrender Vortragsredner und Prediger.
Der eine wird mehr die dargestellten Dinge reden lassen, veranschau-
lichen, der Prediger und Volksredner mehr durch solche Worte zu
wirken suchen, die mit starken Begleitgefhlen verbunden sind.
Diese Entwicklung steht in starkem Gegensatz zu der leichten
reinen Komposition und der gttlichen Helle und Bestimmtheit,
die in den homerischen Epen ebenfalls auf dem Boden einer zunft-
mig berlieferten Kunst erreicht war. Gegenber dieser zur
schlichten klassischen Vollendung und Rundheit gediehenen jonischen
Poesie bedeutet die Chorlyrik des Mutterlandes und des Westens
einen Rckfall des Geschmacks in die vulgre Freude am Sinn-
reichen, Geblmten, in das Schwelgen im Symbolischen und An-
deutenden, in einei Hang zu Pomp und dumpfem Wesen ^). Ihr
Publikum mu primitiver gewesen sein als das Homers. Der Ge-
schmack dieses Publikums hat ebenso die Erzeugnisse anderer berufs-
^) Friedrich Nietzsche, Philologica 11 S. 171 f., wiederholt in Mensch-
liches, Allzumenschliches, Taschenausgabe der Werke 4, 115 Vom er-
worbenen Charakter der Griechen".
Beiwort.
4]
miger gnechischer Kleindichter, delphische Orakel, Bakis** usf.
geschtzt. Diese Stcke ebenso wie die Art des He^iod, Heraklit,
Parmenides, des Rechtes von Gortyn usw. zeigen, da die Griechen
des Mutterlands und des Westens von Haus aus die lichte Klarheit
Homers nicht haben wollten. Pindars Stil hat, gegen Homer und die
Jonier gehalten, einen mehr asiatischen Typus, wie Stil und bildhafte
Denkform des Herakht. Sie alle, auch Pythagoras, haben etwas
Hieratisches.
Fr die geschichtUche Betrachtung ist die Wandlung hchst
merkwrdig. Die Eigentmlichkeiten des Epos, naive Darstellung,
sinnUcher Reiz, Abwechslung sind vernichtet. Dagegen sind gewisse
neue Forderungen zur Alleinherrschaft gelangt. Der Gegenstand ist
ernst undapsTYj-haft, die Darstellung ist auf ein Gedankliches gegrndet
und strebt nach rhetorischem Glnze. Ein
a7rocrc{iv\!>viv ist eingetreten,
ein verlangsamter Rhythmus des Ganzen.
Es ist die gleiche Wandlung etwa, die die italienische Dichtung im
16. Jahrhundert durchgemacht hat, von der naiven homerischen
ppigkeit der Hochrenaissancedichter Bojardo, Ariost usw. zu der
empfindsam gedmpften Klassik der Francesco Berni und Torquato
Tasso, die dem geistigen Zustand der Gegenreformation gem war.
Am deutlichsten ist da die Umarbeitung des Bojardoschen Orlando
inamorato durch Berni, die Leopold v. Ranke, Werke Bd.
50,
S. 204 ff., Leipzig 1888, schn behandelt hat. Bojardo steht noch der
mittelalterUchen, bunten, hfischen Epik nahe, Berni hlt bewut
Abstand dazu und setzt alles in seine Weise um. Bernis Fall ist ein
besonders gnstiges Beispiel, an einer Umarbeitung kann man einen
Stilunterschied am leichtesten aufweisen. Aber es ist nur ein Anzeichen
fr die allgemeine Vernderung, die mit der Sicherheit eines Natur-
gesetzes in jeder Literatur und Kunst auf einer gewissen Entwicklungs-
hhe eintritt: den bergang vom Naiven zum Sentimentalen, vom
Ursprnghchen zum Whlerischen, vom heroischen, knabenhaft
abenteuerlichen , kriegerischen Hochmittelalter zu einem besinn-
licheren, friedlich, geistiger gestimmten bergang und Verdmmern
des Alten. Wollen wir die neue Behandlungsart im allgemeinen
bezeichnen," schreibt Ranke S. 208, so drfen wir vielleicht sagen,
da die alte Darstellungsweise auf Anschauung, die neue auf Re-
flexion gegrndet war. Jene ergriff das Besondere, Individuelle als
ein ursprnglich Unterschiedenes, diese das Allgemeine, der Gattung
Angehrige, was allerdings allemal ein Abstraktum ist, und fate
42
Die Behandlung des Wortsinns.
die Unterschiede gleichsam als Grade. Daher mag es kommen, da
whrend jene, das Partielle verfolgend, hie und da einem der Ab-
straktion gewohnten Geiste unleidlich wird, diese, in jedefn Fall
immer ein Hchstes zu bezeichnen suchend, auf die Letzt nur allzu
einfrmig ausfllt."
Bezeichnend in dieser Richtung ist, da die reckenhaften Kmpen-
beiwrter
Tzccx^Q* optfjLo;, i(pQi[ioq, ptiSc, dTiapoc; verschwunden
sind. Auch die ttuxvottj^ fehlt, die etwa dem Inbegriff dessen,
was auf norddeutsch 'stramm' bedeutet, auf griechisch entspricht,
ebenso (jisvoc;.
Der durch die Beiwrter erzielte color epicus ist nun bei den
einzelnen Chordichtern verschieden. Bakchylides benutzt gern die
homerische Paarung von Bei- und Hauptwort unverndert. Hermann
B 1) hat gezhlt, da in dem uns erhaltenen Bakchylides-Text, der
etwa ein Viertel des pindarischen an Umfang ausmacht, die Zahl der
unvernderten Homerformeln 30 betrgt gegenber 40 bei Pindar, und
zwar vorwiegend ungewhnlichere, ausgesprochen epische vielsilbige
wie
apucpGoyyov XlovxaS, 9; vaucilv eu7Tpi!)(xvoi? 12, 150. Bakchylides
liebt die lichten schimmernden Wrter und gibt den Gttern, Heroen,
Menschen, Dingen durch Vertauschung ihrer Beiwrter immer neue
starke Farben, leuchtende Tne, wechselnde Belichtung, s. die Zu-
sammenstellung bei B, S. 22 f., z. B. die Eos-Eigenschaften poSoSax-
TuXo(;,
poSoTUTjx'-)? bekommen lo und Endais, das Heroldbeiwort
XiY\j96oyYO(; bekommen die Vgel und die Bienen. Schon Ibykos
fr.
9 sagt yXa'jxcoTutSa KacJoravSpav.
Auch Pindar berbietet das Epos, aber mehr in anderer
Richtung. Er will ernster, wuchtiger, gehobener, erhabener sein als
Homer. Statt euxTtfxevo^ suxtlto(;, s5 vatsTawv bei Gebuden sagt
er OsoSfxaTo^;. P 1, 44, N 7,
'71
steht /aXxoTrapao^ von der Lanze,
Homer hatte es vom Helm gesagt. Etwas hnliches ist P 1, 5
(xiX^oiTXQ xspauvo;; Paian 6, 95 u^^ixofx
'EXsva, das wird sonst
von Bumen gesagt. J 6, 19 xp^^apfxaToi.
AiaxiSai,
sonst nur
von Gttern; P 2, 4 TSTpaopiac; IXsXixovo.;.
Homer sagt es von
Poseidon.
Jebb hat in seiner Bakchylides-Ausgabe,
Cambridge 1905, S . 70
f.,
eine Anzahl von inhaltlich sich entsprechenden
Beiwrtern bei
Bakchylides und Pindar einander
gegenbergestellt.
Die Beiwrter
') De Bacchylide Homeri imitatore. Dissertation Gieen 1913. S. 21.
Beiwort.
43
des Bakchylides sind oft erlesener, gewhlter, malerischer, anschau-
licher, aber auch ungeistig, matt, inhaltlich geziert, gewollt, gesucht,
man merkt die Absicht. Vieles ist bloer Apparat, hohl, wie die
ausgeleierten homerischen Wendungen bei Hesiod. Bakchylides hat
viel Beiwrter aus der Blumenwelt
i),
die bei Homer noch fast
fehlen 2); toaTe9avor, toXsoapot;, iottXoxoc;, poSoSaxTuXoc, po86-
TTTQXu:;, xaXuxoaTecpavo^, Xetpio;; viele fr FrauenSchnheit: t(tepx[JiT!:u5,
Xt7rap6^covo(;, xp\}(soKGiLy\>Q,
x^^P^^X^"^^
tjxspoyutoc;, Tavij(TQUpo<;,
u^j;auxY]v; s. bes. XVI 101108. Dagegen feiert Pii dar die Epheben-
schnheit 6, 76; 9, 65; N 3, 19; 11, 12; I 2, 4; 7, 22; fr. 123 3). Bak-
chyhdes hebt dabei die Schnheit und das Sehnsuchtweckende
einzelner Krperteile hervor, Pindar lt es bei allgemeinerem Lob
bewenden (s. die Zusammenstellung der Beiwrter fr die Musen,
Schultz, S.
41),
das entweder geistige Vorzge nennt wie GzyLvoc;
oder vergeistigte, sinnbildhche Begriffe wie apyupso^. ypudea oder ein
Wort mit tu (s. darber S. 80) oder ziemUch unsinnUche Einzelzge.
Konkrete Begriffe, die ihm etwas gelten, sind Glanz (und Synonyma
dazu wie Gold, dcyXao-), alle Stdte sind Xmoipoc;, xpDGouc,
ist bei ihm
fast so viel wie schn". Bei Homer das Beiwort der Aphrodite,
tritt es bei Bakchylides auch zu Artemis, lo, Elpis
(9, 40). Pindar
nennt
,,
golden" O 13, 7 die TzcxZ^eq sfjLiTot;, N 5, 7 die Nereiden,
J 2, 26 Nike, J 8, 5 die Muse, Paian 6, 2 Pytho, P 3, 73 die Gesundheit,
O 11, 13, N 1, 17 die Olive, P 10, 40 den Lorbeer. Man denkt sofort
an Goethes ,,doch grn des Lebens goldener Baum**. Ein Dichter,
der den Begriff golden so gebraucht, ist nicht rein augenhaft eingestellt.
Dazu kme noch Buntheit TcotxtXo
(der Archaiker liebt wie in
seiner Wortkunst auch im Leben das Vielfltige und Verschlungene),
aber blo begriffhch, theoretisch gesagt. Farbenschilderungen gibt
es im ganzen Pindar blo zwei: 6, 39ff. und Threnosfrg. 129.
Das Meer ist bei Homer ato^, yXauxTj, lozi^riq,, (J-ap(^apy], olvo^^, ttoXitj,
7rop9upe7], bei Pindar nur noch ttoXly] (Schultz S. 17). Pindar hat viele
leicht verblate Wrter mit Honig
Bakchylides hat blo (xeXi-
yXcocTCTo^
. Dagegen hat er eine Anzahl von Abstrakta, die seine Vor-
stellungen frben, das alles Umfassende Tcav die Tragiker lieben das
^) Hermann Schultz, De elocutionis Pindaricae colore epico Disser-
tation Gttingen 1905. S. 19.
-) v. Wilamowi^, DiegriechischeLiteratur(KulturderGegenwart)*S. 18.
") V. Wilamowitj, Das Opfer am Grabe (Aischylos Orestie II) Berlin
1896. S. 30. Schultz a. a. 0. S. 42.
44
Die Behandlung des Wortsinns.
auch; s. Bruhns Sophokles-Anhang S. 152; z. B. TiavSatSaXo; fr das
homerische 7coXuSatSaXo<; Dithyr. fr. 75, 5. Vortrefflichkeit eu
(s.
unten S.80). Das wiederholt er oft. ber seinen Lieblingstegriff berhmt
s. unten S. 66. Wenn Bakchylides die homerischen
Wortbestandteile zu
neuen ausgesuchten Beiwrtern umbiegt und zusammenfgt, so hat
er das Bestreben, immer noch eine Stufe feiner, zierlicher, dekorativer
zu sein als die Rhapsoden und vor allem zu wechseln : xi)avoTuX6xa[xoc
statt
xuavoxatTa, paau/etpoc statt paauxapSio;, SoXi/auxrjv
statt SoXi^oSeipo^, u^|;LSipo<; statt u^ixap7)vo^, tfxepdcpLTru^ statt
XpucafjLTTu^. Pindar ist nicht so sehr auf Abwechslung bedacht wie
Bakchylides. Er hat eire feste Anschauung, einen wertenden Ma-
stab, und was er fr recht und edel erkannt hat, wiederholt er gern
:
Er fhlt nicht so sehr das Leben als die Gre und den Glanz. Typisch
fr Bakchyl des ist etwa TuoXuTtXayxTo^; 11, 34, eine sinnreiche Kon-
tamination aus TToXuTpOToc; und TuXayxT) aus den ersten Versen
der Odyssee (Ed. Schwartz, Hermes 39
[1904] 634). B S. 31 weist
darauf hin, da Bakchylides kaum Beiwrter zwei- oder mehrmals
gebraucht, Pindar eine ganze Anzahl. Wo er genau schildert, schwingt
immer ein menschliches Mitgefhl, eine geistige sittliche Anteilnahme
mit. Die Stelle ber die Niederkunft der Euadne
|6, 39ff., die
B S. 35 als Beleg fr Pindars Fhigkeit anfhrt, quadam cum
elegantia depirgere, zeigt weniger dies, sondern eine Art Gemt,
etwas anheimelnd Deutsches (vgl. fr. 87).
2. Bildlichkeit.
Der wichtigste Bestandteil der dichterischen Sprache ist die
Metapher. Sie ist der stimmungsmig gefrbte Ausdruck einer
Vorstellung und als Grundbestandteil der Dichtersprache zu scheiden
von dem ausfhrlichen Vergleich und nicht etwa als dessen ver-
krzte Form aufzufassen. Das homerische, mit epischer Breite aus-
gesponnene Gleichnis ist selten; 7, 1 ff. (Hochzeitstrunk); 10, 86 ff.
(Ruhm als Nachla); Bakchyl.
5, 16 ff. (Adler); 13, 124 ff. (Boreas);
Aischyl. Agam. 47 (Geierpaar). Es verlangt einen zu klar gezeichreten
Satzbau, zu lange Kurven (s. unten S. 86). Dagegen hat die Chor-
dichtung eine reiche Flle kurzer Metaphern, und besonders bei
Pindar ist fast alles leicht metaphorisch, es herrscht durchgngig
dtxupoXoyia.
Die Sprache ist schon an und fr sich Rhetorik, die Wrter sind
ihrer Natur nach Tropen, auch die Figuren
(axYjfjLaTa)
sind schon
Bildlidikeit.
45
in der Sprache begrndet. Daher ist jede Sprache in Rcksicht
geistiger Beziehungen ein "Wrterbuch erblater Metaphern,'* Jean
Paul, Vorschule der sthetik,
50. Wenn die Dichtung uns daran
erinnert, wie sehr unsere ar gezogenen Begriffe von sinnlichen Er-
lebnissen abgeleitet, abgeblat sind, so ist damit nur eine Eigenschaft
der Sprache berhaupt gesteigert (s. fr das Deutsche Albert Waag,
Die Bedeutungsentwicklung unseres Wortschatzes ^, Lahr 1915;
ein Gegenstck fr das Griechische wre sehr zu wnschen).
Bei Gedichten in fremden und gar in toten Sprachen ergibt sich
hier eine groe Schwierigkeit. Welche Gewhr hat man dafr, da
in einem Ausdruck das ursprngliche Bild noch gefhlt wird, und da
er nicht schon Scheidemnze der Umgangs- oder Eichtersprache
geworden ist? Vielleicht ein am Ort blicher Ausdruck, den wir
sonst nicht kennen? Wie ist das Verhltnis von Begriffs- und Ge-
fhlswert der Wrter zu finden? Wie wrtlich mu oder darf man
bersetzen ? Wann ist im einzelnen Fall die Metapher erblat ? Eine
gengende Antwort liee sich nur geben, wenn alle Fragen der griechi-
schen Semasiologie und Synonymik erledigt wren. Und selbst
dann wre das Wissen zunchst blo Gelehrsamkeit (s. oben S. 14).
Unsere Wrterbcher leiten da oft irre. Findet sich ein W^ort
zweimal in verschiedenem Zusammenhang, so wird als Bedeutung
der allgemeinste Sinn gebucht, der bei beiden Stellen pat. Alle
Abschattungen und Obertne, welche in der Wurzel des Wortes
liegen und geeignet wren, den Ausdruck an diesen Stellen bildhaft,
bertragen, khn, gesteigert, belebt erscheinen zu lassen, werden
als sinnwidrig hinausgeworfen. Man kann, wenn man Pape folgt,
die Chordichter, insbesondere Pindar, so bersetzen, da die meisten
Wrter abgegriffen und verblat erscheinen; Pape verzeichnet oft
fr Pindar eine neue Bedeutungsentwicklung fr ein Wort nach
dem Zusammenhang, in dem es bei Pindar gesagt ist. So wird ein
ganz verstndiges nchternes Stck Literatur zum Vorschein kommen.
Nur lehren leider die offenbaren Flle, wo die Chordichter vor starken
Katachresen nicht zurckschrecken und recht prezis schreiben
(s. unten S. 67
f.),
da das ganz besondere Kunstwollen dieser Dichter
den oyxo^, die BilderfUc im einzelnen anstrebt. Einige Beispiele:
P 3, 38 aXX' ETuel Tet/et eaav ev ^uXivw <i\jyyovoi xotSpav, dazu
Pape s. v.
TELXo^:
*.
. seltener von Holz^,aber t. S^Xivov ist der
Scheiterhaufen*. Nein, es ist nicht der Scheiterhaufen, so wenig wie
^OXtvov S6(xov Bakchyl. 3, 49, sondern der hlzerne Wall ; der Kommen-
46
Die Behandlung des Wortsinns.
tator, nicht der bersetzer, mag sagen, da es der Scheiterhaufen
ist, wenn es ntig sein sollte, das zu erklren (bezeichnend die Text-
nderung Tsuxei
nebst Begrndung durch J. J. Hartmann, Mne-
mosyne 46 (1918) 445 f.
J 2, 5 sl)^v 'A9poStTa(; (jLvacTTSipav aStaxav oTicopav, da heit
OTCcopa die Reifezeit, wie immer, nicht btr. die krftigste blhendste
Jugendzeit", ebenso Aischylos Suppl. 976. Nur gemeint ist die
beginnende Mannbarkeit.
4, 8 Tucpcovoc; lizoc; avfx6sa(7a (der Aitna). Das heit die Falle,
das Stellholz wie immer, und es liegt eine grimmige Wucht darin.
Wenn man deutet die Belastung", so entwirft man aufs Geratewohl
eine Bedeutungsentwicklung von Itco^ blo zu dem Zweck, die Pindar-
stelle zu verwischen und zu prosaisieren.
O
9, 23 tioXlv [lOLktpcdc, iizKp'kiyoiyf aotSai^ nicht btr. durch
Gesnge verherrlichen", sondern mit Gesngen berglnzen.
Das Verbum aaLvco Pyth. 1, 52; 2, 28 scheint mir in der Chor-
poesie nicht so abgegriffen, wie man annimmt. Aisch. Choeph. 193
aaivofxaL S* utc' eXtiiSoc; bekommt nur dann Farbe, wenn caivo ein
starker Ausdruck ist, der nach dem Tierhaften hin einen Akzent hat.
Man wird sich gewhnen mssen, weniger leicht zu sagen das heit
in der Poesie das und das", sondern das und das ist gemeint, es heit
aber wie immer da* und das". Das Feinste wird uns oft nicht fabar
sein. Jedes Wort hat seinen Geruch, es gibt eine Harmonie und
Disharmonie der Gerche und also der Worte (Nietzsche, Werke,
Kl. Ausg. 4, 261).
Belebung.
pindar spricht vom Busen der Erde, einer Stadt, vom Rcken
des Meeres, der Erde, ihrer Brust. Die Stadt Kyrene liegt auf einem
weiglnzenden Brusthgel P 4, 8. Es ist die Rede von Hlsen
Arkadiens 3, 27; 9, 59, von der Braue O 13, 107 und dem Knchel
der Berge, vom ^^oviov "AiSa crTOfxa P 4, 44, vom Haar der Erde
N 1, 68 (auch TibuU II, 1, 47, Hr. carm. I 21,
5),
P 1, 20 der tna,
das ganze Jahr scharfen Schnees Amme. N 5, 24 die siebenzngige
Phorminx. Die Erde wird aufgestrt von den Pflgern 2, 69,
Soph. Antig. 338, Ovid met. I 101, II 287. Goethe, Pandora: Erde,
sie steht so fest, wie sie sich qulen lt; Prop. 1 14, 6 urgetur quantis
Caucasus arboribus. N 9, 20 (in einem Orakelspruch) den Weg
schonen" fr den Weg nicht gehen, dann 23 sie stemmten an der
sen
Heimkehr und msteten nur mit den Leibern weiblumigen
Belebung.
Naturgefhl.
47
Rauch. Oft findet sich die dichterische Annahme, wonach krnzen
zugleich fesseln eines zu Bindenden ist (religionsgeschichtlich durch-
aus zutreffend) 1); P 2, 6 aveSyjasv 'OpTuytav aTzcpoLVoiq; Bakchyl.
9, 16, nachgeahmt von den Lateinern mit tempora vinxisse Corona
Hr. carm. I 7, 23. Tibull 115 oder impedire myrto Hr. carm. I 4, 9.
Die lodernden Flammen beim tepo^ ydyioc; des Zeus und der Aigina
(vgl. Ovid. met. 9, 113) nennt Pindar Paian 6, 138 Haare der Luft.
Das sind starke Belebungen des Unbelebten. Aber sie sind nicht
g^f^{
das, was man stimmunggebend nennt. Zwischen dem Ich des Dichters
und der Landschaft ist noch keine intime Bespiegelung, noch kein
geheimes Band. Darin besteht fr uns heute
besonders seit Ent-
stehung des romantischen Naturgefhls ^) der lyrische Stil schlechthin.
Nun wre es ganz verkehrt, zu bestreiten, da antike Griechen Natur-
gefhl gehabt haben. Sie haben sichtlich einen bedeutenden instink-
tiven Takt und knstlerisches Gefhl bei der Wahl der Tempel-
pltze innerhalb der Landschaft bewiesen, ihre Euphorie war von
der umgebenden Natur abhngig, wie u. a. Verse Pindars ber euSta
P 5, 10; J 7, 37 suafxepia; J 1, 40 zeigen, und sie empfinden stark
das numen in den Naturdingen. Diese sind in der Dichtung von einem
groen verweilenden Auge geschaut, geschildert, vergttlicht, ore
rotundo gesagt, aber nicht als erweitertes, spiegelndes Ich umfat.
Wir mchten natrlich wissen, ob in der Landschaft ein Echo und
Spiegel des Ich, der inneren Unendlichkeit oder ein Symbol des All,
der ueren Unendlichkeit, empfunden wird. Im Naturgefhl meldet
sich das All, ein Fenster am Selbstsein ffnet sich, das Ich wird mit
sanfter Gewalt in den Rhythmus des *Ev xat Tuav gesogen. Dergleichen
ist in der lteren griechischen Dichtung jedenfalls nicht ausgesprochen.
Aber dessen bedarf es auch nicht. Zunchst gehrten ausfhrliche
Ergsse des
(1096?
ber Empfindungen seines persnlichsten Ich
gegenber der Natur sicher nicht zur Gattung. Trotzdem : in dem
Der erste grundlegende Abschnitt in Kchling, De coronarum vi RVV
14, 2 (Gieen 1914) S. 4 ff. handelt de vi vinciendi.
'^)
Alexander v. Humboldt, Kosmos II. Rohde, Der griechische
Roman. 1 876. S. 504 ff. F r i e d 1 n d e r , Rmische Sittengeschichte
^
Leipzig 1 901
.
15. 41 7 ff. H. Mot;, ber die Empfindung der Naturschnheit bei den Alten
(Leipzig
1865), eine immer noch lesenswerte Schrift. Karl Woermann,
ber den landschaftlichen Natursinn der Griechen und Rmer, Mnclien 1871.
A. Biese, Die Entwicklung des Naturgefhls bei den Griechen und Rmern (Kiel
18821884), im Mittelalter und in der Neuzeit (Leipzig 1888). GanzenmUer,
Das Naturgefhl im Mittelalter (Goe^' Beitrge zur Kulturgeschichte 18). 1914.
48
Die Behandlung des Wortsinns.
wundervollen Alkmanstck sSouaiv
8*
opewv xopu9aL fehlt zu Goethe
nur das 'Warte nur, balde ruhest du auch'. Man braucht sich ah er blo
einen Augerblick an chinesische Lyrik zu erinnern, um das Goethesche
sich abhebende Ichsagen nicht im mindesten zu vermissen.
i)
Das antike Empfinden scheint ja meist an den Figuren hngen zu
bleiben. Das antike Auge ist mehr tastend als schweifend. Das Natur-
gefhl liebt Merkwrdiges, Abenteuerliches, Absonderliches, Haine,
Grotten, Quellen, besondere, auffallende Bume, Schlnde, dann
anmutige Gestade, die axTai, da gibt es Khlung, Aussicht, Wasser.
In unserm Sinn beseelte Landschaftsmalerei hat es ja auch in der
Neuzeit weder auf dem Balkan noch in Italien gegeben. Die Emp-
findurg gegenber der Natur ist ur gebrechen. Sie ist den Griechen
nicht das verlorene, sondern das gegenwrtige Paradies ^).
Als ein bezeichnendes Beispiel antiken Naturempfindens kann
6 3 ff. gelten, wo die Umgebung von Kalypsos Grotte geschildert
wird: schne 6S(jly), t)
8*
aoiSidcoucr' ottI xaXyj u9atvV (R. A. Schroeder
bersetzt: 'Aber von innen erscholl ein Lied aus lieblicher Kehle'
und setzt damit ein deutsch-stimmurgshaltiges Klang-Etwas an die
Stelle des schnen Stimmkrpers, von dem der Rhapsode spricht;
der sagt, Kalypso sarg, so wie etwa ein Italiener singt, weil er eben
eine schne Stimme hat) schne Bume und Frchte, gut beobachtete
Vgel, Quellen, Blumen und schlielich:
svx X* iTistTa xal aavaTo*; Tiep ItsXwv
TjTQcratTO tSwv xal TspcpeiY) cppsalv ^ctlv.
So staunt Odysseus auf Delos den besonders schnen Palmbaum
an ^163 ff., ebenso Herakles die Bume bei den Hyperboreern Ol. 10
und Sokrates im Phaidros 229 b die Platane am Ilissos.
Zwei biblische Stellen, die fr, de Geschichte des Naturemp-
findens wichtig sind, entnehme ich Adolf von GrcLiian, Hlderlins
Hyperion, Karlsruhe 1919, 10. Die eine beschliet den zweifellos ^)
^) In einem Chorlied fr eine Trawuyi? erwartet man dergleichen kaum.
(Freundl. Hinweis v. d. Mhlls). 2) Mo^ S. 29.
') Wie es in dem je^igen Zusammenhang der Jakobsgeschichte steht,
unmittelbar vor dem Zusammentreffen mit dem einst beleidigten Esau. Nur
was die Urherkunft des Motivs betrifft, steht es mit alten Koboldmrchen'-
auf einer Linie, wie Hermann Gunkel, Das Mrchen im Alten Testament,
(Tbingen 1917) S. 66 ff. zeigt. Aber die massive Vorstellung von einem
btTfallenden Nachtalb liegt fr den Erzhler der dramatisch steigernden,
knstlerisch aufgetauten Jakobsgeschichte viel zu weit zurck und ist zu
niedriger Aberglaube fr ihn, als da man mit Gunkel am Text ndern
Naturgefhl.
4Q
symbolisch gemeinten siegreichen nchtlichen Ringkampf Jakobs
mit dem Engel 1. Mos. 32, 32. Und als er an Pniel vorber war, ging
die Sonne auf". Die andere Ev. Joh. 13, 30 am Schlu der Erzhlung,
wie der Apostel Judas von Jesus durch einen Bissen als Verrter
bezeichnet wird . . . und es war Nacht**. Bei den drei andern, naiveren
Evangelisten fehlt der Zusatz. Grolman nennt das Bildgebung und
umgrenzt folgendermaen : 'B. ist ein bildhaft verstofflichender Aus-
druck, zu dem sich eine ursprnglich rein seelische, gedankliche
Mglichkeit des Dichters weiterentwickelt*. Dergleichen gibt es auch
bei Pindar, und zwar ^.ann man da seinen ganz persnlichen Ton hren.
1, 71 hatte Pindar geschildert, wie Pelops seinen frheren
laTTVTjXa^
Poseidon um Beistand gegen Oinomaos anficht
syY^;
eX)v TzoMoLc, aXb^ oloq sv pQva aruev apiixTJTrov Exptatvav.
Dieses nchtige Bild des schnen erblhten Jnglings, der mit ein-
samer Stimme den Gott ruft, am Meer im Dunkel, nimmt Pindar
wieder auf O 6, 57 ff. als Episode in der Jamosgeschichte:
TSpTcva; sTcsl xp^<JO<J^-9'5^'^<^^o Xisv
xapTTov "Ha^ 'AX(p2q) (xs^acp xaTax?, exaXsdore
IlocrstSav' supuiav . . vuxt^*; UTiatOpLoc;,
wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil ihn diese vor Jahren ge-
dichtete Szene innerlich bewegte. Auch hier klingt, wie beim Herakles
vor den lbumen, eine homerische Situation an, A 348: Achilleus,
dem man die Briseis genommen hat, Saxpucac; erapwv cpap S^^eto
v6a(pi XiacjOeC^ tv'
9*
aXbc, ttoXi^s;, opoov in aTustpova 7c6vtov, vgl.
A 34, s 158,
^
59. Der Englnder Leaf schreibt zu der Stelle: Ameis
thinks, that the infinite" sea intensifies the feeling of despair and
desolation a German ratherthan agreekidea. Gewi soll man nicht
den herbstlichen Zauber, den die Ferne, die Unendlichkeit in der
modern abendlndischen faustischen Lyrik hat** ^), ohne weiteres
hineindeuten, aber in dem trumenden Bck auf das sdliche Meer
lag auch schon fr den antiken Menschen etwas Seelisches, wie
Theokr. 8, 55 zeigt:
aXX' OTTO Ta JceTpx t5l8' aofxai ayxa;;
Ix^^
'^^
oiivvojxs xaX', <Topo>v Tav StxsXav iq aXa,
drfte, um folkloristische Primitivitt herzustellen. So verfahren heit ebenso
willkrlich in Tiefen bohren, wie wenn jemand plfelich auf das Etymon eines
beliebigen Textwortes den Finger legen wollte.
^) Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes P. Wien und
Leipzig 1919 passim.
Dornseiff, Pindars Stil. 4
50
Die Behandlung des Wortsinns.
Mag nun die Iliasstelle Pindar vorgeschwebt haben oder nicht, ganz
ihm eigen ist die eindrucksvolle Betonung der Nacht. Ein gemt-
haftes Naturerleben fhrt hier zu einer stimmungsschwangeren
Bild-
gebung am Satzschlu genau wie im JohannesevangeUum.
Nur ist
die Nacht, die sich hinter Judas auftut, dster, falsch, grauenvoll,
die von Jamos erotisch-pathetisch.
Ferner stehen 10, 72 ein paar wunderschne Schluverse ber
die erste von Herakles geleitete Olympienfeier. Ein Kmpfer hat
ber Erwarten weit mit dem Stein geworfen, alle fahren in die Hhe
und rufen. Dann glnzt der Mond in den Abend, und die jungen
Griechen schmausen und singen:
xal Gru(jL(JLaxta Oopuov
7rapat0u$ jJLsyav sv
8'
scjTrepov
irpXz^zv e\)(i>7ziS<jC, asXava; epaT^v (poLO^ aet^sxo Ss ttocv
TSfJisvo; TSpTTvatcjL OaXiair tov eyxco{Xtov ^.[Kpi TpOTCov.
Das Lied gilt einem schnen Knaben, dem Pindar erotisch huldigt.
Es war die erste Olympienfeier, die Pindar sah und wo er den Knaben
kennen lernte. An diese erinnert er sich in diesem verspteten Chor-
lied. Es ist wohl das erstemal, da die hellenische Jugend von einem
Ergriffenen gesehen wird. Lysis 206 e stehen vergleichbare Zeilen
(man nehme Rudolf Borchardt, Das Gesprch ber die Formen,
Leipzig 1905, S. 30 ff.
dazu).i)
Eine modernere Art von Metapher, die weniger eine Anschauung
erwecken will, sondern mehr an das Gefhl sich wendet, die ihre
Wirkung nur aus den Begleitgefhlen der Worte schpft, liegt vor,
wenn es im 1. Gesang der II as heit Apollo nahte vuxtI sotxco<;.
Damit soll nur Gefhl geweckt werden, Grauen vor der unheml chen
Gttergestalt, keine Vorstellurg. Aber die Stelle steht sehr einsam
in der antiken Dichtung. Diese vage schweifende Beseelung oder
Vergeistigung ist im allgemeinen nicht antik. Dinge und Landschaft,
von ihrem mehr oder weniger starken numen erfllt, sitzen im griechi-
schen Altertum noch fest an ihrem Platze und stehen nicht zu
Stimmungssymbolik, Seelenwiderhall, zu schweifender, webender Ich-
spiegelung zu Gebote.
Personi-
Ebcuso sichtbar sitzen die Din^e fest an ihrem Platz, wenn es
likation.
^^
i^. i j li.
sich um die Versinnlichung geistiger begriffhcher Dmge handelt.
') Verwandte Bildgebungen behandelt Leo Spider, Die neueren Sprachen 28
(1920)
Iff.: ,Die inszenierende Adverbialbestimmung im Franzsischen*.
Personifikation.
51
Trotzdem sind Verknpfungen wie die von Gundolf, Goethe S. 103,
angefhrten Shakespeares : der kalte Tod , blinder Tod , der kahle
Glckner der Zeit, gelber Neid, schwarzes Wort, hohler Meineid in
der lteren griechischen Lyrik durchaus den/<bar als Personifi-
kationen.
12, 16 GTOLGic, dvTiavsLpa; frg. 109 7rev(a^ S6Ttpav, sypav xou-
pOTp6'fOV.
N 1, 16 ToXsfXQU X(x.>y.iyTecQ; J 5, 27
xaXxoxapfxav ttoXsjxov.
P 8, 26 eoal- lid.^oiiq.
P 8, 37 vixy 6paauyuio<;; vgl. N 5, 42; J 2, 26 ist Nike ganz Gttin.
J 3, 40 x
Xsx^^^
avayet cpafjiav TiaXatav euxXscov l'pywv sv
7TV0) vap 7C(7V' XX* avytpo(Xva das knnte im Shakespeare
stehen.
O 1, 33 atxEpai
8*
etciXoittoi jxapTUp(; cjo<pcoTaToi.
Dazu die vielen Verleiblichun gen seiner Hauptidole
X'^9^^*
oXo?,
dtotSa usw. s. Goram, Philologus 14
(1859) 252 ff.
Das mischt sich in der Chorpoesie mit einem Hang zum Genea-
logischen
Pindar dichtet fr einen Adel und ist aus dem Lande
Hesiods, der die genealogischen Anfnge der Theologie gibt
manch-
mal ist es auch bereits nach der Allegorie hin verblat. Eben dieses
Schillernde macht einen Reiz vieler griechischer Dichtungen aus. Bei
Pindar ist das nun besonders stark: Des Hermes Tochter Botschaft
O 8, 81, die Musen Tchter der Erinnerung J 6, 75 (vorschriftliches
Zeitalter!), die Regenwasser sind die Kinder der Wolke O 10, 3, der
Wein Sohn der Rebe N 9, 52, der Tag Sohn der Sonne O 2, 33, der
Nacht Aischyl. Agam. 279, die Lieder Tchter der Musen N 4, 3,
Hybris Mutter des berdrusses 13, 10, Ausrede Tochter des Epime-
theus P
5, 26, Alala Tochter des Krieges frg. 78. Der Ausdruck
opcpavi^ELv P
4, 283 (statt voacpt^Etv Aischyl. Choeph.
620)
gehrt
zu diesen genealogischen Tnungen. Wir kommen mit diesen Pr-
gungen in einen sehr frhen altertmlichen Sprachbereich, den
namentlich der Orient bewahrt hat. Die morgenlndischen Sprachen
zeichnen sich insonderheit dadurch aus, da sie alle Wirkungen
und Erfolge, sogar Werkzeuge der ttigen Kraft, endlich auffallende
Darstellungen und hnlichkeiten am liebsten mit dein W^irt Sohn
und Tochter bezeichnen. Die Khnheit der Morgcnln({er geht hierin
weit." Herder, Metakritik 3. Abschnitt, Goldziher, Zeitschr. f.
Vlkerps. 18
(1888) 69 ff.
52
Die Behandlung des Wortsinns.
Wenn Heraklit (53Diels), dessen asiatische Wesensfarbe oben S. 15
betnt wurde, sagt n6Xs(xoc ttocvtcov [xev TraTYjp scttl, Travttov ^k
aCTLXsCx; xal tou? (jlv sou^ sSsl^s (^xs wrde die Chorlyrik sagen)
To^c, Se avpcoTcouc, toijc; [xev SouXouc; iTTO^Tjae toij^ ^k iXsuOepouc;,
so ist das stilistisch genau dasselbe wie Pindar frg. 169:
Nofxot; 6 TuavTWv adiXeO^; vaTcov ts xal dOavdcTcov
yet Stxattov t6 iaioTaTOV
UTTEpTOCTa
X^^P^-
Dieses genealogische Verknpfen hat auch Bakis Herodot 8, 77
TixTst (JLsv Kopoc; "Ypiv, orav TioXtj^ 6Xo<; sTurjTat, es ist vterlich
beiehrsam wie etwa in unserm Sprichtwort die Genealogie Vorsicht
ist die Mutter der Weisheit'*.
Fr den Herausgeber altgriechischer Dichtungen entsteht daher
oft die Gewissensfrage, ob er das betreffende Wort gro oder klein
schreiben soll. Pindar eigentmlich ist nun ein besonders hufiges
Hin und Her zwischen Begriff (etwa einer Stadt, ihrer Einwohner-
schaft) und gttlicher Person, von Wort zu Wort wechselnd. Als
Beispiel sei herausgegriffen frg. 195 EuapfxaTs (die Stadt)
xp^^oxtTcov
(die Heroine) IpcoTarov ayaXfjLa (die Stadt) 0Y]a. Von besonders
auffallenden Stellen seien noch genannt die Anfnge von 8, P
4,
P 12, N 1, N 11. Dithyr. frg. 78 xXuO' 'AXaXa, UoUiiou GuyaTsp
(die Person), ey^ecov 7rpoot[xtov (die Sache), & OusTai usw. (die Person).
O 8, 22
QeiLiQ acTxsLTat kann heien, es wird Recht gepflegt und Themis
wird verehrt. Es ist oft eine absichtliche Undeutlichkeit zu merken
darber, ob der betreffende Begriff (eine Stadt, eine Institution, eine
Tugend) oder die gttliche Person gemeint ist. Der Ausdruck schillert.
Die Musen sind Schenkerinnen der Dichtkunst bei Homer; aber
Pindar sagt: die Muse bringen N 3, 28; ebenso werden die Chariten,
von denen Stesichoros sagt ToiaSs
X9^
XapCrcov SafAcofxaTa xaXXi-
xojjLcov u[jLVtv bci Pindar einfach zum Gedicht J 1, 6 ajxcpoTspav
Tot x'^tpLTCOv cnl)v Qzolc, ^z{)^(xi TsXo<;; Hymn fr 29f a Ss Toiq
iP^^^y-'^^'
xoiq (die Gttinnen) ayXaoxapTiou^ (die Jahreszeiten) tixtsv dcXala;
(die Gttinnen) "Hpa^ (beides); N 2, 10 scttl S* eolx^; opsiav ye
(die Mdchen oder die Tauben) IlsXsiaSaiv (Mdchen und Sternbild),
jjLY) TTjXosv 'Oaptcova vslcjat. Dergleichen schillert doch in ganz
anderm Ma als die homerische Schilderung des Streites zwisc':en
Achilleus und dem Flugott Skamandros O 212ff. Allerdings steht
zweimal fr den Flugott, der den Achill angerufen hat, avspi
Personifikation.
53
stoafjLsvo^, TTOTajxoc; auSLvvjc;, aber das ist ein formelhafter
Hexameterschlu, und im Lauf der Schilderung ist man nicht im
Zweifel, wo klein und wo gro zu schreiben ist, der Flu ist
Domne und Kampfmittel des Gottes Skamandros. Dagegen
liegt jene Verwischung schon genau vor 1 'Hax; \ihv xpoxoTusTiXo;
IxtSvoTTo Traaav in cdonv, und es wird deutlich, da diese die Personi-
fikation verdunkelnde, krzende, schillernde Ausdrucksweise dem
Bestreben der Rhapsoden entspringt, dem blichen verbrauchten
Vers von der rosenfingrigen Morgenrte auszuweichen.
Personifikation oder Prosopopoiia^) ist ein unzureichender Aus-
druck, denn man merkt oft, wie neu und gefllt, ja wie tief gesehen
und echt empfunden diese gttlichen Potenzen sind, die Pindar als
persnhche Wesen einfhrt, die Echo 14, der Hall" des Liedes,
die Hora N 8, 1,
die Theia J 5, L Ein sehr lebendiges, kindhaft religises
Verhltnis zu Dingen und Begriffen fhlt darin noch irgendeine
gttliche Kraft, ein eZov. Diese vorwissenschaftlichen Griechen
leben in einem geistig poetischen Medium, in dem Gott, Heros, Begriff,
Mensch, Natur noch nicht sauber voneinander geschieden sind.
Freilich, die Mythologie beginnt in die Erstarrung eines gereiften
Systemes einzugehen, und es wird anderseits geglaubt, da die Gottheit
sittlich gut ist, aber noch laufen viele Fden des Zusammenhangs
zwischen Gott und Natur hinber und herber, und eine Erlebnis-
identitt von Ding und numen ist zu merken. Die VersinnUchungen,
Belebungen von Begriffen haben oft dieses urantike Durchfhlen der
gttlichen Kraft in den Dingen, die Grenze zwischen Gro- und Klein-
schreiben in den Texten ist zum Verzweifeln flssig. Man mu ihre
Festsetzung ein fr allemal aufgeben. Oft ist es natrlich verblat
und Literatur geworden, und man ist versucht, die Wrter gro
zu schreiben und mit Gnsefchen zu vei sehen, z. B. in 13, 6,
einem leicht virtuosen Stck ohne persnhche Wrme und Anteil-
nahme des Dichters, grenzt es an trockene Allegorie, wie Euno-
mia, Dike, Eirene, Hybris und Koros in genealogische Szene gesetzt
werden. Das ist fast Heraldik und Emblen:atik des 17. Jahrhunderts*).
') Jakob Burckhardt, Vortrge. Basel 1918. S. 387ff. ber dieselben
Erscheinungen in der griechischen bildenden Kunst Karl Robert, Archo-
logische Hermeneutik. Berlin 1919. S. 4680. W. Wackernagel, Kl.
Schriften III, Leipzig 1874, 100 ff.
')
Der Weg bis dahin geht ber Figuren wie die Fama bei Vergil, Aen. IV
173 ff., Prudentius Psychomachia, ber die mittelalterlichen Gestalt(n der
Frau Welt, Frau Saelde, Frau Zuht, Frau Ere, Frau Minne, die Emblomata
54
Die Behandlung des Wortsinns.
berhaupt die genealogische Verknpfung derartiger gttlicher
Wesen ist nicht mehr ganz unverbraucht. Am Anfang von N 8 ist
die Zeit, die rechte, schne, blhende Zeit des Liebens gewi stark
als auermenschliche Macht gefhlt. Aber etwas daran ist auch blo
Sprachangelegenheit, Begriffsbildung und liegt auf dem Weg zu
sptantiken Schilderungen wie Achill Tat IV, 12, 1. Das erbt sich
fort bis auf uns: *In den feurigen, von flatterndem Kraushaar be-
schatteten Augen wohnte Wahrheit und auf dem weichen Munde
neben einem kindlichen Zuge der Trotz der Liebe und eine gefhrliche
Entschlossenheit'
(K. F. Meyer, Angela Borgia).
Am bildlichen Ausdruck ist der Winkel sichtbar, unter, dem der
betreffende Dichter Menschen und Dinge sieht. Was ihn strker zum
Beleben anregt, ist irgendwie pathosbetont bei seiner Eingestelltheit.
Da ist eine Art Erkenntnistheorie der Dichterseele mglich, ein Me-
verfahren seines Empfindens, eine Charakterkunde.
Daran, wo und welche bertragungen ein Dichter verwendet, ob
und wie er Einzelnes durch Allgemeines sagt (s. oben S.
19),
das Ganze durch einen Teil benennt, der ihm geeignet scheint, ein
Mitverstehen des Ganzen zu bewirken, weil er bezeichnend oder
symbolisch dafr ist (Herd, Dach fr Haus, Kopf, (jwfxa
fr Person,
die Wirkung durch die Ursache, die Sache durch den Stoff, Dinge,
Personen durch ihren Ort benennt (Paris war in Aufregung statt
die Pariser, siehe zu diesem Punkt die Personifikationen der Stdte
oben S.
52),
diese vielen Bedeutungsbertragungen und -Verschie-
bungen, das sind alles Zge, in denen sich das Sein des Dichters
auswirkt. Er schafft, sagt, beleuchtet die Dinge, wie sie nach ihm
scheinen sollen. Bei dem Dichter als Seh-Medium ist nun immer
noch zu fragen, sieht er das so als neuschpferischer Einzelner oder
als einer, der in der Rolle der Aufgabe befangen ist oder als Mensch
seines Jahrhunderts oder Angehriger seines Volkes, oder Exemplar
seiner Rasse? Eine Entscheidung darber ist oft nur intuitiv zu
geben, eine vollstndige Aufteilung auch wohl kaum anzustreben.
Es kann sich ferner ebensowenig darum handeln,
Entlehnungen
in der Renaissancepoesie, Personifikationen wie Shakespeares Hope u. dgl.
Darber Jakob Grimm, Deutsche Mythologie 11 S. 731 ff., III S. 259 ff., 268
f.;
Kl. Sehr. II S. 314 ff. Uhland, Volkslieder (Abhandlung III) S. 30. Cotta.
ber die Emtlemata, die auf HorapoUon u. dgl. zurckgehen, Giehlow,
Jahrbcher des Allerhchsten Kaiserhauses 1915.
Der Bilderbereich.
55
festzustellen. Ein Prfen des literarischen Eigentumsrechtes ist
erstens auerordentlich schwierig
wie will man den Diebstahl nach-
weisen?
zweitens recht untergeordnet und fhrt nur zu gering-
fgigen Feststellungen. Eine durch Zusammenarbeit vieler in vielen
Jahren Textabsuchens herzustellende Topik wrde kaum einen Ur-
sprnglichkeitsmesser der betreffenden Dichter abgeben, sondern
eine ebenso willkrliche Anhufung von Gelehrtenflei wie eine Stati-
stik der Akkordverbindungen von Komponisten. Ein Vlkerpsychologe
knnte vielleicht einmal danach greifen. Das ist eine Sackgasse, die
von der Peripherie des Werkes ausgeht und sich von da weiter weg
bewegt in den toten Rohstoff hinein. Auch damit wird kein Wert-
mastab geschaffen, da man sagt: dieses Bild kommt schon frher
vor, vgl. vgl. vgl., aber wie individuell hat der Dichter es hier gewendet
und umgebildet. Es verhlt sich vielmehr so: der Mensch ist bei
der Entstehung von Dichtung in der Osta (xavta, in dem schpferischen
Schwangergehen immer auf dem Weg zu Bildlichem, Sinnbildlichem.
Er gleitet nun oft in etwas bereits Geprgtes zur Seite, weil ihm dies
ganz oder zum Teil gengt. Wenn das bei einem heutigen Dichter
oft c'er Fall ist, so werden wir es mit Recht bemngeln. Einem
Gedichtbuch, das Dinge nochmals vornehmen will, die in Goethes
Werther, in Heines Buch der Lieder, in Baudelaires Fleurs du mal,
bei Rilke etwa bereits erledigt sind, werden wir nicht viel Daseins-
recht zubilligen. Aber der antike Dichter stand, wie oben S. 2
betont, weder vor dieser Aufgabe noch hatte er diesen Ehrgeiz.
Fr den nachgoethischen Leser und Forscher ist die Verlockung
gro, in lyrischen Gedichten blo das Bekenntnis des Dichters, das
Individuelle zu sehen und fr voll anzuerkennen und gegen das brige
hart zu sein. Zumal, wenn er ein Deutscher ist, wird er gern scharf
trennen zwischen dem Eigenen, Persnlichen, Neuartigen des Ver-
fassers und dem, was andere auch haben Jenes ist allein das Dichteri-
sche und hat einen Wert, und weder Mit- noch Nachwelt war grnd"-
lich genug, das aus dem andern herausschlen zu wollen. Das andere
ist das Konventionelle. Und das Konventionelle, das wei man
geniu, ist uerlich und oberflchlich. Diese beiden Wrter sind
mit ihren vernichtenden Nebenbedeutungen wohl in keine andere
Sprache zu bersetzen. Also fehlt auch berall auerhalb Deutsch-
lands der Begriff und die Sache, zumal bei den Griechen. Nicht jede
Frucht besteht aus Schale und Kern. Und als ob nicht die Tradition
immer weiser wre als der mittelmige Einzelne.
56
Die Behandlung des Wortsinns.
Der Bereich von Pindars Bildern, der mit dem der brigen archa-
ischen Poesie ziemlich zusammenfllt, ist bald zu bersehen. Der
Kreis von Lieblingsvorstellungen, der Vorrat an hergebrachten und
erprobten Ausdrucksmitteln in der griechischen Chordichtung lt
sich in seiner Geschlossenheit und mittelalterlichen Einfalt mit dem
der mhd. Lyriker vergleichen: saelde, tugent, suesse, milte, maze,
zuht, ere, staete, von da ist es nicht weit zu oXo^, apsTy), TrXouTOt;.
Das sind sozusagen die Grundbestandteile des Stils wie Sule, Metope,
Giebel oder Spitzbogen, Strebepfeiler, Rundfenster. Die Auswahl
und Betonung der Teile ist bei den einzelnen Tempeln, Domen und
Dichtern verschieden.
Was Pindar liebt, steht gleich in den ersten Zeilen des ersten
Gedichts: Wasser, Gold, leuchtendes Feuer bei Nacht, Sonne. Sein
Lobgedicht ist ein angezndetes Feuer J 4, 43 xetvov ol^oli Tiupc^v
(S(jLvcav, der Wettspielruhm ein strahlendes Licht N 9, 41 SeSopxe
pao?, ebenso N 3, 84. Er hat das Augenhafte des griechischen
Menschen'). Wenn wir sagen das Licht der Welt erblicken" fr
Geborenwerden, so ist das ganz abgeblat, dagegen N 1, 35 IttsI
CTTrXayx'vcov utto (xaxepo; auTtxa aTjTocv ic, atyXav
{xoXev. Pindar
liebt das Helle, den Glanz, Gold, Buntheit, hat gern die Ausdrcke
<pXeYiv, Siai6u<T<jetv.
J 7, 23 (pXeyeTat ^h to7cX6xoi(n Moicolk;.
O 9, 21 lyoi 8e Tot ptXav ttoXiv ^aXspai^ TUL9XeYC0v dotSatc,
P 5, 45 'AXe^ttdcSa, ae
8*
vjxofjLOi 9XeY0VTt XaptTs?.
Die Stdte heien fast immer InzoLpoc, (s. oben S. 43).
Gold ist
ein Lieblingsbegriff Pindars. Neben seinem Glanz und seiner Un-
zerstrbarkeit hat es damals den grten Seltenheitswert. Die gold-
reiche mykenische Zeit (Schuchhardt, Alteuropa, Leipzig 1919, 242)
liegt lang zurck. Siehe besonders die Anfnge von 1 und J 5.
fters wird der ruhig schauende Blick auf Menschen und Dinge
genannt, die Gtter heien eTrtcrxoTrot 14, 1, axonoi O 6, 59; 1, 55
(auch einmal der menschliche Herrscher MayvTjTCov ctxottov N 5, 27),
gewi nicht die Aufseher, sondern die berirdischen Wesen, die
auf die betreffende Stadt und die Menschen darin schauen und fr
sie sorgen. Oder O 7, 11 (JcXXote
8'
aXXov etuotttsijsi Xapi^ J^coeaXfxto;
aSufjLsXel otfjLa jxsv :^6p[iiyyi, die beiden schnen Stellen J 8,
36
und Proshodion fr. 87, wo von der niedergekommenen Mutter nur
1) Stellen fr Freude der Griechen am Licht gibt Pazschke, ber die
homerische Naturanschauung. Stettin 1849. S. 6 f.
Der Bilderbereich.
57
gesagt wird: sie blickt auf den Sohn. Oder der merkwrdige Aus
druck 6(p6aX(x6(; fr den Herrschenden, das strahlende Auge,~das
alles sieht und von berall gesehen wird 2, 10, P 5, 18 und 56.
Die Gtterbeinamen owTric;, yXauxcoTric. Das kann leicht umschlagen
in das schadende Auge, den bsen Blick, den Neid der Daimonen,
das dcCTxavov, malocchio, iettatura.
Den schnen Hymnus an die Theia J 5, Iff. hat von Wilamowitz
erlutert. Pindar hat *eine Hypersensibilitt des Gesichts, kraft
dessen alle Dinge in seinen Augen in einem wundersamen Licht
brennen, einem verschnernden, verklrenden Licht, wie es die
Blicke Tizians, Turners und Whistlers berauscht', Romagnoli Pin-
daro, Florenz 1910, p.
65.
Das griechisch Augenhafte geht ja so weit, da Licht fr Klang
steht: Bakchyl. Tcarav fr. 4, 17 TcaiStxol
6*
ufxvot 9XeY0VTai; Aischyl.
Pers. 393 (raXTiy^
8*
auTf) Tcavx' exelv* eTrecpXeyev; Sept. 101 XTtjTTOV
SISopxa und wundervoll Eurip. Phoen. 1377 ItccI
8'
d9et6y) Tcupao-
^Q Tup(7Y]viX7J<; GOLkniyyoc; rj-l] (Beispiele aus Bruhns Sophokles-
Anhang S. 155f.), eine Vermischung der verschiedenen Gebiete der
Sinne, die die deutschen Romantiker, voran E. Th. A. Hofmann,
bewut angewandt haben. Bei diesen steht aber meist Hrbares
fr Sichtbares: Die Farben khngen, die Nacht rauscht u. dgl.
Das Lied^), oft gleichbedeutend mit Ruhm, wird Gebude mit
weileuchtender Front P 6, 7 eToifxo; ufxvcov Tjcraup^c; ev tcoXu-
Xpuao) 'ATToXXwvia rzTtiy^iGTOLi vdcTra folgt bis Vers 14 eine aus-
fhrliche Ausgestaltung des Bildes der Schatzhuserreihe hoch oben
in Delphi, der die Schlagsteine und Sturzwasser des Hochgebirges
nichts anhaben kntien^). Horz' Exegi monumentum aere perennius
ist dasselbe Bild.
P 7, 3 xpYjTTLS* aoiSav Itz-koigi aXeaOat, vgl. lat. condere vom
Gedicht Prop. 11 1, 42.
O 6, 1 xpuaea^ uTzoGTOLGOLVzec, eutsixs^ 7cpoG\Sp6) aXajxou
|
xCova^
OiQ oxe ayjTOV [xsyapov Tra^ofxev.
N 8, 46 CTEU Ss TocTpa XaptaSat^ te Xapov uTcspEtaat XtOov
MoiaaZov.
Das Lied als Inschriftenstein N 4, 80 (xaxpw {i ixi KaXXixXsL
xeXeueic; CTTaXav OsfXEV ITap^ou Xtou XEUxoT^pav.
*) Darber eine Marburger Dissertation G. Kuhlmann, De poetae et
poematis Graecorum appellat onibus. 1906.
*) Interpretation von v. Wilamowitz.
58
Die Behandlung des Wortsinns.
Die Dichter sind P
3, 113 textovsc Itcscov; N
3, 4 TsxTove^ xcoficov;
Soph. Daidalos fr. 162 TexT6vapxo(; Mouora; Aristoph. ra
1004 sagt ber Aischylos 6 TipcoTO^ tcov 'EXXyjvcov Tcupycocra;
piQfjiaTa ae^vdc.
Weitere Bilder und Vergleiche aus der Baukunst verzeichnet
von Wilamowitz zu Eurip. Herakles 1261.
Der Kampfsieger stellt seine Stadt hoch aufrecht hin J 6, 55; 5, 48.
Oft stehen Ausdrcke aus der Gymnastik, speziell aus dem Sport
des betreffenden Siegers, um das dichterische Tun zu bezeichnen.
Ringkampf N 4, 94 oltzol'Koligtoc, Iv Xoycp sXxsiv.
J 2, 35 [xaxpa Stcrxyjcraic; axovTtacjatfjLi, to crou', ocrov mit Ver-
mischung der beiden Bilder der Wurfscheibe und des Speers.
Speerwurf:
N
9, 54 dxovTt^cov gxotzoV y^tcrTa Moicrav.
P
1, 43 eATTOfxat (jly)
x<^^^^^<^P<?o'^
ocxovO* wctelt' aywvoc; aXet'
e^co 7caXa(jLa Sovswv usw.
13, 93; N 7, 70; auch J 4, 3 jjlvco Stwxetv klingt an.
Pfeilschieen
9, 5 und 11; J 1, Iff; 1, 114; 2, 91; I 6, 46;
Ku^mann, S. 28, rechnet auch N 4, 6 hierzu:
pTJfjLoc
S* spyfJLz-
Tcov ypovtcoTpov iOTEUSi, 6 Ti xs yXcocTCTa 9pv6<; lEcXot
Wettlauf O 8, 54; N 8, 19. Weitsprung N 5, 19.
Solche Bilder aus der Gymnastik hat hnlich Aisch. Agam. 1245,
1296; Soph. OT 1197 xa* uTispoXav To^suaac expocTTjas tou tuocvt'
euSaifxovo^ oXou; dazu Nestle, Neue Jbb. 1907, 225ff.
Das Lied erscheint demgem als Rennwagen
der vornehmste
Agon!
und wird aufgezumt N 1, 7 ^s^aL (jlsXo^; besonders sinnreich
ausgefhrt O 6, 21 ff. Der Musenwagen ist ebenfalls ein agonistisches
Bild P 10, 65; J 2, 2; O 9, 81; J 8, 61 (Simonides); frg. 205 Bergk,
Bakchyl.
5, 177. Aristoph. vesp. 1022, dazu v. Wilamowitz zu Eurip.
Her. 779, der darauf hinweist da man bei uns ins alte romantischeLand
reitet. Ganz natrlich, uns fehlen ebenso nach rckwrts die sakralen
Wagenrennen und homerischen Streitwagen, wie den Griechen das
mittelalterliche Rittertum. Die Entrckung des Parmenides im Ein-
gang seines Gedichtes geschieht ebenfalls zu Wagen.
Aus der
dejtschen Sprache sind zu vergleichen die Prgungen ursprnghch,
vortrefflich, den Zweck treffen oder verfehlen, bers Ziel hinaus-
Der Bilderbereich.
59
schieen, den Nagel auf den Kopf, ins Schwarze treffen (Hildebrandt,
Vom deutschen Sprachunterricht
102), und man hat sich von da aus
eine Dichtung vorzustellen, der diese Sprachsphre besonders viel ist.
Das Pflcken, Krnze winden fr dichten", der Honig, die
Blumen, das ist neu gegenber Homer. Die Sitte des Bekrnzens
stammt aus religisen Vorstellungen ber schtzende Umwindung
(s. oben S. 47).
Ein mheloses, leichtes Abpflcken, das tut der
Sieger N 2, 9,
der Glckliche, der ttXoutoc;, Xo;, apsTTj hat, der
bekommt auch den feinsten, duftigen oto^, die fine fleur, die creme,
die Flocke von der Wolle. 1, 13 SpsTuwv (xsv xopucpa^; apsTocv tto
Traaav, ayXat^sTai Ss xal [jLoucrixa; Iv dccoTco. Aber nie wrde Pindar
so von seiner eignen Dichterttigkeit reden. Vom feinsinnigen Zu-
hrer sagt er P
6, 48 SpsTicov aorpioLv Iv [luxoigi ITLeptScov. Pindar
will Krnze flechten in emsiger, treuer, kunstvoller Arbeit, sein Lied
tritt als Lohn des Siegers neben den Kranz : 6, 86 avSpxcnv a^xH-aTalct
7rXXtov7coixtXovu(jLVov;01,
lOSsfjis 8s CTTScpavcocjaixeLvovtTTusic) v6[x6^
AtoXTjt^i {xoXTia
/p7].
*P7)(iaTa TcXsxetv bewundert er an einem alten
Epinikiendichter aus Aigina N 4, 94, in dem Pindar mit Wohlgefallen
ein Kunstideal hinstellt, das in der Richtung seines eignen Wesens
h'egt: ctav
eptSa CTTpscpoi^, pYj^Laxa ttXsxcov, dcTraXataTO^ sv Xoyco
eXxstv
I
(xaXaxa (xsv 9pov6)v ectXol^, Tpa^ut; Se 7raXtY>tOTOic; ecpsSpo^.
Oder er nennt sein Lied N
7, 78 ff. stolz ein Goldelfenbeinstck mit
Korallen, ganz im archaischen Geschmack am fleiigen Zusammen-
stellen, an vielen bunten Einzelheiten, am Zierat. Er ist kein Tnzer,
auch kein ,, Tnzer zwischen Schwertern" oder in Ketten", wie
Nietzsche, Philologica, auch Werke, kl Ausgabe IV 271 einmal schreibt,
auch keine Nachtigall, wie Bakchylides von sich sagt. Er ist eher
der Deutsche unter den Griechen, wie Knig Saul der Deutsche im
Alten Testament ist. Irgendein Inkognito, ein Unausgeglichenes ist in
seinem Wesen. Wenn die Makedonier die antiken Preuen sind
(338
=
1866),
so sind die Botier die Schweizer (Leuktra = Mor-
garten, Sempach, Murten, Nanzig, Mantinea
=
Marignano), voran
Epameinondas mit seiner knorrigen, rechtlichen Tugendhaftigkeit.
Auch Pindar hat diese schwere Physis und den Hang zum Betrach-
samen. Der spte Botier Plutarch wrde dann einen Augenblick
aussehen wie Jeremias Gotthelf
-f-
Jakob Burkhardt (s. S. 44).
Recht allein steht Pindar mit dem Gebrauch der Wrter tt'Svo^;
und [L6yoc, in lobendem verklrtem Sinn. Diese Wrter, sonst
meist, wie jedes Wrterbuch bolcf^t, im Sinn von Dranl^snl, Mhsal,
60
Die Behandluner des Wortsinns.
Not, Leid, Kummer, schmerzhafte Anstrengung in der Richtung der
Ableitungen Tuovvjpo^, (xoxYjpo^.
In vielen Sprachen ist der Begriff
der Arbeit
vgl. eben dies Wort im Mhd.
aus dem der Strapaze
oder passiven krankhaften Darbens hervorgegangen und berhrt
sich darum leicht mit dem der Armut in der gemeinsamen Anschauung
physischen Elends. Es ergibt sich somit jedenfalls, da die Vorstellung
der Arbeit dermaleinst keinen Raum im menschlichen Denkvermgen
fand", Geiger II 206. Pindar ist einer der ersten Arbeitsethiker,
auch Hesiod
itiq apsTYJ^ ISpcoTa 6eol TrpoTcapoiev eyjxav ist ja ein
Boiotier, yoCkzizon Ta xaXa heit das Sprichwort, angefhrt von
Piaton, Hipp. mai. Schlu.
Pindar hat das Dichten sehr ernst genommen, immer wieder
betont er: zwei Dinge mssen zusammenwirken, um ein Kunstwerk
zu erzeugen: die Arbeit und Sorgfalt des Dichters, die {jicXstt) N 6, 54,
O 14, 18 und das Irrationale, das Schpferische, Gttliche, das ge-
heimnisvolle Geschenk der Musen. In Versen wie:
O 11, 8 Ta (Xv apLETspa
|
^^cocrcja Troifxatvstv eeXei,
EX eou S' dvYjp (TO<paI<; dcvet TTpaTriSecraiv 6(xot(o<;.
O 10, 95 Tp90VTL S' euptl xXso^;
|
xopat LeptSec; Atoc;.
lyo) Ss auve9a7iT6[XV0(;
CTTuouSa, xXuTov e6vo(; Aoxptov ajj!,9S7r(70V
ist der erste ungelenke Schritt nach einer Dichterpsychologie ^)
im Altertum zu erblicken. Seine Kunst ist ihm (pua, nichts Gemachtes,
sondiern Schpfung, gewachsen wie ein guter Preiskmpfer oder ein
lbaum (Soph. 0. Kol. 698 (p^TEUpL* dyyjpaTov auTOTiotov), kein Kunst-
produkt.
Die huldigende (puXXooXCa, die am Ende von P 9 geschildert
ist, klingt an P 8, 56 'AXxjxava <TT9dvoi(jL dXXco, d. h. mit Zweigen,
Reisern. Aber auch da wirkt der Ausdruck c7T9avoc; leicht in der
Richtung auf das Kunstmige hin zurckbiegend.
Blhen, im Saft stehen (ocXXeiv), Frucht geben, sind stndige
Liebhngsausdrcke von ihm, J 6, 1 ff. dXXovTo^ dvSpcov ox; 6t
CTUfXTTOdtou. Die Blumen, Rosen, Veilchen usw. verwendet zuerst
Sappho sehr dichterisch, fr. 68 p6Sou(; ex IIiEpta; und in den Hoch-
zeitsgesngen. Sie sind also vom nachhomerischen griechischen
Mittelalter aus in der europischen Lyrik stehend geworden. Die
Vergleiche mit Edelsteinen hat zuerst der Kitharode Timotheos
'')
Wilhelm Brner, Knstlerpsychologie im Altertum, Ztschr. f. sthe-
tik?
(1912) S. 82 ff.
Der Bilderbereich.
61
(Wilamowitz, Timotheos' Perser, S. 49). Da finden sich spter die
Margariten und Perlen hinzu. Die Zikaden und Nachtigallen singen
in dem Apollonpaian des Alkaios fr. 17 dem Gott, Sophokles rhmt
sie in dem Chodied auf seinen Geburtsort Kolonos.
Seine Dichtung bringt etwas zum Essen, rhmt Pindar. O 11, 8
Tot jxv a(XTepa yXcocrcTa Tcoifxabstv sXei mglchst etwas Ses.
Der Gleichklang (jlsXoc; und [izki war sehr einleuchtend. 9, 4
jjLsXtr^apu^; N 9, 17 (xsXiySoutuoc;; J2, 30 (xsXCxofXTro;; fr. 1-25, {xeXiaao-
TsuxTcov x-)Qpicov (ia yXuxspwTspo^ ofjLcpa;
Die vielen Wrter mit
Honig sind neu gegenber Homer. 10, 98 (xeXtTi euavopa tcoXiv
xaTaps^^v. Schultz, De Pindaricae sermonis colore epico 43,
denkt daran, da hier die Vorstellung mitschwingt, da die Stadt
wie ein Opfertier geschmckt wird. N 3, 77 (jls[jlsiy[jlVov y.i\i
Xuxcp (7t!)v yaXaxTi xipva^t^va S' ezpG^ olik^ztzzi, das sieht auch wie ein
kultisches
v7)9aXiov aus.
Ebenso ist, wie Kuhlmann S. 16 zeigt, der Honigseim gemeint mit
der p6(To<;
J 6, 62 Tcarpav XaptTcov apSovTt xaXXlaxcf Spocrw (von den sieg-
reichen Wettkmpfern, wenn sie ihre Vaterstadt berhmt
machen).
P
5, 98 (XEyaXav S* dtpsTav Spcjc) (xaXaxa xa)[JLO)v 'jtco j^EujjLaatv,
da mischt sich das Bild des trufenden Honigs mit dem des
mitreienden Stromes.
P
8, 57 patvco xal ufjivcp, I 6, 21 vaciov paiv(Xv EuXoylat^.
J 4, 72 vtv xotfxdc^ojxai Tp7rvav ETTtGTOc^cov
X'^9^'^-
Der Epinikos wird mit der von Blume zu Blume schweifenden Biene ^)
verglichen P 10, 53 cotoc; u^avcov in aXXoT XXov cot [iIXiggol
6uvi Xoyov, d. h. ein wirklich schnes Siegeslied mu von Thema
zu Thema berspringen. Aber den Dichter oder sich vergleicht er
nicht mit der Biene wie Simonides oder wie Aristophanes aves 749
den Phrynichos ciGmpzl pLsX^TTa Opuvtxo; a|i.ppoatcov {isXicov
TCeoCTXSTO XapTOV.
Sein Lied ist ein Heilmittel, Linderung N 4, 1 ^piGToq Eucppooruva
iaTp6^; N 8, 50 ETraotSat^ dcvyjp vcoSuvov xat tk; xafxaTov 0^xv;
N 3, 17 &KOC, uytYjpov und vor allem das ganze Asklepiosgedicht P 3.
Bei andern Bildern mu man nicht vergessen, da sie auf dem
Walter Robert Tornow, De apium mellisque significatione. Berlin
1893. Ernst Maa, Griechen und Semiten auf dem Isthmus, v. Wilamo-
wi, SBB. 190S, 340.
52
Die Behandlung des Wortsinns.
heien Sdbalkan gesagt sind, wo Wasser die ber alles geschtzte
Vcrbedingung jeglichen Lebens, Schatten kstlichste Erquickung
ist (Aisch. Ag. 966).
Die Sonne wird nicht gepriesen wie etwa von
Echnaton. Sie wird anerkannt als das Wrmends^te auf der Welt 1.
Aber das schimmernde Licht, auch das des Mondes, schaut der grie-
chische Augenmensch mit Freude^). Mit seinen Versen begiet also
Pindar die Sieger und ihren Ruhm wie drstende Pflanzen in der
Drre, als besorgter Grtner und Pflger.
N 8, 40 au^STaL S' dpSTa ^^copat; kipGOLic,
|
oic; otz SevSpsov crcet
V Gocpdlc; avSpcov aepeta* ev StxatoK; ts izpbc, uypov atOepa.
P 8, 57 patvco *AXx(xava ufjLvco; Paian 6, 1 ^Acppo^izoLC, apoupav
ri
XaptTWv dvaTToXL^ofxev; N 1, 13; 9, 26; N 6, 33; N 10 26;
Pratinas fr. 5 xdv [xecrav vstov apoupav aloXi^s tw jxeXei.
Das Lied ist ein ksthcher Trunk J 6, 74 tilgco
092 Aipxa? dyvv
uScop; 7, 7 nach ausfhrlichem homerischen Gleichnis (s. S. 44)
xal lyct) vsxTap /utov, Moiaav Socytv
7TS(jL7ro)v, yXuxuv xapTcov
9pev6(;, tXd(Txo[i.at. Der Anfang von J 6 ist ein weit ausgefhrtes
Gleichnis zwischen drei Siegesgedichten und der Spende beim Beginn
des Symposions. Das Lied erscheint so als Mischkrug SstjTspov xpaT^pa
Motaatcov (leXecov xLpvaptev. Bei Dionys. Chalk. 1 spricht ebenso
der Dichter als Vortrinker (dazu Reitzenstein , Epigramm und
Skolion 31).
Wieder ein anderes Bild nennt den Dichter Quelle, das Gedicht
Flu P 4, 298 oTTOtav, 'ApxeatXa, epe Tuaydv djjipocTicov etcecov.
N 7, 11 ei Ss TU)^73 Tiq epSwv, pLeXi9pov* aiTtav pocdai Moiaav
evsaXs, da kreuzt sich dieses Bild mit dem des Honigs in sehr
verkrzter Weise.
N 7, 61 uSaToc cixs pod^ 91X0V kc, avSp' ^ycov, xXo<; stiqtujxov aivsaco.
J 7, 19 xXuTat^ sTiecov poaLori.
O 10, 9 vuv 4^a90v eXicjcjofJisvav ovra xufjia xaTaxXucicrsi psov
OTra TE xoivov Xoyov 9tXav t[cto(jlV eq
X^9^^'
Kratinos IIutlvt) fr. 7 dva^ "AttoXXov, tcov Ittcov tcov pU(jidTCov
xava^ouCTi Tcvjyai, ScoSxdxpouvov t6 cxTOfxa, 'IXtaao^ V
T^ 9dpuyL . . . dviavTa xauTa xaraxXucjEi 7T0i7)(xac7iv.
Dieses Bild hat Horaz zur Charakterisierung Pindars gewhlt IV
2, 5 monte decurrens velut amnis usw.
Die* beflgeltenWorte' Homers hatW.Wackernagel schn erlutert^).
J^Siehe S. 56f. ') Kl. Schriften III, 178ff.
Der Bilderbereich.
63
Pindar sagt Homer nach N 7, 20, nur durch seine ipsuSscn TuoTava
TE (xa^ava hafte dem Odysseus asfjLVov xt an. Er seinerseits ist stolz,
da ein Agonsieger durch die
*
Flgel des Gesanges' in weit sichtbare
Hhe gehoben wird:
J 1, 64 etY) vtv eucpcovcov TCTSpuyecjcriv aepGevT* a.y'koLcdq IltepiScov.
P 8, 32 ejxa TroTavov afxcpl (xa^ava.
Pratinas fr. 1, 3 epie Set xsXaSsLv olaTS x^xvov dcyovTaTroixtXo-
TTTepov (jLeXo<;.
Sein Dichten ist Schmcken mit einem Gewand, mit kunstvoll
gelegten Falten
O 1, 105 xXuTcdGi SaiSaXco(7e{jLV ujxvcov TiTu^atc;.
J 1, 32 TrepLCTTeXXwv dcotSav.
O 1, 7 sv 6 7roXu9aTO(; [xvo<; djx9taXXTat.
P 9, 87 6c, HpaxXsL gto^iol (jly) TcspiaXXsi
oder ein Weben
N 4, 44 s5u9atv yXuxsZa xal toS* auTixa
96p{xtY^
jJt.Xo<;
fr. 179 u9aLV(o S* *A[xu6aovtSaL<7LV tcoixIXov avSyjjxa.
Bakchyl. 5, 9^ (juv XapLTScjaL aGu^covoL; U9ava(; ufxvov.
J 9, 8 U9atv vuv . . . ti xXlv6v.
Zu den Tieren hat er kein nheres Verhltnis, die Verwendung
von einschlgigen Ausdrcken scheint eher aus der Welt des Sprich-
wortes zu stammen wie P 2, 93 gegen den Stachel lken. Fuchs und
Lwe steht in einer Art Priamel 11, 19; auch der begegnende Wolf
P 2, 84 ist ganz volksmig. Dagegen der Adler in stolzem Flug
ber den krchzenden Raben als Sinnbild des wahren Dichters
O 2, 97; N 3, 80; 5, 21
das ist individuell gesehen.
Wenn sich die Knigin Klytaimestra als Haushund bezeichnet
bei Aischyl., Agam. 608, 895, wenn esheit P 4, 142 [xta ou? KpTjEt
T (xdtTYjp xal paaru(JLY)S!. SaX(i,6vL oder Aischyl. Agam. 244 aTaupwTo^
von der jungfrulichen Iphigenie vor der Opferung, so ist das griechisch
ungalant, aber im Ton schwingt etwas mit von dem erhabenen
Raunen, mit dem die Pythia, die ,, delphische Biene", die fabelartige
Verwendung von Stier, Schlange, Wolf usw. in ihren Sprchen in
dunkle totemistische (T[jlv6ty3(; gehllt hat,wie etwa Aischyl.Agam.1125
in Kassandras Sehersprchen ^izzyz Ta<; o6^ tov xaijpov oder 1258
auTY) S^TTou; Xaiva. Pindar fr. 122 9opaScov xopav dy^Xa deutet
ebendahin, aber dylXa heit auf spartanisch auch die Knabenriege
Plut. Lyk. 16.
64
Die Behandlung des Wortsinns.
Von Gewerben, Handwerkern unterhalb der agonfhigen Gesell-
schaft kommt bei Pindar vor auer dem hufig genannten Seefahrer
der Jger N 6, 14 der pflgende Landmann (s. oben), der Fischer
P 2, 79. Einmal eine Aufzhlung J 1, 47 (xvjXooTa t dpoxa t*
opvtXoxco TS xal 6v tcovtoc, Tpacpsi, die an Sophokles' TuoXXa toc Setva
erinnert. Damit scheint sein Blickfeld an erwerbenden Berufskreisen
durchmessen. Nur der Steuermann unter den Seefahrern ist auch
bei ihm angesehen P4, 274; J 4, 71; P 1,91; Bakchyl. 12, Iff. wie bei
Heraklit fr. 64 toc Se TravTa otaxi^si Kepauvo^ und bei Aisch. Agam.
1618.
Mehrmals bringt er zum Vergleich bei den Wetzstein, auf
dem das Gold geprft und die Schneide geschrft wird J 6, 73; 6, 82;
10, 20; N8, 20; P 10, 67; Bakchyl. Hyporch. fr. 14, dann den Ambo,
auf dem die Zunge P 1, 86 oder das Herz Enkom. fr. 123 ge-
schmiedet wird.
Der Sophist** J 6, 28, der Chordichter, der herumreist als Fahren-
der, oder der seine Gedichte hinschickt, spricht gern als Bote, der
gereist kommt, einen Weg geht. Schon im Wort Tupootfxiov 6 481;
Emped. fr. 35 liegt dasselbe Bild (Diels, Parmenides 47). Auch Homer
hat
olfjLo^ aotS%.
J 4, Iff.; Bakchyl. 5, 31; 9, 48; 19, 1.
J 2, 33 ou yap Trayo^ ouSs TrpocravTTQt; a xsXsuOo; yCvsTai.
N 6, 45 TiXaTsiat Tca^osv "koyioiaiv svtI TTpoaoSoi.
N 6, 57 exovTt S' eyw vcotcj) {xsstucov StSu[jLov
axo;
(5cyyXo<; av.
N 6, 61 xat Ta^Tav jxsv TraXaioTepoL oSv afxa^tTov spov.
P 4,
247 fxaxpdc
(xot vstarat xaT dfJia^iTov wpa yotp auvaTUTSt
xat Tiva oIjjLov tGOL\ii pax^v.
Auch dabei schillert es gern
im Ausdruck zwischen Lied und Ruhm hinber und herber.
Dann wird oft die dichterische Annahme lebhaft ausgestaltet, da
der Dichter an dem Ort wirklich ist, wo der Ruhm gewonnen wurde,
oder da er just von dort gefahren oder gegangen kommt oder auch
ein Schiff von dort herschickt.
7, 13 xal vuv un djxcpoT^poiv g^v A. xaTsav.
P 2, 2 t68 Tav XiTcapav dcTio 0y)av cpipoiv fxeXo? Mp^ofiai.
P 1, 75 apeofxat Trap (jlsv SaXafJLivoc; *A6avatcov
x^P^^^ |
|Jtta66v,
ev STrapTa
8'
epsco Tav Tip Kt0atpo)vo(; (xa/av.
O 9, 41 9poi<; Se np(OToyVta(; cgtei yXwddav.
N 9, 1 xw[xaCTO(jLv Tcap* *A7t6XX(ovo(; SXucov60, MoLcyai, Tav
v0XTt(7Tav iq AiTvav.
Der ilderbereich.
55
Oder der Dichter fhrt zu Schiff, Bakchyl. 16, 2. Die dpsTai,
TOt xaXa, von dem Ruhm, den die Musenkunst gibt, getragen, finden
ihren Pfad ber Land und ber die See: J 6, 22; P 10, 29. ava:
3'
IcjTLa Tstvov heii3t N 5, 50 eine Selbstaufmunterung zum Singen.
Ferner N 5, 2 und P 2, 67. Seeluft weht berhaupt. Die Hoffnungen
der Menschen schwanken auf den Wogen N 6, 57; 12, 5. Wie ein
rechter Steuermann soll Hieron das Segel hoch aufspannen P 1, 91,
wie ein kundiger Seefahrer soll man den bevorstehenden Wind voraus-
wissen N 7, 17. Das Bild vom Staatsschiff (Alkaios fr.
6)
kUngt oft
an P 1, 86 vcajxa S^xatw Tc/jSaXtcp aTparov, P 1 0, 72 ttoXlcov xuepvadtsc,
P 8, 11 Ttslf; ptv v (xvtXco, 6, 100 in strmischer Zeit mu man
zwei Anker auswerfen. N 6, 33 tSia vaucTToXeovre; sTctxcofjLia,
P 2, 62 euavsa S* avaaaofxai. cttoXov a(xcp' apSTa xeXaSscov. Die
Dichtung und der agonale Ruhm fhrt bis ans Ende der Welt. P 10, 29
7UpaiVt TTpOi; sd^aTov ttXoov; O 3, 43 izpoc, eor^^axiav Gvjpcov apSTaiCTiv
txavcov (ScTTTETat otxoOsv 'HpoLxXioc, oTTaXav. Das Gedicht ist der
Fahrtwind der Muse. N 6, 28 euuv* Inl toutov aye, Mottra, opov
sTcecov euxXea, P 4, 3. Agonsieg als Ursache des Ruhms ebenfalls
dem Fahrtwind verglichen Aischylos Pers. 602.
Der Verlauf eines
Gedichtes, sein Gedankengang, ist der Kurs eines Schiffes, den mu
man einhalten:
P 11, 39
^
(xe Tic; avsjxo^ s^w tcXoou IaXsv, ox; 6t* axaTov evaXtav.
N 3, 26 6u(xe, Ttva 7cp6^ aXXoSaTcav axpav s(i,v ttXoov Trapafxetsai.
P 10, 51 xa)7cav cr^^acrov usw.
Bakchyl. 12, Iff. oxrel xuspvYjTac; ao(^6<;.
Wie alle hybrisscheuen Griechen der lteren Zeit ist Pindar stark
von der Schicksalgebundenheit der irdischen Dinge durchdrungen.
Von da stammt eine Vorliebe fr Bilder vom Losen. Mit Wohl-
gefallen erzhlt er die rhodische Sage von der Verlosung der Welt
unter die Gtter O 7, ruft die Chariten von Orchomenos an O 14, 1
KoL(piGio}v uSdcTcov Xa^oLcrai, vgl. P 8, 22 sttscts S* ou Xap^TCov exac;
a
vacToq. Die Gtter erlosen die Gegend, deren Herren und Schtzer
sie sind, N 11, 1 a ts TcpuTavsla XsXoyxa^'EdTta; 9, 15; Bakchyl. 13,
186 Euvofxta, oc aXta^ ts XlXoyxsv. Der Mensch erlost 6Xo? N9, 45;
(ft^aiq *napicovLa J 4, 49; q)pEvwv xapTco; P 2, 74; T^?) N 7, 4;
ioToc
N 7, 54; "AiSavP 5, 96; Wettspielsiege P 10, 20; 8, 88; O 10, 61;
N 10 27; J 8, 69. Bei Bakchylides erlost der Mensch auer dem allem
(4, 20 (jLotpa ectXcov; 1, 166 uyieia; 180 Ttpta; 6, 2 xuSo(;; 3, 11 yspa;;
Dornselff, Pindars Stil.
5
66
Die Behandlung des Wortsinns.
10, 70 yav TuoXtSxpiov; 10, 39 Xapirwv Ttfxat, die Epinikien, die der
gefeierte Wettkmpfer erhlt) auch die Scopa Mouaav 19, 4. Dichter
zu sein, war fr Pindar dagegen anscheinend nicht erlosbar, dazu
ist er doch zu stolz auf seine (jieXeTa N 6, 62; O 14, 18 und seine
xapT^pot (jLspifxva J 8, 13.
Xi^n^^und
Pindar ist nun aber nur fr uns sptgeborene nachchristliche
ver-
Menschen vor allem augenhaft, sinnlich und stellt krperhafte runde
mischung
der Bilder. Bilder hin. Man mu ihn mit andern vergleichen, um zu sehen,
da er fr griechische Verhltnisse gedanklich und geistig eingestellt
ist. Er hat seine garz bestimmten strengen Mastbe, an denen er
die Sinnenweit mit; sein Ziel ist durchaus nicht wahllose Verzierung
und Buntheit, Lebendigkeit und Glanz. Sein LiebHngsbegriff ist
Ruhm, berhmt xXioQ So^a euSo^ta xkeivoq xXutoc; euSo^oi; sucovujjloc;,
den er unwillkrlich berall sagt; Publizitt, Zelebritt in seiner
besseren griechischen Gesellschaft ist unerllich fr Heroen, Sieger,
Stdte, Gedichte, Begebenheiten, sie ist Vorbedingung fr alles,
ihre Erhalturg und ihr Erwerb das hchste Ziel. Das ist die Luft,
in der er atmet. Gewi ist das schon episch, aber es ist fixer, ab-
gezoger er und starrer und intensiver geworden. Der Begriff, die
gedankliche Vorstellung, fr die ein solches mattes, abgegriffenes
Wort wie berhmt nur die Chiffre ist, bedeutet ihm schon etwas.
Das, was ihm allein eigen ist, was ich kaum sonst
i)
kenne,
ist ein stndiges Schweben auf der Kippe zwischen Bild und Begriff,
ein Schillern hinber und herber zwischen bertragenem und
Eigertlichem, ein sprdes Zaudern bei der Wahl zwischen schnem
Schleier und der Sache selbst. Er mengt Bild und Sache miteinander.
Besonders stark ist in dieser Beziehung die fter angezogene Stelle
06, 22ff.
'^Q.
<I)ivTt;, aXXa ?eu$ov usw. Zu Grund liegt die dichterische
Annahme, da der Dichter an dem Ort ist, von dem er singt, wie
an den S. 64 gerannten Stellen. Hier nimmt er nun weiter an, da
das siegreiche Gespann ihn dahinfahren mu. Aber schon ylvo;
bedeutet zugleich Stammsitz und AhnenSchicksal, und die^,Tore der
Hymren*', die den Maultieren geffnet werden sollen, schillern zwischen
eirem wirklichen Hoftor, dem Tor der Hren, der berleitung zu
den alten Jamiden und dem Lobhed.auf den olympischen Erfolg.
Pindar hat diese Neigung der archaischen Poesie zu gesteigerter
metaphorischer Orramertierurg in so starkem Grade, da sich
) Stellenweise bei Sophokles, vgl. Headlam, Class. Review 16 (1902) 442.
Vergeistigung und Vermischung der Bilder.
57
mitunter zwei Bilder so hart kreuzen, da es uns schwer wird, noch
durch das Geschling der Schnrkel klar zu blicken. Aber wir mssen
bedenken, da das geschlossene Publikum dieser geschlossenen, fr
unsere Begriffe jungen vorpapieienen Literatur eine Kenntnis des ge-
schlossenen Bilderkreises besa, die einem Dichter manches ge-
stattete. Er kann einzelne Zge, die in verschiedene Bilder gehren,
eng nebeneinander herstellen, die Hrer brachten dem Dichter eine
willige Einbildungskraft entgegen, so da er oft nur in Stichworten
zu reden braucht. Es ist, wie wenn ein Tonsetzer fr eine Hrerschaft
von geschulten Kennern schreibt, die auch lnger dauernde Disso-
nanzen und Vorhalte ertragen und nicht gleich nach der Auflsung
in den Dreiklang rufen. (S. dazu Wilamowitz zu dem Chorlied Eurip.
Herakles 875ff.) Auch bei Aischylos kommen zuweilen zwei Bilder
sehr rasch hintereinander, etwa Chceph. 202 die Menschen als Schiffer
in Not, ein erster Funke von Hoffnung als Samerkorn. Aber hier
lt Pindar alles hinter sich. . Bei ihm ist Vermischung der Bilder
die Regel.
O 7, 45 die Wolke der Vergelichkeit zieht den geraden Weg der
Dinge (oder Handlungen), weg aus den cppsve^ (Denken, Gedchtnis,
Bewutsein).
6, 81 ich habe eine Sage auf der Zunge, die wie ein schriller
Wetzstein fr mich, der ich ohnedies willig bin, zu mir herankriecht
in schnflieendem Hauch.
7, 68 TeXeuTasv Xoycov xop\)(^0Li ev aXaGeia tzztoIgoli. Paian
6, 127 wir wollen dich (Aigina) nicht ungespeist mit Paianen betten,
sondern du sollst der Gesnge Fluten empfargen und sagen.
N 7, 11 (jLeXt9pov* aiTtav pocxZai MoLaav eveaXs. P 10, 51 Halte
das Ruder, schnell stemme den Anker zum Boden, vom Bug, die
Abwehr der felsigen Klippe. Denn die Blte preisender Hymnen
jagt wie die Biene von einem Stoffe zum andern. Innerhalb zweier
Verse erscheint das Lied als Boot, Blte und Biene.
9, 47 iyeip etteov crcpiv ol^ov Xi.yuv.
N 1, 18 TToXXcov ETTeav xatpov ou i{;eu8ei aXcov.
N 8, 15 AuSta (xiTpa xava^^aSa TceTTOLXtXfxeva.
P 4, 158 (jov vOoc; T^ac; pTt. xufxaCvei.
J 8, 14: SoXioc; yap octwv eTr'avSpacri. xpsfxaTat, eXCacrwv (ou TTOpov.
P 2, 94 Gegen den Stachel lken ist ein schlpfriger Pfad (zwei
bel des Zugtieres vermischt: wer gegen den Stacliel ausschlgt,
sticht sich, und auf schlpfrigem Pfad t^loitot ninn ans).
5*
58
Die Behandlung des Wortsinns.
J 2, 39 Niemals hie an dem gastlichen Tisch strmischer Wind
das Segel reffen, sondern er drang bis zum Phasis in den Sommern,
im Winter segelnd zu des Nils Gestade.
N 1, 24 Er hat erlost, da gegen die Tadler die Edlen Wasser
wider den Rauch tragen.
Bakchyl. 10, 51 Tt (xaxpav yXcoG-aav IdGOLQ eXauvo ext^*; oSou.
Die antiken Rhetoren nennen so etwas xax6?^7]Xov, ^^u^pov
Arist rhet. 3, 3 oder Katachresen, zu deutsch: Blumenkohl, d. h. die
Anwendung ganz verschiedener Bildlichkeiten innerhalb eines und
desselben Gedankens, so da im ersten Wort die Einbildung rechts,
im zweiten links hingezogen wird (Jean Paul
82).
Es droht dabei
die Gefahr der unfreiwilligen Komik wie bei ,,er legte eine warme
Lanze fr den Antrag ein" oder dem Zahn der Zeit, der schon so
viele Trnen getrocknet und auch ber diese Wunde Gras wachsen
lassen wird". Solche Bilderknuel kommen etwa bei Heine vor,
der bei allen seinen bekannten Vorzgen auch viele allegorische
Klischees hat (die Nachtigallen, Seufzer, Trnen usw.) und zugleich
epigrammatische Krze anstrebt:
Sprhn einmal verdchtige Funken
aus den Rosen, sorge nie,
die Welt glaubt nicht an Flammen,
und sie nimmt's fr Poesie.
Schiller: La nicht des Neides Zgel umnebeln deinen Geist; Vergil
Aen. VI
4
8;
dazu Norden.
Auch diese Bildervermischung hat ihre bescheidene Entsprechung
in der Sprache des Lebens, nmlich in der Kontamination infolge des
Strebens nach Krze: iam dudum sumite poenas. Das gehrt mein.
Denk einmal hin. Wer hat das weg?
Da gibt es nun im einzelnen noch Unterschiede: entweder klingt
ein Bild mgUchst kurz an, in einem einzigen Wort O 12, 6 ij^euSy]
[xeTa(jLcovt.a Ta[jLvoL(7at; statt ,, eitle Lgen durchschneidend" wrden
wir sagen die Wellen eitler Lgen durchschneidend". Oder ein
Bild wird kurz angedeutet, und sofort folgt ein anderes. P 4, 137
ji,aX6axa (pcova TroTiCTa^cov oapov dcXXsTO xpTjmSa cjo^pcv stiscov.
Oder das Bild wird wie die mythologischen Personifikationen (s. oben
S.
52)
durch ein Wort unterbrochen, das rein sachlich etwas von dem
Begriff aussagt, der im brigen durch das Bild ersetzt werden soll.
O 2, 81 ("ExTopa) Tpotac; a{jLa;(ov acTTpa^ xtova.
Sinnbild.
5g
P 9, 37 mit dezentem Euphemismus ex Xexscov xsZpat (jieXLaSeoc
TcoCav; vgl. fr. 122, 7;
Aisch. Suppl. 664.
Der Inbegriff der Dunkelheit bei Pindar ist der: sein Pathos,
seine Einbildungskraft gilt irgendeinem Allgemeineren, was hinter
und ber den von ihm gebrauchten Worten steht. So kommt in
seine Worte eine ganz besondere Hoheit und Emphase, wie bei
Heraklit. Auch dieser denkt nicht, was er denken mchte, nmlich
die Begriffe ununterbrochene Bewegung, Gegenstze und ihre
Einheit; er will das Allgemeine und hat immer nur das Besondere,
das zum Sinnbild wird. Die Wrter scheinen etwas anderes zu be-
deuten, scheinen anders gewendet und beleuchtet als sonst. Das
fhrt auf die Frage des Symbolischen.
V 3. Sinnbild. Lieblingswrter.
Schon in der Sprache des Lebens findet sich auf Schritt und Tritt
die sinnbildliche Bezeichnung. Die menschliche Sprache ist ein System
von beweglichen, verschieb- und bertragbaren Zeichen, durch die
sich die Mitglieder der menschlichen Gesellschaft untereinander
verstndigen ^). Und zwar bewegt der Sprechende, wie Steinthal,
Haupttypen des menschlichen Sprachbaus 1860, 282, lange vor dem
Auftreten der amerikanischen Pragmatisten gesehen hat, die Vor-
stellungen in gewisser Weise mit dem Instinkt des Handelnden,
Ttigen. Aber er berechnet, ermit, erschpft sie nicht, er denkt nicht
Wesen und Inhalt der Dinge und ihrer Bewegungsweisen voll aus.
Wie gewisse Bewegungen von Truppen lit Signalen, aber nicht mit
Worten kommandiert werden, so wird auch hier blo signalisiert".
So steht in der Umgangssprache als Teil fr das Ganze fr Mensch
Kopf (Familie von 5 Kpfen), Seele (Ort von 300 Seelen), als Attribut
fr den Trger Kutte fr Mnch, Blaustrumpf, Maske, Domino,
Schrze fr Mdchen, Schleiernehmen fr Nonne werden, Pfeffer-
sack fr Kaufmann, ein tapferer Degen, als Ort fr die dort befind-
lichen Personen Kammer (nach franzs. chambre), Abgeordneten-
haus, Frauenzimmer, Hof, Kabinett, Bursch (bursa), Liedertafel,
Tafelrunde, Paris war in Aufregung statt die Pariser (s. zu diesem
Punkt die Personifikationen der Stdte oben S. 52).
Dieselben sprachhchen Vorgnge erscheinen nun in der Dichtung
als
N'*"chpfungen Einzelner. Der Dichter oder jeder, der gehobene
^) Henri Bergson, Schpferische Entwicklung. Jena 1912. S. 162 ff.
70
Die Behandlung des Wortsinns.
Sprache redet, wird das Ganze durch einen Teil benennen, der ihm
geeignet scheint, ein lebendiges, anschauliches Mitverstehen des
Ganzen zu bewirken, weil er bezeichnend oder symbolisch dafr ist,
und so den engeren und weiteren Begriffsbereich der Wrter ausnutzen
(Herd), Dach fr Haus, xapa, c7co{j,a fr Person, Kiel fr Schiff,
S6pu, trabs Ennius Ann. 616; Hr. carm. I 1, 13, Lorbeer ernten
fr Ruhm, (s. oben S. 21, 33).
*In jedem Ding offenbart sich, wenn es sinnbildlich gebraucht
wird, eine zweite wunderbare Bedeutung, viel wertvoller als die
erste. Die Dinge lassen sich deshalb symbolisch verwenden, weil
die Natur im Ganzen und in jedem ihrer Teile Symbol ist*. Emerson,
Essays 'Poetry*.
Alle die TpoTiot wie Metonymie, Synekdoche, Hypallage wird
der genaue Leser bei jedem Dichter sehen, aber aus Furcht, pedantisch
zu erscheinen
man will doch einem Dichter nicht seine rhetorischen
Figuren nachgerechnet haben , werden sie berall, wo die Romantik
eingewirkt hat, schamhaft verschwiegen. Die Zeit von etwa 1750
bis zur Romantik hat die Regeln gebenden Poetiken beseitigt. Aber
die Scheu vor der lebenttenden autoritativen Kraft jener antik-
romanischen Normen hat lange nachgewirkt. Die Angst, fr einen
Magister der Opitzzeit zu gelten, hat es weithin verhindert, da man
sich sachlich und ruhigen Gewissens mit den verschiedenen Kunst-
mitteln der gehobenen Sprache, d. h. mit der verpnten Oberflche
beschftigte. Es hatte eben einer so tiefen Umwlzung bedurft, bis
unsere Literatur sich der erlernbaren Poetik entledigt hatte.
Als Beispiel fr die sinnbildliche Seite des gehobenen Ausdrucks
nehme man einmal das Vaterunser. Durch die Umgebung der groen
w^eiten Begriffe Himmel, Reich, Erde, dein (auf Gott bezogen), Name
geschieht mit dem Wort Brot sofort folgendes: es wird zum Sinnbild
gesteigert und geweitet und scheint begrifflich genau zu besagen
alle Notdurft des Leibes". Man wrde schwren, das stehe wirklich
da. Ebenso sind im Alten Testament manche sinnbildlichen Wrter
nur fliehende Schleier fr die Sache selbst: Ernte fr Gottesgericht,
Joch fr Knechtschaft. Etwas hnliches geht oft in der pindarischen
Pathetik vor. Infolge der umgebenden allgemeinen gehobenen Be-
griffe (s. oben S. 19 f.) werden die fest dinglich umgrenzten so be-
sonders beleuchtet und in der Perspektive einer vergeistigenden
Groheit gesehen, da sie den Luftglanz eines Sinnbildes um sich
haben.
Sinnbild.
71
Hier erhebt sich wieder dieselbe lexikahsche Schwierigkeit, die
oben S. 45 erwhnt wurde. Wenn es P 4, 19 heit: xelvoi; 6pvic,
EXTsXeuTacrei usw., so belehrt uns jedes Wrterbuch mit vielen Be-
legen aus Epos und Drama: . . . 2. bh. Vorzeichen, verhngnis-
volle Vorbedeutung, auch wenn sie nicht aus dem Vogelflug ent-
nommen ist". Aber solange keine Prosastelle vorliegt, da 6pyi<;
Vorzeichen bedeutet, gilt: 6pvi^ heit Vogel, immer und berall,
wird aber von der Dichtung oft sinnbildlich nach der Mantik hin
verwendet und bedeutet dann Vorzeichen, Omen.
Seit der symbolistischen Dichtung haben wir bewutere, geschrftere
Sinne fr diese Seite des dichterischen Ausdrucks. Die Symbolisten
waren denkende Literaten, sehr gebildet und haben viel ber Dichtung
gewut. Der SymboUst gebraucht die Worte absichtlich so, da
ihre alltglichen Nebenvorstellungen und Begleitgefhle ausgeschaltet
werden und sie ihre banalen Zune und Ausblicke verlieren. Was
so an Unmittelbarkeit abhanden geht, wird doppelt eingebracht
durch die Befreiung der Geheimnisse der Dinge, durch Seele. Was
der Symbohst bewut tut
er regelt und benutzt die sonst un-
dichterischen, chaotischen, anhaftenden Wortwerte nach dem Gesetz
seines Fhlens , das hat jeder Dichter unbewut getan. Nur
werden besonders solche Dichter, die ein nicht einfaches, senti-
mentalisches Verhltnis zu den Dingen der Wirklichkeit haben,
auch zu allen Zeiten und berall leicht symbolistisch sein. Sie
werden ihre besondere Art haben, eine eigene Luft um die Worte
zu legen.
Pindar bedient sich bei dem dichterischen Beleben lebloser Dinge
solcher Mittel, da auch die Dinge etwas apsTY) abbekommen, ernste,
pathetische Haltung. Die Rohre, die im Sumpf bei Orchomenos
wachsen und zu Auloi verarbeitet werden, nennt er P 12, 27 tcicttoI
XopeuTav (xapTupe^, ebenso die Sulen des Herakles bei Gibraltar
N 3, 22 x(ova<; vauTtXia^ ecr^aTac; (xapTupe^;. So vergeistigt er mit-
unter die Dinge, zieht ihnen den Krper aus, um sie zu apsTY) zu
machen. Immer ist er ethisch eingestellt, ja morahsch, tte mont^e,
wie St. Beuve einmal von seinem Nachahmer Ronsard sagt. Einmal
macht er Anstalten, in Liebesschmerzen zu den jungen Gliedern
des Theoxenos aus Tenedos, von dessen Augen die Strahlen funkeln,
zu schmelzen wie das Wachs der heiligen Bienen, wenn es von der
Hitze gebissen wird. Aber es geht nicht anders, es mu dazu: wem
es nicht ebenso ergeht, der front gewaltsam um Geld oder, der
72
Die Behandlung des Wortsinns.
Weiberfrechheit dienend, lt er sich wahllos tragen auf jedem Wege".
Also auch das mu eine Leistung sein, dcpCTY).
Pindar hat irgendein appyjTov, man sprt oft eine Wrme und
Inbrunst bei ihm, weniger in als um und hinter den Worten. Sie
wird gefhlt in dem Atem, mit dem sie gesprochen zu werden scheinen.
Pindar nennt etwa die Worte czicpoLVoc,, oTocva XeovTO(; von Nemea
(N
6, 44) so, da seine ganze apeTr)-Welt mitverstanden wird. Solche
Worte scheinen einen Nebensinn von weit ausgreifender Bedeutung
zu tragen. Wenn es N 7, 51 9avvatc; oipzTouic, oSov xuptav Xoycov
oixosv heit fr den Gedanken: ihr Ruhm ist so alt wie ihr Ursprung,
so ist oixoev fr ,,vom Ursprung her" entschieden mit leicht symbol-
hafter Emphase gesagt. hnlich wirkt im kleinen ein Singular un-
mittelbar nach dem Plural, wenn es heit, das Tnen des Aulos
statt Tnen der Auloi (s. oben S. 24)
P 10, 39. Oder man nehme
den Schlu von P 6. Da stehen im Lob des Prinzen Thrasybulos
die hohen, allgemeinen, abgezogenen Begriffe Verstand, Reichtum,
Unrecht, bermut, Jugend, Weisheit, und Pindar wei sie wohl
zu fhren. Wie seltsam dadurch beleuchtet steht dabei ev {xu^ol;
IlieptSciiv. Oder P 12, 14 Xuypov t* Epavov IloXuSexTcp vjxe, [xarpo^
t' epiTTsSov SouXoCTuvav to t* avayxaiov "kixoc;. Das abgezogen be-
griffliche Wort SouXo<7\jvav und das dingliche Xe/o^; stehen neben-
einander etwa wie ein Plural und ein Singular. Das letztere be-
kommt aber eine Folie, eine Vorbereitung, die es vereinzelt nie
haben wrde.
Magebend fr das Vermgen eines Dichters, den Worten die
Eigenschaft des Bekanntseins zu nehmen und sie sinnbildlich neu
leuchten zu lassen, ist neben dem Umfang und der Dichte seines
Dichterischen die Ursprnglichkeit und Eigenbewegung seiner Welt-
anschauung. Es hngt davon ab, ob er im Allgemeinsten, in den
Grundfragen von unten herauf ringsum lebendig ist. Eine solche
Lebendigkeit und Gelstheit im Metaphysischen ist nun nicht zu
allen Zeiten da, es gehrt dazu ein xaipo;. Nur an bestimmten Punkten,
an einer Wende wachsen die Dichter, die eine strke lebendige Sinn-
bildlichkeit der Sprache haben mssen und haben knnen. Pindar
steht genau an dem Punkt in der griechischen Geistesentwicklung,
wo sich Bild- und Gedankenerlebnis die Wage hlt. Bei ihm ist es
in cer Schwebe, peTrst. Er ist noch unversehrt im Mythos, jedenfalls
ist es ihm nicht bewut, da das im Verblassen ist, und doch regt
sich schon-Kler Keim zu dem Gedanklichen, das im Griechentum
Sinnbild.
73
dieser Zeit zum Angriff auf den Mythos und zu der Forderung fhrt,
die Natur zu denken. Auch Aischylos sinnt dem Gott Sittlichkeit
an, aber er hat nicht das pindarisch Schillernde, weil alles einklingt
in dem getragenen Flusse des Tragischen, des Dichterischen. Das
bertnt bei ihm alles Zwiespltige, Oszillierende. Man kann den
Hiob vergleichen, der dem mythologischen Denken noch nher ist
als die Propheten und bei dem die Hebraisten klagen, wie wir bei
Pindar, die Wrter bedeuteten bei ihm was anderes als sonst, auch
Dante, wenn man mit Wilamowitz
i)
so weit gehen will. Die Gren-
mae bei Hiob, Pindar und Dante sind sehr verschieden, aber sie
sind im Spenglerschen Sinn gleichzeitig** und analog. Sie sind
die groen Auenseiter in ihren Welten am Ausgang des Mittelalters,
die einsam in sich selber die groe Wendung durchmachen und so
zu Mikrokosmen der betreffenden Kulturentwicklung werden. Hiob
steht abseits von der prophetischen Religiositt, man wei nicht
wo und wann, er ist getrnkt mit vorderasiatisch mythologischer
Anschauung der Natur und gelangt zu seiner ganz ihm eigenen Theo-
dizee. Er ist eine Zusammenfassung des Alten Testaments. Bei
Dante glhen, schillern und klingen die begrifflichen Bauglieder
der Scholastik, sonst so oft trocken, eckig, steif, im magischen Licht
gotischer bunter Glasfenster, brnstig beseelt und umklammert,
und doch steht schon die Tragik des Kolumbus in Odysseus* letzter
Fahrt" (Hlle
26),
die vita nuova ist zugleich Minnesang und petrar-
kisch modern. Dante ist
abgesehen davon, da er Dante ist
eine mikrokosmische Brcke vom Mittelalter zur Neuzeit. Und so
ist auch Pindar ein abseits stehender Auenseiter, in dem mikro-
kosmisch das ltere Griechentum an seinem Ende Gestalt wird. Er
lebt im Heroenmythus wie kein anderer und hat wie kein anderer
die Kraft, nach wenig Worten in diese geschlossene Welt zu bannen,
er hat das getragen Festliche des leibbejahenden griechischen Lebens,
das Agonale, den dorisch-platonischen Eros zum jungen mnnlichen
Leib, das platonische Eifern um die apsTY], den dorischen Ehrgeiz,
mit kleinen Massen etwas Erhabenes auszusprechen, eine trotzdem
durchschimmernde antik-griechische Wortfreude, das bedchtige
griechische Lob des Mahaltens und die Rationalitt der Spruch-
weisheit. Und da er das alles mit einem ganz persnlichen Ernst
sagt, das ist der Grund, weshalb die Wrter bei Pindar so anders
aussehen als sonst.
*) Griechische Literaturgeschichte in Kultur der Gegenwart I 5 S. 52.
74
Die Behandlung des Wortsinns.
Literarhistorisch betrachtet, wird Pindar kraft dieses ergriffenen
ernsten Tones, mit dem er spricht, trotz allem der erste Odendichter
bleiben. Man mag noch so sehr betonen, da Pindar kein Klopstock
und kein Platen, kein Victor Hugo ist: was seine Gedichte von anderer
griechischer Chorlyrik unterscheidet, ist doch der Odencharakter.
Ich setze hier eine Kennzeichnung desselben aus der sthetik von
Moriz Carriere her, Leipzig 1859, II 572: Die mehr objektive Lyrik
der Anschauung zeichnet sich zunchst dadurch aus, da der Dichter
die Empfindung, den Gedanken, der sein Gemt bewegt, auch als
das in andern Regionen Mchtige darstellt und dadurch klarmacht.
Indem aber Natur und Geschichte nur herangezogen' werden, um
jene das Gefhl bewegende Idee zu zeigen, wird von ihm nur dasjenige
aufgenommen, was dazu frderlich ist; zugleich wird diese Idee als
die Seele der Dinge oder der Ereignisse ausgesprochen, so da solche
dadurch in das Licht der Ewigkeit gerckt werden und in dem End-
lichen eine unendliche Bedeutung sich enthllt." Gewi, neben
Klopstock gehalten, wird der Unterschied deutlich, und das von
Boeckh bis Drachmann gebruchliche Hineininterpretieren einer
Leitidee in die Epinikien war ein Irrtum. Aber dieser Irrtum htte
in den deutschen Philologen des 19. Jahrhunderts nicht entstehen
knnen, wenn mit Pindar nicht der zur Ode fhrende Weg beschritten
wre. Der Ton ist da. Pindar hat
wie Aischylos, jeder auf seine
Weise
die geschichtliche Zuflligkeit der Chorsprache in seelische
Notwendigkeit umgeschaffen. Darum wirkt alles so einheitlich und
berzeugend. Man glaubte nicht des yevo^; zu bedrfen, um seine
Sprache zu verstehen. Die alten Worte haben im Munde seines Chors,
der xoLvcovta [xaXaxa TraiScov oapoiai eine neue wehmtige Ein-
dringlichkeit und Spannung.
Um zu zeigen, wie sehr Pindar auf das Odenhafte, auf den Klop-
stock-Stil hinstrebt, stehe hier eine Bemerkung Jean Pauls ber
Klopstock, Vorschule der sthetik
78: K. hat oft wenig feste
sinnliche Folie hinter seinem Spiegel. Vier Mittel
denn die Krze
ist blo das fnfte
ergreift er, um seine Gestalten zu luftigen
auf einer Ossianswolke zu verglasen: erstlich das abstrakte Personifi-
zieren der Zeitwrter mit einigen Pluralen noch dazu, wie ihm Ge-
staltung lieber ist als Gestalt, z. B. die Erhebung der Sprache Dar-
stellung, die innerste Kraft der Dichtkunst; zweitens die Kompara-
tiven, welche den Sinnen so wenig bieten (ihr gewhlterer Schall,
bewegterer, edlerer Gang)
ferner die verneinenden Adverbia,
Lieblingswrter.
75
z. B. unanstoenden Schrittes, weil hier das Sinnliche gerade das
ist, was aufgehoben wird
und endlich seine zu oft umkehrende
gestaltlose Figur, die die Schlacht schlgt, den Tanz tanzt, den Zauber
zaubert. Daher
ist
die Messiade dieser groen Seele (nicht des groen
Geistes. Jene empfindet neu, dieser schafft neu) ein schimmernder
durchsichtiger Eispalast.**
Was hier Jean Paul an Klopstock als abstraktes Personifizieren
^wJte?"
hervorhebt, dem entspricht bei Pindar noch ein Weiteres. Er liebt
es, durch artikelsetzende Substantivierung von Adjektiven die Zahl
der seienden, festen, abstrakten Gren in der Natur zu vermehren:
t6 TepTTvov P 8, 92; N 7, 74; toc TepTuva 9, 28; 14, 4 toc ts TspTuva
xolI toc yXuxea; P 3, 83 rot xaXa; P 8, 6; Bakch. 2, 6 t6 (jLaX8ax6v;
O
1, 30 Ta (xsULxa. to (xopcrtpiov P 12, 30; N 4, 61; N 7, 44; t^
fjtIXXov 2, 63 Bakch. 9, 96; 10, 45; t6 (TUYysvf; N 6, 8; P 10,
12 t6 epLcpue^. Seine archaische, etwas eleatische Welt besteht aus
Seiendem. Reihen starrer Assistenz*', sagt Wlfflin einmal von
der lteren italienischen Malerei im Gegensatz zu der bewegteren
Sehweise der Cinquecentisten. Dergleichen substantivierte Neutra
haben eine starke Anziehungskraft auf das vorsokratische Den-
ken ausgebt. Es gibt kaum eine Prinzipienfrage in der lteren
griechischen Philosophie, die nicht, grammatisch betrachtet, sich
um eines jener Neutra drehte: das ocTrsLpov des Anaximander,
das TTuxvov und apatov des Anaximenes, das eleatische 6v,
Iv, ofjLoiov, TauTov, das aocpov Heraklits, die Qualitten uypov,
^Yjpov, 6ep[x6v, t};uxpov.** Karl Reinhardt, Parmenides, Bonn 1916,
252, s. auch Burkhardt, Griechische Ku turgeschchte III 305.
Jeder bedeutendere Dichter hat wohl bestimmte, fr ihn sehr vieles
umschlieende Worte, denen er eine sinnbildliche Gewalt zu leihen
vermag, das sind fr ihn Affekttrger, lust- oder pathosbetonte
Lieblinge ^). Etwa glhen, suseln, rauschen, jauchzen, schwellen
beim jungen Goethe, wohlgebildet, gefllig, bedeutend, anstndig
beim alten Goethe, wallen bei Klopstock, wandern, rauschen, weben,
schauern bei Eichendorff (wie verschieden klingt rauschen" beim
jungen Goethe und bei Eichendorff).
') Darber gibt es Untersuchungen von Berthold Schulz, Zeitschrift
des deutschen Unterrichts 25
(1910)
(zu Kleists Penthesilea) und von den
Wiener Literaturpsychologen Leo Spider und Sperber, Motiv und
Wort (ber Christian Morgenstern und Gustav Meyrinck). Leipzig, Reis-
land 1918.
76
Die Behandlungf des Wortsinns.
Pindar ist nun in hohem Ma ein Dichter mit Lieblingswrtern,
was eine Vergleichung der Beiwrter bei ihm und Bakchyhdes deut-
lich zeigte. Auer den Beiwrtern sind mir noch andere Wrter
aufgefallen, deren oftmalige Wiederholung fr Pindar bezeichnend
ist: acoTo^;, GaXXo), SpeTica mischen (s. S.
95),
ferner ein etwas von
oben her befehlendes
ypy)
(oder IcttIv eolxo^, 6(pzi'Kzi) abweisend,
autoritativ und orthodox. Er, Pindar, mu die Sieger besingen
O 6, 106; J 8, 74; 1, 34; 3, 7. Hieron mu e 7ra(7xs(i.ev
P 3, 103; der Sterbliche mu die Hybris meiden P
2, 34;
3, 59; N 11, 47; der Gedichtanfang mu strahlend sein O 6, 4;
Xpv)
fxapvaaai cpua N 1, 25. Man mu mit allen Mitteln den Feind
schwchen J 4, 48. An zwei Stellen ist /pY) sogar anaphorisch wieder-
holt J 8, 15 und J 3, 7f Der groe Gnomensprecher Pindar hebt
den Begriff des Fuges noch mehr als die andern sentenzfrohen Griechen.
Etwas verbindlicher ist izpirczi 2, 50; P 5, 43 und 104; N 7, 82;
encom. fr. 121; Bakchyl. 19, 11; von dergleichen npinsi stammt
gewi das decet der rmischen Dichter, z. B. Horaz carm. I 4, 9
nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
4. Abstufung der Strke.
Emphase.
Die symbolhafte Verdichtung und Aufhhung ist letztlich eine
eindrucksvolle Art, Sinnakzente zu setzen und deren Strke ab-
zumessen. Die griechische Chordichtung versteht es, Dinge mit
Emphase, mit Bedeutung zu sagen: P 12, 11 Tptxov . . . xaatyvYjTav
|xepo^ svvaXta Ssptcpco Xolcti te (xotpav avcov er brachte den Seri-
phiern ein Drittel der drei Schwestern als ihr Teil, ihr Schicksal
(zugleich mit Wortspiel) 8, 20 e^svvsTre xpaTswv TraXa SoXiyjrjpeTtxov
Aty-vav TTotTpav. Da steht: er sprach sein Vaterland aus, gemeint
ist: er machte es berhmt. Man hat mitunter bei Pindar den Ein-
druck, da er zurckhaltende farblose Worte liebt, ihnen aber durch
seine Art sie hinzusetzen, eine langsame Wucht gibt. Das wirkt
dann hnlich wie die tragische Ironie im attischen Drama.
N 2, 14 v Tpota [xsv "ExTCop AtavTO^; axouTev.
N 3, 61 xat ey/ECTcpocoK; zTiiiiziEaic, AtioTrecrai ytZpccc; ev 9pa(Tl
Tca^ai' onoic, c(piGi (xy) xoipavo? ottictco TcaXtv . . . (jloXoi;
wuchtiger Euphemismus!
O 9, 74 > e(X0povL Set^ai uaGstv IlaTpoxXou taTOCv voov.
J 5, 56 yevsav KXeovixou exjxacov.
O 7, 83 6 T SV "Apysi xaXxoc; eyvco vtv
Dynamik: Emphase.
Litotes.
77
Mit hnlichem Ton gebraucht er das Wort (xapTup (s. S.
71),
gebrauchen
die Tragiker das Wort auviarcop Aisch. Agam. 1090; Eurip Hippol.413.
Darin liegt eine hnliche grimme Trockenheit und dorische Kargheit
wie in des Aischylos Grabschrift:
aXxTjv suSoxifJLOV MapaOtoviov aXdo^ av elizoi
xal apu^aiTTjei^ M^o<; iTttdTajxsvo:;.
Mit zrtlicher Emphase sagt spter die bellenist sehe Liebesdichtung
(TuviCTTCop von Orten und Dingen, z. B. der Leuchte, die das Glck
der Liebenden gesehen haben. Melcagros AP V 8, Philodem V 4,
die rmischen Augusteer bernehmen das mit conscia Roma Prop.
I 12, 2; conscius aether Verg. Aen. IV 167.
Sodann benutzt die Chorlyrik stark bestimmte Mittel der Dynamik,
Doppelte
z. B. die Litotes ^), die doppelte Verneinung, die laudatio non virtuti- neinung.
bus appellandis, sed vitiis detrahendis Gellius III 6, 11. Diese bildet
eine verstrkte Bejahung, durch sie wird ein archaisch-zierliches Aus-
biegen, ein
*
Untertreiben* erreicht. Schon bei Homer ist die Litotes oft
dazu da, ein mezzo forte zu bewirken. M 364 oiq s^ax* ouS' aTULyjcrs
(xeyo; TsXatxcovto^ Moiq. Das wird nun in der Chorlyrik weit ber-
boten. N 4, 21 Ka8(i,eLoi vt.v oux aex.ovxe; (Scvccrt [iziyvuov; J 2, 12
oux ayvcoT* ocelSco; 20 oux ejxetJLcpy] puotSicppov
x^^P^c;
P 9, 80 oux
aTifxacravTa vlv; N 1, 22 aXXoSaTucov oux aTuetpaToi. 86(xot evtl;
P 9, 58 OUTE TrayxapTTCov 9uto)v out* ayvcora Tjpwv; P
1, 59
x^^PH-*
oux aXXoTptov; N 1, 63
YJpa;
al'SpoStxa^;; P 6, 11 veipeXa^ azpocTOQ
(xaziXix^(;;
vgl. Horaz III 4, 43 Titanas immanemque turmam. P 2, 32
Ixion hat gemordet oux Tsp tzx^olc,.
Aisch. Hiket. 181 die Syringen
schweigen nicht. Aisch. Eumen 903 Athena mit behutsamer Milde und
Hoheit zu den Erinyen: e9U(JLVYJc7at cTroia vtxvjc; jxy) xaxvjc; sTctaxoTca.
Man fhlt sich an die schchtern steife Charis der Lckchen an den
altjonischen Skulpturen erinnert. Es ist echt mittelalterlich: auch
in der mhd. Poesie ist die Litotes oft zu treffen. Die Litotes ist aber
auch einer verhaltenen Wucht fhig, aischyleisch s. Prom. 351 f.
ber Atlas: ectttjxs xtov* oupavou ts xal
xov6(; cSfxot? IpetSoiv,
^Xo^
oux euayxaXov; Aischyl. Sept. 545 eXwv S* eotxev ou xaTtT)-
X\!)(jsLv (xa/Tiv (xaxpac; xeXsuou S* ou y.cL'zai.iGyyvzlv Tiopov; J 6, 33
CTcpcTEpa^ ou 9e(aaT0 y^z^^i'st papu966yyoio vsupa; 'HpaxXsyj^ (dies
') Weyman, Die Litotes, Fleckeis. Jahrb. Suppl. 15 (1887) 485.
78
Die Behandlung des Wortsinns.
als Anfangswort der neuen Strophe!);
1, 81 6 {i-eya; xtv^uvo^
vxXxtv o'i 9caTa Xafxavei; 86 ouS* dxpavToi^ e9av|;aTo kntcji; P 6, 37
Xa{jiat7reT<; S*
^p' iTuot; oux OLnipi^zyt; O 10, 42 OavaTOV aiTT'iv oux
l^ecpuyev.
Es ist aber m. E. nicht richtig, wenn man, wie das meist geschieht
beim bersetzen und Interpretieren, solche Stellen behandelt, als
stnden starke Bejahungen oder Superlative wirklich da. Denn es
steht doch die Litotes da. Die Litotes ist eine Art fishing, sie ntigt
den Hrer, von sich aus zu dem Gesagten etwas hinzu zutun und hat
dadurch etwas Unausgedrcktes, Gedmpftes, Anregendes, Be-
unruhigendes, Spornendes, Kitzelndes. Sie ist eine Form der poe-
tischen Sprache", die im Effekt dem Superlativ o er Elativ der
Prosa ungefhr entsprechen mag, aber sie gehrt zu den vielen Mitteln,
durch die sich die Poesie von der gemeinen Prosa abschliet, die in
der antiken Literatur mit ihren zunftmig, fest weiterberlieferten
Gattungen schematisclier sind als bei uns, aber auch eingreifender ^).
Superlativ.
Im Gegcusatz dazu besteht die Neigung, durch den Superlativ
als Elativ in dieser gesungenen Kunstsprache spezifisch religise
Erhabenheit zu bezeichnen:
O 1, 42 uTraTov eupuTijxou totI 8c5{xa Ai6(; ^); 4, 1 fXaryjp
uTuepTaTE povToc;; P 2, 38 uTrepox^TaTa TipeTrev OupaviSa,
'jyaTspt Kpovou; P 8, 4 iyoiGOL xXvjtSa^ uTcepTOCTa;; 26
pe^J^aiaa xal oat^ UTcepTotToui; -J^pcoa^ ev (xa^o'-K-
Das in der Litotes hegende sorgsame, sparsame Abwgen der Dynamik
des Ausdrucks wird oft verwischt. Sophokles, Oedipus rex 1213 ist die ber-
lieferung zu halten Hvjpt a' ax'^v})' 6 r.dv^y 6p<5v ypovo?. In dem milden Aus-
druck hegt eine echt chorlyrische Emphase, fast tragische Ironie, die durch
V. Wilamowi^' nderung a/wv verdrngt wird. Ein feierliches wahrlich!"
umschwebt solche Wrter. Veranlassung zu der nderung war vielleicht
Ais^ch. Prom. 19 x'-vt cf a-/tov Suc/utoi; /a?vite'j,aa(3tv Trp'^aTraocotXe'jatu. Aber auch
hier wird jeder zugeben, da das ax^vta bezeichnender fr die Diktion der
Tragiker ist als das cfxwv. Da Hephaistos den Titanen ungern festschmiedet,
sagt ei immerzu, dns ist nichts Neues. Aber da Prometheus sich ungern
festschmieden lt, das ist mit schmerzvoller, verhaltener Bitterkeit gesagt
und ist griechis"h tragischer Sl.
)
Das unmittelbar vorhergehende e'jvofx<oTaTov U
Ipavov (Vers
37),
das be-
sagen soll, da es sich um das harmloseste Festmahl von der Welt gehandelt
habe, ist ein richtiger Vergleichssuperlativ, ebenso 77 xa/y-zdro)^ apfxctxwv,
100 u-aTov Epyexai (50 ctpcpl Seurata jedenfalls formelhaft).
Dynamik: Superlativ.
79
N 10, 13 6
8*
oXoi cpepTaTOc;; J 6, 39 <pspT3CT0(;
Te>a{jicov;
9, 56 (pspTOCTcav KpoviSav; 6, 69 Zr^vo^ kiz axpoTocTC)
9, 61 e^ev Se CTTrIpfxa jjLlYt<^fo^' Xo^o^;; 10, 45 TraTpl (AeyiaTcp,
da wrde er nie eine Litotes setzen, ebensowenig wenn er von
seiner Dicbterttigkeit spiicbt; 1, 19 utuo yXuxuTaTaK;
(ppovTtatv; 112 euol Molaa xapTepcoTaTov sXo^ aXxa TpscpEt.
9, 94 xaXoc xaXXicjTa ts pe^at';, da stebt der Superlativ, um die
Anapber nicbt preiszugeben, eine Wallung von 7ratStx6<; Ipco^
scheint mitzuwirken, da er so bohe Tne nimmt.
N 7, 44 evSov (5cXaeL TuaXatTaTO).
Aucb das aptcTTov jiev uSop 1,1 ist mehr Elativ als Superlativ,
daneben ist zu stellen fr. 101 9epTaTov uScop, es ist dasselbe, wie
wenn er sagte lepov Scop. N 4, 63 Xeovtov ovuyac; 65uTaTOU(;
dx{xav xal SeivoTaTcov axaaaK; oSovtcov, das wrde er wohl nicht
sagen, wenn es sich um einen gewhnlichen Lwen bandelte und
nicbt, wie hier, um eine unheimliche daimonische Schreckgestalt.
Ebenso das Unheimliche, Entsetzliche beim A tnaausbruch P
1,
21 7cup(; ayvoTavat irayat und 25 xetvo o 'A9ai(TTOLo xpouvou^
IpTTETov SsivoTocTou^ avaTTEfjLTcei. Audcrs hlt es Pindar in den
virtuosen Gedichten fr Kyrene, die er mit groer Meisterschaft,
aber mit weniger innerer Anteilnahme als andere gedichtet hat,
P 9, 7 TioXuxapTTOTaTac;; 69 xaXXtCTTav toXlv; P 5, 48 Xoycov (pepToc-
T)v pLvafjLYjia; P 4, 280 t6 xXesvvoTaTov (xeyapov Bocttou. Auch Bak-
chyhdes behlt den Superlativ als Elativ anscheinend den Gttern
vor dcpicjTapxoi) Al6? 12, 58; aptcTTOTraTpa 10, 106; ^eyiGrToavaCTaa
"Hpa 18, 21 (xeytCTTOTcaTwp ZeO*; 5, 199. Nur in dem besonders
stark auftragenden .Gedicht fr Hieron 3, 12 steht ber diesen:
TcXeiorxapxo;;. Ob sich bei andern Dichtern derselbe Superlativ-
gebrauch findet, wre der Untersuchung wert. Vergil hlt es wohl
hnlich (Aen. 6, 165). Fr Superlative hat Pindar manchen Ersatz:
die Fahrt bis zum Nil und den Heraklessulen, der cjto^, Blte,
Adler, Wasser. Besonders bezeie#inend fr Pindar ist, da er den
Klopstockschen Komparativ hat, jenen andeutenden Anlauf nach
dem Erhabenen, zu N
8, 5 tcov dpeiovcov epcoTwv ; 17 b Xoc; avpcoTuoKjt.
TcapfjLovfOTEpo^. O 7, 53 CTo<pCa fjLeC^cov. P 5,
12 cjocpoi Se toi xiXXtov
cpepovTt . . . Suvajxiv; 89 xtCctev
8*
dcXaca piel^ova 0ec5v. Aber bei
Klopstock ist es der berschwang, eine begonnene weite Kurve,
Barock, bei Pindar ist es emphatisches Andeuten, Gedrungenheit,
80
Die Behandlung des Wortsinns.
verdichtendes Weglassen. Klopstock krzt mit Suspension, Pindar
mit Kontraktion.
Milderung.
Harte Ausdrcke fr Unglck, Frevel, Schlechtigkeit, Hliches
werden herabgestimmt oder umgangen. Manches wird in einem Ton
der Reserve, der Diskretion gesagt, den die Rhetoren TaTretvcoati;
(Aristot. rhet. HI
2)
oder [lzio^gk; nennen, humilitas, deminutio.
Der Ausdruck wird herabgestimmt, der schwchere steht fr den
eigentUchen. Zuweilen geht das bis zum Euphemismus, der Sub-
stitution aus Furcht oder Scham, wo ein Ausdruck von harmloserer
Bedeutung steht, damit das harte, nackte, ominse Wort gemieden
wird. Bakchyl. 119 xopav As^tOsav Sdcfiaasv;
Pind. Paian 6, 85
pacret 96V6) TcsSacjatq; P 1, 78 toligi MyjSsiol xocfxov
TcoXefxtov
dvSpwv xajjLovTcov. Vgl. 01 xa^ovTs; die Gestorbenen (so auch der
strenge Wortsinn von sterben). Das hat auch die Orakelsprache, s. die
BakisverseHdtS, 77 SZaAixy) asaasi xpaTspovKopov ''Tptoc; ulov.
Oder 9upa) fr vernichten Paian 2, 73 (stammt wohl von dem frbenden
Blut der Erschlagenen: Aisch. Agam. 732, N 1, 68)
i).
Lobworte.
^q^^^ bezeichnend sind ferner seine, wie oben betont, weniger
als bei andern wechselnden lobenden Wrter und Begriffe, ganz
unbersetzbar zum Teil. Die vielen mit su- zusammengesetzten
Beiwrter euavcop, suavY)^;, uSai(JL6)v, euSo^o^, supovo^, suxXsyj^,
euuSpo^, eucppwv, sucovu^xoc;
die rmische Dichtung ahmt das mit
bene nach (Prop. II 34, 6 bene concordes)
unterscheiden sich von
unsein Lobeserhebungen wie ein dorischer Tempel von einem gotischen
Dom. Der Grieche, und Pindar mit besonderem Ton darauf, sagt
etwas ist wohl-, schn-, ganz-, (jrav-, s. oben S.
43)
gesund-,
richtig. Wir erheben, sagen ber-, bertreffen, berragen, ber-
legen sein, hoch-, weisen nach oben, vergeistigen dadurch. Wenn
bei Pindar steht au^avco, P 8, 38 au^wv Ss TidcTpav MstSuXiSav; N 3, 58
dcTLTaXXsv ev oipiiivoiGi izoiai 6u[jl6v au^cov, so sind wir in Versuchung
zu bersetzen
*
erheben'. Ausdrcke, die in die Hhe weisen, Zu-
sammensetzungen mit axpo-, utpL-, hat Pindar hnlich wie beim
Superlativ nur fr Geistiges oder Gttliches, oLxp6ao(poc,; 5,
17
utJ^tvscpT); Zz{)c, (wenn 5 nicht von Pindar herrhrt, so entfllt die
Stelle); N 2, 19 utpi^jLeSovTt Ilapvacycp, wo der Berggott vorgestellt
Das hat auch noch die rmische Dichtung, z. B. Properz I 13, 11 haec
tibi vulgares istos compescet amores fr verhindern.
Milderung.
Lobworte.
Das Ich".
81
wird, ebenso xopucpdc, soweit es nicht einfach die creme, fine fleur
bedeutet, das Oberste, Feinste wie ocwto^ (so Ol, 13; 7, 4);
P 3, 80
Xoywv xopucpat; N 1, 34 'HpoLxXioq . . . xopu^ai^ apsTav pisydcXai^.
Die Wettspiele natrlich erhalten dieses Lobwort auch.
Ein weiterer Sinnakzent bei Pindar ist der komparativische Ver-
gleich mit einer Sache, die in der Natur die betreffende Eigenschaft
denkbar vollkommen vertritt. Diese wird von seinem gelobten
Gegenstand aber noch bertroffen fr. 192 fxeXtacroTsiSxTCov xTjpicov
Ifxa yXuxspcoTspo^ ofJLcpa; N 4, 81 cTTaXav Ilaptou Xi0oi) XeuxoTSpav;
P
3, 75 ac7Tpo^ oupavLou (p<x\il TYjXauysCTTSpov xstvo) cpdco^; s^txopLav;
O
9, 23 ayavopo^ itttcou acFdov xal va6<; uTroTTTspou. Otto Schwab,
Historische Syntax der griechisch,en Comparation (Schanz' Beitrge
IV
2)
Wrzburg 1894 II 21 ff., der diese Beispiele verzeichnet, weist
mit Recht darauf hin, da dergleichen Begriffe ,, schner als die Rose'*
unanschaulich, unvorstellbar sind. Sie liegen also mehr in der Richtung,
die zur Rhetorik fhrt, als in der der plastischen Wesenseigentmlich-
keit des griechischen Sprachgeistes.
5. Das chorlyrische Ich.
Eine wichtige semasiologische Eigentmlichkeit der griechischen
Chorlyrik ist der Wortsinn von ich" im Chorgesang. Es bedeutet
in der Regel anscheinend nicht die Choreuten, sondern den Dichter.
Der Dichter kann als erster Sprecher des Chores seine persnlichen
Meinungen und Angelegenheiten singen lassen. Der Chor ist oft
ein Instrument, das so wenig eine eigne Seele hat wie eine Kithara.
Die
Choreuten sind Orchesterinstrumente, weiter nichts. Pindars
Chor singt ich (d. h. Pindar
1)
berrage an aocpia alle andern Dichter"
und hnliches mehr. Das ist durchaus nicht selbstverstndlich:
man knnte sich eine Chorlyrik vorstellen, die gerade dadurch, da
sie berall das Fhlen einer Gesamtheit in Worte kleidet, Gre
und Monumentalitt anstrebt. Der griechische Chor redet nur an
einzelnen Stellen aus seiner eignen Rolle heraus. Und dann immer
aus ganz bestimmten ueren Anlssen, die mit seiner Festttigkeit
zusammenhngen Wir wollen den Komos singen" u. dgl.
Da wird also die ursprngliche Form des Chorlieds nicht ber-
schritten Der Chor bleibt eine Gruppe von Arbeitssngern insoweit,
als er seine Ttigkeit, sein Fhlen nur dann erwhnt, wenn es
sich um die eigentlichen primitiven Urfunktionen des Chors handelt:
Dornseiff, Pindars Stil.
6
82
Die Behandlung des Wortsinns.
das Begleiten einer Handlung mit Musik, sei es nun einer Arbeit
oder eines Spcofxsvov. Hieran etwas zu ndern, hat man sich offenbar
nur schwer entschlieen knnen. Das erklrt auch das merkwrdig
zgernde Verhalten des Chors in manchen Dramen, in denen er
als Vertreter der Rolle, die er darstellt, zu tatkrftigerem Ver-
halten berechtigt und verpflichtet wre. Bei gewissen Psalmen, die
chorlyrisch gedacht sind, ist das anders. Schon eine Wendung wie
Psalm 95, 6 ff.:
Zieht hinein! Lat uns niederfallen und uns verneigen!
Lat uns knien vor Jahwe, unserm Schpfer,
Denn er ist unser Gott, wir das Volk, das er weidet.
Die Herde seiner Hand.
wre in der griechischen Chorlyrik unerhrt. So weit geht der griechi-
sche Chor nicht aus sich heraus. Das hat die bedchtige, khle
Religiositt der homerischen und archaischen Zeit verhtet, die
noch nicht die Ekstase des dionysischen Bakchanten und die In-
brunst des eleusinischen Mysten kannte. Dieselbe Stimmung, die
die TTpoaxiivYjcji? aus den Hymnen verdrngte oder besser gr nicht
erst eingelassen hat, um Mythenerzblungen an ihre Stelle zu setzen,
hat verhindert, da die Erregungen einer Gemeindeseele, eines
kollektivischen Fhlens Inhalt einer entwickelteren rituellen Poesie
blieben wie bei den oben erwhnten uralten Litaneien.
Es fehlt der griechischen Chorlyrik an der inneren Hundert-
fltigkeit der Stimme, an der eigentlich chorischen Flle, wie sie
die besten Psalmen und Chorle besitzen. Dafr gewinnt die griechische
Chordichtng, wo ein Einzelner spricht, ein Mehr an Beweglichkeit
und Buntheit des Inhalts. Die Dichter, die zum erstenmal durch
den Chor ihr eignes Ich reden lieen, mssen Menschen gewesen sein
von homerisch freier Geistigkeit, einem gewissen Rationalismus
am Orient gemessen, die es mehr lockte, sich selbst zu geben, von
sich zu erzhlen, aus ihrem Eignen zu lehren, als sich in die Geheim-
nisse eines Ritus zu versenken, den Seelenzustand einer Gemeinde
zu erfhlen und Sprachrohr einer Gesamtheit zu sein, wohin
ihr Auftrag eigentlich ging. Und diese Dichter mssen in einer Ge-
sellschaft gelebt haben, die Neues, Individuelles zu schtzen wute,
ja verlangte, die lngst erhaben war ber dumpfe Gottesangst. Die
Griechen sind die Rationalisten gegen die Orientalen. Mystik ist
bei ihnen nicht sehr entwickelt. Die Lyrik hat nur eine kurze Ge-
Das chorlyrische Idi.
83
schichte bei ihnen. Sie schmelzen nicht, singen nicht. Die Elegie
ist kein Gesang, sie ist auf die Pointe gestellt, fr die Pointe hat
man die Mitte des Pentameters eingerichtet; auerdem ist sie lehrhaft.
Blo im Dithyrambos, aus dem sich die tragischen Chre ent-
wickelt haben, ist es anders, z. B. Pind. fr. 75, 7; Prat nas Ir. 1, 3;
Soph. Aias 701, Antig. 152. Aber selbst im Drama begibt sich der
Dichter nicht ganz der Lehrer- und Predigerstellung des orocpoi;. Er
redet zuweilen im Chor mit bergehung aller Rollenrechte der
Choreuten. Aischyl. Hiket 41 und 525; vgl. Wil. Aisch.-Interpr. 241.
So in dem groen Mittelchor des Knig Oedipus 863 ff. et [loi ^uveitq;
Oedipus Kolon. 1211 ff. Das chorlyrisch gehaltene Ich hngt dem
Tragdienchor sehr nach.
Mehr Freiheit, ich zu sagen, als im Epinikos und Paian hatten
die Mdchen in den Parthenien: bei Alkman in Sachen des Schn-
heitsagons zwischen Agido und Hagesichora, bei Pindar in fr. 104d,
26 ff. und 45 ff.
Das Ich in der pindarischen Chordichtung schillert genau so
zwischen Dichter und Chor hinber und herber, wie die Personifi-
kationen schillern zwischen Gott und Sache und die Metaphern
zwischen Bild und Sache. Das ist eine Feinheit alter, langgepflegter
Kunst fr eine Hrerschaft von Kennern, hnlich wie die Amphibolie
(tragische Ironie) im attischen Drama
^).
Die antiken Erklrer sagen
das auch z. B. Schol. N 1, 19: Ich trat an die Hoftore eines gast-
freundUchen Mannes, Schnes besingend, wo mir ein angemessenes
Mahl gerichtet ist,*' a(x9toXov TuTspov 6
xop6(; yj
6 tcoit^tt)^ toto
9Y](ji. SuvaTat yap 6
x^P^^
Xeyeiv 9*
eauToO xuptco^, Suvarat Se
xal 6 ivSapo^ (jLeTa9optxco^ etTcstv. Die Zweideutigkeit liegt aber
nicht blo tatschlich vor, als Kreuz und Strafe fr nachgeborene
akribe Interpreten, sondern sie ist gewollt Pindar schafft sich so
ein chorlyrisches Ich, das orakelhaft wie eine Pythia redet und gut
zu seinem majesttischen Eifern um Mythen und apsTY) pate.
P 8, 98 Atyiva, 9(Xa jxarep, das kann im Munde der Chorsnger
heien meine Mutter" und von Pindar aus 0 Mutter des Siegers";
P 4, 1 CTafjLEpov fxv
X9'h
^^ damit kann der Chor in Kyrene und
Pindars 9[Xa
^^jx^
angeredet sein.
Paian 5, 44 AaTc^ Iva
fxc
TcalSec;
| Euixevei S^^aaGe v6<{i epa-
TcovTa usw.
*) Trautner, Die Amphibolien bei den griechischen Tragikern. Disser-
tation Erlangen 1908.
6*
84
D'G Behandlung des Wortsinns.
Pa.<an 2. 102.
J 7, 37 und 49 auffallend warmes, ergriffenes Ich (= Pindar
+
Familie des Siegers).
N 9, 1 Festlich wollen wir ziehn von Apollon aus Sikyon weg,
Musen, nach dem neugegrndeten Aitna
Ebenso schillert der Sinn des Gesagten infolge der dichterischen
Annahme, da das sprechende Ich, Dichter oder Chor, sich an dem
Ort der ruhmvollen Tat befindet (s. oben S. 64).
Ich heit mitunter ich an deiner Stelle" und gibt eine Mahnung
in gemilderter und verhaltener Form.
P 3, 107ff. GiLiy.c6<; Iv GyLi-polq, [li^vq ev [xsyaXott;
|
laGOfxai usw.
N 1, 31 oux spaM-ai ttoXuv Iv {^.syapcp ttXoutov xaTaxpu^'ai;
sysLv usw.
N 9, 29 ei SuvaTov, Kpovicov, TcsZpav
OotvixoaToXcov sy^^ecov
avaaXXofxai oic, tcodgigtol usw.
3, 45 o VLV Stco^co xsvoc; et/jv.
13, 14 SY]pto(jLai. TcoXeatv izepi TrXyjst xaXcov, ich an eurer Stelle,
als euer Mund.
Dieses Schwanken der Bedeutung von ich verbietet es, fr die
Epinikien den Satz aufzustellen: ich = der Dichter. Und das ist
gut fr zwei Stellen:
P 8, 57 'AXxfxava (JTS^avoLcn aXXo paivco Se xal fAvco ysiTCOv
6tl (Xol xal XTcavcov 9uXa5 e(xc5v uTravTacrev,
wo Imre Mller^) mit Recht auf Aischyl. Sept. 5023 verweist (zu
dem Begriff ysiTCov als gttlichem Schtzer der Stadt). Wenn der
Chor der aiginetischen aXtxe; das sagt, so ist alles leicht verstndlich
:
ein Alkmaionbezirk ist auf Aigina in nchster Nhe und der Sieger
Aristomenes hat vor den Pythien bei einem Alkmaionorakel (ver-
mutlich ebenda) angefragt;
und P 5, 73 to S' Ifxov yapuet (Wilamowitz: yapusT und yaoiievT
)
dcTTo TcapTac; eTurjpaTOV xXeo^
oev yeyevyafxevot
LXOVTO yjpavSs 9c5Tec AiystSat
|
e{xol TuaTsps;,
der kyreneische Chor sagt: Apollon hat die Dorer (Nachkommen des
Herakles und Aigimios) nach Lakedaimon, Argos und Pylos geleitet,
^) Quomodo Pindarus chori persona usus sit. Freiburger Dissertation
1914. S. 40 f.
Das chorlyrische Ich.
Die Sa^fgung.
85
und er sagt in einem Orakelspruch, von Lakedaimon (Sparta) seien
die Ai^jiden nach Thera gekommen, meine Tca pe?. las Letzte
kann der kyreneische Chor nicht sagen, die Choreuten gehren
nicht zur TiaTpa der A giden. Hier ist also ich = Pindar.
Fr die weitere Geschichte der Gattung des wirkhchen oder
fiktiven Chorheds fr Festautfhrung ist diese Mehrdeutigkeit sehr
wichtig. Hier ist nmlich ganz deutlich die Vorstufe einer Haupt-
eigentmlichkeit des hellenistischen, profan-knstlerischen Hymnos,
wie er in Kallimachos' Hymnen Bions Adonisgedichten^), CatuUs
epithalamium, pervigilium Veneris usw. erscheint. Auch diese schillern
alle in verschiedener Hinsicht. Sie sind halb mimisch-chorisch, halb
episch-rezitativisch, sie spielen leicht romantisch mit der Fiktion,
Begleitgedicht zu einer heiligen Handlung zu sein, und schildern
sie doch zugleich, eine hchst kunstvolle Stilmanier, kraft deren
es in der Schwebe bleibt, ob der Dichter oder der Festordner eines
Chores spricht, ob das Spcousvov Wirklichkeit oder Annahme ist.
In der deutschen Literatur hat diese wirkungsvolle, dekorative
Kunstform vor allem Schiller verwendet, in der Glocke und im
Eleusischen Fest. Ein kallimacheis her Hymnos steht zu e nem
wirklchen etwa wie ein Chopin'sches Nocturne zu einem wirklichen
Stndchen emes nachts zur Laute Sirgenden vor ihrem Fenster
oder ein Serenade betiteltes Musikstck eines modernen Tonsetzers
zu einer Nachtmusik fr einen vornehmen Herrn im 18. Jahrhundert.
C. Die Satzffigung.
1. Harte Fgung.
Jede Festpoesie hat eine Richtung auf umschreibende amplificatio.
Nominaler
Das Aufbauschen einfacher Dinge, sprachliches Ausbiegen, Falten- baier Aus-
wurf und Schmuck, scheinen sie geradezu vorauszubestimmen,
sentimentale Rhetorik zu werden. Da die griechische Chordichtung
dennoch so ganz anders aussieht als etwa Oden von Klopstock,
Victor Hugo, Swinburne und die laudi Gabriele d'Annunzios, liegt
daran, da die nchstliegenden Mittel beredter amplificatio den
griechischen Chordichtern fehlen: die ausfhrliche Antithese, die
Anapher, die Aufzhlung. Besonders von der symmetrischen Anti-
these lebt geradezu sonst jede rhetorische Dichtung. Hier ist es
') v.Wilamowi^, Reden und Vortrge. 1913. S. 28Q u. 333. Reifeen-
stein, Hellenistische Wundererzhlungen, Leipzig 1906, 157 ff.
86
Die Sa^fgung.
anders. Die Satzbewegung ist nicht geschwungen und frei ausladend.
Alles Gewicht liegt in den Nomina, in den Substantiven und ihren
Beiwrtern. Ausdrucksvolle Verben werden gemieden, die immer
wiederkehrenden sind leer (das ojxiXelv u. dgl., s. Aischylos' Lieb-
lingswort TTpETcstv). Die bermasse der Nomina gibt dieser Chor-
poesie ihr starres Geprge
wie auch der altgermanischen Dichtung
(s R. M. Meyer, Altgermanische Poesie 17) und ihren Nachkommen,
wie Richard Wagner. Verba wirken natrlich-lebendiger, anschau-
licher, bewegter als Substantiva (Jean Paul, Vorschule der sthetik
78). Fr den naiven Stil ist das Ttigkeitswort das Entscheidende,
fr den sentimentahschen das Haupt- und Eigenschaftswort
');
s. S. 134.
Die Sprache der Chorlyrik ist mehr dem einzelnen Wort als dem
Satz zugewandt. Das ist ein Kennzeichen der aucrT7)p6c dpjJiovta,
fr die die antike Stilbetrachtung auer Aischylos Pindar als den
Hauptvertreter der Poesie ansah neben Thukydides und Antiphon
in der Prosa. Vor allen Dingen gehrt Heraklit dazu. Bei der au(jTY]p6(;
apfjLovta, der harten Fgung, wie Norbert v. Hellingrath'^) bersetzt,
ist das Wort die taktische Einheit. In prosaischer Rede ist das einzelne
Wort durchaus eingeordnet in die gespannte Kurve der Satzbewegung.
Es kommt mit seinem sinnlichen, bildlichen Eigenwert nicht voll
zur Geltung, sondern der Hrer nimmt sich davon, was er zum begriff-
lichen Sinn des Satzes braucht. Die Wrter sind groenteils in her-
gebrachten Verbindungen abgeschliffen und dienen blo dazu, zu
Gruppen zu verschmelzen und einen Begriff, eine Bewegung, Handlung
auszusagen, der zwischen oder ber den Worten liegt. Ebenso steht
es in einem groen Teil der dichterischen Rede, wo glatte Fgung,
yXacpupa ap|iovia herrscht, wo einem belebten Sprachtempo nichts
Hemmendes in den Weg gelegt werden soll, besonders in den einfachen,
frei gehenden F'ormen der Reimpoesie: Eichendorff ist da das schnste
moderne Beispiel. Von griechischer Dichtung wrden viele Sprech-
teile der Komdie und die Anakreonteen dahin gehren, die nugae
Catulls unter den Lateinern Bis zu diesem leichten Flu lockert
sich die antike Poesie sehr selten, sie ist vielmehr meist der ap(^.ovta
euxpaTo; zuzurechnen, einer wohltemperierten
Mittelstufe.
1) Kawerau, Stefan George und Rainer Maria Rilke. Berlin 1914. S. 36.
2) Die Pindarbertragungen Hlderlins. Mnchener Dissertation 1910.
Hellingrath deutet den Sinn von aua-r^po; dpaovta mit Glck etwas um. Diony-
sios von Halikarnass, de comp. verb. 22 versteht darunter das Fortschreiten
von Buchstabe zu Buchstabe.
Harte Fgung.
87
Der Gegenpol wre die aucTTinp^? apaovta, die harte Fgung
der Chorpoesie. Das einzelne Wort ist die taktische Einheit, es wird
betont, vereinzelt, mit Bedeutung gesagt. Alles, was griechische
Chordichtung ist oder von da herkommt
selbst Bakchylides,
obwohl nach Trspl d'ou^' ev tw yy.y.c^upc TravTYj xxaXXLypa9y][JL'iV0^,
entspricht diesem Urteil nur innerhalb der Chordichtung
,
gehrt
dazu, Terpandros, vieles bei Aischylos, Timotheos, Lykophron,
Kerkidas, Simmias' Tcchnopaignia^), in deutscher Dichtung Klop-
stock, Hlderlin, Richard Wagner, George, das meiste in der gegen-
wrtigen deutschen Dichtung der Jngeren, sonst Edda. In der
Satzfgung bei der glatten Fgung einfache und Fxhmiegsame, bei
der harten erstaunhchere Satzgefge: Anakoluthe, bald prdikatlos
hingestellte Worte, in deren Krze ein Satz zusammengedrngt ist,
bald weitgespannte Perioden, die zwei-, dreimal neu einsetzen und
dann doch berraschend abbrechen, nur niemals die widerstandslose
Folge des logischen Zusammenhangs, stets voll jhen Wechsels in
der Konstruktion und im Widerstreit mit den Perioden der Metrik.
So von schwerem Wort zu schwerem Wort reit diese Dichtart den
Hrer, lt ihn nie zu sich kommen, nie im eigneh Sinn etwas ver-
stehen, vorstellen, fhlen: von Wort zu Wort mu er dem Strome
folgen, und dieser Wirbel der schweren stoenden Massen in seinem
verwirrenden oder festhch klaren Schwung ist ihr Wesen und eigent-
licher Kunstcharakter. Und wenn bei glatter Fgung der Hrer
zunchst von einer Vorstellung erfllt war, so sehr, da im uersten
Falle er das Wort selbst kaum noch erfat, so erfllt ihn hier so sehr
das Tnende und Prangende des Wortes, da er im uersten Fall
dessen Bedeutung und was damit zusammenhngt, dann noch er-
fasst'* (v. Hellingrath S. 5 f.). Das Bauliche, Ordnende des Satzes,
die formende, platzanweisende Kraft des verbalen Prdikats und
des hheren Satzbaus fllt nahezu weg. Es herrscht ein Neben-
einander der Worte.
Damit verschmht diese Dichtung ungeheure Mglichkeiten.
Nicht umsonst ist das euSouctiv xopucpaC von Alkman so berhmt.
Es fllt als verbal beseelend aus dem strengen Chorstil heraus und
nhert sich unserm poetischen Empfinden. Es ist zivilisierter zu
sagen, die Gipfel schlafen, der Sturm zrnt, als Ausdrcke zu ge-
') Auch die hellenistisch barocke Rhetorik der Asianer will oft auf engstem
Raum, ohne ein Wort zu verlieren, den Ausdruck steigern und pomps
machen. Vgl. Leo, Rmische Literaturgeschichte, Hermes 49 (1914) 183.
88
Die Sat}fgung.
brauchen die in der S. 53 gekennzeichneten Erlebnisform wahr-
zunehmen zwingen.
Das Wort wird von diesen archaischen Dichtern ja erst entdeckt.
Der Mensch hat auch, wenn er lngst zu sprechen sich bewut ist,
doch noch kein Bewutsein, da er Worte spricht, so da der Begriff
des Wortes selbst berall von dem des Spruches ausgeht, sogar in
ganz neuen Sprachentwicklungen, wie parole von parabola" (Geiger
I, 176).
Ein Hinweis auf stco;,
fxuo^, loyoc, gengt.
Die neue Wichtigkeit, die dem einzelnen Wort in der Chordichtung
be' gelegt wird, zeigt sich deuthch in der Behandlung des schmckenden
Beiworts. Das Epos bentzte dessen Gewicht hchstens als Moment
der heiteren Ruhe, um die ganz besondere epische Breite und Bewegt-
het zu erzielen. Im allgemeinen aber gelingt es Homer, den Bei-
wrtern ihre Schwere zu nehmen und dies Handwerkszeug der braven
Rhapsoden als gelockerte Fllung fr seinen still rollenden Vers
einzustellen. Diese Beiwrter werden jetzt in der Dichtung des griechi-
schen Mutterlandes ernster genommen. Die Wrter sitzen anders,
klingen anders, das spezifische Gewicht der Redeteile ndert sich.
Das Zeitma wird breiter und gehaltener. Die Chorlyrik nimmt die
Beiwrter gewichtiger, wertet sie bewuter aus^). Auch in der Sprache
des tglichen Lebens im damaligen Griechenland reden die Menschen
dorisch, vierschrtig, unbeholfen, sozusagen in Pfundnoten, wie etwa
das Recht von Gortyn zeigt. Die verschiedenen griechischen Chor-
dichter haben sich gegenber dieser Tendenz in verschiedener Weise
verhalten, sie suchten sich ihr entweder entgegenzustemmen oder
gaben sich iljr willig hin. Simonides ist verloren, so da man nicht
mehr sehen kann, was nach Homer neu erreicht war an geschliffener,
frei strmender
apfxovia euxparoc;. Es ist Zartes und Geistreiches
von ihm erhalten. Man ist versucht, bei seinem Neffen Bakchylides
das Leichte, Flssige, Durchsichtige, das Homerisch
- Ionische, das
Schlanke, Feingliedrige, Zerbrechhche seiner Verse mit darauf zurck-
zufhren, da er sich an die Kunst seines bedeutenden
Verwandten
anschlo. Denn BakchyUdes selber ist ein verwertendes
kleines
^) Die antike Theorie lehrte spter genau wie die alten Dichter gehandelt
haben: die ovor/ara Trs^oir/'^^^a sind ntig zur Erzielung von tjzyxlr.r^piTzt'OL nach
Demetrios t:. epur^v. 38, die fa/voxr,; kann sie dagegen so wenig wie die hnzl
Wjv.olt'x brauchen. Aristot. rhet. 111 3, vgl. de poet. 21 : xiv (Jv-fjaxtuv Tct hinXi
pd>aaTa apfxoTtei toi? 6ti}'jpdtfjLot;, a't 8e -^XiXTai xo'.i r^ponxot?, al 8e (j.eTacpr>potl toEc
{aijefot;.
Harte Fgung.
Apposition.
89
Tilent. Bakchylides bernimmt ganze Wendungen, Pindar setzt
sie fast immer irgendwie in seineu Stil um. Pindar nimmt den nomi-
nalen Ausdruck der hymnischen Chordiktion am wichtigsten, weil
er seiner Natur gem war. Ihn, den von dem eben entstehenden
Europa noch kaum berhrten boiotischen Dorer, den gegen seine
fortschrittliche Ze t gerichteten Adhgen, zieht es zur kargen Krze,
zur taciteischen archaistischen Gedrungenheit und Wucht. Aber
die Gesellschaft, in der er lebt, die Dichtung, die er pflegt und auf
deren meisterliche Ausbung er stolz ist, ist ornamentierend. So
entsteht die ganz seltsame Vermischung von Bildern, die zugleich
zierlich und pathetisch, rhetorisch und inbrnstig, affektiert und
ergriffen ist. Auch seine Tendenz zur Vergeistigung zeigt sich in den
langen Wrtern. ,,Je lnger ein Wort, desto unanschaulicher; daher
geht schon durch die Wurzeleinsilbigkeit der Lenz dem Frhling
vor, ebenso glomm dem glimmte" (Jean Paul, Vorschule
83).
Ein Beleg fr die Liebe der Chordichtung zum einzelnen, schweren, Apposi-
prunkenden Wort und fr ihre Scheu vor Satzbewegung ist zunchst
die hufige Apposition.
P 1, 20 vt96Gra' AtTva, TraveTV]^ yjovo; 6E,zioLC, TtiQva.
Hyporch. fr. 109 gtolgiw etcixotov avsXcov, mvioLC, SoTeipav, kypOLV
XOl)pOTp6(pOV.
Paian 6, 83 xuavoTrXoxoio tzolZSol tzovtiolq SzTioq iaxav, 7clc7t6v
ipxoQ 'A^^atwv.
13, 4 KopivOov, *I(76{xiou Tcpoupov ITocrstSavoc;, dyXaoxoupov.
P 9, 63 YjjovTat TE vtv ocavaTov,
Z^va xal ayvov 'AtcoXXcov', avSpaat )rap[xa (pi'hoiq
(Xyx^"
(JTOV, oTTotova (JLyjXcov.
2, 61 (ttXouto^) d(TTY)p dpi^7)Xo<;, eTi){X(OTaTOV dvSpl pfyyo?.
N 8, 32 t/poi S' pa Tzv.pcpoiGK; ^v xal TrdXai
aiLHjXwv (jLiJcov 6fJL69otTO^, SoXocppaSy)^, xaxoTcotov veiSo;.
Aisch. Agam. 1090 (Kassandra:) [xidoeov jxev ov, ToXXd ctovlcttopx
auTocpova xolxl xal dpTdva<;
dvSpo<; CTCpayeiov xai tteSov pavTYjoiov.
Oft werden dabei in der Richtung auf den S. 19, 66 besprochenen
Hang zur Vergeistigung Abstrakta fr die Person oder den Gegen-
stand eingesetzt, oder es steht die Handlung fr den Handelnden.
P 4, 250 MyjSetav
xdv ricXiao 9ov6v, wie es schon bei Homer
von der Lanze heit Ilr^Xiou ex xopu9^^, 96VOV (jL(xevat YjpcoecjCTtv
90
Die Sa^fgung.
n 144, derselbe Vers T 391, Pindar ist wohl durch den Anklang
PeliasPclion mitveranlat.
N 10, 9 piavTtv OixXetSav, ttoXsjxoio vicpoc;, vgl. Wilamowitz zu
Eurip. Herakles 1140,,da ist er berckt von einem trichten Rhaps-
oden, der Ilias P 244 eingeflickt hat, so da ttoXsjxoio ve9o^ auf
Hektor zu gehen scheint". Mir scheint der Ausdruck in seiner sub-
stantivischen Gedrungenheit und seinem wuchtigen u^oc, so ur-
pindarisch, so auf einer Linie mit allem hier Angefhrten, da ich
die Worte nennt einmal in absurder Weise den Amphiaraos 7coXe(xoto
vscpoc;" zu unfreundlich finde. Pindar kann nicht verpflichtet werden,
homerische Stellen, die ihm einfallen, nachzuschlagen, philologisch
einwandfrei zu interpretieren und nur unter Wahrung des ursprng-
lichen Sinnzusammenhangs zu verwenden; vgl. brigens A 274.
2, 6
0Y)pcova oTTtv (so Wilamowitz) Sixaiov ^svcov epsLCTfx*
*
Axpa-
yavToc
(das Scholion vergleicht T 229 lpxo<; 'A^aLcov) eucovij-
fjLCOv TS Tcarspcov wtov opoTioXtv.
Aischyl. Suppl. 41 ff. Iviv t' avovofxov tolc, Tupoyovou ocx; s^
sTTtTvotac;, Ztjvo^ zcpoL^iv, dazu Wilamowitz, Aischylos, Inter-
pretationen S. 28.
Ag. 109 'Axatcov St0povov xpocTO?, *EXXao^ v^a? $6fjL9pova
Tayav.
Choeph. 235: Elektra beim Erkennen Orests
6i 9tXTaTOV (jteXTjfxa Swfxaaiv 7raTp6?, SaxpuTO; eXtcI^ aTclp-
[lOLTOc; awTVjptou.
Agam. 1371 eOuaev auTOu TuatSa, 9iXTaT0v efxol wSiva.
1364 (ScTToXtg S' ecjTj, [iiGoq optfxov aGrToZ<;.
Soph. Phil. 991. Elektra 289 (xtcjyjfjLa
i).
Im Deutschen lt sich vergleichen 'er ist ihr Schwrm, ihre
stete Sorge, ihr ganzes Glck, du meine Wonne, du mein Schmerz'
(Rckert). Auch Ta TuaiSixa ist eine solche pluralische Abstraktion
(S. 24),
Hamlet: Schwachheit, dein Name ist Weib.
Solche Abstrakta fr den greifbaren Trger sind sonst als kraft-
voll und nachdrcklich beim Schimpfen gebruchlich B 235 xax'
XYXa(E787;
0228; 260);
p4467i:YJ[j,a;r42X(o7),
im Lateinischen
scelus malum pestis opprobrium labes, im volksmigen Deutsch
du Laster, du Schrecken'*.
1) Bruhns Sophokles-Anhang S. 138 f. Deutsche Beispiele Waag S. 97.
Apposition.
g\
Diese Verdichtungen ganzer Stze zu Nomina stellen den Hang
der Chorpoesie zum Substantiv auf dem Gipfel dar. Auch Heraklit
hat mitunter diese paradox unverbundenen Appositionen fr. 29, 30,
51, 52. Karl Reinhardt, Parmenides S. 217, schreibt ber Heraklits
Stil: fr. 1 Tou Xoyou touSs e6vT0<; asl a^iJveTOt ytyvovTaL (5cv6po)7rot.
Die merkwrdige Prgung und Spannung Heraklitischer Stze
beruht zum nicht geringen Teile darauf, da die Satzglieder als weit
strkere, selbstndigere Krfte wirken, als es die sptere rhetorisch
durchgebildete Sprache vertrgt. Man mu, um solchen Satzbau
zu verstehen, imstande sein, im Subjekt die Antithese seines Prdi-
kats, im Attribut die Antithese seines Verbums zu empfinden.
In spterer, verstndlicherer Stilisierung wrde der erste Satz un-
gefhr lauten: 6 [izv "koyoq oSe scttiv, avpcoTuot S' ouSetcots ^uviaaiv
auTv.** Eiese Appositionen erscheinen gehuft mehrmals in den
hymnischen Anfngen:
N 1 *'A(X7rveu(jLa asptvov 'AX9eou,
xXstvav SupaxocTcrav aXoi; 'OpTuyia,
SefxvLov ^ApTEfjLtSo;, AaXou xaatyvyjTa;
ebenso P 2; vgl. sonst Aisch. Ag. 356 ^ Zsu aaiXeu xal Nu^ (piXta,
jxsyaXcov xoafxcov XTeareLpa; Soph. Aias 695; Antig. 100.
Das ist in vercfichteter Form die Weise der hymnischen Dichtung,
Anrufungsformeln und Lobpreis durch aneinandergereihte Partizipien
zu geben, Aretalogie als Anrede im Du-Stil, wie sie Pindar auch selber
in hymnischen Versen formt ^): O du, der du die usw.
5, 17 (TcaT7)p u4'tv9y]<; Zeu, Kpovtov t vatwv X6(pov Tifxcov
T *AX96v.
P 1, 38 Aijxts xal AaXoL* avaacrcov
OoLe, Ilapvaacrou ts xpavav KacjTaXtav 9iXeo)v.
Auch Sive-Sive-Stellen fehlen bei ihm nicht: Hymn. fr. 29, J 7, 1 ff.,
(Norden 144 ff.) Bakchyl. 18, Iff., Paian 9, 13 ff. (da werden ebenfalls
dpETat hin und her erwogen). Nahe steht die hufende, reihende
Anrufung vieler Gtter, wie Jason P 4, 194 ff. beim Abfahren der
Argo betet, oder die ersten Worte des aischyleischen Prometheus
in seiner einsamen Qual 88 ff.
') Norden, Agnostos Theos. Leipzig 1913. S. 166 ff. Reifeenstein,
Neue Jahrbcher 31
(19i3)
S. 153 f.
92
Die Sa^fgung.
d> ^loc, atYjp xal Tax^'^crepot Tivoat
TuoTajxcov TE TrYjyal ttovtlcov ts xu^loctcov
avyjptfxov yeXacrpLa;
vgl. Alphabet in Mystik und Magie (In Vorbere'turg). Dadurch er-
hlt das Ganze einen hohen Ton der Anrufung, eine liturgische Hal-
tung, die Verse bekommen etwas Rufendes, Hymnisches.
Bezeichnend fr die antike dichterische hohe Sprache berhaupt
ist ein Zurckdrngen des Verbalen durch Setzen der Partizipia
oder Weglassen der ,,Copula**. Wenn der antike Mensch den hohen
Ton auflegt und feierlich wird, so will er das Sein, das Eleatische,
die Substanz, seiende schne und groe Dinge. Das ist ihm das
Wesentliche, nicht wie uns Nachchristen und Germanen die Begriffs-
kreise Funktion, Leben, Werden, Richtung, Entwicklung, Ferne,
Unendlichkeit, Zukunft. Selbst in der Prosa ist es hnlch. Die
Verba knnen in den anfken Sprachen nicht so schrankenlos und
ohne Mittelglieder mit belebgen Sub- und Objekten verbunden
werden w'e in den modernen Sprachen. Spengler, Der Untergang
des Abendlandes,
1918, S. 612 west darauf hin, da man lateinisch
nie sagen knnte: e'ne Industr'e erschliet sich Absatzgebiete, der
Rat'onaUsmus gelangt zur Herrschaft.
Die Form der dichten Appositionen erinnert mitunter an die
Kenning und lt Pindar den altnordischen Skalden hnlich erscheinen,
deren Dichtungen ja oft geradezu ein Mosaik nebeneinander gesetzter
Worte darstellen. Auf beiden Seiten handelt es sich um eine ziemlich
unberhrt gebliebene, geschlossene W^elt auf mittelalterlicher, stndi-
scher Stufe.
Ein Grund fr die vorwiegend nominale und statische Ausdrucks-
weise der strengen Chorlyrik ist auer der Primitivitt ihres sprach-
lichen Materials die Beschaffenheit ihrer musikalischen Seite gewesen.
Von daher ist wohl die au(jTY)p6(; apptovta in der europischen Literatur
zum erstenmal aufgekommen
das Epos ist denkbar euxpaTo;.
Die Art der Auffhrung knnen wir uns gar nicht archaisch und
gebunden genug vorstellen. Der Rhythmus der Verse war
soweit
wir wissen
nicht mannigfaltiger, als da ganze und halbe Taktteile
wechselten. Jedenfalls war es undenkbar, da etwa eine inhaltlich
wichtige Silbe
6-
oder 8 mal lnger ausgehalten wurde als andere blo
syntaktisch notwendige
wie das in unserer Gesangsmusik seit
vielen Jahrhunderten mglich ist. Eine archaisch einfache Rhythmik
herrscht im griechischen Gesang, die eine Lngung, d. h. Hervor-
Chorische Sa^rhythmik.
93
hebung sinnbetonter Worte ausschlo. Diese Starrheit wurde dadurch
verstrkt, da der Unisono-Chor einem Leiter unterstand, der jede
Lnge durch taktierendes Aufstampfen mit dem Fu bezeichnete
(Lukian, de saltat 10). Man darf also behaupten, da die musikalische
Seite der griechischen Chorlyrik betrchtlich hinter der dichterischen
zurckgeblieben ist. Das zeigt sich auch darin, da es
den Dithy-
rambos ausgenommen
nirgends zum Durchvertonen gekommen
ist. Wenn also Pindar einen siebenstrophischen Paian schuf, so war
die literarische Leistung rein rumlich siebenmal grer als die
musikalische; denn die Melodie war in jeder Strophe die gleiche*).
Wenn ein Chor so streng im Takt singt und der Takt noch durch
die Schritte der Snger stark unterstrichen wird, so mu der Text-
dichter darnach streben, die Worte gleichmig auf die Takte zu
verteilen. Das spielt natrlich so lange keine Rolle, als der Chor ein-
fache Litaneien zu singen hat. Es wird aber mit dem Augenblick
schwierig, wo der Chordichter den Ehrgeiz hat, mannigfaltig neu
und pomps zu reden. Man sollte jedes Wort dieser Dichtungen
singen knnen, und Betende, die den Gott und den Heros priesen,
sollten es in den Mund nehmen: das war die groe Anforderung, die
die Zunft der Chorlyriker an die sprachliche Schpferkraft ihrer
MitgUeder stellte. Partikel und grammatisch-logische Konjunktionen,
berhaupt alles, was dem Bau des Satzes dient, entging sicherlich
dem Ohr leicht bei der uerst archaischen fremdartigen Weise des
Vortrags. Die glnzenden, inhaltschweren Worte, tonvolle, krftige
Wurzeln, die seltsamen ^nzlcd "Ki^eiQ waren das allein angemessene.
Es geht nicht an, auf einen Taktteil zu singen 0LV0i^i(f6pyLiyyzq, dann
auf einen musikahsch ebenso wichtigen ol S' oxe St), tov S* o)^ ov,
^
pdc VU TOt.
Der Chorlyriker meidet die logischen Partikeln bewut und ist
nicht etwa unfhig zu ihrem richtigen Gebrauch: wo er sie gebraucht,
tut er es mit Bndigkeit. Man darf einem einzelnen Chorlyriker
wie etwa Pindar nicht die Fhigkeit absprechen, Stze logisch zu
verknpfen. Wenn die Chorlyriker diesen Zeit und Raum schluckenden
Kitt des Satzbaues auf das ntigste einschrnkten, so erstrebten sie
vielleicht etwas hnliches wie Richard W agner, als er zum Stabreim
und zu dem schwer wuchtenden Wortstil der Edda griff, der ihm fr
seine reckenhaftesten Gestalten allein eine hinreichend kraftvolle
Deklamation zu verbrgen schien. Die Chorlyrik knpft das Gebinde
') Croiset, La po6sie de Pindare S. 85.
94
Die Sa^fgung.
des Satzes auseinander und gibt dem dadurch
losgelsten, vereinzelten
Wort greres Gewicht, daher die sonoren und
pittoresken Worte,
die zugleich Ohr und Phantasie fllen. Die Musik trug diese isolierten
Worte und gab ihnen das ntige Relief, so da die Partikeln entbehr-
lich waren 1).
Man soll nicht ein Naturwunder darin sehen, da die
Griechen
die erhabenen Gedanken des Aischylos und Pindar in knstHch
dunkelster Form bei Oratorienauffhrung zu apprezieren
befhigt
waren, sondern sich klar darber sein, da das einzelne inhaltschwere
Wort fr sich als Bild wirken soll, als Klang, als Ort, als Begriff
und. die ganze Reproduktion weniger einen gedanklichen Fortgang
erstrebt, als auf das Ohr und das innere Auge wirken will. Populr
will die Chordichtung, namentlich Pindar nicht sein. Wenn die
Kenner es nicht wrdigten, der Gott wrdigte sicher die Feinheiten
und die daran gesetzte Ergriffenheit des Dichters. Fr ihn sind sie
da, wie die Rckseiten der Giebelplastiken, die ebenso treu und
sorgsam ausgearbeitet sind wie die Vorderansicht, obwohl sie nie
ein Sterblicher sieht. Dasselbe finden wir ja in der religisen Kunst
des Abendlandes, an den Kathedralen wie in der streng polyphonen
Musik2).
^^zeh-^^
Den alles beherrschenden Hauptwrtern stehen seltsam farblose
Wrter.
Zeitwrter gegenber. Es kommt in vielen Fllen auf pompse
Ersatzverben fr sein** hinaus. Die Epinikien, im weiteren berhaupt
die meiste Chorpoesie ist ein Anreden, ein feierliches Nennen, aus
dem Pathos des Preisens und Betens geboren. Es ist ganz natrlich,
da da die Hauptwrter die Ttigkeitswrter berwiegen.
Ein Lieblingswort der Chorlyriker ist mischen, ebenso die ver-
wandten Begriffe berhren, begegnen, hinzusetzen.
ofJLiXsiv J 3, 6 6Xo(;
TiXayEai^ Ss cppeveaCTiv ou^ 6(xaj<; TiavTa
)(p6vov aXXcov o^i-iXst.
Bakchyl. 1, 50 tiXoutoc; Ss xal SeiXouaLV dvpcoTuoLi;
OpltXsL.
N 1, 61 TTotat^; ofjLtXvjcTst tiSx<^^^-
N 10, 72 x^XsTa
3'
epic, avpcaTrotc; ofxiXetv xpeacjovcov.
Soph. Ai. 1201 (jLoi Tept];tv ofitXetv.
) Ebenda S. 129.
2) Zeitschrift Rheinlande 19 (1919) S. 200.
Farblose Zeitwrter.
QS
(jLsCyvujjLt J 3, 3 euXoytai^ aaTCov [iz^LzlxQoii; N 1, 17.
J 2, 28 aavocTOti; AivTjaLSccfxou ncd^zc; ev Ttfjtalc; epLet-
N 2, 22 oxTO) GTe(p6iyoic, sfxsixsv
t^St).
N 4, 21 KaSfjLSLOL viv oux asxovTsc; cvsai (jLeEyvuov.
1, 90 ai{xaxoupiai(; ayXaalcri (jLefxetxTat.
P 5,19 aiSoiEGTaTOv yepa<; Tsa touto fxetyvijfjLsvov cppevi.
Komposita davon:
l7tt(xeiyvu(xt N 9, 31 ayXataiat
8*
ddTUvojJiot^ ETrifjLet^at Xaov.
jjL(jietyvu[i.t P 4, 201; vgl. Soph. Oed. Kol. 1057.
au(x{xe(yvu(xt P 9, 72 euOaXeZ auvefiet^e Tu^a.
TTpoajxeCyvufXL 1, 22 xpocTet, Trpocrsfxst^e SsdTroTav.
Soph. Trach.
^
olov 7rpoc7e(jLi$ev &(p(x.p tottoi; t6 6eo-
TTpOTUOV.
xepavvufJLi P 10, 41 voaot S' outs yvjpai; ouXofxevov xexparai
Ispql yevea Y)(xtv.
10, 104 topa TS xexpa[i,evov, a ttots dcvaiSea Favu-
(XYjSet avaTov (ScXaXxe.
P 5, 2 6 ttXoutoc; eupuaevY)^, xav tk; apcT? xexpa-
{xevov xaapql
xotvdtci) N 3, 11 eyo) Se xetvcov ts vlv 6apot<; Xijpoc ts xoivaaro(xat
vgl. P 1, 97.
Bakchyl. 15 , 49 euneTz'koiai xotvaxra; Xaptcrt (das
fllt uns nicht weiter auf, weil zufllig im Deutschen
mitteilen denselben Sinn hat),
^uvdcciiv P 3, 47 6aoi (jloXov aurocpUTOv sXxecov ^uvaovec;.
dtvTiao) J
6, 14 Totaiatv opyat; e^sTat avTtaaat?.
Aisch. Suppl. 38.
auvavradai O
2, 106 ou Stxa auvavTOpLevo^;, aXXdc (jLocpycov utt'
avSpwv; J 2, 2.
TTpotJTtevat N
3, 68 6^; tocvSe vadov euxXet Trpocrlvjxs Xoycp.
Lyyavco P
8, 22 a SixatoTToXi? apexaL^; xXetvaccjiv AtaxiSav
tyoLCTa vac70(;.
J
1, 18 ^v t' aeXotcrt 6(yov ttXe^cjtcov dycovcov.
P
4. 296
V^X^a iy^fzev.
^/aiSci) N
5, 42 tuoix^Xcov
eJ;au<ja^ upLvwv.
J 4, 10 jxapTUpia dcTcX^Tou S^a^ ETue^aucrav xard ttocv
teXo;.
96
Die Sa^fgung.
scpocTiTCo O 9, 60 TTOTfxov k,(f6i']j(xiq opcpavov ysvsa<;.
1, 86 ouS' axpavTOL; e9a4'aTO ztzzgi.
TisXa^w O 1, 78 xpocTSL Ss TrsXacrov.
Bakchyl. 9, 38 crco];jiaTa [rcpog yjxia 7reXa(T(ja(;
=
nieder-
ringen
;
11, 33 TzoixiXoLic; Ts^vat^ TrsXacrcysv.
Diese Worte sich mischen, berhren, begegnen usw. stehen fr
jede Relation, fr jede Verbindung und knnen alle Beziehungen
bezeichnen. Es liegt darin etwas Gehaltenes hnlich wie auf vielen
griechischen Reliefs, die Kmpfe oder irgendein Beisammen von
Menschen ausdrcken. Was z. B. auf dem Neaplcr Orpheusrelief
zwischen Orpheus und Eurydike vorgeht, ist ein solches sanftes
LysfJisv.
Eine Erinnerung weckt die andere, manches fordert eine Er-
klrung, eine widersprechende Korrektur, eine Nutzanwendung.
So spinnt sich der Fden weiter im strengen Rhythmus des Tempel-
reigens, so da sich der Hrer, dem inhaltlich alles vertraut ist, wie
beim Genu einer Musik tragen lassen kann, ohne durch irgendetwas
Unlyrisches
eine Partikel, eine Floskel
von der schmalen,
geraden Linie zeitweise abgezogen zu werden. Inhaltbeladene Worte
werden wie Bilder nebeneinandergestellt mit Bedacht von einem
besonnenen Meister dekorativer Kunst und ergeben eine seltsame,
gebndigte Bewegtheit des Ausdrucks, man mchte sagen, fast
jenseits aller Syntax. Es ist wie ein Friesrelief, ein Zug, ein Komos
ohne Anfang und Ende, oft knnte man die Glieder der Komposi-
tion miteinander vertauschen.
Das Ornamentale der Rede berwuchert das Tektonische. Jedes
Flieen fehlt, der Satzbau scheint mitunter geradezu verschwunden
zu sein. Gewichtige feierliche Worte folgen hart aufeinander, koordi-
niert oder in pompser, dunkler Verschlingung. Die Simplizitt der
Syntax darf jedoch nicht mit Drftigkeit verwechselt werden. Satz
und Satz sind in einer schwebenden Weise aneinandergeknpft:
immer durch kleine Wendungen, die zwischen den rtlichen, den
zeitlichen und den kausalen in der Mitte hangen und dem Ganzen
eine undefinierbare Luft geben wie yap, aXXdc, Ss.
2. Das Beiordnen.
Die beherrschende Satzfgung ist die Nebeneinander-Ordnung
Das Bedrfnis, jedes bereinander von Satzteilen, jede Schachtelung,
Das Beiordnen.
Vergleich ohne wie.
97
zu vermeiden, tritt eben in der Hufigkeit der Apposition und in der
Vorliebe fr farblose Zeitwrter in Erscheinung. Bezeichnend fr das
grundstzliche Nebeneinander der Teile ist das xat, das mitunter den
Schlusatz des Gedichtes bei P. einleitet (P. 10, 69; 4, 298; J 5, 59).
Das Auffallendste an Koordinieren, was die Scheu vor der genauen
vergleich
ohne wie.
logischen Verknpfung der Stze in der Chordichtung bewirkt hat,
ist der Vergleich ohne wie. Die gedankliche Verknpfung der beiden
Vergleichshlften bleibt unausgesprochen. Sie stehen nebeneinander
wie zwei Bilder. Die Sprache ist da sozusagen noch oder wieder
auf der agglutinierenden Stufe.
11, 19 eyyuaCTOfjLai. (X(jllv, ^ Moicjai,
dTparov
dxp6(7096v
TS xal at^M-axav acpt^ecrat. t6 yap
kii(p\je<; out* atOoiv
aXcoTTY]^
I
oT* eplpofjLOL XsovTE; SiaXXdc^avTO ^6o(;.
O 10, 9 vuv t|;acpov eXtacrojjLevav
oTia xu[i.a xaxaxXucyaet peov
oTra T xoivov Xoyov
(ptXav Tei(TO(i,ev s^
X^9^^'
O 2, 108 IttsI ^^dcfjLfxo; apLfxov
TrepiTuscpsuyev
xal xsLVO; Sera xap(Jt,aT' (StXXoic; eOvjxsv
T^; av 9paCTai S6vatT0.
N 2, 6 ocpeiXsL
afjia (jlsv 'IcrpttaScov SpsTTsdOai xocXXlcttov
(SccoTov ev lluioidi ts vixav
Ti(jLov6ou TratS** eaTi S' eoix6<;
opELav ye EXeLaScov
{XY) TTjXoOev *Oapicova vetcrat.
N
4, 82 6
xp^<^o<?
e^'opLsvo^
auya^ eSei^ev aTcacrac;, u(j,vo(; Se tcov dyacov
epyfxdcTcov atrtXeucrtv tcjoSaifJLova xe^xet 9coTa.
P 10, 67 TTELpcovTt Se xal
XP^^^<^
^^ aadvoi TTpsTCEi xal v6o(;
6pe6<;; s. auch N 3, 80 ff.
Epigrammatisch erscheint die Form dieses Vergleichs auch sonst,
die antithetische Zweiteilung des Distichons ldt dazu ein z. B.
Kallimachos epigr. 28
exatpo) t6 TzoiriiioL to xuxXixv ouSs xeXeuOo)
XatpO)
Tic, TIOXXOIL)^ >8e xal Ss CpEpEl.
Diese Form der Vergleichung ist die verkrzte Priamel. Priamel
Priamei.
praeambulum
( = Vorauslauf) ^) nennt man dieses volksmige Auf-
') Euling, Die Priamel bis Rosenplt (Germanist. Abhandlungen Bd.
25,
Dornseiff, Pindars Stil.
7
98
Die Satjfgung.
zhlen verschiedener anerkannter Tatsachen aus der Natur und dem
Menschenleben , um irgendeinem Satz dadurch ein breites Relief
zu geben, eine Art Einleitung ( = praeambulum) zu dem Haupt-
spruch. Der am Schlu stehenden Weisheitsregel laufen eine ganze
Reihe unter sich zusammenhangloser Vorderstze voraus, die aber
alle die Schluregel illustrieren. Aufzhlung von Gipfelbegriffen
verschiedener Art:
11, 1 eaTiv dvOpcoTroic; dveficov ore TcXeicjTa
/P^ctk;' eaTLV S' oupavtcov uSoctcov,
6(xptcov TuatScov ve9eXa<;.
et Se aC)v ttovco tk; e Trpdaaoi.
P 1, 75 dpeofjtai
Tcap (JLEV SaXafxZvo^ 'Aavatcov
x^P^^
(xlctOov, ev ETTOcpTa S* epeco tocv Tipo Kiaipcovo^
M-d^av
Tuapd Ss Tav suuSpov dxTav
*IfjLepa 7a(Se(T(TLV u^vov AsLvofxeveoc; TeXeaai(;.
P 1, 99 t6 Ss Traetv e5 TrpcoTOv deXcov
SU S' dxoueiv SeuT^pa (xoip** d[JL90Tepot!Tt
3'
dvyjp
6^ dv
iyxiipciy) xal eXv) (vgl. J 5, 12 ff.),
fr. 234
1)9* dp(jLaCTLv tTTTuo^
ev S' dpOTptp oijc;' Tuapd vauv S*
Luei Ta^tciTa SeX9t(;
xaTcpw Ss ouXeuovTL 96VOV xtSva
X9^
xXdufxov e^eupeiv.
Das Hyporchema-Bruchstck 106 fr Hieron: die lakonische
Hndin ist am schnellsten, die Ziegen von Skyros geben am besten
Milch, Waffen mu man von Argos, das
dpfxa von Thera holen, aber
das kunstreiche
oxriyiOL
von Sizilien.
1, 1 dpiCTTov (xev uScop, 6 Se xpuGbc, at06(xevov Trup
ocTe StaTTpeTuei vuxtI [izyoLvopoQ e^o/a ttXoutou"
el S' deOXa yaptjev eXSeat, 9tXov ^TOp,
(XYjxeO' dXiou axoTTei
dXXo aXTcvoTcpov ev dpiepa 9aevv6v dcrrpov ep-jQjxa^ 8l* atepoc;,
[jliqS* '0Xu(X7ria(; dyoiva 9epTepov auSdaofjiev.
O 3, 42 et S' dptCTTeuet (xev uScop, XTedvcov Se
xp^<^o<;
alSoteaTaTO;,
vuv Se
0Y)p6)v usw.
hrsg. von Voigt. Breslau 1905). Eine der bekanntesten altgriechischen Priameln
ist das Skohon yiafveiv iih
piOTov usw.
Priamel.
QQ
Parallele: Bakchyl. 3, 85 aC; [ih
aiGyjp a(jL(avTO(;* uScop Se ttovtou
ou CTa7TTat,' eu9poauvY]
8'
6 ^p^cro^
avSpl
8'
(hier zunchst Parenthese *fr den Menschen gibt
es zwar keine zweite Jugend, aber . .
/) apeTa(; ys (jiev
ou (XLVijOei
poTcov (j,a acofxaTi cpeyyo;, aXXa
Mouddc viv Tpecpei.
Ob diesen drei Stellen nicht eine in Sizilien verbreitete Priamel
zugrunde liegt?
1, 111 etxol
(jiv div
Motaa xaprepcoTaTOv iXoc, aXxa Tpe^pei*
XXoKTi S' aXXoi (xeyaXoi* t6
8'
i^xo^'^ov xopu9ouTai aCTiXeudt.
N 1, 26 7rpaa(Ti piev ^pyco [xev aOevo;
ouXatai 8e cppvjv', sacrfxevov Trpol'Setv
cuyyevig ol^ iTieTai.
2, 3 T^va eov, t(v' ^poicx., tIvol
8*
v8pa XXa8Y](T0(Xv; ^roi
HiGOL (JLV Alo^' *OXu(x7TLa8a
8'
^(TToccTEv *HpaxX7]c; .... 07)pO)VOC
Se TTpaopta^ Vxa vtxacpopou yycov7)Tov.
J 5, 30 Iv (jLv AiTCoXwv ucrtatdt (pavvat<;
0LVt8ai xpaTpoi,
iv 8 07)ai<; tTUTroaooc^ *I6Xao(;
ylpa^
eX^^
EpciEi)^
8'
v "ApyEi, KacjTOpo;
8'
at^f^o^ HoXu-
8UX0<; t' 7u' EupcoTa pEEpot^.
dXX' V Otvcova ptEyaXvjTopEc; opyai
AJaxou 7rai8cov t*
Sappho Oxyrh. pap. X 1914 nr. 1231 ol [ikv f7r7rY)Ov crrprov ol
8 7Tct8cOV, ol 8 VCXCOV 9aLCj'7cl yOtV (JlEXatVaV E(X(JLVai XaXXlCTTOV,
lyw 8 xrjv' ttco tk; Eparat.
Das Chorlied Aischylos Choeph. 585 ff., das mit seinen drei Belegen
aus der Sage (Althaia, der Dalila Skylla, den Lemnierinnen) sehr
im Stil der alten selbstndigen Chordichtung gehalten ist, beginnt
mit einer feierlichen Priamel ber das, was in der Welt 8lv6v ist.
Ebenso Sophokles Antig. 332 TcoXXa toc 8i:va, d. h. dirus und tremen-
dus, schlimm und imponierend, gewaltig und seltsam, wunderlich
und bewundernswert, grauenmachend und faszinierend, gttlich
und dmonisch, 'energisch*, das Gefhl numinoser Schon wockcMidi).
') Rudolf Otto, Das Heilige. Breslau 1918. S. 44.
100
Die Sa^fgung.
Aischylos gibt da, worauf W ilamowitz zu der Stelle hinweist, die
volksmige Vorform zu dem, was spter in der griechischen Wissen-
schaft" die Lehre von den vier Elementen gegeben hat, er zhlt die
Schrecknisse des Landes und des Meeres,' des Feuers (Blitz) und der
Luft (Winde) auf, die der Mann mit seinem Wagemut, das Weib
mit seiner Liebesleidenschalft dennoch bertrifft. Sophokles lt
den Chor den bisher erreichten Fortschritt in der Zivilisation besingen:
Schiffahrt, Ackerbau, Vogelfang, Jagd, Zhmung der Haustiere,
Sprache, Stdtebau, und warnt vor berhebung. Das ist alles klang-
voll, leibhaft, bunt, aber in seiner Dinghaftigkeit von etwas kind-
licher Primitivitt. Der Sophokles besonders ist seit den technischen
Errungenschaften der Neuzeit nicht eindringlicher geworden. Da
haben sich Psalmenstellen besser gehalten, z. B. 8, 5 ff. und 19. Da
verblat der Grieche wie etwa ein Franzose des 17. Jahrhunderts
gegenber Shakespeare.
Verwandt ist auch die Durchmusterung von Berufen und
Neigungen in der Diatribe und der rmischen Satire (sunt quos
curriculo) und in der Elegie, der das Spruchmige, Bedchtige aus
ihrer lehrhaften Zeit nachhngt bis in die vertrumtesten Tibull-
gedichte. Divitias alius fulvos; Prop. II 1, 43 navita de ventis, de
tauris narrat arator. Noch in der neugriechischen Volksdichtung
ist die Priamel behebt
i).
In der Reformationszeit blhte die Priamel als eigene Dichtungs-
form. Sie hat etwas Meistersngerliches an sich.
Es liegt in dieser
Form eine volksmige, kindliche Einfalt:
Wer Dirnen vertraut sein Rat,
den Gnsen seine Saat,
den Bcken seinen Garten,
der darf des Glckes nicht warten.
Diese Wiederholungen derselben Begriffe in immer neuen Formu-
lierungen oder Aneinanderreihungen zusammengehriger sind in der
altgermanischen Poesie sehr beliebt (vgl. R. M. Meyer, Altgermanische
Poesie S. 433
f.)
Man ist da nicht weit von den Gipfelfragen in der
frhen Rtseldichtung, etwa im Traugemundslied, Uhlands Volks-
liedersammlung I, 1, dazu die Abhandlung III, 137 Cotta:
*) Vgl. aus Politis, ExXoyV):
va fxouva xal TpayouStaTTj; Mv f^eXa XXt]
'/J^?^'
Priamel.
\Q\
waz ist wisser denne der sne?
waz ist shneller denne daz rech?
waz ist hher denne Berg?
waz ist finsterre den die naht?
Antwort Sonne, Wind, Baum, Rabe.
oder den Zahlensprchen
i),
z. B. Sprche Salomos 30, 15 ff.: Vier
sprechen nie: genug! die Unterwelt und der unfruchtbare Mutter-
scho, die Erde, die des Wassers nie satt wird, und das Feuer; vgl.
Sirach 25, 1;
7
10; 26,5 und 28; 50, 25; Pindar J 5, 12: Zwei Dinge
sind das schnste ei Tic, e Tuacr^wv Xoyov eaXov axo6y}. N 3, 70 ff.
Aber das Fehlen von Zwischengliedern, das nebeneinanderstellende
Aufzhlen ist auch wuchtigen Pathos fhig, s. etwa Psalm 104, 28:
Du gibst ihnen, sie lesen auf;
Du tust deine Hand auf, sie sttigen sich mit Gutem;
Du verbirgst dein Antlitz, sie werden bestrzt . . .
er schauet die Erde an, sie bebet;
er rhret die Berge an, sie rauchen.
Asyndetische (xeyaXoTcpeTTeia, Aisch. Choeph. 71, Eurip. Androm,
637, Phoeniss. 847, Herakles 101, dazu Wilamowitz Herakles H^,
24 u. 233.
Und verbunden mit italienisch befeuertem und beredtem amore
kann die Priamel auch so aussehen (Heyse, Italienisches Lieder-
buch, hinreiend schn vertont von Hugo Wolf):
Gesegnet sei, durch den die Welt entstund,
Wie trefflich schuf er sie nach allen Seiten.
Er schuf das Meer mit endlos tiefem Grund,
Er schuf die Schiffe, die vorbergleiten.
Er schuf das Paradies mit ewgen Lipht,
Er schuf die Schnheit und dein Angesicht.
Es soll der Gedanke ausgedrckt werden: was anderwrts in
der Natur, im Leben so ist, ist hier so . . . Dieser begriffliche Vor-
stellungsweg wird nun sehr bildhaft, krperhaft gegeben. Die Sprache
bleibt der Wirklichkeit nah bei Dingen und Leibern, die griechische
Wortfreude, die Lust am Rednerischen kommt auf ihre Rechnung,
und es wird zugleich statt der form- und grenzenlosen Denkbewegung
eine ebenmig geteilte, gegliederte Fhrung des Gedankens erreicht.
') Buchstabenmystik. Heidelberger Dissertation 1916 S. 29 f.
102
Die Sa^fgung.
Es ist dieselbe Besonderheit der griechischen diesseitig und sinnen-
haft gerichteten Seele, die die sog. polare Ausdrucksweise ^) liebt,
jene Eigentmlichkeit der griechischen Rede, da es oft fr ,,alle"
heit Gtter und Menschen, Frauen und Mnner, Brger und Freunde
(z. B. P 4, 78; 7, 90; P
5, 56), fr berall" auf dem Land und auf
dem Meer (z. B. J 5, 5),
fr immer" bei Tag und Nacht, in Glck
und Unglck. Immer wieder kommen diese gleich gebogenen Hlften,
auch in der Formung der SpruchWeisheit (s. unten S. 132).
3. Wortstellung.
Ein anderes Mittel, um dem Unisono-Gleichschritt der griechischen
Chre mglichst die Eintnigkeit zu nehmen, ist das Ausnutzen der
unbeschrnkten Mglichkeiten in der Anordnung der Worte. Schon
in der Prosa ist das Verhltnis zwischen gestaltfreudiger Anordnung
der Worte und der Reihenfolge, die die Strenge des Gedankengangs
bewirkt, in den antiken Sprachen anders als in den modernen. Heute,
besonders bei uns Germanen, berwiegt die Logik die Rcksicht
blo auf die Sache, der gedankliche, begriffliche Bogen, der den Satz
spannend berwlbt; Subjekt, Prdikat, Objekt. Im Nebensatz
das Prdikat zuletzt. Alle Attribute vor dem Beziehungswort. In
den alten Sprachen herrscht mehr der Lauf des Gedankens, die Reihen-
folge ist freier, impressionistischer, geselliger, mehr auf den Zustand
des Hrers zugeschnitten, rednerischer. Ferner: das einzelne Wort
hat noch mehr Gewicht, mehr Klang, Bildhaftes, Krperliches, ist
noch nicht so abgegriffen wie bei uns, die wir schon ber 2000 Jahre
lnger reden. Ganz zum Schlu, beim Senken der Stimme, kommt
die syntaktische Formung ganz leicht und lssig esse existimetis",
esse videatur"^).
Was nun insbesondere der Gattung der Chorlyrik ganz fremd ist,
ist das Benutzen des Satzes, nicht der Worte als Ausdruck, wie es
in Prosa, im Epos, in der Einzellyrik, in aller scharf zuspitzenden
und steigernden Darstellung der Fall ist. Wir nehmen im Leben
fast stets nicht die einzelnen Worte begrifflich auf, sondern den Satz.
Das ist hier ganz anders: die Griechen haben da ein Ausdrucksmittel,
') Ernst Kremmer, Die polare Ausdrucksweise (Schanz' Beitrge 14).
Wrzburc; 1903. S. 257 ff. v. Wilamowi^ zu Eurip. Herakles 1106. Bruhn,
Sophokles-Anhang S. 134.
)
Salomon Reinach, Manuel de la philologie classique. Paris 1907.
S. 157 f.
Wortstellung.
103
ein ganz besonderes Pathos, einen neuen Ton gefunden, der in der
europischen Literatur sich als hoher Odenton immer von Zeit zu
Zeit meldet.
Das wesentliche Merkmal der Anordnung der Worte in der griechi-
schen Chordichtung ist das Fehlen jedes Ebenmaes grerer Gruppen,
wie der ausfhrlichen Antithese, der Entsprechung der GUeder in
den Psalmen. Das einzige Zugestndnis, das dem syntaktischen
Gleichma gemacht wird, ist die Anapher, die Wiederholung des
Anfangswortes. Auch sie kommt nicht oft, sie ist zu symmetrisch.
J 8, 15
x?y]
S'
XP^
S' ebenso J 3, 8;
Dithyr. fr. 75, 18 f.
axet
T
axet TS Oxyrh. pap. XIII Vers 10 dreimal ev Se O 14, 6
1 G0(p6<;, ei xaX6<; et Tic; ayXao^; avyjp Bakchyl. 3, 15.
.
J .5, 32 aiveoiv
aivecov Se.
11, 27 Tcecpve
Tcecpve 8e. Bis zu einem gewissen Grad kann
man auch solche mit {xev
Se hinzurechnen J 6, 71 (jieTpa
jjtev
fjLsTpa Se 13, 14 TcoXXa {xev
TioXXa 8e P 9, 123,
N 11, 6, N 11, 3 eO fxev
e Se N 1, 63 6ggo\j(; [ikv
6ggo\)(;
U N 10, 27
xpU H-ev
xplc; Se N 10, 87 i^fjLiau jiev
yi^ligu U.
Die Antithese verlangt Satzkurven, die die Kunst der inhalt-
schweren einzelnen Worte nicht gibt. Und auf kleinen Raum ge-
klemmt ergben Antithesen gorgianische taoxcoXa, das wre dann
blo niedlich, Tcaiyviov^). berhaupt jedes Ebenma im Sprach-
lichen und in der Gliederung der Teile meidet die pindarische Dich-
tung, wie um dem stark ausgeprgten musikalisch-strophischen
Parallehsmus das Starre zu nehmen und ihn durch Buntheit zu
bertnen. Gem der kurzatmigen Rhythmik mute auch die
Diktion des Textes kurzatmig sein, es mute mgUchst viel Text-
inhalt auf kleinen Raum zusammengedrngt werden, denn ein Er-
fassen grerer Zusammenhnge war undenkbar.
Symmetrie wird gemieden. Zwei parallele Glieder werden stets
mglichst unsymmetrisch ausgedrckt, gern chiastisch. Die Kentauren
P
2, 48; Ta ixaTp6ev [ibj xoctco, toc S* UTrepe 7caT?6(; P 10, 38.
Die drei Enkel der Rhodos werden 7, 74 folgendermaen aufgezhlt:
v (von den Shnen der Rhodos) eI; (xi:v Kdtjxipov 7rpeauTaT6v
') So tadelt Demetrios uipl 4pfxr|vefac
250 die demosthenische Stelle hiUii
ijoi
8'
^ajpiTTov. Derartiges tte jede ^tiv6xr^i.
104
Die Sa^fgung.
TS 'laXuorov ^'texev AtvSov t. In der Anrufung der drei Chariten
O 14, 13 kommt die dritte sehr nachtrglich.
Ein Glied nominal, das andere verbal.
J 5, 36 crrofievot *HaaxXel' TipoTepov, xal ct6v 'Axps^Sai^.
6, 17 ajxcpoTEpov (xdcvTtv t' ayaOov xal Soupl (Jiapvaaat.
Selbst wenn dieser Vers in der Thebais gelautet hat: xal ^oupl
fxaxeaai,
wie Bethe^) will, so ist noch ein Stieben nach Vermeidung
der epischen Formel festzustellen Aber Schroeder proll. 46 wird
wohl recht haben, wenn er ein solches asymmetrisches Ausbiegen
dem Epos nicht zutraut, und annimmt, was v. Wilamowitz als episches
Vorbild dichtet: afjL96Tepov [iolv'ziq (oder aaiXsiJc) t dya^^ xpa-
Tep6(; T*
atxf^TQ'T'yj^;-
2, 73 Ta ijLEV xep<7o6sv
Swp S' XXa (pcpei.
Ein Glied adjektivisch, das andere substantivisch:
P 12, 9 Tcapeviotc; t' utto t* oltcXoltoic, 691007 xecpaXai^-
Weitere Belege Bruhns Sophokles Anhang S. 124.
Ein Glied xuptco^, das andere umschrieben:
P 3, 50
7]
sptvw Tuupl 7rep66fXVot Sefxac
^
xeifxcovi.
P 1,72 6 <I>oivi5 oTupaavcavT aXaXaTcc;. 10,23 x-pG^^vT^TToScovapeTa.
Nur ein Glied hat ein Beiwort (vgl. S. 105 ber dtTui xotvou):
N 5, 2 sttI tzolgolc, oXxaSoc iv t' axdcTCO.
Aisch. Eumen. 919 xal Ze^c; 6 TrayxpaTrjc; "ApYj^ re.
In der deutschen Volksdichtung ist oft das zweite Glied von zwei
parallelen das ausfhrlichere: der Reif und auch der kalte Schnee,
bei Met und khlem Wein, Laub und grnes Gras, Silber und rotes
Gold, Kummer und groe Not. Beyer, Euphorion 1919, 358, dem
ich diese Beispiele entnehme, erklrt diese Besonderheit aus der
Metrik. In der griechischen Dichtung ist eher das erste Glied ge-
wichtiger, aber nicht so, da man eine Regel aufstellen knnte.
Verg. Aen. 2, 195 quos neque Tydides nee Larisaeus Achilleus.
Singular und Plural: N 7, 37 Sx6pov \ikv ajxapTe, TuXayxOevTe^ S*
elq 'Ecptjpav ?xovto.
Unterschiede in der Verbalform:
P 10, 17 ETTOLTO [LolpoL xal ttXoutov dvOetv arpiaiv.
N 9, 32 EVTL TOI 9iXi7C7TOL T auToi xal xTcavcov ^uxoi.(; exovte^
xpe(T<Jova(; avSps<;.
1) Thebanische Heidenlieder 1891, 58f., 94ff.; Rohde, Psyche* I 114.
Asymmetrische Wortstellung.
105
1, 12 SpETuwv (xev
dyXat^eTai Se xal.
J 3, 11 Se5a{JLvcp ote^ocvou;, ra Ss
xapu^e.
P 4, 266 eiTTOTe IHixr^Tat
ri
(xyLCfiTzti.
P 8, 77 aXXov uTrepee aXXcov -XXov 8e xarapaivst.
J 5, 13 El tk; EU Tiaayov Xoyov ectXov axour. Ca ist vorher sehr
ausfhrlich gesagt: jetzt nenne ich die zwei schnsten Dinge. Aber
auch die setzt er nicht symmetrisch nebeneinander, sondern sub-
ordiniert sie zu einem einzigen.
Sehr willkommen ist das oltzo xolvou, um dem Ebenma zu ent-
gehen. \\ il. 7\i Eurip. Herakl. 237 umschreibt diesen Sprachgebrauch:
ein Satzglied, das fr zwei Stze unbedirgt ntig ist, steht erst
beim zweiten.
N 9, 14 Trarpicov otxcov a7c6 t "ApYEo;; 22 yaXxEOL<; oTuXotatv
inizzioic le g^v ^'vtecjlv. Parallele Sprachformen werden abgendert.
Das erste oute oder aiTc bleibt weg, das zweite strahlt seine ver-
neinende Kraft nach vorn. P 10, 29 vaual S* o'jts ne^oq icov xev
cpoic (mehr Belege Waldemar Loebe, De negationum bimcmhrium
usu, Berliner Diss. 1907, 58); 11, 16. Auf ein
fxsv
folgt oft ein ts
t
6, 4 ff.; 8, 88; 5, 10 ff. oder gar ein tj wie J 8, 35; 1. 104 oder
auf ein te ein Ss:
P 4, 79 iodoLq
8*
a[Jt,<poTpa vtv e/ev,
a TE MayvYjTCov ETcix^opio^
, ajAcpl Ss
aTsysTO.
N 9, 43 TcoXXa asv sv xovta yspao), xa 8e.
Das erste GHed fehlt:
P 9, 65 'AypEa xal Nofxiov, toi?
8*
'ApiaTaiov xaXstv (fehlt
Tot; fXEV).
P 3, 91 TTo* *ApfjLovtav yafXEv ocoTriv, 6 Ss 'Nripzoc,
-
uaiSa
(fehlt 6 (jiEv).
Beim einen Glied fehlt der Artikel:
1, 1 (S^.plCTTOV LLEV uScOp, 6 S^
XP^^^^'
N 4, 82 6
xpua6<;
k^6[Lzvoq auyac; eSei^ev aTraaac;, jxvo? S^.
Dasselbe gilt von greren Gliedern und ganzen Stzen:
O 2, 108 ETCEt ^(X[l[LO(;
aptf^OV TUEpiTTECpEUyEV
xal xtl^foq oaa ^apfxaT* XXot; e6y]Xv,
Tt<; av (ppaaai SijvaiTo;
Die Form des Vergleichs ohne wie verlangt, schon um nicht zu dunkel
zu werden, eine einfache bersehbare Nebencinanderstellung. Gerade
die wird obendrein noch gemieden. Das Strkste an ungleichmiger
106
Die Safefgung.
berladung paralleler Priamelglieder mit schwerer Wortornamentik
leistet O 1, Iff.
Auch bei Antithesen werden die Worte so verschraubt gestellt,
da man Mhe hat, auf beiden Seiten den betonten Begriff zu finden.
O 9, 48 aLvsi Se TraXaiov (xsv olvov, avsa S* u(jlv<ov VECOTepwv.
P 1, 55 aaevet jxev
xp^'^^
aivcov, dXXa (xoiptSiov 9)v.
Darum darf man auch etwas, was wie eine Antithese aussieht
und es auch berall sonst wre, bei Pindar zunchst daraufhin ansehen:
P 2, 67 ToSe (xev
y.i'koq
7r(X7rTat* t6 KacjT^pEiov S' ev
AioXtSecrcTi
x^P^^K
sXwv a6p7)c7ov. P 2 ist selbst das
Kastoreon, vgl. v. d. Mhll, RM 72(1918) 307 ff.
Asymmetrie ist das Bezeichnende. Deshalb ist die Textnderung
Schmids, Arch. f. Relw. 19 (1919)
279 zu Eur. Hippol. 61 ff. ab-
zulehnen. Der Chorstil ist da anders als der Hymnenstil sonst, der
anderswo im allgemeinen Wiederholungen gleicher Anfnge liebt.
Auf der andern Seite werden ganz auseinanderliegende Dinge als
parallele Glieder unerwartet zeugmatisch** nebeneinandergestellt:
P 4 (das goldene Vlie des Widders von Phrixos) tw tuot' ex
TTOVTOU (jacoT) EX TS [xaTpuiocc; dcscov eXscov.
O 1, 88 eXev S* OivopLaou tov Tuapevov ts ctuvsuvov : xaetXs
xal ETU^e.
Soph. Trach. 351 EpuTOv
6'
eXot ttjv
6*
u^'tTiupyov OlyaXioL'^.
N 10, 25 xpaT-/)(y . . . "EXXava cxTpaTov . . . xal . . . (JT9avov:
Evix7]<T xal sXaE.
P
1, 40 EsXyjdaK; TauTa vow
Tt0(XV EUavSpOV T X^pOLVl
Ev6u[JLELCT6aL Xal 701ELV.
P 8, 19 CTT9ava)(jtVOV uiv Tiota llapvaatSi AcoptEt t xcofxoi.
P 4, 104 OUTE spyov ot ettoc; elttcov. 67 octto S' auTov syoi
Motaaiai Scocto) xal to Tuay^puarov vaxo^ xpiou.
P
3, 82 (pspEiv
=
aushalten und (ein Kleid) tragen.
N
4, 68 Scopa xal xparo^ ^9avav EyysvEf; auTw.
Das ist 'enharmonische Verwechslung'
1)
wie 'Zerreiet eure Herzen
und nicht eure Kleider*, Joel 2, 13, und bewirkt gedrungene Krze.
Eben dahin gehrt die Vertauschung der Beiwrter: N 9, 8
p6(jLto(; gehrt zu auXo-, dadurch bekommt aber hier die
96pfj.iy^
etwas Geheimnisvoll-Dionysisches. P 3, 6 TsxTova vcoSuvLa^ a(i.pov
yuiapxEo^. Asklepios strkt die GUeder, die Schmerzlosigkeit ist
') Headlam, Class. review 16 (1902) 338 ff.
Asymmetrie.
\ 07
sanft. 7, 63 TToXiiocrxov yaZav avpwTcoLCTL xal ecppova [jL7)Xot<;.
Beispiele gibt Wilamowitz zu Eurip. Her. 883^).
berhaupt wird Attribut und Nomen mglichst mit andern
Satzteilen verschlungen und verschrnkt. P 8, 27 dooil<; uTiepTaTou^
Yipoioic; v (xaxat^. So sucht die antike Dichtersprache mglichst zu
verhten, da das Wort mit seinem Attribut verschmilzt zu einem
Begriff, der zwischen beiden Worten liegt: schnelle Schlachten,
erhabene Heroen
und wir deshalb nicht mehr so recht auf jedes
einzelne der beiden Worte achten mgen
und sucht sie durch
khne Verschrnkung auseinanderzureien , damit die Wrter
isoliert bleiben und Ton und Sinn auf sich lenken. So lassen sich
selbst Pronomina, Koniunktionen und anderes der Art isolieren,
die ohne das Strkende dieser syntaktischen Spannung an die ihnen
eng zugehrigen Wrter sich anlehnen mten.
In der chorlyrischen Wortstellung findet sich ferner zuerst das
Einrahmen mehrerer Wrter zwischen Artikel (oder Attribut) und
Hauptwort, das in der ganzen antiken Dichtung dann so auffllt
(s. Norden, Vergils Aeneis 6. Buch2, Leipzig 1916, 391 ff.).
P 12, 6 Tav TTOTE naXXa<;
6 Worte
Aava.
O 12, 5 at
13 Worte
^Xt^Se^.
14, 22 oTi ot veav
8 Worte
x^^Tav.
2, 15 Twv Se 7ue7rpaY(J,evcov
15 Worte
epycov teXo;.
So ist es den Chorlyrikern mglich, ein Mosaik von Worten zu
schaffen, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff nach rechts und
links und ber das Ganze hin seine Kraft ausstrmt, ein Minimum in
Umfang und Zahl der Zeichen, ein Maximum an Energie der Zeichen ^).
N 9, 15 xpsdCTCOv Ss xaTTTTauet S^xav tocv Tipodev avY)p.
Wie elastisch und gedrungen schnellt da das Subjekt am Schlu
nochmals empor 1 Den Namen des Helden sagt Pindar gern ganz
zuletzt. Vorher gibt er in einem langen Satz seine Taten, dann wie
einen letzten Trumpf den berhmten Namen, womglich den Anfang
einer Strophe bildend.
J 6, 30, 35, 40, 62.
P 12, 17; 9, 17; 11, 22.
O 10, 30; 13, 17; O 6, 9; O 9, 75.
berhaupt das Subjekt tritt, wenn es ein Eigenname ist, an den
Schlu des Satzes. Das ist zugleich ein Stck echt naiver Kunst,
P
Leo NGG 1898, 474. Pasquali, Orazio lirico, Florenz 1920, 54.
')
Nietzsche ber Horaz.
108
Die Sa^fgung.
ti
^-
vgl. a 198, ^ 15,
Y
265. Heinzel, ber den Stil der altgerm. Poesie,
Straburg 1875, 7: Dem Dichter schwebt ein neuer Begriff so lebendig
vor Augen, da er ihn wie einen bekannten mit dem Pronomen ein-
fhrt und erst spter mit dem eignen Wort unzweideutig bezeichnet
(Diels, Parmenides 22).
Name als Schlutrumpf am Anfang einer Strophe:
P 12, 13 ff. Nach einem Satz von vi er Versen in Vers 17: uioi; Aavdca;.
J 6, 35 'HpaxXsT];, nach v'er Versen.
J 4, 55 u[.6<; *AXx[jLava(; nach einem Satz von fnf Versen.
9, 75 kommt der Name des Patroklos besonders wuchtig
drohend, nachdem er seit Vers 70 fllig ist.
O 10, 33 MoXtove; uTrep^taXot als Schlu eines Satzes von zehn
Versen.
O 10, 55 Xpovoc;.
2,
40* 0y)pcovo(; nach sieben Versen.
J 1, 30 werden Jolaos und die Dioskuren am Strophenanfang
umschrieben genannt als Subjekt eines anakoluthischen Satzes mit
Parenthesen, der von Vers 17 ab geht.
Er gewinnt dadurch fr den Strophenbeginn einen vollen starken
Akkord, ein TrpoacoTrov TTjXauyec;. Besonders stark und wirksam N 3, 22.
Ich glaube deshalb, eine starke Interpunktion am Strophenschlu
ist verkehrt, wenn ein relativer Anschlu die neue Strophe erffnet.
Pindar liebt das Strophen-Enjambement, z. B. 3, 30. Ganz fehlt es
blo in P 1; 6; N 11; 5. Die Chre in den Tragdien kennen es
nicht.
Auch andere wichtige Satzglieder spart er sich" fr den Strophen-
anfang auf:
2, 17 XoLTTO) Yevei.
1, 23 SupaxoCTtov tTrTro^^apfjiav aatX^a.
Ein nachtrgliches, retardiertes Subjekt hat greres Gewicht:
P 4, 36 ouS* aTTtYjcje iv, aXX* ripo^c; Se^aro.
P 12, 19 inel avSpa epp^aaTO, fcapevo^ xeij/e.
Aber das ist immer nur ein einzelner hingesetzter heller Ton,
ein sforzato, keine Vorbereitung und Steigerung ber eine grere
Strecke hin.
ber den Anfang einer neuen Triade weg ist Enjambement selten,
etwa 8, 23
l^ox
avOpwTcwv; O 9, 29; ey^vovT P 2, 73 xaXoc;; P 4, 162,
185, 231, 254, J 4, 19 und 55.
Wortstellung.
IQQ
Selbst wenn er einmal einen Ansatz zu Steigerung macht, wenn er
vorbereitet, jetzt kommt etwas, Doppelpunkt
im letzten Augen-
blick biegt er die Spitze um in seine bliche Verschlingung:
13, 97 *Ia0[i,oL ra t' ev Nefxsa Tuaupo) sTret tjctco 9avep* apoa,
nun denkt man, er schreit heraus: sechzig Siege haben sie dort!
Nein: aXaO-y); te (jiot e^opxo; iiziGGtrcci e^'^xovTaxi Sy)[X90Tpo)v
aSuyXcoaCTO^ oa xapuxo^ eaXoO. hnlich N 7, 48 ff.; J 5, 13 (s. oben
S. 105).
Die verschrnkte Wortstellung dient zuweilen dazu, den Hrer
zunchst auf eine falsche Fhrte zu locken, z. B. N4, 28 denkt man
bei dem langsamen Vortrag zumal
bei TrsTpco, da die Wagen
an einem Felsen zerschellen. Erst wenn man an eXsv kommt, merkt
man, da es sich um einen poetischen Singular handelt: Halkyoneus
zerschmettert die Wagen durch Werfen mit groen Steinen. Dadurch
bekommen ziemlich einfache Stilmittel wie dieser poetische Singular
eine ganz einzige Wucht der Wirkung.
N 9, 16 avSpoSafjiavT *Epi9uXav mnnerbegtigend, jeder denkt
zunchst mnnerbezwingend. Das soll man auch wegen der Hals-
bandgeschichte.
1, 57 TT] hlt man zuerst fr Verblendung, zu der er frevelnd
greift; erst im Lauf des Satzes merkt man, da es Qual ist, die er
bekommt.
6, 46 man soll denken, die Schlangen nhren ihn mit ihrem
eignen loc;, bis dann fXEXtaaav kommt.
P 1, 76 ('A6ava(cov)
x^P^"^
^^^^ ^^^ Prposition zu erkennen dank
dem nachfolgenden (jlictov. P 4, 274 Xayera^ berboten durch
xuepvdcTa^;: wenn man den Fhrer des Volks an Bord bringt, steht
der Steuermann noch ber ihm.
Wer die oft nicht enden wollenden Satzungetme sieht, wo an
dem Hrer ein schweres Wort nach dem andern vom Chor gesungen
vorberzog, fr den ist es klar: bei dem Durchschnittshrer konnte
es sich nur um ein stimmungsmiges Aufnelmien von glnzenden
Wortbildern handeln, etwa wie die Gemeinde sich an einer lateinischen
Liturgie erbauen kann, deren Wortsinn sie nicht versteht, oder wie
man sich von den Akkordverbindungen moderner Orchestermusik
tragen lt, ohne die melodische Linie zu verfolgen. Pindar spricht
bisweilen von seinem Dichten wie von Hinstellen schner Dinge, vom
Behngen mit Gewndern (s. oben S. 63). Damit meint er auch sehr
das einzelne Wort. Ungeheure Stze, wurmartig, die von Relativsatz zu
110
Die Safefgung.
Konjunktion, von Konjunktion zu Partizip, von Partizip zu Relativ-
pronomen weiterkriechen. Apposition reiht sich an Apposition. P
12,
1
bis 12 ist ein einziger Satz. Atreo) ors
, a
vaietq
, tXao;
S$at
viv vixdcaavTa Ts^v, tocv tuote ndcXXa^; ecpeupe
pyjvov
StaTcXe^ataa, tov
als
, Ilepaeu^ tcote
uaev
{lolpav ycov
Andere besonders starke Beispiele P 4,
20
27; Bakch.
16, Iff.
Dieser chorlyrische yxo^, den Pindar und auch Aischylos auf
die Spitze treiben, hat ein sehr langes, zhes Leben in der europischen
Literatur gehabt. Einmal ist er zunchst zurckgedrngt
worden
durch die attische Klassik. Allerdings diese ganz bestimmte Art
feierlicher Rede ist von den Chortexten zunchst auf Sprechteile
der Tragdien bergegangen
am strksten bei Aischylos, dem der
schwere Prunk der chorlyrischen Sprache zweite Natur war. Aber
in der chorischen Sprache ist seit Sophokles eine grere gegliederte
Weitrumigkeit, etwas lnger gespannte Bogen. Inhaltliche Ent-
sprechung zwischen Strophe und Gegenstrophe sucht er nicht mehr
Wort fr Wort, d. h. archaisch, altvaterisch, detailliert, in parallelen
Fltchen wie Aischylos zu verdeutlichen, sondern lt sie in gro-
zgiger Weise durchschimmern (s. die Nachweise bei Martha Horneffer.
De strophica sententiarum responsione, Dissertation Bonn 1914) ^).
In der griechischen Lyrik und in der rmischen bis zum pervigilium
Veneris (Catull, Tibull, manches von Vergil ausgenommen) ist kein
Flu, keine rechte Bewegung. Das kommt von der allmchtigen
berlieferungsmasse, die vom homerischen Epos und der Chorlyrik
aus alles beherrscht. Dadurch drngen sich berall verhltnismig
bergroe, feste Klischees des Ausdrucks ein, eine bestimmte, ge-
haltene Bewegung legt sich darber. Eine weiche Linie und eine
ausdrucksvoll gestaltete, durch und durch empfundene Sprache
kann nur stellenweise aufkommen in den kleinen Formen. Ob man
z. B. nach dem Lesen Catullischer nugae eines seiner groen alexan-
drinischen Gedichte in die Hand nimmt oder von euripideischen
Dialogen zu Chorpartien bergeht, immer glaubt man dasselbe
seltsame Stocken und Stampfen der Rede zu fhlen. Der alexan-
drinische Stil ist der der Chorlyrik, kompliziert durch das
Streben, mit mythographischen Andeutungen zu unterhalten,
der mythologische und geographische Ballast ersetzt d:e chorly-
Man vergleiche die Entwicklung von den kleinen EchoWirkungen i^,
der Musik des 17. und des lteren 18. Jahrhunderts zu den freieren Crescend
seit Stamitz.
Der chorlyrische oyxo.
\\\
rische Verwendung der Mythen fr ein sehr gebildetes Publi-
kum. Formell ist die Dunkelheit in den Schutzflehenden des
Aischylos und in der Alexandra des Lykophron gleicher Art, abgesehen
davon, da es der Stolz Lykophrons ist, Anspielungen auf entlegene
Mythen mglichst in jedem seiner volltnenden Worte zu bringen,
die er allerdings im Wrterbuch sucht.
DieseDichtung kommt nur schwer los von der archaisch gebundenen
Chordichtung, die den Worten, nicht dem Satz zugewandt ist. Alle
gehobene Rede in der Folgezeit der Antike ist von da her zum groen
Teil festgelegt. Immer kommt, sobald eine gewisse Hhe des dichteri-
schen Tones angestrebt wird, statt lyrischer Gesichte und leicht
gleitender, gelster Rede die schwere Fracht der berladenen Worte,
der yxoc
mit seinen gestauten, kriechenden Stzen.
Dieser yxo; hlt sich so zh wie etwa die Formen der strengen
Kontrapunktik in der neuzeitlichen Musik Schon als eine viel ge-
lstere, flieendere, weniger starre, persnlichere Schreibweise
herrscht, wird die alte stimmenfhrende Form der ins bersinnliche
gerichteten Feierlichkeit wieder und wieder hervorgeholt. In der
modernen Musik erscheint fr gewisse Stimmungswirkungen die
Fuge. Lykophron oder irgendein anderer feierlicher Sptling ver-
hlt sich zu der alten pindarischen Chorkunst wie Bralmis, Reger,
Cesar Franck zu Johann Sebastian Bach. Die Griechen haben
vieles teils in ihrer bosselnden Wortkunst, teils in ihren schnen
Reden niedergelegt, was die Deutschen in Musik erledigen.
Im pindarischen yxo; sind zwei Mglichkeiten der stark gehobenen
Ausdrucksweise im Keimzustand noch ur gesondert zu spren, die
Friedrich Gundolf, Goethe, S. 600, bei der Besprechung von Goethes
Pandora unterscheidet: Man merkt die Freude des langsamen Ein-
pressens und Heraustreibens, das Vergngen an Flle und berflle,
mit dem Goethe hier eine eigne Verstechnik und sogar Grammatik bt,
um in den kleinsten Raum ein Maximum von Bildern, Wendungen,
Lehren, selbst Worten zu drngen. In der Pandora waltet eine
artistische Wollust des Bosseins, des Hineintreibens und Heraus-
treibens, des Zwngens und Drngens, und nie hat sich Goethe weiter
entfernt von seiner natrlichen Abneigung gegen das Forcieren**'.
Da er dabei die Sprachtechnik der griechischen Tragdie, zumal
der Chre, vor Augen hatte, ist gewi ; aber nur weil sie damals seiner
inneren Neigung und ueren Aufgabe entsprachen, konnten ihn
diese Muster anregen. Die Gedrungenheit der griechischen Tragdie
112
Die Sa^fgung.
ebenso wie der pindarischen Gesnge und der von ihnen an-
geglhten Goethischen Jugendhymnen und Rhapsodien
hat
brigens einen andern Grund: den dithyrambischen, bilderver-
knpfenden, massentrmenden, durch Kothurn, Gesang und Maske
zugleich gesteigerten und gestauten berschwang, in dem die logischen
Vermittlungen und bergnge aufhren. In der Pandora dagegen
war es gerade die langsame, bewute, mit handwerklichem Nachdruck,
mit raffiniertem Tastgefhl und geschrftem Blick fr die gedrungene
Einzelform arbeitende Zierkunst, welche die sprachliche Forcierung
und Farcierung zeitigte, der intellektuelle und gar nicht rauschhafte
Wille, jede Spanne Vers aufs Knappste zu nutzen, nicht Unanschau-
liches, nichts Unbedeutendes, nur sinnlich Eindrckbares und geistig
Umspannendes zu sagen. So sind harte Bosseleien und schnrkelige
Ausmalungen entstanden wie die folgende:
In Flechten glnzend schmiegte sich der Wunderwuchs,
Der, freigegeben, schlangengleich die Ferse schlug.
So sind die Chre berladen bis zur UndeutHchkeit mit aufgereihten
Einzelbildern, aus dem Bestreben, in einer Strophe eine Menge Ttig-
keiten zu veranschaulichen und auszudeuten:
Erde, sie steht so fest,
Wie sie sich qulen lt.
Wie man sie scharrt und plackt.
Wie man sie ritzt und hackt
usw.
So erklrt sich die immer gewichtige, aber oft erzwungene Spruch-
weisheit, in die beinahe jede Anschauung und Ausmalung ausluft.
Sprche sind die Klammern, womit der Weise die Ornamente des
Malers trennt oder vernietet . . . besonders die Stichomythien werden
durch die Neigung zur Sentenz fast jeden dramatischen Nervs be-
raubt zugunsten der Sinnflle.
Pindar gehrt nicht nur, wie Gundolf schreibt, an die Seite der
Tragdie, sondern als ein sehr frher bedchtiger Wortknstler
zu-
gleich ebensosehr an die Seite der Pandora.
II. Die Glieder des Baues und ihre
Behandlung.
1. Der Lobpreis.
Beim
Epinikos, der uns am besten bekannt ist, heben sich meist
vier Bestandteile heraus, die jeder fr sich in den Bereich einer
bestimmten Gattung fallen. Das betreffende yevo^ ist in diesem Fall
TOTio; in dem ysvo; des Epinikos. Es sind dies:
1. das persnlich-enkomiastische, die eigentliche Domne des
Epinikos, der Rahmen fr das Ganze,
2. das hymnische,
3. das gnomische,
4. das episch-mythologische Element.
Diese vier Bestandteile sind in den einzelnen Gedichten in ganz ver-
schiedener Quantitt zu finden, einer oder der andere fehlt zuweilen
ganz. Es handelt sich um eine immer neue Gestaltung der immer
gleichen Motive wie im Minnesang, in der Renaissancekunst. Die
beste Analogie ist wohl die Variationenform in der Musik. Jeder
Epinikos ist eine Variation ber ein Thema, das ein fr allemal ge-
geben ist, und dessen kunstreiche Umbiegung der Kenner in der
Wortornamentierung, in der Verbindung und Gliederung der obli-
gaten Teile geno.
Die Schnheit ist durchaus die des Fragments. Man sieht pltz-
hch ein leuchtendes Bild, hrt einen Klang, der einem bleibt. Aber
den Gedankengang eines lngeren Gedichtes genau zu verfolgen,
ist fast unmglich. Ich habe das beim Vorlesen an mir selber und
anderen erprobt. Nicht weil es zu tief wre, sondern alles ist zu
undisponiert. So unsangbare Stcke wie etwa Nem. 7 kann man sich
heute nur schwer von einem Chor aufgefhrt vorstellen. Gerade
diese Mischung von dichterischen, erzhlenden oder hymnischen
Teilen mit persnlichen, oft trockenen und prosaischen Plaidoyers
scheint aber alt zu sein: Alkmans Parthenion lehrt es. Mit den
Versen 78
80 geht Pindar nicht blo gegen die Rivalen an, er
Dornseif f, Pindars Stil. 8
114
n. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
pflegt vielmehr die alte chorlyrische Kunst, die er wohlgefllig in
der Gestalt des Euphanes schildert N 4, 89 ff.
Mannigfaltigkeit ist gefordert P 10, 53; 11, 42. Mghchst vieles
soll kurz berhrt werden. Es springt von einem auf das andere ber.
Die Assoziation scheint das herrschende Kunstprinzip, also man
darf keine Disposition machen. Selten schliet der Gedanke mit
einer Strophe. XXo In XXo uvsiv. Das berspringen und Weiter-
spinnen ist in seiner Kunst sehr bemerkenswert. Die logischen ber-
leitungen vom Lob auf den Sieger zum Mythos sind Zugestndnisse
an die Richtigkeit, an die Korrektheit, schulmige schematische
Mittelchen des te^xo^. Aber das ndert wenig am Gesamteindruck.
Die Epinikien muten schnell gedichtet werden und wurden ein
einziges Mal aufgefhrt. Da braucht nicht alle Drapierung echt und
massiv zu sein. Etwas Leinwand, Pappe, Kulisse ist erlaubt. Die
berleitung zum erzhlenden Teil und letzte Rckkehr zum Lob
des Siegers gemahnt mitunter an die Art, wie ein akademischer
Festredner an frstlichen Geburtstagen auf das Schluhoch zufuhr
mit entschlossenem Herumwerfen des Steuers. In der Verknpfung
und Disponierung der Teile eines Gedichtes folgt der Dichter der
Schulschablone.
Ein begonnener Gedankengang wird pltzlich durch einen Gemein-
platz unterbrochen, worauf dann ein ganz neues Thema angeschlagen
wird. Beispiele N 8, 1723; P 9, 7683; P 1,8186; N 10,
1924,
P 2, 52-57; 10, 86-96; 2, 58.
N 4, 33 ff. ich mchte jetzt gern ausfhrlicher erzhlen. Aber
der
TEfjLo; verbietet es, und ich bin imstande, ihn zu befolgen, besser
als meine neidischen Feinde.
N 7, 52 naiv: aber eine Ende machen ist s bei jedem Ding
(dann folgt Gnomik).
Die Selbstanreden sind dann mitunter von umstndlicher Feier-
lichkeit.
O 1, 17 dXXa Awptav dcTTo (p6py.iyyoi TTacjaaXou Xafxavc.
Dergleichen hat wie die Priamel das Volkslied oft: Nun wollen
wir aber heben an*'. Ankndigungen darber, was er jetzt reden
will, gibt der Rhapsode im hymnischen Prooimion, Hesiod, Empe-
dokler>. Das chorlyrische Ich des Dichters tritt dadurch in Ver-
bindung mit dem Publikum, mit dem er sich eins wei.
Das Epinikion hat schon eine lange Entwicklung
hinter sich.
Der Dichter kann es sich erlauben, den tzQ\i6c, dieser Gattung etwas
1. Der Lobpreis.
i|5
leichthin zu behandeln. Das Publikum verlangt, da alle obliga-
torischen Bestandteile des gottesdienstlichen Festlieds da sind, aber
wo und wie, darber wird
so knnte man es empfinden
fast
zwischen Dichter und Publikum im Text debattiert. Wie z. B. der
gnomische Teil in P 12 vor Torschlu noch schnell vom Zaun gebrochen
wird, ist sehr belehrend. Ganz pltzlich fngt er an von dem
Lieferungsvertrag, dem Wortlaut der Bestellung P 9, 103; 6, 92;
P 10, 64.
ber den Inhalt wurde vorher bei der Bestellung vereinbart.
In der Regel mute erwhnt werden: Art und Schauplatz des Siegs,
der Gott, dem der Agon galt, Namen des Siegers mit Zunamen, d. h.
dem seines Vaters, die frheren Siege, die der Sieger selbst und seine
Verwandten bereits gewonnen hatten. Dazu etwa noch die Namen
der Trainer und Erwhnungen verstorbener Verwandter, irgendwelche
sonstigen Ruhmestitel des Siegers
wie bei Chromios in N 1 und 9
oder seiner Familie (P 9, Schi.).
Eine Beschreibung des Wettkampfes gibt Pin dar kaum (N 8, 72; P
5, 30, 49),
dazu ist er zu sehr Vergeistiger, das wre zu nackt konkret,
zu xupico^. Dagegen schildert Bakchyl.
5, 37 ausfhrlich den Phere-
nikos 9, 26 ff., den Automedes 10, 20 ff., Simonides fr. 16.
Die TOTToi als Mittel, den Stoff der Chorlyrik zu bereichern,
sind letztlich im Sinn der Gesichtspunkte S. 5, 15 rhetorische.
Erzhlungen, Mythen, d. h. digressiones einzulegen, empfehlen
alle rhetorischen Handbcher. Speziell dem Verfasser von Enkomien,
Xoyot TcavYjyupLxot, zu denen man doch die Epinikien rechnen darf,
raten die Rhetoren Arist. III,
17, p.
1418 a, Cic. orator 19, 65 a
dringend, dem peinUchen Loben von Personen durch Einstreuen
von digressiones auszuweichen. Auch die Scholien betrachten die
mythischen Teile bei Pindar als 7uapexaaei(;. Auch die verschiedenen
TpoTuot der interrogatio, apostrophe J 6, 62; 13, 18; Bakch. 19, 15
im Lob des Athleten und Hymnenstil 2, 1 fallen in einen Bereich,
wo die dichterisch-lyrische Eingebung
zumal bei Griechen
hart an die rhetorische grenzt. Und Sentenzen beizugeben, wo irgend
angngig, sind bekanntUch die griechischen Sophisten und Redner
unermdUch.
Der Epinikos ist noch im besonderen ein Xyo^ 7cav7)YupLx6(;:
er hngt zusammen mit einer TravTjyupU, einer panhellenischen Feier,
die zu Ehren einer Gottheit eingesetzt ist und einen Teil ihres Kultes
bildet. Da ist es angebracht, mit dem Lob dieses Gottes zu
8*
116
n. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
beginnen nach Dionys. Halle, rhet. 1227 ff ^). Man lobt ihn
dcTo Tcov TTpoaovTCov auTcp, d. h. von der Sphre seiner Wirksam-
keit, von seinen Erfindungen oder dem aus, was er den Menschen
Ntzliches oder Segensreiches verliehen hat, den Zeus als Knig
der Gtter, als Bildner des Weltalls, den Apollo als Erfinder
der Musik, als Sonnengott, als Urquell alles Guten. Es mu
aber das Lob des Gottes , das ja nur zur Einleitung dienen soll,
o)^ (X7) Tou l7n.6vTOc; 6 Xoyo^ 6 Tcpoaycov [xst^cov YtyvoiTO, nur kurz
sein. An das Lob des Gottes schliet sich das Lob der Stadt
an, in oder bei welcher die Panegyris gefeiert wird (vgl. Genethl.
p. 366);
ihre Grndung und Entstehung; ob ein Gott oder Heros
ihr Grnder war, und was man von ihm zu sagen hat; die Taten der
Stadt in Krieg und Frieden, ihre Gre, Schnheit, Macht, ihre
Kunstschtze, ffentlichen und Privat-Gebude, ihre Lage an einem
Flu, auch etwaige Mythen von der Stadt. Dann geht man auf
das Festspiel selbst ber, seine Entstehung und Einsetzung und
deren Veranlassung. Vergleich mit anderen Festspielen. Jahreszeit,
in die es fllt. Die Art des Spiels, ob gymnastisch und musisch zu-
gleich, oder blo eins von beiden. Der Kranz, der dem Sieger winkt.
Die Eiche wird gelobt, weil sie dem Zeus geheiligt ist, weil sie die
erste und lteste Nahrung des Menschen gewhrte, weil sie ein Baum
der Weissagung ist (oTt oux acpcovoi;). So lt sich auch der lbaum,
der Lorbeer, der hrenkranz und die Fichte loben. EndUch ist der
vorliegende Kranz mit anderen zu vergleichen."
Das Prooimion ist beim ysvo^ TravYjyupixov unerllich. Es
liegt in der Sache begrndet, da man bei einem so delikaten Be-
ginnen wie dem Loben von Personen nicht mit der Tr ins Haus
fllt. Aber die Wahl des Eingangs steht vollkommen frei. Aristot.
rhet. ni, 14 meint, man knne ohne weiteres anbringen, was einem
gerade in den Sinn kommt.
Zweck einer Lobrede ist die Amplifikation ausschlielich der guten
Eigenschaften des Gelobten nach Menandros ITspl iTtiSeixTixcov
Rh. Gr. III, 547 ff. In der Einleitung mag man die Schwierigkeit
der Aufgabe berhren, in gebhrender Weise einem solchen
Gegen-
stand gerecht zu werden. Dabei wird man mit Nutzen einen unerme-
lichen Gegenstand heranziehen: Wie das Auge nicht vermag, den
schrankenlosen Ozean zu umfassen, so ist die Rede nicht imstande,
') Volkmann, Rhetorik der Griechen und Rmer-. Leipzig 1885, 344.
2. Die Mythen.
117
das Lob in seinem ganzen Umfang zu erschpfen." Oder: der Redner
erklrt seine Verlegenheit, von welchem Punkt aus er seine Lob-
rede beginnen solle, und gewinnt so zugleich einen bergang zu
seinem eigentlichen Gegenstand.
Gewi haben de Red.ier die Chorlyrik nachgeahmt, aber es
charakterisiert doch wirksam das Rednerische auch schon der
Chorlyrk, wenn es so aussieht, als ob diese selbstverstndl ch
nachweislich spter nach prosaischen Reden argelegten Rezepte
schon in desen frhen Gedichten befolgt wren.
Zur Hymnik Pindars s. oben S. 9L
2. Die Mythen.
In der Chordichtung hat das Wort der crocpo^ und die }(opUTaL
Der
(7096;
ist, wie Pindar stolz sagt, iBioc, Iv xoivcp azoikzic, und
Lehrer des Volks, er erzhlt und belehrt, um zu bessern, wie es Arl-
stophanes Frsche 1012 verlangt. Die primitive Urform der kultischen
Litanei ist also bereichert, indem Geschichten erzhlt werden. Wie
frh diese Bereicherung durch Mythos eintritt, sehen wir an den
althochdeutschen Merseburger Zaubersprchen. Erzhlen wider-
spricht aber auch dem Wesen eines Chorliedes nicht (wir sahen, im
chorlyrischen ,,ich" sind crocpoc; und ^opeuTat nicht scharf geschieden).
Mancher Sngerchor ist unermdlich, in zahlreichen Strophen eine
Geschichte zu Ende zu singen (vgl. Kommersbuch). So entsteht
die Ballade: das lyrische Element, die dem Anla das Liedes ent-
springende Stimmung, schliet sich an eine Geschichte an, nimmt
sie fr sich in Beschlag und formt sie bis in die Einzelheiten. Da
bildet sich schnell ein Stil heraus, der von dem Zustand der sonstigen
Weise des Erzhlens in den betreffenden Literaturen ziemlich un-
abhngig ist oder bewut von ihr abweicht. Zweck und Art des Bei-
sammenseins und der Auffhrung erlauben es nicht, da lngere
Strecken hindurch eine epische Objektivitt und Unbeteiligtheit
durchgehalten werden kann. Dazu singen zu viele mit und ist die
Stimmung des Augenblicks, die (ppovTl<; Trap tcoSo^ zu zwingend.
Gestalten und Geschehnisse werden von Etappe zu Etappe knapp
drastisch beleuchtet und begutachtet, oft kommt unterbrechend
die Moral von der Geschichte: bei den Griechen die Sentenz. Man
kann da manche hnUchkeiten zwischen der griechischen Chorlyrik
und unseren erzhlenden Volks- und Kommersliedorn beobachten.
Nach besonderen Grnden fr die Mythen in den Epinikien zu
118
n. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
suchen, ist nicht ntig. Sie nehmen genau denselben Platz in anderen
Chorgattungen ein. Der Chorlyriker beabsichtigt nie, zur Unter-
haltung der vornehmen Gesellschaft irgendwelche
xXsa avSpcov zu
besingen, wie es der homerische Rhapsode tut, sondern er erzhlt
eine Geschichte aus der Sage aus ganz bestimmtem Anla als aocpoc;.
Bei geistlichen Liedern hat sich der Brauch herausgebildet, da
statt der Taten des Gottes irgendeine Sage von einem Heros erzhlt
wird. Diese Entwicklung ist besonders durchgreifend beim Di-
thyrambos gewesen, der vom Chor derDionysosdiener aus zur attischen
Tragdie geworden ist. Ebenso ist der Paian fast zur reinen Ballade
geworden. Die ausgesprochen kultischen Bestandteile sind zurck-
getreten.
Fr den Griechen war als die Geschichte, auf die manJm Fest-
lied ausbiegt, der Heroenmythos ohne weiteres gegeben. Das war
fr Dichter und Publikum ganz selbstverstndlich. [lxjQoc, ist der
griechische Ausdruck fr diesen erzhlenden Teil des Siegesliedes.
Nach unserer Ausdrucksweise handelt es sich oft um Sage", d, h.
Erzhlungen aus der Heroenzeit, um Legende", d. h. Erzhlungen
von eigentmlich geistlichem Ton ber heilige Orte, besonders be-
gnadete Personen usw. Von Mythus reden wir blo bei Gtter-
geschichten 1). Eine solche steht bei Pindar nur 7: die Athena-
geburt; sie dient da als olitiov fr einen rhodischen Kultbrauch.
Das Mythische", der Heroenkreis, lag diesen Menschen nher
als die unmittelbare Vergangenheit. Hier war das phantastisch
Schne, hier waren die Legenden der heil gen Kulte, hier apsTY)
der Ahnen. Die Heroenzeit war immer aktuell, jeder kleine
Vasenmaler schilderte sie, die Stdte prgten sie auf ihre Mnzen,
die klassischen rtlichkeiten wurden heilig gehalten. Bei jeder Ge-
legenheit berief man sich auf sie (z. B. die Athener vor der Schlacht
bei Plataeae Herod. 9, 27) Besonders in den Perserkriegen schienen
die homerischen Kmpfe das mythische Vorbild zu sein: die groe
Zeit der Sage schien wiedergekehrt
man denke an den plastischen
Schmuck der Schatzhuser zu Delphi. Diese Heroenzeit hatte durch
Homer ihren hchsten Glanz erhalten. Er war die griechische Bibel.
Man war gewohnt, die Gegenwart in die mythische Heroenzeit zurck-
zusehen. Diese Gewohnheit wirkte noch strker dadurch, da das
Publikum besonders der Epinikoi, die wir ja am besten kennen,
') Bethe, Mythus, Sage, Mrchen. Hess. Bl. f. Volkskunde 4 (1905) S. 97 ff.
Gunkel, Mrchen im Alten Testament. Tbingen 1917. S. 6 f.
2. Die Mythen.
119
der Adel war. Fr Gedichte, die er bestellte, war es unerlsslich,
da die apsTV) der Vorfahren der betreffenden Familie oder Polis
erwhnt wurde oder der lepbq Xoyo^ des betreffenden Heiligtums.
Der Ehrgeiz der Adelsgeschlechter ging auch dahin, auf diesem
Weg mit irgend etwas Homerischem genealogisch verknpft zu sein.
Wenn man die Analogie des abendlndischen Mittelalters heranziehen
will, so mu man Heldensage, Heiligenlegende in Epos, Hymnik,
Kathedralenplastik und die Romane ber antike Helden zusammen-
nehmen, um einen hnlichen archaischen, das geistige Leben er-
fllenden Kreis von Gestalten und Begebenheiten zu finden.
Es fhrt eine gerade Linie von den erzhlenden, mythischen
Teilen in den homerischen Hymnen ber Pindar und Bakchylides
zu Kallimachos und den Festgedichten der rmischen Elegiker
(Properz, sogar Tibull I 7, H 5, dann Claudian usw.).
Die hnlichkeiten haben dazu gefhrt, hier die Befolgung einer
Schulregel zu sehen: alle diese Gedichte sollten nach dem Nomos-
Schema gebaut sein, der erzhlende Teil wre dann der Nabel" ^).
Das ist die auf Grund von hnlichkeiten fter gemachte Annahme
von fast verschwrerhaft geheimnisvollen Zusammenhngen, die
in der Philologie so viele Irrtmer verschuldet hat. So wurde die
lteste griechische Religion von Creuzer auf orientalische Hicro-
phanten zurckgefhrt, in Pindar tiefsinnige Intimitten der Sieger-
familien gesucht (Dissen) und in den Dichtertexten auf Grund falsch
verallgemeinerter und deshalb geforderter Wiederkehr gleicher
Versgruppen gestrichen und hinzugedichtet. So forderte man auch
hier eine zugrunde liegende Regel, deren Dasein die berlieferung
bswillig verschweigt.
Sicherlich hat der Chordichter oft von Legenden, die zur Wahl
standen, einfach die schnere genommen, sie sind ihm mehr poetisches
Motiv als heilige Wahrheit. Durch die eingelegten und angedeuteten
Mythen, die jeder kennt, entstehen Stimmungsobertne, reicherer
Klang. Zu den Abschweifungen, zu den glnzenden Bildern des
Mythos standen die Griechen wohl hnhch wie wir zu hnlichen
Erscheinungen in der Oper. Wie ein Ballett oder in der neueren
Oper ein wirkungsvolles Tongemlde man denke etwa an das
^) Rudolph Westphal, Mezger u. a., auch Crusius eine Zeitlang.
(Verhandlungen der 39. Philol. Versammlung Zrich, 18S7, 266ff.) Lbbert,
De Pindari carminum compositione, Bonner Programm 18S7. Jthnor,
Wiener Studien 14 (1892)
9ft.
120
II- E)ie Glieder des Baues und ihre Behandlung.
Gewitter in Wagners Rheingold Akt I
im Gang der Handlung
begrndet ist, darin sind wir nicht peinlich. Es mu kommen, und
es kommt, der bergang dazu ist Nebensache.
Der Mythos bezieht sich entweder erstens auf das Wettspiel oder
dessen Ort: 1, 3, 10; P 12; N 9, 10; Bakchyl. 9, 13 oder zweitens
auf Vaterstadt oder Geschlecht des Siegers in 6, 7, 8, 9, 13; P
4,
5, 9; N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; J 1, 3,4, 5, 7; Bakchyl. 1, 8, 12; auch
ltere Epinikiendichter wie Timokritos und Euphanes von Aigina
haben es so gehalten (N 6, 53 ff.) oder drittens bispel-artig als Gleich-
nis, Vorbild auf die Person des Gefeierten 2, 4; P 2, 3, 6, 8, lO; 11;
N 1, 4, 25; J 4, 52; Bakchyl.
3, 5, 11. Fraustadt
i)
S. 31 betont, da
diese letzte Gruppe lauter Pflanzstdten gilt, die auf keinen ehr-
wrdigen Mythenbestand zurckblicken konnten.
In der Chorpoesie legen es die Dichter darauf an, bei irgendeiner
Stelle ohne weiteres auszubiegen nach einem Mythos. Die Leit-
linie dahin ist von allen so oft zurckgelegt, da die berleitungen,
Verknpfungen, Assoziationsanlsse gering und wunderlich vag
sein knnen, sie finden den Weg trotzdem 2).
1. Der Dichter will singen und gibt den Grund an, der irgendwo
in der ruhmvollen Vergangenheit zu suchen ist: 6, 22; 7, 20; 10, 24;
13, 29.
2. Mit Relativsatz an den eigens dazu genannten Heros oder
an irgendein Wort angehngt: 1, 23; 3, 13; 6, 29; 8, 30; P 3, 8.
3. Kunstreicher 9, 2111; N 3, 2631; N 1, 3134; N 10,
4-55; J 5, 19.
^
4. Im Kreis herum: erst e'nen w' cht* gen Punkt, dann ausfhr-
liche Darstellung, die zum Anfang zurckkehrt: 1, 96; 6, 71; P 4,
5967; 259 ff.; 9, 69. Dies die eigentliche digressio.
5. ber Sentenz: P 3, 59; N 9, 27; J 8, 59.
6. Selbstinterpellation: P 10, 50; 11, 38; N 4, 69; J 6, 55.
7. Ohne bergang: 8, 54; 13, 93; 9, 80; 3, 38.
Diese aocpoi wollen Geschichten singen wie die unersttlichen
Erzhler in 1001 Nacht. Mit orientalischer Naivitt hngt Pindar eme
bunte Geschichte an die andere. Aber mich mahnt nun einer (der
Auftraggeber!), wo ich den Durst nach Liedern stille, der Pfhcht,
wieder aufzuwecken auch den alten Ruhm deiner Ahnen", P 9, 103.
^) De encomiorum historia, Dissertation Leipzig 1909.
2) Drachmann, De recentiorum interpretaiione Pindarica 324. Vgl. oben
S. 114.
2. Die Mythen.
121
In der Aneinanderreihung solcher Geschichten in nicht allzu
breiter Form bietet auch die hesiodische Katalogpoesie Analogien.
Der stereotype bergang zu einer neuen Geschichte mit
yj
oly] u. .
Wenn Pindar 2, 90 nach Nennung des Achilleus in der nchsten
Strophe beginnt mit 6<; "ExTopa eacpaXe usw., so ist das derselbe
Stil wie Scut. Heraclis 57. Eur pides in seinen Prologen verfhrt
noch ebenso.
Ein Erbe Homers ist damit unverkennbar in der griechischen
Chordichtung selbst bei flchtigem Lesen. Das Epische erscheint
bei den verschiedenen Chordichtern verschieden dosiert. Zweifellos
vom homerischen Epos stammt die Einfhrung direkter Rede. Sie
nimmt sich im Chorgesang so seltsam aus, da die Entlehnung von
dieser Seite her nicht zu verkennen ist ^). Sie ist bei Bakchylides
hufiger als bei Pindar.
Bakchylides vertritt eine freiere, jonische Richtung, mit der
er die Art seines Oheims Simonides fortsetzt. Das elegante Pathos
in der Klage der Danae bei Simonides klingt schon unpindarisch.
Bakchylides' Erzhlung ist balladenartig zugespitzt. Er bereitet
den groen Akzent vor, whrend er den oyxoc, im einzelnen preis-
gibt, um jenen gut herauszubringen. Die Gedichte von der Be-
gegnung des Herakles mit Meleagros, vom Taucher Theseus, vom
Phnixtod des milten Kroisos sind grozgig und dramatisch. Die
Keer sind offenbar bestrebt, in die Chorsprache einen homerischen
Zug zu bringen, etwas Gelockertes, Jonisches. Sie bernehmen viel
Episches, ohne sich zu bemhen, es in chorlyrischen Stil umzusetzen
(s. oben S. 42).
Auch bei Sophokles ist hnliches durch Vereinfachung im Ein-
zelnen erreicht, in der Metrik sowohl wie in der Diktion. Er hat viel
Wasser in den fr die archaische Zeit berauschenden Wein des chor-
lyrischen oyxoc; gegossen und so Bewegung, Flu, freien Atem, Weite,
Weichheit des Konturs erreicht, der sich der reife Aischylos der
Orestie nicht mehr verschlossen hat.
Ist aber die wichtige Rolle, die die erzhlenden mythischen Teile
"^J^J"**
in der Chorpoesie spielen, dem Einflu des Epos zuzuschreiben?
^^JJj""
Frher war man geneigt, sie unbedingt zu bejahen 2); neuerdings
mchte man das Verhltnis eher umkehren: In der Chorlyrik sollen
noch die olischen Heldenlieder zu erkennen sein, die zu erschlieenden
') v. Wilamowitj, Timotheos' Perser. 1903. S. 104 f.
') v. Wilamowi, Einleitung in die attische Tragdie S. 103.
122
li. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
Vorstufen des jonischen Epos. Man meint, der verschiedene Er-
zhlungsstil in Chorlyrik und Epos der Griechen beruhe eben auf
dem entscheidenden Unterschied zwischen Lied und Epos, den
Heusler so schn zeigt ^). Man kann nun m. E. eine pindarische Er-
zhlung nicht mit dem Hildebrantslied oder den Zwei Knigskindern
vergleichen 2). Die Abgerissenheit dieser Volkslieder besteht darin,
da sie mit kurzem Ruck das Ende der Erzhlung abwerfen. Das
kommt wohl auch bei den griechischen Gedichten einmal vor (vgl.
P 4, 246),
aber es ist dort nicht die Regel. Bezeichnend fr diese
ist das fortgesetzte Anspielen, das andeutende Darstellen von Dingen,
die man als den Hrern bekannt voraussetzt, und sentenzise Begut-
achten zwischendurch. Das geht bis zu einem fast glossierenden
engen Anschlu an irgendeine epische Darstellung^). Trotzdem wird
man wohl diesen Mangel an Geschlossenheit der Erzhlung nicht
damit in Beziehung setzen drfen, da das griechische Publikum
auch vom Epos her gewhnt war, Bruchstcke des Epos, Rhapso-
dien", anzuhren, keine Anforderungen an Geschlossenheit stellte*).
Vielmehr liegt die Kurzatmigkeit des Erzhlens im Wesen eines
Liedes fr Chorauffhrung. Sie entspricht der Gedrungenheit der
Diktion. Der Hauptunterschied gegenber den germanischen Liedern,
die dort die Vorstufe des Epos gebildet haben, ist der: dort decken
sich die epische Fabel und der Liedinhalt, die beiden Formen Epos
und Lied unterscheiden sich nur durch die Erzhlungsart, hier epische
Breite, dort liedhafte Knappheit; dagegen behandelt die griechische
Chordichtung oft nur die Episode einer Sage, einen Xoyo;, der aus
bestimmten Grnden herausgegriffen und in irgendeine Beleuchtung
gerckt wird. Es ist also nicht auszudenken, wie aus dem Stil dieser
griechischen Chorlyrik durch Anschwellung und Verbreiterung die
rein erzhlende Weise des homerischen Epos htte entstehen sollen.
Mit Recht hat man dagegen die Mythen bei Pindar und Bakchy-
Ides in einen literarischen Zusammenhang mit den homerischen
Hymnen gebracht. Hier hat zweifellos eine Beeinflussung statt-
') Lied und Epos, Dortmund 1905.
2) Bethe, Homer, Leipzig 1914. S. 16 ff.
')
V. Wilamowi^, Isyllos v. Epidauros fr P 3, Textgeschichte der
Lyriker 42 fr Bakchylides' Antenoriden. Die hellenistische Dichtung hat diese
Abgerissenheit mit Raffinement nachgebildet. Theokrit 22 (Afoaxojpoi); 24 ('Hpa-
x/t'ox^;);
[25]
CHpotx^s XeovTocpovo;); [Moschos] 3 (Meppot). v. Wilamowi^,
Timotheoo' Perser S. 103.
') V. Wilamowi^, Timotheos' Perser S. 102 f.
2. Die Mythen.
123
gefunden. Als einmal Chor- und Rhapsodenpoesie nebeneinander
bestanden, hat die moderne homerische Literatur aus dem reicheren
Kleinasien die bescheidene des rmeren Mutterlandes verndert.
In den homerischen" Gedichten, die zu Ehren der Gtter gesungen
werden, kommt nach einer kurzen Anrede an diese bald eine Ge-
schichte. Ein homerischer Hymnos" ist ein krzeres oder lngeres
Stck Epos, das sich von einem Gesang der Ilias blo dadurch unter-
scheidet, da der Rhapsode die Ankndigung dessen, wovon er reden
will, oder die Bitte an die Gottheit, ihm etwas einzugeben, stark
betont. Im 5. Jahrhundert ist es tatschlich ungefhr so, da der
Lyriker fr den Rhapsoden eingetreten ist, sich nach einem krzeren
oder lngeren sachUchen Vorwort ein Stck aus einem bekannten
Sang lste und es bis zu einem willkrlich gewhlten Ruhepunkt,
etwa einer Rede und groen Sentenz fhrte" ^).
Trotz allem: Die Heldensage ist sicherUch nicht vom Epos her
eingedrungen, sondern war immer Stoff der Chorpoesie ^). Alkmans
Parthenion zeigt schon genau die Form des pindarischen Epinikos
mit seinem Wechsel von gnomisch durchsetzter Mythenerzhlung
und enkomiastischen Partien und
was besonders wichtig ist
weist nicht mehr von homerischem Stil, von xuxXixov auf als die
Spteren. Im Gegenteil: eher weniger. Simonides, so weit wir ihn
kennen, und besonders Bakchylides, erzhlen viel epischer. Auch in
diesem Punkt scheint Pindar die Stilforderungen der Chordichtung mit
neuem Ernst aufgenommen zu haben. Ihm ist ein ergriffenes Pathos
des Preisens eigen, das mit dem homerischen Ethos des Erzhlens
nichts zu tun hat. Er gibt Bilder, pathetische oder glanzvolle Szenen,
keine Schilderungen, die sich entwickeln und ausklingen. An irgend-
einem Wort entflammt sich pltzUch seine Phantasie, und er beginnt
eine Geschichte zu erzhlen. Er gibt alle gleichzeitigen Einzelheiten
eines Moments, dann geht er, ohne zu vermitteln, zur Schilderung
eines ziemlich entfernten oder betrchtlich spteren Geschehnisses
ber wie ein Maler (man vgl. P 4). Es ist ein gleichsam improvisiertes
blitzartiges Zusammenschauen, er hat eine wundervolle Gabe, irn
Nu etwas hinzuzaubern. Wie die Szenerie wechselt, unvermerkt
sich verschiebend, das ist ganz berreife, hohe, verfeinerte Kunst.
Die Erzhlungstechnik und das geradezu unwirkliche Versetzen in
') Reienstein, GGA 1904 S. 957.
^) v. Wilamo wit5, Griechische Literaturgeschichte in Kultur der Gegen-
wart S. 45. Bethe, Homer S. 46.
124
n. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
etwas ganz anderes in dem besonders eigentmlichen Stck Pythia 4
erinnert an die Art Flauberts in der Education sentimentale, z. B.
Vers 120 ff.
Alles Epische wird von dem eigentlichen Chorstil, dessen Vertreter
Pindar ist, umgebogen, selten direkt bernommen. Wie seltsam
sieht ein xaTocXoyoc; aus O 10, 60 ff., P 4, 169 ff., verglichen mit einem
hesiodeischen oder dem in Ilias B.
In den mythischen Teilen ist man der Natur recht fern. Da herrscht
eine sehr starke Konvention, in die aber Pindar uns noch heute
mit leise narkotischer Gewalt zu bannen vermag, v. Wilamowitz
schreibt Griechische Literaturgeschichte S. 48: Oft gengt bei
den bekannten Stoffen eine Anspielung mit Hervorhebung einzelner
Zge, ein Einzelbild statt der Erzhlung. Es ist zuweilen, als stnde
diese Lyrik zur Heldensage wie die Epik zur Natur: die Herakles
und Achilleus sind hier, was die Lwen und Strme bei Homer sind.'*
Es hat aber auch hier ein aTrocsfxvuveaaL stattgefunden, wie in der
Ausdrucksweise im allgemeinen (s. oben S. 41). Der Dichter als
Snger beim kultischen Reigen will etwas, will bessern, erheben,
erbauen, mahnen, beten, er klingt nicht blo, um zu erfreuen, wie der
Rhapsode.
Es tritt ferner etwas hervor, worauf Julius Lange bei Besprechung
der pompeianischen Malerei^) hingewiesen hat: ,,In all den Dar-
stellungen tragischer und gttlicher Szenen wahrt die Hauptfigur
mitten darin eine gewisse statuenhafte Einheit als selbstndiger
Gegenstand der Bewunderung. Der Held selber soll dem Beschauer
gegenber zur Geltung gelangen, nicht seine Ergriffenheit vom Pathos
der Situation. Das Ethos des Heros, der sich selber gleich bleibt,
die Charis seines jungen, starken Leibes liegt dem Knstler am
Herzen, die Substanz, nicht die Funktion. Dabei wird kein Portrt
angestrebt, sondern die Darstellung des Staatsbrgerideals, das
Bild des freigeborenen und hoch- und freigestellten Menschen, seine
Gestalt, seine Form, seinTunund Auftreten unter anderen Menschen.'*
Das ist zu erweitern auf dem Menschenleib berhaupt. Man erinnere
sich an den Eindruck der Heldenschilderungen etwa Jasons P
4,
die Opferung der Iphigenie Aisch. Agam. 240 ff. Es ist dies ein
Wertlegen auf das uerliche und Oberflchliche, was auer den
Deutschen und den Juden alle europischen Vlker haben, die
') Darstellung der menschlichen Gestalt. Straburg 1903. S. 104.
2. Die Mythen.
^25
Franzosen, Italiener, antiken Griechen wohl besonders stark. Von
der einfachsten Verrichtung bis zum hchsten Pathos bewahren
sie in Haltung und Schilderung irgendein Etwas, das geeignet ist,
sichtbare Vorzge ins beste Licht zu setzen. Man vergleiche auf
den hchsten Stufen Grnewald und Michelangelo s oben
S. 37.
Die Gestalten sind ferner Typen, Verkrperungen einer einzigen
Eigenschaft, sie haben keine inneren Konflikte
wie in jeder
pr m tiven Poesie. bpt^: Tantalos, Ixion, Sisyphos, Koronis,
Asklepios; Gerechtigkeit: Aiakos; Treue: Kastor; Ergebenheit:
Jolaos; Weisheit: Chiron.
Der rechte Chordichter seit Stesichoros: Pindar, Aischylos ent-
wickelt nie seine Geschichte; er resmiert mit eingefgten Sen-
tenzen. Manche Stcke sind etwas reicher komponiert. Auf
mehreren Stufen wird immer tiefer in die Vergangenheit zurck-
gegangen und zuletzt rasch wieder an den Ausgangspunkt zurck-
gekehrt (P
3; 7; 3; P 4). Es kommt ihnen auf die eindrucks-
volle Situation an, die ausfhrlich ausgemalt wird. Die Vorgeschichte
wird durch Rckblicke nachgeholt. Oft ist es, wie Friedlnder sagt
Rhein. Mus, 1914, S. 335: Es ist seine Art, eine Situation aus dem
Epos herauszugreifen und als isoliertes Rild zu rahmen.
Das yevoc; fhrt, wie oben gesagt, dazu, da die erzhlte Ge-
schichte von Zeit zu Zeit glossiert wird. Das ldt geradezu dazu ein,
die Geschichte auch einmal zu ndern oder wenigstens eine be timmte
Fassung zu bevorzugen und die andere ausdrcklich abzulehnen.
Das hat nicht nur Pindar getan, sondern schon Stesichoros. Dessen
Helenagedichte sind nur in diesem Zusammenhang verstndlich.
Man mag sie mit Pindars Darstellung der Neoptolemosgeschichte
in Paian 6 und ihrer Palinodie in Nemea 7 vergleichen. Die Lsung
der Widersprche, die Stesichoros in den Geschichten ber die Gttin
Helena findet, ist nicht geistreich, sondern fromm. Fromm sind auch
die meisten nderungen bei Pindar, aber etwas Rationalitt meldet
sich auch schon. Die beste Analogie zu Stesichoros' Helena bieten
die Gnostiker, die behaupteten, nicht der Christos selber habe den
Kreuzestod erlitten, sondern ein Scheinleib. Das ist nicht Spitz-
findigkeit, sondern Umdeutung einer berlieferung aus einfacherer
Zeit durch Glubige aus einer gestufteren, spteren. Genau das-
selbe tut Stesichoros. Er ist der frheste Doket ^), Die Chorlyrik
') Vgl. die Hera-Nephele in der Ixiongeschichte. Zielinski, Helena.
Sddeutsche Monatshefte 2 (1905). S. 140: Das Trugbild war ein delphisclies
126
W- Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
neigt mehr zu Sagenverschiebungen als das Epos, dem die gottes-
dienstlichen Mastbe fehlen, die jene an die Geschichten legt und
darum bessernde nderungen vornimmt. Und von der Chorlyrik
kommt das Drama her.
Bei der stillschweigenden Polemik behlt Pindar die gewhnliche
Erzhlung, Schritt fr Schritt vorgehend, bei, bis zu dem entscheiden-
den Wort, wo seine nderung hervortritt, s. bes. P 3 (Heimsoeth,
Rh.M. 5 (1847) 6.)
An Sagenkorrekturen auer der oben erwhnten in N 7 liegen vor:
Hymnos fr. 32, 5 Themis ist die erste Gattin des Zeus, nicht
Metis, wie Hesiod erzhlt hatte.
N 5, 14 scheut er sich, die Ermordung des Phokos zu erzhlen.
J 6, 36 SV pivtp XeovTo^ absichtlich zweideutig wie N 10, 62 der
Baum: in den Een hatte sich Herakles auf sein Fell gestellt.
So soll man auch glauben, bis kommt TcepiTiXavaTai.
J 8, 23 exotfxaTo: Zeus schlferte die Aigina ein und nahte ihr
sich nicht als Feuer, wie er in Paian 6, 138 gedichtet hatte.
J 4, 63 x^Xxoapav oxto) avovTCov: Herakles hat nicht im Wahn-
sinn die Kinder der Megara umgebracht, sondern sie sind im
Kampf gefallen.
O 3, 17: Ursprnglich hatte wohl Herakles die Olive mit Ge-
walt geholt wie den delphischen Dreifu (Heimsoeth, RM 5, 6).
1, 46 ff. Pelops ist nicht von den Gttern verspeist worden,
sondern wurde von dem verliebten Poseidon entfhrt.
60 die Strafen des Tantalos?
P
2, 31 Ixion empfngt die Strafe auch wegen des Schwher-
mordes. Den hatte ihm nach der gangbaren Form Zeus vllig
verziehen und ihn nur wegen der Belstigung Heras bestraft.
P 9 fromme, fast in alttestamentlichem Stil beredte Umbildung
des Heldenerziehers Chiron zu einem Begleiter Apollons,
der dessen Allwissenheit huldigt.
P 3, 25 Koronis hatte sich in der Ehoie einem vornehmen Thes-
salier hingegeben, hier dem fremden Arkader Ischys.
27 bei Hesiod" war ein Rabe der Bote,
34
eine Pest,
43
reist Apollon wie ein homerischer Gott hin,
55
wurde Asklepios n cht bestochen.
Hausmittelchen
"
cpaaaa-Motiv ein beliebtes Mittel, zwei gttliche Synonyme
mythographisch auseinanderzuhalten nach Usener, Rh.M. 53 (1898)
S. 345.
2. Die Mythen.
127
Das trbe Wort der Vorfahren Vers 81 ist wohl Q. 527 Soiot
yap TS TiLot xaTaxetaTat ev Ai(; oSei Scopov ola SiSouort
xaxcov, eTepO(; Se eaoiv. Das hat Pindar ohne Komma vor
xaxc5v gelesen, so da er von im ganzen drei Fssern spricht,
vgl. S. 90.
O 10, 51 der Kronoshgel wurde von Herakles so genannt und
war nicht ein uraltes Kronosheiligtum, wie die elische Tra-
dition wollte (Lbbert).
6 in der Vorlage war blo Euadne gttlichen Ursprungs. Pindar
gibt auch Pitane denselben.
9, 40 ^a TioXEfjLov fxaxav
ts Tcaciav /copl^; aavdcTCov sagt er,
um von dem Kampf des Herakles gegen Poseidon, Apollon
Hades loszukommen. Man sieht, es ist ihm ein Bedrfnis,
die Gottheit vergeistigt, in eleatisch verharrendem Sein zu
denken. Mythische Gtterkmpfe sind ihm zuwider. Er
verlangt ctejjlvotyjc; von den (xuot.
N 10 ber die Abweichungen von den Kyprien wegen religisen
Anstonehmens: Sthlin, Philologus 1903.
P
5, 59 bei Hdt. u. Pausanias erlangt Battos seine Stimme aus
Schreck ber die ihm neuen Lwen. Pindar erzhlt eine fr
Battos ehrenvollere Version: Battos hat seine Stimme gleich-
sam verborgen ber das Meer gebracht und erst in Libyen
herausgeholt (Pasquali, Quaest'ones Call macheae, 1914 S. 110).
Im
Pindar
spricht bei diesen nderungen die griechische Lokal-
frmmigkeit
des
Mutterlandes und Delphi und
ganz leise
die
aufkommende
Philosophie.
Er nhert sich von weitem dem Mono-
theismus
eines
Xenophanes und fordert Allmacht und Fehlerlosig-
keit
vom
Wesen des Gottes. Im Grunde ist seine Gottheit im
wesentlichen
eine
einzige. Alle Gtter sind ihm gleich vollkommen,
hoheitsvoll,
untereinander
kaum verschieden. eoc;, 3ai(x<ov ist
jeder in
gleicher
Weise.
Pindar
gehrt in die Reihe der Opponenten gegen Homer, wie
Heraklit (fr. 42 tov Se "OjxTQpov ^cpaaxev ^lov ex tcov aycvcov ex-
aXXsCTai xal
paTutt^eCTat xal 'Apx^Xoxov ofiotw^), Xenophanes,
Euripides,
Piaton.
Von Zeit zu Zeit erhebt sich aus dem tiefsten
Grunde
des
Hellenischen
der Widerspruch gegen Homer (nur von hm
stammt die
griechische
Heiterkeit"), aber Homer blieb oft siegreich ^),
') Nietzsche,
Philologica I S. 262
=-
Weike, Taschenausgabe III S. 246.
128
n. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
Pindar ist einer der ersten, der von dem Lauf der geistigen Entwicklung
gezwungen wird, die Sage zu vertiefen. Er tut es mit ergreifendem
linkischem Ernst, mit Liebe und einer gewissen scheuen Andacht.
Er ist noch zufrieden mit den alten Formen, er ndert aus
einem sich ankndigenden kritischen Bedrfnis nur an den
Mythenfassungen, aber es liegt doch schon der leichte Schatten
des Endhaften ber diesen Gedichten. Das geistige Weiterwachsen
seines Jahrhunderts, auerhalb seines Kreises, erfat auch ihn,
wie in einer kommunizierenden Rhre die Wasserhhe sich zum
allgemeinen Stand hinfindet. Auch er kritisiert die Mythen aus dem
Bedrfnis nach einer Theodizee wie Xenophanes, Aischylos, dann
Euripides. Pindar steht hart am Rand der einbrechenden neuen
Zeit, die vom Dichter die Erfindung neuer Mythen verlangt. Euri-
pides ist nicht mehr tSio^ ev xolvo) crTaXei^. Mit dem Aufkommen
der Bekenntnisdichtung tritt die Frage nach dem Inhalt des Kunst-
werks mit Macht hervor. Zum griechischen Mittelalter steht die
umdeutende Dichtung des 6. und 5. Jahrhunderts hnlich wie die
italienischen Renaissance-Epiker zum Rittertum. Zum Teil werden
die Erzhlungen in Burleske gewandt: Bojardo, Ariost, der komische
Herakles, zum Teil mit dem neuen Pathos ausgestattet: Tasso. Aus
der schnen Abhandlung Rankes
i)
kann man viele Stze einfach
auf die Mythendarstellung der Chorlyrik bertragen.
Die Sublimierung, Ethisierung, Vergeistigung der alten Erzhlungen
seit dem 6. Jahrhundert in Griechenland findet ihr Seitenstck in
der Umbildung, die die entwickelte Jahwe-Religion an den alten
jdischen Erzhlungen von Dmonen, Totengeistern, Mrchenwesen,
Zauberhandlungen vorgenommen hat, bis sie die Form zeigten, in
der sie heute in der Bibel stehen. Gunkel, Mrchen im Alten Testa-
ment, Tbingen 1917, 167 f.
Pindars eigner Ton zeigt sich weniger in der Erfindung als in der
Beseelung und VersinnbildUchung des mythologisch stofflich Ge-
gebenen. Er hat das dichterische Vermgen, seine Gesinnungslyrik
so von dem Anla abzuheben, wie etwa die Betrachtung des
Kreuzestodes Christo in einem KirchenUed sich loslst von dem
zuflligen Anla, da es gerade Karfreitag ist. Die Art, wie die
Chorhymnik Paul Gerhardts den christlichen Mythus durchdringt
0 Haupt voll Blut und Wunden" , ist mutatis mutandis
') s. oben S. 41.
3. Die Spruchweisheit.
|2Q
gar nicht so weit verschieden von der griechischen Chorlyrik
man
denke etwa an a^xTcvsufxa crefjLvov 'AXcpeou. Die literarhistorische
Entwicklung bietet da noch eine weitere Analogie: hier wie dort
steht der hervorragendste Vertreter am Ende und scheint zu spt
gekommen zu sein, Klopstock wie Pindar ^).
3. Die Spruchweisheit.
Die Gnomik kann, wie
S. 126 angedeutet, in der Chorlyrik einen
breiten Raum einnehmen, weil es einem singenden Chor zuwider
bt, lange Strecken hindurch die sachliche Unbeteiligtheit des einzelnen
Erzhlers zu wahren. Er wird immer geneigt sein, von Zeit zu Zeit
dreinzureden, festzustellen und einzuschrfen, was aus der Geschichte
zu ersehen ist und der Hrer zu seinem Nutz und Frommen daraus
lernen soll. Dazu kommt bei der griechischen Chordichtung, da
die Stimme des Chores blo dazu dient, den belehrenden aoc^oe; zu
Worte kommen zu lassen. Der Erzhlungsstil ist also von Haus
aus weder episch, noch volksliedmig, noch balladenhaft. Es handelt
sich vielmehr um eine Art Predigt ber eine Geschichte.
Die Gnomik ist etwas sehr Zentrales in der ganzen antiken Litera-
tur.
"
Diese bekommt durch die Gnomik auf weite Strecken etwas
Lehrhaftes. Weil im Altertum die interessante PersnUchkeit"
keinen Eigenwert hat, ist das selbstverstndliche Kunstziel proprie
communia dicere (Horaz, ars poetica
128) Das fhrt leicht zum
Gemeinplatz. Damit ist die Literatur noch nicht zur Langeweile
und Banalitt verurteilt, aber es ist die Richtung auf eine Art ge-
geben, die wir Deutschen nicht als die hchste Mglichkeit der Litera-
tur ansehen. Gnomik trivialisiert leicht die Rede. Die Franzosen
lieben dieses ideal classique mehr. Man denke etwa daran, in wie
hohen Tnen ein so einflureicher Kritiker wie Brunetiere von den
lieux communs und den idees gen6rales spricht ^).
Das Wohlgefallen an Sentenzen beruht nach Aristoteles rhet.
II 21 1395b auf zweierlei: Einmal freuen sich die Zuhrer, in einer
allgemeinen Form das ausgesprochen zu hren, was sie schon vor-
her als besondere Vorstellung in sich hatten. Zweitens aber verleiht
die Gnome der Rede Charakter, yjOixo^)^ tzoizI Totix; Xdyou^;, weil sie
die Gesinnung des Redenden bekundet. Die Gnome imponiert
durch ihre Entfernung von den zuflligen Einzelheiten, fordert fr
^) Ni ersehe, Menschliches Allzumenschliches I Nr. 281. Werke 111 S. 243.
2) E. R. Curtius, Brunetire. Straburg 1914. S. 21f.
Dornseiff, Pindars Stil.
130
II. Die Glieder des Baues ufid ihre Behandlung.
sich Beachtung und erscheint bedeutend, weil sie Weiteres umfat,
als gerade vorliegt.
Vor allem aber merkt man an der Spruchweisheit, da das Morgen-
land nahe ist. Die yvcofiY] und das maschal, da ist der Unterschied
nicht gro. Gute Sprche helfen jedem im Leben, von diesem Grund-
satz hat der Orient auch heute noch nicht gelassen. Aussprche der
Weisen ber die Hinflligkeit der Welt, die Eitelkeit der Dinge,
die Krze des Lebens, den Wechsel des Glcks sind gern hervorgeholte
Kostbarkeiten. Europa hat sich in der Dichtung immer mehr von
diesem Lehrhaften abgewandt: Freidanks Bescheidenheit u. dgl.
war noch hohe Literatur, die Adagia des Erasmus sind schon Ge-
lehrsamkeit, die Sprche Goethes, Rckerts eine Spezialitt einzelner,
die fr die Patriarchenluft des Ostens geffnete Sinne hatten.
Durch diese sentenzis formulierten allgemeinen Wahrheiten
gibt es immer Ausblicke auf das Ganze, Ewige des Lebens. Und
deren bedarf die Chorlyrik, die das Monumentale erstrebt. Wo
immer wir lngere ,erzhlende Stcke chorischer Lyrik haben, finden
wir, da der Bericht sich ins Allgemeine ausweitet, sobald das Aller-
ntigste. Tatschliche
auch dies in der S. 126 besprochenen Art
mitgeteilt ist (s. etwa Aisch. Agam. 250, 436, 461).
Im einzelnen sind manche Anklnge an die ltere didaktische
Elegie derTheognis, Solon zu spren. Im allgemeinen jedoch ist
die Formung der Sentenz in der Chorlyrik original ^). Als chor-
lyrischer Topos ist das beilufige Einfgen von fatalistischen Sprchen
schon bei Alkman fertig da
der Abschlu der Mythen-
erzhlung im Parthenion sgtl tic, atcov tIgic, ist typisch , und
vor allem Bakchylides vertritt den chorlyrischen Durchschnitt:
seine leeren, vllig uninteressiert hingesagten Sentenzen klappern.
Pindars Sentenzen gehren zur Bewegung und leiten sie weiter.
Bakchylides' Sentenzen unterbrechen sie, um auf die Moral hinzu-
weisen.
Die Gnomik gibt Pindars Gedichten das ungeheuer Naive, das
ihnen trotz allen barocken Sprachpompes anhaftet. Die Sentenz
ist oft wenig bedeutsam, aber durch orakelhafte Dunkelheit geadelt.
Er kann gar nicht schnell genug mit der Moral der Geschichte kommen.
Ist immer bereit , abzubrechen mit einem berhaupt . .
.",
ja . .
.".
) Zur Formung der Sentenzen vgl. oben S. 97 ff.
3. Die SpruchWeisheit.
13|
Die Reflexionen und Maximen dienen oft als Brcken, Klammern,
berleitungen, sie sollen einen pltzlichen Themawechsel verschleiern
oder mildern.
Die allgemeine Wahrheit, als Spruch an den Beginn gestellt,
kUngt leicht etwas dogmatisch. Das ist aber nur Stil, Vorbereitung
und berleitung fr die Erzhlung einer Geschichte. Man braucht
da nicht gleich von der Warte des apollinischen Propheten" zu
sprechen.
Eine Besonderheit Pindars scheint eine gewisse bissige Art zu
sein, das Gedicht mit einem Sprichwort zu beschlieen, eine etwas
knurrende Sphragis (P 2, 5; 2, 3, 13; N 7; J 4, 5).
Auch die Art,
wie Pindar den sogenannten polaren Zusatz verwendet, gehrt hierher.
Nem.
1, 53; P 2, 83; 11, 29.
Diesen gnomischen , der Kunstform adquaten Zug ins All-
gemeine hat Pindar
soweit wir urteilen knnen
mehr als andere
und ihn berall in seiner Ausdrucksweise durchschimmern lassen.
Er ist der letzte groe Dichter, der sich in der archaischen Weise
als Didaktiker fhlt. Er identifiziert sich am meisten von allen
mit der Gnomik, ist eifriger, wuchtiger als die anderen. Der rein enko-
miastische, mythische Gehalt ist bei ihm am vollstndigsten in seinem
Ton und Strom aufgelst. Etwas vllig davon Verschiedenes ist
der bermige Gebrauch, den Euripides von der Sentenz macht.
Euripides* Helden sind Sophisten, die einander durch Deduktionen
allgemeingltigen Inhalts am sichersten zu widerlegen glauben.
Pindar sagt Sprche wie ein buerischer Priester, Euripides wie ein
Advokat (gegen Pindar gehalten I).
Will man die pindarische Chorpoesie nherungsweise mit einer
unserer literarischen Bezeichnungen benennen, so drfte sie der
Gesinnungslyrik zuzurechnen sein. Diese will in verwandten Seelen
die gleiche Gesinnung wecken und lebendig erhalten. sthetisch
betrachtet ist sie Mischgattung, etwa wie Kunsthandwerk. Der
Eindruck ist davon abhngig, ob man die Stimme eines Menschen
vernimmt, in dem diese Gesinnung ethisch lebendig ist. Sie ver-
mittelt einen Strom von Wahrheit, das Knstlerische wird nebenbei
genossen und in jeder Qualitt dankbar und gengsam hingenommen ^),
Solche chorische Reflexions- und Gesinnungslyrik gibt es in alt-
ndischer und althebrischer, auch in altgermanischcr Dichtung.
^) Theodor A. Meyer, Das Kirdienlied. Programm Sdint|;ial. Hoil-
bronn 1892.
9*
132
n. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
Dann im Kirchenlied (s. S. 3, 128)
und in den Festgedichten Schillers:
Siegesfest, Eleusisches Fest, Knstler, bei Hlderlin und George.
Welches ist nun aber die Gesinnung, der Pindar dient ? Zunchst
ist da viel von den xpsiTTovec; die Rede, dem Schicksal, der Gefahr
der Hybris. Es sind die Lehrweisheiten der griechischen Volks-
religion. Auch das Pathos der griechischen Tragdie geht hervor
aus dem starken Gefhl einer ganz unerklrlichen Unvertrglichkeit
zwischen heroischer Gre und der Nichtigkeit des Wohin, aus dem
Gefhl von dem unbeantworteten Warum, das unaufhrlich in
tausend Tonarten aus dem menschlichen Leben heraustnt. Die
Poesie der Griechen gewann aus der Betrachtung dieser Dinge ein
Pathos, das in seiner Trauer unaussprechHch schn war. Die Ilias
hatte eine mchtige untere Strmung davon bei all ihrer gesunden
kindlichen Objektivitt, in der Tragdie bestimmt diese Trauer
das ganze threnoshafte Moll der Verse ^). Hier haben die Sentenzen
eine einzigartige Majestt.
Pindar spricht von denselben Dingen in hnlichen, sichtlich
festliegenden Formen, aber doch anders. Er ist eine dem Leben
zugewandte, praktische, eifernde Natur. Er spricht nie von der Niedrig-
keit und Machtlosigkeit der Menschen gegenber den Gttern, ohne
sogleich irgendein lebenstechnisches Linderungsmittel dazuzugeben.
Selbst die mdeste Stelle, das Tt 8s tk;; tI S* o tl?; im Altersgedicht
P 8 klingt aus in den Gedanken, da ein Agonsieg leuchtender Glanz
und honigse Zeit fr die Menschen ist. Pindar hat darin dieselbe
simplicite pratique et profonde ^) wie andere Dichter des grie-
chischen Mittelalters, Solon und Theognis und vor allem wie
Archilochos, dem er als adliger Auenseiter nahesteht. Das (jly) Xiyjv
des verarmten parischen condottiere, nicht zu sehr jubeln und nicht
zu sehr jammern 1 unterscheidet sich durch die soldatische Burschen-
haftigkeit von dem bedchtigen Ta xal toc des boiotischen Proxenos
von Delphi, aber gegenber den feinen elegischen Joniern und
Keern gehren sie zusammen.
Um die Komposition im ganzen richtig zu sehen, empfiehlt es
sich, einen Blick auf die Kompositionskunst der Griechen sonst zu
') Mit Benu^ung der schnen S^e von E. D. West, Browning, Dark-
Blue Magazine 1871, angefhrt von Dowden, Shakespeare. Deutsche Aus-
gabe S. 21.
'^)
Croiset, La Poesie de Pindare*454.
3. Die SpruchWeisheit.
133
werfen, v. Wilamowitz rhmt dem Labda der Ilias und dem epischen
Bericht ber Hektors Tod (ab 526) eine Strenge der Tektonik nach,
eine Symmetrie, die kein Giebelfeld bertrifft (Gr. Lit.-G. 12). Das
Attische bedeutet gegenber dem Jonischen einen weiteren Schritt
zum Europischen hin: Tragdie, Komdie, Lustspiel, Dialog, Rede
der groen Athener weist den strengen und keuschen Adel der schnen
Form, die groe Tektonik, die das Ornament im Zaum hlt und dem
Logos des Kunstwerks dienstbar macht (ebenda S. 224).
Demgegenber ist in der Chorpoesie die Komposition durchaus
fassadenmig, nicht klar durchsichtig gegliedert mit Betonung
der Teilgrenzen, keine Durchfhrung, keine thematische Arbeit,
vielmehr eine asiatische Technik des Einrahmens, wie sie die indischen
Erzhlungen pflegen, verwischt wie die Diktion. Whrend das
Griechentum sonst die berwindung des gyptischen Flchenstils
bedeutet, in der bildenden Kunst so gut wie in der Literatur, das
entschiedene Weitergehen zu europischem Logos, rundum abge-
tasteter Plastik, kluger besonnener Klarheit und berschaubarer
geordneter Gliederung der Teile, ist hier noch der stliche primitivere
Flchenstil festgehalten. Der Anfang mu schn sein
darauf ist
Pindar stolz: O 6, P 7, N 4 , dann wuchert und kriecht das brige
unzentriert irgendwie weiter. Europisches vorbereitendes Hinarbeiten
auf einen groen poetischen Hhepunkt, d. h. jede Steigerung fehlt.
Meist ist der Anfang pomps und das Ende trocken. Das ist archaische
Kompositionskunst, vor der attischen zentrierten Weise.
Infolge des Nebeneinanders von Hymnik, Gnomik, Enkomiastik
und Erzhlung beschrnkt sich der Raum fr jeden besonderen
Bestandteil, die einzelne Vorstellung tritt nicht ganz, sondern
halberhoben hervor wie beim Relief, und indem an ihre teilweise
Ausfhrung sich ein allgemeiner Satz oder W^hrspruch knpft, tritt
sie in diesen, in den Grund zurck, um einer neuen, die hnlich ge-
krzt ist, Raum zu geben" ^). Um diesen Vergleich mit dem Reliefstil
festzuhalten: man wird nicht an Metopen denken oder an festum-
grenzte Vasenbilder, sondern mehr an einen stark ornamenthaft
gehaltenen Fries mit kontinuierlicher Darstellung. Es entwickelt
sich eins aus dem anderen, in dem es andeutungsweise schon ist, wie
symbolhafte Tiere und Pflanzen in einem frhen Ornamentstreifen,
^) AdolphSchoell, ber das Altfrnkische in Pindars Stil. Gesammelte
Aufstze. Berlin 1884. S. 9.
134
n. Die Glieder des Baues und ihre Behandlung.
visionr geschaute Bilder von eigentmlich
zwingender
cteijlvoty)^,
die fr uns traumhaft vorberschweben wie auf einem Teppich, eine
Gestaltenreihe ohne Anfang und Ende. Fr die mitlebenden Griechen
zogen sie ^ohl so selbstverstndlich vorber wie ein Komos ^).
Nachtrge
zu Seite 19:
Im Gegenteil der Hang, die Dinge ungewhnlich, gewhlt, um-
stndlich zu sagen, die Freude am langen gewichtigen Wort (s.S. 88),
bringt Komposita auch an solche Stellen, wo man das Simplex
erwartet. Etwa wie man am Schlu eines Briefes schreibt: ich
verbleibe Ihr usw. Headlam, Class. review 16
(1902) 337 f. hat
Stellen gesammelt, wo Sophokles statt
slvai sagt ^uvetvai. An
dergleichen wird man oft beim Lesen Pindars erinnert, vgl. die
S. 95 verzeichneten Komposita von
(jLetYvu(xi oder 1, 29 e^ajcaTcovTt,
51 hzBoiaccJio, 69 avs9p6vTi<7v, 86 i(f>6i^aLTo; O
2,
108 mpi-
7ue9suYv.
Simplicia haben volksmige Einfalt, Wucht der sinn-
lichen Ausdrucksflle, man hat die Sprache da aus erster Hand.
Das Simplex stellt sich ein , wo sich einem das Einfache oder
das Ewige auf die Zunge drngt. Das Kompositum dagegen
ist zeremonis, weltmnnisch, zivilisiert, rhetorisch, theatralisch,
das Simplex schon in der Prosa burisch einfach, altfrnkisch,
kernig, auch in der Amtssprache sagt man es, wo man von
altem Schrot und Korn sein will. Gute Beobachtungen fr das
Lateinische gibt hierber Max C. P. Schmidt, Stilistische Beitrge I,
Leipzig 1912, 54 ff
.
zu Seite 86:
Der Sentimentalische biegt damit zurck zum Primitiven. Denn
auch das primitive Denken bevorzugt die nominale Ausdrucksweise
bei der Satzbildung, arbeitet gegenstndlich, attributiv, vgl. Max
Deutschbein, Satz und Urteil, Cthen 1919 S. 4.
*) Was das fr die Griechen war, beleuchtet Jakob Burckhardt, Vor-
trge. Basel 1918. ber Prozessionen", v. Salis, Die Kunst der Griechen,
Leipzig 1919, 157 ff.
Namen und Sachen.
Aigiden 84.
Aischylos 8, 67, 73, 77, 99,
llOf.
Alkman 6, 83, 123, 130.
Allgemeine Begriffe 19.
Anapher 103.
Antithese 106.
dtTTO xotv^O 105.
Apposition 89.
Arbeit 60.
Archaik 8.
Archilochos 6, 132.
Asianer 87.
Asymmetrie 103.
Augenhaftes 56 f.
Bakchyhdes 1, 42, 88.
Beiordnen 96.
Beiwort 34 ff.
Belebung 46.
Berni 41.
Bildgebung 49.
Bildlichkeit 44 ff.
Blumen 43, 60.
Chorlyrik 3.
Dante 73.
Diatribe 100.
Dithyrambus 6.
Edda 32, 92, 93.
Einrahmen 107.
Emphase 76.
^v oioc Suotv 26.
Enjambement 108.
ETTixXV.act? 30.
Euphemismus 80.
Fgung, harte, 86.
Genealogische Verknp-
fung 51.
Y^vo; 2.
George 18, 25, 87, 132.
Gleichnis, homerisches 44.
Goethe 31, 75, 111.
Herakleitos 15, 52, 69, 91.
Hesiodos 29.
Hiob 73.
Hlderlin 87, 132.
Homer 35, 40, 133.
Horaz 37.
Hymnik 91.
Ich, chorlyrisches 81.
individuell und konven-
tionell 2, 55.
Kallimachos 85, 97.
Kehrreim 4.
Kennlng 32, 92.
Kirchenlied 128.
Klopstock 25, 74, 79, 87.
Kompositum 134.
Krnze 47, 59.
Kunst, bildende
7, 8 f., 31,
48, 57, 75, 133.
Lasos 6.
Lautes Lesen u. Beten 34.
Licht fr Klang 57.
Lieblingswrter 75.
Litotes 77.
Lobworte 80.
Lykophron 33, 111.
Mehrzahl 23 f.
Metrik 13.
Milderung 80.
mischen" 94 f.
Mundart 11.
Musik 13, 92, 110, 111.
Naturgefhl 47.
Nomesform 119.
Ode 74.
Orakelpoesie 29.
Parmenides 15.
Parthenien 83.
Personifikation 50;
Poetischer Wortscha^ 17.
polare Ausdrucksweise
102, 131.
Ti^'poi; 32.
Preziositt
9, 67.
Priamel 97.
Psalmen 3, 82, 100 f.
Rhetorik 15f., 115ff.
Sagenkorrekturen 125 ff.
Sappho 99.
Schicksal 65.
Schiffahrt 65.
Schiller, Friedrich
85, 132.
Simonides von Keos
7, 88.
i
Simplex 18.
i
Sinnbild 69.
i
Sive-sive-Stil 9.
i
Sophokles 100, 110.
Stesichoros 120.
Superlativ 78.
Symbohsten 71.
Synonymik 27.
Testament, Altes
26, 36,
49, 101.
Neues 49.
Tiere 63.
TOTco;
2, 113.
bersehen 14, 45, 71.
Umschreibung 28.
I
Vergil 26, 30.
Vergleich ohne wie 97.
Versma 13.
Wort, einzelnes 88.
Zahlenspruch 101.
Zeugma 106.
Behandelte Stellen.
Olymp.
1, 1: 98. 1, 71:
49. 6,22:66. 6,57:49.
9,1: 6. 10,72: 50. 95:
60. 11,8:60. 13,49:5.
Pyth. 2, 67: 106. 3, 38:
45. 107:84. 4:8. 4, | Jsthm. 2, 5 : 46. 8,1:26.
19:
57:
k
/
5"*
Domseiff,
Franz
4.276
Pindars
stil
Do
PLEASE
DO
NOT
REMOVE
CARDS
OR
SLIPS
FROM
THIS
POCKET
UNIVERSITY
OF
TORONTO
LIBRARY
^
tel.^^
y^i%
.^
^^.'-^v
i-
W^
-m.
wm
i^^^lT
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Altgriechisch Lehrgang Lektion 44 PDFDokument24 SeitenAltgriechisch Lehrgang Lektion 44 PDFChristianFelberNoch keine Bewertungen
- Gross, Adolf, Die Stichomythie in Der Griechischen Tragödie Und Komödie, Ihre Anwendung Und Ihr Ursprung, Berlin, Weidmann, 1905Dokument109 SeitenGross, Adolf, Die Stichomythie in Der Griechischen Tragödie Und Komödie, Ihre Anwendung Und Ihr Ursprung, Berlin, Weidmann, 1905schediasmataNoch keine Bewertungen
- 无 Das Schweigen der Sirenen - Studien zur deutschen und österreichischen Literatur (PDFDrive) PDFDokument434 Seiten无 Das Schweigen der Sirenen - Studien zur deutschen und österreichischen Literatur (PDFDrive) PDF孙祺祺Noch keine Bewertungen
- Wolfgang Schadewaldt - Von Homers Welt Und Werk - Aufsätze Und Auslegungen Zur Homerischen Frage-K.F. Koehler (1965) PDFDokument516 SeitenWolfgang Schadewaldt - Von Homers Welt Und Werk - Aufsätze Und Auslegungen Zur Homerischen Frage-K.F. Koehler (1965) PDFKapou KaponNoch keine Bewertungen
- Sentenz in der Literatur: Perspektiven auf das 18. JahrhundertVon EverandSentenz in der Literatur: Perspektiven auf das 18. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Kleine deutsche Literaturgeschichte: erzählt an 20 GedichtenVon EverandKleine deutsche Literaturgeschichte: erzählt an 20 GedichtenNoch keine Bewertungen
- Rhetorik und Wissenspoetik: Studien zu Texten von Athanasius Kircher bis Miljenko JergovicVon EverandRhetorik und Wissenspoetik: Studien zu Texten von Athanasius Kircher bis Miljenko JergovicNoch keine Bewertungen
- Lachawitz Gunter Einfuhrung in Die Griechische SpracheDokument73 SeitenLachawitz Gunter Einfuhrung in Die Griechische SpracheRand Erscheinung100% (1)
- Wiederaufgelegt: Zur Appropriation von Texten und Büchern in BüchernVon EverandWiederaufgelegt: Zur Appropriation von Texten und Büchern in BüchernNoch keine Bewertungen
- Und Theben liegt in Oberfranken.: Die Genese der literarischen Kulisse, aufgezeigt an Werken E.T.A. HoffmannsVon EverandUnd Theben liegt in Oberfranken.: Die Genese der literarischen Kulisse, aufgezeigt an Werken E.T.A. HoffmannsNoch keine Bewertungen
- Deutsche Literaturgeschichte für Einsteiger: Eine spannende und unterhaltsame Reise durch die deutsche Literatur vom Mittelalter bis zur GegenwartVon EverandDeutsche Literaturgeschichte für Einsteiger: Eine spannende und unterhaltsame Reise durch die deutsche Literatur vom Mittelalter bis zur GegenwartNoch keine Bewertungen
- NIZAMI, Haft Paykar (Ed. Ritter & Rypka)Dokument364 SeitenNIZAMI, Haft Paykar (Ed. Ritter & Rypka)Jonathan Dubé50% (2)
- LiteraturgeschichteDokument37 SeitenLiteraturgeschichteIvana Radovanovic100% (1)
- Platons Lieb-ido: Ein wissenschaftlicher Roman - eine Überredung zur SelbsttherapieVon EverandPlatons Lieb-ido: Ein wissenschaftlicher Roman - eine Überredung zur SelbsttherapieNoch keine Bewertungen
- Wahrheit Und Kunst. PeterDokument520 SeitenWahrheit Und Kunst. Peteralexiselisandro100% (1)
- Albin Lesky - Geschichte Der Griechischen Literatur-Saur (1999 (1971) )Dokument1.025 SeitenAlbin Lesky - Geschichte Der Griechischen Literatur-Saur (1999 (1971) )Fernando Orozco100% (1)
- Knjizevnost 2 Skripta - Po Pitanjima Za UsmeniDokument44 SeitenKnjizevnost 2 Skripta - Po Pitanjima Za UsmeniJelena Cvet NešićNoch keine Bewertungen
- Gumbrecht - Koloniale ChronikenDokument517 SeitenGumbrecht - Koloniale ChronikenSanjaminoNoch keine Bewertungen
- Ha Zauberlehrling Ss2003Dokument11 SeitenHa Zauberlehrling Ss2003Gruia AndreeaNoch keine Bewertungen
- Logik der Prosa: Zur Poetizität ungebundener RedeVon EverandLogik der Prosa: Zur Poetizität ungebundener RedeAstrid ArndtNoch keine Bewertungen
- SpringerDokument4 SeitenSpringerrealgabriel22Noch keine Bewertungen
- Wörterbuch Der Rhetorik SynekdocheDokument106 SeitenWörterbuch Der Rhetorik SynekdocheMonika TNoch keine Bewertungen
- Literarische Ägäis: Ein Kulturraum zwischen Mythos und GeschichteVon EverandLiterarische Ägäis: Ein Kulturraum zwischen Mythos und GeschichteAnastasía AntonopoúlouNoch keine Bewertungen
- Mehrdeutigkeit als literarisches Thema: Strategien und Funktionen von der Romantik bis zur GegenwartVon EverandMehrdeutigkeit als literarisches Thema: Strategien und Funktionen von der Romantik bis zur GegenwartStefan DescherNoch keine Bewertungen
- Gale M.R. - Avia Pieridum Loca Tradition An Innovation in Lucretius - 2005Dokument21 SeitenGale M.R. - Avia Pieridum Loca Tradition An Innovation in Lucretius - 2005Jean-Claude PicotNoch keine Bewertungen
- Book JAKOBI - Der Einfluss Ovids Auf Den Tragiker Seneca (1988)Dokument246 SeitenBook JAKOBI - Der Einfluss Ovids Auf Den Tragiker Seneca (1988)VelveretNoch keine Bewertungen
- Kröll - Ekphrasis Im Spätantiken Epos - 2013Dokument14 SeitenKröll - Ekphrasis Im Spätantiken Epos - 2013Αλέξανδρος ΣταύρουNoch keine Bewertungen
- Epochen 1200 1949Dokument11 SeitenEpochen 1200 1949helNoch keine Bewertungen
- Stellen, schöne Stellen: Oder: Wo das Verstehen beginntVon EverandStellen, schöne Stellen: Oder: Wo das Verstehen beginntNoch keine Bewertungen
- Rauswühlen, rauskratzen aus einer Masse von Schutt: Zum Verhältnis von Stadt und Erinnerung im Werk von Peter WeissVon EverandRauswühlen, rauskratzen aus einer Masse von Schutt: Zum Verhältnis von Stadt und Erinnerung im Werk von Peter WeissNoch keine Bewertungen
- See Held Und Kollektiv 1993Dokument19 SeitenSee Held Und Kollektiv 1993Ricky JamesNoch keine Bewertungen
- Finderglück: Mäßig unzeitgemäße BetrachtungenVon EverandFinderglück: Mäßig unzeitgemäße BetrachtungenAnne HamiltonNoch keine Bewertungen
- VolksballadenVon EverandVolksballadenHermann SchladtNoch keine Bewertungen
- Das Mittelalter der Gegenwart: Poetische ZeitenräumeVon EverandDas Mittelalter der Gegenwart: Poetische ZeitenräumeNoch keine Bewertungen
- Poetik des chinesischen Logogramms: Ostasiatische Schrift in der deutschsprachigen Literatur um 1900Von EverandPoetik des chinesischen Logogramms: Ostasiatische Schrift in der deutschsprachigen Literatur um 1900Noch keine Bewertungen
- Port Über Hölderlins Landschaftkunst PDFDokument28 SeitenPort Über Hölderlins Landschaftkunst PDFSantiago H. AparicioNoch keine Bewertungen
- Lecture Notes Ancient Greek Comedy 2016Dokument179 SeitenLecture Notes Ancient Greek Comedy 2016EvelinaNoch keine Bewertungen
- Es tagt schon im Orangenhain: Skizzen zur spanischen LiteraturVon EverandEs tagt schon im Orangenhain: Skizzen zur spanischen LiteraturNoch keine Bewertungen
- Latenz: Zur Genese des Ästhetischen als historischer KategorieVon EverandLatenz: Zur Genese des Ästhetischen als historischer KategorieNoch keine Bewertungen
- Wolfram Groddeck Uber Holderlin Brod Und WeinDokument4 SeitenWolfram Groddeck Uber Holderlin Brod Und Weindeutsch993Noch keine Bewertungen
- Schilder, Klaas - Zur Allgemeinen Begriffsgeschichte Des ParadoxenDokument467 SeitenSchilder, Klaas - Zur Allgemeinen Begriffsgeschichte Des ParadoxenLars KieselNoch keine Bewertungen
- Iphigenie DM 2Dokument13 SeitenIphigenie DM 2Alexandra-Ioana RoșuNoch keine Bewertungen
- Zwei Liebesgedichte vom Ausgang der lateinischen Antike: Ausonius' Bissula und das Pervigilium VenerisVon EverandZwei Liebesgedichte vom Ausgang der lateinischen Antike: Ausonius' Bissula und das Pervigilium VenerisNoch keine Bewertungen