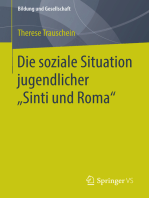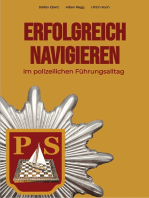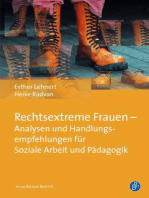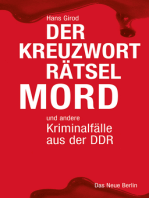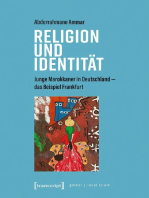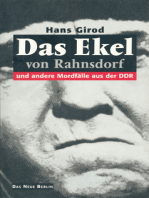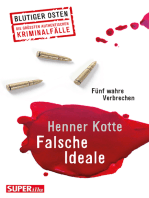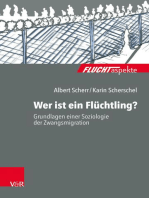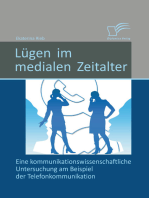Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Devianz Und Delinquenz Türkischstämmiger Jugendlicher
Hochgeladen von
ggggggg66zr0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
229 Ansichten128 SeitenCopyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
229 Ansichten128 SeitenDevianz Und Delinquenz Türkischstämmiger Jugendlicher
Hochgeladen von
ggggggg66zrCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 128
Auslnderkriminalitt -
Delinquenz und Devianz trkischstmmiger
Jugendlicher und Heranwachsender in Rheindorf-Nord
DIPLOMARBEIT
angefertigt an der Fachhochschule Kln
Fachbereich Sozialpdagogik
vorgelegt von
Jessica Lado
Wielandstrae 12
50968 Kln
Martrikelnummer: 11033507 1 7
im WS 2004/2005
1. Gutachter: Prof. Dr. phil. Dr. rer. hort. habil. Herbert Schubert
2. Gutachter: Prof. Dr. Andreas Thimmel
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ......................................................................................................... 1
1. Zum Begriff der so genannten Auslnderkriminalitt ... 3
2. Allgemeine Delinquenz und Devianz-Theorien.. 4
2.1. Die Klassische Schule ..... 5
2.2. Biologische Erklrungsanstze 6
2.3. Psychologische Kriminalittstheorien.. 6
2.3.1. Psychoanalytischer Ansatz... 6
2.3.2. Kontrolltheorie und Halttheorie... 8
2.3.3. Theorie der Neutralisationstechniken.. 10
2.4. Sozialpsychologische Kriminalittstheorien 11
2.4.1. Theorie der differenziellen Assoziation/Kontakte... 11
2.4.2. Theorie der differentiellen Verstrkung und
des Lernens am Modell 12
2.4.3. Frustrations-Aggressions-Theorie... 13
2.5. Soziologische Kriminalittstheorien 13
2.5.1. Anomietheorie.. 13
2.5.2. Kulturkonflikttheorie 15
2.5.3. Subkulturtheorie16
2.5.4. Theorie der differentiellen Gelegenheit 17
2.5.5. Theorie des Labeling Approach (Etikettierungsanstatz).. 18
2.5.6. kologische Theorie der Chicagoer Schule..21
2.6. Mehrfaktorenanstze und Prozessmodelle22
3. Zur Delinquenz von Jugendlichen und Heranwachsenden mit
Migrationshintergrund in Deutschland 24
3.1. Zu den Verzerrungsfaktoren der Polizeilichen Kriminalstatistik. 29
3.2. Lebenslage der Bevlkerung mit trkischem Migrationshintergrund...... 32
3.2.1. Wohnumfeld und Parallelgesellschaft . 36
3.2.2. Berufliche und Wirtschaftliche Situation der trkischen
Bevlkerung......................................... 38
3.3. Mgliche Faktoren von Devianz und Delinquenz
trkischstmmiger junger Menschen..........39
3.3.1. Sozialisationsbedingte Faktoren der Entstehung von
Delinquenz 39
3.3.2. Migrationsbedingte Faktoren der Entstehung von
Delinquenz 41
3.3.3. Soziokulturelle Merkmale der Entstehung von
Delinquenz 42
3.3.4. Institutionelle Faktoren der Entstehung von Delinquenz. 44
3.3.5. Ungleiche Ausbildungschancen49
3.3.6. Zur sprachlichen Situation 52
3.3.7. Einfluss der gesellschaftliche Faktoren ... 54
3.4. Die Bedeutung des Islam fr junge trkischstmmige Menschen. 56
3.5. Einfluss und Nutzung der Medien...61
3.6. Trkische Jugendliche und Ihre Identittsbildung.. 64
4. Der Sozialraum Rheindorf-Nord....69
4.1. Leverkusen Rheindorf-Nord... 71
4.2. Analyse des Sozialraumes anhand der
Bevlkerungs- und Sozialstrukturdaten.. 73
4.2.1. Arbeitslose und Sozialhilfeempfnger... 76
4.2.2. Rumliche Situation... 78
4.2.3. Angebotsstruktur Jugendarbeit in Rheindorf-Nord 79
4.3. Deskriptive Analyse der polizeilich registrierten
Kriminalitt fr Rheindorf-Nord . 82
4.3.1. Zur Bewertung der Kriminalittsentwicklung der
rtlichen Fall- und Tatverdchtigenzahlen... 84
4.3.1.1. Der Anteil der verschiedenen Deliktsgruppen der
registrierten Delinquenz junger Menschen... 86
4.3.1.2. Nichtdeutsche und deutsche Tatverdchtige im
Vergleich. 88
4.3.1.3. Konzentration der Tatorte und Tterwohnorte 90
4.4. Qualitative Analyse.. ... 93
4.4.1. Interviews mit trkischstmmigen Bewohnern und
Bewohnerinnen 93
4.4.2. Interviews mit trkischstmmigen Jugendlichen und
Heranwachsenden aus Rheindorf .... 95
4.4.3. Interviews mit dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe
und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern der
Jugendeinrichtungen 98
4.4.4. Interviews mit den zustndigen Polizeibeamten ... 100
5. Ergebnisse der Analyse und abschlieende Darstellung. 103
5.1. Sozialpdagogische Handlungsanstze.. 108
Literatur 114
Anhang. 124
Einleitung
Es ist schon vierzig Jahre her, dass der Zuzug trkischer Gastarbeiter begonnen
hat. Nun wchst in Deutschland schon die dritte Generation heran, die Enkel der
Immigranten der sechziger und siebziger Jahre. Im Jahr 2003 lebten in der
Bundesrepublik Deutschland 1,88 Millionen Trken (Statistisches Bundesamt,
2005). Seit Anfang der siebziger Jahre trifft der Begriff Gastarbeiter fr die
trkischen Arbeitnehmer nicht mehr zu, er suggeriert einen vorbergehenden
Aufenthalt und entspricht nicht mehr der Realitt, er sollte deshalb auch keine
Verwendung mehr finden (Herbert, 2003).
Der Begriff der Auslnderkriminalitt ist seit langem ein Bestandteil der
rechtsextremen Propaganda, bietet aber auch in den Medien und der Politik sowie in
der fachffentlichen Auseinandersetzung immer wieder Anlass zu Diskussionen. Mit
Verweisen auf die Tatverdchtigen-Statistiken der Polizei soll bewiesen werden, dass
Auslnder um ein Mehrfaches krimineller sind als Deutsche, insbesondere
Jugendliche und Heranwachsende. Diese Aussagen fhren hufig zu einer
Dramatisierung der Gegebenheiten und sind abstrahiert von der Wirklichkeit.
Aufgrund dieser Tatsache sah ich es als unbedingt erforderlich an, den Begriff der
Auslnderkriminalitt besonders zu errtern. Um solchen Annahmen entgegen zu
setzen und diese Problematik zu beleuchten, mchte ich in dieser Arbeit erarbeiten,
ob eine erhhte Kriminalitt besteht. Auerdem, sowohl ob Jugendliche und
Heranwachsende mit einem Migrationshintergrund strkeren kriminalisierenden
Einflssen ausgesetzt sind, als auch welche spezifischen Merkmale die Kriminalitt
dieser Gruppe aufweist. Im Besonderen soll hier der Blick auf die mnnlichen
Jugendlichen und Heranwachsenden mit trkischem Migrationshintergrund gerichtet
werden, da die trkischstmmige Bevlkerung den grten Teil der hier lebenden
Migranten bilden und besonders die von ihnen angeblich ausgehende Gewalt und
Delinquenz immer wieder angefhrt wird. Die Arbeit in der Materie offenbarte
schnell, dass das Thema der Auslnderkriminalitt, die Gestaltung und
Aussagekraft statistischer Unterlagen und die Lebenslagen der trkischen
Bevlkerung sowie die groe Inhomogenitt dieser Gruppe zahllose Fragen und
Problemfelder aufwarf. Der Frage, welche Aufgaben sich daraus fr eine prventive
Sozialpdagogik ableiten lassen, soll nachgegangen werden.
Im ersten Teil soll ein berblick ber den Stand der Delinquenz in Deutschland und
die allgemeinen Theorien der Jugendkriminalitt geschaffen werden. In diesem Teil
soll sowohl dem Etikettierungsansatz (Labeling-Approach), der Kulturkonflikttheorie
und der Theorie der sozialstrukturellen Benachteiligung Platz eingerumt werden, da
angenommen wird, dass sie in Bezug auf junge Migranten eine besondere Bedeutung
haben (Schwind, 2004), als auch ein kleiner berblick ber die gngigen
Kriminalittstheorien gegeben werden. Des Weiteren wird die Lebenslage der
Bevlkerung mit trkischem Migrationshintergrund errtert, unter besonderer
Bercksichtigung kriminogener Faktoren auf die mnnlichen trkischstmmigen
Jugendlichen und Heranwachsenden. Die Ergebnisse zeigen, dass trkischstmmige
Menschen und ihre Kinder hnlichen, aber auch unterschiedlichen
Beeinflussungsfaktoren unterliegen wie die deutsche Bevlkerung, die ein deviantes
oder delinquentes Verhalten bewirken knnen. Zum einen bestehen
1
sozialisationsbedingte, soziokulturelle und migrationsbedingte Faktoren, zum
anderen institutionelle und gesellschaftliche Faktoren, die einer genaueren
Bearbeitung bedrfen. Einen besonderen Stellenwert nimmt hierbei die spezielle
Problematik der Identittsbildung ein, auf die in Abschnitt 3.6 gesondert
eingegangen wird. Dabei ist zu sagen, dass die Frauen in dieser Arbeit nicht
bergangen werden sollen, aber da sie hinsichtlich der Kriminalitt eine weniger
groe Rolle spielen, bleiben sie hier weitestgehend unerwhnt. Auch im ffentlichen
Raum sind sie weniger auffllig und prsent, was fr eine genauere Bearbeitung
sicherlich von Interesse wre, diesen Rahmen allerdings sprengen wrde.
Es wird in einem weiteren Teil um den Sozialraum Rheindorf-Nord gehen, der
beschrieben und analysiert wird. In diesem Sozialraum wird die Delinquenz der
Jugendlichen und Adoleszenten allgemein ermittelt und der aktuelle Stand bewertet.
Ein besonderer Blick wird auf die Nichtdeutschen und ihre Delinquenz geworfen.
Eine Sekundranalye und systematische Analyse der allgemeinen Statistiken sowie
die qualitative Bearbeitung von Experteninterviews und Bewohner-Befragungen
wird in diesem Abschnitt dargestellt. Welche Entwicklung in nchster Zeit zu
erwarten sein wird, und welche prventiven und repressiven Manahmen Erfolg
versprechend sind, um einer eventuell problematischen Entwicklung
entgegenzuwirken, wird in einem abschlieenden Teil dargestellt.
Der Begriff der Kriminalitt (Delinquenz) findet im Folgenden als soziologischer
(materieller) Verbrechensbegriff Verwendung. Er beschreibt nicht ausschlielich die
Verste gegen die Rechtsordnung (strafrechtlich formeller Verbrechensbegriff),
soweit sie als Vergehen oder Verbrechen eingestuft werden. Genau genommen kann
dann erst nach der rechtskrftigen Verurteilung des Tters oder der Tterin von
Delinquenz gesprochen werden. Der soziologische Verbrechensbegriff beinhaltet in
einer weiteren Ausdehnung auch sozialschdliches und abweichendes Verhalten
(Devianz) unabhngig von vorhandener Strafe, da es in der Entwicklung der
Menschheit immer wieder zu Gesetzeslcken, Vernderungen und Fehlern kam (vgl.
Schwind 2004). Die Polizeiliche Kriminalstatistik, auf die sich die hier gemachten
Angaben zur Kriminalitt sttzen, registriert die von der Polizei bearbeiteten Delikte
und die hierzu ermittelten Tatverdchtigen. Tatverdchtig ist jeder, der aufgrund der
polizeilichen Ermittlungs-Ergebnisse entsprechend verdchtig ist, eine
Gesetzeswidrigkeit begangen zu haben.
Eine rechtliche Klassifizierung nach verschiedenen Altersstufen findet sich im
Kinder- und Jugendhilfegesetz und im Jugendgerichtsgesetz. Personen von vierzehn
bis unter achtzehn Jahren werden als Jugendliche eingestuft. Ab 14 Jahren sind sie
bedingt strafmndig und unterliegen dem Jugendstrafrecht. Sie knnen also eine
Jugendstrafe erhalten. Heranwachsende sind Personen von 18 bis unter 21 Jahren, die
wie alle Erwachsenen absolut strafmndig sind. Es wird jedoch auf die individuelle
Reife Rcksicht genommen, so dass das Jugendstrafrecht bedingt Anwendung finden
kann. Wenn allgemein von jungen Menschen gesprochen wird und keine nhere
Differenzierung erfolgt, so sind im weiteren Sinne alle Personen unter 21 Jahren
gemeint.
2
1 Zum Begriff der so genannten Auslnderkriminalitt
Das Thema Auslnderkriminalitt ist ein empfindsames Feld. Eine differenzierte
und kritische Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist notwendig, um vorhandene
Vorurteile nicht zu untersttzen. Denn dieses gehrt immer wieder zum Propaganda-
Repertoire rechtsextremistischer Gruppierungen, aber auch Politiker und einige
Medien bedienen sich dieser Begrifflichkeit gerne, um Stimmungen zu erzeugen oder
Auflagen zu erhhen (vgl. zu Medien 3.5). Frank Gesemann (2000) betont, dass in
den letzten Jahren die Auseinandersetzungen um die Auslnderkriminalitt auch in
Deutschland an Schrfe gewonnen haben, das hat auch seit den vergangenen Jahren
an Aussagekraft nicht eingebt. Jugenddelinquenz und Jugendgewalt und deren
vermeintliche Zunahme wird ebenfalls als Grundlage fr Forderungen nach
Verschrfung strafrechtlicher Sanktionen, schnellerer Aburteilung berfhrter
Gesetzesbrecher und unverzglicher Abschiebung von Ttern nichtdeutscher
Herkunft genutzt.
Durch den Begriff der Auslnderkriminalitt wird AuslnderInnen eine hhere
Kriminalittsbelastung, im Vergleich zur deutschen Bevlkerung unterstellt. Dem
Begriff der ,,Auslnderkriminalitt haftet bereits eine rassistische Konnotation an
(www.polwiss.fu-berlin.de). Da hier Merkmale der Personengruppe genannt werden,
die eine hhere Kriminalittsbehaftung der Gruppe suggerieren (Jugend, Jungen,
Auslnder), mit dem Begriff der Kriminalitt entstehen ohnehin schon negative
Assoziationen. Der Begriff Auslnderkriminalitt fhrt zwei Rechts- und damit
auch Herrschaftsbegriffe zusammen, die beide mit starken sozialen Vorurteilen
belastet sind (Bielefeld, 1988, S.182). Der Begriff Auslnder ist in rechtlicher
Bedeutung eine Person, die eine andere Staatsangehrigkeit als die ihres
Aufenthaltslandes besitzt (vgl. Brockhaus). Umgangssprachlich wird eine Person
jedoch als Auslnder bezeichnet, wenn sie auslndischer Abstammung ist,
unabhngig von der Staatsangehrigkeit.
`Auslnder ist eine politische Kategorie, die sich aus der Differenz
zwischen der Staatsangehrigkeit eines Individuums und seinem momentanen
geographischen Standort ergibt. Dafr, dass dies eine Ursache fr
Kriminalitt sein sollte, existiert kein einziger triftiger Grund (Eisner 1998,
S.11).
Eisner (1998) weist ebenfalls darauf hin, dass diese Einordnung erst soziologisch
bedeutsam wird, wenn die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Lebensverhltnisse von Angehrigen verschiedener ethnischer Minderheiten in einen
Zusammenhang mit der Entwicklung von Kriminalitt und Gewalt gebracht werden
knnen. Der Begriff bildet die Realitt der Migration und deren Probleme ebenso
zunehmend unzureichend ab, denn mit der Liberalisierung der Einbrgerungspraxis
werden immer grere Teile der ethnischen Minderheiten zu Deutschen oder werden
als Deutsche geboren werden. Angesichts der Tatsache, dass es die Gastarbeiter
nicht mehr gibt und bereits die Enkelkinder in Deutschland heranwachsen, sind
folgerichtig Formulierungen zu finden, die integrationsfreundlicher und genauer sind
(vgl. Gesemann, 2000). Geiler (2001) besttigt dies und fordert den Ausschluss der
Begriffe Auslnder und Auslnderkriminalitt aus dem ffentlichen Diskurs, da
3
sie falsche, einseitige oder missverstndliche Aussagen, Meldungen, Begriffen und
Daten enthalten, die das Vorurteil vom kriminellen Gastarbeiter untersttzen. Dies
sei unerlsslich fr einen integrationsfrdernden Umgang mit ethnischen
Minderheiten.
Whrend diese Begrifflichkeit auch besonders thematisiert wird, wird sie ebenso
tabuisiert. Aus Angst der Auslnderfeindlichkeit bezichtigt zu werden oder diese
sogar auszulsen, halten Personen aus allen Bereichen eine Auseinandersetzung mit
dieser Thematik fr unvernnftig und unsinnig.
Die noch immer festzustellende Tabuisierung des Themas `Auslnder-
kriminalitt` hat nicht nur die Diskriminierung von Auslndern nicht verhindern
knnen, sondern darber hinaus die fatale Folge gehabt, dass die
Frhwarnfunktion krimineller Aufflligkeiten nicht genutzt worden ist.
Erforderliche, gezielt auf problematische Lebenslagen von (jungen) Auslndern
gerichtete Interventions- und Prventionsmanahmen sind unterblieben oder
zumindest nicht ausreichend umgesetzt worden (Deutsches Polizeiblatt, 2000).
2 Allgemeine Delinquenz und Devianz-Theorien
Die Verhaltensweisen und Handlungen, die gesellschaftlichen Normvorstellungen,
bestimmten (konformen) Personengruppen oder Personen widersprechen, werden als
deviantes Verhalten (lat. abweichendes) beschrieben. Devianz bezeichnet die
Differenz zwischen geltenden informellen, formellen oder rechtlichen Normen und
dem Verhalten des Individuums. Normen sind an den Werten der jeweiligen
Gesellschaft orientiert und ihnen ist ein Anspruch auf Befolgung, ein Sollen"
immanent, wodurch sie zu Regeln fr bewusstes Handeln, Vorschriften fr
Verhalten, Verhaltenserwartungen oder gar Verhaltensforderungen" werden (vgl.
Lamnek, 2001). Schfers (2001) nennt, um eine Durchsetzung und Einhaltung der
Normen zu gewhrleisten einen Kontrollmechanismus (soziale Kontrolle) als
unbedingt erforderlich. Diese soziale Kontrolle besteht aus Sanktionen, die sowohl
positiv als auch negativ ausfallen knnen, das heit normkonformes Verhalten wird
belohnt, und Norm abweichendes Verhalten wird bestraft. Devianz kann also zu
Konflikten fhren und/oder sogar Sanktionen nach sich ziehen. Mit dem Begriff der
Delinquenz (Strafflligkeit) wurde bereits 1899 (im amerikanisches Jugendstrafrecht)
ein Begriff eingefhrt, der die Kriminalitt von Kindern und Jugendlichen von der
der Erwachsenen unterscheiden sollte (vgl. Schfers, 2001).
Lothar Bhnisch (1999) beschreibt abweichendes Verhalten aus pdagogischer Sicht
als vielschichtig und nicht eindeutig als Normverletzung definierbar.
Abhngig von Situation und Kontext unterliegt es unterschiedlichen Bewertungen
und ist somit relativ. Bereits die ,,kriminelle Handlung, also die klar bestimmbare
Gesetzesverletzung, wird je nach kulturellem und sozialem Kontext unterschiedlich
bewertet Bei der Tatbeurteilung sowie bei der Bewhrungs- und Rehabilitations-
prognose ist vielfach das soziale Herkunftsmilieu entscheidend.
Die Frage nach den Ursachen und Beweggrnden fr Devianz und Delinquenz
beschftigt also die Theorien im Wesentlichen und weniger die Lsungen fr ein
eben solches Verhalten. Die folgenden Theorien sind als Erklrungsanstze zu
4
betrachten und entbehren einer Allumfasstheit. Die Individualitt und Komplexitt
von menschlichem Verhalten lsst eine vollstndige Erfassung unter
Bercksichtigung aller Aspekte und Vielfltigkeit nicht zu. Die Theorien, die
kriminelle Devianz von Jugendlichen und Heranwachsenden (wie Kriminalitt
generell) zu erklren versuchen, also abweichendes Verhalten mit bestimmten
Bedingungsfaktoren verbinden, haben eine Gemeinsamkeit. Sie gehen alle davon
aus, dass die soziale Umwelt auf das Verhalten eines Menschen einen groen
Einfluss hat, unabhngig ob es konform oder abweichend ist (vgl. Korte; Schfers,
2000).
2.1 Die Klassische Schule
Begrnder der Klassischen Schule war Cesare di Beccaria, Doktor der Rechte in
Pavia (1738-1794), ein Strafrechtsreformer (weitere Vertreter sind Feuerbach und
Romilly). Sie gingen davon aus, dass der Mensch nicht von Geburt an zum
Verbrecher bestimmt ist. Den Entschluss zur kriminellen Tat trifft er in eigener
Verantwortung aufgrund freier Entscheidung seines Willens. Der Mensch ist von
Geburt an gut, kann lediglich negative Veranlagungen mitbringen und wird dann
eventuell durch seine Entwicklung und Erfahrungen mit der Umwelt zum Verbrecher
(Wrtenberger, 1964). Dies kann fr alle Menschen gelten und beschrnkt sich nicht
auf bestimmte Gruppen. Sie nahmen aufgrund dieser These, nicht die Tter als
Gegenstand der Analyse, sondern die Tat selbst. Nach dieser Theorie liegen die
Wurzeln des Verbrechens im natrlichen Egoismus, der sozialen Stellung (Armut)
und der Unwissenheit (Dummheit).
Cesare Beccaria, ein Bewunderer Kants (1724-1804), stellte fest, dass der Mensch
resozialisierbar ist. Hauptsache ist das Verhltnis von Gesellschaft und Tter
(Angemessenheit der Sanktion, gesellschaftliche Reaktionen als Sanktion)
(Schwindt, 2004). Forderungen Cesare di Beccarias waren nach Schwindt:
Willkrverbot fr die Polizei
Strikte Abhngigkeit des Richters vom Gesetz
Zgige Abwicklung des Strafverfahrens
Gewhrung ausreichender Zeit fr die Strafverteidigung
ffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen
Unschuldsvermutung zugunsten des Tatverdchtigen
Abschaffung des Strafzwecks der Vergeltung zugunsten der Abschreckung
Abschaffung grausamer Strafarten wie Folter oder Todesstrafe
Primat der vorbeugenden Kriminalpolitik
Die klassischen Kriminaltheorien knnen in den zentralen Aussagen nach Siegfried
Lamnek (1997) in folgenden Punkten zusammengefasst werden:
Gesellschaftliche und nicht individuelle Bedingungen sind grundlegend fr
ein abweichendes Verhalten.
Jedes Mitglied der Gesellschaft kann sich abweichend verhalten und von
solchen Bedingungen betroffen sein.
5
Deswegen knnen nur die Taten und nicht die Tter oder Tterinnen
Gegenstand der Analyse werden.
Fr die Beurteilung der Tat muss die Gesellschaft und Tat in Relation gesetzt
werden.
Sanktionen sollen prventiv wirken und somit die Sozialschdlichkeit
bercksichtigen.
2.2 Biologische Erklrungsanstze
Cesare Lombroso, italienischer Psychiater und Begrnder der Kriminalanthropologie
(1835-1909), beschreibt die These vom geborenen Verbrecher 1876 in Luomo
delinquente. Cesare Lombroso sieht den Kriminellen auf einer anthropologisch
niederen Stufe der Menschheit stehen. Er beschreibt delinquentes Verhalten als einen
Rckfall in frhe menschliche Entwicklungsstadien. Lombroso nahm Krpermae
und andere uerlichkeiten als Ausgangspunkt zur Kriminalittserklrung.
Es wird eine vererbte Veranlagung zum abweichenden Verhalten angenommen, die
wie eine Krankheit zu verstehen ist (an Krperanomalien zu erkennen). Der Tter
und seine biologisch-genetische Konstitution stehen im Mittelpunkt des Interesses
(Lamnek, 1997). Es sind keine zwingenden Zusammenhnge feststellbar, trotzdem
fand diese Theorie eine traurige Wiederaufnahme unter anderem in der so genannten
Sippenforschung der Nationalsozialisten.
Neben dem Ansatz Lombrosos wurden noch andere biologische Erklrungen, zum
Beispiel die der Zwillings- und Adoptivforschung erforscht, in denen eineiige und
zweieiige Zwillinge verglichen wurden. Durch eine hhere Kriminalitts-
bereinstimmung bei eineiigen Zwillingspaaren entwickelte sich die Theorie, dass
Delinquenz in den Genen bereits angelegt sei. Fr die Adoptionsstudien wurden
Adoptivkinder sowie die Kriminalittsbelastung des Adoptiv- und des biologischen
Vaters untersucht, um eventuelle Vererbung von delinquenten Verhalten
festzustellen. Diese Anlagebedingungen der Kriminalitt stieen auf weite Kritik,
weil sie im Besonderen die Umwelteinflsse auen vor lieen (vgl. Schwind 2004).
Kritisch zu sehen sind die relativ kleinen Stichproben, sowie die Missachtung von
Umweltfaktoren. Die auftretenden schwierigen sozialen Umstnde in
Adoptionsfamilien, die auf das kriminelle Verhalten Einfluss haben knnten, wurden
ebenfalls nicht untersucht. In der heutigen professionellen Diskussion finden diese
Theorien jedoch kaum noch Beachtung, sie sind als veraltet anzusehen (vgl.
Lamnek1997).
2.3 Psychologische Kriminalittstheorien
2.3.1 Der Psychoanalytische Ansatz
Begrnder des Psychoanalytischen Erklrungsansatzes zur Kriminalittsentstehung
waren Sigmund Freud (1856-1939) sowie die orthodoxe Lehre von Theodor Reik
(1925), August Eichorn (1925) sowie Alexander/Staub 1929. Grundstzlich gehen
diese Theorien davon aus, dass im Gefhlsleben nichts zufllig und ohne Grund
6
geschieht und ein groer Anteil der Psyche das Handeln und Fhlen des Menschen
unbewusst beeinflusst. Kriminalitt wird als Ausdruck einer Persnlichkeitsstrung
erklrt, deren Ursache in frhen Beeintrchtigungen der psychischen Entwicklung
liegt. Das Bewusste ist nur die Spitze des Eisbergs (Schnell, 1982). Der Tter wird
als Individuum gesehen, das von Natur aus asozial ist, und erst durch Erziehung und
Sozialisation lernen muss sich selbst zu kontrollieren, um somit seine Triebe und
Wnsche beherrschen zu knnen (vgl. Schwind 2004). Insbesondere werden zwei
Erklrungsanstze zur Delinquenz herangezogen, einerseits der neurotisch bedingte
und andererseits der durch Verwahrlosung bedingte.
Das von Freud entwickelte Modell geht von einer Dreiteilung der menschlichen
Psyche aus:
1. Es (Triebhaftigkeit; speichert die Triebe und das Verdrngte)
2. Ich (Ausgleich; stellt die Vermittlungsinstanz zwischen den beiden Ebenen dar)
3. ber-Ich (moralische Gebote; ist die moralische Instanz, also das Gewissen)
Delinquenz kann durch ein zu starkes oder zu schwaches ber-Ich entstehen. Bei
einem zu starken ber-Ich spricht man von einer neurotisch bedingten Kriminalitt,
ein zu schwaches ber-Ich kann zur verwahrlosungsbedingten Kriminalitt fhren.
Der sterreicher August Aichhorn (1987) beschrieb kriminelles Verhalten als
Merkmal einer Charakter-Fehlentwicklung. Menschen, die der Verwahrlosungs-
struktur zugeordnet werden, weisen hufig eine starke Bindungsschwche auf. In
ihrem Leben sind selten feste bzw. wechselnde Bezugspersonen (evtl. Heimkinder)
zu finden, es mangelt ihnen an Basic-Trust. Nachdem sie eine Gewalttat begangen
haben, spontan oder geplant, wrden sie nach Aichhorn anschlieend keine
Schuldgefhle aufweisen.
Gustav Brandt beschreibt (1972) zwei Faktoren fr die Ausbildung einer
Verwahrlosungsstruktur, die an die Dreiteilung Freuds anknpft.
1. Mangel an ehrlichen und gefhlsbetonten Beziehungen im frhesten Kindesalter.
Dieser fhrt zu einer Ich-Schwche und einer existentielle Unsicherheit, die alle
spteren positiven Identifikationen und den Erwerb von Liebesfhigkeit belasten.
Diese seien indessen wesentliche Voraussetzungen dafr, kindliche ungesteuerte
Triebhaftigkeit zu bewltigen und Ablehnungen und Versagen auszuhalten.
2. Der berfluss an ehrlichen gefhlsbetonten Beziehungen. Ausgeprgte
Verwhnungen oder die Mglichkeit fortwhrend zwischen mehreren Bezugs-
personen whlen zu knnen, beeinflusst die Fhigkeit Versagen und Ablehnung (da
die erforderlichen Ablehnungen fehlen) zu verarbeiten. Schwierigkeiten werden dann
oft in der Realitt deutlich und knnen traumatisierend wirken.
Erwartungshaltungen sind hufig irrational und bedingen Delinquenz, da Verzicht
nicht erlernt werden konnte (ber-Ich-Defekt). Ich-Verarmung, ungengende
Impulskontrolle und geringe Frustrationstoleranz knnen die Folge sein.
Menschen mit einer Neurosenstruktur zeichnet ein ausgeprgtes
Anpassungsvermgen, sowie stark verinnerlichten Normen aus. Beim Begehen eines
Gewaltverbrechens entwickeln sich hinterher auffallend starke Schuldgefhle beim
7
Tter oder der Tterin. Diese Eigenschaften knnen durch eine starke Unterdrckung
des Autonomiestrebens in der analen Phase bedingt werden. ber-Ich-Defekte,
erzeugt durch Identifikationsdefizite in der frhkindlichen Entwicklung, stren den
psychischen Apparat und liefern ebenfalls ein Erklrungspotential fr
Psychoneurosen und kriminelle Taten. Kriminelle Handlungen knnen entweder
unter Drogeneinfluss (Alkohol, THC, etc.) oder in ausgeprgten Stresssituationen
passieren (Aichhorn 1925). Ursache fr eine Neurosenstruktur kann in der
Ausbildung eines bertriebenen Gewissens liegen, das aufgrund fehlender stabiler
Erfahrungen mit der sozialen Umwelt entstand. Die Ambivalenz zwischen
berschttung mit Zuneigung und willkrlicher Bestrafung, verhindert die
Entwicklung der Fhigkeit auf sofortige Bedrfnisbefriedigung verzichten zu
knnen. Fr das Kind wird die ambivalente Mutter zum Sndenbock, da sie unter
Schuldgefhlen wegen ihrer teilweise ablehnenden Haltung dem Kind gegenber
leidet. Aichhorn beschreibt, dass in unzhligen Fllen die von der Mutter abhngigen
Kinder die Selbstvorwrfe bernehmen werden und sich schuldig fhlen, was eine
notwendige Ablsung von der Mutter erschwere. Lebensnotwendige Antriebe
werden so negiert und an der Entfaltung gehindert. Belangreich fr die Delinquenz
nach Aichhorn, sei ein tyrannisches ber-Ich das die Gesamtpersnlichkeit
dominiert und die Triebansprche des Es rigoros unterdrcke. Im Falle eines
Ausbruchs der unterdrckten Triebe reagiert der Delinquent, wie schon erwhnt mit
groen Schuldgefhlen und der noch strkeren Unterdrckung derselbigen. Diese
ungengende Ausbildung des Urvertrauens kann also zu psychopathischen
Strungen (Manie, Depression) fhren. Aufgrund fehlender Konfliktbewltigungs-
techniken knnen sozialschdliche (kriminelle) Triebe nicht sozialadquat kanalisiert
werden. Der psychosoziale Ansatz ist keine geschlossene Theorie und empirisch
nicht abgesichert, da die Kriminalitt an sich nicht erklrt wird, es werden nur
Beurteilungen ber wenige Sonderflle abgegeben. Dieser Ansatz ist eine
tterorientierte und individualistische Analyse im Anschluss an delinquentes
Verhalten sowie entwicklungspsychologisch begrenzt auf die frhkindliche
Entwicklung. Die Prvention reduziert sich somit auf Sozialisationsbedingungen in
der Familie des Kleinkindes.
Auch die neuere Psychoanalyse sieht ein delinquentes Verhalten bedingt durch
Fehlverhalten der Eltern im frhkindlichen Bereich. Dadurch treten Strung der
Sozialisation auf. Kritisiert wird insbesondere die weitgehende Individualisierung
delinquenten Verhaltens unter Ausblendung sozialstruktureller Dimensionen. Ihnen
wird auerdem vorgeworfen, sie seien einerseits begrifflich oft undurchsichtig,
gingen von fiktiven Persnlichkeitsstrukturen (ES, ICH, BER-ICH) aus und
andererseits sei die Hypothesenbildung oft spekulativ und rckschauend orientiert.
Fr die Erklrung delinquenten Handelns haben dennoch Teilbereiche ihre
Berechtigung gefunden.
2.3.2 Kontrolltheorie und Halttheorie
Die Kontrolltheorien (et al. Hirschi, 1969) knpfen an die Psychoanalyse an.
Ausgehend von der Frage weshalb so viele Menschen sich sozial konform verhalten,
werden dagegen die Ursachen fr abweichendes Verhalten nicht hinterfragt. Als
8
Basis der sozialen Kontrolltheorien gilt, dass feste soziale und informelle
Beziehungen, Bindungen und Verantwortlichkeiten zur Verhinderung von
Delinquenz beitragen. Die Gefahr der Delinquenz wird umso grer, je mehr sich
diese Bindungen lockern (Schwind 2004, S.104). Travis Hirschi konzipierte diesen
Ansatz, der sich auf die Frage bezieht, welche Einflussfaktoren den inneren und den
ueren Halt mitbestimmen. Dieser, vor allem in den USA verbreitete Ansatz, geht
von der Grundannahme aus, dass ein Jugendlicher umso weniger zu abweichendem
Verhalten neigt, je strker er in sein gesellschaftliches Umfeld integriert ist.
Kriminelles Verhalten tritt dort verstrkt auf, wo diese Kontrolle zu schwach ist oder
versage. Hirschi unterteilt die Bindung an Menschen und Normen in vier Elemente
auf, commitment, attachment, involvement und belief.
Commitment beinhaltet die rationale berlegung des Individuums, was
abweichendes Verhalten einbringt. Wenn ein Jugendlicher gelernt hat,
Kosten-Nutzenanalysen seines Verhaltens vorzunehmen, wird er durch
Strafandrohungen und Sanktionen eher zu konformen Verhaltensweisen
bewegt werden knnen.
Attachment beschreibt die emotionale Bindung an andere Menschen.
Wenn ein Jugendlicher enge emotionale Bindungen zu prosozialen
Bezugspersonen hat, wird er deren Normen verinnerlichen. Entsprechendes
gilt fr die Bindungen zu kontraproduktiven Bezugspersonen.
Involvement, das Eingebundensein in normkonforme Aktivitten
Je strker ein Jugendlicher durch produktive Ttigkeiten in Anspruch
genommen wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer
abweichenden Karriere. Mangelnde Gelegenheiten zu normkonformen,
produktiven und selbstwertsteigernden Aktivitten frdern dementsprechend
Delinquenz. Jugendliche, die in der Schule, im Beruf und in der Freizeit keine
produktiven Handlungsfelder finden, sind also gefhrdet.
Belief stellt den Glauben an die Existenz eines allgemeinen Wertesystems
dar. Je strker das gesamtgesellschaftliche Wertsystem verinnerlicht ist, desto
weniger Abweichungstendenzen sind zu erwarten.
Die These geht davon aus, dass ein Individuum gesellschaftliche Normen eher
anerkennt, je mehr es an konventionelle Menschen gebunden ist. Im Gegenteil dazu
ist es umso wahrscheinlicher, dass jemand, der frei von Bindungen zur
konventionellen Gesellschaft ist, Straftaten begeht (Stelly, 2003). Unterschiedliche
Studien (Rand 1987, Knight/Osborn/West 1977, Blumstein /Cohen/Farrington 1988)
belegen den Einfluss der Beziehung zu relevanten Anderen oder der Einbindung in
konventionelle Lebensbereiche auch fr einen Abbruch von delinquenten Karrieren.
Die Theorie des inneren Haltes nach Reiss (1951) und Reckless (1961/1973) geht
davon aus, dass einem Menschen nur die Handlungsmglichkeiten fr das eigene
Leben zur Verfgung stehen, die in den Sozialisationsphasen erlernt wurden.
Internalisierte Werte und Normen, Interpretationen und Rationalisierungen,
9
Verhaltensmuster, berwiegend durch die informelle Kontrollinstanz Eltern durch
Vorleben oder verbal vermittelt, bilden das Handwerkszeug zum Bestehen oder
Versagen im Sozialgefge (Kls 2004). kriminelles Verhalten hat
dementsprechend mit dem Versagen der Familie als der wichtigsten Primrgruppe im
Erziehungsprozess zu tun (Schwind).
Reckless baut ein Verhltnis zwischen innerem und uerem Halt auf. Einen
ueren Halt knnen alle formellen und informellen Kontrollinstanzen geben, die
eine Art Betreuung, Begleitung, Aufsicht im weitesten Sinne leisten
(Erziehungsberechtigte, Schule, Lehrstelle, soziales Umfeld, aber auch die Polizei,
Justiz). So nimmt er an, dass trotz fehlendem uerem Halt der innere Halt eine
kriminelle Entgleisung verhindern kann und natrlich auch umgekehrt. Fehlen
jedoch sowohl uerer als auch innerer Halt, so sei der Weg in die Kriminalitt und
damit auch in die Strafflligkeit absehbar (vgl. Schwind). Im Falle eines defizitren
inneren Haltes wird beschrieben, dass die Gefahr des Abgleitens in die
Kriminalitt grer ist, als wenn eine Kompensation durch einen ueren Halt
(auch andersherum) nicht gewhrleistet ist. Der Kriminaldirektor Jrg-Michael Kls
(2004) am Polizei Prsidium Berlin nennt vor allem Erwartungen an die Person,
Perspektivlosigkeit, sowie Geld- oder Ehrversprechungen, Mutproben oder
Loyalittsnachweise als zustzliche Faktoren zur Entstehung einer kriminellen
Karriere bei Jugendlichen mit fehlendem Halt.
An den Kontrolltheorien wird generell kritisiert, dass die Wirkungsweise der inneren
Kontrolle und auch des inneren Halts sowie ihre Bedeutung fr das Nichtauftreten
von Kriminalitt einfach behauptet werden, ohne selbst durch empirische Nachweise
abgesichert zu sein (vgl. Schwind).
2.3.3 Theorie der Neutralisationstechniken
Die Vertreter dieser Theorie (Matza/Sykes, 1957) leiteten aus Beobachtungen
delinquenter Jugendlicher der Unterschicht die Grundfrage ab, warum sich viele
Menschen, trotz einer partiellen Anerkennung und Internalisierung gesamtgesell-
schaftlicher Normen, delinquent verhalten. Sie glauben nicht an eine oppositionelle
Grundhaltung delinquenter Jugendlicher gegen die Mittelschichtsnormen. Nach
Matza und Sykes rechtfertigt bzw. rationalisiert der Delinquent die fr ihn
unertrgliche Situation der Unstimmigkeit, zwischen Anerkennung der Normen und
dem Wissen um die Begehung unerlaubter Handlungen, mit einer besonderen
Technik, die spezifisch subkulturell erlernt wurde. Die Rechtfertigungsgrnde
werden nur vom Delinquenten als gltig angesehen, die soziale Kontrolle erfhrt
durch sie eine Einschrnkung. Der Delinquent ist nach Matza und Sykes ein sich
permanent entschuldigender Versager, dessen Rechtfertigung gesellschaftlich nicht
akzeptiert, sondern sanktioniert wird. Das Verhalten wird von Matza und Sykes mit
den Techniken der Neutralisation erklrt, die sich in fnf Kategorien wie folgt
darstellen:
Ablehnung der Verantwortung (Opfer der Umstnde, feindliche Umwelt,
schlechte Gesellschaft, lieblose Eltern, etc.)
10
Verneinung/ Verharmlosung der Tat (Bagatellisierung des Schadens, alles
ist versichert, der hat doch genug davon, es htte schlimmer kommen
knnen, der ist doch reich, etc.)
Ablehnung des Opfers (Tter sieht sich als Rcher, Vergeltung, das Opfer ist
schuld; z.B. Prostituierte, Homosexuelle, Auslnder)
Verdammung des Verdammenden (schiebt die Verwerflichkeit seines
Handelns von sich weg und bertrgt sie auf die, die ihn verurteilen, und
seine Handlungsweise missbilligen So viele Menschen sind Verbrecher,
Die Welt ist schlecht, korrupte Polizei, etc.)
Berufung auf hhere Instanzen (oftmals ideologisch bzw. religis/
fanatischen Ursprungs )
Die Techniken der Neutralisation werden in das Unterbewusste verdrngt. Dadurch
setzt sich der Delinquent subjektiv frei von seiner Schuld (Sack/Knig, 1968).
Kritisch wird gesehen, dass nicht deutlich wird welchen Einfluss von sozial-
strukturellen oder individualpsychologischen Bedingungen es gibt und welche
Technik wann zum Einsatz kommt. Ebenfalls wird nicht deutlich in welcher Form
Normen verinnerlicht wurden und in welcher Strke die Neutralisierungstechniken
wirken mssen, um abweichendes Verhalten zuzulassen (Lamnek, 2001).
2.4 Sozialpsychologische Kriminalittstheorien
2.4.1 Theorie der differenziellen Assoziation / Kontakte
Die Theorie der differenziellen Assoziation wurde 1949 erstmals von Edwin H.
Sutherland formuliert und spter von seinem Schler und Mitarbeiter Cressey (1955)
weitergefhrt. Sie wird auch ,,Theorie der differentiellen Kontakte" oder ,,Theorie
der differentiellen Lernstrukturen genannt, es handelt sich hierbei um eine
Lerntheorie. Basis dieser Theorie ist, dass deviantes Verhalten ebenso wie das
normkonforme erlernt wird. Als Grundlage fr deviantes und/oder delinquentes
Verhalten wird also der Lernprozess verstanden. Dieser ist entscheidend fr eine
kriminelle Karriere, die dort beginnt, wo die Techniken fr das delinquente
Verhalten und auch die Normen oder Einstellungen erlernt wurden. Das Lernen
erfolgt im Prozess der differentiellen Assoziation, dem Kontakt mit devianten (nicht
devianten) Verhaltensmustern (Stelly, 2000). Personen, die diese Verhaltensmuster
vorleben und mit denen ein persnlicher Kontakt besteht, spielen fr die bernahme
dieser Verhaltensmuster eine groe Rolle. Die Theorie schliet nicht aus, dass auch
offiziell konforme und integrierte Personen gleichwohl Muster und Legitimationen
fr abweichendes Verhalten bermitteln knnen. Umgekehrt knnen auch auffallend
deviante Personen positive Muster vermitteln. Dem Kontakt mit Individuen, die aktiv
Delinquenz leben und delinquente Werte pflegen, kommt eine besondere Bedeutung
zu. Dies gilt etwa im Fall des Vorhandenseins von und der Assoziation mit
delinquenten Peers (Stelly, 2000). Viele Studien zeigen, dass Personen, die enge
Beziehungen zu delinquenten Peers haben, strker in Kriminalitt involviert sind
(z.B. Elliott/Voss, 1974; Akers, 1979; Patterson/Dishion, 1985) (Stelly, 2000). Die
Aneignung bzw. Ablehnung bestimmter Normen und Handlungsweisen vollzieht
11
sich also in Interaktion, Kontakt und intensiver Verstndigung mit anderen
Mitgliedern einer Gemeinschaft oder spezifischen Gruppen einer Gesellschaft. Dort
wird deviantes Verhalten, Motive und Techniken, aber auch Triebe,
Rationalisierungen und Einstellungen erlernt (vgl. Lamnek, 2001, S.99). Sutherlands
zentrale These lautet daher, dass Menschen kriminell werden, wenn bei ihnen
Einstellungen, die Gesetzesverletzungen begnstigen, gegenber Einstellungen, die
Gesetzesverletzungen erschweren, berwiegen. Je nach Hufigkeit, Dauer, Prioritt
und Intensitt sollen differentielle Kontakte unterschiedlich wirksam werden.
Sutherland weist schlielich darauf hin, dass das Erlernen kriminellen Verhaltens
nicht auf Nachahmung begrenzt ist. Nicht der Umgang mit Personen, bei denen
kriminelles Verhalten zu beobachten ist, ist ausschlaggebend, sondern das Ausma
der Gesetzesverletzung begnstigenden Einstellungen und Bewertungen, die diesem
Verhalten gegenber gebracht werden (vgl. Lamnek).
Kritik findet diese Theorie in ihrer Einfachheit, denn sie bercksichtigt individuelle
Unterschiede in der Lernfhigkeit nicht, auerdem lassen sich nicht alle Bereiche der
Kriminalitt durch diese erklren (Trieb-/ Affektverbrechen). Auch der empirischen
berprfbarkeit seien durch eine Vielzahl an Kontakten Grenzen gesetzt. Die
Theorie lsst weiterhin offen, warum es berhaupt zu diesen Verhaltensmustern
kommt und welche Bedingungen fr die Wahl der Kontakte von Bedeutung sind
(Schwab 2004).
2.4.2 Theorie der Differentiellen Verstrkung und des Lernens am
Modell
Die Verfasser Burgess und Akers entwickelten die Theorie der Differentiellen
Verstrkung 1966 als Erweiterung der Theorie Sutherlands. Sie sahen nach
empirischer berprfung der Theorie diese als ungengend und zum Teil auch
widersprchlich an. Burgess und Akers bauen ihre Theorie auf die Fragen auf, wie
eine Person kriminelles Verhalten erlernt, und wie dieses Verhalten verstrkt wird.
Eine Kombination der Assoziationstheorie mit der Lerntheorie, wobei sie sich
verstrkt an die Verhaltens- und Lerntheorien anlehnen (Lamnek 2001). Sie gehen
davon aus, dass die Wirkung von Assoziationen im Falle von mangelnder
Verstrkung nicht hinreichend ist um kriminelles Verhalten zu erklren. Ihre These
beschreibt ein Erlernen von kriminellem Verhalten durch das Prinzip der operanten
Konditionierung. Eine Person reagiert auf dieselbe Art und Weise, aber die
Reaktionen auf sein Verhalten (Verstrker) verndert die Hufigkeit. Anerkennung,
Lob und Statusgewinn bei bedeutsamen Personen oder tatschliche Inhalte
(materiellen Gewinn) knnen Verstrker sein. Diebstahl und Raub wird unabhngig
von der Verstrkung von Personen insbesondere durch Gewinn belohnt.
Delinquentes Verhalten wird vornehmlich in den Gruppen erlernt. Diese Gruppen
strken das Individuum mageblich und ber verbale Aussagen und Sanktionierung
nehmen sie groen Einfluss. Wird konformes Verhalten in Situationen weniger
verstrkt als abweichendes Verhalten, so kann es zu einer Entkrftung der
herkmmlichen Normbindung kommen.
12
Das berwiegen der Verstrkung muss, hnlich der Theorie der
differentiellen Assoziation, auch in Abhngigkeit von Wert, Hufigkeit und
Intensitt der Verstrkung verstanden werden. Die Wahrscheinlichkeit fr
abweichende Verhaltensweisen, die in diesem Sinne vermehrt verstrkt
werden, steigt. (Ratzka 2001/ unter Internetverweisen).
Die Strke des kriminellen Verhaltens, so Lamnek, ist ein direktes Ergebnis der
Hufigkeit und der Wahrscheinlichkeit der Verstrkung dieses Verhaltens.
2.4.3 Frustrations-Aggressions-Theorie
Die Frustrations-Aggressions-Theorie nach John Dollard (Yale Schule 1939) und
Miller (1939) lehnt sich an berlegungen von Freud an. Sie ist dem Bereich der
persnlichkeitsbezogenen Theorien zuzuordnen, die Kriminalitt und ihre Ursache
mit Strungen der Psyche des Tters erklren. Dieser Ansatz geht davon aus, dass
jede erlebte Frustration Ursache fr eine neue Aggression ist, die zu kriminellem
Verhalten fhren kann (Schwind 2004). Diese Behauptung muss dahingehend
modifiziert werden, dass sie nicht fr alle Aggressionen gelten kann und nicht ohne
die Betrachtung anderer Faktoren, wie zum Beispiel die Lebensgeschichte des
Tters, auskommt (Dollard, 1994).
Eine umfassende kausale Beziehung zwischen Frustration und Aggression wird
angenommen.
Aggression ist stets die Folge von Frustration.
Frustration fhrt immer zu irgendeiner Form von Aggression.
Frustration ist dabei der Zustand, der dann eintritt, wenn eine Zielreaktion
(gewnschtes, angestrebtes Ziel) gehemmt oder nicht erreicht wird. Hierbei ist die
Aggression reaktiver Natur und nicht Ausdruck eines eigenstndigen
Aggressionstriebes. In Kindheit und Jugend erlittene Frustrationen werden von
kriminologischer Seite (Keupp, 1971) mehr oder weniger fr spteres aggressives
oder kriminelles Verhalten als Jugendlicher bzw. Erwachsener angesehen (Schwind).
Es wird angenommen, dass Delinquente in hherem Mae Frustrationen unterliegen
und/ oder eine niedrigere Frustrationstoleranz im Vergleich zu normkonformen
haben (vgl. Lamnek). Das Aggression auf einen angeborenen Trieb zurckgefhrt
wird, ist seitens der Verhaltensforschung kritisch zu sehen. Dieser Ansatz scheint
nach Lamnek jedoch die vermeintliche berproportionale Delinquenz der
Unterschichtsangehrigen zu erklren, da sie soziale Faktoren bercksichtigt.
2.5 Soziologische Kriminalittstheorien
2.5.1 Anomietheorie
Emile Durkheim fhrte 1893 in Folge von sozialen Desintegrationserscheinungen
durch Arbeitsteilung den Begriff der Anomie (Regellosigkeit oder Normlosigkeit)
13
ein (Lamnek, 1996). Durkheim untersuchte soziale Erscheinungen in den modernen
Industriegesellschaften. Diese waren geprgt durch Arbeitsteilung, Individualismus
und Wirtschaftszyklen. Diese Umstnde fhren nach Durkheim zu einer sozialen
Desintegration in der Gesellschaft, der Anomie. Der Ansatz der Anomietheorie geht
hnlich wie die Subkulturtheorie davon aus, dass auch abweichende Personen die
allgemein berwiegenden Werte der Mehrheitsgesellschaft, insbesondere im Sinne
der Wirtschaftsgesellschaft, teilen. Wohlstand, Sicherheit und soziale Anerkennung
sind fr sie ebenso erstrebenswert. Personen mit geringer Bildung aus wenig
angesehenen Bevlkerungsgruppen besitzen allerdings nicht im gleichen Mae wie
die anderen Bevlkerungsgruppen die legalen Mittel, diese Werte zu verwirklichen.
Als Folge der Ausweitung der unendlichen menschlichen Bedrfnisse, tritt Anomie
besonders in Zeiten pltzlicher wirtschaftlicher Not oder starken Wachstums auf und
fhrt zu einer erhhten Rate von Devianz. Sie uert sich im Fehlen von
gemeinsamen Verbindlichkeiten, Erwartungen und normativen Regulierungen, die
die Interaktionen leiten und steuern, was letztlich zum abweichenden Verhalten
Einzelner fhrt (Durkheim, 2002).
Verbrechen ist aber auch strukturerhaltend, weil die folgende Strafe die bedrohten
Kollektivgefhle intensiviert. Der Verbrecher ist somit Wirkungsfaktor des sozialen
Lebens, denn er ist Vorlufer fr gesellschaftliche Wandlungen (Lamnek).
Kernaussagen der Anomietheorie nach Durkheim sind:
Es gibt keine Gesellschaft, in der keine Kriminalitt existiert (Durkheim).
Kriminalitt ist die normale Gegenseite sozialer Regelungen.
Sie ist regulierender Wirkungsfaktor des sozialen Lebens (sozialer
Tatbestand).
Sie ist ein integrierender Bestandteil jedes gesunden Gemeinwesens und eine
vllig normale Erscheinung.
Strafe verdeutlicht allen Individuen Normen, dadurch Stabilisierung des
gesellschaftlichen Systems.
Anomie tritt erst dann ein, wenn die sozialen Regeln keine Beachtung mehr
finden. Anomie stellt sich vor allem in Zeiten sozialer Umbrche ein.
Anzeichen fr Anomie sind sprunghaft ansteigende Kriminalittszahlen.
Robert K. Merton griff die Gedanken Durkheims zur Anomie auf (zuerst 1938,
spter 1974) und differenzierte sie, indem er zwischen kulturell vorgegebenen Zielen
und institutionalisierten (legitimen) Mitteln zur Zielerreichung unterschied. Merton
(1995) versteht unter dem Begriff der Anomie eine Uneinigkeit zwischen kultureller
und sozialer Struktur, die urschlich fr Kriminalitt ist.
Kulturelle Struktur, meint die vielschichtigen gemeinschaftlichen
Wertvorstellungen, die das Verhalten der Mitglieder einer Gesellschaft oder
Gruppe regeln. Sie sind in einer Werthierarchie geordnet und knnen fr
jedes Individuum unterschiedlich sein.
Soziale Struktur beschreibt die Kontrolle und Regulation der erlaubten
Mittel zur Zielerreichung. Sie kennzeichnet die verfgbaren Mittel und die
Chancenstruktur (schichtspezifisch differente Verteilung)
14
Eine Unstimmigkeit zwischen kultureller und gesellschaftlicher Struktur lsst
Anomie entstehen. Verwehren also die sozial-strukturellen Bedingungen
(Arbeitslosigkeit, schlechte Aufstiegschancen etc.) das Erreichen der kulturellen
Ziele (Wohlstand, Bildung), kann es zum Gebrauch illegaler Mittel kommen
(Delinquenz), um diese zu erreichen (vgl. Merton, 1995). Merton geht hierbei von
einer schichtspezifischen Differenzierung aus. Die Theorie geht der Frage nach, wie
es zu erklren ist, dass die Hufigkeit abweichenden Verhaltens in den verschiedenen
sozialen Schichten variiert. Merton stellte somit fest:
Normabweichendes Verhalten ist ein Symptom fr das Auseinanderklaffen
von den als legitim anerkannten gesellschaftlichen Zielen und den
Zugangsmglichkeiten, zu den zur Erreichung dieser Ziele erlaubten Mitteln
(Schwab 2004, S.128).
Unterschichtgruppen sind in den objektiven Mglichkeiten des Aufstiegs/ des
Gelderwerbs behindert.
Die Betroffenen greifen daher nach Schwind (2004) auf eines der folgenden
Verhaltensmuster (Rollenanpassungen) zurck:
Konformitt: kulturelle Ziele werden bejaht, man schrnkt sich ein oder ist
zufrieden, Normen werden akzeptiert.
Ritualismus: kulturelle Ziele werden herabgesetzt oder aufgegeben,
Normen akzeptiert.
Rckzug: kulturelle Ziele und legales Erreichen werden abgelehnt, Flucht
in Scheinwelt (Drogen, Sekten etc.).
Innovation: kulturelle Ziele werden akzeptiert, aber illegal erreicht.
Rebellion: Ziele und Mittel werden bekmpft, erhofft wird Vernderung
des Sozialgefges (Terrorismus, politisch motivierte Kriminalitt).
Anomie wird als ein Zusammenbruch der kulturellen Struktur verstanden, zu dem
es insbesondere dann kommt, wenn es zwischen den kulturellen Normen und Zielen
und den sozial strukturierten Fhigkeiten der Gruppenmitglieder zu einem
normenkonformen Handeln eine scharfe Trennung besteht (Merton).
Kritisch an dieser Theorie wird das Fehlen einer Erklrung, der Wahl zu Konformitt
oder Nonkonformitt und deren Bedingungen gesehen. Die Konformitt vieler
Unterschichtangehriger wird nicht errtert (Lamnek, 2001). Sie erklrt vornehmlich
die UnterschichtKriminalitt, aber nicht die White-ColorKriminalitt.
Kriminalitt und Innovation werden gleichgesetzt. Des Weiteren knnen
sozialstrukturelle Differenzen, zum Beispiel der Geschlechter, nicht erklrt werden.
2.5.2 Kulturkonflikttheorie
Nach der von Thorsten Sellin 1938 entwickelten Theorie entsteht Kriminalitt bei
Nichtdeutschen durch den Widerspruch zwischen dem Werte- und Normensystem
des Heimatlandes und dem Adoptivland (vgl. Schwind, 2004). Anomisches
Verhalten entsteht danach auch aus dem Konflikt zwischen kulturell
15
unterschiedlichen Normen- und Wertvorstellungen. Normkonflikte treten besonders
dort auf, wo Einwanderer groe Schwierigkeiten haben sich an die neue Kultur des
Gastlandes anzupassen. Ein Auenkonflikt entsteht, wenn die Migranten sich
den neuen Normen verschlieen und an ihren alten festhalten (Schwind). Verstrkt
werden kann dieses Verhalten durch Gefhle der Heimat- und Orientierungslosigkeit
und die Ablehnung durch die Mehrheitsgruppe der einheimischen Bevlkerung. Eine
Diskriminierung und Respektlosigkeit gegenber den Eltern seitens der
Mehrheitsgesellschaft fhrt bei den Kindern ebenfalls zum Respektverlust vor den
Eltern. Besonders wenn die Rolle des Vaters durch Arbeitslosigkeit und/oder
Sprachprobleme ideologisch wird, tritt eine Verhaltensverunsicherung ein, die nicht
selten zu Haltlosigkeit fhren kann (vgl. Schwind). Aber auch Delinquenz, die durch
Frustration ber nicht erreichbare Ziele aufgrund des Auslnderstatus entsteht,
beschreibt einen ueren Konflikt (vgl. Anomie-Theorie). Diese Theorie hat sich
aber gerade bei der ersten Gastarbeitergeneration in Deutschland nicht besttigt, da
keine hhere Kriminalittsbelastung im Vergleich zu Deutschen vorliegt. Allerdings
weisen die zweite und dritte Generation eine nennenswerte Belastung auf. Dort
kommt es zu einem inneren Kulturkonflikt, dieser entsteht durch eine
Orientierungslosigkeit und der Ambivalenz zwischen Elternhaus und sozialem
Umfeld. Hierbei handelt es sich um einen Konflikt in der Gruppe der Nichtdeutschen
selbst (u.a. Familie), der zerrttende Wirkung haben kann. Die Kinder internalisieren
die Ziele, Normen und Wertvorstellungen des Gastlandes und rebellieren gegen die
differenten Ansichten und Auffassungen ihrer Eltern besonders in
Moralvorstellungen und Erziehungsmethoden. Verstrkt werden die Konflikte noch
durch Sprachprobleme innerhalb der Familien und den damit verbundenen
unterschiedlichen Wertvorstellungen. Oft entstehen Erscheinungen der Entfremdung,
die eine Haltlosigkeit bewirken knnen und Delinquenz frdern (Schwind).
Die Thesen Sellins zur Kulturkonfliktstheorie knnen zu Erklrung der Situation der
trkischen Jugendlichen und Heranwachsenden in Deutschland Anwendung finden.
2.5.3 Subkulturtheorie
Die Subkulturtheorie von Whyte (1943) und A. K. Cohen (1955) geht auf Studien
jugendlicher Gangs durch die Chicagoer Schule zurck. In greren komplexen
sozialen Gebilden sind Normen, Werte und Symbole nicht fr alle Mitglieder
gleichbedeutend. Groe Gesellschaften sind in sich durch verschiedene Subsysteme
strukturiert, die sich untereinander dadurch unterscheiden knnen, dass in ihnen
unterschiedliche Werte und Normen gelten. Ein gewisses Verhalten kann in der
einen Subgruppe als konform gelten und andererseits mit dem Normsystem einer
anderen Subgruppe oder auch der Makrogesellschaft kollidieren und als kriminell
erklrt werden (vgl. Lamnek, 2001). Subkulturen bernehmen also einige Normen
der dominanten Kultur, unterscheiden sich jedoch in anderen Werten und Normen
von dieser. Intragesellschaftliche Normenkonflikte knnen die Quelle von deviantem
Verhalten und Delinquenz sein (Lamnek). Cohen gilt als der bedeutendste Vertreter
der Subkulturtheorie. Er beschreibt, dass das Bilden einer Subkultur als kollektive
Reaktion auf Anpassungsprobleme entstehen kann. Subkulturen stellen also eine
Mglichkeit der kollektiven Lsung eines gemeinsamen Problems dar (Cohen,
16
1968). Aus gesellschaftlich ungleichen Lagen, fr die eine bestehende Gesellschaft
keine hinreichenden Lsungen zur Verfgung stellen kann, entsteht Delinquenz
(Lamnek). Die Mittelschicht definiert die kulturellen Ziele (Schwerpunkt
Statussymbole) fr smtliche Gesellschaftsmitglieder. Die kulturellen Ziele
(Normen) werden auch von der Subkultur bernommen, die strukturellen
Mglichkeiten dieser reichen jedoch nicht aus, um diese Ziele (Statussymbole) zu
erreichen (Statusfrustration). Aus diesem Spannungsverhltnis ergibt sich
Unzufriedenheit, die nach einer kollektiven Lsung drngt. Erklrung der
Unzufriedenheit mit der eigenen sozialen Lage sind Statusprobleme, wonach die
Kultur der Bande Probleme lst, indem sie Statuskriterien schafft, nach denen die
Akteure leben knnen. Die Statuskriterien vollziehen sich unter kollektiv-
solidarischer Ablehnung bzw. vollstndiger Umkehrung der Mittelschichtwerte, in
der sich eigene, in der Subkultur legitime, Lsungsmglichkeiten entfalten (Cohen).
Nach Cohen entwickeln sich folgende Reaktionen:
Resignation mit der Situation des Verbleibes in der eigenen Schicht
Versuch, trotz der ungnstigen Ausgangslage, die Normen der
Mittelschicht zu erreichen
Ablehnung der Mittelschichtziele zugunsten eines subkulturellen Werte-
und Normensystems, Kompensation in der delinquenten Bande, Normen in
der Bande knnen erfllt werden, daher Statusgewinn (Schwind, 2004)
Des Weiteren betont Cohen, dass das Auftreten abweichenden Verhaltens desto
wahrscheinlicher ist, je geringer die emotionale Bindung der Unterschicht-
Jugendlichen an Personen ist, die das Mittelschicht-Wertesystem akzeptiert haben,
denn umso geringer sind soziale Kontrollfunktionen fr konformes Verhalten.
Wiederum stellt sich die Frage, warum sich ein Groteil der Unterschichts-
angehrigen normenkonform verhlt.
2.5.4 Theorie der Differentiellen Gelegenheit
Die Theorie ist eine Weiterentwicklung und Verknpfung der Anomietheorie
Mertons mit dem kologischen Ansatz der Chicago-Schule sowie der Theorie der
differentiellen Assoziation Sutherlands mit der Kulturkonflikttheorie (Schwind,
2004). Cloward und Ohlin gehen nach Schwind in ihrer Arbeit von 1961 davon aus,
dass Delinquenz abhngig von den speziellen Gelegenheiten ist, die sich dem
Delinquent bieten. Im Weiteren ist der Zugang zu ungesetzlichen Mitteln, der von
sozialen Bedingungen abhngt, von Bedeutung. Dieser Zugang sei nicht fr alle
Individuen gleich (Gegensatz zu Merton). Basis fr diese berlegung waren die
amerikanischen Slums, die eine ungleich hhere Gelegenheit boten delinquente
Verhaltensweisen leichter und schneller zu erlernen als andere Stadtteile (vgl.
Lamnek, 2001). Bedingungen fr das Entstehen delinquenter Subkulturen:
Mangelnder Zugang zu legitimen Mitteln zur Verwirklichung
internalisierter konventioneller Ziele
Verbindung mit Gleichgesinnten im nheren Wohnbereich
17
Techniken zur Bewltigung von Angst und Schuld
Zugang zu illegitimen Mitteln, Typisierung delinquenter Subkulturen
Leben in einer kriminellen Umwelt
Zugang zu kriminellen Rollen
soziale Kontrolle durch kriminelle Erwachsene
desorganisiertes Gebiet (Slums), hohe vertikale und geografische Mobilitt
mangelndes stabiles System konventioneller/ krimineller Rollen
schwache soziale Kontrolle
Einsatz legitimer/ illegitimer Mittel bleibt ohne Erfolg
Rauschmittel verfgbar
Die Theorie kann keine Bedingungen angeben, wann und unter welchen
Voraussetzungen bei sonst gleichen Ausprgungen der gesellschaftlichen Strukturen
der eine sich abweichend, ein anderer sich dagegen konform verhlt (Lamnek, 1979,
S. 265). Theorie bietet Anstze fr kriminalpolitische Manahmen (Stdtebau,
Sozialkontrolle, etc.)
2.5.5 Theorie des Labeling Approach (Etikettierungsansatz)
Der Labeling Approach, auch Etikettierungsansatz, Stigmatisierungsansatz oder
interaktionistische Theorie genannt, fand, obwohl schon frher formuliert, erst in den
sechziger Jahren breiteren Anklang. Wesentliche Vertreter sind Tannenbaum (1938),
Lemert (1951) und Becker (1963). Der Ansatz erfuhr eine weite Verbreitung, sowohl
mit erheblichen Modifizierungen als auch in Verknpfungen mit anderen Theorien.
Delinquenz wird als Resultat eines Interaktions-Prozesses zwischen dem Einzelnen
und den Instanzen der sozialen Kontrolle verstanden und ist nicht tiologisch
orientiert (vgl. Lamnek, 2001). Der aus den USA stammende Ansatz geht zunchst
davon aus, dass Kriminalitt ubiquitr in der Gesellschaft verteilt ist.
Dunkelfeldforschungen wie von James F. Short und Ivan F. Nye von 1957 zeigen,
dass Schwer- und Leichtkriminelle sich gleichermaen aus allen Schichten und aus
intakten wie zerrtteten Familien kommen (vgl. Sack, 1974). Der als Urvater der
Etikettierungstheorie geltende Tannenbaum (1938) beschreibt schon frh das
zentrale Grundelement des Labeling Approach durch das Zuschreiben der
Abweichung durch die soziale Reaktion auf bestimmtes Handeln. Edwin Lemert griff
die Gedanken Tannenbaums 1951 wieder auf und formulierte erstmals die
Unterscheidung in primre und sekundre Devianz. Er misst der primren
Abweichung (Delikte vor der ersten Reaktion) keine wesentliche Bedeutung zu, da
deviantes Verhalten jugendtypisch ist und ohne entsprechende Sanktionen auch nicht
zwingend eine biographische Konsequenz haben muss (vgl. Lamnek). Primre
Devianz kann unterschiedliche Ursachen haben und kann durch die tiologischen
Theorien, die bis jetzt vorgestellt wurden, erklrt werden. Er geht davon aus, dass
erst die offizielle Reaktion ausschlaggebend sei und eine sekundre Devianz
produziere, die stigmatisiert und eine ablehnende Haltung verursache.
18
verschiedene Ursachen
Labeling
primre Devianz
sekundre Devianz
Umweltreaktionen und -definitionen
Abb. 1: Schematische Darstellung der sekundren Devianz
Quelle: in Lamnek nach Rters, 2001
Allerdings hebt Lamnek nach Lemert hervor, dass eine negative Wirkung nicht
zwangslufig entstehen muss, sondern im Einzelfall sogar auch eine Hilfe sein
knne. Der Anspruch lautet folglich Reaktionen und Sanktionen so einzurichten,
dass einer etikettierenden Beeinflussung mglichst ausgewichen wird.
Das Karrieremodell von Howard S. Becker, entwickelt am Beispiel von Marihuana-
Rauchern (1963), wird als gemigt beschrieben, nhert sich aber bereits dem
radikalen Labeling-Ansatz an, da er Devianz nicht als Eigenschaft des Verhaltens,
sondern ausschlielich als Folge der Etikettierung versteht, dennoch wird der
primren Devianz noch ein Platz eingerumt. Becker beschreibt wie schon Lemert,
dass Mechanismen der Self-fulfilling Prophecy durch eine Etikettierung ausgelst
werden knnen (vgl. Lamnek; Becker, 1981).
Becker ist der Auffassung, dass gesellschaftliche Gruppen Devianz dadurch
bewirken, dass sie Regeln aufstellen, deren Verletzung Devianz konstituiert.
Diese Regeln werden auf gewisse Menschen angewendet und stempeln diese zu
Outsidern. Nach diesem Gesichtspunkt ist Devianz
keine Qualitt der Handlung, die eine Person begeht, sondern vielmehr eine
Konsequenz der Anwendung von Regeln durch andere und der Sanktionen
gegenber einem Missetter. Der Mensch mit abweichendem Verhalten ist
ein Mensch, auf den diese Bezeichnung erfolgreich angewandt worden ist;
abweichendes Verhalten ist Verhalten, das Menschen so bezeichnen
(Becker, 1981).
Siegfried Lamnek (1977) formuliert sieben Thesen, die weitestgehend allen Labeling
Autoren gerecht zu werden versuchen.
1. Die Voraussetzung fr die Klassifikation abweichenden Verhaltens ist die
Normsetzung selbst. Die Mchtigen einer Sozialstruktur determinieren die
Normen anhand ihrer Interessen.
2. Die Determination der Normen setzt deviantes Verhalten nicht fest. Normen
mssen erst zur Anwendung kommen, um eine Abweichung oder Einhaltung
zu ermglichen.
19
3. Daraus resultiert erst die Definition der Delinquenz, die als Produkt gesell-
schaftlicher Zuschreibungsprozesse zu verstehen ist.
4. Diese wiederum werden selektiv vorgenommen und geben offiziellen und
gesellschaftlich institutionalisierten Instanzen eine privilegierte Definitions-
mglichkeit.
5. Etikettierungsprozesse werden durch diese Selektion provoziert. Den
gelabelten Individuen wird ein geringer Verhaltensspielraum zugestanden,
es findet eine Begrenzung der konformen Verhaltensmglichkeiten statt.
6. Anhand fehlender konformer Verhaltensmglichkeiten wird auf deviantes
Verhalten ausgewichen. Durch die Etikettierung wird eine sekundre Devianz
geschaffen.
7. Aufgrund der Zuschreibung des Abweichens und der Anwendung devianter
Verhaltensweisen kommt es bei dieser Personengruppe zu einer devianten
Selbstdefinition. Das Individuum bildet eine Identitt, die dem Label
entspricht (durch Zuschreibung entsteht die abweichende
Identitt/Mechanismus der self-fulfilling prophecy).
Der Labeling Approach wurde in einer radikalen soziologischen Version von Fritz
Sack (1968) weiter entwickelt und erhielt erstmals gesellschaftspolitische
Sprengkraft (Lamnek). Gesttzt auf die damaligen Ergebnisse der
Dunkelfeldforschung ging er davon aus, dass Straftaten normal seien und
gleichmig verteilt seien (Ubiquittsthese). Deshalb beruhe die registrierte
Kriminalitt nicht auf Handlungsweisen der Tter, sondern sei die Folge von
Definitionsprozessen durch die strafrechtlichen Kontrollinstanzen. Die Selektion der
registrierten Delikte aus der Gesamtmenge der begangenen Delikte erfolge nicht
gleichmig oder nach der Schwere, sondern verzerrend, insbesondere zum Nachteil
von sozial schwachen Ttern. Deshalb sei die Analyse der Definitions- und
Selektionsmechanismen die bedeutende Aufgabe der Kriminologie.
Im Gegensatz zu den oben genannte Theoretikern schliet der radikale Labeling
Approach die Frage nach der primren Devianz bzw. ihre Ursachen vllig aus und
gilt somit als reine Kriminalisierungstheorie (vgl. Schwind, 2004).
Insgesamt wird am Labeling-Approach besonders kritisch gesehen, dass die
Interaktionen zwischen Etikettierenden und Etikettierten sowie die Persnlich-
keitsmerkmale der Etikettierten ausgeblendet werden. Die unterschiedliche
Delinquenz der Geschlechter wird nicht erklrt. Dem Labeling-Approach wird
auerdem vorgehalten, er vernachlssige, dass Menschen auch durch ihre eigenen
Handlungen ohne vorherige Etikettierung in eine kriminelle Entwicklung geraten
knnen. Etikettierte Personen werden als Opfer der Gesellschaft verstanden und
darber mglicherweise entlastet. Es fehlen Erluterungen zu der groen Zahl der
Delinquenten, die delinquentes Verhalten ablegen. Des Weiteren wird die
Ubiquittsthese in Frage gestellt, da eine gleiche Verteilung in Dunkelfeldstudien
widerlegt wurde. Nach Peters (1996) delegitimiert dieser Ansatz pdagogische
Handlungen, da diese zu einem Label fhren wrden. Es wird die Non- Intervention
gefordert.
20
2.5.6 kologische Theorie der Chicagoer Schule
Der kologische Ansatz der Chicagoer Schule bzw. der Theorie der sozialen
Desorganisation von Shaw und McKay (1969) geht auf die Entdeckung von
deliquency areas in den Chicagoer Stadtteilen zurck Die daraus entstandenen
Erkenntnisse finden aktuelle Verwendung und haben in der heutigen Prvention eine
wesentliche Bedeutung. Die Basis bildet die Annahme, dass im Rahmen der
Industrialisierung und ihrer sozialen Vernderungen eine Verschlechterung der
Gemeinschaftlichkeit und der Moral einhergeht. Die im urbanen Raum, im
Gegensatz zum lndlichen Raum, einen moralischen Niedergang kennzeichnet.
Rumlichen Verteilung und die rtlichen Entstehungsbedingungen der Delinquenz
sind im Focus des Interesses (vgl. Schwind, 2004). Trasher (1927) sieht also hohe
Kriminalittsraten in Quartieren, die sich durch Armut, schlechte Wohnverhltnisse,
geringen Ausbildungsstand, hohe Wohnungsfluktuation und groe Bevlkerungs-
dichte auszeichnen, als Folge sozialer Desintegration. Fehlende Partizipation an
gesellschaftlichem und gemeinschaftlichem Leben aufgrund von Unwillen oder
Unfhigkeit fhrt zum Ausschluss aus der Mehrheitsgesellschaft. Shaw und Mc Kay
untersuchten die Aufenthaltsorte von delinquenten Gruppen und entdeckten, dass
besonders in Gebieten mit geringer sozialen Kontrolle (Stadtkernen,
Geschftsvierteln, Industriegebieten) delinquentes Verhalten verstrkt auftrat. Aus
dieser Entdeckung heraus entwickelten sie eine Theorie der geografischen
Verbreitung von Kriminalitt, die aufzeigte, dass Grostdte berproportional
betroffen waren und der lndliche Raum am geringsten (Stadt-/Land-Geflle).
Innerhalb der Stdte stellten sie deliquency areas mit erhhter Delinquenz fest.
Diese wiesen eine geringe soziale Kontrolle auf und geringe soziale Solidarisierung
und Identifikation der Bevlkerung mit ihrem Quartier. Shaw und McKay stellten die
These auf, dass eine funktionierende Struktur sozialer Netze und persnlicher
Bezugssysteme Strafflligkeit verhindert. Ein Zerfall dieser Funktionen begnstige
im Umkehrschluss also Delinquenz. Sie unterschieden zwischen Primrkontrolle
durch Nachbarn und Umfeld und Sekundrkontrolle durch die Polizei oder andere
ffentliche Dienste. Hierbei stellten sie eine hhere Prventivwirkung der primren
Kontrolle fest.
Die beiden US-Sozialforscher George L. Kelling und James W. Wilson stellten 1982
die Broken-Window-Theorie vor, die als Basis einer Anzahl von Manahmen diente.
Wilson und Kelling gingen von einer kausalen Verknpfung zwischen stdtischer
Unordnung und steigender Kriminalitt aus. uere Kennzeichen von Chaos in einer
Umgebung (zerbrochene Fensterscheiben/ leer stehende Huser/ sichtbarer Mll/
Graffiti/ zerstrtes ffentliches Eigentum etc.) verhindern die Identifikation der
Bewohner mit dem Quartier und schwchen Verantwortungsbewusstsein sowie
primre Kontrolle. Die Bewohner ziehen sich verunsichert zurck und fhlen keine
Verantwortung fr ihr Quartier.
21
Diese disorder und Verfall beunruhigen die Bevlkerung mehr als tatschliche
Kriminalitt und sie werden zunehmend unzufrieden. Die fr eine wirksame
Kriminalprvention in einem Quartier entscheidende informelle soziale Kontrolle
fllt weg. Diese Entwicklung sei frderlich fr delinquente Subkulturen. Eine hohe
Wohnungsfluktation und Stigmatisierung tritt ein und berlsst zunehmend
Delinquenten das Quartier, das nun zu
zerfallen droht. Eine Bewegung kommt in
Gang, die nur sehr schwer aufzuhalten
scheint. Somit bildeten sich Konzepte, die
ein frhes Eingreifen in diese Entwicklung
beinhalten.
Das bekannteste Prventivkonzept, das auf
diese Theorie fut, ist die Null-Toleranz-
Offensive aus New York. Zero tolerance
bezeichnet dabei den rigorosen Kampf gegen
jede Unordnung im ffentlichen Raum, zu
der neben Mll, Graffiti, Vandalismus und
verfallenden Gebuden auch bestimmte Personengruppen wie Bettler, Obdachlose,
Drogenkonsumenten und andere sozial Randstndige gezhlt wurden
(Hermann/Laue, 2003). Die Kriminalittsrate wurde dort zwischen 1990 und 1996
um knapp die Hlfte gesenkt, allerdings auch an anderen Orten ohne diese Offensive.
Dennoch fand dieses Konzept groen Anklang, da die ersten Zeichen von Verfall
und Unordnung mit praktischen, verwaltungsrechtlichen, polizeilichen und
repressiven Mitteln entschieden bekmpft wurden (vgl. Ortner/Pilgram/Steinert, Die
Null-Lsung, 1998). Hierbei ist kritisch zu sehen, dass die Broken-Window-
Hypothese keine Erklrung fr die Entstehung der Kriminalitt liefert. Unumstritten
sind aber der Einfluss der primren Kontrolle und die Bedeutung der Identifikation
der Bewohner mit ihrem Quartier in Bezug auf Delinquenz. Einer Unordnung im
Quartier entgegenzuwirken (Graffitis/ Mll etc.) hat unzweifelhaft eine prventive
Wirkung (vgl. Ortner/Pilgram/Steinert, Die Null-Lsung, 1998).
Abb. 2: Broken-Window-
Hypothese; Quelle: Isoplan
2.6 Mehrfaktorenanstze und Prozessmodelle
Die bis jetzt vorgestellten Theorien und Anstze lassen keine Erklrung jeglicher
Form von Delinquenz zu, sie versuchen Delinquenz aus einem bestimmten Faktor
(Anomie, Sozialstruktur, Bindungen etc.) zu erklren und eine einheitliche Theorie
zu begrnden. Sie verfahren deduktiv, sie nehmen eine Generalthese und leiten
daraus die Erklrungen einzelner Handlungen ab, die Meisten haben allerdings
Mngel bezglich der Erklrung von zum Beispiel Verkehrskriminalitt, der
ungleichen Geschlechterverteilung und irrationalen Gewaltdelikten (vgl. Schwind
2004). Auch wenn einige diese Formen bedingt erklren ist doch eine Allumfasstheit
nicht gegeben.
Als Begrnder der multifaktoriellen Anstze gilt Ferri (1896), ein Schler
Lombrosos. Im Unterschied zu diesem bewertete er in seinen Untersuchungen
anthropologische und soziale Merkmale. Die Vertreter multifaktoraler Anstze gehen
22
davon aus, dass stets eine Vielzahl von Faktoren, sowohl biologischer,
psychologischer also auch soziologischer Art, an der Entstehung der Delinquenz
beteiligt sind. Die empirisch ausgerichteten Mehrfaktorenanstze (multiple causation
approach) prfen eine Flle persnlicher und sozialer Daten von Untersuchungs-
personen auf ihre statistische bereinstimmung mit kriminellem oder
nichtkriminellem Verhalten.
Die festgestellten Wechselbeziehungen bilden gleichzeitig die Grundlage fr die
Entwicklung statistischer Prognoseverfahren (Schwind 2004). Die monokausalen
Kriminalittstheorien wurden nicht als Grundlage benutzt, denn den
Mehrfaktorenanstzen ist eine induktive Vorgehensweise zu Eigen.
Diese Anstze sind im Besonderen vom Ehepaar Sheldon und Eleanor Glueck, das
seit 1930 diverse empirische Untersuchungen zur Ermittlung kriminologisch
relevanter Merkmalskombinationen durchgefhrt hat, in Unraveling Juvenile
Delinquency (1950) thematisiert worden. Die Gluecks haben 500 delinquente
(Jugendstrafvollzug) und 500 nichtdelinquente Jugendliche auf 402 Faktoren hin
berprft (Schwind). Spter reduzierten sie diese Faktoren auf drei Wesentliche, die
einen groen Einfluss auf sptere Delinquenz haben sollten. Diese Faktoren waren
die Strenge der Mutter, die Beaufsichtigung der Mutter und der Zusammenhalt
innerhalb der Familie (vgl. Glueck/Glueck, 1968). Sie entwickelten eine statistische
Prognosemethode, welche sich in Erhebungen allerdings als nicht sehr aussagekrftig
erwies (Lamnek, 2001). In so genannten Kohortenstudien (Philadelphia Birth Cohort
Study, Wolfgang, 1972; Cambridge-Study, West, 1973) wurde die Entwicklung
ganzer Geburts- oder Schuljahrgnge ber einen weiten Zeitraum hinweg untersucht.
Diese Kohortenstudien ergaben, dass ein groer Teil der Jugenddelinquenz nur
episodenhaft auftritt und es nur einen kleinen Teil an Intensivttern gibt. Weiterhin
wurde ein Zusammenhang zwischen belastenden Faktoren wie Armut, kriminelle
Familie, Erziehungsdefizite, Verhaltensaufflligkeiten in der Schule und frher
Beginn der Delinquenz festgestellt. Allerdings lassen diese Faktoren keinen Schluss
ber knftige Intensivtter zu (vgl. Lamnek). Multifaktorielle Anstze beschreiben
also keine selbstndige geschlossene Theorie, sondern die Vereinigung verschiedener
Teilaspekte, vieler Faktoren, die zu Kriminalitt bedingen knnen (Multiple
Causation Approach).
Aufgrund der empirischen Ausrichtung werden die Mehrfaktorenanstze als
wertvolle Basis fr die Theorienbildung gesehen, allerdings wird ihnen ihre
Theorielosigkeit als Vorwurf gemacht. Wegen der empirisch-induktiven
Vorgehensweise fehlt den multifaktoriellen Anstzen eine theoretische Konzeption,
die eine Verbindung der einzelnen Faktoren untereinander logisch stringent
ermglichen wrde (Lamnek 1977, S.28).
Diesen Vorwrfen versuchen theorieverbindende Anstze entgegenzutreten, diese
versuchen in deduktiven Ausfhrungen, die umfassenderen Erklrungsmodelle zu
integrieren und die bestehenden Kriminalittstheorien miteinander zu verbinden.
Dass die empirischen Mehrfaktorenanstze bedeutende Anteile zum Verstndnis der
Kriminalitt haben ist weitestgehend anerkannt. Ihre prognostische Aussagekraft
wird allerdings in Frage gestellt. Dennoch sind sie fr die Praxis sehr interessant.
Lamnek sieht sie diese Methoden mindestens partiell brauchbar.
23
3 Delinquenz von Jugendlichen und Heranwachsenden mit
Migrationshintergrund in Deutschland
Analysen zur Entwicklung der Kriminalitt nichtdeutscher Jugendlicher und
Heranwachsender sttzen sich vor allem auf die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS).
Sie wird zur Bewertung der Kriminalittsentwicklung immer wieder herangezogen
und wird deswegen auch ein Schwerpunkt im weiteren Verlauf sein. Nach der
Verffentlichung der PKS traten wiederholt alarmierende Presseberichte ber die
wachsende Auslnderkriminalitt und die besorgniserregende Jugendkriminalitt
zu Tage.
Die PKS ist also trotz der spter vorgestellten und weitgehend berechtigten
Beanstandungen immer noch eine der wichtigsten Quellen zur Analyse der
Kriminalittsentwicklung. In welcher Form Feststellungen, in Bezug auf
Jugendliche und Heranwachsende mit einer nichtdeutschen Staatsangehrigkeit
durch die PKS mglich sind, soll hier nachgegangen werden.
Ein berblick ber die Forschung in Westeuropa zeigt, dass fr viele
Migrantengruppen und ethnische Minoritten die Kriminalittsbelastung (gemessen
an der PKS) etwa das zwei- bis dreifache vom gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt
betrgt. Herausgegriffen werden dabei vor allem Zahlen, nach denen die Kriminalitt
junger mnnlicher Auslnder, an ihrem Bevlkerungsanteil gemessen, etwa dreimal
so hoch erscheint wie die der altersgleichen Deutschen. Wenn also die PKS nchtern
betrachtet wird, werden Nichtdeutsche hufiger als Deutsche (siehe oben)
strafrechtlich auffllig. Insbesondere die Zunahme der Jugenddelinquenz, vor allem
bei Gewaltdelikten, wird deutlich. Jedoch lsst die PKS einen Vergleich der
Kriminalitt von Deutschen und Nichtdeutsche nur sehr begrenzt zu. Bei der
Kriminalittsbelastung der beiden Bevlkerungsgruppen sind unterschiedliche
Verzerrungsfaktoren aufzuzeigen (vgl. 3.1). Die sozialen Probleme junger Menschen
mit Migrationshintergrund lassen kaum einen Vergleich zu. Bei einem mglichen
Vergleich sind besonders die Lebenslagen zu beachten. Aber dennoch muss die
erhhte Devianz dieser Gruppe beachtet werden. Whrend die Statistik immer wieder
Anhaltspunkte ber kriminelle Folgen einer misslungenen Integration aufzeigen
knnte, ist dies bei jugendlichen Sptaussiedlern aus Osteuropa nicht der Fall, da sie
meist eine deutsche Staatsangehrigkeit besitzen und in der Statistik nicht berall
gesondert erfasst werden. Dennoch sind auch hier hnliche Konflikte und Folgen zu
beobachten (Ostendorf, 1999).
Christian Pfeiffer (et al.) fand in seiner Studie fr den Deutschen Jugendgerichtstag
1998 in Hamburg heraus, dass sowohl die Befunde der PKS, der Aktenanalyse und
der Strafverfolgungsstatistik als auch die Selbstberichte der Jugendlichen sowie
Angaben der Opfer konform auf eine leicht erhhte Delinquenzbelastung von
Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft hinweisen. Diese Forschungsergebnisse
unterstreichen die Forderung nach einer kritischen neutralen Diskussion des Themas.
Bewertungen der Kriminalittsentwicklung sttzten sich in der Regel auf Zahlen,
meist auf absolute Zahlen, der PKS. In der PKS 2003 wurden insgesamt in
Deutschland 2.355.161 Tatverdchtige (TV) ermittelt (1,2% mehr als 2002) und
24
3.486.685 Flle aufgeklrt. Whrend die Anzahl der deutschen TV im letzten Jahr
um 2,6% auf 1.801.411 stieg, nahm die Anzahl der TV ohne deutsche
Staatsangehrigkeit gegenber dem Vorjahr (2002: 24,4%) um 2,3% auf 553.750 ab
(vgl. PKS, 2003, BRD).
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
1993 1995 1997 1999 2001 2003
Jahr
A
n
z
a
h
l
d
e
r
T
V
Nichtdeutsche TV
Abb. 3: Entwicklung der Zahl nichtdeutscher Tatverdchtiger in Deutschland
Quelle: PKS, 2003; eigene Berechnung
Eine Bewertung der tatschlichen Kriminalittsbelastung ist im Vergleich der
Deutschen zu den Nichtdeutschen jedoch wegen des Dunkelfeldes der nicht
ermittelten Tter in der Polizeilichen Kriminalstatistik nur eingeschrnkt mglich.
Die PKS verweist und beschreibt in dieser Kategorie auf die Verzerrungsfaktoren
und schliet eine Mglichkeit des Vergleiches aus. Die Anzahl tatverdchtiger
Asylbewerber nahm um 6,8% ab und betrgt 2003 73.573. Ihr Anteil an den
ermittelten nichtdeutschen Tatverdchtigen betrgt damit 13,3% (2002: 13,9%).
Die begangenen Delikte umfassen zu fast 60% Ladendiebsthle und Verste gegen
das Auslnder- und das Asylverfahrensgesetz. Der Anteil der Nichtdeutschen an den
Tatverdchtigen bei den Straftaten gegen das Auslndergesetz und das
Asylverfahrensgesetz liegt bei 92,7% (2002: 93,2%). Etwa jede/jeder Vierte (23,9%;
2002: 26,7%) nichtdeutsche TV ist wegen einer Straftat nach Auslndergesetz oder
Asylverfahrensgesetz ermittelt worden. Ohne auslnderspezifische Delikte betrug der
Tatverdchtigenanteil Nichtdeutscher 19,0% und ist damit gegenber 2002 (19,2%)
leicht gesunken. Die Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der nichtdeutschen
Tatverdchtigen insgesamt seit 1993. Diese lsst einen Rckgang des Anteils an den
Tatverdchtigen insgesamt seit 1993 erkennen (PKS, 2003).
Die langfristige Vernderung der Tatverdchtigenzahlen seitens der Personen ohne
deutsche Staatsangehrigkeit ist seit 1997 berwiegend rcklufig. Vernderungen
an der Gesamtzahl drften nach der PKS vor allem auf demographischen Einflssen
beruhen (Wanderbewegungen aus bzw. ins Ausland).
25
Abb. 4: Anteil der ethnischen Gruppen an den TV ausgewhlter Altersgruppen;
Quelle: PKS, 2003; eigene Berechnung
Allgemein werden von Jugendlichen (14 bis 17 Jahre), noch mehr von
Heranwachsenden (18 bis 20 Jahre) hufiger Straftaten begangen als von
Erwachsenen. Die Zahl der tatverdchtigen Jugendlichen im Jahr 2003 betrug
293.907, das sind 1,3% weniger als 2002 (297.881). Die Tatverdchtigenzahl der
Jugendlichen und ihr Anteil an den Tatverdchtigen im ethnischen Vergleich seit
1993 entwickelten sich insgesamt wie folgt:
Abb. 5: Entwicklung der Anteile der jugendlicher TV nach ethnischer Herkunft in
Deutschland; Quelle: PKS, 2003; eigene Berechnung
26
Der in der Abbildung (Abb. 5) dargestellte Trend weist eine Rcklufigkeit der
nichtdeutschen tatverdchtigen Jugendlichen im Verhltnis zu den deutschen
tatverdchtigen Jugendlichen auf. Nichtdeutsche an den tatverdchtigen
Jugendlichen machten 2003 16,9% (2002: 17,2%) aus. Es wurden 49.809
nichtdeutsche und 244.098 deutsche jugendliche Tatverdchtige ermittelt. Die
Anzahl der tatverdchtigen deutschen Jugendlichen ging gegenber 2002 um 1,0%,
die Anzahl der nichtdeutschen um 2,8% zurck. Die PKS stellt eine Rcklufigkeit
der Tatverdchtigenzahlen der Jugendlichen bei Ladendiebstahl und bei den
deutschen Tatverdchtigen auerdem bei Raub, ruberischer Erpressung und
ruberischem Angriff auf Kraftfahrer fest. Zunahmen wurden bei Krperverletzung
und Leistungserschleichung verzeichnet. Der Anteil der deutschen Jugendlichen an
den Gesamttatverdchtigen in Deutschland betrug 2003, 7,1% (2002: 7,3%) (vgl.
PKS, 2003).
Tatverdchtige Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) wurden im Jahr 2003
247.456 ermittelt, das sind 0,7% mehr als 2002 (245.761). Die Tatverdchtigenzahl
der Heranwachsenden und ihr Anteil an den Tatverdchtigen im ethnischen
Vergleich seit 1993 entwickelten sich insgesamt wie folgt:
Abb. 6: Entwicklung der Anteile der Heranwachsenden an TV nach ethnischer
Herkunft in Deutschland; Quelle: PKS, 2003; eigene Berechnung
Wie bei den jugendlichen Tatverdchtigen lsst sich auch hier im Vergleich ein
Rckgang der nichtdeutschen tatverdchtigen Heranwachsenden am Gesamtanteil
der jugendlichen Tatverdchtigen verzeichnen. Der Anteil Nichtdeutscher an den
27
tatverdchtigen Heranwachsenden lag 2003 bei 21,5% und verzeichnete 53.106 TV
(2002: 22,8%). Die Anzahl der tatverdchtigen deutschen Heranwachsenden stieg
gegenber 2002 um 2,5% und betrug 2003 194.350 TV. Es waren 2003 5,4%
weniger nichtdeutsche TV als 2002 zu verzeichnen. An der Gesamtzahl der
Tatverdchtigen in Deutschland machten die Heranwachsenden TV insgesamt 7,7%
(2002: 7,5%) aus (vgl. PKS, 2003).
Obwohl in der zeitlichen Entwicklung ein deutlicher Rckgang der nichtdeutschen
Tatverdchtigen an den Gesamtzahlen der TV in den jeweiligen Altersgruppen zu
verzeichnen ist, sind sie dennoch berproportional hher zum Bevlkerungsanteil
vertreten. Nach der Studie von Fuchs/Lamnek (1992) vertreten viele deutsche Brger
den Standpunkt, dass Asylanten und Gastarbeiter berproportional viele Delikte
verantworten mssen. Auch andere Umfragen kommen zu dem Ergebnis, dass viele
Brger Auslnder, Aussiedler und Jugendliche fr eine hohe Kriminalitt
verantwortlich machen. Eine hohe Auslnderkriminalitt kann, als Seismograph
fr misslungene Integration (Reich, 2003) angesehen werden. Beim Blick auf die
Polizeiliche Kriminalstatistik, die Verurteiltenstatistik und die Strafvollzugsstatistik
scheinen sich solche Meinungen zu untermauern, dennoch muss dies differenzierter
betrachtet werden.
bb. 7: TV nach Altersgruppe und ethnischer Herkunft in Deutschland;
Ein Gercht geht um in Deutschland das statistische Gercht von der
A
Quelle: Eigene Berechnung nach der PKS 2003
hohen Auslnderkriminalitt. Seine trbe Quelle ist die Polizeiliche
Kriminalstatistik, deren Datenmassen auslnderfeindlich verschmutzt sind.
(Geiler, 1995)
28
Die PKS stellt jedoch ebenfalls fest, dass die seit langem in Deutschland lebenden
und beruflich integrierten Nichtdeutschen sich grtenteils strafrechtlich unauffllig
verhalten.
3.1 Zu den Verzerrungsfaktoren der Polizeilichen Kriminalstatistik
Politisch hat die PKS eine relativ groe Bedeutung, da sie scheinbar die Mglichkeit
bietet, Aussagen ber die Kriminalitt in der Bundesrepublik zu treffen. So generiert
sie einerseits durch eine hohe Aufklrungsquote eine effektive Polizeiarbeit und
andererseits eine erfolgreiche Innenpolitik anhand geringer Fallzahlen. Sie dient zur
Rechtfertigung sowie der Ressourcenverteilung in den unterschiedlichen Bereichen.
Einzelne gesellschaftliche Gruppen knnen auf sie ihre Vorstellungen sttzen
(vgl. Albrecht/ Lamnek, 1979). Die PKS wird daher des fteren als
Arbeitsnachweis der Polizei beschrieben (Mansel, 1998). Kritik findet besonders
die Tatsache, dass in Fllen der Konzentrierung seitens der Polizei auf bestimmte
Deliktbereiche auch mehr Taten aufgedeckt werden. Der Mnchener Kriminologe
Prof. Dr. Horst Schler-Springorum beschreibt dieses Phnomen folgendermaen:
Mehr Polizei schafft nicht weniger, sondern mehr Kriminalitt.
Die PKS hat bezglich der Ursachen fr Delinquenz keine Aussagekraft (Seiden-
Pielen/Farin, 1994). Aus erhebungstechnischen Grnden ist es fr die Statistiker
einfach zwischen Deutschen und Nichtdeutschen zu unterscheiden. Aus der Sicht der
Sozialwissenschaften, der Migrationsforschung und der Kriminologie ist diese
Kategorisierung jedoch uerst problematisch. (Wenzel 2001) Ein einfacher
Vergleich der Zahlen der PKS und das Schlieen auf eine besondere Delinquenz der
in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund verbieten sich aus
einer Vielzahl von Verzerrungsfaktoren. Je mehr solche Verzerrungsfaktoren
herausgenommen werden, desto strker gleichen sich die Zahlen von Deutschen und
Auslndern an (Karger, Sutterer). In die PKS aufgenommen wird die polizeilich
registrierte Kriminalitt (Hellfeld), alle Flle in denen ein Tatverdacht besteht. Sie
fhrt Tatverdchtige, es handelt sich nicht um berfhrte Tter. Somit gibt die
Polizeiliche Kriminalstatistik nur wenig Anhaltspunkte fr die Vernderung der
Kriminalitt im Erfassungsbereich. Bei der Interpretation mssen verschiedene
Faktoren beachtet werden.
Er/Sie vergleicht Unvergleichbares - und zwar nicht nur pfel mit Birnen,
sondern pfel mit Tomaten oder sauren Gurken (Geiler, 1998).
Das Vergleichen mit anderen Kriminalstatistiken, wie der Strafverfolgungsstatistik
ist fast unmglich. In der Strafverfolgungsstatistik (SVS) sind alle Abgeurteilten und
verurteilten Personen erfasst. Es gibt eine groe Differenz zwischen den Zahlen der
PKS und der SVS, die in manchen Deliktgruppen sogar 1:5 betrgt
(Albrecht/Lamnek, 1979). In Bezug auf die nichtdeutschen Tatverdchtigen muss
beachtet werden, dass die PKS den tatschlichen Gegebenheiten des ausgewiesenen
Verhltnisses zwischen Deutschen und Nichtdeutschen zunehmend weniger
29
entspricht. Die PKS kann etwa nicht den Anteil von Sptaussiedlern und
Russlanddeutschen an der Kriminalitt ausweisen, ebenso wenig den Anteil
eingebrgerter trkischer TV. Diese werden als deutsche TV registriert.
Kriminalstatistiken sind nur aussagefhig, so die Experten, wenn also das
Sozialprofil der Tter bzw. TV in die Untersuchung einbezogen wird.
Das Sozialprofil einer Gruppe beeinflusst sowohl Tendenzen zu delinquenten
Verhalten als auch die Reaktionen von Staatsanwaltschaft, Polizei und Gericht, und
dies muss bei einem Vergleich beachtet werden. Rainer Geiler beschreibt in der
Frankfurter Rundschau (1998), dass Mnner hher als Frauen, junge Menschen
hher als ltere, Grostadtbewohner hher als Landbewohner, schlecht Ausgebildete
hher als Hochqualifizierte und Statusniedrige hher als Statushohe mit Delinquenz
belastet sind. Er betont, dass Deutsche und ethnische Minderheiten sich hinsichtlich
dieser Kriterien beachtlich unterscheiden. Beim Betrachten der Bevlkerungs- und
Wohnungsstatistiken wird deutlich, dass fr die nichtdeutsche Bevlkerung sowohl
ein erhhter Anteil der mnnlichen Bevlkerung besteht als auch eine Konzentration
der Lebensrume auf Grostdte (Statistisches Bundesamt). Sie fallen ebenfalls
hufiger unter niedrige Qualifikations- und Statusgruppen und sind somit nach
Geiler (1998) einem hheren sozialstrukturelle Druck zu delinquentem Verhalten
ausgesetzt. Die nichtdeutsche Bevlkerung unterliegt aufgrund ihres Sozialprofils
ebenso einer hheren Gefahr der Kriminalisierung durch Instanzen der
Strafverfolgung im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft. Wird ein Vergleich der
nichtdeutschen und deutschen Gruppen mit hnlichem Sozialprofil erstellt, ist bis auf
wenige Altersgruppen keine erhhte Delinquenz festzustellen (vgl. Geiler, 1998).
Zu diesem Ergebnis kommen zahlreiche Studien, die Unterschiede im Sozialprofil
beachten und Deutsche und Nichtdeutsche mit einer hnlichen Soziallage
vergleichen.
Die Kategorie der Nichtdeutschen hat in der PKS also keine differenzierende
Funktion, sondern vielmehr eine pauschalierende. Die PKS weist auf diesen
trgerischen Effekt hin, sie gibt unter anderem an, dass die Gesamtzahl der Personen
ohne deutsche Staatsangehrigkeit aus sehr unterschiedlichen Gruppen hinsichtlich
ihrer sozialen Merkmale (Diplomaten, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer, Studenten,
Schler, Hausfrauen, Touristen, Geschftsreisende, Asylbewerber, Flchtlinge,
Arbeitslose usw.) und Nationalitten zusammengesetzt ist. Diese Gruppen knnen
sich erheblich in der Kriminalittsaufflligkeit unterscheiden (vgl. PKS, 2004).
Besonders die Einbeziehung der kriminellen Belastung von Asylbewerbern verzerrt
das Bild. Die Kriminalitt der Asylbewerber unterscheidet sich signifikant von der
der hier lebenden Arbeitsmigranten. Rainer Geiler verweist auf unterschiedliche
Deliktstrukturen aufgrund der unterschiedlichen Lebenslagen und besonderen
Lebensbedingungen, denn Asylbewerber leben in einer extremen sozialen und
psychischen Notsituation.
Zu den genannten Faktoren, die die PKS beeinflussen, kommen weitere
Verzerrungsfaktoren. Beachtung mssen auch Delikte finden, die nur Auslnder
begehen knnen, weil sie mit ihrer besonderen Lage in Verbindung stehen, wie zum
Beispiel Meldevergehen, falsche Angaben ber die Herkunft oder die Einreisewege,
illegaler Grenzbertritt und Straftaten gegen das Auslndergesetz oder das
30
Asylverfahrensgesetz. Diese auslnderspezifischen Delikte erhhen die
Tatverdchtigenquote der Nichtdeutschen bedeutsam, knnen dagegen von
Deutschen nur sehr begrenzt verbt werden.
Irrefhrend in der Kriminalstatistik ist weiterhin die fehlende Unterscheidung
zwischen Nichtdeutschen, die zur Wohnbevlkerung in Deutschland gehren und
Illegalen, Durchreisenden und vorbergehend in Deutschland lebenden Personen. Es
werden alle Nichtdeutschen erfasst, die einer Straftat verdchtig sind. Darunter fallen
auch Touristen, Besucher, Durchreisende, Grenzpendler, Stationierungsstreitkrfte
und Illegale, die nicht zur Wohnbevlkerung gehren. Sie sind aber an einer Vielzahl
von Straftaten beteiligt und erhhen die Quote der nichtdeutschen Tatverdchtigen.
Ein Vergleich mit der Auslnderquote in der Wohnbevlkerung wird aus diesem
Grund illegitim (vgl. Pfeiffer).
berdies geraten ethnische Minderheiten allgemein hufiger in einen falschen oder
bertriebenen Tatverdacht als Deutsche (Tatverdachteffekt). Der Tatverdachteffekt
hat verschiedenartige Ursachen. Unter anderem ist die Hemmschwelle in der
Bevlkerung, die Handlung einer Person als strafbar anzusehen und diese bei der
Polizei anzuzeigen, gegenber Auslndern geringer als gegenber Deutschen
(Anzeigeeffekt).
Geiler beschreibt nach einer Studie der Polizei-Fhrungsakademie 1996, dass es
ebenso einen Polizeieffekt gbe, dieser beschreibt ebenfalls ein
vorurteilsbehaftetes Verhalten seitens mancher Polizeibeamten, dies konnte bei
Teilen der Polizei nachgewiesen werden. Einige Studien (Geiler/ Marien, 1990)
belegen diese Effekte durch die so genannte Schwundquoten, durch hufige
Verfahreneinstellungen und Freisprche im Verlauf der Strafverfolgung. Dies weist
darauf hin, dass die berreprsentanz von Auslndern in der PKS vor allem Folge
der ihnen gegenber strkeren Kontrolle ist (Mansel, 1988).
Eine weiterer nennenswerter Verzerrungsfaktor entsteht auf Grund der organisierten
Kriminalitt. Da die PKS nur eng definierte Einzelflle registriert, nicht aber
deliktbergreifende Strukturen, wie das organisierte Verbrechen (Schmuggel,
Drogenhandel, Schleuserbanden, Menschenhandel, Prostitution etc.), wird das Bild
zuungunsten der hier lebenden Migranten verzerrt.
Zur Beantwortung der Frage, ob Auslnder krimineller sind als Einheimische,
muss sowohl die Heterogenitt dieser Gruppe differenziert als auch die
verschiedenartigen Gesichtspunkte von Auslnderkriminalitt beachtet werden.
Die grte Gruppe, die Arbeitsmigranten, verhlt sich bewiesenermaen in
besonderem Mae gesetzestreu. Es besteht keine erhhte Kriminalitt, sie halten sich
sogar im Vergleich zu Deutschen mit vergleichbarem Sozialprofil besser an die
Gesetze. Festzuhalten ist also, dass die Mehrheit an integrierte Migranten in
Deutschland, nicht fter mit dem Gesetz in Konflikt kommt als Deutsche. Dennoch
weist die Gruppe der mnnlichen Jugendlichen der zweiten und dritten Generation
mit schlechten beruflichen Aussichten oder mangelnden Sprachkenntnissen oder
ohne Beschftigung (selbst unter Bercksichtigung der unterschiedlichen
Verzerrungsfaktoren) durchaus eine hhere Delinquenzrate auf (Geiler, 1995;
Pfeiffer, 1995).
31
Diese Gruppe ist aufgrund ihrer besonderen sozialen Lage heutzutage strker
kriminogenen Einflssen ausgesetzt und gefhrdeter als gleichaltrige Deutsche. Die
Sozial- und Bildungspolitik sollte sich um den Abbau von sozialen Ausgrenzungen
der Familien mit Migrationshintergrund bemhen. Bessere Chancen im
Bildungssystem sowie in der Berufsausbildung fr junge Migranten mssen weitere
Ziele darstellen um Ausgrenzung zu verhindern. Rainer Geiler (2001) fordert einen
Ausschluss der Begriffe Auslnder und Auslnderkriminalitt im ffentlichen
Diskurs, da diese in falschen, einseitigen oder missverstndlichen Aussagen,
Meldungen, Begriffen und Daten die Vorurteile vom kriminellen Gastarbeiter
frdern. Nur so sieht er einen integrationsfrdernden Umgang mit ethnischen
Minderheiten gelingen.
Die besondere Delinquenzbelastung gerade der nichtdeutschen (mnnlichen) jungen
Menschen fhrt ntiger Weise zu der Frage nach der sozialen Situation dieser. In der
Kriminologie unbestritten und zu den hufigsten Erklrungen von Kriminalitt
gehrend, ist die Bedeutung von Lebenslagen. Hier spielen individuelle und
kulturelle Merkmale von den sozialen, wirtschaftlichen sowie rechtlichen
Lebensbedingungen eine Rolle. Die Delinquenz von Migranten und die von
Deutschen hat durchaus die gleichen Faktoren und Bedingungen zum Auslser,
jedoch lassen sich fr die Migranten ber die allgemein geltenden delinquenz
frdernden oder -hemmenden Bedingungen hinaus, noch fr sie spezifische
Bedingungen finden. Defizite in ihrer rechtlichen und sozialen Integration sowie
kulturelle Merkmale der betreffenden ethnischen Gruppe knnen eine erhhte
Delinquenzbelastung bedingen.
Die hhere Kriminalittsbelastung von jungen Auslndern im Hell- wie im
Dunkelfeld und die Zusammenhnge, die sich mit ihrer individuellen,
kulturellen und sozialen Situation nachweisen oder zumindest begrndet
vermuten lassen, besttigen die Bedeutung von Lebenslagen fr ihre
Delinquenz (Deutschen Polizeiblatt, 5/2000).
Diese besonderen Aspekte der Lebenslagen sind also hinsichtlich dieser Arbeit
besonders interessant und im Folgenden ausfhrlich dargestellt.
3.2 Lebenslage der Bevlkerung mit trkischem Migrationshintergrund
War Deutschland im 19. Jahrhundert noch ein Auswanderungsland, so ist es in der
zweiten Hlfte des 20. Jahrhunderts zu einem Einwanderungsland geworden, das
multi-ethnischen Charakter aufweist. Seit 1954 kamen 31 Millionen Menschen nach
Deutschland, 22 Millionen zogen im gleichen Zeitraum weg. Insgesamt geht ein
Drittel der Bevlkerung der alten Bundesrepublik auf Zuwanderung zurck.
Deutschland liegt damit weltweit an der Spitze der Zuwanderungsstatistik (vgl.
Trken bei uns, 2000).
Alle im Folgenden verwendeten Zahlen beruhen auf der Quelle des Statistischen
Bundesamtes. Nach dieser lebten 2003 in Deutschland 7.335.000 Menschen mit einer
32
auslndischen Staatsangehrigkeit, das entspricht einem Anteil von 8,9% an der
Gesamtbevlkerung (Datenreport, 2004).
Abb. 8: Die hufigsten Bevlkerungsgruppen in Deutschland 2003;
Quelle: Stat. Bundesamt; eigene Berechnung
Der tatschliche Bevlkerungsanteil mit Migrationshintergrund liegt aufgrund von
Einbrgerungen und zugewanderten Aussiedlerinnen und Aussiedlern hher. Seit
1990 kamen mehr als zwei Millionen Sptaussiedler nach Deutschland, diese
Menschen besitzen zum Groteil die deutsche Staatsangehrigkeit. Sie haben
dennoch mit vergleichbaren Migrations-problemen zu kmpfen wie andere
Migranten auch.
Ein Viertel aller in Deutschland lebenden
Auslnder besa Ende 2003 die
Staatsangehrigkeit eines EU-Staates (25,2%).
Ein weiteres Viertel der auslndischen
Bevlkerung stammt aus der Trkei (25,6%). Mit
ca. 1,9 Millionen Menschen stellen die trkischen
Immigranten die grte Migrantengruppe, das
heit, etwa jeder dritte Einwanderer kommt aus
der Trkei. Im Jahr 2003 waren 3,89 Millionen
(53,1%) Migranten mnnlichen, 3,44 Mio.
(46,9%) weiblichen Geschlechts. Nach wie vor ist
der Mnneranteil im Vergleich zur deutschen
Bevlkerung hher (Abb. 9). Die Einwanderungs-
bevlkerung ist immer noch wesentlich jnger als
die deutsche.
Abb. 9: Nichtdeutsche Bevlkerung nach Geschlecht in Deutschland;
Quelle: Stat. Bundesamt; eigene Berechnung
33
18,3% (1,34 Mio.) der nichtdeutschen Bevlkerung waren im Jahr 2003 unter 18
Jahre alt. 5,56 Millionen (75,7%) waren zwischen 18 und 65 Jahren alt und weitere
6,0% (441.000) 65 Jahre und lter. Prognosen gehen von einem Anwachsen der
Bevlkerungsgruppe der ber 60 Jahre alten Migranten von heute rund 600.000 auf
1,3 Mio. bis zum Jahr 2010 aus. Jeder fnfte nichtdeutsche Brger (20,5%) wurde
bereits in Deutschland geboren, bei den unter 18-Jhrigen sind es zwei Drittel
(68,7%). Die absolute Zahl der in Deutschland geborenen Kinder mit auslndischer
Staatsbrgerschaft ist seit In-Kraft-Treten des neuen Staatsangehrigkeitsrechtes zum
1. Januar 2000 gesunken und lag 2003 bei 39.355 (5,6%) aller Neugeborenen. 36.819
(5,2%) Kinder erhielten so die deutsche Staatsangehrigkeit mit der Geburt.
Es wurden 82.921 (11,7%) Kinder von binationalen Ehegemeinschaften und
Partnerschaften geboren. Von den im Jahr 2003 in der Bundesrepublik Deutschland
geborenen 706.721 Kindern haben auf diese Weise 159.095 (22,5%) mindestens
einen nichtdeutschen Elternteil. Ende 2003 lebten knapp 61% der Auslnderinnen
und Auslnder mehr als 10 Jahre, 42,3% mehr als 15 Jahre, etwa ein Drittel zwanzig
Jahre oder lnger und 18,9% sogar 30 Jahre und mehr in Deutschland. Von den in
Deutschland lebenden Migranten besaen 3.486.000 (47,5%) einen unbefristeten
Aufenthaltsstatus und 3.850.000 (52,5%) einen befristeten Aufenthaltstitel.
Abb. 10: Auslndische Bevlkerung in Deutschland nach Altersgruppe und
Geschlecht 2003; Quelle: Stat. Bundesamt; eigene Berechnung
Die trkisch-deutsche Vereinbarung ber die Anwerbung von Arbeitskrften wurde
am 31.Oktober 1961 geschlossen und gilt als Meilenstein in der deutsch-trkischen
Geschichte (Sen, 2004). Der Arbeitskrftemangel aufgrund des starken
Wirtschaftswachstums sollte durch die Anwerbung auslndischer Arbeitnehmer
entlastet werden. Obwohl durch die Fluchtbewegung aus der DDR viele
Arbeitskrfte kamen, war diese Anzahl jedoch nicht ausreichend. Aus der Sicht der
damaligen trkischen Militrregierung sollte durch eine befristete Emigration der
Arbeitsmarkt entlastet und Devisen ins Land gebracht werden. Durch das Know-
34
How der qualifizierten Rckkehrer erhoffte man sich die wirtschaftliche
Modernisierung in der Trkei zu frdern (vgl. Herbert, 2003). Ebenso sollten die
Emigrationsbemhungen einiger Brger so unter Kontrolle gebracht werden.
Die ersten 2100 trkischen Gastarbeiter kamen im November 1961 auf der
Grundlage des Anwerbeabkommens nach Deutschland.
Damit beginnt eine vierzigjhrige Migrationsgeschichte. Von 1955 bis 1973 wurden
Millionen Arbeitskrfte aus den Mittelmeerstaaten angeworben, die mageblich zum
so genannten Wirtschaftswunder beigetragen haben (Politik & Unterricht 2000).
Abb. 11: Entwicklung der auslndischen Bevlkerung Deutschlands seit 1961
Quelle: Stat. Bundesamt; eigene Berechnung
Die erste Generation angeworbener trkischer Arbeiter hatte ein verhltnismig
niedriges Ausbildungs- und Qualifikationsniveau, sie lebten zum grten Teil in von
den Betrieben zur Verfgung gestellten Gemeinschaftsunterknften. Sie hatten
minimale Anforderungen an ihren Lebensstandard, da sie den Groteil ihres
Verdienstes in die Trkei schicken wollten. Dieser Geldtransfer war enorm. Viele
trkische Arbeitnehmer hatten den Wunsch in die Heimat zurckzukehren und sich
dort eine Existenz aufzubauen, sie fhlten sich in der BRD als Fremde (Bade, 2004).
Der Mauerbau 1961 stoppte die Wanderung aus dem Osten und begnstigte den
raschen Zustrom trkischer Arbeitskrfte. Der 1973 vereinbarte Anwerbestopp
brachte eine Wende in der Migrationgeschichte, er sollte die Zahl der Auslnder in
der Bundesrepublik verringern. Wirtschaftliche Schwierigkeiten (Rezession 1967,
lkrise 1973) machten dies notwendig, dennoch riss der Strom der nach Deutschland
kommenden Auslnder nicht ab, denn die auslndischen Arbeitskrfte holten ihre
Familien nach. Die Rckkehr in die Trkei schien eine Rckkehr nach Deutschland
nicht mehr zu ermglichen, auerdem wurden strengere Regelungen zur
Familienzusammenfhrung erwartet. Der Auslnderanteil stieg bestndig weiter,
whrend sich der Anteil der Arbeitnehmer bei etwa einem Drittel festigte. Klaus J.
Bade und Jochen Oltmer (2004) beschreiben einen weiteren Wendepunkt durch den
35
zweiten Militrputsch 1980 in der Trkei. Nun kamen Trken und Kurden als
Asylbewerber in die BRD. Die achtziger Jahre werden als Phase der faktischen
Niederlassung verstanden.
Die groe Arbeitslosigkeit in der Trkei (Arbeitslosenquote 1983 ber 18%) und
brisante politische Lage waren dafr bedeutsam. Aufgrund der guten medizinischen
Versorgung sowie der besseren Schul- und Berufsausbildungs-Chancen blieben viele
trkische Arbeiter in Deutschland, die Aufenthaltsdauer stieg stetig an (Herbert
2003). Der Anwerbestopp wirkte also wie ein Bumerang in der Arbeitsmarkt- wie in
der Auslnderpolitik. Er verstrkte nmlich die herrschende Tendenz zu
Daueraufenthalt und Familiennachzug. (Bade/Oltmer). In Deutschland fand die
grte Zuwanderungswelle zwischen 1988 und 1993 statt. 7,3 Millionen Aussiedler,
Asylbewerber, Gastarbeiter und nachziehende Familienmitglieder kamen in
diesem Zeitraum nach Deutschland.
3.2.1 Wohnumfeld und Parallelgesellschaft
Faruk Sen vom Zentrum fr Trkeistudien (ZfT) schreibt 2001 in Integration oder
Abschottung?- zur Situation der trkischen Zuwanderer in Deutschland, dass die
Wohnsituation den Bleibeabsichten der trkischen Arbeitnehmer entspricht.
1992 besaen 1,7 Mio. Trken einen Anteil von 45.000 Immobilien in der BRD, aber
die Zahl wchst steigend. Fr 2004 stellt Sen fest, dass mittlerweile schon 163.000
trkeistmmige Haushalte Wohneigentum in Deutschland gebildet haben (Sen; Zft,
2005). Die trkischen Arbeitnehmer und ihre Kinder und Enkel erwerben zunehmend
Eigentum in Deutschland, in denen sie auch ihr Leben dauerhaft gestalten wollen.
Sie entwickeln eine groe Verbundenheit zu Deutschland und tragen so ihrerseits zur
Integration bei. Nach Cord Pagenstecher (1996) wohnten 1972 mehr als die Hlfte,
1980 mehr als 90,2 % der Migranten in einer Mietwohnung. Seit 1970 konzentrierte
sich die auslndische Wohnbevlkerung in bestimmten Quartieren, dieser
Konzentrationsprozess kam etwa ab 1980 zum Stillstand. Diese Segregation
erleichterte die Entstehung einer eigenen Infrastruktur.
Ab 1965 entstanden informelle Treffs und die ersten politischen, kulturellen und
religisen Immigrantenvereine. Dagegen wird heutzutage immer wieder das Wort
Parallelgesellschaft in die Diskussion gebracht. Gettoisierung und Abgrenzung
wird trkischen Migranten vorgeworfen. Es bildeten sich ethnische Infrastrukturen
bei der trkischen Minderheit. Die meisten Dinge des alltglichen sozialen Lebens
knnen in vielen Grostdten schon innerhalb der trkischen Gemeinschaft erledigt
werden (Sen, 2001). Es gibt Quartiere, die von trkischer Bevlkerung dominiert
werden, in solchen Gebieten ist die gesamte Infrastruktur im weiteren Sinne trkisch,
auf deutsche Dienstleistungen muss nicht mehr zurckgegriffen werden. Fr
nichtberufsttige Ehefrauen besteht oft keine Mglichkeit zum Kontakt mit der
deutschen Bevlkerung. Faruk Sen beschreibt, dass diese ethnischen Infrastrukturen
besonders dort erfolgreich sind, wo Angebote entweder gar nicht bestanden oder die
Integration in Strukturen der deutschen Gesellschaft als ungengend empfunden
wurde. Die Sorge besteht, dass diese ethnischen Selbstorganisationen in einer
eigendynamischen Entwicklung den Rckzug in die eigene Ethnie verstrken
knnten. Mittlerweile findet eine Abgrenzung auch in anderen gesellschaftlichen
36
Bereiche statt, zum Beispiel im Sport wird anhand der zunehmenden innerethnischen
Mannschaften deutlich, dass es einen Rckzug gegeben hat.
Das betrifft also auch Bereiche, denen traditionell ein groes Integrationspotenzial
zugeschrieben wurde (vgl. Sen).
Sen sieht dafr sowohl soziale als auch kulturelle Ursachen. Schwierigkeiten treten
in der Freizeitgestaltung durch Alkoholverbot fr Muslime (Koran; vgl.3.4) auf, aber
auch durch empfundene Benachteiligung trkischer Jugendlicher in deutschen
Vereinen durch deutsche Trainer.
Sport hat fr viele Jugendliche mit Migrationshintergrund eine groe Bedeutung, sie
kompensieren dort Benachteiligungen und knnen ebenso Anerkennung finden.
Diese Abgrenzung in sozialen Bereichen wirkt integrationshemmend, ist aber
durchaus verstndlich. In segregativen Quartieren sind deutsche Sprachkenntnisse fr
den Alltag nicht mehr unbedingt erforderlich, viele Migranten lernen aus diesem
Grund die deutsche Sprache nur noch unzureichend. Vorteile bieten sich bei
Gewohnheiten bezglich Essen und Kleidung, sie mssen auf kaum etwas aus der
Heimat verzichten. Fr die schulische Situation ist eine solche Segregation nicht von
Vorteil, da in den Schulklassen eine Mehrheit von trkischen Kindern zu finden ist.
Integration wird so erschwert (vgl. zu Schule 3.3.4). Von Wilamowitz-Moellendorff
zeigt bei Befragungen trkischstmmiger Brger auf, dass diese in der Freizeit
berwiegen innerethnische Kontakte haben und die deutsche Sprache weniger
verwenden (fr Trken mit deutscher Staatsangehrigkeit kommt er zu anderen
Ergebnisse vgl. 3.3.6 Sprache).
Er betont, dass dies nicht unbedingt auf Abschottungstendenzen hinweisen muss,
sondern auch ein Ergebnis der Wohn- und Lebenssituation sein kann. In Stadtteilen
in denen trkischstmmige Brger weitestgehend unter sich sind und sich stark auf
bestimmte Orte konzentrieren, laufen viele Berhrungen in der Freizeit
unvermeidlich im innerethnischen Umfeld ab. Im Sinne einer besseren Integration
wre aber eine Verstrkung der Kontakte zwischen Deutschen und Trken
wnschenswert (Von Wilamowitz-Moellendorff, 2002). Das Projekt des Institutes
fr Soziologie und der Fachhochschule fr Soziale Arbeit in Basel ber Jugend und
Gewalt 2001, kommt nach der Auswertung von 260 Dossiers delinquenter
Jugendlicher, Befragungen, Datenanalyse und deren Auswertungen zu folgendem
Ergebnis. Bezglich Wohnort und Delinquenz ergab sich ein wesentlicher
Zusammenhang, Wohn-Ort und -Art prgen die Entwicklung der jungen Menschen
besonders. Projektleiter Ueli Mder und Matthias Drilling gliedern die Stadt
aufgrund Wohnungsrelevanter statistischer Daten in vier Stadtteiltypen auf.
Gentrifiziete Altstadt (billige Bewohner durch noblere ersetzt),
Innerstdtische durchmischte mittelstndische Quartiere,
Grnderzeitliche Arbeiterquartieren und
Vorstdtische, gut situierte Wohnquartiere.
Fr diese Studie ergab sich, dass der Grossteil (45%) der Delinquenten aus den
grnderzeitliche Arbeiterquartieren kamen. Diese Stadtteile zeichnen sich durch
einen hohen Auslnderanteil, kleine Wohnungen und eine hohe Bevlkerungsdichte
aus. Auch bei physischer Gewalt liegen diese Stadtteile an der Spitze der
Auswertungen.
37
3.2.2 Berufliche und wirtschaftliche Situation der trkischen
Bevlkerung
Das Zentrum fr Trkeistudien kommt in zahlreichen Untersuchungen zu der
Feststellung, dass Trken es schwerer haben als Deutsche sich in den Arbeitsmarkt
einzugliedern. Auch bei gleichen Qualifikationen wie ihre Mitbewerber, beklagen
viele eine Diskriminierung zu ihren Ungunsten. Bei den jungen trkischstmmigen
Menschen zeichnet sich eine langsame positive Entwicklung ab. Nur eine geringe
Zahl der trkischstmmigen Menschen in Deutschland, sind als Beamte oder
Selbstndige in freien Berufen ttig (vgl. ZfT). Viele Unternehmen haben sich auf
ihre multikulturellen Arbeitnehmer eingestellt. Von einer gleichwertigen Stellung der
trkischstmmigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, am Arbeitsmarkt, kann
dagegen nicht gesprochen werden. Aufgrund mangelnder Qualifikationen vieler
trkischer Arbeitnehmer, aber auch an dem diskriminierenden Verhalten vieler
Arbeitgeber, scheitern hier die Bemhungen (vgl. 3.3.5) Die Kinder, der damals noch
ungelernten niedrig qualifizierten Arbeiter, haben mittlerweile besser qualifizierte
Arbeitspltze eingenommen und ihre berufliche Qualifikation verbessert sich
fortschreitend. Dennoch sind hier Marginalisierungen deutlich erkennbar.
Nach den Untersuchungen des ZfT kommen die Trken zu einer positiven
Eigeneinschtzung ihrer wirtschaftlichen Lage. Dennoch stellen sie einen
berproportional hohen Anteil an den Arbeitslosen. 2004 waren ca. 538.139
Auslnder in Deutschland ohne Job. 80% der Arbeitslosen (430.500) waren aus dem
EU-Ausland, hiervon wiederum stellten die Trken 40% (172.200). Die
Arbeitslosenquote fr alle nichtdeutschen Arbeitssuchenden betrgt 20,1%, wobei
die Arbeitslosenquote insgesamt fr Deutschland bei 11,7% liegt (Statistisches
Bundesamt; Bundesagentur fr Arbeit). Der trkischen Bevlkerung steht auerdem
ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen im Vergleich zu deutschen Familien zur
Verfgung, da die Familien grer sind, das Einkommen aber geringer. Ein Ergebnis
der Studie des Instituts Arbeit und Technik (IAT) in Gelsenkirchen stellt eine
Verschlechterung der beruflichen Situation der Migranten fest, besonders im
Vergleich der Arbeitslosenquoten und dort wiederum besonders bei den jungen
Menschen (vgl. www.iatge.de).
Studien belegen dennoch, dass Arbeitsmigranten der ersten Generation sich besser
sich mit strukturellen Benachteiligungen arrangieren als Deutsche, aber auch besser
als ihre Kinder und Enkel. Bei dieser Gruppe besteht sogar eine hhere
Gesetzestreue, sie reagieren im Vergleich zu Deutschen mit vergleichbarem
Sozialprofil seltener mit deviantem oder delinquentem Verhalten.
Arbeitswissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass obwohl von dieser Gruppe
berproportional hufig in belastenden und gefhrlichen Positionen gearbeitet wird,
und sie ungleich hufiger von Arbeitslosigkeit bedroht sind als Deutsche, sie mit
ihrer Arbeit genauso zufrieden sind wie ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen
(vgl. Geiler 1996). Fr strukturelle und andere benachteiligende Faktoren scheint
die erste Generation der Arbeitsmigranten Kompensationsmglichkeiten gefunden zu
haben, die fr ihre Kinder und Enkel nicht mehr zu gebrauchen sind. In welcher
Form und welche Ursachen dies haben kann, wird im nchsten Punkt ausfhrlich
behandelt.
38
3.3 Mgliche Faktoren von Devianz und Delinquenz trkischstmmiger
junger Menschen
Die hhere Kriminalittsbelastung von jungen Auslndern im Hell- wie im
Dunkelfeld und die Zusammenhnge, die sich mit ihrer individuellen,
kulturellen und sozialen Situation nachweisen oder zumindest begrndet
vermuten lassen, besttigen die Bedeutung von Lebenslagen fr ihre
Delinquenz (Deutschen Polizeiblatt, 5/2000).
Hinsichtlich der Ursachen soll also hierbei zwischen sozialisations- und
migrationsbedingten sowie kulturellen, institutionellen und gesellschaftlichen
Faktoren unterschieden werden.
3.3.1 Sozialisationsbedingte Faktoren der Entstehung von Delinquenz
Die jungen Menschen mit Migrationshintergrund sehen sich in einem
Widerspruchszustand, sie orientieren sich an den unterschiedlichen Normen in
Familie, Schule und Gleichaltrigengruppe und finden dort eine Ambivalenz vor
(Yildrim, 2001). Die von Sellin formulierte Kulturkonflikttheorie findet fr die
trkischstmmigen Jugendlichen und Heranwachsenden durchaus ihre Berechtigung
(vgl.2.5.2). In den Familien entstehen Funktionsverluste, es gibt eine Vielzahl von
Kommunikationsproblemen und Entfremdungsprozessen zwischen Eltern und
Kindern. Viele blicken auf Gewalterfahrungen in ihrer Erziehung zurck.
Der Direktor des Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN)
Christian Pfeiffer stellt in einer durchgefhrten Schlerbefragung fest, dass eine
Vielzahl Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft Gewalt als einzige Strategie zur
Lsung ihrer Konflikte wahrnimmt. Oft fehlte in ihrem Sozialisationsumfeld eine
Anleitung andere Verhaltensstrategien zu erlernen.
Im Rahmen der KFN-Schlerbefragung wurden im Jahre 1998 insgesamt 16.190
Jugendliche aus neun verschiedenen Stdten befragt. Diese Jugendlichen besuchten
die neunte bzw. zehnte Jahrgangsstufe einer allgemein bildenden Schule.
Trkische Jugendliche sind nach dieser Befragung sehr viel hufiger von schwerer
elterlicher Gewalt in der Kindheit und im Jugendalter betroffen als deutsche
Jugendliche. Auch die von den Jugendlichen beobachtete elterliche Partnergewalt
tritt bei dieser Gruppe hervor.
Bei den Antworten zur Erfahrung mit schwerer elterlicher Gewalt im letzten Jahr
standen die trkischen Jugendlichen an vorrangiger Stelle, fast jeder Fnfte von
ihnen hat im Laufe des letzten Jahres zu Hause Misshandlungen erfahren. Bei den
jungen Deutschen berichtet nur jeder achtzehnte von Misshandlungen durch seine
Eltern.
39
Abb. 12: Jugendliche Opfer schwerer Gewalt in verschiedenen ethnischen Gruppen;
Quelle: Eigene Berechnung nach dem KFN- Forschungsbericht
Jeder dritte trkische Jugendliche berichtete davon Partnergewalt (Eltern) im letzten
Jahr beobachtet zu haben, dem gegenber steht nur jeder elfte Deutsche.
Diese Unterschiede blieben weitgehend bestehen, wenn die Faktoren
Arbeitslosigkeit/Sozialhilfe ebenfalls einbezogen und kontrolliert wurden, das heit
nur solche Familien verglichen werden, die derselben sozialen Gruppe angehren.
Abb. 13: Beobachtete Partnergewalt (Eltern) nach ethnischer Herkunft;
Quelle: Eigene Berechnungen nach KFN- Forschungsbericht
40
Pfeiffer schliet daraus, dass die hohe Rate der innerfamiliren Gewalt in trkischen
Familien nicht primr mit ihrer sozialen Lage erklrt werden kann. Er betont die
erhhten Raten beobachteter elterlicher Partnergewalt auch bei Jugendlichen, deren
Familie aus der Trkei immigriert sind, aber mittlerweile die deutsche Nationalitt
haben (Eingebrgerte). Hier findet sich ein deutlicher Unterschied zu den
eingebrgerten Jugendlichen aus anderen Lndern.
Nach den Befunden aus der Schlerbefragung gilt generell, dass Kinder, die
Gewalterfahrungen gemacht haben, eine eineinhalb- bis dreimal hheres Risiko
haben, selber zu Gewaltttern zu werden als nicht geschlagene Kinder. Je hher die
Intensitt und die Dauer der erlittenen Gewalt ausfallen, umso hher wchst die
jeweilige Gewaltrate bei den Kindern und Jugendlichen. Wenn die Jugendlichen
zustzlich Gewalt der Eltern untereinander beobachtet haben, steigert sich dies
wiederum.
Einen geschlechtsspezifischen Aspekt der Sozialisation Jugendlicher bringen
Pfeiffers Befragungen ebenfalls zu Tage. Mnnliche Jugendliche, die zu Hause oder
im Freundeskreis von ihren Gewalttaten gegenber anderen Jugendlichen berichten,
werden hierfr weit seltener als Mdchen bestraft bzw. abgelehnt und erheblich
hufiger gelobt. Und auch dieser Einflussfaktor ist bei trkischen Jugendlichen
deutlicher ausgeprgt als bei den Jugendlichen aus anderen ethnischen Gruppen (vgl.
Pfeiffer, 1999). Die Studie macht deutlich, dass innerfamilire Sozialisations-
erfahrungen, hier speziell die Gewalt gegen Kinder und deren Beobachtung
gewaltfrmiger Konfliktaustragung von bedeutsamen primren Bezugspersonen,
ber soziale Lernprozesse dazu beitragen eine Risikogruppe zu erzeugen (Pfeiffer).
Assmann/Nuschenpickel besttigen dies in ihren Fallanalysen delinquenter
Jugendlicher. Abweichende Strukturen innerhalb der Familie gegenber den
Anforderungen in Schule, Beruf und Freizeit sind primr Grnde fr Devianz. Durch
die Dominanz der Vter entsteht fr mnnliche Jugendliche ein problematisches
Rollenvorbild (KFN). Eins der wesentlichen Probleme innerhalb der trkischen
Familien ist der Erziehungsstil der Vter, der teilweise nur drftig auf die
Anforderungen der Gesellschaft vorbereitet.
3.3.2 Migrationsbedingte Faktoren der Entstehung von Delinquenz
Die migrationsbedingten Vernderungen und die vielfltigen Anforderungen, die
Schule, berufliche Bildung und Arbeitswelt an die Jugendlichen stellen, knnen
offenbar von vielen trkischen Familien nicht kommunikativ bearbeitet werden. Eine
groe Rolle spielt dafr die Illusion der Rckkehr (Pagenstecher, 1996).
In der Elterngeneration fehlen kulturelle Kompetenzen. Vor allem die Rckkehr-
Orientierung der Eltern und das wiederholte Pendeln der Jugendlichen zwischen der
Trkei und Deutschland haben zur Folge, dass die Eltern ihren Kindern keine klare
Zukunftsperspektive vermitteln knnen.
Die laufende ungeplante Verlngerung des Aufenthalts machte das Leben in
Deutschland zu einem dauerhaften Provisorium. Anstatt dem Ziel der
Rckkehr nher zu kommen scheint es stets gleich weit entfernt zu bleiben,
der Zeithorizont verschwimmt immer mehr (Pagenstecher, 1996).
41
Elke Korte (1990) beschreibt die Rckkehr-Orientierung als ein Familienprojekt, das
den Familienzusammenhalt strkt. In vielen Migrantenfamilien findet ber die
Rckkehrplanungen eine gemeinsame Zukunftsentwicklung statt. Die daraus
entstehenden Konflikte innerhalb der Familien drfen dennoch nicht bersehen
werden. Eltern, die sich Kindern gegenbersehen, welche diese Zukunftsplne nicht
mehr teilen wollen, sehen sich in einer existenzbedrohenden Lage. Sie greifen nicht
selten zu Lsungen, wie Zwangsheirat oder auch sie in die Trkei zurckzuschicken.
Eine endgltige Abnabelung der Kinder kann so mglicherweise aufgeschoben oder
verhindert werden. Nach Korte beinhaltet das Rckkehrziel auch die traditionelle
Verpflichtung der Kinder, ihre Eltern zu achten und zu versorgen, diese droht beim
Daueraufenthalt in Deutschland verloren zu gehen.
Fr viele Jugendlichen bedeutet das, dass sie ihre eigene Lebensplanung ohne die
Hilfe der Eltern entwerfen mssen. Im Falle einer Familienideologie, die auf der
Rckkehr basiert, sind Gesprche gegebenenfalls sogar gar nicht mglich. Peter Loos
beschreibt, dass in vielen dieser Flle an die Stelle der Familie die peer-group
(Gruppe der Gleichaltrigen) tritt.
Der Jugendliche versucht, sich eine eigene Geschichte, Biographie zu geben,
deren Kontinuitt nicht durch die Migration bedingt zerrissen ist (Loos, 2000).
Solche Situationen, in die die Jugendlichen sich verwickeln, Situationen, die
gewissermaen ihre eigene Geschichte generieren, werden nach Loos besonders
gesucht.
3.3.3 Soziokulturelle Merkmale der Entstehung von Delinquenz
Merkmale, welche die soziale Gruppe der Trken und ihr Wertesystem betreffen,
sind besonders Begriffe wie Ehre, Achtung und Ansehen. Das sind Anforderungen,
die an das Handeln der jungen Menschen gestellt werden.
Yzim Yildirim hat hervorgehoben, dass ein traditionell erzogener trkischer
Jugendlicher auch verantwortlich fr seine Familie ist. Sieht diese sich einer
Bedrohung entgegen, ist er verpflichtet alles, was in seiner Macht steht zu tun, um
diese bedingungslos zu schtzen. Eine auerordentliche Schande wre es, wenn er
sich dieser Verantwortung entziehen wrde. Ein Nichtbeachten dieses Kodexes,
aufgrund von zum Beispiel Bagatellen oder Unrecht, wrde die Ehre stark verletzen.
Frank Gesemann verweist in einer Analyse zur Kriminalitt nichtdeutscher
Jugendlicher in Berlin in Bezug auf diese Anforderungen auf die ethnographische
Studie Turkish Power Boys von Hermann Tertilt. Dort hat sich gezeigt, dass das
Konzept der Ehre in der Jugendbande eine bedeutende Rolle spielt.
Fr die Gruppenstruktur und die Entwicklung der erstrebten maskulinen
Charakterzge wie Unerschrockenheit, Aggressions- und Gewaltbereitschaft oder
verbale und krperliche Durchsetzungskraft scheint dies elementar zu sein.
Er stellt das stark entwickelte Mnnlichkeitsbewusstsein der Jugendlichen in Bezug
zu fehlender sozialen Besttigung und einem beschdigten Selbstbild. Delinquenz
wird als Reaktion auf eine gesellschaftliche Situation verstanden, in der die
Jugendlichen ihre Ethnizitt und Klassenzugehrigkeit vorwiegend durch
Ausgrenzung, Geringschtzung und Missachtung erleben (Gesemann, 2000).
42
Die Familie spielt fr trkische Jugendliche eine groe Rolle, die konservativen
Rollenstrukturen sind aufgrund der vernderten kulturellen und strukturellen
Rahmenbedingungen in einem Wechsel begriffen. Die traditionelle Familie, geprgt
durch eine patriarchalische Struktur, wird in Deutschland in Frage gestellt (vgl.
Mller, 1998). Diese Infragestellung der (traditionellen) Autoritt des Mannes in der
Familie ist durch die Berufsttigkeit der Frau bedingt. Ebenfalls trgt schlecht
bezahlte und wenig anerkannte Arbeit des Vaters zum Imageverlust bei.
Durch das Erlernen der Sprache der Aufnahmegesellschaft fhlt sich das Kind den
Eltern gegenber berlegen. Eine weitere Verunsicherung erfahren die Vter durch
die schnellere Anpassung ihrer Kinder an die Kultur der Aufnahmegesellschaft.
So wird der Kulturkonflikt in die Familie hineingetragen und verschrft den
Generationenkonflikt.
Fr die Erziehung sind vornehmlich die Mtter zustndig, allerdings offenbart sich
auch hier ein Konflikt. Denn zu den zu vermittelnden gewnschten trkischen
Wertorientierungen und Verhaltensmustern bestehen in der deutschen
gesellschaftlichen Realitt oft zu wenige Bezge. Die Werte knnen seitens der
Jugendlichen zu inhaltlosen Ideologien werden (Mller, 1998).
Heitmeyer zeigt (vgl. Abb.13) welche vielfltigen Konflikte trkischstmmige junge
Menschen mit ihren Eltern haben, sowohl spezielle als auch jugendtypische Eltern-
Kind-Konflikte. Auf die Frage: Haben die folgenden Punkte hufig, gelegentlich
oder nie zu Auseinandersetzungen mit Ihren Eltern gefhrt?, haben die Kinder und
Jugendlichen wie folgt geantwortet:
Abb. 14: Auseinandersetzungen mit den Eltern;
Quelle: Eigene Berechnung nach Untersuchungsbericht, Heitmeyer, 1997
In diesem Zwiespalt solidarisiert sich der Jugendliche mit Schicksalsgenossen, um
den aus den Widersprchen erwachsenden Rollenkonflikt zu bewltigen. Das in
seiner Erfllung behinderte Bedrfnis nach Kommunikation und Anerkennung beim
Jugendlichen fhrt zu Identittsdiffusion (Erikson, 1973).
43
3.3.4 Institutionelle Faktoren
Kindertageseinrichtungen, Schulen und das berufliche Bildungssystem sind die
elementaren institutionellen Faktoren. Der schulischen und beruflichen Ausbildung
fllt eine zentrale Rolle fr Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu,
sowohl fr ihre Chancen in der Gesellschaft als auch fr ihre berufliche und soziale
Integration. Die Bildungsabschlsse stellen einen bedeutsamen Zugang in die
Gesellschaft dar. Die Bildung hat fr ihre Lebensperspektiven eine herausragende
Bedeutung und ermglicht ihnen in der Aufnahmegesellschaft eine gesellschaftlich
anerkannte Position einzunehmen (Kristen, 2003).
Die Schulen bieten durch die Spracherziehung und das Zusammenbringen der
ethnisch unterschiedlichen Kinder eines Alters wichtige Mglichkeiten der
Integration. Die Mglichkeiten der Schule und die an sie gerichteten Anforderungen
unterliegen aber immer fter einer Widersprchlichkeit. Im deutschen
Bildungswesen werden mit Blick auf die erzielten Bildungsabschlsse ethnische
Unterschiede und eine Benachteiligung der Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund den deutschen gegenber deutlich. Migrantenkinder erreichen
niedrigere Bildungsabschlsse als gleichaltrige deutsche Kinder. Sie besuchen
hufiger die Hauptschule, whrend sie in den hheren Bildungsgngen wie der
Realschule oder dem Gymnasium unterreprsentiert sind (vgl. Abb. 14).
Abb.15: Auslnderanteil im Schuljahr 2002/2003 nach ausgewhlten Schularten;
Quelle: Eigene Berechnung nach Daten des Statistischen Bundesamtes
Im Schuljahr 2002/2003 haben in Deutschland rund 961.000 Kinder und Jugendliche
mit einem auslndischen Pass allgemein bildende Schulen besucht (10% aller
Schlerinnen und Schler). Knapp 44% der auslndischen Schlerinnen und Schler
besaen die trkische Staatsangehrigkeit. Whrend von den Schlerinnen und
Schlern in Gymnasien 3,9% einen auslndischen Pass besaen waren es in
Hauptschulen 18,2%. In Integrierten Gesamtschulen lag der Auslnderanteil bei
44
knapp 13%, in Sonderschulen bei 16%. Diesem Bild entsprechend erreichten die
auslndischen Jugendlichen ein deutlich niedrigeres Abschlussniveau als ihre
deutschen Mitschlerinnen und Mitschler. Von den auslndischen Absolventinnen
und Absolventen verlieen knapp 20% die allgemein bildenden Schulen ohne
Abschluss gegenber 8% der deutschen. 11% der auslndischen Jugendlichen
erwarben die Hochschul- bzw. Fachhochschulreife, bei den deutschen waren es gut
26% (Statistisches Bundesamt, 2003).
Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen ethnischen Gruppen im Ausma der
Benachteiligung, wobei trkische und italienische Kinder und Jugendliche die
schlechtesten Positionen im Bildungs- und Berufssystem besetzen, whrend andere
Gruppen, wie beispielsweise Griechen und Spanier, besser abschneiden. Diese Werte
verdeutlichen, dass auslndische Schler und besonders Trken im deutschen
Bildungssystem benachteiligt sind. In vielen Fllen haben Kinder mit
Migrationshintergrund die deutsche Sprache im Vorschulalter noch nicht ausreichend
erlernt und sehen sich in der Schule vielen Schwierigkeiten gegenber. Ein eventuell
mehrmaliges Wiederholen der Klasse macht sie nun aufgrund des Alters erneut zu
Auenseitern.
Abb.16: Deutsche und auslndische Absolventen und Absolventinnen nach
Abschlussart 2002; Quelle: Eigene Berechnung nach Datenreport 2004
Cornelia Kirsten beschreibt 2003, dass Migrantenfamilien durchschnittlich
besonderen Restriktionen unterworfen sind, da es ihnen hufig an erforderlichen
Ressourcen fehle, um den Bildungserfolg ihrer Kinder effektiv zu untersttzen.
Fortwhrende Hilfe bei den Hausaufgaben oder der Vorbereitung auf
Klassenarbeiten, die zu einer Frderung des Schulerfolges beitragen, kann bei vielen
Migrantenfamilien nicht geleistet werden. Besonders unzureichend fallen diese
Hilfen aus, wenn die Deutsch-Kenntnisse der Eltern nur ungengend sind. Schon in
den Grundschulen sind die ethnischen Gruppen ungleich verteilt, es bildet sich
vielerorts eine Konzentration der nichtdeutschen Kinder auf bestimmte Schulen. Ein
45
hohes Ausma an ethnischer Schulsegregation ist zunchst mit Blick auf die
Integrationschancen von Migrantenkindern unerwnscht (Kirsten, 2003). Diese
Konzentration sei integrationshemmend, da die Kinder so nur bedingt mit
einheimischen Kindern Kontakt aufbauen knnen und dies wesentlich fr den
Spracherwerb sei. Kontakte zu deutschen Kindern sind nach Kirsten elementar, da
sie auch auerhalb der Schule einen Spracherwerb ermglichen. Empirische Studien
belegen, dass insbesondere die Art der ethnischen und schichtspezifischen
Zusammensetzung in den Schulen fr die Bildungschancen der Kinder von
Bedeutung sei und unterschiedliche Ausgangsbedingungen schafft. Kirsten betont,
dass eine hohe Migrantenkonzentration das Leistungsniveau herab setzt und damit
die Wahrscheinlichkeit des Einzelnen senkt, auf eine Realschule oder ein
Gymnasium gehen zu knnen. Sie sieht eine mehrfache Marginalisierung der
Migrantenkinder vorliegen, sowohl durch die mangelnde Ressourcenausstattung (ein
Nachteil auch gegenber der Mehrheitsgesellschaft) als auch durch den Besuch von
Grundschulen mit geringerem Leistungsniveau.
Die Mehrzahl der auslndischen Schler und Schlerinnen sind in Deutschland
geboren und haben einen Kindergarten oder die Vorschule besucht. Dennoch lassen
sich deutliche Differenzen zu deutschen Schler und Schlerinnen hinsichtlich der
Art der besuchten Schule (ab der Sekundarstufe I) erkennen. Der erste
Bildungsbergang von der Grundschule in die verschiedenen weiterfhrenden
Schulformen spielt nach Kirsten eine Schlsselrolle, denn hier werden bedeutsame
Weichen fr die Zukunft gelegt.
Die Entscheidungen bezglich der Schulform sind richtungweisend fr sptere
Bildungswege oder berufliche Chancen und sind weitestgehend bindend.
Migrantenkinder besuchen ungleich hufiger als deutsche Kinder im Anschluss an
die Grundschule eine Hauptschule und haben nur eine geringe bergangsrate zu
Gymnasien, das gilt besonders fr trkische und italienische Kinder. Auch bei den
Schulnoten zeigen sich hier Parallelen. Migrantenkinder zeigen in Mathematik
bessere Leistungen als in Deutsch, allerdings sind einheimische Kinder in beiden
Disziplinen besser. Das typische Muster im Abschneiden der verschiedenen
Nationalittengruppen bleibt auch hier bestehen, trkische und italienische Kinder
schneiden am schlechtesten ab. Diese Angaben besttigten sich unter anderen in der
PISA-Studie (Programme for International Student Assessment). Kinder mit
Migrationshintergrund haben in allen getesteten Kompetenzbereichen schlechtere
Ergebnisse erzielt als einheimische Kinder. Es gab jedoch ein groes
Leistungsgeflle zwischen den Gruppen, auch innerhalb der Lnder und zwischen
den Kompetenzbereichen. Fr Westdeutschland und die dort lebenden Kinder mit
Migrationshintergrund hngt das Leistungsniveau betrchtlich vom Sprach-
hintergrund, der Verweildauer, den Sprachgepflogenheiten und der Sozialschicht der
Familie ab. Die schulische Frderung spielt ebenfalls eine entscheidene Rolle
(Stanat, Petra u.a., 2002). Die OECD (organisation for economic co-operation and
development) unterscheidet in ihren Erhebungen zwischen drei Gruppen: den native
students (Muttersprache Deutsch), den first-generation students (in BRD geboren,
jedoch Eltern Migranten) und den non-native students (selbst im Ausland geboren
worden, erst spter nach Deutschland immigriert).
46
Abb. 17: Leistungsvergleich nach der zu Hause gesprochenen Sprache;
Quelle: Eigene Berechnung nach OECD 2001
Die Zahlen verdeutlichen, dass die Migrationsbiographie eine bedeutsame Rolle fr
die schulische Platzierung der Jugendlichen spielt.
In keinem anderen Land ist der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren
Leistungsniveau so gro wie in Deutschland. Dies ist fr die Bildungsforscher ein
Nachweis fr ein hohes Ma an Ungleichheit im Bildungssystem. Die Kinder, die in
Deutschland geboren wurden und deren Muttersprache deutsch ist, bringen in allen
drei Leistungsbereichen bessere Ergebnisse als die first-generation students oder
non-native students. Deutlich wird hier welchen gravierenden Einfluss der
Migrationshintergrund hat.
Im internationalen Vergleich sieht Deutschland aufgrund des hervorstechenden
Unterschiedes zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und einheimischen
Jugendlichen schlecht ab, hier liegt die BRD weit ber dem OECD-Schnitt.
Die Studie verdeutlicht weiterhin, welcher groen Bedeutung es zukommt, welche
Sprache auerhalb der Schule gesprochen wird. Auch hier liegt die BRD unter dem
Schnitt. Kirsten fhrt die unterdurchschnittlichen Ergebnisse unter anderem auf die
mangelhafte Integration der Schlerpopulation mit Migrationshintergrund zurck.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt der schulischen Situation der Migrantenkinder
nennt Kirsten im Wissen ber das Bildungssystem. Dies stellt eine bedeutsame
Ressource fr den Schulerfolg der Kinder dar. Ein geplantes und geschicktes
Verhalten kann aufgrund von Wissen um unterschiedliche Gesichtspunkte des
schulischen Lebens eine groe Hilfe fr den Bildungserfolg sein. Die Eltern, die
eigene Erfahrungen mit den Bildungsapparaten und Mechanismen hatten, knnen
diese besser einschtzen und zugunsten ihrer Kinder agieren.
Fr Migrantenfamilien, fr die gegebenenfalls das deutsche Bildungssystem fremd
ist, besteht eine groe Benachteiligung, da ein strategisch effektives Verhalten
erschwert ist (vgl. Kirsten, 2003).
47
Die 6. Empfehlung der Bildungskommission der Heinrich-Bll-Stiftung zu Schule
und Migration (2004) kommt zu der Empfehlung, dass eine Vernderung des
deutschen Schulsystems, die Heterogenitt von SchlerInnen akzeptiert und die
Frderung von Kindern vor die Segregation stellt, hier deutlich verbessernd wirken
knnte.
Die Karriere der strafbaren Handlungen der Kinder geht fast immer mit
gravierendem Schulversagen einher. Leistungen werden verweigert und das
aggressive Verhalten fhrt bis zu Devianz. Die Schulen werden mit diesem
Problem oft nicht fertig und meinen es mit einem Schulausschluss lsen zu
knnen. Tatschlich wird die Schule von den Kindern oft nicht als das System
erlebt, das untersttzt und weiterhilft, sondern als eines, das zustzlich unter
Druck setzt und ausgrenzt (Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitts-
prvention, 1999).
Aufgrund der marginalen Schulsituation zeichnet sich im Hochschulbereich eine
hnliche Situation ab. Das deutsche Bildungssystem ermglicht sehr wohl einer
groen Zahl an nichtdeutschen Studenten einen Hochschulabschluss zu erwerben.
Jedoch ist festzustellen, dass der Groteil der nichtdeutschen Studenten sich
ausschlielich fr diese Studienzwecke in Deutschland aufhlt. Zu unterscheiden
sind demnach zwei Kategorien von auslndischen Studierenden. Zum einen die so
genannten Bildungsinlnder, die ber eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung
verfgen, zu einem groen Teil in Deutschland geboren sind, aber nicht die deutsche
Staatsangehrigkeit besitzen. Zum anderen die so genannten Bildungsauslnder, die
ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben und zum Zwecke
des Studiums nach Deutschland einreisen. Deren Anteil lag bis zum Wintersemester
2000/2001 relativ konstant bei etwa zwei Drittel an allen Studierenden mit
auslndischer Staatsangehrigkeit, nahm seitdem aber kontinuierlich zu und lag im
Wintersemester 2003/2004 bei ber 73%. An den deutschen Hochschulen waren im
Wintersemester 2002/2003 mehr als 1.930.000 Studierende eingeschrieben, darunter
waren 227.000 (11%) junge Menschen mit einer auslndischen Staatsangehrigkeit.
Bei den Studienanfngerinnen und Studienanfngern hatten im selben Semester 16%
einen auslndischen Pass. Ein Jahr zuvor waren es nur 206.000 auslndische
Studierende, davon waren 30% Bildungsinlnder. Die meisten auslndischen
Studierenden an den Hochschulen in Deutschland stammten im Wintersemester
2001/2002 aus europischen Lndern (knapp 130.000), wobei hier die Nicht-EU-
Lnder dominierten (ber 80.000) (vgl. Statistisches Bundesamt, 2004).
Im Wintersemester 2003/2004 betrug der Anteil der Bildungsauslnder an den
auslndischen Studienanfngern sogar mehr als vier Fnftel (84,8%) aller
Studierenden mit auslndischer Staatsangehrigkeit (Migrationsbericht, 2004).
48
Abb. 18: Auslndische Studierende an deutschen Hochschulen im jeweiligen
Wintersemester; Quelle: Eigene Berechnung nach Angaben vom Statist. Bundesamt
3.3.5 Ungleiche Ausbildungschancen
Das duale System ist ein wesentlicher Grund des hohen Ausbildungsniveaus in
Deutschland. Die schulische Ausbildung wird mit der am Arbeitsplatz vereinigt und
ermglicht sowohl den jungen Menschen den angenehmen Wechsel von der Schule
in das Berufsleben als auch den Unternehmen eine Angleichung der Ausbildung an
die sich rasch wandelnden Anforderungen. Die Ausbildungssituation junger
Menschen mit Migrationshintergrund ist auch heute noch nicht optimal, sie haben am
dualen Ausbildungssystem bisher nur begrenzt teilgenommen.
Die ethnischen Unterschiede im Schulsystem setzen sich beim bergang in das
Ausbildungssystem und in den Arbeitsmarkt fort. Hier bedingen wiederum
verschiedenste Ursachen die Marginalisierung. Herold (2002) benennt als Ursachen
die Unwissenheit der Eltern ber die Bedeutung der beruflichen Ausbildung fr die
Arbeitsmarktchancen, das traditionelle Rollenverstndnis auslndischer Mdchen
sowie schulische und sprachliche Defizite. Die Bereitschaft von Betrieben junge
Migranten auszubilden ist ebenfalls nicht ausreichend (Hernold, 2002).
49
Abb. 19: Anteil der Auslndischen Auszubildenden in Deutschland; Quelle: Eigene
Berechnung, Datenreport 2004
Auch die Stiftung Zentrum fr Trkeistudien sieht die Ursachen in diesen Punkten
und nennt zusammenfassend:
Ungengende Informationen ber die Vielfalt an Ausbildungsberufen und
ber das Ausbildungssystem
Arbeitsmarktdiskriminierung
Hohe Erwartungen an trkische Jugendliche zur kulturellen
Anpassungsbereitschaft
Konfessionelle Bindung in diversen Ausbildungsberufe, z.B. im sozialen
Bereich, die Muslimen nicht zu Verfgungen stehen
Das Zentrum fr Trkeistudien sieht die Diskriminierung seitens der Ausbildungs-
betriebe in deren Mutmaungen einer geringen Einbindung der Jugendlichen in
soziale Netzwerke und andere soziale Merkmale begrndet. Anderseits bei der
Angst vor kulturellen Schwierigkeiten und Unwissenheit ber die deutsche Kultur
seitens der Jugendlichen. Besonders trkische Jugendliche seien betroffen, da sie
vielfach als fremd eingestuft werden. Die Ausbildungsbeteiligung der jungen
Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu den gleichaltrigen
Einheimischen ist sehr gering. Von den 1,6 Mio. Auszubildenden in einer dualen
Berufsausbildung waren im Jahr 2002 nur etwa 5% (85.200) nichtdeutsche
Auszubildende. 2003 waren 11% (4.000) der 35.000 Jugendlichen ohne
Ausbildungsplatz nichtdeutsche und darunter 2.000 trkischstmmige Jugendliche.
Im Vergleich zum Auslnderanteil an den Absolventinnen und Absolventen der
allgemein bildenden Schulen von 8% sind auslndische Jugendliche in der dualen
Berufsausbildung unterreprsentiert (vgl. Statistisches Bundesamt, 2003).
50
Abb. 20: Auslndische Auszubildende nach Nationalitt 2002;
Quelle: Eigene Berechnung, Datenreport 2004
Auslndische Auszubildende konzentrierten sich sehr stark auf wenige Berufe sowie
auf wenig zukunftsweisende Branchen. Demzufolge finden sich jungen Menschen
mit Migrationshintergrund auch in den ungnstigeren beruflichen Stellungen. Im
Vergleich zu den jungen Deutschen verrichten trkische Jugendliche hufiger un-
und angelernte Ttigkeiten und haben einen geringeren Lohn (Seifert 1992).
Abb. 21: Die am strksten besetzten Ausbildungsberufe Nichtdeutscher 2003;
Quelle: Eigene Berechnung, Datenreport 2004
51
Ausbildungen werden fter abgebrochen und sie erleben eine hhere
Arbeitslosigkeit. In Bezug auf diese Daten muss darauf hingewiesen werden, dass
auch hier eine Statistische Aussagekraft immer geringer wird und genaue Angaben
nicht zu machen sind. Dennoch lsst sich auch hier eine Marginalisierung der jungen
Trken und Trkinnen feststellen, die sich anhand des knappen
Ausbildungsplatzangebotes noch zu verschrfen droht.
Cornelia Kirsten fasst in Bildungsentscheidungen und Bildungsungleichheit (1999)
fr die Bildungssituation der Migrantenkinder Folgendes zusammen:
Migrantenkinder schlagen die ungnstigeren Bildungswege ein. An Haupt-
schulen sind sie ber- und an hheren Bildungsgngen unterreprsentiert.
Rund 20% der nichtdeutschen Kinder verlassen jedes Jahr das Schulsystem
ohne Schulabschluss. Ebenfalls sind sie an Sonderschulen und Schulen fr
Lernbehinderte berreprsentiert
Die Benachteiligung setzt sich beim Wechsel in das Ausbildungssystem fort.
Auslndische Jugendliche zeigen eine erheblich geringere
Ausbildungsbeteiligung als gleichaltrige Deutsche, zudem brechen sie ihre
Ausbildung hufiger ab und konzentrieren sich bei der Berufswahl weitaus
strker auf nur wenige Berufe (Boos-Nnning et al., 1990).
Beim Wechsel in den Arbeitsmarkt setzt sich dies ebenfalls fort. Junge
Migranten finden sich in den nachteiligsten beruflichen Positionen, die
vielfach auf die fehlenden Bildungsqualifikationen zurckzufhren sind. Sie
verfolgen hufig un- und angelernte Ttigkeiten, verfgen ber einen
geringeren Verdienst und sind mit hherer Arbeitslosigkeit konfrontiert
(Dietz 1987, Seifert 1992).
Der Grad der Benachteiligung unterscheidet sich nach ethnischer
Zugehrigkeit, wobei Trken und Italiener im Bildungs- und Berufssystem
am schlechtesten dastehen (Bender & Seifert, 1996).
Die defizitre schulische und berufliche Qualifikation der jungen Trken und
Trkinnen trgt gravierend zu deren hoher Arbeitslosigkeit bei, dennoch hat sich die
berufliche Position im Vergleich zu der ersten Generation eindeutig verbessert. Die
hier dargestellte marginalisierte Situation der jungen Menschen mit
Migrationshintergrund, und hier auch besonders der jungen Trken und Trkinnen,
stellt eine besondere Gefhrdung dieser Gruppe in Bezug auf Kriminalitt dar. Hier
wird Perspektivlosigkeit und Frust produziert, die eine kriminelle Karriere
begnstigen knnen.
3.3.6 Zur sprachlichen Situation der trkischstmmigen Jugendlichen
Auch die Sprachleistungen der in Deutschland geborenen Trken ist durchweg
unterdurchschnittlich. Ein groes Stck des Integrationsprozesses wird durch die
gelernte Sprache des Aufnahmelandes verwirklicht. Also, wenn die Integration als
gesellschaftliche Handlungsmglichkeit betrachtet wird, ist sie ohne sprachliches
Handeln unmglich (vgl. Cakir, 2001). Die Migrantenfamilien knnen aufgrund der
52
oft eigenen mangelnden deutschen Sprachkenntnisse die Sprachausbildung ihrer
Kinder nur bedingt untersttzen. Die sprachlichen Fhigkeiten der trkisch-
stmmigen jungen Menschen sind durch eine doppelte Halbsprachigkeit
gekennzeichnet (vgl. Dr. Seref Ates). Das bedeutet, dass die jungen Trken und
Trkinnen generell die Umgangssprache beherrschen, aber Probleme mit der
Schriftsprache haben. Beide Sprachen werden so beherrscht, das sie ein
Zurechtkommen im Alltag ermglichen, jedoch fr schwierigere Konstruktionen
(z.B. fachtheoretischen Anforderungen) nicht ausreichen. Dr. Ates beschreibt die
Folgen der doppelten Halbsprachigkeit wie folgt:
In den Kpfen entstehen unterschiedliche Sprachstrukturen, die ihre
sprachliche Entwicklung behindern.
Ihre Emotionen knnen sie mit der einen oder anderen Sprache zum
Ausdruck bringen (oder auch gar nicht).
Die sprachliche Kommunikation ist auf einen bestimmten Wortschatz
beschrnkt.
Die Beauftragte der Bundesregierung fr die Belange der Auslnder (1997) berichtet,
dass Kinder mit Migrationshintergrund zuerst die Muttersprache erlernen und nicht
selten durch ein fehlendes Kindergartenplatzangebot erst mit der Einschulung
Kontakt zur deutschen Sprache bekommen. Besonders hufig trifft das in den von
Segregation gekennzeichneten Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf zu.
Dann kommt es zu den von Dr. Ates beschriebenen Schwierigkeiten, wobei die
Mdchen hier ein positiveres Bild hinterlassen. Sie machen bessere Lernfortschritte
und ihre Sprachbeherrschung ist auf allen Ebenen besser als die der Jungen. Auch
hier wird die Bedeutung einer frhen, mglichst im Kindergarten einsetzenden,
bilinguale und bikulturellen Erziehung deutlich. In der Schule ist es aus oben
genannten Grnden oft schon zu spt. Durch Segregation und ethnischer
Konzentration auf bestimmte Schulen kommt es sogar whrend des Unterrichts dazu,
dass die Kinder in ihrer eigenen Sprache kommunizieren. Fr die Schulen stellt das
eine groe Herausforderung an ihre Integrationsleistung dar.
In einem Arbeitspapier, das von der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben
wurde, beschreibt Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (2002) die individuellen
Perspektiven und Problemlagen der Trken in Deutschland. In dieser Studie wurden
326 trkischstmmige Menschen interviewt (Face-To-Face), und sie hat aufgrund der
kleinen Menge der Befragten einen qualitativen Charakter. Es wurden zufllige
Stichproben genommen (nur Westdeutschland). Von Wilamowitz-Moellendorff
betont aber, dass durch dieses zufllige Auswahlverfahren gewhrleistet wrde, dass
die Antworten fr den grten Teil der trkischstmmigen Bevlkerung in
Deutschland ein zuverlssiges Stimmungsbild zeigen. Nach seinen Umfragen kommt
er zu dem Ergebnis, dass ein Drittel der Befragten mit deutscher Staatsbrgerschaft
in der Freizeit berwiegend deutsch spricht, 40% sprechen sowohl trkisch als auch
deutsch. Nicht mal jede/r Vierte der Befragten spricht berwiegend trkisch.
53
Nur 10% der Befragten mit trkischer Staatsbrgerschaft verwenden in der Freizeit
berwiegend die deutsche Sprache.
Abb. 22: Verwendete Sprache in der Freizeit, 2002; Quelle: Eigene Berechnung
nach Umfragergebnissen, von Willamowitz-Moellendorff, 2002
Etwa ein Drittel spricht beide Sprachen in etwa gleichem Ausma. 57% sprechen
berwiegend trkisch. Er kommt zu dem Resultat, dass die Deutschen trkischer
Herkunft, die ein Drittel der Befragten ausmachten, erkennbar gut in die deutsche
Gesellschaft integriert sind. Der Gebrauch der deutschen Sprache ist ihnen
selbstverstndlich und die Bekanntenkreise bestehen sowohl aus Trken als auch aus
Deutschen. Nur in den Familien bleiben die Kontakte berwiegend auf Trken
beschrnkt. Bei den Befragten mit trkischer Staatsbrgerschaft zeichnete sich
jedoch ein Sprachdefizit ab, sie sprechen vor allem trkisch auch im Freundeskreis
oder bei Freizeitaktivitten. Kontakte zu Deutschen finden in dieser Gruppe nur
zwangsweise statt.
3.3.7 Einfluss der gesellschaftlichen Faktoren auf Delinquenz
Weitere Faktoren, die eine erhhte Delinquenz trkischstmmiger Jugendlicher und
Heranwachsender bedingen knnen, sind deren hohe Anteile an Arbeitslosigkeit und
die damit verbundene Perspektivlosigkeit. Sie unterliegen weiterhin einer rechtlichen
Stellung, die ihnen politisches Mitwirken verweigert und keine Sicherheit bietet.
Frank Gesemann (2000) sieht diese sozialen, konomischen und politischen
Ausschlusserfahrungen als begnstigend fr einen Rckzug in die Traditionen und
Kultur der eigenen ethnischen Gruppe an.
54
Konfliktpotenzial bietet besonders das raumeinnehmende Freizeitverhalten der
Jugendlichen, das oft aufgrund enger Wohn- und Lebensverhltnisse auf den
ffentlichen Raum ausgeweitet wird. Wie schon erwhnt finden sich in den von
Segregation geprgten Stadtteilen Verarmung und Arbeitslosigkeit wieder, die in
besonderem Mae die Jugendlichen betreffen.
Kriminalitt und Gewalt unter Jugendlichen sind in diesem Fall zwar mit
Armut verbunden, aber nicht die Armut ist die Ursache von Gewalt, sondern
die damit verbundene Ausschlusserfahrung (Kapphan, 2000).
Die von Pfeiffer durchgefhrte Studie besttigt die Annahme, dass Jugendliche mit
Migrationshintergrund diese Ausschlussverfahren nicht einfach hinnehmen, wie ihre
Eltern es noch taten. Sie vergleichen ihre gesellschaftliche Position mit der
Mehrheitsgesellschaft und sehen sich dort erheblichen Benachteiligungen gegenber.
Mit den Ausgrenzungserfahrungen wchst vermutlich auch ihre Tendenz, sich zu
delinquenten Gruppen zusammenzuschlieen (Pfeiffer; Wetzels, 1999).
Eine Kompensation dieser Ausgrenzungen durch Konsumgter, die Status erhhend
wirken knnen, kann aufgrund schlechter finanzieller Lage nur durch illegale
Beschaffungsmglichkeiten erreicht werden (Gesemann, 2000). Prventionsanstze
sollten hier die nichtdeutsche Bevlkerung mit einbeziehen und mit Manahmen zur
Frderung benachteiligter Wohngebiete verknpft werden. Nach Pfeiffer und
Wetzels sollten sowohl die Peer-Group als auch die Familie mit einbezogen werden
und alle offiziellen Akteure vernetzt werden, um rechtzeitiges Hilfeleisten zu
ermglichen.
In rechtlicher Hinsicht sind Jugendliche mit einem trkischen Pass in einer
unsicheren Situation und haben nur unzureichend Chancen zur Teilhabe an
gesellschaftlichen Gtern. Die Rechtsstellung als Auslnder bedingt Isolierung und
Deklassierung. Als Auslnder unterliegen sie dem allgemeinen deutschen Recht,
dem Auslnderrecht, den besonderen Regelungen fr Auslnder aufgrund
zwischenstaatlicher Vertrge mit den Abgabelndern sowie dem Recht des
Heimatlandes und dem EG-Recht. Auslnder ist jeder, der nicht Deutscher im
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist. Auslnder bentigen fr die
Einreise und den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland grundstzlich eine
Aufenthaltsgenehmigung. Wie lange und unter welchen Bedingungen Auslnder in
Deutschland leben sowie Fragen der Familienzusammenfhrung regelt das
Auslndergesetz, das oft als zu kompliziert kritisiert wird (6. Familienbericht).
Seit dem 1. Januar 2000 knnen in Deutschland geborene Kinder von
Nichtdeutschen mit Daueraufenthaltsstatus mit der Geburt die doppelte
Staatsangehrigkeit bekommen. Das erleichtert die Einbrgerung und in Deutschland
von Migranten geborenen Kinder werden als Deutsche anerkennt, das ius sanguinis
(Abstammungsrecht) wurde also durch das ius soli (Geburtsortprinzip) ersetzt.
Dabei sollen sie sich zwischen dem 18. und dem 23. Lebensjahr fr eine
Staatsangehrigkeit entscheiden. Neben in Deutschland geborenen Menschen drfen
auch Migranten, die seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben und bestimmte
Voraussetzungen erfllen (vorhandene Aufenthaltserlaubnis, ausreichende
Sprachkenntnis, nicht arbeitslos oder sozialhilfebedrftig, keine strafrechtlichen
55
Belastungen) eingebrgert werden (vgl. Sen, 2000). Seit dem 1.1.2005 trat das neue
von der Bundesregierung initiiertes Zuwanderungsgesetz in Kraft, ein wesentlicher
Schritt zu einer Aktualisierung der Auslnderpolitik Es enthlt umfangreiche
Regelungen zur Integration und besonders zur Sprachfrderung.
Das Bundesministerium fr Inneres (BmI, 2004) betont, dass dies die Integration der
rechtmig und dauerhaft bei uns lebenden Migranten und deren Kindern frdern
soll. Das BmI weist darauf hin, dass daran durchaus ein ffentliches Interesse
besteht, da kein demokratischer Staat es stetig hinnehmen kann, dass ein
verhltnismig groer Teil seiner Bevlkerung ber Generationen hinweg von den
Rechten und Pflichten des Staatsbrgers oder Staatsbrgerin ausgeschlossen bleibt.
Die deutsche Staatsangehrigkeit zu erhalten, hat auch fr die beruflichen
Perspektiven der Jugendlichen einen groen Wert, denn ohne sie wird ihre
Berufswahl eingeschrnkt. Zugang zum Beamtenstatus zu erhalten ist zum Beispiel
nicht mglich. Mit einer Aufenthaltserlaubnis haben sie dennoch Anspruch auf
Frderung der sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration, erhalten
Kindergeld, Erziehungsgeld und Ausbildungsfrderung. In den Zweigen der
gesetzlichen Sozialversicherung sind sie Deutschen gleichgestellt.
Bei der Inanspruchnahme von Leistungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
knnen in bestimmten Konstellationen aber auch Benachteiligungen fr die
Jugendlichen auftreten, sogar der Aufenthalt in Deutschland kann unter Umstnden
(vgl. Anhang; Fall Mehmet aus Mnchen) gefhrdet sein. Sie genieen grundstzlich
Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Sie knnen in politischen
Parteien und kommunalen Ausschssen (Landesrecht) und Auslnderbeirten
mitwirken.
Eine Wahl auf Kommunalebene ist ihnen laut dem Grundgesetz nicht erlaubt.
Bei Kommunalwahlen besitzen nur Brger aus den Mitgliedsstaaten der EU das
aktive und passive Wahlrecht. Fr eine verbesserte Integration wre es von groem
Vorteil, wenn die Trken in Deutschland auf Kommunalebene whlen knnten. Eine
Partizipation an der Politik auf dieser Ebene und eine demokratische Mitbestimmung
wren fr ein Zugehrigkeitsgefhl frderlich, das angesichts der vielen
Verunsicherungen nur bedingt entstehen konnte.
3.4 Die Bedeutung des Islam fr junge trkischstmmige Menschen
Die Religion hat eine groe Bedeutung fr junge Trken und Trkinnen in vielen
Bereichen ihres Lebens. In Bezug auf Kriminalitt ist zu prfen, welche
Auswirkungen die Religion auf das Leben und die Einstellungen der jungen
Menschen sowie ihre Identittsfindung hat. Die in Deutschland lebenden Migranten
haben viele Religionen, die grte ethnisch-religise Gemeinschaft bilden jedoch die
Muslime (Tibi, 2001). Heute leben drei Millionen Muslime in Deutschland, von
denen etwa zwei Drittel trkische Staatsbrger sind. Die in Deutschland lebenden
Trken sind zu 98% Muslime, jeder Dritte ist nach Faruk Sen praktizierender
Muslim. Ein Prozent sind Yeziden (eine Mischreligion aus Christentum, Islam und
Zoroastrismus), sie gehren zur ethnischen Gruppe der Kurden. Ein weiteres Prozent
sind Christen. Allerdings kann eine Gleichsetzung der Trken und dem Islam
56
aufgrund der enormen kulturellen und religisen Vielfltigkeit eine Verzerrung
verursachen (Sen, 2004; Tibi, 2001). Der in Deutschland von Migranten praktizierte
Islam definiert sich auch besonders von den jeweiligen Herkunftslndern her.
Der Islam (arab. Begriff: Unterwerfung/Hingabe an Gott) ist eine monotheistische
Religion mit weltweit rund 1,3 Milliarden Glubigen. Ein Muslim ist dem Begriff
nach einer, der sich Gott unterwirft (Islam Lexikon, 2004). Der Islam hat keine
bergeordnete organisatorische Struktur, sondern zeichnet sich durch viele
unterschiedliche Gruppierungen aus, die teilweise auch unterschiedliche
Vorstellungen haben. In Deutschland haben sich mittlerweile viele trkisch-
islamische Vereine und Organisationen gebildet, die wichtige Anlaufstellen fr junge
Trken und Trkinnen geworden sind. Obwohl es mehr hnlichkeiten als
Unterschiede in den Glaubenslehren von Islam und Christentum gibt, sehen viele in
der ihnen fremd erscheinenden Religion des Islam ein echtes Integrationshemmnis
(Schmidt-Fink, 2003). Angst vor berfremdung, Entstehung sozialer Konflikte und
Gefhrdung, das Kopftuch, die Rolle der Frau und islamischer Fundamentalismus
sind Themen, welche die deutschen Brger mit dem Islam in Verbindung bringen.
Trotz der langen Zeit, die Muslime in der BRD leben, sind in der
Aufnahmegesellschaft nur geringe Kenntnisse ber diese Religion festzustellen
(vgl. Sen, 2004). In Deutschland ist ein Hinwenden der lteren Trken und
Trkinnen, aber auch der jungen zum Islam zu verzeichnen. Faruk Sen nennt das
Leben als kulturelle und religise Minderheit in der Diaspora als Ursache (Sen;
Goldberg, S. 91). Der Islam beeinflusst das Leben der Glubigen, die sich
weitestgehend nach ihm richten, in verschiedener Art und Weise.
Abb.23: Ausrichtung des Lebens nach dem Islam;
Quelle: Eigene Berechnung nach Umfragergebnis, Wilamowitz-Moellendorff, 2001
57
Die Ernhrung, Erziehungsvorstellungen, Geschlechterverhltnis, Lebensfhrung
und -plne werden durch den Islam geprgt. In den oben schon genannten Umfragen
in trkischen Haushalten von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (2001) wird fr
einige sowohl eine Hinwendung zu Islam als auch eine Skularisierungstendenz
sichtbar. In Fragen der Religion sind die Befragten gespalten (von Wilamowitz-
Moellendorff). Die Befragten mit trkischer Staatsangehrigkeit richten ihr Leben zu
53% berwiegend/vollstndig nach dem Islam. Skularisierungstendenzen werden
nur bei Deutschen trkischer Herkunft deutlich, ein groer Teil der 85 Deutschtrken
(41%) hat nur geringen Bezug zum Islam, nur ein Viertel richtet sich berwiegend
oder vollstndig nach den Regeln des Islams. Insgesamt richteten sich 13% der 326
insgesamt Befragten vollstndig und 30% berwiegend nach den Regeln des Islam.
27% der Befragten befolgen diese nur noch teilweise und etwas mehr als ein Viertel
der Befragten weniger oder berhaupt nicht.
Die Umfrage macht weiterhin deutlich, dass der berwiegende Teil der Befragten fr
einen toleranten Islam steht und Menschen mit anderen religisen Ansichten
durchaus akzeptiert. 75% der Befragten gaben an, dass vor Gott alle Menschen
unabhngig von ihrer Religion und ihres Glaubens gleich seien. Die Hlfte ist der
Ansicht, dass Islam und Christentum im Grunde die gleichen Werte vertreten, 42%
verneinten dies (manche vertraten keine Meinung).59% von ihnen stimmte der
Aussage zu, dass der Islam dem Christentum berlegen sei. Wchst der
Integrationsgrad allerdings, was auch anhand der Staatsangehrigkeit zu sehen ist, so
verringert sich ein berlegenheitsbewusstsein, und eine Annherung wird deutlich.
Hierfr findet in den ffentlichen Diskussionen der Begriff des Euro-Islam immer
mehr Verwendung.
Aktuellere Studien, wie die von Alacacioglu durchgefhrte quantitative
Untersuchung bei Gemeindemitgliedern und Schlern und Schlerinnen (2002) oder
die Shell-Studie 2000, nehmen zunehmend jugendliche Muslime und Muslima in
das Blickfeld. Die trkischstmmigen Jugendlichen und Heranwachsenden sehen
sich einerseits reichhaltiger werdenden kulturellen und gesellschaftlichen
Mglichkeiten und andererseits verschrfender soziokonomischer Ungleichheit
gegenber. Das macht sich auch in Bezug auf die Religion sichtbar. Die 1997
quantitativ-empirisch angelegte Untersuchung Verlockender Fundamentalismus
von Wilhelm Heitmeyer, Joachim Mller und Helmut Schrder von der Bielefelder
Universitt untersucht die Einstellung der Jugendlichen zum Islam gesondert. Sie
betrachteten die islamische Religiositt als persnliche Angelegenheit, die kollektiv-
kulturelle Aspekte und als Drittes die politische Dimension des Islam. Sie stellen
aufgrund der Ergebnisse von 1221 Befragungen trkischer Jugendlicher aus 63
Schulklassen allgemein- und berufsbildender Schulen Nordrhein-Westfalens fest,
dass 67% der Befragten (mit trkischem Pass) eine enge Bindung zum Islam hatten.
berlegenheitsgefhle wurden deutlich und bei einigen wenigen wurde ein Zuspruch
zu fundamentalistischen und radikalen Organisationen festgestellt. Diese fhlten sich
entschieden durch islamistische Vereine wie zum Beispiel der Islamische
Gemeinschaft Milli Grs e.V. vertreten. Grnde fr eine solche Orientierung
sehen die Wissenschaftler in fremdenfeindlicher Gewalt beziehungsweise eigenen
Diskriminierungserfahrungen. Auerdem in der Verweigerung von Anerkennung
einer kollektiven Identitt durch die Mehrheitsgesellschaft als auch gesellschaftlicher
58
Modernisierungsprozesse. Den Jugendlichen, die sich zu solchen Organisationen
hingezogen fhlten, waren mangelhafte Schulbildung, schlechte Abschlsse und
somit auch schlechte berufliche Chancen gemein. Heitmeyer und seine Kollegen
kommen zu dem Schluss, dass diese radikalen Meinungen ein dauerhaftes und
langfristiges Problem darstellen. Radikale Vereine und Organisationen beanspruchen
Macht und liefern den Jugendlichen ein berlegenheitsgefhl, mit dem sie die
eigenen Ohnmachtserfahrungen kompensieren knnen. Jugendliche, die sich nach
demonstrativer Strke sehnen, unterliegen einer Gefahr durch diese Organisationen
instrumentalisiert zu werden. Heitmeyer sieht in den ideologischen und
sozialrumlichen Angeboten der Organisationen die Gefahr der weiteren
Verbreiterung der Organisationen und ihrer politischen Ziele. Er stellt fest, dass hier
ber ein jugendkulturelles Problem hinaus voraussichtlich auch ein politisches
Problem entstehen knnte.
Allerdings sind auch bildungserfolgreiche Jugendliche dem Islam vermehrt
zugeneigt, sie betonen jedoch ihre Unabhngigkeit zur Trkei und ihre Intension an
der westlichen Welt als Muslime teilzuhaben. Sie distanzieren sich von
fundamentalistischem und radikalem Gedankengut. Der Islam kann durch die festen
Verhaltensregeln und klare Deutungsmuster eine Sicherheit und einen festen Halt in
der Migration bieten und als identitts-stabilisierender Faktor wirken (vgl.
Heitmeyer). Die Studie zeigt besonders, dass ein Dramatisierung und das Schaffen
von Bedrohungsszenarien genauso unangebracht sind wie entlastende
Verharmlosungen und Tabuisierungen. Heitmeyer nennt in Die Zeit (1998),
aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen eine soziale Integration der Migranten
als notwendig, um ein eintrgliches Zusammenleben zu ermglichen. Die Politik
muss dort ansetzten, wo Jugendliche nach kultureller Sicherheit in einer
vertrauenswrdigen Gemeinschaft suchen und sie ansprechen, bevor sie dies in
einem fundamentalistischen Islam finden. Aber auch die Grenzen allgemeingltiger
demokratischer Werte sind deutlich zu machen.
In den genannten Untersuchungen geht es um die Darstellung der Breite der
Entwicklung von Religion in der Moderne jenseits von politisch-ideologischen
Wahrnehmungsstrategien (Boos-Nnning, 2004). Die Jugendlichen scheinen auf der
Suche nach Identitt, Zugehrigkeit und Partizipation den Islam immer mehr als
Mglichkeit wahrzunehmen. Ihnen liegt viel daran als selbstbewusste junge Muslime
und Musliminnen wahrgenommen zu werden. Hier bietet die Religion eine
Mglichkeit zu Bildung einer Identitt und eine Authentizitt, die ihnen die deutsche
Gesellschaft nicht anbieten kann. Yasemin Karakasoglu und Ursula Boos-Nnning
(2004) sehen eine vielseitige Ausprgung der islamischen Orientierung bei den
Jugendlichen, von betont skularer Orientierung ber verinnerlichte islamische Ethik
oder eine sthetisierte Annherung (islamische Kleidung) mit und ohne Befolgung
der rituellen Praxis bis hin zu einem Leben ganz nach den Regeln des Islam.
Die betonte Zugehrigkeit zum Islam ermglicht es ihnen, in einem
gemeinsamen Erlebnisbereich mit den Eltern zu verbleiben, und die
selbstndige Aneignung von Wissensinhalten und Riten vermittelt ihnen den
Status von Experten/Expertinnen, mit dem sie gegenber der Elterngeneration
eine Art sanfte Emanzipation durchsetzen knnen, ohne in offene
Konfrontation zu geraten (Boos-Nnning, 2004).
59
In der ffentlichen Diskussion steht oft das Tragen von Kopftchern oder
traditioneller Kleidung. Fr die jungen Menschen sind dies elementare
Ausdrucksformen ihrer Identitt und sollten als solche wahrgenommen werden. Sie
vertreten die Meinung, dass ein Leben als moderne junge Menschen einer
Religionsausbung nicht im Wege steht. Sie wollen an einer pluralistischen
Gesellschaft teilhaben und von ihr anerkannt werden. Es handelt sich um eine
Identittsfindung, die eine Integration junger Menschen eventuell so erst ermglicht.
Sie erlangen Selbstvertrauen durch die Zugehrigkeit zur Umma (religise
Gemeinschaft). Auch Heitmeyer sieht bei den meisten Jugendlichen einen
pragmatischen Umgang mit religisen Anforderungen. Sie sehen keinen
Widerspruch zwischen ihrem islamischen Glauben und dem Leben in einer
modernen westlichen, [] demokratischen Gesellschaft (vgl. Heitmeyer).
Die jungen Menschen, die es schaffen, europische Kultur und gesellschaftliche
Werte mit ihren Vorstellungen von Religiositt zu verbinden, ermglichen die
Entwicklung von einem Euro-Islam (ZfTS). Faruk Sen betont in einem Interview
mit einer trkischen Internet Zeitung, dass die Muslime in der Europischen Union
nach den Normen der industriellen Leistungsgesellschaft leben und die Demokratie
voll akzeptiert haben. Der Pluralismus sei ein Bestandteil ihrer Lebensphilosophie
geworden, sie seien weitestgehend skulare Muslime und lebten nicht voll nach den
Normen der Scharia (im Sprachgebrauch Recht, im engeren Sinn die von Gott
gesetzte Ordnung im Sinne des Islam; Islam Lexikon).
Faruk Sen arbeitet zurzeit im Rahmen seiner Ttigkeit als Vorsitzender des Zentrums
fr Trkeistudien zusammen mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen an einer
Ausarbeitung zur Einfhrung von islamischem Religionsunterricht an Schulen.
Dieser soll innerhalb der regulren Unterrichtszeiten und in deutscher Sprache
stattfinden. Es soll eine Curriculum-Entwicklungsgruppe geben, bei der Vertreter
der Regierung und der Ministerien, Migrantenvertreter sowie Experten aus den
Herkunftslndern mitwirken (Sen). Weiterhin sind Lehrsthle zur Ausbildung von
Lehrkrften fr den islamischen Religionsunterricht geplant, um Lehrer mit
Migrationshintergrund und deutscher Sozialisation fr diese Aufgaben auszubilden.
Hier sollen die Inhalte des Islams nicht wie in einigen Koranschulen, indoktrinativ
mit fraglichen pdagogischen und theologischen Konzepten gelehrt werden, sondern
an alltglichen Erfahrungen der Schler ansetzend und auf Toleranz ausgerichtet
werden.
Obwohl meiner Meinung nach Religion und Staat strikt zu trennen sind, sehe ich
aber, dass ein fehlender islamischer Religionsunterricht die Basis fr radikale
fundamentalistische Organisationen und Koranschulen verbessert und an der
Lebenswirklichkeit der jungen Trkinnen und Trken nicht anknpfen kann. So ist in
einigen europischen Lndern, die den Islam anerkennen, ein Frderung des
interreligisen Dialogs sowie eine traditionelle Annherung zu verzeichnen. Hier
knnen Jugendliche kritisch mit den Religionen umgehen und etwas Neues schaffen,
das ihrer Lebenssituation entspricht (vgl. Sen, 2004).
60
3.5 Einfluss und Nutzung der Medien
Zum einen ist der Einfluss, der Nutzen und die Wahrnehmung der trkischen und
deutschen Medien auf die Jugendlichen und Heranwachsenden interessant, zum
anderen wie die Medien ihrerseits die trkischstmmigen Jugendlichen darstellen
und diese wiederum von der Umwelt wahrgenommen werden.
Migration wird in der deutschen ffentlichkeit als Problem der kulturellen
berforderung diskutiert. Besonders die trkischen Migranten gehren dabei zu den
als kulturell besonders fremd angesehenen Zuwanderergruppen (Schulz, 2001).
Die Medien, unabhngig welcher Sprache sie sich bedienen, geben Informationen
selten ungefiltert oder wertfrei weiter. Da den Medien aus konomischen
Gesichtspunkten in erster Linie Verkaufzahlen wichtig sind, bedienen sie sich
populistischen Themen. Wichtige Teile von Informationen werden ausgelassen und
verzerren zum Teil Bilder und Eindrcke. Statt zu informieren, wecken sie
Emotionen (vgl. Wetzel, 2001).
Sie dienen nicht nur als Vermittler zwischen Politik und Bevlkerung, sondern
beeinflussen beide auch. 1994 stellte der Rundfunkrat eine Verantwortung fr
Eskalation bzw. Deeskalation von fremdenfeindlichem Verhalten seitens der Medien
fest: Journalistinnen und Journalisten sind nicht nur beschreibende und darstellende
Chronisten der politischen und gesellschaftlichen Realitt, sie sind auch Akteure und
knnen gar zu Ttern werden. Sie haben auf die Verantwortlichkeit der Politik zu
verweisen, aber auch Eigenverantwortlichkeit wahrzunehmen. Juliane Wetzel sieht
in Bezug auf das Thema Auslnderfeindlichkeit in der Gegebenheit, dass
Migranten zumeist in negativen Zusammenhngen erscheinen, einen wesentlichen
Punkt fr sich verstrkende Vorurteile. Aber auch in den trkischen Medien finden
sich vergleichbare Vorgnge, die aus Sensationshascherei Fremdenhass schren und
integrationshemmend auftreten.
Die trkischen Medien haben auf in Deutschland lebende trkische Migranten einen
Einfluss. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA, 2000) fhrte
eine reprsentative Umfrage zur Mediennutzung und sozialen Integration der
trkischen Wohnbevlkerung ab 14 Jahren in Privathaushalten in Deutschland durch.
Es wurde festgestellt, dass in Deutschland lebende Trken weitestgehend mehrere
Medien nutzen, und dabei sowohl trkische als auch deutsche (50%). Nur wenige
(17%) nutzten ausschlielich trkische Medien, allerdings nutzten 28%
ausschlielich deutsche Medien. Durch diese Umfrage konnten Zusammenhnge
zwischen bestimmten Integrationsmilieus und Mediennutzungsstilen erkennbar
gemacht werden. Es wurden sechs Integrationsmilieus identifiziert, drei davon
wurden durch eine relative Nhe zur deutschen Mehrheitsgesellschaft
gekennzeichnet. Diesen Milieus gehrten ber die Hlfte der Befragten an, diese
nutzten deutsche und trkische Medien in vielfltigsten Kombinationen. 20% der
Befragten kennzeichnete eine Abgrenzung zur deutschen Mehrheitsgesellschaft. Dies
schliee aber eine Nicht-Nutzung deutscher Medien nicht unbedingt ein.
Die Untersuchung weist darauf hin, dass eine Mediennutzungsschwelle niedriger zu
sein scheint als die Schwellen in den bestehenden Lebenswelten. Der trkische
Fernsehsender TRT-International wird von den Meisten empfangen. Unter den
Zeitungen ist (ca. 20.000 Leser) die trkische Zeitung Hrriyet die
auflagenstrkste, seit 1965 wird sie in Deutschland verkauft. Sie ist national-
61
konservativ ausgelegt und muss sich des fteren mit Vorwrfen der
Deutschlandfeindlichkeit auseinandersetzen. Kulturell bleiben die Trken in
Deutschland ber Fernsehen und Zeitungen mit ihrer alten Heimat verbunden (FAZ,
10.01.02). Der Kolumnist der Hrriyet und Prsident des Trkischen Presserates
Oktay Eksi berichtet in einem nicht wissenschaftlichen Referat ber das
Deutschlandbild in den trkischen Medien (Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998). 1997
untersuchte er 122 Artikel der bekanntesten Tageszeitungen (Cumhuriyet, Hrriyet,
Milliyet, Yeni, Yzy) auf ihren Tenor bezglich Deutschlands.
Als Ergebnis dieser Untersuchung nannte Eski, dass durchschnittlich ein positives
Deutschlandbild berwiege. Einzig die Zeitung Hrriyet weise teilweise eine
ablehnende Berichterstattung ber Deutschland auf. Man knne nach Eski nicht von
einer durch Vorurteile geprgten Berichterstattung sprechen. Das Bild von
Deutschland wird allerdings aufgrund der EU-Thematik oft negativ gezeichnet
(Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998). Den trkischen Boulevard-Medien wird jedoch
nicht selten ein deutschlandfeindlicher Tenor unterstellt.
Wie die Trkei und die Trken in Deutschland in den deutschen Medien dargestellt
werden, ist hufig hnlich kritisch. In Deutschland ist jedoch die negative
Trkeiberichterstattung nicht nur eine Erscheinung der Boulevardpresse, sondern
auch im seriseren Journalismus anzutreffen. Oft werden Konflikte, die soziale und
konomische Ursachen haben, zu ethnischen und kulturellen gemacht, ein
verantwortungsloser Journalismus unter dem Deckmantel der Seriositt und
differenzierten Berichterstattung. Artikel wie im Nachrichtenmagazin Der Spiegel
2004, verffentlichte Titel Allahs rechtlose Tchter (Abb.24: Titelbild) zu
muslimischen Frauen in Deutschland verffentlicht, schren ngste und Emprung,
und lassen ein falsches Bild fr eine groe Zahl junger Muslima entstehen, mit
welchem diese lange zu kmpfen haben werden. Solche Artikel, die durchaus
Probleme skizzieren, die einer Thematisierung bentigen, mssen sich, solange sie
eine Undifferenziertheit dieses Ausmaes beinhalten, den Vorwurf gefallen lassen,
sie seien ihrerseits intergrationshemmend.
Bis jetzt haben die deutschen Medien der trkischen Jugend nicht vermittelt, dass
sie auch Teil der deutschen Gesellschaft sind, sagt Hakan Uzun, Vorsitzender der
"European Association of Turkish Academics". Dieser nach Uzun verantwortungs-
loser Journalismus macht die schon bestehenden Kommunikationsprobleme
zwischen verschiedenen "communities" in der deutschen Gesellschaft nur noch
grer. Auch das Thema der Auslnderkriminalitt dient wie schon erwhnt gerne
der Auflagensteigerung. Der Fachbereich Politikwissenschaft der Freien Universitt
Berlin stellte eine Studie vor Von deutschen Einzelttern und auslndischen Banden
Medien und Straftaten, die errtern sollte, ob ber Straftaten von Migranten in den
Medien anders berichtet wird als ber jene von Deutschen. Die Wissenschaftler
beobachteten 1997 ber drei Monate die auflagenstrksten Zeitungen und
Zeitschriften (Der Spiegel, Bild, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Rheinische Post, Westdeutsche Allgemeine Zeitung) und analysierten 1565
Artikeln. Sie stellten eine erhebliche Differenz in der Berichterstattung ber
Deutsche und Migranten fest. Migranten wurden als Personen gewissenloser
dargestellt. Sprachkenntnisse, Fotos und Nationalitt wurden betont und
untersttzten so stereotype Vorstellungsmuster. Sozialisation und Ursachen wurden
62
seltener beleuchtet, auch Stellungnahmen der Personen selbst sind nach den Berliner
Wissenschaftlern selten zu finden. Die Artikel lieen Migranten hufig mit
organisierte Kriminalitt in Verbindung bringen und schrten so ngste (vgl.
Rainer Geiler, 2001).
Abb. 24: Titelbilder Der Spiegel; Quelle: www.spiegelstudien.de
Juliane Wetzel (2001) sieht einen negativ gefrbten Sprachgebrauch in den
deutschen Medien bezglich der Migranten. Die Begriffe wie Invasion, Flut oder
Schwemme sieht sie in Bezug mit Migration kritisch. Auch wenn eine positive
tolerante Entwicklung zu bemerken ist, wird das Bild der trkischstmmigen
Menschen in Deutschland aufgrund von Populismus durch auflagen frdernden
Journalismus verzerrt (Wetzel). Prof. Dr. Karl-Heinz Meier-Braun, Leiter der
Fachredaktion SWR International und Auslnderbeauftragter des Sdwest-
Rundfunks, ist der Meinung, Politik und Medien mssen sich verstrkt um das
Thema Migration kmmern. In einem Referat, anlsslich der Prsentation der Studie
Das Auslnderbild in den Thringer Tageszeitungen 1995-1999 am 15.12.2000 in
Erfurt, beschreibt er die alltgliche Berichterstattung als mangelhaft und
undifferenziert. Er wirft den Berichterstattungen vor, die Entwicklung der zweiten
und dritten Generation nicht ausreichend zu bercksichtigen. Der Fokus sollte auch
auf die positiven Dinge der Migration gerichtet werden und die trkische
Bevlkerung aus dem Unterdrckte-Frau-mit-Kopftuch-Image entlassen werden.
Alltagsgeschehen, Hintergrundinformationen und normale Bilder sollten mehr
Bercksichtigung finden (Maier-Braun 2000). Maier-Braun sieht ebenfalls, dass die
nichtdeutsche Bevlkerung auch als Zielgruppe der Medien besser angesprochen
werden msste. Hier liegt eine Leserschaft brach, die auch als zahlende Kunden
nicht bergangen werden sollte. Besonders fr die Integration der zweiten und dritten
Generation sieht er eine Wichtigkeit darin, dass diese sich auch in der
Medienlandschaft als Teil der Gesellschaft wieder finden.
Prof. Dr. Bernd-Ruediger Sonnen von der Universitt Hamburg (1998) warnt aus
Sicht der Deutschen Vereinigung Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe vor einer
Dmonisierung der Jugendlichen, unabhngig von der Nationalitt. Diese
63
Dramatisierung der Jugendkriminalitt wird allzu schnell zum Anlass fr eine
verstrkte Repressivitt in der Jugend- und Kriminalpolitik genommen, obwohl ein
sensibler und rationaler Umgang seiner Meinung nach angebrachter wre.
Festzuhalten wre, dass die trkischen Jugendlichen von den Medien einerseits als
Zielgruppe vermehrt wahrzunehmen sind und andererseits als Teil dieser
Gesellschaft und nicht als Gefahr darzustellen sind. Dass die Medien die Mglichkeit
zur schnellen niederschwelligeren Integration haben, zeigen viele trkische Knstler,
die sich mittlerweile etabliert haben. Musik-Produktionen wie das Duett zwischen
dem Klner Knstler Gentleman und dem trkischen Snger Mustafa Sandal
zeigen, welches Potential in solchen Co-Produktionen steckt. (Deutschland Charts
auf Platz acht eingestiegen/ Oriental Turkish Pop meets Reggae/ HipHop).
Medienwirksame Auftritte, die beide Kulturen verbinden, alle Jugendlichen
ansprechen und ein Zugehrigkeitsgefhl vermitteln, wren auch weiterhin
wnschenswert.
3.6 Trkische Jugendliche und ihre Identittsbildung
Die Identitt ist das Resultat der gesamten Situation und Entwicklung eines
Menschen. Erziehung, Erfahrungen in der Familie, Erfahrungen in sozialen Gruppen
und Cliquen sowie durch die Schule und andere relevante Bezugspersonen sind
ausschlaggebend fr die Entwicklung einer Identitt. Die eigene Identitt zu finden
ist das zentrale Problem von jungen Menschen. Die Identittsfindung beinhaltet alle
Probleme der Adoleszenzphase, Ablsung vom Elternhaus, Anerkennung der
Geschlechtsrolle, Vorbereitung auf den Beruf und die Konfrontation mit den
bestehenden Werten und Normen. Identittsfindung ist ein lebenslanger Prozess, der
das Individuum immer wieder mit Problemen konfrontiert (vgl. Schenk-Danzinger,
1994) Faruk Sen (2003) rumt der Identifikation trkischer Migranten mit
Deutschland einen groen Stellenwert ein um, auf ihren Integrationsgrad zu
schlieen. Zur Feststellung der kulturellen Identitt der trkischstmmigen
Migranten sind besonders Bleibeabsichten, Einbrgerungswnsche und das
Verbundenheitsgefhl zu Deutschland zu betrachten.
Bremer Politologen haben 2001 in der Studie Zur kollektiven Identitt trkischer
Migranten in Deutschland das Selbstverstndnis trkischer Migranten untersucht.
Sie kamen aufgrund von mehr als hundert Interviews mit trkischen Menschen der
ersten und zweiten Generation zu dem Ergebnis, dass diese eine trkisch geprgte
Identitt innehatten. Die ethnischen Wurzeln werden nicht verleugnet und besitzen
einen hohen Stellenwert. Diese Identitt sei aber nicht im Widerspruch zu
Deutschland zu sehen, sondern beinhalte ein durchaus positives Deutschlandbild,
denn fr viele ist die Trkei fremd geworden. Grundstzliche Abgrenzung oder gar
Ablehnung gegenber der deutschen Gesellschaft wurde von den Befragten nicht
besttigt. Ein wichtiger Bestandteil der kollektiven Identitt der trkischstmmigen
Menschen in Deutschland ist der Islam. Das gilt wie im Abschnitt 3.4 auch fr die
jungen trkischstmmigen Menschen. Bei den Jugendlichen der dritten Generation
ist ein Bedeutungsverlust des Zugehrigkeitsgefhls zu beobachten.
Die Wissenschaftler stellen fest, dass sie sich sehr differenziert mit den Werten und
Normen ihrer Elterngeneration auseinandersetzen. Eine Abstimmung der Traditionen
64
und Kulturelemente findet statt, die zu einer Akzeptanz oder Ablehnung, abhngig
von eigenen Lebensplnen in der deutschen Gesellschaft, fhrt. Schulz sieht hier eine
Notwendigkeit fr die Bildung einer gemeinsamen Identitt, besonders aufgrund der
Marginalisierungsempfindungen der Jugendlichen. In dieser Generation werden
Benachteiligungen in Ausbildung, Beruf und im Alltag nicht einfach hingenommen.
Die Studie zeigt fr diese Gruppe ein schwindendes Vertrauen in die Gesellschaft,
welches bei ihren Eltern und Groeltern sehr ausgeprgt zu finden ist. Sen weist
darauf hin, dass das Vertrauen zu bestimmten staatlichen Institutionen (Justizwesen,
Regierung, Polizei) bei der trkischen Bevlkerung in Deutschland gut ist und sie
mit Staat und Gesellschaft zufrieden sind. Die Studie zeigt, dass es durchaus
bearbeitungswrdige Punkte gibt, aber eine allzu groe Angst vor
Parallelgesellschaften nicht notwendig ist (Schultz/Sackmann, 2001).
Die erste Gastarbeitergeneration hatte aufgrund ihrer Rckkehrperspektive ihre
Wurzeln im Herkunftsland beibehalten und fhlte sich zu diesem kulturell zugehrig.
Eine Infragestellung der Identitt spielte keine Rolle. Benachteiligungen wurden
aufgrund des eigenen Vergleiches mit der Herkunftsgesellschaft und nicht mit der
Aufnahmegesellschaft nicht wahrgenommen.
Die erste Generation identifiziert sich deutlich als trkisch. Sen nennt die
Bewahrung dieser Identitt fr sich selbst und auch fr die Kinder als mgliche
Ursache der Segregation seitens der Migranten. Die Rckkehrabsichten stehen in
engem Zusammenhang mit der Zufriedenheit der persnlichen Situation in
Deutschland. Das Ergebnis einer reprsentativen Befragung der Stiftung Zentrum fr
Trkeistudien (ZfT) ergab 2003 zunehmende Rckehrwnsche bei Trkinnen und
Trken in NRW (28,5%), 8% mehr als in den Vorjahren (vgl. ZfT, 2004). Auch hier
wird die groe Heterogenitt der trkischen Bevlkerung in Deutschland sichtbar.
Einbrgerungen nehmen stark zu und werden aufgrund des neuen
Staatbrgerschaftsrechts auch weiterhin zunehmen, auch wenn die erwnschten
Zahlen nicht erreicht wurden und werden. Diese Verbesserung bietet politische
Partizipationsmglichkeiten und gesellschaftliche Gleichstellung fr die vielen
jungen Trken und Trkinnen in Deutschland.
Hierbei sind hnliche Schwankungen wie bei den Rckkehrabsichten festzustellen,
Einbrgerungswnsche hngen ebenfalls von der gesellschaftlichen Stimmung und
den subjektiven Perspektiven der Migranten ab. Die zweite und dritte Generation,
deren Sozialisation weitestgehend in Deutschland stattfand, entwickelte einen
anderen Bezug zu Deutschland und der Trkei (vgl. Sen). Der Bezug zur Trkei
wurde zwar weniger aber nie ganz verloren. Ihre Rckkehrwnsche wurden
zunehmend illusionr und sie orientierten sich zunehmend an der deutschen
Gesellschaft. Hier ist in Bezug zur Delinquenz zu sagen, dass sie ohne die noch
vorhandenen Rckkehr-Illusionen nicht mehr ber die Technik dieser
Problemneutralisierung verfgen, wie die Generation vor ihnen. Dadurch sind sie bei
Vorenthaltung gesellschaftlicher Chancen einem hheren Druck zur
Gesetzeswidrigkeit ausgesetzt (vgl. Pfeiffer, 1997).
Forderungen nach Akzeptanz, als Teil dieser Gesellschaft zu gelten, und Ansprche
auf soziale und kulturelle Gleichberechtigung wurden seitens der Jugendlichen in
den letzten Jahren zunehmend gestellt. Werte und Normen transportierten die
65
Familien zwar weiter, allerdings bernahmen die Jugendlichen aus ihrer
Sozialisation heraus gleichzeitig die der deutschen Gesellschaft. Konflikte entstehen
so innerhalb der Familien, wenn die Jugendlichen zwischen der Kultur, den Normen
und Werten ihrer Eltern und Groeltern und den Erwartungen und kulturellen
Normen der deutschen Mehrheitsgesellschaft hin und her gerissen sind (vgl. Sen).
Sie mssen sich in beiden Kulturen Anerkennung verschaffen und erleben dort
zunehmend Ablehnung, da sie von beiden Kulturen negativ wahrgenommen werden.
Die Identitt der trkischen Kinder und Jugendlichen wird einerseits im Umgang mit
den Mitgliedern ihrer Nationalitt oder Ethnie, andererseits in Interaktionen mit der
Bevlkerung der Aufnahmegesellschaft entwickelt.
Innerhalb den einzelnen Nationalittengruppen erfahren sich trkische Jugendliche in
mehr oder weniger groem Ausma als ethnische Gemeinschaft. Sie fhlen sich in
der Aufnahmegesellschaft kulturell fremd und werden auch so wahrgenommen. In
den Beziehungen als Jugendliche zu den Erwachsenen einerseits und als
Nichtdeutsche gegenber den deutschen Jugendlichen andererseits verlieren ihre
Identitts-findungen durch die unterschiedlichen Erwartungen, die beiderseits an sie
gestellt werden, an Klarheit. Die Jugendlichen versuchen, da sie auf beide Seiten
angewiesen sind, diese Rollenkonflikte auf ihre Weise zu bearbeiten. Identittskrisen
werden deutlich, da die trkischstmmigen Jugendlichen sich, wie schon erwhnt,
mit Gleichaltrigen aus Deutschland vergleichen. Dabei wird ihnen der eigene Status
bewusst und sie nehmen die Benachteiligungen erheblich sensibler wahr als ihre
Eltern (Sen). Die Diskrepanz zwischen gesellschaftlichen Standards und
tatschlichen Bedingungen in den Lebenswelten der Jugendlichen verlangt nach
Bewltigungsstrategien. Hier bot die Entstehung von Subkulturen teilweise Abhilfe,
denn so konnte die Referenzgruppe auf hnlich marginalisierte Jugendliche verlagert
werden. Die Umwelt, die die jungen Menschen umgibt, hat einen groen Einfluss auf
deren Identittsentwicklung. Aufgrund von gefhlter und realistischer Ausgrenzungs
und Diskriminierungserfahrungen der trkischen Jugendlichen, nahm fr einige die
Subkultur einen besonderen Stellenwert in der Identittsfindung ein (vgl. von
Wilamowitz-Moellendorff 2001). Erfahrung der Diskriminierung haben nach den
Befragungen von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (2001) jedoch fast zwei
Drittel der trkischstmmigen Menschen gemacht. Auch in der Studie der Stiftung
Zentrum fr Trkeistudien zum Thema Konstanz und Wandel der Lebenssituation
trkischstmmiger Migranten in Nordrhein-Westfalen, bei der trkische Migranten
befragt wurden, gaben 80% der Befragten an, einmal oder mehrmals diskriminiert
worden zu sein.
Der Integrationsgrad und die Aussichten aus Sicht der jungen trkischen
MigrantenInnen sind zwiespltig. Positive als auch problematische Entwicklungen
knnen wahrgenommen werden, die objektive und subjektive wirtschaftliche und
gesellschaftliche Integration ist sehr unterschiedlich und weit gefchert (vgl. Mller,
1998). Sowohl eine immer grer werdende Zahl gut ausgebildeter und gebildeter
trkischstmmiger Menschen mit guten Berufsperspektiven, wenn auch noch nicht
im ausreichenden Mae, als auch eine besorgniserregende Zahl junger Trken und
Trkinnen mit sehr viel schlechterer Ausbildung und ausgesprochen schlechten
Berufschancen, ist zu finden. Faruk Sen macht deutlich, dass es trkischstmmige
Jugendliche mit vielen Kontakten zu unterschiedlichsten Ethnien und Menschen gibt,
66
aber auch die, die sich auf die eigene Ethnie konzentrieren und wenige oder gar keine
Kontakte zu nichttrkischen Jugendlichen haben. Weiterhin gibt Sen an, dass es
Gruppen gibt, die die Werte der Aufnahmegesellschaft bernommen haben und sich
ihr zugehrig fhlen und solche, die sich ausdrcklich an den Werten der
Herkunftsgesellschaft orientieren.
Diese letzte Gruppe fhlt sich entweder in der Herkunftsgesellschaft oder aber
nirgends zugehrig. Einige sehen ihre Anforderungen an die Gesellschaft erfllt,
andere sehen sich benachteiligt und sind unzufrieden. Auch die Segrationsmotivation
ist deutlich different, von gewollter Abschottung bis hin zu gewollter und sogar
geforderter Dazugehrigkeit (Sen, 2001).
Eins wird deutlich: Die Trken gibt es nicht und vor einer Verallgemeinerung aus
jeglicher Perspektive sollte Abstand genommen werden.
Die Studien der Stiftung Zentrum fr Trkeistudien fassen folgende zentrale
Erkenntnisse ber trkischstmmige Migranten zusammen:
Die Menschen haben sich auf ein dauerhaftes Leben in Deutschland
eingerichtet
Sie identifizieren sich zunehmend mit dem Zuwanderungsland ohne sich
jedoch von ihrem Herkunftsland und ihrer Herkunftskultur abzuwenden.
Es wird von einer lngeren Zeit der Doppel- oder Mischidentitten
ausgegangen.
Dabei wird Integrationsleistung und Integrationsbereitschaft deutlich.
Hemmnisse, Defizite und Schwierigkeiten werden ebenso auftreten.
Man kann von keiner homogenen Gruppe mehr ausgehen. Zwischen der
ersten und den Nachfolgegenerationen, ebenso wie innerhalb der zweiten und
dritten Generation, sind in fast allen Lebensbereichen Verschiedenheiten
sichtbar.
Ein zunehmender Integrationsgrad der jngeren Migranten wird festgestellt,
jedoch bei nach wie vor bestehenden Defiziten gegenber der
Mehrheitsgesellschaft.
Bilinguale Sprachfrderung sowie verbesserte Untersttzung der schulischen
und beruflichen Bildung junger Menschen in Verbindung zu den Eltern sind
dringend notwendig.
Verstrkte Anstze einer gezielten Antidiskriminierungsarbeit knnen
Mglichkeiten zur Prvention von Ungleichbehandlung, insbesondere in den
Bereichen Arbeitsmarkt und Behrdenalltag, erarbeiten und die
ffentlichkeit fr rechtliche und tatschliche Diskriminierung sensibilisieren
(Sen, 2004).
Die hhere Beteiligung der trkischstmmigen mnnlichen Jugendlichen
(besonders bei Gewaltdelikten) besteht nach Christian Pfeiffer aufgrund einer
Vielzahl von Faktoren. Seine Untersuchungen werten die folgenden Punkte als
mageblich fr die Ursachen von Delinquenz und Devianz nichtdeutscher
Jugendlicher aus:
67
Geringerer Bildungsgrad, geringere Schulbildung, fehlende Berufsausbildung
Erfahrungen von Gewalt in der Familie
Traditionelles Rollenverstndnis von mnnlicher berlegenheit (Macho)
Dieses zunehmend in Frage gestellt durch die deutsche Kultur
Folge: Konflikte in den Familien.
Erhhte Arbeitslosigkeit
Relative Armut / Perspektivlosigkeit
Marginalisierungs-, Diskriminerungsempfindungen seitens der Jugendlichen
Folge: Frustration, die sich in erhhter Aggressionsbereitschaft zeigt
Wohnen in stdtischen Ballungsrumen, die generell eine deutlich hhere
Kriminalittsrate als Kleinstdte oder lndliche Regionen aufweisen
Hherer Anteil junger Mnner (im Vergleich zu Deutschen)
Diese Faktoren betreffen im strkeren Mae die trkischstmmige Bevlkerung als
die deutsche Bevlkerung und begnstigen Kriminalitt und abweichendes
Verhalten, besonders das der jungen Mnner.
Diese Ursachen erklren den realistisch erhhten Anteil der mnnlichen
trkischstmmigen Jugendlichen und Heranwachsenden an Delinquenz, lassen
jedoch eine Schlussfolgerung der gescheiterten Multikultigesellschaft (Der
Spiegel, 2004) oder der kriminellen Auslnder nicht zu. Allerdings sollte dies als
Anzeichen von mangelnder oder noch nicht gelungener Integration herangezogen
werden, um eine Verbesserung auf einigen Ebenen zu planen. Christian Pfeiffer sieht
in der Verbesserung der schulischen und beruflichen Qualifikation, der
Sprachkenntnisse und Konfliktfhigkeit der trkischstmmigen Jugendlichen
wesentliche Mglichkeiten, um die Integration zu untersttzen und Delinquenz
vorzubeugen. Abschlieend zu sagen ist, dass die Staatsangehrigkeit eines
Menschen keine Ursache fr kriminelles oder abweichendes Verhalten ist. Die
Auslnderkriminalitt gibt es nicht.
Hier treten lediglich belastende Lebensbedingungen und Probleme auf, die mit dem
Status als Auslnder verbunden sind. Die hohe Kriminalittsbelastung, auf die
Kriminalstatistiken gegebenenfalls hinweisen, sollten - wenn berhaupt - als
Anhaltspunkt begriffen werden, und auf die besonderen Lebenslagen der jungen
Menschen aufmerksam machen. Weiterhin sollte dies als Anlass fr verstrkte
Integrationsbemhungen genutzt werden.
68
69
4 Der Sozialraum Leverkusen Rheindorf-Nord
Abb. 25: Luftbild Leverkusen Rheindorf von www.speedmap.leverkusen.de
Interessant fr die Analyse der Delinquenz junger Menschen sind besonders Stdte
und Siedlungen, dort scheint eine zustzliche Begnstigung von Kriminalitt und
Gewaltbereitschaft zu bestehen. Diese wird nach Oberwittler (1999) kennzeichnet
durch Verdrngungsprozesse, selektive Wanderungsprozesse und Segmentierung der
Wohnbevlkerung nach Einkommen, Nationalitt und Lebensstil. Prozesse der
sozialen Desintegration werden auf diese Weise intensiviert. In den Diskussionen der
Sozialwissenschaft spielt die verstrkte rumliche Konzentration von sozialen
Problemen, im Kontext zu deviantem Verhalten von jungen Menschen, eine
zunehmend groe Rolle. Es besteht in der Theoriediskussion kein Zweifel mehr
darin, dass Delinquenz sowohl auf individuellen als auch auf sozialen Einflssen
basiert. Diese spielen sich unmittelbar im sozialen Nahraum und der rumlichen
Umgebung ab. Lothar Bhnisch (2001) geht davon aus, dass soziologisch und
sozialpsychologisch gesehen die Jugend durch das jugentypische Kriterium
sozialkultureller Differenzierung gekennzeichnet ist. Das heit sie zeigt
subkulturelles Sozialverhalten und hat ein gegenwartsorientiertes Zeitverstndnis.
Er schreibt die sich daraus ergebene typische strukturelle Rcksichtslosigkeit werde
anhand von Rcksichtslosigkeit gegenber dem Bestehenden und der
gesellschaftlichen Zukunft deutlich. Dieser Gegenwartsdrang der Jugend in der
modernen Gesellschaft sei seitens der klassischen Bildungsinstitutionen nicht zu
70
befriedigen. Diese sind auf Zukunft angelegt und erwarten einen
Bedrfnisaufschub, der den gegenwartsorientierten Neigungen der Jugendlichen
widerspricht. Hierfr wird die Bedeutsamkeit von auerinstitutionellen
Mglichkeiten und Rumen deutlich, in denen das Unwirkliche des Selbst sozial
verwirklicht werden kann (Bhnisch, 2001). Darin sieht Bhnisch die Ursache fr
das Auffallen von Jugendlichen im Sozialraum.
In diesem Teil wird nun der Sozialraum Leverkusen Rheindorf-Nord genauer
beleuchtet, um diese Effekte zu verdeutlichen. Von besonderem Interesse ist hier also
die auerschulische Bildungs- und Jugendarbeit. Obwohl den Schulen ebenfalls eine
besondere Bedeutung zukommt, werden sie hier nicht nher betrachtet, dennoch
erfolgt im abschlieenden Teil einen kurze Thematisierung.
Das Ziel dieses empirischen Teils liegt in der Bearbeitung und Darstellung der
Delinquenz der nichtdeutschen Jugendlichen und Heranwachsenden mit trkischem
Migrationshintergrund und ihren Einflussfaktoren im sozialkologischen Kontext auf
der Grundlage verschiedener, sich ergnzender Datenquellen und methodischer
Anstze. Die Untersuchung des Sozialraum Rheindorf-Nord gliedert sich in vier
Teile und enthlt sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Teil.
Einleitend wird der Sozialraum Leverkusen Rheindorf-Nord beschrieben und ein
kurzer Abriss ber die Geschichte, Geographie, Infrastruktur und Lage gegeben. Die
physischen Raumabgrenzungen werden anhand von Karten und deren Definition
dargestellt. Im folgenden Teil wird anhand der Grundlage der vom statistischen Amt
der Stadt Leverkusen bereitgestellten aktuellen Bevlkerungs- und Sozialdaten auf
Stadt- und Stadtviertelebene, die Analyse des Sozialraums Rheindorf-Nord
dargestellt. Ebenfalls werden die rumliche Situation und die Angebotsstruktur der
Jugendarbeit im Quartier dargestellt.
Des Weiteren wird eine deskriptive Analyse des Umfangs und der Struktur der
registrierten Kriminalitt mit besonderem Blick auf die Kriminalitt der
nichtdeutschen Bevlkerung und der Jugendlichen und Heranwachsenden gegeben.
Methodisch wird mit der Analyse der PKS sowie der Bevlkerungsstatistik anhand
dieser Daten gearbeitet. Um jugendspezifische Besonderheiten darzustellen, werden
alle Altersgruppen der Tatverdchtigen einbezogen. Bei dieser Darstellung wird nach
persnlichen, deliktspezifischen und rumlichen Gesichtspunkten unterschieden, so
kann eine mglicherweise hhere Belastung der nichtdeutschen Jugendlichen als
Tatverdchtige im Vergleich zu deutschen Jugendlichen und Heranwachsenden
bearbeitet werden. Die zu berprfenden Fragen lauten wie folgt:
Wie stellt sich die Kriminalitt in Rheindorf-Nord zurzeit dar?
Welche Rolle spielen die jungen Tatverdchtigen dabei?
Welche Deliktarten sind typisch?
Wie hoch ist der Anteil von Nichtdeutschen an der Zahl der Tatverdchtigen?
Welche sozialstrukturellen Problemkonzentrationen mit einer erhhten
Kriminalittsbelastung in Rheindorf-Nord korrelieren und welche Einflsse
71
Gelegenheitsstrukturen auf die rumliche Verteilung der Kriminalitt haben, soll
ebenfalls nachgegangen werden.
Aufgrund der Daten der Leverkusener Statistik konnten kleinrumliche
Kriminalittsschwerpunkte festgestellt und dargestellt werden. Wegen der
mangelnden statistischen Reprsentativitt aufgrund der begrenzten Anzahl der
Tatverdchtigen pro Erfassungszeitraum sind die analysierten Ergebnisse nur als
Darstellung relativer Unterschiede zu verstehen.
Aufgrund dieser nur begrenzt zu verwendenden Statistik erschien es bedeutend die
quantitative Analyse der Delinquenz der jungen Menschen und speziell der
nichtdeutschen in Rheindorf durch einen qualitativen Teil zu ergnzen, dem im
vierten Teil Platz eingerumt wird. Dort stehen Interviews mit lokalen Experten
(unter anderem mit Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen sowie Polizeibeamten),
trkischstmmigen Bewohnern und mit trkischstmmigen Jugendlichen und
Heranwachsenden im Mittelpunkt. Dabei waren besonders der Itegrationsgrad, die
Nutzung der Jugendeinrichtungen, bestimmte Gruppenbildungen und die allgemeine
Delinquenz im Stadtteil von Interesse. Die subjektive Betrachtungsweise des
Quartiers von den beteiligten Personen soll eingefangen, beschrieben und
ausgewertet werden. Zudem soll die Bewertung von lokalen Experten und
Expertinnen zur aktuellen Situation der Integration und der Lebenslagen von
trkischstmmigen jungen Menschen dargestellt werden. Dazu gehrten ebenfalls
mehrere Stadteilbegehungen, die im abschlieenden Teil kurz erlutert werden und
direkt in Prventivanstzen einflieen.
4.1 Leverkusen Rheindorf-Nord
Leverkusen in Nordrhein-Westfalen liegt nordstlich von
Kln und hat etwa 162.000 Einwohner und Einwohnerinnen.
Leverkusen wird besonders mit dem Welt-Pharmakonzern
Bayer AG und dessen Sportverein Bayer 04 Leverkusen
(BayArena) in Verbindung gebracht, auch das Leverkusener
Autobahnkreuz ist vielen ein Begriff. 1930 wurde die Stadt
Leverkusen mit 42.619 Einwohnern, durch eine Vereinigung
der Orte, Rheindorf, Schlebusch, Steinbchel und der Stadt
Wiesdorf gegrndet. 1949 siedelte die Denso-Chemie an der
(neuen) Wuppermndung an den Rhein an
(www.infoleverkusen.de).
Abb. 26: Leverkusener, Bayer-Kreuz, Quelle: www.wdr.de
Die Siedlung Rheindorf-Nord wurde 1957 errichtet, dabei richtete man sich nach
dem stdtebaulichen Stil der 50er Jahre. Ein Fehlbestand von Wohnungen in der
Nachkriegszeit zwang den Staat zur Frderung des Wohnungsbaues. Seit 1950
wurden dementsprechend viele Gebude gebaut, die breiten Schichten der
Bevlkerung Wohnraum boten (Sozialer Wohnungsbau). In der Folge der raschen
72
Industrialisierung wurde also vor dem Hintergrund der Stadterweiterungen und dem
raschen Bevlkerungswachstums in Rheindorf-Nord gebaut. Besonders fr die
Menschen, die aus den Gebieten Pommern, Schlesien und Ostpreuen zugezogen
sind sollte genug Wohnraum geschaffen werden. Seit den 60er Jahren (Zeit
wirtschaftlichen Wachstums) wurde von der groflchigen Siedlungsplanung der
50er Jahre Abstand genommen. Der soziale Wohnungsbau reduzierte sich erheblich
und konzentrierte sich vorwiegend auf
einkommensschwache Haushalte (Riege,
1993). Investitionen in den Stadtteil und
dessen Wohnungen wurden begrenzt und ein
baulicher Verfall ist vielerorts sichtbar. Seit
den 80er Jahren ist eine Ansiedlung von
Sptaussiedlern in Rheindorf-Nord zu
beobachten.
Der Wohnungsbestand im Quartier ist
unterschiedlich, prgend fr die Baustruktur
ist dennoch die Zeilenstruktur, die heute als
nicht mehr zeitgem gilt. Es sind
weitestgehend diese Sozialwohnungen aus
den fnfziger Jahren, die von Migranten
(inbegriffen Aussiedler) dominiert werden zu
finden, am Rande von Rheindorf-Nord sowie
in Rheindorf-Sd befinden sich kleinere
Gebiete mit Eigentums- und Mietwohnungen
sowie einige Reihenhuser und Eigenheime.
Abb. 27: Karte des Katasteramtes der Stadt Leverkusen,
DGK5 mit eingefrbten Grenzen und Barrieren
Rheindorf grenzt an Hitdorf, Wiesdorf (Deponie), Brrig, Kppersteg, Opladen und
Langenfeld. Das Gebiet ist durch die Autobahn vom Rhein getrennt, dies
beeintrchtigt die Freiraum- und Umweltqualitten. Als rumliche Grenzen und
Barrieren fr den Nordteil von Rheindorf knnen die Autobahn, die Bahnschienen
und die Schnellstrae gesehen werden sowie die natrlichen Waldgrenzen. Dadurch
ergibt sich eine rumliche Isolierung. Rheindorf-Sd und -Nord werden durch die
Schnellstrasse separiert. Durch Rheindorf-Nord und ferner daran vorbei (Abb. 25:
violett eingefrbt) fhrt eine Hauptverkehrsstrasse, die an der Sd-Ostseite einen
kleinen Teil an Husern ausgrenzt und eine Durchfahrtsfunktion innehat.
Der Knigsberger Platz (Vgl. Abb.25 Stern) bildet das kleine Zentrum des Stadtteils
und bietet einige Einkaufsmglichkeiten. Rheindorf-Nord hat kaum Angebote, die
eine gesamtstdtische Funktion haben, so bleibt die Bevlkerung weitestgehend
unter sich. Auch symbolische Identifikationspunkte und Merkzeichen sind kaum zu
finden, die befragten Jugendlichen wiesen aber eine Starke Identifikation mit
Leverkusen und Bayer auf und nannten als besonders prgendes Symbol das in
Abbildung 24 dargestellten Bayer-Kreuz. Das groe Kreuz der Evangelischen
73
Kirche, an einer der prgenden Hauptstrassen in Rheindorf-Nord, wird von den
befragten Jugendlichen und Bewohnern (alle nicht evangelisch) als ungnstig
beschrieben, obwohl es als Treffpunkt sehr beliebt ist.
In Rheindorf-Nord besteht ein erhhter Anteil an benachteiligten Bevlkerungs-
gruppen im Vergleich zu Leverkusen (vgl. 4.2). Es besteht durchaus die Gefahr der
Stigmatisierung des Stadtteils, wenn dies in begrenztem Rahmen nicht schon der Fall
ist. Aufgrund der Interviews mit Bewohnern aus Rheindorf lies sich dies allerdings
nur begrenzt besttigen. In Rheindorf-Nord liegen, die Kthe-Kollwitz-Gesamtschule
(KKS), eine Volkshochschule (VHS) und drei Grundschulen sowie mehrere
Kindergrten und Jugendeinrichtungen, die spter ausfhrlicher vorgestellt werden
sollen. Verkehrsanbindung hat Rheindorf-Nord durch eine S-Bahn-Linie und
mehrere Buslinien. Die Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur ist ausgezeichnet,
allerdings liegt die S-Bahnhaltestelle am Rande von Rheindorf, so dass viele
Bewohner Rheindorfs zu Fu eine weite Strecke zurcklegen mssen um sie
erreichen zu knnen. Kneipen und Gastronomie sind in umfassender Zahl vorhanden.
Es gibt auffllig viele kleine Kneipen und einige Speiselokale. Eine gute
landschaftliche Einbindung sowie viele Grnflchen stehen zur Verfgung, es sind
einige Wanderwege ins Umland zu finden, die von lteren Menschen und Familien
genutzt werden. Die Versorgung und soziale Infrastruktur wird als angemessen
beschrieben, dennoch lassen sich Defizite fr manche Bewohnergruppen aufzeigen.
4.2 Analyse des Sozialraumes anhand der Bevlkerungs- und
Sozialstrukturdaten
Abb. 28: Leverkusen-Rheindorf, Verhltnis der Bevlkerung;
Quelle: Eigene Berechnung nach der Statistikstelle LEV
In Leverkusen leben (nach Erhebungen im Jahr 2002) laut der Statistikstelle der
Stadt Leverkusen 161.931 Menschen. Davon leben in Rheindorf 16.396 Personen
(10,1% der Leverkusener Bevlkerung) und in Rheindorf-Nord 9.531 (5,9%). Damit
lebt der Groteil (ca.58%) der Rheindorfer Bevlkerung in Rheindorf-Nord.
74
Die Verteilung der Menschen in Rheindorf-Nord nach Geschlecht ist fast
ausgeglichen, wobei ein leicht erhhter Anteil an Frauen (52,2%) festzustellen ist.
Abb. 29(links): Anteil Nichtdeutscher und Deutscher an der Gesamtbevlkerung im
Vergleich; Quelle: Eigene Berechnung nach Angaben der Statistikstelle LEV, 2002
Abb. 30(rechts): Anteil unter 18-Jhriger Nichtdeutscher und Deutscher im
Vergleich, Quelle: S.o.
Insgesamt ist fr Rheindorf-Nord ein leicht erhhter Anteil
Nichtdeutscher im Vergleich zu Leverkusen festzustellen, besonders
in der Altersgruppe der unter 18-Jhrigen. Die Arbeitslosen- und
Sozialhilfequote liegt ebenfalls etwas ber dem Leverkusener
Durchschnitt. Alle Daten beruhen auf den Angaben der Statistikstelle
Leverkusen vom 31.12.2002. In Rheindorf-Nord beluft sich der
Anteil der Deutschen an der
Bevlkerung auf 86,7%, die
Nichtdeutschen machen 13,3%
(1.267) aus (Deutsche in Leverkusen
88%; Auslnder 12,%).
Rheindorf hat insgesamt 11,9%
nichtdeutsche Bewohner, das bedeutet
der Quartiersanteil ohne Rheindorf-
Nord betrgt nur 9,8% ein deutlich
geringerer Anteil.
ber ein Viertel der nichtdeutschen
Bevlkerung in Rheindorf-Nord ist
trkischer Herkunft.
Abb. 31: Ethnische Zusammensetzung der Gesamtbevlkerung in Rheindorf-Nord;
Quelle: Eigene Berechnung nach Angaben der Statistikstelle LEV, 2002
75
Insgesamt leben 325 Menschen mit
trkischer Staatsangehrigkeit in
Rheindorf-Nord. Die Mazedonier
bilden die zweitgrte Gruppe
gefolgt von den Italienern. Die Ex-
Jugoslawen sind mit 5% vertreten
und bilden nach den Marokkanern
mit 7% die fnftgrte Gruppe.
Besonders gro ist der Anteil der
nichtdeutschen unter 18-Jhrigen
von 18,7% in Rheindorf-Nord
(Leverkusen 13,1%, Rheindorf
gesamt 14,7%).
Abb. 32: Ethnische Zusammensetzung der nichtdeutschen unter 18-
Jhrigen in Rheindorf-Nord; Quelle: Eigene Berechnung nach
Angaben der Statistikstelle LEV, 2002
An den nichtdeutschen unter 18-Jhrigen machen die Trken 35%
aus, das heit sie bilden mit 117 Personen die grte nichtdeutsche
ethnische Gruppe von jungen Menschen unter 18 Jahren.
Die Bevlkerung in Rheindorf zeichnet sich also durch eine erhhte Anzahl junger
Menschen (unter 18) aus, die 19,7% der Bevlkerung stellen, in Rheindorf-Nord
stellen sie 19,4%. In Gesamt-Leverkusen liegt der Anteil dieser Gruppe bei 17,8%.
Im Stadtteil Rheindorf-Nord liegt der Anteil der nichtdeutschen Minderjhrigen an
der Gruppe der Minderjhrigen bei 18,7% (Leverkusen 15,3%; Rheindorf gesamt
14,7%). Als Grnde fr den starken Anteil der nichtdeutschen Minderjhrigen in
Rheindorf-Nord kommen zwei wesentliche Ursachen in Betracht, die sich beide
eindeutig statistisch belegen lassen. Zum einen ist das der generell hhere Anteil der
Nichtdeutschen in Rheindorf-Nord im Vergleich zu den anderen Stadtgebieten (vgl.
Abb:27), zum anderen ist aber auch in der Statistik auffllig, dass innerhalb des
Sozialraumes Rheindorf-Nord die Nichtdeutschen einen relativ gesehen hheren
Anteil an Minderjhrigen in ihrer Gruppe haben. So haben in Rheindorf-Nord 27,3%
der Nichtdeutschen die Volljhrigkeit noch nicht erreicht. Unter den Nichtdeutschen
in den anderen Stadtgebieten ist dieser Anteil wesentlich niedriger (Leverkusen
19,4%; Rheindorf gesamt 24,5%). Das bedeutet, dass in Rheindorf-Nord nicht nur
relativ mehr Nichtdeutsche leben, sondern diese auch mehr Nachkommen haben
(vgl. Alterstruktur der Nichtdeutschen in Abb. 33)
Vergleicht man in Rheindorf-Nord den Anteil der ber 60-Jhrigen unter den
deutschen und nichtdeutschen Bewohnern, so fllt ein starker Unterschied auf.
Whrend unter den deutschen Bewohnern dieser Anteil mit 33,4% selbst im
stadtweiten Vergleich ein extremer Wert ist (Leverkusen: 25,2%, Rheindorf gesamt
29,7%), so liegt er bei den Nichtdeutschen bei nur 8,1%, was ebenfalls ein
stadtweites Minimum ist (Leverkusen 11,3%, Rheindorf gesamt 8,4%).
76
Abb. 33: Struktur der Bevlkerung, Leverkusen-Rheindorf im Vergleich nach Alter
und Herkunft; Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der Statistikstelle LEV
Die Bevlkerungsentwicklung war im Jahre 2002 negativ (Bevlkerungsbilanz: -53),
es wurden 131 Kinder geboren und es wurden 184 Sterbeflle verzeichnet.
Die Wanderungsbilanz ist dagegen positiv, denn es wurden 1.160 Zuzge und 1.133
Fortzge in gesamt Rheindorf gemessen (Wanderungsbilanz: +27 positiv).
4.2.1 Arbeitslose und Sozialhilfeempfnger
Da die Stadt ihre Erhebungen der Arbeitslosen und
Sozialhilfeempfnger auf die Stadtteile beschrnkt,
knnen nur Aussagen betreffend Rheindorf gesamt und
Leverkusen getroffen werden. Fr Rheindorf ergibt sich
ein wesentlich hherer Anteil an Sozialhilfeempfngern
im Vergleich mit der Stadt Leverkusen. Liegt der Anteil
in Leverkusen noch bei 3,5% (5.681 Bezieher), so liegt
er in Rheindorf mit 5% (823 Bezieher) deutlich ber
dem Stadtdurchschnitt. Die Zusammensetzung der
Soziahilfeempfnger nach Altersgruppen verhlt sich
hnlich, wobei in Rheindorf (43,5%) der Anteil der
minderjhrigen Sozialhilfeempfnger gegenber in
Leverkusen (37,7%) leicht erhht ist.
Abb. 34: Sozialhilfe-Vergleich Rheindorf und LEV; Quelle: Eigene Berechnung,
Statistikstelle Leverkusen
77
Wesentlich interessanter und aufflliger ist die Unterscheidung nach der ethnischen
Herkunft. Hier zeigt sich, dass sowohl in Leverkusen als auch in Rheindorf
nichtdeutsche Sozialhilfeempfnger in der Gruppe der Minderjhrigen weniger stark
vertreten sind als in der Gruppe aller Sozialhilfeempfnger.
Setzt man die Anteile der nichtdeutschen Sozialhilfeempfnger in Relation zum
Anteil an der Gesamtbevlkerung so zeigt sich, dass Nichtdeutsche berproportional
stark unter den Empfngern vertreten sind. In Leverkusen wie in Rheindorf, sowohl
in der Gesamtgruppe als auch bei den Minderjhrigen, liegt der Anteil nichtdeutscher
Sozialhilfeempfnger deutlich ber der Auslnderquote.
Abb. 35: Sozialhilfe-Vergleich Deutsche und Nichtdeutsche in LEV und Rheindorf;
Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der Statistikstelle LEV
Auffllig ist allerdings, dass in Rheindorf in der Gruppe der Minderjhrigen fast ein
Verhltnis von 1:1 von nichtdeutschen Sozialhilfeempfngern zu ihrem Anteil an der
Bevlkerung erreicht wird.
Dies bedeutet nicht, dass es in Rheindorf nur wenige minderjhrige nichtdeutsche
Sozialhilfeempfnger gibt, sondern veranschaulicht vielmehr, dass in Rheindorf in
dieser Gruppe ethnische Herkunft kaum Einfluss auf die Bedrftigkeit hat.
Die Arbeitslosenquote in Rheindorf liegt mit 11,5% leicht ber dem Leverkusener
Durchschnitt (10,6%). Bezeichnend ist fr die gesamte Stadt der erhhte Anteil von
nichtdeutschen Arbeitslosen gegenber ihrem Bevlkerungsanteil.
78
Abb. 36: Arbeitslosenquote in verschiedenen Teilen der Bevlkerung in LEV und
Rheindorf; Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der Statistikstelle LEV
4.2.2 Rumliche Situation
In Leverkusen leben durchschnittlich 2,07
Personen in einem Haushalt, in Rheindorf
annhernd 2,23. In Rheindorf-Nord liegt die
durchschnittliche Haushaltsgre mit 2,27
Personen je Wohneinheit leicht darber.
In Rheindorf-Nord (56%) besteht wie im
brigen Leverkusen (70,7%) der grte Anteil
des Wohnungsbestandes aus Gebuden mit 1-2
Wohnungen. Allerdings ist dieser Zustand in
Rheindorf und Leverkusen gegenber
Rheindorf-Nord wesentlich strker ausgeprgt.
Der Anteil an Gebuden mit 3-6 Wohnungen
liegt stadtweit auf hnlichem Niveau bei 17,4-
19,4%. Besonders auffllig ist jedoch, dass in
Rheindorf-Nord besonders viele Gebude mit
mehr als sieben Wohnungen vorhanden sind.
Abb. 37: Haushaltsgre im Vergleich;
Quelle: Eigene Berechnung nach Daten der Statistikstelle LEV
79
Der Gebudetyp mit sieben und mehr
Wohnungen liegt mit 26,6% weit ber dem
Anteil in Leverkusen, was der dichteren
Besiedelung entspricht. Das spiegelt ebenfalls
den Baustil des sozialen Wohnungsbaus der
fnfziger Jahre wieder, der die Schaffung von
mglichst viel billigem Wohnraum zur
Unterbringung der Bevlkerung anstrebte.
Der Baustil passt heute nicht mehr zu den
individuellen und persnlichen Vorstellungen
eines groen Teils der Bevlkerung, das
spiegelt sich ebenfalls in der Bevlkerungs-
struktur wieder.
Abb.38: Rumliche Situation nach dem Merkmal Anzahl der Wohnungen (X) in
einem Gebude; Quelle: Eigene Berechnung der Statistikstelle LEV
4.2.3 Angebotsstruktur Jugendarbeit in Rheindorf-Nord
Jungen Menschen sind gem 11 KJHG die zur Frderung ihrer Entwicklung
erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfgung zu stellen. Sie sollen an den
Interessen junger Menschen anknpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet
werden, sie zur Selbstbestimmung befhigen und zu gesellschaftlicher Mitver-
antwortung und sozialem Engagement anregen und hinfhren.
Der Jugendpdagogik (auerhalb der Schule) hat nach Bhnisch (2001) die Aufgabe
die rumliche Aufflligkeit zu kanalisieren und ihrer Kriminalisierung entgegenzu
wirken. Ulrich Deinet (et. al. Rauschenberg, 2002) sieht der Kinder- und
Jugendarbeit eine wichtige prventive Aufgabe zukommen. Unabhngig von den
geographischen Rumen wird hier verstrkt subjektbezogen gearbeitet und erschliet
so nicht nur die Sozialrume der jungen Menschen sondern deren Lebensrume, die
nicht zwangslufig mit einem Sozialraum bereinstimmen (lndliche Rume etc.).
Besonders benachteiligte junge Menschen knnen dort Handlungen zur
Lebensbewltigung erproben und erlernen. Die Kinder- und Jugendarbeit ergnzt die
Arbeit der Schulen und der Familien, ist aber auch eine eigenstndige wichtige
Bildungseinrichtung, die ebenso fr junge Menschen Rume schaffen und
revitalisieren sollte. Die Kinder- und Jugendangebote in Rheindorf-Nord sind
gemischt und werden von unterschiedlichen Trgern und Organisationen angeboten.
Es ist anhand der Analyse der ffnungszeiten der Angebote im Quartier nach den
Berechnungen der Fachhochschule deutlich, dass die Angebote sich in den
Zeitrumen sehr berschneiden und fr Heranwachsende Defizite aufweisen.
Es werden drei Einrichtungen vorgestellt, die fr Jugendliche und Heranwachsende
entsprechende Angebote bieten.
80
Das Evangelische Jugendhaus in der Elbestrasse 4-6 bietet Aufenthaltsrume,
pdagogische Betreuung und unter anderem Tischtennis bis durchschnittlich 19.00
Uhr. Einmal die Woche wird jeweils ein Jungen- und ein Mdchentag gestaltet, an
denen das Haus sich ausschlielich fr die jeweilige Gruppe ffnet. Das Publikum
wird als gemischt beschrieben und viele Jugendliche und Kinder, unabhngig von
Ethnie, Alter und Geschlecht, treffen sich hier.
Im Jugendhaus in der Felderstrasse 160 begegnen sich ebenso junge Menschen aller
Ethnien ab 14 Jahren, denen ebenfalls einmal die Woche das Haus
geschlechtshomogen zur Verfgung steht. Das Haus bietet eine ausgezeichnete
Ausstattung und kann viel bieten. Nicht nur Billard und Kicker knnen gespielt
werden, hier sind Proberume fr Musik sowie Instrumente ebenso wie Computer
und Foto-Ausrstungen nutzbar (weiterhin Werkzeuge, Maschinen, Medien, etc.).
Fr grere Erlebnisse sorgen das persnliche Engagement eines Mitarbeiters, der
Trial anbietet sowie Ausflge und andere sportliche Aktivitten. Das Haus sieht sich
mit Einsparungen und Personalmangel konfrontiert. Das Gelnde ist weitrumig und
liegt direkt an einem See, das Haus hat in der Woche bis 21.00 Uhr geffnet sowie
jeden ersten und dritten Sonntag im Monat.
Das Jugend-MediaCaf der Katholischen Jugendwerke Leverkusen e.V. (in
Kooperation mit dem Bchereifrderverein Rheindorf und der Pfarrgemeinde Heilig
Kreuz Rheindorf) in der Memelstrasse 6 bietet eine Bcherei und eine kleine
Jugendecke sowie kostenlosen Zugriff auf das Internet an acht PC-Arbeitspltzen.
Das Internet kann allerdings nur Mittwoch bis Freitag zwischen 15-19.00 Uhr
genutzt werden. Schwerpunkt ist die Bcherei, die 1998 aus der ehemaligen
Stadtbibliothek Rheindorf hervorgegangen ist, und das Internetcaf. Auch hier wird
mit weiteren Einsparungen gerechnet, sogar eine Umsiedlung in die Schule wird
berlegt. Schon jetzt arbeiten 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ehrenamtlich mit,
um das MediaCaf aufrechtzuerhalten. Die Einrichtung wird weitestgehend von
deutschen Jugendlichen und Erwachsenen genutzt.
Zustzlich zu den drei Einrichtungen der offenen Jugendarbeit gibt es eine Vielzahl
an Vereinen, besonders zu nennen der TUS-Rheindorf 1892 e.V. in dem viele
Jugendliche und Heranwachsende den verschiedensten Sportarten nachgehen.
Besonders beliebt, unabhngig von der Altersgruppe, ist der Fuball, hier werden bis
zu 25 Mannschaften aller Altersklassen angeboten. Aber auch andere Sportarten, wie
Leichtathletik, Badminton, Handball, Teakwan-Do, Turnen oder Volleyball erfreuen
sich groer Beliebtheit. Hier findet wichtige Integrations- und Prventionsarbeit statt.
Die in Rheindorf-Nord lebenden Jugendlichen und Heranwachsenden haben auf den
ersten Blick durchaus ausreichende Freizeitmglichkeiten, dennoch sind mehr
sinnvolle Angebote zu schaffen, die bestimmte Themen aufgreifen, wie zum Beispiel
Migration, Gewalt oder Geschlechterverhltnis.
Abb. 39: Einrichtungen der offenen Jugendarbeit/ Aufenthaltsorte der
Jugendlichen und Heranwachsenden in Rheindorf Nord, eigene Einfrbung
Quelle: Karte des Katasteramtes der Stadt Leverkusen, DGK5
81
82
4.3 Deskriptive Analyse der polizeilich registrierten Kriminalitt fr
Rheindorf-Nord
Besonderen Blick wird auf die ethnische Herkunft der Jugendlichen und
Heranwachsenden gelegt, die kritisch wahrgenommen werden und auch nicht selten
als Tatverdchtige in Erscheinung treten. Die in der Kriminalittsberichterstattung
besonders hervorgehobenen und problematisierten/registrierten Personengruppen
sind besonders junge Menschen (Jugendliche) sowie die nichtdeutschen
Tatverdchtigen (Auslnder). Tatschlich sind auch in Rheindorf-Nord die
deutschen und die nichtdeutschen jungen Menschen im Verhltnis zu ihrem
Bevlkerungsanteil unter den polizeilich als tatverdchtig Registrierten (wie auch
landes- und bundesweit), quantitativ berreprsentiert. Der Darstellung und
Bewertung dieser Sachverhalte soll die vorliegende Analyse dienen. Besonders wird
die Entwicklung der Jugenddelinquenz und die der Heranwachsenden sowie die
Aufflligkeit von Nichtdeutschen in Rheindorf dargestellt werden.
Ausgangspunkt sind die fr die PKS aufbereiteten polizeilichen Daten zu
registrierten Straftaten und Tatverdchtigen fr zwlf ausgewhlte Straen in
Rheindorf-Nord. Auf die Vorbehalte und Einschrnkungen im Umgang und der
Bewertung dieser Statistiken wurde im ersten Teil dieser Arbeit bereits eingegangen,
sie gelten auch fr die hier dargestellten und errterten Befunde. Dennoch muss
nochmals erwhnt werden, dass bei der Interpretation und Bewertung dieser Zahlen,
(PKS = Anzeige- und Verdachtsstatistik) zu beachten ist, dass es sich lediglich um
Tatverdchtigenzahlen handelt. Ob berhaupt eine Straftat im Sinne der
Strafvorschriften vorliegt und ob der Tatverdchtige tatschlich als Tter berfhrt
wird, hat die Justiz noch zu prfen. Richtigerweise kann also nur bewertet werden, in
welchem Umfang Anzeige erstattet wurde und gegen welche Personen sich der
geuerte Tatverdacht gerichtet hat.
Fr die nichtdeutsche Bevlkerung knnen sich die in 3.1. beschriebenen
Verzerrungseffekte zu ihren Ungunsten auswirken, dies muss bercksichtigt werden.
Das Bundeskriminalamt wie auch das Statistische Bundesamt berechnen seit lngerer
Zeit nur noch Belastungszahlen (TV 100.000 Bewohner) fr Deutsche.
Ebenso wurde fr Rheindorf keine Staatsangehrigkeit vermerkt, die Auswertung der
Daten wurde anhand der Vornamen der Tatverdchtigen vorgenommen und hat nur
eine sehr begrenzte Aussagekraft. Dennoch sind anhand dieser Auswertung eventuell
sogar bessere Aussagen ber Jugendliche mit Migrationshintergrund zu treffen, da so
Einbrgerungen und eine eventuelle deutsche Staatsangehrigkeit ber die
Problemlage des Migrationshintergrund nicht wegtuschen knnen.
Der vorliegende polizeiliche Datensatz enthlt fr 538 tatverdchtige Personen, die
polizeilich erfasst wurden, den Vornamen, die Altersgruppe, das Geschlecht, die
Wohnadresse, das Delikt und den Tatort. Dabei sind einige Besonderheiten der
Statistik unbedingt zu beachten. Der Datensatz enthlt nicht die Tatverdchtigen, die
mit einem Delikt in Rheindorf Nord in Zusammenhang gebracht werden, sondern sie
enthlt lediglich Tatverdchtige, die bei ihrer polizeilichen Erfassung mit einem
Erstwohnsitz in Rheindorf-Nord amtlich registriert waren. Auerdem ist es von
83
zentraler Bedeutung, dass die hier vorliegende Statistik nicht alle Tatverdchtigen
mit einem Wohnsitz in Rheindorf-Nord umfasst, sondern nur fr zwlf ausgewhlte
Straen. Eine polizeiliche Statistik fr den Sozialraum Rheindorf oder Rheindorf-
Nord wird nicht explizit gefhrt. Die Polizei beschrnkt sich bei ihren Auswertungen
auf eine Einteilung von Leverkusen in einen sdlichen und einen nrdlichen Teil,
wobei als geographische Grenze, die von West nach Ost verlaufende Autobahn A1
verwendet wird. Aus diesen Grnden kann aus der vorliegenden Erhebung nur
bedingt auf die tatschlichen Kriminalittsverhltnisse geschlossen werden.
Trotzdem soll sie hier Verwendung finden, da sie zumindest fr die zwlf
ausgewhlten Straen plausible und anschauliche Daten liefert. Die in dem Datensatz
enthaltenen Straen sind die
Memel-,
Baumberger-,
Monheimer-,
Elbe-,
Warthe-,
Pregel-,
Oker-
Zschopaus-,
Oder-,
Saale- und
Weichselstrasse
sowie der
Knigsberger Platz.
(Abb. 38: Stern)
Abb. 40: Quelle der Karte: Stadt Leverkusen Katasteramt,
DGK5; eingezeichnete Straen des Datensatzes der PKS
84
4.3.1 Zur Bewertung der Kriminalittsentwicklung der rtlichen Fall-
und Tatverdchtigenzahlen
Zunchst wurde der Datensatz um das Merkmal der ethnischen Herkunft ergnzt,
indem die Vornamen in die Kategorien Deutsch und Nichtdeutsch eingeteilt wurden.
Mit Sicherheit kann so keine vollkommen fehlerfreie Differenzierung erfolgen, aber
dennoch ist eine mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffende Unterscheidung mglich.
Eindeutig den osteuropischen Sptaussiedlern zuzuordnenden Namen wurden dabei
als Deutsch eingestuft, da sie die deutsche Staatsangehrigkeit besitzen.
In diesem Zusammenhang ist zu erwhnen, dass der Datensatz bei zwei
Tatverdchtigen keinen Vornamen und Altergruppe enthielt. Darber hinaus war bei
einem weiteren die Altergruppe ebenfalls nicht bekannt. Dies fhrt bei manchen der
folgenden Grafiken zu Fehlerwerten, die gesondert hervorgehoben sind.
Abb. 41: Allgemeine Entwicklung der Tatverdchtigen seit 1999 in Leverkusen
Rheindorf-Nord in den ausgewhlten Straen;
Quelle: Polizeiliche Eingangsstatistik LEV, 2004
In den Jahren von 1999 bis 2002 bewegt sich die Anzahl der Tatverdchtigen (in den
ausgewhlten Straen) von Leverkusen Rheindorf-Nord in allen Altersgruppen und
damit auch insgesamt auf hnlichem Niveau. Dabei liegt die Anzahl der
Gesamttatverdchtigen zwischen 62 (2002) und 103 (1999).
Die Gruppe der Erwachsenen nimmt dabei den grten Teil der Tatverdchtigen ein.
Ihr Anteil bewegt sich zwischen 34% (1999) und 61% (2000). Der Anteil der
Heranwachsenden liegt zwischen 11% (1999) und 8% (2001/2002). Fr die
Jugendlichen liegt der Anteil stark schwankend zwischen 43% (1999) und 18%
(2000). Die Altersgruppe der Kinder bewegt sich anteilsmig auf niedrigem Niveau
mit dem Minimalwert von 6% (2001) und dem Maximalwert von 12% (1999).
85
Das Jahr 2003 stellt eine auergewhnliche Entwicklung dar. So steigt in allen
Altersgruppen die Anzahl der Tatverdchtigen sprunghaft an. Gegenber dem
Vorjahr 2002 (entspricht 100%) steigt die Anzahl der Tatverdchtigen insgesamt auf
347%. Auch fr die einzelnen Altersgruppen zeigt sich dieses Bild ohne Ausnahme
(Erwachsene 306%; Heranwachsende 340%; Jugendliche 447%; Kinder 500%).
Zeitweilige Zunahmen in Grenordnungen von ca. 10 Prozentpunkten gelten bei so
kleinen Datenstzen gegenber dem vorangegangenen Jahr als vernachlssigbar
(Fahrmeier, 2001). Gerade bei kleineren Stdten und Gemeinden muss unbedingt ein
lngerer Zeitverlauf betrachtet werden, da hier im Vergleich mit beispielsweise
einem ganzen Bundesland relativ hohe Schwankungen beobachtet werden, ohne dass
dies auf eine dauerhafte Niveaunderung hinweist.
Solche extremen Wachstumsraten wie fr den ausgewhlten Bereich von Rheindorf-
Nord festzustellen sind, sind allerdings damit nicht zu erklren. Leider stehen die
Werte fr das Jahr 2004 noch nicht zur Verfgung. Es muss also mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass bei der Erhebung und
Aufbereitung Fehler unterlaufen sind. Die zustndige Statistikstelle der Polizei
Leverkusen (PK-Sd) hat ausdrcklich auf die Mglichkeit hingewiesen, dass bei der
Aufstellung der so genannten Eingangsstatistik durch die Sachbearbeiter und
Sachbearbeiterinnen vor Ort durchaus Fehlerquellen entstehen, die sich dann bei
einem so kleinen Datensatz extrem auswirken.
Dies wird untermauert, wenn der Vergleich mit der Stadt Leverkusen erfolgt.
Abb. 42: Anzahl der TV in Leverkusen nach Altersgruppen;
Quelle: PKS Leverkusen 2004, eigene Berechnung
86
Hier zeigt sich ein anderes Bild. Dieser extreme Trend lsst sich in keinster Weise
und fr keine der Altersgruppen fr den Gesamtraum Leverkusen belegen.
Auch in Gesprchen mit der Polizei konnten keine Besttigung fr diesen Anstieg in
Rheindorf Nord gefunden werden. Es wurde aus subjektiver Sicht eher eine gleich
bleibende und stagnierende Situation beschrieben. Eine mgliche Erklrung kann
allerdings darin gesehen werden, dass die Bekmpfung der
Jugendgruppendelinquenz im Jahr 2003 ein wichtiges und politisch gewolltes
polizeiliches Ziel wurde. Dies fhrte zu einer bedeutenden Dunkelfeldaufhellung.
Das Projekt Jugend lste im Jahr 2002 die Einsatzkommission Jugend ab und ist
seit 2003 mit einer weiteren Mitarbeiterin (zu den drei bestehenden) verstrkt
worden. In der Leverkusener Kriminalstatistik wird ausdrcklich betont, dass die
auf einer Dunkelfeldaufhellung beruhende Steigerung nicht gleichbedeutend mit
einer tatschlichen Zunahme der Straftaten ist. Auerdem wird erwhnt, dass die
jhrliche Belastung in den verschiedenen Stadtteilen starken Schwankungen
unterliegt und damit eine direkte Vergleichbarkeit weder gegeben noch mglich ist.
Auerdem wird wie oben erwhnt auch keine stadtteilspezifische Statistik gefhrt.
Darber hinaus kommen in diesem Zusammenhang die so genannten Intensivtter
hinzu. Dies sind im Sinne der PKS Tter, die im Erfassungszeitraum (Kalenderjahr),
mindestens zwei Mal in Erscheinung getreten sind und mindestens fnf Straftaten
begangen haben (PKS Leverkusen, 2003). Zwar sind im vorliegenden Datensatz
Intensivtter mglicherweise zu erkennen, dennoch ist aufgrund von hufigen und
gngigen Vornamen keine eindeutige Zuordnung mglich, weshalb an dieser Stelle
darauf verzichtet werden soll.
4.3.1.1 Der Anteil der verschiedenen Deliktsgruppen der registrierten
Delinquenz junger Menschen
Fr die registrierte Kriminalitt zeigt sich bundesweit, dass der berwiegende Teil
der Delinquenz der jungen Menschen zur Kategorie der leichten und mittleren
Delinquenz zuzuordnen ist. Dies ist ebenfalls fr die ausgewhlten Straen von
Rheindorf-Nord festzustellen. Zu dieser Kategorie gehren berwiegend die als
Bagatelldelinquenz zu wertenden Fallgruppen der Sachbeschdigung und des
Ladendiebstahls.
Ausgenommen werden die gefhrliche und schwere Krperverletzung, der Handel
und die Einfuhr von Betubungsmitteln sowie der Diebstahl unter erschwerten
Umstnden. Diese fallen unter die Kategorie der schwereren Delikte. In der
Abbildung 41 wurden die typischen Delinquenztypen der Jahre 1999 bis 2003
zusammengefasst, um ein mglichst genaues Bild zu schaffen. Jugendtypische
Delinquenz ist hier der Ladendiebstahl (RN, 21%), gefolgt vom Diebstahl allgemein
und unter erschwerten Umstnden sowie leichten Diebsthlen. Der Anteil der
Krperverletzungen (undifferenziert) macht 18% der angezeigten Taten aus. Die
gefhrliche oder schwere Krperverletzung (8%) beinhaltet nach StGB ( 223a,
224-229 StGB) die mit einer Waffe (Schusswaffe/Messer) ausgefhrte oder zu
schwerwiegenden Verletzungen fhrende Krperverletzung. Darber hinaus
aber auch die von mehreren gemeinschaftlich begangene Krperverletzung
(223a).
Abb. 43: Delinquenz der unter 21jhrigen in den ausgewhlten Straen in
Rheindorf-Nord; Quelle: Polizeiliche Eingangsstatistik Leverkusen, 2004
Hier wird eine Rauferei an der mehrere J ugendliche mehr oder weniger
beteiligt sind, automatisch in eine Kategorie eingeordnet, die ihr nicht immer
angemessen erscheint. Das erklrt warum der Anteil von Delikten der
Kategorie gefhrliche und schwere Krperverletzung und damit der
Sammelkategorie Gewaltdelikte so hoch ausfllt.
J eder bzw. jede Fnfte der Tatverdchtigen unter 21 aus Rheindorf-Nord
wurde eines Ladendiebstahls bezichtigt, dies wird als jugendtypische
Delinquenz betrachtet. Ein enormer Anstieg der Tatverdchtigen in dieser
Deliktsgruppe kann gegebenenfalls durch eine bessere technische Ausstattung
(Videoberwachung) der Geschfte, der erhhten Aufmerksamkeit ihres
Personals, der Art der Warenprsentation oder im Anzeigeverhalten bedingt
werden. Das kann zu einer verstrkten Registrierung der oft aufflligen und
unprofessionell vorgehenden Ttergruppen fhren.
An dieser Stelle sei noch mal besonders darauf aufmerksam gemacht, dass
wenn in diesem Zusammenhang von Tatverdchtigen in Rheindorf-Nord
gesprochen wird diese Aussagen nur fr den betrachteten Teil von Rheindorf-
Nord Gltigkeit besitzen. Statistisch gesehen ist eine erhhte Aufflligkeit im
J ugendalter durchaus normal. Auch eine mehrmalige Aufflligkeit mit
Bagatelldelikten ist in diesen Lebensphasen durchaus hufig und weist nicht
zwingend auf eine zuknftige kriminelle Karriere hin.
87
88
4.3.1.2 Nichtdeutsche und deutsche Tatverdchtige im Vergleich
Trotz all der genannten methodischen Einschrnkungen und Probleme interessiert
gleichwohl in welchem Umfang die nichtdeutsche Bevlkerung im Vergleich zur
deutschen am rtlichen Kriminalittsgeschehen beteiligt ist. Denn auch wenn die
bekannten Verzerrungsfaktoren - soweit die verfgbaren Daten dies zulassen -
bercksichtigt werden, zeigt sich, dass sowohl im Lngsschnitt als auch im
Querschnittsvergleich die Gruppe der Nichtdeutschen mit einem, gemessen am
Bevlkerungsanteil, berdurchschnittlichen Beitrag zum registrierten
Deliktsaufkommen erfasst wird.
Um diesen Vergleich besonders aussagekrftig zu gestalten, bietet sich an ein
normiertes Ma zu verwenden, die Tatverdchtigenbelastungszahlen (TVBZ). Zieht
man dieses Ma heran, so wird ein direkter Vergleich von Deutschen und
Nichtdeutschen mglich, wobei die soziale Lage und die bekannten
Verzerrungseffekte unbercksichtigt bleiben. Die TVBZ einer Gruppe gibt darber
Auskunft wie viele Tatverdchtige auf 100.000 Menschen dieser Gruppe entfallen.
Fr Nordrhein-Westfalen (NRW) liegen fr die Gruppe der unter 21-jhrigen
verlssliche Zahlen vor. Hier zeigt sich, dass die nichtdeutsche Bevlkerung ber
einen Zeitraum von fast zehn Jahren stets wesentlich strker belastet ist. So kommen
auf 100.000 deutsche Bewohner im Mittel ca. 4.500 Tatverdchtige. Im Kontrast
dazu trifft auf 100.000 nichtdeutsche Bewohner fast die doppelte Anzahl von
durchschnittlich 8.500 Tatverdchtigen.
Abb. 45: TVBZ der deutschen und nichtdeutschen Bevlkerung unter 21 Jahren in
NRW; Quelle: PKS, NRW 2003
89
Betrachtet man den Anteil der Nichtdeutschen in den verschiedenen Altersgruppen
an der Zahl der Tatverdchtigen fr Leverkusen, so besttigen sich die
Beobachtungen von NRW. Auch hier sind die nichtdeutschen Tatverdchtigen
gegenber ihrem Anteil an der Bevlkerung berreprsentiert. Die folgende
Abbildung zeigt die ethnische Zusammensetzung der TV in Leverkusen fr die Jahre
2001 bis 2003 nach Altergruppen, wobei das Merkmal des Alters durch die Variable
X beschrieben wird. Besonders hoch ist der Anteil der Nichtdeutschen in der
Altersgruppe der Heranwachsenden.
Abb. 46: Anteil der nichtdeutschen Tatverdchtigen in den Altersgruppen in LEV;
Quelle: PKS, NRW 2003
An dieser Stelle sei kurz ein Wiederholung der genannten Bewertungsprobleme des
Vergleiches zwischen deutschen und nichtdeutschen TV dargestellt. Die
Kriminalittsbelastung der Deutschen und Nichtdeutschen kann besonders angesichts
der ungleichen strukturellen Zusammensetzung wie Alters-, Geschlechts- und
Sozialstruktur nicht vergleichbar sein. Denn diese sind im Vergleich zur deutschen
Bevlkerung durchschnittlich jnger und hufiger mnnlichen Geschlechts. Sie
unterliegen also gerade in den jungen Altersgruppen einer erhhten Gefahr als
Tatverdchtige polizeiauffllig zu werden.
Die PKS weist in ihren statistischen Datendarstellungen weiterhin darauf hin, dass
die Nichtdeutschen ebenfalls hufiger in Grostdten leben und zu einem greren
Anteil der unteren Einkommens- und Bildungsschichte angehren sowie hufiger
von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Verste gegen das Auslndergesetz erhhen
ihrerseits die Statistik, ebenso wie die Registrierung von Illegalen, Gsten, Touristen/
Durchreisenden, Grenzpendlern und Stationierungsstreitkrften. Auch in dem hier
betrachteten Bereich von Rheindorf-Nord finden sich hnliche Verhltnisse, die
90
nichtdeutsche Bevlkerung ist ebenfalls stark bergewichtet vertreten. Auf eine
genauere Analyse wird aufgrund des oben genannten Defekts nicht eingegangen.
Abb. 47: Ethnische Zugehrigkeit der Tatverdchtigen in Rheindorf-Nord aus den
ausgewhlten Straen; Quelle: Polizeiliche Eingangsstatistik LEV, 1999-2003
4.3.1.3 Konzentration der Tatorte und Tterwohnorte
Fr eine teilraumspezifische Kriminalittsanalyse sind sowohl der Wohnsitz der
Tatverdchtigen, die Tatorte der Straftaten als auch die Tatort-Wohnort-Beziehung
von Interesse. Shaw und McCay (1969) entwickelten Theorien, die kriminelle und
physische Umgebung miteinander in Verbindung bringen, weiter und entwickelten
eine rumliche Ttertheorie. Wohndichte von Ttern und Tterinnen soll sich nach
ihnen auf bestimmte Gebiete im Quartier konzentrieren, die sind ebenfalls mit
vermehrt auftretenden sozialen Problemen belastet ist. So msste sich die Belastung
der Tatverdchtigen besonders in jenen Straenabschnitten konzentrieren, die einen
erhhten Anteil an sozial belasteter Bevlkerung in Sozialwohnungen mit geringer
Wohnqualitt aufweisen. Bisher konnte kein direkter Zusammenhang zwischen
Kriminalitt und der Art des Wohngebudes sicher nachgewiesen werden
(Jehle, 1996), dennoch wird dies auch in Rheindorf-Nord deutlich. Soziale Belastung
und Anzahl der Tatverdchtigen konzentriert sich auf bestimmte Straen und Pltze
(vgl. Abb. 48).
91
Abb. 48: Eigene Berechnung; TV, ihre Wohnorte und Anzahl der Taten in Rheindorf-
Nord nach der polizeilichen Eingangsstatistik LEV, 1999-2003
In diesem Zusammenhang, ist auch der Sachverhalt interessant, wo die
Tatverdchtigen amtlich gemeldet sind, was nicht immer mit dem tatschlichen
Wohnort bereinstimmen muss.
Hier fallen besonders die Elbestrae die Monheimer Strae, die Baumberger Strae
und der Knigsberger Platz auf. Einerseits ist die unterschiedlich hohe
Anwohnerzahl ausschlaggebend andererseits die Gelegenheitsstruktur der Orte. In
Abb.48 werden nicht nur die hufigsten Wohnorte der Tatverdchtigen gezeigt,
sondern auch die ihnen zugeordneten Deliktanzahlen. Erklrend muss erwhnt
werden, dass die Straen sich in ihrer Lnge und damit Anwohnerzahl stark
unterscheiden. Ein unmittelbarer Rckschluss auf die tatschlichen Verhltnisse der
Belastungen der verschiednen Straen zueinander kann deshalb nicht erfolgen. Im
Verhltnis zueinander fllt besonders die Warthestrae auf, in dieser kommen auf die
zwlf TV jeweils im Durchschnitt 5,6 Delikte. Dass hier eventuell ein
Kriminellenschwerpunkt vorliegt und/oder mehrere Mehrfachtter fr die
Erhhung verantwortlich sind, kann nur gemutmat werden.
Die Chicagoer Schule befasste sich mit dem Wohnort von Strafttern und dem
Quartier. Spter rckten auch die von diesen Strafttern ausgewhlte Tatorte in den
Mittelpunkt des Interesses. Die Entscheidungsprozesse der Tter wurden nach Brown
und Altmann (1981) in einem Konzept zusammengefasst. Nach diesem sind vor
allem die Entdeckungsmglichkeit, faktische Hindernisse, symbolische Hindernisse
und das soziale Klima von Bedeutung.
92
Abb. 49: Eigene Berechnung der Anzahl von Tatorte der TV der ausgesuchten
Straen; Quelle: Polizeiliche Eingangsstatistik LEV, 1999-2003
Abbildung 49 zeigt die von den oben genannten Tatverdchtigen ausgewhlten
Tatorte, die ber fnfmal frequentiert wurden. Deutlich wird, dass gerade die durch
deutlich negative strukturelle Merkmale gekennzeichnet Straen, wie der
Knigsberger Platz, der Wiesdorfer Platz und die Monheimer Strae, eine erhhte
Verdichtung der Tatorte aufweisen. Die zentrumsnahe Gegend am Knigsberger
Platz bietet zustzlich eine Gelegenheitsstruktur im halbffentlichen und ffentlichen
Raum, die durch Geschfte und Ladenlokale geprgt ist. Als Treffpunkt fr soziale
Kontakte wird der Knigsberger Platz vor allem bevorzugt in den Abendstunden von
sozialen Randgruppen frequentiert.
Abschlieend kann gesagt werden, dass es einer qualitativen Analyse bedarf, um eine
zutreffende Aussage zur Delinquenzbelastung der nichtdeutschen Bevlkerung zu
machen. Die Kriminalstatistik ist mit Vorsicht zu beschreiben und zu bewerten und
lsst leider keine detaillierten aussagekrftigen Schlsse zu. Besonders um die
Merkmale sozialer Randstndigkeit und die Besonderheit der Delinquenz von
trkischstmmigen jungen Menschen und jungen Menschen im Allgemeinen zu
beleuchten, ist das Erfahrungspotenzial der Experten und Expertinnen von
Bedeutung. Ihnen msste durch den Kontakt zu den betreffenden jungen Menschen
eine Einschtzung der Integration und sozialer Lagen mglich sein. Aber auch
trkischstmmige Bewohner und den jungen Menschen selbst wird die Kompetenz
einer Bewertung der Lage zugesprochen.
4.4 Qualitative Analyse
Durch den qualitativen Ansatz kommen alle Akteure und Personen zu Wort, die mit
den jungen Menschen in Verbindung stehen sowie die jungen Menschen selbst.
Allerdings knnen so Lcken und Selektionen seitens der befragten Personen nicht
ausgeschlossen werden, eine Reprsentativitt ist also nicht gegeben. Eventuell
wurden so nicht alle Sichtweisen und Perspektiven dargestellt und aufgegriffen.
Ebenfalls sind mgliche Vernderungen innerhalb von Rheindorf-Nord bezglich
Gruppen oder Orten zu bercksichtigen. Hinweise auf Problembereiche und eine
Darstellung der Lebenswelt der Zielgruppe, die der realen Situation in Rheindorf-
Nord entspricht, waren dennoch gegeben. Es wurden ausschlielich Face-To-Face
Interviews durchgefhrt. Diese wurden als Leitfadengesprche gefhrt, die eine hohe
Bereitschaft der Befragten zur Mitarbeit und sprachliche Kompetenz verlangen, es
wurden sowohl offene als auch geschlossene Fragen gestellt (Schnell; Hill; Esser,
1999). Die bei diesem Verfahren zu erwartenden Schwierigkeiten bezglich der
Vergleichbarkeit und der schwierigen Auswertung traten ebenso auf, wie eine
begrenzte Gltigkeit und Zuverlssigkeit der Antworten. Allerdings konnten so
Schwerpunkte von den Befragten selber gesetzt werden und das spontane
Kommunikationsverhalten wurde untersttzt (Hopf, 1978).
Die Gesprche wurden auf Tonband aufgenommen und im Anschluss der
schriftlichen und inhaltlichen Ausarbeitung wieder gelscht. Die als allgemein
bedeutend geltenden Aussagen werden im Wortlaut wiedergegeben.
4.4.1 Interviews mit trkischstmmigen Bewohnern und
Bewohnerinnen
Die befragten trkischstmmigen Bewohner und Bewohnerinnen antworten dabei in
erster Linie in einer Funktion als Beobachter und Akteure in ihrer sozialen
Umgebung. Es wurden insgesamt drei Familien (7 Personen) befragt. Alle befragten
Eltern hatten Kinder im Alter zwischen 3 und 22 J ahren und waren in der zweiten
Generation trkischer Herkunft (Aufenthaltsdauer zwischen 20 und 35 J ahren). Sie
leben im Sozialraum Rheindorf-Nord, und die Kinder gehen/gingen dort auch zur
Schule (teilweise sie selbst ebenfalls). In den Familien gab es keine schwerwiegende
Delinquenz der Kinder, aber von zwei jungen Erwachsenen wurde von Diebsthlen
im Kindesalter berichtet, was aber als Ausrutscher benannt wurde. Interesse bestand
besonders an der persnlichen Erfahrung als trkische Familie und Person in
Rheindorf-Nord und der Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld und dem subjektiven
Sicherheitsgefhl. Weiterhin waren die persnlichen Kontakte zu Nachbarn und
anderen Familien, Vereinen, Schulen und ihr Bezug zur Religion und der Trkei
interessant. Alle befragten Personen sprachen sehr gut Deutsch, da die Form des
Interviews beiderseits eine gewisse sprachliche Kompetenz verlangt. So kamen nur
Familien in Frage, denen schon ein hoher Integrationsgrad zuzuordnen ist (vgl. dazu
Studie, Heitmeyer 3.3.6). Dies konnte besttigt werden, alle Personen sprachen ihrer
eigenen und der Integration ihrer Kinder ein gutes Zeugnis aus. Zwei hatten bereits
93
die deutsche Staatsangehrigkeit angenommen, drei Personen hatten die Absicht.
Die Rckkehrwnsche bestanden bei allen Befragten in einer Form des Pendeln,
wie die Eltern das machen, Sommer Trkei, Winter Deutschland. Die Befragten
waren alle islamischen Glaubens und besuchen in unterschiedlicher Intensitt
Moscheen und Vereine. Eine Diskrepanz zum Leben in einer deutschen Kultur und
Probleme dadurch wurden verneint. Fr die Kinder wurden Besuche ebenfalls
angestrebt, es wird versucht ber den Glauben Werte und Wissen zu vermitteln.
Die Kinder besuchen regelmig die stdtische Koranschule in Leverkusen, wenn
kein Fuballspiel ist (eine Mutter). Ein fehlendes Angebot fr Muslime in
Rheindorf-Nord wurde zwar festgestellt, eine Vernderung dagegen nicht erwartet.
Die interviewten Eltern und Kinder nutzen sowohl trkische Medien als auch
deutsche. Trkische Medien wurden genutzt, um sich auf dem Laufenden zu
halten, Zeitung und Fernsehen. Keine der Familien konnte ber erhebliche
Diskriminierungs-Erfahrungen berichten, gelegentliche Erlebnisse (die gucken mal
doof, die denken ich bin unterdrckt) wurden als nicht gravierend eingestuft.
Eine Mutter berichtete, dass sie auf Kommentare (seitens lterer Bewohner) direkt
reagiere und das Gesprch sucht, um so die Situation auf freundliche Art und Weise
zu bereinigen. Auch von seitens der Institutionen wurde ber keine Diskriminierung
berichtet, die Eltern sind selbst schon in Deutschland ihrer Schullaufbahn
nachgegangen und kennen sich dort gut aus. Die fr trkische Familien
beschriebenen defizitren Kenntnisse ber die Institutionen waren hier nicht
gegeben. Keines der Kinder aus den befragten Familien besucht ein Gymnasium,
dennoch wird fr die noch jngeren Kinder, die zurzeit die Gesamtschule besuchen,
ein hherer Abschluss angestrebt.
Der schulischen Laufbahn der Kinder wird viel Wert beigemessen und die Familien
sind in der Lage entsprechende Untersttzung zu bieten. Die Befragten wiesen alle
einen heterogenen Freundes- und Bekanntenkreis auf, keiner hatte ausschlielich
inner-ethnische Kontakte (ebenfalls die Kinder). Da die Mnner alle berufsttig
waren, wurde die wirtschaftliche Lage gut eingeschtzt, auch einen Rollen-Konflikt
sah keine der Familien besttigt (im Koran sind Mann und Frau gleichviel wert).
Eine der Frauen, die ebenfalls halbtags berufsttig ist, sagte: wir leben nach dem
Koran gleichberechtigt. Dass ich auch arbeite, ist da kein Problem, sogar wichtig fr
die Kinder - als Vorbild. Fr die Kinder der dritten Generation wurde kritisch
festgestellt, unsere Kinder haben keine Probleme, die machen das durch Sport und
Religion, haben viele Freunde. Konflikte werden erst schlimm, wenn da keine
Perspektive mehr ist. Auch die befragten trkischen Familien differenzieren klar
nach sozialen Bedingungen und sehen keine ethnischen Konflikte als Basis fr
Delinquenz. Probleme gibts nur wenn vieles zusammen kommt, wie bei den
Deutschen auch.
Zu Fragen zum Sicherheitsempfinden im Quartier wurde weitestgehend positiv
geantwortet. Die Frauen gaben allerdings an besonders abends nicht mehr gern raus
gehen zu wollen. Zur sozialen Integration im Stadtteil nannten einige den
Knigsberger Platz als hemmend (also dort findet nichts statt, den finde ich
94
unangenehm, Penner und Leute, die nichts zu tun haben.). Besonders bedeutend fr
die Integration der Kinder wurden die Sportvereine und Schulen genannt (dort
haben die mit allen Kontakt, in einer Mannschaft gibt es alle mglichen Kinder,
hier knnen sie viel lernen, meine haben aus ihren Klassen viele unterschiedliche
Freunde, ich finde das wichtig). Besonders sehen die Familien die
Integrationsprobleme seitens der Trken in Rheindorf als weniger gravierend (es
gibt zwar welche, die nicht wollen, aber die meisten bemhen sich und kommen gut
klar). Fr Rheindorf wird eine andere Gruppe als wenig integriert gesehen: die
Russen haben mehr Probleme. Die Aussiedler wurden als wenig integrationsfreudig
gesehen, allerdings geht auch Kritik an die deutschen Bewohner (seitens der
Deutschen msste auch mal mehr kommen).
Fr die Kinder und J ugendlichen wird sich eine interkulturelle Begegnungssttte
gewnscht, die unter besonderer pdagogischer Betreuung die Kommunikation der
Generationen und der Kulturen ermglicht. Die vorhandenen Huser in Rheindorf-
Nord wurden seitens zwei Familien als dafr weniger geeignet beschrieben.
Der Bezug zu Rheindorf bzw. Leverkusen ist durch die Sportvereine und die
Berufsttigkeit bei Bayer sehr hoch (die Kinder nicht so, aber fr uns und die
J ugendlichen ist der Bezug zu Leverkusen gro., mein Vater hat schon da
gearbeitet., Wir haben immer hier gewohnt). Das soziale Leben auerhalb der
Familie spielt sich jedoch weitestgehend auerhalb von Rheindorf-Nord ab, dort wird
religisen und sportlichen Aktivitten nachgegangen und die meisten Einkufe
erledigt.
Festhaltend ist zu sagen, dass die befragten trkischen Bewohner in Rheindorf-Nord
keine wesentlichen Integrationsprobleme sehen und sich ebenso integriert fhlen.
Ihre Kinder sind sehr wohl in der Lage den Spagat zwischen den Kulturen zu
schaffen und ihre Perspektiven als trkischstmmige Deutsche positiv
wahrzunehmen. Da die Familien alle der Mittelschicht zuzuordnen sind, muss an
dieser Stelle offen bleiben wie sich die Situation fr sozial und integrativ schlechter
gestellte Familien darstellt.
4.4.2 Interviews mit trkischstmmigen J ugendlichen und
Heranwachsenden aus Rheindorf
Es wurden drei junge Menschen aus Rheindorf-Nord befragt, sie dienten ebenfalls
als Beobachter ihres Lebensraums aus trkischstmmiger Sicht und als junge
Menschen in Rheindorf-Nord. Interessant waren schulische-, Peer- und psycho-
soziale Faktoren sowie Aufenthaltsrume und Aktionsrume, um die Lebenswelt
und Sichtweisen von trkischstmmigen Rheindorfer J ugendlichen einzufangen.
Methodisch wurde mit einer Mischung aus strukturiertem und offenem Interview fr
die Zielgruppe gearbeitet (Glinka, 1998). Nur wenige Oberpunkte wurden
festgehalten, so konnten die jungen Menschen ihre Schwerpunkte frei whlen. Die
Interviews wurden offen gefhrt und ebenfalls auf Tonband aufgezeichnet.
Die Interviewten waren 15, 18 und 21 J ahre alt und trkischer Herkunft. Eine junge
Frau (18) war vertreten. Zwei besaen bereits die deutsche Staatsangehrigkeit.
95
Allen Befragten waren ausreichend gute Deutschkenntnisse zu Eigen und wurden
bereits als dritte Generation in Deutschland geboren. Ihre Groeltern immigrierten
als damalige Gastarbeiter nach Deutschland, die Groeltern (die noch leben) sind
heute noch in Deutschland, sie pendeln zwischen alter und neuer Heimat hin und her.
Die Befragten beschrieben, dass sie und die eigenen Eltern nur gelegentlich fr einen
Besuch der Verwandten in die Trkei reisen, der Kontakt wird weitestgehend ber
Telefon und Post gehalten. Der Kontakt der Eltern zu diesen wird als ganz gut
beschrieben. Der eigene Bezug wird mit geht so oder ich hab die voll lange nicht
mehr gesehen beschrieben. Alle drei fhlen sich dennoch als Deutsch-Trken, halt
ne Mischung. Einer nennt sich Leverkusener-Trke mit deutschem Pass(lacht).
Die schulische Situation wird bei allen als befriedigend beschrieben (eine Mutter
ergnzt knnte besser sein).
Der 21 jhrige junge Mann besucht ein Berufskolleg in Leverkusen und beschwert
sich ber die Fahrerei. Er hatte keine Probleme in der Gesamtschule: Meine
Mutter ging ja auch schon hier zu Schule die Gegend hier ist okay... denke in
Wiesdorf oder so ist es schlimmer.
Zu den J ugendeinrichtungen sagt er: Meinen Bruder lass ich da alleine nicht gern
hin...ich war viel am Sportplatz und ab und zu im Park (oft auch in Opladen), aber
da?. Bei den befragten jungen Menschen und trkischstmmigen Bewohnern und
Bewohnerinnen ist auffllig, dass keiner die J ugendeinrichtungen besonders nutzt.
Diese Tatsache kann durch das groe sportliche Engagement der Befragten erklrt
werden.
Er beschreibt kritisch, dass vielen J ungen (auch den trkischen) oft richtige
Vorbilder fehlen, dies wirke sich dann in Situationen der Langeweile negativ aus.
dann machen die halt Bldsinn, wenn die jemanden htten, nach dem die sich
richten knnen.... Die Situation der trkischstmmigen Bevlkerung in Rheindorf
wird seinerseits positiv beschrieben. Er differenziert sehr stark zwischen dem
berufsttigen und nichtberufsttigen Bevlkerungsteil: die, die keine Arbeit
haben, knnen ihren Kindern keine Werte mehr vermitteln. Die Frage zur
Religion beantwortet er knapp mit ich gehe mit meinem Vater gelegentlich in die
Moschee.
Die junge Frau beschreibt, dass ihre Freundinnen in Leverkusen wohnen (hier habe
ich nur eine Freundin). Die Kontakte entstanden durch die dortige Koranschule. Sie
beschreibt Rheindorf-Nord als in Ordnung, fr sie wren mehr Internet-
Mglichkeiten nur fr Mdchen wichtig. Sie trgt zurzeit kein Kopftuch, aber sagt
spter vielleicht, ihr ist die Religion wichtiger als den befragten J ungen. Das hlt
mich und ich fhl mich stolz sagt sie und macht von Ihrem Beruf abhngig, ob
sie Kopftuch tragen knnte oder nicht: Danach richte ich mich dann. Sie beschreibt
ihre Lebenswelt als durchweg positiv und die Zukunft hoffnungsvoll. Eine
verschrfte Lage bezglich der Delinquenz in Rheindorf kann sie nicht feststellen,
es ist sogar besser geworden.
96
Der fnfzehjhrige J unge misst seiner schulischen Laufbahn keine sonderlich hohe
Bedeutung bei: Ich werde Fuballprofi. Seinen Eltern ist mehr daran gelegen, sie
schicken ihn zur Nachhilfe, das wird seinerseits kritisch gesehen. Er betont seine
Noten wren ausreichend gut (nicht mal ne fnf). Er betont ausdrcklich, dass
seine deutschen Freunde schlechter in der Schule seien. Seinen Freundeskreis
beschreibt er als gemischt (Araber, Deutsche, Russen alles). Als liebste
Freizeitbeschftigung nennt er das Fuballspielen und ebenfalls das Angucken von
Fuballspielen (die BayArena ist total cool), weiterhin nennt er das Fernsehen
gucken (Video) und zocken beim(Freund). Zu den J ugendhusern bemerkt er
nur ja, ab und zu zum Billard, aber nur seltenzu viele Groeund Tischtennis
mag ich nicht so. Er besucht ebenfalls die Koranschule im Leverkusener
Kulturzentrum, uert sich jedoch nur kurz dazu (das ist ganz gut, meiner Mutter ist
das sehr wichtig).
Auf die Frage nach seiner Einschtzung von Delinquenz im Quartier antwortet er mit
der Erzhlung ber eine Schlgerei mit einem deutschen Freund (der kam mir
voll doof, jetzt ist aber wieder alles ok, wir haben uns entschuldigt, beide!). Wenn
jemand doof guckt, ist mir das doch egalund sonstalso ich kann ja deutsch. Er
berichtet von einem J ungen, dessen schlechte Deutschkenntnisse des fteren Anlass
fr Hnseleien bieten, (den rgern die voll oft deswegen...der tut mir immer leid).
Er berichtet von einem weiteren Freund, der in Wiesdorf zur Schule geht: Den
haben so J ungs, aber ltere, abgezogen. Handy, Geld alles wegbestimmt fr
Drogen. An der Schule da ist es voll schlimm, die ziehn einen in der Pause ab, aber
hier an der Schule nicht. Zu Drogen uert er sich sehr verchtlich: ja manche
kiffen, aber da wird man langsam von.
Alle Befragten wiesen eine stabile Ich-Identitt auf und berichteten von keinerlei
Diskriminierungserfahrung. Fr die Befragten spielt die Religion in der Lebenswelt
eine unterschiedliche, jedoch immer eine gewisse Rolle, was den Studien zur
Bedeutung der Religion fr junge Muslime entspricht. Keiner hatte Kontakt zu
delinquenten Peers/Cliquen. Sie beschrieben (oder hatten bereits) Zugangschancen
zum Arbeitsmarkt genutzt oder sahen diese positiv. Delinquente
Gelegenheitsstrukturen konnten nicht besttigt werden, die Freizeitgestaltung
konzentrierte sich jedoch bei den lteren bereits deutlich auerhalb von Rheindorf-
Nord und war tendenziell auch darber geprgt. Die Freizeitangebote wurden
ihrerseits (fr Heranwachsende) eher negativ eingestuft. Der jngere Befragte
uerte sich deutlich positiver (ja hier ist doch voll viel, wir sind immer drauen).
Durch den eigenen Sportverein sowie den Fuballverein Bayer-Leverkusen ergaben
sich jedoch Identifikationen, die verstrkt auf Stadtebene lagen. Eine rumliche
Bindung und Orientierung am Quartier konnte nur begrenzt festgestellt werden. Die
Befragten uerten sich positiv ber den Assimiliationsgrad ihrer Eltern und die
eigenen Integration. Verstrkte Benachteiligung aufgrund des Migrations-
hintergrunds konnten nicht benannt werden. Als Orte, an denen sich ihrer Meinung
nach besonders Delinquenz ereignet, sind der Park und der Knigsberger Platz, auch
die S-Bahn Station (abends/nachts) ist zu nennen. Die beiden lteren Befragten
gehen von einer Vernderung der Qualitt der Gewalt aus: Was die Kleinen heute
97
schon alles im Fernsehen sehn, da ist Rambo ja harmlos gegen. Ein Nachahmen der
Fernsehidole wird vermutet, besonders kritisch werden Manga-Filme (Anime-
Zeichentrick) angemerkt, in denen unrealistische Gewalt auf Kinder zugeschnitten
gezeigt wird. Besondere Bemhungen sollten ihren Meinungen nach den Aussiedler-
J ugendlichen zuzukommen. Die werden wohl oft zu Hause geschlagen und selber
sind einige auch gut dabei (hier wird der Alkohol gemeint). Ideen und
Vorstellungen waren besondere Betreuung dieser Zielgruppe sowie allgemein mehr
Mglichkeiten fr junge Erwachsene. Die Betreuung von trkische Migranten im
Allgemeinen und die Einrichtungen fr junge Menschen werden als ausreichend
beschrieben (da ist doch fr jeden was dabei). Positiv erwhnt werden hier
besonders die Caritas und der TUS-Rheindorf.
4.4.3 Interviews mit dem J ugendamt, der J ugendgerichtshilfe und
Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeitern der J ugendeinrichtungen
Es wurden Gesprche mit den zustndigen Personen des J ugendamtes gefhrt,
whrend bei einem der Termine der Leiter eines der J ugendhuser teilnahm.
Auerdem konnten weitere Gesprche mit vier Mitarbeitern in den beiden
J ugendhusern durchfhrt werden. Darber hinaus wurde noch ein Gesprch mit
einer Mitarbeiterin einer weiteren Einrichtung durchgefhrt und ein Besuch bei der
zustndigen Mitarbeiterin der J ugendgerichtshilfe fr Rheindorf-Nord abgestattet.
Festzuhalten ist vor allem, dass keine rein trkischstmmigen Gruppen festzustellen
sind und die Integration der jungen trkischstmmigen Menschen mittlerweile als
positiv eingestuft wird. Gruppen, die sich bilden, sind - ausgenommen von denen der
jungen Aussiedler - eher lose Cliquen, die sich aus Interesse finden und auch wieder
lsen. Zu den beliebtesten Treffpunkten gehrt eine Schranke vor einem der
J ugendhuser. Dieser wird von den Heranwachsenden mit Autos auch als Treffpunkt
fr abendliche Diskothekenbesuche genutzt. Des Weiteren werden die
Bushaltestellen genannt, die den jungen Menschen als Austauschplatz dienen (im
Winter, jetzt zwar nicht unbedingt), bei Ortsbegehungen waren diese Pltze jedoch
auch bei schlechtem Wetter von jungen Leuten frequentiert.
Dass die Auseinandersetzungen unter den J ugendlichen gewaltttiger geworden
seien, wird ambivalent gesehen (Wir knnen keinen qualitativen Anstieg
feststellen, mittlerweile treten sie auch noch zu, wenn einer schon bewusstlos
ist). Mehrere Personen weisen auf eine zunehmende Verrohung der
Umgangssprache der J ugendlichen hin (die sagen Sachen, da gehrt - Ey Du Arsch-
zum normalen Umgangston). Einer der befragten Polizeibeamten beschreibt
hnliches (die sagen nicht mehr Mdchen oder Frauen, ich will es gar nicht
sagen). Allerdings wird eine Zunahme der Delinquenz tendenziell von allen
Befragten verneint. Auerdem beschreiben die Sozialarbeiter und Sozial-
arbeiterinnen eine groe Intoleranz der Erwachsenenwelt (Die Verstndnis-
Toleranz ist gegenber den J ugendlichen sehr gering). So wird zum Beispiel die
Suche nach geeigneten Rumen fr die jugendlichen Aussiedler als problematisch
geschildert. Es mssen aber Rume da sein, wo sich die J ugendlichen treffen
98
knnen. Die Aussiedler bleiben lieber unter sich. Mehrere Male wurde die
schlechte finanzielle und personelle Ausstattung der J ugendarbeit angesprochen.
Man kann viel machen, die Frage ist nur wer und wers bezahlt, Es fehlt an
Personalstellen. Auch die ungnstige Arbeitszeit (oft bis in den Abend), wenig
Verdienst und anstrengende Arbeit mit einer schwierigen Zielgruppe wird als
Hindernis gesehen, um gute Mitarbeiter zu finden. Die Huser werden (nach einem
enormen Kraftakt des einen Hauses) wieder von verschiedenen Ethnien besucht.
Berichtet wird von einer sehr hierarchisch aufgebauten Clique der jungen Aussiedler,
die enorm raumaneignend bei einem der Huser vorging und andere nicht dazu
gehrende J ugendliche verdrngte. Keine Gruppe vorher nutze die Rume
dermaen stark und zerstrte sie gleichermaen auch so. Mittlerweile ist das
Publikum wieder gemischter, obwohl das teilweise nur durch Hausverbote zu
Stande kam. Die J ugendlichen die des Hauses verwiesen wurden campieren
teilweise immer noch vor dem betreffenden J ugendhaus. Den Mitarbeitern der
J ugendhuser fllt bezglich der trkischstmmigen J ugendlichen nichts
Auergewhnliches auf: Wenige Mdchen, auch am Mdchentag, das ist aber nicht
sonderlich auffllig, das betrifft auch die Deutschen. Allerdings gehen sie davon
aus, dass die trkischen Familien die Erziehung sehr ernst nehmen und rigoroser bei
begangenen Straftaten sind, da dies eine Schande fr die ganze Familie darstellt.
Auch wird festgestellt, dass zu muslimischen Festen die meisten jungen Trken
versuchen sich daran zu halten und gemeinsam mit der Familie an bestimmten Zeiten
zu essen, dann sind die alle pltzlich weg, und auf einmal wieder da. Also auch fr
die Gruppe der trkischen J ugendlichen, die die J ugendhuser in Rheindorf besucht,
spielt die Familie und anzunehmend die Religion und ihre Werte eine groe Rolle.
Das entspricht den Ergebnissen der Studien von (vgl. 3.3.3) Von Wilamowitz-
Moellendorf (2002).
Festzuhalten bleibt, dass die trkischstmmigen J ugendlichen zurzeit aus
professioneller Sicht in ihrer Delinquenz und auch Integration keine als
problematisch darzustellende Gruppe sind. Der Gruppe der jungen Aussiedler muss
in Zukunft besondere Beobachtung gelten. Die Zusammenarbeit mit der Polizei wird
als positiv beschrieben, so wie die Zusammenarbeit mit den brigen Akteuren.
Delinquenten kommen weitestgehend aus Familien der unteren
Einkommensschichten und/oder berforderten Familien (durch: viele Kinder, allein
erziehend, Scheidung, Arbeitslosigkeit etc.). Ethnische Ursachen werden
weitestgehend ausgeschlossen, sie knnen gegebenenfalls als Verstrker oder
zustzliche Belastung wirken, aber allein keine Kriminalitt verursachen. Die
gesellschaftlichen und sozialpolitischen Entwicklungen, besonders die
Ausgrenzungsprozesse, die in besonderem Masse auf junge Nichtdeutsche (besser
Migranten - also auch auf die jungen Aussiedler) zutreffen, wurden ebenfalls von
den Experten und Expertinnen benannt.
99
4.4.4 Interviews mit den zustndigen Polizeibeamten
Als Interviewpartner standen der zustndige Bezirksbeamte von Rheindorf und ein
Polizeibeamter des Projekts J ugend der Leverkusener Polizei zu Verfgung.
Generelle Aussage: Fr die J ugend typisch seien weitestgehend Bagatelldelikte, die
wenigsten wrden als Erwachsene noch weiterhin delinquent sein, nur bei wenigen
Intensivttern verfestige sich eine kriminelle Karriere. Der zustndige Beamte des
Projekts J ugend beschreibt das belehrende Gesprch und den Vorgang an sich als
meist abschreckend genug fr den Grossteil der Kinder und J ugendlichen. Eine den
Lerntheorien entsprechende Aussage (vgl. 2.4.2).
Cliquen/Gruppen, die im Stadtteil Rheindorf auffllig sind, gibt es nach Angaben der
Beamten nicht, die Cliquen sind aus Schule und Sport sehr gemischt. Ausnahme
auch aus Sicht dieser Experten seien zur Zeit die Aussiedler, die auffllig seien und
eine ethnisch sehr homogene Gruppe bildeten. Dass in dieser Gruppe junger
Menschen in Zukunft noch mit einer erhhten Delinquenz zu rechnen ist, bis auch
hier von einer gelungenen Integration ausgegangen werden kann, wird vermutet.
Der Bezirksbeamte ist zustndig Kontakt zu den J ugendlichen und den zustndigen
Einrichtungen zu halten (Schulen/J ugendhuser) und sucht bekannte Treffpunkte auf,
um diesen herzustellen und abschtzen zu knnen, wie sich was entwickelt und wer
mit wem Bldsinn macht.
Fr die Schulen und das Quartier stellt er keine negative quantitative oder qualitative
Entwicklung fest, jedoch wird eine Verbesserung der Situation in der Gesamtschule
beschrieben seit der Rektor in der Schule rigoros durchgreift. Delikte, die frher
aus Angst vor Imageverlust nicht gemeldet wurden, werden jetzt direkt seitens der
Lehrer und Lehrerinnen, der Stufen-Leiter und -Leiterinnen und seitens des Rektors
weitergeleitet. Das hatte zur Folge, dass den Schlern und Schlerinnen bewusst
geworden ist, dass nun auf Delikte, die frher unbestraft blieben durchaus eine Strafe
folgen kann. Die Deliktanzahl sei aufgrund dessen enorm zurckgegangen.
Die Entwicklung der Kriminalitt wird aus subjektiver Sicht als rcklufig
beschrieben, eine bessere Vernetzung knnte eine Ursache dafr sein. Wenn die
also etwas anstellen, dann wei ich das noch heute und kann mich dann direkt mit
den entsprechenden Stellen in Verbindung setzten, was man da machen kann oder
wie man ggf. dagegen steuern kann.. Des Weiteren beschreibt er die Tatsache, dass
der Sozialraum und die darin lebenden J ugendlichen ihm mittlerweile sehr gut
bekannt sind, und die Mglichkeit der Anonymitt nicht mehr so gegeben sei als
delinquenzhemmend. Das Quartier sei ruhiger geworden, die Straftaten, die hher als
in anderen Vierteln waren, sind zurckgegangen. Es haben sich andere
Brennpunkte entwickelt.
Die Drogendelikte halten sich im Rahmen. Zum Handel kommt es nur bedingt,
hauptschlich geht es um den eigenen Konsum. Die Quantitt hat meiner Meinung
nach deutlich zugenommen - J ngere und mehr. aber die Schwierigkeiten liegen
darin den Nachweis zu fhren, es kommt ja meistens nicht zur Anzeige, weil es sich
um geringe Mengen handelt. Und wenn die teilweise mit 13 schon anfangen, sind
100
sie noch nicht mal strafmndig. Waffen werden weitestgehend bei ethnischen
Minderheiten gefunden, mit der Begrndung, ich muss mich doch verteidigen. Die
Gewaltdelikte haben bis auf Ausnahmen keine quantitative Entwicklung erlebt,
allerdings geht er von einer gesteigerten Gewaltbereitschaft aus. Es wird eine
verbale, nach auen gerichtete Gewaltbereitschaft beschrieben. Das ist schon
aufgefallen, die haben einen Umgangston, der einfach Gegengewalt provoziert.
Innerhalb der Cliquen der J ugendlichen gbe es kaum Gewalt, Ausnahme bilden hier
die Russlanddeutschen: Wenn da innerhalb der Gruppe jemand etwas macht, was
den anderen nicht passt, wird er bestraft, und das wars dann auch. Auch hier wird
die Raumaneignung der J ugendlichen durch massive Gewalt, aber auch Zerstrung
erwhnt.
Die trkischstmmigen J ugendlichen sind relativ friedlich - bis auf ein paar
Ausnahmen, eine besondere Aufflligkeit bezglich ihrer Delinquenz ist seitens des
Bezirksbeamten nicht feststellbar. Als Ursachen nennt er: Aus den Familien kenne
ich das, da die Eltern strenger sind als deutsche Familien, die achten mehr auf ihre
Kinder, auch was Schulleistungen betrifft. Zur Integration der trkischen Familien
in Rheindorf gibt er an: Die Nachbarn von trkischen Familien sagen, die wren
ruhig und freundlich, die Gren. Mittlerweile sprechen die auch relativ gut die
deutsche Sprache. Die werden einfach akzeptiert. Die Akzeptanz fr die
Aussiedler ist bei weitem geringer.
In Bezug auf Probleme im Zusammenhang mit Russlanddeutschen wurde betont,
dass die Beteiligten das meist unter sich ausmachten. Da dringe nichts bis zur Polizei
durch, eine Integration habe bisher nicht stattgefunden (die bleiben unter sich).
Da diese Migrationsgruppe als homogener darstellt wird als die nachweislich
heterogene Gruppe der Trken bedarf es gerade hier einer besonders aufmerksamen
Bearbeitung um nicht vergleichbaren stigmatisierungs- und verallgemeinerungs-
Tendenzen zu Unterliegen. Diese Problematik kann hier jedoch nicht ausfhrlich
behandelt werden.
Er bemerkt: Straftter kommen verstrkt aus speziellen Straen in Rheindorf,
Straftaten werden dann auch in unmittelbarer Nhe stattfinden. Fr delinquente
J ugendliche und Heranwachsende stellt er keine ethnischen Grnde fest, sondern
sieht die Ursachen vermehrt in Folgendem: Die haben alle die gleichen
Voraussetzungen. Eltern (wenn noch zusammenlebend), meistens Sozialhilfe-
empfnger, die schulischen Leistungen sind eher mies. Den Eltern ist es egal was die
Kinder den ganzen Tag machen. Sie haben kein Geld, sie wohnen Tr an Tr und
stecken sich quasi an.
Es gibt dennoch ein paar Spezis, die ebenfalls im Projekt J ugend betreut werden,
die eine Vielzahl von Delikten begangen haben, das sei aber nicht die Regel. Bei den
beschriebenen J ugendlichen handelt es sich um trkischstmmige J ungen, die
besonders durch Gewaltdelikte aufgefallen sind. Unterbrochenes Schulleben,
unsichere, sogar kaputte Familienverhltnisse und eine fehlendes mnnliches
Vorbild sowie Gewalterfahrung in ihrer Kindheit kennzeichnen die Situation der
J ugendlichen. Eine positive Entwicklung ist nach Aussagen beider Beamten nicht zu
101
erkennen. Dafr, dass diese Situation typisch trkisch sein solle, gbe es keinerlei
Anzeichen. Um solchen kriminellen Entwicklungen vorzubeugen und um zustzlich
zur Repressivitt prventiv zu arbeiten, wurde die damalige EK J ugend (1997)
gegrndet. Das Projekt J ugend, wie es heute heit, arbeitet nach den landesweit
vereinbarten Zielen zur Reduktion der J ugendgruppendelinquenz und behandelt vor
allem Krperverletzungs-, Bedrohungs-, Ntigungs- und Raubdelikte, die aus
Gruppierungen von jungen Menschen begangen werden. Besondere Beachtung findet
die Gewalt an Schulen und die Betreuung von jungen Intensiv-, Mehrfachttern/-
tterinnen. Zurzeit werden elf J ugendliche aus Leverkusen betreut, davon die zwei
genannten J ugendlichen aus Rheindorf-Nord. Leider knnen diese Flle hier nicht
ausfhrlicher dargestellt werden, da Interviews bedauerlicherweise nicht mglich
waren. Ziel des Projekts soll, im Rahmen der Betreuung, die Sensibilisierung der
J ugendlichen und die Entwicklung eines Unrechtsbewusstseins bezglich ihres
Handelns sein. Als Beispiel wird das typische Abziehen genannt, was als
ruberische Erpressung geahndet wird. Die fllt in eine Strafkategorie, die kein
Bagatelldelikt mehr darstellt und mit Haftstrafen von bis zu einem J ahr belegt ist.
Der zustndige Beamte des Projekts J ugend kann ebenfalls keinen Anstieg der
nichtdeutschen Tatverdchtigen bzw. der Quantitt im Allgemeinen feststellen. Fr
die trkischen J ugendlichen hlt er fest, dass da jetzt trkische Mitbrger
berprsentiert wren, kann ich gar nicht sagen. Wir haben hier alles dabei
gehabt,kann man jetzt nicht an der Staatsangehrigkeit Trkisch festmachen.
Er sieht ebenfalls, wie sein Kollege, die Schwierigkeiten und Ursachen in den
sozialen Lebenslagen der jungen Menschen. Wenn die keinen Perspektiven haben
bezglich Berufsausbildung etc stellt sich letztendlich Langeweile ein. Er betont
besonders einen Ziel-Mittel-Konflikt: J eder mchte irgendwo glnzen. Und wenn
man das nicht auf dem legalen Weg tun kann, dann tut mans vielleicht auf dem
illegalen.
Subjektiv sieht er ein Phnomen darin bestehen, dass vermehrt jngere Geschwister
in die Fustapfen ihrer lteren Geschwister treten in Bezug auf kriminelles
Verhalten, insbesondere auch bei denen, wo die lteren in Haft genommen werden
mussten. Nach dem Motto: Was der ltere Bruder geschafft hat, kann ich sogar noch
toppen, Abschreckung scheint hier nicht zu funktionieren.
Zur Integration trkischer Familien stellt er fest: Die erste Generation ist sehr
angepasst, es gibt keine Probleme, die zweite steht dazwischen und bei der dritten
Generation wchst sich das so langsam aus. Auch er sieht fr eine erhhte
Delinquenz nichtdeutscher Jugendliche keine ethnische Grnde. Ich wrde das nicht
so an der Nationalitt festmachen, das hat eher mit was mit sozialem Niveau und
dem sozialem Umfeld zu tun, wie und wo die gro werden.
Das Verhltnis zwischen der Tat und der subjektiven Wahrnehmung der Strafen aus
Sicht der jungen Menschen wird von den Beamten als defizitr beschrieben. Oft
liegen zwischen der Tat und der dafr bestimmten Strafe eine erhebliche Zeitspanne.
Also zwischen Straftat und Strafe knnen 2 bis 2,5 J ahre liegen, so dass dort
berhaupt kein Bezug mehr da ist. Das ist ein groes Manko, wenn man dem
Leitsatz J ugendstrafrecht ist Erziehungsstrafrecht des J ugendstrafrechts ernst
nimmt.
102
103
5 Ergebnisse der Analysen und abschlieende Darstellung
Abschlieend kann fr die Delinquenz trkischstmmiger Jugendlicher und
Heranwachsender allgemein und in Rheindorf-Nord Folgendes festgehalten werden:
Fr Rheindorf-Nord besteht keine Grundlage zu einer dramatisierenden Bewertung
der Struktur und des Umfangs der Jugenddelinquenz generell und der Delinquenz der
trkischstmmigen Jugendlichen und Heranwachsenden. In Rheindorf-Nord
bestehen, wie andernorts auch, Probleme und Erscheinungen jugendtypischer
Lebensarten und Handlungsweisen, die von der erwachsenen ffentlichkeit, ferner
von den jungen Menschen selbst, als schwierig wahrgenommen werden. In
Rheindorf-Nord gibt es keinen schrecklich kriminellen Auslnder oder gefhrliche
Jugendliche. Die junge Menschen sollten als Zielgruppe von prventiven Angeboten
gesehen werden und nicht ausschlielich als Tter oder Tterinnen.
Die Integration und Desintegration von Jugendlichen und von Nichtdeutschen sollte
dennoch fr Rheindorf-Nord ein wichtiges und relevantes Thema sein. Fr
zielgruppenbezogene Prventionsanstze ist die Orientierung an vorhandenen
Gelegenheitsstrukturen ausschlaggebend, dabei sollten sowohl negative
Gelegenheitsstrukturen als auch positive (Freizeitangebote/Manahmen) analysiert
werden. Um die rumlichen Gegebenheiten in Rheindorf und Umgebung kennen zu
lernen, wurden mehrere Stadtteilbegehungen durchgefhrt. Im Rahmen des
interdisziplinren Projekts Sicherheit und Integration im Wohnquartier durch Stadt-
und Sozialplanung am Beispiel des Nordquartiers von Leverkusen-Rheindorf war
die Mglichkeit gegeben mit lokalen Experten den Stadtteil zu begehen. Der
Bezirkspolizist, der Jugendhilfeplaner und ein Vertreter der Wohnungsbau-
genossenschaft begleiteten diesen Rundgang mit Lehrkrften und Studenten und
Studentinnen der Fachhochschule Kln. Um die Situation des Stadtteils
einzuschtzen (und fr die darauf folgenden Interviews), waren dies wichtige
Vorrausetzungen. So konnten typische Jugendtreffpunkte und Angstrume besehen
werden und auch Konflikte, die Bewohner mit jungen Menschen und deren Mll
(Dosen/Zigaretten etc.) haben konnten dank des Vertreters der Wohnungsgesellschaft
Leverkusen mbH (WGL; ca. 2.370 Wohneinheiten) benannt werden. Es wurden
konkrete Flle beschrieben, meiner Einschtzung nach waren dieser Mll sowie die
Treffpunkte der Jugendlichen durchaus im Rahmen des blichen. Devianz und
Delinquenz sind auch in Rheindorf-Nord rumlich unterschiedlich verteilt. Das gilt
sowohl fr die Meta-Ebene einer Region oder eines Landes ebenso gltig wie fr die
Mikro-Ebene. Diese Verteilung wurde in Teil 4.3.1.3 dargestellt. Dennoch bleibt hier
zu beachten, dass diese nach der PKS gesammelten Daten ber die Orte der
Dunkelfelddelinquenz nicht viel aussagen mssen.
Erwachsene nutzen diese Orte, Straen, Wege und Pltze, Parks und Bushaltestellen
sowie Fugngerzonen weitestgehend zweckgebunden. Fr jungen Menschen haben
diese Orte aber eine besondere Bedeutung, denn sie dienen als soziale Rume des
Austausches und der Kommunikation unter Geschlechtern und Kulturen innerhalb
der Peer-Group. Diese Orte werden auch hinsichtlich des fortwhrenden Abbaus an
anderen Mglichkeiten und Rumen, angesichts knapper Haushaltslagen, an
104
Bedeutung zunehmen. Dabei verhalten sich die Jugendlichen und Heranwachsenden
an diesen Orten nicht immer normkonform, was allerdings hinsichtlich einer
Ablsung vom Elternhaus nicht berbewertet werden sollte. Die interviewten
Jugendlichen besttigten die Wichtigkeit der Orte fr ihr soziales Leben. Wichtige
Treffpunkte waren besonders die Bushaltestellen sowie der Park, aber auch vor dem
Jugendzentrum trafen sich junge Menschen, um sich auszutauschen. Diese Orte und
Rume werden von diesen zu ihrem Erwachsenwerden gebraucht. Aus den
Beobachtungen vor Ort, den Gesprchen mit Jugendlichen und den Experten, lieen
sich keine homogenen Gruppen benennen. Die Cliquen zeichneten sich
weitestgehend aus offenen und losen Freundschaften aus, die ethnisch, geschlechtlich
und altersmig durchmischt waren. Dennoch waren wenige Mdchen darunter zu
finden (was als nicht auergewhnlich
gilt), die Gruppen der jungen Aussiedler
wurden allerdings von allen als sehr streng
abgesondert beschrieben. Beobachtungen
dieser Gruppe konnten meinerseits nicht
gemacht werden, was diese Aussagen
wahrscheinlich eher untersttzt als
widerlegt (trkischstmmige Gruppen sind
nicht zu finden).
Abb. 46: Jugendliche in Rheindorf-Nord auf dem Weg in den Park; eigene Fotos
Die jugendkriminologische Forschung sieht, dass den persnlichen Beziehungen zur
Nachbarschaft und deren kommunikativen Prozessen eine groe prventive
Bedeutung zukommt. Allerdings auch eine ebenso benachteiligende, besonders
auffllig bei Mehrfachttern, die mehr Zeit auf der Strasse als zu Hause verbringen.
Die Studien ergeben, dass auf Verhalten, auf das frher informell reagiert wurde,
immer hufiger formell (Polizei) reagiert wird. Die Bewohner und Schler
beschreiben eine gengsame nachbarschaftliche Situation, dennoch wurde die
Aussage wie jeder kmmert sich um seinen Kram und man sagt sich freundlich
Guten Tag, das war es auch schon getroffen. Das weist auf eine geringe soziale
Kontrolle hin. Rumliche und architektonische Gestaltungen knnen durchaus als
zustzliche prventive Mittel genutzt werden.
Die Stadtteil-Begehungen in Rheindorf verdeutlichen, dass es keine
auergewhnlichen Aufflligkeiten im Vergleich zu anderen Orten gibt, dennoch
sind Probleme sichtbar. Der jugendtypische Mll und Lrm wurde whrend der
Vor-Ort-Besuche, und den Gesprchen fters thematisiert. Obwohl eine Verwarnung
der Polizei oder der Bewohner von den Jugendlichen bereitwillig angenommen
wurde und sie dann auch aufrumen, sind diese Effekte nicht von Dauer. Um nach
der Broken-Windows-These nicht weiteren Mll hinterherzuziehen, knnten
Behlter aufgestellt werden, die sich nach den Treffpunkten der jungen Menschen
richten, Partizipation ist unbedingt erforderlich um eine Annahme zu garantieren.
105
Die Entwicklung und Bewertung der Delinquenz von Jugendlichen und
Heranwachsenden ist nur mit Blick auf ihre Lebenssituation mglich. Hier zeigt sich
eine Situation von jungen Menschen, die gezeichnet ist durch gesellschaftliche
Umbrche, Segregationstendenzen und von den Folgen eines fortwhrenden Abbaus
von Leistungen in allen Bereichen, die diese Gruppe betreffen. Prozesse der sozialen
Ausgrenzung und Desintegration scheinen zuzunehmen, und damit verringern sich
Chancen in der Gesellschaft Anerkennung zu finden. Ihnen fehlen zu oft
Partizipationsmglichkeiten (kleine Lobby) und andere gesellschaftlich akzeptierte
Mittel, um sich solchen Prozessen zu stellen und sie zu ihren Gunsten zu
beeinflussen (BmI, 2001). Die Delinquenz dieser Altersgruppe muss als temporres,
vorbergehendes und jugendtypisches Phnomen betrachtet werden. Die Qualitt der
Straftaten liegt weitestgehend im Bereich der leichten Kriminalitt und kann bei allen
sozialen sowie ethnischen Gruppen beobachtet werden (Pfeiffer, 1998). Das
Geschlecht spielt jedoch eine Rolle, weibliche Tterinnen sind in allen
Deliktbereichen auffallend geringer vertreten als mnnliche, das gilt besonders fr
die Gewaltdelikte (PKS, 2004). Das spiegelt sich ebenfalls in der Situation in
Rheindorf-Nord deutlich wieder. Besondere Beachtung bentigen also, aus
kriminalprventiver Sicht, die mnnlichen Jugendlichen und Heranwachsenden,
deren Delinquenz nicht temporr und vorbergehend ist. Diese Mehrfachtter (und
auch, wenn auch deutlich weniger, Tterinnen) sind auffallend fter aus sozial
benachteiligten Quartieren und Familien.
Die beschriebenen Kriminalittstheorien lassen, wie erwhnt, keine allumfassende
Erklrung der Delinquenz junger Menschen zu. Immer bedeutender wird die
Verknpfung zwischen Anlagen und Umwelt. Einige Studien machen deutlich
welche Bedeutung relevanten anderen (z.B. auch Nachbarn) bei der Entwicklung
und Integration von jungen Menschen zukommt. Positive, strkende und frdernde
Manahmen vor Ort im unmittelbaren sozialen Umfeld der Jugendlichen sind
wichtig, um die Mglichkeiten eine legale Identitt aufzubauen zu erlangen und um
ein positives Selbstwertgefhl zu entwickeln.
Die urbane Vernderung im ffentlichen Raum spielt bei der Auseinandersetzung
mit dem Thema Delinquenz und Gewalt von Jugendlichen und Heranwachsenden
eine groe Rolle. Fr die Jugendlichen und Heranwachsenden werden Ressourcen
geringer. Ihre Rume verengen sich immer mehr durch Privatisierung und
konomische Nutzung, die diese oft als Zielgruppe negieren und ausgrenzen, sogar
bewusst verdrngen. Jugendtypischer Lrm und ausbreitende Raumnutzung sind
immer weniger erwnscht. Fr Rheindorf-Nord zeigt sich hnliches anhand des aus
Finanzmangel geplanten Umzugs des MediaCafes, das aus dem Zentrum des
Quartiers in eine Schule verlegt werden soll. Im Falle einer konomischen Nutzung
des Gebudes werden Jugendliche, die nur rumhngen unter Umstnden nicht
mehr gern gesehen und eventuell auch nicht geduldet. Im Falle von Widersetzung
drohen nicht selten verstrkt Stigmatisierungs- und Kriminalisierungsprozesse
(Breyvogel, 1998). Diese Erfahrungen besttigen die Expertinnen aus Rheindorf-
Nord ebenfalls, die Schwierigkeiten hatten berhaupt Rume zu finden und zu
mieten (in diesem Fall fr Aussiedler-Jugendliche), Oft wurden Ablehnungen
ausgesprochen aus Furcht vor jugendtypischem Verhalten, aber auch vor ihrer
106
Delinquenz. Die Toleranz und Akzeptanz der Jugend gegenber scheint in Rheindorf
allzu gering zu sein. Lothar Bhnisch (2001) sieht in einer gemeinwesenorientierten
ffentlichkeitsarbeit wichtige Anstze, um zu bewirken, dass deviantes Verhalten
der jungen Menschen nicht direkt kriminalisiert wird und sie somit auch sozial
isoliert werden.
Die Delinquenz und Gewalt mnnlicher Jugendlicher nichtdeutscher Herkunft,
bezogen auf ihren Bevlkerungsanteil, stellt sich seitens der Leverkusener
Kriminalstatistik als berproportional hoch dar. Obwohl seit langem wie auch im
Jahre 2004 ein Rckgang der nichtdeutschen Tatverdchtigen stattfand, sind sie
gerade bei Gewaltdelikten stark vertreten (Reich, 2003). Das ffentliche
Meinungsbild greift dieses auf und sieht ebenso in dieser Gruppe eine Gefahr. Hier
wird weiterhin die zweifelhafte Glaubwrdigkeit und Aussagekraft dieser Statistiken
in Bezug auf alle erfassten Gruppen deutlich. Die Untersuchungen und Studien, die
alle verzerrenden und zu bercksichtigen Effekte einbeziehen, relativieren das Bild
allerdings drastisch. Die Delinquenz nichtdeutscher und deutscher Jugendlicher
gleicht sich nach diesen Berechnungen weiter an. Sie lsst aber, auch nach
Bereinigung um diese Effekte, eine erhhte Gewalt- und Delinquenzgefhrdung und
-belastung der mnnlichen Jugendlichen nichtdeutscher Herkunft erkennen (Geiler,
2000). Weiterhin weisen die Untersuchungen des KFN aus, dass unter jungen
Auslndern berproportional viele Mehrfachtter zu finden sind (Pfeiffer, 1998).
Eine statistisch gesehen erhhter Anteil (in Bezug zur Bevlkerung) besttigt sich
ebenfalls fr Rheindorf, diese Aussagen knnen seitens der Rheindorfer Experten
und Expertinnen allerdings nicht untersttzt werden. Jugendgruppengewalt, die
hufig in Bezug zu jungen Nichtdeutschen genannt wird, ist in Rheindorf-Nord nicht
akut zu finden. Den Experten und Expertinnen zu Folge wurden diese vor einiger
Zeit auftretenden Probleme mit sich zu delinquenten Gruppen zusammen-
schlieenden Jugendlichen, in Leverkusen gesamt und auch in Rheindorf einige Zeit
zuvor aufgehoben. Um diesem Phnomen entgegenzutreten und prventiv wirksam
zu sein, wurde 1997 seitens der Polizei die EK-Jugend gegrndet (seit 2002, Projekt
Jugend). In dem Leverkusener Projekt Jugend haben zurzeit sechs von zehn
Jugendlichen einen Migrationshintergrund (bzw. die Eltern), was wie erwhnt
allerdings nicht als aussagekrftig eingestuft wird.
Eine quantitative Erhhung der Delinquenz, hin zu brutaleren Jugendlichen oder
auch erheblicher Auslnderkriminalitt, kann nicht bemerkt werden. Im Gegenteil,
wird von den trkischen Bewohnern und ihren Kindern und Jugendlichen sowie
Heranwachsenden als ruhig, integriert und angenehm berichtet. Die Probleme, die
mit diesen Altersgruppen auftreten, werden von allen differenziert gesehen und nicht
ethnitisiert. Die Probleme der jungen Zuwanderer aus dem Osten werden als
gravierender beschrieben aber ebenfalls differenziert betrachtet.
Um diese Tatsachen der erhhten Belastung zu erklren, kommt man nicht darum
herum sich die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund genauer zu
betrachten. Hierbei wird schnell deutlich, dass es erhebliche Unterschiede in den
Lebenslagen und sozialen Wirklichkeiten zwischen nichtdeutschen und deutschen
Jugendlichen und Heranwachsenden gibt (Boos-Nnning, 1982; Sen, 2001).
107
Hier sind viele Faktoren, die Delinquenz frdern auffllig, unter anderem sind die
sozialisationsbedingten, migrationsbedingten, soziokulturellen und institutionellen
Faktoren zu nennen (vgl. 3.3.3). Familiren Belastungen, erhhte Arbeitslosigkeit,
eine unsichere rechtliche Position und ein niedriger sozialer Status, spezifische
konservative Mnnlichkeitsvorstellung, mgliche Gewalterfahrungen in der Familie
sowie daraus folgende soziale Desintegration bedingen besonders die Delinquenz der
nichtdeutschen mnnlichen jungen Menschen. Das trifft allerdings nur fr einen Teil
dieser heterogenen Gruppe zu. Eine Differenzierung ist unerlsslich, um den
nichtdeutschen Menschen, die Interesse an sprachlicher und darber hinaus gehender
sozialer Integration haben und/oder bereits vollkommen integriert sind, kein Unrecht
zu tun. Viele Faktoren mssen bercksichtigt werden, um die realen soziale
Konflikte und Schwierigkeiten nicht zu ethnisieren. Dies darf vor allem nicht
geschehen, damit sich diese gesellschaftliche Wahrnehmung nicht in eine self-
fullfilling prophecy verwandelt und sich die jungen Menschen diesem Label
(delinquente junge Auslnder) ergeben (vgl. Labeling Approach). Die befragten
trkischen Menschen aus Rheindorf-Nord entsprachen in keiner Weise diesem
mglicherweise erwarteten Bild.
Der Umwelt (soziales Leben) und dem Raum (Quartier) in dem junge Menschen
leben und auch ihre Straftaten begehen kommt eine besondere Rolle zu. Hier sollten
Prventionskonzepte ansetzen, um an der tatschlichen Lebenswelt anzuknpfen zu
knnen. Lokale bauliche und stdteplanerische Gegebenheiten und die Vernetzung
aller bedeutsamen Personen sind zu bercksichtigen, aber besonders ist auf die
Beteiligung der jungen Menschen zu achten. Wenn sie partizipieren, mitgestalten
und erreicht werden knnten, wrde das positiv auf das Quartier zurckstrahlen.
Projekte, die spezifisch auf die Bedrfnisse der jungen Menschen in ihrem Quartier
ausgerichtet sind, garantieren an der Lebenswelt anzuknpfen und die Zielgruppe
auch nachhaltig zu erreichen. Vorraussetzung dafr ist die genaue Analyse der
Sozialrume und der Zielgruppe, um die Nutzung der vorhandenen Gegebenheiten,
Erfahrungen und Kompetenzen zu ermglichen. Wie erwhnt muss Prventionsarbeit
vernetzt und ressortbergreifend umgesetzt werden.
Hier liegen in Rheindorf hervorragende Leistungen vor, die kaum eine Verbesserung
bentigen. Alle Beteiligten sprachen sich positiv ber die Kommunikation und
Vernetzung aus und betonten ihre Vorzge. Fr bedrfnisorientiertes und
kriminalprventives Handeln, das auf gefhrdete junge Menschen in allen sie
betreffenden Bereichen eingeht, ist dies eine optimale Voraussetzung. Da in
Rheindorf die Zusammenarbeit so gut dasteht, ist dementsprechend eine frhzeitige
Begleitung und Intervention mglich.
Die trkischen Jugendlichen und Heranwachsenden in Rheindorf-Nord scheinen
keine auergewhnlichen Probleme zu belasten, sie seien integriert und eher
unauffllig, dennoch wre es fatal diese Gruppe aus den prventiven Projekten
auszuschlieen, da es andere gibt, die mehr auffallen. Die Analyse zeigt, dass
auch sie Probleme haben und daher als Zielgruppe nicht aus dem Blick genommen
werden sollten (Allerdings nicht als Die Trken). Die positiven Entwicklungen
drfen gleichwohl nicht bersehen werden, hier wre ein Austausch denkbar. Sie
108
knnten als eine Art Vorbild fr Jugendliche fungieren, deren Integration in eine
Gesellschaft, die ihnen fremd ist (oder sie selbst als fremd empfindet) noch nicht
stattgefunden hat. Fr Rheindorf-Nord sollte die Prioritt (nach Angaben von fast
allen Akteuren und Bewohnern) bei den Jugendlichen und Heranwachsenden der
Aussiedlerfamilien liegen. Diese Gruppe scheint besonders zielgruppenspezifische
Prventionskonzepte zu bentigen, die ihre besonderen Hintergrnde, Bedrfnisse
und Perspektiven bercksichtigen.
5.1 Sozialpdagogische Handlungsanstze
Abb. 47: Jugendliche - Fuball in der Unstrutstrae, 10/2003; Eigene Fotos
Welche Mglichkeiten bieten sich in Rheindorf an, um die jungen Menschen zu
untersttzen ihre Identitt in der Mehrheitsgesellschaft zu finden, ohne dabei zu
illegalen Mitteln greifen zu mssen?
Alle Jugendlichen und Heranwachsenden suchen nach Annerkennung, diese kann
besonders durch Sport erlangt werden (Sen, 2004). Das Interview mit der
Vorstandsvorsitzenden des TUS Rheindorf macht deutlich welche Mglichkeiten
hier liegen, Rume zu erobern, Regelverhalten zu erlernen, kulturellen Austausch
und Erlebnis zu schaffen sowie Anerkennung und Identitt zu finden. Viele der
trkischstmmigen jungen Menschen aus Rheindorf-Nord finden in ihrem Verein
Gemeinschaft und Anerkennung. Der TUS Rheindorf bemht sich um Trainer und
Trainerinnen jeglicher ethnischer Herkunft um Diskriminierungen auszuschlieen.
Das Konzept geht auf. Hier knnen relevante Bezugspersonen und Kontakte
geschaffen werden, die aus der Isolation von Familie und Schule hinaus fhren, dort
besteht die Mglichkeit einen ueren Halt (vgl. dazu Halttheorie 2.3.2) zu erfahren.
Christian Pfeiffer (2003) weist darauf hin, dass eine zu groe Zahl der Jugendlichen
aus Aussiedlerfamilien sich den Sportvereinen nicht anschliet, im Gegensatz zu den
trkischstmmigen Jugendlichen. Hier wre seitens der Rheindorfer Jugendlichen
aus Aussiedlerfamilien ein Ansatzpunkt gegeben, dem nachgegangen werden sollte.
Der Sport bietet nach Pfeiffer die groe Chance junge Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen und ethnischen Gruppen zusammenzufhren.
109
Die Trainer und bungsleiter knnten angehalten werden sich ebenfalls vermehrt fr
integrationsfrdernde und gewaltverhindernde Mglichkeiten zu interessieren und
Fortbildungen etc. besuchen. Die Potenziale des Sports und auch der Musik mssen
ausgeschpft werden. Um neue Zielgruppen zu erreichen sollten verstrkt
niedrigschwellige Angebote unterbreitet werden. Der TUS Rheindorf knnte
ermutigt werden sich fr bislang nicht erreichbare Jugendliche zu ffnen und diese
auch zu bewerben. Es gibt ebenfalls einige prventive Projekte, die Sportvereine und
Schulen oder Jugendzentren verbinden, da bieten sich evaluierte frderliche Anstze
an. Sportveranstaltungen wie zum Beispiel Fuballturniere, Streetball-Aktionen und
Mitternachtssport/ffnung der Turnhallen knnten initiiert werden, an die gute
Einbindung der Ressourcen an Grnflchen in Rheindorf knnte angeknpft werden.
Aber auch die vielseitigen musikalischen Mglichkeiten sollten weiter ausgeschpft
werden (Ausstattung Jugendhaus/Bandrume etc., Schule, private Musikschulen
etc.). Seitens der jungen Menschen wurde ber eine Szene LEV-Underground
berichtet, hier finden sich junge Menschen die Rap und Hip-Hop machen und sogar
selbst produzieren. In Rheindorf-Nord wohnen zwei der bekannten DJs, diese jetzt
schon (Stadtteil) bekannten jungen Heranwachsenden knnten zu musikalische
Workshops oder Aktionen beitragen.
Auch die Schulen sind in der Frage von Prvention und Integration relevant, hier
knnen gesellschaftlich gesehen negative Entwicklungen junger Menschen beizeiten
erkannt und beeinflusst werden. Hier knnen wesentliche Kompetenzen erlernt
werden, mit denen sich einer kriminellen Karriere entgegengestellt werden kann.
Auch die Schulen in Rheindorf-Nord haben sich auf ihre ethnischen Minderheiten
eingestellt. Eine weitere Etablierung von Konfliktlotsen-Programmen und Peer-
Mediationsprojekten (unter verstrkter Einbeziehung von benachteiligten
Jugendlichen) knnte weiterhin die Integration frdern und Delinquenz vermindern.
Ein gewaltfreies Klima an den Schulen zu schaffen muss oberstes Ziel sein (BAG
KJS, 2003). Einer Medienerziehung sowie die Thematisierung von Gewaltkonflikten
im Zusammenhang mit der Schule durch Aktionen (Projektwoche) zum Thema
Gewalt scheint gerade fr die jungen Menschen mit Migrationshintergrund sinnvoll
zu sein. Die Studie von Pfeiffer sieht ebenfalls ein Unterrichtsfach Pdagogik fr
einen wesentlichen Ansatzpunkt, um aus dem Kreislauf von mglichen
Erziehungsdefiziten (Gewalt) auszubrechen.
Das frderliche Einben von Toleranz und Demokratie kann hier stattfinden und auf
die Lebenswelt der Jugendlichen einwirken. Das ist Bildungsarbeit, die nicht nur
Mathematik- und Deutsch-Kenntnisse betrifft. Die Schule spielt fr Kinder und
Jugendliche in unserer Gesellschaft eine wesentliche, in vielen Fllen sogar die
wesentliche Rolle in ihrem Alltags- und Sozialleben (Report; Max-Planck-Institut
43/2003).
Das gilt ebenso fr die auerschulische Bildung der Jugendeinrichtungen. In
Rheindorf tragen diese ihren Teil dazu bei, indem sie geschlechtsspezifische
Angebote (Mdchen/Jungen-Tag etc.) erbringen. Aus Personalmangel lassen sich
viele Ideen leider nicht umsetzten und die guten gegebenen Vorrausetzungen an
110
Personal und Material nicht ausschpfen. Hier wre hinsichtlich der Aussiedler mit
Sicherheit ein erhhter Bedarf, der finanziell abgedeckt eine gute prventive Arbeit
untersttzen knnte. Besonders an den mnnlichen Identitten kann gearbeitet
werden, diese sind oft problematisch zu sehen. Auf die teilweise berzogenen
Mnnlichkeitsideale und Vorstellungen der trkischstmmigen Jugendlichen und
Heranwachsenden kann hier anhand von Vorbildern, die sich hinsichtlich ihrer
eigenen Mnnlichkeit bewusst reflektiert haben, positiv eingewirkt werden. Dies gilt
in besonderem Mae auch fr die jungen Aussiedler, deren konservatives
Rollenverstndnis das der trkischen fast bertrifft. Auch in den Jugendhusern in
Rheindorf sind Mdchen weit unterreprsentiert, durch gezielte Jungenarbeit kann
auch fr die Mdchen eine positive Entwicklung entstehen. Auch eine sinnvolle
Medienpdagogik wre in den Jugendhusern in Rheindorf-Nord mglich und
sicherlich angebracht, um Gewalt und Delinquenz entgegenzuwirken.
Dazu ist eine fachliche sozialpdagogische/sozialarbeiterische Betreuung von einer
angemessen Anzahl an kompetenten Mitarbeitern notwendig. Diese Voraussetzungen
mssen aufrechterhalten werden, um in den Husern noch adquate Betreuung
leisten zu knnen. Hier sollte auch in Rheindorf-Nord nicht gespart werden.
Eine Erweiterung der geschlechtsspezifischen Handlungsfelder und Verstrkung der
Jungenarbeit wren wnschenswert. Die von einigen Befragten erwhnten fehlenden
Vorbilder, vor allem mnnliche, knnten gerade in Anbetracht der oft berzogenen
Rollenverstndnisse der jungen nichtdeutschen Mnner von groer Bedeutung sein.
Auch die Mediation als Methode zu einer gewaltfreien Konfliktlsung knnte hier
angebracht werden und in Verbindung mit so genannten Coolness-, Selbst-
behauptungs-, Deeskalations- und sozialem Kompetenztrainings als gute Basis der
sozialpdagogischen Prvention dienen (Wurr, 1993).
Fr diese Arbeit ist eine besonders bemerkenswerte Absonderung der trkischen
Familien fr Rheindorf-Nord nicht erkennbar, vielmehr nehmen sie am
gesellschaftlichen Leben teil und/oder bestimmen es sogar.
Die trkische Gemeinschaft, die es dennoch gibt, bietet sich Hilfe und Rckhalt.
Dennoch sollten trkischstmmigen Jugendlichen und Heranwachsenden mehr
Identifikationsmglichkeiten geboten werden, das gilt ebenfalls generell fr alle
jungen Menschen in Rheindorf-Nord. Die ambivalente Situation von
trkischstmmigen jungen Menschen ist teilweise durch eine zustzliche
Verunsicherungen im Bereich der Normen und Werte gekennzeichnet. Nichtdeutsche
Familien sowie Aussiedlerfamilien sind deshalb in besonderer Weise zu untersttzen.
Da von einer erhhten Zahl trkischstmmiger Jugendlicher mit Gewalterfahrung
ausgegangen wird, sind besonders die Eltern in die Lage zu versetzen innerfamilire
Konflikte gewaltfrei zu lsen sowie ihre Kinder bei der Integration zu untersttzen
(Pfeiffer, 1998). Durch Integrationsprogramme sollten Eltern und Kinder spezifische
Angebote erhalten (BAG KJS). Hierzu sollten kompetente Vermittler die Wege fr
eine Harmonisierung von Werten und Normen des Herkunftslandes mit denen der
neuen Heimat aufzeigen. In Anbetracht der unsicheren rechtlichen Lage der jungen
Trken und Trkinnen sind vermehrte Mglichkeiten an Beteiligung und
111
Mitgestaltung im sozialen Umfeld und ebenfalls an politischen Handlungsebenen (im
Stadtteil) erstrebenswert, um ein verbessertes Zugehrigkeitsgefhl zu ermglichen.
Situative und strukturelle Bedingungen haben Einfluss auf Delinquenz und die Angst
vor dieser. Aus den Interviews mit trkischen Bewohnern und Bewohnerinnen aus
Rheindorf-Nord geht hervor, dass besonders die Frauen sich abends unbehaglich
fhlen. Das mag nicht verwunderlich sein, allerdings betonen sie auch den
Knigsberger Platz schon ab nachmittags zu meiden. Ein Platz, der dem
gesellschaftlichen und auch kulturellen Austausch dienen sollte. Auch ber Mll und
Unordnung in bestimmten Straen beklagen sich einige Bewohner, dies ist bei den
Rundgngen und Stadtteilerkundungen ebenfalls fr Ortsfremde nicht zu bersehen.
Nach den kologischen Kriminalittstheorien (vgl.2.5.6) wre es sinnvoll diese
Beschwerden aufzugreifen und dieser Unordnung zu begegnen, allerdings ohne neue
Verdrngungsprozesse auszulsen (Jugendliche, Obdachlose, etc.). Es ist also um die
soziale Kontrolle wieder herzustellen wichtig die Kriminalittsngste aufzunehmen
und aufzuarbeiten. Eine genauere Erhebung und Analyse zu konkreten ngsten ist
Voraussetzung.
Aus integrativer Sicht ist es besonders wichtig, dass mehr Kinder mit trkischen
Wurzeln, besonders zur sprachlichen Frderung, in die Kindergrten gehen. Um die
schon erwhnten sprachlichen Defizite (vgl. 3.3.6) zu vermeiden, sind Migranten-
familien vermehrt dazu zu motivieren ihren Kindern den Besuch zu ermglichen.
Christian Pfeiffer (1999) stellt fest, dass Integration bereits im Kindergarten
beginnen muss. Er sieht es als erwiesen an, dass die auslndischen Kinder, die in
deutschen Kindergrten integriert sind weitestgehend flieend Deutsch sprechen.
Anschluss an deutsche Kinder und weniger Schulprobleme sind weitere positive
Merkmale. Es ist in den Kindergrten darauf zu achten, dass die Kinder sprachlich
nicht unter sich bleiben, er beschreibt positive Anstze aus Kanada, wo die Kinder
mit Migrationshintergrund im Gegensatz zu Deutschland mglichst gleichmig auf
die Einrichtungen verteilt werden. Auch die Gewaltprvention kann schon im
Kindergarten durch altersgerechte Vermittlung von Konfliktlsungsstrategien
bestrkt werden.
Der Erziehungsberatung ( 16 ff, 28 SGB VIII) und familienpdagogischen Arbeit
kommt besonders bei der Betreuung von Familien mit Migrationshintergrund eine
groe Bedeutung zu. Die mglichen innerfamiliren Konflikte, die bei Familien mit
Migrationshintergrund auftreten knnen, mssen begleitet werden. Beratungs-
angebote mit freiem und kostenlosem Zugang kommt dabei eine hohe prventive
Bedeutung zu. Fr Rheindorf ist die gut eingebundene Lage des Jugendamtes in der
Elbestrae auf dem Schulgelnde von Vorteil.
Das Jugendamt gewhrleistet nach Art. 8 Abs. 2 GG das Wchteramt des Staates und
ist somit eine wichtige Sttze des Staates zu Sicherstellung einer ordnungsmigen
Erziehung. Auch hier sind, wie fr die Jugendhuser auch, finanzielle Einbuen nicht
vertretbar, wenn adquater Jugendschutz noch gewhrleistet werden soll.
Der Deutsche Richterbund NRW erwartet mit Krzungen im Leistungsbereich der
Jugendmter enorme konomische Folgekosten und fordert die Effektivitt der
112
Arbeit der Jugendmter durch die Kommunen zu strken. Die Interviews mit dem
Jugendamt besttigen ebenfalls die These, dass sich die trkischstmmigen
Menschen, auch besonders die jungen, zurzeit als integriert und weitestgehend
problemlos erweisen. Es gibt keine nennenswerte Entwicklung, die eine Aufflligkeit
bezeichnet. Die Probleme, die noch vor einiger Zeit auftraten haben sich gelegt, neue
Gruppen sind aufgetreten. Fr eine erfolgreiche Hilfe durch das Jugendamt ist die
rechtzeitige Kenntnis von Fehlentwicklungen entscheidend. Kooperationen der
staatlichen Institutionen sind durchaus wnschenswert, wenn sie das
Vertrauensverhltnis der Betroffenen nicht gefhrden, besonders wichtig ist dabei
der Jugendbereich der Polizei. In Rheindorf ist dies der Fall und wird wie gesagt von
allen Beteiligten wahrgenommen und positiv bewertet, auch wenn es noch zu
Unstimmigkeiten kommen kann. Die Polizei ist vernetzt mit dem Jugendamt und gibt
Informationen schnell weiter und umgekehrt. Das garantiert ein kompetentes
Eingreifen aller Akteure. Die Polizeibeamten sind ebenfalls bestens ber Familie und
Umfeld aufgeklrt und knnen so angemessen agieren.
Abweichendes Verhalten wird meistens im Prozess des Erwachsenwerdens
berwunden, hierbei sind strenge strafrechtliche Sanktionen nicht angebracht. Fr die
meisten haben Aufnahme der Polizei und das Verfahren selbst ausreichend
abschreckende Wirkung, wie die Beamten auch in den Gesprchen bestrkten. Fr
die jungen Intensivtter und Intensivtterinnen ist eine frhzeitige Erkennung
notwendig, dies wurde in Rheindorf durch die organisatorische Verbesserungen vor
Ort (Vernetzung: Jugendamt-Schulen-Jugendenrichtungen-Polizei) erreicht.
Der DRB NRW 2004 nennt, dass gerade fr die strafrechtliche Sanktion
Jugendlicher und Heranwachsender schnelles Handeln geboten ist. Die Strafen
werden von Jugendlichen nicht mehr angenommen, wenn sie mit erheblichem
zeitlichen Verzug ausgesprochen werden (sogar kontraproduktiv). Die Mglichkeit
der Reflexion und ein Bezug zur Strafe sind dann nicht mehr gegeben. Hierauf wird
von den Experten der Polizei aus Leverkusen und Rheindorf ebenfalls hingewiesen.
Die Beamten sind dahingehend sensibilisiert und bemhen sich Flle von jungen TV
besonders schnell zu bearbeiten, es wird dann gegebenenfalls auch versucht den
kleinen Dienstweg zu beschreiten.
Ermunterung zur Nachbarschaftshilfe und Partizipation der Bewohner und
Bewohnerinnen durch Zukunftswerksttten knnten weitere Punkte sein. So
knnen Interessen und Anliegen aller Bewohner ermittelt werden, auch die der
jungen Menschen. Aktions- und Erlebnisrume fr junge Menschen zu schaffen,
damit eine Langeweile nicht in Delinquenz umschlgt, wre wnschenswert.
Die benannten Defizite in der Toleranz der Bevlkerung gegenber den
jugendtypischen Verhaltensweisen sollten aufgegriffen werden, und ebenso eine
Sensibilisierung der jungen Menschen fr die Belange der lteren Brger erfolgen
(Peters, 1995). Der Tatsache, dass in Rheindorf-Nord berdurchschnittlich viele
junge Nichtdeutsche auf ltere Deutsche treffen, muss Rechnung getragen werden.
Manahmen, die Begegnungen zwischen Jung und Alt, Deutschen und
Nichtdeutschen ermglichen sollten vermehrt geschaffen werden, um die
113
Atmosphre im Quartier zu verbessern und ungerechtfertigten Befrchtungen und
Labeling Prozessen entgegenzutreten und Integration zu ermglichen.
Die trkischstmmigen Jugendlichen und Heranwachsenden in Rheindorf-Nord aber
auch in Deutschland gesamt, bilden keine homogene Gruppe und sollten nicht in
Stereotype der Statistik oder der pdagogischen Arbeit eingegrenzt werden.
Festzuhalten bleibt, dass ein erhhter Anteil mannigfaltigen Benachteiligungen
unterliegt, die verstrkt Devianz und Delinquenz bedingen, dies muss aber
abstrahiert von der ethnischen Herkunft gesehen werden. Wie bei allen jungen
Menschen erschweren Vernderungen in der Jugendphase und
Individualisierunstendenzen sowie Pluralisierungen der Milieus ihre
Adoleszenzphase (vgl. Scherr in Rauschenbach, 2002). Die berall auftretenden
positiven Entwicklungen drfen ebenso nicht bersehen werden. Eine dritte
Generation wchst heran, in der viele als Deutsche mit trkischen Wurzeln ihren
Identittsfindungsprozess trotz Schwierigkeiten erfolgreich abgeschlossen haben. Die
jungen Menschen, die an dieser Entwicklung aus unterschiedlichen Grnden noch
nicht teilnehmen konnten, sollte eine pdagogische Jugendarbeit begleiten, die diese
Identittsfindung ermglicht und ein positives Selbstverstndnis untersttzt.
Sozialrumlichen und lebensweltlichen Situationen dieser heterogenen Gruppen
muss Rechnung getragen werden und die entsprechenden Angebote zu Verfgung
gestellt werden. Ziel einer sozialrumlichen und prventiven Jugendarbeit darf es
allerdings nicht sein den ffentlichen Raum, der Aneignungsmglichkeiten bietet, fr
diese weiter zu begrenzen. Vielmehr ist das Image der gefhrlichen Jugendlichen
zu verbessern und Dialog- sowie Austauschmglichkeiten zu schaffen. Eine
Vernetzung der Akteure auf Quartiersebene, um eine frhzeitige Begleitung durch
schwierige Lebensabschnitte der jungen Menschen zu ermglichen, ist weiterhin
auszubauen und zu pflegen. Die Staatsangehrigkeit entscheidet nicht ber die
Delinquenzbelastung. Hhere Belastungen mssen differenziert gesehen werden und
sind Ausdruck von schwierigen Lebenslagen. Die Akteure vor Ort sind fr die
besonderen Probleme der Jugendlichen und besonders der jungen Nichtdeutschen
und der Aussiedler zu sensibilisiert
Literatur:
Aichhorn, August: Verwahrloste Jugend, Verlag Hans Huber, Bern, 1987
Alamdar-Niemann, Monika: Trkische Jugendliche im Eingliederungsproze, Verlag
Dr. Kovac, 1. Aufl., 1992
Albrecht, Peter-Alexis; Pfeiffer, Christian: Die Kriminalisierung junger Auslnder,
Befunde und Reaktionen sozialer Kontrollinstanzen, Juventa Verlag, 1979
Albrecht, Peter-Alexis; Lamnek, Siegfried: Jugendkriminalitt im Zerrbild der
Statistik,Eine Analyse von Daten und Entwicklung, Juventa Verlag, 1979
Albrecht, Hans-Jrg (Hrsg.); Plewig, Hans-Joachim, Mnder, Johannes; Sack, Fritz
Jugendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalitt, Neuwied Luchterhand, 1987
Bauer, Gertrud: Sozialisationsbedingungen jugendlicher Straftter, Enke Verlag,
Stuttgart, 1985
Becker, Howard S.: Auenseiter, Soziologie abweichenden Verhaltens, Fischer TB.
Verlag, Frankfurt/Main, 1981
Bielefeld, Uli: Inlndische Auslnder, Zum gesellschaftlichen Bewusstsein trkischer
Jugendlicher in der Bundesrepublik, Campus Verlag, 1988
Boers, Klaus; Gutsche, Gnter; Sessar, Klaus (Hrsg.), Sozialer Umbruch und
Kriminalitt in Deutschland, Opladen., 1997
Boos-Nnning, Ursula: Berufswahl trkischer Jugendlicher. Entwicklung einer
Konzeption fr die Berufsberatung, Beitrge zur Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung 121, Nrnberg: IAB., 1989
Boos-Nnning, Ursula; Karakasoglu, Yasemin: Viele Welten leben,
Bundesministerium fr Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2004
Bhnisch, Lothar: Abweichendes Verhalten, Eine pdagogisch-soziologische
Einfhrung, 2. Aufl., Juventa Verlag, Weinheim und Mnchen, 2001
Breyvogel, W. (Hrsg.), Stadt Jugendkulturen und Kriminalitt, Bonn: J.H.W.Dietz,
1998
Burgess, E.W.; Bogue, D.J.: The Delinquency Research of Clifford R. Shaw and
Henry D. McKay and Associates, 1964
Cakir, Mustafa: Soziale und bildungspolitische Rahmenbedingungen der Migration
und der Stellenwert des Deutschen unter den Trken, Shaker Verlag, Aachen
2001
Chaidou, Anthozoe: Junge Auslnder aus Gastarbeiterfamilien in der Bundesrepublik
Deutschland, ihre Kriminalitt nach offizieller Registrierung und nach ihrer
Selbstdarstellung, Frankfurt am Main, u.a.: Peter Lang Verlag, 1984
Cohen, Albert K.; Claessens, Dieter: Grundfragen der Soziologie, Bd. 7,
Abweichung und Kontrolle, Juventa Verlag, 1968
Dollard, John (Hrsg.); Leonard,W. (Hrsg.); Doob, Neal E. (Hrsg.): Frustration und
Aggression, Reprint., Beltz PVU (Aufl.: Nachdr. d. 5. Aufl. 1973), 1994
Durkheim, Emile; Knig, Rene (Hrsg.): Die Regeln der soziologischen Methode,
Suhrkamp Verlag, 2002
Enke, Thomas: Sozialpdagogische Kriesenintervention bei Delinquenten
Jugendlichen, Eine Lnsschnittstudie zu Verlaufstrukturen von
Jugenddelinquenz, Juventa Verlag, Weinheim und Mnchen, 2003
114
Feuerhelm, Wolfgang; Mller, Heinz; Porr, Claudia (Hrsg.): Ist Prvention gegen
Jugendkriminalitt mglich? Erklrungsanstze, Grenzziehung und
Perspektiven fr die Handlungsfelder Jugendhilfe, Schule, Justiz und Politik,
Ministerium fr Kultur, Jugend, Familie und Frauen, Mainz 2000
Gehl, Gnter (Hrsg.): Kinder- und Jugendkriminalitt, ber den Umgang mit einem
gesellschaftspolitischen Sprengsatz, Perspektiven und Konzepte, Verlag Rita
Dadder, Weimar 2000
Geiler, Rainer: Das Gefhrliche Gercht von der hohen Auslnderkriminalitt.
Aus Politik und Zeitgeschichte B 35, S. 30- 39, 1995
Geiler, Rainer: Sind Auslnder krimineller als Deutsche? Anmerkungen zu einem
vielschichtigen Problem; in Zeitschrift fr Migration und Soziale Arbeit, Heft
1/2000, u. in Gegenwartskunde 1/2001
Geiler, Rainer: Auslnderkriminalitt-Vorurteile, Missverstndnisse, Fakten, in:
Zeitschrift fr Migration und Soziale Arbeit, 1/2000
Gesemann, Frank: Kriminalitt nichtdeutscher Jugendlicher in Berlin,
Bestandsaufnahme -Ursachenanalyse-Manahmen zur Gewaltprvention,
DVJJ-Journal, Heft 2/2000, S.113 ff; Serie Prvention
Glinka, H-J.: Das narrative Interview, Eine Einfhrung fr Sozialpdagogen,
Weinheim, Mnchen 1998
Goldberg, Andreas Sauer, Martina: Die Lebenssituation und Partizipation trkischer
Migranten in Nordrhein-Westfalen, Zentrum fr Trkeistudien, Essen 2000
Hamburger, Franz; Seus, L.; Wolter, O.: Zur Delinquenz auslndischer Jugendlicher.
Bedingungen der Entstehung und Prozesse der Verfestigung. Wiesbaden,
BKA.,1981
Herbert, Ulrich: Geschichte der Auslnderpolitik in Deutschland, Bundeszentrale fr
politische Bildung, Band 410, C.H. Beck Verlag, 2003
Hernold, Peter (Hrsg); von Loeffelholz, Hans D.: Berufliche Integration von
Zuwanderern, Rheinisch-Westflisches Institut fr Wirtschaftsforschung e.V.
Hermann, Dieter; Laue, Christian: Kommunale Kriminalprvention, Ein populres
kriminalpolitisches Konzept, in Sicherheit und Kriminalitt Heft 1/ 2003 ,
LpB
Heitmeyer, Wilhelm; et al. (Hrsg.): Gewalt: Schattenseiten der Individualisierung
bei Jugendlichen aus unterschiedlichen Milieus. Weinheim: Juventa
Verlag,1996
Heitmeyer, Wilhelm; Mller, Joachim; Schrder, Helmut: Verlockender
Fundamentalismus. Trkische Jugendliche in Deutschland. Frankfurt:
Suhrkamp Verlag,1997
Hermann, Dieter/ Laue, Christian: Kommunale Kriminalprvention Ein populres
kriminalpolitisches Konzept, in Sicherheit und Kriminalitt Heft 1/ 2003 LpB
Hurrelmann, Andreas (Hrsg.); Klocke, Andreas: Kinder und Jugendliche in Armut,
VS Verlag fr Sozialwissenschaften, 2001
Jehle, Jrg-Martin: Kriminalprvention und Strafjustiz. Kriminologie und Praxis,
Band 17. Wiesbaden, Kriminologische Zentralstelle e.V., 1996
Karakasoglu-Aydin, Yasemin: Trkische Muslime in Nordrhein
Westfalen,Ministerium fr Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes
Nordrhein Westfalen,1997
115
Kaul, Peter; Flach, Karl,A.; Renner Klaus; Schmidt, Heinz: Jugendkriminalitt eine
Folge fehlender Berufsausbildung, G. Schindele-Verlag, Rheinsttten, 1979
Kristen, Cornelia: Ethnische Unterschiede im deutschen Schulsystem, aus Politik und
Zeitgeschichte, B 21-22/2003
Kristen, Cornelia: Bildungsentscheidungen und Bildungsungleichheit ein berblick
ber den Forschungsstand, Arbeitspapiere -Mannheimer Zentrum fr
Europische Sozialforschung Nr. 5, 1999, (www.mzes.uni-mannheim.de)
Kolinsky, Eva: Deutsch und trkisch leben, Bild und Selbstbild der trkischen
Minderheit in Deutschland, Bern, Peter Lang AG, 2000
Korte, Hermann.; Schfers, Bernhard (Hrsg.): Einfhrung in die Hauptbegriffe der
Soziologie, 5. Aufl., Leske+Budrich, Opladen 2000
Krummacher, Michael; Kulbach, Roderich; Waltz, Victoria; Wohlfahrt, Norbert:
Soziale Stadt, Sozialraumentwicklung, Quartiersmanagement,
Herausforderungen fr Politik, Raumplanung und soziale Arbeit,
Leske+Budrich, Opladen 2003
Lamnek, Siegfreid.: Theorien abweichenden Verhaltens, W. Fink Verlag, 7.Aufl.
Mnchen 2001
Lamnek, Siegfried.: Neue Theorien abweichenden Verhaltens, W. Fink Verlag,
2.Aufl., Mnchen 1979
Loos, Peter: Kriminalisierungserfahrungen trkischer Jugendlicher in Berlin
Bericht aus einem Forschungsprojekt, Berliner Forum Gewaltprvention,
2000
Mansel, Jrgen: Quantitative Entwicklung von Gewalthandlungen Jugendlicher und
ihrer offiziellen Registrierung. Anstze schulischer Prvention zwischen
Anspruch und Wirklichkeit. Zeitschrift fr Sozialisationsforschung und
Erziehungssoziologie, 15, 101-121, 1995
Mansel, Jrgen: Die Disziplinierung der Gastarbeiternachkommen durch Organe der
Strafrechtspflege,1988, In: Zeitschrift fr Soziologie 17 (5), taz Beilage
9/1998, aus Onlinezeitung Dr. Juergen Mansel
Mansel, Jrgen; Klocke, Andreas (Hrsg.): Die Jugend von heute. Selbstanspruch,
Stigma und Wirklichkeit, Juventa Verlag, Mnchen 1996
Mansel, Jrgen; Brinkhoff, Klaus-Peter (Hrsg.): Armut im Jugendalter, Soziale
Ungleichheit, Gettoisierung und die psychosozialen Folgen, Juventa Verlag,
1998
Meier-Braun, Karl-Heinz: Das Auslnderbild in den Thringer Tageszeitungen 1995
1999, (Hrsg.) Der Auslnderbeauftragte der Thringer Landesregierung,
2. Aufl., Juli 2001, Bestellbar bei der Thringer Landesregierung
Meier-Braun, Karl-Heinz: Blinde Flecken? Politik und Medien mssen sich
verstrkt um das Thema Migration kmmern, Referat anlsslich der
Prsentation der Studie Das Auslnderbild in den Thringer Tageszeitungen
1995-1999 am 15.12.2000, Erfurt, Internet SWR
Mertens, Gabriele: Trkische Migrantenfamilien, Familienstrukturen in der Trkei
und in der Bundesrepublik, Angleichungsprobleme trkischer
Arbeiterfamilien, Beispiel West-Berlin, AGG Bonn, 1977
Merton, Robert K.: Soziologische Theorie und soziale Struktur, Gruyter, 1995
Mller, Joachim: Jugendliche trkischer Herkunft, Alltagserfahrungen und
116
Orientierungen, aus W&F Wissenschaft und Frieden, Heft 4/98
Mnder, Johannes; Sack, Fritz; Albrecht, Hans-Jrg; Plewig, Hans-Joachim:
Jugendarbeitslosigkeit und Jugendkriminalitt, H. Luchterhand Verlag,
Neuwied, 1987
Ortner, Helmut (Hrsg.): Die Null-Lsung, Zero-Tolerance Politik in New York, Das
Ende der urbanen Toleranz?, Nosmos Verlagsgesellschaft,1998
Ostendorf, Heribert: Ursachen von Kriminalitt, in Informationen zu politischen
Bildung 248, Kriminalitt und Srafrecht,1999
Ostendorf, Heribert: von der Forschungsstelle fr Jugendstrafrecht und
Kriminalprvention an der Universitt Kiel ber: Chancen und Risiken von
Kriminalprvention (Vortrag Landesprventionstag Gemeinsam gegen
Kriminalitt des Landes Sachsen-Anhalt) 19. Oktober 2000, (Internet)
Oberwittler, Dietrich.: Neighborhood Cohesion and Mistrust - Ecological Reliability
and Structural Conditions (working paper/ No. 3), 2001
Oberwittler, Dietrich.: Juvenile Delinquency in Urban Neighborhoods Do
Community Contexts Matter? Paper Presented at the First Annual Meeting of
the European Society of Criminology, Lausanne Sept. 2001 (working paper/
No. 2), 2001
Oberwittler, Dietrich: Sozialkologisch orientierte Analyse der Jugenddelinquenz
und ihrer sozialstrukturellen Korrelate im urbanen Raum. DFG-Antrag auf
Gewhrung einer Sachbeihilfe (Auszge) (working paper/ No. 1), 1999
Pagenstecher Cord, Die Illusion der Rckkehr. Zur Mentalittsgeschichte von
Gastarbeit und Einwanderung, in Soziale Welt, 47 (2), 1996
Peters, Helge: Devianz und soziale Kontrolle; Eine Einfhrung in die Soziologie
abweichenden Verhaltens, Juventa Verlag, 1995
Polat, lger: Soziale und kulturelle Identitt trkischer Migranten der zweiten
Generation in Deutschland, Dr. Kovac Verlag, 1997
Pfeiffer, Christian: Das Problem der so genannten Auslnderkriminalitt.
Empirische Befunde, Interpretationsangebote und (kriminal-)politische
Folgerungen, KFN Forschungsberichte, Hannover, 1995
Pfeiffer, Christian: Steigt die Jugendkriminalitt? Zugleich eine Erwiderung auf
Michael Walters Beitrag in diesem Heft. DVJJ-Journal 7., 1996
Pfeiffer, Christian; Delzer, Ingo; Enzmann, Dirk; Wetzels, Peter: Ausgrenzung,
Gewalt und Kriminalitt im Leben junger Menschen. Kinder und Jugendliche
als Opfer und Tter. Hannover: Eigenverlag des DVJJ, 1998
Pftzenreuter, Wolf-Dieter: Zur Entwicklung der Situation nichtdeutscher
Jugendlicher in Schule, Ausbildung und Beruf Berliner Forum
Gewaltprvention
Rauschenbach, Thomas; Dx, Wiebke; Zchner, Ivo (Hrsg.):
Jugendarbeit im Aufbruch, Selbstvergewisserungen, Impulse, Perspektiven,
Votum Verlag, 2002
Reich, Kerstin: Kriminalitt von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Sind
auslndische Jugendliche krimineller? in: Sicherheit und Kriminalitt Heft
1/2003 Hrsg: LpB, (Internet)
Rebmann, Matthias: Auslnderkriminalitt in der Bundesrepublik Deutschland,
Internet Angebot der Stiftungsverwaltung Freiburg, Freiburg i. Br. 1998
117
Riege, Mario: Der soziale Wohnungsbau, Sein Beitrag und seine Grenzen fr eine
soziale Wohnungspolitik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur
Wochenzeitung Das Parlament. B 8-9, 2/1993
Sack, Fritz (Hrsg.); Lderssen, Klaus (Hrsg.): Seminar: Abweichendes Verhalten 1.
Die selektiven Normen der Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main,
1974
Sack, Fritz (Hrsg.); Lderssen, Klaus (Hrsg.): Seminar: Abweichendes Verhalten 3.
Die Gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalitt, Band 2/ Strafproze und
Starfvollzug, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1974
Schch, Heinz; Gebauer, Michael: Auslnderkriminalitt in der Bundesrepublik
Deutschland, Kriminologische, rechtliche und soziale Aspekte eines
gesellschaftlichen Problems, Nomos verlagsgesellschaft Baden-Baden, 1991
Schnell, Rainer; Hill, Paul.B.; Esser Elke: Methoden der empirischen
Sozialforschung, 6.Aufl., Mnchen/Wien, R. Oldenburg Verlag 1999
Schorb, Bernd: Was guckst Du, was denkst Du?, Der Einfluss auf das Auslnderbild
von Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren, 2. Aufl. 2000, Unabhngige
Landesanstalt fr Rundfunk und neue Medien (ULR)Kiel- bestellbar (Internet)
Schwind, Hans-Dieter: Kriminologie, Eine praxisorientierte Einfhrung mit
Beispielen,14. Aufl., Kriminalistik Verlag Heidelberg, 2004
Schultz, Tanjev, Sackmann Rosemarie: "Wir Trken . . ." Zur kollektiven Identitt
trkischer Migranten in Deutschland, Aus Politik und Zeitgeschichte
(B43/2001)
Seifert, Wolfgang (Hrsg.): Wie Migranten leben, Lebensbedingungen und soziale
Lage der Auslndischen Bevlkerung in der Bundesrepublik,
Wirtschaftszentrum Berlin fr Sozialforschung (WBZ), 1995
Seidel-Pielen, Eberhard: Unsere Trken - Annherungen an ein gespaltenes
Verhltnis, Elefanten Press Verlag, Berlin 1995
Sen, Faruk; Goldberg, Andreas; Halm, Dirk: Die Deutschen Trken, LIT Verlag
Mnster, 2004
Sen, Faruk: Trkische Minderheit in Deutschland. In: Informationen zur politischen
Bildung 277. 4. Quartal 2002. Trkei. Hrsg. v. d. Bundeszentrale fr
politische Bildung. Mnchen, Franzis print+media GmbH, 2002
Sen, Faruk: Integration oder Abschottung? Zur Situation trkischer Zuwanderer in
Deutschland, ZAR 2001
Sen, Faruk; Goldberg, Andreas: Trken in Deutschland - Leben zwischen zwei
Kulturen, Verlag C.H. Beck , Mnchen 2002
Shaw, Clifford R. u. McKay, Henry D. 1969: Juvenile Delinquency and Urban Areas
(2.A.), Chicago: Chicago University Press (Internet)
Sykes, Gresham M.; Matza, David: Techniken der Neutralisierung: Eine Theorie der
Delinquenz. In: Sack, Fritz.;Knig, R.(Hrsg.): Kriminalsoziologie,
Frankfurt/Main: Akademische Verlagsgesellschaft, 1968
Solga, Heike: Das Paradox der integrierten Ausgrenzung von gering qualifizierten
Jugendlichen, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21-22/2003
Steffen, Wiebke: Strukturen der Kriminalitt der Nichtdeutschen. In: Jrg-Martin
Jehle (Hrsg.) Raum und Kriminalitt. Sicherheit der Stadt.
Migrationsprobleme. Godesberg 2001
118
Sonnen, Bernd-Ruedeger: Die Medien und Auslnderkriminalisierung als politisches
Instrument, Beilage zur taz, 9/1998
Tertilt, H.: Turkish Power Boys. Zur Interpretation einer gewaltbereiten Subkultur,
in: Zeitschrift fr Sozialisation und Erziehung, 1/1997
Tibi, Bassam: Islamische Zuwanderung, Die gescheiterte Integration, 2. Aufl.,
Deutsche Verlagsanstalt GmbH, Stuttgard Mnchen, 2002
Tibi, Bassam: Der Islam und Deutschland, Muslime in Deutschland, 2. Aufl.,
Deutsche Verlags- Anstalt GmbH, Stuttgart Mnchen, 2001
Vassaf, G.: Wir haben unsere Stimme noch nicht laut gemacht, Felsberg 1985
Von Wilamowitz- Moellendorf, Ulrich: Trken in Deutschland, Einstellungen zu
Staat und Gesellschaft, Projekt Zuwanderung und Gesellschaft, Nr. 53/2001,
Konrad Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2001, (Internet)
Von Wilamowitz- Moellendorf, Ulrich: Trken in Deutschland II, Individuelle
Perspektiven und Problemlagen, Projekt Zuwanderung und Gesellschaft,
Nr.60, Konrad- Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin 2002, (Internet)
Wetzel, Juliane: Fremde in den Medien, Informationen zur politischen Bildung,
Heft271, 2001
Wollenschlger, Michael Die Gast- und Wanderarbeiter im deutschen Arbeitsrecht,
RdA, 1994
Wilpert, Czarina: Die Zukunft der zweiten Generation, Erwartungen und
Verhaltensmglichkeiten auslndischer Kinder,
Hain Verlag, Bodenheim, 1997
Wollenweber, Horst (Hrsg.): Kinderdelinquenz und Jugendkriminalitt, Paderborn,
Mnchen, Wien, Zrich, Schningh, 1980
Wollenschlger, Michael Konzeption fr eine Zu-/Einwanderungsgesetzgebung fr
die Bundesrepublik Deutschland, ZRP 2001, S. 459
Wmann, Ludger: Familirer Hintergrund, Schulsystem und Schlerleistungen im
internationalen Vergleich, aus Politik und Zeitgeschichte, B 21-22/2003
Wurr, Rdiger : Abweichendes Verhalten und sozialpdagogisches Handeln, 3.Aufl.,
Kohlhammer Verlag, 1993
Yildirim, Kazim: Sozialisationsbedingte Gewalt, Berliner Forum Gewaltprvention
Weitere Literatur zu genannten Studien:
Bundeskriminalamt (Hrsg.): Moderne Sicherheitsstrategien gegen das Verbrechen.
Vortrge und Diskussionen der Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes vom 17. bis
19. November 1998. Wiesbaden, S. 91-124
DJI (Deutsches Jugendinstitut) -Projektgruppe Delinquenz von Kindern eine
Herausforderung fr Familie, Jugendhilfe und Politik 1999: Straftatverdchtige
Kinder und ihre Familien Problembewusstsein zustndiger Institutionen.
Dokumentation, Mnchen (www.dji.de )
Eifler Stefanie, Ratzka Melanie in: Gelegenheitsstrukturen und Kriminalitt,
Universitt Bielefeld, 2001 Die Reihe Soziale Probleme, Gesundheit und
119
Sozialpolitik. Materialien und Forschungsbericht wird herausgegeben von der
Wissenschaftlichen Einheit Soziale Probleme, Gesundheit und Sozialpolitik an der
Fakultt fr Soziologie der Universitt Bielefeld.
Der Mythos der Monsterkids Strafunmndige Mehrfach- und Intensivtter Ihre
Situation Grenzen und Mglichkeiten der Hilfe Dokumentation des Hearings des
Bundesjugendkuratoriums am 18. Juni 1998 in Bonn, Herausgegeben von der
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalittsprvention am Deutschen
Jugendinstitut und dem Bundesjugendkuratorium, Deutsches Jugendinstitut e.V.
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalittsprvention
Die Beauftragte der Bundesregierung fr die Belange der Auslnder, 1997, Nummer
7 Integration oder Ausgrenzung? Zur Bildungs- und Ausbildungssituation von
Jugendlichen auslndischer Herkunft
Deutschland und die Trkei im Spiegel der Medien: die Verantwortung der Medien
in den deutsch-trkischen Beziehungen , Verf.: Edgar Auth., Istanbul 1998, (Politik
und Gesellschaft) Bonn: FES Library, 1998, Friedrich-Ebert-Stiftung
Sachverstndigenkommission: 6. Familienbericht: Familien auslndischer Herkunft
in Deutschland/3 (Internet)
Internet:
www.ifk.jura.uni-tuebingen.de
Stelly, Wolfgang, Thomas, Jrgen: Wege aus schwerer Jugendkriminalitt
Stand der Forschung, Instituts fr Kriminologie, Nr.1, 2000
www.uni-bielefeld.de
Ratzka, Melanie: Forschung Differentielle Assoziationen, Rational Choice
und kriminelles Handeln/ Universitt Bielefeld Fakultt fr Soziologie, 2001.
www.isoplan.de
Integration in Deutschland 3/2004, 20.Jg., 28. September 2004, Isoplan
Aktueller Informationsdienst zu Fragen der Migration und Integrationsarbeit,
Herausgeber: isoplan - Institut fr Entwicklungsforschung, Wirtschafts- und
Sozialplanung GmbH. Besonders AiD-Integration in Deutschland
www.lpb.bwue.de
Trken bei uns Zeitschrift Politik & Unterricht 3/2000 (wird von der
Landeszentrale fr politische Bildung Baden-Wrttemberg herausgegeben.) -
Migration, Heft 3/2000 , Hrsg.: LpB
www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Migrationsforschung
Arbeitsstelle Migrationsforschung am Institut fr Politikwissenschaft der
Westflischen Wilhelms-Universitt Mnster
120
www.imis.uni-osnabrueck.de
Institut fr Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), IMIS ist
ein interdisziplinres und interfakultatives Forschungsinstitut der Universitt
Osnabrck.
www.uni-bamberg.de
europisches forum fr migrationsstudien (efms), Institut an der Universitt
Bamberg. Auf dem efms-Webserver finden Sie Informationen ber das
Institut und ber seine Aktivitten; dazu sind Materialien zu Migration und
Integration (Statistiken, Texte, Datenbanken) online zugnglich.
www.zuv.unibas.ch
Projektbericht des Institutes fr Soziologie und der Fachhochschule
fr Soziale Arbeit in Basel ber Jugend und Gewalt 2001
www.bmi.bund.de
Bundesministerium des Inneren
www.integrationsbeauftragte.de
Beauftragte der Bundesregierung fr Migration, Flchtlinge und Integration.
Ein stndig aktualisiertes Informationsangebot zu Fragen der Auslnder-,
Migrations- und Flchtlingspolitik, zur Ttigkeit der Integrationsbeauftragten
und weitere Hinweise in diesem Themenbereich.
www.boell.de
Christiane Bainski/Sabine Mannitz/Anne Sliwka/Heike Solga/Sybille
Volkholz und Gl Yoksulabakan, Schule und Migration: 6. Empfehlung der
Bildungskommission der Heinrich-Bll-Stiftung, in: Heinrich-Bll-Stiftung
und Bildungskommission der Heinrich-Bll-Stiftung (Hrsg.), Selbststndig
Lernen. Bildung strkt Zivilgesellschaft, Weinheim & Basel (Beltz Verag),
2004
www.uni-oldenburg.de
unter Forschung aktuell: Studie der Arbeitsgruppe Stadtforschung an der
Universitt Oldenburg, Leitung: Prof. em. Dr. Walter Siebel und Dr. Norbert
Gestring Zwischen Integration und Ausgrenzung. Lebensverhltnisse
trkischer Migranten der Zweiten Generation. Fr diese Studie zu den
Bereichen Arbeit, soziale Netzwerke und Wohnen befragten die
WissenschaftlerInnen in ausfhrlichen Interviews in Hannover 55 trkische
Migranten der zweiten Generation (die also in Deutschland aufgewachsen
sind) sowie 41 Personen, die beruflich mit Migranten zu tun haben und ber
deren Zugang und Platzierung im Arbeits- und Wohnungsmarkt entscheiden.
www.senbjs.berlin.de
Senatsverwaltung fr Bildung, Jugend und Sport
www.mzes.uni-mannheim.de
MZES: Mannheimer Zentrum fr Europische Sozialforschung, ein
interdisziplinres Forschungsinstitut der Universitt Mannheim.
www.iatge.de
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, Kulturwissenschaftliches
Institut
www.turk.ch/islam/de/turkischejugendliche.htm
Dr. Seref Ates,
121
www.bezreg-arnsberg.nrw.de
Fachtagung der Bezirksregierung Arnsberg
zum Thema Integration und Identitt Trkischstmmige Jugendliche - Leben
in oder zwischen zwei Kulturen Vortrag von Prof. Dr. Faruk en am 28.
November 2003 in Dortmund
www.gesis.org
GESIS - Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen
e.V. Zentrale Aufgabe der GESIS ist die Untersttzung der
sozialwissenschaftlichen Forschung. Zu den Dienstleistungen der GESIS
gehren der Aufbau und das Angebot von Datenbanken mit Informationen zu
sozialwissenschaftlicher Literatur und zu Forschungsaktivitten sowie die
Archivierung und Bereitstellung von Umfragedaten aus der Sozialforschung.
Hier besonders Zentralarchiv fr Empirische Sozialforschung, Universitt zu
Kln
www.forum-kriminalpraevention.de
"forum kriminalprvention" versteht sich dabei als aktuelle, interdisziplinre
Informationsbrse fr alle, die kriminalprventive Aufgaben wahrnehmen
oder fr diese Belange interessiert werden sollen.
www.bpb.de
Bundeszentrale fr politische Bildung
www.destatis.de
Das Statistische Bundesamt Deutschland
www.kfn.de
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.
Das KFN ist ein unabhngiges, interdisziplinr arbeitendes Forschungsinstitut
in Trgerschaft eines gemeinntzigen Vereins
Forschungsberichte Nr. 80 Innerfamilire Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche und ihre Auswirkungen von Christian Pfeiffer, Peter Wetzels und
Dirk Enzmann Hannover im November 1999 Kriminologisches
Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN)
www.bmfsfj.de
Bundesministerin fr Familie, Senioren, Frauen und Jugend
www.bagjaw.de
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW) ist der
arbeitsgemeinschaftliche Zusammenschluss von derzeit fnf Trgergruppen,
acht Landesarbeitsgemeinschaften und dem Arbeitskreis "Benachteiligte
Jugendliche" im Verband Deutscher Privatschulen (VDP)
www.spiegelstudien.de
Spiegel Titelbilder: SPIEGELstudien ist ein im Jahre 2003 gegrndetes
interdisziplinres Forschungsprojekt, das kulturhistorische Untersuchungen
zur Ikonographie der Sensations-Berichterstattung durchfhrt, nach medien-
wissenschaftlichen Methoden zur Erklrung von Jounalismus-Verdrossenheit
sucht und informationstechnologische Verfahren zur Verarbeitung,
www.uni-konstanz.de/rtf/kik/index.htm
Unter dem Titel "Konstanzer Inventar" ist in den vergangenen Jahren eine
grere Zahl von Sonderauswertungen verffentlichter und unverffentlichter
122
Daten zur Struktur und Entwicklung der registrierten Kriminalitt und der
Sanktionspraxis in der Bundesrepublik Deutschland entstanden, die im
Rahmen verschiedener Einzel- und bersichtsdarstellungen graphisch
aufbereitet und verffentlicht wurden. Sowie statistisch und graphisch
aufbereitete Daten zur Entwicklung der amtlich registrierten Kriminalitt auf
Basis der Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik und der gerichtlichen
Verurteiltenstatistik (Strafverfolgungsstatistik) bereit.
www.mpib-berlin.mpg.de/en/forschung/nwg/arbeitsberichte.htm
The Max Planck Institute for Human Development
Daten und Fakten zu Migrantenjugendlichen an Sonderschulen in der
Bundesrepublik Deutschland, Justin J. W. Powell; Sandra Wagner
Working Paper 1/2001
www.muslim-markt.de
umfangreiche Seite -Islam fr deutschsprachige Glubige- von Dr. Yavuz
zoguz und Dr. Grhan zoguz
www.news.jugendsozialarbeit.de
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e.V
www.bezreg-arnsberg.nrw.de
Fachtagung der Bezirksregierung Arnsberg zum Thema Integration und
Identitt Trkischstmmige Jugendliche - Leben in oder zwischen zwei
Kulturen Vortrag von Prof. Dr. Faruk en am 28. November 2003 in
Dortmund
www.scp.nl
Sociaal en Cultureel Planbureau,(Sozial and Cultural Planning Office of the
Netherlands; das SCP verffentlicht Publikationen ber das Leben in Holland
mit Blick auf die Bevlkerung im Allgemeinen und besonderer Gruppen (u.a.
Behinderte, ethnische Minderheiten, junge Menschen etc.)
www.inburgernet.nl
InburgerNet ermglicht vom Justizministerium, Aktuelles zum Thema
Migration in Holland und mehr. Auf Grund der Ermordung des Filmemachers
van Gogh, war es fr diese Arbeit sehr interessant zu beobachten, wie die
Hollnder mit dieser Thematik umgehen.
123
Anhang:
Individual und ffentlicher Personen-Nahverkehr Rheindorf-Nord
Leitfaden der Interviews
Individual und ffentlicher Personen-Nahverkehr Rheindorf-Nord
Quelle: Individualverkehr (PNV): Aneta Brancewicz, Florian Schalow (FH-Kln)
124
Quelle: ffentlicher Personen-Nahverkehr(PNV): Aneta Brancewicz, Florian
Schalow (FH-Kln)
125
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Jugendkriminalität: Eine Explikation kriminogener Faktoren auf der Grundlage ausgewählter Kriminalitätstheorien im Bezugsrahmen des sozialwissenschaftlichen Diskurses, in der Abgrenzung zur Erwachsenenkriminalität und diesbezüglicher polizeilicher HandlungsmöglichkeitenVon EverandJugendkriminalität: Eine Explikation kriminogener Faktoren auf der Grundlage ausgewählter Kriminalitätstheorien im Bezugsrahmen des sozialwissenschaftlichen Diskurses, in der Abgrenzung zur Erwachsenenkriminalität und diesbezüglicher polizeilicher HandlungsmöglichkeitenNoch keine Bewertungen
- Was macht Migration mit Männlichkeit?: Kontexte und Erfahrungen zur Bildung und sozialen Arbeit mit MigrantenVon EverandWas macht Migration mit Männlichkeit?: Kontexte und Erfahrungen zur Bildung und sozialen Arbeit mit MigrantenNoch keine Bewertungen
- Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: Handlungsstrategien gegen eine rechtsextreme Jugendkultur und fremdenfeindliche EinstellungenVon EverandRechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: Handlungsstrategien gegen eine rechtsextreme Jugendkultur und fremdenfeindliche EinstellungenNoch keine Bewertungen
- Die soziale Situation jugendlicher „Sinti und Roma“Von EverandDie soziale Situation jugendlicher „Sinti und Roma“Noch keine Bewertungen
- FRINDTE Rechtsextremismus NSU 2016Dokument491 SeitenFRINDTE Rechtsextremismus NSU 2016Bence HimpelmannNoch keine Bewertungen
- Corrective Rape" in Südafrika: Reflexionen zu den historischen und politischen Bedingungen homophober GewaltVon EverandCorrective Rape" in Südafrika: Reflexionen zu den historischen und politischen Bedingungen homophober GewaltNoch keine Bewertungen
- Lebenslagen älterer Migrantinnen und Migranten in DeutschlandVon EverandLebenslagen älterer Migrantinnen und Migranten in DeutschlandNoch keine Bewertungen
- GötT Luke Schwarz 10B English VersionDokument29 SeitenGötT Luke Schwarz 10B English VersionPupskopflolTVNoch keine Bewertungen
- Täter Taten Opfer - Kriminologie PDFDokument868 SeitenTäter Taten Opfer - Kriminologie PDFShenja Lenin100% (2)
- Hat Migration Auswirkung auf den psychischen Gesundheitszustand?Von EverandHat Migration Auswirkung auf den psychischen Gesundheitszustand?Noch keine Bewertungen
- Jugend und islamistischer Extremismus: Pädagogik im Spannungsfeld von Radikalisierung und DistanzierungVon EverandJugend und islamistischer Extremismus: Pädagogik im Spannungsfeld von Radikalisierung und DistanzierungNoch keine Bewertungen
- 1 47 1 ViktimisierungsbefragungenInDeutschland PDFDokument600 Seiten1 47 1 ViktimisierungsbefragungenInDeutschland PDFabhiNoch keine Bewertungen
- Hybride Alltagswelten: Lebensstrategien und Diskriminierungserfahrungen Jugendlicher der 2. und 3. Generation aus MigrationsfamilienVon EverandHybride Alltagswelten: Lebensstrategien und Diskriminierungserfahrungen Jugendlicher der 2. und 3. Generation aus MigrationsfamilienNoch keine Bewertungen
- Rechtsextreme Frauen – Analysen und Handlungsempfehlungen für Soziale Arbeit und PädagogikVon EverandRechtsextreme Frauen – Analysen und Handlungsempfehlungen für Soziale Arbeit und PädagogikNoch keine Bewertungen
- Metamorphose – Sexuelle Sozialisation in der weiblichen PubertätVon EverandMetamorphose – Sexuelle Sozialisation in der weiblichen PubertätNoch keine Bewertungen
- Ruck nach rechts?: Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und die Frage nach GegenstrategienVon EverandRuck nach rechts?: Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und die Frage nach GegenstrategienNoch keine Bewertungen
- Deutschlands verlorene 13 Jahre Teil 6: Justiz - Quo vadis?Von EverandDeutschlands verlorene 13 Jahre Teil 6: Justiz - Quo vadis?Noch keine Bewertungen
- Organisierte Kriminalität und Terrorismus im Rechtsvergleich: Deutsch-Chinesischer Rechtsdialog, Band IVon EverandOrganisierte Kriminalität und Terrorismus im Rechtsvergleich: Deutsch-Chinesischer Rechtsdialog, Band INoch keine Bewertungen
- Der Kreuzworträtselmord: Authentische Kriminalfälle im DoppelbandVon EverandDer Kreuzworträtselmord: Authentische Kriminalfälle im DoppelbandNoch keine Bewertungen
- Rechte Gewalt in Deutschland: Zum Umgang mit dem Rechtsextremismus in Gesellschaft, Politik und JustizVon EverandRechte Gewalt in Deutschland: Zum Umgang mit dem Rechtsextremismus in Gesellschaft, Politik und JustizNoch keine Bewertungen
- Juergen Roth Der Deutschland ClanDokument299 SeitenJuergen Roth Der Deutschland Clan19simon85100% (1)
- Religion und Identität: Junge Marokkaner in Deutschland - das Beispiel FrankfurtVon EverandReligion und Identität: Junge Marokkaner in Deutschland - das Beispiel FrankfurtNoch keine Bewertungen
- 2015 Book SelbstbestimmungUndAnerkennungDokument395 Seiten2015 Book SelbstbestimmungUndAnerkennunghanna.koppensteinerNoch keine Bewertungen
- Leifgen Menschenrechte Und Das Islambild in Der Deutschen PolitikDokument333 SeitenLeifgen Menschenrechte Und Das Islambild in Der Deutschen PolitikAtero VirtanenNoch keine Bewertungen
- Strafvollzug, Straffälligenhilfe und der demografische WandelVon EverandStrafvollzug, Straffälligenhilfe und der demografische WandelNoch keine Bewertungen
- Diagnostisches Fallverstehen bei jungen geflüchteten Menschen: Ein zielgruppenspezifisches Diagnostikmodell für die psychosoziale PraxisVon EverandDiagnostisches Fallverstehen bei jungen geflüchteten Menschen: Ein zielgruppenspezifisches Diagnostikmodell für die psychosoziale PraxisNoch keine Bewertungen
- Kurdische Jugendliche in Deutschland zwischen Inklusion und Exklusion: Eine sekundäranalytische StudieVon EverandKurdische Jugendliche in Deutschland zwischen Inklusion und Exklusion: Eine sekundäranalytische StudieNoch keine Bewertungen
- Mädchenkriminalität - Auf der Suche nach Identität, Selbstwert und Anerkennung: Eine biografische Fallrekonstruktion von drei kriminellen Mädchen nach G. RosenthalVon EverandMädchenkriminalität - Auf der Suche nach Identität, Selbstwert und Anerkennung: Eine biografische Fallrekonstruktion von drei kriminellen Mädchen nach G. RosenthalNoch keine Bewertungen
- Splatterfilm und Torture Porn: Politische und soziokulturelle Parallelen zu dem Amerika der 70erVon EverandSplatterfilm und Torture Porn: Politische und soziokulturelle Parallelen zu dem Amerika der 70erNoch keine Bewertungen
- Flucht Und Migration KriminalitätDokument13 SeitenFlucht Und Migration KriminalitätAlexandra EveNoch keine Bewertungen
- Gewalthandlungen bei Mädchen: Wie Gewalt zur Identitätsentwicklung eingesetzt wirdVon EverandGewalthandlungen bei Mädchen: Wie Gewalt zur Identitätsentwicklung eingesetzt wirdNoch keine Bewertungen
- Eine kritische Analyse der Geldwäscheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht: Definitionswahl, Ausmaß, Auswirkungen und die Bekämpfung durch den „Kodex karny“ in PolenVon EverandEine kritische Analyse der Geldwäscheproblematik mit aktuellem Bezug zum polnischen Recht: Definitionswahl, Ausmaß, Auswirkungen und die Bekämpfung durch den „Kodex karny“ in PolenNoch keine Bewertungen
- Entnazifizierung und Erzählung: Geschichten der Abkehr vom Nationalsozialismus und vom Ankommen in der DemokratieVon EverandEntnazifizierung und Erzählung: Geschichten der Abkehr vom Nationalsozialismus und vom Ankommen in der DemokratieNoch keine Bewertungen
- Staatsversagen auf höchster Ebene: Was sich nach dem Fall Mollath ändern mussVon EverandStaatsversagen auf höchster Ebene: Was sich nach dem Fall Mollath ändern mussSascha PommrenkeNoch keine Bewertungen
- 11.08.02 MenschenrechtedeineRechteDokument92 Seiten11.08.02 MenschenrechtedeineRechteSultan çaçaNoch keine Bewertungen
- Neuerechte 2Dokument155 SeitenNeuerechte 2Herbert GründelNoch keine Bewertungen
- Gewalt, Krieg und Flucht: Feministische Perspektiven auf SicherheitVon EverandGewalt, Krieg und Flucht: Feministische Perspektiven auf SicherheitNoch keine Bewertungen
- Köln Book 2021Dokument76 SeitenKöln Book 2021ciwihi6238Noch keine Bewertungen
- Strahlenfolter - V2K - Organized Stalking - Ein Soziales Informationsproblem - Martin Teske - WWW - hearingvoices-Is-VoicetoskullDokument19 SeitenStrahlenfolter - V2K - Organized Stalking - Ein Soziales Informationsproblem - Martin Teske - WWW - hearingvoices-Is-VoicetoskullKlaus-Dieter-ReichertNoch keine Bewertungen
- Skript Zu Neuen Formen Der KriminalpräventionDokument6 SeitenSkript Zu Neuen Formen Der KriminalpräventionАнастасия РомановаNoch keine Bewertungen
- Zukunft mit Kindern, Zukunft für Kinder: Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland im europäischen KontextVon EverandZukunft mit Kindern, Zukunft für Kinder: Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland im europäischen KontextNoch keine Bewertungen
- Islam in Sicht: Der Auftritt von Muslimen im öffentlichen RaumVon EverandIslam in Sicht: Der Auftritt von Muslimen im öffentlichen RaumNoch keine Bewertungen
- Mafia, Macht und Politik in Italien: Eine politikwissenschaftliche Analyse der Jahre bis 1993Von EverandMafia, Macht und Politik in Italien: Eine politikwissenschaftliche Analyse der Jahre bis 1993Noch keine Bewertungen
- Wer ist ein Flüchtling?: Grundlagen einer Soziologie der ZwangsmigrationVon EverandWer ist ein Flüchtling?: Grundlagen einer Soziologie der ZwangsmigrationNoch keine Bewertungen
- Transnationale Familien Rumäniens: Wie Kinder und Jugendliche die Arbeitsmigration ihrer Eltern erlebenVon EverandTransnationale Familien Rumäniens: Wie Kinder und Jugendliche die Arbeitsmigration ihrer Eltern erlebenNoch keine Bewertungen
- Rassismus in Deutschland 2023Dokument104 SeitenRassismus in Deutschland 2023Boris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Projektmappe Im Fach Deutsch Als FremdspracheDokument18 SeitenProjektmappe Im Fach Deutsch Als FremdspracheLizi CixelashviliNoch keine Bewertungen
- Die Verschränkung Von Rassismus, Sexismus Und Sexualisierter Gewalt in Österreichischen PrintmedienDokument27 SeitenDie Verschränkung Von Rassismus, Sexismus Und Sexualisierter Gewalt in Österreichischen PrintmedienNina M.Noch keine Bewertungen
- Lügen im medialen Zeitalter: Eine kommunikationswissenschaftliche Untersuchung am Beispiel der TelefonkommunikationVon EverandLügen im medialen Zeitalter: Eine kommunikationswissenschaftliche Untersuchung am Beispiel der TelefonkommunikationNoch keine Bewertungen
- Sexualisierte Gewalt in Einrichtungen der stationären Altenhilfe: Herausforderungen für die Soziale ArbeitVon EverandSexualisierte Gewalt in Einrichtungen der stationären Altenhilfe: Herausforderungen für die Soziale ArbeitNoch keine Bewertungen
- Migration & Integration 7: Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und PraxisVon EverandMigration & Integration 7: Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und PraxisNoch keine Bewertungen
- Die im Dunkeln sieht man nicht: 70 Zeitzeugen zu den missachteten Folgen der Corona-PolitikVon EverandDie im Dunkeln sieht man nicht: 70 Zeitzeugen zu den missachteten Folgen der Corona-PolitikNoch keine Bewertungen
- NS PolizeiDokument12 SeitenNS PolizeiEsLebeDeutschlandNoch keine Bewertungen
- Klinische Perspektiven Auf DevianzDokument109 SeitenKlinische Perspektiven Auf Devianzggggggg66zrNoch keine Bewertungen
- Familie Und Jugendhilfe in Krisenhaften Erziehungsprozessen, Bohler, Karl FriedrichDokument23 SeitenFamilie Und Jugendhilfe in Krisenhaften Erziehungsprozessen, Bohler, Karl Friedrichggggggg66zrNoch keine Bewertungen
- Metaphernforschung in Der Kognitiven Psychologie Und in Der SozialpsychologieDokument19 SeitenMetaphernforschung in Der Kognitiven Psychologie Und in Der Sozialpsychologieggggggg66zrNoch keine Bewertungen
- Klinische Perspektiven Auf DevianzDokument109 SeitenKlinische Perspektiven Auf Devianzggggggg66zrNoch keine Bewertungen
- Fluchen Und Schimpfen KontrastivDokument15 SeitenFluchen Und Schimpfen Kontrastivggggggg66zrNoch keine Bewertungen
- Der Diskursive Aufstand Der Schwarzen Unterklassen", Hip-HopDokument28 SeitenDer Diskursive Aufstand Der Schwarzen Unterklassen", Hip-Hopggggggg66zrNoch keine Bewertungen