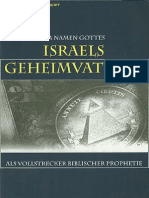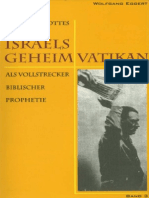Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Geary Patrick J. - Die Merowinger. Europa Vor Karl em Grossen - 325 S PDF
Hochgeladen von
Bobotov CookOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Geary Patrick J. - Die Merowinger. Europa Vor Karl em Grossen - 325 S PDF
Hochgeladen von
Bobotov CookCopyright:
Verfügbare Formate
In seiner Geschichte der Merowinger richtet Patrick J.
Geary den Blick des Lesers auf jenen komplexen Erb vorgang,
den wir bis heute oft als eine bloe Wachablsung zwischen
Bar baren und Rmern miverstehen. Ausgehend von den jng-
sten For schungsergebnissen der Archologie, Kulturgeschichte
und historischen Ethnographie, zeichnet der renom mierte
Medivist im Gegensatz dazu einen langgestreckten Proze der
Barbarisierung der Rmer und Romanisierung der Barbaren
nach, in dessen Verlauf beide Bevlkerungsteile kaum noch
unterscheidbar miteinander ver schmolzen.
Patrick J. Gearys Darstellung ist ebenso klar in der Gedan-
kenfhrung wie in der Sprache und gehrt zu den wichtig-
sten Bchern, die ber diese oft vernachlssigte Epoche der
abendln dischen Geschichte geschrieben wor den sind.
Kaum eine andere Epoche der europi schen Geschichte ist so
sagenumwoben und legendenverhangen wie jene Jahr hunderte,
an deren Ende mit Karl dem Groen die erste Symbolgestalt
eines neuen Europa die welthistorische Bhne betritt. Blutrn-
stige Barbaren und herrschaftsmde Rmer bevlkern eine vage
historische Erinnerung, in die sich das Geschlecht der Mero-
winger vornehmlich durch die hervorstechen den Merkmale der
Dummheit, Feigheit und Impotenz eingeschrieben hat.
Gleichwohl ist die Bedeutung dieser Schwellenzeit kaum
zu bersehen. Die Franken und ihre erste Dynastie, das K-
nigsgeschlecht der Merowinger, ste hen vermittelnd zwischen
Sptantike und Mittelalter. Das frnkische Gro reich ist nicht
nur die dauerhafteste Staatsbildung aller germanischen Vl-
kerschaften, es bildet auch die histori sche Keimzelle, aus der
bedeutende eu ropische Reiche Frankreich, Italien, Burgund
und, auf langen Um- und Sonderwegen, Deutschland hervor-
gegangen sind. Vor allem aber treten die Franken in Westeuropa
das Erbe Roms und der lateinischen Antike an.
Umschlagentwurf: Fritz Ldtke, Mnchen Umschlagbild: Fibel,
merowingisch, 7. Jhdt., Charnay (Sane-et-Loire), Runion des
Muses Nationaux, St. Germain-En-Laye
unverkuich
040930
Patrick J. Geary
Die Merowinger
Europa vor Karl dem Groen
Aus dem Englischen von
Ursula Scholz
Verlag C. H. Beck Mnchen
Titel der amerikanischen Originalausgabe
Before France and Germany
Te Creation and Transformation of
the Merovingian World
Oxford University Press, New York Oxford 988
Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme
Geary, Patrick J.:
Die Merowinger: Europa vor Karl dem Grossen
Patrick J. Geary.
Aus dem Engl. von Ursula Scholz.
Mnchen: Beck, 996
ISBN 3 406 40480 4
C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), Mnchen
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I. Das Westrmische Reich am Ende des 5. Jahrhunderts. . . . . . . 14
Die westrmischen Provinzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Das Imperium vom 3. bis zum 6. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . .23
Die Umgestaltung der westrmischen Gesellschaf . . . . . . . . . . .28
Die Militarisierung 29 Die Barbarisierung 36 Die Besteuerung 43
Die Gewinner: eine Aristokratie von Grundbesitzern . . . . . . . .47
Die Verlierer: alle anderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
II. Die barbarische Welt bis zum 6. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . 60
Die barbarische Gesellschaf vor der Vlkerwanderung. . . . . . . . 65
Die germanische Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Das Handwerk 71 Die Gesellschafsordnung 74 Die Gefolgschaf 81
Der rmische Einu auf die germanischen Stmme . . . . . . . . . .84
Die neuen germanischen Gesellschafen . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Das Ostrmische Reich und die Goten . . . . . . . . . . . . . . . 90
Balthen und Terwingen 93 Amaler und Greutungen 97
Von den Terwingen zu den Westgoten 98 Von den Greutungen
zu den Ostgoten 101
Das Westrmische Reich und die Franken . . . . . . . . . . . . . . 103
III. Rmer und Franken im Knigreich Chlodwigs . . . . . . . . . . . 108
Die frnkische Ethnogenese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Chlodwig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Die Herrschaf ber das Frankenreich: die bernahme
der rmischen Verwaltungsstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . 122
Die Bevlkerung des Frankenreiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Die Wirtschaf in Stadt und Land 132 Die frnkische
Gesellschaf 141 Haus und Familie 143 Das Dorf 147
Die soziale Ordnung 149
IV. Das Frankenreich im 6. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Die Nachfolger Chlodwigs im 6. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . 158
Die Expansionnach auen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Die innere Ordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Die Bischfe: edel von Geburt und im Glauben . . . . . . . . . . . . 166
Die geistliche Funktion des Bischofs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Das Kloster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Martin von Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Die Rhneklster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Bischfe gegen Mnche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
V. Das Frankenreich unter Chlothar II. und Dagobert I . . . . . . . . 200
Das wiedervereinigte Frankenreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Die Regionen des Frankenreiches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Der Knigshof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Die kniglichen Domnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Die Christianisierung der kniglichen Tradition. . . . . . . . . . . . 218
Die Ausbildung der Adelstradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Columban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Ein christlicher frnkischer Adel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
VI. Der Niedergang der Merowinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Dagoberts Nachfolger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Neustrien-Burgund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Austrasien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Die Wiedervereinigung unter den Arnulngern . . . . . . . . . . . . 253
Nach der Schlacht von Tertry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Die Ausbildung territorialer Knigreiche . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Aquitanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Die Provence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Bayern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Die gesellschaflichen Vernderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Die angelschsische Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Das neue Knigtum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
VII. Das Vermchtnis des merowingischen Europa . . . . . . . . . . . . 287
Die Rois Fainants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Die Einzigartigkeit der frhfrnkischen Gesellschaf . . . . . . . . . 293
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Literaturhinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Vereinfachte Stammtafel der Merowinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
8
Vorwort
Die germanische Welt war vielleicht die groartigste und dau-
erhafeste Schpfung des politischen und militrischen Genies
der Rmer. Da sie ihre Schpfer spter ablsen sollte, kann die
Tatsache nicht verschleiern, da sie ihre Existenz rmischer Initia-
tive, den jahrhundertelangen geduldigen Bemhungen rmischer
Kaiser, Generle, Soldaten, Grundherren, Sklavenhndler und
einfacher Kaueute verdankte, die aus rmischer Sicht chaotische
Welt der Barbaren politisch, gesellschaflich und wirtschaflich so
umzugestalten, da sie sie verstehen und beherrschen konnten.
Die Barbaren ihrerseits waren in den meisten Fllen begierig, an
dieser Entwicklung teilzuhaben und richtige Vlker zu werden,
das heit Strukturen zu schaen, die innerhalb der verfhreri-
schen Welt der antiken Kultur zu bestehen vermochten. Diese
Bemhungen waren so erfolgreich, da es Goten, Burgundern,
Franken und anderen Vlkern, die im Westrmischen Reich die
Herrschaf bernahmen, bereits in der Sptantike unmglich war,
sich selbst und ihre Vergangenheit anders als in den rmischen
Kategorien von Ethnographie, Politik und Recht zu verstehen,
wie es ihnen auch unmglich war, ohne die landwirtschaflichen
und kommerziellen Traditionen der Rmer zu prosperieren oder
unter Verzicht auf die rmischen Traditionen von Politik und
Recht Macht auszuben. So stellten auch antike Geschichtsschrei-
ber, wie Plinius und Tacitus, die Geschichte der barbarischen
Vlker in den griechisch-rmischen Kategorien von Stmmen,
Vlkern und Nationen dar und beschrieben ihre religisen und
sozialen Sitten entweder im Vergleich oder im Gegensatz zu den
Wertvorstellungen und Schwchen der rmischen Gesellschaf.
Als im 6. Jahrhundert Autoren wie Cassiodor und Gregor von
Tours die Geschichte der inzwischen siegreichen Barbarenvlker
niederschrieben, benutzten beide ebenso wie ihre romanisierten
barbarischen Informanten noch dieselben Kategorien zur Erkl-
rung der Gegenwart und der Vergangenheit.
9
Da sowohl die Geschichtswissenschaf als auch die Ethnologie
bzw. die Soziologie, die heute die Forschung dominieren, unmit-
telbare Nachkommen dieser Traditionen sind, el es den neu-
zeitlichen Historikern schwer, bei ihrer Rckschau den Ursprung
der europischen Gesellschaf anders als in diesen Begrien und
Strukturen zu erfassen. Erst in den letzten Jahrzehnten haben
Ethnologen, die die inneren Strukturen nichtwestlicher, traditio-
neller Gesellschafen erforschten, gezeigt, wie Gelehrte sich aus
den spezisch westlichen Wahrnehmungsmustern lsen knnen,
um nicht nur fremde Gesellschafen, sondern bis zu einem ge-
wissen Grade auch die Anfnge unserer eigenen zu verstehen.
Diesen Proze untersttzt die Arbeit der Archologen, deren
Funde die einzige Quelle fr das Verstndnis der schriflosen
Welt der Barbaren darstellen, die nicht von der Sprache und da-
mit von den Wertvorstellungen der griechisch-rmischen Kultur
getrbt ist. Ihre Erkenntnisse haben unser Verstndnis davon,
wie die sprlichen Zeugnisse der sptantiken Barbarenwelt zu
interpretieren sind, allmhlich verndert.
Aber auch wenn wir diese Welt im Lichte der modernen Eth-
nologie und Archologie neu zu verstehen beginnen, werden
wir doch stndig daran erinnert, wie tief die rmische Kultur
lange vor der rmischen Eroberung und der Vlkerwanderung
bereits in sie eingedrungen war. Die Gestaltung der barbarischen
Welt durch die Rmer war nicht nur ein Proze der Wahrneh-
mung, bei welchem die Rmer ihre aus Kontakten mit Barbaren
gewonnenen Erkenntnisse nach rmischen Wertvorstellungen
ordneten. Auch wenn die Rmer diese Welt zu verstehen such-
ten, vernderten und strukturierten ihre Wahrnehmung und
ihre Einunahme sie in einer sowohl aktiven als auch passiven
Weise, deren Ausma man erst in neuerer Zeit zu erkennen be-
ginnt. Dies gilt besonders fr die Franken, deren Ursprung und
Frhgeschichte das Tema des vorliegenden Buches sind. Ihre
gesamte Existenz wie jede einzelne Phase ihrer Geschichte ist
nur im Kontext der rmischen Prsenz nrdlich der Alpen zu
10
verstehen, denn ihr Zusammenwachsen zu einem Volk und ihre
allmhliche Verwandlung in die Eroberer groer Teile Europas
waren von Anfang an Teil der rmischen Erfahrung. Aber diese
rmische Geschichtserfahrung ist meilenweit von dem entfernt,
was sich die meisten Menschen unter dem antiken Rom vor-
stellen. Sie war Teil einer provinzialrmischen Welt, besonders
derjenigen der Sptantike, einer Welt, die der neuzeitlichen
Vorstellungskraf in mancher Hinsicht weit fremder ist als die
der Barbaren.
Die Geschichte der barbarischen Knigreiche und besonders
die der Franken ist daher die Geschichte der Umgestaltung der
provinzialrmischen Welt, einer Entwicklung, die zwar gelegent-
lich von gewaltttigen Episoden begleitet wird, welche sich tief in
das westliche Geschichtsbewutsein eingegraben haben wie die
Plnderung Roms 40 oder die Niederlage des letzten rmischen
Befehlshabers in Gallien 486 , die aber weit mehr die Ge-
schichte einer allmhlichen und gelegentlich fast unmerklichen
Verschmelzung vielfltigster Traditionen ist. Dieser historische
Proze verlief keineswegs immer in einer einzigen Richtung, und
seine rmischen und barbarischen Protagonisten unterscheiden
sich in der Regel nicht voneinander. Die Vernderung lt sich
sehr viel besser anhand zuflliger Einzelheiten und Beispiele als
durch die Betrachtung der groen Ereignisse nachvollziehen.
Unsere Untersuchung setzt mit einem Zeitpunkt ein, der in
gewisser Weise ebenso willkrlich gewhlt ist wie ihr Ende. Wir
beginnen mit dem . Jahrhundert und der Frhphase der Gestal-
tung der Barbarenwelt durch die Rmer, und wir schlieen mit
einem Ausblick auf das Jahr 800, als die barbarische Welt sich
schlielich gezwungen sah, die rmische wiederzubeleben.
11
Die Darstellung der Merowingerzeit
Im frhen 9. Jahrhundert beschuldigte Florus von Lyon in einem
auerordentlich hefigen akademischen Streit seinen Gegner, den
Bischof Amalarius von Metz, der grten Snde des mittelalter-
lichen Geisteslebens, der Originalitt. In seinem Bericht ber
die Synode, bei der der Bischof verurteilt wurde, erklrt er: Sie
fragten ihn, wo er diese Dinge gelesen habe. Daraufin antwortete
dieser, gehemmt in seiner Rede, er habe sie weder aus der Schrif
noch aus den berlieferten Lehren der Kirchenvter und auch
nicht von Hretikern bernommen, sondern sie im Inneren
seines Herzens gelesen. Die versammelten Vter antworteten:
Hier ist wahrhaf der Geist des Irrtums.
Der Autor des vorliegenden Buches wrde von Florus und der
Synode sicherlich freigesprochen. Die diesem Buch, das als Ein-
fhrung in die Geschichte der Merowinger gedacht ist, auferlegten
Sachzwnge sind so gro, da es nur wenige Anmerkungen und
kurze bibliographische Hinweise enthalten kann. Wer sich in der
Literatur ber das merowingische Europa auskennt, wird hier
wenig Neues nden; ich beziehe mich stndig auf einen umfangrei-
chen Bestand an Literatur, die zum grten Teil von europischen
Wissenschaflern verentlicht wurde. Hier soll keine neue Teorie
ber den Ursprung der europischen Kultur vorgelegt, sondern
das umfangreiche Schriftum ber die Sptantike und das Frh-
mittelalter, das aus vielerlei Grnden einer breiteren Leserschaf
meist verschlossen bleibt, zugnglich gemacht werden.
Spezialisten der Merowingerzeit scheuen sich noch strker als
andere Medivisten davor, fr jemand anderen als sich selbst zu
schreiben. So verharrte das Verstndnis dieser entscheidenden
Epoche weitgehend in jenen Klischeevorstellungen, die es vor
ber fnfzig Jahren unter dem zweifachen Einu der nostal-
gischen Betrachtung der antiken Hochkultur und des von den
deutsch-franzsischen Kriegen entfachten nationalistischen
Eifers geprgt hatten. Den Franzosen galt die Merowingerzeit
12
allzu hug als die erste von mehreren Perioden, in der unge-
hobelte und treulose germanische Horden in Gallien einelen,
das Land besetzten und diese kultivierte stdtische Welt in drei
dstere Jahrhunderte strzten. Fr einige deutsche Gelehrte der
Vergangenheit verkrperten die Merowinger den Triumph eines
neuen und krafvollen Volkes ber die dekadenten Nachfolger
Roms. Jedes einzelne Versatzstck dieser Vorstellungen wurde
nach und nach aus dem alten Geschichtsbild herausgebrochen,
und heutzutage ist davon wenig briggeblieben. Doch die Kunde
davon ist kaum ber akademische Kreise hinausgedrungen, und
noch weniger die Nachricht, da ein neues Verstndnis dieser
entscheidenden Epoche an seine Stelle getreten ist. Ich hoe,
die Ergebnisse dieser wichtigen Neubewertung einer greren
Leserschaf darlegen zu knnen, die mit dieser Periode der eu-
ropischen Geschichte wenig oder gar nicht vertraut ist.
Zwar sttze ich mich dabei in groem Umfang auf bedeutende
Gelehrte, unter anderem auf Eugen Ewig, Friedrich Prinz, Karl
Ferdinand Werner, Michael Wallace-Hadrill, aber bei der Inter-
pretation, der Beurteilung und der Auswahl von Teilen ihrer
Arbeiten war ich sehr whlerisch. Kein Bereich der Geschichte
der Merowinger ist unumstritten, und jedes einzelne der in
diesem Buch behandelten Temen verdiente eine Ergnzung
durch eine eigene historiographische Abhandlung und knnte
mit zahlreichen Argumenten, die unsere Schlufolgerungen in
Frage stellen, angegrien werden. An einigen Stellen weise ich
auf solche Gegenargumente hin, an anderen habe ich wegen
Platzmangels darauf verzichtet. Insgesamt sind die Einzelheiten
zum berwiegenden Teil durch andere Forscher geklrt worden,
als einigermaen neu und gewi kontrovers wird sich wohl die
Synthese erweisen. Im besten Falle bleibt mir die Honung, da
andere Spezialisten ber die Fehler, Lcken und Fehleinscht-
zungen, die sie hier vornden werden, so erbost sind, da es sie
zur Abfassung ihres eigenen, besseren Berichts ber Europa vor
Karl dem Groen drngt.
13
Peter Brown gab mir den ersten Ansto, dieses Buch zu
schreiben; ihm danke ich fr seine Ermutigung und seinen Rat.
Maria Cesa, Friedrich Prinz und Falko Daim haben Teile des
Manuskripts gelesen und mir wertvolle Anregungen gegeben.
Meine Studenten an der Universitt von Florida, unter denen
ein frher Entwurf des Manuskripfs zirkulierte, gaben ebenfalls
ntzliche Hinweise. Barbara Rosenwein und Edward Peters lasen
das gesamte Manuskript und berichtigten zahlreiche Fehler und
Widersprchlichkeiten. Diejenigen, die jetzt noch vorhanden
sind, habe allein ich zu verantworten.
Gainesville, Florida, im August 987 P. J. G.
14
I. Das Westrmische Reich am Ende des
5. Jahrhunderts
Um das Jahr 30 n. Chr. kaufe ein rmischer Hndler namens
Gargilius Secundus eine Kuh von dem Barbaren Stelus, der in
der Nhe der heutigen niederlndischen Stadt Franeker lebte.
Sein Dorf lag jenseits des Rheins, der damals die Grenze zwi-
schen der rmischen Provinz Germania inferior und jenem
Gebiet bildete, das die Rmer das freie Germanien nannten.
Wahrscheinlich versorgte Secundus die auf solche Kleinhnd-
ler angewiesene rtliche Garnison mit Frischeisch und Leder.
Rmische Soldaten ernhrten sich gut, und Rindeisch war ihre
Lieblingsspeise. Auerdem beweisen archologische Funde aus
anderen Orten entlang der rmischen Befestigungsanlagen in
Nordeuropa, da Gerbereien in der Nhe rmischer Standorte
in groem Umfang Leder fr Schuhe, Zelte, Rstungen und
andere Waren von manchmal hoher Qualitt nicht nur fr die
Soldaten herstellten, sondern auch fr die Zivilisten, die an
diesem uersten Rand der Zivilisation zusammen mit dem
Militr den Glanz Roms reprsentierten. Der Handel, der den
Rmer 5 Silbermnzen kostete, wurde von zwei Zenturionen
aus der ersten und der fnfen Legion bezeugt und von zwei
rmischen Veteranen namens Lilus und Duerretus garantiert,
die sich nach Beendigung ihres Militrdienstes in der Nhe
ihrer frheren Einheiten niedergelassen hatten.
Der Kauf eines
einzelnen Tieres war ein kleiner und alltglicher Handel, wie
er sich zweifellos am Limes stndig wiederholte, entlang der
rmischen Reichsgrenze, die im heutigen Schottland am Firth
of Clyde begann, Grobritannien durchzog, wenige Meilen
westlich von Franeker an der Rheinmndung wieder einsetzte
und dem Rhein durch das heutige Holland und Deutschland bis
in die Schweizer Alpen folgte. Dort bog der Limes nach Osten
und verlief an der Donau entlang durch die groe Pannonische
15
Tiefebene, das heutige sterreich, Ungarn und Rumnien bis
zum Schwarzen Meer, insgesamt ber eine Entfernung von fast
5 000 Kilometern.
Mehr als 400 Jahre spter und mehr als 600 Kilometer von
Franeker entfernt versuchte eine andere Gruppe rmischer Kauf-
leute, mit den Barbaren Handel zu treiben. Im spten 5. Jahrhun-
dert, etwa um die Zeit, als der rmische Feldherr Odoaker den
letzten Kaiser des Westrmischen Reiches, Romulus Augustulus,
zum Rcktritt zwang, traten in Passau am Inn Kaueute an einen
heiligen Mann namens Severinus heran, der sowohl als Bescht-
zer der Rmer als auch als Freund der Barbaren galt, und baten
ihn, er mge Feletheus, den Knig des benachbarten Stammes der
Rugier, auordern, einen Markt zu errichten, auf dem die Rmer
mit den Rugiern Handel treiben knnten. Bei der barschen, aber
vorausschauenden Antwort des Heiligen wird es den Passauern
geschaudert haben: Die Zeit ist fr diese Stadt gekommen, wo
sie wie die brigen von ihren Bewohnern verlassenen Kastelle
am Oberlauf de daliegen wird. Wozu soll man also fr die Orte
Waren vorsehen, wo knfig ein Kaufmann gar nicht erscheinen
kann?
2
Gegen Ende des 5. Jahrhunderts waren die Legionen von
den alten Grenzen abgezogen oder sollten bald ganz zurckbe-
ordert werden; die jahrhundertealten Handelsverbindungen,
die ihnen gefolgt waren, lsten sich schnell auf; auer in einem
Bruchteil des Westens waren die politischen und militrischen
Strukturen des Imperiums berall zusammengebrochen.
Der Gegensatz zwischen diesen beiden Verhandlungen an den
Reichsgrenzen knnte als beispielhaf fr den Niedergang und
den Zerfall der antiken Welt angesehen werden. Die Rmer von
Passau waren im Begri, von barbarischen Horden des Feletheus
berrannt zu werden; zwei fremde Welten standen kurz vor einer
Auseinandersetzung, die im Westen die Zivilisation fr fast ein
Jahrtausend ersticken sollte. Tatschlich lagen diesem Gegensatz
ganz andere Realitten zugrunde. Gegen Ende des 5. Jahrhun-
derts hatten sich 25 Generationen von Barbaren und Rmern
16
gegenseitig so tiefgreifend beeinut, da die Welt des Severinus
aus Noricum dem Gargilius Secundus unbegreiich erschienen
wre, genau wie die des Feletheus den Stelus verwirrt htte. Die
beiden Welten waren weitgehend zu einer verschmolzen, da
innerhalb des Imperiums das Barbarentum die rmische Welt
verndert hatte, whrend die Barbaren ihrerseits romanisiert
wurden, bevor sie auch nur einen Fu ber die Reichsgrenzen
gesetzt hatten. Bedenkt man, da der Vater des Kaisers Romulus
Augustulus im Gefolge des Hunnen Attila gedient hatte und da
ausgerechnet der rmische Kaiser Zeno die Rugier anstifete, das
rmische Knigreich Italien anzugreifen, so leuchtet ein, da in
der sptantiken Welt die alten Kategorien von Zivilisation und
Barbarentum keine Geltung mehr besaen. In dieser letzten Kon-
frontation fungierten die barbarischen Rugier als Handlanger
der zentralen, imperialen Macht, whrend die Bedrohung der
Stabilitt des Imperiums von den Rmern des Knigreiches
Italien unter der Fhrung des Patricius Odoaker ausging.
Damit verstndlich wird, wie diese Umformung vonstatten
ging, werden die ersten beiden Kapitel des vorliegenden Buches
den Spuren der an den geschilderten geschflichen Transaktio-
nen Beteiligten folgen, und zwar zunchst den rmischen Hnd-
lern und Soldaten und dann den barbarischen Herdenbesitzern,
und dabei die Welten untersuchen, die sie und ihre Nachfolger
vom . Jahrhundert bis zum Ende des 5. Jahrhunderts bewohnten.
Aufgrund der beiden unterschiedlichen Perspektiven werden sich
die Darstellungen gelegentlich berschneiden oder sogar einan-
der widersprechen, da die jeweilige Wirklichkeit einer Zeit von
den darin lebenden Menschen bestimmt wird. Unser Ziel ist es,
die Umrisse der gesellschaflichen und kulturellen Entwicklung
darzulegen, die im Laufe dieser Jahrhunderte Europa verndert
hat. Erst auf diesem Hintergrund knnen wir allmhlich erfassen,
wie die Franken und ihre Nachbarn in der neuen Welt des 6. bis
8. Jahrhunderts lebten.
17
Die westrmischen Provinzen
So unbedeutend er auch war, spiegelt der an der Rheinmndung
abgeschlossene Handel doch exemplarisch die Beziehungen
zwischen Rmern und Barbaren entlang der schier endlosen
Grenze, die in erster Linie beide Welten nicht voneinander trenn-
te, sondern vielmehr ihre wechselseitigen Beziehungen prgte.
Diese Beziehungen bestanden weder im . Jahrhundert noch in
den wirren Zeiten des 4. und 5. Jahrhunderts vorwiegend aus
Feindseligkeiten. Weit typischer als die Jahre des Krieges waren
die Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte des Friedens, in deren
Verlauf die beiden Gesellschafen sich so stark einander angli-
chen, da sie schlielich untereinander mehr Gemeinsamkeiten
als mit ihrer jeweils eigenen Vergangenheit hatten.
Auf der rmischen Seite dieser Grenze war seit ber einem
Jahrhundert ein Proze der Zivilisierung durch Romanisierung
in Gang, der sich noch ber drei Jahrhunderte hinweg fortset-
zen sollte. Hier, am Rande der Welt, wo, wie die Rmer immer
wieder klagten, die Menschen so primitiv waren, da sie nicht
einmal Wein tranken, bedeutete Zivilisierung keineswegs an-
spruchsvollen Kulturtransfer. Sie wurde vielmehr von Menschen
wie unserem Viehhndler und den von ihm belieferten Soldaten
vermittelt. Fr solche Menschen, meist Bauern aus dem dichter
besiedelten Westen, die hofen, nach Beendigung ihrer Dienst-
zeit im Umkreis ihres Standorts wohlhabende Bauern zu werden,
war Zivilisation gleichbedeutend mit der Beherrschung der
groben Zge einer Sprache, die fr den Militrdienst ausreichte,
mit der in den Rhetorikschulen gelehrten Sprache aber nur ganz
entfernt verwandt war. Zivilisation bestand in erster Linie in der
Einfhrung von Annehmlichkeiten, die den grauen, nordischen
Winter ertrglich machten, dem Bau von Bdern, Arenen und
dergleichen. Und sie bedeutete den Genu der Privilegien der
Macht, in den hier nicht nur die Wohlhabenden, sondern auch
die einfachen Soldaten ebenso wie die Hndler und die Vete-
18
ranen kamen, die bei den Lagern ihrer ehemaligen Legionen
angesiedelt waren.
ber diese materiellen Aspekte rmischer Lebensart hinaus
kultivierten die Angehrigen der Oberschicht in den Provin-
zen, die Rhetoriker in den Schulen von Bordeaux, Lyon, Trier
und anderen Stdten und die Spitzenbeamten der rmischen
Verwaltung, weiterhin viele der traditionellen rmischen Werte
und Errungenschafen. Dazu zhlte an erster Stelle das rmische
Rechts- und Justizwesen. Zu diesen Werten gehrte auch die Pe-
ge der rmischen pietas, das heit die hingebungsvolle Ein- und
Unterordnung in Familie und Religion und die Pichterfllung.
Und sie umfaten die Liebe zur lateinischen oder gar griechi-
schen Literatur, welche die mige Oberschicht der Provinzen
frderte und pegte, um an einem Kernstck rmischer Kultur
teilzuhaben, aber zunehmend auch in dem Bestreben, sich selbst
davon zu berzeugen, da die Essenz, das Wesentliche dieser
Kultur niemals untergehen werde. Keine dieser Wertvorstellun-
gen wurde in den westlichen Provinzen des Imperiums jemals
vollstndig aufgegeben.
Die Eroberung dieses riesigen Gebietes war planlos verlaufen,
und seine Grenzen waren eher das Ergebnis rmischer Niederla-
gen als systematischer Zielsetzung. Innerhalb von Gallien, dessen
Verwaltung in die dem rmischen Senat unterstellte Provinz
Gallia Narbonensis und die dem Kaiser unterstellten Provinzen
Gallia Lugdunensis, Aquitania und Belgica aufgeteilt war, durch-
drang die Romanisierung von den administrativen Zentren aus
das keltische Umland. Die Stdte mit ihren Bdern, Monumen-
ten und Teatern sowie mit ihren Schulen und Tempeln boten
dem rmischen Verwaltungspersonal die Annehmlichkeiten des
zivilisierten Lebens, whrend sie die eingeborene keltische Be-
vlkerung dem Sog des rmischen Kulturkreises aussetzten. Wie
berall in der rmischen Welt besaen diese Stdte ihr eigenes
entliches Leben, dessen Mittelpunkt der rtliche Senat oder
die curia bildete, die aus den fhrenden Kpfen der Stadtverwal-
19
tung bestand und aus deren Reihen decuriones gewhlt und mit
entlichen mtern beaufragt wurden. Die StadtMi waltung
der Stadt war meist nur fr die Instandhaltung der Straen und
Brcken verantwortlich, whrend einzelne Kurienmitglieder
eine Vielzahl anderer entlicher Aufgaben wahrnahmen; sie
besorgten etwa die Einziehung von Steuern und Gebhren, der
munera, organisierten die Bereitstellung von Pferden fr den
Postdienst und die Versorgung von durchreisenden Beamten.
Zwar gab es in ganz Gallien ein keltisches Handwerk, das tra-
ditionell feine Metallwaren und Textilien herstellte, sowie eine
erst in jngerer Zeit entdeckte Keramik- und Glasproduktion,
die sich an Vorbildern aus Italien und den stlichen Reichsteilen
orientierte. Dennoch waren die gallischen und germanischen
Provinzen berwiegend von der Landwirtschaf geprgt. Die
Grundlage fr die Organisation der Landgebiete lieferten
rmische Vermessungstechnik und Landteilungen, deren Flur-
gliederungen in groen Teilen Sdfrankreichs heute noch aus der
Luf zu erkennen sind. Im grten Teil Galliens war das wichtigste
Produkt Getreide, obwohl sich auch der von den Rmern ein-
gefhrte Weinbau derart stark verbreitete, da Kaiser Domitian
(8-96 n. Chr.) zum Schutz der italienischen Weinproduktion eine
weitere Ausdehnung zu verhindern suchte. Insgesamt bte Galli-
en jedoch keinen bedrohlichen Konkurrenzdruck auf die brigen
Reichsteile aus. Zwar konnte man hier durchaus ein Vermgen
erwerben, aber nur mit der Warenerzeugung fr den lokalen
Bedarf und in zunehmendem Mae durch die Belieferung der
an den Grenzen stationierten rmischen Armeen, die von der
Nordsee bis zum Schwarzen Meer Menschen und Material aus
Gallien bezogen.
Jede Stadt war eng mit der lndlichen Umgebung, in der die
Oberschicht ihre Gter und Landhuser besa, verbunden.
Diese Landgter, die von Sklaven aus den Grenzgebieten und
von freien keltischen Bauern bewirtschafet wurden, konnten
Tausende von Morgen umfassen und bildeten die wirtschaf-
20
liche Grundlage der wohlhabenden Senatorenfamilien, die
das Provinzleben beherrschten. Der rtliche Adel bestand aus
denen, die im Dienste des Imperiums Wohlstand und Ansehen
erworben hatten, sowie aus einigen ortsansssigen Kelten, die
in der Zivilverwaltung und im Militrdienst Karriere gemacht
hatten und denen es gelungen war, in die rmische Oberschicht
einzuheiraten. Voraussetzung solcher sozialen Mobilitt waren
die bernahme der rmischen Religion und der Erwerb einer
klassischen Bildung. Auf diese Weise wurden beide Enden des
keltischen Gesellschafsspektrums in die rmische Kultur hin-
eingezogen; am unteren Ende wurden die Bauern der Drfer und
Weiler in das rmische Landwirtschafssystem integriert, an der
Spitze sorgte die keltische Oberschicht dafr, da sich ihre Shne
die rmische Kultur aneigneten und sich damit die Mglichkeit
erneten, im rmischen Lebensstil teilzuhaben.
Innerhalb dieser sich romanisierenden Welt war das Militr
allgegenwrtig. Nach der Niederschlagung des von Vercingetorix
angefhrten Aufstandes im Jahre 52 v. Chr. hatten die gallischen
Provinzen ihre Eingliederung in das Imperium weithin akzep-
tiert, ja sogar begrt. Je weiter man jedoch nach Norden und
Osten, zum Rhein oder zur Donau hin kam, wurde der Einu
der Festungen oder castra im Vergleich zu dem der zivilen stdti-
schen oder drichen Siedlungen immer strker. Die Provinzen
Ober- und Niedergermanien wurden anders als die gallischen
Provinzen unmittelbar von den dort stationierten Militrbefehls-
habern verwaltet, ein Beweis fr die fortdauernde Bedrohung
der Romanitas ein umfassender Begri fr alles, was mit Rom
zusammenhngt durch die Vlker jenseits des Rheins. Hier war
berall Militr nicht zufllig waren die beiden Zeugen des oben
erwhnten Kuhhandels Zenturionen , und diese Prsenz war
darauf angewiesen, aus den strker besiedelten Gebieten Galliens
Truppenverstrkungen und Handwerkserzeugnisse wie Kleidung
und Waen zu beziehen, die nicht vor Ort hergestellt werden
konnten. Die Legionen und Veteranensiedlungen am Rhein und
21
an der Donau beschtzten rmische Kaueute wie Secundus, die
mit den Barbaren Handel trieben, und sicherten die im Entstehen
begriene rmische Agrarstruktur in den Grenzregionen gegen
einzelne antirmische Aufstnde und blitzartige berflle junger
Barbaren, die begierig auf Ruhm und Beute waren. Vor allem aber
sollte die Anwesenheit der Legionen die Gefahr umfangreicher,
organisierter Angrie auf die Grenzen abwehren, die fr die
besiedelten Gebiete Galliens und die Donauprovinzen bedrohlich
werden konnten.
In der mehr als fnf Jahrhunderte whrenden Epoche rmi-
scher Vorherrschaf im Westen lagen Britannien, Gallien und
Germanien am Rande der rmischen Interessensphre. Das
Rmische Reich war im wesentlichen mediterran geprgt und
blieb es bis zu seinem Ende; dafr sorgten Italien, Spanien und
Nordafrika als westliche Kerngebiete. Aber die kulturellen, wirt-
schaflichen und volkreichsten Zentren des Imperiums waren die
groen Stdte des Ostens, Alexandria, Antiochia, Ephesus und
spter Konstantinopel. Der Westen hatte nur eine einzige wirkli-
che Grostadt aufzuweisen, lange Zeit allerdings die grte von
allen Rom. In den ersten Jahrhunderten des Imperiums konnte
Rom sich noch den Luxus leisten, die Romanitas des Westens
aufrechtzuerhalten. Diese Regionen versorgten zwar die Legio-
nen an den Grenzen mit Rekruten und Waen und verhalfen den
rtlichen Senatoren zu jenem otium, jener weitgehend arbeits-
freien Existenz, die eine zivilisierte, gebildete Lebensfhrung erst
ermglichte; aber ansonsten trugen sie wenig zum kulturellen
und wirtschaflichen Leben des Imperiums bei.
Der kritischste Grenzabschnitt des Westrmischen Reiches war
die Nordgrenze entlang der Donau. Whrend in Britannien nur
drei Legionen auf Dauer stationiert waren und vier die Rhein-
grenze sicherten, standen elf Legionen an der Donau, und das
aus gutem Grund. Die Groe Pannonische Tiefebene, die mit
Unterbrechung durch die Karpaten von den Steppen Zentrala-
siens bis zu den Alpen reicht, ist eine der groen Einfallsrouten
22
nach Europa; und die Donau, die ihrem Verlauf folgt, eignet sich
weit besser als Wasserstrae zum Balkan und nach Italien denn
als Reichsgrenze. Somit bildeten in der nrdlichen Hlfe des
Imperiums die zwischen den Alpen und dem Schwarzen Meer
gelegenen Provinzen Raetia, Noricum, Pannonia Superior und
Inferior, Dacia und Moesia Superior und Inferior eine lebens-
wichtige Verteidigungslinie. Bis weit in die zweite Hlfe des 2.
Jahrhunderts hatte die Anwesenheit rmischer Truppen entlang
der Rhein-Donau-Grenze die Stmme des freien Germanien
von Invasionsversuchen abgeschreckt; vereinzelte Versuche, die
Grenzsicherung in Obergermanien und Rtien auf die Probe zu
stellen, waren zwar schnell unterbunden worden, aber sie lieen
doch Schlimmes fr den Fall ahnen, da die rmische Prsenz
verringert wrde.
Ein solcher Truppenabbau erfolgte unter Marc Aurel (6-80),
als sich die Aufmerksamkeit des Philosophenkaisers den mili-
trischen Problemen im Osten des Imperiums zuwandte. Zur
Fortfhrung des Krieges gegen die Parther verlegte er Truppen
von der Rhone und der Donau nach Osten. Es waren nicht viele,
wahrscheinlich nur drei Legionen, und diese wurden aus weit
voneinander entfernten Regionen abgezogen, aber das gengte
bereits. Whrend des Partherkrieges schlossen sich jenseits
der Donau mehrere Barbarenstmme zu einem schlielich als
Markomannen bezeichneten Verband zusammen und trafen
militrische Vorbereitungen, die das Imperium bald bedrohen
sollten.
Diesen Proze werden wir im nchsten Kapitel aus der Per-
spektive der Barbaren betrachten. Aus rmischer Sicht war die
rasche Vernderung in der barbarischen Welt vor allem deshalb
bedeutsam, weil sie in die Markomannenkriege mndete, die 66
ausbrachen, als ber 6 000 Barbaren die Donau berschritten
und das reiche pannonische Hinterland zu verwsten begannen.
Der erste Ansturm wurde zurckgeschlagen; Schwierigkeiten
bereiteten dabei allerdings zum einen die Strke der Barbaren,
23
zum anderen eine Epidemie, vermutlich eine Art Pocken, welche
die aus den Partherkriegen zurckgekehrten Legionen einge-
schleppt hatten und die in den rmischen Provinzen wtete.
Als die Ordnung wiederhergestellt war, plante Marc Aurel eine
grere Oensive, um die Barbaren vom Fluufer zu vertreiben
und in den nrdlich gelegenen Bergen eine leichter zu schtzende
Grenze zu errichten, aber die germanischen Stmme bewegten
sich zu schnell. Im Jahre 70 berschritt eine riesige Streitmacht
aus Markomannen und Quaden die Donau, kmpfe sich den
Weg durch Pannonien frei, drang nach Noricum ein und erreichte
schlielich sogar Italien, wo sie Aquileja belagerten und Oderzo
nrdlich des heutigen Venedig plnderten. Die Barbaren hatten
Italien erreicht, und obwohl Marc Aurel und nach ihm sein Sohn
Commodus sie schlielich besiegten und unterwarfen, sollte
das Imperium nach diesem Ansturm nie mehr das sein, was es
einmal gewesen war.
Das Imperium vom 3. bis zum 6. Jahrhundert
Die politische Geschichte des spten Imperiums ist allgemein
bekannt und soll hier nur kurz skizziert werden, damit wir uns
spter bei der systematischen Analyse der westlichen Gesellschaf
dieser Periode darauf beziehen knnen. Der Druck der Barba-
ren entlang der Donau und der Parther im Osten schwchte
die ohnehin schon labile Binnenstruktur des Imperiums und
leitete eine Phase politischer und wirtschaflicher Unruhen ein,
die rund 90 Jahre, von der Ermordung des Commodus 92 bis
zur Tronbesteigung des Diokletian 284, dauerte und im allge-
meinen als Krise des 3. Jahrhunderts bezeichnet wird. Whrend
dieser Zeit erhob und strzte das Militr einen Kaiser nach dem
anderen, stets auf der Suche nach einem Befehlshaber, der der
Armee Reichtum verschaen und sie gegen den wiederkehrenden
24
Druck der germanischen Stmme und der Perser zum Sieg fhren
konnte. Diese Zeit schwerer Konikte zwischen Tronanwrtern
und ihren Armeen, einer enormen Ination und allgemeiner
Unsicherheit endete mit den Reformen des Diokletian, eines
Soldaten aus Dalmatien, der in der Armee bis zum Kommandeur
der kaiserlichen Leibwache aufgestiegen war und schlielich
selbst den Purpur angelegt hatte.
Diokletian regierte von 284 bis 305. Ihm gelang es, durch er-
folgreiche militrische Unternehmungen und eine geschickte
Diplomatie die Bedrohungen von innen und auen abzuwenden.
Um das riesige Imperium eektiver regieren zu knnen, machte
er seinen Stellvertreter Maximian zu seinem Mitregenten im
Westen und verlieh ihm den Titel Augustus. Um 292 ernannte
er zwei jngere Mitregenten, Galerius und Constantius, gab ih-
nen den Titel Caesar und designierte sie zu Nachfolgern. Diese
Aufeilung des Imperiums in ein Ost- und ein Westreich und die
Errichtung der Tetrarchie waren nicht von Dauer, wiesen aber
langfristig den Weg zu einer Teilung, die sich in den folgenden
Jahrhunderten in Politik, Gesellschaf und Kultur immer deut-
licher abzeichnete.
Diokletian bentigte mehr als ein Jahrzehnt, um die militri-
sche Kontrolle ber das gesamte Imperium wiederherzustellen.
Gleichzeitig bemhte er sich um die Reorganisation der Verwal-
tungs- und Wirtschafsstrukturen. Zu diesem Zweck teilte er das
Imperium in mehrere Prfekturen fr den Osten und den We-
sten ein und diese dann in insgesamt rund 00 Provinzen, etwa
doppelt so viele wie zuvor; ferner trennte er die militrische von
der zivilen Verwaltung, die er erweiterte, um die wachsende Last
rechtlicher und nanzieller Aufgaben zu bewltigen. Auf diesen
Verwaltungsapparat werden wir spter ausfhrlicher eingehen.
Die Bemhungen Diokletians, die Wirtschaf durch Preis- und
Gewichtskontrollen und durch eine Whrungsreform zu erneu-
ern, zeitigten weit weniger Erfolg als seine administrativen und
militrischen Manahmen. Der Frieden unter seiner Regierung
25
mehrte besonders in den Stdten den Wohlstand, aber die gleich-
zeitige Steuererhhung, die zur Finanzierung der umfangreichen
Verwaltung und des Militrs notwendig war, belastete die Lei-
stungsfhigkeit des Imperiums schwer.
Das erfolgloseste, wenn auch bekannteste Unternehmen Dio-
kletians war die Christenverfolgung. Wahrscheinlich auf Betrei-
ben des Caesars Galerius, eines der Mitregenten, erlie er 303
ein Edikt, worin er anordnete, da alle Exemplare der Heiligen
Schrifen abzuliefern und zu verbrennen und alle christlichen
Kultsttten zu zerstren seien. Er verbot den Christen jegliche
Form von Versammlungen, nahm ihnen das Brgerrecht und
ordnete die Gefangennahme aller Bischfe und Priester an.
Die groe Christenverfolgung, die im Osten nachhaltiger als
im Westen betrieben wurde, erwies sich zwar letzten Endes als
Fehlschlag, aber an ihren Folgen hatte die Christenheit noch
lange zu tragen.
Die ursprnglich als eine Reformbewegung innerhalb des
Judentums entstandene Christensekte war am Ende des 3. Jahr-
hunderts in allen stdtischen Zentren des Imperiums vertreten.
Bischfe vereinten unter ihrer Fhrung Christen der unter-
schiedlichsten Berufe und Schichten, deren private und quasi
geheime religise Gebruche und Glaubensberzeugungen
zwar in scharfem Gegensatz zu denen ihrer Nachbarn standen,
gleichzeitig aber auch den Zusammenhalt der Gruppen gewhr-
leisteten. Ihr radikaler und ausschlielicher Monotheismus,
ihr Glaube daran, da die wenigen Erwhlten in Glckselig-
keit, der Rest der Menschheit unter Qualen ewig weiterleben
wrden und da nur die Anhnger dieses Kultes die Erlsung
erlangen knnten, stieen verstndlicherweise in der brigen
Gesellschaf auf Ablehnung. Jedoch trugen der unbeirrbare
Glaube an ihren Gott, die eindrucksvollen Erzhlungen von
Wundern, die Christen vollbracht hatten, und die berzeugende
Art, in der ihre Prediger solche Manifestationen auf den Inhalt
des christlichen Glaubens bezogen, dazu bei, das Christentum
26
in allen Stdten auszubreiten und das Interesse derjenigen zu
erwecken, die Macht am dringendsten bentigten, nmlich der
aus den Wirren des 3. Jahrhunderts hervorgegangenen neuen
Eliten, die sich einen weiteren Aufstieg erhofen.
305 dankten Diokletian und Maximian ab; ihnen folgten die
Caesaren Galerius und Constantius. Das Prinzip der verfassungs-
migen Nachfolge wurde jedoch von den Armeen des gesamten
Imperiums bestritten, welche die Nachfolgeregelung fr sich
beanspruchten. Nach dem Tode des Constantius im Jahre 306
brachen neue Kmpfe aus, die bis 32 anhielten, als Konstantin
in der Schlacht an der Milvischen Brcke in einem nrdlichen
Stadtteil von Rom Maxentius, den Sohn des Maximian und
seinen Rivalen im Westen, besiegte und ttete. Spter schrieb
Konstantin seinen Sieg dem Christengott zu, und innerhalb eines
Jahres gewhrten er und sein stlicher Mitherrscher Licinius
dem Christentum ebenso wie allen anderen Religionen volle
Glaubensfreiheit.
Konstantin war nicht der Mann, der sich mit einer Hlfe des
Imperiums begngt htte; um 324 marschierte er im Osten ein,
besiegte bei Chrysopolis Licinius und dessen Caesar und lie
beide hinrichten. Kurz danach beschlo er den Wiederaufau der
am Bosporus gelegenen Stadt Byzanz, die die strategisch wichti-
ge Verbindung zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen
Meer beherrschte. Er gab der prachtvoll wiederaufgebauten
und vergrerten Stadt seinen eigenen Namen und machte sie
zu einem Denkmal des endgltigen Sieges des Christengottes.
Konstantinopel war anfnglich nur eine kaiserliche Residenz
wie Trier und Mailand im Westen und Serdica und Nicomedia
im Osten, entwickelte sich aber bald zum neuen Rom, zur
Hauptstadt des christlichen Imperiums.
Die von Konstantin gegrndete Dynastie wurde durch Ri-
valitten und Morde ebenso zerrttet wie die von Valentinian,
einem pannonischen Soldaten, gegrndete Dynastie nach dem
Tode Julians im Jahre 363. Valentinian konzentrierte sich auf
27
die Westhlfe des Imperiums, die damals von den Alemannen
und den Franken bedroht wurde. Den Osten bergab er seinem
Bruder Valens. Der Einfall der Hunnen im Gebiet des Schwarzen
Meeres 375 fhrte zu erneutem Druck auf Rom, und die stlichen
und westlichen Kaiser gerieten in zunehmendem Mae unter
die Kontrolle ihrer Heermeister, im allgemeinen Barbaren, die
sich in den Armeen des Imperiums hochgedient hatten. Darber
hinaus schlo nach der Niederlage und dem Tod des Valens in
der Schlacht von Adrianopel im Jahre 378 einem entscheiden-
den Ereignis, auf das wir spter noch zurckkommen werden
sein Nachfolger Teodosius mit den siegreichen Goten 382
einen Vertrag, der ihnen erlaubte, sich innerhalb des Imperiums
anzusiedeln, ein verhngnisvoller Przedenzfall. Zwar kam es im
Osten um 400 zu einer Gegenreaktion gegen die Tendenz, sich
auf barbarische Militrfhrer und ihre Gefolgschaf zu verlassen.
Im Westen aber hatten die langanhaltende militrische Krise und
die leere Staatskasse zur Folge, da der Einu solcher Anfhrer
und ihrer Truppen stndig wuchs. Als 476 Odoaker, Sohn eines
Skirenfrsten und rmischer Ozier, Kaiser Romulus Augustulus
absetzte, hatte im Westen das Amt des Kaisers schon lange seine
Bedeutung verloren, da es fast vollstndig unter der Kontrolle
barbarischer Knige stand, deren reale Machtflle durch die
rmischen Titel, die ihnen die ostrmischen Kaiser verliehen,
unterstrichen wurde. Nach Auassung der ostrmischen Kaiser
waren solche Barbarenfhrer besser legitimiert als Rmer vom
Typ des Syagrius, der 486 von den Franken gestrzt wurde, oder
sein Zeitgenosse, der halblegendre Ambrosius Aurelianus, auf
dessen Widerstand gegen die Sachsen in Britannien die Sage von
Knig Arthur zurckgeht.
28
Die Umgestaltung der westrmischen Gesellschaf
Die Barbarisierung des Westens hatte weder mit der germani-
schen Siedlungsbewegung des spten 4. und des 5. Jahrhunderts
noch mit der Krise des 3. Jahrhunderts oder gar mit den Marko-
mannenkriegen begonnen. Sie bestand auch nicht ausschlielich
aus dem Eindringen barbarischer Vlker und ihrer Sitten in das
Imperium. Der Westen war immer primr keltisch und germa-
nisch gewesen, und vom 3. bis zum 5. Jahrhundert behaupteten
sich die eingeborenen Traditionen wieder in zunehmendem
Mae, whrend zugleich die Vorherrschaf Italiens in Politik
und Kultur verel. Ferner beschrnkte sich dieser Proze nicht
auf den Westen, sondern er vollzog sich in weit ausgeprgteren
Formen auch im Osten, wo die lateinische Kultur ebenfalls kein
autochthones, sondern ein fremdes Element darstellte. Aber
whrend die Renaissance vorrmischer Traditionen im Osten das
Wiedererstarken alter Hochkulturen, besonders der griechischen,
bedeutete, fhrte sie im Westen zur Erneuerung keltischer und
germanischer Traditionen.
Die Barbarisierung war nur ein Teil der raschen Vernderun-
gen, die sich im 3. und 4. Jahrhundert in der rmischen Gesell-
schaf, Kultur und Verfassung vollzogen. Doppelt gefhrdet durch
innere Krisenfaktoren Seuchen, fallende Geburtenraten, eine
instabile Verfassung und die Unfhigkeit der rmischen Welt, von
einem arbeitsintensiven, vorwiegend auf Sklaverei beruhenden
System zu einem ezienteren, merkantilen oder vorindustriel-
len System berzugehen und den wachsenden ueren Druck
auf die berdehnten Grenzen, mute das Imperium ein neues
Gleichgewicht suchen. Das Ergebnis, das am Ende des 3. und zu
Beginn des 4. Jahrhunderts zutage trat, war eine stark vernderte,
aber dynamische Welt.
So wie die Armee die tragende Sule der Romanisierung im
ganzen Imperium gewesen war, wurde sie vom 3. Jahrhundert
an zur treibenden Kraf der Barbarisierung. Diese innere Um-
29
wandlung der Armee stand in engem Zusammenhang mit der
allgemeinen Militarisierung der rmischen Gesellschaf und
Verfassung, so da die Armee zur selben Zeit, als sie in steigen-
dem Mae ein barbarischer Faktor im Imperium wurde, auch
zur alles durchdringenden Kraf und zum Modell der Reichsorga-
nisation avancierte.
Die Militarisierung
Die rmischen Legionen, die die Grenzen schtzten, waren aus
vielerlei Grnden ein wirksames Mittel der Romanisierung gewe-
sen. Erstens blieben sie verhltnismig lange, manche Legionen
ber Generationen und sogar Jahrhunderte hinweg, am selben
Standort stationiert. Da ferner regelrechte militrische Aktionen
entlang der Grenzen auerordentlich selten vorkamen, hatten
die Soldaten, die in den ersten Jahrhunderten des Imperiums
zum groen Teil aus der buerlichen Schicht Italiens rekrutiert
wurden, reichlich Zeit und auch Kapital, sich an Landwirtschaf
und Handel ihres Stationierungsgebietes zu beteiligen. Da es
schlielich blich war, den Veteranen Land an ihrem Dienstort
zu bereignen, und weil zahlreiche Veteranen und Legionre
Frauen aus der ansssigen Bevlkerung heirateten, beherrschten
aktive und ausgediente Soldaten das lokale Leben.
So fhrte die dauerhafe Anwesenheit rmischer Soldaten
zu einer grundlegenden Vernderung der Wirtschaf und der
Gesellschaf einer Region. Die Notwendigkeit, die Armee zu
versorgen und den Veteranen Land zu verschaen, stand bei der
Organisation der Regionen im Vordergrund. Jede Legion besa
eine riesige Menge Land, das von Bauern-Soldaten bearbeitet, an
Veteranen verliehen oder an Zivilisten verkauf bzw. verpachtet
werden konnte. In der Nhe der Lager entstanden die unver-
meidlichen zivilen Siedlungen, die jeder Militrposten hervor-
bringt. Sie wurden canabae genannt, was eigentlich Kneipen oder
30
Weinstuben bedeutet und ihre wichtigste Aufgabe hinreichend
erlutert. Diese wilden Ansiedlungen versorgten die Soldaten
mit Getrnken, Frauen und spter auch in zunehmendem Mae
mit Werksttten, Herbergen und sonstigen Dienstleistungen und
Vergngungsangeboten.
Solange die Legionen ihre Mannschafen aus der romanisier-
ten Bauernschaf der Provinzen rekrutierten, war der rmische
Charakter der militrischen Prsenz zumindest in bescheidenem
Umfang gesichert. Von der Regierungszeit Hadrians an (7-38)
wurden jedoch die Rekruten den in ihren Heimatprovinzen
stationierten Legionen zugeteilt. Dies mag zwar die gewnschte
Wirkung gehabt haben, die Zahl der Rekruten zu erhhen und
ihre Einsatzfreude zu steigern, da diese nun ihre eigene Heimat
verteidigten, es begnstigte aber auch einen wachsenden Lo-
kalpatriotismus sowie partikularistische Tendenzen in Religion,
Kunst und Sprache und zunehmend auch in der politischen Iden-
titt. Im 4. Jahrhundert war der Militrdienst wie andere Berufe
zur erblichen Verpichtung geworden. Auf diese Weise wurden
Legionen und Auxiliartruppen hug zu sich selbst reproduzie-
renden Einheiten. Die Ehefrauen der Soldaten und Veteranen,
die zwar theoretisch vor 97 in ihrer aktiven Dienstzeit nicht
heiraten durfen, aber schon damals seit Jahrzehnten Familien
gegrndet hatten, stammten, wie bereits erwhnt, berwiegend
aus der rtlichen Bevlkerung. So wuchsen Generationen von
Bauern-Soldaten und rtlichen Wrdentrgern in der Umge-
bung des Limes in die ortsansssigen, nichtklassischen Sitten
und Traditionen hinein. Vor dem 3. Jahrhundert wurden die
Auswirkungen dieser Vernderung auerhalb der Grenzregionen
jedoch kaum wahrgenommen, da die von ihr betroenen Men-
schen fr das Machtzentrum des Reiches eine verhltnismig
untergeordnete Rolle spielten.
Die Ausbung politischer Macht im Rmischen Reich war
lange Zeit ein Jonglierakt gewesen, an dem sich der Senat, die
Armee und natrlich der Kaiser beteiligten, aber bis zum Tode
31
des Commodus im Jahre 92 waren diese drei Institutionen im
allgemeinen von Italikern und Spaniern besetzt. ber die Hlfe
der Senatoren stammte aus Italien, die brigen Linien mit we-
nigen Ausnahmen aus den am strksten latinisierten Provinzen
Spanien, Afrika und Gallia Narbonensis. Da sie auerdem
einen betrchtlichen Teil ihres Vermgens in italischem Land
anlegen muten, verpichtet waren, regelmig an Sitzungen in
Rom teilzunehmen, Erlaubnis fr Reisen auerhalb Italiens be-
ntigten und dazu neigten, verstrkt untereinander zu heiraten,
wurden senatorische Familien, die aus der Provinz stammten,
rasch italisch, so wie auf einem niedrigeren gesellschaflichen
Niveau Soldatenfamilien provinziell wurden. Dieser Senat ver-
dankte seine Bedeutung verfassungsmigen, wirtschaflichen
und sozialen Faktoren. Erstens verpichtete die Verfassung den
Kaiser, Senatoren das Kommando aller seiner Legionen mit
Ausnahme der gyptischen Legion sowie die Verwaltung der
greren Grenzprovinzen und das Oberkommando zu bertra-
gen. Zweitens besa der Senat zwar einen starken erblichen Kern,
war aber in jeder Generation oen fr eine bestimme Anzahl
von Kandidaten, die zusammen mit den alten Senatorenfamilien
einen enormen Besitz, vorwiegend Grund und Boden, kontrol-
lierten. Dies galt besonders fr den Westen, wo selbst in Krisen-
zeiten die Armut des Staatsschatzes hug in krassem Gegensatz
zum privaten Reichtum einzelner Senatoren stand. Schlielich
erstreckte sich der Einu der Senatoren durch ein Netzwerk
politischer Abhngigkeiten und ihren ber das ganze Imperium
verstreuten Grundbesitz bis in die letzten Winkel des Reiches.
Wenn er herausgefordert wurde, konnte der Senat selbst fr den
ehrgeizigsten Kaiser zu einem furchtbaren Gegner werden.
Vor dem 3. Jahrhundert wurde die militrische Macht, auf
der die kaiserliche Strke beruhte, hauptschlich von der Pr-
torianergarde ausgebt, einer Eliteeinheit von ungefhr 0000
Soldaten, die dem Kaiser und seinem Hofstaat dienten und ihn
nicht selten whlten oder absetzten. Diese muten rmische
32
Brger sein und wurden wie die Senatoren bis zum Ende des 2.
Jahrhunderts vorwiegend aus Italien rekrutiert. Auf diese Weise
trugen auch sie zur Wahrung des im Kern italischen Charakters
des Imperiums bei.
Es erstaunt daher nicht, da lange Zeit alle Kaiser aus italischen
oder spanischen Senatorenfamilien stammten. Gleich welche
Auseinandersetzungen es zwischen Kaiser, Senat und Armee
auch geben mochte und so unerbittlich, blutig und brutal diese
auch of ausgetragen wurden, sie fanden doch zwischen Parteien
statt, die im wesentlichen dieselben kulturellen, sozialen und
politischen Wertmastbe besaen.
Mit der Herrschaf des Septimius Severus (93-2), des Ober-
kommandierenden der Donauarmee, der von seinen Truppen zum
Kaiser ausgerufen worden war, begann eine wichtige neue Phase
der rmischen Geschichte. Die Verteidiger der Provinzen, beson-
ders der Westprovinzen, kamen nun an die Macht; diejenigen, die
das Imperium bislang geschtzt hatten, die Grenzarmeen und ihre
Befehlshaber, bernahmen nun die Kontrolle des Staatsapparats.
Aus der Sicht der alten italischspanischen Senatorenaristokratie
und der Bewohner der strker besiedelten und zivilisierten Gebie-
te war dies ein Zeitalter des Unglcks und der Krise. Zahlreiche
Oziere aus der Provinz, die den Senat hug unverhohlen ver-
spotteten, wurden von ihren Armeen zum Imperator ausgerufen,
kmpfen gegeneinander um die Vorherrschaf und wurden meist
ermordet, wenn sie sich als unfhig erwiesen, den Sieg gegen innere
und uere Feinde zu erringen oder ihre Anhnger angemessen
zu bereichern. Alle Versuche des Senats, die Wahl des Kaisers zu
kontrollieren, wurden durch die Neigung der Provinzarmeen ver-
eitelt, die Nachfolgeregelung als ihr ererbtes Recht zu betrachten,
besonders wenn der neue Kaiser aus dem Militr stammte. Aus
der Sicht derer jedoch, die an der Grenze lagen, und besonders von
Pannonien aus gesehen, war es ein goldenes Zeitalter. Die westli-
chen Legionen hatten ihre Strke und Kampfraf demonstriert,
und als die afrikanischen Severer sich um die Festigung ihrer
33
Position bemhten, suchten sie Rckhalt bei den Mannschafen
und den Anfhrern ihrer Grenztruppen.
Anfangs war Severus selbst bereit, mit dem Senat, dessen
Mitglied er gewesen war, zusammenzuarbeiten. Aber der Wi-
derstand des Senats veranlate ihn, sich auf die Provinzarmee
zu sttzen, die er und seine Nachfolger mit betrchtlichen Sol-
derhhungen, Schenkungen oder Vergnstigungen und mit dem
Recht zur Eheschlieung belohnten. Die zustzlichen Ausgaben,
die solche Freigebigkeit verursachte, wurden aus dem Verkauf
des riesigen Vermgens bestritten, das er von oppositionellen
Senatoren konszierte. Sein der Nachwelt unter dem Beinamen
Caracalla bekannter Sohn setzte die promilitrische Politik
seines Vaters verstrkt fort und erhhte den Sold der Soldaten
um 50 Prozent. Zur Finanzierung ergri er zwei Manahmen:
Erstens wertete er, wie frher schon sein Vater, den Denarius
ab, die Silberwhrung, mit der die Truppen bezahlt wurden;
innerhalb weniger Jahrzehnte fhrte dies zu einem vollstndigen
Zusammenbruch des Whrungssystems. Zweitens verdoppelte
er die traditionelle fnfprozentige Erbschafssteuer, die alle
rmischen Brger entrichten muten. Darber hinaus erhob
er zur weiteren Steigerung der Steuereinnahmen alle Freien des
Rmischen Reiches zu rmischen Brgern. Damit erkannte er
zwar lediglich eine lngst bestehende Situation als rechtmig
an, denn die Unterscheidung zwischen Brgern und Nichtbr-
gern besa bereits keine wesentliche Bedeutung mehr. Dennoch
verstrkte er dadurch das Gewicht und das Selbstwertgefhl der
Provinzbewohner im Imperium, die sich seitdem von Britannien
bis nach Arabien als Rmer mit denselben Rechten und Mglich-
keiten wie die Italiker betrachteten. Wie die Erhhung des Soldes
zielten diese Manahmen darauf ab, die Stellung der Vlker an
der Peripherie des Imperiums auf Kosten derer im Zentrum zu
strken. Den grten Vorteil aus diesen Vernderungen zogen
die Soldaten und die Veteranen.
Caracallas Politik fhrte zu einer wachsenden Militarisierung
34
des Imperiums und vor allem der Provinzen, wo die Zivilver-
waltung lange Zeit aus sich berschneidenden mtern und
Zustndigkeiten bestanden hatte. Erstmals verfgten nicht nur
Oziere, sondern auch gemeine Soldaten ber so betrchtliche
Einkommen, da die canabae und die zivilen Siedlungen am
Limes auflhen konnten. Gebiete wie Pannonien, die sich von
den Markomannenkriegen noch kaum erholt hatten, erlebten
pltzlich einen gewaltigen, geradezu explosionsartigen Auf-
schwung. In Aquincum zum Beispiel erhielt die alte canaba den
Status einer stdtischen colonia, und entsprechend der neuen
Wrde wurden die alten Holz- und Lehmhtten durch steinerne
Huser ersetzt und suberlich entlang von gepasterten Straen
aufgereiht. Diese neuen Huser waren mit Heilufheizungen,
ieendem Wasser aus einer ausgedehnten stdtischen Wasser-
versorgung und eleganten Fresken ausgestattet. Die Stadt erhielt
eine Mauer und ein neues Forum, das mehr der Selbstdarstellung
als dem Geschfsleben diente, dem das alte noch vollkommen
gengte. In Carnuntum, das ebenfalls zu einer colonia erhoben
wurde, vollzog sich eine hnliche Entwicklung; unter anderem
wurden dort ein prachtvolles entliches Bad mit einer ent-
lichen Sulenhalle von 43 x 03 Meter Ausdehnung und eine
etwa 2,5 Meter hohe Mauer erbaut.
Dieser entlichen und privaten Bauttigkeit entsprach eine
steigende Produktion von Luxusgtern und sogar ein allmhlich
prosperierendes lokales Kunsthandwerk, ein Zeichen dafr, da
diese Region zum erstenmal reich genug war, um Knstler zu
ernhren, auch wenn die Qualitt ihrer Arbeiten selten mit den
gallischen, rtischen, syrischen und italischen Erzeugnissen,
die sie nachahmten, konkurrieren konnte. Alle diese Formen
der Prosperitt standen in einem direkten Zusammenhang mit
dem verbesserten Status und dem gewachsenen Wohlstand der
Soldaten.
Die verbesserte Wirtschafslage der Grenzprovinzen verscha-
te dem Militr nun auch in den zivilen Angelegenheiten des
35
tglichen Lebens eine dominierende Rolle. Die Provinzkurien
wurden mancherorts zunehmend von Ozieren und Veteranen
beherrscht, die es sich aufgrund ihrer Abndungen leisten konn-
ten, sich fr den Senat zu qualizieren. Die rumliche Trennung
von Militrlager und Zivilsiedlung wurde aufgegeben, nachdem
Disziplinlosigkeit, aber auch der fr die Siedlungen bentigte
Schutz beide immer strker verschmolzen hatte. Als die Frei-
gebigkeit der Severer zur ausufernden Anarchie der Soldateska
fhrte, grien die unter der stetig steigenden Besteuerung lei-
denden Bauern immer huger zu bewanetem Raub und sogar
zu organisiertem Widerstand. Mit solchen Briganten konnte
man nur fertig werden, wenn Soldaten den Frieden in den Pro-
vinzen aufrechterhielten und die Ruberbanden bekmpfen, die
im 3. Jahrhundert berall aufauchten. Der Einsatz von Soldaten
als Polizei wurde zur Regel, wenn hohe Militrs in einer ihnen
zunehmend feindlich gesinnten Gesellschaf wichtige mter
bei der Eintreibung von Steuern und in der Justizverwaltung
bernahmen.
Diese Krisen, in deren Verlauf das Militr eine noch grere
Bedeutung gewann, waren ironischerweise von ihm selbst ver-
ursacht worden. Da die Severer sich nie auf die Untersttzung
durch den Senat verlassen konnten, muten sie Wege nden,
um den Anspruch des Senats auf die Heereskommandos zu
unterlaufen und sich die Loyalitt der Armeen durch stndige
Solderhhungen zu sichern. Finanziert wurde diese Politik durch
weitere Beschlagnahmungen von Senatoreneigentum wegen
tatschlicher oder vorgeblicher Verschwrungen und durch eine
drastische Verminderung des Silbergehalts der Whrung. Dies
brskierte den Senat natrlich noch mehr und gefhrdete dar-
ber hinaus die nanzielle Stabilitt des Imperiums. Verschrf
wurde die Situation zustzlich dadurch, da die Provinzarmeen
Geschmack an ihrer Macht als Kaisermacher gefunden hatten
und sie mit unerschpicher Energie dazu nutzten, Kaiser zu
ermorden und einzusetzen. Zwischen dem Tod des Severus
36
Alexander (235) und der Tronbesteigung des Diokletian (284)
gab es mindestens 20 mehr oder weniger rechtmige Kaiser
sowie zahllose Prtendenten, Usurpatoren und Mitregenten.
Die lngste Regierungszeit whrend dieser Periode war mit
neun Jahren die des Prtendenten Postumus, der sich selbst zum
Herrscher ber Gallien, Britannien, Spanien und zeitweise ber
Teile Norditaliens aufwarf.
Die Wiederherstellung der Ordnung durch Diokletian festigte
die Rolle des Militrs. Obwohl er bekanntlich die zivile und die
militrische Verwaltung voneinander trennte, wurde unter ihm
und seinen Nachfolgern die Zivilverwaltung den militrischen
Bedrfnissen entsprechend neu geordnet, eine nicht weiter er-
staunliche Entwicklung angesichts der Tatsache, da whrend des
3. und 4. Jahrhunderts der Weg zu einem hohen entlichen Amt
normalerweise ber den Militrdienst fhrte. Viele ehrgeizige
Zivilbeamte kamen aus dem Militr oder dienten wenigstens
zeitweise in der Armee. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts waren
die militrische Organisation und Struktur sowie die kulturellen
und politischen Wertvorstellungen der Soldaten zum mageb-
lichen Modell geworden, an dem sich die rmische Gesellschaf
orientierte. Aber diese Soldaten waren nicht mehr die italischen
Bauern frherer Zeiten; immer huger waren es dieselben Bar-
baren, zu deren Abwehr sie angeworben worden waren.
Die Barbarisierung
Schon Marc Aurel hielt es fr ntig, Sklaven und Barbaren zur
Bekmpfung anderer Barbaren einzusetzen, und gliederte ger-
manische Kriegergruppen in die rmische Armee am Limes ein.
Zwar geschah dies damals als auergewhnliche Manahme,
aber grundstzlich war der Einsatz von Barbaren im Militr
nichts Neues. Whrend in den Legionen und Prtorianerko-
horten nur rmische Brger dienen durfen, wurden schon seit
37
lngerer Zeit Fremde in Auxiliareinheiten eingesetzt. Als jedoch
im 3. und 4. Jahrhundert der Druck auf die Grenzen im Osten
und Norden sowie die zahlreichen inneren Spannungen mehr
Soldaten erforderten, als das durch Seuchen und eine sinkende
Geburtenrate geschwchte Imperium aufringen konnte, wurden
die Mannschafen immer huger mit Barbaren aufgefllt.
Die ersten barbarischen Hilfstruppen im rmischen Heer stell-
ten benachbarte Stmme. Die rmische Auenpolitik bemhte
sich stndig, die Stammesfhrer entlang der Grenzen fr Rom
zu gewinnen. Man bot ihnen Geschenke oder das rmische Br-
gerrecht an und versprach ihnen militrische und wirtschafliche
Untersttzung, damit sie ihre eigenen Stmme ruhig hielten
und die Rmer gegen andere, feindlichere abschirmten. Mit
den Anfhrern wurden Vertrge geschlossen, die ihnen selbst
meist Gold, ihrem Volk Getreide verschafen. Als Gegenleistung
versprachen sie Rom Hilfstruppen. In der zweiten Hlfe des
3. Jahrhunderts gri diese Praxis immer weiter um sich, und
rmische Einheiten, die auerhalb der Grenzen des Imperiums
rekrutiert worden waren, trugen die Namen barbarischer Vlker.
Wir nden Einheiten von Franken, Sachsen, Vandalen, Goten,
Sarmaten, Quaden, Chamaven, Iberern, Assyrern und ande-
rer Stmme. Normalerweise wurden diese Barbaren in Dienst
gestellt, dienten eine Zeitlang, kehrten dann zu ihrem eigenen
Volk zurck und wurden so zu den Gastarbeitern der antiken
Welt. Fr diese Menschen war der Kriegsdienst eine Gelegen-
heit, Reichtmer zu erwerben und die rmische Welt aus erster
Hand kennenzulernen. Aber der Einsatz fremder Truppen fhrte
auch of zu Spannungen und Streitigkeiten. Nicht selten lste
der Druck bei der Aushebung der Rekruten Widerstand und
Revolten gegen die Rmer und ihre Helfer in der barbarischen
Welt aus. Teilweise um solchen Widerstand zu vermeiden, des-
sen Ursachen im Kontakt zwischen den in Frage kommenden
Rekrutierungsgebieten und feindlichen, im freien Germanien
lebenden Stmmen vermutet wurden, begannen die Rmer im
38
Laufe des 3. Jahrhunderts, Barbaren innerhalb des Imperiums
anzusiedeln.
Die ersten Barbaren, die mit ihren Familien im Imperium,
und zwar in entvlkerten Gebieten Galliens und Italiens, ange-
siedelt und Laeten genannt wurden, waren kleine Gruppen von
Flchtlingen oder Kriegsgefangenen, die rmischen Prfekten
oder Grundbesitzern zugeteilt wurden. Diese Menschen dienten
einem doppelten Zweck: Erstens bearbeiteten sie Bden, die
durch Epidemien, allgemeinen Bevlkerungsschwund oder die
Flucht der freien Bevlkerung vor der Besteuerung brachlagen.
Zweitens trugen ihre Siedlungen unter dem wachsamen Auge
Roms dazu bei, Rekruten fr die Armee hervorzubringen und
aufzuziehen; denn die Siedler und ihre Nachkommen waren zum
Militrdienst verpichtet.
Zwischen diesen Laeten und den Fderaten, den freien barbari-
schen Einheiten, lagen Welten. Letztere begannen seit dem Ende
des 4. Jahrhunderts, das Militr und insbesondere die als comitaten-
ses bezeichneten mobilen Eliteeinheiten zu beherrschen, die etwa
unter Konstantin nicht an den Grenzen, sondern innerhalb der gr-
eren Provinzstdte oder in deren Nhe stationiert wurden. Diese
Einheiten konnten sofort aufrnarschieren, um Eindringlingen an
jedem Punkt der Grenze entgegenzutreten oder um ihr weiteres
Vordringen zu verhindern, wenn diese bereits durchgebrochen wa-
ren, womit sie eine bedeutende strategische Neuerung darstellten.
Ihre enge Nachbarschaf zu rmischen Siedlungen, die sie ernhren
und versorgen muten, beschleunigte jedoch die Assimilation in
kirbarischer Soldaten und rmischer Zivilisten.
Diese Einheiten der foederati standen unter dem Kommando
ihrer eigenen Anfhrer, die zwar hug aus Familien stammten,
die den Rmern schon seit Generationen gedient hatten, de-
ren Macht aber von ihren barbarischen Gefolgsleuten abhing.
Archologische Funde aus verschiedenen Barbarensiedlungen
innerhalb des Rmischen Reiches beweisen, da die Siedlungen
der laeti von den Wohnbezirken der einheimischen rmischen
39
Bevlkerung und noch strker von denen freier Germanen deut-
lich getrennt waren, whrend die foederati nicht nur in engem
Kontakt mit der rtlichen Bevlkerung lebten, die sie kraf ihrer
militrischen Bedeutung nicht selten dominierten, sondern auch
enge und dauerhafe Kontakte zu den Stmmen jenseits von
Rhein und Donau pegten.
Die Anfhrer dieser Gruppen, die meist als Reichsgerma-
nen bezeichnet werden, rckten im 4. und 5. Jahrhundert in
die hchsten Rnge des rmischen Heeres auf. Angesichts der
berragenden Bedeutung der germanischen Truppen und der
fest verankerten Tradition des sozialen Aufstiegs durch Mili-
trdienst berrascht dies nicht. Bereits whrend der Herrschaf
Konstantins hren wir von einem Franken namens Bonitus,
der rmischer General wurde. Im Laufe des 4. Jahrhunderts
bekleideten frnkische Befehlshaber viele Fhrungspositionen
der Armee im Westen und erlangten eine solche Macht, da sie
nach Belieben Kaiser erheben und absetzen konnten: Arbogast,
Bauto und Richomer waren unter Gratian und Valentinian II.
Heermeister, magistri militum; Bauto und Richomer wurden
sogar Konsuln. Die ozielle Laudatio, die 385 anllich des
Konsulats des Bauto, eines heidnischen Franken von jenseits des
Rheins, gehalten wurde, verfate kein geringerer als der heilige
Augustinus, damals noch ein junger Rhetoriklehrer in der Kai-
serresidenz Mailand.
Die germanisch-rmischen Befehlshaber waren alles andere
als ungebildete und unkultivierte Barbaren. Sie bewegten sich
in den hchsten und gebildetsten Kreisen des Imperiums,
einige waren sogar mit Mnnern wie Bischof Ambrosius von
Mailand befreundet und korrespondierten mit Rhetorikern wie
Libanius. Gewi, sie waren Heiden, aber ihr Heidentum war das
des senatorischen Adels, wie es am Beispiel der Bekanntschaf
Richomers mit dem Gelehrten Symmachus deutlich wird, und
nicht die Religion des freien Germanien. Nachdem Arbogast 392
Valentinian II. zum Selbstmord gezwungen hatte, lie er einen
40
Rhetoriker namens Eugenius zum Kaiser proklamieren, unter
anderem weil er dessen rmisch-heidnische Wertvorstellungen
teilte. Zwei Jahre spter wurden Arbogast und sein Strohmann
von dem orthodoxen Kaiser Teodosius besiegt. Aber den Sieg
verdankten die Orthodoxen mageblich einer anderen Gruppe
von Barbaren, den arianischen Westgoten und ihrem Anfhrer
Alarich, der aus Unzufriedenheit mit der Belohnung, die ihm
Teodosius fr seine Hilfe zuteil werden lie, rebellierte und
sechzehn Jahre spter Rom plnderte. Im spten 4. Jahrhundert
waren Kategorien wie Barbaren und Rmer, Heiden und Christen
viel komplexer, als man es sich of vorstellt.
Die letzte, entscheidende und am hugsten miverstandene
Phase barbarischer Prsenz im rmischen Imperium war das
Eindringen ganzer Vlker, gentes, ein Proze, der mit dem Volk
Alarichs eingesetzt hatte. Ausgelst wurde die Wanderungsbe-
wegung von den Hunnen, die um 375 die relativ stabilen unter
gotischer Herrschaf rund um das Schwarze Meer lebenden
Gemeinschaften barbarischer Vlker zerstrten. ber ein
Jahrhundert lang hatten diese Goten, ber die wir im nchsten
Kapitel mehr hren werden, in enger Beziehung mit dem Impe-
rium gelebt und abwechselnd in der rmischen Armee gedient
oder gegen sie gekmpf. Das Knigreich der Greutungi oder
spter Ostgoten wurde vernichtet, und ihr Knig Ermanarich
opferte sich seinem Gott in einem rituellen Selbstmord. Seine
heterogenen Vlker gingen zum groen Teil in der hunnischen
Konfderation auf. Die spter Westgoten genannten Tervingi
setzten angesichts des Zusammenbruchs und einer drohenden
Hungersnot ihren obersten Richter Athanarich ab, baten unter
der Fhrung der prormischen Frsten Fritigern und Alaviv
Kaiser Valens um Aufnahme in das Rmische Reich und boten
ihm als Gegenleistung ihre militrischen Dienste an. Valens
glaubte, auf diese Weise seinen Mangel an Soldaten beheben zu
knnen, stimmte zu und versprach ihnen Land in entvlkerten
Teilen Trakiens.
41
Kurzfristig wie langfristig wirkte sich die Aufnahme eines gan-
zen Volkes in den Reichsverband verhngnisvoll aus. Zunchst
wurden die Goten aufgeteilt. Einige wurden sofort zur Sicherung
der Ostgrenze abkommandiert, andere bezogen ein Winter-
quartier bei Adrianopel, whrend die Mehrheit in Trakien
angesiedelt wurde, wo die lokalen rmischen Behrden aus der
verzweifelten Notlage der Menschen Prot zu schlagen suchten
und die Goten zwangen, ihre eigenen Leute gegen Hundeeisch
zu verkaufen. Der gngige Preis war ein Gote fr einen Hund.
Die daraufin ausbrechenden Unruhen wurden verschrf, als
Ostgoten, unzufriedene Goten aus dem Raum Adrianopel und
andere, die in die Sklaverei verkauf worden waren, hinzustieen.
Die Spannungen weiteten sich zu einem allgemeinen Aufstand
aus, und als Valens diesen am 9. August 378 niederzuschlagen
versuchte, wurde seine Armee zur allgemeinen berraschung
auch der Goten selbst vernichtet und er selbst zusammen
mit zahlreichen hheren Ozieren gettet.
Die Goten, denen sich mehrere andere Barbarengruppen
anschlossen, marschierten in Richtung Konstantinopel, aber in
erster Linie auf der Suche nach Nahrung und nicht nach Beute;
sie waren ohnehin nicht in der Lage, eine stark befestigte Stadt
einzunehmen. Schlielich brachen auch noch Kmpfe zwischen
den verschiedenen Gruppen aus. 382 schlo Teodosius mit den
Westgoten einen frmlichen Vertrag, siedelte sie in Trakien
entlang der Donau an und gestattete ihnen, unter der Herrschaf
ihrer eigenen Anfhrer zu leben und als foederati unter deren
Kommando zu kmpfen. Diese Siedlungsphase hielt nicht lange
an; kurz nach der Niederlage des Arbogast waren die Goten unter
ihrem Knig Alarich wieder unterwegs und plnderten 40 Rom,
bevor sie sich schlielich 48 in Sdwestgallien niederlieen.
Die Ansiedlung eines ganzen Volkes manche Schtzungen
sprechen von ber 200000 Menschen stellte ein Modell fr
die zuknfige Integration barbarischer Vlker dar, die entweder
ber Donau und Rhein geohen oder eingedrungen waren, aber
42
aufgehalten oder gar besiegt werden konnten. Dazu gehrten
die Ostgoten, Vandalen, Burgunder, Sueben und spter die Lan-
gobarden. Lange Zeit glaubte man, bei der Ansiedlung sei den
Barbaren unbesiedeltes Land oder konszierter Grundbesitz
zugeteilt worden. Den Proze, in dessen Verlauf Westgoten,
Burgunder und Ostgoten eine neue Heimat fanden, deutete
man im allgemeinen als Ausweitung der hospitalitas, also des
Systems, nach welchem Soldaten bei der Zivilbevlkerung ein-
quartiert wurden, wobei ihnen ein Drittel des Grundbesitzes, auf
dem sie untergebracht waren, zuel. Ein solches Verfahren liee
vermuten, da sich das wirtschafliche und soziale Gefge der
Regionen, in denen Barbaren angesiedelt wurden, grundlegend
vernderte. In neuerer Zeit hat man angenommen, da den
Barbaren anstelle von Grundbesitz Anteile am Steueraufom-
men gewhrt wurden, so da die Grundbesitzer im ungestrten
Besitz ihres Landes blieben.
3
Die Wirklichkeit lag wahrscheinlich
irgendwo dazwischen und war von Gegend zu Gegend wohl
sehr unterschiedlich. Zeitgenssische Autoren sprechen auch
von Landzuteilungen an die Goten und andere Stmme, und
die Ansichten, alle entsprechenden Belege seien bertreibungen
oder rhetorische Freiheit gewesen, sind noch zu diskutieren.
Andererseits beweisen archologische Funde, da barbarische
Krieger in bewohnten Gegenden Galliens und Italiens siedelten
und meist in den Regionen, denen sie zugeteilt waren, nicht
selbst Grundbesitz bearbeiteten. Sie tendierten zur Siedlung in
Stdten oder an strategisch wichtigen Punkten an den Grenzen
der jeweiligen Region und lebten im brigen wie viele rmische
Aristokraten von den Pachten und Abgaben aus den von ihnen
erworbenen Lndereien. Rmische Beamte mgen in ihrem
Bemhen, wenigstens die Illusion von einem imperialen System
aufrechtzuerhalten, diese Arrangements gelegentlich als Steuern
verstanden haben; mglicherweise erhielten die verbndeten
Barbaren den dritten Teil der Steuern, der zuvor fr die Zentral-
verwaltung eingezogen worden war. Ob die Geld einnehmenden
43
Barbaren und die zahlenden Rmer diesen Unterschied zwischen
Steuern und Pachteinnahmen machten, ist vllig oen. Fest steht
jedoch, da sich im 4. und 5. Jahrhundert das Steuersystem des
Imperiums erheblich wandelte, was sich unmittelbar auf die Ver-
teidigungsfhigkeit und die Gesellschafsstruktur auswirkte.
Die Besteuerung
Der Unterhalt des Heeres erforderte enorme Aufwendungen, die
nur dadurch gedeckt werden konnten, da der Staat das System
nderte, durch welches er seine Einnahmen sicherte. Bei seinem
ungeheuren Reichtum hatte das rmische Weltreich niemals
ein System der Kreditaufnahme auf knfige Einnahmen, etwa
in der Art von Schuldverschreibungen, entwickelt; diese sollten
erst im Mittelalter erfunden werden. Statt dessen versuchten die
Kaiser, ihren gewaltig angewachsenen Finanzbedarf durch eine
radikale Umgestaltung des Steuersystems zu befriedigen eine
Vernderung, die nicht nur fr die wirtschaflichen, sondern
auch fr die sozialen und politischen Strukturen weitreichende
Folgen hatte.
Von alters her bestand die jhrliche Abgabe, welche die
Reichsverwaltung von den Provinzen einzog, aus den verschiede-
nen Arten des tributum, oenbar Formen direkter Steuern oder
Kontributionen, zu deren Einziehung die Zentralregierung die
rtliche Kurie ermchtigte. Wie diese Steuern eingezogen wur-
den, scheint ganz den jeweiligen Kommunen berlassen worden
zu sein, nur die Gesamtsumme wurde von der Provinzverwaltung
festgesetzt. Da es dem Ansehen in der entlichkeit diente,
seinen Gemeinsinn auf mglichst grozgige Weise hervorzu-
kehren, wurden diese Steuern in guten Zeiten of nahezu vollstn-
dig von den Wohlhabenden, von curiales oder Dekurionen, den
Mitgliedern der rtlichen curia, gezahlt, womit letztere zugleich
ihren Rang als fhrende Brger unterstrichen. Auf Freiwilligkeit
44
beruhten auch viele entliche Leistungen des Imperiums; die
Reichen bernahmen mter, die Armen beteiligten sich am
Straenbau und anderen Arbeiten. Dieses System war fr die
Lokalgren vorteilhaf; denn es rckte die Gemeinde, in der sie
eine fhrende Rolle spielten, in den Mittelpunkt des entlichen
Interesses. Aber auch die Zentralverwaltung protierte davon,
weil der Einsatz der Dienste und des Vermgens der rtlichen
Magistrate dem Staat Geld
und Arbeitskrfe ersparte. Als ungnstig erwies es sich jedoch
insofern, als es diesen prominenten Persnlichkeiten die Mglich-
keit ernete, bei der Reichsregierung gelegentlich eine Absenkung
der festgesetzten Steuersumme zu erwirken. Wenn dies huger
geschah, wie etwa unter der Herrschaf Marc Aurels, war der Kaiser
gezwungen, zur Vermeidung von Deziten den Edelmetallgehalt
der Mnzen zu vermindern, weil ihm ja das Verfahren, Anleihen
auf knfige Steuereinnahmen aufzunehmen, nicht zur Verfgung
stand. Dennoch konnten diese festgeschriebenen Steuern in einer
Zeit wachsenden Finanzbedarfs und galoppierender Ination nicht
einmal annhernd die Bedrfnisse der kaiserlichen Armee decken.
Obwohl im 4. Jahrhundert das Realeinkommen der Soldaten und
der Zivilbediensteten durch Geldentwertung auf die Hlfe dessen,
was sie am Ende des 2. Jahrhunderts erhalten hatten, gesunken war,
brachten die hohe Zahl von Soldaten und Zivilbediensteten, die
Unregelmigkeiten in der Steuereinziehung, der Bevlkerungs-
schwund und die Zerstrungen durch Plnderungen und Kriege
die Finanzen des Reiches vor allem im Westen in eine ernsthafe
Krise.
Whrend der Krise des 3. Jahrhunderts erzwangen der Zusam-
menbruch der Whrung und der ungeheure Finanzhunger des
Militrs eine Reform dieses Steuersystems. Zunchst fhrte
Diokletian die annona ein, im wesentlichen eine Steuer auf
landwirtschafliche Produkte, die hnlich wie die Vermgens-
steuer durch die rtliche Verwaltung eingezogen wurde. Um
die Last dieser Steuer annhernd gerecht aufzuteilen, wurde
45
im 4. Jahrhundert ein neues System eingefhrt, das nicht die
Kommunen als Ganzes, sondern den einzelnen erfate. Jedem
Brger wurde eine Steuerschuld auferlegt, die seiner Mglichkeit
entsprach, zur annona beizutragen. Diese Steuerpicht wurde
nach der landwirtschaflich nutzbaren Flche die Maeinheit
war das iugum errechnet sowie nach der capitatio, die manche
Wissenschafler als Kopfsteuer, andere in einem weiteren Sin-
ne als allgemeine Steuerpicht eines Individuums oder eines
Grundbesitzes verstehen. Anfangs basierte diese Besteuerung
zwar noch auf dem persnlichen Besitz des einzelnen Brgers,
aber schon am Ende des 4. Jahrhunderts vollstndig auf Antei-
len am Ertrag, der fr den gesamten vorhandenen Grundbesitz
ermittelt worden war.
4
Schlielich aber konzentrierten sich die
Bemhungen des rmischen Fiskus darauf, diese Zahlungen
von den Wohlhabenden in Form von Gold einzuziehen. Freie
Pchter, die man coloni nannte, da sie selbst kein Land besa-
en, waren verpichtet, ein ihnen zugewiesenes Stck Land zu
bewirtschafen, damit sie ihre Steuerverpichtungen erfllen
konnten. Nach und nach wurde ihr Grundherr zu ihrem Steu-
ereintreiber und errang so betrchtliche Verfgungsgewalt ber
ihre Person, womit sichergestellt wurde, da sie aus ihrem Land
das notwendige Einkommen erzielten.
Die auf dieser Basis erstellten Steuerlisten wurden anfangs re-
gelmig auf den neuesten Stand gebracht, und die Einziehung
der Abgaben besorgten wie zuvor die Magistrate der rtlichen
Kurie. Als jedoch die Bevlkerung und die landwirtschafli-
che Produktion abnahmen, als einzelne fr sich die Befreiung
von ihrem Steueranteil erwirken konnten und der Geldbedarf
des Imperiums zur Finanzierung des Militrs zugleich immer
grer wurde, machten sich ernsthafe und extrem belastende
Ungerechtigkeiten im System bemerkbar. Gleichzeitig begann
man, die Steuerveranlagungen als abstrakte Ertragseinheiten zu
betrachten, die von einer Steuerliste auf eine andere bertragen
werden konnten.
46
Die Auswirkungen dieses Steuersystems vernderten im 4.
und 5. Jahrhundert die Rolle der rtlichen Eliten in der Reichs-
verwaltung. Manche curiales, die fr die Zahlung des jhrlichen
Steueraufommens garantieren muten, selbst wenn es in ihrer
Gemeinde nicht eingetrieben werden konnte, standen vor dem
wirtschaflichen Ruin. Damit schwanden das Ansehen und die
Bedeutung des traditionellen freiwilligen Dienstes fr die Allge-
meinheit. Whrend einige Reiche durch eine Vielfalt von legalen
und illegalen Steuererleichterungen ihre persnliche Belastung
vermindern konnten, wuchs die Belastung derjenigen, die fr
die Gemeinde verantwortlich waren, unaufrlich. Infolgedessen
verlor die lokale curia ihre Bedeutung als Zentrum des ent-
lichen Lebens, die Tradition des Prestigeerwerbs durch Dienst
fr die Allgemeinheit brach in sich zusammen. Die Belastung
der curiales war so hoch, da man sie jetzt zur bernahme von
mtern zwingen und ihnen verbieten mute, sich ihren Pich-
ten durch Flucht aus den Stdten zu entziehen. Diejenigen, die
bereit oder sogar begierig darauf waren, die Steuereinziehung zu
bernehmen und davon gab es immer noch welche , hofen
oensichtlich, ihre Macht nutzen zu knnen, um sich durch
Erpressung der Bevlkerung persnlich zu bereichern. Mit dem
Niedergang der kommunalen Verwaltung wurde die Provinz-
verwaltung strker an der Eintreibung der annona beteiligt, und
nun erreichte der lange Arm der kaiserlichen Steuereintreiber
zum ersten Mal die einzelnen Brger, die zu schwach waren,
um jene Privilegien zu erwirken, mit welchen sich die Starken
schtzten. Der Verfall des freiwilligen Dienstes fr die Allge-
meinheit, eine unmittelbare Folge der Steuerbelastung, blhte
die Reichsbrokratie ungeheuer auf, was wiederum ein noch
hheres Steueraufommen erforderlich machte.
47
Die Gewinner: eine Aristokratie von Grundbesitzern
Die Hauptnutznieer dieses Wandels waren die senatorischen
Grogrundbesitzer des Westens, die dank ihrer Verbindungen
im gesamten Imperium und ihrer privaten militrischen Macht
von der ansteigenden Steuerbelastung praktisch nicht betroen
waren. Auf diese Weise entwickelte sich im Westen eine paradoxe
Situation, unermelicher Reichtum einzelner stand einem extrem
armen Fiskus gegenber. Man hat geschtzt, da um die Mitte
des 5. Jahrhunderts die gesamten Jahreseinnahmen der stlichen
Reichshlfe etwa 270 000 Pfund Gold betrugen, wovon 45 000
Pfund fr das Militr bestimmt waren. Zur selben Zeit lag im
Westen das gesamte Jahresbudget bei etwa 20 000 Pfund Gold
eine fast lcherlich anmutende Summe, wenn man bedenkt,
da ein einzelner reicher italischer Senator mit Leichtigkeit ein
jhrliches Einkommen von 6 000 Pfund erzielen konnte. Fr
solche Menschen bedeutete ihre Bindung an die Romanitas in
erster Linie die Pege einer elitren Kulturtradition und die
Bewahrung der Freiheiten und Privilegien ihrer Schicht. Diese
waren ihnen lange Zeit wichtiger gewesen als die Ausbung der
Kontrolle ber die Reichsverwaltung, in der sie im Gegenteil
eher eine Bedrohung ihrer Eigenstndigkeit erblickten. Wenn
Konstantinopel Barbaren einsetzte, um die wenigen Reichen
wieder zur bernahme von Verantwortung zu zwingen, muten
diese bekmpf werden; wenn die Barbaren und ihre Knige aber
die Privilegien der senatorischen Aristokratie schtzen konnten,
waren sie willkommen. So verwundert es denn auch nicht, da
um die Mitte des 5. Jahrhunderts ein aristokratischer gallor-
mischer Grundbesitzer am Hof des Burgunderknigs einem
christlichen frommen Mann, der schon lange den Untergang des
rmischen Imperiums vorausgesagt hatte, mit der spttischen
Frage entgegentreten konnte, warum seine Prophezeiung nicht
eingetroen sei. Das Imperium als politisch-militrische Realitt
war in Burgund in der Tat bereits untergegangen, aber da seine
48
eigene Position davon nicht betroen war, hatte der Grundherr
dieses Ableben gar nicht wahrgenommen.
5
Dieser Rmer, der
nicht wute, da er nicht mehr im rmischen Imperium lebte,
war reprsentativ fr einen relativ neuen Adel, dessen Entste-
hung hchstens bis in die Zeit Konstantins zurckreicht. Im
Westen war das 4. Jahrhundert eine besonders glckliche ra
fr diejenigen, die sich der kaiserlichen Gunst erfreuten. Dies
waren ursprnglich die Rmer und die barbarischen Groen
am Hof von Trier. Um die Jahrhundertmitte konnte die Stadt
Trier, die bis Ende des 4. Jahrhunderts kaiserliche Residenz und
Sitz der Prfektur Galliens war, in berschwenglicher Weise mit
Rom und Konstantinopel verglichen werden. Die von Ausonius
und anderen lateinischen Dichtern gefeierte Stadt bildete einen
Mittelpunkt der Zusammenarbeit und der Assimilation rmi-
scher und germanischer Eliten. Hier traten viele frnkische und
alemannische Frsten zum ersten Male in rmische Dienste,
und von hier aus konnten Reichsgermanen zurckgesandt
werden, damit sie ihre Stmme in einer Weise regierten, die die
Kooperation mit Rom sicherstellte.
Abgesehen vom Reichtum und der Gre Triers beruhte die
Bedeutung der Stadt fast ausschlielich auf ihrer Funktion als
Verwaltungszentrum. Ihr Niedergang begann denn auch un-
mittelbar, nachdem Kaiser Honorius in den letzten Jahren des
4. Jahrhunderts seine Residenz nach Mailand und schlielich
nach Ravenna verlegt hatte. Der Reichsfeldherr Stilicho beschlo
um 395, die Prfektur nach Arles zu verlegen. Die Familien, die
durch kaiserliche Gunst zu Macht gekommen waren, folgten
dem Kaiser und dem Prfekten nach Sden und nach Osten. Der
Abstieg der Stadt wurde zustzlich beschleunigt, als Barbaren die
Stadt zwischen 40 und 435 nicht weniger als viermal plnderten,
wenn auch oensichtlich nicht zerstrten.
Familien, deren Macht im Westen nicht nur auf kaiserlicher
Gunst, sondern auch auf eigenen Einknfen beruhte, lebten
weiter entfernt vom Limes. Besonders im Rhnetal, in Aquitanien
49
und entlang der Mittelmeerkste knpfen groe Familien wie die
Syagrii, Pontii, Aviti, Apollinares, Magni und andere ein Netz von
Heiratsverbindungen, Protektion und Grundbesitz. Hier hatte
die rmische Zivilisation ihre tiefsten und krfigsten Wurzeln
geschlagen, und die Mitglieder dieser groen Familien setzten
die Tradition der rmischen Kultur weit ber die Zeit hin fort,
als die kaiserliche Macht im Westen bereits erloschen war.
Der oben dargestellte Proze der Machtverlagerung hatte im
Laufe der Zeit dazu gefhrt, da sich innerhalb des Imperiums
regionalistische Tendenzen ausbreiteten. Bereits im 3. Jahrhun-
dert hatte die gallische Aristokratie den bergang der politischen
Kontrolle auf regionale Prtendenten begrt, mit dem Ergebnis,
da die im Lande stationierten Armeen eine Reihe von gallischen
Kaisern erheben konnten. Und der Grund dafr, da Stilicho die
Prfektur an die untere Rhne verlegte, war eher die Bedrohung
durch Usurpatoren aus diesen Regionen als durch Barbaren von
der anderen Rheinseite.
Die Kultur, die diese Aristokratie kennzeichnete, unterschied
sich in zunehmendem Mae von der des Ostreiches. Im Osten
fhrte die Renaissance der griechischen Kultur unter der Pa-
tina des Lateinischen zu einer wachsenden Bedeutung der
Philosophie und besonders innerhalb der christlichen Elite
zu Streitigkeiten und Spannungen ber die rechte Lehre. Im
Westen verzichtete man hingegen im 4. und 5. Jahrhundert
zunehmend auf eine ernsthafe Beschfigung mit der griechi-
schen Wissenschaf, hier wurde die Philosophie immer strker
von der Rhetorik verdrngt. Die Erziehung, nach wie vor eine
ausschlieliche Domne der weltlichen Grammatik- und Rheto-
rikschulen, sollte den Nachwuchs der Elite mit dem kulturellen
Hintergrund und den rhetorischen Fhigkeiten ausstatten, die
er zur Bekleidung hoher mter bentigte. Diese von staatlich
angestellten und bezahlten Rhetorikern geleitete Erziehung
war ausschlielich literarisch und damit heidnisch. Die Kirche
beteiligte sich an der formalen Erziehung ihrer Mitglieder nicht;
50
im Westen existierten keine Teologenschulen wie zum Beispiel
in Alexandria und Antiochia. Daher blieben junge heidnische
wie christliche Aristokraten nach wie vor einem gemeinsamen
kulturellen Erbe verbunden, das die unerlliche Voraussetzung
fr den Aufstieg im Reichsdienst darstellte und in einer Gesell-
schaf, die in wachsendem Mae in erbliche Berufe gegliedert
war, eine der wenigen Mglichkeiten sozialer Mobilitt auerhalb
des Militrs bot, welches, wie wir gesehen haben, immer strker
barbarisch geprgt war.
Diese Ausbildung in der literarischen und rhetorischen Traditi-
on war die groe Gemeinsamkeit der rmischen aristokratischen
Gesellschaf; die Wertvorstellungen der christlichen und heidni-
schen Rmer des 4. und frhen 5. Jahrhunderts waren nahezu
identisch. Die entscheidende Kluf bestand vielmehr zwischen
der gebildeten Elite und allen anderen Menschen. Nicht die Re-
ligion oder die politische Struktur, sondern die Bildung trennte
die rmische Elite von den Barbaren, die in steigender Zahl in
ihrer Mitte lebten.
Einige der besonders privilegierten Aristokraten zogen sich
vollstndig in eine Welt von fast unvorstellbarem Luxus und
Genu zurck und verzichteten auf eine Rolle im entlichen
Leben, whrend sich andere ganz der Literatur widmeten. So
verbrachte etwa Symmachus, den wir vorwiegend als Schrifstel-
ler und Verteidiger der altrmischen heidnischen Traditionen
kennen, lediglich drei Jahre seines Lebens im Staatsdienst. Die
Bereitschaf zum Dienst fr die Allgemeinheit war jedoch nicht
vollstndig geschwunden, und mit der Erosion der politischen
Zentralgewalt im Westen sowie der Macht rtlicher Kurien
stiegen einige Mitglieder der senatorischen Aristokratie in die
entsprechenden Positionen jener beiden Institutionen auf, die
an deren Stelle traten, der barbarischen Knigshfe innerhalb
des Reiches und der Kirche. Der oben erwhnte Rmer am
burgundischen Knigshof vertritt den Typus jener Rmer, die
den Barbarenknigen die administrative Fachkompetenz zur
51
Verfgung stellen konnten, welche sie zur Sehafmachung
ihrer Vlker innerhalb der rmischen Welt bentigten. ber
solche Instruktoren verfgten die barbarischen Hfe auch schon,
bevor sie in das Imperium aufgenommen wurden. Namentlich
bekannt sind einzelne wie Cassiodor und Boethius am Hofe des
ostgotischen Knigs von Italien oder die rmischen Patrizier in
Burgund. Viele andere Rmer, die den Fiskus und die Verwaltung
der Barbarenknige geleitet haben mssen, blieben anonym,
haben aber ihre Spuren bei der Ausarbeitung der barbarischen
Gesetzeswerke hinterlassen, die sich in der Form und of sogar
im Inhalt an sptrmische Gesetze anlehnen, sowie in den un-
terschiedlichsten Dokumenten und Verfahren der kniglichen
Verwaltungen, die vom sptrmischen System der Provinzver-
waltung abgeleitet sind.
Auf lokaler Ebene fllte die Aristokratie durch die bernahme
der Bischofsmter auch das durch die Ausung der Kommu-
nalverwaltung entstandene Machtvakuum aus. Diese Entwick-
lung ist im 4. und 5. Jahrhundert in Gallien, wo die Bischfe
aus dem Hochadel stammten, weit deutlicher ausgeprgt als
in Italien und Spanien, wo die Bischfe aus groen, aber nicht
aus den vornehmsten Familien hervorgingen, was vermutlich
darauf hinweist, da in diesen Regionen andere Formen lokaler
Machtausbung noch strker ausgeprgt waren als nrdlich der
Pyrenen und der Alpen.
Gegen Ende des 3. Jahrhunderts waren die Fundamente der
kirchlichen Organisation lngst gelegt und die unbestrittene
Vorrangstellung des Bischofs etabliert. Obwohl dieser im Ein-
vernehmen mit der rtlichen Gemeinde ernannt und von einem
Nachbarbischof geweiht wurde, amtierte ein einmal eingesetzter
Bischof auf Lebenszeit und konnte nur von einer Versammlung
der Nachbarbischfe abgesetzt werden. Damit besa er faktisch
unbegrenzte Macht. Er weihte Priester, Diakone und Diakoninnen,
er nahm neue Mitglieder in die Gemeinde auf, exkommunizierte
diejenigen, deren Glaubensansichten oder Lebenswandel er mi-
52
billigte, und er besa die vollstndige Kontrolle ber die Finanzen
der Dizese. In der Regel deckte sich sein Sprengel mit dem welt-
lichen Verwaltungsbezirk. Dieser war im wesentlichen stdtisch,
denn normalerweise besa jede Stadt einen eigenen Bischof.
Teoretisch erstreckte sich die bischiche Autoritt auch auf das
Umland, aber da die Christianisierung des lndlichen Europa ein
uerst langsamer, erst im 0. Jahrhundert vollstndig abgeschlos-
sener Proze war, bildete die Stadt sein Machtzentrum.
Natrlich war die tatschliche Macht des Bischofs vor der Zeit
Konstantins sehr unterschiedlich, besonders im Westen, wo der
Bischof auerhalb der christlichen Gemeinde wenig Ansehen
geno. Die kaiserliche Protektion durch Konstantin und seine
Nachfolger vernderte diese Situation grundlegend. Erstmals
war mit der Position des Bischofs so viel Einu verbunden,
da die Aristokratie sie als Instrument zur Erhaltung und Aus-
dehnung ihrer eigenen Macht nutzen konnte. Bischfe erhielten
kaiserliche Zuwendungen und Privilegien und bernahmen
sogar Befugnisse rmischer Magistrate, die frher den Provinz-
prfekten vorbehalten gewesen waren. Der Besitz des Bistums
dehnte sich auch durch fromme Schenkungen auerordentlich
aus, zum groen Teil durch Schenkungen vornehmer Frauen,
die im 4. und 5. Jahrhundert eine beraus wichtige, bisher aber
wenig gewrdigte Rolle bei der Ausbreitung des Christentums
im Westen spielten. Die neue Religion ernete Frauen einen
der wenigen Wege, sich aus der normalerweise untergeordneten
Stellung ihrer privaten Welt herauszubewegen und am ent-
lichen Leben teilzunehmen. Als Wohltterinnen, Pilgerinnen
und in zunehmendem Mae dadurch, da sie in gottgeweihter
Jungfrulichkeit lebten, konnten Frauen einen Status erringen,
den sie bislang in der ausschlielich mnnlich geprgten Welt
der Antike nicht gekannt hatten.
Dennoch stellte die Wahl von Aristokraten in Kirchenmter
im 4. Jahrhundert noch eine Ausnahme dar. Es lste einen
Skandal aus, als ein reicher gallischer Senator namens Paulinus
53
seine Karriere aufgab und seine Gter verlie, um Geistlicher
zu werden, und tatschlich Bischof wurde. Da Ambrosius, der
Sohn eines Prtorianerprfekten, sich zum Bischof whlen lie,
war ebenfalls auergewhnlich, obwohl es sich um einen so
bedeutenden Bischofssitz wie Mailand handelte.
Aber im 5. Jahrhundert wurde es besonders in Gallien fast zur
Regel, da Aristokraten kirchliche mter besetzten. Die Bisch-
fe entstammten nun meistens der senatorischen Aristokratie
und wurden of nicht aus dem Klerus, sondern aus den Reihen
derjenigen ausgewhlt, die sich in Fhrungs- und Verwaltungs-
aufgaben bewhrt hatten. Die Wahl zum Bischof wurde zum
Hhepunkt der weltlichen Karriere, des cursus honorum, der mit
der Kirche ursprnglich nichts zu tun hatte. Und es berrascht
nicht, da die Wertvorstellungen dieser Bischfe denen ihrer
Schicht und der weltlichen Gesellschaf entsprachen, in der sie
Karriere gemacht hatten. Die Tugenden, fr die diese Bischfe
hug auf Epitaphen und in Grabreden gefeiert wurden, waren
weltliches Prestige und weltliche Ehre und damit die traditionel-
len Werte der heidnischen rmischen Gesellschaf und nicht so
sehr ihre geistlichen Qualitten. Und da den meisten Bischfen
des Westens jeglicher religise und theologische Hintergrund
fehlte, uerten sie sich auch kaum ber theologische oder
geistliche Fragen.
Andererseits entsprach die Wahl solcher Mnner damals
vermutlich exakt den Bedrfnissen ihrer Gemeinden. Als die
Kommunalverwaltungen immer weniger dazu in der Lage waren,
den stndig steigenden Forderungen der kaiserlichen Steuer-
eintreiber, den barbarischen Oberbefehlshabern, die aus dem
entfernten Konstantinopel in die Provinzen geschickt worden
waren, den rtlichen Grogrundbesitzern, die of reicher und
mchtiger waren als die zivilen Magistrate, entgegenzutreten,
bentigten die Gemeinden neue mchtige Frsprecher, die ih-
nen Schutz gewhren konnten. Im Osten fhrten andersartige
politische und religise Wertvorstellungen dazu, da asketische
54
Heilige, die auerhalb der weltlichen Gesellschaf lebten, soziale
und politische Bedeutung erlangten und aufgrund ihrer Neu-
tralitt als Beschtzer und Schiedsrichter anerkannt wurden.
Ansehen und Einu auf weltliche Angelegenheiten bezogen
sie aus ihrer Stellung als Gottesmnner. Im Westen dagegen hielt
man Ausschau nach Mnnern, die bereits Macht und weltliche
Ehren errungen hatten, und setzte sie in hohe Kirchenmter ein.
Obwohl auch hier gelegentlich heilige Mnner aufraten, gelang
es dem gallormischen Episkopat immer wieder, Geltung und
Autoritt dieser Asketen dem Bischof strikt unterzuordnen. Der
sicherste Weg hierzu war es, die Verehrung der toten und nicht
der lebenden Heiligen zu frdern. Sptestens im 5. Jahrhundert
wurde im Westen die Verehrung von Mrtyrern und Heiligen
unter strenger bischflicher Kontrolle zum Kernstck der
volkstmlichen Religiositt, und bischiche Propagandisten
beeilten sich, mit der Abfassung von Heiligenviten und Wunde-
rerzhlungen deren Unterordnung unter die Hierarchie zu beto-
nen. Auf diese Weise gelang es den gallormischen Bischfen, die
Macht der Gottesfreunde in den Dienst ihrer eigenen sozialen
und religisen Vorherrschaf zu stellen, ohne deren Bedeutung
zu verleugnen.
Die wichtigste Tugend dieser westlichen Bischfe hatte ihre
Wurzeln nicht in der christlichen spirituellen oder asketischen
Tradition, sondern es war die Pietas, die zentrale Tugend, die seit
der Antike mit der patriarchalischen Rolle des Kaisers als Pater
patriae und seit Konstantin ganz allgemein mit hohen Staats-
mtern assoziiert wurde. Diese im wesentlichen konservative
Tendenz strkte darber hinaus die Macht der senatorischen
Aristokratie, die als einzige Schicht solche Persnlichkeiten
hervorbringen konnte und deshalb praktisch alle gallischen
Bischfe stellte. Die Bischofssitze der gallischen Stdte wurden
ber Generationen hinweg meist mit Angehrigen bestimmter
mchtiger Senatorenfamilien besetzt, die mit Hilfe dieser m-
ter die Interessen ihres Geschlechts vorantrieben. Schon bevor
55
die letzten Spuren der rmischen Verwaltung im Westen ver-
schwunden waren, entstand ein System, das man mit Recht als
Bischofsherrschaf und als eines der dauerhafesten Merkmale
der westlichen politischen Landschaf bezeichnet hat.
6
Allmhlich fanden jedoch unter dem Einu so auerge-
whnlicher Mnner, wie Hilarius von Arles, sowie stlicher
monastischer Traditionen, die ber die Insel Lrins an der pro-
venzalischen Kste nach Gallien gelangt waren, asketische Ideale
der stlichen Christenheit Eingang in die bischiche Tradition,
wenn auch nicht immer in der Praxis, so doch zumindest in
der Teorie. Das Bischofsamt war im 5. Jahrhundert so eng mit
der gallormischen Aristokratie verbunden, da die von diesen
neuen Werten ausgehende Wirkung im Westen nicht nur auf das
Selbstverstndnis des Bischofsamtes, sondern auch auf das der
Aristokratie bergri. In zunehmendem Mae erblickte die Ari-
stokratie im Episkopat ihre zentrale Institution, und allmhlich
begann sie, sich selbst und ihre Romanitas im Sinne christlicher
Wertvorstellungen neu zu denieren.
Die Verlierer: alle anderen
Unter diesen Umstnden erstaunt es nicht weiter, da sich die
Position des oben erwhnten gallormischen Aristokraten am
burgundischen Hof so wenig verndert hatte, da ihm die Auf-
lsung des rmischen Imperiums entgangen war. Es verwundert
auch nicht, da der Grund, der zu seiner Begegnung mit dem
heiligen Mann gefhrt hatte, die Not der Armen war. Sie waren
die Opfer der kaiserlichen Besteuerung gewesen und waren nun
Opfer des senatorischen Adels. Auch sie werden den Zerfall des
Rmischen Reiches nicht wahrgenommen haben, und zwar aus
dem einfachen Grunde, weil sich die Beaufragten (agentes),
die ihre Abgaben eintrieben, ob sie nun Steuereinnehmer oder
56
Grundherren hieen, von Regime zu Regime und von Jahrhun-
dert zu Jahrhundert nur wenig nderten. Wie wir sehen werden,
wurden die im 4. Jahrhundert eingefhrten Steuern noch im 8.
Jahrhundert in kaum vernderter Form erhoben.
Die Wirtschaf des gesamten Imperiums beruhte natrlich
berwiegend, besonders im Westen, auf der Landwirtschaf.
Ursprnglich war die Landarbeit auerhalb von Italien und Spa-
nien nicht von Sklaven, sondern meistens von freien, als coloni
bezeichneten Pchtern geleistet worden. Dies mag teilweise am
Preis der Sklaven und ihrer relativ geringen Ezienz als Landar-
beiter gelegen haben, ganz sicher aber auch daran, da freie coloni
anders als Sklaven wehrpichtig waren und das Staatsinteresse
die Aufrechterhaltung eines umfangreichen Rekrutenpotentials
erforderte.
Selbst wenn Sklaven in der Landwirtschaf eingesetzt wurden,
erhielten sie normalerweise ein Stck Land zur Bearbeitung,
wofr sie Abgaben entrichteten. Hug konnten sie nicht ohne
ihr Land verkauf werden. Sie durfen Eigentum erwerben, das
sie an ihre Kinder vererben konnten, und of heirateten sie in
die unteren Schichten der freien Gesellschaf ein.
Im Laufe des 3. Jahrhunderts lie sich der Status freier Land-
pchter oder coloni allmhlich nicht mehr von dem der servi
oder Sklaven unterscheiden. Unter Diokletian wurden Bauern,
die kein eigenes Land besaen, unter dem Namen ihres Grund-
herrn auf dem Grund registriert, den sie bearbeiteten, und so an
das Land gebunden, fr welches sie die capitatio und die annona
entrichteten. Diese Regelung begnstigte die Grundbesitzer,
denen auf diese Weise Arbeitskrfe erhalten blieben, aber auch
das Imperium, das die Grundherren mit der Steuereinziehung
beaufragen konnte. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts unter-
schieden sich in vielen Reichsteilen die coloni nur noch dadurch
von Sklaven, da sie rechtsfhig waren, und auch dies nur in
eingeschrnktem Umfang: Sie waren an das Land, auf dem sie
geboren waren, gebunden, durfen es nicht verlassen und hat-
57
ten den Grundbesitzer nicht nur als patronus, sondern auch als
dominus zu respektieren.
Zwar gab es in der Sptantike auch noch freie Bauern mit ei-
genem Landbesitz, aber sie wurden immer seltener. Ohne den
Schutz mchtiger Herren oder kaiserliche Gunst waren sie die
hugsten Opfer der Steuereintreiber, und literarische Zeugnisse
lassen vermuten, da ihr Los sich von dem der coloni of kaum
unterschied.
Wer sich diesem Steuersystem nicht entziehen konnte, hatte nur
wenige Alternativen zum berleben. Berichte aus Gallien vom
ausgehenden 3. Jahrhundert erwhnen wiederholte Aufstnde
der Bagauden, heterogener Gruppen von Provinzbewohnern, die
die Besteuerung zur Rebellion getrieben hatte. Diese Bedrohung
war so ernsthaf, da zu ihrer Bekmpfung mehrfach Militr ein-
gesetzt werden mute. Neue Aufstnde brachen 47, 435-437, 442,
443 und 454 aus. Die Unterdrckung dieser Erhebungen erfor-
derte umfangreiche militrische Operationen. In einigen Fllen
handelte es sich nicht einfach um unkoordinierte buerliche Ge-
waltausbrche, sondern um regelrechte Separatistenbewegungen,
die die rmischen Beamten und die Grundherren vertrieben und
sowohl eine Armee als auch ein Justizsystem aufauten. In allen
Fllen aber waren diese Aufstnde zum Scheitern verurteilt; sie
wurden mit der ganzen Macht der kaiserlichen Armee nieder-
geschlagen wie bei den Bagauden in Aquitanien nach 440, zu
deren Vernichtung die Westgoten ausgesandt wurden.
Erfolgreicher als die Bagauden waren die Bischfe, die auf-
grund ihres sozialen und politischen Gewichts die Kommunen
reprsentieren und schtzen konnten. Den Typus dieser adligen
Bischof-Protektoren personiziert am besten Germanus von
Auxerre, der im spten 4. Jahrhundert den Rang eines Generals
bekleidet hatte, bevor er Bischof wurde. Als zum Beispiel Gallien
mit einer ungewhnlich hohen Besteuerung belegt wurde, reiste
er zweimal nach Arles und bemhte sich um eine Steuersenkung,
whrend andere als Bagauden zu den Waen grien. Die Auf-
58
stndischen wurden schlielich besiegt, ihr Anfhrer gettet;
Germanus hingegen gelang es, eine Steuererleichterung zu er-
wirken. Kein Wunder also, da er aus weit entfernten Gegenden,
wie der Provinz Armorica und sogar aus Britannien, gebeten
wurde, sich fr Steuererleichterungen einzusetzen, woraufin
er bereitwillig Reisen zu dem Prtorianerprfekten in Arles und
sogar an den Kaiserhof in Ravenna unternahm. Im Laufe der Zeit
kam es zu einer bertragung der Heldentaten der Bagauden auf
Bischfe wie Germanus, die Erinnerung an diese wurde christlich
transzendiert, so da sie zu Mrtyrern wurden.
7
Um eine Steuererleichterung zu erlangen, konnte ein in
wirtschafliche Not geratener Freier auch einen anderen Weg
einschlagen; er konnte sich in das patrocinium reicher, mch-
tiger Senatoren oder anderer Notabein begeben, die kraf ihrer
militrischen Macht oder ihres Reichtums im Umgang mit
lokalen Kurialen und sogar mit kaiserlichen Steueragenten
grere Druckmittel zur Hand hatten. Mit dieser Option begab
sich der einzelne jedoch in die Hand seines Patrons, selten eine
wnschenswerte Situation.
Die letzte und wohl am hugsten gewhlte Mglichkeit bot
die Flucht. Die ganze Sptantike hindurch war aufgegebenes
Ackerland (agri deserti) eine allgemein verbreitete Erscheinung,
weil die Bauern, Freie wie Unfreie, vor den Zwangsmanahmen
der Grundherren und Steuereintreiber einfach ohen, im all-
gemeinen, um coloni anderer Grundherren unter gnstigeren
Umstnden zu werden. Da die Steuerlast des brachliegenden
Landes vom Grundherrn aufgebracht werden mute, waren viele
Grundbesitzer nun ihrerseits gezwungen, ihr Land aufzugeben.
Auf dem Hhepunkt der Landuchtbewegung scheinen scht-
zungsweise 20 Prozent der landwirtschaflich nutzbaren Flche
des Imperiums betroen gewesen zu sein. Ein Teil dieser Land-
ucht ging wohl auch auf die Erschpfung der Bden zurck,
ihre Hauptursache waren jedoch die unerfllbaren Steuer- und
Abgabenverpichtungen. Die Auswirkungen waren katastrophal;
59
denn wenn die Felder nicht bebaut wurden, bedeutete dies, da
die Steuereinnahmen anderswo erzielt werden muten und die
Belastung der noch bewirtschafeten Hfe weiter anstieg. Dar-
ber hinaus fhrten die Versuche, verlassenes Ackerland wieder
zu rekultivieren, zu groangelegten Ansiedlungen von Barbaren
innerhalb des Reiches.
Die Flucht und Aufgabe von zu hoch besteuertem Land und
die Unterwerfung unter Grundherren, die mchtig genug waren,
um Bauern und Handwerker vor Steuerforderungen zu schtzen,
hatte eine wachsende Privatisierung des Westens zur Folge. Am
Ende des 5. Jahrhunderts war die Gesellschaf auf dem besten
Wege, zu einer zweigeteilten Welt zu werden. Auf der einen Seite
standen die reichen, unabhngigen Aristokraten, die selbst prak-
tisch entliche Institutionen waren, und auf der anderen Seite
die von ihnen Abhngigen, die an das Land gebunden und wirt-
schaflich und politisch ihren Schutzherren ausgeliefert waren.
Weder die Elite, der es gelungen war, sich selbst kulturell, sozial
und politisch von den Institutionen des Imperiums zu lsen, noch
die Masse, die in der Unterwerfung unter diese Elite Schutz vor
den Ansprchen des Imperiums suchte, hatte irgendeinen Anla
zur Trauer darber, da romanisierte barbarische Knigreiche an
die Stelle eines barbarisierten rmischen Weltreiches traten.
60
II. Die barbarische Welt bis zum 6. Jahrhundert
Wachstafeln wie diejenige, auf der das Geschf unsers germa-
nischen Herdenbesitzers Stelus mit dem rmischen Hndler
Gargilius Secundus verzeichnet wurde, stellten wahrscheinlich
die einzigen schriflichen Dokumente dar, mit denen er und
seine barbarischen Zeitgenossen jemals in Berhrung kamen.
Abgesehen von dem gelegentlichen Gebrauch von Runen, je-
ner rtselhafen Zeichen, die meist fr rituelle Zwecke in Holz
oder Stein eingeritzt wurden, sollte es Jahrhunderte dauern, bis
die Nachkommen dieser Menschen sich der Schrif bedienen
konnten, und noch lnger, bis sie ihre Gedanken und ihr Leben
in ihrer eigenen Sprache niederschreiben konnten. Wenn daher
Historiker versuchen, die barbarische Welt der Sptantike zu
verstehen, mssen sie sich stets der schriflichen Zeugnisse der
zivilisierten griechischen und rmischen Nachbarn der Barbaren
bedienen, mit denen diese in Kontakt kamen. Das ist zwar un-
umgnglich, aber auch gefhrlich, weil die antiken Ethnographen
und Geschichtsschreiber bei der Schilderung der barbarischen
Welt ihre eigenen Absichten verfolgten und nach Methoden
verfuhren, die kaum dem entsprechen, was man heute deskrip-
tive Vlkerkunde nennt. Angesichts einer nach vllig fremden
Prinzipien in Stmmen organisierten Welt bemhten sich die
antiken Autoren, in das, was ihnen als Chaos erschien, Ordnung
zu bringen; und die Ordnung, die sie whlten, war die anerkannte
griechische ethnographische Tradition, in der die Schrifsteller
sptestens seit Herodot Barbaren beschrieben hatten.
Meist ohne absichtliche Verflschungen oder oenkundige
Lgen in die Einzelheiten ihrer Beschreibung einieen zu
lassen, versuchten die antiken Beobachter der Barbaren, diese
fremden Vlker mit Hilfe einer interpretatio Romana verstndlich
zu machen, indem sie diese in die ihnen vertrauten kulturellen
und sozialen Kategorien einordneten. Vielleicht aus Neugier,
Angst, moralischem oder missionarischem Eifer ordneten sie
61
ihre Erkenntnisse nach vorgefaten Strukturen und schilderten
die Objekte ihrer Darstellungen mit einem tradierten Vokabular
und in Bildern, die ihren eigenen Vorstellungen entsprachen.
Diese Tendenz, die Barbaren nicht mit ihren eigenen Kate-
gorien, sondern in denjenigen der sogenannten Zivilisation zu
erfassen, war besonders bei rmischen Gelehrten ausgeprgt, die
wie Plinius (23-79 n. Chr.) und Tacitus (55-6/20 n. Chr.) ihre
eigene Erfahrung und die ihrer griechischen Vorgnger nutzten,
um die Welt jenseits des Limes zu beschreiben. Die Rmer waren
nicht allzu kreativ; sie waren in erster Linie Organisatoren. Ihr
wichtigster Beitrag bestand darin, da sie dem vielfltigen Chaos,
das sie von den eroberten Vlkern erbten, Struktur, Form und
Gesetzmigkeit verliehen. In der Architektur geschah dies durch
den Ausbau und die Wiederholung einfacher Formen von den
Gewlben und Arkaden zur Einfassung und Gestaltung groer
Rume; eine Hchstleistung vollbrachten sie im Bereich der
Verwaltung, indem sie einen riesigen Vielvlkerstaat aufauten
und organisierten. Als die Rmer sich der barbarischen Welt
zuwandten, nahmen sie ebenfalls eine gewaltige organisatorische
Aufgabe in Angri, zunchst intellektuell, als sie die Barbaren in
einer Weise beschrieben, die rmische Ordnungsund Wertvor-
stellungen auf diese sonst unverstndliche Welt bertrug, und
dann politisch, indem sie die Barbaren durch aktive Diplomatie,
militrische Unternehmungen und die Verlockungen ihrer Kultur
allmhlich in den rmischen Einubereich brachten.
Fr den zivilisierten Rmer nherte man sich mit jedem
Schritt, den man sich von der Stadt und ihren kulturellen und
politischen Strukturen entfernte, der Welt der Tiere. Schlielich
galt der Mensch als zoon politikon, als das Wesen, fr das sich das
Leben in der urbanen Polis am besten eignete. Besonders stark
ausgeprgt ist diese Sichtweise bei Autoren wie Tacitus; obwohl er
einerseits das Ausma beklagt, in dem die germanischen Stmme
durch die rmische Zivilisation korrumpiert wurden, beschreibt
er die Menschen als immer wilder und bestialischer, je weiter er
62
sich von der rmischen Welt entfernt. Als Extremfall betrachtet
er die Fenni, die keine Pferde und keine Waen besitzen; sie es-
sen Gras, kleiden sich in Felle und schlafen auf dem Boden. Die
Arbeit ist nicht nach Geschlechtern aufgeteilt, und sie besitzen
nicht einmal eine Religion. Damit leben sie am uersten Ran-
de dessen, was fr einen Rmer Menschsein bedeutet. Jenseits
dieses Stammes, fhrt Tacitus fort, ist nun schon Mrchen: da
die Hellusier und Oxionen Gesicht und Antlitz von Menschen,
aber Leib und Glieder von Tieren haben.
Daher berrascht es nicht, da in der rmischen Vlkerkunde
Barbaren mit fast monotoner Gleichfrmigkeit beschrieben wer-
den: Alle Barbaren glichen einander und waren sowohl in ihren
Tugenden als auch ihren Lastern eher den Tieren als den Rmern
verwandt. Sie waren in der Regel gro, plump und belriechend;
sie lebten nicht nach festen, schriflich xierten Gesetzen, son-
dern nach sinnlosen, unberechenbaren Gewohnheiten. Im Krieg
waren sie stolz und gefhrlich, im Frieden dagegen faul, leicht
reizbar und streitschtig. Sprichwrtlich war ihre Treulosigkeit
gegen Menschen auerhalb ihres Stammes; durch Trunksucht
und andauernde Hndel fhrten sie ihren eigenen Niedergang
herbei. Ihre Sprache glich eher dem Geschrei von Tieren als der
menschlichen Sprache, ihre Musik und ihre Poesie waren roh
und ohne Ma. Soweit sie Heiden waren, stellte ihre Religion
ein von Aberglauben entstelltes Zerrbild der rmischen Religion
dar. Waren sie christlicher Religion, so vertraten sie eine grobe,
hretische Version des wahren Glaubens.
Diese Vlker kamen in einem scheinbar nie versiegenden Strom
aus dem Norden, der Gebrmutter der Vlker, auf der Suche
nach Land vorwrtsgetrieben durch ein unablssiges Bevlke-
rungswachstum. Diese Barbaren waren einander in gewisser
Weise alle so hnlich, da man sie allesamt fr ein einziges Volk
halten konnte. Es schien niemals neue Vlkerschafen zu geben,
vielmehr wurden diejenigen, die vernichtet oder zerstreut worden
waren, stndig durch nachrckende ersetzt.
63
Dennoch bemhten sich die rmischen Geschichtsschreiber
und Ethnographen gewissenhaf, diese chaotischen Horden zu
klassizieren, zu beschreiben und bestimmten Regionen und
Gruppen zuzuordnen, was zwar eine Herkulesarbeit verlangte,
aber damit auch genau das, was den Rmern am meisten lag. So
ndet man in rmischen Schrifen auerordentlich detaillierte
Beschreibungen der verschiedenen germanischen und skythi-
schen Vlker, eingeteilt nach Herkunf, Sprache, Sitten und Re-
ligion. Und auch dabei wurde nach bester rmischer Tradition
Ordnung in ein Chaos gebracht.
ber die Methode, die klassizierenden Kategorien, Stereo-
typen und Absichten dieser Literatur und damit die Art, wie
Rmer das Barbarentum betrachteten, braucht man sich nicht zu
wundern; sie waren eng mit der klassischen Kultur verbunden.
Weit erstaunlicher ist wohl, da sich nur wenige Konstrukte
der Rmer als so zhlebig erwiesen haben wie ihr Bild von den
Barbaren im allgemeinen und den germanischen Stmmen im
besonderen. Die antike Ethnographie hinterlie ein zweifaches
Erbe. Zum einen und das ist fr uns am wichtigsten prgte
sie die ganze Sptantike und das Frhmittelalter hindurch die
meisten historischen Beschreibungen der Germanenstmme.
Viele moderne Medivisten stellen an den Anfang ihrer Werke
Karten, die auf der Germania des Tacitus und den Commentarii
Caesars basieren, und sie bemhen sich eifrig, die Barbarenvlker
der Vlkerwanderungszeit dem einen oder anderen bei Tacitus
erwhnten Stamm zuzuordnen. Noch bedeutsamer wurde, da
viele Historiker dazu neigten, die im . Jahrhundert von Tacitus
verfate Beschreibung der germanischen Sitten unmittelbar auf
die Goten, Franken, Burgunder und andere im 4. und 5. Jahrhun-
dert ins Rmische Reich eingedrungene Vlker zu bertragen,
und da sie glaubten, die Entwicklung der gesellschaflichen
und politischen Institutionen der germanischen Knigreiche
mit den Kategorien dieser lteren Stammesgewohnheiten er-
klren zu knnen, was etwa dem Versuch entspricht, mit Hilfe
64
einer Beschreibung Neuenglands aus dem 7. Jahrhundert die
amerikanischen Verhltnisse des 20. Jahrhunderts darzustellen.
Auerdem tendierten sie dazu, die antiken Beschreibungen
barbarischer Sitten, Verhaltensweisen und des Barbarentums
berhaupt als Erklrung fr den im Frhmittelalter erfolgenden
Proze der Eroberung und Siedlung heranzuziehen.
Ideologisch folgenschwerer war zweitens, da die antiken
Darstellungen zutiefst die Art und Weise formten, in der gro-
e Teile Europas und Amerikas das neuzeitliche Deutschland
wahrnehmen. Im 9. Jahrhundert begelten phantastische Vor-
stellungen ber primitive kommunistische Gesellschafen und
eine religionshnliche Freiheitsliebe der altgermanischen Vlker
die junge sozialwissenschafliche Spekulation. In den dreiiger
Jahren des 20. Jahrhunderts konstruierten nationalsozialistische
Ideologen einen Zusammenhang zwischen der Errichtung des
Dritten Reiches und den Stmmen der Germania des Tacitus,
indem sie die Geschichte der Vlkerwanderung als integralen
Bestandteil der Geschichte von Deutschlands Volk und Nation
interpretierten. Whrend dieser Versuch, eine mythische germa-
nische Vergangenheit fr moderne Propagandazwecke zu nutzen,
nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich berwunden worden
ist, erblicken diejenigen, bei denen die europischen Kriege
des zu Ende gehenden Jahrhunderts einen Rest von Mitrauen
und Feindseligkeit gegenber Deutschland und den Deutschen
hinterlassen haben, im negativen Urteil der antiken Autoren
ber Stolz, Faulheit, Streitsucht, Trunksucht und Treulosigkeit
der Germanen brauchbare Erklrungen fr einen Groteil der
jngeren deutschen Geschichte.
Beide Tendenzen sind ebenso bedauerlich wie irrefhrend. Die
antiken Quellen mssen mit groer Sorgfalt und in Kenntnis der
Vorurteile und Traditionen der antiken Geschichtsschreibung
interpretiert und unter Bercksichtigung der von Archologen
gesammelten Erkenntnisse gelesen werden. Die Forschung mu
die von den Autoren gelieferten wertvollen Informationen sehr
65
bedacht auswerten und sich dabei des Systems bewut sein,
innerhalb dessen griechische und rmische Autoren ihre Be-
obachtungen zu strukturieren versuchten. Darber hinaus darf
man weder im Guten noch im Schlechten einen Zusammenhang
zwischen der Geschichte der barbarischen Vlker und der deut-
schen Geschichte im modernen Sinne konstruieren, sondern
sie ist als Teil der Geschichte der Sptantike zu betrachten. Als
solche gehrt sie nicht enger zur Geschichte des modernen
Deutschland als zu der Frankreichs, Italiens oder auch der Ver-
einigten Staaten.
Die barbarische Gesellschaf vor der Vlkerwanderung
Versuchen wir, die Welt unseres germanischen Viehzchters
Stelus mit Hilfe der materiellen Ergebnisse der Archologie und
nicht aus den Schrifen rmischer Autoren zu rekonstruieren,
so betreten wir sehr ungewohntes und verwirrendes Terrain.
Erstens nden wir nicht nur keinen wissenschaflichen Beweis
fr die Unterteilung der germanischen Vlker in zahllose Stm-
me, sondern es fllt uns sogar sehr schwer, diese von Kelten
und Balten klar zu unterscheiden. Die von den antiken Autoren
meist als Germanen bezeichneten Vlkerschafen bestanden aus
einem komplexen Gemisch von Vlkern, von denen sich einige
zweifellos in Sprachen verstndigten, die zur indogermanischen
Sprachenfamilie zhlten. Andere dagegen waren Balten, Kelten
und Finnen, die stndig absorbiert wurden und neue soziale
Gruppen bildeten. Da aus der frhesten Periode der germa-
nischen Kultur keine sprachwissenschaflichen Erkenntnisse
vorliegen, ist eine Beurteilung aus archologischer Sicht zuverls-
siger. Danach stammte die germanische Gesellschaf von Vlkern
der Eisenzeit ab, die in den nrdlichen Teilen Mitteleuropas und
den sdlichen Regionen Skandinaviens im 6. Jahrhundert v. Chr.
66
aufraten. Die frheste Phase dieser Gesellschaf, die als Jastorf-
Kultur bekannt ist, ist mit der frhen Eisenzeit der Hallstatt- und
La-Tene-Kulturen weiter sdlich und westlich zeitgleich und
von diesen of nicht zu unterscheiden. Ihre charakteristischsten
Merkmale sind, soweit sie unsere Untersuchung betreen, die
Bedeutung der Rinderzucht und die Kunst der Eisenbearbeitung,
wobei sie mit dem ersten Punkt mit den benachbarten Kelten
und Balten bereinstimmt, sich im zweiten dagegen von ihnen
in mancher Hinsicht abhebt.
Die germanische Kultur
Da sich die germanischen Siedlungen nach Form und Gre
sowie nach klimatischen und geographischen Bedingungen stark
voneinander unterscheiden, lassen sich kaum allgemeingltige
Aussagen treen. Auer an der Kste wurden sie meistens am
Rande extensiv bewirtschafeter natrlicher Lichtungen errichtet.
Die an der Nordseekste und zwischen Rhein und Oder siedeln-
den Germanenstmme errichteten relativ groe Holzhuser, die
von vier Pfostenreihen gesttzt wurden, welche den Innenraum
in drei parallele Rume teilten. Darin wohnte nicht nur die Fa-
milie, sondern sie beherbergten auch das kostbare Vieh, dessen
Krperwrme im Winter die Familie warmzuhalten half. In dieser
sehr typischen Form des germanischen Hauses lebten die Men-
schen in einem groen Raum, der vom brigen Gebude durch
eine Innenwand mit einer Trnung getrennt war. Jenseits die-
ser Tr lag eine doppelte Reihe von Viehstnden, die durch einen
Mittelgang getrennt waren. Die Anzahl der Tiere, die gehalten
werden konnten, schwankte betrchtlich. Einige Huser konnten
nur zwlf, andere sicher dreiig oder mehr aufnehmen.
2
Weiter landeinwrts, im heutigen Westfalen und in dem Gebiet
zwischen Elbe und Saale, bauten die Germanen eine andere Art
von Husern. Hier war das traditionelle Wohngebude, wie die
67
Ausgrabung in einem Dorf im Hardt bei Zwenkau in der Nhe
von Leipzig zeigt, ein schmales, rechteckiges Haus, wie es schon
aus der Bronzezeit bekannt ist. Auch diese Huser wurden von
Pfosten getragen, hatten aber keine zustzlichen Trgerpfosten
im Inneren und waren im allgemeinen zwischen fnf und sieben
Meter lang und nur drei bis vier Meter breit. Daneben wurden
verschiedene Gebude errichtet, darunter groe Huser mit zwei
Rumen und einer Grundche bis zu 60 Quadratmeter, lange
schmale Huser mit 25 Quadratmetern Bodenche und kleinere,
fast quadratische Gebude mit etwa 2 Quadratmetern Grund-
che, die oenbar als Scheunen oder Stlle dienten. Schlielich
bauten einige germanische Gemeinschafen in der Elbe-Oder-
Region, zum Beispiel in Zedau bei Osterburg, kleine, teilweise
unter der Erde gelegene Gebude von etwa 2 Quadratmetern, die
wahrscheinlich hauptschlich als Vorratskammern dienten.
Unabhngig von der Form der Huser bildeten diese meist klei-
ne Drfer, die sich von Ackerbau und Viehzucht und, wo es mg-
lich war, von Fischfang ernhrten. Ein Dorf bei Leipzig bestand
zum Beispiel aus zwei der oben beschriebenen greren Huser
und sechs kleineren Husern mit ihren Nebengebuden.
Das wichtigste Getreide war Gerste, daneben Weizen und Ha-
fer. Bohnen und Erbsen wurden ebenfalls recht hug angebaut.
In Kstengebieten wurde Flachs angepanzt, mehr zur lgewin-
nung als zur Herstellung von Leinen, das als Bekleidung nicht
weit verbreitet war. Die Felder waren in annhernd rechteckige
Flchen eingeteilt, deren Gre stark schwankte. Aufau und
Anordnung lassen darauf schlieen, da Fruchtwechsel blich
war, damit der Boden sich von der intensiven Nutzung erholen
konnte. Die Felder wurden durch Kalkzusatz und bei lange ge-
nutzten Flchen auch durch Dung verbessert; erschpfer Boden
wurde mitunter aufgegeben und durch Brandrodung neues
Ackerland gewonnen.
Die Bestellung der Felder erfolgte auf zwei Arten, die oen-
sichtlich beide aus der Bronzezeit stammten. Die meisten Felder
68
wurden mit einem ziemlich einfachen Hakenpug bearbeitet.
Dieses einfache hlzerne Gert, das von Ochsen gezogen wurde,
bestand im wesentlichen aus einer Pugschar oder einem Pug-
messer, das in den Boden einschnitt, und einem Handgri zur
Fhrung. Es besa kein Streichbrett zum Wenden und Belfen
des Bodens und mute daher zweimal im rechten Winkel durch
das Feld gezogen werden, um die Erde richtig vorzubereiten.
Neben diesen ziemlich leichten Pgen wurden einige Felder
mit einem schwereren Pug kultiviert, der sich zum Wenden und
Belfen des schweren nordeuropischen Lehmbodens eignete.
Obwohl derartige Gerte nicht erhalten sind kaum erstaun-
lich, da sie aus Holz bestanden und nur fr die Pugschar etwas
Eisen bentigt wurde , zeigen sorgfltige Untersuchungen der
Mutterbden und Untergrundschichten einiger keltischer und
germanischer Felder, da der Boden tatschlich auf eine Weise
gewendet wurde, die deutlich fr den Gebrauch eines derartigen
Gertes spricht.
Das Getreide wurde mit einer Sichel geerntet, in mancher
Hinsicht ein Rckschritt, bedenkt man den Gebrauch von Sichel
und Sense in der keltischen Welt, auch wenn die eisernen Sicheln
der germanischen Bauern vermutlich wirksamer gewesen sind
als die Bronze- und Feuersteingerte der Kelten. Das Getreide
blieb am Halm und wurde of leicht angerstet, um es vor dem
Verderb zu bewahren, und dann in erhhten und mit Erde ver-
schlossenen Kornspeichern aus Holz aufewahrt. Wenn Getreide
bentigt wurde, wurde es vom Stroh getrennt und gedroschen.
Die Krner wurden von Hand mit einem einfachen Mhlstein,
wie er seit Jahrtausenden in Gebrauch war, gemahlen: Nach und
nach begannen zur Zeit des Stelus und unter dem Einu der be-
nachbarten Kelten und Rmer einige germanische Stmme zwi-
schen Elbe und Rhein, besser konstruierte und leistungsfhigere,
drehbare Mhlsteine zu gebrauchen. Nach dem Mahlen wurde
das Mehl zu einer Art Brei oder zu einem Teig verarbeitet, der
auf Lehmplatten zu Fladen gebacken wurde. Ein betrchtlicher
69
Teil des Getreides wurde auch zu einem starken, dickssigen
Bier vergoren, das sowohl eine wichtige Nahrungsquelle als auch
ein wesentliches Attribut des geselligen Lebens war.
Der Getreideanbau war fr die germanische Gesellschaft
lebenswichtig: Plinius beschreibt in seiner Historia naturalis das
so gewonnene Produkt als das wichtigste Grundnahrungsmittel
der Germanen.
3
Aber landwirtschafliche Arbeit verschafe kein
gesellschafliches Ansehen, die Konservierung, das Mahlen und
die Zubereitung der Nahrung blieb den Frauen berlassen ein
eindeutiges Zeichen fr den geringen Stellenwert, den sie in
der von Mnnern beherrschten Gesellschaf besaen. Diejenige
buerliche Beschfigung, die den germanischen Mnnern am
meisten zusagte, besonders in den verhltnismig oenen K-
stenzonen, war die Tierhaltung, insbesondere die Rinderzucht.
Schon Caesar hatte festgestellt: Ackerbau treiben sie mit wenig
Eifer und ernhren sich hauptschlich von Milch, Kse und
Fleisch.
4
Zweifellos ist dieses Urteil angesichts der tatschlichen
Ernhrungsgewohnheiten der germanischen Vlker falsch, es gibt
aber ihr kulturelles Selbstverstndnis zutreend wieder. Die Zahl
der Rinder bestimmte das gesellschafliche Prestige ihres Besit-
zers und war der wichtigste Mastab fr Reichtum und Einu.
Rindvieh war in der traditionellen Gesellschaf in solchem Mae
gleichbedeutend mit Wohlstand, da der moderne englische Aus-
druck fee, der aus dem mittelalterlichen ef abgeleitet ist, seinen
Ursprung im germanischen Wort fehu (in heutigem Deutsch:
Vieh) hat, was Rindvieh, bewegliches Eigentum und schlielich
ganz allgemein Reichtum bedeutet. Die aus dem Lateinischen
stammenden englischen Begrie cattle, chattle und capital mach-
ten in der Sptantike eine hnliche Entwicklung durch und sind
von dem sptlateinischen captale abgeleitet, was Eigentum im
allgemeinen und im engeren Sinne Viehbestand meint.
Neben Rindern zchteten die Zeitgenossen des Stelus in der
Reihenfolge ihrer Bedeutung auch Schweine, Schafe, Ziegen und
Pferde sowie die kurz zuvor eingefhrten Hhner und Gnse.
70
Entgegen der Vorstellung, die Germanen htten sich stndig nur
auf der Jagd befunden, lieferten Haustiere praktisch das gesamte
Fleisch fr die Ernhrung. An den meisten archologischen
Fundsttten machten die Knochen von Wildtieren hchstens
8 Prozent aller tierischen berreste aus, whrend der durch-
schnittliche Anteil der Reste von Haustieren bei 97 Prozent liegt.
Die wichtigsten Tagdwildarten waren Hirsch und Wildschwein.
Wildrinder, der Wisent und der Auerochse, wurden wahrschein-
lich sowohl wegen des Felles und der Hrner als auch wegen ihres
Fleisches gejagt. Der unbedeutende Anteil von Knochen solcher
Tiere in drichen Siedlungen lt jedoch darauf schlieen, da
die Jagd als Sport, als Ertchtigung fr den Krieg oder zur Be-
kmpfung von Nahrungskonkurrenten der Haustiere betrieben
wurde und nicht zur Ergnzung der Nahrung.
Angesichts der Bedeutung der Rinderzucht verwundert es
nicht, da die frhen germanischen Vlker bei der Bewirtschaf-
tung ihrer Herden sehr planmig vorgingen. Wie andere auch,
schlachtete, tauschte oder verkaufe Stelus wahrscheinlich 50
Prozent seiner Rinder, bevor sie das Alter von dreieinhalb Jahren
erreichten. Diese bildeten den entbehrlichen Zuwachs der Herde,
die auf diese Weise immer etwa gleich gro blieb. Den Rest der
Herde behielt er etwa zehn Jahre lang, in dieser Zeit dienten die
Rinder zur Zucht und zur Milchgewinnung. Da noch ltere Tiere
weniger Milch lieferten, wurden sie sptestens dann geschlachtet,
getauscht oder an die Rmer verkauf.
Schweine als futtersuchende Tiere wurden hauptschlich in
den waldreicheren Gebieten von Europa gehalten, und je weiter
man sich von den Kstenebenen entfernt, desto mehr nimmt
die Schweinezucht zu, whrend die Rinderzucht abnimmt. Auch
Schweine unterlagen einer systematischen Auslese und Bewirt-
schafung. Etwa 22 Prozent wurden im ersten Jahr, 28 Prozent
im zweiten und 35 Prozent im dritten Jahr geschlachtet, wenn sie
ein Gewicht von etwa einem Zentner erreicht hatten.
Alle Teile der Tiere wurden verwertet, sei es als Nahrung oder
71
zur Herstellung von Kleidung, Schilden oder Gertschafen. Das
Fleisch wurde roh, gebraten, gebacken oder gekocht verzehrt. Es
wurde durch Ruchern, Trocknen oder, wenn Salz zur Verfgung
stand, durch Einsalzen haltbar gemacht. Milch wurde frisch
verbraucht oder zur Aufewahrung eingedickt. Butter wurde
sowohl verzehrt als auch in ranziger Form als Gewrz, Arznei
und zur Haarpege verwendet, eine Gepogenheit, die von den
Rmern die sich ihrerseits gerne mit Olivenl einschmierten
mit Abscheu zur Kenntnis genommen wurde.
Das Handwerk
Im Gegensatz zu den Kelten stellten die germanischen Vlker in
den ersten Jahrhunderten ziemlich grobe Keramikgefe und
Gebrauchsgegenstnde her. Ton, der fast berall zur Verfgung
stand, wurde mit der Hand ohne Tpferscheibe bearbeitet und zu
einfachen Gegenstnden wie Tpfen, Gefen verschiedener Art,
Schpfellen und Spinngewichten geformt. Solche Gegenstnde
wurden mit recht einfachen geometrischen Mustern verziert,
die entweder eingeritzt oder mit einem Rollstempel, der das
Muster wiederholte, in den feuchten Ton eingedrckt wurden.
Obwohl die Kelten schon lange Brandfen kannten, brannten die
Germanen oenbar ihre Keramikwaren im oenen Holzfeuer.
Diese vorwiegend fr den Alltagsgebrauch bestimmten und
weniger dem Schmuck oder der Selbstdarstellung dienenden
Gegenstnde waren anscheinend wie die Getreidegewinnung
das Werk von Frauen.
Frauen waren auch verantwortlich fr Weben, Spinnen und
die Herstellung von Textilien, ber die wir vorwiegend durch
den ausgezeichneten Erhaltungszustand der Kleidungsstcke
in den durch Lufabschlu konservierten Grabsttten in den
Mooren des Weser-Ems-Gebietes, Schleswig-Holsteins, Jtlands
und der dnischen Inseln Kenntnis erhielten. Einige dieser
72
sogenannten Moorleichen hatten einfache Begrbnisse, andere
waren aber oenbar hug die Opfer von Hinrichtungen oder
rituellen Opferungen. Die Toten trugen an kleinen Websthlen
gewebte Kleidungsstcke aus handgesponnener Wolle. Die groe
Vielfalt der Muster und Schnitte der Kleidung weist auf einen
unterschiedlichen Sozialstatus und mglicherweise verschiedene
Dorfgemeinschafen hin. Die Vlker nahe der Rheinmndung
waren besonders bekannt fr ihre feinen Wollstoe, die sogar
im rmischen Raum geschtzt wurden.
Im allgemeinen kleideten sich die Frauen in lange, rmello-
se Gewnder, die an den Schultern mit Fibeln oder Broschen
zusammengehalten wurden. Der untere Teil der Kleidung, der
durch einen Grtel zusammengehalten wurde, war of in Falten
gelegt und ziemlich weit. Dazu trugen sie Blusen, Unterkleidung
und ein Halstuch, Mdchen of eine Art kurzen Wollrock und
gelegentlich einen kurzen Pelzumhang.
Die Mnner trugen wollene Hosen, Kittel und Umhnge aus
Tuch oder auch Pelz. Manche Hosen waren lang und hatten so-
gar Fe; andere reichten nur bis zum Knie, den Unterschenkel
bedeckten gewickelte Bnder. ber der Hose wurde ein Kittel
getragen und durch einen Grtel zusammengehalten. Als Mantel
diente ein langes rechteckiges Wolltuch, das an der Schulter mit
einer Fibel befestigt und geschmckt wurde. Schuhe und Mtzen
aus Leder und im Winter ein Pelzumhang vervollstndigten die
Tracht.
Die Kleidung war neben der Haar- und Barttracht ein wichtiges
Merkmal der sozialen Stellung. Dennoch geno ihre Herstellung
in der Gesellschaf kein hohes Ansehen. Das wichtigste und am
weitesten entwickelte Handwerk der germanischen Vlker der
Antike war die Eisenbearbeitung. Im letzten vorchristlichen und
im ersten nachchristlichen Jahrhundert nahm die Eisenproduk-
tion in der germanischen Welt rapide zu. Das Rohmaterial war
leicht zu gewinnen; denn Erz mit niedrigem Eisengehalt lag in
groen Teilen Nordeuropas frei zutage oder unter der Erdober-
73
che, und die groen Wlder boten reichlich Holz zur Produktion
von Holzkohle. Praktisch jedes Dorf oder jede Siedlung besa
eine eigene Produktionssttte und verfgte ber Spezialisten,
die Eisengerte und Schmuck herstellen konnten. Diese Mnner
wie die Rinderzucht war die Eisenproduktion Mnnersache
bauten kleine einfache, aber wirkungsvolle Erdfen, in denen
sie das Erz auf Holzkohlefeuer ausschmolzen und mit Hilfe von
Blaseblgen die dazu bentigten Temperaturen von
3
00 bis
600C erzeugten. Die Erdfen faten nur etwa einen Liter Erz
und konnten in einem Arbeitsgang aus dem besten verfgbaren
Erz hchstens 50 bis 250 Gramm Eisen erzeugen. Der gesamte
Vorgang war zeitraubend und beanspruchte erheblichen Auf-
wand und groes Geschick. Er bestand aus nicht weniger als
acht Arbeitsschritten, von denen drei jeweils unterschiedliche,
sorgfltig zu kontrollierende Temperaturen erforderten. Im Ver-
gleich zu den in der zivilisierten Welt damals schon verbreiteten
rationelleren Techniken war die Ausbeute drfig, die Qualitt
dieses Eisens aber auerordentlich hoch. In den Hnden eines
erfahrenen und geschickten Schmiedes konnte das Eisen ge-
hmmert, gebogen, umgearbeitet und zu Stahl von ausnehmend
hoher Qualitt verarbeitet werden. Die feinsten Produkte dieser
Schmiede, Schwertklingen mit einem biegsamen Innenteil aus
weicherem Stahl und einem hrteren Rand an der Schneide, wa-
ren groartige Beispiele fr die Kunst der Waenschmiede und
der Ausrstung der rmischen Truppen weit berlegen.
Solche hochwertigen Gegenstnde wurden aber insgesamt
nur in geringer Stckzahl hergestellt. Bis weit ins Mittelalter
hinein blieb die germanische Welt arm an Eisen, insbesondere
was die Waen betrif. Gegenstnde wie Langschwerter, die
groe Mengen Stahl erforderten, waren uerst selten, ebenso
die langen breitchigen Lanzen, die spter zu typisch germa-
nischen Waen wurden. Verbreiteter waren eiserne Pfeilspitzen
und krzere, einschneidige Schwerter. Eisen wurde auch fr
Schildbuckel verwendet, am hugsten aber zur Herstellung von
74
Werkzeugen zur Bearbeitung von Holz, das das wichtigste Mate-
rial fr die Gebrauchsgegenstnde des Alltags war und blieb, und
zur Anfertigung kleiner eiserner Ziergegenstnde. Die Qualitt
der Produkte, die vermutlich meistens mittelmig ausel, hing
ganz von dem jeweiligen Schmied ab.
Landwirtschaft und Handwerk der germanischen Vlker
dienten vorwiegend dem Eigenbedarf einer Subsistenzwirtschaf
und nicht zu Handelszwecken. Zwar gab es innerhalb der ger-
manischen Welt und zwischen den germanischen Stmmen und
ihrer Umgebung einen Gterverkehr, doch beruhte dieser nicht
primr auf dem Handel. Zwischen Einzelpersonen und Gruppen
fand ein friedlicher Austausch primr in Form von Geschenken
statt, der zwar freiwillig zu sein schien, in Wirklichkeit aber
obligatorisch und normativ war. Geschenke zu machen war ein
Mittel, Ansehen und Macht zu gewinnen. Den wahren Gewinn
bei diesem Besitzwechsel machte nicht der Empfnger, sondern
der Geber, der damit seine berlegenheit demonstrierte und
sich den Empfnger verpichtete.
Noch hheres Ansehen verschafe der Gewinn von Gtern und
Vieh durch Raubzge und Kriege. Er war mehr als alles andere fr
die germanische Gesellschaf kennzeichnend und denierte die
gesellschafliche Stellung. Raubzge fanden vorwiegend zwischen
Stmmen und innerhalb der Stmme zwischen Familien statt,
die miteinander in Fehde lagen. Die Beute bestand in erster Linie
aus Vieh und Sklaven. Die germanische Gesellschaf fand ihre
Bestimmung, ihren Wert und ihre Identitt in der Kriegsfhrung,
und sowohl ihre wirtschafliche als auch ihre gesellschafliche
Struktur waren auf dieses Ziel hin angelegt.
Die Gesellschafsordnung
Die oben beschriebenen Gruppen hielten sich selbst niemals fr
ein Volk, dem man einen gemeinsamen Namen geben knnte.
75
Der Begri germanisch wurde von den Galliern geprgt. Den-
noch haben Gelehrte lange versucht, die Germanen sowohl als
ein Ganzes zu beschreiben als sie auch nach objektiven Kriterien
in Gruppen einzuteilen. Der erste derartige Versuch der Neuzeit
basierte ausschlielich auf sprachlichen Merkmalen aus einer
Zeit nach der Vlkerwanderung und teilte die germanische Welt
in nordgermanische Vlker einschlielich der Einwohner Skan-
dinaviens, ostgermanische Vlker, die die Goten, Burgunder und
Vandalen umfaten, sowie westgermanische Vlker, zu denen
unter anderem die Franken, Sachsen, Bayern und Alemannen
zhlten, ein. So verdienstvoll eine solche Unterscheidung der
germanischen Sprachen nach der Vlkerwanderung fr die
Linguisten auch sein mag unter denen darber allerdings
betrchtliche Meinungsverschiedenheiten herrschen , hilf
uns dieses Schema doch wenig, die Unterschiede zwischen den
germanischen Vlkern des . und 2. Jahrhunderts zu verstehen.
Ntzlichere Unterscheidungsmerkmale bieten die oben beschrie-
benen materiellen Unterschiede und deren Vergleich mit spteren
linguistischen Erkenntnissen. Daraus ergeben sich signikante
Unterscheidungsmerkmale fr eine sinnvollere Einteilung der
germanischen Vlker in die eibgermanischen Stmme, das heit
die Vlker, die zwischen Elbe und Oder lebten, die Rhein-Weser-
germanischen Stmme, die zwischen diesen beiden Flssen nher
am rmischen Limes siedelten, und die nordgermanischen Stm-
me, die die Kstenregionen bewohnten. Diese Einteilung scheint
kulturelle und religise Gemeinsamkeiten widerzuspiegeln, die
sich gelegentlich dadurch manifestierten, da sich innerhalb
dieser Gruppen fr bestimmte Zwecke recht umfangreiche
Zusammenschlsse von Vlkern bildeten. Jedoch sollte man
sich diese Gruppen nicht als soziale, ethnische oder politische
Einheiten vorstellen. Dazu war die Struktur der germanischen
Gesellschaf viel zu ieend und komplex.
Die berreste germanischer Siedlungen sind wichtige Zeug-
nisse der Sozialstruktur dieser Vlker. Wie wir gesehen haben,
76
lebten sie bevorzugt in kleinen Drfern. Im Gegensatz zu allen
Versuchen, in der Gesellschafsstruktur der Germanen eine
primitive Form des Kommunismus und der Gleichheit auszuma-
chen, verfgten germanische Gemeinden schon im . Jahrhundert
v.Chr. ber eine breite Dierenzierung in bezug auf Wohlstand
und gesellschafliche Stellung, und manche Belege lassen auf die
Existenz einer homogenen Schicht schlieen, die man als Adel
bezeichnen knnte.
Die grte Schicht innerhalb der germanischen Gemeinschaf-
ten war die der Freien, deren Sozialstatus vorwiegend durch
die Anzahl ihrer Rinder bestimmt wurde und deren Freiheit
in ihrer Teilnahme an Kriegszgen zum Ausdruck kam. Die
Anzahl der Rinder im Besitz eines einzelnen konnte inner-
halb eines Dorfes sehr unterschiedlich sein und weist damit
auf betrchtliche Unterschiede im Wohlstand hin. In einem
bei Wesermnde ausgegrabenen Dorf fand man zum Beispiel
einige Huser, deren Stlle nur fr zwlf Khe ausreichten, wh-
rend andere bis zu 32 Tieren Platz boten. In anderen Drfern
spricht die Anordnung von kleinen Gebuden um ziemlich
groe, feste Huser dafr, da zumindest einzelne Einwohner
Unfreie besaen, die in Auengebuden rund um das Haus des
Vornehmsten wohnten.
Zur germanischen Gesellschaf gehrten auch Sklaven, ge-
whnlich Kriegsgefangene. Normalerweise lebten sie in eigenen
Haushalten und muten ihre Herren mit bestimmten Mengen
von Nahrungsmitteln, Vieh und Kleidung versorgen, auch wenn
manche als Hirten oder Haussklaven eingesetzt worden sein
drfen.
Die germanische Gesellschaf war eindeutig patriarchalisch
aufgebaut, die Sippen unterstanden jeweils einem mnnlichen
Oberhaupt. Der einzelne Haushalt wurde vom Vater beherrscht,
der die Gewalt ber alle Familienmitglieder, seine Frau oder
gelegentlich seine Frauen, seine Kinder, abhngigen Leute und
Sklaven, ausbte. Die germanischen Stmme praktizierten die
77
Polygamie; wer reich genug war, durfe zwei oder mehr Frauen
haben, andere nur eine.
Die Familie war selbst ein fester Bestandteil der greren
Verwandtschafsgruppe, der Sippe oder des Clans. Dieser weitere
Kreis von Verwandten, dessen Umfang und Zusammensetzung
die Forschung nur unter groen Schwierigkeiten bestimmen
kann, umfate wahrscheinlich nicht mehr als 50 Haushalte.
Er schlo vermutlich nicht nur die agnatischen Verwandten,
das heit die Verwandten des Hausvaters, sondern auch die
cognatischen, das heit die Verwandtschaf der angeheirateten
Sippenmitglieder, ein. Die wichtigsten einigenden Prinzipien
der Sippe scheinen nach innen das gemeinsame Bewutsein der
Verwandtschafsbeziehungen, verstrkt durch eine besondere Art
von Frieden, der gewaltsame Auseinandersetzungen innerhalb
der Sippe zu einem Verbrechen machte, fr das es weder Wie-
dergutmachtung noch Shne gab, ein Inzestverbot und wahr-
scheinlich auch Eigentumsrechte des einzelnen gewesen zu sein.
Nach auen war das strkste einigende Prinzip die Verpichtung,
im Namen seiner Familie an Fehden der Sippe teilzunehmen
und so fr die Handlungen seiner Familie Verantwortung zu
bernehmen. Solche Fehden scheinen mehr als alles andere die
Gre einer Sippe bestimmt und begrenzt zu haben.
Die Sippe bildete zwar das grundlegende Ordnungsprinzip,
war aber auerordentlich instabil und teilte und vernderte
sich stndig. Da die Bewahrung des Friedens nach innen und
die Teilnahme am Krieg nach auen eine Sippe konstituierten,
konnte jeder Friedensbruch zur Grndung einer neuen Sippe
fhren; dies konnte auch geschehen, wenn die Verpichtung zu
gegenseitiger Hilfeleistung nicht erfllt wurde. Und da die Grup-
penbindungen bilateral waren, konnten mehrfache Eheschlie-
ungen zwischen zwei Sippen dazu fhren, da kleinere, weni-
ger erfolgreiche Sippen in grere aufgenommen wurden. Die
gleiche Instabilitt herrschte in einem noch strkeren Mae im
Stamm, der bergeordneten sozialen Einheit.
78
Mehr als jede andere germanische Institution ist der germa-
nische Stamm Opfer einer unkritischen bernahme grie-
chisch-rmischer Vorstellungen geworden, wozu zum einen die
Vorstellung der Rmer ber ihre eigene Stammesherkunf, zum
anderen die griechische Ethnographie verleiteten. Der Stamm
bestand aus einer sich stndig verndernden Gruppierung von
Menschen, die durch gemeinsame Wertvorstellungen, berlie-
ferungen und Institutionen miteinander verbunden waren.
Wenn sich diese Gemeinsamkeiten vernderten, vernderten
sich auch die Stmme. Sie vergrerten sich, indem sie andere
Gruppen absorbierten, sie spalteten sich und bildeten neue
Stmme, oder sie gingen in strkeren Stmmen auf. So stellten
diese Gruppen whrend der gesamten germanischen Stammesge-
schichte eher Prozesse als stabile Strukturen dar; stndig bildeten
sich neue Stmme, wobei sich dieser Proze in manchen Zeiten
allerdings beschleunigte.
Nach Tacitus glaubten die germanischen Vlker, da sie
von dem Gott Tuisto abstammten, dessen Sohn Mannus der
Urvater aller Germanen sei. Dieser Glaube an eine gemein-
same Abstammung zeigt sich in dem Wort Stamm. Sowohl
das deutsche Wort Stamm, althochdeutsch theoda, als auch
das griechische ethnos und das lateinische gens sind von Be-
grien abgeleitet, die Verwandtschaf implizieren und so die
Fiktion einer biologischen und genealogischen Abstammung
von einem gemeinsamen Urahnen betonen. Der Glaube an
diesen gemeinsamen mythischen Vorfahren und damit auch
die ebenfalls mythische Reinheit des Blutes war ein wichtiger
Bestandteil der Stammesidentitt und die Grundlage anderer
wichtiger Stammesmerkmale. In diesem Sinne bildete der
Stamm eine einzige groe Sippe oder Familie, die gemeinsame
Werte und einen gemeinsamen Frieden besa, welche zum
Zusammenhalt verpichteten.
Neben dem einigenden Glauben an einen gemeinsamen Ur-
sprung teilten die Stmme auch kulturelle Traditionen. Obwohl
79
die Forschung die gemeinsame Sprache frher als wichtigstes Ele-
ment dieser kulturellen Traditionen betrachtete, steht keineswegs
fest, da die Sprache fr die frhen Stmme diese Bedeutung
besa. Zentrale kulturelle Merkmale scheinen die Kleidung,
die Haartracht, der Schmuck, die Art der Waen, die materielle
Kultur, der religise Kult und eine gemeinsame mndliche Ge-
schichtstradition gewesen zu sein. Alle diese Merkmale trugen
dazu bei, nicht nur die Stmme voneinander zu unterscheiden,
sondern auch innerhalb eines Stammes die sozialen Unterschiede
zu klren.
Die gemeinsamen Abstammungsmythen und kulturellen
berlieferungen bildeten die Grundlage fr eine Rechts- und
besonders fr eine Friedensgemeinschaf. Fr das berleben
eines Stammes war ein gemeinsamer Frieden bzw. eine Hem-
mung der Angrislust, durch die gemeinsame Anstrengungen
mglich wurden, von schlechthin existentieller Bedeutung.
Dieser Frieden wurde gewahrt und verkrpert im Stammes-
recht, dem Gewohnheitsrecht, welches den Umgang der Sippen
untereinander sowie Streitflle regelte. Das Wort Freund ist mit
dem Wort Frieden eng verwandt. Mitglieder eines Stammes wa-
ren Freunde; sie waren an einem Frieden oder an einem nach
berliefertem Recht geschlossenen Pakt beteiligt. Doch anders
als der Frieden innerhalb der Sippe wurde dieser Frieden durch
einen gewaltttigen Streit nicht gebrochen; vielmehr waren Rache
und Fehde die normalen Mittel, mit denen Sippen innerhalb ihres
Stammes Konikte austrugen. Das Stammesrecht verbot oder
mibilligte nicht in erster Linie Gewaltttigkeiten innerhalb eines
Stammes, sondern legte Regeln fest, nach denen diese Fehden
auszutragen waren, und setzte bestimmte Grenzen fr Zeit und
Ort dieser Fehden. Insbesondere war Gewalt whrend religiser
Feste, bei den Versammlungen der Freien des Stammes und auf
Kriegszgen verboten. Wer in solchen Zeiten die Friedenspicht
miachtete, konnte vom Stamm selbst verurteilt und entweder
hingerichtet oder verbannt werden. Wurde er zum Gesetzlosen
80
erklrt das war wrtlich jemand, der den Schutz des gewohn-
heitsrechtlichen Stammesfriedens nicht mehr geno , durfe
er von jedermann gettet werden, ohne da dieser Rache zu
befrchten hatte.
Schlielich war der Stamm eine politische Gemeinschaft.
Wenn er auch primr in Sippen gegliedert war, so erforderten
gemeinsame Unternehmungen besonders militrischer Natur die
Existenz grerer politischer Einheiten. Diese konnten grer
oder kleiner als diejenigen Gruppen sein, mit denen sie andere
kulturelle, mythische und gesetzliche Traditionen teilten. So
konnten etwa verschiedene Stmme eine gemeinsame kultische
berlieferung, aber keine gemeinsamen politischen Institutionen
besitzen; andererseits konnten sich verschiedene Gruppen vor-
bergehend fr militrische Zwecke zusammenschlieen.
Das hchste politische Gremium des Stammes war die Ver-
sammlung der freien Krieger. Diese Versammlung, das Ting,
diente als hchstinstanzliches Gericht fr Prozesse gegen Tter,
die fundamentale Stammesgesetze gebrochen hatten, als Gele-
genheit, sich zu treen und Bindungen zwischen den Mitgliedern
zu festigen, und nicht zuletzt als Kriegsrat. Organisation und
Leitung dieser Versammlungen wie auch des gesamten Stam-
mesverbandes waren von Stamm zu Stamm verschieden und
vernderten sich innerhalb desselben Stammes im Laufe der
Zeit erheblich. In einigen Stmmen standen die freien Mnner
bestimmter Abteilungen unter der Fhrung von Herzgen,
die von den Kriegern gewhlt wurden oder aus angesehenen
Familien stammen oder auch beides. Diese Herzge fhrten
die Krieger in den Kampf und bten in Friedenszeiten in ihrem
Stammesgebiet die Vorherrschaf aus.
An der Spitze einiger Stmme stand ein Herrschafstrger, des-
sen Titel um dem Wort Knig nur unzureichend wiedergege-
ben wird. Oenbar besaen die germanischen Vlker vor der Vl-
kerwanderung zwei Arten von Knigen, einen im wesentlichen
religisen und einen militrischen, wobei allerdings nicht alle
81
Stmme beide Positionen kannten. Ersteren nennen die Quellen
thiudans oder sinistus. Dieser Knig wurde wahrscheinlich aus
einer kniglichen Familie gewhlt, das heit aus einer Familie, die
die ethnischen, geschichtlichen und kulturellen Traditionen des
Stammes am strksten verkrperte. Von diesem Knig berichtet
Tacitus, er sei ex nobilitate gewhlt, aufgrund seiner Abstammung
aus einer adligen Familie. Vermutlich war dieser Knig mit dem
traditionellen, verhltnismig stabilen, sehafen Stamm eng
verbunden, der vielleicht in sehr koniktreichen Beziehungen zu
seinen Nachbarn lebte, zumindest aber einem prekren Gleich-
gewicht der Gewalt. Der thiudans stand in enger Beziehung zu
dem germanischen in Wirklichkeit indogermanischen Gott
Tiwaz, dem Beschtzer einer stabilen sozialen Ordnung und
Garanten fr Recht, Fruchtbarkeit und Frieden.
Die Rolle dieses Knigs war bei den germanischen Stmmen
sehr unterschiedlich. In einigen spielte er eine berwiegend
religise Rolle, bei anderen fhrte er den Vorsitz der Versamm-
lungen, bei wieder anderen konnte er auch das militrische
Kommando bernehmen. Aber einige Stmme kannten dieses
Knigtum berhaupt nicht. Bei wiederum anderen wurde das
Oberkommando einem nichtkniglichen Fhrer anvertraut, den
Tacitus als dux bezeichnet. Er wurde wegen seiner militrischen
Kompetenz gewhlt und bernahm im Kriegsfall anstelle des K-
nigs die Befehlsgewalt ber den Stamm. Auf diesen militrischen
Fhrer werden wir spter noch ausfhrlicher eingehen.
Die Gefolgschaf
Wie wir sahen, bestand der Stamm aus Familien oder fami-
lienhnlichen Einheiten, die durch gemeinsame Glaubensin-
halte und soziale Bindungen zusammengehalten wurden. Im
Gegensatz zu dieser einheitsbildenden Struktur stand eine
andere soziale Gruppe, deren Mitglieder aus allen mglichen
82
Sippen und sogar Stmmen kamen und die sowohl die Quelle
der Strke eines Stammes als auch betrchtlicher Instabilitt
sein konnte. Dabei handelt es sich um die Kriegergemeinschaf,
die Tacitus comitatus und die neuzeitliche deutsche Forschung
Gefolgschaf nennt. Kriegsfhrung war, wie wir gesehen haben,
die wichtigste Aufgabe germanischer Mnner; sie bestimmte in
hohem Mae ihr Ansehen und ihren Wohlstand. Innerhalb der
Gesellschaf verbndeten sich daher einige junge Freie wenn
auch bei weitem nicht alle , die nach Ruhm drsteten, mit fr
ihre Fhigkeiten bekannten Fhrern und bildeten Eliteeinhei-
ten bewaneter Krieger. Sie traten in eine enge persnliche
Beziehung zum Anfhrer, der fr Unterhalt und Ausrstung
verantwortlich war und sie zu Sieg und Beute fhren sollte. Die
jungen Leute ihrerseits waren ihm vollstndig ergeben, und es
galt als Schande, nicht auch bis zum Tod zu kmpfen, wenn er
in der Schlacht el.
Die Gefolgschaf war nicht etwa die militrische Grundeinheit
eines Stammes. Es handelte sich dabei vielmehr um Kriegerge-
meinschafen zum Zwecke stndiger Plnderung und Kriegs-
fhrung. Sie beteiligten sich zwar durchaus an den militrischen
Unternehmen ihres Stammes, ihre eigenen Aktionen waren
aber keine Stammeskriege, sondern Streifzge auf eigene Faust,
die den Frieden oder die bewanete Waenruhe zwischen den
Stmmen gefhrden konnten. Diese Kriegergruppen waren des-
halb zwar einerseits ein destabilisierendes Element innerhalb der
ohnehin labilen Stammesstruktur, andererseits aber auch Keim-
zellen neuer Stammesbildungen. Die Gre seiner Gefolgschaf
verlieh dem siegreichen Kriegsherrn hohes Ansehen und Macht,
und gelegentlich konnten Spannungen innerhalb des Stammes
dazu fhren, da sich die Kriegergruppe abspaltete und mit den
von ihr Abhngigen einen neuen Stamm bildete.
Der Aufau der germanischen Gesellschaf mit ihrer mili-
trischen Struktur, den lockeren Sippenverbnden und der
schwachen Zentralgewalt hatte eine permanente Instabilitt
83
zur Folge. Konikte innerhalb der Stmme waren die Regel,
und Einigkeit konnte nur durch Konzentrierung der Feind-
seligkeit gegen andere Stmme aufrechterhalten werden,
was die Krieger beschfigte und das Ansehen des Anfhrers
mehrte, sowie durch religise und soziale Rituale, die den
Zusammenhalt des Stammes strken sollten. Dabei bewhrte
sich besonders der Austausch von heiratsfhigen Tchtern, ein
Versuch, die Sippen miteinander zu verbinden und dadurch
Fehden vorzubeugen oder sie zu beenden. Weitere Rituale zur
Lsung von Konikten waren Feste und Trinkgelage, auf denen
demonstrativ Zusammengehrigkeit bekundet wurde. In den
drichen Stammesgesellschafen hatten diese Anlsse groe
Bedeutung; denn gemeinsames Essen und vor allem Trinken
waren uerst wichtige Rituale zur Stabilisierung der fragilen
sozialen Bindungen. Natrlich arteten solche Gelage nicht
selten in zerstrerischen Streit aus, wenn im Rausch erhobene
Anschuldigungen alten Groll wiederbelebten und neue Gewalt-
ttigkeiten heraufeschworen.
Es berrascht daher nicht, da in rascher Folge Stmme auf-
tauchen und verschwinden. Von Natur aus instabil, waren diese
Einheiten stndigen Vernderungen unterworfen, wenn Sippen
sich befehdeten und spalteten, wenn Krieger sich unabhngig
machten und neue Stmme bildeten und wenn durch innere
Streitigkeiten geschwchte Stmme von anderen Stmmen
erobert und absorbiert wurden. Solange sich dieser Proze
jedoch zwischen Germanen, Kelten und Balten vollzog, die
alle in vergleichbaren materiellen und sozialen Bedingungen
lebten, blieb diese Instabilitt in einem gewissen Gleichgewicht.
Erst der Kontakt mit den Rmern sollte dieses Gleichgewicht
zerstren.
84
Der rmische Einu auf die germanischen Stmme
Obwohl die germanischen Stmme eng mit ihren keltischen und
baltischen Nachbarn verbunden und von diesen of nicht zu un-
terscheiden waren, war die germanische Gesellschaf selbst im .
Jahrhundert keineswegs ganz ohne Kontakt mit der rmischen
Welt. Auf vielerlei hchst bezeichnende Weise machte sich die
Prsenz Roms in der gesamten germanischen Welt bemerkbar.
Erstens fand in der schmalen, etwa 00 Kilometer breiten Zone
entlang des Limes ein recht intensiver Handelsaustausch zwi-
schen Rmern und Barbaren statt, der rmische Produkte in die
germanische Welt brachte. In dieser Zone waren rmische Wa-
ren unterschiedlichster Art in Gebrauch, und Geschfe wie das
zwischen Stelus und dem rmischen Kaufmann weisen darauf
hin, da germanische Viehzchter rasch in die Geldwirtschaf
der rmischen Welt einbezogen wurden.
Whrend Alltagsprodukte der rmischen Provinzmanu-
fakturen im Hinterland des freien Germanien nicht sehr
stark verbreitet waren, erregten rmische Luxuserzeugnisse
anscheinend berall die Aufmerksamkeit der germanischen
Elite. In ganz Nordeuropa, vom Rhein bis jenseits der Oder,
haben Archologen bemerkenswert gleichartige Grabsttten mit
Waen, Juwelen und rmischen Luxusgtern gefunden. Diese
sogenannten Lbsowtyp-Grber belegen sowohl die Bedeutung
rmischer Luxuswaren und rmischen Lebensstils fr die ger-
manische Elite als auch die Gemeinsamkeiten und vermutlich
auch Verbindungen zwischen den Eliten der gesamten Region.
Ob diese rmischen Luxusgter ber den Handel erworben oder,
was wahrscheinlicher ist, durch den Austausch von Geschenken
weitergegeben wurden, wissen wir nicht. Fest steht jedoch, da
bereits im . Jahrhundert, lange vor der Vlkerwanderung, ein
germanischer Adel, der sein Selbstverstndnis in seiner milit-
rischen Rolle fand, allmhlich in den Bann Roms geriet.
Das Eindringen rmischer Handelsgter und Kulturtechniken
85
in die germanische Gesellschaf hatte tiefgreifende Konsequenzen.
Erstens bewirkten die Einfhrung des Geldes und die Ausdehnung
der Mrkte fr germanisches Vieh, Felle und wohl auch andere
Produkte wie Pelze, Bernstein und Sklaven eine Vertiefung der
sozialen Unterschiede. Nicht als ob vor dieser Zeit die germani-
schen Vlker in einer utopischen Art von hinterwldlerischem
Primitivkommunismus gelebt htten; wie wir oben sahen, wei-
sen die Unterschiede in der Gre der Rinderherden bereits auf
eine gegliederte Gesellschafsstruktur hin. Whrend diese jedoch
belegen, da einige Germanen das Doppelte und Dreifache ihrer
Nachbarn besaen, trug die nun mgliche Anhufung von Geld
und Luxusgtern aus dem Rmischen Reich betrchtlich zur
sozialen Dierenzierung zwischen einzelnen Individuen und Fa-
milien bei. Mit der Ausdehnung der sozialen Kluf zwischen den
Angehrigen germanischer Stmme wuchsen auch Macht und
Stellung der traditionellen Anfhrer ganz erheblich.
Zweitens vernderte die Nachfrage nach rmischen Waren, die
nur durch Handel oder Kriegsfhrung erworben werden konn-
ten, den Grad der Aktivitt und das Ausma der Interaktionen
zwischen germanischen Vlkern. Als die Stmme in das rmische
Handelsnetz einbezogen wurden, traten ihre Anfhrer notwendi-
gerweise in politische Beziehungen mit Rmern, ein Ergebnis, das
besonders von den rmischen Regierungsbeamten gewnscht
wurde. Aus rmischer Sicht war es hchst wnschenswert, da
die germanischen Stmme von mchtigen Oberhuptern regiert
wurden, die im Namen ihrer Stmme verhandeln und mit Rom
bindende Vertrge abschlieen konnten und deren persnliche
Treue zu Rom sich mit Geschenken gewinnen lie. Auerdem
war es vorteilhaf, solche Stmme von rmischen Lieferungen von
Eisen, Getreide und anderen Exportgtern abhngig zu machen.
So zielte die rmische Politik auf eine als Stabilisierung der bar-
barischen politischen Strukturen verstandene Entwicklung und
auf die Ausbildung eines barbarischen Wirtschafssystems, das
den rmischen Produkten Exportmrkte sicherte.
86
Insgesamt fhrte die rmische Politik jedoch dazu, da die
germanische Gesellschaf noch strker destabilisiert wurde, die
soziale und wirtschafliche Dierenzierung sich innerhalb der
germanischen Stmme verschrfe und innerhalb dieser Vlker
pro- und antirmische Fraktionen entstanden, die hug zur
Spaltung von Stmmen fhrten. Diese Destabilisierung breitete
sich in der germanischen Welt wie eine Kettenreaktion aus und
setzte einen strmischen Proze von rasch aufeinander folgenden
Stammesbildungen und sozialen Umschichtungen in Gang, der
zu einem Konikt fhrte, der in der germanischen Welt keinen
Namen hat, dem wir aber auf der anderen Seite des Limes bereits
begegnet sind, dem Markomannenkrieg. Aus dessen Nachwirren
gingen neue Vlker und Bndnissysteme hervor, darunter auch
die Franken, das Volk, mit dem wir uns in diesem Buch vorwie-
gend beschfigen.
Die Rmer betrachteten den Markomannenkrieg in erster
Linie als eine Konfrontation zwischen Rmern und Barbaren
entlang der Donaugrenze. Doch merkten sie sehr wohl, da
sie mit weit mehr Barbarenstmmen als den Markomannen
und den Quaden konfrontiert waren, jenen beiden Stammes-
verbnden, die dem rmischen Limes am nchsten wohnten.
Diese beiden Gruppen hatten lange zu dem Grtel rmischer
Klientelstaaten entlang der Grenze gehrt, deren Beziehungen
zu Rom eng und im groen und ganzen friedlich gewesen
waren. Nicht eindeutig zu interpretierendes archologisches
Material spricht sogar dafr, da die Frsten dieser Gruppen
auf dem besten Wege waren, in ihrem Lebensstil und ihren mi-
litrischen Befestigungsanlagen rmisch zu werden. Sie besaen
mglicherweise Landhuser und Lager, die von den Rmern
fr sie erbaut worden waren oder zumindest aus Baumaterial
bestanden, das rmische Legionen geliefert hatten. Im Verlauf
des Krieges schlossen sich jedoch Teile zahlreicher anderer
Verbnde den Markomannen und Quaden an. Whrend der
Verhandlungen mit Rom nach der ersten Invasion im Jahre
87
67 n. Chr. sprach der Markomannenknig Ballomarius fr
mindestens elf Stmme.
Wahrscheinlich waren sogar noch mehr Gruppen beteiligt.
Archologische Ausgrabungen haben in Gebieten des heutigen
Bhmen und sterreich, in den Regionen, aus denen die Mar-
komannen und Quaden kamen, Fundstcke nordgermanischer
Herkunf aus dieser Periode zutage gefrdert. Darber hinaus
wurden rmische Waen, die wahrscheinlich von germanischen
Kriegern erbeutet und ihnen spter mit ins Grab gegeben worden
waren, in so weit nrdlich gelegenen Gebieten wie Schleswig-
Holstein, Jtland und der Insel Fnen im heutigen Dnemark
entdeckt. Insgesamt lassen diese Funde darauf schlieen, da
sogar Krieger aus dem sdlichen Skandinavien an den Kmp-
fen teilgenommen haben. Ferner weisen sie darauf hin, da die
Rmer zu Recht argwhnten, der Druck auf die Donaugrenze
sei durch die Bewegung von Vlkern aus dem Norden zustande
gekommen. Es gibt deshalb berechtigten Anla zu der Vermu-
tung, da sich das gesamte freie Germanien in einer Periode von
Ungleichgewicht und Spannung befand.
5
Die Markomannenkriege waren auch keineswegs die einzige
Folge der innergermanischen Vernderungen, die Rom zu sp-
ren bekam. berall an der Rhein-Donau-Grenze wirkten sich
die innergermanischen Unruhen aus: Im Jahre 66/67 drngten
Langobarden und Ubier zur Donau.
70 stieen die Chatten ber den Rhein vor, whrend Sar-
maten und Kostoboken an der unteren Donau aktiv waren. 72
berelen die Chauken aus dem Kstengebiet zwischen Ems
und Elbe die Kste des heutigen Frankreich, und 74 drngten
verschiedene Gruppen von Germanen nach Rtien. So befand
sich die germanische Welt oensichtlich von einem bis zum
anderen Ende in Bewegung, und der Druck auf die rmische
Welt bildete nur das ferne Echo dieses inneren Umbruchs. In
Germanien vollzog sich eine grundlegende Umstrukturierung,
ein Proze, in dem einst machtvolle Stammesbndnisse wie die
88
Markomannen aufgesplittert wurden, alte Stmme verschwanden
oder grundlegend reorganisiert wurden und neue Vlker und
Bndnisse wie die Franken und Alemannen an deren Stelle traten.
Viele Gruppen wie etwa die Goten, die vorher als kleine Stmme
greren Verbnden untergeordnet waren, schlossen sich zu gro-
en Wanderlawinen zusammen. Gotische Frsten fhrten ihre
Gefolgsleute in neue Gebiete, im allgemeinen nach Sden und
Osten. Die letzten Jahrzehnte des zweiten Jahrhunderts waren
die dynamischste Periode in der germanischen Geschichte.
Die neuen germanischen Gesellschafen
Die Unruhe am Ende des zweiten Jahrhunderts vernderte die
Struktur der germanischen Stmme grundlegend, sowohl derer,
die in unmittelbarer Nhe des Limes siedelten, also auch so weit
entfernter, da die Rmer nur eine vage Kenntnis von ihrer
Existenz hatten.
In dieser Zeit stndiger Kriegszge gewann die schon immer
wichtige Rolle der kriegerischen Unternehmungen der Stmme
noch einmal an Bedeutung. Um zu berleben, mute ein Stamm
durch und durch militarisiert werden, er wurde selbst zu einer
Armee. Dieser Wandel verlieh den nichtkniglichen Heerfhrern
der germanischen Stmme ein neues Gewicht. Zwar waren sie
schon immer mit der Kriegsfhrung betraut gewesen, aber ihre
of von den Rmern untersttzten Bemhungen, das begrenzte
militrische Amt zu einer breiter angelegten und dauerhaferen
Fhrungsposition auszubauen, waren auf den entschiedenen
Widerstand ihrer Stmme gestoen. Nun, da die organisierte
Kriegsfhrung zum bestndigen, alles umfassenden Aspekt der
Stammesexistenz geworden war, erhhte sich ihr Status betrcht-
lich. Als erfolgreiche Heerfhrer konnten diese Befehlshaber, die
im Gotischen mit dem keltischen Lehnwort als reiks, im Westen als
89
kuning bezeichnet wurden, fr sich in Anspruch nehmen, da der
Sieg ein Zeichen gttlicher Gunst war, und so ihrer Position eine
religise Aura verleihen, obwohl sie ursprnglich nicht wie der
thiudans notwendigerweise kniglicher Abstammung waren.
Unter der Fhrung des reiks, kuning oder Heerknigs, wie er
und seinesgleichen in der neueren deutschen Forschung genannt
werden, erfuhren Identitt und Zusammensetzung der Stmme,
die im wesentlichen immer instabile Gruppen gewesen waren,
eine erneute Umwandlung. Die Verlagerung traditioneller Sied-
lungsgebiete lie die Bedeutung der agrarischen Traditionen der
Gemeinschaf sinken und damit einhergehend auch den Frucht-
barkeitskult solcher Gtter wie Tiwaz. An ihrer Stelle wandten
viele germanische Stmme ihre Verehrung Wotan oder Odin zu,
dem Gott des Krieges und der besonderen Gottheit der Heerk-
nige, die ihn als den Verleiher des Sieges ansahen und durch den
Sieg eine Art religiser Legitimation ihrer Stellung erwarteten.
Der neue Kult war der hochmobilen und sich rasch ndernden
Natur des Stammes angemessener.
Die Siege schufen neue Traditionen, die sich konzentrisch
um den Kriegerknig als den Vertreter und of Abkmmling
Wotans rankten. Dies wiederum vernderte die Identitt der
Gemeinschaf. Obwohl die alten Stammesnamen gelegentlich
beibehalten wurden, war die Identitt des Stammes nun mit der
Identitt dieser Heerfhrer verknpf. Jeder, der mit ihnen zu-
sammen kmpfe, war ein Mitglied ihres Stammes, unbeschadet
frherer ethnischer, sprachlicher, politischer oder kultureller
Herkunf. Jeder andere war entweder Feind oder Sklave.
Aber auch noch so glnzende militrische Fhrerschaf konnte
allein die charismatische Wirkung eines Heerfhrers nicht in ein
dauerhafes institutionelles Knigtum umwandeln. Ein reiks oder
kuning, der hofe, sich und seine Familie ber die anderen aristo-
kratischen Familien seines polyethnischen Stammes zu erheben,
brauchte greren Reichtum, mehr Ehren und Untersttzung,
als er allein erwerben konnte. Aus diesem Grunde brauchten die
90
Barbarenfhrer Rom und den Kaiser, der sogar fr die Bewohner
des freien Germanien der einzig wahrhaf groe Knig war,
um dessen Hilfe sie sich eifrig bemhten.
An den Nordgrenzen des stlichen und westlichen Imperiums
suchten diese Heerfhrer nanzielle und politische Untersttzung
in Form von Bndnissen mit Rom. Sie bentigten rmische Titel
und mter, um ihre Stellung nicht nur gegenber ihren eigenen
Vlkern, sondern auch in ihrem Verhltnis zu anderen Stmmen
zu legitimieren. Sie brauchten rmisches Getreide und Eisen,
um ihre Krieger zu ernhren und auszursten, und rmisches
Gold und Silber, um ihren hohen Rang durch auallende und
blendende Zurschaustellung von Edelmetall zu reprsentieren.
All dies war Rom, wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, zu
verschaen bereit, aber es forderte auch seinen Preis dafr. Am
meisten bentigte Rom etwas, was die Barbaren liefern konnten,
militrische Verstrkung durch Hilfstruppen. So arbeiteten bar-
barische Kriegsherren und rmische Kaiser gemeinsam an der
Schaung der neuen barbarischen Welt.
Das Ostrmische Reich und die Goten
Wie dieser Proze im Osten verlief, lt sich am besten veranschau-
lichen, wenn man Schritt fr Schritt die Entwicklung der Goten
verfolgt, jenes Barbarenstammes, der in der Sptantike von an-
deren Barbaren wie von den Rmern gleichermaen respektiert
und gefrchtet wurde. Daher wollen wir auf eine umfassende
Darstellung der verschiedenen Barbaren, die in das Imperium
eindrangen, verzichten und statt dessen die einzelnen Stadien
der gotischen Stammesbildung genauer betrachten. Obwohl die
nach ihren erstaunlichen Siegen innerhalb des Reiches und ihrer
Landnahme in Italien und Spanien entstandenen Legenden den
Eindruck erwecken, als ob das gesamte Volk von Skandinavien
91
nach Osten gezogen sei, bevor es sich am Schwarzen Meer nie-
derlie, zeigt ihre wirkliche Geschichte, wie sie Herwig Wolfram
eindrucksvoll dargestellt hat, eine ganz andere Vergangenheit. Er
schildert, wie Menschen von sehr unterschiedlicher ethnischer,
kultureller und geographischer Herkunf zu Goten wurden und
wie sich im Verlauf dieser Entwicklung die Bedeutung dessen,
was ein Gote ist, vernderte.
6
Die Menschen, die sich selbst die Goten oder Gutonen nannten
der Name bedeutet wahrscheinlich lediglich Volk, wie viele
ltere Stammesnamen , bewohnten im . Jahrhundert n. Chr. ein
Gebiet zwischen Oder und Weichsel. Sie waren eng verbndet
und manchmal beherrscht von drei anderen germanisch-kelti-
schen Gruppen, den Vandalen, den Lugiern und den Rugiern. In
ihrem kultischen und materiellen Leben unterschieden sie sich
kaum von anderen, eng verwandten Barbarengruppen, obwohl
ihr Knig, wenn man Tacitus glauben darf, bereits im . Jahr-
hundert ungewhnlich mchtig war er scheint die Befugnisse
des reiks mit dem religisen Ansehen des thiudans vereinigt zu
haben. Diese Knige mit ihrer Kerngruppe von Kriegern waren
die Trger einer Tradition und einer ezienten Militrorganisa-
tion, die nichtgotische Krieger verlocken konnte, an ihrer Seite zu
kmpfen. In kaum mehr als fnf Generationen wuchs der kleine,
abhngige Stamm zu einer Gromacht der barbarischen Welt
heran. Zum groen Teil waren es die Erschtterungen, die seine
Konsolidierung am rechten Weichselufer begleiteten, welche jene
gewaltsamen Vernderungen in Gang setzten, die die Rmer als
den Markomannenkrieg erlebten.
Im spten 2. und im 3. Jahrhundert drangen einige Trger die-
ser gotischen Tradition allmhlich nach Sden und Osten vor,
bis sie schlielich die Ufer des Dnjepr in der Nhe des heutigen
Kiew erreichten. Nicht alle Goten zogen als einheitliches Volk in
diese Region, vielmehr wurden die verschiedenen pontischen,
sarmatischen, baltischen und germanischen Vlker, die bereits
in der Dnjepr-Region lebten, unter gotischer Fhrung zu einem
92
mchtigen Bndnis unter einem gotischen Heerknig zusam-
mengeschlossen. Von hier aus geriet die stndige Expansion des
neugebildeten gotischen Volkes im Jahr 238 in einen direkten und
gewaltsamen Konikt mit Rom, als jene Goten, welche die Rmer
nach den Ureinwohnern der Region als Skythen bezeichneten,
unter der Fhrung ihres Knigs Cniva die stlichen Provinzen
des Imperiums um das Schwarze Meer zu berfallen und zu
plndern begannen. Die daraus resultierenden Kriege waren fr
das Imperium viel verheerender als die gegen die Markomannen.
Die Goten drangen tief in das Reich ein, 25 tteten sie sogar
Kaiser Decius und seinen Sohn, als diese versuchten, die reich
mit Beute beladenen Scharen an der Heimkehr zu hindern. Nur
unter groen Schwierigkeiten gelang es den Kaisern Claudius II.
in seinem Todesjahr 269 und Aurelian 27, sich dem Ansturm
der Skythen entgegenzustemmen und sie schlielich zu be-
siegen.
Die Niederwerfung wurde mit typisch rmischer Grndlich-
keit durchgefhrt, das vereinigte gotische Knigreich praktisch
zerstrt. Aber genau wie ein Sieg kann auch eine Niederlage zum
entscheidenden Ereignis bei der Entstehung eines Volkes werden.
Aus den berresten des gotischen Bndnisses entwickelten sich
zwei neue gotische Vlker stlich des Dnjestr errichtete die
knigliche Familie der Amaler wieder ein gotisches Knigreich,
whrend an der unteren Donau eine dezentrale, aber vitale goti-
sche Gesellschaf unter der Fhrung aristokratischer Familien,
besonders der Balthen, entstand, die einen Teil der alten goti-
schen Tradition fortfhrten. Im Jahre 332 schlo Ariarich, der
balthische Fhrer dieses Vielvlkerbndnisses der sogenannten
Terwingen, der statt des Knigstitels den eines Richters fhrte,
mit Kaiser Konstantin den ersten aus einer Reihe von Vertrgen
oder foedera und erzielte so den bentigten Frieden und die
Untersttzung fr die Sehafwerdung der Goten innerhalb der
Einusphre des Imperiums.
93
Balthen und Terwingen
Gesellschaf und Kultur der Terwingen waren komplexe Ver-
bindungen der verschiedenen Gruppierungen, aus denen sie
bestanden. Die gotische Methode der politischen Organisation,
die sich auf mchtige Heerfhrer sttzte, konnte schnell und
eektiv ausgebaut werden, so da eine kleine Gruppe von Ad-
ligen grere Mengen von Kriegervlkern zu einer gotischen
Konfderation zusammenschlieen konnte. Die Goten waren
daher kaum ein Stamm im Sinne einer Gruppe gemeinsamer
Abstammung, sondern eher eine politische Konstellation kleiner
Gruppen oder kunja unterschiedlichen kulturellen, sprachli-
chen und geographischen Ursprungs, die von ihren jeweiligen
reiks angefhrt wurden und einen gemeinsamen Kult besaen.
Einige reiks regierten von Festungen auf dem Lande und nicht
von Drfern und Stdten aus, obwphl es solche in dieser alten
Region mit Sicherheit gab. Der reiks beherrschte sein Gebiet mit
Hilfe seiner militrischen Gefolgschaf, des comitatus, whrend
selbst freie Dorfewohner im allgemeinen vom politischen
Entscheidungsproze ausgeschlossen waren. Dies ist von der
organisierten politischen Mitsprache, wie sie Tacitus beschreibt,
meilenweit entfernt, und zwar aus einem wichtigen Grund: Die
terwingischen Goten waren keine Germanen im Sinne von Ta-
citus, sondern eine osteuropische Gesellschaf. Die einigenden
Elemente der gotischen Konfderation waren die Armee, die
bis auf eine kleine Elitekavallerie im wesentlichen aus Infanterie
bestand, und die von der Balthenfamilie vermittelten und getrage-
nen Traditionen.
Entsprechend dem mit Rom abgeschlossenen Vertrag dienten
die terwingischen Goten im allgemeinen als treue Verbndete.
Sie unternahmen nicht nur im Aufrag der Rmer Expeditionen
gegen ihre barbarischen Nachbarn, sondern viele dienten allein
oder in Gruppen unterschiedlich lange in der rmischen Armee.
In der Tat zhlten bis etwa 400 gotische Heermeister zu den be-
94
deutendsten magistri militum in der Osthlfe des Imperiums.
Erlesene Juwelen, Gefe und Schmuckstcke, die in dieser
Periode in dem Terwingenstaat hergestellt wurden, beweisen,
in welchem Mae die gotischen Eliten die handwerklichen und
knstlerischen Traditionen der Rmer, Griechen und anderer
schtzten und nachahmten. So tief durchdrangen die Werte und
Strukturen des Rmischen Reiches diese Gesellschaf, da sogar
das schmckende Beiwerk rmischer Verfassungsstrukturen in
diesem Grenzstaat bewundert und nachgeahmt wurde, wenn
auch in einer Art interpretatio barbarica, im Unterschied zu der
besser bekannten interpretatio Romana, von der ich an frherer
Stelle gesprochen habe. Das eindrucksvollste Beispiel hierfr ist
die Kopie einer rmischen Gedenkmnze, die in einem Schatz in
Szilgysomly im heutigen Rumnien gefunden wurde, mit den
Portraits der Kaiser Valentinian I. und Valens, die gemeinsam von
364 bis 375 regierten, und der Umschrif Reges Romanorum,
Knige der Rmer. Dies ist wahrscheinlich eine lateinische
bersetzung des Wortes thiudans. Fr die Goten war der Kaiser
der groe Knig, ein wesentliches, wenn auch manchmal ambi-
valentes Element ihrer eigenen politischen Struktur.
Die dem Imperium entgegengebrachte Bewunderung und die
Zusammenarbeit mit ihm waren innerhalb des terwingischen
Staatenbundes nicht unumstritten. Man kann von pro- und
antirmischen Gruppen innerhalb des Adels sprechen, da ver-
schiedene gotische Fhrer bestrebt waren, ihre eigene Stellung
in der Konfderation zu festigen und auszubauen, indem sie
entweder von Konstantinopel Untersttzung erhofen oder die
Terwingen gegen die Rmer zu vereinigen versuchten. Jenseits
der Donau bemhten sich verschiedene Gruppen innerhalb des
Imperiums, die Goten fr eine Zusammenarbeit zu gewinnen,
um ihre eigenen politischen Ziele voranzutreiben. Unter dem
groen balthischen Richter Athanarich (365-376/8) waren die
Beziehungen der Terwingen zum Imperium besonders gespannt.
Sein Vater hatte als gotische Geisel in Konstantinopel gelebt, und
95
obwohl der Kaiser diesem im neuen Rom eine Statue errichten
lie, hatte er seinen Sohn schwren lassen, niemals den Fu in das
Rmische Reich zu setzen. Die balthischen Richter betrachteten
oenbar die rmische Politik als eine mgliche Bedrohung ihrer
Fhrerschaf in der Konfderation, und Athanarich fhrte eine
Reihe von Kriegen gegen Kaiser Valens, die im Jahre 369 mit
einem Vertrag endeten, der den Goten erlaubte, praktisch als
gleichberechtigte und selbstndige Verbndete der Rmer zu
handeln.
Athanarichs schwieriges Verhltnis zu den Rmern stand
in einem engen Zusammenhang mit seinen innenpolitischen
Problemen; denn um die Macht in der gotischen Konfderation
konkurrierte mit ihm insbesondere die starke prormische Grup-
pierung, die von den Terwingen Fritigern und Alaviv angefhrt
wurde. Die Rivalitt zwischen dem konservativen Athanarich,
der den Zusammenhalt des Bndnisses durch eine Belebung der
alten gotischen Traditionen zu strken versuchte, und dem reiks
Fritigern kam hauptschlich in Formen religiser Gegnerschaf
und Verfolgung zum Ausdruck. Unter den verschiedenen Grup-
pen innerhalb der Konfderation lebten Christen verschiedener
Glaubensrichtungen, die im Krieg gefangengenommen oder
deren Gemeinschafen von den Goten aufgenommen worden
waren. Der bedeutendste unter ihnen war Wulla (etwa 3-383),
wahrscheinlich der Sohn eines gotischen Vaters von hohem
sozialem Rang und einer kappadokischen Mutter, deren Eltern
oder Groeltern vermutlich 257 bei einem gotischen Raubberfall
verschleppt worden waren. Nach 330 besuchte er Konstantinopel
als Mitglied einer gotischen Gesandtschaf und erwarb oenbar
eine gute lateinische und griechische Bildung. Im Jahre 34 wurde
er in Antiochia zum Bischof der Christen im gotischen Land
geweiht und kehrte zurck, um seinen Glauben zu verbreiten,
der schon frher durch lateinische und griechische Missionare
eingefhrt worden war. Sein hoher Rang, seine ozielle Bevoll-
mchtigung und seine ausgezeichnete Bildung, die ihn befhigte,
96
die Bibel ins Gotische zu bersetzen, trugen zu seinem Erfolg
bei der Bekehrung der Goten bei.
Wullas eigene Position in der grten theologischen Streit-
frage des 4. Jahrhunderts, dem Glaubensstreit um die gttliche
Natur Christi, war ein Kompromi zwischen der Position der
Christen, die spter die Orthodoxen genannt wurden und die
glaubten, da Christus eins sei mit dem Vater, und derjenigen
der Arianer, die seine gttliche Natur bestritten. Ohne eine dieser
Auassungen vollstndig zu bernehmen, zog es Wulla vor, vom
Wesen des Gttlichen berhaupt nicht zu sprechen. Aus diesem
Grund sind er und seine gotischen Nachfolger flschlicherweise
fr Arianer gehalten worden.
Wulla war zwar der bedeutendste und erfolgreichste, aber
nicht der einzige christliche Missionar. Die orthodoxe Kirche
vertrat Bischof Vetranio von Tomi, der im terwingischen Adel
Frsprecher fand. Die rivalisierenden Arianer wurden hauptsch-
lich von der Terwingenopposition unter Fritigern untersttzt,
welcher hofe, damit dem arianischen Kaiser Valens zu gefallen.
Athanarich betrachtete alle Richtungen des Christentums als
eine Bedrohung fr die gotische Kulttradition, die eines der ent-
scheidenden Elemente seines politischen Erfolges gewesen war,
und begann mit einer Anzahl von Verfolgungen, von denen die
wichtigste nach dem Jahre 3 69 anng und unterschiedslos alle
Glaubensrichtungen der Christen betraf. Whrend dieser inneren
Auseinandersetzungen kam die Lsung von auen: 376 wurde
das militrische Bndnis unter Athanarich durch den pltzlichen
Einfall der Hunnen aus Asien im Gebiet des Schwarzen Meeres
zerstrt und die Infrastruktur des gotischen Staates durch eine
gleichfalls aus vielen Vlkerstmmen bestehende hunnische Kon-
fderation ersetzt. Die Mehrheit der terwingischen Elite verlie
Athanarich und folgte Fritigern und Alaviv ber die Donau in
das Imperium. Athanarich selbst mute das Gelbde, das er sei-
nem Vater gegeben hatte, brechen und in Konstantinopel Schutz
suchen, wo er 38 ehrenvoll empfangen wurde, aber schon zwei
97
Wochen nach seiner Ankunf starb. Diese Krise war das Vorspiel
zu einer neuen Phase der gotischen Stammesgeschichte. Von nun
an traten die Gefolgsleute von Fritigern als die Westgoten in die
Geschichte ein.
Amaler und Greutungen
Whrend die Balthen die verschiedenen Vlker am Unterlauf
der Donau und am Schwarzen Meer in der terwingischen
Konfderation zusammenfaten, grndeten die Mitglieder der
kniglichen Familie der Amaler im sdlichen Ruland ein neues
gotisches Knigreich. Ihr erster Knig war Ostrogotha, der zur
ersten Generation nach dem rmischen Sieg von 27 gehrte und
in gewissem Sinne als der Grnder des gotischen Knigtums
in seiner neuen, eingeschrnkten Form gelten kann. Da dieses
Knigreich weit von der rmischen Grenze entfernt lag, wissen
wir nur wenig ber seine Geschichte; es mu ein polyethnischer
Verband nach dem gotischen Muster mit einem zentralen
Heerknigtum und einer starken kriegerischen Oberschicht
gewesen sein. Dieser Steppenverband war den Rmern als die
Greutungen oder Skythen bekannt, das erste ein neuer Volks-
name, das zweite eine aus der griechischen Antike stammende
Bezeichnung fr Steppenvlker. So wie die westlicher gelegene
Konfderation die kulturellen und militrischen Traditionen der
Region unter der politischen Kontrolle des balthischen Adels
fortsetzte, war das Knigreich der Greutungen, obwohl es sich
selbst mit gotischer Tradition identizierte, in bezug auf seine
Sitten, seine ethnische Zusammensetzung und vor allem sein
Kriegswesen ganz und gar ein Steppenvolk.
Der greutungische Knig Ermanarich, nach der spteren go-
tischen Geschichtsschreibung der Edelste der Amaler, der in
den Heldenepen, aber auch in der Geschichte eine bedeutende
98
Rolle spielte, herrschte ber eine groe Anzahl unterworfener
Vlker der russischen Steppen. Sein Knigreich kontrollierte die
traditionellen Handelsrouten, die das Schwarze Meer und die
baltische Welt miteinander verbanden. Seine Herrschaf ber
dieses Bndnis war keineswegs unumstritten, und er hatte sich
gerade mit anderen Gruppen in einen tdlichen Kampf um die
Macht verstrickt, als der Einfall der Hunnen vor 376 sein Knig-
reich zerstrte. Ermanarich ttete sich selbst, mglicherweise
als Opfer an die Gtter, und der grte Teil seines Volkes ging
in der hunnischen Konfderation auf. Eine Minderheit leistete
noch etwa ein Jahr lang Widerstand, bevor sie ebenfalls unter-
worfen wurde oder wie die Terwingen in das rmische Imperium
chtete. Erst nach dem Zerfall der hunnischen Konfderation
sollten diese unter Anknpfung an die amalische Tradition als
Ostgoten wieder auferstehen.
Von den Terwingen zu den Westgoten
Nach ihrer Ansiedlung in Sdgallien blickten die Westgoten auf
die Zeit zwischen 376 und 46 wie auf eine Wiederholung der
vierzigjhrigen Wanderschaf des hebrischen Volkes im Sinai
zurck. Die Analogie, auf die sich das theologische und politische
Selbstverstndnis der Goten sttzte, das neue auserwhlte Volk
zu sein, war insofern treend, als genau so, wie in der Sinaizeit
aus den verschiedenen Flchtlingsgruppen, die gypten verlassen
hatten, das hebrische Volk hervorgegangen war, die vierzigjh-
rige Ungewiheit und Wanderung innerhalb des Imperiums die
terwingischen Flchtlinge unter Fritigern zu dem formte, was wir
heute als die Westgoten bezeichnen. Der abschlieende Proze
der Schaung eines territorialen Knigreiches innerhalb des
Imperiums wurde dadurch ermglicht, da das gotische Volk,
das ursprnglich als gotische Armee organisiert war, zu einer
99
rmischen Armee werden konnte und seine Fhrer Legitimitt
und Untersttzung als rechtmig eingesetzte rmische Oziere
gewannen. Die Entstehung eines westgotischen Staates ging nicht
so sehr auf die Einfhrung einer barbarischen und noch weni-
ger einer germanischen Gesellschaf in den Westen zurck,
sondern auf die Angleichung des gotischen Systems an das
gesamte rmische Verwaltungs- und Militrsystem.
Wir haben im vorigen Kapitel von der Aufnahme der Goten un-
ter Fritigern durch die Rmer gehrt und von ihrer Verzweiung,
die sie dazu fhrte, in Adrianopel eine Konfrontation mit dem
Kaiser selbst zu wagen, aus der sie siegreich hervorgingen. Dieser
Sieg von Adrianopel war jedoch kurzlebig. Die Goten brauch-
ten Nahrung, und auf die Dauer konnten sie diese nur durch
Kooperation mit dem rmischen Weltreich erhalten. So schlo
wohl noch Fritigern im Jahre 382 nach einem kurzen und nutz-
losen Krieg mit Kaiser Teodosius einen Vertrag, nach dessen
Bestimmungen die Goten in Dakien und Trakien als fderiertes
Volk angesiedelt werden sollten, das seine Herrschafsstruktur
behalten und dem Imperium bei Bedarf dienen sollte.
Diese Siedlungsphase dauerte nicht lange, aber sie lie Zeit
fr das Aufreten des neuen und machtvollen gotischen Fh-
rers Alarich, dessen Position weit strker als die Fritigerns, der
terwingischen Richter und sogar Athanarichs die eines echten
Monarchen war. Obwohl von der kaiserlichen Regierung hug
verraten, wurde Alarichs ganze Laufahn von seinem vergebli-
chen Streben nach Anerkennung und Legitimierung als oberster
Heermeister des Imperiums beherrscht. Alarich fhrte sein Volk,
das erneut von den Hunnen bedroht wurde, aus Trakien in die
Balkanlnder, nach Griechenland und nach Illyrien. Im Jahre 397
war der Kaiser, der Alarich vorher nicht als Knig, sondern als
Tyrannen oder Usurpator betrachtet hatte, gezwungen, ihn zum
militrischen Befehlshaber der stlichen illyrischen Prfektur zu
ernennen ein Schritt, der als Modell fr zuknfige Abkommen
mit den Fhrern barbarischer gentes innerhalb des Imperiums
100
diente. Der neue Vertrag hielt noch krzere Zeit als der erste, und
40 fhrte Alarich seine Armee nochmals durch das Imperium.
Dieser letzte Feldzug gipfelte in der Plnderung Roms im Jahre
40. Weit dringender als die rmische Beute bentigte Alarich
jedoch Nahrung. Deshalb wollte er sein Volk bis nach Nordafrika
fhren, ein Ziel, das erst ein anderes Barbarenvolk erreichte, die
Vandalen.
Alarich starb im selben Jahr, in dem er Rom eingenommen
hatte, und sein Nachfolger Athaulf schlo schlielich einen
Vertrag mit dem Kaiser Honorius, um Gallien von dem Usur-
pator Iovinus zu befreien. Im Jahre 43 fhrte er seine Goten
als rmische Armee nach Aquitanien. Erst als der Kaiser seinen
Teil des Abkommens die Goten zu versorgen brach, besetzte
Athaulf die Hauptstdte der Region. Athaulf strebte wie Alarich
nach kaiserlicher Anerkennung und Besttigung und heiratete
44 mit Galla Placidia eine Rmerin, die Tochter des Kaisers
Teodosius, womit er seine Familie mit der theodosianischen
Dynastie verband und auf diese Weise seine Beziehung mit der
kaiserlichen Regierung wiederherzustellen versuchte. Er ver-
handelte auch mit dem aquitanischen Adel, um eine territoriale
Herrschaf nicht nur ber die Goten, sondern ber die gesamte
Bevlkerung der Region zu errichten. Seine Ermordung im Jahre
45 machte alle diese Plne zunichte. Sein Nachfolger Walia fhr-
te die Goten nach Spanien in der Honung, Alarichs Zug nach
Nordafrika wiederaufnehmen zu knnen, aber er kam nicht an
sein Ziel und wurde schlielich in rmische Dienste genommen.
Er kehrte nach Aquitanien zurck, wo er und seine Goten, die
ein barbarisches Volk und eine rmische Armee zugleich wa-
ren, angesiedelt wurden und das westgotische Knigreich von
Toulouse grndeten. Damit waren das Ende der vierzigjhrigen
Wanderung sowie der Hhepunkt des langen Prozesses der
westgotischen Stammesbildung erreicht.
101
Von den Greutungen zu den Ostgoten
Nach Ermanarichs Tod wurde die Hauptmasse der Greutun-
gen in die hunnische Konfderation eingegliedert. Eine kleine
Gruppe oh jedoch in das Rmische Reich und wurde unter
den verschiedenen Fderaten in Pannonien angesiedelt. Obwohl
die Goten den hunnischen Eroberern mit sehr zwiespltigen
Gefhlen gegenberstanden, dienten diejenigen, die bei den
Hunnen geblieben waren, Attila treu und folgten ihm sogar unter
drei kniglichen gotischen Brdern Valamir, Tiudimir und
Vidimir nach Gallien. Sie bernahmen auch viele hunnische
Gepogenheiten, ihre Kleidung, die Waen und sogar die Sitte,
die Kpfe der Kinder zu deformieren. Einen weiteren Beweis fr
die enge Beziehung zwischen den Hunnen und den Goten bietet
die Verwendung gemeinsamer Namen. Sogar der Name Attila
stammt wie viele andere Hunnennamen aus dem Gotischen,
whrend Goten ihrerseits hunnische Namen trugen. Obwohl
die Goten den Hunnen dienten, behielten sie doch ihre eigenen
Organisationsformen bei und festigten sogar ihr Identittsge-
fhl durch Wahrung der Traditionen ihrer frheren Knige. Als
jedoch nach 453 die hunnische Konfderation mit Attilas Tod
zusammenbrach, entstanden eine neue Identitt und ein neuer
Name fr diese Gruppe: die Ostgoten.
Nach dem Zerfall der hunnischen Konfderation schlossen
einige der nun wieder unabhngigen Ostgoten wie viele andere
frhere Mitglieder der Konfderation, etwa die Gepiden und
die Rugier, einen Vertrag mit dem Rmischen Reich und wur-
den als Fderaten in Pannonien angesiedelt. Ein gentiles Heer
wie die Ostgoten konnte nur in einer Region gedeihen, in der
die rmische Landwirtschafsstruktur noch intakt war. Aber in
Pannonien war diese durch die Kmpfe mit den Barbaren lngst
zerstrt. So waren die Ostgoten immer, wenn die regelmigen
Zahlungen aus dem Reich ausblieben, versucht, ihren Vertrag
zu brechen und Raubzge in das Reich zu unternehmen. Als
102
Ergebnis einer solchen Revolte im Jahre 459 wurde Teoderich,
der kleine Sohn des Tiudimir, als Geisel nach Konstantinopel
gebracht. Er lebte dort vom 8. bis zum 8. Lebensjahr und erwarb
in dieser Zeit eine sehr genaue Kenntnis des Imperiums und
besonders des kaiserlichen Regierungssystems. Kurz nach sei-
ner Heimkehr bernahm Teoderich beim Tode seines Onkels
Valamir zusammen mit seinem Vater das Knigreich und fhrte
kurze Zeit spter die Goten nach Makedonien, wie es Alarich im
Jahrhundert zuvor mit den Westgoten getan hatte. Hier agierte
er weit erfolgreicher als jener in den politischen Machtkmpfen
des Imperiums und erlangte durch seine Zusammenarbeit mit
Kaiser Zeno die Stellung des magister militum, im Jahre 484 das
Konsulat und das rmische Brgerrecht; er wurde wie die Kaiser
ein Flavier. Dennoch war er stets bereit, zur Strkung der eigenen
Position seine Armee gegen den Kaiser einzusetzen.
In der Honung, sich sowohl von Teoderich als auch von
dem germanischen Knig Odoaker befreien zu knnen, beauf-
tragte Zeno Teoderich im Jahre 488 mit dessen Vernichtung.
Zu diesem Zweck sammelte Teoderich ein buntes Heer aus
Barbaren und Rmern, begann seinen siegreichen Kampf gegen
Odoaker und wurde whrend des Jahres 493 der unumstrittene
Machthaber in Italien. Der Vertrag, der seine Invasion in Italien
legitimierte, hatte ihm so lange unumschrnkte Macht ber die
Halbinsel verliehen, bis Zeno persnlich das Oberkommando
bernehmen sollte. Aber in der Zwischenzeit starb Zeno, und
sein Nachfolger war so sehr mit anderen Problemen beschfigt,
da er nicht nach Westen ziehen konnte. So konnte Teoderich
ungehindert seinen eigenen Herrschafsbereich errichten.
Er versuchte, seine Macht durch ein doppeltes System zu fe-
stigen, das im Grunde mehr auf rmischen als auf barbarischen
Traditionen beruhte. Dazu nahm er sogar den oziellen Titel
Flavius Tbeodericus rex an. Die rmische Verfassung, nach der
die Bevlkerung Italiens weiterhin regiert wurde, lie er unan-
getastet. Im Gegenteil, als Flavius Teodericus reprsentierte
103
er den Kaiser und stand nach dessen Willen an der Spitze der
Regierung.
Die Barbaren, denen er seinen Sieg verdankte, waren kein Teil
dieses rmischen Verfassungssystems. Obwohl er als Knig der
Ostgoten zur Macht gekommen war und ausdrcklich an die
alte amalische Tradition angeknpf hatte, machte er keinen
Versuch, als Knig der Goten zu regieren. Er befehligte seine
barbarische Gefolgschaf, ob Ostgoten oder Angehrige anderer
Stmme, die ihm nach Italien gefolgt waren, als Bestandteil eines
gut organisierten Militrsystems, des exercitus Gothorum, einer
oziell als rmisch anerkannten Armee, die alle Mnner ohne
Rcksicht auf ihre Herkunf aufnahm.
In diesem doppelten System, dessen beide Krfe dieser durch
und durch rmische Gote, der als Barbar rmischer Brger ge-
worden war, wie kein anderer verkrperte, vollendete sich der
Proze der ostgotischen Stammesbildung. Teoderichs Einu
beschrnkte sich jedoch nicht auf die Barbaren Italiens. Als der
erfolgreichste barbarische Machthaber beherrschte er die Vlker
des Westens in einer losen Konfderation, die die Burgunder,
die Westgoten und im Norden die Alemannen und Franken
umfate.
Das Westrmische Reich und die Franken
Die Stammesbildung der westlichen Barbarenvlker verlief weni-
ger dramatisch als die der stlichen, erwies sich aber als historisch
weit folgenreicher. Diese Vlker entstanden ebenfalls im groen
germanischen Aufruhr der Markomannenkriege, als die von den
benachbarten kriegerischen Stmmen ausgehende Bedrohung
die Bildung neuer Konfderationen zwischen den Vlkern am
Rhein erzwang. Jedoch anders als die Goten, Burgunder, Lango-
barden und andere, die sich zwar erst im 4. Jahrhundert bilde-
104
ten, aber Namen und Traditionen fortfhrten, die sie mit alten
sdskandinavischen Vlkern verbanden, bewahrten die Franken,
Alemannen und Bajuwaren keine ihrer alten Stammestraditio-
nen. Obwohl sich die Alemannen im allgemeinen selbst Sueben
nannten, waren diese Stammesbndnisse vor ihrem Eintritt in
das Imperium weder in stabilen Knigreichen zusammengefat,
noch hinterlieen ihre inneren Angelegenheiten und selbst ihr
Aufreten innerhalb des Limes bei ihren rmischen Zeitgenos-
sen einen gengend starken Eindruck, da diese Notiz davon
genommen htten. Sie kamen weder als Invasionstruppe noch als
Fderaten. Vielmehr drangen kleine Gruppen von Kriegerbauern
langsam und fast unbemerkt ber den Rhein, um im rmischen
Heer zu dienen oder sich in den Westprovinzen des Imperiums
anzusiedeln.
Da die zeitgenssischen Autoren ber diese Vlker schweigen,
stellen deren schwierig zu deutende Bestattungsgewohnheiten
unsere wichtigste Informationsquelle ber die Vernderungen
innerhalb dieser germanischen Gemeinschafen zwischen Rhein
und Weser dar. Etwa um das Ende des 3. Jahrhunderts traten zum
ersten Mal im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen
militrischen Wandel neue kultische Gepogenheiten bei der
Anordnung der Grber in Erscheinung. Zum Beispiel haben
Archologen auf dem aus dem 4. Jahrhundert stammenden
Friedhof von Lampertheim stlich von Worms 56 Grabsttten
gefunden, die eine allmhliche Abkehr von den germanischen
Bestattungsbruchen bezeugen. Hier ndet man eine Vielzahl von
Bestattungsarten: Verbrennung, Urnenbestattung und Begrbnis
ohne Verbrennung. 29 Grber bargen keinerlei Grabbeigaben;
bis auf drei Ausnahmen enthielten alle anderen persnliche
Schmuckstcke und Gebrauchsgegenstnde, aber keine Waen.
Drei Grber waren jedoch Grabsttten von bewaneten Mn-
nern.
7
Im Laufe des 4. Jahrhunderts begann die Ausnahme zur Regel
zu werden; sowohl auerhalb als auch innerhalb des Limes wur-
105
den die Toten immer fer in Friedhfen beerdigt, die in Reihen
aufgeteilt und von Osten nach Westen oder von Norden nach
Sden ausgerichtet waren. Whrend die lteren germanischen
Grabsttten innerhalb des Imperiums keine Waen enthalten
hatten rmische Soldaten benutzten staatseigene Ausrstung,
kein persnliches Eigentum , gleichen die in diesen Grbern
gefundenen Waen und Juwelen in wachsendem Mae denen, die
man im freien Germanien gefunden hat. Aber auch die Grber
im freien Germanien enthielten immer mehr Produkte aus der
rmischen Provinz, wie beispielsweise Grtelverzierungen, die
wahrscheinlich von Soldaten, die im Imperium Kriegsdienst lei-
steten, nach Hause gebracht worden waren. Solche Reihengrber
waren sogar auf rmischen Provinzfriedhfen und in der Nach-
barschaf von rmischen Siedlungen aufzunden. Tatschlich
drfe dieser neue Friedhofstyp zuerst innerhalb oder in der
Nhe des rmischen Limes in Erscheinung getreten sein und sich
dann in Richtung auf das freie Germanien ausgebreitet haben.
Aus den archologischen Funden kann man beinahe schlieen,
da diese neue Sitte der Barbaren innerhalb der Grenzen des
Imperiums entstand. Im ganzen schuf die Militarisierung des
Rmischen Reiches in Nord- und Ostgallien eine Gesellschaf
von zunehmend reicheren germanischen Kriegern, die sowohl in
engem Kontakt mit ihren Verwandten und Freunden auerhalb
des Imperiums standen als auch enge gesellschafliche Verbin-
dungen mit der gallormischen Bevlkerung unterhielten.
Diese Form der Bestattung ist fr den grten Teil des nrd-
lichen Mitteleuropa so charakteristisch, da deutsche Forscher
den gesamten barbarischen Westen als Reihengrberzivilisation
beschrieben haben. Whrend aber frher Historiker, die die
barbarischen Wanderungen als tatschliche Bewegungen ganzer
Stmme verstanden, diese vernderten Begrbnisformen als
Zeichen fr die Ankunf neuer Vlker aus Skandinavien oder
von anderswo interpretiert haben, sieht die Forschung darin
heute einen Beleg fr den Wandel der sozialen, politischen und
106
kulturellen Strukturen von Vlkern, die bereits in West- und
Mitteleuropa lebten. Diese Vernderungen glichen jenen, die
einst aus den Goten eine starke und erfolgreiche Militrmacht
geformt hatten.
Dieselben Zwnge, welche die Markomannenkriege ausgelst
hatten, lieen innerhalb der westlichen germanischen Vlker
neue militrisch organisierte Bndnisse und Vlker entstehen.
Wie im Osten fhrten die Erfordernisse einer stndigen Kriegs-
fhrung zur wachsenden Bedeutung des Heerfhrers (dux
oder kuning) und zu einer zunehmenden Militarisierung der
Gesellschaf. Auf fortschreitende Militarisierung weisen auch
die neuen Begrbnisformen hin; nun wurden Krieger mit ihren
Waen beigesetzt. Ob man glaubte, da diese Waen in einem
Soldatenleben nach dem Tode gebraucht wurden, oder ob den
Verstorbenen die Mitnahme ihres persnlichen Eigentums zu-
stand, ist ungewi. Nach dem Reichtum der Schmuckstcke und
der Pracht der Waen in diesen Grbern zu urteilen, steht jedoch
fest, da der Gewinn fr diejenigen Gruppen, die den Proze der
Transformation vollzogen hatten, gro war.
Die westgermanische Revolution war so tiefgreifend, da die
meisten westgermanischen Stmme im Gegensatz zu den Goten,
Burgundern und anderen stlichen Barbaren, die einen alten
Namen weiterfhrten und so trotz vielfltiger sozialer Vern-
derungen ein Identittsbewutsein bewahrten, oensichtlich
noch nicht einmal einen klar umrissenen Abstammungsmythos
besaen; diesen bernahmen sie spter von anderen Vlkern.
Die Alemannen zum Beispiel hatten keine groe historische
Tradition. Ihr Name bedeutet wahrscheinlich einfach alle Mn-
ner, Menschen. Obwohl sie sich selbst manchmal als Sueben
bezeichneten, waren sie wahrscheinlich ein Zusammenschlu
kleinerer Stmme, die lange Zeit in der Region stlich des Rheins
und sdlich des Mains ansssig gewesen waren. Einige wenige
Ausflle ber den Rhein und die Donau hinaus zwischen der
Mitte des 3. und der Mitte des 5. Jahrhunderts, deren Bedeutung
107
und Strke von der Forschung vermutlich stark bertrieben
worden sind, legen von dem Proze der Stammesbildung, der
sich jenseits der Grenze vollzog, Zeugnis ab.
Kluge Archologen vermeiden es, ihre Fundstcke mit ethni-
schen Epitheta zu belegen; Totengebeine besitzen bekanntlich
keine Psse. Aber zweifellos belegt die Vielfalt des archologischen
Materials die Entstehung mehrerer neuer Vlker einschlielich
des Volkes, das sich vielleicht schon damals manchmal selbst als
die Franken bezeichnete.
108
III. Rmer und Franken im Knigreich Chlodwigs
Viele erzhlen aber, die Franken seien aus Pannonien gekommen
und htten sich zunchst an den Ufern des Rheins niedergelassen,
dann seien sie ber den Rhein gegangen und nach Toringien
gezogen, dort htten sie nach Gauen und Stadtbezirken gelockte
Knige ber sich gesetzt, aus ihrem ersten und sozusagen adlig-
sten Geschlecht.
ber die ltesten Frankenknige schrieb der heilige Hie-
ronymus, was schon vorher die Geschichte des Dichters Vergil
berichtet: Ihr erster Knig sei Priamus gewesen; als Troja durch
die List des Odysseus erobert wurde, seien sie von dort fortgezo-
gen und htten dann Friga als ihren Knig gehabt; sie htten sich
geteilt, und der erste Volksteil wre nach Mazedonien gezogen,
der andere htte unter Friga sie wurden als Frigier bezeichnet
Asien durchzogen und sich am Ufer der Donau und am Oze-
an niedergelassen; dann htten sie sich nochmals geteilt, und
die Hlfe von ihnen sei mit ihrem Knig Francio nach Europa
gezogen. Sie durchwanderten Europa und besetzten mit ihren
Frauen und Kindern das Ufer des Rheins; nicht weit vom Rhein
versuchten sie eine Stadt zu erbauen, die sie nach Troja benann-
ten. [Colonia Traiana, das heutige Xanten].
2
Die erste Version ber die Herkunf der Franken verfate
Gregor von Tours im spten 6. Jahrhundert, die zweite der frn-
kische Chronist Fredegar im 7. Jahrhundert. Sie gleichen einander
insofern, als beide oenbaren, da die Franken wenig ber ihre
Herkunf wuten und da sie gegenber anderen Vlkern der
Antike, die einen alten Namen und eine ruhmreiche Tradition be-
saen, ein gewisses Minderwertigkeitsgefhl empfunden haben
drfen. Die erste Legende verbindet die Franken mit der groen
Pannonischen Tiefebene, der Heimat des Martin von Tours, der
zum hchsten Schutzpatron der Franken aufsteigen sollte, und
dem ungefhren Ursprungsort der Goten, des Stammes mit der
109
grten Erfolgsgeschichte der Vlkerwanderungszeit. Damit gibt
die Legende zu verstehen, da die Franken den Goten in ihrem
Ursprung und infolgedessen in ihrer Ehre ebenbrtig sind. Die
zweite, sptere Legende verbindet die Ursprnge der Franken
mit denen der Rmer; und wenn sie gleich alt waren und aus
derselben Heldenstadt stammten, konnten die Franken und die
Rmer Galliens eine gemeinsame Abstammung als Grundlage
fr die Schaung einer gemeinsamen Gesellschaf fr sich in
Anspruch nehmen.
Die frnkische Ethnogenese
Natrlich sind beide Legenden Phantasieprodukte, denn noch
weniger als die meisten anderen barbarischen Vlker besaen
die Franken eine gemeinsame Geschichte, Abstammung oder
Tradition aus einer heroischen Wanderungszeit. Wie ihre aleman-
nischen Nachbarn waren sie im 6. Jahrhundert eine ziemlich neue
Grndung, ein Zusammenschlu rheinischer Stammesgruppen,
die lange Zeit unterschiedliche Identitten und Institutionen
bewahrten. Der Name Franke erscheint zum ersten Mal um
die Mitte des 3. Jahrhunderts in rmischen Quellen. Er bezeich-
nete eine Vielfalt sogenannter istwonischer Stmme, die so lose
miteinander verbunden waren, da es einige Forscher gnzlich
abgelehnt haben, in ihnen eine Gemeinschaf zu sehen, whrend
andere, ohne ihre Einheit kategorisch zu bestreiten, lediglich von
einem Stammesschwarm sprechen. Diese Gruppen umfaten
die Chamaven, Chattuarier, Brukterer, Amsivarier und Salier und
wahrscheinlich andere wie Usipeter, Tubanten, Hasier und Cha-
suarier. (Der Name Ripuarer ist brigens viel jnger; er erscheint
erst im 8. Jahrhundert. Der Name Sigambrer, der von Gregor von
Tours und anderen verwendet wird, ist wahrscheinlich nur eine
Reminiszenz an die von antiken Autoren erwhnten Sigambrer.)
Unter Wahrung ihrer Eigenstndigkeit verbanden sich diese klei-
110
nen Gruppen gelegentlich zu gemeinsamen Verteidigungs- oder
Angrisunternehmungen und identizierten sich dann selbst mit
dem Namen Franke, der soviel wie der Khne, der Tapfere
und spter, nachdem er sich verbreitet hatte, der Freie bedeu-
tete, ein von den Franken selbst bevorzugter Bedeutungsgehalt.
In Wirklichkeit waren die frhen Franken alles andere als frei.
Sie lebten in enger Nachbarschaf zum Imperium, waren relativ
unbedeutend und in sich gespalten, und sie existierten vor dem
6. Jahrhundert entweder als unterworfene, von Rom abhngige
Klientelstaaten oder dienten innerhalb des Limes als im allge-
meinen zuverlssige Lieferanten von militrischen Mannschaf-
ten und Ozieren. Zu Beginn des spten 3. Jahrhunderts hren
wir vereinzelt von frnkischen Raubzgen und Aufstnden
und sogar von frnkischen Piraten, die in den Mittelmeer-
raum eindrangen und Nordafrika und die spanische Kste in
der Nhe von Tarragona berelen. In der Regierungszeit von
Constantius Chlorus und Constantin wurden diese Aufstnde
grausam niedergeschlagen, ihre Anfhrer in den Arenen den
wilden Tieren vorgeworfen, und eine groe Zahl ihrer Krieger
wurde in die kaiserliche Armee eingereiht. Schlielich wurde die
als Salier bezeichnete Gruppe als laeti in dem Gebiet von Tox-
andrien (Tiesterbant in der Nhe des heutigen Kampen in den
Niederlanden) angesiedelt; sie sollten das Land rekultivieren, eine
Puerzone zwischen den zivilisierteren Regionen des Imperiums
und anderen, noch unvollstndig unterworfenen barbarischen
Vlkern bilden und nicht zuletzt als sicheres Reservoir frnki-
scher Rekruten fr die kaiserliche Armee dienen.
Diese brutale Behandlung der Franken war im groen und
ganzen wirksam. Von nun an stellten sie im Westen trotz gele-
gentlicher Versuche antirmischer Gruppen, ins Rmische Reich
einzudringen, ber ein Jahrhundert loyale Truppen und Heerfh-
rer. Wie wir gesehen haben, verhielten sich Franken wie Arbogast
und Mallobaudes sogar gegenber Stammesgenossen wie loyale
Oziere des Imperiums, und als 406 der Westen von der Invasion
111
der Vandalen, Alanen und Sueven bedroht wurde, erwiesen sich
die Franken im Kampf gegen sie als treue Verbndete.
Whrend der langen Zeit in rmischen Diensten, die nur
kurzlebige Aufstnde und Geplnkel unterbrachen, war es gar
nicht zu vermeiden, da die Identitt der Franken und ihre
politische und militrische Struktur durch die Begegnung mit
den Traditionen des Imperiums stark beeinut wurden. Der
Militrdienst war das bei weitem wichtigste Instrument der
Romanisierung, und die frnkischen Stmme am Mittel- und
Niederrhein waren davon mehr betroen als die meisten an-
deren. Diese tiefe Einwirkung und Vernderung wird in einem
solchen Beleg wie der Grabinschrif eines in Pannonien beige-
setzten Soldaten aus dem 3. Jahrhundert greifar: Francus ego
cives, miles romanus in armis (Franke bin ich meiner Nation
nach, als rmischer Soldat stehe ich unter Waen).
3
Da ein
Barbar zur Beschreibung seiner Identitt das lateinische civis
verwendete, einen Begri, der ohne jede Kenntnis der Traditio-
nen rmischer Staatskunst und Gesetzgebung unverstndlich
war, weist deutlich darauf hin, wie stark die frnkische Gesell-
schaf zu einem integralen Teil des Imperiums geworden war.
Die zweite Hlfe der Inschrif ist nicht weniger bezeichnend:
Ein Franke der Nation nach war tatschlich ein rmischer
Soldat, und in zunehmendem Mae fand man seine Identitt
als Franke im Unterschied zu den engeren Kategorien als
Chamaver, Chatte, Brukterer, Amsivarer oder Salier durch
den Dienst in der rmischen Armee.
Solche Dienste wurden reich belohnt, und nach und nach
rckten die Salier im 5. Jahrhundert aus ihrem toxandrischen
Reservat in die strker romanisierten Gebiete des heutigen
Belgien und des nrdlichen Frankreich und am Unterrhein vor,
wobei sie in das angestammte Gebiet der Tringer eindrangen.
Diese Expansion verlief im wesentlichen friedlich, allerdings
mute der rmische General Aetius im Jahre 428 und erneut
um 450 frnkische Aufstnde, die von dem salischen Frsten
112
Chlodio angefhrt wurden, niederschlagen. Solche gewaltttigen
Zwischenspiele verhinderten jedoch zu anderen Zeiten keines-
wegs eine enge Zusammenarbeit, wie der Beitrag der Franken
zum Sieg des Aetius ber die Hunnen im Jahre 45 in der Nhe
von Orleans beweist.
Im Laufe des 5. Jahrhunderts bernahmen die Salier die Herr-
schaf ber den Stammesschwarm der Franken unter der
Fhrung von Chlodios Sippe, der auch Merovech, mglicher-
weise, aber nicht nachweislich einer seiner Shne, und dessen
Nachfolger Childerich, wiederum mglicherweise ein Sohn
Chlodios, angehrten. Wie auch immer diese salischen Frsten
miteinander verwandt waren, sie gehrten mit Sicherheit zur
salischen Fhrungsgruppe und pegten wie andere Adelsfamilien
die Gewohnheit, ihr Haar lang wachsen zu lassen. Auf diese Sitte
geht ihre sptere Charakterisierung als reges criniti, als langhaa-
rige Knige, zurck.
Childerich, einer der Stammesfhrer aus der Sippe Chlodios,
bernahm die Fhrung der Franken vor dem Jahr 463 und war
der letzte frnkische Heerfhrer, der die Tradition des Militr-
dienstes als Reichsgermane fortsetzte. Wir wissen, da er unter
dem Oberbefehl des gallischen Heerfhrers Aegidius 463 bei
Orleans gegen die Westgoten kmpfe und erneut 469 bei Angers
unter dem rmischen Befehlshaber oder comes Paulus. Obwohl
gewisse Dierenzen dazu fhrten, da er Nordgallien verlie
und ins Exil nach Turingia ging, wobei Unklarheit darber
besteht, ob Tringen jenseits des Rheins oder einfach Tournai
gemeint ist, blieb er der Welt der sptrmischen Zivilisation eng
verbunden. Historiker haben sogar mit Recht vermutet, er habe
nach seiner Verbannung durch den rmischen Kommandanten
Galliens unmittelbare Hilfe von Konstantinopel erhalten. Die
prchtigen Grabbeigaben, die 653 in Tournai, dem Zentrum
seiner Macht, gefunden wurden, belegen den Wohlstand und
die internationalen Verbindungen eines erfolgreichen Fdera-
ten im spten 5. Jahrhundert. Die Waen, Juwelen und Mnzen,
113
mit denen er bei seinem Tode im Jahre 482 beigesetzt wurde,
stammten aus byzantinischen, hunnischen, germanischen und
gallormischen Werksttten. Dienste fr Rom waren immer noch
der sicherste Weg, Reichtum und Macht zu gewinnen.
Aber die rmische Welt, der er diente, unterschied sich immer
weniger von seiner eigenen. Aegidius selbst hatte nach der Er-
mordung des Kaisers Mariorian im Jahre 46 die Beziehungen zu
Rom abgebrochen und war ein Gegner des mchtigen Rikimer.
Aegidius war durch die Territorien der Burgunder und Goten
von den unter unmittelbarer Kontrolle der Reichsarmee stehen-
den Gebieten getrennt und befehligte seine Gefolgschaf von
seiner Festung in Soissons aus weniger kraf einer oziellen
rmischen Funktion als durch die Macht seiner barbarischen
bucellarii, seiner Privatarmee. Nach seinem Tod im Jahre 464 ber-
nahm sein Sohn Syagrius seine Position, und der sptere Bericht
des Gregor von Tours, er sei zum rex Romanorum, zum Knig
der Rmer, gewhlt worden, ein durch und durch barbarischer
Titel, beschreibt wahrscheinlich sehr genau seine Stellung. Ob
Syagrius nun einen rmischen Titel, mglicherweise den eines
patricius, fhrte oder nicht, die reale Grundlage seiner Macht
bestand darin, da er von seiner barbarischen Armee zum Knig,
das heit zum militrischen Anfhrer, erhoben worden war. Tat-
schlich mgen die Rmer Syagrius fr einen Verrter gehalten
haben, als nach dem Friedensschlu im Jahr 475 Kaiser Julius
Nepos praktisch ganz Gallien an die Westgoten abtrat. Aber er
war nicht der einzige Herrscher ber ein Barbarenvolk nrdlich
der Loire. Das Grab Childerichs enthielt einen Siegelring mit der
Inschrif Childirici regis.
Die grte Macht im Westen war das Knigreich der Westgoten,
und Childerich war ein zu kluger Herrscher, um diesem gegen-
ber eine eindeutig feindselige Haltung einzunehmen. Da seine
Schwester mit einem Westgotenknig verheiratet war, beweist,
da er gute Beziehungen zu dem zwar andersglubigen, aber
legitimen Knigreich von Toulouse aufgebaut hatte. Aber wie
114
andere barbarische Herrscher in rmischen Diensten vor ihm,
unterhielt Childerich zugleich auch gute Beziehungen zu der
gallormischen Gesellschaf sowohl im Knigreich von Soissons
als auch oensichtlich in jenen Gebieten, die zu seinem unmit-
telbaren Herrschafsbereich gehrten. Obwohl er ein Heide war,
der allerdings strker in der rmischen als in der germanischen
Tradition verhafet war, galt er als Beschtzer der Romanitas
und damit auch der orthodoxen christlichen Kirche. Durch sein
huges Zusammenwirken mit Aegidius und Syagrius sowie
durch seine freundschaflichen Beziehungen zu gallormischen
Bischfen baute er seine Position nicht nur innerhalb seiner
frnkischen Kriegergefolgschaf, sondern auch im Rahmen der
bestehenden rmischen Machtstrukturen aus. Insgesamt schuf er
damit die Grundlage fr den Aufstieg seines Sohnes Chlodwig,
der 482 seine Nachfolge antrat.
Chlodwig
Nach dem Tod Childerichs ging die Fhrung der salischen
Franken auf seinen Sohn Chlodwig ber, der die Politik seines
Vaters fortsetzte. Ein Brief, den der gallormische Bischof Remi-
gius von Reims unmittelbar nach Childerichs Tod schrieb, zeigt,
da der junge Franke von der gallormischen Fhrungsschicht
als Administrator der Belgica Secunda anerkannt wurde und
da man von ihm erwartete, da er die christliche rmische
Gemeinde untersttzen werde, obwohl er ein Heide war: Ein
groes Gercht hat uns erreicht, da Ihr die Verwaltung der
Belgica Secunda bernommen habt. Es ist nicht verwunderlich,
da Ihr genauso begonnen habt, wie es Eure Vorvter immer
getan haben Eure Gunsterweise mssen rein und ehrlich sein.
Ihr mt Eure Bischfe ehren und immer auf ihren Rat hren.
Solange Ihr in bereinstimmung mit ihnen steht, wird Eure
Provinz gedeihen.
4
115
Diese Empfehlung an einen heidnischen Frsten, sein Amt ge-
recht auszuben und den Rat der Bischfe zu suchen, entsprach
keineswegs einer neuen Lage der Dinge, sondern beschrieb
lediglich die Tradition der reichsgermanischen Herrscher, die
im Dienst der inzwischen christianisierten Romanitas standen.
Chlodwig tat oensichtlich einige Jahre lang, was von ihm erwar-
tet wurde, aber die Neigung militrischer Fhrer, ihre Herrschaf
auszudehnen, und der Tod des mchtigen Westgotenknigs Eu-
rich, der im Westen ein Machtvakuum hinterlie, lenkten seine
Aufmerksamkeit auf das Knigreich des Syagrius, das wahrschein-
lich die Provinz Lyon und Teile der Belgica Secunda einschlo.
486 begann Chlodwig mit Hilfe anderer frnkischer Frsten
einen Krieg gegen Syagrius, der in einer einzigen Schlacht in der
Nhe von Soissons entschieden wurde. Syagrius wurde besiegt,
und obwohl er entkam und zu dem Westgotenknig Alarich
II. oh, wurde er an Chlodwig ausgeliefert, der ihn heimlich
ermorden lie.
Die Annexion des Knigreichs von Soissons durch Chlodwig
war in mancher Hinsicht ein Staatsstreich: Ein romanisierter
Barbarenknig trat an die Stelle eines rmischen rex. Chlodwig
bernahm unverndert das, was von den bucellarii des Syagrius
briggeblieben war, die rmische Provinzverwaltung, das Perso-
nal der Provinzregierung sowie das Fiskalland, das vorher Aegidi-
us und Syagrius beherrscht hatten. Wie Gregor von Tours, unsere
wichtigste Quelle, ber zwei Generationen spter schrieb, wurde
seine Stellung auch vom gallormischen Adel wenigstens formal
anerkannt. Aber Chlodwigs Sieg hatte noch weiterreichende
Wirkungen. Schon zuvor hatten sich einige frnkische Gruppen
im Knigreich von Soissons niedergelassen, vielleicht waren sie
nach Childerichs Verbannung dort geblieben. Eventuell wurde
der Feldzug Chlodwigs gegen Syagrius auch von seinem Wunsch
geleitet, die Herrschaf ber diese Franken wiederherzustellen.
Sein Sieg beschleunigte die Migration frnkischer Gruppen von
Norden nach Sden, so da das Kernland des Syagriusreiches
116
rasch zum frnkischen Machtzentrum wurde. Dies zeigt sich am
deutlichsten in der Verfgung, die Chlodwig ber seine Bestat-
tung traf. Whrend sein Vater das Gebiet von Tournai zu seinem
Machtzentrum erhoben hatte, wo er auch beigesetzt worden war,
wurde Chlodwig im Jahre 5 in Paris beerdigt.
Wollte der ehrgeizige Barbarenknig Chlodwig im frhen 6.
Jahrhundert seine Macht festigen, so mute er sich mit anderen
Krfen im Westen auseinandersetzen, und zwar zunchst mit
den anderen keltischen, germanischen und frnkischen Vlkern
beiderseits des Rheins einschlielich der Armoricaner, Tringer,
Alemannen und Burgunder, spter mit dem rmischen Imperi-
um, das nun auf den Osten geschrumpf war, den Westgoten von
Toulouse und Spanien und den Ostgoten von Italien.
Die Chronologie der Regierungszeit Chlodwigs ist honungs-
los unklar; sogar die Identitt der verschiedenen Vlker, die er
besiegt und in sein Knigreich aufgenommen haben soll, ist
zweifelhaf. Anscheinend erkmpfe er zuerst gegen die Kelten
der Region Armorica eine Pattsituation, wobei er bestenfalls eine
sehr begrenzte Anerkennung der frnkischen Vorherrschaf in
dieser Landschaf erzielte. Nach Gregor unterwarf er um 49
die Tringer, vermutlich nicht die auf der rechten Rheinseite
angesiedelten, sondern eine kleine Gruppe, die wie die Franken
ber den Niederrhein abgewandert war. Aller Wahrscheinlichkeit
nach war die Unterwerfung eine viel langwierigere Angelegen-
heit, als Gregor glauben machen wollte; die Kampfandlungen
dauerten mindestens bis 502, wenn nicht noch lnger. Chlodwigs
dritter und wichtigster Sieg ber Barbaren war der ber die Ale-
mannen. Den entscheidenden Sieg errang er bei Tolbiacum, dem
heutigen Zlpich sdwestlich von Kln, wahrscheinlich um 497.
Eine ansehnliche Zahl der Alemannen chtete jedoch in das
Gebiet von Rtien sdlich des Bodensees und des Oberrheins,
wo der Ostgote Teoderich sie unter seinen Schutz nahm. Nach
der Niederwerfung der Tringer und der Alemannen wurde
Chlodwig um das Jahr 500 in einen ergebnislosen Kampf gegen
117
die Burgunder verwickelt, der durch Vermittlung Teoderichs
endete.
Wie schon sein Vater vor ihm festigte Chlodwig die Beziehungen
zu den gotischen Knigreichen durch Heiraten. Vielleicht nahm
er sogar die Religion der Goten an. Trotz der anderslautenden
Darstellung des Gregor von Tours, der seinen Bericht zwei Ge-
nerationen nach dem Tod Chlodwigs niederschrieb und von ihm
ein Bild schuf, das mit den bruchstckhafen Kenntnissen, die
wir ber den historischen Chlodwig besitzen, kaum in Einklang
zu bringen ist, vermuten der britische Historiker Ian Wood und
sein deutscher Kollege Friedrich Prinz, da Chlodwig mit dem
Gedanken gespielt habe, zum Arianismus bzw. Quasiarianismus
seiner gotischen und burgundischen Nachbarn berzutreten,
und vielleicht sogar konvertierte.
5
Angesichts der Stellung, die
der frnkische Herrscher in der lockeren ostgotischen Konfde-
ration einnahm, erscheint diese Vermutung durchaus plausibel.
Whrend seiner gesamten Regierungszeit bewahrte Chlodwig
eine respektvolle, wenn auch nicht immer bequeme Haltung
gegenber dem groen ostgotischen Knig Teoderich, nach
welchem er sogar seinen ltesten Sohn benannte, und der zwar
Gegner Chlodwigs wie die Alemannen beschtzte, aber auch
eine vorbergehende Waenruhe zwischen Chlodwig und dem
Westgotenknig Alarich II. vermittelte.
Schlielich entschlo sich Chlodwig jedoch, den Entschei-
dungskampf mit den Goten vor allem sdlich der Loire zu wagen.
Sicherlich hing diese Entscheidung mit seinem vieldiskutierten,
aber gnzlich im dunkeln liegenden bertritt zum Christentum
zusammen, der in Reims am Weihnachtsfest des Jahres 496, 498
oder auch erst 506 erfolgte. Welchem Glauben Chlodwig dabei
den Rcken kehrte, ist nicht gesichert. Nach Gregor von Tours
war es ein Polytheismus, zu dem insbesondere die rmischen
Gtter Saturn, Jupiter, Mars und Merkur gehrten. Diese Behaup-
tung mu nicht unbedingt ein Fall von interpretatio Romana sein.
Wie wir gesehen haben, huldigten die barbarischen Heerfhrer
118
in rmischen Diensten bereits seit langer Zeit der rmischen
Staatsreligion. Eine andere oder auch zustzliche Mglichkeit
besteht darin, da Chlodwig einem synkretistischen frnkischen
Polytheismus abschwor; dazu gehrte ein Meeresgott, der teils
ein Meeresungeheuer, teils Mensch und teils Stier war und eine
besondere Familiengottheit der Merowinger gewesen zu sein
scheint, wie die Nachfolger Chlodwigs nach dem legendren
Urahn der Sippe Merowech benannt wurden.
Schlielich oder vielleicht zustzlich kann sich Chlodwig, wenn
die Tesen von Wood und Prinz zutreen, von einem politisch
motivierten Arianismus abgewandt haben.
Ebenfalls problematisch bleibt, zu welcher Religion er bertrat.
Angesichts der synkretistischen Natur der sptantiken Religion
ist die Annahme keineswegs zwingend, da der bertritt zum
Christentum eine Konversion zu einem radikalen Monotheismus
darstellte; Chlodwig kann Christus auch durchaus als einen zu-
stzlichen mchtigen, siegverleihenden Verbndeten angesehen
haben, den man fr sich gewinnen mute. Die Bedeutung seiner
Konversion, wie sie von Gregor beschrieben wurde, widerspricht
dem sicherlich nicht. Nach Gregor war es Chlodwigs orthodoxe
burgundische Ehefrau Chrodechild, die ihn als erste drngte, ihre
Religion anzunehmen. Der entscheidende Ansto kam jedoch
wie zwei Jahrhunderte zuvor fr den ehrgeizigen heidnischen Im-
perator Konstantin den Groen in der Schlacht. Als Chlodwig bei
Tolbiacum von den Alemannen bedrngt wurde, gelobte er, sich
im Falle des Sieges taufen zu lassen. Die Parallele zu Konstantin,
auf die Gregor ausdrcklich verweist, war unmiverstndlich.
Um welche Art von Konversion es sich auch handelte, eine
persnliche Angelegenheit war sie jedenfalls nicht. Die Religion
des Frankenknigs war ein wesentlicher Bestandteil der Identitt
und des militrischen Erfolges eines ganzen Volkes, das von ihm
sein Selbstverstndnis und seinen Zusammenhalt bezog. Die
Konversion des Knigs bedeutete notwendigerweise auch die
Konversion seiner Gefolgschaf. Daher ist es kein Wunder, da
119
Gregor berichtet, Chlodwig habe vor seiner Taufe sein Volk
vermutlich seine wichtigsten Gefolgsleute befragt. Und es
verwundert auch nicht, da nicht er allein getauf wurde, sondern
gleichzeitig mehr als 3000 aus seinem Heer die Taufe emp-
ngen. Wenn auch viele Franken ihrem Knig zum Taufecken
folgten, war die Konversion zweifellos eine militrische Angele-
genheit, die Anerkennung eines neuen und mchtigen, den Sieg
verleihenden Gottes durch den Befehlshaber und sein Heer.
Die Konversion Chlodwigs zum orthodoxen Christentum
hatte uerst weitreichende Auswirkungen nach innen wie
nach auen. Die siegreichen Franken waren wie andere germa-
nische Vlker auch primr ein Heer, das zwar das Monopol der
militrischen Machtausbung besa, aber insgesamt nur eine
Minderheit unter der Gesamtbevlkerung bildete und keinerlei
Erfahrung in der Zivilverwaltung und auf anderen Gebieten
besa, wie sie zum Erhalt einer Gesellschaf unabdingbar sind.
Nun trennte dieses Heer kein kultisches Hindernis mehr von den
einheimischen Bewohnern Galliens, den Bauern, Handwerkern
und, was besonders wichtig ist, dem gallormischen Adel und
seinen Fhrungsschichten, den Bischfen, fr die die Religion
ein ebenso wichtiges Element ihrer Identitt darstellte wie fr die
Franken. Die Christianisierung ermglichte nicht nur eine enge
Zusammenarbeit zwischen Gallormern und Franken, wie sie in
den gotischen und burgundischen Knigreichen schon lange die
Regel gewesen war, sondern auch eine wirkliche Verschmelzung
der beiden Vlker, ein Proze, der im 6. Jahrhundert auf allen
Ebenen in vollem Gange war.
Nach auen war die Konversion gleichbedeutend mit einer
Ablehnung der religisen Traditionen der Nachbarn der Franken,
nmlich der Goten und des arianischen Teils der Burgunder, und
fr beide Knigreiche stellte sie eine unmittelbare Bedrohung
dar. Gregor behauptete, da der orthodoxe Konvertit Chlodwig
es unertrglich fand, da diese Arianer noch einen Teil Galliens
besitzen, aber das war kaum der Grund.
6
Vielmehr ernete die
120
Zugehrigkeit zur Orthodoxie diesem auf Expansion bedachten
Herrscher die Aussicht darauf, die gallormische Aristokratie
der Nachbarknigreiche zur Zusammenarbeit gewinnen zu
knnen. Somit bedrohte die Konversion des Knigs die innere
Stabilitt seiner beiden Nachbarn, und ungeachtet der unsicheren
Chronologie mu sie als Teil der frnkischen Herausforderung
der gotischen Vorherrschaf und der burgundischen Prsenz im
Westen betrachtet werden.
Die relative Schwche des westgotischen Knigreiches von
Toulouse nach dem Tod Eurichs ermutigte Chlodwig zweifellos
zur Expansion nach Sden. Hinzu kam, da Chlodwig nun als
Nachfolger des Syagrius mit den Westgoten eine ungesicherte
Grenze teilte, die er mit seinen Franken im Jahre 498 bereits in
einem Zug nach Bordeaux berschritten hatte. Danach beschf-
tigten ihn seine Kmpfe gegen die Alemannen und Burgunder,
aber um 507 hatte er die Hnde frei, um sich erneut gegen das
westgotische Knigreich sdlich der Loire wenden zu knnen.
Der Feldzug war gut vorbereitet; es nahmen daran einige Burgun-
der teil sowie Truppen, die von seinem rheinischen Verwandten
Chloderich, dem Sohn des Knigs Sigibert von Kln, angefhrt
wurden. Chlodwig hatte einen Vertrag mit Kaiser Anastasius
geschlossen; die Expedition war mit byzantinischen Flottenbe-
wegungen vor der italischen Kste abgestimmt worden, die den
Ostgoten Teoderich erfolgreich daran hinderten, den Westgoten
zu Hilfe zu eilen. Bei Vouill nordwestlich von Poitiers wurden
die Goten vollstndig besiegt. Alarich II. el, und im Jahr darauf
wurden die gotische Hauptstadt Toulouse eingenommen und
die gotische Prsenz nrdlich der Pyrenen auf einen schmalen
Kstenstreifen bei Narbonne im uersten Osten reduziert.
Auf seiner triumphalen Heimreise wurde Chlodwig in Tours
von Abgesandten des Kaisers Anastasius aufgesucht, der ihn in
einer oziellen Urkunde zum Ehrenkonsul erhob. Chlodwig
nutzte diese Ehrung, die oensichtlich die kaiserliche Aner-
kennung seines Knigtums oder zumindest die symbolische
121
Adoption in die kaiserliche Familie einschlo, um seine Macht
ber die neugewonnenen Gallormer zu festigen. Er erschien in
der Basilika Sankt Martin von Tours, bekleidet mit einem Pur-
purumhang und einem Chlamys oder Militrgewand, und setzte
sich ein Diadem aufs Haupt. Keines dieser Symbole gehrte zur
konsularischen Tradition, aber vielleicht wollte er sein Knigtum
durch die Verbindung mit der rmisch-kaiserlichen Tradition
aufwerten. Mit einer berhmt gewordenen, wenn auch zweideu-
tigen Formulierung behauptet Gregor, da er von diesem Tage
an Konsul oder Augustus genannt wurde.
7
Welche Bedeutung dieses Ritual auch besa, Chlodwig wandte
sich bald der praktischen Durchsetzung seiner Ansprche zu und
ging daran, seine Position innerhalb der Franken abzusichern.
Vom erfolgreichsten Anfhrer dieses multizentralen Verbandes
war er zu einer Machtflle aufgestiegen, wie sie kein Barbar
nrdlich der Alpen vor ihm besa. Nun verdrngte er andere
frnkische Frsten, die zum groen Teil aus seiner eigenen Sippe
stammten, um seine Macht ber die Franken ebenso wie zuvor
jene ber die Gallormer zu festigen. Dabei verfuhr er ebenso
brutal wie wirkungsvoll. Unter anderem liquidierte er die ge-
samte Familie des Knigs Sigibert, der die am Rhein bei Kln
siedelnden Franken regierte; er lie den rivalisierenden salischen
Anfhrer Chararich und dessen Sohn hinrichten und veranla-
te die Ermordung des Ragnachar, eines frnkischen Knigs in
Cambrai. Zur Zeit Gregors waren die skrupellosen und klugen
Manver Knig Chlodwigs schon zur Legende verklrt worden,
und zweifellos zhlten ihm gewidmete, mndlich tradierte Ge-
dichte oder Gesnge zu den Quellen Gregors. Doch selbst diese
legendren, von einem gallormischen Bischof berlieferten
Darstellungen vermitteln noch einen Eindruck von der Persn-
lichkeit und dem politischen Scharfsinn Chlodwigs. Er achtete
sorgfltig darauf, jeweils nicht nur den Besitz seines Opfers an
sich zu ziehen, sondern auch dessen leudes, das engste Gefolge.
Gegen Ende seines Lebens, so berichtet Gregor, klagte er gerne:
122
Weh mir, da ich nun wie ein Fremdling unter Fremden stehe,
und keine Verwandten mehr habe, die mir, wenn das Unglck
ber mich kommen sollte, Hilfe gewhren knnten!
8
Wie Gregor
versichert, entsprang diese Klage jedoch nicht der Trauer um die
toten Verwandten, sondern der Honung, noch einen lebenden
zu nden, den er ermorden knnte.
Die Herrschaf ber das Frankenreich:
die bernahme der rmischen Verwaltungsstrukturen
Nach den meisten Beschreibungen beruhte die Herrschaft
Chlodwigs ber seine umfangreichen Eroberungen auf Angst
und persnlichem Charisma. Gregors Schilderungen der Mor-
de Chlodwigs an seinen Verwandten und der brutalen Rache
an einem frnkischen Krieger, der es gewagt hatte, um seinen
Anteil an der bei Soissons gemachten Beute zu streiten, verstr-
ken das Bild vom barbarischen Eroberer, der schnell zur Lge
und noch schneller zur Streitaxt gri. Mglicherweise besa
er solche Charaktereigenschafen, aber deshalb waren sie nicht
typisch barbarisch; sie zierten auch so manchen sptrmischen
Kaiser. Jedenfalls htten sie allein nicht gengt, um soviel Land
zu erobern, und erst recht nicht zur Schaung eines Knigreichs,
das nach seinem Tode zwar geschwcht und geteilt wurde, aber
doch als ansehnliches Erbe an seine Nachfolger berging. Die
auerordentliche Heterogenitt der von ihm eroberten Lnder
und Vlker umfate vielfltige politische, soziale und religise
Ordnungssysteme, die zu einem zusammenhngenden und
stabilen Herrschafsbereich verbunden werden muten. Anders
als die Reiche Attilas, Teoderichs und der meisten barbarischen
Eroberer blieb das Knigreich Chlodwigs und seiner Familie aber
ber Jahrhunderte bestehen.
Da Attila keine Dynastie grndete, berrascht kaum. Auf-
stieg und Fall solcher charismatischen Herrscher waren in der
123
Antike nichts Ungewhnliches. Strkere Beachtung verdient das
Schicksal des gotischen Knigreiches Teoderichs. Seine glanz-
volle Schpfung hatte zwei fatale Schwchen. Erstens unternahm
Teoderich nie den Versuch, die rmische mit der gotischen
Gesellschaf zu verschmelzen, und hinterlie daher seinen Nach-
folgern ein instabiles Erbe. Von entscheidender Bedeutung war
aber zweitens, da Italien von Konstantinopel und dem Zentrum
rmischer Macht einfach nicht weit genug entfernt war, als da
man ihm erlaubt htte, eigene Wege zu gehen.
Teoderich hatte versucht, zwei Traditionen getrennt vonein-
ander aufrechtzuerhalten, diejenige seiner christlich-orthodoxen
rmischen Bevlkerung und die des arianischen Gotenheeres,
das zum groen Teil um Ravenna, Verona und Pavia siedelte.
Aber Angehrige seiner eigenen Familie erlagen der Anzie-
hungskraf der rmischen Tradition und Kultur, so da sich die
nchste Generation der Amaler nach seinem Tode (526) dem
strker traditionsgebundenen gotischen Adel entfremdete und
untereinander hefig zerstritten war. Daher plante schlielich
Amalaswintha, die Tochter Teoderichs und Regentin fr ihren
minderjhrigen Sohn Athalarich (526-534), mit Kaiser Justinian
zu einem Ausgleich zu kommen. Ihre Ermordung im Jahre 535
bot Justinian den Anla, den Goten den Krieg zu erklren; der
folgende zwanzigjhrige blutige Konikt vernichtete die Ostgoten
und hinterlie ein zerstrtes Italien.
Im Gegensatz zum glanzvollen, aber dem Untergang geweih-
ten Reich Teoderichs in Italien mischten sich im Knigreich
Chlodwigs von Anfang an frnkische und rmische Traditionen.
Auerdem lagen Gallien und Germanien so weit am Rande der
byzantinischen Interessensphre, da sie bei Justinian und sei-
nen Nachfolgern kaum mehr als eine oberchliche Beachtung
fanden. Daher konnten die Franken in relativer Ruhe die Folgen
ihrer Eroberungen verarbeiten.
Ein Teil der erfolgreichen Aufbaupolitik Chlodwigs kann
zweifellos seinem durch das lange Haar und die mythische Ab-
124
stammung seiner Ahnen begrndeten Charisma sowie seiner
Fhigkeit zugeschrieben werden, andere davon zu berzeugen,
da dieses Charisma allein durch seine Person an zuknfige
Generationen weitergereicht werden knne. Gleichwohl darf dies
nicht berbewertet werden. Fr die Errichtung einer dauerhafen
und eektiven Herrschaf war das rmische Erbe sowohl der
Eroberer als auch der Unterworfenen weit bedeutsamer.
Die einheimische Bevlkerung im Norden, vor allem aber in
Aquitanien, dem Gebiet sdlich der Loire, das zum westgotischen
Knigreich gehrt hatte, hatte die sptrmische Infrastruktur
praktisch unverndert beibehalten. Sie pegte nach wie vor die
lateinische Bildung und Sprache und lebte weiterhin nach rmi-
schem Recht; aber auch die rmische Fiskal- und Agrarstruktur
sowie das Netz rmischer Straen, Stdte und Handelsverbin-
dungen war ohne ernsthafe Lcken erhalten geblieben. Dies
alles und die Reste der weiterhin ttigen rmischen Verwaltung
erbten die Franken. Nach ihrem Sieg konnten Chlodwigs Fran-
ken, die an eine enge Zusammenarbeit mit den Rmern gewhnt
waren, diese Verwaltung ohne Schwierigkeiten in ihre eigenen
administrativen Strukturen einbeziehen.
Ihrerseits wurden die Franken tiefgreifend romanisiert. Chlod-
wig und seine Franken waren schon vor dem Sieg bei Soissons an
rmische Disziplin gewhnt. Ganze Generationen von Franken
in rmischen Diensten hatten Organisation und Machtausbung
der Rmer kennengelernt. Dieses Erbe zeigt sich sogar im sali-
schen Recht, der vermutlich am strksten frnkisch geprgten
Tradition. Zwischen 508 und 5 erlie Chlodwig den Pactus
Legis Salicae, einen ebenso grundlegenden wie umstrittenen
Text, der in unserer Betrachtung der frnkischen Gesellschaf
noch mehrfach erwhnt werden wird. In seiner ltesten ber-
lieferungsform besteht der Pactus aus 65 Kapiteln und ist nach
dem westgotischen Gesetz das lteste Beispiel einer schriflichen
Rechtssammlung eines barbarischen Knigreichs. Schriflich
xierte Gesetze beruhten auf keiner barbarischen Tradition;
125
die Kodizierung von Gewohnheitsrecht in noch so unsyste-
matischer Form konnte nur unter dem Einu des rmischen
Rechts entstehen und nur von Menschen durchgefhrt werden,
die in dieser Tradition gebt waren. Der Text ist in lateinischer
Sprache abgefat; die Hypothese, es handle sich um die ber-
setzung einer verlorengegangenen frnkischen Version, hat die
Wissenschaf lngst aufgegeben. Merkmale des rmischen Rechts
und rmischer Rechtsorganisation zeigen sich schon in der Form
des Textes. Mit der Verentlichung des Gesetzeswerks handelte
Chlodwig nicht als Barbarenknig, sondern als rechtmiger
Herrscher ber einen Teil der romanisierten Welt. Auerdem gilt
der Pactus nicht nur fr die Franken, sondern fr alle barbari,
Nichtrmer, seines Knigreiches.
Der grte Teil des Pactus stellt keine neue Gesetzgebung dar.
Mglicherweise waren viele Bestimmungen bei der Verentli-
chung sogar bereits veraltet. Bis auf wenige Ausnahmen ist das
Gesetzeswerk frei von christlichen Elementen; es beschreibt eine
Gesellschaf aus einfachen Bauern und Viehzchtern und nicht
die siegreichen Eroberer Galliens; manche Abschnitte enthalten
weniger Vorschrifen als vielmehr Listen von Bugeldern und
Strafen und sogar ltere Rechtssprche. Hauptziel des Pactus ist
es, durch die Festsetzung von Bugeldern und Strafen Fehden
und Blutrache zwischen den Sippen zu vermeiden, nach Tacitus
ein altes Anliegen der germanischen Gesellschaf. Zwar beru-
hen die Kodizierung selbst und einige Teile des Pactus auf der
Initiative Chlodwigs, ein Groteil des Textes reicht aber in eine
weit frhere Zeit zurck.
Das bedeutet jedoch nicht, da der Text lediglich germani-
sches Gewohnheitsrecht wiedergibt. Im Gegenteil, die lteren
Teile knnen sehr wohl rmischen Ursprungs sein. Wichtige
Belege hierfr liefern die im Pactus erwhnten Ortsnamen und
der lteste erhaltene Prolog. Hierin heit es, vier frnkische
Frsten, die Befehlshaber (rectores) gewesen seien, htten sich
wegen der unaufrlichen Streitigkeiten zwischen den Franken
126
zusammengetan und das Salische Gesetz erlassen.
9
Darin sah
man meist eine mythische Ursprungslegende oder auch einen
Hinweis auf die Existenz ansonsten unbekannter Unterknige
zur Zeit Chlodwigs. In einer anschlieenden Passage werden
als Grenze der frnkischen Besiedelung der Flu Ligeris und
der Wald Carbonaria genannt, obwohl sich die Franken bereits
weit ber diese Grenzen hinaus ausgebreitet hatten. Die meisten
Forscher sehen in diesen Ortsangaben die Loire im Sden und
den Kohlenwald zwischen den Flssen Sambre und Dyle im
heutigen Belgien. Damit wre ungefhr die Nord- bzw. Sdgrenze
von Chlodwigs Reich beschrieben, aber einige Forscher halten
Ligeris auch fr die Lys, die die Nordgrenze von Toxandrien
gebildet habe. In jngster Zeit hat der franzsische Historiker
Jean-Pierre Poly als Trepunkte der vier rectores die Drfer Bo-
degem, Zelhem und Videm zwischen Lys und dem Kohlenwald
vorgeschlagen, was immer noch in etwa innerhalb des Gebiets
von Toxandrien lge. Ferner nimmt Poly an, die vier rectores seien
vier hochrangige reichsgermanische Oziere des 4. Jahrhun-
derts gewesen, die nicht aus frnkischem Recht, sondern kraf
ihrer Befehlsgewalt ber rmische Truppen die Macht besaen,
den Frieden zu sichern, Gewaltttigkeiten zu unterdrcken und
mit den Familienoberhuptern ber Wergeidzahlungen zur
Beendigung von Fehden zu verhandeln. Er schliet daraus, die
Franken htten schon lange vor der Eroberung durch Chlodwig
Elemente der rmischen Verfassung in ihre Rechtsordnung und
ihr politisches System bernommen. Bei der Kodizierung habe
Chlodwig auf diese ltere Tradition zurckgegrien.
0
Die Franken zur Zeit Chlodwigs waren mit den rmischen
Rechtstraditionen vertraut. Ebenso vertraut waren sie mit der
rmischen Verwaltung, oder sie gewhnten sich rasch daran.
Wie wir gesehen haben, wurde Chlodwig bereits vor seinem Sieg
ber Syagrius von Bischof Remigius als rechtmiger rmischer
Statthalter anerkannt, und nach seinem Sieg ber innere und
uere rmische und barbarische Rivalen besttigte der Kaiser
127
seine Legitimitt. Zum Hof Chlodwigs gehrten nicht nur die
traditionellen Amtstrger, wie sie zum Haus eines frnkischen
Hochadligen gehrten und die hier durch Knigsnhe noch
hher standen, die antrustiones des Knigs, sein persnliches Ge-
folge, das die besondere Gunst des Knigs geno und vom maior
domus, dem Seneschall und dem Kmmerer angefhrt wurde,
sondern ebenso rmische Oziere. Obwohl aus der Zeit vor 528
keine schriflichen Dokumente merowingischer Knige berlie-
fert sind, belegt die Form spterer Urkunden, da die Knige die
Sekretre (scrinarii) und Kanzler (referendarii) der sptrmischen
Verwaltung bernommen hatten. Dabei handelte es sich wie in
der sptrmischen und der gotischen Verwaltung umweltliches
Personal; die Verwendung von Klerikern in der kniglichen
Kanzlei sollte eine karolingische Neuerung darstellen.
Fr die Verwaltung des merowingischen Knigreiches war das
geschriebene Wort lebenswichtig, weil das sptrmische Steu-
ersystem, ein grundlegendes Element der kniglichen Macht,
fortbestand und eine genaue Kontrolle der Besteuerung Schrif-
lichkeit voraussetzte. Da davon im Gegensatz zu den Quellen
der sptmittelalterlichen Verwaltung so wenig erhalten ist, liegt
daran, da man nicht auf dauerhafem Pergament, sondern auf
leicht verderblichem Papyrus schrieb und da niemandem daran
gelegen war, dieses berreichlich vorhandene Material ber die
Zeit seines unmittelbaren Nutzens hinaus aufzubewahren. Den-
noch gibt es Hinweise auf eine beachtliche Vielfalt schriflicher
Verwaltungsakte der frnkischen Knige und ihrer Beaufragten,
agentes, wie sie sich nach der Merowingerzeit erst wieder im 2.
Jahrhundert ndet.
Da Franken und Gallormer Erben rmischer Traditionen
waren, bedeutet nicht, da sie dieselben Traditionen bernom-
men hatten. Wie wir in den ersten Kapiteln gesehen haben, hatte
Romanitas fr Rmer in der Provinz praktisch nichts mehr mit
politischen Strukturen und ganz sicher nichts mehr mit Militr zu
tun. Die gallormische Aristokratie hatte die Provinzverwaltung
128
nanziell knapp gehalten und sie dadurch nahezu bedeutungslos
gemacht; einen Groteil der Steuereinhebung, der Sicherung der
entlichen Ordnung und sogar der Rechtsprechung hatte sie
selbst bernommen. Wenn die Zentralverwaltung der frhfrn-
kischen Knige primitiv war, war sie es nicht mehr und nicht
weniger als die Verwaltung, die Chlodwig von Syagrius geerbt
hatte. Bei aller Liebe zu Rom hatten die Gallormer eine starke
Zentralregierung schon lange fr eine Bedrohung ihrer Famili-
enherrschafen gehalten.
Solange die Provinzstatthalter oder die Barbarenknige der gal-
lormischen Elite Autonomie und die Kontrolle ber die von ih-
nen Abhngigen gewhrten, war diese Aristokratie immer bereit,
den Staat zu untersttzen. Wie oben erwhnt, erkannte Remigius
die Legitimitt Chlodwigs bereits vor dessen Sieg in Soissons und
vor dessen Konversion an; Erzbischof Caesarius von Arles betete
506 auf der Synode von Agde auf Knien um Erfolg, Wohlergehen
und langes Leben fr den arianischen Westgotenknig Alarich
II. Fr diese Aristokratie, die keineswegs auf eine Zentralgewalt
erpicht war, war es viel gnstiger, dem Bischof, den sie selbst
aus den eigenen Reihen gewhlt hatte, auf der lokalen Ebene
der civitas, das heit in der Stadt und dem Umland, die Leitung
dessen zu berlassen, was vom rein staatlichen Bereich, der res
publica, briggeblieben war. Daher bedeutet die Mahnung des
Bischofs Remigius an Chlodwig, dem Rat seiner Bischfe zu fol-
gen, nichts anderes als die Auorderung, den Rat der rmischen
Aristokratie zu beachten. Die Macht ber die Bevlkerung bten
die groen Landbesitzer aus; sie waren die wirkliche Obrigkeit.
So besa ihr Bewutsein, zu einer greren rmischen Welt zu
gehren, einen weit strkeren Bezug zur klassischen Bildung,
besonders der Rhetorik, und zur orthodoxen Religion als zur
Reichsverwaltung.
Nahm die Aristokratie das Monopol des kulturellen Erbes
Roms fr sich in Anspruch, so beanspruchten die Franken wie
Generationen von Reichsgermanen vor ihnen das militrische
129
Erbe. So weitgehend die Franken in bezug auf die militrische
Disziplin und die Teilnahme an der Machtpolitik des Westr-
mischen Reiches romanisiert waren, blieben sie mit Ausnahme
einer kleinen Elite von den rmischen sozialen und kulturellen
Traditionen ebenso unberhrt wie die gallormische Aritokratie
von der rmischen Militrtradition. Die einzigartige Leistung
Chlodwigs und seiner Nachfolger bestand darin, da seine Er-
oberungen und seine Konversion ihm den Weg erneten, diese
beiden Hlfen des rmischen Erbes zusammenzufhren. Diese
Entwicklung dauerte lange und verlief nicht ohne Schwierigkei-
ten, schuf aber mit der Zeit eine neue Welt.
Im frhen 6. Jahrhundert trat die Dualitt dieses Erbes am
deutlichsten in der Lokalverwaltung zutage. Zwar sind unsere
Quellen auerordentlich drfig, aber oensichtlich reprsen-
tierten die gallormischen Bischfe weiterhin ihre Gemeinden,
und die Reste der lokalen Justiz- und Finanzverwaltung waren
erhalten geblieben. Die wichtigste Vernderung bestand darin,
da in greren Stdten ein comes, der dem Knig persnlich
unterstand und daher wohl Franke war, zusammen mit einer
vermutlich kleinen Garnison stationiert wurde. Seine Aufgaben
waren vorwiegend militrischer und rechtlicher Natur. Er hob
in seinem Bereich Truppen aus und setzte, wenn er dazu in der
Lage war, gegenber den Franken das knigliche Recht durch.
Ohne die Mitarbeit des Bischofs und anderer Gallormer konnte
er nichts ausrichten, aber diese Zusammenarbeit war meist dann
gewhrleistet, wenn er nicht versuchte, die Steuerbelastung zu er-
hhen oder in den Einubereich der lokalen Eliten einzugreifen.
Hug scheint er in diese lokalen Eliten sogar eingeheiratet zu
haben, besonders in entlegenen Teilen des Knigreiches, in denen
nur wenige Franken lebten. ber diese Entwicklung werden wir
in den folgenden Kapiteln noch mehr erfahren.
An der Spitze des politischen Spektrums wirkte sich dieses
doppelte Erbe in einer Entscheidung aus, die weitreichende
Folgen fr das Frankenreich hatte, nmlich in der Teilung des
130
Reiches nach Chlodwigs Tod 5.
Warum es unter seinen vier
Shnen aufgeteilt wurde, wei niemand genau; an Hypothesen
fehlt es allerdings nicht: Vielleicht lag es an einer allgemeinen
Tradition germanischer Gesellschafen, die sich auch bei den
Burgundern, Goten, Vandalen und Angelsachsen ndet, die alle
die gleichzeitige Herrschaf mehrerer Knige kannten, was nicht
notwendigerweise eine Mehrzahl von Knigreichen bedeutete.
Vielleicht ergab sich die Teilung aus dem salischen Recht, viel-
leicht auch aus der nahezu magischen Kraf der merowingischen
Abstammung. Wahrscheinlicher ist die Teilung ein Ergebnis der
besonderen dualen Natur des Knigtums Chlodwigs. Er hatte
sich zum alleinigen Befehlshaber der Franken aufgeworfen,
und obwohl er mglicherweise seine Verwandtschaf nicht so
grndlich ausgerottet hatte, wie Gregor berichtet, gab es auer
den Shnen von zweien seiner Frauen keine Anwrter auf seine
Nachfolge. Anderen germanischen Traditionen zufolge htte
diese Situation in sehr unterschiedlicher Weise geregelt werden
knnen. Der lteste Sohn Teuderich htte das Knigreich als
Ganzes erben knnen. Seine Halbbrder, die Shne der Knigin
Chrodechild, htten dann die Stellung von Unterknigen ber-
nommen, whrend Teuderich Knig des gesamten Frankenrei-
ches geworden wre. Ian Wood hat aber darauf hingewiesen, da
angesichts des Altersunterschiedes zwischen den Brdern die
Wahrscheinlichkeit gro gewesen wre, da die jngeren Brder
im Laufe der Zeit ihre Positionen und auch ihr Leben eingebt
htten. Jedenfalls scheint gerade diese Lsung das gewesen zu
sein, was Chlodwig durch die systematische Ausrottung seiner
Verwandtschaf zu beenden versuchte.
Die Teilung des Reiches unter seinen vier Shnen scheint eher
eine rmische als eine frnkische Lsung gewesen zu sein. Chlod-
wigs Territorien wurden nach nahezu rmischer Grenzziehung
geteilt, jeder Bruder erhielt seinen eigenen Hof und zweifellos
rmische Berater in der jeweiligen Hauptstadt. Die Teilung
selbst spiegelt aber weniger rmische Reichstradition als die Tra-
131
dition der gallormischen Aristokratie; sie bercksichtigte nicht
so sehr die Grenzen rmischer Provinzen, sondern die der klei-
neren rmischen civitates, die zum Brennpunkt gallormischer
Interessen geworden waren. So erhielt Teuderich, der in Reims
residierte, die Gebiete um Trier, Mainz, Kln, Basel und Chlons
sowie die neu eroberten rechtsrheinischen Gebiete. Chlothar
erhielt die alten salischen Kerngebiete zwischen dem Kohlen-
wald und der Somme sowie Noyon, seine Hauptstadt Soissons
und Laon. Zu Childeberts Anteil gehrten die Kstenregionen
zwischen der Somme und der Bretagne, wozu vermutlich neben
seiner Hauptstadt Paris auch Amiens, Beauvais, Rouen, Meaux,
Le Mans und Rennes gehrten. Der jngste der Brder, Chlodo-
mer, herrschte von Orleans aus ber Tours, Sens und vermutlich
Troyes, Auxerre, Chartres, Angers und Nantes.
Wie diese Aufeilung zustande kam, ist unbekannt. Ausgearbei-
tet wurde sie sicher von Rmern, die die Steuereinnahmen jeder
Region kannten, gleichzeitig aber auch darauf achteten, da ihre
eigene Machtbasis erhalten blieb. Mit grter Wahrscheinlichkeit
fllten selbst in dieser Schicksalsfrage des frnkischen Knig-
reichs Franken und Rmer die grundlegenden Entscheidungen
in enger Zusammenarbeit.
Die Bevlkerung des Frankenreiches
Die sozialen, kulturellen und wirtschaflichen Traditionen der
Bevlkerung im Reich des Knigs Chlodwig waren komplex
und heterogen. Franken und Gallormer unterschieden sich
ursprnglich nicht nur kulturell voneinander, sie bildeten auch
selbst keineswegs homogene Gruppen.
132
Die Wirtschaf in Stadt und Land
Die rmische Gesellschaf hatte sich zu jener regional zersplit-
terten und sozial geschichteten Welt entwickelt, die wir im ersten
Kapitel beschrieben haben. Diese Gesellschaf war tief in der
Struktur ihres Wirtschafssystems verwurzelt, fr welches die
Konzentration des Landbesitzes in den Hnden einer kleinen,
auerordentlich reichen Elite und eine groe Bevlkerungsmehr-
heit, Sklaven wie Freie in mittelloser und hug verzweifelter
Notlage, charakteristisch waren. Das Resultat waren eine Land-
wirtschaf, die of unfhig war, die Bevlkerung zu ernhren, und
eine Infrastruktur, die fast ausschlielich die Eliten mit Handels-
waren und handwerklichen Erzeugnissen versorgte.
Diese Agrarstruktur, die das frhe Mittelalter jahrhunderte-
lang prgte, erbrachte in guten Jahren geringfgige berschsse
und fhrte in schlechten Jahren hug zu katastrophalen Hun-
gersnten. Gelegentlich hat man die Krisenanflligkeit dieser
konomischen Basis mit dem Einfall der Barbaren begrndet,
die jedoch in Wirklichkeit weder die Besitzverhltnisse noch die
landwirtschafliche Technik nennenswert beeinuten. Wo die
Feldeinteilung, die landwirtschaflichen Techniken und die Guts-
verwaltung der Rmer bis ins 6. Jahrhundert erhalten geblieben
waren, war die Kontinuitt enorm. Dies galt zwar weniger fr
die rheinischen Gebiete, aber weithin im Norden und besonders
im Sden des Frankenreiches. Entscheidender als die Barbaren
wirkten sich der allgemeine Bevlkerungsrckgang und die im
3. Jahrhundert einsetzende Flucht von wenig ertragreichem oder
steuerlich berlastetem Land aus. Der Mangel an landwirtschaf-
lichen Arbeitskrfen blieb weiterhin ein Hauptproblem, und
die seit Diokletian ergrienen Manahmen verschrfen die
Situation womglich noch. 57 verbot die Synode von Epaon den
bten, die Sklaven der Lndereien, die sie von Laien als Geschenk
erhalten hatten, freizulassen, denn es ist unbillig, da, whrend
die Mnche tglich das Feld bauen, ihre Knechte in Freiheit m-
133
ig gehen.
2
Bis weit ins 9. Jahrhundert bemhten sich Knige,
Adlige und Geistliche darum, verlassenes und unbesiedeltes Land
wieder agrarisch nutzbar zu machen.
Die Kultivierung des Ackerbodens erfolgte mit Hilfe provin-
zialrmischer Techniken, die aber jetzt arbeitsintensiver als in
frheren Zeiten waren. Werkzeuge wie das in Gallien zur Zeit des
Plinius benutzte mechanische Mhgert waren verschwunden;
Wassermhlen wurden zwar an der Rhne, an der Ruwer und
in anderen Gegenden eingesetzt, waren aber selten; die anderen
Gertschafen, Pge, Sensen, Hacken usw. waren zum groen
Teil oder gar vollstndig aus Holz. Eisen war selten und kostbar,
so selten, da man hug die Hilfe der Heiligen anrief, um ver-
lorengegangene Gegenstnde aus Eisen wiederzunden, und
wenn sie sich fanden, wurde das glckliche Ereignis manchmal
zu den Wundern des Heiligen gezhlt. Werkzeuge aus Eisen, die
vorwiegend zur Herstellung hlzerner Gertschafen dienten,
wurden sorgfltig behtet und sparsam eingesetzt.
Die Getreideproduktion, die in der rmischen Welt vor allem
aus Weizen bestanden hatte, wurde zunehmend von dunkleren
Getreidesorten wie Gerste beherrscht, die den germanischen
Vlkern vertraut waren. Dieser Wandel hat sicher mit einem
Geschmackswandel zu tun, vom traditionellen mediterranen zu
einem nrdlicheren Geschmack, er entsprach aber auch prakti-
schen Notwendigkeiten. Dunklere Getreidesorten waren nicht
nur hrter, sondern konnten auch lnger als der empndlichere
Weizen gelagert und zur Herstellung eines starken und nahrhaf-
ten Bieres verwendet werden.
Ein landwirtschaflicher Zweig, der in der frhen Merowin-
gerzeit tatschlich expandierte, war der Weinbau. Die Rmer
hatten berall, wohin sie kamen, den Weinbau eingefhrt, aber
in die nrdlicheren Regionen Europas gelangte der Wein erst
mit der Ausbreitung der kirchlichen Institutionen. Wein wurde
nicht nur zur Liturgie bentigt, er war auch das Getrnk der
Elite. Die zunehmende Investition in den Weinbau auf Kosten
134
der traditionellen Subsistenzwirtschaf deutet vermutlich auf
einen wachsenden Einu des Adels auf landwirtschafliche
Entscheidungen hin.
Die vorgeschichtliche Beschfigung der germanischen Vlker
mit der Viehzucht wurde im frnkischen Reich fortgesetzt und
weitete sich aus. In der gesamten Lex Salica und in anderen Geset-
zestexten spielt das Vieh eine wichtige Rolle; die Ausfhrlichkeit,
mit der die Viehzucht behandelt wird, verstrkt den ohnehin
vorherrschenden Eindruck, da Haustiere wie zur Zeit des Stelus
fr die Barbaren weiterhin die Grundlage von Reichtum und
Ansehen bildeten.
Die Mehrzahl der Bevlkerung lebte zwar immer noch auf dem
Lande, aber die frnkischen Stdte besaen im Knigreich eine
groe Bedeutung, und zwar als Residenzen von Bischfen, Grafen
und Knigen und gleichzeitig als Wirtschafszentren. Wie viele
Menschen in diesen Stdten lebten, ist auerordentlich schwer
zu bestimmen. Hinweise liefert lediglich die Archologie; da sich
deren Erkenntnisse aber weitgehend auf die Bezirke innerhalb
der im 3. Jahrhundert errichteten Stadtmauern beschrnken, lt
sich ber die Bevlkerungszahlen in den vorstdtischen Vierteln
vorzglich spekulieren. So haben einige Historiker vermutet, da
im 6. Jahrhundert Paris 20 000 und Bordeaux 5 000 Einwohner
zhlten, whrend andere die Meinung vertreten, diese Schtzungen
mten um fast 50 Prozent niedriger angesetzt werden. Gesichert
ist lediglich die Erkenntnis, da die gesellschafliche, kulturelle
und politische Bedeutung dieser Stdte weit grer war, als man
es angesichts ihrer geringen Einwohnerzahlen erwarten drfe.
Der grte Teil der rmischen Aristokratie hatte die Stdte
schon lange Zeit zuvor verlassen und sich in der Sicherheit und
Autonomie ihrer umfangreichen Landgter etabliert, einige
Aristokraten waren aber auch zurckgekehrt; in den Gedichten
des Sidonius Apollinaris und den Heiligenviten erfahren wir, da
reiche und mchtige Rmer nicht nur in den Stdten Aquitaniens
und Galliens, sondern auch in Trier, Metz und Kln lebten. Die
135
wichtigsten gallormischen Einwohner waren jedoch die Bisch-
fe. Zusammen mit ihrem Klerus bernahmen sie einen groen
Teil der entlichen Aufgaben der Stdte, sie organisierten unter
anderem die traditionelle Verpichtung zur Armenfrsorge und
zur Instandhaltung der Stadtmauern und Aqudukte. Ihre Anwe-
senheit war so ausschlaggebend, da antike Stdte, die nicht zu
Bischofssitzen wurden, im Laufe des frhen Mittelalters hug
vllig aufgegeben wurden. Die Prsenz eines bischichen Hofes
entschied ber Leben und Tod eines stdtischen Zentrums.
ber einen anderen wichtigen Stadtbewohner, den frnkischen
Knig oder seinen Stellvertreter, den comes mit seiner Militr-
organisation, berichten die Quellen weit weniger als ber den
Bischof und den Klerus. Wie die gotischen und burgundischen
wurden auch die frnkischen Eliten von den Stdten angezogen;
dort konnten sie sowohl das von ihnen und ihren Vorfahren so
lange ersehnte Wohlleben genieen, als auch durch ihre Anzahl
jene Sicherheit nden, die ihre politische Position und ihr ge-
sellschaflicher Rang erforderten. Anders als die spten Mero-
winger und sicherlich anders als die Karolinger residierten die
frhen Merowinger und ihre Stellvertreter in Stdten, wo sie die
Ertrge der erworbenen Besitztmer in Empfang nahmen und
verbrauchten und so dazu beitrugen, da das ganze 7. Jahrhundert
hindurch Handel und Handwerk gediehen. Es trif zwar zu, da
die Bischfe und der Klerus die wichtigste Sule der stdtischen
Kontinuitt bildeten und da ihre Bauvorhaben, die Kathedralen,
Kapellen, Hospize und auerhalb der Mauern die Basiliken und
Friedhfe, allmhlich das Stadtbild prgten. Aber dennoch darf
man den Einu etwa eines Teudebert auf das stdtische Leben
nicht bersehen, der im Amphitheater von Arles wieder Spiele
abhalten lie, oder den Chilperichs I., der in Paris und Soissons
Pferderennbahnen baute.
Die Stadt des 6. Jahrhunderts war aber mehr als die Residenz
des Bischofs, des frnkischen comes oder Knigs. Sie spielte auch
eine lebenswichtige Rolle fr den Handel. Trotz der barbarischen
136
Plnderungen und der internen gallormischen Auseinanderset-
zungen, ungeachtet des Bevlkerungsrckgangs und der Archai-
sierung der westlichen Gesellschaf funktionierten das rmische
Straennetz und noch wichtiger die Handelsverbindungen
auf dem Wasserwege weiterhin. Dieser Verkehr unterschied sich
jedoch sehr von den Handelsverbindungen der vorangegangenen
Jahrhunderte oder des Sptmittelalters, als das stdtische Wachs-
tum mit einem Aufschwung der Handelsttigkeit einherging. Um
die besondere Struktur des Handels der Merowingerzeit zu ver-
stehen, mssen wir zunchst verstehen, wie sich der Gterverkehr
im Frankenreich des 6. Jahrhunderts insgesamt vollzog.
Die Debatte ber die verhltnismige Vitalitt der westeu-
ropischen Wirtschaf im 6., 7. und 8. Jahrhundert hat schon
viel Tinte gekostet. Einerseits belegen Mnzfunde die bis ins 7.
Jahrhundert anhaltende Bedeutung gemnzten Goldes; Urkun-
den und erzhlende Quellen erwhnen Kaueute, Importgter
und ein funktionierendes System der Einnahme von Zllen
und Gebhren bis weit ins 8. Jahrhundert. Andererseits wird
hug deutlich, da Edelmetall strker zur Selbstdarstellung
denn als Tauschmittel verwendet wurde und da Gter und
Prestigeobjekte nicht primr durch den Handel, sondern durch
militrische Unternehmungen, Plnderungen oder auch den
Austausch von Geschenken in Umlauf gebracht wurden. So
scheint einerseits die Handelswelt der Sptantike intakt gewesen
und teilweise sogar nach Norden ausgedehnt worden zu sein;
syrische, griechische und jdische Hndler durchzogen das Fran-
kenreich in allen Richtungen, manchmal mit Kamelkarawanen,
und verkaufen ihre Waren, lokale Getreidehndler kaufen und
verkaufen auf prosperierenden Mrkten. Andererseits erblickt
man eine archaische Gesellschaf, in der Kriegsfhrung und
Austausch von Geschenken die Modalitten des Gterverkehrs
bestimmten und in der Gold mehr fr Schmuckgegenstnde,
zur Ausstattung der Kirchen und Verzierung der Pferdegeschirre
verwendet wurde denn als Tauschmittel. Diese berraschende
137
Gleichzeitigkeit erwuchs aus der komplexen Natur der merowin-
gischen Gesellschaf, in der die Mechanismen des Warenumlaufs
eng mit den sozialen Beziehungen verknpf waren. Alle diese
Mechanismen erfllten bei verschiedenen Gesellschafsgruppen
zu verschiedenen Zeiten ihre Funktion, und jeder einzelne spielte
eine wichtige Rolle in der lokalen, regionalen und internationalen
Verteilung von Gtern und Dienstleistungen.
Der bei weitem berwiegende Anteil der Nahrungsmittel wur-
de entweder von den Bauern oder ihren Grundherren auf den
Markt gebracht. Der geringe berschu, der nicht konsumiert
wurde, gelangte durch Verkauf, Schenkung oder Raub zu den
Konsumenten, je nach den sozialen und politischen Beziehun-
gen zwischen den Tauschpartnern. Dabei waren Schenkung und
Diebstahl huger als Verkauf. Hochadlige Franken oder Rmer
untersttzten ihre Gefolgschaf und die Mitglieder ihres Hau-
ses, indem sie sie mit Nahrung, Kleidung, Waen und anderen
fr ihre Lebensfhrung und ihre soziale Stellung notwendigen
Gtern versorgten. Bischfe verteilten Almosen an die Armen,
die auf den stdtischen Armentafeln verzeichnet waren, womit
sie die traditionelle Verpichtung der kaiserlichen Freigebigkeit
bernahmen und zum Unterhalt der Bevlkerung beitrugen.
Freundschaf wurde durch den Austausch von Geschenken be-
siegelt. Dieses Geecht von Geschenken und Gegengeschenken
sorgte vermutlich in weitem Umfang fr den Austausch und die
Verteilung des landwirtschaflichen berschusses.
Zwischen Feinden, also zwischen Personen, die nicht durch
gegenseitige Beziehungen oder Freundschaf miteinander ver-
bunden waren, zirkulierten Gter durch Plnderung und Raub.
Dazu gehrten die Kriegsfhrung oder einfach periodische
berflle auf den Besitz und den Viehbestand des Feindes als
Teil anhaltender Fehden. Auch Knige und ihre Stellvertreter
erhielten neben Steuern Geschenke in Form von Lebensmitteln,
Wein, Wachs oder anderen Produkten, die im Grunde einen
Tribut darstellten.
138
Beide Arten von Transaktionen konnten sowohl innerhalb
der Stadt als auch auf dem Lande gettigt werden. In der Stadt
fand jedoch auch die weniger gebruchliche, aber immer noch
bedeutende Form des Gteraustauschs zwischen neutralen
Parteien statt, der Handel. So erfahren wir vom Verkauf von
Lebensmitteln vorwiegend in Krisenzeiten, wenn Spekulanten,
die sie gehortet hatten, enorme Prote erzielen konnten, obwohl
sicher auch regulre Mrkte existierten. Der grere Teil der Han-
delsgeschfe betraf jedoch Waren, die nicht berall verfgbar
sowie relativ leicht zu transportieren waren und nach denen eine
groe Nachfrage bestand. Dazu zhlte vor allem das Salz, das in
tieiegenden Kstenregionen durch Verdampfung gewonnen
und dann ins Binnenland gebracht wurde. Ebenso wichtig waren
Wein, l, Fisch und Getreide.
Auch handwerkliche Erzeugnisse wurden regional und sogar
ber groe Entfernungen hinweg gehandelt, wenn auch unge-
klrt bleibt, wie dieser Gterverkehr ablief. Im Sden wurde die
traditionelle mediterrane Tpferware nach sptantiken Mustern
bis ins 8. Jahrhundert hinein produziert; in den Ardennen und
in der Umgebung von Kln hergestelltes Glas fand seinen Weg
bis nach Friesland und sogar nach Schweden; frnkische Waen,
die in ganz Europa sehr begehrt waren, wurden im gesamten
Frankenreich, in Friesland und in Skandinavien gefunden. Auch
Stoe wurden zwischen den Regionen ausgetauscht; besonders
bekannt waren die preiswerten Stoe aus der Provence, die bis
nach Rom, Monte Cassino und Spanien gelangten.
So stark die Einwohnerzahl der frnkischen Stdte auch gesun-
ken war, lebten in den Stdten doch immer noch eine Vielzahl
von Hndlern. Gregor von Tours berichtet, da Desideratus,
der Bischof von Verdun, von Knig Teudebert ein Darlehen
von 7000 Goldstcken erhielt, wofr die Kaueute seiner Stadt
brgten, die vermutlich auf den Handel mit Lebensmitteln
spezialisiert waren. Gleichzeitig belegt der Bericht Gregors aber
auch die Existenz einer auf Geschenken beruhenden Zirkulation
139
von Reichtum und Handel: Teudebert gewhrte Desideratus
das Darlehen als besondere Gunst, um seine Grozgigkeit zu
demonstrieren. Nach Gregor protierten diejenigen, die den
Handel betrieben,
3
von dem Darlehen, und der Bischof war in
der Lage, die Rckzahlung des Darlehens mit Zinsen anzubieten.
Der Knig lehnte dies mit der Begrndung ab, er bentige das
Geld nicht. Da in der Stadt gengend Kaueute vorhanden wa-
ren, die gemeinsam ein solches Darlehen zurckzahlen konnten,
weist darauf hin, da ihr Handel nicht unbedeutend war. Da
die Rckzahlung spter vom Knig grozgig abgelehnt wurde,
legt die Vermutung nahe, da ihm das System des Handelskredits
fremd war; er zog es vor, die Stadt in seiner politischen Schuld zu
halten. Fr einen merowingischen Knig war Gold nicht in erster
Linie eine Art von Geld, mit dem man durch kluge Investitionen
mehr Geld verdienen konnte, sondern ein Instrument, durch das
er seine Grozgigkeit unter Beweis stellen und die Bindungen
zu seinem Volk festigen konnte.
Die Besitzer groer Lndereien, Laien wie Kleriker, hatten ne-
ben den stdtischen Kaueuten ihre eigenen Agenten, manchmal
Juden, in anderen Fllen Mitglieder ihres eigenen Haushalts,
gelegentlich Sklaven oder Freigelassene, die den Verkauf der
berschsse und den Einkauf von nicht am Ort hergestellten
Produkten besorgten. Auch diese Agenten betrieben nicht nur
Handel; sie konnten auch beaufragt werden, anderen Magnaten
Geschenke zu berbringen und Gegengeschenke anzunehmen.
Man darf vermuten, da ein Groteil der Geschfe, die sie zu
erledigen hatten, weder Handel noch im engeren Sinne Tausch-
handel waren, sondern die berbringung von Waren, die die
Beziehungen zwischen den Eliten konsolidierten.
Schlielich gab es in jeder greren Stadt eine Gruppe fremder
Kaueute, die den Adel mit Luxusgtern versorgte. Der Fernhan-
del lag vorwiegend in den Hnden von Syrern, Griechen und
Juden, die man in Arles, Marseille, Narbonne, Lyon, Orleans, Bor-
deaux, Bourges, Paris und anderswo antrif. Sie lieferten Juwelen,
140
kostbare Gewnder und Schmuck ebenso wie Papyrus, Gewrze
und andere Waren. Diese Kaueute konnten in den frnkischen
Stdten grere Gemeinschafen mit eigenen Magistraten oder
Konsuln bilden und spielten vielleicht auch in der gesamten
Gemeinde eine aktive Rolle. Gregor von Tours berichtet, da ein
syrischer Kaufmann namens Eusebius zum Bischof von Paris
aufstieg, das Gefolge seines Vorgngers entlie und durch Syrer
ersetzte.
4
Unbestreitbar bten die internationalen Fernhndler
eine betrchtliche Macht aus.
Zu dieser Macht gelangten sie, weil sie dem Adel die pracht-
vollen Luxusgter verschaen konnten, die dieser zu Reprsen-
tationszwecken bentigte. Wichtig waren diese Kaueute auch
deshalb, weil die von ihnen entrichteten Importzlle und Gebh-
ren fr die Merowinger eine wertvolle Einnahmequelle bildeten.
Besonders in der Provence, wo der Groteil der mediterranen
Importe ankam, nahmen knigliche Zollbeamte betrchtliche
Summen ein, die in den kniglichen Schatz wanderten. Die Auf-
teilung der Provence unter den frnkischen Unterknigen diente
vermutlich ebenso der Aufeilung umfangreicher Zolleinnahmen
wie der Aufeilung von Land.
Als Gegenleistung konnte der Westen diesen Fernhndlern
wenig anderes als Gold bieten. Dies war nicht neu. Abgesehen
von Bauholz und gelegentlich Sklaven hatte Gallien nie in groem
Stil exportiert. Unter den Franken kam der Waenexport hinzu.
Obwohl der Export von Sklaven zumindest theoretisch verboten
war Arbeitskrfe waren knapp, und die Franken importierten
selbst Sklaven aus den slawischen Gebieten , wurde an der Rh-
ne dennoch Sklavenhandel betrieben. Frnkische Waen waren
ein gefhrliches Exportgut, da die Kufer sie gegen die Franken
einsetzen konnten. Daher verlief der Ost-West-Handel weitge-
hend in einer Richtung: Gold, das als Beutegut oder Tribut aus
dem Ostreich nach Westen gelangt war, o als Bezahlung fr
Luxusgter zurck. Da im spten 6., im 7. und frhen 8. Jahrhun-
dert der Umfang der Beute abnahm, ging der Handel ebenfalls
141
zurck. Dieser Abu von Gold, der nur durch die spteren
frnkischen Eroberungen unter den Karolingern unterbrochen
wurde, lie den internationalen Handelsu schlielich zu einem
Rinnsal schrumpfen. Und mit dem Handel verschwanden auch
die internationalen Fernhndlergemeinschafen, die dem Leben
der frnkischen Stdte Farbe, kultivierten Schli und einen ge-
wissen Reiz verliehen hatten.
Die frnkische Gesellschaf
Franken siedelten in Gallien lange vor Chlodwig, vermutlich so-
gar, bevor sie berhaupt Franken waren. Wie wir gesehen haben,
kann die Eroberung des Reiches des Syagrius ebenso eine Reakti-
on auf diese Situation wie eine Ursache ihrer Zuspitzung gewesen
sein. Einige Franken, manchmal mehrere Familien, drangen in
die rmische Welt ein, gelegentlich nur einige Kilometer tief.
Andere Menschen dagegen, die in der rmischen Welt lebten,
laeti oder Fderaten, wurden allmhlich zu Franken. Angesichts
der drfigen schriflichen Quellen lt sich auerordentlich
schwer feststellen, auf welche Weise diese Regionen Westeuropas
frnkisch wurden. Die klarsten Ausknfe geben die im zweiten
Kapitel erwhnten Reihengrber. Im spten 5. Jahrhundert zeigt
sich dort ein bedeutsamer Wandel. Vor dieser Zeit gab es in den
Reihengrbern innerhalb des Reiches nur wenig Grabbeigaben.
Nun begann man allmhlich, die Toten mit mehr Waen und
Schmuck beizusetzen, was den groen Reichtum belegt, der
durch Militrdienst und hugere Plnderungen erworben wor-
den war. Betrachtet man die Qualitt und Vielfalt der in diesen
Grbern des spten 5. Jahrhunderts gefundenen Grabbeigaben,
kommt man zu dem Schlu, da der Militrdienst, ob unter
Childerich und Chlodwig oder den verschiedenen rivalisieren-
den gallormischen Befehlshabern, oder auch Raubzge auf
142
eigene Faust den Anfhrern von Kriegerverbnden dauerhafen
Reichtum bescheren konnten.
Ein erhellendes Beispiel fr archologische Funde aus Gr-
bern dieser Zuwanderer des spten 5. Jahrhunderts und ihrer
Nachfolger ist der Friedhof von Lavoye an der Maas, der zu
Beginn unseres Jahrhunderts freigelegt wurde. Rene Joroy
hat diese Funde wissenschaflich untersucht und publiziert.
5
Der ber einer frhen gallormischen Siedlung vermutlich
einer lndlichen villa errichtete Friedhof umfat 362 Grber,
von denen 92 auf einen Zeitraum zwischen dem spten 5. oder
frhen 6. Jahrhundert bis zur zweiten Hlfe des 7. Jahrhun-
derts datiert werden knnen; mangels Grabbeigaben lassen
sich die anderen Grber nicht datieren. Die Grber sind in
Reihen angeordnet und von Norden nach Sden ausgerichtet.
Oensichtlich scheint der Friedhof um eine Gruppe von neun
Grbern herum entstanden zu sein, vermutlich die Familien-
grabsttte eines mchtigen Franken. Das zentrale Grab (Num-
mer 39) ist das lteste, grte, tiefste und reichste der Gruppe
und enthlt die berreste eines fnfzig- bis sechzigjhrigen
Mannes. Mit ihm zusammen wurden Waen und Gegenstnde
von auerordentlichem Wert und groer Pracht begraben: Eine
mit Granat verzierte Grtelschnalle aus Goldcloisonne, eine
Brse mit granatverzierter Schliee, ein Dolch mit goldenem
Gri, ein prchtiges Langschwert von fast einem Meter Lnge,
das mit Gold, Silber und Granaten geschmckt ist, drei Speer-
spitzen, ein Schild und zu seinen Fen eine Glasschale und
ein bronzegetriebener Kelch, der mit Szenen aus dem Leben
Christi verziert ist und vermutlich aus einer christlichen Kirche
geraubt worden war. Diese Gegenstnde gleichen denjenigen,
die in weiten Teilen Nordfrankreichs und Deutschlands sowohl
innerhalb als auch auerhalb des rmischen Limes gefunden
wurden, und knden nicht nur vom kriegerischen Charakter
des Toten und seinem Reichtum, sondern auch von der Aus-
dehnung der Kulturregion, der der Bestattete angehrte. Die
143
benachbarten Grber stammen ebenfalls aus dem frhen 6.
Jahrhundert und beherbergten vermutlich Mitglieder seiner
Familie. Von den fnf nchstgelegenen sind drei Frauengrber,
die ebenfalls reich mit Juwelen, Gefen und Spinnwirteln
ausgestattet sind. Vielleicht waren dies seine Frauen; wie die
Germanen zur Zeit des Tacitus praktizierten die Franken des 6.
Jahrhunderts Polygamie, und dieser vornehme Franke konnte
sich sicher mehrere Frauen leisten. Die beiden anderen Gr-
ber enthalten die Gebeine von Kleinkindern, ein Zeugnis der
Kindersterblichkeit, die die europische Gesellschaf bis weit
ins 9. Jahrhundert hinein bedrckte.
Nrdlich, stlich und westlich schlieen sich die anderen Gr-
ber dieser frnkischen Gemeinde an. Manche haben hnliche,
allerdings weniger prachtvolle, die meisten allerdings berhaupt
keine Grabbeigaben. Diese Gemeinde, die an der Stelle einer fr-
heren rmischen villa lebte und vielleicht die Nachkommen der
am Ort lebenden Gallormer integriert hatte, soll die Grundlage
fr unsere Untersuchung der Struktur und Organisation der
frnkischen Gesellschaf im 6. Jahrhundert bilden.
Haus und Familie
Alle Grabsttten von Lavoye bilden wie die des Vornehmsten
Gruppen, was vermutlich auf die Sippenzusammenhnge
hinweist. Was Sippenzugehrigkeit im 6. Jahrhundert genau
bedeutet, ist schwer zu bestimmen. Die frnkische Gesellschaf
bewahrte die Organisationsformen der Wanderungszeit, und
obwohl die Grogemeinschaf der Sippe fr den Adel weiterhin
wichtig war, war sie fr den gewhnlichen Franken wahrschein-
lich weniger bedeutsam als die einzelne Hausgemeinschaf und
das Dorf.
Zwischen der rmischen und der germanischen Tradition der
144
patriarchalischen Familienstruktur gab es kaum Unterschiede;
beide verschmolzen rasch und reibungslos im Sinne einer Herr-
schaf ber die Hausgemeinschaf. Der Vater war das Oberhaupt
der Familie und bte seine Autoritt, das mundiburdium, ber alle
Hausbewohner aus, ber Frauen, Kinder und Sklaven. Je wohlha-
bender ein Mann war, desto grer war seine Hausgemeinschaf.
Die merowingischen Knige vor und nach Chlodwigs Taufe hat-
ten hug mehrere Ehefrauen, andere Mchtige wie der in Lavoye
beigesetzte sicherlich ebenfalls. Bis weit ins 9. Jahrhundert hinein
kannten die Franken und andere germanische Gesellschafen
vielfltige Formen der Eheschlieung. Am gelugsten war die
bertragung des Besitzes und des mundiburdium ber die Frau.
In der frnkischen Gesellschaf wurden Frauen hoch geschtzt,
vor allem wegen ihrer Fhigkeit, Kinder zu gebren. Nach der
Lex Salica betrug das Wergeid einer hau im gebrfhigen Alter
das Dreifache eines gewhnlichen Mannes oder einer Frau unter
zwlf oder ber vierzig Jahren.
Daher erforderte die bergabe einer Frau von einem auf den
andern Mann eine Gegenleistung. Diese wurde in der Regel in
Form eines Brautpreises entrichtet, aber um das 6. Jahrhun-
dert wurde daraus eine blo rituelle Zahlung. Das wichtigere
Geschenk war die Hochzeitsgabe des Brutigams an die Braut,
nach frnkischem Brauch bis zu einem Drittel seines Besitzes.
Nach Vollzug der Ehe schenkte der Ehemann der Frau darber
hinaus die Morgengabe. Schlielich war es blich, da der Vater
der Braut dem Paar nach der Hochzeit ein Geschenk machte.
Die der Eheschlieung vorausgehenden Verhandlungen fhrten
die Oberhupter der Familien, wichtige Familien besiegelten den
Abschlu mit einem frmlichen schriflichen Vertrag. Die Hoch-
zeit selbst wurde entlich gefeiert und bezeugte den Abschlu
oder die Festigung einer Allianz zwischen zwei Familien.
Eine zweite, weniger frmliche Art der Eheschlieung, die
keine bertragung von mundiburdium oder Mitgif erforderte,
war ebenfalls blich. Dabei handelte es sich um die sogenannte
145
Friedelehe, eine nur zwischen Mann und Frau eingegangene
private Verbindung. Solche Ehen stellten eine Bedrohung fr
die Familienoberhupter und die Kirche dar, die in zuneh-
mendem Mae auf die Legitimitt der Kinder und die Un-
verzichtbarkeit von Ehevertrgen drngte. Dennoch wurden
solche Verbindungen entlich anerkannt, wenn auch von
vielen mibilligt. Diese Eheschlieungen wurden of als eine Art
Entfhrung der Braut inszeniert; der Mann entfhrte die Frau,
hug mit deren Einwilligung. Nach Vollzug der Ehe mute die
Familie der Frau entscheiden, ob sie Rache und Genugtuung
fr den Raub der Tochter fordern oder deren Entfhrer als
Schwiegersohn akzeptieren wollte.
Darber hinaus hielten sich die Franken vielfach Konkubinen
zwischen oder auch whrend der einzelnen Ehen. Solche Ver-
bindungen galten bis weit ins 8. Jahrhundert hinein als normal,
obwohl die Kirche von Zeit zu Zeit Einwnde erhob; die daraus
hervorgehenden Kinder stellten eine potentielle Gefahr fr die
Erbschafsansprche der legitimen Nachkommen dar.
Wie die Sippe beruhte auch das Erbrecht in der frnkischen
Gesellschaf auf Gegenseitigkeit, obwohl Tchter von manchen
Formen der Erbschaf ausgeschlossen waren. Dies wird in dem
berhmten Kapitel des Pactus Legis Salicae festgehalten, auf das
sich franzsische Rechtsgelehrte im 4. Jahrhundert beriefen, um
der Mglichkeit entgegenzuwirken, da die franzsische Krone
an den Knig von England fallen knnte. Dort werden Frauen
von der Erbschaf an salischem Land ausgeschlossen. Niemand
wei jedoch genau, was salisches Land eigentlich war; denn in
der zweiten Hlfe des 6. Jahrhunderts erlaubte Chilperich II.
ausdrcklich, da Tchter salisches Land erbten, wenn keine
Shne vorhanden waren. Mit Sicherheit waren Frauen jedoch
am beweglichen Besitz erbberechtigt. Beim Tod ihres Ehemannes
konnte eine Frau wohl auch seinen gesamten Besitz erben, soweit
sie ihn ohne mnnliche Hilfe verwalten konnte.
Zur Familie gehrten neben der Frau oder den Ehefrauen die
146
minderjhrigen legitimen und illegitimen Kinder. Manche For-
scher haben vermutet, da Polygamie und Konkubinat zu einer
hohen Anzahl von Frauen in den Haushalten der Magnaten
gefhrt htten; dadurch seien der brigen Bevlkerung Frauen
entzogen worden mit dem Ergebnis, da die Geburtenzier
insgesamt zurckgegangen sei. Das mag zutreen; andererseits
steht aber auer Zweifel, da die Franken wie andere buerliche
Gesellschafen vor und nach ihnen gelegentlich Kinder tteten
oder verkaufen, wenn die Ressourcen knapp wurden. In der
neueren Literatur hat man darum viel Aufebens gemacht. Es
gibt aber keinerlei Beweise dafr, da Kindsmord eine gngige
Praxis, und erst recht nicht dafr, da die Ermordung neugebo-
rener Mdchen im Brauchtum des Frankenreiches tief verwurzelt
gewesen wre.
Zum Haushalt gehrte neben den Verwandten auch eine
Vielzahl von Dienern, Sklaven und Gefolgsleuten. Geht man
von den Verhltnissen in spteren buerlichen Gemeinschafen
aus, gehrte der Hausvater einer Elite an, wofr eine ausrei-
chende wirtschafliche Basis an Land und Vieh erforderlich
war, damit ein Haus gebaut und eine Ehe geschlossen werden
konnten. Viele, wenn nicht die meisten anderen Menschen leb-
ten vermutlich als Mitglieder anderer Haushalte an den Hfen
von Knigen, den Residenzen reicher Magnaten oder auf den
Hfen vermgender Bauern. Dazu gehrten Haushaltssklaven
Sklavenarbeit in grerem Umfang war weniger verbreitet als
bei den Rmern , unverheiratete Verwandte, verlassene Kinder
von weniger wohlhabenden Nachbarn, die als Dienstpersonal
aufgenommen und erzogen wurden, und Lohnarbeiter, denen
die ntigen Mittel zur Errichtung eines eigenen Haushalts
fehlten. Die Grenordnung solcher Haushalte war sehr unter-
schiedlich; sie konnten lediglich aus der Kernfamilie bestehen,
aber auch Dutzende von Gefolgsleuten im Dienst vornehmer
Mnner oder Frauen umfassen.
147
Das Dorf
Die normale Form der landwirtschaflichen Nutzung, welche die
Rmer in Gallien wie berall im Imperium eingefhrt hatten,
war die villa, das heit ein isoliertes Landgut, dessen Zentrum
ein von Mauern umschlossener Hof von unterschiedlicher Gre
(80 bis 80 Quadratmeter fr die kleinen, 300 Quadratmeter
fr die groen) war. Dieser bestand aus dem Wohnhaus des
Besitzers und den Unterknfen der Sklaven, die die Feldarbeit
verrichteten. Im Laufe des 3. und 4. Jahrhunderts wurden die
meisten isolierten villae im Norden zugunsten strker konzen-
trierter Siedlungsrume aufgegeben, die hug in der Nhe von
Wldern oder Flulufen lagen. Mglicherweise war dies eine
Schutzmanahme in unsicheren Zeiten. Diese neuen Gemein-
schafen unterschieden sich von den lteren villae nicht nur durch
die relativ dichte Besiedelung, sondern auch durch die leichte-
re Bauweise der Huser, welche aus Holz in unregelmigen
Gruppen errichtet wurden. Im Laufe des 5. und 6. Jahrhunderts
verwandelten sich diese neuartigen Siedlungen allmhlich in die
Drfer des Mittelalters.
Gleichzeitig kam es im Westen des heutigen Deutschland zu
wichtigen Vernderungen. In der Sptantike waren in Deutsch-
land viele Siedlungen verdet. Seit Beginn des 5. Jahrhunderts
setzte in den romanisierten Gebieten Deutschlands eine um-
fangreiche Neubesiedelung ein. In der Umgebung von Trier
entstanden zwischen 450 und 525 zwanzig neue Siedlungen,
zwischen 525 und 600 waren es 28, zwischen 600 und 700 weitere
26. Ein hnliches Wachstum ist in der Umgebung von Kln zu
beobachten; die Anzahl der Siedlungen stieg hier von 28 im 6.
Jahrhundert auf 66 im 7. Jahrhundert. Gleichzeitig erlebten die
nrdlichen und stlichen Regionen einen Rckgang der Besie-
delung, der erst im 8. Jahrhundert zum Stillstand kam.
6
Diese vom 4. bis zum 6. Jahrhundert gegrndeten Siedlungen
bildeten den Raum, in dem die Bevlkerung im Norden des
148
Frankenreiches drei Jahrhunderte lang bis zu den groen Ver-
nderungen der Karolingerzeit leben sollte. In der Merowinger-
zeit spielten sie eine wichtige soziale und kulturelle Rolle in der
frnkischen Gesellschaf.
Whrend Bauern und Viehzchter unter Umstnden betrcht-
liche Entfernungen bis zu ihren Feldern und Weiden berwinden
muten, war das Dorf selbst Mittelpunkt des religisen und
gesellschaflichen Lebens. Den ersten Ansto fr die Errichtung
dricher Siedlungen an bestimmten Orten gab of die Existenz
eines Kultzentrums. In heidnischer Zeit war dies vielleicht ein
lndlicher Tempel, spter eine Kapelle oder eine Einsiedelei.
Die merowingische Religion war ausgesprochen individuen-
und ortsbezogen. Sie konzentrierte sich auf die Verehrung von
Personen, die zu ihren Lebzeiten ihre Gemeinde beschtzt und
verteidigt hatten und die nach ihrem Tod, weil sie Gott besonders
nahestanden, fr ihre Gemeinden sorgen konnten. Dieses enge
Band zwischen den Lebenden und den Toten dehnte sich auch
auf den rtlichen Friedhof aus. In Flonheim zum Beispiel wur-
den die zentralen, aus vorchristlicher Zeit stammenden Grber,
die dem Hauptgrab von Lavoye entsprechen, spter mit einer
Kapelle berbaut, die dann zum Zentrum der anwachsenden
christlichen Nekropole wurde. Die lokale Bevlkerung hatte
ihre heidnischen Vorfahren dabei keineswegs vergessen, sondern
christianisierte sie nachtrglich.
7
Dieses Kontinuum zwischen
der Gemeinde und dem Wohnort der Toten verlieh dem Dorf
Dauer und Stabilitt.
Das Dorf war auch die Ebene ber der Familie, auf der das
gesellschafliche und politische Leben der Menschen organisiert
wurde. So wurde als erste juristische Instanz auf Dorfebene
eine eigene Gerichtsbarkeit ins Leben gerufen. Zwar konnte der
rmische Richter oder der frnkische comes ins Dorf kommen
oder seinen Stellvertreter entsenden, um Streitigkeiten zwischen
Freien zu schlichten. Huger jedoch traten die Familien- oder
Sippenoberhupter zusammen, um Konikte beizulegen und
149
Entscheidungen zu treen, ohne auf die entliche Justiz zu-
rckzugreifen.
Sobald schlielich das Dorf als solches konstituiert war, wur-
de es zu einer wichtigen Steuereinheit in der rmischen und
spter frnkischen Verwaltung. Festgesetzte Abgaben an den
Grundherrn und an den Fiskus abzufhrende Steuern schufen
Kontinuitt. Die Drfer wurden zu Einkommensquellen und
Rekrutierungspltzen fr Aristokraten und Knige.
Die soziale Ordnung
War der Tote im Grab 39 von Lavoye ein Adliger? Diese Frage
war ber ein Jahrhundert lang Gegenstand einer endlosen Dis-
kussion zwischen europischen Historikern. Zunchst stellte man
die Frage, ob die Franken des 6. Jahrhunderts einen vom Knig
unabhngigen Adel besaen oder ob Chlodwig den frnkischen
Adel genauso wie seine Sippe ausgerottet habe. Kernpunkt dieser
Diskussion ist die Frage nach dem Ursprung des europischen
Adels und seinen Beziehungen zur Monarchie. Ging der Adel,
den wir im spteren Mittelalter antreen, aus der Herrschaf
ber Grundbesitz und unfreie Personen hervor, die das Land
bestellten, also aus der Grundherrschaf, oder aus der militri-
schen und politischen Macht ber Freie, der Volksherrschaf?
Und wenn der zweite Fall zutrif, erlangte der Adel diese Macht
durch Usurpation kniglicher Autoritt oder aufgrund eines
lteren ererbten Rechts? Die gesamte Diskussion ist vielleicht
ein klassisches Beispiel dafr, wie man die richtigen Antworten
nicht nden kann, wenn man die falschen Fragen stellt. Immerhin
trugen diese Fragestellungen dazu bei, wichtige Eigentmlichkei-
ten der frnkischen Gesellschaf prziser zu erfassen.
Die gallormische Aristokratie umfate ganz eindeutig eine
unabhngige, sich selbst erhaltende Elite, deren gesellschafli-
cher Rang und politische Macht auf ihrer Herkunf, ererbtem
150
Reichtum sowie einer besonderen Rechtsstellung als viri inlustri
beruhte. Sie kooperierte zwar of mit den Knigen, war aber
nicht deren Geschpf. Eine ltere Gelehrtengeneration, die sich
am neuzeitlichen europischen Adel mit seinem privilegierten
Rechtsstatus orientierte, versuchte vergebens, unter den Franken
eine vergleichbare gesellschafliche Gruppe zu nden. Im Gegen-
satz zu anderen barbarischen Vlkern wie den Alemannen und
den Bajuwaren ist im Pactus Legis Salicae von Adligen nirgends
die Rede. Statt dessen stt man auf die wichtige Unterscheidung
zwischen ingenui, Freien, die auch einfach Franci genannt werden,
und verschiedenen Arten von Unfreien. Eine besondere Gruppe
der ingenui waren die domini, die Herren, die verschiedene Grup-
pen von Unfreien beherrschten und daher vermutlich umfangrei-
chen Landbesitz besaen. Aber dennoch hatten diese domini, die
zweifellos zur Oberschicht der frnkischen Gesellschaf gehrten,
keine besondere Rechtsposition, wie sie zum Beispiel in einem
hheren Wergeid zum Ausdruck kme.
Das Wergeld fr Mnner stieg nur mit der Nhe zum Knig.
Die Mitglieder des kniglichen Haushalts und seiner Wache, die
leudes, trustis dominica, convivae regis oder antrustiones genannt
werden, waren die Personen, deren besonderer Status durch ein
hheres Wergeid geschtzt wurde. Rechtshistoriker wie Heike
Grahn-Hoek haben daraus geschlossen, da eine Schicht von
adligen Franken, sollte sie vor Chlodwig existiert haben, oen-
sichtlich von diesem liquidiert wurde; er und seine Nachfolger
htten dann einen Dienstadel geschaen, der sich vom Knig nur
allmhlich dadurch trennte, da er Heiratsverbindungen mit dem
rmischen Adel einging und auerdem von den mrderischen
Kriegen innerhalb der Merowingerfamilie protierte.
8
Sozialhistoriker wie Franz Irsigler fragten weniger nach der
Existenz von Rechtstraditionen des Adelsstandes als nach dem
tatschlichen Status und der Macht gesellschaflicher Gruppen.
9
Erkenntnisse aus anderen Regionen wie zum Beispiel Skandina-
vien legen die Vermutung nahe, da die Tatsache, da der Pactus
151
keinen Adel erwhnt, lediglich darauf hinweist, wie wenig Macht
selbst ein Knig wie Chlodwig ber die frnkischen Adligen be-
sa. Der Pactus versucht, die Blutfehden zu beschrnken, indem
er einen Bugeldtarif erstellt, den alle Parteien annehmen
mssen. Ein freier Adliger konnte nicht gezwungen werden, ein
Bugeld anzunehmen, weil es die Ehre seiner Familie beeckt
htte, weshalb er auch nicht zusammen mit einfachen Freien
und kniglichen Agenten aufgelistet werden konnte. In anderen
barbarischen Gesetzen wie denen der Alemannen und der Ba-
juwaren mag die Tatsache, da diese Bugelder von auen, von
den frnkischen Knigen, auferlegt wurden, erklren, warum
dort der Adel unter diese Gesetze fllt.
Sucht man nicht nach einer gesetzlich denierten Schicht,
sondern nach einem Adel, der durch seinen ererbten Status,
Reichtum und politische Macht charakterisiert wird, dann gibt
es einen frnkischen Adel ganz oensichtlich bereits im 5. und
6. Jahrhundert. Tatschlich glich der frnkische Adel in vielen
wesentlichen Merkmalen der gallormischen Aristokratie, was
die Assimilierung beider Gruppen besonders nrdlich der
Loire, wo viele Franken siedelten, erheblich erleichterte und be-
schleunigte. Frnkische Magnaten wie der in Lavoye begrabene
verfgten ber umfangreichen Landbesitz, Land, das secundum
dignationem, also dem Rang entsprechend, verteilt worden war
und das Allodialbesitz war, also keine Entlohnung fr jahrelan-
gen Knigsdienst, sondern ererbtes und unveruerbares Land.
Da der Adelsstatus an die nchste Generation vererbt werden
konnte, zeigt sich an den Grbern der Kinder. Diese enthalten of
hnliche Juwelen und Waen wie die Erwachsenengrber, aber
ihren Status, der in der Grabausstattung zum Ausdruck kommt,
hatten sie nicht durch eigene Verdienste erworben, sondern von
ihren Eltern ererbt.
Ein frnkischer Adel auf der Grundlage erblichen Reichtums
existierte also entweder schon vor dem merowingischen Knig-
tum, oder er entstand zur gleichen Zeit. Zwar setzten die Mero-
152
winger gelegentlich Mnner aus einfachen Verhltnissen ein, aber
die meisten Inhaber hoher mter wie Heerfhrer oder comites
entstammten diesem Adel. Gregor von Tours erwhnt vielfach
den Privatbesitz solcher Mnner, die ihre mter auf legale oder
illegale Weise dazu nutzen konnten, ihren Reichtum zu mehren
und Grundbesitz und villae zu erwerben.
Neben ihrem Grundbesitz verfgten die frnkischen Adligen
auch ber ihr eigenes Gefolge, das quivalent der kniglichen
trustis, sowie ber unfreie Diener, die pueri, die sie auf ihren Ln-
dereien rekrutierten. Auch dieses Gefolge gehrte in gewissem
Sinne zum adligen Haushalt, der sich ebenfalls aus der Sippe und
aus Verbndeten, den amici, zusammensetzte, die untereinander
durch Schwur zu gegenseitiger Hilfe verpichtet waren. Dieses
Gefolge erlangte besondere Bedeutung bei der Austragung von
Fehden, dem blichen Weg, auf dem frnkische Adlige Mei-
nungsverschiedenheiten ber ihren jeweiligen Status und ihre
Vorrechte untereinander klrten.
Neben dem Grundbesitz und dem Gefolge besa der frnkische
Adlige ein nichtmaterielles, aber entscheidendes Attribut, das
ihn von anderen Menschen abhob, das ererbte Charisma, das
Heil, derjenigen Familien, die fr ihre erfolgreiche Fhrerschaf
berhmt, mit anderen Worten nobiles waren. Diejenige Familie
galt als adlig, die im Ruf stand, da aus ihr Mnner mit militri-
schen Fhrungsqualitten und der Befhigung zu groen Taten
hervorgingen.
Dieses Charisma mute gegenber der brigen Gesellschaf
manifestiert werden, und das geschah im 6. Jahrhundert durch
den aristokratischen Lebensstil. Anders als die senatorische Ari-
stokratie der Rmer bedurfen die frnkischen Magnaten keiner
Befestigungen zu ihrem Schutz, sondern sie fhrten ein Leben
voller Kmpfe, Jagden und was vielleicht am wichtigsten war
voller Feste, die die Mglichkeit boten, potentielle Feinde fr
sich zu gewinnen und dem Gefolge die Freigebigkeit des Herrn
durch Verteilung von Geschenken zu demonstrieren.
153
Wir haben bereits gesehen, da grozgiges Schenken zu den
wichtigsten Kanlen gehrte, auf denen Gter zwischen den
Schichten der frnkischen Gesellschaf zirkulierten. Es begrndete
und festigte Beziehungen zwischen Geber und Empfnger, wobei
letzterer sich durch die Annahme des Geschenks in die Schuld
des ersteren begab. Mit seiner Freigebigkeit bewies der Anfhrer
seinen Adel ebenso wie mit seiner Fhigkeit, sein Gefolge gegen
die Feinde zu fhren und Reichtum meist Vieh und bewegli-
che Gter zu erwerben, den er dann verteilte. Auf diese Weise
konstituierten Plnderung und Freigebigkeit die beiden Teile des
Systems des Warentauschs und Gterverkehrs, das neben dem in
den frnkischen Stdten immer noch blhenden Handel und der
Landwirtschaf existierte, von der alles andere abhing.
Die Mehrzahl der anderen mit Grabbeigaben bestatteten To-
ten von Lavoye waren vermutlich freie Mnner und Frauen, die
ingenui des Pactus, die die Mehrheit des frnkischen Volkes und
das Rckgrat seines Heeres bildeten. Was fr diese Menschen
Freiheit bedeutete, ist allerdings unklar; Freiheit ist immer re-
lativ, und besonders in traditionellen Gesellschafen, in denen
Abhngigkeitsverhltnisse selbstverstndlich sind, ist die Art
der politischen, wirtschaflichen, rechtlichen Abhngigkeit
entscheidender als die Frage, ob sie existierte.
Die freien Franken von Lavoye und anderen Orten des Fran-
kenreiches waren insofern frei, als sie zum Heeresdienst unter
dem Knig verpichtet und als Krieger berechtigt waren, am
ffentlichen Gericht teilzunehmen. Die Verpflichtung zum
Kriegsdienst war das entscheidende Kriterium, das sie von den
Unfreien unterschied, nicht etwa ihre Beziehung zum lokalen
grundbesitzenden Adel, der durchaus das Land besitzen konnte,
das sie bearbeiteten, der in Kriegszeiten kommandierte und sie
auch in die Abhngigkeit drngen konnte. Karl Bosl versuchte,
sie als Knigsfreie zu beschreiben, als frei geborene Mnner,
die der Knig theoretisch durch seine Heerfhrer und Grafen
befehligen konnte.
20
154
Neben diesen unfreien Freien, wie Bosl es nannte, gab es
in der frnkischen Gesellschaf verschiedene Arten persnlich
abhngiger Menschen, die servi casati, unfreie Pchter, die
sptantiken coloni, Haussklaven und seltener in der Landwirt-
schaf arbeitende Sklaven auf groen Gtern. Sklaven waren in
den germanischen Gesellschafen traditionellerweise Kriegsge-
fangene oder Menschen, die wegen einer Missetat ihre Freiheit
verloren hatten. Als die germanischen Stmme jedoch in das
Rmische Reich eindrangen und sich neben und anstelle der
gallormischen Grundherren niederlieen, bernahmen sie das
rmische Verstndnis von Sklaverei. Darber hinaus schwand der
zunehmend rein formale Unterschied zwischen coloni und un-
freien Pchtern. Keine der beiden Gruppen leistete Kriegsdienst,
das entscheidende Kriterium der Freiheit im Frankenreich, und
so tendierten sie zur Verschmelzung. Beide Gruppen galten als
Teil des Grundbesitzes und gehrten rechtlich zur familia des
Grundherrn, ob dieser nun ein einfacher ingenuus oder ein Ad-
liger war. Mit der Zeit zhlten wohl auch solche Freien zu dieser
Gruppe, die sich aus wirtschaflichen Grnden den Kriegsdienst
nicht mehr leisten konnten. Sie sanken allmhlich auf das Niveau
der Unfreien ab, verloren das Recht, vor Gericht aufzutreten, und
wurden im engsten Sinne des Wortes von den Herren abhngig,
auf deren Land sie lebten und deren Felder sie bearbeiteten.
So kam es an beiden Enden des sozialen Spektrums zu einer
Amalgamierung gallormischer und barbarischer Gesellschafen,
deren Ausma vom jeweiligen zahlenmigen Verhltnis der
Franken und anderen Barbaren zur eingeborenen Bevlke-
rung abhing.
Im Gegensatz zur politischen Kontrolle durch die Franken war
ihre Siedlungsdichte in ihrem Reich sehr unterschiedlich. Im
Osten und Norden war die Besiedlung am Mittel- und Niederr-
hein auerordentlich stark. In diesen Regionen waren Rmer
als Kleriker, Hndler oder in den berresten der Verwaltung
nur noch innerhalb der Mauern von Stdten wie Kln, Bonn
155
und Remagen anzutreen. Auf dem Lande waren die verbliebe-
nen rmischen Bauern in der frnkischen Schicht der unfreien
Abhngigen aufgegangen, hatte das frnkische System der Land-
bewirtschafung das rmische abgelst.
Es gab jedoch auch Ausnahmen. In der Gegend um Trier, die
um 480 selbst aus der Sicht Ostroms Teil der Francia Rinensis
geworden war, wurden zwar die Lndereien in Fiskalbesitz der
kniglichen Domne zugeschlagen, kirchlicher Grundbesitz
und sogar kleine rmische Gter und Hfe blieben aber neben
neuen frnkischen Siedlungen erhalten. Dieses Muster ist beson-
ders typisch fr die Regionen weiter sdlich im burgundischen
Knigreich und fr die von den Goten eroberten Gebiete des
Westrmischen Reiches.
Im Sdosten bildeten die Ardennen eine natrliche Grenze
der dichten frnkischen Besiedelung, obwohl auch im Sden
bis zur Seine eine langsame, aber stete germanische Wanderung
und Besiedelung vor Chlodwig, die sich nach dessen Sieg ber
Syagrius beschleunigte, eine erhebliche Zahl von Franken in die-
se Region brachte. Zwischen Seine und Loire siedelten deutlich
weniger Franken; archologische und linguistische Zeugnisse
weisen aber auf verstreute Inseln frnkischer Besiedelung in
einem berwiegend gallormisch geprgten Land hin.
Noch weniger Franken nden sich sdlich der Loire. Vor 507
blieb die Region von ihren westgotischen Herrschern, die meist
von ihren stdtischen Residenzen aus mit Hilfe der aquitanischen
Aristokratie die lndlichen Gebiete kontrollierten, weitgehend
unbehelligt. An der tatschlichen Besiedelung nderte die frn-
kische Eroberung kaum etwas. Sicher wurden einzelne Franken
als comites in den Sden geschickt, andere lieen sich zweifellos
in den reichen Stdten Aquitaniens nieder, aber diese verspreng-
ten Franken beeinuten die Bevlkerung, ihre Sprache und
Gewohnheiten kaum.
Obwohl sich die Anzahl der Franken auch nicht annhernd
genau schtzen lt, ist vermutet worden, da es im gesamten
156
frnkischen Reich etwa 50 000 bis 200 000 Franken und sechs bis
sieben Millionen Gallormer gegeben hat. Diese Zahlen sind mit
groer Wahrscheinlichkeit zu hoch angesetzt; aber es erscheint
nicht ganz unberechtigt, von etwas mehr als 2 Prozent Franken
an der Gesamtbevlkerung auszugehen.
Diese 2 Prozent, die sich nrdlich der Loire konzentrierten und
die brige Bevlkerung beherrschten, besaen einen Einu, der
ihren Anteil an der Bevlkerung bei weitem bertraf. Whrend
die wenigen Franken im Sden rasch die Sitten und vermutlich
auch die Sprache und das Selbstverstndnis der Rmer ber-
nahmen, trif im Norden das Gegenteil zu. Hier ersetzte das
frnkische Selbstverstndnis innerhalb weniger Generationen
das rmische. Germanische Namen berwiegen, und selten wird
ein in der Region Geborener als Rmer bezeichnet; Romani
sind diejenigen, die sdlich der Loire leben. Alles, was von der
rmischen Identitt blieb, war der romanische Dialekt der Be-
vlkerung, obwohl vermutlich noch am Ende des 9. Jahrhunderts
in einigen nordfranzsischen Regionen frnkisch gesprochen
und verstanden wurde. Im Laufe des 8. Jahrhunderts war dieser
Wandel so grndlich vollzogen, da allgemein, aber flschlicher-
weise angenommen wurde, die Romani seien nach Chlodwigs
Sieg ausgerottet worden. Zwar ist dies nur eine Legende, aber
eine, die veranschaulicht, wie tiefgreifend die Vernderungen in
Gallien waren.
Nrdlich der Alpen war unter Chlodwig eine neue Art von
christlichem Barbarenreich errichtet worden, das den Westen
Europas fr immer prgen sollte. Mit Ausnahme Burgunds
dessen Knigreich von Chlodwigs Shnen zerschlagen und
in den frnkischen Herrschafsbereich integriert werden sollte
stand der Kern des frnkischen Reiches fest; eine lockere Kon-
fderation von barbarischen Frsten war durch einen einzigen
Herrscher ersetzt worden, dessen Reichtum nur von seiner Ge-
waltbereitschaf bertroen wurde; eine unbequeme Allianz von
heidnischen und arianischen Barbaren und christlichen Rmern
157
war von einem kultisch geeinten Knigreich unter einem christ-
lichen Knig abgelst worden, den der Kaiser in Konstantinopel
anerkannte und die orthodoxen Bischfe, die Reprsentanten der
gallormischen Elite, untersttzten. Trotz der Zwietracht und der
mrderischen Gewaltttigkeiten, von denen die Regierungszeiten
der Shne und Enkel Chlodwigs gekennzeichnet waren, sollte
sich der Wandel Westeuropas in der von ihm eingeschlagenen
Richtung fortsetzen.
158
IV. Das Frankenreich im 6. Jahrhundert
Die Nachfolger Chlodwigs im 6. Jahrhundert
Obwohl das von Chlodwigs Shnen regierte Frankenreich in
mehrere Knigreiche aufgeteilt war, galt es weiterhin als Ein-
heit; es gab nur ein regnum Francorum. Innerhalb dieses auf-
geteilten Reiches folgten Chlodwigs Nachfolger weiterhin den
Spuren seiner Politik. Nach auen unternahmen sie wiederholt
gemeinsame Anstrengungen, um auf Kosten der Nachbarn ihr
Knigreich auszudehnen, im Inneren nicht wenige Versuche, sich
gegenseitig umzubringen. Das Ergebnis ist eine verwirrende und
gewalterfllte politische Geschichte, die strker an die rmische
Sptantike als an germanische Traditionen erinnert. Was ihre
mrderischen Familienstreitigkeiten betrif, hatten die Mero-
winger oensichtlich viel von den Rmern gelernt.
Die Expansion nach auen
Die Ausdehnung des Frankenreiches gelangte unter den Shnen
und Enkeln Chlodwigs weitgehend zum Abschlu. Nach einer
Reihe von Teilerfolgen wurde um 534 das burgundische Reich
endgltig besiegt und Teil des Frankenreiches. Zwei Jahre sp-
ter suchten die Ostgoten verzweifelt nach Verbndeten gegen
Justinian, der Italien zurckerobern wollte, und berlieen den
Franken, die sie dafr im Krieg gegen die Rmer untersttzen
sollten, die Provence. Feldzge gegen die verbliebenen westgoti-
schen Auenposten in Aquitanien fhrten dazu, da um 54 die
gotische Prsenz nrdlich der Pyrenen auf einen Kstenstreifen
bei Narbonne reduziert wurde.
159
Im Osten nutzte Teuderich I. die Krise, die die Wiedererobe-
rung Italiens nicht nur in Italien selbst, sondern auch im nrdlich
anschlieenden Alpengebiet auslste, und brachte einen groen
Teil der Region unter seine Herrschaf. Zunchst besiegte er die
Reste der Tringer, die lange Zeit Verbndete der Ostgoten
gewesen waren, und brachte im Norden die Sachsen unter eine
abgeschwchte Form frnkischer Kontrolle. Sein Sohn Teude-
bert I., der von 533 bis 548 regierte, ging noch weiter. Der Rck
zug der Ostgoten aus der Provence isolierte die Alemannen,
die stlich von Burgund im heutigen Sdwestdeutschland und
der Nordschweiz siedelten; Teudebert integrierte sie ebenso
wie die Rtoromanen in den Alpenregionen um Chur in sein
Knigreich. Er dehnte seinen Machtbereich noch weiter nach
Osten aus ber das neu entstandene Vlkergemisch aus Trin-
gern, Langobarden, Erulern, Sueben, Alemannen und anderen
Stmmen die mit den Resten der rmischen Bevlkerung von
Noricum und Raetien zum Volk der Bajuwaren verschmolzen
waren. 539 nutzte er diese Region als Aufmarschgebiet fr einen
Einfall nach Italien, wo er durch wechselnde Bndnisse mit den
Byzantinern und Ostgoten sowie durch Verrat Venetien unter
seinem Einu zu bringen verstand.
Teudebert war mehr als ein plndernder Barbarenknig.
Gemeinsam mit seinen rmischen Ratgebern, die ihn dabei
untersttzten, strebte er vermutlich danach, das zu vollbringen,
was andere gallische Prtendenten vor ihm jahrhundertelang
versucht hatten, nmlich vom Westen aus den Kaiserthron zu
erobern. Sein Plan scheiterte, und nach seinem Tod gab sein Sohn
Teudebald I., der von 548 bis 5 5 5 regierte, die groen Ziele auf.
Aber immerhin hatte Teudebert sowohl die Strke als auch die
Ziele der Nachfolger Chlodwigs demonstriert.
Mit Subsidien, Verhandlungen und der Untersttzung
unterschiedlicher Parteien und Prtendenten versuchten die
Kaiser in Konstantinopel in den folgenden Jahren, die Macht des
Frankenreiches den kaiserlichen Interessen im Westen dienst-
160
bar zu machen, besonders bei dem Versuch, die Langobarden
wieder loszuwerden, die nach den Rckeroberungsversuchen
Justinians nach Italien eingedrungen waren. Obwohl solche
Versuche insgesamt erfolglos blieben, bezeugen sie sowohl die
Anerkennung der frnkischen Vorherrschaf im Westen durch
Byzanz als auch die anhaltend enge Verbundenheit der Franken
mit dem Rmischen Reich.
Die Merowinger unternahmen keinen Versuch, die Regio-
nen stlich des Rheins oder sdlich der Loire fest in ihr Reich
einzubinden; die Sicherung der Herrschaf ber das frnkische
Kernland band alle ihre Krfe. Bei jeder Eroberung gestanden sie
der Bevlkerung das Recht zu, nach ihrem eigenen barbarischen
oder rmischen Recht zu leben, und in Tringen, Alemannien,
Bayern, Rtien, in der Provence und sogar in Aquitanien setzten
sie frnkische duces ein in der Provence patricius und in Rtien
praeses oder Tribun genannt , die im Namen des Knigs regier-
ten. Diese duces oder patricii waren in dem Sinne Franken, da
sie von Franken ernannt worden waren. In Bayern zum Beispiel
stammten sie aus der mchtigen Familie der Agilolnger, die
mit Burgundern, Franken und Langobarden verwandt waren.
In Rtien heiratete der frn
kische Befehlshaber schnell in eine mchtige, in der Region
ansssige Rmerfamilie ein, und seine Nachkommen besaen
bis zum Ende des 8. Jahrhunderts das Monopol sowohl auf die
weltliche Herrschaf als auch auf das Bischofsamt. So verhielt
es sich fast berall. Die duces unterhielten bereits vor ihrer Er-
nennung Verbindungen zur lokalen Elite oder heirateten sehr
rasch in diese ein. Diese Regionen besaen deshalb, besonders in
Zeiten schwacher merowingischer Knige, die besten Aussichten,
unabhngig zu werden.
161
Die innere Ordnung
Als 560 Chlothar I., der letzte Sohn Chlodwigs, starb, wurde
das Reich wieder einmal unter seine vier Shne aufgeteilt, von
denen einer sechs Jahre spter starb. Nach seinem Tod bestand
das Gesamtreich aus drei groen Teilgebieten. Diese Tradition,
das Knigreich aufzuteilen, dauerte im Frankenreich bis weit ins
9. Jahrhundert fort. Dennoch fhrten die folgenden Reichstei-
lungen nicht zu unendlicher Zersplitterung. Statt dessen wurde
das Kernland des Knigreiches um die Mitte des 6. Jahrhunderts
dreigeteilt. Zwar verschoben sich die Grenzen dieser Teilreiche
bei jeder der folgenden Teilungen geringfgig. Im folgenden
Jahrhundert waren sie aber so weit gefestigt, da die Reiche eigene
Namen erhielten: Austrasien, Neustrien und Burgund.
Es wre irrefhrend, den Namen Austrasien das stliche
Land wrtlich zu verstehen, da zu diesem Reichsteil nicht nur
die Ostgebiete zwischen Rhein und Maas und die von Teude-
rich und seinem Sohn Teudebert eroberten Gebiete stlich des
Rheins gehrten, sondern auch die Champagne, die knigliche
Residenz in Reims spter in Metz und ein ansehnlicher Teil
Mittel- und Sdgalliens. Obwohl ein betrchtlicher Anteil der Be-
vlkerung dieser Region germanischer Abstammung war, bil-
dete Austrasien im 6. Jahrhundert ein Zentrum rmischer Kultur
und rmischen Einusses. Wie wir gesehen haben, wurden hier
ehrgeizige Plne einer imperialen Politik geschmiedet, die weit
hinausgingen ber alles, was der Ostgote Teoderich je erstrebt
hatte. Der Hof wurde zu einem Zentrum der lateinischen Wis-
senschafen; aus dem austrasischen Teil Aquitaniens, aber auch
von auerhalb des Frankenreiches, empng der Knig gebildete
Rmer wie Venantius Fortunatus. Diese oene Hinwendung zur
rmischen Kultur beeinute auch den frnkischen Adel und
beschleunigte die Verschmelzung der beiden Oberschichten.
Oensichtlich planten die austrasischen Knige aber mehr
als die bernahme der rmischen Kultur und die Eroberungen
162
imperialen Ausmaes. Theudebert versuchte vermutlich, in
seinen stlichen Besitzungen dasselbe rmische Steuersystem,
das in Teilen seiner gallischen Gebiete noch funktionierte,
einzufhren. Brunichild, die westgotische Ehefrau seines mit-
telbaren Nachfolgers Sigibert I., setzte diese Romanisierung mit
dem Ergebnis fort, da sich zwischen Adel und Knigtum eine
wachsende Kluf aufat, die zu einer langen und blutigen Reihe
von Kriegen fhrte.
Dabei mgen Steuerreformen eine gewisse Rolle gespielt haben,
aber in der frnkischen Gesellschaf wurden solche Konikte
meistens personalisiert und als Familienfehden ausgetragen. In
diesem Falle spaltete die Fehde die Familie der Merowinger und
fhrte zum Untergang des austrasischen Knigtums.
Neustrien, das neue Land im Westen, mit seiner merowin-
gischen Residenz Soissons war zwar das kleinste Teilreich,
verfgte aber ber das grte Fiskalland, rmische Stdte wie
Paris, Tours und Rouen und die produktivste Bevlkerung. Der
neustrische Knig Chilperich (56-584) verbrachte einen groen
Teil seiner Regierungszeit im Kampf um die Ausdehnung seines
Reiches gegen seinen Bruder, den austrasischen Knig Sigibert
(56-575), und gegen dessen Witwe Brunichild. Dieser Kampf,
der vorgeblich um das Erbe ihres 567 verstorbenen Bruders
Charibert gefhrt wurde, war gleichzeitig eine bittere Fehde,
die Chilperichs Frau Fredegund und ihre Erzrivalin Brunichild
entfesselt hatten. Chilperich war bereits unter anderem mit
Fredegund verheiratet, als er die westgotische Prinzessin Gals-
winth, die Schwester der Brunichild, zur zweiten Frau nahm.
Wie Gregor ber das Verhltnis zu der neuen Braut berichtet,
wurde sie von ihm mit groer Liebe verehrt. Sie hatte nmlich
groe Schtze mitgebracht.
Von Fredegund aufgehetzt und
aus Angst, Galswinth knnte mit ihrer Mitgif zu ihren Eltern
zurckkehren, lie er sie umbringen. Emprt und begierig, die
gnstige Gelegenheit zur Aufeilung von Chilperichs Reich nicht
zu versumen, versuchten Sigibert, der Ehemann der Brunichild,
163
und seine Brder, Chilperich abzusetzen. Das Resultat war eine
ber drei Generationen gefhrte Fehde, in deren Verlauf die
Familie der Merowinger fast ausgerottet wurde und die erst nach
dem Tod von zehn Knigen und der Hinrichtung Brunichilds II.
durch Chilperichs Sohn Chlothar II. 63 endete.
Der dritte Reichsteil war Burgund, zu dem nicht nur das alte
Knigreich Burgund, sondern auch ein bedeutender Teil Galli-
ens mit der Hauptstadt Orleans gehrte. In dieser Region lebten
ursprnglich zu einem erheblichen Prozentsatz Burgunder, R-
mer und Franken. Burgund sttzte sich in erster Linie auf die
wichtige Kirchenprovinz Lyon, die lange Zeit das Zentrum der
senatorischen Macht gewesen war. Knig Guntram (56-592)
bentigte diese rmischen Aristokraten fr seine Verwaltung
und besetzte sein wichtigstes Amt, das des patricius, dreimal in
Folge mit Rmern. Die drei Bevlkerungsgruppen gingen in-
nerhalb kurzer Zeit ineinander auf, allerdings blieb die rmische
Tradition dominierend. Angesichts der Bedeutung der Rhne
verlegte Guntram um 570 seinen Hof nach Chlon und machte
die Stadt damit sowohl zu einem religisen als auch politischen
Zentrum seines Reiches.
Obwohl Guntram unausweichlich in die gewaltttige Fehde
zwischen den Ehefrauen seiner beiden Brder verwickelt wur-
de, scheint er strker als die anderen Frankenknige von einer
christlich-rmischen Herrschafsidee durchdrungen gewesen
zu sein, vielleicht ein Ergebnis der Tatsache, da sein Reich das
rmischste der drei Teilreiche war. Hier konnten nicht nur die
rmische Kultur, sondern auch rmische Rechtstraditionen und
christliche Vorstellungen von den Pichten eines Knigs Wur-
zeln schlagen. Aber wie wir gesehen haben, war die rmische
Tradition fr Gewalt genauso anfllig wie die der Franken. Eine
einleuchtendere Erklrung fr Guntrams Herrschafsstil war
seine persnliche Frmmigkeit; Gregor von Tours beschreibt ihn
in uerst gnstigem Licht. Dennoch blieb er durchaus zu der fr
die Sptantike charakteristischen Brutalitt fhig. Als er zum Bei-
164
spiel seinen Kmmerer verdchtigte, im Knigsforst der Vogesen
Auerochsen gewildert zu haben, ordnete er eine Entscheidung
im Zweikampf an. Nachdem sich der Nee des Kmmerers und
der Wildhter, der den Vorwurf erhoben hatte, in einem wsten
Kampf Mann gegen Mann gegenseitig gettet hatten, suchte der
Kmmerer Zuucht in einer nahe gelegenen Kirche. Der Knig
lie ihn ergreifen, an einen Pfahl binden und zu Tode steinigen.
Der einzige Unterschied zwischen seinem Verhalten und dem
seines Grovaters Chlodwig bestand vielleicht darin, da er, wie
Gregor berichtet, spter bereute, einen treuen Diener wegen eines
so geringfgigen Vergehens gettet zu haben.
Die stndigen Fehden zwischen den Nachkommen Chlodwigs
schwchten alle Parteien und steigerten die Macht der frnki-
schen und rmischen Aristokratie, deren Untersttzung fr den
Sieg unentbehrlich war. Die fhrenden Schichten der Merowin-
gerreiche bildeten jedoch keineswegs eine Einheit, wenn sich
auch verschiedene Gruppen zeitweise zum Kampf gegen einen
besonders verhaten kniglichen Beamten zusammenschlieen
konnten. Vielmehr kennzeichnete die in der Merowingerfamilie
vorhandene Gewaltbereitschaf auch die Beziehungen innerhalb
der Aristokratie; in dieser Hinsicht gab es zwischen Rmern
und Franken keinen Unterschied. Private Kriegsfhrung war
die Regel.
Jegliche Unterscheidung zwischen privaten und staatspoli-
tischen Motiven der merowingischen Knige und Adligen ist
knstlich. Zur Erklrung der Existenz adliger Oppositionsgrup-
pen braucht man nicht zwischen dem Widerstand des Adels
gegen die Besteuerung und Bevormundung nach rmischem
Muster und seinen privaten Streitigkeiten zu unterscheiden. Seit
langer Zeit waren die Besteuerung wie die Fehden eine Priva-
tangelegenheit gewesen. Wenn man in Gregors Berichten nicht
zwischen persnlichen und politischen Motiven unterscheiden
kann, dann liegt dies daran, da sie nicht voneinander zu trennen
waren. Ob Knig oder Adliger, man kmpfe fr die Familienehre
165
und eine eigenstndige Herrschaf. Aber erst im 7. Jahrhundert
bernahm der Adel in diesem Kampf die fhrende Rolle.
Eine der Gruppen, die ein gewisses Verantwortungsbewutsein
fr die res publica, die entlichen Angelegenheiten, bewahrt
hatten, war der Klerus. Obwohl auch er fast ausschlielich aus
der rmischen oder romanisierten frnkischen Aristokratie
stammte und of tief in die blutrnstigen Fehden verwickelt
war, verstand er es insgesamt doch, die Macht und den Einu
seiner Gesellschafsschicht nicht nur fr sich selbst und seine
Familien, sondern auch in bezug auf sein Amt zu erhalten und
auszubauen. Knig Chilperich I. beklagte sich einmal: Keiner
herrscht jetzt berhaupt als allein die Bischfe.
2
Natrlich war
das eine bertreibung, aber im Frankenreich des 6. Jahrhunderts
hielt niemand so fest wie die Bischfe die Schlssel sowohl zur
weltlichen als auch zur geistlichen Macht in seiner Hand.
ber die frnkische Kirche ist viel geschrieben worden. In
Wirklichkeit gab es sie gar nicht. Die religise Landschaf setzte
sich aus mehreren Kirchen zusammen, an deren Spitze jeweils
ein Bischof stand und welche die kultischen und politischen
Zentren der lokalen Eliten bildeten. Im Laufe des 6. Jahrhunderts
vermittelten die frnkischen Knige dem Episkopat ein gewisses
Zusammengehrigkeitsgefhl; dennoch blieb dieser ebenso in
Parteien gespalten wie die gallormische Gesellschaf, die ihn
kontrollierte und die Bischofsmter besetzte.
Auerdem existierten neben der Bischofskirche zumindest
zwei und schlielich drei knigliche Kirchen, von denen jede
einzelne ihre eigenen Traditionen hervorbrachte, ihre eigenen
Beziehungen zu den lokalen Eliten pegte und ihren eigenen re-
ligisen Mittelpunkt besa. Diese Bezirke entsprachen ihrerseits
den wichtigsten Kulturregionen des Frankenreiches, der Region
nrdlich der Loire, Aquitanien und dem Osten einschlielich der
Rhne und der provenzalischen Kste.
166
Die Bischfe: edel von Geburt und im Glauben
Die erste Kirche in Gallien war die Bischofskirche gewesen; ihre
Traditionen reichen in die ltesten Zeiten der senatorischen Ari-
stokratie zurck. Die Zeit ihrer Entstehung, das spte 3. Jahrhun-
dert, fllt mit der Entstehung der Provinzaristokratie zusammen;
beide entwickelten sich also gleichzeitig und bildeten eine nicht
voneinander zu trennende Institution.
Die groe Mehrheit der frhen merowingischen Bischfe war
aus der gallormischen Aristokratie hervorgegangen. Angesichts
der Bedeutung der Bischfe im sptrmischen Gallien war auch
nichts anderes zu erwarten. Die im 7. Jahrhundert verfaten Hei-
ligenviten merowingischer Bischfe beginnen denn auch in der
Regel mit der Beschreibung der adligen Familie, aus welcher der
Bischof entstammte: Er war edel von Geburt, aber noch edler
durch seinen Glauben, eine Charakteristik, die in der gesam-
ten Hagiographie mit geringen Variationen stndig wiederholt
wird. Die Botschaf ist eindeutig: Ein Bischof mute angesehene
Vorfahren besitzen. Dieser weltliche Rang konnte jedoch durch
religise Tugend ersetzt werden, die dann ihrerseits die ganze
Familie, aus der er stammte, adelte.
Statistische Untersuchungen der sozialen Herkunf der mero-
wingischen Bischfe sind mit groer Vorsicht zu genieen, weil
entsprechende Angaben fehlen. Wie Martin Heinzelmann gezeigt
hat, sind von den 707 namentlich bekannten Bischfen der acht
Kirchenprovinzen Tours, Rouen, Sens, Reims, Trier, Metz, Kln
und Besanon zum Beispiel 328 nur dem Namen nach bekannt.
3
Von den 79 Bischfen, die einer bestimmten Gesellschafsschicht
zugeordnet werden knnen, stammten jedoch nur acht eindeu-
tig nicht aus der senatorischen Aristokratie, wie zum Beispiel
Iniuriosus von Tours, der von niederer, aber dennoch freier
Abstammung war. Angesichts der aristokratischen Grund-
tendenz der Quellen kann man natrlich davon ausgehen, da
solche Informationen um so seltener weitergegeben wurden, je
167
niedriger die gesellschafliche Herkunf war. Doch trotz fehlender
biographischer Angaben weisen viele Indizien darauf hin, da
die groe Mehrheit der Bischfe aus mchtigen und bedeuten-
den Familien stammte. So hatten Verwandte der Bischfe als
referendarins, maior domus oder domesticus hug wichtige und
hohe weltliche mter inne, wie sie frher die Bischfe selbst
verwaltet hatten, und in den Bischofslisten einzelner Dizesen
und ihrer Nachbardizesen sind immer wieder die gleichen
Namen verzeichnet.
Dies kommt so hug vor, da man davon sprechen kann, da
bischiche Familien die Bischofssitze ber Generationen
hinweg fr sich beanspruchten. Am berhmtesten ist der Fall
des Geschichtsschreibers Gregor von Tours. Beide Eltern Gre-
gors stammten aus aristokratischen Familien der Auvergne, die
in Langres, Genf, Lyon und natrlich in Tours Bischfe gestellt
hatten. Gregor rhmt sich dessen, da von seinen 8 bischi-
chen Vorgngern alle bis auf fnf seine Verwandten gewesen
seien. Vermutlich ist sein Fall typisch. Wir wissen zum Beispiel,
da es in Nantes, Chlons, Paris, Sens, Laon, Metz, Orleans und
Trier die Regel war, da Shne ihren Vtern oder Neen ihren
Onkeln nachfolgten.
Solche Bischofsdynastien belegen sowohl die Macht der
Bischfe bei der Ernennung ihrer Nachfolger als auch das of
ber Generationen zurckreichende Netzwerk zwischen den
aristokratischen Familien ganz Galliens. Die Kontrolle der Bi-
schofsmter war eines der wichtigsten Ziele der Familienpolitik,
wobei die Rivalitt unter senatorischen Familien gefhrlich und
tdlich sein konnte. Ein drastisches Beispiel dafr sind die Aus-
einandersetzungen zwischen der Familie des Gregor von Tours
und der des Felix von Nantes (ca. 52-582). Felix stammte aus
einer der mchtigsten Familien Aquitaniens. Energisch frderte
er die kirchlichen und weltlichen Interessen sowohl seines Bis-
tums als auch seiner Familie, die recht eng miteinander verknpf
waren. Sein Bewunderer Venantius Fortunatus schreibt ihm die
168
Bekehrung des wilden Volkes der Sachsen zu, das heit der
schsischen Piraten, die an der Kste siedelten und von den
Merowingern frmlich anerkannt worden waren. In Nantes selbst
versuchte Felix, zum Nutzen seiner Stadt den Handel auf das
rechte Ufer der Loire zu orientieren.
4
Von diesen Bemhungen
protierte auch seine Familie.
Felix hatte das Bischofsamt als Nachfolger seines Vaters Eu-
merius, der 549 oder 550 gestorben war, angetreten und pegte
einen hochadligen Lebensstil. Fortunatus hat seinen Lieblingssitz,
das im Poitou an der Loire gelegene Landgut Charce, das mehr
als 3000 Hektar umfate, als ideales Adelsgut mit Weinbergen
und pinienbedeckten Hgeln beschrieben. Im spten 6. Jahrhun-
dert besa die Herrschaf der Familie ber Nantes vermutlich
bereits eine lange Tradition; Martin Heinzelmann hat darauf
hingewiesen, da in den Bischofslisten von Nantes schon im
4. und 5. Jahrhundert die relativ seltenen Namen Eumerius und
Nonnechius so hie auch der Verwandte und Nachfolger des
Bischofs Felix hug wiederkehren.
Im Gegensatz zu Fortunatus schtzte Gregor diese Familie we-
nig und Felix schon gar nicht. Er beschrieb ihn als einen Mann
von unendlicher Habsucht und Selbstberhebung.
5
Gregors
Ha war verstndlich. Als 580 der Archidiakon Rikulf versuchte,
Gregor abzusetzen, vermutlich weil er sich vom rtlichen Klerus
hatte whlen lassen, untersttzte Felix den Archidiakon nicht
nur, sondern nahm ihn auch in Nantes auf, nachdem der Plan
gescheitert war.
Welche Motive Felix dabei bewogen, ist unklar. Aber sicherlich
hingen sie ebenso stark mit der Rivalitt zwischen den Familien
wie mit der Kirchenpolitik zusammen. Er hatte Gregors Bruder
Peter, einen Diakon der Kirche von Langres, beschuldigt, er habe
seinen eigenen gewhlten Bischof und Verwandten Silvester
ermordet, um dessen Nachfolge anzutreten. Dieser Vorwurf em-
prte Gregor, vielleicht weil er der Wahrheit ziemlich nahekam.
Einige Jahre zuvor war Peter mit Sicherheit in die Verurteilung
169
und Absetzung eines anderen Diakons namens Lampadius
verwickelt gewesen, und diese Verstrickung fhrte schlielich
zu Peters Tod. Auch die Anschuldigungen, die Felix gegen Peter
wegen Silvester vorbrachte, mgen zumindest teilweise der Wahr-
heit entsprochen haben. Mit Sicherheit beanspruchte Gregors
Familie Langres als einen ihrer Bischofssitze, und Peter mag
der Meinung gewesen sein, da nicht Silvester, sondern ihm selbst
im Jahre 572 die Nachfolge des Bischofs Tetricus gebhrte. Wie
sich die Angelegenheit auch verhalten haben mag, Lampadius
stachelte den Sohn des Silvester so lange auf, bis dieser Peter in
Langres auf oener Strae erschlug. Oensichtlich billigte Felix
die Art nicht, in der die Mitglieder der Familie Gregors nach dem
Bischofsamt strebten.
Genauso dachte Gregor ber Felix. Als dieser im Sterben lag,
versuchte er, seinen Neen Burgundio zum Nachfolger zu er-
nennen. Gregor war als Metropolitanbischof fr die Tonsur und
die Weihe des jungen Burgundio zustndig, und er geno die
se Rache, die Unrechtmigkeit dieses Vorgehens ausfhr-
lich darzulegen; er sandte Burgundio mit dem Rat nach Hause:
Kehre also, Teuerster, nach Nantes zurck und bitte den, der dich
erwhlt hat, er mge dir zuerst die Tonsur erteilen. Und wenn
du es dann zum Priester gebracht hast, so zeige dich treu und
eiig im Dienste der Kirche; wenn dann Gott deinen Oheim
abrufen wird, so wirst du mit Leichtigkeit zur Bischofswrde
aufsteigen.
6
Nach dem Tod des Bischofs Felix konnte Gregor
nicht verhindern, da Nonnechius, ein entfernter Verwandter
des Verstorbenen, ernannt wurde, aber immerhin nicht der von
Felix gewhlte Burgundio.
Solche komplexen Familienrivalitten konzentrierten sich auf
das Bischofsamt, weil dieses einen Preis darstellte, um den es sich
zu kmpfen lohnte. Die Herrschaf ber die groen Bistmer
war der Schlssel zum Erhalt der regionalen Macht einer Sippe.
Auerdem verschafe sie groen Reichtum. Vom 4. Jahrhundert
an waren riesige Landchen an die Kirche bertragen worden,
170
und den gesamten Grundbesitz kontrollierte der Bischof. Einen
Eindruck davon, wie eine Familie von diesem Reichtum protie-
ren konnte, vermitteln die wenigen erhaltenen Testamente frn-
kischer Bischfe: Remigius von Reims zum Beispiel setzte seine
Kirche und seinen Neen Lupus, den Bischof von Soissons, den
Priester Agricola und den 66 verstorbenen Bertram von Le Mans
als Erben ein. Bertram machte seine Kirche zum Alleinerben.
Diese Testamente verfgen ber Lndereien, Kirchen, Sklaven,
coloni und bewegliche Gter, welche die Familie durch Erbschaf,
knigliche Geschenke, Kauf, Tausch und Konszierung erwor-
ben hatte. Die Prosperitt der Familie erforderte die Kontrolle
ber den Besitz des Bischofs, und nachdem solche Schenkungen
ber Generationen hinweg blich geworden waren, verwundert
es nicht, da die Familien die Besetzung der Bischofssthle all-
mhlich als ein Erbrecht betrachteten, fr dessen Verteidigung
es sich selbst zu tten lohnte.
Gemordet wurde ohne Unterschied in gallormischen wie
frnkischen Familien, soweit man diese zu jener Zeit berhaupt
noch voneinander unterscheiden kann. Im allgemeinen geht
man davon aus, da der frnkische Episkopat sich bis weit ins 8.
Jahrhundert fast ausschlielich aus den Reihen der gallormi-
schen Aristokratie rekrutierte. Tatschlich ist das Bischofsamt
als Bollwerk der rmischen Bevlkerung eingeschtzt worden,
denn es allein konnte die rmischen Traditionen und die rmi-
sche Kultur vor den barbarischen Franken schtzen.
Zwar stammten im 6. Jahrhundert und im Sden noch im
7. und 8. Jahrhundert die Bischfe aus den groen senatorischen
Familien. Aber Allianzen und Heiratsverbindungen zwischen
Rmern und Franken gab es schon vor Chlodwig, und im Laufe
des 6. Jahrhunderts begannen diese Familien zu verschmelzen,
indem sie die Knigsnhe und militrische Macht des frnki-
schen Groen mit den kulturellen Traditionen, dem regionalen
Patronat und dem Netz der Verwandtschafsbeziehungen der
senatorischen Aristokratie vereinten. Die meisten Belege, die das
171
Gegenteil beweisen sollen, beziehen sich auf die rmischen Na-
men in den merowingischen Bischofslisten, die einige Historiker
als Beweis fr eine fortdauernde Beherrschung des Episkopats
durch rmische Familien angesehen haben. Es ist allerdings
schwierig, przise zwischen rmischen und frnkischen Familien
vor allem im Norden und in Burgund zu unterscheiden, erst
recht aufgrund von Namen. Shne, die fr den Klerikerstand
vorgesehen waren, erhielten womglich ohne Rcksicht auf den
familiren Hintergrund christliche oder lateinische Namen, an-
dererseits dominierten im Norden sogar in Familien rmischer
Ab stammung schon sehr frh germanische Namen, was zum
Teil seinen Grund in Heiratsverbindungen zwischen Franken
und Rmern, zum Teil in politischen Loyalittsbezeugungen
gegenber den frnkischen Knigen hatte. In der zweiten Hlf-
te des 6. Jahrhunderts nden sich unter den Nachkommen der
Familie des Bischofs Remigius von Reims nicht nur rmische
Namen wie Lupus, sondern auch die frnkischen Namen Romulf
und sehr wahrscheinlich Leudegisel und Attalenus. Der selbe
Vorgang vollzog sich am Rhein, als in Trier und Kln die alten
rmischen Familien mit den frnkischen Sippen, mit denen sie
die Macht teilten, verschmolzen, ebenso wie in Burgund, wo eine
aufstrebende lokale Aristokratie burgundische, frnkische und
rmische Adelstraditionen in sich vereinte. Im Vordergrund aller
Bemhungen stand die Erhaltung der Macht und Autonomie der
Familie unabhngig von deren Abstammung.
Die auerordentliche materielle und politische Bedeutung
des Bischofsamtes erklrt, warum sich bereits in der Antike die
Tradition herausbildete, fr dieses Amt erfahrene Mnner aus-
zuwhlen, die ihre Fhigkeiten in Politik und Verwaltung bereits
unter Beweis gestellt hatten. Zwar kamen manche Bischfe nach
einer regulren Laufahn als Kleriker ins Amt und stiegen vom
Lektor zum Priester und dann zum Bischof auf, aber das waren
so groe Ausnahmen, da ihr Eintreten wie in dem Fall des
Bischofs Nivard von Reims oder des Heraclius von Angoulme
172
von den Hagiographen fr erklrungsbedrfig gehalten wurde.
Nach dem Cato 55 von Klerus und Volk zum Kandidaten fr die
Nachfolge des heiligen Gallus in Clerment gewhlt worden war,
prsentierte er seinen klerikalen Werdegang als Nachweis seiner
Qualikationen: Auch habe ich alle Stufen des geistlichen Amts
immer nur nach kirchenrecht licher Vorschrif erlangt. Zehn
Jahre war ich Lektor, fnf Jahre habe ich im Amt des Subdiako-
nen gedient, fnfzehn Jahre aber brachte ich als Diakon zu, und
zwanzig Jahre bekleide ich die Wrde des Priestertums. Was bleibt
mir denn noch brig, als da ich das Bistum empfange, das mein
treuer Dienst verdient hat?
7
Er bekam den Job nicht.
Viele Bischfe traten ihr Amt nach einer weltlichen Karriere an,
und selbst fr diejenigen, die innerhalb des Klerus aufstiegen, war
nicht das Priestertum der bliche Weg zu einem kirchlichen Amt.
Junge Mnner, die fr ein Bischofsamt vorgesehen waren, wur-
den normalerweise zu einem engen Verwandten, der Bischof war,
zur Erziehung geschickt. Eine sorgfltige Erziehung galt als Vor-
aussetzung fr das Bischofsamt, da der Bischof seinerseits fr die
Erziehung des Klerus und anderer junger Leute verantwortlich
war, die Verwandte oder Verbndete an seinen Hof schickten.
Da jedoch die meisten dieser Bischfe ihr Amt in einem spte-
ren Lebensabschnitt bernommen hatten, war diese Erziehung
strker von der Tradition der sptrmischen Wissenschaf als
von theologischer, asketischer oder spiritueller Unterweisung
geprgt. Die niederen Weihen konnten schnell erworben werden,
aber die von ehrgeizigen Klerikern am meisten begehrte Position
war die des Archidiakons. Dieser war die wichtigste Person am
bischichen Hof; er kontrollierte die Temporalia der Dizese
und verwaltete meistens im Aufrag des Bischofs das gesamte
Bistum. Daher berrascht es nicht, da der Archidiakon meist
ein aussichtsreicher Kandidat fr die Nachfolge seines Bischofs
war, zumal er einerseits umfangreiche Erfahrungen gesammelt
hatte und andererseits als Verwalter des Dizesanbesitzes ber die
Mittel verfgte, den Knig, den brigen Klerus und die Glubigen
173
zu bestechen. Das traf zum Beispiel fr Rikulf zu, mit dem Gregor
soviel rger hatte. Angesichts der krfigen Untersttzung, die
Rikulf beim Klerus von Tours fand, mag dieser durchaus Rikulf
dem Bischof vorgezogen haben, trotz oder vielleicht sogar wegen
der traditionellen Ansprche von Gregors Familie und Rikulfs
relativ einfacher Abstammung.
Die wenigen Bischfe, die eine solide theologische und asketi-
sche Bildung vorweisen konnten, erlangten ihr Amt hug aus
dem Ordensleben heraus. Nur im Kloster konnte einigermaen
verllich eine ernsthafe religise Erziehung erworben werden,
und wenn diese sich mit dem administrativen und politischen
Geschick eines fhigen Abtes verband, erwuchs daraus tatschlich
ein eindrucksvoller Kandidat fr das Bischofsamt. Auerdem
waren viele bte erst nach einer Zeit des aktiven Hofdienstes
ins Kloster eingetreten. Von vornehmer Herkunf, mit besten
Beziehungen, vorzglich ausgebildet und erfahren, galten sie
aus der Sicht ihrer Familie, des Klerus und des Knigs als ideale
Bischfe. Das Exempel eines solchen Bischofs war Papst Gregor
der Groe (590-604), der aus einer rmischen Adelsfamilie kam
und von 579 bis 585 Prfekt einer Stadt gewesen war, sich dann
in ein von ihm selbst gegrndetes Kloster zurckzog, bevor er
sich gezwungen sah, die Wrde des hchsten kirchlichen Amtes
anzunehmen. In Gallien nahmen die Karrieren von Bischfen
wie Salvinus von Albi, Numeranus von Trier und Guntharius
von Tours einen hnlichen Verlauf.
Auch wenn viele Bischfe vor ihrer Ernennung erst weltliche
mter ausgebt hatten und dann ins Kloster eingetreten waren,
so gelangte doch eine sehr viel grere Anzahl unmittelbar aus
ihren skularen Positionen zur Bischofswrde. Das Bischofsamt
krnte einen cursus honorum im traditionellen Sinne. Im 5. und
6. Jahrhundert verliefen diese Karrieren hug ber die aus der
Sptantike verbliebenen mter oder Positionen als Provinzver-
walter; im 7. Jahrhundert bildete der Dienst am Knigshof die
entscheidende Etappe.
174
So war es auch dem Ururgrovater Gregors, dem Bischof
Gregor von Langres, ergangen. Dieser ltere Gregor hatte vierzig
Jahre lang als Graf von Autun gedient, vermutlich von 466 bis
506, hatte mit Armentaria eine Frau aus ebenfalls senatorischer
Familie und vermutlich Tochter des Bischofs Armentarius von
Langres, geheiratet und eine Familie gegrndet. Nach dem Tod
seiner Frau bekehrte er sich zum Herrn und wurde zum Bischof
von Langres gewhlt, ein Amt, das er bis zu seinem Tode um das
Jahr 540 innehatte.
8
In der Mitte des 6. Jahrhunderts hufen sich solche Bekehrun-
gen im Zusammenhang mit den oben beschriebenen politisch-
familiren Rivalitten. So wollten zum Beispiel nach dem Tod
des Bischofs Ferreolus von Uzs sowohl Albinus, der Prfekt von
Marseille und Kandidat des rector der Provence Dynamius, als
auch Jovinus, der abgesetzte Vorgnger und Rivale des Dynamius,
seine Nachfolge antreten. Albinus wurde von Dynamius ohne
die Zustimmung Knig Guntrams ernannt. Man htte sicher
versucht, ihn abzusetzen, wre er nicht kurz danach gestorben.
Sein rechtzeitiges Ableben ernete den Weg fr eine Neubeset-
zung, aber bevor Jovinus installiert werden konnte, ernannte
Dynamius den Diakon Marcellus, einen Sohn seines Freundes
Felix und Angehrigen einer mchtigen senatorischen Familie
aus Marseille. Das Ergebnis war ein Krieg, in dessen Verlauf
Jovinus die Stadt Uzes belagerte, bis Bischof Marcellus seinen
Abzug erkaufe.
9
Im Laufe des 6. und 7. Jahrhunderts geschah es immer fer,
da der comes, der Vertreter des Knigs, in einer civitas zum
Bischof avancierte. In einigen Fllen mag die Bischofswrde als
selbstverstndliche Krnung des cursus honorum gegolten haben,
die auf das Amt des comes folgte. Der Unterschied zwischen
weltlichem und geistlichem Amt war so undeutlich geworden
wie in der Zeit vor Diokletian der Unterschied zwischen ziviler
und militrischer Laufahn.
Mnner in hohen Stellungen waren meist verheiratet, und wenn
175
die Frau anders als Armentaria, die Frau des Bischofs Gregor von
Langres, vor der Wahl ihres Gatten nicht verstorben war, hielt sie
als episcopa, Frau des Bischofs, Einzug in die bischiche Resi-
denz und das entliche Leben. Das Zlibatsgebot fr den Klerus
war noch relativ neu und wurde im frnkischen Knigreich nicht
sonderlich streng befolgt. Obwohl seit der zweiten Hlfe des 4.
Jahrhunderts mehrere Ppste die sexuelle Enthaltsamkeit des
Klerus gefordert hatten, wurde diese erst unter dem wachsenden
Einu der aus dem Osten stammenden asketischen Tradition,
die wie wir im zweiten Kapitel sahen die senatorische Ari-
stokratie im 4. Jahrhundert erfate, zum Ideal der gallischen
Bischfe. Im 6. Jahrhundert ging man im allgemeinen davon
aus, da verheiratete Mnner, die in den Klerus eintraten, ihre
Ehefrauen zwar behielten, die ehelichen Beziehungen aber ab-
brachen, und da die Frauen ihren Mnnern bei der Ausbung
ihres Amtes zur Seite standen. Um jegliche Spur von Skandal zu
vermeiden, lebten sie getrennt; die Frau des Bischofs durfe das
Schlafzimmer ihres Mannes nicht einmal betreten, das in einigen
Fllen eine Art Dormitorium war, in dem der Bischof umgeben
von seinen Klerikern schlief.
Im Verlauf des 6. Jahrhunderts waren immer weniger Diakone,
Priester und Bischfe verheiratet, und der Status der Kleriker-
frauen verschlechterte sich durch Konzilsbeschlsse zunehmend.
Dennoch spielten diese und besonders die episcopae bis ber die
Mitte des Jahrhunderts hinaus zusammen mit ihren Ehemnnern
eine entliche Rolle. Das hinreiendste Portrt einer episcopa
liefert Gregor von Tours mit der Charakteristik der Frau des
Bischofs Namatius von Clermont-Ferrand aus dem spten 5.
Jahrhundert. Nach seinem Bericht betrieb sie persnlich den
Bau der Kirche des heiligen Stefan. Sie sa gerne in der Kirche,
las eine ltere Darstellung seines Lebens und gab den Malern
an, was sie auf den Wnden darstellen sollten.
0
Trotz dieser
vorteilhafen Schilderung nennt Gregor aber noch nicht einmal
den Namen dieser Frau. Etwas nachteiliger beschreibt er die Frau
176
des Sidonius Apollinaris, die Tochter des Kaisers Avitus. Nach
seiner Wahl zum Bischof pegte Sidonius den Bettlern, die an
seine Tr klopfen, das Familiensilber zu schenken. Seine Frau,
die ebenfalls ungenannt bleibt, beschimpfe ihn wegen der ihrer
Meinung nach bertriebenen Freigebigkeit, lie dann die Bettler
aufspren und kaufe das Silber zurck.
Der Niedergang des asketischen Ideals in der Adelsgesellschaf
des 6. Jahrhunderts mag zu einem Wandel im Verhalten der
episcopa und ihres Ehemannes gefhrt haben. Jedenfalls be-
richtet Gregor wenig Gutes ber die Frauen seiner bischichen
Zeitgenossen. Typischer war nach Gregors Ansicht Susanna, die
Frau des Bischofs Priscus von Lyon, der 573 geweiht wurde. Sie
untersttzte nicht nur ihren Mann bei der Verfolgung der An-
hnger seines Vorgngers, des heiligen Nicetius, sondern sie und
ihr Gefolge pegten auch die Rume des Bischofs aufzusuchen.
Mit groer Befriedigung berichtet Gregor, da sie schlielich
wahnsinnig wurde. Vom Teufel besessen, irrte sie barhuptig
durch die Straen von Lyon, verkndete berall, da Nicetius
in Wirklichkeit ein Mann Gottes gewesen sei, und ehte ihn an,
er mge sie verschonen.
2
Der einzige ernst zu nehmende Rivale des Bischofs im Kampf
um die Macht in der Stadt war der comes. Aber mit dem Zerfall
der Zivilverwaltung hatten sich die Bedingungen dieses Wett-
bewerbs verndert. Das Amt des Bischofs geno ein hheres
Ansehen als das des comes, zumal of Aristokraten Bischfe
wurden, die zuvor als comites gedient hatten. Im Verlauf des 6.
Jahrhunderts verlor das Amt des comes fortschreitend sein An-
sehen und seine Macht an das des Bischofs, was zum Teil damit
zusammenhngt, da viele Bischfe aus hheren Gesellschafs-
schichten stammten. Whrend spter die Kirche eine Schneise der
sozialen Mobilitt ernete, wie es sie im weltlichen Bereich nicht
gab, galt im 7. und 8. Jahrhundert weithin gerade das Gegenteil.
Andererseits kamen comites zwar in der Regel aus denselben
Gesellschafsschichten wie die Bischfe, gelegentlich waren sie
177
aber auch einfacher Herkunf und konnten je nach Fhigkeit und
Geschick im Knigsdienst aufsteigen. So zum Beispiel Leudast,
der comes der Stadt Tours, der Gregors grter Feind war. Wenn
man Gregor Glauben schenken darf, war Leudast das klassische
Beispiel eines Aufsteigers. Er wurde als Sohn eines Sklaven gebo-
ren und war so zart, da er nicht einmal in der Kche arbeiten
konnte. Dennoch machte er durch knigliche Gunst Karriere,
wurde Seneschall und schlielich comes von Tours. Hher konn-
te er nicht hinaus; obwohl er in manchen Gegenden mchtige
Freunde besa, war er kein ernsthafer Gegenspieler fr den ber
glnzende Beziehungen verfgenden Bischof. Spter wurde er
auf Befehl der Knigin Fredegund zu Tode gefoltert.
3
Gegen Ende des 6. Jahrhunderts hatte sich das Krfeverhltnis
zwischen dem comes- und dem Bischofsamt so stark verschoben,
da die Ernennung eines comes der Zustimmung des Bischofs
bedurfe bzw. da in Wirklichkeit der Bischof den comes ernannte.
So hatte Knig Teudebert zum Beispiel Gregor gebeten, Leudast
wieder zu ernennen. Der comes galt kaum noch als Stellvertreter
des Knigs, sondern war zum Beamten der bischichen Ver-
waltung geworden.
Die von solchen Bischfen erworbene Verwaltungserfahrung
bereitete sie gut auf die Administration ihrer Bistmer vor. Ihre
politische Macht ermglichte es ihnen, vielfach als Beschtzer
ihrer Gemeinde gegen knigliche Forderungen aufzutreten.
Wenn Bischfe sich Knigen oder ihren Beaufragten in den
Weg stellten, um unbliche oder bermige Steuern abzuweh-
ren, waren sie gegenber dem Knig insofern im Vorteil, als sie
die lokale Machtelite reprsentierten, deren Untersttzung der
Knig bentigte. Der Schutz, den der Bischof seiner Gemeinde
angedeihen lie, war of genauso eine Verteidigung der rtlichen,
zum groen Teil ererbten Herrschafs- und Besitzverhltnisse
wie Schutz des Gottesvolkes.
Geburt, Ausbildung und erwiesene Kompetenz in der Verwal-
tung waren fr einen Bischof unerllich, aber allein nicht ausrei-
178
chend; der Bischof mute auch gewhlt und konsekriert werden.
Dabei fhrten kirchlicher Brauch von einem Kirchenrecht kann
man noch nicht wirklich sprechen , das Vorrecht des Knigs und
die lokale Machtpolitik hug zu erheblichen Krisen.
Die Tradition verlangte, da der Bischof von Klerus und Volk
gewhlt wurde. In der Praxis wurden die meisten Bischfe wahr-
scheinlich nicht auf diese Weise gewhlt, obwohl im isolierten
sptrmischen Gallien dieser Formel manchmal annhernd
entsprochen wurde, wenn man unter Klerus in erster Linie
den Archidiakon und unter Volk die senatorische Aristokra-
tie versteht. Nach der Errichtung des frnkischen Knigtums
wurde ein neues Element eingefhrt bzw. wiedereingefhrt, die
Zustimmung des Knigs. Daher muten im 6. Jahrhundert bei
der Ernennung des Bischofs der Knig, der Dizesanklerus und
die Aristokratie zusammenwirken. Zustzlich gab es im Hinter-
grund die Volksmenge, die bei Bedarf dazu ermuntert werden
konnte, bei umstrittenen Nachfolgeregelungen ihren Ansichten
Ausdruck zu verleihen.
Da es keine eingespielten Verfahren fr die Regelung der Nach-
folge gab, wurde der nahende Tod eines Bischofs von allen Seiten
mit einer Mischung aus Angst und Honung erwartet. Der Tod
eines Bischofs und ein Interregnum konnten Gewaltttigkeiten,
Plnderungen und die Begleichung alter Rechnungen mit sich
bringen. Tatschlich hat man gewhnlich eine solche Phase der
Unruhen erwartet. Als der Bischof Teodor von Marseille von
seinem Gegner Dynamius gefangengenommen wurde, plnderte
der darber entzckte Klerus die bischiche Residenz, gleich
als ob der Bischof schon tot wre.
4
In diesem Falle berlebte
der Bischof aber und wurde sogar zu seinem Bischofssitz zu-
rckgebracht. In anderen Fllen brachten diejenigen, die auf die
Amtsnachfolge spekulierten, den Amtsinhaber zu Tode. Dieser
Vorwurf wurde gegen den eigenen Bruder Gregors erhoben, und
Gregor selbst beschuldigte Bischof Frontonius von Angouleme,
seinen Vorgnger Marachar ermordet zu haben;
5
in Lisieux ver-
179
schworen sich ein Priester und der Archidiakon zur Ermordung
des Bischofs Aetherius, und nur das Versagen des fr den Aufrag
angeworbenen Klerikers rettete diesem das Leben.
6
Um eine geordnete Nachfolge sicherzustellen und ihrer Familie
das Amt zu erhalten, versuchten manche Bischfe, die Wahl und
die Weihe ihres Nachfolgers bereits zu ihren Lebzeiten durchzu-
setzen. Wir haben oben von dem Versuch des Bischofs Felix von
Nantes erfahren, seinem Neen die Nachfolge zu sichern. Solche
Praktiken widersprachen dem kirchlichen Gewohnheitsrecht
und stieen auf ernsthafen Widerstand. Huger uerte der
Bischof eine starke Vorliebe fr einen bestimmten Nachfolger,
wie zum Beispiel der heilige Bischof Maurilio von Cahors, der
erfolgreich darauf drang, da Ursicinus, der referendarius der
Knigin Ultrogotha, zum Nachfolger gewhlt wurde.
7
Auf
hnliche Weise verschafe Bischof Sacerdos von Lyon seinem
Nachfolger Nicetius das Amt.
8
Die Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Familien,
kniglichen Kandidaten und den Favoriten des lokalen Klerus
nahmen ernste Formen an, sobald der Bischof tot war. Norma-
lerweise muten drei Dinge sichergestellt werden, die Wahl, die
Besttigung durch den Knig und die Weihe, wobei letztere am
wichtigsten war. War jemand erst einmal geweiht, so konnte
seine Wahl noch so skandals sein und die Besttigung durch
den Knig noch ausstehen; selbst wenn er im uersten Falle
verbannt oder gar exkommunziert wurde, war es auerordentlich
schwierig, vor seinem Ableben einen neuen Bischof zu ernennen,
und auf jeden Fall blieb er Bischof. Bischof Faustianus von Dax
wurde auf dem zweiten Konzil von Mcon von Knig Guntram
zwar abgesetzt, weil er auf Anordnung des kniglichen Rivalen
Gundovald geweiht worden war, aber anschlieend muten die
drei Bischfe, die ihn konsekriert hatten, fr ihn sorgen und
ihm jhrlich 00 Goldstcke bezahlen
9
Die Heiligkeit der Weihe
war so unantastbar, da der Erwhlte Gottes Bischof blieb, ohne
Rcksicht darauf, wie er dieses Amt erlangt hatte. Eine hnliche
180
Haltung bestimmte die Einstellung zu den weltlichen mtern,
besonders in bezug auf die sptrmischen Kaiser und die Kni-
ge. Gottes Wirken manifestierte sich auch in den verworfensten
Menschen, und er allein konnte sie absetzen, wenn er auch andere
Menschen als Werkzeuge benutzen mochte.
Besser als alles andere weisen die dramatischen Umstnde
einer Bischofswahl auf die Komplexitt und Zwiespltigkeit
der politischen Macht im Frankenreich des 6. Jahrhunderts hin.
Dieses uerst lukrative Amt machte eine Art von Konsens oder
zumindest einen vorbergehenden Waenstillstand zwischen
den interessierten Parteien erforderlich. Jeder Fall lag anders, und
Gregor von Tours lebhafe Berichte verschleiern of mehr als sie
erklren. Warum lie es Childebert nach dem Tod des Bischofs
Laban von Eauze zu, da ein Laie namens Bertram ihn so unter
Druck setzte, da er diesen als Nachfolger Labans besttigte? Und
warum weigerte er sich dann nach Labans Tod, dem Drngen
seines designierten Nachfolgers, des Diakons Waldo, nachzuge-
ben, der vermutlich der Patensohn des Bertram war und darber
hinaus die uneingeschrnkte Untersttzung der Brgerschaf
von Eauze geno?
20
Gregor erklrt uns dies nicht, und sonstige
Anhaltspunkte besitzen wir nicht. Was auch immer die Motive
des Knigs gewesen sein mgen, in diesem Augenblick war er in
der Lage, seinen Willen gegen Klerus und Volk durchzusetzen.
In anderen Fllen, etwa in der Auseinandersetzung in Uzes, wur-
den nacheinander zwei Kandidaten des Knigs von mchtigen
Lokalinteressen abgeblockt. Hier erkennt man die Grenzen der
kniglichen Macht.
Die geistliche Funktion des Bischofs
Die Macht des Bischofs beschrnkte sich nicht auf die Zahl seiner
Freunde bei Hofe, auf seine Familie und seine guten Beziehun-
gen zu seiner Anhngerschaf in der Bischofsstadt. In seiner
181
Gemeinde galt er im wesentlichen als derjenige, der den Willen
Gottes ausfhrte, der Kern seiner Macht lag in seiner Kontrolle
ber alles Sakrale. Wenn wir dies hinter den blutigen Intrigen
bischicher Politik kaum zu erkennen vermgen, dann deshalb,
weil wir die im 6. Jahrhundert selbstverstndliche Vorstellung
von der gttlichen Vorsehung heute nicht mehr teilen.
Ein vorbildlicher Bischof war sowohl Vorgesetzter seines
Klerus als auch der Ordensleute seiner Dizese, vor allem aber
war er der Verteidiger des Glaubens und der Beschtzer der
Armen. Verteidigung des Glaubens konnte, allerdings selten,
die theologische Verteidigung der Lehre gegen die Irrtmer der
Arianer oder was noch seltener vorkam eines Chilperich,
eines gelehrten frnkischen Knigs, der eine Abhandlung ber
die Dreifaltigkeit zu schreiben versuchte, bedeuten. Aber im
Frankenreich gab es ebenso wenige echte Hretiker wie echte
Teologen. Den Glauben zu verteidigen bedeutete schon etwas
huger, in den Dizesen polytheistische Praktiken, das heit die
synkretistischen religisen Observanzen, die zweifellos von den
neu konvertierten Franken beibehalten wurden, zu bekmpfen.
Beim Konzil von Orlans im Jahre 533 beschlossen zum Beispiel
die vorwiegend aus dem nrdlichen Aquitanien angereisten
Bischfe Manahmen gegen Katholiken, die weiterhin den
Gtzen opferten, ein Beschlu, der acht Jahre spter bei einem
weiteren Konzil an gleicher Stelle wiederholt wurde.
2
Man darf
nicht glauben, da das Heidentum auf den strker barbarischen
Norden beschrnkt war. In Gallien war das Christentum vor-
nehmlich eine Angelegenheit der Aristokratie gewesen, und in
den lndlichen Regionen des gesamten Frankenreiches war das
Heidentum keineswegs ausgestorben; traditionelle buerliche Ri-
tuale berdauerten Jahrhunderte. Die lndlichen Gebiete konnten
erst vollstndig christianisiert werden, als ein Netz von Pfarreien
auch den hintersten Winkel des Knigreiches umspannte, eine
Entwicklung, die erst im 9. Jahrhundert einsetzte.
Eine wichtigere, wenn auch prosaischere Aufgabe der Verteidi-
182
gung des Glaubens bestand in der Unterweisung der Laien und
des Klerus durch Predigten und die Frderung von Schulen.
Bischfe, die in der monastischen Tradition, besonders der von
Lrins, erzogen worden waren, waren fr diese Aufgabe bestens
vorbereitet; der merowingische Bischof Caesarius von Arles
hinterlie eine Sammlung von Predigten, in der seine Fhigkeit,
die rhetorische Ausbildung in den Dienst der Erziehung des
Klerus und der Laien seiner Dizese zu stellen, deutlich sichtbar
wird. Im 6. Jahrhundert besaen die meisten Bischfe eine solide
Ausbildung in der lateinischen Literatur, wenn auch nicht in der
christlichen Lehre, und konnten so wenigstens die Lehren des
Caesarius und anderer ihren eigenen Bedrfnissen anpassen.
Als dringlichere Aufgabe betrachteten die Bischfe die
Aufrechterhaltung der Disziplin in der unruhigen und schwer
zu regierenden Welt, in der sie lebten. Dazu muten sie zwischen
den unterschiedlichen Fraktionen, die ihre Gemeinden und die
Gemeinschaf der Bischfe bildeten, ein Bewutsein fr Zu-
sammengehrigkeit und gemeinsame Ziele schaen, Laien und
Klerikern Mastbe christlichen Verhaltens vermitteln und diese
auch durchsetzen.
In dieser von starken Persnlichkeiten geprgten Welt fanden
die rivalisierenden Krfe der Gesellschaf in der Persnlichkeit
des Heiligen einen ganz wesentlichen Bezugspunkt der Ein-
heit. Eines der wichtigsten Ergebnisse der neueren Forschung,
besonders der von Peter Brown, ist die Erhellung der entschei-
denden gesellschaflichen Bedeutung der Heiligenverehrung in
der frhmittelalterlichen Gesellschaf.
22
In diesen Gemeinden,
die of durch sehr gewaltttige und oen ausgefochtene Rivali-
tten gespalten waren und in denen kein lebender Mann, keine
lebende Frau sich einhelliger Zustimmung sicher sein konnte,
wurde der Heilige zum alle verbindenden gesellschaflichen
Element. Mnnliche und weibliche Heilige waren einerseits Teil
der bernatrlichen Welt, verblieben aber andererseits durch
ihre Grabsttte bei den Menschen und standen ihnen bei. Da-
183
mit wurde der Heilige zu einer fabaren, physischen Quelle von
Autoritt und Macht, zum sicheren Hort in einer von stndigen
Wechselfllen bedrohten Welt.
Zwar zweifelte kein Christ an der Macht der Heiligen, es drfe
aber durchaus unterschiedliche Auassungen ber die Heiligkeit
eines gerade Verstorbenen gegeben haben. Immerhin waren jeder
Mann und jede Frau zu ihren Lebzeiten in irgendeiner Weise in
politische Auseinandersetzungen verstrickt. Bischof Priscus von
Lyon und seine Frau Susanna waren zum Beispiel keineswegs
bereit, den Amtsvorgnger Nicetius fr einen Auserwhlten Got-
tes zu halten. In solchen Fllen mute die Gemeinde zu einem
Konsens ber den besonderen Status eines Heiligen gelangen,
und dieser Vorgang konnte vom Bischof gelenkt werden. Dafr
eignete sich die rhetorische Ausbildung der frnkischen Bischfe
vorzglich; ihre Aufgabe bestand darin, die zerstrittene Gemeinde
zu berzeugen und ihr die unfehlbaren Hinweise auf die Macht
des Heiligen zu erlutern. Den Konsens ber den Heiligen, der
gleichzeitig den Konsens ber den Bischof herstellte, konnte
dieser erreichen, indem er die Migeschicke der Feinde und
die Erfolge der Freunde des Verstorbenen mit ihrem jeweiligen
Verhltnis zu ihm erklrte. Auf diese Weise wurden Bischof und
Heiliger, was ihr Ansehen betraf, voneinander abhngig.
Die Kontrolle ber die Heiligen wurde den Bischfen von der
brigen Gesellschaf und auch von den Heiligen selbst nicht ohne
Widerstand eingerumt. Gerade letztere forderten die Bischfe
am strksten heraus, wogegen der westliche Episkopat ohne Z-
gern und weitgehend erfolgreich vorging. Whrend die spirituelle
Macht der Bischfe im Ansehen der toten Heiligen eine ihre
strksten Quellen besa, war die Macht der lebenden Heiligen
ihre strkste Bedrohung. Im Osten waren heilige Mnner und
Frauen durch ihr asketisches und weitabgewandtes Leben zu ei-
nem wichtigen Faktor der Machtbalance in drichen, regionalen
und gelegentlich sogar kaiserlichen Angelegenheiten geworden.
Solche Menschen erhielten die Anerkennung als Gesandte
184
Gottes nicht vom Bischof, vom Kaiser oder seinen Stellvertre-
tern, sondern unmittelbar durch Akklamation der entlichen
Meinung. Eine solche Situation war fr den bischichen Adel
des Frankenreiches absolut unannehmbar. Die Geschichte des
Langobarden Vullaic zeigt, wie die Bischfe auf diese Bedro-
hung reagierten.
3
Als kleines und vermutlich arianisch getaufes Kind hatte
Vullaic den Namen Martin gehrt und, ohne dessen Leben
und Werk zu kennen, eine tiefe Verehrung fr ihn entwickelt.
Mit der Zeit brachte er sich selbst das Lesen bei, wurde Schler
des Abtes Aredius von Limoges und kam schlielich nach Tours,
wo er Staub vom Grab des heiligen Martin als Reliquie erhielt.
Nach seiner Rckkehr nach Limoges dehnte sich der Staub auf
wunderbare Weise aus und strmte aus der kleinen Kapsel, in der
er ihn um den Hals trug. Von diesem Wunder inspiriert, begab er
sich in die Gegend von Trier, wo er in den Ruinen eines Tempels
auf einer Sule eine Statue der Diana fand, die von den Einheimi-
schen verehrt wurde. Vullaic bestieg eine andere Sule und hielt
dort in Nachahmung des Sulenheiligen Simeon einen harten
Winter ber aus. Bald strmten die Menschen aus der Umgebung
herbei, um den heiligen Mann zu sehen, und von seiner Sule
aus predigte er gegen das Gtzenbild auf der Nachbarsule. Von
seinen Worten und seinem Beispiel berzeugt und von seinen
Gebeten angefeuert, zerstrten die Einheimischen die Statue.
Trotz dieses Erfolges erhoben die Bischfe der Umgebung Ein-
wnde. Schlielich schickten sie ihn mit einem Aufrag fort und
zerstrten in seiner Abwesenheit seine Sule. Mit gebrochenem
Herzen, aber ohne den Mut, den Bischfen zu widersprechen,
reihte er sich in den rtlichen Klerus ein.
Fr Gregor und seine Mitbischfe hatte Vullaic alles falsch
gemacht, was er falsch machen konnte, mit einer Ausnahme, die
ihn aber schlielich rettete.
Erstens war er Bauer. Vullaic stammte aus unklaren barbari-
schen Verhltnissen; im 6. Jahrhundert waren die Langobarden
185
die wildesten und unkultiviertesten Menschen innerhalb der
rmischen Welt. Seine Unkultiviertheit bewies die Tatsache, da
er den heiligen Martin ohne vorherige Anleitung durch einen
dazu qualizierten Bischof verehrte, der ihm die richtige Form
der reverentia, die tiefe innere Einsicht, die dem gebildeten Klerus
zugnglich war, htte vermitteln knnen.
Zweitens hatte er zugelassen, da ihn das Staubwunder mit
Stolz erfllte. Anstatt in seinem Kloster zu bleiben, sah er in dem
Wunder ein Zeichen dafr, da er irgendwie fr hhere und
mehr entliche Aufgaben auserwhlt sei, und unternahm seine
eigene Mission. An anderer Stelle erklrt uns Gregor, wie man
mit diesem Wunder htte umgehen mssen. Als in einem Kloster
von Bordeaux die Kornernte durch die Gebete eines Novizen auf
wunderbare Weise gerettet wurde, lie der kluge Abt den jungen
Mann sofort ergreifen, verprgeln und eine Woche lang in seine
Zelle schlieen, damit es ihm nicht zu Kopf stieg, da er zum
Werkzeug des gttlichen Willens geworden war.
24
Drittens hatte Vullaic ohne Ausbildung und ohne Erlaubnis
zum Volk gepredigt, eine Aufgabe, die dem Bischof vorbehalten
war. Hier allerdings war der Blinde der Blinden Fhrer, und es
ntzte ihm wenig, da seine Predigt zur Zerstrung des Gtzen-
bildes und zur Bekehrung der Menschen gefhrt hatte.
An diesem Punkt war Vullaic nur eine Handbreit davon
entfernt, mit den Wanderpredigern, Wunderttern und anderen
Unruhestifern gleichgesetzt zu werden, die bis ans Ende ihrer
Tage in bischichen Gefngnissen dahinsiechten. Vor diesem
traurigen Schicksal bewahrte ihn lediglich sein Gehorsam. Er
akzeptierte die Entscheidung der Bischfe, versuchte nicht, die
Sule wieder aufzurichten, und beendete seine Tage als Diakon
unter strenger bischicher Aufsicht.
Sowohl in der Geschichtsschreibung Gregors als auch in sei-
nen Heiligenviten und in der merowingischen Hagiographie
insgesamt taucht dieses Tema der bischichen Kontrolle ber
die Heiligen immer wieder auf. Es ist Teil eines alles durchdrin-
186
genden Plans, jede Form bernatrlicher Macht der Hierarchie
unterzuordnen und alles, was nicht assimiliert werden konnte,
als Irrlehre oder Heidentum zu brandmarken. Selbst in Gregors
Berichten ber das Leben der Eremiten ist der Bischof niemals
weit entfernt. Als zum Beispiel der Eremit Friardus in der Nhe
von Nantes im Sterben lag, war sein letzter Wunsch, den Bischof
zu sehen, und er verstarb, sobald dieser bei ihm eingetroen war.
Bevor der heilige Patroclus seine Karriere als Eremit begann,
legte er Wert darauf, vor seinem Bischof zu erscheinen und ihn
um die Tonsur zu bitten.
25
Die bischiche Tradition versuchte nicht nur, sich die Macht
der christlichen Heiligen einzuverleiben, sondern auch den
volkstmlichen Glauben in die christliche Tradition zu inte-
grieren. Hchst aufschlureich ist in dieser Hinsicht der Bericht
des Venantius Fortunatus ber den heiligen Marcellus von Paris
und den Drachen: Ein Drache hatte die Auenbezirke von Paris
in Angst und Schrecken versetzt. Bischof Marcellus begab sich
hinaus, zhmte das Untier und befahl ihm, zu verschwinden.
Das Ungeheuer gehorchte und ward nicht mehr gesehen. Wie
Jacques Le Go dargelegt hat, gehen in dieser Legende bischf-
liche Autoritt und Volksglaube eine charakteristische Verbin-
dung ein.
26
Der Drache, der die barbarischen und mediterranen
Vorstellungswelten bevlkert, symbolisiert nicht nur den Teufel,
sondern dient auch als ambivalentes Symbol der Naturkrfe der
Erde und des Wassers, die gefhrlich und faszinierend zugleich
sind. In der Legende erscheint der Bischof als die zhmende
Macht, die ber die Krfe der Natur triumphiert, sie aber nicht
zerstrt. Der ngstliche Drache war vom heiligen Marcellus
so beeindruckt, da er ehend seinen Kopf neigte und wie ein
kleiner Hund mit dem Schwanz wedelte. Mit der Vertreibung des
Ungeheuers hatte der Bischof die Krfe der Natur, in diesem Falle
die sumpgen und unbewohnbaren Moore in der Nhe der Seine,
anerkannt und sie zugleich in eine rationale und zivilisierende
Beziehung zur Menschheit gebracht. Das Ansehen des Bischofs
187
in seiner Gemeinde beruhte daher nicht nur auf seiner Fhigkeit,
sich die traditionelle christliche Macht anzueignen, sondern in
gleichem Mae auf seinem Vermgen, auch ltere und elementare
Gewalten zu bndigen.
Das Kloster
Im Jahre 8 ordnete Kaiser Karl der Groe eine Untersuchung
an: Lat feststellen, ob es in Gallien vor der Verkndung der
Regel des heiligen Benedikt in diesen Kirchenprovinzen Mnche
gab.
27
Im 9. Jahrhundert war die Regel des heiligen Benedikt zur
Grundregel des Ordenslebens im Westen geworden. Wenn die
von Karl dem Groen beaufragten Gelehrten ihre Arbeit grnd-
lich ausgefhrt htten, htten sie nicht nur antworten mssen,
da es in Gallien bereits vor der Einfhrung der Benediktregel
monastisches Leben gab, sondern da das benediktinische
Mnchtum im Frankenreich eine relativ neue Erscheinung war.
Drei Formen monastischer Tradition waren ihm vorausgegangen,
die des Martin von Tours, die Tradition von Lrins und die irische
Mnchstradition des heiligen Columban. Um das Frankenreich
des 6. Jahrhunderts zu verstehen, ist es unerllich, die ersten
beiden Formen des Mnchtums zu errtern.
Martin von Tours
Das Leben des heiligen Martin spiegelt wie in einem Brennglas
das Westrmische Reich des 4. Jahrhunderts. Martin wurde als
Sohn eines Soldaten um 36 im heutigen Szombathely in Ungarn
geboren, einem wichtigen pannonischen Verteidigungsposten
innerhalb der Donaugrenze. Er kam nach Italien, als sein Vater,
ein Militrtribun, nach Pavia versetzt wurde, und wurde dort zum
188
Katechumenen. Dem rmischen Gesetz entsprechend, ergri
auch Martin den vterlichen Beruf und zog als Soldat mit seiner
Einheit nach Amiens. Dort soll die berhmte Geschichte mit dem
Mantel vorgefallen sein: Als er eines Tages am Stadttor einen vor
Klte zitternden Bettler erblickte, teilte er seinen Uniformmantel
in zwei Hlfen und gab dem Armen eine davon. Obwohl er mit
seinem halben Mantel in der ganzen Stadt ausgelacht wurde, hatte
er in der Nacht eine Erscheinung des Herrn, der die verschenkte
Mantelhlfe trug. Dieser Mantelteil wurde spter zur cappa,
der wichtigsten Reliquie der frnkischen Knige, die von den
Klerikern am Knigshof, aus denen die capella, die Hofapelle,
bestand, gehtet und verehrt wurde.
Martin wurde in Amiens getauf und erhielt kurz darauf in
Worms die Erlaubnis, den Militrdienst zu verlassen. Er begab sich
zu Bischof Hilarius von Poitiers, um sich in seinem neuen Glauben
zu vervollkommnen. Bald reiste er zum Besuch seiner Eltern nach
Italien, wo er erfuhr, da die arianischen Westgoten Hilarius in den
Osten verbannt hatten. Da er nicht nach Gallien zurckkehren
konnte, lebte er eine Zeitlang als Eremit auf der Insel Gallinaria
im Tyrrhenischen Meer und sammelte erste Erfahrungen mit
dem Mnchtum. Als Hilarius 36 die Heimreise nach Poitiers
antreten durfe, begab sich Martin sofort zu ihm und erhielt die
Erlaubnis, das in Gallinaria begonnene Einsiedlerleben in Liguge
weiterzufhren. Binnen kurzer Zeit verbreitete sich sein Ruf; eine
Gemeinschaf von Jngern scharte sich um ihn, und hug wurde
er gerufen, um in Mittel- und Westgallien zu predigen. Als Bischof
Lidorius von Tours 37 starb, lockten die Brger von Tours Martin
in ihre Stadt und machten ihn zu ihrem Bischof.
Obwohl Martin sein Amt gewissenhaf ausbte, fhrte er wei-
terhin in einer Zelle in der Nhe der Stadt ein monastisches Le-
ben. Wiederum entstand um ihn ein neues Kloster, Marmoutier.
Von hier aus gri er weiterhin in die religisen Angelegenheiten
des Westens ein, und als herausragender Verfechter des rechten
Glaubens unternahm er ausgedehnte Reisen, die ihn bis nach
189
Trier und sogar nach Rom fhrten. Er starb 397 und wurde in
einem steinernen Sarkophag in einer Basilika auerhalb der
Stadtmauern beigesetzt, die mit der Zeit zu einer vielbesuchten
Pilgersttte wurde.
Zunchst jedoch fanden die Verehrung des heiligen Martin und
seine Mnchstradition nicht weit ber die Region seines inten-
sivsten Wirkens hinaus Beachtung. Bevor Chlodwig Martin zum
besonderen Schutzpatron seiner Familie erkor, war dessen Kult
auf die Region an der Loire, auf Aquitanien und einige Gegenden
in Spanien beschrnkt. Die von ihm begrndete Mnchstradition,
eine recht eklektische Form, die stliche asketische Elemente mit
der Lebensweise des gallischen Klerus im Westen verband, schlug
auerhalb der Region seines aktivsten Wirkens keine Wurzeln.
Dafr kann man mehrere Grnde anfhren: Anders als der groe
aristokratische Bischof von Gallien war Martin ein Auenseiter,
ein Soldat in den Augen rmischer Aristokraten ein minder-
wertiger Beruf und zu alledem eine seltsame Kombination von
Mnch und Bischof, ein Asket, der sich dennoch unablssig in
weltliche Angelegenheiten mischte. Nrdlich der Loire und im
Sdosten Galliens scheint diese Form des Mnchtums wenig
Anziehungskraf ausgebt zu haben.
Da dieser hchst auergewhnliche Mann schlielich so
populr wurde, verdankt er ganz wesentlich seinem Biographen
Sulpicius Severus, einem gebildeten und vornehmen Schler
Martins. Dieser portrtierte seinen Lehrer als die Inkarnation
eines neuen Bischofstyps, der als groer Kirchenmann ein akti-
ves Leben fhrte, das traditionell mit hohen rmischen mtern
assoziiert wurde, und dennoch in der Lage war, ein klsterliches
Leben der Selbstverleugnung aufrechtzuerhalten. Dieser in ty-
pisch sptlateinischer Prosa verfate Bericht ber ein aktives und
zugleich kontemplatives Leben wirkte sicher auf aquitanische
Kleriker anziehend, die in der Religion mehr als die Alltagsrouti-
ne der Verwaltungsaufgaben und die stndige Bedrohung durch
politische Auseinandersetzungen suchten.
190
Entscheidend fr die Ausdehnung der Martinsverehrung war
aber nicht der gelehrte aquitanische Mnch und Aristokrat Sulpi-
cius, sondern Chlodwig, der neu konvertierte Franke. Was Martin
fr ihn bedeutete, ist nicht ganz klar. Vor allem mu er in ihm
einen wichtigen Verbndeten bei seinem Sieg ber die Westgoten
erblickt haben. Da der Martinskult sich allmhlich in den Adelsfa-
milien derselben Regionen ausbreitete, in denen Chlodwig seine
Eroberungen machte, war dessen besondere Verehrung Martins
wohl ein Mittel, enge Beziehungen mit den Fhrungseliten seiner
neu eroberten Lnder zu knpfen. Mglicherweise hat Martin, der
pannonische Soldat, der dann in Gallien eine fhrende Rolle spiel-
te, Chlodwig auch in besonderer Weise beeindruckt. Im Gegensatz
zur geschnten Darstellung des Sulpicius war Martin eindeutig
kein bedeutender Intellektueller und kein Literat wie die meisten
Bischfe, die Chlodwig im Sden seines Reiches angetroen haben
mu, sondern ein Mann der Tat, der die Quellen der Macht kannte
und damit umzugehen wute. Auch Chlodwig war ein relativer
Auenseiter, der vielleicht selbst pannonischer Herkunf zu sein
glaubte, wenn die oben erwhnte Legende bereits im Umlauf war,
und auch er war ein Konvertit, der in Gallien seinen Weg machte.
Damit hatten Martin und Chlodwig vieles gemeinsam.
Jedenfalls wurde der Schutzpatron der aquitanischen Bischfe
durch Chlodwig zum Schutzheiligen des frnkischen Knig-
reiches und zum Symbol der neuen frnkischen Kirche. Die
Martinsverehrung und mit ihr der Versuch, ein aktives ent-
liches Wirken mit der asketischen, kontemplativen Tradition in
Einklang zu bringen, breitete sich im Norden bis Paris, Chartres,
Rouen und Amiens aus, im Osten bis Trier, Straburg und Basel,
im Westen bis Bayeux, Avranches und Le Mans und im Sden bis
Saintes, Angoulme, Limoges und Bordeaux, um nur einige der
Stdte zu nennen, in denen im 6. Jahrhundert sein Kult blhte.
In den nchsten beiden Jahrhunderten folgte der Martinskult
der frnkischen Ausdehnung nach Norden bis Utrecht und nach
Osten bis Linz.
191
Das aquitanische Mnchtum sollte nicht als eine systemati-
sche Bewegung oder gar eine Gruppe von Klstern verstanden
werden, die eine bestimmte Regel oder einen Kanon von Re-
geln befolgten. Es bestand vielmehr aus einer Reihe von lokal
begrenzten Initiativen, die zwar von Martins Vorbild inspiriert,
aber institutionell nicht mit Marmoutier verbunden waren. Auch
wissen wir wenig ber die innere Organisation und Ordnung die-
ser Gemeinschafen wie wir sehen werden, in anderen, strenger
formalen Mnchstraditionen ein erhebliches Problem.
Das Beispiel Martins wirkte nicht nur auf Mnner, sondern
auch auf Frauen anziehend. Whrend sich jedoch Mnnerge-
meinschafen um einen besonders eindrucksvollen Eremiten
bildeten, scharten sich Frauengemeinschafen um Oratorien oder
Basiliken, in denen die berreste der von den frommen Frauen
besonders verehrten Heiligen aufewahrt wurden. Frauenklster
befanden sich meistens in Stdten oder deren unmittelbarer
Umgebung, wo sie vom Bischof berwacht und vor Mnnern
geschtzt werden konnten. Eine der blichen Formen, zu einer
Frau zu kommen, war nmlich immer noch der Brautraub, und
Adelsklster waren geeignete rtlichkeiten, in denen man eine
Frau um ihrer Erbschaf willen rauben, vergewaltigen und dann
heiraten konnte.
Die Rhneklster
Die einzige Region, in der sich der Martinskult auer in Aqui-
tanien schon vor Chlodwig durchsetzte, war die am strksten
romanisierte Region des Frankenreiches, das Rhnetal. Hier ent-
wickelte sich fast gleichzeitig und parallel ein anderes Mnchtum,
das aber aristokratischer geprgt und sorgfltiger geordnet war
und unmittelbarer an die stliche Mnchstradition anknpfe.
Beide Traditionen und ihre Anhnger beargwhnten einander;
die Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten spiegelten
192
vermutlich nicht nur verschiedene klsterliche Observanzen,
sondern auch bedeutsame Spaltungen innerhalb der spten
gallormischen Aristokratie im Westen.
Lrins, das erste groe Rhnekloster, wurde zwischen 400
und 40 vom heiligen Honoratus, dem Angehrigen einer
konsularischen Familie aus Nordgallien, gegrndet. Als junge
Mnner hatten er und sein Bruder sich dem asketischen Leben
verschworen und waren in den Osten gepilgert, um dort das st-
liche Mnchtum kennenzulernen. Nachdem sein Bruder auf der
Peloponnes gestorben war, kehrte Honoratus nach Gallien zurck
und grndete auf der Insel Lrinum ein kleines Kloster nach dem
Vorbild der Klster, die er im Osten kennengelernt hatte.
Zur selben Zeit, wie Honoratus Lrins grndete, errichtete Jo-
hannes Cassianus das Kloster Sankt Viktor bei Marseille. Cassian
war ein Schler des Johannes Chrysostomus in Konstantinopel
und des Papstes Leo des Groen in Rom gewesen, aber geprgt
hatte ihn vor allem die fnfzehnjhrige Erfahrung seines Einsied-
lerlebens in Syrien und seines Mnchslebens in der gyptischen
Wste. So brachte Cassian stliches Mnchtum unmittelbar
nach Westen, und zwar sowohl in seinen Instituta, worin er das
monastische Leben und die klsterliche Disziplin detailliert
beschreibt, als auch in seinen Collationes, einer Sammlung der
Weisheiten und Sprche der gptischen Anachoreten. Letztere
stellen zwar kaum eine wrtliche Wiedergabe der Lehren der
Wstenvter dar, dokumentieren aber doch den Geist und die
Lebendigkeit des stlichen Mnchtums und empfehlen es dem
Westen als Vorbild.
Das von Honoratus und Cassian eingefhrte stliche Mnch-
tum kam gerade rechtzeitig nach Westen, um den von den Wir-
ren des 5. Jahrhunderts vertriebenen Aristokraten des Nordens
eine geistige und kulturelle Zuucht zu bieten. Insbesondere die
Klosterinsel Lrins wurde zum Zuuchtsort fr die nordgalli-
schen Aristokraten, die wie Honoratus selbst vor den politischen
und gesellschaflichen Unruhen der Heimat geohen war. Die
193
Liste dieser Flchtlinge ist lang und enthlt vornehme Namen.
Lediglich als Beispiele seien genannt: Der heilige Hilarius, ein
Verwandter des Honoratus und spter Erzbischof von Arles,
Caesarius aus Chlon-sur-Sane, der sein Leben ebenfalls als
Erzbischof von Arles beendete; Salvian, der aus Kln oder Trier
nach Marseille kam, und Faustus, der ursprnglich aus der Bre-
tagne kam, Abt von Lrins und spter Bischof von Riez wurde.
Anders als das von Martin initiierte Mnchtum, bewahrte das
Mnchtum an der Rhne einen stark aristokratischen Charakter.
Diese elitre Tradition wird deutlich in der Qualitt der dort ent-
standenen Schrifen und dem Niveau der theologischen Ausein-
andersetzung. Diese Mnner waren vor ihrer Hinwendung zum
Ordensleben sorgfltig in der heidnischen Rhetorikertradition
ausgebildet worden, und obwohl sie nach Lrins gekommen wa-
ren, um Stillschweigen, Einsamkeit, Enthaltsamkeit und Gebet zu
pegen, nutzten sie dennoch weiterhin ihre intellektuellen Fhig-
keiten. Daher brachte Lrins, anders als die Klster aus der Mar-
tinstradition, Intellektuelle hervor oder nahm zumindest Einu
auf das Geistesleben. Das eindrucksvollste Beispiel dafr, welchen
Einu Lrins im 5. Jahrhundert auf Teologen ausbte, ist die
Teilnahme Cassians und mindestens zweier seiner Mnche an
der Polemik um die Gnadenlehre des heiligen Augustinus. Diese
sogenannten Semipelagianer, die wie andere Mnche dem aske-
tischen Leben, dem Verzicht und der Selbstbeherrschung groe
Bedeutung zumaen, konnten die pessimistische Beurteilung
der menschlichen Krfe durch den afrikanischen Bischof nicht
teilen. Die augustinische Lsung des Spannungsverhltnisses
zwischen Unausweichlichkeit und Verantwortung zu akzeptieren,
bedeutete fr sie die Zerstrung der Eigenverantwortung. Die
Prdestinationslehre des Augustinus galt nicht nur als fatalisti-
sche, hretische Erklrung des Problems der gttlichen Gnade
oder der menschlichen Willensfreiheit, sie war auerdem neu.
In seinem Angri gegen diese Neuerung der augustinischen
Teologie fand Vincentius von Lrins eine Formulierung, die zur
194
grundlegenden Denition des orthodoxen Konsenses werden
sollte: Die Gnadenlehre des Augustinus sei nicht akzeptabel, weil
sie nicht mit dem bereinstimme, was berall, immer und von
allen (ubique semper ab omnibus) geglaubt worden sei.
28
Diese
Formulierung zeigt, wie fest die monastische Bildungselite die
kosmopolitische und universale Kultur der christlich-rmischen
Zivilisation aufrechterhielt.
Der aristokratische Charakter von Lrins zeigt sich auch in
seiner Anziehungskraf; es war ein zwar abgeschiedener, aber
lebendiger und angenehmer Zuuchtsort, wo die entwurzelten
Eliten in der Hingabe an die Welt des Geistes und in der Suche
nach spiritueller Vollkommenheit fr eine kurze Zeit oder fr
ein ganzes Leben Trost nden konnten. Viele Mnche, die wie
Hilarius, Faustus und Caesarius spter Bischofsmter bernah-
men, grndeten in ihren Stdten hnliche Gemeinschafen. Da
die Mehrzahl dieser Bischofssitze an der von Rhne und Sane
gebildeten Fluachse lagen, drang das Mnchsideal von Lrins
allmhlich nach Norden vor, nach Arles, Lyon, Autun, St. Maurice
dAgaune, zu den Klstern des Jura und sogar bis Troyes.
Obwohl die Unterschiede zwischen den Traditionen Martins
und denen von Lrins und Marseille mehr in der Gewichtung
als in den Inhalten begrndet waren, galten sie im 6. und noch
im 7. Jahrhundert als tiefgreifend. Zwar ist ber die Organisation
der Martinsklster wenig bekannt, das Mnchtum an der Rhne
stand in seiner Strenge aber oensichtlich der stlichen Tradition
nher. Das aquitanische Mnchtum scheint mehr ein Ergebnis
von Improvisation gewesen zu sein; ein heiliger Mann tauchte auf,
eine Gruppe von Jngern sammelte sich um ihn, und die daraus
entstehende Gemeinschaf lebte mehr als Gruppe von Eremiten
denn als regulre Klostergemeinschaf zusammen. Diese lockere
Form des klsterlichen Lebens kannte und verurteilte Cassian in
seinen Instituta, ohne jedoch Martins Namen zu erwhnen.
Tatschlich scheinen sich die Verfechter der beiden Traditio-
nen das 6. Jahrhundert hindurch gegenseitig ignoriert zu haben;
195
denn sie vermieden es, die jeweils andere Tradition unmittelbar
anzugreifen, und wo irgend mglich sogar, von ihrer Existenz
auch nur zu sprechen. So erwhnen Hilarius von Arles, Eucherius
von Lyon, Vincentius von Lrins, Caesarius von Arles und die
anderen fhrenden Vertreter des Rhne-Mnchtums niemals
den heiligen Martin. In manchen weitgehend von Lrins beein-
uten Regionen wie dem Jura, wo die Martinsvita des Sulpicius
gelesen und der Heilige verehrt wurde, galt dieser einfach nicht
als Teil einer monastischen Tradition, die an Lrins und Marseille
anknpfe.
Andererseits spricht Gregor von Tours, der groe Verfechter
der Martinsverehrung im 6. Jahrhundert, kaum ber das Rh-
nemnchtum. In allen seinen Berichten ber die gallischen Bi-
schfe und Heiligen erwhnt er nicht ein einziges Mal Caesarius
von Arles, Faustus von Riez, Honoratus, Hilarius oder Salvian.
Lrins nennt er nur im Zusammenhang mit der berfhrung
der Gebeine des heiligen Hospitius; die dort gepegte asketische
Tradition erwhnt er nicht. Die beiden Welten des gallischen
Mnchtums blieben geteilte Lager.
Dennoch waren die hnlichkeiten grer als die Unterschiede.
Beide waren ungefhr gleichzeitig aus stlichen Mnchstra-
ditionen entstanden. Beide erfaten vorwiegend Kleriker. Wir
haben oben gesehen, wie eng der Bischof mit der von Gregor
gepriesenen Mnchs- und Eremitentradition verbunden war. Im
Rhnegebiet war Ordensleben vorwiegend eine Angelegenheit
adliger Kirchenmnner; untersttzt wurde es vom Klerus, nicht
von den Laien. Letztere blieben dem Mnchtum gegenber zum
groen Teil neutral, solange sie selbst nicht der Welt entsagen
und ins Kloster eintreten wollten. Lediglich bte, die das Kloster
verlieen und einen Bischofssitz bernahmen, spielten in der
weltlichen Gesellschaf eine wichtige Rolle. Daher beeinuten
diese beiden Welten einander kaum.
Im Laufe des spten 5. und des 6. Jahrhunderts begannen die
beiden Formen des Ordenslebens miteinander zu verschmelzen.
196
Bischofssynoden forderten immer huger die Durchsetzung
der im Rhnetal befolgten strengeren Regeln, etwa die strikte
Unterordnung der Mnche unter den Abt und die stabilitas
loci, wonach die Mnche in dem Kloster, in welchem sie ihre
Gelbde abgelegt hatten, verbleiben und nicht herumreisen
und neue Einsiedeleien und Zellen grnden sollten. Die im
Rhnetal gepegte Form monastischen Lebens erschien den
Konzilen weit sinnvoller als die spontanere aquitanische, weil
sie den Bischfen die Aufsicht ber die Mnche erleichterte.
Insgesamt aber, ob im Rhnetal oder in Aquitanien, stand das
Ordensleben fest unter bischicher Kontrolle oder sollte es
wenigstens stehen. Diese Unterordnung verlangte bereits das
erste frnkische Konzil, das 5 stattfand. Der dort beschlossene
Canon 9 stellte kategorisch fest: Aus Grnden der religisen
Demut sollen bte der Autoritt des Bischofs unterstehen und
mssen vom Bischof zurechtgewiesen werden, wenn sie gegen
die Regel verstoen haben.
29
Bischfe gegen Mnche
Da dieser Beschlu auf den folgenden Synoden des 6. Jahrhun-
derts wiederholt werden mute, weist darauf hin, da die Bischfe
die Klosteraufsicht zwar beanspruchten und die bte diese
theoretisch anerkannten, bte und btissinnen aber gelegent-
lich zum Verdru ihrer Bischfe betrchtliche Selbstndigkeit
entwickelten. Diese Widerspenstigkeit konnte soziale und poli-
tische Ursprnge haben wie in dem Fall der Revolte im Kloster
vom Heiligen Kreuz, das Radegunde, die Ehefrau Chlothars I.,
in Poitiers gegrndet hatte.
30
Nach Radegundes Tod weigerten
sich die Nonnen, die wie ihre Grnderin aus kniglicher Familie
stammten, deren Nachfolgerin anzuerkennen, und revoltierten.
Einige verlieen das Kloster und heirateten, whrend andere
mit Hilfe ihres bewaneten Gefolges auf die Bischfe, die zu
197
Verhandlungen angereist kamen, losgingen. Dieser Fall bildete
jedoch in jeder Hinsicht eine Ausnahme. Die aufrhrerischen
Nonnen waren Merowingerinnen; Agnes, die Nachfolgerin der
Radegunde, scheint eines der wenigen Konventsmitglieder ge-
wesen zu sein, die nicht aus kniglicher Familie stammten; aus
ungeklrten Grnden hatte sich der Bischof von Poitiers lange
Zeit geweigert, die Klosteraufsicht zu bernehmen. Eine solche
Situation kann kaum als typisch gelten.
Huger und verhngnisvoller war eine andere Form des
Ungehorsams. In seinem Liber in gloria confessorum berichtet
Gregor, da Bischof Agricola von Cavillon nach dem Tod des
Desideratus sofort seinen Archidiakon aussandte, um dessen
Leichnam einzuholen. Desideratus hatte als Einsiedler inmitten
einer um seine Person entstandenen Mnchsgemeinschaf gelebt.
Die Mnche verweigerten jedoch die bergabe des Leichnams.
3
Dies war eine ernsthafe Bedrohung der Grundfesten der bischf-
lichen Macht. Wie wir gesehen haben, bildeten sich Mnchs-
gemeinschafen meistens um einen wegen seiner Frmmigkeit
bekannten Eremiten, um eine Basilika oder das Grab eines als
heilig geltenden Mannes. Und gerade von solchen verstorbenen
Heiligen konnten Bischfe ihre Macht beziehen, wenn sie die
Kontrolle ber den Zugang zu ihnen besaen. Wenn im Westen
die Heiligenverehrung der bischichen Kontrolle entzogen
werden konnte, wie es lange Zeit im Osten der Fall gewesen war,
konnte das Monopol der religisen und politischen Aufsicht des
Bischofs ebenso wie das seiner aristokratischen gallormischen
Verwandtschaf in Gefahr geraten. Und genau dies geschah im
7. und 8. Jahrhundert.
Angesichts der realen und potentiellen Gefhrdungen ihrer
Position durch Beaufragte frnkischer Herren, rivalisierende
Familien, verrgerte Verwandte und unbotmige Heilige fan-
den die Bischfe Halt in der gegenseitigen Solidaritt. Vielleicht
in Erkenntnis ihrer prekren Existenz stellten die frnkischen
Bischfe ihre Dierenzen so weit zurck, da sie sich zu regel-
198
migen regionalen und Reichskonzilen zusammenfanden, wo
sie gemeinsame Probleme errterten und Gegenmanahmen
beschlossen. Unter der Leitung der Metropoliten agierten sie
als Gruppe und berieten ber Fragen, die fr einen einzelnen
Bischof zu komplex oder zu gefhrlich waren.
Die Initiative zur Einberufung der Reichskonzile ging aller-
dings nicht vom zerstrittenen frnkischen Episkopat aus. Das
erste Reichskonzil begann 5 auf Betreiben Chlodwigs, weitere
folgten von Zeit zu Zeit auf Initiative der Knige. Darber hinaus
wurden viele Konzile einschlielich des ersten nicht von allen
Bischfen des frnkischen Reiches besucht; diese beschrnkten
sich strker auf ihren regionalen Gesichtskreis, wenn auch an
einigen Konzilen, etwa am Konzil von Orleans im Jahre 549, tat-
schlich die Bischfe oder deren Stellvertreter aus der gesamten
frnkischen Welt teilnahmen.
Die den Synoden zur Errterung vorgelegten Probleme waren
eine Kombination von aktuellen Schwierigkeiten und allgemei-
neren, die Bischfe und das Knigreich betreenden Fragen. Ein
Groteil der Beschlsse galt der Kollegialitt der Bischfe und
der Aufrechterhaltung der bischichen Autoritt. Man forderte
die Abhaltung jhrlicher Provinzialsynoden, um so die Brder-
lichkeit und Liebe zwischen ihnen zu frdern. Damit suchten
sich die Bischfe vor ihren Mitbrdern, ihrem Klerus und den
Eingrien des Knigs zu schtzen.
Ein zweiter wichtiger Komplex war die Disziplin des Klerus.
Wo immer es mglich war, versuchten die Bischfe, Unklarheiten
zu beseitigen und im weltlichen oder Dizesanklerus jene Form
der christlichen Askese zu frdern, die sie im nach der Regel
lebenden Mnchsklerus so sehr bewunderten. In fortschreiten-
dem Mae wurden die Traditionen der westlichen religisen
und gesellschaflichen Praxis dem stlichen asketischen Ideal
angeglichen, gleichzeitig aber auch die klsterlichen Gemein-
schafen aufgefordert, sich der strikten Aufsicht des Bischofs zu
unterwerfen.
199
Im folgenden Jahrhundert wurde diese korporative bischi-
che Kontrolle ber die Disziplin und die Ausbung der Religion
im Frankenreich aber von einer neuen Form des Mnchtums
grundstzlich herausgefordert. Dieses Mnchtum trat auf dem
Kontinent in den letzten Jahren des 6. Jahrhunderts in Erschei-
nung und breitete sich unter der Herrschaf der beiden grten
Merowinger, Chlothars II. und Dagoberts I., rasch aus. Bevor wir
uns nher mit dieser Herausforderung beschfigen, mssen wir
zunchst das Frankenreich unter diesen beiden groen Knigen
betrachten.
200
V. Das Frankenreich unter Chlothar II.
und Dagobert I.
Das wiedervereinigte Frankenreich
Branichild wurde vor Chlothar gebracht, da er sie zutiefst
hate ; er lie sie drei Tage lang verschiedenen Foltern ausset-
zen, dann gab er den Befehl, sie zuerst auf ein Kamel zu setzen
und im ganzen Heer herumzufhren und sie dann mit dem
Haupthaare, einem Fu und einem Arm an den Schwanz eines
ber alle Maen bsartigen Pferdes zu binden; dabei wurde sie
dann durch die Hufe und den rasenden Lauf in Stcke geris-
sen.
Die brutale Demtigung und Zerstckelung der Knigin Bruni-
child war der letzte dramatische Akt (63) der Konsolidierungs-
phase des frnkischen Knigreiches unter Chlothar II. (584-629).
Die nchsten 25 Jahre seiner Herrschaf und der seines Sohnes
Dagobert I., der seit 623 zusammen mit seinem Vater und von 629
bis 639 alleine regierte, sollten zur friedlichsten, erfolgreichsten
und bedeutendsten Periode der frnkischen Geschichte seit der
Regierungszeit Chlodwigs werden. Es war auch die Zeit, in der
jene adligen Krfe, die schlielich die merowingische Dynastie
strzen sollten, ein neues Selbstverstndnis entwickelten und
ihre Macht in Ruhe ausbauten und festigten.
Chlothars Sieg war durch das Zusammenwirken der burgundi-
schen und austrasischen Aristokratie mglich geworden. Der von
Gregor bewunderte Burgunderknig Guntram war 592 kinderlos
gestorben, und sein Nee Childebert II., der Sohn Brunichilds
und des austrasischen Knigs SigibertL, gelangte auf den Tron.
Nach Childeberts Tod 596 versuchte Brunichild, als Regentin
fr ihre minderjhrigen Enkel Teudebert II. (595-62) und
201
Teuderich II. (596-63) sowohl Austrasien als auch Burgund
zu beherrschen. Vergeblich bemhte sich Chlothar II., die Zeit
der Minderjhrigkeit zu nutzen, um die beiden Knigreiche an
sich zu reien.
599 vertrieb der austrasische Adel, der mit der Herrschaf
Brunichilds unzufrieden war, die alte Knigin, und sie oh in das
Knigreich ihres Enkels Teuderich, wo sie herzlich empfangen
wurde. Zunchst arbeiteten die Brder in dem Bestreben, ihren
neustrischen Vetter Chlothar zu verdrngen, zusammen; es ge-
lang ihnen auch, einen betrchtlichen Teil seines Reiches zu er-
obern. Die Spannungen zwischen den Parteigngern Brunichilds
vorwiegend dem Adel in den strker romanisierten Gegenden
Burgunds und ihrem Enkel Teuderich einerseits sowie den
austrasischen und burgundischen Franken andererseits erreich-
ten jedoch im Jahre 62 ein solches Ausma, da Teudebert
das Reich seines Bruders berel. Der Angri endete in einer
Katastrophe; Teudebert wurde gefangengenommen, in Chlons-
sur-Marne eingekerkert und gettet. Teuderich befahl, seinem
minderjhrigen Neen Merowech den Schdel einzuschlagen.
Die Vereinigung der beiden Knigreiche hielt nur einige Mo-
nate lang. Der von Arnulf von Metz und Pippin I. vertretene
austrasische Adel forderte Chlothar auf, in das Knigreich zu
kommen. Teuderich versuchte, gegen sie vorzugehen, starb aber
berraschend in Metz. Brunichild wollte ihre Herrschaf ber
Burgund erhalten, indem sie ihren Urenkel Sigibert, den ltesten
Sohn des Teuderich, zum Knig ber beide Reiche erhob, aber
Sigibert und seine Urgromutter wurden vom burgundischen
Adel verraten und Chlothar in die Hnde gespielt. Sigibert und
sein Bruder Corbus wurden hingerichtet, sein Bruder Merowech,
dessen Pate Chlothar war, nach Neustrien verbannt, und Bruni-
child erlitt das oben nach dem Chronisten Fredegar beschriebene
Schicksal.
Chlothars Sieg war eigentlich ein Sieg des austrasischen und
burgundischen Adels, weshalb er unmittelbar nach der Hinrich-
202
tung Brunichilds Manahmen zum Vorteil derjenigen ergri, die
ihm zum Sieg verholfen hatten. Warnachar, der besondere Favorit
Teuderichs II. und Brunichilds, dessen Verrat die Festnahme der
Knigin ermglicht hatte, wurde unverzglich zum maior domus
von Burgund ernannt; Chlothar schwor einen feierlichen Eid, da
er ihn niemals aus seinem Amt entfernen werde. In Austrasien
setzte Chlothar einen gewissen Rado als maior domus ein, der in
dieser Region vermutlich eine hnliche Rolle gespielt hatte.
Kurz danach erlie Chlothar in Paris ein Edikt mit 24 Artikeln,
worin er im wesentlichen versprach, die traditionellen Rechte
des Adels, der Kirche und des Volkes zu respektieren.
2
Das war
zwar nichts Neues, aber diese Manahmen sollten gewhrlei-
sten, da der in den Jahren der inneren Auseinandersetzungen
und der Willkrherrschaf der Westgotin Brunichild und ihrer
Nachkommen blich gewordene Machtmibrauch unterbun-
den wurde. Es ist nicht ohne Ironie, da ein groer Teil der
Opposition gegen Brunichild auf ihren Versuch zurckging,
rmische Steuertraditionen wiedereinzufhren, das Edikt aber
vermutlich als Antwort auf Bittschrifen erlassen wurde, welche
Bischfe aus dem Sden verfat hatten, die sich auf rmische
und westgotische Traditionen beriefen. So versprach Chlothar,
da die Bischfe von Klerus und Volk gewhlt werden sollten
und da der Knig den Gewhlten besttigen werde, wenn
dieser des Amtes wrdig sei; er verbot den Bischfen die Er-
nennung ihrer Nachfolger; er besttigte die Aufsichtsgewalt des
Bischofs ber seinen Klerus; er garantierte, da Witwen und
Jungfrauen, die sich in Klstern oder in ihren eigenen Husern
einem religisen Leben weihten, nicht zur Heirat gezwungen
werden konnten. Ein Groteil des Edikts betrif das Justizwe-
sen. Auer bei schweren Missetaten sollten Kleriker nur von
Kirchengerichten abgeurteilt werden; Verfahren, in die Kleri-
ker und Laien verwickelt waren, sollten in Anwesenheit eines
kirchlichen und eines entlichen Richters verhandelt werden;
weder Freie noch Sklaven durfen ohne Urteil bestraf oder
203
hingerichtet werden; Juden durfen gegen Christen nicht ge-
richtlich vorgehen. Chlothar befate sich auch mit Mistnden
im Steuerwesen. Wo immer unrechtmige Steuern erhoben
worden waren, sollten frmliche Untersuchungen eingeleitet
werden, um sie zu berichtigen; es sollten keine Zlle erhoben
werden, die nicht bereits whrend der Herrschaf der Knige
Guntram, Chilperich und Sigibert eingefhrt worden waren;
kein kniglicher Steuereinnehmer durfe in kirchliche oder
private Immunitten eingreifen; der Besitz von Personen, die
bei ihrem Tod kein Testament hinterlassen hatten, sollte an ihre
rechtmigen Erben und nicht an den Knig fallen.
Schlielich versprach das Edikt, die Autoritt und die tradi-
tionelle Rolle der lokalen Machthaber zu respektieren. In ei-
nem berhmten Kapitel versprach Chlothar, da kein Richter
[vermutlich kein kniglicher Beamter] aus einer Provinz oder
Region in einer anderen ernannt werde. Manche Historiker
haben darin einen Rckzug der kniglichen Politik gesehen, eine
Garantie der lokalen Autonomie, die einer Abtretung kniglicher
Gewalt an den lokalen Adel gleichkam. In Wirklichkeit spiegelt
sich darin das seit der Rmerzeit blich gewordene Verfahren,
lokalen Beamten die Verantwortung zu bertragen, was bedeutet,
da die Ernennung kniglicher Beamter in hnlicher Weise wie
die Wahl der Bischfe erfolgte. Auerdem verbietet ein anderes
Kapitel weltlichen und geistlichen Magnaten, die in mehr als einer
Region Lndereien besaen, Richter oder Beaufragte zu ernen-
nen, die nicht aus der jeweiligen Region kamen. Obwohl also
das Edikt weder das Ergebnis einer Verfassungsrevolution noch
einer Preisgabe kniglicher Rechte an den Adel ist, besttigt es die
zutiefst lokale Grundstruktur des Frankenreiches. Herrschaf im
Sinne von Steuereinziehung und Rechtswahrung zwischen damit
einverstandenen Freien war innerhalb der civitas oder des pagus,
das heit des die Stadt umgebenden Verwaltungsbezirks, eine
lokale Angelegenheit. Kein Versuch des Knigs, der Kirche oder
eines Grogrundbesitzers, in dieses System Auenseiter einzu-
204
schleusen, sollte toleriert werden. Folglich wurde die Herrschaf
ber die drei von Chlothar vereinten Teilreiche nie zentralisiert,
im Gegenteil. Jeder Teil bewahrte unter Chlothar seine eigenen
regionalen Machtgrundlagen und in gewissem Umfang auch
seine Institutionen; hnliches gilt auch fr die Regierungszeit
Dagoberts, den Chlothar 623 mit der Verwaltung Austrasiens an
der Herrschaf beteiligte und der ihm 629 als Knig des gesamten
Frankenreiches nachfolgte. Im Laufe des 7. Jahrhunderts ver-
strkte sich diese Tendenz noch, whrend andere Regionen wie
Bayern, Tringen, Friesland, Aquitanien und die Provence, die
frher entweder wie Aquitanien und die Provence unter den drei
frnkischen Knigen aufgeteilt oder von Austrasien kontrolliert
worden waren, sich zu relativ autonomen Unterknigreichen bzw.
Dukaten entwickelten.
Die Regionen des Frankenreiches
Im Zuge der Kooperation zwischen Knig und Adel, die schlie-
lich zur Wiedervereinigung der Teilreiche fhrte, wurde die
Rolle der kniglichen Ratgeber in den frnkischen Regionen
auerordentlich wichtig, da sie in weitem Umfang das Ausma
des kniglichen Einusses bestimmten. In Burgund, wo zur
Zeit Brunichilds die kniglichen Amtstrger Kontrollinstanzen
des Knigs gewesen waren, hatte der Adel, scharf gespalten in
westliche Franken und Romano-Burgunder im Rhnetal,
wenig Interesse an einer starken Zentralregierung mit einem
maior domus an der Spitze. Als Warnachar 626/27 starb, lie der
burgundische Adel Chlothar wissen, er wnsche keine weitere
Ernennung, sondern bitte um die Erlaubnis, unmittelbar mit dem
Knig zu verhandeln. Dies bedeutete aller Wahrscheinlichkeit
nach, da der Adel sich selbst regieren wollte. Besonders die
sdlichen Regionen, die in etwa dem alten Knigreich Burgund
entsprachen, entwickelten das ganze restliche Jahrhundert hin-
205
durch separatistische Tendenzen, in deren Zentrum mchtige
Adelsfamilien standen.
Wie stark sich innerhalb von weniger als 5 Jahren diese
Autonomietendenzen entwickelt hatten, lt sich im Bericht ber
Dagoberts Besuch in Burgund im Jahre 628 nachlesen. Fredegar
berichtet in seiner Chronik: Seine Ankunf hatte die Bischfe,
die Groen, die im Reiche Burgund lebten, und die anderen Ge-
folgsleute in solche Furcht versetzt, da sich jedermann wundern
mute; die Armen aber, die nun zu ihrem Rechte kamen, hatte
dies mit groer Freude erfllt.
3
Die Anwesenheit des Knigs, der
durch Burgund zog, Recht sprach und Unrecht bereinigte, machte
sicher groen Eindruck, war aber nur vorbergehend. Lokale
Magnaten waren stndig bestrebt, ihre eigene Machtbasis zu fe-
stigen und sich der kniglichen Aufsicht zu entziehen. Als 626/27
der knigliche maior domus Warnachar starb, versuchte dessen
Sohn Godinus, die von seinem Vater geschaene regionale Macht
durch Heiratsverbindungen zu konsolidieren, und gri dabei zu
einem auergewhnlichen Mittel; er heiratete seine Stiefmutter
Bertha, die Witwe seines Vaters. Chlothar war darber so erbost,
da er ihn tten lie. Spter agitierte in Burgund Brodulf, der
Onkel von Dagoberts Halbbruder Charibert II., dem Chlothar
lediglich ein Knigreich an der Kste Aquitaniens bertragen
hatte, massiv gegen Chlothar. Vermutlich versuchte Brodulf,
seinen Schwiegersohn auf den burgundischen Tron zu setzen.
Bevor Dagobert 628 Burgund verlie, lie er Brodulf hinrichten.
Doch konnte der Knig sich nicht stndig in Burgund aufalten,
und in seiner Abwesenheit entwickelten sich zwangslug erneut
Autonomietendenzen.
Im Knigreich Austrasien, das unter Sigibert I. und seinen
Nachfolgern fast ein ganzes Jahrhundert relativ einheitlicher
Herrschaf erlebt hatte, suchte sich der Adel mit unterschiedli-
chen Mitteln zu schtzen. Dort drngte man Chlothar, seinen
Sohn Dagobert als Knig einzusetzen. Auerdem wurden die
Bestrebungen Chlothars abgeblockt, das austrasische Knigreich
206
durch die Ablsung des austrasischen Teiles von Aquitanien
und des Gebiets westlich der Ardennen und der Vogesen zu
verkleinern. Als Dagobert gegen die Aufeilung Einspruch erhob,
wurde eine Gruppe von zwlf Schiedsmnnern gebildet, die
den Streit schlichten sollte. Da der wichtigste von ihnen Arnulf
von Metz war, neben Pippin I. der mchtigste Reprsentant des
austrasischen Adels, berrascht es nicht, da Dagobert das ge-
samte Gebiet nrdlich der Loire behalten konnte, das zuvor zu
Austrien gehrt hatte.
Hier wird die Strategie deutlich, die der Adel zur Erhaltung
seines Einusses in Austrasien eingeschlagen hatte. Die Region
sollte zentral verwaltet werden und einen eigenen Knigshof ha-
ben, aber unter der Kontrolle von Pippin und Arnulf bleiben, die
63 Chlothar in das Knigreich gerufen hatten. Als Arnulf spter
den Hof verlie, trat ein anderer Austrasier, Bischof Kunibert von
Kln, an seine Stelle. Die Macht dieser Mnner war so gro, da
sie den Knig sogar zwingen konnten, ihre Rivalen auszuschalten,
so zum Beispiel Chrodoald, ein fhrendes Mitglied der mchtigen
Familie der Agilolnger, die Verbindungen in ganz Austrasien
nach Bayern und bis ins Langobardenreich besa.
Nachdem Dagobert 629 die Nachfolge seines Vaters angetreten
und das Zentrum seiner Aktivitten nach Paris verlagert hatte,
wurde der Einu des austrasischen Adels auf den Knig schw-
cher. Nur Pippin blieb bei ihm, aber auch er el in Ungnade, und
vielleicht hatte Dagobert ihn nur deshalb nach Neustrien mitge-
nommen, weil er ihn im Auge behalten wollte. Dennoch war die
strategische Bedeutung Austrasiens so gro, da der Knig weder
die Region noch deren Adel vernachlssigen durfe. Frnkische
Niederlagen gegen die slawischen Wenden unter der Fhrung
des frnkischen Knigs Samo in den Jahren 63-633 zwangen ihn,
ein verkleinertes austrasisches Knigtum zu errichten und seinen
zweijhrigen Sohn Sigibert als Knig einzusetzen. Zu dessen
Erzieher ernannte Dagobert einen Gegner Arnulfs und Pippins,
den domesticus Urso. Aber die eigentliche Macht in diesem K-
207
nigreich teilten sich Bischof Kunibert von Kln, ein enger Freund
Pippins, und Herzog Adalgisel, der mit groer Wahrscheinlichkeit
ein Arnulnger war. So blieb der austrasische Adel allen Anstren-
gungen des Knigs zum Trotz an der Macht. Diese wurde durch
die Verbindung der beiden fhrenden Adelsfamilien, und zwar
durch die Heirat zwischen Arnulfs Sohn Ansegisel und Pippins
Tochter Begga, zustzlich gefestigt. Aus dieser neuen Sippe, die als
Arnulnger oder Pippiniden bezeichnet wird, sollte die nchste
Knigsdynastie, die der Karolinger, hervorgehen.
Neustrien war das Herrschafszentrum Chlothars gewesen,
und nach 629 blieb es das auch unter Dagobert. Hier konzen-
trierten sich das grte Fiskalland, die wichtigsten Stdte Paris,
Soissons, Beauvais, Vermand-Noyon, Amiens und Rouen sowie
die reichsten Klster des Frankenreiches. Paris wurde immer
strker zur kniglichen Hauptresidenz und zum Mittelpunkt
der religisen und politischen Ideologie des Knigs. Die groen
Knigsklster Saint-Germain-des-Prs und Saint-Denis lagen
unmittelbar vor den Toren der Stadt, und besonders letzteres
wurde unter Dagobert zum religisen Zentrum der kniglichen
Familie. Dagobert beschenkte Saint-Denis reichlich, erhob den
Kirchenpatron neben dem heiligen Martin zum Schutzheiligen
des Knigs und bestimmte die Kirche zur kniglichen Begrb-
nissttte, was sie bis zur Franzsischen Revolution blieb.
Auerhalb der drei zentralen frnkischen Regionen war die
Kontrolle ber das Frankenreich sehr unterschiedlich ausgeprgt.
Das an der Kste gelegene Knigreich Aquitanien hatte Chlothar
seinem Sohn Charibert bertragen, den der Chronist Fredegar
als einfltig bezeichnet. Wie die Errichtung eines austrasischen
Knigreiches war die eines Knigreiches in Aquitanien die Reak-
tion auf eine Bedrohung von auen, in diesem Falle von seiten
der Gascogner und der Basken. Bis zu Chariberts Tod im Jahre
632 konnte der Friede gewahrt werden, aber kurz danach bedroh-
ten die Basken Aquitanien erneut. Dagobert beaufragte eine
burgundische Armee, die Region zu besetzen und zu befrieden,
208
doch diese erzielte nur Teilerfolge. Das von Herzog Arnebert
angefhrte Kontingent wurde bei seiner Rckkehr in der Land-
schaf Soule von den Basken aus dem Hinterhalt berfallen und
aufgerieben, eine Niederlage, die zur Entstehung der Legende
beigetragen haben mag, die ein Jahrhundert spter abgewandelt
wurde und eine vergleichbare Niederlage der frnkischen Armee
unter dem Kommando des Grafen Roland bei Roncesvalles
beschrieb.
Parallel zu den Rckschlgen in Aquitanien erlebte Dagobert
Niederlagen in Tringen und bei seinen Feldzgen gegen die
Slawen. Die Wenden waren von Samo geeint worden, einem
Franken, der zwar als Kaufmann beschrieben wird, aber auch
ein frnkischer Agent gewesen sein kann, der ausgesandt worden
war, um die Wenden gegen die Awaren zu organisieren, ein Step-
penvolk, das in Pannonien an die Stelle der Hunnen getreten war
und nicht nur das Byzantinische Reich, sondern auch Italien und
das Frankenreich bedrohte. Er war auerordentlich erfolgreich
bei der Organisierung der Slawen und der Abwehr der Awaren,
weshalb ihn die Slawen zu ihrem Knig machten, was er etwa
35 Jahre lang blieb. Sein Knigreich erstreckte sich von Bhmen
bis Krnten und bedrohte bald das Einugebiet der Franken
in Tringen. Dagoberts Versuch, die Wenden zu unterwerfen,
schlug fehl, nicht zuletzt wegen der Unzuverlssigkeit Austrasi-
ens. Wie bereits erwhnt, fhrte diese slawische Bedrohung zur
Wiedererrichtung des Knigtums in Austrasien.
Nach der Wiedererrichtung des austrasischen Knigtums und
der Einsetzung des Austriers Radulf als Herzog in Tringen
kam es dort zu hnlichen Schwierigkeiten. Radulf verteidigte
Tringen erfolgreich gegen die Wenden, machte es aber im
Laufe der Zeit zu einem relativ autonomen Knigreich. Spter,
nach Dagoberts Tod, erhob er sich gegen Sigibert, besiegte ihn
und ernannte sich selbst zum Knig in Tringen, ein bses
Omen fr die Zukunf der Merowingerfamilie.
4
Das am Ende des 6. Jahrhunderts geschaene, abgelegene
209
Herzogtum Bayern konzentrierte sich um Regensburg, die alte
Rmerstadt Castra Regina. Es dehnte sich allmhlich die Donau
hinunter und im Sden zu den Alpen hin aus, fllte das vom
Rckzug der Langobarden nach Italien und der Franken nach
Austrasien hinterlassene Vakuum und integrierte die verschiede-
nen rmischen und barbarischen Siedler dieser Bergregion. Die
Bedrohung durch Awaren, Slawen und Bulgaren hielt Bayern und
seine agilolngischen Herzge in enger Abhngigkeit von den
frnkischen Knigen. Um 630 veranlate ein auf Anraten seines
frnkischen Adels erlassener Befehl Dagoberts, die in Bayern
berwinternden bulgarischen Flchtlinge zu erschlagen, deren
Gastgeber, innerhalb einer Nacht tausende Mnner, Frauen und
Kinder umzubringen. Dennoch mochten die Agilolnger von
Dagobert nicht vollstndig abhngig werden. Die Ermordung
ihres Verwandten Chrodoald auf Betreiben Pippins belegt, da
am Knigshof ein Oppositionspotential vorhanden war. Daher
nahmen sie Beziehungen zu den Awaren und Langobarden auf
und schlossen im Laufe des 7. Jahrhunderts zahlreiche Heiratsver-
bindungen mit dem langobardischen Knigshaus. Zwar gingen
sie nicht so weit wie Radulf und beanspruchten nicht den K-
nigstitel, aber ihre langobardischen Nachbarn zgerten nicht, sie
so zu nennen. Der Geschichtsschreiber Paulus Diaconus schrieb
im 8. Jahrhundert, Tassilo sei 593 von Childebert zum Knig von
Bayern erhoben worden.
Der Knigshof
Chlothar und Dagobert konnten nicht hoffen, das gesamte
Frankenreich lasse sich regieren, indem knigliche Beamte in
die einzelnen Reichsteile entsandt wurden und dort Schlssel-
positionen einnahmen. Statt dessen versuchten sie, Angehrige
der regionalen Eliten am kniglichen Hof zu Paris zusammen-
zuziehen, wo diese besser beobachtet, aber auch politisch und
210
kulturell ausgebildet und beeinut werden konnten. Da sie
die besten und fhigsten Adligen fr kirchliche und weltliche
mter in ihrer jeweiligen Heimatregion auswhlten, konnten
sie diese anschlieend zurckschicken und so ihr Versprechen
erfllen, wichtige mter mit Angehrigen der lokalen Elite zu
besetzen; gleichzeitig stellten sie auf diese Weise sicher, da in
den entscheidenden mtern Mnner saen, die mit dem Knig
zusammenarbeiten konnten.
Die Adelsfamilien ihrerseits betrachteten den Hof als einen
Ort, an den sie ihre Shne und Tchter zur Erziehung schicken,
wo sie Kontakte knpfen und ihren Familien die mter sichern
konnten, die zur Erreichung der familienpolitischen Ziele erfor-
derlich waren. So wurde der neustrische Hof zu einem wichtigen
kulturellen Zentrum des Frankenreiches, wo junge gallormi-
sche Aristokraten aus Aquitanien, wie Desiderius, der sptere
Bischof von Cahors, und Eligius, ein Aristokrat aus Limoges, der
spter Dagoberts Schatzmeister und Bischof von Noyon wurde,
Freundschaf mit jungen Adligen aus dem Norden schlossen,
so mit Audoenus (bekannt als Saint Ouen, Audoin oder Dado),
der spter Dagoberts referendarius und dann Bischof von Rouen
wurde. Hier konnten auch Heiraten angebahnt werden, etwa zwi-
schen dem jungen austrischen Adligen Adalbald aus Ostrewant
und Rictrudis, einer Gallormerin aus Aquitanien. Sogar aus
Northumbrien schickte Knig Edwin seine beiden Shne zur
Erziehung an den Hof Dagoberts.
Der Hof bernahm dabei unterschiedliche Aufgaben. Die
jungen Mnner aus vornehmen Familien hatten bereits eine
Erziehung erhalten, bevor sie etwa im Puberttsalter an den Hof
kamen und sich mglicherweise durch einen besonderen Eid an
den Knig banden. Oensichtlich wurden sie gemeinsam mit den
Knigskindern unter der Leitung eines kniglichen Erziehers
oder des maior domus erzogen. Ihre Erziehung umfate ver-
mutlich sowohl eine militrische Ausbildung derjenigen, die fr
weltliche mter vorgesehen waren, als auch eine Ausbildung in
211
Rhetorik und Notariatswesen fr diejenigen, die in die knigliche
Kanzlei eintreten sollten. Dennoch waren die jungen Adligen
nicht nur am Hof, um Verwalter zu werden; hier sollten sie das
komplexe Netzwerk von Freunden, Patronen und Knigsnhe
knpfen und erweitern, das ihre Familien untersttzen und
bereichern konnte.
Den umfassendsten Einblick in ein solches kulturelles, gesell-
schafliches und politisches Netzwerk vermitteln der Lebenslauf
und die Korrespondenz des Bischofs Desiderius. Seine Eltern
Salvius und Herchenefreda stammten beide aus der gallormi-
schen Aristokratie von Albi. Er war eines von fnf Kindern, deren
klangvolle rmische Namen Rusticus, Siagrius, Seiina und Avita
an senatorische Traditionen erinnerten. Als erster wurde der
lteste Bruder Rusticus an den Hof geschickt, wo er als Kaplan
und Diakon amtierte, bevor der Knig ihm den Bischofssitz von
Cahors anvertraute. Auch der zweite Bruder Siagrius kam zu
Chlothar an den neustrischen Hof und kehrte spter als Graf
von Albi in seine Heimat zurck. Schlielich wurde er zum pa-
tricius der Provence ernannt, der in seiner Stellung einem dux
vergleichbar war.
Auch Desiderius wurde nach dem Studium der Rhetorik und
des Rechtes an den Hof berufen, wo er als Schatzmeister amtierte.
Zu seinen Mitarbeitern zhlten einige der bedeutendsten und
einureichsten Mnner des 7. Jahrhunderts der zuknfige
Bischof Paul von Verdun, Abbo von Metz, Eligius von Nantes
und Audoenus von Rouen. Das hsche Leben bot vielfltige
Mglichkeiten. Der Hof Chlothars und Dagoberts geriet zuneh-
mend unter klerikalen Einu; bischiche Hinge wie Eligius
und Audoenus besaen weit greren Einu als Bischfe des
6. Jahrhunderts, und sowohl am Hof als auch in den Provinzen
schlug eine neue monastische Kultur, auf die wir spter nher
eingehen werden, im frnkischen Adel tiefreichende Wurzeln.
Aber der Hof bot auch all jene Mglichkeiten der Zerstreuung
und Verfhrung, die Knigshfe berall charakterisierten. Beson-
212
ders nachdem Dagobert um 629 seine erste, kinderlos gebliebene
Frau Gomatrudis verstoen und Nanthild geheiratet hatte, war
der Hof, wenn man dem eher feindlich gesonnenen Fredegar
glauben darf, fr seine Ausschweifungen berchtigt, und als der
Knig lter wurde und es sich immer deutlicher abzeichnete, da
auf seinen Tod eine erneute Reichsteilung unter minderjhrigen
Nachfolgern folgen wrde, wurde der Hof auch zu einem Zen-
trum der Intrigen. Oensichtlich sorgte sich die Mutter des De-
siderius um den guten Ruf ihres Sohnes; in einem aus dieser Zeit
erhaltenen Brief beschwrt sie ihn, sich sowohl vor den Gefahren
der Hofpolitik als auch den moralischen Versuchungen zu hten:
Sei wohlttig gegenber jedermann, rt sie ihm, bewahre vor
allem deine Keuschheit, sei vorsichtig in Wort und Tat.
5
Desiderius folgte ihrem Rat und wurde nach der Ermordung
seines Bruders Rusticus 630 von Dagobert als dessen Nachfolger
zum Bischof von Cahors ernannt. Eine solche Karriere wurde
immer typischer fr das frhe 7. Jahrhundert. Zwar war es schon
in der Vergangenheit nicht auergewhnlich gewesen, da An-
gehrige der kniglichen familia zu Bischfen ernannt wurden,
aber nun wurde dies zum Regelfall. Oensichtlich behielt sich
Dagobert persnlich das Recht zur Ernennung und Besttigung
der Bischfe vor und berlie es nicht seinem Halbbruder oder
spter seinem Sohn ein Mittel, die Knigsherrschaf auch in
Austrien und im sdlichen Aquitanien zu sichern.
In Cahors stellte Desiderius jene beiden Fhigkeiten in den
Dienst des Knigs, die die Bischfe des 7. Jahrhunderts auszeich-
neten: Sein Biograph beschreibt ausfhrlich das umfangreiche
Kirchenbauprogramm, das er in Gang brachte, lobt aber auch sei-
ne Leistungen im Festungsbau. Er lie nicht nur die Stadtmauern
ausbessern, sondern auch Trme und befestigte Stadttore bauen.
Auch errichtete er seinem Biographen zufolge das erste Kloster
von Cahors, in welchem er begraben zu werden wnschte. Da-
neben pegte er enge Kontakte mit den Aristokraten, mit denen
zusammen er erzogen worden war und am Hof gedient hatte.
213
In seiner Korrespondenz, die erhalten geblieben ist, nden sich
nicht nur Briefe seines Erzbischofs bzw. an diesen und andere
aquitanische Bischfe, sondern unter anderem auch Briefe an
Dagobert, Sigibert III., Grimoald, den maior domus von Austrien,
Chlodulf, der oensichtlich ein Sohn des Arnulf von Metz war,
Bischof Medoald von Trier, Abbo von Metz, Audoenus von Rou-
en, Paul von Verdun, Felix von Limoges, Eligius von Noyon und
Palladius von Auxerre. Diese weitlugen Verbindungen waren
eindeutig ein Resultat der am Hof verbrachten Jahre und einer
weiterhin wichtigen Stellung im Knigreich. In zwei Briefen an
Abbo von Metz bzw. Audoenus von Rouen erinnert er mit Freude
an die glcklichen Tage, die sie gemeinsam am Hofe Chlothars
verbracht hatten.
ber Desiderius und seine ebenfalls am Hof erzogenen Mitbi-
schfe wissen wir aufgrund ihrer Korrespondenz und der nach
ihrem Tod verfaten Biographien ziemlich viel. Weit weniger
gut informiert sind wir hingegen ber die weltlichen Amts-
trger, die am Hof ausgebildet worden waren, wenn man auch
vermuten darf, da zwischen ihnen ein hnliches Netzwerk von
Beziehungen entstand. Einige, wie Siagrius, der Bruder des De-
siderius, kehrten als comites in ihre Heimat zurck. Andere wie
Radulf wurden als duces in die Grenzregionen des Frankenrei-
ches geschickt, wo sie vielleicht schon enge Verbindungen be-
saen oder rasch ausbildeten. Wieder andere wie der Austrier
Adalbald, der die Aquitanierin Rictrudis heiratete, wurden
oensichtlich mit Frauen aus unsicheren Regionen verheiratet,
damit die zur eektiven Herrschafsausbung notwendigen
Bande geknpf wurden. Solche Bemhungen trafen of auf
Widerstand; Adalbald wurde auf Betreiben seiner Schwger
ermordet. Dennoch wird deutlich, da im ersten Viertel des 7.
Jahrhunderts zahlreiche austrasische und neustrische Familien
Verbindungen nach Aquitanien, in die Provence, nach Burgund
und zu den rechtsrheinischen Gebieten entwickelten, die am
Hof der Knige geknpf wurden, whrend eine betrchtliche
214
Anzahl von Aquitaniern, vorwiegend Bischfe, mter im nrd-
lichen Frankenreich erhielten.
So spielte der Hof unter Chlothar und Dagobert dadurch bei
der Durchsetzung des kniglichen Herrschafsanspruchs eine
wesentliche Rolle, da er Persnlichkeiten an sich zog, ausbilde-
te und dann als kompetente Amtsinhaber in die Reichsgebiete
aussandte. Weniger aullig vollzogen sich in diesen Jahrzehn-
ten zwei andere Entwicklungen, die sich auf die europische
Geschichte aber ebenfalls nachhaltig auswirken sollten: Es ent-
stand erstens die zweigeteilte Domne, die fr die folgenden
Jahrhunderte die landwirtschaflichen Strukturen prgte, und
es kam zweitens zu einer allmhlichen Christianisierung der
kniglichen Tradition, die durch die neue Domnenorganisation
begnstigt wurde.
Die kniglichen Domnen
Der von Chlodwig konszierte kaiserliche Besitz in Nordgallien
war stets der Grundpfeiler des Reichtums der Merowinger ge-
wesen. Vorwiegend aus diesem Grund erhielten seine Shne bei
der Reichsteilung nach seinem Tod Hauptstdte, die zwischen
Rhein und Loire relativ nahe beieinander lagen. Die civitas von
Paris bestand zumindest zu drei Vierteln aus Fiskalland; der
grte Teil befand sich in Chelles, Rueil und Clichy; in Soissons
gruppierte sich Fiskalland um Bonneuil-sur-Marne, Compigne
und Nogent-sur-Marne; an der unteren Seine lag Fiskalland um
Etrepagny, dem Forst von Bretonne und um die spter erbauten
Klster Jumiges und Saint-Wandrille; das umfangreichste K-
nigsland bei Amiens lag um Crecy-en-Ponthieu.
Diese riesigen kniglichen Domnen unterlagen whrend der
Merowingerzeit stndigen Vernderungen. Teile davon wurden
wichtigen Magnaten bertragen, andere wurden zum Standort
bedeutender Klster. Jedoch besaen sie einige Kennzeichen,
215
die sie von anderen Gebieten und Gtern von Privatpersonen
unterschieden. Dabei handelt es sich erstens um die topographi-
schen und demographischen Charakteristika dieser Gebiete. Es
gab in dieser sanf gewellten Region im wesentlichen zweierlei
Arten von Bden. Der eine Bodentyp war ein sandiges Hoch-
land, das leicht zu bearbeiten war und sich zur Bewirtschafung
durch einzelne buerliche Familien anbot, der andere ein schwe-
res, fruchtbares Tieand, das besser von Gruppen buerlicher
Arbeitskrfe bewirtschafet wurde, die massivere und teurere
Gerte wie den schweren Pug benutzten.
Nachdem die klassischen rmischen Villen, wie oben dargelegt,
aufgegeben worden waren, wurde die Region relativ dicht von
Franken besiedelt, was vom Beginn des 6. Jahrhunderts an eine
umfangreiche Entwaldung und die zunehmende Umstellung von
der Viehzucht auf den Getreideanbau zur Folge hatte.
Da darber hinaus ein Groteil dieses Grundbesitzes Fiskal-
land blieb, war er nicht den hugen Teilungen unterworfen wie
privater Allodialbesitz des Adels, der stndig mit Kauf, Verkauf
und Tausch von Land beschfigt war. Normalerweise bedeutete
der Tod eines Grundbesitzers die Aufeilung des Landbesitzes
unter seine Erben. Da es sich hier jedoch um Fiskalland handelte,
unterschieden sich die Dienste und Abgaben, die freie und un-
freie Bauern zu entrichten hatten, von denen auf Allodialland.
Besonders die Pchter einzelner groer Hfe waren auf dem Teil
des Landes, dessen Ertrge unmittelbar dem Knig zustanden,
zu umfangreichen Diensten verpichtet.
So setzte vermutlich schon zur Zeit Chlothars und Dagoberts
eine Entwicklung ein, in deren Verlauf sich allmhlich eine Do-
mnenstruktur herausbildete, welche fr die landwirtschafliche
Organisation des Hochmittelalters typisch wurde. Diese Struktur
war grundstzlich zweigeteilt. Der eine Teil bestand aus einzelnen
Bauernstellen, den sogenannten Mansen ein Begri, der sich
in der ersten Hlfe des 7. Jahrhunderts durchsetzte , die gegen
festgesetzte Abgaben bewirtschafet wurden. Solche Mansen wur-
216
den oensichtlich hug im Laufe der Rodungsphase geschaen
und mit Freien, ans Fiskalland gebundenen Bauern oder mit
Sklaven als unfreien Pchtern besetzt. Andererseits bildete ein
betrchtlicher Teil des Anwesens den Herrenhof, und obwohl
dieser im 7. Jahrhundert noch vorwiegend von Sklaven bewirt-
schafet wurde, muten die Mansenbauern auf der Domne,
deren Ertrag unmittelbar dem Knig zuo, in festgesetztem
Umfang Dienstleistungen erbringen.
Da diese Lndereien Fiskalland waren, blieb hier das sptr-
mische Steuersystem, das privatisiert worden und in der Hofver-
waltung aufgegangen war, lnger als staatliches oder zumindest
knigliches System erhalten. Die Kontinuitt der Besitzverhlt-
nisse ermglichte einen dauerhafen Einzug von Einnahmen und
eine fortlaufende Planung, und da es sich um Fiskalland handelte,
konnte sich kein Bischof und kein lokaler Adliger zwischen die
kniglichen Beamten und die Bauern stellen und eine Vermin-
derung der Steuern oder gar, wie im 6. Jahrhundert geschehen,
eine Vernichtung der Steuerlisten verlangen.
Diese Lndereien mssen hohe Gewinne abgeworfen haben
und bildeten eine Hauptquelle des kniglichen Reichtums, mit
dem der knigliche Hof, die Bauvorhaben, die kniglichen Repr-
sentationsaufgaben und die von den Knigen erwartete Freige-
bigkeit nanziert wurden. Dieses Modell breitete sich allmhlich
im gesamten Frankenreich aus und wurde in Burgund, Austrasien
und sogar im entfernten Bayern bereitwillig bernommen, wo
die Bodenbeschaenheit, die Bevlkerung und die Verfgbarkeit
von Fiskalland entsprechende Gewinne versprachen. Im Sden
setzte es sich weniger durch, weil ltere, gallormische Traditio-
nen und eine andere Art der Bewirtschafung sich gegenber der
Umstrukturierung als resistenter erwiesen.
Aber nicht nur die neue Gutsorganisation, sondern die Gter
selbst waren vom Adel als Belohnung fr seine Dienste und
von den Kirchen zum Dank fr ihre Gebete hei begehrt. Zwar
waren die Knige verpichtet, Bittstellern gegenber grozgig
217
zu sein, und schenkten ihnen daher gelegentlich Land, aber sie
scheinen es nach Mglichkeit vermieden zu haben, Fiskalbesitz
an Laien zu bertragen. Wohl erfahren wir von grozgigen
Schenkungen an verschiedene Adlige, besonders an diejenigen,
die Chlothar gegen Brunichild untersttzt hatten, aber von
diesen Gtern waren die meisten von oppositionellen Adligen
konsziert worden. Dennoch muten die Knige gelegentlich
Fiskalland verschenken, und normalerweise besttigten sie mit
diesen Schenkungen die Immunitt, das heit dieselben Rechte
ber die Bauern und an den Einknfen, wie sie sie selbst in-
negehabt hatten. Die langfristigen Auswirkungen dieser Praxis
erwiesen sich als unheilvoll, weil die kniglichen Einknfe an
den neuen Besitzer bergingen und damit die Macht des Knigs
allmhlich untergraben wurde.
Im Gegensatz dazu vergaben Chlothar und besonders Dagobert
weit grozgiger Fiskalland an die Kirche. Dies war eine alte
Tradition. Chlodwig hatte die Kirche von Sainte-Genevieve, in
der er beigesetzt wurde, mit Fiskalland beschenkt, Childebert I.
Saint-Germain-des-Prs auf kniglichem Land gegrndet. Chlo-
thar und besonders Dagobert begnstigten Saint-Denis, das in
der Nhe ihrer Lieblingsvilla Clichy lag. Dagobert schenkte dem
Kloster nicht nur konszierte Gter wie die des aufrhrerischen
Herzogs Sadregisel aus Aquitanien, sondern auch betrchtliche
Lndereien aus Fiskalbesitz bei Paris und in entfernteren Regio-
nen, etwa im Limousin, in Le Mans und der Provence.
Dagobert verfolgte mit dieser Vergabe von Knigsgut bestimm-
te Absichten. Mit der Zeit jedoch hatte sie eine unvorhergese-
hene, doppelte Wirkung. Langfristig schwchte sie die Stellung
des Knigtums gegenber der Aristokratie, die entweder solche
Gter als Geschenk erhalten hatte oder der es gelungen war, die
Kontrolle ber die von den Knigen reich beschenkten Klster zu
erwerben. Sie trug aber auch dazu bei, die zweigeteilte Domne
ber das Pariser Becken und das Fiskalland hinaus zu verbreiten,
bis sie schlielich im spten 8. Jahrhundert zum dominierenden
218
Modell der landwirtschaflichen Struktur geworden war.
Keine dieser beiden Auswirkungen hatte Dagobert jedoch
beabsichtigt, als er Saint-Denis und andere Kirchen beschenk-
te. Seine Motive waren religiser und monarchischer Art er
verband die knigliche Tradition mit einer speziellen Form des
Christentums in der Absicht, beide zu strken.
Die Christianisierung der kniglichen Tradition
ber ein Jahrhundert lang hatten die frnkischen Knige eine
gut funktionierende, enge Zusammenarbeit mit den Kirchen
gepegt. Unter Dagobert wurde diese Verbindung jedoch syste-
matischer, expliziter und weitreichender. Das Knigtum frderte
die Ausbildung und Ernennung von Bischfen wie Desiderius,
deren persnliche Loyalitt auer Frage stand. Aber dies war
nur einer der Grnde fr die enge Beziehung zwischen Monarch
und Kirche; die Vermutung, da Dagobert einen frnkischen
Episkopat zum Schutz vor den Ansprchen der adligen Laien
habe schaen wollen, ist anachronistisch. Vielmehr bemhte er
sich intensiv um den spirituellen Schutz und die innere Festigung
seines Reiches, um jene stabilitas, die eine gut ausgestattete Kirche
verschaen konnte.
Zwei Wege fhrten zu dieser stabilitas. Zunchst sollte, wie
Dagobert zu Beginn seines Briefes darlegte, in welchem er die
Ernennung des Desiderius zum Bischof von Cahors verkndete,
unsere Wahl und Entscheidung in allen Dingen mit dem Willen
Gottes bereinstimmen.
6
Diese Verpichtung Gott gegenber
erwuchs aus der Tatsache, da alle Territorien und Knigreiche
bekanntlich unserer Macht unterworfen wurden, damit sie durch
die Grozgigkeit Gottes regiert werden. Diese Formulierung
ist nicht neu und bedeutet auch nicht, da Dagobert sich als
Knig von Gottes Gnaden eine spter von den Karolingern
benutzte Wendung verstand, sondern sie enthlt die Anerken-
219
nung der Tatsache, da der Knig von Gott abhngig ist, sowie
der Pichten, die sich aus dieser Abhngigkeit ergeben.
Diese Verpichtung umfate die Besetzung kirchlicher und
weltlicher mter mit gottesfrchtigen Mnnern wie Desiderius
und die Ausbung einer gerechten Herrschaf. Wie sie umge-
setzt wurde, haben wir oben beschrieben. Die von Dagobert
am Knigshof ausgebildeten und ber das gesamte Knigreich
verteilten Bischfe waren, ganz abgesehen von ihren politischen
und gesellschaflichen Verbindungen, hervorragend befhigte
und an den Mastben ihrer Zeit gemessen wrdige Kirchenmn-
ner. Dagoberts Bemhen um Gerechtigkeit kommt nicht nur in
solchen Reisen zum Ausdruck, wie sie 629 Burgund in Unruhe
strzten, sondern auch in der Kodizierung der Gesetze der ri-
puarischen Franken, der Alemannen und mglicherweise auch
der Bayern: Anders als die salische und die burgundische Rechts-
sammlung sind die spteren Codices keine Aufzeichnungen des
Gewohnheitsrechts durch rmische Juristen auf Anordnung
des lokalen Knigs, sondern auferlegtes Recht. Der erste Codex
wurde fr das von Dagoberts Sohn Sigibert regierte kleine Knig-
reich Austrasien verfat, die anderen beiden frnkischen Gesetze
erlieen duces, die ein Merowingerknig ernannt hatte.
Der zweite Weg zur stabilitas fhrte ber die Vergabe von
Almosen und besonders ber die Freigebigkeit gegenber den
Klstern. Fredegar, der an Dagoberts spterer Regierungszeit viel
auszusetzen hatte, erkannte dessen Freigebigkeit vorbehaltlos an.
Und er vermutete, der Knig htte sogar seine Seele retten kn-
nen, wenn er noch freigebiger gewesen wre; er htte dann doch
noch denn er verteilte ja ber alle Maen reiche Almosen an
die Armen das Ewige Knigreich verdient, so glaubt man, wenn
blo seine Gebefreude seine Habsucht berwogen htte.
7
In Wirklichkeit war Dagobert ein geradezu verschwenderischer
Almosengeber und verlangte noch auf seinem Sterbebett, sein
Sohn solle seine letzten Schenkungen an Saint-Denis bestti-
gen. Die Freigebigkeit gegenber Saint-Denis haben wir oben
220
bereits erwhnt; sie wurde geradezu zum Kennzeichen der
Regierungszeit Dagoberts. Er stattete das Kloster nicht nur mit
umfangreichem Grundbesitz aus und verlieh ihm die Immunitt,
sondern schenkte ihm auch groe Mengen Gold, Gemmen und
wertvolle Gegenstnde. Der berlieferung nach richtete er beim
Kloster auch die groe Oktobermesse ein, die ber Jahrhunderte
ein wichtige Einkommensquelle der Mnche darstellte. Und
schlielich whlte er Saint-Denis zur letzten Ruhesttte.
Diese Freigebigkeit war keine Einbahnstrae. Als Gegenleistung
erwartete Dagobert den geistlichen Beistand der Mnche. Insbe-
sondere fhrte er in Saint-Denis die Tradition der laus perennis
ein, des immerwhrenden Chorgesangs nach dem Vorbild von
Saint-Maurice dAgaune, wobei ein Mnchschor den anderen
ablste, so da zu jeder Stunde des Tages und der Nacht Gebete
fr den Knig, seine Familie und das Knigreich zu Gott aufstie-
gen. Dagobert nahm seine Pichten ernst und erwartete dasselbe
von seinem Lieblingskloster.
Die Ausbildung der Adelstradition
Welche Regel die Mnche von Saint-Denis zur Zeit Dagoberts
befolgten, wissen wir nicht. Vermutlich standen sie in irgendeiner
Weise der Tradition des heiligen Martin nahe. Nach Dagoberts
Tod fhrte sein Sohn die sogenannte Mischregel ein, die aus
den Regeln Benedikts und Columbans stammte. Diese Form des
Mnchtums, die im 7. Jahrhunden zu nehmend an Bedeutung
gewann, war Teil eines religisen und gesellschaflichen Wandels,
der im Laufe der Zeit die frnkische Welt grundlegend vernderte
und das Schwergewicht der Macht von den merowingischen K-
nigen und Bischfen auf die frnkischen Adligen und Mnche
verlagerte.
Die frnkischen Adelsfamilien, die ihre Unabhngigkeit und
Macht in den unruhigen letzten Jahren des 6. Jahrhunderts
221
ausgebaut hatten, waren keine Neuschpfung, wie man frher
annahm. Wie wir gesehen haben, existierte bereits vor Chlodwig
ein frnkischer Adel, der auch unter seinen Nachfolgern stets
eine bedeutende Rolle spielte. Anders als die gallormische
Aristokratie, die nicht nur ber eine starke politische und ge-
sellschafliche Basis verfgte, sondern auch in der orthodoxen
Christenheit eine Schlsselstellung einnahm, weil sie ber
die Besetzung hoher mter entschied und diese auch selbst
ausbte, spielte der frnkische Adel nach der Bekehrung der
Franken zum Christentum in der Gesellschaf keine religise
Rolle. Zwar mgen die Mitglieder des Adels weiterhin wegen
ihrer ntilitas, also wegen ihrer militrischen Fhigkeiten und
ihres politischen Scharfsinns, Ansehen genossen haben, und in
einer nicht vollstndig christianisierten Gesellschaf haben sie
mglicherweise auch Reste ihrer frheren religisen Bedeutung
bewahrt. Eligius von Noyon traf zum Beispiel in der Nhe seiner
Stadt auf Verwandte des neustrischen maior domus Erchinoald,
die Sommerfeste mit Spielen und Tnzen abhielten, die zumin-
dest er als heidnische Rituale betrachtete, jene hingegen als Teil
ihres seit unvordenklichen Zeiten berlieferten Brauchtums
bezeichneten. Mit der Konversion Chlodwigs wurde der Adel
jedoch rasch christlich, wenigstens insofern, als er Christus als
den mchtigsten der siegverleihenden Gtter anerkannte und
die Durchfhrung christlicher Rituale verlangte, um sein eigenes
Wohlbenden und das seiner Familien zu sichern.
Dennoch blieb dem frnkischen Adel vor dem letzten Viertel
des 6. Jahrhunderts der Weg zur unmittelbaren Mitwirkung an
dem sich ausbreitenden christlichen Kult weitgehend verschlos-
sen. Bischof zu werden, bedeutete die bernahme der kulturellen
und gesellschaflichen Traditionen der senatorischen Aristokratie
aus dem Sden; dazu fanden sich im 6. Jahrhundert frnkische
Familien nur vereinzelt bereit. Mnch zu werden, war fr einen
frnkischen Adligen ebenfalls unblich. Wie wir gesehen haben,
waren die Klster berwiegend Grndungen der Bischfe, die sie
222
unterhielten und streng kontrollierten. Zwar bot Lrins Adligen
eine Art mnchischer Existenz, aber auch dies war eine rmi-
sche kulturelle und religise Tradition, die vornehmlich adlige
Kleriker anzog, die sich bereits fr das Mnchsleben entschieden
hatten. Die Adligen im Norden hatten kaum Beziehungen zu
solchen Klstern, die tief in der gallormischen Kulturtradition
wurzelten und unter der strengen Aufsicht des aus der alten Elite
stammenden Bischofs standen. All dies begann sich zu ndern,
als eine Persnlichkeit in Erscheinung trat, die fr das Gallien
des 6. Jahrhunderts so auergewhnlich und fremdartig war,
wie es im 4. Jahrhundert der heilige Martin gewesen war der
irische Mnch Columban.
Columban
Die irische Gesellschaf und die Form des Christentums, die sie
hervorbrachte, unterschieden sich grundlegend von allen auf dem
Kontinent bekannten Formen. Von allen Regionen Westeuropas,
die die neue Religion frh und bereitwillig bernommen hatten,
war Irland als einzige nie Bestandteil des rmischen Imperiums
gewesen. Es blieb eine isolierte und archaische keltische Gesell-
schaf. In einem sehr technischen Sinne war diese Gesellschaf
insofern unzivilisiert, als die Stadt, das wichtigste Element der
antiken Gesellschafs- und Kulturorganisation, ihr vor den im 8.
Jahrhundert einsetzenden Einfllen der Wikinger vllig unbe-
kannt war. Darber hinaus war das Land extrem dezentralisiert;
es war in kleine Knigreiche oder Stmme aufgeteilt, die ihrer-
seits aus Familienverbnden bestanden, die als septs bezeichnet
wurden, dem quivalent des germanischen Wortes Sippe.
Umstritten ist, wann das Christentum erstmals bis Irland
vordrang, aber linguistische Erkenntnisse weisen darauf hin,
da bereits im spten 4. oder frhen 5. Jahrhundert einige Iren
Christen waren. Es gab jedoch weder Bischfe noch Bistmer,
223
bevor in der ersten Hlfe des 5. Jahrhunderts zunchst Bischof
Palladius und kurz danach Patrick auf die Insel kamen und eine
Kirchenorganisation nach dem Vorbild der gallischen Kirche,
die sie vom Festland kannten, aufzubauen begannen. Whrend
das von Patrick eingefhrte System zunchst im Norden ange-
nommen wurde, blieb in anderen Gegenden Irlands die ltere,
nichtepiskopale Form des kirchlichen Lebens erhalten, und nach
seinem Tod verschwand selbst in den Gegenden, wo er die gr-
ten Erfolge erzielt hatte, ein Groteil seiner Kirchenorganisation.
Da Irland weder Stdte noch Provinzen kannte, war es kaum
eine ideale Region fr den Ausbau einer episkopalen Kirche; im
6. Jahrhundert wurde die irische Kirche zu einer Konfderation
von Mnchsgemeinschafen, von denen jede einzelne in etwa
einer Sippe entsprach und unter der Jurisdiktion des Erben
des Grndungsheiligen der Region stand.
Diese Klster hatten viele Elemente der stlichen Mnchstra-
dition vermutlich auf dem Weg ber Lrins aufgenommen,
aber grundlegend abgewandelt und der irischen Kultur angepat.
Sie unterstanden dem unbeschrnkten Weisungsrecht des Abtes,
dessen Amt innerhalb der herrschenden sept erblich war. Wenn
Mitglieder klsterlicher Gemeinschafen neue Klster grndeten,
verblieben sie unter der Aufsicht des Abtes des Grndungsklo-
sters. Innerhalb der Klster gab es hug einen Bischof, aber er
besa nur liturgische und kultische und keine administrativen
Funktionen. Anders als die Klster des Kontinents, die Ge-
meinschafen von Mnnern oder Frauen beherbergten, die der
Welt zu entiehen wnschten, waren diese irischen Klster die
Zentren des christlichen Lebens und die wichtigsten religisen
Institutionen, auf die sich die religise Praxis der Laien konzen-
trierte und nach deren Vorbild sie ausgebt wurde. Sie waren
auch Zentren einer umfangreichen lateinischen Literatur und
Wissenschaf, wenn auch recht esoterischer Art, zum Teil weil
die lateinische Sprache vom irischen Alltagsleben gnzlich abge-
schieden war. Sie bildeten aber auch Zentren einer auerordent-
224
lich strengen asketischen Lebensweise; einige waren znobitisch
organisiert, andere bestanden aus Einsiedlerzellen.
Zu den besonderen Eigenheiten des irischen Mnchtums ge-
hrte die Vorliebe seiner Mnche, in die Ferne zu ziehen. Dabei
handelte es sich nicht um Pilgerfahrten im moderneren Sinne,
also nicht um eine Reise zu einem besonderen Schrein und zu-
rck, sondern um den Versuch, die Vorstellung vom christlichen
Dasein als einer Reise durch ein fremdes Land zwischen Geburt
und Tod auszuleben. So machten sich viele irische Mnche auf
den Weg, trennten sich von allem, was ihnen vertraut war, und
reisten allein oder mit Gleichgesinnten nach Schottland, Island
und auf den Kontinent nicht in der Absicht, zu missionieren,
sondern einfach, um als Mnche und Pilger in der Fremde zu
leben. Von allen Pilgern, die den Kontinent erreichten, war Co-
lumban, der um 590 von Schottland aus in Gallien eintraf, der
wichtigste.
Columban und seine Weggefhrten fanden Zugang zum Hof
des Knigs Guntram von Burgund, jenes Knigs, den Gregor von
Tours am meisten bewunderte. Guntram nahm sie freundlich
auf und erlaubte ihnen, sich in der Festungsruine von Annegray
in den Vogesen niederzulassen. Ihre auerordentlich strenge
Lebensweise zog viele Menschen an, und bald erhielt Columban
von Guntram eine weitere Ruine, in der er das Kloster Luxeuil
grndete. Kurz danach kam eine weitere Grndung in Fontaines
hinzu. Er blieb zwanzig Jahre lang in Burgund, aber mit der Zeit
fhrte die wachsende Popularitt seiner mnchischen Lebens-
weise und Observanz zu Spannungen mit den Bischfen. Einige
Vorwrfe richteten sich gegen die in seinen Gemeinschafen
praktizierten Riten, insbesondere dagegen, da Columbans
Mnche Ostern nach dem irischen und nicht nach dem konti-
nentalen Kalender feierten. Wichtiger war jedoch die Beziehung
zwischen seinen Klstern und dem Episkopat. Gallische Klster
unterstanden der strikten Aufsicht des Ortsbischofs. Columban
kontrollierte nach irischer Tradition seine Klster selbst und
225
lehnte jede Einunahme der burgundischen Bischfe ab. Er
beugte sich dem Anspruch der Bischfe nicht und appellierte
an Papst Gregor den Groen (590-604) in Rom, er mge ihm
die Weiterfhrung seiner keltischen Tradition gestatten, ein in
Gallien bislang unerhrter Vorgang. Gregor verstarb jedoch,
bevor der Appell ihn erreicht hatte.
Bevor diese Streitfrage entschieden werden konnte, geriet
Columban in Konikt mit Knigin Brunichild und deren Sohn
Teuderich, dessen Polygamie er oen zu verurteilen wagte.
Schlielich wurde er aus Burgund verjagt und begab sich an
den Hof Chilperichs in Neustrien. Hier wie im austrasischen
Knigreich des Teudebert wurde er sehr freundlich empfan-
gen. Er wanderte nach Alemannien, wo er mit polytheistischen
Elementen vermischte Reste christlicher Observanz vorfand und
sich eine Zeitlang in Bregenz am Bodensee aufielt. Schlielich
ging er jedoch ber die Alpen ins Langobardenreich, dessen K-
nig Agilulf ihn aufnahm und ihm in Bobbio zwischen Mailand
und Genua Land schenkte, wo er seine letzte Klostergrndung
ins Leben rief. Nach Chlothars Sieg ber Brunichild lud ihn der
Knig ein, nach Luxueil zurckzukehren, aber zu dieser Zeit war
er bereits zu alt, und so blieb Columban bis zu seinem Tod im
Jahre 65 in Bobbio.
Ein christlicher frnkischer Adel
Der Einu Columbans auf den frnkischen Adel kann kaum
berschtzt werden. Er verkrperte eine Form strengen und
furchtlosen Christentums, die weder Ausdruck gallormischer
Kultur noch von den Bischfen geschaen worden war. Dar-
ber hinaus wurde sie von einem Heiligen propagiert, der sich
nicht von der Welt abwandte, sondern enge Beziehungen zu den
mchtigen Familien des gesamten nrdlichen Frankenreiches
unterhielt. Diese Verbindungen waren besonders stark unter
226
dem Hofadel in Neustrien ausgeprgt und knnen in der Vita
des Columban nachgelesen werden, die Jonas, ein in Susa ge-
borener Mnch des Klosters Bobbio, unter dem unmittelbaren
Nachfolger des Grnders verfat hat. Und in der Tat schufen
Columban und seine monastische Tradition einen gemein-
samen Boden, auf dem sich die Netzwerke nordfrnkischer
Aristokraten zusammenschlieen konnten, die hier eine
ihrem gesellschaflichen und politischen Rang angemessene
religise Denkweise vorfanden.
Die Liste der von Columban beeinuten Adligen liest sich
wie ein Whos Who der frnkischen Aristokratie. So wurde Co-
lumban zum Beispiel in der Nhe des Marnetals von Agnerich
freundlich aufgenommen, der Teudebert nahegestanden hatte
und sich nach dessen Tod den Adligen anschlo, die Chlothar II.
untersttzten. Sein Sohn Burgundofaro wurde referendarius am
Hof Dagoberts und spter Bischof, seine Tochter Burgundofara
btissin. In derselben Region fand Columban auch Zugang zu
Autharius und seinen drei Shnen Audo, Audoenus (Dado) und
Rado, von denen Audo spter in Jouarre sein eigenes Kloster
grndete. Audoenus, der ein Kloster in Rebais errichtete, wurde
referendarius unter Dagobert und beendete sein Leben als Bischof
von Rouen. In Austrasien stand Columban in Verbindung mit den
Anhngern Chlothars II., insbesondere mit Romaricus, der spter
nach Luxeuil ging und dann das Kloster Remiremont grndete,
welches in den folgenden Jahrhunderten zu einem bedeutenden
Adelskloster wurde. Bertulf, ein Verwandter Arnulfs von Metz,
trat ins Kloster Luxeuil ein und folgte Columban spter nach
Bobbio, wo er schlielich Abt wurde. In Burgund unterhielt Co-
lumban sehr enge Beziehungen zur Familie des dux Waldelenus,
dessen Verwandtschaf im Sden bis in die Provence und im
Osten bis Susa verzweigt war. Zwei dieser Verwandten, Eustathius
und Waidebert, wurden spter bte von Luxeuil.
Allen diesen frnkischen Familien waren einige Merkmale
gemeinsam. Erstens hatten alle eines oder mehrere Mitglieder,
227
die von diesem neuen Mnchtum fasziniert waren und entweder
Luxeuil aufsuchten oder gar als Mnche dort eintraten. Zweitens
grndeten sie selbst auf Familienbesitz Klster. Diese Klster
folgten meistens der Regel, die Columban fr seine burgundi-
schen Klster verfat hatte; allerdings verschmolz diese im 7.
Jahrhundert mit der Benediktregel, die das frnkische Mnchtum
zu beeinussen begann, woraus sich die sogenannte irisch-frnki-
sche Mnchstradition entwickelte. Die neue Regel bewahrte einen
groen Teil der in der Regel Columbans enthaltenen Unabhn-
gigkeit, milderte aber die extremen Formen der irischen Askese.
Drittens bernahmen diese Klster eine neue gesellschafliche
Rolle. Sie bildeten nicht nur Zentren der Frmmigkeit, sondern
auch den geistlichen Mittelpunkt der begrenzten politischen
Einheiten, die von den Familien kontrolliert wurden; auf diese
Weise wurden sie ein fester Bestandteil des politischen und ge-
sellschaflichen Lebens der Grnderfamilien. Die Grnder und
ersten bte oder btissinnen dieser Klster wurden spter als
Heilige verehrt, und damit verband sich in ihnen die Adelsherr-
schaf mit einer auf sakraler Macht und Religiositt beruhenden
Familientradition.
Das aus der Zeit des heiligen Martin stammende Bild vom
rauhen, primitiven gallischen Mnchtum existierte nicht mehr.
Die vom frnkischen Adel gegrndeten Klster standen im
Einklang mit dessen vornehmem Status. Es waren groe Klster
mit reich geschmckten Kirchen, in denen adlige Mnner und
Frauen ihren gewohnten Lebensstil trotz aller Hingabe an Gott
beibehalten konnten. Einen Eindruck von diesem Reichtum
vermittelt das Testament der Burgundofara, der Tochter des Ag-
nerich, der Columban gefrdert hatte.
9
Sie war btissin eines auf
dem Grundbesitz ihres Vaters errichteten Klosters in der Nhe
von Meaux, das spter Faremoutiers genannt wurde, hatte aber
beim Eintritt ins Kloster ihren Besitz nicht aufgegeben. In ihrem
633 oder 634 verfaten Testament setzte sie ihre Grndung als
Haupterben ein. Zur Schenkung gehrte Grundbesitz, den sie
228
von ihrem Vater geerbt oder den sie gekauf hatte; dieser bestand
aus lndlichen villae, Weinbergen, Mhlen an der Marne und am
Aubetin sowie aus Husern und Grundbesitz in Meaux und in
der Umgebung der Stadt. Ihr Kloster war also keineswegs eine
lndliche Einsiedelei, sondern eine wohlhabende Institution, die
durch persnliche Beziehungen und Besitzverhltnisse mit der
Familie des Grnders verbunden war. Diese Bindungen brachen
auch beim Tod der Burgundofara nicht ab; das Kloster blieb unter
dem Einu der Familie, wurde zu deren Grabsttte und ihrem
geistlichen Zentrum.
Das beste Beispiel fr eine solche Familiengrabsttte ist die
Kirche Saint-Paul in Jouarre, die, wie oben schon erwhnt, von
Audo, einem Sohn des Columban nahestehenden Autharius,
gegrndet worden war. Hier benden sich unter anderem heute
noch die Grber des Audo, der Teodochilda, der ersten btissin
von Jouarre, und ihres Bruders Agilbert, der den ersten Teil sei-
ner Laufahn als Missionar in England verbracht hatte und zum
Bischof von Essex ernannt wurde, bevor er als Bischof von Paris
auf den Kontinent zurckkehrte. Auerdem birgt die Krypta
die Grber der Agilberta, einer Cousine der Teodochilda, der
aus Bayern stammenden Balda, der Tante der Agilberta und der
Teodochilda, sowie das Grab der Moda, die Baldas Cousine
und Ehefrau des Autharius war. Da alle diese Personen spter
als Heilige verehrt wurden, wurde die Familiengrabsttte auch
zum Zentrum der geistlichen Macht und des Ansehens aller
Familienangehrigen.
Der zur selben Zeit zu beobachtende Wandel der frnkischen
Bestattungssitten steht vermutlich mit dem Bau solcher Famili-
engrabsttten in Zusammenhang. Seit dem 4. Jahrhundert waren
frnkische Grber normalerweise in lndlichen Friedhfen wie
Lavoye angelegt worden, wo die Toten vollstndig bekleidet und
mit Waen, Gertschafen und Schmuck beigesetzt wurden. Daran
hatte die Christianisierung nichts gendert. Solche Grber waren
kein Ausdruck religisen Glaubens, sondern gesellschaflicher und
229
kultureller Kontinuitt, der Verbundenheit mit den Vorfahren, die
ebenfalls auf diese Weise beigesetzt worden waren.
Von der zweiten Hlfe des 6. Jahrhunderts an wurden diese
Bestattungsformen jedoch allmhlich von Begrbnissen in oder
um Kirchen abgelst. Dies war lange Zeit eine gallormische
Tradition gewesen, und bereits die knigliche Familie Chlodwigs
hatte sich fr eine Beisetzung innerhalb der Kirche entschieden.
Allmhlich wurde dies zur Regel, und die Familien suchten nach
Grablegen in der Nhe von Heiligengrbern. Wenn eine Familie
ihr eigenes Kloster besa und wie die Nachkommen des Authari-
us ihre eigenen Heiligen hervorbrachte, um so besser. In anderen
Fllen suchte man nicht nach einer neuen Begrbnissttte, son-
dern baute eine Grabkapelle auf dem alten Reihengrberfeld. In
Mazerny in den Ardennen sind die Grber des 6. Jahrhunderts
zum Beispiel in traditioneller Form, parallel und in Nord-Sd-
Richtung, angeordnet. Eine Grbergruppe aus dem 7. Jahrhundert
bildet jedoch ein Rechteck und scheint auf den ersten Blick die
Ordnung zu stren, da vierzehn Grber in Ost-West-Richtung
liegen. Der Archologe Bailey Young hat vermutet, da diese
Grber ursprnglich innerhalb einer Holzkapelle lagen und
eine um die Grber eines Mannes und einer Frau angeordnete
Familiengrabsttte bildeten. Die reichen Beigaben dieser beiden
Grber lassen auf einen hohen Sozialstatus der Toten schlieen;
es handelt sich vielleicht um die Erbauer der Kapelle, die bis zur
vollstndigen Aufgabe des Friedhofs vermutlich gegen Ende des
8. Jahrhunderts als ihre Familiengrabsttte diente.
0
In anderen Fllen, etwa im rheinischen Flonheim und in Arlon
in der belgischen Provinz von Luxemburg, wurden oensichtlich
Kapellen ber Grbern von Menschen errichtet, die im frhen
6. oder sogar schon im spten 5. Jahrhundert verstorben waren.
In diesen Fllen waren die Nachkommen oensichtlich bemht,
ihre Vorfahren, die teilweise vermutlich noch Heiden waren, an
den Wohltaten der neuen Tendenz zur Heiligung der Adelsfamilie
teilhaben zu lassen.
230
In engem Zusammenhang mit der Entwicklung von adligen
Eigenklstern wie denen der Familie des Autharius, die nicht
dem Bischof, sondern der Grnderfamilie unterstanden, fllte
sich der Begri Heiligkeit mit neuen Inhalten, die das Selbst-
verstndnis des Adels vernderten. Im vierten Kapitel haben
wir das vom gallormischen Episkopat ausgeformte Modell
der Heiligkeit kennengelernt. Heilige waren entweder Mnner
senatorischer Abstammung, die das aktive Leben eines Bischofs
fhrten, oder heilige Mnner und Frauen, die der Welt entsagten,
um Mnche oder Einsiedler zu werden, sich von der Welt voll-
stndig abwandten, aber unter der strikten Aufsicht und Leitung
des Bischofs verblieben. Im 7. Jahrhundert taucht zunehmend ein
neuer Heiligentypus auf der Adlige, der am Knigshof diente,
bevor er auszog, um ein Kloster zu grnden, einen Bischofssitz
zu verwalten oder Missionsreisen zu unternehmen, aber seine
engen Bindungen an die Welt nie aufgab. Dies waren keineswegs
Mnner und Frauen, die vor den beln ihrer Zeit ohen, son-
dern sie pegten meistens gute Beziehungen zu den Knigen
und anderen Adligen. Sie beteiligten sich sogar nach dem Klo-
stereintritt weiterhin an der weltlichen Politik. Die Hagiographen,
die ihre Viten verfaten, legen Wert darauf, sie in diesem Lichte
darzustellen, und erinnern an Matthus 22,2: Gebt dem Kaiser,
was des Kaisers und Gott, was Gottes ist.
In der Hagiographie
des 7. Jahrhunderts wurde der Anteil des Kaisers nicht vergessen;
selten wurden Heilige mit so guten Beziehungen zu den Knigen
beschrieben, was besonders bemerkenswert scheint, wenn man
sich an die Vorwrfe erinnert, die gegen Dagobert wegen der
an seinem Hof herrschenden Unmoral erhoben worden waren.
Audos Bruder, der heilige Audoenus von Rouen, war zum Bei-
spiel ein Heiliger in kniglichen Diensten, den Dagobert, wie
uns berichtet wird, mehr liebte als alle anderen Hinge. Der
heilige Wandregisel war ein Adliger aus Austrasien, der in der
kniglichen Verwaltung diente und selbst dann noch zu Pferd,
das heit in der klassischen Fortbewegungsart des Adels, an den
231
Hof kam, als er bereits die Tonsur erhalten hatte. Der berhmteste
unter diesen neuen Heiligen war Arnulf von Metz, ein vertrauter
Ratgeber und Beaufragter des Knigs und gleichzeitig eine der
fhrenden Persnlichkeiten des austrasischen Aristokratie.
Natrlich hatten auch viele der frheren senatorischen Bischfe
wichtige weltliche mter ausgebt; wir haben gesehen, da das
Bischofsamt die Krnung des sptantiken cursus honorum dar-
stellte. Doch gehen die Hagiographen des 5. und 6. Jahrhunderts
rasch und fast entschuldigend ber diese weltlichen Karrieren
hinweg. Der entscheidende Bruch zwischen dem frheren welt-
lichen Leben und der kirchlichen Laufahn wird betont, und in
einigen Fllen sogar der Eindruck erweckt, als ob die Heiligen
nach ihrer Konversion weltliche mter nur symbolisch ausgebt
htten. Sulpicius Severus stellte Martin von Tours so dar, als ob
er bereits vor der Entlassung aus der rmischen Armee dem
Waenhandwerk entsagt htte. Die Heiligenviten des 7. Jahr-
hunderts hingegen gehen detailliert auf das Leben ihrer Helden
vor der Konversion ein; sie beschreiben ihre Familien, die ausge-
zeichneten Heiratsverbindungen, die sie eingegangen waren, ihre
Ttigkeit am Hof, ihre Macht und das Ansehen, das sie genossen.
Im Gegensatz zu Sulpicius, der Martin als friedliebenden Solda-
tenmnch beschreibt, preist der Verfasser der Vita des Arnulf von
Metz dessen auerordentliche Geschicklichkeit im Umgang mit
Waen. Die merowingische Hagiographie schreckte nur davor
zurck, Heilige zu beschreiben, die nach ihrer Konversion dem
Herrn weiterhin als Krieger dienten. Der Heilige des 7. Jahrhun-
derts verlie seine Familie oder seine Gesellschafsschicht nie.
Seine Heiligkeit strahlte vielmehr auf die Familie zurck und
verklrte die gesamte Verwandtschaf; damit wurde die Familie
und ihr gesellschafliches Umfeld geheiligt.
Dieser Wandel in der Darstellung ist mehr als eine Vernde-
rung der literarischen Tradition. Die Hagiographie diente im
wesentlichen als eine Form der Propaganda; die Berichte ber
adlige Heilige waren Teile eines Programms, das am Hof und
232
zunehmend in den Machtzentren des nordfrnkischen Adels
entwickelt wurde, um die Bildung einer selbstbewuten christ-
lichen frnkischen Elite durch eine eigene kulturelle Tradition,
die sich von Neustrien aus im ganzen Frankenreich verbreitete,
zu feiern, zu legitimieren und voranzutreiben.
Da der neue Heiligentypus und das irisch-frnkische Mnch-
tum, mit dem er identiziert wurde, den Bedrfnissen der Elite
entgegenkamen, bedeutet nicht, da es sich dabei lediglich um
einen politischen Schachzug des Adels handelte. Diese neue poli-
tische Form der Heiligkeit hat die Christianisierung des Franken-
reiches vermutlich strker gefrdert als die ltere gallormische
Tradition. Das Christentum war lange Zeit ein stdtisches Ph-
nomen geblieben, und selbst in den am strksten romanisierten
Teilen Westeuropas war es nur ganz sporadisch in lndliche
Gebiete vorgedrungen. Die verstrkte kirchliche Bettigung des
frnkischen Adels und das Wirken irischer Wandermnche wie
Columban fhrten dazu, da die christliche Lehre und der christ-
liche Kult in lndlichen Regionen Wurzeln schlugen. Religiser
Kult und politische Macht wurden als unausliche Einheit be-
trachtet, ob auf der Reichsebene eines Knigs Dagobert oder auf
der lokalen Ebene des frnkischen Adels, der in seinem Macht-
bereich einen einheitlichen Kult durchzusetzen versuchte. Es lag
daher im Interesse des Adels, die Ausbreitung des Christentums
zu untersttzen. So hat zum Beispiel die Familie des Gundoin, der
in der ersten Hlfe des 7. Jahrhunderts dux im Elsa war, dort,
aber auch im nrdlichen Burgund Klster gegrndet und die
Verehrung der heiligen Odilia eingefhrt. Natrlich war es kein
Zufall, da Odilia aus dieser Familie stammte, ebensowenig aber
auch, da die Familie enge Kontakte zu Columban unterhielt. In
hnlicher Weise betrieb die Familie des thringischen Herzogs
Rodulf die Christianisierung von ihren Residenzen in Erfurt
und Wrzburg aus. Fr solche Adlige waren Kult und Herrschaf
nicht voneinander zu trennen.
Einige der wichtigsten Missionsunternehmen leiteten in en-
233
ger Zusammenarbeit mit Dagobert knigliche Bischfe, die am
Hof von Neustrien ausgebildet worden waren. Der Aquitanier
Amandus grndete mit Untersttzung des Knigs Klster in
Flandern, vor allem in Elnone, dem spteren Saint-Amand, in
Gent und Antwerpen. Von Noyon aus betrieben Acharius und
seine Nachfolger Eligius und Mummolinus die Missionierung
ebenso eifrig voran wie Audomar von Terouanne aus. Alle diese
Unternehmungen wurden ausnahmslos vom Knig vor allem
durch Schenkungen riesiger Teile von Fiskalland gefrdert.
Diese Aktivitten waren ein Versuch, das Christentum und
den frnkischen Einu im Norden durchzusetzen, und zwar
besonders in Friesland, das unter Chlothar II., Dagobert und
ihren unmittelbaren Nachfolgern wegen seiner herausragenden
Rolle fr den Handel sowie Lage an den Handelsrouten zwischen
Paris, London, Kln und den Gebieten zwischen Scheide und
Weser zunehmend an Bedeutung fr das Frankenreich gewann.
Die enge Verbindung zwischen der Expansion des Christentums
und der Beteiligung des Knigs an diesem Handel erkennt man
am Bau einer Kirche in Utrecht.
2
Um 600 stieg die Bedeutung
der Rheinmndung fr den Handel mit Kln; um diese Zeit von
den Friesen geprgte Goldmnzen, die merowingische Mnzen
nachahmten, wurden in Sdwestengland, an der Westkste von
Jtland von der Elbemndung bis Limford und rheinaufwrts
bis Koblenz und sogar bis zum Bodensee gefunden. Um 630 war
Dorestad sdlich von Utrecht zum Zentrum des friesischen Han-
dels aufgestiegen. Zu dieser Zeit grndete Dagobert die Kirche
von Utrecht und unterstellte sie Bischof Kunibert von Kln, dem
er die Festung von Utrecht mit der Auage schenkte, die Friesen
zu missionieren. Gleichzeitig sandte er die beiden Mnzmeister
Madelinus und Rimoaldus von Maastricht nach Dorestad,
damit sie den zunehmenden Handelsaustausch dieser Region
regulierten und daraus Gewinne erwirtschafeten. Die Christia-
nisierung der Region war also eng mit der Kontrolle ihrer wirt-
schaflichen Aktivitten verbunden.
234
Die Auswirkungen der irisch-frnkischen religisen Bewegung
beschrnkten sich aber nicht auf den Knig, den Hof von Neustri-
en und den nordfrnkischen Adel. Auch Mnner aus dem Sden
wie Desiderius von Cahors waren tief davon beeindruckt, und als
die Verschmelzung der Adelstraditionen weiter fortgeschritten
war, dehnte sich die Bewegung ebenso nach Sden und Osten
wie nach Norden aus. Zwar hatten schon einzelne gallormische
Bischfe ihre Verpichtung zur Christianisierung der Landbe-
vlkerung sehr ernstgenommen; aber erst in der ersten Hlfe
des 7. Jahrhunderts erfolgte im Norden wie sdlich der Loire
und stlich des Rheins der erste ernsthafe, gut vorbereitete und
systematische Versuch, das Christentum nicht nur in den Eliten,
sondern in der gesamten Bevlkerung zu verbreiten. Zum ersten-
mal in der europischen Geschichte kehrte sich die Richtung,
in der religise Impulse verliefen, um. Nachdem Jahrhunderte
hindurch mediterrane Formen des Christentums nach Norden
vorgedrungen waren, eroberte und vernderte vom Norden aus
eine neue, vitale Form des Christentums, die eng mit den knig-
lichen und adligen Interessen und Machtgrundlagen verbunden
war, allmhlich den romanisierten Sden.
235
VI. Der Niedergang der Merowinger
Dagoberts Nachfolger
Von Chlon aus, wo er sein Werk der Gerechtigkeit fortgesetzt
hatte, reiste er ber Autun nach Auxerre und dann weiter ber
Sens nach Paris; dort lie er auf den Rat der Franken hin Knigin
Gomatrudis in der Villa von Reuille zurck, weil sie unfrucht-
bar war, und heiratete Nanthild, eine auergewhnlich schne
Jungfrau, und machte sie zu seiner Knigin.
Diese Beschreibung von Dagoberts zweiter Ehe in den lange
nach den Ereignissen niedergeschriebenen Gesta Dagoberti
zeigt, wie sptere Generationen Dagoberts Beschlu beurteilten,
Knigin Gomatrudis zu verlassen. Fredegar, der Gewhrsmann
der Gesta, nennt keine Grnde fr die Trennung und erwhnt
lediglich, da in Reuille die Hochzeit mit Gomatrudis stattgefun-
den hatte; er verliert auch kein Wort ber Nanthilds Schnheit,
sondern weist lediglich darauf hin, da sie vor ihrer Hochzeit
eine einfache Dienstmagd gewesen sei.
2
Wie wir gesehen haben,
hielten es die Merowinger in der Regel nicht fr notwendig, sich
von einer Frau zu trennen, wenn sie eine andere heirateten. Doch
mag Dagobert in diesem Falle mehrere Grnde gehabt haben:
Gomatrudis war die Schwester seiner Stiefmutter Sichildis; er
hatte sie auf Anordnung seines Vaters geehelicht. Sie war daher
vermutlich die Tante seines Stiefruders Charibert und Schwester
des Brodulf, den er gerade hatte hinrichten lassen, weil dieser
zugunsten von Charibert gegen ihn konspiriert hatte. Eine Schei-
dung von seiner Frau war der logische Schritt, um sich endgltig
vom Einu dieser Familie zu befreien, deren Verbindung mit
der Knigsfamilie sein Vater arrangiert hatte.
Dennoch ist auch die sptere Version, die den Scheidungsgrund
236
in der Unfruchtbarkeit der Frau sieht, verstndlich. 629 mu
Dagobert verzweifelt auf einen Erben gewartet haben, und wenn
nicht er, dann bestimmt die Franken, das heit der Adel. Seit
Bestehen der Dynastie hatte das Fehlen eines erwachsenen Erben
immer Unruhe mit sich gebracht ein langes Interregnum mit
hefigen Auseinandersetzungen um den Einu auf den knf-
tigen Knig oder die Knige, eine Gelegenheit, die Macht der
Adelsparteien zu steigern und die von Dagobert ersehnte stabi-
litas zu zerstren. Er hatte aus der von seinem Vater erreichten
Konsolidierung Nutzen ziehen knnen, weil er sechs Jahre vor
dessen Tod an der Herrschaf beteiligt wurde. Eine gemeinsa-
me Herrschaf war eines der sichersten Mittel, die dynastische
Kontinuitt zu wahren. So stand er 629 unter dem Druck, vor
sich selbst und dem Adel gegenber, einen oder mehrere Erben
zu zeugen. Zwar wrden die Adligen keinen Autokraten dulden,
aber ein schwacher Knig nutzte niemandem. Zeiten schwacher
Zentralgewalt bedeuteten normalerweise Unruhen, das Aueben
alter Fehden und gewaltttiger Auseinandersetzungen zwischen
den Groen des Reiches. Ein starkes Knigreich bentigte einen
starken Knig und Dagobert daher einen Sohn. Die zweite Heirat
war aber nicht der einzige Versuch, einen Erben zu bekommen.
Im folgenden Jahr gebar ihm Ragentrudis, eine Frau aus Aus-
trasien, seinen ersten Sohn, Sigibert III. Um 633 schenkte ihm
Nanthild einen zweiten Sohn, Chlodwig II.
Aber es war zu spt. Dagobert starb 639, und seine Shne waren
noch zu jung, um jene Kontinuitt zu sichern, die zur Aufrechter-
haltung der von ihrem Vater und ihrem Grovater geschaenen
Tradition notwendig war. Und diese Situation blieb fast das ganze
folgende Jahrhundert hindurch unverndert. Sigibert III. starb
jung und hinterlie mit Dagobert II. einen minderjhrigen Sohn,
der die Tonsur erhielt, in ein irisches Kloster verbannt wurde und
erst zwanzig Jahre spter zurckkehrte. Chlodwig II. regierte nach
einem zweijhrigen Interregnum und einer langen Zeit der Min-
derjhrigkeit bis 657 und hinterlie bei seinem Tod wiederum
237
minderjhrige Shne, Childerich II. in Austrasien, Chlothar III.
in Neustrien und Teuderich III., der 673 die Nachfolge seines
Bruders Chlothar antrat. So gelang es der Merowingerfamilie fast
vierzig Jahre lang nicht, auch nur annhernd eine funktionieren-
de Zentralverwaltung des Reiches sicherzustellen.
Doch waren nicht alle diese Merowinger solche rois fainants,
Nichtstuer oder Taugenichtse, wie der Volksmund sie spter
nannte. Childerich II. versuchte zum Beispiel, seinen kniglichen
Herrschafsanspruch durchzusetzen und die Verwaltung seines
Reiches zu leiten; er wurde deshalb ermordet. Auch sein Bruder
Teuderich begngte sich nicht damit, nur sein Teilreich zu re-
gieren, sondern vereinigte nach dem Tod des maior domus Ebroin
das Knigreich und brachte es tatschlich fertig, eine kurze Zeit
zu herrschen, wurde dann aber in der Schlacht von Tertry 687
von Pippin II. geschlagen und bis zu seinem Tod 690 oder 69
unter strenger Aufsicht gehalten. Bei seinem Tod wiederholte sich
das Unheil; er hinterlie mit Chlodwig IV. einen minderjhrigen
Sohn. So standen die merowingischen Knige von 69 an unter
der Kontrolle der verschiedenen Adelsgruppierungen, die nun
die Hauptakteure im Kampf um die politische Vorherrschaf
geworden waren. Die Angehrigen der kniglichen Familie wa-
ren ntzliche Symbolguren, um die sich die Parteien scharen
konnten, spielten aber keine selbstndige Rolle. Sogar die genauen
familiren Verbindungen zwischen den Merowingern sind un-
klar. Die Zeitgenossen hielten es nicht einmal fr notwendig,
die genaue Verwandtschafsbeziehung zwischen dem letzten
Merowingerknig Childerich III. (743-75) und den berhmteren
Nachkommen Chlodwigs festzuhalten.
So trugen die zahlreichen Perioden der Minderjhrigkeit mehr
als alles andere zum Zerfall der kniglichen Macht bei. Dieser
Umstand und nicht ein angeblich erblicher Degenerationspro-
ze fhrte zum Untergang der Dynastie. Dennoch kann man
auch damit das Geschehen nicht vollstndig erklren. Andere
Knigsfamilien berlebten vergleichbare Phasen und errangen
238
dann wieder die Herrschaf. Der Machtverlust der Merowinger
war Teil einer komplexeren Vernderung der frnkischen Welt
im 7. und 8. Jahrhundert. Zwar erwuchsen diese Vernderungen
aus den politischen, gesellschaflichen, wirtschaflichen und
religisen Traditionen, die bereits unter Chlothar II. und Dag-
obert Gestalt angenommen hatten, aber sie muten keineswegs
unausweichlich zum Zerfall des merowingischen Knigtums
fhren; erst zusammen mit den langen Zeiten der Minderjh-
rigkeit erwiesen sie sich als fatal.
In Neustrien-Burgund und in Austrasien kmpfen adlige
Gruppierungen um die Kontrolle des Fiskus und der Klster und
um das Amt des maior domus. In den Randgebieten Friesland,
Tringen, Alemannien, Bayern, Provence und Aquitanien mach-
ten sich die Herzge zu Herren autonomer Frstentmer.
In diesem Kampf ging das Gleichgewicht zwischen Reform-
mnchtum und Knigsdienst verloren, und der frnkische Epi-
skopat nahm strker denn je die Merkmale weltlicher Herrschaf
an, weil Bischfe sich nicht mehr nur um die Verwaltung ihrer
civitas kmmerten und dem Knig als Ratgeber dienten, sondern
unmittelbar in die Auseinandersetzungen um die Kontrolle ber
die frnkischen Reichsteile verwickelt wurden. Gleichzeitig erlitt
die vom gallormischen Adel ererbte Erziehungstradition der
Kirche irreparable Schden. Der in der Mitte des 8. Jahrhunderts
so deutlich zu Tage tretende Niedergang der Literatur im Fran-
kenreich war vermutlich weniger als ein Jahrhundert alt.
Der Verlust von Friesland und damit des Nordseehafens Dore-
stad sowie zeitweilige Wirren in der Provence, die die Mittelmeer-
hfen Fos und Marseille in Mitleidenschaf zogen, beeintrchtigten
die Fernhandelsverbindungen des Knigreichs an beiden Enden.
Durch die inneren Unruhen wurde auch die regelmige Plnde-
rung der Nachbarknigreiche beendet und damit der Nachschub
an Beute und Tributen unterbrochen, der die Hauptquelle des
Mnzgeldes fr diesen Handel gewesen war. Anstelle der Gold-
mnzen, die zur Selbstdarstellung und fr den Fernhandel benutzt
239
wurden, tauchten jetzt lokale Silbermnzen auf, die zwar von leb-
hafen regionalen Handelsverbindungen zeugen, aber vermutlich
auf den Niedergang des Fernhandels hinweisen.
Und dennoch erfolgten zu dieser Zeit eine umfangreiche
Missionierung, die Konsolidierung des irisch-frnkischen
Mnchtums, die fortschreitende Verbreitung der Benediktregel
in weiten Teilen des Frankenreiches und die Ausbildung derje-
nigen geographischen Einheiten, die sich langfristig als stabiler
erwiesen als das Frankenreich. Jede dieser Vernderungen ms-
sen wir betrachten.
Neustrien-Burgund
Obwohl der austrasische Adel gehof hatte, Dagobert werde
seinem ltesten Sohn Sigibert ein geeintes Knigreich berge-
ben, bestimmte dieser vier Jahre vor seinem Tod, da Sigibert
nur Austrasien, der jngere Chlodwig II. dagegen Neustrien
und Burgund erben sollte. Zustzlich erhielt Sigibert ein Drittel
des kniglichen Besitzes, die Stdte Poitiers, Clermont, Rodez,
Cahors in Aquitanien, Marseille in der Provence und andere
Stdte sdlich der Loire. Die anderen beiden Drittel des knigli-
chen Besitzes wurden gleichmig zwischen Dagoberts Witwe
Nanthild und Chlodwig aufgeteilt, der beim Tod seines Vaters
etwa vier Jahre alt war.
Dagobert hatte Aega, ein fhrendes Mitglied des neustrischen
Adels und einen treuen Anhnger des Knigshauses, zum maior
domus und Regenten ernannt (639-64). Zusammen mit Nanthild
leitete dieser sowohl den Hof als auch das Reich. Als Aega starb,
folgte ihm Erchinoald (64-658), ein weiterer Hochadliger aus
Neustrien, der mit Dagoberts Mutter Haldetrud verwandt war.
Seine Besitzungen lagen an der unteren Seine in der Gegend von
Jumiges und Saint-Wandrille sowie in der Gegend von Noyon
und Saint-Quentin, an der Marne und der Somme.
240
Erchinoald scheint zu einer groen und mchtigen Adelsfami-
lie gehrt zu haben, die im 7. Jahrhundert lange Zeit versuchte,
Neustrien zu beherrschen. Die Art, wie er und seine Familie an
der Festigung und Ausdehnung ihrer politischen und gesell-
schaflichen Stellung arbeiteten, veranschaulicht den Wand-
lungsproze des neustrischen Adels in den auf Dagoberts Tod
folgenden Generationen. Dann entschied der frnkische Adel
nach Erchinoalds Tod durch Wahl, wer maior domus werden
sollte, und er whlte 658 Ebroin; zum erstenmal wurde das Amt
vom Adel und nicht vom Knig oder Regenten allein besetzt.
Indizien weisen darauf hin, da die spteren Hausmeier Waratto
(680-686), dessen Sohn Ghislemarus (680) und Schwiegersohn
Bercharius (686-688) mit Erchinoald verwandt waren. Nach-
dem Pippin II. Bercharius 687 bei Tertry besiegt hatte und ihn
vermutlich ein Jahr spter hinrichten lie, verheiratete er seinen
eigenen Sohn Drogo mit Anstrudis, der Witwe des Bercharius
und Tochter des Waratto. Das Netz der Verwandtschafsbezie-
hungen und das von dieser Familie im Laufe des 7. Jahrhunderts
angehufe Vermgen waren so umfangreich geworden, da es
den Pippiniden an der Zeit schien, beides zu bernehmen.
Erchinoald pegte enge Beziehungen zum irisch-frnkischen
Mnchtum. Ursprnglich nahm er Wandermnche wie den
Abt Furseus auf, der um 64 nach Neustrien kam, nachdem er
in Irland und Ostengland Klster gegrndet hatte. Erchinoald
half Furseus bei Klostergrndungen in Lagny und auf seinem
eigenen Besitz in Peronne. Er schenkte ihm auch die Lnderei-
en des Wandregisel, auf denen Furseus das Kloster Fontenelle
grndete.
Die Untersttzung des Mnchtums war Teil der Strategie, mit
welcher Erchinoald die Stellung seiner Familie festigte, die vom
Knigshof immer unabhngiger wurde. Vor allem aber machte
er Furseus zum Mittelpunkt seines Familienkultes. Er bat den
irischen Abt, Pate seines Sohnes zu werden, und lud ihn deshalb
nach Peronne ein. So verband eine spirituelle Verwandtschaf
241
Furseus und die Nachkommen des Erchinoald. Zwar stamm-
ten die dem Furseus in Peronne fr das Kloster berlassenen
Gter aus dem kniglichen Fiskus, aber nach den nahezu zeit-
genssischen Virtutes Sancti Fursei schrieb Erchinoald den Besitz
nicht der Freigebigkeit des Knigs, sondern der Gnade Gottes zu,
nachdem der Heilige den Ort erwhlt hatte: Ich danke Gott, der
mir diesen Besitz verlieh, den du zu deinem Wohnsitz erwhlt
hast.
3
Die Grndung von Peronne und die Anwesenheit des
Heiligen sollten eindeutig Erchinoald zugute gehalten werden,
und beides beanspruchte er als sein Eigentum. Als Furseus in
Mezerolles, einem kleinen Kloster an der Somme, das er auf dem
Besitz des Herzogs Haimo gegrndet hatte, starb, erschien der
maior domus und forderte: Gebt mir meinen Mnch. Nach
dem Bericht der Virtutes el die Entscheidung durch eine Art
Gottesurteil. Zwei wilde Bullen wurden vor einen Karren ge-
spannt, auf dem der Leichnam des Heiligen ruhte, und durfen
ziehen, wohin Gott es bestimmte. Die Bullen zogen stracks nach
Peronne, wo Furseus beigesetzt wurde.
Die Sorgfalt, mit der Erchinoald seine Beziehungen zu Furseus
sowohl zu dessen Lebzeiten als auch nach dessen Tod pegte,
besagt nicht, da er die irische Mnchstradition bedingungslos
untersttzte. Nach dem Tod des Furseus vertrieb er die irischen
Mnche aus Peronne und ersetzte sie vermutlich durch Franken.
Gefhrlich wurde fr die Zukunf der Familie des Erchinoald,
da die Mnche bei Iduberga, der Frau Pippins I., Zuucht fan-
den und damit bei einer Angehrigen der hchsten Kreise des
austrasischen Adels.
Nanthild und Erchinoald besaen in Burgund, wo seit Chlo-
thar II. kein kniglicher maior domus mehr regiert hatte, wenig
Einu. 642 reiste Nanthild nach Orleans im Knigreich Burgund
und zog dort die Regierung an sich. Sie wollte ihren Einu in
der Region strken und berzeugte tatschlich einen Teil des
Adels so weit, da er Flaochad zum maior domus whlte, einen
Mann mit engen Verbindungen nach Neustrien und insbeson-
242
dere zu Nanthild, deren Nichte er heiratete. Erchinoald erblickte
darin oensichtlich eine Gelegenheit, auerhalb Neustriens
Untersttzung fr seine eigene Position zu nden; denn er traf
mit Flaochad eine Vereinbarung, in der beide versprachen, sich
gegenseitig in ihren mtern zu untersttzen. Obwohl Flaochad
den Groen und Bischfen des Reiches Treue geschworen hatte,
stie er bald auf eine umfangreiche Adelsopposition unter der
Fhrung des burgundischen patricius Willebad. Fnfzehn Jahre
zuvor war dieser einer der drei Getreuen Dagoberts gewesen, die
fr den Tod des Brodulf verantwortlich waren. Zunchst waren
Flaochad und Willebad oensichtlich Verbndete, Flaochads
neues Amt hatte aus ihnen jedoch persnliche Feinde gemacht.
Die Grnde fr die von Willebad angefhrte Opposition ver-
mitteln umfangreiche Einsichten in das burgundische Knigreich
in der Mitte des 7. Jahrhunderts. Man hat sie bereits mit der
Feindschaf der Burgundormer gegen den Franken Flaochad,
als Versuch, die lokale Autonomie zu erhalten, und sogar als
Privatfehde zwischen dem patricius und dem maior domus zu
erklren versucht. Die Grnde waren jedoch recht vielfltig. Seit
der Zeit des letzten maior domus hatte Willebad zu den jenigen
Burgundern gehrt, die am strksten von der relativen Vernach-
lssigung der Region durch die Zentralgewalt protiert hatten.
Durch seine Herrschaf ber die Gebiete von Lyon, Vienne und
Valence war er auerordentlich reich und mchtig geworden.
Auch andere hatten davon protiert, besonders um Chlon, das
alte Zentrum des Burgunderreiches, und die Ernennung eines
maior domus mit engen Bindungen zum frnkischen Neustrien
bedeutete oenbar eine Bedrohung dieser Unabhngigkeit.
Doch war Willebad keineswegs der Anfhrer eines geeinten
Burgund. Andere burgundische Adlige, einschlielich des dux
Chramnelenus von Besanon und des dux Wandalbertus von
Chambly, die beide aus der Familie des Waldelenus stammten,
der Columban untersttzte, sowie des dux Amalgar von Dijon,
untersttzten Flaochad. Der Grund lag vielleicht nicht so sehr
243
darin, da sie als Rmer und Franken gegen die einheimischen
Burgunder einen Entscheidungskampf um die Autonomie fhr-
ten, als darin, da sie die anderen groen Familien Burgunds
reprsentierten, die lange Zeit mit Willebad rivalisiert und
vielleicht sogar mit seiner Familie in der Vergangenheit Fehden
gefhrt hatten. Ein von Neustrien untersttzter maior domus
verschafe ihnen in ihrem Kampf gegen Willebad einen starken
auswrtigen Verbndeten; die Auseinandersetzung endete in
einer blutigen Schlacht bei Autun, an der nur die Hauptgegner
und ihre engsten Verbndeten beteiligt waren. Fredegar berichtet,
da die brigen Krieger aus Neustrien und Burgund einfach nur
zuschauten, ein Beweis dafr, da zumindest bis zu diesem Zeit-
punkt der Kampf kein ethnischer oder nationaler Widerstandsakt
oder oener Aufruhr war, sondern eher eine private Fehde.
4
Es
handelte sich also sowohl um einen inneren Konikt zwischen
den wichtigsten Familien Burgunds als auch um einen ueren,
wobei burgundische Adlige sich der neustrischen Oberhoheit
widersetzten.
Die langfristigen Ergebnisse der Bemhungen, in der Region
das Amt des maior domus wieder einzufhren und die neu-
strische Oberhoheit zu festigen, waren drfig. Zwar wurden
Willebad und seine engsten Parteignger gettet, aber Flaochad
konnte seinen Sieg nicht auskosten; elf Tage nach der Schlacht
starb er am Fieber. Nanthild, die das ganze Projekt in Gang gesetzt
hatte, war bereits einige Monate vor der letzten Konfrontation
gestorben. Das Amt des maior domus blieb unter einem gewissen
Radobertus oensichtlich bestehen, bis die beiden Knigreiche
662 endgltig unter dem neustrischen maior domus Ebroin
vereint wurden. Der wahre Sieger der Auseinandersetzung war
vermutlich die Familie des Waldelenus. Sie dehnte ihren Einu
in den nchsten Jahrzehnten sdlich von Besanon nach Sd-
burgund und bis in die Provence aus.
Zustzlich zu dem Status, den Erchinoald aufgrund seiner
Verwandtschaf mit der Gromutter Chlodwigs II. innehatte, zu
244
seinem Amt als maior domus, zu seinem ererbten oder vom Fis-
kus erworbenen Wohlstand und zu seinem spirituellen Prestige
als Besitzer einer erlesenen Sammlung von irischen Mnchen
verfgte er ber eine weitere Sttze seiner Macht: Er hatte dem
jungen Knig Chlodwig eine Frau aus den Reihen seiner eigenen
Sklavinnen zugefhrt. Balthild war als angelschsische Sklavin
ins Frankenreich gekommen, wo Erchinoald sie gekauf hatte
und nach dem Bericht seines Biographen von ihrer Schnheit,
Intelligenz und ihrem starken Charakter so fasziniert war, da
er sie zu seiner Frau oder seiner Konkubine machen wollte.
Statt dessen wurde sie zur Frau seines Knigs.
Frauen niederer Herkunf zu heiraten, war, wie wir gesehen
haben, bei den merowingischen Knigen seit Charibert I. (56-
567) blich, der zwei Dienerinnen seiner Frau, die Schwestern
Meroed und Marcoveifa, geheiratet hatte. Spter ehelichte
Chilperich I. (560/6-584) mit Fredegund eine Magd seiner Frau.
Zwei der Frauen Teudeberts II., Bilichild und Teudechild,
waren ebenso wie Dagoberts Frau Nanthild Unfreie gewesen.
Solche Ehen waren politisch uerst vorteilhaf. Die Ehe mit der
Tochter eines Adligen bedeutete zwangslug den Abschlu einer
Allianz mit der Familie der Frau und verschafe ihren mnn-
lichen Verwandten hohe mter. Dies konnte allerdings auch
andere Adelsgruppen verstimmen und in der Verwandtschaf
der Knigin eine starke Opposition erzeugen, falls ihre Shne
bei knfigen Reichsteilungen nicht bercksichtigt wurden. Die
Schwierigkeiten, die Dagobert mit der Verwandtschaf seiner
Frau Gomatrudis zu berwinden hatte, zeigen, wie ernsthaf
diese Bedrohung werden konnte. Sklavinnen und Frauen niederer
Herkunf vertraten hingegen keine mchtigen Adelsparteien, und
wenn sie keine Shne gebaren oder in Ungnade elen, konnten sie
vom Hof entfernt werden. Wenn sie jedoch mnnliche Erben ge-
baren und sich wie Nanthild und Balthild als klug und intelligent
erwiesen, konnten sie zu betrchtlichem Einu gelangen.
Da solche Kniginnen keine mchtige mnnliche Verwandt-
245
schaf besaen, neigten sie dazu, Untersttzung bei der Geist-
lichkeit zu suchen, und wurden so zu den bedeutendsten Klo-
stergrndern und Frderern der Missionierung. Dies galt zum
Beispiel fr Balthild, die besonders mit den Bischfen Chrod-
obert von Paris und Audoenus von Rouen sowie mit den bten
Waldabert van Luxeuil, Teudefrid von Corbie einem von ihr
gegrndeten Kloster und Filibert von Jumiges enge Verbin-
dungen pegte. Nach dem Tod ihres Gatten Chlodwig im Jahre
657 bernahm sie mit Untersttzung ihrer geistlichen Ratgeber
die Regentschaf fr ihren minderjhrigen Sohn Chlothar III.
(geb. 657, gest. 673). Ihre auerordentliche Freigebigkeit gegen-
ber kirchlichen Einrichtungen trug dazu bei, da die Region
Paris, die vorwiegend aus Fiskalland bestand, weitgehend in
geistlichen Besitz kam, eine Politik, die ihr und ihren Shnen eine
Zeitlang krfige Untersttzung sicherte, die aber letztlich den
Arnulngern die Instrumente in die Hand gab, sich in Neustrien
eine starke Machtposition zu schaen. Doch solche Absichten
waren Balthild zu ihrer Zeit zweifellos ferngelegen.
Zu ihren Aktivitten im Bereich der Klostergrndung und
Klosterreform zhlten die Grndung von Corbie und Chelles,
die Einfhrung der Mischregel in Saint-Denis, dessen Ausstat-
tung mit der kirchlichen Immunitt gegenber dem Bischof
und mit der weltlichen Immunitt gegenber dem Knig sowie
die Frderung zahlreicher anderer Basiliken und Klster durch
Schenkungen. Damit verfolgte sie nicht nur das Ziel, den poli-
tischen Rckhalt dieser Einrichtungen zu gewinnen. Das Pro-
gramm der geistlichen Reform war die Fortsetzung der bereits
von Dagobert betriebenen Bemhungen um die Stabilitt des
Knigreiches und darber hinaus ein vorzgliches Mittel, das
Ansehen des Knigshauses zu mehren. Die Basiliken, die sie und
andere merowingische Knige grndeten, waren zum grten
Teil knigliche Begrbnissttten und dienten derselben Funktion
wie Jouarre und kleinere, von Adelsfamilien gestifete Klster. Die
Reformierung dieser Einrichtungen und die Einfhrung einer
246
liturgischen Ordnung, in der das Gedenken an die Toten einen
festen Platz hatte, war eng mit der Entstehung eines kniglichen
Kults verknpf; Balthild schuf so eine Verbindung zwischen
frheren Merowingern und ihren eigenen Shnen. Wie der
Autor der Balthildvita es mit einer Wendung ausdrckte, die er
hchstwahrscheinlich aus einem der kniglichen Privilegien fr
solche Institutionen entliehen hatte, wurden diese Schenkungen
vorgenommen, damit es ihnen [den Mnchen] angenehmer
werde, um die Milde Christi, des hchsten Knigs, fr den Knig
und um Frieden zu bitten.
5
Gleichzeitig setzte eine Entwicklung ein, die der traditionellen
Verbindung zwischen den Heiligen und der Knigsfamilie einen
neuen Bedeutungsgehalt verlieh. Balthild, ihr Ehemann und
ihre Shne legten im Bestreben, sich unmittelbar mit der Macht
dieser besonderen Toten zu umgeben, innerhalb des Knigspa-
lastes eine Sammlung von Reliquien an. Sie begngten sich nicht
damit, die Heiligen an den traditionellen Orten zu verehren, die
insgesamt die Heiligengeographie des Frankenreiches bildeten,
sondern begannen, die Heiligen um sich zu versammeln. Bereits
Chlodwig II. hatte den Arm des heiligen Dionysius aus dessen
Basilika geholt; wenig spter wurde die knigliche Sammlung
um die cappa des heiligen Martin bereichert, die jahrhunder-
telang in Tours verehrt worden war und im Laufe der Zeit zum
Mittelpunkt der Hofapelle wurde, die ihren Namen von dieser
cappa erhielt.
Im Jahre 658 starb Erchinoald, und Balthild, die dessen Familie
vermutlich nicht zustzlich strken wollte, erwhlte zusammen
mit den Franken Ebroin zu dessen Nachfolger, einen Adligen
aus der Gegend von Soissons, der bereits frher im Knigsdienst
gewesen war. Ebroin und Balthild versuchten zielstrebig, die
Knigshfe von Neustrien und Burgund zusammenzulegen
und in beiden Teilreichen ihren Herrschafsanspruch im Namen
Chlothars durchzusetzen. Das Ergebnis war natrlich eine hefige
Opposition in Neustrien und Burgund.
247
Der erste Mordanschlag gegen Ebroin schlug fehl; er wurde
von einem Sohn des dux Radebert namens Ragnebert ange-
fhrt, einem Adligen aus Neustrien, der vermutlich mit dem
burgundischen maior domus Radobertus verwandt war, den
Ebroin abgelst hatte. Ragnebert und seine Komplizen wurden
festgenommen, er selbst in ein burgundisches Kloster gesteckt
und auf Gehei Ebroins gettet.
Das Attentat ist kennzeichnend fr den Widerstand, auf den
Ebroin und Balthild stieen. Ragnebert wurde in der Dizese
Lyon als Mrtyrer verehrt, ebenso brigens Willebad, der eben-
falls von der Hand eines Neustriers gestorben war. Dennoch
war in der zweiten Hlfe des 7. Jahrhunderts der eigentliche
Streitpunkt nicht die Autonomie Burgunds gegenber der
neustrischen Vorherrschaf, sondern die individuelle Macht
der neustrischen und burgundischen Fhrungsgruppen. Die
privaten Interessen berwogen vor den regionalen, und sogar
Adlige in hohen Kirchenmtern machten aus ihren Besitzungen
in zunehmendem Mae unabhngige Herrschafsgebiete, indem
sie Mnzsttten einrichteten und ihre Angelegenheiten autonom
regelten. Balthild und Ebroin versuchten, diese Entwicklung
durch die Ernennung loyaler Bischfe, die am Knigshof aufge-
wachsen und erzogen worden waren und das irisch-frnkische
Mnchtum untersttzten, aufzuhalten. Das bedeutete aber einen
Bruch des von Chlothar II. gegebenen Versprechens, die mter
mit Vertretern der jeweiligen Region zu besetzen. Daher stie
diese neue Politik auf die hrteste Opposition von Adelsfamilien
wie der des Bischofs Aunemund von Lyon und seines Bruders
Dalnus, des Grafen der Stadt, die Lyon und das Umland der
Stadt in ein autonomes Herrschafsgebiet verwandelt hatten.
Aunemund wurde als Anfhrer der burgundischen Opposition
hingerichtet. In der Vita des Angelsachsen Wilfrid wird Balthild
beschuldigt, den Tod von neun Bischfen angeordnet zu haben;
doch war dies das einzige ihr zur Verfgung stehende Mittel, die
Autonomie solcher bischich-adliger Enklaven zu beenden. In
248
Lyon ersetzte sie Aunemund durch ihren treuen Parteignger und
Almosenverwalter Genesius. Erembert, einen Mnch aus dem
Kloster Saint-Wandrille, ernannte sie zum Bischof von Toulouse
und einen anderen Getreuen, Leodegar, den Bruder des Grafen
von Paris, zum Bischof von Autun.
Whrend Balthilds gesamter Regentschaf untersttzten diese
Mnner die von ihr und Ebroin gefhrte Politik. Als die Regentin
jedoch 664 oder 665 gezwungen wurde, sich in ihr Kloster Chel-
les zurckzuziehen, gingen sie zur Opposition ber, allen voran
Leodegar. 673 starb Chlothar berraschend, und Ebroin erhob
dessen jngeren Bruder Teuderich III. zum Knig. Daraufin
verlagerte der neustrisch-burgundische Adel seine Untersttzung
auf Teuderichs Bruder Childerich II., der in Austrasien zu Knig
ernannt worden war. Von allen verlassen, mute Ebroin sich ins
klsterliche Exil nach Lexeuil begeben, whrend sein Strohmann
Teuderich nach Saint-Denis verbannt wurde.
Der Zusammenschlu von Neustrien und Burgund hielt nicht
lange. Leogedar el bei Childerich II. bald in Ungnade und
wurde ebenfalls nach Luxeuil geschickt. 675 wurde Childerich
vielleicht auf gemeinsames Betreiben von Leodegar und Ebroin
ermordet, woraufin wiederum Unruhen ausbrachen. Ebroin
und Leodegar kehrten aus dem Exil zurck, letzterer schlo sich
Teuderich III. an, der aus Saint-Denis zurckgeholt worden war.
Die Partei Leodegars whlte Leudesius, den Sohn des Erchinoald,
zum maior domus, whrend Ebroin sich austrasischen Adligen
anschlo, die sich um Chlodwig III., einen angeblichen Sohn
Childerichs, sammelten. Ebroin trug den Sieg davon, ttete Leode-
gar und Leudesius und brachte es fertig, Neustrien und Burgund
fr weitere fnf Jahre zusammenzuschlieen. Als er jedoch ver-
suchte, seine Macht auch auf Austrasien auszudehnen, stie er
bei einem Nachkommen Arnulfs von Metz und Pippins I, Pippin
II., auf Widerstand. 680 wurde Ebroin von einem neustrischen
Adligen ermordet, der anschlieend bei Pippin Zuucht fand.
249
Austrasien
Die lange Reihe von Interregna und die daraus folgenden mrde-
rischen Auseinandersetzungen in Neustrien-Burgund zerstrten
die von Dagobert geschaene Einheit. Wie dies jedoch geschah,
kann nur vermutet werden, da viele Einzelheiten auerordentlich
unklar sind. Unsere Kenntnisse von den damaligen Vorgngen in
Austrasien sind noch weit drfiger. Zum erstenmal seit Chlodwig
regierte jemand ein frnkisches Teilreich, der mglicherweise
nicht aus kniglichem Geblt stammte.
Sigibert III., den Dagobert zum Herrscher ber Austrasien
bestimmt hatte, starb 656 und hinterlie mit Dagobert II. einen
Sohn. Was dann geschah, ist Gegenstand umfangreicher und
wahrscheinlich nie zu beendender Diskussionen. Die einzige
nahezu zeitgenssische erzhlende Quelle, der Liber Historiae
Francorum, berichtet: Als nun im Laufe der Zeit auch Knig
Sigibert starb, lie Grimoald dessen kleinen Sohn namens Dag-
obert scheren, schickte ihn mit dem Bischof Dido aus der Stadt
Poitiers in die Fremde nach Irland und machte seinen eigenen
Sohn zum Knig. Die Franken aber waren darber sehr erzrnt,
legten Grimoald einen Hinterhalt, ergrien ihn und brachten
ihn dem Frankenknig Chlodwig zur Verurteilung. In der Stadt
Paris wurde er in den Kerker geworfen, in schmerzvolle Fesseln
gelegt und starb schlielich als gerechte Strafe fr das, was er an
seinem Herrn verbt hatte, unter hefigen Qualen.
6
Dieser Grimoald war der maior domus Grimoald I., Sohn
Pippins I. des lteren, und sein oben erwhnter Sohn war Chil-
debert, der oensichtlich eine Zeitlang in Austrasien herrsch-
te. Damit wird deutlich, da die Familie, die im folgenden
Jahrhundert die Merowinger ablsen sollte, in der Mitte des 7.
Jahrhunderts bereits einen entsprechenden, wenn auch fehlge-
schlagenen Versuch unternommen hatte, der vom neustrischen
Adel vereitelt worden war. Es bleibt jedoch vllig oen, ob dies
wirklich der Sinn des Unternehmens war; immerhin war das
250
knigliche Nachfolgerecht erstmals von der Adelsmacht in
Frage gestellt worden.
Wie so viele Teile der merowingischen Geschichte lt sich
auch der exakte Ablauf dieser Ereignisse nicht rekonstruieren;
dennoch fehlt es nicht an Verfechtern der einen oder anderen wis-
senschaflichen Teorie. Nimmt man den oben zitierten Bericht
fr bare Mnze, so scheint der Usurpationsversuch gescheitert zu
sein. Da Sigibert III. 656, sein Bruder Chlodwig 657 starb, knnte
der Eindruck entstehen, da die Usurpationsphase hchstens
ein Jahr dauerte, bevor Grimoald an die Neustrier verraten und
hingerichtet wurde. Dieser Annahme widerspricht jedoch ein
urkundlicher Beleg dafr, da Grimoald 66 noch lebte. Deshalb
nahm man an, da Dagobert bis 66 regierte und Grimoald ihn
in diesem Jahr nach Irland verbannte und seinen eigenen Sohn
zum Knig machte. Zur Sttzung dieser Teorie ging man davon
aus, da ein Schreiber bei der Niederschrif der oben zitierten
Passage irrtmlich Chlodoveo (Chlodwig) statt Chlothario
geschrieben habe und da die Hinrichtung Grimoalds in Wirk-
lichkeit unter Chlothar III. um 66 oder 662
stattgefunden habe. Eine andere, auf das sechste Jahr des
Knigs Childebert datierte Urkunde legte jedoch den Schlu
nahe, da die Usurpation noch frher erfolgt sein msse und
da Grimoalds Sohn in Austrasien und Neustrien vom Tod Si-
giberts bis zum Tod Childeberts im Jahre 66 als rechtmiger
Knig anerkannt wurde; erst danach wurde sein Vater verraten
und hingerichtet. Andere Forscher spekulierten, da es sich gar
nicht um eine Usurpation im strengen Sinne gehandelt habe,
sondern da Grimoald der Nachkomme einer Tochter der
Merowingerfamilie gewesen sei und daher mit einem gewissen
Recht seinem Sohn einen merowingischen Namen gegeben
und ihn zum Nachfolger Sigiberts gemacht habe. Mglicher-
weise war Dagobert II. nicht von dem ehrgeizigen Grimoald,
sondern von den Neustriern ins Exil geschickt worden. Die
ganze Vorstellung von einer Usurpation wre dann eine sptere
251
Uminterpretation aus neustrischer Sicht. Genau werden wir es
aber nie wissen.
Was immer in Austrasien tatschlich geschehen ist, der gesamte
verwirrende Vorgang belegt hchst bedeutsame Einstellungsver-
nderungen hinsichtlich der Beziehung der Region zum mero-
wingischen Knigtum. Als Grimoalds Sohn als Knig anerkannt
wurde, war Dagobert II., der Sohn Sigiberts III., vermutlich
noch nicht geboren. So stand das Teilreich vor der Aussicht, da
nach des Knigs Tod sein Bruder Chlodwig II. seine Nachfolge
antreten und das gesamte Knigreich unter neustrische Herr-
schaf bringen knnte. Dies war natrlich in Austrasien nicht
akzeptabel, wo es, wie wir gesehen haben, eine lngere Tradition
der Einheit und Autonomie gab als in Neustrien oder Burgund.
Sowohl unter Chlothar II. als auch unter Dagobert hatte sich die
austrasische Identitt dadurch gefestigt, da der Knig im Land
aufgewachsen war und seinen eigenen Palast und seinen eigenen
Hof besa. Welche Motive der Inthronisierung des Childebert
auch zugrunde lagen, das wichtigste war eindeutig die Ablehnung
der neustrischen Oberherrschaf ber Austrasien.
Diese Ablehnung grndete keineswegs in einer ethnischen
Opposition zwischen Ost und West, Germanen und Rmern.
Im 7. Jahrhundert gehrten zu Austrasien nicht nur Regionen
im Osten des frnkischen Reiches wie Metz und Trier, sondern
auch so alte rmische Stdte wie Reims, Chlons und Laon.
Keine Sprachgrenze teilte die Regionen, und die Adelsfamilien
hatten Verbindungen zwischen beiden geschaen. Die Magna-
ten betrachteten sich selbst als Franken. Die wichtigsten Motive
fr die austrasische Haltung waren Einusphren und lokale
politische Traditionen.
Trotz der vermuteten Abstammung Grimoalds und der Er-
hebung seines Sohnes zum Knig war sein Sturz ein schwerer
Rckschlag fr die Bestrebungen seiner Familie, wenn auch die
Tatsache, da dieser Rckschlag die Zukunf der Sippe nicht
vollstndig ruinierte, einen Hinweis darauf gibt, wie mchtig
252
diese war. Aber vorlug waren die ehrgeizigen Ziele der Fami-
lie durchkreuzt und ihr Einu in Austrasien gebrochen. Nach
Childeberts Tod setzten Balthild und Ebroin den minderjhrigen
neustrischen Knig Chlothar III. auf den Knigsthron Austra-
siens. Bei diesem Arrangement scheinen die von Sigiberts Witwe
Chimnechild und dem austrasischen dux Wulfoald angefhrten
Gegner des Grimoald eine fhrende Rolle gespielt zu haben; sie
brachten im folgenden Jahr einen Kompromi zustande, wonach
Childerich II., der jngere Bruder Chlothars, seine Kusine, die
Tochter Sigiberts III. und der Chimnechild und Schwester des
verbannten Dagobert II., heiraten sollte. Chimnechild bernahm
fr den minderjhrigen Childerich die Regentschaf und sicherte
so den entscheidenden austrasischen Einu am Knigshof.
In einer Gesellschaf, in der Verwandtschafsbeziehungen sich
ausschlielich oder vorwiegend an der mnnlichen Abstammung
orientierten, htte Grimoalds Tod das Ende der Familie bedeutet.
Aufgrund der oenen Struktur der Adelssippe im Frhmittelalter
konnte aber auch ein solch harter Rckschlag die Sippe Pippins
nicht ausrotten. Grimoalds eigene Linie endete natrlich mit
dem Tod seines Sohnes Childebert, aber die durch die Heirat
von Grimoalds Schwester Begga und Arnulfs Sohn Ansegisel
besiegelte Allianz zwischen seiner Familie und der des Arnulf
von Metz sicherte den Fortbestand der Sippe. Von dieser Familie
hrt man die folgenden zwanzig Jahre lang nichts. Doch sollte die
Tradition der Pippiniden in der Person Pippins II. wiederbelebt
werden, und im frhen 8. Jahrhundert erinnerte der maior domus
Grimoald II. an seinen Vorfahren gleichen Namens.
Einer der Grnde fr das berleben der Sippe war die religise
Bedeutung, die einige ihrer Mitglieder erworben hatten, an erster
Stelle Arnulf von Metz und Gertrud von Nivelles. Die Gebeine
Arnulfs, der ursprnglich in Remiremont beigesetzt worden war,
wurden von seinem Nachfolger in die Apostelkirche von Metz
berfhrt, wo seine Nachkommen seine Verehrung frderten
und vorantrieben. Die auerordentliche Bedeutung Arnulfs fr
253
die Entwicklung des Selbstverstndnisses dieser Familie wird
dadurch belegt, da im Gegensatz zur hagiographischen Tradi-
tion, die Eltern des Heiligen zu benennen, die im 7. Jahrhundert
entstandene Vita Arnulfs seine Eltern nicht erwhnt und da
auch alle spteren Versuche scheiterten, ihre Identitt zu klren.
Wie manche
mythischen Heldengestalten ist Arnulf der Grnder der Fami-
lie, besitzt aber selbst keine identizierbaren Vorfahren.
Gertrud war die Schwester des Grimoald und btissin des
von den Pippiniden gegrndeten Klosters Nivelles. Obwohl
frhe Versuche, sie als eine germanische Isis zu betrachten,
sicherlich abwegig sind, wurde die Ausdehnung des Kults dieser
Frau, die eine politische Heirat am Hof Dagoberts II. zugunsten
eines Lebens im Familienkloster ausschlug, zu einem wichtigen
Element der Heiligung der Nachkommen ihrer Schwester Begga,
der Frau des Ansegisel.
Diese beiden Heiligen verschafen der Familie eine Art von
Legitimation, die in oenem Gegensatz zu dem anwachsenden,
von Dagobert I. begonnenen und von Balthild fortgefhrten und
ausgedehnten Knigskult stand. Am Ende des Jahrhunderts war
die Verehrung Arnulfs und Gertruds weit ber ihre Sippe und
deren Gefolgschaf hinaus verbreitet. Der Kult beider Heiligen
durchdrang ein Frankenreich, das bald von ihren Nachkommen
regiert werden sollte.
Die Wiedervereinigung unter den Arnulngern
Wie wir gesehen haben, fhrten der Tod Chlothars III. von
Neustrien im Jahre 673 und der Widerstand des neustrisch-
burgundischen Adels gegen Ebroin dazu, da Childerich II.
aufgefordert wurde, die Krone von Neustrien anzunehmen. Um
sich jedoch vor austrischer Einunahme zu schtzen, forderte
der Adel die Garantie der Versprechungen, die Chlothar im Edikt
254
von Paris abgegeben hatte, womit die Ernennung von rectores
aus anderen Regionen in allen Teilen des vereinten Knigreichs
verboten bleiben sollte. Als der Knig versuchte, dieses Verspre-
chen zu brechen und den austrasischen dux Wulfoald zum maior
domus des gesamten Reiches zu machen, wurde er zusammen
mit seiner schwangeren Frau ermordet.
Der sich anschlieende Krieg ebnete die Rckkehr der Familie
des Grimoald in der Person Pippins II. den Weg. Dieser verbn-
dete sich als austrasischer dux oensichtlich mit Ebroin gegen
Wulfoald und Dagobert II., der 676 aus Irland zurckgekehrt
war und versucht hatte, die Herrschaf in Austrasien wieder zu
bernehmen. 679 wurde Dagobert II. ermordet, vermutlich aus
demselben Grund wie Childerich; der Hochadel beider Teilreiche
hatte keine Verwendung fr einen Merowinger, der nicht nur
verwalten, sondern auch herrschen wollte. Da auch Ebroin 680
gettet wurde, zeigte, da Austrasien unter der Fhrung Pippins
Wulfoald starb im selben Jahr nicht von Neustrien beherrscht
werden wollte.
Sechs Jahre lang hielt Waratto, der neue maior domus von
Neustrien, Frieden mit Austrasien, wenn auch nur unter Schwie-
rigkeiten. Nach seinem Tod im Jahre 686 zog Pippin gegen Wa-
rattos Nachfolger und Schwiegersohn Bercharius zu Felde und
schlug die Neustrier in der Schlacht von Tertry-sur-Somme (687).
Pippin erlangte Zugang zu Teuderich III., der berlebt hatte,
indem er Ebroin, Waratto und Bercharius weit entgegengekom-
men war. Damit ernete sich fr Pippin eine Gelegenheit, sich
selbst nicht zum dux oder maior domus, sondern, um mit den
spten Annalisten zu sprechen, zum princeps oder Herrscher des
gesamten Frankenreiches zu erheben.
255
Nach der Schlacht von Tertry
Pippin hatte sich eine Chance verschaf, das Ziel aber noch
nicht erreicht. Nach 687 unternahm er den unumgnglichen,
aber hchst schwierigen Versuch, seine Macht in Neustrien zu
festigen. Weder militrische Eroberung allein noch die brutale
Unterdrckung des Adels, wie sie Ebroin betrieben hatte, reich-
ten dazu aus. Eine weitere Adelsrebellion wre ausgebrochen,
ein weiterer Mrder htte sich gefunden, und Pippin wre den
Weg so mancher anderer Prtendenten gegangen. Statt dessen
kehrte er 688 nach Austrasien zurck und lie seinen Vertrauten
Nordebertus und vermutlich auch seinen Sohn Drogo zurck,
um den Einu seiner Familie auf die Machtstrukturen Neustri-
ens zu festigen auf das Netz von Sippen, das die Machtbasis
Warattos gebildet hatte, den kniglichen Hof und den Patronat
ber die Kirche.
Das erste und einfachste Ziel war schnell erreicht. Bercharius
starb bald nach der Schlacht von Tertry auf Anstifung seiner
Schwiegermutter, wie es hie, obwohl auch Pippin diesen Tod
nicht allzu tief betrauert haben drfe und die frisch verwitwete
Adaltrudis (oder Anstrudis) Pippins ltesten Sohn Drogo heira-
tete. Wie oben dargelegt, besa Warattos Sippe mglicherweise
Verbindungen zur Familie des Erchinoald und dadurch auch
zur Mutter Dagoberts I. Durch die Heirat zwischen Drogo und
Anstrudis absorbierte Pippin den neustrischen Anteil der Erchi-
noald-Sippe. So hatte er sich die mchtige Adelsfamilie nicht zum
Feind gemacht, sondern sie an der Grundlegung der Macht der
Arnulnger beteiligt.
Die Verwandtschaf mit der alten neustrischen Hausmeierfami-
lie verschafe Pippin Zugang zum zweiten Grundpfeiler seiner
Macht in Neustrien, dem merowingischen Knigshof. Wie wir
gesehen haben, war die Rechtsprechung seit Dagobert I. eine der
wichtigsten Aufgaben der merowingischen Knige. Mit der den
Knigen lange Zeit verweigerten Ausbung politischer Fhrer-
256
schaf durch die Ernennung von Grafen und Bischfen war der
Gerichtshof der merowingischen Knige zu deren wichtigstem
Machtinstrument im frnkischen Knigreich geworden. Zum
Knigshof kamen Magnaten aus dem gesamten Frankenreich.
Unter dem Vorsitz des Knigs, des maior domus oder des Pfalz-
grafen wurden Flle von hchster Bedeutung, an denen Laien und
mchtige Geistliche des Knigreiches beteiligt waren, verhandelt
und entschieden. Whrend der Knig wohl kaum in der Lage
war, in jener furchterregenden Weise Recht zu sprechen, fr die
Dagobert berhmt gewesen war, und die spten Merowinger
vermutlich den Versammlungen nicht einmal beiwohnten, ver-
schafen diese den Adligen einen Rahmen, innerhalb dessen sie
sich an gewaltlosen, aber lebenswichtigen Auseinandersetzungen
beteiligen konnten.
Die Aneignung dieser Machtgrundlage verlief um so langsa-
mer, als der Vorgang hchst heikel war. Zwischen den Magnaten
mute ein Konsens herbeigefhrt werden; der Gegner mute vor
der entlichen Meinung und nach den Regeln des frnkischen
Gewohnheitsrechts berwunden werden. Dies war nicht immer
leicht, wie zwei Beispiele zeigen werden. Der erste Fall betraf
die Konszierung des Eigentums eines gewissen Amalbert, der
frher Ebroin untersttzt hatte. Amalbert wurde beschuldigt,
sich unrechtmig den Besitz eines Waisen angeeignet zu haben.
Der Beschuldigte erschien nicht vor Gericht. Als Amalberts Sohn
Amalrich zur Verteidigung seines Vaters das Wort ergreifen woll-
te, wurde festgestellt, da er dazu keine Vollmacht seines Vaters
besa. Das Verfahren wurde zugunsten des Waisen entschieden,
der seinen Besitz zurckerhielt, und Amalbert gezwungen, ein
Bugeld zu zahlen. Die formale Beschreibung des Verfahrens
sollte nicht zu der Vorstellung verleiten, der Fall sei von den
anwesenden Magnaten als einfache Sachentscheidung beurteilt
worden; die Sprache verschleiert die Manver, mit denen die Pip-
piniden ihre Ziele verfolgten. Diese beginnt man zu ahnen, wenn
man erfhrt, da der Vormund des Waisen niemand anders als
257
Pippins Vertrauter Nordebertus war; dieses Urteil war der letzte
Akt einer langen Reihe von Prozessen, mit denen die Pippiniden
ihrem alten Feind zugesetzt hatten. Wie Paul Fouracre dargelegt
hat, war es ein Ergebnis des auerordentlichen Geschicks, mit
dem Pippin es verstanden hatte, die gesamte Macht des Adels
gegen einen einzelnen zu richten. An dem Verfahren hatten zwlf
Bischfe und vierzig hochrangige Laien teilgenommen.
7
Doch diente das Knigsgericht nicht immer als politisches In-
strument der Arnulnger. Die anderen Magnaten am Knigshof
konnten ihnen gelegentlich immer noch eine Schlappe zufgen.
Als eine solche Niederlage kann man die Entscheidung in dem
zweiten Fall betrachten. Im Jahre 697 erschien Drogo, den der Abt
des Klosters Tussonval wegen eines Landguts bei Noisy verklagt
hatte, vor dem Gerichtshof des Knigs Childebert III. (694/95-
7) in der kniglichen villa Compigne, die anstelle von Paris
zur bevorzugten Residenz der Merowinger geworden war. Der
Abt legte eine Urkunde Knig Teuderichs III. vor, in der die
Besitzrechte des Klosters an diesem Gut besttigt wurden, und
behauptete, Drogo habe es sich zu Unrecht angeeignet. Drogo
erwiderte, das Landgut sei ihm durch seine Frau aufgrund eines
Tauschvertrags zugefallen. Damit wird deutlich, da er versuchte,
sich den ehemaligen Besitz der Familie des Waratto einzuver-
leiben. Der Abt rumte ein, da ein Tausch geplant worden war,
versicherte aber, da dieser nie zustande gekommen sei. Da
Drogo keine Tauschurkunde vorlegen konnte, wurde der Streit
zugunsten des Abtes entschieden.
Auch in diesem Fall schufen Verfahrensregeln und Sachverhalte
den formalen Rahmen, innerhalb dessen tiefgreifende Interes-
sengegenstze ausgefochten wurden. Unter den Bischfen und
Magnaten, die zu Gericht versammelt waren, befanden sich
Pippin selbst, Grimoald, Pippins Sohn und Nachfolger als desi-
gnierter maior domus, sowie Bischof Konstantin von Beauvais, ein
getreuer Anhnger Pippins. Anwesend waren aber auch Bischof
Savarich von Auxerre und Agnerich, der patricius der Proven-
258
ce und von Niederburgund, die am Ende des 7. Jahrhunderts
oensichtlich beide ihren jeweiligen Herrschafsanspruch auf
Kosten des Knigstums ausweiteten. Das Verfahren stellte damit
vermutlich eine Konfrontation zwischen Pippiniden und deren
Gegnern dar, und diesmal gewannen letztere.
Der dritte Grundpfeiler der Macht Pippins in Neustrien war die
Kirche. Wie wir gesehen haben, hatten neustrische Knige, K-
niginnen und Adlige beim Ausbau der kirchlichen Grndungen
zu einem der wichtigsten Instrumente ihrer Macht eine fhrende
Rolle bernommen, indem sie altes Knigsgut in Kirchengut ver-
wandelten. Pippin und seine Nachfolger verstanden es geschickt,
sich als Schutzherren dieser Institutionen zu etablieren, und er-
warben auf diesem Wege betrchtliche Machtflle in der Region.
Und auch hier war die Verschmelzung seiner Familie mit der des
Waratto der Schlssel zu seiner Politik. In den letzten Jahren des
7. und zu Beginn des 8. Jahrhunderts festigte Pippin seinen
Einu auf die Kirche der Region Rouen, wo der Groteil der
Gter Erchinoalds und Warattos gelegen hatte. In diesem Proze
nahmen die Klster Saint-Wandrille und Jumiges sowie der
Bischofssitz von Rouen die Schlsselstellung ein. Schon frh
hatte Pippin den Patronat ber das kleine Kloster Fleury-en-
Vexin inne, das er mit Hilfe der Mnche von Saint-Wandrille
erweiterte und reformierte. Hchst bedeutsam ist, da er das
Kloster unter seinen und seiner Familie Schutz nahm, ihm da-
mit eine Art Immunitt verlieh, die nicht vom Knig ausging,
und auf diese Weise das Kloster seiner unmittelbaren Aufsicht
unterstellte. Schrittweise bernahmen er und seine Nachfolger
die Schutzherrschaf und den Patronat von Saint-Wandrille
und Jumiges. Da diese Klster dem Bischof von Rouen unter-
standen, mute Bischof Ansbert, ein Parteignger der lteren
neustrischen Partei, in die Verbannung geschickt werden. Damit
wurde der Weg frei, Godinus, vermutlich Bischof von Lyon und
Parteignger Pippins, zum Abt von Jumiges zu machen. Ferner
erhob Pippin Bischof Bainus von Terouanne, der zuvor mit
259
Fleury-en-Vexin in Verbindung gestanden hatte, zum Abt von
Saint-Wandrille.
Die Kontrolle ber diese auerordentlich begterten Institu-
tionen schuf an der unteren Seine eine Machtbasis, von der aus
der Einu der Familie in alle Teile des vereinten Frankenreiches
ausstrahlen konnte. In den Dizesen Nantes, Chlons und Sois-
sons wiederholte sich im wesentlichen jeweils derselbe Vorgang:
Klster wurden reformiert und erweitert und mit neuen Mn-
chen, hug aus Saint-Wandrille, ausgestattet, bte und Bischfe
wurden eingesetzt, die aus Pippins Familie stammten oder ihr
treu ergeben waren, und die wichtigsten Institutionen wurden
der Schutzherrschaf der Familie unterstellt.
Diese drei Manahmen die Absorbierung regionaler Adels-
familien in den Sippenverband, die Manipulation des Knigsge-
richts und die Kontrolle von kirchlichen Einrichtungen festig-
ten Pippins Macht im gesamten Frankenreich. Da er sich jedoch
vorwiegend in Austrasien und Neustrien besttigte, nutzten die
duces in den Randregionen des Reiches die Gelegenheit, ihren
Einu in ihren jeweiligen Machtbereichen ebenfalls auszudeh-
nen und abzusichern. Auerdem brach nach seinem Tod im Jahre
74 und nach dem Ableben seines Sohnes Grimoaldll. innerhalb
seiner Familie ein hefiger Kampf um die Nachfolge aus, der das
gesamte Gebude, das er ber drei Jahrzehnte hinweg so sorgfltig
errichtet hatte, zum Einsturz zu bringen drohte.
Zu Beginn des Jahres 74 sandte Pippin, der sein Ende nahen
fhlte, nach Grimoald, seinem Sohn und designierten Nachfol-
ger als maiordomus. Auf dem Weg zu seinem Vater nach Jupille
wurde Grimoald in der Basilika des heiligen Lambert in Lttich
ermordet. Pippin selbst starb einige Monate spter und hinter-
lie eine ungelste Nachfolgefrage, die der Opposition gegen
die Pippiniden die letzte Gelegenheit bot, ihre Unabhngigkeit
zu wahren. Es folgten drei Kriegsjahre und anschlieend sechs
Jahre verzweifelter politischer Manver, in denen die von Pippin
geschaene, auf drei Pfeilern ruhende Machtbasis weitgehend
260
zusammenbrach, bis sie von seinem Nachfolger Karl Martell
neu aufgebaut wurde.
Pippin hinterlie drei potentielle Nachfolger. Pippins eigene Wahl
el auf Teudoald, den minderjhrigen Sohn Grimoalds, dem Pip-
pin seine Witwe Plektrud anvertraute. An zweiter Stelle folgten die
Shne von Pippins Sohn Drogo, der 708 verstorben war; es waren
Hugo, der um 74 Priester wurde, Arnulf, Pippin und Godefried,
von denen die letzten beiden minderjhrig waren. Schlielich war
da noch Karl, der als Martell der Hammer in die Geschichte
einging, der einzige erwachsene berlebende Sohn Pippins. Er
war jedoch kein Sohn der Plektrud, sondern der Nachkomme
einer Konkubine Pippins, vielleicht auch, was nach frnkischem
Brauch mglich erscheint, einer zweiten Frau. Plektrud warf Karl
jedenfalls ins Gefngnis, bestimmte Teudoald zum maior domus
in Neustrien und setzte Arnulf zum dux von Metz ein.
Innerhalb krzester Zeit ergri der neustrische Adel die Ge-
legenheit zum Aufstand und sammelte sich um Dagobert III.
(7-75), den Sohn Childeberts III. Er besiegte die Pippiniden
bei Compigne und schlug Teudoald in die Flucht. Dieser starb
kurz nach der Schlacht, und die Neustrier whlten mit Ragam-
fred einen Mann aus ihren eigenen Reihen zum maior domus.
Ragamfred verbndete sich mit den Friesen und dem aquitani-
schen Herzog Eudo, um die Pippiniden zu vernichten, und zog
nach Metz. Karl entkam dem Gefngnis seiner Stiefmutter und
mobilisierte seine austrasischen Anhnger zum Kampf gegen
die Neustrier. Inzwischen verstarb Dagobert, und die Neustrier
fanden einen Sohn Childerichs II. namens Daniel, den sie als
Chilperich II. zu ihrem Knig erhoben. Karl hingegen fand in
Chlothar IV. seinen eigenen Merowinger.
Aus allen Teilen des Frankenreiches erhielten die Neustrier
Untersttzung, aus Rouen, Cambrai, der Region Paris, Ober-
burgund, Alemannien und aus so weit entfernten Regionen wie
der Provence und Bayern. Der Hof Chilperichs II. wurde zum
Sammelpunkt aller Gruppen, die die ehrgeizigen Ziele der Pippi-
261
niden bekmpfen wollten; diesen ging es allerdings eher um die
Bewahrung ihrer eigenen Autonomie als um die Untersttzung
der Merowingerdynastie.
Karl mute sowohl gegen Plektrud als auch gegen die Neustrier
kmpfen. 727 besiegte er jedoch seine Stiefmutter und im fol-
genden Jahr bei Soissons die Neustrier. Endlich konnte er nach
Neustrien ziehen und die Festigung der Macht seiner Familie in
Angri nehmen.
Die Konsolidierung seiner Macht nahm etwa fnf Jahre in An-
spruch und vollzog sich in einem mhsamen Proze, in dessen
Verlauf in Neustrien und Burgund eine Stadt nach der anderen
unter Kontrolle gebracht wurde. Als wichtigstes Instrument sei-
ner Politik nutzte er die Besetzung kniglicher und bischicher
mter. Schlielich aber behauptete er sich nicht nur erfolgreich
als princeps des Knigreichs, das Ergebnis war auch eine neue
kirchliche Struktur und eine neue Kultur. Mehr als alles andere
markiert diese Entwicklung, die fr die gesamte Karolingerzeit
charakteristisch werden sollte, einen Bruch mit der sptantiken
Tradition des Regionalismus. Bevor wir jedoch die unter Karl
Martell erfolgten kulturellen und religisen Neuerungen be-
trachten, mssen wir uns den Vernderungen zuwenden, die sich
in dieser Periode politischer Unruhe in den anderen Teilen des
Frankenreiches vollzogen.
Die Ausbildung territorialer Knigreiche
Nachdem der maior domus Bercharius gettet worden war, kam
Pippin der Jngere, der Sohn des Ansegisel, aus Austrasien und
folgte ihm im Amt [principatus] des maior domus. Von dieser Zeit
an trugen die Knige zwar den Namen, besaen aber nicht die
Wrde [eines Knigs] Zu dieser Zeit weigerten sich Godafred,
der Herzog der Alemannen, und andere Herzge mit ihm, den
frnkischen duces zu gehorchen, weil sie den merowingischen
262
Knigen nicht lnger dienen konnten, wie sie es frher zu tun
gewohnt waren, weshalb jeder sich an sich selbst hielt.
8
Der Mann, der im 9. Jahrhundert diese Zeilen verfate, be-
schrieb die Beziehung zwischen den Pippiniden und den an-
deren duces des Frankenreiches vielleicht genauer, als er selbst
wute. Inzwischen war das Amt das maior domus tatschlich zu
einem Frstenamt geworden. Vor dem 7. Jahrhundert wurde der
Begri princeps lediglich im Zusammenhang mit kaiserlichen
oder kniglichen mtern verwendet. Nun erhoben die maiores
zunehmend Anspruch auf Souvernitt. Aber die Schwchung
des Knigtums und die gleichzeitige Festigung der regionalen
Macht, die den Hausmeiern von Neustrien und Austrasien einen
nahezu kniglichen Status verschafe, wirkte sich auch auf die
Herzge in anderen Regionen aus. Die duces von Tringen,
Friesland, Aquitanien, Alemannien und Bayern wurden unab-
hngiger. Im frhen 8. Jahrhundert bten sogar die Bischfe ein
principatum ber ihre Territorien aus. Als sich ihr gemeinsames
Band, die Beziehung zu einem mchtigen Merowingerknig,
auste, empfanden solche unabhngigen Herren gegenber den
Pippiniden, die hchstens ihresgleichen, in vielen Fllen ihnen
dem sozialen Rang nach aber unterlegen waren, keine vergleich-
bare Treueverpichtung.
Jede Randregion des frnkischen Reiches besa ihre eigene
gesellschafliche und politische Ordnung, und jede war mit
dem Zentrum in anderer Weise verbunden. Drei der wichtigsten
Regionen werden wir als Beispiele dafr untersuchen, wie sich
dieser Proze im Frankenreich vollzog, Aquitanien, die Provence
und Bayern.
Aquitanien
Aquitanien war die Region mit der strksten rmischen Konti-
nuitt in Kultur und Gesellschaf. Auerdem war es die reichste
263
Region des Frankenreiches und besa durch die Nachbarschaf
zu den Westgoten und Basken hohe strategische Bedeutung.
Die Bindungen an rmische Gesellschaf und Kultur waren
in Aquitanien auerordentlich stark; Sprache, gesellschaft-
liche Organisation und religiser Kult hatten sich seit dem
6. Jahrhundert nur wenig verndert. Die groen, von Sklaven
und coloni bewirtschafeten Landgter, die die Agrar- und Ge-
sellschafsstruktur seit dem 5. Jahrhundert prgten, bestanden
ohne gravierende Unterbrechungen fort. Man hat geschtzt, da
manche dieser fundus genannten Gter so gro wie heute ein
franzsisches Departement waren; kleinere konnten immerhin
noch die Ausmae einer heutigen Kommune haben. Im Laufe
des 7. Jahrhunderts, als der Hochadel seinen Besitz durch Kauf,
Tausch und Erbschafen ausdehnte, gewannen diese Latifundien
noch weiter an Umfang.
Daneben existierten in Aquitanien kleinere freie Bauernstel-
len. Im 6. Jahrhundert hatte die ber den Hafen von Marseille
eingeschleppte Pest die Region bis nach Orleans im Norden
verwstet. Sie fhrte zu einem betrchtlichen Bevlkerungs-
schwund und wegen des Mangels an Arbeitskrfen zum Ver-
lust von bewirtschafeten Flchen. Im 7. Jahrhundert nahm die
Bevlkerung allmhlich wieder zu, und die Bauern wurden
ermutigt, brachliegendes Land im Besitz des Fiskus, des Adels
und der kirchlichen Einrichtungen zu bestellen. Mit diesen frei-
en Bauern wurde vereinbart, da sie das Land bearbeiten und
dafr einen Teil als Eigentum erhalten sollten. Dadurch stieg die
landwirtschafliche Produktion der Region allmhlich an und
schuf einen Wohlstand, der Autonomiebestrebungen frderte
und Aquitanien zu einem erstrebenswerten Besitz machte, um
den es sich zu kmpfen lohnte.
Die Reichtmer Aquitaniens, nicht nur die landwirtschafli-
chen Produkte, sondern auch Salz, Holz, Pelze, Marmor, Blei,
Eisen und Silberminen, hatten die Region schon lange zu einem
wertvollen frnkischen Besitz gemacht. Wie wir gesehen haben,
264
erhielt bei jeder Reichsteilung jeder Knig einen Teil Aquitaniens.
Andererseits statteten diese Knige die groen Klster und Kir-
chen des Nordens auerordentlich grozgig mit Grundbesitz,
Einnahmequellen und Abgabenbefreiungen aus. Unter anderem
besaen die nordfrnkischen Bistmer Le Mans, Metz, Kln,
Reims, Paris und Chlons in Aquitanien umfangreiche Gter,
ebenso die Klster Saint-Wandrille, Saint-Denis, Corbie und
Stavelot. Diese Prsenz des Nordens im Sden fhrte zu stndi-
gen Interaktionen zwischen den Laien und den Kirchenfrsten
beider Regionen.
Dem nrdlichen Einu im Sden stand eine starke aquita-
nische Prsenz im Norden gegenber. Seit Chlodwig hatte die
senatorische Aristokratie aus dem Sden an den Hfen der
Merowinger Schlsselpositionen besetzt, dem Norden wichti-
ge Bischfe gestellt und im gesamten Frankenreich politische
Allianzen und Heiratsverbindungen geschlossen. So kann man
zwar den besonderen Charakter der Region und ihr rmisches
Geprge nicht verleugnen, sollte aber andererseits den rmi-
schen Charakter des Provinzadels auch nicht berbetonen.
Whrend die kleinen und mittleren Grundbesitzer zweifellos
ihre lokalen Traditionen bewahrten, gehrte der Hochadel zu
beiden Welten, bewegte sich frei von einer in die andere und
war in der Lage, seine weitreichenden Verbindungen zu nut-
zen, um an den politischen und kulturellen Entwicklungen des
gesamten frnkischen Knigreichs teilzuhaben. Gewi, diese
Aristokraten waren Rmer, aber vorwiegend in demselben
Sinne, wie die Menschen nrdlich der Loire ungeachtet ihrer
ethnischen Abstammung sich selbst als Franken betrach-
teten. Der Begri Franke bedeutete nun eine geographische
Zuordnung, und Rmer bezeichnete immer fer lediglich
einen Bewohner des Sdens. Vom ersten Drittel des 7. Jahr-
hunderts an bemhten sich diese Rmer zunehmend um die
gleiche Art von Autonomie, wie sie die anderen Regionen des
Frankenreiches anstrebten.
265
Dieser Wunsch nach Autonomie wurde um so grer, als die
Bedrohung durch Basken und Gascogner anhielt. Wie wir gesehen
haben, machte Dagobert seinen Halbbruder Charibert II. zum
Knig eines kleinen aquitanischen Reiches und errichtete damit
einen Auenposten zur Kontrolle der Basken. Im wesentlichen
dasselbe tat Ebroin um 650, als er oensichtlich einen Adligen
aus Toulouse namens Felix zum patricius ernannte und ihm das
principatum ber alle die Stdte bis zu den Pyrenen und ber
dieses uerst ble Volk der Basken anvertraute.
9
In Wirklich-
keit gri er damit auf das Grenzknigtum des Charibert zurck
und stellte an die Spitze des nun als principatum bezeichneten
Gebietes einen nichtkniglichen Amtstrger. Nachdem Felix
gestorben war, beanspruchte sein Nachfolger Lupus im Verlauf
der Wirren nach dem Tod Childerichs II. die Souvernitt und
sogar den Knigsthron.
Obwohl Lupus im folgenden Jahr starb, blieb die faktische
Autonomie Aquitaniens bis weit ins 8. Jahrhundert hinein er-
halten. Der nchste aquitanische Herzog, von dem wir etwas
wissen, ist Eudo, der als princeps der Aquitanier bezeichnet
wird. Seine Herkunf und Abstammung sind unbekannt. Sein
Name weist jedoch auf Neustrien hin, und wahrscheinlich besa
er sowohl zu Aquitanien als auch zu Neustrien Beziehungen, auf
deren Basis er seine Position ausbauen und stabilisieren konnte.
Dies ist fr die unabhngigen frnkischen principes dieser Zeit
typisch. Whrend der allmhlichen Konsolidierung der Pippini-
den im Norden und der nach Pippins Tod im Jahre 74 folgenden
Kmpfe gelang es Eudo, sein Prinzipat nach Norden und Osten
auszudehnen. Neustrische Gegner der Pippiniden unter der
Fhrung des maior domus Ragamfred und seines Merowingers
Chilperich II. fanden in Eudo einen Verbndeten. Solange er es
nur im Sdwesten mit den Basken, einem uneinigen gotischen
Knigreich im Sdosten und einem in Aufruhr bendlichen
frnkischen Norden zu tun hatte, konnte er seine Unabhngigkeit
tatschlich bewahren. Dieses Gleichgewicht wurde jedoch durch
266
den von der islamischen Invasion ausgelsten Zusammenbruch
des westgotischen Spanien zerstrt.
Der Zusammenbruch Spaniens vollzog sich rasch und war
vollstndig. Nach der vernichtenden Niederlage des Knigs Ro-
derich in der Schlacht bei Guadaleta im Jahre 7 lste sich der
Widerstand im gesamten Lande auf. Bis 79 war Septimanien
gefallen, und 72 belagerte eine islamische Armee Toulouse. Hier
wurde sie von Eudo und seinem durch baskische Einheiten ver-
strkten aquitanischen Herr aufgehalten und erlitt eine schwere
Niederlage. Fr diesen Sieg scheint Eudo die Anerkennung durch
Papst Gregor II. erhalten zu haben, der nach mchtigen Bundesge-
nossen auerhalb Italiens Ausschau hielt, um sowohl den Westen
vor dem Islam zu schtzen, als auch was ihm vielleicht noch
wichtiger war Verbndete gegen die Langobarden zu nden.
Es folgte eine Periode
der Konsolidierung und des Friedens, in der Eudo oensicht-
lich einen Vertrag mit dem rebellischen Berberkommandeur der
strategisch wichtigen Region Cerdagne abschlo und ihm seine
Tochter zur Frau gab. Vermutlich war ihm klar geworden, da
die strkste Bedrohung in Zukunf aus dem Norden kommen
wrde, weshalb er die Neutralitt oder gar die Untersttzung
der Moslems bentigte.
Zehn Jahre spter hatte Karl Martell, der Sohn und Nachfolger
Pippins II., seine Stellung im Norden soweit gefestigt, da er sich
den anderen Teilreichen und unabhngigen Territorien des Fran-
kenreiches zuwenden konnte. 73 el er in Aquitanien ein und
machte reiche Beute. Eudo geriet dadurch in eine unmgliche
Lage. Sein Verbndeter in der Cerdagne war zuvor vom Gou-
verneur des islamischen Spanien besiegt worden, so da Eudo
schutzlos dastand. Im folgenden Jahr nutzte der Gouverneur
Abd ar-Rahman diese ungeschtzte Lage aus, drang in der Gas-
cogne und in Aquitanien ein und unternahm Plnderungszge
bis Bordeaux und Poitiers. Als Eudo versuchte, ihn aufzuhalten,
wurde die aquitanische Armee vernichtet, und er sah sich ge-
267
zwungen, Karl Martell um Hilfe zu bitten. Der Sieg der Franken
bei Tours und Poitiers hinderte nicht nur die Moslems daran,
nrdlich der Pyrenen weiter vorzudringen, sondern bedeutete
auch das Ende der Unabhngigkeit Aquitaniens. Eudo sank zum
Gefolgsmann Karl Martells herab, und sptere Versuche seiner
Shne und Nachfolger, nach Karls Tod im Jahre 74 und dem Tod
seines Sohnes Pippin im Jahre 768 die Unabhngigkeit wieder
zu erlangen, wurden brutal niedergeschlagen.
Die Provence
Im gesamten Frankenreich wiederholte sich die aquitanische
Entwicklung nach demselben Grundmuster: Adlige mit loka-
len und reichsweiten Verbindungen nutzten die Schwchung
der Zentralgewalt, um unabhngige Herrschafsbereiche zu
errrichten, sammelten sich als treue Anhngerschaf um ir-
gendeinen Merowinger und schlossen Bndnisse zum Schutz
vor den Pippiniden mit Machthabern auerhalb des frnkischen
Reiches. In der Provence geschah dies im letzten Drittel des 7.
Jahrhunderts.
Hier gelang es den patricii Antenor und Maurontus, letzterer
mglicherweise ein entfernter Verwandter des neustrischen
maior domus Waratto, die Situation auszunutzen und sich von
den Pippiniden unabhngig zu machen. Diese Politik richtete
sich aber oensichtlich nicht gegen die Merowinger selbst und
insbesondere nicht gegen Childebert III.; denn Antenor war einer
der Magnaten, die 697 dem Gerichtsverfahren beiwohnten, bei
dem Drogo gehindert wurde, durch seine Heiratsverbindung
seinen Familienbesitz auszudehnen. Vielmehr scheint Childebert
ein Kristallisationspunkt der antipippinidischen Opposition im
gesamten Frankenreich gewesen zu sein. Wie wir sehen werden,
nahm der Rebell aus der Provence nicht nur am Knigsgericht teil,
wo er zur Niederlage der Pippiniden beitrug, sondern Mitglieder
268
seines Hofes sollten sich spter auch in Regionen wiedernden,
die Pippin und seinen Nachfolgern feindlich gesinnt waren.
Diese oene Untersttzung der Merowinger scheint unter
Childeberts Nachfolger Chilperich II. in begrenztem Umfang
fortgefhrt worden zu sein, der fr kurze Zeit eine Oppositi-
on gegen Karl Martell zustande brachte. Auch in den Zeiten
unverhllter Rebellion konnte Chilperich oensichtlich einen
gewissen Einu auf die Zolleinnehmer in Marseille und Fos
ausben und die traditionellen Immunitten, die Saint-Denis
dort geno, garantieren. Die provenzalischen patricii strebten
wohl unabhngige Herrschafsgebiete nach dem Vorbild an, das
ihnen die Pippiniden selbst gegeben hatten sie schworen dem
rechtmigen Merowingerknig Treue, besuchten seinen Hof
und erkannten seine Verfgungsgewalt ber einige wichtige Teile
des Fiskus an. Andererseits waren sie ebensowenig wie Pippin
oder spter Karl Martell bereit, eine merowingische Oberherr-
schaf anzuerkennen.
Herren wie Antenor und Maurontus grndeten ihre Macht auf
lokale Gesellschafsbeziehungen und die Kontrolle der kirch-
lichen und weltlichen mter. ber Jahrzehnte hinweg hatten
Heiraten, Erbschafen und Landtransaktionen diese Mnner
in den Besitz riesiger Lndereien in den Regionen, in denen sie
ttig waren, gebracht. Die Gter, die im Rhnetal of aus relativ
isolierten Hfen oder aus greren Latifundien bestanden,
wurden von Sklaven unter der Aufsicht und Leitung von coloni
bewirtschafet, die ihrerseits of Freigelassene waren, das heit
frhere Sklaven oder deren Nachkommen, die von ihren Herren
freigelassen worden waren. Solche Freigelassenen scheinen der
Schlssel zur lokalen Kontrolle gewesen zu sein. Whrend der
Status eines Freigelassenen in der Antike ein Zwischenstadium
darstellte und erst die Kinder von Freigelassenen als Freie galten,
wurde er bis zum 7. Jahrhundert erblich. Die Nachkommen frei-
gelassener Sklaven, die meist auf einem Stck Land angesiedelt
wurden oder auch mehrere Landstcke erhielten, die sie mit
269
Hilfe von Sklaven bearbeiteten, hatten der Familie ihres frheren
Herrn weiterhin betrchtliche nanzielle Abgaben zu leisten und
waren ihr auch moralisch verpichtet. Obwohl sie rechtlich frei
waren, konnten sie in die Unfreiheit zurckfallen, wenn sie ihren
besonderen Verpichtungen gegenber ihren frheren Herren
nicht nachkamen. Sie waren daher fr die Verwaltung der Gter
von Grogrundbesitzern, die Fhrung ihrer Geschfe und damit
insgesamt fr die unmittelbaren Kontakte ihrer Herren mit der
brigen Gesellschaf besonders geeignet.
Am anderen Ende des sozialen Spektrums kontrollierten die
Magnaten die mter des comes, dux oder patricius sowie auf
lokaler Ebene die mter, die aus der traditionellen Provinzver-
waltung erwachsen waren. Sie besetzten auch die Bischofsmter;
in allen Stdten kmpfen rivalisierende Familien um das Bischof-
samt und scheuten dabei nicht davor zurck, Prtendenten zu
ermorden, wenn es ihnen zur Erreichung ihres Zieles notwendig
erschien. Kirchen und Klster waren besonders ergiebige Quel-
len des Reichtums, den man unter den Parteigngern aufeilte,
um sich ihrer Loyalitt zu versichern. In Marseille konszierte
Antenor die Gter des Klosters Saint-Victor und befahl dem Abt,
alle Besitzurkunden auf den Hochaltar zu legen, um sie dann zu
verbrennen und so allen Versuchen knfiger bte vorzubeugen,
ihre Rechte geltend zu machen. Karl Martells viel diskutierte
Politik, Kirchengut zur Entlohnung seiner Anhnger zu kons-
zieren, war lediglich die Fortsetzung einer Strategie, die bereits
die principes des frhen 8. Jahrhunderts verfolgt hatten.
Diese Auseinandersetzungen innerhalb der Provence und in
anderen Regionen wirkten sich schlielich zum Vorteil Pippins
und Karl Martells aus. Wenn Antenor und Marontus sich als
principes durchzusetzen versuchten, so geschah das auf Kosten
anderer lokaler Magnaten; damit kmpfen sie nicht nur gegen
die Pippiniden, sondern auch gegen lokale Rivalen, die of ber
ebenso gute Verbindungen in der Region wie weit darber hinaus
verfgten. In der Provence kam der Hauptwiderstand von der
270
oben erwhnten, in Burgund und im Jura etablierten Sippe des
Waldelenus, die aus der Region Besanon stammte. Im spten
7. Jahrhundert hatte diese Familie, die enge Beziehungen zu
Austrasien unterhielt, in die Familie eingeheiratet, die um Susa,
Gap und Embrun die wichtigsten Alpenpsse nach Italien kon-
trollierte. Im ersten Drittel des 8. Jahrhunderts fhrte Abbo, das
Oberhaupt der Sippe, die lokale Opposition gegen Maurontus
an.
Diese lokalen Rivalitten mndeten in Fehden, die ber Gene-
rationen hin gefhrt wurden, und im Laufe der Zeit hielten alle
Parteien auerhalb der Region nach Verbndeten Ausschau, die
ihnen helfen konnten, die Waage zu ihren Gunsten zu senken.
Zwischen 720 und 740 setzte
Maurontus auf die Moslems in Septimanien und forderte Wali
von Narbonne auf, ihm in der Provence zu Hilfe zu kommen,
whrend Abbo mit Karl Martell kooperierte, der eine Reihe
von Feldzgen zur unteren Rhne unternahm. Wie in Spanien
und Aquitanien versuchten die Moslems, ihre ursprnglichen
Verbndeten zu entmachten und die Region zu besetzen. Karl
nutzte die Lage, um sich als Retter der Christenheit zu prolieren,
vertrieb die Moslems aus Septimanien, bernahm die Kontrolle
der Region, setzte den mit ihm verbndeten Abbo als patricius
ein und strkte dessen Position mit Besitztmern, die er von
seinen Gegnern konszierte, welche in den prokarolingischen
Quellen als Rebellen bezeichnet werden.
Aber Karl begngte sich nicht damit, einen Verbndeten zu
belohnen und ihm anschlieend die Mglichkeit zu lassen, er-
neut eine separatistische Bewegung in Gang zu setzen. Vielleicht
durfe Abbo, der sich relativ spt mit Karl verbndet hatte, nur
deshalb patricius werden, weil er keine legitimen Erben besa.
Vor seinem Tod vermachte er seinen gesamten Besitz, den durch
Generationen von Familienstrategen angehufen Reichtum
sowie den Lohn, den er von Karl fr seine treuen Dienste erhal-
ten hatte, seinem Familienkloster Novalesa in der Region des
271
heutigen italienischen Piemont. Mit Abbos Tod ging das Kloster
wie spter die groen neustrischen Klster in den Besitz der
Karolinger ber, womit diese zum strksten Machtfaktor der
Region wurden.
Bayern
Die einzige grere Region, die im frhen 8. Jahrhundert nicht
in den Einuberich der Pippiniden geriet, war Bayern. Am
Schnittpunkt der frnkischen, langobardischen, slawischen
und awarischen Welten gelegen, hatte sich Bayern unter seinen
agilolngischen Herzgen lange zuvor zur autonomen Region
entwickelt. Da die Agilolnger ihr Territorium ausdehnen und
unabhngig handeln konnten, verdankten sie zum groen Teil
ihrer Fhigkeit, sich ihren Nachbarn gegenber exibel zu ver-
halten und die unterschiedlichen Vlkerschafen ihres Reiches
zu einen. In den Zeiten starker frnkischer Zentralgewalt wie
unter Dagobert I. blieb Bayern keine andere Wahl, als sich der
Oberherrschaf der Merowinger zu unterwerfen, nicht zuletzt
auch wegen der Bedrohung, die vom slawischen Knigreich
des Samo und von den Awaren, den Nachfolgern der Hunnen
in Pannonien, ausging. Wenn diese Nachbarn gechwcht waren
wie nach dem Tod Samos (um 660), nutzten die Bayern die Lage
rasch aus und bauten ihre Stellung aus. Waren die Nachbarn aber
stark, wie zwanzig Jahre spter der langobardische Herzog von
Trient, muten sie sich zurckziehen, in diesem Falle aus der
Region Bozen in Sdtirol. Die Awaren, die das Knigreich des
Samo nun nicht mehr zu frchten brauchten, behaupteten das
Gebiet bis nach Lorch an der Enns.
Die Agilolnger grndeten ihre wachsende Autonomie unter
anderem auf das in Teilen Bayerns aus der Sptantike erhaltene
Fiskalland und auf die berreste der rmischen Verwaltungsor-
ganisation. Am deutlichsten zeigt sich dies daran, da sie ihren
272
Regensburger Hof im ehemaligen pretorium, der Residenz des
rmischen Statthalters, errichteten.
Die territoriale Expansion und die politische Einigung der
ethnisch gemischten Bevlkerung war mit der religisen Ei-
nigung eng verknpf; die Kmpfe um die Fhrungsrolle bei
der Missionierung und um die politische Vorherrschaf gingen
Hand in Hand. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts gehrten zu den
Einwohnern Bayerns nicht nur Remanen in den Alpenregionen,
die christlich orthodox geblieben waren, sondern auch Alpenbe-
wohner unterschiedlichen Bekenntnisses, Slawen und arianische
Germanen. Die Strategien zur Bekehrung dieser Vlker waren
so vielfltig wie die Vlker selbst.
Zunchst sicherten einzelne christliche Gemeinden wie in
Salzburg die Kontinuitt des sptantiken Christentums. Das
Ausma dieser Kontinuitt ist schwer zu bestimmen, aber die
Christianisierung Bayerns war anders als in anderen germa-
nischen Gebieten kein ausschlielich importiertes Phnomen,
sondern vollzog sich eher von innen.
Der zweite einzigartige Aspekt des bayerischen Christentums
waren seine alten Verbindungen zu Norditalien, besonders zu
Verona. Auch diese gingen auf die Sptantike zurck, wurden
durch die frhfrnkischen Eroberungen in Norditalien zustzlich
gestrkt und mit der Errichtung eines bayerischen Herzogtums
unter frnkischer Oberhoheit keineswegs unterbrochen. Unter
den Agilolngern stellte die enge Verwandtschaf des Herzogs
mit der langobardischen Knigsfamilie sicher, da diese Verbin-
dungen erhalten blieben.
Das irisch-frnkische Mnchtum kam ber Luxueil nach
Bayern. Seine ersten Vertreter waren der Abt Eustasius und der
Mnch Agrestius, die im ersten Drittel des 7. Jahrhunderts in
Bayern missionierten. Ihre Ttigkeit war wie die anderer Mis-
sionare, etwa des heiligen Emmeram, und wie im Westen Teil
der frnkischen Bemhungen, nicht nur das Christentum zu
verbreiten, sondern auch eine fest an das Frankenreich gebun-
273
dene Gesellschaf zu formen. Diese Art des Christentums ben-
tigten die bayerischen Herzge fr ihre eigene Konsolidierung.
Andererseits frchteten sie sich davor und betrachteten es zu
Recht als fnfe Kolonne und Bedrohung ihrer Autonomie,
da diese Kleriker und die von ihnen gegrndeten Institutionen
weiterhin enge Verbindungen mit dem Westen und besonders
mit Austrasien pegten.
So berrascht es nicht, da der Bayernherzog Teodo nicht
nach Westen, sondern nach Sden Ausschau hielt, um Unterstt-
zung bei der Kirchenorganisation zu nden, als er im frhen 8.
Jahrhundert das Machtvakuum im Frankenreich nutzte, um sein
Herzogtum zu einer zentralisierten Monarchie auszubauen. Er
reiste 76 nach Rom und bat Papst Gregor II., ihm beim Aufau
einer regulren Kirchenhierarchie behilich zu sein. Diese bay-
erisch-ppstliche Allianz war eine Vorwegnahme der Bndnisse,
die sowohl Eudo von Aquitanien als auch Karl Martell mit dem
Papst eingingen.
Bayern entwickelte sich nicht nur zu einem immer eigenstndi-
geren Reich, sondern im spten 7. Jahrhundert auch zunehmend
zum Zuuchtsort der Gegner der Pippiniden. Deren promi-
nentester Vertreter war Bischof Rupert von Worms, der um 694
oensichtlich freiwillig vom merowingischen Hof ins Exil ging
und nach Regensburg kam, wo er von Teodo aufgenommen
wurde und die Erlaubnis erhielt, die alte Rmerstadt Salzburg
zu seinem Sitz zu machen. Spter kehrte Rupert in den Westen
zurck, vermutlich um sich an der um Chilperich II. entstande-
nen, kurzlebigen Opposition zu beteiligen.
Anders als die anderen mehr oder weniger unabhngigen Rei-
che des spten 7. und frhen 8. Jahrhunderts bewahrte Bayern
seine Unabhngigkeit im wesentlichen bis in die Regierungszeit
Karls des Groen. Die Grnde dafr lagen in der Entfernung Bay-
erns vom Zentrum der karolingischen Macht, der erfolgreichen
Art, in der die Herzge ihre Allianzen mit den Langobarden und
gelegentlich auch mit den Awaren pegten, sowie in der Tatsa-
274
che, da Pippin und seine Nachfolger mit anderen, wichtigeren
Problemen zu kmpfen hatten.
Die anderen Regionen des Frankenreiches verhielten sich
eher wie Aquitanien und die Provence, nicht so sehr wie Bayern.
Friesen, Alemannen und Tringer kamen alle unter die Ober-
herrschaf Karl Martells, allerdings in einem aufwendigen und
zerstrerischen Proze. Aquitanien, Burgund und die Provence
hatten noch Generationen lang unter den materiellen Schden
der Eroberungen Karl Martells zu leiden. Aber die kulturellen
Auswirkungen auf die europische Gesellschaf machten sich
noch weit langfristiger bemerkbar.
Die gesellschaflichen Vernderungen
Der Westen hatte die Bischofsherrschaf seit der Antike gekannt,
als Bischfe wie Germanus von Auxerre im 5. Jahrhundert ihre
Gemeinden weit eektiver als lokale Bagauden vor einer of
feindlichen und indierenten Umwelt zu schtzen verstanden.
Zwischen 700 und 730 hatte sich die Bischofsherrschaf jedoch
radikal verndert. Betrachten wir den kurzen Bericht ber das
Leben des Bischofs Savarich, des Nachfolgers des Germanus,
aus der nahezu zeitgenssischen Geschichte der Bischfe von
Auxerre:
Savarich war, wie berichtet wird, von sehr hoher Geburt. Er
begann, ein wenig von den Pichten seines Standes abzuweichen
und sich mehr um weltliche Angelegenheiten zu kmmern, als
es einem Bischof angemessen war, und das in einem solchem
Ausma, da er sich mit Waengewalt die Gebiete von Orleans,
Nevers, Tonnerre und das Avallonais aneignete Unter Mi-
achtung der Wrde eines Bischofs stellte er eine groe Armee
auf; als er aber auf Lyon marschierte, um es mit Waengewalt
zu erobern, wurde er durch einen gttlichen Blitz getroen und
starb sofort.
0
275
Immerhin war Savarich Bischof gewesen. Sein Nachfolger
Hainmar, der als vocatus episcopus bezeichnet wird, war oen-
sichtlich weder ordiniert noch geweiht worden. Er habe sein
principatum fnfzehn Jahre lang gehalten, heit es, bevor er
zum Mrtyrer geworden sei, als er vor Karl Martell iehen
mute, den er zusammen mit Eudo von Aquitanien verraten
haben soll. Diese Kriegerbischfe oder genauer, diese Krieger, die
Bistmer innehatten, waren weit entfernt von den politischen
Bischfen des 6. Jahrhunderts und sogar von solchen wie Arnulf
von Metz und Leodegar von Autun.
Der radikale Wandel des Episkopats bestand nicht darin, da
Bischfe zu Schlsselguren im Kampf um die politische Vor-
herrschaf wurden oder da Bischofssitze als Privatbesitz und
Bollwerke der territorialen Organisation groer Adelsfamilien
galten. Auch ihre Bereitschaf, sich aktiv an den blutigen Aus-
einandersetzungen des 8. Jahrhunderts zu beteiligen, war nicht
neu. Dies alles gehrte zur langen Tradition des Episkopats und
wurde erst in den anachronistischen Wahrnehmungen spterer
kirchlicher Propagandisten als verwerich verdammt. Im 5. und 6.
Jahrhundert gab es sogar Bischofsdynastien, und bereits vor den
Franken waren Bischfe tief in die Politik verstrickt gewesen.Das
Neue bestand darin, da im Gegensatz zur frheren bischichen
Macht, die nicht nur auf weltlichen Verbindungen, sondern auch
stets auf der Stellung des Bischofs als Reprsentant und Wchter
der gttlichen Macht beruhte, der neue Bischofstyp vorwiegend
und sogar ausschlielich ein weltlicher Magnat war. Die Macht
der frheren Bischfe grndete auf der Kontrolle des Zugangs zu
heiligen Orten oder Gegenstnden, auf dem Reichtum und den
Verbindungen ihrer Familie sowie auf der bernahme sptrmi-
scher kultureller Traditionen, wozu so langeingefhrte Brger-
pichten wie die Armenhilfe und die Bewahrung des Friedens in
den Gemeinden gehrten. Die Macht und das Ansehen des neuen
Bischofs beruhten hingegen ausschlielich auf der Kontrolle ber
die materiellen Ressourcen einer oder mehrerer Dizesen.
276
Savarich und Hainmar waren keine Ausnahmen. Im ersten
Drittel des 8. Jahrhunderts vernderte sich das Amt des Bischofs,
die wichtigste Institution der Sptantike und der wichtigste Re-
prsentant der Romanitas, sehr schnell fast bis zur Unkenntlich-
keit. Und niemand zog greren Nutzen daraus als Karl Martell.
Sein Vetter Hugo war gleichzeitig Bischof von Rouen, Bayeux
und Paris und wahrscheinlich auch von Lisieux, Avranches und
Evreux; zugleich war er Abt von Saint-Wandrille, Saint-Denis
und Jumiges. Diese mterhufung wurde immer gebruchlicher.
In Trier trat ein Mann die Nachfolge seines Vaters nicht nur als
Bischof dieser Stadt an, sondern auch als Bischof von Laon und
Reims, wobei unklar ist, ob berhaupt einer von beiden ordiniert
war. Nach Hugos Tod ging die Skularisation bischicher und
klsterlicher mter noch weiter. Seine Nachfolger in Rouen und
Saint-Wandrille konnten nicht einmal lesen.
Karls Umgang mit den Bischofssitzen und den Klstern war
das Kennzeichen seines Konsolidierungsprozesses in Neustrien.
Die Methoden, mit denen sein Vater seine Position gefestigt hatte
Absorbierung anderer Sippen, Manipulation des Knigsge-
richts und bernahme der Schutzherrschaf ber die Klster ,
hatten sich als ungengend erwiesen. Versuche, die Familie des
neustrischen maior domus und ihre Verbndeten zu absorbieren,
waren langfristig erfolglos geblieben. Das Knigsgericht war un-
berechenbar geworden, da die Merowinger sich immer noch als
fhig erwiesen, unabhngig zu handeln und mit der Opposition
gemeinsame Sache zu machen; ihre Gerichte konnten daher nicht
mehr lnger als Bhne fr politische Manver genutzt werden.
So sollte die Kirche zum Brennpunkt der Konsolidierungsbe-
mhungen Karl Martells werden, aber nicht in der von seinem
Vater betriebenen Weise. Es sollte eine neue Kirche sein, die von
seinen Verwandten und treuesten Gefolgsleuten ohne Rcksicht
auf deren geistliche Ausbildung oder weltliche Erziehung, auf
lokale Kulturtraditionen und solche Nebenschlichkeiten wie
Bischofswahl und Konsekration beherrscht wurde.
277
Die einzige Einrichtung, die Karl mit Vorsicht und Respekt
behandelte, war Saint-Denis. Die riesigen Besitztmer der Basi-
lika waren, wie er sehr wohl wute, der Schlssel zur Macht in
Neustrien. Saint-Denis hatte Ragamfred gegen Karl untersttzt;
nach 77 wagte er erste vorsichtige Schritte, um die Kontrolle
zu bernehmen und ernannte seinen Neen Hugo zum Abt;
gleichzeitig schtzte er aber die umfangreichen Besitzrechte des
Klosters gegen Ansprche anderer und steigerte dessen Reichtum
durch die Schenkung der brigen Teile der groen merowingi-
schen villa Clichy-Ruvray, ein Besitz von schtzungsweise mehr
als 2000 Hektar. Mit dieser Schenkung wurde Saint-Denis zum
weitaus grten Grundbesitzer in der Region Paris. Natrlich
gehrte das Land zu dieser Zeit im selben Mae Karl wie Saint-
Denis so eng war die Verbindung zwischen ihm und dem
Kloster, da er seinen Sohn Pippin III. dort erziehen lie und bei
seinem Tod 74 in der Vorhalle der Basilika beigesetzt wurde.
Diese neue Situation der Kirche, die Karl zwar nicht initiiert,
aber gefrdert hatte, war fr das kulturelle und religise Leben
des Frankenreiches von entscheidender Bedeutung. Die zerst-
rerischen Kriege zur Befriedung des Landes und der Wandel des
Bischofsamtes verdrngten die Pege der Wissenschafen, die so
lange mit der Bischofskultur verbunden gewesen war. Verwstet
von den Armeen Karl Martells und seines Sohnes Pippin III.,
blieben weder Aquitanien noch die Provence jene Zentren der
Bildung, die sie lange Zeit gewesen waren. Die Tradition des
gebildeten Laien starb ganz aus, ebenso die Rolle von Laien in
den Kanzleien der Knige und der Hausmeier. Schreiben konnte
nur noch der Klerus, und entsprechend ging die in der gesamten
Merowingerzeit so wichtige Schriflichkeit insgesamt zurck.
Im Hinblick auf die rmische Kulturtradition und das gallor-
mische Selbstverstndnis waren diese Konsequenzen zweifellos
katastrophal. Karl Martell vollendete jedoch insgesamt, was keine
weltliche Macht in den vorangegangenen Jahrhunderten zustan-
de gebracht hatte. Durch die Manipulation der Kirchenmter, die
278
Konszierung des Kirchenbesitzes und die Ernennung ungebil-
deter, rein weltlicher Gefolgsleute gelang es ihm schlielich, die
religise Grundlage zu zerstren, auf der die unabhngige Macht
des frnkischen Episkopats lange Zeit beruht hatte. In Zukunf
wurden mittelalterliche Bischfe zu mchtigen Herren, die spter
mit Herzgen, Grafen und selbst Knigen um die Macht konkur-
rierten. Niemals mehr sollten sie wie in den vorangegangenen
Jahrhunderten ein Monopol ber das Heilige besitzen. Diese
Rolle, einhergehend mit einer Fhrungsposition im kulturellen
Leben, bernahmen die Klster.
Auf diesem Kahlschlag der religisen Kultur im frhen 8. Jahr-
hundert errichteten Karl und seine Nachfolger eine neue Form
des Episkopats sowie ein neues System der Klster. Darber
hinaus schufen sie gleichzeitig eine neue religise Grundlage
ihrer eigenen Herrschaf. Die Sulen dieses Gebudes waren die
angelschsischen Missionare und der rmische Papst.
Die angelschsische Mission
Das frhe 7. Jahrhundert war die groe Zeit des irischen Ein-
usses auf dem Kontinent gewesen; damals hatten Columban
und viele weniger berhmte Wandermnche nach ihm das
irisch-frnkische Christentum in enger Zusammenarbeit mit
dem Adel auf dem Kontinent verbreitet. Unter Pippin II. traten
zunehmend Angelsachsen als die aktivsten Missionare und
Reformer im Frankenreich an die Stelle der Iren. Diese beiden
Gruppen unterschieden Welten voneinander. Erstens besa Eng-
land im spten 7. Jahrhundert eine von ppstlichen Beaufragten
fest etablierte Bischofshierarche, ganz anders als die strker
monastisch geprgte dezentralisierte Kirchenstruktur in Irland,
die zu dieser Zeit bereits geschwcht war, oder das traditionelle
System der frnkischen Lokalkirchen. Zweitens war die angel-
schsische Kirche in enger Zusammenarbeit mit den Knigen
279
errichtet worden. Die Bischfe und bte waren es gewhnt, von
den Knigen, auf deren Territorien sie arbeiteten, kontrolliert zu
werden und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Schlielich war das
angelschsische Mnchtum benediktinisch geprgt. Augustin von
Canterbury und viele seiner Mitstreiter waren Mnche gewesen,
und die Ausbreitung des rmisch-episkopalen Christentums auf
der Insel verlief in engem Zusammenhang mit der Ausdehnung
der benediktinischen Klster, die Benedict Biscop in seinen
groen Klstern Wearmouth und Jarrow noch verstrkte. Diese
rmische und benediktinische Form des Christentums brachten
die angelschsischen Missionare auf den Kontinent.
Die ersten angelschsischen Missionare, Wilfrid und Willibrord,
konzentrierten sich auf Friesland, wo der politische Charakter
ihrer wie der folgenden Missionierung deutlich wurde. Wilfrid
war von Erzbischof Teodor von Canterbury als Bischof von
York abgesetzt worden, weil er sich der Aufeilung seiner groen
Dizese widersetzt hatte, und auf seinem Weg ber das Rheinland
nach Rom in Neustrien war er persona non grata, weil er die
Rckkehr Dagoberts II. untersttzt hatte stie er zuerst auf
die Friesen. 690 kam sein Nachfolger Willibrord und begann
in den von den Franken zurckeroberten Gebieten unter dem
Schutz PippinsII. seine Missionsttigkeit. Als erstes unternahm
er eine Reise nach Rom, um vom Papst die Billigung seiner
Ttigkeit zu erhalten. Fr einen frnkischen Kleriker wre das
unvorstellbar gewesen, fr einen angelschsischen aber war es
selbstverstndlich.
Christianisierung und Unterwerfung der Friesen gingen
Hand in Hand. Bekehrung bedeutete die bernahme des frn-
kischen Christentums und damit den radikalen Bruch mit der
gesellschaflichen und politischen Vergangenheit. Die Friesen
erkannten dies genau. Nach der Legende nahm Herzog Radbod
Unterricht in der neuen Lehre und stand kurz vor der Taufe, als
er Willibrord fragte, ob seine Vorfahren im Himmel oder in der
Hlle seien. Die orthodoxe Antwort lautete, als Heiden seien sie
280
sicher in der Hlle, er selbst werde aber als Getaufer gewi in
den Himmel kommen. Als Radbod dies hrte, lehnte er die Taufe
mit der Begrndung ab, er knne im nchsten Leben nicht ohne
seine Vorfahren auskommen.
Willibrord wurde mehr als 80 Jahre alt und starb 739. Teo-
retisch war er Oberhaupt eines autonomen Erzbistums unter
direkter Weisungsbefugnis des Papstes geworden. Pippin hatte
ihn nach Rom geschickt, damit er zum Erzbischof der Friesen
geweiht wrde, und grndete damit nach dem Vorbild der eng-
lischen Kirche einen neuen Metropolitansitz. Willibrord hatte
umfangreiche Missionsplne fr ganz Friesland und bis Dne-
mark und Sachsen entwickelt. Erfolgreich war er aber nur dort,
wo Pippin und spter Karl das Territorium kontrollierten, in
allen anderen Gebieten erlitt er nur Mierfolge. Darber hinaus
wurde seine Kirchenprovinz nach seinem Tode der frnkischen
Kirche einverleibt.
Willibrords berhmterer Nachfolger und Landsmann Winfrid,
dem der Papst den Namen Bonifatius gab, unter dem er allgemein
bekannt ist, stie bei seiner Missionsarbeit auf dieselben Schwie-
rigkeiten. Zunchst konzentrierte er sich auf Friesland, aber bald
begab er sich in rechtsrheinisches Gebiet. Wie Willibrord reiste er
nach Rom, um seiner Mission den ppstlichen Segen zu sichern;
79 erhielt er den Aufrag, den gentiles den wahren Glauben
zu predigen, womit vermutlich die Tringer gemeint waren.
Nach Anfangserfolgen in dieser Region kehrte er 722 nach Rom
zurck, um die Bischofsweihe zu empfangen, und ein weiteres
Mal 738, um den Aufrag einzuholen, die Kirche in Bayern und
Alemannien zu organisieren. Bonifatius wird zwar als Apostel der
Deutschen bezeichnet, aber einen Groteil seiner Missionsarbeit
leistete er in Gegenden, die bereits seit Generationen christlich
waren. Irisch-frnkische Missionare, Wanderbischfe und Adlige
aus rechtsrheinischen Regionen hatten in weiten Teilen Aleman-
niens, Tringens und besonders Bayerns christliche Gemeinden
aufgebaut, aber diese waren nicht in einer gemeinsamen Kirche
281
zusammengefat, und nicht alle befolgten die rmischen Tra-
ditionen. Dies wollte Bonifatius ndern. Auerdem waren diese
Kirchen keine politischen Machtinstrumente der Karolinger. Das
war zwar fr Bonifatius selbst nicht von allzu groer Bedeutung,
wohl aber fr seine karolingischen Frderer.
Diese Vernderungen stieen keineswegs auf allgemeine Zustim-
mung, besonders nicht bei vllig orthodoxen, wenn auch nichtr-
mischen Kirchenmnnern wie Bischof Virgil von Salzburg, einem
brillanten Iren, der dem rmischen Konformittszwang hartncki-
gen Widerstand entgegensetzte. Bonifatius war stets eifrig darauf
bedacht, in seinen Mandatsgebieten eine strikte Einhaltung der
rmischen Kirchenstrukturen und rmischer Vorstellungen von
Moral und religiser Tradition durchzusetzen. Wo dies durch Karl
Martell oder nach seinem Tod durch Pippin III. und Karlmann
erzwungen werden konnte, waren die Ergebnisse beachtlich, wenn
diese weltliche Untersttzung sich auch huger gegen autonome
Opponenten als gegen unmoralische, unqualizierte oder unwr-
dige Bischfe richtete, die von den Karolingern selbst ernannt
worden waren.
Die Missionsarbeit und das auerordentliche Organisationsta-
lent des Bonifatius trugen reiche Frchte. In Hessen, Tringen
und Franken errichtete er benediktinische Klster als Sttten der
Kulturvermittlung und Bistmer als kirchliche Kontrollzentren.
Den Wert seiner Form der zentralisierten Kirche schtzte auch
der immer noch unabhngige Herzog Odilo von Bayern, der
ihn einlud, die bayerische Kirche zu organisieren. Als Willibrord
starb, wurde dessen Provinz ebenfalls der Jurisdiktion des Bonifa-
tius unterstellt. 732 wurde er vom Papst zum Erzbischof ernannt
und stand damit an der Spitze eines riesigen, gut organisierten
und zunehmend reformwilligen hierarchischen Systems.
Karl und seine Nachfolger protierten in betrchtlichem Um-
fang von dieser Organisationsttigkeit. 743 war es mglich, ein
Konzil aller Bischfe Austrasiens unter dem Vorsitz von Karls
Sohn Karlmann einzuberufen. Dieses Konzil, das eine strenge
282
hierarchische Ordnung in der Kirche festlegen sollte, setzte den
Mastab fr knfige Synoden. Es wurde im Frhjahr einbe-
rufen, und el mit der jhrlichen Musterung auf dem Maifeld
zusammen, wodurch nicht nur Bischfe, sondern auch weltliche
Groe an der Versammlung teilnahmen. Auerdem wurden die
Konzilsbeschlsse nicht im Namen der Bischfe verkndet, wie
es seit der Antike der Brauch gewesen war, sondern im Namen
Karlmanns. Diesem Vorbild folgte bald eine 744 im Westen abge-
haltene Synode, die hnliche Beschlsse fate, womit auch dort
die Grundlage fr den Aufau einer Kirche nach austrasischem
Vorbild gelegt wurde. 745 und 747 fanden unter diesen Vorzei-
chen Konzile der gesamten frnkischen Kirche statt. Durch ihre
Untersttzung des Missionsbischofs hatten die Karolinger die
Kontrolle ber ein gut diszipliniertes und eektives Instrument
der zentralen Kontrolle erlangt.
Neben der Reformierung der Bischofskirche grndete Bo-
nifatius, der dem benediktinischen Mnchtum ein Leben lang
verbunden blieb, Klster und reformierte andere, die der be-
nediktinischen Tradition nher als der irisch-frnkischen oder
der gallormischen standen. Auch hierin wurde er von Karl und
seinen Shnen krfig untersttzt. Die Ausdehnung des benedik-
tinischen Mnchtums auf Kosten der lteren Formen monasti-
schen Lebens ist bezeichnend fr den wachsenden Einu der
Karolinger in der frnkischen Welt.
Bei allen Diensten, die er den Karolingern leistete, war Boni-
fatius dennoch nicht ihre Kreatur. Wre er das gewesen, htte er
nicht solche Erfolge erzielt. Um 742 wurde er, ber den Erzbi-
schofitel hinaus, auch zum missus Sancti Petri, zum Botschafer
des heiligen Petrus, ernannt.
2
Seine Legitimation erhielt er von
Rom, und diese rmische Legitimation versuchte er auch seiner
Kirche zu verleihen.
Anders als der merowingische grndete der neue frnkische
Episkopat nicht auf den lokalen Traditionen adliger Macht oder
in der Schutzherrschaf ber die lokalen Heiligen. Fr die po-
283
litischen Bischfe Karl Martells stand fest, da sie lediglich die
Untersttzung des maior domus bentigten. Aber Bonifatius und
seine Bischfe waren immer noch Auenseiter, die vom Papst er-
nannt oder von einem angelschsischen Missionsmnch erwhlt
worden waren; sie konnten sich nicht auf vor Ort gewachsene
religise Traditionen sttzen, sie muten ihre Legitimation im-
portieren, und zwar vorwiegend aus Rom.
Daher kam es im 8. Jahrhundert im gesamten Frankenreich
nicht nur zum Aufau eines Episkopats und von Klstern, die
sich an Rom orientierten, sondern auch in groem Umfang zum
Import von Heiligenreliquien aus Rom fr die neuen Kirchen.
Der Ansto dazu kam zum groen Teil aus Rom. 739 sandte
Papst Gregor III. Karl Martell die Schlssel zum Grab des hei-
ligen Petrus und ein Glied aus der Kette des Heiligen. Diese
Geschenke, wie sie noch nie zuvor gehrt und gesehen worden
waren
3
,
machten, wie der Fortsetzer der Fredegar-Chronik be-
richtet, im Frankenreich tiefen Eindruck. Darin irrte er. Schon
viel frher hatte der Papst Schlssel und Fesseln vom Grab des
heiligen Petrus verschenkt, und zwar an England, das er fest an
die rmische Kirche zu binden versuchte. Nun sollte mit diesen
Symbolen auch die frnkische Kirche an Rom gebunden werden.
Im Verlauf dieses Prozesses vernderte sich die Heiligengeogra-
phie Westeuropas. Die wichtigsten Berhrungspunkte zwischen
Himmel und Erde waren nun nicht mehr die Grber gallischer
Heiliger, heiliger Bischfe oder gar heiliger adliger Vorfahren.
Solche Stellen konnten nun berall sein, sie konnten verlegt
werden, und wohin, bestimmte Rom.
Das neue Knigtum
Die neu konstituierte frnkische Kirche wurde daher auf einem
ganz anderen Fundament der Heiligkeit als die ihrer merowin-
gischen Vorgngerin errichtet. Der Wandel der Heiligkeit des
284
Knigtums stellte dabei fast ein Nebenprodukt dar. Seit 78/9
war die Macht Karls und seiner Nachfolger unangefochten. Das
739 verfate Testament des Abbo war sogar datiert im 2. Jahr
der Herrschaf des berhmten Karl ber die frnkischen Knig-
reiche.
4
Inzwischen hatte es lngere Perioden hindurch nicht
einmal Merowinger gegeben, die als Galionsguren htten dienen
knnen. Frher waren solche Bezugspersonen notwendig oder
zumindest ntzlich gewesen, um das frnkische Knigreich zu
erhalten, denn sie verkrperten die Einheit des Reiches und die
Legitimitt der frnkischen Tradition im historischen Zusam-
menhang der Sptantike.
Um die Mitte des Jahrhunderts war diese Art der Identitt
und Legitimitt ein Anachronismus geworden, wenn sich auch
Magnaten aus den Randregionen gelegentlich zur Rechtfertigung
ihrer Opposition gegen die Karolinger wie zum Beispiel unter
Pippin II. darauf beriefen. Aber diese Tradition hatten die Rmer
und Angelsachsen, die das Frankenreich umgestalteten, nie recht
verstanden, und ihre fremdartige Auassung von Knigtum, be-
sonders der Grundsatz, da Knige nicht nur herrschen, sondern
auch regieren mssen, wurde auch von der frnkischen Elite
bernommen. Das karolingische Kirchensystem grndete auf der
importierten rmischen Heiligkeit; damit war es nur noch eine
Frage der Zeit, bis sich auch die politische Macht darauf berief.
Die Entwicklung vollzog sich allmhlich und gleichsam
natrlich und erwies sich sowohl fr den Papst als auch fr
den princeps als vorteilhaf. Die Ppste hatten seit dem frhen
8. Jahrhundert auerhalb Italiens nach Untersttzung ihrer
zunehmend unabhngigen, aber gegenber den Langobarden
prekren Position in Mittelitalien gesucht. Das Byzantinische
Reich konnte keinen wirksamen Schutz mehr bieten, auch waren
die Ppste nicht an einer Bevormundung durch Konstantinopel
interessiert. Sie hatten sich an die Bayern und die Aquitanier
gewandt, aber beide hatten sich nicht als so hilfreich wie erhof
erwiesen. So bat Gregor III. 739 Karl Martell um Hilfe und sandte
285
ihm die oben erwhnten Reliquien. Vielleicht plante Gregor die
Errichtung einer unabhngigen rmischen Herrschaf in Mitte-
litalien unter dem Schutz eines entfernten frnkischen Knigs.
Zwar wurde aus diesen ersten Kontakten nicht viel, aber mit
ihnen begann die lange und vielschichtige Beziehung zwischen
den Ppsten und den Karolingern.
Etwas mehr als zehn Jahre spter bentigte Karls Sohn Pippin
seinerseits die Hilfe des Papstes. Nachdem sein Vater gestorben
war und sein Bruder sich 747 entschlossen hatte, Mnch zunchst
in Montecassino, dann in Rom zu werden, war Pippin zwar der
alleinige Herrscher im Frankenreich, aber nicht der einzige, der
diese Herrschaf beanspruchte. Sein Halbbruder Grifo, der von
der Nachfolge ausgeschlossen worden war, war nicht weniger
mchtig als Pippin und bildete in den Randzonen des Knigreichs
einen bestndigen Kristallisationspunkt der Opposition. Auch
hatte Karlmann bei seinem Eintritt ins Kloster Shne hinter-
lassen, die eine zuknfige Bedrohung fr Pippins eigene Erben
darstellen konnten. Pippin bentigte daher eine Legitimation,
die sich von der rein politischen Macht unterschied und die
anderer frnkischer Groer und selbst die seiner eigenen Sippe
bertraf. Diese fand er an demselben Ort, an dem seine Kirche
ihre Heiligkeit gefunden hatte, in Rom.
So sandte er 749 oder 750 Bischof Burchard von Wrzburg und
Fulrad, den spteren Abt von Saint-Denis, wo Pippin erzogen
worden war, zu Papst Zacharias, um wegen der Knige in Fran-
cien zu fragen, die damals keine Macht als Knige hatten, ob das
gut sei oder nicht.
5
Dies war keine frnkische Fragestellung, son-
dern eine rmische, und die Antwort eine Selbstverstndlichkeit.
So wurde Pippin 75 auf Gehei des Papstes Zacharias gem
der frnkischen Sitte zum Knig gewhlt und entweder von
Bonifatius oder den frnkischen Bischfen gesalbt. Dieser Ritus
mit seinen biblischen, gotischen, irischen und angelschsischen
Reminiszenzen war eine Neuerung im Frankenreich niemals
zuvor war ein Knig durch einen kirchlichen Ritus in seinem Amt
286
besttigt worden. Frher hatten das Blut und die langen Haare der
Merowinger gengt. Der letzte Merowinger Chilperich III. taugte
nun nicht einmal mehr als anachronistisches Symbol, weshalb
man ihm die Haare abschnitt und ihn in ein Kloster steckte, wo
er den Rest seines Lebens verbrachte.
287
VII. Das Vermchtnis des merowingischen Europa
Die Nachkommen Chlodwigs hatten das Erbtheil seines krie-
gerischen und grimmigen Geistes verloren, und Unglck oder
Mangel an Verdienst hat dem letzten Knige des merowingischen
Geschlechtes den Beinamen der Faule verschaf. Sie bestiegen
den Tron ohne Macht und sanken ohne Namen in das Grab.
Ein lndlicher Palast in der Nhe von Compigne war ihnen zur
Residenz oder zum Gefngnisse angewiesen, aber jedes Jahr im
Monate Mrz oder Mai wurden sie in einem von Ochsen gezoge-
nen Wagen nach der Versammlung der Franken gefahren, um den
fremden Gesandten Audienz zu ertheilen und die Handlungen
des Major Domus zu genehmigen.
So beschrieb Edward Gibbon die letzten Merowinger in seiner
groartigen Geschichte des Verfalls und Untergangs des Rmischen
Reiches.
Sein Urteil fllt noch milde aus; die meisten Historiker
fhrten nmlich den Niedergang der Merowinger auf deren
persnliche Verderbtheit, ihre ererbte Degeneration oder auf
beides zurck. Auf die selbstherrliche Brutalitt und treulose
Grausamkeit Chlodwigs und seiner Nachfolger seien Impotenz,
Passivitt und Inkompetenz ihrer letzten Erben gefolgt. Die
gesamte Familie wurde in den letzten 200 Jahren nicht sehr
hochgeschtzt. Die Erben der europischen Tradition haben sich
mit der ganzen Epoche vom Sieg bei Soissons bis zur Salbung
Pippins auerordentlich schwergetan.
Whrend alle westeuropischen Lnder Karl den Groen
gerne als einen der Ihren beanspruchen und Paneuroper ihn
als Vater Europas bezeichnen, erhebt kaum jemand Anspruch
auf Chlodwig und nicht einmal auf Dagobert. In Deutschland
versuchten ganze Forschergenerationen in ihren Untersuchungen
der Stammesherzogtmer und ihrer Ursprnge, eine Kontinuitt
zwischen der Wanderungszeit und den bei der Ausung des
Karolingerreiches entstandenen Herzogtmern nachzuweisen.
288
Sie vergaen dabei hufig, da diese Stammesherzogtmer
knstliche, von den Merowingern und ihren Protagonisten ge-
schaene Gebilde waren.
In Frankreich geht die nationale Erinnerung in einem khnen
Sprung von der gallormischen Zeit des Syagrius wenn nicht
gar von den Zeiten des Asterix direkt zur glorreichen Epoche
Karls des Groen ber. Eine von drei zerstrerischen deutsch-
franzsischen Kriegen geprgte Tradition lie die Franzosen
vergessen, da es vor der douce France ein Frankono lant
gegeben hatte und da das Zentrum dieses frnkischen Landes
an der unteren Seine gelegen hatte. Les Francs sont-ils nos ance-
tres? (Sind die Franken unsere Vorfahren?), lautet der Leitarti-
kel der populren franzsischen Zeitschrif Histoire et Archeologie
aus dem Jahre 98.
2
In den meisten Epochen der europischen
Geschichte bevorzugte man es im allgemeinen zu beiden Seiten
des Rheins, diese Frage mit Nein zu beantworten.
Diese Abneigung, die Kontinuitt zwischen der Merowinger-
zeit und der spteren Geschichte Europas anzuerkennen, hat
eine Reihe von Grnden. Der erste und oensichtlichste ist die
Neigung, die antimerowingische Propaganda der Karolinger
und ihrer Anhnger unkritisch zu bernehmen, die das An-
sehen der merowingischen Knigsfamilie untergraben sollte.
Allzu hug wurde diese negative Beurteilung der Merowinger
fr bare Mnze genommen und als sachlich zutreende Ein-
schtzung der Dynastie und besonders ihres unrhmlichen
Endes aufgefat.
Dieses Bild der Merowingerfamilie erklrt zwar, weshalb die
nachfolgenden Dynastien nicht mit ihr assoziiert werden wollten,
nicht aber, warum die gesamte Epoche im historischen Urteil
so schlecht weggekommen ist. Ein Grund liegt vielleicht in der
besonderen Natur der Gesellschaf, der Kultur und der Institutio-
nen der Merowingerzeit. Die Welt, die wir untersucht haben, war
stets tief in der Sptantike verwurzelt und wurde im Vergleich
zu frheren oder spteren Perioden nie recht verstanden. Um
289
das negative Image der Merowingerzeit zu verstehen, mssen
wir beide Faktoren nher betrachten.
Die Rois Fainants
Gibbon sttzt sich bei seiner Beschreibung der letzten Merowin-
ger vorwiegend auf Einhard, der die Biographie Karls des Groen
mit einer abwertenden Beschreibung der Merowinger beginnt
und diese insgesamt als bedeutungslos darstellt. Nach Einhard
hatte die Familie schon lange vor der Absetzung Childerichs III.
jegliche Macht verloren und besa auer dem Knigstitel nichts
Hervorhebenswertes mehr. Childerichs Pichten bestanden dar-
in, mit langem Haupthaar und ungeschorenem Bart auf dem
Trone zu sitzen und den Herrscher zu spielen, die von berall
her kommenden Gesandten anzuhren und ihnen bei ihrem
Abgange die ihm eingelernten oder anbefohlenen Antworten
wie aus eigener Machtvollkommenheit zu erteilen berall,
wohin er sich begeben mute, fuhr er auf einem Wagen, den ein
Joch Ochsen zog und ein Hirte nach Bauernweise lenkte. So fuhr
er nach dem Palast, so zu der entlichen Volksgemeinde, die
jhrlich zum Nutzen des Reiches tagte, und so kehrte er dann
wieder nach Hause zurck.
3
In der Forschung ber das frhe 8. Jahrhundert wurde dieses
die aufstrebenden Karolinger begnstigende Bild lange Zeit ber-
nommen. Schon der erste Fortsetzer der Chronik des Fredegar
bemhte sich, den Liber Historiae Francorum, eine 727 vollen-
dete neustrische Chronik, im austrasischen und in der Folge
karolingischen Sinne zu berarbeiten. Die zweite Fortsetzung,
die Karl Martells Halbbruder Childebrand veranlate, lehnt sich
noch enger an die karolingische Tradition an. In diesen Texten
tauchen erstmals jene Beschreibungen der Merowinger auf, wie
sie jahrhundertelang weitertransportiert wurden. Childerich II.
zum Beispiel war haltlos und sehr jhzornig und brachte so
290
das Volk der Franken dazu, da es sich gegen ihn auehnte,
ihn verspottete und verachtete .. ..
4
Dies ist nicht das Bild eines
besonders gefhrlichen Knigs oder eines Tyrannen, sondern das
eines Knigs, der Verachtung verdient. Seine Frivolitt steht im
Gegensatz zur Beschreibung von Mnnern wie Grimoald, ein
Mann von groer Milde, voll Gte und Freundlichkeit, freigebig
mit seinen Almosen und eifrig im Gebet
5
. Karl Martell wird als
der beraus umsichtige dux bezeichnet.
6
Diese berlieferung, die mit Einhard ihren Hhepunkt erreicht,
qualiziert die Merowinger als lcherliche Anachronismen ab. Sie
erscheinen weniger strend als nutzlos. Natrlich kann man dieses
Urteil anfechten, ohne zu bestreiten, da das Bild im wesentlichen
zutrif. Der Knig mit seiner archaischen Haartracht und seinem
rituellen Ochsenkarren, der Gesandte empfngt und als Symbol
der Reichseinheit zu den jhrlichen Versammlungen der Franken
zieht, mu den neuzeitlichen Leser an den britischen Monarchen
erinnern, der in einer goldenen Kutsche vorfhrt, Botschafer
empfngt und jedes Jahr die von der Regierungspartei verfate
Rede zur Parlamentsernung vortrgt. Die symbolische Personi-
zierung des Knigreiches kann fr Gesellschafen auerordentlich
ntzlich und wichtig sein, auch wenn die Personen nicht regieren,
sondern gerade weil ihre Bedeutung auerhalb der Tagespolitik
liegt. Childerich reprsentierte die frnkische Tradition vor den
Franken und den anderen Menschen sowohl in seiner Erscheinung
als auch zweifellos in der Weise, wie er die jhrlichen Versamm-
lungen leitete. Sogar der Ochsenkarren war keineswegs ein Beweis
seiner Primitivitt, sondem ein altes Symbol frnkischer Identitt;
seit den Zeiten unseres Viehhndlers Stelus aus dem . Jahrhundert
war das religise und politische Leben der Germanen immer eng
mit dem Viehbestand verbunden gewesen. Die richtige Einscht-
zung einer solchen Bedeutung erforderte jedoch ein subtileres
Verstndnis der Tradition und ihrer Funktion fr die Herrschaf,
als es die Karolinger und ihre zunehmend strker romanisierten
Ratgeber aufzubringen vermochten.
291
Sie ersetzten die Merowinger auf der Grundlage einer neu-
en und langfristig auerordentlich wirksamen Legitimation.
Childerich wurde nicht wegen Tyrannei, Verbrechen, Unge-
rechtigkeit oder irgendeines Lasters abgesetzt, sondern schlicht
und einfach wegen seiner Inkompetenz. Wie Edward Peters
herausgearbeitet hat, wurde in die traditionelle Dichotomie
zwischen dem gerechten Knig und dem Tyrannen eine neue
und folgenreiche Kategorie eingefhrt, die des nutzlosen
Knigs, des rex inutilis.
7
Als Inbegri des nutzlosen Knigs
gingen die Merowinger in die Geschichte ein, und die gesamte
Geschichtsschreibung blickte auf sie nicht mit Furcht oder
Abscheu, was eine Knigsdynastie ertragen kann, sondern mit
Spott und Hohn. Diese Verachtung fr die letzten Merowinger
wurde auf ihre Vorgnger zurckprojiziert, sogar auf den gro-
en Knig Dagobert. Das franzsische Kinderlied Le bon roi
Dagobert vermittelt das Bild eines dummen und unfhigen
Mannes, und hinterhltigerweise auch das eines Knigs, dessen
treuer Berater Saint Eloi, der heilige Eligius von Noyon, auf ihn
aufpassen mu:
Le bon roi Dagobert
Avait sa culotte lenvers.
Le grand Saint Eloi lui dit: O mon roi!
Votre Majest est mal culotte.
Cest vrai, lui dit le roi,
Je vais la remettre lendroit.
Le bon roi Dagobert
Chassait dans la plaine dAnvers.
Le grand Saint Eloi lui dit: O mon roi!
Votre Majest est bien essoue!
Cest vrai, lui dit le roi,
Un lapin courait apres moi.
8
292
Einem Knig, der ohne Hilfe nicht einmal seine Hose anziehen
kann und entsetzt vor einem Hasen chtet, wird die Geschichte
kaum mit Respekt begegnen.
Den karolingischen Geschichtsschreibern gelang es vorzglich,
dieses Bild der Merowingerdynastie so plastisch zu gestalten, da
es ber Jahrhunderte hinweg erhalten blieb. Auch konnten sptere
politische Apologeten das Bild von einer Dynastie, die wegen
Inkompetenz ihre Macht verloren hatte, sehr gut gebrauchen.
Wenn ein Merowinger abgesetzt, ins Kloster geschickt und an
seiner Stelle ein neuer Knig gewhlt und gesalbt werden konnte,
dann konnte das auch einem Karolinger widerfahren. Weniger
als ein Jahrhundert spter geschah dies mit Ludwig dem From-
men, dem Sohn Karls des Groen. Und was noch wichtiger ist,
im 0. Jahrhundert wurde die Ablsung der Karolinger durch
die Sachsen und spter durch die Kapetingerdynastie mit den-
selben Argumenten gerechtfertigt, wie sie gegen die Merowinger
vorgebracht worden waren. Auch sie wurden als Taugenichtse,
als fainants, betrachtet und konnten daher um ihren Tron ge-
bracht werden. In Frankreich und spter auch in England sollte
die Tradition des Widerstands gegen Knige, die sich nicht auf
deren Tyrannei, sondern auf ihre Unfhigkeit berief, bis weit ins
7. und 8. Jahrhundert hinein fortleben, wenn auch am Ende des
8. Jahrhunderts Ludwig XVI., der Inbegri des fainant, nicht
ins Kloster, sondern auf die Guillotine geschickt wurde.
Das negative, von den Karolingern geschaene und aus politi-
schen Motiven stndig wiederholte Bild der Merowinger erklrt,
warum die Dynastie in einem so schlechten Licht dargestellt wurde,
gengt aber nicht zur Erklrung dafr, warum das 6. und 7. Jahr-
hundert, dieses fr die westeuropische Geschichte konstitutive
Zeitalter, genauso wenig geschtzt wird wie Dagobert und Chil-
derich. Das lt sich am besten mit dem fremdartigen Charakter
dieser Welt und der Sptantike erklren, die sie hervorbrachte.
Zum Abschlu werden wir deshalb einige der hervorstechendsten
Merkmale der frnkischen Gesellschaf betrachten.
293
Die Einzigartigkeit der frhfrnkischen Gesellschaf
Die merowingische Kultur entstand im Rahmen der Sptantike
und ging mit ihr unter. Ihre charakteristische politische Struktur
blieb das Knigreich des reichsgermanischen Armeekomman-
danten, der durch die Vereinnahmung der Mechanismen der
rmischen Provinzverwaltung seine knigliche Familie als
legitime Herrscher ber die westrmischen Provinzen nrdlich
der Pyrenen und der Alpen etablieren konnte. Seine Herrschaf
bestand vorwiegend im Kommando ber die frnkische Armee
und in der Rechtsprechung, das heit in der Durchsetzung
rmischen Rechts oder romanisierten Barbarenrechts, soweit
dies vor dem Hintergrund der Tradition seines eigenen Volkes
mglich oder angebracht war. Die wirtschafliche Grundlage
seiner Macht bildeten einerseits das umfangreiche rmische
Fiskalland und andererseits die fortdauernden Mechanismen
des rmischen Besteuerungssystems. Insgesamt beruhte die
Gesellschaf auf kleinen Einheiten, auf den sptantiken Std-
ten und ihren weitgehend intakten lokalen Machtstrukturen.
Wo immer es mglich war, ob in Nordgallien um Soissons, in
Trier oder im rheinischen Kln, im entfernten Regensburg oder
Salzburg, integrierten sich die Merowinger und ihre Protago-
nisten in diese erhaltenen rmischen Strukturen und bezogen
von ihnen ihre Macht und ihre Legitimation. In relativ kurzer
Zeit wurden die Kriegerbanden, welche die mobilen Streitkrfe
der reichsgermanischen Armeekommandanten gebildet hatten,
sehaf und verschmolzen mit der jeweiligen Einwohnerschaf.
Der entscheidende Unterschied zwischen dieser Gesellschaf
und den Goten in Italien und Spanien bestand darin, da sie
das orthodoxe Christentum der Einheimischen bernahm
und so eine rasche Assimilation der verschiedenen Gemein-
schafen in Europa ermglichte. Bis zum 8. Jahrhundert war
dieser Proze so weit vollendet, da er nicht nur eine neue
Welt hervorgebracht hatte, sondern zugleich die Vergangenheit
294
fr die nachfolgenden Generationen geradezu undurchsichtig
geworden war.
Ein wesentliches Merkmal des Frankenreiches war die oszillie-
rende politische und kulturelle Identitt seiner Einwohner. Fr
viele neuzeitliche Franzosen, die sich mit der rmischen Kul-
turtradition und ihrem Gegensatz zur germanischen Eroberung
und Besetzung identizieren, war die gallormische Aristokratie
der Merowingerzeit ein enttuschender Haufen. Die Gallormer
waren bereit, ihre rmische Kulturtradition gegen jeden Versuch
der rmischen Kaiser, in ihre lokalen Angelegenheiten einzugrei-
fen, zu verteidigen. Sie machten daher schnell und bereitwillig
gemeinsame Sache mit jedem Barbarenherrscher, der ihre Bedin-
gungen akzeptierte. Von Caesarius von Arles und Remigius von
Reims ber Eligius von Noyon und weit darber hinaus hatte r-
misches Selbstverstndnis nichts mit politischer Autonomie von
den Franken zu tun. Im politischen Bereich verhielten sich die
Eliten in Aquitanien und der Provence genauso wie ihre Gegen-
spieler im Norden; sie weigerten sich hartnckig, die modernen
Kategorien regionaler politischer Strukturen auf der Grundlage
kultureller und ethnischer Identitt anzuerkennen, und heira-
teten ohne Zgern in andere Eliten ein. Wenn auch gelegentlich
versucht wurde, den Sden als Hort heroischen Widerstandes
gegen die germanisch-frnkische Barbarei zu portrtieren, er-
scheinen die Eliten der Region dem neuzeitlichen Franzosen
berwiegend als eine Gesellschaf von Kollaborateuren.
Noch ratloser stand die Forschung vor den Franken des
Nordens, einer seltsamen Spezies von deutschsprachigen Krie-
gern, die sich der Einrichtungen der sptantiken rmischen
Verwaltung bedienten und deren hervorstechendste Merkma-
le, einschlielich des Knigtums, ein Produkt der rmischen
militrischen und zivilen Tradition waren. So stolz sie auf ihr
Frankentum waren, bemhten sie sich doch eifrig, die rmi-
sche Staatsreligion, das orthodoxe Christentum, zu frdern
und die Anerkennung ihrer Legitimitt durch den rmischen
295
Kaiser in Konstantinopel zu gewinnen. Das politische Schicksal
des Byzantinischen Reiches fllt fast ebenso viele Seiten der
merowingischen Chroniken wie das des Frankenreiches. Die
Leichtigkeit, mit der die Franken sich innerhalb einer Welt
von rmischen Stdten, des internationalen Fernhandels, der
gebildeten Herrschaf, des geschriebenen Rechts und der latei-
nischen Literatur etablierten, ohne ihre traditionellen Fehden,
Sippenstrukturen und persnlichen Allianzen aufzugeben,
verwirrt diejenigen zutiefst, die erwarten, da die Franken
sich wie die von Tacitus beschriebenen germanischen Stmme
verhielten. Es verwundert daher kaum, da deutsche Gelehrte,
die im 9. und frhen 20. Jahrhundert auf der Suche nach ihrer
Frhgeschichte zurckblickten, diese rmischen Franken zum
groen Teil bergingen und dem Mythos eines authentischen
germanischen Volkes stlich des Rheins den Vorzug gaben.
In Wirklichkeit waren sowohl die romanisierten Knigreiche
Galliens und im westlichen Deutschland als auch die sogenann-
ten Stammesherzogtmer stlich des Rheins Schpfungen der
merowingischen Welt. In beiden Regionen fhrten am Ende
des 5. Jahrhunderts eindeutig lokale Interessen zunchst zu
Personenverbnden um einzelne Frsten oder einureiche
Familien; spter, im Laufe des 7. Jahrhunderts, gingen aus diesen
vorwiegend zu militrischen Zwecken gebildeten Gruppierungen
etwa zur Abwehr der Basken in Aquitanien oder der Slawen in
Tringen territoriale Einheiten hervor, die das Vokabular der
ethnischen und kulturellen Solidaritt zu politischen Zwecken
einsetzten. Die politischen Organisationseinheiten, die Europa
im 0. und . Jahrhundert prgen sollten im Westen Aquitani-
en, Burgund, die Provence und Frankreich, im Osten Bayern,
Alemannien, Tringen und Sachsen , haben ihren Ursprung
in der Merowingerzeit. Zwar bezogen diese Gebiete ihre Namen
von lteren geographischen Einheiten oder Personenverbnden,
aber ihre Institutionen, ihre geographischen Grenzen und ihre
Fhrungsrolle entstanden im 7. Jahrhundert. Die Karolingerzeit
296
sollte lediglich eine Atempause im regional orientierten Ausbau
der spt-merowingischen Welt bilden.
Dieser tief verwurzelte Regionalismus war deshalb charakte-
ristisch fr die Merowingerzeit, weil die wichtigsten Protagoni-
sten der Zeit, die Franken ebenso wie die Rmer, aus den
Strukturen der gallormischen Sptantike und vorwiegend der
rmischen Provinzstdte hervorgegangen waren. Die Verlage-
rung des kulturellen und politischen Machtzentrums von der
Stadt aufs Land el mit dem Untergang der merowingischen Welt
zusammen. In weitem Umfang bedeutete dies gleichzeitig eine
Verlagerung der religisen Macht von der stdtischen Welt der
Bischfe auf die lndlichen Klster, ein Proze, der bereits im 6.
Jahrhundert eingesetzt hatte, im 7. und 8. Jahrhundert aber von
irischen und angelschsischen Mnchen vollendet wurde. Mit
der Verlndlichung der westeuropischen Kirche ging der Nie-
dergang der Stadt als wirtschafliches und politisches Zentrum
einher. Mit dem Rckgang des internationalen Fernhandels und
der steigenden Bedeutung der Klster im Wirtschafsleben des
Westens traten die Stdte ihre Funktion als Handelszentren an die
Klster ab, wofr Saint-Denis mit seiner groen Messe das ein-
drucksvollste Beispiel bietet. Ferner wurden die groen Klster
wie Corbie, St. Bavo in Gent und das Bonifatius-Kloster Fulda
zu Zentren der handwerklichen Produktion und zu wichtigen
Handelspltzen sowohl fr Nahrungsmittel als auch fr hand-
werkliche Erzeugnisse. Als die politische Bedeutung der Stdte
schwand, errichteten die Knige und ihre Groen ihre Hauptre-
sidenzen eher in lndlichen Villen als in den von Chlodwig und
seinen Nachfolgern bevorzugten Stdten. Die letzten Merowinger
residierten meist in Compigne, whrend die Karolinger den
grten Teil ihrer Zeit auf ihren Lieblingsgtern verbrachten,
bis Karl der Groe mit Aachen einen unbedeutenden Badeort
auf dem Land zu seiner Hauptresidenz erkor.
Die Machtzentren des Rmischen Reiches hatten den Westen
zunehmend vernachlssigt, eine Situation, die der Bevlkerung
297
sehr entgegenkam. Die Sprache und die Riten der internationa-
len rmischen Kultur wurden benutzt, um lokale Interessen zu
betonen. Dies galt besonders fr die wesentlichen Elemente der
merowingischen Macht die Heiligen, die Bischfe, die Knige
und den Adel. In der Sptantike und in der Merowingerzeit be-
zog jedes einzelne dieser Elemente seine Autoritt aus lokalen,
indigenen Wurzeln. Sobald sie von einer komplexen Ordnung
abhngig wurden, entstand eine neue Welt.
Im 6. Jahrhundert beruhte die religise Macht auf dem Lokal-
heiligen oder besser auf seinen Reliquien. Als ein Mdchen aus
Toulouse, das vom Teufel besessen war, zum Exorzismus nach
Sankt Peter in Rom gebracht wurde, weigerte sich der Dmon,
aus ihr auszufahren; er bestand darauf, da er nur von Remigius
von Reims ausgetrieben werden knne.
9
Wie Raymond Van Dam
gezeigt hat, betrachtete man Gallien, was die Kraf seiner Heiligen
und die seiner speziellen Schutzheiligen betraf, als unmittelbaren
Rivalen Roms.
0
Der Westen war bestrebt, sowohl im religisen
als auch im politischen Bereich seinen eigenen Weg zu gehen.
Im frhen 9. Jahrhundert kam ein taubstummes Mdchen aus
Aquitanien in das von Einhard im Rheinland gegrndete Kloster
Seligenstadt, nachdem der Vater erfolglos in mehreren anderen
Heiligtmern die Heilung seiner Tochter gesucht hatte. Als sie die
Basilika betrat, wurde sie von hefigen Krmpfen geschttelt, Blut
o ihr aus Mund und Ohren, und sie el zu Boden. Als man sie
aufob, konnte sie sprechen und hren, und sie verkndete, sie
sei von den in dieser Kirche verehrten Heiligen, Marcellinus und
Peter, geheilt worden, rmischen Mrtyrern, deren Reliquien kurz
zuvor aus Rom ins Frankenreich gebracht worden waren.
Diese beiden Wunder belegen die Verlagerung der religisen
Macht von den Merowingern auf die Karolinger. In beiden Fllen
manifestiert sich die religise Macht in Heiligen, und jedesmal
spielt die Handlung nrdlich der Alpen. Seit dem Ende der
Merowingerzeit wird diese Macht jedoch von Rom vermittelt.
Marcellinus und Peter waren in den Norden verbracht worden,
298
und zwar nicht in eine Stadt, sondern in ein auf dem Lande
gelegenes Kloster, das paradoxerweise den Namen Stadt der
Seligen erhalten hatte.
Parallel zu diesem Wandel vollzog sich, wie oben dargelegt,
die von Rom autorisierte Ernennung und Kontrolle frnkischer
Bischfe durch Bonifatius und die Karolinger. Die Wiederer-
richtung von Metropolitansitzen und die Einfhrung rmischer
Bruche und Normen anstelle der gallormischen und irisch-
frnkischen band die Macht der Bischfe strker an zentrale als
an lokale Quellen.
Die Merowinger waren ganz vorwiegend die Verkrperung
der lokalen Autoritt gewesen. Trotz Wahl und Weihe waren
sie Knige aus eigener Kraf, die von keiner ueren religisen
oder weltlichen Macht abhingen. Die Wahl und die Salbung
Pippins mit ppstlicher Billigung oder nach manchen berlie-
ferungen auch auf ppstliches Gehei nderte das Wesen dieses
Knigtums zutiefst und verknpfe es mit einer religisen und
institutionellen Tradition, die sich von der alten gallormischen
und frnkischen Welt tiefgreifend unterschied.
Schlielich erwuchs zusammen mit den Karolingern ein neuer
Reichsadel, der sich aus Adligen der unterschiedlichsten Her-
kunf zusammensetzte. Viele stammten aus alten austrasischen
Familien, andere aus regionalen Eliten, die die Karolinger in
den verschiedenen Reichsteilen untersttzt hatten; wieder an-
dere waren im Dienst der Karolinger oder gar ihrer Vorgnger
aufgestiegen, hatten sich aber rechtzeitig auf die Seite der Sieger
geschlagen. Aus dieser relativ kleinen Gruppe rekrutierten die
Karolinger ihre Bischfe und Grafen, die sie in das gesamte Reich
aussandten. Die Familien, die ihre Macht der Knigsgunst und
nicht ihren lokalen Beziehungen verdankten, waren nicht we-
niger als die rmischen Heiligen, die angelschsischen Bischfe
oder die karolingischen Knige darauf angewiesen, Macht und
Ansehen aus externen Quellen zu beziehen. Erst einige Zeit
spter sollten sie untereinander Heiratsverbindungen eingehen,
299
in den Gebieten, in die sie entsandt worden waren, Wurzeln
schlagen und die regionalen Adelshuser des Hochmittelalters
errichten. Obwohl diese Vernderungen im Namen der rmi-
schen Tradition vollzogen worden waren, blieb am Ende des 8.
Jahrhunderts, als sich diese neuen Krfe durchgesetzt hatten,
vom authentischen sptrmischen Westen nicht mehr viel brig.
Jenes Rom, das Bonifatius gefrdert hatte, war selbst eine neue,
knstliche Schpfung, ebenso wie die in karolingischen Kreisen
gepegte lateinische Literatur und das karolingische Herrscher-
bild. Und dennoch bentigte diese transformierte barbarische
Welt so dringend eine rmische imperiale Tradition, dringender
sogar als im 6. Jahrhundert, da Karl Martells Enkel an einem
Weihnachtstag des Jahres 800 den Titel eines Imperator und
Augustus erhielt. Die barbarische Welt, jene Schpfung Roms,
war zu dessen Schpfer geworden.
300
Anmerkungen
Vorwort
1 Florus Diaconus, Opusculus adversus Amalarium, in: Migne,
PL, Bd. 119, S. 82 (A).
I. Das Westrmische Reich am Ende des 5. Jahrhunderts
1 P. C. J. A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, sGravenhage
1951, S. 130, Tafel 16.
2 Das Leben des heiligen Severin. Lateinisch und deutsch, hg. v.
Rudolf Noll, Passau 1981, 22, S. 87.
3 Walter Goart, Barbarians and Romans A.D. 418-584: Te
Techniques of Ac commodation, Princeton 1980.
4 Walter Goart, Caput and Colonate: Towards a History of Late
Roman Taxation, Toronto 1974.
5 Vita patrum Iurensium Romani, Lupicini, Eugendi, II, 10, in:
MGH, Scriptores rerum Merovingicarum (in der Folge SSRM),
Bd. 3, S. 149.
6 Martin Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur
Kontinuitt rmischer Fhrungsschichten vom 4. bis zum
7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungs-
geschichtliche Aspekte (= Beihefe der Francia 5), Mnchen
1976.
7 Raymond Van Dam, Leadership and Community in Late An-
tique Gaul, Berkeley 1985, S. 5156.
301
II. Die barbarische Welt bis zum 6. Jahrhundert
1 P. Cornelius Tacitus, Germania. Bericht ber Germanien. La-
teinisch und deutsch, bersetzt von Josef Lindauer, Mnchen
1983, S. 68.
2 Hier und an anderen Stellen dieses Kapitels sttzt sich der
Verfasser auf Bruno Krger (Hg.), Die Germanen. Geschichte
und Kultur der germanischen Stmme in Mitteleuropa, Bd.
1: Von den Anfngen bis zum 2. Jahrhundert unserer Zeit
rechnung, 2. Auage, Berlin 1978.
3 Plinius Maior, Naturalis historia, hg. v. C. Mayho, Leipzig
1892, 18, 44.
4 C.Julius Caesar, Der Gallische Krieg, bersetzt von Otto Schn-
berger, Z richMnchen 1990, 22, S. 143.
5 Horst Wolfgang Bhme, Germanische Grabfunde des 4. bis 5.
Jahrhunderts zwischen unterer Elbe und Loire. Studien zur
Chronologie und Bevlkerungsgeschichte, 2 Bde. (= Mnch-
ner Beitrge zur Vor- und Frhgeschichte 19), Mnchen
1974.
6 Im folgenden sttze ich mich weitgehend auf Herwig Wolfram,
Die Goten. Von den Anfngen bis zur Mitte des 6. Jahrhun-
derts. Entwurf einer historischen Eth nographie, 3. neubearb.
Au., Mnchen 1990.
1
7 Hans Zeiss, Frstengrab und Reihengrbersitte, in: Forschun-
gen und Fortschritte 12, 1936, S. 302f.; Neudruck in: Siedlung,
Sprache und Bevlkerungsstruktur im Frankenreich, hg. v.
Franz Petri (= Wege der Forschung 49), Darmstadt 1973, S.
282.
III. Rmer und Franken im Knigreich Chlodwigs
1 Gregor von Tours, Historiarum libri decem. Zehn Bcher
Geschichten, Bd. 1.2, Darmstadt 1964 (= Freiherr vom Stein-
302
Gedchtnisausgabe 2,3), II, 9, S. 89.
2 Chronicarum quae dicuntur Fredegarii libri quattuor. Die vier
Bcher der Chroni ken des sogenannten Fredegar, in: Quellen
zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhun derts (= Freiherr vom
Stein-Gedchtnisausgabe 4a), Darmstadt 1982, III, 2, S. 85.
3 Zitiert bei Joachim Werner, Zur Entstehung der Reihengrber-
zivilisation. Ein Beitrag zur Methode der frhgeschichtlichen
Archologie, in: Siedlung, Sprache und Bevlkerungsstruktur,
hg. v. Franz Petri (= Wege der Forschung 49), Darm stadt 1973,
S.294.
4 MGH, Epp., Bd. 3, S. 113.
5 Ian Wood, Gregory of Tours and Clovis, in: Revue beige de
philologie et dhistoire 63, 1985, S. 249272; Friedrich Prinz,
Grundlagen und Anfnge. Deutsch land bis 1056 (= Neue
Deutsche Geschichte, hg. v. Peter Moraw, Volker Prss und
Wolfgang Schieder, Bd. 1), Mnchen 1985, S. 63f.
6 Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschichten, II, 37, S. 129.
7 Ibid., II, 38, S. 135.
8 Ibid., II, 42, S. 141.
9 Lex Salica, Prolog 2, in: MGH, LL nat. Germ., Bd. 4 (2), S. 2f.
10 Lex Salica 82, 2, S. 142. Herrn Professor Poly danke ich fr die
freundlicherweise gewhrte Einsichtnahme in das Manuskript
seiner Untersuchung der Lex Salica.
11 Hier sttze ich mich auf Ian Wood, Kings, Kingdoms and Con-
sent, in: P. H. Sawyer und Ian Wood (Hgg.), Early Medieval
Kingship, Leeds 1977, S. 629.
12 Carl Joseph von Hefele, Conciliengeschichte. 2. Auage, Bd.
2, Freiburg 1875, S. 683; MGH, Conc. S.21.
13 Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschichten, III, 34, S. 187.
14 Ibid., X, 26, S. 389.
15 Rene Joroy, Le cimetire de Lavoye: Ncropole mrovingi-
enne, Paris 1974.
16 Jean Chapelot und Robert Fossier, Te Village and House in
the Middle Ages, Berkeley 1985, S. 54f.
303
17 H. Ament, Frnkische Adelsgrber von Flonheim in Rhein-
hessen (= Germanische Denkmler der Vlkerwanderungszeit
5), Berlin 1970, S. 157.
18 Heike Grahn-Hoek, Die frnkische Oberschicht im 6. Jahr-
hundert. Studien zu ihrer rechtlichen und politischen Stellung
(= Vortrge und Forschungen, Sonder band 21), Sigmaringen
1976.
19 Franz Irsigler, Untersuchungen zur Geschichte des frhfrn-
kischen Adels (= Rheinisches Archiv. Verentlichungen des
Instituts fr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an
der Universitt Bonn 70), Bonn 1969.
20 Karl Bosl, Freiheit und Unfreiheit. Zur Entwicklung der
Unterschichten in Deutschland und Frankreich whrend des
Mittelalters, in: Vierteljahrsschrif fr Sozial- und Wirtschafs-
geschichte 44, 1957, S. 193219; Neudruck in: Frhformen der
Gesellschaf im mittelalterlichen Europa, Mnchen 1964, S.
180203.
IV. Das Frankenreich im 6. Jahrhundert
1 Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschichten, IV, 28, S. 233.
2 Ibid., VI, 46, S. 85.
3 Martin Heinzelmann, Laristocratie et les vchs entre Loire
et Rhin jusqu la n du VIP sicle, in: Revue dhistoire de
lglise de France 62, 1975, S. 7590.
4 Venantius Fortunatus, Carmina, Lib. IV, 10, in: MGH, Auct.
ant., Bd. 4 (1).
5 Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschichten, V, 5, S. 287.
6 Ibid., VI, 15, S.35.
7 Ibid., IV, 6, S. 201.
8 Gregor von Tours, Liber vitae Patrum, in: MGH, Scriptores
rerum Merovingicarum, Bd. 1 (2), S. 6S7.
9 Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschichten, VI, 7, S. 21.
304
10 Ibid., II, 17, S.99.
11 Ibid., II, 22, S. 103 f.
12 Ibid., IV, 36, S. 247.
13 Ibid., V, 48, S. 4748, S. 367.
14 Ibid., VI, n,S.27.
15 Ibid., V, 36, S. 347.
16 Ibid., VI, 36, S.65.
17 Ibid., V, 42, S. 357.
18 Ibid., IV, 36, S. 245.
19 Ibid., VIII, 20, S. 187f.
20 Ibid., VIII, 22, S. 191.
21 Concilium Aurelianense, anno 533, canon 20 und Concilium
Aurelianense, anno 541, canon 15, MGH, Conc, Bd. 1, S. 64
und 90.
22 Besonders Relics and Social Status in the Age of Gregory of
Tours, in: Peter Brown, Society and the Holy in Late Antiquity,
Berkeley 1982, S. 222250.
23 Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschichten, VIII, 15, S. 181
f.
24 Ibid., IV, 34, S. 241 f.
25 Gregor von Tours, Liber vitae patrum, S. 705709.
26 Jacques Le Go, Time, Work and Culture in the Middle Ages,
Chicago 1980, S. 153158.
27 MGH, Capit., Bd. 1 (1), S. 164.
28 Vinzenz von Lrins, Commonitorium 2, 3, hg. v. R. S. Moxon,
Cambridge 1915, S. 10.
29 Carl Joseph von Hefele, Conciliengeschichte, 2. Au., Freiburg
1875, Bd. 2, S. 664; MGH, Conc, Bd. 1, S. 7.
30 Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschichten, IX, 39, S. 297f.
31 Liber in gloria confessorum, 85, in: MGH, SSRM, Bd. 1, S.
802803.
305
V. Das Frankenreich unter Chlothar II. und Dagobert I.
1 Chroniken des Fredegar, IV, 42, S. 201.
2 Childeberti secundi decretio, in: MGH, Capit., Bd. 1, S.
1523.
3 Chroniken des Fredegar, IV, 58, S. 223.
4 Chroniken des Fredegar, IV, 87, S. 263.
5 Vita Desiderii Cadurcae urbis episcopi, in: MGH, SSRM, Bd.
4, S. 569.
6 Ibid., S. 571 f.
7 Chroniken des Fredegar, IV, 60, S. 227.
8 Vita Eligii episcopi Noviomagensis liber II, 20, in: MGH,
SSRM, Bd. 4, S. 712.
9 J. Guerout, Le testament de Sainte Fare: matriaux pour ltude
et ldition criti que de ce document, in: Revue dhistoire ec-
clesiastique 60, 1965, S. 761821.
10 Bailey K.Young, Exemple aristocratique et mode funeraire
dans la Gaule mero vingienne, in: Annales ESC 41, 1986, S.
396401.
11 Vita Audoini episcopi Rotomagensis, in: MGH, SSRM, Bd. 5,
S. 555.
12 Stphane Lebecq, Dans lEurope du nord des VII
e
IX
e
siecles:
Commerce frison ou commerce franco-frison?, in: Annales
ESC 41, 1986, S. 361377.
VI. Der Niedergang der Merowinger
1 Gesta Dagoberti I. regis Francorum, in: MGH, SSRM, Bd. 2,
S. 408.
2 Chroniken des Fredegar, IV, 58, S. 223 f.
3 Virtutes Fursei abbatis Latiniacensis, in: MGH, SSRM, Bd. 4,
S. 444.
4 Chroniken des Fredegar, IV, 90, S. 267 f. J.M. Wallace-Hadrill,
306
Te Long-Haired Kings and Other Studies in Frankish History,
New York 1962, S. 142 f.
5 Vita Sanctae Balthildis, in: MGH, SSRM, Bd. 2, S. 493 f.
6 Liber historiae Francorum. Das Buch von der Geschichte der
Franken, in: Quel len zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts
(= Freiherr vom Stein-Gedchtnisausgabe 4a), Darmstadt
1982, 43, S. 365 f.
7 Paul J. Fouracre, Observations on the Outgrowth of Pippinid
Inuence in the Regnum Francorum afer the Battle of Tertry
(687715), in: Medieval Prosopo graphy 5, 1984,5.131.
8 Erchanbertus, Breviarum regnum Francorum, in: MGH,
Scriptores, Bd. 6, S. 328.
9 Ex miraculis S. Martialis, in: MGH, Scriptores, Bd. 15, S.
281.
10 Ex Gestis episcoporum Autisiodorensium, in: MGH, Scripto-
res, Bd. 13, S. 394.
11 Vita Vulframni, in: MGH, SSRM, Bd. 5, S. 668.
12 Concilium in Austria habitum q. d. Germanicum, 742, in:
MGH, Conc, Bd. 2 (1), S. 3.
13 Chronicarum quae dicuntur Fredegarii continuationes. Die
Fortsetzungen der Chroniken des sogenannten Fredegar, in:
Quellen zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts (= Frei-
herr vom Stein-Gedchtnisausgabe 4a), Darmstadt 1982, 22,
S.293.
14 Testamentum, hg. v. Patrick J. Geary, in: ders., Aristocracy in
Provence: Te Rhne Basin at the Dawn of the Carolingian
Age, Philadelphia 1985, S. 40f.
15 Annales regni Francorum. Die Reichsannalen, in: Quellen zur
karolingischen Reichsgeschichte. Erster Teil (= Freiherr vom
Stein-Gedchtnisausgabe 5), Darmstadt 1955, S. 15.
307
VII. Das Vermchtnis des merowingischen Europa
1 Gibbons Geschichte des allmligen Sinkens und endlichen
Unterganges des rmi schen Weltreiches. Deutsch von Johann
Sporschil. In 12 Bnden. Vierte Auage, Leipzig 1863, Bd. 10,
Kap. 52, S. 113.
2 Nr. 56, September 1981.
3 Einhard, Vita Karoli. Leben Karls des Groen, in: Quellen zur
karolingischen Reichsgeschichte. Erster Teil (= Freiherr vom
Stein-Gedchtnisausgabe 5), 1, Darmstadt 1955, S. 167f.
4 Fortsetzungen des Fredegar, 2, S. 273.
5 Ibid., 6, S. 281.
6 Ibid., 18, S. 289.
7 Edward Peters, Te Shadow King: Rex Inutilis in Medieval
Law and Literature 7511327, New Haven 1970.
8 Jean-Edel Berthier, 1000 Chants 2, Paris 1975, S. 50.
9 Venantius Fortunatus, Vita Sancti Remedii, MGH, Auct. ant.,
Bd. 4 (2), S. 6467.
10 Raymond Van Dam, Leadership and Community, S. 171.
11 Einhard, Translatio et miracula SS Marcellini et Petri, 3, 5, in:
MGH, Scriptores, Bd.15(1),S. 249f.
308
Literaturhinweise
1. Quellen
Die magebliche Quellenkunde zur merowingischen Geschich-
te ist Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im
Mittelalter; . Hef, Weimar 952; Beihef: Die Rechtsquellen,
hg. v. Rudolf Buchner, Weimar 953. Deutsche bersetzungen
mittelalterlicher Quellen sind in der Sammlung der Freiherr vom
Stein-Gedchtnisausgabe (FSGA) der Wissenschaflichen Buch-
gesellschaf Darmstadt, Abteilung A, erschienen: Ausgewhlte
Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Folgende Titel
betreen unser Tema: Gregor von Tours, Zehn Bcher Geschich-
ten (Frnkische Geschichte), hg. v. Rudolf Buchner, 2 Bde. (=
FSGA 2 und 3), j./S. Au., Darmstadt 990; Quellen zur Geschichte
des 7. und 8. Jahrhunderts, hg. v. Herwig Wolfram (= FSGA 4 a),
2. Au., Darmstadt 994. Darin Die vier Bcher der Chroniken
des sogenannten Fredegar, Die Fortsetzung der Chroniken des
sogenannten Fredegar, Das Buch von der Geschichte der Franken
und Jonas erstes Buch vom Leben Columhans. Ferner Quellen zur
karolingischen Reichsgeschichte, 3 Teile (= FSGA 57), Darmstadt
95 5960. Im Ersten Teil (= FSGA): Die Reichsannalen und
Einhard, Leben Karls des Groen.
2. Allgemeine Literatur
Die Geschichte der Franken insgesamt und die Merowingerzeit
im besonderen behandeln: Edward James, Te Origins of France:
From Clovis to the Capetians, 500000, London 982 (dort n-
det sich auch eine ausfhrliche Bibliographie); Friedrich Prinz,
Grundlagen und Anfnge: Deutschland bis 056 (= Neue deutsche
Geschichte, hg. v. Peter Moraw, Volker Prss und Wolfgang Schie-
309
der, Bd. ), Mnchen 985; Karl Ferdinand Werner, Die Ursprnge
Frankreichs bis zum Jahr 000 (= Geschichte Frankreichs, hg. v. Jean
Favier, Bd. ), Stuttgart 989; Patrick Perin und Laure-Charlotte
Feer, Les Francs, Bd. : A la conqute de la Gaule, Bd. 2: A Vo-
rigine de la France, Paris 987; Bruno Gebhardt, Handbuch der
deutschen Geschichte, Bd. , Stuttgart 970. Neuerdings siehe auch
Reinhold Kaiser, Das rmische Erbe und das Merowingerreich (=
Enzyklopdie deutscher Geschichte 26), Mnchen 993, sowie Ian
Wood, Te Merovingian Kingdoms 45075, London 994.
I. Das Westrmische Reich am Ende des
5. Jahrhunderts
Arnold Hugh Martin Jones, Te Later Roman Empire, 3 Bde.,
Oxford 964, bleibt immer noch das wichtigste englische Stan-
dardwerk. Weitere wichtige Abhandlungen sind Peter Brown,
Religion and Society in the Age of Saint Augustine, Berkeley 969;
ders., Te World of Late Anitquity A.D. 50750, New York 97;
ders., Te Cult of
the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago
98; ders., Society and the Holy in Late Antiquity, Berkeley 982,
sowie Ramsay MacMullen, Soldier and Civilian in the Later Ro-
man Empire, Cambridge, Mass. 963. Standardwerk zum Tema
der gallormischen Adelsfamilien bleibt Karl Friedrich Strohe-
ker, Der senatorische Adel im sptantiken Gallien, Reutlingen
948. Eine wichtige Untersuchung ist auch Raymond Van Dam,
Leadership and Community in Late Antique Gaul, Berkeley 985.
Die Kontinuitt der rmischen politischen Ideologie in Ost und
West verfolgt Michael McCormick, Eternal Victory: Triumphal
Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval
West, Cambridge 986.
310
II. Die barbarische Welt bis zum 6. Jahrhundert
E. A. Tompson verentlichte zahlreiche Arbeiten ber die
Barbaren, besonders erwhnenswert ist Romans and Barhari-
ans: Te Decline of the Western Empire, Madison 982. Immer
noch ntzlich ist der berblick von J. M. Wallace-Hadrill, Te
Barbarian West: Te Early Middle Ages A. D. 400000, London
962. Weitere wichtige Arbeiten verentlichten: Walter Go-
art, Barbarians and Romans, A.D. 48584: Te Techniques of
Accommodation, Princeton 980; Lucien Musset, Les Invasions.
. Les Vagues germaniques, 2ieme ed. mise jour, Paris 969;
Alexander C. Murray, Germanic Kingship Structure. Studies in
Law and Society in Antiquity and the Early Middle Ages, Toronto
983. Die grundlegende methodische Untersuchung verfate
Reinhard Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden
der frhmittelalterlichen gentes, Wien-Kln. 2. Au. 977. Inhalt-
lich und methodisch beraus erhellend zum Tema Goten ist
Herwig Wolfram, Die Goten. Von den Anfngen bis zur Mitte
des 6. Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie, 3.
neubearb. Au., Mnchen 990; ferner ders., Te Shaping of the
Early Medieval Principality as a Type of Non-Royal Rulership, in:
Viator 2, 97, S. 335. Zur Sptzeit der Ostgoten vgl. Tomas
Burns, Te Ostrogoths, Bloomington 984. Die archologischen
Forschungsergebnisse sind zusammengefat in: Bruno Krger
(Hg.), Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen
Stmme in Mitteleuropa, Bd. : Von den Anfngen bis zum 2.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung, 2. Au., Berlin 978. Weitere
wichtige Arbeiten sind: Joachim Werner, Zur Entstehung der
Reihengrberzivilisation, in: Siedlung, Sprache und Bevlkerungs-
struktur im Frankenreich (= Wege der Forschung 49), hg. v. Franz
Petri, Darmstadt 973, S. 285325; Horst Wolfgang Bhme, Germa-
nische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen unterer Elbe
und Loire. Studien zur Chronologie und Bevlkerungsgeschichte,
2 Bde. (= Mnchner Beitrge zur Vor- und Frhgeschichte 9),
311
Mnchen 974; ders., Archologische Zeugnisse zur Geschichte
der Markomannenkriege (6680 n. Chr.), in: Jahrbuch des R-
misch-germanischen Zentralmuseums 22, 975, S. 5327. Zu den
Vlkerschafen der Donauregion vgl. Herwig Wolfram und Falko
Daim (Hgg.), Die Vlker an der mittleren und unteren Donau im
fnfen und sechsten Jahrhundert, Wien 980.
III. Rmer und Franken im Knigreich Chlodwigs
Grundlegend fr die frhfrnkische Zeit ist Erich Zllner, Ge-
schichte der Franken bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, Mnchen
970. Die Arbeiten von Eugen Ewig umfassen die gesamte Mero-
wingerzeit. Wichtige Beitrge enthlt die Sammlung Sptantikes
und frnkisches Gallien. Gesammelte Schrifen (952973) (=
Beihefe der Francia 3), hg. v. Hartmut Atsma, 2 Bde., Mnchen
976979; vgl. auch ders., Die Merowinger und das Franken-
reich, 2. Au., Stuttgart-Berlin-Kln 993. Siehe auch die Unter-
suchungen von J. M. Wallace-Hadrill, Te Long-Haired Kings and
Other Studies in Frankish History, New York 962; Ian Wood, Te
Merovingian Kingdoms 45075, London 994. Zur merowin-
gischen Archologie vgl. Patrick Perin, La datation des tombes
mrovingiennes. Historique Mthodes Applications, Genf 980.
Auch Schler von Wallace-Hadrill lieferten wichtige Beitrge zur
Geschichte der Merowinger. Vgl. insbesondere: Wendy Davies
und Paul Fouracre (Hgg.), Te Settlement of Disputes in Early
Medieval Europe, Cambridge 986; P. H. Sawyer und I. N. Wood
(Hgg.), Early Medieval Kingship, Leeds 977; Patrick Wormald,
Donald Bullough und Roger Collins (Hgg.), Ideal and Reality
in Frankish and Anglo-Saxon Society. Studies presented to J. M.
Wallace-Hadrill, Oxford 983.
Zur Familien- und Gesellschafsstruktur vgl. David Herlihy,
Medieval Households, Cambridge 985; Suzanne Fonay Wemple,
312
Women in Frankish Society: Marriage and the Cloister 500900,
Philadelphia 98. Zur Wirtschaf der Merowingerzeit vgl. Renee
Doehaerd, Le Haut Moyen ge occidental, conomies et socites,
Paris 97; Robert Latouche, Les Origines de lconomie occidentale,
IVXIe sicle, Paris 956; Georges Duby, Krieger und Bauern: die
Entwicklung von Wirtschaf und Gesellschaf im frhen Mittelalter,
Frankfurt/M. 977.
IV. Das Frankenreich im 6. Jahrhundert
Zur Geschichte der Politik und der Institutionen vgl. Herwig
Wolfram, Intitulatio I, Lateinische Knigs- und Frstentitel bis zum
Ende des 8. Jahrhunderts (= Mitteilungen des Instituts fr ster-
reichische Geschichtsforschung, Ergnzungsband 2), Wien 967;
Eugen Ewig, Die frnkischen Teilungen und Teilreiche (563),
in: Sptantikes und frnkisches Gallien, S. 470; J. M. Wal-
lace-Hadrill, Te Long-Haired Kings, S. 48206. Ntzlich auch
Bernard Bachrach, Merovingian Military Organization 4875,
Minneapolis 972; Archibald R.Lewis, Te Dukes in the Regnum
Francorum A.D. 55075, in: Speculum 5, 976, S. 3840. Zu
den Beziehungen zwischen Byzanz und den Franken vgl. Walter
Goart, Byzantine Policy in the West under TiberiusII and Mau-
rice: Te Pretenders Hermenegild and Gundovald (579585), in:
Traditio 3, 957, S. 738.
Wichtige Beitrge zur Kirchengeschichte liefern: J. M. Wallace-
Hadrill, Te Frankish Church, Oxford 983; Hubert Jedin (Hg.),
Handbuch der Kirchengeschichte, Band II: Die Reichskirche nach
Konstantin dem Groen. Erster Halbband: Karl Baus und Eugen
Ewig, Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon, Freiburg u.a. 973.
Zweiter Halbband: Karl Baus, Hans-Georg Beck, Eugen Ewig und
Hermann Josef Vogt, Die Kirche in Ost und West von Chalkedon
bis zum Frhmittelalter (45700), Freiburg u.a. 975; Martin
Heinzelmann, Bischofsherrschaf in Gallien. Zur Kontinuitt r-
313
mischer Fhrungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale,
prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte (= Beihefe
der Francia 5), Mnchen 976; Georg Scheibelreiter, Der Bischof
in merowingischer Zeit (= Verentlichungen des Instituts fr
sterreichische Geschichtsforschung 27), Wien 983. Zu Martin
von Tours vgl. Clare Stanclie, St. Martin and His Hagiographer:
History and Miracle in Sulpicius SeveruSy Oxford 983. Die klas-
sische Untersuchung des merowingischen Mnchtums verfate
Friedrich Prinz, Frhes Mnchtum im Frankenreich, 2. Au.,
Mnchen 988. Vgl. auch ders. (Hg.), Mnchtum und Gesellschaf
im Frhmittelalter, Darmstadt 976. Die umfangreichste Unter-
suchung der merowingischen Hagiographie und Gesellschaf
hat Frantisek Graus, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der
Merowinger. Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit, Prag
965, vorgelegt.
V. Das Frankenreich unter Chlothar II. und Dagobert I.
Zur dynastischen Geschichte des spten 6. und frhen 7. Jahrhun-
derts vgl. Eugen Ewig, Die frnkischen Teilreiche im 7. Jahrhundert
(6374), in: Sptantikes und frnkisches Gallien, S. 7220; J. M.
Wallace-Hadrill, Te Long-Haired Kings, S. 20623. Das Stan-
dardwerk ber die weltlichen mter der Merowingerzeit ist Horst
Ebling, Prosopographie der Amtstrger des Merowingerreiches von
Chlothar II. (63) bis Karl Martell (74) (= Beihefe der Francia 2),
Mnchen 974. ber die Landgter und deren Bewirtschafung
vgl. besonders John Percival, Seigneurial Aspects of Late Roman
Estate Management, in: Te English Historical Review 332, 969,
S. 449473; Walter Goart, From Roman Taxation to Medieval
Seigneurie: Tree Notes, in: Speculum 47, 972, S. 6587 und S.
373394; ders., Old and New in Merovingian Taxation, in: Past and
Prsent 96, 982, S. 32; Adriaan Verhulst, La genese du regime
domanial classique en France au haut moyen ge, in: Agricoltura
314
e mondo rurale in occidente neWalto medioevo (= Settimane di
Studio del centro italiano di studi sullalto medioeveo 3), Spoleto
966, S. 3560.
Zu Columban und dem frnkischen Mnchtum vgl. H. B. Clarke
und M. Brennan (Hgg.), Columbanus and Merovingian Mo-
nasticism (= British Archaeological Reports 3), Oxford 98;
Friedrich Prinz, Frhes Mnchtum, sowie ders., Heiligenkult
und Adelsherrschaf im Spiegel merowingischer Hagiographie,
in: Historische Zeitschrif 204,967, S. 529544; R. Sprandel, Der
merowingische Adel und die Gebiete stlich des Rheines, Freiburg
957; ders., Struktur und Geschichte des merowingischen Adels, in:
Historische Zeitschrif 93, 96, S. 337. Zur Kulturgeschichte
vgl. Pierre Riche, ducation et culture dans loccident barbare du
VP au VHP sicle (= Patristica Sorbonensia 4), Paris 967; M. L.W.
Laistner, Tought and Letters in Western Europe A. D. 500900,
Ithaca 957; Franz Irsigler, Untersuchungen zur Geschichte des
frhfrnkischen Adels (= Rheinisches Archiv. Verentlichungen
des Instituts fr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an
der Universitt Bonn 70), Bonn 969. Zur Missionierung vgl. Karl
Ferdinand Werner, Le rle de laristocratie dans la christianisation
du nord-est de la Gaule, in: Revue dhistoire de lglise de France
62, 976, S. 4573; C. E. Stanclie, From Town to Country: Te
Christianisation of the Touraine, 370600, in: Studies in Church
History 6, 979, S.4359; Ian N.Wood, Early Merovingian Devoti-
on in Town and Country, ibid., S. 676; Paul Fouracre, Te work
of Audoenus of Rouen and Eligius of Noyon in Extending Episco-
pal Inuence from the Town to the Country in Seventh-Century
Neustria, ibid., S. 779.
VI. Der Niedergang der Merowinger
Zu den frnkischen Regionen des spten 7. und des 8. Jahr-
hunderts vgl. neben den oben zitierten Arbeiten Eugen Ewigs
315
dessen Aufsatz Volkstum und Volksbewutsein im Frankenreich
des 7. Jahrhunderts, in: Sptantikes und frnkisches Gallien , S.
23273. Allerdings stimme ich nicht mit allen dort vertretenen
Tesen berein. Ferner Erich Zllner, Die politische Stellung der
Vlker im Frankenreich, Wien 950; Karl Ferdinand Werner, Les
principautes peripheriques dans le monde franc du VIII
e
sicle*,
in: I problemi dellOccidente nel secolo VIII (= Settimane di Stu-
dio del Centro italiamo di studi sullalto medioevo 20), Spoleto
973, S. 483532. Zu einzelnen Regionen vgl. Edward James, Te
Merovingian Archaeology of South-West Gaul, 2 Bde. (=British
Archaeological Reports, Supplementary Series 25), Oxford 977;
Michel Rouche, LAquitaine des Wisigoths aux Arabes 4878:
Naissance dune region, Paris 979; Patrick J. Geary, Aristocracy in
Provence: Te Rhne Basin at the Dawn of the Carolingian Age,
Philadelphia 985; A.Joris, On the Edge of Two Worlds in the Heart
of the New Empire: Te Romance Regions of Northern Gaul during
the Merovingian Period, in: Studies in Medieval and Renaissance
History 3, 966, S. 3552; Matthias Werner, Der Ltticher Raum
in frhkarolingischer Zeit, Gttingen 980; Herwig Wolfram, Der
heilige Rupert und die antikarolingische Adelsopposition, in: Mit-
teilungen des Instituts fr sterreichische Geschichtsforschung
80, 972, S. 434; Otto Gerhard Oexle, Die Karolinger und die
Stadt des heiligen Arnulf, in: Frhmittelalterliche Studien , 967, S.
250364; Herwig Wolfram, Die Geburt Mitteleuropas: Geschichte
sterreichs vor seiner Entstehung 378907, Wien 987.
Zu den merowingischen Kniginnen vgl. Janet E.Nelson,
Queens as Jezebels: Te Careers of Brunhild and Balthild in
Merovingian History, in: Medieval Women, hg. v. Derek Baker,
Oxford 978, S. 377; Pauline Staord, Queens, Concubines and
Dowagers: Te Kings Wife in the Early Middle Ages, London 983.
Zur verwirrenden Geschichte von Grimoald und Childebert
vgl. Eugen Ewig, Noch einmal zum Staatsstreich Grimoalds, in:
Sptantikes und frnkisches Gallien , S. 573577; Heinz Tomas,
Die Namensliste des Diptychon Barberini und der Sturz des Haus-
316
meiers Grimoald, in: Deutsches Archiv 25, 969, S. 763. Zum
Aufstieg der Karolinger vgl. Paul J. Fouracre, Observations on
the Outgrowth of Pippinid Inuence in the Regnum Francorum
afer the Battle of Tertry (68775), in: Medieval Prosopography
5, 984,, S. 3; Josef Semmler, Zur pippinidisch-karolingischen
Sukzessionskrise 74723, in: Deutsches Archiv 33, 977, S. 36.
Die grundlegende Arbeit ber die angelschsische Missionierung
des Kontinents bleibt Wilhelm Levison, England and the Conti-
nent in the Eighth Century, Oxford 946. Zum Papsttum des 8.
Jahrhunderts vgl. Tomas F. X. Noble, Te Republic of St. Peter:
Te Birth of the Papal State, 680825, Philadelphia 984. Zu Karl
Martell und den frhen Karolingern vgl. Josef Semmler (wie
oben); Rosamond McKitterick, Te Frankish Kingdoms under the
Carolingians 75987, London 983. Die Literatur zur Krnung
Pippins ist sehr umfangreich. Vgl. Michael J. Enright, Iona, Tara
and Soissons: Te Origin of the Royal Anointing Ritual ( Arbeiten
zur Frhmittelalterforschung 7), Berlin 985.
VII. Das Vermchtnis des merowingischen Europa
Die wichtigste Untersuchung ber die Entstehung der traditio-
nellen Einschtzung der Merowinger bleibt Edward Peters, Te
Shadow King: Rex Inutilis in Medieval Law and Literature 75327,
New Haven 970. Zu Einhards Beurteilung der Merowinger vgl.
Adolf Grauert, Noch einmal Einhard und die letzten Merowinger,
in: Lutz Frenske u. a. (Hgg.), Institutionen, Kultur und Gesellschaf
im Mittelalter. Festschrif fr Josef Fleckenstein zum 65. Geburtstag,
Sigmaringen 984, S. 5972. Karl Ferdinand Werner bemhte
sich jahrelang in Deutschland und Frankreich um eine neue
Beurteilung der frnkischen Geschichte. Vgl. besonders seinen
Sammelband Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und
Frankreichs: Ursprnge Strukturen Beziehungen. Ausgewhlte
Beitrge, Sigmaringen 984, und darin S. seinen Artikel En
317
guise dintroduction: Conqute franque de la Gaule ou changement
de rgime?
318
320
321
Personenregister
(Die Seitenzahlen beziehen sich auf das
Original und nicht auf diese e-Ausgabe)
Abbo, patricius der Provence 207208,
218
Abd ar-Rahman, Gouverneur von Spa-
nien 205
Acharius, Bischof 179
Adalbald 164
Adalgisel 159
Aega, neustrischer maior domus 184
Aegidius, gallischer Heerfhrer 87, 88,
90
Aetherius von Lisieux, Bischof 138
Aethius, rmischer General 87
Agilulf, Langobardenknig 173
Agnerich, frnkischer Adliger 174
Agrestius, Mnch 209
Agricola von Cavillon, Bischof 152
Alarich, gotischer Fhrer 3234, 77, 78
Alarich II., Westgotenknig 89, 91, 93,
99
Alaviv, terwingischer Fhrer 74, 75
Albinus 134
Amalaswintha, Regentin 96
Amalbert 197
Amandus, Bischof 179
Ambrosius Aurelianus 23
Ambrosius von Mailand, Bischof 32, 42
Anastasius, rmischer Kaiser 9394
Ansegisel, Sohn Arnulfs von Metz 194
Antenor, patricius der Provence 205
207
Arbogast 32, 34, 86
Aredius von Limoges, Abt 142
Ariarich, terwingischer Fhrer 72
Armentarius von Langres, Bischof 134
Arnebert, Herzog 160
Arnulf von Metz, Heiliger 155, 158,
177178
Athalarich 96
Athanarich, balthischer Fhrer 33, 74
75
Athaulf, gotischer Fhrer 78
Attila, Hunnenknig 14, 79,95
Audo, Sohn des Autharius 174, 175
Audoenus von Rouen, Bischof 162, 163,
174, 177, 188
Audomar, Bischof 179
Augustin von Canterbury, Mnch 214
Augustinus, Heiliger 32, 149
Aunemund von Lyon, Bischof 190191
Aurelian, rmischer Kaiser 72
Ausonius 39
Autharius, frnkischer Adliger 174, 175,
177
Ballomarius, Markomannenknig 68
Balthild, Ehefrau Clodwigs II. 188191,
194, 195
Bauto 32
Begga, Schwester Grimoalds I. 194
Bercharius, neustrischer maior domus
185, 196, 201
Bertram von Le Mans 131
Bertulf 174
Boethius 41
Bonifatius, Heiliger 215217, 219, 230
Bonitus, rmischer General 32
Bosl, Karl 119
Brodulf 158, 186
Brown, Peter 140
Brunichild, Ehefrau Sigiberts I. 125,
Burgundio 130
Burgundofara, btissin 174, 175
Burgundofaro, Bischof 174
Caesarius von Arles, Erzbischof 99, 140,
148, 150, 226
Caracalla, rmischer Kaiser 2728
Cassian 148, 149, 150
Cassiodor 41
Chararich, salischer Fhrer 94
Charibert, Sohn Chlothars II. 159, 160
Charibert I., merowingischer Knig 188
Childebert I., Sohn Chlodwigs 101,139,
322
167
Childebert II., Burgunderknig 154
Childebert III., austrasischer Knig 192,
198,206
Childerich, salischer Huptling 8790
ChilderichIL, austrasischer Knig 182,
191,194, 195,223
Childerich III., merowingischer Knig
183, 222, 224
ChilperichL, neustrischer Knig 105,
125,127, 188
Chilperich III., merowingischer Knig
112,200, 204, 206
Chilperich III., merowingischer Knig
220
Chimnechild, Witwe Sigiberts III. 194
Chloderich, Sohn Sigiberts von Kln 93
Chlodio, salischer Huptling 87
Chlodomer, Sohn Chlodwigs 102
Chlodwig und das Christentum 9193,
111, 145147, 152, 170
und das Frankenreich 8995, 115, 131,
165
und seine Nachfolger 122124,192,
221, 228;
siehe auch Chlothar I., Teudebert I.,
Teuderich I.
und die Verwaltung des Reiches
95101, 120, 121, 203 Chlodwig II.,
merowingischer Knig 182, 184, 188,
189
Chlothar L, Sohn Chlodwigs 101, 124
Chlothar II., frnkischer Knig 125,
154160, 162, 164, 167, 190 Chlothar
III., neustrischer Knig 182, 188, 191,
192, 194, 195
Chrodechild, Ehefrau Chlodwigs 102
Chrodoald 159, 161
Claudius, rmischer Kaiser 72
Cniva, Gotenknig 72
Columban und das irische Mnchtum
171173
und der frnkische Adel 173180
Commodus, rmischer Kaiser 20
Constantius, Caesar 20, 22
Dagobert I. und der austrasische Adel
157159
und Bayern 208
und das Christentum 167169, 179,
189
und das Frankenreich 157161, 167
169, 184, 191, 195, 203
und seine Nachfolger 181184
und seine Scheidung 163, 181182,188
Dagobert II., Sohn Sigiberts III. 182,
192,193,195
Dagobert III., Sohn Childeberts III. 200
Decius, rmischer Kaiser 72
Desideratus, Bischof 107
Desideratus, Einsiedler 152
Desiderius von Cahors, Bischof 161164,
168, 180
Diokletian, rmischer Kaiser 2022, 29,
3637, 45, 103
Domitian, rmischer Kaiser 17
Drogo, Sohn Pippins II. 185, 196, 198,
206
Dynamius 134, 137
Ebroin, neustrischer maior domus 182,
185, 187, 190, 191, 194, 195, 204
Einhard 222, 223, 229
Eligius von Noyon, Bischof 162, 163, 170,
179, 226
Emmeram, Heiliger 209
Erchinoald, neustrischer maior domus
170, 184186, 187188, 190, 199
Ermanarich, greutungischer Knig 33,
7677, 79
Eudo, Herzog 200, 204, 205, 210, 211
Eumerius, Bischof 129
Eurich, Westgotenknig 89, 93
Eusebius, Bischof 108
Eustasius, Abt 209
Faustanius von Dax, Bischof 138
Felix von Nantes, Bischof 129, 130, 138
Ferreolus von Uzes, Bischof 134
Flaochad, maior domus von Burgund
186187
Fouracre, Paul 197
323
Fredegar 84, 157, 160, 163, 169, 181, 187,
223
Fredegund, Ehefrau Chilperichs I. 125,
136
Friardus, Eremit 143
Fritigern, terwingischer reiks 7477
Frontonius von Angoulme, Bischof 137
Furseus, Heiliger 185186
Galerius, Caesar 20, 21, 22
Galla Placidia, Tochter des Teodosius
78
Gallus 132
Galswinth, Ehefrau Chilperichs I. 125
Germanus von Auxerre, Bischof 46, 211
Gertrud von Nivelles 194195
Gibbon, Edward 221, 222
Godafred, Herzog 201
Godinus, Sohn Warnachars 158
Gomatrudis, Ehefrau Dagoberts I. 163,
181,188
Grahn-Hoek, Heike 116
Gratian, rmischer Kaiser 32
Gregor I., Papst 133, 173
Gregor II., Papst 204, 210
Gregor III., Papst 218, 219
Gregor von Langres, Bischof 134
Gregor von Tours
ber den Adel 117, 127
ber Aegidius 88, 90
ber das Bischofstum 135, 137, 139,
142143, 152
und seine Bischofsdynastie 129
ber Chilperich I. 125
ber Chlodwig 9195, 101
und Felix von Nantes 130
ber die Herkunf der Franken 84, 85
ber Guntram 126, 172
ber Leudast 136
ber das Mnchtum 150, 152
ber die Wirtschaf 107108
Grimoald I. 192194, 223
Grimoald II. 198200
Gundoin, elsssischer dux 179
Gundovald 138
Guntram, Burgunderknig 126, 134, 138,
154, 172
Hadrian, rmischer Kaiser 25
Haimo, Herzog 185
Hainmar, Bischof 211, 212
Heinzelmann, Martin 128, 129
Heraclius von Angoulme, Bischof 132
Hilarius von Arles, Bischof 44, 148, 150
Hilarius von Poitiers, Bischof 145
Honoratus, Heiliger 148
Honorius, rmischer Kaiser 39, 78
Hospitius, Heiliger 150
Hugo, Bischof 212213
Iniuriosus von Tours, Bischof 128
Iovinus, Usurpator 78
Irsigler, Franz 116
Joroy, Rene 110
Jonas, Mnch 174
Jovinus 134
Julius Nepos, rmischer Kaiser 88
Justinian, rmischer Kaiser 96, 123
Karl der Groe 144, 221, 228
Karl Martell 200201
und Aquitanien 205
und die karolingische Historiographie
223
und die Kirche 207, 212218
und sein kultureller Einu 211214
und die Provence 206208
und der rmische Papst 210, 218219
Karlmann, Sohn Karl Martells 216217,
219
Konstantin, rmischer Kaiser 22, 32, 42,
43, 72, 92
Kunibert von Kln, Bischof 158, 159,
179
Laban von Eauze, Bischof 139
Le Go, Jacques 143
Leo der Groe, Papst 148
Leodegar von Autun, Bischof 191
Leudast, Graf von Tours 136
324
Leudesius, Sohn des Erchinoald 191
Libanius 32
Licinius, rmischer Kaiser 22
Lidorius von Tours, Bischof 145
Ludwig der Fromme 225
Lupus 204
Mallobaudes 86
Marachar, Bischof 137
Marc Aurel, rmischer Kaiser 1920,
30, 36
Marcellus, Bischof 134
Marcellus von Paris, Heiliger 143
Mariorian, rmischer Kaiser 88
Martin von Tours, Heiliger 84,144147,
169, 178, 189
Mauilio von Cahors, Bischof 138
Maurontos, patricius der Provence 205,
207208
Maximian, Mitregent 20, 22
Merovech, salischer Huptling 87
Namatius von Clermont-Ferrand, Bi-
schof 135
Nanthild, Ehefrau Dagoberts I. 163,181,
182, 184,186188
Nepos, Prtendent 23
Nicetius von Lyon, Bischof 136, 138, 141
Nivard von Reims, Bischof 132
Nonnechius von Nantes, Bischof 129,
130
Odilia, Heilige 179
Odilo von Bayern, Herzog 216
Odoaker, germanischer Knig 14, 23, 80
Ostrogotha, amalischer Knig 76
Palladius, irischer Bischof 171
Patrick, Heiliger 171
Patroclus, Eremit 143
Paul von Verdun, Bischof 162
Paulinus 42
Peters, Edward 224
Pippin I., austrasischer Adliger 155, 158,
161, 186
Pippin II., austrasischer maior domus 182,
185, 191, 196201, 207, 214215
Pippin III., frnkischer Knig 213, 216,
219,229
Plektrud, Witwe Pippins II. 200, 201
Plinius 49, 55, 103
Poly, Jean-Pierre 98
Postumus, Prtendent 29
Prinz, Friedrich 91, 92
Priscus von Lyon, Bischof 135, 141
Radbod, Herzog 215
Radegunde, Ehefrau Chlothars I. 151
Rado, Sohn des Autharius 174
Radulf, Herzog 160, 164
Ragamfred, neustrischer maior domus
200, 204, 213
Ragnachar, frnkischer Knig 94
Ragnebert, neustrischer Adliger 190
Remigius von Reims, Bischof 89, 98, 99,
131, 132, 226
Richomer 32, 88
Rikulf, Archidiakon 130, 133
Roderich, spanischer Knig 204
Rodulf, Herzog 179
Romaricus 174
Romulus Augustulus, rmischer Kaiser
13, 14, 23
Rupert von Worms, Bischof 210
Rusticus von Cahors, Bischof 162, 163
Sacerdos von Lyon, Bischof 138
Sadregisel, Herzog 167
Samo, Fhrer der Wenden 159, 160, 208
Savarich von Auxerre, Bischof 211, 212
Severus Alexander, rmischer Kaiser 29
Severus Septimius, rmischer Kaiser
2627
Sizgrius, patricius der Provence 162, 164
Sidonius Apollinaris 104, 135
Sigibert von Kln, frnkischer Knig
93, 94
Sigibert I., austrasischer Knig 125, 154
Sigibert IIL, Sohn Dagoberts I. 169, 182,
184,192
Silvester, Bischof 130
Stilicho 39
Sulpicius Severus 146, 150, 178
Susanna, Ehefrau des Bischofs Priscus
von Lyon 135136, 141
Syagrius, gallischer Heerfhrer 23, 88, 89,
90, 120, 221
Symmachus, rmischer Adliger 32, 40
Tacitus 4951, 62, 64, 71, 73, 97, 111, 227
Tassilo, Herzog 161
Tetricus, Bischof 130
Teoderich, Ostgotenknig 79, 80, 91,
93, 95, 96
Teodo, Herzog 210
Theodor von Canterbury, Erzbischof
215
Teodor von Marseille, Bischof 137
Teodosius, rmischer Kaiser 23, 32, 34,
69, 78
Teudebald I. 123 Teudebert I. 105, 107,
122123, 125, 136
Teudebert II. 154155, 173, 188
Teuderich I. 101, 122
Teuderich II. 154155, 173
Teuderich III. 182, 191, 196, 198
Teudoald, Sohn Grimoalds II. 200
Valens, rmischer Kaiser 22, 33, 7475
Valentinian, rmischer Kaiser 22
Valentinian II., rmischer Kaiser 32
Van Dam, Raymond 229
Venantius Fortunatus 124, 129, 130, 143
Vetranio von Tomi, Bischof 75
Vinzentius von Lrins 149
Ende E-Book: Geary, Patrick - Die Merowinger
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Hermann Wieland Atlantis Edda Und BibelDokument284 SeitenHermann Wieland Atlantis Edda Und Bibelseiwachsam100% (12)
- Patrick J. Geary, Die Merowinger-Europa Von Karl Dem Großen (1996)Dokument325 SeitenPatrick J. Geary, Die Merowinger-Europa Von Karl Dem Großen (1996)amalarius100% (5)
- Eggert Wolfgang - Israels-Geheimvatikan Bd.2 - 295 S PDFDokument295 SeitenEggert Wolfgang - Israels-Geheimvatikan Bd.2 - 295 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- 04 - Frühmittelalter PDFDokument940 Seiten04 - Frühmittelalter PDFsvense1267% (3)
- Dave Hunt - Die Frau Und Das TierDokument126 SeitenDave Hunt - Die Frau Und Das TiertechjNoch keine Bewertungen
- Heckethorn Charles William - Geheime Gesellschaften, Geheimbünde Und Geheimlehren, 1900 - 542 S PDFDokument304 SeitenHeckethorn Charles William - Geheime Gesellschaften, Geheimbünde Und Geheimlehren, 1900 - 542 S PDFBobotov Cook100% (1)
- Norden, E., 1920, Die Germanische Urgeschichte in Tacitus GermaniaDokument526 SeitenNorden, E., 1920, Die Germanische Urgeschichte in Tacitus GermaniaDe Grecia Leonidas100% (1)
- Geister, Götter, Teufelssteine: Sagen- und Legenden-Führer Mecklenburg-VorpommernVon EverandGeister, Götter, Teufelssteine: Sagen- und Legenden-Führer Mecklenburg-VorpommernNoch keine Bewertungen
- Aberg-Die Franken Und WestgotenDokument320 SeitenAberg-Die Franken Und Westgotencoolerthanhumphrey100% (1)
- Averil Cameron - Das Späte Rom 284 430 N CHRDokument439 SeitenAveril Cameron - Das Späte Rom 284 430 N CHRsoNtyp100% (1)
- Eggert Wolfgang - Israels-Geheimvatikan Bd.1 - 388 S PDFDokument388 SeitenEggert Wolfgang - Israels-Geheimvatikan Bd.1 - 388 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Geschichte Der Inquisition Im MittelalterDokument695 SeitenGeschichte Der Inquisition Im MittelalterLaura S.Noch keine Bewertungen
- Das römische Kaiserreich: Aufstieg und Fall einer WeltmachtVon EverandDas römische Kaiserreich: Aufstieg und Fall einer WeltmachtNoch keine Bewertungen
- Das Schlaue Buch - Erste Hilfe - Survival - 110 S PDFDokument110 SeitenDas Schlaue Buch - Erste Hilfe - Survival - 110 S PDFBobotov Cook100% (2)
- Das Schlaue Buch - Erste Hilfe - Survival - 110 S PDFDokument110 SeitenDas Schlaue Buch - Erste Hilfe - Survival - 110 S PDFBobotov Cook100% (2)
- Über Die Sprache Der Ostgoten in ItalienDokument228 SeitenÜber Die Sprache Der Ostgoten in ItaliencarlazNoch keine Bewertungen
- Geheime Figuren Der Rosenkreuzer, Aus Dem 16ten Und 17ten Jahrhundert - Heft 1 - PDF 32 S PDFDokument32 SeitenGeheime Figuren Der Rosenkreuzer, Aus Dem 16ten Und 17ten Jahrhundert - Heft 1 - PDF 32 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Archaologie Der Westlichen SlawenDokument465 SeitenArchaologie Der Westlichen SlawenMichał Grossman100% (4)
- Zombifizierung Der Politik Durch Okkultlogen - 67 S PDFDokument67 SeitenZombifizierung Der Politik Durch Okkultlogen - 67 S PDFBobotov Cook100% (1)
- Hexenkräuter - Wissenschaft Und Mythos - 126 S PDFDokument126 SeitenHexenkräuter - Wissenschaft Und Mythos - 126 S PDFBobotov Cook100% (4)
- Houben, Hubert - Die Normannen-Verlag C. H. BeckDokument122 SeitenHouben, Hubert - Die Normannen-Verlag C. H. Beck나경태Noch keine Bewertungen
- Werner, J. - Beitrage Zur Archaologie Des Attila-ReichesDokument145 SeitenWerner, J. - Beitrage Zur Archaologie Des Attila-Reichescoolerthanhumphrey100% (2)
- Geschichte Der Griechischen Etymologika - Reitzenstein 1897 (425p) PDFDokument425 SeitenGeschichte Der Griechischen Etymologika - Reitzenstein 1897 (425p) PDFkrenari68100% (1)
- Vida SteppenvölkerDokument9 SeitenVida SteppenvölkerPobesnelimrmotNoch keine Bewertungen
- Frühe Kulturen der Ägäis: Bd. 1: Die Ahnen der homerischen HeldenVon EverandFrühe Kulturen der Ägäis: Bd. 1: Die Ahnen der homerischen HeldenNoch keine Bewertungen
- Die Fantastischen Elemente Im NibelungenliedDokument6 SeitenDie Fantastischen Elemente Im NibelungenliedSrdjan GacaninNoch keine Bewertungen
- Hattusa-Hauptstadt Der HethiterDokument8 SeitenHattusa-Hauptstadt Der Hethitermanfredm6435Noch keine Bewertungen
- Eggert Wolfgang - Israels-Geheimvatikan Bd.3 - 514 S.Dokument513 SeitenEggert Wolfgang - Israels-Geheimvatikan Bd.3 - 514 S.Bobotov Cook100% (2)
- Heindel, Max - Die Rosenkreuzer-Weltanschauung Oder Mystisches Christentum - PDF - 216 S PDFDokument216 SeitenHeindel, Max - Die Rosenkreuzer-Weltanschauung Oder Mystisches Christentum - PDF - 216 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Pieta Karol - Die Keltische Besiedlung Der Slowakei PDFDokument419 SeitenPieta Karol - Die Keltische Besiedlung Der Slowakei PDFIon Dumitrescu100% (2)
- Germania01pfeiuoft PDFDokument530 SeitenGermania01pfeiuoft PDFMarcos GonzálezNoch keine Bewertungen
- Halberstadt - Ovid Im MittelalterDokument775 SeitenHalberstadt - Ovid Im MittelalterGabriel MuscilloNoch keine Bewertungen
- Rothkranz Johannes - Die Kommende Diktatur Der Humanität - Oder - Die Herrschaft Des Antichristen - 139 S PDFDokument79 SeitenRothkranz Johannes - Die Kommende Diktatur Der Humanität - Oder - Die Herrschaft Des Antichristen - 139 S PDFBobotov Cook100% (1)
- Rothkranz Johannes - Die Kommende Diktatur Der Humanität - Oder - Die Herrschaft Des Antichristen - 139 S PDFDokument79 SeitenRothkranz Johannes - Die Kommende Diktatur Der Humanität - Oder - Die Herrschaft Des Antichristen - 139 S PDFBobotov Cook100% (1)
- Brather (HRSG.) : Zwischen Spat Antike Und FruhmittelalterDokument490 SeitenBrather (HRSG.) : Zwischen Spat Antike Und Fruhmittelaltercoolerthanhumphrey100% (4)
- Cooper William - Mystery Babylon - Transkripte - 524 S PDFDokument524 SeitenCooper William - Mystery Babylon - Transkripte - 524 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Geary Patrick J. - Die Merowinger. Europa Vor Karl em Grossen - 325 S PDFDokument325 SeitenGeary Patrick J. - Die Merowinger. Europa Vor Karl em Grossen - 325 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Eckartshausen - Die WolkeDokument51 SeitenEckartshausen - Die WolkeBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Bona I. Das HunnenreichDokument306 SeitenBona I. Das Hunnenreichcoolerthanhumphrey100% (2)
- Zur Frage Eines Awarischen Stratums Des Ungarischen WortschatzesDokument149 SeitenZur Frage Eines Awarischen Stratums Des Ungarischen WortschatzesBelak1Noch keine Bewertungen
- Älteste Germanische Namen Der Völkerwanderungszeit in Lateinischen Und Griechischen QuellenDokument5 SeitenÄlteste Germanische Namen Der Völkerwanderungszeit in Lateinischen Und Griechischen Quellenboschdvd8122Noch keine Bewertungen
- Aberg-Die Goten Und LangobardenDokument182 SeitenAberg-Die Goten Und Langobardencoolerthanhumphrey100% (1)
- Die Kiptschak Die Oghusen Murad Adji 2002Dokument137 SeitenDie Kiptschak Die Oghusen Murad Adji 2002m.ali eren100% (2)
- Studien Zu Spätrömischen Grabfunden in Der Südlichen Niederrheinischen BuchtDokument160 SeitenStudien Zu Spätrömischen Grabfunden in Der Südlichen Niederrheinischen BuchtRenate BlumNoch keine Bewertungen
- (Enzyklopädie Der Griechisch-Römischen Antike 9) Christian Mann - Militär Und Kriegführung in Der Antike-Oldenbourg Wissenschaftsverlag (2013) PDFDokument181 Seiten(Enzyklopädie Der Griechisch-Römischen Antike 9) Christian Mann - Militär Und Kriegführung in Der Antike-Oldenbourg Wissenschaftsverlag (2013) PDFz100% (2)
- Spirituelle Kurzgeschichten Aller Völker Und Zeiten - PDF 113 S PDFDokument113 SeitenSpirituelle Kurzgeschichten Aller Völker Und Zeiten - PDF 113 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- BONA - HunnenreichDokument306 SeitenBONA - HunnenreichSabrina N. BojNoch keine Bewertungen
- Entstehung Der Deutschen SpracheDokument6 SeitenEntstehung Der Deutschen SpracheEx ZombieSchafNoch keine Bewertungen
- Geheime Figuren Der Rosenkreuzer, Aus Dem 16ten Und 17ten Jahrhundert - Heft 3 - PDF 34 S PDFDokument34 SeitenGeheime Figuren Der Rosenkreuzer, Aus Dem 16ten Und 17ten Jahrhundert - Heft 3 - PDF 34 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Was Ist Eine Nation - Ernest RenanDokument10 SeitenWas Ist Eine Nation - Ernest RenanHans GansNoch keine Bewertungen
- Hislop, Alexander - Von Babylon Nach Rom - Der Ursprung Der Römisch-Katholischen Religion - Erstausgabe 1858, Reprint 1997, 383 S.Dokument384 SeitenHislop, Alexander - Von Babylon Nach Rom - Der Ursprung Der Römisch-Katholischen Religion - Erstausgabe 1858, Reprint 1997, 383 S.Bobotov Cook100% (1)
- Das Notfallhandbuch - 58 S PDFDokument58 SeitenDas Notfallhandbuch - 58 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Wal - Norbert Harry MarzahnDokument284 SeitenWal - Norbert Harry Marzahn111bismillah100% (3)
- Wal - Norbert Harry MarzahnDokument284 SeitenWal - Norbert Harry Marzahn111bismillah100% (3)
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 1 - Januar 1944Dokument23 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 1 - Januar 1944Ruffy81Noch keine Bewertungen
- A History of The German Language (1893)Dokument324 SeitenA History of The German Language (1893)Anonymous IogovJW100% (3)
- Bemmann - Völkerwanderung BestattungenDokument31 SeitenBemmann - Völkerwanderung BestattungenmuseologeNoch keine Bewertungen
- Pierre Riché - Die Welt Der KarolingerDokument201 SeitenPierre Riché - Die Welt Der Karolingertesterli3932Noch keine Bewertungen
- Fruhe Awarinnen Und Spate Germaninnen B PDFDokument25 SeitenFruhe Awarinnen Und Spate Germaninnen B PDFWolfgang NiedermeierNoch keine Bewertungen
- Die GepidenDokument140 SeitenDie GepidenAnonymous 0tO38z100% (1)
- Roscher, WH - Ausfuhrliches Lexicon Der Griechischen Und Romischen Mythologie VI-VII (U-Z)Dokument1.254 SeitenRoscher, WH - Ausfuhrliches Lexicon Der Griechischen Und Romischen Mythologie VI-VII (U-Z)Xangot100% (1)
- Goldbrakteaten Aus Sievern: Spätantike Amulett-Bilder Der 'Dania Saxonica' Und Die Sachsen-'Origo' Bei Widukind Von Corvey / Karl Hauck Mit Beitr. Von K. Düwel, H. Tiefenbach Und H. VierckDokument584 SeitenGoldbrakteaten Aus Sievern: Spätantike Amulett-Bilder Der 'Dania Saxonica' Und Die Sachsen-'Origo' Bei Widukind Von Corvey / Karl Hauck Mit Beitr. Von K. Düwel, H. Tiefenbach Und H. VierckDigital Library Numis (DLN)Noch keine Bewertungen
- Bohme H.W. Germanische Grabfunde Des 4. Bis 5. Jahrhunderts Zwischen Unterer Elbe Und LoireDokument388 SeitenBohme H.W. Germanische Grabfunde Des 4. Bis 5. Jahrhunderts Zwischen Unterer Elbe Und Loirecoolerthanhumphrey100% (4)
- Charles, Heinrich - Der Deutsche Ursprung Des Namens Amerika (1922, 126 S., Scan)Dokument216 SeitenCharles, Heinrich - Der Deutsche Ursprung Des Namens Amerika (1922, 126 S., Scan)cantor976Noch keine Bewertungen
- Die Sowjet-Union - Gegebenheiten Und Möglichkeiten Des Ostraumes (1943)Dokument33 SeitenDie Sowjet-Union - Gegebenheiten Und Möglichkeiten Des Ostraumes (1943)Sven Weißenberger100% (2)
- Carter - Romulus, Romos, RemusDokument25 SeitenCarter - Romulus, Romos, RemusrbrtfNoch keine Bewertungen
- Angelika Die ErulerDokument161 SeitenAngelika Die ErulerCentar slobodarskih delatnosti d. o. o.Noch keine Bewertungen
- Werner - Munzdatierte Austrasische GrabfundeDokument211 SeitenWerner - Munzdatierte Austrasische Grabfundecoolerthanhumphrey100% (1)
- Die Stämme Der Israeliten Und Germanen (1931) Von Paul SenstDokument13 SeitenDie Stämme Der Israeliten Und Germanen (1931) Von Paul SenstEx ZombieSchafNoch keine Bewertungen
- Die Goten Und Langobarden in Italien - Nils ĀbergDokument174 SeitenDie Goten Und Langobarden in Italien - Nils ĀbergАнтон БабоскинNoch keine Bewertungen
- Steuer - Helm Und RingschwertDokument49 SeitenSteuer - Helm Und RingschwertAantchu100% (1)
- Cahill Thomas Wie Die Iren Die Zivilisation RettetenDokument217 SeitenCahill Thomas Wie Die Iren Die Zivilisation RettetenM.r. G-c100% (2)
- Roscher, WH - Ausfuhrliches Lexicon Der Griechischen Und Romischen Mythologie IV-V (Q-T)Dokument1.616 SeitenRoscher, WH - Ausfuhrliches Lexicon Der Griechischen Und Romischen Mythologie IV-V (Q-T)XangotNoch keine Bewertungen
- Töth Ewald - Licht-Quanten Aktiviertes Wasser - Das Wasser Des Lebens - 36 S PDFDokument36 SeitenTöth Ewald - Licht-Quanten Aktiviertes Wasser - Das Wasser Des Lebens - 36 S PDFBobotov Cook100% (1)
- Kiss P. Attila: Gepiden Im Heutigen Bulgarien Studia Hungaro-Bulgarica T 3Dokument13 SeitenKiss P. Attila: Gepiden Im Heutigen Bulgarien Studia Hungaro-Bulgarica T 3Kiss AttilaNoch keine Bewertungen
- Heerd, Ulrich - Das Haarp Projekt, Nikola Tesla, Modernste WaffenDokument86 SeitenHeerd, Ulrich - Das Haarp Projekt, Nikola Tesla, Modernste Waffenderanged_nightingale100% (1)
- Bierbrauer, V.,Archaeologie Und Geschichte Der Goten Vom 1.-7. Jahrhundert, Fruehmittelalterliche Studien28 (1994), 51-171Dokument121 SeitenBierbrauer, V.,Archaeologie Und Geschichte Der Goten Vom 1.-7. Jahrhundert, Fruehmittelalterliche Studien28 (1994), 51-171Karlo von Ivanek100% (3)
- Bierbrauer, V.,Archaeologie Und Geschichte Der Goten Vom 1.-7. Jahrhundert, Fruehmittelalterliche Studien28 (1994), 51-171Dokument121 SeitenBierbrauer, V.,Archaeologie Und Geschichte Der Goten Vom 1.-7. Jahrhundert, Fruehmittelalterliche Studien28 (1994), 51-171Karlo von Ivanek100% (3)
- Bierbrauer - Ethnos Und MobilitätDokument131 SeitenBierbrauer - Ethnos Und MobilitätKiss AttilaNoch keine Bewertungen
- Frank Hills Iron Mountain ReportDokument308 SeitenFrank Hills Iron Mountain ReportdeceptorixNoch keine Bewertungen
- Geschichte BayernsDokument20 SeitenGeschichte BayernsLinas KondratasNoch keine Bewertungen
- SchulzeDoerrlamm 2010 Heilige Nagel LanzenDokument84 SeitenSchulzeDoerrlamm 2010 Heilige Nagel LanzenleipsanothikiNoch keine Bewertungen
- Glasierte Keramik in Pannonien PDFDokument96 SeitenGlasierte Keramik in Pannonien PDFMartin ČechuraNoch keine Bewertungen
- PTS 66 Avitus Von Vienne Und Die Homöische Kirche Der Burgunder (2011) PDFDokument343 SeitenPTS 66 Avitus Von Vienne Und Die Homöische Kirche Der Burgunder (2011) PDFnovitestamentistudiosusNoch keine Bewertungen
- Von Der Wiege Bis Zur Bahre PDFDokument322 SeitenVon Der Wiege Bis Zur Bahre PDFjakobemmaNoch keine Bewertungen
- 007-038 Auer ÖJH77Dokument36 Seiten007-038 Auer ÖJH77Martin AuerNoch keine Bewertungen
- WOLFRAM - Gotisches Königtum Und Römisches Kaisertum Von Theodosius Dem Grossen Bis Justinian L.Dokument29 SeitenWOLFRAM - Gotisches Königtum Und Römisches Kaisertum Von Theodosius Dem Grossen Bis Justinian L.Floripondio19100% (1)
- Die Völkerwanderung II.Dokument3 SeitenDie Völkerwanderung II.Sara Gigova100% (1)
- Antike Fundmünzen Aus Lauriacum: Die Sammlung Spatt/Enns / Von Bernhard ProkischDokument52 SeitenAntike Fundmünzen Aus Lauriacum: Die Sammlung Spatt/Enns / Von Bernhard ProkischDigital Library Numis (DLN)Noch keine Bewertungen
- Corpus Der Römischen Funde Im Europäischen Barbaricum - Lesefunde Aus Dem NordöstlichenDokument287 SeitenCorpus Der Römischen Funde Im Europäischen Barbaricum - Lesefunde Aus Dem NordöstlichenAstral AgnusNoch keine Bewertungen
- Widengren - 1969 - Der Feudalismus Im Alten IranDokument193 SeitenWidengren - 1969 - Der Feudalismus Im Alten IranslovanNoch keine Bewertungen
- Catalog Der Texte Der HethiterDokument22 SeitenCatalog Der Texte Der HethiterjjlajomNoch keine Bewertungen
- Klaus-Peter Matschke, Münzstätten, Münzer Und Münzprägung Im Späten ByzanzDokument21 SeitenKlaus-Peter Matschke, Münzstätten, Münzer Und Münzprägung Im Späten ByzanzAndrei OrobanNoch keine Bewertungen
- Geschichtsquellen Des Deutschen MittelaltersDokument197 SeitenGeschichtsquellen Des Deutschen MittelaltersTristan SharpNoch keine Bewertungen
- Marquart - Osteuropäische Und Ostasiatische Streifzüge Ethnologische Und Historisch-Topographische Studien Zur Geschichte Des 9. Und 10. Jahrhunderts (Ca. 840-940) - 1903Dokument618 SeitenMarquart - Osteuropäische Und Ostasiatische Streifzüge Ethnologische Und Historisch-Topographische Studien Zur Geschichte Des 9. Und 10. Jahrhunderts (Ca. 840-940) - 1903Huwawa35100% (1)
- Altorientalische Und Semitische OnomastikDokument258 SeitenAltorientalische Und Semitische OnomastikDan PolakovicNoch keine Bewertungen
- Die Staufer: Mit Literaturnachträgen von Gerhard LubichVon EverandDie Staufer: Mit Literaturnachträgen von Gerhard LubichBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2)
- Gnosis - Gnostizismus - Theologische Real Enzyklopädie Bd.13, Berlin, NewYork, 1984 - 62 S PDFDokument62 SeitenGnosis - Gnostizismus - Theologische Real Enzyklopädie Bd.13, Berlin, NewYork, 1984 - 62 S PDFBobotov CookNoch keine Bewertungen
- Bischoff Erich - Im Reiche Der Gnosis - 158 S PDFDokument158 SeitenBischoff Erich - Im Reiche Der Gnosis - 158 S PDFBobotov Cook100% (1)
- Ipares, S. - Geheime Weltmaechte - Eine Abhandlung Ueber Die Innere Regierung Der Welt (1936, 57 S., Scan-Text, Fraktur)Dokument57 SeitenIpares, S. - Geheime Weltmaechte - Eine Abhandlung Ueber Die Innere Regierung Der Welt (1936, 57 S., Scan-Text, Fraktur)ilsen143Noch keine Bewertungen
- Waehrungsreform Und Neue Geldsysteme - 48 S.Dokument48 SeitenWaehrungsreform Und Neue Geldsysteme - 48 S.Bobotov CookNoch keine Bewertungen
- Beter Peter - Kurzfassung Seiner Aussagen - 48 S.Dokument48 SeitenBeter Peter - Kurzfassung Seiner Aussagen - 48 S.Bobotov Cook50% (2)
- E. Beninger, Germanengräber Von Laa An Der Thaya (N.-Ö) - Eiszeit Und Urgeschichte 6, 1929, 143 - 155.Dokument15 SeitenE. Beninger, Germanengräber Von Laa An Der Thaya (N.-Ö) - Eiszeit Und Urgeschichte 6, 1929, 143 - 155.russenkindNoch keine Bewertungen
- Zeugnisse Und Excurse Zur Deutschen Heldensage (Erste Nachlese)Dokument135 SeitenZeugnisse Und Excurse Zur Deutschen Heldensage (Erste Nachlese)carlazNoch keine Bewertungen
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 2 - 1944Dokument23 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 2 - 1944Ruffy81Noch keine Bewertungen
- Die Italischen Bischöfe Unter Ostgotischer Herrschaft (490 - 552 N. CHR.), 2006. Y. KoepkeDokument422 SeitenDie Italischen Bischöfe Unter Ostgotischer Herrschaft (490 - 552 N. CHR.), 2006. Y. KoepkeApik_failNoch keine Bewertungen
- Greil - Die Slawenlegende - Die - Aufklarungsdokumentation (OrigiDokument146 SeitenGreil - Die Slawenlegende - Die - Aufklarungsdokumentation (OrigiAnonymous qkhwe0nUN1Noch keine Bewertungen
- Aberg Die Franken Und Die Westgoten VolkerwanderungszeitDokument307 SeitenAberg Die Franken Und Die Westgoten Volkerwanderungszeitamadgearu100% (1)
- PTS 66 Avitus Von Vienne Und Die Homöische Kirche Der Burgunder (2011) PDFDokument343 SeitenPTS 66 Avitus Von Vienne Und Die Homöische Kirche Der Burgunder (2011) PDFnovitestamentistudiosusNoch keine Bewertungen
- BoerSageErmanarich PDFDokument352 SeitenBoerSageErmanarich PDFmatrix513Noch keine Bewertungen