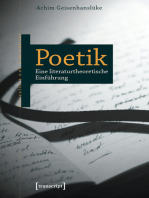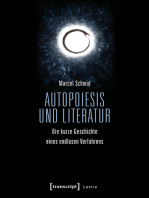Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
(Romanistisches Jahrbuch) Petrarkismus
Hochgeladen von
Chris PifferOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
(Romanistisches Jahrbuch) Petrarkismus
Hochgeladen von
Chris PifferCopyright:
Verfügbare Formate
Petrarkismus
Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status
(diskutiert an einem Beispiel aus Tassos Lyrik)*
Von Andreas Kablitz
Petrarkismus meint Petrarca-imitatio. Diese Feststellung galt lange als unumstöß-
lich, ja sie schien von so zwingender Selbstverständlichkeit zu sein, daß jede Dis-
kussion darüber schlicht abwegig wirken mußte. Doch spätestens seit den 80er
Jahren hat sich dies geändert. Die zunehmende Professionalisierung der Literatur-
wissenschaft, der wachsende Anspruch, sie den Standards einer Theoriebildung zu
unterwerfen oder doch wenigstens zu öffnen, die in anderen Disziplinen gelten, hat
auch die Evidenz jenes Urteils untergraben, das sich in dem eingangs formulierten
Satz resümieren ließ. Entscheidend für die Problematisierung dieses Befunds war
der Ausfall seiner historistischen Prämisse. Was der Identifikation von Petrarkis-
mus und Petrarca-imitatio seine unverbrüchliche Stütze zu geben schien, bestand
ja gerade in der Anwendung eines humanistischen Begriffs, der eine zentrale Kate-
gorie der zeitgenössischen diskursiven Praxis bezeichnete, auf jene lyrische Filia-
tion, die, ausgehend von Italien, während des 16. und 17. Jahrhunderts ihren Sieges-
zug über weite Teile und Sprachen Europas antrat. Was also lag näher, in diesem
‚Eigenbegriff‘ des Humanismus auch die Essenz einer lyrischen Praxis zu vermu-
ten, die sich ganz offensichtlich an Petrarcas Canzoniere orientierte. Vergessen sei
dabei freilich nicht, daß diese Selbstverständlichkeit der Erklärung des Petrarkis-
mus als Petrarca-imitatio zu seinem Ruf in der romanistischen Forschung nicht
eben beitrug. Denn spätestens seit der Romantik hat jene Nachahmungsästhetik
ihr Prestige maßgeblich eingebüßt. So kann es nicht verwundern, daß selbst ein so
akribischer Historiker der Literatur wie Ernst Robert Curtius, der Festlegung
seiner Arbeiten auf einen pointillistischen Positivismus namens Topos-Forschung
zum Trotz, für den Petrarkismus nur ziemlich abfällige Worte fand, die seine
anderweitige Sympathie für die Genieästhetik ganz unmißverständlich zum Aus-
druck bringen. Denn er meinte über den Petrarkismus einmal, daß er sich „wie
eine Pest über Italien und Frankreich verbreitete.“ 1 So gehört es zu den ,Ver-
* Dieser Artikel bildet die erweiterte Fassung eines Vortrags, den ich im Rahmen des Kollo-
quiums Europäischer Petrarkismus zu Ehren von Prof. Dr. Bernhard König anläßlich
seines 70. Geburtstags im Oktober 2002 an der Universität zu Köln gehalten habe. Ihm
sei er deshalb in Freundschaft und Dankbarkeit zugeeignet.
1 Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Bern – München
81973 [Erstausgabe 1948], S. 232.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 105
diensten‘ einer Problematisierung der Identifikation von Petrarkismus und Petrarca-
imitatio, daß sie überhaupt erst das Interesse für dieses literarhistorische Thema
wieder geweckt hat und seine ‚Würdigkeit‘ für eine zünftige Behandlung heraus-
gestellt hat. Denn, wer wollte sich, aller Mühe um historische Gerechtigkeit zum
Trotz, schon mit Nachrangigem beschäftigen? Paradoxerweise also hat gerade die
Abkehr von einer historistischen Verortung des Petrarkismus und das dagegen
gerichtete Bemühen, diese literarische Praxis mittels systematischer Kategorien zu
beschreiben, ein neues Interesse an diesem historischen Phänomen hervorgebracht
und seither eine ganze Fülle von Arbeiten entstehen lassen.2 Die Prämissen dieser
Diskussion, also die Absicht des Ersatzes einer zeitgenössischen, deskriptiven
Begrifflichkeit durch eine theoretisch befriedigende Erklärung, haben sich nahe-
liegenderweise auf dasjenige systematische Paradigma bezogen, welches seit den
70er Jahren des inzwischen vergangenen Jahrhunderts alle Theoriebildung maß-
geblich bestimmte: auf die Kategorie des Systems. Es bot sich gewissermaßen an,
anhand der betreffenden Diskussion auch sogleich eine Kontroverse über den
Petrarkismus auszutragen, denn die Konjunktur des Systembegriffs in der Wissen-
schaft von der Literatur ist kaum älter als diejenige seiner Kritik im Zeichen des
sogenannten Neo- oder Poststrukturalismus. Es liegt deshalb in der Logik dieser
theoretischen Kontroverse, daß sie auch in der Debatte über den Petrarkismus
ihren Niederschlag fand. Die betreffenden Positionen, die mir bis auf den heutigen
Tag die wesentlichen Koordinaten dieser Diskussion zu bestimmen scheinen, sind
formuliert worden von Klaus W. Hempfer und Rainer Warning. Es macht dem
Leser die Information darüber in einer nicht eben durch Übersichtlichkeit gekenn-
zeichneten Publikationslandschaft recht bequem, daß die betreffenden Beiträge im
selben Band, der einer der Tagungen des Romanistischen Kolloquiums entstammt,
abgedruckt sind.3 Beide Positionen stehen deshalb gewissermaßen dialogisch neben-
einander und erfüllen damit selbst bereits ein Kriterium, welches auch die Debatte
als solche bestimmt. Denn eben aufgrund seines primär dialogischen Charakters
hat Warning dem Petrarkismus den Charakter eines Systems abgesprochen und
sich damit in jene Filiation der Kritik am Konzept der Literatur als System ein-
gereiht, die mit den Namen Michail Bachtins und Julia Kristevas verbunden ist.4
Demgegenüber hat Klaus W. Hempfer den Systemcharakter des Petrarkismus be-
tont.5 Ich habe mich an anderer Stelle bereits mit den beiden Positionen ausein-
andergesetzt,6 möchte die betreffende Kontroverse an dieser Stelle indessen aus
2 Ich verweise in diesem Zusammenhang nur auf die unlängst erschienene, sehr sorgfältige
Petrarkismus-Bibliographie 1972–2000, hrsg. Klaus W. Hempfer, Gerhard Regn, Sunita
Scheffel, Stuttgart 2005.
3 Die Pluralität der Welten. Aspekte der Renaissance in der Romania, hrsg. Wolf-Dieter
Stempel, Karlheinz Stierle, München 1987.
4 Rainer Warning, „Petrarkistische Dialogizität am Beispiel Ronsards“, ebda., S. 327–358.
5 Klaus W. Hempfer, „Probleme der Bestimmung des Petrarkismus. Überlegungen zum
Forschungsstand“, ebda., S. 253–277.
6 Andreas Kablitz, „Die Selbstbestimmung des petrarkistischen Diskurses im Proömial-
sonett (Giovanni della Casa – Gaspara Stampa) im Spiegel der neueren Diskussion um
den Petrarkismus“, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 73 (1992), S. 381–414.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
106 Andreas Kablitz
einer anderen Sicht der Dinge vortragen und mich dabei zunächst dem Status des
Petrarkischen Canzoniere selbst zuwenden, um für ihn ein wenig näher seinen
‚Systemstatus‘ zu charakterisieren, um sodann von dorther einen Blick auf den
Petrarkismus zu richten.
In diesem Zusammenhang nehme ich eine Anregung auf, die von Hugo Fried-
rich stammt. In seinem selbst epochemachenden Standardwerk mit dem Titel
Epochen der italienischen Lyrik bemerkt er einmal, eher beiläufig, Petrarcas Canzo-
niere stelle das zweite System der (nachantiken) europäischen Lyrik dar.7 Friedrich
hat den Systembegriff hier letztlich unspezifisch, jedenfalls ihn nicht näher auf
seine theoretischen Implikationen hin befragend, gewählt. Indessen möchte ich im
folgenden genau dies tun. Was bedeutet es für Petrarca und seine Lyrik, näherhin
für deren Verhältnis zum ersten System der nachantiken Lyrik, also zur Dichtung
der provenzalischen Trobadors, wenn wir in dieser Hinsicht den Systembegriff so-
zusagen ernst nehmen?
Als konstitutiv für diese Dichtung sei hier ein Prinzip genannt, das als paradig-
matische Variation bezeichnet sei. Nun wirkt eine solche Bestimmung, zumindest
auf den ersten Blick, ausgesprochen nichtssagend oder, anders gesagt, tautolo-
gisch. Denn schließlich hat Roman Jakobson in einer der nach wie vor erfolgreich-
sten Charakteristiken des poetischen Diskurses dessen distinktives Merkmal als
die Überblendung der syntagmatischen Achse der Sprache durch paradigmatische
Relationen definiert. Insofern nimmt sich die versuchte Charakteristik jener Lyrik,
die bei den Trobadors entsteht, herzlich wenig spezifisch aus. Wenn ich an dieser
Bestimmung gleichwohl festhalten möchte, dann deshalb, weil ich das Prinzip
paradigmatischer Variation in dieser Dichtung nicht aus einer allgemeinen Theorie
der poetischen Sprache heraus begründen möchte, sondern als das Ergebnis einer
ganz singulären Kombination zwischen den semantischen sowie pragmatischen
Voraussetzungen der Troubadourlyrik und ihren formalen Verfahren beschreiben
möchte. Was dabei entsteht, wäre insofern nicht ein Exemplum für den grundsätz-
lichen Charakter des Poetischen, sondern eine spezifische, ja vielleicht singuläre
Konstellation.
Der semantische Kern der Minnelyrik besteht bekanntlich in der Werbung des
Sängers um die Gunst der besungenen Dame, einer Werbung, der per definitionem
kein Erfolg beschieden sein kann. Denn wohl als einen Tribut an die ‚offizielle‘
Moral schließt das System den Akt sexueller Vereinigung aus. (Daß sich dies in
einigen Sondergattungen der Troubadourlyrik anders verhält, steht dazu nicht im
Widerspruch, sondern bestätigt vielmehr die Eigenheiten des grand chant courtois,
indem sie dessen Grenzen und Lizenzen ostentativ überschreiten.) Die sich daraus
ergebende, sozusagen systemisch notwendige fortdauernde Verweigerung der Dame
aber führt konsequent zu einer permanenten Wiederholung des im Grunde immer
Gleichen: zur je veränderten Aufforderung des Sängers an die Geliebte, sich ihm
doch endlich in der gewünschten Weise zuzuwenden. Eben in dieser Konstruktion,
so scheint mir, steckt nun der Ansatz für das Prinzip paradigmatischer Variation.
7 Hugo Friedrich, Epochen der italienischen Lyrik, Frankfurt am Main 1964.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 107
Die Notwendigkeit der Wiederholung des letztlich stets gleichen Anliegens zwingt
zur fortwährenden verwandelten Formulierung dieses Anliegens; und eben hiermit
lassen sich auch die formalen sprachlichen Muster der Variation verbinden. So
besteht die vielleicht singuläre Charakteristik dieser Dichtung, deren immenser,
Jahrhunderte währender Erfolg womöglich nicht zuletzt darin einen Grund hat, in
diesem strukturellen Zusammenhang zwischen der Semantik und den poetischen
Verfahren, die beide auf dem Prinzip paradigmatischer Variation gründen. Dieser
Zusammenhang zwischen beiden läßt sich übrigens auch in anderer Weise skizzie-
ren. Die Weigerung der Dame nobilitiert die gleichwohl fortbestehende Liebe eines
Sängers, indem sie den Unterschied von bloßer Triebhaftigkeit und fin’amors be-
gründet, und zugleich führt die dadurch entstehende unablässige Wiederholung
desselben Wunsches zu dessen fortschreitender sprachlicher Differenzierung. Und
so wie der Affekt durch den Unterschied zum Trieb geadelt wird, so wird auch die
Sprache kunstvoll und gewinnt eine Artifizialität, die sie von der wie auch immer
zu definierenden Normalsprache erkennbar unterscheidet. Diese Liebeslyrik ver-
knüpft insofern zwei kulturelle Leistungen: Triebsublimation und Wortkunst.8
Die Dominanz des Prinzips paradigmatischer Variation für dieses poetische
System zeigt sich vor allem daran, daß es nicht allein die Struktur des einzelnen
Textes prägt, sondern gleichermaßen die Beziehung zwischen einzelnen Texten
organisiert. Nichts anderes meint es, wenn vom dialogischen Charakter dieser
Dichtung die Rede ist. Sie funktioniert auch hier als fortwährende Variation anderer
Rede. Dabei eignet dieser Variation das Moment der Konkurrenz; und von hierher
gewinnt die Variation ihre Richtung. Variation tritt als Überbietung in Erschei-
nung. Auch an dieser Stelle ergibt sich noch einmal eine Parallele zwischen Seman-
8 Mir scheint aufgrund dieser Gegebenheiten des Systems der Troubadourlyrik auch eine
geläufige, nicht zuletzt in Friedrichs Epochen der italienischen Lyrik zu findende Charak-
teristik ihrer Liebeskonzeption als einer ‚platonischen‘ verfehlt zu sein. Denn offen-
kundig, die Zahl der ziemlich eindeutigen Belege dafür im Wortlaut dieser Dichtung ist
gewaltig, zielt das Begehren des Sängers auf eine Erfüllung ab, die ganz eindeutig ‚unpla-
tonisch‘ zu nennen ist. Wenn hier gleichwohl eine Sublimation des körperlichen Eros
statthat, dann ist sie nicht in der Qualität des Begehrens angesiedelt, sondern in dem Aus-
schluß der Befriedigung dieses Begehrens. Erst in dieser konsequenten, eben ‚systemi-
schen‘ Negation des Sexus ist ein Ursprung für eine doppelte Differenzierungsleistung
anzusetzen, welche sich in der Lyrik der Trobadors vollzieht. Zum einen gelingt durch
diese Exklusion eine Unterscheidung von Trieb und Eros, weil die stets wiederholte und
erneuerte Werbung ein Maß an diskursiver Differenzierung einfordert, das dem Eros
allererst eine Sprache verleiht und damit die Opposition zum Trieb begründet. Mir
scheint im gleichen Zug dabei auch die Differenzierung zwischen Alltagssprache und
Wortkunst stattzufinden, wobei sich beides wechselseitig bedingt. Nur im Raum einer
‚entpragmatisierten‘ Kunst-Sprache konnte sich wohl eine Ethik des Eros entwickeln,
welche sich von aller ‚offiziellen‘ Moral recht unverstellt entfernt. Doch nur eine solche
Transgression, die eine stetige Differenzierung verlangt, gab zum anderen die Gelegenheit
für die Entstehung der Differenz von Alltagssprache und Wortkunst. (Ich kann diese
strukturellen Gegebenheiten der Trobadorlyrik hier nur in Ansätzen skizzieren, werde
diese Überlegungen indessen andernorts des näheren ausarbeiten.)
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
108 Andreas Kablitz
tik und formalem Verfahren. Denn der Sänger wirbt ja um doppelte Gunst, um
die Gunst der besungenen Dame zur Befriedigung seines erotischen Begehrens
und um die Gunst des Publikums zur Befriedigung seines künstlerischen Ehrgeizes.
Deshalb erstaunt es kaum, wenn die fortschreitende sprachliche Komplexität als
Ausweis eines überlegenen Könnens enggeführt wird mit der fortschreitenden
Steigerung der Vorzüge, welcher der Dame je bescheinigt werden, um sie vor allen
anderen Damen auszuzeichnen, bis sie schließlich zu einer nicht mehr nur irdi-
schen Gestalt geraten ist. Hier wie dort also der Gestus der Überbietung.
Mit der zur überirdischen Frau überhöhten Dame ist erkennbar ein Hinweis
auf Dante gesetzt. Bei ihm vollzieht sich eine der folgenreichsten Veränderungen
innerhalb des überkommenen lyrischen Systems, und diese Verwandlung besteht
bekanntlich in einer Narrativierung, wie sie mit der Vita nova statthat. Nun läßt
sich zweifelsohne sagen, daß auch jede Werbungssituation eine zumindest mini-
male Abfolge von Ereignissen voraussetzt, die Vita nova insoweit nur explizit
macht und entfaltet, was je schon impliziert war. Ich möchte statt dessen – und
wie sich zeigen soll, nicht zuletzt im Hinblick auf Petrarca – diese Narrativierung
etwas anders charakterisieren und von einer Konfrontation des lyrischen Dis-
kurses mit der Dimension der Zeit sprechen. Von Konfrontation ist hier zunächst
in einem sehr materiellen Sinn die Rede, denn in der Tat wird ja im Prosimetrum
der Vita nova der lyrische Diskurs der rime der Prosa der Erzählung und des Kom-
mentars gegenübergestellt. Daß also so etwas wie eine Geschichte entsteht, liegt
am Prosateil dieses Textes. Erst bei Petrarca wird die lyrische Rede selbst eine
bezeichnenderweise auch nur noch rudimentäre narrative Struktur herstellen. Wir
können dies vielleicht als einen Hinweis darauf verstehen, daß das Verhältnis
zwischen lyrischer Rede und narrativer Ordnung hier im Grunde stets ein prekäres
bleibt. Mit dieser Bemerkung ist übrigens allem anderen als einer romantischen
Affinität von Lyrik und Erlebnis das Wort geredet. Nur scheint jene strukturelle
Doppelung von Sprechsituation und dargestellter Situation, die in die zeitliche
Distanz des Präteritums gebracht sind, nicht recht aufzugehen mit den Prinzipien
einer lyrischen Tradition, welche in der Situation der Werbung ihren pragmati-
schen Hintergrund besitzt und deshalb gerade von der zeitlichen Kongruenz von
énoncé und énonciation bestimmt wird. Wenn sich deshalb bei Dante eine Kon-
frontation des überkommenen lyrischen Diskurses mit der Zeit vollzieht, dann läßt
sich dies meines Erachtens weniger als eine Entfaltung jener impliziten Narrati-
vität erklären, die auch in jeder Werbungsrede steckt. Vielmehr ergibt sie sich, so
scheint mir, als eine Konsequenz der Veränderungen der semantischen Koordina-
ten dieser lyrischen Tradition, näherhin der gewandelten Charakteristik der be-
sungenen Dame. Weil Beatrice nicht mehr als nur eine irdische Gestalt gezeichnet,
sondern gewissermaßen zwischen Diesseits und Jenseits angesiedelt wird und aus
genau diesem Grund zwischen beiden Sphären zu vermitteln vermag, kommt der
Gegensatz von Leben und Tod ins Spiel und eben damit die Dimension der Zeit.
Ostentativ scheint der Text der Vita nova darum bemüht zu sein, dieser Zeit von
allem Anfang an eine Richtung und eine Ordnung zu geben. Bereits im ersten
Kapitel, das die erstmalige Begegnung des noch im Kindesalter befindlichen Pro-
tagonisten mit seiner Beatrice zum Inhalt hat, wird diese Ordnung bestimmt.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 109
Denn in dem Augenblick, in dem Dante Beatrice trifft, hört er die Worte Apparuit
iam beatitudo vestra: „Schon ist dein Heil erschienen.“ 9 Insoweit das Heil das dem
Menschen aufgegebene Ziel bedeutet, sind auf diese Weise die Eckpunkte, der
Beginn der erzählten Geschichte und ihr Ende, von allem Anfang an einander
zugeordnet. Die Zeit ist in der Geschichte der Vita nova also aufgehoben in der
zutiefst christlichen Figur einer Erfüllung von Verheißung. Die Versicherung, die
mit dem zitierten Satz gegeben ist, bringt es mit sich, daß das Ziel der Zeit ihr
immer schon eingeschrieben ist. Was die zeitliche Kohärenz der Vita nova begrün-
det, ist deshalb weit eher diese Struktur von Verheißung und Erfüllung als die
narrative Logik einer schlüssigen Geschichte. Diese narrative Kohärenz bleibt viel-
leicht auch bei Dante geringer, als es der in der Forschung übliche und aus gutem
Grund allenthalben praktizierte Vergleich mit Petrarcas Canzoniere zu suggerieren
scheint. Schließlich ist auch die Geschichte der Vita nova in weiten Teilen paradig-
matisch organisiert. Nicht zuletzt deshalb scheint mir nicht die Narrativierung als
solche, sondern vielmehr die mit ihr verbundene Konfrontation mit der Dimension
der Zeit die entscheidende Veränderung gegenüber der Tradition zu sein. Genau
hier wird denn auch bei Petrarca eine maßgebliche Verwandlung stattfinden. An
die Stelle der ostentativen Disziplinierung der Zeit, die im Verhältnis zwischen
Verheißung und Erfüllung von allem Anfang an aufgehoben ist, tritt die kaum
weniger ostentative Herauslösung der Zeit aus aller sie bändigenden Ordnung.
Selbst der Gegensatz von Leben und Tod scheint zur Bedeutungslosigkeit herab-
zusinken, wenn die verstorbene Laura den rettungslos Verliebten nicht anders
bekümmert, als sie es schon zu Lebzeiten getan hatte. Ja, der markierten Aufhe-
bung der Zeit in einer biblischen Semantik von Verheißung und Erfüllung in der
Vita nova stellt Petrarcas Canzoniere eine Zeitkonstellation gegenüber, welche die
christlichen Ordnungen der Zeit ostentativ verkehrt. Denn der Karfreitag, der Tag,
an dem das Erlösungswerk Christi sich vollzieht, wird hier zum Tag der Ver-
strickung in Irrtum und Sünde. Zeit erscheint deshalb bei Petrarca als eine Dimen-
sion der Dispersion. Sie eröffnet nun Kontingenz.10
9 Dante, Vita nova, hrsg. L. C. Rossi, mit einer Einleitung von Guglielmo Gorni, Mailand
1999, S. 11.
10 Ich kann an dieser Stelle die verschiedenen Implikationen der hier diskutierten Differen-
zen der Ordnung der Zeit in der Vita nova wie im Canzoniere nicht des näheren erörtern.
Zu begegnen ist allerdings einem Argument, das sich auf den ersten Blick dem hier
gemachten Unterschied zwischen beiden Texten entgegenhalten ließe. Denn wenn die Zeit
in der Vita nova durch die am Beginn stehende Verheißung immer schon teleologisch von
ihrem Ende her organisiert ist, dann könnte Ähnliches von Petrarcas Proömialsonett
gelten, das ebenfalls vom Schluß des Zyklus her, von der Konversion des einsichtig
Gewordenen der Zeit eine Richtung gibt. Indessen sind die Unterschiede dabei nicht zu
übersehen. Denn die Verheißung mag am Beginn von dem Unverständigen unerkannt
bleiben, aber sie ist gleichwohl in der Sache selbst angelegt. Am Beginn der Geschichte,
die der Canzoniere erzählt, steht statt dessen nicht Unverständnis, sondern ein fataler Irr-
tum, die Täuschung über die wahre Natur des Geschauten (dem bezeichnenderweise die
Aufklärung durch das Wort versagt bleibt, weshalb die Augen zum – ungeschützten –
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
110 Andreas Kablitz
Diese Öffnung der Zeit für die Kontingenz aber stellt eine der vielleicht wesent-
lichsten Veränderungen dar, welche das überkommene System dieser Lyrik bei
Petrarca erfährt, und sie wird zumal für den Petrarkismus von besonderem Belang
sein. Denn was damit zumindest tendenziell zur Disposition gestellt ist, das ist das
integrative Potential der erotischen Situation für die gesamte dargestellte Welt.
Eine solche Auflösung der Bindungskraft dieses semantischen Kerns zeigt sich in
Ansätzen ja bereits im Canzoniere selbst, und zwar in jenen Texten, die nicht mehr
von der Liebe handeln und unter denen das prominenteste Beispiel zweifellos die
Italienkanzone bildet. Gewiß gelingt es Petrarca, sie anderweitig in das System
seines Canzoniere hineinzuholen. So überträgt er etwa die Muster des erotischen
Diskurses auf die Klage über den erbärmlichen Zustand seiner Heimat, und
zudem lassen sich solche Texte als ein Dialog mit der politischen Dichtung der
Provenzalen verstehen. In diesem Sinn mag man für die größere thematische Viel-
falt des Canzoniere gegenüber der Vita nova auch ein poetologisches Argument
anführen, ist es doch offenkundig zugleich Petrarcas Anliegen, mit seinen Rerum
vulgarium fragmenta – auch in dieser Hinsicht ganz gegen den sensus litteralis
dieses Titels gerichtet – so etwas wie eine Summa der volkssprachlichen Dichtung
vorzunehmen und mit all ihren überlieferten Formen in einen Dialog zu treten.
Freilich war eine solche Intention ja schon Dantes Vita nova nicht ganz fern, der
gleichwohl bei einer engen thematischen Bindung an die Liebe bleibt. Bei ihm also
hat die thematische Ordnung augenscheinlich Vorrang, um so auffälliger erscheint
es demgegenüber, wie das integrative Potential der erotischen Situation für den
Petrarkischen lyrischen Diskurs abnimmt. Jene singuläre Konstellation also, welche
den semantischen Kern dieser Liebesdichtung und die poetischen Verfahren seit
den Trobadors der Provence einander zuordnete, verliert in Petrarcas Canzoniere
erkennbar an Bindungskraft.
Wollte man ein weiteres Merkmal benennen, das den Canzoniere von der über-
kommenen Lyrik unterscheidet, dann ist es der Zuwachs an Autoreflexivität, den
die lyrische Dichtung hier gewinnt. Dieser vielstrapazierte Begriff will hier vor
allem besagen, daß traditionelle Implikationen dieses poetischen Systems hier zum
Gegenstand der dargestellten Welt werden. Dafür sei nur ein signifikantes Beispiel
genannt. Von Anfang an stellte sich für die bei den Trobadors begründete Minne-
dichtung die Frage nach dem Verhältnis zwischen deren Liebeskonzept und der
offiziellen moralischen Norm. Wie ließ es sich vermitteln, daß jener Affekt des
Eros, den die christliche Ethik als die Todsünde der luxuria kennt, zu einem
fin’amors nobilitiert wurde? Gewiß konnten wir eine Konzession an diese offizielle
Norm zweifellos im Ausschluß des Geschlechtsakts finden. Insoweit das Begehren
Einfallstor der Sünde geraten). Daß die Geschichte gleichwohl noch ein zumindest halb-
wegs gutes Ende findet, ist statt dessen nicht einer von Anfang an gegebenen Versiche-
rung geschuldet, sondern die Ursache dafür tritt als pure Kontingenz in Erscheinung.
Daß die Abkehr von der als falsch erkannten Liebe stattfindet, folgt nicht der von Beginn
an eingeschriebenen Wahrheit, sondern ist eher unwahrscheinlich. Wo die Zeit sich als
Veränderung bemerkbar macht, ist sie deshalb gerade unberechenbar.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 111
strukturell von seiner – grundsätzlich negierten – Erfüllung getrennt wird, ist der
Konflikt mit der offiziellen Moral marginalisiert. Indessen sollte es nicht bei einer
solchen Strategie der Minimierung der Transgression bleiben. Die Lyrik des stil-
novismo – und allem anderen voran Dantes Vita nova – läßt sich vielmehr als der
Versuch der Aufhebung dieses Konflikts von Affekt und Norm beschreiben. Wenn
die Liebe zu einer Beatrice schließlich auf den in ihrem Namen schon gewiesenen
Weg zum Himmel führt, dann ist dieser Eros ganz in den Dienst christlicher Moral
gestellt. Die betreffende Integration findet mittels einer Ähnlichkeitsrelation statt,
die zwischen diesseitiger Schönheit und jenseitiger Perfektion angelegt ist, sie
bedient sich also eines symbolischen Verfahrens. In gewisser Weise ist es freilich
kurios, daß der aus orthodox theologischer Sicht so prekäre Eros zum Gegenteil
seiner selbst gerät, und vielleicht mußte auf jene Hypostasierung der Aufwertung
dieses Eros eine Gegenreaktion folgen, wie sie sich ja bereits in Dantes Commedia
– erwähnt sei nur der Gesang der Francesca da Rimini, der fünfte des Inferno –
herausbildet. Bei Petrarca aber wird der Konflikt von Affekt und Norm als solcher
zum zentralen Gegenstand der dargestellten Welt und bestimmt maßgeblich das
Gefühlsleben des heillos verliebten Sängers. Eben solches will Autoreflexivität hier
besagen.11
Unbeschadet der hier skizzierten Veränderungen aber hat Petrarca unverkenn-
bar am tradierten poetischen System Teil. Er dialogisiert, wie Bernhard König an
verschiedenen Beispielen brillant demonstriert hat,12 mit seinen Vorgängern, um
diesen Dialog zugleich in ein Strukturmuster seines eigenen Zyklus zu verwandeln.
Ja, Petrarca macht selbst die Zyklusbildung als solche zum Gegenstand paradig-
matischer Variation, präsentiert sie sich doch gleichermaßen als Zitat und Ver-
wandlung der Sammlungsstruktur von Dantes Vita nova. Die Komplexität para-
digmatischer Variation nimmt also im Canzoniere um eine weitere Ebene zu.
So weit, so gut. Aber welchen Beitrag leistet der Aufweis dieser Charakteristika
von Petrarcas Canzoniere zu einer Antwort auf die eingangs noch einmal aufge-
worfene Frage nach dem Systemcharakter des Petrarkismus? Meine erste Antwort
besteht darin zu sagen, daß sich der Petrarkismus vielleicht nicht angemessen als
11 Reflexiv also ist hier im ‚starken‘ Sinne des Wortes gemeint und bezeichnet das Nachden-
ken über die Sache, es meint insoweit mehr als bloße Bezüglichkeit. Mir scheint diese ter-
minologische Bemerkung deshalb angebracht zu sein, weil vielleicht im Zeichen eines
postmodernen oder poststrukturalen Dichtungsverständnis diese Differenz sich ein biß-
chen zu verlieren droht. Selbstreflexivität als Selbstverweis scheint mir hier nicht immer
in der notwendigen Weise von Selbstthematisierung unterschieden zu sein. Deshalb sei
noch einmal an Roman Jakobson erinnert, der eine in dieser Hinsicht hilfreiche Differen-
zierung eingeführt hat. Denn bei ihm sind die autoreflexive und die metasprachliche
Funktion der Sprache treffend voneinander geschieden.
12 Erwähnt sei hier nur seine fulminante Untersuchung „Dolci rime leggiadre. Zur Verwen-
dung und Verwandlung stilnovistischer Elemente in Petrarcas Canzoniere (Am Beispiel
des Sonetts In qual parte del ciel)“, in: Petrarca 1304–1374. Beiträge zu Werk und Wir-
kung, hrsg. F. Schalk, Frankfurt am Main 1975, S. 113–138.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
112 Andreas Kablitz
ein eigenes System beschreiben läßt,13 sondern als eine spezifische Systemtransfor-
mation. Charakteristisch für ihn ist zunächst, daß die traditionelle Ordnung inter-
textueller Variation eine hierarchische Struktur gewinnt. Petrarca wird zum domi-
nanten Gegenstand dieses intertextuellen Dialogs. Die Gründe dafür wird man
wohl zurecht in einer Übertragung humanistischer Prinzipien auf die volkssprach-
liche Literatur vermuten können. Insofern halte ich die von Toffanin geprägte und
auf Bembo gemünzte Formel des umanesimo volgare 14 nach wie vor für ausge-
sprochen glücklich. Petrarca wird im intertextuellen Dialog dieser Lyrik als eine
Autorität installiert, die etwa derjenigen Ciceros für die lateinischsprachige Lite-
ratur korrespondiert. Diese dominante Ausrichtung des Prinzips intertextueller
Variation auf Petrarca bedeutet durchaus nicht, daß nicht auch anderweitiger
Dialog nach wie vor stattfinde. Auch die Petrarkisten dialogisieren untereinander,
wie Bernhard König oder Alfred Noyer-Weidner nachgewiesen haben.15 Und doch
gewinnt auch dieser interne Dialog zwischen den Petrarkisten eine zusätzliche
Qualität. Ich greife zur Charakteristik dieses Unterschieds auf die zitierte Studie
von Alfred Noyer-Weidner zum Verhältnis von Bembos und Torquato Tassos
Einleitungssonett zurück. Während Bembo mit seinem Proömialgedicht einen
epischen Überbietungsanspruch gegenüber dem Petrarkischen Canzoniere erhebt,16
korrigiert Tasso diesen Anspruch, um mit deutlichen Hinweisen auf Petrarcas
Einleitungssonett das lyrische Register als das für diese Dichtung angemessene
zu behaupten. Hier wird gewissermaßen um Petrarkische Orthodoxie gerungen.
Dies aber bedeutet für den intertextuellen Dialog dieser Dichtung, daß sich das
Prinzip paradigmatischer Variation nicht mehr vollständig auf das anderweitige
Prinzip eines Überbietungsanspruchs abbilden läßt. Der Überlegenheitsanspruch
Tassos gegenüber Bembo beruft sich auf die größere Nähe zum Original. Um so
auffälliger ist es deshalb, daß Tasso in demselben Proömialsonett, in dem er sich
zum einen so ostentativ an Petrarca anschließt, sich an dessen Ende kaum weniger
demonstrativ von ihm distanziert. Petrarcas Einleitungsgedicht ist bekanntlich ein
13 Dies würde dann a forteriori auch schon für Petrarca selbst gelten. Ich zögere deshalb, für
seine Lyrik, wie Friedrich es getan hat, von einem „zweiten“ System zu sprechen.
14 G. Toffanin, Il Cinquecento, Mailand 21941, S. 83. Besonders akzentuiert hat diese These
dann G. Mazzacurati, Misure del classicismo rinascimentale, Neapel 1967 (vgl. im beson-
deren S. 154ff.).
15 Vgl. Bernhard König, „Liebe und Infinitiv. Materialien und Kommentare zur Geschichte
eines Formtyps petrarkistischer Lyrik (Camões, Quevedo, Lope de Vega, Bembo, Petrarca)“,
in: Italien und die Romania in Humanismus und Renaissance. Festschrift für Erich Loos
zum 70. Geburtstag, hrsg. Klaus W. Hempfer, Enrico Straub, Wiesbaden 1983, S. 76–101.
Alfred Noyer-Weidner, „Zu Tassos ‚binnenpoetischer‘ Auseinandersetzung mit Bembo
(Samt anschließendem Hinweis auf das Desideratum einer kritischen Ausgabe von Bem-
bos Rime)“, in: ders., Umgang mit Texten, Bd. I, hrsg. Klaus W. Hempfer, Stuttgart 1986,
S. 334–353.
16 Vgl. hierzu des näheren die Studie von Alfred Noyer-Weidner, „Lyrische Grundform
und episch-didaktischer Überbietungsanspruch in Bembos Einleitungsgedicht“, ebda.,
S. 289–333.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 113
Reuegedicht, und auch Bembo hatte diese Tradition fortgesetzt und ihr eine didak-
tische Wendung gegeben. Alle, die diese Verse lesen, so heißt es bei ihm, sollten die
schädlichen Wirkungen Amors erkennen und deshalb, durch diese Lektüre ange-
leitet, lernen, sich ihm zur Wehr zu setzen und die Fehler zu vermeiden, denen der
Verfasser dieser rime selbst zu seinem Unglück anheimgefallen war. Tasso setzt
statt dessen am Schluß zu einer kaum verhohlenen, zumindest partiellen Legiti-
mierung der Liebe an. Wenn man nur zur Zeit von ihr abläßt, dann ist es ein Ver-
gnügen, Liebesverlangen im Herzen zu tragen: dolce è portar voglia amorosa in
seno schließt dieser Text.
So weit die hier referierten Ergebnisse der Studie von Alfred Noyer-Weidner,
die eben zu der bereits aufgeworfenen Frage Anlaß geben, warum das Einleitungs-
sonett Tassos so markiert gegensätzliche Positionen bezieht. Wie läßt es sich mit-
einander vereinbaren, daß hier zum einen Bembos Überbietungsanspruch durch
die Demonstration von Petrarkischer Orthodoxie zurückgewiesen wird, um im
gleichen Zug demonstrativ auch auf Distanz zu ihm zu gehen? So widersprüchlich
dies erscheint, ich glaube, daß beides dennoch zusammengehört und letztlich ur-
sächlich mit der Einsetzung Petrarcas als der Autorität dieses lyrischen Diskurses
verbunden ist. Denn eben diese Zuschreibung eines besonderen Ranges macht das-
jenige schwierig, was seit altersher dem Verfahren intertextueller Variation eine
Richtung gibt: eben der Anspruch der Überlegenheit. Insofern ist es nur konse-
quent, wenn Tasso Bembo sozusagen in seine Schranken verweist. Doch zum
anderen stellt sich damit die Frage, wie sich denn eine notwendige Differenz
gewinnen läßt gegenüber dem Werk desjenigen, der als Autorität dieses Diskurses
installiert ist; und notwendig bleibt die Herstellung einer solchen Differenz, weil
sie allein dem eigenen Text so etwas wie eine Identität – anders gesagt: Informa-
tivität – garantieren kann. Die Antwort auf diese Frage steckt, so scheint mir, in
der ambivalenten Position von Tassos Proömialsonett. Gerade die Akzeptanz
Petrarcas als der schlechthinnigen Autorität, dessen Orthodoxie deshalb gegen-
über dem Abweichler wiederherzustellen ist, erzeugt zum anderen die Unvermeid-
lichkeit einer Abweichung gegenüber dem Canzoniere. Denn unvermeidliche Diffe-
renz läßt sich angesichts seines Rangs nicht mehr umstandslos in einer
Konkurrenz um den ersten Platz gewinnen, und so wird solche Differenz zur
Abweichung, zur markierten Abweichung. Die Begründung von lyrischer Auto-
rität und deren gleichzeitige Infragestellung gehören im System des Petrarkismus
zusammen. Diesem System ist das Spiel um Identität und Differenz strukturell
eingeschrieben. Es erwächst aus dem paradoxen Umstand, daß Normativität
Abweichung produziert, weil sie so allein Informativität erhält.17
17 Theoretisch denkbar ist durchaus eine Alternative, die Information erhält, ohne zu Diffe-
renz führen zu müssen. Gemeint ist der Kommentar. Ihm ist gewissermaßen schon als
Gattung die Herstellung oder Fortschreibung von Autorität eingeschrieben. Denn nur
dasjenige, das Geltung besitzt und beanspruchen kann, lohnt es zu kommentieren. In der
Tat ist der Lyrik des Petrarkismus diese Variante nicht fremd geblieben. Ich habe an
anderer Stelle nachzuweisen versucht, in welcher Weise sich Bembos Rime als ein solcher
Kommentar zum Petrarkischen Canzoniere und seinen diskursiven Ordnungen begreifen
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
114 Andreas Kablitz
Während ich bislang diese Paradoxie von Normativität und Differenz vor allem
systematisch als einen Konflikt zwischen Modellbildung und Informativität
beschrieben habe, gibt es freilich auch eine bemerkenswerte Umbesetzung inner-
halb der Ästhetik der imitatio, welche sich mit dem Petrarkismus vollzieht. Daß
sich auch die in der volkssprachlichen Lyrik seit altersher etablierten Formen der
Intertextualität einer solchen Kategorie der Nachahmung subsumieren lassen,
muß auf den ersten Blick erstaunlich erscheinen. Denn wie ist es denkbar, das
etwas, das etwas anderes nachahmt, zugleich einen höheren Rang zu beanspru-
chen scheint? Nachahmung scheint immer schon eine Hierarchie zu etablieren
zwischen Nachahmendem und Nachgeahmtem, die stets zulasten des ersteren aus-
geht. In der Tat ist die Existenz einer solchen Rangfolge zu einem wesentlichen,
althergebrachten polemischen Argument gegen alle Nachahmung geworden. Ihren
prominentesten Vertreter hat sie in Platons Philosophie gefunden, bei dem alle
imitationes einen metaphysisch befestigten niederen Stellenwert besitzen. Indessen
scheint die Praxis der imitatio nicht dieser Platonischen Position gefolgt zu sein,
sondern einer Aristotelischen, der es in der Tat gelingt, die Nachahmung mit dem
Wettstreit um den Vorrang zu verknüpfen. Signifikant in dieser Hinsicht ist die
Quintilianische Bewertung der imitatio als einer Form der exercitationes.18 Was
hier als Teil eines didaktischen Programms begriffen ist, läßt sich indessen
unschwer in eine diskursive Praxis überführen. Denn was bildet das Ziel solcher
Übungen? Dies ist offensichtlich der Erwerb von Fertigkeiten, sie dienen der Per-
fektionierung der eigenen Kompetenz. Just diese Eigenheit aber, die in der imitatio
angelegte Steigerung von Kompetenz zum Zwecke der Vervollkommnung, besitzt
eine Entsprechung in einer intertextuellen Praxis, in der Nachahmung mit Über-
legenheitsanspruch einhergeht. Wenn ich ein solches Konzept der imitatio als
‚Aristotelisch‘ bezeichnet habe, dann deshalb, weil seine Bestimmung der Technik
als mimesis tes physeos gleichermaßen die Perfektionierungsidee stets schon ein-
schließt. Nachahmung ist hier nicht als eine Relation zwischen zwei Objekten, ei-
nem Nachahmendem und einem Nachgeahmten gedacht, sondern ein Verfahren,
das auf Vervollkommnung zielt. Die Analogie zur Natur entsteht folglich nicht als
eine Reproduktion ihrer Gegenstände, sondern als eine Anwendung des ihr selbst
inhärenten Prinzips der Vervollkommnung, Aristotelisch gesprochen, als Erfül-
lung des in der Natur als solcher angelegten Kategorie der Entelechie. Ein signifi-
kantes Beispiel für ein solches Verständnis der Nachahmung im Aristotelischen
Werk bietet seine Charakteristik der Mimesis in der Poetik. Wenn die Dichtung
lassen. (Vgl. Andreas Kablitz, „Lyrische Rede als Kommentar. Anmerkungen zur Petrarca-
Imitatio in Bembos Rime“, in: Der petrarkistische Diskurs. Spielräume und Grenzen, hrsg.
Klaus W. Hempfer, Gerhard Regn, Stuttgart 1993, S. 29–76.) Indessen ist diese Möglich-
keit nicht die dominante Form petrarkistischen Dichtens geblieben, das sich eben nicht
grundsätzlich – wie ein Kommentar – als eine Form der Metasprache präsentiert, son-
dern letztlich auf der gleichen diskursiven Ebene wie das Original angesiedelt ist. Genau
diese strukturelle Ähnlichkeit aber produziert die bezeichnete Ambivalenz von Normati-
vität und Transgression.
18 Vgl. Quintilian, Institutio oratoria, X,2,7.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 115
der Geschichtsschreibung überlegen ist, dann deshalb, weil sie der Kontingenz des
Vorfindlichen, an die der Historiker um der Wahrheit willen gebunden bleibt, ein
höheres Maß an – logischer – Ordnung gegenüberstellen kann. Insoweit Nach-
ahmung also nicht auf eine für sie stets abträgliche Reproduktion normativer
Objekte beschränkt ist, sondern sich auf das entelechische Prinzip der Vervoll-
kommnung bezieht, vermag sie Mehrwert zu produzieren, statt nur Nachrangiges
hervorzubringen. Wenn es Aristoteles also in seiner Korrektur der – zunächst
nichts als evidenten – Platonischen Verhältnisbestimmung vermag, die mit aller
Nachahmung selbstverständlich verbunden zu sein scheinende Nachrangigkeit zu
überwinden, dann gelingt ihm dieses Kunststück durch Komplexitätszuwachs.
Nachahmung bezieht sich nicht mehr auf eine Relation von Objekten, sondern auf
eine Analogie von formalen Prinzipien. Es hat nun den Anschein, als korrespon-
diere die intertextuelle Praxis der volkssprachlichen Lyrik, wie sie sich bei den
Trobadors herausbildet, recht genau diesem Aristotelischen Konzept der Mimesis.
Wenn der neue Text zitiert, dann nicht, um sich in die Nachfolge eines unerreich-
baren Ideals zu stellen, dessen Normativität noch einmal markiert wird, sondern
weil der Konkurrent markiert wird, dessen Ruf und Rang den Wettstreit lohnt,
einen Wettstreit, der auf Perfektionierung und folglich die eigene Überlegenheit
zielt. Aus dieser Sicht der Dinge betrachtet, erscheint die für den Petrarkismus
charakteristische intertextuelle Struktur gewissermaßen als eine Hybride zwischen
einer Platonischen und einer Aristotelischen Konzeption der Nachahmung.19 Die
darin zutage tretende Unentschiedenheit über den Status des Vollkommenen aber
bringt es mit sich, daß die Transgression von Normativität nun als solche zu einem
Wert aufsteigt, Abweichung als solche folglich ästhetisch aufgewertet wird. Viel-
leicht liegt darin eines der Merkmale petrarkistischen Dichtens, das einer auf den
ersten Blick zutiefst prämodernen diskursiven Filiation eine Gemeinsamkeit mit
den Prinzipien moderner Ästhetik verleiht.20
19 Die Opposition der Positionen, welche dieser Hybride zugrunde liegt, scheint mir übri-
gens ein durchgängiges Problem der humanistischen Diskussion zu bilden. Bekanntlich
ist die Qualität antiker Normativität strittig. In berühmten Kontroversen wie derjenigen
zwischen Pietro Bembo und Gianfrancesco Pico della Mirandola steht zur Debatte, ob
man einem einzigen Musterautor – vorzugsweise Cicero – oder einem eklektischen
Modell folgen soll. Was dabei letztlich in Frage steht, ist implicite indessen die Konkur-
renz einer Aristotelischen und einer Platonischen Konzeption der imitatio. Gibt es eine
abstrakte Idee von Vollkommenheit, der man sich durch den Erwerb stets verbesserungs-
fähiger Fertigkeiten nähern kann, oder ist Idealität in einem stets schon vorfindlichen
Modell angelegt, das man sich als solches anzueignen hat? Die Unentschiedenheit, wel-
che den betreffenden, stets erneut auftretenden und schon allein deshalb ungelösten Kon-
troversen zugrunde liegt, wird in der skizzierten hybriden Struktur des Petrarkismus als
solche erkennbar und zugleich diskursiv produktiv gemacht.
20 Die Frage hat Weiterungen, die ich hier nicht im einzelnen verfolgen kann. Lohnend wäre
etwa die Frage, inwieweit sich eine solche Aufwertung der Abweichung als ästhetischer
Kategorie zur zeitgenössischen Ästhetik der meraviglia verhält, welche im secondo Cin-
quecento eine vielfach vertretene, dezidiert anti-Aristotelische Position bezeichnet, die
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
116 Andreas Kablitz
All dies blieb bislang ziemlich abstrakt, und so ist es längst an der Zeit, einen Text
etwas genauer zu Rate zu ziehen. Als Beispiel sei ein Gedicht noch einmal von
Torquato Tasso gewählt, ein berühmtes Stück aus seinen Rime: Ecco mormorar
l’onde:
Ecco mormorar l’onde,
e tremolar le fronde
a l’aura mattutina, e gli arboscelli,
e sovra i verdi rami i vaghi augelli
cantar soavemente
e rider l’orïente;
ecco già l’alba appare
e si specchia nel mare,
e rasserena il cielo
e le campagne imperla il dolce gelo,
e gli alti monti indora.
O bella e vaga Aurora,
L’aura è tua messaggera, e tu de l’aura
ch’ogni arso cor ristaura.21
Selbst ein nur oberflächlicher Blick auf dieses Gedicht gibt zu erkennen, daß hier
Verfahren des Petrarkischen Canzoniere zur Anwendung kommen. Am wohl signi-
fikantesten zeigt sich dies am Umgang mit solchen Lexemen, die auf den Namen
der Geliebten, den Namen der Laura deuten. Denn die besungene Dame in diesem
Text trägt denselben Namen wie die Angebetete des Canzoniere selbst. Zu den
Effekten dieser Namensidentität später ein wenig mehr. Zunächst sei der spezi-
fische Einsatz der betreffenden Verfahren etwas genauer studiert. Zwei Dinge sind
es, die auf den Namen der Geliebten verweisen, der Lufthauch und die Morgen-
röte: l’aura und l’aurora. In beiden Fällen läßt sich ein in der Sache angelegter
Zusammenhang zwischen der Dame und den Dingen angeben, welchen die Ähn-
lichkeit oder gar Identität des Nomens nur zum Ausdruck bringt. Die Morgenröte
als Botin der Sonne verweist auf die Frau, deren Schönheit selbst dem alles über-
strahlenden Glanz der Sonne gleichgestellt wird oder ihn gar zu übertreffen
scheint; und das Rot der Aurora ruft zudem die Farben von Lauras Wangen in
Erinnerung. Der namensidentische Lufthauch l’aura bezeichnet nichts anderes als
jenen Atem oder Odem, welcher das Leben selbst einhaucht. So hat diese aura
denn auch im Frühling, wenn die erstorbene Natur zu neuem Leben erwacht, einen
privilegierten Ort, und in der Tat erscheint dem liebenden Ich des Canzoniere seine
Laura als der Quell seines eigentlichen Lebens. Ganz in einem solchen Sinn ist die
sich gerade gegen die anderweitig etablierte Normativität der Poetik wendet. (Nur um
Mißverständnissen vorzubeugen, sei erwähnt, daß hier die ‚Modernität‘ einiger Merk-
male des Petrarkismus nicht im Sinne einer ‚kausal-zeitlichen‘ Beziehung als ‚Vorläufer‘,
‚Wegbereiter‘ oder ähnlichen verstanden ist. Vorderhand seien damit nur Ähnlichkeiten
bezeichnet, über deren strukturellen oder evolutionären Zusammenhang keine weiteren
Aussagen gemacht seien.)
21 Torquato Tasso, Opere, hrsg. Bertolo Tommaso Sozzi, Bd. II, Turin 1956, S. 71.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 117
aura auch in unserem Gedicht eingesetzt und kündigt das Ende der Nacht und den
Beginn des Morgens an. Insoweit also greift Tasso hier schlicht Verfahren Petrar-
cas auf, um sie eben nachzuahmen. Worin aber steckt der Unterschied zwischen
Petrarca und Petrarkismus in unserem Fall? Denn in der Tat scheinen hier Diffe-
renzen zu bemerken zu sein. Ja, der Text scheint nachgerade auf die diskrete Aus-
stellung solcher Unterschiede hin angelegt zu sein, und dies läßt sich vielleicht am
deutlichsten am Verhältnis zwischen dem Lufthauch und der Morgenröte ablesen.
Denn auch diese beiden sind in ein zeichenhaftes Verhältnis zueinander gesetzt,
der Lufthauch ist als Botin der Morgenröte apostrophiert. Diese zeichenhafte
Beziehung zwischen beiden spielt zunächst natürlich auf ihre zeitliche Abfolge an.
Der Lufthauch des Morgens geht dem Erscheinen der Morgenröte vorauf und
kündigt insofern ihre Ankunft an. Indessen wird dieser zeitliche Bezug durch
einen weiteren überlagert, und zwar durch die Beziehung auf der Ebene des Signi-
fikanten. Denn der Lufthauch, l’aura, bildet zugleich einen phonetischen Teil des
Wortes, welches die Morgenröte bezeichnet, l’aurora. Insofern wendet Tasso nicht
allein die Verfahren des Canzoniere an, sondern er potenziert sie zugleich. Nun ist
auch die Beziehung zwischen den verschiedenen Dingen von Belang, die aufgrund
ihres Signifikanten auf die besungene Dame deuten, und die Ordnung der Natur
selbst, die zeitliche Abfolge von morgendlichem Wind und Morgenröte wird mit
der Beziehung zwischen den sie bezeichnenden Worten parallelisiert. Man könnte
fragen, ob das solchermaßen arrangierte Verhältnis zwischen l’aura und l’aurora
gewissermaßen die manieristische Variante des Petrarkischen Spiels mit Lauras
Namen darstellt. Indessen will ich diese ja schon verschiedentlich aufgeworfene
Frage nach dem literarhistorischen Ort Tassos hier nicht weiter verfolgen, wohl
aber einige Konsequenzen der beobachteten Potenzierung von Petrarcas Verfahren
bei Tasso bedenken. Was diese Potenzierung nämlich bewirkt, ist letztlich nichts
anderes als die Loslösung des betreffenden Verfahrens von seiner ursprünglichen
Funktion, ja diese Funktion wird nachgerade marginalisiert. Wenn schon in
Petrarcas Canzoniere, wie bemerkt, eine Auflösung des ursprünglichen konzeptuel-
len Zusammenhangs zwischen der Semantik der Werbung und den poetischen Ver-
fahren sich beobachten läßt, dann steigert in dieser Hinsicht der Petrarkismus
etwas, das schon bei Petrarca selbst angelegt ist. Die Emanzipation der aus dem
Canzoniere zitierten Verfahren von ihrer Bindung an die erotische Situation, die
bei Petrarca – allen Exkursen zum Trotz – noch immer eine unverkennbar integra-
tive Funktion besaß, nimmt hier deutlich ab. Denn daß Dinge wie die Morgenröte
auf die Person der Geliebten verweisen, gerät in diesem Text zu kaum mehr als
einer kleinen Erwähnung am Ende. So wie der Lufthauch die Morgenröte an-
kündigt, so, heißt es, deutet die Morgenröte auf Laura. Aber diese Volte am Ende
wirkt gewissermaßen aufgesetzt, und dieser Effekt liegt nicht zuletzt daran, daß
schon zuvor die Aufmerksamkeit des Lesers auf ganz anderes gerichtet war.
Kaum zufällig hat Monteverdi dieses Gedicht Tassos in Töne gesetzt, denn was
es auszeichnet, ist eine bemerkenswerte lautliche Ordnung. Die Schilderung des
sich mehr und mehr entfaltenden Morgens ist einer Rede übertragen, die deutlich
von den dunklen Vokalen immer mehr zu den hellen übergeht. Dies läßt sich
zumal anhand der ersten Verse dieses Gedichts ablesen: Von der Dominanz des o
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
118 Andreas Kablitz
führt der Weg über a und e zum i. Die Ankunft des Tageslichtes ist insofern mime-
tisch in der lautlichen Ordnung nachvollzogen mit der Ablösung der dunklen
durch die hellen Vokale. Diese verschiedenen Parallelen zwischen Sprache und
Welt, die mit der ostentativen Äquivalenz von Lautkörper und bezeichneten
Dingen nachgerade ein kratylisches Sprachkonzept in Szene zu setzen scheinen,
lösen diese Verfahren von ihrer ursprünglichen Zentrierung um die Person der
Laura. Eben dies gibt der Schluß zu erkennen, wenn die Erinnerung an die Geliebte
zu kaum mehr als einer epigrammatischen Volte gerät. Zu dieser Ablösung der
Petrarkischen Verfahren von ihrem semantischen Zentrum trägt nicht zuletzt die
Suggestion der Unmittelbarkeit des Naturgeschehens bei, welcher Eindruck vor
allem durch die mehrfache Wiederholung der Interjektion ecco entsteht, einem bei
Petrarca ganz unbekannten Verfahren.22 Auch dadurch wird die Präsenz der Natur
als solcher, unabhängig von ihrer semiotischen Funktion für die erotische Situa-
tion, markiert. Und schließlich ist auch die Einordnung des Namens der Laura in
die Ordnung dieses Gedichts von solcher Art, daß sie die bisherigen Verfahren
letztlich umkehrt. Denn der Windhauch hatte die Morgenröte nicht zuletzt des-
halb angekündigt, weil sich das erste Lexem l’aura als ein Teil des zweiten l’aurora
präsentierte. Just diese Bewegung aber wird im Verhältnis zwischen der Morgen-
röte und der Person der Laura ins Gegenteil verkehrt. So wirkt das Auftreten der
Laura am Ende dieses Textes fast ein wenig gezwungen, und eben dies markiert
die Ablösung der hier praktizierten Verfahren von ihrer überkommenen Funktion.
Zu einer solchen Marginalisierung trägt schließlich auch die Identität des Namens
dieser Laura mit derjenigen bei, die ihr hier Modell steht. Denn eben diese osten-
tative Nähe bewirkt zugleich, daß die Unterschiede um so sichtbarer werden. Viel-
leicht wird die vorhin skizzierte Ambivalenz der Rolle Petrarcas als Autorität und
Gegenstand ostentativer Distanzierung in der intertextuellen Variation des petrar-
kistischen Systems mit dieser Namensidentität der beiden Geliebten nachgerade
emblematisch sichtbar. Die ostentative Nähe und die Markierung des Abstands
sind die beiden Seiten derselben Sache.
Nun läßt sich die Differenz zwischen dem hier betrachteten Gedicht Tassos
und Petrarcas Canzoniere nicht nur auf der Ebene der allgemeinen Verfahren
beobachten. Sie wird um so deutlicher, wenn man einen Blick auf den Text Petrar-
cas wirft, dem Tasso hier unmittelbar repliziert. Es handelt sich um dessen Sonett
Nr. 219:
Il cantar novo e ’l pianger delli augelli
in sul dì fanno retentir le valli,
e ’l mormorar de’ liquidi cristalli
giù per lucidi, freschi rivi et snelli.
Quella ch’à neve il volto, oro i capelli,
nel cui amor non fur mai inganni né falli,
22 Bei Strozzi, wie ich einem Hinweis Bernhard Königs verdanke, läßt sich solches schon
zuvor finden.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Petrarkismus. Einige Anmerkungen zu einer Debatte über seinen Status 119
destami al suon delli amorosi balli,
pettinando al suo vecchio i bianchi velli.
Così mi sveglio a salutar l’aurora,
e ’l sol ch’è seco, et più l’altro ond’io fui
ne’ primi anni abagliato, et son anchora.
I’ gli ò veduti alcun giorno ambedui
levarsi inseme, e ’n un punto e ’n un’hora
quel far le stelle, et questo sparir lui.23
Daß es sich bei Tassos Gedicht um eine Replik auf dieses Petrarkische Sonett
handelt, geht nicht nur aus der beiden gemeinsamen morgendlichen Szenerie her-
vor, sondern ergibt sich zumal aus der Identität einzelner Worte. So sei nur auf das
Verbum mormorar hingewiesen, das in Tassos erstem Vers zu finden ist und bei
Petrarca – in gleicher Infinitivform – in Vers 3 steht. Natürlich spielt auch Petrar-
cas Text mit der Namensbeziehung zwischen Laura und Aurora. Besonders deut-
lich wird ihr Zusammenhang am Beginn des zweiten Quartetts, wo der Leser sogar
für einen Moment im Unklaren darüber belassen wird, ob hier ein Porträt Lauras
oder eines der Aurora gezeichnet wird.24 Was bei Tasso im Vergleich mit Petrarcas
Gedicht indessen vor allem ins Auge fällt, ist die völlige Preisgabe der mytho-
logischen Referenz. Die Geschichte von Eos und Tithonos bildet in Petrarcas
Sonett eine Verdichtung jener Wunschvorstellungen, deren Erfüllung der heillos
Verliebte für sich selbst nie gewinnen kann. Was für ihn Utopie bleiben muß, gerät
in der mythischen Beziehung zwischen Eos und Tithonos zu einem im eigentlichen
Sinne des Wortes natürlichen Geschehen und scheint von daher zugleich eine Legi-
timität beanspruchen zu können, die der offizielle Kanon der Moral dem Be-
gehren des Sängers permanent versagt. Bei Tasso aber fehlt der Aurora jegliche
mythische Valenz. Sie wird hier hineingeholt in jenes zuvor untersuchte Spiel der
Lautzeichen, das die Parallelität von Worten und Dingen konsequent in Szene
setzt. Bei Petrarca ist die erotische Situation von allem Anfang an in verschlüssel-
ter Form präsent. Auch in der Schilderung des Beginns, von der Klage des Vogels,
die auf den Sänger selbst anspielt, hin zu dem Rauschen des Wassers, das an die
Nymphen denken läßt, ist es Laura, welche die Szenerie beherrscht. Tasso geht
statt dessen den gegenteiligen Weg. Die Dinge, die auf die Person der Geliebten
hinzudeuten scheinen, entwickeln nun ein Eigenleben, in dem sich die aus dem
Canzoniere übernommenen Verfahren von ihrer semantischen Funktion ablösen
und die ausdrückliche Präsenz Lauras am Ende des Gedichts wie einen Fremd-
körper erscheinen lassen.
23 Francesco Petrarca, Canzoniere Nr. 219, 1–14, zitiert nach: Francesco Petrarca, Canzoniere,
hrsg. M. Santagata, Mailand 22004, S. 931.
24 Ich habe diesen Text an anderer Stelle näher untersucht. Vgl. Andreas Kablitz, „Laura
und die alten Mythen. Zum Verhältnis von antikem Mythos und christlicher Heils-
geschichte in Petrarcas Canzoniere“, in: Petrarca-Lektüren. Gedenkschrift für Alfred Noyer-
Weidner, hrsg. Klaus W. Hempfer und Gerhard Regn, Stuttgart 2003, S. 69–96.
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
120 Andreas Kablitz
Um abschließend noch einmal zu resümieren: Daß sich die Ordnung inter-
textueller Variation, wie sie für die volkssprachliche Dichtung von Beginn an kon-
stitutiv war, im Petrarkismus nicht mehr bruchlos dem Prinzip fortschreitender
Überbietung subsumieren läßt, hatten wir als eines der Kennzeichen petrarki-
stischen Dichtens behauptet. Dies läßt sich auch in unserem Beispiel beobachten.
Ostentativ setzt Tasso nicht nur Verfahren des Canzoniere ein, sondern potenziert
sie, wie gesehen. Eine solche Potenzierung läßt sich durchaus mit den Techniken
der Überbietung in Verbindung bringen, wie sie seit altersher Geltung besitzen.
Indessen bewirkt eine solche Überbietung hier zugleich anderes als die bloße Mar-
kierung überlegenen Könnens; denn sie bewirkt auch eine mehr oder minder deut-
lich kenntlich gemachte Distanzierung gegenüber dem anderweitigen Modell Petrar-
ca, indem die übernommenen und potenzierten Verfahren des Canzoniere sich von
ihrer überkommenen Funktion lösen. Nähe und Distanz sind hier zwei Seiten der-
selben Medaille. Die Markierung von Differenz ist hier nicht mehr in der Behaup-
tung von Überlegenheit aufgehoben. Sie wird vielmehr als solche informativ. Imi-
tatio und demonstrative Abweichung sind im System petrarkistischen Dichtens
insofern aufeinander bezogen. Die Veränderung des Prinzips herkömmlicher inter-
textueller Variation, auf welcher Verwandlung der Petrarkismus wesentlich beruht
und die in der Einführung einer Hierarchie in die Ordnung dieses Dialogs besteht,
bringt die Ambivalenz von Autorität und Distanzierung mit sich. Das System des
Petrarkismus als spezifische Transformationsstufe des Systems der volkssprach-
lichen Dichtung rückt durch die Kombination oder besser durch die Hybridisie-
rung der herkömmlichen intertextuellen Variation mit dem humanistischen Prinzip
einer Nachahmung von auctoritates die Ambivalenz von Imitatio und Subversion
in sein Zentrum.
Köln, im Dezember 2004
Bereitgestellt von | Ludwig-Maximilians-Universität München Universitätsbibliothek (LMU)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 30.04.19 16:50
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Skript Atombau Und Periodensystem 2014 PDFDokument118 SeitenSkript Atombau Und Periodensystem 2014 PDFDr. Bernd Stange-Grüneberg100% (1)
- Hans Robert Jauss-Wege Des Verstehens - W. Fink (1994)Dokument436 SeitenHans Robert Jauss-Wege Des Verstehens - W. Fink (1994)juan1414100% (3)
- Die Kürze Des Lebens - Seneca (ClearScan) PDFDokument97 SeitenDie Kürze Des Lebens - Seneca (ClearScan) PDFPedddddddder100% (2)
- Einführung in Die Deutsche LiteraturwissenschaftDokument42 SeitenEinführung in Die Deutsche LiteraturwissenschaftErna Jukić100% (1)
- Aristoteles, Hans-Georg Gadamer (HG.) - Nikomachische Ethik VIDokument79 SeitenAristoteles, Hans-Georg Gadamer (HG.) - Nikomachische Ethik VIcarorubenNoch keine Bewertungen
- (Ru-Board) Die Metapher Der Mischung in Den Platonischen Dialogen Sophistes Und Philebos 3896655051 (Academia, 2010)Dokument328 Seiten(Ru-Board) Die Metapher Der Mischung in Den Platonischen Dialogen Sophistes Und Philebos 3896655051 (Academia, 2010)klapouschak100% (1)
- Der Totale Parteienstaat - Klaus KunzeDokument232 SeitenDer Totale Parteienstaat - Klaus KunzeGurki MeyerNoch keine Bewertungen
- Vaihinher Kommentar Zu Kants Kritik Der Reinen VernunftDokument1.106 SeitenVaihinher Kommentar Zu Kants Kritik Der Reinen VernunftAlana Costa100% (1)
- Lehrbuch der Geschichte der Philosophie: Die Philosophie der Griechen + Die hellenistisch-römische Philosophie + Mittelalter + Renaissance + Aufklärung + Die deutsche Philosophie (Kant und Idealismus) + Die Philosophie des 19. JahrhundertsVon EverandLehrbuch der Geschichte der Philosophie: Die Philosophie der Griechen + Die hellenistisch-römische Philosophie + Mittelalter + Renaissance + Aufklärung + Die deutsche Philosophie (Kant und Idealismus) + Die Philosophie des 19. JahrhundertsNoch keine Bewertungen
- Marco Polo Legende Und LebenDokument128 SeitenMarco Polo Legende Und LebenChris PifferNoch keine Bewertungen
- (Beiträge Zur Altertumskunde 320) Michael Erler, Jan Erik Heßler-Argument Und Literarische Form in Antiker Philosophie_ Akten Des 3. Kongresses Der Gesellschaft Für Antike Philosophie 2010-Walter de GDokument629 Seiten(Beiträge Zur Altertumskunde 320) Michael Erler, Jan Erik Heßler-Argument Und Literarische Form in Antiker Philosophie_ Akten Des 3. Kongresses Der Gesellschaft Für Antike Philosophie 2010-Walter de GTheaethetus100% (3)
- Gale M.R. - Avia Pieridum Loca Tradition An Innovation in Lucretius - 2005Dokument21 SeitenGale M.R. - Avia Pieridum Loca Tradition An Innovation in Lucretius - 2005Jean-Claude PicotNoch keine Bewertungen
- Platon in Ägypten Karl NawratilDokument6 SeitenPlaton in Ägypten Karl NawratilClassicusNoch keine Bewertungen
- Creszenzo, Luciano - Alles Fließt, Sagt HeraklitDokument213 SeitenCreszenzo, Luciano - Alles Fließt, Sagt Heraklitbeatrixscarmeta100% (1)
- Polnischer BarockrhetorikDokument378 SeitenPolnischer BarockrhetorikleszkeryNoch keine Bewertungen
- Das Neue Platonbild Hans KrämerDokument20 SeitenDas Neue Platonbild Hans KrämerClassicus100% (1)
- Seneca PDFDokument97 SeitenSeneca PDFTudor Speed100% (2)
- Bettine Menke - ProsopopoüaDokument5 SeitenBettine Menke - ProsopopoüaderridererNoch keine Bewertungen
- Wolfgang Preisendanz - Wege Des Realismus PDFDokument240 SeitenWolfgang Preisendanz - Wege Des Realismus PDFMerima BegićNoch keine Bewertungen
- Dieseeleunddiefo 00 LukuoftDokument390 SeitenDieseeleunddiefo 00 LukuoftmarheideggerNoch keine Bewertungen
- Armand Nivelle - Frühromantische Dichtungstheorie-De Gruyter (1970)Dokument236 SeitenArmand Nivelle - Frühromantische Dichtungstheorie-De Gruyter (1970)RaquelNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Studien 24 - 124-136 - Eine Quelle Der Frühen Schop-Kritik Ns - S. BarberaDokument13 SeitenNietzsche Studien 24 - 124-136 - Eine Quelle Der Frühen Schop-Kritik Ns - S. BarberaPolar666Noch keine Bewertungen
- Frank Chronotopoi 2015Dokument11 SeitenFrank Chronotopoi 2015doraszujo1994Noch keine Bewertungen
- Grimm KlassikDokument12 SeitenGrimm KlassikHartmut StenzelNoch keine Bewertungen
- Differenz der demokritischen und epikureischen NaturphilosophieVon EverandDifferenz der demokritischen und epikureischen NaturphilosophieNoch keine Bewertungen
- Sonne Und PunschDokument262 SeitenSonne Und PunschBiharriyaNoch keine Bewertungen
- 1 PB PDFDokument36 Seiten1 PB PDFGorean TorvieNoch keine Bewertungen
- Wertkritischer Exorzismus statt Wertformkritik: Zu Robert Kurz' "Abstrakte Arbeit und Sozialismus"Von EverandWertkritischer Exorzismus statt Wertformkritik: Zu Robert Kurz' "Abstrakte Arbeit und Sozialismus"Noch keine Bewertungen
- 2a. Poetik Antike RenaissanceDokument9 Seiten2a. Poetik Antike RenaissanceKarolina ChatzimichaliNoch keine Bewertungen
- Stillstand. Entrückte Perspektive: Zur Praxis literarischer EntschleunigungVon EverandStillstand. Entrückte Perspektive: Zur Praxis literarischer EntschleunigungNoch keine Bewertungen
- Die Setzung Des SubjektsDokument169 SeitenDie Setzung Des SubjektsEdgar RezaNoch keine Bewertungen
- »Aufzeichnungen eines Vielfachen«: Zu Friedrich Nietzsches Poetologie des SelbstVon Everand»Aufzeichnungen eines Vielfachen«: Zu Friedrich Nietzsches Poetologie des SelbstNoch keine Bewertungen
- Jannidis Et Al - 1999 - Rede Über Den Autor An Die Gebildeten Unter Seinen VerächternDokument34 SeitenJannidis Et Al - 1999 - Rede Über Den Autor An Die Gebildeten Unter Seinen VerächternceprunNoch keine Bewertungen
- Th_BEIN_Liebe_und_Erotik_im_MittelalterDokument2 SeitenTh_BEIN_Liebe_und_Erotik_im_MittelalterDariaNoch keine Bewertungen
- TRENDELENBURG. Historische Beiträge Zur Philosophie, 2 Band - Vermischte AbhandlungenDokument408 SeitenTRENDELENBURG. Historische Beiträge Zur Philosophie, 2 Band - Vermischte AbhandlungenBianca Tossato Andrade100% (1)
- Paradigma Fotografie PDFDokument29 SeitenParadigma Fotografie PDFRodrigo AlcocerNoch keine Bewertungen
- Autopoiesis und Literatur: Die kurze Geschichte eines endlosen VerfahrensVon EverandAutopoiesis und Literatur: Die kurze Geschichte eines endlosen VerfahrensNoch keine Bewertungen
- Das Mittelalter der Gegenwart: Poetische ZeitenräumeVon EverandDas Mittelalter der Gegenwart: Poetische ZeitenräumeNoch keine Bewertungen
- 2.2 Literatur Und Theorie (Tom Poljanšek)Dokument13 Seiten2.2 Literatur Und Theorie (Tom Poljanšek)menoitiosNoch keine Bewertungen
- Raumlektüren: Der Spatial Turn und die Literatur der ModerneVon EverandRaumlektüren: Der Spatial Turn und die Literatur der ModerneNoch keine Bewertungen
- Dynamisierte Raeume KomplettDokument225 SeitenDynamisierte Raeume KompletteldragonlectorNoch keine Bewertungen
- Die theoretische Philosophie Ernst Cassirers: Zu den Grundlagen transzendentaler Wissenschafts- und KulturtheorieVon EverandDie theoretische Philosophie Ernst Cassirers: Zu den Grundlagen transzendentaler Wissenschafts- und KulturtheorieNoch keine Bewertungen
- Honneth, Axel. Menke, Christoph - Klassiker Auslegen. Theodor W. Adorno. Negative Dialektik. 2Dokument17 SeitenHonneth, Axel. Menke, Christoph - Klassiker Auslegen. Theodor W. Adorno. Negative Dialektik. 2monomorphNoch keine Bewertungen
- Nihilismus - Und - Symbolische - Form. - Nietzsc Ernst CassirerDokument5 SeitenNihilismus - Und - Symbolische - Form. - Nietzsc Ernst CassirerJorge Hernando PachecoNoch keine Bewertungen
- Behler, Ernst - Frühromantik - IV. Antike Und Moderne, Klassik Und RomantikDokument25 SeitenBehler, Ernst - Frühromantik - IV. Antike Und Moderne, Klassik Und RomantikAldonati LucasNoch keine Bewertungen
- Elemente grotesken Erzählens in der europäischen VersnovellistikVon EverandElemente grotesken Erzählens in der europäischen VersnovellistikNoch keine Bewertungen
- Clakcd 1Dokument514 SeitenClakcd 1Gustavo FaigenbaumNoch keine Bewertungen
- Literarische Heterotopien in Paul Austers 'Stadt Aus Glas'Dokument26 SeitenLiterarische Heterotopien in Paul Austers 'Stadt Aus Glas'Philip KetzelNoch keine Bewertungen
- III.1.4 Roland Barthes: Von Der Semiologie Zur Lust Am TextDokument13 SeitenIII.1.4 Roland Barthes: Von Der Semiologie Zur Lust Am TextERIC MONSIEURNoch keine Bewertungen
- (Marxistische Ästhetik + Kulturpolitik) Werner Mittenzwei - Brechts Verhältnis Zur Tradition-Damnitz (1974) PDFDokument304 Seiten(Marxistische Ästhetik + Kulturpolitik) Werner Mittenzwei - Brechts Verhältnis Zur Tradition-Damnitz (1974) PDFBrunoNoch keine Bewertungen
- Kritik - Selbstaffirmation - Othering: Immanuel Kants Denken der Zweckmässigkeit und die koloniale EpistemeVon EverandKritik - Selbstaffirmation - Othering: Immanuel Kants Denken der Zweckmässigkeit und die koloniale EpistemeNoch keine Bewertungen
- Hekalot Studien Peter PDFDokument320 SeitenHekalot Studien Peter PDFnsbopchoNoch keine Bewertungen
- Der Magnetische Spiegel - Inf PDFDokument28 SeitenDer Magnetische Spiegel - Inf PDFArtur NowakowskiNoch keine Bewertungen
- Das Dämonische in der "Theorie des Romans" von Georg LukácsVon EverandDas Dämonische in der "Theorie des Romans" von Georg LukácsNoch keine Bewertungen
- PoetikDokument5 SeitenPoetikKarolina ChatzimichaliNoch keine Bewertungen
- Eibl. Karl. Realismus Als Widerlegung Von Literatur. Dargestellt Am Beispiel Von Lenz' HofmeisterDokument12 SeitenEibl. Karl. Realismus Als Widerlegung Von Literatur. Dargestellt Am Beispiel Von Lenz' Hofmeisterrenato.fabrete-hasunumaNoch keine Bewertungen
- Formästhetiken und Formen der Literatur: Materialität - Ornament - CodierungVon EverandFormästhetiken und Formen der Literatur: Materialität - Ornament - CodierungTorsten HahnNoch keine Bewertungen
- Tempus-Setzung in Thomas Bernhards Der Stimmenimitator PDFDokument110 SeitenTempus-Setzung in Thomas Bernhards Der Stimmenimitator PDFdr_benwayNoch keine Bewertungen
- Beantwortung Der Frage: Was Ist Postmodern?: Jean-François LyotardDokument11 SeitenBeantwortung Der Frage: Was Ist Postmodern?: Jean-François LyotardERIC MONSIEURNoch keine Bewertungen
- 6 Geistesgeschichte - O Laura, Geliebter Lorbeer - ZEIT ONLINEDokument8 Seiten6 Geistesgeschichte - O Laura, Geliebter Lorbeer - ZEIT ONLINEChris PifferNoch keine Bewertungen
- Luigi Pirandello - Sechs Personen Suchen Einen Autor - LiteraturenDokument5 SeitenLuigi Pirandello - Sechs Personen Suchen Einen Autor - LiteraturenChris PifferNoch keine Bewertungen
- 10 RenaissanceDokument9 Seiten10 RenaissanceChris PifferNoch keine Bewertungen
- f3 Index SonderzeichenDokument1 Seitef3 Index SonderzeichenChris PifferNoch keine Bewertungen
- Gebrauchsanweisung-Q7000 QM Ti-RzbDokument2 SeitenGebrauchsanweisung-Q7000 QM Ti-RzbChris PifferNoch keine Bewertungen
- Luigi Pirandello 150 - Niemand Erzählte Wie Er Von Der Pein Des Lebens - WELTDokument5 SeitenLuigi Pirandello 150 - Niemand Erzählte Wie Er Von Der Pein Des Lebens - WELTChris PifferNoch keine Bewertungen
- Gerundio, Sandra GeldnerDokument8 SeitenGerundio, Sandra GeldnerChris PifferNoch keine Bewertungen
- Den Apple Hardware Test Auf Dem Mac Verwenden - Apple SupportDokument2 SeitenDen Apple Hardware Test Auf Dem Mac Verwenden - Apple SupportChris PifferNoch keine Bewertungen
- Aspekte Des Gegenwartsitalienischen IIDokument81 SeitenAspekte Des Gegenwartsitalienischen IIChris PifferNoch keine Bewertungen
- Installationsanleitung Office 2016 U.2019Dokument3 SeitenInstallationsanleitung Office 2016 U.2019Chris PifferNoch keine Bewertungen
- Dongle W10Dokument1 SeiteDongle W10Chris PifferNoch keine Bewertungen
- Gira 028667 TX44 Schalter - Taster Wippe Mit Symbol Klingel AnthrazitDokument3 SeitenGira 028667 TX44 Schalter - Taster Wippe Mit Symbol Klingel AnthrazitChris PifferNoch keine Bewertungen
- DB - Etdu1 - de Tastdimmer 1.OGDokument4 SeitenDB - Etdu1 - de Tastdimmer 1.OGChris PifferNoch keine Bewertungen
- Apple-Tastatur in Windows Mit Boot Camp Verwenden - Apple SupportDokument9 SeitenApple-Tastatur in Windows Mit Boot Camp Verwenden - Apple SupportChris PifferNoch keine Bewertungen
- Godot PDFDokument99 SeitenGodot PDFChris PifferNoch keine Bewertungen
- Uneiniges Italien. Die Sudfrage Als Stru PDFDokument25 SeitenUneiniges Italien. Die Sudfrage Als Stru PDFChris PifferNoch keine Bewertungen
- Designgeschichte PpsDokument12 SeitenDesigngeschichte PpsChris PifferNoch keine Bewertungen
- Die Medea Von PasoliniDokument4 SeitenDie Medea Von PasoliniChris PifferNoch keine Bewertungen
- 61-327-3-PB-Oster PasoliniDokument17 Seiten61-327-3-PB-Oster PasoliniChris PifferNoch keine Bewertungen
- 61-327-3-PB-Oster PasoliniDokument17 Seiten61-327-3-PB-Oster PasoliniChris PifferNoch keine Bewertungen
- 2015 19 Cigna Pasolini Hegel BenjaminDokument25 Seiten2015 19 Cigna Pasolini Hegel BenjaminChris PifferNoch keine Bewertungen
- Grammatic TitelblattDokument1 SeiteGrammatic TitelblattChris PifferNoch keine Bewertungen
- It13 PizzaDokument3 SeitenIt13 PizzaChris PifferNoch keine Bewertungen
- Guten Appetit! ItalianoDokument1 SeiteGuten Appetit! ItalianoChris PifferNoch keine Bewertungen
- Hadot Timée PlatonDokument22 SeitenHadot Timée PlatonbobbyNoch keine Bewertungen