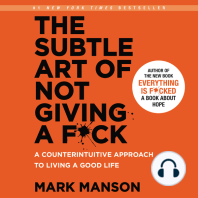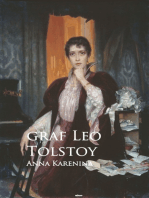Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
LE Klausur WS20 21
Hochgeladen von
AmmarArshadOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
LE Klausur WS20 21
Hochgeladen von
AmmarArshadCopyright:
Verfügbare Formate
Klausur zur Vorlesung Leistungselektronik (WiSe 2020/2021)
Bearbeitungszeit: 120 Minuten Prüfer: Prof. Dr.-Ing. T. P. Sanders
Erlaubte Hilfsmittel:
Keine Einschränkungen, Klausur muss aber eigenständig und handschriftlich bearbeitet
werden.
Die Verwendung nicht erlaubter Hilfsmittel wird als Täuschungsversuch gewertet, wodurch die
Klausur mit „nicht bestanden“ bewertet wird.
Zu jedem Ergebnis ist eine Rechnung oder eine Begründung erforderlich, bloße Zahlenwerte werden
nicht als Lösung anerkannt.
__________________________ ______________ Steinfurt, ______________________
Name Matrikelnummer Ort, Datum, Unterschrift
---------------------------------- Ab hier auf dieser Seite bitte nichts selber eintragen! -----------------------------
Uhrzeit Abgabe (falls vorzeitig):
Abwesenheiten:
Ergebnis:
Aufgabe 1
Aufgabe 2
Aufgabe 3
Aufgabe 4
Summe
Note:
Seite 1 von 5 Klausur Leistungselektronik Prof. Sanders
Aufgabe 1
Abbildung 1: M2C-Schaltung mit aktiver Last und Kommutierungsinduktivitäten
Die M2C-Schaltung aus Abbildung 1 enthält einen Transformator mit einem Übersetzungsverhältnis
ü = Np/Ns = 1 und ist primärseitig an eine Netzspannung Up = 110 V (f = 60 Hz) angeschlossen. Die
aktive Last besteht aus einem Gleichstrommotor, welcher einen ideal geglätteten Strom IDC in Höhe
von 2 A aufnimmt. Die Kommutierungsinduktivitäten haben den Wert LK = 10 mH.
1.1
Berechnen Sie die Anfangsüberlappung u0 und erklären Sie, unter welchen Bedingungen diese in der
Praxis gemessen werden könnte.
1.2
Berechnen Sie den bei einem Steuerwinkel α = 30° auftretenden Überlappungswinkel u und erklären
Sie, warum dieser kleiner ist als die Anfangsüberlappung u0.
1.3
Wie groß ist dann die Spannung Udα an dem Gleichstrommotor?
1.4
Zeichnen Sie für den Betriebspunkt von Aufgabe 1.3 den von der Schaltung aufgenommenen
Netzstrom iS1 zusammen mit der Netzspannung Up in ein Diagramm. Welche Auswirkungen könnte
diese Stromform auf das speisende Netz haben?
1.5
Wie groß sind die Spannung Udα an dem Gleichstrommotor und die von der Schaltung
aufgenommene Wirkleistung P bei einem Steuerwinkel von α = 145°?
Seite 2 von 5 Klausur Leistungselektronik Prof. Sanders
Aufgabe 2
Abbildung 2: Foto und Schaltung eines IGBT-Moduls (Quelle: Infineon)
Die Halbleiter-Bauelemente für einen Frequenzumrichter sind in einem gemeinsamen Modulgehäuse
untergebracht. Dazu gehören 6 IGBTs, 6 Freilaufdioden, 4 Gleichrichterdioden und ein
Temperatursensor.
Der Modulaufbau besteht aus einer gemeinsamen Bodenplatte aus einer elektrisch isolierenden
Keramik, die auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie beschichtet ist. Auf der Modulinnenseite sind
darauf die Dies der Halbleiter (Chips) aufgelötet. Das Modul selber ist mit einer dünnen Schicht
Wärmeleitpaste thermisch an einen Kühlkörper angeschlossen.
IGBT Freilaufdiode Gleichrichterdiode Sensor
Wärmewiderstand, Chip zu Gehäuse 1,7 K/W 2,1 K/W 1,1 K/W 4 K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse zu 1,2 K/W 1,3 K/W 0,9 K/W 3 K/W
Kühlkörper, mit Wärmeleitpaste
Maximale Sperrschichttemperatur 125 °C 125 °C 125 °C -
Mittlere Verlustleistung im 8W 6W 7W 0W
Nennpunkt pro Halbleiter
2.1
Zeichnen Sie das thermische Ersatzschaltbild eines Halbleiters im Modul.
Der Kühlkörper soll dabei als Wärmesenke mit konstanter Temperatur angenommen werden.
Gehen Sie dabei davon aus, dass die Bauelemente nur über den Kühlkörper in einem thermischen
Kontakt stehen, die thermische Querleitfähigkeit der Bodenplatte also vernachlässigt werden kann.
2.2
Welche Temperatur darf der Kühlkörper höchstens annehmen, damit im Nennpunkt keins der
Bauelemente zu warm wird?
Welche Temperatur wird dann vom Temperatursensor im Modul gemessen?
2.3
Welchen Wärmewiderstand Rth,KA darf der Kühlkörper maximal haben, wenn die
Umgebungstemperatur maximal 45 °C annehmen kann und der Frequenzumrichter im Nennpunkt
arbeitet?
2.4
Wie hoch dürfte die Kühlkörpertemperatur werden, wenn die Verlustleistungen der IGBTs und der
Freilaufdioden im Nennpunkt halbiert werden könnten?
Seite 3 von 5 Klausur Leistungselektronik Prof. Sanders
Aufgabe 3
Abbildung 3: Vollbrücke als Wechselrichter
Eine Vollbrücke nach Abbildung 3 soll eine sinusförmige Wechselspannung uAC mit einer Frequenz
von fAC = 60 Hz und einem Effektivwert von UAC,RMS = 120 V erzeugen.
Die Induktivität hat einen Innenwiderstand von R = 150 mOhm, die Schaltfrequenz soll fSW = 8 kHz
betragen.
Die IGBTs und Dioden sollen als ideal angenommen werden, wodurch zunächst auch keine Totzeit
berücksichtigt werden muss.
3.1
Wie groß muss die Spannung UDC mindestens sein, um bei einem Ausgangsstrom von 30 A (effektiv)
noch die gewünschte Ausgangsspannung zu erzeugen?
Vernachlässigen Sie hierbei den Stromripple in der Induktivität. Der Ausgangsstrom soll zudem zur
Ausgangsspannung UAC in Phase sein.
3.2
Welche zwei Ansteuerverfahren für die Vollbrücke gibt es und wie unterscheiden diese sich?
Welchen Wert muss die Induktivität für die beiden Ansteuerverfahren jeweils mindestens haben,
damit der Stromripple bei einer Spannung von UDC = 180 V immer kleiner als 5 A bleibt?
3.3
Die Ansteuersignale für die IGBTs sollen von einem Mikrokontroller generiert werden, dessen Masse
mit dem negativen Potential von UDC verbunden ist. Die Ausgänge des Mikrokontrollers können 0 V
oder 5 V und einen Strom von maximal 50 mA liefern. Warum können die Gates von SL1 und SL2 nicht
direkt von diesem Mikrokontroller angesteuert werden?
3.4
Warum ist die Ansteuerung der IGBTs SH1 und SH2 komplizierter als die von SL1 und SL2? Wie wird
dieses Problem meist gelöst?
Seite 4 von 5 Klausur Leistungselektronik Prof. Sanders
Aufgabe 4
Abbildung 4: LED-Treiber
Abbildung 4 zeigt die Schaltung eines LED-Treibers (links, hier nur 3 LEDs dargestellt) und eine
vereinfachte Ersatzschaltung (rechts).
4.1
Beschreiben Sie kurz, was beim Einschalten des Schalters S und kurz danach passiert. (Ströme,
Spannungen, sperrt oder leitet die Diode D?, Schaltvorgänge müssen hier nicht genau beschrieben
werden.)
4.2
Beschreiben Sie kurz, was beim späteren Ausschalten des Schalters S und kurz danach passiert.
(Ströme, Spannungen, sperrt oder leitet die Diode D?, Schaltvorgänge müssen hier nicht genau
beschrieben werden.)
4.3
Was könnte der Grund für den Einsatz einer schnellen Schottky Diode als Diode D zusätzlich zu den
Leuchtdioden hier sein?
4.4
Leiten Sie eine Formel für die Ausgangsspannung Ua in Abhängigkeit vom Tastgrad S und der
Eingangsspannung U0 für den kontinuierlichen Betrieb her. Vernachlässigen Sie dabei alle Verluste
und gehen Sie von idealen Bauelementen aus.
Wird die Anzahl der anschließbaren LEDS durch die Höhe der Eingangsspannung U0 eingeschränkt?
4.5
Was könnte in der Praxis passieren, wenn die Zuleitung zu den LEDs unterbrochen werden würde?
Seite 5 von 5 Klausur Leistungselektronik Prof. Sanders
Das könnte Ihnen auch gefallen
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeVon EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (19994)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionVon EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2475)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksVon EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyVon EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeVon EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (5784)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleVon EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (353)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionVon EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (12941)
- How To Win Friends And Influence PeopleVon EverandHow To Win Friends And Influence PeopleBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (6503)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionVon EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2391)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Von EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9485)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Von EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9054)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleVon EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2552)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderVon EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (5700)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationVon EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (5341)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationVon EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2385)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItVon EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (3265)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Von EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (7769)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionVon EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9752)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksVon EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (7086)