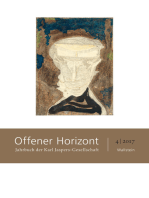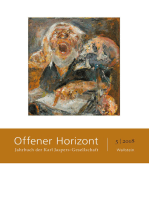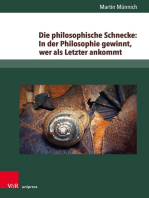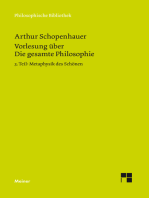Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Was Ist Literaturwissenschaft
Hochgeladen von
PaulinaTheodoropOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Was Ist Literaturwissenschaft
Hochgeladen von
PaulinaTheodoropCopyright:
Verfügbare Formate
Antonsen · Boerner · Haupt · Sorg (Hrsg.
)
Was heißt und zu welchem Ende studiert man Literaturwissenschaft?
F4717-Antonsen.indd 1 03.12.2008 11:04:53 Uhr
F4717-Antonsen.indd 2 03.12.2008 11:04:54 Uhr
Was heißt und zu
welchem Ende studiert man
Literaturwissenschaft?
Festschrift für Stefan Bodo Würffel
zum 65. Geburtstag
Herausgegeben von
Jan Erik Antonsen, Maria-Christina Boerner,
Sabine Haupt und Reto Sorg
Wilhelm Fink
F4717-Antonsen.indd 3 03.12.2008 11:04:54 Uhr
Publiziert mit Unterstützung
des Rektorats und des Hochschulrates der Universität Freiburg/Schweiz
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe
und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung
einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung
und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien,
soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten.
© 2009 Wilhelm Fink Verlag, München
Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn
Internet: www.fink.de
Einbandgestaltung: Gerhard Blättler
Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co KG, Paderborn
ISBN 978-3-7705-4717-9
F4717-Antonsen.indd 4 03.12.2008 11:04:54 Uhr
INHALT
INHALT
Zur Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ERIC ACHERMANN
Von Buch und Büchern. Zur Objektivität und
Allgemeinheit des Lesens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
JAN ERIK ANTONSEN
»Nimm und lies«. Zur Funktion der Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MARIA-CHRISTINA BOERNER
»Geistliche Dämmerung«. Zur Bedeutung des Religiösen in Georg
Trakls Dichtung und in der frühen abstrakten Malerei . . . . . . . . . . . . . . . . 31
BERNHARD BÖSCHENSTEIN
Autobiographisch begründete komparatistische Literaturwissenschaft.
Eine Skizze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
DIMITER DAPHINOFF
In die Krise – aus der Krise. Bemerkungen
zu einer verunsicherten Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ROLF FIEGUTH
Osip Mandel’štams literaturwissenschaftliches Prosa-Poem
Gespräch über Dante (1933). Eine Lektüreempfehlung. . . . . . . . . . . . . . . . . 59
LUCAS MARCO GISI
Topografie und Topologie. Zur Relevanz der Kategorie des Raums für
die Literaturgeschichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SABINE HAUPT
Ein Heizer. Anleitung zur Selbstverwirklichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
F4717-Antonsen.indd 5 03.12.2008 11:04:54 Uhr
6 INHALT
THOMAS HUNKELER
Passen Sie gut auf sich auf! 3 Gründe, warum wir nicht nur die Literatur,
sondern auch die Literaturwissenschaft brauchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
HELMUT KOOPMANN
Möglichkeiten des Wissenstransfers in der (germanistischen)
Informationsgesellschaft. Plädoyer für eine ins Abseits geratene Gattung,
die das Studium der Literaturwissenschaft erleichtern könnte . . . . . . . . . . . 95
HERMANN KURZKE
Ohne Pathos geht es nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
STEFANIE LEUENBERGER
Das Entziffern des »Wogegen«. Literaturwissenschaft und
Kulturgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
URS MEYER
Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben einer ideologiekritischen
Interpretation. Zur Rezeption von Erich Kästners Emil und die Detektive
und Gerhard Lamprechts gleichnamiger Verfilmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
RALPH MÜLLER
Personifikation als Gedanke. Zur kognitiven Interpretation von Schillers
Antrittsvorlesung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
WOLFGANG PROSS
Zum Problem der historischen Erfahrung. Antihermeneutische
Bemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
PETER RUSTERHOLZ
Literaturwissenschaft: Lebendige Tradition als Medium der Erkenntnis
der Gegenwart und Ferment der Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
GESINE LENORE SCHIEWER
Literatur – Technologie – Ethik. Das Dilemma von Informations-
technologie und freischwebender Intelligenz am Beispiel der
Mehrsprachigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
RALF SCHNELL
Über philologische Erkenntnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
RETO SORG
›Beschreibung eines Kampfes‹ oder Was heißt und zu welchem Ende
studiert man Literaturwissenschaft? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
F4717-Antonsen.indd 6 03.12.2008 11:04:54 Uhr
INHALT 7
JÜRGEN SÖRING
Was heißt und zu welchem Ende studiert man Literaturwissenschaft? . . . . . 191
THOMAS SPRECHER
Spuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
ELISABETH STUCK
Literaturwissenschaft und Hörästhetik. Mediengeschichtliche
Veränderungen in selbstreferenziellen Hörspielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
F4717-Antonsen.indd 7 03.12.2008 11:04:54 Uhr
F4717-Antonsen.indd 8 03.12.2008 11:04:54 Uhr
ZUR EINLEITUNG
Zur Einleitung
Was Philologie ist und sein soll,
hat sich aus ihrer Geschichte ergeben.
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
Der vorliegende Band versammelt Beiträge, die anlässlich des 65. Geburtstags von
Stefan Bodo Würffel verfasst worden sind. Die Autoren sind Kollegen, Mitarbeiter
und Schüler, die sich sowohl dem kreativen Forscher wie dem faszinierenden Leh-
rer und engagierten Hochschulpolitiker freundschaftlich verbunden fühlen. Dass
sich diese Verbundenheit dabei über die Skepsis des Geehrten, der den ritualisier-
ten Gesten akademischer Institutionen stets kritisch und mit Vorbehalten begeg-
net, hinweg setzt, hat einen ganz einfachen, pragmatischen Grund: Die Herausge-
ber sind überzeugt, dass die Tradition der Festschrift der beste, weil unmissver-
ständliche Weg ist, Freundschaft und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Was
ehrt einen Wissenschaftler mehr als der Versuch seiner Kolleginnen und Kollegen,
Farbe zu bekennen! Ein aufgeklärt kritischer und engagierter Germanist wie Stefan
Bodo Würffel wird den von uns gewählten Weg eines problemorientierten Sam-
melbands mit Sicherheit zu schätzen wissen. Dass dabei ein Thema im Mittelpunkt
steht, bei dem literarische Texte, historisches Problembewusstsein und politische
Dringlichkeit zusammen kommen, ergibt sich aus dem wissenschaftlichen Werde-
gang des Geehrten.
Nach einer wirkungsgeschichtlichen Dissertation zu Stefan George, die in Göt-
tingen 1975 zur Promotion führte1, habilitierte sich Stefan Bodo Würffel 1984 an
der Universität Bern mit einer Arbeit zu Heinrich Heine2, worin er jene Konzepti-
on vom wissenschaftlichen Umgang mit Literatur entwickelte, die ihn im kollegia-
len Gespräch ebenso leitete wie in seinen Publikationen und in der Lehre, erst in
Genf, dann in Bern, ab 1994 schließlich in Freiburg in der Schweiz. Wissenschaft
bestimmt und vermittelt den ›produktiven Widerspruch‹, den die Literatur gegen-
über der Gesellschaft bedeutet und zum Ausdruck bringt, nur dann, wenn sie ihren
emphatischen Kern bewahrt und die Vermittlung ihrer besonderen Realien und
Begriffe mit einer allgemeinen Erziehung zur Mündigkeit, zum kritischen, auch
sich selbst in Frage stellenden Denken verbindet.
1 Vgl. Würffel: Wirkungswille und Prophetie. Studien zu Werk und Wirkung Stefan Georges.
2 Vgl. Würffel: Der produktive Widerspruch. Heinrich Heines negative Dialektik.
F4717-Antonsen.indd 9 03.12.2008 11:04:54 Uhr
10 ZUR EINLEITUNG
Dies war uns der Anstoß für eine grundsätzliche Reflexion über die Bedingun-
gen und Möglichkeiten der Disziplin Literaturwissenschaft. Denn jedes Wissen ist
an ein Nachdenken gebunden, das die Gewissheiten, die es schafft, wieder in Frage
stellt – es ist dies eine Dialektik, der insbesondere die Beschäftigung mit literari-
schen Texten unterliegt. Der Literatur haftet immer auch ein reflexives Moment
an, indem sie nicht bloß ein bestimmtes Welt- und Sprachverständnis artikuliert,
sondern auch die Probleme, die mit diesem Verständnis und der Verständigung
darüber einhergehen. Literarische Texte sind mithin »kognitive Prozesse, die den
möglichen Erkenntnisgehalt sprachlicher Aussagen und damit ihren eigenen syste-
matisch bezweifeln«3. Dies zwingt jede Beschäftigung mit diesem Gegenstand –
und insbesondere jene, die sich mit dem Etikett der Wissenschaft schmückt – zur
andauernden Selbstvergewisserung, zur Überprüfung ihres Tuns und seiner Vor-
aussetzungen. Seit ihren Anfängen dreht sich diese Beschäftigung – als ›Poetik‹ oder
›Literaturkritik‹, als ›Philologie‹ oder ›Literaturwissenschaft‹, oder wie immer sonst
man sie bestimmt hat – um die Schlüsselfragen, was Literatur sei und welches ihre
Funktion. Die auf den Poetiken von Aristoteles und Horaz gründende Überzeu-
gung, die Aufgabe von Literatur bestehe darin, zu bilden und zu unterhalten, ist
noch heute der gemeinsame Nenner jener Bestimmungsansätze, die daran festhal-
ten, dass die literarische Ausdrucksweise eine philosophische Dimension habe und
konstitutiv für unsere Kultur sei.4
Insofern repräsentiert die auf Friedrich Schillers berühmte Antrittsvorlesung von
1789 anspielende Fragestellung »Was heißt und zu welchem Ende studiert man
Literaturwissenschaft?« nicht mehr und nicht weniger als die Leitfrage jenes Fach-
bereichs, der die Theorie und Geschichte der Literatur betreibt. Dabei erscheint die
Frage nach Sinn und Zweck literaturwissenschaftlichen Arbeitens heute notge-
drungen im Lichte der anhaltenden Debatte um den Stellenwert und um die Aus-
richtung der universitären Beschäftigung mit Literatur. Wo die arrivierte Nach-
kriegsgeneration noch selbstbewusst Bilanz ziehen konnte: Wie, warum und zu
welchem Ende wurde ich Literaturhistoriker? 5, brennt heute die Frage, ob die Litera-
turwissenschaft überhaupt noch eine Zukunft habe. Die Verunsicherung ist so
groß, dass das Bedürfnis nach grundsätzlicher Reflexion über die Bedingungen der
Möglichkeit der Disziplin mehr und mehr dem Bestreben weicht, auf die vom bü-
rokratischen Apparat gebieterisch gestellte Frage nach dem unmittelbaren Nutzen
von Literaturwissenschaft die entsprechenden Antworten zu liefern, und zwar ganz
unabhängig davon, ob man nun für die ›Erweiterung‹ der Disziplin plädiert oder
für ihre ›Rephilologisierung‹.6 Während die Ausgangsfrage bei Schiller noch in eine
3 Hamacher: Unlesbarkeit, S. 9.
4 Vgl. Aristoteles: Poetik, S. 29ff. u. Horaz: Ars Poetica. Die Dichtkunst, S. 25.
5 Vgl. die 1972 von Siegfried Unseld herausgegebene Festschrift für Robert Minder: Wie, wa-
rum und zu welchem Ende wurde ich Literaturhistoriker?
6 Vgl. Erhart: Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Erweiterung? [2004] und zur
neuen Konjunktur des Begriffs der ›Philologie‹ Gumbrecht: Die Macht der Philologie [2002]
sowie Alt: Die Verheißungen der Philologie [2007].
F4717-Antonsen.indd 10 03.12.2008 11:04:54 Uhr
ZUR EINLEITUNG 11
selbstbewusste Apologie der eigenen Disziplin als eines akademischen Fachs mün-
dete, auf der Grundlage einer ebenso polemischen wie selbstkritischen Unterschei-
dung zwischen dem Betreiben von Wissenschaft als reiner Wahrheitssuche und
dem Treiben des akademischen »Brotgelehrten«, dem es einzig darum zu tun sei,
»die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amte fähig und der Vorteile
desselben teilhaftig werden kann«7, scheint sich die Diskussion dieser Frage heut-
zutage ausschließlich in den Dimensionen von Schillers »Brotgelehrtem« zu bewe-
gen: Allem Anschein nach ist die universitäre literaturwissenschaftliche Zunft ge-
genwärtig weitgehend von der ökonomischen Gretchenfrage der Anwendbarkeit
des Wissens und Könnens, das sie vermittelt, eingeschüchtert und sieht sich im
politisch-gesellschaftlichen Diskurs über Sinn und Zweck ihres Tuns in die ›totale‹
Defensive gedrängt. Was dabei zunehmend aus dem Blickfeld zu geraten scheint,
ist die Besinnung auf die Bedeutung und die Relevanz des Fachs jenseits seines un-
mittelbaren gesellschaftlich-ökonomischen Nutzens.
Schillers Ausgangsunterscheidung zwischen Wissenschaft und bloßem akademi-
schen Pragmatismus scheint in diesem Zusammenhang gar nicht so inaktuell zu
sein. Sie fordert zumindest zur Standortbestimmung auf, zu erneutem und wieder-
holtem Nachdenken darüber, was wir eigentlich tun oder tun sollten, wenn wir Li-
teraturwissenschaft betreiben, und welche Zwecke sich damit verbinden. Dabei
käme vielleicht wieder in Erinnerung, dass die Literaturwissenschaft ein philoso-
phisch-historisches Fach ist, dessen Relevanz in seiner Kompetenz der sprachlich-
historischen Reflexion liegt und damit einen kulturellen Auftrag erfüllt, dass Lite-
raturwissenschaft ihre grundsätzlichste Berechtigung in der prinzipiellen Ausle-
gungsbedürftigkeit der Literatur hat; es käme einem vielleicht wieder in den Sinn,
dass Literatur eine kulturelle Betätigung darstellt, die per definitionem das »Unge-
reimte« und »Wunderbare«, ja, das »Unmögliche«8 zum Gegenstand hat. Was Aris-
toteles, von dem diese erste Bestimmung des Gegenstands von Literatur stammt,
dabei erkannt hat, ist der Umstand, dass Literatur sich nicht in erster Linie mit
dem, was ist, beschäftige (das sei Aufgabe der Geschichtsschreibung), sondern mit
dem, was sein könnte;9 der Literatur komme damit ein Maß an Eigengesetzlichkeit
zu, das sie über die bloße Mimesis des Vorhandenen hinaushebe. Es ist diese Eigen-
gesetzlichkeit des Literarischen, die, so macht es den Anschein, im bunten und
ausufernden Treiben der Literaturwissenschaft heute mitunter vergessen zu gehen
droht.
So zwingend es ist, dass sich die Rhetorik der Wissenschaft von derjenigen der
Literatur durch die Verwendung von kategorialen Begriffen unterscheidet, so un-
möglich kann sie den Widerspruch zur Konvention, den die Literatur darstellt, für
7 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, S. 412; der Text
stellt Schillers Antrittsvorlesung an der Jenaer Universität vom 26. und 27. Mai 1789 dar, die
im November 1789 im Teutschen Merkur und gleichzeitig als Sonderdruck der Akademi-
schen Buchhandlung in Jena erschienen ist.
8 Aristoteles: Poetik, S. 83.
9 Vgl. ebd., S. 29.
F4717-Antonsen.indd 11 03.12.2008 11:04:54 Uhr
12 ZUR EINLEITUNG
sich selbst gänzlich negieren. Es gibt also keinen Grund dafür, dass es der Literatur-
wissenschaft anders ergehe als jenem Literaten, der in einem Mikrogramm von Ro-
bert Walser die moderne Intellektualität verkörpert: »Ich bin durch einen längeren
Aufenthalt in literarischen Kreisen stark ästhetisiert worden. Es ging oder geht vie-
len so. Vor lauter Verstehen kann es geschehen, daß man nichts mehr versteht.«10
Erst indem die Literaturwissenschaft das ›Verstehen‹ als Problem thematisiert und
in ihrer Methodologie reflektiert, wird ihr Gegenstand – die Literatur – adäquat
vermittelt.
Diese Festschrift kann und will keine Einführung in die Literaturwissenschaft
geben und auch nicht als Ariadnefaden durch das Labyrinth verschiedener Verste-
henszugänge dienen. Vielmehr versammelt sie Beiträge, die als eine Art Kaleidos-
kop die nach wie vor aktuelle Fragestellung Schillers in vielfältiger und wechselnder
Perspektive spiegeln. Den Autoren und Autorinnen danken wir herzlich für ihre
engagierte Mitarbeit und dem Rektorat und dem Hochschulrat der Universität
Freiburg/Schweiz für ihre finanzielle Unterstützung, ohne die diese Publikation
nicht zustande gekommen wäre.
Jan Erik Antonsen, Maria-Christina Boerner, Sabine Haupt und Reto Sorg
10 Walser: Aus dem Bleistiftgebiet. Mikrogramme 1924/25, Bd. 1, S. 118.
F4717-Antonsen.indd 12 03.12.2008 11:04:54 Uhr
Eric Achermann (Münster)
VON BUCH UND BÜCHERN.
ZUR OBJEKTIVITÄT UND ALLGEMEINHEIT DES LESENS
Bücher sind merkwürdige Gegenstände. Ich kann sie auf- und zuklappen, ich kann
sie in Bibliotheken ausleihen und nach Hause schleppen, ich kann damit Briefe
beschweren oder auch Fliegen klatschen. Die meisten Bücher können auch gelesen
werden. Das Lesen aber, oder vielleicht besser: die Lesbarkeit, gründet nicht – zu-
mindest nicht ausschließlich – in materiellen Eigenschaften. Es ist zwar nicht un-
wichtig, ein Buch auf- und zuklappen zu können oder es aus einer Bibliothek nach
Hause tragen zu dürfen, doch erscheinen diese Umstände beim Versuch, die Les-
barkeit näher zu bestimmen, als nebensächlich. Sie hängt vielmehr erst einmal da-
von ab, ob ich oder ein anderer es für angemessen erachtet, einen gewissen Gegen-
stand einem erlernten und eingeübten Verfahren zu unterziehen, dem Lesen eben.
Die Lesbarkeit eines Buches basiert auf dem Vertrauen oder der stillschweigenden
Annahme, dass es sich bei den Dingen auf den einzelnen Seiten um Schrift handelt
und dass diese Schrift einen Sinn ergibt.
Der Prozess des Lesens kennt mehrere Etappen. In einem der originellsten litera-
turwissenschaftlichen Beiträge der letzten Jahre hat Klaus Weimar versucht, diese
Etappen der Vermittlung zwischen Schrift und Vorstellung ins Bewusstsein zu he-
ben, um daraus eine »Ethik des Lesens und Verstehens« abzuleiten.1 Diese Überle-
gungen dienen hier als Anlass, um – unabhängig von oder gar im Widerspruch zu
Weimars Absicht – die grundlegende Objektivität des Lesens herauszustellen.
Ausgehend von kognitionspsychologischen Untersuchungen bestimmt Weimar
»Lesen« als eine Transformation von Schrift in Sprache: »Lesen heißt aufgrund von
Schrift zu sich selbst Sprechen«2. Als »zwingendes Komplementärphänomen« zu
diesem »inneren Sprechen« müsse ein »inneres Hören« angenommen werden, das
die versprachlichte Schrift zu rezipieren in der Lage ist.3 Das Gelesene wird ver-
nommen. Die einmal vernommene Sprache wird anschließend – immer vorausge-
setzt, der Lesende ist der vernommenen Sprache mächtig – erneut transformiert,
diesmal nicht in Sprache, sondern in eine »Textwelt«. Das Vernommene wird ver-
standen. Beide Transformationen implizieren beim Lesen die Vorstellung einer
Statthalterschaft, nämlich anstelle eines Dritten oder Fremden zu sprechen und das
im Namen eines Fremden Gesprochene zu verstehen.
1 Weimar: Lesen, S. 62.
2 Ebd., S. 51f.
3 Vgl. ebd., S. 55: »Der Akt des Lesens ist ein in sich geteilter oder doppelter: ein Versprachli-
chen der Schrift einerseits und ein Vernehmen der Sprache andererseits, und zwar nicht ab-
wechslungsweise, sondern stets untrennbar zugleich.«
F4717-Antonsen.indd 13 03.12.2008 11:04:54 Uhr
14 ERIC ACHERMANN
Für Weimar nun geht diese doppelte Transformation von Schrift in Sprache
(durch Vernehmen) und von Sprache in Textwelt (durch Verstehen) mit einer zu-
nehmenden, letztlich nicht mehr aufhebbaren Individualisierung einher:
Deshalb ist es nicht nur eher unwahrscheinlich wie im Falle der Verwandlung
von Schrift in Sprache, es ist ausgeschlossen, daß wir die Verwandlung von Spra-
che in Textwelt genau so vollziehen wie das Fremde, in dessen Namen wir dabei
handeln. Jeder Versuch, das eigene Versprachlichen und Verstehen als Vertreter
und Statthalter des abwesenden Fremden zu erweisen, sollte sich seither eigent-
lich von selbst verbieten.4
Diese Aussagen scheinen mir problematisch, der Schluss inakzeptabel. Ich bin mit
Weimar einverstanden, dass zwischen den Resultaten des eigenen Leseprozesses
und denjenigen eines Anderen keine Identität besteht. Wer wollte dies aber auch
behaupten? Stelle ich mir dieses Fremde als ein Sprechendes vor, so können – da ein
solches sprechendes Fremdes faktisch ja gar nicht existiert – weder Abweichung
noch Identität meines inneren Sprechens im Hinblick auf ein nicht existierendes
Sprechen behauptet werden; verpflichte ich mich hingegen in einem bewussten
Akt der Rekonstruktion einer historischen Figur, die diesem Fremden nach meiner
Ansicht oder gesicherter Kenntnis entspräche, so wird dieses Fremde nicht mit dem
Fremden des inneren Sprechens als identisch erachtet werden, weil ich mir diese
mutmaßlichen Autoren oder Autorinnen nicht als Sprechende, sondern als Schrei-
bende vorstelle. Dass der vom Lesenden supponierte Sprech- und Schreibvorgang
in diesem zweiten Fall nicht »genau so« wie der eigene aktuelle Lesevorgang vollzo-
gen wird, scheint mir offensichtlich, da das innere Sprechen und das imaginierte
fremde Schreiben durchaus verschiedene Handlungen repräsentieren. Zwischen
diesen Handlungen mag eine mehr oder minder enge Analogie behauptet oder be-
stritten werden, und dazu gibt es sehr viele und stark divergierende Ansichten,
nichtsdestoweniger: »Schrift ist nun einmal trivialerweise etwas anderes als Sprache;
[…]. Schreiben kann man nur Schrift, und geschriebene Sprache gibt es deshalb so
wenig wie ein hölzernes Eisen oder einen schwarzen Schimmel.«5 Und selbst wenn
ich mir das Fremde in eben dem Moment vorstellte, in dem das Fremde eine von
ihm selbst verfasste Schrift läse, und so mein inneres Sprechen dem Lesen eines le-
senden, vormals schreibenden Fremden entspräche, wäre das Problem bloß aufge-
schoben. Das lesende Fremde müsste wiederum ein Fremdes supponieren, da nach
Weimars Verständnis Lesen nur dann »Lesen« heißen kann, wenn im Namen eines
Anderen gesprochen wird.
Etwas allgemeiner formuliert sollte niemand im Ernst eine genaue Identität zwi-
schen zwei mentalen Zuständen oder einem mentalen Zustand und einem äußeren
physischen Ereignis behaupten, und auch nur schon die Behauptung einer weitge-
henden Übereinstimmung setzte voraus, dass wir zumindest eine vage Ahnung hät-
ten, was denn hier miteinander zu vergleichen wäre. Dies alles betrifft jedoch nicht
4 Ebd., S. 60.
5 Ebd., S. 54.
F4717-Antonsen.indd 14 03.12.2008 11:04:54 Uhr
VON BUCH UND BÜCHERN 15
ausschließlich das Lesen, das Vernehmen oder das Verstehen, sondern eignet als
kritisches Moment allen Wahrnehmungen und Empfindungen, das heißt allen
Prozessen, in denen innere, mentale Ereignisse als referierende, als auf äußere Er-
eignisse Bezug nehmende, erachtet werden. Wie könnte ich sicher sein, dass ich die
rote Farbe auf dem Stuhl da genau so sehe, wie sie ist, bzw. wie sie von meinem
Nachbarn oder dem Maler, der sie aufgetragen hat, gesehen wird? Auch hier haben
wir es mit einem Statthalter eines Fremden zu tun, dem Statthalter einer Sache
nämlich, die ich mir in meinem Inneren, und zwar als rot, vorstelle. Ich tue dies im
Vertrauen darauf, sie rot zu sehen; und ebenso wähne ich ›rot‹ zu lesen, nämlich im
Vertrauen darauf, die Folge ›r‹, ›o‹ und ›t‹ richtig identifiziert zu haben, ohne dass
auf der Ebene des Vernehmens der Umstand, dass mein innerlich gesprochenes
»rot« weder dem innerlich noch dem äußerlich gesprochenen »rot« eines Fremden
identisch sein kann, als bemerkenswert erschiene; ebenso wenig erscheint auf der
Ebene des Verstehens der Umstand, dass die Vorstellung, die ich mit ›rot‹ verbinde,
mit einer anderen Vorstellung, die das Fremde mit ›rot‹ verbindet oder verbinden
würde, nicht identisch ist, als außergewöhnlich und bloß dem Lesen eigen.
Jedes Wahrnehmen und jedes Lesen implizieren ein Verinnerlichen. Und dies
wiederum mag eine unscharfe Vorstellung von ›Individualisierung‹ mit sich brin-
gen. Genau genommen scheint mir jedoch, dass Interiorisierungen den entgegen-
gesetzten Weg gehen – den Weg der Objektivierung und Verallgemeinerung. Viel-
leicht ist es dieser Umstand, den Weimar »Selbstentfremdung« nennt.6 Es scheint
mir entscheidend zu sein, dass ich bei jeder Form der Wahrnehmung nicht von der
Identität meiner Vorstellungen und derjenigen der anderen, sondern von einer
Identität der vorgestellten Gegenstände ausgehe. Nicht, was ich und andere wahr-
nehmen, sondern das, was ich und andere wahrzunehmen glauben, also diejenigen
Gegenstände, die unsere Vorstellungen darzustellen scheinen und von denen ich
auch vermute, dass andere gegebenenfalls darauf referieren, werden als identisch
supponiert. Was ich wahrnehme, erachte ich als objektiv gegeben, es sei denn, ich
lebte in der ständigen Überzeugung, dass keine Außenwelt existiere.
Um den Unterschied zwischen Wahrnehmen und Lesen genauer zu bestimmen,
möchte ich zum Ausgangspunkt, zum Buch, zurückkehren: Literaturwissenschaft-
ler neigen dazu, das Buch als wenig problematisch, ja hin und wieder quasi als Trä-
ger faktischer Garantien zu erachten, die gewisse, eher einfache Streitpunkte schlag-
artig auszuräumen vermöchten: »Hier steht es doch!« Nach Weimar hätten wir es
mit einer bedeutenden Fehlleistung zu tun. Richtig nämlich müsste es heißen:
»Hier drin lese ich«, womit denn auch die angenommene Faktizität ebenso schlag-
artig der Subjektivität wiche.
Als empirische Grundlage einer Wissenschaft bildet das Buch jedoch ein Skan-
dalon. Die Lesbarkeit von Büchern macht aus ihnen Hybride, wie eine einfache
Beobachtung zu illustrieren vermag: In einer Klasse oder einem Seminar sind viele
Exemplare eines Buches, das heißt Bücher, und trotzdem kann ich fragen, wer das
Buch gelesen hat. Ich setze also eine Identität voraus, die nicht materiell begründet
6 Ebd., S. 62.
F4717-Antonsen.indd 15 03.12.2008 11:04:54 Uhr
16 ERIC ACHERMANN
ist, sondern auf der ideellen Identität von Zeichen aufbaut. Ebenso wie ich auf die
Frage, »aus wie vielen Ziffern besteht ›4 352 261‹?«, mit »sieben« (tokens oder Vor-
kommnisse) oder »sechs« (types) antworten kann. Das gleiche gilt für längere Syn-
tagmen, das heißt, ich kann auf die Frage, »aus wie vielen Wörtern besteht ›Apfel
Apfel Apfel Apfel Birne‹?«, mit »fünf« (tokens) oder »zwei« (types) antworten; und
natürlich kann ich das auch mit Sätzen, Satzverbindungen und ganzen Texten tun.
Diese Eigenschaft, die für Zeichen bedeutend ist, gilt aber auch für die Zugehö-
rigkeit von Dingen zu Klassen, Gattungen, Arten, Sorten und dergleichen: So kann
ich auf die Frage, wie viele Früchte in einer Schale liegen, gegebenenfalls zutreffend
mit »acht« (einzelne Früchte), »zwei« (Äpfel und Birnen) oder »vier« (Elstar, Jona-
than, Abate und Williams) antworten. Der Unterschied zwischen der allgemeinen
token/type-Relation beliebiger Dinge und der spezifischen von Zeichen dürfte nun
darin liegen, dass der Umgang mit Zeichen deren Typenhaftigkeit voraussetzt – wo
ein token nicht auf ein type bezogen wird, ist kein Zeichen. In der eleganten Formu-
lierung Goodmans beruht die token/type-Relation gewöhnlicher Äpfel in einem to
have without symbolizing, während das Sichbeziehen einem to symbolize without ha-
ving gleichkomme. Eigenschaften, welche die Dinge besitzen und als Kriterien zur
Klassenbildung dienen, erscheinen beim Umgang mit eigentlichen Zeichen als ne-
bensächlich. Diese Form der Typenhaftigkeit, die nicht auf innerlichem Besitz ei-
ner Eigenschaft, sondern auf äußerlicher Bezugnahme auf ein anderes beruht, ist
für jedes Zeichen als Zeichen und damit auch für den Prozess des Lesens konstitu-
tiv.7
Der Prozess der Interiorisierung, der durch das Lesen in Gang gesetzt wird,
mündet primär nicht in uneinholbare Individualisierung, sondern führt vorerst
einmal zu einer Form der Verallgemeinerung: Aus tokens werden types – und aus
Büchern Texte. ›Text‹, so können wir hier für die Bedürfnisse unserer Argumentati-
on definieren, soll im Gegensatz zu ›Exemplar‹ dasjenige bezeichnen, was die ideel-
le Identität der verschiedenen materiellen Zeichenträger, der Bücher, ausmacht.
Diese Identität setzt etwas voraus, das als überindividuell erscheint, nämlich Re-
geln, Kodes oder Normen. Mögen auf der Ebene des Vernehmens die Differenzen
zwischen dem inneren Sprechen verschiedener Individuen bei der Dekodierung
von Schrift auch enorm sein (Tempo, Prosodie, Stimmlage, Lautung etc.), so sind
diese Differenzen in Ansehung der Typen, die erkannt werden, vergleichsweise ge-
ring, da die Hauptaufgabe in der korrekten Typenidentifikation besteht. Falsche
Typenzuweisungen werden als Fehler des Lesenden sanktioniert.
Die Versprachlichung von Schrift setzt also zur Identifikation der Schriftzeichen
die Kenntnis eines Schriftsystems voraus, mag diese Kenntnis den jeweiligen An-
forderungen genügen oder nicht. Gleichzeitig scheint es mir ausgemacht, dass alle
die Beweggründe, Zeit auf das Entziffern von schwarzen Flecken auf weißem Pa-
pier zu verwenden, letztlich auf dem Vertrauen oder der stillschweigenden Annah-
me gründen, dass es sich bei diesen Flecken um Zeichen handelt – und nicht etwa
um Fliegendreck oder das neckische Spiel der Abendsonne –, also um ausgewählte
7 Goodman: Languages of Art, S. 53.
F4717-Antonsen.indd 16 03.12.2008 11:04:54 Uhr
VON BUCH UND BÜCHERN 17
Elemente aus einem als bekannt vorausgesetzten Vorrat an Mitteln, die einer Mit-
teilungsabsicht dienen. Das allem Lesen vorgängige, ahnungsvolle Erkennen von
gewissen Flecken als Zeichen bildet einen ersten Schritt auf dem Weg, der vom
materiellen Buch zu einer mentalen Textwelt führt. Dieser Anfang ist untrennbar
an ein Apriori gebunden, an eine Intentionalitätsunterstellung: Alles Lesen beruht
auf dem Vertrauen oder der stillschweigenden Annahme, dass die Transformation
der Flecken in etwas, das sie nicht sind, eine sinnvolle Tätigkeit ist; alles Lesen be-
ruht auf der Annahme eines Fremden, der den Sinn einer solchen Tätigkeit plausi-
bel macht. Diese »imputatio«, wie sie Weimar treffend nennt8, diese ›Zurechnung‹
oder – in meinen Worten – diese ›Absichtsunterstellung‹ kann zutreffend oder irrig
sein, sie bleibt an ein Apriori gebunden, das bereits auf der Ebene des Lesens als
Zeichenidentifikation einsetzt. In der Regel lesen wir keine Äpfel (es sei denn von
Bäumen); wir lesen einen Apfel nicht, wenn wir ihn essen, und auch dann nicht,
wenn wir ihn einer Sorte zuweisen; in recht seltenen Fällen aber lesen wir einen
Apfel, nämlich genau dann, wenn wir vorgängig zwei Annahmen machen: Dass ei-
ne Mitteilungsabsicht bestehe und dass der Apfel als ein Mittel zur Mitteilung
dient. Dies ist etwa der Fall, wenn er als Bewertungsmittel von Aufsätzen in der
Grundschule oder als Symbol für die Erbsünde erkannt wird.
So unterscheiden sich denn auch Zeichen von Indizien oder Symptomen sowie
Bedeutung von Information. Ein bestimmtes Geräusch kann etwa als Quietschen
von Reifen wahrgenommen werden und diese Wahrnehmung kann durchaus in-
formativ sein: Das Quietschen lässt auf Zivilisation, heißen Asphalt, Gefahr u. ä. m.
schließen. Nichtsdestoweniger empfiehlt es sich, solche Informationen nicht als
»Bedeutungen« zu bezeichnen.9 Das Quietschen bedeutet ›heißen Asphalt‹ ebenso
wenig wie der Satz, »hier liegt ein Buch« ein deiktisches Zeichen, einen Akkusativ,
ein Präsens, 16 Buchstaben und drei Leerschläge bedeutet; es bedeutet Unfall eben-
so wenig wie Fontanes Effi Briest 334 bedruckte Seiten in der Reclam-Ausgabe und
einen gelben Umschlag bedeutet. Die Aussage »Effi Briest ist ausgesprochen dick«
gehört nicht zu der Textwelt, die Weimar als Ergebnis des Verstehensprozesses er-
achtet, auch wenn ich beim Lesen diese Erfahrung immer wieder machen sollte.
Was wir unter ›Textwelt‹ oder ›Bedeutung eines Textes‹ verstehen, ist etwas ande-
res, nämlich etwas, von dem wir vermuten, dass es uns rational nachvollziehbar
und mit geltenden Mitteln mitgeteilt wird. Es gibt somit kein Bedeuten, das privat
oder individuell ist. Vielen, und allen voran den Literaturwissenschaftlern und Li-
teraturwissenschaftlerinnen, mag diese Aussage problematisch erscheinen. Sind es
nicht eben gerade diejenigen Informationen, die ich von eigentlichen Bedeutungen
abgetrennt habe, die unter dem Gesichtspunkt der Literarizität als bedeutend zu
erachten sind? Nach einer weit verbreiteten Meinung besteht Literatur nicht zuletzt
darin, dass in ihr die konventionalisierten Zeichen opak würden, da sie – wie Kunst
8 Weimar: Lesen, S. 56.
9 Natürlich ist dies eine Frage der Wortwahl. Grice (Meaning, passim) etwa unterscheidet zwi-
schen natural und nonnatural meaning. Ich verwende ›Bedeutung‹ hier nur für nonnatural
meaning.
F4717-Antonsen.indd 17 03.12.2008 11:04:54 Uhr
18 ERIC ACHERMANN
überhaupt – weder durch Darstellung (representation) noch Ausdruck (expression)
auf ein Äußerliches verweise, sondern die Aufmerksamkeit auf ihre eigene Form
richte. In einem berühmten Aufsatz, When is art?, hat Goodman dargelegt, dass
Kunst auch dann noch verweise, wenn sie weder darstelle noch ausdrücke, da sie
durch die Eigenschaften des Werkes exemplifiziere. Unter exemplification versteht
er possession plus reference. Damit zeigte aber das Kunstwerk hauptsächlich seine
Klassenzugehörigkeit an, und zwar aufgrund einer Eigenschaft, die das Werk be-
sitzt, und dies im Gegensatz zu Zeichen, die ohne eine bestimmte Eigenschaft zu
besitzen etwas auszudrücken oder zu denotieren in der Lage wären. Diese Exempli-
fikation ist jedoch, wie Goodman darlegt, ein Verweisen, das den Gegenständen
zukommt, »insofar as our attention is directed to it as an exemplifying symbol«, das
heißt, wenn Intentionalitätsunterstellung oder mehr oder minder starke Habituali-
sierung nach einem solchen Verweisen fragen: »whether an object is art – or a chair
– depends upon intent or upon whether it sometimes or usually or always or exclu-
sively functions as such.«10
Der Leseprozess führt so zur Konstruktion einer Textwelt, die ich aufgrund sup-
ponierter objektiver Eigenschaften der verwendeten Mittel sowie der supponierten
Allgemeinheit dieser Mittel wiederzugeben oder nachzuerzählen, kurz: zu para-
phrasieren, mich in der Lage wähne. Teile ich eine Paraphrase mit, so werde ich –
insbesondere wenn die Richtigkeit dieser Paraphrase in Frage gestellt wird – auf
Argumente zurückgreifen, die Ansprüche auf objektive Beobachtbarkeit oder allge-
meine Nachvollziehbarkeit geltend machen. Die Argumente lassen sich demnach,
wie ich glaube, zwei verschiedenen Klassen zuordnen, die von zwei unterschiedli-
chen Gesichtspunkten geprägt sind. Entscheidend ist dabei, ob ich meine Auf-
merksamkeit hauptsächlich dem Text oder der kommunikativen Situation zuwen-
de. Es sei hier ein Beispiel erwähnt: Es ist nicht anzunehmen, dass bei dem Satz
»Ein Kilo Hackfleisch und zwei Kilo Blutwurst hätt’ ich gern von Ihnen« der Metz-
ger begeistert in die Hände klatscht und »Hexameter« ruft. Es sei denn, der Metz-
ger beobachte dasselbe Phänomen in allen oder zahlreichen Äußerungen des Kun-
den, es sei denn, der Metzger stehe nicht in seiner Metzgerei, sondern sitze in einer
Dichterlesung. Beobachtung oder Situation führen so zu einer Verlagerung der
Aufmerksamkeit von einer supponierten Mitteilungsintention zu einer supponier-
ten ästhetischen Intention, welche die Einstellung zur Äußerung bestimmen.11
Diese Einstellungen schließen sich gegenseitig nicht aus; sie treten in den jewei-
ligen Diskussionen in der Regel vereint auf, wobei ein Wechsel der Einstellung
durchaus als zulässig erachtet wird. In Diskussionen und Debatten um das richtige
Textverständnis werden die Einstellungen häufig durch Hinweise angezeigt, so zum
Beispiel: »Hier steht aber ausdrücklich ›Tisch‹ und nicht ›Altar‹«, »der Text wurde
in der Nietzschenachfolge als dionysischer gelesen« etc. Argumente, die auf Beob-
10 Goodman: When is Art?, S. 67 u. 70.
11 Es sei hier auf Genettes (Fiction et diction, S. 11ff.) Unterscheidung zwischen »essentialisti-
schen« und »konditionalistischen« Theorien verwiesen. Zur »ästhetischen Einstellung« vgl.
auch Bourdieu: Die Regeln der Kunst, S. 455f.
F4717-Antonsen.indd 18 03.12.2008 11:04:54 Uhr
VON BUCH UND BÜCHERN 19
achtungssätzen hinsichtlich des Textes und dessen Beziehung zu anderen Texten
aufbauen, nenne ich »textwissenschaftlich«, Argumente hingegen, die auf der Vor-
stellung der Kommunikation aufbauen, bezeichne ich als »philologisch«.12 Die ein-
zigen Argumente, die hier nicht interessieren, sind Argumente, die sich auf meinen
Leseeindruck berufen, da es ja gerade dieser Eindruck ist, den es argumentativ zu-
gunsten einer höheren Akzeptanz meiner Position zu überwinden gilt.
Die textwissenschaftliche Argumentation basiert auf Beobachtungen der Art,
»hier steht es«, das heißt in Hinweisen auf Textereignisse, die als objektiv gegeben
erachtet werden. Widerspruch gegen solche Sätze erfolgt in der Annahme einer
fehlerhaften Wahrnehmung oder einer wie auch immer gearteten Unkenntnis der
im engeren Sinne sprachlichen Kodes (Schrift, Lexik, Grammatik etc.). Auf sol-
chen Beobachtungssätzen beruhen Argumente, die das vermeintlich richtige Text-
verständnis durch den Verweis auf wiederholte Beobachtungen gleicher oder ähnli-
cher Textvorkommnisse zu plausibilisieren trachten. Dies geht häufig einher mit
der Bestimmung von Beobachtungsräumen, die als relevante Kontexte (einem Text,
einem Werk, einer Zeit, einer sozialen Schicht etc.) zur Bildung solcher Vergleiche
bzw. als deren Resultat stipuliert werden. Die wiederholten Beobachtungen kön-
nen schließlich zur Formulierung allgemeiner Regelmäßigkeiten führen, die für
den gewählten Geltungsbereich zutreffen oder gar ›literaturtheoretisch‹ über die
Bereiche hinaus für alles, was Literatur ist, als geltend erachtet werden. Es ist zu
vermuten, dass mit zunehmender Allgemeinheit der Argumente deren Konsensfä-
higkeit abnimmt. Dies hängt offensichtlich damit zusammen, dass die Typenhaf-
tigkeit eines Buchstabens einfacher zu eruieren ist als die Typenhaftigkeit im Be-
reich der Lexik (zum Beispiel Wortfelder), der Aussagen (zum Beispiel Topik), gar
ganzer Texte und Textcorpora. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass mit zuneh-
mender Komplexität der Beobachtungssätze zunehmend auch Entscheidungen
hinsichtlich der Rationalitätsannahmen und Adäquatheit vorausgesetzt werden,
das heißt, dass mit zunehmender Komplexität die rein textwissenschaftliche Ein-
stellung zunehmend aufgegeben wird und (eingestanden oder uneingestanden)
philologische Argumente Verwendung finden. Dies geschieht insbesondere dann,
wenn die Nähe bzw. die Ferne gewisser Texte behauptet wird.
Die philologische Argumentation beruht auf der Annahme einer Mitteilungsab-
sicht und den damit verbundenen Rationalitätsannahmen. Diese Annahmen set-
zen einerseits voraus, dass – wo nicht anders angezeigt – der ›common sense‹, das
Prinzip der Widerspruchsfreiheit, grundlegende Intuitionen etc. respektiert wer-
den, andererseits, dass ein situationsadäquater Umgang mit Äußerungen stattfin-
det. Was mir hier vorschwebt sind Verhaltensweisen, die den Grice’schen Kommu-
nikationsmaximen und allgemeinen Normen der Kommunikation entsprechen.
Die Untersuchung der Mitteilungsabsicht, die Rationalität und Adäquatheit impli-
ziert, setzt Vorstellungen hinsichtlich der jeweiligen Kommunikationssituation vo-
raus. Die philologische Lektüre ist also von Anfang an eine historische, da der Text
an einen supponierten Verfasser bzw. eine supponierte Verfasserin gebunden er-
12 Vgl. Achermann: Was ist hier Sache?
F4717-Antonsen.indd 19 03.12.2008 11:04:54 Uhr
20 ERIC ACHERMANN
scheint, deren Absichten aufgrund einer implizierten Allgemeinheit von Rezipien-
ten verstanden werden können. Auch hier dürften Annahmen bezüglich der Wi-
derspruchsfreiheit und grundlegender Intuitionen als unproblematischer erschei-
nen als Behauptungen, welche die Intention einer umfangreichen Äußerung oder
gar die Interaktion von Produzent und Rezipient von Aussagen betreffen. Das Pro-
blem, dass nicht zuletzt literarische Texte sich eben derjenigen Transgressionen be-
dienen, die sich zumindest zeitweilig aus dem Kooperationsprinzip zu verabschie-
den scheinen, bedeutet jedoch nicht, dass eine stark figurale Rede etwa nicht auf
Normen angewiesen wäre. Der Eindruck oder die Feststellung einer Transgression
setzt im Gegenteil die Vorstellung einer Norm voraus.
Textwissenschaftliche und philologische Herangehensweise bedingen sich wech-
selseitig. Sie gehen von zwei verschiedenen Annahmen aus, die gleichermaßen in-
tuitiv sind: Dass ein Buch sein muss, damit Bedeutung sein kann; dass eine Absicht
sein muss, damit da ein Buch ist. Lesen heißt also immer, dass objektive Beobach-
tungen von allgemeinen Normvorstellungen als Rationalitätsannahmen abhängen.
F4717-Antonsen.indd 20 03.12.2008 11:04:54 Uhr
Jan Erik Antonsen (Freiburg/Schweiz)
»NIMM UND LIES«. ZUR FUNKTION DER LEKTÜRE
Am Anfang jeder Literaturwissenschaft steht die Lektüre, jener Vorgang, den Alf-
red Andersch in seinem Roman Sansibar oder der letzte Grund, ebenso liebevoll wie
genau, in der Beschreibung von Barlachs lesendem Klosterschüler folgendermaßen
geschildert hat:
Aber dann bemerkte er auf einmal, daß der junge Mann ganz anders war. Er war
gar nicht versunken. Er war nicht einmal an die Lektüre hingegeben. Was tat er
eigentlich? Er las ganz einfach. Er las aufmerksam. Er las genau. Er las sogar in
höchster Konzentration. Aber er las kritisch. Er sah aus, als wisse er in jedem
Moment, was er da las. […] Er sieht aus wie einer, der jederzeit das Buch zuklap-
pen kann und aufstehen, um etwas ganz anderes zu tun.1
Das Lesen der hölzernen Klosterschüler-Figur hat hier sinnbildlichen Charakter,
indem es das richtige freie und kritische Lesen veranschaulicht, das sich von jener
Art der Lektüre, wie sie die Protagonisten des Romans pflegen, unterscheidet.
Denn der Klosterschüler ist weder ein oberflächlicher Leser, der den Text nur rasch
überfliegt und nicht über die Konzentration, Zeit oder Muße verfügt, Einzelheiten
wahrzunehmen oder gar lesend über das Gelesene nachzudenken, noch ist er ein
Leser, der sich völlig an die Lektüre verloren hat, der – wie es die Metapher des
Versunkenseins zum Ausdruck bringt – ganz, vielleicht bis zum Moment der Iden-
tifikation mit einer oder mehreren der zum Leben erweckten Figuren, in die darge-
stellte Welt eingegangen ist und keine Distanz zum Gegenstand der Lektüre mehr
erkennen lässt. Indem der Klosterschüler ein mittleres Maß zwischen diesen beiden
extremen Formen der Lektüre einhält, erscheint er als ein disziplinierter Leser, der
sich selbst im Zaum und die Begegnung mit dem Text unter Kontrolle hat. Da-
durch stellt er gleichsam das Idealbild eines Lesers dar; er wird zu dem Leser, den
sich die Autoren als Rezipienten ihrer Texte gewünscht haben mögen, für den sie
ihren Text geschrieben haben.2
Wenn auch bei Andersch letztendlich das Ideal einer Lektüre beschrieben wird
– ein Ideal, das sich, vielleicht bezeichnenderweise, in der leblosen Plastik manifes-
tiert, die ihrerseits nur die Repräsentation eines Lesers darstellt –, so geht doch eine
solche konzentrierte Auseinandersetzung mit ihrem Gegenstand jeder, von welchen
Prämissen auch immer geleiteten, wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur
1 Andersch: Sansibar, S. 40.
2 Zur Funktion und Bedeutung der lesenden Figur wie der Lektüre überhaupt in Sansibar vgl.
Stocker: Vom Bücherlesen, S. 95–134.
F4717-Antonsen.indd 21 03.12.2008 11:04:55 Uhr
22 JAN ERIK ANTONSEN
voraus – oder sollte ihr vorausgehen. Anderschs Interpretation von Barlachs hölzer-
ner Figur soll mir im Folgenden als Ausgangspunkt für einige (durchaus einen per-
sönlichen Standpunkt einnehmende) Überlegungen zu Gegenstand und Aufgabe
literaturwissenschaftlichen Arbeitens dienen. Anderschs lesende Klosterfigur eignet
sich dafür, weil sie zum Nachdenken anregt. Sie tut dies, weil sie als künstlerisches
Artefakt ihrerseits interpretationsbedürftig ist: Von der lesenden Figur erfährt der
Leser des Textes nichts weiter, als dass sie liest; selbst der Gegenstand ihrer Lektüre
bleibt unbekannt. Interessant ist sie lediglich als lesende, wobei selbst die Art ihres
Lesens nichts weiter als das Ergebnis der Interpretation der Figur durch den sie be-
trachtenden Protagonisten ist. Was Gregor, den kommunistischen Parteifunktio-
när, offenbar fesselt, ist der Vorgang des Lesens, dem die hölzerne Plastik Ausdruck
gibt. Sie erinnert ihn an etwas, was ihm abhanden gekommen ist und was er wie-
derzugewinnen versucht. Zugleich ist der lesende Klosterschüler in Anderschs Ro-
man eine zutiefst bedrohte Figur; ihre Existenz ist in Gefahr, weil sie als Kunstwerk
(und ihre Kunst) als ›entartet‹ gilt.
Einen weiteren Horizont eröffnet die Figur, wenn sie in den literarhistorischen
Zusammenhang jener alten und wirkungsmächtigen Tradition gestellt wird, zu der
sie gleichsam eine Coda bildet: das Motiv der erzählten Lektüre. Lesende kommen
in Texten in aller Regel nicht nur vor, damit in der Darstellung des Lesevorgangs
das richtige Lesen von einem falschen unterschieden werden kann, sondern um ei-
ne Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der erzählten Lektüre zu initiieren.
Dabei kommt der Thematisierung des Lesens in Texten – wie es dann auch bei An-
dersch wieder der Fall ist – insofern eine besondere Bedeutung zu, als sich in der
erzählten Lektüre, indem sie stets auch die Rezeptionsbedingungen des eigenen
Textes zum Thema erhebt, ein Moment der Selbstreflexion Bahn bricht; es kontu-
riert sich hier immer auch eine Aussage darüber, wie der Text selbst gelesen und
verstanden werden will (oder wie er nicht gelesen und verstanden werden will). Mit
dem Motiv der erzählten Lektüre wird daher stets auch, mehr oder minder deut-
lich, ein Selbstverständnis des literarischen Texts zur Schau getragen, das seinerseits
auf einem Selbstbewusstsein des Autors als Autor beruht, welches sich in der Anti-
ke und im Mittelalter, im 17. und 18. Jahrhundert immer wieder neu zum Aus-
druck bringen muss.3
Dass Dichtung auf Leser oder Hörer eine Wirkung ausübt, sie rührt oder zu ei-
nem bestimmten Verhalten zu bewegen vermag, ist schon sehr früh in der Literatur
3 Die wohl wichtigste und prominenteste Funktion ist jene, die ich Illusionierung der Welt
nennen möchte: die Lektüre als Prisma, durch das die erzählte Welt vom Protagonisten wahr-
genommen wird. Exemplarisch hierfür sind Cervantes’ Don Quijote und Goethes Die Leiden
des jungen Werthers; in beiden Romanen spielt die Lektüre nicht nur eine zentrale inhaltliche
Rolle, sondern verweist auch auf ein jeweils sich neu akzentuierendes Selbstverständnis fik-
tionaler Literatur und das entsprechende Leseverhalten; auf diese Funktion des Motivs der
erzählten Lektüre, die schon öfters erörtert worden ist, gehe ich im Folgenden nicht mehr
ein, vgl. Marx: Erlesene Helden, S. 111–164; zur Thematisierung des Lesens in der Literatur
vgl. Wuthenow: Im Buch die Bücher, Stockhammer: Leseerzählungen sowie Berthold: Fiktion
und Vieldeutigkeit.
F4717-Antonsen.indd 22 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»NIMM UND LIES« 23
zur Darstellung gebracht worden: Als wohl ältester Beleg dafür in der europäischen
Literatur kann eine berühmte Episode in der Odyssee gelten: Als Odysseus, der nach
seiner Flucht von Ogygia von den Phaiaken gastfreundlich aufgenommen worden
war, den Sänger Demodokos von der Eroberung Trojas erzählen hört, bricht er zu-
nächst in Tränen aus, entschließt sich aber dann, seinen Gastgebern die Geschichte
seiner Irrfahrten zu erzählen.4 Dargestellt wird hier zum einen der unmittelbare
Effekt dieses Vortrags – Odysseus beginnt zu weinen – und zum anderen eine Re-
aktion des Rezipienten: Odysseus lässt sich durch den Vortrag zur Nachahmung
anregen und wird seinerseits zum Erzähler, und dies nun auch in erzähltheoreti-
scher Hinsicht, indem Odysseus für die nächsten vier Bücher gänzlich als intradie-
getische Erzählerfigur fungiert. Der Vortrag des Sängers, die Darbietung von Dich-
tung, fungiert hier erzähltheoretisch als Motivierung des Wechsels der Erzählebe-
nen: Odysseus schlüpft, angeregt durch Demodokos, selbst in die Rolle des
Erzählers (bzw. Sängers) und kommt so in die Lage, die unerzählte Vorgeschichte
des Epos in einer weit ausgreifenden Analepse nachzuholen.
Gänzlich anderes im Sinn haben Paolo Malatesta und Francesca da Rimini in ih-
rer gemeinsamen Erzählung vom Unglück, das sie in die Hölle geraten ließ, wo ih-
nen Dante im fünften Gesang des Inferno begegnet: Francesca pflegte nämlich mit
ihrem Schwager Paolo die Stunden der Muße mit der gemeinsamen Lektüre eines
der modischen Ritterromane zu verbringen; als sie aber zu jener Stelle kamen, an der
Lanzelot in ehebrecherischer Absicht Ginever, die Gattin König Artus’, küsst, fühlen
sie sich angeregt, dem Beispiel ihrer Romanhelden zu folgen: »Quel giorno piú non
vi leggemmo avante«5 – »An jenem Tag lasen wir nicht weiter«, heißt es nur lako-
nisch. Fühlt sich Odysseus angeregt, dem Beispiel des Sängers zu folgen und selbst
die Rolle des Erzählers zu übernehmen, den Erzählvorgang damit nachahmend, ah-
men Paolo und Francesca das Gelesene nach, die Handlung, die an der Stelle in der
Geschichte von Lanzelot und Ginever erzählt wird. Für den Ehebruch, den sie damit
begehen, werden sie nach ihrem Tod in die Hölle verbannt6; sie erscheinen damit
nicht nur, in der Nachfolge (und Gesellschaft) von Dido und Kleopatra, von Paris
und Tristan, als Märtyrer der Liebe, als die sie sich Dante gegenüber darstellen, son-
dern als die ersten wahrlich tragischen Opfer der Lektüre. Dabei kann das, was an
der kruzialen Stelle im Ritterroman erzählt wird, nur aus dem Zusammenhang er-
schlossen werden; der Ehebruch, den Lanzelot und Ginever begehen, ist selbst nicht
4 Vgl. Homer: Odyssee, S. 97–100 (VIII, 469–586); der Bericht von Odysseus’ eigener Ge-
schichte setzt mit dem Beginn des neunten Buchs ein.
5 Dante: Divina Commedia, S. 24 (Inferno V, 138) (die folgenden Übersetzungen stammen,
wo nicht eigens anders angegeben, von mir).
6 Die Erzählung beruht auf einer wahren Begebenheit, die Dante wohl von Francescas Neffen,
Guido Novello da Polenta, kannte, bei dem er seine letzten Lebensjahre verbrachte. Fran-
cescas Gatte, Giangiotto Malatesta, soll, wie der Kommentar zu dieser Stelle zu berichten
weiß, ausnehmend hässlich und grob gewesen sein; Francesca hatte also allen Grund, sich
ihrem Schwager zuzuwenden. Als der Ehebruch herauskam, ermordete der betrogene Ehe-
mann Gattin und Bruder, vgl. den Kommentar des Herausgebers in Dante: Göttliche Komö-
die, S. 483.
F4717-Antonsen.indd 23 03.12.2008 11:04:55 Uhr
24 JAN ERIK ANTONSEN
Gegenstand der Erzählung (wie auch das Vergehen von Paolo und Francesca nicht
eigens genannt wird). Sowohl die in der genannten Lektüre erzählte Handlung als
auch die durch diese Lektüre angeregte Handlung bleiben unerzählt; sie bilden eine
signifikante Lücke im Erzählvorgang, die lediglich aus dem Kontext zu erschließen
ist. Tatsächlich ist der Vorgang so formuliert, als sei es das Buch selbst oder sein Au-
tor, die hier als Verführer wirken, und nicht der Inhalt des Gelesenen. »Galeotto fu’ l
libro e chi lo scrisse«7 – »Verführer war das Buch und der’s geschrieben«. Wie der
Vorgang und die Art der Lektüre und sogar das auslösende Moment des Ehebruchs,
der Kuss, in der Erzählung Francescas Erwähnung finden, aber nicht der in der er-
zählten Lektüre begangene Ehebruch selbst, so werden die Umstände der gemeinsa-
men Mußestunden und die Lektüre als auslösendes Moment für Paolos und Frances-
cas Ehebruch erzählt unter Auslassung dieses Ereignisses selbst. So stehen erzählte
Lektüre und die dadurch motivierte Handlung in einem Verhältnis der Analogie zu-
einander; man könnte hier so weit gehen, unter Anwendung eines Terminus aus der
im Mittelalter praktizierten Bibelexegese zu sagen, dass Dante das Verhältnis von er-
zählter Lektüre und dadurch motivierter Handlung als typologisches anordnet, als
Beziehung von Typus zu Antitypus.
Als Initiation der Handlung fungiert das Buch auch in Cyrano de Bergeracs Sci-
ence-Fiction-Erzählung avant la lettre Voyage à la lune: Hier sind es sämtliche nach-
folgend erzählten Ereignisse, die, im buchstäblichen Sinn, durch die Lektüre eines
Buchs in Gang gesetzt werden. Auf dem Heimweg von einem Zechgelage unterhält
man sich mit dem Versuch, das Wesen des Mondes, der den Heimkehrenden den
Weg beleuchtet, zu bestimmen: Er sei eine Dachluke am Himmel, durch die man
das himmlische Paradies schimmern sehe, das Wirtshausschild des Bacchus, der im
Himmel ein Restaurant eröffnet habe, oder die Sonne, die im Negligé durch ein
Loch beobachte, was auf der Welt getrieben werde, wenn sie nicht da sei; nur der
Ich-Erzähler, ein Anhänger des kopernikanischen Weltbilds, ist fest davon über-
zeugt, dass es sich beim Mond um eine Weltkugel handle, wie die Erde eine sei. Zu
Hause angekommen, stößt dieser nun auf ein aufgeschlagenes Buch, Cardanos De
subtilitate, ein philosophisches Werk, das aufgrund seiner pantheistisch-naturphi-
losophischen Ausrichtung noch im 17. Jahrhundert Anklang bei den kirchenkriti-
schen Libertinisten fand (zu denen Cyrano gehörte):
Et quoique je n’eusse pas dessein d’y lire, je tombai de la vue, comme par force,
justement dans une histoire que raconte ce philosophe: il écrit qu’étudiant un soir
à la chandelle, il aperçut entrer, à travers les portes fermées de sa chambre, deux
grands vieillards, lesquels, après beaucoup d’interrogations qu’il leur fit, répondi-
rent qu’ils étaient habitants de la lune, et cela dit, ils disparurent. Je demeurai si
surpris, tant de voir un livre qui s’était apporté là tout seul, que du temps et de la
feuille où il s’était rencontré ouvert, que je pris toute cette enchaînure d’incidents
pour une inspiration de Dieu qui me poussait à faire connaître aux hommes que
la lune est un monde.8
7 Dante: Divina Commedia, S. 24 (Inferno V, 137).
8 Cyrano: Œuvres, I, S. 7f.
F4717-Antonsen.indd 24 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»NIMM UND LIES« 25
Was die Lektüre dieser Stelle auslöst, ist nichts anderes als den Entschluss, den
Mond gleich selbst in Augenschein zu nehmen: Der Ich-Erzähler unternimmt, mit
Hilfe einiger neuartiger technischer Hilfsmittel, eine Reise zum Mond. Was sich in
der Erzählung bei Dante als Funktion der Lektüre herausgestellt hat, kommt auch
hier zum Ausdruck; jedoch nimmt Cyrano unverkennbar bereits parodistisch auf
ein solches Motiv Bezug. Wie bei Dante entspringen die erzählten Ereignisse dem
Akt der Nachahmung jener Handlung, die Gegenstand der Lektüre ist; die Mög-
lichkeit einer solchen Reise scheint überhaupt erst dadurch auf, dass sie Gegenstand
der erzählten Lektüre ist. Ebenso wie bei Dante fungiert das Buch als Vermittlungs-
instanz zum Unternehmen, das der Ich-Erzähler dann in Angriff nimmt; das Buch
vermittelt den Anreiz zur Reise, indem es Informationen liefert, die dazu angetan
sind, den Wunsch nach weiteren Informationen zu wecken. An die Stelle des bei
Dante als negativ gewerteten sexuellen Begehrens tritt indes bei Cyrano die Neu-
gier, die ›curiositas‹, jene von der Kirche als Sünde abgestempelte Eigenschaft, wel-
che die Voraussetzung für jene Entdeckungen bildete, die zur Formulierung eines
neuen astronomischen Weltbildes führten.9 Dabei scheint es, als ob die ›curiositas‹
nur der vorgängigen Versprachlichung ihres Gegenstands bedarf, um eine Hand-
lung zu ihrer Befriedigung hervorzurufen. Das Buch fungiert dann im buchstäbli-
chen Sinn als Voraussetzung des Unternehmens, indem es die Reise vorgängig in
die Vorstellung versetzt, so dass sie als Handlung nachgeahmt werden kann. Was
gesagt ist, kann getan werden.
Die Stelle, die der Ich-Erzähler liest, hat im Prinzip die Funktion der Span-
nungserregung; nur ist es hier nicht das Buch selbst, dessen fortgesetzte Lektüre die
angestachelte Neugier befriedigen könnte, sondern der Besuch jenes Ortes, von
dem die Lektüre Kunde gegeben hat; indem von zwei Mondbewohnern auf Erden-
besuch die Rede ist, scheint zudem auch die Möglichkeit der Reise durchaus gege-
ben. Die Reise zum Mond rückt dann an die Stelle der Fortsetzung der Lektüre.
Das Lesen der aufgeschlagenen Stelle hat überhaupt nur den einen Zweck der Ani-
mation zu jener Reise, denn sowohl der Umstand, dass auf dem Tisch ein aufge-
schlagenes Buch liegt, erscheint dem Ich-Erzähler als ein Zufall oder »Wunder«10,
als auch der Umstand, dass er die aufgeschlagene Stelle tatsächlich liest. Dabei stellt
sich das so unvermittelt aufgeschlagene Buch gar nicht als eines heraus, dessen zum
Zweck der Belehrung oder des Vergnügens betriebene Lektüre seine vornehmliche
Bestimmung wäre: Das Buch hat hier vielmehr die Funktion eines Orakels, von
dem man sich Aufschluss in Hinsicht auf Entscheidungen, die getroffen werden
müssen, erhofft; deshalb ist hier nicht die vollständige Lektüre relevant, sondern
lediglich diejenige einer zufällig aufgeschlagenen Stelle, die, wie es im Umgang mit
der Bibel oder einem sonst heiligen Text gängige Praxis war, als Handlungsanwei-
sung interpretiert werden konnte. Cyranos Erzählung parodiert mit der Inan-
9 Zur Umwertung der ›curiositas‹ in der Frühen Neuzeit vgl. bes. Blumenberg: Legitimität,
S. 263–528.
10 »Mais, écoute, Lecteur, le miracle ou l’accident dont la Providence ou la Fortune se servirent
pour me le confirmer« (Cyrano: Œuvres, I, S. 7).
F4717-Antonsen.indd 25 03.12.2008 11:04:55 Uhr
26 JAN ERIK ANTONSEN
spruchnahme einer Textstelle aus einem der kirchlichen Lehrmeinung widerspre-
chenden philosophischen Werk nicht nur eine mögliche Lektüre oder Deutung des
Bibeltextes, sondern nimmt durch diese parodistische Bezugnahme gleich auch die
parodistisch-kritische Intention des eigenen Textes, der sich vor allem gegen kirch-
liche Dogmen richtete, vorweg. Cardanos Buch steht damit auch sinnbildlich für
Cyranos Erzählung, die – darauf scheinen diese deutlichen Ironiesignale zu verwei-
sen – selbst auch nicht ernst genommen werden will.
Auch das wohl berühmteste Beispiel für den erzählerisch dargestellten und pro-
minent gemachten Effekt einer Lektüre, der Bericht von Augustins Bekehrung zum
christlichen Glauben, erscheint zunächst als eine Handlungsanweisung:
[…] und ich weinte in der bittersten Zerknirschung meines Herzens. Auf einmal
aber höre ich aus dem Nachbarhaus eine Stimme – ob es die eines Jungen oder
eines Mädchens war, kann ich nicht sagen – im Singsang wiederholend ausrufen:
»Nimm und lies, nimm und lies.« Augenblicklich hellte sich meine Miene auf,
und ich versuchte mich krampfhaft darauf zu besinnen, ob es etwa ein Kinder-
spiel gäbe, bei dem ein solches Verslein vorkomme, aber ich konnte mich nicht
erinnern, das irgendwo gehört zu haben. Ich hörte auf zu weinen und erhob
mich: Ich wußte dem keinen anderen Sinn zu geben, als daß Gott mir befehle,
das Buch zu öffnen und die Stelle zu lesen, auf die zuerst mein Blick fallen würde
[…] Ich ergriff es, schlug es auf und las still für mich den Abschnitt, der mir als
erster in die Augen fiel: »Wir wollen unser Leben führen, wie es sich für den Tag
geziemt, nicht mit Ess- und Trinkgelagen, nicht mit Orgien und Ausschweifun-
gen, nicht mit Streit und Hader. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und
tut nicht, was dem Fleisch genehm ist, damit ihr nicht seinem Begehren verfallt«.
Weiter wollte ich nicht lesen, es war auch nicht nötig weiterzulesen. Denn kaum
hatte ich diesen Satz zu Ende gelesen, fühlte ich mich vom Licht der Gewissheit
durchdrungen und die ganze Nacht des Zweifels war entschwunden.11
Es ist zweifellos diese Passage, die Cyrano in seiner Erzählung parodiert. Anders
aber als für Cyranos Ich-Erzählerfigur handelt es sich hier nicht um ein Ereignis,
das eine aus dem Moment entfachte Neugier befriedigen soll, sondern um ein exis-
tentielles Problem: Augustinus erscheint in diesem autobiographischen Bericht als
11 »[…] et flebam amarissima contritione cordis mei. Et ecce audio vocem de vicina domo cum
cantu dicentis et crebro repetentis quasi pueri an puellae, nescio: ›Tolle lege, tolle lege‹. Statim-
que mutato vultu intentissimus cogitare coepi, utrumnam solerent pueri in aliquo genere lu-
dendi cantitare tale aliquid, nec occurrebat omnino audisse me uspiam repressoque impetu
lacrimarum surrexi nihil aliud interpretans divinitus mihi iuberi, nisi ut aperirem codicem et
legerem quod primum caput invenissem. […] Arripui, aperui et legi in silentio capitulum,
quo primum coniecti sunt oculi mei : ›Non in comisationibus et ebrietatibus, non in cubili-
bus et inpudicitiis, non in contentione et aemulatione, sed induite dominum Iesum Chris-
tum et carnis providentiam ne feceritis in concupiscentiis‹. Nec ultra volui legere nec opus
erat. Statim quippe cum fine huiusce sententiae quasi luce securitatis infusa cordi meo omnes
dubitationis tenebrae diffugerunt« (Augustinus: Confessiones, S. 177f. [VIII, 29]; die Über-
setzung der Bibelstelle [Röm. 13, 13f.] nach dem Text der neuen Zürcher Bibel, S. 251).
F4717-Antonsen.indd 26 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»NIMM UND LIES« 27
ein Gott Suchender, dem schließlich die ersehnte Erleuchtung zuteil wird. Dabei
ist dieses Ereignis, so stellt es Augustin dar, ganz wesentlich an den Akt der Lektüre
geknüpft: Es ist die Lektüre, welche die plötzliche Erkenntnis aufscheinen lässt, die
Augustin auf eine als richtig erkannte Lebensführung hinweist, eine Erkenntnis,
die durch die Metapher des Lichts veranschaulicht wird und sich damit im eigentli-
chen Sinn als Erleuchtung erweist. Die im Bibeltext formulierte Handlungsan-
weisung soll dabei durchaus wörtlich verstanden werden, doch läuft gerade diese
wörtliche Auffassung auf eine allgemeinere Aussage hinaus: auf den Aufruf zur tief-
greifenden Änderung des Lebens. Anders als bei Cyrano erwächst aus diesem Lek-
türeerlebnis nicht eine bestimmte, einmal durchzuführende Handlung; vielmehr
bewirkt das Lesen dieser wenigen Sätze aus dem Römerbrief eine Änderung seines
Verhaltens ganz im Allgemeinen, eine Abwendung von seinem bisherigen Leben
im religiösen Zweifel (dem er mit den Instrumenten der Philosophie beizukom-
men versucht hat) und die Hinwendung zum Glauben, die dann in den Entschluss,
sich taufen zu lassen, mündet.12 Das Wirken Gottes vermittels der Lektüre stellt
sich für Augustinus als Wiederholung des die Nacht vertreibenden »Fiat lux« des
Schöpfergottes am Anbeginn der Tage dar; erst im Moment der Lektüre, durch die
Gott zu ihm spricht, erkennt Augustin sich als Geschöpf Gottes. Die erzählte Lek-
türe in dieser Passage der Confessiones lässt sich daher eher einer anderen Funktion
zuordnen als der Initiation der Handlung: Das Buch wird hier zum Instrument der
Selbsterkenntnis, indem der Lesende durch die Lektüre zu der ihm gemäßen Iden-
tität findet.
Dass der Gott Suchende nicht in mystischer Versenkung durch einen von außen
an ihn herangetragenen Vorgang der Inspiration, sondern im Akt des Lesens seine
Erleuchtung findet, ist sicher kein Zufall: Damit wird der Buchcharakter der christ-
lichen Religion (im Gegensatz etwa zum Ritualcharakter der römischen, der Religi-
on des größten Teils seiner prospektiven Leser) unterstrichen; Gottes Wort richtet
sich an den Leser (oder Hörer) seines heiligen Textes. Deshalb kann Augustin –
auch dies wird von Cyrano parodiert – mit dem Bibeltext wie mit einem Orakel,
das man zu befragen sich anschickt, umgehen; es ist in der Tat die Stimme eines
Orakels, die Augustin dazu veranlasst, die in den Garten mitgebrachte Ausgabe der
Paulus-Briefe aufs Geratewohl aufzuschlagen. Dass die Orakel-Stimme nicht selbst
Medium der Erleuchtung ist, sondern nur mittelbar, über die Lektüre eines Textes,
zu ihr beiträgt, kann metonymisch als Verweis auf die Ablösung der heidnischen,
durch Rituale der Gottesbefragung gekennzeichneten Religion durch die christli-
che, auf einer Tradition der schriftlichen Überlieferung basierende Religion gedeu-
tet werden. Die kurze, aber ungeheuer symbolträchtige Szene kann ebenso als geis-
tesgeschichtlicher Beleg für die endgültige Ablösung des Paradigmas der Stimme
12 Dass diese Episode und nicht der offizielle Akt der Taufe als eigentliche Bekehrung zum
Christentum aufzufassen ist, unterstreicht der Umstand, dass von der Taufe wie von etwas
vergleichsweise Unwichtigem nichts Genaues berichtet wird, vgl. Augustinus: Confessiones,
S. 191 (IX, 6).
F4717-Antonsen.indd 27 03.12.2008 11:04:55 Uhr
28 JAN ERIK ANTONSEN
durch das der Schrift aufgefasst werden (als regelrechte Abdankung der Stimme,
die in ihrer letzten Äußerung ihre Kompetenzen der Schrift, dem Buch als Medium
der Schrift, überträgt).
In allen bisher besprochenen Beispielen bringt die Lektüre als Effekt eine be-
stimmte Handlung hervor. Die Handlung, die da jeweils neu in Gang kommt, ist
dabei nicht als Reaktion im eigentlichen Sinn zu verstehen, wie das sonst gemein-
hin der Fall ist, indem sie nicht Handlung darstellt, die auf eine Handlung folgt,
von der die Handelnden schon betroffen sind; vielmehr ist die Handlung, auf die
hier reagiert wird, indem sie nachgeahmt wird, eine bloß wahrgenommene, da sie
bloß im Buch vorkommt und so auf einer Handlungsebene angesiedelt ist, die ver-
schieden von derjenigen der Erzählung ist (erzähltheoretisch gesprochen: auf einer
intradiegetischen Erzählebene). Würde man lediglich den bloßen Akt des Lesens
zur Erklärung der jeweiligen Handlungen heranziehen, so blieben sowohl Frances-
cas und Paolos Ehebruch als auch die ungewöhnliche Reise von Cyranos Ich-Er-
zählerfigur oder Augustins Bekehrung gänzlich unmotiviert. Die erzählte Lektüre
ähnelt damit jenem Kunstgriff, der im Theater im Auftritt des Deus ex machina
sichtbar wird: einer Maßnahme zur Motivierung einer sonst nicht motivierten
Handlung. Dies kommt besonders deutlich bei Augustin zum Ausdruck, indem
die Lektüre der Bibelstelle ihm den Ausweg aus einer ihm ausweglos erscheinenden
Situation weist; die ›machina‹, die in entsprechenden Situationen auf dem Theater
einen Gott auftreten lässt, stellt sich hier als Buch dar, aus dem Gott zu Augustin
spricht. Bei Cyrano ist es eine im 17. Jahrhundert technisch unmögliche Reise, die
durch diesen Kunstgriff eine Motivierung erfährt und sogar durch das Vorbild des
Gelesenen, dem naturwissenschaftlichen und technologischen Wissen zum Trotz,
plötzlich als möglich erscheint; dem Gelesenen kommt dabei eine größere Über-
zeugungskraft zu als dem Wissen aus Erfahrung. Und bei Dante wird durch den
Umstand, dass es die Lektüre war, die Paolo und Francesca zum verbotenen Liebes-
akt motiviert hat, zu verstehen gegeben, dass nichts anderes Schwager und Schwä-
gerin zu einer solchen Sünde hätte bewegen können; das Buch erscheint dann in
genauer Umkehrung der Situation bei Augustinus als Werkzeug des Teufels (dessen
Lektüre den ›Diabolus ex machina‹ bzw. ›ex libro‹ aktiviert, welcher den Ereignis-
sen die schlimmstmögliche Wendung verleiht).
Fungiert das Buch im Buch, die erzählte Lektüre nun als Initiation der Handlung
(wie bei Homer, Dante und Cyrano), als Medium der Selbstvergewisserung (wie
bei Augustin) oder als Mittel zur Illusionierung der Welt (wie bei Cervantes und
Goethe – die Liste möglicher Funktionen ließe sich verlängern), stets erscheint der
aufgerufene Text (und mit ihm auch der aufrufende) als ein Artefakt, dessen Be-
deutung sich als offen herausstellt, dessen Pragmatik wie Semantik nicht als festge-
legt erscheinen, sondern eine Mannigfaltigkeit statuieren, die essentiell ist. Was all
diesen erzählten Lektüren gemeinsam ist, ist der Umstand, dass sie je besondere
Lektüren sind, die den Gegenstand der Lektüre verwandeln, ihn der jeweiligen Er-
zählung, in der sie zum Gegenstand werden, anverwandeln. In dieser Fähigkeit zur
Anverwandlung und Umdeutung liegt letztlich die subversive Qualität von Litera-
F4717-Antonsen.indd 28 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»NIMM UND LIES« 29
tur. Wovon die Dichter zwischen Homer und Goethe wussten und was sie hier in
den unterschiedlichsten Zusammenhängen und mit den unterschiedlichsten Zie-
len vorführen, ist der »ästhetische Mehrwert«13 von Literatur, eine Qualität von
Literatur, die zunächst einmal bewirkt, dass auf Literatur verschieden eingegangen
werden kann, dass Literatur nicht bloß etwas zu verstehen gibt, sondern Verschie-
denes, dass sie Verstehensmöglichkeiten eröffnet.
Hier ist der Punkt, von dem aus die genuine und zugleich vornehmste Aufgabe
der Literaturwissenschaft erkennbar wird: das Aufdecken dieses Mehrwerts und je-
ner literarischen und letztlich sprachlichen Mechanismen, die ihm zugrunde lie-
gen. Dies ist es auch, was Anderschs sprachliche Nachbildung von Barlachs hölzer-
ner Statuette zum Faszinosum macht: Der lesende Klosterschüler macht auf die
Offenheit des Textes für Möglichkeiten des Verstehens aufmerksam, und er tut dies
auf die denkbar radikalste Weise, indem der gelesene Text (und dessen aktuelles
Verständnis) gar nicht zur Sprache gebracht wird, vielmehr eine signifikante Leer-
stelle bildet, auf die lediglich durch den in Haltung und Mimik der Figur sich mit-
teilenden Vorgang des Lesens hingewiesen wird. Es ist, als ob sich in der leblosen
Plastik, in dem gleichsam für immer eingefrorenen Gestus des Lesens, die vollstän-
dige Offenheit des Textes abbildete.
Indem sich die Lektüre in der Lektüre selbst zum Gegenstand macht, tritt die
Literatur zu sich selbst als Literatur in ein reflexives Verhältnis. Texte sind, als
sprachliche Gebilde, auf Mehrdeutigkeit angelegt; dem Skandalon der Mehrdeu-
tigkeit können Texte nicht entgehen – sie ist ihnen, im buchstäblichen Sinn, auf-
grund ihrer Eigenart als Gebilde von Zeichen eingeschrieben. Die Mehrdeutigkeit
eines Textes, Qualität oder Ärgernis, befähigt ihn auch erst dazu, dass er sich selbst
zu seinem Gegenstand zu machen vermag. Mehrdeutigkeit und Selbstreferentiali-
tät zeichnen im Prinzip alle Texte aus und im besonderen Maße die literarischen.
Wer Texte als Dokumente der Mentalitätsgeschichte oder gar als Vehikel zur Welt-
deutung aufbietet, setzt sich der Gefahr aus, das immer schon und endgültig ver-
standen zu haben, dessen Verstehensmöglichkeiten auszuloten eigentlich seine Auf-
gabe wäre.
Wenn in allen diesen Texten die Lektüre thematisiert wird, so verbindet sich da-
mit auch der Anspruch eines besonderen Erfahrungsmodus: der einer Erfahrung,
die auf Welt Bezug nimmt, indem sie dies nicht unmittelbar tut, sondern mittelbar,
über das Medium des literarischen Textes, und damit eine Distanz und eine Pers-
pektive eröffnet, die das Wirkliche in neuem Licht erscheinen lässt. Es ist gerade
die Distanz zur Wirklichkeit – eine Distanz, die in den angeführten Texten da-
durch wirksam wird, dass die Wirklichkeit ihrerseits erst im Spiegel der Texte lesbar
wird –, welche die Literatur dazu befähigt, in ein kritisches Verhältnis zu ihr zu
treten. Gerade wenn die Literaturwissenschaft die Literatur in ihren ästhetischen
Qualitäten, in ihrer Distanz zum Wirklichen, ernst nimmt, hat sie gesellschaftliche
Relevanz. Erst die Distanz zum Gegebenen befähigt einen dazu, dieses in Frage zu
stellen, und erst im Wissen um solche Zusammenhänge und in der Fähigkeit, diese
13 Vgl. Steinfeld: Der leidenschaftliche Buchhalter.
F4717-Antonsen.indd 29 03.12.2008 11:04:55 Uhr
30 JAN ERIK ANTONSEN
Mechanismen zu erkennen, ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit Texten
denkbar. Und eine solche Kompetenz ist nach wie vor essentiell. Die dringlichste
und vornehmste Aufgabe der Literaturwissenschaft liegt im Nachweis der tenden-
ziell subversiven Qualität literarischer Texte und deren gesellschaftlicher Konse-
quenzen, kurz: im Aufweisen der Relevanz von Mehrdeutigkeit. Ziel von Literatur-
wissenschaft ist damit, Leser nicht nur zu guten Lesern zu bilden, sondern zu Bür-
gern, die zum ›produktiven Widerspruch‹14 befähigt sind.
14 Vgl. Würffel: Der produktive Widerspruch.
F4717-Antonsen.indd 30 03.12.2008 11:04:55 Uhr
Maria-Christina Boerner (Dresden und Freiburg/Schweiz)
»GEISTLICHE DÄMMERUNG«.
ZUR BEDEUTUNG DES RELIGIÖSEN IN GEORG TRAKLS
DICHTUNG UND IN DER FRÜHEN ABSTRAKTEN MALEREI
I.
Als zur Jahrtausendwende Jacques Derrida auf Einladung von Jürgen Habermas in
Frankfurt einen Vortrag zur Frage nach der Universität der Zukunft hielt, lautete
seine Antwort:
Die Universität müßte also auch der Ort sein, an dem nichts außer Frage
steht: Die gegenwärtige und determinierte Gestalt der Demokratie sowenig
wie selbst die überlieferte Idee der Kritik als theoretischer Kritik, ja noch die
Autorität der Form ›Frage‹, des Denkens als ›Befragung‹.1
Man muss wohl nicht Derridas Theorie der Dekonstruktion mit ihrer radikalen
Kritik und Demontage überlieferter Begriffe und Denkkonzepte sowie insbesonde-
re wissenschaftlicher Normen anhängen, um auch die anschließenden Ausführun-
gen für bedenkenswert zu halten:
Aber darin ist zugleich die Universität und sind zumal die Humanities zutiefst
dem verbunden, was man die Literatur nennt, im europäischen und moder-
nen Sinn des Wortes: die Literatur als das Recht, alles öffentlich auszuspre-
chen, ja ein Geheimnis zu wahren, und sei es im Modus der Fiktion.2
Damit stellt der französische Philosoph und Literaturtheoretiker einen Zusammen-
hang von Universität als gesellschaftlicher Institution und Literatur als intellektuel-
ler Ausdrucksform her, wobei er mit dem Hinweis auf den literarischen »Modus
der Fiktion« auch daran erinnert, dass Literatur gegenüber den eher festgefügten
Regeln des wissenschaftlichen Diskurses über ganz andere Möglichkeiten verfügt,
in unkonventioneller Weise zu sprechen. Im Rückblick auf die Geschichte der Lite-
raturwissenschaft und insbesondere der Germanistik scheint es allerdings, als habe
man sich seit den 1960er Jahren geradezu als Musterknabe auf dem Gebiet des
(Selbst)-Infragestellens profilieren wollen, wenn es darum ging, die methodischen
Grundlagen im Umgang mit dem Forschungsgegenstand Literatur festzulegen.
Zwar gehören die Ausarbeitung theoretischer Ansätze und Konzepte, mit denen
Literatur wissenschaftlich bestimmt und analysiert werden kann, sowie die Präzi-
sierung und Differenzierung der verwendeten Terminologie und Kategorien eben-
1 Derrida: Die unbedingte Universität, S. 14.
2 Ebd., S. 15.
F4717-Antonsen.indd 31 03.12.2008 11:04:55 Uhr
32 MARIA-CHRISTINA BOERNER
so zu den wesentlichen Bedingungen einer sich selbst reflektierenden (›Geistes‹-)
Wissenschaft wie die Kritik oder Widerlegung bestimmter Methoden durch neue
Erkenntnisse und Forschungsinteressen. Doch widerstreben der daraus resultieren-
de, viel bemängelte Methodenpluralismus sowie die rasante Geschwindigkeit, mit
der eben noch moderne, von ihren Kritikern auch gern als modisch bezeichnete
theoretische Entwürfe alsbald wieder in die historische Rumpelkammer verbannt
werden, einer Zusammenführung zu einer einheitlichen Systematik mit verbindli-
chen wissenschaftlichen Prinzipien für das Fach. Entsprechend groß ist das Ange-
bot von Handbüchern und Einführungen, mit denen Fachleute den Studierenden
die Orientierung im nahezu undurchschaubar anmutenden Gestrüpp der verschie-
denen, meist miteinander konkurrierenden Methoden mit ihren unterschiedlichen
Ansätzen aus Soziologie, Psychologie, Philosophie, Ethnologie, Linguistik, den Ge-
schichts- und Medienwissenschaften oder neuerdings auch den Neurowissenschaf-
ten erleichtern möchten, dabei allerdings manchmal den Eindruck verstärken, der
eigentliche Gegenstand der Literaturwissenschaft sei die Theorie und nicht die Li-
teratur. Zugleich wächst offenbar im Zuge der verstärkten Konkurrenz, in der die
zeitaufwendige Lektüre von literarisch anspruchsvollen Büchern gegenüber den
Film-, Fernseh- und Computermedien an Attraktivität verliert, auch der Druck,
die Beschäftigung mit Literatur nicht mehr nur im Hinblick auf die vorgeblich
besser ›nutzbaren‹ und nachprüfbaren Forschungsergebnisse in den Naturwissen-
schaften vor der Öffentlichkeit zu legitimieren, sondern auch dem ›iconic turn‹3
am Ende des 20. Jahrhunderts Rechnung zu tragen und mit dem kulturellen Struk-
turwandel hin zum ›Leitmedium‹ Bild die gesellschaftliche Funktion und Bedeu-
tung des geschriebenen Wortes neu zu überdenken.
In der Folge dieser Veränderungen lassen sich seit den 1990er Jahren zuneh-
mend Modelle finden, in denen statt immer weiterer Spezialisierung und Ausdif-
ferenzierung der literaturwissenschaftlichen Analysemethoden für eine fächer-
übergreifende Erweiterung der Philologien und ihre engere Verknüpfung durch
übergeordnete Fragestellungen plädiert wird. Zwar hat sich die Arbeit der Litera-
turwissenschaft auch in der Vergangenheit nicht auf das Sammeln und Edieren von
literarischen Werken beschränkt und die Kritik an der rein ›werkimmanenten In-
terpretation‹, die ihre Zuflucht nach den nationalsozialistischen Ideologisierungen
in der inhaltlichen und formalästhetischen Analyse des Textes selbst nahm und
außertextuelle Zusammenhänge bewusst ausschloss, führte gerade in den 1960er
Jahren zu der bis heute andauernden breiten Methodendiskussion mit komplexe-
3 Der Chicagoer Anglist und Kunsthistoriker W. J. T. Mitchell hatte 1992 vom ›pictorial turn‹
in Abgrenzung zum ›linguistic turn‹ gesprochen und damit erstmals die allgegenwärtige Prä-
senz des Bildes in der modernen Gesellschaft auf den Begriff gebracht (The Pictorial Turn,
S. 89–94). Gottfried Boehm erweiterte 1994 in seiner Abhandlung Die Wiederkehr der Bilder
den Terminus zum ›iconic turn‹, mit dem er auch die Forderung nach einer methodisch ad-
äquaten Bildwissenschaft im Umgang mit der Allgegenwärtigkeit des Bildes in jeglichen Me-
dien verband. Zu den Entwürfen einer fächerübergreifenden Bildwissenschaft vgl. Maar u.
Burda: Iconic Turn.
F4717-Antonsen.indd 32 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»GEISTLICHE DÄMMERUNG« 33
ren Fragestellungen, die sich nicht zuletzt im selben Maße wandelten, wie sich Li-
teratur selbst verändert. Doch ist offenbar das Bedürfnis nach umfassenderer kon-
textueller und interdisziplinärer Verknüpfung in jüngster Zeit gewachsen. Davon
zeugt bereits das zunehmende Interesse an der Einrichtung oder Ausweitung des
Faches Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an den Universitäten,
das explizit den kulturellen Kontext zum »tragenden Konzept des Faches«4 erklärt.
Die verkürzend auch Komparatistik genannte Disziplin will dabei nicht nur die in
der Literatur realiter kaum bestehenden Grenzen der Nationalphilologien – auch
über den europäischen Kulturbereich hinaus – überwinden, sondern setzt ebenso
auf eine Homogenisierung der wissenschaftstheoretischen Grundlagen in den Lite-
raturwissenschaften wie auf den Dialog mit den anderen Kunstgattungen und Wis-
senschaften.
Wenn dagegen allgemein die ›Medien‹5 zum Forschungsgegenstand werden,
dann rückt ein weiterer Indikator für das Bestreben nach fächerübergreifender Ver-
netzung ins Blickfeld: Seit den 1990er Jahren steht zum Beispiel der Begriff ›Inter-
medialität‹ hoch im wissenschaftlichen Kurs.6 Gegenüber dem bereits seit dem
Ende der 1960er Jahre verwendeten Terminus der ›Intertextualität‹ verbindet sich
mit diesem neuen »Integrationsbegriff«7 ein »umfassenderes Konzept«8, in dem
nicht mehr nur innerhalb eines Mediums die Beziehungen zwischen Texten und
den Prätexten bzw. Prätextgruppen, sondern die »in einem Artefakt nachweisliche
Verwendung oder Einbeziehung wenigstens zweier konventionell als distinkt ange-
sehener Ausdrucks- oder Kommunikationsmedien«9 untersucht werden. Damit
will man sowohl den aktuellen Tendenzen zur Medienmischung oder -kombinati-
on wie der multimedial vermittelten Realitätswahrnehmung mehr Beachtung
schenken. Die vielfach diskutierte Problematik eines übergeordneten Rahmenkon-
zepts zur Zusammenführung der disparaten Einzeldisziplinen, das auf einem hete-
rogene Phänomene bezeichnenden und daher höchst unterschiedlich definierten
Medienbegriff beruht, verschärft sich noch einmal bei dem derzeit verbreiteten
Versuch einer Neuordnung der ›Geisteswissenschaften‹ unter dem Dach der
4 Corbineau-Hoffmann: Einführung in die Komparatistik, S. 7.
5 Als »kleinste[n] gemeinsame[n] Nenner« für den Medienbegriff in den verschiedenen wis-
senschaftlichen Disziplinen bezeichnet Gerd Hallenberger »die potentiell massenhafte Ver-
breitung von Botschaften verschiedenster Art unter Verwendung von Zeichensystemen und
spezifischen Übermittlungstechnologien« (Hallenberger: Art. Medien. In: Reallexikon, Bd. II,
S. 551–554, hier: S. 551).
6 Es existieren natürlich auch Vorbehalte gegen ein solches weiteres Schlagwort. So verzeichnet
das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft keinen eigenen Artikel zu diesem Begriff,
sondern verweist nur innerhalb des Artikels zur ›Intertextualität‹ auf dessen Existenz (Ulrich
Broich: Art. Intertextualität. In: Reallexikon, Bd. II, S. 177). Zu den Chancen intermedialer
Forschung vgl. Helbig: Intermedialität; Rejewski: Intermedialität; Wolf: Intermedialität.
7 Helbig: Intermedialität, S. 8.
8 Wolf: Intermedialität, S. 166.
9 Wolf: Art. Intermedialität, S. 238; Rajewski: Intermedialität, S. 1.
F4717-Antonsen.indd 33 03.12.2008 11:04:55 Uhr
34 MARIA-CHRISTINA BOERNER
›Kultur‹.10 Mit dem Zauberwort ›Kulturwissenschaften‹, das zunächst an die um
1900 entstandenen kulturwissenschaftlichen Überlegungen von Ernst Cassirer,
Georg Simmel, Aby Warburg, Max Weber und anderen anknüpft, sollen neuere
Ansätze von der Systemtheorie über die Mentalitäts- und kollektive Gedächtnisfor-
schung bis hin zur Medienwissenschaft und ethnologischen Kulturanthropologie
in ein koordiniertes Wissenschaftsgebilde verwandelt werden. Mieke Bal hat hierzu
betont, dass dies nicht zum dogmatischen Totalitarismus einer Superdisziplin mit
universalem Geltungsanspruch führen müsse, sondern damit eher eine die jeweili-
gen Kompetenzen der verschiedenen Ansätze nutzende Interdisziplin zu schaffen
sei.11 Dabei können die Literaturwissenschaften ihre Kompetenzen besonders dann
einbringen, wenn Kultur – auch, aber eben nicht ausschließlich – als ›Text‹ begrif-
fen wird12 und kulturelle Gegenstände als symbolische oder ikonisch bezeichnete
Objekte einer analysierenden Lektüre13 unterzogen werden. Ob diese Suche nach
einer übergreifenden, das Einzelne und Widersprüchliche integrierenden Perspek-
tive tatsächlich zu einem »cultural turn« führt, wie bereits zu vernehmen ist14, hängt
nicht zuletzt von der Bereitschaft der einzelnen Wissenschaftler ab, einen effektiv
fächerübergreifenden Dialog zu führen.
Stefan Bodo Würffel, der mit dieser Festschrift geehrt werden soll, hat stets ein
besonderes Augenmerk auf diesen Dialog mit den Vertretern der unterschiedlichen
Disziplinen gelegt. Auch seine wissenschaftlichen Arbeiten etwa zur Literatur und
Geschichte, insbesondere zu Nation und Nationalismus in der deutschsprachigen
Literatur, zum Hörspiel als einer Literaturgattung, die mit vielfältigen akustischen
Mitteln operiert, oder zu verschiedenen Aspekten der Verbindung von Literatur
und Musik bei Mahler, Zemlinsky Wagner u. a. belegen sein Interesse an fächer-
übergreifenden Zusammenhängen. In diesem Sinne, so hoffe ich, knüpfen die fol-
genden Überlegungen zur Lyrik Georg Trakls und zur expressionistischen Malerei
auf dem Weg in die Abstraktion an diese Vermittlungsarbeit an.
10 »Kultur als der von Menschen erzeugte Gesamtkomplex von kollektiven Sinnkonstruktio-
nen, Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen« (Ansgar Nünning: Art.
Kulturwissenschaften. In: ders.: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 299–302,
hier: S. 301). Zur Frage einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft
z. B. Böhme u. Scherpe: Literatur und Kulturwissenschaften; Engel: Kulturwissenschaften.
11 Mieke Bal plädiert – auch in Abgrenzung zu den ›cultural studies‹ mit ihrer marxistisch ge-
prägten Gesellschaftstheorie – für eine »Kulturanalyse« innerhalb eines Fächerkanons, für
den ›Kulturwissenschaften‹ den Rahmen als theoretisch fundierte, aber nicht dogmatisch
einengende Interdisziplin bieten und »Begriffe, Intersubjektivität und kulturelle Prozesse« im
Mittelpunkt stehen (Bal: Kulturanalyse, S. 7–27).
12 Nach Bachmann-Medick handelt es sich dabei um »ein Verständnis der Textvermitteltheit
von Kulturen ebenso wie von kulturellen Implikationen literarischer Texte« (Kultur als Text,
S. 45). Die Kritik etwa von Seiten der Kunstgeschichte an einer textdominierten Kulturwis-
senschaft, welche die »epistemische Kraft der Bildlichkeit« verkenne (Krämer u. Bredekamp:
Bild – Schrift – Zahl, S. 12), ist berechtigt, sollte aber nicht zu einem neuerlichen Konkur-
renzkampf um die Vorherrschaft eines Wissenschaftsparadigmas führen.
13 Bal: Kulturanalyse, S. 23.
14 So Turk: Philologische Grenzgänge, Bachmann-Medick: Cultural Turns.
F4717-Antonsen.indd 34 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»GEISTLICHE DÄMMERUNG« 35
II.
Jenseits der derzeit wieder eingehend geführten Diskussion, ob die westliche Welt
sich angesichts einer kaum zu leugnenden Renaissance des Religiösen von der lieb-
gewordenen Vorstellung einer Einheit von moderner Gesellschaft und Säkularisie-
rung15 verabschieden sollte, besteht immerhin ein allgemeiner Konsens in der Auf-
fassung, dass die christliche Religion zumindest historisch gesehen zu den grundle-
genden Bestandteilen der abendländischen Kultur gehört. Es sollte sich also gerade
für eine kulturwissenschaftlich orientierte Literaturwissenschaft lohnen, den poeti-
schen Auseinandersetzungen mit der religiösen Überlieferung nachzugehen. Be-
sonderes Interesse verdient diese Thematik nicht nur in Perioden offensichtlichen
Zusammenwirkens von religiösen und literarischen Entwürfen wie im Barock oder
in der romantischen Kunstreligion, sondern auch in Phasen des Umbruchs, wie er
gerade für die Zeit um 1900 festzustellen ist. Denn der tradierte kulturelle und
metaphysische Bezugsrahmen des Christentums wird zur Jahrhundertwende nach-
drücklich in Frage gestellt, weil die Naturwissenschaften mit ihren kausalistischen
und mechanistischen Denkmodellen zur dominierenden Weltanschauung avancie-
ren. Aber auch die historisch-kritische Bibelforschung des 19. Jahrhunderts lässt
vom messianischen Erlöser nur mehr gerade den geschichtlichen Zimmermanns-
sohn aus Galiläa übrig und deutet alles Göttliche als mythische Überhöhung be-
reits von Christi Zeitgenossen. Schließlich wird seitens der Philosophie der christli-
chen Religion ein weiterer schwerer Schlag versetzt, als Friedrich Nietzsche der bib-
lischen Erzählung vom »Tod Gottes«16 auf geradezu paradox anmutende Weise eine
neue, atheistische Bedeutung gibt, welche die Annahme einer Existenz Gottes ver-
abschiedet und damit die Theologiekritik des 19. Jahrhunderts von Feuerbach bis
Schopenhauer effektvoll zu einem Ende führt. Darüber hinaus entfaltet Nietzsches
subversive Kritik am Christentum17 als einer lebens- und weltverneinenden Lehre
zur Jahrhundertwende eine fast schon ebenso allgemeine Wirkung, wie zuvor Jahr-
hunderte lang die christlichen Dogmen für die Darstellung (und Darstellbarkeit)
Gottes und seines Sohnes in der Kunst verbindlich waren. Alle diese hier mit gebo-
tener Knappheit skizzierten Veränderungen spiegeln sich in der künstlerischen Pro-
duktion zu Beginn der Moderne, da Künstler wie Autoren sich vom ›Ballast‹ der
tradierten Aufgaben und Darstellungsmuster befreit sehen, was ihnen zugleich eine
Neuorientierung ermöglicht und abverlangt, in der nicht nur neue Sujets entwi-
ckelt werden, sondern gerade auch kulturell überlieferte Stoffe hinterfragt, trans-
formiert oder sichtbar zerstört werden. In neueren historischen Studien geht man
deshalb zwar für die Jahrhundertwende von einer Krise des überkommenen Kir-
15 Säkularisierung als historischer und religionssoziologischer Begriff, der den Wandel von reli-
giös geprägten Organisationsformen, Begriffen usw. sowie den Bedeutungsschwund von Re-
ligion in den europäischen und nordamerikanischen Gesellschaften zusammenfasst.
16 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. In: Kritische Studienausgabe, Bd. 3, S. 481.
17 Vor allem in seiner polemischen Schrift Der Antichrist. In: Kritische Studienausgabe, Bd. 6,
S. 165–254.
F4717-Antonsen.indd 35 03.12.2008 11:04:55 Uhr
36 MARIA-CHRISTINA BOERNER
chenglaubens aus, die als ›Entkirchlichung‹ und ›Dechristianisierung‹18 wissen-
schaftlich beschrieben wird. Gleichwohl gehört Religion – nicht nur in ihrer christ-
lichen Ausprägung19 – zu den zentralen Themen öffentlicher kulturpolitischer Dis-
kurse, in »zivilisationskritischen wie kulturreformerischen Debatten«20. Ebenso
wenig verschwinden auch religiöse Themen aus Literatur und Kunst im Fin de
Siècle, ja sie behaupten ihren Platz sogar in den sich selbst als Avantgarde definie-
renden Gruppierungen. Denn der umfassende Anspruch der Moderne um 1900
innovativ zu wirken, bezieht sich nicht nur prospektiv auf eine Kunst der Zukunft,
sondern ebenso retrospektiv auf das Tradierte als Teil einer kulturellen Identität,
die eine Auseinandersetzung mit den überlieferten Stoffen und Motiven erfor-
derlich macht. Dies hat der so kämpferisch verkündete Bruch der Avantgarde mit
dem Überlieferten vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten lassen. In den letz-
ten Jahren gelangte jedenfalls das enge und produktive Verhältnis zwischen der äs-
thetischen Moderne der Jahrhundertwende und den verschiedenen Formen des
Religiösen christlicher, mystischer, aber auch okkultistischer und esoterischer Aus-
prägung verstärkt ins Blickfeld literaturwissenschaftlicher und kunsthistorischer
Forschung.21 Steht auch im Folgenden das schöpferische Potential der (Re-) Akti-
vierung des religiösen Erbes im Fokus des Interesses, soll damit die Kehrseite, näm-
lich ihre ebenfalls vorhandenen regressiven und antirationalen Züge, keineswegs
geleugnet werden.
Wie zentral religiöse Vorstellungen gerade für expressionistische Künstler waren,
ist bereits von den Zeitgenossen konstatiert worden. So hält Eckart von Sydow in
den Neuen Blättern für Kunst und Dichtung 1918/19 fest:
Die geistige Revolution Mittel-Europas, welche den Namen des ›Expressionis-
mus‹ führt, scheint auch die religiösen Tendenzen wieder neu erkräftigen zu wol-
len. Es ist dies ganz besonders überraschend; denn: hatte nicht Nietzsche als
größtes Verdienst dies gewonnen, daß er den Gott getötet hatte. Und nun regen
sich, zum mindesten in den verschiedenen Bekenntnissen expressionistischer
Führer, ›atavistische‹ religiöse Neigungen in ganz unzweideutiger Art.22
Dementsprechend ist in der Forschung der manifeste Rückgriff auf die Bibel und
christliche Themen im Expressionismus zu Recht hervorgehoben worden.23 Die
18 Lehmann: Erforschung der Säkularisierung, S. 13.
19 Zum verbreiteten Phänomen der ›Neomystik‹ um 1900, das verschiedene Formen der Trans-
zendenzerfahrung auch abseits christlicher Traditionen umfasst, vgl. Spörl: Gottlose Mystik,
sowie Baßler u. Châtelier: Mystique, mysticisme et modernité.
20 Graf: Alter Geist und neuer Mensch, S. 186.
21 Vgl. dazu Tuchmann u. Freemann: Das Geistige in der Kunst; Kat. Okkultismus und Avantgar-
de; Gruber: Erfahrung und System; Braungart, Fuchs u. Koch: Ästhetische und religiöse Erfah-
rungen.
22 Von Sydow: Das religiöse Bewußtsein des Expressionismus. In: Best: Theorie des Expressionismus,
S. 98–104, hier: S. 98.
23 Dies gilt nicht nur für den so genannten ›messianischen Expressionismus‹ (Vietta u. Kemper:
Expressionismus, S. 186–204), sondern auch für andere expressionistische Autoren und bil-
F4717-Antonsen.indd 36 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»GEISTLICHE DÄMMERUNG« 37
Wirkung von Nietzsches radikaler Kritik an der Metaphysik, dem Christentum
und der Institution Kirche ist allerdings bei vielen expressionistischen Autoren
ebenso unverkennbar. Auch bei Georg Trakl, dessen Zugehörigkeit zum Expressio-
nismus freilich kontrovers beurteilt wird, finden sich gerade im Frühwerk Beispiele
für eine mit Nietzsches Polemik konform gehende Entlarvung der Kirche, die als
»tote« Institution vergeblich in »seelenlosem Spiel mit Brot und Wein«24 die Aufer-
stehung Christi predigt. Nach Eduard Lachmann, der diesen kritischen Ansatz
Trakls ignorierte und stattdessen seine gesamte Dichtung als Ausdruck einer »christ-
lichen Heilswahrheit«25 in gottferner Zeit deutete, hat es nur vereinzelt Versuche
gegeben, den religiösen Bezügen nachzugehen. So hat zwar Alfred Doppler in ei-
nem kurzen Aufsatz von 1987 die »Elemente der Bibelsprache« in Trakls Gedichten
untersucht und betont, dass »etwa von 1912 an […] die Bibel zur Quelle für eine
poetische Mitteilung [wird], in der sich das Religiöse nicht direkt ausspricht, aber
in der Struktur der Gedichte anwesend ist.«26 Doch wurden seine Überlegungen
eher selten aufgegriffen, obwohl bereits die Titel mehrerer Gedichte in Trakls
schmalem Werk wie Psalm bzw. De profundis, Passion, Geistliches Lied und der klei-
ne dreiteilige Zyklus Rosenkranzlieder unverkennbar einen religiösen Ton oder Ge-
halt evozieren, ohne dass allerdings die Texte die so geschürten Erwartungen als
christliche Poesie erfüllten. Denn sie verweigern sich nachdrücklich den überliefer-
ten Formen religiöser Sprechweisen (etwa als Psalm, Hymnus oder Gebet) und
werden deshalb in der Forschung zumeist als poetischer Ausdruck für den Verlust
metaphysischen Sinns oder christlicher Heilsgewissheit gedeutet27, womit sich
Trakl in den Chor expressionistischer Stimmen zur ›leeren Transzendenz‹28 einrei-
hen würde. Gerade seinem Gedicht Psalm I29 kommt dabei eine besondere Bedeu-
tung zu, weil Trakl nach einhelliger Forschungsauffassung mit der 1912 im Brenner
abgedruckten und Karl Kraus gewidmeten zweiten Fassung zu seinem eigenen un-
dende Künstler und verstärkt für jüdische Intellektuelle. Hierzu z. B. Châtelier: Revolution
aus mystischer Gesinnung?; Kat. Zeichen des Glaubens; Kat. München leuchtete; Horch: Expres-
sionismus und Judentum; Ulmer: Passion und Apokalypse.
24 Trakl: Die tote Kirche. In: Dichtungen und Briefe, Bd. 1, S. 256.
25 Lachmann: Kreuz und Abend, S. 10.
26 Doppler: Elemente der Bibelsprache, S. 83. Der »paradiesische Mensch, der Sündenfall, die Pas-
sion, die Ankündigung der Endzeit und des Gerichts« sind die von Doppler aufgeführten bi-
blischen Themen in Trakls Lyrik (ebd.). Weniger überzeugend, da nicht zwingend nur auf den
biblischen Prätext zurückzuführen, ist seine Liste der »häufigsten verwendeten Hauptworte«,
darunter so allgemein gebräuchliche wie »Abend, Nacht, Finsternis, Baum und Strauch« u. a.
(S. 84). Vgl. auch die Einwände von Anette Hammer, die selbst anhand zweier Gedichte die
intertextuellen Bezüge zur Bibel näher untersucht (Lyrikinterpretation und Intertextualität,
S. 92ff.). Als Beispiele für Einzelanalysen zur religiösen (christlichen) Motivik bei Trakl z. B.
Böschenstein: Arkadien und Golgatha; Kaiser: Christus im Spiegel, S. 124–141.
27 Vgl. z. B. Kaiser zu dem Nachlass-Gedicht Psalm II: »Trakls Gedicht ist ein Gegenpsalm«
(Christus im Spiegel, S. 125).
28 Vgl. Vietta: Lyrik des Expressionismus, S. 155–157, und die dort abgedruckten Gedichte
(S. 158–179).
29 Trakl: Psalm I, 2. Fassung (1912). In: Dichtungen und Briefe, Bd. 1, S. 55–56.
F4717-Antonsen.indd 37 03.12.2008 11:04:55 Uhr
38 MARIA-CHRISTINA BOERNER
verwechselbaren Ausdruck gefunden hatte. Über das ganze Gedicht verteilen sich
eindeutig biblische oder religiöse Bezugswörter wie »verlorenes Paradies«, »Novi-
zen«, »Kreuzgang«, »heilige[n] Legenden«, »Kirche« »Engel«, »Schatten der Ver-
dammten«, »Schädelstätte«, »Gottes goldene Augen« und rufen zusammen mit erst
in diesem semantischen Umfeld ebenfalls religiös deutbaren Wörtern wie »Licht«,
»Weinberg«, »Garten […] im Abend«, »Gold des Himmels« sowohl christliche My-
thologeme vom Sündenfall, von Schuld, Verdammnis und Christi Passion als auch
Formen und Orte christlicher Praxis in Erinnerung. Sie bilden damit einerseits eine
durchgehende, Sinn suggerierende Motiv-Kette für das komplexe Gebilde des Ge-
dichts, in dem sich außerdem noch Anklänge an antike Mythologie (Nymphen,
»Sohn des Pan«) und an Arthur Rimbauds Prosadichtung Une saison en enfer mit
Hinweisen auf die alltägliche Gegenwart (mit dem »glühenden Asphalt«, »den
Fenstern des Spitals« und den »Kinder[n] des Hausmeisters«) mischen.30 Aber die
Glieder dieser Kette bleiben andererseits innerhalb des Gedichts narrativ unver-
knüpft in ihrer Vereinzelung bestehen. Sie fügen sich jedenfalls nicht zu einem ein-
heitlichen Sinnganzen oder doch nur in einer allgemein-unbestimmten Bedeutung,
indem sie zu der übergreifenden Thematik des allgegenwärtigen Todes passen. Der
lange, von den übrigen Strophen isolierte Schlussvers »Schweigsam über der Schä-
delstätte öffnen sich Gottes goldene Augen«31 synthetisiert noch einmal die christ-
lichen Motive in einem abschließenden Bild, in dem der Opfertod Jesu auf Golga-
tha ebenso gegenwärtig ist wie ein anthropomorpher Gott, der in den biblischen
Klagepsalmen die dialogische Struktur gewissermaßen legitimierte, da einem ›Du‹
die Bedrängnisse des Gläubigen vorgetragen werden konnten. Doch macht hier das
alles durchdringende Schweigen Gottes eine solche Kommunikation sinnlos, und
im Gegensatz zu dem fast zeitgleichen, viele Parallelen aufweisenden De profundis
gibt es nicht einmal mehr ein Sprecher-Ich in diesem Psalm, das mit Gottes Abwe-
senheit, stellvertretend für den gottverlassenen modernen Menschen, hadern könn-
te. Gleichwohl bleibt der Schlusssatz bewusst ambivalent in seiner Bedeutung,
denn das Öffnen der Augen signalisiert nach dem Tod einen Neuanfang, dem die
Farbe Gold einen zusätzlichen Glanz verleiht. Eine Entscheidung darüber zu fällen,
ob Trakls Dichtung auf poetische Weise einen transzendenten oder religiösen Ge-
halt evoziert oder ob er das »Schweigen Gottes« (De profundis) mit seinen Folgen
für den ›heil-losen‹ Menschen der Moderne bis in die Struktur seiner Gedichte hin-
ein festhält und jegliche Hoffnung auf einen metaphysischen (nicht nur christli-
30 Rémy Colombat deutete dies als »grundlegende Antithese von Mythos und Gegenwart«
(Existenzkrise und »Illumination«, S. 69).
31 Trakl: Psalm I, 2. Fassung. In: Dichtungen und Briefe, Bd. 1, S. 56; dazu auch die Dokumen-
tation der verschiedenen Textstufen in der Innsbrucker Trakl-Ausgabe, Bd. II, S. 17–23. Ver-
gleichbar ist dies mit dem Schluss von Geistliche Dämmerung, 1. Fassung (Dichtungen und
Briefe, Bd. 1, S. 390).
F4717-Antonsen.indd 38 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»GEISTLICHE DÄMMERUNG« 39
chen) Sinn tilgt, heißt letztlich die kunstvolle Widersprüchlichkeit und Vieldeutig-
keit gegen die Komposition dieses Gedichts (und vieler anderer) aufzulösen.32
Einen Neuansatz für die Deutung tradierter religiöser Formen in moderner Ly-
rik bot Wolfgang Braungart mit seiner These von Literatur, insbesondere von zykli-
scher Dichtung als einem »dem Ritual ähnliche[n] Geschehen«, wobei er Zyklus
und Ritual als elementare kulturanthropologische Kategorien beschrieb.33 Braun-
gart bezog dies auf die auffällige zyklische Struktur und Anordnung von Trakls
Gedichten und arbeitete einige ihrer zahlreichen motivischen Anspielungen34 auf
Kult und Religiosität des Katholizismus heraus, die auch dem Protestanten Trakl in
seiner katholischen Heimatstadt Salzburg vertraut waren. Auch nach Braungarts
Schlussfolgerung handelt es sich jedoch bei Trakls Gedichten um eine »völlige De-
struktion jeder religiösen Sinngebung«, die ihre Wirkungskraft letztlich daraus
beziehe, dass »in der zyklischen Struktur die abgewiesene religiöse Welt des
›Orgelgeleier[s]‹ […] und ihre rituelle Ordnung des Lebens ästhetisch immer noch
anwesend«35 seien. In gewissem Gegensatz dazu steht die Auffassung von der
»poetische[n] Religiosität« in Trakls Gedichten, die sich etwa für Károly Csúri im
Verfahren der »Transparenz« manifestiert. Darunter versteht Csúri das gegenseitige
Durchdringen und Durchlässigwerden von getrennten »Sphären« (oder Motivbe-
reichen), um im »Sichtbaren die Zeichen einer unsichtbaren […] Welt transparent
zu machen«36.
Abgesehen von diesen anhaltenden Kontroversen zur Beurteilung des Religiösen
in Trakls Werk zeichnet sich nach übereinstimmender Forschungsmeinung seine
Dichtung dadurch aus, dass sie dem logisch orientierten Lektüre-Verständnis größ-
te Schwierigkeiten bereitet, indem ihre elliptische und asyndetische Syntax, ihre
verschlüsselte Bildlichkeit und ihre befremdliche Anordnung von narrativen Ein-
zelmotiven beständig gegen Kohärenzgebote verstoßen. Aber gerade die rätselhafte
Mehrdeutigkeit und das Unverständliche seiner Verse oder Prosatexte sind auch das
Ergebnis eines sorgfältigen Kompositionsprozesses, wie die erhaltenen Textstufen
vieler Gedichte belegen. Sie erwecken dabei immer wieder den Eindruck »höchste[r]
Bedeutsamkeit«37, als wären in ihnen begrifflich nicht fassbare, eben transzendente
Sinnschichten verborgen, was sicherlich den Anreiz zu ihrer Bergung erhöht.
Ein ähnliches Verfahren lässt sich auch in der zeitgenössischen bildenden Kunst
beobachten; verschiedentlich wurde bereits auf Analogien zur expressionistischen
32 So betonte Kemper kürzlich die spezifische Form der »Verweigerung einer eindeutigen Bot-
schaft« bei Trakl, welche »die Frage nach der Beziehung zu Gott und Religion neu zu stellen«
zwingt, zugleich aber für den christlichen Trost Suchenden keine Antwort bereit hält (Zwi-
schen Dionysos und dem Gekreuzigten, S. 169).
33 Braungart: Zur Poetik literarischer Zyklen, S. 20.
34 Z. B. in der häufig wiederkehrenden Formel von ›Brot und Wein‹ mit ihrem unverkennbaren
Bezug zur Eucharistie-Feier (ebd., S. 22).
35 Braungart: Zur Poetik literarischer Zyklen, S. 27.
36 Csúri: Zur poetischen Religiosität, S. 116.
37 Baßler: Verwandlung des Bösen, S. 29, vgl. auch ders.: Entdeckung der Textur; zur Unverständ-
lichkeit als Merkmal moderner Lyrik auch Wunberg: Jahrhundertwende, S. 6–54.
F4717-Antonsen.indd 39 03.12.2008 11:04:55 Uhr
40 MARIA-CHRISTINA BOERNER
Künstlergruppe Der Blaue Reiter aufmerksam gemacht. So verglich Petra Renkel38
Trakls Wende von der mimetischen Referenzfunktion der Sprache hin zu einer die
klanglichen und rhythmischen Werte des einzelnen Wortes verabsolutierenden
Kompositionsweise mit den Prinzipien der abstrakten Malerei, wie sie eine der
Leitfiguren des Expressionismus, Wassily Kandinsky, in den Jahren zwischen 1910
und 1912 in München entwickelte. Als Kandinsky, ursprünglich Jurist aus Mos-
kau, mit ebenso messianischer Emphase wie terminologischer Unschärfe in seiner
einflussreichen Schrift Über das Geistige in der Kunst (1912) eine Malerei propa-
gierte, die Farbe, Form und Linie von ihren Abbildfunktionen und ihrer Bindung
an den Gegenstand befreit, wollte er das alle Künste (Malerei, Musik, Literatur,
Theater und Tanz) verbindende ›Geistige‹ erfahrbar machen und eine nachhaltige
psychische Wirkung beim Rezipienten erzielen.39 Mit seiner Vorstellung von einer
Malerei der entmaterialisierten Farbe und Form bezog sich Kandinsky auch auf
mystisches, theosophisches und okkultes Gedankengut, das zur Jahrhundertwende
Hochkonjunktur hatte und nicht nur die innere menschliche Erfahrungswelt wie-
der in den Vordergrund rückte, sondern den verborgenen Erscheinungsformen des
Spirituellen ein neues Gewicht verlieh.40 Er schloss zugleich an antinaturalistische
Tendenzen des Fin de Siècle wie den Symbolismus und Futurismus an, richtete sich
dabei aber ausdrücklich gegen die Folgen von Ästhetizismus und ›l’art pour l’art‹ als
einer »zweckberaubten, materialistischen Kunst«41, die er als Zeichen eines allge-
meinen geistigen Niedergangs deutete, zu dem der gegenwärtige Materialismus
und Atheismus geführt hätten.
Angesichts dieser Kontexte kann es nicht verwundern, dass einer der Wege, die
Kandinsky in der Entwicklung zur abstrakten Malerei beschreitet, bei aller revolu-
tionären Kunstprogrammatik auch über religiöse Traditionen führt, vor allem in
ihrer Ausprägung als russische Ikonenmalerei und bayerische Hinterglasmalerei. In
den zwischen 1910 und 1914 entstandenen Bildern entwickelt er seine abstrakten
Kompositionen42, indem er zumeist von einem konkreten Ausgangspunkt ausgeht,
der nicht zuletzt das Abgleiten ins nur Dekorativ-Ornamentale als eine falsche, weil
bedeutungslose Abstraktion verhindern soll. Neben Landschaften, auf denen zu-
nächst noch gegenständliche Relikte wie Berge, Kirchtürme oder Reiter zu entde-
cken sind, finden sich ebenso Werke mit biblischen Themen wie Sintflut, Trompe-
38 Vgl. Renkel: »Das Wort ist innerer Klang«; vgl. auch Mönig: Franz Marc und Georg Trakl.
39 Vgl. Kandinsky: »Der Künstler ist die Hand, die durch diese oder jene Taste [z. B. durch
Farbe] zweckmäßig die menschliche Seele in Vibration bringt« (Über das Geistige in der Kunst,
S. 64). Zur theosophischen Vorstellung der Vibration vgl. Ringbom: Kandinsky und das Ok-
kulte, S. 98f.
40 Kandinsky selbst beruft sich auf die Theosophie von H. P. Blawatzky (Über das Geistige in der
Kunst, S. 42), daneben spielt auch Rudolph Steiner eine Rolle. Dazu Ringbom: Kandinsky
und das Okkulte; Washton Long: Expressionismus, Abstraktion; Ackermann: Eine Sprache.
41 Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst, S. 25–26, Zitat S. 26; S. 31, u. S. 36.
42 Zur Unterscheidung von »Impression« (Eindruck der »äußeren Natur)«, »Improvisation«
(innere Eindrücke) und »Komposition« (sorgfältig erarbeitete und absichtlich gestaltete
Empfindungen) vgl. Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst, S. 142.
F4717-Antonsen.indd 40 03.12.2008 11:04:55 Uhr
»GEISTLICHE DÄMMERUNG« 41
tenklang bzw. Auferstehung, Jüngstes Gericht, Paradies, Der hl. Gabriel und Allerheili-
gen, auf denen sich zum Beispiel Engel mit Posaunen, Heilige mit Aureolen (bzw.
Geistmenschen mit Auren nach theosophischem Verständnis), das erste Menschen-
paar mit dem Apfel und andere vertraute Gestalten der christlichen Ikonographie
von den abstrakten Formen und Farben abheben. Es ist aber gerade diese Vertraut-
heit mit den überlieferten Darstellungen, die das geübte Auge des Betrachters etwas
erkennen lässt, auch wenn die Bild-Figuren in stark reduzierter Form erscheinen.
Ebenso wählt Kandinsky für die beiden wichtigsten Programmschriften dieser Jah-
re christliche Motive: Der über den Drachen siegende hl. Georg ziert als Blauer
Reiter den gleichnamigen Almanach der Künstlergruppe, und der Ritterheilige rei-
tet auch vor den einstürzenden Mauern einer Stadt auf dem Umschlag der Schrift
Über das Geistige in der Kunst. Besonders die hier anklingende Thematik des na-
henden Untergangs aus der Tradition apokalyptischer Literatur jüdischer und
christlicher Provenienz gehört im deutschen Frühexpressionismus bereits vor dem
1. Weltkrieg zum festen Repertoire von Literatur und Malerei, in dem einerseits
die beabsichtigte Zerstörung der bürgerlichen Welt mit ihrer überlebten Kunst
und andererseits die Utopie vom ›Neuen Menschen‹, der den ästhetischen wie
gesellschaftlichen Neubeginn herbeiführen soll, ihren ebenso programmatischen
wie eschatologisch-pathetischen Ausdruck finden.43 Daneben fließen Elemente aus
der russischen religiösen Kunsttradition und zeitgenössischen philosophisch-litera-
rischen Diskussion ein, wie jüngst Noemi Smolik hervorgehoben hat.44 Insbeson-
dere nutzt Kandinsky mit seiner Titelwahl die assoziative Kraft dieser im orthodo-
xen wie westlichen Christentum vertrauten Begriffe: Ihr »innerer Klang« dient ihm
zur Vermittlung des geistigen bzw. eben auch metaphysischen Gehalts, den ein
Wort wie ›Sintflut‹ wohl eher transportieren kann als Begriffe wie ›Wasser‹ oder
›Überschwemmung‹.45 Solange Kandinsky derartige, die Tradition biblischer His-
torienmalerei aufgreifende Titel zur Bestimmung seiner Bilder beibehält, wahrt er
auch den Rest von Bedeutung, den das Wort gegenüber der Farbe, Linie oder dem
musikalischen Ton immer noch besitzt, wenn es nicht als reine Aneinanderreihung
von Buchstaben zum Beispiel lautmalerisch oder als Nonsens-Produkt eingesetzt
wird.46 Er nutzt diese Eigenschaft des Wortes dazu, dem Betrachter seiner Werke,
der sich erst allmählich an die neue, ebenso gegenstands- wie begriffslose Aus-
drucksweise der Abstraktion gewöhnen musste, einen Anhaltspunkt für den er-
43 Dazu Vondung: Die Apokalypse in Deutschland u. ders.: Mystik und Moderne.
44 Smolik: Auferstehung und kulturelle Erneuerung.
45 Seine Theorie zum »inneren Klang« erläutert er an der symbolistischen Poesie des Belgiers
Maurice Maeterlinck (Über das Geistige in der Kunst, S. 44–47). Zur Bedeutung von Bildti-
teln für die Rezeption von Gemälden vgl. Bruch: Der Bildtitel, S. 242–320.
46 In Kandinskys Bühnenkomposition Der gelbe Klang (1909), das sich am Modell der bibli-
schen Heilsgeschichten orientiert und im Schlussbild das Kreuzsymbol evoziert (S. 64), de-
monstriert z. B. eine »angsterfüllte Tenorstimme« den rein klanglichen Einsatz des Wortes:
sie schreit »undeutliche Worte« wie »Kalasimunafakola« (ebd., S. 60). Ab 1913 meidet der
Maler Bedeutung tragende Titel bzw. Untertitel, um nicht von der abstrakten ›Komposition‹
abzulenken (Zimmermann: Die Kunsttheorie von Wassily Kandinsky, Bd. 1, S. 388f.).
F4717-Antonsen.indd 41 03.12.2008 11:04:55 Uhr
42 MARIA-CHRISTINA BOERNER
strebten ›geistigen‹ Sinngehalt zu bieten. Dem entspricht der eigene Arbeitsprozess
einer schrittweisen Auflösung des Bildgegenstandes, wobei die Studien in der Regel
die Motive deutlicher erkennen lassen als die ausgeführten Ölbilder.47 In ähnlicher
Weise enthalten auch Trakls Entwürfe zumeist christliche Motive oder Motivzu-
sammenhänge in höherem Maße und leichter erkennbar als in den ›endgültigen‹
Texten.48 Der zunehmende Abbau übergreifender semantischer Zusammenhänge
führt aber nicht zur vollkommenen Ablehnung von Sinn oder Bedeutung. Es lässt
Trakl vielmehr einen größeren Freiraum, um das einzelne, insbesondere das kultu-
rell vermittelte Wort so einzusetzen, dass es beim Leser Assoziationen weckt, die
zum Beispiel auf Erinnerungen an biblische Erzählmotive basieren. Zugleich kann
er das Vertraute aber in neue, verstörende Kontexte stellen.
Kandinskys Vorgehensweise ist keine singuläre Erscheinung, denn auch bei dem
1853 in Olmütz (Mähren) geborenen und seit 1905 an der Stuttgarter Akademie
lehrenden Adolf Hölzel lassen sich, vielleicht noch deutlicher, Parallelen erkennen.
Hölzels erstes weitgehend abstrakt-experimentelles Bild ist die Komposition in Rot I,
die bereits 1905 entstand, vom Künstler aber erst 1916 der Öffentlichkeit präsen-
tiert wurde. Als Pionier der abstrakten Malerei, die er ab 1907/08 stetig weiterent-
wickelte, hielt Hölzel ausdauernder als Kandinsky an gegenständlichen bzw. figür-
lichen Reminiszenzen fest, wobei wiederum die anhaltende Präsenz religiöser Mo-
tive und Bildtitel wie Prozession, Wallfahrt, Bilder zur Legende der Hl. Ursula,
Anbetung, Die Heilige Familie (bzw. Geburt) und Bergpredigt hervorsticht.49 Sein
vorrangiges Interesse galt dabei zunächst den thematisch bedingten vielfigurigen
Massenszenen, die er zu einem großen Farbkomplex zusammenfügte. Innerhalb
dieser kompakten Farbmassen heben sich die Einzelfiguren nur noch dank der hel-
len, das Inkarnat der Gesichter markierenden Farbtupfer bzw. aufgrund der farb-
lich abgesetzten Konturlinien andeutungsweise von einander ab. Die abstrahieren-
de, ganz auf Farbe und Form ausgerichtete Vereinheitlichung der Figuren ohne in-
dividualisierende Binnenzeichnung hat Hölzel aus zeitgenössischen künstlerischen
Verfahren bei den Nabis um Maurice Denis und in der Wiener Secession weiter-
entwickelt.50 Bei aller Abkehr von der mimetischen Darstellung erhält der Betrach-
ter jedoch über die Bildtitel, vertraute Kompositionsschemata sowie die Nimben
um die Köpfe der zu erahnenden Gestalten Hinweise auf die religiöse Bildtraditi-
on. Diese können auch ganz allgemein gehalten sein wie zum Beispiel bei dem
großformatigen Bild Biblisches Motiv (Farbige Komposition, Galerie der Stadt Stutt-
gart) von 1914, in dessen Zentrum sich eine Gruppe von Figuren in leuchtend ro-
47 Allein zur Komposition VII von 1913, deren thematischer Ausgangspunkt die Auferstehung
bzw. das Jüngste Gericht ist, existieren mindestens 21 Zeichnungen und 10 Ölstudien. Den
Abstraktionsprozess lässt Kandinsky sogar dokumentarisch in einer von Gabriele Münter
fotografierten Serie festhalten, vgl. Friedel: Das bunte Leben, S. 445.
48 Dasselbe gilt für biographische Details und oft auch für literarische Anspielungen oder Zita-
te.
49 Speziell in den Jahren 1909/10–1912 dominieren religiöse Themen, vgl. Venzmer: Adolf
Hölzel, S. 86–88, sie finden sich aber auch noch in den Werken der 20er Jahre.
50 Vgl. hierzu von Maur: Der verkannte Revolutionär, S. 58, zum Folgenden S. 81f.
F4717-Antonsen.indd 42 03.12.2008 11:04:56 Uhr
»GEISTLICHE DÄMMERUNG« 43
ten Gewändern mit gelben Heiligenscheinen befindet. Das Gemälde geht aus einer
Collage-Arbeit zum Thema Anbetung hervor, deren Eindruck einer aus farbigen
Papierfragmenten zusammengesetzten Komposition beim späteren Ölbild bewahrt
bleibt. Wie bei Kandinsky zeugen Hölzels Bilder von einer Reduktion der christli-
chen Thematik auf wenige sprachliche und malerische Signale, die sich zwar zu
keinem klaren Bildgegenstand fügen, es aber dennoch dem Betrachter ermögli-
chen, den abstrakten Farben und Formen eine ›geistige‹ Bedeutung zuzuordnen.
Insbesondere die Absicht, das kulturelle Bezugssystems der Bibel bzw. der christli-
chen Überlieferung zu aktivieren, spielt offensichtlich in der Übergangsphase der
modernen Kunst hin zur radikalen Abstraktion, in der es keine Erinnerung an die
gegenständliche oder eben kulturelle Bezugswelt mehr gibt, eine zentrale Rolle, was
wohl nicht einfach als Zitat eines verstaubten Bildungsgutes gedeutet werden kann.
Auch Trakls Gedichte mit ihrem bemerkenswert reduzierten Wort- und Motivre-
servoir partizipieren an diesen Entwicklungen in Kunst und Literatur, indem sie
mit anderen Werken der modernen Lyrik die Tendenz zur Unverständlichkeit tei-
len und Wörter und Metaphern so einsetzen, dass sie immer weniger direkt auf die
konkrete Erfahrungswelt zurückbezogen werden können. Gleichzeitig zeichnen sie
sich aber dadurch aus, dass sie dem Rezipienten besondere Angebote machen, aus
den verbleibenden Einzelteilen selbst Sinn herzustellen. Zu den Verfahren Trakls,
Bedeutung zu generieren bzw. zu evozieren, gehört neben Zyklus-Bildung, Zitaten
aus der europäischen Dichtung von Hölderlin bis Rimbaud, Wortwiederholungen,
Klang- und Rhythmusverbindungen eben auch der wirkungsvolle Einsatz jener
sparsam verteilten, aber markant gesetzten Signalwörter (besonders im Titel oder
am Ende eines Gedichts) aus der kulturellen Tradition der christlichen Religion.
Seiner Dichtung gelingt damit, was Derrida zum paradox anmutenden Merk-
mal von Literatur erklärte: »alles öffentlich auszusprechen« und zugleich »ein Ge-
heimnis zu wahren«51.
51 Derrida: Die unbedingte Universität, S. 14.
F4717-Antonsen.indd 43 03.12.2008 11:04:56 Uhr
F4717-Antonsen.indd 44 03.12.2008 11:04:56 Uhr
Bernhard Böschenstein (Genf )
AUTOBIOGRAFISCH BEGRÜNDETE KOMPARATISTISCHE
LITERATURWISSENSCHAFT. EINE SKIZZE
Der Titel dieser Festschrift lädt zu einer objektiven Definition und Begründung
ein. Ich möchte versuchen, über den Umweg einer subjektiven Darstellung eigener
literaturwissenschaftlicher Arbeit aus autobiografischer Perspektive zur vorgeschrie-
benen Fragestellung vorzustoßen. Dies entspricht dem Stadium eines vor zehn Jah-
ren aus der aktiven Lehrtätigkeit ausgeschiedenen Germanisten und Komparatis-
ten.
Es ist leichter zu erklären, wie man dazu kam, Literaturwissenschaft zu studie-
ren, als den Zweck dieses Studiums zu erläutern. Der Weg zum Literaturwissen-
schaftler impliziert keineswegs die Beantwortung der Fragen »was heißt und zu
welchem Ende studiert man Literaturwissenschaft?« Oft, und in meinem Fall war
es so, studiert man dieses Fach, ohne sich diese Fragen vorher beantwortet zu ha-
ben. Die eigene Biografie führte unwillkürlich dorthin. Nicht ohne Künstlichkeit,
nicht ohne sich einen Ruck zu geben, blickt man, am Ende einer literaturwissen-
schaftlichen Karriere, zurück und versucht zu definieren, was man geleistet hat und
wozu dies geschah.
Literaturwissenschaft war für mich stets eine textbezogene interpretatorische
Wissenschaft. Andere Zweige der Literaturwissenschaft haben mich stets weniger
angezogen:
Las ich in Literaturgeschichten, überkam mich meist ein Gefühl von Unwissen-
schaftlichkeit. Ich empfand Auswahl, Gewichtung, Perspektive der Einteilung des
Stoffes als willkürlich, parteiisch, unvollständig. Der erzählende Gestus war mir nie
selbstverständlich. Ich sah in ihm ein strategisches Behelfsmittel, um aneinander-
zufügen, was oft nur äußerlich zusammengehörte. Las ich psychoanalytisch fun-
dierte literaturwissenschaftliche Texte, erkannte ich in dem für die Interpretation
relevanten Aspekt des besprochenen Textes zwar wesentliche, aber zugleich doch
auch partielle Auffassungen, die mir, im Vergleich zu meiner Beziehung zum unter-
suchten Werk, zu einseitig vorkamen. Wenn ich mich mit Forschungsberichten zu
einem Autor befasste, überfiel mich oft der Eindruck großer Zeitbedingtheit und
wechselseitiger Abhängigkeit, die sich bis zur geistigen Unfreiheit zuspitzen konn-
ten. Ich verurteilte die von der Tyrannei des Zeitgeistes erzwungenen Fragestellun-
gen. Was wollte ich dem denn entgegenhalten?
Es war die skandalöse Freiheit des seinen eigenen Reaktionen vertrauenden Le-
sers, für den feststand, dass seine in ihm gegenwärtigen bisherigen Lektüren einen
Resonanzraum ermöglichen, der spezifische Fragen und Antworten zeitigen würde,
die für andere Leser nicht selbstverständlich waren. Davon Zeugnis abzulegen,
schien mir die mir zufallende Aufgabe zu sein.
F4717-Antonsen.indd 45 03.12.2008 11:04:56 Uhr
46 BERNHARD BÖSCHENSTEIN
Wie kam ich zu diesem Selbstvertrauen? Ich blickte zurück und stellte fest, dass
meine gymnasiale und universitäre Ausbildung sich um drei Literaturen konzent-
rierte, deren Zusammenklang mir als originelle und zukunftshaltige Möglichkeit
erschien. Diese drei Literaturen waren und sind immer noch für mich die deutsche,
die französische und die altgriechische Dichtung.
Gab es denn die Möglichkeit, diese drei Bereiche gleichzeitig zum Sprechen zu
bringen? In meiner Zürcher Dissertation Hölderlins Rheinhymne1 spielten Pindar
implizit als Vorbild für die Hymnenform und Rousseau als Gegenstand zweier
Strophen eine Hauptrolle. Dass ich einen Autor ausgewählt habe, dessen Gedichte
aus der Zeit seiner Reife durchgängig von antiken Dichtern geprägt sind, ist kein
Zufall gewesen. Dass in der ausgewählten Hymne Rousseau eine zentrale Rolle be-
hauptet, konnte ich ebenso mit meinen vorgängigen Lese-, Schul- und Universi-
tätserfahrungen in Verbindung bringen. Dass sich also diese beiden ›fremden‹ Lite-
raturen im Rhein stellenweise gemeinsam artikulieren, entsprach einem mir erst
viel später bewusst gewordenen Programm.
In Aufsätzen über Stefan George, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke
bevorzugte ich französische oder antikisierende Themen oder deren Zusammen-
spiel.2 In Goethes Natürlicher Tochter schienen mir Wilhelm von Humboldts Aga-
memnon von Aischylos3, Voltaires von Goethe übersetzte Dramen4 und Rousseau
als Erzieher5 gegenwärtig zu sein.
Das zentrale Beispiel war natürlich Hölderlin und seine Rezeption durch Stefan
George. Wie denn? Hölderlins Entdeckung um 1910 ist die Folge der Ausstrah-
lung des französischen Symbolismus auf die deutsche Dichtung. Außer George be-
zeugen auch Rilke und vor allem Trakl diese Konstellation.6 Der wiederentdeckte
Dichter ist durch seine Übersetzungen Pindars und Sophokles’ zu einer Dichtungs-
und Sprachform gelangt, deren Fremdheit, Neuheit, Originalität mit Forderungen
der symbolistischen und nachsymbolistischen Poetik zusammenhingen.
Dies sei genauer skizziert: Gegenüber der französischen Romantik verkörpern
Baudelaire, Mallarmé und Rimbaud eine von Sprachmagie und autonomer, poeto-
logisch reflektierter Inszenierung getragene Dichtung, die mit den von Hölderlin
übersetzten Dichtern der griechischen ›Klassik‹ die Sprachmächtigkeit und die Pri-
orität ›poetischer Logik‹ teilt. So jedenfalls ließ sich um 1910 die Antike, die Höl-
derlin übermittelte, rezipieren.
Meine Biografie hat mich zum Nachvollzug dieser Rezeption geführt. Dazu ge-
hörte das deutsch-französische Aufwachsen in Berlin und Paris und in einer zwei-
1 Böschenstein: Hölderlins Rheinhymne.
2 Vgl. Böschenstein: Von Morgen nach Abend, S. 93f., 101–103, 106–119, 144–164, 199–
215.
3 Vgl. Böschenstein: Die natürliche Tochter, S. 347.
4 Ebd., S. 350f.
5 Ebd., S. 351–353.
6 Dazu Böschenstein: Von Morgen nach Abend. Für die symbolistische Rezeption Trakls vgl.
S. 229–257, für die Hölderlin-Rezeption Georges S. 78–82 u. 104f., Rilkes S. 82ff., Trakls
S. 84–88 u. 229–257.
F4717-Antonsen.indd 46 03.12.2008 11:04:56 Uhr
AUTOBIOGRAFISCH BEGRÜNDETE KOMPARATISTIK 47
sprachigen Familie sowie die frühe freundschaftliche Beziehung zu Mitgliedern des
George-Kreises, denen sowohl die französischen Symbolisten wie die antiken Hym-
nen- und Tragödiendichter bedeutend waren. Das Gymnasium in Bern, die Uni-
versität in Paris und Zürich, die 34 Jahre währende Lehrtätigkeit in Genf waren wie
gesagt oft auf diese drei vielfach zusammenhängenden Literaturen konzentriert
und ergaben von selber eine komparatistische Ausrichtung.
Rückblickend ist nun die Frage zu stellen, was diese biografisch begründete
Konstellation den Lesern meiner Aufsätze bringen kann: Die durch die eben skiz-
zierte Konstellation bedingte Auswahl von Texten führte notwendig zur ›hohen‹
Dichtung und ließ zweitrangige Autoren weg. Ein ästhetisch motiviertes Auswahl-
prinzip verband sich mit Rezeptionszusammenhängen. Was sollte für den Leser
dabei herausspringen?
Zunächst die aus einer nationalsprachlichen Einseitigkeit herausführende Mög-
lichkeit, linguistisch und historisch differierende literarische Werke zueinander in
Verbindung zu bringen. Dann die Gelegenheit, die von mir geteilte Überzeugung
zu überprüfen, dass die durch alte und neuere Traditionen inzwischen ›kanonisier-
te‹ Dichtung auch wirklich den von ihr beanspruchten Rang zu behaupten verdien-
te. Im Einzelnen kam es mir darauf an, an den untersuchten Texten Beziehungen
zum Sprechen zu bringen, die nur dank der ungewohnten Zusammenstellung ver-
schiedener Texte aus verschiedenen Sprachen eine Konstellation freigaben, die
sonst unbeachtet geblieben wäre. Dies sei anhand von Beispielen vorgeführt. Ich
wähle den Weingott Dionysos.
In Hölderlins Werk stelle ich fest, dass er eine zentrale Rolle spielt. Die erste
pindarisierende Hymne Wie wenn am Feiertage … ist vom Anfang der Euripidei-
schen Bakchen inspiriert, den Hölderlin übersetzt hat.7 Die Ode Dichterberuf
nimmt andere Aspekte der Bakchen auf.8 Die Hymne Der Rhein vergleicht Rous-
seau mit dem »Weingott«9. Wie ist dies möglich?
Gegen Ende der Antigonä huldigt der Chor dem Dionysos. Hölderlin erwähnt
im Zusammenhang mit einer von der Französischen Revolution inspirierten ge-
schichtsphilosophischen und poetologischen Interpretation des Verlaufs der Anti-
gonä einen Vers aus dem Dionysos-Chor, der die revolutionäre Bedeutung offen-
bart, die er dem Weingott in politischer Hinsicht zuerkennt: »Werd’ offenbar!«10
Rilke dichtet in französischer Sprache halb hingegeben, halb kritisch abgewandt,
zwei Eros betitelte Dionysos-Gedichte in seinem Band Vergers.11 Trakl ruft in Un-
tergang (3. Fassung) das (von Dionysos inspirierte) »trunkene Saitenspiel«12 aus
Hölderlins Elegie Brot und Wein auf, gleichzeitig Vorstellungen von Rimbaud in
7 Zu diesem Bezug vgl. Böschenstein: ›Frucht des Gewitters‹, S. 72 u. 78–84.
8 Ebd., S. 83f.
9 Hölderlin: Der Rhein, Vers 145, Bd. I, S. 332.
10 Hölderlin: Antigonä, Vers 1199, Bd. II, S. 905, zitiert in griechischer Originalsprache S. 920
der Anmerkungen zur Antigonä.
11 Zu diesem Bezug vgl. Böschenstein: Von Morgen nach Abend, S. 208f.
12 Trakl: Untergang (3. Fassung), S. 388.
F4717-Antonsen.indd 47 03.12.2008 11:04:56 Uhr
48 BERNHARD BÖSCHENSTEIN
eine weichere Klanglichkeit übersetzend. Diese griechisch-französischen Verbin-
dungen in deutschen Dichtungen wären vielleicht einem nicht komparatistisch ge-
richteten Literaturwissenschaftler nicht aufgefallen.
Warum verteidige ich hartnäckig diese komparatistische Option? Hier hat mich
Hölderlins erster Brief an Böhlendorff geprägt. Dort steht: »das eigentliche natio-
nelle wird im Fortschritt der Bildung immer der geringere Vorzug werden.« Und
der anzustrebende »freie Gebrauch des Eigenen«13 werde erst über den Umweg des
Fremden gelingen. Dieses muss in den Umgang mit dem Eigenen eingehen. Dies
geschieht für mich nicht nur im primären literarischen Bereich, sondern auch im
sekundären. Von jeher haben mich literarische Werke fasziniert, denen dieser Um-
weg über das Fremde anzusehen war.
Was will ich mit diesen Beispielen zeigen? Ich vertraue auf eine auf eigene bio-
grafisch bedingte Erfahrungen gegründete Arbeit der Textinterpretation, die kraft
spezifischer Voraussetzungen einen eigenen Beitrag zur Erkenntnis großer abend-
ländischer Dichtung beisteuern kann. Diese sehr subjektive Begründung meiner
Tätigkeit sei keineswegs als exemplarisch angepriesen. Sie will nur eine Möglichkeit
literaturwissenschaftlicher Arbeit und eine Erläuterung eines möglichen Zwecks
dieser Arbeit darstellen. Sie ist sich genau der Einseitigkeit und der ›Parteilichkeit‹
dieser Position bewusst und sie täuscht sich nicht darüber, dass die meisten Kolle-
gen ganz andere Begründungen ihrer Arbeit vorlegen werden, deren Berechtigung
durchaus nicht angefochten werden soll. Denn nichts liegt mir ferner als methodi-
sche Intoleranz, Schulmeisterei, Tyrannei, diktatorisches, päpstliches Gebaren. Wo
immer ich solchen Haltungen begegnet bin, habe ich mich dagegen gestellt.
Diese Anmerkungen gehen von der Überzeugung aus, subjektiv begründete de-
tailreiche Konstellationen seien für die Literaturwissenschaft möglicherweise ergie-
biger als unpersönliche, scheinbar objektive Verfahrensweisen, die zwar auf allge-
meinen Konsens rechnen können, jedoch oft kreativer Entdeckungen ermangeln.
Was die Mehrheit der Leser für richtig hält, kann ebendeswegen zur Banalität ver-
kümmern. Literaturwissenschaft ist für mich immer mit Anstößen, mit Umwer-
tungen verbunden. Nicht betretene Pfade, mögen sie auch als abseitig oder esote-
risch verurteilt werden, sind in meinen Augen inspirierender als Bestätigungen
›gültiger‹ Befunde. Von meinen akademischen Lehrern blieben mir vor allem dieje-
nigen Vorlesungsstunden haften, die mich gänzlich überrascht und durch ihre
Fremdheit zum Nachdenken gezwungen haben. Ich liebte es, gegen den Strom zu
schwimmen.
Von Hölderlin wurde mir die so schwer zu entziffernde Antigonä-Übersetzung
besonders teuer, von Stefan George von jeher das verkannte, französisch geprägte
Frühwerk, von Celan die scheinbar aus dem Rahmen fallende Büchnerpreisrede
Der Meridian. Ich wusste von Hölderlins unzähligen Sinnfehlern, von Georges un-
beholfener Preziosität, von Celans Abneigung gegen diskursive Rede. Aber diese
Einseitigkeiten schienen mir für die literaturwissenschaftliche Erfassung die größ-
ten Chancen zu bieten. Und Goethes vielgeschmähte Natürliche Tochter, die auch
13 Hölderlin: Brief Nr. 237 vom 4. 12. 1801. Bd. III, S. 460, Zeilen 9f. u. 27f.
F4717-Antonsen.indd 48 03.12.2008 11:04:56 Uhr
AUTOBIOGRAFISCH BEGRÜNDETE KOMPARATISTIK 49
Stefan Bodo Würffel intensiv erkundet hat, wurde mir zu einem seiner vieldeutigs-
ten Werke, gegen den Zeitgeist geschrieben, aber durchweg von ihm geprägt.
Jegliche opportunistische Übereinstimmung mit Zeitgeistmoden habe ich im-
mer abgelehnt, weil ich in ihr eine Bedrohung des eigenen personalen Kerns be-
fürchtete, der für geisteswissenschaftliche Tätigkeit doch wohl immer noch eine
unabdingbare Voraussetzung bildet. Das Beispiel der sich dem Nationalsozialismus
beugenden deutschen und österreichischen, ja anfangs sogar auch teilweise schwei-
zerischen Germanistik hat mich stark geprägt, vor allem, als ich 1964 in Harvard
endlich die Gelegenheit fand, die von den Autoren in Deutschland aus den Rega-
len entfernten Werke der 1930er und 1940er Jahre in breitem Umfang kennen zu
lernen.
Literaturwissenschaft als weder rückwärts gewandte noch ihre erarbeiteten me-
thodologischen Überzeugungen ohne Kontinuität dem Zeitgeist zuliebe über Bord
werfende Tätigkeit, vielmehr als ein komplexer, von unlösbaren, dem Gegenstand
abgerungenen Spannungen fruchtbar zeugender Dialog mit den poetisch reichsten
Werken verschiedener Literaturen ist für mich ein Beitrag zum literarischen ›Welt-
gespräch‹, zu dem wir eingeladen sind und zu dem wir unsererseits neue Teilneh-
mer einladen können.
F4717-Antonsen.indd 49 03.12.2008 11:04:56 Uhr
F4717-Antonsen.indd 50 03.12.2008 11:04:56 Uhr
Dimiter Daphinoff (Freiburg/Schweiz)
IN DIE KRISE – AUS DER KRISE. BEMERKUNGEN
ZU EINER VERUNSICHERTEN WISSENSCHAFT
I.
Im Jahre 2002 rief der damalige Chefredaktor der renommierten Zeitschrift PM-
LA, Carlos J. Alonso, die Literaturwissenschaftler dazu auf, die Gefahren, in die
sich ihre Disziplin selbstverschuldet begeben habe, nicht zu unterschätzen. Insbe-
sondere bedauerte Alonso das Verschwinden eines »workable consensus on the sub-
ject of the study« und die »absence of a common intellectual enterprise«1. Über den
Gegenstand des Literaturstudiums und dessen Vermittlung bestünde keine Einig-
keit (mehr).
Die Krise der Literaturwissenschaft ist seit den frühen 1990er Jahren verschie-
den gedeutet worden. Die einen führen sie auf die Dominanz von »theory«2, die
anderen umgekehrt auf deren zunehmende Verdrängung aus Lehre und Forschung
zurück.3 Indem sich die »Current Literary Theory«4 – wie Brian Vickers am Bei-
spiel Shakespeares zu zeigen versuchte – die literarischen Gegenstände arrogant an-
eigne und instrumentalisiere, verschwinde angeblich das Verständnis dafür, was das
Studium der Literatur naturgemäß ausmachen sollte: der literarische Text selber.
Zehn Jahre nach Vickers stimmte einer der prominenten Vertreter der geschmäh-
ten »Current Literary Theory« selbst, Terry Eagleton, in die Klage ein: »Whereas in
the old days you could be drummed out of your student drinking club if you failed
to spot a metonym in Robert Herrick, you might today be regarded as an un-
speakable nerd for having heard of either metonyms or Herrick in the first place«5.
Nicht nur das terminologische Rüstzeug des angehenden Fachmanns scheint ver-
loren gegangen zu sein, sondern auch die elementare Kenntnis der Literaturge-
schichte.
Noch alarmierender fällt Eagletons Diagnose in seinem neuesten Buch aus, das
sich als Anleitung zum Lesen versteht: Nach dem Verschwinden der großen Theo-
1 Alonso: Editor’s Column, S. 402. Vgl. auch Daphinoff: As You Like Him, S. 103–112.
2 Vgl. z. B. Vickers: Appropriating Shakespeare. Den Anstoß dazu gaben u. a. Steven Knapp u.
Walter Benn Michaels 1982 mit ihrem provokativen Aufsatz Against Theory, vgl. Against
Theory, S. 11–30.
3 Vgl. hierzu Eagleton: After Theory.
4 Vickers, Appropriating Shakespeare, S. xv. Zu deren Exponenten vgl. z. B. Shakespeare and the
Question of Theory (1985).
5 Ebd., S. 3. Vgl. seine dezidierte Argumentation gegen die Kritiker von »theory« im Kapitel
Losses and Gains im gleichen Buch (S. 74–102, bes. S. 93).
F4717-Antonsen.indd 51 03.12.2008 11:04:56 Uhr
52 DIMITER DAPHINOFF
rien der 1960er und 1970er Jahre sei auch die Disziplin selbst, die Literaturwissen-
schaft, im Begriff abzudanken: »Like thatching or clog dancing, literary criticism
seems to be something of a dying art«6. Daran seien freilich nicht die »theorists«
schuld. Ob Formalisten oder Poststrukturalisten – die großen Meister ihres Fachs
hätten »scrupulously close reading«7 praktiziert.
Woher dann das Unbehagen? Denn dass es eine Malaise gibt, darüber scheint –
zumindest im angelsächsischen Raum – weitgehend Einigkeit zu bestehen. So for-
derte erst kürzlich Marjorie Perloff in ihrer Ansprache vor der Modern Language
Association of America (MLA) imperativ: »It Must Change«8. In ihrer Ursachen-
forschung macht sie die zunehmende Bedeutungslosigkeit des ›Kerngeschäfts‹ lite-
raturkritischer Betrachtung, der Arbeit am literarischen Text, für die mangelnde
Anerkennung unserer Disziplin in der Öffentlichkeit verantwortlich – und damit
auch für die schwindenden Chancen der Studienabgänger auf eine akademische
Laufbahn: »the governing paradigm for so-called literary study is now taken from
anthropology and history […].« Und: »[…] the literary, if it matters at all, is always
secondary; it has at best an instrumental value. Accordingly, it would be more accu-
rate to call the predominant activity of contemporary literary scholars otherdiscipli-
nary rather than interdisciplinary«9. Als Remedur empfiehlt Perloff, sich auf die
»discipline of poetics« zu besinnen und die Schriften von Plato, Aristoteles, Horaz
und Sidney wieder in den Unterricht einzubeziehen. Denn ohnehin werde die Be-
schäftigung mit Literatur zunehmend in Frage gestellt; anders als Ökonomen, Phy-
siker, Mediziner und Juristen hätten »literary scholars […] no definable expertise«10.
Solche Unterstellungen hätten – zumindest in den USA – politische Konsequen-
zen:
[…] administrators are beginning to argue, perhaps English departments should
concentrate on the study of composition and rhetoric, disciplines that really do
teach students things they need to know, and the foreign literature departments
should focus on language learning, so important in business, professional life,
and especially government service.11
Verständlich, dass sich unter den Betroffenen Selbstzweifel und Paranoia ausbrei-
ten. In der für ihn typischen Manier beschreibt Terry Eagleton die Existenzängste
von Literaturwissenschaftlern wie folgt: »Literary critics live in a permanent state of
dread – a fear that one day some minor clerk in a government office, idly turning
over a document, will stumble upon the embarrassing truth that we are actually
6 Eagleton: How to Read, S. 1.
7 Ebd., S. 2.
8 Perloff: Presidential Address, S. 652–662.
9 Ebd., S. 654 bzw. 655.
10 Ebd., S. 655.
11 Ebd., S. 656.
F4717-Antonsen.indd 52 03.12.2008 11:04:56 Uhr
IN DIE KRISE – AUS DER KRISE 53
paid for reading poems and novels. This would seem as scandalous as being paid for
sunbathing or having sex«12.
Eagletons Begründung für die eingangs festgestellte Misere der Literaturwissen-
schaft ist ihrerseits eine politische. Die sprachliche Sensibilität, die für den Umgang
mit Literatur unverzichtbar ist, leide an den Folgen des »advanced capitalism« und
der Globalisierung mit ihrer »unscrupulous way with signs, computerized commu-
nication and glossy packaging of ›experience‹«. Mehr noch: »[…] what is in peril on
our planet is not only the environment, the victims of disease and political oppres-
sion, and those rash enough to resist corporate power, but experience itself«13. Eagle-
tons Nostalgie ist zugleich (spät-)marxistisch und unwiederbringlich romantisch;
sie preist die Vorzüge der Langsamkeit, des Füllfederhalters und der Schreibma-
schine. Der Computer – bzw. die elektronische Kommunikation – stumpfe die
Empfänglichkeit des Lesers für das sprachliche Kunstwerk ab.
Die Befürchtung, das Internet läute den Niedergang des Buches und der Buch-
kultur ein und mache damit das Literaturstudium vollends überflüssig, vermag
Perloff nicht zu teilen. Vielmehr sieht sie »teachers of language and literature« ver-
mehrt in die Pflicht genommen, der Internet-Generation den Unterschied zwi-
schen ›Wahrheit‹ und ›Fiktion‹ zu erklären, literarische Werke in ihrem geschichtli-
chen und geografischen Kontext zu situieren und – vor allem – »literary criticism«
zu praktizieren, »which can only work if we read very closely and evaluatively«14.
Perloffs unspektakuläre, aber durchaus bedenkenswerte Rezepte zur Meisterung
der Krise ihrer Zunft münden in eine emphatische Ermutigung:
It is time to trust the literary instinct that brought us to this field in the first place
and to recognize that, instead of lusting after those other disciplines that seem so
exotic primarily because we don’t really practice them, what we need is more the-
oretical, historical, and critical training in our own discipline.15
II.
Die Verunsicherung, unter der die Literaturwissenschaft in den USA leidet, lässt
sich auch in Europa beobachten. Sie ist nicht neu. Als ich kurz nach 1968 mein
Grundstudium in Germanistik und Anglistik absolvierte, standen Fragen nach
der gesellschaftlichen Relevanz und der Wissenschaftlichkeit literarischer Fächer
im Zentrum universitärer Debatten. Helmut Seiffert hatte eben den zweiten Band
seiner Einführung in die Wissenschaftstheorie vorgelegt, in welchem er apologetisch
12 Eagleton, How to Read, S. 22.
13 Ebd., S. 17.
14 Perloff, Presidential Address, S. 661.
15 Ebd., S. 662. Zur Debatte, die Perloffs Presidential Address auslöste, vgl. die Beiträge von
Virginia Jackson und Jonathan Culler in der Rubrik Theories and Methodologies in PMLA
123 (1, 2008), S. 181–187 bzw. 201–206.
F4717-Antonsen.indd 53 03.12.2008 11:04:56 Uhr
54 DIMITER DAPHINOFF
die Ausdehnung des Titelbegriffs über die ›analytischen‹ Wissenschaften hinaus
erläuterte: »Sofern ›geisteswissenschaftliche‹ Vorgehensweisen wie Phänomenolo-
gie, Hermeneutik oder Dialektik auch als ›Wissenschaft‹ bezeichnet werden kön-
nen, dürfen wir das Nachdenken über sie natürlich auch ›Wissenschaftstheorie‹
nennen«16.
Zur selben Zeit hielt mein nachmaliger Lehrer, Walther Killy, eine »Leichenrede
auf eine Fakultät« – die Philosophisch-historische – und warb polemisch für eine
»vorläufige Germanistik«17 in einem Aufsatz, der mit einer Frage von Studienan-
fängern an das von ihnen selbst gewählte Fach beginnt, die seither kaum an Rele-
vanz eingebüsst hat: »Was die Beschäftigung mit Literatur, zumal vergangener, uns
überhaupt angehe – das wollen Studenten wissen, die Literatur studieren«18. Vor
bald 40 Jahren stellte Killy eine Diagnose auf, die mit derjenigen Marjorie Perloffs
oder Terry Eagletons in unseren Tagen auf den ersten Blick fast wörtlich überein-
stimmt: »In den historisch-ästhetischen Fächern herrscht eine bodenlose Unsicher-
heit […]«19. Die Gründe, die für die Krise angeführt werden, könnten freilich un-
terschiedlicher nicht sein. Für die Pleite der »akademische[n] Beschäftigung mit
Literatur« machte Killy »Vulgärmarxisten«20 verantwortlich, denen er durch seine
Berufung nach Bern auswich. Ihre »spruchbandartig deklariert[en] Grundpositio-
nen« vermiesten Killy den »inzwischen diskreditierten ästhetischen«21 Genuss.
Welten öffnen sich zwischen dem Bedauern des feinsinnigen Germanisten über das
verloren gegangene Selbstverständnis seiner Disziplin unter dem Eindruck ›linker‹
Anfeindungen und der vom Altmarxisten Terry Eagleton der kapitalistischen Glo-
balisierung und dem World Wide Web angelasteten Desensibilisierung der heuti-
gen Studierenden für Literatur.
Angesichts andauernder Anfechtungen und Selbstzweifel der Disziplin scheint
die Frage berechtigter denn je: Wie und warum studiert man am Anfang des 21.
Jahrhunderts Literaturwissenschaft?
Zunächst sei die Feststellung erlaubt, dass die (akademische) Beschäftigung mit
Literatur ein Privileg ist und bleibt. Sie ist weder für das Funktionieren des Ge-
meinwesens nötig, noch ist sie direkt anwendbar im Alltag. Die aus dem Literatur-
studium gewonnenen Erkenntnisse lindern keine Not, verhindern keinen Krieg,
vermehren nicht das Volkseinkommen. Sie bringen grundsätzlich zweierlei Nut-
zen: Der eine ist gewissermaßen privater Natur und lässt sich mit Killys ästheti-
schem Genuss annähernd beschreiben; der andere liegt in der inneren Logik der
Disziplin, in ihrer Eigengesetzlichkeit begründet. Ein Germanist oder Anglist mit
einem Magisterdiplom darf von sich behaupten, dass er eine Ausbildung absolviert
hat, die ihn zum Fachmann im Umgang mit literarischen Gegenständen macht. Er
16 Seiffert: Einführung, S. 2.
17 Vgl. Killy: Bildungsfragen, S. 9–17 bzw. 18–28.
18 Ebd., S. 18.
19 Ebd.
20 Ebd.
21 Ebd.
F4717-Antonsen.indd 54 03.12.2008 11:04:56 Uhr
IN DIE KRISE – AUS DER KRISE 55
hat sich ein Fachwissen angeeignet, das ihn dazu befähigt, kritisch zu denken, Texte
zu analysieren, sie in ihre jeweiligen geschichtlichen und kulturellen Kontexte ein-
zuordnen und allenfalls das Ausmaß ihrer Teilnahme am fortlaufenden Dialog von
Texten miteinander und untereinander zu beurteilen. Er hat eine bescheinigte
Kompetenz erworben, Literatur zu vermitteln, so wie ein diplomierter Bäckermeis-
ter die Befähigung attestiert bekommen hat, Brot zu backen. Der Unterschied zwi-
schen beiden Typen von Fachleuten besteht im Nutzen und in der Anwendbarkeit
der erworbenen Fähigkeiten: Während der Bäcker einen elementaren (physischen)
Hunger stillt, tut dies der Literaturwissenschaftler bestenfalls im übertragenen
Sinn.
Der Eigengesetzlichkeit der literaturwissenschaftlichen Ausbildung, die auf Per-
fektion und Perpetuierung dringt, steht der im Subjektiven begründete Nutzen der
akademischen Beschäftigung mit Literatur gegenüber. Denn unzweifelhaft ist die
Suche nach Antworten auf drängende persönliche Fragen eine wichtige Motivation
für die Wahl eines Literaturstudiums. Literatur erfasst und vermittelt ›Welt‹ und
macht uns so uns selbst verständlich. Sie macht einsichtig, wie wir zu dem gewor-
den sind, was wir sind. Sie zeigt auf, wie wir konditioniert, welchen Mächten (pou-
voirs) wir ausgesetzt sind, wie über uns (zu allen Zeiten, wiewohl unter wechseln-
den Bedingungen) bestimmt wird – selbst dort, wo wir uns als autonom Handeln-
de begreifen.22 Milton ging soweit zu behaupten, er könne »the ways of God to
men« ergründen und vermitteln (Paradise Lost, I, 26).23 Dieser (humanistische) Er-
kenntniswert von Literatur hat die Anfechtungen marxistischer, strukturalistischer
und post-strukturalistischer Provenienz überlebt. Als Harold Bloom aus dem
Dunstkreis von Jacques Derrida und der Yale School of Deconstruction heraustrat24,
gab er den gewichtigen Büchern seines Alters programmatische Titel: The Western
Canon (1994) und Shakespeare: The Invention of the Human (1998). Literaturstudi-
um als Lebenshilfe. Ein Auslaufmodell, würde man meinen, aber eines, das sich zäh
dagegen wehrt, als solches abgetan zu werden.
Die Beschäftigung mit Literatur befriedigt aber auch die Bedürfnisse des homo
ludens in jedem (akademischen) Leser. Denn unzweifelhaft eignet der analytischen
Lektüre von Texten auch etwas Spielerisches. Literatur lädt zu imaginärer Teilnah-
me ein, die ein sowohl ästhetisches wie intellektuelles Vergnügen bereitet; beides
liegt in der Natur des Spiels. Fiktion kann uns buchstäblich in fremde Welten ent-
führen, wie dies zum Beispiel Jonathan Swift mit seinen Gulliver’s Travels oder
H. G. Wells mit seiner Time Machine tun; sie kann alternative Modelle gesell-
schaftlicher Organisation entwerfen (Thomas Morus: Utopia, 1516), sie kann at-
traktive Identifikationsangebote an die Leser richten, die sie zur Reflexion über ihre
eigene Rolle in der Gesellschaft anleiten (Charlotte Brontë: Jane Eyre), sie kann
eingespielte Lesehaltungen und -erwartungen durchbrechen und so – spielerisch –
auf die Regeln aufmerksam machen, die fiktionale Texte für gewöhnlich befolgen
22 Vgl. Foucault: Les mots et les choses, bes. S. 314–354.
23 Milton: Poetical Works.
24 Vgl. z. B. Bloom u. a.: Deconstruction and Criticism.
F4717-Antonsen.indd 55 03.12.2008 11:04:56 Uhr
56 DIMITER DAPHINOFF
(Laurence Sterne: Tristram Shandy); sie kann die Identifikation mit Figuren und
Geschehen durch Verfahren der Distanzierung und Verfremdung verhindern, um
dem Betrachter das Dargebotene sowohl als ein ›Gemachtes‹, als Artefakt, wie auch
als ein zu Bedenkendes und gegebenenfalls zu Überwindendes zu empfehlen (Ber-
tolt Brecht: Mutter Courage, Der gute Mensch von Sezuan usw.).25 Fiktion kann aber
auch schlicht Rätsel aufgeben, deren Lösung dem Rezipienten aufgegeben ist (E. A.
Poes Tales, Robert Brownings »dramatic monologues«). Die ›Lösung‹ solcher litera-
rischen Rätsel ist nur ein Extremfall dessen, was die Lektüre von anspruchsvollen
Texten im Leser an Kräften und Regungen mobilisiert: emotionale Beteiligung,
intellektuelle Leistung, ästhetische Stimulierung.
III.
Wie umfassend Beschäftigung mit Literatur den Leser beanspruchen kann (im Sin-
ne der oben skizzierten Wirkungsweisen), mag eine kurze Stelle aus Shakespeares
später Liebestragödie Antony and Cleopatra veranschaulichen. Der vom Kriegsglück
verlassene Antonius argwöhnt, dass ihn seine Geliebte Kleopatra verraten hat und
mit Octavius Caesar gemeinsame Sache macht (»Packed cards with Caesar«,
IV.14.19). Aus Furcht vor seinem Zorn flieht Kleopatra ins Grabdenkmal, das sie
sich schon zu Lebzeiten hat errichten lassen, und lässt verkünden, sie sei tot. Als
Antonius die Nachricht erhält, fühlt er sich zutiefst beschämt und seines Lebens-
sinns beraubt:
I will o’ertake thee, Cleopatra, and
Weep for my pardon. So it must be, for now
All length is torture: since the torch is out,
Lie down, and stray no farther. Now all labor
Mars what it does; yea, very force entangles
Itself with strength: seal then, and all is done.
Eros! – I come, my queen. – Eros! – Stay for me.
Where souls do couch on flowers, we’ll hand in hand,
And with our sprightly port make the ghosts gaze:
Dido and her Aeneas shall want troops,
And all the haunt be ours. (IV.14.44–53)
Die Stelle ist in unserem Zusammenhang in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Einmal
durch ihren Appell an die Emotionen des Zuschauers bzw. Lesers: Shakespeare bie-
tet seine höchste Sprachkunst auf, um Antonius’ Erschütterung in Worte zu fassen.
Die sonst für den römischen Feldherrn typischen ausladenden Satzstrukturen wei-
chen hier einer Parataxe, die in ihrer Schlichtheit die Betroffenheit nachvollziehbar
25 Vgl. Daphinoff: Verfremdung, S. 613–626.
F4717-Antonsen.indd 56 03.12.2008 11:04:56 Uhr
IN DIE KRISE – AUS DER KRISE 57
macht (Z. 44–50). Die evozierten Bilder (»the torch is out«) lassen keinen Zweifel
am spontanen, aber unwiderruflichen Entschluss des Römers, seiner sinnlos gewor-
denen Existenz ein Ende zu setzen (»All length is torture«, »seal then, and all is do-
ne«). Antonius’ Verzweiflung bedient aber auch ästhetische Bedürfnisse: Die Mü-
digkeit, die den Kämpfer angesichts des Todes der Geliebten befällt, verlangsamt
den Sprechrhythmus und bricht den Pentameter auf (»So it must be«, »All length is
torture«, »Now all labor«); Assonanz und Alliteration (»torture – torch«; »down –
now«) machen vollends deutlich, dass die Sprache hier auf sich aufmerksam ma-
chen will, dass sie dem Schmerz poetischen Nachdruck gibt.
Der Leser wird aber auch intellektuell angeregt. Einmal durch die intertextuelle
Anspielung auf Vergil (Aeneis, VI, 467–474), die die Beziehung der Liebenden
durch den Vergleich mit Dido und Aeneas in eine epische Tradition einreiht. So-
dann durch den Identifikationsentzug, den das Wissen des Zuschauers darüber,
dass Antonius einer Lüge aufgesessen ist, bewirkt. Das Mehr-Wissen schafft Dis-
tanz zum Geschehen auf der Bühne: Antonius’ Betroffenheit ist echt, sie gilt mögli-
cherweise aber dem falschen Objekt. Der Todesdrang, dessen eloquenter Ausdruck
Mitgefühl erwecken sollte, entpuppt sich im Kontext von einer Vergeblichkeit und
Pathetik, die auch Antonius’ militärische Abenteuer im Stück kennzeichnen. Zwei-
fel an der Echtheit von Kleopatras Liebe sind an dieser Stelle ebenso berechtigt wie
Zweifel am Urteilsvermögen des römischen Feldherrn.
Shakespeares Antony and Cleopatra – soviel lässt sich allein anhand des gewähl-
ten Ausschnitts zeigen – erfordert eine kritische Aufmerksamkeit, die umso loh-
nender ist, wenn sie möglichst viele Aspekte des Textes einbezieht – formale (Met-
rum, Rhythmus, Rhetorik), thematische (zum Beispiel die Beschaffenheit der Lie-
be), intertextuelle (Vergil). Kenntnis der historischen Ereignisse und ihrer
Überlieferung (Plutarch) ist ebenso gefragt wie zum Beispiel ein Verständnis für die
römische Auffassung, die Selbstmord als identitätserhaltende Tat respektiert.
Ein Text, der so viele ›approaches‹ zu seinem Verständnis zulässt bzw. erfordert
(es ließen sich leicht noch mehr aufzählen), beweist nicht nur seine literarische
Qualität, sondern auch die Berechtigung eines umfassenden, interdisziplinär ange-
legten Begriffs von literary studies. Um relevant zu bleiben, dürfen diese weder
otherdisciplinary (Perloff ) noch ohne jeden literarischen Inhalt sein. Vielmehr müs-
sen sie integrativ vielfältige Interpretationsverfahren zulassen, wie dies schon Jost
Hermand gefordert hat26, und transnational ausgerichtet sein. Der Dialog, den
Texte mit anderen eingehen, macht die komparatistische Orientierung des Studi-
ums der Literaturwissenschaft(en) unabdingbar, wie dies schon der Begründer der
akademischen Beschäftigung mit Literatur in England, Matthew Arnold, 1864 in
seinem Aufsatz The Function of Criticism at the Present Time für die sich konstituie-
rende Disziplin forderte27:
26 Hermand: Synthetisches Interpretieren.
27 Im Englischen bis heute literary criticism und nicht etwa ›literary science‹.
F4717-Antonsen.indd 57 03.12.2008 11:04:56 Uhr
58 DIMITER DAPHINOFF
[…] the criticism I am really concerned with […] is a criticism which regards
Europe as being, for intellectual and spiritual purposes, one grand confederation,
bound to a joint action and working to a common result; and whose members
have, for their proper outfit, a knowledge of Greek, Roman and Eastern antiqui-
ty, and of one another.28
28 Arnold: Essays in Criticism, S. 39.
F4717-Antonsen.indd 58 03.12.2008 11:04:56 Uhr
Rolf Fieguth (Freiburg/Schweiz)
OSIP MANDEL’ŠTAMS LITERATURWISSENSCHAFTLICHES
PROSA-POEM GESPRÄCH ÜBER DANTE (1933).
EINE LEKTÜREEMPFEHLUNG1
Undenkbar, Dantes Gesänge zu lesen, ohne sie zur Gegenwart hinzulenken.
Dazu sind sie geschaffen. Sie sind Geräte zum Einfangen der Zukunft. Sie
erfordern einen Kommentar im Futurum.
Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow
Wenn Dante zum Thema dieses Gesprächs gewählt wurde, so nicht, weil ich
etwa vorschlagen wollte, man möge ihn im Sinne des Lernens bei den
Klassikern beachten und ihn zusammen mit Shakespeare und Lev Tolstoj an
etwas wie eine Kirpotinsche Table d’hôte2 setzen, sondern weil er der größte
und unstrittigste Herr der ein- oder mehrfach wandelbaren poetischen
Materie ist, der früheste und zugleich stärkste chemische Dirigent einer
lediglich in Fluten und Wellen, in Aufschwüngen und lavierenden
Zickzackbewegungen existierenden poetischen Komposition.
Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow
Was macht uns eigentlich Lust und Freude am theoretischen Nachdenken über Li-
teratur und am Interpretieren von Werken? Unsere theoretisch-wissenschaftlichen
Antriebe sind seit dem Verhallen der heftigen Diskussionen vergangener Jahrzehn-
te ein wenig erschlafft, wir weichen gern den Geröllhalden der Texte aus und wan-
deln lieber auf den fußfreundlicheren Gründen des biografischen, politisch-histori-
schen oder philosophischen Kontexts. In dieser etwas müden Stimmungslage ist
1 Das Gespräch entstand 1933 und wurde erstmals 1965 in einer englischen Übersetzung,
1967 erstmals in russischer Sprache publiziert. Ins Deutsche übersetzt wurde es bisher zwei-
mal, unter schwierigen Bedingungen in der DDR von dem hier kaum bekannten Norbert
Randow (Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow), und von dem bei uns zu Recht
berühmten Ralph Dutli (Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Dutli). Bei deutschen Zita-
ten aus dem Gespräch lege ich, als Hommage für eine besondere geistige Tat, die Übersetzung
von Norbert Randow zugrunde, verändere sie aber stillschweigend da, wo es mir angezeigt
scheint. Der Name des russischen Dichters erscheint in meinem eigenen Text in wissen-
schaftlicher Transkription (»Mandel’štam»), bei Zitatangaben in der Schreibung der Vorlage
(»Mandelstam«). – Die vorliegende Studie wurde zuerst im März 2004 in Lausanne am 3e
cycle »Poétique et science« (organisiert von Leonid Heller) als Vortrag in russischer Sprache
gehalten und wird in stark überarbeiteter Form hier erstmals publiziert.
2 Anspielung auf V. A. Kirpotin (1898–1997), 1932–1936 Literatursachwalter beim ZK der
KPdSU.
F4717-Antonsen.indd 59 03.12.2008 11:04:56 Uhr
60 ROLF FIEGUTH
der Hinweis auf eine vollkommen unkonventionelle, scharfsinnige, erregende und
anregende literaturwissenschaftliche Gedankendichtung nicht verkehrt, wie Osip
Mandel’štams Gespräch über Dante eine ist. Es soll hier Vorfreude auf die Lektüre
dieses Werks erzeugt werden.
Man merkt seiner avantgardistischen Lebhaftigkeit, dem fast übermütigen Ge-
dankenreichtum und kompositorischen Virtuosentum nicht an, dass es 1933 in
einer Epoche der kulturpolitischen Lähmung in der Sowjetunion geschrieben wur-
de.3 Es bezieht sich implizit polemisch auf eine kulturpolitische Situation der Sow-
jetunion, da die Avantgarden abgewürgt und mit der Idee einer bevorstehenden
Weltrevolution auch die fruchtbar begonnene Erarbeitung einer modernen, revo-
lutionären Perspektive auf die Weltkultur verabschiedet wurde. Wenn Mandel’štam
ganz überwiegend einige Gesänge des Inferno ins Bild bringt, Dantes Eigenschaft
als Verbannter hervorhebt und nicht versäumt, auf die gegenseitige Durchdringung
von Gefängniswelt und normaler Welt im Italien des 14. Jahrhunderts zu verwei-
sen4, so sind dies auch Kommentare zur sowjetischen Wirklichkeit um 1930. Zum
anderen bezieht es Stellung gegen die theologisch-geistesgeschichtliche Tradition
des Schreibens über Dante (vgl. dazu insbesondere das IV. Kapitel). Mandel’štams
neues Reden über Dantes Dichtung schließt vor allem kühn an das konkret Hand-
werkliche sowie an die moderne Naturwissenschaft an, was nachstehend näher
illustriert werden soll. Neu will aber in demselben Zusammenhang auch Man-
del’štams Reden über die Person Dantes sein. Sie wird aus der abstrahierenden Ver-
klärung späterer Jahrhunderte herausgeholt und in ihrer konkreten Menschlich-
keit, ihrem Sinn für das Materielle am Prozess der Entstehung von Malerei und
Poesie, und mit ihrer spezifischen, lebensnahen ›Unkultiviertheit‹ beleuchtet.
Mandel’štam sieht Dante als den »Raznocinec«5, den »Kulturparvenü«, der sich oft
»nicht zu benehmen weiß«, grobe Wörter in seiner Dichtung verwendet und sich
einen Sinn für das handgreiflich Konkrete bewahrt.
Im Zusammenhang des vorliegenden Bandes interessiert das Gespräch als hoch-
moderne, insbesondere aber auch hoch lebendige Gedankendichtung über Poesie,
Kunst und weltkulturelle Tradition, und somit als poetische Literaturtheorie oder
Autorpoetik. Zwar wäre es schöner gewesen, wenn die vorliegende Hinführung auf
Mandel’štams ungewöhnlichen Text auch sachkundige Kommentare zu den darin
vorgetragenen speziellen Interpretationen der Göttlichen Komödie enthielte; dafür
fehlt mir aber die Kompetenz.
3 Zu den biographischen und kulturpolitischen Umständen der Entstehung des Gesprächs vgl.
Dutli: Mandelstam, S. 394–401. Ein schöner kleiner Essay über Mandel’štam findet sich in
Mierau: Russische Dichter, S. 173–177 (›Häuslicher Hellenismus‹).
4 Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow, Kap. VII, insbesondere S. 87.
5 Ebd. Kap. II, S. 25f. – Aus den »Raznocincy« [wörtlich: »Angehörige diversen Standes«] spei-
ste sich das Gros der russischen Bildungsträger im 19. Jahrhundert. Bedeutende »Raznocin-
cy« waren F.M. Dostoevskij (Enkel von Popen und Kaufleuten), und A.P. Cechov (Sohn ei-
nes Krämers und Enkel von Leibeigenen). Mandel’štam, Kind einer nicht völlig assimilierten
jüdischen Familie, sah sich selbst in der Tradition der »Raznocincy«.
F4717-Antonsen.indd 60 03.12.2008 11:04:56 Uhr
GESPRÄCH ÜBER DANTE 61
1. Das Gespräch über Dante als literaturwissenschaftliches
Poem in Prosa
Der Anfang des Gesprächs erinnert an den Stil (nicht unbedingt an die Konzeptio-
nen) der russischen Formalisten:
Das dichterische Sprechen ist ein gekreuzter Prozess, und zwar setzt es sich aus
zweierlei Klängen zusammen: Der erste dieser Klänge ist die für uns hörbare und
spürbare Veränderung der Instrumente des dichterischen Sprechens, die mitten
in dessen Energieausbruch entstehen; der zweite Klang ist das eigentliche Spre-
chen, das heißt die von den genannten Instrumenten geleistete Intonations- und
phonetische Arbeit. (Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow, S. 7)
Solchem Stil zum Trotz ist das Ganze aber – nach meiner Einschätzung, und wie
schon angedeutet – eine Gedankendichtung in Prosa, die sich die Freiheit nicht
nur zu lockerer, unakademischer Themen- und Gedankenführung nimmt6, son-
dern eine förmliche Kultur des Gedankensprungs bzw. des künstlerisch geplanten
Gedankenfluges in alle Richtungen praktiziert. Statt wie üblich die nervenscho-
nende logikgefestigte Gedankenstrickleiter zu knüpfen, konfrontiert uns der Dich-
ter mit dem poetischen Wort in Aktion, er spricht uns über die besagten Probleme
an – was macht uns überhaupt Spaß am Lesen, Nachdenken und Reden über Lite-
ratur? – durch das poetische Tun, das er uns vorführt. Er beseitigt die beruhigende
Distanz zwischen Meta- und Objektebene und zieht uns in den schönen Wirrwarr
der letzteren hinein, indem er die Objektebene zur Metaebene macht, und umge-
kehrt.
Dies vollführt er unter anderem durch die verblüffende, frei assoziierende Ver-
wendung einer technisch-handwerklichen und mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Begrifflichkeit und Metaphorik, die zum einen die ›Modernität‹ der Dante-
schen und der eigenen Dichtung hervorhebt, die aber zum anderen und vor allem
in ihrer frappierenden Konkretheit jeder gedankenblassen Abstraktion ein Schnipp-
chen schlägt, und zwar dergestalt, dass der Text auch dadurch zur ›dunklen‹ und
ausdeutbaren modernen Gedankendichtung, zu einem »Poem« wird.
Der russische Dichter kommt also Dantes »Poem«7 nicht mit einem logikgefes-
tigten Traktat, sondern mit einem eigenen »Poem«, wenngleich in Prosa. Dahinter
steckt eine besondere Strategie, von der noch die Rede sein wird.
6 Dies wäre indiziert durch die Gattungsbezeichnung Gespräch (»razgovor« klingt konkreter als
das üblichere »beseda«, beide wohl Lehnübersetzungen von frz. »causerie«); gemeint ist ein
besonders hörerfreundlich, in Stil und Gedankenführung locker gestalteter Vortrag in oraler
oder schriftlicher Form.
7 Nach russischem Sprachgebrauch ist auch Dantes Göttliche Komödie ein »Poem« im weiteren
Sinne.
F4717-Antonsen.indd 61 03.12.2008 11:04:57 Uhr
62 ROLF FIEGUTH
Zunächst aber: Was ist ein Poem?
Das narrative Poem, zumindest in seiner romantischen, symbolistischen oder klas-
sisch-modernen Version, benutzt als Folie die Struktur der Novelle, deformiert de-
ren Erzählzusammenhang und schwächt überhaupt die Dominanz des narrativen
Prinzips zugunsten anderer, assoziativer und poetisch-lyrischer Kohärenzprinzi-
pien. Das ›philosophische‹ Poem benutzt analog dazu als Folie den Aufbau des phi-
losophischen Traktats, deformiert dessen thematische Schrittfolge bei der Ent-
wicklung einer gedanklichen Konzeption und schwächt die klare Dominanz einer
einheitlichen gedanklichen Sinnlinie gleichfalls zugunsten der Spürbarkeit poe-
tisch-assoziativer Zusammenhänge. In beiden Typen des Poems wird der hierarchi-
sche Unterschied zwischen Abschweifung und Hauptlinie minimalisiert oder sogar
aufgehoben, daher die herausragende Rolle der Abschweifungen oder Digressionen
in den Poemen der genannten literarhistorischen Situationen. Mandel’štams stark
vom klassisch-modernen Akmeismus8 geprägtes Gespräch kreiert den Subtypus des
›literaturwissenschaftlichen Poems in Prosa‹.9
Hier dominiert die Abschweifung auf allen Ebenen. Das Einzelwort wird durch
– paronomastische oder andere – Abschweifungen zum lautlich-semantischen me-
tamorphotischen »Zyklus«10 erweitert: Das »Zitat« (citata) wird zur ununterbro-
chen zirpenden »Zikade« (cikada); das »Redeorgan« gerät zum »Redewerkzeug«
und schließlich zum modernen Gerät oder Apparat (snarjad), zum Beispiel zum
Fluggerät (samolet); der Versrhythmus wird über den metrischen Versfuß zum
Werkzeug des Gehens und »bringt« die Poesie und das dazugehörige Denken »auf
die Beine«; die Schreibfeder (pero) wird auf den Vogel (ptica) und damit auf den
Begriff des Fluges (lët) weiter geführt und mit dem Stab in der Hand des Dirigen-
ten in Verbindung gebracht, und vieles andere mehr. Abschweifungen sind auch
die zahlreichen Metaphern und Vergleiche mit ihren charakteristischen »Ausflü-
gen« in verschiedenste Bereiche der Technologie und Naturwissenschaften.
Nach analogem Abschweifungs-Prinzip wird die Satzverknüpfung, der Aufbau
des Absatzes und des Kapitels geregelt. Auch bei der Verkettung der elf Kapitel ist
das Prinzip der Abschweifung nicht außer Kraft gesetzt. Das alles hat mit der schon
angedeuteten Strategie zu tun. Hier wird nämlich ein Poem, Dantes Göttliche Ko-
8 Der Akmeismus, ca. 1910 – ca. 1925, ist, in Konkurrenz zum Futurismus, die früheste nach-
symbolistische russische Avantgarde-Dichter-Gruppe. Von der Wolkigkeit des Symbols woll-
te er zurück zur Konkretheit des poetischen Wortes und der dargestellten Dinge; den »Ada-
mismus« (den Rückgang auf das nicht von falscher Bildung verformte Menschentum) ver-
band er mit dem Respekt vor den Höchstleistungen (»akmé« – gr. »die Blüte«) der
Menschheitskultur und vor dem Handwerklichen an der Dichtung. Der Gruppe gehörten
als heute bekannteste Dichter Nikolaj Gumilëv, Anna Achmatova und Osip Mandel’štam
selbst an.
9 Eine Übertragung von Strukturelementen des narrativen Vers-Poems auf novellistische Pro-
sawerke ist in der russischen Literatur gang und gäbe (Gogol’, Odoevskij, Dostoevskij);
Nachforschungsbedarf besteht für die Beziehungen zwischen Verstraktat (›philosophisches‹
Poem) und Prosatraktat.
10 Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow, S. 31f.
F4717-Antonsen.indd 62 03.12.2008 11:04:57 Uhr
GESPRÄCH ÜBER DANTE 63
mödie, in seiner radikal zentrifugalen Dynamik sichtbar gemacht durch ein anderes
»Poem«, dasjenige Mandel’štams, das selbst durch zentrifugale Dynamik gekenn-
zeichnet ist. Folgende zentrale Passage des Gesprächs bezieht sich ebenso gut auf
Dantes wie auf Mandel’štams Poem:
Ich will sagen, dass die Komposition sich aus keiner Anhäufung von Einzelteilen
ergibt, sondern daraus, dass sich ein Detail nach dem andern von der Sache los-
reißt, von ihr weggeht, davonflattert, sich vom System abspaltet, in einen eigenen
funktionalen Raum oder funktionale Dimension abgeht, aber jeweils zu einem
streng vorgeschriebenen Zeitpunkt und unter der Voraussetzung einer dazu her-
angereiften und einmaligen Situation. (Mandelstam: Gespräch über Dante, übs.
Randow, S. 17f. )
Man kann hier aber noch einen Schritt weiter gehen. Im V. Kapitel lanciert
Mandel’štam den Begriff der »heraklitischen Metapher«, der Metapher, die ihren
Gegenstand flüssig oder überflüssig macht, ihn »durchstreicht« (perecerkivaet) und
seine Hierarchie und Struktur vernichtet, indem sie seinen Prozesscharakter, sein
unabgeschlossenes Werden hervortreibt:
Manchmal vermag Dante eine Erscheinung so zu beschreiben, dass nicht das
Geringste von ihr übrig bleibt. Dazu bedient er sich eines Verfahrens, das ich
›heraklitische Metapher‹ nennen möchte: Sie unterstreicht die Fluidität eines
Phänomens mit derartiger Kraft und durchstreicht es dann mit derartig schwung-
vollen Strichen, dass der direkten Anschauung, ist das Werk der Metapher getan,
im Grunde nichts mehr zu beißen übrig bleibt. (Mandelstam: Gespräch über Dante,
übs. Randow, S. 59)
Analog hierzu sehe ich das Verhältnis des Mandel’štamschen zu dem Danteschen
Werk: Das Gespräch ist gleichsam selbst eine »heraklitische Metapher« für Dantes
Göttliche Komödie. Diese wird hier mehr oder weniger heimlich »durchgestrichen«,
indem das moderne Gesprächspoem deren dynamisch-zentrifugale Dynamik poe-
tisch vor Augen führt.
Die Kultur der Abschweifungen hat also durchaus Methode. Auch eine eigen-
willig gebaute und geformte Sinnlinie des Gesprächs lässt sich sehr wohl sichtbar
machen.
2. Die elf Kapitel und ihre merkwürdige Verkettung
Mit fortschreitender Lektüre wird die Verwirrung über all die Gedankensprünge
zur Einsicht, dass in spannender, endloser Variation immer dieselben Grundgedan-
ken veranschaulicht, von jedem kleinen Einzelaspekt aus stets auch die Gesamtpro-
blematik des Kunstwerks anvisiert werden – des Kunstwerks, das keine statische
Struktur sein soll, sondern ein Energieausbruch, der sich unter immer neuen Ener-
gieausbrüchen beständig nach allen Seiten hin ausbreitet und sich durch diese Be-
wegung seinen eigenen Raum und seine eigene Zeitlichkeit schafft. Und dennoch
F4717-Antonsen.indd 63 03.12.2008 11:04:57 Uhr
64 ROLF FIEGUTH
schält sich wohl bei jedem Kapitel ein verborgenes Hauptthema heraus, das gewis-
sermaßen musikalisch ins nächste Kapitelchen und ins nächste Hauptthema trans-
formiert wird; diese Hauptthemen bilden in ihrer seltsamen Verkettung eine re-
konstruierbare Sinnlinie, die allerdings nicht imperativisch dominiert.
Im ersten Kapitel kommen wie in einer »Ouvertüre« die wichtigsten Themen
und Motive des Gesprächs vor. Kurz angerissenes Thema des Kapitelbeginns ist die
Phonetik der poetischen Rede; dieses wird sogleich in einen poetischen Konflikt
mit dem viel allgemeineren Problem der Künstlichkeit oder »Technizität« der poe-
tischen Kunst gebracht, die in die Natur der Sprache eindringt. An die Stelle der
herkömmlichen fertigen »[dichterischen] Bilder« treten die besonderen Umstände
ihrer Herstellung, die »Werk(zeug)mittel« und die Strategie des Verwandelns und
Kreuzens. Dante sei kein »Bilderfertigsteller« sondern ein »Werkzeugmeister der
Poesie« und ein »Stratege der Verwandlungen und Kreuzungen«. Für den Sachken-
ner (der ich nicht bin) anschaulich ist hier der Vergleich mit der Technik des Tep-
pichwebens, wo durch Kreuzung vieler verschiedener Webstrukturen (Kettfäden)
unregelmäßige Ornamente, nicht aber wiederkehrende Muster entstehen sollen.
Nicht die Materie als Materie ist wichtig (diese kann auch »Wasser« sein), sondern
die sich kreuzenden Musterimpulse. Da aber die Materie die italienische Sprache
ist, wird ihr hier mit der amüsanten Festlegung auf »infantilen, dadaistischen
Klang« (schon im Mittelalter!) eigenwilliger Respekt gezollt, und zwar mit dem
schönen Zitat
E consolando usava l’idioma
Che prima i padri e le madri trastulla;
[…]
Favoleggiava con la sua famiglia
De’ Troiani, di Fiesole, e di Roma. (Par., XV, 122–123, 125–126)
Und brauchte, lullend, jene Redeweise,
An der zuerst sich Väter freun und Mütter;
[…]
[Die andere] Erzählte Märchen in der Ihr’gen Mitte,
Von Rom und Fiesole, und den Trojanern (Dante: Göttliche Komödie, S. 343).
Als Hauptgedanke des Kapitels kann festgehalten werden: Das Metrum, der Vers-
fuß, setzt das Werk in Bewegung. Poetische Kunst ist nicht Abbildung von stati-
scher oder bewegter Wirklichkeit, sondern sie schafft sich ihre eigene technisch-
werkzeugbezogene Wirklichkeitsbewegung, und damit auch ihren eigenen mehrdi-
mensionalen Raum und ihre eigene Zeit. Bemerkenswert ist die Digression über
die »Magnetisierung« der Verben durch ihre verschiedenen Tempusformen (imper-
fetto, passato rimoto, perfetto composito).
Ausgehend von einer eigenartigen Verschränkung von Averroes und Aristoteles
in Inferno IV, v. 144 kommt es in diesem Kapitel auch zu einem berühmt geworde-
nen Exkurs über die Funktion der Zitate:
F4717-Antonsen.indd 64 03.12.2008 11:04:57 Uhr
GESPRÄCH ÜBER DANTE 65
Der Schluss des vierten Gesanges des Inferno ist eine wahre Zitatenorgie. Hier
finde ich die reine und unvermengte Demonstration von Dantes Anspielungskla-
viatur.
Eine Klaviertastenwanderung über den gesamten Gesichtskreis der Antike hin.
Etwas wie eine Chopinsche Polonaise, wo der bewaffnete Cäsar, mit den blutun-
terlaufenen Augen eines Greifes, und Demokrit, der die Materie in Atome zerleg-
te, nebeneinander herschreiten.
Zitate sind keine Exzerpte. Zitate sind Zikaden. Unaufhörliches Zirpen ist ihnen
eigen. (Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow, S. 17)
Der Fluss der Assoziationen setzt sich über Musik und Orgelbau sowie Medizin
fort bis zur Geologie und Kristallographie – alles Vergleiche und Metaphern für
den dynamischen, zentrifugalen Bewegungszustand des literarischen Werks und
der vieldimensionalen Raumzeitlichkeit, die es sich schafft –, nicht nur als Ganzes,
sondern auch in den Teilbereichen seiner ›Bildlichkeit‹. Bilder, Vergleiche und Me-
taphern sind nicht beschreibend bei Dante, sondern versinnbildlichen die Struktur
des Gegenstandes, der selbst ganz unwesentlich werden kann.
Dieser Gedanke wird nun im kurzen dritten Kapitel in geradezu logischem An-
schluss vertieft – und zwar im Wesentlichen mit Hilfe der Metapher der Kristallogra-
phie, einer Wissenschaft, die es mit Gestaltungen zu tun hat, welche die Vorstellung
des dreidimensionalen Raums sprengen müssen – ähnlich den Waben der Bienen.
Nicht weniger logisch setzt das 4. Kapitel diesen Gedankengang fort mit einer
polemischen Wendung gegen die, wie Mandel’štam meint, einseitig christliche Al-
legorisierung von Dantes Dichtung und ihrer »Bildlichkeit«. Der russische Dichter
sieht hier einen Einsatz von lebendigen, kräftigen Farben, ja sogar der chemischen
Komponenten der Malerfarben, und begründet von hier aus sein Postulat und sei-
nen Versuch, für Dante einen naturwissenschaftlich geprägten Interpretationszu-
gang zu erarbeiten.
Der Vorgang der chemischen Reaktion verschafft ihm die Idee der »(ein- oder
mehrmaligen) Verwandelbarkeit der poetischen Materie« (obratimost’ / obrašcae-
most’), die er bei Dante beständig praktiziert sieht und die er gegen die Allegorie-
bildung setzt. Das atomare bzw. molekulare Wesen der Materie bringt ihn zu der
Vorstellung, dass in der Materie – wie auch im Kunstwerk – im wesentlichen ›nur‹
Energien und Bewegung wirksam sind.
Einen Höhepunkt erreichen diese Gedankenflüge in dem utopischen Bild vom
Flugzeug, das während des Fluges neue Flugzeuge produziert und diese gezielt zu
deren selbstständigem, eigenem Flug aussetzt – eine der eindrucksvollsten
Mandel’štamschen Metaphern für seine Sicht der zentrifugalen Bewegungsenergie
des literarischen Kunstwerks.
Die erste Hälfte des Gesprächs endet im V. und VI. Kapitel mit der Theorie der
»heraklitischen Metapher« (s.o.) und der unzerstörbaren Prozessualität des unend-
F4717-Antonsen.indd 65 03.12.2008 11:04:57 Uhr
66 ROLF FIEGUTH
lich »werdenden« Werks (die Kunst kennt keine fertigen Sachen und keine festen
Sinnstrukturen) sowie mit einer an der Relativitätstheorie anknüpfenden Theorie
von literarischem Raum und literarischer Zeit, die durch die Bewegungen des
Kunstwerks erst geschaffen werden. Es liegt am Tage, dass Mandel’štam aus Dantes
Göttlicher Komödie die hochmodernen Konzeptionen von Entstehung (»Urknall«)
und unendlich dynamischer Ausbreitung des Weltalls ablesen und diese auf das
Wesen des Kunstwerks projizieren möchte. Dass hier zugleich auch wieder die
Geologie, die Mineralogie, die Kristallographie zu Ehren kommen, sei nur am Ran-
de vermerkt.
Mustert man nun die zweite Hälfte des Gesprächs, macht man eine überraschen-
de Entdeckung: Es geht gewissermaßen noch einmal von vorne los, wenn auch mit
womöglich noch höherer poetischer Intensität. Ich hege die Vermutung, dass
Mandel’štam hier gewissermaßen im Flug ein zweites Flugzeug produzierte und es
auf den Flug schickte – oder, modern raketentechnisch gesagt: Er zündet hier eine
zweite Stufe.
Wieder sind es einfache, ›niedrige‹ Aspekte des literarischen Werks, die zu im-
mer neuen Ausgangspunkten für metaphernreiche Veranschaulichungen der Werk-
komposition und der literarischen Raum- und Zeitbildung verwendet werden, aber
es sind nicht genau dieselben Aspekte, wie zuvor. Nunmehr ist es das Timbre (die
Klangfarbe) der Wörter und Sätze mit großartigen Ausflügen in die Klangfarben
der Musikinstrumente (Kap. 7), ferner die Sprechwerkzeuge des Dichters (die Be-
wegung der Sprech- und Essmuskeln; Kap. 8 und 9), seine Schreibwerkzeuge mit
eindrucksvollen Digressionen zur »chemischen Musik« und zur Geschichte und
Rolle des Dirigierstabes (Kap. 10). Sie alle sind maßgeblich an der Werkkompositi-
on und der Erzeugung der literarischen Raum- und Zeitgebilde (Kap. 11) beteiligt,
und erneut, wie schon am Ende der ersten Hälfte, wird dem modern naturwissen-
schaftlichen Konzept von Zeit und Raum ein Hinweis auf ältere, romantische Er-
kenntnisse der Kristallographie und der Gesteinskunde (Stein und Zeit) mit aus-
drücklichem Verweis auf Novalis11 hinzugefügt.
Mit verstärktem Schwung und Nachdruck wird für den Mut auch zur literatur-
wissenschaftlichen Anleihe bei modern naturwissenschaftlichen Konzeptionen so-
wie bei der Orgelmusik und der symphonischen Musik plädiert und eine Konzent-
ration nicht auf die »Formbildung« (formoobrazovanie), sondern auf die »Erup-
tionsbildung«12 (poryvoobrazovanie) im literarischen Kunstwerk gefordert.
11 Mandelstam: Gespräch über Dante, übs. Randow, S. 115
12 Eines von vielen Übersetzungsproblemen schafft das Wort »poryv«. Randow übersetzt es re-
lativ konsequent und etwas illegal mit »leidenschaftlicher Ausbruch«, was zu einseitig die
Emotion des Autors hervorhebt, während Mandel’štam offenkundig namentlich die – vom
Autorsubjekt auch einmal losgelösten – heftigen Energieausbrüche und Bewegungsanstöße
in der dynamischen Werkstruktur meint. Ich entscheide mich für »Energieausbruch«, gele-
gentlich auch nur »Eruption«.
F4717-Antonsen.indd 66 03.12.2008 11:04:57 Uhr
GESPRÄCH ÜBER DANTE 67
Den Abschluss bildet ein deutlich revolutionärer Protest gegen die ordnende
Syntax, der bereits im 10. Kapitel gestartet wurde:
Die alte italienische Grammatik ist, ebenso wie unsere russische, immer derselbe
aufgeregte Vogelschwarm, dieselbe bunte toskanische »schiera«, das heißt die flo-
rentinische Menge, die die Gesetze wechselt wie Handschuhe und gegen Abend
die am Morgen desselben Tages für das Allgemeinwohl erlassenen Anordnungen
vergessen hat.
Es gibt keine Syntax. Es gibt einen magnetisierten Energieausbruch, eine Sehn-
sucht (toska) nach dem Schiffsheck (korabel’naja korma), eine Sehnsucht nach
Wurmgehäck (cervjacnyj korm), eine Sehnsucht nach dem noch nicht erlassenen
Gesetz, eine Sehnsucht (toska) nach [dem toskanischen] Florenz. (Mandelstam:
Gespräch über Dante, übs. Randow, S. 111f.)
Mit anderen Worten – die Syntax bringt uns durcheinander. Alle Nominative
müssen durch richtungsanweisende Dative ersetzt werden. Das ist das Gesetz der
ein- oder vielfach wandelbaren dichterischen Materie, die nur im Energieaus-
bruch der Ausführung existiert. […]
Hier ist alles umgekehrt: die Substantive sind nicht Subjekt, sondern Ziel des
Satzes. Gegenstand der Dantewissenschaft wird eines Tages, wie ich hoffe, die
gegenseitige Unterordnung von Energieausbruch und Text sein. (Mandelstam:
Gespräch über Dante, übs. Randow, S. 125)
Ich habe zu zeigen versucht, dass Mandel’štams literaturwissenschaftliches Poem in
Prosa seine zentrifugale Struktur ganz methodisch bildet und einsetzt und dabei
auch eine – quasi in zwei Stufen beschleunigte – Entfaltung einer Sinnlinie bewerk-
stelligt. Zu den Kompositionsgeheimnissen dieses Werks wäre noch viel zu sagen:
Die meist sehr kurzen Absätze ähneln Strophen, die Kapitel sind gleichsam techno-
logisch-literaturwissenschaftliche ›Gesänge‹, manche Kapitelschlüsse stehen zu an-
deren Kapitelschlüssen in einem Verhältnis thematischer Äquivalenz.
Ferner ist die naturwissenschaftlich-technische Metaphorik, nach meiner Ein-
sicht, über das Gespräch hin so aufgebaut ist, dass ein hoch modernes thematisches
Zentrum mit Metaphern älterer Techniken eingekreist wird. Von Werkzeugen,
Schreibutensilien, Kettfäden, Farbenherstellung, Orgelbau, Segeltechnik, Minera-
logie und Kristallografie ist viel die Rede, aber fast noch mehr von der modernen
Physik und Mathematik mit ihrer neuen Kosmologie und ihren neuen Konzepten
zu Materie, Energie, Bewegung, Raum und Zeit sowie zur Entstehung und Aus-
breitung des Universums. Und eben hier liegt das Zentrum dieser gesamten Meta-
phorik, die vom mathematisch-naturwissenschaftlichen Standpunkt aus höchst-
wahrscheinlich (ich kann es nicht beurteilen) recht willkürlich aus Einzeltheoremen
verschiedener seinerzeit aktueller mathematischer und physikalischer Konzeptionen
zusammengesetzt ist, und doch ihre eigene Kohärenz entwickelt. All diese Theore-
me verwendet Mandel’štam neben vielen anderen Metaphern und Vergleichen zur
Charakteristik von Dantes Göttlicher Komödie, eine Charakteristik, die mindestens
ebenso gut eine Charakteristik seiner eigenen Poetik ist.
F4717-Antonsen.indd 67 03.12.2008 11:04:57 Uhr
68 ROLF FIEGUTH
Wollte ich zum Abschluss Mandel’štams Konzeption des literarischen Kunst-
werks in den wissenschaftshistorischen Kontext (russischer Formalismus, Croce,
Vossler) einordnen, käme ich mir vor wie ein Schmetterlingsforscher, der seine
schönen Objekte nicht im Flug beobachten kann und sie daher erst tötet, dann
aufspießt und schließlich in diesem Zustand beschreibt und in ein Ordnungssys-
tem bringt. Was aber bleibt, ist die wohl heftigste Provokation des Dichters gegen-
über uns Literaturwissenschaftlern: Die Schrift, der geschriebene Text, auf den es
mir, auf den es uns in erster Linie immer angekommen ist und ankommt, ist, so
sagt es Mandel’štam wiederholt, künstlerisch und poetisch selbst ein Nichts – wich-
tig sind allein die Kräfte, Bewegungen, Impulse, Energieausbrüche, die – vom
Künstler womöglich streng kontrolliert – dahinter stehen, sich dahinter ereignen.
Aber es ist manchmal sehr fruchtbar, anregend und geradezu ermutigend, sich so
herausgefordert zu sehen.
F4717-Antonsen.indd 68 03.12.2008 11:04:57 Uhr
Lucas Marco Gisi (Basel)
TOPOGRAFIE UND TOPOLOGIE. ZUR RELEVANZ
DER KATEGORIE DES RAUMS FÜR DIE LITERATURGESCHICHTE
»Warum schreiben Sie?«1 – In seinen Poetikvorlesungen geht der Schriftsteller Hu-
go Loetscher der Frage nach, warum Schriftsteller immer wieder (öffentlich) zu
dieser Frage Stellung beziehen müssen, während man einen Arzt nicht fragen wür-
de, warum er heile. Der Grund dafür mag sein, dass alles, was über das Überlebens-
notwendige hinausgeht, legitimationsbedürftig erscheint. Allerdings ist der unmit-
telbare Nutzen des Toreschießens auch nicht unbedingt evident und trotzdem frage
man, so Loetscher, den Fußballer nicht, warum er es tue.
Aber stürzt der Literaturwissenschaftler, wenn man die Frage an ihn richtet,
nicht in noch tiefere Verlegenheit als der Schriftsteller? Mag es gegenüber dem
Schriftsteller der Wunsch nach einer natürlichen Erklärung für das beeindruckende
Außerordentliche, also der Wunsch, zu ›begreifen, was uns ergreift‹, sein, der die
Frage motiviert, so muss befürchtet werden, dass dieselbe Frage gegenüber den Ver-
fassern von (wissenschaftlichen) Texten über Texte weniger Interesse als Skepsis ge-
genüber dem Sinn und Zweck von deren Tun signalisiert. Die Frage wäre also in
diesem Fall vielmehr Ausdruck der wohlwollenden Annahme, dass hinter der lite-
raturwissenschaftlichen Tätigkeit wenigstens eine nachvollziehbare Motivation
oder eine hehre Absicht stehen müsse – wenn schon der Wert des Produkts dieser
Tätigkeit nicht unbedingt erkennbar ist. Und doch will die Literaturwissenschaft
nicht einfach ›gut gemeint‹ und damit – frei nach dem Gottfried Bennschen Dik-
tum – das Gegenteil von Kunst sein.
Wenn im Folgenden nach Antworten gesucht wird auf die Frage, was Literatur-
wissenschaft heißt und zu welchem Ende man sie studiert, so geht es nicht um Be-
stimmungen und Rechtfertigungen grundsätzlicher Art. Vielmehr sollen lediglich
– ausgehend von einem Blick auf die Geschichte der Disziplin – Möglichkeiten der
literaturwissenschaftlichen ›Umsetzung‹ von Anregungen der so genannten kultur-
wissenschaftlichen Wende der Geisteswissenshaften reflektiert werden. Konkret
soll nach der Relevanz der Kategorie des Raums für die Literaturgeschichte gefragt
werden. Im Zentrum der Überlegungen steht die Literaturgeschichte; zum einen,
weil sie das ›Kerngeschäft‹ und den fachgeschichtlichen Ursprung der Literaturwis-
senschaft ausmacht, zum anderen, weil innerhalb der breit geführten Diskussionen
um die Bedeutung des Raums für die Kulturwissenschaften die (literatur-)histori-
sche Perspektive noch etwas unterbelichtet scheint. Außerdem bezieht sich gerade
Schillers Antrittsvorlesung, auf die die Leitfrage dieses Bandes Bezug nimmt, auf
1 Loetscher: Vom Erzählen erzählen, S. 157.
F4717-Antonsen.indd 69 03.12.2008 11:04:57 Uhr
70 LUCAS MARCO GISI
Grundprobleme der historischen Wissenschaften. Hier, beim Problem der histori-
schen Zeit, sollen die folgenden Überlegungen zum Raum ihren Ausgangspunkt
nehmen.
1. Von der Zeit zum Raum: Literaturgeschichte
nach der Geschichte
Raum und Zeit sind (nach Kant) Parameter der Erfahrung; in diesem Sinn ›findet‹
auch Geschichte in Raum und Zeit ›statt‹. In den historischen Wissenschaften, und
so auch in der Literaturwissenschaft, ist eine aufgrund ihres narrativen Darstel-
lungsmodus nahe liegende, generelle Dominanz der Temporalität festzustellen2,
hinter der allerdings zuweilen noch eine der Aufklärung geschuldete Geschichts-
auffassung zu schlummern scheint. Dies lässt sich verdeutlichen durch einen Rück-
griff auf Friedrich Schillers unter dem Titel Was heißt und zu welchem Ende studiert
man Universalgeschichte? publizierte Jenaer Antrittsvorlesung von 1789, eine Ausein-
andersetzung mit August Ludwig Schlözers und Kants Konzepten einer Univer-
salgeschichte.3 Geschichte erscheint bei Schiller als Kausalkette, deren Glieder der
Geschichtsphilosoph rekonstruieren kann, indem er einen »vernünftigen Zweck«
der Geschichte, also ein »teleologisches Prinzip« postuliert und sich so Glied für
Glied von seiner Gegenwart zum Anfang der Geschichte ›zurück bewegt‹.4 Die To-
talität des Geschichtsprozesses wird für den Betrachter lediglich erkennbar über die
Annahme einer Parallele zwischen zeitlich zurückliegender, archaischer Eigenkul-
tur und räumlich entfernten, primitiven Fremdkulturen.5 Schillers Geschichtsauf-
fassung prägt einen für die Aufklärungshistorie typischen, in seinen Ausläufern bis
ins 20. Jahrhundert wirksamen (kulturellen) Evolutionismus. In diesem Postulat
eines stetigen geschichtlichen Fortschritts stecken zwei, aus heutiger Sicht proble-
matische Annahmen: ein teleologisches Prinzip und eine Betrachtung der Vergan-
genheit als Vorgeschichte der Gegenwart.
Gegen eine teleologische Geschichtsauffassung und gegen ein evolutionäres Ver-
ständnis von Geschichte wendet sich etwa der kultursemiotische Ansatz von Yuri
M. Lotman. Mit Rekurs auf dynamische Prozesse in kybernetischen Modellen ver-
steht dieser stattdessen die Geschichte als offenen Prozess, der durch Unvorherseh-
barkeit, Zufall und Indeterminiertheit geprägt ist. Aus der Tatsache, dass Texte (im
weitesten Sinn) der Gegenstand der historischen Wissenschaften sind, resultieren
2 Vgl. Schlögel: Räume und Geschichte, S. 33.
3 Vgl. Schiller: Werke und Briefe, Bd. 6, S. 411–431. Auch Hans Robert Jauß’ Überlegungen
zur Literaturgeschichte setzen bei Schillers Rede an, vgl. Jauß: Literaturgeschichte als Provoka-
tion, S. 147–149.
4 Vgl. Schiller: Werke und Briefe, Bd. 6, S. 426–428.
5 Vgl. ebd., S. 417f. Zur Ausbildung dieser Vorstellung einer Übersetzbarkeit von räumlicher
Diversität in zeitliche Stufenfolgen vgl. Gisi: Einbildungskraft und Mythologie, insbes. S. 80–
149.
F4717-Antonsen.indd 70 03.12.2008 11:04:57 Uhr
TOPOGRAFIE UND TOPOLOGIE 71
für den Historiker nach Lotman zwei unvermeidbare Verzerrungen: Erstens unter-
stellt die syntagmatische Linearität der Narration eine Kausalitätsrelation zwischen
den Ereignissen selbst. Zweitens folgt der Historiker der dem geschichtlichen Ab-
lauf entgegengesetzten Blickrichtung, was zur Folge hat, dass ihm Ereignisfolgen
determiniert erscheinen, die eigentlich auf die unvorhersagbaren Entscheidungen
von Individuen zurückgehen und somit undeterminiert sind.6
Auch der Anthropologe Claude Lévi-Strauss stellt die Vorstellung, geschichtli-
cher Fortschritt verlaufe in eine Richtung und sei notwendig und kontinuierlich,
in Frage. Entscheidend ist nach ihm nicht die genetische Entwicklung einer Kultur,
sondern die räumliche Dispersion unterschiedlicher Kulturformen und ihr jeweili-
ger Vernetzungs- und Heterogenitätsgrad. Kulturelle Unterschiede seien folglich
nicht Ausdruck einer »zeitlichen Stufenfolge«7, sondern der räumlichen Differenz.
Die als Ende der großen Erzählungen und geschichtsphilosophischen Suche
nach einem Sinn in der Geschichte verkündete Posthistorie hat sich zwar selbst als
etwas vorschnelle Spekulation über das ›Ende‹ der Geschichte erwiesen. Gleich-
wohl resultierte aus der geschichtsphilosophischen Selbstreflexion eine Differenzie-
rung der Vorstellungen von der historischen Zeit. Bis vor ein paar Jahren fand hin-
gegen die Frage nach der Relevanz der Kategorie des Raums für die historischen
Wissenschaften weitaus weniger Beachtung. Aber gerade angesichts der enormen
Aufmerksamkeit, die dem Raum in den letzten Jahren in den Kulturwissenschaften
zuteil wurde, scheint es angebracht, den Stellenwert des/der so genannten ›spatial‹,
›topographical‹ und/oder ›topological turn(s)‹ für die Literaturgeschichtsschrei-
bung zu reflektieren.
2. Vom Geodeterminismus zur Geopolitik:
Traditionen der Literaturgeschichte
Tatsächlich wurde in neuerer Zeit eine Vernachlässigung der »geographisch-räumli-
chen Bedingungen« gegenüber dem »Aspekt historisch-zeitlicher Determination«8
in der Literaturgeschichtsschreibung beklagt und deren Korrektur insbesondere
durch eine kulturwissenschaftliche Orientierung der Literaturwissenschaft gefor-
dert. Aber um sich nicht vorschnell der Forderung nach einer Neuausrichtung der
Disziplin anzuschließen, sei ein Blick auf die Geschichte der Disziplin geworfen.
Literaturgeschichte, wie sie sich um 1840 als Wissenschaft, Gegenstand und Gat-
tungsbezeichnung zugleich durchsetzt,9 widmet sich der Ausbildung einer Natio-
nal-Literatur von ihren Anfängen bis zu ihrem Höhepunkt und ist somit auf die
Kausalität und Finalität historischer Entwicklungen zentriert. Geht man aber etwas
6 Vgl. Lotman: Universe of the Mind, S. 217–237.
7 Lévi-Strauss: Rasse und Geschichte, S. 34, vgl. ferner ebd., S. 68–75.
8 Stellmacher: Raum und Zeit, S. 289 u. 291.
9 Vgl. Weimar: Literatur, Literaturgeschichte, Literaturwissenschaft, S. 18f.
F4717-Antonsen.indd 71 03.12.2008 11:04:57 Uhr
72 LUCAS MARCO GISI
weiter zurück, dominiert nicht die historische Zeit, sondern der geografische Raum
die literaturkritischen und -historischen Diskurse.
Im Rahmen der Querelle des Anciens et des Modernes sehen sich um 1700 die Par-
teigänger der ›Alten‹ gezwungen, zur Begründung des Vorzugs der Leistungen der
Antike (zumindest) im Bereich der Kunst und Literatur einen kulturellen Relativis-
mus zu verfechten. Verantwortlich für kulturelle Blütezeiten sind demnach die
günstigen physikalischen Bedingungen, insbesondere das Klima, die Luft und der
Boden, eines bestimmten Kulturraums zu einer bestimmten Zeit. Da sich die phy-
sikalischen Bedingungen erstens je nach geografischer Lage unterscheiden und sich
zweitens mit der Zeit ändern können, bilden sie die Ursachen kultureller Entwick-
lung(en).
Solche Überlegungen prägen die Réflexions critiques (1719) des Abbé Jean-Bap-
tiste Dubos, der die spezifischen Ausprägungen des »Genies« und den jeweiligen
»Charakter der Nationen«10 vornehmlich auf die Luftbeschaffenheit zurückführt.
Orientiert an den Versuchen des schottischen Altphilologen Thomas Blackwell, die
Umstände zu eruieren, die Homers literarische Ausnahmeleistungen ermöglichten,
sucht Johann Jakob Bodmer nach den Ursachen für die kulturelle Blüte der Stau-
ferzeit und kommt zum Schluss, dass in Deutschland damals nicht nur politisch,
sondern auch physikalisch ein angenehmeres Klima geherrscht haben müsse.11
Auch Johann Gottfried Herder untersucht literarische Werke als historische Pro-
dukte einen spezifischen Kulturraumes, beispielsweise wenn er die ›Geschlossen-
heit‹ der griechischen Tragödie mit der ›Offenheit‹ von Shakespeares Historiendra-
ma vergleicht.12 Zwar interessiert die sich innerhalb des Historismus ausdifferen-
zierende Nationalliteratur-Geschichtsschreibung vornehmlich das zeitliche ›Zu-
sich-Kommen‹ des Nationalgeistes, aber auch die Kategorie des Raums spielt,
weniger direkt hinsichtlich der geografischen Erstreckung der Nation als indirekt
über die Annahme einer geografisch-physikalischen Prägung dieses Nationalgeis-
tes, nach wie vor eine wichtige Rolle.13
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erklingen die Aufrufe zur stärkeren Berücksich-
tigung des Raums bei der literaturhistorischen Betrachtung vornehmlich von Sei-
ten einer sich als Wissenschaft konstituierenden Volkskunde. In seiner Rektoratsre-
de von 1907 fordert August Sauer eine Erweiterung der Literaturgeschichte durch
eine »stammheitliche[ ] Volkskunde«, worunter dieser eine Betrachtung des Men-
schen (und analog des Dichters) als ein »Produkt des Bodens, dem er entsprossen
ist«14, versteht. Sauer präludiert damit Josef Nadlers Literaturgeschichte der deut-
schen Stämme und Landschaften (1912ff.), dessen einer nationalistischen Ideologie
10 Dubos: Kritische Betrachtungen, Bd. 2, insbes. S. 136–298, zit. S. 284.
11 Vgl. Blackwell: An Enquiry, insbes. S. 3–12, u. Bodmer u. Breitinger: Sammlung Critischer
Schriften, 7. Stück, S. 25–53.
12 Vgl. Herder: Werke, Bd. 1, S. 526–572.
13 Vgl. Weimar: Literatur, Literaturgeschichte, Literaturwissenschaft, S. 15f., u. Fohrmann: Das
Projekt der deutschen Literaturgeschichte, S. 69–125.
14 Sauer: Literaturgeschichte und Volkskunde, S. 31 u. 21.
F4717-Antonsen.indd 72 03.12.2008 11:04:57 Uhr
TOPOGRAFIE UND TOPOLOGIE 73
geschuldete »Literaturgeographie« auf einer Kausalität zwischen Raum (Nation),
Bevölkerung (Stamm) und Kultur (Literatur) basiert.15 Eine Konsequenz der Auf-
ladung geodeterministischer Konzepte zu einer rassistischen Blut-und-Boden-
Ideologie für ein ›Volk ohne Raum‹ während des Dritten Reiches war die weitge-
hende Tabuisierung der Raumfrage innerhalb der Nachkriegsgermanistik. Die Per-
manenz des geopolitischen Denkens des 19. Jahrhunderts lässt sich jedoch, wie
jüngst gezeigt wurde, gerade in der literarischen Semantik bis in unser Jahrhundert
nachweisen.16
Mit diesen wenigen Hinweisen sollte deutlich gemacht werden, dass die Katego-
rie des Raums nicht – wie man vielleicht aus heutiger Sicht auf den Historismus des
19. Jahrhunderts gerne annehmen möchte – einen blinden Fleck der Literaturwis-
senschaft bezeichnet, sondern im Gegenteil geodeterministische und -politische
Theoreme die literaturhistorische Reflexion seit ihren Anfängen mitprägen. Das
Determinismusproblem und der Ideologieverdacht erklären aber auch, wieso die
Kategorie des Raums in der neueren Literaturwissenschaft weitgehend in den Hin-
tergrund getreten ist.
3. Von der Topografie zur Topologie:
Der Raum der Literaturgeschichte
Und doch ist der Raum als wissenschaftliche Kategorie plötzlich wieder da. So stell-
te etwa Michel Foucault fest, dass sich die Gegenwart im Gegensatz zu dem von der
Geschichte geprägten 19. Jahrhundert als »Zeitalter des Raumes«17 begreifen lasse.
Tatsächlich ist durch den ›spatial turn‹ der letzten Jahre der Raum geradezu zu ei-
nem Leitparadigma der Kulturwissenschaften geworden.18 Hinter diesem Schlag-
wort versteckt sich eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Ansätze, wobei sich hin-
sichtlich der Relevanz der Kategorie des Raums für die Literaturgeschichte in syste-
matischer Hinsicht drei Schwerpunkte lokalisieren lassen: erstens die Wechsel-
wirkung zwischen physikalischem Raum und Literatur, zweitens die Formen der
literarischen Raumrepräsentation bzw. -konstruktion und drittens die methodische
Verwendung von Raummetaphern. Ohne auf Einzelbeispiele einzugehen, versuche
ich, diese Ansätze kurz zu umreißen.
Ein erstes Forschungsfeld bildet also die Untersuchung der Prägung der Litera-
turgeschichte durch den jeweiligen Raum. Ansatzpunkte dazu könnten Fernand
Braudels Überlegungen zu einer Géohistoire liefern.19 Indes bildet der bereits ge-
nannte Geodeterminismus das Hauptproblem solcher Ansätze. Zudem wird hier
mit einem aus heutiger Sicht problematischen absoluten Raumbegriff operiert.
15 Vgl. Neuber: Nationalismus als Raumkonzept.
16 Vgl. Werber: Die Geopolitik der Literatur.
17 Foucault: Von anderen Räumen, S. 931.
18 Vgl. Bachmann-Medick: Cultural Turns, S. 284–338.
19 Vgl. Braudel: Géohistoire.
F4717-Antonsen.indd 73 03.12.2008 11:04:57 Uhr
74 LUCAS MARCO GISI
Gleichzeitig besteht ein gewisser Spielraum, wenn nicht von nationalen Bezugsgrö-
ßen ausgegangen wird, sondern beispielsweise Phänomene der Interkulturalität
oder das Spannungsfeld zwischen Regionalismus und Globalisierung untersucht
werden. In dieser Perspektive ist es aber vice versa eher die Literatur als Medium der
Raumgestaltung, welche die Ausbildung von Kulturräumen (mit-)bestimmt.
Mit dem zweiten Ansatz ist zunächst nicht mehr als eine Geschichte der Darstel-
lung realer Räume in der Literatur – jeweils in Abhängigkeit von zeitgenössischen
Raumkonzepten der Wissenschaften und Zeitdiskurse – gemeint.20 Gleichzeitig
sind aber auch Untersuchungen zur Darstellung von Sachverhalten durch Ver-
räumlichung dazuzurechnen, sei es die erzählerische Umsetzung von Zeit in
Raum(-metaphern) im Sinne von Michail Bachtins Chronotopos-Begriff, sei es die
Darstellung abstrakter Sachverhalte als räumliche Oppositionen im Sinne Lot-
mans. Gegenüber diesen Ansätzen setzen neuere kulturwissenschaftliche Arbeiten
bei der Feststellung an, dass der Raum immer relativ zum Beobachter ist und somit
selbst eine kulturelle Konstruktion darstellt. Die Abhängigkeit der Struktur von
Räumen von ihrer Sinnfunktion betont bereits Ernst Cassirer21, während Michel
de Certeau deutlich macht, wie der Raum durch kulturelle Praktiken erst erzeugt
wird.22 Die Konsequenzen dieser kulturalistisch-konstruktivistischen Neubestim-
mung des Raumbegriffs äußern sich in einem ›topographical turn‹, indem der Fo-
kus auf die Untersuchung von Repräsentationsformen realer und imaginärer Räu-
me, den Topografien, gelegt wird.23
Zur Hinwendung zur Topografie ist in jüngster Zeit ein neu erwachtes Interesse
der Kulturwissenschaften an einer Topologie hinzugekommen.24 Topologie meint
die Raumbildung als Denkoperation wie auch mittels spezifischer (Kultur-)Techni-
ken, wobei phänomenologische oder strukturalistische Zugänge zunächst auf eine
Identifizierung von Äquivalenzen zielen. Auf die Methoden der Literaturwissen-
schaft bezogen – und dies wäre das dritte Anwendungsfeld – könnte das heißen,
nach der Relevanz von Raummetaphern für literaturhistorische Rekonstruktionen
zu fragen. Zwar wird (Literatur-)Geschichte den Zwängen einer narrativen Dar-
stellung selten entgehen und hierin der Linearität der Sprache folgen müssen. Hin-
gegen können Raummetaphern bei der Konzipierung von Modellen zur Anord-
nung und Abbildung literaturhistorischer ›Fakten‹ durchaus fruchtbar angewendet
werden. Insbesondere, weil sie geeignet scheinen, um Diskontinuitäten oder Syn-
chronien innerhalb historischer Figurationen zu erfassen. So ließe sich Literaturge-
schichte etwa anhand der Erforschung von Konstellationen, das heißt des wechsel-
seitigen Zusammenhangs zwischen Theorien und Personen25, oder der Analyse von
20 Vgl. Weigel: Zum ›topographical turn‹, S. 157–159.
21 Vgl. Cassirer: Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum.
22 Vgl. Certeau: Kunst des Handelns, S. 215–238.
23 Vgl. Weigel: Zum ›topographical turn‹ u. Günzel: Raum – Topographie – Topologie, S. 18–21.
24 Vgl. Günzel: Raum – Topographie – Topologie u. Borsò: Grenzen, Schwellen und andere Orte.
25 Vgl. insbes. die Beiträge der beiden Herausgeber in Mulsow u. Stamm: Konstellationsfor-
schung, S. 31–97.
F4717-Antonsen.indd 74 03.12.2008 11:04:57 Uhr
TOPOGRAFIE UND TOPOLOGIE 75
Netzwerken betreiben. Eine Alternative zu genealogischen Modellen könnte auch
das von Deleuze und Guattari vorgeschlagene Modell des Rhizoms bieten.26 Kon-
krete Versuche, wie eine Literaturgeschichte anhand von Raummodellen aussehen
könnte, hat jüngst Franco Moretti vorgelegt, indem er die Karte und den Baum als
Modelle zur Erfassung und Darstellung literaturhistorischer ›Fakten‹ verwendet
hat.27
Das Hauptinteresse – so lassen sich die neueren Ansätze auf einen gemeinsamen
Nenner bringen – liegt auf den kulturellen Praktiken der Konstruktion und Reprä-
sentation von Räumen. Literatur als Medium ist selbst eine dieser Praktiken und
zugleich ein ›Ort‹, um letztere zu reflektieren. Das Ziel einer Literaturwissenschaft,
die Aspekte der Topografie und Topologie berücksichtigt, müsste somit ein Beitrag
zu einer historischen Semantik kultureller Räume sein. Eine Literaturgeschichte
des Raums – in seinen unterschiedenen Bedeutungen – gilt es indes noch zu schrei-
ben. Zu welchem Ende studiert man nun also Literaturwissenschaft? Um Literatur
als kulturelle Hervorbringung geschichtlich zu ›verorten‹. Damit ist noch nicht ge-
klärt, was Literaturwissenschaft ist, aber vielleicht angedeutet, was Literaturwissen-
schaft nach dieser Auffassung (auch) sein könnte: eine historische Topografie und
Topologie der Literatur.
26 Vgl. Deleuze u. Guattari: Tausend Plateaus, S. 11–42.
27 Vgl. Moretti: Graphs, Maps, Trees.
F4717-Antonsen.indd 75 03.12.2008 11:04:57 Uhr
F4717-Antonsen.indd 76 03.12.2008 11:04:57 Uhr
Sabine Haupt (Freiburg/Schweiz)
EIN HEIZER.
ANLEITUNG ZUR SELBSTVERWIRKLICHUNG
Würde mich jemand fragen: »Zu welchem Ende studiert man Literaturwissen-
schaft?« müsste ich spontan antworten: bis zu ihrem bitteren! Bis eben alles aus-
und leergeforscht ist und man endlich wieder einfach nur lesen darf. Bis ans Ende
aller Sätze und Fragen – Punkt. Doch gemeint wäre mit der Frage wahrscheinlich
ganz etwas anderes. Vermutlich etwas wie: Muss das wirklich sein? Gibt es über-
haupt irgendeine Notwendigkeit, Literaturwissenschaft zu studieren? Etwas, das
mit Existenz und Sinn und Bestimmung zu tun haben könnte? Gibt es einen inne-
ren Zwang, eine Art Berufung, etwas, das junge Menschen mit Macht in schlecht
geheizte Bibliotheken und überfüllte Seminarräume zieht? Und, ganz praktisch
und lebensberaterisch gedacht: Was soll man einem empfehlen, der ausgerechnet
hier die Sinnfrage stellt? – Ich persönlich wäre überfragt, ganz ehrlich. Doch zum
Glück wird gewiss nie einer den Weg zu mir finden, bis zu mir herab steigen, leise
an meine Türe pochen, Eintritt begehren, um mich sodann mit seinem heiligen
Lebensernst zu belästigen. Und so besitze ich alle Freiheit & Freizeit dieser Welt,
Dunkles durchzuspielen: schwierige Schacheröffnungen, den Untergang des
Abendlands, die typischen Kinderfragen der Philosophen, und (warum nicht?) so-
gar solche Kleinigkeiten wie die Sinnkrise der Literaturwissenschaft.
Wozu Dichter in dürftiger Zeit? fragte Hölderlin. Und wenn der es schon nicht
wusste, darf man wohl getrost etwas länger darüber nachdenken. Wozu – könnte
die aktuelle Anverwandlung dieser Urfrage lauten – soll man die asklepiadeische
Odenstrophe pauken oder begreifen, was Derrida unter ›différance‹ verstand? Soll
man das nur lernen oder auch behalten? Nur fürs Examen oder gleich fürs ganze
Leben? Und wenn ja, für welches? »Niemand kann Ihnen raten und helfen, nie-
mand«, schrieb Rilke einem jungen Dichter, »Es gibt nur ein einziges Mittel. Ge-
hen Sie in sich. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt; prüfen Sie, ob
er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt, gestehen Sie sich
ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde zu schreiben.« In der
»stillsten Stunde der Nacht« solle sich der junge Dichter dann fragen: »muss ich
schreiben«? Nur wenn – so Rilke weiter – dieser höchste Grad der Notwendigkeit
erreicht sei, dürfe er seinem »Drange« nachgeben.
Nun, so fragen wir uns heute – da oben in den Hörsälen wie hier unten in den Ge-
wölben – welcher Drang vermag solchem Anspruch wohl standzuhalten? Würden
heutige Dichter auf Rilke hören, bräche gewiss recht bald das gesamte Buchwesen
zusammen: einige wenige Verleger, Kritiker und Buchhändler wären einzig damit
F4717-Antonsen.indd 77 03.12.2008 11:04:57 Uhr
78 SABINE HAUPT
befasst, die ebenso raren überlebenden Autoren (das heißt diejenigen, die siegreich
durchs Fegefeuer kritischer Selbstprüfung gelangt und damit vom sicheren Tode
der Unberufenheit erlöst wären) nach allen Regeln der Kunst zu hegen und zu pfle-
gen, zu hätscheln und zu tätscheln, mit netten Drinks, bequemen Sesseln und Ren-
tenansprüchen zu versorgen, bis aus diesem ursprünglich und urwüchsig der exis-
tentiellen Not geschuldeten Berufsstand ein Klüngel fettleibiger, selbstzufriedener
Ruhmjunkies geworden wäre, bei dessen unerfreulichem Anblick Originalgenies
wie Rilke oder Hölderlin in ihrem kühlen Grabe gewiss ein paar elegische ›Roula-
den‹ gedreht hätten.
Wie stark also muss der Drang sein, um legitim zu erscheinen? Und wann spätes-
tens sollte man ihm nachgeben? Die Literaturgeschichte sowie das eigene berufsbe-
ratende Kopfkino kennen hier verschiedene Szenarien, um ans Ziel zu gelangen:
Sie reichen von Goethes Ritt nach Sesenheim, über Virginia Woolfs Tintenfass-
mord an ihrem gezähmten Hausengel bis hin zur tautologischen Erkenntnis des
Schweizer Dramatikers Lukas Bärfuss: »Schreiben verschafft einem Menschen eine
Existenz als Dichter. Er lebt als Dichter, er denkt als Dichter, er schreibt als Dich-
ter.« Der gemeine Literaturwissenschaftler hingegen lebt als Beamter, denkt als
Oberlehrer und schreibt als Bandwurm. Frei tänzelnde oder abgründig schlurfende
Geniehaftigkeit ist bei ihm ausdrücklich und vordenklich nicht erwünscht. Hier
drängt der Drang a priori in methodische und historische Bahnen, wird ab- und
umgelenkt, subsumiert und sublimiert und schließlich auf wissenschaftshygienisch
vorteilhafte Weise in eines der vorgewärmten Betten kanalisiert. Dort rinnt und
blubbert er dann schadstofffrei so vor sich hin. Manche betreiben damit gemächli-
che Quellenkunde, andere, von eher teleologischem Temperament, bewegen sich
mit Verve in die entgegen gesetzte Richtung, lassen Gedanken in eifrige Systeme
münden oder verströmen sich assoziativ im Ozean ihrer angelesenen Enzyklopädie.
Ich mache da keine Ausnahme, auch ich habe meine Methode: hier, in meinem
Kellerloch, steht auf jedem Rohr ein Spruch: »Man kann einen Menschen nichts
lehren, man kann ihm nur helfen, sich selbst zu entdecken (Galileo Galilei)« oder:
»Gedanken sind nicht stets parat, man schreibt auch, wenn man keine hat. (Wil-
helm Busch)«. Und wenn der abblätternde Putz die Schrift korrumpiert, alles unle-
serlich macht, wird eben rasch etwas Neues darüber gepinselt. Manche Kollegen
nennen so etwas dann gerne ›Palimpsest‹, und das ist, wenn der Galilei durch den
Busch hindurchschimmert oder umgekehrt. Ich hingegen klopfe einmal kräftig
auf ’s Rohr, und wenn der Spruch dann hält, bin ich’s zufrieden. Hier unten kommt’s
auf die Terminologie nicht mehr so an.
Für unser zivilisatorisch gewiss hochwertiges Tun haben wir jedoch – im Gegensatz
zum Schriftsteller, der ja nichts gelernt hat, außer eben seinem inneren Drange zu
folgen – keinerlei Ausreden. Wir können nicht behaupten: »Ich musste diese Re-
zension schreiben, weil ich sonst todkrank geworden wäre« oder: »Wenn ich diese
Handschrift nicht herausgebe, ist mein Leben verpfuscht«. Wir können so etwas
allein schon deswegen nicht sagen, weil niemand es uns glauben würde. Denn rein
F4717-Antonsen.indd 78 03.12.2008 11:04:57 Uhr
EIN HEIZER 79
ökologisch betrachtet, das heißt hinsichtlich unserer Stellung in der Nahrungsket-
te, sind wir ja nur Hyänen und Aasgeier, die auf einigen erlesenen Literatur- und
Kulturleichen hocken (man spricht euphemistisch auch gerne von ›Textkörpern‹),
diesen die letzten Pikanterien aus den vergilbten Knochen zerren und picken, wäh-
rend uns die untergehende Sonne am Horizont zu immer effizienterer Entbeinung
gemahnt. Wer kann schon den Schnabel halten, wenn das corpus delicti über Jahr-
zehnte und Jahrhunderte in aller Munde verwest? Dies freilich gilt nur für die Ent-
sorgung der Klassiker. Bei AutorInnen der Gegenwart ist die ökologische Funktion
des Literaturwissenschaftlers eine andere. Hier besetzt er gewissermaßen die syste-
mische Nische des Schmarotzers bzw. des anämischen (und saisonbedingt biswei-
len blutrünstigen) Vampirs, der lebendige Kunst in tote Analyse verwandelt und
dabei – in aller Regel – mindestens das Doppelte der Ausgesaugten verdient, ver-
mutlich als Entschädigung für das entgangene symbolische Kapital.
Manch einem dieser wehrlosen, der hermeneutischen Gier preisgegebenen Kadaver
(Charogne!) gelingt es allerdings, sich dem Zugriff, post mortem, zu entziehen, in-
dem er seine Nahrhaftigkeit listig verschleiert oder, noch perfider, qua Selbstentlei-
bung und/oder Schnellverwesung der Hand des Leichenfledderers zuvorkommt.
Und wenn sich der professionelle Zergliederer dann mit Heißhunger und inbrüns-
tiger ›Lust am Text‹ auf einen solchen, in subversiver Fäulnis vorverwesten Sprach-
und Textleib, zum Beispiel einen Holzschen oder Jandlschen Klangtorso, stürzt,
sich dabei mit seinem Textbegehren aber die Zähne ausbeißt – denn was ließe sich
aus einem fauligen Schwall wie:
… wenn du haben verloren / den zusammensetzen von Worten zu satzen, wenn
du haben verloren / den worten überhaupten, sämtlichen Worten, du haben /
nicht einen einzigen worten mehr: dann du vielleicht / werden anfangen leuch-
ten, zeigen in nachten pfaden / denen hyänen, du fosforeszierenden aasen!),
anderes deduzieren als die radiküle Selbstzerfleischwerdung und Selbstzersatzung
des Wundwindwortes? – bleibt die bissige »Rache des Intellekts an der Kunst« für
einmal ungestillt. Frau Sontag möge verzeihen. Hungrig schnüren wir weiterhin
um den Brei, mutmaßen missmutig dieses und jenes; und wenn ein Unglücklicher
mich in solchen Momenten tatsächlich fragt: »Wozu hast du eigentlich Literatur-
wissenschaft studiert?«, verspeise ich ihn anstelle des Textes. Die Keller der Univer-
sitäten sind schalldicht, das hat man mir garantiert, als sie mich nach unten brach-
ten.
Freilich gibt es unter Literaturwissenschaftlern auch ein paar Schummler und
Schmuggler, haltlose Individuen, die ihren Drang schlecht beherrschen und heim-
lich unter der Bank Gedichte schreiben, diese dann allerdings meist wieder verwer-
fen, weil es nicht einmal für die Schublade reicht. Andere wieder haben ernstere
Ambitionen, wollen es eingebildeten Autoren wie Egon Kunstmann oder Friederi-
ke Säusel mal so richtig zeigen, sie, diese Erzfeinde, die sich nicht entblöden, tat-
sächlich ›Kunst‹ zu betreiben, sich narzisstisch in jeder Talkshow spreizen und in
F4717-Antonsen.indd 79 03.12.2008 11:04:57 Uhr
80 SABINE HAUPT
ihrem kreativen Dünkel glauben, mit eitlem Geschmiere in die Weltliteratur einzu-
gehen (Doch weit gefehlt! Diese heil’gen Hallen weiß die Zunft gottlob vor bübi-
scher Entweihung zu schützen!), demütigen, sprachlos machen, indem sie nun ih-
rerseits mit einem ›richtigen‹ Roman aufwarten, das heißt mit dem ganz großen
Wurf, welcher unbeschadet postmoderner Anfechtungen gewiss zum Weg weisen-
den Klassiker des neuen Jahrtausends würde, wären da nicht die lieben Kollegen,
die bereits Schenkel klopfend zum Hallali blasen. Der große Roman ist freilich
immer nur Plan B, geeignet für die Zeit nach der Pensionierung/Emeritierung,
wenn das Brot allmählich wieder dem Geiste weicht. Plan A heißt nach wie vor:
Wissenschaft, Analyse, oft gnadenloser Verriss oder, sofern man sich direkt im Be-
trieb einrichten möchte, ebenso gnadenlose Lobhudelei.
Schillers idealistisches Geschwätz vom »philosophischen Geist«, der keinerlei
Fleisch- und Brothunger verspüre und sich daher weder an wehrlosen Textkörpern
noch an unschuldigen Gedanken vergehe, kann ich freilich nicht nachvollziehen.
Hier unten ist es viel zu heiß für solch naives Getue, ein aufgeblasener Gutmensch
könnte unter solch schwülen klimatischen Bedingungen wohl kaum überleben.
Wenn ich denen da oben so richtig einheize, bis mir der Schweiß (und nicht wie
früher die Tinte, als ich noch in den höheren Stockwerken verkehrte!) aus der
»schlaffen Seele« tropft, dann frage ich mich, wie der im Revolutionsjahr 1789 von
Schiller diagnostizierte »rasche Wechsel von Finsternis und Licht« so ganz ohne
Kohle wohl stattgefunden haben mag. Hier im Haus ist sie jedenfalls der Motor,
der Lichtschalter, die Mutter aller Dinge, der Stoff, an dem sich alle wärmen, und
ich, der Heizer, sorge (mit Rat & Tat!) für die richtige Wohlfühltemperatur – solan-
ge jedenfalls, bis der Solarenergie entsprechende Zellen unterm Dach frei geräumt
werden. Doch bis dahin wird Wissenschaft weder hitze- noch staubfrei sein.
Wir haben also keine Ausrede. Wer Literaturwissenschaft studiert hat, hat etwas
Anständiges gelernt. Und wenn einer das Gegenteil behauptet, was ja durchaus
vorkommen soll, und zwar häufiger als man sich das im Ghetto der eigenen Fakul-
tät vorzustellen vermag, wenn also so ein Manager-Fuzzi, Hirnforscher, Bezirks-
staatsanwalt, Apotheker, Fleischhacker, also einer von den Nutztieren, möchte man
fast sagen, eben dieses Gegenteil behauptet, sich hinstellt und unsere Zunft einfach
nicht ernst nimmt, dann entgegnen wir diesem Unfug mit einem überlegenen Lä-
cheln, zitieren Schiller oder sogar den Philosophen Wilhelm Schmidt-Biggemann
(FU Berlin), der kürzlich behauptete – und das unterschreiben wir natürlich alle
mit Tinte UND Blut – das Wesentliche an den Geisteswissenschaften sei die Phan-
tasie. Er meinte damit, man traue es sich zu, die »Dinge einfach durchzudenken«.
Dabei, so Schmidt-Biggemann, gehe es »nicht darum, ob diese Dinge richtig oder
falsch sind, sondern allein darum, dass sie erst einmal da sind«. Bravo! Solchen Mut
zur Lücke, diese ontologische Bescheidenheit brauchen die Klassiker von morgen.
Denn allein das bohrende ›Wozu?‹ ist ja schon hoch verdächtig. Frage ich mich et-
wa, wozu ich hier unten durch die Gänge trabe, Kohlen schleppe und schaufle?
Damit die da oben es schön warm und gemütlich haben und beim Denken nicht
F4717-Antonsen.indd 80 03.12.2008 11:04:57 Uhr
EIN HEIZER 81
ins Schwitzen geraten oder einen gar zu kühlen Kopf bekommen, was sonst? Aber
auf ’s »interesselose Wohlgefallen« und die »Entkoppelung von Arbeit und Denken«
lasse ich – auch im Schweiße meines Angesichts – nichts kommen. Diese Lektion
habe ich gelernt, das könnte ich noch unter dicksten Staubschichten herauf- und
herunterzitieren. Den anderen geht es offenbar ähnlich. Sammelbände zur neuen
Rechtfertigungslehre mit Titeln wie »Das Ende der Bescheidenheit« oder: »Wir
basteln uns eine soziale Identität« verschicke ich täglich per Rohrpost nach oben.
Dort werden sie gebraucht, wie das tägliche Brot.
Und haben wir das Zitieren einmal hinter uns, gehen uns im kulturell erweiterten
Universum tatsächlich mal die passenden Argumente aus, schwätzen wir uns, nicht
(mund-)faul (Vorbild Schiller!), einfach schnell und geschmeidig durch’s ganze
Problem hindurch, reden uns was zurecht von Lesekompetenz, analytischem Denk-
vermögen, humanistischer Bildung, Klärung der Selbst- und Weltverhältnisse, kul-
turellem Gedächtnis, Kritikfähigkeit und dergleichen mehr. Und wir reden und
reden, so lange, bis dem Fleischhauer das Hackebeilchen auf die Gummistiefel fällt
und der Hirnforscher Kopfweh bekommt. Denn das gehört in unserem Fach ja so-
zusagen zum Kompetenzkernbereich: wenn wir eines beherrschen, dann das: dis-
ku-tie-ren! Rhetorik! Hermeneutik! Da sind wir sogar besser (weil skrupelloser und
hemmungsloser) als Theologen, Juristen oder Politiker. Wir bewaffnen uns mit ei-
ner Ladung übrig gebliebener Zitate, und los geht’s in den rhetorischen Schlagab-
tausch. Mit unserer Verve und unserem theoretischen Erfindungsreichtum disku-
tieren wir jeden beliebigen Gegner zurück in die sprachlose Vorgeschichte. Stein-
zeit! Schweigen! Ein Germanistikprofessor an einer Fakultätsratssitzung, ein
Deutschlehrer auf einer Notenkonferenz, ein Feuilletonredakteur bei der Morgen-
besprechung, ein Haus- und Heizmeister in der Portiersloge – sie alle ersetzen ei-
nen schlaffördernden Kamillentee oder das soporiphige Brummen der Klimaanla-
ge. Man nickt uns milde zu, weil man weiß, dass man jetzt ein wenig abschalten
kann, und man nickt ebenso freundlich, wenn wir unsere Ansprache endlich been-
den, weil nach uns eigentlich nur noch die Kaffeepause kommen kann. Alles ande-
re wäre wirklich eine Zumutung.
Selbstironie bzw. eine besondere Abart derselben gehört zum Handwerk. Germa-
nisten machen sich gerne über Germanisten lustig. Auch das haben sie mit den
Dichtern gemeinsam (man denke nur an Gottfried Benns und Arno Schmidts
Schimpftiraden über Goethes »Scheißverse«, seine »steifbeinige Geheimratsbehag-
lichkeit« und »gravitätische Stümperei«). Und so würde kein Literaturwissenschaft-
ler vom anderen behaupten, dieser betreibe so etwas wie ›Wissenschaft‹, ohne ein
grellrotes Paar Gänsefüßchen in sein kollegiales Urteil hineinbaumeln zu lassen.
Dass ich nun aber, statt weiterhin Diskurs und Jargon meines Fachs zu beflü-
geln, trotz wohlwollender Förderung hier unten im Keller tätig bin, entbehrt, ne-
ben der üblichen lebensgeschichtlichen Umstände, nicht einer gewissen fachge-
schichtlichen Konsequenz. Ich verkörpere – bisher allerdings noch als avantgardis-
tische Vorhut und befangen in einer gewissen ›splendid isolation‹ – den Typus des
F4717-Antonsen.indd 81 03.12.2008 11:04:57 Uhr
82 SABINE HAUPT
Existenz-Turners. Ich bin sozusagen mein eigener ›turn‹ und knüpfe damit in ge-
wiss recht innovativer Weise an den in der Literaturwissenschaft inzwischen gängi-
gen Prozess der permanenten Revolution, pardon: Metamorphose an. Bekanntlich
wird unsere Wissenschaftlichkeit seit dem Ende der so genannten Geistesgeschich-
te (der Weltgeist habe sie selig mitsamt ihrer verzopften Vorstellung von Sinn &
Form!) durch diverse ›turns‹ in Schwung & Trab gehalten, sodass wir uns in regel-
mäßigen Abständen – früher alle 10 Jahre, heute ca. alle 10 Monate – einmal um
uns selbst drehen und von hinten wieder einholen. Ermöglicht wird diese erstaun-
liche mentale Flexibilität vom quasi serapionistischen Blick, mit dem wir – in
hochromantischer Selbstentgrenzung – uns und unsere Wissenschaft kreativ beäu-
gen und immer wieder neu erfinden, meist im Schlepptau irgendeiner knallharten
Echtwissenschaft wie Linguistik, Geographie und Neurologie, oder in meinem
konkreten Fall, der Niduinquination, der Lehre von der thermodynamischen Un-
terwanderung großer Häuser. –
Am liebsten wäre uns natürlich die Mathematik als Dreh- und Angelpunkt eines
neuen Turns. Doch irgendetwas klemmt da im Theoriemechanismus: immer, wenn
sich wieder mal jemand an diesen Brocken heranwagt, sich redlich abmüht und
plagt, die Schönheit der Sprache durch formale Gesetze zu berechnen, endlich da-
für zu sorgen, dass sich der Nebel der Vagheit verzieht, das milchgraue Gespenst
des Ungefähren von seiner Beute ablässt und kreischend in den Orkus der Fachge-
schichte fährt, kommt irgend so ein Spielverderber dahergelaufen und beginnt zu
schwätzen, in typisch germanistischer Manier, bis einem die geordneten Sinne
schwinden und man das Denken, das mathematisch reine, wieder einmal auf über-
morgen verschiebt. – Ich berechne hier täglich den Druck meiner Rohre, überwa-
che die Temperatur des gesamten Kessels. Damit ist mein Bedarf sowohl an Zahlen
wie auch an Empirie weit gehend gedeckt; ich kann die rechenschwachen Kollegen
da oben sehr gut verstehen. Einem Legastheniker würde man ja auch kein Germa-
nistikstudium empfehlen. Und so ergeht es dem Positivismus nicht viel besser als
der Mathematik. Er soll ruhig noch ein wenig warten, bis er zur Hilfswissenschaft
geadelt wird, zumal er ja bereits an der Reihe war, einst ja ganz nett als Stallknecht
gedient und brav die Pferde gesattelt, das Stroh der frühen Jahre gedroschen hat.
Doch heute, wo Autoren im Sportwagen vorbeibrausen und uns eine lange Avant-
gardistennase drehen, dabei gnädig das ein oder andere Papierchen aus dem Fenster
streuen, über das wir uns, ganz ausgehungerte Meute am Straßenrand, mit Feuerei-
fer stürzen (ich selbst kehre den Kram bisweilen vom Treppenabsatz weg), ist – wo
war ich gleich stehen geblieben? – ein anderes Tempo angesagt. Wer heute noch die
Zeit hat, eine entlegene Handschrift zu entziffern oder komplizierte Variantenkol-
lationen anzufertigen, ist selbst Schuld. Wozu schließlich hat man Selbstdenken
und Mitdiskutieren gelernt und eines dieser kreativen ›Laberfächer‹ studiert?
Wie gesagt: Wer Literaturwissenschaft studiert hat, hat etwas Anständiges gelernt.
Da gibt es keine Ausrede. Ich sitze hier im Keller und verübe eine, gesamtgesell-
schaftlich gesehen, ehrenwerte, wenn auch leicht anrüchige Tätigkeit. Aus meinen
F4717-Antonsen.indd 82 03.12.2008 11:04:58 Uhr
EIN HEIZER 83
Studienkolleginnen und -kollegen sind ausnahmslos achtbare Zeitgenossen und
-genossinnen geworden. Wer nicht Journalist, Deutschlehrer oder Germanistik-
professor wurde, hat inzwischen umgesattelt, viele bereits während des Studiums.
Einer von ihnen arbeitet zum Beispiel heute als Tierarzt in einer bevölkerungsar-
men Gegend in Norddeutschland. Von einem zweiten weiß ich, dass er Wärmfla-
schen und Blutdruckmesser verkauft, sowie Stützstrümpfe und Windeleinlagen,
nachdem er sein Studium der Germanistik und Kunstgeschichte abgebrochen und
sich zum Drogisten ausbilden ließ. Viele haben im zweiten Semester eine solche
Stützstrumpfkrise. Plötzlich verspürt man das unabweisbare Bedürfnis, doch noch
etwas Sinnvolles aus seinem Leben zu machen. Etwas Besseres als Medizin fällt den
meisten allerdings dann doch nicht ein. Deswegen ist es unerlässlich, die Vorzüge
eines literaturwissenschaftlichen Studiums noch einmal in aller Deutlichkeit her-
aus zu streichen. Schlechte Ärzte hat dieses Land schließlich genug.
Da, wie gesagt, kein Studienanfänger je an meine Tür klopfen und um Hilfe bitten
wird – meist verliert sich der Ratsuchende bereits in den oberen Etagen, nie gelangt
er bis in die Eingeweide des Hauses – darf ich meinen unmaßgeblichen Gedanken
hier also einmal freien Lauf oder zumindest freies Geleit geben. Und so tagträume
ich von den vielen jungen Menschen, die, nachdem sie in den oberen Büros der
Psychologen und Studienberater so vieles über Assessmentphasen, Eignungstests,
Persönlichkeitsmanagement und Portfolios gehört haben, sich endlich, nach Stun-
den und Tagen, zu mir verirren, mit wirren Gedanken unter ungekämmtem Haar,
die Stufen hinuntertorkeln, mir sozusagen über die Schwelle rollen, wie reifes Fall-
obst nach dem ersten Hagel. »Ach, lass’ doch die Philister da oben«, flüstere ich ih-
nen ins Ohr, bitte und ziehe sie hinunter in mein Reich. Dort gibt es Kaffee und
Kuchen, auch den ein oder anderen höllischen Schnaps. Und ich sage: »Dieses Stu-
dium ist unbedingt zu empfehlen. Vor allem, wenn man für technische und mathe-
matische Berufe so ungeeignet ist wie du, mein Kleines, wenn man morgens nicht
so gern aufsteht und abends gerne ins Kino geht, Probleme lieber bespricht als sie
zu lösen, wenn man sich nicht die Hände schmutzig machen und auch keine
schwere Lasten schleppen möchte, wenn man ein Ding, statt es nachzubauen, lie-
ber von allen Seiten betrachtet, wenn einem das Flüchtige, der Wind und die
Schrift lieber sind als die Erde und das Metall.« So, in etwa würde ich sprechen,
dabei natürlich auch erwähnen, dass es heterosexuelle junge Männer in den Litera-
turwissenschaften noch kuscheliger haben als junge Frauen im Maschinenbau. Was
für diese die Rolle des blinden Huhns ist für jene die des Hahns im Korb. Maßge-
schneidert! Vor allem, wenn er es bis zum Assistenten bringt und bei den zahlrei-
chen Probevorlesungen der nächsten Jahrzehnte dann viel um die Welt kommt.
Herrlich! Heute in Flensburg, morgen in Kassel, übermorgen in Dortmund. –
Doch es fragt mich ja keiner.
Und deswegen fasse ich jetzt einfach hemmungslos zusammen: Literaturwissen-
schaft sollte man nur studieren, wenn man alles andere gewissenhaft geprüft und
verworfen hat. Was natürlich nicht bedeutet, dass man sich nach dem Abitur erst-
F4717-Antonsen.indd 83 03.12.2008 11:04:58 Uhr
84 SABINE HAUPT
mal einer Schlosserlehre zu unterziehen hätte oder sich zur Stewardess ausbilden
lassen sollte, um Himmels Willen! Solche gesellschaftlichen Schlüsselfunktionen
sind bereits in mentalen Vorspielen zu eliminieren. Wer auch nur mit dem Gedan-
ken spielt, Literaturwissenschaft zu studieren, ist für solche Berufe bereits nicht
mehr qualifiziert. Doch mit einem gut angelegten Gedankenexperiment lässt sich
vieles von vorn herein ausschließen. Das gilt für den ehrenwerten Beruf des Park-
wächters (nur morsche Blätter!) ebenso wie für denjenigen des Zollbeamten (von
Grenzgängern mit der Knarre im Anschlag Papiere einzufordern, widerstrebt mei-
ner pazifistischen Grundgesinnung). Anderes ließe sich ansatzweise durchaus ein-
mal anprobieren, zum Beispiel Bibliothekar (eine passende Alternative für alle, die
Bücher mögen, aber zu faul sind, sie selbst zu lesen), Frisör (der kümmert sich auch
um die Köpfe anderer Menschen, erlebt aber tagtäglich die Gnade eines sichtbaren
Resultats seiner Mühen) oder Architekt (die labern und schwafeln auch lauter wir-
res und unüberprüfbares Zeug, doch respektieren, wenn auch Zähne knirschend,
immerhin die Gesetze der Statik, und man kann in ihren Elaboraten – oh Wunder
– oft recht annehmlich wohnen, sodass man dem behaglichen Specksteinkamin in
der proportional ausgewogenen Dreiviertelstellung zur Terrasse gerne verzeiht, dass
man sich so viele Stunden mit seinem hochtrabend verschwiemelten ›Konzept‹
langweilen musste). Wenn also diese Alternativen erst einmal experimentell tag-
träumerisch durchlaufen und abgehakt sind, beginnt das eigentliche Problem. Hat
man nämlich endlich kapiert, warum man ausgerechnet Germanistik studiert und
eben nicht etwa Kirchenmusik, Informatik oder Zahnmedizin, sollte man bei die-
ser mühsam erworbenen Überzeugung auch bleiben. Da ein literaturwissenschaft-
liches Studium in der Regel (also außerhalb der Regelstudienzeit) viel mehr Zeit in
Anspruch nimmt als ein, na, sagen wir, Studium der Betriebswirtschaft, bleibt na-
türlich auch viel mehr Zeit für Zweifel. Es soll sogar Institute geben, in denen die
Kultur des Selbstzweifels implizit in den Studiengang integriert ist, zum Beispiel in
Form so genannter ›Methodenseminare‹, bei denen die Studierenden gewiss bei je-
der Sitzung die Vermutung beschleicht, sich im Raum geirrt zu haben. Ähnliches
gilt für die von freihändig und schöngeistig schwebenden Geistern bzw. von in ko-
ryphäischen Würden ergrauten Ordinarii regierten Oberseminare, in welchen sich
– nicht zuletzt angesichts des ganz gezielt erzeugten darwinistischen Klimas –
Selbstzweifel ganz automatisch, gewissermaßen als selbsterfüllende Prophezeiung
einstellen: »Bin ich dieser unendlichen Bibliothek überhaupt gewachsen, wie soll
ich mich da je zurechtfinden?«, oder: »Hätte ich nicht doch besser Medizin stu-
diert, Theater gespielt oder eine Banklehre durchgestanden, um mich ein bisschen
brauchbar oder sozial relevant zu fühlen, Spaß oder wenigstens Sicherheit zu ha-
ben?«
Auch in dieser entscheidenden Phase des Studiums, die etwa vom zweiten bis zum
vorletzten Semester dauert (bei besonders sensiblen Gemütern gibt es dann noch-
mals einen dramatischen Rückfall mitten in der Abschlussprüfung – und das sind
dann genau wieder die Momente, in denen sich für den prüfenden Exstudenten das
zu bewähren hat, was man unter ›weicher‹ Wissenschaft versteht), gibt es keine bes-
F4717-Antonsen.indd 84 03.12.2008 11:04:58 Uhr
EIN HEIZER 85
sere Entscheidungsfindung als das systematische Eliminieren von (noch schlechte-
ren) Alternativen. Denn seien wir doch ehrlich: welcher auch nur irgend gesunde,
nach Selbstentfaltung strebende junge Mensch käme ohne Not auf den Gedanken,
ein Fach zu studieren, das früher Philologie hieß und die Liebe (und damit natürlich
auch den Eros) sublimatorisch ans Wort bindet, wo – zumal in diesem Alter – sein
ganzes Wesen danach schreit, sich reallibidinös zu verströmen, auszubreiten, statt zu
binden und kleinkrämerisch auf jeden Buchstaben zu achten. Nein, mit 19 Jahren
sollte man sich schon sehr genau überlegen, ob es nicht besser ist, an der frischen
Luft zu arbeiten oder sich als Diskjockey und Reiseanimateur zu erproben.
Freilich gibt es auch bei uns diese Ausnahmeerscheinungen, die Frühberufenen und
Spätgeborenen, deren begnadetes Fachbegehren ein inkommensurables ist, die sich
schon morgens beim Aufwachen im Dachgeschoß der elterlichen Vorstadtvilla auf
die Vorlesung über althochdeutsche Grammatik freuten wie später auf die neueste
Ausgabe von ›Arbitrium‹, weil dort ein Verriss steht, mit dem sie der Assistentin des
verhassten Kollegen Hinterfux stellvertretend eins über den hochmütigen Schädel
brennen, zu Mittag bereits die beiden Gutachten für die Berufungskommission in
M. geschrieben haben (ein gutes und ein schlechtes, für alle Fälle, da man noch
nicht absehen kann, ob Kollegin F. den Kandidaten aus W. oder die Frau aus B. vor-
schlagen wird). Das sind die wahren Stützen unseres Fachs, die Überzeugten, von
keinerlei Skepsis Gehemmten/Verunreinigten, gremiengestählt, ubiquitär, als Gut-
achter, Herausgeber, Mitherausgeber, Vizedekan aktiv in Forschung (bisweilen auch
in der Lehre), unermüdlich und von bewundernswert ungebrochenem Eifer. Diese
Damen und Herren wollten im 2. Semester natürlich nicht Medizin studieren, sie
wussten ja bereits vor dem Abitur, dass für sie nur ein Leben im Dunstkreis der aller-
höchsten Kulturgüter und -geister in Frage käme. Manche von ihnen wussten sogar,
an welchem renommierten Institut sie einst Professor werden wollten. – Doch, wie
gesagt, bei diesem Typus handelt es sich um einen absoluten Sonderfall. Der ge-
wöhnliche, das heißt klassisch ambivalente Germanistikstudent stellt sich die Sinn-
frage täglich neu und täglich frisch. Da hilft es, wenn man die Sache vor dem Spie-
gel ein wenig einübt. Man stelle sich dabei vor, jemand sage einen Satz wie: »Sie als
Literaturwissenschaftler …« oder: »Was sagt eigentlich die Literaturwissenschaft zu
diesem Problem?« Man versuche sodann (immer mit prüfendem Blick in den Spie-
gel), ernst zu bleiben, die Brisanz der Frage zu erkennen und irgendwie ins Existen-
zielle abzubiegen. Nur so lässt sich ein gut geöltes Labertalent ungehemmt zum Ein-
satz bringen. Und das geht so: Leichtes Stirnrunzeln, Lesebrille (unabkömmliches
Requisit, unbedingt bald zulegen, ruhig auch schon bei 0,25 Dioptrien!) zurechtrü-
cken, leichtes, gepflegtes Räuspern, eventuell Fingerkuppen gespreizt aufeinander
zubewegen – so in etwa … Abweichungen werden durchaus toleriert, jedenfalls soll-
te man mimisch/gestisch irgendetwas einstudiert haben, das den habituellen Zwei-
fel elegant überspielt und dabei dennoch eine gewisse Aura von Langsamkeit und
Nachdenklichkeit zurück lässt, ohne allzu manieriert zu wirken.
F4717-Antonsen.indd 85 03.12.2008 11:04:58 Uhr
86 SABINE HAUPT
Nur so werdet ihr Krisen und Zweifel überstehen. Und ich sage euch – würde ich
zu all denen sagen, die sich doch noch zu mir verirren: Vergesst Schiller! Vergesst
die intrinsische Motivation! Das sture Beharren auf sachlichen Interessen ist dys-
funktional! Macht es wie die da oben: paukt die asklepiadeische Odenstrophe, aber
bitte nur für die Prüfung! Und wenn ihr dann bei Kaffee und Schnaps heulend in
meinem Kellerloch sitzt, verrate ich euch noch ein Geheimnis: Die wahren Elite-
Universitäten entstehen nicht in Mitteleuropa oder Nordamerika, da hilft weder
Tradition noch gefühlte Exzellenz, nein: die Zukunft liegt am Persischen Golf und
am Roten Meer. Dort wachsen sie, die Klippschulen der neuen Eliten, mit den Öl-
milliarden der Könige und Prinzen und dem philosophischen Geist emeritierter
Brotsäcke. Und wenn ihr Glück habt, dürft ihr danach in Mexiko City Literaturse-
minare für Polizisten halten, damit der allgemeinen Verrohung der Sitten ein kul-
tureller Riegel vorgeschoben wird. Denn sehet: Ihr seid der Kulturriegel! Eure kul-
turellen, sozialen und historischen Verstehens- und Deutungsleistungen sind global
gefragt! Macht es euch bequem, die Welt braucht euch!
F4717-Antonsen.indd 86 03.12.2008 11:04:58 Uhr
Thomas Hunkeler (Fribourg)
PASSEN SIE GUT AUF SICH AUF ! 3 GRÜNDE, WARUM WIR
NICHT NUR DIE LITERATUR, SONDERN AUCH DIE
LITERATURWISSENSCHAFT BRAUCHEN
Spätestens seit der ›linguistic turn‹ der sechziger Jahre vom ›cognitive turn‹ der spä-
ten neunziger Jahre überrundet und abgelöst wurde, befinden sich die Geistes- und
besonders die Literaturwissenschaften in einer strukturellen Krise, die von verunsi-
cherten Köpfen bereits als Anfang vom Ende und als Vorbote des abendländischen
Untergangs gedeutet wird. Doch inwiefern mehr oder weniger deutlich zurückge-
hende Studierendenzahlen in vormals überlaufenen Disziplinen für die Gesellschaft
wirklich als Unglück zu gelten haben, ist durchaus fraglich. Will man die Gefahr
eines zu simplen Plädoyers pro domo vermeiden, so muss die Frage nicht lauten, wie
viele Literaturwissenschafterinnen und -wissenschafter das Land (bzw. die Univer-
sität) braucht, sondern viel eher, wozu Literaturwissenschaft eigentlich dient, wel-
ches Wissen sie fördert und welche Kompetenzen sie schult. Denn was soll man ei-
ner neoliberalen Doxa entgegensetzen, wie sie heute etwa in Frankreich und an-
derswo ohne Skrupel vertreten wird? Wo der Präsident der Republik zukünftigen
Studierenden zwar das Recht zugesteht, auch »alte Literatur« (was immer mit die-
sem Begriff genau gemeint ist) zu studieren, zugleich aber die (rhetorische) Frage
stellt, warum die Steuerzahler und damit die Gesellschaft ein solches Studium ei-
gentlich weiterhin ermöglichen (sprich: finanzieren) sollen.1 Man kann es natürlich
vorziehen, auf derart tendenziöse Fragen keine Antwort zu geben und auf bessere
politische Zeiten zu hoffen. Doch der um sich greifende Rechtfertigungsdruck in
den Geisteswissenschaften hat vielleicht zumindest in jener Hinsicht etwas Gutes,
dass er bei den Betroffenen für eine Standortbestimmung sorgt und auf ein schärfe-
res Bewusstsein der Eigenheiten und des Entwicklungspotenzials einer Disziplin
hinausläuft. Denn auch wenn niemand ernsthaft davon spricht, die Literaturwis-
senschaft abzuschaffen, ist es immer im Sinn einer Wissenschaft, ihre Grundlagen
und Voraussetzungen periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizie-
ren.
So hat sich der Essayist Tzvetan Todorov in einer kürzlich erschienenen Studie2
mit der Frage beschäftigt, warum die Literatur heute in Gefahr sei und ihre Bedeu-
tung von immer weniger Leuten erkannt werde. Seine Antwort allerdings scheint
auf den ersten Blick paradox: laut dem Literaturwissenschafter Todorov sind nicht
etwa eine verfehlte Bildungspolitik, die neuen Medien oder das Wegfallen der
Buchpreisbindung am Rückgang der literarischen Kultur schuld, sondern… die
Literaturwissenschaft selbst. In der Schule, so Todorov, lerne man heute nicht mehr,
1 Vgl. Citton: Lire, interpréter, actualiser, S. 23f.
2 Todorov: La Littérature en péril.
F4717-Antonsen.indd 87 03.12.2008 11:04:58 Uhr
88 THOMAS HUNKELER
wovon die Werke handeln, sondern nur noch, wovon die Literaturkritik spreche,
die man den Lehrern an der Universität eingetrichtert habe. Aber auch außerhalb
von Schule und Universität, ja in der Literatur selbst habe, so Todorov, eine zuneh-
mend formalistische Tendenz Einzug gehalten, die den Blick auf die Grundaufgabe
der Literatur verbaut habe: nämlich dem Leser ihm bislang unbekannte menschli-
che Erfahrungen zu ermöglichen.
Auch wenn man Todorovs Kulturpessimismus nicht teilt, kommt man nicht
umhin, ihm zumindest in einer Feststellung Recht zu geben: dass nämlich schlech-
te Literaturwissenschaft und schlechter Literaturunterricht der Literatur einen Bä-
rendienst erweisen. Das gilt nun allerdings nicht nur für eine formalistisch orien-
tierte Literaturkritik, sondern für jede Interpretationsweise, der es nicht gelingt,
das literarische Werk in seiner Vielschichtigkeit zur Geltung zu bringen und eben
diese Komplexität dem Leser anschaulich darzustellen. Festzuhalten bleibt aber vor
allem, dass Todorovs Breitseite gegen den einst von ihm maßgeblich vertretenen
Formalismus und dessen ebenso unheimliche wie vage Begleiter namens Solipsis-
mus und Nihilismus in ein Plädoyer nicht nur für die Literatur, sondern auch gegen
die Literaturwissenschaft mündet, wobei letztere im besten Fall gleichsam überflüs-
sig erscheint. Erleben statt analysieren, lesen statt verstehen: in Todorovs Programm
zur Rettung der Literatur gibt es offensichtlich keinen Platz für ein kritisches, dis-
tanziertes Lesen, wie es die Literaturwissenschaft praktiziert. »Die Texte haben uns
viel beizubringen«3: Wohl nicht zufällig sind es in Todorovs Essay die Texte selbst,
die gleichsam anthropomorph als Lehrer fungieren und damit die Vorstellung einer
vermittelnden, interpretierenden Annäherung an den Text überflüssig machen.
Buch und Leser verschmelzen in dieser romantisch inspirierten Vorstellung zu ei-
nem Herz und einer Seele, während dem Literaturwissenschafter – nun gleichsam
in der Rolle des verschmähten Liebhabers – nichts anderes übrig bleibt, als sich in
ein Kloster oder gegebenenfalls in eine höhere Bildungsanstalt zurückzuziehen, wo
er unter Gleichgesinnten nicht allzu viel Unheil anrichten kann.
Und dennoch: Wie sehr der schöne Gedanke einer selbstgenügsamen Gemein-
schaft von Text und Leser an der Realität des Lesens und an den Bedürfnissen der
Leser vorbeigeht, konnte man erst kürzlich exemplarisch an Sophie Calles grandio-
ser Installation Prenez soin de vous an der Kunstbiennale Venedig 2007 im französi-
schen Pavillon vorgeführt bekommen. Am Anfang von Calles Arbeit steht eine
Mail, in der ihr Geliebter – ein französischer Schriftsteller – ihr das Ende ihrer Lie-
besbeziehung mitteilt. Der Text dieser Mail nun löst bei der Künstlerin eine Reak-
tion aus Unverständnis und Erstaunen aus, wie sie in ihrem einleitenden Text zum
Ausstellungskatalog schreibt:
3 Ebd., S. 88.
F4717-Antonsen.indd 88 03.12.2008 11:04:58 Uhr
PASSEN SIE GUT AUF SICH AUF! 89
Ich habe eine Abschiedsmail erhalten. Ich konnte nicht antworten.
Es war, als wäre diese Mail nicht an mich adressiert.
Sie endete mit den Worten: Passen Sie gut auf sich auf [Prenez soin de vous].
Diese Empfehlung habe ich mir zu Herzen genommen.
Ich habe 107 Frauen – eine gefederte und zwei aus Holz – ausgesucht, damit sie
den Brief, ausgehend von ihrem Beruf, von ihrem Talent, unter einem professio-
nellen Aspekt interpretieren.
Um ihn zu analysieren, zu kommentieren, ihn zu spielen, zu tanzen, zu singen.
Um ihn zu zergliedern. Ihn auszuschöpfen. Um für mich zu verstehen.
An meiner Stelle zu sprechen.
Um mir die Zeit zu nehmen, Schluss zu machen.
In meinem Tempo.
Gut auf mich aufzupassen.4
Was genau diesen Abschiedsbrief in Sophie Calles Augen zu einem skandalon
macht, wird von der Künstlerin zwar nicht weiter ausgeführt, doch der Titel der
Ausstellung macht es dennoch deutlich: Es ist in erster Linie die Tatsache, dass die
Sprache als Kommunikationsmedium selbst da, wo sie explizit Nähe evoziert, im
gleichen Moment eine Distanz entstehen lässt. Vincent Kaufmann spricht in die-
sem Zusammenhang von einem »équivoque épistolaire«, das heißt einer der asyn-
chronen Kommunikation inhärenten Zweischneidigkeit, die darin besteht, dass
der Schreiber zwar einerseits den Kontakt sucht, ihn aber anderseits mittels seines
Schreibens, das heißt durch den Schreibakt selbst, im gleichen Moment zu vermei-
den bzw. zu verschieben trachtet.5 Die an die Adressatin gerichtete Aufforderung,
gut auf sich aufzupassen, ist in diesem Sinn nicht nur in ihrer formellen Höflich-
keit äußerst befremdlich; sie ist in erster Linie zutiefst widersprüchlich, da sie als
Annährung ausgibt, was doch in Tat und Wahrheit ein Bruch ist: »Passen Sie gut
auf sich auf« – denn ich passe nicht mehr auf Sie auf.
In unserem Zusammenhang interessant ist nun vor allem Sophie Calles Reak-
tion des Nicht-Verstehens bzw. Nicht-Verstehen-Wollens. Gerade weil der Ab-
schiedsbrief ihres Liebhabers an und für sich banal erscheint, als eine ebenso ele-
gante wie brutale Aneinanderreihung von selbstgefälligen Erklärungen und frag-
würdigen Entschuldigungen, scheint es paradoxerweise notwendig, eben dieser
Banalität einen – tieferen? anderen? – Sinn zu geben, ihr überhaupt einen Sinn zu
geben. So ist denn Calles Aufruf an 107 Frauen – Künstlerinnen, Wissenschaftle-
rinnen, Freundinnen –, den von ihr weitergeleiteten Abschiedsbrief in einer für sie
typischen Weise zu interpretieren, nicht dem Ziel gewidmet, den ›wahren‹ Sinn des
Briefs zu erkennen. Er dient vielmehr dazu, einen bislang nicht existierenden Inter-
pretationsrahmen zu kreieren, einen Resonanzraum, in dem Sinn nicht in Rück-
bindung auf einen Urtext oder auf eine außertextuelle Realität, sondern als Resultat
der Kombination, der Überkreuzung und der Infragestellung aller Bearbeitungen
4 Calle: Prenez soin de vous. Nicht paginierter Katalog der Installation an der 52. Biennale Ve-
nedig.
5 Kaufmann: L’équivoque épistolaire.
F4717-Antonsen.indd 89 03.12.2008 11:04:58 Uhr
90 THOMAS HUNKELER
erst entstehen kann. Was Sophie Calles Installation aber in erster Linie erfahrbar
machen will, ist die Notwendigkeit, ja die Unvermeidlichkeit der Interpretation im
Gegensatz zu einer Vorstellung des direkten, immediaten Lesens. Was in ihr exem-
plarisch aufscheint, ist eine andere Form des Lesens6: nicht die stille, fast verschäm-
te Lektüre in einsamer Zurückgezogenheit (wie es sich doch eigentlich für einen
Liebes- und auch einen Abschiedsbrief zu geziemen scheint), sondern eine in den
öffentlichen Raum getragene und vor allem solidarisch mitge- und ertragene Le-
sung, die untrennbar in einen (virtuell) unbegrenzten Prozess der Sinngebung
mündet.
Natürlich ist Prenez soin de vous nicht in erster Linie als Verteidigung der univer-
sitären Literaturwissenschaft zu verstehen. Doch weil die Installation die Bedeu-
tung einer interpretativen Annäherung an den (nichtliterarischen) Text (eines Lite-
raten) ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stellt, soll sie hier gleichsam als Allegorie
eines kritischen, literaturwissenschaftlich geschulten Lesens gelten und damit die
im folgenden anskizzierten drei Thesen zur Bedeutung der Literaturwissenschaft
einleiten.
These 1: Literaturwissenschaft ist die Kunst, das Gleiche mehr
als einmal zu lesen, um nicht überall das Gleiche zu lesen.
Wie Juristen verdächtigt man auch Literaturwissenschafter gerne übertriebener
Spitzfindigkeit und unnötiger Haarspalterei. In der Tat ist für den Laien nicht im-
mer einleuchtend, worin etwa die Bedeutung einer Abhandlung zum Komma bei
Kleist bestehen soll. Genügt es nicht, literarische Texte einfach zu lesen? Ihre Hand-
lung nachzuvollziehen, ihre Schönheit zu bewundern, ihre Ausdruckskraft zu lo-
ben? Warum die Sache komplizierter machen, als sie eigentlich ist?
Ganz generell gesprochen ist die Frage, die die Literaturwissenschaft an den Text
stellt, weniger eine des Was als des Wie. Geschichten nacherzählen ist nicht ihr Ziel.
Weil aber auch ein Literaturwissenschafter sich der sogartigen Wirkung von Erzäh-
lungen nicht leicht entziehen kann, weil auch eine Literaturwissenschafterin in ei-
nem noch so vertrackten Roman zunächst einmal die Geschichte kennen möchte
– »reading for the plot« nennt Peter Brooks7 diese anthropologische Grundkon-
stante des Lesens –, ja weil sogar Aristoteles in seltsamer Banalität darauf beharrt,
eine Tragödie müsse einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben8, ist es notwen-
dig, jeden Roman, jedes Theaterstück, jedes Gedicht mehr als einmal zu lesen.
Denn eine erste Lektüre – die für die meisten Leser auch gleich die letzte ist, wie bei
einer Zeitung, die man nach dem Gebrauch entsorgt – ist der Handlung, ist dem
Inhalt gewidmet: Man möchte wissen, was geschieht, vor allem aber wie es ausgeht,
ob der Held seine Geliebte bekommt, ob der Bösewicht bestraft wird, usw. Erst
6 Vgl. Manguel: A History of Reading, S. 41–53 u. 149–161.
7 Brooks: Reading for the Plot, S. 3–36.
8 Aristoteles: Die Poetik, S. 24f.
F4717-Antonsen.indd 90 03.12.2008 11:04:58 Uhr
PASSEN SIE GUT AUF SICH AUF! 91
wenn diese Fragen beantwortet sind, wenn dieses Grundbedürfnis befriedigt ist,
haben wir überhaupt Muße, uns mit anderen, komplexeren Fragen zu beschäfti-
gen: Warum ist auch der Bösewicht nicht immer böse? Was bedeutet dieser oder
jener Satz? Was genau fasziniert mich an der Beschreibung jenes Frühlingsmorgens
am Anfang des siebten Kapitels? Aus dieser Perspektive betrachtet besteht Litera-
turwissenschaft nicht darin, Einfaches kompliziert zu machen, sondern im (ver-
meintlich) Einfachen das Komplizierte, das Komplexe zu erkennen. Denn nichts
ist einfacher, als ein Buch spannend, als ein Gedicht schön zu finden; aber nichts ist
schwieriger, als diese Gefühle im und am Text festzumachen, als zu zeigen, dass es
die Lektüre und nicht die Sonne auf meinem Arm ist, die mir soeben ein Glücksge-
fühl beschert hat.
In seinen Meditationen zur »Lust am Text« beschreibt Roland Barthes die zwei
Arten des Lesens, wie wir sie hier unterscheiden: eine der Anekdotenabfolge gewid-
mete, schnelle Lektüre, und ein langsames, fast pingelig genaues Lesen, das jedes
Wort und jedes Satzzeichen abwägt und befragt. Je nach Text ist die eine oder ande-
re Leseweise vorzuziehen, so Barthes, denn es wäre ein Irrtum zu meinen, schnell
zu lesen könne zwingend ein Gefühl der Langweile verhindern: »Lesen Sie einen
Roman von Zola langsam, lesen Sie alles in ihm: dann fällt Ihnen das Buch vor
Langeweile aus den Händen; doch lesen Sie einen modernen Text nur rasch und
häppchenweise, dann wird er undurchsichtig und verweigert sich Ihrer Lust.«9 Ei-
ne Unterscheidung, wie Barthes sie hier vorschlägt – in S/Z wird er dafür das Ge-
gensatzpaar »scriptible/lisible« prägen – kann helfen, Romane wie jene von Alain
Robbe-Grillet oder Claude Simon besser zu lesen; und doch ist sie seltsam statisch
und auch ungerecht, weil sie schematisch modellisiert, was doch in der Leseerfah-
rung nicht wirklich trennbar ist. Das weiß natürlich auch Barthes, der für sich per-
sönlich die Freiheit eines ständigen Hin- und Hers einfordert: »Was ich an einer
Erzählung mag«, so schreibt er, »ist nicht in erster Linie ihr Inhalt oder gar ihre
Struktur, sondern viel eher die Abschürfungen, die ich dem hübschen Äußeren zu-
füge: ich eile, ich hüpfe, ich hebe den Kopf, ich tauche wieder ein.«10 In der Tat ist
die Hauptgefahr einer zweifachen, im schwachen Sinne ›literaturwissenschaftli-
chen‹ Lektüre, dass es am Ende nicht die sprachliche Form, sondern der Inhalt ist,
der unter den Tisch fällt, weil wir seine Faszinationskraft schon abgehakt und ver-
gessen haben. Doch in diesem Fall wird die Formanalyse tatsächlich zum Selbst-
zweck und damit zur sterilen Aneinanderreihung von Wortfeldern, Mikrostruktu-
ren und rhetorischen Figuren. Hier geht ob der Wissenschaft die Literatur und da-
mit neben dem Sinn auch die Sinnlichkeit verloren, die doch Barthes so wichtig
war.
9 Barthes: Le plaisir du texte, S. 23: »Lisez lentement, lisez tout, d’un roman de Zola, le livre
vous tombera des mains; lisez vite, par bribes, un texte moderne, ce texte devient opaque,
forclos à votre plaisir […]«.
10 Barthes: Le plaisir du texte, S. 22: »Ce que je goûte dans un récit, ce n’est donc pas directe-
ment son contenu, ni même sa structure, mais plutôt les éraflures que j’impose à la belle en-
veloppe: je cours, je saute, je lève la tête, je replonge.«
F4717-Antonsen.indd 91 03.12.2008 11:04:58 Uhr
92 THOMAS HUNKELER
Zweimal lesen: eine schwierige Aufgabe also. Vielleicht kann man sie nur da-
durch lösen, dass man den Text zweimal in der von Barthes praktizierten, oszillie-
renden Art liest: indem man den Text jedes Mal an einem anderen Ort schnell oder
langsam liest, sich von der Intrige tragen lässt und dann doch plötzlich innehält,
wenn ein Stein des Anstoßes oder manchmal auch nur ein literarisches Sandkorn
die so gut geölte fiktionale Maschinerie ins Stocken bringt.
These 2: Literaturwissenschaft hat die Aufgabe,
die Sakralisierung der Literatur zu verhindern.
Mit dem Begriff der illusio bezeichnet der französische Soziologe Pierre Bourdieu11
den Hang aller am literarischen Feld teilhabenden Personen und Institutionen, die
Literatur als einen gleichsam transzendenten Wert zu etablieren und sie auf diese
Weise, wenn auch weitgehend unbewusst, zu sakralisieren. Auch die Literaturwis-
senschaft hat als wichtige Instanz des literarischen Feldes häufig eine ausgeprägte
Tendenz, die von ihr studierten Werke nicht als durch historische und soziale Pro-
zesse produzierte Kulturgüter zu sehen, sondern sie im Gegenteil als jenseits dieser
Prozesse liegende, überzeitliche Werte zu behandeln. Diese Tendenz, die von der
textimmanenten Literaturkritik ebenso wie von der Philologie maßgeblich geför-
dert wurde und wird, ist als direkte Konsequenz der dem kritischen Lesen voraus-
gehenden Isolation und Dekontextualisierung des literarischen Werks zu verstehen.
Ein solches Vorgehen wird allerdings dann problematisch, wenn es nicht mehr dar-
um geht, das jeweilige Werk im Wechselspiel zwischen Singularität und Exemplari-
tät zu verstehen, sondern wenn seine ebenso unbestreitbare wie unbestrittene Ein-
zigartigkeit zur Hypostasierung des Werks und damit zur Negation seines Kontex-
tes führt. Weder darf es darum gehen, das literarische Werk gleichsam in seiner
biografischen, sozialen oder literarhistorischen Entstehungsgeschichte aufzulösen
und zu einem simplen Dokument zu machen, noch ist es sinnvoll, in das gegentei-
lige Extrem zu verfallen und die Werke der Weltliteratur – darunter geht es ja nicht
– als Aneinanderreihung von Monumenten aere perennius darzustellen, vor denen
die Nachgeborenen ergriffen und stumm in die Knie zu sinken haben. Dass eine
solche Art der Literaturvermittlung zum Scheitern verurteilt ist, ist einleuchtend:
im einen Fall verschwindet die Literatur, im anderen die Vermittlung.
Paradoxerweise aber ist es die Angst um die Literatur, die die Literaturwissen-
schaft heute am meisten gefährdet: dass die Jungen nicht mehr lesen, dass sie nicht
mehr das Richtige lesen, oder, fast am schlimmsten, dass sie nicht mehr richtig le-
sen. Habt doch Vertrauen in den Gegenstand Eurer Verehrung, möchte man den
Gralshütern der Literatur zurufen: eine schlechte Lektüre schadet einem guten
Buch, eine schlechte Inszenierung einem guten Theaterstück sicherlich weniger als
das Verbot, sich dem Text anders als von den Kennern autorisiert zu nähern. Eine
feministische Inszenierung von Warten auf Godot, wie sie Samuel Beckett ein Gräu-
11 Bourdieu: Les règles de l’art, S. 316–321. Siehe auch Jurt: Pierre Bourdieu, S. 112–129.
F4717-Antonsen.indd 92 03.12.2008 11:04:58 Uhr
PASSEN SIE GUT AUF SICH AUF! 93
el war (das er übrigens zu verbieten suchte), mag beispielsweise durchaus auf einer
widersinnigen Vereinnahmung des Textes beruhen; doch hat sie das nicht unerheb-
liche Verdienst, den Text vor der Gefahr der klassischen Mumifizierung zu retten
und ihn wieder in Umlauf zu bringen. Denn wenn der Text wirklich so gut ist, wie
die Kenner es meinen, wird er auch unbedarfte Annäherungen überstehen; ja es ist
gerade diese Art von Annäherungen, die eine Bewegung zurück zum Text oder zu-
mindest zurück zur Literatur auslösen kann. Das stimmt übrigens auch im Fall Be-
cketts, der als junger Mann einen sehr ungerechten Essay zu »ce cochon de Marcel«
– sprich zu Proust – schrieb und dennoch im Kontakt (und im Widerstand) zu
dessen großem Werk seine eigene Poetik fand.12
These 3: Literaturwissenschaft ist ernüchternd.
Wer kennt ihn nicht, Baudelaires berühmten Aufruf zur Trunkenheit. »Enivrez-
vous«, ruft der Dichter seinen Lesern zu, und er fügt hinzu: »Womit? Mit Wein,
Poesie oder Tugend, wie Sie wollen. Aber berauschen Sie sich.«13 Wie der Wein
dient die Dichtung in Baudelaires Augen als Refugium vor der mediokren, quälen-
den Realität seiner Zeit, ja als Schutz vor der alles verschlingenden Zeit schlecht-
hin. Und auch Marcel Prousts berühmtes Diktum, dass die Literatur das echte,
wahre Leben sei und nicht unsere Alltagsexistenz, zeugt davon, dass die Literatur
nicht nur als künstliches Paradies, sondern in erster Linie als künstlerisches Paradies
gilt: als jener ideale und doch existente Ort, an den wir flüchten, wenn der Alltag
unerträglich wird.
Nur zu gut kennen wir alle den Moment, wo wir uns – ein schönes Buch in der
Hand, gegebenenfalls auch einen guten Film im Videogerät – in unseren Lieblings-
sessel zurückziehen, um mittels der Kraft der Fiktion der meist so prosaischen
Wirklichkeit zu entkommen, und sei es nur für einige Stunden. Doch auch die
immer mächtiger werdende Kulturindustrie, die Sirenen der Werbung und sogar
die Politik haben unsere Schwäche für gut erzählte Geschichten längst entdeckt
und machen sie sich schamlos zunutze. Seien es die schmalztriefenden Geschichten
aus der Schwarzwaldklinik oder die voyeuristisch aufgearbeiteten Erkenntnisse fo-
rensischer Beamter, seien es Paris Hiltons Gefängnisaufenthalt oder Nicolas Sarko-
zys photogen in Szene gesetzte Beziehungsprobleme: unsere Aufmerksamkeit – ein
sehr beschränktes Gut! – wird mit peppig aufbereiteten Geschichten von den wah-
ren Problemen unserer Lebenswelt abgelenkt, wie Christian Salmon14 kürzlich in
einem beunruhigenden Buch zu dieser storytelling genannten gezielten Konditio-
nierung unserer Imagination aufgezeigt hat. Unter kundiger Anleitung von ange-
mieteten Semiotikern und Narratologen, die die traditionellen Rhetoriker immer
mehr ersetzen, manipulieren so genannte ›Politeraten‹ das nur allzu gutgläubige
12 Vgl. hierzu Hunkeler: Samuel Beckett liest Marcel Proust.
13 Baudelaire: Petits poèmes en prose, S. 115.
14 Salmon: Storytelling.
F4717-Antonsen.indd 93 03.12.2008 11:04:58 Uhr
94 THOMAS HUNKELER
Publikum via gut erzählte und vor allem leicht verdauliche Geschichten, deren
ideologische Dimension eben gerade in der vermeintlichen Absenz des Ideologi-
schen steckt.
Gegen eine derartige Vereinnahmung durch die suggestive Macht der well made
story, von der niemand wissen kann oder will, ob sie wahr ist und vor allem, ob sie
irgendeine Bedeutung hat, hilft weniger eine mediale Verweigerungshaltung als ei-
ne im besten Sinne ernüchternde literaturwissenschaftliche Haltung, die der Faszi-
nation eine Analyse und der Identifikation eine Distanznahme entgegensetzt, um
formale, ideologische und pragmatische Dimensionen der erzählten Geschichten
explizit und damit bewusst zu machen. Auf diese Weise setzt ein literaturwissen-
schaftlich geschulter Blick der fiktional stimulierten willing suspension of disbelief
(Coleridge) ein Antidot entgegen, das Yves Citton in einem hübschen Wortspiel
mit dem Begriff der witty suspicion of all beliefs bezeichnet15: eine Haltung, die darin
besteht, sich zwar einerseits von der Fiktion verführen zu lassen, andererseits aber
nie völlig die Kontrolle zu verlieren. Natürlich ist uns allen beim spannendsten
Thriller oder beim grässlichsten Horrorfilm stets mehr oder weniger bewusst, dass
es genügt, die Augen zu schließen, um von den dargestellten Ereignissen Abstand zu
gewinnen und sie als gestellt zu entlarven. Doch um die Faszination der well made
story nicht nur zu verspüren, sondern sie auch zu verstehen und gegebenenfalls ihre
ideologische Dimension zu erkennen, braucht es mehr als nur eine kräftige Dosis
guten Menschenverstand. Erst eine kritische Annäherung an Geschichten, wie sie
die Literaturwissenschaft praktiziert, erlaubt es nämlich, jene als Konstrukte zu
identifizieren, mittels derer gewisse Ziele erreicht werden sollen, die nicht zwin-
gend nur ästhetischer Natur sind. Dass eine solche Annäherung etwas Ernüchtern-
des, vielleicht sogar etwas Trockenes hat, ist offensichtlich, aber im Wechselspiel
mit der immer wieder neu auferstehenden berauschenden Kraft der Fiktion durch-
aus nicht ohne Reiz.
Natürlich kann es nicht Aufgabe der Literaturwissenschaft sein, jungen Menschen
das Lesen beizubringen. Aber es ist ihre Aufgabe, die unerhörte Öffnung zur Welt,
die das Lesen einem Kind erlaubt, immer wieder neu anzuregen. Denn Lesen ist
Entdecken. Wenn Jugendliche mit dem Lesen aufhören, meist in der Zeit der Pu-
bertät, dann deshalb, weil Bücher für sie keine Entdeckungen mehr zu bieten schei-
nen; in Wirklichkeit aber, weil man sie zu einer Art Lesen erzogen hat, das nur
noch eine kontrollierte Öffnung auf die Welt ermöglicht. Es ist die Aufgabe der
Literaturwissenschaft, diese utilitaristische und missbräuchliche Deformierung des
Lesens, dieses ›Ablesen‹, rückgängig zu machen. Nur wenn wir gut auf das Lesen
aufpassen – auf ein zugleich kritisches, befreiendes und lustvolles Lesen – dann
passen wir auch gut auf uns selbst auf.
15 Citton: Lire, interpréter, actualiser, S. 202.
F4717-Antonsen.indd 94 03.12.2008 11:04:58 Uhr
Helmut Koopmann (Augsburg)
MÖGLICHKEITEN DES WISSENSTRANSFERS IN DER
(GERMANISTISCHEN) INFORMATIONSGESELLSCHAFT. PLÄDOYER
FÜR EINE INS ABSEITS GERATENE GATTUNG, DIE DAS STUDIUM
DER LITERATURWISSENSCHAFT ERLEICHTERN KÖNNTE
Im 18. Jahrhundert brach eine bis dahin unbekannte Krankheit aus, und sie ergriff
ganz Deutschland: Lesewut. Man hat geschätzt, daß sich die Buchproduktion vom
17. bis zum 18. Jahrhundert mehr als verdoppelt habe. Zwei Drittel der Publikatio-
nen des 18. Jahrhunderts entstanden ab 1750. In Nicolais Allgemeiner deutscher
Bibliothek wurden von 1765–1806 insgesamt 80 000 Titel besprochen. Insgesamt,
so eine Schätzung, umfaßte das deutschsprachige Schrifttum zwischen 1700 und
1800 175 000 Titel.
Eine Lawine war ins Rollen gekommen. Bis 1700 gab es 58 Zeitschriften, bis
1800 schon 4 000. Um 1800 betrug die Gesamtauflage der Tageszeitungen
300 000, die insgesamt etwa 3 Millionen Leser erreichten. Kurz nach 1800 ent-
standen Lesegesellschaften mit etwa 60 000 Abonnenten. Auch andere Wirtschafts-
zweige profitierten von der Lesewut: es gab Lese-Chaiselongues und spezielle Lese-
Stühle. Aber vor allem gab es Bücher. Nur ein Problem, das uns heute geradezu
quält, stellte sich damals offenbar nicht ein: wie diese Bücherflut zu verarbeiten sei.
Sie kanalisierte sich augenscheinlich von selbst, und vor allem: das Phänomen der
Informationsüberflutung erschreckte (offenbar) niemanden.
Nein, man konnte nicht genug an Büchern kriegen, auch nicht im 19. Jahrhun-
dert: man wollte möglichst alles wissen und zu allem Zugang haben. Dafür gibt es
ein höchst prägnantes Beispiel: 1828 machte sich ein junger österreichischer Verle-
ger die Lesewut in großem Stile zunutze: er gründete eine »Universal-Bibliothek«,
und sie lebt heute noch: Reclams Universalbibliothek.
Denn universell sollte sie sein; ihre Reichweite war von vornherein ohne Grenzen
gedacht, weltweit in Zeit und Raum. Reclams kündigten alles an: die sämtlichen
deutschen Klassiker, Verschollenes und Neuestes, Erhabenes und Vergnügliches,
das Beste aus fremden Literaturen, das Beste des antiken Schrifttums, auf deutsch.
Der Arbeiter, das Ladenmädchen, der Kontorist, der Student, der Schüler, der
Reisende, der junge Dichter oder Künstler sollte das Stück für Stück und nach
Wunsch für zwei Silbergroschen haben können. […] Mitte November des Jahres
siebenundsechzig lagen fünfunddreißig Nummern der Sammlung vor.1
1 Thomas Mann: Hundert Jahre Reclam. In: Mann: Gesammelte Werke in 13 Bänden, Bd. X,
S. 247f.
F4717-Antonsen.indd 95 03.12.2008 11:04:58 Uhr
96 HELMUT KOOPMANN
Das war ein Zitat des größten Universalisten, den die deutsche Literatur im 20.
Jahrhundert kennt, nämlich von Thomas Mann. Er hielt die Festrede auf das hun-
dertjährige Bestehen des Verlags, und damals, 1928, nach hundert Jahren also, gab
es bereits 6 500 Nummern der Sammlung. Wahrhaft: eine Universal-Bibliothek.
Sie war eine Bibliothek für alle Zeiten (im Impressum der Hefte fehlte bezeichnen-
derweise die Jahreszahl des Erscheinens), für alle, über alles. Auf einer alten Ausga-
be von Mozarts Zauberflöte steht als Werbung für diese Universal-Bibliothek: »Sie
umfaßt die verschiedensten Wissensgebiete aller Zeiten und Völker«.
Doch was der gebildeten Welt von damals ein Wunschtraum war, ist heute zu
einem Albtraum geworden.
Nicht, daß wir die Reclam-Bibliothek missen möchten. Aber die Bücherflut hat
ein Ausmaß erreicht, das sich nicht mehr kanalisieren läßt; in der globalen Infor-
mationsgesellschaft ist an die Stelle des Wissens Orientierungslosigkeit getreten, an
die Stelle universaler Kenntnisse der Wunsch nach zu bewältigender Auswahl, und
dazu gesellt sich ein anderer: die Spreu vom Weizen zu trennen, das Ephemere vom
Unverzichtbar-Wichtigen. Das betrifft auch die Literatur der gelehrten Welt: also
die Germanistik. Es gibt über vieles viel zu viel – wir ertrinken an uns selbst.
Das freudige Desaster sei an einem Beispiel erläutert: an der Literatur über Tho-
mas Mann. Klaus W. Jonas, der Thomas Mann-Bibliograph, verzeichnete in seiner
Bibliographie für die Zeit von den Anfängen der literarischen Produktion Thomas
Manns bis zu seinem Tod 1955 insgesamt 4 500 Titel – über fast fünf Jahrzehnte.
Für die nächsten zwei Jahrzehnte (1956 bis 1975) nannte die Bibliographie schon
6 200 Titel. Der dritte Band, der die Thomas-Mann-Literatur von 1976 bis 1994
umfaßt, enthält für diese knapp zwanzig Jahre ebenfalls mehr als 6 000 Eintragun-
gen.2 Dabei war die Auswahl von Anfang an streng, vieles an akademischen Schrif-
ten nicht aufgenommen, etwa nur in Maschinenschrift vorhandene akademische
Arbeiten – und darunter fielen die zahlreichen Dissertationen, die bis in die 50er
Jahre in Deutschland allein so greifbar waren. Nimmt man Jonas’ Angaben zusam-
men, kommt man auf knapp 18 000 Arbeiten der Sekundärliteratur über einen
Zeitraum von knapp einhundert Jahren. Es ist bloß eine Auswahl, berücksichtigt
sind nur die wichtigsten Sprachen, und das heißt: vor allem die westeuropäischen,
weniger Neuerscheinungen aus dem slavischen Sprachraum und schon gar nicht
Sprachen des außereuropäischen Kulturraums, also etwa ostasiatische Arbeiten, es
sei denn, sie wären in einer der großen Zeitschriften, so in Doitsu Bungaku, in deut-
scher Sprache erschienen. Man darf also insgesamt von etwa 20 000 Arbeiten aus-
gehen, und ein Ende ist weniger denn je abzusehen. Statistisch gesehen erscheint
jeden zweiten Tag etwas Neues. Sicher ein Ausnahmefall – aber kein absoluter. Die
Zahl der Arbeiten über Goethe hat noch astronomischere Ausmaße erreicht, die
über Schiller nicht weniger.
2 Jonas: Die Thomas-Mann-Literatur, Bd. 1–3.
F4717-Antonsen.indd 96 03.12.2008 11:04:58 Uhr
MÖGLICHKEITEN DES WISSENSTRANSFERS 97
Wissen wir nun über Thomas Manns Werk immer mehr und immer besser Be-
scheid? Das ist nicht sicher, aber sicher ist, daß sich über derartige Zeiträume hin-
weg Eigengesetzlichkeiten entwickelt haben, die man oft erst erkennt, wenn man
die Forschungsgeschichte zu überschauen und zu bewerten versucht. Was passiert,
wenn die Forschung ungefiltert weiterwuchert? Wenn nicht mehr gelesen wird, was
andere vorher geschrieben haben? Wenn das literaturwissenschaftliche Rad in jeder
Generation neu erfunden und nicht mehr selektiert wird, was überflüssig und nur
zum wiederholten Male wiederholt wird? Wir ziehen einige Folgerungen:
1. Ein ›Recycling‹ früher einmal gemachter Entdeckungen oder Beobachtungen
setzt spätestens nach einer Generation ein. Alte Erkenntnisse werden in fast re-
gelmäßigen Abständen immer wieder neu vorgebracht. Man kann es, was das
Beispiel Thomas Mann angeht, am besten an den Buddenbrooks beobachten,
dem mit über 4 Millionen meistverkauften Buch dieses Autors: was schon kurz
nach dem Erscheinen über das Verfallsthema gesagt wurde, wurde in den frühen
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in extenso wiederholt, es beherrschte Tei-
le der Thomas-Mann-Diskussion in den sechziger und siebziger Jahren und ist
in den neunziger Jahren erneut aufgeflammt. Der Zugewinn ist, gemessen an
der Zahl der publizierten Arbeiten, eher gering, das immer wieder Hervorge-
kehrte erdrückend. Das Gleiche gilt etwa für das alte Dauer-Thema vom Ver-
hältnis von Kunst und Leben.
2. Je stärker eine Beobachtung, eine Erkenntnis ›recycelt‹ wird, desto weniger Spiel-
raum gibt es für Differenzierungen: je länger sich die literaturwissenschaftliche
Forschung mit einem Thema, einem Aspekt, einer Werkperiode oder einer Gat-
tung beschäftigt, desto stärker werden die Erkenntnisse kanalisiert, entdifferen-
ziert, manchmal sogar banalisiert. Pessimisten könnten daraus den Schluß zie-
hen, daß der Interpretationsraum um so schmaler wird, je mehr Interpreten sich
mit einem Thema beschäftigen und vor allem: je länger sie das tun.
3. Je stärker ein Paradigma die Forschung einer Generation oder eines Jahrzehnts
bestimmt, desto mehr schwinden andere Interpretationsmöglichkeiten aus dem
Horizont der Exegese. So wird man nicht unbedingt davon ausgehen können,
daß die Entdeckung jener Bedeutung, die die Homosexualität für Thomas
Mann möglicherweise gehabt hat, ein wirklicher Erkenntniszugewinn gewesen
ist – denn andere Erkenntnisraster sind dadurch weggewischt worden, so daß
man, kritisch gesehen, nicht von einer Erweiterung des Wissens sprechen kann,
sondern nur von einer Veränderung des Erkenntnismodells. Und: je grundsätzli-
cher ein solches Modell angewandt wird, desto absoluter wird es, das heißt: Kri-
tik daran wird – wie seinerzeit in der kommunistischen Textinterpretation – als
›falsches Bewußtsein‹ denunziert. Anders gesagt: Interpretationen, die einem
›Modell‹ folgen, geraten in der Regel in eine Engführung hinein, die den Blick
für andere Deutungsmöglichkeiten verstellt. Auch das Umfeld wird dann häufig
ausgeblendet.
4. Je länger die Beschäftigung mit einem Autor anhält, desto mehr lassen sich
die gleichen charakteristischen Pendelausschläge beobachten, die auch für
F4717-Antonsen.indd 97 03.12.2008 11:04:58 Uhr
98 HELMUT KOOPMANN
den Wechsel von einer Epoche zu einer anderen, von einem Normensystem, um
mit René Wellek zu sprechen, zu einem anderen eintreten. Hatte man in den
50er und 60er Jahren vor allem den Kunstcharakter eines Werkes von Thomas
Mann betont, das intellektuelle Moment, so in den beiden folgenden Jahrzehn-
ten vor allem die psychischen Hintergründe. Diese Pendelausschläge erfolgen in
der Regel aber nur auf einer Ebene: nach einem solchen Wechsel wird fast im-
mer das Gegenteilige betont, nicht etwa etwas völlig anderes gesehen.
5. Dabei neigt die Forschung dazu, ein gewachsenes Werk, das oft über mehr als
fünfzig Jahre hin entstanden und in sich durchaus widersprüchlich ist, zu homo-
genisieren. Je länger ein Werk zurückliegt, desto pauschaler sind die Urteile, des-
to weniger wird nach Lebensphasen und Entstehungsschichten eines Werkes
differenziert. Und: je mehr über einen Autor gearbeitet worden ist, desto einlini-
ger wird am Ende sein Bild. Natürlich ist nicht zu erwarten, daß bei 20 000 Pu-
blikationen zu Thomas Mann jede etwas Neues bringt. Aber je mehr erscheint,
desto problematischer wird der Erkenntnisgewinn. Das ist keine frohe Botschaft,
sondern ein betrübliches Fazit. Es wird niemanden irgendwo davon abhalten,
dennoch über Thomas Mann zu schreiben. Doch was bleibt? Wie lassen sich
hundert Jahre Forschungsgeschichte transparent machen, wie läßt sich Epheme-
res von Essentiellem trennen, und: welches Instrument ermöglicht es uns, mit
einer solchen Bücherflut sinnvoll zu arbeiten?
Das gleiche Bild der Wissensüberflutung stellt sich aus einem anderen Blickwinkel
vielleicht noch bedrohlicher dar: wir sind hoffnungslos überfordert, was bereits die
Wahrnehmung der Literatur zu einzelnen Epochen angeht. Das läßt sich gut am
Beispiel literarischer Gesellschaften im Gebiet des frühen 19. Jahrhunderts illu-
strieren. Vor wenigen Jahren gab es nur wenige – jetzt tummeln sich neben der
Goethe- und der Schillergesellschaft die Kleist-Gesellschaft, die Hölderlin- und die
Eichendorff-Gesellschaft, die Heine-, die Immermann-, die Novalis- und die Nes-
troy-Gesellschaft, die Droste-Gesellschaft, die Hebbel-Gesellschaft und die Rü-
ckert-Gesellschaft, alle mit Jahrbüchern vertreten, die weitgehend das gleiche Ge-
biet abdecken. Das steigert nicht unbedingt das Niveau: so viele gute Aufsätze kön-
nen gar nicht geschrieben werden, daß sie Jahr für Jahr die Qualität der Jahrbücher
auf hohem Niveau hielten. Die Folge: auch mittelmäßige Arbeiten, Schülerversu-
che, Proseminarschriften werden veröffentlicht – die Jahrbücher müssen nun ein-
mal erscheinen, und unter 200 Seiten darf keines absinken, wenn es und mit ihr
die jeweilige Gesellschaft weiter glaubwürdig bleiben will. Erscheinen einmal Dop-
pelbände einer Gesellschaft, beginnt man schon, an ihrer Bonität zu zweifeln – das
wirkt wie am Aktienmarkt die Gewinnwarnung. Doch wer soll das alles lesen, was
uns als lesenswert vorgehalten wird?
Aber auch anderes ist geeignet, unsere Aufnahmefähigkeit ebenso hoffnungslos
zu überfordern: die Fülle öffentlich geförderter, damit als besonders studierenswert
anerkannter Bücher ist überwältigender denn je. Bei der Deutschen Forschungsge-
F4717-Antonsen.indd 98 03.12.2008 11:04:58 Uhr
MÖGLICHKEITEN DES WISSENSTRANSFERS 99
meinschaft sind in den letzten Jahren jährlich etwa 900 Anträge auf Druckkosten-
zuschüsse für ausgezeichnete Arbeiten gestellt worden, bei dem Förderungs- und
Beihilfefonds Wissenschaft der Verwertungsgesellschaft WORT, der zweiten großen
Organisation zur Förderung wissenschaftlicher Publikationen, jährlich etwa 240.
Die allermeisten davon entfielen in das Gebiet der Geisteswissenschaften. Ebenfalls
nicht unbeträchtlich an der Förderung wissenschaftlicher Arbeiten beteiligt: die
Volkswagenstiftung, die Thyssen-Stiftung, die Boehringer-Stiftung, die Reimer-
Stiftung, viele Universitäts- und Länderstiftungen, kommunale Unterstützungsver-
eine, in der Schweiz Pro Helvetia und anderes. In Österreich liegen die Dinge ähn-
lich. Nicht hinzugerechnet, aber ebenfalls als Fördermaßnahmen wirksam: die vie-
len, ja fast zahllosen Preise, Stipendien für alle und, so scheint es, für alles. »Man
muß das Negative positiv zu lesen verstehen«, sagt Thomas Mann einmal.3 Ja, es
muß eine Lust sein, zu forschen – vor allem in Deutschland. Aber: wer soll das alles
aufnehmen, was da erforscht wird?
Dabei ist alles zumindest nach außen hin vom Besten: Die Zahl der Höchstleis-
tungen nimmt, glaubt man den Zensuren für Dissertationen, auf geradezu beäng-
stigende Weise zu – wir haben einen Höchststand an Dissertationen mit dem Prä-
dikat ›summa cum laude‹ erreicht, und in jedem Jahr wird dieser Höchststand wie-
der übertroffen. Der Kenner der Materie vermutet: nicht ohne Hintersinn. Denn
viele Förderinstitutionen berücksichtigen nur Arbeiten mit der Bestnote. So wird
diese zuweilen aus an sich durchaus achtbaren sozialen Gründen so hoch wie mög-
lich angesetzt. Aber wie dem auch sei: öffentlich geförderte Werke beanspruchen
mehr als andere, gelesen zu werden. Aber sind selbst diese Höchstleistungen noch
überschaubar? Der Thomas Mann-Forscher etwa hat es ja überdies noch mit den
20.000 Arbeiten seiner Vorgänger zu tun – manches sicher schnell zu lesen, aber
manches Buch auch von Großformat. Kurzum: hier hat vermutlich jeder etwas
verpaßt, unzureichenderweise mit Flüchtigkeit behandelt, was unbedingt ernst ge-
nommen zu werden verdiente. Mit dem Hinweis auf Spezialgebiete kann sich nie-
mand herausreden: denn er hat an den meisten deutschen Universitäten ja sein
Fach uneingeschränkt zu vertreten, also vom 17. bis zum 21. Jahrhundert. So wird
es manchem gehen – es sei denn, er habe einen Forschungsauftrag, wie das einmal
bissig ein amerikanischer Kollege schrieb, für lesbisches Verhalten unter Eski-
mofrauen zu erfüllen. Das war vor längerer Zeit gesagt. Aber heute wirkt das gar
nicht mehr so absurd. Es gibt inzwischen ganz andere Denominationen und abson-
derliche Besetzungen. So mußte jemand an einer deutschen Universität die Litera-
tur der früheren DDR behandeln und war in allem anderen bestens, aber gerade
dafür nicht ausgewiesen.
Kehren wir zu unserem roten Faden zurück. Wie ist der Wissenstransfer, der ja oft
auch ein Forschungstransfer ist, zu bewerkstelligen? Was sind andererseits die Fol-
3 Th. Mann: Die Kunst des Romans. In: Gesammelte Werke, Bd. X, S. 348–362, hier: S. 358.
F4717-Antonsen.indd 99 03.12.2008 11:04:58 Uhr
100 HELMUT KOOPMANN
gen der Wissensüberflutung? Die unübersehbare Menge der Sekundärliteratur hat
zu einer eigentümlichen Polarisierung geführt. Die Thomas-Mann-Forschung läßt
das wiederum klar erkennen. Schon seit etwa zwanzig Jahren zeichnet sich die Ten-
denz ab, entweder überhaupt nicht mehr auf die Arbeiten anderer einzugehen –
größere Monographien werden weitgehend ohne Auseinandersetzung mit der For-
schungsliteratur geschrieben. Damit verbunden ist ein rapider Verlust an Diskussi-
onswilligkeit, wohl auch an Diskussionsfähigkeit. Vielleicht eine Notwehrhandlung
gegenüber einem Allzuviel an sekundären Stimmen, vielleicht auch Selbstherrlich-
keit von selbsternannten Alleswissern? Auf der anderen Seite: ein Übermaß an Dis-
kussionen, meist in Fußnotenhalden geführt. Das ist die seltenere Variante – sie
endet oft in Grabenkämpfen, die Auseinandersetzung mit anderen dient nicht im-
mer dazu, die eigene Linie klarer zu machen. Amerika hat in vielen Fällen den
Tiefstand der Auseinandersetzungskultur sogar bewußt gefördert: indem bei der
Textexegese eine close-reading-Methode bevorzugt wird, also die genaue Textlektü-
re im Vordergrund steht; im Hintergrund findet sich dann nicht mehr sehr viel.
Das mag kein Übel sein – aber ein Übel ist die immer wieder gestellte Frage, was
denn der Studierende bei der Lektüre eines gewissen Textes dabei persönlich emp-
finde, fühle, denke, assoziiere. Das geht einher mit einem rapiden Schwund an his-
torischem Bewußtsein. Schon in den früher siebziger Jahren stellte ein Student ei-
nem außerordentlich renommierten Universitätslehrer, der einen Kurs über deut-
sche Übersetzungen ins Englische aus dem 18. Jahrhundert gab, die entwaffnende
Frage: »And what about Hermann Hesse?« Auf die Antwort des Dozenten, daß
Hesse nicht ins 18. Jahrhundert gehöre, entgegnete jener Student: »I don’t care
about chronology«. Er wollte seinen Hesse haben, weil alle ihn damals hatten, auch
wenn er ihn so nicht haben konnte. Und die deutschen Studenten? Wichtiges und
Unwichtiges können die meisten nicht mehr voneinander unterscheiden. Das ist
natürlich nicht nur, aber auch die Schuld ihrer Lehrer.
Was tun? Wie werden wir mit der Wissensflut fertig, wie bewahren wir unsere
Diskussionsfähigkeit, ohne in Überflüssigkeiten zu versinken, wie können wir
Wichtiges von Unwichtigem trennen? Die Frage betrifft die japanische Germanis-
tik so gut wie die deutsche, die amerikanische so gut wie die chinesische. Sicher ist
nur: wir werden überschwemmt. In den letzten Jahren gibt es mehr Bibliotheken
denn je, die Bibliothèque Mitterand in Paris umfaßt 12 Millionen Bände auf 420
Kilometern Regallänge; die amerikanische Nationalbibliothek kommt auf 850 Ki-
lometer. »Die beste Definition der Heimat ist Bibliothek«4, hat Canetti in der Blen-
dung gesagt, aber wie kann sie Heimat bleiben, da sie so riesig geworden ist? Man
lächelt fast über Reclams Universalbibliothek. Unser Zeitalter quillt über vor Infor-
mation. Im Internet ist mehr als eine halbe Milliarde an Texten gespeichert, Wissen
ist in der Tat universal geworden. Aber welche speziellen Informationen lassen sich
aus diesem Wissen herausziehen? Wissen sollte uns befreien, aber nicht selten lähmt
es uns. »Gespeichert, das heißt vergessen«, hat Enzensberger einmal gesagt, und wie
4 Canetti: Die Blendung, S. 56.
F4717-Antonsen.indd 100 03.12.2008 11:04:58 Uhr
MÖGLICHKEITEN DES WISSENSTRANSFERS 101
in Ergänzung dazu Botho Strauß: »Ich weiß nichts. Ich weiß nur, daß ich infor-
miert bin«5.
Wie ist der Informationsflut zu steuern? Wie ist sie zu nutzen, was kann unge-
nutzt bleiben? Das sind Fragen, die sich unser Fach stellen muß, und unser Fach
muß sie sich in Asien ebenso stellen wie in Deutschland. Wird der Germanist zum
Vermittlungsmanager, zum Informationsnavigator?
Er muß es werden. Aber: wie kann man der Flut der global immer stärker an-
wachsenden Information genügen, welche Strategien müssen wir entwickeln, um
das Bewahrenswerte weiterzugeben, das Überflüssige zu ignorieren, und zwar mög-
lichst schon dann, bevor wir es selbst zu Kenntnis genommen haben? Wie können
wir uns vor der ewigen Wiederkäu bewahren?
Wir wollen unserer pessimistischen Bestandsaufnahme hinzufügen, daß alle bis-
herigen Mittel, mit der Wissensüberflutung fertig zu werden, mehr oder weniger
versagt haben. Personalbibliographien locken nicht (mehr), sondern schrecken ab,
mehr denn je. Die Internationale Bibliographie der Primär- und der Sekundärlite-
ratur zu Kafka umfaßt drei Bände, der zweite Band (der in zwei Teilbände aufge-
gliedert ist) im ersten Teil die Sekundärliteratur von 1955 bis 1980: auf 626 Seiten.
Der zweite Teil des zweiten Bandes umfaßt die Literatur von 1981 bis 1997, auf
etwa 500 Seiten.6 Der Kommentar von Judith Ryan, Harvard University, »Endlich
ein Leitfaden durch das Labyrinth der Kafka-Forschung«7, kann nur als blanker
Zynismus verstanden werden: die Ausmaße des Labyrinthes werden jetzt erst sicht-
bar, aber ein Leitfaden ist weniger denn je zu sehen. Insgesamt fast 1 100 Seiten
Bibliographie, freilich mit Annotationen. Man ist versucht, die Bände zuzuschla-
gen, bevor man sie aufgeschlagen hat.
Das Phänomen der Überflutung unseres Wissens durch immer neues Wissen
zeichnete sich schon vor vielen Jahren ab. Eine Lösung schien zunächst das Interna-
tionale Referatenorgan Germanistik zu bieten: eine umfassende Bestandsaufnahme
der Titel, kurze Rezensionen der selbständig erschienenen Arbeiten. Es konnte der
Wissensflut allerdings nicht steuern. Die Aufsätze blieben unkommentiert, bei den
selbständig erschienenen Schriften fanden sich reine Inhaltsangaben neben schar-
fen, meist aus Zeit- und Raumgründen nicht fundierten Hinrichtungen, fanden
sich wohlwollende Ankündigungen neben kleinlichen Beckmessereien. Ein Übel:
die Erbhöfe. Seit Jahrzehnten rezensieren immer die Gleichen auf dem immer glei-
chen Gebiet. Auch da zeichnen sich Kanalisierungen ab, die der Sache nicht gut
tun. Ein zweites Organ: arbitrium. Die Zeitschrift enthält ausführliche Rezensio-
nen, aber wiederum werden Aufsätze nicht rezensiert, sondern nur sehr sorgfältig
ausgewählte selbständig erschienene Werke. Die Rezensionen in den Jahrbüchern
literarischer Gesellschaften: bunt, beliebig gewonnene Rezensenten, und ein Übel
zeichnet sich zunehmend stärker ab: daß Rezensionen von inkompetenten Anfän-
5 Strauß: Niemand Anderes, S. 127.
6 Caputo-Mayr u. Herz: Kafka. Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur.
2 Bde.
7 Ryan zitiert in: ebd., Bd. 1, S. XIV.
F4717-Antonsen.indd 101 03.12.2008 11:04:58 Uhr
102 HELMUT KOOPMANN
gern geschrieben werden, nicht von denen, die Erfahrung und Wissen mitbringen.
Das wirkt manchmal so, als würde ein Segelflieger auf einen Jumbojet losgelassen.
Kompetente Rezensionen kompetenter Rezensenten kann man mit der Lupe su-
chen.
Was bleibt, um mit Christa Wolf zu fragen? Hier können eigentlich nur aus Ver-
zweiflung geborene Vorschläge gemacht werden. Einer von ihnen: Die alte Form
des Forschungsberichtes müßte wiederbelebt und publizistisch vorrangig behan-
delt werden. Forschungsberichte können die Flut der Literatur filtern, sie können
akzentuieren, bewerten, das neue vom Ewig-Wiederholten trennen, sie könnten
jene Leitfäden durch das Labyrinth der Forschung sein, von dem Judith Ryan an-
läßlich der Kafka-Bibliographie gesprochen hat. Sie müßten von kompetenten
Kennern geschrieben werden – am besten jeweils von mehreren. Nun kann natür-
lich nicht alles und jedes forschungsgeschichtlich erfaßt werden. Es käme gerade
für die nichtdeutsche Germanistik darauf an, die Forschung, wenn sie denn diesen
Namen überhaupt noch verdient, wenigstens zu ausgewählten Kapiteln zu sichten.
Es ist eine Illusion, zu glauben, daß das Gesamtgebiet der neueren deutschen Lite-
raturgeschichte vom 16. bis zum 21. Jahrhundert noch überschaubar wäre, und
noch absurder ist es, zu vermuten, daß dieser gewaltige Bereich ins Ausland vermit-
telt werden könnte. Eine gewisse Konzentration ist dort eher noch als anderswo
nötig: etwa auf die Goethezeit oder auf die klassische Moderne oder auf Gegen-
wartsliteratur. Dahinter muß die Frage stehen: was ist über die Universitäten hin-
aus der jeweiligen Öffentlichkeit zu vermitteln? Das Beispiel der Germanistik in
anderen weit entfernten Ländern, etwa Südafrika, zeigt: am ehesten deutsche Klas-
sik und Gegenwartsliteratur. Die Forschungsergebnisse darüber müßten zusam-
menfassend kritisch gesichtet und verständlich geschrieben, in Zeitschriften oder
auch in kleiner Buchform leicht zugänglich sein, sie müßten für Studenten des Fa-
ches zur verbindlichen Lektüre erklärt werden, sie müßten vielleicht auch das For-
schungsinteresse eines ganzen Landes auf wenige Bereiche lenken, damit dessen
Stimme auch außerhalb dieses Landes gehört wird – sonst geht sie hoffnungslos
unter. Dabei wäre zweitrangig, in welcher Form derartige Berichte veröffentlicht
würden – man sollte sich allerdings dessen bewußt sein, daß ein Buch der bessere
Gefährte, vielleicht sogar der bessere Lebensgefährte ist als ein Laptop. Über den
Brand der Bibliothek von Alexandria spricht man noch heute. Die ersten Compu-
ter haben allenfalls noch Museumswert.
Diese Vorschläge sind solche im Irrealis. Aber man muß nun einmal dem Übel
beikommen, das Goethe schon beklagt hat, wenn er sagte: »Alle Männer vom Fach
sind darin sehr übel dran daß ihnen nicht erlaubt ist das Unnütze zu ignorieren«8.
Forschungsberichte könnten diesem Übel abhelfen, zumindest ein wenig. Profitieren
könnte sogar unsere Zunft. Denn sie könnte dem genügen, was eine pädagogische
8 Goethe: Maximen und Reflexionen, S. 86.
F4717-Antonsen.indd 102 03.12.2008 11:04:59 Uhr
MÖGLICHKEITEN DES WISSENSTRANSFERS 103
Abhandlung aus dem 18. Jahrhundert einmal notierte: Der Professor »muß sich stel-
len, als wisse er alles, sonst wird ihn bald Hof, Stadt und Student auszischen«.
Der Gegenargumente gibt es viele. Das augenfälligste: wer einen Forschungsbe-
richt liest, liest dann oft nicht mehr das, worüber dieser Forschungsbericht spricht.
Anders gesagt: Die Gefahr einer Kenntnis aus zweiter oder dritter Hand ist außeror-
dentlich groß, groß die Versuchung, es bei dem bewenden zu lassen, was ein anderer
als Destillat seines Lesens und Wissens veröffentlicht hat. Ein zweiter Einwand: For-
schungsberichte bewegen sich in die gleiche Richtung, in die sich die Forschung
überhaupt bewegt: sie kanalisieren, vereinfachen, entdifferenzieren, bringen auf eine
Linie, was in Wirklichkeit oft einem mäandrischen Kurs gleicht. Und zusätzlich zu
bedenken: sie entstammen ja im Regelfall einer Feder, bringen also zwangsläufig ein
gehöriges Maß an Subjektivität in die Berichterstattung hinein. Wer korrigiert, wer
kritisiert den Kritiker? Forschungsberichte scheinen überdies geeignet zu sein,
fruchtbare Ansätze, die aber irgendwie nicht im Hauptstrom liegen, zu ignorieren,
also innovative Vorschläge zu unterschlagen. Es kommt hinzu, daß ein Berichter-
statter zwangsläufig seinem Lebensalter, seinem Bildungsstand, seiner Neigung zum
Konservativen oder zum Progressiven nachgibt und damit oft schnell das verurteilt,
was ›anders‹ ist. Und: ist der Bericht zu ausführlich, läßt er die großen Linien nicht
erkennen, ist er auf eben diese großen Linien aus, unterschlägt er vielleicht sehr be-
deutsame Einzelheiten. Und schließlich: was ist wichtig, was ephemer? Wir rühren
mit alledem an Fragen der Evaluation, die sich im heutigen Wissenschaftsbetrieb
aber, amtlicherseits verordnet, immer häufiger stellen. Es bedürfte also eines gerade-
zu divinatorischen Blicks, um adäquat urteilen zu können. Was geschieht mit dem,
was in derartigen Forschungsberichten verschwiegen wird? Gegen ein derartiges
Verschweigen gibt es keine spätere Auferstehung – jedenfalls nicht, wenn da ein
Sterblicher über einen Sterblichen geschrieben haben sollte.
Andererseits: mit der unübersehbar gewordenen Wissensflut ist ohne eine Kana-
lisation guten Gewissens nicht weiterzuleben. Es müssen also Kompromisse ge-
schlossen werden, und diese sind zwangsläufig in irgendeiner Richtung hin immer
ungerecht, inadäquat, vorläufig. Es kommt aber, wie immer bei Kompromissen,
auf die Feineinstellung, die mehr oder weniger richtige Justierung an, auf die Struk-
turierung eines Forschungsberichtes, vor allem aber auf die nötige Fairneß des oder
der Berichterstatter. Es sind fast nicht lösbare Probleme, unerfüllbare Forderungen.
Aber vielleicht zeichnet sich doch eine Möglichkeit ab, mit unserem eigenen Wis-
senschaftsbetrieb fertig zu werden und diesen auch zu legitimieren – vor uns selbst
vor allem.
Erfahrungen mit dieser alten und zugleich wieder neu zu belebenden Textsorte
liegen seit längerem vor. Sie sind durchaus nicht entmutigend. Die Deutsche Schil-
lergesellschaft hat etwa in verschiedenen Forschungsberichten in einigem zeitlichen
Abstand die Flut der Schillerveröffentlichungen transparent und auf ihre Haupt-
richtungen hin erkennbar gemacht. Für andere große Forschungsgegenstände wäre
das nachzuholen. So gibt es nur zwei ausführlichere Forschungsberichte über die
Thomas-Mann-Forschung, von denen einer inzwischen aus zeitlichen Gründen
überholt ist, dazu einige umfangreichere Publikationen, vor allem von angelsächsi-
F4717-Antonsen.indd 103 03.12.2008 11:04:59 Uhr
104 HELMUT KOOPMANN
scher Seite: etwa von John Fetzer über Doktor Faustus9 oder von Hugh Ridley über
Buddenbrooks und den Zauberberg.10 Ein Zufall? Für die deutsche Thomas-Mann-
Forschung ist bezeichnend, daß die umfangreicheren Werke fast ohne Forschungs-
diskussionen auskommen. Dahinter steht oft der verständliche Wunsch, für ein
größeres Publikum zu schreiben, das von Spezialstudien nichts hören will. Anders
gesagt: hier zeichnen sich Bestrebungen ab, unsere Wissenschaft zu popularisieren.
Das ist natürlich bis zu einem gewissen Ausmaß möglich und sicher auch wün-
schenswert. Aber der Preis, den die Wissenschaft dafür zahlt, ist hoch. Eine neue
Naivität bricht sich Bahn, und diese Unmündigkeit ist selbstverschuldet.
Diese Überlegungen sind, obwohl sie ein wenig auf eigenen Erfahrungen basie-
ren, dennoch weitgehend Überlegungen am sprichwörtlichen grünen Tisch – wür-
de man sie umsetzen, wäre das mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, denn
gute Forschungsberichte sind außerordentlich zeitaufwendig und setzen erhebliche
Investitionen an Leselust und Schreibvergnügen voraus. Man kann es im übrigen
durch einen einzigen Forschungsbericht mit der gesamten Zunft verderben. Aber
vielleicht verlohnt dennoch ein weiteres Nachdenken über den Vorschlag. Dabei ist
hier unberücksichtigt gelassen, daß vor alledem oder besser: hinter allem die Frage
nach der Berechtigung unserer Wissenschaft überhaupt steht. Sie muß sich heutzu-
tage pausenlos rechtfertigen, denn Politiker sind in jedem Land der Welt davon
überzeugt, daß sie viel kostet und zunächst sichtbarlich nichts bringt, was die Kos-
ten rechtfertigen würde. Die Frage nach der Berechtigung unserer Existenz als
Wissenschaft ist als Frage nach Wesen und Nutzen der Kultur überhaupt im tech-
nischen Zeitalter, das längst zu einem Zeitalter der Informationsgesellschaft gewor-
den ist, eine nicht ungefährliche Frage. Es ist aber gar nicht erforderlich, daß die
Germanistik zur Kulturwissenschaft mutiert – denn das ist sie ja von Anfang an
gewesen. Heute gibt es so aparte Berufsbezeichnungen wie den ›Kulturwirt‹, das
Wort offenbar dem ›Volkswirt‹ oder dem ›Betriebswirt‹ nachgebildet. Das ist ein
ebenso fragwürdiger wie problematischer Versuch, dem eine Lebensberechtigung
zu verschaffen, der sich selbst gerade aufgegeben hat. Aber vielleicht bekommen
wir ja eines Tages auch den ›Literaturwirt‹. Literaturcafés gibt es bereits.
Das sind in unserem Rahmen eigentlich unziemliche Überlegungen. Es soll hier
aber ja nur darum gehen, in der Forschung und aus der Forschung die Vielfalt der
Meinungen, Ansichten, Ergebnisse und Wege zu erhalten und, was das Wichtigere
ist, sie sichtbar zu machen. Ein idealer Forschungsbericht, um zur Sache selbst zu-
rückzukehren, unterdrückt nichts, was es nicht verdient hätte, und präsentiert die
Fülle der Erkenntnisse in einem angemessenen Rahmen. Und das heißt: hier relati-
viert sich auch alles, nichts wird als solitär vorgestellt. Er könnte nicht nur die Viel-
falt der Bemühungen sichtbar machen, sondern vor allem das, was sichtbar zu wer-
den verdient. Und wer in einem solchen Forschungsbericht genannt wäre, der
könnte sich durch den alten Satz bestätigt sehen: »Ein Germanist ist, wer von ei-
nem anerkannten Germanisten als Germanist anerkannt ist«.
9 Fetzer: Changing Perceptions.
10 Ridley: The Problematic Bourgeois.
F4717-Antonsen.indd 104 03.12.2008 11:04:59 Uhr
Hermann Kurzke (Mainz)
OHNE PATHOS GEHT ES NICHT
Wozu Literaturwissenschaft? Eine Antwort findet man in den drei Bitten aus Kleists
Gebet des Zoroaster:
Durchdringe mich ganz, vom Scheitel zur Sohle, mit dem Gefühl des Elends, in
welchem dies Zeitalter darnieder liegt, und mit der Einsicht in alle Erbärmlich-
keiten, Halbheiten, Unwahrhaftigkeiten und Gleisnereien, von denen es die Fol-
ge ist. Stähle mich mit Kraft, den Bogen des Urtheils rüstig zu spannen, und, in
der Wahl der Geschosse, mit Besonnenheit und Klugheit, auf daß ich jedem, wie
es ihm zukommt, begegne: den Verderblichen und Unheilbaren, dir zum Ruhm,
niederwerfe, den Lasterhaften schrecke, den Irrenden warne, den Thoren, mit
dem bloßen Geräusch der Spitze über sein Haupt hin, necke. Und einen Kranz
auch lehre mich winden, womit ich, auf meine Weise, den, der dir wohlgefällig
ist, kröne!1
Das ist eine idealistische Antwort. Die Aufgabe der Literaturwissenschaft ist es
dann nach wie vor, am Prozess der Erziehung der Menschheit teilzunehmen – sei
ihr Anteil daran auch noch so klein. Alle sogenannten Methoden müssen von die-
sem Grundpathos durchdrungen sein. Man muss durch alle Techniken und Termi-
nologien des Fachs hindurch die Liebe zur Literatur spüren, eine Begeisterung, die
trägt. Es genügt nicht, Textklempner zu sein, ohne Glauben, ohne Liebe, ohne
Hoffnung.
Mit Kleists Gebet des Zoroaster habe ich drei Jahrzehnte lang meine Einführung
in die Literaturwissenschaft begonnen. Ich hatte dafür zwei Sitzungen mit zusam-
men drei Zeitstunden zur Verfügung. Das begann vorweg mit einer ersten Ord-
nung der Fragen, die man an einen Text stellen kann. Ich sortierte sie zu fünf Grup-
pen, die zugleich wie eine Checkliste verwendet werden können. Ich behauptete,
dass man jeden Text das ganze Studium hindurch nach diesem Schematismus be-
handeln könne und solle, und erlebte, dass das immer wieder auch geschah. Noch
heute würde ich das genauso machen und verfalle deshalb ins Präsens.
Die erste Gruppe ist mit Textkritik und Überlieferungslage überschrieben und
zielt auf die Sicherung der Herkunft des zu untersuchenden Dokuments: Wer hat
das wann und wo geschrieben oder woher ist es übernommen, wann und wo wurde
es zuerst gedruckt, was bedeutet der Fundort für die Interpretation etc. Die zweite
Gruppe heißt Textkommentar und ermittelt die historischen und biografischen
Umstände sowie Quellen, Zitate, Kontexte und Diskurszusammenhänge. Die drit-
1 Kleist: Gebet des Zoroaster. In: Sämtliche Werke, Bd. II/7, S. 7f.
F4717-Antonsen.indd 105 03.12.2008 11:04:59 Uhr
106 HERMANN KURZKE
te Gruppe betrifft die Form- oder Strukturanalyse und befasst sich unter Makro-
struktur mit der Gattung, unter Mikrostruktur mit den sprachlichen Mitteln im
Einzelnen. Die vierte Gruppe ist die immanente Interpretation. Hier wird gefragt:
»Wozu dient dieses Form-Gefäß, was wohnt in diesem Struktur-Gebäude?«, wird
also der Inhalt mit der Form in Beziehung gesetzt, und wird ermittelt, alle bisheri-
gen Punkte zusammenfassend, was der Autor mit diesem Text in seiner Zeit eigent-
lich wollte. Die fünfte Gruppe fasst alle externen Textzugänge, also alle über die im-
manente Interpretation und den Horizont des Autors hinausreichenden Fragestel-
lungen vorläufig in einem einzigen Sack zusammen – handle es sich nun um
literatur- und rezeptionsgeschichtliche Optiken oder um die vielen verschiedenen,
mehr oder weniger modernen Methoden literatursoziologischer, psychoanalyti-
scher, feministischer und gendertheoretischer, systemtheoretischer, poststruktura-
listischer oder dekonstruktivistischer Prägung. Das ist ja alles interessant, gehört
aber in den siebten Stock und führt nur zu leerem Geschwätz, wenn man es be-
treibt, bevor man die Fundamente errichtet hat.
Nach diesen Vorreden muss das Gebet des Zoroaster, dessen Autor ich noch nicht
bekannt gebe, von einem zufällig ausgewählten Seminarteilnehmer vorgelesen wer-
den. Dieser liest in der Regel sehr schlecht. Nicht nur, weil ich den Text in der Ge-
stalt des Erstdrucks austeile, also in Frakturschrift, sondern vor allem, weil er einem
zwanzigjährigen jungen Menschen von heute auch inhaltlich zunächst beinahe un-
verständlich ist. Bewusst nähere ich mich den Studierenden, die in der Regel im
ersten Semester sind und oft ihre allererste Stunde an der Universität erleben, erst
einmal mit etwas ganz und gar Fremdartigem, hole sie nicht da ab, wo sie sind,
sondern gebe ihnen eine Nuss zu knacken, auf deren Inhalt sie vorerst nur neugie-
rig gemacht werden sollen. Schritt für Schritt kommt dann die Aufklärung, und
am Ende der Arbeit ist aus Dunkel Licht geworden, der Lohn der Mühe stellt sich
ein, jeder Satz glitzert, und die Erfahrung des Verstehens fällt umso begeisternder
aus, je unverstandener ihr Gegenstand am Anfang war. – Es muss alles vorgelesen
werden, von Kopf bis Fuß jede Zeile, von »Berliner Abendblätter« bis zu dem »x.«
am Ende, mit dem Heinrich von Kleist seine Autorschaft verschlüsselt.
Berliner Abendblätter.
1stes Blatt. Den 1sten October 1810.
Einleitung.
Gebet des Zoroaster
(Aus einer indischen Handschrift, von einem Reisenden in den Ruinen von Pal-
myra gefunden.)
Gott, mein Vater im Himmel! Du hast dem Menschen ein so freies, herrliches
und üppiges Leben bestimmt. Kräfte unendlicher Art, göttliche und thierische,
spielen in seiner Brust zusammen, um ihn zum König der Erde zu machen.
F4717-Antonsen.indd 106 03.12.2008 11:04:59 Uhr
OHNE PATHOS GEHT ES NICHT 107
Gleichwohl, von unsichtbaren Geistern überwältigt, liegt er, auf verwunderns-
würdige und unbegreifliche Weise, in Ketten und Banden; das Höchste, von Irr-
thum geblendet, läßt er zur Seite liegen, und wandelt, wie mit Blindheit geschla-
gen, unter Jämmerlichkeiten und Nichtigkeiten umher. Ja, er gefällt sich in sei-
nem Zustand; und wenn die Vorwelt nicht wäre und die göttlichen Lieder, die
von ihr Kunde geben, so würden wir gar nicht mehr ahnden, von welchen Gip-
feln, o Herr! der Mensch um sich schauen kann. Nun lässest du es, von Zeit zu
Zeit, niederfallen, wie Schuppen, von dem Auge Eines deiner Knechte, den du
dir erwählt, daß er die Thorheiten und Irrthümer seiner Gattung überschaue; ihn
rüstest du mit dem Köcher der Rede, daß er, furchtlos und liebreich, mitten unter
sie trete, und sie mit Pfeilen, bald schärfer, bald leiser, aus der wunderlichen
Schlafsucht, in welcher sie befangen liegen, wecke. Auch mich, o Herr, hast du, in
deiner Weisheit, mich wenig Würdigen, zu diesem Geschäft erkoren; und ich
schicke mich zu meinem Beruf an. Durchdringe mich ganz, vom Scheitel zur
Sohle, mit dem Gefühl des Elends, in welchem dies Zeitalter darnieder liegt, und
mit der Einsicht in alle Erbärmlichkeiten, Halbheiten, Unwahrhaftigkeiten und
Gleisnereien, von denen es die Folge ist. Stähle mich mit Kraft, den Bogen des
Urtheils rüstig zu spannen, und, in der Wahl der Geschosse, mit Besonnenheit
und Klugheit, auf daß ich jedem, wie es ihm zukommt, begegne: den Verderbli-
chen und Unheilbaren, dir zum Ruhm, niederwerfe, den Lasterhaften schrecke,
den Irrenden warne, den Thoren, mit dem bloßen Geräusch der Spitze über sein
Haupt hin, necke. Und einen Kranz auch lehre mich winden, womit ich, auf
meine Weise, den, der dir wohlgefällig ist, kröne! Über Alles aber, o Herr, möge
Liebe wachen zu dir, ohne welche nichts, auch das Geringfügigste nicht, gelingt:
auf daß dein Reich verherrlicht und erweitert werde, durch alle Räume und alle
Zeiten, Amen!
x.2
Der erste Punkt, Textkritik, wird aufgerufen, und erst einmal nach der mutmaßli-
chen Herkunft des Textes gefragt. »Aus einer indischen Handschrift« ist die erste
Antwort. Hm. Und wo steht er? In den »Berliner Abendblättern«, offenbar einer
Zeitung. Und wo genau? Im ersten Blatt, sogar in der ersten Nummer dieser Zei-
tung überhaupt. Was pflegt auf der ersten Seite der ersten Nummer einer Zeitung
zu stehen? Eine Programmerklärung – daher die Überschrift »Einleitung«. In der
Tat handelt es sich um die Programmerklärung einer neu gegründeten Zeitung.
Aber wieso dann »indische Handschrift«? Wer ist überhaupt der Autor? »Zoroas-
ter«, so lautet die naheliegende Antwort. Aber wer ist »x.«? Man kommt rasch auf
das Thema »Fiktion«, auf den Unterschied zwischen »Gebet des Zoroaster« und
»Gebet des Chefredakteurs«, kommt vom fiktiven Autor auf den wirklichen und
auf die Frage, warum versteckt sich Heinrich von Kleist hinter der Maske des Zo-
roaster, und warum gibt er Selbsterfundenes als »indische Handschrift« aus? Die
Beantwortung wird vorerst auf Punkt 4 vertagt.
Der zweite Punkt, Textkommentar, wird aufgerufen, es wird erklärt, wer Zoroas-
ter/ Zarathustra war, die kurze Geschichte der Berliner Abendblätter wird skizziert,
2 Ebd.
F4717-Antonsen.indd 107 03.12.2008 11:04:59 Uhr
108 HERMANN KURZKE
die Situation des Jahrs 1810 in Berlin und die Demütigung Preußens seit der
Schlacht von Jena und Auerstädt 1806 werden beschrieben, und Kleists Gebet des
Zoroaster wird in den Kontext der preußischen Reformen gestellt, die den unmit-
telbaren Bezugshintergrund des Textes bilden.
Der dritte Punkt entwickelt unter Makrostruktur erst die Formelemente, die es
erlauben, den Text der Gattung des Gebets zuzuordnen. Dabei entsteht (entwickelt
aus dem Vergleich mit dem Vaterunser) wie von selbst eine Aufbauanalyse, die eine
Gliederung ergibt: Anrede (»Gott, mein Vater im Himmel!«), Lobpreis und Prädi-
kation (»Du hast dem Menschen …«), drei Bitten (»Durchdringe mich …, Stähle
mich … lehre mich …«), Doxologie (»auf dass dein Reich …«), Schlussformel
(»Amen!«).
Unter Mikrostruktur werden erst einmal allerlei rhetorische Figuren gesammelt,
die grob gruppiert werden zu Satzbaufiguren einerseits (Parallelismen etc.) und
Bildfiguren andererseits (Metaphern etc.). Dann geht es, von den Satzbaufiguren
ausgehend, um Stilebenen (Dreistillehre), insbesondere um die Kennzeichen des
genus grande, zu dem Kleists Text gehört. Die Rolle der Kommata, woraus sich
dann Grundvorstellungen von Rhythmus und Klang in Prosatexten entwickeln las-
sen, wird an Beispielen verdeutlicht:
Gleichwohl, von unsichtbaren Geistern überwältigt, liegt er, auf verwunderns-
würdige und unbegreifliche Weise, in Ketten und Banden; das Höchste, von Irr-
thum geblendet, läßt er zur Seite liegen, und wandelt, wie mit Blindheit geschla-
gen, unter Jämmerlichkeiten und Nichtigkeiten umher.
Der Satz enthält elf Satzzeichen: neun Kommata, einen Strichpunkt und einen
Punkt. Einige dieser Kommata sind fakultativ, das heißt sie sind zwar nicht falsch,
aber weder nach den damaligen noch nach den heutigen Regeln zwingend. Andere
entstehen durch Inversionen, also Umstellungen des gewohnten Standardsatzbaus.
Wir beseitigen probeweise die Inversionen und die nicht erforderlichen Kommata.
Mit nur ganz geringfügigen Eingriffen erhalten wir einen klanglich leblosen Satz,
der dahinrasselt wie eine Maschine:
Gleichwohl liegt er von unsichtbaren Geistern überwältigt auf verwundernswür-
dige und unbegreifliche Weise in Ketten und Banden; das Höchste läßt er von
Irrthum geblendet zur Seite liegen und wandelt wie mit Blindheit geschlagen
unter Jämmerlichkeiten und Nichtigkeiten umher.
Von den elf Zeichen blieben zwei, ein Strichpunkt und ein Punkt, und man hat
keine Luft mehr, wenn man den Satz in einem Zug gesprochen hat. Versucht man
aber, jedes Komma als deutliche Pause zu artikulieren, entsteht ein feierlicher, hym-
nischer, lyrischer Sprechgesang:
Gleichwohl,
von unsichtbaren Geistern überwältigt,
liegt er,
auf verwundernswürdige und unbegreifliche Weise,
F4717-Antonsen.indd 108 03.12.2008 11:04:59 Uhr
OHNE PATHOS GEHT ES NICHT 109
in Ketten und Banden;
das Höchste,
von Irrthum geblendet,
läßt er zur Seite liegen,
und wandelt,
wie mit Blindheit geschlagen,
unter Jämmerlichkeiten und Nichtigkeiten umher.
Weil ein großer Stil dieser Art im heutigen Leben nicht mehr vorkommt und ein
bisschen Übung braucht, wird das Experiment an zwei weiteren der vielen prächti-
gen Sätze dieses Texts wiederholt. Zoroaster fühlt sich zur Rettung der Menschen
berufen und betet, unter Verwendung von zwanzig Kommata, zwei Strichpunkten
und zwei Punkten, wie folgt:
Nun lässest du es, von Zeit zu Zeit, niederfallen, wie Schuppen, von dem Auge
Eines deiner Knechte, den du dir erwählt, daß er die Thorheiten und Irrthümer
seiner Gattung überschaue; ihn rüstest du mit dem Köcher der Rede, daß er,
furchtlos und liebreich, mitten unter sie trete, und sie mit Pfeilen, bald schärfer,
bald leiser, aus der wunderlichen Schlafsucht, in welcher sie befangen liegen,
wecke. Auch mich, o Herr, hast du, in deiner Weisheit, mich wenig Würdigen, zu
diesem Geschäft erkoren; und ich schicke mich zu meinem Beruf an.
Hebt man die kühnen Inversionen auf, erhält man wieder eine hindernislos dahin-
schießende und ermüdende Version:
Von Zeit zu Zeit läßt du es nun wie Schuppen von dem Auge eines deiner Knech-
te niederfallen … Auch mich wenig Würdigen hast du in deiner Weisheit zu die-
sem Geschäft erkoren und ich schicke mich zu meinem Beruf an.
Und wieder ergibt sich ein schönes freirhythmisches Gedicht, wenn wir die Satzzei-
chen als deutliche Pausen artikulieren:
Nun lässest du es,
von Zeit zu Zeit,
niederfallen,
wie Schuppen,
von dem Auge Eines deiner Knechte,
den du dir erwählt,
daß er die Thorheiten und Irrthümer seiner Gattung überschaue;
ihn rüstest du mit dem Köcher der Rede,
daß er,
furchtlos und liebreich,
mitten unter sie trete,
und sie mit Pfeilen,
bald schärfer,
bald leiser,
aus der wunderlichen Schlafsucht,
F4717-Antonsen.indd 109 03.12.2008 11:04:59 Uhr
110 HERMANN KURZKE
in welcher sie befangen liegen,
wecke.
Auch mich,
o Herr,
hast du,
in deiner Weisheit,
mich wenig Würdigen,
zu diesem Geschäft erkoren;
und ich schicke mich zu meinem Beruf an.
Kommata sind Dämme, vor denen der Sprachfluss sich staut. Sie können geordnet
eingesetzt werden zur Regulierung dieses Flusses, sie können artistisch eingesetzt
werden zur Erzeugung von Wasserkunst, sie können aber auch wie Knüppel in ei-
nem Text liegen, der dann wie ein Wildbach die Hindernisse umschäumt. An die-
ser Stelle der Analyse entstehen oft die ersten Aha-Effekte, und in einigen Seminar-
teilnehmern keimt ein zartes Pflänzchen Liebe zur gebändigten Dramatik der
Schreibweise Kleists.
Es folgt, immer noch im Kapitel Mikrostruktur, eine Metaphernanalyse. Als
Aufgabe wird gestellt, nach Bildern zu suchen. Das Ziel dabei ist nicht, Bedeutun-
gen zu sehen, sondern von den Bedeutungen zurückzudenken zur dem Bild zu-
grundeliegenden Wirklichkeit. Man erkennt dann schnell mehrere Metaphern-
gruppen. Da sind zuerst die Waffenmetaphern, der Bogen, die Pfeile, der Köcher,
die Geschosse, schließlich das Grundbild »ihn rüstest du«. Vor dem inneren Auge
der Seminarteilnehmer steigt das Bild eines sich rüstenden Kriegers auf, der, wäh-
rend er seine Waffen anlegt, im Gespräch mit seinem Gott Rechenschaft ablegt von
dem Kampf, auf den er sich vorbereitet. Worum geht es bei diesem Kampf? Eine
zweite Metapherngruppe enthüllt das. Sie zeigt uns zuerst Bilder von Gefangen-
schaft und Befreiung (»in Ketten und Banden«) dann aber vor allem einen Bild-
komplex, der mit den Feldern »Sehen« und »Auge« zusammenhängt. Dazu gehören
negativ Wendungen wie »geblendet«, »mit Blindheit geschlagen«, »wunderliche
Schlafsucht«, »wie Schuppen« (von den Augen niederfallen) und »wecken«. Ihr po-
sitives Gegenstück ist die Vision »von welchen Gipfeln, o Herr! der Mensch um
sich schauen kann«. Zu dem Menschen auf dem Gipfel gehört auch die Metapher
»König der Erde«. Man erkennt bereits aus der Metaphernanalyse, dass »Zoroaster«
sich fühlt als ein sich rüstender Kriegerprophet, der die Menschen gefangen, schla-
fend und geblendet vorfindet und seine Aufgabe darin sieht, sie zu befreien, zu we-
cken, sehend zu machen und auf die Gipfel des Menschseins zu führen, wo jeder
von ihnen als König der Erde um sich zu schauen vermag.
Von hier aus ist der Weg zur immanenten Interpretation nicht weit. »Zoroaster«
erscheint als Maske, hinter der sich Heinrich von Kleist als Herausgeber der Berli-
ner Abendblätter verbirgt, der nicht weniger will als die in »Jämmerlichkeiten und
Nichtigkeiten«, in »Erbärmlichkeiten, Halbheiten, Unwahrhaftigkeiten und Gleis-
nereien« verstrickten Preußen zu befreien, und nicht nur sie, sondern auch die
Menschen überhaupt, und sie zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückzufüh-
F4717-Antonsen.indd 110 03.12.2008 11:04:59 Uhr
OHNE PATHOS GEHT ES NICHT 111
ren, von der er weiß aus der »Vorwelt« und aus den »göttlichen Liedern, die von ihr
Kunde geben«, also aus den alten Epen der Völker.
Ein maßloses Unterfangen! Ein Boulevardblatt soll aus Bürgern Könige machen!
Um das Vertrauen zurückzugewinnen und die Seriosität des Plans zu prüfen, muss
man an dieser Stelle Kontexte nachholen. Wer war dieser Kleist überhaupt? Es folgt
eine knappe Charakterisierung von Leben und Werk, mit besonderem Akzent auf
der Abfolge wechselnder Lebenspläne, auf den großen Aufbrüchen, denen dann
jeweils nach kürzerer oder längerer Zeit schreckliche Zusammenbrüche zu folgen
pflegten. Die Aufbrüche, die immer aufs Ganze gingen, die Depressionen, die im-
mer vernichtend waren, bis hin zu jenem letzten großen Aufbruch, dem Freitod am
Wannsee – das muss jeden Seminarteilnehmer ergreifen. Die Gründung der Berli-
ner Abendblätter, das ist dann die Folgerung, gehört zu einem solchen großen Auf-
bruch. Die Zoroastermaske ermöglicht ein Pathos, das für Kleist damals unum-
stößlich war.
Aus den vielen analytischen Möglichkeiten, die sich im Sack der fünften Gruppe
(externe Fragestellungen) befinden, wird nur noch ein schmales Tortenstück heraus-
geschnitten, die Wirkungsgeschichte, und auch aus ihr wird nur ein einziger Punkt
berührt: Was bedeutet dieser Text hier und heute, wenn wir ihn im Rahmen eines
literaturwissenschaftlichen Einführungsseminars behandeln? Geht er uns noch an?
Man mag es lächerlich oder wenigstens stark übertrieben finden, wenn ein damals
wenig angesehener Berliner Großstadtdichter gleich die Menschheit erlösen möch-
te. Aber ein Hauch von jenem großen Atem sollte doch jeden inspirieren, der Lite-
raturwissenschaft betreibt. Es reicht nicht, wenn man lernt, Texte nach Regeln aus-
einander zu nehmen, man muss auch die Jämmerlichkeiten und Nichtigkeiten be-
kämpfen wollen, in denen auch unser Zeitalter darniederliegt, man muss auch
teilhaben wollen an jenem großen Prozess der Erziehung der Menschheit, in dessen
Dienst alle große Literatur (sogar die, die sich dagegen sperrte) immer gestanden
hat. Das ist das leuchtende Licht, das immer vorangeht und einen hindurch zieht,
wenn es Wüsten zu durchqueren gilt. Das ist das heimliche Feuer, das einen wärmt
in jeder Stunde des Lebens, denn es gibt kaum eine Situation, die ein Literat nicht
schon für uns ausgedrückt und vorbedacht hätte – das allein ist schon eine Art
Trost. Literaturwissenschaft darf nie langweilig sein und kann nie langweilig sein,
wenn dieser Rückbezug zum eigenen Leben und seinem Zusammenhang mit der
Geistes-, Geschmacks-, Seelen- und Empfindungsgeschichte des abendländischen
Menschen gelingt. Ohne diesen Rückbezug wüssten wir ja nicht, von welchen Gip-
feln der Mensch um sich schauen kann! So schonend man angesichts einer langen
Missbrauchsgeschichte mit dem genus grande umzugehen hat – wenn man eine
große Frage gestellt bekommt, ist der große Stil nicht zu vermeiden. Ganz ohne
Pathos geht es dann nicht ab.
F4717-Antonsen.indd 111 03.12.2008 11:04:59 Uhr
F4717-Antonsen.indd 112 03.12.2008 11:04:59 Uhr
Stefanie Leuenberger (Freiburg/Schweiz)
DAS ENTZIFFERN DES »WOGEGEN«.
LITERATURWISSENSCHAFT UND KULTURGESCHICHTE
Die historische Methode ist eine philologische,
der das Buch des Lebens zugrunde liegt.
Walter Benjamin
»Is Literature Still Central to German Studies?« Hauptpunkt der von Frank Tromm-
ler angeregten Debatte zu dieser Frage im German Quarterly 20071 war die Ge-
wichtung von literaturwissenschaftlichen Fragestellungen gegenüber kultur- und
medienwissenschaftlichen Perspektiven. Die Debatte ist einer der jüngsten Beiträge
zur grundsätzlichen Diskussion über eine »Neuorientierung der Literaturwissen-
schaft und/oder/als Kulturwissenschaft«2, die seit über einem Jahrzehnt geführt
wird. Man hat bereits dafür plädiert, nicht deren vorläufigen Abschluss anzustre-
ben, sondern vielmehr die Dynamik des Theoriewandels innerhalb der Kulturwis-
senschaften zu untersuchen und die laufende Auseinandersetzung mit den For-
schungsgegenständen davon leiten zu lassen. Hingewiesen wurde auf die Differen-
zierungsimpulse, die das Masternarrativ des ›cultural turn‹ unterwandern, auf die
verschiedenen ›Wenden‹, von denen einige erneut zur Literaturwissenschaft hin-
führten oder direkt von ihr ausgingen: etwa die kritische Selbstreflexion über die
Bedingungen der eigenen Forschungstätigkeit und die Darstellungs- und Erzähl-
strategien innerhalb der Kulturwissenschaft, die als ›reflexive‹ oder ›literary turn‹
bezeichnet wurde, oder der Blick auf Dekolonisierungsphänomene und ihre kriti-
sche Darstellung durch neuere Literaturen der Welt außerhalb Europas oder auch
der ›translational turn‹, der die Kategorie der Übersetzung über Text- und
Sprachphänomene hinaus als kultur- und sozialwissenschaftlichen Grundbegriff
entwickelt.3
Eine der Antworten auf die Frage »Wozu Literaturwissenschaft?«, zu der jede
akademische Generation Stellung nehmen muss, seit sich zumindest eine der eins-
tigen Aufgaben der europäischen Philologien, ihr Beitrag zur Herausbildung natio-
naler Identität, als problematisch erwiesen hat, ist damit bereits gefunden. Die Li-
teraturwissenschaft bildet mit ihrem breiten Spektrum an theoretischen Ansätzen
den Ausgangspunkt für eine kulturwissenschaftliche Forschung, indem sie es er-
möglicht, das Lesen von Zeichen in ihrer ganzen Vieldeutigkeit und den Umgang
1 Trommler: Is Literature Still Central, S. 97.
2 Vgl. Nünning/Sommer: Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft, S. 26f.
3 Vgl. Bachmann-Medick: Cultural turns, S. 7–57.
F4717-Antonsen.indd 113 03.12.2008 11:04:59 Uhr
114 STEFANIE LEUENBERGER
mit Texten als Verfahren überhaupt zu lernen – und damit die Lektüre ›gegen den
Strich‹.
Auch zeigt die Diskussion im German Quarterly, dass für viele der amerikani-
schen Germanisten, die zu Wort kamen, die Frage der ›Abgrenzung‹ eigentlich kein
Problem darstellt. Die Tendenz der German Studies, ihr Forschungsgebiet weiter
zu fassen und ›Kultur‹ in ihren vielfältigen Ausprägungen zum Gegenstand der Un-
tersuchung zu machen, geht auf die Anfänge der Disziplin in den 1970er Jahren
zurück. Experten auf dem Gebiet der deutschen Literatur, der Kunst, Philosophie,
Geschichte und Politik sollten zusammengebracht werden und sich gegenseitig
über die Entwicklung der eigenen Forschung und Lehre informieren – die aus zeit-
historischem Interesse auf das 20. Jahrhundert fokussiert war. Ende der 1980er
Jahre wurde dann die Forderung nach einer »interdisziplinären Germanistik« be-
kräftigt und ebenfalls im German Quarterly diskutiert.4 Zwar existierten unter-
schiedliche Auffassungen darüber, was bei dieser Ausrichtung des Fachs genau zu
untersuchen sei: »High or low culture? Texts or texuality? Kultur or Kulturen
(cultures)?«5 Einig war man sich nur in der Opposition gegen die traditionelle Ger-
manistik und in der Ansicht, deren im 19. Jahrhundert konstituiertes Forschungs-
paradigma habe oft innovative interdisziplinäre Perspektiven verhindert.6 Gerade
im Aufrechterhalten der Pluralität der Perspektiven und Standpunkte – gegen den
Zwang, ein einzelnes Forschungsparadigma für die German Studies allgemein zu
entwickeln – sah man nun die Möglichkeit, die Reflexion anzuregen.7
Diese Konzeption der German Studies hat sich bis heute im Wesentlichen erhalten,
wie die Debatte im German Quarterly von 2007 zeigt. Russell Berman etwa
schrieb:
Frank Trommler expresses concern that literature has lost the centrality it once
held in the field. This view depends on a misunderstanding of »centrality«, which
hardly means exclusiveness. While literature was important at the romantic ori-
gins of Germanistik, the field also included much more that today belongs to his-
tory, anthropology, law and other disciplines. Similarly the positivistic focus on
manuscripts included a distinctive interest in context, and the Geistesgeschichte of
the early twentieth century also went far beyond literary works, narrowly defined.
If we worry that the field today is submerging literature in a mass of other materi-
als, our benchmark is the exceptionally narrow textualism that prevailed between
New Criticism and Deconstruction. Today’s German Studies as Cultural Studies
is probably closer to the historical suppleness of the field than Werkimmanenz
ever was.8
4 Vgl. Lützeler: Letter from the Editor: »Germanistik« as German Studies, S. 139f.
5 Vgl. Peck: Introduction, S. 142f.
6 Vgl. Hohendahl: Interdisciplinary German Studies: Tentative Conclusions, S. 227.
7 Ebd., S. 142.
8 Vgl. Russell Bermans Beitrag zur Debatte in: The German Quarterly 80 (1, 2007), S. 101.
F4717-Antonsen.indd 114 03.12.2008 11:04:59 Uhr
DAS ENTZIFFERN DES »WOGEGEN« 115
Einig ist man sich, dass innerhalb des Studiums der Literaturwissenschaft die Kon-
textualisierung literarischer Werke durch Lektüre von Texten aus dem Gebiet der
Philosophie, Theologie, Soziologie, Geschichtswissenschaft, Psychoanalyse und
Kunstgeschichte einer bestimmten Epoche notwendig ist. Denn dies erst ermög-
licht es, verschiedene Perspektiven zu erkennen, aus denen ein Text studiert werden
kann, und weiterführende Fragestellungen zu formulieren: etwa, wie literarische
Texte »an umfassenderen Vorgängen der Symbolisierung teilhaben, die ausdrück-
lich an kulturelle Praktiken sozialer Gruppen, an ethnische und geschlechtsspezifi-
sche Differenzen und politische Machtgefüge rückverwiesen sind«9.
Doch nicht erst die kritische Selbstreflexion des europäischen Literatur- und Kul-
turverständnisses gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat dazu geführt, kulturelle Hie-
rarchien sowie deren Text-Kanonisierungen in Frage zu stellen und nach Untersu-
chungsperspektiven jenseits der überkommenen Beschränkung auf Nationallitera-
turen zu suchen. Der Neubestimmung einer Disziplin günstig zu sein scheint der
Blick ›von außen‹, von der ›Peripherie‹ her – sei es, dass man diese Perspektive frei-
willig einnimmt, oder, dass man dazu gezwungen wurde. Jeffrey Peck vertrat diese
Sicht, wenn er 1989 schrieb, die Position der »Auslandsgermanistik« – außerhalb
des »Territoriums« der deutschen Muttersprache – zwinge ihre Teilnehmer zum
Bewusstsein ihrer Differenz. Es sei notwendig, dass der einzelne Wissenschaftler
dieses Gefühl der Fremdheit und Entfremdung sowohl von Deutschland als auch
von seiner eigenen nationalen Identität bewahre. Die kritische Reflexion beginne
dort, wo die Marginalisierung als Teil des »Projekts Germanistik« thematisiert wer-
de. Der »Außenseiter«, so Peck, werde dann zum »Insider« – aber nur insofern, als
er an einem Ort »dazwischen«10 einen Platz finden könne: im vermittelnden refle-
xiven Raum zwischen den Grenzen nationaler oder disziplinärer Territorien, zwi-
schen Mehrheit und Minderheit, Stärke und Schwäche oder anderen Polen einer
binären Opposition, die Machtverhältnisse repräsentiert, – und zwar ohne den
Zwang, eine feste Position einnehmen zu müssen.
Deutlich wird hier Pecks Hinweis auf die wissenschaftsgeschichtlichen Vorläufer
einer Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft, die Kultur als Symboluniversum
und textualen Zusammenhang versteht, der es also um das »Verständnis der Text-
vermitteltheit von Kulturen ebenso wie von kulturellen Implikationen literarischer
Texte«11 geht. Als Philologen blickten sie nicht nur über den Rand nationalliterari-
scher Traditionen hinaus, sondern plädierten für einen Kulturbegriff, der neben
Kunst und Literatur auch andere symbolische und technische Praktiken der Kultur
einschloss, nach deren historischem Gewordensein sie fragten. Ihre Studien waren
bestimmt durch »einen am Ästhetischen geschulten Blick perspektivischen
Verstehens«12 und durch ihre Stellung als ›Außenseiter‹. Sowohl Ernst Cassirer mit
9 Vgl. Bachmann-Medick: Kultur als Text, S. 15.
10 Peck: Remapping the Topography, S. 183.
11 Vgl. Bachmann-Medick: Kultur als Text, S. 45.
12 Vgl. Weidner: Figuren des Europäischen, S. 8.
F4717-Antonsen.indd 115 03.12.2008 11:04:59 Uhr
116 STEFANIE LEUENBERGER
seinem Versuch, die verschiedenen Bereiche des menschlichen kulturellen Handelns
als Teile eines Systems mit unterschiedlichen Formen von Symbolbildung zu verste-
hen, wie auch Aby Warburg mit seinen fächer- und epochenübergreifenden For-
schungen zum Nachleben antiker Bildformen und zur Psychologie menschlicher
Ausdrucksweisen, deren Ort einmal die Hamburger kulturwissenschaftliche Biblio-
thek war, und Walter Benjamin mit seinen kulturgeschichtlichen Arbeiten wurden
zu Exilanten – im eigentlichen Sinn oder durch die Auslagerung ihres Werks.
Eine Literaturwissenschaft, die sich der Entfremdung erinnert und im Raum
zwischen binären Oppositionen ihren Ort sieht, läuft weniger Gefahr, zu vergessen
und daher sich fragen lassen zu müssen, wozu sie gut sei. Walter Benjamin hat ein-
mal vorgeschlagen, beim Versuch der Kritik eines Werks erstens nach dessen Stelle
im »Schrifttum jener Epoche« zu fragen, zweitens zu bestimmen, worin es »typisch«
und worin »singulär« sei und drittens seine »polemischen Untergründe« darzustel-
len: das »Wogegen«13. Vielleicht nahm Walter Muschg genau darauf Bezug, wenn
er in einem Marburger Studium-Generale-Vortrag das »Wogegen« besonders be-
tonte: Ohne die Wissenschaft von der Literatur, so Muschg, werde man bald ver-
gessen, wie literarisch eingesetzte Zeichen empfangen und entziffert werden kön-
nen. In literarischen Texten seien »das Spielpotential, das Menschheitsgedächtnis,
die sinnliche Intelligenz, die Anleitung zum Handeln und zum Widerstehen« zu
finden. Das Literaturstudium sei daher der Ort, wo »Leute mit einem eigensinni-
gen Gegenstand so sorgsam und widerspruchsfähig umgehen lernen, wie wir mit
unseresgleichen zu selten umgehen; wo der Sinn für das Mögliche – das beste und
das schlimmste Mögliche – geübt, wachgehalten werden kann«14.
Am Anfang dieses Studiums steht jedoch die Neugier nach Kunstwerken, die, wie
Gert Mattenklott es ausdrückte, nicht anders erklärt werden kann als aus der »ur-
sprünglichen Erfahrung von Ergriffenheit, deren Lusterleben begierig nach Wie-
derholung macht«15. Dass diese Lust die Grenzen einer ›Nationalliteratur‹ nicht
kennt, hat dazu geführt, dass zahlreiche Gelehrte im Laufe der Zeit ihre Tätigkeit
auf das Studium der Weltliteratur ausweiteten.
Exemplarisch dafür ist der Weg des 1892 in Berlin geborenen Erich Auerbach.
Seine historisch-synthetische Literaturbetrachtung führte ihn über die Frage der
Darstellung und Interpretation von Wirklichkeit in der europäischen Literatur
vom Gebiet der Romanistik hin zum Konzept einer »Philologie der Weltliteratur«.
Wie manche seiner Zeitgenossen war Auerbach gezwungen, das Verhältnis Deutsch-
lands zu Europa und zur Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, von
innen und von außen zugleich: als Schüler des französischsprachigen Gymnasiums
in Berlin und später als Jurist, der 1913 über das Problem der Mittäterschaft pro-
movierte, wobei er seine Thesen anhand von Beispielen aus der französischen Lite-
ratur erläuterte, dann als freiwilliger Soldat und schwer Verwundeter im Ersten
13 Benjamin: Symeon, der neue Theologe, Licht vom Licht. Hymnen, S. 266.
14 Muschg: Erlaubt ist, was gelingt, S. 178.
15 Mattenklott: Kanon und Neugier, S. 353.
F4717-Antonsen.indd 116 03.12.2008 11:04:59 Uhr
DAS ENTZIFFERN DES »WOGEGEN« 117
Weltkrieg, als Übersetzer der Scienza Nuova von Giambattista Vico, als Romanis-
tik-Student und Beiträger in den Diskussionen zum Dante-Jubiläum 1921, der,
mit Stefan Georges Commedia-Übertragung argumentierend, gegen die Tendenz
auf deutscher Seite anschrieb, die Figur des italienischen Dichters nationalkulturell
für Deutschland zu vereinnahmen, später als Professor auf einem Lehrstuhl für Ro-
manische Sprachen in Marburg, von dem ihn die Nazis 1935 vertrieben, als Emi-
grant in Istanbul, wo er sein Hauptwerk Mimesis verfasste, und aus der Perspektive
des amerikanischen Exils, nachdem er Professor für romanische Sprachen an der
University of Pennsylvania und später in Yale geworden war, wo er 1957 starb.16
Auerbachs philologische Arbeit findet erneut Aufmerksamkeit in einer Zeit, in
der vielerorts ein interdisziplinärer Studiengang ›European Studies‹ eingerichtet
wird, in der Europa als »Projekt« und »Erbe« die akademischen Diskussionen be-
schäftigt und die methodisch-theoretischen Voraussetzungen einer »kulturwissen-
schaftlichen Erforschung Europas«17 geprüft werden. So befassten sich 2007 zu
Auerbachs 50. Todestag mehrere Publikationen und Veranstaltungen innerhalb der
Komparatistik, der Kultur- und der Geschichtswissenschaft mit der Bedeutung sei-
ner Studien für eine Philologie als Kulturgeschichte: Ein in Berlin erschienener
Sammelband vereint Beiträge über Auerbachs ideengeschichtliche Prämissen, über
seine Freundschaft zu Zeitgenossen wie Walter Benjamin, Ernst Bloch, Raoul
Hausmann und Siegfried Kracauer sowie über das Nachwirken seiner philologi-
schen Methode etwa in Edward Saïds literatur- und kulturtheoretischen Arbeiten.18
In Florida hatte eine Tagung zu »Exile, Judaism and Literary Criticism« das Ziel,
Auerbachs bekanntestes Werk Mimesis in den Kontext der Widersprüche der Mo-
derne zu stellen, seinen komparatistischen Ansatz als Ausdruck diasporischer Er-
fahrung zu lesen und die politische Dimension seiner Literaturkritik zu ermessen.19
Dazu gehörten auch Überlegungen zur Bedeutung von Mimesis als einem »deutsch-
jüdischen Text«20. Und in Istanbul widmete sich ein Symposium den intellektuel-
len Netzwerken, die dort während Auerbachs Exilzeit entstanden, sowie seinen Er-
fahrungen im Umfeld des türkischen Säkularisierungs- und Reformprozesses.21
16 Zur Biographie vgl. Barck: Erich Auerbach in Berlin, S. 195–214; u. Gumbrecht: Vom Leben
und Sterben der großen Romanisten, S. 152–174.
17 Weidner: Figuren des Europäischen, S. 7.
18 Die Beiträge gehen auf ein 2004 vom Berliner »Zentrum für Literaturforschung« veranstalte-
tes Kolloquium zurück: Vgl. Treml/Barck: Erich Auerbach, S. 9.
19 Die Diskussion der Frage nach dem politischen Charakter von Auerbachs Lektüren begann,
nachdem René Wellek 1954 die amerikanische Ausgabe von Auerbachs Mimesis rezensiert
und das Buch als »akontextuell« und »unzeitgemäß« bezeichnet hatte. Sie wurde weiterge-
führt auf einem Symposium, das 1996 zum 50. Jahrestag des Erscheinens von Mimesis in
Stanford stattfand und u. a. den Charakter dieses Buches als Exilwerk thematisierte. Vgl.
Nichols: Philology in Auerbach’s Drama of (Literary) History, S. 63–77.
20 Shahar: Zurück zum Roman, einem Zufluchtsort der Menschheit in ihren schweren Zeiten (hebr.).
21 Vorgestellt wurde auch eine in Berlin entstehende umfangreiche Edition von Briefen Auer-
bachs. Vgl. die Vorauswahl einiger Briefe: Vialon: »Und wirst erfahren wie das Brot der Fremde
so salzig schmeckt«.
F4717-Antonsen.indd 117 03.12.2008 11:04:59 Uhr
118 STEFANIE LEUENBERGER
Die Vorstellung einer ›Identität‹ Europas hat ihre Unschuld verloren – »theoretisch
seit der poststrukturalistischen und postkolonialen Kritik hegemonialer Identitä-
ten, politisch seit der Debatte über den Türkeibeitritt«, wie Daniel Weidner es for-
mulierte.22 Welche Ansatzpunkte bietet Auerbachs Arbeit für eine interdisziplinäre
›europäische Kulturgeschichte‹, die essentialisierende Zuschreibungen vermeiden
will? Vorgeschlagen wurde, Auerbachs Terminus »Figur« zu übernehmen und da-
mit Phänomene zu bezeichnen, die keine festen Begriffe oder Konzepte bilden,
sondern durch den Charakter der Vorläufigkeit und der Grenzüberschreitung ge-
kennzeichnet sind. Wenn Europa, wie Rémi Brague meinte, weniger das Ergebnis
von Verbindungen als das von Unterscheidungen ist23, so müssen diese Unterschei-
dungen selbst studiert werden. Zu fragen sei, so Weidner, wie sie konstituiert und
stabilisiert werden und welche Effekte sie auf das System haben. So könne eine
historische Perspektive eingenommen, das Schreiben einer vereindeutigenden Ge-
schichte Europas aber vermieden werden.24
Das Konzept der ›Figur‹ diente Auerbach in der Mimesis-Studie zur Verdeutli-
chung seines Darstellungsmodells.25 Entstanden ist die Figuralprophetie in der his-
torischen Situation der Ablösung des Christentums aus dem Judentum, als eine
Form der Geschichtsdeutung war sie schon immer Textinterpretation: sie »enthält
die Deutung eines innerweltlichen Vorgangs durch einen anderen«26. Die »Figura«
ist ein Protagonist der Gegenwart, eine konkrete Figur in Raum und Zeit, die aber
dennoch auf etwas Zukünftiges, Verheißenes verweist. Sie enthält etwas Vorläufi-
ges, Unvollständiges, und somit bleibt das Weltgeschehen immer deutungsbedürf-
tig, offen und fraglich.27
Anhand der Lektüre einzelner Szenen aus verschiedenen Werken der europäi-
schen Literatur folgte Auerbach den Entwicklungen der Darstellung von Wirklich-
keit und zeigte, wie jede Epoche das realistische Narrativ den sozialen und kulturel-
len Bedingungen entsprechend neu formte. In seiner Herausarbeitung unterschied-
licher Erzählstrategien, poetischer Strukturen und Formen der Stilmischung wird
deutlich, dass nach Auerbach der Realismus die Wirklichkeit nicht einfach abbil-
det: Er ist vielmehr ein komplexes, anspruchsvolles und ironisches poetisches Mo-
dell, in dem das Erhabene sich im Alltäglichen offenbart und das Heilige im Profa-
nen, in dem das Tragische mit dem Komischen verbunden ist, das Majestätische
mit dem Grotesken und das Metaphysische mit dem Sinnlichen.28 Das Modell von
Auerbachs Mimesis ist die ›Stilmischung‹: die Studie kann, so entdeckte eine auf-
merksame Analyse, als Arbeit über eine Poetik gelesen werden, die verschiedene
22 Vgl. Weidner: Figuren des Europäischen, S. 7.
23 Vgl. Brague: Europa. Eine exzentrische Identität.
24 Vgl. ebd., S. 8f.
25 Vgl. Auerbach: Mimesis, S. 151f.
26 Auerbach: Figura, S. 80.
27 Vgl. ebd., S. 81.
28 Zum Folgenden vgl. Shahar: Zurück zum Roman, einem Zufluchtsort der Menschheit in ihren
schweren Zeiten (hebr.).
F4717-Antonsen.indd 118 03.12.2008 11:04:59 Uhr
DAS ENTZIFFERN DES »WOGEGEN« 119
Diskurse, Sprachen und Stimmen zusammenbringt – und damit unterschiedliche
Sichtweisen auf Sein und Zeit.29 Nach Auerbach ist der realistische Stil der europä-
ischen Literatur eng verbunden mit der Geschichte der Säkularisierung: Es ist eine
Darstellung der Welt, die von Bewegung, Veränderung und schnellen Standpunkt-
wechseln regiert ist, in der der Realismus auf sinnlicher Wahrnehmung, auf Dis-
kursen des Begehrens und Dialogen der Alltäglichkeit beruht. Das Hauptthema
des Realismus ist das Werden, seine Perspektive die Ironie, seine Helden sind die
Narren.
Zwar ist Auerbachs Lektüre selektiv und behält einen eurozentrischen Blickwin-
kel bei. Auch erscheint Mimesis als Beispiel für eine Arbeit, die in Zeiten von Krieg
und Vernichtung entstand als Ergebnis einer Art Abkehr vom Leben hin zur Litera-
tur. Dennoch ist es, so Shahar, mehr als eine Studie zur Darstellung von Wirklich-
keit in der europäischen Literatur: es ist ein politischer Text, der gegen den Faschis-
mus eintritt. Der humanistischen Tradition verpflichtet, hält er fest an einer offe-
nen Gesellschaft, die von der Dogmatik der Kirche und totalitären Tendenzen
ebenso frei ist wie von einem naiven Verständnis von Aufklärung und Rationalis-
mus. Er vertritt zwar die europäische Tradition und Sichtweise der Literatur,
widmet sich aber der Bewegung über die territorialen Grenzen von Sprachen
und Nationalliteraturen hinweg. Auch bleibt der Klang der Fremdwörter in den
unübersetzten Zitaten gegenwärtig und unterläuft so die Hegemonie der deutschen
Muttersprache. Darin ist das Echo einer humanistischen, kosmopolitischen Kultur
zu hören, die nationale Beschränkungen von Literatur und Kanon hinter sich
lässt.30
Nach Auerbach impliziert Realismus die Pluralität von Stimmen und Begehren. Er
ist der Würde des Menschen verpflichtet, ohne die Unvollkommenheit der Reali-
tät, die Schwächen und Fehler des Menschen zu leugnen. Diese Perspektive leitete
Auerbach selbst von seiner Auseinandersetzung mit Vicos Ȋsthetischem Historis-
mus« her. Vico, dessen Verdienst »die Erkenntnis des Menschen in den Frühzeiten
seines gesellschaftlichen Zustandes« war, nutzte zur Interpretation der ältesten Do-
kumente der Sprache, des Rechts, der Religion und der Dichtung die Methode der
Philologie.31 Sie wurde ihm zum Inbegriff der Wissenschaft vom Menschen als
einem geschichtlichen Wesen und umschließt alle Disziplinen, die davon handeln.
Nach Vico ist es dem Menschen möglich, die historische und politische Welt zu
erkennen, weil er sie selbst gemacht hat. Das gegenseitige Verstehen beruht auf der
allen Menschen gemeinsamen »Anlage zu bestimmten Lebens- und Entwicklungs-
formen«32. Doch sei nützlich, so Auerbach 1936 über Vicos Idee der Philologie,
daran zu erinnern, dass das »Gemeinsam-Menschliche« hier nicht in einem gebil-
29 Ebd.
30 Vgl. Shahar: Zurück zum Roman, einem Zufluchtsort der Menschheit in ihren schweren Zeiten
(hebr.).
31 Auerbach: Giambattista Vico und die Idee der Philologie, S. 235f.
32 Ebd., S. 238.
F4717-Antonsen.indd 119 03.12.2008 11:04:59 Uhr
120 STEFANIE LEUENBERGER
deten, aufgeklärten, fortschrittlichen Sinn verstanden wurde, sondern »in der gan-
zen, großen, schrecklichen Wirklichkeit der Geschichte.« Vico formte den ge-
schichtlichen Menschen
nicht nach dem eigenen Bilde; er entdeckte nicht sich selbst im Anderen, sondern
den Anderen in sich selbst: er entdeckte sich selbst, den Menschen, in der
Geschichte, und längst verschüttete Kräfte unseres Wesens wurden ihm enthüllt.
Das ist seine Humanität; etwas weit Tieferes und Gefährlicheres als das, was man
zumeist unter diesem Wort versteht.33
Anders als Herder, der den Zustand der frühen Menschheit mit Rousseau als einen
Naturzustand der Freiheit des Gefühls und der Instinkte ohne Gesetze und Institu-
tionen auffasste, – eine unpolitische Sichtweise, wie Auerbach bemerkte –, verstand
Vico ihn als eine Zeit, in der die Menschen, arm an logischen Verstandeskräften,
aber reich an sinnlicher Erschütterungsfähigkeit und Formkraft, sich ihre phantas-
tische, doch strenge, oft grausame »sakral-formelhafte Welt- und Lebensordnung«34
schufen. Das Einsetzen fester Grenzen als psychologischer und materieller Schutz
gegen das Chaos einer komplexen Welt war nach Auerbach das Ergebnis dieses
»magischen Formalismus«35. »And later on, mythical imagination serves as the base
of a political system and as a weapon in the struggle for political and economic po-
wer«, so Auerbach über Vicos Auffassung von diesem frühen »Zeitalter der
Institutionen«36. Denselben ›magischen Formalismus‹, den Auerbach bei Vico her-
vorhob, sah auch Ernst Cassirer in der Gegenwart erneut am Werk, als er The Myth
of the State verfasste, der wie die Mimesis-Arbeit 1946 erschien.
Wie kann heute aus der Perspektive einer »philologischen Kulturgeschichte«37 ge-
forscht und gelehrt werden angesichts der Menge des Materials, der Methoden und
der Anschauungsweisen? Wie ist es möglich, zugleich mit der Literatur einer Epo-
che auch die Bedingungen zu studieren, unter denen sie sich entwickelt hat, »die
religiösen, philosophischen, politischen, ökonomischen Verhältnisse, die bildende
Kunst und etwa auch die Musik in Betracht zu ziehen« und gleichzeitig »auf all
diesen Gebieten die Ergebnisse der ständig tätigen Einzelforschung«38 zu verfolgen?
Auerbach stellte diese Frage schon 1952 in seinem Aufsatz Philologie der Weltlitera-
tur. In seinem Versuch einer Antwort plädierte er für eine Vergangenheitskompe-
tenz und somit für das Gegenteil der heute geforderten Kompetenz zur Analyse der
Gattungen und Repräsentationsformen einer Gegenwart, die durch eine internati-
onale Medien-, Markt- und Populärkultur geprägt ist. »Zwar ist es die Gesinnung
und Lage unserer Zeit, aus der wir das Ganze der Geschichte ergreifen müssen,
33 Ebd., S. 241.
34 Auerbach: Giambattista Vico und die Idee der Philologie, S. 235.
35 Auerbach: Vico and aesthetic historism, S. 273.
36 Vgl. ebd., S. 272.
37 Weidner: Figuren des Europäischen, S. 9.
38 Vgl. Auerbach: Philologie der Weltliteratur, S. 305.
F4717-Antonsen.indd 120 03.12.2008 11:04:59 Uhr
DAS ENTZIFFERN DES »WOGEGEN« 121
wenn es für uns bedeutend werden soll; aber den Geist der eigenen Zeit besitzt ein
begabter Student ohnehin«39. Er bedürfe jedoch eines akademischen Lehrers, um
die Sprachformen und Lebensumstände früherer Epochen zu verstehen und die
Methoden und Hilfsmittel zu ihrer Erforschung kennen zu lernen. Für Studien zu
einem bestimmten Gebiet müsse exemplarisch vorgegangen und jeweils ein kon-
kreter, genauer, gegenständlicher Ansatz gefunden werden, der ausstrahle, so dass
von ihm aus Weltgeschichte getrieben werden könne. Diese Gegenständlichkeit
der Phänomene dürfe in der Analyse nicht verloren gehen, wenn es das Ziel sei,
»die Menschen in ihrer eigenen Geschichte ihrer selbst bewußt zu machen.«40
Dass in der Zeit einer »Standardisierung der Erdkultur« unsere »philologische
Heimat« nicht mehr die Nation, sondern die Erde ist und »perfectus vero cui mun-
dus totus exilium est«41, scheint eine gute Voraussetzung dafür zu sein, aus dieser
Perspektive »von außen« die kulturellen Formen der Vergangenheit und der Ge-
genwart zu studieren und das Entziffern des »Wogegen« zu üben sowie den Wider-
spruch.
39 Ebd., S. 305f.
40 Auerbach: Philologie der Weltliteratur, S. 310.
41 Ebd., S. 309.
F4717-Antonsen.indd 121 03.12.2008 11:05:00 Uhr
F4717-Antonsen.indd 122 03.12.2008 11:05:00 Uhr
Urs Meyer (Freiburg/Schweiz)
FÜNF SCHWIERIGKEITEN BEIM SCHREIBEN EINER
IDEOLOGIEKRITISCHEN INTERPRETATION. ZUR REZEPTION
VON ERICH KÄSTNERS EMIL UND DIE DETEKTIVE UND
GERHARD LAMPRECHTS GLEICHNAMIGER VERFILMUNG
Wer heute literarische Texte interpretieren will, hat zumindest fünf Schwierigkeiten
zu überwinden. Er muss den ›Mut‹ haben, den scheinbar ergebnislosen Streit der
Interpretationen fortzusetzen; er muss die ›Klugheit‹ haben, verschiedene Interpre-
tationsansätze einander gegenüberzustellen, um sie einer gegenseitigen Relativie-
rung zuzuführen; die ›Kunst‹, die eigene Interpretation nutzbar zu machen, zum
Beispiel für schulische Zwecke; das ›Urteil‹, diese so zu vermitteln, dass sie nicht
ihrerseits zur Einseitigkeit tendiert; die ›List‹, sie in Festschriften oder anderen Pub-
likationsorganen unter interessierten Lesern zu verbreiten.
Diese Schwierigkeiten sind beträchtlich für jeden, auch wenn er die Freiheit hat,
sich mit der Interpretation von Literatur in aller Profession zu beschäftigen. Es er-
übrigt sich die Bemerkung, dass es keinen Vergleich gibt zu den Schwierigkeiten,
die sich Bertolt Brecht entgegenstellten beim Versuch, im Zeitalter des Faschismus
›die Wahrheit‹ zu schreiben.1 Sollte es dem Interpreten literarischer Werke indes
gelegentlich gelingen, an die Schwierigkeiten des Letzteren zu erinnern, dürfte
auch sein Schreiben mit Erkenntnis und Wirkung belohnt sein. In diesem Sinne
möchte ich mich einem scheinbar ›ausgeforschten‹ und doch kontroversen Text
zuwenden, Erich Kästners Emil und die Detektive (1929), sowie der gleichnamigen
Verfilmung durch Gerhard Lamprecht aus dem Jahre 1931. Rekonstruiert, wo
nicht selbst entwickelt werden fünf Lesarten dieses Textes, die an gegensätzlicheren
Orten nicht ansetzen könnten. Es stellt sich hierbei die Frage, inwiefern ein klassi-
sches Werk der Kinderliteratur der Leserin oder dem Leser auch Aufschlüsse über
die Zeitumstände geben kann, in denen es geschrieben oder gelesen worden ist.
Dazu ist es nun schon einleitend wichtig, das aus der falschen Erinnerung Käst-
ners häufig zitierte Erscheinungsjahr 1928 zu korrigieren. In Wahrheit fallen so-
wohl der Entstehungs- wie auch der Erscheinungstermin in den Herbst 1929, das
erste gedruckte Exemplar des Buches liegt exakt am 15. 10. 1929 auf dem Tisch
von Kästner, neun Tage also nur vor dem ›Schwarzen Donnerstag‹.2 Nachdem
schon am 13. Mai 1927 an der deutschen Börse ein erstes Kursgewitter tobte, mit
einer rasanten Talfahrt seit dem Dezember 1928, steht das aus dem Ersten Welt-
krieg hoch verschuldete Deutsche Reich im Herbst 1929 nicht nur kurz vor dem
größten Börsencrash der Geschichte, es steht auch viel unmittelbarer als 1928 der
1 Vgl. Brecht: Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, S. 74.
2 Vgl. Tornow: Erich Kästner und der Film, S. 46, Anm. 54.
F4717-Antonsen.indd 123 03.12.2008 11:05:00 Uhr
124 URS MEYER
politische Wandel bevor, der mit dem Aufstieg Adolf Hitlers verbunden ist. Dem-
nach stellt sich die Frage verstärkt, wie die Besonderheit dieser Zeit in Kästners auf
den ersten Blick harmlose jugendliterarische Detektiverzählung eingeflossen ist.
Und es fragt sich dabei weniger, ob Kästner solche Bezüge auf die politischen und
wirtschaftlichen Ereignisse der Zeit bewusst hergestellt hat, als vielmehr, welche
Zeitbezüge aus der Sicht der Rezipienten diesem Buch zu einem der größten litera-
rischen Erfolge des vergangenen Jahrhunderts verholfen haben.
Die Erfolgsgeschichte des Romans ist dabei in mehrere Stadien einzuteilen. Der
spontanen Rezeption des Kinderbuchs folgte schon rasch die produktive Rezeption
der Literaturverfilmung Lamprechts, welche die weitere Rezeptionsgeschichte des
Buches, insbesondere auch die nachfolgenden Literaturverfilmungen entscheidend
prägte. Beide Werke, Kästners Buch und Lamprechts Verfilmung, können also
durchaus im unmittelbaren Zusammenhang miteinander betrachtet werden.
1. Vorahnung demokratischen Denkens
Es wirkt heute so, als sei das Urteil über Kästner als Person (der ›sentimentale Mo-
ralist‹) und über sein Werk (›Kinderliteratur an der Grenze zur Trivialliteratur‹) ab-
schließend gefällt. Kästner ist ein Autor, der schon zu Lebzeiten einseitige Interpre-
tationen seines Werks geradezu provozierte, von denen sich selbstredend jede für
die ›bessere‹ hält. Angesichts solcher Interpretationen, die ideologisch im engen
Sinne einer Zuspitzung auf literaturkonservative, moralistische, sozialgeschichtli-
che, feministische oder auch literaturimmanente Thesen sind, ist freilich stets zu
fragen: für wen ›besser‹?
Und hier spätestens kommt der Leser ins Spiel, zum Beispiel Siegfried Kracauer.
1925 verkörperte für ihn der Detektivroman noch »die Idee der durchrationalisier-
ten zivilisierten Gesellschaft«3. Den Weg der vernünftigen Aufklärung verließ die
Form, der auch Brecht Interesse entgegen brachte4, erst mit den Werken Simenons
oder Dürrenmatts. In Kästners Kinderroman finden wir das Kriminalschema noch
in klassischer Form: Emils Fahndung nach dem Verbrecher endet durch die Koope-
ration der Berliner Kinder und nach Beweislage mit dessen Überführung. Die ›ge-
rechte‹ bürgerliche Ordnung wird mit Hilfe der staatlichen Instanzen wieder herge-
stellt. Vor diesem Hintergrund attestiert Kracauer Lamprechts Film und Kästners
Roman eine »schwache Vorahnung demokratischen Denkens«5.
Die ›demokratischen Tugenden‹, mit denen Kästner seine nur bedingt auch an-
tiautoritär agierenden Kinder ausstattet, entstammen dem Fundus der zeitgenössi-
schen bürgerlich-humanistischen Pädagogik, und sie sind getragen von Kästners
utopischem »Glauben an die Jugend«6: Solidarität, Mut, Ehre, Unabhängigkeit,
3 Kracauer: Der Detektiv-Roman, S. 107.
4 Brecht: Über die Popularität des Kriminalromans, S. 450.
5 Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 236.
6 Vgl. Doderer: Emil Kästners ›Emil und die Detektive‹, S. 108.
F4717-Antonsen.indd 124 03.12.2008 11:05:00 Uhr
FÜNF SCHWIERIGKEITEN 125
Selbstdisziplin und Pflicht. Es sind Werte, die Kracauer als demokratische wohl
anerkennt, in ihrer greifbaren Überzeugungskraft aber bereits anzweifelt. Er be-
zeichnet sie als ›Stimmungen‹ eher denn als ›Haltungen‹. So muss er am Ende ein-
räumen, dass es den »demokratischen Haltungen in diesem Film an Vitalität
gebricht«7.
2. Frauen lesen anders
Zu den jüngeren Kästner-Lektüren der pointierten Art gehört Ruth Klügers Bei-
trag Korrupte Moral: Erich Kästners Kinderbücher, veröffentlicht in ihrem viel be-
achteten Buch Frauen lesen anders.8 Zwar attestiert Klüger Kästner, als Verfasser
von Kindergeschichten »begabt und erfolgreich«9 gewesen zu sein. Doch entpuppt
sich dieses gemütliche Lob als ironisch schon im zweiten Absatz, in dem Klüger
ihre ganz und gar nicht mehr unter der Narrenkappe der Höflichkeit vorgetragene
feministische Kritik des Autors und seines Werkes eröffnet. Diese gehorcht zwar
den tradierten Mustern der literarischen Polemik. Doch bleibt auffällig, wie wenige
Zwischenschritte von Walter Benjamins bereits einmal der ›Grausamkeit‹ geziehe-
nen10 zeitgenössischen Rezension des Gedichtbands Ein Mann gibt Auskunft (1930)
aus dem Jahre 193111 bis zur aktuellen Polemik Klügers führen. Während Benja-
min sich noch darüber ärgerte, dass Kästner ›für‹ die »Zwischenschicht – Agenten,
Journalisten, Personalchefs« statt ›über‹ das Proletariat oder ›gegen‹ die Großbour-
geoisie schrieb, und dass er sich zudem in einer passiven ›linken Melancholie‹ ver-
lor, statt zur Tat aufzurufen, geht Klüger in ihrer Kritik weiter und wirft dem Autor
vor, einen Beitrag zur nationalsozialistischen Ideologie geleistet zu haben.
Klügers Kernthese lautet, dass Kästner eben gerade zu jenen Autoren zählt, die
den Brecht’schen ›Schwierigkeiten, die Wahrheit in finsteren Zeiten zu schreiben‹,
aus dem Weg gegangen sind. Entsprechend werden seine Werke abwertend tituliert
als »Kitschromane für Erwachsene«12 oder gar als »verlogen«13 bezeichnet. Auch
heißt es, mit Blick auf die historische Schreibsituation Kästners, er beschreibe die
»(Hitler-)Zeit als Inbegriff der Gemütlichkeit«14.
Es ist kaum zu bestreiten, dass Kästners Moralvorstellungen und Tugendbegrif-
fe, in besonderem Maße etwa sein hochgradig idealisiertes Bild der Mutter, die im-
mer auch seine Mutter Ida Kästner war, gänzlich und unglücklich in ihrer Zeit
7 Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 237.
8 Klüger: Korrupte Moral: Erich Kästners Kinderbücher. Der Titel Frauen lesen anders spielt an
auf Kästners Rede Kinder lesen anders zur Jugendbuchwoche 1956, abgedruckt in: Kästner:
Vermischte Beiträge, S. 533f.
9 Ebd., S. 63.
10 Vgl. Schuh: Walter Benjamins Grausamkeit, S. 64.
11 Vgl. Benjamin: Linke Melancholie, S. 279.
12 Ebd., S. 64.
13 Ebd.
14 Ebd., S. 65.
F4717-Antonsen.indd 125 03.12.2008 11:05:00 Uhr
126 URS MEYER
verhaftet sind. Es ist ebenfalls kaum zu übersehen, wie rasch die sozialkritischen
Töne in Kästners Werk nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verklin-
gen. Zwiespältig war gewiss schon die politische Haltung in seinen vor dem 30. Ja-
nuar 1933 veröffentlichten Werken.
Eine einseitige Kästner-Kritik, wie sie Ruth Klüger aber nun im Anschluss an
Benjamin entwickelt, fordert jedoch ihrerseits das Misstrauen heraus. Es scheint,
als müsse die Frage noch einmal gestellt werden, ob eine solche – auf die Spitze ge-
triebene – Verurteilung eines Autors der ›Inneren Emigration‹, dessen vor der nati-
onalsozialistischen Machtergreifung veröffentlichten Werke 1933 verbrannt wur-
den, und der zwischen 1933 und 1945 mit einem weit reichenden Schreibverbot
belegt worden war, auch jenseits politisch motivierter Schriftsteller-Polemik ge-
rechtfertigt ist.
3. Kinder spielen anders
Emils Kindheit ist geprägt durch den frühzeitigen Tod seines Vaters. Er lebt mit
seiner allein erziehenden Mutter. Es wird nicht ausdrücklich gesagt15, aber der Be-
zug zur Gegenwart muss den Zeitgenossen noch evident gewesen sein, dass Emil
zur Identifikationsfigur all jener Kriegswaisen taugte, die kurz vor oder während
des Ersten Weltkriegs geboren wurden und in der nämlichen Zeit ihren Vater verlo-
ren hatten. 1929 waren diese (Halb-)Waisen zwischen 11 (bei Geburt 1918) und
15 (bei Geburt 1914) Jahre alt. Emil besucht die Realschule, ist also in der Fiktion
der Erzählten Zeit mindestens 10 Jahre alt.
Aufgrund der bandenartigen Organisation der Berliner Kinder, die sich um Emil
gruppieren, sahen sich manche Interpreten verleitet, den durchaus gewagten, histo-
risch aber nicht vollkommen abwegigen Vergleich mit der Formation der Hitlerju-
gend zu ziehen.16 Während Kracauer noch von demokratischen Tugenden einer
»Bande Berliner Gören«17 spricht, die sich auf einen (dann wohl als gerecht gedach-
ten) »Kinderkreuzzug«18 gegen den Bösewicht Grundeis begeben, macht das Inter-
pretationsangebot Marianne Bäumlers deutlich, dass die ›Zusammenrottung‹ einer
Jugendbande in der Kinderliteratur der präfaschistischen Zeit durchaus negative
Konnotationen zu wecken vermag.19 Bäumler kehrt die originale narrative Situati-
on, in der die guten Jungs den bösen Dieb jagen, insofern um, als sie der Jugend-
bande eine Hetz- und Treibjagd auf einen gesellschaftlichen Außenseiter unterstellt.
15 Kästner: Emil, S. 170: »Als Emil fünf Jahre alt war, starb sein Vater, der Herr Klempnermeis-
ter Tischbein. Und seitdem frisiert Emils Mutter.« Emil wäre somit 1929 16 Jahre alt, da die
Handlung aber nicht genau auf das Erscheinungsjahr des Buches datiert ist, sondern unbe-
stimmt in den 1920er Jahren spielt, ist auch ein jüngeres Alter anzunehmen.
16 Vgl. z. B. Grafe u. Patalas: Nicht nur Pieck & Pabst, S. 144.
17 Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 236.
18 Ebd.
19 Bäumler: Die aufgeräumte Wirklichkeit des Erich Kästner, S. 147–159.
F4717-Antonsen.indd 126 03.12.2008 11:05:00 Uhr
FÜNF SCHWIERIGKEITEN 127
Beide Übertreibungen scheinen somit möglich: die gut organisierten Kinder veran-
stalten eine spielerische ›Hetzjagd‹ gegen den verbrecherischen ›Außenseiter‹ oder
aber die Schwächeren solidarisieren sich untereinander gegen den ihnen körperlich
überlegenen Bösewicht.
Gleichwohl mutet die Idee, Kästner habe in der Figur des Taschendiebs Grund-
eis einen verfolgten ›gesellschaftlichen Außenseiter‹ darstellen wollen, wie eine
recht gröbliche Missachtung der Autorintention an. Grundeis’ Vergehen steht für
Emil, der ihn ab dem Moment, in dem er den Taschendiebstahl noch im Zug ent-
deckt, den »Dieb« nennt, von Beginn an fest. Es gilt also, wie Klüger zu Recht be-
merkt20, nicht die Unschuldsvermutung. Nur, in der Logik des Detektivromans
muss der Täter zuerst gestellt werden, bevor er mittels Beweisen zu überführen ist.
Und es sind gleich mehrere Indizien, die zum Anfangsverdacht führen: Grundeis
verhält sich sonderbar, versteckt sich hinter seiner Zeitung, sitzt am Ende allein mit
dem Jungen im Zug, betäubt ihn mit präparierter Schokolade und ist, als der Junge
wieder aufwacht, (genau wie die 140 Mark) verschwunden. Es ist angesichts dieser
Indizienlage schwer zu verstehen, warum Klüger von einem »Sündenbock« oder
gar – mit Blick auf die Kinder – von einem »aggressiven Zusammengehörigkeitsge-
fühl, das nach einem Opfer sucht«21 spricht. Ein Anfangsverdacht auf Diebstahl ist
auch nach moderner kriminalistischer Einsicht durchaus gegeben.
Ernsthaft in der Art Erwachsener betreiben die Kinder vornehmlich ihre Mobil-
machung gegen den Dieb und den Aufbau einer bandenartigen Organisations-
struktur. Diese erinnert entfernt an die Jugendbewegungen der Weimarer Repub-
lik22 oder legt gar, obwohl sie hier ohne Direktion durch Erwachsene von den Kin-
dern selbst ad hoc gebildet wird, den Vergleich mit der Hitlerjugend nahe. Die
Kinderbande sammelt Geld, verabredet Signale (der Junge mit der Hupe), versam-
melt sich an bestimmten Orten, richtet eine Telefonzentrale, einen Bereitschafts-
dienst und ein Hauptquartier ein (auf einer Baustelle gegenüber dem Hotel, in
dem Grundeis logiert), wählt Verkleidungen und Tarnungen (als Liftboy), spio-
niert im Hotel und bestimmt ein Losungswort (»Parole Emil«) und einen Verbin-
dungsmann.23 Diese Organisation zeigt Wirkung: Am Ende verfolgen »neunzig bis
hundert«24 Kinder den Dieb auf seinem Weg zum Bankinstitut, auf einer Jagd, die
prädestiniert ist für eine filmische Umsetzung mit einer beträchtlichen Zahl von
Statisten, zum Dreh einer jener im Kino der Zeit so beliebten Massenszenen. Lam-
precht zeigt sich in seinem Emil-Film noch unmittelbar beeinflusst von der propa-
gandistischen Filmkunst Sergej Eisensteins, die er schon zuvor in einer Reihe von
sozialkritischen Milieufilmen adaptiert hatte.
Die ›Zusammenrottung‹ der Bande wie die Verfolgungsjagd beschreibe Kästner
in einer durch den »verzerrten Gebrauch des Militärjargons« schon »fast parodis-
20 Vgl. Klüger: Korrupte Moral: Erich Kästners Kinderbücher, S. 71.
21 Ebd., S. 72.
22 Vgl. Thamer: Jugendmythos und Gemeinschaftskult.
23 Vgl. Kästner: Emil, S. 213–224.
24 Ebd., S. 244.
F4717-Antonsen.indd 127 03.12.2008 11:05:00 Uhr
128 URS MEYER
tisch«25 wirkenden ›Sprache der Kinder‹. Wie sehr dieser Kinderjargon nicht für
bare Münze zu nehmen ist, vielmehr die Erwachsenensprache ironisch imitiert und
zitiert, zeigt der Brief Emils an seine Großmutter, in dem Emil Augen zwinkernd
behauptet, der Ort seines Verbleibs sei ein »Amtsgeheimnis«26. Kinder, das wird in
Kästners Buch mit pädagogischem Zeigefinger deutlich gemacht, sprechen den Er-
wachsenen nach dem Mund – im Guten wie im Schlechten. Wäre es im Sinne des
radikalen Pazifisten Kästner gewesen, den Kindern, die sein Buch lasen, den Auf-
bau paramilitärischer Organisationen ernsthaft zu empfehlen, hätte er bestimmt
auch davon Abstand genommen, nur ein Jahr später das antimilitaristische Gedicht
Primaner in Uniform (1930) zu verfassen.
Je nachdem also, wie man das Verhältnis zwischen Opfer und Täter akzentuiert,
kann man in der Bande Emils ein Abbild oder gar Vorbild der Hitlerjugend sehen
oder ein Gegenbild, dann nämlich wenn man die Solidarität der Kinder in den
Mittelpunkt stellt, die paramilitärische Organisation als Imitation der Erwachse-
nenwelt begreift und den Verfolgten nicht mehr als ›Außenseiter‹ stilisiert, sondern
als das versteht, was er in Kästners Roman zunächst einmal ist: als Taschendieb und
Bankräuber.
4. Gangster sehen anders aus
Auch die »Schwarzweißtechnik«27 der Figurenzeichnung, etwa des ›bösen‹ Diebs
Grundeis im Kontrast zum ›guten‹ Detektiven Emil, wurde Kästner zuweilen zur
Last gelegt. Emil wird zwar zu Beginn der Erzählung in der Art von Lausbuben-
Geschichten als wenig tugendhafter Dorfjunge dargestellt, der einer Autoritätsfigur
wie dem Dorfpolizisten üble Streiche spielt.28 Im weiteren Verlauf der Geschichte
ist er aber ganz der zuvorkommende »Musterknabe«29. Auch alle anderen Figuren
Kästners wirken wie Karikaturen. Das Karikaturhafte des Bösewichts Grundeis ist
sogar derart augenfällig, dass eine politische Implikation in Erwägung gezogen wer-
den sollte. Im Roman selbst wird Grundeis aus der Perspektive Emils eingeführt:
Er [Emil, U. M.] lehnte sich also in die entgegengesetzte Ecke des Coupés und
betrachtete den Schläfer. Warum der Mann nur immer den Hut aufbehielt? Und
ein längliches Gesicht hatte er, einen ganz schmalen schwarzen Schnurrbart und
hundert Falten um den Mund, und die Ohren waren sehr dünn und standen weit
ab.30
25 Hanuschek: Keiner blickt dir hinter das Gesicht, S. 173. Vgl. auch Pausch: Militarismen eines
Pazifisten.
26 Kästner: Emil, S. 218.
27 Doderer: Erich Kästners ›Emil und die Detektive‹, S. 111.
28 Vgl. Kästner: Emil, S. 187.
29 Ebd., S. 184.
30 Ebd., S. 190.
F4717-Antonsen.indd 128 03.12.2008 11:05:00 Uhr
FÜNF SCHWIERIGKEITEN 129
Der »Herr im steifen Hut«31 hat ein ›längliches Gesicht‹, einen ›schmalen schwar-
zen Schnurrbart‹, ›Falten um den Mund‹ und ›dünne Ohren‹. Dieses Signalement
mag auf manche Leserinnen und Leser der Zeit durchaus wie eine parodistisch-
physiognomische Beschreibung des visuell schon 1929 außerordentlich präsenten,
ja aufdringlichen nationalsozialistischen Parteiführers gewirkt haben.32 Hitler,
1929 gerade 40 Jahre alt geworden, war auf den zeitgenössischen Fotografien auf-
fällig oft mit einem zivilen Hut bekleidet, wo er ihn nicht wie später (zum Beispiel
auf dem Nürnberger Parteitag 1929) durch eine steife militärische Uniformmütze
ersetzte.33 Der ›steife Hut‹ wiederum war in den Texten der Weltbühne- und Simpli-
cissimus-Autoren Inbegriff für autoritäres Verhalten. Zudem wird Grundeis als
»Schläfer« bezeichnet, und auch Emil wird in einen tiefen Schlaf mit Albtraum
versetzt. Es handelt sich vermutlich um nur schwach kodierte, kontrafaktische
Hinweise auf das spätere böse Erwachen (im Roman wie in der Welt), dem der
Slogan aus den Anfangstagen der Hitlerzeit »Deutschland erwache« schon früh sei-
nen Namen gab. Diese Assoziation liegt gar nicht fern, wenn wir uns erinnern, dass
der mit Kästner eng verbundene Tucholsky nur kurze Zeit nach Erscheinen des
Emil-Romans sein parodistisches Gedicht Deutschland erwache! (1930) veröffent-
lichte (»daß der Nazi dir einen Totenkranz flicht –: / Deutschland, siehst du das
nicht –?«34).
Die visuellen Konnotationen und literarischen Anspielungen, die in der Cha-
rakterisierung der Figur Grundeis’ versteckt sind, werden durch Kästners Zeichner
Walter Trier zwar relativiert. Mit den ihm eigenen schwungvollen Linien verpasst
er der Figur das Aussehen eines britisch anmutenden Kavaliers. Verstärkt wird die
im Text eher schwer herauslesbare physiognomische Karikatur Hitlers allerdings in
der Erstverfilmung des Buchs, in der Grundeis durch den schon aus Fritz Langs
Metropolis (1927) bekannten Filmbösewicht Fritz Rasp verkörpert wird.
Vielleicht wäre Rasp in seiner Rolle als Grundeis nicht gerade als Hitler-Double
durchgegangen. Doch ist die physiognomische Ähnlichkeit zwischen Rasp, der tief
liegende, durchdringende Augen und einen dünnen Mund zum Markenzeichen
hatte, der aber nur in dieser Grundeis-Rolle den charakteristischen schmalen dunk-
len Schnauzer trug, und Hitlers Bild in der Öffentlichkeit zu jener Zeit frappie-
rend. Es genügt hier, ein Pressebild Heinrich Hoffmanns aus den 1920er Jahren,
das Hitler in einem Umzug anlässlich der Beerdigung eines SA-Mannes in Zivil
und mit Stehkragen zeigt35, zu vergleichen mit dem berühmten Bild, das Rasp als
Grundeis auf dem Weg zum Bankinstitut abbildet, verfolgt von einer Gruppe von
Kindern.
31 Ebd., S. 189.
32 Zur ikonischen Tradition der Führerphysiognomik vgl. Schmölders: Hitlers Gesicht.
33 Vgl. Lang: Adolf Hitler: Gesichter eines Diktators, Tafeln 6, 7, 10, 14, 15, 18, 21, 24, 25 (Par-
teitag 1929), 32 u. ö.
34 Kurt Tucholsky (pseud. Theobald Tiger): Deutschland erwache! In: Arbeiter Illustrierte Zei-
tung, Nr. 15 (1930), S. 290.
35 Von Lang: Adolf Hitler: Gesichter eines Diktators, Tafel 21.
F4717-Antonsen.indd 129 03.12.2008 11:05:00 Uhr
130 URS MEYER
Vielleicht wird erst angesichts solcher Filmbilder deutlich, wie sehr Kästners
oder spätestens Lamprechts Figurenzeichnung die Parallele zwischen Grundeis und
Hitler zumindest im Subtext dem zeitgenössischen Leser und Filmzuschauer nahe
legt. Wenn schon ein Weg von Caligari zu Hitler führt, so führt er an der filmisch-
dämonischen Figurendarstellung Grundeis’ auch nicht ohne weiteres vorbei.
Die dem linksbürgerlichen Autor Kästner unterstellte Absicht, einen »Gesetzes-
brecher mit der undeutschen Physiognomie und dem polnischen Namen« Kindern
vorgesetzt zu haben, die an ihm eine Art »Judenpogrom«36 vollziehen, ist somit
kaum plausibler, als die These, es handle sich bei Grundeis um ein literarisches Al-
ter Ego Hitlers, karikaturhaft dargestellt als Gauner und Kinderverführer. Dass
Kästner mit dem Namen Grundeis vor allem die literarische Parallele zu den restli-
chen sprechenden Namen seines Buches im Auge hatte, wie (Emil) »Tischbein«
oder (Pony) »Hütchen«, ist anzunehmen. Grundeis sammelt sich am Grunde von
nichtstillen Gewässern, von wo aus es, da sein spezifisches Gewicht geringer ist als
dasjenige des Wassers, nach einem Anstieg des Volumens urplötzlich an die Wasser-
oberfläche springt und zu Treibeis wird. Der sprechende Name könnte also durch-
aus eine diskrete Vorahnung zu Hitlers baldigem Aufstieg in sich bergen. Auch der
Name Hitler nämlich ist in einem ähnlichen Sinne bedeutsam, als Ableitung von
Hiedler. Das bairische und österreichische Dialektwort »Hiedl« bezeichnet einen
unterirdischen Wasserquell oder Flusslauf, der sporadisch überquillt und in Kellern
und Bodenvertiefungen Überschwemmungen verursacht.37
Hitlers diabolisch und auratisch inszenierte Gesichtszüge waren 1929 omniprä-
sent. Sie bildeten einen wesentlichen Bestandteil der Führer-Idolatrie in den Foto-
graphien des ›Augenzeugen‹ Heinrich Hoffmann, sie finden sich aber auch in den
zeitgenössischen Karikaturen verzerrt wieder. Schon am 28. Mai 1923 veröffent-
lichte Thomas Theodor Heine eine Anti-Hitler-Karikatur unter dem Titel Wie sieht
Hitler aus? in der Satire-Zeitschrift Simplicissimus. Es handelt sich um eine Auswahl
von 12 Abbildungen, denen Heine die Frage nach Hitlers ›wahrem Gesicht‹ zu-
grunde legte. Die Bildunterschriften lauten »Ist es wahr, dass er in der Öffentlich-
keit nur mit einer schwarzen Gesichtsmaske erscheint?«38 oder »Das Charakteristi-
sche seines Gesichtes sind doch wohl die faszinierenden Augen?«39 Auch Hitlers
Mund, Nase, Schnauz oder Ohren (»Er hört die leisesten Äußerungen der Volks-
stimme; sind nicht seine Ohren besonders entwickelt?«40) werden in einzelnen Ab-
bildungen satirisch überzeichnet. Es folgen die Karikaturen eines fetten, mageren
und ›schönen‹ Hitlers.41 Hitler, von dem bis dahin noch kein Pressefoto existierte,
begann erst gegen Ende 1923 sein Bildnis in der Öffentlichkeit mit Hilfe seines
Leibfotografen bewusst zu inszenieren.
36 So Grafe u. Patalas: Nicht nur Pieck & Pabst, S. 144.
37 Vgl. Udolph: Professor Udolphs Buch der Namen, S. 174–176.
38 Simplicissimus, Jg. 28, Nr. 9 (28. 5. 1923), S. 107.
39 Ebd.
40 Ebd.
41 Vgl. ebd.
F4717-Antonsen.indd 130 03.12.2008 11:05:00 Uhr
FÜNF SCHWIERIGKEITEN 131
Auch die Tradition der Anti-Hitler-Karikaturen wurde dadurch belebt. Ironi-
scher Weise hatten die Nationalsozialisten keine Mühe mit diesen politischen Ka-
rikaturen der Gegner: Hitlers Propagandahelfer Ernst Hanfstaengl instrumentali-
sierte sie sogar, indem er sie 1933 unter dem Motto ›Tat gegen Tinte‹ neu veröf-
fentlichte und mit der Behauptung versah, sie alle hätten sich nicht bewahrheitet.42
In diesen Karikaturen dominiert die verzerrende Darstellung des Parteiführers als
Marionette oder Gangster, die nicht nur in der Darstellung von Grundeis einen
möglichen Reflex haben könnte, sondern bis in die viele Jahre später verfasste Hit-
ler-Satire Brechts Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (1940) wirksam blieb.
Der Gangster Arturo Ui, beschrieben aus dem Exil, ist im Aussehen und Verhalten
zwar viel direkter mit Hitler in Verbindung zu bringen als der Gangster Grundeis.
Die Indirektheit der Hitler-Darstellung war aber vielleicht gerade ein Markenzei-
chen der von Benjamin (und ohne Namen zu nennen später auch von Brecht) an-
gegriffenen Weltbühne-Autoren, zu denen Kästner gehörte. Im Jahr der Erstpubli-
kation von Kästners Emil-Roman erschien in Kurt Tucholskys und John Heart-
fields Bildband Deutschland, Deutschland über alles zunächst kommentarlos, also
ohne Hinweis auf Hitler, die Fotomontage eines ›Arschs mit Ohren‹. Erst ein Jahr
später entschlüsselten die Verfasser selbst diese Montage als indirekte Hitler-Kari-
katur.43
Es sind aber nicht nur die äußere Gestalt und die Namengebung, die Parallelen
zwischen Grundeis und Hitler denkbar machen. Auch das Verhalten der Grundeis-
Figur könnte in die Richtung einer Hitler-Karikatur weisen. Er gaukelt Emil Lü-
genmärchen über Berlin vor, die mit der Realität der Großstadt wenig zu tun ha-
ben. Mit seiner verführerischen, viel verheißenden Rhetorik sucht der dämonische
Gangster die vermeintliche Naivität des Kindes auszunutzen:
Na, da wirst du aber staunen! In Berlin gibt es neuerdings Häuser, die sind hun-
dert Stockwerke hoch, und die Dächer hat man am Himmel festbinden müssen,
damit sie nicht fortwehen … Und wenn es jemand besonders eilig hat, und er
will in ein andres Stadtviertel, so packt man ihn auf dem Postamt rasch in eine
Kiste, steckt die in eine Röhre und schießt sie, wie einen Rohrpostbrief, zu dem
Postamt, das in dem Viertel liegt, wo der Betreffende hin möchte … Und wenn
man kein Geld hat, geht man auf die Bank und läßt sein Gehirn als Pfand dort,
42 Hanfstaengl: Hitler in der Karikatur der Welt. Tat gegen Tinte. Diese Sammlung kritischer
Hitler-Karikaturen, darunter auch Beispiele aus dem Satire-Magazin Simplicissimus, wurde
von Hitlers Berater Hanfstaengl im Jahre 1933 rückblickend zusammengestellt. Die zynische
Gegenüberstellung von ›Schrift‹ (Karikaturen aus den Jahren vor der Machtergreifung) und
›Tat‹ (politische Entwicklung um 1933) diente der Verunglimpfung der politischen Gegner.
43 Vgl. Tucholsky: Deutschland, Deutschland über alles, S. 176. Vgl. den Kommentar zur Abbil-
dung auf S. 402: »Im Juli/Aug. 1930 warb der Neue Deutsche Verlag in der WaA für DD mit
einer Reihe von Preisfragen und versprach für die beste Antwort Buchprämien im Wert von
3 Mark. Am 31. 7. 1930 betraf die ›Preisfrage: Was sagst Du zu Deutschland?‹ vorliegende
Collage: Eine Zeichnung, die einen wild gestikulierenden Hitler darstellt, der einen Band
von DD wegschmeißt, ist unterschrieben: »Hitler ist empört. Er findet sich auf Seite 176 des
Buches ›Deutschland, Deutschland über alles‹ zu treffend porträtiert!«
F4717-Antonsen.indd 131 03.12.2008 11:05:00 Uhr
132 URS MEYER
und da kriegt man tausend Mark. Der Mensch kann nämlich nur zwei Tage ohne
Gehirn leben; und er kriegt es von der Bank erst wieder, wenn er zwölfhundert
Mark zurückzahlt. Es sind jetzt kolossal moderne medizinische Apparate erfun-
den worden und …44
Zu solchen trügerischen Reden eines »verfolgten Rattenfängers«45 – als den ihn
Siegfried Kracauer bezeichnete – passt, dass Grundeis Emil bewusstlos macht mit
präparierter Schokolade. Dieser fällt in einen langen, Angst erregenden »Traum, in
dem viel gerannt wird«46. Darin geht es um einen – groteskerweise von Pferden
gezogenen – führerlosen Zug, in dem nur noch Grundeis sitzt. Er dreht sich so
rasch im Kreise, dass ein unglückliches Zusammenprallen der Lokomotive mit dem
letzten Zugwagen vorhersehbar wird. Nachdem Emil den Absprung von diesem
Todeszug schafft, nimmt der Zug die Verfolgung Emils auf. Erst vor einer gläser-
nen Mühle, in der Emil seine Mutter entdeckt, macht der Zug endlich halt, und
der böse, satirisch-groteske Traum findet ein Ende in Kästners Utopie einer heilen
Kindheit und Familie inmitten einer bedrohten und ›verkommenen‹ Welt.
Die Karikatur eines dämonischen Gauners, der seine Ziele nur erreicht, indem
er täuschende Reden hält und den Verstand seiner Mitmenschen ausschaltet, korre-
spondiert nun – das könnte durchaus in der Intention Kästners gelegen und sich
zumindest dem zeitgenössischen Leser so dargestellt haben – mit anderen Karika-
turen Hitlers aus jener Zeit, die ihn als gefährlichen Propagandisten zu entlarven
versuchten. Dabei ist festzustellen, dass Kästners Hitlerbild noch bis nach dem
Krieg dem hier wirksamen einfachen Prinzip der Dämonisierung unterlag. In sei-
ner Rede »Über das Verbrennen von Büchern« etwa wird Goebbels der »kleine
Hinkende Teufel«47 genannt.
5. Sieger fliegen anders
Beargwöhnt wurde an Lamprechts Kästner-Verfilmung schon von der zeitgenössi-
schen Filmkritik die pompös, ja monumental wirkende Schlussszene. Sie zeigt in
äußerst pathetischen, wirklichkeitsfremden Bildern die ›siegreiche‹ Rückkehr des
gefeierten Emil in seine Heimatstadt nach der Verhaftung von Grundeis. Die Über-
treibung wird besonders deutlich an der Tatsache, dass der kleine Emil mit einem
Flugzeug eingeflogen wird, und eine große Masse von Menschen ihm zujubelt.
Diese Szene findet in Kästners Romanvorlage keine Entsprechung. Sie könnte viel-
mehr mit einen Grund dafür geliefert haben, weshalb sich Kästner selbst mehrfach
negativ und enttäuscht über das Ergebnis der Verfilmung geäußert hat.
Deutlich zu erkennen ist heute der Einfluss, den diese monumentale Filmszene
auf Leni Riefenstahl gemacht hat, die sie in ihrem massenornamentalen NS-Propa-
44 Kästner: Emil, S. 190.
45 Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 237.
46 Kästner: Emil, S. 193.
47 Kästner: Über das Verbrennen von Büchern, S. 573.
F4717-Antonsen.indd 132 03.12.2008 11:05:00 Uhr
FÜNF SCHWIERIGKEITEN 133
gandafilm Triumph des Willens (1935) über den Nürnberger Parteitag 1934 nahezu
Bild für Bild reinszenierte, notabene mit Hitler als jenem Helden, der dem Flug-
zeug entsteigt und von der Menge applaudiert wird. Die Herausgeber von Kracau-
ers filmanalytischen Bemerkungen zu Emil und die Detektive sehen Anspielungen
auf diese Sequenz im ironisch-parodistischen Helden-Heimkehrerfilm Hail the
Conquering Hero (1944).48 Die ikonische Tradition, die Lamprechts Verfilmung
folgt, lässt sich aber auch verfolgen in Charlie Chaplins parodistischem Anflug mit
Bruchlandung Hynkels in The Great Dictator (1940) und bis ins 21. Jahrhundert,
etwa am Beispiel des Propaganda-Anflugs des amerikanischen Präsidenten George
W. Bush jr. auf einen Flugzeugträger nach dem angeblichen Ende seiner ›Hetzjagd
auf die Terroristen‹ des elften Septembers. Die Filmsequenz in Riefenstahls Film,
welche die Ankunft Hitlers in Nürnberg zeigt, beginnt mit einer Aufnahme der
Wolken über der Stadt. Zunächst ist allein der Schatten von Hitlers Flugzeug zu
sehen, das über die Menschenmasse fliegt, musikalisch untermauert durch Wagners
Die Meistersinger von Nürnberg, übergehend in das Horst-Wessel-Lied. Am Nürn-
berger Flughafen wird Hitler endlich mit frenetischem Applaus von den auf ihn
wartenden Menschen empfangen. Die Filmästhetik, die auch diese Filmsequenz
ganz unironisch prägt, ist die eines Kontrastes zwischen der ornamentalen Funkti-
on der Masse und dem heroisierenden Pathos der ›Siegerehrung‹, die durch die
Ankunft mit dem Flugzeug aus den Wolken heraus zu einer Art technisierter Apo-
theose gesteigert wird.
6. Zusammenfassung
Die Folgewidrigkeit, mit der literarische Ideologeme, selbst in einem scheinbar tri-
vialen Kinderroman wie Emil und die Detektive zu interpretieren sind, hat sich bis
hierher in geradezu verblüffender Weise gezeigt. Die Wahrheit einer Interpretation
genügt, das zumindest lässt sich aus den Fragen, die hier offen gelassen wurden,
lernen, selten unseren wissenschaftlichen Ansprüchen an die Wahrheit. Bietet uns
das noch nicht Grund zur literaturwissenschaftlichen Resignation, so ist es doch
ein Anlass zur dauerhaften Achtsamkeit vor jener interpretatorischen Eindimensio-
nalität, mit der wir oft konfrontiert sind. Doch wie hier am Beispiel einiger wider-
sprüchlicher Kästner-Interpretationen gezeigt, lässt sich das Spannungsfeld zwi-
schen der Autorintention, der historischen Produktionssituation, dem literarischen
Text und der jeweiligen Rezeptionssituation oft viel schwerer auflösen, als wir es
uns wünschen. Pflicht des Literaturwissenschaftlers ist es daher eher, derlei produk-
tive Widersprüche mit der nötigen Sorgfalt auszuloten, statt sie zu zementieren.
Erleichtert wird diese Sorgfaltspflicht, sobald wir auch anerkennen, wie sehr sich
das Studium der Literatur aus derartigen Spannungen und Irritationen wie von
selbst belebt, es mithin zu einem detektivischen Vergnügen wird, sich mit literari-
schen Werken zu beschäftigen, an welchen vielleicht allein der konventionelle Kin-
48 Vgl. Kracauer: Von Caligari zu Hitler, S. 236.
F4717-Antonsen.indd 133 03.12.2008 11:05:00 Uhr
134 URS MEYER
derdetektiv Emil keine helle Freude gehabt hätte. Die Enttäuschung des erwachse-
nen detektivischen Literaturwissenschaftlers, dass sich seine Fälle fast nie restlos
aufklären, dürfte sich demgegenüber in Grenzen halten, ist sie doch zugleich die
Freude des Lesers literarischer Texte überhaupt. Und diese Freude ist mit Sicher-
heit, darauf sollte dieser Aufsatz doch hinaus laufen, eines der ›Enden‹, zu welchen
wir bis heute Literaturwissenschaft betreiben.
F4717-Antonsen.indd 134 03.12.2008 11:05:00 Uhr
Ralph Müller (Freiburg/Schweiz)
PERSONIFIKATION ALS GEDANKE. ZUR KOGNITIVEN
INTERPRETATION VON SCHILLERS ANTRITTSVORLESUNG
1. Sprechende Geschichte
Die Formulierung, die Schiller für den Titel des Drucks der Vorlesung Was heißt
und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte wählte, ist in verschiedenen
Epochen aufgefallen. Karl Kraus zum Beispiel diskutierte seitenlang mit den Lesern
seiner Zeitschrift Die Fackel, welche Wörter im Titel Subjekt und Objekt sind.1
Heutzutage stoßen sich Leser vielleicht weniger an Begriffen wie »Universalge-
schichte« als an der archaischen Wortwahl.2 Nimmt man »Ende« in seinem heute
geläufigsten Sinne von ›Abschluss‹, dann könnte man den Titel dieser Festschrift als
Anlass nehmen, über die scheinbar endlose Abfolge von akademischen Qualifikatio-
nen zu diskutieren. Spontan fallen mir mehrere Nicht-Germanisten ein, die sich ei-
ner solchen ironischen Lektüre des Titels mit kaum verhohlenem Vergnügen hinge-
ben würden. Damit würden sie aber nicht nur die Laufbahn eines Literaturwissen-
schaftlers in Frage stellen, sondern die Relevanz der Literaturwissenschaft überhaupt
bzw. die Notwendigkeit, dass sich jemand beruflich mit Literatur beschäftigt.
Die Frage nach der Relevanz geisteswissenschaftlicher Fächer ist keine neue Er-
scheinung. Auch Schiller behandelt in seiner Vorlesung diese Frage: »Es ist keiner
unter Ihnen allen, dem Geschichte nicht etwas wichtiges zu sagen hätte […]«. Das
ist metaphorisch formuliert, denn Geschichte an sich sagt nichts, vielmehr wird die
Geschichte personifiziert als sich mitteilendes Wesen dargestellt. Schiller fährt im
selben Satz fort:
alle noch so verschiedenen Bahnen Ihrer künftigen Bestimmung verknüpfen sich
irgendwo mit derselben [der Geschichte, R. M.]; aber Eine Bestimmung theilen
Sie alle auf gleiche Weise miteinander, diejenige, welche Sie auf die Welt mit-
brachten – sich als Menschen auszubilden – und zu dem Menschen eben redet
die Geschichte.3
1 Vgl. Kraus: Die Sprache, S. 103–113. Deutet man den Titel elliptisch (»Was heißt [man] und
zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte«), steht »Universalgeschichte« im Akkusa-
tiv. Dann aber fragt der Titel nach den Dingen, die Universalgeschichte heißen oder aber nach
Namen für die Universalgeschichte. Nahe liegender ist Kraus’ Auffassung, dass »Universalge-
schichte« im ersten Teilsatz als Nominativ und im zweiten Teilsatz als Akkusativ fungiert.
2 Konsequenterweise hat Tucholsky die Diktion unter Beibehaltung des Zeugmas angepasst:
»Was ist und zu welchem Ende brauchen wir einen Paß?«. Der Paß und der Reisende. In: Tu-
cholsky: Gesamtausgabe, Bd. 5, S. 51.
3 Schiller: Nationalausgabe [NA], Bd. 17, S. 359f.
F4717-Antonsen.indd 135 03.12.2008 11:05:00 Uhr
136 RALPH MÜLLER
Das Ziel, den Menschen auszubilden, wird nicht nur von der Geschichte in An-
spruch genommen, sondern gilt allgemein als humanistisches Bildungsziel. Inso-
fern ist es reizvoll, Schillers Personifikation auf die Literaturwissenschaft zu über-
tragen. Allerdings bemerkt man dann, dass »Geschichte« sowohl die Geschichts-
wissenschaften als auch ihren wissenschaftlichen Gegenstand bezeichnen kann.
Demgegenüber unterscheidet der Titel dieser Festschrift für Stefan Bodo Würffel
zwischen Gegenstand und Wissenschaft und ersetzt »Universalgeschichte« nicht
durch »Literatur«, sondern durch »Literaturwissenschaft«. Vor diese Wahl gestellt,
möchte ich doch lieber sagen: »zu eben dem Menschen redet die Literatur«.
Die Ersatzprobe durch »Literaturwissenschaft« deutet an, dass Schillers Personi-
fikation eine naive Sicht der Geschichte entwirft: Indem die Geschichte per se spre-
chen kann, braucht der Wissbegierige bloß zu lauschen, und die wissenschaftliche
Bemühung um Erkenntnis weicht dem passiven Zuhören. Dabei wird die Ge-
schichtswissenschaft in der Personifikation durch eine metonymische und meta-
phorische Operation obsolet: In der metaphorischen Operation wird dem Abstrak-
tum Geschichte menschliche Sprachfähigkeit zugeschrieben, sodass sie sich ohne
menschliches Zutun von selbst mitteilen kann. Die Personifikation funktioniert
aber gleichzeitig metonymisch, indem die ›eigentlichen‹ historischen Berichterstat-
ter hinter der Figur der Geschichte zurücktreten und die Vielzahl der Stimmen in
der einen Stimme der Geschichte zusammengefasst werden.4
Diese Personifikation ist dennoch keine raffinierte Form manipulativen Sprach-
gebrauchs oder Ausdruck einer Selbsttäuschung, sondern der ganze Ausschnitt be-
handelt die Relevanz der Universalgeschichte und nicht die methodischen Proble-
me ihrer bruchstückhaften Überlieferung. Diese löst Schiller mit dem Vorschlag
einer gegenchronologisch, rückläufig verfahrenden Geschichtsschreibung.5
Unter der Voraussetzung, dass die Argumentationsfigur auf die fachliche Rele-
vanz beschränkt bleibt, ließe sie sich vielleicht doch auf die Literatur übertragen.
Allerdings scheint eine Gesprächsmetapher (unter Verzicht auf die metonymische
Austreibung der individuellen Stimmen der Autorinnen und Autoren) der Litera-
tur angemessener zu sein.6
Betrachtet man also die Literatur als ein langes Gespräch, dann kann ihre Rele-
vanz aufgezeigt werden: Ein Gespräch, das seit Jahrtausenden stattfindet, mit viel-
fältigen Beiträgen, die auf vorangegangene reagieren und weitere nach sich ziehen,
ist ein kultureller Schatz, den Leser für sich immer aufs neue entdecken können.
Denn Literatur eröffnet wie ein Gespräch die Möglichkeit, bei aktiver Teilnahme
4 Metonymie und Metapher sind in dieser Hinsicht keine polaren Gegensätze, wie sie in der
Tradition von Jakobson bisweilen dargestellt werden (vgl. Jakobson: Zwei Seiten der Sprache
und zwei Typen aphatischer Störungen). Vielmehr können sich Worte sowohl auf der metony-
mischen als auch auf der metaphorischen Achse befinden.
5 Vgl. Würffel: Für eine Literaturgeschichte des fremdkulturellen Lesers, S. 119.
6 Diese Gefahr steckt auch in Metaphern wie ›Dialogizität‹ und diverse Auffassungen von ›In-
tertextualität‹, sofern sie reale Akteure ausblenden.
F4717-Antonsen.indd 136 03.12.2008 11:05:00 Uhr
PERSONIFIKATION ALS GEDANKE 137
intellektuelle und entspannte Unterhaltung zu finden, aber auch Orientierung für
das eigene Leben.
Freilich ist damit nur begründet, warum Literatur eine lohnenswerte Beschäfti-
gung ist, denn die Ahnung, dass Literaturwissenschaftler nebst Lohn und Brot auch
ideellen Gewinn aus ihrer Tätigkeit ziehen, begründet noch nicht die Relevanz ih-
res Fachs. Diese Relevanz ergibt sich vielmehr dadurch, dass Literaturwissenschaft
weniger eine ›Gesprächsteilnehmerin‹ als eine ›Beobachterin‹ ist. Unter dieser Per-
spektive ergibt sich für die Literaturwissenschaft primär der Auftrag des Archivie-
rens, aber auch des Dokumentierens und Erläuterns des ›Gesprächs‹ mit allen, die
daran teilnehmen. Dies kann die Rekonstruktion historischer Kontexte für wissen-
schaftliche Interpretationen erfordern, da in der literarischen Kommunikation Ver-
stehen nicht so selbstverständlich sichergestellt werden kann wie im mündlichen
Gespräch durch direkte Rückfragen. Dies erfordert auch Textanalysen, um aufzu-
zeigen, was denn die besondere Form eines Textes im Vergleich zu anderen Texten
ausmacht, und welche Wirkungen damit erzielt werden können.
2. Kognitive Poetik
Obige Liste literaturwissenschaftlicher Aufgaben ist nicht komplett. Auch das Bild
von Literaturwissenschaftlern, die quasi wie Psychologen hinter verspiegelter Schei-
be das faszinierende Gespräch der Literatur verfolgen, ist fern von jeder analogen
Beziehung zur Realität. Aber die Vorstellung, dass Literatur auch in kühnen For-
menexperimenten noch zum Publikum ›spricht‹, hat etwas Überzeugendes. Wörter
– selbst wenn sie vor langer Zeit niedergeschrieben wurden – besitzen aufgrund
ihrer Anordnung und Auswahl die Disposition, vielfältige und komplexe Gedan-
ken und Gefühle zu erzeugen, und dies gibt Literatur einen besonderen Stellenwert
unter allen Medien.
Ein Interesse für solche vielfältigen Gedanken und Gefühle, die durch (literari-
sche) Texte vermittelt werden, hat in den letzten Jahren in Ausrichtungen wie der
so genannten Kognitiven Poetik programmatischen Ausdruck gefunden.7 Der Ko-
gnitiven Poetik geht es um eine »kognitionspsychologisch gestützte Erklärung der
Wirkung spezifischer Textmerkmale«8.
Eine solche kognitive Sichtweise auf Metaphern und andere Tropen wie Personi-
fikationen liegt nahe, weil sie nicht nur aufgrund der Informationen der Textober-
fläche verstanden werden, sondern auch ein bestimmtes Wissen voraussetzen. Man
muss zum Beispiel erkennen können, dass die Textwelt von Schillers Vorlesung
nicht wirklich eine Figur namens Geschichte enthält. Über diese Beobachtung hin-
aus teilen aber die meisten Vertreter der Kognitiven Poetik die Ansicht, dass Meta-
phern mehr sind als eine besondere Art, Gedanken auszudrücken: Sie reflektieren
eine allgemein menschliche Fähigkeit – oder vielmehr Tendenz –, Abstraktes und
7 Vgl. Stockwell: Cognitive Poetics.
8 Köppe u. Winko: Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft, S. 332f.
F4717-Antonsen.indd 137 03.12.2008 11:05:00 Uhr
138 RALPH MÜLLER
Komplexes durch andere Erfahrungsbereiche zu verstehen.9 Demnach beruhen
sprachliche Metaphern auf gedanklichen Metaphern, so genannten ›konzeptuellen
Metaphern‹. Schillers Personifikation, zum Beispiel, bietet zweifellos eine elegante
Formulierung für die Auffassung, dass Geschichte ›uns etwas zu sagen habe‹. Sie
bewegt sich gleichzeitig im Rahmen konventioneller konzeptueller Metaphern,
denn sie ist verwandt mit Wendungen wie »das ist nichtssagend« oder »Was hat uns
Schiller heute noch zu sagen?« Sie unterliegt im Sinne der Theorie der konzeptuel-
len Metapher einer konventionalisierten Weise, über Bedeutsamkeit von Artefak-
ten zu sprechen und zu denken.
Solche konzeptuellen Analysen sind attraktiv, weil sie metaphorische Bedeutung
auf körperlich erworbene oder sozial vermittelte Erfahrungen zurückführen. Auf
diese Weise tragen Metaphern und Personifikationen reichere Bedeutungskompo-
nenten, als sich Philologen traditionellerweise vorstellen.10 Allerdings sind verschie-
dene Grundannahmen dieser Theorie kritisiert worden11, und aus spezifisch litera-
turwissenschaftlicher Sicht müssen vor allem folgende Punkte beobachtet werden:
Grundsätzlich sind konzeptuelle Metaphern dadurch definiert, dass ein konzeptu-
eller Quellbereich mit körperlichen oder sozial vermittelten Erfahrungen einen ab-
strakten oder komplexen Zielbereich strukturiert. Dennoch ist unklar, welche Er-
fahrungen für das Strukturieren jeweils relevant sind und wie sie auf allfällige
Strukturen im Zielbereich wirken. George Lakoff lässt an manchen Stellen erken-
nen, dass die projizierten Strukturen kreativ ergänzt oder erweitert werden kön-
nen.12 Gemäß Peter Stockwell finden sich in der Literatur sogar ganz neue und
widersprüchliche konzeptuelle Metaphern.13 Demzufolge kann nicht immer stich-
haltig dargelegt werden, in welchem Umfang Erfahrungen durch bestimmte Meta-
phern projiziert werden. Hingegen konnte nachgewiesen werden, dass reale Leser
innovative Metaphern nicht immer im Rahmen derselben konzeptuellen Metapher
interpretieren.14 Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Problem, dass es auch für
sachverständige Metaphernforscher nicht in jedem Fall klar ist, wie man von einem
bestimmten Ausdruck zur konzeptuellen Metapher kommt.15 Schließlich lenken
Lakoffs griffige Formeln für konzeptuelle Metaphern – nach dem Muster Bedeut-
samkeit ist Sprechen – von der wirklich interessanten Frage ab, welche Wissens- und
Erfahrungsbestände im Rahmen einer Metapher tatsächlich projiziert werden.16
9 Vgl. Ziegler u. Müller: Metaphern zwischen Sprache, Stil und Denken.
10 Die so genannte Simulationssemantik liefert sogar Hinweise, dass man sich beim Verstehen
von manchen Wörtern (auch Metaphern) die dazugehörigen motorischen Aktivitäten vor-
stellt; vgl. Gibbs: Metaphor Interpretation as Embodied Simulation.
11 Vgl. hierzu die Zusammenfassung der wichtigsten Kritikpunkte in Eder: Zur kognitiven Me-
tapher in der Literaturwissenschaft.
12 Vgl. Lakoff u. Turner: More than Cool Reason.
13 Vgl. schon Stockwell: Cognitive Poetics, S. 110f.
14 Vgl. Eder: Zur kognitiven Metapher in der Literaturwissenschaft, S. 176f.
15 Vgl. Semino, Heywood u. a.: Methodological Problems in the Analysis of Metaphors in a Corpus
of Conversations about Cancer.
16 Vgl. auch Eder: Zur kognitiven Metapher in der Literaturwissenschaft, S. 188f.
F4717-Antonsen.indd 138 03.12.2008 11:05:00 Uhr
PERSONIFIKATION ALS GEDANKE 139
Die Theorie der konzeptuellen Metapher gibt somit weder Gewissheit über die Ge-
danken, die von metaphorischen Ausdrücken erzeugt werden, noch erlaubt sie eine
sichere Zuordnung von Ausdruck und konzeptueller Metapher. Für die Kognitive
Poetik sind solche Schwächen aber kein Nachteil, denn sie reflektieren die relative
Offenheit, mit der Leser literarische Texte interpretieren. Vielmehr stellt sich die
Frage, wie mit dieser Offenheit umgegangen werden sollte.
3. Leser-Modelle und Modell-Leser
Kognitive Poetik beruht darauf, dass man für bestimmte Fragestellungen Modelle
konstruiert. Diese Modelle sind Annäherungen an reale Denk- oder Verstehens-
prozesse, befassen sich typischerweise mit dem Leser und sind meistens auf be-
stimmte, isolierte Phänomene beschränkt, die anhand von Erkenntnissen aus den
Kognitionswissenschaften modelliert werden können. Solche Modelle können zum
Beispiel beschreiben, wie Leser Empathie für fiktionale Figuren entwickeln oder
unter welchen Bedingungen Metaphern ästhetisch wahrgenommen werden. Sie
sind aber weniger geeignet, um für eine wissenschaftliche Interpretation den Sinn
einer Textstelle zu ermitteln, denn sie tendieren dazu, alle erdenklichen Lesarten als
gleichberechtigt zu betrachten.17 Die Kognitive Poetik teilt hier ein grundsätzliches
Problem mit der empirischen Leserpsychologie: Bei empirischen Resultaten erlaubt
zwar der Begriff des »statistischen Lesers«18, statistische Resultate hinsichtlich der
Lesekompetenz zu differenzieren, sodass man Durchschnittswerte, die eventuell
defizitären Umgang mit Literatur reflektieren, nicht verabsolutieren muss. Wenn es
aber darum geht, eine wissenschaftliche Interpretation vorzunehmen, wiegt ein
Faktum, das am Text nachgewiesen werden kann, jede Umfrage auf, selbst wenn sie
unter allen Germanistinnen und Germanisten, die jemals zu Schiller publiziert ha-
ben, gemacht würde. Das heißt nicht, dass kognitive Modelle für das Erstellen wis-
senschaftlicher Interpretationen unbrauchbar sind. Sie bieten Ergänzungen zu Fra-
gen der Wirkungsdispositionen von Texten und machen bei der Analyse von
schwierigen Texten – zum Beispiel Kafkas Erzählungen, deren Widersprüche viele
reale Leser subjektiv harmonisieren – auf wichtige Texteigenschaften aufmerksam.
In dieser Hinsicht weisen kognitive Modelle auf der Basis von generalisierbarem
Leseverhalten Vorteile gegenüber dem so genannten ›Modell-Leser‹ auf, der als
»textbasiertes Konstrukt« ein vollständiges literaturwissenschaftliches Verstehen vo-
raussetzt19 und als ›Double‹ des Literaturwissenschaftlers entsprechend den An-
sprüchen eines Texts immer kompetenter wird. Theoretisch muss man davon aus-
gehen, dass sehr viele kognitive Leser-Modelle konstruiert werden können. Für die
Praxis können aber verschiedene kognitive Fähigkeiten epochenunabhängig gene-
17 Stockwells »idealised reader« umfasst z. B. alle möglichen Interpretationen; vgl. Stockwell:
Cognitive Poetics, S. 42f.
18 Vgl. Dixon u. Bortolussi: Psychonarratology, S. 43–46.
19 Jannidis: Figur und Person, S. 31.
F4717-Antonsen.indd 139 03.12.2008 11:05:00 Uhr
140 RALPH MÜLLER
ralisiert werden20, und außerdem findet man in literaturwissenschaftlichen Argu-
mentationen zwei Lesertypen besonders häufig: Einerseits einen defizitären Leser,
dem eine bestimmte für ein korrektes Verständnis einer Textstelle relevante Kom-
petenz abgeht (zum Beispiel keine Ahnung von der antiken Mythologie); anderer-
seits einen gut informierten (also überdurchschnittlich kultivierten) ›Gebildeten
Leser‹.
4. Die Metapher
Für die Analyse von Metaphern oder Personifikationen kann aus diesen allgemei-
nen Anmerkungen zunächst geschlossen werden, dass es aus arbeitsökonomischer
Sicht gar nicht notwendig ist, für jeden Schritt der Analyse kognitive Modelle zu
verwenden. Es kann sinnvoller sein, bei der Suche nach Metaphern oder Personifi-
kationen eine präzise Definition zu verwenden, als sich zu fragen, ob ein Schüler
der Sekundarstufe II eben diese Formen finden könnte.
Um die im Rahmen einer Metapher projizierten konzeptuellen Wissens- und
Erfahrungsbestände zu analysieren, bietet sich der Rückgriff auf den »Gebildeten
Leser« an, und – sofern man nicht jede erdenkliche Analogiebildung zulassen
möchte – eine textnahe Rekonstruktion der (eventuell impliziten) Analogie. Ich
greife diesbezüglich nochmals das Beispiel von Schillers Personifikation auf und zi-
tiere etwas ausführlicher:
Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte […]. Durch alle
Zustände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnden Gestalten der Mei-
nung, durch seine Thorheit und seine Weisheit, seine Verschlimmerung und sei-
ne Veredelung, begleitet sie ihn; von allem, was er sich nahm und gab, muß sie
Rechenschaft ablegen. Es ist keiner unter Ihnen allen, […].
Auch »begleiten« und »Rechenschaft ablegen« deuten auf eine Personifikation hin,
aber Versuche, diese Analogie näher zu beschreiben, führen schnell zu individuel-
len Interpretationen, die zwar sehr interessant sind, sich aber nicht notwendig aus
dem Text ableiten lassen. So stellt sich die Frage, inwiefern man den Abschnitt vor
dem Hintergrund allegorischer Darstellungen der Geschichte lesen sollte. Immer-
hin beschreibt ein Ausschnitt gegen Ende der Vorlesung die Geschichte als »un-
sterbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten«, die wie der homerische Zeus »mit
gleich heitern Blicke« das Weltgeschehen betrachtet. Wie aber ist die etwaige Er-
gänzung zu bewerten, Schillers Personifikation sei klar an die Figur der Fama ange-
lehnt, denn auch diese verkünde mit zwei Trompeten »Torheit und Verschlimme-
rung« oder »Weisheit und Veredlung«? In diesem Zusammenhang ist ein »Gebilde-
ter Leser« nützlich, der Hinweise darauf gibt, wie eine typische (informierte)
Interpretation aussehen könnte. Freilich ist es bei historischen Texten schwierig,
20 Ich greife hier Eisenhuts Begriff des »generalisierbaren Lesers« auf; vgl. Eisenhut: Überzeu-
gen, S. 18–20 u. 92.
F4717-Antonsen.indd 140 03.12.2008 11:05:00 Uhr
PERSONIFIKATION ALS GEDANKE 141
einen solchen Leser zu rekonstruieren. Zwar sind die (evolutionsbiologischen) Be-
dingungen kognitiver Verarbeitung stabil geblieben, aber unsere Lebensumwelt hat
sich verändert und mit ihr unsere Erfahrungen. Angesichts dessen haben die histo-
rischen sprachlichen Zeugnisse, an denen typische und konventionelle Ausdrucks-
gewohnheiten aufgezeigt werden können, Bestand. Dank der Weiterentwicklung
der Computerphilologie und elektronischer Korpora können solche Spuren durch
den Vergleich von vielen ähnlichen Wortverwendungen immer besser untersucht
werden.
Betrachtet man zunächst Verwendungen des Wortes »Geschichte« im relativ
kleinen Korpus von Schillers Werken der Nationalausgabe, zeigt sich, dass »Ge-
schichte« zwar von einer Fülle von Metaphern begleitet wird,21 dass aber Personifi-
kationen in diesem Kontext nicht häufig sind. Wenn Schiller eine Personifikation
verwendet, dann sind die entsprechenden Stellen eher im pathetischen Stil pro-
grammatischer Essayistik oder der Lyrik gehalten.22 In stilistischer Hinsicht scheint
die Wahl einer Personifikation also auffällig zu sein. Allerdings sind die metapho-
risch verwendeten Verben eher konventionell: »Begleiten« wird nicht nur mit Be-
zug auf Personen verwendet, sondern es ist auch üblich zu sagen, dass diverse Zu-
stände, aber auch Gedanken uns begleiten. Ebenso wird die Wendung ›etwas zu
sagen haben‹ zwar hauptsächlich auf Menschen bezogen, sodass jemand (einer be-
stimmten Person im Dativ) etwas/viel/wenig ([ein substantiviertes Adjektiv:] An-
genehmes/Galantes/Witziges) zu sagen hat. Die Wendung kann aber auch mit rela-
tiv unspezifischen Abstrakta verwendet werden.23
Diese beispielhaften Ergebnisse bestätigen die Analogie ›Mensch-Geschichte‹
und sie unterstützen die Sicht, dass der zweite Abschnitt eine menschliche han-
delnde Personifikation der Geschichte entwickelt. Allerdings scheint die Personifi-
kation vor dem typischen Lesehintergrund eines »Gebildeten Lesers« eher ein
fleischloses Grundgerüst zu sein. Erst gegen Ende der Vorlesung entwickelt sich ein
allegorischer Raum mit einer figurativen Darstellung der Geschichte, der reichere
Erfahrungen aufgreift.
Dieser Argumentation ungeachtet verfügt der generalisierbare Leser potenziell
über die Fähigkeit, eine Personifikation subjektiv weiterzuspinnen. Immerhin hat
Schiller nicht vereinfacht gesagt: »Geschichte ist wichtig«, sondern die stilistische
Form der Personifikation gewählt. Indirekte Formulierungen und andere stilisti-
sche Auffälligkeiten laden dazu ein, den stilistischen Mehraufwand zu motivieren,
also eine Aussage mit kontextuellem Wissen anzureichern. Die Aussage wird umso
21 Vgl. allgemein Demandt: Metaphern für Geschichte.
22 Vgl. aus Schillers Aufsatz Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen
mit seiner geistigen: »Naturgeschichte und Physik stürzen den Aberglauben, die Geschichte
reicht den Spiegel der Vorwelt […]« (Schiller: Nationalausgabe [NA], Bd. 20, S. 55).
23 Vgl. den Brief an C. von Beulwitz (29. 10. 1789): »daß solche heftige Zufälle bey ihr nicht
soviel zu sagen haben« (Schiller: Nationalausgabe [NA], Bd. 25, S. 310); aber auch den Brief
an Wilhelm von Humboldt (27. 6. 1798): »Es ist ja überhaupt noch die Frage, ob die Kunst-
philosophie dem Künstler etwas zu sagen hat.« (Schiller: Nationalausgabe [NA], Bd. 29,
S. 245)
F4717-Antonsen.indd 141 03.12.2008 11:05:01 Uhr
142 RALPH MÜLLER
relevanter, je mehr der neue Informationsstand auf das kontextuelle Wissen zu-
rückwirkt.24 Solche kontextuellen Effekte folgen nicht notwendigerweise aus dem
Text, so wie auch die oben ausgeführte Anwendung von Schillers Personifikation
auf die Literaturwissenschaft assoziativ war. Gewiss sagen solche Assoziationen
mehr über den Interpretierenden als über den Text aus. Da sie aber von Lesern oft
als lohnend empfunden werden und das ausmachen, was Texte den Lesern zu sagen
haben, können sie nicht ernst genug genommen werden.
24 Vgl. Sperber u. Wilson: Relevance, S. 235-237, zum besonderen Fall der Metapher.
F4717-Antonsen.indd 142 03.12.2008 11:05:01 Uhr
Wolfgang Proß (Bern)
ZUM PROBLEM DER HISTORISCHEN ERFAHRUNG.
ANTIHERMENEUTISCHE BEMERKUNGEN
1. »Das würde mir kein Buch gesagt haben« – oder doch?
Zu den Zeugnissen einer großen Krise im Leben Heinrich von Kleists zählt der be-
rühmte Brief vom 16./18. November 1800, in dem der Schriftsteller seiner Braut
Wilhelmine von Zenge von einem – angeblichen – Erlebnis auf der Reise über
Leipzig und Dresden nach Würzburg im Herbst 1800 berichtet. Nach einem Hin-
weis auf bedeutende Entdeckungen und Ereignisse, für die er Columbus, Galilei,
Newton, den Luftfahrtpionier Jean-François Pilâtre de Rozier und den General
Charles Pichegru heranzieht, stellt Kleist fest, »daß nichts in der ganzen Natur un-
bedeutend u gleichgültig u jede Erscheinung der Aufmerksamkeit eines denkenden
Menschen würdig ist.«1 Der durch seinen Schulmeisterton nicht erfreuliche Brief
fährt nun damit fort, daß Kleist seine Fähigkeit zu solcher Wahrnehmung buch-
stäblich exhibiert, um sich gegenüber der Braut als Vorbild darzustellen, und jenes
Würzburger »Erlebnis« bildet den Anlaß dazu:
Ich gieng an jenem Abend vor dem wichtigsten Tage meines Lebens in Würzburg
spazieren. Als die Sonne herabsank war es mir als ob mein Glück untergienge.
Mich schauerte wenn ich dachte, daß ich vielleicht von Allem scheiden müßte,
von allem, was mir theuer ist.
Da gieng ich, in mich gekehrt, durch das gewölbte Thor, sinnend zurück in die
Stadt. Warum, dachte ich, sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch keine
Stütze hat? Es steht, antwortete ich, weil alle Steine aufeinmal einstürzen wollen
– und ich zog aus diesem Gedanken einen unbeschreiblich erquickenden Trost,
der mir bis zu dem entscheidenden Augenblicke immer mit der Hoffnung zur
Seite stand, daß auch ich mich halten würde, wenn Alles mich sinken läßt.
Das, mein liebes Minchen, würde mir kein Buch gesagt haben, und das nenne ich
recht eigentlich lernen von der Natur.2
»Das würde mir kein Buch gesagt haben« – diese Feststellung des Briefschreibers ist
bestenfalls Verdrängung, schlimmstenfalls Imponiergehabe, aber auf jeden Fall un-
wahr; daran ändert auch die Zeichnung eines Gewölbebogens nichts, den Kleist
am 30. Dezember 1800 nachträglich dem Schreiben hinzufügte, um seiner Bemer-
kung Authentizität zu verleihen. Denn die Formulierung der Frage, weshalb die
Steine des Torgewölbes nicht einstürzen, die seiner Wahrnehmungsfähigkeit an-
1 Kleist: Briefe, S. 159.
2 Ebd.
F4717-Antonsen.indd 143 03.12.2008 11:05:01 Uhr
144 WOLFGANG PROSS
geblich spontan entspringt, und ihre Beantwortung im Selbstgespräch ist nichts als
ein modifiziertes Zitat, für das zwei Quellen in Frage kommen: einmal der Origi-
naltext, der zu dieser Zeit jedem Lateinschüler bekannt gewesen sein dürfte. Es ist
der 95. von Senecas Moralischen Briefen an Lucilius, in dem sich Seneca unter Her-
anziehung eines berühmten Terenz-Zitats folgendermaßen äußert:
Ille versus et in pectore et in ore sit:
»Homo sum, humani nihil a me alienum puto.«
Habeamus in commune nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi
simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur.
[Jener Vers soll in unserem Herzen und Munde sein:
»Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches acht’ ich mir fremd.«
Wir sollten festhalten, daß wir zur Gemeinschaft geboren sind. Unsere Gesell-
schaft hat große Aehnlichkeit mit einem Gewölbe von Steinen, welches fallen
würde, wenn diese nicht wechselseitig sich entgegenstünden, wodurch es eben
gehalten wird.3]
Die andere Möglichkeit wäre die indirekte Übernahme Senecas aus einer ebenfalls
weit verbreiteten Quelle, den Moralists des Earl of Shaftesbury (1709), die in ihrer
Diskussion der Stellung des Menschen im Universum von großer Bedeutung für
die Natur- und Geschichtsphilosophie des späten 18. Jahrhunderts ist.4 Daß dieses
scheinbar so singuläre Lebenszeugnis Kleists in seiner Formulierung auf einem Zi-
tat beruht, mag für die Kleist-Philologie unerfreulich sein; aber es sollte ein Anlaß
sein, statt über dessen vieldiskutierte, aber anzweifelbare ›Kant-Krise‹ zu spekulie-
ren, auch andere geistesgeschichtliche Zusammenhänge zu bedenken.
2. »De quoi te mêles-tu? … est-ce là ton affaire?«
Häresien dieser Art sind geschichtlichen Materialen per se inhärent, und es scheint
höchste Zeit, sie gegen den postmodernen Salto rückwärts, den die Literaturwis-
senschaft heute in ihre lebensphilosophische Vergangenheit vollzieht, zur Geltung
zu bringen. Nicht nur bekundet sie immer noch Mühe, die theologische Herkunft
ihrer Auslegungsverfahren und ihren Habitus der Sinnstiftung abzustreifen, ja sie
gefährdet in der Diskrepanz von laut vorgetragenem Anspruch und dilettantischen
Resultaten das Ansehen des Faches.5 In hervorragender Weise wurde in den letzten
3 Seneca: Epistulae morales, S. 1955; Kursivierung des von Kleist zitierten Satzes durch den
Verf.
4 Der entsprechende Textausschnitt aus Shaftesburys The Moralists (Teil II, Abschnitt IV) fin-
det sich zweisprachig abgedruckt in: Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch-
heit (Ausg. Proß), vgl. hierzu Bd. III/1, S. 1047–1063; Zitat S. 1048 bzw. S. 1055f.
5 Argumente lassen sich den spöttischen Kritiken der FAZ am Germanistentag des Jahres 2007
oder der NZZ an der Debatte um die Qualitätsstandards der Geisteswissenschaften nur
schwer entgegenhalten; vgl. Oliver Jungen: Der hat die Kokosnuß geklaut! Wohl vom Affen ge-
bissen: Zum Abschluß des Germanistentages in Marburg. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
F4717-Antonsen.indd 144 03.12.2008 11:05:01 Uhr
ZUM PROBLEM DER HISTORISCHEN ERFAHRUNG 145
Jahrzehnten die Disziplingeschichte gerade der Neugermanistik erforscht; aber die
um sich greifende neue Ideologisierung, welche die ausufernde Debatte um die
Kulturwissenschaften hervorgebracht hat, zeigt, daß sie daraus keine Schlüsse gezo-
gen hat. Das Fach – wenn es denn Wissenschaft sein will – kennt klar zwei Aufga-
benbereiche: die kritische Sichtung der Begriffe und Verfahren, mit denen es ope-
riert, und die Sichtbarmachung der historischen Vielfalt der Texte, ihrer Milieus
und ihrer Verbreitung. Sicher keine Aufgabe einer Literaturwissenschaft ist zum ei-
nen die »öffentliche Auslegung des Seins« (Karl Mannheim), die zu den Legenden-
bildungen des Wilhelminismus und zum Scheitern der George-Schule, der völki-
schen Germanistik und der immanenten Interpretation geführt hat, zum anderen
das Ziel einer umfassenden Kulturtheoriebildung, das sich die Kulturwissenschaft
gesetzt hat, das aber Max Weber bereits 1904 in seinem Objektivitäts-Aufsatz als
Chimäre bezeichnet; er spricht von der
Sinnlosigkeit des selbst die Historiker unseres Faches gelegentlich beherrschen-
den Gedankens, daß es das, wenn auch noch so ferne, Ziel der Kulturwissen-
schaften sein könne, ein geschlossenes System von Begriffen zu bilden, in dem
die Wirklichkeit in einer in irgendeinem Sinn endgültigen Gliederung zusam-
mengefaßt und aus dem heraus sie wieder deduziert werden könnte. […] Ein
System der Kulturwissenschaften auch nur in dem Sinne einer definitiven, objek-
tiv gültigen, systematisierenden Fixierung der Fragen und Gebiete, von denen sie
zu handeln berufen sein sollen, wäre ein Unsinn in sich: stets kann bei einem
solchen Versuch nur ein Aneinanderreihung von mehreren, spezifisch gesonder-
ten, untereinander vielfach heterogenen und disparaten Gesichtspunkten heraus-
kommen, unter denen die Wirklichkeit für uns jeweils »Kultur«, d. h. in ihrer
Eigenart bedeutungsvoll war oder ist.6
Aber unverdrossen treten, pompös wie je nur ein Hauptpastor Goeze, Propheten
und Prophetinnen der Postmoderne und ihrer kulturwissenschaftlichen und le-
bensweltlichen Sinngebungen mit immer neuen turns an die Öffentlichkeit7, die
Botschaft – daß die Welt schlecht sei, und daß das Heil von den Interpreten kom-
me – ist allerdings so dürftig wie die Traktate der Miss Drusilla Clack in Wilkie
Collins’ Roman The Moonstone (1868), welche sie zur Bekehrung ihrer Mitmen-
schen um sich verstreut. Einlassungen dieser Art verdienen nur die Antwort des
Derwischs im Schlußkapitel von Voltaires Candide: »De quoi te mêles-tu? … est-ce
là ton affaire?« Weltverbesserung und ›Kulturkritik‹ sind nicht Aufgabe der Litera-
turwissenschaft, wozu sie sich im Gefolge des ›New Historicism‹ oder der ›Postco-
28. September 2007 (Nr. 226); Joachim Güntner: Fehlberufene Professoren und andere Pan-
nen. Diskussion um Qualitätsstandards in den Geisteswissenschaften. In: Neue Zürcher Zeitung,
27. November 2007 (Nr. 276), S. 46.
6 Weber: Die ›Objektivität‹ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. In: ders.:
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, S. 146–214, Zitat S. 184f.
7 Einen – völlig unkritischen – Überblick gibt Bachmann-Medick: Cultural Turns. Dies ist nur
eine von vielen Publikationen, die deutlich macht, wie sehr es offensichtlich an Kriterien und
am Willen fehlt, um die Pseudo-Axiome zu zerpflücken, auf denen diese turns beruhen.
F4717-Antonsen.indd 145 03.12.2008 11:05:01 Uhr
146 WOLFGANG PROSS
lonial Studies‹ fatalerweise legitimiert glaubt; eindringlich sei daran erinnert: »il
faut cultiver notre jardin« (Candide). Man sollte allerdings die Grenzen dieses Gar-
tens nicht zu eng ziehen. Denn es gibt auch Diskussionen der Literaturtheorie und
Philologie um Fragen wie »Was ist ein Werk?«, die per se nicht abschließbar sind,
aber trotzdem in langwierigen Debatten auf einen Begriff gebracht werden sollen.8
Nichts ist gegen die Schulung von Sorgfalt in Begriffsbildung und Argumentation
einzuwenden; aber ein Begriff, der höchsten logischen Anforderungen zu genügen
vermöchte, läuft Gefahr, jede empirisch-historische Konkretheit zu verlieren. Und
um historische Erfahrung als eigentliche Bedingung unseres Tuns geht es im Fol-
genden.
3. Der rückständige Habitus der Literaturwissenschaft
der Postmoderne
Bei einem Blick auf Kunstgeschichte und Musikwissenschaft wird deutlich, wie
rückständig die Literaturwissenschaft hier in ihren verbissenen theoretischen An-
strengungen agiert. Zwischen den Vertretern der Musik- bzw. Kunstwissenschaft
und dem Musikleben oder dem Kunstbetrieb gibt es eine Kooperation, der an einer
Vermittlung historischen Wissens an das Publikum gelegen ist. Die Erweiterung
der ästhetischen Erfahrung durch die historische Aufführungspraxis, die damit ver-
bundene Entdeckung vergessener Komponisten und die Relativierung des Kanons
durch die Neubewertung bestimmter Werke bis hin zur Moderne haben die Erfah-
rung des Hörens in den vergangenen Jahrzehnten unglaublich bereichert. Der heu-
tige Museumsalltag kann ohne die Vor- und Zuarbeit der Kunstgeschichte ohnehin
nicht gedacht werden. Neuentdeckungen oder -zuschreibungen, aber auch Korrek-
turen der Œuvrekataloge halten den Kenntnisstand in ständigem Fluß. Die Diszi-
plin selbst kann und will sich nicht auf akademische Bewahrung verlassen; es ge-
nügt, wenn Restauratoren neue Sachverhalte buchstäblich ans Tageslicht bringen,
um kanonische Interpretationen umzustürzen – man denke nur an die Restaurie-
rung der Sixtinischen Kapelle (1984/92), die einen völlig anderen als den vertrau-
ten Michelangelo sichtbar gemacht hat. Die Literaturwissenschaft bleibt dagegen
in Denkstrukturen befangen, die jede Modernisierung verhindern, was auch im-
mer die postmoderne Literaturtheorie an scheinbar Neuem und Preziösem über
den ›Tod des Autors‹ oder die ›Unmöglichkeit von Sinn‹ gesagt haben mag. Geblie-
ben ist der Habitus der Disziplin, wie sie sich ihrem Selbstverständnis nach präsen-
tiert: ein zähes Festhalten an der hagiographischen Konzeption des Autors; ein Pri-
mat der Interpretation, der die Werke als ›Botschaften‹ betrachtet und deshalb in
unzulässiger Weise die Grenze zu Weltdeutungen überschreitet; eine überflüssige
8 Vgl. hierzu den Forschungsbericht von Spoerhase: Was ist ein Werk? Über philologische Werk-
funktionen. Unbefriedigend bleibt an diesem sonst verdienstvollen Referat die Tatsache, daß
Literaturwissenschaftler über Begriffe wie ›Werk‹ und ›Œuvre‹ debattieren, als würden sie
diese Begriffe nicht mit der Kunst- und Musikwissenschaft teilen.
F4717-Antonsen.indd 146 03.12.2008 11:05:01 Uhr
ZUM PROBLEM DER HISTORISCHEN ERFAHRUNG 147
Debatte über ›Werte‹, die Probleme einer Geschmackssoziologie zu Fragen über-
zeitlicher Normen hypostasiert, und schließlich ein zähes Festhalten an Kanonvor-
stellungen, welche die historische Vielfalt der Literatur einebnet – all dies dient der
Sicherung eines literaturwissenschaftlichen ›Gewohnheits-Ich‹, dessen ›Unrettbar-
keit‹ das ›posthistoire‹ eigentlich verkünden wollte. Auffällig ist, um wie viel ent-
spannter die Mediävistik, ähnlich wie die Klassische Philologie, mit solchen Pro-
blemen umgeht als die neueren Literaturwissenschaften; sowohl die Lebenswelten
der Texte wie der biographische Kontext der Autoren sind in diesen Fächern – man
ist versucht zu sagen: glücklicherweise – in weite Ferne gerückt und, falls über-
haupt, schwer faßbar, also haltlosen Spekulationen unzugänglich. Dabei bleibt die
Alltagspraxis in den neueren Philologien auf Rückgriffe auf Materialien angewie-
sen, das historischen Befunden entnommen wird.
4. Das ›Artefakt‹ in der Kunstgeschichte
Der Kunsthistoriker Oskar Bätschmann hat 1984 in seiner Einführung in die kunst-
geschichtliche Hermeneutik ein radikal neues Vorgehen bei der Auslegung des Kunst-
werks gefordert, indem er den Gegenstand seiner Disziplin als bloßes ›Artefakt‹
definierte.9 Die primäre Aufgabe, welche dieses Artefakt stelle, ist die Frage nach
dem, »was das Bild als es selbst hervorbringt«; es gibt keine Unmittelbarkeit der
Anschauung, welche den Zugang zum Darstellungsprozeß garantiere.10 Es geht um
das, was Bätschmann den ›Bildprozeß‹ nennt, also die »Erkenntnis der spezifischen
Produktivität der Bilder«11. Die hier – gegenüber dem emphatischen Duktus von
Gadamers Hermeneutik – geforderte »Askese der Auslegung«12 stellt sich explizit
gegen die Fortführung eines traditionellen Interpretationsansatzes, der bereits nach
dem ›Sinn‹ kultureller Artefakte fragt, wenn er sich noch nicht einmal über die
Voraussetzungen ihrer Analyse im klaren ist.13 Der Gegenstand der kritischen Be-
stimmung der Möglichkeit einer kunstgeschichtlichen Hermeneutik liegt bei
Bätschmann zudem in der Wendung gegen die übliche Annahme, es gebe zwei le-
gitime, an sich separate, wenn auch kombinierbare Formen der Zuweisung von
›Bedeutung‹ an ein Kunstwerk: einmal durch die rekonstruierende Anamnese der
Bedingungen, unter denen ein Künstler seinem Werk einen bestimmten ›Sinn‹ ein-
prägte, zum andern in der Tilgung der historischen Differenz zwischen der Entste-
hungszeit des Kunstwerks und der Gegenwart durch die Interpretation. Denn:
9 Vgl. Bätschmann: Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik (2001).
10 Ebd., § 44, S. 127.
11 Ebd., §§ 46–55, S. 132–155.
12 Ebd., § 2, S. 8; § 55, S. 154–155.
13 Ebd., § 21, S. 57f. – Diese Kritik an der Antizipation der ›Totalität‹ eines Kunstwerkes nimmt
einen zentralen Aspekt des in seiner Kritik an der etablierten Historiographie einflußreichen
Artikels von Roger Chartier Le monde comme représentation vorweg, der fünf Jahre nach
Bätschmanns Einführung in der Zeitschrift Annales (1989) erscheinen sollte.
F4717-Antonsen.indd 147 03.12.2008 11:05:01 Uhr
148 WOLFGANG PROSS
»Die Entzifferung des einst gemeinten Sinns und die Konstruktion eines unhistori-
schen Sinns versuchen beide, eine Botschaft zu eruieren, die von den Werken in der
Art eines Kerygma, einer Verkündigung, an mich gerichtet ist«14. Dabei bleibt aber
die Frage, »ob wir mit der Anamnese und der Wiederherstellung des Sinnes nicht
einen zu kurzen Weg einschlagen und unsere Probleme nur scheinbar lösen«15. Bil-
der können nicht »auf Aussagen reduziert werden«16.
5. Der Gegenstand der Literaturwissenschaft:
Das sprachliche ›Artefakt‹ als Aggregat
Ebensowenig können dies literarische Texte. Die notwendige Konsequenz, welche
die Literaturwissenschaft aus der Kritik des Kunsthistorikers am Habitus seiner
Disziplin ziehen könnte, wäre, den Begriff des ›Textes‹ durch den des ›sprachlichen
Artefakts‹ zu ersetzen; und diesem Artefakt wäre der Charakter einer ›Botschaft‹ zu
entziehen und an seine Stelle ein neutraler Begriff zu setzen, der es als bloße ›Äuße-
rung‹ oder ›Ausdruck‹, als Feststellung (›statement‹) bzw. ›Repräsentation‹ betrach-
tet17, die eine Fülle von evidenten und nicht-evidenten Informationen enthält. Mit
der Suspendierung der Frage nach ›Sinn‹ und ›Bedeutung‹ wäre das Artefakt nicht
mehr mit der Unterstellung einer Intentionalität behaftet, die über den Zeitpunkt
seiner Entstehung hinausreichen soll und deshalb auch völlig außerhalb seines
Kontexts innerhalb eines Spieles von Frage und Antwort ›verstehbar‹ sei. Ein Arte-
fakt hält unter dem hier benannten Gesichtspunkt vielmehr den Zeitfluß an, und
durch seine Gestalt erscheint es als Momentaufnahme, in der eine Reihe von in-
haltlichen Momenten, ästhetischen Dispositiven und kreativen Energien seines
Urhebers und des Milieus, in dem er agierte, als Informationen konserviert er-
scheinen; dies bedeutet keinesfalls, daß man bei Beginn der Arbeit an diesem Ge-
genstand bereits in der Lage ist, diese Informationen als solche zu erfassen. Der
Terminus der ›Horizontverschmelzung‹, den Gadamers Hermeneutik von 1960
propagierte, war zwar suggestiv, weil er das beruhigende Gefühl einer Souveränität
vermittelte, mit der man jedem – in seiner Neuheit noch so verwirrenden – Gegen-
stand gegenübertreten konnte. Aber tatsächlich ist alles, was wir uns als Interpreten
zugestehen dürfen, einzig die im Sinne Max Webers planvolle und auf ihre Wider-
legbarkeit zu kontrollierende ›Zurechnung‹ einzelner Fakten zu einem Bedeutungs-
zusammenhang, die von der Maßgabe einmal unserer Wahrnehmung, dann unse-
res Wissens ausgeht, um ein einzelnes Artefakt in einem Ensemble anderer Daten
zu situieren; aber dazu bedarf es begründeter Argumente, die jene dialektische
14 Ebd. § 27, S. 78–81; Zitate S. 80 u. 81.
15 Ebd.
16 Ebd., § 20, S. 54–56; hier S. 56.
17 In der Geschichtswissenschaft wie der Kunstgeschichte hat sich die ›Repräsentationsge-
schichte‹ seit den 1980er Jahren zu einem eigenen Forschungsansatz entwickelt; vgl. erneut
den oben in Anm. 13 genannten Artikel von Chartier.
F4717-Antonsen.indd 148 03.12.2008 11:05:01 Uhr
ZUM PROBLEM DER HISTORISCHEN ERFAHRUNG 149
Überprüfung des Wissensbestandes und die Bereitschaft zur Selbstkorrektur erfor-
dern, auf der Bätschmanns Einleitung so nachdrücklich beharrte.18 Bei der Kon-
frontation mit einem neuen Text/Objekt ist der entscheidende Ansatzpunkt nicht,
was wir zu lesen glauben, sondern die Frage nach dem, was wir wahrzunehmen ver-
mögen. Anstelle von ›Botschaft‹ wäre von ›Zeichen‹ mit nicht abschließend festge-
legter bzw. festlegbarer Bedeutung zu sprechen. Es geht dabei nicht allein um die
Möglichkeit ihrer Entschlüsselung in einer Rezeption, die immer eine variable, und
deshalb nie durch den Urheber dieses ›statements‹ oder Artefakts zu antizipieren
ist; bei dieser Denomination geht es vielmehr primär um die Konfiguration und
Kombination von zeichenhaften Informationen aus – und dies ist entscheidend –
heterogenen Bereichen, die in das Aggregat des sprachlichen Artefakts eingehen, als
das sich jeder Text zunächst präsentiert. Alle Formen von Zeichen sind in ihrer Be-
deutung von Gebrauch und Konventionen abhängig, und demnach ist das Verhält-
nis von Zeichen und Bedeutung zwangsläufig auf Dauer sowohl instabil wie unein-
deutig; dies ist auch unumgänglich, wenn sie innerhalb einer Gemeinschaft funk-
tionieren sollen. So sehr auch der Gebrauch eines Zeichens – und nicht nur in der
Sprache – auf Langfristigkeit angelegt sein mag, so ist doch die Unterbrechung des
Bezugs von Wort und Sache, von Zeichen und Bedeutung eine immer präsente
Möglichkeit, die nicht nur latent vorhanden, sondern in der Literatur manifest ge-
nutzt und gesucht wird; auf ihr beruht die Dynamik nicht allein künstlerischer
Variabilität, sondern des diachronischen Wandels schlechthin. Jedes neu entstehen-
de Aggregat eines sprachlichen Artefakts ist jedoch nicht völlig zufällig oder arbi-
trär; es paßt sich zwei Strukturvorgaben an. Die eine ist in der Regel vom Genre
oder der Gattung bestimmt: Es wird ein Modul ausgefüllt, selbst wenn bestimmte
dieser Vorgaben modifiziert werden. Die andere liegt im literarischen Milieu, in
dem sich das Artefakt behaupten will. Aus diesen Vorgaben resultiert sein eminent
historischer Charakter.
6. Das ›Makrozeichen‹ und seine richtungslosen Elemente
Der bedeutende italienische Romanist und Semiologe D’Arco Silvio Avalle hat des-
halb in seinen Studien vor allem zur mittelalterlichen romanischen Literatur und in
Auseinandersetzung mit den Theorien des Russischen Formalismus grundsätzlich
Zweifel daran geäußert, ob der Terminus ›Zeichen‹ im Sinne de Saussures über-
haupt aus der Sprach- auf die Literatur- bzw. generell Kulturwissenschaften über-
tragbar sei.19 Seinerseits hat er unter Hinweis auf den Artefakt-Charakter aller Poe-
18 Vgl. Gadamer: Wahrheit und Methode; hier besonders S. 288–290. Zu Max Weber vgl. be-
sonders den Aufsatz von 1913 Ueber einige Kategorien der verstehenden Soziologie. In: Weber:
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, S. 427–474; hierzu auch Bätschmann: Einfüh-
rung, § 42, S. 120–123.
19 D’Arco Silvio Avalle (1920–2002) gehörte zu den Begründern der außerordentlich einfluß-
reichen ›Rivista di cultura e critica letteraria‹ Strumenti critici, die seit Herbst 1966 bei Einau-
F4717-Antonsen.indd 149 03.12.2008 11:05:01 Uhr
150 WOLFGANG PROSS
sie gegenüber der gesprochenen Sprache eine Unterscheidung von »segni culturali«
– Kulturzeichen – von den »Sprachzeichen« der gesprochenen Sprache vorgeschla-
gen, und dabei, in Anlehnung an Jan Mukarovský, den Begriff des ›Makrozeichens‹
(»macro-segno«) eingeführt.20 Solche Makrozeichen können als komplexe und po-
lymorphe Zeichenverbindungen auftreten, die um Personen, Bilder, Themen, nar-
rative Schemata oder Genres kreisen, wie sie der Typus der ›verlassenen Geliebten‹
(zum Beispiel Ariadne, Dido), des romantischen Helden als Gegenpol zur Gesell-
schaft (Don Juan, Faust), oder das Schema der Brautwerbung in der frühmittelal-
terlichen Spielmannsepik darstellen.21 Betrachten wir als Beispiel eines solchen kul-
turell komplexen Zeichens einen der berühmten Liedtexte Shakespeares, das zweite
Lied des Ariel aus dem Tempest (1611), mit dem der Luftgeist den Königssohn Fer-
dinand über den Tod seines Vaters tröstet, der bei dem von Prospero entfesselten
Sturm vermeintlich im Meer umgekommen ist:
ARIEL sings
Full fathom five thy father lies;
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell
Burthen Ding-dong
Hark! now I hear them, – Ding-dong, bell.22
Der Shakespeare-Forschung gilt Ariels Lied als Musterbeispiel eines nicht-diskursi-
ven Textes von onirischer Qualität,23 und nicht zufällig hat ihn Herder schon 1774
mit anderen Texten Shakespeares in seine erste Volksliedersammlung aufgenom-
men. Aber die Verwandlung des vergänglichen Körpers in die dauerhaftere Form
eines anderen Lebens auf dem Grunde der See, von der Ariel singt, besitzt bereits
ein Gegenstück – ich spreche bewußt nicht von ›Vorbild‹ – in einem der letzten
Sonette der schmalen, aber eindrücklichen Sammlung der Rime des Monsignore
di erscheint. – Vgl. hierzu den Abschnitt Poesia aus dem Kapitel La semiologia dei motivi. In:
D’Arco Silvio Avalle: Dal mito alla letteratura e ritorno, S. 39–155; hier S. 134 bzw. S. 125f.
20 Vgl. ebd. den einleitenden Aufsatz Dal mito alla letteratura, S. 5–22, hierzu S. 14–17. – Be-
sondere Bedeutung spielt dabei für Avalle der bereits 1934 entstandene, 1936 publizierte
Vortrag Jan Mukarovskýs L‘art comme fait sémiologique [dt. in: Mukarovský, Kapitel aus der
Ästhetik, S. 138–147.]
21 Avalle: ebd.: La semiologia dei motivi, S. 132–139. – Vgl. auch Avalles exemplarische Analyse
des Makrozeichens der letzten Ausfahrt des Odysseus (L’ultimo viaggio di Ulisse, ebd., S. 211–
233).
22 Shakespeare: The Tempest I/2.
23 Vgl. exemplarisch John Tyree Fain: Some Notes on Ariel’s Song. In: Shakespeare Quarterly, Vol.
19/4 (1968), S. 329–332.
F4717-Antonsen.indd 150 03.12.2008 11:05:01 Uhr
ZUM PROBLEM DER HISTORISCHEN ERFAHRUNG 151
Giovanni della Casa (Erstdruck 1558). Dort findet sich allerdings eine explizite
Bezugnahme auf zwei berühmte Episoden von Ovids Metamorphosen, einmal die
Geschichte des Fischers Glaucus, der sich nach dem Genuß eines Krautes wie unter
Zwang ins Meer stürzt und selbst zum Meeresgott mutiert – sie dürfte auch Shake-
speare vertraut gewesen sein. Die zweite ist die des Aesacus, der aus Gram, den Tod
der Geliebten verursacht zu haben, den Tod in der Tiefe sucht, von der Göttin The-
tis aber aus Mitleid in einen Tauchervogel verwandelt wird.24 Della Casa gibt bei-
den Ovid-Episoden eine allegorische Deutung: Wie Glaucus hat auch der Dichter
sich ins Meer des Lebens gestürzt, und dieses hat an ihm eine Metamorphose voll-
zogen; und wie der Vogel Aesacus vermag seine Seele nur dann frei in der Luft zu
schweben, wenn sie nicht vom Genuß des irdischen Lebens beschwert ist.
Già lessi, et hor conosco in me, sì come
Glauco nel mar si pose huom puro et chiaro,
Et come sue sembianze si mischiaro
Di spume et conche et fersi alga sue chiome;
Però che ’n questo Egeo che vita ha nome
Puro anch’io scesi e ’n queste de l’amaro
Mondo tempeste, ed elle mi gravaro
I sensi et l’alma, ahi, di che indegne some!
Lasso! et soviemmi d’Esaco, che l’ali
D’amoroso pallor segnate anchora
Digiuno per lo cielo apre e distende,
E poi satollo indarno a volar prende;
Sì ’l core anch’io, che per sé leve fora,
Gravato ho di terrene esche mortali.25
Neben Della Casa hat auch Torquato Tasso das Motiv des sich verwandelnden
Glaucus in einem seiner Sonette an Lucrezia Bendidio aufgegriffen; den Anlaß bie-
tet ein Geschenk von Kräutern, die ihm die Geliebte aus dem eigenen Garten zu-
kommen läßt. In der Anrede an die »erba felice«, mit der das Sonett schließt, heißt
es:
24 Ovid: Metamorphosen, Buch XIII, VV. 898–968 u. Buch XI, VV. 749–795.
25 Della Casa: Rime; Sonett Nr. LXII, S. 188–189 (»Was ich einst gelesen habe, erfahre ich nun
an mir: wie Glaucus sich einst, mit heilem und glatten Körper, ins Meer stürzte, und wie
seine Gestalt sich mit Schwämmen und Muscheln überzog, und seine Haare zu Algen wur-
den, so geschah es auch mir. In dieses Meer, das Leben heißt, in diese Stürme einer bitteren
Welt stieg auch ich unberührt; und diese beschwerten mir die Sinne und die Seele mit, ach!,
so unwürdiger Last. Ich Elender! denn auch Aesacus kommt mir in den Sinn, der mit den
Flügeln, die noch die Blässe seiner Liebeskrankheit zeichnen, sich in die Luft zu heben ver-
mag, wenn er nüchtern ist, aber satt vergebens sucht, sich wieder aufzuschwingen. So ist
auch mein Herz, das von sich aus leicht sich heben könnte, beschwert von der irdischen Spei-
se der Sterblichkeit«).
F4717-Antonsen.indd 151 03.12.2008 11:05:01 Uhr
152 WOLFGANG PROSS
ben sei tu dono avventuroso e grato
ond’addolcisca il molto amaro e sazio
il digiuno amoroso in parte i’ renda:
già, novo Glauco, in ampio mar mi spazio
d’immensa gioia, e ’n piú tranquillo stato
quasi mi par ch’ immortal forma i’ prenda.26
Es sind drei völlig unterschiedliche Umformungen des ovidischen Themas, die wir
damit zwischen 1558 und 1611 antreffen: eine Allegorie der Verunreinigung der
Seele durch das »Meer des Lebens« bei Della Casa, der beide Episoden Ovids kom-
biniert; eine Verherrlichung der Liebe, die den Dichter als zweiten Glaucus un-
sterblich macht, bei Tasso; und schließlich eine Feier des Todes als Verwandlung
und Rückkehr in die Natur bei Shakespeare, der wie Tasso nur die Glaucus-Episode
transformiert. Man könnte im Blick auf solche Heterogenität der Sinngebung von
einer gewissen ›Richtungslosigkeit‹ der Elemente sprechen, aus denen sich der Ver-
wandlungs-Topos der Episoden Ovids zusammensetzt: Sie präjudizieren keine der
drei unterschiedlichen Sinngebungen in den Verarbeitungen der genannten Auto-
ren, sondern sie bilden einen beliebig um weitere Belege erweiterbaren topologi-
schen Raum, der durchaus nicht auf den Zeitraum der hier untersuchten Beispiele
eingegrenzt werden muß, aber aus Gründen der Profilierung des Befundes limitiert
wurde.
7. Der verfehlte Begriff der ›historischen Rekonstruktion‹
In der Regel erscheint Vertretern einer interpretierenden Literaturwissenschaft hi-
storische Arbeit als bloße ›Rekonstruktion‹ von Einflüssen, die am ›Eigentlichen‹
des Werkes vorbeigehe. Dies ist eine Floskel, die keiner Überprüfung standhält.
Bereits Johann Martin Chladenius, einer der Väter der deutschen Historik, hat in
seiner Allgemeinen Geschichtswissenschaft (1752) sehr pointiert formuliert, daß zwi-
schen der Geschichte als ›Geschehen‹ und dem, was uns davon bekannt ist, scharf
zu trennen sei. Denn von ersterer sei uns das Wenigste zugänglich, und historische
Erkenntnis sei eine Konstruktion, die sich nur auf dieses wenige Bekannte stützen
könne:
Die Geschichte ist von der Erkentniß derselben, wie auch von der Erzehlung und
Nachricht unterschieden. Gleichwie die Vorstellung der Begebenheit von der
Begebenheit selbst unterschieden ist, und durch einen historischen Satz ausge-
druckt wird, also ist auch von der Geschichte die Erkentniß der Geschichte zu
unterscheiden.
26 Tasso: Rime per Lucrezia Bendidio; Sonett Nr. XXXIX, S. 56 (»Wohl bist du ein glückverhei-
ßendes und willkommenes Geschenk, das mir vergangene Bitternis versüßt und mit dem ich
der Entbehrung meiner Liebe etwas Linderung verschaffe: Schon öffnet sich mir in unge-
messener Freude das weite Meer wie einem zweiten Glaucus; ruhiger werde ich, und mir ist,
als würde mir eine unsterbliche Hülle zuteil«).
F4717-Antonsen.indd 152 03.12.2008 11:05:01 Uhr
ZUM PROBLEM DER HISTORISCHEN ERFAHRUNG 153
Wir handeln nehmlich von der historischen Erkentniß: was uns also von den
Dingen, die sind und geschehen, nicht bekannt ist, das gehöret zwar zur Geschich-
te, aber nicht zur Geschichtskunde, noch zur historischen Erkentniß.
Ein anderes ist die Verbindung der Geschichte, und die Verbindung unserer
Erzehlungen. Wir haben deswegen gleich anfangs die Geschichte von der Erkent-
niß derselben sorgfältig unterschieden: und daraus entstehet der allergröste
Unterscheid der allgemeinen Erkentniß und der historischen Erkentniß. Jene ist
lauter menschliche Erkentniß, und ein Werk des menschlichen Verstandes: die
Geschichte aber ist nicht menschliche Erkentniß, sondern sie ist vorhanden,
wenn auch niemand vorhanden wäre, der sie erkennete. […] Die Geschichte
muß also erst zur menschlichen Erkentniß werden: aber sie wird, wegen unserer
so sehr eingeschränckten Erkentniß, niemahls zu einer solchen Erkentniß, darin-
nen alles ausgedrückt, und wie abgedruckt wäre, was in der Geschichte an und
vor sich selbst enthalten ist. In der Geschichte ist daher auch, eigentlich zu reden,
nichts verborgenes, sondern in Ansehung unserer Erkentniß, ist vieles, ja das
allermeiste, verborgen.27
›Rekonstruktion‹ wäre, angesichts der prägnanten Unterscheidungen von Chlade-
nius, nichts anderes als der wenig sinnvolle Versuch einer Homogenisierung von
inkompletten oder gar unzugänglichen Informationen über das Milieu und den
Entstehungsprozeß eines Werkes. Hier liegen die Grundprobleme der Annahmen
des Historismus und der Verstehenslehre der Hermeneutik Diltheys. Zudem gibt
es noch ein weiteres Problem, das sich in der Forderung nach einer Exegese von
sprachlichen Artefakten aus der Perspektive der ›Gegenwart‹ artikuliert: Wohl gibt
es einen ›Präsentismus‹ als Habitus, den der französische Historiker François Har-
tog 2003 analysiert hat. Sein Hauptkennzeichen ist die Überschreibung der Ge-
schichte nach eigenen Interessen, die sich in der Technik des historischen bricolage
der Postmoderne äußert:
Le 20e siècle est celui […] qui surtout dans son dernier tiers, a donné l’extension
la plus grande à la catégorie du présent: un présent massif, envahissant, omnipré-
sent, qui n’a d’autre horizon que lui-même, fabriquant quotidiennement le passé
et le futur, dont il a, jour après jour, besoin.28
Aber diese sogenannte ›Gegenwart‹ ist – und das ist zusätzlich zu bedenken – ihrem
Wesen nach zeitlich zwar simultanes Geschehen, aber ohne daß irgendeine Koordi-
nation des Handelns stattfände; sie ist in striktem Sinn ›synchron kontingent‹. Die
Welt von heute ist nach wie vor von einer multipolaren Weltsicht mit stark akzen-
tuierten Gruppenprägungen und -interessen geprägt, die sich aus unverändert be-
stehenden heterogenen Traditionsbeständen speisen. Die Theoriendynamik der
›cultural turns‹ ist der Ausdruck dieser Tatsache, und deshalb sind sie weitgehend
ungeeignet, das Instrument der Analyse von ›Kultur‹ als Gesamtphänomen zu bil-
27 Chladenius: Allgemeine Geschichtswissenschaft; Zitate: Kap. 1, § 14, S. 8; Kap. 8, § 42, S. 362;
Kap. 8, § 43, S. 263.
28 Hartog: Régimes d‘historicité, S. 200.
F4717-Antonsen.indd 153 03.12.2008 11:05:01 Uhr
154 WOLFGANG PROSS
den, soweit ein solches Unternehmen überhaupt sinnvoll sein kann. Wer historisch
argumentiert, muß sich dieser Ausgangslage bewußt sein: Aus der ›synchronen
Kontingenz‹ des Gegenwärtigen nähert man sich einer Vergangenheit, die nur par-
tiell und nicht in ihrer Totalität zugänglich ist und die zudem in den überlieferten
sprachlichen Artefakten Informationen enthält, die keineswegs als solche evident
sind. Die Struktur der historischen Erfahrung ist demgemäß davon bestimmt, wie
erfolgreich die Entzifferung der Informationen verläuft, die das sprachliche Arte-
fakt enthält, um einen topologischen Raum zu eröffnen und die entschlüsselten
›statements‹ eines partikulären Textes mit den Informationen anderer Artefakte zu
korrelieren, ohne Rücksicht auf die Unterscheidung zwischen ästhetischen und
scheinbar ›außerästhetischen‹ Funktionen. Denn alle Elemente eines sprachlichen
Artefakts sind gleichzeitig Träger von ästhetischen Bedeutungen und außerästheti-
schen Informationen.29 So entstehen Reihen, die eine prägnante Situierung eines
Textes in einem topologischen Raum gestatten, der ohnehin über die Grenzen des
im engen Sinne Literarischen hinausgeht. Ich gebe ein letztes Beispiel, das sich auf
Goethes berühmte Definition von Shakespeares Drama in der Rede zum Schäke-
spears Tag von 1771 bezieht:
Schäkespears Theater ist ein schöner Raritätenkasten, in dem die Geschichte der
Welt vor unsern Augen an dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt. Seine
Plane sind, nach dem gemeinen Stil zu reden, keine Plane, aber seine Stücke dre-
hen sich alle um den geheimen Punkt (den noch kein Philosoph gesehen und
bestimmt hat), in dem das Eigentümliche unsres Ichs, die prätendierte Freiheit
unsres Wollens, mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt.30
Es ist eine bedenkenswerte Metaphorik, die Goethe hier in der Rede von dem »ge-
heimen Punkt (den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt hat)« gebraucht;
aber selbst die neuesten Editionen der Münchner und der Frankfurter Goethe-
Ausgaben versagen sich hier, trotz erkennbaren Erklärungsbedarfs, jeden Kommen-
tar. 1761 waren in Augsburg Johann Heinrich Lamberts Cosmologische Briefe über
die Einrichtung des Weltbaues erschienen. Ihre zentrale These ist, daß es in der Mitte
des Weltalls einen unsichtbaren oder noch nicht erblickten Zentralkörper gibt, der
den letzten Orientierungspunkt sämtlicher Umlaufbahnen aller möglichen Syste-
me an Gestirnen und ihrer scheinbar eigengesetzlichen Bewegungen bilden muß.
Erst in diesem Kontext der Astronomie gewinnt Goethes Metaphorik eine prä-
gnante Kontur, die auf historischer Erfahrung beruht.
29 Mukarovský: Ästhetische Funktion, Norm und ästhetischer Wert als soziale Fakten. In: ders.,
Kapitel aus der Ästhetik; S. 7–112, hier: S. 103f.
30 Goethe: Zum Schäkespears Tag. S. 413.
F4717-Antonsen.indd 154 03.12.2008 11:05:01 Uhr
Peter Rusterholz (Bern)
LITERATURWISSENSCHAFT:
LEBENDIGE TRADITION ALS MEDIUM DER ERKENNTNIS
DER GEGENWART UND FERMENT DER ZUKUNFT
La science est grossière, la vie est subtile,
et c’est pour corriger cette distance que
la littérature nous importe.
Roland Barthes
Die Frage Was heißt und zu welchem Ende studiert man Literaturwissenschaft, könnte
man meinen, müsste von allen, die sich mit Literaturwissenschaft beschäftigen,
leicht beantwortet werden können. Allerdings kann von einer allgemein gültigen
Antwort nicht die Rede sein. Könnte dies begründet sein durch die historischen
Wandlungen des Lebens und der Kunst? Wollen wir uns nicht zufrieden geben mit
einem Inventar möglicher Antworten und der Kritik ihrer Defizite, müssen wir
dieses Problem im Horizont von Schillers Frage betrachten: Was heißt und zu wel-
chem Ende studiert man Universalgeschichte? In welchem Verhältnis stehen Literatur
und Literaturgeschichte zur Universalgeschichte? Inwiefern sind Schillers Antwor-
ten aktualisierbar?
1. Schillers Antrittsrede: Was heißt und zu welchem Ende
studiert man Universalgeschichte?
Die Rede setzt mit einer Typologie der Gelehrsamkeit ein, die unverändert
aktuell bleibt. Schiller unterscheidet den von äußeren Motiven nach Anstellung,
Ehre und praktischem Nutzen getriebenen »Brotgelehrten«, der nur die Bruch-
stücke verwertbaren Wissens sucht, vom »philosophischen Kopf«, der, ständig
sein Wissen ergänzend, seine Begriffe zu einem Ganzen zu ordnen versucht, aber
jederzeit bereit ist, das sich bildende System um eines besseren willen zu verän-
dern. Da Literatur in besonderem Maße sensibel auf jede Veränderung von Lebens-
formen reagiert und ihrerseits medial vermittelte neue Lebensformen prägt, be-
darf auch die Literaturwissenschaft der ständigen Erneuerung durch den philoso-
phischen Kopf, soll sie nicht zum Medium von Brotgelehrten verwalteter
Bildungskonserven degenerieren. Dass die Bildung philosophischer Köpfe beider
Geschlechter auch heute wünschbar, ja zur Entwicklung lebendiger Wissenschaft
notwendig wäre, ist kaum zu bestreiten. Weniger klar, eher unsicher aber ist, ob die
Universität der Tendenz zu rascher Ökonomisierung so weit zu widerstehen ver-
F4717-Antonsen.indd 155 03.12.2008 11:05:01 Uhr
156 PETER RUSTERHOLZ
mag, dass sie die Bildung philosophischer Köpfe beider Geschlechter nicht verhin-
dert.1
Schiller stellt, bevor er den Gegenstand seiner Wissenschaft und das Ziel seiner
Forschung zu bestimmen versucht, die Frage: »Was sind wir jetzt?«2 Seine Skizze
historischer Entwicklung beschreibt ungebrochenen Forschritt und kommt zu den
optimistischen Schlüssen:
Die Schranken sind durchbrochen, welche Staaten und Nationen in feindseligem
Egoismus absonderten. Alle denkenden Köpfe verknüpft jetzt ein weltbürgerli-
ches Band, und alles Licht seines Jahrhunderts kann nunmehr den Geist eines
neuern Galilei und Erasmus bescheinen. […] Den Frieden hütet jetzt ein ewig
geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats setzt ihn zum Wächter über
den Wohlstand des andern.3
Er bestimmt dann als Stoff universalhistorischer Forschung die Begebenheiten, die
»auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jetzt lebenden Generation«
einen wesentlichen Einfluss gehabt hätten.4 In der Perspektive des Welthistorikers
sieht er »eine lange Kette von Begebenheiten von dem gegenwärtigen Augenblicke
bis zum Anfange des Menschengeschlechts hinauf, die wie Ursache und Wirkung
ineinander greifen.«5 Zwar präsentiere sich die Weltgeschichte dem Historiker nur
als eine Sammlung von Bruchstücken, aber der philosophische Verstand füge sie zu
einem vernünftigen Ganzen zusammen. Er sieht dies legitimiert »in der Gleichför-
migkeit und unveränderlichen Einheit der Naturgesetze und des menschlichen
Gemüts.«6 Er meint, dass die Ereignisse entferntesten Altertums in den neuesten
Zeiten wiederkehrten, so dass von den neuesten Erscheinungen ein Rückschluss
auf historische Ereignisse und umgekehrt möglich sei und, was als Ursache und
Wirkung erscheine, auch als Beziehung von Mittel und Absicht gesehen werden
könne. Er ist sich allerdings bewusst, diese Harmonie aus dem Bedürfnis des eige-
nen Inneren zu gewinnen und damit »einen vernünftigen Zweck in den Gang der
Welt und ein teleologisches Prinzip in die Weltgeschichte« zu projizieren.7 Letztes
1 Siehe dazu: Frühwald: Das freie Denken, S. 83: »Darin aber liegt die Misere der Geisteswis-
senschaften begründet, dass sie strukturell der allgemeinen Tendenz zur raschen Ökonomi-
sierung der Universitäten nicht nachkommen, nicht nachkommen können, wenn sie nicht
die Grundprinzipien ihres lehrenden und forschenden Tuns (und damit sich selbst) aufgeben
wollen.«
2 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, S. 755.
3 Ebd., S. 756f.
4 Ebd., S. 762.
5 Ebd., S. 761. Zur Geschichte dieses Deutungsmusters der unendlichen Kette geschaffenen
Seins von Plato bis Leibniz: Lovejoy: The Great Chain of Being. Lovejoy hatte dieses Konzept
in seinen William James-Vorlesungen 1936 entwickelt.
6 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, S. 763.
7 Ebd., S. 764.
F4717-Antonsen.indd 156 03.12.2008 11:05:01 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT 157
Ziel dieser Weltgeschichte sei, »an dieser unvergänglichen Kette, die durch alle
Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes Dasein zu befestigen.«8
Unmittelbar vor diesem idealistischen öffentlichen Bekenntnis verfasste er in
das Philosophische Gespräch aus seinem Romanfragment Der Geisterseher ein radika-
les, modernes Gegenbild zu diesem Konzept, eine Philosophie des Augenblicks, die
jeden Zusammenhang zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft negiert
und damit auch die Interpretation von Ursache und Wirkung als Verhältnis von
Mittel und Absicht verwirft. Schiller distanziert sich zwar deutlich von dieser Per-
spektive, nennt seinen Geisterseher eine »Farce« und kommt in einem Brief an Char-
lotte von Lengefeld und Karoline von Beulwitz vom 26. Januar 1789 zum Schluss:
»Gott bewahre mich, daß ich ganz so denken sollte, wie der Prinz in der Verfinste-
rung seines Gemütes.«9
Schiller vertritt in der Antrittsrede noch eine idealistisch-utopische Perspektive,
im Geisterseher fingiert er eine nihilistisch-moderne Perspektive. Eine Möglichkeit
der Verbindung beider ist aber insofern in der Antrittsrede angelegt, als sie die
Möglichkeit der historischen Rekonstruktion der Teile mit der bewussten Fiktion
der philosophischen Konstitution des Ganzen kombiniert. Zur Zeit der Rede hoff-
te er noch auf die Veränderung der feudalen Verhältnisse durch die Prinzipien der
Aufklärung und durch die französische Revolution. Nachdem die Revolution diese
Hoffnung im Blut erstickte, setzte er seine Hoffnung auf die ästhetische Erziehung
durch die Kunst. Er nennt als zentrale Forderung der Zeit, »sich mit dem vollkom-
mensten aller Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren politischen Freiheit zu
beschäftigen.«10 Aber er rechtfertigt seine Neigung, sich vorerst der Schönheit und
nicht dem politischen Schauplatz zuzuwenden, mit der These, »daß man, um jenes
politische Problem in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische den Weg neh-
men muß, weil es die Schönheit ist, durch welche man zu der Freiheit wandert.«11
2. Wandlungen des Verständnisses der Literatur-
und Geistesgeschichte
Noch im 19. Jahrhundert erhielt sich die Voraussetzung eines Subjekts der Ge-
schichte als blasse Vorstellung eines Initiators der Schöpfung oder des hegelschen
Weltgeists, der die Vorstellung einer sinnvollen Ordnung zwischen Ursprung und
Ziel der Geschichte ermöglicht. Dann aber entdeckten die positivistische Soziolo-
gie Comtes und die Psychoanalyse Freuds, dass Progression und Regression jeder-
zeit möglich sind und nichts als gesicherter Zustand einer Entwicklung betrachtet
werden kann. Die Idee einer von Kultur unabhängigen, immer gleich bleibenden
Natur des Menschen löste sich im Lauf der Moderne auf. Das weltbürgerliche Kon-
8 Ebd., S. 767.
9 Schiller: Briefe, S. 190.
10 Schiller: Ästhetische Erziehung, S. 572.
11 Ebd., S. 573.
F4717-Antonsen.indd 157 03.12.2008 11:05:01 Uhr
158 PETER RUSTERHOLZ
zept Schillers wurde durch eine nationalistische Rezeption pervertiert. Die beiden
Weltkriege des 20. Jahrhunderts und die Shoah haben die Hoffnung, die Ziele der
Ästhetischen Erziehung des Menschen zu erreichen, zerstört. Die Grund legenden
Konzepte der zwischen 1770–1800 entstehenden Geisteswissenschaften sind in
Frage gestellt, die Idee des Fortschritts suspekt und die Möglichkeit eines sinnvol-
len Zusammenhangs der Geschichte negiert worden. Auch in unserem 21. Jahr-
hundert erscheinen die Ideale der Aufklärung utopisch und der Krieg der Kulturen
wahrscheinlicher als das Anbrechen eines Zeitalters des ewigen Friedens. Die Re-
naissance archaischer Irrationalismen und Fundamentalismen ist nicht zu bestrei-
ten.
Nicht alle Antworten, wohl aber alle Fragen, die Schiller zur Begründung histo-
rischen Wissens gestellt hat, und seine Ziele bleiben aktuell.
Schwundstufen des früheren Geschichtsverständnisses bestimmten aber noch
die Literaturgeschichte als Geistesgeschichte, bis diese nach dem Zweiten Weltkrieg
vollends fragwürdig wurde. Nach der nationalistischen und faschistischen Perversi-
on der Germanistik beschränkten die bestimmenden Vertreter des Faches, wie zum
Beispiel Emil Staiger oder Wolfgang Kayser, sich weitgehend auf den klassisch-ro-
mantischen Kanon der Tradition und auf eine reduzierte Auffassung der Geschich-
te, die diese punktuell im literarischen Werk, nicht aber das Werk im historischen
Kontext wahrnahm, die das Werk phänomenologisch als Kunstgebilde, nicht aber
seine Funktion im gesellschaftlichen Kontext untersucht hat.12 Durch den Natio-
nalsozialismus ist die Rezeption moderner Formen der Kunst sowie neuerer Me-
thoden der Kunst- und Kulturwissenschaft der Anfänge des 20. Jahrhunderts un-
terbrochen und nach 1945, erst nach einer Phase der Restauration älterer Traditio-
nen bis ca. 1966, wieder aufgenommen worden. Wandlungen der Lebensformen,
der Kultur und Kunst in der Zeit beginnender wirtschaftlicher Hochkonjunktur,
die Evolution der Medien und die beginnende Globalisierung bewirkten Verände-
rungen des Literaturbegriffs und der literaturwissenschaftlichen Methoden.13
Literaturgeschichte ist in tieferem Sinn nicht nur als abgrenzbares Teilgebiet un-
ter anderen Teildisziplinen wie Edition, Literaturtheorie, Analyse, Interpretation,
Literaturkritik als Inventar literarischer Überlieferung zu betrachten, sondern in
dem doppelten Sinne, wie er auch für die Geschichte gilt: als Bezeichnung eines
Objektbereichs und als dessen sich wandelnde Rezeption und Darstellung. Litera-
turgeschichte, wie Geschichte überhaupt, konstituiert sich im Horizont gegenwär-
tiger Erkenntnisinteressen und Modelle der Auslegung und der Interpretation.
Diese sind ihrerseits historisch bedingt und müssen in dieser doppelten Abhängig-
keit durchschaut werden.
12 Siehe dazu Rusterholz: Formen ›textimmanenter‹ Analyse, S. 365–385.
13 Exemplarischer Fall eines Ereignisses, das man als Indiz eines im kulturgeschichtlichen Kon-
text veränderten Literaturverständnisses und dadurch bedingten Paradigmawechsels der Li-
teraturwissenschaft verstehen kann, ist der Zürcher Literaturstreit. Siehe dazu Rusterholz:
Der Zürcher Literaturstreit, S. 312–314.
F4717-Antonsen.indd 158 03.12.2008 11:05:01 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT 159
3. Konkurrenz und Wechsel der Methoden
Erst nach 1966 wurden in Deutschland und in der Schweiz die lange zuvor ent-
standenen Methoden des russischen Formalismus, des Prager Strukturalismus und
der Semiotik rezipiert, die seither zum klassischen Fundus strukturaler Analyse ge-
hören. Gegen die Werkinterpretation organisierte sich daraufhin, verstärkt durch
die Wissenschaftskritik der 68er Bewegung, eine rasch wachsende Zahl und Kon-
kurrenz rezeptionsorientierter, ideologiekritischer und sozialgeschichtlicher Me-
thoden und Verfahrensweisen, die die hermeneutische Funktion von Autor-Text-
Leser und Gesellschaft mit spezifisch anderer und eigener Gewichtung versahen.
Dies konnte bis zur Umkehrung des Bedeutungsproblems führen. Der literarische
Text erzeugt in Grenzfällen solcher Methodik nicht die vom Autor intendierte oder
vom Leser interpretierte Bedeutung, sondern die Strukturen des Textes werden
durch die Sozialisationsbedingungen, Macht- und Medienverhältnisse, von denen
die Lesenden abhängig sind, mit Bedeutung versehen. Während die Verfahrenswei-
sen der Werkinterpretation zumindest die Möglichkeit eines autonomen Subjekts
voraussetzen, negieren poststrukturalistische und postmoderne Theorien und von
ihnen abhängige Auslegungen diesen Begriff grundsätzlich.14 Auch die Begriffe
›Kunstwerk‹ und ›Text‹ werden problematisiert; die Analyse und Interpretation von
Texten wird durch die Analyse ›diskursiver Praktiken‹ ersetzt. Leider gibt es keine
einheitliche oder gar verbindliche Definition des gegenwärtig geradezu inflationär
verwendeten Diskursbegriffs, der entweder im Sinne eines bestimmten Philoso-
phen wie Foucault oder als Bezeichnung bestimmter Sorten von Gebrauchstexten
oder ganz allgemein als Synonym für Text verwendet wird. Im engeren Sinn kann
›Diskurs‹ als Bezeichnung eines bestimmten, geregelten Aussagesystems, zum Bei-
spiel theologischer, medizinischer oder juristischer Rede, als konventionalisiertes
System des Denkens, Argumentierens und Redens verstanden werden, als Organi-
sationsform des Wissens unter bestimmten sozialen Bedingungen der politischen
und kulturellen Machtverhältnisse bestimmter Zeit. Der literarische Diskurs kann
immer in doppeltem Sinne verstanden werden, als mixtum compositum, der Dis-
kurse aufnimmt und verändert, oder als Gegendiskurs, der sich von den alltags-
sprachlich konventionalisierten oder wissenschaftlich geregelten Diskursen und
ihren Machtverhältnissen abhebt.
Die für die Literaturwissenschaft entscheidende Frage ist aber nicht die Frage
einer generell richtigen Philosophie, sondern die Frage: entspricht der methodische
Zugriff dem Zeichen-, Sprach- und Kunstbegriff des zu analysierenden Texts? In
welchem Verhältnis steht er zum Gattungssystem der Literatur und zu den Dis-
kurssystemen der Kultur? Inwiefern ist der Mensch Subjekt oder Objekt der Zei-
cheninterpretation?
14 Siehe dazu Rusterholz: Zum Verhältnis von Hermeneutik und neueren antihermeneutischen
Strömungen, S. 157–178. Ders.: Die Kunst der Interpretation und die Künste der Dekonstrukti-
on, S. 155–172.
F4717-Antonsen.indd 159 03.12.2008 11:05:01 Uhr
160 PETER RUSTERHOLZ
4. Literatur als Seismogramm der Veränderung von Wirklichkeit
Literarische Texte von besonderer Qualität wirken in doppelter Funktion als die
Sprache erneuernde, die Klischees der Diskurse der Macht entlarvende Texte und
als historische Dokumente, als Seismogramme der Veränderung von Wirklichkeit.
Ernst Jandls Gedicht wien: heldenplatz zum Beispiel evoziert die historische Rede,
die Adolf Hitler nach dem Einmarsch seiner Truppen in Wien gehalten hat: »Als
Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der deut-
schen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.«15
Die Klagenfurter Zeitung begann ihren Leitartikel zum 16. 3. 1938 mit den Sät-
zen: »Über Nacht ist die Stadt eine andere geworden. Das gedrückte Leben ist aus
ihr gewichen, die verschiedenen Aufmärsche sind verschwunden, e i n e Parole be-
herrscht alle Menschen: ›Heil dem Führer, Sieg und Heil dem gesamten Deutschen
Reich!‹«16
Der österreichische Dichter Ernst Jandl war als 14-Jähriger auf der Ringstraße in
Wien, nahe dem Heldenplatz, in einer Menschenmasse eingezwängt, beschimpft
von einer Frau, die sich durch seine im Gedränge unvermeidliche Bewegung des
Knies gestört und bedrängt fühlte. Beide hören die Rede des ›Führers‹ Adolf Hitler
nach dem Anschluss Österreichs an Großdeutschland am 15. März 1938. Diese
traumatische, auch für Stil-, Traditions- und Geschichtsverhältnis prägende Ju-
genderfahrung von 1938 hat Jandl 1962 im folgenden Gedicht verarbeitet:
wien: heldenplatz
der glanze heldenplatz zirka
versaggerte in maschenhaftem männchenmeere
drunter auch frauen die ans maskelknie
zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick.
und brüllzten wesentlich.
verwogener stirnscheitelunterschwang
nach nöten nördlich, kechelte
mit zu-nummernder aufs bluten feilzer stimme
hinsensend sämmertliche eigenwäscher.
pirsch!
döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz
mit hünig sprenkem stimmstummel.
balzerig würmelte es im männechensee
und den weibern ward so pfingstig ums heil
zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte.17
15 Aus der Rede Hitlers vom 15. 3. 1938. In: Weiss und Hanisch: Vermittlungen, S. 197.
16 Ebd.
17 Jandl: Laut und Luise, S. 44.
F4717-Antonsen.indd 160 03.12.2008 11:05:01 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT 161
Einer der besten Kenner der österreichischen Geschichte der Gegenwart, der Wie-
ner Historiker Ernst Hanisch, sagt über diesen Text:
Im Grunde steht der nachgeborene Historiker ratlos vor dem Massengeschehen
in den Märztagen des Jahres 1938. […] Ich kenne keinen Text, der auf einer hal-
ben Druckseite jene kollektive Flucht aus der Realität so präzise einfängt und so
vielfältig, ironiegesättigt analysiert wie Ernst Jandls Gedicht.18
Er beantwortet die Frage, was der Historiker von literarischen Texten erwarte: »Ei-
ne erweiterte Realitätsdefinition, ein Durchbrechen des puren Faktischen, eine
Sensibilisierung für neue Fragestellungen« und meint,
daß künstlerische Texte in viel stärkerem Maße Träger von »Information« sind als
wissenschaftliche Texte. Vor allem deshalb, weil literarische Texte komplexere
Codes verwenden, stärker verschlüsselt sind und nicht nur auf das Was, sondern
auch auf das Wie der Aussage achten.19
Der Text provoziert Fragen aus verschiedensten Bereichen der Psychologie, der So-
ziologie, der Sozialgeschichte und der Theorien des Faschismus und des autoritären
Charakters. Zudem aber wird deutlich, wie die Sprache Jandls die klassizistischen
Sprachtraditionen negiert, die Kultur negiert, die durch den Nationalsozialismus
missbraucht, pervertiert worden ist. Die Kunstsprache, die er der verhunzten Spra-
che der missbrauchten Tradition entgegensetzt, wird zum adäquaten Ausdruck der
Barbarisierung des auf primitive Affekte reduzierten Unmenschen.
Zerbrochen sind die harmonischen Krüge,
die Teller mit dem Griechengesicht,
die vergoldeten Köpfe der Klassiker –20
schreibt er schon in seinem frühen Gedicht Zeichen von 1953. Und
geschichtshaß
gründlichst empfangen
habe er zur nazizeit21
schreibt er noch in seiner 1979 uraufgeführten ›Sprechoper‹ Aus der Fremde. Gera-
de hier bezieht er sich aber doch wieder auf Schiller, in kunstvoll verfremdeter
Form. Sie ist durchwegs im Konjunktiv, in Strophen zu je drei Zeilen geschrieben,
als Dialog von zwei in der dritten Person erzählten Sprechrollen. Das Stück erzählt
und reflektiert nicht nur deren Leben, sondern auch den Prozess der eigenen Pro-
duktion. In diesem Zusammenhang sprechen »Sie« und »Er« von ›Versdrama‹ und
von ›dramatischem Gedicht‹. Sie hält die Bezeichnung ›Versdrama‹ für besser, wo-
rauf er erwidert:
18 Weiss und Hanisch: Vermittlungen, S. 12.
19 Ebd., S. 11.
20 Jandl: Andere Augen, S. 46.
21 Jandl: Aus der Fremde, S. 59.
F4717-Antonsen.indd 161 03.12.2008 11:05:02 Uhr
162 PETER RUSTERHOLZ
was allerdings an Schiller
erinnert haben würde
wie ja der Text auch22
Er signalisiert dadurch – den Traditionsbruch simultan markierend und überwin-
dend – , dass nicht die Formen der Klassiker an sich, sondern ihre Rezeptionen
verderbt und antiquiert seien, aber in veränderter Weise durchaus neue, andere Ak-
tualität gewinnen könnten. Der Traditionsbruch ist damit nicht geheilt, aber die
Erinnerung der Tradition nicht mehr blockiert. Die Literaturwissenschaft hat da-
bei eine andere Funktion als die Texte von Autorinnen und Autoren. Diese reagie-
ren mit sensibler Wahrnehmung und gewandelter Form auf die veränderten Arten
des Lebens, mit Negation oder Wechsel der Traditionen. Literaturwissenschaft hat
die Aufgabe, sowohl die Fülle der Traditionen im Gedächtnis zu behalten als auch
bei den Lesern und Leserinnen das Verständnis zu schaffen für die avantgardisti-
schen, Konventionen negierenden Konzepte der jeweils neuen Literatur. Konzent-
riert sich Literaturwissenschaft allerdings auf die gerade aktuelle Literatur, verfehlt
sie ihre Aufgabe nicht weniger, als wenn sie die Tradition pflegt, ohne deren Ver-
hältnis zur Gegenwart zu bedenken. Walter Benjamin hat diese Tendenz scharf kri-
tisiert und in seinem Aufsatz von 1931 Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft
den historischen Horizont als unabdingbare Voraussetzung der Literaturwissen-
schaft angemahnt: »Die Literaturgeschichte des Modernismus denkt nicht daran,
vor ihrer Zeit durch eine fruchtbare Durchdringung des Ehemaligen sich zu legiti-
mieren, sie vermeint, das durch Gönnerschaft dem zeitgenössischen Schrifttum ge-
genüber besser zu können.«23 Er lobt die Gebrüder Grimm als Beispiele von »For-
schernaturen, die ihrer Epoche unmittelbar in der ihr adäquaten Form des Gewese-
nen dienten« und tadelt eine damals wie heute aktuelle Tendenz: »An Stelle dieser
Haltung ist der Ehrgeiz der Wissenschaft getreten, an Informiertheit es mit jedem
hauptstädtischen Mittagsblatt aufnehmen zu können.«24
Solcher Ehrgeiz begründet die Genese eines dritten Typus des Gelehrten, des zeit-
geisthörigen Mode-Gelehrten, der sich immer wieder den Jargon einer aktuellen phi-
losophischen Strömung aneignet, bevor er sich dessen zeichen-, sprach- und kunst-
theoretische Voraussetzungen überlegt und für seine praktische Arbeit berücksichtigt
hat. Er wechselt chamäleonartig seine Verfahrensweisen und Methoden, ohne zu fra-
gen, ob sie den je unterschiedlichen Voraussetzungen und historischen Kontexten
der Literatur entsprechen. Das sollte nicht als Plädoyer für historistische Rekon-
struktion missverstanden werden, wie auch schon Benjamin im oben zitierten Aufsatz
betont: »Denn es handelt sich ja nicht darum, die Werke des Schrifttums im Zusam-
menhang ihrer Zeit darzustellen, sondern in der Zeit, da sie entstanden, die Zeit, die
sie erkennt – das ist die unsere – zur Darstellung zu bringen.«25 Der philosophische
Kopf aber wird wohl zu ständiger Veränderung und Wandlung seiner Konzepte be-
22 Ebd., S. 71.
23 Benjamin: Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft, S. 288.
24 Ebd., S. 289.
25 Ebd., S. 290.
F4717-Antonsen.indd 162 03.12.2008 11:05:02 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT 163
reit sein, aber nicht der Mode folgend, sondern den unterschiedlichen Formen der
Literatur und ihrer kulturellen Kontexte entsprechend, so, dass er trotz immer wie-
der akuter Krise der Literatur- und Kulturwissenschaften neue Wege des Forschens
und Lehrens findet. Ob dies gelingt, hängt weitgehend vom Verhältnis zu den ge-
schichtlichen Veränderungen der Kulturen ab, hängt davon ab, ob Literaturwissen-
schaft zu reagieren vermag auf die Strukturen verändernden Wandlungen von Ge-
sellschaften in je verschiedenen, aber zunehmend global vernetzten Kulturräumen.
5. Literaturwissenschaft – Kulturwissenschaft
Wie die Rezeption der Moderne durch den Nationalsozialismus und den zweiten
Weltkrieg blockiert wurde, so wurden auch die Ansätze interdisziplinärer Kultur-
wissenschaft, die schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den Philosophen
Ernst Cassirer, den Soziologen Georg Simmel und den Kunstwissenschafter Aby
Warburg begründet wurden, erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wieder aktuell,
als sich immer deutlicher zeigte, dass eine monodisziplinäre Literaturwissenschaft,
gleich welcher methodischen Richtung, zum Verständnis der Literatur einer durch
Medien, Technik und Naturwissenschaften geprägten Lebenswelt nicht genügt.
Naturwissenschaften und Technik sind nicht nur Stoffe der Literatur, sondern auch
die moderne Poetik bestimmende Momente der Organisationsformen des Den-
kens, Wissens und Gestaltens.
Empirische Wissenschaften können als Versuche der Reduktion der Komplexi-
tät der Lebenswelt durch Modellierung und Abstraktion auf mess-, zähl- und wäg-
bare Faktoren verstanden werden. Die Ansichten und Fiktionen der Literatur ver-
suchen durch die Art und Weise ihrer ganz anders gestalteten Formen sprachlicher
Darstellung, sowohl Komplexität durch anschauliche Darstellung zu reduzieren als
auch durch perspektivisch gebrochene, in Grenzfällen paradoxe und grotesk ver-
fremdende Darstellung zu erhalten. Freilich bemisst sich die Qualität der Literatur
nicht nach ihrem objektiven wissenschaftlichen Gehalt, sondern nach ihrem sym-
bolischen Sinn und Tiefgang. Je partikulärer und abstrakter die wissenschaftliche
Theorie wird, desto eher versucht Literatur, nicht nur, aber auch mit archaischen
Bildern Leben anschaulich zu zeigen. Wir leben ja alle in zwei Welten, in einer
gleichsam ptolemäischen anschaulichen Welt, in der Mond und Sonne auf- und
untergehen wie noch bei Claudius, obgleich auch er die Aufklärung und das neue
Weltbild schon hinter sich wusste, und in der abstrakten nachkopernikanischen
Welt der Wissenschaften, die wir nur denken, uns aber nicht vorstellen können.
Literatur nun ist immer wieder anders und immer wieder neu durch diese Doppel-
erfahrung geprägt. Dies gilt heute zum Beispiel in besonderem Maße für die Texte
von Durs Grünbein, dessen poetologisches Denken durch die Erkenntnisse der
Hirnforschung geprägt ist, dessen Texte aber die Grenzen dieser Wissenschaft durch
die individuelle und doch gesellschaftlich repräsentative Art der Gestaltung spren-
gen. In seinem Text Mein babylonisches Hirn beschreibt er das Ziel des Dichters
seiner Generation:
F4717-Antonsen.indd 163 03.12.2008 11:05:02 Uhr
164 PETER RUSTERHOLZ
Das Erreichen tieferer Hirnareale, die Markierung in Form einzigartiger Engram-
me, das ist sein Ziel, und insofern liegt in Neurologie die Poetik der Zukunft
versteckt. Auf der Jagd nach den Gedächtnisspuren unterwirft er alle anderen
Belange seines Lebens der fixen Idee, nur dafür da zu sein, ihn an das Kontinuum
verdichteter Bilder anzuschließen, darin liegt das unheilbar Manische seines Tuns.
Ein Vers des Kallimachos aus Kyrene bringt ihm genausoviel Gegenwart wie der
Zuruf des Postboten vor der Tür. Aus den Worten der Freundin hört er vielleicht
mehr an Echos heraus, als die Gefühlsdiplomatie im Augenblick wahr haben will.
So aufmerksam lauscht er in das Stimmengewirr vieler Zeiten, in die Zitate und
Sprachfetzen seiner Gegenwart, daß die markantesten sich in den innersten Aus-
läufern seines Gehörs fangen … Bis eine Zeile, ein Codewort die Zusage gibt:
Hier stößt du, endlich, auf Grund.26
Das Hirn ist die Voraussetzung der sinnlichen Wahrnehmung und der Speicherung
der Erfahrung, der Memoria, und insofern liegt in der Neurologie die Poetik der
Zukunft versteckt. Der Dichter, wie Grünbein ihn sieht, ist auf der Jagd nach dem
Kreuzungspunkt der gegenwärtigen Wahrnehmungsspuren und der Gedächtnis-
spuren, ist auf der Jagd nach dem ›Moment juste‹, wo plötzlich das Gewirr ver-
schiedenster Stimmen sich zum Fragment einer Aussage verdichtet. Welch eminent
wichtige Funktion hier trotz aller Sprach- und Weltskepsis dem dichterischen Wort
zukommt, wird im nächsten Textausschnitt dieses poetischen Manifests deutlich:
Im dichterischen Wort, das als Gesang einst begann, trifft sich die älteste Empfin-
dung mit dem jüngsten Einfall, der Stammhirnaffekt mit dem neuesten Gegen-
stand, mit der aktuellen Idee, – in einem Akt blitzhafter Imagination. Sein
Geheimnis ist die Unmittelbarkeit, seine Magie die physische Präsenz eines Spre-
chers, der immer woanders oder lange schon tot ist. In den verschiedenen Rhyth-
men, den verdichteten Bildern wird die Vorstellung des einzelnen synchronisiert
mit der Weltwahrnehmung aller – solange es Überlieferung gibt.27
Insofern der radikal ganz und gar Heutige seine sinnliche Wahrnehmung mit sei-
nem historischen Gedächtnis verbindet, synchronisiert er seine Vorstellung des
einzelnen mit der Weltwahrnehmung aller und macht so seine Privaterfahrung
kommunizierbar, verstehbar für Dritte. Literaturwissenschaft, die nicht beachtet,
dass unsere Formen des Lebens und Denkens durch medial vermittelte, durch Na-
turwissenschaften und Technik gebildete Strukturen modelliert sind, müsste ohne
Erkenntniswert bleiben. Aber auch Kultur- und Medienwissenschaft, die vergisst,
dass unser Bewusstes und Unbewusstes geschichtlich geprägt ist, dass nicht das
Hirn, sondern der Mensch denkt, verfehlt die Erkenntnis unseres Lebens.28 Auch
26 Grünbein: Mein babylonisches Hirn, S. 20f.
27 Ebd., S. 22.
28 Der Neurophysiologe Max R. Bennet und der Philosoph Peter M. Hackert untersuchten
kritisch die Sprache der neurowissenschaftlichen Arbeiten von Damasio, Edelman, Kandel
und Crick. Sie kommen zum Schluss, dass diese Attribute auf das Gehirn beziehen, die nur
dem Menschen als Ganzem zukommen, dass sie indexikalische Zeichen mit symbolischen
F4717-Antonsen.indd 164 03.12.2008 11:05:02 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT 165
inter- und transdisziplinäre Kulturwissenschaft vermag nicht die innere und äußere
Freiheit zu schaffen, die Schiller gemeint hat. Wohl aber vermag sie die Mächte der
Bedeutungsbildung unserer Gegenwart aus ihrer Genese zu erhellen und Antwor-
ten auf die bedrängenden Fragen zu finden: Weshalb oder inwiefern sind wir Sub-
jekte der Bedeutungs- und Sinnbildung – oder: Sind wir hilflose Objekte des durch
Mächte und Märkte gesteuerten Bedeutungstransports?
Zeichen verwechseln. Nicht das Hirn fühlt oder denkt oder handelt, sondern der Mensch als
ganze Person. Dazu gehören nicht nur die physiologischen Voraussetzungen des Hirns, son-
dern der Mensch mit seiner je besonderen Fähigkeit des Wahrnehmens, Fühlens und Den-
kens. Siehe Bennet und Hacker: Philosophical Foundations.
F4717-Antonsen.indd 165 03.12.2008 11:05:02 Uhr
F4717-Antonsen.indd 166 03.12.2008 11:05:02 Uhr
Gesine Lenore Schiewer (Bern)
LITERATUR – TECHNOLOGIE – ETHIK. DAS DILEMMA
VON INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND FREISCHWEBENDER
INTELLIGENZ AM BEISPIEL DER MEHRSPRACHIGKEIT
Seit mehr als einer Dekade wird seitens der UNESCO die Frage der Vielfalt von
Sprachen und Kulturen im Cyberzeitalter thematisiert. Als in den neunziger Jahren
noch neun von zehn Internetbenutzern die englische Sprache verwendeten, wurde
bereits prognostiziert, dass der sich damals erst ankündigende »Kampf der Viel-
sprachigkeit« um Dominanz – wie in offensichtlicher Anlehnung an Samuel Hun-
tingtons »Kampf der Kulturen« betont wurde – noch nicht einmal begonnen ha-
be.1 Inzwischen ist der Anteil von nicht englischsprachigen Nutzern tatsächlich
deutlich gestiegen2 und Institutionen wie die UNESCO, aber auch die EU und
Länder wie die Schweiz und Belgien mit mehreren Amtssprachen unterstützen die
Mehrsprachigkeit. Es werden Anstrengungen unternommen, der Benachteiligung
oder gar Verdrängung einzelner Sprachen trotz des durch die Vielsprachigkeit be-
dingten wirtschaftlichen Wettbewerbsnachteils und der entstehenden Kosten durch
die Adaption von Kommunikationsmitteln im Feld von Produktvermarktung,
Marketingkommunikation, Übersetzungen und Dolmetschertätigkeiten entgegen
zu wirken.
Die Bestrebungen setzen dabei auf mehreren Ebenen an: Der Einsatz von Infor-
mationstechnologien zur Förderung von Multilingualität im interkulturellen Me-
dienkontakt wird flankiert von einer spezifischen Informationsethik, die sich Fra-
gen nach dem sinnvollen und gesellschaftlich wünschenswerten Einsatz dieser
Technologie ebenso wie den sozialen und politischen Folgen stellt.3 Die bislang
wenig thematisierte Rolle von Literatur und Literaturwissenschaft im Zusammen-
hang ethisch motivierter Reflexion des Einsatzes von Technologie soll in den fol-
genden Überlegungen markiert werden.
1. Mehrsprachigkeit und Neue Medien
aus der Sicht der UNESCO
Angesichts der Herausforderungen durch die neuen Medientechnologien versteht
sich die UNESCO als internationales Forum für die gesellschaftlichen, kulturellen,
1 Vgl. Quéau: Informationsgesellschaft.
2 Seit Ende der neunziger Jahre hat sich gleichzeitig das Internetangebot in den verschiedenen
Nationalsprachen stark entwickelt. Vgl. Weber: Sprachkonflikte, S. 111.
3 Vgl. z. B. Capurro u. a.: Informationsethik, Rauch: Informationsethik, Hausmanninger u. a:
Netzethik, Kuhlen u. a: Informationsethik, Scheule: Digital Divide.
F4717-Antonsen.indd 167 03.12.2008 11:05:02 Uhr
168 GESINE LENORE SCHIEWER
ethischen und rechtlichen Folgen der »Informationsgesellschaft«4. Neben den
Chancen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation werden Risiken
wie die Gefahr der kulturellen und sprachlichen Homogenisierung betont.
UNESCO-Vertreter Philippe Quéau warnt vor der Tendenz zum Verlust mündli-
cher Kulturen und einer »zerstörerischen Standardisierung von Kulturen und Spra-
chen, die von der Woge der vereinheitlichenden Rationalität des Welthandels und
der normativen Logik« ausgehe.5 So würden zunehmend »maschinenfreundliche«
Texte verfasst, die die Autoren zwingen, ihren Stil oder ihr Denken so zu verän-
dern, dass sie für Übersetzungsautomaten verständlich sind.
Vor diesem Hintergrund hat die 32. Generalkonferenz der UNESCO im Okto-
ber 2003 zwei Dokumente verabschiedet: die Empfehlung zur Förderung von Mehr-
sprachigkeit und universellen Zugang zum Cyberspace (Recommendation concerning
the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace) sowie
die Charta zum Erhalt des digitalen Kulturerbes (Charter on the Preservation of the
Digital Heritage). Hier werden Maßnahmen befürwortet, die es jedem einzelnen,
jeder Kultur und jeder Sprache erlauben sollen, am Internet mit Gewinn teilzuha-
ben.6 Es wird festgehalten, dass »linguistic diversity in the global information net-
works and universal access to information in cyberspace are at the core of contem-
porary debates and can be a determining factor in the development of a knowledge-
based society«7. Die Bewahrung der Multilingualität wird mit der Förderung der
Neuen Medien nicht nur als vereinbar eingeschätzt, sondern es werden sogar güns-
tige Auswirkungen auf die Entwicklung einer Wissensgesellschaft angenommen.
Fragen der konkreten Realisierung dieses Programms werden allerdings nicht ver-
tieft. Große Hoffnungen aber sind mit der Informations- und Kommunikations-
technologie, insbesondere automatischen Übersetzungssystemen, Suchmaschinen
mit multilingualem information retrieval, online-Wörterbüchern und dem ma-
schinellem Sprachverstehen verbunden.
2. Pragmatischer Informationsbegriff und Informationsethik
Und zu solchen Hoffnungen geben die jüngsten Entwicklungen der Computerlin-
guistik durchaus Anlass. Die Sprachtechnologie für multilinguale Kommunikation
hat Eingang in zahlreiche Produkte gefunden, die in vielen Zweigen der Wirtschaft
zu einem selbstverständlichen Instrumentarium geworden sind. Die entsprechen-
den Anforderungen werden als Herausforderung für die Computerlinguistik be-
trachtet und die Entwicklung von Werkzeugen zur Aufbereitung von Wissen, zum
Wissensmanagement und zur maschinellen Sprachverarbeitung ist sowohl Ziel
4 Vgl. UNESCO: Informationsethik.
5 Quéau: Informationsgesellschaft.
6 UNESCO: Statement des zweiten UNESCO INFOethik Kongresses 1998.
7 UNESCO: Recommendation.
F4717-Antonsen.indd 168 03.12.2008 11:05:02 Uhr
LITERATUR – TECHNOLOGIE – ETHIK 169
wissenschaftlicher Anstrengungen als auch Gegenstand wirtschaftlichen Interes-
ses.8
Es lohnt also, hier genauer hinzusehen: Das Beispiel eines elektronischen, mehr-
sprachigen Kommunikationsforums zur Unterstützung von Lernprozessen ohne
Sprachbarrieren auf der Grundlage eines interaktiven Lernsystems etwa beschreibt
die Informationswissenschaftlerin Christa Womser-Hacker. Es ist ein System, dass
sich an Studierende verschiedener Muttersprachen aus unterschiedlichen Kulturen
richtet und den Austausch in internationalen Gruppen ermöglichen soll. Aber:
Innerhalb von Lehr- und Lernumgebungen kommt der Rolle des Moderators
besondere Bedeutung zu, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass durch
die alleinige Bereitstellung der technischen Infrastruktur Kooperation und Kom-
munikation unter den Lernenden erfolgt. Unter Moderation wird nicht nur ein
Monitoring, d. h. das Beobachten bzw. Verfolgen der Vorgänge, verstanden, son-
dern hinzu kommen aktive Aufgaben, die normalerweise in der Präsenzlehre den
Lehrenden obliegen.9
Christa Womser-Hacker räumt ein, dass Lernende verschiedener Kulturen äußerst
unterschiedliche Erwartungen an den Moderator stellen, wodurch es zu Schwierig-
keiten kommen kann.10 Da Wissen nicht nur in verschiedenen Sprachen vorliegt,
sondern auch spezifischen kulturellen Bedingungen unterliegt11, wurde im Kontext
des internationalen Informations- und Wissensmanagements ein ›pragmatischer
Informationsbegriff‹ eingeführt.12 In dieser pragmatischen Perspektive wird Infor-
mation im Zusammenhang ihrer Nutzung und Wirkung reflektiert und informati-
onsethischen Erwägungen unterzogen.13
Dem liegt zugrunde, dass technologische Entwicklungen wie das oben skizzierte
mehrsprachige Kommunikationsforum neue Verantwortlichkeiten mit sich brin-
gen, da die pragmatischen Dimensionen ihrer Nutzung durch interkulturelle An-
wender verschiedener Sprachen nicht ignoriert werden dürfen. Darüber hinaus
impliziert jedes Übersetzungssystem, jedes natürlichsprachliche retrieval-System,
jede multilinguale IT-Schnittstelle Rahmenfaktoren, die darüber entscheiden, auf
welchen Anwendungsbereich sich das System bezieht, wie es eingesetzt wird, wel-
che begleitenden Maßnahmen ergriffen werden, von wem es mit welchem Interesse
entwickelt wird, ob es konkurrierende Anbieter und Systeme gibt etc. Auch darf
der Aspekt des wirtschaftlichen (Verdrängungs-)Wettbewerbs unter Entwicklern
und Betreibern solcher Systeme nicht übersehen werden.
8 Vgl. Seewald-Heeg: Sprachtechnologie.
9 Womser-Hacker: Kommunikationsforum, S. 296f.
10 Ebd., S. 299.
11 In einer frühen Studie hat Florian Coulmas schon 1977 Zusammenhänge von Konvention
und Kultur und Grund legende Aspekte der Abhängigkeit des Verstehens von der Teilnahme
an der Kultur untersucht. Vgl. Coulmas: Sprachverhalten, S. 60ff.
12 Vgl. Capurro: Informationswissenschaft, S. 22f.
13 Vgl. Kuhlen: Informationsethik, S. 158.
F4717-Antonsen.indd 169 03.12.2008 11:05:02 Uhr
170 GESINE LENORE SCHIEWER
Schon diese wenigen Hinweise lassen erkennen, dass alle technologischen Hilfs-
mittel – deren Nützlichkeit gar nicht bestritten werden soll – Gerechtigkeit im
Sinne gleichwertiger Nutzungsmöglichkeiten für die Sprecher unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen keineswegs garantieren können. Denn eine Voraussetzung
für deren Nutzung durch möglichst weit gestreute Gruppen von Menschen ist die
Entwicklung solcher Systeme in den verschiedenen Sprachen, Gesellschafts-, Reli-
gions- und Kulturkreisen selbst. Die Verfügbarkeit der erforderlichen wirtschaftli-
chen Ressourcen ist dabei ein maßgeblicher Faktor.
Es geht also um eine Auseinandersetzung mit den sozialen Problemen der Ver-
teilung von Gütern, da der tatsächliche Zugang zur Information das größte Prob-
lem der Cybergesellschaft darstellt. Die nationalstaatlich geregelten politischen und
juristischen Mittel sind dabei kaum zur Anwendung zu bringen, da die Neuen Me-
dien Staats-, Kultur- und Sprachgrenzen überschreiten.14 Diese Problematik wird
von Informatikern, Juristen und Ökonomen reflektiert – die Geistes- und Sozial-
wissenschaften beteiligen sich hingegen wenig, womit aber die Chance der Mitge-
staltung vertan wird.15 Denn keinesfalls, dies betont der Philosoph Karsten Weber,
dürfe sich die Illusion durchsetzen, dass es bei informationsethischen Konzeptio-
nen um eine Gestaltung der technischen Gegebenheiten gehe. Vielmehr stehe eine
Gestaltung der Gesellschaft an, die die Rahmenbedingungen für einen gerechten
Umgang mit den Neuen Medien zu bestimmen habe.16 Diese Gestaltung der Zu-
kunft gilt es, Weber zufolge, allen Betroffenen zu ermöglichen, dies von ihnen aber
auch zu verlangen.17 Mit anderen Worten: Technologie allein kann die Bewahrung
und Förderung von Multilingualität gewiss nicht sicherstellen.
3. Zur Reflexion von Technologie und Ethik in Kybernetik und
Science Fiction: Norbert Wiener – Stanisław Lem
Die Mahnung, ethische Verantwortung nicht in das Feld technologischer Möglich-
keiten zu verschieben, wurde aber schon viel früher ausgesprochen: sogar der Be-
gründer der Kybernetik, Norbert Wiener, hat sich 1964 in Gott und Golem Inc. da-
mit auseinandergesetzt:
Ich war einmal mit einer Gruppe von Ärzten beim Essen – sie sprachen unge-
zwungen miteinander und besaßen genügend Selbstvertrauen, auch unkonventi-
onelle Dinge ohne Scheu auszusprechen –, und sie begannen die Möglichkeit
eines radikalen Angriffs gegen die degenerative Krankheit zu diskutieren, die als
Vergreisung bekannt ist.18
14 Vgl. Weber: Gerechtigkeit, S. 132.
15 Vgl. hierzu ebd., S. 134.
16 Vgl. Weber: Digitale Spaltung, S. 117. Vgl. auch Kuhlen: Informationsethik, S. 30ff.
17 Weber: Gerechtigkeit, S. 186.
18 Wiener: Gott und Golem, S. 94.
F4717-Antonsen.indd 170 03.12.2008 11:05:02 Uhr
LITERATUR – TECHNOLOGIE – ETHIK 171
Norbert Wiener schließt folgende Überlegung an:
So tröstlich die Idee [der Aufschiebung des Todes um unbestimmte Zeit] auf den
ersten Blick auch sein mag – in Wirklichkeit ist sie sehr erschreckend, und vor
allem für die Ärzte. Denn wenn eins feststeht, so ist es dies, daß die Menschheit
als solche die unbestimmte Verlängerung allen entstehenden Lebens nicht lange
überdauern könnte. […]
Es ist undenkbar, daß alle Menschenleben unterschiedslos verlängert werden soll-
ten. Wenn die Möglichkeit unbestimmter Verlängerung jedoch besteht, so bringt
die Begrenzung eines Lebens oder selbst die Weigerung oder nachlässige Unter-
lassung, es zu verlängern, eine moralische Entscheidung der Ärzte mit sich. […]
Kann der Arzt diese Macht über Gut und Böse, die man ihm aufdrängen wird,
überleben?19
Jede neue Möglichkeit des technologischen, medizinischen oder sonstigen Eingriffs
und der willentlichen Steuerung bringt, wie aus Wieners Darlegung hervorgeht,
neue Verantwortlichkeiten und gesellschaftlichen Regelungsbedarf mit sich. Wo
zuvor Determinismus wirkte, schafft die Technologie die Möglichkeit einer Wahl.
Dieses Problem diskutiert auch Stanisław Lem seit den sechziger Jahren etwa
anhand eines fingierten Beispiels, nämlich der Möglichkeit, das Geschlecht von
Kindern regulativ zu steuern. Lem verweist darauf,
[…] daß man die unanfechtbare Direktheit der ursprünglichen, ethisch neutra-
len These ›es ist nicht möglich‹ (daß man zum Beispiel das Geschlecht eines Kin-
des nach Belieben bestimmt) ersetzen muß durch die Direktive ›es ist nicht
erlaubt‹ (es wäre zwar möglich, das Geschlecht eines Neugeborenen zu bestim-
men, aber es ist nicht zulässig, zumindest in bestimmten Situationen, wenn etwa
das ›Auswahlkontingent‹ für ein bestimmtes Geschlecht gerade ausgeschöpft
ist).20
Das an dieser Stelle theoretisch diskutierte Problem des Ethischen ist Gegenstand
zahlreicher Gedankenexperimente in der Science Fiction Lems.21 Immer wieder il-
lustriert er in seinen literarischen Texten die Grenzen des technisch Möglichen als
Dilemma von Fortschritt und Verantwortung. So kommen die MASTEN (MAxi-
male STufe der ENtwicklung) in der Erzählung Altruizin oder Der wahre Bericht
darüber, wie der Eremit Bonhomius das universelle Glück im Kosmos schaffen wollte,
und was dabei herauskam nach Erprobung aller denkbaren Methoden, Menschen
glücklich zu machen, zu dem Entschluss, ihre gottgleichen Möglichkeiten nicht
mehr einzusetzen: »Individuen kann man nicht und Gesellschaften darf man nicht
glücklich machen, denn jede Gesellschaft muß ihren eigenen Weg gehen, indem sie
auf natürliche Weise Stufe um Stufe der Entwicklung durchläuft und alles Gute
19 Ebd., S. 95f.
20 Lem: Ethik, S. 326f.
21 Vgl. hierzu Gräfrath: Weltenschöpfer, S. 201.
F4717-Antonsen.indd 171 03.12.2008 11:05:02 Uhr
172 GESINE LENORE SCHIEWER
und Schlechte, was dabei herauskommt, ausschließlich sich selbst zu verdanken
hat.«22
Lem ist bestrebt, in seinen literarischen Texten zu realisieren, was er in Phantas-
tik und Futurologie, 1964, gattungstheoretisch reflektiert. Die Aufgabe anspruchs-
voller Science Fiction besteht seiner Ansicht nach darin, prognostisch die Folgen
technischer Entwicklungen durchzuspielen, und »die Wahl zwischen einem unbe-
grenzten technischen Fortschritt und dem bewussten Festhalten an bestimmten
Werten der traditionellen Kultur«23 auszutarieren. Da beides zugleich, der Fort-
schritt und das Festhalten an hergebrachten Werten, Lem zufolge nicht möglich
ist, bedarf es der beständigen und unabhängigen Auseinandersetzung respektive –
mit Karl Mannheim gesprochen – der ›freischwebenden Intelligenz‹.24 Lem hat da-
mit der Literatur eine bedeutende Rolle in der Abwägung gesellschaftlicher Optio-
nen zugewiesen und der Literaturwissenschaft nicht den, aber doch immerhin ei-
nen roten Teppich ausgerollt.
Denn gerade die vermeintliche Neutralität von Technik und Technologie lässt ja
vielfach in Vergessenheit geraten, dass ihre Entwicklung vor dem Hintergrund spe-
zifischer Interessen, seien sie wirtschaftlicher, politischer oder militärischer Art, zu
sehen ist. Die Herausforderung an die Gesellschaft besteht daher nicht in erster Li-
nie darin, etwa den Informationszugang für alle gleich werden zu lassen und den
›digital divide‹ bezüglich der Verfügbarkeit moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologie zu überwinden. Sie besteht vielmehr darin, deren Leistung
ebenso wie die problematischen Facetten mit den jeweils neu entstehenden Verant-
wortlichkeiten überhaupt zu erkennen, durchzuspielen und abzuwägen. Dies ist
die Herausforderung, der sich Autoren wie Lem in ihrem Selbstverständnis als ›frei-
schwebende Intelligenz‹ stellen.
Der Literaturwissenschaft wächst dann die Rolle zu, den ethischen Anspruch
der betreffenden literarischen Texte kritisch zu reflektieren. Dabei kann es natür-
lich weder darum gehen, Vorentscheidungen irgendeiner Art zu Fragen der Auto-
nomie von Literatur und Ethik zu fällen, noch darum, Literatur gewissermaßen per
Dekret mit einem ethischen Anspruch »auszustatten«.25 Ebenso wenig kann jedoch
etwa aufgrund eines mehr oder weniger expliziten Postulats der Zweckfreiheit von
Kunst gegebenenfalls das Ethische in Literatur – womöglich unter Marginalisie-
rung der betreffenden Gattung – ignoriert werden. Dies insbesondere, wenn es so
offenkundig auf literarisch und sachlich anspruchsvollem Niveau wie im Fall der
Texte Lems ausagiert wird. Selbstverständlich ist auch, dass es weder auf der Ebene
des literarischen Textes noch in der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung
um Lösungen und griffige Formeln gehen kann; entscheidend ist vielmehr die
Kontinuität der Auseinandersetzung mit Handlungsoptionen und möglichen Kon-
22 Lem: Ethik, S. 250.
23 Gräfrath: Weltenschöpfer, 1998, S. 200.
24 Vgl. ebd., S. 201.
25 Vgl. Mandry: Moral, S. 9. Vgl. die Abwägung entsprechender Kriterien von Josef Früchtl in:
Früchtl: Ästhetische Erfahrung und Moderne Moral.
F4717-Antonsen.indd 172 03.12.2008 11:05:02 Uhr
LITERATUR – TECHNOLOGIE – ETHIK 173
sequenzen in einer technologisch bestimmten Informations- und Kommunikati-
onsgesellschaft. Dass der literaturwissenschaftliche Zugang zur literarischen The-
matisierung von Rationalitätsstrukturen, selbst geschaffenen Sachzwängen und
Regelungsansprüchen auf einem soliden transdiziplinären Bildungshintergrund er-
folgen muss, kann nicht unerwähnt bleiben. Die Chance aber, die hier zu ergreifen
ist, besteht darin, einen Beitrag zum notwendigen Schritt von der technologisch
sich verselbstständigenden Informations- zur sich selbst reflektierenden Wissensge-
sellschaft zu leisten.
F4717-Antonsen.indd 173 03.12.2008 11:05:02 Uhr
F4717-Antonsen.indd 174 03.12.2008 11:05:02 Uhr
Ralf Schnell (Siegen)
ÜBER PHILOLOGISCHE ERKENNTNIS
Als Peter Szondis Traktat Über philologische Erkenntnis 1970 erneut erschien1 – zu-
erst hatte der Autor den 1962 geschriebenen Text unter dem Titel Zur Erkenntnis-
problematik in der Literaturwissenschaft in Die Neue Rundschau 2, danach in Univer-
sitätstage 1962 3 publiziert –, konnte man sich als Student der Freien Universität
Berlin des Eindrucks kaum erwehren, es handele sich um eine höchst unzeitgemä-
ße Betrachtung. Nicht nur brachte der an der FU lehrende Szondi seine Schrift ei-
nem größeren intellektuellen Publikum zu einem Zeitpunkt zur Kenntnis, in dem
das Interesse an Fragen spezifisch philologischer Erkenntnis vergleichsweise gering
erscheinen musste: Der Tod des Berliner Germanistikstudenten Benno Ohnesorg
lag gerade drei Jahre zurück; die politisierten Studenten, zumal die der FU Berlin,
begannen sich zunehmend zu radikalisieren und zu fraktionieren; zudem zeichne-
ten sich mit der bewaffneten Befreiung Andreas Baaders durch die ›Rote Armee
Fraktion‹ die ersten militanten Verwerfungen in der Bundesrepublik Deutschland
ab. Darüber hinaus aber war auch der Publikationskontext dieses Traktats irritie-
rend: Er erschien in einem Band der edition suhrkamp mit dem Titel Hölderlin-
Studien, einer Sammlung von Aufsätzen, die sich mit Hölderlins hymnischem
Spätstil, darunter seine Hymne Friedensfeier, auseinandersetzten, ferner mit einem
Brief Hölderlins an Böhlendorff vom 4. Dezember 1801, mit dem Verhältnis von
Gattungspoetik und Geschichtsphilosophie sowie einem Fragment Hölderlins zur
Tragödientheorie.
Überraschender noch als Zeitpunkt und Publikationskontext dieser Veröffentli-
chung aber war für den Studenten des Jahres 1970, der kurz vor dem Abschluss sei-
nes Studiums der Germanistik, Publizistik und Theaterwissenschaft stand, offenbar
die Lektüre des Textes selbst gewesen. Noch heute markieren Unterstreichungen im
Bändchen 379 der edition suhrkamp vier seinerzeit offenbar besonders ins Auge fal-
lende Erkenntnisse, deren Prägnanz die Formulierungskunst Szondis ebenso elegant
wie konzentriert und tiefsinnig zu übermitteln wusste. Die erste lautet:
Vielmehr gehört gerade die Historizität zu seiner [des einzelnen Werks, R. Sch.]
Besonderheit, so dass einzig d i e Betrachtungsweise dem Kunstwerk ganz gerecht
wird, welche die Geschichte im Kunstwerk, nicht aber die, die das Kunstwerk in
der Geschichte zu sehen erlaubt.4
1 Vgl. Szondi: Hölderlin-Studien. Mit einem Traktat über philologische Erkenntnis.
2 Vgl. Szondi: Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft.
3 Vgl. ebd.
4 Szondi: Hölderlin-Studien, S. 22.
F4717-Antonsen.indd 175 03.12.2008 11:05:02 Uhr
176 RALF SCHNELL
Diese Einsicht stand durchaus im Widerspruch zu ihrer Zeit: einer Zeit, da sich
selbst Studenten der Germanistik am Leitfaden von Ernest Mandels Marxistischer
Wirtschaftstheorie (1970) eher für die Basis-Überbau-Problematik interessierten,
übrigens mit größtem Studieneifer, als für Grundfragen der Hermeneutik oder den
Traditionsbestand der geisteswissenschaftlichen Fächer; einer Zeit, in der die
Schriften des späten Georg Lukács, insbesondere seine Essays zur deutschen Litera-
tur des 19. Jahrhunderts (Die Grablegung des alten Deutschland, 1967) und zur
Faust-Problematik (Faust und Faustus, 1967) in erschwinglichen Auswahlausgaben
(rowohlts deutsche enzyklopädie) erschienen waren und binnen kurzem Auflagen
von mehreren zehntausend Exemplaren erzielten; einer Zeit, in der ein ›Arbeitskol-
lektiv‹ unter Beteiligung von Germanistikstudenten der FU Berlin im Berliner
Oberbaumverlag die ersten Bände einer Reihe mit dem Titel Materialistische Wis-
senschaft herausgab, um unter Federführung eines ›Autoren-Kollektivs sozialistische
Literaturwissenschaft Westberlin‹ ›Grundlagen einer historisch-materialistischen
Literaturwissenschaft‹ erarbeiten zu lassen. Es war eine Zeit voller gesellschafts- und
wissenschaftspolitischer Tendenzen, die sich mit Szondis Postulat, »die Geschichte
im Kunstwerk« zu sehen, durchweg nicht vereinbaren wollten, sondern allenthal-
ben die marxistisch geprägte Wahrnehmung des »Kunstwerks in der Geschichte«
durchzusetzen versuchten.
Die zweite unterstrichene Textstelle in Szondis Traktat erscheint im Rückblick
nicht weniger aufschlussreich. Sie lautet:
Sowenig sich aber die Interpretation über die vom Text und von der Textgeschich-
te bereitgestellten Tatsachen hinwegsetzen darf, sowenig darf die Berufung auf
Fakten die Bedingungen übersehen, unter denen die Fakten erkannt werden. […]
darüber hinaus wäre zu fragen, ob das objektive Material von der subjektiven
Interpretation überhaupt streng kann getrennt werden, ist doch die Verwendung
des Materials selbst schon Interpretation.5
Dies war eine Einsicht, soviel ließ sich auch zu Beginn der 1970er Jahre auf Anhieb
erkennen, die sich auf einen mehr als eineinhalb Jahrhunderte währenden, von
Schleiermacher über Dilthey bis zu Gadamer sich erstreckenden hermeneutischen
Diskurs berufen konnte – und ausdrücklich, einschließlich eines Rückgriffs auf
Emil Ermatingers Philosophie der Literaturwissenschaft (1930), auch berief. Auf ei-
nen Diskurs mithin, der sich mit Nachdruck vom Positivismus der Naturwissen-
schaften absetzte; der akribisch betriebene Philologie und ästhetische Wahrheit
nicht in einem Gegensatz-, sondern in einem Bedingungsverhältnis sah; der die
Geschichtlichkeit und den Perspektivismus jeder Art Interpretation einräumte, oh-
ne deshalb den Anspruch auf ›Interpretation‹ preiszugeben. Irritierend wirkte die-
ses literaturwissenschaftliche Selbstbewusstsein, weil es zwischen der Scylla werk-
immanenter Textexegese und der Charybdis eines ›historisch‹ sich verstehenden
Materialismus souverän einen Kurs der Deutungsverpflichtung zu halten wusste,
der sich durch nichts als die Dignität – und das hieß hier: den Kunstcharakter – ei-
5 Ebd., S. 25.
F4717-Antonsen.indd 176 03.12.2008 11:05:02 Uhr
ÜBER PHILOLOGISCHE ERKENNTNIS 177
nes Werks leiten ließ. Nicht zuletzt die Tatsache aber, dass der Autor des Traktats
sich in seinem Argumentationsgang exemplarisch auf die erste Strophe von Höl-
derlins Hymne Friedenfeier einließ, mithin keinerlei außerliterarische Parameter in
Anspruch nahm, dürfte den Grad der Irritation deutlich erhöht haben.
Dies lässt sich ohne Übertreibung auch im Hinblick auf die dritte unterstriche-
ne Textstelle sagen:
Evidenz aber ist das adäquate Kriterium, dem sich die philologische Erkenntnis
zu unterwerfen hat. In der Evidenz wird die Sprache der Tatsachen weder über-
hört, noch in ihrer Verdinglichung missverstanden, sondern als subjektiv beding-
te und in der Erkenntnis subjektiv vermittelte vernommen, also allererst in ihrer
wahren Objektivität.6
Die Behauptung, dass ein kaum verifizierbares Kriterium wie ›Evidenz‹ das den
philologischen Anteilen am Prozess der Interpretation angemessene sei, konnte sei-
nerzeit ebenso wenig auf Einverständnis rechnen wie der dialektische Bezug von
Subjektivität und Objektivität, der auf der ›wahren Objektivität‹ einer ›subjektiv
vermittelten‹ Erkenntnis bestand. Der Anspruch auf den wissenschaftlichen Cha-
rakter eines Studiums der Literatur im Sinne Szondis sah sich zu Beginn der 1970er
Jahre erheblichen, widerspruchsvollen Legitimationszwängen ausgesetzt: gegen-
über einer sozialhistorisch orientierten Literaturgeschichtsschreibung marxistischer
Provenienz einerseits, die Literatur zum ›Überbau‹-Phänomen reduzierte und ihren
Wert politisch, nach ihrem Anteil an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen be-
stimmte; gegenüber der Rede von der gesellschaftlichen Dysfunktionalität aller
künstlerischen Produktion andererseits, die der Krise der Geisteswissenschaften,
insbesondere der Germanistik, in jenen Jahren den Boden bereitete. Zwischen die-
sen beiden Polen sich zu bewegen, ohne erschüttert zu werden, inmitten zahlrei-
cher weiterer Facetten, Skalierungen und Abschattungen von Angriffen, mit denen
die Literatur wie die Wissenschaft von ihr sich während der folgenden Jahre in
Frage gestellt sahen, von den Studienplänen für eine ›reformierte‹ Germanistik bis
hin zu den Hessischen Rahmenrichtlinien im Fach Deutsch – das verlangte gewiss
mehr als ein Beharrungsvermögen, dem man damals vermutlich ein gewisses Maß
an Ignoranz bescheinigt hätte.
Die Essenz seiner Überlegungen fasste Szondi in einer Conclusio zusammen,
die, was für den Autor zu Beginn der 1960er Jahre wie auch ein Jahrzehnt später
noch als Credo seines Verständnisses von Literaturwissenschaft gelten sollte, ein-
drucksvoll pointierte:
Die Literaturwissenschaft darf nicht vergessen, daß sie eine Kunstwissenschaft ist;
sie sollte ihre Methodik aus einer Analyse des dichterischen Vorgangs gewinnen;
sie kann wirkliche Erkenntnis nur von der Versenkung in die Werke, in ›die Logik
ihres Produziertseins‹ (Th. W. Adorno) erhoffen. Daß sie dabei nicht der Willkür
und dem Unkontrollierbaren anheimzufallen braucht, jener Sphäre, die sie
6 Ebd., S. 27.
F4717-Antonsen.indd 177 03.12.2008 11:05:02 Uhr
178 RALF SCHNELL
manchmal mit einer merkwürdigen Geringschätzung die dichterische nennt,
muß sie freilich mit jeder Arbeit von neuem beweisen. Dieser Gefahr aber ins
Auge zu sehen, statt bei anderen Disziplinen Schutz zu suchen, schuldet sie ihrem
Anspruch, Wissenschaft zu sein.7
Nimmt man die vier angeführten, unterstrichenen Textstellen als Indizien für be-
stimmte Aufmerksamkeitspotentiale, die seinerzeit durch die Lektüre erregt wor-
den sind, so darf man davon ausgehen, dass Szondis Essay sein Ziel gleich mehrfach
erreicht hat: Irritationen zu erzeugen, gängige Verstehensmuster in Frage zu stellen,
zum Nachdenken anzuregen und eine fachwissenschaftliche Perspektive zu weisen.
Mehr ist von einem Traktat über philologische Erkenntnis kaum zu erwarten. Über
die Konsequenzen einer solchen Lektüre hat ein Autor bekanntlich keine Macht,
noch ist er für diese verantwortlich zu machen. Ob der Leser mit den Argumenten,
Überlegungen und Vorschlägen sachgerecht oder nach Belieben verfährt, ob er sich
an die Belehrungen hält oder diese unbeachtet, gar dem Vergessen anheim fallen
lässt – wer will das wissen? Zum Zeitpunkt der Lektüre vermutlich nicht einmal
der gerade belehrte Leser selbst. Eines aber durfte man Szondis Traktat über philolo-
gische Erkenntnis bereits zu Beginn der 1970er Jahre attestieren: Dass sein Autor ei-
ner Literaturwissenschaft einen Boden bereitet hatte, auf den sie sich gelegentlich
nur hätte besinnen müssen, um die kritischen und selbstkritischen Fragen und Be-
fragungen der folgenden Jahre und Jahrzehnte selbstbewusst und dauerhaft beste-
hen zu können.
Peter Szondis Freitod am 18. Oktober 1971, im Alter von 42 Jahren, war ein
Schock, nicht allein für seine Schüler und Studenten, sondern für die Gelehrten-
welt insgesamt, soweit sie sich den Geisteswissenschaften verbunden wusste. Die
Ratlosigkeit, die dieser Tod hinterließ, entsprach der Größe des Verlustes, dessen
manche erst gewahr wurden, als die Unumkehrbarkeit dieses Schrittes ins öffentli-
che Bewusstsein trat. Die verdienstvolle Edition der nachgelassenen Schriften
Szondis durch Jean Bollack, Henriette Beese, Wolfgang Fietkau, Hans-Hagen
Hildebrandt, Gert Mattenklott, Senta Metz und Helm Stierlin haben diesen Ver-
lust deutlicher noch hervortreten lassen. Denn was mit der dreibändigen Studien-
ausgabe der Vorlesungen Szondis, die 1973/74 unter dem Titel Die Theorie des bür-
gerlichen Trauerspiels und Poetik und Geschichtsphilosophie erschien, was wenige Jah-
re später ergänzend mit der zweibändigen Ausgabe seiner Schriften (1978) an
Wahrnehmungsmöglichkeiten von Szondis Lebenswerk erschlossen wurde, das be-
wies in thematischer Breite, analytischer Schärfe und prägnanter Formulierung,
was eine ›Versenkung in die Werke‹ zu leisten vermochte. Die von Szondi argu-
mentativ begründete und in seiner philologischen Praxis beispielhaft vertretene Li-
teraturwissenschaft als »Kunstwissenschaft« bot ein reiches Anschauungsmaterial
für das Leistungsvermögen einer Disziplin, die mutig genug war, nicht »bei ande-
ren Disziplinen Schutz zu suchen«. Wie seine frühen monografischen Veröffentli-
chungen, die 1956 zuerst erschienene Theorie des modernen Dramas und der 1961
7 Ebd., S. 35. – Das Binnenzitat entstammt Adorno: Valérys Abweichungen, S. 43.
F4717-Antonsen.indd 178 03.12.2008 11:05:02 Uhr
ÜBER PHILOLOGISCHE ERKENNTNIS 179
veröffentlichte Versuch über das Tragische (1961), belegten auch die letzten Aufsätze
und Entwürfe noch – darunter die von Szondi hinterlassenen, Fragment gebliebe-
nen, posthum (1972) erschienenen Celan-Studien –, was Jean Bollack einmal tref-
fend umschrieben hat als »Selbstreflexion, die fortschreitend eine Korrektur der
Perspektiven bedingt, und die sich selbst als eine Konsequenz der epistemologi-
schen Voraussetzungen erweist«8.
Schon Szondis Theorie des modernen Dramas hatte freilich erkennen lassen, dass
die postulierten Tugenden philologischer Erkenntnis keineswegs als selbstgenügsa-
me Paraphrasierung oder Explikation eines beliebigen Textfundus zu verstehen sei-
en. Werkimmanenz war Szondis Sache nicht. »Entscheidende Einsichten«, so hieß
es bereits im Nachwort aus dem September 1956, »verdankt die Untersuchung der
Hegelschen Ästhetik, E. Staigers ›Grundbegriffen der Poetik‹, dem Aufsatz von
G. Lukács ›Zur Soziologie des modernen Dramas‹ und Th. W. Adornos ›Philoso-
phie der neuen Musik‹.«9 Ausdrücklich werden hier Begrifflichkeiten und Termi-
nologien benachbarter Disziplinen (Soziologie, Philosophie) genannt, bei denen
die Literaturwissenschaft der 1960er und 1970er Jahre immer wieder ›Schutz su-
chen‹ sollte. Doch hat Szondi seine literarischen und poetologischen Gegenstände
zu keinem Zeitpunkt den epistemologischen Perspektiven und Prämissen der
Nachbardisziplinen überantwortet. Vielmehr hat er seine Wissenschaft als Kunst-
wissenschaft auf ihre Möglichkeiten befragt, der Erschließung ihres Gegenstands-
bereichs durch das ihr eigene Verfahren, eben durch philologische Erkenntnis, Ein-
sichten auch in die historischen, gesellschaftlichen und philosophischen Dimensio-
nen der Poesie abzugewinnen.
Mit diesem Anspruch stand und steht Szondis Werk in einer Tradition literatur-
wissenschaftlicher und ästhetiktheoretischer Arbeiten, die bis in unsere Gegenwart
eine einzigartige, unverlierbare Faszinationskraft ausstrahlen: Nietzsches Geburt der
Tragödie aus dem Geiste der Musik etwa oder Lukács’ Theorie des Romans, Benjamins
Ursprung des deutschen Trauerspiels und Adornos Ästhetische Theorie, ebenso Ador-
nos Noten zur Literatur, unter ihnen vor allem die Rede über Lyrik und Gesellschaft
und der Essay über den Standort des Erzählers im modernen Roman, sind hier bei-
spielhaft zu nennen. Werke also, deren antisystematische Konzeption durch den
Impuls zu großen Synthesen konterkariert wird, deren sprachlicher Duktus Bild
und Begriff so miteinander verschmilzt, dass die Grenzen zwischen Wissenschaft
und Kunst aufgehoben scheinen.
Werke aber auch, die vor allem eine weitere Gemeinsamkeit miteinander verbin-
det: ihre Herkunft aus dem Geist der Geschichtsphilosophie. Unter diesem An-
spruch Kunstphilosophie und ästhetische Theoriebildung zu betreiben, setzte die
Gebilde der Kunst stets einem eminent teleologischen Anspruch aus. Philosophi-
sche Ästhetik mutet zumal der Literatur zu und erwartet von ihr, den Geist einer
Epoche so in sich aufzunehmen und zu transformieren, dass sie deren Struktur und
historischen Wahrheitsgehalt in ihrer Formensprache mitzuteilen vermag. Die phi-
8 Bollack: Vorwort zu den Vorlesungsbänden, S. 9.
9 Szondi: Theorie des modernen Dramas, S. 162.
F4717-Antonsen.indd 179 03.12.2008 11:05:02 Uhr
180 RALF SCHNELL
losophische Erschließung der Gattungen lädt auf diese Weise deren Traditions- und
Konventionsbildungen nicht allein mit Geschichte auf, sondern verpflichtet sie zu-
gleich einem Problemlösungshorizont, dem sie – überprüft man die ästhetische
Theorie an der poetischen Praxis in historischer Perspektive – kaum haben stand-
halten können.
Szondi hat diesen Weg klar gesehen, aber er hat ihn nicht beschritten. Er hat ihn
präzise benannt in Form einer epistemologischen Selbstreflexion, die der Theorie
des modernen Dramas ihre Grenzen zeigt, indem sie ihr die trügerische Sicherheit
eines Fazits verweigert:
Die Geschichte der modernen Dramatik hat keinen letzten Akt, noch ist kein
Vorhang über sie gefallen. So ist, womit hier vorläufig geschlossen wird, in keiner
Weise als Abschluß zu nehmen. Für ein Fazit ist die Zeit so wenig gekommen wie
für das Aufstellen von neuen Normen. Vorzuschreiben, was modernes Drama zu
sein hat, steht seiner Theorie ohnehin nicht zu. Fällig ist bloß die Einsicht in das
Geschaffene, der Versuch seiner theoretischen Formulierung.10
Um Missverständnisse auszuschließen, hat Szondi von der 7. Auflage an dem Titel
des Werks die Zeitmarken 1880–1950 hinzugefügt, den Anspruch auf die Mög-
lichkeit einer ›theoretischen Formulierung‹ für die Entwicklung des modernen
Dramas aber unverändert beibehalten. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht um-
schrieb Szondi die spezifischen Aufgaben, die sich der Literaturwissenschaft für die
Zukunft stellten, mit der Formulierung: »Ihr Ziel ist der Aufweis neuer Formen,
denn die Geschichte der Kunst wird nicht von Ideen, sondern von deren Formwer-
dung bestimmt.«11
Dass der hier auf ›Form‹ und ›Formwerdung‹ sich berufende Anspruch auf The-
oriehaltigkeit philologischer Erkenntnis mit Formalismus nichts, viel aber mit Er-
kenntnis zu tun hat, wurde vollends durch die Publikation eines weiteren Bandes
mit Schriften aus dem Nachlass deutlich. Er erschien 1973 und trug den merkwür-
digen Titel Über eine »Freie (d. h. freie) Universität«. Stellungnahmen eines Philolo-
gen12. Der Titel entstammte einem Kommentar, den Szondi anlässlich der drohen-
den Einführung von Zwangsexmatrikulationen im Juli 1966 im FU-Spiegel, der
offiziellen Zeitschrift der Studentenschaft der Freien Universität Berlin, publiziert
hatte.13 In seinem Beitrag nahm Szondi seinerzeit Stellung gegen die »Härte-
postulate«14 konservativer Kollegen aus der Juristischen Fakultät der FU Berlin, die
das Überziehen von Regelstudienzeiten mit dem Hinweis angeprangert hatten:
Wer nach neun Semestern [seinerzeit die Regelstudienzeit an der Juristischen
Fakultät der FU Berlin, R. Sch.] nicht fertig ist, der legt den Verdacht nahe, daß
10 Ebd.
11 Ebd.
12 Vgl. Szondi: Über eine »Freie (d. h. freie) Universität«. Stellungnahmen eines Philologen.
13 Ebd., S. 21.
14 Ebd., S. 20.
F4717-Antonsen.indd 180 03.12.2008 11:05:03 Uhr
ÜBER PHILOLOGISCHE ERKENNTNIS 181
mit seinem Studium etwas nicht stimmt, und zwar in seinem individuellen
Bereich, nicht etwa im institutionellen der Universität.15
Szondis Auseinandersetzung mit diesem Verdikt bewegt sich im argumentativen
Bereich einer kritischen Textanalyse. Er legt die inhaltlichen Schwachstellen des
Satzes offen, indem er seine immanenten Widersprüche herausarbeitet. Er weist
seine reaktionären Dimensionen anhand sprachlicher und gedanklicher Unge-
reimtheiten nach. Das Politische, so macht Szondi deutlich, zeigt sich in den For-
mulierungen, in sprachlichen Prägungen und im Satzbau. Mit einem Wort: Szondi
zerpflückt den Satz seines Kollegen nach allen Regeln sprachanalytischer Kunst.
Wie in diesem Beitrag, so bezog Szondi auch in seinen übrigen Einlassungen –
darunter das umstrittene Gutachten zum Prozess um die Flugblätter der Kommune
I (Aufforderung zur Brandstiftung)16 – höchst engagiert Position zu aktuellen hoch-
schulpolitischen Fragen. Er tat dies auf eine Weise, die sich deutlich unterschied
von den universalistischen Themen und generalistischen Geltungsansprüchen
›klassischer‹ Intellektueller. Zwar wies, was Szondi zu sagen hatte, deutlich über die
Grenzen der Philologie hinauswies. Seine prägnanten Texte führten fast immer in
allgemeine gesellschaftliche und historische Problemzonen. Mit seinen Argumen-
ten wurden stets aufs Neue eminent politische Konturen auch begrenzter akademi-
scher Diskussionsfelder erkennbar. Doch hatte diese Qualität mit Szondis Methode
einer kritischen Analyse sprachlicher Vorgänge zu tun. Szondi löste in und mit sei-
nen Stellungnahmen zu hochschulpolitischen, gesellschaftlichen und akademi-
schen Vorgängen ein, was er von der Literaturwissenschaft verlangte: Er ›versenkte‹
sich in die zur Diskussion stehenden Texte. Er nahm seine Kontrahenten beim
Wort. Er arbeitete, auch wenn es sich nicht um dichterische Werke handelte, die
›Logik ihres Produziertseins‹ heraus. Auf diese Weise kam er ihnen auf die Spur.
Peter Szondi sprach und schrieb, wie es der Untertitel des 1973 erschienenen
Bändchens annoncierte, stets als Philologe. Sein Traktat über philologische Erkennt-
nis ist auch vier Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung von faszinierender Ak-
tualität.
15 Ebd., S. 18.
16 Vgl. ebd., S. 34–54.
F4717-Antonsen.indd 181 03.12.2008 11:05:03 Uhr
F4717-Antonsen.indd 182 03.12.2008 11:05:03 Uhr
Reto Sorg (Lausanne)
›BESCHREIBUNG EINES KAMPFES‹ ODER WAS HEISST UND ZU
WELCHEM ENDE STUDIERT MAN LITERATURWISSENSCHAFT?
Ob der Existenz der Insel
Hegt’ er niemals einen Zweifel –
Seiner alten Kaka Singsang
War ihm Bürgschaft und Gewähr.
Heinrich Heine
1. Flucht auf der Stelle
Das früheste Werk, das sich von Franz Kafka erhalten hat, ist die Erzählung Be-
schreibung eines Kampfes. Als Max Brod sie 1936 im Nachlassband der Gesammelten
Werke herausgibt, merkt er an, sie sei das Erste überhaupt gewesen, was Kafka ihm
seinerzeit vorgelesen habe.1 Für Kafkas Freund markiert der Text eine symbolische
Klammer, denn er ist auch etwas vom Letzten, womit er sich beschäftigen wird.
1969, kurz nach seinem Tod, erscheint sein kommentierter Paralleldruck der bei-
den überlieferten Fassungen2, die er 1936 noch zu einer Mischfassung kompiliert
hatte.3 Für die Kafka-Forschung ist Beschreibung eines Kampfes also in jeder Hin-
sicht ein Meilenstein.
Kafkas Erstling, von dem hier die erste, ursprünglichere Fassung berücksichtigt
wird, weist bereits alle einschlägigen Merkmale auf, die man mit dem Autor verbin-
det: distanzloses Erzählen, groteske Körperscham, parabolische Struktur, beiläufige
Reflexionen, gestische Komik, verlorene Figuren, namenloses Unglück und schwe-
1 Vgl. Brod: Nachwort, S. 310; die Entstehungszeit datiert er auf 1902 oder 1903 (vgl. ebd.).
Dass Kafka das Manuskript nicht vernichtet habe, wie fast alle anderen frühen Sachen, ver-
danke sich einem Zufall; vgl. ebd., S. 306. – Brod hat die Entstehungszeit später geringfügig
korrigiert; zur Editionssituation vgl. Binder: Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen,
S. 44ff., u. Schillemeit: Kafkas Beschreibung eines Kampfes. Ein Beitrag zum Textverständnis
und zur Geschichte von Kafkas Schreiben; nichts Neues hingegen bei Neymeyr: Konstruktion
des Phantastischen. Die Krise der Identität in Kafkas Beschreibung eines Kampfes.
2 Vgl. Kafka: Beschreibung eines Kampfes. Die zwei Fassungen. Parallelausgabe nach den Hand-
schriften. Der mit dem Ruf eines zweifelhaften Editors behaftete Brod kann mit Fug und
Recht auch als Begründer der kritischen Kafka-Editionspraxis gelten, zumal seine zusammen
mit Ludwig Dietz realisierte Ausgabe erstmals auch ausgewählte Manuskriptseiten faksimi-
liert.
3 Vgl. Kafka: Beschreibung eines Kampfes [1936].
F4717-Antonsen.indd 183 03.12.2008 11:05:03 Uhr
184 RETO SORG
bende Ironie. Rätselhaft ist der dramatisch klingende Titel, denn von einem buch-
stäblichen Kampf ist auf den rund fünfzig Druckseiten an keiner Stelle die Rede.4
Das Textgeschehen ließe sich mit Deleuze/Guattari als »Flucht auf der Stelle«5
umschreiben. In der Rahmenerzählung gehen zwei junge Männer zusammen auf
einen Berg. In den fantastisch und grotesk angelegten Binnengeschichten löst sich
die Grenze zwischen Außen- und Innenwelt auf, und die Figuren verschwimmen.6
Am Schluss, als die beiden Jünglinge den ersehnten Aussichtspunkt erreichen, er-
öffnet sich ihnen die Aussichtslosigkeit:
»Ach Gott«, sagte er, stand auf, lehnte sich an mich und wir giengen, »da ist ja
keine Hilfe. Das könnte mich nicht freuen. Verzeihen sie. Ist es schon spät? Viel-
leicht sollte ich morgen früh etwas thun. Ach Gott.«
Eine Laterne nahe an der Mauer oben brannte und legte den Schatten der
Stämme über Weg und weißen Schnee, während der Schatten des vielfältigen
Astwerkes umgebogen wie zerbrochen auf dem Abhang lag. (BK, 220)7
Wie zu Beginn regiert am Ende tiefe Nacht, und die Dinge werfen ihre Schatten
auf abschüssigen Grund.
Die kryptische Komposition, die ihr den Ruf einbrachte, eine »Crux der Kafka-
Forschung«8 zu sein, macht die Erzählung für die Philologie zu einer besonderen
Herausforderung. Die eigentliche Provokation besteht jedoch darin, dass Kafka die
Ursache für das »›schwankende[ ] Unglück‹« (BK, 124) seiner Figuren mit dem
›metaphorischen‹ Wesen der Literatur gleichsetzt. In dem Abschnitt, den er aus
dem Textganzen herauslöst und 1909 als Gespräch mit dem Beter separat publiziert,
gründet dessen wahnhafter »›Zustand‹« (BK, 128) im Unvermögen, die Welt mit
Begriffen zu erfassen. Da dem Beter die »Namen der Dinge« entfallen, braucht er
stattdessen diejenigen Umschreibungen, welche ihm eben einfallen:
4 Im Unterschied zum Titel anderer Erzählungen stammt Beschreibung eines Kampfes wirklich
»von Kafkas eigener Hand« (ebd., S. 151 [Nachwort von Brod]; vgl. ebd. S. 9 [Faksimile der
ersten Textseite]); allerdings trägt diesen Titel nur die erste der beiden Fassungen. Vgl. auch
Kafka: Beschreibung eines Kampfes, Gegen zwölf Uhr […], S. 5 [Historisch-kritische Ausgabe];
sowie Reuß: Zur kritischen Edition von »Beschreibung eines Kampfes« und »Gegen zwölf Uhr
[…]«.
5 Deleuze u. Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur, S. 98.
6 Angesichts der disparaten Erzählsituation meinte der junge Martin Walser 1961 in seiner
Doktorarbeit, hier sei der Versuch, das Darstellungsproblem zu lösen, »[völlig] mißglückt«
(Walser: Beschreibung einer Form. Versuch über Kafka, S. 28).
7 Im Folgenden wird nach der Kritischen Ausgabe von Roland Reuß im Verlag Stroemfeld
(Roter Stern) zitiert, und zwar in Klammern im laufenden Text, unter Verwendung der Sigle
BK und Angabe der jeweiligen Seitenzahl.
8 Schillemeit: Kafkas Beschreibung eines Kampfes. Ein Beitrag zum Textverständnis und zur Ge-
schichte von Kafkas Schreiben, S. 102.
F4717-Antonsen.indd 184 03.12.2008 11:05:03 Uhr
›BESCHREIBUNG EINES KAMPFES‹ 185
»Ich habe Erfahrung und es ist nicht scherzend gemeint, wenn ich sage, daß es
eine Seekrankheit auf festem Lande ist. Deren Wesen ist so, daß ihr den wahrhaf-
tigen Namen der Dinge vergessen habt und über sie jetzt in einer Eile zufällige
Namen schüttet. Nur schnell, nur schnell! Aber kaum seid ihr von ihnen wegge-
laufen, habt Ihr wieder ihre Namen vergessen. Die Pappel in den Feldern, die Ihr
den ›Thurm von Babel‹ genannt habt, denn Ihr wußtet nicht oder wolltet nicht
wissen, daß es eine Pappel war, schaukelt wieder namenlos und Ihr müßt sie nen-
nen ›Noah, wie er betrunken war‹« (BK, 128, 131).
Was seit der aristotelischen Poetik als Bedingung der Möglichkeit von Literatur gilt,
also die Gabe, in Worte zu fassen, was denkbar und möglich wäre9, wandelt sich
hier zum Anzeichen einer Krise. Die Anspielungen auf die babylonische Sprachver-
wirrung und die Sintflut suggerieren ein biblisches Ausmaß. Zudem isoliert Kafka
die sprachlich induzierte Dissoziation nicht als Merkmal einer erkennbar verblen-
deten Figur, wie es die Narrenliteratur oder die Schauer-Romantik tut, sondern er
gestaltet sie als Figurenperspektive, die der Leser zwangsläufig teilt. Ein allwissen-
der Erzähler, der die beklemmend faszinierende Sicht relativieren könnte, fehlt.
Generell fällt den beschriebenen Figuren das Sprechen schwer. Lieber »summen«
(BK, 20) sie oder versuchen, »wie ein Posthorn zu blasen«, da der Hals »voll Thrä-
nen« (BK, 27) ist. Nicht nur der verbale Ausdruck, auch der Körper selber ist der
Deformation ausgesetzt. Die Figuren gehen »›gebückt‹« (BK, 44), wachsen ins Un-
ermessliche (vgl. BK, 196) und drohen, auseinander zu fallen (vgl. BK, 148). Sie
bestehen aus monströsen »Fettmassen« (BK, 99) oder wirken »›silhuettenartig‹«,
wie »›aus Seidenpapier herausgeschnitten‹« (BK, 151). Des Öfteren verlieren sie das
Gleichgewicht und fallen hin (vgl. BK, 48). Am Ende fügt sich der eine mit einem
Messer eine »tiefe[ ] Wunde« zu, damit der andere an ihr »saug[en]« (BK, 219)
kann.
Wenn man die Motive von Kafkas ›Beschreibung‹ überblickt, wird auch der Ti-
tel sprechender. Der ›Kampf‹ wird als Zwist der Figuren lesbar, die sich wie Ge-
heimpolizisten (vgl. BK, 140) belauern. Obwohl sie »nahe beisammen« sind, haben
sie »einander gar nicht gerne« (BK, 216). Jenseits des Sinnlichen erscheint der
Kampf als ein Ringen um intellektuelle und geistige Verortung. Dass diese Sehn-
sucht unerfüllt bleiben muss, liegt in der Logik des Textes, der den Gesetzen einer
Ästhetik der falschen Form unterliegt. Weder schaffen es die Figuren, sich einen
»›Namen‹« (BK, 171) zu machen, noch gelingt es ihnen, sich »›mit der Wahrheit
ab[zugeben]‹« (BK, 151). Formal schlägt sich der Konflikt als schwankende Erzähl-
situation nieder. Was umstritten ist, ist die Bedeutung.10
9 Vgl. Aristoteles: Die Poetik, S. 29.
10 In dem Fall besonders gründlich, da die Darstellung ans Inkonsistente grenzt und noch nicht
– wie in Kafkas späteren Texten – parabolisch gerundet auf ein rätselhaft Bestimmtes-Unbe-
stimmtes hin ausgerichtet ist.
F4717-Antonsen.indd 185 03.12.2008 11:05:03 Uhr
186 RETO SORG
2. Wissenschaft als Beruf
Die Gewissheit, die »Wahrheit zu enträthseln«11 und das Gewonnene »zu einem
vernunftmäßig zusammenhängenden Ganzen«12 zu erheben, steht in Friedrich
Schillers berühmter akademischer Antrittsrede Was heißt und zu welchem Ende stu-
diert man Universalgeschichte? außer Frage. Es ist im historischen Jahr 1789, zwei
Monate vor dem Beginn der Französischen Revolution, als er den begeisterten Stu-
denten in Jena beibringt, welch noble und nützliche Aufgabe die Universalge-
schichte wahrnehme. Sie sei dazu da, »unser fliehendes Daseyn zu befestigen«13
und die scheinbar wirren Ereignisse des Weltenlaufs mit »weitreichende[m] Blick«14
im »großen Naturplan«15 zu verorten.
Für Kafka und seine Zeitgenossen gehört ein solch idealistischer Glaube an die
heilsame Funktion der Humanwissenschaften längst selbst der Geschichte an. So-
gar Max Weber, der allen Bedenken zum Trotz an der »Rationalisierung und Intel-
lektualisierung« und damit an der »Entzauberung der Welt«16 festhält, verspottet
diejenigen, welche noch mit allgemeingültigen teleologischen Systemen hausieren,
als »neue Propheten und Heilande«17. Wenn sich für Weber überhaupt noch ein
umfassendes System abzeichnet, dann das »bürokratische«18. Die Konsequenzen,
die er aus seiner Standortbestimmung zieht, führen zu einer unerhört pragmati-
schen, auf die kontrollierte Bewältigung des Hier und Jetzt gemünzten Maxime:
Der Wissenschaftler solle schlicht und einfach »der ›Forderung des Tages‹ gerecht
werden – menschlich sowohl wie beruflich«19.
Keineswegs passé ist für Weber indes Schillers Leitfrage nach dem »eigentlichen
Zweck« der propagierten »Studien«20. Ganz im Gegenteil, ohne sakrosanktes Leit-
system ist das Rechtfertigungsbedürfnis größer denn je. Auch Weber entwickelt
seine grundsätzlichen Überlegungen ausdrücklich im Hinblick auf Studierende,
und zwar 1917 in München. Wie Schillers Rede ist Webers Vortrag Wissenschaft als
Beruf im Grunde der Versuch einer Legitimation seines Fachbereichs. Im Unter-
schied zu Schiller, der aus dem Hochgefühl heraus spricht, »alles um sich herum
seiner eigenen vernünftigen Natur […] assimiliren«21 zu können, um umgekehrt
»aus sich selbst heraus […] ein teleologisches Prinzip in die Weltgeschichte«22 zu
tragen, argumentiert Weber positivistisch. Da die Wissenschaft nicht (mehr) im
11 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, S. 22.
12 Ebd., S. 24.
13 Ebd., S. 30.
14 Ebd., S. 28.
15 Ebd., S. 29.
16 Weber: Wissenschaft als Beruf, S. 44; vgl. auch 19.
17 Ebd., S. 45.
18 Ebd., S. 4.
19 Ebd.
20 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, S. 2.
21 Ebd., S. 25.
22 Ebd., S. 26.
F4717-Antonsen.indd 186 03.12.2008 11:05:03 Uhr
›BESCHREIBUNG EINES KAMPFES‹ 187
Stande sei, die klassischen Orientierungsfragen, was man tun und wie man leben
soll, zu beantworten, werde das Heil in einer »Befreiung vom Intellektualismus«23
gesucht. Bei allem Verständnis für den Wunsch, die Rationalität zu verabschieden,
der insbesondere die Jugend bewege, plädiert Weber für Sachlichkeit und lehnt die
lebensphilosophische Vergötzung des »Erleben[s]« und den damit einhergehenden
Kult der »Persönlichkeit«24 ab. Was er spöttisch beklagt, ist eine eigentliche Verkeh-
rung des platonischen Modells der Erkenntnis:
Die Gedankengebilde der Wissenschaft sind ein hinterweltliches Reich von
künstlichen Abstraktionen, die mit ihren dürren Händen Blut und Saft des wirk-
lichen Lebens einzufangen trachten, ohne es jedoch je zu erhaschen. Hier im
Leben aber, in dem, was für Platon das Schattenspiel an den Wänden der Höhle
war, pulsiert die wirkliche Realität: das andere sind von ihr abgeleitete und leblo-
se Gespenster und sonst nichts.25
Es ist unschwer zu erkennen, dass auch in Kafkas Erzählung Beschreibung eines
Kampfes die Erkennbarkeit der Welt problematisiert wird. Im Schattenspiel der Er-
zählung liegen die Dinge und ihre Hintergründe im Dunkeln, die Identitäten sind
nicht festgeschrieben und die Landschaften, die das erzählende Ich durchmisst,
verwandeln sich laufend, bis ihm »der Weg […] unter den Füßen zu entgleiten
droht« (BK, 79). Da »alle Dinge ihre schöne Begrenzung« (BK, 104) verlieren, wird
auch ihr »›Zusammenhang‹« (BK, 152) immer unwahrscheinlicher. Der Versuch
ihrer Benennung scheitert, am Ende bleiben sie »›namenlos‹« (BK, 131). Wenn
Schiller alles daran setzt, das »fliehende[ ] Daseyn zu befestigen«26, so erscheint das
Transitorische bei Kafka als courant normal.
Die Figuren erregt nichts, »›außer Angst‹« (BK, 212), wie in der Episode, in wel-
cher der Erzähler eine Gesellschaft verlässt, um »mit kleinem Schritt« vor die Tür
zu treten. Wie er auf der Straße dann »aus dem Schatten ins Mondlicht« wechselt,
kommt ihm alles »›unwirklich‹« und »›komisch‹« (BK, 167) vor. Mit erhobenen
Händen gebietet er dem »Sausen der Nacht« (BK, 167) Schweigen und setzt – auf
seine Art – zu einem Vortrag an:
»Gott sei Dank, Mond, du bist nicht mehr Mond, aber vielleicht ist es nachlässig
von mir daß ich dich Mondbenannter noch immer Mond nenne. Warum bist du
nicht mehr so übermüthig, wenn ich dich nenne ›vergessene Papierlaterne in
merkwürdiger Farbe‹. Und warum ziehst du dich fast zurück, wenn ich dich
›Mariensäule‹ nenne und ich erkenne deine drohende Haltung nicht mehr Mari-
ensäule, wenn ich Dich nenne ›Mond, der gelbes Licht wirft‹« (BK, 167f.).
Das nächtliche Selbstgespräch – das sich inzwischen ebenso an Studierende richtet,
denn sie sind es, die Kafka begeistert lesen – exponiert erneut die Frage nach dem
23 Weber: Wissenschaft als Beruf, S. 25.
24 Ebd., S. 15.
25 Ebd., S. 21.
26 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, S. 30.
F4717-Antonsen.indd 187 03.12.2008 11:05:03 Uhr
188 RETO SORG
Verhältnis der Dinge und ihrer Namen. In der symbolträchtigen ›Dekonstruktion‹
des Monds lösen sich die alltäglichen wie die poetischen Vorstellungen und Be-
zeichnungen auf, mit dem Ergebnis, dass die Figur ihrerseits das Weite sucht. Der
Schatten, den sie auf ihrer Flucht wirft, fällt erschreckend »klein« (BK, 168) aus.
Nicht nur aufgrund ihrer kritischen Einstellung gegenüber essentialistischen
Weltdeutungsansprüchen, sondern auch hinsichtlich ihrer stoischen Grundhaltung
sind Webers Vortrag und Kafkas Erzählung vergleichbar. Trotz des Unglücks, das
sie gefangen hält, fehlt Kafkas Figuren zum tragischen Ende das heroische Format:
Sie »fallen nicht«, sie »flattern« – um sich »in Schwebe« (BK, 188) zu halten. Und
wird das »›eingezäunte[ ] Gespräch‹« einmal utopisch konterkariert, dann nur iro-
nisch halbherzig. »›Sollte man nicht anders leben können?‹« (BK, 184 u. 188),
rutscht dem Erzähler beiläufig über die trockenen Lippen. Die an und für sich re-
volutionäre Frage verkehrt sich unter diesen Umständen ins Gegenteil, und den
Figuren bleibt nichts übrig, als weiter so dahin zu leben.
Wie bei Kafka werden die großen Fragen auch bei Weber nicht abschließend be-
antwortet. Was sich bei ihm abzeichnet, ist ebenfalls ein unspektakulärer Prozess.
Wissenschaft sei »heute ein fachlich betriebener ›Beruf‹ […] im Dienst der Selbstbe-
sinnung und der Erkenntnis tatsächlicher Zusammenhänge, und nicht eine Heils-
güter und Offenbarungen spendende Gnadengabe«27. Das Schicksal, »in einer gott-
fremden, prophetenlosen Zeit zu leben«28, gelte es »männlich [zu] ertragen«29. Die
einzig denkbare (aber unvorstellbare) Alternative wäre, »in die weit und erbarmend
geöffneten Arme der alten Kirchen zurück[zukehren]«30.
Je auf ihre Art erweisen die frühe Erzählung Kafkas und die späte Selbstbestim-
mung Webers, dass die universalistischen Konzeptionen idealistischer Provenienz
– sie mögen noch so rational begründet oder vitalistisch entgrenzt sein – nicht
mehr haltbar sind. Die Herausforderung der Zeit – Weber hält seine Rede 1917,
auf dem Höhepunkt des Weltkriegs, und auf Einladung des Bundes der freien,
nicht korporierten Studenten31 – besteht darin, die Ruhe zu bewahren und sich in
Kontingenz zu üben.32 Im Wissen um die Bedeutung dieser Einübung sind der
Wissenschaftler und der Schriftsteller verbunden.
3. Kampf ums Proprium
Mit ihrem Sinn für die magische Macht des Bezeichnens markiert Kafkas Erzäh-
lung den springenden Punkt der Literatur, an dem auch ihre wissenschaftliche Be-
trachtung ansetzen muss. Obwohl es »sowohl nicht-literarische Fiktion als auch
27 Weber: Wissenschaft als Beruf, S. 40.
28 Ebd., S. 41.
29 Ebd., S. 44.
30 Ebd., S. 44f.
31 Vgl. Weber: Wissenschaft als Beruf, S. 48 (Nachwort).
32 Vgl. Makropoulos: Modernität und Kontingenz.
F4717-Antonsen.indd 188 03.12.2008 11:05:03 Uhr
›BESCHREIBUNG EINES KAMPFES‹ 189
nicht-fiktionale Literatur«33 gibt, besteht das Proprium der Literatur in ihrer Fähig-
keit zur Erfindung, also in dem, was man Fiktion nennt. Die Pointe von Kafkas
Beschreibung eines Kampfes liegt darin, dass der frühe Text antizipiert, was zu einem
Spezifikum (spät-)moderner Fiktion werden wird. Gemeint ist jene latent groteske
Synthese von Realismus und Fantastik, die nicht surrealistisch ist. Ins Unheimliche
spielend, erscheint das Unmögliche vermittels Innensicht der Figuren als wahr-
scheinliche Einbildung. Durch die fehlende Auktorialisierung wirkt die fiktionale
Welt – trotz der fantastischen Züge – tatsächlich wie die ›Beschreibung‹ der Wirk-
lichkeit.34
Wer über Sinn und Zweck philologischer Studien heute nachdenkt, sollte wis-
sen, dass der Selbstzweifel von Anfang an zum Selbstverständnis der Literaturwis-
senschaft – jedenfalls der neugermanistischen – gehört hat.35 In die Defensive führt
die kritische Selbstreflexion nur dann, wenn man sie preisgibt. Eine Philologie, die
sich botmäßig der Produktion von kommensurablem Faktenwissen verschreibt
und glaubt, daraus ihre Legitimation zu beziehen, wird sich im Verteilkampf um
die finanziellen Ressourcen mit Sicherheit als überflüssig erweisen. Daten und Be-
griffe, kanonisches Text- und Kontextwissen sind nicht per se nützlich, sondern die
unabdingbare Voraussetzung, um zu bestimmen, was man ›ästhetische Erfahrung‹36
nennt.
Der »Wettbewerbsvorteil eines Germanisten« besteht nicht in der »Fähigkeit zur
Transferleistung, zur Analyse und Produktion von Texten, zur schnellen, themen-
bezogenen Recherche und zur Teamarbeit«37, wie dies den Humanities wohlgesinn-
te Manager meinen. Was die Philologie ausmacht, ist, dass sie die Relevanz von
Mehrdeutigkeit erweist und die »Insularität des ästhetischen Erlebens«38 besprech-
und beschreibbar macht. Dass Literatur eine »Abstandnahme von der Alltagswelt«39
33 Gabriel: Fiktion, S. 595.
34 In Beschreibung eines Kampfes verwendet Kafka noch nicht die personale Erzählsituation der
späteren Erzählungen (etwa 1912 Die Verwandlung), sondern kombiniert die Perspektiven
mehrerer Ich-Figuren. Die damit bewirkte Unmittelbarkeit der Darstellung ist jener der per-
sonalen Erzählsituation vergleichbar.
35 Aus der Methodendiskussion von einst ist längst eine Legitimationsdebatte geworden; vgl.
Szondi: Über philologische Erkenntnis [1962], Unseld: Wie, warum und zu welchem Ende wur-
de ich Literaturhistoriker? [1972], Barthes: Leçon/Lektion [1978], Jauß: Ästhetische Erfahrung
und literarische Hermeneutik [1982], Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift [1991],
Derrida: Die unbedingte Universität [2001], Fricke: Literatur und Literaturwissenschaft. Bei-
träge zu Grundfragen einer verunsicherten Disziplin [2001], Bloom: Genius. Die hundert be-
deutendsten Autoren der Weltliteratur [2002], Gumbrecht: Die Macht der Philologie [2003],
Steinfeld: Der leidenschaftliche Buchhalter. Philologie als Lebensform [2004], Gumbrecht:
Diesseits der Hermeneutik [2004], Hörisch: Das Wissen der Literatur [2007] u. Alt: Die Verhei-
ßungen der Philologie [2007].
36 Vgl. Jauß: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, S. 31–44.
37 Ein Lufthansa-Manager, zit. nach Bogdal u. a.: BA-Studium Germanistik. Ein Lehrbuch,
S. 12.
38 Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik, S. 123.
39 Ebd., S. 125.
F4717-Antonsen.indd 189 03.12.2008 11:05:03 Uhr
190 RETO SORG
bedeutet (Hans Ulrich Gumbrecht) und einen »außerhalb der Macht«40 stehenden
Ort markiert (Roland Barthes), heißt keineswegs, dass sie heilig oder absolut wäre,
sondern bekräftigt im Gegenteil ihren Sinn für die Wirklichkeit.
Die Bedeutung der Philologie besteht darin, dem Wissen die ›Begriffslosigkeit‹,
wie sie die ästhetische Erfahrung vermittelt, zu erschließen. Texte und Kontexte
nach den Regeln der Zunft zu bestimmen, bildet dazu die Voraussetzung. Im Un-
terschied zu Kafkas Figuren, die in ihrer »›glücklichen Unruhe‹« (BK, 35) aufgehen
und es hinnehmen, dass sie »verwirrt« (BK, 36) sind und »›die Dinge […] nur in so
hinfälligen Vorstellungen‹« (BK, 135) erfassen, erweist die Philologie, dass Litera-
tur die Fragwürdigkeit – im hegelschen Sinn – aufhebt und dass Ambiguität ihr
konstitutives Merkmal ist.41 Um im Sinne Kafkas zu sprechen: Es geht darum, den
›schwankenden Grund‹, auf dem wir uns bewegen, zu begründen.
Die ästhetische Erfahrung mag als ›Entgrenzung‹ (Barthes)42, ›Epiphanie‹
(Bohrer)43, ›Erlebnis‹ (Gumbrecht)44 oder ›Mehrwert‹ (Steinfeld und Alt)45 beschrie-
ben werden, maßgeblich ist, dass sie zu den herrschenden Vorstellungen im ›pro-
duktiven Widerspruch‹ (Würffel)46 steht. Das philologisch gewonnene Differenz-
Wissen systematisch pflegen und für die Reflexion der kontingenten Verhältnisse
fruchtbar machen, kann man nur im Rahmen einer Bildungsanstalt, die sich dem
Ideal der »unbedingte[n] Universität«47 verschreibt. Der Literatur gewachsen sind
allein Lehrende und Studierende, die ›alles‹ in Frage zu stellen vermögen, zur akri-
bischen Lektüre48 bereit sind und für die nötige Unruhe sorgen. Diesen Kampf an
der Universität zu institutionalisieren, bedeutet, ihn nicht auf Biegen und Brechen
zu führen, sondern auf Dauer. – Nur wer auch ein »philosophische[r] Kopf« ist,
kann ein guter »Brodgelehrte[r]«49 werden.
Wer aber das aus der ästhetisch-literarischen Erfahrung erwachsende Wissen
preisgibt, gleicht dem »Dicken« aus Kafkas Erzählung, der untergeht »wie ein Göt-
terbild […], das überflüssig geworden« (BK, 111) ist, weil er die Zeichen der Zeit
nicht zu lesen versteht.
40 Barthes: Leçon/Lektion, S. 23.
41 Vgl. Szondi: Über philologische Erkenntnis, insbes. S. 30–32.
42 Vgl. Barthes: Leçon/Lektion.
43 Vgl. Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins.
44 Vgl. Gumbrecht: Die Macht der Philologie u. ders.: Diesseits der Hermeneutik.
45 Vgl. Steinfeld: Der leidenschaftliche Buchhalter u. Alt: Die Verheißungen der Philologie.
46 Vgl. Würffel: Der produktive Widerspruch. Heinrich Heines negative Dialektik.
47 Derrida: Die unbedingte Universität. S. 12 u. 77.
48 Vgl. Barthes: Die Lust am Text, S. 20.
49 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, S. 3; Schiller pole-
misierte gegen die ›Brodgelehrten‹, wohl wissend, dass seine Zuhörer nolens volens zu solchen
werden.
F4717-Antonsen.indd 190 03.12.2008 11:05:03 Uhr
Jürgen Söring (Neuchâtel)
WAS HEISST UND ZU WELCHEM
ENDE?STUDIERT MAN LITERATURWISSENSCHAFT?
[…] wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt
Ist ein Barbar […].
Goethe: Torquato Tasso
Ich will nicht verhehlen, dass mich die spontane Zusage zur Mitwirkung an diesem
Band nachträglich in Verlegenheit gebracht hat. Nicht etwa, weil ich mich im
Drang der Geschäfte lieber um meinen Beitrag herumgedrückt hätte. Im Gegen-
teil! Die einmal mehr als ›hochaktuell‹ gehandelte Themenstellung ist es, angesichts
derer ich periodisch aufstoßende Anwandlungen von Überdruss kaum mehr nie-
derkämpfen kann. Und das aus drei Gründen:
Erstens widerstrebt mir, der – ungeprüften – Annahme eines offenbar längst ver-
innerlichten ›Legitimationsnotstandes‹ beizupflichten und damit jener – von Odo
Marquard angeprangerten – »›Übertribunalisierung‹ der menschlichen Lebens-
wirklichkeit« Vorschub zu leisten, die mich als »Angeklagten« vor ein imaginäres
Gericht zerrt1, um mir – nach dem Vorbild des (vom Chor der Mitläufer eilfertig
sekundierten) Oberpriesters Ramphis in Verdis Aida – dreimal jenes dröhnende
»Discolpati!« entgegenzuschleudern, ohne dass ich – im Unterschied zum Missetä-
ter Radames – etwas verbrochen hätte.2
Dieser inzwischen ›absolut‹ gewordene »Rechtfertigungsdruck« ist es vor allem3,
der in unserm Fach zu dem beklagenswerten Trend ›von der Sache (: der Literatur
und Dichtung) weg‹ und damit zu einer zweifelhaften Anbiederung an immer ra-
scher wechselnde ›Paradigmen‹, turns oder ›Leitwissenschaften‹ geführt hat, wovon
man sich in dem compte rendu des Marburger Germanistentages unter dem Titel
Der hat die Kokusnuss geklaut! ein ebenso groteskes wie alarmierendes Bild machen
kann.4 Aber auch dazu haben seit mindestens einem halben Jahrhundert, also kei-
neswegs erst im ›Jahr der Geisteswissenschaften‹ (2007) so viele kluge Leute in allen
Medien und auf allen Kanälen so viel Kluges gesagt, dass man allein mit den biblio-
1 Marquard: Der angeklagte und der entlastete Mensch, S. 47 u. 49.
2 IV. Akt, 3. Szene = Nr. 15 Gerichtsszene.
3 Marquard: Der angeklagte und der entlastete Mensch, S. 49.
4 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28. 9. 2007.
F4717-Antonsen.indd 191 03.12.2008 11:05:03 Uhr
192 JÜRGEN SÖRING
grafischen Nachweisen zum Thema ein Buch vom Umfang einer Festschrift hätte
füllen können.5
Zweitens widerstrebt mir, auf den – so nur im deutschen Sprachgebrauch umge-
henden – Begriff ›Literaturwissenschaft‹ festgelegt zu werden, obwohl ich selber
viele Semester über Literaturwissenschaft im Grundriss Vorlesung gehalten habe.6
Allerdings auch in der Absicht, unser Fach, das, wie im Französischen, ›Deutsche
Sprache und Literatur‹ oder einfach ›Deutsche Philologie‹ heißen sollte, von der
Hypothek einer irreführenden Prätention zu entlasten, der es überhaupt nur genü-
gen kann, wenn es um zweifellos nötiges Sachwissen geht, wie es historisch-kriti-
sche Editionen, Erläuterungen und Dokumente sowie Kommentarwerke, Reallexi-
ka oder Handbücher zu unser aller Vorteil erarbeitet, erfasst und kodifiziert haben.
Dennoch kann solches »äußerliche Tun« eines ›Brotgelehrten‹ den ›philosophischen
Kopf‹ nicht befriedigen7, der sich – wie Paulus – lieber dem »Geist« der Sache ver-
schreibt8, so unverzichtbar dessen »Erklärung«, »Vergegenwärtigung« und »Entschlüs-
selung«9 (oder Deutung) an die ›Pflege des Buchstabens‹ gebunden bleibt.10
Drittens widerstrebt mir, Schillers – auf einen »höhern Endzweck«11 zielende –
Frage womöglich nach Maßgabe einer inferioren Kosten-Nutzen-Rechnung beant-
worten zu sollen, die das Existenzrecht unseres Faches an die Entwicklung solcher
›Kompetenzen‹ bindet12, die das Studium von Sprache und Literatur dem vulgären
Postulat gesellschaftlicher ›Relevanz‹, ›Praxistauglichkeit‹ und ›Effizienz‹, mit einem
Wort: ihrem ›Gebrauchswert‹ tributpflichtig machen. Selbst die ›vernünftigste‹
Zweckbestimmung auf dieser Linie, die mittlerweile von jedem Rapport de profil
zur Wiederbesetzung freiwerdender Stellen ängstlich befolgt und werbewirksam
beschworen wird, ist nach meinem Verständnis eine Zweck-Entfremdung, indem
sie das Literaturstudium heteronomen Interessen unterordnet, also Verrat am
»spezifische[n] ›Selbstzweck‹-Charakter« unseres Faches begeht, das – wie Axel
5 Hervorheben möchte ich den Beitrag von Gerhard Kaiser für die Sendereihe SWR2 Wissen
vom 6. 1. 2003 mit dem Titel: Wozu noch Geisteswissenschaften?
6 Am Leitfaden der folgenden Gliederung: Einleitung (Literatur- und Wissenschaftsbegriff,
medienkundliche Ortsbestimmung) – I: Philologische Propädeutik (Text – Werk – Autor –
Leser) – II: Literarische Ästhetik – III: Rhetorik – IV: Stilistik – V: Poetik – VI: Historik – VII:
Hermeneutik – VIII: Literaturkritik/Literarische Wertung – IX Literaturtheorie/Poetologie – X:
Wissenschaftsgeschichte.
7 Vgl. Hegel: Phänomenologie, S. 524 sowie Schiller: Was heißt und zu welchem Ende, S. 360ff.
8 2 Kor 3, 5f., aber auch Rö 7, 6. In: Die Heilige Schrift.
9 Patzig: Erklären und Verstehen, S. 64.
10 Hölderlin: Patmos v. 224ff.: »daß gepfleget werde / der veste Buchstab, und bestehendes gut/
Gedeutet.«
11 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende, S. 363.
12 Wie sie z. B. in der Justification d’un poste de professeur-e-assistant-e des littératures der Univer-
sité de Neuchâtel vom 13. 12. 2007 festgehalten sind: »capacité à la réflexion et à la lecture
critique, en particulier afin de décoder les discours sociaux; capacité à penser rigoureusement,
mais aussi de manière créative; capacité à communiquer oralement et par écrit, de façon ana-
lytique, synthétique ou argumentative.«
F4717-Antonsen.indd 192 03.12.2008 11:05:03 Uhr
WAS HEISST UND ZU WELCHEM ENDE? 193
Horstmann schon vor zehn Jahren gegensteuernd bemerkt hat – »so etwas wie ein
[…] ›Luxusphänomen‹ [ist], auch darin der antiken Wissenschaft [: der Jewri{a
im Sinne des Aristoteles] durchaus vergleichbar. […] nur wenn man ehrlich und
[…] selbstbewusst genug ist, sich dies einzugestehen […], wird man über Versuche
ideologischer Pseudo-Rechtfertigung hinauskommen.«13 Überflüssig zu betonen,
dass ich ein bekennender Anhänger solcher Jewri{a bin, die eben Muße, otium
oder scolh{, das heißt Freiheit von ›Wirtschaftskämpfen‹ voraussetzt14, um sich
der ›denkenden Betrachtung‹ poetischer Hervorbringungen sowie ihrer sachge-
rechten Vermittlung im Medium der Sprache zuwenden zu können.
Zumal der poetische »Geist« ist, wie Max Scheler gewusst hat, das »aller [unmit-
telbaren] Wirksamkeit Bare«. »In seiner ›reinen‹ Form« ist er »ursprünglich schlecht-
hin ohne alle ›Macht‹, ›Kraft‹, ›Tätigkeit‹«, »Energie« und »verwirklicht« sich einzig
in der – ihm allererst ›Kraft verleihenden‹ – Aneignung durch solche, die auf ihn zu
hören bereit sind.15
Insofern wäre die Beweislast umzukehren zu der Frage, mit welcher Befugnis
»Legitimationszwang«16 ausgeübt wird, wenn es die Indolenz der Harthörigen und
Verstockten ist, die die vermeintliche Wirkungslosigkeit des ›Geistes‹ wie seiner
›Wissenschaft‹ zu verantworten hat. Der ›Geist‹ pflegt sich nämlich, Karl Marx zu-
folge, allein deshalb »in der Weltgeschichte [zu] ›blamieren‹«, weil er »keine Interes-
sen und Leidenschaften«, also keine engagierten Menschen, »hinter sich«17 hat;
ohne freilich den Verfechtern der studia humaniora die Gegenfrage ersparen zu
wollen, ob sie denn immer das Nötige tun und getan haben, um jenes ›leiden-
schaftliche Interesse‹ an den humanities zu wecken, für die sich zu ›engagieren‹ viel-
leicht lohnend sein könnte.
Meine Besinnung auf das proprium unseres Faches wird daher nur einige ›unzeit-
gemäße Betrachtungen‹ von der bescheidenen Sorte beisteuern können, begleitet
von jenem – schon Wieland vertrauten – Gefühl leiser Skepsis,
wenn man nicht umhin kann sich selbst zu sagen: daß man, mit allem guten Wil-
len, durch Bekanntmachung seiner […] Gedanken über gewisse Gegenstände
[…] am Ende doch immer nur leeres Stroh dresche, Wasser mit einem Siebe
schöpfe, in den Sand schreibe.18
Halbwegs verlässlichen Boden unter den Füßen verschaffen soll mir gleichwohl die
– umformulierte – Fragestellung: Was heißt und zu welchem Ende studiert man
Philologie?, worunter »hier, in einem sehr allgemeinen Sinne, die Kunst, gut zu le-
sen, verstanden werden [soll]«19. Philologie hat es mit dem le{gein (: legere, Auf-le-
13 Horstmann: Wozu Geisteswissenschaften?, S. 42f.
14 Vgl. Weber: Wirtschaft und Gesellschaft.
15 Scheler: Die Stellung des Menschen, S. 66, 57 u. 67.
16 Marquard: Der angeklagte und der entlastete Mensch, S. 49.
17 Scheler: Die Stellung des Menschen, S. 68.
18 Wieland: Über den freyen Gebrauch, S. 9f.
19 Nietzsche: Der Antichrist, S. 233; dazu: Söring: Grenzen der Lesbarkeit.
F4717-Antonsen.indd 193 03.12.2008 11:05:03 Uhr
194 JÜRGEN SÖRING
sen) schriftlich fixierter Zeichen, kurz: dem überlieferten lo{goV, also der Rede, dem
Wort, der Sprache, insbesondere dem poetischen Sprachgebrauch, das aber heißt:
gerade mit dem zu tun, was den Menschen (als zw{on lo{gon Écon, animal ratio-
nale et symbolicum) – neben aufrechtem Gang sowie dem Gebrauch der Hände20 –
in seinem Wesen bestimmt und deshalb von anderen Lebewesen unterscheidet21;
den Umschlag des lo{goV ins Á-logon: also ›Widersinnige‹, ›Irrationale‹, ausdrück-
lich inbegriffen.
An diesem – von Heidegger fundamentalontologisch gewendeten – Apriori der
Sprache möchte ich daher nur ungern rütteln lassen:
Weil für das Sein des Da, das heißt Befindlichkeit und Verstehen, die Rede kons-
titutiv ist, Dasein aber besagt: In-der-Welt-sein, hat das Dasein als redendes In-
Sein sich schon ausgesprochen. Das Dasein hat Sprache.22
Darüber hinaus kann »die Mitteilung der existenzialen Möglichkeiten der Befind-
lichkeit, das heißt das Erschließen von Existenz […] eigenes Ziel der ›dichtenden‹
Rede werden.«23
»Verstehen und Auslegung«24 aber solcher Rede ist die Aufgabe recht verstande-
ner Philologie: Ein Beruf (: vocatio), den ich – auf Tacitus gestützt25 – mit dem la-
teinischen Wort interpretari umreißen möchte, dessen Bedeutungsumfang sich in
die Einzelaspekte Übersetzen und Dolmetschen (1), Erklären und Erläutern (2), Deu-
ten und Auslegen (3) gliedern lässt. Interpretation ist ein auf Verständnis zielendes
Amt der Vermittlung und Wegweisung (: Hodegetik), das im Grunde nur wieder-
holt bzw. fortsetzt, was altehrwürdige Weisheit (: prisca sapientia) den mythischen
Seherdichtern, allen voran: dem Orpheus, zugeschrieben hat26; von dem Gott Her-
20 Leroi-Gourhan: Le geste et la parole.
21 Cicero: De oratore I (32): »Dies eine ist doch unser wesentlichster Vorzug vor den Tieren, daß
wir miteinander reden und unseren Gedanken durch die Sprache Ausdruck geben können.«
Vgl. Cassirer: Was ist der Mensch, S. 40; vgl. dazu: Historisches Wörterbuch der Philosophie, 5,
Sp. 1059ff.: Mensch.
22 Heidegger: Sein und Zeit, S. 165 (= § 34)
23 Ebd., S. 162 (= § 34).
24 Ebd., S. 148ff. (= § 32).
25 Vgl. Tacitus: Germania 10., S. 9: »Das Verfahren beim Losen ist einfach. Sie [: die Germa-
nen] schneiden von einem fruchttragenden Baum einen Zweig ab und zerteilen ihn in kleine
Stücke; diese machen sie durch Zeichen (notis quibusdam) kenntlich und streuen sie planlos
und wie es der Zufall will auf ein weißes Laken. Dann betet bei einer öffentlichen Befragung
der Stammespriester […] zu den Göttern, hebt […] nacheinander drei Zweigstücke auf und
deutet sie (interpretatur) nach den vorher eingeritzten Zeichen.«
26 Vgl. Horaz: Ars poetica v. 391–407, wo der ›heilige Orpheus‹ als kulturstiftender Dolmet-
scher und Sprachrohr der Götter (: interpres deorum) beschworen wird; möglicherweise an
Platon anknüpfend, der Sokrates (Ion 534e 4) ausführen lässt, dass die Dichter im Allgemei-
nen nichts anderes als äermh}nhV t^wn Je^wn seien.
F4717-Antonsen.indd 194 03.12.2008 11:05:03 Uhr
WAS HEISST UND ZU WELCHEM ENDE? 195
mes zu schweigen, auf dessen ›Vermittlungs-Dienste‹ sich27, wenngleich etymolo-
gisch mehr als zweifelhaft, die Hermeneutik beruft.28
Auf die Gefahr hin, mich selber, wie der bejahrte »Prorektor« der ›hohen Schule
St. Görgen‹, »als bleicher Bleicher der klassischen alten Wäsche«29 in Misskredit zu
bringen, riskiere ich noch einen Schritt weiter zurück, indem ich behaupte, das ei-
gentliche Modell für den Interpreten als Vermittler sei der Dämon Eros, dessen –
doppelte – »Verrichtung« es, laut Diotima, ist: »zu verdolmetschen und zu überbrin-
gen [1] den Göttern, was von den Menschen, und [2] den Menschen, was von den
Göttern kommt. […] In der Mitte zwischen beidem ist es [: das Dämonische] als
die Ergänzung [3], so dass nun das Ganze in sich verbunden ist.30 Und durch dies
Dämonische geht auch alle Weissagung und die Kunst der Priester […] und alle
Wahrsagung und Bezauberung«31: die Kunst des Schriftgelehrten und Philologen,
jedenfalls ihrem höchsten Begriff nach, nicht ausgenommen!
Mit der zusätzlichen Pointe, dass sich in der Philo-logie als der Liebe zum Lesen
des dichterischen Wortes und seiner Interpretation vielleicht etwas von jenem ver-
mittelnden Eros wiederfindet, den es bei denen zu wecken gilt, die auf die berühm-
te Frage des Philippus in der Apostelgeschichte: »Verstehest du auch, was du liesest?«32,
noch keine Antwort wissen und deshalb, wie der – mit seiner rätselhaften Schrift-
Stelle allein gelassene – Kämmerer der Kandace33, der professionellen Anleitung
bedürfen. Deren Ziel ist die Erschließung des Sinn-Gehalts schriftlich tradierter
Texte in ihrem alles umgreifenden Kon-Text34; allerdings in dem – jeden absoluten
›Wahrheits‹-Anspruch selbstkritisch in Frage stellenden – Bewusstsein, dass solche
›Erschließung‹, wie das zitierte Beispiel zeigt, niemals interessen-unabhängig, viel-
mehr interessen-bestimmt ist. Philippus will, richtiger soll, vom Engel des Herrn
beauftragt, Proselyten machen! (Darum sei – zumindest in Parenthese – an die Ge-
fahr möglichen Missbrauchs der Exegeten-Rolle erinnert, der genau dann vorliegt,
wenn der Interpret mit selbstverliebter Herrschaftsgeste Deutungshoheit als privi-
legium für sich beansprucht!).
27 Vgl. Weimar: Hermeneutik, S. 26.
28 Vgl. Gadamer: Hermeneutik, Sp. 1061ff.: »Hermeneutik ist die Kunst des äermhneýein, d. h.
des Verkündens, Erklärens und Auslegens. ›Hermes‹ hieß der Götterbote, der die Botschaf-
ten der Götter den Sterblichen ausrichtet.« – Vgl. dazu Grondin: Hermeneutik, Sp. 1353: »So
einleuchtend sie [die Verbindung mit dem Götterboten Hermes, J. S.] sein mag, gilt heute
diese Etymologie als unhaltbar.«
29 Jean Paul: Giannozzo, S. 994.
30 Der in Christus als Mittlerfigur Fleisch gewordene Logos wäre unter dem gewählten Blick-
winkel die neutestamentliche Parallele zum platonischen Eros!
31 Platon: Symposion 202d–203a.
32 Apg 8, 26–35; in: Die Heilige Schrift.
33 Jes 53, 7f. (in Apg 8, 32f. verzerrt zitiert; möglicherweise nach der LXX?); in: ebd. Vgl. dazu
das Gemälde Philippus der Kämmerer von Hans Marées in der Berliner Nationalgalerie.
34 Beispielsweise (1) linguistisch-poetologisch-literaturgeschichtlich, (2) kunst- und kulturhi-
storisch, (3) religiös, (4) ideen- und mentalitätsgeschichtlich, (5) individualgeschichtlich und
psychologisch, (6) sozio-ökonomisch und politisch (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
F4717-Antonsen.indd 195 03.12.2008 11:05:03 Uhr
196 JÜRGEN SÖRING
Von möglichen Interessendifferenzen jedoch abgesehen wird dabei im Prinzip
vorausgesetzt, dass literarische Texte (gleichviel ob profan oder sakral) ein ›Verwei-
sungsganzes von Bedeutsamkeit‹ darstellen.35 Sie sind Sinngebilde, deren Bedeu-
tungshaltigkeit nicht nur Sinn-Erwartung begründet, sondern ihre Erkenntniswei-
se als Sinn-Aneignung durch Sinn-Verleihung vorzeichnet.36 Verstehen als die spezifi-
sche Erkenntnis-Absicht gegenüber literarischen Texten hat diese – im Interesse
expliziter Auslegung – immer schon als Sinngebilde entworfen, das heißt ihnen in-
tentionalen Sinn verliehen, auch in solchen Fällen, wo die Sinn-Erwartung des In-
terpreten enttäuscht wird.37
Angesichts dieser Sachlage »muß der Philologe«, wenn er den Anforderungen
seines Amtes entsprechen will, Nietzsche zufolge, »drei Dinge […] verstehen, [1]
das Altertum, [2] die Gegenwart, [3] sich selbst«38. Diese Bedingungen, von denen
keiner hoffärtig annehmen sollte, dass er sie hinreichend erfüllt, bezeichnen zu-
gleich die Defizite, denen – meines Erachtens – nur ein studium litterarum abhelfen
kann39, das hingebungsvoll darum bemüht bleibt, »die fast unendliche stoffliche
Fülle [: jener Fächer: illarum artium] mit wissenschaftlichem Erkennen [scientia et
cognitione] zu umgreifen«. Denn anders als sein Gesprächspartner Quintus Mucius
Scaevola, aber ähnlich wie später Flaubert, ist Cicero der Auffassung, dass die
kunstfertige Beherrschung des Logos in Rede und Schrift »höchste Bildung auf
wissenschaftlichem Gebiet voraus[setzt]«40.
Manch einer glaubt indes, einer solchen Anstrengung überhoben zu sein und
deshalb lieber (und bequemer!) beklagen zu sollen41, dass der gegenwärtige Zu-
stand der Welt einen Notstand der Literatur und Philologie, ja der Geisteswissen-
schaft insgesamt bedinge. Die schleichende (und der medialen Überflutung mit
Erinnerungs-Exerzitien seltsam gegenläufige) Auszehrung des Geschichtsbewusst-
seins sei es zumal, die sich auch durch das Wort Wilhelm Diltheys: »Was der
Mensch sei, sagt ihm nur seine Geschichte«42, oder die Überzeugung Nicolai Hart-
35 Vgl. Heidegger: Sein und Zeit, §§ 18 u. 32.
36 Vgl. Hartmann: Sinngebung, S. 185: »Es gilt schließlich von der Sinngebung in der Ge-
schichte dasselbe wie von der Sinngebung im Leben des Einzelnen: der Mensch erhält sie
zurück aus der Welt, der er sie gibt. Die Erfüllung dessen, was er in sie hineinträgt, fällt ihm
zu.«
37 Vgl. Söring: Literaturwissenschaft, S. 271f. Sogar die berühmte page blanche will offensicht-
lich noch etwas ›bedeuten‹. Die – in Novalis’ Monolog bereits vorweggenommene – post-
strukturalistische Behauptung reiner Selbstbezüglichkeit der Zeichen, deren letzte Konse-
quenz die ›Auslöschung der Realität‹ (und damit die Aufgabe von ›Bedeutsamkeit‹ über-
haupt) ist (vgl. Baudrillard), annulliert den Zeichen-Charakter, da ein Zeichen als Zeichen
auf etwas anderes (Augustinus: aliquid aliud) zeigt und verweist.
38 Nietzsche: Wir Philologen, S. 332.
39 Cicero: De oratore, I (10).
40 Ebd., I (5); zu Flaubert vgl. Söring: Der Erkenntnis-Anspruch von Poiesis, S. 219–223.
41 Vgl. dagegen Marquards – allen »Verkümmerungsprognosen« (Marquard: Der angeklagte
und der entlastete Mensch, S. 101) ins Wort fallende – Plädoyer für die Unvermeidlichkeit der
Geisteswissenschaften.
42 Dilthey: Traum, S. 224.
F4717-Antonsen.indd 196 03.12.2008 11:05:03 Uhr
WAS HEISST UND ZU WELCHEM ENDE? 197
manns: »Die Geschichte ist der Prozeß, in dem der Mensch erst erfährt, was er
[›selbst der Intention und der Bestimmung‹, d. h.] dem Wesen nach ist«43, nicht
mehr habe aufhalten lassen: Eine – jedem historisch Geschulten gewiss vertraute –
Unterrichts-Erfahrung, über die Goethe einerseits seinen ›Unmut‹ in Versen ausge-
gossen hat44, wiewohl ihm andererseits illusionslos klar war, dass »schon fast seit
einem Jahrhundert […] Humaniora nicht mehr auf das Gemüt dessen [wirken] der
sie treibt«, weshalb es »ein rechtes Glück [sei], daß die Natur dazwischen getreten
ist, das Interesse an sich gezogen und uns von ihrer Seite den Weg zur Humanität
geöffnet hat«!45
Niemand wird, aller Rabulistik, aber auch allen – auf Buchmessen regelmäßig
verkündeten – Steigerungsraten zum Trotz, ernsthaft bestreiten wollen, dass sich
der Terrainverlust der klassischen (ebenso wie der neueren Literaturen) und ihrer
›Magd‹: der Philologie, in den letzten zweihundert Jahren eher noch beschleunigt
hat; und zwar doch wohl infolge jener grundstürzenden »Umkehr aller Vorstel-
lungsarten und Formen«46 bezüglich unserer – stets perspektivisch beschränkten –
›Ansicht‹ von Raum und Zeit, Sein, Dasein und Bewusstsein, die vor allem durch
Astro-, Kern- oder Quantenphysik, durch Biochemie, Genforschung und Informa-
tik: durch Naturwissenschaft und Mathematik, in Gang gesetzt worden ist. Na-
mentlich unser Bild vom Menschen und seinem ›Ich‹ ist im Begriff, sich durch
neurophysiologische Einsichten so fundamental zu wandeln47, dass ein Festhalten
am traditionell definierten humanum »der reinste Schwindel ist«, wie Robert Musil
seinen Mann ohne Eigenschaften schon 1930 lakonisch hat konstatieren lassen.48
Diese heute ganz offenkundige ›Auswanderung‹ der – nicht selten von Dichtern
hellsichtig vorgespurten – Erkenntnis in die sciences dures (aber auch sciences humai-
nes!) hat jedoch, aufs Ganze gesehen, zu einer »Entlastung der Literatur« von ihrem
43 Hartmann: Sinngebung, S. 185f.; vgl. dazu Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandel
des kulturellen Gedächtnisses.
44 Vgl. Goethe: West-östlicher Divan, S. 44: »Wer nicht von dreitausend Jahren / Sich weiß Re-
chenschaft zu geben, / Bleib im Dunkeln unerfahren, / Mag von Tag zu Tage leben.«
45 Womit jede ›Alleinvertretungsanmaßung‹ fächerübergreifend außer Kraft gesetzt ist! Der
Brief an Knebel vom 25.11.1808 zitiert nach: Herder: Journal, S. 214: Eine Entwicklung, an
der die Philologen nicht ganz unschuldig gewesen zu sein scheinen; vgl. ebd. S. 215, Anm. 15,
den Hinweis auf Friedrich Paulsen: Geschichte des gelehrten Unterrichts. 3. Aufl. Berlin u.
Leipzig 1921, Bd. 2, S. 80: Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts fehlte es den
klassischen Studien an den Universitäten »an Eifer bei den Lehrern und an Glauben bei den
Hörern«! Nicht zuletzt wohl ein Beweggrund für Herders Projekt einer – als Real-Gymnasi-
um (und »Republik für die Jugend«) konzipierten – ›liefländischen Vaterlandsschule‹, deren
Programm er in seinem Reise-Journal ausführlich entfaltet.
46 Hölderlin: Anmerkungen zur Antigonae, S. 271.
47 Mit heute kaum schon absehbaren Folgen für Fragen nach dem liberum arbitrium, der
Schuldfähigkeit, Verantwortung und des Rechtswesens. Inwiefern dieser Trend im Interesse
einer Neubegründung der aristotelischen Mimesis-Theorie für die Neurogermanistik frucht-
bar gemacht werden kann, zeigt – eine echte trouvaille! – Lauer in seinem Vortrag über Lesen
mit Spiegelneuronen.
48 Vgl. Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, S. 359.
F4717-Antonsen.indd 197 03.12.2008 11:05:03 Uhr
198 JÜRGEN SÖRING
seit Anbeginn wahrgenommenen (oder ihr angesonnenen) pseudo-religiösen Stif-
ter-Amt geführt und damit zugleich eine Rückbesinnung auf ihre Kernaufgaben
möglich gemacht. In diesem Punkt teile ich die – ebenfalls 1930 geäußerte – Zu-
versicht Hermann Hesses, nach dessen Einschätzung »sich auch der kindlichsten
Fortschrittstrunkenheit die Erkenntnis bald aufdrängen [wird], daß Schrift und
Buch Funktionen haben, welche ewig sind. Es wird sich zeigen, daß die Formulie-
rung durch das Wort und die Überlieferung dieser Formulierungen durch die
Schrift nicht nur wichtige Hilfsmittel, sondern überhaupt das einzige Mittel sind,
kraft dessen die Menschheit eine Geschichte und ein fortdauerndes Bewusstsein
ihrer selbst haben kann.«49 Kurz: »Ohne Wort, ohne Schrift und Bücher«, ich füge
ausdrücklich hinzu: ohne Sprache, »gibt es keine Geschichte, gibt es nicht den Be-
griff der Menschheit.«50
Darum tut, wer sich auf der Spur Nietzsches als Mensch verstehen will51, gut
daran, sich für die ›Liebe zur Sprache‹ zu engagieren, das heißt Philologie als jene
»Goldschmiedekunst und -kennerschaft des W o r t e s « zu studieren,
welche von ihrem Verehrer vor Allem Eins heischt, bei Seite gehn, sich Zeit lassen,
still werden, langsam werden – […]. Gerade damit aber ist sie heute nöthiger als
je, gerade dadurch zieht sie und bezaubert sie uns am stärksten, mitten in einem
Zeitalter der ›Arbeit‹, will sagen: der Hast, der unanständigen und schwitzen-
den Eilfertigkeit, das mit Allem gleich ›fertig werden‹ will, auch mit jedem alten
und neuen Buche: – sie selbst wird nicht so leicht irgend womit fertig, sie lehrt
g u t lesen, das heisst langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken
und offen gelassenen Thüren, mit zarten Fingern und Augen lesen …52
Wer philologisch tätig ist, kümmert sich demnach in ausgezeichneter Weise um das
proprium humanitatis: die Sprache, also jene ›Macht‹ (vis), von deren konsoziieren-
der, zivilisierender sowie instituierender »Thätigkeit (Energeia)«53 Cicero zu rüh-
men weiß, dass sie »die zerstreuten Menschen an einem Orte zu versammeln, sie
von einem wilden und rohen Leben zu unserer menschlichen und politischen Ge-
sittung hinzuführen oder schon bestehenden Staatswesen die Gesetze, Gerichte
und Rechtsnormen vorzuschreiben [vermochte].«54 Inwiefern der ordo (: die »gute
49 Hesse: Magie des Buches, S. 247f.
50 Lesch/Zaun: Die kürzeste Geschichte, S. 181 (als Motto wohl ›nach Hesse‹ zitiert)!
51 Vgl. dazu den – u. a. im platonischen Protagoras 343b 2 überlieferten – Spruch gnvJi
sayto{n (: ›erkenne dich selbst‹ oder ›wisse, was ein Mensch ist‹: Historisches Wörterbuch der
Philosophie, Bd. 5, Sp. 1059) bzw. Hegel: Enzyklopädie, § 377: »Erkenne dich selbst, dies abso-
lute Gebot hat weder an sich noch da, wo es geschichtlich als ausgesprochen vorkommt, die
Bedeutung nur einer Selbsterkenntnis nach den partikulären Fähigkeiten, Charakter, Neigun-
gen und Schwächen des Individuums, sondern die Bedeutung der Erkenntnis des Wahrhaf-
ten des Menschen, wie des Wahrhaften an und für sich, – des Wesens selbst als Geistes.«
52 Nietzsche: Morgenröthe, S. 17.
53 Humboldt: Ueber die Verschiedenheit, S. 418.
54 Cicero: De oratore, I (32) u. (33). Nur im Vorbeigehen reiche ich weiter, dass das neue Gra-
duiertenprogramm der Universitäten Basel, Bern und Zürich (: Sprache als soziale und kultu-
F4717-Antonsen.indd 198 03.12.2008 11:05:03 Uhr
WAS HEISST UND ZU WELCHEM ENDE? 199
Ordnung«) eines funktionierenden und zugleich menschlichen Gemeinwesens auf
›richtigem‹ Sprachgebrauch beruht, kann man überdies bei Konfuzius lernen, von
dem Folgendes erzählt wird: Sein Schüler
Zi-lu sprach zu Konfuzius: »Wenn Euch der Herrscher des Staates Wei die Regie-
rung anvertraute – was würdet Ihr zuerst tun?« Der Meister antwortete: »Unbe-
dingt die Namen richtigstellen.« Darauf Zi-lu: »Damit würdet Ihr beginnen? Das
ist doch abwegig. Warum eine solche Richtigstellung der Namen?« Der Meister
entgegnete: »Wie ungebildet du doch bist, Zi-lu! Stimmen die Namen und
Begriffe nicht, so ist die Sprache konfus. Ist die Sprache konfus, so entstehen
Unordnung und Misserfolg. […] Darum muß der Edle die Begriffe und Namen
korrekt benutzen und auch richtig danach handeln können. Er geht mit seinen
Worten niemals leichtfertig um.«55
Gegenwärtig ist unsere Sprache nicht nur ›konfus‹, sondern in einem – durch allge-
meinen ›Kulturwandel‹ bewirkten, durch hemmungslose Entfesselung des ›Gere-
des‹ begünstigten56 sowie durch computer-gestützte globale Vernetzung der Kom-
munikation beschleunigten – Zustand der Verwahrlosung und Nivellierung, der
zumal denjenigen Anlass zur Sorge gibt, die befürchten, dass die Sprache »aus der
Existenzdeutung des Menschen, der Welt und der Natur«57 irreversibel verdrängt
werden, ja sogar ›verloren‹ gehen könne.
Angesichts solcher Lagebeurteilung tut man sich schwer, die »Poësie« (und mit
ihr die Philologie), unter Berufung auf Hölderlins Patmos-Hymne etwa58, als »Pan-
acee« anzupreisen, die wir »wohl brauchen [könnten], […] nach der politisch phi-
losophischen [vor allem: naturwissenschaftlich-technischen!] Kur«59; und noch
schwerer will es mir fallen, mich mit ›zukunftsorientierten Situationsbestimmun-
gen‹ »[p]rophetisch, träumend« aufs Glatteis zu wagen, wie – beiläufig – Schiller
selber, der die Universalgeschichte in seiner Antrittsvorlesung vom 26. Mai 1789
frohgemut auf ein »Zeitalter der Vernunft« zusteuern lässt, ohne mit einem Rück-
relle Praxis) sich zum Ziel gesetzt hat, »die konstitutive Rolle der Sprache für die Ausbildung
einer ›Kultur‹ zu vermitteln«; allerdings in eher theoretischer Ausrichtung mit dem hochge-
steckten »Ziel«, einmal mehr »die Linguistik […] als Grundlagenwissenschaft im Kontext
eines kulturwissenschaftlichen Paradigmas zu verankern.« (SAGG-Bulletin 1 [2008], S. 11)
55 Konfuzius: Gespräche, S. 79 (= XIII, 3).
56 Vgl. Heidegger: Sein und Zeit, S. 169f. (= § 35): »Das Gerede ist […], gemäß der ihm eige-
nen Unterlassung des Rückgangs auf den Boden des Beredeten, ein Verschließen.« – »Das
Gerede, das in der gekennzeichneten Weise verschließt, ist die Seinsart des entwurzelten Da-
seinsverständnisses.«
57 Frühwald: Die verlorene Sprache, S. 2f.
58 Vgl. Hölderlin: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe, Bd. 2, S. 165: »Wo aber Gefahr ist,
wächst / Das Rettende auch«!
59 Hölderlin: Brief 172. In: ders.: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe, Bd. 6, S. 306.
F4717-Antonsen.indd 199 03.12.2008 11:05:04 Uhr
200 JÜRGEN SÖRING
fall in jene »barbarischen Verbrechen« zu rechnen, die er schon »in die Vergessen-
heit«60 hatte fallen sehen!
Nein. Die Aussichten für eine Rephilologisierung der europäischen Wissens-
Kultur sind, nachdem diese sich mit beginnender Neuzeit durch naturwissenschaft-
liche Autopsie und empirische Forschung von der bloßen »Kommentierung eines
[tradierten] Textbestandes« emanzipiert hat, nicht eben vielversprechend. Die Zeit,
als »Kultur [vornehmlich] Textkultur«61 und das Bildungsprivileg noch an die –
weitgehend eingebüßte – Kompetenz, »Texte lesen zu können«62, geknüpft war,
sind unwiederbringlich und, wie ich betonen möchte: mit Recht vorbei; ganz zu
schweigen von den dramatischen Folgen jener – durch Oswald Spengler herbeige-
führten – ›kopernikanischen Wende‹ in der Geschichtsbetrachtung, deren ernüch-
terndes Resultat die Dezentrierung der europäisch-abendländischen Kultur im glo-
balen Maßstab ist.63
Aber sollte man, eingedenk auch der Entgleisungen des iconic (oder pictural)
turn in eine immer zügellosere ›Bildkultur‹ (visual culture), nicht vielleicht doch ei-
ne Lanze brechen für die philologische Rückbesinnung auf »der Güter Gefährlichs-
tes, die Sprache«, die, Hölderlin zufolge, »dem Menschen gegeben [ist], […] damit
er zeuge«, das heißt in Worten hervorbringe und Zeugnis ablege von dem, »was er
sei«64? Die Voraussetzung solcher Poiesis ist freilich, dass überhaupt »eine Sprache
da ist«65, suszeptibel und ›vermögend‹, das immer komplexer werdende Selbstver-
ständnis des Menschen und seine ›Stellung im Kosmos‹ auf der Höhe unserer Zeit
60 Schiller: Was heißt und zu welchem Ende, S. 366f. – Knapp zwei Monate später brach die
Französische Revolution aus, in deren Folge sich die »Hausgenossen« der »europäische[n]
Staatengesellschaft« in Bürger- und Koalitionskriege, in imperialistische Eroberungskriege
und ›Völkerschlachten‹, sodann in nationalistisch, ökonomisch oder auch ideologisch-rassis-
tisch motivierte Welt- und Vernichtungskriege gestürzt haben!
61 Mitchell hat in seiner Picture Theory, S. 5, wohl zu Recht herausgestellt, dass »all media are
mixed media, all representations are heterogeneous«!
62 Breidbach: Lesen, S. 202. Davon abgesehen gilt, was Gadamer in Wahrheit und Methode,
S. 9, unter Bezugnahme auf Hegels Philosophische Propädeutik, § 41–45, festgehalten hat,
dass nämlich »die Philosophie ›die Bedingung ihrer Existenz in der Bildung hat‹, und wir
fügen hinzu: mit ihr die Geisteswissenschaften«, die Philologie demnach eingeschlossen.
»Denn das Sein des Geistes ist mit der [textbasierten] Idee der Bildung wesenhaft ver-
knüpft.«
63 Spengler: Der Untergang des Abendlandes, Bd. 1 [1923], S. 23f.: »Ich nenne dies dem heuti-
gen Westeuropäer geläufige Schema [der historischen Periodisierung in ›Altertum – Mittelal-
ter – Neuzeit‹], in dem die hohen Kulturen ihre Bahnen um uns als den vermeintlichen Mit-
telpunkt alles Weltgeschehens ziehen, das ptolemäische System der Geschichte und ich be-
trachte es als die kopernikanische Entdeckung im Bereich der Historie, daß in diesem Buche
ein System an seine Seite tritt, in dem Antike und Abendland neben Indien, Babylon, China,
Ägypten, der arabischen und mexikanischen Kultur […] eine in keiner Weise bevorzugte
Stellung einnehmen.«
64 Hölderlin: Im Walde. In: ders.: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe, Bd. 2, S. 326.
65 Hölderlin: Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes. In: ders.: Sämtliche Werke.
Stuttgarter Ausgabe, Bd. 4, S. 264.
F4717-Antonsen.indd 200 03.12.2008 11:05:04 Uhr
WAS HEISST UND ZU WELCHEM ENDE? 201
und Erkenntnis zu artikulieren, also neue Antworten auf die alten Fragen Kants zu
finden66, mit einem Wort Goethes: die Herausforderungen unserer durchgreifend
veränderten Weltansicht nicht nur »dichterisch […] gewältigen«67, sondern auch
lesen, deuten und verstehen zu können.
Eine solche Sprache kann naturgemäß nicht er-funden, sondern sie muss – nach
der (wohl auf Ulrich von Hutten anspielenden68) Devise Fausts69 – durch philolo-
gisches Studium mustergültigen Sprachgebrauchs wiedergewonnen, ausgebildet
und fortentwickelt werden. Dabei ist es, ebenso naturgemäß, der Höhenkamm
exemplarischer Texte von weltliterarischem Rang, an dem wir unsere verkümmern-
de Sprachfähigkeit zu schulen und zu messen haben: also der Kanon der großen
Dichter, Denker, Historiografen, Redner und wissenschaftlichen Prosaisten70; jene
Werke, die schon Horaz, ohne darum (und ebenso wenig wie ich selber) ein lauda-
tor temporis acti zu sein, »mit fleißiger Hand bei Nacht und bei Tage«71 hin und her
zu wenden empfohlen hat.
Sollte ich mit diesen »Gedanken, die ungeheure Stelzschritte machen und die
Erfahrung [vielleicht] nur mit winzigen Sohlen berühren«, unwillkürlich entschlei-
ert haben, dass mit mir »etwas nicht in Ordnung« ist, obzwar der »Gedankenflug«
mein »Beruf ist und [m]eine Einkommensquelle«, so tröste ich mich damit, zu je-
ner ›Spezies‹ von »Luft–Schifffahrer[n] des Geistes« zu gehören, für deren »hoch-
fliegende Gedanken« man, so Musils Ulrich, »eine Art Geflügelfarm geschaffen
[hat], die man Philosophie, Theologie oder Literatur nennt«: Einen – weitgehend
– windgeschützten Biotop, in dem ich mich wohlfühle, solange ich, wie »die Droh-
nen«, »ein der Wollust und dem Geist gewidmetes Leben führen«72 kann.
66 Vgl. Kant: Logik, S. 25: »Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung läßt
sich auf folgende Fragen bringen: 1) Was k a n n i c h w i s s e n ?
2) Was s o l l i c h t h u n ?
3) Was d a r f i c h h o f f e n ?
4) Was i s t d e r M e n s c h ?
Die erste Frage beantwortet die M e t a p h y s i k , die zweite die M o r a l , die dritte die R e -
l i g i o n und die vierte die A n t h r o p o l o g i e . Im Grunde könnte man aber alles dieses
zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen.«
67 Goethe: Bedeutende Fördernis, S. 188.
68 Vgl. dazu Dichtung und Wahrheit, IV, 17, S. 248, wo Goethe die entsprechende Wendung
aus Huttens berühmtem Brief an Willibald Pirckheimer vom 25. Oktober 1518 (: sed quid-
quid horum est, proprium non habemus nisi nostris quibusdam meritis illud nobis conciliemus)
folgendermaßen übersetzt: »aber was auch deren [: der Vorfahren] Wert sei, ist nicht unser
eigen, wenn wir es nicht durch Verdienste erst eigen machen«. – (In Albrecht Schönes Faust-
Kommentar stillschweigend übergangen.)
69 Vgl. Goethe: Faust v. 682f.: »Was du ererbt von deinen Vätern hast / Erwirb es um es zu be-
sitzen.«
70 Ein neuerer Vorschlag von Lamping u. Zipfel: Was sollen Komparatisten lesen?
71 Horaz: Ars poetica, v. 173 (: ›Lobredner vergangener Zeiten‹) u. v. 268f. (: vos exemplaria
Graeca / nocturna versate manu, versate diurna).
72 Nietzsche: Morgenröthe, S. 331, sowie Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, S. 358f.
F4717-Antonsen.indd 201 03.12.2008 11:05:04 Uhr
202 JÜRGEN SÖRING
Denn das Entscheidende bleibt doch, was schon Montaigne für »das Wichtigs-
te« gehalten hat, nämlich als Philologe »Lust und Liebe zur Sache«: zur Literatur
und Dichtung, »zu wecken«73, die ja in ausgezeichneter Weise Poiesis einer (als
sprachliche Artikulation immer auch sich zum Gegenstand machenden) Selbst-,
Welt- und Transzendenz-Erfahrung ist, die die Bedingung, Verfassung und Bestim-
mung unseres Daseins in Natur und Geschichte nach ästhetischen Grundsätzen
durch Mimesis, Imagination und Reflexion darzustellen, zu erkunden und zu deu-
ten, das aber heißt: Wirklichkeit überhaupt erst in einem Leib, Seele und Geist
umfassenden Sinn (: rühmend oder klagend, Sinn stiftend oder zerstörend, sati-
risch übertreibend oder ironisch in der Schwebe haltend, humorvoll relativierend
oder grotesk verzerrend, fantasmagorisch fingierend, kritisch auf Veränderung
dringend oder sachlich benennend) erfahrbar zu machen und auf diese Weise den
Leser zu bezaubern (khleîn) und zu erfreuen (delectare), zu belehren (docere) und
zu erbauen (oÎkodomeîn), zu verblüffen (épater), zu verwirren (confundere) oder
gar zu verstören (perturbare): in jedem Fall aber zu bewegen (movere) und zu ver-
wandeln (metamorfoÿn), zu erheben (ÿqoÿn) und zu läutern (kaJari{zein)
sucht.
73 Montaigne: Essais, S. 177: »Pour revenir à mon propos, il n’y a tel que d’allécher l’appétit et
l’affection, autrement on ne faict que des asnes chargez de livres. On leur donne à coups de
foüet en garde leur pochette pleine de science, laquelle, pour bien faire, il ne faut pas seule-
ment loger chez soy, il la faut espouser«: »Ich fasse das Hauptergebnis […] nochmals zusam-
men: das Wichtigste ist, Lust und Liebe zur Sache zu wecken; sonst erzieht man nur gelehrte
Esel, und man erreicht nur, daß sie einen Sack voll toten Wissens, das ihnen eingeprügelt ist,
mit sich herumtragen; aber man darf das Wissen, wenn es richtig wirken soll, nicht nur in
sich anhäufen, es muß ganz unser eigen werden.« (Montaigne: Die Essais, S. 97)
F4717-Antonsen.indd 202 03.12.2008 11:05:04 Uhr
Thomas Sprecher (Zürich)
SPUREN
Erfreuend und ehrenvoll ist der Auftrag, für die Festschrift eines Hochverdienten ein
Feld zu durchwandern, auf dem die wundervollsten Blumen blühen, und dabei nach-
zusinnen über die Frage »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Literaturwis-
senschaft?« Natürlich studiert man aus Freude, Neugier und Not, wie denn nicht. Ge-
rechte Beobachter mögen immerhin einwerfen, dass man Mannigfaches mit Fug diesem
Wort noch zur Seite stellen dürfe, ja müsse, und ohnehin werden es die Brotgelehrten
anders wissen als die realexistierenden Anfängerinnen. So seien denn doch etwas größere
Ausführlichkeit und Einlässlichkeit am Platze. Im Formalen erlaube der so willkomme-
ne Anlass, von strenger wissenschaftlicher Besinnung ausnahmsweise abzusehen, Würfel
und Karten aufzunehmen, elastisch-fußnotenfreie, im Üchtland wohlgelittene Formen
ins Spiel zu bringen und der Fülle des Dargebrachten als ernste Scherze festlich anzufü-
gen.
Hoch in die Luft fliege ich und segle in alle Meeresunendlichkeit. Ich leide in poli-
tischen Systemen. Menschliche Zustände der schönsten und schlimmsten Art wer-
den mir unter die Haut getrieben. Lesen und Lernen verschmelzen. Zonen und
Zeiten überbrückend, schafft Literatur Gegenwärtigkeit. Im Austausch überwin-
den die Menschen die Grenzen von Geburt, Tod und Individualität; er leitet sie
hinüber in die Gattung. Und das Ich erfährt: Das alles kann dies Leben auch noch
bieten! Literatur ist eine unglaubliche Befreiung von der Last der Gegebenheiten,
der kruden Materie, den erbärmlichen Mühlen des Alltags.
Aufgehoben im Rhythmus der Sprache, verlangt man nach keinen anderen Urmüt-
tern mehr.
Texte schaffen Räume, Reiche, Welten. Kein Autor ohne demiurgischen Zauber.
Je bedeutender ein Text, um so weniger sind die Fragen, der er spannt, einer Lö-
sung zugänglich, nach dem Muster der Bibel. Davon leben die Literaturwissen-
schaftler.
Literatur als Schulung des Möglichkeitssinns: Noch die realistischste Erzählung
steht kategorisch auf dem Boden der Unwirklichkeit, behauptet die kantianische
Autonomie des Ästhetischen. Sie ist nie wirklich geworden und wird es nie werden.
Sie kommt nicht vom Wirklichen her und geht nicht aufs Wirkliche zu.
F4717-Antonsen.indd 203 03.12.2008 11:05:04 Uhr
204 THOMAS SPRECHER
Braucht schon das Lesen viel Zeit, so verbindet sich das Schreiben mit noch größe-
rer Langsamkeit. Es lässt sich nicht industrialisieren. Die Manufaktur der Produk-
tion stößt auf natürliche Grenzen: der täglichen Energie, Schreibfrische; der Le-
benszeit. Auch dieses Gut macht Knappheit kostbar.
Es schadet in der Regel nicht, einem Text interpretatorisch zu Leibe zu rücken mit
dem Pathos des Erlösers. Endlich soll er ins rechte Licht gestellt werden, unter der
Sonne der richtigen Deutung aufblühen! Aber erträglich ist dies meist nur durch
Ironie.
Der liebe Gott hat den deutschen Professor geschaffen und der Teufel den Kolle-
gen. Diesen Witz habe ich noch von jedem deutschen Professor gehört.
Literaturgeschichten: Vom Mikrokosmos innerfiktionaler Sinngebilde zum Mak-
rokontext von Epochenspezifika; und umgekehrt. Literaturgeschichtsschreibung
rückt die einzelnen Texte in einen Zusammenhang. Diese Einteilungen sind relativ
richtig und absolut falsch.
Kein Text ohne Kontext. Der Kontext liefert Erklärungen und schränkt die strah-
lende Ungebundenheit des Textes ein. Er bindet ihn, aber wo eigentlich – am Bo-
den?
Dass das Hirn des Menschentiers über das Tierische hinaustreibt, ist Fluch und Se-
gen. Zum übertierischen Gehirn gehört das Sprachvermögen, die Fähigkeit, zu
sprechen und gesprochene Sprache zu verstehen. Später fand der Mensch zur
Schriftlichkeit. Im Gegensatz zum Gesprochenen hielt sich das Geschriebene in der
Zeit. Es wurde vernommen auch von Menschen, die weit weg, ja die noch nicht
einmal geboren waren, als der Schreiber es schrieb. Das eröffnete fantastische Mög-
lichkeiten. Über Zeit und Raum hinweg konnte man, im Medium der Schrift, ge-
hört werden; konnte man hören. Gleichzeitig führte die Verschriftlichung zu ande-
ren Qualitäten. Die Schrift entkörperlichte die Rede. Sie löste sich vom sprechenden
Menschen. Der Autor trat zurück. Wer las, wusste so genau nicht mehr, wer ge-
schrieben hatte. Er wusste es weit weniger als jener, der hörte. Schon die mündliche
Sprache hatte die Möglichkeit geboten, vom Austausch des praktischen Lebens ab-
zusehen und ästhetischen Mehrwert zu schaffen, Kunstformen, die für sich standen
und gar keinen konkreten Zweck verfolgten, Lieder, Gedichte. Die Schrift vermehr-
te diese Formen. Und seltsam: Sie hielten sich und florierten. Die Menschen lebten
mit ihnen, liebten und pflegten sie. Ohne ein tiefes, anhaltendes, existentielles Be-
dürfnis nach Sprachkunstwerken wären sie unfehlbar verworfen worden. Was nicht
gefällt, fällt. Aber Literatur gehört zu dem Unnötigen, auf das die Menschen drin-
gend angewiesen sind. Wo Notdurft überwunden ist, tut das Zwecklose Not.
Die Literaturwissenschaft geht in den Akademien nicht auf. Die akademische Lite-
raturwissenschaft muss das tun, was sie besser kann als alle anderen.
F4717-Antonsen.indd 204 03.12.2008 11:05:04 Uhr
SPUREN 205
Selbstverständlich haben auch Dichter ihren Markt. Sich mit Kafka, Celan, Max
Frisch, Robert Walser, Bachmann zu befassen, hat noch keine akademische Karrie-
re verdorben. Andere Autoren, wie Hermann Hesse, scheinen geschäftsschädigend
zu sein. Da macht sich langlebiger Dünkel geltend. Die Identifikation von Autor
und Interpret hat das Kindische nie verlassen.
Hüte dich vor literaturwissenschaftlichen Prägungen, die wie Reliquien verwendet
werden (»Postmoderne«, »Horizontverschmelzung«, »Intertextualität« …)!
Es ist möglich, verschiedenen literaturwissenschaftlichen Positionen Recht zu ge-
ben, auch wenn sie einander auszuschließen scheinen, etwa indem sie als komple-
mentär verstanden werden.
Zum Spannendsten gehört immer das Verhältnis von Text und Interpretation, von
Partitur und Imagination. Wie bewahrt man das Heilige, durch Werktreue oder
durch Anpassung, Neuschaffung? Hier die Religionsgründer, die Dichter, die Stif-
ter, dort die Päpste, die Exegeten, die Regisseure, die Umsetzer, die Archivare, die
Stellvertreter und Großsiegelbewahrer in den Nöten einer veränderten Welt, vor
ahnungslosem Publikum, vor renitenter Herde. Gut, wo die Deutungshoheit, die
doch nie außerintellektuell begründbar ist, wenigstens politisch-institutionellen
Halt findet. So lässt sich das argumentative Welken etwas aufhalten.
Lesen soll keine Abkehr von der Wirklichkeit sein, sondern zu ihr hinleiten. Man
soll sich in die Welt lesen. Lesen bewirkt einen Zuwachs an Wirklichkeit und kul-
turellem Gedächtnis. Was übrigens weiß die heutige Literatur vom Leser? Wie lässt
sich die alte Lesekultur unter den Bedingungen der neuen Informationstechnolo-
gie in die Zukunft überführen?
Das Zeitalter der Exklusivität ist längst vorbei. Das Lesen von Büchern wird nicht
nur von Literaturwissenschaftlern Erklärungen zugeführt, sondern auch
von Psychologen, Neurowissenschaftlern und Moralisten. Das spricht nicht ge-
gen die Literaten. Sie beziehen ihr Rüstzeug ja auch von Nachbarwissenschaften.
Multidisziplinarität ist im Übrigen kein Ziel, sondern ein Mittel zur Problemlö-
sung.
Wer sich einzig um sich selber dreht, ist nicht wirklich unterwegs.
Die Literaturwissenschaft zersplittert in hundert Sub- und Subsubdisziplinen. Zu-
letzt ist jeder Philologe eine wandelnde Sparte für sich. Ich habe einmal sogar er-
lebt, wie sich ein Linguist hart an der Wandtafel in zwei Schulen aufgeteilt und für
beide neue Begriffskaskaden aus der Luft gegriffen hat. Übrigens sind nicht alle
diese neuen Fächer und Fächlein Moden, geboren aus Verdruss und Langeweile,
Narzissmus und Müßigkeit.
F4717-Antonsen.indd 205 03.12.2008 11:05:04 Uhr
206 THOMAS SPRECHER
Der Interpret nähert sich dem Text mit verschiedenen Posen: Er gibt den Jäger und
schlachtet ihn nach erfolgreichem Abschuss aus. Er ist Sammler und legt ihn wie
eine primula elatior ins Schulheft der flachgepressten Blumen.
Die Literatur muss sich nicht an die Theorie halten, und es schadet ihr nicht, so zu
tun, als bedürfte sie ihrer nicht.
Man studiert Germanistik, weil man von Physik nichts versteht, Fremdsprachen zu
schwierig findet, die Juristerei zu trocken. Aber keine Studienwahl darf faute de
mieux erfolgen. Der Weg des geringsten Widerstandes ist nie der Königsweg.
Das Literaturstudium lässt es etwas schwerer fallen, nur naiver Leser zu sein. Die
Rätselhaftigkeiten des Lesens bleiben, aber sie haben nun studierte Gründe.
Bücher bleiben länger am Leben als Menschen und leichter als die meisten Gegen-
stände. So werden sie zu Zeugen von Zeiten. Sie bewahren Vergangenheiten auf
und schützen sie vor dem gänzlichen Vergessenwerden. Das Gegenwärtighalten ist
die Form des Ernstes, den jedes Heute dem Frühern schuldet, auf dem es zuletzt
doch steht. Der Umstand allein, dass Menschen und Zeiten sterben, entwertet sie
nicht. Handlungen und Gefühle behalten ihre Würde. Im Medium der Literatur
wird das ferne Pathos glaubwürdig. Was bleibt also, ist das Buch, als Rest und
Spur.
Ein gutes Buch weckt Glücksgefühle. Keine Angst! Die Antwort auf die Frage, wes-
halb es dies tut, trübt das Glück nicht, sondern vermehrt es. Man kann mit einem
Sprachwerk unendliche Probleme und unendliche Freude haben.
Anderes und anders wird immer gelesen an den Schulen. Nichts schwankender als
der Kanon.
Die Großkritiker sind nicht allein schuld an der Lächerlichkeit ihrer Prätention.
Immer sind literaturtheoretische Überlegungen Auslöser von frischer Polemik ge-
wesen. Was hat man nicht über die spezifische Qualität literarischer Texte gestrit-
ten, über Kriterien für überzeugende Interpretationen. Debatten und Kontroversen
beleben das Geschäft, darum fördert sie das Feuilleton. Zuviel Konsens ist aber
auch wissenschaftlich schädlich. Allerdings leistet nicht jede Dissensbildung Fort-
schritt, und Ad-personam-Invektiven tun es in den seltensten Fällen. Zur germa-
nistischen Umgangsformenlehre gehören: höfliche Artikulation des Widerspruchs;
Einsicht in die Koexistenz des Unverträglichen; kunstvolles Schattenboxen, gesitte-
te Lufthieberei; Grundkenntnisse in der rhetorischen Ballistik; Übersicht über die
Morphologie dezenter Bosheit.
Denn sie wissen nicht, was sie lesen.
F4717-Antonsen.indd 206 03.12.2008 11:05:04 Uhr
SPUREN 207
Die Praxis des Interpreten und die Theorie der Interpretation halten sich nicht im-
mer auf einer Höhe.
Trau keiner Besprechung, die du nicht selbst gefälscht hast.
Wie Männer sein sollen und wie sie nicht sein sollen. Was wir verlangen müssen.
Worüber man schweigen soll. Wie man mit Frauen auf keinen Fall umgehen soll,
jedenfalls nicht mit verheirateten. – Niemand erzieht besser als Literatur.
Wider die Militanz in der Literaturwissenschaft. Schulen, die einander totschlagen
wollten, haben noch immer der Lächerlichkeit in die Hand gearbeitet.
Literatur darf alles. Es gibt keine Instanz, die ihr etwas verbieten dürfte noch über-
haupt könnte. Manche Literaturwissenschaftler sind deswegen von ihrem Gegen-
stand schwer beleidigt.
Von der Promiskuität der Texte. Sofort treten sie in Verhältnisse. Sie zitieren andere
Texte, spielen auf sie an, führen sie fort, vermischen sich mit ihnen, stellen sich ge-
gen sie, lehnen sie ab. Gegen Bezüge und Vergleiche kann sich kein Text wehren. So
entsteht eine Milchstraße von Textsternen; Myriaden von Wortgebilden umwir-
beln einander. Die Literaturwissenschaft spielt die Sonne, die zwei Texte kuppelnd
erwählt, um ihr exegetisches Weihlicht auf sie fallen zu lassen.
Der Interpret stört die Intimität des Textes. Er rückt ihm nahe im Geiste der Ent-
jungferung. Er geht an ihn heran, als habe das noch niemand getan, als sei er der
erste und einzige. Da er dies aber meist nicht ist, muss er die Früheren ansprechen,
muss aussprechen, was sie richtig gemacht und verfehlt, was sie vergessen, überse-
hen, falsch gewürdigt haben. Die Liebhaber streiten sich über das richtige Liebha-
ben. Interpretation hat, nein: ist etwas Obszönes.
Literatur als Pflege des Wirklichkeitssinns: Sie schult die Fantasie für die Realität.
Der Interpret ist ein Idiot am Narrenseil, hoffnungslos auf falscher Fährte. Die
selbstsichere Botschaft des Textes ist: Ich bin stärker und reicher als alle Interpreta-
tion. Die Interpreten sind Turandotsche Prinzen: des Todes, wenn sie den Namen
der Prinzessin nicht wissen. Große Texte haben viele Skalpe am Gürtel.
Eines der farbigsten Felder der Literaturwissenschaft ist das Feuilleton. Man springt
auf dem Trampolin, immer schön in der Mitte, und zeigt staunenden Augen seine
großartige Sprungkraft. Und doch ist das Feuilleton noch gar nichts gegen das
Fernsehen. Natürlich geht es auch dort nie ums Ich, sondern stets nur um die Lite-
ratur, das beweisen die Preise, die massenmediale Bekanntheit zuverlässig regnen
lässt.
F4717-Antonsen.indd 207 03.12.2008 11:05:04 Uhr
208 THOMAS SPRECHER
Die Heiligkeit eines Sprachwerks kann ausfransen. Dann müssen die Editoren für
Ordnung im Textsakralen sorgen.
Welches der Auftrag der Literatur sei? Seltsame Frage. Wer dürfte ihr überhaupt
Aufträge geben?
Alle philosophischen Fakultäten kennen die ›Perlhuhnvorlesungen‹, in die ein
außeruniversitäres Publikum dankbar strömt. Sie seien für berechtigt gehalten,
schließlich zahlt das Volk den ganzen Betrieb. Andererseits muss der Verzicht auf
die Bedienung des städtischen Bildungsbürgertums nicht in Sterilität, Humorlosig-
keit, Unverständlichkeit enden.
Die Kunst hat sich nicht endlich vom Überbau der Religion gelöst, um sich an den
Unterbau des Banalen zu ketten.
Dadaistische Einschüsse in dogmatischen Systemen, ob gewollt oder nicht, dienen
der Durchlüftung und diätetischen Bekömmlichkeit.
Literatur ist nicht für jedes Menschenalter dasselbe. Ein und derselbe Text wird zu
verschiedenen Zeiten von verschiedenen Menschen anders verstanden. Diese Er-
kenntnis ist ein Ausgangspunkt.
»Besseres Verständnis von Texten führt zu besserem Verständnis der Welt; und um-
gekehrt.« Die Trivialität dieser These besticht, betört, betrügt.
Man studiert, um sich die Mittel zur Arbeit zu erwerben. Einsatz, Umsetzung des
Gelernten ist alles. ›Arbeit‹ ist indes nicht nur Lehre und Forschung, sondern Le-
bensvollzug.
Hüte dich vor den Heiligen! Auch das eine wissenschaftsimmanente Verpflichtung
zur Skepsis und Fragekultur.
Die Qualität der Lehrer in Ehren − aber um eigene Lektüre kommt man nicht her-
um. Wer nicht liest, muss sich nicht mehr entscheiden, ob er Literaturwissenschaft
studieren soll. Nichtlesen ist unter allen Umständen die falsche Antwort auf die
herausfordernde Utopie des panoramischen Überblicks.
Jede Literaturgeschichte auf der Höhe der Zeit schafft Anlass, sich von ihr abzusto-
ßen. Jedes literaturwissenschaftliche Buch ein Grab, über das hinweg es doch im-
mer nur vorwärts gilt.
Literaturwissenschaft als Therapie? Hängt vom Patientengut ab, der sanitarischen
Essenz der Studierenden.
F4717-Antonsen.indd 208 03.12.2008 11:05:04 Uhr
SPUREN 209
Literatur als Schule der Beweglichkeit, auch für außerliterarische Berufe. Das Lite-
raturstudium durchdringt mit dem Wissen darum, dass alle Positionen der Verän-
derbarkeit ausgesetzt sind. Ins Moralische gewendet handelt es sich um eine Schule
der Toleranz.
Die meisten literarischen Werke leben vom Hörensagen.
Kenntnisse belohnen wohl durch sich selbst; aber man lebt nur, wenn klingender
Lohn dazukommt.
Die massenfachliche Brotlosigkeit der Germanistik als factum brutum. Bei ihr ist es
besonders falsch, sich erst am Ende des Studiums heilig-nüchtern zu fragen, was
man nun tun soll. Allerdings studiert man Literaturwissenschaft nicht zwingend,
um einen literaturwissenschaftlichen Beruf auszuüben.
Traue keiner Definition, auch nicht jener der Literaturwissenschaft! Definiere
selbst! Dann kommt das Misstrauen von selbst.
Geistig ist das Literaturstudium fast immer fremdfinanziert.
Transparenz und Enigma fallen manchmal zusammen. Es soll aber eine sachgemä-
ße Rätselhaftigkeit sein.
Im Unterschied zu anderen Wissenschaften können in der Literaturwissenschaft
auch Theorien, die ihren Gegenstand nachweislich verfehlen, folgenlos weiter zu
Gehör gebracht werden. Im Umlauf ist also immer einiges Falsches. Der Markt
versagt, da er Spreu und Weizen nicht zu trennen vermag, und verweist das litera-
turwissenschaftliche Individuum auf seinen Kopf.
Auch in der Literaturwissenschaft muss man durch viele Schulen gehen, denn nicht
jede Schule schult.
In seinen Göttern malt sich der Mensch, ja. In seinen Thesen malt sich der Do-
zent.
Das Kommen und Gehen der Germanisten. Die meisten Dichter überleben ihre
Deuter, und wenn Großkritiker nach Jahrzehnten der Dominanz von der Bildflä-
che endlich verschwinden, auf der zuletzt Pietät sie noch gehalten hat, schadet das
niemandem und ruft nicht nach Ersatz.
Der gesunde Menschenverstand ist, wie uns Descartes versichert, die bestverteilte
Sache der Welt. Daher ist es klug, dem auszuweichen, was man nicht kann, und
eine natürliche Scheu vor dem Risiko ist den Literaturwissenschaftlern, denen
F4717-Antonsen.indd 209 03.12.2008 11:05:04 Uhr
210 THOMAS SPRECHER
schon aus statistischen Gründen gesunder Menschenverstand nicht abgesprochen
werden darf, vielleicht angeboren. Aber sie haben doch gemeinhin viel zu große
Angst vor der Blamage. Welches Risiko geht denn ein, wer furchtlos im ohnehin
Ungesicherten, im letztlich durch alle Schulhaupthermeneutik nicht zu Sichernden
freie Schritte wagt? Wer entscheidet darüber, was verfehlt ist, mit welchem Recht,
und für wie lange könnte sich sein Urteil in Kraft halten? Originalität, die den
Fehlschlag in Kauf nimmt, ist höher zu schätzen als Absicherung auf allen Seiten.
Ein wenig würfelt doch immer, wer schreibt.
F4717-Antonsen.indd 210 03.12.2008 11:05:04 Uhr
Elisabeth Stuck (Bern und Fribourg)
LITERATURWISSENSCHAFT UND HÖRÄSTHETIK.
MEDIENGESCHICHTLICHE VERÄNDERUNGEN IN
SELBSTREFERENZIELLEN HÖRSPIELEN
»Was heißt und zu welchem Ende studiert man Literaturwissenschaft?« lautet der
anspielungsreiche Titel dieser Festschrift. Versteht man unter ›Literatur‹ Texte in
verschiedenen medialen Darbietungsformen wie auditiv wahrnehmbare literarische
Gattungen, muss die Auseinandersetzung mit der Frage, was denn unter Literatur-
wissenschaft zu verstehen sei, Klärungen von hörästhetischen und von medienge-
schichtlichen Fragestellungen ebenfalls enthalten. Der vorliegende Beitrag be-
stimmt die grundlegenden Elemente einer Hörästhetik und konkretisiert diese am
Beispiel von selbstreferenziellen Hörspielen.
An der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Literatur zum Hö-
ren lässt sich zum einen aufzeigen, welche theoretischen Aspekte für den Umgang
mit Medientexten relevant sind. Zum andern lässt sich an der auditiv wahrnehm-
baren Literatur darlegen, welche mediengeschichtlichen Aspekte eine wichtige Rol-
le spielen. Im folgenden Beitrag wird in einem ersten Teil ein theoretischer Rahmen
für die wissenschaftliche Untersuchung von Literatur zum Hören skizziert; der
zweite Teil zeigt am Beispiel von selbstreferenziellen Hörspielen – das heißt von
Hörspielen, die produktions- und rezeptionsästhetische Bedingungen von ›elektro-
akustischer Kunst‹ spielintern thematisieren1 – auf, wie sich mediengeschichtliche
Veränderungen in der Literatur zum Hören niederschlagen. Nicht zuletzt ergreife
ich in dieser Festschrift gern die Gelegenheit, meinem akademischen Lehrer und
Kollegen Stefan Bodo Würffel, der als Hörspielforscher und ausgewiesener Hör-
spielexperte2 die literaturwissenschaftliche Untersuchung des deutschsprachigen
Hörspiels maßgeblich geprägt hat, mit einem Beitrag zur auditiv wahrnehmbaren
Literatur zu gratulieren.
1. Elemente einer literarischen Ästhetik des Hörens
Welches sind die ästhetischen Aspekte, mit denen sich Hörtexte bestimmen und
beschreiben lassen? Zur Beantwortung dieser Frage wird das Hören herausgegriffen
und als ästhetische Kategorie vorübergehend isoliert. Denn Überlegungen zur Äs-
thetik des Hörens sind nicht nur für den Umgang mit literarischen Kunstwerken,
die in der Rezeption allein auf die auditive Wahrnehmung gerichtet sind, angezeigt,
sondern auch für literarische Werke, die sich sowohl visueller wie auch auditiver
1 Vgl. Huwiler: Erzähl-Ströme, S. 16.
2 Würffel: Hörspiel, u. ders.: Ausnahmezustände und Aufnahmezustände.
F4717-Antonsen.indd 211 03.12.2008 11:05:04 Uhr
212 ELISABETH STUCK
Zeichensysteme bedienen. Die neueste Entwicklung in der digitalen Literatur zeigt
zum Beispiel, dass die akustische Ebene zunehmend wichtiger wird. Waren die frü-
hen Beispiele digitaler Poesie vor allem auf visuelle Elemente konzentriert, finden
wir heute auch zunehmend Installationen, welche die akustische Ebene nutzen. Ich
greife heute das Hören auch aufgrund theoretischer Überlegungen heraus: Neuere
kognitive Theorien und psycholinguistische Studien gehen davon aus, dass auditi-
ve und visuelle Zeichen unterschiedlich verarbeitet werden und dass es anschlie-
ßend zu einer Integration der beiden Ebenen kommt. Mit Bezug zu diesen kogniti-
onswissenschaftlichen Überlegungen, die auch in neuere Ansätze des multimedia-
len Lernens einfließen, sei hier signalisiert, dass mit dem Herausgreifen des Hörens
nicht ein Primat des Hörens für den Umgang mit Literatur postuliert wird. Solche
Versuche, die dem Hören den Vorrang zuschreiben wollen, gab es in den letzten
Jahrzehnten auch. Am weitesten in diese Richtung gehen die Plädoyers von Joa-
chim Ernst Berendt, der mit Publikationen wie Ich höre, also bin ich3 die Vorrang-
stellung des Hörens vor dem Sehen immer wieder emphatisch verteidigt hat. Ich
betrachte hingegen das Hören als Ergänzung zum Lesen und schließe mich damit
einer Forderung an, die Eduard Sievers schon 1912 aufgestellt hat: Die beim Still-
Lesen zum Zuge kommende »Augenphilologie« ist zu ergänzen mit einer »Sprech-
und Ohrenphilologie«4. Im Folgenden werden als theoretischer Bezugrahmen der
Hörästhetik die Rhetorik, die Prosodik und die Semiotik herangezogen.
Die auditive Sprachwahrnehmung spielt seit der Antike in der Rhetorik eine zen-
trale Rolle. Rhetorische Schriften aus der Antike wie zum Beispiel die Rhetorik von
Aristoteles behandeln neben dem Redner und der Rede auch den Hörer. Für das
hier aufgeworfene Thema besonders relevant sind rhetorische Überlegungen, wel-
che die auditive Sprachwahrnehmung mit der visuellen vergleichen. Isokrates, der
mehrere Schriften zur Rhetorik verfasst hat und auch eine Rhetorik-Schule leitete,
wirft zum Beispiel die Frage auf, ob das Lesen oder das Hören die geeignete Rezep-
tionsform von schriftlich konzipierten Texten sei. Isokrates postuliert auch eine
grundsätzliche qualitative Unterscheidung zwischen Hören und Lesen: Die visuelle
Sprachwahrnehmung bildet die Grundlage für ein kritisches und vertiefteres Text-
verständnis; der auditiven Sprachwahrnehmung hingegen schreibt er die leichtere
Beeinflussbarkeit zu. Hören ist laut Isokrates nicht über die Ratio gesteuert, son-
dern unterliegt irrationalen Prozessen.5
Für eine Ästhetik des Hörens interessant ist die mittelalterliche Predigt-Rheto-
rik. Die ars praedicandi greift die auditive Sprachwahrnehmung stärker aus der Per-
spektive des Hörers auf als die antike Rhetorik, die den Erfolg des Redners in seiner
Wirkung auf das Publikum in den Vordergrund gestellt hatte. Bei Thomas von To-
di, der im späten 14. Jahrhundert gewirkt hat, finden wir zum Beispiel Anleitungen
3 Vgl. Berendt: Ich höre, also bin ich.
4 Sievers: Rhythmisch-melodische Studien, S. 78.
5 Vgl. Usener: Hörer.
F4717-Antonsen.indd 212 03.12.2008 11:05:04 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT UND HÖRÄSTHETIK 213
für die Rhythmisierung des Predigttextes.6 Mit solchen rhetorischen Regeln ver-
folgt Thomas von Todi das Ziel, das Ohr des Hörers zu erfreuen.
In der Neuzeit kommt es zu dem Zeitpunkt, als mit der zunehmenden Verbrei-
tung von gedruckten Texten auch das stille Lesen zunimmt, zu einer lebhaften Dis-
kussion der ästhetischen Qualität des Hörens und des Lesens. Ende des 18. Jahr-
hunderts fordert zum Beispiel Wieland, dass Dichtung laut zu lesen sei. Heinrich
von Kleist pflegte seine literarischen Texte zu erproben, indem er sie einem kleinen
Kreis von Zuhörern laut vortrug und die Texte kritisieren ließ. In diese Zeit und in
diesen Kreis gehört auch eine interessante rhetorische Schrift, die für eine differen-
zierte Hörkultur wirbt. Adam Müller widmet sich innerhalb seiner 1816 erschiene-
nen Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland ausführlich
dem Hören und überschreibt eine dieser Reden mit dem Titel Die Kunst des Hö-
rens7.
In der Literaturwissenschaft gilt die rhetorisch-stilistische Analyse der Klang-
struktur von Texten insbesondere in der Gedichtanalyse seit langem als anerkannte
und in der schulischen und universitären Lehre viel praktizierte Methode. Von da-
her ließe sich einwenden, dass die Forderung nach einer rhetorisch orientierten
Hörästhetik schon längst eingelöst sei. Nur wenig verbreitet ist hingegen eine per-
zeptionsorientierte Rhetorik von Literatur zum Hören. In der kognitiven Litera-
turwissenschaft gibt es einzelne Bestrebungen, die auditive Wahrnehmung von rhe-
torischen Elementen, wie zum Beispiel die Wirkung von Lautwiederholungen, zu
beschreiben. Reuven Tsur, Vertreter einer kognitiven Poetik, greift auf die Erkennt-
nisse der linguistischen Erforschung der gesprochenen Sprache zurück und integ-
riert diese in ein wahrnehmungsorientiertes Modell für den Umgang mit literari-
schen Klangstrukturen. Diese kognitive Modellierung von rhetorischen Elementen
dient auch der kritischen Überprüfung von Zusammenhängen zwischen Klang
und Bedeutung. So überprüft Tsur zum Beispiel mit diversen empirischen Unter-
suchungen den Bereich Lautsymbolik. Die Aussage, dass gewisse Laute eine be-
stimmte Bedeutung haben, ist eine weit verbreitete Lehrmeinung, die sich bisher
einzig auf intuitive Annahmen stützte. Tsurs Untersuchungen bieten hier eine in-
tersubjektiv überprüfbare Basis für differenzierte Aussagen über Zusammenhänge
zwischen Laut und Bedeutung im Kopf des Hörers.8
Neben der Rhetorik ist für eine Ästhetik des Hörens als zweiter Aspekt das Ge-
biet der Prosodik, das von der Linguistik und der linguistischen Poetik bearbeitet
wird, von Bedeutung. Prosodie, das heißt das ›Dazu-Gesungene‹, betrifft die Into-
nation, das Sprechtempo (dazu zählen auch Pausen), Akzente, Rhythmus und an-
dere Elemente der individuellen Sprechweise des Vortragenden wie zum Beispiel
regionale Färbungen der Satzmelodie. Die Prosodik bietet die Möglichkeit, sich
mit Phänomenen der akustischen Sprachperformanz und Sprachperzeption ratio-
nal auseinanderzusetzen. Prosodia rationalis: Or an essay towards establishing the me-
6 Die Informationen zu Thomas von Todi stammen aus Murphy: Rhetoric in the Middle Ages.
7 Vgl. Müller: Reden über die Beredsamkeit.
8 Vgl. Tsur: Sound Patterns.
F4717-Antonsen.indd 213 03.12.2008 11:05:04 Uhr
214 ELISABETH STUCK
lody and measure of style lautet programmatisch der Titel einer 1779 veröffentlich-
ten Schrift, worin Joshua Steele sich der englischen Prosodie widmet.9
Für das Deutsche arbeitet Karl Philipp Moritz die erste Prosodie aus, in der er als
grundlegende Erkenntnis die Relativität der Akzentsetzung festhält. Diese relatio-
nale Bestimmung des Akzents spielt auch in der linguistischen Erforschung der
Prosodie eine Rolle.
In den 1990er Jahren ist eine auffällige Intensivierung der linguistischen Erfor-
schung von prosodischen Elementen zu verzeichnen. Dies hängt damit zusammen,
dass auch Messverfahren für die supra-segmentalen Elemente entwickelt worden
sind. Wichtige Erkenntnisse für eine Ästhetik des Hörens in der Literaturwissen-
schaft bieten Studien, die diese neuen Erkenntnisse in der Prosodik mit einem kog-
nitiven Ansatz verbinden und prosodische Elemente wie den Rhythmus über die
akustische Performanz definieren und untersuchen.10
Für literarische Genres, die sich neben dem sprachlichen Zeichensystem noch
anderer Zeichensysteme bedienen, bietet die Semiotik einen wichtigen theoreti-
schen Bezugsrahmen. Insbesondere für die Erfassung des Performativen hat sich
ein zeichentheoretischer Zugriff auf Literatur als erhellend erwiesen. Eine Semiotik
des Theaters, wie sie beispielsweise von Erika Fischer-Lichte11 vorgelegt wurde, bie-
tet Beschreibungskategorien für die verschiedenen Zeichensysteme, die in einer
Aufführung auf der Bühne zum Zuge kommen. Bei Hörspielen handelt es sich um
eine akustisch wahrnehmbare Performanz. Die Hypothese liegt nahe, dass sich zei-
chentheoretische Differenzierungen für die Hörästhetik ebenfalls lohnen. Im Be-
reich des Hörspiels, wo eine akustische Performanz von verbalen, para-verbalen
Zeichen und von nonverbalen Zeichen wie Ton und Geräusch vorliegt, verspricht
ein semiotischer Ansatz Erkenntnisse über Formen und Funktionen der verschie-
denen Zeichensysteme. Manfred Schmedes hat eine Hörspielsemiotik vorgelegt,
die eine Grundlage für die Differenzierung des Gehörten bietet.12
Die ästhetischen Möglichkeiten von Hörspielen sind seit dem Beginn der Gat-
tungsgeschichte ein wichtiges Thema, das in zahlreichen Hörspielen spielintern
immer wieder aufgegriffen wurde. Die Ausschaltung des Gesichtssinns findet sich
in vielen Kunstwerken, die auf akustischen Zeichensystemen beruhen. Das Vorfüh-
ren der Tatsache, dass man nicht sehen kann, tritt bereits im ersten Beispiel aus der
Geschichte des Hörspiels auf. Das von Richard Hughes verfasste Hörspiel mit dem
Titel A Comedy of Danger (1924) beginnt mit dem Ausgehen des Lichts bei einem
Grubenunglück. Gleich zu Beginn wird spielintern vorgeführt, dass die Ausblen-
dung des Gesichtssinns auch die äußere Kommunikationssituation der Gattung
Hörspiel prägt. Auch in späteren Phasen der Hörspielgeschichte finden wir Bei-
spiele dafür, dass der Ausfall der visuellen Wahrnehmung betont wird. So trägt et-
wa Urs Widmers erstes Hörspiel den Titel Wer nicht sehen kann, muß hören (1969).
9 Vgl. Steele: Prosodia.
10 Vgl. Küper: Meter, Rhythm and Performance.
11 Vgl. Fischer-Lichte: Semiotik, u. Fischer-Lichte: Performativität.
12 Schmedes: Medientext Hörspiel.
F4717-Antonsen.indd 214 03.12.2008 11:05:04 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT UND HÖRÄSTHETIK 215
Darin gehen mehrere Morde an Damen einer Teegesellschaft auf das Konto eines
keuchenden Geräuschs. Aus semiotischer Perspektive betrachtet wird hier eine
wichtige Figur auf ein para-verbales Geräusch reduziert. Da es sich dabei um den
Mörder handelt, ist dieses Geräusch nicht nur ein Mittel zur Figurenzeichnung,
sondern auch ein Handlungselement: Immer wenn dieses Keuchen ertönt, kommt
es zu einem Mord.
Neben dieser Betonung des akustischen Zeichensystems setzen einige Hörspiele
einen Schwerpunkt auf die Rhetorik, und zwar auf Dialogformen wie das Verhör.
Die dramatischen Möglichkeiten der Hörspielästhetik werden beispielsweise ge-
nutzt, um das Bedrängende und Manipulierende eines brutalen Verhörs zu zeigen.
So leitet die Ausblendung des Gesichtssinns in Peter Handkes Das Verhör (1969)
eine Handlung ein, in der dem Publikum die Ausübung von sprachlicher Macht
vorgeführt wird: Ein Mann wird überwältigt, indem ihm ein Mantel über dem
Kopf zusammengebunden wird. Diese Gewaltausübung erhält ihre Fortsetzung in
einem brutalen Verhör, dem dieser Mann unterworfen wird. Die Rhetorik dieses
Verhörs macht für die Rezipienten hörbar, dass hier ein Machtmissbrauch ge-
schieht, der mit sprachlicher Folterung gleichzusetzen ist.
An der für die Hörspielgeschichte wichtigen Wende zum Neuen Hörspiel am
Ende der 1960er Jahre kommt es ebenfalls zu bedeutsamen Thematisierungen der
ästhetischen Möglichkeiten des Hörspiels. So führt Wolf Wondratscheks Hörspiel
Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels von 1969 in aller Deutlichkeit eine De-
montage des traditionellen literarischen Hörspiels vor. Ein Chaos bei einer Hör-
spielproduktion steht im Zentrum eines weiteren Hörspiels aus dieser Zeit des Pa-
radigmenwechsels: 1970 demonstriert Herbert Achternbuschs Hörspiel in München
und am Starnberger See, dass es produktionsästhetisch verschiedene Möglichkeiten
für ein Hörspiel gibt. So diskutiert der Autor zu Beginn spielintern mit den Schau-
spielern über die Fragen, wie das Stück zu konzipieren sei und welche Darstellungs-
mittel – beispielsweise Originalton – zum Zug kommen sollen. Für die neu ange-
strebte akustische Kunst werden nicht nur die traditionellen ästhetischen Mittel
der Gattung hinterfragt, sondern es bestehen auch Erwartungen, den Hörenden
eine neue, mündige Position zuzugestehen.13
2. Mediengeschichtliche Aspekte
Als wichtige mediengeschichtliche Entwicklung gilt es festzuhalten, dass das Hör-
spiel zu Beginn der Gattungsgeschichte eine ausschließlich an das Radio gebunde-
ne Kunstform ist. Erst mit den Möglichkeiten der digitalen Produktion setzt ein
Paradigmenwechsel ein: Am Ende des 20. Jahrhunderts gibt es neben der Studio-
13 Zu dieser emanzipatorischen Bewegung im Neuen Hörspiel vgl. Würffel Ausnahmezustände,
S. 221–223.
F4717-Antonsen.indd 215 03.12.2008 11:05:04 Uhr
216 ELISABETH STUCK
produktion auch eine freie Hörspielszene, die in der Produktion nicht abhängig
vom Hörspielstudio eines Radiosenders ist.14
Diese Entwicklung lässt sich an einigen Hörspielen, die selbstreferenziell die
medialen Bedingungen thematisieren, aufzeigen. Das erste deutschsprachige Hör-
spiel, Hans Fleschs Zauberei auf dem Sender (1924), demonstriert in Form einer
Groteske die medialen Bedingungen des Radios, indem eine Sendepanne inszeniert
wird. Flesch, der damalige Intendant des Frankfurter Senders Welle 467 unter-
nimmt einen ersten Versuch, mit den technischen Gegebenheiten und den Sende-
gefäßen des neuen Mediums zu spielen sowie dessen akustische Illusionsmöglich-
keiten zu demonstrieren. So löst die Märchentante Spuk im Sender aus. Sie will
weg von ihrem Tages-Sendegefäß und einmal abends ein Märchen erzählen. Wäh-
rend sie zu erzählen beginnt, hört man plötzlich Tanzmusik, den Klang einer Trom-
pete und verschiedene Stimmen. Hinter diesem Durcheinander steht ein Zauber-
künstler: Der ganze Spuk entsteht dadurch, dass ein Künstler auftritt, dessen Kunst
nur durch das Auge wahrnehmbar ist. Dem Zauberer ist die Mitarbeit am Rund-
funk verwehrt, weil er mit visuellen Tricks arbeitet. Deshalb beginnt er mit akusti-
schen Mitteln das Rundfunkprogramm durcheinander zu bringen. Mit diesem
Kunstgriff erhält der Autor die Möglichkeit, das Spezifische der Gattung Hörspiel,
nämlich das Hörbare, in grotesker Verzerrung zu betonen. Man hat übrigens lange
den Untertitel Versuch einer Rundfunkgroteske nicht beachtet. Mit dieser Inszenie-
rung einer Sendepanne wird in Zauberei auf dem Sender zudem die Störungsanfäl-
ligkeit und die Manipulierbarkeit des Mediums Radio demonstriert.
Dieses selbstreflexive Aufgreifen von Produktionsbedingungen lässt sich nicht
nur zu Beginn der Geschichte des deutschsprachigen Hörspiels feststellen, sondern
zeigt sich immer wieder in verschiedenen Stücken. So setzt sich beispielsweise Urs
Widmer mit Der tolle Tonmeister (1988) spielintern mit den Produktionsverhältnis-
sen im Radiostudio auseinander. Widmer inszeniert spielintern einen grotesken
Rollenwechsel, indem der Tonmeister, zu dessen professioneller Rolle im Studio
das Schweigen gehört, plötzlich das Sagen hat und mit großen Tiraden den ganzen
Radiostudio-Betrieb kommentiert. Die Thematisierung des Mediums Radio wird
bevorzugt mit Mitteln der Übertreibung und der grotesken Verzerrung realisiert.
Oft übernehmen solche Stücke auch die Funktion, Kritik am Medien- und Kultur-
betrieb zu üben. Sehr deutlich wird diese groteske Übertreibung mit medienkriti-
scher Funktion in Max Goldts Stück Die Radiotrinkerin (1989). Vera, eine professi-
onelle ›Radiotrinkerin‹ unterhält sich mit einem Moderator über ihre Sendung.
Darin betrinkt sie sich vor den Hörerinnen und Hörern bis an die Grenze der Be-
wusstlosigkeit und unterhält ihr Publikum gleichzeitig mit endlosem Geschwätz
über ihr Privatleben und über Allgemeinplätze. Diese Sendung ist sehr erfolgreich,
weil die Offenheit beim Publikum gut ankommt. Mit Hilfe einer grotesken Insze-
nierung einer bekenntnishaften und geschwätzigen Kommunikationskultur am
Radio macht Goldt auf Schwächen in der Unterhaltungskultur aufmerksam.
14 Vgl. Krug: Kleine Geschichte, S. 136ff.
F4717-Antonsen.indd 216 03.12.2008 11:05:04 Uhr
LITERATURWISSENSCHAFT UND HÖRÄSTHETIK 217
Ab den 1990er Jahren kommt es in der Produktion von Hörspielen zu einem
Paradigmenwechsel. Mit den digitalen Produktionsmöglichkeiten entsteht ein
Spielraum für Produktionen, die unabhängig von Radiosendern existieren. Eine
interessante Thematisierung dieser freien Szene auf privater Basis finden wir in ei-
nem selbstreferenziellen Kurzhörspiel von 2002 mit dem Titel Radio Trottoir. Sabi-
ne Bohnen und Bernd Breitbach setzen darin eine Frau als Hauptfigur ins Zent-
rum, die von ihrer Küche aus Radio macht. Diese Frau ist während 24 Stunden auf
Sendung. Ihr männliches Gegenüber wendet ein, dass man doch nicht von ›Radio-
Machen‹ sprechen könne, wenn niemand zuhöre. Radio Trottoir treibt die neue,
von einem Studio unabhängige Produktionsmöglichkeit von Radiosendungen ad
absurdum, indem jede technische Infrastruktur weggelassen wird. Die Frau behaup-
tet zwar, sie sei auf Sendung, aber ihr fehlen sowohl der äußere Apparat für die
Produktion von Radiosendungen als auch das Publikum.
In den selbstreferenziellen Hörspielen der Gegenwart lässt sich ein zunehmen-
des Interesse am Publikum feststellen. Sowohl in der Pionierzeit des Hörspiels als
auch während der großen Innovationsphase zu Beginn der 1970er Jahre dominie-
ren beim Hörspiel im Hörspiel und bei der Thematisierung des Radios in Hörstü-
cken produktionsästhetische Aspekte. In einigen Hörstücken seit den 1990er Jah-
ren rückt nun die Rezeption in den Vordergrund. So etwa in Bodo Hells Hörspiel
Mein Radio und ich – ein Hörstück zum Sendungsbewusstsein für 9 HörerInnenstim-
men und 1 Flüsterkommentar aus dem Jahr 2004. Hörerinnen und Hörer aus ver-
schiedenen Alters- und Berufsgruppen kommen im Originalton zu Wort. Diese
Auswahl von Stimmen collagiert Hell zusammen mit einer kommentierenden Flüs-
terstimme zu einem Hörstück, das positive und negative Kritik an diversen Sende-
gefäßen enthält.
In Hörspielen, die selbstreferenziell angelegt sind, manifestieren sich deutlich
wichtige produktionsästhetische Bedingungen von Literatur zum Hören, und es
finden sich spielinterne Spuren, die Veränderungen in der Mediengeschichte und
damit verbundene Veränderungen auch für die Hörenden thematisieren.
Solange bei der Entstehung von Hörspielen nicht das geschieht, was das oben
kommentierte Hörspiel Radio Trottoir thematisiert – nämlich dass sich die Produk-
tion von Radiosendungen ausschließlich im Kopf einer Radiomacherin abspielt,
die kein Publikum mehr hat –, bleibt das Hörspiel ein produktives Genre. Die neu-
en Produktions- und Distributionsmöglichkeiten nach der digitalen Umgestaltung
der Hörspielszene bieten eine Chance dafür, dass die Gattung Hörspiel ein neues
Publikum zu erreichen vermag.
F4717-Antonsen.indd 217 03.12.2008 11:05:04 Uhr
F4717-Antonsen.indd 218 03.12.2008 11:05:04 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS
1. Primärliteratur
Achternbusch, Herbert: Hörspiel in München und am Starnberger See. HR/BR 1970.
Andersch, Alfred: Sansibar oder der letzte Grund. Zürich: Diogenes 1970.
Aristoteles: Die Poetik. Griech./Dt. Übers. u. hg. v. Manfred Fuhrmann. Stuttgart:
Reclam 1989 (RUB; 7828).
Arnold, Matthew: Essays in Criticism. London u. Cambridge: Macmillan 1865.
Augustinus, Aurelius: Confessiones. Ed. Martin Skutella. Editionem correctiorem
curaverunt H. Juergens et W. Schwab. Stuttgart: Teubner 1981.
Baudelaire, Charles: Petits poèmes en prose (Le Spleen de Paris). Paris: Gallimard
1973.
Benjamin, Walter: Linke Melancholie. In: ders.: Gesammelte Schriften. Hg. v. Rolf
Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Bd. 3. Frankfurt: Suhrkamp 1972,
S. 279–283.
Blackwell, Thomas: An Enquiry into the Life and Writings of Homer. 2. Aufl. Lon-
don: o. V. 1736. ND: Hildesheim u. New York: Olms 1976 (Anglistica & Ame-
ricana; 173).
Bodmer, Johann Jakob u. Johann Jakob Breitinger (Hg.): Sammlung Critischer, Po-
etischer und andrer geistvollen Schriften, zur Verbesserung des Urtheils und des Wi-
zes in den Wercken der Wolredenheit und der Poesie. 3 Bde. Zürich: Conrad Orell
u. Comp. 1741–1744.
Bohnen, Sabine u. Bernd Breitbach: Radio Trottoir. Eigenproduktion 2002.
Braudel, Fernand: Géohistoire und geographischer Determinismus (1949). In: Jörg
Dünne u. Stephan Günzel (Hg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie
und Kulturwissenschaften. Frankfurt: Suhrkamp 2006, S. 395–408.
Brecht, Bertolt: Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. In: ders.: Große
kommentierte Berliner u. Frankfurter Ausgabe. Hg. v. Werner Hecht u. a. Bd. 22:
Werke, Schriften 2, Teil 1, Frankfurt: Suhrkamp 1993, S. 74–89.
Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke. Bd. 4. Frankfurt: Suhrkamp 1967.
Brecht, Bertolt: Über die Popularität des Kriminalromans. In: ders.: Gesammelte
Werke. Bd. 19. Frankfurt: Suhrkamp 1969, S. 450–457.
Brontë, Charlotte: Jane Eyre. Oxford: Oxford University Press 2008 (Oxford
World's Classics).
Calle, Sophie: Prenez soin de vous. Arles: Actes Sud 2007.
Canetti, Elias: Die Blendung. 8. Aufl. München: Hanser 1998.
F4717-Antonsen.indd 219 03.12.2008 11:05:04 Uhr
220 LITERATURVERZEICHNIS
Cassirer, Ernst: An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture
[1944]. New York: Double Day Anchor 1953.
Cassirer, Ernst: Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum (1931). In: Jörg
Dünne u. Stephan Günzel (Hg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie
und Kulturwissenschaften. Frankfurt: Suhrkamp 2006, S. 485–500.
Cassirer, Ernst: Was ist der Mensch? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kul-
tur. Stuttgart: Kohlhammer 1960.
Celan, Paul: Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materialien. Hg. v. Bernhard
Böschenstein u. Heino Schmull unter Mitarb. v. Michael Schwarzkopf u. Chris-
tiane Wittkop. In: ders.: Werke. Tübinger Ausgabe. Hg. v. Jürgen Wertheimer.
Frankfurt: Suhrkamp 1999.
Certeau, Michel de: Kunst des Handelns. Aus dem Franz. übers. v. Ronald Voullié.
Berlin: Merve 1988.
Cervantes Saavedra, Miguel de: Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha.
Aus dem Span. v. Ludwig Braunfels. 7. Aufl. München: Artemis & Winkler
1993.
Chladenius, Johann Martin: Allgemeine Geschichtswissenschaft, worinnen der Grund
zu einer neuen Einsicht in allen Arten der Gelahrtheit gelegt wird. Mit einer Einl.
v. Christoph Friederich u. einem Vorwort v. Reinhard Koselleck. Wien u. a.:
Böhlau 1985 (Klassische Studien zur sozialwissenschaftlichen Theorie, Weltan-
schauungslehre und Wissenschaftsforschung; 3) [Neudruck der Ausgabe Leip-
zig, 1752].
Cicero: De oratore/Über den Redner. Lat./Dt. Übers. u. hg. v. Harald Merklin.
2. Aufl. Stuttgart: Reclam 1976 (RUB; 18273).
Cyrano de Bergerac: L’Autre Monde ou les États et Empires de la Lune [= Voyage à la
lune]. In: ders.: Œuvres complètes. Édition critique. Textes établis et commentés
par Madeleine Alcover. Vol. I. Paris: Honoré Champion 2000, S. 1–161.
Dante Alighieri: La Divina Commedia. Testo critico stabilito da Giorgio Petrocchi.
Torino: Einaudi 1975.
Dante Alighieri: Dantes Göttliche Komödie. Mit Bildern von Gustav [sic!] Doré.
Übersetzt von Philalethes [König Johann von Sachsen]. Erläutert v. Edmund
Th. Kauer. Berlin: Th. Knaur Nachfahren o. J. [ca. 1927].
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie. Aus dem Italien. übertr. v. Wilhelm G.
Hertz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1978 (dtv; 2107).
Deleuze, Gilles u. Félix Guattari: Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus.
Aus dem Franz. übers. v. Gabriele Ricke u. Ronald Voullié. Berlin: Merve 1992.
Della Casa, Giovanni: Rime. A cura di Giulio Tanturli. Parma: Fondazione Pietro
Bembo/Ugo Guanda editore 2001, Sonett Nr. LXII, S. 188–189.
Dilthey, Wilhelm: Traum. In: Gesammelte Schriften. Bd. 8. Hg. v. B. Groethuysen.
Leipzig u. Berlin: Teubner 1931.
Dubos, Jean-Baptiste: Kritische Betrachtungen über die Poesie und Mahlerey. Übers.
v. Gottfried Benediktus Fuchs. 3 Bde. Kopenhagen: Mummische Buchhand-
lung 1760–1761.
F4717-Antonsen.indd 220 03.12.2008 11:05:04 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 221
Euripides: Les Bacchantes. Hg. v. Henri Grégoire in Verbindung mit Jules Meunier.
Paris: Les Belles Lettres 1973.
Flesch, Hans: Zauberei auf dem Sender. Versuch einer Rundfunkgroteske. Südwest-
deutscher Rundfunkdienst Frankfurt 1924.
Foucault, Michel: Von anderen Räumen. In: ders.: Schriften in vier Bänden. Dits et
Ecrits. Hg. v. Daniel Defert u. François Ewald. Frankfurt: Suhrkamp 2001–
2005, Bd. 4, S. 931–942.
Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik. 3. Aufl. Tübingen: Mohr (Siebeck) 1972.
Goethe, Johann Wolfgang: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Dritter und
Vierter Teil. In: ders.: Sämtliche Werke. Nach den Texten der Gedenkausgabe des
Artemis-Verlages. Hg. v. Peter Boerner. 45 Bde. München: Deutscher Taschen-
buch Verlag 1961–1963, Bd. 24.
Goethe, Johann Wolfgang: Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort.
In: ders.: Sämtliche Werke. Nach den Texten der Gedenkausgabe des Artemis-
Verlages. Hg. v. Peter Boerner. 45 Bde. München: Deutscher Taschenbuch Ver-
lag 1961–1963, Bd. 39, S. 186–190.
Goethe, Johann Wolfgang: Die Leiden des jungen Werthers. In: ders.: Sämtliche Wer-
ke. I. Abt. Bd. 8. In Zusammenarb. mit Christoph Brecht hg. v. Waltraud Wiet-
hölter. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag 1994.
Goethe, Johann Wolfgang: Maximen und Reflexionen. Hg. u. mit einem Nachwort
v. Helmut Koopmann. München: Beck 2006.
Goethe, Johann Wolfgang: Sämtliche Werke. Nach den Texten der Gedenkausgabe
des Artemis-Verlages. Hg. v. Peter Boerner. 45 Bde. München: Deutscher Ta-
schenbuch Verlag 1961–1963.
Goethe, Johann Wolfgang: Der West-östliche Divan. In: ders.: Sämtliche Werke.
Nach den Texten der Gedenkausgabe des Artemis-Verlages. Hg. v. Peter Boer-
ner. 45 Bde. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1961–1963, Bd. 5.
Goethe, Johann Wolfgang: Zum Schäkespears Tag. In: ders.: Sämtliche Werke nach
Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Bd. I/2: Der junge Goethe 1757–
1775. Hg. v. Gerhard Sauder. München u. Wien: Hanser 1987, S. 411–414.
Goldt, Max: Die Radiotrinkerin. EIG 1989 [gedr. Fass.: ders.: Die Radiotrinkerin.
Ausgesuchte schöne Texte. Mit einem Vorw. v. Robert Gernhardt. Reinbek b.
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2005 (rororo; 23685)].
Grünbein, Durs: Mein babylonisches Hirn. In: ders.: Galilei vermißt Dantes Hölle.
Aufsätze. Frankfurt: Suhrkamp 1996, S. 18–33.
Handke, Peter: Hörspiel. WDR/HR 1968.
Hartmann, Nicolai: Sinngebung und Sinnerfüllung. In: ders.: Der philosophische Ge-
danke und seine Geschichte. Aufsätze. Stuttgart: Reclam 1955 (RUB; 8538–40),
S. 133–187.
F4717-Antonsen.indd 221 03.12.2008 11:05:04 Uhr
222 LITERATURVERZEICHNIS
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
im Grundrisse (1830). Hg. v. Friedhelm Nicolin u. Otto Pöggeler. Hamburg:
Meiner 1969.
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Phänomenologie des Geistes. Hg. v. Johannes
Hoffmeister. 6. Aufl. Hamburg: Meiner 1952.
Heidegger, Martin: Sein und Zeit. 10. Aufl. Tübingen: Niemeyer 1963.
Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testaments. Stuttgart: Verlag der Zwing-
li-Bibel 1955.
Heine, Heinrich: Bimini [1854]. In: ders.: Sämtliche Schriften. Hg. v. Klaus Brieg-
leb. Bd. 6,1.: Gedichte. Hg. v. Walter Klaar. München u. Wien: Hanser 1975,
S. 241–266.
Hell, Bodo: Mein Radio und ich – ein Hörstück zum Sendungsbewusstsein für 9 Hö-
rerInnenstimmen und 1 Flüsterkommentar. ORF 2004.
Herder, Johann Gottfried: Journal meiner Reise im Jahr 1769. Hg. v. Katharina
Mommsen u. a. Stuttgart: Reclam 1976 (RUB; 9793).
Herder, Johann Gottfried: Werke. Hg. v. Wolfgang Proß. 3 Bde. München u. Wien:
Hanser 1984–2002.
Hesse, Hermann: Magie des Buches. In: ders.: Gesammelte Werke. Hg. v. Volker
Michels. Bd. 11 (Schriften zur Literatur), Frankfurt: Suhrkamp 1970, S. 244–
255.
Hölderlin, Friedrich: Anmerkungen zur Antigonae. In: ders.: Sämtliche Werke. Stutt-
garter Ausgabe. Hg. v. Friedrich Beißner. Stuttgart: Kohlhammer 1946–1985,
Bd. 5, S. 265–272.
Hölderlin, Friedrich: Im Walde. In: ders.: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. Hg.
v. Friedrich Beißner. Stuttgart: Kohlhammer 1946–1985, Bd. 2, S. 326.
Hölderlin, Friedrich: Patmos. In: ders.: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. Hg. v.
Friedrich Beißner. Stuttgart: Kohlhammer 1949–1985, Bd. 2, S. 165–172.
Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. Hg. v. Friedrich Beiß-
ner. 8 Bde. Stuttgart: Kohlhammer 1946–1985.
Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke und Briefe. Hg. v. Jochen Schmidt. Frank-
furt: Deutscher Klassiker Verlag 1992–1994.
Hölderlin, Friedrich: Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes. In: ders.:
Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. Hg. v. Friedrich Beißner. Stuttgart: Kohl-
hammer 1949–1985, Bd. 4, S. 241–265.
Homer: Odyssee. Übers. v. Wolfgang Schadewaldt. Zürich: Artemis 1966.
Horaz: Ars Poetica/Die Dichtkunst. Lat. u. dt. Übers. u. hg. v. Eckart Schäfer. Stutt-
gart: Reclam 1984 (RUB; 9421).
Hughes, Richard: A Comedy of Danger. BBC 1924.
Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus
und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts [1830–
1835]. In: ders.: Schriften zur Sprache. 4. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 1972, S. 368–756.
Humboldt, Wilhelm von: Gesammelte Schriften. Hg. v. Albert Leitzmann. Bd. 8.
Berlin: Behr 1909.
F4717-Antonsen.indd 222 03.12.2008 11:05:04 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 223
Jandl, Ernst: Andere Augen. In: Ernst Jandl. Poetische Werke. Hg. v. Klaus Siblewski.
Bd. 1. München: Luchterhand 1997.
Jandl, Ernst: Aus der Fremde. Sprechoper in 7 Szenen. Darmstadt u. Neuwied: Luch-
terhand 1980.
Jandl, Ernst: Laut und Luise. Neuwied u. Berlin: Luchterhand 1971 (SL; 38).
Jean Paul: Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch. In: Werke in zwölf Bänden. Hg. v.
Norbert Miller, Bd. 5. München: Hanser 1975.
Kafka, Franz: Beschreibung eines Kampfes. In: ders.: Beschreibung eines Kampfes. No-
vellen. Skizzen. Aphorismen. Aus dem Nachlaß. [Hg. v. Max Brod.] Prag: Heinr.
Mercy Sohn 1936 (Gesammelte Schriften; 5), S. 9–66.
Kafka, Franz: Beschreibung eines Kampfes. Die zwei Fassungen. Parallelausgabe nach
den Handschriften. Hg. u. mit einem Nachw. versehen v. Max Brod. Textedition
Ludwig Dietz. Frankfurt: Fischer 1969 (Kafka Edition S. Fischer).
Kafka, Franz: Beschreibung eines Kampfes. In: ders.: Beschreibung eines Kampfes. Ge-
gen zwölf Uhr […]. Hg. v. Roland Reuß u. a. Frankfurt: Stroemfeld (Roter Stern)
1999 (Historisch-kritische Edition sämtlicher Handschriften, Drucke u. Typo-
skripte).
Kandinsky, Wassily: Der gelbe Klang. Eine Bühnenkomposition. In: Horst Denkler
(Hg.): Einakter und kleine Dramen des Expressionismus. Stuttgart: Reclam 1992,
S. 54–64 (RUB; 8562).
Kandinsky, Wassily: Über das Geistige in der Kunst [1952]. Mit einer Einf. v. Max
Bill. 10. Aufl. Bern: Benteli o. J.
Kant, Immanuel: Kants Werke [Akademie-Textausgabe], Bd. IX: Logik, Physische
Geographie, Pädagogik. Berlin: de Gruyter 1968.
Kästner, Erich: Der Karneval des Kaufmanns. Gesammelte Texte aus der Leipziger Zeit
1923–1927. Hg. v. Klaus Schuhmann. Leipzig: Lehmstedt 2004.
Kästner, Erich: Emil und die Detektive. In: ders. Romane für Kinder. Zürich: Atrium
1959 (Gesammelte Schriften; 6), S. 157–265.
Kästner, Erich: Über das Verbrennen von Büchern. In: ders.: Vermischte Beiträge.
Zürich: Atrium 1959, S. 533–534 (Gesammelte Schriften; 5).
Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe. Hg. v. Roland Reuß
u. Peter Staengle, Bd. II/7, Berliner Abendblätter I. Basel u. Frankfurt: Stroem-
feld (Roter Stern) 1997.
Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden. Bd. 4: Briefe von
und an Heinrich von Kleist 1793–1811. Hg. v. Klaus Müller-Salget u. Stefan
Ormanns. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag 1997 (Bibliothek deutscher
Klassiker; 122).
Konfuzius: Gespräche (Lun-yu). Übers. u. hg. v. Ralf Moritz. Stuttgart: Reclam
2005 (RUB; 9656).
Kraus, Karl: Die Sprache. In: ders.: Schriften. Hg. v. Christian Wagenknecht. Bd. 7.
Frankfurt: Suhrkamp 1987.
F4717-Antonsen.indd 223 03.12.2008 11:05:05 Uhr
224 LITERATURVERZEICHNIS
Lamprecht, Gerhard (Regie) u. Billy Wilder (unter Mitarb. v. Emmerich Preßbur-
ger u. Erich Kästner, Drehbuch): Emil und die Detektive. Deutschland: UFA
1931.
Lem, Stanisław: Technologie und Ethik. Ein Lesebuch. Hg. v. Jerzy Jarzebski. Frank-
furt: Suhrkamp 1990.
Loetscher, Hugo: Vom Erzählen erzählen. Münchner Poetikvorlesungen. Mit einer
Einf. v. Wolfgang Frühwald. Zürich: Diogenes 1988.
Lotman, Yuri M.: Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. London u.
New York: Tauris 1990 (Tauris Transformations).
Mandelstam, Ossip: Gespräch über Dante. Russ. u. dt. Aus dem Russ. übertr. v.
Norbert Randow. Mit einem Nachwort v. Leonid E. Pinski. Leipzig u. Weimar:
Kiepenheuer 1984 (Gustav Kiepenheuer Bücherei; 43).
Mandelstam, Ossip: Gespräch über Dante. Übers. u. hg. v. Ralph Dutli. Zürich:
Ammann 1991 (Gesammelte Essays; 2).
Mann, Thomas: Hundert Jahre Reclam. In: Gesammelte Werke in 13 Bänden, Bd. X,
Frankfurt: Fischer 1974.
Marquard, Odo: Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften. In: ders.:
Apologie des Zufälligen. Philosophische Studien. Stuttgart: Reclam 2001 (RUB;
8351), S. 98–116.
Milton, John: Poetical Works. London: Oxford University Press 1966.
Montaigne, Michel de: Essais. In: Œuvres complètes. Textes éd. par Albert Thibau-
det et Maurice Rat. Paris: Gallimard 1962.
Montaigne, Michel de: Die Essais. Ausgew., übertr. u. eingel. v. Arthur Franz. Stutt-
gart: Reclam 1976 (RUB; 8308).
More, St. Thomas: Utopia. Hg. v. Edward Surtz, S. J. New Haven u. London: Yale
University Press 1964.
Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. Hg. v. Adolf Frisé. Reinbek:
Rowohlt 1978.
Nietzsche, Friedrich: Der Antichrist. Fluch auf das Christentum. In: ders.: Sämtliche
Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino
Montinari. Berlin u. New York: de Gruyter 1980, Bd. 6, S. 165–254.
Nietzsche, Friedrich: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. v. Giorgio Colli u.
Mazzino Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1999.
Nietzsche, Friedrich: Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile. In:
ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Hg. v. Giorgio Col-
li u. Mazzino Montinari. Berlin u. New York: de Gruyter 1980, Bd. 3, S. 9–331.
Nietzsche, Friedrich: Wir Philologen. In: Werke. Hg. v. Karl Schlechta, 6. Aufl.,
Bd. III. München: Hanser 1969, S. 323–332.
Platon: Ion, Symposion und Protagoras. In: ders. Gesamtausgabe der Dialoge in sieben
Bänden einschließlich Begriffslexikon. Übertr. v. Rudolf Rufener, eingel. v. G.
Krüger u. O. Gigon. Zürich: Artemis 1950–1975.
F4717-Antonsen.indd 224 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 225
Poe, Edgar Allan: The Collected Works of Edgar Allan Poe. Bd. 2: Tales and Sketches
1831–1842. Hg. v. Thomas Ollive Mabbott. Cambridge, Mass. u. London: The
Belknap Press of Harvard University Press 1978.
Rilke, Rainer Maria: Kommentierte Ausgabe in 4 Bänden. Supplementband: Gedichte
in französischer Sprache mit deutschen Prosafassungen. Hg. v. Manfred Engel u.
Dorothea Lauterbach. Frankfurt: Insel 2003.
Sauer, August: Literaturgeschichte und Volkskunde. Rektoratsrede gehalten in der Aula
der K. K. Deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag am 18. November 1907.
Prag: Selbstverlag der K. K. Deutschen Karl-Ferdinands-Universität 1907.
Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos. 7. Aufl. Bern u. München:
Francke 1965.
Schiller, Friedrich: Briefe. Hg. v. Gerhard Fricke. München: Hanser 1955.
Schiller, Friedrich: Schillers Werke. Nationalausgabe, 1–42 Bde. Weimar: Böhlau
1943–2003.
Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von
Briefen. In: ders.: Sämtliche Werke. Bd. V. Hg. v. Gerhard Fricke u. Herbert G.
Göpfert. 5. Aufl. München: Hanser 1975, S. 570–693.
Schiller, Friedrich: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?
In: Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 17. Hg. v. Norbert Oellers, S. 359–
376.
Schiller, Friedrich: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?
In: ders.: Sämtliche Werke. Bd. IV. Hg. v. Gerhard Fricke u. Herbert G. Göpfert.
3. Aufl. München: Hanser 1962, S. 749–767.
Schiller, Friedrich: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?
Neudruck der Erstausgabe der Jenaer akademischen Antrittsrede Schillers aus dem
Jahre 1789. Im Auftrag des Rektors der Friedrich-Schiller-Universität hg. u.
durch einen Anhang sowie Abb. erg. v. Bolko Schweinitz, Paul Mitzenheim u.
Günter Steiger. Jena: Friedrich-Schiller-Universität 1982 (Jenaer Reden u.
Schriften).
Schiller, Friedrich: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?
In: ders.: Werke und Briefe in zwölf Bänden. Bd. 6 [=Historische Schriften und
Erzählungen I]. Hg. v. Otto Dann. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag 2000,
S. 411–431.
Schiller, Friedrich: Werke und Briefe. 12 Bde. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag
1988–2002 (Bibliothek deutscher Klassiker).
Seneca, Lucius Annaeus: Lucius Annäus Seneca des Philosophen Werke. Fünfte Abt-
heilung. Briefe. Fünftes Bändchen. Übers. v. A. Haakh. Stuttgart: Metzlersche
Buchhandlung 1851.
Shakespeare, William: Antony and Cleopatra/Antonius und Kleopatra. Dt. Prosafas-
sung, Anmerk., Einl. u. Kommentar. Hg. v. Dimiter Daphinoff. Tübingen:
Francke 1995 (Englisch-deutsche Studienausgabe der Dramen Shakespeares).
F4717-Antonsen.indd 225 03.12.2008 11:05:05 Uhr
226 LITERATURVERZEICHNIS
Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der
Weltgeschichte. Bd. 1. München: Beck 1923.
Sterne, Laurence: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Oxford:
Oxford University Press 1998 (Oxford World’s Classics).
Strauß, Botho: Niemand Anderes. München: Hanser 1987.
Swift, Jonathan: Gulliver’s Travels. Oxford: Oxford University Press 2008 (Oxford
World’s Classics).
Tacitus: Germania. Bearb. v. Franz Eckstein. In: Aus dem Schatze des Altertums. B.
Lateinische Reihe/10. Bamberg: Buchner 1953.
Tacitus: Germania. Übers. v. Manfred Fuhrmann. Stuttgart: Reclam 1971 (RUB;
726).
Tasso, Torquato: Rime per Lucrezia Bendidio. A cura di Luigi De Vendittis. Torino:
Einaudi 1965.
Trakl, Georg: Dichtungen und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. Hg. v. Walther
Killy u. Hans Szklenar. Salzburg: Otto Müller 1969.
Trakl, Georg: Sämtliche Werke und Briefwechsel. Innsbrucker Ausgabe. Historisch-
kritische Ausgabe mit Faksimiles der handschriftlichen Texte Trakls. Hg. v. Eber-
hard Sauermann u. Hermann Zwerschina. Basel u. Frankfurt: Stroemfeld/Roter
Stern 1995ff.
Trakl, Georg: Werke. Entwürfe. Briefe [1984]. Hg. v. Hans-Georg Kemper u. Frank
Rainer Max. Nachw. u. Bibliographie v. Hans-Georg Kemper. Bibliogr. erg.
Ausg. Stuttgart: Reclam 1995 (RUB; 8251).
Tucholsky, Kurt: Deutschland, Deutschland über alles. Hg. v. Antje Bonitz u. Sarah
Hans. Reinbek: Rowohlt 2004 (Gesamtausgabe; 12).
Tucholsky, Kurt: Gesamtausgabe. Texte und Briefe, Bd. 5. Reinbek: Rowohlt 1999.
Vergil: Aeneis. Zürich: Artemis & Winkler 1994 (Sammlung Tusculum).
Walser, Robert: Aus dem Bleistiftgebiet. Mikrogramme 1924/25, Bd. 1: Prosa. Hg. v.
Bernhard Echte u. Werner Morlang. Frankfurt: Suhrkamp 1985.
Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Hg. v. Johannes Winckelmann. 5. Aufl.
Tübingen: Mohr 1980.
Wells, H. G.: The Time Machine. London: Penguin Books 2005 (Penguin Clas-
sics).
Widmer, Urs: Der tolle Tonmeister. SWF 1988.
Widmer, Urs: Wer nicht sehen kann, muß hören. In: WDR-Hörspielbuch 1969. Köln:
Kiepenheuer & Witsch 1969, S. 51–75.
Wieland, Christoph Martin: Über den freyen Gebrauch der Vernunft in Glaubenssa-
chen sammt einer Beylage. In: ders.: Sämmtliche Werke [Repr. Nachdruck]. Ham-
burg: Stiftung zur Förderung von Wissenschaft u. Kultur 1984, Bd. IX 29.
Wiener, Norbert: Gott und Golem Inc [1964]. Düsseldorf u. Wien: Econ 1965.
Zürcher Bibel. Zürich: Genossenschaft Verlag der Zürcher Bibel 2007.
F4717-Antonsen.indd 226 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 227
2. Sekundärliteratur
Achermann, Eric: Was ist hier Sache? Zum Verhältnis von Philologie und Kulturwis-
senschaft. In: Germanistische Mitteilungen. Zeitschrift für deutsche Sprache, Kultur
und Literatur 65 (2007), S. 23–39.
Ackermann, Marion: Eine Sprache, die besser wirkt als Esperanto. Überlegungen zum
Einfluß des Spiritismus auf Kandinsky. In: Moritz Baßler u. Hildegard Châtellier
(Hg.): Mystique, Mysticisme et modernité en Allemagne autour de 1900/Mystik,
Mystizismus und Moderne in Deutschland um 1900. Straßburg: Presse Universi-
taire de Strasbourg 1998 (Faustus/Etudes germaniques), S. 187–201.
Adorno, Theodor W.: Valérys Abweichungen. In: ders.: Noten zur Literatur II. Frank-
furt: Suhrkamp 1961 (bs; 71), S. 42–94.
Alonso, Carlos J.: Editor’s Column: My Professional Advice (to Graduate Students).
In: PMLA. Publications of the Modern Language Association 117 (3, 2002),
S. 401–406.
Alt, Peter-André: Die Verheißungen der Philologie. Göttingen: Wallstein 2007 (Göt-
tinger Sudelblätter).
Assmann, Aleida: Erinnerungsräume: Formen und Wandel des kulturellen Gedächt-
nisses. München: Beck 1999.
Auerbach, Erich: Figura. In: ders.: Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie.
Bern u. München: Francke 1967, S. 55–92.
Auerbach, Erich: Giambattista Vico und die Idee der Philologie. In: ders.: Gesammel-
te Aufsätze zur romanischen Philologie. Bern u. München: Francke 1967, S. 233–
241.
Auerbach, Erich: Philologie der Weltliteratur. In: ders.: Gesammelte Aufsätze zur ro-
manischen Philologie. Bern u. München: Francke 1967, S. 301–310.
Auerbach, Erich: Vico and aesthetic historism. In: ders.: Gesammelte Aufsätze zur
romanischen Philologie. Bern u. München: Francke 1967, S. 266–274.
Avalle, D’Arco Silvio: Dal mito alla letteratura e ritorno. Milano: Mondadori
1990.
Bachmann-Medick, Doris: Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissen-
schaften. Reinbek: Rowohlt 2006.
Bachmann-Medick, Doris (Hg.): Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der
Literaturwissenschaft. Frankfurt: Fischer 1996.
Bal, Mieke: Kulturanalyse. Hg. u. mit einem Nachw. vers. v. Thomas Fechner-
Smarsly u. Sonja Nef. Frankfurt: Suhrkamp 2002.
Barck, Karlheinz: Erich Auerbach in Berlin. Spurensicherung und ein Porträt. In:
Erich Auerbach. Geschichte und Aktualität eines europäischen Philologen. Hg. v.
Martin Treml u. Karlheinz Barck. Berlin: Kadmos 2007, S. 195–214.
Barner, Wilfried: Kommt der Literaturwissenschaft ihr Gegenstand abhanden? Vorü-
berlegungen zu einer Diskussion. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 41
(1997), S. 1–8.
Barthes, Roland: Le plaisir du texte. Paris: Seuil 1973.
F4717-Antonsen.indd 227 03.12.2008 11:05:05 Uhr
228 LITERATURVERZEICHNIS
Barthes, Roland: Leçon/Lektion [1978]. Franz. u. Dt. Antrittsvorlesung im Collège
de France, gehalten am 7. Januar 1977. Übers. v. Helmut Scheffel. Frankfurt:
Suhrkamp 1980 (es; 1030).
Barthes, Roland: Die Lust am Text [1973]. Aus d. Franz. v. Traugott König. Frank-
furt: Suhrkamp 1974 (bs; 378).
Baßler, Moritz: Die Entdeckung der Textur. Unverständlichkeit in der Kurzprosa der
emphatischen Moderne 1910–1916. Tübingen: Niemeyer 1994 (Studien zur
deutschen Literatur; 134).
Baßler, Moritz: Wie Trakls ›Verwandlung des Bösen‹ gemacht ist. In: Hans-Georg
Kemper (Hg.): Interpretationen. Gedichte von Georg Trakl. Stuttgart: Reclam
1999 (RUB; 17511), S. 123–141.
Baßler, Moritz u. Hildegard Châtellier (Hg.): Mystique, Mysticisme et modernité en
Allemagne autour de 1900/Mystik, Mystizismus und Moderne in Deutschland um
1900. Straßburg: Presse Universitaire de Strasbourg 1998 (Faustus/Etudes ger-
maniques).
Bätschmann, Oskar: Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Die Ausle-
gung von Bildern. 5., aktualisierte Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft 2001.
Benjamin, Walter: Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft. In: ders.: Gesam-
melte Schriften. Bd. III: Kritiken und Rezensionen. Hg. v. Hella Tiedemann-Bar-
tels. Frankfurt: Suhrkamp 1972, S. 283–290.
Benjamin, Walter: [Rezension zu] Symeon, der neue Theologe, Licht vom Licht. Hym-
nen. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. III. Frankfurt: Suhrkamp 1991,
S. 266.
Bennet, Max R. u. Peter M. Hacker: Philosophical Foundations of Neuroscience. Ox-
ford: Blackwell 2003.
Berendt, Hans Joachim: Ich höre, also bin ich. München: Goldmann 1991.
Berthold, Christian: Fiktion und Vieldeutigkeit. Zur Entstehung moderner Kultur-
techniken des Lesens im 18. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 1993 (Communi-
catio; 3).
Best, Otto F. (Hg.): Theorie des Expressionismus. Stuttgart: Reclam 1982 (RUB;
9817).
Binder, Hartmut: Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen. München: Wink-
ler 1975.
Bloom, Harold: Genius. Die hundert bedeutendsten Autoren der Weltliteratur [2002].
Aus dem Amerikan. übertr. u. mit Nachdichtungen v. Yvonne Badal. München:
Knaus 2004.
Bloom, Harold: Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead
Books 1998.
Bloom, Harold: The Western Canon. New York: Harcourt Brace 1994.
Bloom, Harold, Paul de Man, Jacques Derrida u. a. (Hg.): Deconstruction and Cri-
ticism. New York: Riverhead Books 1979.
Blumenberg. Hans: Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt: Suhrkamp 1966 (stw;
24).
F4717-Antonsen.indd 228 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 229
Bogdal, Klaus-Michael, Kai Kauffmann u. Georg Mein, unter Mitarb. v. Meinolf
Schumacher u. Johannes Volmert: BA-Studium Germanistik. Ein Lehrbuch.
Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2008 (re; 55682).
Böhme, Hartmut u. Klaus R. Scherpe (Hg.): Literatur und Kulturwissenschaften:
Positionen, Theorien und Modelle. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1996 (re;
575).
Bohrer, Karl Heinz: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins. Frank-
furt: Suhrkamp 1981 (es; 1058).
Bollack, Jean: Vorwort zu den Vorlesungsbänden. In: Peter Szondi: Die Theorie des
bürgerlichen Trauerspiels im 18. Jahrhundert. Studienausgabe der Vorlesungen.
Bd. 1. Frankfurt: Suhrkamp 1973 (stw; 219), S. 9.
Borsò, Vittoria: Grenzen, Schwellen und andere Orte. »… La géographie doit bien être
au cœur de ce dont je m’occupe«. In: dies. u. Reinhold Görling (Hg.): Kulturelle
Topographien. Stuttgart u. Weimar: Metzler 2004, S. 13–41.
Böschenstein, Bernhard: Arkadien und Golgatha. In: Hans-Georg Kemper (Hg.):
Interpretationen. Gedichte von Georg Trakl. Stuttgart: Reclam 1999 (RUB;
17511), S. 84–95.
Böschenstein, Bernhard: ›Frucht des Gewitters‹. Zu Hölderlins Dionysos als Gott der
Revolution. Frankfurt: Insel 1989.
Böschenstein, Bernhard: Hölderlins Rheinhymne. 2. Aufl. Zürich u. Freiburg i. Br.:
Atlantis 1968.
Böschenstein, Bernhard: Von Morgen nach Abend. Filiationen der Dichtung von Höl-
derlin zu Celan. München: Fink 2006.
Böschenstein, Bernhard (Hg.): Johann Wolfgang Goethe: Die natürliche Tochter.
Mit den Memoiren der Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti und drei Studien von
B. B. Frankfurt: Insel 1990.
Bourdieu, Pierre: Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris:
Seuil 1992.
Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes.
Übers. v. Bernd Schwibs u. Achim Russer. Frankfurt: Suhrkamp 1999 (stw;
1539).
Brague, Rémi: Europa. Eine exzentrische Identität, Frankfurt u. New York: Campus
1993.
Braudel, Fernand: Géohistoire und geographischer Determinismus (1949). In: Jörg
Dünne u. Stephan Günzel (Hg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie
und Kulturwissenschaften. Frankfurt: Suhrkamp 2006, S. 395–408.
Braungart, Wolfgang: Zur Poetik literarischer Zyklen. Mit Anmerkungen zur Lyrik
Georg Trakls. In: Károly Csúri (Hg.): Zyklische Kompositionsformen in Georg
Trakls Dichtung. Szegeder Symposion. Tübingen: Niemeyer 1996, S. 1–27.
Braungart, Wolfgang, Gotthart Fuchs u. Manfred Koch (Hg.): Ästhetische und reli-
giöse Erfahrungen der Jahrhundertwenden II: um 1900. Paderborn u. a.: Schö-
ningh 1998.
Breidbach, Olaf: Lesen. In: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, S. 195–
207.
F4717-Antonsen.indd 229 03.12.2008 11:05:05 Uhr
230 LITERATURVERZEICHNIS
Brod, Max: Nachwort. In: Franz Kafka: Beschreibung eines Kampfes. Novellen. Skiz-
zen. Aphorismen. Aus dem Nachlaß. [Hg. v. Max Brod.] Prag: Heinr. Mercy Sohn
(Gesammelte Schriften; 5), S. 306–319.
Brooks, Peter: Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Cambridge:
Harvard University Press 1984.
Bruch, Natalie: Der Bildtitel. Struktur, Bedeutung, Referenz, Wirkung und Funktion.
Eine Typologie. Frankfurt: Lang 2005 (Europäische Hochschulschriften. Reihe
XXI: Linguistik; 285).
Capurro, Rafael: Einführung in die Informationswissenschaft. Abrufbar unter: <www.
capurro.de/iwinhalt.html>.
Capurro, Rafael, Klaus Wiegerling, Andreas Brellochs (Hg.): Informationsethik.
Konstanz: UVK Universitätsverlag Konstanz 1995.
Caputo-Mayr, Maria Luise u. Julius Michael Herz: Franz Kafka. Internationale Bi-
bliographie der Primär- und Sekundärliteratur. 2 Bde. 2. Aufl. München: Saur
2000.
Châtelier, Hildegard: Revolution aus mystischer Gesinnung? Zur Rezeption des Religi-
ösen in Literatur und Kunst des Expressionismus. In: Cornelia Nowak, Kai Uwe
Schierz u. Justus H. Ulbricht (Hg.): Expressionismus in Thüringen. Facetten eines
kulturellen Aufbruchs. Galerie am Fischmarkt. Jena: Glaux 1999, S. 280–287.
Chartier, Roger: Le monde comme représentation. In: Annales d’histoire économique et
sociale 44/6, 1989, S. 1505–1520 [dt.: Chartier, Roger: Die Welt als Repräsenta-
tion. In: Matthias Middell u. Stefan Sammler (Hg.): Alles Gewordene hat Ge-
schichte. Die Schule der »Annales« in ihren Texten 1929–1992. Leipzig: Reclam
1994, S. 320–347].
Citton, Yves: Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires? Paris: Edi-
tions Amsterdam 2007.
Corbineau-Hoffmann, Angelika: Einführung in die Komparatistik. Berlin: Erich
Schmidt 2000.
Coulmas, Florian: Rezeptives Sprachverhalten. Eine theoretische Studie über Faktoren
des sprachlichen Verstehensprozesses. Hamburg: Buske 1977.
Csúri, Károly: Zur poetischen Religiosität in Trakls Dichtung. In: Karlheinz F. Au-
ckenthaler (Hg.): Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur. Bern
u. a.: Lang 1995, S. 111–139.
Culler, Jonathan: Why Lyric? In: PMLA. Publications of the Modern Language Asso-
ciation 123 (1, 2008), S. 201–206.
Daphinoff, Dimiter: As You Like Him: Shakespeare in the 21st Century. In: Sabine
Coelsch-Foisner u. György E. Szöny (Hg.): »Not of an Age, but for All Time«.
Shakespeare across Lands and Ages. Wien: Braumüller 2004, S. 103–112.
Daphinoff, Dimiter: Verfremdung. In: Klaus Kanzog u. Achim Messer: Reallexikon
der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 4. Berlin: de Gruyter 1982, S. 613–626.
Deleuze, Gilles u. Félix Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur [1975]. Aus dem
Franz. v. Burkhart Kroeber. Frankfurt: Suhrkamp 1976 (es; 807).
F4717-Antonsen.indd 230 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 231
Deleuze, Gilles u. Félix Guattari: Kapitalismus und Schizophrenie. Tausend Plateaus.
Aus dem Franz. übers. v. Gabriele Ricke u. Ronald Voullié. Berlin: Merve
1992.
Demandt, Alexander: Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse im
historisch-politischen Denken. München: Beck 1978.
Derrida, Jacques: Die unbedingte Universität [2001]. Aus dem Franz. v. Stefan Lo-
renzer. Frankfurt: Suhrkamp 2001 (es; 2238).
Dixon, Peter u. Marisa Bortolussi: Psychonarratology. Foundations of the Empirical
Study of Literary Response. Cambridge: Cambridge University Press 2003.
Doderer, Klaus: Erich Kästners »Emil und die Detektive« – Gesellschaftskritik in ei-
nem Kinderroman. In: Rudolf Wolff (Hg.): Erich Kästner – Werk und Wirkung.
Bonn: Bouvier 1983, S. 104–116 (Sammlung Profile; 1).
Doppler, Alfred: Elemente der Bibelsprache. In: ders.: Die Lyrik Georg Trakls. Beiträ-
ge zur poetischen Verfahrensweise und zur Wirkungsgeschichte. Salzburg u. Wien:
Otto Müller 2001, S. 82–87 [zuerst in: Trakl-Forum 1987. Hg. v. Hans Weich-
selbaum. Salzburg: Otto Müller 1987].
Dutli, Ralph: Mandelstam. Meine Zeit, mein Tier. Eine Biographie. Zürich: Am-
mann 2003.
Eagleton, Terry: After Theory. London: Allen Lane 2003.
Eagleton, Terry: How to Read a Poem. Oxford: Blackwell 2007.
Eder, Thomas: Zur kognitiven Theorie der Metapher in der Literaturwissenschaft.
Eine kritische Bestandesaufnahme. In: Franz Josef Czernin u. Thomas Eder (Hg.):
Zur Metapher. Die Metapher in Philosophie, Wissenschaft und Literatur. Mün-
chen: Fink 2007, S. 167–195.
Engel, Manfred: Kulturwissenschaften – Literaturwissenschaften als Kulturwissen-
schaft. In: KulturPoetik. Hg. v. Manfred Engel, Bernhard Dierterle, Dieter Lam-
ping u. a., Bd. 1 (1, 2001), S. 8–36.
Eisenhut, Johannes: Überzeugen. Literaturwissenschaftliche Untersuchungen zu ei-
nem kognitiven Prozess. Diss. Universität Freiburg/Schweiz. Freiburg 2007.
Erhart, Walter (Hg.): Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Erweiterung?
Stuttgart: Metzler 2004 (Germanistische Symposien. Berichtsbände; XXVI).
Eyckman, Christoph: Die Christus-Gestalt in der expressionistischen Dichtung. In:
Wirkendes Wort 23 (1973), S. 400–410.
Fetzer, John F.: Changing Perceptions of Thomas Mann’s Doctor Faustus: Criticism
1947–1992. Columbia, SC: Camden House 1996.
Fischer-Lichte, Erika: Semiotik des Theaters. 3 Bde. Tübingen: Gunter Narr
1983ff.
Fischer-Lichte, Erika u. a. (Hg.): Performativität und Ereignis. Tübingen u. Basel:
Francke 2003 (Theatralität; 4).
Fohrmann, Jürgen: Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und
Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und
Deutschem Kaiserreich. Stuttgart: Metzler 1989.
F4717-Antonsen.indd 231 03.12.2008 11:05:05 Uhr
232 LITERATURVERZEICHNIS
Foucault, Michel: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris:
Gallimard 1966.
Foucault, Michel: Von anderen Räumen. In: ders.: Schriften in vier Bänden. Dits et
Ecrits. Hg. v. Daniel Defert u. François Ewald. Frankfurt: Suhrkamp 2001–
2005, Bd. 4, S. 931–942.
Fricke, Harald: Literatur und Literaturwissenschaft. Beiträge zu Grundfragen einer
verunsicherten Disziplin. Paderborn u. a.: Schöningh 2001 (Explicatio; 10).
Friedel, Helmut (Hg.): Das bunte Leben. Wassily Kandinsky im Lenbachhaus. Mit
einem Textbeitrag von Rudolf H. Wackernagel. München: Prestel 1995.
Früchtl, Josef: Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil. Eine Rehabilitierung.
Frankfurt: Suhrkamp 1996.
Früchtl, Josef: Die moderne Moral der Literatur. In: Mandry 2003, S. 29–42.
Frühwald, Wolfgang: Die verlorene Sprache – Zur Krise der Geisteswissenschaften in
der modernen Welt. SWR2 Aula – Manuskript v. 12. Januar 2003.
Frühwald, Wolfgang: Wieviel Wissen brauchen wir? Politik, Geld und Bildung. Ber-
lin: University Press 2007.
Gabriel, Gottfried: Fiktion. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Hg.
v. Klaus Weimar, Harald Fricke, Klaus Grubmüller u. Jan-Dirk Müller, Bd. 1.
Berlin u. New York: de Gruyter 1997, S. 594–598.
Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutik. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie,
Bd. 3, Sp. 1061–1073.
Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift. Von Wolfgang Frühwald, Hans Ro-
bert Jauß, Reinhart Koselleck, Jürgen Mittelstraß, Burkhart Steinwachs. Frank-
furt: Suhrkamp 1991 (stw; 973).
Genette, Gérard: Fiction et diction. Paris: Seuil 1991.
Gibbs, Raymond W.: Metaphor Interpretation as Embodied Simulation. In: Mind
and Language 21,3 (2006), S. 434–458.
Gisi, Lucas Marco: Einbildungskraft und Mythologie. Die Verschränkung von Anthro-
pologie und Geschichte im 18. Jahrhundert. Berlin u. New York: de Gruyter 2007
(spectrum literaturwissenschaft/Komparatistische Studien; 11).
Goodman, Nelson: Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indiana-
polis: The Bobbs-Merrill Company 1968.
Goodman, Nelson: When is Art? In: Ders.: Ways of Worldmaking. Hassocks: The
Harverster Press 1978, S. 57–70.
Graf, Friedrich Wilhelm: Alter Geist und neuer Mensch. Religiöse Zukunftserwartun-
gen um 1900. In: Ute Frevert (Hg.): Das Neue Jahrhundert. Europäische Zeitdia-
gnosen und Zukunftsentwürfe um 1900. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht
2000, S. 185–228.
Grafe, Frieda u. Enno Patalas: Nicht nur Pieck & Pabst. In: dies.: Im Off. Filmarti-
kel. München 1974, S. 141–146.
Gräfrath, Bernd: Es fällt nicht leicht, ein Gott zu sein. Ethik für Weltenschöpfer von
Leibniz bis Lem. München: Beck 1998.
F4717-Antonsen.indd 232 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 233
Grice, Paul: Meaning (1948/1957). In: Ders.: Studies in the Way of Words. Harvard:
Harvard University Press 1991, S. 212–223.
Grondin, Jean: Hermeneutik. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 3,
Sp. 1350–1374.
Gruber, Bettina (Hg.): Erfahrung und System. Mystik und Esoterik in der Literatur
der Moderne. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997.
Gumbrecht, Hans Ulrich: Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen Impuls
im wissenschaftlichen Umgang mit Texten. Aus dem Amerikan. v. Joachim Schul-
te. Frankfurt: Suhrkamp 2003.
Gumbrecht, Hans Ulrich: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz.
Übers. v. Joachim Schulte. Frankfurt: Suhrkamp 2004 (es; 2364).
Gumbrecht, Hans Ulrich: Vom Leben und Sterben der großen Romanisten. Mün-
chen: Hanser 2002.
Günzel, Stephan: Raum – Topographie – Topologie. In: ders. (Hg.): Topologie. Zur
Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften. Bielefeld: transcript
2007 (Kultur- und Medientheorie), S. 13–29.
Hamacher, Werner: Unlesbarkeit. In: Paul de Man: Allegorien des Lesens [1979]. Aus
dem Amerikan. v. Werner Hamacher u. Peter Krumme. Mit einer Einl. v. Wer-
ner Hamacher. Frankfurt: Suhrkamp 1988, S. 7–26 (es; 1357).
Hammer, Anette: Lyrikinterpretation und Intertextualität. Studien zu Georg Trakls
Gedichten »Psalm I« und »De Profundis«. Würzburg: Königshausen & Neumann
2006.
Hanfstaengl, Ernst: Hitler in der Karikatur der Welt. Tat gegen Tinte. Berlin: Braune
Bücher Carl Rentsch 1933.
Hanuschek, Sven: Keiner blickt dir hinter das Gesicht. Das Leben Erich Kästners.
München u. Wien: Hanser 1999.
Hartog, François: Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris:
Seuil 2003 (La librairie du XXIe siècle).
Hausmanninger, Thomas, Rafael Capurro (Hg.): Netzethik. Grundlegungsfragen
der Internetethik. München: Fink 2002.
Helbig, Jörg (Hg.): Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären For-
schungsgebiets. Berlin: Erich Schmidt 1998.
Hell, Cornelius u. Wolfgang Wiesmüller: Die Psalmen-Rezeption biblischer Lyrik in
Gedichten. In: Heinrich Schmidinger (Hg.): Die Bibel in der deutschsprachigen
Literatur des 20. Jahrhunderts. Bd. 1: Formen und Motive. Mainz: Matthias Grü-
newald 1999, S. 158–204.
Hermand, Jost: Synthetisches Interpretieren. Zur Methodik der Literaturwissenschaft.
3. Aufl. München: Nymphenburger 1971 (sammlung dialog; 27).
Hohendahl, Peter U.: Interdisciplinary German Studies: Tentative Conclusions. In:
The German Quarterly 62 (2, 1989), S. 227–234.
Horch, Hans Otto: Expressionismus und Judentum. Zu einer Debatte in Martin Bu-
bers Zeitschrift ›Der Jude‹. In: Thomas Anz u. Michael Stark (Hg.): Die Moderni-
F4717-Antonsen.indd 233 03.12.2008 11:05:05 Uhr
234 LITERATURVERZEICHNIS
tät des Expressionismus. Stuttgart u. Weimar: Metzler 1994 (Metzler Studienaus-
gabe), S. 120–141.
Hörisch, Jochen: Das Wissen der Literatur. München: Fink 2007.
Horstmann, Axel: Wozu Geisteswissenschaften? Die Antwort August Boeckhs. Vortrag
v. 24. November 1997. In: Heft 93 [1998] der Humboldt-Universität zu Berlin,
S. 23–48.
Hunkeler, Thomas: Samuel Beckett liest Marcel Proust. In: Reiner Speck u. Michael
Maar (Hg.): Marcel Proust. Zwischen Belle Epoque und Moderne. Frankfurt:
Suhrkamp 1999, S. 142–153.
Huwiler, Elke: Erzähl-Ströme im Hörspiel. Zur Narratologie der elektroakustischen
Kunst. Paderborn: Mentis 2005 (Explicatio).
Jackson, Virginia: Who Reads Poetry? In: PMLA. Publications of the Modern Langua-
ge Association 123 (1, 2008), S. 181–187.
Jakobson, Roman: Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen. In:
ders.: Aufsätze zur Linguistik und Poetik. Hg. v. Wolfgang Raible. Frankfurt:
Ullstein 1979, S. 117–141.
Jannidis, Fotis: Figur und Person. Beitrag zu einer historischen Narratologie. Berlin u.
New York: de Gruyter 2004 (Narratologia; 3).
Jauß, Hans Robert: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik [1982].
Frankfurt: Suhrkamp 1991 (stw; 955).
Jauß, Hans Robert: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. In:
ders.: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt: Suhrkamp 1970 (es; 418),
S. 144–207.
Jonas, Klaus W.: Die Thomas-Mann Literatur. Bd. I: Bibliographie der Kritik 1896–
1955. Berlin: Erich Schmidt 1972; Bd. II: 1956–1975. Berlin: Erich Schmidt
1980; Bd. III: ders. zus. mit Helmut Koopmann: 1976–1994. Frankfurt: Klos-
termann 1997.
Jurt, Joseph (Hg.): Pierre Bourdieu. Freiburg: Orange Press 2007.
Kaiser, Gerhard: Christus im Spiegel der Dichtung. Exemplarische Interpretationen
vom Barock bis zur Gegenwart. Freiburg i. Br., Basel u. Wien: Herder 1997.
Kaiser, Gerhard: Wozu noch Geisteswissenschaften? SWR2 Wissen – Manuskript v. 6.
Januar 2003.
Kat. München leuchtete. Karl Casper und die Erneuerung der christlichen Kunst in
München um 1900. Kat. zur Ausstellung d. Bayer. Staatsgemäldesammlungen,
Staatsgalerie Moderner Kunst u. des 88. Dt. Katholikentages München 1984
e.V. im Haus d. Kunst, München vom 8. Juni - 22. Juli 1984. Hg. v. Peter-Klaus
Schuster. München: Prestel 1984.
Kat. Zeichen des Glaubens – Geist der Avantgarde. Religiöse Tendenzen in der Kunst
des 20. Jahrhunderts. Kat. zur Ausstellung zum 86. Deutschen Katholikentag v.
31. Mai - 13. Juli 1980 in Berlin, Schloß Charlottenburg, Große Orangerie. Hg.
v. Wieland Schmied. Berlin: Klett-Cotta 1980.
Kaufmann, Vincent: L’équivoque épistolaire. Paris: Minuit 1990.
F4717-Antonsen.indd 234 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 235
Kemper, Hans-Georg: Zwischen Dionysos und dem Gekreuzigten. Georg Trakl und
der Expressionismus. In: Wolfgang Braungart, Gotthart Fuchs u. Manfred Koch
(Hg.): Ästhetische und religiöse Erfahrungen der Jahrhundertwenden II: um 1900.
Paderborn, München, Wien u. a.: Schöningh 1998, S. 141–169.
Killy, Walther: Bildungsfragen. München: Beck 1971.
Klüger, Ruth: Korrupte Moral: Erich Kästners Kinderbücher. In: dies.: Frauen lesen
anders. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1996, S. 63–82.
Knapp, Steven u. Walter Benn Michaels: Against Theory. In: W. J. T. Mitchell (Hg.):
Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism. Chicago: University of
Chicago Press 1985.
Köppe, Tilmann u. Simone Winko: Theorien und Methoden der Literaturwissen-
schaft. In: Handbuch der Literaturwissenschaft. Bd. 2: Methoden und Theorien.
Hg. v. Thomas Anz. Stuttgart u. Weimar: Metzler 2007, S. 285–369.
Kracauer, Siegfried: Der Detektiv-Roman. Eine Deutung. In: ders.: Werke. Hg. v. Inka
Mülder-Bach u. Ingrid Belke. Bd. 1. Frankfurt: Suhrkamp 2006, S. 103–209.
Kracauer, Siegfried: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deut-
schen Films. Mit 64 Abb. übers. v. Ruth Baumgarten u. Karsten Witte. Frank-
furt: Suhrkamp 1979 (Schriften; 2).
Krämer, Sybille u. Horst Bredekamp (Hg.): Bild – Schrift – Zahl. München: Fink
2003.
Krug, Hans-Jürgen: Kleine Geschichte des Hörspiels. Konstanz: UVK Verlagsgesell-
schaft 2003.
Kuhlen, Rainer: Informationsethik. Umgang mit Wissen und Information in elektro-
nischen Räumen. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2004 [UTB].
Küper, Christoph (Hg): Meter, Rhythm and Performance – Metrum, Rhythmus, Per-
formanz. Proceedings of the International Conference on Meter, Rhythm and
Performance, held in May 1999 at Vechta. Frankfurt u. a.: Lang 2002 (Linguis-
tik International; 6).
Lachmann, Eduard: Kreuz und Abend. Eine Interpretation der Dichtungen Georg
Trakls. Salzburg: Otto Müller 1954 (Trakl-Studien; 1).
Lakoff, George u. Mark Turner: More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic
Metaphor. Chicago: University of Chicago Press 1989.
Lamping, Dieter u. Frank Zipfel: Was sollen Komparatisten lesen? Berlin: Erich
Schmidt 2005.
Lauer, Gerhard: Lesen mit Spiegelneuronen. Was ist Neurogermanistik? SWR2 Aula
– Manuskript v. 4. Mai 2008.
Lehmann, Hartmut: Von der Erforschung der Säkularisierung zur Erforschung von
Prozessen der Dechristianisierung und Rechristianisierung im neuzeitlichen Europa.
In: ders. (Hg.): Säkularisierung, Dechristianisierung, Rechristianisierung im neu-
zeitlichen Europa. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Göttingen: Vanden-
hoek & Ruprecht 1997, S. 9–16.
Lerer, Seth (Hg.): Literary History and the Challenge of Philology. The Legacy of Erich
Auerbach. Stanford: Stanford University Press 1996.
F4717-Antonsen.indd 235 03.12.2008 11:05:05 Uhr
236 LITERATURVERZEICHNIS
Leroi-Gourhan, André: Le geste et la parole. Technique et language. Paris: Michel
Albin 1964/65.
Lesch, Harald u. Harald Zaun: Die kürzeste Geschichte allen Lebens. Eine Reportage
über 13, 7 Millionen Jahre Werden und Vergehen. München u. Zürich: Piper 2008.
Lévi-Strauss, Claude: Rasse und Geschichte. Aus dem Franz. v. Traugott König.
Frankfurt: Suhrkamp 1972.
Lotman, Yuri M.: Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. London u.
New York: Tauris 1990 (Tauris Transformations).
Lovejoy, Arthur O.: The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea.
Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1936.
Lützeler, Paul Michael: Letter from the Editor: »Germanistik« as German Studies. In:
The German Quarterly 62 (2, 1989), S. 139–140.
Maar, Christa u. Hubert Burda (Hg.): Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder. Köln:
DuMont 2004.
Makropoulos, Michael: Modernität und Kontingenz. München: Fink 1997.
Mandry, Christof (Hg.): Literatur ohne Moral. Literaturwissenschaften und Ethik im
Gespräch. Münster: LIT 2003.
Manguel, Alberto: A History of Reading. London: Harper Collins 1996.
Marquard, Odo: Der angeklagte und der entlastete Mensch in der Philosophie des 18.
Jahrhunderts. In: ders.: Abschied vom Prinzipiellen. Philosophische Studien. Stutt-
gart: Reclam 1981 (RUB; 7724), S. 39–66.
Marx, Friedhelm: Erlesene Helden. Don Sylvio, Werther, Wilhelm Meister und die Lite-
ratur. Heidelberg: Winter 1995 (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte; 139).
Marx, William: L’adieu à la littérature. Histoire d’une dévalorisation XVIII–XXe sièc-
le. Paris: Editions de Minuit 2005.
Mattenklott, Gert: Kanon und Neugier. In: Wozu Literaturwissenschaft? Kritik und
Perspektiven. Hg. v. Frank Griesheimer u. Alois Prinz. Tübingen: Francke 1991,
S. 353–364.
Maur, Karin von: Der verkannte Revolutionär. Adolf Hölzel – Werk und Wirkung.
Stuttgart: Hohenheim 2003.
Mierau, Fritz: Russische Dichter. Poesie und Person. Dornach: Pforte 2003.
Mitchell, W. J. T.: Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. Chica-
go u. London: The University of Chicago Press 1994.
Mitchell, W. J. T.: The Pictorial Turn. In: Artforum 1992 (March), S. 89–94.
Mönig, Roland: Franz Marc und Georg Trakl: Ein Beitrag zum Vergleich von Malerei
und Dichtung des Expressionismus. Münster: LIT 1996 (Interpretation u. Ver-
mittlung; 3).
Moretti, Franco: Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for a Literary History. London
u. New York: Verso 2005.
Müller, Adam: Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland
[1816]. Hg. v. Jürgen Wilke. Stuttgart: Reclam 1983 (RUB; 7946).
Mulsow, Martin u. Marcelo Stamm (Hg.): Konstellationsforschung. Frankfurt: Suhr-
kamp 2005.
F4717-Antonsen.indd 236 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 237
Mukařovský, Jan: Kapitel aus der Ästhetik. Frankfurt: Suhrkamp 1970 (es; 230).
Murphy, James J.: Rhetoric in the Middle Ages. Berkeley: University of California
Press 1974.
Muschg, Adolf: Erlaubt ist, was gelingt. Der Literaturwissenschaftler als Autor. In:
Frank Griesheimer u. Alois Prinz (Hg.): Wozu Literaturwissenschaft? Kritik und
Perspektiven. Tübingen: Francke 1991, S. 161–179.
Neuber, Wolfgang: Nationalismus als Raumkonzept. Zu den ideologischen und for-
malästhetischen Grundlagen von Josef Nadlers Literaturgeschichte. In: Klaus Gar-
ber (Hg.): Kulturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk im Blick auf das
Europa der Frühen Neuzeit. München: Fink 2002, S. 175–191.
Neymeyr, Barbara: Konstruktion des Phantastischen. Die Krise der Identität in Kafkas
»Beschreibung eines Kampfes«. Heidelberg: Winter 2004 (Beiträge zur neueren
Literaturgeschichte; 206).
Nichols, Stephen G.: Philology in Auerbach’s Drama of (Literary) History. In: Litera-
ry History and the Challenge of Philology. The Legacy of Erich Auerbach. Hg. v.
Seth Lerer. Stanford: Stanford University Press 1996, S. 63–77.
Nünning, Ansgar: Zehn Thesen zum Thema Literaturwissenschaft und/oder/als Kul-
turwissenschaft: Prolegomena, Plädoyer und Projekte für eine kulturwissenschaftlich
ausgerichtete Literaturwissenschaft. In: Herbert Foltinek u. Christoph Leitgeb
(Hg.), Literaturwissenschaft: intermedial – interdisziplinär. Wien: Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften 2002, S. 39–65.
Nünning, Ansgar u. Roy Sommer: Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft.
Disziplinäre Ansätze, theoretische Positionen und transdisziplinäre Perspektiven. In:
Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft. Disziplinäre Ansätze – Theoretische
Positionen – Transdisziplinäre Perspektiven. Hg. v. Ansgar Nünning u. Roy Som-
mer. Tübingen: Narr 2004, S. 9–29.
Parker, Patricia u. Geoffrey Hartman (Hg.): Shakespeare and the Question of Theory.
New York u. London: Methuen 1985.
Patzig, Günther: Erklären und Verstehen. Bemerkungen zum Verhältnis von Natur-
und Geisteswissenschaften. In: ders.: Tatsachen, Normen, Sätze. Aufsätze und Vor-
träge. Stuttgart: Reclam 1980 (RUB; 9986), S. 45–75.
Pausch, Sibylle: Militarismen eines Pazifisten. Sprachliche Beobachtungen zu Erich
Kästners Buch und Film »Emil und die Detektive« (1929/1931). In: Horst D.
Schlosser (Hg.): Das Deutsche Reich ist eine Republik. Beiträge zur Kommunikati-
on und Sprache der Weimarer Zeit. Frankfurt u. a. 2003 (Frankfurter Forschun-
gen zur Kultur- und Sprachwissenschaft; 8), S. 39–49.
Peck, Jeffrey M.: Introduction: In: The German Quarterly 62 (2, 1989), S. 141–
143.
Peck, Jeffrey M.: Remapping the Topography. In: The German Quarterly 62 (2, 1989),
S. 178–187.
Perloff, Marjorie: Presidential Address 2006: It Must Change. In: PMLA. Publica-
tions of the Modern Language Association 122 (3, 2007), S. 652–662.
F4717-Antonsen.indd 237 03.12.2008 11:05:05 Uhr
238 LITERATURVERZEICHNIS
Quéau, Philippe: Eine ethische Vision der Informationsgesellschaft. Abrufbar unter:
<www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2539/1.html> [1998].
Rajewski, Irina O.: Intermedialität. Tübingen u. Basel: Francke 2002.
Rauch, Wolf: ›Informationsethik. Die Fragestellung aus der Sicht der Informationswis-
senschaft‹. In: Cyberethik. Verantwortung in der digital vernetzten Welt. Hg. v. An-
ton Kolb, Reinhold Esterbauer u. Hans-Walter Ruckenbauer. Stuttgart, Berlin
u. Köln: Kohlhammer 1998, S. 51–57.
Renkel, Petra: ›Das Wort ist innerer Klang‹. Abstraktionstendenzen in der expressionis-
tischen Kunst zwischen Wassily Kandinsky und Georg Trakl. In: Thomas Eichner u.
Ulf Bleckmann (Hg.): Intermedialität. Vom Bild zum Text. Bielefeld: Aisthesis
1994, S. 77–93.
Reuß, Roland: Zur kritischen Edition von »Beschreibung eines Kampfes« und »Gegen
zwölf Uhr […]«. In: Franz Kafka-Hefte, Nr. 2. Frankfurt: Stroemfeld 1999 (Histo-
risch-kritische Edition sämtlicher Handschriften, Drucke u. Typoskripte), S. 3–8.
Ridley, Hugh: The Problematic Bourgeois: Twentieth Century Criticism on Thomas
Mann’s »Buddenbrooks« and »The Magic Mountain«. Columbia, SC: Camden
House 1994.
Ringbom, Sixten: Kandinsky und das Okkulte. In: Armin Zweite (Hg.): Kandinsky
in München. Begegnungen und Wandlungen 1896–1914. München: Prestel 1982,
S. 85–101.
Ringbom, Sixten: Überwindung des Sichtbaren: Die Generation der abstrakten Pio-
niere. In: Maurice Tuchmann u. Judith Freemann (Hg.): Das Geistige in der
Kunst: Abstrakte Malerei 1890–1985. [Übers. aus d. Amerikan. durch e. Arbeits-
gruppe am Kunsthistor. Seminar d. Univ. Stuttgart.] Stuttgart: Urachhaus 1988,
S. 131–153.
Rusterholz, Peter: Formen ›textimmanenter‹ Analyse. In: Grundzüge der Literaturwis-
senschaft. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold u. Heinrich Detering. 6. Aufl. München:
Deutscher Taschenbuch Verlag 2003 (dtv; 30171), S. 365–385.
Rusterholz, Peter: Die Kunst der Interpretation und die Künste der Dekonstruktion.
In: 1955–2005. Emil Staiger und die Kunst der Interpretation heute. Hg. v. Joa-
chim Rickes, Volker Ladenthin u. Michael Baum. Bern u. Berlin: Lang 2007
(Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik; 16), S. 155–172.
Rusterholz, Peter: Der Zürcher Literaturstreit. In: Schweizer Literaturgeschichte. Hg.
v. Peter Rusterholz u. Andreas Solbach. Stuttgart: Metzler 2007, S. 312–314.
Rusterholz, Peter: Zum Verhältnis von Hermeneutik und neueren antihermeneuti-
schen Strömungen. In: Grundzüge der Literaturwissenschaft. Hg. v. Heinz Ludwig
Arnold u. Heinrich Detering. 6. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag
2003 (dtv; 30171), S. 157–178.
Salmon, Christian: Storytelling. La Machine à fabriquer des histoires et à formater les
esprits. Paris: La Découverte 2007.
Scheule, Rupert M., Rafael Capurro u. Thomas Hausmanninger (Hg.): Vernetzt
gespalten. Der Digital Divide in ethischer Perspektive. München: Fink 2004.
F4717-Antonsen.indd 238 03.12.2008 11:05:05 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 239
Schillemeit, Jost: Kafkas »Beschreibung eines Kampfes«. Ein Beitrag zum Textver-
ständnis und zur Geschichte von Kafkas Schreiben. In: Gerhard Kurz (Hg.): Der
junge Kafka. Frankfurt: Suhrkamp 1984 (st; 2035), S. 102–132.
Schlögel, Karl: Räume und Geschichte. In: Stephan Günzel (Hg.): Topologie. Zur
Raumbeschreibung in den Kultur- und Medienwissenschaften. Bielefeld: transcript
2007 (Kultur- u. Medientheorie), S. 33–51.
Schmedes, Götz: Medientext Hörspiel. Ansätze einer Hörspielsemiotik am Beispiel der
Radioarbeiten von Alfred Behrens. Münster: Waxmann 2002 (Internationale
Hochschulschriften; 371).
Schuh, Franz: Walter Benjamins Grausamkeit. In: Die Zeit 39 (2004), S. 64.
Seewald-Heeg, Uta: Sprachtechnologie für die multilinguale Kommunikation. St. Au-
gustin: Gardez 2003.
Seiffert, Helmut: Einführung in die Wissenschaftstheorie. Bd. 2. München: Beck
1970 (Beck’sche Schwarze Reihe; 61).
Semino, Elena, John Heywood u. Mick Short: Methodological Problems in the Ana-
lysis of Metaphors in a Corpus of Conversations about Cancer. In: Journal of Prag-
matics 36 (2004), S. 1271–1294.
Shahar, Galili: Zurück zum Roman, einem Zufluchtsort der Menschheit in ihren
schweren Zeiten (hebr.). In: Haaretz, 8. 6. 2007.
Sievers, Eduard: Rhythmisch-melodische Studien. Vorträge u. Aufsätze. Heidelberg:
Winter 1912 (Germanische Bibliothek, 2. Abt.: Untersuchungen & Texte; 5).
Smolik, Noemi: Auferstehung und kulturelle Erneuerung. In: Hartwig Fischer u.
Sean Rainbird (Hg.): Kandinsky: Malerei 1908–1921. Ausst. Kat. Kunstmuse-
um Basel. Ostfildern: Hatje Cantz 2006, S. 137–156.
Söring, Jürgen: Der Erkenntnis-Anspruch von Poiesis. Einige Bemerkungen zum Ver-
hältnis von Dichtung und Wissen(schaft). In: Colloquium Helveticum 37 (2006),
S. 199–299.
Söring, Jürgen: Grenzen der Lesbarkeit. Über die Kunst des Versagens. In: Bulletin
CILA 43. Neuchâtel 1986, S. 189–211.
Söring, Jürgen: Literaturwissenschaft. In: Handlexikon zur Literaturwissenschaft. Hg.
v. Diether Krywalski. 2. Aufl. München: Ehrenwirth 1976, S. 271–281.
Sperber, Dan u. Deirdre Wilson: Relevance. Communication and Cognition, 2. Aufl.
Malden u. Oxford: Blackwell 1995.
Spinner, Helmut F., Michael Nagenborg u. Karsten Weber (Hg.): Bausteine zu ei-
ner neuen Informationsethik. Berlin u. Wien: Philo 2001.
Spoerhase, Carlos: Was ist ein Werk? Über philologische Werkfunktionen. In: Scientia
poetica, Bd. 11 (2007), S. 276–344.
Spörl, Uwe: Gottlose Mystik in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende.
Paderborn, Wien u. Zürich: Schöningh 1997.
Steele, Joshua: Prosodia rationalis. Or an Essay towards Establishing the Melody and
Measure of Style. London: J. Nichols 1779 [Reprint 1971].
Steinfeld, Thomas: Der leidenschaftliche Buchhalter. Philologie als Lebensform. Mün-
chen: Hanser 2004.
F4717-Antonsen.indd 239 03.12.2008 11:05:05 Uhr
240 LITERATURVERZEICHNIS
Stellmacher, Wolfgang: Raum und Zeit als Koordinaten der Literaturgeschichte. In:
Peter Wagener (Hg.): Sprachformen. Deutsch und Niederdeutsch in europäischen
Bezügen. Festschrift für Dieter Stellmacher zum 60. Geburtstag. Stuttgart: Steiner
1999 (Zeitschrift für Dialektologie u. Linguistik. Beihefte; 105), S. 289–295.
Stocker, Günther: Vom Bücherlesen. Zur Darstellung des Lesens in der deutschsprachi-
gen Literatur seit 1945. Heidelberg: Winter 2007 (Beiträge zur neueren Litera-
turgeschichte; 249).
Stockhammer, Robert: Leseerzählungen. Alternativen zum hermeneutischen Verfah-
ren. Stuttgart: Metzler 1991.
Stockwell, Peter: Cognitive Poetics. An Introduction. London: Routledge 2002.
Szondi, Peter: Theorie des modernen Dramas, 4. Aufl. Frankfurt: Suhrkamp 1967
(es; 27).
Szondi, Peter: Über eine »Freie (d. h. freie) Universität«. Stellungnahmen eines Philo-
logen, Frankfurt: Suhrkamp 1973 (es; 620)
Szondi, Peter: Über philologische Erkenntnis. In: Die Neue Rundschau 73 (1, 1962),
S. 146–165.
Szondi, Peter: Über philologische Erkenntnis [1962]. In: ders.: Hölderlin-Studien.
Mit einem Traktat über philologische Erkenntnis [1967]. Frankfurt: Suhrkamp
1970 (es; 376), S. 9–34.
Szondi, Peter: Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft. In: Universi-
tätstage 1962. Wissenschaft und Verantwortung. Berlin 1962, S. 73–91.
Thamer, Hans-Ulrich: Jugendmythos und Gemeinschaftskult. Bündische Leitbilder
und Rituale in der Jugendbewegung der Weimarer Republik. In: Eckart Conze u. a.
(Hg.): Geschichte zwischen Wissenschaft und Politik. Festschrift für Michael Stür-
mer zum 65. Geburtstag. Baden-Baden: Nomos 2003, S. 268–286.
Todorov, Tzvetan: La Littérature en péril. Paris: Flammarion 2007.
Tornow, Ingo: Erich Kästner und der Film. München: Deutscher Taschenbuch Ver-
lag 1998.
Treml, Martin u. Karlheinz Barck (Hg.): Erich Auerbach. Geschichte und Aktualität
eines europäischen Philologen. Berlin: Kadmos 2007.
Tsur, Reuven: What Makes Sound Patterns Expressive? The Poetic Mode of Speech
Perception. London: Duke University Press 1992.
Tuchmann, Maurice u. Judith Freemann (Hg.): Das Geistige in der Kunst: abstrakte
Malerei 1890–1985. [Übers. aus d. Amerikan. durch e. Arbeitsgruppe am
Kunsthistor. Seminar d. Univ. Stuttgart.] Stuttgart: Urachhaus 1988.
Turk, Horst: Philologische Grenzgänge. Zum Cultural Turn in der Literatur. Würz-
burg: Königshausen & Neumann 2003.
Udolph, Jürgen u. Sebastian Fitzek: Professor Udolphs Buch der Namen. Woher sie
kommen. Was sie bedeuten. München: Bertelsmann 2005.
Ulmer, Renate: Passion und Apokalypse. Frankfurt: Lang 1992.
UNESCO (Hg.): Statement des zweiten UNESCO INFOethik Kongresses 1998. Ab-
rufbar unter: <www.unesco.ch/biblio-d/stat_infoethik_frame.htm> [1998].
F4717-Antonsen.indd 240 03.12.2008 11:05:06 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 241
UNESCO (Hg.): Universal Declaration on Cultural Diversity. Abrufbar unter:
<por tal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html> [2001].
UNESCO (Hg.): Charter on the Preservation of the Digital Heritage. Abrufbar un-
ter: <portal.unesco.org/ci/en/ev.php–URL_ID=13366&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html> [2003].
UNESCO (Hg.): Informationsethik. Ethische Fragen der Informationsgesellschaft.
Abrufbar unter: <www.unesco.de/c_arbeitsgebiete/informationsethik.htm>
[2003].
UNESCO (Hg.): Recommendation concerning the Promotion and Use of Mulitlingu-
alism and Universal Access to Cyberspace. Abrufbar unter: <portal.unesco.org/ci/
en/ev.php-URL_ID=13475&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html> [2003].
Unseld, Siegfried (Hg.): Wie, warum und zu welchem Ende wurde ich Literaturhis-
toriker? Eine Sammlung von Aufsätzen aus Anlaß des 70. Geburtstags von Robert
Minder. Frankfurt: Suhrkamp 1972 (st; 60).
Usener, Sylvia: Hörer. In: Gerd Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik,
Bd. 3. Tübingen: Niemeyer 1996, S. 1562.
Venzmer, Wolfgang: Adolf Hölzel: Leben und Werk. Monographie mit Verzeichnis der
Ölbilder, Glasfenster und ausgewählter Pastelle. Stuttgart: Deutsche Verlags-An-
stalt 1982.
Vialon, Martin (Hg.): »Und wirst erfahren wie das Brot der Fremde so salzig schmeckt«.
Erich Auerbachs Briefe an Karl Vossler (1926–1948). Mit einem Nachw. hg. v.
Martin Vialon. Warmbronn: Keicher 2007.
Vickers, Brian: Appropriating Shakespeare. Contemporary Critical Quarrels. New
Haven u. London: Yale University Press 1993.
Vietta, Silvio u. Hans-Georg Kemper: Expressionismus. 2., bibliog. erg. Aufl. Mün-
chen: Fink 1983.
Vondung, Klaus: Die Apokalypse in Deutschland. München: Deutscher Taschen-
buch Verlag 1988.
Vondung, Klaus: Mystik und Moderne. Literarische Apokalyptik in der Zeit des Expres-
sionismus. In: Thomas Anz u. Michael Stark (Hg.): Die Modernität des Expressionis-
mus. Stuttgart u. Weimar: Metzler 1994 (Metzler Studienausgabe), S. 142–150.
Von Lang, Jochen (Hg.): Adolf Hitler. Gesichter eines Diktators. Eine Bilddokumen-
tation. Gütersloh: Herbig 1975.
Walser, Martin: Beschreibung einer Form. Versuch über Kafka [1961]. Frankfurt
u. a.: Ullstein 1973 (Ullstein Buch; 2878).
Washton Long, Rose-Carol: Expressionismus, Abstraktion und die Suche nach Utopia
in Deutschland. In: Tuchmann, Maurice u. Judith Freemann (Hg.): Das Geistige
in der Kunst: abstrakte Malerei 1890–1985. [Übers. aus d. Amerikan. durch e.
Arbeitsgruppe am Kunsthistor. Seminar d. Univ. Stuttgart.] Stuttgart: Urach-
haus 1988, S. 201–217.
F4717-Antonsen.indd 241 03.12.2008 11:05:06 Uhr
242 LITERATURVERZEICHNIS
Weber, Karsten: Digitale Spaltung und Informationsgerechtigkeit. In: Rupert Scheu-
le, Rafael Capurro u. Thomas Hausmanninger (Hg.): Vernetzt gespalten. Der
Digital Divide in ethischer Perspektive. München: Fink 2004, S. 115–120.
Weber, Karsten: Informationelle Gerechtigkeit. Herausforderungen des Internets und
Antworten einer neuen Informationsethik. In: Helmut F. Spinner, Michael Nagen-
borg u. Karsten Weber (Hg.): Bausteine zu einer neuen Informationsethik. Berlin
u. Wien: Philo 2001, S. 129–194.
Weber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 3., erw. u. verb. Aufl., hg.
v. Johannes Winckelmann. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1968, S. 146–214.
Weber, Max: Wissenschaft als Beruf [1917/1919]. Nachwort v. Friedrich Tenbruck.
Stuttgart: Reclam 1995 (RUB; 9388).
Weber, Peter J.: Sprachkonflikte und neue Medien: Anmerkungen zu einer zeitgenössi-
schen Disziplin aus interdisziplinärer Sicht. In: Methodology of Conflict Linguistics/
Methodologie der Konfliktlinguistik/Méthodologie de la linguistique de conflit. Hg.
v. Klaus Bochmann, Peter H. Nelde u. Wolfgang Wölck. St. Augustin: Asgard,
S. 103–125.
Weidner, Daniel (Hg.): Figuren des Europäischen. Kulturgeschichtliche Perspektiven.
München: Fink 2006.
Weigel, Sigrid: Zum ›topographical turn‹. Kartographie, Topographie und Raumkon-
zepte in den Kulturwissenschaften. In: KulturPoetik 2 (2, 2002), S. 151–165.
Weimar, Klaus: Hermeneutik. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft,
Bd. II. Hg. v. Harald Fricke. Berlin u. New York 2000, S. 25–29.
Weimar, Klaus: Lesen. Zu sich selbst sprechen in fremdem Namen. In: Heinrich Bosse
u. Ursula Renner (Hg.): Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel.
Freiburg i. Br.: Rombach 1999 (Rombach Grundkurs; 3), S. 49–62.
Weimar, Klaus: Literatur, Literaturgeschichte, Literaturwissenschaft. Zur Geschichte
der Bezeichnungen für eine Wissenschaft und ihren Gegenstand. In: Christian Wa-
genknecht (Hg.): Zur Terminologie der Literaturwissenschaft. Akten des IX. Ger-
manistischen Symposions der Deutschen Forschungsgemeinschaft Würzburg 1986.
Stuttgart: Metzler 1988, S. 9–23.
Weiss, Walter u. Ernst Hanisch (Hg.): Vermittlungen. Texte und Kontexte österreichi-
scher Literatur und Geschichte im 20. Jahrhundert. Salzburg u. Wien: Residenz
1990.
Werber, Niels: Die Geopolitik der Literatur. Eine Vermessung der medialen Weltraum-
ordnung. München: Hanser 2007.
Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von: Geschichte der Philologie [1921]. Leipzig:
B. G. Teubner Verlagsgesellschaft 1959.
Wolf, Werner: Art. Intermedialität. In: Ansgar Nünning (Hg.): Metzler Lexikon
Literatur- und Kulturtheorie. Stuttgart u. Weimar: Metzler 1998, S. 238–239.
Wolf, Werner: Intermedialität: ein weites Feld und eine Herausforderung für die Lite-
raturwissenschaft. In: Herbert Foltinek u. Christoph Leitgeb (Hg.): Literaturwis-
senschaft: intermedial – interdisziplinär. Wien: Österreichische Akademie der
Wissenschaften 2002, S. 163–191.
F4717-Antonsen.indd 242 03.12.2008 11:05:06 Uhr
LITERATURVERZEICHNIS 243
Womser-Hacker, Christa: Ein mehrsprachiges Kommunikationsforum zur Unterstüt-
zung von Lernprozessen ohne Sprachbarrieren. In: Wissen in Aktion. Der Primat
der Pragmatik als Motto der Konstanzer Informationswissenschaft. Festschrift für
Rainer Kuhlen zum 60. Geburtstag. Hg. v. Rainer Hammwöhner, Marc Rittber-
ger u. Wolfgang Semar. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2004, S. 291–308.
Wunberg, Gotthart: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne. Hg. v.
Stephan Dietrich. Tübingen: Narr 2001.
Würffel, Stefan Bodo: Ausnahmezustände und Aufnahmezustände. Das ›Neue Hör-
spiel‹. In: Monika Estermann u. Edgar Lersch (Hg.): Buch, Buchhandel und
Rundfunk 1968 und die Folgen. Wiesbaden: Harassowitz 2003, S. 213–226.
Würffel, Stefan Bodo: Das deutsche Hörspiel. Stuttgart: Metzler 1978 (SM; 172).
Würffel, Stefan Bodo: Für eine Literaturgeschichte des fremdkulturellen Lesers. Vorü-
berlegungen zur Konzeption einer rückläufigen Literaturgeschichte. In: Kontrover-
sen, alte und neue. Hg. v. Albrecht Schöne, Bd. 11. Tübingen: Niemeyer 1986,
S. 115–122.
Würffel, Stefan Bodo: Der produktive Widerspruch. Heinrich Heines negative Dia-
lektik. Bern: Francke 1986.
Würffel, Stefan Bodo: Wirkungswille und Prophetie. Studien zu Werk und Wirkung
Stefan Georges. Bonn: Bouvier 1978 (Abhandlungen zur Kunst-, Musik- u. Lite-
raturwissenschaft; 249).
Wuthenow, Ralph-Rainer: Im Buch die Bücher oder Der Held als Leser. Frankfurt:
Europäische Verlagsanstalt 1980.
Ziegler, Evelyn u. Ralph Müller: Metaphern zwischen Sprache, Stil und Denken. In:
Der Deutschunterricht 6 (2006), S. 2–6.
Zimmermann, Reinhard: Die Kunsttheorie von Wassily Kandinsky. 2 Bde. Berlin:
Gebr. Mann 2002.
3. Lexika
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. v. Joachim Ritter. Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 1971–2007.
Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. v. Gert Ueding. Tübingen: Niemeyer
1992ff.
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Begr. v. Paul Merker u. Wolfgang
Stammler. Hg. v. Klaus Kanzog u. Achim Masser. Berlin u. New York: de Gruy-
ter 1958–1984.
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Hg. v. Klaus Weimar, Harald Fricke
u. Jan-Dirk Müller. Berlin u. New York: de Gruyter 1997–2003.
Wörterbuch der philosophischen Metaphern. Hg. v. Ralf Konersmann. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2007.
F4717-Antonsen.indd 243 03.12.2008 11:05:06 Uhr
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Dialogische Ordnung: Machtdiskurs und Körperbilder in der höfischen Trauerdichtung Johann von Bessers (1654–1729)Von EverandDialogische Ordnung: Machtdiskurs und Körperbilder in der höfischen Trauerdichtung Johann von Bessers (1654–1729)Noch keine Bewertungen
- Offener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 3/2016Von EverandOffener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 3/2016Noch keine Bewertungen
- Offener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 6/2019Von EverandOffener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 6/2019Noch keine Bewertungen
- Der feste Buchstabe: Studien zur Hermeneutik, Psychoanalyse und LiteraturVon EverandDer feste Buchstabe: Studien zur Hermeneutik, Psychoanalyse und LiteraturNoch keine Bewertungen
- Geschichte der philosophischen Terminologie: Im Umriss dargestelltVon EverandGeschichte der philosophischen Terminologie: Im Umriss dargestelltNoch keine Bewertungen
- Offener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 4/2017Von EverandOffener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 4/2017Noch keine Bewertungen
- Offener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 2/2015Von EverandOffener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 2/2015Noch keine Bewertungen
- Wie Menschen möglich sind: Eine Historische Anthropologie. Unter Mitarbeit von Carolin SachsVon EverandWie Menschen möglich sind: Eine Historische Anthropologie. Unter Mitarbeit von Carolin SachsNoch keine Bewertungen
- Konzepte des Kollektiven: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasVon EverandKonzepte des Kollektiven: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasNoch keine Bewertungen
- Transnationale Karpaten (II): Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasVon EverandTransnationale Karpaten (II): Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasNoch keine Bewertungen
- Literatur - Politik - Kritik: Beiträge zur Österreichischen Literatur des 20. JahrhundertsVon EverandLiteratur - Politik - Kritik: Beiträge zur Österreichischen Literatur des 20. JahrhundertsNoch keine Bewertungen
- Offener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 5/2018Von EverandOffener Horizont: Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft 5/2018Noch keine Bewertungen
- Þáttasyrpa – Studien zu Literatur, Kultur und Sprache in Nordeuropa: Festschrift für Stefanie GropperVon EverandÞáttasyrpa – Studien zu Literatur, Kultur und Sprache in Nordeuropa: Festschrift für Stefanie GropperAnna Katharina HeinigerNoch keine Bewertungen
- Die philosophische Schnecke: In der Philosophie gewinnt, wer als Letzter ankommt: Wittgensteins Philosophie zwischen Lebenssorge und KulturkritikVon EverandDie philosophische Schnecke: In der Philosophie gewinnt, wer als Letzter ankommt: Wittgensteins Philosophie zwischen Lebenssorge und KulturkritikNoch keine Bewertungen
- Die Auflösung des abendländischen Subjekts und das Schicksal Europas: Symposium 2000 des Nietzsche-Forums München. Vorträge aus den Jahren 2000-2003. Sonderband 3 der Reihe "Mit Nietzsche denken". Publikationen des Nietzsche-Forums München e.V.Von EverandDie Auflösung des abendländischen Subjekts und das Schicksal Europas: Symposium 2000 des Nietzsche-Forums München. Vorträge aus den Jahren 2000-2003. Sonderband 3 der Reihe "Mit Nietzsche denken". Publikationen des Nietzsche-Forums München e.V.Noch keine Bewertungen
- Berlin im Feuilleton der Weimarer Republik: Zur Kulturkritik in den Kurzessays von Joseph Roth, Bernard von Brentano und Siegfried KracauerVon EverandBerlin im Feuilleton der Weimarer Republik: Zur Kulturkritik in den Kurzessays von Joseph Roth, Bernard von Brentano und Siegfried KracauerNoch keine Bewertungen
- Tragödie als Bühnenform: Einar Schleefs Chor-TheaterVon EverandTragödie als Bühnenform: Einar Schleefs Chor-TheaterNoch keine Bewertungen
- Vorlesung über Die gesamte Philosophie oder die Lehre vom Wesen der Welt und dem menschlichen Geiste, 3. Teil: Metaphysik des SchönenVon EverandVorlesung über Die gesamte Philosophie oder die Lehre vom Wesen der Welt und dem menschlichen Geiste, 3. Teil: Metaphysik des SchönenNoch keine Bewertungen
- Historische Sprachwissenschaft als philologische KulturwissenschaftVon EverandHistorische Sprachwissenschaft als philologische KulturwissenschaftNoch keine Bewertungen
- Geschichtskritik nach ›1945‹: Aktualität und StimmenvielfaltVon EverandGeschichtskritik nach ›1945‹: Aktualität und StimmenvielfaltNoch keine Bewertungen
- Archive in Kroatien: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasVon EverandArchive in Kroatien: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasNoch keine Bewertungen
- Manfred Angerer – Gesammelte Schriften und VorträgeVon EverandManfred Angerer – Gesammelte Schriften und VorträgeMarkus GrasslNoch keine Bewertungen
- Ursprung und Sprache bei Friedrich Hölderlin und Walter BenjaminVon EverandUrsprung und Sprache bei Friedrich Hölderlin und Walter BenjaminNoch keine Bewertungen
- Emotionen, Wissen und Aufklärung: Gefühlskulturen im Großbritannien des 18. JahrhundertsVon EverandEmotionen, Wissen und Aufklärung: Gefühlskulturen im Großbritannien des 18. JahrhundertsNoch keine Bewertungen
- Textgelehrte: Literaturwissenschaft und literarisches Wissen im Umkreis der Kritischen TheorieVon EverandTextgelehrte: Literaturwissenschaft und literarisches Wissen im Umkreis der Kritischen TheorieNoch keine Bewertungen
- Freilegungen: Überlebende - Erinnerungen - TransformationenVon EverandFreilegungen: Überlebende - Erinnerungen - TransformationenNoch keine Bewertungen
- Die Gründung des SOKW: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasVon EverandDie Gründung des SOKW: Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte SüdosteuropasNoch keine Bewertungen
- Versuch über den Menschen: Einführung in eine Philosophie der KulturVon EverandVersuch über den Menschen: Einführung in eine Philosophie der KulturBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (24)
- Theodor Fontane: ‚Wegbereiter‘ für weibliche Emanzipation um 1900?: Vergleichende Untersuchung literarischer Weiblichkeitskonzepte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Theodor Fontanes ‚Cécile‘ (1887) und Helene Böhlaus ‚Der Rangierbahnhof‘ (1896)Von EverandTheodor Fontane: ‚Wegbereiter‘ für weibliche Emanzipation um 1900?: Vergleichende Untersuchung literarischer Weiblichkeitskonzepte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Theodor Fontanes ‚Cécile‘ (1887) und Helene Böhlaus ‚Der Rangierbahnhof‘ (1896)Noch keine Bewertungen
- Diskurse, Texte, Traditionen: Modelle und Fachkulturen in der DiskussionVon EverandDiskurse, Texte, Traditionen: Modelle und Fachkulturen in der DiskussionNoch keine Bewertungen
- Blumfeld und die Hamburger Schule: Sekundarität – Intertextualität – DiskurspopVon EverandBlumfeld und die Hamburger Schule: Sekundarität – Intertextualität – DiskurspopNoch keine Bewertungen
- Der Autor in seinem Text: Autofiktion in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur als (post-)postmodernes PhänomenVon EverandDer Autor in seinem Text: Autofiktion in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur als (post-)postmodernes PhänomenNoch keine Bewertungen
- Tabuzonen und Tabubrüche in der Deutschschweizer LiteraturVon EverandTabuzonen und Tabubrüche in der Deutschschweizer LiteraturNoch keine Bewertungen
- Archiv für Begriffsgeschichte, Band 65,2: Schwerpunkt: Leibniz und die SpracheVon EverandArchiv für Begriffsgeschichte, Band 65,2: Schwerpunkt: Leibniz und die SpracheCarsten DuttNoch keine Bewertungen
- Wer ist weise? der gute Lehr von jedem annimmt: Festschrift für Michael Albrecht zum 65. GeburtstagVon EverandWer ist weise? der gute Lehr von jedem annimmt: Festschrift für Michael Albrecht zum 65. GeburtstagHeinrich P DelfosseNoch keine Bewertungen
- Mäzenaten im Mittelalter aus europäischer Perspektive: Von historischen Akteuren zu literarischen TextkonzeptenVon EverandMäzenaten im Mittelalter aus europäischer Perspektive: Von historischen Akteuren zu literarischen TextkonzeptenNoch keine Bewertungen
- Petrarca und die Herausbildung des modernen Subjekts: . E-BOOKVon EverandPetrarca und die Herausbildung des modernen Subjekts: . E-BOOKNoch keine Bewertungen
- Romanisches Erzählen: Peter Handke und die epische TraditionVon EverandRomanisches Erzählen: Peter Handke und die epische TraditionNoch keine Bewertungen
- Ostelbischer Adel im Nationalsozialismus: Familienerinnerungen am Beispiel der WedelVon EverandOstelbischer Adel im Nationalsozialismus: Familienerinnerungen am Beispiel der WedelNoch keine Bewertungen
- Phänomen Kultur: Perspektiven und Aufgaben der KulturwissenschaftenVon EverandPhänomen Kultur: Perspektiven und Aufgaben der KulturwissenschaftenNoch keine Bewertungen
- Peter Lotar (1910−1986): Kulturelle Praxis und autobiographisches SchreibenVon EverandPeter Lotar (1910−1986): Kulturelle Praxis und autobiographisches SchreibenNoch keine Bewertungen
- Warum uns die Worte fehlen, wenn wir sie nicht gebrauchen: Versuch einer ontologischen Revision des WerkbegriffsVon EverandWarum uns die Worte fehlen, wenn wir sie nicht gebrauchen: Versuch einer ontologischen Revision des WerkbegriffsNoch keine Bewertungen
- Liber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeVon EverandLiber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Leseprobe L 9783518295274Dokument21 SeitenLeseprobe L 9783518295274268bh4dk2rNoch keine Bewertungen
- Erinnern als Überschritt: Reinhart Kosellecks geschichtspolitische InterventionenVon EverandErinnern als Überschritt: Reinhart Kosellecks geschichtspolitische InterventionenNoch keine Bewertungen
- Das achtzehnte Jahrhundert: Hermeneutik und Recht im 18. JahrhundertVon EverandDas achtzehnte Jahrhundert: Hermeneutik und Recht im 18. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Der Weimar-Jena Plan: Die Beziehung des Nietzsche-Archivs zur Universität Jena 1930–1935Von EverandDer Weimar-Jena Plan: Die Beziehung des Nietzsche-Archivs zur Universität Jena 1930–1935Noch keine Bewertungen
- Arbeit an der Kultur: Margaret Mead, Gregory Bateson und die amerikanische Anthropologie, 1930-1950Von EverandArbeit an der Kultur: Margaret Mead, Gregory Bateson und die amerikanische Anthropologie, 1930-1950Noch keine Bewertungen
- 5 38 PBDokument594 Seiten5 38 PBLarryNoch keine Bewertungen