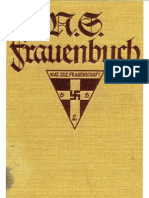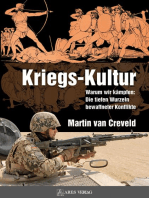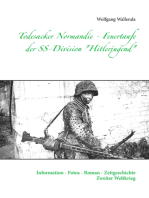Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SS Leitheft - 08. Jahrgang - Heft 03 1942
SS Leitheft - 08. Jahrgang - Heft 03 1942
Hochgeladen von
Ruffy810%(1)0% fanden dieses Dokument nützlich (1 Abstimmung)
110 Ansichten56 SeitenSS Leitheft - 08. Jahrgang - Heft 03 1942
Copyright
© © All Rights Reserved
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenSS Leitheft - 08. Jahrgang - Heft 03 1942
Copyright:
© All Rights Reserved
0%(1)0% fanden dieses Dokument nützlich (1 Abstimmung)
110 Ansichten56 SeitenSS Leitheft - 08. Jahrgang - Heft 03 1942
SS Leitheft - 08. Jahrgang - Heft 03 1942
Hochgeladen von
Ruffy81SS Leitheft - 08. Jahrgang - Heft 03 1942
Copyright:
© All Rights Reserved
Sie sind auf Seite 1von 56
SO III IID ARIA DI III
YS one ta
Penne NER
5
v
:
.
g |
RANA
IS,
LAR
BES
ER RE RRR
; |
see ee)
Se OE Op GRE TRON AOC ONE
Trevue
‘Treu bis zum letzten Atenizug -
Pflicht — die Tugend der Preufien ..
Robert Bosch / Treue zum Werk
Richard Wagner / Des Fithrers Verhti
grofien Meister ....
Wir geben das Erbe weiter
Ein Grenzwall wird Siedlungsraum.
Sterne als Wegweiser...
Ein Soldat-erlebt einen Baum -
Yamato
Die Vision des groften Kénigs...
Thr seid geborgen im Herzen der Heimat
Die Drohne hat keinen Vater .
Rundbrief des Scurifileiters der fH Leithefte an die
ff-Manner .
Sudetenland — ein Bridcenhoger Sich dem Osten 39 4
Alfred Rosenberg: Die Pflicht unseres Daseins / Werner
Beumelburg: Das héchste Gut der deutschen Seele / Hans
Carossa: Geheimnisse / Robert Hamerling: Das _ger-
manische Jahrhundert / Kurt Kuberzig: Mein Kind
Erwin Guido Kolbenheyer: Gottes Wort / Wilhelm
Pleyer: Lied der Sudetendeutschen.
Als Motiy dieses Heftes haben wir auch fiir das
Titelblatt die Treue gewahlt. Ste wird versin
Tickt durch die alte germanische Bandverscili
gang. Kiinsilerische Gestaltung: Hans Klocker
Yerantwortlicher Herausgeber: Der Reichsfihrer f, /4-Hauptamt Berlin W 35,
Liitzowstrafte 48/49. Druck: Buchgewerbehaus M. Miiller & Sohn, Berlin SW 68.
Der Einzelpreis des Heftes betrigt 40 Reichspfennig. Bestellungen, Zahlungen und
Auslieferung beim #-Drucksdhrifienversand, Berlin SW 68, Wilhelmstrafte 122.
Postscheckkonto: Berlin 6783. Bankkonto: Berliner Stadtbank, Berlin SW 68,
Friedridhsiralle 46, Girokasse 9, Girokonto: 1157
(ISG
REGO ORR ERB RRRAROCROOROER
SERGE ERROR OOROR
ISYDPILTZEII
a ARADO GEER ERA RE DEORE EOE EEE
RRORER
4
ESP PRT TPF G AD DER IIOS PILI PL POT FOIE
|) RRR REE RRR ELE EEE
RARER ARAB ROR BDL ER ROP LE EDR
Dv Grhebungen des
Gemiltes find es, die vieles tragen helfen, was
fonft den Men{djen gufammenbreden liege. Wer
aber made wird, mége id) fragen, ob er dent
tikecyaupt ein Derlangen nad) diefen tieferen
Regurigen des Gemtites gefpriet hat, und er wird
dann vielleidyt nicht felten fic) felbft und feiner
Sdwarhheit Me Scyuld gufdyreiben miifen, wenn
ev unfalig war, fid) dort jene Reaft zu fudjen,
Die andeve Pienfdyen leidstee Here werden lagt
iver die Unvillen, ja aud) mandmal Ungeredye
tigkeiten eines Menfdyenlevens. Er mag fidy
aud) feagen, ob ex felb(t nady Lebenstameraden
gefudt hat, de ihm in feinen fyweren Stunden
gue Geite fteyen, oder ob er nur als griess
gedimiger Deveingetter, auf fidy allein geftellt, das
Hafein zu meifteern verfudst, es vielleidyt veefludt
hat. Es wied [ids jeder diefe Seage beantworten
F6nnen, Ob ec wirklich) fic) Verntitjte, fene Cinbeit
der inneren Reaft zu begreifen, Me heute den
deutftyen Goldaten und den deutftyen Sanger
als verftiedene Erftyeinungsformen der gleiden
deutfyen Dolfsfeele gufammenfiigt. Ge wird
dann verftehen, dak Inftinft und Tat und Inz
ftintt und Gdjau im Grunde das gleide find,
und da8 Geftalt im Perk, Geftalt im Gemiit
gufammen die Geftalt des Lebens bedingen.
DKefem immer erneut fid) im Kampf bewshrens
den Leben Dienen wie alle, und defen Dtenft
fiegveidy duedygufiijven in der Verteidigung haljee
‘Werte, ift die Yodyte PNidt unferes Dafeins.
ALFRED ROSENBERG
RRR REPEAL A RAIA ARRR RRR ARR RRO RRO RRC ORR OREO ROOR CREE
GILG.
aI Ds
RRRPPRELILILS
A RT RE RRR ARR ORR EERIE RBEES
DR DIRT PRPS IIPS ILL L FFP IF S|
LBRERESR RARER QLOERR ERO OER
ELE ORR R REEL ORL RR ROR RROD RRR
TREU UND UNVERZAGT / PLASTIK VON KURT ZIMMERMANN
TREUE
er gegenwiirtige Krieg liefert taglich Beweise kiihnen Wagemuts und
einzigartigen Heldentums. Ungezihlt aber ist das scheinbar kleine
und namenlose Heldentum der deutschen Soldaten. Es ist die stille, zaihe
Bewihrung der Treue und der Zuyerlissigkeit. Die Treue der Gesinnung
ist es gewesen, die einzelne Einheiten unseres Heeres und unserer
Walfen-# drei- Monate lang iroiz Hinschliefung und Abscaniirung yoo
normaler Zufuhr standhalten lie® und der Ostfront die Festigkeit und
Tlirte verlich, die bei dieser Kilie und diesem Massenansturm des Peindes
allein eine Katastrophe verhinderte. Was das heifit, weift nur der, der die
Formen kennt, unier denen der Krieg im Osten sich abspielt. Wenn der
Gegner versucht, unsere Strategie nachzuahmen, so erleidet er jedesmal
Schiftbruch, Generalfeldmarschall Rommel. hat es- ausgesprochen: ,,Ein-
kreisungssdilachien, wie sie im gegenwiirtigen Kriege geschlagen werden,
kann man nur mit deutschen Soldaten schlagen.*
Was sich hier bewihrt hat, gilt fiir alle Zukunft. Treue ist die deutsche
Tugend. Treue ohne Inhalt gibt es nicht. Sie hat nichts zu tun mit Sturheit:
die mégen die Gegner besitzen. Sie deckt sich auch nicht mit Hartnackigkeit
oder Zuverlissigkeit allein, obwohl das ihre notwendigen Begleiter sind.
Treue, Glaube und Ehre sind wie drei Schalen um einen kostbaren Kern.
Der Kern aber ist die Seele unseres Volkes, jenes einzigartige innere Reich,
aus dem die kiinstlerisch formende, musizierende, die Welt mit immer neuen
Gestaltungen von Traumgesichten iiberraschende Kraft emporsteigt, dic
unser kostbarster Besitz ist. Das Wissen um diesen Reichtum ist in dem
einen weniger, in dem anderen klarer vorhanden. Es gibt keinen deutschen
Menschen ohne Ideal. Treue ist nichts anderes als ein Sichbekennen zu dem
eigenen Tnneren, ur eigenen Berufung, aur eigenen Aufgabe. Im Grunde
genommen sind Handlungen der Treue, die in Stunden héchster Not aus
innerer Verpflichtung entspringen, religidse Akte. Davon wissen die Men-
schen zu erziihlen, die jene Augenblicke kennen — sie. sind nicht hiufig im
Leben —, in denen man der inneren Berufung gewissermafen auf die Spur
kommt, die Verpflicitung einen iiberkommt. Das gilt fiir politische Kimpfer
genau so wie fiir Denker, Kiinstler und Erfinder. Das haben auch die
-Kameraden erlebt, die auf scheinbar verlorenem Posten in Eis und
Schnee in Treue zum Fiihrer und zur Heimat ausgeharrt haben.
Seine Aufgabe wie einen Befchl des Himmels erkennen, heiftt fiir den deut-
schen Menschen treu sein. Treue ist immer etwas Gottgebundenes. Daran
aweifelt nur der oberfléchliche Skeptiker. Die Treue zur Heimat, die Treve
zur Bewegung, die Treve zum Fithrer wurzeln leizien Endes in der Kraft
der inneren Vorstellung. Wer innerlich arm ist, kann auch nicht wahrhaft
treu sein. ‘Treue ist die wortlose Sprache inncren Reichtums.
Treue erweist sich durch die Tat. In Zeiten der Not und des Ungliicks hat
jas deutsche Volk immer am treuesten erwiesen, und zwar der kiimp-
1
fende Teil dieses Volkes, also der Teil, der diese Not litt und am schwersten
daran irug. Das waren die Soldaten in den Schiiizengritben des letzten
Weltkrieges. Das waren dic ersten Mitkémpfer des Fiihrers. In diesem
Krieg tragt die Front wiederum die Haupilast; aber auch die Heimat gibt
tiglich Beweise der ticfsten Treue in Enthchrung und Entsagung.
Zur Treue gehirt Bestindigkeit. Es wire widersinnig zu denken, ich wechsle
meine Heimat, oder ich wechsle mein Volk. Unser Leben wird einmal sinn-
voll gewesen sein, wenn wir uns treu geblieben sind. Es gehért auch alles
zusammen. Treue ist in Wahrheit nichi teilbar. Dem Fihrer treu bleiben,
der Heimat treu bleiben, der Frau und den Kindern treu bleiben, das ist
eine Treue.
Die # ist ein Orden der Treue. Treue zum Fithrer, Treue zu den Kame-
raden, Treue zur Heimat und zur Familie sind Feuer, aus denen wir brennen.
Wir kennen unser Volk. Wir wissen aus seiner unheilvollen Geschichte, daft
seine Gutgliubigkeit und Harmlosigkeit von Verfiihrern schwer miflbraucht
worden ist. Die 44 soll den Schutzwall bilden um unser héiligstes Kleinod,
um den inneren Reichtum des deutschen Volkes. Ein tiefer Glaube an die
gittliche Berufung unseres Volkes und seines Fihrers erfiillt uns. Er macht
uns reich. Er macht uns hart und unerbittlich. Er gibt uns die Kraft der
Treue in den Stunden diuferer und innerer Belasiung. Gd.
D, Treue ift das hédfte Gut der deutitjen Geele und
thee Vollendung. Gs ift micjt jeder berufen, Grofes zu
fmaffen fiir fein Datecland. Aber das ewige Gajicefal migt
uns nit nad) dem Umfang unferer Taten, fondern nad
Der Gefinnung, aus dev fie ent{tanden, und nad dem Biller,
den wie aufwandten, um unfere PAlict zu erfiillen. Das
heigt aber mitts anderes, als dag dec Magia’ unferes
Lebens in der Treue liegt, mit der wir an unferem Daters
land hangen, und es heift ebenfo, dag die Creue das Licht
ift, das den einzelnen in Me Gemeinihaft fiiyct. Die Treue
ift die lebte und Ysdsfte Stufe, die unfece Geele auf iyeem
HSeg erretdyt, und wee fie ecworben, der hat vor dem
Sdpicfal beftanden. ‘Werner Veumelburg
‘
Treu bis zum letzten Atemzug
un, das geschah also in den Tagen, da die Russen mii Schneeschuh-
bataillonen iiher den gefrorenen [Imensee und das vereiste Moor am
Ostufer durchgebrochen waren und in den ersten Stunden dieser ihrer
Winteroffensive einige Dirfer in der Flanke einer Division genommen
hatten, die spiter zuriickerobert wurden. In diesen erbitterten Kampfen
gegen eine erdriickende Ubermacht geriet durch einen pléizlichen Uberfall
bei stockfinsterer Nacht die Granatwerfergruppe in sowjetische Gefangen-
schaft, Wahrend es der Kompanie im letzten Augenblick noch gelungen
war, einer Umgehung auszuweichen und sich vorliufig einige hundert Meter
bis zum Waldrand zuriiccenzichen, war diese Granatwerfergruppe, die bis
zuletzt gefeuert hatte, im Riiccen abgeschnitten worden und mitsamt ihrem
schweren Granatwerfer in die Hiinde des Feindes gefallen.
»Es ging alles so plétzlich“, sagte er, und es schien nun, als wolle er mir
alles ganz genau erzihlen, .eh’ wir iiberhaupt zur Besinnung gekommen
waren, hatten sie sich hinterriicks wie die Katzen auf uns gestiirzt und
hielien uns die Laufe ihrer Maschinenpistolen vor die Brust. Wie soll ich
dir diesen Augenblick der Gefangennahme schildern? Mein erster Gedanke
war: ,,S0, jetzt ist alles aus.’ Dann schwirrten mir unzihlige andere Ge-
danken durch den Kopf. Doch endlich wuchsen aus der Fiille und dem
Durcheinander plitzlicher Einfalle zwei Gedanken, die mich in dieser Nacht
dann nicht mehr loslieffen. Der erste war ein beruhigender: Ich dachie an
viele guie Kameraden, die wihrend dieses Feldzuges gefallen waren, und
wurde ruthiger und gefaRter. SchlieBlich hatten wir in diesen Monaten schon
manches Mal dem Tod ins Auge gesehen und waren schon vorher, ein jeder
fiir sich, liingsi mit ihm fertig geworden. Der Zweite beunruhigte mich. Ich
dachte: Unser schwerer Granatwerfer! Unsere Munition! Damit werden sie
nun unsere eigenen Kameraden beschieflen, und das ist eine Schande.
Und das dachten alle!
Denn als sie uns mit vorgehaltener Pistole die Taschen durchwithlten, uns
alles raubten, von der Uhr bis zur Brieftasche, als sie uns vorlaufig in einen
alien Schuppen gezerrt haiten und wir in Kilte und Finsternis zusammen-
hodcten, da hirte ich aus den wenigen Worten, die zwischen uns fielen, dak
diese Gedanken alle bewegten.
im iibrigen mochte uns zu Muie sein wie einem Schiftbriichigen, der sich.
zwar noch iiber Wasser hilt, der aber doch genau weif, daf ihn die Wellen
bald verschlingen werden. Dann aber, im Morgengrauen, schlugen die ersten
Granaten unserer deutschen Artillerie in unserer Nihe ein, und nun war es .
uns wie dem Schiffbriichigen, der am Horizont auf einmal eine Rauchfahne
entdeckt hat,
»Sie kommen zuriidc!" sagte einer, und seine Stimme war voller Hoffnung.
Sie greifen wieder an!“ meinte ein anderer, und ein Hoffnungsfunken
wollte in uns Feuer entfachen. ,Sie lassen uns nicht im Stich! Sie werden
heute morgen zum Gegenangriff antreten!“ sagte der Gruppenfithrer, und
wir begannen wieder an unsere Errettung zu glauben. Ja, als die Morgen-
3
démmerung durch die Ritzen unseres Schuppens drang und die Salven
unserer Ariillerie in immer kiirzeren Abstanden im Dorf einschIngen, sahen
wir wieder hoffnungsfroh und zuversichilich den komimenden Stunden
enigegen ..."
Der Ladeschitize des schweren Granatwerfers hielt in seinem Bericht an.
..Bs ist dann aber doch alles ganz anders gekommen. Gegen Morgen zerrten
uns ein paar schwerbewaffnete Bolschewisten nach draulen. Wir glaubien,
dafi nun das iibliche Verhér kommen wiirde. Doch sie schleppten uns in
unsere alte Granatwerferstellung. Sie fuchtelten mit Pistolen vor uns
herum, es waren Offiziere oder auch Kommissare. Ein Dolmetscher, seinem
Anssehen nach Jude, macite uns klar, daft es fiir uns tiur noch zwei Még-
lichkeiten gabe. Entweder — er zeigte auf dic vielen Pistolen, die ihre
Linfe auf uns richteten — entweder wiirden wir jetzt alle erschossen, oder
wir wiirden jetzt auf den Waldrand, in dem Bereitstellungen unserer Kom-
panien erkannt seien, mit unserem eigenen Granatwerfer schieen, Das
aber unverziiglich und sofort, Oder die Pistolen. Wir hatten die Wahl.
Falls wir feuern wiirden, gargntierte uns das Oberkommando der Roien
incon dade aven uit cttovietan Tusa’
Wir bissen uns anf die Lippen. Vor Wut.
* Wir wuftten: Auf Kameraden schietten? Niemals!
Trotzdem gab uns unser Werferfiihrer den Feuerbefehl. Jeder yon uns
ging an seinen ihm bestimmten Platz, Mich wies unser Grappenfthrer
aurick. Laden, sagte er, wiirde er dieses Mal selber.
Nun, du kennst den sciweren Granatwerfer. Seine Bedienung ist im Prinzip
so einfach. Die Granate wird yon oben in das Rohr hereingelassen und
zischt daun von selbst nach Bruchteilen von Sekunden durch die Luft.
4
Der Werferfiihrer nahm die erste Granate. Lieft sie in das Rohr fallen.
Im selben Augenblick aber, sage ich dir, ch’ daft die erste Granate das Rohr
verlassen hatte, schob er eine zweite der ersten Granate nach.
Diese Sckunden werde ich nie, nie im Leben vergessen. Es folgte das, was
kommen muffie und was der Werferfiihrer bewultt gewollt hatte: ein Rohr-
krepierer, eine ungeheure Detonation, die den Granatwerfer und alle Um-
stehenden zerfeizte. Tot die bolschewistischen Offiziere, die sich an dem
Anblidk hatien ergiitzen wollen, — gefallen meine drei Kameraden. Weil
der Werferfiihrer mein Amt als Ladeschiitze selbst itbernommen hatte, und
ich darum nur abseits stand, geschah mir nichts. Das wilde Durcheinander,
das im selben Augenblick bei den Sowjeis entstand, gab mir selbst die Még-
Tichkeit, durchzubrennen. ‘Das Dorf aber wurde am selben Tag von unseren
Infanieristen im Gegenangriff genommen...“
In der Nacht hatte ich noch Wache. Es war eine helle, kalie Marznacht, In
unbeschreiblich tiefem Blau stand Stern an Stern, und wie die Ehre und
die Treue besiiindig und erhaben weit tiber unserem kleinen Leben stehen,
so zogen sich — iiberstit von tausendfachem Flimmern — die breiten Him-
melsstraRen hin. PK, Willi Dikmann
Gebeimniffe
Stern mug verbrennen Golang wit ieren,
flaflos im Raume, watyen die Mitte. .
* damit um Erden Jn bitter Eintradt
das Leben getint. fucyert wit Licht.
Blut mug veefinFen, Und alle Wunder
viel Blut, viel Ceanen, geftvehn an Ufecn.
damit uns Erde ‘Bait dedngen alle
3ur Heimat wird. gum feefen Gtrand.
‘Yo Redfte rafen ‘Bie find beladen
in wundem Aaffe, Wit Stoff dee Sonne.
quillt lautce Reiltcaft ‘Weir miiffen feywinden,
aus gutem Tod. fo fac? find wie,
Ss gibt fein Ende,
nue gltijendes Dienen,
Serfallend fender
wit Stralen aus, HANS CAROSSA
Pflicht ~ die Tugend der Preuffen
“ ar jemals wohl in der Geschichte ein Volk so hoffnungslos zertreten
wie das deutsche nach dem Dreifiigjahrigen Krieg? Der Westfiilische
Friede stellte die deutsche Zerrissenheit unter die Aufsicht fremder Grof-
miichte; dreifig Jahre Krieg auf deutschem Boden hatien Wohlstand und
Arbeiislust vernichtet. Die Acker lagen wiist, die Dérfer in Triimmer:
die deutschen Menschen waren seelisch zerbrochen, ohne Selbst-
vertrauen, bewunderten knedhtisch alles, was aus Frankreich kam;
die Fiirsten und der Adel verschwendeten die Stcuergelder des Volkes,
in den Stidten herrschte Bestechlichkeit und Vetternwirischaft. Wie sollte
es aus dieser Tiefe je wieder einen Aufstiez geben? Welch ungeheure
Kraftanstrengung gehérte dazu! Wie aber sollte dieses zerbrochene, ver-
kommene Volk zu solcher Anspannung der Krafte je fahig scin?
,Die Seligkeit ist fiir Gott, alles andere muff mein per
Da wurde in einem kleinen deutschen Lande, in Brandenburg-Preuften, der
Wille wach, das Unmigliche miglich zu machen. Die Fiirsien dieses Landes
dachten noch nicht an Deutschland, sie dachten nur an ihr eigenes kleines
Land, Und.doch kam alles, was sie taten, dereinst dem ganzen deuischen
Volke zugute. Der Grofte Kurfiirst legte den ersten Grund, und der Sol-
datenkénig Friedrich Wilhelm I. baute weiter. Er war der Mann, der an
die Riesenaufgahe ging, das Volk zu einer villig neuen Haltung zu erziehen.
Er formie sich Beamte und Soldaten, genau und sorgsam bis in die kleinste
Kleinigkeit, piinktlich anf die Minute, in strenger Zucht und unbedingtem
Gehorsam das Ich dem Ganzen opfernd, die Leistung bis aufs hichsie
steigernd. Mit Haut und Haar verlangie der Kénig den Menschen fiir seinen
_ Dienst: ,,Die Seligkeit ist fiir Gott, aber alles andere muff mein sein.” Er
lobie nicht, er lohnie nicht, er dankte nicht; was sie taten, war selbstver-
stiindlich, denn es war ibre Pflicht. Damals, in diesen Jahren, da das
PreuBentum gehimmert wurde, erhielt das Wort Pflicht seinen chernen.
unerbitilichen Klang. Unter dieser Pflicht stand der Konig genau so wie
der letzte Soldat und der letzte Beamte. Niichiern, herb und hart war
dieses preultische Pflichigebot, aber es ziichtete Menschen, die das Letzte aus
sich herausholten, die die Bequemlichkeit und den Genufi dem Dienst des
Ganzen zum Opfer brachten. Es war hart und oft schmerzvoll. aber es
mufite sein. Aus diesem preufischen Pflichtgefiihl sind die Tatea des
Siebenjiihrigen Krieges erwachsen, die der Welt wie unfaflbare Wunder er-
schienen, mit Hilfe dieses preuffischen Pflichtgefiihls hat Bismarck die
deutsche Zwietracht gebiindigt und das Bismarck-Reich gesdhaffen: dieses
Pflichtgefith! wuchs itiber Preufiens Grenzen hinaus und durchdramg ganz
Deutschland, es hartete und straffte das oft zu weiche, verschwommene
deutsche Wesen, es gab die Kraft zu den Taten von Verdun und Flandern
im Ersten Weltkrieg, zum Bestehen des russischen Winters im Zweiten Welt-
6
ieg. Es gab dem deutschen Volk die Kraft, den schweren Weg vom West-
lischen Frieden zur Reichsgriindung in Versailles und zum Grof-
deuischen Reich Adolf Hitlers zu gehen. Es weitete und vertiefie sich im
Laufe der Jahrzehnte; auf den Soldatenkénig folgten Scharnhorst, Gneisenan,
Clausewitz und Moltke, und preuftisches PflichtbewuBtsein ging schliefilich
in den Nationalsozialismus cin.
Freirvillige Pflichterfiillung
Mit grimmiger Harte, oft mit Schimpfen und Priigeln hatte Friedrich
Wilhelm. das Pilichtbewutsein in die Menschen hineingebrachi. Sie zitterten
yor ihm, und das Muft, unter dem sie standen, war bei vielen die Furdat vor
der Strafe. Es ging damals in den harten Anfangen wohl nicht anders. Aber
schon Friedrich Wilhelm war sich klar, dafi die Pilichterfiillung unter dem
Druck der drohenden Strafe nur ein Notbehelf war. Wenigstens fiir die
Offiziere verlangie er schon eine hihere Form: ,Derjenige Offizier, welcher
sein devoir (Pflicht) nicht aus eigener Ambition (Ehrgefiihl) tut, sondern zu
seinem Dienst angehalten werden muf, meritieret (verdient) nicht, Offizier
zu sein.” Hier tritt an die Stelle des dufleren Mui das innere Muft aus
eigenem Antrieb. An Stelle der Strafe iritt als trethende Kraft das Ehr-
gefubl. Pflicit bleibt es so und so, und der widerstrebende innere Schweine-
hund mut so und so kleingemacht werden; aber das eine Mal geschieht das
dureh den erhobenen Stock des Korporals, das andere Mal durch das innere
Gebot der Anstiindigkeit. Aus dem Heer des Soldaienkénigs wurde das
Heer Friedrichs des Groen, das Heer des Siebenjiihrigen Krieges. Nie hatte
es die furchibaren sieben Jahre durchkampfen konnen, wenn es nur durch
Zwang und Gewalt zusammengehalten gewesen wiire. Schon in den Ba-
taillonen des alten Fritz lebte etwas, das héher war als erzwungener Ge-
horsam: eine freiwillige Hingabe an die Persénlichkeit des grofien Fiihrers,
Finfzig Jahre spiiter wurde aus diesem Heer das Volksheer der Befreiungs-
kriege. Scharnhorst und Gueisenau erhohen die Forderung, da damit die
hohere Form der Pflichterfiillung im ganzen Heer lebendig werden miifie.
Gneisenan empiérte sich iiber die Meinung, ,,da8, weil einige des Priigelus
wert sind, alle gepriigelt werden miissen‘; nicht im Holze, sondern im Ehr-
gefiihl miisse man die Beweggriinde zum Wohlverhalten zu finden vermégen.
Die Manner der Befreiungskriege hatien ihren Idealismus an der Phi-
losophie des Kénigsberger Philosophen Kant gestarki, »Pilicht, du. er
habener grofer Name”, schrieb er, ,der du nichts Belicbtes, was Ein-
schmeichelung bei sich fiihrt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst,
doch auch nicht drohest..., sondern blof ein Geseiz aufstellst, welches von
selbst im Gemtite Eingang findet." Nicht Lockung mit Lohn, nicht Drohung
mit Strafe, sondern nur die scilichte, einfache Einsicht, daft das Pflichtgebot
notwendig erfiillt werden muf: so stellt Kani den Begriff der Pflicht in
héchster Klarheit hin. Solange der Mensch sich von Hoffnung auf Lohn oder
von Furcht vor Strafe, und sei es in noch so verfeinerter, getarntcr Form,
beeinflussen lait, solange ist von sittlichem Handeln, von Pilichterfilluns
im héchsten Sinne nicht die Rede.- Das ist eine ungeheuer hochgespannte
Forderung, welche hichsten Idealismus verlangi, Es ist klar, daft die
meisten Menschen nicht die Kraft des Willens und der sittlichen Selbst-
iiberwindung besitzen, um diese Forderung voll zu erfiillen. Die meisten
brauchen doch eine Unterstiitzung ihres Willens, der vor dem Pflichigebot
ausweichen méchte — es braucht ja nicht immer gleich in der Form des
Stockes zu sein. Schon die Miglichkeit einer Bestrafung wirkt antreibend.
Aber Ideale miissen hichstgesteckte Ziele sein. Und eines diirfen wir sagen:
Seit den Tagen des Soldaienkinigs ist unser Volk in den Antrieben zu
seiner Pflichterfiillung dem Ideal Kants immer niher gekommen. Die
Forderung, die Friedrich Wilhelm glaubte nur fiir die Offiziere erheben zu
kénnen, da@ an Stelle der Strafe und des Zwanges das Ehrgefiihl zu treten
habe, diese Forderung erheben wir heute fiir das ganze Volk. Es wird
immer eine Masse geben, die diesem Anruf gegeniiher taub bleibt. Sonst
kénnten ja eines Tages Gerichte, Gefangnisse und Strafgesetz abgeschafit
werden. Fs hat verschwtirmte Menschen gegeben, die einen solchen Zustand
fiir moglich hielten; wir wissen, dafi das wirklichkeitsfremde Tréumerei
ist. Auch wenn durch Erbauslese die Zahl der Uniermenschen und der
Minderwertigen immer weiter herabgesetzt wird, so werden immer viele
bleiben, die des Riicshalts am Strafgesetz bediirfen. Aber, wie Gneisenau
sagt, weil einige des Priigelns wert sind, miissen darum alle gepriigelt
werden? Das Ringen darum, die Zah] der Auserlesenen zu vergréfiern, die
aus eigener innerer Finsieit und Anstindigkeit das Gebot der Pilicht er-
fiillen, nur weil es Pflicht ist, muB ewig weitergchen. Es gibt Menschen,
die die Kriegsgesetze der Ernahrung aus diesem Grunde innehalten, andere,
die es aus jenem tun. Es gibt Menschen, die ihre Arbeit fleifig und ehrlich
verrichien aus diesem Grunde, andere ans jenem. In den Schulen geht die
Bemiihung dahin, die Kinder zu ehrlicher Arbeit ohne Vortduschung einer
nicht vorhandenen Leistung lediglich auf Grund von Stolz und Ebrgefih]
zu erziehen. Wir diirfen den Glauben haben, daf es in unserem Volk noch
viele Krifte gibt, die solener Pilichierfiillung fahig sind; es kommt nur
darauf an, sie zu wecken.
Das Gebot aus dem Innern
Eines ist sicher: hiichsie Leistungen werden nur erreicht durch das Gebot,
das aus dem Innern kommi, durch Pflichterfillung im Kantschen_Sinne.
Friedrich der Grofe spricht in seinen Briefen von ,,einer religiésen Hingabe
an seine Pilichten“. Als er nach der furchtbaren Katastrophe von Kune:
dorf alles fiir verloren hieli, die Fithrung abgab und zum Tode entschlossen
war, da dauerte es doch nur wenige Tage, und er hatte sich wieder in der
Hand. ,,Verlalt dich darauf", sdirieb er seinem Bruder, ,,solange ich dic
Augen offen habe, werde ich fiir den Staat sorgen, wie es meine Pilicht ist.”
Nie dagewesen, unerhért in seiner erbarmungslosen preufischen Harte ist
der Anruf, mit dem er den schwer yerwundeien, schreienden Junker auf
dem Schlachtfeld von Leuthen zur Haltung brachte: ,,Sterb’ Er anstindig,
Junker!" Nur einer durfte ein solches Wort wagen: Friedrich.
Aber dieses preullische Pilicht- und Ehrgebot, welches hente allgemein
deutsch geworden ist, ist doch im Kern nichis anderes als ein altes ger-
manisches Evbe, das in Preufen nen zum Leben erweckt worden ist. Unser
Yolk triigt es als rassisches Erbe von Anfang an in sich. Als die burgundi-
sehen Helden von den asiatischen Horden der Hunnen in der Etzelburg
8
eingeschlossen sind und ihren letzien Kampf kampfen, bei dem es nicht
mehr um Sieg und Rettung, nur noch um tapferes Sterben geht, so erzahlt
das Nibelungenlied, da bietet die Kénigin Kriemhild ihren Briidern freien
Abzug, wenn sie ihr Hagen, den Mirder Siegfrieds, auslicfern. Der Jiingste
der Kénige, Giselher, ein halbes Kind noch, hiingt am Leben und kann sich
nur schwer von den Hoffnungen lésen, aber ohne einen Augenblick des
Zauderns weist er die Rettung um diesen Preis der gebrochenen Kamerad-
schaftstreue und der gebrochenen Ehre von sich, Die Wirklichkeit der Ge-
schichte entspricht dem Ideal der Sage: Der letzie Gotenkiinig Teja ktimpft
am Vesuy, wie Friedrich im Siebenjihrigen Kriege kémpfie. Diese Ger-
manen kennen freilich noch nicht das Wort Pflicht, und ihr Opfer geschieht
nicht in dem Bewufitsein, dai es fiir den Staat oder das Volk sein mul;
sie handeln_einzig aus dem inneren Gebot der Ehre; aber was sie tun, ist
dennoch im Wesen nichts anderes, als was spiiter Friedrich Wilhelm, Friedrich
der Grofte, Kant, Gneisenau verlangten.
»ch kann nicht anders“
Wenn eine Mutter, die ihr Kind umsorgt, antworten wiirde: Ich tue nur
meine Pflicht, dann hiitten wir ein Gefiihl des Befremdens. Warum? Pflicht,
auch wenn sie nur aus dem inneren Mufi getan wird, ist eben doch immer
ein Muli und verlangt Selbstiiberwindung. Die Mutter aber kann gar nicht
anders; sie miifite sich gerade Gewalt antun, um nicht so zu handeln. Hier
geschieht das edle Handeln aus innerer Notwendigkeit, aus einem edlen
Trieb heraus. Hier istim Grunde nicht die cinzclne Tat gut, sondern der
ganze Mensch ist gut. Solches selbsilose Handeln voll aufopfernder Hingabe
aus innerem Trieb gibt es auch schon bei Tieren; wir brauchen auch hier
nur an Beispiele der Mutterliebe zu denken. Sich selbst iiberwindendes
Handeln aus bewuftier Pflichterkenntnis vollbringt dagegen nur der
Mensch. Man kann viel dariber sireiten, was das Hihere sei; man kann
geliend machen, daft das Pflichigebot harter und schwerer zu erfiillen sei
und das Handeln aus edlem Trieb ja keine Selbstiiherwindung fordere, aber
demgegeniiber auch wieder, daf die gesamte Charakteranlage, die sich
zur edlen Tat nicht erst zu itberwinden brauche, hher siche als die, die erst
ein inneres Widerstreben niederkimpfen miissé. Der Sireit ist im Grunde
miifig, auch geht beides oft ineinander iiber. Wenn Luther vor dem
Wormser Reichstag sein ,,Ich kann nicht anders“ spricht, wenn der
Philosoph Giordano Bruno, der als erster mit den Augen des Geistes die
Unendlichkeit des Weltenraumes schauie. den Widerruf vor den Priestern
der rémischen Kirche verweigerte und auf dem Scheiterhaufen starb, dann
liegt in diesem [ch kann nicht anders“ ein Bekenntnis zu einem hichsten
Pflichtgebot aus innerer Notwendigkeil, zu der Trene gegeniiber sich selhst
und der Sache, der Idee. Die Freiwilligen von Langemarck stiirmten mit
dem Deutschlandlied in den Tod, hingerissen vom groflen Schwung der Be-
geisterung. In den folgenden Jahren aber kam das Granen der groBen
Materialschlachien, und nun mufie doch wieder das harte Gebot der Pilicht
wirksam werden. Der Fiihrer schildert das im .Kampf{": Es kam die Zeit,
da jeder zu ringen hatte zwischen dem Trich der Selbsterhaltung und dem
Mahnen der Pflicht... Je mehr sich aber diese Stimme, die zur Vorsicht
mahnie, mithte, je lanter und eindringlicher sie lockte, um so schirfer wird
dann der Widerstand, bis endlich nach langem inuerem Streite das Pilicht-
bewuftisein den Sieg davontrug. Schon im Winter 1915/16 war bei mir dieser
Kampf entschieden. Der Wille war endlich restlos Herr geworden. Konnte
ich die ersten Tage mit Jubel und Lachen mitstiirmen, so war ich jetat ruhig
und enischlossen. Dieses aber war das Dauerhafte."
Der Befehl des Gerissens
Es gibt eine tagliche Pilichierfiillung, die treu und bray die taglichen
Vorschriften und Befehle erfiillt. Sie darf in ihrer Bedeutung in keiner
‘Weise herabgesetzt werden, sie ist notwendig; aber sie muft sich bewuRt
bleiben, daf sie nicht das Letzte und Hichsie ist. Es kénnen Lagen ein-
treten, wo Vorschriften gebrochen werden miissen, Befehle nicht befolgt
werden diirfen, ein véllig selbstiindiges Handeln auf eigene Verantwortung
Notwendigkeit wird. Als der preufische Kénig Friedrich Wilhelm III. sich
1812 zum Biindnis mit Napoleon gegen Rufiland entschlof, da gab es
preuftische Offiziere, die es nicht ertrugen, fiir den Unierdriicker ihres
Vaierlandes zu kiimpfen, die darum den Abschied nahmen und in russische
Dienste traten. Zu ihnen gehérte Carl von Clausewitz. Manner wie Yorck, die
ganz in der aliprenRischen Tradition wurzelien, nannten dies Verhalten
Pilichivergessenheit und Fabnenflucht. Yorek erhielt vom Kénig den Befehl,
das Kommando iiber das preufische Hilfskorps unter Napoleon zu iiber-
nehmen, und so bitter es ihm war, er tiberwand sich und tat stumm seine
Pflicht. Dann aber kam die Stunde, da Napoleon geschlagen war, da alles
den General Yorek drangte, den Anschluf an die Russen zu erklaren, und
da alle seine Bemiihungen, Weisungen vom Kinig aus Berlin zu erlangen,
ergebnislos blicben. Nun wurde gerade dieser Mann vom Schicksal vor die
Entscheidung gestellt, die engere Pflicht zu brechen um der weiteren und
hbheren willen. Und er tat tapfer den Schriti, so schwer es ihm wurde,
handelte gegen den Befehl des Kénigs und erklarte in der Miihle von Tau-
roggen das preullische Korps fiir neutral. Damit erdffnete er den Be-
freiungskrieg. Fiir das, was er tat, nahm er die volle Verantwortung auf
sich: Ich schwore Eurer Koniglichen Majestit, schrieb er, daft ich auf
dem Sandhaufen ebenso ruhig wie auf dem Schlachifelde, auf dem ich
grau geworden bin, die Kugel erwarten werde.* Er brach den Befehl, den
ihm der Staat gegeben hatte, und gehorchte, wie vorher Clausewitz dem
Befehl des Gewissens, um dem Volk die Treue zu halien. Unier diesem
Befehl des Gewissens hahen die Manner der Freikorps am Annaberg ge-
kampft, hat die nationalsozialistische Bewegung von Anfang an gestanden.
Seit den Tagen Friedrich Wilhelms I. ist die Idee der Pflicht immer tiefer
und weiter geworden, sie hat immer mehr an Freiwilligkeit und eigenem
Antrieb in sich aufgenommen. Sie isi von Preuflen ber ganz Deutschland
hin gewachsen. Aber immer muff sie den unerbittlich harten Kern der
eisernen preufischen Pflichterfiillung behalten, der einzig den schwersten
Belastungsproben gewachsen ist. Denn Deutschland, das Land der Mitte.
auch wenn es fiihrendes Land Enropas ist, wird immer gefahrlicher leben
als andere Vélker. Darin ruht seine Verpilichtung und seine GroBe.
Wirich Haacke
Go fab das Geherauge
eines Didters die Fulunft Europas
Der isterreichische Dichter Robert Hamerling schrich vor jetzt rund
100 Jahren (gestorben 1889) itber das ,germanische Jahrhundert”:
Whine hellen Gegeraugen taucy’ icy efn in ew’ge Lichte,
Und vor meine Geele teeten gufunftsftwangere Geficyte:
lus dem uc) verhtillten Duntel cinft'ger (iefals{dwerer Zeiten
Gely’ te} eine hohe Géttin nay und immer naher fiyveitent.
Du, o zwanzigites feit Chriftus, waffentliccend und bewundert,
int witd did) die Maywelt nennen das germaniftye Fabryundect.
Deutfiyes Vole! Die weite Srd_ witd von Deinem Rum ergitteen,
Denn Geridt wieft Du einft yalten mit den Seinden in Gewittern.
Englands unberdyrten Boden wird Dein ftarker Sug betreten,
Danterfillt wird Deine Stiheung dann gu ihrem Herrgott beten.
Und den ténernen Rolog, Rufland, ftirzéeft Du zervorften,
Qin des Oftens weiten Landern wird der deutfdye QAdler horften.
Ofterceith, Du totgeglaubtes, eye hundect Yabr’ vergehen,
Wdielt Du ftolz und jugendtedftig in dem Deuthhen Rete fteher.
‘Mut des neuen Woymens Reiche wird fidy ftolz einft Deutftyland
Cudy verein’gt in junger Seetheit wird die Ueeaine glangen. [Reéngen,
Deutfihes Vole, ich ére Flingen fajon de Sl6ten und die Geigen
Und de Paufen und Trompeten zu dem grogen Giegesreigen.
Sreue Hic} der Heldengeiten, das Gelhie tft Div vervandet.
Sirdjte nidjts von Deinen Seinden! wWabeheit ya’ idj Die veretindet.
rT
ae
ROBERT BOSCH Treue zum Werk
Js der Mechanikus Bosch 1887 im Hinterhaus der Rotebiihlstrafe 75b in
Stuttgart Besuch bekam, ahnie er noch nichi, welche Felgen dieses Er-
@ignis haben wiirde. Ein gewisser Herr Daimler Kam mit einem besonderen
Anliegen. Er wollie keine Klingelanlage, wie Bosch sie mit seinem Gesellen
und seinem Laufjungen sonst in Wohnhiusern und Gasthofen einrichtete
Der Besucher, der trotz seines vor vier Jahren geschaffenen ersten schnell-
laufenden Verhrennungsmotors und des ersien Motorrades, das er danach
bauie, noch lange nicht der welthcriihmte Mann war, wollte einen Zinder
fiir seine orésfesten Benzinmotore. Ob Bosch ihm diesen Apparat kon-
struieren wiirde? —
Der Bauer und Kronenwirt Servatius Bosch von Albeck bei Ulm hatie
Robert, sein achtes Kind, 2u einem Mechaniker und Optiker in Ulm 15jahrig
in die Lehre gegeben. Das war aber nicht etwa Roberts Wunsch gewesen.
Thm hatte der Sinn nach den Naturwissenschafien gestanden, besonders der
Botanik. Doch des Vaters Spruch hatte ihn geazwungen, sich mit den An-
fongseriinden derFeinmechanik ebenso wie mit der Binrichtung elekirischer
Telephon- und Lichianlagen veriraut zu machen. Nach seiner Dienstzeit
bei den Pionieren in Ulm finden wir ihn bei Sehuckert in Niirnberg und —
von Hause aus bemiiteli und somit besonders ungchunden — in den Ver-
einigten Staaten.
12
Mit der schwibischen Griindlichkeit und Zihigkeit hat sich Bosch dann der
Anregung Daimlers gewidmet. Gewif gab es Vorbilder in den Ziindern,
z.B. an den Deutz-Motoren. Troizdem war das, was Daimler wiinschte,
cine konstruktiv neue Aufgabe. So entstand noch im Jahre 1987 der erste
Bosch-Niederspannungs-Magnetziinder mit Abreiftvorrichtung, dem neun
» Jahre spiiter der tausendste folgte. 1901 zog Robert Bosch in das nenerbante
Fabrikgebaude, in dem seine nun 45 Arbeiter gegen Mitte des Jahres den
zehntausendsten Magnetziinder fertigstellien, wahrend daneben bereits
Versuche mit einem neuartizen Hochspannungsziinder anlicfen.
So arbeitet Bosch mit Energie, ja Leidenschaft. Nicht die Leistung schlocht-
hin, die itberdurchschnitiliche Leistung erhebt cr zum Prinzip, zam Prinzip,
das spéter unter dem Namen ,,Bosch-Qualitit" seinen Erzeugnissen den
Weltmarkt 6ffnet. Mit den Erzeugnissen Geld verdienen? Gewif, die Ar-
beiter und Werkstoffe miissen bezahlt werden. Doc .lieber Geld verlieren
als Vertrauen“ — cin Grundsaiz, der ihn auf seinem Woege zum Grofunter-
nehmer und Wirtschafispionier unabdingbar begleitet, mit all der clasti-
schen Konsequenz, die gerade den Schwaben kennzeichnet, und die Robert
Bosch im Verein mit seinen charakterlichen Kigenschaften zu cinem der
erfolgreichsten Unternehmer Dentschlands macht.
1912 der 1000000ste Magnetziinder. 1913: 3750 Képfe Belegschaft. In-
zwischen die Aufnahme des Baues von Lichtmaschinen, und Scheinwerfern,
dann auch Anlassern — die Bosch-Kerzen werden zu einem Begriff. Der
Krieg und die Nachkriegsjahre bringen zwar Veriinderungen — doch der
Aufstieg wird dadurch nur kurz unterbrochen. Das Bosch-Horn tritt seinen
Siegeszug durch die Welt an. 1923 sind bereits iiber 100.000 Bosch-Licht-
maschinen und Bosch-Hérner in die Welt gegangen, die Zahl der Beschal-
tigten tibersteigt 10000. 1925 wird der Bau von Einspritzpumpen und
Diisen fiir Dieselmotoren in Angriff genommen. 1928 kommt der Bosch-
Winker. Beinahe die meisten Erzeugnisse sind in mehreren Millionen im
Gebrauch. Die Motorisieramg im neuen Reich bringt dem Hause Bosch
naturgemiR neue, tthergroRe Aufgaben, ist das Haus doch mit der Motori-
sicrung aufs innigsie verbunden, ja es hat daran einen Anteil, den man als
entscheidend betrachten darf. 1936, am Ende einer fiinfzigjhrigen Ent-
widclung, verfiigt Robert Bosch iiber 16.000 Arbeiter und Angesiellie,
Was sind nun die Griinde solcher Erfolge, solchen Aufstieges, solcher Ent-
widklung? Bosch, der als 81jahriger im Marz dieses Jahres 2u scinen Ahnen
einging, cin Deutscher bis in jede Faser, und im besonderen ein Schwabe —
er hatte so ganz und gar nichts Amerikanisches an sich. Er war anstiindig —
von einem Ausmalt, von dem andere iiberzeugi sind, da es den geschaft-
lichen Erfolg unméglich macht. Er hatte Haltung, war klar, treu, freiheit-
lich, menschenliebend und wurde seinen Arbeitern und Angestellten ,,Vater
Bosch". Er war kein Erfinder, doch er holte die bestgecigneten Fachleute
heran, setzt@ sie an die Konstruktionen, férderte die Besien unter seinen
Mitarbeiiern und war gewissenhaft bis ins Letzie, Er stand zu seinen Fr-
zeugnissen. Nur Qualitatserzeugnisse wurden hergestellt, nur Qualitits-
erzeugnisse verliefen sein Haus. Um Qualitatsarbeit zu erreichen, hat er
nichts gescheut, was in seinen Krafien stand. Und es stand viel in seinen
Kriiften, so viel, daf die Qualitét seiner Erzougnisse zum Begriff auf der
Welt wurde. Bosch hat fiir die Motorisierung mit seinen Mitarbeitern
13
— und gerade auf leiztere Feststellung hat er immer Wert gelegt
— einige ganz grundlegende Voraussetzungen geschaffen. Das Automobil
trug seine Arbeit voran — aber andererseits férderte Bosch durch seine Zu-
behGrieile die Entwicklung des Automobils. Diese technische Wechselscitig-
keit fand in ihm den Mann, der das Zeug, den Charakier und den Weit-
blick hatte. Nur unter diesem Gesichtspunkt aber kann man seinen Auf-
stieg vom Mechanikus der achtziger Jahre, vom Handwerksmeister zum
weltbekannten Wirischaftsfiihrer sehen. Sein Hochspannungsmagnetziinder
ermiglichte erst den schnellaufenden Ottomotor. Nicht minder wichtig ist
seine betriebssichere Hochspannungsziindkerze, das Bosch-Horn, die span-
nungsregelnde Lichtmaschine. Seine Einspritzpumpe gab den Ansto8 zum
Siegeszug des Diescllastwagens. Seine Leichtéleinspritzung ermiglichte mit
die unvorstellbaren Geschwindigkeiten der scinellsien Flugzeuge. Wenn
Bosch nach der Jahrhundertwende den Achtstundentag einfiihrte, spiter
eine Alters- und Hinterbliebenenfiirsorge schaffte, die .,Bosch-Hilfe“, heute
mit einem Kapital von 34 Millionen Reichsmark, so spricht daraus die Ver-
bundenheit mit seinem Betrieb, die ihn eben zum ,,Vater Bosch“ machte.
Es mag seinen ganz persénlichen Neigungen entsprochen haben — und mit
ein Ausgleich fiir seine ersten jugendlichen Berufspliine gewesen sein — das
Robert-Bosch-Krankenhaus" zu stiften, eine Klinik der homdopathischen
Heilkunde, heute als Forschungsstiitie anerkannt. Es entspricht dariiber
hinaus so ganz der unermiidlichen Produktivittit seiner Persinlichkeit, was
wir im ,.Bosch-Hof* vor uns haben. Dieser entstand aus einem Torfwerk in
Oberbayern und umfafii heute mehrere Hife mit zusammen tiber 1700 ha
Flache. Dieses Mustergut, von dem fast die Hiilfte der landwirtschaftlich
genutzten Flache durch Urbarmachung von Hochmooren gewonnen wurde,
ist ein wichtiger Versorger der Haupistadt der Bewegung geworden.
Bosch hat es sich nie verdrieBen lassen, gegen Leistungen mit Leistungen
aufzukommen, So hat ein einzelner aus Treue zu seinem Werk, zur Ver-
pilichtung etwas Einmaliges, Gediegenes zu schaffen und das Geschaffene
immer mehr zu vervollkommnen, fiir die Volksgemeinschaft Wertvolles und
Bleibendes geleistet. Je bescheidener die Mittel waren, die ihm anfangs zur
Verfiigung standen, je stiirker die Hindernisse, die sich ihm entgegensiellten,
desto treuer blich er der inneren Verpflichtung gegeniiber, dic er als Auf-
gabe sah wie der Kiinstler sein Werk. Premmipretthar
oe a oe
a
SS
Des Filhrers Verhaltnis zu dem grofen Meister
Es ist weder Zufall noch Laune, daft der Fiihrer von allen Meistern der
deutschen Tonkunst gerade Richard Wagner seine besondere Liebe und
Verehrung entgegenbringt und das deutsche Kulturkleinod Bayreuth mit
der fiirstlichen Grofziigigkcit betreut, die der Meister zu seinen Lebzeiten
bei den Lenkern des soeben unter Preufens Fi ‘tihrung neugeschaffenen Deut-
schen Reiches so schmerzlich missen mufite.
Gewift ist von den Angehirigen der Familie des Bayrenther Meisters dem
Fiihrer schon friih tiefsies Verstehen und gliubigstes Hoffen entgegen-
gebracht worden. Richard Wagners Schwiegersohn, Hl. St. Chamberlain, der
Gate seiner vor kurzem verstorbenen jiingsten Tochter Eva, hat am 1. Ja-
nuar 1924 in dunkelster vilkischer Zeit in einem offenen Briefe zur Er-
quickung von Tausenden von Deutschen voll seherischer Kraft das herr-
lichste Bekenntnis zu Adolf Hitlers Persénlichkeit und Wirken niedergelegt.
Wenn er in diesem Briefe sagt, daft der Herd, worauf sich die Glut entfache,
in der Hitlers Gedanken geschmiedet werden, das Herz sei, und dafl der
Fiihrer sein deutsches Volk mit inbriinstiger Licbesleidenschaft liebe, so
rihrt er damit an die starke innere Wesensverwandischaft der beiden
Groften, Wagner und Hitler. Denn auch Wagner hat das deutsche Volk
leidenschaftlich_gelicbt und hat fiir sich als Gegenleistung fiir das, was er
dem deutschen, Volke schenkte, nichts gefordert als ,.wahro Lice". Zu seiner
Begliidsung wurde ihm diese auch zuieil, wiewohl nicht in dem umfassen-
den, meingeschréinkten und iiberschwenglichen Mafle wie dem Fithrer, dem
das deutsche Volk ja auch nicht anders zu danken vermag als durch seine
nimmer aufhérende, leidenschaftliche Liebe.
Das Erinnern des Fiihrers an die ihm schon vor 1923 bewiesene Zuneigung
und Treue des Hauses Wahnfried erklaért aber noch nicht seine Begeisterung
und Verehrung fiir den Bayreuther Meister: Der Fiihrer will mit der Art
und Weise, wie er Bayreuth fordert, Tausenden von deutschen Volks-
genossen den Genufi eines der erhabensten Kulturgiiter der Menschheit er-
mdglichen, und zwar nicht um teures Geld nur, wie im vergangenen Kaiser-
reich, sondern unenitgeltlich, wie es sich Richard Wagner von Anfang an
ersehnt hatte. Damit begleicht Adolf Hitler auch eine lingst fillige
Dankesschuld an den deutschgesinntesten Meister deutscher Tonkunst; denn
keiner unter den grofen deutschen Tondichtern hat sich nachgewiesener-
mafen so viel ernste Sorgen um Deutschland gemacht, keiner hat so un-
ermiidlich in Wort und Schrift mutvoll wihrend seines ganzen Lebens an
vorderster Stelle fiir Deutschland gestritten, und keiner hat, wie Richard
Wagner, so scharf geschen und so klar erkannt, ,,wo sich die wabren Feinde
des Deutschtums bergen.
Und der Fuhrer weil, daft die hohe und ernste Kunst Richard Wagners dem
Besucher der Bayrenther Fesispiele eine tiber alles wandervolle Ermutigung
des eigenen Lebensgcistes, cine Steigerung des ihm so hocinéligen Lebens-
mutes zur vollen freien Lebensfrendigkeit, cine Frheiterung des immer
umdrohten Lebenshorizontes durch die erhabenen und schénen Bilder der
idealen Kriifte im Menschenwesen” bedeutet. Und so wie der Fithrer selbst
immer wieder als Besucher der Bayreuther Fesispiele sich ins Helle und
Freie dieser idealen Kunst tréstlich begliickend erheben lafit, so ist er dafiir
besorgt, daB auch im dritten Jahre des gewaltigen Ringens um die Freiheit
Deutschlands und der ganzen Welt die hohe, mit schénem Ernst dureh-
leuchtete Kunst Richard: Wagners wieder Tausenden schaffender deutscher
Miner imd Frauen den Glauben an Deutschland siirkt und ibnen die
Hoffnung, diese Tochter der ewigen Liebe, die den mit dem Leben kimp-
fenden Menschen nicht sinken laft, wiederum neu belebt.
Welch cin weltenwendendes Zeitgeschehen liegt zwischen dem aufriittelnden
Erleben der ersten Lohengrin-Auffihrung des zwilfjahrigen Knaben Adolf
Hitler in Linz und dem Tage, da der aus dem Schofie des Volkes ans
eigener Kraft zum Fiihrer aller Deutschen aufgestiegene Kanzler des Deut-
schen Reiches machtvoll seine schiitzende Hand iiber das Werk des Bay-
reuther Meisters erheben kann! Wie erinnerungsméchtig diese erste Lohen-
grin-Auffihrung in Adolf Hitler lebt, davon zeugt die Schilderung in
»Mein Kampf", in welcher der Fiihrer der strahlenden Bilder dieses Lohen-
grin-Erlebens mit den Worten gedenkt: ,Mit einem Sehlage war ich gefesselt
Die jugendliche Begeisterung fiir den Bayreuther Mister kannie keine
Grenzen. Immer wieder zog es mich zu seinen Werken, und ich empfinde es
heute als ein besonderes Gliick, daft mir durch die Bescheidenheit der pr:
ziellen Auffiihrung die Méglichkeit einer spateren Steigerung erhalten blieb.
Welch tiefen Waltens geheimnisvoller Krafte werden wir inne, wenn wir
bedenken, daft die Weissagung an Konig Heinrich, die der Dichter Richard
Wagner Lohengrin in den Mund lest:
Dir Reinem ist ein grofer Sieg verlichn.
Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen
des Ostens Horden siegreich niemals ziehn™,
heute in eisenklirrender Zeit mit dem miichtigsten Aufgebot, das je, solange
die Erde sieht, kampfend iiber diesen Planeten schritt, der Mann wahr-
macht, dem einst als Knabe machtvoll diese Verse an das Herz rithrten!
Hans Gansser
16
RICHARD WAGNER / PLASTIK VON ARNO BREKER
Die Tontunft unferer grogen Meifter, inavefondere Ridjavd tWagners, ift diver alle Zeiten yinweg
nie verfiegender Reaftquell unferee Mation. In dev deutfdyen Mupie ift deutfije Religiofiteit und Innes
lidqeeit Geftatt geworden. Vor ite neigen wie uns als vor dem tiefert Geyeimnis deutfder Geele,
Wein Rind
Gin Rind ift mic geboren.
‘Vic lagen in der Sdylacyt;
da bat mich foldyes VEiffen
beglticet und ftarP gemadyt.
Gin Rind mit zacten Gliedern,
mit Aanden feidenweid.
Rein Bild in meinem Herzen
Fommt foldjee Fartheit gleidy.
Die Sdylacht, Me wird geftylagen;
mein Rind, das lachelt bald.
In unfece tiefften Créume
das fitwere Seuer allt.
Yas fann mic nod) geftyeyen?
Bu Fyaufe fpielt mein Rind
mit taufend bunten Blumer
und mit dem Dbendwind.
In allen unfeen Gdjladten,
beim Marit) und nadyts im Felt,
da [ptict mein Herz die Liebe,
Die uns veerbunder halt.
Die fiyweren Waffen (eyweigen,
dev Abend laftet {cywer,
und mit den beaunen Webel
Fommt weit die Gelnfudyt yer.
Tey weig, woftir id) Fampfe;
zu Haufe ladt mein Rind,
Und dacum bint fo ftacfer
als Gdmerz und Opfec find.
KURT KUBERZIG
»ICH WEISS, WOFUR ICH KAMPFE!"
DIE KLEINE PUPPENMUTTER
Wir geben das Srbe weiter
Fohann MWridael Dietfdy AT17, 7 Rinder
‘Thomas Cheiftof Dietid) ¥1710 41774, 4 Ainder
Yoyann Veit — Dietid) ¥ 1752 A 1812, 13 Ainder
Rarl Fatov Diet) ¥ 1798 4 1863, 7 Kinder
Johann Auguit Dietity y 1838 41874, 5 Kinder
Duguit Ludwig Dietfty ¥ 1969 4 1954, 5 Rinder
Georg Suiedvidy Dietfdy oo Cyeiftine, gev. Saymite
1907 16.6. 1934 Asie
Helga ¥ 14.6. 1936
Rlaus Y 19.5, 1939
Volfer ¥ 19.4. 1942
‘In Dankbavkett: Cheiftel und Georg Diet ty
Ve mir liegt dieses Blatt. Es ist eine Geburtsanzeige, die kiirzlich in
einer Zeitung zu lesen war. Lieber Leser, du mu@t einmal aufmerksam
die Kinderzablen des Mannesstammes dieser Familie in den einzelnen Gene-
rationen verfolgen. Du kannst vieles daraus lernen. Es ist, wie wenn du
eine Familienchronik aufschligst. Jedes Blatt darin spricht seine eigene
Sprache, Scheinbar sind das tote Namen und tote Zahlen, Die Namen von
Mannern und Frauen, die vor uns waren und dahingegangen sind. Wer
tiefer blidct, erkennt aber Leben hinter diesen trockenen Aufzeichnungen:
das miihevolle, sorgenbeladene aber auch mutige und vor allem kinderfrohe
Leben unserer Vorfahren. Da haben in dieser Familie Dietsch — es kinnte
auch deine eigene sein oder die tausender lebender Deuischet — in efem
Jahrhundert drei Generationen miinnlicher Ahnen 24 Kindern das Leben
geschenkt. Hast du schon einmal in deiner eigenen Familienchronik nach-
geblittert? Es geniigt nicht, daB du weifit, wer dein Groftvater war, wer
dein Urgroftvater und dessen Ahnen gewesen sind und wozu sie es im Leben
gebracht haben; ob sie tiichtig waren, fleiftig und begabt, in welcher Rich-
tung ihre Talente sich enifaliet haben. Es gelingt dir vielleicht, manches in
deinem eigenen Wesen und Schicksal damit besser zu verstehen. Aber das
17
Buch der Vergangenheit kannst du doch nicht ganz aufschlieflen. Alle diese
Dinge gehen dahin, du selbst wie dein Vater und seine Vorfahren gehen
durch dieses Lieben, durch Leid und Freud hindurch und tragen ihr Schiek-
sal bald iapfer und mutig, bald scheint’s tiber ihre Kraft au gehen. Aber
eines bleibt in dicsem unendlichen Strom erkennbar und wirksam: die Zahi
erbgesunder Kinder, die sie hinterlassen haben. Und du magst blattern, in
welcher Chronik du willst, immer driingt sich dir die Erkenninis auf: unsere
Ahnen haben den Mut und auch die Kraft zur grofen Kinderzahl gehabt
und damit fiir das deutsche Volk mehr geleistet, als wenn sie ein schénes
Andenken ihrer Vortrefflichkeit, Ttichtigkeit und Begabung hinterlassen
hitten. Und wir miissen klar sehen: sie haben es nicht schiner gehabt im
Leben als wir, 0 nein! Allein in diesen bundert Jahren zwischen 1700 und
1800, in denen diese Familie Dietsch eine kinderreiche — und noch nicht
einmal die kinderreichste — Familie war, haben schwere Kriege Europa
erschiitiert und unsere deutsche Erde ist vielmals das Schlachifeld europai-
scher Heere gewesen. Und doch. ‘Trotz aller Miihsale, irotz aller wirtschaft-
licher Not ist der Mut und das Verirauen in eine giitige Vorsehung, die das
Schicksal unseres Volkes lenkt, so stark gewesen, da cine lebensfrohe
Kinderschar diesen vielfach bedriickten, in Sorge und Not lebenden Eltern
entwadisen ist und ihnen mitgeholfen hat, das Leid der Zeit 2u iberwinden.
Sichen wir nicht fast beschiimt vor solcem Beispicl? Blittere in deiner
eigenen Familienchronik nach. Du wirst ahnliches finden, Und damals hat
man weniger geroufit von Erbgeseizen und Familienkunde als heute. Die
wissenschafilichen Erkenntnisse iiber alle diese Dinge sind ja erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts und in unserer Zeit aufgetancht. Man hat weniger
davon gewullt, aber man hat auf alle Fille aus einem elementaren Instinkt
heraus gehandelt. und das Widktigste gelan, ras zu tun ist: in einer grofen
Kinderzahl das Ahnenerbe iber die Verginglichkeit der -Generationen
hinausgehoben und damit dazu beigetragen, da der ewige Blutstrom des
deuischen Volkes nicht versiest.
Sage nidit, wir seien kliger, forigeschrittener als unsere Abnen. Das
Schicksal wird uns einst nicht nach unseren Morten ridiien, sondern nach
unseren Taten. Sage nichi, die Gegenwarissorgen seien zu grof, das Woh-
nungsproblem sei nicht gelést, die Hausgchilfinnenfrage sei schwierig; oft
feblt nur der Mut und vor allem der Enischluf dazu, auf bequeme Lebens-
fihrung zu verzichten. Die Verluste des Welikrieges 1914 bis 1918 und des
gegenroiirtigen Krieges konnen aber nur ausgedlichen werden durch erhokte
Kinderzahl in den Familien.
Es ist daher dem Vaterland niitzlicher, wenn. an Stelle der vielfach iiblichen
Geburisanzeigen, in denen hocherfreute Eltern in mehr oder weniger ge-
schmackvoller Form die Geburt ihres ersten und sehr oft einzigen Kindes
mit riesigem Getiise anzeigen, solche Geburtsanzeigen erscheinen wie die
obige: sie enthilt eine Verpflichtung fiir den, der sie verffentlicht, und fiir
den, der sie liest, und damit fir uns alle. Ga.
18
Ein Grenzwall wird Siedlungsraum
A 1s das Reich infolge innerer Uneinigkeit aus sich heraus nicht mehr die
Kraft besaf, die Tiirken endgiiltig aus Europa zu vertreiben, hat es
einen Schutzwall gegen weitere itirkische Einfalle errichiet. Vom Karpaien-
bogen bis zur Adria als Glanzleistung deutschen Organisationstalentes ent-
stand die Milifirgrenze. Unter deutscher Fithrung waren anch die inner-
halb dieses Raumes lebenden fremden Volker hereit, fiir das Reich, aber
damit auch fiir ihre Heimat und ihr Volk, Wache zu stehen, Deutsch war
die militiirische Fiihrung, deutsch die Verwaltung, deutsch die Zucht und
Ordnung, und doch konnte in der Militérgrenze jedes Volk nach seiner
arteigenen Kultur leben. ‘
Die Grenzer waren aber nicht nur Soldaien, sondern auch Bauern. Thre
dienstfreie Zeit war ausgefiillt mit Feldbestellmgen, mit Viehhiiten und
anderen Arbeiten. Denn ein jeder hatte als Lehen Haus und Feld, und somit
war sein Wachestehen gleichzeitig Schutz seines eigenen Hab und Gutes.
Dieser Wall sicherte durch Jahrhunderte dem Lande.den Frieden. Unter
dem Schutze der Militéirgrenze konnie das Hinterland in Ruhe und Frieden
der Arbeit nachgchen. Viel galt es zu schaffen. Die unter der Tiirkenzeit
verwiisteten Landereien mufften von neuem urbar gemacht werden, Walder
wurden gerodet, Siimpfe irockengelegt und Brache unter den Pflug ge-
nommen. Der deutsche Bauer schritt allen voran. Ex war den anderen
Vélkern Lehrmeisier. So entstand zu einer Zeit, in der das Reich dahin-
siechte, hier im Stidosten eine neue deutsche Welt. Ein deutsches Dorf wuchs -
neben dem anderen.
Eine Mauer von Soldaten
Die ersten Anfiinge der Militargrenze gehen auf die Zeit nach der Schlacht
von Mohatsch 1525 zuriid. Als die Tiirken grofe Teile Ungarns und
Kroatiens besetzten, griffen die dsterreichischen Grenzlander zur Selbstwehr
und organisierten einen Grenzschutz. Mit einem Statut vom Jahre 1630
erhilt die Militiirgrenze cine festere Form. Im Zuge der Tiirkenvertreibung
aus dem Donauraum wird die Militargrenze immer mehr nada Siiden ver-
legt und hat nach dem Frieden von Passarowitz 1718 ihre gréfite Aus-
dehnung. Von der Adria lings der Save und Donau bis Siebenbiirgen zieht
sich der Schutzsireifen. Auf diesem 1750 Kilometer langen Streifen leben
zur Zeit der gréften Ausdehnung im Jahre 1848 rund 1 250000 Kinwohner.
. Neben ihrer Hauptaufgabe, Schutz des Reiches gegen tiirkische Einfalle,
haben die Grenzer als tiichtige Soldaten auch an allen tibrigen Fronten
gekampfi, sowohl im Dreiltigiihrigen Krieg wie auch hei der Abwehr ver-
schiedener franzisischer Finfalle. Bei der Niederwerfung des madjarischen
Aufstandes vom Jahre 1848 haben sie sich hervorragend hewiahrt. Zur Zeit
ihrer gréfiten Ausdehnung konnte die Militargrenze ein Aufgebot von
etwa 120000 Mann stellen. In den Revolutionsjahren 1848/49 standen
20 Prozent der Bevélkerung unter Waffen.
Dieses Aufgebot war nur durch die vollkommene organisatorische Erfassung
der Gesamtbevilkerung miglich. Da die Zivilverwaltung innerhalb der
Militiirgrenze ebenfalls in den Hiinden des Militars lag, war die Erfassung
ee
3
erleichtert worden. Schon hei der Geburt wurde der Grenzer in die Standes-
liste eingetragen, womit praktisch erstmalig die Wehrkartei erscheint. Von
seiner Kindheit an wuchs der Grenzer in die militirische Ordnung hinein.
Im wehrfihigen Alter wurde er zur Ausbildung und zum aktiven Dienst
einberufen. Daneben war er aber als Kolonist zur Arbeit beurlaubt. Doch
auch zu Hanse ging di Ausbildung weiter. Mehrmals im Jahre stand er
im Kordondienst, d. h. im Patrouillen- und Wachdienst entlang der Grenze.
Mithin_war er mehrere Monate im Jahre unter Waffen. Nach zchn bis
zwilf Dienstjahren trat er in das Reserveverhaltnis. Die Grenzer waren
durch diesen Dienst besonders ziihe, mit dem Geliinde vertraute Krieger,
die sich besonders fiir Bandenkriege und Sicherungsdienst eigneten.
BUCHEN- »
FE i DE iseaD
SERBIEN
Dieser Schutzwall Mitteleuropas hatte gleichzeitig die Aufgabe eines
Sanitétskordons, der Europa vor dem Einschleppen der verschiedensten
orientalischen Seuchen zu beschiitzen hatte. Viele Seuchen, wie Pest, nahmen
ihren Weg iiber den Balkan nach Mitteleuropa. Seit Errichtung des Sani-
tatskordons kam tiber den Balkan keine Pest mehr nach Europa. Der
Sanitatskordon bestand in der Hauptsache aus Quarantinestationen, die
bei den Grenziibergangen eingerichtet waren.
Soldaten werden Wehrbauern
Die Militargrenze war immer auch auf den wirtschaftlichen Fortschritt ihres
Gebietes bedacht. Ihre wirtschaftliche Organisation erfafte das gesamte
Land mit seiner Bevélkerung in ihrem Bereich. Der dem Feind abgerungene
Boden, Ud- und Neuland, wurde urbar gemacht und von den Grenzern
bearbeitet. Jede Grenzerfamilie erhielt als Lehen Land zugeteilt, dessen
GrdRe sich nach der Dienststellung des einzelnen sowie nach der Ergiebig-
keit des Bodens richtete. Alle Angehérigen einer Sippe oder einer Familie
bildeten die sogenannte Hauskommunion, die gemeinsam den zugeteilien
Boden bewirtschaftete. Der Vorstand der Hauskommunion war fiir diese
Bewirtschaftung verantwortlich.
20
Die riesigen Waldungen in Kroatien und Slawonien wurden ebenfalls als
Gemeinschafisbesitz von der Militirgrenze bewirtschaftet. Die Ertrignisse
aus den Waldungen bildeten das finanzielle Riickgrat der Grenze.
An Steuern hatten die Grenzer lediglich Gemeindeumlagen zu zahlen, wohl
waren sie aber verpflichtet, neben dem Waffendienst jederzeit auch Arbeit
dienst zn Ieisten, die Frauen genau so wie die Manner. Mit diesen Arbeits-
kriften hat die deutsche Fithrang Kulturarbeit von geschichtlicher Grolte
vollbrachi, So wurden im ganzen Donauraum Siimpfe trockengelegt und
viel mehr Land gewonnen als durch die beriihmten Trodkenlegungen an
der Kiiste der Niederlande. Mit der Trockenlegung schwanden auch dic
Malaria und andere Seuchen. Seit der Rémerzeit haben nirgendwo Soldaten
eine tihnliche Leistung vollbracht. So wurde dieses mit deutschem Blut dem.
Feinde abgerungene und urbar_gemachte Land vor allem dank dem Ein-
saize deutscher Kolonisten die Kornkammer Europas
Der Grenzroall ein Vorposten deutscher Kultur
Die Militérgrenze war nicht nur auf den wirtschaftlichen, sondern auch auf
den kulturellen Fortschritt bedacht. So wurden iiberall Grundschulen und
in einzelnen Regimentsorten auch héhere Schulen errichtet. Der Haupt-
unterricht wurde den Grenzern in ihrer Muttersprache gegeben; der deut-
schen Sprache, als Sprache des Militérs und der Zivilverwaltung, wurde
selbstverstandlich, und zwar dort, wo es sich nicht um deutsche Gebiete
handelte, der ihr gebiihrende Platz eingeraumt. Jeder Grenzer war aus
eigenem Antrieb bestrebt, Deutsch zu erleruen, und war stolz, wenn er dic
Sprache seiner Vorgesetzten sprechen konnte. Juden durften in der Militar-
grenze keinen Grund erwerben und wurden in den Stidien nur in ganz
beschrankter und genau festgelegter Zahl geduldet,
Die habsburgische Dynastie in Wien war sich jedoch ihrer dentschen Auf-
gabe nicht bewuftt und lieferte das heif erstrittene Siedlungsland dem
madjarischen Chauvinismus aus. — Bald nach dem Ausgleich vom Jahre
1867 und der Uberlassung dieser Gebiete an Ungarn setzten die Madjaren
in den Jahren 1871 bis 1873 die Auflésung der Militirgrenze durch. Eine
deutsche Organisationsleistung weltgeschichilichen Ausmafes zerfiel damit
und geriei bei den nachfolgenden Generationen immer mehr in Vergessen-
heit. Doch gerade heute, wo nach den deuischen Waffensiegen das deutsche
Volksium wieder als ordnende Macht in diesem Raum anttritt, miissen wir
uns auf unsere geschichtlichen Leistungen und die deutsche Sendung in
diesem Raum besinnen.
So stehen heute an einem Abschnitt der ehemaligen Milittirgrenze die Sol-
daten einer bodenstindigen #-Freiwilligen-Division. Es sind deutsche
Bauern, die zum Schutze ihrer Heimat und ihrer Sippen unter Waffen
stehen. Sie wollen also Wehrbauern, Bauern und Soldaten zugleich sein.
Mit ihnen stehen manche Séhne dieser Militargrenzvélker im Osten und
kampfen wieder unter deutscher Fiihrung, freiwillig, wie es ihre Vater
taten. Sie wissen, dafi aus der Waffenbriiderschaft der Schlachtfelder im
Osten die neue, gréfere europiische Einheit emporwachsi. Sie wissen, dal,
sie im Inieresse dieser Einheit so manche Opfer zm bringen haben. Sie
wissen aber auch, dali dieser grifferen Kinheit dem deutschen Volk kraft
seiner Leistungen die Fithrung zufallt.
2
STERNE ALS WEGWEISER
Es ist eine bekannte Tatsache, daft die Gestirne seit alters her zur Orien-
tierung benutzt werden, ein Verfahren, das in der astronomischen Navi-
gation auf Sce und in der Luftschiffahrt seine Vollendung gefunden hat.
Fiir den Frontkimpfer ist aber nieit so sehr die Ermitilung seines Stand-
ortes nach geographischer Breite und Lange von Bedentung, als vielmehr
die Festlegung der Himmelsridhiungen zur Bestimmung der Marschrichtung,
wenn die iiblichen Hilfsmittel ausgefallen sind oder jeglicher Lichischein
unbedingt vermieden werden muf. Im folgenden sollen daher diejenigen
Verfahren betrachiet werden, die Siellung und Lauf der Gestirne zur Rich-
tungshestimmung verwenden. :
Am Tage kommt bei klarem Himmel eigentlich nur die Sonne in Frage. Die
héchste Stelle ihres Tagesweges gibi uns die Siidrichiung. Das ist zwar
leicht ansgesprochen, aber die praktische Durchfiihrung laft viel zu wiin-
schen iibrig. Zunachst fehlt im Felde hierzu die nétige Zeit. Trotzdem sei
das Verfahren hier erértert. Ein Pfahl wirft einen Schatten. Der kiirzeste
Schatten gehért zur Siidstellung der Sonne. Die Genanigkeit der Beob-
achtung wird erhéht, wenn man bedenkt, daft gleichen Schatienlingen zu
beiden Seiten der Stidrichtung gleiche Abweichungen des Schattens von der
Siidrichtung entsprechcn — ebener Boden vorausgesetzt —, so daft also
Siiden immer ‘wieder erhalien wird, wenn man den Richtungsunterschied
zwischen gleichen Schatten halftet. Dieser Schattenwerfer ist uralt, lift
jede Genauigkeit zu — kostet jedoch Zeit.
Schnell sind die Himmelsrichtngen gefunden, wenn eine ungefiihr richtig-
gehende Uhr vorhanden ist. Die deutsche Sommerzeit ist die Ortszeit des
30. Liingenkreises Ost, das ist etwa die Linie Leningrad—Kiew. Das Ver-
fahren beruhi auf der Uberlegung, daft der kleine Zeiger der Uhr wei volle
Drehungen wahrend eines Umlaufes der Sonne von Siid bis wieder herum
nach Siid macht. Wiirde der Weg der Sonne parallel zum Horizont laufen —
wie es am Nordpol der Fall ist —, so wiirde der kleine Zeiger doppelt so
rasch wandern wie die Sonne. Wir halten die Uhr nun so, daft das Ziffer-
blatt horizontal liegt und der kleine Zeiger nach der Sonne zeigt. Mittags
um 12 fallt dann die Siidrichtung mit der Richtung des kleinen Zeigers 2n-
sammen. Um 3 Uhr nachmittags hat er schon einen Viertelkreis zuriick-
gelegt, die Sonne: aber erst hiervon die Hiilf'e. Siiden liegt also in der Mitte
zwischen der 12 und der 3 auf dem Zifferblatt. Noch ein Beispiel: 6 Uhr
abends, kleiner Zeiger auf die Sonne gerichtet. Siiden liegt dann in der
Mitte zwischen der 12 und dem kleinen Zeiger, also dort, wo die Ziffer 3 ist.
um 8 Uhr abends also dort, wo die Ziffer 4 steht. Nachmittags gchen wir
immer von der 12 im Sinne des forischreitenden Uhrzeigers zum Kleinen
Zeiger, vormittags natiitlich entgegengesctzt. Man mache sich das ctwa fiir
9 Uhr friih klar. Befinden wir uns aber) nicht auf der Linie Leningrad—
«Kiew, so miissen wir dstlich davon die Zeitangabe der Uhr fiir jeden Grad
um 4 Minuten vermehrt, westlich davon um 4 Minnten vermindert denken,
ehe wir die Mitte zwischen 12 und dem kleinen Zeiger suchen. Wesentlich
fiir die ganze Methode war unsere Annahme tiber den Lauf der Sonne. Wir
22
fe
3
:
sind aber mehr oder minder weit vom Nordpol entfernt. Je weiter wir uns
yon ihm entfernen, um so mehr weicht der Sonnenweg von dem Lauf des
Horizontes ab, um so steiler verliuft er. Der kleine Zeiger wandert nicht
mehr doppelt so schnell wie die Sonne. Gehen wir noch weiter nach Siiden,
etwa nach Afrika, so ereignet es sich schlieflich, daB der Sonnenlauf durch
den Himmelsscheitel fiihrt. Damit ist die Richtung des kleinen Zeigers un-
bestimmt und die Methode wird unbrauchbar.
Der tigliche Sonnenlauf bietet noch eine andere Méglidikeit dar. Die Aul-
gangsstelle wandert mit der Jahreszeit. Am Friihlingsanfang (21. 3.) und
Herbstanfang (23. 9.) geht die Sonne tiberall — von den Polen abgesehen —
im Osien auf und im Westen unter. Die Lageiinderung der Aufgangsstelle
ist zn dieser Zeit am gréfiten. Ende Juni (21. 6.) und Ende Dezember (21. 12.)
liegt die Aufgangsstelle ungefiihr in Nordost, baw. Siidosi, wenn wir an-
nehmen, daf wir uns in mittlerer geographischer Breite auf der Nordhalb-
kugel befinden. Sie andert sich einen Monat vorher und nachher kaum
merklich, Fir die iibrigen Monaie ist eine Schiitzung vorzunehmen. Ist die
Sonne nicht allzu weit vom Horizont entfernt, solaft sich unter Hinzufiigung
des ortsiiblichen An- oder Abstieges die Auf- oder Uniergangsstelle er
mitteln,
An Stelle der Sonne lift sich auch der Mond benutzen, jedoch erfordert er
erheblich mehr an Aufmerksamkeit. Man muff sich dariiber klar sein, daa
z.B, der Vollmond der Sonne genau gegeniibersteht, er also sinngema® be-
nutzt werden kann. Sbnliches gilt fiir das erste und letzte Viertel.
Am nichilichen Himmel ist die Orientierung sehr viel einfacher. Unsere
Erdkugel dreht sich in 24 Stunden einmal herum, und daher sicht es so ans,
als ob die Himmelslandschaft voriiberzieht, so wie wir aus dem fahrenden
Zug die Telegraphenstangen in enigegengesetzier Vahririchtung voriiber-
fliegen sehen. Der ruhende Punkt am Firmament liegt daher anf der ver-
langerten Erdachse, ganz in der Nahe des Polarsternes oder Nordsternes.
Gehen wir von ihm senkrecht hinab zum Horizont. so ist Norden gefunden.
Es kommt also lediglich darauf an, diesen Nordstern zu finden. Die Auf-
suchung geschicht vermittels des Grofen Wagens, des bekanntesten Stern-
bildes. An die geknickie Deichsel schlieften sich die Vorderriider an. Ver-
Yangert man die Verbindung der beiden Hinterrader fiinffach nach der
Seite des Deichselknicks, so stéft man in ziemlich sternarmer Gegend auf
einen hellen Stern, den gesuchten Polarstern. Wichtig ist hierbei dic Tat-
sache, da der Grofe Wagen in unseren Breiten iiberhaupt nicht untergebt,
dh, also das ganze Jahr iber zur Aufsuchung des Nordsternes geeignet ist.
Das Verfahren ist so einfach, daf es mit 2um eisernen Bestand der Aus-
bildung gehéren sollte. Wenn man noch héhere Anforderungen an die Ge-
nauigkeit stellt, so denke man sich den Polarstern mit dem Deichselknidk
verbunden und vom Nordstern eine doppelte Vollmondbreite auf dieser
Linie abgetragen. Lotet man diesen Punkt auf den Horizont herab, so ist
Norden gefunden.
Nachts kann man dic Himmelsrichtungen anch aus dem Lauf der Sterne ab-
lesen, jedoch erscheint das Verfahren nur dann angebracht, wenn grifere
Teile des Himmels bedeckt sind und die Aufsuchung des Polarsternes nicht
durchfibrbar ist. Ist nur der Wagen zu sehen, so ist damit auch schon die
i 23
Richtung zum Polarstern festgelegt, selbst dann, wenn auch die beiden
Hinterrader unsichtbar sind. Hin anderes brauchbares und leicht zu be-
haltendes Sternbild steht dem Wagen in bezug anf den Polarstern gerade
gegeniiber. Man braucht nur die Wagenmitte mit dem Polarstern zu ver-
binden und diese Strecke um sich selbst zu verlingern. Damii stofen wir
auf das Sternbild Kassiopeia, das grofle W am Himmel. Erscheint es aber
an der héchsten Stelle des Himmels, wenn wir nordwiirts blidcen, so hat es
die Gestalt des M. Je nachdem wie es in einer Wolkenliicke erscheint, gibt
es einen Hinweis, wo der Polarstern zu denken ist. R
Endlich sei_ noch der Beobachtung horizontnaher Sterubilder gedacht, deren
Auf- bzw. Untergangssielle bekannt ist. Der Himmelsgleicher kann als der
‘Weg eines genau im Osten auf- und im Westen untergehenden Gestirns be-
schrieben werden. Leider gibt es nur wenige helle Sterne anf dieser Linie.
Das bekanate Sternbild Orion wird von ihr in den drei Giirtelsternen, auch
Jakobsstab genannt, geschnitten. Der Adler berithrt mit der linken Fligel-
spitze gerade den Himmelsgleicher Beide Beispicle lassen sich in Ost und
West verwenden
Mégen auch sonst unsere Gedanken beim Anblick der Sterne andere Wege
echen, heute sollien auch die fernen Gestirne ihren Beitrag zur Ertingung
des Sieges leisten, und wenn hier und da cinmal die Gestirne als Richtungs-
weiser dienen konnten, dann haben diese Zeilen ihren Zweck erfiillt. ee
eit
Porte von Robert Bory
‘Chaeakter haben {ft vor allergvopter Bedeutung. Gin renfey von Cyaratter itigt
Und betvdigt nidit und Halt fein Tort.
*
‘Immer have teh nady dem Grundfats geyandelt: ,2 fever Geld vertieren als Devtrauen.”
Die Unantaftvackeit meiner Verfpredungen, der Blaube an den Weert meiner Pare
und an metn 2Wort ftanden mic (tete yover ate ein poriibergeyender Gewinn.
*
‘ler aufeidytig fetnen Weg fucht, ete (einem Gew/ffen verantwortlicy, dem dirfen wit
unfere Adjtung nicht verfagen, ec mag mit uns oder gegen uns geben. Ga were untlug,
3u vertangen, dag Ednftig fid) jeder einfad) mit dem begnaigt, was man ihm bietet.
os witd aud) Painftig Rampf (etn, aber es follte ein eyetidjer, anfidndiger Rampf fein
2
£
{ und 5 zeigen die einpriigsamsten § , den Groflen Bar oder Grofien Wagen und
en Orion. Wie Bild 2 ist die Orientierung nach dem Groen Wagen besonders leicht
TZ (1830-1900)
rr rc ell
Gottes Wort
G, hat ein fed Rreatue ihe eigen Gpeady, damit fie in den
Himmel dringet. Gebet die Blumen, fie beten mit Sarven und
preifen alfo den Mtaienhimmel mit zartet Dtften. Und yovet Ne
‘Végel, die Bienen, feyet das fthilleende Edistein und wie Me Mrucen
um den Abendftrayl tangen. WU das ift (don, und was ftyén ift, das
ift aud) ein Gebet, fo fein Himmel findt.
Tht nit ein jeglites: Stern, Ment, Tier, Gottes Wort? Sind
geffiet, wadfen und verdecben nad) der Stund, de ift in iyce Mature
eingeordnet von Anbeginn. Go wit ihnen lauftjen in ire Tiefe, fo
béren wir das ewig Gotteswort, gefprodjen duce die Maur.
‘WGie k6nnen dee Gott-Matue nidts neymen und nidjts yingufligen.
Gelbft dev ievende Waln ift notwendig und hat feine Zeit. Yon
innen, aus dem eignen Gelbft yeraus, mug fic) das Yohere Leven
entwieten.
So hat ein fedlides Ding fein Gfab und beides, gu wirken und zu
leiden, ift die vor Gott eingepflangt Rraft in uns, und ift die Motu
felbften. Gott braudyt ein jeden mit feinem Willen, nad feinem
‘Paillen, zu [einem Beillen.
ERWIN GUIDO KOLBENHEYER
ALTE FICHE / BLEISTIFTZEICHNUNG
\
\ Gin Goldat erlebt einen Baum
Bei einer Geliindeiibung war einem Soldaten eine Eiche aufgefallen, die er
wegen ihrés ausgepriigien Wuchses zu zeichnen sich vorgenommen hatte.
Am\nichsten dienstfreien Sonntag ging er hinaus, den Zeichenblock unter
dem Arm, die Zeichenstifie in der Tasche.
Es war noch \friih am Tage. Hart knallten des Soldaten Stiefel auf dem
Pflasier der morgenstillen Sirafen, Bald hatte er die Steinwiiste der GroR-
stadigarnison im Ricken. Noch einige mit Grin durchsetzte Vorstadtstrafen,
dann stand er vor dem Wald, dem weiten, stillen Wald.
Der Mann ziigerie einzuireten. Eine Welle wiirzigen Kiefernduftes schlug
ihm entgegen. Das war eine andere Welt als die, aus der er socben kam.
Er hielt den Atem an. — Und wahrend er ihn pfcifend von sich stieft, stieR
er zugleich die Hast der Grofistadt von sich. Tief hob und senkte sich die
Brust. Gelassen schritt er in die feierliche Halle.
Er fiihlte sich im Einklang mit sich selbst und mit der Welt um ihn. Er
wnllte beides ans der gleichen Mitte her hewegt, sich selbst und die ihn
rings umgchende Natur.
Nun brauchte cr sich nicht mehr zu wappnen gegen etwas auRer ihm. Denn
hier gehérte alles ihm. Es war um ihn und in ihm. Das Raunen und das
Fliistern in den Zweigen und den Tiefen, es war in seiner Brust. Das Fluten
und Gkinzen der Farben, des Lichts und der Schatten, er hatie es als Bild
in sich. Die starken und zarten Formen der Baume und Griiser, er brauchie
sich nicht Mithe zu geben, sie zu betrachten. Das Gesetz,*nach dem sie
waren, war sein eigenes. Seine Augen und Obren waren nach innen ge-
tichtet. Und doch fand alles Eingang, das Nachste und das Fernste, die
Griiser und die Baume, die Végel und Eichkatzen, der See und der Himmel,
der Nebel und die Morgensonne, das Zwitschern und das Ranschen, eine -
ganze Zauberwelt von Ténen und Gestalten.
Und das war dem Soldat das tief Begliickende: klar und bewuft erlebte ez
das alles als eine unabiinderliche Ordnung.
Ein Singen und Klingen erwachte in der Ferne, kam niiher, schwoll an zu
rauschenden Akkorden. Begann es in dem Fliistern des Geaweigs, im Sang
der Vigel oder in der Brust des Mannes?
Gestalten wuchsen aus dem Boden, wie von Kiinstlerhand gemeifielt, wiirdig
einer Welt voll Schinheit.
Bildtafeln fiillten Flachen cines Raumes, der nicht zu iibertreffen war an
schlichter Form und doch so reich an Formen wie der Wald.
Da stand die Eiche des Soldaten, die er sich unterfangen wollte, mit dem
Stift auf em Papier zu bannen. Jetzt wuffte er, wie er sic zeichnen mufite,
nicht als ein Spiel von Linien, wie er sie friher sah, nein so, wie er sie
heute, jetzt erlebte, als das Gesetz des Schipfers, das sein eigenes war. Mit
25
eRe
einem Bleistift auf Papier? Ja, mit Bleistift auf Papier, das war sein fester
Wille, wollte er das Gottgesetz im Baume niederschreiben,
Halt, mein Lieber, rief der Gott, so leicht hast du mich nicht — und er ent-
zog sich ihm gerade in dem Augenblick, als der Soldat sich anschickte, die
ersie Linie auf das Papier zu setzen.
Da stand die Eiche, ein Baum wie alle anderen, aus Stamm, Geaweig und
Blattwerk, mit zernarbier Rinde, grau und griin, ein Gewirr yon Licht und
Schatien. Wo war das Gitilidie daran?
Da saft der arme Mann, ein Kénig, der sein Reich verloren hatte.
Jetzt hatte er sich zu entscheiden, Wiirde er den Kampf aufnchmen oder
verzichten? Er entschied sich als Soldat. Er trat an zum Kampf, zum
Kampf mit Gott. Nicht cher wiirde er das Ringen enden, als bis er Gott
gezwungen hatie, ihn als Werkzeng anzunehmen. Es war ja nicht. Ver-
messenheit, was ihn so handeln hief. Er wollte ja nur dienen, das ewige
Geseiz aufschreihen fiir die Briider, damit sie besser den Weg zu eigenem
Erleben finden. Das war sein Gottesdienst an diesem Sonntag.
Nachdem er sich so noch cinmal Rechenschaft fiir sein Tun gegeben hatte,
machie er sich an die Arbeit. Er setzte alle Waffen ein, den Willen und die
Phantasie, die Vorstellung und den bewufften Verstand. Alles sammelie er
auf einen Punkt, auf den Punkt, in dem die Spitze seines Stiftes das Papier
beriihrie. Mit allen seinen angespannien Kraften begann er nun die Eiche
zu erschaffen, Er vollzog an ihr die Schépfung neu. Kraftvoll aus der
Wurzel lieft ex sie erwachsen in den Stamm, die Aste, Zweige und Bliiiter.
Und wie er sie zum Leben erweckte, erlebte er mit ihr die Hunderte von
Jahren durch. Er war bei ihr im Jubeln mit der Sonne, im Ringen mit dem
Wind, in den Jahren reicher Nahrung und in den Jahren des Hungers.
Mit feinsten Sinnen spiirte er, wie hier der Ast sich riickwiirts wenden
muftte, im schinsten Schwunge aufgehalten, ob er wollte oder nicht. Er
mufte sich versagen, um dafiir nach verzweiflungsvollem Hin und Her um
80 schéner sich dem Ganzen einzufiigen. Nichts konnte wachsen, wie es
wollte, Eins mufie sich zum anderen fiigen. Da ging es oft hart her. Gar®
manchem Zweiglein hitte es besser behagt, sich in anderer Richiung 2u be-
wegen. Nein, dem Ganzen dienen, forderte das Gesetz des Baumes.
Auch das vergalt der Zeichner nicht, was scheinbar gegen das Geseiz ver-
stieft, die diirren Aste und das von Miftwuchs und Fraft befallene Gezweig,
das zugrunde gehen mufite, weil es nicht geniigend Lebenskraft besaft oder
einer fremden Kraft erlag.
Immer tiefer drang der Soldat in das Wesen seines Schaffens ein, Er hitte
jetzt genau so gut auf einem kahlen Felsen im Meer sitzen kénnen oder in
einer stillen Stube. Den Baum da vor sich hatte er schon lange nicht mehr
angesehen. Aus sich heraus erschuf er ihn, War er noch selbst der Schaffende?
Oder schuf in ihm und aus ihm der im ewigen Gesetz der Schépfungen
Gemeinsame? Ja, von dem Wollen des Soldaten iiberwiltigt, war er in die
Brust des Menschen eingekehrt. Mensch und Gott waren eins geworden, eins
im Werk, das nun vollendet war. aK,
26
_ YAMATO
Yamato ist der Name einer japanischen Landschaft. Da aus diesem
\Raum heroorragende japanische Soldaten heroorgegangen sind, ist der
Wame Yamato ein Sinnbild fiir Tapferkett und Pflichterfilllung gerorden,
Nichts laft sich von einem fremden Volk auf das eigene iibertragen.
Aber ernen kénnen. roir aus dem japanischen Beispiel, rie Tapferkelt
und Mut im religidsen Grundgefthl rourzeln.
's geschah im Jahre 1932 wesilicher Zeitrechnung, da ein japanischer
Major, bei den Kiimpfen um Schanghai schwer verwundet, die Besinnung
verlor und so das Ungliick hatte, in die Hinde des Feindes zu fallen. Durch
die vorriickenden japanischen Truppen wurde er hernach wieder befreit
und zuriickgefiihrt. Eines Tages war in der Presse zu lesen, dafi der Major
gerade auf dem Schauplatz der Kimpfe, in deren Verlauf er gefangen-
genommen worden war, sich den Freitod gegchen hatte.
Was vermittelt uns dieses Vorkommnis? — Nur weil er verwundet und
besinnungslos lag, war der Offizier gefangengenommen worden; war dat
eine Schande fiir einen Krieger? Warum bereitete er seinem Leben ein
Ende, statt sich weiter fiir das Vaterland einzusetzen und ihm mit scinen
Kenninissen, seiner Erfahrung, seinem Mut und seinem Geist zu dienen? —
Nur aus dem Yamato-Geist her, jenem Geist des japanischen Menschen, ist
seine Handlungsweise zu erkliren,
In den Sagas im westlichen Japan ist die Tradition des kraftvollen Ritter-
geistes ganz besonders lebendig geblieben; die Grundlage fiir die Geistes-
erziehung des Saga-Ritters ist in dem Buch ,Hagakure", einem Werk iber
die ritterliche Moral, zu erblicken, in dem es heift: ,,Wenn du zwei Wege —
Leben oder Tod — zu wihlen hast, so wahle den letzteren.* Der Major, der
diese Lehre tief in sich irug, ging den Weg des Todes. Doch warum soll
man den Tod suchen? |
In dem Ritterkodex der japanischen Krieger von heute, ,Senjinkun“ oder
die Lehre im Kriegslager, heifit es:.,,Lebend sollst du nicht die Schande des
Gefangenen tragen; nach dem Tode sollst du nicht den schlechten Ruf von
» Schuld_und Unheil hinierlassen." Von alters her gilt es in Japan als eine
grofe Schande, in Gefangenschaft weiterzuleben; eher soll man sterhen.
Es mégen im gegenwirtigen Krieg — anders als in alten Zeiten — gewisse
Faille nicht zu vermeiden sein, in denen man gefangengenommen wird; man
mag durchaus der Ansicht sein, man brauche nicht unbedingt zu sterben,
sobald man nur mit den hochentwickelten neuzeitlichen Waffen seine Pflicht.
ja, sein Auferstes getan hat, und man niitzt seinem Lande viel mehr, indem
man am Leben bleibt und seine Bestimmung — sei es im Kriege oder im
Frieden — erfiillt. Eine solche Anschauung hat-eine gewisse Berechtigung:
der japanische Soldat indessen denkt anders: Wenn er in der Schande der ~
Gefangenschaft weiterlebt, so bedeutet dies, dal er nicht his. zum Tode ge-
kampft hat, daf er noch die Méglichkeit gehabt hat, weiterzukampfen, und
er ist_von tiefem Bedauern dariiber erfiilli, dai er fiir Tenno, Vaterland
und Volk nicht bis zum Tode gckampft hat.
Ti
~Sei es zur See, wo meinen Leih das Seewasser tauft,
Sei es zu Land, wo mein Gebein in den Bergen das Moos deckt —
Allein fiir den groflen Herrscher will ich kiimpfen
Ohne einen Gedanken an mich.“
Wie dieses uralte Lied, das wir immer wieder anstimmen, zum Ausdrack
bringt, ist es tiberhaupt nicht denkhar, daft der Soldat ins Leben zuriick-
kehrt. — Lord Nelson sagte bei seinem Tode: ,Gott sei Dank, ich habe
meine Pflicht getan"; der Japaner aber kimpft nicht um der Pflicht willen,
sondern um sein Leben aufzuopfern. Erwin Balz, einer der besten Kenner
Japans, berichtet ein eigenes Erlebnis aus der Zeit des Russisch- Japanischen
Krieges: Ein japanischer Bekannter besuchte ihn mit seinem Sohn, der am
niichsten Morgen an die Front einriiccen sollie. Nachdem der junge Mensch
sich verabschiedet hatie, unterhielt sich Dr. Bilz mit seinem japanischen Be-
kannten iiber den Krieg; der alte Mann erzithlte ihm,.da@ er vor vier
Jahren ‘beim Boxeraufstand den iltesten Sohn verloren hatte und nun den
zweiten in den Krieg schickte. Er fuhr fort, da sein in Ehre getragencs
Familienwappen nunmehr keinen Trager mehr haben werde, da er keine
weiteren Sdhne habe. Biilz sagie ihm iréstend: ,,Nicht alle, die zur Front
sehen, sind zum Fallen bestimmt; ich glaube, Ihr Sohn wird mit grofem
Waffenruhm heimkehren.“ Der alte Vater schiittelte den Kopf und ent-
gegnete: Nein, mein Sohn geht in den Kampf, um den Heldentod zu
finden, nicht um lebend heimznkehren.* — Erwin Biilz stellt fest: Es war
ein gelassenes Wort, wie es einem Philosophen zukommt.
Diese Einstellung ist der wahre Grund, warum Japan bisher keinen Krieg
yerloren und auch im gegenwértigen Krieg Grofostasiens wundervolle
Erfolge errungen hat. Es ist nichis anderes als eine todesmutige Tat, in
den denkbar kleinsien Unterseebooten an die gewaltigen Kriegsschiffe der
USA.-Flotte heranzugehen und sie zu versenken. Die Selbstvernichtung der
japanischen Flieger hat den Sinn, sich selbst als einen Teil der Bomben-
last zu betrachten und in den Feind zu stiirzen, um ihrer Bestimmung
gerecht zu werden. Am 12. Dezember vorigen Jalires gab das Kaiserliche
Hauptquartier bekannt, daft neun von zehn Marineflugzeugen sich selbst
erfolgreich vernichtet haben. Dieser Heldengeist ist es, der das japanische
Reich geschiitzt; dieser Heldengeist hat es der japanischen Wehrmacht be-
reits in den Jahren 1274 und 1281 gestattet, mit nur 50000 Mann die weit
iiberlegenen Mongolen, die etwa 150000 Mann zablten, vernichtend zu
schlagen und ihren furchtbaren Uberfall abzuwehren. Im Chinesisch-
Japanischen Krieg von 1894/95 und im Russisch-Japanischen Krieg von
1904/05 wurden die glinzenden Siege Japans eben durch diesen Geist
herbeigefiihrt. Und auch die Soldaten, die heute im unerhért weiten
Raum des Pazifiks zu Land, zur See und in der Luft kampfen, sind alle
daranf gefaftt, dem Vaterland ihr Letztes zu opfern und in die Reihen
der Gitter einzugehen.
Diejenigen, die einen solchen Geist als Fatalismus bezeichnen und in ihm
eine sinnlose Verachtung des teuren menschlichen Lebens erblicken, sind
weit entfernt davon, den japanischen Soldatengeist zu verstehen. Die
kiihnen Waffentaten der japanischen Soldaten sind Offenbarungen chen
28
me RP
Japanische Darstellung eines Samurai-Kriegers,
der sein Leben der Ehre und dem Volke weiht
-
wees
oe
ae
dieses kraftvollen Geistes, der fiir das Bestehen und die Ehre des Reichs,
fiir die Gerechtigkeit und den wahren Frieden wirkt.
Es wiirde auch ein unverzeihlicher [rrtum sein, wollte man in diesem Geist
auch nur eine Spur urspriinglicher Brutalitat sehen. Die Liebe. des japa-
nischen Menschen zur Blume ist bekannt; seine Asthetik laBt ihn jedoch
nicht die Blume allein suchen, vielmehr schdtzt er sie im organischen
Verein mit den Blaitern und Zweigen; deshalb schneidet er niemals die
Bliite allein ab, sondern ft sie an ihrem Zweig. Die japanische Zivili-
sation hat ihren Menschen nicht allein den hohen Opfergeist, sondern auch
ein empfindsames Mitgefiihl beigebracht. Dieses Mitgefiih] bewiihrt sich
in der Haltung des japanischen Soldaten gegeniiber dem Feind. besonders
dem gefangenen. Aus dem Mittelalter wird hierfiir ein schlagender Beweis
berichtet: Im Jahre 1184, im Verlauf eines erbitterten Biirgerkrieges, be-
siegte der hervorragende Krieger Kumagai einen Ritter aus dem feindlichen
Lager, Atsumori, und nahm ihm nach der damaligen Kriegssitte den Kopf.
Atsumori zéhlte noch nicht zwanzig Jahre, und von seinem friihen Tod
erschiittert, legte Kumagai das Schwert ab, verliefi den Ritterstand und
wurde Priester, um als solcher sein Leben mit Gebeten fiir das Scelenheil
des Gefallenen zu verbringen.
im vergangenen Weltkrieg gelangten japanische Freiwillige, die in der
kanadischen Armee dienten, an der Westfront zum Einsatz; unter ihnen
befand sich der Freiwillige Isomura, der bei einem Angrifff auf einen deut-
schen Verwundeten sticf. Der Verwundete gab durch schwache Bewegungen
zu erkennen, daft er furchtbaren Durst. litt, und ohne zu zégern gab ihm
Isomura aus seiner Feldflasche zu trinken, in der sich noch ein letzter Rest
kostbaren Wassers befand. Mitilerweile war ein britischer Soldat heran-
gekommen, der den verwundeten Deutschen mit dem Bajonett anfiel:
Isomura warf sich dazwischen und rief: ,Siehst du denn nicht, da der
Mensch schwer verwundet ist?“ — ,,Ach was", enigegnete der Brile, .ver-
wundet oder nicht verwundet — jeder Feind mehr, der getétet wird, ist
fir uns ein Gewinn.* — ,,Wo ist denn deine chrisiliche Nachstenliebe?“
Die habe ich 2u Hause gelassen, als ich in den Krieg zoe", entgegnete
der Brite.
Ebenfalls im Weltkrieg hért der japanische Freiwillige Morooka einen blut-
jungen Gegner, den er mit dem Bajoneit angriff, ,Mutter!" rufen. Als er
das Wort hérte, das ihm bekannt war, konnte er nicht zum zweitenmal
mit dem Bajonett gegen den Feind stoften, und dieser soll auf diese Weise.
wenngieich verwundet, geretiet worden und spiiter in die Heimat zuriick-
gekehrt sein.
Die Japaner halen es zwar fiir unter ihrer Wiirde, gefangengenommen
zu werden,’ doch haben sie ein tiefes Mitgefiihl fiir die Gefangenen, die sie
selbst machen. Im Laufe des russisch-japanischen Krieges kamen viele
Russen als Gefangene nach Japan, und keiner unter ihnen wird sich wohl
ohne Dankbarkeit der grofizigigen Behandlung erinnert haben, die, ihm in
Japan zuteil wurde. Eine solehe Haltung gegeniiber dem verwundeten
Feind gilt in Japan seit alters als Tugend. Aus der Geschichte geht deutlich
hervor, daft die am Mongoleneinfall beteiligien feindlichen Koreaner, die in
japanische Hand fielen und keiner besonderen Behandlung wert waren,
eine menschenfreundliche Aufnahme gefimden haben; der Kaiser voa
30
Korea hat sich sogar veranlaftt gesehen, der japanischen Regierung in
einem Schreiben seinen Dank fiir cine solche Behandlung zum Ausdruck zu
bringen. Hierbei ist zu bedenken, daft es sich beim Mongoleneinfall um eine
denkbar gefahrliche Bedrohung Japans und seines Volkes gehandelt hat.
* Im Russisch-Japanischen Krieg fiel der I. Division und der Il. japanischen
Armee die Fiirsorge fiir die ersten russischen Gefangenen zu; es wurde eine
Besichtigung der Gefangenen befohlen, die den Zwed hatte, die japani-
schen Soldaten mit den Uniformen, Kennzeichen und Merkmalen des
Gegners vertraut zu machen. Eine Anzahl Mannschaften einer bestimmten
Kompanie siellie sich bei der Besichtigung jedoch nicht ein, und als Grund
hierfiir wurde folgendo Uberlegung festgestellt: Es ist eine Schande, als
Soldat gefangengenommen zu werden, und es ist unertriglich, als Ge-
fangener das Gesicht dem Feinde zeigen zu miissen; der Samurai begrcift
die Gefiihle des Samurai und erspart ihm diese Demiitigung. — Aus diesem.
Grunde nahmen die Soldaten an der Besichtigung der russischen Gefangenen
nicht teil. — Die feindlichen Offiziere, die den Befehl gaben, alle Japancr,
selbst die gefangenen, zu téten, diirften die Haltung der japanischen Sol-
daten nicht verstanden haben.
Auf einem der Schaupliiize des gegenwartigen Krieges GroBostasiens, den
Philippinen, wurde Anfang Januar eine Anzahl japanischer Zivilisten von
den USA.-Truppen niedergemetzelt; in der Geschichte Japans kommen
solche Greueltaten nicht vor.
Die Japaner kimpfen heute fiir das Vaterland und fiir alle Vilker Gro
ostasiens, sie kimpfen einen opfervollen, schweren Kampf, in dem sie an
sich selbst die hiirtesten Anforderungen stellen; nichisdestoweniger haben
sie tiefes Miigefiihl fiir die Mitmenschen, und aus diesem Umstand werden
im Verlauf der Kampfe zahlreiche bezeichnende und riihrende Vorkomm-
nisse entstehen, die in die Geschichte des Krieges eingehen und dort ihrer-
seits Zeugnis ablegen werden fiir den Geist Japans, den Yamato Tamashii.
Kazuichi Miura
Uno gaven wie ofe treue Jnr die und mie und allen,
‘UND nidjts fonft auf dec Felt, da waidyft fie fray und fpat,
Das {ft genug, und Feiner” und mitten, wo wit fallen,
{ft dann vor uns geftellt, da wird fie ausgefat. :
Sie tann uns feiner (dymahen, Und haben wir die Treue
ba halt Fein Seind mehr Sehritt, ‘und nidyts fonft auf der t8eit,
die Fann dev Tod nidt mayen das ift genug, und Feiner
mit feinem yarten Gdynitt. {ft dann vor uns geftellt.
HANS BAUMANN
Der Tod begleitete mit einladender Geste den Weg, auf dem Offiziere und Soldaten
ihren todwunden Konig Friedrich trugen, ihn aus dem Fihrhause bei Otscher hin-
iiber iiber die Oderbriicke nach dem Schlosse Reitwein zu bringen, Als er auf der
Beustatt lag, ganz allein im diisteren Raum (die Offiziere besprachen im Neben-
zimmer das Ungliick des Tages), pochte der Tod beim Kanig an: Folge mir, verlelt
den Weg des Leidens und der Qualen. Ausruhen sollst du von den Miihsalen des
Lebens. Siche, ich schenke dir Ruhe und Frieden.
Des Kinigs Gedanken kreisien um das Blutbad von Kunersdorf, er v
Geiste das Liirmen der Schlacht, fiihlte die vereinigte Streitmacht der Ru
Osterreicher heranfluten, feucrte sein Heer zum Kempfe an, muBte aber doch
erkennen, daft der Hunde dort zu viele waren, die das edle Wild zu Tode hetzen wollten
Flir einen Augenblidc kam das volle Bewufttsein auriids. Die zittrige Hand ergriff
ein Blatt und brachte den Befehl an den General Fink zu Papier.
Als der General an das Krankenlager trat, bewegten sich die blassen Lippen des
Konigs. Er suchte mit letzter Kraft die Zeilen des Blattes 2» wiederholen:
Die ungliidsliche armée, so ich [hm ibergebe, ist nicht mehr im Stande, sich mii
den Russen 2u schlagen... Wen Laudon nach Berlin wolte, Soldien kénte Er unter
wegens attaquiren und Schlagen. Solches, wo es guht gehet, gibt dem ungehik einen
anstandt und hilt die suchen auf, Zeit gewonnen ist Sehr vihl bei diften desparaten
Umstinde
Der Kiénig liegt allein. Dunkelbeit fillt den Roum, und in ihr werden aufs neue die
Stunden der unseligen Sehlacht wach: In dem Fiebertranm stiirzen Pferde, sterhen
Krieger, in den Ohren braust der gelle Ruf des Kampfgewiihls,
Da heben sich die Augenlider, der Blick fallt in den Spiegel an der Wand: Der
Kénig schaut ein weilles Angesicht und im Schatien tiefer Hihlen verglimmende
Augen. Ein Sehrei michte sich der Kehle entringen, Der Tod legt die Hand auf die
Sehulter des Kénigs und spricht leise, ganz leise, giitige Worte, um ibn aus dem
qualvollen Leben des ewigen Kampfes zu locken,
Das Herz schligt matt. Der Konig hat seit der verlorenen Schlacht nichts mehr an
Speise und Trank zu sich genommen. So hat die Erscheinung des Todes es leicht,
den Gedanken ans Sterben zu nihren. Ein ermatteter Leib ist rascher bereit, das
Leben aufaugehen. —
32
Hinter der Gestalt des Todes erscheint plitzlich das strenge Gesicht des Vaters.
Hab’ ich ans Sterben gedacht, Sohn, glaubt er zu vernehmen, ,als alle Glieder im
Schmerz zu zerreiften schienen, als die Gicht meinen Korper plagte? Mein Leben war
nur Arbeit, Sorge und Qual. Es gab ungezihlte Stunden, da mir der Tod Rettung
gewesen wiire, Aber mich hielt die Pilicht! Immer den Weg der Pilicht gehen, das
macht den Mann zum Manne. Nur so erringst du sehlieftlich die Krone des Kiimpfens.
Und wisse, Sohn, héher als ich und du gilt Preufien!™
Friedrich fahrt empor. ,Preufen!" geht es laut tiber seine Lippen.
Der treue Diener, der im Nehenraum Wache hilt, blickt erschredst durch die leicht
gebfinete Tir, Er sieht den Todesschweift an der fahlen Stirn seines Kénigs und
gieBt ihm ein wenig Wein iiber die zitternden Lippen. Er wird froh, weil der matte
Leib es annimmt. Mit leisem Schritt entfernt sich der Diener wieder.
Fine Weile geht hin. Der Kénig rafft sich empor, starrt in das fladcernde Licht der
fast herabgebrannten Kerze.
Das Leben verlischt wie das Licht’, denkt es hinter der hohen Stirn, Nur, da das
Licht als lebloses Ding keine Qualen erduldet, keine so unsagbare Not des Leibes
und des Geistes*
Wieder sehiittelt das Fieber den Kénig. Die Rechie greift nach dem Rock auf dem
Stuhl und holt die kleine Silberbiichse hervor. Aber wie er den Behiilter mit Gift in
der Hand fuhli, beginnen die Krafte des Lebens dem Leibe Bewulitsein zu geben.
Noch einmal glaubt er des Vaters Worle 2u héren. ,Héher als ich und du gilt
PreuBen.” Der Satz schieBt ihm durch Hirn und Herz, Und nun, da der Kinig
wieder Bewullisein gewinnt, ist auch die Kénigsseele wach. Soll ich dir folgen,
:Tod? Fuhrst du das Heer aus der Niederlage.2u neuem Sieg? Sterben ist leicit in
diesen Stunden unaussprechlicher Not. Immer den sthweren Weg wihlen, den Weg
der Hirte, der eisernen Pflicht. Allein,so gewinnt der Mensch die Krone der Kampfe.*
Sowie des Kinigs Geist wieder solche Gedanken denkt, wiichst der Wille zum Leben
und zum Kampf. Eine Stunde verrinnt noch, in der die Kréfte zusammenstrimen.
»Preuflen braucht den Willen des Kénigs, wenn die Armee auf den Schlachtfeldern
liegt, Ersatz kaum ausgebildet ist, das Offizierkorps zumeist aus Knaben besteht.*
Die Worte, die er cinst an Voltaire schrieb, steigen in der Erinnerung herauf: .Jch
aber, dem der Schiffbruch droht, muf, mutig trotzend dem Verderben, als Kénig
denken, leben..." Er setat den Gedanken fort, anders als einst in der Stunde, da
er ihn zu Papier gebracht’— ,,und darf nicht sterben. Nein!* Das letzte Wort wirft
er laut und entschieden in den Raum. Der Leibjiger tritt gleichsam befohlen ins
Gemach. Der Kinig sitzt aufrecht
»Bring Er mir das Friihstiide!" fordert er den Diener auf. Dieser, véllig tberrascht
liber die schier wunderbare- Wandlung des Zustandes seines Kénigs, erfiillt eiligst
das Gebot. Der Konig lift den Adjutanten bestellen, Als der Offizier hdchst tlber-
rascht ins Zimmer tritt, findet er den Kinig hereit, Befchle auszugcben.
Die Lage sei also nicht aussichtslos?” —
;Russen und ihre Verbiindeten seien uneinig tiber den Fortgang der Auseinander-
Setzung mit Brandenburg. Sie scheuen auch nach Kunersdorf den Wagemut Prenftens."
Des Kinigs Feuerseele lodert hell aul. ,Wo sieht der Feind?”
wEr lagert zur Stunde in den Waildern zwiscien der Oder und der Reppener Allee.”
{Schreib Er meinem Bruder! gebietet der Kinig dem Offizier. Ich verkiindige das
Wunder des Hauses Brandenburg. Der Feind hatte cine aweite Schlecht wagen und
den Krieg beenden kinnen, Er-hat es nicht gewagt: unsere Lage ist weniger ver-
oweifelt, als sie gestern war.”
33
Wahrend der Offizier die Worte: niederschreibt, tritt der Konig, nun schon den
Soldatenrock um die Schultern, neben ihn. Die blauen Augen irelfen den Blick des
Adjutanten, Der Ktnig schligt thm auf die Schultern:
»Stelle Er sich vor, wes mein Geist in dieser Nacht gelitien, Fast war das Maft
meiner Leiden zu groft. Der Tod schien Rettung zu sein. Hire Er. Als mich der Tod
aus dem Leben locken wollte in dieser Nacht, habe ich, obschon das Sterben leicht
gewesen wire, dem Tode den Gehorsam verweigert. Im dunkelsten Augenblick griff
meine Hand nach dieser Dose, die das Gift enthilt. Weift Er, was es heiftt, wenn ich
lebend hier stehe? Oft ist es leichter, aus dem Leben zu gehen, als nicht zu sterben.
Der schwerere Weg ist im Leben immer der richtigste. Ich habe ihn gewahlt, damit
mein Staat aufrechterhalten bleibe. Der Wille ist sttirker als Tod und Verderben!*
Heilige Stille erfillt den Raum. Der Offizier steht in vollendeter Haltung vor dem Konig.
»Mégen die Jungen der Nation es fiir alle Zeiten merken. Es gibt Augenblicke, in
denen der Tod aus dem Leben lockt vor der Zeit. Wer dem Tode folgi und sich zum
Gift oder zur Kugel fliichtet, ist ein Schwachling und bt am Leben Verrat!" —
Des Kénigs Mut und der Wille zum Leben retteten Prenften. Auf die Niederlage vor
Kunersdorf folgten die Siege von Liegnitz und Torgau. Und Preuflen gewann den
Siebenjithrigen Krieg.
Das preuflische Wunder war Friedrich selber, Das Wunder war der Gedanke der
Pilicht. Er wurde in Preufen geboren, und seine vollkommenste Verkérperung wat
der Konig Gerhart Schinke
Joe feid geborgen im Herzen der Heimat
er Rhein irtigt Eisschollen. Die Morgensonne treibt mit den blanken ‘g
Kristallen ihr glitzerndes Spiel und verklart die Mauern der alten 4
Stadt am Sirom.
Ich suche ein Haus, in dem wohl wenig Sonne sein mag seit jenem Tage, der
vor einem halben Jahre die Botschaft vom Heldentod des einzigen Sohnes
brachte. Aber die Mutter ist gefa8t und kann auch schon wieder ein wenig
[réhlich sein. Ich finde anch die Quelle dieser tapferen Uberwindung: ,,Ich
habe eigentlich immer nur fiir meinen Sohn gearbeitet und gesorgt. Jetzt
will ich der Idee dienen, fiir die er gefallen ist, so gut ich kann. Ich habe
eine Miitterberatungsstelle iibernommen, und sehen Sie, ich nuihe gerade fiir
die NSV."
Ich muft der Mutier vom letzten Abend ihres Sohnes erzihlen, yom sieg-
reichen Durchbruch durch die Stalin-Linie, vom Gefecht im Morgengrauen
und vom tapferen Sterben ihres Sohnes. Und das macht die Mutter so stolz,
daB ihr Sohn nun auf jener Hohe am Sbrutsch ein schines Grab gefunden
hat, die er mit seinen Mannern bis zum Letzten verteidigte. —
Uber dem Land an der Ruhr liegt im hereinbrechenden Abend grau der
Qualm der Schlote, Eine dunkle Schwere liegt auch tiber dem Haus, das ich
betrat. Zwei Sohne blieben vorm Feind, Die Trauer der Eltern ist bis ins
Innerste beherrscht. Der Vater, em alter weiflhaariger Offizier, spricht von
34
eS eee
den Séhnen. Es ist ein ganz alter Mannschaftshaus-Kamerad darunter. Was
unseren gefallenen Kameraden in den Jahren des Aufbaus der Hauser be-
wegte, das hat der Vater miterlebt. Und nun midhte er, daft diese Bindung
und Lebenserfiillung, die sein Sohn in unseren Hausern fand, bleibt in der
Bindung seiner Familie an die Hauser.
Das Einzelschicksal versinkt im Gespriich. Der alte Soldat miéchte héren,
wie die Front ist, wie der Gegner ist, und er findet auch Worte der Zukunfits-
gliubigkeit: ,,Man kann es nicht glauben, dali sie tot sind. Sie kommen
wieder und bleiben mit dem Sieg und der gliicklichen Zukunft." Seine Augen
gehen zu den Bildern der Sthne. In einer Vase bliiht langstieliger weifter
Flieder. Ein kleiner heller Schein steht in den Augen des Vaters. —
In einer kleinen Stadt 1m winterlichen Thiiringerland. Der einzige Sohn ist
geblicben. Die Mutter zeigt mir seine letzten Briefe: .Es ist mein Trost, daft
ihm das erfiillt wurde, stiirmen und siegen zu diirfen. Wir waren so ge-
wohnt, daft er ganz in der Idee aufging. Sein Tod muf uns ja die Krénung
seiner Haltung sein.” —
Stutigart. Hier muf ich vier Trauerhiuser aufsuchen. Einmal treffe ich
niemand an. Der Vater ist auch Offizier, und die Mutter versieht den Haus-
halt einer kinderreichen Familie.
Mit einer Mutter sitze ich vor dem blumengeschmiidcten Bild des gefallenen
Sohnes. Es fallen wenig Worte; aber eines blieb mir haften:
»Was mich so traurig macht — daft nun gar nichts bleibt von meinem Sohn.
Wenn er wenigstens ein Kindchen hinterlassen hatte. Da kénnte man doch
sein Gesicht noch sehen, denn das witre sicher darin." —
An der Nordsee in einem Lehrerhaus. Auch hier kommt ein Sohn nicht
wieder. In den Tagen der Tranernachricht ist die Schwester mit ihren
Kindern zu ihren Eltern geeilt. Die beiden Kleinen sind Trost und Freuden-
bringer in aller Trauer. Die Mutter hat einen unerfiillten Wunsch: Wenn
er doch Kinder hinterlassen hatte. Ich wei es jetzt: man soll auch in Not-
zeiten — ja gerade dann — Kinder haben. —
Bei der Mutter eines gefallenen Kameraden weilt die Braut. Ihre tiefen
tapferen Wort sind mir unvergellich: Mein Gliick habe ich hingeben
miissen; aber es kommt da dafiir das Glick vieler junger Menschen in
Friede und Freud’ einer besseren Zukunft." —
Im diémmernden Abend stehe ich am Meer. Meine Gedanken wandern zu
den Kameraden, die wir im Osten zur Ruhe betteten. Ihre frohe Jugend,
ihr Tatendrang sind stumm und kalt. Thr tiefster Glaube, ihre beste Sehn-
sucht aber strémten ins Herz der Heimat, machen die Trauer stolz und
richten auf aus der Bitiernis des Opfernmiissens zu glaubigem Vertrauen
auf Zukiinftiges, das Gliick und Freude sein wird.
Das Meer rollt, Welle um Welle, ins Dunkel. Sterne glimmen auf — iiber
uns und tiber euch, ihr stillen Kameraden in fremder Erde. Aber ihr seid
uns ja ganz nahe im ewigen, heiligen Herzen der Heimat.
Theo Hickfang
5
Die Drohne hat keinen Vater
Eine wichtige Tatsache fir die Lehre von der Vererbung
Noa dem! matirseed ichtlichen Umesh
wissen wir, dafi ein Lebewesen immer cin
Produkt von Vater und Mutter ist; biologisch
gesprochen heiftt das: Erst muft sich das weib-
liche Ei mit der minnlichen Samenzelle ver-
einen, das Fi muft also befruchtet werden, ehe
ein neues Lebewesen daraus entstehen kann.
So ist es in der Regel, und wir sind von dieser
naturgesetzlichen Tatsache so iiberzeugt, daft
wir nur mit Verwunderung yon einer Aus-
nahme Kenntnis nehmen.
Und doch gibt es solche Ausnahmen — wie
iiberall im’ Leben —, und der Biologe_kennt
diese Erscheinung unter dem Namen .,Parthe-
nogenesis” (parthenos = Jungfrau, genesi
Erzeugung) und versteht darunter die ,,jung-
fréuliche Geburi", bei der ein neues Lebe-
wesen aus einem unbefrnchteten Ei entsteht.
Diese héchst merkwiirdige Erscheinung lift
sich wissenschaftlich noch nicht recht erkliren,
sie mufi zuniichst als cine cinfache Tatsache
hingenommen werden. Zu solchen aus einem
unbefruchteten Ei hervorgegangenen Lebe-
wesen gehért auch die Drobne.
Wir crinnern uns, daB es im Bienenstaat drei Gruppen von Bienen gibt.
Zuniichst ist da die schon durch ihre Grife hervorragende Kénigin, die
die Aufgabe hat, méglichst viele Fier zu legen. Sie erfiillt diese Aufgabe
auch mit gréftem Eifer, denn sie legt taglich im Friihjahr und Sommer die
siattliche Zahl von 500 bis 2000 und sogar 3000 Eiern — im Jahr ins-
gesamt 150.000 bis 200000 Stick — zum Wohle ihres Volkes. Eine andere
Aufgabe hai die igin nicht zu erfiillen, nur fiir den notwendigen Ge-
burteniiberschult in ihrem Staate muB sie sorgen.
Dafiir wird sie von der zweiten Gruppe im Bienenstaat, den sogenannien
Acbeiterinnen, audi redlich belohnt, indem diese ihre Kénigin krafiig
niihren und dingstlich schiitzen und auch fiir die Pflege und Aufzucht der
Brut sorgen.
Aber da ist noch eine weitere Gruppe von Bienen anzutreffen, niimlich die
Drohnen, die Miinnchen im Staate (sie miiften deshalb eigentlich der Drohn
heifien). Diese Minner haben nichts zu tun und sind richtige Faulpelze.
Sie kémnen sich nicht einmal hinreichend ernihren und wiirden elendig
zugrunde gehen, wenn sie nicht von den Arbeitsbienen von Zeit zu Zeit den
stidsstoffhaltigen Futtersaft als Ereiinzung der Honignahrung dargereicht
erhielten.
36
a Sia ag | a
Trotz ihrer Faulheit ist die Drohne ein ganz wichtiges Tier im Bienenstaat.
Sie hat eine einzige Aufgabe zu erfiillen, die darin besteht, die Kénigin
zu befruchten. Dazu unternimmt die junge Kénigin an einem schénen
Sommertage einen Hochzeitsflug und 1éft sich in der Luft von einer Drohne
hegatten. Die Drohne stirbt und die Kénigin fliegt allein weiter zu ihrem
Volk.
Die befruchtete Kénigin hat yon der Drohne etwa 200 Millionen mannliche
Samenfiidchen mitbekommen, die sie in einer besonderen Blase in ihrem
Kérper aufbewahrt. Diese Samenfiiden bleiben befruchtungs- und lebens-
féhig. Die meisten Eier. die die Kénigin ihrem Volke schenkt, werden von
einem solchen Samenfaden aus ihrer Vorratskammer befruchtet. Daraus
enistehen dann wieder Arbeiterinnen und bei besonders guter Pflege und
reichlicher Fiitterung der Larven Kéniginnen. Und nun das Merkwiirdige:
Die Kénigin legt auch Eier, die aus einem noch unbekannten Grunde nicht
yon einem solchen Samenfaden befruchtet worden sind. Solche Eier diirfien
den biologischen Gesetzen nach nicht zur Entwicklung kommen. Aber die
Natur schlégt uns hier ein Schnippchen und Jat aus diesen Eiern doch
Lebewesen entstehen, niimlich Drohnen.
Damit unterliegen also die Drohnen ganz ungewohnten Verwandtschafis-
und Vererbungsgesetzen. Da sie aus unbefruchteten Eiern hervorgegangen
sind, kinnen sie also keinen Vater haben. Aus dem gleichen Grunde bringen
sie natiirlich auch keine Erbeigenschaften des Vaters mit, sondern nur
solche der Mutter. Aber dafiir stehen die Drohnen in engster Beziehung
zum Groftvater. Ist doch die Mutter der Drohne immer als Produkt von
Kénigin und Drohne aus einem befruchteten Ei hervorgegangen und
enthilt somit Erbmerkmale von ihrer Mutter und von ihrem Vater. Erb-
fakioren von beiden Eltern gehen nun auch in die nachste Generation tiber,
damit also auch auf die aus einem unbefrachteten Ei enistehende Drohne.
Sie kann also nur Erbmerkmale von Mutter und Grofteliern besiizen, nicht
aber solche eines Vaters.
Diese sonderbaren Verwandtschafisverhaltnisse haben die Drohnen zu
einem interessanten Forschungsgegenstand der Biologie gemacht. Man kann
an den Drohnen bestimmte Erbgesetze kennenlernen, wie sie bei anderen
Lebewesen nicht festzustellen sind. Auch in der praktischen Bienenzucht
macht man sich diese Erkenntnis zunuize. Ein Imker wird eine Kénigin
niemals linger als zwei Jahre ihrem Volk belassen. Danach besteht die
‘Gefahr, dai der Vorrat an Samenfiden aus ihrer Befruchtung aufgebraucht
ist und sie nur noch unbefruchteie Bier absetzt, die sich zum Entsetzen des
Bienenyaters zu lauter Drohnen entwickeln wiirden, Der ,,Weisel ist
»drohnenwiitig, stellt der Imker fest und wechselt die Kénigin aus, denn
die freftbegierigen, notorischen Faulenzer im Bienenstaat sind in zu groler
Anzahl hichst unerwiinscht. Und noch etwas kénnen wir daraus lernen:
Auch in dieser Abweichung von der Grundregel der Natur, daft jedes Lebe-
wesen einen Vater hat, wird ein geheimnisvoller, ordnender Wille sichtbar,
der dahin wirkt, dali nur verhiilinismaig wenige Minnchen erzeugt werden,
die im Bienenstaat fiir die Erhaltung der Art vollig geniigen.
Bruno Baege,
3
An meine Kameraden!
Bei der Schriftleitung der /4-Leithefie kommen tiglich Briefe der Front-
kameraden an, in denen alle méglichen Fragen gestellt werden. Die Kame-
raden wenden sich an uns mit ihren persénlichen Sorgen und Néten, und
wir sind gern bereit, mit Rat und Tat Abhilfe zu schaffen, wo es méglich ist.
Dazu zunichst grundsitzlich: Es ist sehr erfreulich, daf die #-Leithefte zu
einem wirklichen Band zwischen Front und Heimat geworden sind, und wir
werden alles tun, dieses Band immer fester und inniger zu gestalten. Die
#4-Leithefte sollen nicht etwa nur unterhalten oder belehren, sondern sie
sollen allen #f-Kameraden einen festen Hali bieten in ihrem schweren Kampt
und Bausteine unserer religidsen und politischen Lebensanschauung geben. Es
ist nicht unsere Aufgabe, hicr anf Einzelfragen einzugehen. Diese werden,
wie seither, in unmittelharem Briefwechsel mit den Kameraden erledigt.
Soweit es sich aber um Fragen grundsaizlicher Art handelt, die fiir alle Be-
deutung haben, sollen sie hier besprochen werden. Es tritt zum Beispiel die
Frage anf, ob man sich jetat schon fiir die Osisiedlung bewerben kénne odez
miisse, Nach einer Mitieilung des Reichskommissars fiir die Festigung dent:
schen Volkstums in Berlin solleh Kriegsteiinehmer withrend des Krieges
sich nicht fiir den Osten bewerben. Es wird dafiir Sorge getragen werden,
daB nach dem Kriege cine geniigende Anzahl von Objekten den Kriegsteil-
nehmern zur Verfiigung steht. Andere Kameraden wollen wissen, wie die
Frau daheim, die ein Kind erwartet, eine $f-milige, schéne Geburtsfeier
der Familie vorbereiten kdnue, Dazu sei bemerki, daft das 4f-Hauptamt im
August ein monatlich erscheinendes Heft ,,Die Feier* herausgeben wird, in
dem praktische Anweisungen und Ratschlige fiir die Gestaltung von Feiern
der Sippe (Lebensfeiern) gegeben werden. Das Heft ist durch das /f-Haupt-
amt, Berlin W 35, Liiizowsiralle 48/49, zu beziehen.
Hine grofe Sorge bereitet vielen Kameraden die Beireuung der Frauen der
Kameraden, die auf dem Felde der Ehre geblieben sind. Bei jedem Ober-
abschnitt der #4 befindet sich ein Fiihrer, der sich mit dieser Aufgabe befalit.
Die Kameraden diirfen beruhigt sein, es wird alles getan, daf die Frauen
und Hinterbliebenen der Gefallenen nicht allein stehen. Es ist unsere heilige
Pilicht, die Kameradschaft der #f-Angehérigen in jeder Lebenslage prak-
tisch zu pflegen. Die $f will zeigen, daB sie, dem Willen des Reichs-
fiihrers-#4 entsprechend, nicht ein Mannerbund ist, sondern eine Gemein-
schafi aller Angehérigen, auch der Frauen und Kinder der 4f-Manner. Wir
werden im nichsten Rundbrief auf weitere grundsitzliche Fragen eingehen
und nehmen Anregungen gern entgegen.
Der Schrifleiter der #/-Leithefte
‘
Gudetenland
ein Brickenbogen nach dem Osten
Ds: »béhmischen Wilder” haben den angeblichen Kessel Bohmens" im
Denken unseres Volkes beinahe abgeschlossen, wihrend doch diese
Kette eigenfarbiger Landschafien mit dem gesamideutschen Schaffen aufs
engste verwoben war. Kin Voitersreuth oder Konradseriin, ein Ullersdorf oder
Wiirbental und all die anderen Rodungsdérfer und -stidte haben seit fast
800 Jahren den breiten Waldgiirel am Fufle und an den Flanken des
groflen Gebirgsbogens aufgelockert. Vom hiiringer Wald spannt er sich
mit dem Erzgebirge, Riesengebirge und Alivater bis zu den Karpaten.
Selbst der Buhmerwald, der eigentliche Querriegel innerhalb des von West
nach Ost flutenden deutschen Lebens, ist schon seit der Zeit, da die Hohen-
staufen im Egerland die Landschaften Béhmens mit dem alien Reichsboden
verwoben, auch von der béhmischen Seite her deutsches Siedelland ge-
worden. Bauern und Glasmacher, Bergknappen und Stadtbiirger haben so
neben den vorwiegend tschechiscuen Teilen der Linder einen geschlossenen
deutschen Boden geschaffen, das Sudetenland. Von den sechs alten Stiimmen.
des Reiches haben mindesiens vier hier unmitielbar Menschen eingeseizt.
Zn den reichen Diirfern des Egerlandes waren die Kinschichten des Bdhmer-
waldes wie die Waldhufendérfer an den Gebirgshichen des Erzgebirges
hinzugewachsen und die Berghiuersiedlungen an den Ziun- und Silber-
adern. Das tippige Elbetal und der rote Hopfenboden des Saazer Bedxens
haben den erfindungsreichen Gebirglern in den kargen Talern ostwarts der
Elbe nachbarschaftlich zur Seite siehen kinnen. Die Schénhengster Bauern
auf den grofen Héfen und die selbsthewuften ‘Teftaler haben mit den
Waldbauern und Holzarbeitern rings um den Altvater und im Gesenke zu-
sammengearbeitet, und im Gartenland des Olmiitzer Beccens kam ebenso
wie in der Odersenke und im Kuhliindchen ein gut Teil Bauernlandes in
die deutsche Hand.
Von den ersten deutschen Biirgern Prags, die dem Przemyslidenherzog den
Freibrief abgerungen hatten, wurde das wache Reichsbewulitsein iiber die
dem Reiche ,allzeit getreuen™ Stadte wie das Reichspfand Eger, Briix (unter
den Briidern Gorenz) oder die deutsche Ordensstadt Troppau, an_denen
Hussitenstiirme zerbrachen, weitergegeben. Von den reichshewufiten Herren
von Schlidc auf Elbogen und Joachimsthal fihet die Tradition zu Wallen-
stein, den Herzog von Friedland, der als Generalissimus die Erneuerung des
Reiches auf Kosten des habsburgischen Territorialstaates entwarf, und dafiir
auf Geheift des Hofes von einem englischen Offizier in Eger niedergestolen
wurde. K's war wohl einer der nachhaltigsten Schltige, die dieses Deutsch-
tum trafen, als nach der Schlacht am Weifen Berg Kaiser Ferdinand die
troizig lutherischen Biirger und nahezu den ganzen deutschen Adel des
Landes verwies. Bis zum Sturmjahr 1848 dauerte es nun zwei Jahrhunderte,
da konnten die spanischen, schottischen, welschen, tschechischen und anderen
neuen Grundherren wohl am Wiener Hofe Deutsch lernen, aber nicht
39
Fithrer in dieser Volksgruppe werden; die mufiten in dem Sudetendeutsch-
tum selbst heranwachsen.
Zwei Wesensziige hat dieses Siedlungsland, das da auf halbem Weg nach
dem weiteren deutschen Osten liegt, in seinen Menschen besonders geweckt,
und.weder der ischechische Nachbar noch die wechselnde wirtschafiliche Er-
gicbigkeit des Gebirgshodens haben diese Widerstandskriifte zur Ruhe
kommen lassen. Das eine Mal galt es, nach den hussitischen und anderen
Rebellionen die ganzen béhmischen Linder immer wieder in das Gefiige
des Reiches einzubauen, Handel und Wandel einzurichten. Das andere Mal
galt es, die neu entdeckten Erzadern zu erschlieBen, nach ihrem Versiegen
den Weg in neue Handwerke, vor allem in die Weberei, zu finden und
schlieflich aus den zahllosen Gebirgswebern, aus den Glashiitten und iiber
Heilquellen und Kohlenflizen Industrien und einen Wirischafiskérper auf
zubauen, um das fehlende Brot kaufen zu kénnen. War das Brot nicht im
Lande und im Siidosten der ésterreichischen Monarchie zu finden, dann er-
schlossen sie sich die Weilen der Well, wenn es sein multle, selbsi als
deutsche Musikanten. Die einsamen Waldtiler und selbsthewuftten Klein-
stidte haben ein yollkhaftes Kulturschaffen entwickelt, das vom Reichtum
des Egerliinder Fachwerkhauses bis zum unerschipflichen Volksliederschata
des Kuhlindchens reicht. Die unermiidliche Formenfrende der ,nord-
béhmischen* Glasmacher und der ,,westbéhmischen* Porzellanformer weist
aber ebenso auf jenes schipferische Handwwerkertnm hin, das ans dem
Nebeneinander frinkischen wie schlesischen Wesens gewinnt und aus diesem
Erbgut dem gesamideuischen Schaffen dauernde Werte brachte. Wie ge-
waltig der Finschmelzunasvorgang gewesen ist, der Menschen aus den ver-
schiedenen deutschen Stiimmen auf diesem Boden schon im Mittelalter
geistig gesamtdeutsches Reichsland schaffen lief, daftir ist wohl das Streit-
gespriich des Ackermanns mit dem Tod, das der Egerlinder Magister Jo-
hannes um 1400 als Stadtschreiber in Saaz niederschrieb, die stirkste
Urkunde in der neuhochdeutschen Sprache.
In den Zeiten kulturbewuftter Kaiser auf der Prager Burg waren diese
Candschafien die Bluispender der deutschen Stadtinsel in der tschechischen
Binnensee. Sie bewahrien aber ihre vielfaltigen Bindungen mit den Ganen
des Reiches und damit ihre kulturelle Sonderentwicklung neben der Prager
Hofkultur. Nur so ist zu verstehen, welch bedeutungsvolle Einbruchssiellen
in den schwarz-gelben Grenzmauern die grofen Badeorte der Goethezeit,
Marienbad, Karlsbad und Tepliiz, damals fiir das Hereinfluten der deut-
schen Bewegung wurden. Die letzten hundert Jahre, die seit dem Aus-
marsch der Freikorps aus den bihmiscien Waldern gegen Napoleon ver-
gangen sind, erlebien hier das Aufwachsen des politischen Bildes von der
Volksgemeinschaft zn einem den alten Staatsgedanken sprengenden
Glauben. Wahrend in diesen ,,béhmischen Landschaften“ deutsche Kiinstler
wie C. D. Friedrich und Adalbert Stifter die-Urspriinglichkeit vilkischen
Lebens entdeckten und diese ,,Romantik” dem gesamtdeutschen Volke er-
schlossen, sammelte sich das Sudetendeutschtum politisch und wirischaftlich
zn jener Grenzmark, die inmitten des staatlichen Zerfalles Siidosteuropas
und seiner habsburgischen und’ franzisisch-tschechischen Konstruktionen
einer der unerschiitterlichen Pfeiler fiir das kommende Grofideutsche Reich
wurde, Kurt Oberdorffer
40
Lied dev Gudetendeut(ten
Alls Géer wit Famen
in faatlofe Ydildnis,
es guollen Mie Gdbollen
von unferem Pflug.
Ybir fallten viel Baume,
wit hellten Me Raume,
wit fyufen diefes Zand,
das die Heimat uns teug.
Wir deangen ins Herze
den Bergen um Crze,
wit gruben und huben
viel Reitytum hervor.
Die Fife erlohte,
es ftiegen Me Grylote
nod tibern Wochften Turm
deiner Dome empor.
Aix fthafften und cafften,
vergeffen des Geiftes,
da traf uns, o Here,
deine vichtende Hand!
Yiun fehn dein Gebot wir,
nun danten der FTot wir
und beten nur um eins:
Hever, {hiem unfer Land!
WILHELM PLEYER
OZ ANIAS LAVHOSANVT Yad TIVEdd av
HOSLOA WAG LONVYd OS
NV”
NACIMSad NAG NI UAT aA
Das könnte Ihnen auch gefallen
- SS - Handblätter Für Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 1-5 (Thema 4 Unvollständig, 33 S., Scan, Text) PDFDokument33 SeitenSS - Handblätter Für Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 1-5 (Thema 4 Unvollständig, 33 S., Scan, Text) PDFSA NiemannNoch keine Bewertungen
- Die Dienstdolche Der SA Und Des NSKK PDFDokument338 SeitenDie Dienstdolche Der SA Und Des NSKK PDFstary82% (11)
- SS-Oberabschnitt West - Die Ordensgesetze Der SS (1938, 12 S., Scan, Fraktur)Dokument12 SeitenSS-Oberabschnitt West - Die Ordensgesetze Der SS (1938, 12 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- SS - Rassenkunde Und Richtlinien Zur Gattenwahl (23 S.)Dokument23 SeitenSS - Rassenkunde Und Richtlinien Zur Gattenwahl (23 S.)Jara Mertens40% (5)
- ELEMENTE Zer Metapolitik - Issue 2Dokument52 SeitenELEMENTE Zer Metapolitik - Issue 2wdarreNoch keine Bewertungen
- Stürmer Von Riga: Die Geschichte Eines FreikorpsDokument49 SeitenStürmer Von Riga: Die Geschichte Eines FreikorpsAxisHistoryNoch keine Bewertungen
- Chemie Hilft Siegen / Dr. Walter Schäfer - 1941Dokument67 SeitenChemie Hilft Siegen / Dr. Walter Schäfer - 1941bpsat100% (2)
- Speer Albert Die Neue ReichskanzleiDokument133 SeitenSpeer Albert Die Neue Reichskanzleiklaustrophobie100% (7)
- M.Dv.170 - 3 Merkbuch Über Die Munition Für Die 3,7 CM S.K. C30 in Dopp L C30, Einh L C34 U. Ubts L C39 - 1944Dokument17 SeitenM.Dv.170 - 3 Merkbuch Über Die Munition Für Die 3,7 CM S.K. C30 in Dopp L C30, Einh L C34 U. Ubts L C39 - 1944p colmantNoch keine Bewertungen
- Stark, Fritz - Die 21. SS-Standarte (1933, 140 S., Scan, Fraktur)Dokument140 SeitenStark, Fritz - Die 21. SS-Standarte (1933, 140 S., Scan, Fraktur)jukkilu100% (1)
- SS-Oberabschnitt West - Die Ordensgesetze Der SS (1938, 12 S., Scan, Fraktur)Dokument12 SeitenSS-Oberabschnitt West - Die Ordensgesetze Der SS (1938, 12 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- SS-Hauptamt - SS-Mann Und Blutsfrage (42 Doppels., Scan)Dokument42 SeitenSS-Hauptamt - SS-Mann Und Blutsfrage (42 Doppels., Scan)jukkilu100% (2)
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 03 (1944, 53 S., Scan)Dokument53 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 03 (1944, 53 S., Scan)jukkiluNoch keine Bewertungen
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 06 (1944, 52 S., Scan)Dokument52 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 06 (1944, 52 S., Scan)jukkilu100% (1)
- Himmler, Heinrich - Die Schutzstaffel Als Antibolschewistische Kampforganisation (1937, 33 S., Scan, Fraktur)Dokument33 SeitenHimmler, Heinrich - Die Schutzstaffel Als Antibolschewistische Kampforganisation (1937, 33 S., Scan, Fraktur)greger224Noch keine Bewertungen
- SS-Hauptamt - Rassenpolitik (Um 1943, 97 S., Scan)Dokument97 SeitenSS-Hauptamt - Rassenpolitik (Um 1943, 97 S., Scan)jukkilu100% (3)
- Willrich, Wolfgang - Des Reiches Soldaten (1943, 71 S., Scan, Fraktur)Dokument71 SeitenWillrich, Wolfgang - Des Reiches Soldaten (1943, 71 S., Scan, Fraktur)Patryk Stencel100% (1)
- SS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 11-15 (27 S., Scan)Dokument27 SeitenSS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 11-15 (27 S., Scan)jukkilu100% (2)
- Soldaten Der Leibstandarte SS Adolf Hitler Im KampfDokument19 SeitenSoldaten Der Leibstandarte SS Adolf Hitler Im KampfAxisHistory92% (13)
- D 656-27 Die Tiger-Fibel (1943)Dokument92 SeitenD 656-27 Die Tiger-Fibel (1943)Sven WeißenbergerNoch keine Bewertungen
- Sieg Der Waffen Ist Sieg Des KinderDokument36 SeitenSieg Der Waffen Ist Sieg Des KinderAxisHistory100% (6)
- Semmelroth, Ellen Und Stieda, Renate Von - N.S. Frauenbuch (1934, 287 S., Scan, Fraktur)Dokument287 SeitenSemmelroth, Ellen Und Stieda, Renate Von - N.S. Frauenbuch (1934, 287 S., Scan, Fraktur)jukkilu100% (1)
- Schulungsbriefe 1933 / 4Dokument16 SeitenSchulungsbriefe 1933 / 4AxisHistoryNoch keine Bewertungen
- Deutsch-Russisches Soldatenwörterbuch (1942)Dokument41 SeitenDeutsch-Russisches Soldatenwörterbuch (1942)Sven Weißenberger100% (4)
- SS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 16-20 (Thema 16 Unvollstaendig, 30 S., Scan)Dokument30 SeitenSS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 16-20 (Thema 16 Unvollstaendig, 30 S., Scan)jukkiluNoch keine Bewertungen
- Hoffmann, Heinrich - Des Fuehrers Kampf in Norwegen (1940, 21 Doppels., Scan)Dokument21 SeitenHoffmann, Heinrich - Des Fuehrers Kampf in Norwegen (1940, 21 Doppels., Scan)greger224Noch keine Bewertungen
- Deutsche Polizei Im Osten MagazineDokument23 SeitenDeutsche Polizei Im Osten Magazinedutch2100% (2)
- Guenther, Hans - Kleine Rassenkunde Des Deutschen Volkes (1934, 172 S., Scan, Fraktur)Dokument172 SeitenGuenther, Hans - Kleine Rassenkunde Des Deutschen Volkes (1934, 172 S., Scan, Fraktur)Octopus7507100% (1)
- Historische Tatsachen - Nr. 96 - Siegfried Egel - Geheimnisse Um Heinrich Himmler (2005, 40 S., Scan)Dokument40 SeitenHistorische Tatsachen - Nr. 96 - Siegfried Egel - Geheimnisse Um Heinrich Himmler (2005, 40 S., Scan)Historische_TatsacheNoch keine Bewertungen
- Rosenberg, Alfred - Gestalt Und Leben (1938, 26 S., Scan, Fraktur)Dokument26 SeitenRosenberg, Alfred - Gestalt Und Leben (1938, 26 S., Scan, Fraktur)monotema12Noch keine Bewertungen
- Deutsche Uniformen Album - SA SS HJDokument57 SeitenDeutsche Uniformen Album - SA SS HJAxisHistory78% (9)
- Johann Von Leers: Geschichte Auf Rassischer GrundlageDokument84 SeitenJohann Von Leers: Geschichte Auf Rassischer Grundlagelackner3772Noch keine Bewertungen
- Fundmunition 6 - Achtung Fundmunition ! Lebensgefahr !Dokument9 SeitenFundmunition 6 - Achtung Fundmunition ! Lebensgefahr !bpsat100% (1)
- Schulungsbriefe 1933 / 5Dokument16 SeitenSchulungsbriefe 1933 / 5AxisHistoryNoch keine Bewertungen
- Bartsch, Max - Was Jeder Vom Deutschen U-Boot Wissen Muss (1939, 30 S., Fraktur)Dokument30 SeitenBartsch, Max - Was Jeder Vom Deutschen U-Boot Wissen Muss (1939, 30 S., Fraktur)JagurielNoch keine Bewertungen
- 1000 Worte LuftschutzDokument26 Seiten1000 Worte LuftschutzbpsatNoch keine Bewertungen
- Auswaertiges Amt - Dokumente Polnischer Grausamkeit (1940, 459 S., Scan)Dokument459 SeitenAuswaertiges Amt - Dokumente Polnischer Grausamkeit (1940, 459 S., Scan)abelard1913100% (4)
- Der Adler 1944 5Dokument12 SeitenDer Adler 1944 5AxisHistory100% (4)
- Historische Tatsachen - Nr. 103 - Siegfried Egel - Desinformationsagenten Weiter Aktiv (2008, 40 S., Bild)Dokument40 SeitenHistorische Tatsachen - Nr. 103 - Siegfried Egel - Desinformationsagenten Weiter Aktiv (2008, 40 S., Bild)Historische_TatsacheNoch keine Bewertungen
- Immer Am Feind: Deutsche Luftwaffe Gegen EnglandDokument67 SeitenImmer Am Feind: Deutsche Luftwaffe Gegen EnglandAxisHistory100% (2)
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 2 1944Dokument23 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 2 1944FloridaManNoch keine Bewertungen
- Guenther, Hans - Ritter, Tod Und Teufel, Der Heldische Gedanke (1935, 213 S., Scan-Text, Fraktur)Dokument213 SeitenGuenther, Hans - Ritter, Tod Und Teufel, Der Heldische Gedanke (1935, 213 S., Scan-Text, Fraktur)greger224Noch keine Bewertungen
- Die Taschenlampe - Hubert PatzeltDokument18 SeitenDie Taschenlampe - Hubert PatzeltbpsatNoch keine Bewertungen
- (1936) Das Fuhrerkorps Des Dritten ReichsDokument33 Seiten(1936) Das Fuhrerkorps Des Dritten ReichsHerbert Hillary Booker 2nd100% (3)
- Historische Tatsachen - Nr. 45 - Udo Walendy - Luegen Um Heinrich Himmler - 1. Teil (1991, 40 S., Scan)Dokument40 SeitenHistorische Tatsachen - Nr. 45 - Udo Walendy - Luegen Um Heinrich Himmler - 1. Teil (1991, 40 S., Scan)Historische_TatsacheNoch keine Bewertungen
- Triebe Deutscher Panzer 1935 1945Dokument52 SeitenTriebe Deutscher Panzer 1935 1945Baewoylf100% (2)
- Standarten Und Flaggen Der Deutschen Wehrmacht 1933-1945 PDFDokument162 SeitenStandarten Und Flaggen Der Deutschen Wehrmacht 1933-1945 PDFstary100% (3)
- Liese, Hermann - Ich Kaempfe - Die Pflichten Des Parteigenossen (1943, 99 S., Text)Dokument99 SeitenLiese, Hermann - Ich Kaempfe - Die Pflichten Des Parteigenossen (1943, 99 S., Text)ilsen143100% (1)
- Dokumente Über Die Alleinschuld Englands Am Bombenkrieg Gegen Die Zivilbevölkerung (Hrsg. Auswärtigen Amt) PDFDokument116 SeitenDokumente Über Die Alleinschuld Englands Am Bombenkrieg Gegen Die Zivilbevölkerung (Hrsg. Auswärtigen Amt) PDFraffnix100% (1)
- SS Germanische Leithefte 3. Jahrgang - Hefte 1-2 (1943)Dokument34 SeitenSS Germanische Leithefte 3. Jahrgang - Hefte 1-2 (1943)c108Noch keine Bewertungen
- Hartmann, M. - Jaeger Am Kuban - Ausstellung Einer Oberbayrischen Jaeger Division (1944, 31 S., Scan-Text)Dokument31 SeitenHartmann, M. - Jaeger Am Kuban - Ausstellung Einer Oberbayrischen Jaeger Division (1944, 31 S., Scan-Text)greger224100% (1)
- Schlag Auf SchlagDokument67 SeitenSchlag Auf SchlagAxisHistory100% (2)
- VB-Feldpost - Im Angriff und im Biwak: Soldaten erzählen SoldatengeschichtenVon EverandVB-Feldpost - Im Angriff und im Biwak: Soldaten erzählen SoldatengeschichtenNoch keine Bewertungen
- "Sind wir eigentlich schuldig geworden?": Lebensgeschichtliche Erzählungen von Tiroler Frauen der Bund-Deutscher-Mädel-GenerationVon Everand"Sind wir eigentlich schuldig geworden?": Lebensgeschichtliche Erzählungen von Tiroler Frauen der Bund-Deutscher-Mädel-GenerationNoch keine Bewertungen
- Zwischen Aufbruch und Randale: Der wilde Osten in den Wirren der NachwendezeitVon EverandZwischen Aufbruch und Randale: Der wilde Osten in den Wirren der NachwendezeitNoch keine Bewertungen
- Kriegs-Kultur: Warum wir kämpfen: Die tiefen Wurzeln bewaffneter KonflikteVon EverandKriegs-Kultur: Warum wir kämpfen: Die tiefen Wurzeln bewaffneter KonflikteNoch keine Bewertungen
- Ideologie der Waffen-SS: Ideologische Mobilmachung der Waffen-SS 1942-45Von EverandIdeologie der Waffen-SS: Ideologische Mobilmachung der Waffen-SS 1942-45Noch keine Bewertungen
- Todesacker Normandie - Feuertaufe der SS-Division "Hitlerjugend": Information - Fotos - Roman - Zeitgeschichte Zweiter WeltkriegVon EverandTodesacker Normandie - Feuertaufe der SS-Division "Hitlerjugend": Information - Fotos - Roman - Zeitgeschichte Zweiter WeltkriegNoch keine Bewertungen
- Landsknecht oder idealistischer Trottel?: Als Gebirgsjäger im Gebirgsjäger-Regiment 100 - Teil IIVon EverandLandsknecht oder idealistischer Trottel?: Als Gebirgsjäger im Gebirgsjäger-Regiment 100 - Teil IINoch keine Bewertungen
- Verblüffende Siege: Die größten Überraschungscoups der KriegsgeschichteVon EverandVerblüffende Siege: Die größten Überraschungscoups der KriegsgeschichteNoch keine Bewertungen
- Verschwiegene Opfer der SS. Lebensborn-Kinder erzählen ihr Leben: Im Auftrag des Vereins »Lebensspuren e. V.« herausgegeben von Astrid Eggers und Elke SauerVon EverandVerschwiegene Opfer der SS. Lebensborn-Kinder erzählen ihr Leben: Im Auftrag des Vereins »Lebensspuren e. V.« herausgegeben von Astrid Eggers und Elke SauerHerausgeber Verein »Lebensspuren e. V.«Noch keine Bewertungen
- Simrock, Karl - Gesammelte Werke 05 - Das Nibelungenlied (326 S., Scan, Fraktur)Dokument326 SeitenSimrock, Karl - Gesammelte Werke 05 - Das Nibelungenlied (326 S., Scan, Fraktur)jukkilu100% (1)
- Siemens, Hermann - Grundzuege Der Vererbungslehre, Rassenhygiene Und Bevoelkerungspolitik (1930, 145 S., Scan, Fraktur)Dokument145 SeitenSiemens, Hermann - Grundzuege Der Vererbungslehre, Rassenhygiene Und Bevoelkerungspolitik (1930, 145 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- Siegel, Erich - Die Deutsche Frau Im Rasseerwachen (1934, 44 S., Scan, Fraktur)Dokument44 SeitenSiegel, Erich - Die Deutsche Frau Im Rasseerwachen (1934, 44 S., Scan, Fraktur)Esausegen100% (2)
- Simrock, Karl - Gesammelte Werke 01 - Ausgewaehlte Gedichte (160 S., Scan, Fraktur)Dokument160 SeitenSimrock, Karl - Gesammelte Werke 01 - Ausgewaehlte Gedichte (160 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- Siemens, Hermann - Vererbungslehre - Rassenhygiene Und BevölkerungspolitikDokument105 SeitenSiemens, Hermann - Vererbungslehre - Rassenhygiene Und BevölkerungspolitikEsausegenNoch keine Bewertungen
- Siebarth, Werner - Hitlers Wollen - Nach Kernsaetzen Aus Seinen Schriften Und Reden (1939, 321 S., Scan, Fraktur)Dokument321 SeitenSiebarth, Werner - Hitlers Wollen - Nach Kernsaetzen Aus Seinen Schriften Und Reden (1939, 321 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- Siegel, Erich - Die Deutsche Frau Im Rasseerwachen (1934, 46 S., Scan-Text, Fraktur)Dokument46 SeitenSiegel, Erich - Die Deutsche Frau Im Rasseerwachen (1934, 46 S., Scan-Text, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- Sengstock Und Fassbender Und Roggendorff - Albert Leo Schlageter - Sein Prozess Und Seine Erschiessung (1933, 71 S., Scan, Fraktur)Dokument71 SeitenSengstock Und Fassbender Und Roggendorff - Albert Leo Schlageter - Sein Prozess Und Seine Erschiessung (1933, 71 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- Magie Als Experimentelle NaturwissenschaftDokument267 SeitenMagie Als Experimentelle NaturwissenschaftBenjamin Rüffin100% (1)
- Runenhäuser - Philipp StauffDokument125 SeitenRunenhäuser - Philipp StauffZurück AtlantisNoch keine Bewertungen
- Siber, Paula - Um Das Gewissen Der Deutschen Frau (Um 1931, 14 S., Scan, Fraktur)Dokument14 SeitenSiber, Paula - Um Das Gewissen Der Deutschen Frau (Um 1931, 14 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- Semmelroth, Ellen Und Stieda, Renate Von - N.S. Frauenbuch (1934, 287 S., Scan, Fraktur)Dokument287 SeitenSemmelroth, Ellen Und Stieda, Renate Von - N.S. Frauenbuch (1934, 287 S., Scan, Fraktur)jukkilu100% (1)
- SS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 16-20 (Thema 16 Unvollstaendig, 30 S., Scan)Dokument30 SeitenSS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 16-20 (Thema 16 Unvollstaendig, 30 S., Scan)jukkiluNoch keine Bewertungen
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 03 (1944, 53 S., Scan)Dokument53 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 03 (1944, 53 S., Scan)jukkiluNoch keine Bewertungen
- SS-Hauptamt - SS-Mann Und Blutsfrage (42 Doppels., Scan)Dokument42 SeitenSS-Hauptamt - SS-Mann Und Blutsfrage (42 Doppels., Scan)jukkilu100% (2)
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 06 (1944, 52 S., Scan)Dokument52 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 06 (1944, 52 S., Scan)jukkilu100% (1)
- SS-Hauptamt - Rassenpolitik (Um 1943, 97 S., Scan)Dokument97 SeitenSS-Hauptamt - Rassenpolitik (Um 1943, 97 S., Scan)jukkilu100% (3)
- SS-Hauptamt - Sieg Der Waffen - Sieg Des Kindes (Um 1941, 36 S., Text)Dokument36 SeitenSS-Hauptamt - Sieg Der Waffen - Sieg Des Kindes (Um 1941, 36 S., Text)BibliothequeNatioNoch keine Bewertungen
- SS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 8 - 1944Dokument52 SeitenSS Leitheft - 10. Jahrgang - Heft 8 - 1944Ruffy81Noch keine Bewertungen
- Sponholz, Hans - Danzig - Deine SA (1940, 107 S., Scan, Fraktur)Dokument107 SeitenSponholz, Hans - Danzig - Deine SA (1940, 107 S., Scan, Fraktur)jukkiluNoch keine Bewertungen
- SS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 11-15 (27 S., Scan)Dokument27 SeitenSS - Handblaetter Fuer Die Weltanschauliche Erziehung Der Truppe - Themen 11-15 (27 S., Scan)jukkilu100% (2)