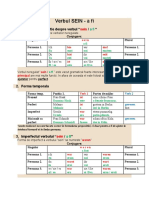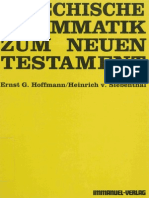Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Guidelines Bachelorthesis
Guidelines Bachelorthesis
Hochgeladen von
Marijana KlasanCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Guidelines Bachelorthesis
Guidelines Bachelorthesis
Hochgeladen von
Marijana KlasanCopyright:
Verfügbare Formate
1
Richtlinien fr das
Verfassen einer Bakkalaureatsarbeit
Die Bakkalaureatsarbeit ist grundstzlich als Einzelarbeit zu verfassen. Sollte eine
Zusammenarbeit von Studierenden erwnscht sein, so ist dies fr die
Grundlagenerarbeitung, Recherche, Analyse etc. zulssig. Die Abgabe erfolgt jedoch in
klar zuordenbaren Einzelarbeiten (wie wir das im Einzelfall ja auch schon besprochen
haben!).
Wesentlicher Bestandteil einer Bakkalaureats-Arbeit ist eine klar ersichtliche eigene
Forschungsleistung. (Damit habt Ihr bei Eurer Aufgabenstellung eh kein Problem gehabt)
UMFANG
ca. 20 Seiten inkl. Abbildungen, d.h. 30.000 - 40.000 Zeichen reiner Text (exkl.
Literatur- und Abbildungsverzeichnisse, Anhnge etc.)
Zustzlich abzugeben ist eine Abstract (1000 bis max. 2000 Zeichen) in deutsch und
englisch sowie ein pdf-Dokument der Arbeit.
AUFBAU
Der Aufbau einer Bakkalaureatsarbeit entspricht weitgehend dem einer Diplomarbeit:
-
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Hauptteil
Schlussfolgerungen
Bibliographie
Abbildungsverzeichnis
ZITIERWEISEN
1. Zitate
Jede wrtlich bernommene Textstelle und jeder bernommene Gedankengang aus einer
fremden Quelle muss in Form einer Anmerkung, d.h. als Fu- oder Endnote, kenntlich
gemacht werden. Die Angabe dieser Quelle muss so exakt sein, dass das Zitat jederzeit
nachprfbar ist.
Wrtliche Zitate werden in Anfhrungszeichen [ ] gesetzt. Zitate innerhalb eines
Zitates werden am Anfang und Ende mit einem Apostroph [ oder > < ] versehen.
Sinngeme Zitate, d.h. die Wiedergabe der Hauptgedanken einer fremden Quelle mit
eigenen Worten, werden nicht durch Anfhrungszeichen gekennzeichnet. Das Ende eines
solchen sinngemen Zitats im Text wird mit einer Anmerkungsnummer (Hochzahl)
versehen, welche in der Fu- oder Endnote angegeben wird.
Jedes wrtliche Zitat muss originalgetreu wiedergegeben werden. Auch inhaltliche oder
orthografische Fehler werden bernommen. Durch ein in eckige Klammern
eingeschlossenes Ausrufezeichen [ ! ] oder [ sic ! ] kennzeichnet der Verfasser, dass es
sich nicht um einen Fehler beim Abschreiben handelt. Hervorhebungen im zitierten Text
werden ebenfalls bernommen.
Jede nderung des Originaltexts muss kenntlich gemacht werden:
- Krzungen werden durch fortlaufende Punkte gekennzeichnet; durch zwei Punkte,
wenn ein Wort, durch drei Punkte, wenn mehr als ein Wort ausgelassen wird.
- Eigene Ergnzungen werden in Klammern gesetzt
- Eigene Hervorhebungen sowie Anmerkungen sind durch den Zusatz [ Herv. d.
Verf.] bzw. [ Anm. d. Verf.: ... ] zu kennzeichnen.
Im Allgemeinen soll ein Zitat nicht mehr als zwei bis drei Stze umfassen. Lngere Zitate
sollten mit eigenen Worten sinngem wiedergegeben werden oder als Ergnzungen im
Anhang angefgt werden.
Grundstzlich wird nach dem Originaltext zitiert. Falls dieser nicht zugnglich ist und aus
einer Sekundrquelle zitiert wird, ist in der Anmerkung neben der Originalquelle die
Sekundrquelle mit dem Vermerk (zitiert nach: ...) anzugeben.
2. Anmerkungen (Fu- oder Endnoten)
Quellenangaben von Zitaten sowie Ergnzungen und Erluterungen zum Text vom
Verfasser selbst werden in Fu- oder Endnoten angefhrt. Funoten werden an das Ende
der jeweiligen Seite, Endnoten an das Ende des Textes gesetzt, wobei Funoten als
benutzerfreundlicher einzustufen und daher den Endnoten vorzuziehen sind. Die
Anmerkungen erfolgen in fortlaufender Nummerierung.
In ihrer vollstndigen Form umfasst eine Literaturangabe in einer Anmerkung immer:
a) bei Bchern einzelner Autoren
Vorname und NAME der Verfasserin / des Verfassers, Titel des Werkes, ggf. Untertitel,
Bandangabe, Reihentitel, Erscheinungsort (gegf. Verlag), Erscheinungsjahr, Seitenzahl,
auf die sich das Zitat bezieht;
Bei mehreren AutorInnen werden diese durch einen Schrgstrich [ / ] getrennt. Falls die
Anzahl der AutorInnen so gro ist, dass nicht alle genannt werden knnen, wird dies
durch den Zusatz ua. (et al.) gekennzeichnet. Ist das angefhrte Buch nicht die
Originalausgabe, so muss die verwendete Auflage durch deren Erscheinungsjahr samt
angefhrter Hochzahl fr die Nummer der Auflage angegeben werden, da andernfalls die
Seitenzahlen fr die Zitate nicht bereinstimmen. (19600/1974)?
b) bei Bchern mit Beitrgen mehrerer Autoren
Vorname und NAME der Verfasserin / des Verfassers, "Titel des Beitrags, ggf. Untertitel",
in: NAME, Vorname des (der) Herausgeber(s) (eher umgekehrt) samt dessen / deren
Kennzeichnung als Herausgeber (Hg.), Titel des Sammelwerkes, ggf. Untertitel, ggf.
Auflage, Bandnummer, Reihentitel u. -nummer, Erscheinungsort (gegf. Verlag),
Erscheinungsjahr, Seitenzahlen des Beitrags, hier: Seitenzahl, auf die sich das Zitat
bezieht;
c) bei Beitrgen aus Zeitschriften
Vorname und NAME der Verfasserin / des Verfassers, "Titel des Aufsatzes, ggf.
Untertitel", in: Titel der Zeitschrift, Jahrgang, Erscheinungsjahr, Heftnummer,
Seitenzahl(en) des Aufsatzes, hier: Seitenzahl, auf die sich das Zitat bezieht;
Beispiele
a) Sigfried GIEDION, Raum, Zeit, Architektur, die Entstehung einer neuen Tradition,
Zrich / Mnchen (Artemis) 1941, 41989, S. 51
b) Otto KAPFINGER, "Glanz des Ornats Glamour der Verpackung", in: KOLLHOFF,
Hans (Hg.), ber Tektonik in der Baukunst, Wiesbaden (Vieweg) 1993, S. 78-97,
hier: S. 81
c) Christian KHN, "Keine Mauern mehr, Helmut Wimmers jngste Wohnbauprojekte:
Die geduldige Suche nach neuen Formen gesellschaftlichen Wohlergehens, in:
Architektur & Bauforum 2/96, Wien 1996, S. 36-54, hier: S. 37
Wiederholungen von Quellenangaben :
In der wissenschaftlichen Literatur sind vor allem bei Wiederholungen der gleichen Quelle
verschiedene Abkrzungen bei den Quellenangaben blich. Die in der Folge genannten
Mglichkeit sind die gngigsten:
Autor, Titel (gegf. gekrzt), Seite:
GIEDION, Raum, Zeit, Architektur ..., S. 51
KAPFINGER, "Glanz des Ornats ...", S. 81
KHN, "Keine Mauern mehr ...", S. 37
Autor, Erscheinungsjahr, Seite
GIEDION, 1941, 51
KAPFINGER, 1993, S. 81
KHN, 1996, 37
3. Literaturverzeichnis :
An das Ende jeder wissenschaftlichen Arbeit gehrt eine Bibliografie. Sie umfasst die in
den Anmerkungen zitierte Literatur sowie darber hinausgehende verwendete Literatur.
Die Autoren werden dabei in alphabetischer Reihenfolge aufgefhrt.
Beispiele
-
GIEDION, Siegfried, Raum, Zeit, Architektur, die Entstehung einer neuen Tradition,
Zrich / Mnchen (Artemis) 1941, 41989
KAPFINGER, Otto, "Glanz des Ornats Glamour der Verpackung", in: KOLLHOFF,
Hans (Hg.), ber Tektonik in der Baukunst, Wiesbaden (Vieweg) 1993, S. 78-97
KHN, Christian, "Keine Mauern mehr, Helmut Wimmers jngste Wohnbauprojekte:
Die geduldige Suche nach neuen Formen gesellschaftlichen Wohlergehens", in:
Architektur & Bauforum 2/96, Wien 1996, S. 36-54
Wenn mehrere Werke des gleichen Autors im Literaturverzeichnis aufgefhrt sind, sollten
diese chronologisch geordnet werden. Der Name des Autors wird dann entweder
wiederum voll ausgeschrieben oder mit dem folgenden Krzel versehen: ders. (dies.), ...
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Hundeherz PDFDokument1 SeiteHundeherz PDFJelenaNoch keine Bewertungen
- Telc b2Dokument1 SeiteTelc b2youssefelfounassi3Noch keine Bewertungen
- Conjugarea Verbelor SEIN-A FiDokument5 SeitenConjugarea Verbelor SEIN-A FiJeny MarsNoch keine Bewertungen
- Grandma's BirthdayDokument32 SeitenGrandma's BirthdayLauraNoch keine Bewertungen
- Handbücher Des Drachen - Rollenspiel-Essays (2017)Dokument178 SeitenHandbücher Des Drachen - Rollenspiel-Essays (2017)Cevyn Jaxon100% (1)
- Ernst G. Hoffmann, Griechische Grammatik Zum Neuen TestamentDokument732 SeitenErnst G. Hoffmann, Griechische Grammatik Zum Neuen TestamentKirsten Simpson100% (2)
- Neo20 AufstellerDokument1 SeiteNeo20 AufstellerjakeinaberNoch keine Bewertungen
- Bharavis Poem Kiratarjuniya Vol XV PDFDokument241 SeitenBharavis Poem Kiratarjuniya Vol XV PDFPSGNoch keine Bewertungen
- DSA - HeldenbriefDokument2 SeitenDSA - HeldenbriefRobert HecklerNoch keine Bewertungen
- Prateritum 3Dokument2 SeitenPrateritum 3Proud93Noch keine Bewertungen
- Der Richter Und Sein HenkerDokument5 SeitenDer Richter Und Sein Henkersleberre53Noch keine Bewertungen
- Te 395 S Tom SawyDokument3 SeitenTe 395 S Tom SawyDEEP725Noch keine Bewertungen
- Verb TabelleDokument3 SeitenVerb TabelleJavier FoNoch keine Bewertungen
- NaturalismusDokument7 SeitenNaturalismusRaluca RunceanuNoch keine Bewertungen
- Starke VerbenDokument3 SeitenStarke Verbenisabellav100% (1)