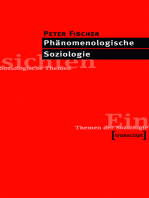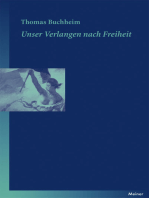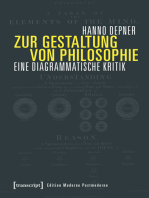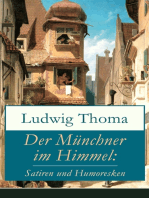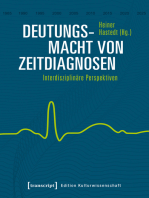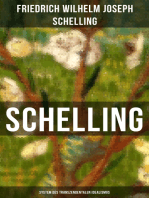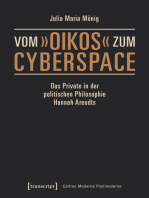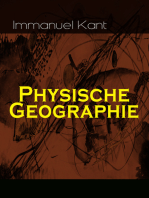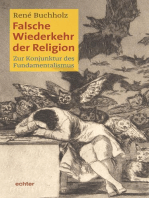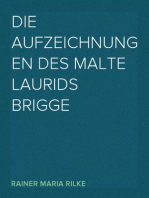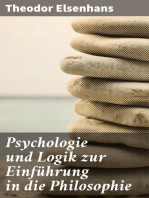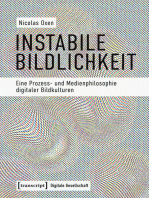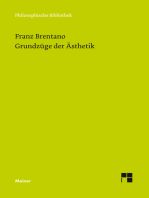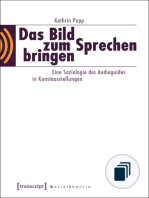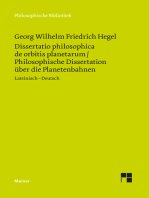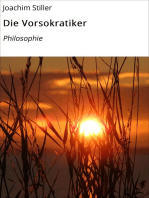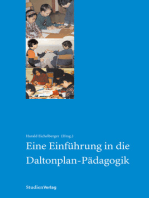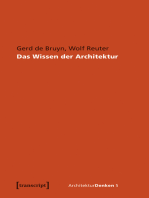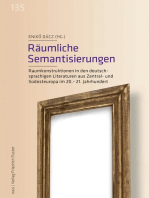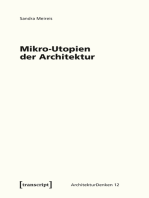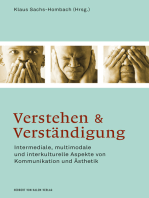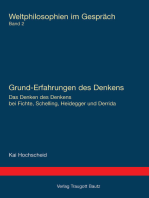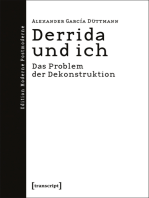Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Otto Neurath - Physikalismus (1931) PDF
Hochgeladen von
For No One0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
155 Ansichten7 SeitenOriginaltitel
Otto Neurath - Physikalismus (1931).pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
155 Ansichten7 SeitenOtto Neurath - Physikalismus (1931) PDF
Hochgeladen von
For No OneCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 7
Neurath, Otto. (1931). Physikalismus. In: Scientia: Rivista di Scienza.
Vol. 50. pp. 297-303.
PHY8IKALI8MUS
Der « Wiener K reis» (Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Phi
lipp Frank, Hans Hahn, Herbert Feigl, Fritz Waismann, Kurt
Gödel, Otto Neurath u. a.) arbeiten einen « logischen E m pi
rismus » aus. Im Anschluss an Mach und Poincarä, vor allem
aber im Anschluss an Russell und Wittgenstein, wird die Gesamt
heit der Wissenschaften einheitlich behandelt. Carnaps « Lo
gischer Aufbau der W elt» zeigt, in welcher Richtung sich die
weitere systematische Arbeit bewegen wird. Wittgensteins
« Tractatus Logico-Philosophicus» klärte unter anderem die
Stellung der Logik und Mathematik: neben die sinnmehrenden
Aussagen treten die « Tautologien », die uns zeigen, welche Um
formungen innerhalb der Sprache möglich sind. Die Sprache
der Wissenschaft schaltet durch ihre Syntax von vornherein alles
sinnleere aus.
Wurde zunächst vom « Wiener Kreis » fast ausschliesslich
« Physik » im engeren Sinne analyisert, so werden nummehr in
wachsendem Umfang Psychologie, Biologie, Soziologie in die
Erörterungen einbezogen. Die Aufgabe dieser Richtung ist die
Einheitsswissenschaft und sonst nichts. Dieser radikale Stand
punkt soll im Folgenden, als Konsequenz der bisherigen E n t
wicklungsrichtung in Umrissen für die gekennzeichnet werden,
welche das Grundsätzliche dieser Bestrebungen kennen.
Alle Mitglieder des«Wiener Kreises » sind sich darüber einig,
dass es eine « P hilosophie» mit besonderen Sätzen nicht gibt.
Manche wollen aber noch die Erörterungen über die begriff
lichen Grundlagen der Wissenschaften von dem Betrieb der Wis
senschaften absondern und als «Philosophieren» weiter belas
sen. Nähere Ueberlegungen zeigen, dass selbst diese Abtren
nung undurchführbar ist und dass der Betrieb der Einheit*-
wissensohaft die Begriffsbestimmung mit umfasst.
Vol. L 2*
298 u SC1ENTIA
9t
Wittgenstein und andere, 'welche nur die wissenschaftli
chen Anssagen als « legitime» zulassen, kennen dennoch auch
«nichtlegitime» Formulierungen als vorbereitende «Erläuterungen »
die man später innerhalb der reinen Wissenschaft nicht mehr
verwenden darf; im Rahmen dieser Erläuterungen wird auch
der Versuch gemacht mit Hilfe gewissennassen vorsprachlicher
Mittel die wissenschaftliche Sprache aufzubauen. Hier findet
sich auch der Versuch die Sprache der Wirklichkeit gegenüber
zustellen; an der Wirklichkeit zu überprüfen, ob die Sprache
verwendbar sei. Manches davon lässt sich in die legitime Sprache
der Wissenschaft übertragen, soweit man z. B . worauf wir später
hinweisen, an die Stelle der Wirklichkeit die Gesamtheit der son
stigen Aussagen setzt mit der eine neue Aussage konfrontiert
wird. Aber vieles von dem, was Wittgenstein und andere von den
Erläuterungen und über die Konfrontierung der Sprache mit
der Wirklichkeit sagen, kann nicht aufrechterhalten werden,
wenn man die Einheitswissenschaft von A nfang an au f der w is
senschaftlichen Sprache auftbaut} die selbst ein physikalisches
Gebilde ist, über dessen Struktur, als physikalische Aneinander
reihung (Ornament) man mit den Mitteln eben derselben Spra
che widerspruchslos sprechen kann.
Versuchen wir nun, die innerhalb der W issenschaften vom
«Wiener Kreis» gestellten Forderungen konsequent durchzu
führen und sie au f alles anzuwenden, w as w ir sprachlich form u
lieren . Wir beginnen mit der wissenschaftlichen Sprache, als
einem physikalischen Gebilde.
« V oraussagen» sind das am und auf aller Wissenschaft.
Von Beobachtungsaussagen wird ausgegangen, die von vornherein
Zeit-und Raummass enthalten, und sei es auch nur in unvoll
kommener Weise. Immer liegen räumlich-zeitliche Formulierun
gen vor, hinter die wir überhaupt nicht zurückgehen können,
ohne sinnleeres zu sagen. « Sagen » selbst ist räumlich-zeitliche
Aneinanderreihung.
Mit Hilfe der Beobachtungsaussagen formulieren wir die
Gesetze9 die im Sinne Schlicks nicht als eigentliche Aussagen auf
zufassen sind, sondern als Anweisungen, um zu Voraussagen,
über Einzelabläufe zu kommen, die man wieder durch Beobach
tungsaussagen überprüfen kann.
Es lässt sich die Lehre von der Sprache durchaus mit der
Lehre von den physikalischen Vorgängen verbinden, man bleibt
immer im gleichen Gebiet. Man kann innerhalb des geschlos
senen Sprachgebietes bleibend alles ausdrücken.
PHYSIKALISMUS 299
So werden immer Aussagen m it Aussagen verglichen, nicht
etwa mit einer « Wirklichkeit», m it«Dingen » wie es bisher auch
der Wiener Kreis tat. Dieses Vorstadium hat gewisse ideali
stische, gewisse realistische Elemente aufgewiesen, die völlig
ausgeschaltet werden können, wenn man zur reinen Einheits
wissenschaft übergeht.
Die « Induktion », die zu Gesetzen führt, beruht auf « Ent
schluss », sie ist nicht ableitbar. Die Versuche die « Induktion »
logisch zu begründen, müssen daher scheitern. Wenn eine
Aussage gemacht wird, wird sie mit der Gesamtheit der vor
handenen Aussagen konfrontiert. Wenn sie mit ihnen überein
stimmt, wird sie ihnen angeschlossen, wenn sie nicht überein
stimmt, wird sie als « unwahr » bezeichnet und fallen gelassen,
oder aber der bisherige Aussagenkomplex der Wissenschaft
abgeändert, so dass die neue Aussage eingegliedert werden
kann; zu letzterem entschliesst man sich meist schwer. Einen
anderen « W ahrheitsbegriff *» kann es fü r die W issenschaft nicht
geben.
Die Gesetze aller Wissenschaften muss man unter Um
ständen miteinander verbinden können, um eine bestimmte
Voraussage machen zu können. Ob ein bestimmtes Haus
abbrennen wird, kann man nur wissen, wenn man das Verhalten
der Baubestandteile, das Verhalten der Menschengruppen, die
vieleicht zum Löschen herbeieilen mit in Rechnung stellen kann.
Die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bilden zu
sammen die « E inkeitsw issensckaft». Der Aufbau der Einheits
wissenschaft mit all ihren Gesetzen ist Aufgabe wissenschaftli
cher Arbeit.
Eine Voraussage können wir durch Beobachtungsaussagen
nur dann kontrollieren, wenn wir angeben, wo und wann die
vorausgesagte Veränderung eintritt. Es ist dabei grundsätz
lich gleichgiltig, wie das im einzelnen durch Aussagen be
stimmt wird. Wichtig ist, dass alle Aussagen, Bestimmun
gen in Bezug auf räumlich-zeitliche Ordnung enthalten, die Ord
nung, welche wir aus der Physik kennen. Dieser Standpunkt
soll daher (vergleiche Neurath, «Empirische Soziologie»), der
Standpunkt des « P hysikalism u s» heissen. Die Einheitswis
senschaft umfasst nur physikalististiche Formulierungen. Das
Schicksal der Physik im engeren Sinne, wird so das Schicksal
aller Wissenschaften, soweit Aussagen über kleinste Teile in
Frage kommen. Für den « Physikalismus » ist wesentlich, dass
300 u SCIBNTIA
99
eine Art der Ordnung allen Gesetzen zugrunde liegt, ob es
sich nun um geologische, chemische oder soziologische Gesetze
handelt.
Der « Wiener K reis» strebt mit besonderem Nachdruck,
im Anschluss an die Logistiker, an Wittgenstein und andere,
durch die « Syntax » den Kähmen der « Einheitswissenschaft»
festzulegen, alles « Sinnleere», das heisst alle Metaphysik schon
durch die sprachliche Formulierung auszuschalten. Es ist ein
Mangel der Sprache, wenn sie etwa einen « Nachbar ohne Nach
bar »sprachlich zulässt, einen« Befehl ohne Befehlsgeber» (« K a
tegorischer Im perativ»). Die Mängel der Syntax lassen den
Stand der wissenschaftlichen Forschung erkennen. Eine ein
wandfreie Syntax ist Grundlage einer einwandfreien Einheits
wissenschaft. Die Sprache ist für die Wissenschaft wesentlich,
innerhalb der Sprache spielen sich alle Umformungen der Wis
senschaft ab, nicht durch Gegenüberstellung der Sprache und
einer « W e lt», einer Gesamtheit von « Dingen », deren Manig-
faltigkeit die Sprache abbilden soll. Das versuchen wäre Me
taphysik. D ie eine w issenschaftliebe Sprache kann über steh
selbst sprechen, ein T eil der Sprache über den anderen; hinter
die Sprache kann man nicht zurück.
Das entspricht auch durchaus der « behavioristischen»
Grundhaltung der « Einheitswissenschaft». Das Sprechdenken,
als physikalischer Vorgang ist der Ausgangspunkt aller Wissen
schaft. Man kann zwar sprechen über das Verhalten eines
Nichtsprechenden, man kann aber nicht durch vorsprachliche
Mittel über einen Vorsprachlichen Zustand sprechen. Das
erscheint für uns sofort als etwas Sinnleeres.
Beim Versuch ein Konstitutionssystem zu schaffen, hat
Carnap, der bisher die Arbeiten des Wiener Kreises wohl am
weitesten in der Richtung des Empirismus vorwärts geführt hat,
zwei Sprachen unterschieden, eine «monologisierende)» (phä
nomenale ») Sprache und eine « intersubjektive », («physikali
sche »). E r sucht die physikalische aus der phänomenalen ab
zuleiten. Meiner Ansicht nach lässt sich aber zeigen, dass diese
Teilung nicht durchführbar ist, dass vielmehr nur eine Sprache
von vornherein in F rage kommt, nämlich die physikalische. Man
kann von Kindesbeinen an die physikalische Sprache lernen.
Wenn jemand eine Voraussage macht, die er selbst kontrollieren
will, muss er mit Aenderungen seines Sinnesystems rechnen,
muss er Uhren und Masstäbe anwenden, kurzum, auch der iso
PHYSIKALISM U8 301
liert gedachte Mensch bedient sich bereits der « intersensualen »
und «intersubjektiven » Sprache. Der Voraussagende von Ge
stern und der Kontrollierende von Heute sind gewissennassen
zwei Personen.
Die Worte « blau » oder « h a rt» oder « kreischend » werden
dann eben nur physikalisch verwendet. Sie deuten entweder
an, dass ein Mensch unter bestimmten Bedingungen bestimmtes
Verhalten zeigt, dass er Worte spricht oder NervenVerände
rungen aufweist («Feldaussagen ») so wie etwa ein Probekörper
in der Nähe einer irgendwie geladenen Kugel, oder sie deuten an,
dass irgendwo eine bestimmte Schwingung gegeben ist. Wenn
jemand sagt: « Ich sehe blau », so wird diese Aussage als « Wir
klichkeitsaussage » eingeordnet, wenn man auch ausserhalb des
Menschen räumlich-zeitliche Veränderungen durch diese Aus
sage als gegeben ansieht, oder als « Halluzinationsaussage»
wenn nur bestimmte Veränderungen innerhalb des menschlichen
Körpers angenommen werden, die bestimmte Wahrnehmungs
bereiche des Gehirns betreffen, gleichgiltig, wie man sie im ein
zelnen abgrenzt. Schliesslich kann man auch von einer « Lüge »
sprechen, wenn nämlich nur das Sprechzentrum und die Wort
bildung an dieser Aussage beteiligt sind. Immer aber handelt
es sich um physikalistische Aussagen.
Auch die Aussagen selbst treten als 'physikalistische Elemente
in anderen Aussagen auf. Eine Gegenüberstellung von « Aus
sagen » und anderen Gebilden ist, wie schon erwähnt, sinnleer.
Wenn jemand sagt,« Ich sehe blau »so bauen wir damit Aussagen
über seine Augennervenveränderungon, über seine Gehirnver
änderungen auf, aber auch, wenn er sagt: «Ich fühle Zorn ».
Die Aussagen über «Organempfindungen» die dabei neben Aus
sagen über sonstiges Verhalten eine wesentliche Rolle spielen,
werden dann zum Aufbau des physikalistischen Aussagensy
stems mit herangezogen. Der « Behaviorism us » im weitesten
Sinne (um alle physikalistischen Aussagen über menschli
ches Verhalten zusammenzufassen) bedient sich der Aussagen
über Organempfindnungen genau so wie der Aussagen über Sin
nesempfindungen. Das ist eine Erweiterung z. B. gegenüber
('arnaps Ausführungen, der bisher die «Aussagen über Gefühle
(Zorn usw.)» nur als Aussagen behavioristisch verwertete. Der
Satz « Ich fühle Zorn» ist nur unbestimmter, als der Satz, « Ich
sehe blau », aber ebenso als «Wirklichkeitsaussage » verwertbar.
Die « E inheiisw i*senschaft» auf dem Boden des « P hysika-
302 u 6CZENTIA
99
lism u s» kennt nur Aussagen mit räumlich-zeitlichen Bestim
mungen. oAequivalente A ussagen» werden physikalistisch einge
baut; denn Aussagen, sind physikalistische Gebilde, geschriebene
oder gesprochene Worte. Wenn einem Befehl: «Tu dies, wenn der
Tisch rot i s t » die Aussage beigefügt wird: « Der Tisch ist r o t »,
so geschieht etwas Bestimmtes. Dasselbe geschieht, wenn etwa
gesagt würde « Mensa est rubra ». Die beiden Formulierungen
wären physikalistisch aequivalent. Hingegen bringen « Tau-
tölogieen» kein Sinnmehrung. Dass «2 mal 2 gleich 4 is t »,
gilt eben immer. Die Hinzufügung dieser Bedingung zu einem
Befehl oder einer Aussage ändert nichts, sie ist immer erfüllt.
Im Bahmen des Physikalismus, wird die « Psychologie» zu
einem System des Behaviorismus im weitesten Sinne. Auch
die Soziologie muss in physikalistischer Sprache als « Sozial
behaviorismus » formuliert werden. Es kann nicht von « Normen
an sich » gesprochen werden, nicht von « W erten», von « We
senheiten », nur von Menschen, Dingen und ihren Korrelationen.
Es gibt nur eine Art von Wissenschaften, die Trennung in « Na
turwissenschaften » und « Geisteswissenschaften», die ausser
halb Deutschland ohnehin eine geringe Bolle spielt ist im Bah
men der Einheitswissenschaft durch keine praktischen oder
theoretischen Erwägungen veranlasst. Diese Treunung wird
meist von metaphysicher Seite gefordert.
Da es keine Philosophie mit sinnvollen Sätzen gibt, gibt
es erst recht keine «Naturphilosophie» oder «Kulturphiloso
phie », das sind Zweiteilungen, die aus theologischer und idea
listischer Quelle stammen. Der « Physikalismus » ist durchaus
monistisch und steht der idealistischen Philosophie fremd gegen
über, zu der auch die Phänomenologie zählt.
Verwandte Bestrebungen finden wir in Berlin (Beichenbach,
Dubislav, Greiling u. a.) in Paris und in Warschau. In Berlin
beschäftigt man sich weniger mit der Einheitswissenschaft, als
mit gewissen Grundlagenfragen der Physik und Mathematik im
engeren Sinne, während in Warschau vor allem Logik und Me
talogik, sowie Grundlagenfragen der Mathematik behandelt
werden. In Paris wird der « Rationalismus » von einem Kreise
entschlossener Antimetaphysiker in ähnlichem Sinne gepflegt.
Der Standpunkt des « Wiener Kreises » wird in Aufsätzen
der Zeitschrift « Erkenntnis» vertreten, in den « Veröffentli
chungen des Vereins Ernst Mach-Wien » sowie in den « Schrif
ten zur wissenschaftlichen Weltauffassung» die von Schlick
PHYSIKALISMUS 303
und Frank herausgegeben werden. Es veröffentlichen in dieser
Sammlung: Waismann, Carnap, Mises, Schlick, Frank. Vom
Verfasser dieses Artikels erschien eine « Em pirische Soziologie»,
als behavioristische Soziologie im Bahmen des Physikalismus.
Wenn man von der weiteren Entwicklung des « Physikalis
mus » sprechen will, so kann man wohl erwarten, dass der Ver
such, den Carnap im ((Logischen Aufbau der Welt» unternommen
hat, wiederholt wird, um die Syntax für die Einheitswissenschaft
im Sinne des hier dargestellten Physikalismus zu schaffen. Die
Arbeit an der Einheitswissenschaft tritt an die Stelle aller bishe
rigen Philosophie. Es steht nunmehr die « W issenschaft ohne
W eltanschauung» den «Weltanschauungen »aller Art gegenüber,
den « Philosophieen » aller Art. Der Physikalismus ist die Form
in der unser Zeitalter Einheitswissenschaft betreibt. Was sonst
an Aussagen gemacht wird, ist entweder «sinnleer» oder nur Mit
tel der Emotion: «L y rik ». Für den Physikalism us wie er hier
ganz streng vertreten wird, ist alles, was an Philosophie der
Scholastiker, der Kantianer, der Phänomenologen vorliegt sinn
leer, soweit nicht ein Teil ihrer Formulierungen in wissenschaft
liche, das heisst physikalistische Aussagen übersetzt werden
kann.
W ien.
Otto Neurath
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Wittgenstein als politischer Philosoph: Wittgensteins Philosophie als Grundlage für eine politische PhilosophieVon EverandWittgenstein als politischer Philosoph: Wittgensteins Philosophie als Grundlage für eine politische PhilosophieNoch keine Bewertungen
- Unser Verlangen nach Freiheit: Kein Traum, sondern Drama mit ZukunftVon EverandUnser Verlangen nach Freiheit: Kein Traum, sondern Drama mit ZukunftNoch keine Bewertungen
- Tetens (2013) - Der Naturalismus - Das Metaphysische Vorurteil Unserer ZeitDokument5 SeitenTetens (2013) - Der Naturalismus - Das Metaphysische Vorurteil Unserer Zeitexddidrl2768Noch keine Bewertungen
- Süsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlDokument12 SeitenSüsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlGuacamole Bamako ShivaNoch keine Bewertungen
- 1933 BINSWANGER Das Raumproblem in Der PsychopathologieDokument50 Seiten1933 BINSWANGER Das Raumproblem in Der PsychopathologieSirro's Saymons100% (1)
- Kannetzky Methode Und Systematik Der PhilosophieDokument38 SeitenKannetzky Methode Und Systematik Der PhilosophieJohn O'sheaNoch keine Bewertungen
- Von Dilthey zu Levinas Wege im Zwischenbereich von Lebensphilosophie, Neukantianismus und PhänomenologieVon EverandVon Dilthey zu Levinas Wege im Zwischenbereich von Lebensphilosophie, Neukantianismus und PhänomenologieNoch keine Bewertungen
- Zur Gestaltung von Philosophie: Eine diagrammatische KritikVon EverandZur Gestaltung von Philosophie: Eine diagrammatische KritikNoch keine Bewertungen
- Überleben des Phänomens im Symbolischen: Studien zur sprachphänomenologischen KulturwissenschaftVon EverandÜberleben des Phänomens im Symbolischen: Studien zur sprachphänomenologischen KulturwissenschaftNoch keine Bewertungen
- Transzendentale Archäologie - Ontologie - Metaphysik: Methodologische Alternativen in der phänomenologischen Philosophie HusserlsVon EverandTranszendentale Archäologie - Ontologie - Metaphysik: Methodologische Alternativen in der phänomenologischen Philosophie HusserlsGeorgy ChernavinNoch keine Bewertungen
- Was ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeVon EverandWas ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeNoch keine Bewertungen
- Der Münchner im Himmel: Satiren und Humoresken: Ein Klassiker der bayerischen Literatur gewürzt mit Humor und Satire (Käsebiers Italienreise + Assessor Karlchen + Der Postsekretär im Himmel + Sherlock Holmes in München und viel mehr)Von EverandDer Münchner im Himmel: Satiren und Humoresken: Ein Klassiker der bayerischen Literatur gewürzt mit Humor und Satire (Käsebiers Italienreise + Assessor Karlchen + Der Postsekretär im Himmel + Sherlock Holmes in München und viel mehr)Noch keine Bewertungen
- Demokrit und der blaue Planet: Es gibt nur Leere und Atome, alles andere ist MeinungVon EverandDemokrit und der blaue Planet: Es gibt nur Leere und Atome, alles andere ist MeinungNoch keine Bewertungen
- Deutungsmacht von Zeitdiagnosen: Interdisziplinäre PerspektivenVon EverandDeutungsmacht von Zeitdiagnosen: Interdisziplinäre PerspektivenNoch keine Bewertungen
- Technik.Kapital.Medium: Das Universale und die FreiheitVon EverandTechnik.Kapital.Medium: Das Universale und die FreiheitNoch keine Bewertungen
- SCHELLING - System des transzendentalen Idealismus: Schlüsselwerk des Deutschen Idealismus: System der theoretischen Philosophie nach Grundsätzen des transzendentalen IdealismusVon EverandSCHELLING - System des transzendentalen Idealismus: Schlüsselwerk des Deutschen Idealismus: System der theoretischen Philosophie nach Grundsätzen des transzendentalen IdealismusNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Schriften zur Geschichte der Philosophie: Vorsokratische Philosophie + Sokrates + Platon + Aristoteles + Stoiker + Neuplatoniker + Gnostiker + Skotus Erigena + Die Scholastik + Bako von Verulam + Erläuterungen zur Kantischen Philosophie...Von EverandGesammelte Schriften zur Geschichte der Philosophie: Vorsokratische Philosophie + Sokrates + Platon + Aristoteles + Stoiker + Neuplatoniker + Gnostiker + Skotus Erigena + Die Scholastik + Bako von Verulam + Erläuterungen zur Kantischen Philosophie...Noch keine Bewertungen
- Vom »oikos« zum Cyberspace: Das Private in der politischen Philosophie Hannah ArendtsVon EverandVom »oikos« zum Cyberspace: Das Private in der politischen Philosophie Hannah ArendtsNoch keine Bewertungen
- Physische Geographie: Mathematische Vorkenntnisse und die allgemeine Beschreibung der Meere und des LandesVon EverandPhysische Geographie: Mathematische Vorkenntnisse und die allgemeine Beschreibung der Meere und des LandesNoch keine Bewertungen
- M.edium F.oucault: Weimarer Vorlesungen über Archive, Archäologie, Monumente und MedienVon EverandM.edium F.oucault: Weimarer Vorlesungen über Archive, Archäologie, Monumente und MedienNoch keine Bewertungen
- Material turn: Feministische Perspektiven auf Materialität und MaterialismusVon EverandMaterial turn: Feministische Perspektiven auf Materialität und MaterialismusNoch keine Bewertungen
- Ordo: Philosophisch-historische Grundlegung einer abendländischen IdeeVon EverandOrdo: Philosophisch-historische Grundlegung einer abendländischen IdeeNoch keine Bewertungen
- Im Labyrinth des Kolosseums: Das größte Amphitheater der Welt auf dem PrüfstandVon EverandIm Labyrinth des Kolosseums: Das größte Amphitheater der Welt auf dem PrüfstandNoch keine Bewertungen
- Falsche Wiederkehr der Religion: Zur Konjunktur des FundamentalismusVon EverandFalsche Wiederkehr der Religion: Zur Konjunktur des FundamentalismusNoch keine Bewertungen
- Die Aufzeichnungen des Malte Laurids BriggeVon EverandDie Aufzeichnungen des Malte Laurids BriggeBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (314)
- Psychologie und Logik zur Einführung in die PhilosophieVon EverandPsychologie und Logik zur Einführung in die PhilosophieNoch keine Bewertungen
- Karl Jasper: Einführung in die Philosophie: Eine BuchbesprechungVon EverandKarl Jasper: Einführung in die Philosophie: Eine BuchbesprechungNoch keine Bewertungen
- Instabile Bildlichkeit: Eine Prozess- und Medienphilosophie digitaler BildkulturenVon EverandInstabile Bildlichkeit: Eine Prozess- und Medienphilosophie digitaler BildkulturenNoch keine Bewertungen
- Buch über die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache: Erstes Buch. Zweisprachige AusgabeVon EverandBuch über die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache: Erstes Buch. Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Aristoteles' Bestimmung der Substanz als logosVon EverandAristoteles' Bestimmung der Substanz als logosNoch keine Bewertungen
- Dissertatio philosophica de orbitis planetarum. Philosophische Dissertation über die PlanetenbahnenVon EverandDissertatio philosophica de orbitis planetarum. Philosophische Dissertation über die PlanetenbahnenNoch keine Bewertungen
- Die Metaphysik der Sitten: Moralphilosophie: Rechts- und TugendlehreVon EverandDie Metaphysik der Sitten: Moralphilosophie: Rechts- und TugendlehreNoch keine Bewertungen
- Der Ursprung des neuzeitlichen Zahlensystems: Entstehung und VerbreitungVon EverandDer Ursprung des neuzeitlichen Zahlensystems: Entstehung und VerbreitungNoch keine Bewertungen
- Die Prinzipien der Philosophie: Zweisprachige AusgabeVon EverandDie Prinzipien der Philosophie: Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Das Wissen der Architektur: Vom geschlossenen Kreis zum offenen NetzVon EverandDas Wissen der Architektur: Vom geschlossenen Kreis zum offenen NetzNoch keine Bewertungen
- Räumliche Semantisierungen: Raumkonstruktionen in den deutschsprachigen Literaturen aus Zentral- und Südosteuropa im 20.–21. JahrhundertVon EverandRäumliche Semantisierungen: Raumkonstruktionen in den deutschsprachigen Literaturen aus Zentral- und Südosteuropa im 20.–21. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Physik und Bewusstsein: Ein Ansatz zur subjektiven Erkenntnis der WirklichkeitVon EverandPhysik und Bewusstsein: Ein Ansatz zur subjektiven Erkenntnis der WirklichkeitNoch keine Bewertungen
- Hegels "Logik" als Höhepunkt und Ende der klassischen PhilosophieVon EverandHegels "Logik" als Höhepunkt und Ende der klassischen PhilosophieNoch keine Bewertungen
- Mikro-Utopien der Architektur: Das utopische Moment architektonischer MinimaltechnikenVon EverandMikro-Utopien der Architektur: Das utopische Moment architektonischer MinimaltechnikenNoch keine Bewertungen
- Verstehen und Verständigung: Intermediale, multimodale und interkulturelle Aspekte von Kommunikation und ÄsthetikVon EverandVerstehen und Verständigung: Intermediale, multimodale und interkulturelle Aspekte von Kommunikation und ÄsthetikNoch keine Bewertungen
- Grund-Erfahrungen des Denkens: Das Denken des Denkens bei Fichte, Schelling, Heidegger und DerridaVon EverandGrund-Erfahrungen des Denkens: Das Denken des Denkens bei Fichte, Schelling, Heidegger und DerridaNoch keine Bewertungen
- Derrida und ich: Das Problem der DekonstruktionVon EverandDerrida und ich: Das Problem der DekonstruktionNoch keine Bewertungen
- Ierna Mathesis PDFDokument17 SeitenIerna Mathesis PDFJuan Carlos Martínez TrujilloNoch keine Bewertungen
- Varuna Holzapfel - Das HexeneinmaleinsDokument91 SeitenVaruna Holzapfel - Das HexeneinmaleinsKatherine Captive100% (1)
- Franz Brentano - Die Psychologie AristotelesDokument266 SeitenFranz Brentano - Die Psychologie AristotelesAlin M-escuNoch keine Bewertungen
- Denu 1Dokument48 SeitenDenu 1Liam TracyNoch keine Bewertungen
- Die Grundlagen Des OrganisierensDokument46 SeitenDie Grundlagen Des OrganisierensOfficial Church of ScientologyNoch keine Bewertungen
- (Grundthemen Der Literaturwissenschaft) de Gruyter (2018) PDFDokument670 Seiten(Grundthemen Der Literaturwissenschaft) de Gruyter (2018) PDFAndrea MarchettiNoch keine Bewertungen
- Strahlenfolter Stalking - TI - Psiprofiler - Leben in Einer Geheimdienstdiktatur - Geheimdienst - SatanismusDokument50 SeitenStrahlenfolter Stalking - TI - Psiprofiler - Leben in Einer Geheimdienstdiktatur - Geheimdienst - SatanismusX_Test123Noch keine Bewertungen
- Farbe Im KinoDokument39 SeitenFarbe Im KinopepapepicNoch keine Bewertungen