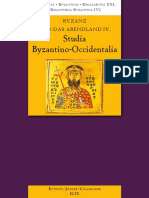Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Portmann Text Kom Pete NZ
Hochgeladen von
abdelhakgOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Portmann Text Kom Pete NZ
Hochgeladen von
abdelhakgCopyright:
Verfügbare Formate
Zürich, 25. 10. 2005 P. R.
Portmann-Tselikas 1
Was ist Textkompetenz?
Paul R. Portmann-Tselikas
1 Einleitung: Über Textkompetenz reden
2 Literate Praxis im Unterricht
3 Kompetentes Handeln mit Texten: repräsentationelle Redeskriptionen und mentale Modelle
4 Die soziokulturelle Dimension
5 Barrieren und Brücken
6 Zum Abschluss
1 Einleitung: Über Textkompetenz reden
Versucht man zu verstehen, was literates Handeln ausmacht, stößt man früher oder später auf die
Frage nach dem, was Menschen dafür können und wissen müssen. Ich nenne diese individuelle
Voraussetzung literaten Handelns ‘Textkompetenz’. Es gibt zwei Wege, die Frage zu
beantworten, was Textkompetenz ist:
1) Man geht neutral-deskriptiv vor und versucht zu beschreiben, wie Lesende oder Schreibende in
unterschiedlichen Schichten und Kulturen mit Texten umgehen. Ziel ist herauszufinden, welche
Rolle Literalität für sie in ihrem Leben spielt, wie sie sie in Szene setzen, welche Kompetenzen sie
dabei ins Spiel bringen (vgl. Baynham 1995, Street 1995).
2) Man setzt – emphatisch heraushebend - einen Begriff von Literalität und Textkompetenz als
kulturellen Standard, der angibt, was gute Texte sind und was kompetenter Umgang mit Texten
ist. Ein solch emphatischer Begriff bestimmt den Maßstab, den idealerweise bestimmte Gruppen
oder sogar alle Mitglieder der Gesellschaft ihrem literaten Handeln zugrunde legen sollten, und gibt
den Punkt vor, von dem her Texte und die Formen des Umgangs mit ihnen beurteilt werden. Das
Erreichen des Ziels (und das Erreichen von Zwischenzielen auf dem Weg dazu) stellt einen hohen
Wert dar und wird mit positiven Attributen belegt (vgl. explizit, wenn auch sehr allgemein Olson
1994, eher implizit, aber um einiges spezifischer, Hatch 1994, vgl. Hasan/Williams 1996).
Ich gehe davon aus, dass die Diskussion über Lesen und Schreiben in unserem Schulsystem immer
mit einem emphatischen Begriff der Textkompetenz assoziiert ist. Dies ist u.a. daran ersichtlich,
dass in Bezug darauf Curricula vorliegen, Unterrichtsziele definiert sind usw. Ich nehme auch an
(und dies ist zunächst eine Hypothese, für die allerdings einiges an Evidenz aufweisbar ist), dass
das gesamte Bewertungssystem in unseren Bildungseinrichtungen so geeicht ist, dass SchülerInnen
mit hoher Textkompetenz eine größere Chance für einen guten Abschluss besitzen und es leichter
haben, in weiterführende Bildungsgänge zu kommen als die anderen. Textkompetenz ist, wenn
diese Annahmen stimmt, in unserem Bildungssystem eine der zentralen Ressourcen für Erfolg.
Textkompetenz in diesem Sinne lässt sich in einer ersten Annäherung folgenderweise
charakterisieren:
Textkompetenz ermöglicht es, Texte selbständig zu lesen, das Gelesene mit den eigenen
Kenntnissen in Beziehung zu setzen und die dabei gewonnenen Informationen und
Erkenntnisse für das weitere Denken, Sprechen und Handeln zu nutzen. Textkompetenz
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 2
schließt die Fähigkeit ein, Texte für andere herzustellen und damit Gedanken, Wertungen und
Absichten verständlich und adäquat mitzuteilen.1
In dieser Beschreibung stecken, trotz ihrer Simplizität, einige wesentliche Vorentscheidungen
sowohl konzeptueller wie auch (sozio)kultureller Art.
• Textkompetenz wird hier durch die Namengebung abgehoben von Sprachkompetenz und nicht
mit dieser gleichzusetzen. Damit ist eine nicht unwichtige Differenzierung angedeutet.
Textkompetenz ist demnach zunächst die Fähigkeit, auf bestimmte Weise mit Sprache
umzugehen. Allerdings kann man bei dieser Feststellung nicht stehen bleiben. Die Tatsache,
dass Sprache, wie sie in Texten gebraucht wird, sich von der prototypischen mündlichen
Sprache unterscheidet, dass sich in der Tradition des Schreibens eine spezifische
Schriftsprache mit ihren lexikalischen, idiomatischen, syntaktischen und pragmatischen
Prägungen herausgebildet hat, zeigt, dass kompetenter Umgang mit Texten eine Vielzahl
spezifischer sprachlicher Kenntnisse voraussetzt.2 In diesem Sinne ist ausgereifte
Textkompetenz ohne eine entsprechende Erweiterung der zugrundeliegenden, dialogisch
konstituierten und auf Alltagskommunikation ausgerichteten Sprachkompetenz kaum zu
haben. Textkompetenz ist verbunden mit und wohl auch angewiesen auf eine entsprechend
ausgeformte Sprachkompetenz.
• Des weiteren wird Textkompetenz in dieser Charakterisierung prototypisch mit dem
schriftlichen Bereich, dem Umgang mit Texten verbunden. Der Hinweis auf das Denken,
Sprechen und Handeln zeigt aber, dass die Kompetenz, die ganz prototypisch in der
Beschäftigung an und mit Texten gefordert ist, Implikationen hat, die weit über diesen Bereich
hinausgehen. Ich kann diese Aspekte hier nur ansprechen und werde darauf im Folgenden bloß
in einzelnen Bemerkungen zurückkommen.
• Die Charakterisierung ist leichter auf Sachtexte beziehbar ist als auf literarische. An Sachtexten
und ihrem Verständnis entscheidet sich wesentlich das schulische Schicksal von Lernenden,
und an ihnen lässt sich vielleicht deutlicher die Notwendigkeit von Informationsverarbeitung
und Informationstransfer zeigen als an literarischen Texten. Damit möchte ich aber auf keinen
Fall ein Urteil über die mögliche Rolle literarischer Texte für die Ausbildung von
Textkompetenz vorwegnehmen. Diese Rolle scheint mir heute eher unterschätzt zu werden.
• Wesentlich ist schließlich der Hinweis auf die Eigenständigkeit der Lernenden beim Transfer
von Einsichten in die Sphären des Denkens, Sprechens und Handelns wie auch bei der
‘verständlichen und adäquaten’ Formulierung von Gedanken in der eigenen Produktion. Mit
diesem Hinweis ist ein ‘ideologisches’ Moment ins Spiel gebracht, ein ganzer Pool von
Normen, Werten und Ansprüchen. Meine Formulierung hier unterscheidet sich nur der Diktion
nach von Forderungen, wie sie in Lehrplänen bezüglich kritischem Lesen, Kreativität,
Autonomie, Einsicht in Textsortenspezifik, Fähigkeit zur Gestaltung von Texten etc.
vorgebracht werden, und zwar – und dies ist entscheidend – immer bezogen darauf, dass jede
einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler dazu imstande sein sollte.
1
Diese Formulierung ist eine leicht veränderte Version einer früheren Bestimmung (Portmann-Tselikas 2002, 14).
Sie dient der Vorverständigung und ist keine Definition. ‘Textkompetenz’ mit Termini wie ‘Text’ und ‘Fähigkeit’ zu
definieren ist zirkulär und bringt einen begrifflich nicht weiter.
2
Vgl. dazu etwa die Studien von Giesecke über die Veränderungen von Sprache, Sprechweisen und
Darstellungskonventionen, wie sie sich im Gefolge des Buchdrucks herausgebildet haben.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 3
Über Textkompetenz reden, so das Fazit dieser ersten Überlegungen, ist kein einfaches
Unterfangen. Die Begriffe und Konzepte, die wir aufbieten, um über Texte und unseren Umgang
mit ihnen zu sprechen, sind beladen mit Vorannahmen, Vorentscheidungen und Vorurteilen.
Interessanter, als sich auf (wohl nur scheinbar) neutrales Terrain zu begeben, ist es, diese Sachlage
zu thematisieren. Die Welt der Texte, wie wir sie uns imaginieren, und die Vorstellungen, die wir
uns über unser Handeln in dieser Welt machen, sind durch und durch soziokulturell geprägt.
Textkompetenz ‘besteht’ nicht einfach; sie ist kein in irgendeinem relevanten Sinne natürlicher
Zustand. Schon die unscheinbare Charakterisierung von Textkompetenz, wie ich sie gegeben habe,
ist (allein schon durch ihren Anspruch auf eine gewisse allgemeine Gültigkeit) unheilbar infiziert
mit folgenreichen Festlegungen. Diese sind, dies ist das Entscheidende, weder ‘richtig’ noch
‘falsch’ – sie beziehen ihre Kraft aus ihrer durch Tradition und Schulung erzeugten
Selbstverständlichkeit, aus ihrem Bezug zu anerkannten Praktiken des Umgangs mit Texten. Diese
prägenden literaten Praktiken (zumindest, soweit sie die Schule betreffen), sind das Thema des
nächsten Abschnitts.
2 Literate Praxis im Unterricht
Was Textkompetenz ist, lernt man anhand von Texten, die von kompetenten Leuten geschrieben
worden sind – und man lernt es aus der Art und Weise, wie der Umgang mit diesen Texten in
Alltag und Schule inszeniert wird. Die soziale Praxis des Lesens, Redens-über-Texte, des
Schreibens zeigt, welche Weisen des Textzugangs praktikabel, erwünscht und weiterführend sind
und welches entsprechend die Kenntnisse sind, über die man verfügen sollte.
Ich möchte hier beispielhaft nur einige Aspekte etwas näher beleuchten, und zwar in Bezug auf
die Rezeption von Texten. Fast jeder einschlägige Ausschnitt aus dem Unterricht kann dazu
dienen, die zu diskutierende Thematik zu exemplifizieren. Hier ein mehr oder weniger zufällig
ausgewählter Unterrichtsmitschnitt, der ebenso eher zufälligerweise aus dem Literaturunterricht
stammt3:
9. Gymnasialklasse. Nach dem Vorlesen einer längeren Passage auf einem
Jugendbuch folgt auf die Frage des Lehrers „Was bedeutet das?“ die folgende, hier
vereinfacht (d.h. ohne Partiturschreibung, die in diesem Fall wenig Zusatznutzen
verspricht) wiedergegebene Sequenz:
M Ja, der hat eben durch den Traum gelernt, seine ähm Erlebnisse zu
verarbeiten und ähm trotz Halluzinationen und Träume etcetera und hin
und her, aber trotzdem ähm ist ja das, was da war, auch die Wirklichkeit
gewesen, mit dem Tod der Eltern. Dann hat er im Traum eben gelernt,
das zu verarbeiten.
L (30 sec., Lehrer schreibt an die Tafel) Thilo
Th Ja, der Onkel will sagen, dass ähm Ben die Tode jetzt verkraftet hat.
L Ja, Todesfälle. (10 sec.: Schreibt an die Tafel) Barbara
B Ben weiß jetzt auch, was er in Zukunft machen will, so dass der jetzt nicht
nur immer Trauer (-)
L Das ist alles richtig, nur: Was macht Ihr jetzt wieder für einen Fehler?
M Wir stellen Behauptungen auf.
L Ja bitte, wo steht das genau? Bleibt doch mal beim Text .... An dieser
Textstelle, was wird genau gesagt? Martin.
3
Die Darstellung hier und unten in 3.1 basiert auf der Darstellung in Portmann-Tselikas 2006.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 4
M Ähm, (liest vor) „Du bist nicht mehr der Junge, der du noch vor einer
Woche warst.“ Der hat sich also ziemlich stark verändert und dann, äh (
) und dann: „Die Dinge haben sich geklärt und du bist mit mir ins
Reine gekommen. Er fügte hinzu: Deine Gedanken sind klar.“ Ja und
seitdem er so/seit er diesen Traum gehabt hat, ist er reifer geworden.
L Ja, nehmt doch das, was da steht. Was soll ich an die Tafel schreiben?
M Dass Ben sich verändert hat.
L Veränderung, jawohl (schreibt an die Tafel)
Becker-Mrotzek/Vogt (2001), S. 94f.
In dieser Sequenz wird sichtbar, dass sich sogar in einem zweifelhaften didaktischen Format und
in der nicht gerade brillanten Intervention einer Lehrkraft eine durchaus bemerkenswerte
Vorstellung davon zeigt, was in der Schule als relevante literate Praxis gelten kann.
Die Voraussetzung der Arbeit in diesem Ausschnitt ist, dass das primäre Verstehen, welches sich
durch den ersten Durchgang durch einen Abschnitt ergibt, nicht genügt (eigentlich genügt es,
schulisch gesehen, fast nie), sondern einer Vertiefung bedarf. Die etwas seltsame Frage des Lehrers
nach der Bedeutung des Gelesenen führt zu einer Reihe von Antworten, die der Lehrer zunächst
unkommentiert lässt und schließlich mit einem Vorwurf quittiert. Darauf bringt ein Schüler eine
strategische Devise ins Spiel, die die Klasse offenbar kennt, aber nicht befolgt. Adäquate
Antworten auf die Ausgangsfrage unterliegen offenbar einer ganz spezifischen Bedingung: Sie
müssen den Text selbst zur Sprache bringen. Die ersten Antworten finden, trotz oder gerade
wegen ihrer Komplexität, bei der Lehrkraft keine Gnade, wohl aber das geradezu banale ‘Ben hat
sich verändert’. Diese Antwort zeichnet sich durch Texttreue aus – sie ist legitimiert dadurch,
dass sie etwas aufnimmt, was dem Text selbst zugehört. Impressionen, Schlüsse, Assoziationen
gehören einer anderen Sphäre an und sind hier nicht gefragt. Die Anstrengung geht, so könnte man
interpretierend zusammenfassen, dahin, den Unterschied herauszuarbeiten zwischen dem, was der
Text mitteilt, und den Effekten, die diese Mitteilung bei den Lesenden (in Form von
Assoziationen, Vermutungen, Interpretationen etc.) erzeugt.
Was an dem Beispiel sichtbar wird, ist die besondere Ausprägung einer verbreiteten Form der
Thematisierung von Texten mit einer dazu gehörigen Typik von Gesichtspunkten und Verfahren
der Textbetrachtung, wie sie jedem mit Unterricht Vertrauten geläufig ist. Die Überformung und
Überarbeitung des primären Textzugangs besteht in einer Reihe textbezogener Formulierungen, die
ihrerseits wieder einer Bewertung unterzogen werden können. In diesem Prozess verändert sich
der Zugang der Lesenden: Aus dem linear dem Text folgenden Aufnehmen von Information wird
eine reflektierte, von Fragen und Verdeutlichungsbestrebungen bestimmte Tätigkeit. Dabei
verwandelt sich der Status des Textes wie der des Verstehens: Aus einem Substrat mehr oder
weniger deutlich wahrgenommener Lesestimuli wird ein Objekt der Betrachtung, aus einem ersten
Eindruck vom Text eine um eine Reihe von Merkmalen und Aspekten erweiterte konzeptuelle
Struktur.
Es geht hier nicht darum, eine empirisch abgesicherte Liste gängiger Verfahren der unterrichtlichen
Texterschließung und der Kontrolle ihrer Resultate aufzustellen. Ich nehme an, dass in Bezug auf
narrative Texte eine Bestandesaufnahme in ihren Grundzügen so ausschauen könnte4:
4
Eine Beobachtung der Arbeit an Sachtexten würde wohl ein inhaltlich ganz anders gefülltes, strukturell aber
analoges Raster ergeben. Es würde hier um Dinge gehen wie die Identifikation von Hauptaussagen, um die
Heraushebung von Ursache und Wirkung, von Hypothese und Begründung, von Daten und daraus zu ziehenden
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 5
Basis Verfahren ad hoc Schema / Begriff
Text > lokales Verständnis sichern > Paraphrase
Text > Geschichte als ganze > Nacherzählung
vergegenwärtigen
Text > Kernereignisse markieren > Wende/Höhepunkt,
Handlungsmotiv
Geschehens-Zusammenhang
Text > konstruieren > Plot
> Geschichte situieren und Schlüsse > Interpretation
Text ziehen
Strukturen, Gattung
Text > Perspektiven, Stilmittel erkennen > Erzählweise
Epochenspezifik, …
Texte > Weisen des Umgehens mit Texten > Regeln/Strategien
lesen erkennen und bewerten korrekten Redens über
Texte
... > ... > ...
Diese Darstellung lässt sich so lesen: Dem Unterrichtsdiskurs liegt ein Text (bzw. eine
Textsequenz, eine Figur aus dem Text, eine Texteigenschaft etc.) zugrunde. Die Thematisierung
erfolgt zunächst ad hoc, gebunden an den vorliegenden Text. Interessant, schwerverständlich,
weiterführend erscheinende Punkte werden aufgegriffen und besprochen. Den Fragen bzw.
Aufgaben der Lehrkraft liegt eine mehr oder weniger deutliche Einsicht in die Struktur der Texte
bzw. in literaturwissenschaftliche und textlinguistische Konzepte zugrunde. Diese Konzepte
können, aber müssen nicht in einem zweiten Schritt explizit gemacht und erläutert werden. In
diesem Falle bilden sie ein Gerüst für eine elaboriertere, begrifflich unterstützte Form der
Beschäftigung mit Texten. Die vom Lehrer angesprochene Strategie wird im Beispiel in diesem
Sinne durch Martin wenn nicht benannt, so doch klar umschrieben: Wir stellen Behauptungen auf.
Sie wird dadurch erkennbar als ‘falsche’ Weise, die gestellte Frage zu beantworten. Dies lässt sich
in eine Regel für ein legitimierbares, selbst kontrolliertes Reden über Texte ummünzen.
Wir haben weniger idiosynkratische, adäquatere und machtvollere didaktische Optionen als die
hier diskutierte zur Verfügung, um unterrichtliche Beschäftigung mit Texten anzuregen und zu
strukturieren. Die so zustande kommenden Formen der Auseinandersetzung mit Texten werden
die am Beispiel sichtbar gewordene Perspektive der Arbeit aber nicht reduzieren, sondern eher
noch deutlicher (und hoffentlich effizienter) in Szene setzen: Es geht um das Erreichen eines
‘besseren’, eines bewusst überformten, differenzierten Verstehens, um Einsicht in textuelle
Strukturen und Zusammenhänge, und vor allem darum, dass diese in der Klasse oder in
Schlüssen und ihrer Zuverlässigkeit, die Unterscheidung von Beispiel und Regularität bzw. Einzelfall und Gesetz,
um die Rekonstruktion von Argumenten, die Benennung von Zusammenhängen usw.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 6
Gruppenarbeit thematisierten Formen des Umgehens mit Texten zuletzt von den Einzelnen
selbständig gemeistert werden können und die Basis für eine reichere Lektüre von Texten bilden.
Was ich hier vorgebracht habe, ist sicherlich kein Beleg, mag aber die folgende Behauptung
wenigstens plausibel machen: Wie in der Schule Textarbeit inszeniert wird und wie dadurch eine
bestimmte Weise des Verstehen präferiert und gesichert wird, wie Fragen geklärt werden, wie
Elemente des Textes analysiert, miteinander verbunden und expliziert werden – in diesen Formen
der Arbeit werden Merkmale dessen, was als kompetenter Umgang mit Texten gilt, herausgestellt.
Der Kanon gängiger Verfahren unterrichtlicher literater Praxis lässt sich so verstehen als
operationale Definition von Textkompetenz.5
Trotz der Spannbreite real existierender didaktischer Zugänge zur Textarbeit halte ich es für
möglich, das Ziel zu benennen, auf das dieser Kanon (ich bitte zu beachten: immer noch in Bezug
auf das Lesen) letztlich hinweist. Es ist dies das Bestreben, den Text zu einer autoritativen Instanz
zu machen. Was der Text sagt, ist am Text abzulesen und an seinen Formulierungen zu belegen
und nicht an beliebigen Einfällen, die seine Lektüre begleiten. Gleichzeitig haben die Lesenden das
Recht, vielleicht sogar die Pflicht, das, was der Text sagt, zu drehen und zu wenden, seine Machart
zu durchschauen und auf ihn vor dem Hintergrund ihres Wissens und ihrer Erfahrungen zu
antworten, befürwortend oder kritisch, je nachdem, was angemessen scheint. In diesem Spiel
ergibt sich eine Reziprozität von Autor und Leser. Wer von beiden das letzte Wort hat, steht nicht
von vornherein fest. Der Autor hat die Überzeugungskraft seines Textes in die Waagschale zu
werfen. Die Leserin bzw. der Leser entscheidet aufgrund seiner Lektüre, welchen Kredit der Text
verdient.6 Ich gehe wohl kaum fehl in der Annahme, dass dies eine soziokulturell höchst
aufgeladene und anspruchsvolle Vision dessen ist, was Textkompetenz idealtypisch leisten soll.7
3 Kompetentes Handeln mit Texten: repräsentationelle Redeskriptionen und mentale
Modelle
Operationale Definitionen sind besser als bloße Charakterisierungen – aber was ist das Besondere
an der skizzierten Art von Textkompetenz, welche ‘inneren’ Dispositionen und Fähigkeiten liegen
ihr zugrunde? Das Folgende ist ein Versuch, auf diese Frage zumindest eine vorläufige Antwort
anzubieten. In einem ersten Schritt skizziere ich den kognitiven Grundmechanismus, der in den
angesprochenen didaktischen Verfahren in Anspruch genommen wird. In einem zweiten Schritt
geht es um das Verstehen, das ja Ausgangspunkt und Ziel aller Bemühungen ist. Lässt sich hierzu
etwas sagen, was die Spezifik des hier diskutierten kompetenten Umgangs mit Texten zu
verdeutlichen vermag? Ich werde die Ausführungen zu beiden Themen kurz halten und manches
nur andeuten können.
5
In genau diesem Sinne werden in vielen Curricula literate Fähigkeiten operational definiert, als Sammlung von
bestimmten Handlungszügen bzw. Kenntnissen.
6
Diese Intention wird sich in der Arbeit an Sachtexten, die Grundlageninformation für die schulischen Fächer
liefern, eher selten realisieren lassen. In der Lektüre von literarischen, populärwissenschaftlichen oder Medientexten
wird dieses Ziel oft sehr bewusst verfolgt. Der ‘ideologische’ Charakter des Redens-über-etwas ist in diesem
Kontexten viel leichter erkennbar und nachvollziehbar zu machen.
7
Ich gehe davon aus, dass die Arbeit auf fast jeder Schulstufe von dieser Vorstellung geleitet ist, und dass
funktionale Ziele Operationalisierungen sind, in denen Aspekte davon aufgehoben sind. Ich kenne kein Curriculum
und keinen Lehrplan, der die Vision kritischer Lesefähigkeit im skizzierten Sinne nicht zumindest als Fluchtpunkt
der didaktischen Bemühungen setzt.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 7
3.1 Repräsentationelle Redeskriptionen
Der Modus, in dem Arbeit an Texten vor sich geht, ist fast stets der der Erzeugung von
Formulierungen über diese Texte. Dabei werden Aspekte besprochener Texte sprachlich neu
gefasst, oder, wie ich hier sagen werde, re-repräsentiert. Solche Re-Repräsentationen kommen wie
von selbst zustande, wenn sich beim Lesen ein Verständnisproblem einstellt und der oder die
Lesende versucht, sich Klarheit zu verschaffen und die gewonnene ‘richtige’ Verständnisweise
sich selbst vorsagt. Unvermeidlich sind Re-Repräsentationen, wenn über Texte gesprochen wird.
Das kennzeichnende an Re-Repräsentationen ist dies, dass sie einem Aspekt des Textes eine
sprachliche Form geben und dieser dadurch herausgehoben wird, Eindeutigkeit, Stabilität und
Prägnanz gewinnt. In vielen Fällen wird er erst dadurch als textuelles Phänomen bewusst. Re-
Repräsentationen beziehen sich auf einen Text und sind von ihm inspiriert, gleichzeitig
strukturieren sie aber den Blick auf den Text und konstituieren ein Bild von ihm.8
Re-Repräsentation ist nicht nur der Modus des Reflektierens und der Kommunikation, sie ist
auch, zumindest in einigen lerntheoretischen Ansätzen, ein Modus des Lernens.9 Besonders
explizit ist in dieser Hinsicht das konnektionistisch-konstruktivistische Modell von Karmiloff-
Smith (1992). ‘Representational redescription’ bezeichnet hier die kognitive Operation, durch die
dem kognitiven System zugängliche Information ‘umgeschrieben’ wird. Dies führt nicht einfach zu
einer Verdoppelung dieser Information, vielmehr wird durch die Re-Repräsentation Element im
bestehenden Wissen fokussiert und herausgehoben. Dieser Akt konstituiert neues Wissen, das
das ursprüngliche bereichert, in ein anderes Format transponiert und es damit auf andere Weise
verwendbar macht, als dies vorher der Fall war (vgl. Karmiloff-Smith 1993, 187).
[Representational redescription is] a cyclical process by which information already present in the
organisms independently functioning, special-purpose representations, is made progressively available, via
redescriptive processes, to other parts of the cognitive system. In other words, representational
redescription is a process by which implicit information in the mind subsequently becomes explicit
knowledge to the mind, first within a domain and then sometimes across domains. (Karmiloff-Smith
1993: 17f.)10
Der ‘representational redescription’ wird hier genau der Stellenwert zugewiesen, den textbezogene
Formulierungen nach der eben vertretenen Auffassung im Unterricht haben. Sie machen nicht oder
nur undeutlich fassbare Aspekte am eigenen Tun und seinen Resultaten sichtbar und halten sie
fest, so werden sie fassbar und auf neue Weise für die weitere Arbeit verfügbar. Was dabei ins
Auge fällt, ist eine Transformation, die mit und durch Re-Repräsentationen zustande gebracht
wird, fassbar am Verlust an Konkretheit, der im Gegenzug kompensiert wird durch explizitere
8
Re-Repräsentationen spielen nicht nur im Lesen, sondern auch im Schreiben eine wichtige Rolle. Man kann – etwa
bezogen auf den Aufsatzunterricht – die Themenstellung, das Ideen-Sammeln, Planen und schließlich das
Überarbeiten von Texten begreifen als Menge von Re-Repräsentationen, die sich auf einen zunächst noch
imaginierten, dann Zug um Zug realisierten Text beziehen. Vgl. in diesem Zusammenhang die Diskussion um
Prätexte im Unterschied zu textkommentierenden bewertenden bzw. planenden Äußerungen bei Wrobel 1995, Rau
1994.
9
Ich verweise hier auf die kognitive Lerntheorie J.R. Andersons (1983) oder die kognitivistische
Spracherwerbstheorie Pienemanns (1998), in denen zumindest einige der relevantesten Aspekte des Lernens als
Erzeugung neuer Repräsentationen von eigentlich Bekanntem interpretiert werden.
10
Karmiloff-Smith hat die Voraussagen, die ihr Modell macht, in unterschiedlichen Domänen, darunter auch in
Bezug auf das frühe Schreiben, geprüft (Karmiloff-Smith 1992, Kap. 6)
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 8
bzw. abstraktere Formulierungen, die flexibler einsetzbar sind, weil sie Eigenschaften des Textes
herausheben und ‘berechenbar’ machen – etwa, indem sie Analogien zu Beständen des Vorwissens
festzuhalten erlauben, Vergleiche mit anderen Texten ermöglichen, Strukturanalogien innerhalb des
Textes identifizierbar und benennbar machen usw. Was dabei herausschaut, ist nicht nur ein
besseres Verständnis des einzelnen Textes. Das didaktische Ziel ist ja dies, dass am ausgefalteten
und kontrollierten Leseprozess eines meist mehr oder weniger austauschbaren Textes
generalisierbare Prozeduren des Umgehens mit Texten eingeübt werden und ineins damit
handlungsrelevante Kenntnisse über Strukturen von ‘guten’ Texten und die Dynamik von
‘adäquaten’ Leseprozessen allgemein aufgebaut werden.
Es kann hier nicht darum gehen, das Modell Karmiloff-Smiths im Detail darzustellen.
Hervorheben möchte ich aber drei Punkte, die mir im Kontext der hier geführten Diskussion
besonders relevant scheinen:
1. Karmiloff-Smith beantwortet in ihrem Modell nicht die Frage, wie ein kognitives System zu
seinen Informationen kommt, sondern die, wie auf der Basis zugänglicher Information
komplexes Wissen und und komplexe Fähigkeiten aufgebaut werden. Diese ‘höheren’ Formen
des Wissens und Könnens müssen aufgrund wahrgenommener Gegebenheiten durch interne,
kognitive Operationen erarbeitet werden.11 Die Möglichkeit, dies extensiv zu tun, ist für
Karmiloff-Smith das Kennzeichen menschlicher Kognition.12 Das Mittel dazu sind die
‘representational redescriptions’. Angewendet auf unser Thema: Einen Text gut zu verstehen
heißt demgemäß imstande zu sein, zu einem Text relevante Re-Repräsentationen zu erzeugen
sowie Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen diesen Re-Repräsentationen wahrzunehmen
und selbst wieder zum Thema von Formulierungen zu machen etc. Entsprechend lässt sich
Lesekompetenz verstehen als die Beherrschung einer Menge von Verfahren der Sinnerzeugung
und der Verständniskontrolle, in denen die im linearen Durchgang durch den Text gewonnene
Information durch höherstufige Prozesse tiefer erschlossen wird. Lesenlernen heißt, diese
Fähigkeit ausgehend von dem je gegebenen Stand zu erweitern, zu differenzieren und zu
spezialisieren. Die im obigen Zitat angesprochenen ‘zyklischen Prozesse’ sind solche Prozesse
der internen Anreicherung, bezogen sowohl auf inhaltliche Kenntnisse (etwa Verständnis eines
Textes) wie auf Fähigkeiten (etwa Lesekompetenz). Die Idee hier ist, dass es reiche,
vieldimensionale und miteinander interagierende Re-Repräsentationen sind, die einer Kenntnis
bzw. einer Kompetenz auf hohem Niveau zugrundeliegen. Diese sind letztlich intern durch
jeden Einzelnen selbst aufzubauen.13 Unterricht muss diesen Aufbau anstoßen und
unterstützen, er kann ihn nicht direkt vermitteln.14
11
Die Spracherwerbsforschung im Feld der Grammatik ist im sprachwissenschaftlichen Bereich das wohl
bekannteste Beispiel dafür, dass solche inneren Operationen (wie immer ihre Basis definiert wird) angenommen
werden müssen. Grammatische Strukturen sind an Äußerungen ablesbar nur aufgrund einer höchst differenzierten
grammatischen Kenntnis; diese kann den Phänomenen nicht einfach abgelesen werden, sondern muss intern
aufgebaut werden. Der Hinweis auf den Spracherwerb macht deutlich, dass Re-Repräsentationen durchaus nicht
immer (vor allem nicht in Bezug auf Basiskompetenzen) bewusst und explizit vorgenommen werden müssen (dazu
s.u.)
12
„The RR model is fundamentally a hypothesis about the specifically human capacity to enrich itself from within
by exploiting the knowledge it has already stored, not just by exploiting the environment. Intra-domain and inter-
domain representational relations are the hallmark of a flexible and creative cognitive system. The pervasiveness of
representational redescription in human cognition is, I maintain, what makes human cognition specifically human.“
(Karmiloff-Smith 1993, 192)
13
Es gibt viele Bereiche, in denen es einen quasi ‘natürlichen’ Sättigungspunkt dieses Prozesses innerer
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 9
2. Ein zentrales Element des Ansatzes von Karmiloff-Smith ist die Idee des success-based
change (Karmiloff-Smith 1993, 24ff. und 172f.). Weiterführende Re-Repräsentationen setzen
funktionierende Verhaltenszüge voraus, also automatisierte Prozeduren, die in konkreten
Kontexten erfolgreich eingesetzt werden können. Ohne eine solche Basis ist Entwicklung im
Sinne der besagten internen Überformung und Flexibilisierung durch sukzessive Re-
Repräsentationen nicht möglich. Findet sie erfolgreich statt, bringt sie neue Niveaus mehr oder
weniger automatischer Beherrschung zustande, die ihrerseits wieder neu überformt und
überarbeitet werden können. In diesem Sinne birgt eine Sequenz wie die im letzten Abschnitt
besprochene für die Lernenden nur dann eine Chance auf Klärung, wenn das primäre
Verständnis des besprochenen Textes genügend differenziert ausgebildet ist. Ist dies (etwa im
Fremdsprachenunterricht, bei schwierigen Texten auch im muttersprachlichen Unterricht) nicht
der Fall, muss fruchtbare Arbeit anderswo ansetzen, nämlich bei den Resultaten der
verfügbaren Kompetenzen. Ein adäquates Vorgehen wäre dann, aufgrund mangelhaften Wort-
oder Satzverstehens scheiternde Leseprozesse zum Thema zu machen und ein einigermaßen
stabiles primäres Textverstehen überhaupt möglich zu machen.
3. Re-Repräsentationen können nach Karmiloff-Smith unterschiedliche Grade der Explizitheit
(die expliziteste Formen sind die verbal formulierten) und der Bewusstheit aufweisen. Im
Hinblick auf das aktuelle Thema lässt sich dies so interpretieren, dass nicht nur im methodisch
disziplinierten Sprechen über Texte Einsichten in Texte gewonnen werden, sondern auch in den
weicheren, eher holistisch orientierten Zugängen, wie sie im Schreib- und Leseunterricht in den
letzten Jahren wieder gängiger geworden sind (etwa im Umsetzen von Texten in Spiel, in
Imitation, Transformation, experimentellem Schreiben etc., nicht zuletzt im Sprechen über
Texte, das durch die Lernenden selbst verantwortet und unterhalten wird, etwa beim
Vergleichen von Texten in Gruppenarbeit usw.). Auch diese Verfahren sind ohne Re-
Repräsentationen nicht zu denken, auch wenn diese nicht die ‘kanonische’ Form expliziter,
nach klaren Kriterien unternommener verbaler Deskription bzw. Explikation haben.
Die aufschließende Kraft dieser ästhetischen, gestalthaften, imaginativen Zugänge liegt an
mindestens zwei Eigenschaften, die ihnen eigen sind: Einerseits beruhen sie auf den
handlungssteuernden kommunikativen und textuellen Schemata, über die die Lernenden
praktisch, wenn auch nicht begrifflich verfügen, und erlauben vielen von ihnen dadurch
sicherere, komplexere und intuitiv befriedigendere Reaktionen, als dies ein auf explizite
Benennung und Deskription fokussiertes Vorgehen erlaubt. Andererseits generiert der
Anschluss an diese bereits beherrschten Verhaltenszüge relevante Erfahrungen und Einsichten.
Auch in einer praktisch angelegten Auseinandersetzung springen Eigenschaften des
Grundlagentextes sozusagen von selbst ins Auge. So kann ein Text nicht parodiert werden,
wenn nicht gewisse seiner Merkmale gezielt imitiert und übertrieben werden. Dadurch werden
sie wahrnehmbar, zunächst eingebunden in Verfahren stilistischer Übersteigerung und
Anreicherung zu geben scheint. Die Kenntnis der Grundgrammatik einer Sprache oder der Regularitäten
perspektivischer bildlicher Darstellung ist in einem geglückten Lernprozess (für alle praktische Zwecke) irgendwann
erreicht (vgl. dazu die Analysen in Karmiloff-Smith 1993). Wahrscheinlich lässt sich Ähnliches auch in Bezug auf
Lesen und Schreiben sagen, zumindest in Basisbereichen wie Buchstaben- und Wortbilderkennung, syntaktisches
Parsing usw.
14
Kritik an einem Unterricht wie dem im Transkript des letzten Abschnitts erfassten wird – vor dem Hintergrund
dieser Vorstellung – die mangelnde Eigenständigkeit und Selbstkontrolle der Lernenden betonen.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 10
protobegrifflicher Thematisierung (etwa, wenn einzelne Formulierungen im Text als besonders
typisch eingeschätzt werden). Auf dieser Basis kann sich dann auch ein expliziter, begrifflicher
Zugriff nahe legen.
3.2 Mentale Modelle
Mit dem Verfahren der ‘representational redescriptions’ ist der modus operandi vertiefenden und
lernenden Umgangs mit Texten, so hoffe ich, im Kern erfasst. Was damit noch nicht beantwortet
ist, ist die Frage, auf welcher Grundlage wir Re-Repräsentationen gewinnen bzw. als solche
erkennen. Eine Re-Repräsentation ist zunächst das Resultat einer kognitiven Operation; im
Weiteren (und das interessiert hier), der sprachlich gefasste Ausdruck einer solchen Re-
Repräsentation, ein eigenständiger, oft sehr kurzer, Text über einen Text (oder, worauf ich hier
nicht eingehe, über wahrgenommene reale Gegebenheiten). Was erlaubt es, beide aufeinander zu
beziehen und diese Beziehung zu beurteilen?
Die Frage ist nicht abwegig, denn wahrscheinlich zeigen nur in einer Minderheit der Fälle direkt
wahrnehmbare Ähnlichkeiten zwischen beiden Texten ihre Zusammengehörigkeit bereits auf der
sprachlich-ausdrucksseitigen Ebene an. In den meisten Fällen des Redens-über-einen-Text muss
die Beziehung eine andere, indirekte sein. Die Vermittlungsinstanz ist hier nicht der Text selbst,
sondern eine Vorstellung, die wir vom Text gewonnen haben, eine kognitive Instanz, oder, wie ich
hier sagen werden, ein textbezogenes mentales Modell.15 Ingredienzen eines solchen mentalen
Modells sind (meist nur bruchstückhafte) Erinnerungen an die sprachliche Gestalt, an
Formulierungen und Stileigenheiten, Momente der Bewertung und solche der Verknüpfung mit
Beständen des Vorwissens usw. Diese werden aber wohl in den meisten Fällen dominiert von
einer Vorstellung vom Inhalt des Textes und (wohl weniger deutlich) von seiner Struktur.
Mentale Modelle bilden die sprachlichen und inhaltlichen Verhältnisse des Textes eher ungenau ab
(und dies ist umso bemerkbarer, je länger ein Text ist), überdies verblassen sie rasch. Wozu sind
sie dann gut? – Während der vorliegende Text zwar in zweidimensionaler Darstellung erscheint,
aber trotzdem nur linear gelesen werden kann, präsentiert das mentale Modell die wesentlichen
Aspekte des Textes quasi simultan. Es ist in diesem Sinne vergleichbar mit einer Landkarte, die
mit ihrer Vogelperspektive Formationen synoptisch zeigt und damit Überblicke ermöglicht, die
ein Gang durch die abgebildete Gegend nicht gestattet. Bezogen aufs Lesen: Nur ein mentales
Modell erlaubt es, Gegebenheiten an ganz unterschiedlichen Stellen im Text ohne Aufwand ko-
präsent nebeneinander zu halten, oder Figuren, charakterisiert durch über den Text hinweg
verstreute Hinweise, zu Personen mit ihren komplexen Charakteren zu synthetisieren, oder in der
Art, wie Schlüsselszenen erzählt werden, ein den Text prägendes Strukturmuster zu erkennen etc.
Mentale Modelle bilden die Grundlage für Re-Repräsentationen. Im Gegensatz zu Landkarten
sind sie aber keine fixierten Gebilde. Erfahrenen LeserInnen gelingt es, im Durchgang durch die
Texte ein genügend differenziertes Verständnis aufzubauen – sie lesen mit der Gewissheit, dass sie
bei Notwendigkeit auf dieser Basis genügend reiche und interessante Re-Repräsentationen
zustande bringen könnten, auch wenn sie dies aktuell nicht über das Maß hinaus tun, das ihnen
beim flüssigen Lesen gelingt. Wie wir gesehen haben, geht der unterrichtliche Zugang zu Texten
fast prinzipiell davon aus, dass die Lernenden in ihrer Lektüre mentale Modelle aufbauen, die in
15
Vgl. zum Begriff des mentalen Modells Johnson-Laird (1983)
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 11
der Perspektive erfahrener LeserInnen nicht genügend elaboriert sind, dass diese präzisiert werden
müssen und dass dies ein Weg ist, die Lesekompetenz weiter auszubilden. Was erfahrene
LeserInnen – aufgrund welcher Anstöße und Ziele immer – sporadisch tun, nämlich eine bewusst
unternommene Überarbeitung des aktuellen Verständnisses, wird hier fast systematisch ins Werk
gesetzt. Zur Erfahrung des Lesens gesellt sich das Interesse an einer expliziten ‘Klärung’, an einem
Resultat, an der Sicherung eines wie immer gearteten Ergebnisses. Bis zu einem gewissen Grade
kann dies durch durch einfaches Nachdenken, durch die Ausbeutung des aktuellen Modells und
seiner internen Struktur sowie seiner Beziehungen zum Vorwissen geschehen. In vielen Fällen
führt der Prozess der Vergewisserung aber dazu, dass der Text erneut ganz oder teilweise gelesen
wird und die bislang vorgenommenen Vorstellungen aufgrund des Wortlauts des Textes
kontrolliert und, wo nötig, erweitert und differenziert werden. Auch in diesem Spiel ist das
mentale Modell das Steuerinstrument. Fragen und darauf bezogene Re-Repräsentation beziehen
sich der Intention nach zwar auf den Text, aber sie tun dies vermittelt über eine kognitive Instanz.
Nicht einmal eine simple Nacherzählung kann sich allein an den Vorgaben des linearen Textes
orientieren, wenn sie glücken soll. Wie weit diese Auseinandersetzung mit dem Text getrieben
wird, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Sobald wir keinen Grund mehr sehen, unser
mentales Modell in Frage zu stellen, werden wir vorsichtigerweise zwar nicht behaupten, ‘die
Bedeutung’ des Textes erfasst zu haben, aber wir werden auch nicht daran zweifeln, dass wir ihr
für die aktuellen Zwecke im Wesentlichen gerecht geworden sind.
Ich möchte diesen Abschnitt nicht abschließen, ohne noch auf einen Punkt hinzuweisen, der mir
für das Verständnis der Spezifik von Textkompetenz zentral erscheint. Re-Repräsentationen und
mentale Modelle bzw. analoge Netzwerke von Konzepten spielen in der Psychologie in fast
jedem Verhaltensbereich eine Rolle. Was ist denn das Spezifische an ihnen in Bezug auf Texte? Ihr
herausragendes Charakteristikum ist, dass sie weitgehend oder allein auf verbal gefasster
Information basieren, und dass Verstehen selbst fast nur an verbalen Äußerungen abgelesen
werden kann.16 Die damit verbundene Anforderung ist eine dreifache:
• Einerseits bedeutet die Dominanz des Sprachlichen die Pflicht, Information fast gänzlich im
sprachlichen Kode auszudrücken. Dies beruht auf einer entscheidende Verschiebung der
Verhältnisse, die etwa im Dialogischen herrschen, wo Para- und Nonverbales sowie die konkrete
Gesprächssituation eine Vielzahl nicht-sprachlicher Verständnis- und Kommunikationshilfen
bereitstellen, oder gegenüber der visuellen Wahrnehmung (vgl. Augst 1992, Scheerer 1993, die
die mit diesen Verschiebungen einhergehenden Anforderungen sehr eingängig beschreiben).
• Damit verknüpft ist zweitens die Aufgabe, aus linear aufgenommener Information ein rundes
Gesamtbild zu erzeugen, in dem die einzelnen Elemente eine Vielzahl von Beziehungen
miteinander unterhalten, die mit der chronologischen Reihenfolge ihres Auftretens im Text wenig
zu tun haben muss (in Bezug auf Sachtexte gilt dies fast prinzipiell). In der Produktion muss
das, was man zu sagen hat (sofern es eine gewisse minimale Komplexität überschreitet), dann
wieder in eine lineare Abfolge gebracht werden – auf nachvollziehbare Weise, und das heißt so,
dass aufgrund der Mitteilung bei den Adressaten der Aufbau eines entsprechenden mentalen
Modells möglichst reibungslos erfolgen kann.
16
Eine Ausnahme bilden etwa Instruktionstexte, wo sich (unter bestimmten Bedingungen) Verstehen in
erfolgreichem Handeln zeigt, ohne Notwendigkeit sprachlicher Re-Repräsentation.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 12
• Sprachlich kodierte Information ist immer karg im Verhältnis zu dem reich differenzierten Bild
von der Sache, das auf ihrer Basis zu erzeugen ist. Dies ist ohne gut orchestrierten (und damit
keineswegs selbstverständlichen) Beizug des Vorwissens nicht möglich. Dieser Bezug auf das
Vorwissen muss (und damit sind wir wieder beim ersten Punkt) weitgehend aufgrund von
sprachlichen Hinweisen und Indizien zustande kommen. Ohne mitlaufende situationale, para-
und nonverbale Information erhöht dies die Anforderungen an die Beherrschung der Sprache und
das Verständnis der indexikalischen Potenz einzelner Wörter und Ausdrücke beträchtlich (vgl.
dazu Feilke 2003).
Sprachliches bildet so die entscheidende Schnittstelle zwischen Text, Verstehen der textuell
gefassten ‘Welt’ und anschließender kommunikativer Bearbeitung des Verstandenen. Es ist,
metaphorisch gesagt, das Nadelöhr, durch das in textbasierter Kommunikation alles Gemeinte
gehen muss – die programmierte Sollbruchstelle, an der Überlastungen deutlich ihre Wirkung
zeigen. Auch Texte, die die Welt der Sachverhalte und Handlungen nicht begrifflich, sondern
durchaus konkret und farbig darstellen, tun dies auf symbolisch gefasste, syntaktisch-textuell
strukturierte und unsinnliche Weise. Die von geübten LeserInnen intensiv erlebte Anschaulichkeit
solcher Texte ist eine Leistung der Lesenden, ein Produkt des Verstehens. Voraussetzung dafür,
dass sie zustande kommen kann, ist die Fähigkeit, die Wörter und Sätze als Sprungbrett für einen
imaginativen Zugang zum Dargestellten zu benützen und dabei zumindest ansatzweise Qualitäten
des direkten, sinnlichen Erlebens in die sprach- und textbezogenen Verstehensprozesse
einzubeziehen. Je abstrakter und begriffsgeladener Texte sind, desto deutlicher werden die
Anforderungen an die Fähigkeit zur genauen Beachtung der semantischen Gehalte von
Formulierungen, zur Abwägung ihres Verhältnisses zum Vorwissen und zum ‘Rechnen’ mit den
Beziehungen, die sie in ihrem sachlichen und textuellen Kontext zueinander unterhalten, d.h. zum
verbalen Denken. Das adäquate Verstehen und Re-Repräsentieren erfordert nicht nur hier, hier
aber besonders leicht wahrnehmbar, sprachliche Präzisionsarbeit.17
4 Die soziokulturelle Dimension
Die Vorstellung von Textkompetenz, die ich hier skizziert habe, erinnert in manchem an Ideen der
Aufklärung: an Vorstellungen von Bildung als Emanzipation, von Schriftlichkeit und schriftlich
konstituierten Texten als einem Instrument, gar als Garanten rationalen Denkens. Dass eine
Auseinandersetzung mit Textkompetenz diese Orientierung an hohen, manchmal etwas abgehoben
tönenden Auffassungen mit ins Spiel bringt, zeigt, dass diese Traditionen im Bildungsbereich und
in unseren hergebrachten Wertesystemen weiterwirken. Aber dies darf nicht fehlinterpretiert
werden. Was hier durch die Isolierung und perspektivische Fokussierung sicherlich sehr pointiert
dargestellt worden ist, ist nicht nur Reflex eines hergebrachten Bildungsideals. Zugleich gilt:
Textkompetenz, wie sie hier skizziert wurde, ist eine durch und durch funktionale Fähigkeit. Dies
wird beglaubigt durch ihre lebensweltliche Relevanz, ihre unbestreitbare Notwendigkeit und
Leistungsfähigkeit ist in vielerlei Kontexten. Man denke etwa an den Alltag der politischen
17
Vgl. Portmann-Tselikas 2001. - Im Kontext der neuen Medien und ihrer multimedialen Möglichkeiten stellt sich
natürlich die Frage nach dem Stellenwert der Einschränkungen und Eigentümlichkeiten sprachbasierter textueller
Kommunikation. Ist sie, verglichen mit anderen Modi der Kommunikation, unnötig beschwerlich und
voraussetzungsreich, oder birgt sie einzigartige Chancen für die Konzipierung und Mitteilung von hochstrukturierten
und effizient kommunizierbaren kognitiven Welten?
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 13
Berichterstattung und der Meinungsbildung. Wer nicht nur die eingeschränktesten Sendungen hört
oder Blätter liest, kommt nicht um die Einsicht herum, dass es zu fast jeder Frage unterschiedliche
Stellungnahmen, Argumente etc. gibt. Oder man denke an eine der Hauptforderungen der
Wissensgesellschaft: lebenslanges Lernen. Wenn man dieses nicht simplizistisch fasst, geht das
nicht anders denn als abwägendes Umgehen mit nicht immer eindeutiger Information. Denkt man
schließlich an formale Ausbildungsgänge, so kann kein weiterführendes Lernen allein auf der
Grundlage von Rezeption und Wiedergabe vorliegender Information funktionieren. Das, was ein
Fach zu bieten hat, ist ja nicht homogene, bloss immer komplexer werdende Information, sondern
ein Meer von unterschiedlichen, teilweise gleichgerichteten, dann wieder voneinander
abweichenden Modellierungen und Positionen, prototypisch in den Wissenschaften, aber bei
weitem nicht nur dort.
In allen diesen Bereichen ist zumindest eine Gemeinsamkeit festzustellen: Sie setzen die Fähigkeit
voraus, Information genau zu verstehen, mit Unklarheiten, Perspektivenverschiebungen und
Widersprüchen umzugehen, Gewichtungen vorzunehmen, das eigene Vorwissen ins Spiel zu
bringen und Glaubwürdigkeiten abzuwägen. Es sind dies Operationen wie die, die hier als
wesentlich für textuell kompetentes Handeln dargestellt wurden und die – wenn auch in
vereinfachter Form – in der schulischen Arbeit am Text zum Thema werden.
Diese Hinweise zeigen, dass es hier nicht nur um ein Erbe der Aufklärung geht, sondern dass das
Konzept der Textkompetenz in durchaus alltäglichen, zweckrational organisierten Kontexten
verankert ist. Dabei ist heute der wissenschaftliche Diskurs als idealtypischer Standard für
sachgerechtes Reden in der heutigen Gesellschaft wohl ein ebenso wichtiger, vielleicht sogar
einflussreicherer Quell für die Vorstellungen davon, wie textuell kompetentes Handeln aussieht
und was sie bewirkt, als die Erinnerung an die Aufklärung. Das Ethos des Fortschritts durch
abwägende Kritik, der individuellen Informiertheit, der Informationsverarbeitung und
Informationstransformation bestimmt das wissenschaftliche Denken und beeinflusst gleichzeitig
die letztlich auf diesen Horizont hin orientierten Bildungsprozesse.
Wenn ich eingangs davon gesprochen habe, dass die hier vertretene Auffassung von
Textkompetenz eine höchst beladene, geradezu riskante sei, dann beruht dies darauf, dass der
skizzierte Umgang mit Texten soziokulturell hochgradig kodiert ist. Die erwähnten Kompetenzen
und mit ihr verbundenen Praktiken haben im Alltag längst nicht aller Mitglieder der Gesellschaft
einen selbstverständlichen Platz. Trotz ihrer Notwendigkeit in vielen Bereichen haben sie einen
‘elitären’ Anstrich – sie bilden zwar einen kulturellen Standard, aber sie sind kein Allgemeingut. In
der Lebenswelt verschiedener Gruppen sind diese Praktiken von ganz unterschiedlicher
Wichtigkeit, sie prägen den Umgang mit Texten und Information, die kommunikativen
Gewohnheiten und Ansprüche und letztlich auch die Weltsicht der Einzelnen auf ganz
unterschiedlich intensive Weise.
Dies hat Konsequenzen für die Schule. Es ist allgemein bekannt, dass Kinder aus sogenannt
‘bildungsfernen Schichten’ statistisch gesehen geringere Chancen haben, die Bildungsangebote der
Schule zu nutzen als die Kinder ‘bildungsnaher Schichten’.18 Die erste Gruppe kann im
18
In ‘Der Standard’ vom12./13.11.2005, S. 3, werden die neuesten statistischen Rahmendaten für Österreich in aller
Kürze so präsentiert: Im Alter von 12 Jahren sitzen 77% der Kinder von AkademikerInnen in der
Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS, also Maturaschule), 58% der Kinder von AHS-AbsolventInnen, 19% der
Kinder von Eltern, die eine Lehre gemacht haben, und 12% von Eltern, die nur die Hauptschule besucht haben. Dies
sind fragmentarische und letztlich unzureichende Daten; sie genügen aber, um eine allgemeine Tendenz sichtbar zu
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 14
Durchschnitt während der Schulzeit nicht nur auf mehr Unterstützung für schulische Belange im
außerschulischen Milieu rechnen, sie kommt auch schon mit anderen Voraussetzungen in die
Schule. Beides zusammen erzeugt ganz offenbar persistierende Unterschiede in den Chancen,
Zugang zu den schulischen Angeboten zu finden. Man kann dies mit guten Gründen auf die
Prägekraft vor- und außerschulischer Erfahrungen mit Praktiken der Kommunikation
zurückführen, die im weitesten Sinne textbasiert sind, das heißt Formen sprachlich basierter
Imagination und Weltbewältigung belohnen und damit die verbale und kommunikative Bearbeitung
von Erfahrung vormachen und stabilisieren. Diese Prägung zeigt sich auch, und für Kinder zuerst,
in den Formen der mündlichen Kommunikation, die eine zentrale Rolle für die Anbahnung und
Grundlegung von Textkompetenz spielt.19
Falls es, wie es scheint, diese Dinge sind, die einen wesentlichen Beitrag zu dem differenziellen
Erfolg schulischer Bildungsbemühungen leisten, heißt dies nicht anderes, als dass Grundlagen der
Textkompetenz und damit eine der zentralen Ressourcen aller Bildungsprozesse in und durch
diese Bildungsprozesse nicht in genügender Weise vermittelt und aufgebaut werden. Schule
(zumindest in Österreich und den anderen deutschsprachigen Ländern, für die die Statistiken
übereinstimmende Tendenzen ausweisen.) verlässt sich auf die Vorleistungen, die in der primären
Sozialisation erbracht und von den Kindern in die Schule mitgebracht werden.20
In Hinblick auf soziokulturelle Kontexte ist eine zweite, ebenso wichtige und im Hinblick auf
unsere so heftig propagierte ‘Wissensgesellschaft’ geradezu entscheidende Frage die, ob wir die
Schülerinnen und Schüler, die in der Schule aufgrund ihrer mitgebrachten Fähigkeiten nicht mit
Nachteilen und übergroßen Schwierigkeiten zu rechnen haben, wirklich genügend fördern, ob die
Schule als Institution die in sie gesetzten Erwartungen im Normalfall erfüllt (und ob dies, wenn sie
es nicht tun sollte, verändert werden kann).
5 Barrieren und Brücken
Was ergibt sich aus den vorgebrachten Überlegungen für den Unterricht? Es ist hier nicht der Ort,
dazu konkreten didaktischen Hinweise zu geben. Vielmehr möchte ich die begonnenen
Überlegungen weiterführen und, an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, auf
Gesichtspunkte hinweisen, die für die didaktische Planung und Beurteilung von Unterricht wichtig
sind.
Lehrkräfte sind Repräsentanten, Bewahrer und Vermittler einer gesellschaftlich hoch gewerteten
Kenntnis. Sie sind dazu verpflichtet, im Fortlauf der Schuljahre stets höhere Ansprüche zu stellen
– das Curriculum baut in dieser Hinsicht ganz gezielt Barrieren auf, deren Überwindung dann als
machen.
19
Überraschend ist dies nicht. Auch die schulische Inszenierung von Textarbeit kommt, wie schon das eingangs
analysiert Beispiel zeigte, nicht aus, ohne dem Mündlichen eine zentrale Position einzuräumen. Vgl. dazu auch
Wallace 1999.
20
Die Problemstellung, so gefasst, erinnert unweigerlich an die soziolinguistische Debatte der siebziger Jahre, die
unglücklicherweise unabgeschlossen geblieben ist und in der sterilen Entgegensetzung von ‘Defizit’ und ‘Differenz’
ihren eigentlichen Gegenstand verloren hat: Unterschiedliche Kommunikationskulturen sind eine gesellschaftliche
Tatsache, als solche sind bewertbar und werden auch tatsächlich bewertet, aus unterschiedlichen Gründen und von
unterschiedlichen Perspektiven her. Vgl. die empirischen Untersuchungen zu Herkunft und Schulerfolg (v.a. in
Bezug auf zweitsprachige Kontexte) etwa von Leseman 1994, Levine 1994, Verhoeven 1997, Knapp 1997.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 15
Beweis für genügenden Lernfortschritt gilt.21 Darüber, wie diese Barrieren adäquat und sinnvoll zu
definieren sind, wird natürlich immer wieder gestritten. In dem Bild von Textkompetenz, das ich
hier gezeichnet habe und von dem ich annehme, dass es den Kern einer weit herum praktizierten
Bildungspolitik und -praxis bestimmt, dominieren die funktionalen Ziele und, bezogen auf die zu
vermittelnden Kenntnisse, prozessuale und formale Aspekte: die Fähigkeit, mit Texten bestimmte
Dinge zu tun, Kenntnis eines relativ breiten Spektrums von Textsorten etc. Entsprechend bezieht
sich der didaktische Diskurs auf Bezugswissenschaften wie die Textlinguistik, die
Spracherwerbsforschung, die Schreibforschung, die Unterrichtsforschung etc. Frühere einschlägige
Vorstellungen waren da stärker auch inhaltlich orientiert. Die Kenntnis der Klassiker, Büchmanns
geflügelte Worte etc. stehen heute kaum mehr im Vordergrund, und die (eher literarisch geprägte)
Stilistik und Rhetorik hat als Ankerpunkt der Orientierung stark an Geltung verloren.
Didaktische Verfahren sind Brücken, die es den Lernenden erleichtern sollen, über diese Barrieren
hinwegzukommen statt an sie anzurennen, und dahinter liegende Gebiete zu erkunden. Aufgrund
der hier vorgebrachten Überlegungen müsste eine bewusst und explizit operierende Didaktik, die
den aktuellen Anforderungen gerecht wird und auch den weniger gut vorbereiteten SchülerInnen
Brücken zu bauen versucht, zumindest drei Bereiche explizit als Entwicklungszonen definieren.
Es geht darum, genauer zu verstehen, a) wie literate Praxis in der Schule aussehen muss, damit sie
als sinn- und lustvolle soziale Praxis erfahrbar werden kann, b) wie die Hauptaufgabe jedes
Unterrichts, Realität in Sprache abzubilden und sprachlich zu bearbeiten, auf eine besser
nachvollziehbare und gleichzeitig lernintensive Weise inszeniert werden kann, und wie die
Repräsentationsleistung von Texten und die ‘Lesbarkeit’ textueller Strukturen klarer sichtbar
gemacht werden kann, c) welche Erkenntnisse nötig sind, damit a) und b) mit Aussicht auf Erfolg
besser beantwortet werden können als bisher.
Diese Fragen bringen nichts Neues ins Spiel – sie beziehen sich auf permanente und permanent
aktuelle Problemfelder. LehrerInnen bemühen sich seit jeher, Unterricht entsprechend zu
gestalten. Im Kontext der hier vorgestellten Überlegungen sind aber mit etwas Glück durchaus
weiterführende Re-Repräsentationen dessen zu gewinnen, worum es im Unterricht geht:
a) In der primären Sozialisation werden, wie oben gesagt, grundlegende sprachbasierte Strategien
des Verstehens und die Fähigkeit, die Darstellungsfunktion von Sprache für kommunikative
Zwecke flexibel auszunutzen, in sehr unterschiedlichem Maße ausgebildet. Damit ist die
operationale Seite dessen bezeichnet, worum es geht. Ich vermute, dass ein zweiter Faktor für
den schulischen Erfolg kaum weniger wichtig ist. Es ist die in den Kontexten primärer
Sozialisation gewonnene Erfahrung, dass verbales Erfassen und Besprechen der Welt in
propositionaler Sacheinstellung, dass sprachbasierte Imagination und die damit einhergehenden
Formen des Redens und Kommunizierens Formen der sozialen Praxis darstellen, in der und
durch die Gemeinschaftlichkeit, gelingender Partnerbezug und soziale Anerkennung erreicht
werden können. Dies kann nicht ohne Folge bleiben für die Ausbildung der Motivations- und
Einstellungskomplexe, die der Einschätzung des Werts und der Chancen literaten Handelns
zugrunde liegen. Ist diese Vermutung haltbar, wird eine schulische Praxis, die vor allem die
21
Im Alltag der Schule sind die Inhalte und ihre Komplexität, v.a. in den Sachfächern, meist im Vordergrund. Es
ist leicht zu vergessen, dass für die Meisterung dieser Komplexität sprachliche Darstellungsmittel für die Erfassung
fachspezifischer Beschreibungs-, Denk- und Argumentationsweisen notwendig sind. Dazu gehören nicht nur
Fachbegriffe, sondern auch fachspezifische Formulierungsroutinen. Die Inhalte sind ohne solche Hilfsmittel kaum
zugänglich und schon gar nicht reproduzierbar.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 16
‘technischen’ Seiten der Textkompetenz betont, möglicherweise viele Schülerinnen und Schüler
nicht erreichen, wenn diese das in diesen schulischen Verfahren steckende Potenzial sinnvoller
sozialer Praxis nur schwer entdecken können.22
b) Die Auffassung von Textkompetenz, die ich hier skizziert habe, kommt im Unterricht aufgrund
der traditionell verfestigten Verfahren der Textarbeit auch dann zum Tragen, wenn die von den
Lehrkräften eingesetzten Fragestellungen und die Kriterien der Bewertung eher implizit als
explizit, eher unscharf als präzise sind. Dies ist, zumindest meiner Einschätzung nach, des
öfteren der Fall. Die Ansprüche an die Textarbeit werden auch so merkbar, allerdings verlieren
die didaktischen Zugänge dadurch ihre Prägnanz und Flexibilität. Der wahrscheinliche Effekt
dieses Umstands ist, dass sich die kompetenteren Schülerinnen und Schüler wohl auch
aufgrund eines solchen ‘verwischten’ Inputs ihren Reim auf die Sache machen können,
während sich für andere kein klares Bild ergibt oder sie ganz den Faden verlieren. Erkennbarkeit
und ‘Lesbarkeit’ textueller Indizien hängt von einsichtsvollen und nachvollziehbaren
Fragestellungen ab; die Sinnhaftigkeit der textbezogenen Arbeit ist ohne diese Voraussetzung
gerade für diese Gruppen gefährdet (zu den hier auf dem Spiel stehenden Dingen vgl. Hornung
2002, Bräuer 1998, Kern 2000).
c) Die Schreib-, Lese- und Unterrichtsforschung der letzten Jahrzehnte hat viele Einsichten
gewonnen. Trotzdem besteht noch ein großer Mangel an handfesten Erkenntnissen gerade in
Bezug auf die eben angesprochenen Bereiche. So wird weitherum angenommen (meines
Erachtens zu Recht), dass literarische Texte besonders viele Möglichkeiten bieten, Brücken zu
bauen – nicht nur in den ersten Schuljahren, sondern durch die ganze Schulzeit hindurch, und
dass die zwei eben genannten Gesichtspunkte nicht nur hier, aber vor allem hier auf
paradigmatische Weise didaktisch artikuliert werden können. Und in den letzten Jahren hat
sich bei vielen LehrerInnen ein Konsens darüber gebildet, dass holistische, imitative etc.
Verfahren des Textunterrichts besonders fruchtbar sind. Ob es sich in beiden Bereichen
wirklich so verhält, ist die eine Frage (allerdings eine, die so allgemein wohl kaum beantwortet
werden kann). Wichtiger und interessanter wäre es, detailliert in Erfahrung zu bringen, welche
beeinflussbaren Faktoren in diesen Feldern besonders geeignet sind, reiche und differenzierte
Texterfahrungen zu ermöglichen, und wie diese in der weiteren literaten Praxis aktiv und
wirksam gehalten werden können (vgl. dazu v.a. Schmölzer-Eibinger 2002 und i.V.).
6 Zum Abschluss
Ich habe versucht, das Konzept der Textkompetenz zu klären und sie gleichzeitig in einem
größeren Kontext zu situieren. Dabei sollte deutlich geworden sein, wie wichtig und wie dringlich
die Auseinandersetzung mit dem Thema ist, sowohl auf didaktischer wie auf wissenschaftlicher
Ebene. Es geht hier um ein zentrales und wohlbekanntes Element von Bildung und
Bildungsprozessen, das aufgrund neuer Ansätze in Linguistik, Psychologie und Didaktik auf neue
Weise beschreibbar gemacht worden ist und auf dieser Basis eine Vielzahl von Facetten und
Zusammenhängen auf teilweise andere Weise zu sehen erlaubt, als dies bisher möglich war.
22
Diese schulische Praxis ist bestimmt durch eine ‘Hingabe an die Sache’ bei meist gleichzeitiger Distanzierung von
unmittelbaren pragmatischen und partnerbezogenen Interessen und Zielen. Es ist nicht unbedingt selbstverständlich,
dass SchülerInnen neben dem intellektuellen bzw. sachbezogenen das auch in dieser Situation steckende soziale und
partnerbezogene Potenzial erkennen.
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 17
Literatur
Anderson, John R. (1983): The architecture of cognition. Harvard University Press
Augst, Gerhard (1992): Aspects of writing development in argumentative texts. In: D. Stein (ed.):
Cooperating with written text. The pragmatics and comprehension of written texts. Berlin:
Mouton de Gruyter, 67-82
Baynham, Michael (1995): Literacy practices: investigating literacy in social contexts. London:
Longman
Becker-Mrotzek, Michael; Rüdiger Vogt (2001): Unterrichtskommunikation. Linguistische
Analysemethoden und Forschungsergebnisse. Tübingen: Niemeyer
Bräuer, Gerd (1998): Schreibend lernen. Grundlagen einer theoretischen und praktischen
Sprachpädagogik. Innsbruck: StudienVerlag
Collins, James (1996): Socialization to text: structure and contradiction in schooled literacy. In:
Michael Silverstein; Greg Urban (Hg.): Natural histories of discourse. University of
Chicago Press, 203-228
Feilke, Helmut (1996): Die Entwicklung der Schreibfähigkeiten. In: Hartmut Günther; Otto
Ludwig (Hrsg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Berlin, 1178-
1191
Feilke, Helmut (2003): Textroutine, Textsemantik und sprachliches Wissen. In: Angelika Linke,
Hanspeter Ortner, Paul R. Portmann-Tselikas (Hrsg.): Sprache und mehr. Ansichten einer
Linguistik der sprachlichen Praxis. Tübingen, 209-227
Giesecke, Michael (1998): Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel. Studien zur
Vorgeschichte der Informationsgesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp (=stw 997). Zweite
Auflage.
Hasan, Ruqaiya; Geoff Williams (Hg.)(1996): Literacy in society. London: Longman
Hatch, Evelyne (1994): Discourse and language education. Cambridge University Press
Hornung, Antonie (2002): Zur eigenen Sprache finden. Modell einer plurilingualen
Schreibdidaktik. Tübingen: Niemeyer
Johnson-Laird, P.N. (1983): Mental models. Cambridge University Press
Karmiloff-Smith, Annette (1993): Beyond modularity. MIT Press
Kern, Richard (2000): Literacy and language teaching. Oxford University Press
Knapp, Werner (1997): Schriftliches Erzählen in der Zweitsprache. Tübingen: Niemeyer
Leseman, Paul (1994): Socio-cultural determinants of literacy development. In: L. Verhoeven
(ed.): Functional literacy. Theoretical issues and educational implications. Amsterdam:
John Benjamins, 163-184
Levine, K. (1994): Functional literacy in a changing world. In: L. Verhoeven (ed.): Functional
literacy. Theoretical issues and educational implications. Amsterdam: John Benjamins,
113-131
Olson, David R. (1994): Literacy and the making of the Western mind. In: L. Verhoeven (ed.):
Functional literacy. Theoretical issues and educational implications. Amsterdam: John
Benjamins, 135-150
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Zürich, 25. 10. 2005 P. R. Portmann-Tselikas 18
Pienemann, Manfred (1998): Language processing and second language development:
processability theory. Amsterdam: John Benjamins
Portmann-Tselikas, Paul R. (2001): Cognitive-academic language proficiency and language
acquisition in bilingual instruction. In: Mediterranean Journal of Studies in Education 6/1,
63-80
Portmann-Tselikas, Paul R. (2002): Textkompetenz und unterrichtlicher Spracherwerb. In: P.
Portmann-Tselikas; S. Schmölzer-Eibinger (Hg.): Textkompetenz. Neue Perspektiven für
das Lernen und Lehren. Innsbruck: Studien-Verlag, 13-44
Portmann-Tselikas, Paul R. (2006): Lehren und Lernen im Spannungsfeld von Textualität und
Textkompetenz. In: M. Scherner; A. Ziegler (Hg.): Angewandte Textlinguistik. Tübingen:
Narr, 47-61
Rau, Cornelia (1994): Revisionen beim Schreiben. Zur Bedeutung von Veränderungen in
Textproduktionsprozessen. Tübingen: Niemeyer
Scheerer, E. (1993): Mündlichkeit und Schriftlichkeit - Implikationen für die Modellierung
kognitiver Prozesse. In: J. Baurmann et al. (eds.): homo scribens. Tübingen: Niemeyer,
141-175
Schmölzer-Eibinger, Sabine (2002): Sprach- und Sachlernen in mehrsprachigen Klassen. Ein
Modell für den Unterricht. In: P.R. Portmann-Tselikas, S. Schmölzer-Eibinger (Hg.):
Textkompetenz. Neue Perspektiven für das Lernen und Lehren. Innsbruck: Studien-
Verlag, 91-125
Schmölzer-Eibinger, Sabine (in Vorb.): Lernen in der Zweitsprache. Theoretische und didaktische
Grundlagen der Förderung von Textkompetenz. Habilitationsschrift, Universität Graz
Street, Brian V. (1995): Social literacies. Critical approaches to literacy in development,
ethnography and education. London: Longman
Verhoeven, Ludo (1997): Acquisition of literacy by immigrant children. In: C. Pontecorvo (Hg.):
Writing development. Amsterdam: John Benjamins, 219-240
Wallace, Catherine (1999): Critical literacy as classroom interaction. In: BAAL 14, 58-72
Wrobel, Arne (1995): Schreiben als Handlung. Überlegungen und Untersuchungen zur Theorie der
Textproduktion. Tübingen: Niemeyer
© Paul R. Portmann-Tselikas, Universität Graz
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Macaire and Nicolas Wirtschaftsdeutsch FDokument2 SeitenMacaire and Nicolas Wirtschaftsdeutsch FFebson Lee MathewNoch keine Bewertungen
- INFO - ЭтикаDokument5 SeitenINFO - ЭтикаDaria CarutaNoch keine Bewertungen
- Facharbeit AutismusDokument31 SeitenFacharbeit AutismusGyörgyi Wlassits100% (1)
- Teil 1 2007 S 1-69Dokument69 SeitenTeil 1 2007 S 1-69birdman99Noch keine Bewertungen
- PräPosition enDokument6 SeitenPräPosition enaksrokx100% (1)
- Pluralbildung Arbeitsblatter Grammatikerklarungen - 27077Dokument3 SeitenPluralbildung Arbeitsblatter Grammatikerklarungen - 27077Nestor PerezNoch keine Bewertungen
- Barem GermanaDokument2 SeitenBarem GermanaWeb AdevarulNoch keine Bewertungen
- Dönem Almanca 5. Sinif 1. SinaviDokument3 SeitenDönem Almanca 5. Sinif 1. SinaviAlim NasirovNoch keine Bewertungen
- Felman - Im Zeitalter Der ZeugenschaftDokument11 SeitenFelman - Im Zeitalter Der ZeugenschaftSanjaminoNoch keine Bewertungen
- Westdeutsche Gesellschaft Für Familienkünde Bezirksgruppe TrierDokument12 SeitenWestdeutsche Gesellschaft Für Familienkünde Bezirksgruppe TrierJeferson Rodrigo KernNoch keine Bewertungen
- Begegnungen A1Dokument26 SeitenBegegnungen A1Марьям РамазановаNoch keine Bewertungen
- Klipper - Information Security Risk ManagementDokument207 SeitenKlipper - Information Security Risk ManagementVictor AlmazánNoch keine Bewertungen
- Aspekte Beruf Deutsch Für BerufssprachkurseDokument16 SeitenAspekte Beruf Deutsch Für BerufssprachkurseIşıl Özbek ArslanNoch keine Bewertungen
- Satzglieder 14-15Dokument3 SeitenSatzglieder 14-15Galina TanevaNoch keine Bewertungen
- Byzanz Und Das Abendland IVDokument275 SeitenByzanz Und Das Abendland IVaikateriniandritsouNoch keine Bewertungen
- Verbo SeinDokument2 SeitenVerbo SeinCarlos Hernandez Villalvilla100% (1)