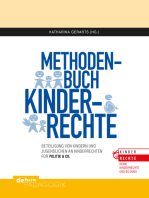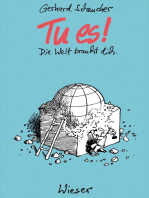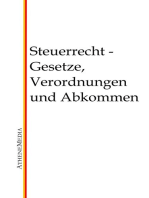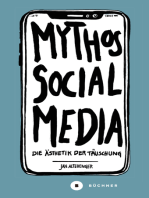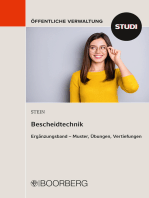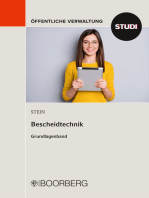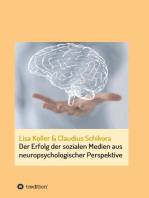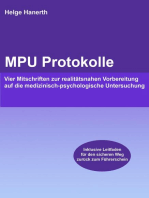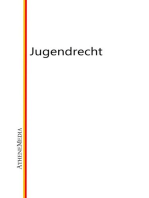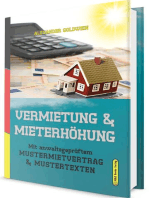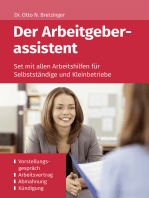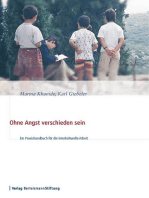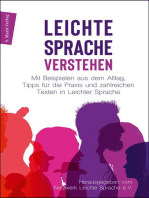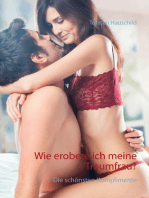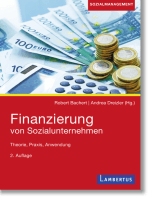Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Konzept Begleiteter Umgang
Hochgeladen von
Boris KarmelukCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Konzept Begleiteter Umgang
Hochgeladen von
Boris KarmelukCopyright:
Verfügbare Formate
itttt„
HORIZONTE
- für Familien - gemeinnützige GmbH
Begleiteter Umgang
gemäß § 18 Abs. 3 SGB VIII / KJHG
1. Die gesetzlichen Grundlagen des Begleiteten Umgangs
Das Kindschaftsrechtsreformgesetz, verabschiedet am 1. Juli 1998, besagt nach
§ 1684 Abs. 1 BGB, dass die Kinder ein Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen
haben und jeder Elternteil ist zum Umgang verpflichtet und berechtigt.
Die gesetzlichen Grundlagen für das zeitlich befristete Angebot zum Begleiteten
Umgang sind § 18, Abs. 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); § 50 KJHG;
§1684, Abs. 4, Sätze 3 und 4 im Kontext mit den §§ 1626, Abs. 3 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB); 1632 BGB; § 49 a Abs. 1, Ziffer 4 und 7 Gesetz über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) und § 52 a, Abs. 2, Satz 4
FGG. Ein Recht auf Umgang mit dem Kind haben auch die Großeltern,
Geschwister, Stiefeltern oder frühere Stiefelternteile und frühere Pflegeeltern,
wenn dies dem Wohl des Kindes entspricht.
Das Gesetz trifft keine Regelung über die Ausgestaltung des Umgangs im
Einzelfall. Die Beteiligten vereinbaren untereinander, wann, wie oft und wie lange
der Umgang stattfinden soll. Hierbei können die Beteiligten auch die Unterstützung
des sozialpädagogischen Dienstes in Anspruch nehmen. Kommt es zu keiner
Einigung, kann jeder Umgangsberechtigte einen Antrag auf Regelung des
Umgangs beim Familiengericht stellen. Das Familiengericht entscheidet nach der
jeweiligen Lage des Einzelfalles unter Beachtung der berechtigten Wünsche der
Umgangssuchenden und des Kindes.
Die Reform des Kindschaftsrechts 1998 stärkt einerseits die Elternschaft als eine
gemeinsame Aufgabe durch Einführung des gemeinsamen elterlichen Sorgerechts
als Regelfall. Andererseits erhält das Kind erstmals einen Rechtsanspruch auf
Umgang mit den Eltern. Außerdem werden die Begriffe „eheliche“ und „nicht-
eheliche“ Kinder aus der Gesetzessprache gestrichen. Das Kind kann somit
selbstständig als Subjekt handeln und wird nicht mehr nur als Objekt elterlicher
Sorge betrachtet. Diese Reform verursacht ein Ansteigen des Begleiteten
Umgangs.
2. Der Begleitete Umgang
Bei dem Begleiteten Umgang wird eine Fachkraft eingesetzt, um die Kontakte des
Kindes zum Umgangsberechtigten zu begleiten.
Der Begleitete Umgang kann auf familiengerichtliche Anordnung zustande
kommen, wobei das Gericht selbst nur in seltenen Fällen die Zeiten und den
Horizonte – für Familien – Geschäftsführung: Sitz: Handelsregister
gemeinnützige Gesellschaft mbH Frau Anne Pausewang, Tornower Weg 6 AG Berlin-Charlottenburg
St.-Nr. 27/603/54792 Frau Elke König 13439 Berlin HRB 135629
itttt„
HORIZONTE
- für Familien - gemeinnützige GmbH
Umfang des Umgangs festlegt. Legt jedoch das Gericht die Zeiten fest, ist es auf
die Mitwirkung des Jugendamtes und der umgangsbegleitenden Stelle angewiesen.
Wenn Umgangssuchende den Begleiteten Umgang wünschen, können sie die
Unterstützung des Jugendamtes in Anspruch nehmen und einen entsprechenden
Antrag stellen. Das Jugendamt prüft die Notwendigkeit des Begleiteten Umgangs
als eigenständige Jugendhilfemaßnahme (§18 Abs. 3 SGB VIII).
Die eigenständigen Interessen des Kindes werden von der Umgangsbegleitung
vertreten und bei den Umgangsmodalitäten berücksichtigt. Des Weiteren gilt für
die Umgangsbegleitung als Richtlinie „so viel wie nötig, so wenig wie möglich
präsent sein“.
2.1 Begleiteter Umgang und die Eltern
Die Trennungsproblematik der Eltern ist häufig nicht verarbeitet. Dies erschwert
die Beratung für den eigentlichen Umgang mit dem Kind. Die Fachkräfte stehen
dabei im Spannungsfeld, einerseits die Rahmenbedingungen des Auftrags BU zu
klären, andererseits die Trennungsproblematik nicht einfach ignorieren zu können.
Die erste Hilfekonferenz findet überwiegend mit beiden Elternteilen statt,
gemeinsame Beratungsgespräche sind ansonsten in der ersten Phase des BU`s
selten möglich.
Im Allgemeinen ist der Berater parteiisch für das Kind, den Eltern gegenüber wird
eine systemische Neutralität gewahrt. Die ressourcen-orientierte Einstellung der
Mitarbeiter ist für die Beratung der hochstrittigen Eltern im Kontext des
„Begleiteten Umgangs“ zentral, um ergebnisorientiert mit den Eltern arbeiten zu
können.
Die Frequenz der Beratungen mit den Eltern schwankt. Oft sind anfangs häufige
Gespräche mit dem Elternteil nötig, bei dem das Kind lebt. Es ist nicht
ungewöhnlich, dass Kinder nach dem Beginn des Begleiteten Umgangs
vorübergehend mit Verhaltensauffälligkeiten reagieren. Wir klären die betroffenen
Elternteile darüber auf und unterstützen sie in dieser schwierigen Phase durch den
lösungsorientierten systemischen Ansatz.
Sind die Kontakte mit dem Umgangsberechtigen und dem Kind etabliert, können
die Beratungen mit dem Umgangsberechtigten im Vordergrund stehen. Die Gründe
sind vielschichtig:
Wut über das nicht gemeinsame Sorgerecht
weniger wichtig für das Kind zu sein als die Mutter
Trauer, das eigene Kind nur besuchen zu dürfen
sich als Vater gesellschaftlich diskriminiert zu fühlen
Horizonte – für Familien – Geschäftsführung: Sitz: Handelsregister
gemeinnützige Gesellschaft mbH Frau Anne Pausewang, Tornower Weg 6 AG Berlin-Charlottenburg
St.-Nr. 27/603/54792 Frau Elke König 13439 Berlin HRB 135629
itttt„
HORIZONTE
- für Familien - gemeinnützige GmbH
manchmal sieht sich der Umgangsberechtigte auch damit konfrontiert, dass
es ihm schwer fällt, kindgerecht zu agieren und eine wirkliche Beziehung mit
seinem Kind einzugehen.
In Gesprächen ist es immer wieder von Nöten, die Perspektive des Kindes hervor
zu heben. Die Eltern sollen in Beratungsgesprächen dabei unterstützt werden,
ihren Kindern einen freien und offenen Kontakt zu Beiden zu ermöglichen. Kinder
fühlen sich dort aufgehoben, „wo in ihnen der getrennte Elternteil wahrgenommen
und zugelassen wird. Unabhängig davon, wie schwierig die Paarbeziehung war
oder wie die Persönlichkeit gewertet wird“1. Das Kind vereinigt immer beide
Elternteile in sich.
In Fällen, wo Kinder Erfahrungen mit häuslicher Gewalt haben, muss im Einzelfall
genau geprüft werden, ob ein Begleiteter Umgang im Sinne des Kindes und für das
Kindeswohl ist.
2.2 Begleiteter Umgang und das Kind
Die Fachkräfte des Begleiteten Umgangs, haben alle Erfahrungen (z. T. auch
umfangreiche diagnostische Erfahrungen) im Umgang mit Kindern aller
Altersstufen. Bei den ersten Kontakten mit dem Kind, aber auch für alle weiteren
Umgänge gilt, das Kind im Spielverhalten zu beobachten.
Ein Selbstverständnis der Fachkräfte ist die Partizipation von Kindern2 im Prozess
des Begleiteten Umgangs.
Bei Kindern unter neun Jahren besteht die Gefahr, bei der direkten Frage, ob es
den Kontakt wünscht, Loyalitätskonflikte zu generieren. Die Umgangsbegleitung
lernt die betroffenen Kinder vor dem eigentlichen „ersten Umgang“ kennen und
organisiert flankierend Einzeltermine mit den Kindern. Bei diesen Terminen kann
mit den Kindern Kontakt und Rückzug „spielend“ thematisiert werden. Das Kind
sollte dabei Nähe und Distanz selbst regulieren können. Meist ist der Umgang
selbst, bei guter Vorbereitung, nicht mehr das Problem, entscheidend ist, was
danach zu Hause passiert.
3. Ziele des Begleiteten Umgangs
Das Ziel der Umgangsbegleitung ist zunächst die Anbahnung, Wiederherstellung
oder Weiterführung der Kontakte zwischen Kind und Umgangssuchenden.
Weitere Ziele des Begleiteten Umgangs sind immer fallabhängig und in
Kooperation mit allen Beteiligten zum Wohle des Kindes zu entwickeln.
Insbesondere sollen die Kompetenzen der Eltern dahingehend gefördert und
gestärkt werden, so dass sie zukünftig selbstständig und eigenverantwortlich in
der Lage sind, den Umgang mit ihrem Kind zu gestalten.
1
Karl Blesken, Berlin, psychomed 10/4, 236-243 (1998)
2
Albert Lenz, Partizipation von Kindern in Beratung und Therapie, (2001) Juventa
Horizonte – für Familien – Geschäftsführung: Sitz: Handelsregister
gemeinnützige Gesellschaft mbH Frau Anne Pausewang, Tornower Weg 6 AG Berlin-Charlottenburg
St.-Nr. 27/603/54792 Frau Elke König 13439 Berlin HRB 135629
itttt„
HORIZONTE
- für Familien - gemeinnützige GmbH
Folgende Ziele sind durch den Begleiteten Umgang anzustreben:
Sensibilisierung aller Beteiligten für die Belange des Kindes
Unterstützung aller Beteiligten, dass zukünftig der Umgang auch ohne
Begleitung durchgeführt werden kann
Förderung der Identitätsbildung des Kindes
Organisation und Gestaltung der Kontakte werden mit den Bedürfnissen
aller Beteiligten abgestimmt
Kontaktaufnahme zwischen den Eltern fördern, um gemeinsam
Absprachen zum Wohle des Kindes zu treffen
Entwicklung und Konsolidierung der emotionalen und sozialen
Beziehungen zwischen den Umgangsberechtigten
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, damit es sein
Befinden und seine Bedürfnisse allen Beteiligten gegenüber äußern kann
4. Arbeitsschritte
getrennte Vorgespräche mit beiden Eltern anhand eines entwickelten
Elterngesprächsleitfaden, um die Erwartungen und Wünsche der Eltern
zu erheben
gemeinsames Gespräch mit beiden Eltern. Bei ehemals gewalttätigen
Übergriffen zwischen den Eltern wird im Einzelfall davon Abstand
genommen
die Umgangsmodalitäten werden mit den Eltern und der Fachkraft
besprochen, schriftlich fixiert und dementsprechend wird der Umgang
durchgeführt
die vorläufigen erarbeiteten Umgangsmodalitäten werden durch
Kontrakte mit beiden Elternteilen bzw. mit den Beteiligten des Umgangs
untermauert und in einem kontinuierlichen Prozess der jeweiligen
Situation sinnvoll angepasst
Kontaktaufnahme mit dem Kind
das Kind wird auf die Umgangskontakte vorbereitet
gemeinsame oder getrennte Beratungsgespräche über den Verlauf des
Umgangs, anzustreben sind gemeinsame Gespräche
der Verlauf des Begleiteten Umgangs wird protokollarisch dokumentiert
Horizonte – für Familien – Geschäftsführung: Sitz: Handelsregister
gemeinnützige Gesellschaft mbH Frau Anne Pausewang, Tornower Weg 6 AG Berlin-Charlottenburg
St.-Nr. 27/603/54792 Frau Elke König 13439 Berlin HRB 135629
itttt„
HORIZONTE
- für Familien - gemeinnützige GmbH
gemeinsame Abschlussgespräche mit beiden Eltern, im Einzelfall auch
getrennte Abschlussgespräche
die erarbeiteten Vereinbarungen der Eltern werden im Abschlussgespräch
schriftlich fixiert und unterschrieben
über den Prozess des Umgangs wird spätestens nach sechs Monaten ein
Zwischenbericht angefertigt
bei Konflikten nach dem bewilligten Zeitraum des Begleiteten Umgangs
kann mit dem Jugendamt über weitere angemessene Maßnahmen
beraten werden
der Begleitete Umgang endet mit einem Abschlussbericht.
Bestehen beim Sorgeberechtigten oder Umgangssuchenden Unklarheiten über
psychische Belastungen des Kindes, setzt sich die Fachkraft von Horizonte e. V.
mit
dem zuständigen Sozialarbeiter vom sozialpädagogischen Dienst in Verbindung,
um das weitere Vorgehen zu besprechen. In begründeten Fällen können das Kind
und die Umgangssuchenden an den dafür zuständigen Fachdienst weiter
verwiesen werden.
4. Formen des Begleiteten Umgangs
Neben dem regulären Begleiteten Umgang bietet Horizonte gGmbH
verschiedene zeitlich begrenzte Interventionsformen der Umgangsbetreuung bei
folgenden Fallkonstellationen an:
Betreute Umgangsanbahnung
Ist eine kurzfristige Unterstützungsintervention für Familien, bei denen es zu
längeren Kontaktunterbrechungen zwischen Kind und Umgangssuchenden
kam.
Betreute Übergabe
Ein Angebot für Familien, bei denen es in Übergabesituationen wiederholt zu
Auseinandersetzungen zwischen den Eltern kam.
Kontrollierter Umgang
Bei dem kontrollierten Umgang ist die Anwesenheit einer Fachkraft wegen
vorhandener oder möglicher Kindeswohlgefährdung (z. B. Kindes-
misshandlung, sexueller Missbrauch) zwingend. Hier gilt es, die
Beeinflussung des Kindes durch den Umgangssuchenden (z. B. Widerruf
einer den Umgangssuchenden belastenden Aussage) zu erkennen und
auszuschließen. Bei einem kontrollierten Umgang werden immer zwei
Fachkräfte für Co-Beratungen eingesetzt. (siehe Anhang)
Horizonte – für Familien – Geschäftsführung: Sitz: Handelsregister
gemeinnützige Gesellschaft mbH Frau Anne Pausewang, Tornower Weg 6 AG Berlin-Charlottenburg
St.-Nr. 27/603/54792 Frau Elke König 13439 Berlin HRB 135629
itttt„
HORIZONTE
- für Familien - gemeinnützige GmbH
Mögliche Ausschlussfaktoren des Begleiteten Umgangs
Ausschlussfaktoren, die für die Mitarbeiter von Horizonte – evtl. auch nur
vorübergehend – einen Entzug des Umgangsrechts erfordern, sind:
Wenn sich das Umgangskind anhaltend weigert, den Umgangssuchenden zu
sehen (wenn PAS ausgeschlossen werden kann)
wiederholten offensichtlichen Alkoholkonsum (oder auch andere Drogen) des
Umgangssuchenden kurz vor oder während des Umgangs
gewalttätige Übergriffe auf das Umgangskind oder der Umgangsbegleitung.
5. Rahmenbedingungen
Ort : Der Begleitete Umgang findet in den Räumen des Trägers Tornower Weg 6,
13439 Berlin statt.
In Absprache mit dem Jugendamt, der Fachkraft, den Umgangssuchenden und mit
den Umgangsgewährenden kann auch ein anderer Ort vorgeschlagen werden.
Dauer: Zunächst sind sechs Monate vorgesehen, aber in der Regel werden 12
Monate berücksichtigt.
Umfang:
In der Regel werden für den Begleiteten Umgang ein 90 Stundenkontingent für
sechs Monate veranschlagt. Eine Co-Beratung wird bei Bedarf in Absprache mit
dem Jugendamt installiert. Des Weiteren können in begründeten Fällen
psychologische Leistungen gewährt werden. Bei Fallkonstellationen, bei der ein
Elternteil psychisch erkrankt ist, bedarf es ebenfalls ein höherer Zeitaufwand. Die
entsprechenden Modalitäten werden mit dem Jugendamt verhandelt.
Der Stundenumfang beinhaltet regelmäßig einen Anteil von 85% fallbezogenen
Tätigkeiten einschließlich Beratung der Eltern, Vor- und Nachbereitung,
Fallbesprechung, Supervision, Teambesprechung, kollegiale Beratung und
Falldokumentation. Einen Anteil von 15 % für die nicht fallbezogene Tätigkeiten
aber zur Qualitätssicherung notwendige Aktivitäten beinhaltet Umfeldarbeit,
Qualitätsentwicklung, Fortbildung und Kontakte mit Kooperationspartnern im
sozialen Umfeld.
Kosten: Die Senatsverwaltung von Berlin hat eine Leistungsbeschreibung mit
Entgeltvereinbarung von 48,98 Euro pro Fachleistungsstunde vorgelegt.
7 Qualitätsentwicklung
Horizonte gGmbH. strebt bei dem Begleiteten Umgang eine Qualitätsentwicklung
mit einem prozesshaften Charakter und eine auf Überprüfung und Verbesserung
Horizonte – für Familien – Geschäftsführung: Sitz: Handelsregister
gemeinnützige Gesellschaft mbH Frau Anne Pausewang, Tornower Weg 6 AG Berlin-Charlottenburg
St.-Nr. 27/603/54792 Frau Elke König 13439 Berlin HRB 135629
itttt„
HORIZONTE
- für Familien - gemeinnützige GmbH
von Qualität ausgerichtete Aktivität an. In einem Qualitätshandbuch hat Horizonte
die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität beschrieben. Evaluationsbögen sind
im Arbeitskreis BU von Berlin in Zusammenarbeit mit dem Senat entwickelt
worden.
Qualifikation der Mitarbeiter
Die Mitarbeiter von Horizonte gGmbH, die den Begleiteten Umgang betreuen, sind
von der Grundqualifikation berufserfahrene Sozialarbeiter, Sozialpädagogen oder
Diplom-Psychologen mit Zusatzqualifikationen wie Familientherapie, systemischer
Berater, Mediationsausbildung, oder haben eine Weiterbildung für den Begleiteten
Umgang absolviert.
8 Sozialdatenschutz
Der Begleitete Umgang ist eine Maßnahme nach dem SGB VIII. Träger, die
Aufgaben nach dem SGB VIII wahrnehmen, müssen die aufgeführten
Bestimmungen zum Schutz der Sozialdaten bei ihrer Erhebung, Nutzung und
Verarbeitung in der Jugendhilfe (§35 SGB I, §§ 67 bis 85 a des SGB X und §§ 61
bis 68 SGB VIII) gewährleisten.
Zu jeder Zeit dürfen nach § 62 SGB VIII Sozialdaten nur erhoben werden, wenn
das Wissen darum zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.
Für die Berichterstattung gilt der § 65 SGB VIII. Der Paragraph besagt, dass die
Weitergabe von Sozialdaten an Dritte nur mit Einwilligung desjenigen möglich ist,
der die Daten anvertraut hat. Die Umgangsbegleitung wird deshalb die
angefertigten Berichte mit den Eltern besprechen jedoch nicht an sie aushändigen.
Um qualitativ gute Arbeit leisten zu können, werden die Eltern zusätzlich um eine
Schweigepflichtentbindung für eine prozessbegleitende Supervision gebeten.
Nach § 50 Abs. 3 SGB VIII können jedoch Daten an das Vormundschafts- oder
Familiengericht ohne Einwilligung weitergegeben werden, wenn eine
Kindeswohlgefährdung besteht.
Horizonte – für Familien – Geschäftsführung: Sitz: Handelsregister
gemeinnützige Gesellschaft mbH Frau Anne Pausewang, Tornower Weg 6 AG Berlin-Charlottenburg
St.-Nr. 27/603/54792 Frau Elke König 13439 Berlin HRB 135629
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Regelungsaufgabe Vaterstellung: Was kann, was darf, was will der Staat?Von EverandRegelungsaufgabe Vaterstellung: Was kann, was darf, was will der Staat?Noch keine Bewertungen
- Kinderschutz Leitfaden Gefluechtete Menschen PDFDokument26 SeitenKinderschutz Leitfaden Gefluechtete Menschen PDFIvaBubaloNoch keine Bewertungen
- Eine exemplarische qualitative Studie zu Belastungen von Kindern der ersten KlasseVon EverandEine exemplarische qualitative Studie zu Belastungen von Kindern der ersten KlasseNoch keine Bewertungen
- Methodenbuch Kinderrechte: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an KinderrechtenVon EverandMethodenbuch Kinderrechte: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an KinderrechtenNoch keine Bewertungen
- Instrumentalisierte Verantwortung?: Entstehung und Motive des »Business Case for CSR« im deutschen Diskurs unternehmerischer VerantwortungVon EverandInstrumentalisierte Verantwortung?: Entstehung und Motive des »Business Case for CSR« im deutschen Diskurs unternehmerischer VerantwortungNoch keine Bewertungen
- Lobbyarbeit: Praxis, Regeln und Akteure – Politik mitgestaltenVon EverandLobbyarbeit: Praxis, Regeln und Akteure – Politik mitgestaltenNoch keine Bewertungen
- Kinderarmut bekämpfen - Armutskarrieren verhindern: Ausgabe 3/2019 - Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen ArbeitVon EverandKinderarmut bekämpfen - Armutskarrieren verhindern: Ausgabe 3/2019 - Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen ArbeitNoch keine Bewertungen
- Experimentieren mit Färberpflanzen Heft 2: Aufgaben und Experimentierkarten für die Sekundarstufe 1Von EverandExperimentieren mit Färberpflanzen Heft 2: Aufgaben und Experimentierkarten für die Sekundarstufe 1Noch keine Bewertungen
- WOW! – Optische Täuschungen: Spiele, Wissen und Experimente zum SelbermachenVon EverandWOW! – Optische Täuschungen: Spiele, Wissen und Experimente zum SelbermachenNoch keine Bewertungen
- Eigentumswohnung: Suchen, kaufen, wohnen: Das große PraxishandbuchVon EverandEigentumswohnung: Suchen, kaufen, wohnen: Das große PraxishandbuchNoch keine Bewertungen
- Warum uns der Klimawandel an innere Grenzen bringt …: … und wie wir daran wachsen könnenVon EverandWarum uns der Klimawandel an innere Grenzen bringt …: … und wie wir daran wachsen könnenNoch keine Bewertungen
- Stakeholder identifizieren und managen im Market Access-Prozess: Herausforderungen für deutsche Pharmaunternehmen nach der Einführung des AMNOGVon EverandStakeholder identifizieren und managen im Market Access-Prozess: Herausforderungen für deutsche Pharmaunternehmen nach der Einführung des AMNOGNoch keine Bewertungen
- Die Aktualität bürgerlicher und politischer Menschenrechte: zeitschrift für menschenrechte 2/2021Von EverandDie Aktualität bürgerlicher und politischer Menschenrechte: zeitschrift für menschenrechte 2/2021Noch keine Bewertungen
- Tierischer Stress mit dem Vermieter: Rechte durchsetzen, Konflikte lösen, Prozesse vermeidenVon EverandTierischer Stress mit dem Vermieter: Rechte durchsetzen, Konflikte lösen, Prozesse vermeidenNoch keine Bewertungen
- ZUR LEBENSBEWÄLTIGUNG TRAUMATISIERTER FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN SOZIALER ARBEIT: Unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten und Grenzen Sozialer ArbeitVon EverandZUR LEBENSBEWÄLTIGUNG TRAUMATISIERTER FLÜCHTLINGE IN DEUTSCHLAND UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN SOZIALER ARBEIT: Unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten und Grenzen Sozialer ArbeitNoch keine Bewertungen
- Kindeswohlgefährdungen – Jugendämter und Schulen: Leitfaden für eine verbesserte Zusammenarbeit der SchnittstelleVon EverandKindeswohlgefährdungen – Jugendämter und Schulen: Leitfaden für eine verbesserte Zusammenarbeit der SchnittstelleNoch keine Bewertungen
- Bescheidtechnik: Ergänzungsband - Muster, Übungen, VertiefungenVon EverandBescheidtechnik: Ergänzungsband - Muster, Übungen, VertiefungenNoch keine Bewertungen
- Läuft bei mir (nicht) - Wie du deiner Depression auf die Nerven gehstVon EverandLäuft bei mir (nicht) - Wie du deiner Depression auf die Nerven gehstNoch keine Bewertungen
- ‚Sex-sells‘ als Werbetrend: Eine Untersuchung von Text und Bild in Hinblick auf die erfolgreiche Werbestrategie ‚Sex-sells‘Von Everand‚Sex-sells‘ als Werbetrend: Eine Untersuchung von Text und Bild in Hinblick auf die erfolgreiche Werbestrategie ‚Sex-sells‘Noch keine Bewertungen
- A Perfect Match?: Online-Partnersuche aus psychologischer SichtVon EverandA Perfect Match?: Online-Partnersuche aus psychologischer SichtNoch keine Bewertungen
- Resilienz in der Sozialpädagogik: Möglichkeiten der ResilienzförderungVon EverandResilienz in der Sozialpädagogik: Möglichkeiten der ResilienzförderungNoch keine Bewertungen
- Das Geheimnis der positiven Ausstrahlung: Sympathisch, souverän und selbstbewusst in sieben SchrittenVon EverandDas Geheimnis der positiven Ausstrahlung: Sympathisch, souverän und selbstbewusst in sieben SchrittenNoch keine Bewertungen
- Anwendungsfelder der Blockchain bei Immobilientransaktionen. Wie eine disruptive Technologie Immobilientransaktionen revolutionieren könnteVon EverandAnwendungsfelder der Blockchain bei Immobilientransaktionen. Wie eine disruptive Technologie Immobilientransaktionen revolutionieren könnteNoch keine Bewertungen
- Der Erfolg der sozialen Medien aus neuropsychologischer PerspektiveVon EverandDer Erfolg der sozialen Medien aus neuropsychologischer PerspektiveNoch keine Bewertungen
- Kunsttherapie in der Onkologie. Visionäre Klinische Sozialarbeit bei Frauen mit Diagnose MammakarzinomVon EverandKunsttherapie in der Onkologie. Visionäre Klinische Sozialarbeit bei Frauen mit Diagnose MammakarzinomNoch keine Bewertungen
- Erbschaftsteuer in Deutschland: Pro und Contra einer RegionalisierungVon EverandErbschaftsteuer in Deutschland: Pro und Contra einer RegionalisierungNoch keine Bewertungen
- Best Ager: Anforderungen an die Produkt- und Kommunikationspolitik von UnternehmenVon EverandBest Ager: Anforderungen an die Produkt- und Kommunikationspolitik von UnternehmenNoch keine Bewertungen
- Teamentwicklung: kindergarten heute leiten kompaktVon EverandTeamentwicklung: kindergarten heute leiten kompaktNoch keine Bewertungen
- Organisationsgebundene pädagogische Professionalität: Initiierter Wandel – Theoretisches Konstrukt – Narrative Methodologie – InterpretationVon EverandOrganisationsgebundene pädagogische Professionalität: Initiierter Wandel – Theoretisches Konstrukt – Narrative Methodologie – InterpretationNoch keine Bewertungen
- Medienarbeit 2.0: Cross-Media-Lösungen. Das Praxisbuch für PR und Journalismus von morgenVon EverandMedienarbeit 2.0: Cross-Media-Lösungen. Das Praxisbuch für PR und Journalismus von morgenNoch keine Bewertungen
- Eichhörnchen; das: Verbreitungsgebiet: weltweit; oft in unmittelbarer Nähe von Menschen mit einer ADHS kurz für: Aufmerksamkeitsdefizit-/HyperaktivitätsstörungVon EverandEichhörnchen; das: Verbreitungsgebiet: weltweit; oft in unmittelbarer Nähe von Menschen mit einer ADHS kurz für: Aufmerksamkeitsdefizit-/HyperaktivitätsstörungNoch keine Bewertungen
- MPU Protokolle: Vier Mitschriften zur realitätsnahen Vorbereitung auf die medizinisch-psychologische UntersuchungVon EverandMPU Protokolle: Vier Mitschriften zur realitätsnahen Vorbereitung auf die medizinisch-psychologische UntersuchungBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Vermietung & Mieterhöhung: Mit anwaltsgeprüftem Mustermietvertrag & MustertextenVon EverandVermietung & Mieterhöhung: Mit anwaltsgeprüftem Mustermietvertrag & MustertextenNoch keine Bewertungen
- MPU-Selbsthilfe: 4. Band MPU-Labor-Wegweiser: Alkohol und/oder DrogenVon EverandMPU-Selbsthilfe: 4. Band MPU-Labor-Wegweiser: Alkohol und/oder DrogenNoch keine Bewertungen
- Die Stunde der Sieger - Achtsamkeit statt Kampf: Psychologie Fokus & Klarheit, emotionale Intelligenz Selbstliebe & Führung lernen, Anti-Stress-Kompetenz & Resilienz trainierenVon EverandDie Stunde der Sieger - Achtsamkeit statt Kampf: Psychologie Fokus & Klarheit, emotionale Intelligenz Selbstliebe & Führung lernen, Anti-Stress-Kompetenz & Resilienz trainierenNoch keine Bewertungen
- Geldwende: Geld und Geldschöpfung auf der realen EbeneVon EverandGeldwende: Geld und Geldschöpfung auf der realen EbeneNoch keine Bewertungen
- Der Arbeitgeberassistent: Set mit allen Arbeitshilfen für Selbstständige und KleinbetriebeVon EverandDer Arbeitgeberassistent: Set mit allen Arbeitshilfen für Selbstständige und KleinbetriebeNoch keine Bewertungen
- WhatsApp - optimal nutzen - 3. Auflage - neueste Version 2020 mit allen Funktionen anschaulich erklärtVon EverandWhatsApp - optimal nutzen - 3. Auflage - neueste Version 2020 mit allen Funktionen anschaulich erklärtNoch keine Bewertungen
- Ohne Angst verschieden sein: Ein Praxishandbuch für die interkulturelle ArbeitVon EverandOhne Angst verschieden sein: Ein Praxishandbuch für die interkulturelle ArbeitNoch keine Bewertungen
- Simplicity - Die Kunst, die Komplexität zu reduzierenVon EverandSimplicity - Die Kunst, die Komplexität zu reduzierenNoch keine Bewertungen
- LEICHTE SPRACHE verstehen: Mit Textbeispielen aus dem Alltag und Tipps für die Praxis in leichter SpracheVon EverandLEICHTE SPRACHE verstehen: Mit Textbeispielen aus dem Alltag und Tipps für die Praxis in leichter SpracheNoch keine Bewertungen
- Wie erobere ich meine Traumfrau?: Die schönsten KomplimenteVon EverandWie erobere ich meine Traumfrau?: Die schönsten KomplimenteNoch keine Bewertungen
- Zeig mal: Gesten: Hände in der nonverbalen KommunikationVon EverandZeig mal: Gesten: Hände in der nonverbalen KommunikationNoch keine Bewertungen
- Finanzierung von Sozialunternehmen: Theorie, Praxis, AnwendungVon EverandFinanzierung von Sozialunternehmen: Theorie, Praxis, AnwendungNoch keine Bewertungen
- Systematische Übersichtsarbeiten Zu Fragen Der Therapie Und Prävention: Teil 1 - Was Ist Eine Systematische Übersichtsarbeit?Dokument3 SeitenSystematische Übersichtsarbeiten Zu Fragen Der Therapie Und Prävention: Teil 1 - Was Ist Eine Systematische Übersichtsarbeit?SimonCheKNoch keine Bewertungen
- Master ThesisDokument99 SeitenMaster ThesishorstgunterzumretzulNoch keine Bewertungen
- Uebung 1. Einheit Mit LoesungenDokument35 SeitenUebung 1. Einheit Mit LoesungenMarkus StahlNoch keine Bewertungen
- Kurzfassung Konzept Sexualpädagogik 141003Dokument3 SeitenKurzfassung Konzept Sexualpädagogik 141003Juhári ÉvaNoch keine Bewertungen
- Kindeswohlgefährdung Nach 1666 BGB Und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)Dokument924 SeitenKindeswohlgefährdung Nach 1666 BGB Und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)Boris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Rassismus in Deutschland 2023Dokument104 SeitenRassismus in Deutschland 2023Boris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Kindschaftssachen Und Häusliche Gewalt Umgang, Elterliche Sorge, Kindeswohlgefährdung, FamilienverfahrensrechtDokument149 SeitenKindschaftssachen Und Häusliche Gewalt Umgang, Elterliche Sorge, Kindeswohlgefährdung, FamilienverfahrensrechtBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Broschüre DeutschDokument24 SeitenBroschüre DeutschBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Sexuelle Gewalt An Kindern: Information, Hilfsangebote, PräventionDokument27 SeitenSexuelle Gewalt An Kindern: Information, Hilfsangebote, PräventionBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Kindeswohlgefährdung Nach 1666 BGB Und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)Dokument924 SeitenKindeswohlgefährdung Nach 1666 BGB Und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)Boris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Mutig Fragen - Besonnen HandelnDokument100 SeitenMutig Fragen - Besonnen HandelnBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Zustandsbericht Zur Lage Im Familienrecht in DeutschlandDokument83 SeitenZustandsbericht Zur Lage Im Familienrecht in DeutschlandBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Nach Auswertungen Des Bundeskriminalamtes Sind 2018 Bundesweit 26 362 Männer Opfer Von Partnerschaftsgewalt GewordenDokument10 SeitenNach Auswertungen Des Bundeskriminalamtes Sind 2018 Bundesweit 26 362 Männer Opfer Von Partnerschaftsgewalt GewordenBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Sexueller Kindesmissbrauch: Erkennen - Verstehen - VorbeugenDokument60 SeitenSexueller Kindesmissbrauch: Erkennen - Verstehen - VorbeugenBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- OLG Braunschweig, Beschluss Vom 20.05.2020 - 1 UF 51 - 20 - OpenJurDokument3 SeitenOLG Braunschweig, Beschluss Vom 20.05.2020 - 1 UF 51 - 20 - OpenJurBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- LUSTRATION Oder Die Ukraine Unter Der KGB-Macht (In German)Dokument56 SeitenLUSTRATION Oder Die Ukraine Unter Der KGB-Macht (In German)Boris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Zu Den Zusammenhängen Zwischen Paraphilen Störungen, Persönlichkeitsstörungen Und SexualdelinquenzDokument9 SeitenZu Den Zusammenhängen Zwischen Paraphilen Störungen, Persönlichkeitsstörungen Und SexualdelinquenzBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Hintergründe Und Deliktstrukturen Von Straftaten Durch FrauenDokument11 SeitenHintergründe Und Deliktstrukturen Von Straftaten Durch FrauenBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Streik DW Wirtschaf 280525g BlackDokument1 SeiteStreik DW Wirtschaf 280525g BlackBoris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Expertise HäufigkeitsangabenDokument82 SeitenExpertise Häufigkeitsangabenprospero1900Noch keine Bewertungen
- Eltern-Kind-Entfremdungs Studie 2020Dokument48 SeitenEltern-Kind-Entfremdungs Studie 2020Boris KarmelukNoch keine Bewertungen
- Витрати на родину з однією дитиною: ШвейцаріяDokument1 SeiteВитрати на родину з однією дитиною: ШвейцаріяBoris KarmelukNoch keine Bewertungen