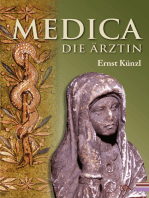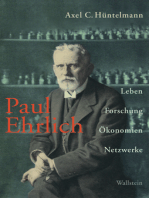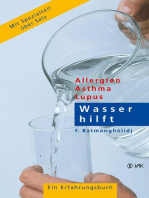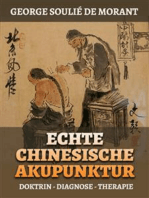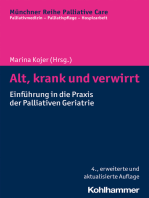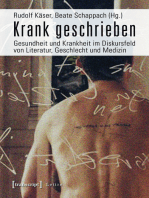Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Wiener Medizin Und Universität
Hochgeladen von
Anna S0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
63 Ansichten5 SeitenGeschichte der Wiener Medizin
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
DOCX, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenGeschichte der Wiener Medizin
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
63 Ansichten5 SeitenWiener Medizin Und Universität
Hochgeladen von
Anna SGeschichte der Wiener Medizin
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 5
MED07
DIE HOHE SCHULE DER MEDIZIN
Nur sehr wohlhabende Wiener konnten sich einen akademisch gebildeten Arzt leisten. Diese
Puechärzte waren allerdings nur theoretisch anhand von alten Lehrbüchern geschult.
Von Anna Ehrlich.
Die Universität
Ursprünglich war die Ausübung der Heilkunst Sache der Geistlichkeit. Seit dem 13. Jahrhundert übten
schon häufig auch Laien den Arztberuf aus. Einige kamen von den Universitäten Padua, Bologna und
Paris. Der erste bedeutendere Arzt war der Dichter Heinrich von Neustadt, der seit 1312 in Wien
lebte. Nach dem Prager Vorbild seines Schwiegervaters Kaiser Karls IV. schritt Herzog Rudolf IV.
mit seinen Brüdern Albrecht III. und Leopold III. am 12. März 1365 zur Gründung einer eigenen
Wiener Universität mit drei Fakultäten (Artes Liberales, Jurisprudenz und Medizin). Albrecht III.
reformierte und erweiterte sie im Jahre 1384 durch die Gründung der Theologischen Fakultät und die
Stiftung des Collegium ducale, des ersten Wiener Universitätsgebäudes (Postgasse 7–9). Das
päpstliche Schisma von 1378 kam ihm zugute, da es zahlreiche Gelehrte zur Abwanderung aus Paris
veranlasste. Einige wählten Wien als neue Wirkungsstätte, darunter die Mediziner Hermann Lurcz
aus Nürnberg und Hermann von Treysa aus Hessen.
Rund um das Collegium ducale entstand ein lateinisches Quartier, wie man das Studentenviertel
nannte. Die Burschen lebten in Bursen, einer Art von Studentenheimen, sie genossen viele Privilegien,
waren allerdings bei den Wienern wegen ihres oft schlechten Benehmens nicht allzu beliebt. Die
Beziehungen der medizinischen Fakultät zu Kirche, Landesfürst und Stadt, ferner zu anderen
europäischen Universitäten sind aus den Fakultätsakten (Acta Facultatis Medicae) ersichtlich, die ab
1399 von den Dekanen laufend verfasst wurden. Aus ihnen erfährt man viel Wissenswertes über den
Alltag an der Fakultät und ihre Rolle im Gesundheitswesen.
Von einer wissenschaftlich-medizinischen Lehre kann in Österreich erst seit 1394 gesprochen werden,
als Galeazzo de Santa Sofia aus Padua zum Leibarzt Herzog Albrechts IV. und an die Universität
berufen wurde. Galeazzos Vater (oder er selbst) verfasste eine Schrift über die Pest, in der er gegen
den Aderlass als Therapie auftrat, womit er damals ziemlich alleine stand. Er wies bereits auf die
Gefahr einer Einschleppung durch den Handel hin. Galeazzo führte das Studium der Pflanzen am
Objekt ein und unternahm mit seinen Studenten Herbulationen, botanische Exkursionen. Weiters
führte er die Anatomie als Lehrgegenstand ein und leitete 1404 die erste Wiener Leichensektion, was
im gesamten deutschsprachigen Raum ein Novum darstellte. Ein in der Vorhalle des Singertores von
St. Stefan entdecktes Wandgemälde zeigt ihn kniend vor der thronenden Madonna mit Kind. Sein
Schüler Johannes Aygel setzte sein Werk fort. Der selbstbewusste Karrieremensch Hans
Spießheimer, besser bekannt als Johannes Cuspinian (+1529) war für seine Beredsamkeit bekannt,
die er allerdings nicht an die Studenten verschwendete. Als glühender Anhänger und Leibarzt von
Kaiser Maximilian I. wurde er Vorsitzender des Geheimen Rates des Kaisers. Er war zweimal als
Gesandter in Ungarn unterwegs, wo er die Doppelhochzeit zwischen Habsburgern und Jagellonen
vorbereitete. Während einer Pestepidemie verließ er die Stadt. Auch Wolfgang Lazius (+1565) war
Professor und kaiserlicher Leibarzt, hatte aber als Militärarzt und in Wiener Neustadt zumindest
praktische Erfahrungen gesammelt. Seine Bedeutung lag jedoch ebenfalls nicht auf medizinischem
Gebiet: Ihm ist die älteste zusammenfassende Wiener Stadtgeschichte Vienna Austriae zu verdanken.
Das Studium
Den Vorlesungen konnte jeder beiwohnen, sie waren kostenlos. Selbst mechanici (Chirurgen) durften
nicht abgewiesen werden. Gelesen wurde über die praktische Heilkunst mit Harnschau, Fieberlehre
und Aderlass, die Lehre von den Gegengiften und Elementen (Säften, Temperamenten),
Gesundheitslehre, die Lehre von den Pulsen und schließlich Anatomie. Die dabei verwendeten Werke
stammten von Hippokrates und Galen, meist aus ins Lateinische übersetzten Bearbeitungen syrischer
(Johannicius), arabischer (Avicenna), persischer (Rhazes) und spanischer (Villanova) Autoren und
natürlich der Vortragenden selbst. Medizinische Fragen und Probleme aller Art versuchte man mit
Hilfe der Autoren theoretisch zu lösen, niemals am Krankenbett. Ob Studenten damals überhaupt
Zutritt zu den Spitälern hatten, ist nicht bekannt.
Ein Student der Medizin sollte zuvor das Studium der Artes Liberales (es entsprach in etwa dem
Gymnasium) abgeschlossen haben. Dann folgten zwei Jahre an der medizinischen Fakultät, bis man
zum medizinischen Bakkalaureat zugelassen wurde. Man musste schwören, als Bakkalar nur unter
Anleitung eines Doktors und/oder mit Zustimmung der medizinischen Fakultät zu praktizieren. Die
Bakkalare hatten also das Recht, in Wien unter Aufsicht völlig legal zu praktizieren – taten dies aber
manchmal ohne die vorgeschriebene ärztliche Aufsicht und handelten sich damit Schwierigkeiten ein.
Wer Puecharzt werden wollte, musste noch weitere drei bis vier Jahre studieren, mit seinem Doktor
zumindest ein Jahr lang die medizinische Praxis ausgeübt und Kranke besucht haben. Vor der Prüfung
musste er außerdem seine legitime (eheliche oder legitimierte) Herkunft nachweisen. Dafür verfügte
der Lizentiat nachher über das uneingeschränkte Jus practicandi und durfte sich als Arzt niederlassen.
Neben seiner Praxis musste er ein Jahr lang kostenlos Kranke im Bürgerspital besuchen, was
allerdings nicht immer gewissenhaft befolgt wurde. Als höchste Stufe der Ausbildung wurde 1415 das
Doktorat eingeführt, das der heutigen Habilitation entsprach und die Voraussetzung für das Recht (und
die Pflicht) an der Universität zu lehren war. Der Kandidat musste mindestens 26 Jahre alt sein, vor
seiner Promotion wenigstens einen Doktor einkleiden oder vierzehn Ellen Tuch von guter Qualität zur
Verfügung stellen. Am Festtage selbst musste er jedem Doktor seiner Fakultät ein Birett
(Kopfbedeckung) und ein Paar gewirkte Handschuhe, jedem Lizentiaten und Bakkalar ein Paar
gewöhnliche Handschuhe schenken. Der Fakultät und dem Pedellen (Universitätsdiener) hatte er je
zwei Gulden zu geben. Die Verleihung der Doktorwürde erfolgte im Stephansdom. Danach folgte der
von ihm bezahlte Doktorschmaus – alles in allem eine teure Angelegenheit. Wer an einer
ausländischen Universität promoviert hatte und in Wien praktizieren wollte, musste die Fakultät um
Aufnahme bitten, sein Diplom vorlegen und sich einer Prüfung, der Repetition unterziehen, ferner
musste er schwören, die Statuten einzuhalten und ein Jahr an der Universität zu lesen. Professor
Martin Stainpeis verfasste 1520 eine Studienordnung für Mediziner, in der er auch die Grundsätze
der ärztlichen Standesmoral darlegte: Vorschriften über die Berechtigung zur Ausübung der Heilkunst
gab es also, die Wirklichkeit wich davon natürlich ab.
Die Sektionen
Bei den anatomischen „Übungen“, die durch Anschläge in der Stadt angekündigt wurden und
öffentlich waren, las der Professor als Lektor die einschlägigen Texte vor und sein Famulus zeigte als
Demonstrator mit einem langen Stab auf die betreffenden Organe, die ein Chirurg oder Bader als
Incisor geschickt freizulegen hatte. Es handelte sich sozusagen um eine Illustration der Worte des
Lektors, nicht aber um eine wissenschaftliche Untersuchung. Als dafür geeigneten Ort wählte man die
Badstube neben der St. Antonskapelle beim Heiligengeistspital (heute steht dort die Sezession) oder
einen Raum des Spitals selbst. Die erste weibliche Leiche wurde im Jahre 1452 aus
Sittlichkeitsgründen nicht dort, sondern unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Bibliotheksraum des
Fakultätshauses in der Weihburggasse11 seziert. Nikolaus von Hebersdorf, genannt Niclas der
Buchartzt, hatte das Haus 1419 der Fakultät vermacht. Ab 1484 fanden die Sektionen in der
Universität statt. Viele Ärzte sahen während ihres gesamten Studiums nie die inneren Organe eines
Menschen in natura: Zwischen 1404 und 1498 sind in Wien nur vierzehn Sektionen dokumentiert. Ein
echtes menschliches Skelett für die anatomische Grundausbildung stand erst ab 1558 zur Verfügung,
und das wurde bald gestohlen.
Der Arzt am Krankenbett
Besuchte einer der gelehrten Doktoren in seinem langen Talar einen wohlhabenden Kranken, so war er
meist von einigen Bakkalaren, Schülern und einem Bader oder Chirurgen, der zur Unterscheidung
vom Gelehrten nur einen kurzen Mantel tragen durfte, begleitet. Der Arzt untersuchte Haut,
Schleimhäute, Blut und Exkremente, er fühlte den Puls. Seine Nase verriet ihm
Stoffwechselerkrankungen und Eiterungen, sein Ohr krankhafte Geräusche aus Magen und Bauch, und
gelegentlich soll es sogar vorgekommen sein, dass er vom Urin des Kranken kostete. Die Harnflasche,
Urinal oder Matula genannt, wurde neben dem langen Talar zum Symbol der Puechärzte schlechthin.
Der Urognostik (Harnschau) lag die galenische Deutung des Urins als Abbauprodukt der Körpersäfte
zugrunde. Menge, Konzentration und Bodensätze wurden beurteilt, die Farbe mit eigenen Farbtafeln
(Urosrad) verglichen. Bald war der Arzt mit der (lateinischen) Diagnose zur Hand, was aber nicht
ausschloss, dass manch einer intuitiv die richtige Behandlungsweise fand. War der Kranke jedoch
sichtlich am Ende seines Lebens angelangt, lehnten die Puechärzte nach Möglichkeit die Behandlung
ab und überließen den Sterbenden der Geistlichkeit. Eine Wiener Sage überliefert dies: Die Patienten
des Paul Ursenpeck (+1491) kamen alle wieder auf die Beine. Denn er nahm nur die Patienten an,
bei denen er seinen „Gevatter Tod“ zu Füssen stehen sah – und wies alle anderen ab. Er soll ein
schönes Haus in der Schönlaterngasse 9 neben dem Basilisken besessen haben, das allgemein nur das
Totendoktorhaus genannt wurde. Aus seinem Nachlass erhielt die Fakultät ihr erstes gedrucktes Buch.
Die Behandlung
Durch die unterschiedlichen Therapieformen sollte das Gleichgewicht der Körpersäfte und damit die
Gesundheit wieder hergestellt werden. Man unterschied innere und äußere Anwendungen.
Unter Cura interna wurde die Verabreichung von Substanzen auf dem Weg der Körperöffnungen
verstanden. Bei den Verabreichungsformen war man erfinderisch, es gab Arzneitrank, Pille, Latwerge
und Leckmittel, Salben, Kataplasma, Puder, Zäpfchen, Tampons und das Klistier. Üblich waren ferner
Gurgel- und Niesmittel, Augen- und Ohrentropfen, Inhalationen, Räucherungen und Eingießungen
von flüssigen Arzneimittelzubereitungen in Nase, Vagina oder sogar Lunge, sie sollten den Abfluss
von Eiter bewirken. Zuständig für die Verordnung waren allein die Ärzte. Die Klistierspritze nahmen
sie selbst allerdings nicht in die Hand, das war – unter ihrer Anleitung – Sache der Bader und
Chirurgen.
Unter Cura externa wurden hingegen alle Behandlungen verstanden, die an der Körperoberfläche
erfolgten. Dazu gehörten Bäder, Pflaster, Aderlässe und Schröpfen, ferner sämtliche chirurgischen
Eingriffe einschließlich solcher an Augen und Zähnen. Der viele Jahrhunderte hindurch so beliebte
Aderlass sollte schlechte Säfte ableiten. Meist entzog man dem Patienten ein drittel Liter Blut, das
natürlich genau geprüft wurde. Allerdings wurde mit dem Aderlass oft schrecklich übertrieben, da
man annahm, der Körper enthalte 24 Liter Blut, und die Natur würde jeden Verlust sofort ersetzen. So
entartete der Eingriff häufig zu einer Art unbeabsichtigter Sterbehilfe, vor allem bei Wöchnerinnen.
Spielen Aderlass und Schröpfen selbst heute noch eine gewisse Rolle, so sind Zugmittel wie das
Haarseil oder Eiterband fast völlig vergessen. Ein durch eine Hautfalte gezogener Leinwandstreifen
oder raues Seil blieb vier Tage liegen, bis eine Eiterung eingetreten war. In der Tiermedizin wurde
dieses Verfahren noch bis ins 20. Jahrhundert bei Entzündungen innerer Organe angewandt.
Der große Außenseiter
Weder als Hof- noch als Leibarzt oder angesehener Universitätsprofessor, sondern als mutiger
Einzelgänger und Reformator der Medizin ist der aus der Schweiz stammende Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, besser bekannt als Paracelsus (+1541) in die Geschichte
der Heilkunst eingegangen, obwohl seine Lehren nicht unumstritten waren. Sein Wirken gilt – neben
der Anatomie des Vesalius – als Wendepunkt zwischen der mittelalterlichen und der neuzeitlichen
Medizin, denn es befreite ihn und die wenigen, die ihm folgten, vom Zwang der Autoritäten. In seiner
Person trafen die Kenntnisse eines Puecharztes mit dem Wissen eines erfahrenen Chirurgen,
Astrologen, Alchemisten, Mineralogen und Empirikers zusammen. Doch er war klein und
unansehnlich, stammelte und stotterte – ein großer Nachteil in einer Zeit, in der Akademiker in
Rhetorik und Dialektik glänzten. 1510 erhielt er in Wien den Grad eines Bakkalaureus der Medizin
1515/16 promovierte er in Ferrara zum Doktor beider Arzneien (Innere Medizin und Chirurgie).
Anschließend reiste er als Mediziner mehrere Jahre lang durch ganz Europa. Paracelsus war in seiner
ganzen Haltung antiautoritär, er vertraute nur auf Tatsachen: „Daß einer wisse und nit wähne!“ Wo er
auftauchte, kam er mit der Obrigkeit in Konflikt und stets stritt er mit der ansässigen Ärzteschaft. Er
war schlechter gekleidet als jeder fahrende Quacksalber, trug einen langen, nach Fuhrmannsart
genähten Leinenkittel und führte ein langes, zweihändiges Schwert mit Knauf bei sich. Ende 1537
weilte er aufs Neue in Wien (Lugeck 7 im Laszlahaus, dem späteren Federlhof), wo ihm die gelehrte
Ärzteschaft bewusst aus dem Weg ging. Bald gab es eine Menge Geschichten über den Sonderling, die
Wahrheit, Dichtung und Wunschdenken miteinander verwoben. Er war der letzte, der ein eigenes
Gesamtgebäude der Medizin erarbeitete und schließt damit die Epoche des Mittelalters ab. Ausgehend
von Chirurgie und Anatomie brachte in die Zukunft weisende Ideen aus Italien in unseren Raum. Im
Gegensatz zur scholastischen Lehre, dass jede Krankheit vom Ungleichgewicht der Körpersäfte her
rühre, war er der Auffassung, dass körperfremde Substanzen den Körper von außen angriffen und sich
durch chemische Mittel bekämpfen ließen. Damit legte er den Grundstein für die moderne
Arzneimittellehre.
Entwicklung der Wiener Medizin bis ins 18. Jahrhundert
Da die Fakultät nach Türkenkrieg, Pest, Syphilis und Studentenschwund darnieder lag, bemühte sich
König Ferdinand I. in den Jahren 1537 und 1554 um ihre Reformierung, wobei ihn Franz Emerich
(+1560) unterstützte. Die Freiheit der Lehre trat gegenüber dem Staatsinteresse in den Hintergrund,
die Professoren wurden zu staatlich ernannten und besoldeten Lehrkanzelinhabern (Ordinarien), die
für die Ausbildung von brauchbaren und rechtgläubigen Ärzten zu sorgen hatten. Zwar waren durch
den Buchdruck neuere wissenschaftliche Werke bekannt geworden, doch fanden medizinische
Forschung und neue Wege auf dem Gebiet der Anatomie, Pathologie, Chirurgie und
Arzneimittelkunde in Wien noch lange keinen Eingang in die Lehre, die streng nach den approbierten
Lehrbüchern erfolgte. Ab 1537 wurde an der Universität Chirurgie zwar als eigenes Fach gelehrt, aber
nur aus den Lehrbüchern von Emerich, Galen, Vesalius, Mondino oder nach dem „Feldbuch der
Wundarznei“, also rein theoretisch. Seit 1555 schuf man dafür eine zweite Lehrkanzel, und die
Fakultät erhielt die Aufgabe, sowohl Wiener Wundärzte als auch Bader im Fach der Wundarznei zu
prüfen. Daneben gab es Chirurgen, die ihre Kunst an italienischen Universitäten erlernt hatten. Dort
gab es schon früh Promotionen zum Doktor der Chirurgie, möglicherweise hatte Dr. med. utriusque
Johannes Kirchhaim (+1470) seinen Titel dort erworben.
Die allgemeine Lebenserwartung war niedrig. Aus den Totenbeschauprotokollen von 1649 entnehmen
wir, dass von einhundert Geborenen bereits ein Drittel bei der Geburt oder im ersten Lebensjahr starb
und nur 15 älter als 60 Jahre wurden. Die Medizinische Fakultät trug weiterhin nichts Brauchbares zur
Verbesserung dieser Situation bei, nicht im 16. und 17. Jahrhundert, da die Professoren ein geringes
Salär bezogen und sich den Lebensunterhalt in der Praxis erwerben mussten. 1688 heißt es in einem
Bericht an die Regierung, dass „in dieser Wienerischen Universität so viele Jahre hero von denen
Professoribus in Medicina gar wenig gehöret worden, daß selbige ihre Scienz am Tag gegeben oder
in Druck hätten ausgehen lassen, als wann die Wienerische Universität in Schlaf liegete oder gar
keine solches Studium mehr zu Wien da wäre“. Viele Studierende zogen die billigere und bessere
Ausbildung im Ausland vor und ließen sich dann in Wien mit dem Repetitionsakt nostrifizieren. So
auch Johann Wilhelm Mannagetta (+1666) aus Wilhelmsburg, der in Padua Medizin studiert hatte
und Professor, Historiograf und Leibarzt dreier Kaiser wurde. Er setzte durch, dass ab 1638 alle Bader
in ganz Österreich ob und unter der Enns von der medizinischen Fakultät approbiert werden mussten:
ein großer Erfolg im Kampf gegen das Pfuscherwesen. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Paul
Sorbait (+1691) brachte er eine Pestordnung heraus, die wesentlich zur Verbesserung des
Gesundheitswesens beitrug.
Für die Berufung ausländischer Wissenschaftler fehlte das Geld. Dieses fehlte überhaupt an allen
Ecken und Enden, man konnte sich Reformen nur schrittweise leisten. Es gab noch immer weder
verlässliche Diagnosehilfen noch wirkungsvolle Heilmittel, und nur die wenigsten Ärzte hatten schon
innere Organe gesehen. 1718 machte die Fakultät wenigstens eine Reihe von Vorschlägen zur
besseren Ausbildung, der Anatomieunterricht wurde ins Bürgerspital verlegt und endlich ernst
genommen. Im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts wurden allmählich treffendere
Diagnosemethoden erfunden, es brauchte allerdings einige Zeit, bis sie zum Allgemeingut der Ärzte
wurden. Internationale Bedeutung errang die Fakultät erst im 18. Jahrhundert, als Gerard van Swieten
den Grundstein zur Ersten Wiener Medizinischen Schule legte.
Literatur: Anna Ehrlich: Ärzte, Bader, Scharlatane. Wien 2007.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Die Arabische MedizinDokument4 SeitenDie Arabische MedizinAlina GirleanuNoch keine Bewertungen
- Medizin im mitteleuropäischen Mittelalter und Renaissance: Eine Wissenschaftliche Hausarbeit aus dem Fachbereich der GeschichteVon EverandMedizin im mitteleuropäischen Mittelalter und Renaissance: Eine Wissenschaftliche Hausarbeit aus dem Fachbereich der GeschichteNoch keine Bewertungen
- Medizin vom Rande gesehen: Aus dem Grenzbereich des MedizinbetriebsVon EverandMedizin vom Rande gesehen: Aus dem Grenzbereich des MedizinbetriebsNoch keine Bewertungen
- Anatomie Neu OCR PDFDokument310 SeitenAnatomie Neu OCR PDFAla Soroceanu89% (18)
- Protokolle des Todes: Authentische Fälle der RechtsmedizinVon EverandProtokolle des Todes: Authentische Fälle der RechtsmedizinNoch keine Bewertungen
- Ärzte, Bader, Scharlatane: Die Geschichte der österreichischen MedizinVon EverandÄrzte, Bader, Scharlatane: Die Geschichte der österreichischen MedizinNoch keine Bewertungen
- Paul Ehrlich: Leben, Forschung, Ökonomien, NetzwerkeVon EverandPaul Ehrlich: Leben, Forschung, Ökonomien, NetzwerkeNoch keine Bewertungen
- Unnützes Medizinwissen: Fakten und Geschichten, die selbst den Arzt verblüffenVon EverandUnnützes Medizinwissen: Fakten und Geschichten, die selbst den Arzt verblüffenNoch keine Bewertungen
- Medizin in Der AntikeDokument18 SeitenMedizin in Der AntikeMichael GasperlNoch keine Bewertungen
- Medizin im antiken Rom: Eine Wissenschaftliche Hausarbeit aus dem Fachbereich der GeschichteVon EverandMedizin im antiken Rom: Eine Wissenschaftliche Hausarbeit aus dem Fachbereich der GeschichteNoch keine Bewertungen
- Drei Medizinische TraktateDokument75 SeitenDrei Medizinische TraktateTorsten SchwankeNoch keine Bewertungen
- Die Medizin von heute ist der Irrtum von morgen: Scharfzüngige Gedanken zur MedizinVon EverandDie Medizin von heute ist der Irrtum von morgen: Scharfzüngige Gedanken zur MedizinNoch keine Bewertungen
- 1904 Bookmatter GeschichteDerPharmazieDokument111 Seiten1904 Bookmatter GeschichteDerPharmazieFelix RuschNoch keine Bewertungen
- Lehrbuch der Entstauungstherapie: Manuelle Lymphdrainage, Kompressionstherapie, Muskel- und Gelenkpumpeffekte und andere VerfahrenVon EverandLehrbuch der Entstauungstherapie: Manuelle Lymphdrainage, Kompressionstherapie, Muskel- und Gelenkpumpeffekte und andere VerfahrenGünther BringezuNoch keine Bewertungen
- Die Ärzte der Charité: Die Götter der Wissenschaft in BerlinVon EverandDie Ärzte der Charité: Die Götter der Wissenschaft in BerlinNoch keine Bewertungen
- Semmelweis Kiado File 1636017294Dokument452 SeitenSemmelweis Kiado File 1636017294VVVNoch keine Bewertungen
- Historische Fälle aus der Medizin: Erstbeschreibungen von der Ahornsiruperkrankung bis zum Pfeifferschen DrüsenfieberVon EverandHistorische Fälle aus der Medizin: Erstbeschreibungen von der Ahornsiruperkrankung bis zum Pfeifferschen DrüsenfieberNoch keine Bewertungen
- Wasser hilft: Allergien - Asthma - Lupus. Ein ErfahrungsbuchVon EverandWasser hilft: Allergien - Asthma - Lupus. Ein ErfahrungsbuchNoch keine Bewertungen
- (Wolfgang U. Eckart) Illustrierte Geschichte Der M (B-Ok - Xyz) PDFDokument384 Seiten(Wolfgang U. Eckart) Illustrierte Geschichte Der M (B-Ok - Xyz) PDFFüleki Eszter100% (2)
- Echte Chinesische Akupunktur (Übersetzt): Doktrin - Diagnose - TherapieVon EverandEchte Chinesische Akupunktur (Übersetzt): Doktrin - Diagnose - TherapieNoch keine Bewertungen
- Als die Dummheit die Forschung erschlug: Die schwierige Erfolgsgeschichte der österreichischen MedizinVon EverandAls die Dummheit die Forschung erschlug: Die schwierige Erfolgsgeschichte der österreichischen MedizinNoch keine Bewertungen
- Medi̇zi̇n İn RomDokument92 SeitenMedi̇zi̇n İn RomizzetelmaciNoch keine Bewertungen
- DE HippokratesDokument6 SeitenDE HippokratesrablaNoch keine Bewertungen
- 2011 Wolfgang U. Eckart - Illustrierte Geschichte Der Medizin - Von Der Französischen Revolution Bis Zur Gegenwart, 2. AuflageDokument384 Seiten2011 Wolfgang U. Eckart - Illustrierte Geschichte Der Medizin - Von Der Französischen Revolution Bis Zur Gegenwart, 2. AuflageПавел РатмановNoch keine Bewertungen
- Auf den Spuren der alten Heilkunst in Wien: Medizinische Spaziergänge durch die StadtVon EverandAuf den Spuren der alten Heilkunst in Wien: Medizinische Spaziergänge durch die StadtNoch keine Bewertungen
- Alt, krank und verwirrt: Einführung in die Praxis der Palliativen GeriatrieVon EverandAlt, krank und verwirrt: Einführung in die Praxis der Palliativen GeriatrieNoch keine Bewertungen
- Der Schwarze Tod PDFDokument6 SeitenDer Schwarze Tod PDFCinzia I.Noch keine Bewertungen
- Medizin im Wandel: Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten Medizin, 1967-2015Von EverandMedizin im Wandel: Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten Medizin, 1967-2015Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Historische Instrumente Der HNODokument145 SeitenHistorische Instrumente Der HNOCristina Laura RuepNoch keine Bewertungen
- Eine kurze Geschichte der Blutdruckmessung: Mit einem kleinen Exkurs zu Stethoskopen, Sphygmomanometer und in die VeterinärmedizinVon EverandEine kurze Geschichte der Blutdruckmessung: Mit einem kleinen Exkurs zu Stethoskopen, Sphygmomanometer und in die VeterinärmedizinNoch keine Bewertungen
- Der Tod kam in Weiß: Hitlers mörderische ÄrzteVon EverandDer Tod kam in Weiß: Hitlers mörderische ÄrzteNoch keine Bewertungen
- Medizinischer Wortschatz - Terminologie Kompakt (PDFDrive)Dokument132 SeitenMedizinischer Wortschatz - Terminologie Kompakt (PDFDrive)ivanana tomiNoch keine Bewertungen
- JhuiijhhvvvDokument5 SeitenJhuiijhhvvvFuthhhNoch keine Bewertungen
- Felicitas Seebacher. Erna Lesk. Herrin Der Sammlungen Des JosephinumsDokument24 SeitenFelicitas Seebacher. Erna Lesk. Herrin Der Sammlungen Des JosephinumsJoe SeebacherNoch keine Bewertungen
- Atlas of Forensic Medicine. CD-ROM. by P. Dickens, S. Leadbeatter, S. Pollak, P. SaukkoDokument697 SeitenAtlas of Forensic Medicine. CD-ROM. by P. Dickens, S. Leadbeatter, S. Pollak, P. SaukkoLetícia Avanci Dal Zot100% (1)
- Krank geschrieben: Gesundheit und Krankheit im Diskursfeld von Literatur, Geschlecht und MedizinVon EverandKrank geschrieben: Gesundheit und Krankheit im Diskursfeld von Literatur, Geschlecht und MedizinRudolf KäserNoch keine Bewertungen
- Der Pathologe weiß alles … aber zu spät: Heitere und ernsthafte Geschichten aus der MedizinVon EverandDer Pathologe weiß alles … aber zu spät: Heitere und ernsthafte Geschichten aus der MedizinBewertung: 3 von 5 Sternen3/5 (5)
- Achelis ÜberwindungDokument18 SeitenAchelis ÜberwindungSolonOfAthensNoch keine Bewertungen
- Der wunderbare Garten der Druiden: Band 1 Die Druiden GalliensVon EverandDer wunderbare Garten der Druiden: Band 1 Die Druiden GalliensNoch keine Bewertungen
- Friedrich Wilhelm Scanzoni Von Lichtenfels (1821 - 1891)Dokument3 SeitenFriedrich Wilhelm Scanzoni Von Lichtenfels (1821 - 1891)Accro TangoNoch keine Bewertungen
- Das Eisenmenger-Syndrom - vom Symptom zu Diagnose und TherapieVon EverandDas Eisenmenger-Syndrom - vom Symptom zu Diagnose und TherapieNoch keine Bewertungen
- Burgenlaendische-Heimatblaetter 20 0102-0112Dokument12 SeitenBurgenlaendische-Heimatblaetter 20 0102-0112Bäre GurkiNoch keine Bewertungen
- Wickel, Salben und Tinkturen: Das Kräuterwissen der Bauerndoktoren in den AlpenVon EverandWickel, Salben und Tinkturen: Das Kräuterwissen der Bauerndoktoren in den AlpenNoch keine Bewertungen
- Abhandlung über die Pest: Mit hundertzwanzig KrankengeschichtenVon EverandAbhandlung über die Pest: Mit hundertzwanzig KrankengeschichtenNoch keine Bewertungen
- Der wunderbare Garten der Druiden: Band 3 Die Apotheke der KeltenVon EverandDer wunderbare Garten der Druiden: Band 3 Die Apotheke der KeltenNoch keine Bewertungen
- Ausgabe 2024 Artikel 3Dokument9 SeitenAusgabe 2024 Artikel 3Amina Isanovic HadziomerovicNoch keine Bewertungen
- Max von Pettenkofer: Pionier der wissenschaftlichen HygieneVon EverandMax von Pettenkofer: Pionier der wissenschaftlichen HygieneNoch keine Bewertungen