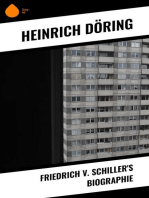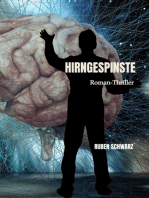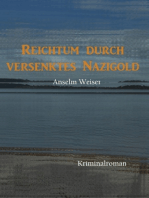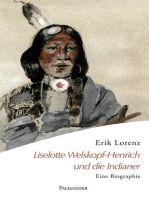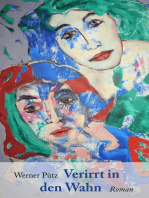Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Sartre - Die Worter
Hochgeladen von
Reiß AusnehmerCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Sartre - Die Worter
Hochgeladen von
Reiß AusnehmerCopyright:
Verfügbare Formate
Die Wrter
oder
Schreiben ist eine Neurose (1963)
Sartre, der nach dem frhen Tod seines Vaters im bildungsbrgerlichen Milieu seines
Grovaters, des
elsssischen Lehrers Charles Schweitzer, eines Verwandten von Albert Schweitzer, a
ufgewachsen war,
hatte schon als Kind zu schreiben angefangen und den Wunsch gehabt, ein Schrifts
teller zu werden.
Durch den zweiten Weltkrieg in die Geschichte und in ein immer strkeres politisch
es Engagement
gestrzt, hatte er seit 1953 begonnen, seinen Schriftstellerberuf in Frage zu stel
len. Um sich darber klar
zuwerden, was ihn dazu gebracht hat, den Sinn seines Lebens im Schreiben zu sehe
n, beschloss er, seine
Kindheitserinnerungen zu schreiben. Er analysierte seine schriftstellerische Ber
ufung als Neurose, die
darin besteht, dass man die Wrter fr die tatschlichen Dinge hlt. In verschiedenen In
terviews sagte er
dazu: Aus dem Bedrfnis heraus, meine Existenz zu rechtfertigen, hatte ich aus der
Literatur etwas
Absolutes gemacht. [] Ich wollte zeigen, wie ein Mensch von der als heilig betrac
hteten Literatur zu
einem Handeln bergehen kann, das dennoch das eines Intellektuellen bleibt. [] In D
ie Wrter erklre
ich den Ursprung meines Wahns, meiner Neurose. Diese Analyse kann jungen Leuten,
die davon
trumen, zu schreiben, helfen. [] Angesichts eines sterbenden Kindes hat Der Ekel k
ein Gewicht []
Was bedeutet Literatur in einer Welt, die hungert.
Um das Jahr 1850 lie sich im Elsass ein Lehrer mit allzu groer Kinderschar dazu he
rab, Krmer zu
werden. Dieser Abtrnnige wollte eine Kompensierung: da er selbst darauf verzichte
te, die Kpfe zu
erhellen, sollte einer der Shne die Seelen lenken; die Familie sollte einen Pasto
r erhalten, und zwar
Charles. Charles machte Ausflchte und lief statt dessen einer Zirkusreiterin nach
. Man drehte sein Bild
gegen die Wand und verbot die Erwhnung seines Namens. Wer kam nun an die Reihe? A
uguste beeilte
sich, dem vterlichen Opfer nachzueifern: er wurde Geschftsmann und stand sich gut
dabei. Blieb nur
noch Louis, der keine ausgeprgten Neigungen besa: der Vater nahm sich den ruhigen
Jungen vor und
machte ihn im Handumdrehen zum Pfarrer. Louis trieb spter den Gehorsam so weit, d
ass er seinerseits
einen Pastor erzeugte, Albert Schweitzer, dessen Laufbahn bekannt ist.
Aber Charles hatte seine Kunstreiterin aus dem Auge verloren; die schne Geste des
Vaters hatte ihn
gezeichnet: sein Leben lang bewahrte er sich den Geschmack am Erhabenen und setz
te seinen Eifer
darein, groe Begebenheiten mit Hilfe kleiner Ereignisse zu fabrizieren. Wie man s
ieht, dachte er nicht
daran, die Berufung, unter welcher die Familie stand, von sich abzutun: er gedac
hte sich aber einer
gemilderten Form der Geistigkeit zu widmen, einem Priestertum, das die Beschftigu
ng mit Kunst-reiterinnen
nicht ausschloss. Da bot sich die Gymnasiallaufbahn an: Charles beschloss, Deuts
chlehrer zu
werden. Er schrieb eine Dissertation ber Hans Sachs, entschied sich fr die direkte
Methode des
Sprachunterrichts, behauptete spter, er habe sie erfunden; er verffentlichte unter
Mitarbeit von
Monsieur Simonnot ein geschtztes <Deutsches Lesebuch>, machte rasch Karriere: ber
Mcon und
Lyon nach Paris. In Paris hielt er bei der Jahresabschlussfeier eine Rede, die d
ann gedruckt wurde: Herr
Minister, meine Damen, meine Herren, meine lieben Kinder, Sie werden niemals err
aten, worber ich
heute sprechen werde! ber die Musik! Er machte vorzgliche Gelegenheitsgedichte. Bei
den
Familientagen pflegte er zu sagen: Louis ist von uns allen der frommste, Auguste
der reichste, ich bin
der intelligenteste! Die Brder lachten, die Schwgerinnen pressten die Lippen zusamm
en. In Mcon
hatte Charles Schweitzer die Tochter eines katholischen Anwalts geheiratet, Loui
se Guillemin. An ihre
Hochzeitsreise erinnerte sie sich mit Grauen: er hatte sie noch vor Abschluss de
s Hochzeitsmahls
weggeschleift und in den Zug geworfen. Noch mit siebzig Jahren sprach Louise von
dem Lauchsalat, den
man ihnen in einem Bahnhofsrestaurant serviert hatte: Er nahm sich alles Weie und
lie das Grne fr
mich brig. Sie brachten vierzehn Tage im Elsass zu, wobei ununterbrochen gegessen
wurde: die Brder
erzhlten sich zotige Geschichten im Elssser Dialekt; von Zeit zu Zeit wandte sich
der Pastor an Louise
und bersetzte ihr, aus christlicher Nchstenliebe, diese Geschichten. Sie lie sich u
nverzglich
Geflligkeitsatteste ausschreiben, die ihr erlaubten, die ehelichen Pflichten zu v
erweigern und ein eigenes
Schlafzimmer zu beanspruchen; sie sprach von ihren Migrnen, gewhnte sich daran, im
Bett zu bleiben,
verabscheute von nun an den Lrm, die Leidenschaft, die seelischen Aufschwnge, das
ganze
aufgeschwollene, gleichzeitig krgliche und theatralische Leben der Schweitzers.
Diese lebhafte und spttische, aber kalte Frau hatte folgerichtige, aber unerbauli
che Gedanken, weil ihr
Mann erbaulich und unlogisch dachte; da er verlogen und leichtglubig war, zweifel
te sie an allem: Die
Leute behaupten, die Erde drehe sich; woher wissen sie das eigentlich? Da sie von
tugendhaften
Schauspielern umgeben war, fllte sie sich mit Hass gegen Tugend und Schauspielere
i. Diese so feine
Realistin, die in eine Familie plumper Spiritualisten geraten war, wurde aus Tro
tz Voltairianerin, ohne
Voltaire gelesen zu haben. Niedlich und rundlich, zynisch und lebhaft, wurde sie
zu einem Geist der
puren Verneinung; mit einem Heben der Augenbrauen, einem unmerklichen Lcheln verw
andelte sie vor
sich selbst, und ohne dass einer es merkte, all diese Attitden in Staub. Ihr nega
tiver Stolz und die
Selbstsucht der Abweisung verzehrten sie. Sie verkehrte mit niemand, war zu stol
z, den ersten Platz
anzustreben, zu eitel, sich mit dem zweiten zu begngen. Sie sagte: Ihr msst es so e
inrichten knnen,
dass man euch nachluft! Man lief ihr zunchst sehr viel nach, dann immer weniger, un
d da man sie
nicht zu sehen bekam, verga man sie schlielich. Sie verlie kaum noch ihren Sessel u
nd ihr Bett. Die
Schweitzers waren Naturalisten und Puritaner - diese Mischung von Eigenschaften
kommt hufiger vor,
als man meint - und liebten als solche die eindeutigen Wrter, die erkennen lieen,
dass man zwar als
guter Christ den Krper geringachte, aber doch mit seinen natrlichen Funktionen hchs
t einverstanden
sei; Louise liebte die verhllte Rede. Sie las gern schlpfrige Romane, wobei sie we
niger Freude an der
eigentlichen Handlung hatte als an den die Handlung verhllenden Schleiern. Das ist
gewagt, das ist gut
geschrieben, sagte sie verstndnisinnig. Gleitet, ihr Sterblichen, lastet nicht! Dies
e Frau, so kalt wie
Schnee, glaubte vor Lachen zu sterben, als sie <La fille de feu> von Adolphe Bel
ot las. Besonders gern
erzhlte sie Geschichten ber Hochzeitsnchte, die alle ein schlechtes Ende zu nehmen
pflegten: in einer
Geschichte war der Ehemann so hastig und brutal, dass sich seine Frau am Bettpfo
sten das Genick brach,
in einer anderen Geschichte fand man die junge Frau am Morgen auf dem Kleidersch
rank, wohin sie sich
geflchtet hatte, nackt und geistesgestrt. Louise lebte im Halbdunkel; Charles kam
zu ihr ins Zimmer,
riss die Vorhnge auf, zndete alle Lampen an, sie hielt sich die Hand vor die Augen
und sthnte:
Charles! Du blendest mich ja! Aber ihr Widerstand berschritt nicht die Grenzen eine
r
verfassungsmigen Opposition: sie harte Angst vor Charles, er ging ihr entsetzlich
auf die Nerven,
bisweilen versprte sie auch Freundschaft fr ihn, vorausgesetzt, dass er sie nicht
anrhrte. Sobald er zu
brllen anfing, gab sie in allem nach. Er machte ihr, indem er sie zu berraschen pf
legte, vier Kinder: eine
Tochter, die schon sehr bald starb, zwei Jungen, noch eine Tochter. Aus Gleichglt
igkeit oder aus Re-spekt
hatte er zugelassen, dass die Kinder katholisch erzogen wurden. Louise selbst gl
aubte an nichts, lie
die Kinder aber religis erziehen, aus Widerwillen gegen den Protestantismus. Die
beiden Jungen hielten
zur Mutter; es gelang ihr, sie diesem soviel Raum einnehmenden Vater zu entfremd
en; Charles merkte es
nicht einmal. Der lteste Sohn, Georges, ging aufs Polytechnikum; der zweite, Emil
e, wurde
Deutschlehrer. Ich mache mir Gedanken ber ihn: ich wei, dass er Junggeselle blieb,
sonst aber seinen
Vater in allen Dingen imitierte, wenngleich er ihn nicht liebte. Vater und Sohn b
erwarfen sich
schlielich; es kam zu denkwrdigen Vershnungsszenen. Emile verhllte sein Leben; er hi
ng sehr an
seiner Mutter und war es, bis zum Schluss, gewohnt, sie heimlich und unangemelde
t zu besuchen; er
ksste und streichelte sie unablssig und sprach dann vom Vater, zuerst ironisch, da
nn wtend und ging
schlielich trenschlagend davon. Sie liebte den Sohn, glaube ich, hatte aber Angst
vor ihm: diese beiden
derben, schwierigen Mnner ermdeten sie, und Georges, der niemals da war, stand ihr
em Herzen nher.
Emile starb im Jahre 1927, halbverrckt vor Einsamkeit: unter seinem Kopfkissen fa
nd man einen
Revolver; in den Koffern lagen hundert Paar Socken mit Lchern, zwanzig Paar Schuh
e mit schief-gelaufenen
Abstzen.
Anne-Marie, die zweite Tochter, verbrachte ihre Kindheit auf einem Stuhl. Man le
hrte sie, sich
geradezuhalten, sich zu langweilen, zu nhen. Sie war begabt: man hielt es fr vorne
hm, diese Begabung
verkmmern zu lassen; Glanz ging von ihr aus: man sorgte dafr, dass sie es nicht me
rkte. Diese
bescheidenen und stolzen Brger waren der Meinung, Schnheit sei fr sie entweder zu t
euer oder zu
wenig standesgem; Schnheit billigten sie nur den Marquisen und den Huren zu. Louise
besa einen
uerst drren Stolz: vor lauter Angst, betrogen zu werden, verkannte sie bei ihren Ki
ndern, ihrem Mann,
bei sich selbst sogar die Eigenschaften, die ins Auge sprangen; Charles war nich
t imstande, die Schnheit
anderer Menschen zu erkennen; er verwechselte Schnheit mit Gesundheit: seit der K
rankheit seiner Frau
trstete er sich in der Gesellschaft krftiger Idealistinnen mit frischen Farben und
Ansatz zum
Schnurrbart, die sich bester Gesundheit erfreuten. Fnfzig Jahre spter, als sie in
einem Familienalbum
die Fotografien betrachtete, entdeckte Anne-Marie, dass sie schn gewesen war.
Ungefhr zur gleichen Zeit, da Charles Schweitzer die Louise Guillemin kennen lern
te, heiratete ein
Landarzt die Tochter eines reichen Hausbesitzers aus dem Perigord und zog mit ih
r in die traurige
Hauptstrae von Thiviers: gerade gegenber der Apotheke. Am Morgen nach der Hochzeit
stellte sich
heraus, dass der Schwiegervater keinen Sou besa. Der Doktor Sartre war darber so e
ntrstet, dass er
vierzig Jahre lang kein Wort mit seiner Frau sprach; bei Tisch begngte er sich mi
t Zeichen, sie nannte
ihn schlielich meinen Dauergast. Trotzdem teilte sie sein Bett, und von Zeit zu Zei
t machte er sie
schwanger, ohne dass ein Wort dabei fiel; sie gab ihm zwei Shne und eine Tochter;
diese Kinder des
Schweigens hieen Jean-Baptiste, Joseph und Helene. Helene heiratete ziemlich spt e
inen
Kavallerieoffizier, der wahnsinnig wurde. Joseph machte seinen Militrdienst bei d
en Zuaven und zog
sich bald ins Elternhaus zurck. Er hatte keinen Beruf: inmitten des vterlichen Sch
weigens und der
mtterlichen Schreiszenen wurde er zum Stotterer und brachte sein Leben damit zu,
mit den Worten zu
ringen. Jean-Baptiste wollte auf die Marineschule, um das Meer zu sehen. Im Jahr
e 1904 machte er in
Cherbourg als Marineoffizier, den bereits das Fieber aus Hinterindien aushhlte, d
ie Bekanntschaft der
Anne-Marie Schweitzer, packte sich das groe und vereinsamte Mdchen, heiratete es,
machte ihm im
Galopp ein Kind, mich, und versuchte dann, sich in den Tod zu flchten.
Sterben ist nicht leicht: das Fieber in den Eingeweiden stieg gelassen an, es tr
aten Besserungen ein. Anne-Marie pflegte ihn hingebungsvoll, ohne aber die Scham
losigkeit so weit zu treiben, dass sie ihn liebte.
Louise hatte sie gegen das Eheleben einzunehmen gewusst: auf eine Bluthochzeit f
olge eine unabsehbare
Kette von Opfern, unterbrochen durch nchtliche Trivialitten. Gleich ihrer Mutter e
ntschied sich auch
meine Mutter fr die Pflicht und gegen die Lust. Sie hatte meinen Vater kaum gekan
nt, nicht vor der
Hochzeit und auch nicht nachher, und musste sich bisweilen fragen, warum dieser
fremde Mann
ausgerechnet in ihren Armen zu sterben wnschte. Man transportierte ihn auf einen
Bauernhof, wenige
Meilen von Thiviers; sein Vater kam jeden Tag mit der Kutsche, um ihn zu besuche
n. Die Nachtwachen
und Sorgen hatten Anne-Marie erschpft, die Milch blieb aus, man bergab mich einer
Amme aus der
Gegend, und auch ich schickte mich an, zu sterben: an Darmkolik und vielleicht a
uch an Verbitterung.
Meine Mutter war zwanzig Jahre alt, besa keine Erfahrung und erhielt keine Ratsch
lge, sie zerriss sich
zwischen zwei unbekannten Lebewesen, die im Sterben lagen; ihre Vernunftheirat e
ntpuppte sich als
Krankheit und als Trauer. Ich jedoch profitierte von der Lage. Damals pflegten d
ie Mtter ihre Kinder
selbst zu stillen, und zwar lange Zeit; ohne den Glcksfall dieser doppelten Agoni
e wre ich den
Schwierigkeiten einer spten Entwhnung ausgesetzt gewesen. Da ich krank war und gew
altsam im Alter
von neun Monaten entwhnt wurde, verhinderten das Fieber und die Dumpfheit, dass i
ch den letzten
Schnitt versprte, der die Bande zwischen Mutter und Kind zu trennen pflegt. Ich t
auchte in eine wirre
Welt, die angefllt war mit einfachen Halluzinationen und drftigen Idolen. Beim Tod
meines Vaters
erwachten Anne-Marie und ich aus einem gemeinsamen Alptraum; ich wurde gesund. A
ber wir waren
Opfer eines Missverstndnisses: sie fand voller Liebe einen Sohn wieder, den sie n
iemals richtig
verlassen hatte; ich erwachte wieder zum Leben auf den Knien einer fremden Frau.
Da sie kein Geld und nichts gelernt hatte, beschloss Anne-Marie, zu ihren Eltern
zurckzuziehen. Aber
das unverschmte Sterben meines Vaters hatte die Schweitzers verrgert. Es erinnerte
allzu sehr an ein
Davonlaufen. Da meine Mutter diesen Tod weder vorausgesehen noch verhindert hatt
e, gab man ihr die
Schuld: sie war es gewesen, die sich unverstndlicherweise einen Ehemann ausgesuch
t hatte, der sich als
nicht haltbar erwies. Im brigen benahm man sich der langen Ariadne gegenber, die m
it einem Kind auf
dem Arm nach Meudon zurckkehrte, durchaus vorbildlich: mein Grovater hatte den Ant
rag auf
Pensionierung gestellt; nun beschloss er ohne ein Wort des Vorwurfs, auch weiter
hin zu unterrichten;
meine Gromutter genoss einen diskreten Triumph. Aber Anne-Marie, eisig berhrt von
soviel Anlass zur
Dankbarkeit, erriet die Missbilligung unter dem allgemeinen Wohlverhalten: natrli
ch ist in einer Familie
eine Witwe immer noch lieber gesehen als eine uneheliche Mutter, aber das ist au
ch alles. Um die
Verzeihung der Familie zu erlangen, machte sie sich ntzlich, ohne weiter nachzure
chnen, fhrte das
Haus ihrer Eltern, zuerst in Meudon, dann in Paris, war gleichzeitig Kindermdchen
, Krankenschwester,
Hausdame, Gesellschafterin, Dienstmdchen, ohne dass es ihr gelang, die stumme Ger
eiztheit ihrer
Mutter zu entwaffnen. Louise fand es lstig, jeden Morgen den Speisezettel zu entw
erfen und jeden
Abend das Haushaltsbuch zu fhren. Aber sie sah es nur ungern, wenn ein anderer es
fr sie machte; sie
lie sich ihre Aufgaben zwar abnehmen, war aber ngstlich darauf bedacht, keine Vorr
echte einzuben.
Diese alternde und zynische Frau hatte nur eine Illusion: sie hielt sich fr unent
behrlich. Die Illusion
schwand: Louise begann auf ihre Tochter eiferschtig zu werden.
Arme Anne-Marie: wre sie passiv geblieben, man htte ihr vorgeworfen, sie sei eine
Last; da sie jedoch
aktiv war, geriet sie in den Verdacht, das Haus regieren zu wollen. Um der erste
n Klippe zu entgehen,
bedurfte sie all ihres Mutes, um der zweiten zu entgehen, all ihrer Demut. Es da
uerte nicht lange, und die
junge Witwe verwandelte sich wieder in eine minderjhrige Tochter: in eine Jungfra
u mit leichtem Makel. Man verweigerte ihr keineswegs das Taschengeld: man verga b
lo, ihr welches zu geben; sie
trug ihre Kleider, solange es eben gehen wollte, ohne dass mein Grovater daran ge
dacht htte, ihr neue
zu kaufen:
Man sah es nicht gern, dass sie allein ausging. Wenn ihre alten Freundinnen, die
meist verheiratet waren,
sie zum Abendessen einluden, musste die Erlaubnis lange vorher eingeholt werden,
und man musste
versprechen, dass sie vor zehn Uhr wieder nach Hause gebracht wrde. Noch whrend de
s Essens musste
der Hausherr aufstehen, um sie im Wagen zurckzubringen. Whrend dieser Zeit ging me
in Grovater im
Nachthemd mit der Uhr in der Hand in seinem Schlafzimmer auf und ab. Um zehn Uhr
, beim letzten
Glockenschlag, begann er loszubrllen. Die Einladungen wurden seltener, und meine
Mutter verlor die
Lust an so kostspieligen Vergngungen.
Jean-Baptistes Tod wurde das groe Ereignis meines Lebens: er legte meine Mutter v
on neuem in Ketten
und gab mir die Freiheit.
Es gibt keine guten Vter, das ist die Regel; die Schuld daran soll man nicht den
Menschen geben,
sondern dem Band der Vaterschaft, das faul ist. Kinder machen, ausgezeichnet; Ki
nder haben, welche
Unbill! Htte mein Vater weitergelebt, er htte mich mit seiner ganzen Lnge berragt un
d dabei
erdrckt. Glcklicherweise starb er sehr frh; inmitten so vieler Mnner, die gleich dem
neas ihren
Anchises auf dem Rcken tragen, schreite ich von einem Ufer zum ndern, allein und v
oller Missachtung
fr diese unsichtbaren Erzeuger, die ihren Shnen das ganze Leben lang auf dem Rcken
hocken: ich lie
hinter mir einen jungen Toten, der nicht die Zeit hatte, mein Vater zu sein, und
heute mein Sohn sein
knnte. War es ein Glck oder ein Unglck? Ich wei es nicht; aber ich stimme gern der D
eutung eines
bedeutenden Psychoanalytikers zu: ich habe kein ber-Ich.
Sterben allein gengt nicht; man muss rechtzeitig sterben. Wre er spter gestorben, i
ch htte mich
schuldig gefhlt; ein bewusst denkendes Waisenkind gibt sich die Schuld: beleidigt
durch seinen Anblick
haben sich seine Eltern in ihre himmlischen Gemcher zurckgezogen. Ich hingegen war
begeistert: mein
klglicher Zustand ntigte Achtung ab, begrndete meine Wichtigkeit; die Trauer, die m
ich umgab,
wurde meinen Tugenden zugerechnet. Mein Vater war rcksichtsvoll genug gewesen, zu
sterben und sich
dadurch ins Unrecht zu setzen. Meine Gromutter sagte immer wieder, er habe sich s
einen Pflichten
entzogen; mein Grovater, mit Recht stolz auf die Langlebigkeit der Schweitzers, k
onnte nicht zulassen,
dass man bereits mit dreiig Jahren verschwand; angesichts dieses verdchtigen Absch
eidens fragte er
sich, ob sein Schwiegersohn berhaupt je existiert habe, und schlielich verga er ihn
. Ich brauchte ihn
nicht einmal zu vergessen; indem er sich auf englische Art empfahl, hatte mir Je
an-Baptiste die Freude
verwehrt, seine Bekanntschaft zu machen. Noch heute wundere ich mich darber, dass
ich so wenig von
ihm wei. Immerhin hat er geliebt, hat er leben wollen, hat er gesehen, wie sich d
er Tod nherte; das
gengt, um einen ganzen Menschen zu machen. Aber niemand in meiner Familie hat je
vermocht, mich
auf diesen Mann neugierig zu machen. Jahrelang konnte ich ber meinem Bett das Bil
d eines kleinen
Offiziers mit naiven Augen sehen, rundem Schdel und gelichteten Haaren, mit einem
starken
Schnurrbart. Als meine Mutter sich von neuem verheiratete, verschwand das Portrt.
Spter erbte ich
Bcher, die ihm gehrt hatten: ein Werk von Le Dantec ber die Zukunft der Wissenschaf
t, ein anderes
von Weber mit dem Titel Zum Positivismus ber den absoluten Idealismus. Er las sch
lechte Bcher wie
alle seine Zeitgenossen. An den Rndern der Seiten entdeckte ich unentzifferbare K
ritzeleien, tote Zei-chen
einer kleinen Erleuchtung, die lebendig war und tanzte um die Zeit meiner Geburt
. Ich habe die
Bcher verkauft: dieser Tote ging mich so wenig an. Ich kenne ihn vom Hrensagen, wi
e die Eiserne
Maske und den Chevalier dEon, und was ich von ihm wei, bezieht sich niemals auf mi
ch: ob er mich
geliebt hat, in seine Arme nahm, ob er seinen Sohn mit den hellen, heute zerfres
senen Augen ansah, daran
hat sich keiner erinnert: das sind verlorene Liebesmhen. Dieser Vater ist nicht e
inmal ein Schatten, nicht
einmal ein Blick: wir beide haben, er und ich, eine Zeitlang die gleiche Erde be
wohnt, das ist alles. Man
hat mich verstehen lassen, dass ich weit eher ein Kind des Wunders als der Sohn
eines Toten sei.
Zweifellos kommt daher meine unglaubliche Leichtfertigkeit. Ich bin kein Chef un
d begehre auch nicht,
einer zu werden. Befehlen, gehorchen, das macht fr mich keinen Unterschied. Der A
utoritrste befiehlt
im Namen eines anderen, eines geheiligten Parasiten - seines Vaters -, er bertrgt
die abstrakten
Gewalttaten weiter, die er erlitten hat. In meinem ganzen Leben habe ich keinen
Befehl erteilen knnen,
ohne dabei lachen zu mssen, ohne dass man darber gelacht htte, weil ich eben nicht
von der
Machtkrtze befallen bin: man hat mir den Gehorsam nicht beigebracht.
Wem sollte ich auch gehorchen? Man zeigt mir ein junges Riesenweib und sagt, es
sei meine Mutter. Von
mir aus htte ich es eher fr eine ltere Schwester gehalten. Diese Jungfrau mit Zwang
saufenthalt, die
sich allen unterordnen muss, ist offensichtlich da, um mich zu bedienen. Ich lie
be sie, aber wie knnte ich sie respektieren, wenn niemand sie respektiert? In uns
erem Hause gibt es drei Zimmer: das Zimmer
meines Grovaters, das Zimmer meiner Gromutter, das Zimmer der Kinder. Die Kinder, das
sind
wir: beide minderjhrig und beide ausgehalten. Aber alle Rcksichten gelten mir. In
mein Zimmer hat
man das Bett eines jungen Mdchens gestellt. Das junge Mdchen schlft allein, wacht a
us keuschem
Schlummer auf; ich schlafe noch, wenn sie ihr tub im Badezimmer nimmt: wenn sie
zurckkommt, ist sie
vollstndig angezogen: wie wre es mglich, dass ich von ihr geboren wurde? Sie erzhlt
mir ihr
Unglck, und ich hre ihr mitleidig zu: spter werde ich sie heiraten, um sie zu bescht
zen. Das
verspreche ich ihr: ich werde schtzend meine Hand ber sie halten, ich werde meine
junge Bedeutung in
ihren Dienst stellen. Glaubt man etwa, ich msse ihr gehorchen? Ich bin so gtig, ih
ren Bitten
nachzugeben. brigens erteilt sie mir keine Befehle: sie entwirft in leichten Wort
en eine Zukunft, die zu
verwirklichen fr mich lobenswert sei: Mein kleiner Liebling wird sehr vernnftig sei
n und sehr reizend,
wenn er sich ruhig die Nasentropfen geben lsst. Ich gehe diesen sanften Prophezeiu
ngen in die Falle.
Blieb der Patriarch: er glich Gottvater so sehr, dass man ihn oft damit verwechs
elte. Eines Tages betrat er
eine Kirche von der Sakristei aus. Der Geistliche bedrohte gerade die Lauen mit
allen Blitzen des
Himmels: Gott ist anwesend! Er sieht euch! Pltzlich entdeckten die Anwesenden unter
der Kanzel
einen hohen Greis mit langem Bart, der sie anschaute: sie liefen davon. Bei spter
en Gelegenheiten
erzhlte mein Grovater, sie htten sich vor ihm auf die Knie geworfen. Er fand Geschm
ack an solchen
Formen der Offenbarung. Im September 1914 offenbarte er sich in einem Kino in Ar
cachon: meine
Mutter und ich, wir saen auf dem Balkon, als er rief, man solle Licht machen; and
ere Herren stellten sich
als Engel in seinen Dienst und riefen: Sieg! Sieg! Der liebe Gott stieg auf die Bhn
e und las das
Kommunique ber den Ausgang der Marne-Schlacht. Zur Zeit, da sein Bart schwarz war
, hatte er als
Jehova gewirkt, und ich vermute, dass sein Sohn Emile indirekt an ihm gestorben
ist. Dieser Gott des
Zornes schwelgte im Blut seiner Shne. Ich hingegen erschien am Ausgang seines lan
gen Lebens. Sein
Bart war wei geworden, mit gelben Tabakspuren, und die Vaterschaft machte ihm kei
nen Spa mehr.
Htte er mich erzeugt, er htte mich unwillkrlich, wie ich glaube, trotzdem noch unte
rjocht: aus
Gewohnheit. Mein Glck war, dass ich einem Toten gehrte: ein Toter hatte die paar S
amentropfen
verschttet, die den blichen Preis eines Kindes ausmachen. Mein Grovater konnte sich
an mir erfreuen,
ohne mich in Besitz zu nehmen: ich wurde sein Wunder, weil ihm daran lag, sein Leb
en als
bewundernder Greis zu beschlieen; er beschloss, mich als ungewhnliche Gunst des Sc
hicksals zu
betrachten, als ein stets widerruf bares Geschenk; was also htte er von mir forde
rn knnen? Ich
beglckte ihn durch meine bloe Gegenwart. Er wurde der Gott der Liebe mit dem Bart
von Gottvater
und dem Heiligen Herzen von Gottsohn; er legte die Hand auf mein Haupt, ich sprte
die Wrme seiner
Handflche; mit einer Stimme, die vor Zrtlichkeit bebte, nannte er mich sein Kleinch
en, Trnen
berschwemmten seine kalten Augen: Alles schrie: Der kleine Bengel hat ihn um den V
erstand ge-bracht!
Er war verrckt nach mir, das sprang in die Augen. Liebte er mich? Bei einer so ffe
ntlichen
Leidenschaft wird es mir schwer, zwischen Aufrichtigkeit und Getue zu unterschei
den: ich glaube nicht,
dass er seinen anderen Enkeln sehr viel Zuneigung schenkte; freilich sah er sie
fast nie, und sie brauchten
ihn auch nicht. Ich hingegen hing in allen Stcken von ihm ab: in mir vergtterte er
seine eigene
Gromut.
Ich habe es oben bereits gesagt: da ich die Welt durch die Sprache entdeckt hatt
e, nahm ich lange Zeit die
Sprache fr die Welt. Existieren bedeutete den Besitz einer Approbation irgendwo i
n den unendlichen
Verzeichnissen des Wortes; Schreiben bedeutete, dass man dort neue Wesen einschr
ieb oder dass man -
dies war meine hartnckigste Illusion - die lebenden Dinge mit der Schlinge der Stz
e einfing. Wenn ich
die Wrter geschickt kombinierte, so verfing sich das Objekt in den Zeichen, und i
ch konnte es halten. Ich
begann damit, mich im Luxembourg durch das glnzende Scheinbild einer Platane fasz
inieren zu lassen:
ich beobachtete sie nicht, ganz im Gegenteil, ich vertraute der Leere, ich warte
te; nach einem Augenblick
kam ihr echtes Blattwerk hervor unter dem Aspekt eines einfachen Eigenschaftswor
tes oder bisweilen
eines ganzen Satzes. Dann hatte ich das Universum um eine wahrhaft schwingende A
rt von Grn
bereichert. Meine Entdeckungen brachte ich niemals aufs Papier; sie sammelten si
ch, wie ich dachte, in
meinem Gedchtnis. In Wirklichkeit verga ich sie. Allein sie gaben mir eine Vorahnu
ng meiner
knftigen Rolle: ich wrde es sein, der Namen vergibt. [] Als Rhetoriker liebte ich n
ur die Wrter: ich
wrde Wortkathedralen errichten unter dem blauen Auge des Wortes Himmel. Ich wrde fr
die
Jahrtausende bauen. Nahm ich ein Buch, so konnte ich es zwanzigmal ffnen und schl
ieen, sah aber sehr
wohl, dass es sich nicht vernderte. Indem er ber die unverwstliche Substanz des Tex
tes glitt, war mein
Blick blo ein winziger Zwischenfall an der Oberflche, er strte nichts, er nutzte ni
chts ab. Ich hingegen,
passiv und vergnglich, war ein geblendetes Insekt, das in die Lichter eines Leuch
tturms geraten war; wenn ich das Arbeitszimmer verlie, so erlosch ich, whrend das
Buch, unsichtbar in der Finsternis, nach
wie vor glnzte: fr sich allein. Ich wrde meinen Werken die Heftigkeit dieser verzeh
renden
Lichtstrahlen geben, und so wrden sie spter, in zerstrten Bibliotheken, den Mensche
n berleben.
Mir behagte es in meinem Unbekanntsein, ich wnschte es zu verlngern und mir daraus
ein Verdienst zu
machen. Ich beneidete die berhmten Gefangenen, die bei Kerzenlicht im Kerker gesc
hrieben haben. Sie
hatten die Verpflichtung bewahrt, ihre Zeitgenossen zu erlsen - und die Verpflich
tung verloren, mit
ihnen verkehren zu mssen. Natrlich hatten die kulturellen Fortschritte meine Chanc
en herabgemindert,
mein Talent im Kerker entfalten zu knnen, aber ich war nicht ganz ohne Hoffnung:
da mein Ehrgeiz so
bescheiden war, wrde es sich die Vorsehung angelegen sein lassen, ihn zu verwirkl
ichen. Inzwischen
schloss ich mich jetzt bereits ein: als Vorwegnahme.
Da mein Grovater sie nun einmal berlistet hatte, benutzte meine Mutter jede Gelege
nheit, mir meine
knftigen Freuden auszumalen. Um mein Entzcken zu erregen, verlieh sie meinem Leben
alle
Eigenschaften, die dem ihrigen fehlten: Ruhe, Mue, Eintracht. Der junge Gymnasial
professor ist noch
unverheiratet, aber eine reizende alte Dame vermietet ihm ein behagliches Zimmer
, wo es nach Lavendel
und frischer Wsche riecht; mit einem Sprung bin ich drben im Gymnasium, mit einem
Sprung wieder
zu Hause; abends bleibe ich einen Augenblick vor meiner Tr stehen, um mit meiner
Zimmerwirtin zu
plaudern, die mich anbetet; brigens werde ich von jedermann geliebt, denn ich bin
hflich und gut
erzogen. Ich hrte nur ein Wort: dein Zimmer; ich verga das Gymnasium, die Witwe de
s hohen
Offiziers, den Provinzgeruch, ich sah nur noch einen Lichtkreis auf meinem Tisch
; mitten in meinem
Zimmer, das in Schatten getaucht war, wo alle Vorhnge geschlossen waren, beugte i
ch mich ber ein
schwarzes Leinenheft. Meine Mutter erzhlte weiter und bersprang dabei zehn Jahre:
Ein
Generalinspektor des Schulwesens nimmt mich unter seinen Schutz, die gute Gesell
schaft von Aurillac
reit sich darum, mich einzuladen, meine junge Frau ist mir in inniger Zuneigung z
ugetan, sie erhlt von
mir schne und gesunde Kinder, zwei Shne und eine Tochter, sie macht eine Erbschaft
, ich kaufe ein
Grundstck am Stadtrand, wir bauen, und jeden Sonntag geht die ganze Familie hinau
s, um den Fortgang
der Arbeiten zu besichtigen. Ich hrte berhaupt nicht zu: whrend dieser zehn Jahre h
atte ich meinen
Tisch nicht verlassen; ich war klein, trug einen Schnurrbart wie mein Vater, hoc
kte auf einem Stapel von
Wrterbchern, mein Schnurrbart wurde wei, die Schreibhand lief noch immer hin und he
r, die Hefte
fielen nacheinander auf den Fuboden. Die Menschheit schlief, es war Nacht, meine
Frau und meine
Kinder schliefen oder waren vielleicht schon tot, meine Zimmerermieterin schlief
; in allen Gedchtnissen
hatte der Schlaf mich ausgelscht. Welche Einsamkeit: zwei Milliarden Menschen lag
en ausgestreckt,
und ich, hoch ber ihnen, war die einzige Nachtwache.
Der Heilige Geist sah mich an. Er hatte sich soeben entschlossen, in den Himmel
zurckzukehren und die
Menschen preiszugeben; ich hatte gerade nur die Zeit, mich anzubieten und ihm di
e Wunden meiner
Seele zu zeigen und die Trnen, die mein Papier benetzten, er las ber meine Schulte
r hinweg, und sein
Zorn legte sich. War er friedlich gestimmt worden durch die Tiefe der Leiden ode
r durch die Pracht des
Werkes? Ich sagte mir: durch das Werk; insgeheim dachte ich: durch die Leiden. S
elbstverstndlich
schtzte der Heilige Geist nur die wahrhaft knstlerischen Schriften, aber ich hatte
Musset gelesen und
wusste, dass die Gesnge der tiefsten Verzweiflung zugleich die schnsten sind, und ic
h hatte
beschlossen, die Schnheit in einer Verzweiflungsfalle zu fangen. Das Wort Genie w
ar mir stets
verdchtig vorgekommen; nun begann es mich vollkommen anzuwidern. Wo blieb die Ang
st, wo die
Prfung, wo die abgewiesene Versuchung, wo blieb schlielich das Verdienst, wenn ich
begabt war ? Nur
mhsam ertrug ich es, einen Krper zu haben und jeden Tag den gleichen Kopf. Ich wol
lte mich doch
nicht in einer geistigen Ausrstung einsperren lassen. Ich nahm meine Erwhlung nur
unter der
Bedingung an, dass sie grundlos war und ohne Anlass glnzte, in einem absolut leer
en Raum.
Ich hatte Besprechungen mit dem Heiligen Geist. Du wirst Schriftsteller werden, sa
gte er mir. Und ich
rang die Hnde: Was ist denn an mir, o Herr, dass du mich erwhlt hast? -Nichts Besonde
res. -
Warum also gerade ich? - Ohne Grund. - Wird mir wenigstens das Schreiben leicht falle
n? -
Keineswegs. Glaubst du, die groen Werke entstehen dadurch, dass einem das Schreib
en leicht fllt? -
O Herr, da ich so nichtig bin, wie kann ich dann ein Buch machen? - Indem du dir Mhe
gibst. -
Also kann jedermann schreiben? - Jedermann, aber dich habe ich erwhlt. Diese Mogelei
war sehr
bequem: sie gestattete mir gleichzeitig, meine Nichtigkeit zu proklamieren und i
n mir den Verfasser
knftiger Meisterwerke zu verehren. Ich war erwhlt und gezeichnet, aber ohne Talent
: alles kam mir von
meiner Geduld und meinem Mhsalen; ich sprach mir jede Eigenart ab, denn charakter
istische
Eigenschaften verkrzen einen; ich war allem untreu, auer dem kniglichen Engagement,
das mich
durch Martern zum Ruhm fhren sollte. Diese Martern musste man finden; sie waren d
as einzige
Problem, aber es schien unlsbar zu sein, denn man hatte mir die Hoffnung geraubt,
im Elend zu leben.
Mochte ich nun unbekannt bleiben oder berhmt werden: auf alle Flle wrde ich ein Geh
alt vom
Unterrichtsministerium beziehen und niemals hungern mssen. Ich versprach mir frcht
erlichen
Liebeskummer, aber sehr lustlos: schmachtende Liebhaber konnte ich nicht aussteh
en. Cyrano de
Bergerac machte mich wtend, denn er war ein falscher Pardaillan, der sich albern
gegenber den Frauen
benahm, whrend der richtige Pardaillan alle Herzen hinter sich herschleppte, ohne
auch nur darauf zu
achten; freilich muss man gerechterweise sagen, dass der Tod seiner geliebten Vi
oletta sein Herz fr
immerdar gebrochen hatte. Ein Witwertum, eine Wunde, die nicht heilen kann: wege
n einer Frau, aber
nicht durch ihr Verschulden; das erlaubte mir, die Anerbieten aller anderen Frau
en zurckzuweisen. Muss
noch vertieft werden! Aber selbst angenommen, dass mein junges Weib aus Aurillac
bei einem Unfall
umkam, so gengte dieses Unglck noch nicht zu meiner Erwhlung, denn es war ebenso zu
fllig wie
allzu alltglich.
Mein wtender Eifer wurde mit allem fertig; manche Autoren waren verspottet und ge
schlagen worden
und hatten bis zum letzten Hauch in der Missachtung und der Nacht gelebt, der Ru
hm hatte nur ihre
Leichen bekrnzt. So wird es auch mir ergehen. Ich werde mit aller Sorgfalt ber Aur
illac schreiben und
seine Plastiken. Da ich nicht zu hassen vermag, werde ich nur danach streben, zu
befrieden und ntzlich
zu sein. Kaum aber erscheint mein erstes Buch, so bricht der Skandal los, und ic
h werde ein Volksfeind:
die Zeitungen der Auvergne beschimpfen mich, in den Lden weigert man sich, mich z
u bedienen,
wutentbrannte Leute werfen mir die Fensterscheiben ein; ich muss flie hen, um ni
cht gelyncht zu werden.
Zuerst bin ich niedergeschmettert, brte monatelang dumpf vor mich hin, murmele un
ablssig: Aber ich
bitte Sie, das ist doch ein Missverstndnis! Denn der Mensch ist gut! Und es ist in
der Tat nur ein
Missverstndnis, aber der Heilige Geist erlaubt nicht, dass es aufgeklrt wird. Ich
werde wieder gesund;
eines Tages setze ich mich an meinen Tisch und schreibe ein neues Buch: ber das M
eer oder das
Gebirge. Es findet keinen Verleger. Ich werde verfolgt, muss mich verkleiden, we
rde vielleicht gechtet,
schreibe andere Bcher, viele andere Bcher, ich liefere eine Versbersetzung des Hora
z, ich entwickle
bescheidene und sehr vernnftige Gedanken zur Pdagogik. Nichts zu machen: meine Hef
te bleiben un-verffentlicht
zu Haufen in einem groen Koffer liegen.
Die Geschichte hatte zwei Schlsse: je nach Laune whlte ich den einen oder den ande
ren. Wenn ic h
trber Stimmung war, sah ich mich auf einem Eisenbett sterben, von allen gehasst,
verzweifelt, in der
gleichen Stunde, da die ersten Trompetenste des Ruhmes erklangen. Bei anderen Gele
genheiten billigte
ich mir ein bisschen Glck zu: im Alter von fnfzig Jahren schrieb ich, um eine neue
Feder
auszuprobieren, meinen Namen auf ein Manuskript, das bald darauf verloren ging.
Irgend jemand fand es
auf einem Speicher, in der Gosse, in einem Schrank des Hauses, aus dem ich gerad
e ausgezogen war, las
es und brachte es aufgeregt zu Artheme Fayard, dem berhmten Verleger von Michel Z
evaco. Ein
Triumph! Zehntausend Stck werden in zwei Tagen verkauft. Und die Reue in den Herz
en! Hundert
Reporter ziehen aus, um mich zu suchen, und finden mich nicht. Ich bin der Welt
vllig abgewandt und
wei lange Zeit nicht, dass die Meinung umgeschlagen ist. Eines Tages schlielich tr
eibt mich der Regen
in ein Cafe. Eine Zeitung liegt herum, ich schaue hin, und was sehe ich? Jean-Pau
l Sartre, der
Schriftsteller in der Maske, der Snger von Aurillac, der Dichter des Meeres, auf d
er Feuilletonseite,
sechsspaltig, fettgedruckt. Ich jubiliere. Nein, ich geniee die Wollust der Schwe
rmut. Jedenfalls gehe ich
wieder nach Hause, packe mit Hilfe meiner Zimmerwirtin den Koffer mit den Heften
ein, schnre ihn fest
zu, schicke ihn an Fayard, ohne meine Adresse anzugeben. An dieser Stelle meiner
Erzhlung brach ich
ab, um entzckende Kombinationen auszuprobieren. Wenn ich nmlich das Paket in der S
tadt aufgab, wo
ich wohnte, stberten die Journalisten mich bald in meinem Versteck auf. Also nahm
ich den Koffer mit
nach Paris und lie ihn durch einen Boten zum Verlag bringen. Bevor ich zurckfuhr,
suchte ich die
Sttten meiner Kindheit auf, die Rue Le Goff, die Rue Soufflot, den Luxembourg. Da
s <Balzar> zog
mich an, denn ich erinnerte mich, dass mein seitdem verstorbener Grovater mich ma
nchmal im Jahre
1913 dorthin mitgenommen hatte. Wir saen dann nebeneinander auf der Bank, alle sc
hauten verstnd-nisinnig
zu uns herber, er bestellte sich ein Bock und fr mich ein winziges Glas Bier, ich
fhlte mich
geliebt. Nun war ich fnfzig Jahre alt geworden und melancholisch, ffnete abermals
die Tr des
Bierrestaurants und bestellte mir das gleiche winzige Glas Bier. Am Nachbartisch
unterhielten sich
schne junge Frauen sehr lebhaft, wobei mein Name fiel. Eine von ihnen sagte: Viell
eicht ist er alt und
hsslich, aber das macht nichts. Dreiig Jahre meines Lebens gbe ich dafr, seine Frau
zu werden. Ich
lchelte stolz und traurig zu ihr hinber, sie sah mich erstaunt lchelnd an, ich stan
d auf und verschwand.
Ich habe viel Zeit gebraucht, um diese Episode zurechtzubasteln und hundert ande
re Episoden, die ich
dem Leser schenke. Man wird dahinter meine in eine knftige Welt projizierte Kindh
eit erkannt haben:
meine Lage, die Erfindungen meines sechsten Lebensjahres, den Trotz meiner verka
nnten Paladine. Ich
trotzte auch noch mit neun Jahren und genoss diesen Trotz sehr ausgiebig. Aus Tr
otz hielt ich als
unerschtterlicher Mrtyrer ein Missverstndnis aufrecht, dessen sogar der Heilige Gei
st berdrssig
geworden zu sein schien. Warum nannte ich jener reizenden Bewunderin eigentlich
nicht meinen Namen?
Ich sagte mir: ACh, sie kommt zu spt. - Aber wo sie mich doch in jedem Fall nehme
n will? - Nun, ich bin
eben zu arm. - Zu arm? Und die Autorenrechte? Dieser Einwand machte mir nichts a
us, denn ich hatte
Fayard geschrieben, er solle das mir zustehende Geld unter dir Annen verteilen.
Aber ich musste nun
endlich einen Schluss finden. Gut also, ich starb in einer kleinen Kammer, von a
llen verlassen, aber
heiteren Gemts, denn meine Mission war erfllt.
Eine Sache fllt mir an dieser tausendfach wiederholten Geschichte auf: am Tage, w
o ich meinen Namen
in der Zeitung sehe, bricht ein Triebrad, und ich bin am Ende. Traurig geniee ich
mein Ansehen,
schreibe aber nicht mehr. Die beiden Schlsse bilden eine Einheit: ob ich nun ster
be, um fr den Ruhm
geboren zu werden, oder ob zuerst der Ruhm kommt und mich ttet, in beiden Fllen ve
rhllt der Drang
zu schreiben eine Lebensverweigerung. Damals hatte mich eine Geschichte stark ve
rwirrt, dir ich
irgendwo gelesen hatte: sie spielte im vergangenen Jahrhundert. Auf einer sibiri
schen Bahnstation geht
ein Schriftsteller hin und her und wartet auf den Zug. Kein Haus weit und breit,
keine Menschenseele.
Der Schriftsteller trgt schwer an seinem trbseligen, umfangreichen Schdel. Er ist k
urzsichtig,
unverheiratet, grob und ununterbrochen wtend; er langweilt sich, er denkt an sein
e Prostata, an seine
Schulden. Auf taucht eine junge Grfin, ihr Wagen kommt nher auf der Strae, die den
Schienen entlang
luft; sie springt aus dem Wagen, eilt auf den Reisenden zu, den sie niemals geseh
en hat, aber zu
erkennen behauptet nach einer Daguerreotypie, die man ihr gezeigt hat. Sie verne
igt sich, ergreift seine
rechte Hand und ksst sie. Die Geschichte hrte da auf, und ich wei nicht, was sie un
s eigentlich sagen
wollte. Mit neun Jahren war ich begeistert darber, dass so ein mrrischer Autor noc
h in der Steppe eine
Leserin fand und dass eine so schne Frau ihm den vergessenen Ruhm wieder nahe bra
chte: dies war eine
Geburt. Ging man weiter in die Tiefe, so war es ein Sterben. Das fhlte ich, das w
ollte ich so; einem
lebenden Brgersmann konnte ein solches Zeugnis der Bewunderung nicht von einer Ar
istokratin zuteil
werden. Die Grfin schien ihm sagen zu wollen: Wenn ich zu Ihnen kommen und Sie berh
ren konnte,
so deshalb, weil es sich nicht mehr lohnt, die berlegenheit des Ranges aufrechtzu
erhalten; ich frage
nichts nach Ihren Gedanken ber meine Handlungsweise, ich halte Sie nicht mehr fr e
inen Mann,
sondern fr das Symbol Ihres Werkes. Gettet durch einen Handkuss, tausend Werst von
St. Petersburg
entfernt, im Alter von fnfundfnfzig Jahren. Ein Reisender fing Feuer, sein Ruhm ve
rzehrte ihn, um blo
noch in flammenden Buchstaben das Verzeichnis seiner Werke brig zulassen. Ich sah
, wie die Grfin
wieder in ihre Kutsche stieg und verschwand und wie die Steppe in die Einsamkeit
zurckfiel; in der
Abenddmmerung fuhr der Zug weiter trotz Haltezeichen, um die Versptung aufzuholen.
Im Rcken
sprte ich den Angstschauer, erinnerte mich an die Geschichte vom <Wind in den Bume
n> und sagte
mir: Die Grfin war der Tod. Der Tod wrde eines Tages kommen, auf einer menschenleere
n Strae, er
wrde mir die Hand kssen.
Der Tod machte mich schwindeln, denn ich lebte nicht gern: daraus erklrt sich der
Schrecken, den er mir
einflte. Indem ich den Tod mit dem Ruhm gleichsetzte, entschied ich ber mein Geschi
ck. Ich wollte
sterben; das Grauen khlte bisweilen meine Ungeduld, aber niemals fr lange Zeit; me
ine heilige Freude
kehrte zurck, ich wartete auf den Blitzstrahl, der mich bis ins Gebein aufflammen
liee. Unsere tiefen
Neigungen sind stets gleichzeitig auf Planen und auf Fliehen gerichtet: ich sehe
gut, dass mein
Unterfangen - zu schreiben, damit man mir mein Dasein verzieh - trotz aller Ange
berei und Lge einige
Wirklichkeit besa. Der Beweis dafr: dass ich auch heute noch schreibe, nach fnfzig
Jahren.
Wenn ich aber auf die Ursprnge zurckgehe, sehe ich dort eine Flucht nach vorn, ein
en Selbstmord a la
Gribouille; ja, mehr als das Heldentum, mehr als das Mrtyrertum suchte ich den To
d. Lange hatte ich
gedacht, so enden zu mssen, wie ich begonnen hatte, irgendwo, irgendwie, so dass
dieses blasse Sterben
bloer Reflex sei meiner blassen Geburt. Meine Auserwhlung vernderte alles: Degenstr
eiche sind
vergnglich, Schriften bleiben. Ich entdeckte, dass sich der Geber im Bereich der
Belletristik in seine
eigene Gabe zu verwandeln vermag, nmlich in einen reinen Gegenstand.
Der Zufall hatte mich Mensch werden lassen, die Hochherzigkeit wrde mich zum Buch
machen; ich
wrde mein Schwatzen, mein Bewusstsein in Bronzelettern umgieen, ich wrde das Lrmen m
eines
Lebens zu Inschriften transformieren, die nicht vergehen, ich wrde mein Fleisch i
n Stil verwandeln, die
schwammigen Zeitspiralen in Ewigkeit, ich wrde vor dem Heiligen Geist als Nieders
chlag der Sprache
erscheinen, wrde mich mit Hartnckigkeit der Menschengattung aufdrngen: ich wrde endl
ich anders
werden, anders als ich, anders als die anderen, anders als alles. Zuerst wrde ich
mir einen unzerstrbaren Leib geben, und dann wrde ich mich den Verbrauchern berlie
fern. Ich wrde nicht schreiben aus
Freude am Schreiben, sondern um diesen unsterblichen Teil in Wrter zu verwandeln.
Schaute ich von der Hhe meines Grabmals hinab, so erschien mir meine Geburt als e
in notwendiges
bel, als eine ganz vorlufige Fleischwerdung, dazu bestimmt, meine Verklrung vorzube
reiten: um
wiedergeboren zu werden, muss man schreiben, zum Schreiben braucht man ein Gehir
n, Augen, Arme;
war die Arbeit beendet, fielen diese Organe in sich zusammen: ungefhr um das Jahr
1955 wrde ein
Kokon aufplatzen, fnfundzwanzig Schmetterlinge in Buchformat wrden davon flattern,
mit ihren Seiten
schlagen und sich schlielich auf einem Regal der Nationalbibliothek niederlassen.
Diese Schmetterlinge
wren nichts anderes als ICH. ICH: fnfundzwanzig Bnde, achtzehntausend Textseiten, d
reihundert
Abbildungen, darunter das Bildnis des Verfassers. Meine Knochen sind aus Leder u
nd Pappe, mein Pa-pierfleisch
riecht nach Kleister und Druckerschwrze, behaglich trme ich mich auf mit sechzig K
ilo
Papier. Ich erlebe eine Wie dergeburt, ich werde endlich ein ganzer Mensch, der
denkt, spricht, singt,
donnert, sich besttigt mit der gebieterischen Trgheit der Materie. Man nimmt mich,
man ffnet mich,
man legt mich auf den Tisch, man glttet mich mit der flachen Hand, wobei ich manc
hmal knacke. Ich
lasse es mit mir machen, und pltzlich blitze ich, blende ich, setze ich mich auf
Distanz durch, pltzlich
durchdringen meine Krfte den Raum und die Zeit, schmettern die Bsen zu Boden und s
chtzen die
Guten. Keiner kann mich vergessen oder totschweigen: ich bin ein groer, praktikab
ler und schrecklicher
Fetisch. Mein Bewusstsein ist zerbrckelt: um so besser. Andere Bewusstseine haben
mich in sich
aufgenommen, man liest mich, ich setze mich durch; man spricht mich, ich bin in
aller Munde als
universelle und einzigartige Sprache; aus Millionen Augen schaue ich als neugier
ige Voraussicht; fr den,
der mich zu lieben wei, bin ich seine geheimste Unruhe, will er mich aber berhren,
so entziehe ich mich
und verschwinde; ich existiere nirgends mehr, ich bin, endlich! Ich bin berall: U
ngeziefer der
Menschheit, meine Wohltaten fressen an ihr und zwingen sie unablssig, meiner Abwe
senheit zu geden-ken.
Das Zauberkunststck glckte: ich begrub den Tod im Leichentuch des Ruhmes, ich dach
te nur noch an
den Ruhm, aber niemals an den Tod, ohne zu bemerken, dass die beiden eine Einhei
t bildeten. Im
Augenblick, wo ich diese Zeilen schreibe, wei ich, dass meine Zeit bis auf wenige
Jahre abgelaufen ist.
Ich stelle mir ohne all zuviel Heiterkeit sehr klar das Alter vor, das sich anknd
igt, und meine knftige
Gebrechlichkeit, dazu Gebrechlichkeit und Tod der Menschen, die ich liebe: meine
n eigenen Tod aber
stelle ich mir niemals vor. Gelegentlich gebe ich den mir nahestehenden Menschen
- einige sind fnfzehn,
zwanzig, dreiig Jahre jnger als ich - zu verstehen, wie leid es mir tut, sie berleb
en zu mssen: sie
lachen mich aus, und ich lache mit ihnen, aber da ist nichts zu machen, da wird
nichts zu machen sein: im
Alter von neun Jahren hat eine Operation mich der Fhigkeit beraubt, eine gewisse
pathetische
Empfindung zu haben, die angeblich zum Menschsein gehrt.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Briefe Schreiben Im Beruf - Beispiele RegelnDokument24 SeitenBriefe Schreiben Im Beruf - Beispiele RegelnEndzhe OwtscharenkoNoch keine Bewertungen
- Georg Patzer Lektureschlussel Hermann Hesse Der Steppenwolf 2007Dokument95 SeitenGeorg Patzer Lektureschlussel Hermann Hesse Der Steppenwolf 2007Ella FlorentinaNoch keine Bewertungen
- Kleine Noten, Die Sich MögenDokument162 SeitenKleine Noten, Die Sich MögenTheophilosProjektNoch keine Bewertungen
- SingendindenUntergangBilderfassung 2Dokument128 SeitenSingendindenUntergangBilderfassung 2knalltuetenNoch keine Bewertungen
- Karl Corino - Robert Musil. Leben Und Werk in Bildern Und Texten-Rowohlt (1988)Dokument508 SeitenKarl Corino - Robert Musil. Leben Und Werk in Bildern Und Texten-Rowohlt (1988)robertoculebroNoch keine Bewertungen
- 7.der Mann Ohne Eigenschaften R.musilDokument8 Seiten7.der Mann Ohne Eigenschaften R.musilGabriela CondreaNoch keine Bewertungen
- Saeuren BasenDokument164 SeitenSaeuren Basensusi21Noch keine Bewertungen
- Josefine Mutzenbacher - Unzensierte Ausgabe: »Der mit Abstand beste deutschsprachige erotische Roman aller Zeiten«Von EverandJosefine Mutzenbacher - Unzensierte Ausgabe: »Der mit Abstand beste deutschsprachige erotische Roman aller Zeiten«Noch keine Bewertungen
- Canetti U Veza - Die Gelbe Straße PDFDokument184 SeitenCanetti U Veza - Die Gelbe Straße PDFariel54100% (1)
- Test Wie Feminin Oder Maskulin Sind SieDokument10 SeitenTest Wie Feminin Oder Maskulin Sind SieMateusz ZyndaNoch keine Bewertungen
- Werkschau: Diplomlehrgang 2021 Literarisches SchreibenVon EverandWerkschau: Diplomlehrgang 2021 Literarisches SchreibenNoch keine Bewertungen
- Also Sprach Zarathustra - Friedrich NietzscheDokument142 SeitenAlso Sprach Zarathustra - Friedrich NietzscheJavier Peris SabaterNoch keine Bewertungen
- Reichtum durch versenktes Nazigold: NS Kunstraub - NS Goldraub - NS Raubkunst - Untergetauchter SS Mann - Liebe und Leidenschaft - Herzl Judentum -Krimi aus BaselVon EverandReichtum durch versenktes Nazigold: NS Kunstraub - NS Goldraub - NS Raubkunst - Untergetauchter SS Mann - Liebe und Leidenschaft - Herzl Judentum -Krimi aus BaselNoch keine Bewertungen
- Der Fluch des Nazigoldes: Folgen des Dritten Reichs - Verbotene Homosexualität - Waffen SS - Untergetauchter SS Mann - Gold für Hitler von Mussolini -Herzl Judentum -Krimi aus BaselVon EverandDer Fluch des Nazigoldes: Folgen des Dritten Reichs - Verbotene Homosexualität - Waffen SS - Untergetauchter SS Mann - Gold für Hitler von Mussolini -Herzl Judentum -Krimi aus BaselNoch keine Bewertungen
- Am Wege Oins oms andr': Essays, Erzählungen, Briefe, Gedichte, RezepteVon EverandAm Wege Oins oms andr': Essays, Erzählungen, Briefe, Gedichte, RezepteNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Erzählungen: Die etruskische Vase + Die Venus von Ille + Das Gäßchen der Madama Lucrezia + Djuman und mehrVon EverandGesammelte Erzählungen: Die etruskische Vase + Die Venus von Ille + Das Gäßchen der Madama Lucrezia + Djuman und mehrNoch keine Bewertungen
- Liselotte Welskopf-Henrich und die Indianer: Eine BiographieVon EverandLiselotte Welskopf-Henrich und die Indianer: Eine BiographieNoch keine Bewertungen
- Krambambuli: Eine tiefsinnige- und zeitlose Erzählung von Marie von Ebner-EschenbachVon EverandKrambambuli: Eine tiefsinnige- und zeitlose Erzählung von Marie von Ebner-EschenbachNoch keine Bewertungen
- Autobiographisches Schreiben Bei HesseDokument9 SeitenAutobiographisches Schreiben Bei HesseMaximilian GruberNoch keine Bewertungen
- Michel B. verzettelt sich: Eifeler Ermittlungen eines EnkelsVon EverandMichel B. verzettelt sich: Eifeler Ermittlungen eines EnkelsNoch keine Bewertungen
- Ferienhaus für eine Leiche: Schweden-Krimi mit RezeptenVon EverandFerienhaus für eine Leiche: Schweden-Krimi mit RezeptenNoch keine Bewertungen
- MonologeDokument177 SeitenMonologelinus.a.grossNoch keine Bewertungen
- Gehe hin, stelle einen Wächter von Harper Lee (Lektürehilfe): Detaillierte Zusammenfassung, Personenanalyse und InterpretationVon EverandGehe hin, stelle einen Wächter von Harper Lee (Lektürehilfe): Detaillierte Zusammenfassung, Personenanalyse und InterpretationNoch keine Bewertungen
- Arthur SchnitzlerDokument2 SeitenArthur SchnitzlerMariachiara ContiNoch keine Bewertungen
- Kishon - Ephraim - Der GlückspilzDokument239 SeitenKishon - Ephraim - Der GlückspilzRon PzVieNoch keine Bewertungen
- Kolonien Der LiebeDokument139 SeitenKolonien Der LiebeŞeyma DemirciNoch keine Bewertungen
- Hermann Schmitz Im Gespräch: Gefühle Sind Keine Privatsache" - Philosophie MagazinDokument17 SeitenHermann Schmitz Im Gespräch: Gefühle Sind Keine Privatsache" - Philosophie MagazinettorebaNoch keine Bewertungen