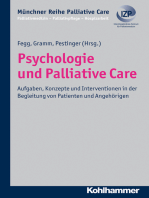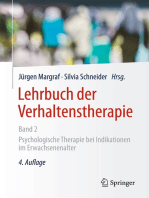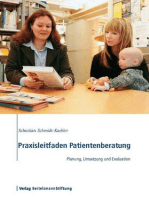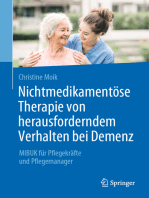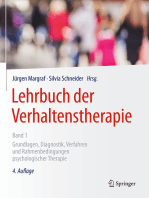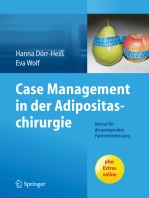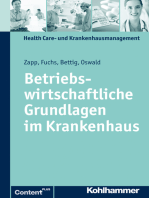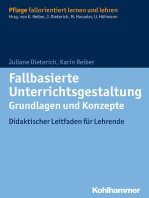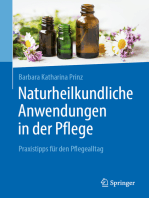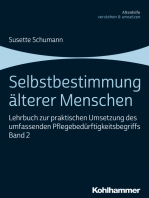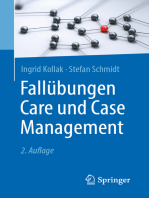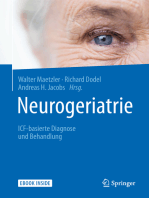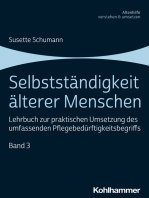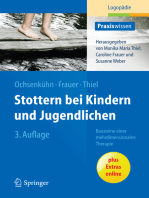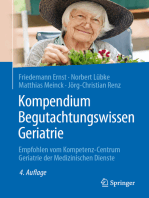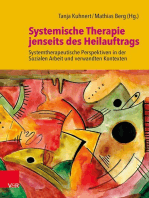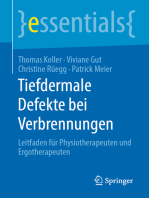Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Dollhummelgaatzkorrneu Beratungskonzept Onkologie
Hochgeladen von
Marwa Rikabi-SukkariOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Dollhummelgaatzkorrneu Beratungskonzept Onkologie
Hochgeladen von
Marwa Rikabi-SukkariCopyright:
Verfügbare Formate
PFLEGEPÄDAGOGIK
Lernfeld Beratung in der Pflege
Umsetzung des Lernfeldkonzeptes in der
Fachweiterbildung für onkologische Pflege
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz
Axel Doll, In der Pflege gewinnt das Thema Beratung immer mehr an Bedeutung. Durch
Diplom Pflegepädagoge,
Fachkrankenpfleger für den Wandel des Krankheitsspektrums hin zur Dominanz chronischer Erkran-
Onkologie kungen liegt der Fokus der Pflege, gerade auch in der Onkologie, auf der Unter-
stützung des Patienten in seiner Krankheitsbewältigung. Um Tumorpatienten
und ihre Bezugspersonen in ihrer Anpassung an die durch Krankheit ausgelöste
veränderte Lebenssituation zu unterstützen, ist es besonders für onkologische
Fachpflegekräfte unerlässlich, über Beratungskompetenzen zu verfügen. Die Vor-
teile des in der Berufspädagogik etablierten Lernfeldkonzeptes werden für die
curriculare Entwicklung onkologischer Fachweiterbildungen genutzt, um eine
Grundlage zu schaffen, Beratungshandeln in der onkologischen Pflege lehr-/
lernbar zu machen. In einem ersten Schritt wird das Handlungsfeld „Beratung in
Sonja Hummel-Gaatz, der onkologischen Pflege“ untersucht. Dazu wird eine Befragung (Fragebogen)
Diplom Pflegepädagogin,
Krankenschwester von 200 onkologischen Pflegekräften und eine Analyse deutschsprachiger Pflege-
literatur durchgeführt. Aus der Synthese dieser Ergebnisse wird ein systemisches
Beratungsmodell entwickelt. Mit Hilfe dieses Modells wird das Lernfeld „Beratung
in der onkologischen Pflege“ abgeleitet. Dafür werden Feld-, Methoden-, System-
Korrespondenzadresse: und Selbstkompetenzen, Lerninhalte und der Zeitrichtwert festgelegt.
Axel Doll
Wannseeschule e.V.
Zum Heckeshorn 36
D-14109 Berlin Einleitung
Tel.: 030 80686 412
adoll@wannseeschule.de In der Pflege gewinnt das Thema Beratung, beeinflusst durch gesellschaftliche, gesundheits-
ökonomische und berufspolitische Faktoren, immer mehr an Bedeutung. Es wird sowohl
von verschiedenen Wissenschaftlern der Pflege- und Gesundheitswissenschaften als auch
von Pfl egepädagogen und Pfl egepraktikern als wichtiges neues Handlungsfeld gesehen
(Schaeffer/Moers 2000, Müller-Mundt 2000, Reibnitz von/Schnabel/Hurrelmann 2001). Der
steigende Bedarf an Beratung in der Pflege resultiert u.a. aus der konsequenten Forderung
nach und Förderung von mündigen und informierten Patienten, die mit deutlich mehr Ei-
genverantwortung und Mitbestimmung an ihrem Krankheitsbewältigungsprozess beteiligt
werden sollen (WHO 1986, Schröck/Drerup 2002, Abt-Zegelin 2003). Für die Pflege wird es
in Zukunft deutlich mehr zum Aufgabenspektrum gehören, einerseits Patienten und deren
Bezugspersonen (Familie, Partner, Freunde, Nachbarn, Betreuer) durch Beratung aktiver in
den stationären Behandlungs- und Pflegeprozess einzubeziehen und andererseits voraus-
schauend und professionell auf die Entlassung und die potentiellen Probleme im häuslichen
Umfeld vorzubereiten (Koch-Straube 2001).
Berufspolitisch schlagen sich diese Veränderungen in aktuellen Gesetzesnovellierungen (Al-
tenpflegegesetz 2003, Krankenpflegegesetz 2004) und nationalen Leitlinien zur Qualitäts-
sicherung nieder, wie z. B. in den nationalen Expertenstandards zum Schmerz- und Entlas-
sungsmanagement (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 2004). Durch
den Wandel des Krankheitsspektrums hin zur Dominanz chronischer Erkrankungen liegt der
Fokus nicht mehr nur auf der Heilung von Krankheiten, sondern auch auf der Unterstützung
der Patienten in ihrer Krankheitsbewältigung. Insbesondere bei Krebserkrankungen kommt es
zu Auseinandersetzungen mit existenziellen Bedrohungen und dadurch zu Lebensbruchkrisen
und traumatischen Erfahrungen (Schaeffer/Moers 2000). Diese krisenhafte Auseinanderset-
zung der Patienten mit ihrer Tumorerkrankung erfordert von der Pflege Beratungsangebote,
die den Patienten zur Anpassung an seine Erkrankung befähigen und die Integration seiner
Schlüsselwörter veränderten Lebenssituation in den Alltag fördern (Rennecke 2000).
Beratung Auf diese Beratungsaufgaben sind Pflegekräfte bisher nur unzureichend vorbereitet. Beratung
wird meist ohne entsprechende qualifikatorische Basis durchgeführt (Abt-Zegelin 2002, Kne-
Lernfeld
lange/Schieron 2000). Deswegen wird von Experten gefordert, Beratung als Lerngegenstand
Handlungsfeld sowohl in die Aus- aber auch in Weiterbildungen stärker zu integrieren und gezielt Kompe-
tenzen zum Beratungshandeln zu entwickeln. Um Tumorpatienten in ihrer Anpassungsleis-
Handlungskompetenzen
tung zu unterstützen, ist es besonders für onkologische Fachpflegekräfte1 unerlässlich, über
Onkologische Pflege Beratungskompetenzen zu verfügen.
206 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
Title Im aktuellen fachdidaktischen Diskurs in der Pflegepädagogik wird davon ausgegangen, dass
vor allem in fächerintegrativen und handlungsorientierten Lehr-/Lernarrangements zu kom-
Counselling in Nursing as a plexem beruflichem Handeln, wie z. B. Beraten von Patienten und Bezugspersonen, befähigt
Learning Field werden kann. In einer Untersuchung von Curricula/Stoffverteilungsplänen onkologischer
The Implementation of the Fachweiterbildungen in Deutschland (Gaatz/Doll 2003) zeigt sich jedoch, dass Beratung als
Learning Field Concept in the Lerngegenstand nur rudimentär verankert ist und vielfach ohne Verknüpfung mit der Pflege
Advanced Training for Onco- in bezugswissenschaftlichen Fächern (Psychologie, Pädagogik) fachsystematisch vermittelt
logy Nursing wird. Damit stehen sich sowohl die politische Forderung nach professionellem Beratungs-
handeln als auch die fachdidaktischen Forderungen nach handlungsorientiertem Lernen auf
der einen Seite, sowie die unzureichende curriculare Umsetzung in den onkologischen Fach-
Abstract
weiterbildungen auf der anderen Seite gegenüber. Anknüpfend an dieses identifizierte Bil-
The subject of “counselling” dungsdefizit wird das in der Berufs- und Pflegepädagogik etablierte Lernfeldkonzept auf die
gains ever more importance in curriculare Entwicklung für die Fachweiterbildung übertragen. Damit werden die besonderen
nursing. Due to changes in the Vorteile des Konzeptes, wie z. B. die Orientierung an der beruflichen Handlungskompetenz
range of diseases towards a und das Prinzip der Fächerintegration für den Weiterbildungssektor nutzbar gemacht.
dominance of chronic illnesses,
nursing, and especially oncolo-
gy nursing, increasingly focuses
on supporting patients in de-
veloping individual strategies Zielsetzung und Methode
for coping with their illness.
Da weder die beiden Lernfelder „Unterstützen, Beraten, Anleiten“ des Alten- und Kranken-
In order to support tumour
pflegegesetzes empirisch gestützt entwickelt und das Beratungsverständnis in der Pflege
patients and their relatives in
the process of adapting to their
klar theoretisch konzeptualisiert wurden, noch das Handlungsfeld für die Beratung in der
altered life situation, it is indis- onkologischen Pflege bisher erfasst wurde, werden in der Untersuchung die beiden nach-
pensable that oncology nurses stehende Ziele verfolgt:
acquire special counselling 1. Das Handlungsfeld „Beratung in der onkologischen Pflege“ berufswissenschaftlich fundiert
competences. The advantages zu analysieren und zu beschreiben
of the learning field concept
2. Das Lernfeld2 „Beratung in der onkologischen Pflege“ für die onkologische Fachweiterbil-
that has been established in
dung empirisch begründet zu entwickeln
professional education sciences
is being employed for the Als Grundlage zur curricularen Konstruktion von Lernfeldern ist eine empirische Untersu-
curriculum development of ad- chung der Handlungsfelder durch eine Analyse der Arbeits- und Geschäftsprozesse (Nieder-
vanced training programs for sächsisches Kultusministerium 2001) bzw. in der Übertragung auf die Pflege durch Analyse
oncology nurses. The authors der Pflege- und Beziehungsprozesse (Wittneben 2003) notwendig. Da dies bisher jedoch
use this concept to develop a noch nicht durchgeführt wurde, stehen keine geeigneten Untersuchungsinstrumente zur
conceptual basis enabling the Verfügung. In Anlehnung an Knigge-Demal (2001) werden deshalb die folgenden Struk-
teaching and learning of the tur- und Prozessmerkmale von Pflegesituationen als Denkmodell und Analyseraster für das
counselling performance in on- Handlungsfeld „Beratung in der onkologischen Pflege“ zugrunde gelegt:
cology nursing. In a first step,
the sphere of activity “coun-
selling in oncology nursing”
is examined. Therefore, a
Struktur- und Prozessmerkmale von Analyseraster für das Handlungsfeld
Pflegesituationen „Beratung in der onkologischen Pflege“
survey (questionnaire) with the (Knigge-Demal 2001) (Hummel-Gaatz/Doll)
participation of 200 oncology
nurses has been conducted Anlässe und Zielsetzungen, die mit Pflegethemen/-phänomene, die Anlass
and an analysis of the German einer Situation verknüpft sind zu Beratung von onkologisch erkrank-
nursing literature was perfor- ten Patienten und Bezugspersonen sind
med. As a synthesis of results,
a systemic counselling model Der Pflegeprozess, der pflegerisches Beratungsprozess
has been developed. Handeln strukturiert
With the support of the deve-
loped counselling model, the
Kontextbedingungen der Organisation, Kontextbedingungen, in die Beratungs-
in die die Berufs- und Pflegesituationen handeln eingebettet sind
learning field of “counselling in eingebettet sind
oncology nursing” is construc-
ted from the described voca- Gesellschaftliche Bedingungen, unter Derzeitige und zukünftige gesellschaft-
tional field of activity. For it, denen sich der Berufsauftrag realisiert liche Anforderungen bezogen auf das
field-, method-, system-, and Handlungsfeld „Beratung in der onkolo-
self competences as well as gischen Pflege“
content and time indexes have
been defined.
Zur Beleuchtung des Forschungsgegenstandes werden zwei methodische Zugänge verwen-
Keywords det, die im Folgenden kurz dargestellt werden.
Counselling Durch eine Befragung von onkologischen Pflegekräften in Form eines Fragebogens werden
Learning field die Pflegephänomene in der Pflegepraxis erfasst, die Anlässe zu Beratung von Patienten
und ihren Bezugspersonen darstellen. Zur Erhebung der Kontextbedingungen wird erfragt,
Sphere of activity inwieweit in der Praxis Beratungsgespräche spontan oder geplant durchgeführt werden.
Decision-making and re- Die Bedeutung der Beratung in der onkologischen Pflege wird ebenfalls empirisch erhoben.
sponsibility Dafür wurden auf dem 26. Deutschen Krebskongress 2004 in Berlin die Teilnehmer des
Pflegekongresses befragt. Insgesamt wurden 200 Fragebögen verteilt. Der Rücklauf betrug
Oncologic Nursing 75%. In die Stichprobe aufgenommen wurden nur Pflegekräfte, die in der stationären oder
207 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
ambulanten onkologischen Pflege tätig sind. Die 33 Fragebögen, die von Arzthelferinnen,
Pflegedienstleitungen oder Mitarbeitern im Aus-, Fort-, Weiterbildungs- und Hochschulbe-
reich ausgefüllt wurden, erfüllten diese Einschlusskriterien nicht und fielen somit aus der
Stichprobe heraus. Insgesamt konnten 116 Fragebögen ausgewertet werden.
Zur quantitativen Auswertung wurde der Fragebogen codiert. Mit dem Statistikprogramm
SPSS wurden Häufigkeiten und Mittelwerte berechnet.
Die Antworten der offenen Fragen wurden in Anlehnung an Mayring (Bortz/Döring, 1995)
einer strukturierenden Inhaltsanalyse unterzogen, dabei die Begriffe codiert und in Katego-
rien geclustert.
Mit Hilfe einer Analyse deutschsprachiger Pflegeliteratur wird dargestellt, welche Beratungs-
konzepte in der Pflege diskutiert werden. Ergänzend zur empirischen Untersuchung werden
anhand der Literaturanalyse Aussagen zu den Kontextbedingungen von Beratung zusam-
mengestellt. Außerdem werden die derzeitigen und zukünftigen gesellschaftlichen Anforde-
rungen bezogen auf Beratung in der onkologischen Pflege aus Expertensicht dargestellt.
In die Literaturanalyse wurden alle Veröffentlichungen der deutschsprachigen Pflegelitera-
tur bis Januar 2004 einbezogen, die Beratung in der Pflege thematisieren. Zur Erstellung
der Bibliographie wurde in den Pflege-Datenbanken CARELIT und CINAHL mit folgenden
Suchbegriffen nach Veröffentlichungen gesucht: Beratung, Pflegeberatung, Patientenbera-
tung, Pflegeberater, Beratungskompetenz, Patientenedukation und Pflegekompetenz. Für
die Recherche von Büchern wurde die Online-Suchmaske von www.amazon.de und von der
Pflegebuchhandlung www.fachbuch-richter.de verwendet. Anhand der Literaturverzeichnisse
und Bibliographien in den Büchern und Artikeln wurden noch fehlende Veröffentlichungen
ergänzend erfasst.
Ergebnisse
Auf der Basis einer Vielfalt von Beratungskonzepten in der Pflege – wie beispielsweise sys-
temtheoretische, verhaltensorientierte oder humanistische Ansätze – wurde von den Autoren
die folgende Definition von Beratung entwickelt. Sie liegt der empirischen Untersuchung
bzw. der gesamten Arbeit zu Grunde:
Beratung in der Pflege ist ein Beziehungsprozess zwischen Pflegenden und Patienten bzw.
seinen Bezugspersonen mit dem Ziel, sie bei der Krankheits- und Krisenbewältigung zu
unterstützen. Dies geschieht durch:
• Unterstützen beim Bewältigen von Problemen
• Unterstützen beim Finden von Entscheidungen
• Fördern, Entdecken und Erhalten von Ressourcen
• Unterstützen beim Auseinandersetzen mit veränderten Lebensumständen und den
daraus resultierenden Emotionen.
Im Folgenden wird das Handlungsfeld „Beratung in der onkologischen Pflege“ anhand des
entwickelten Analyserasters beschrieben.
Pflegethemen und -phänomene
Häufigkeit der verschiedenen Beratungsanlässe bei Patienten
Für die Erhebung der Pflegeprobleme, die für
und Bezugspersonen (n = 116)
Pflegekräfte Anlass zu Beratung von Patienten
und Bezugspersonen sind, wurde ein aus der
2 = selten; 3 = manchmal;
Patienten Bezugspersonen
Voruntersuchung (Gaatz/Doll 2003) erstellter
Mittelwerte: 1= nie;
4 Themenkatalog vorgegeben. Aus dem Vergleich
4 = häufig
3
der Mittelwerte (Abb. 1) lässt sich ablesen, dass
zu bestimmten Themen sowohl Patienten als
2 auch Bezugspersonen häufiger beraten werden
1
(z. B. Angst, Ernährung, Übelkeit/Erbrechen,
Schmerz und Umgang mit Medikamenten) als
At t
An
Ju ntin rop
In tion i t
O d p stö
H öp
Se er
Er ng
In s ig
Kö ei z z
Sc a f n
St alit
M erb
Er hru
H pfl e ng
Üb av
Um keit org
Sc i pa e g
au fu
m
il f
ko s
bs fle ru
o m ät
fe ke
nä
sc ng
ck e
un ild
gs
zu anderen Themen (z. B. Atmung, Juckreiz,
hm
xu z
hl tio
rp
el ers
lo ge
ga /Erb u ng
k
u
h
t
t
r
ng re
Inkontinenz, Sexualität und Stomaversorgung).
n
m che
p
g n
it
Mit Ausnahme von Hilflosigkeit und Inkontinenz
M n
hy
ed
lax
werden Patienten zu den erfassten Themen zwar
.
e
Pflegeprobleme/-themen, die Anlass zu Beratung sind
häufiger beraten als die Bezugspersonen trotz-
Abb. 1 dem zeigt sich eine deutliche Parallelität bei der
Bedeutung der Beratungsthemen.
Mit zwei offenen Fragen wurde nach weiteren relevanten Pflegethemen gefragt. Ein wichti-
ges Ergebnis der Untersuchung ist, dass sich durch die Auswertung der offenen Fragen ein
breites – nicht antizipiertes – Spektrum von Beratungsanlässen ergeben hat, die in sechs
208 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
von den Autoren gebildeten Kategorien systematisiert zusammengefasst wurden. Die Bera-
tungsanlässe lassen sich in Themen der körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen
Dimension der Patienten und ihrer Bezugspersonen unterteilen. Es zeigte sich, dass das ge-
sundheitspolitisch viel diskutierte Versorgungs-/Entlassungsmanagement von den Praktikern
ebenfalls als Teil ihres Handlungsfeldes gesehen wird und Pflegende es als Aufgabe sehen,
eine Dolmetscherfunktion bezogen auf Diagnose und Therapie zu übernehmen (Tab. 1).
Weitere Beratungsanlässe Themenbereiche Themenbereiche
bei Patienten bei Bezugspersonen
Körperliche Dimension:
• Symptommanagement (z. B. Diarrhoe, Thrombopenie) 11 4
• Hilfsmittel (z. B. zentralvenöse Zugänge) 3 4
• Pflegerische Versorgung (z. B. Wundmanagement, Körperpflege) 0 4
• Sonstige Beratungsanlässe 5 3
Psychische Dimension (z. B. psychoonkologische Probleme) 6 8
Soziale Dimension:
• Familie (z. B. familiäre Probleme, Freunde) 4 5
• Berufliche Situation (z. B. Arbeitslosigkeit, Schule) 3 2
• Finanzielle Situation (z. B. Gesundheitsreform) 2 3
• Sonstige Beratungsanlässe 5 7
Spirituelle Dimension (z. B. Glaube, Zukunft) 2 2
Entlassungs- und Versorgungsmanagement (z. B. Verlegung in 9 7
Hospiz, Pflegeüberleitung, Reha)
Dolmetscherfunktion (z. B. Therapiemodalitäten, Aufklärung) 5 5
Summe 55 54
Tab. 1: Spektrum der weiteren Beratungsanlässe (Häufigkeit der Nennungen)
Beratungsprozess
Die Analyse von fünfzehn Be-
Beratung als Problemlöseprozess ratungsmodellen zeigt, dass
Beratungshandeln als ein Ar-
beitsprozess mit aufeinander
aufbauenden Handlungsschrit-
Phase 6: Beratung beenden Phase 1: Beziehung herstellen ten (nach dem Modell der
vollständigen Handlung) iden-
tifi ziert werden kann. Einige
Theoretiker kritisieren jedoch,
Phase 5: Beratungsprozess Phase 2: Beratungsbedarfe/
dass Beratung kein an linearen
reflektieren -bedürfnisse erfassen Phasen orientiertes Geschehen
ist, sondern eher zirkulär und
verschränkt verläuft. Für die
Beratung in der onkologischen
Phase 4: Lösungen Phase 3: Beratungsziele
Pflege stellt ein am etablierten
entwickeln aushandeln Pflegeprozess orientiertes Pha-
senmodell ein sinnvolles Glie-
derungsinstrument dar, das
Abb. 2 hilft den Beratungsprozess zu
strukturieren.
Zu Beginn des Beratungsprozesses stellt die Kontaktaufnahme und der Aufbau einer sym-
metrischen Beziehungs- und Vertrauensbasis eine Grundvoraussetzung für eine ge-
lingende Beratung dar. Abhängig davon, ob die Beratung eingebettet in eine bereits beste-
hende Pflegebeziehung oder losgelöst in einem strukturierten Beratungsangebot stattfindet,
muss diese Phase unterschiedlich intensiv und bewusst gestaltet werden.
Das diagnostische Denken des Beraters ist von zentraler Bedeutung. Mehr oder weniger
explizit stehen zu Anfang des Beratungsprozesses eine gemeinsame Exploration des Pro-
blems und eine Identifikation sowohl des objektiven Beratungsbedarfes als auch des
subjektiven Beratungsbedürfnisses. Hierbei ist eine theoriegeleitete Hypothesenbildung
des Beraters notwendig; durch strukturiertes Beobachten, waches Analysieren der Gesamt-
situation (durch Fragen und Spiegeln) und gemeinsames Bewerten kann das Problem als
Ausgangspunkt der Beratung identifiziert werden.
209 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
Mit dem zu Beratenen wird eine gemeinsame Zielsetzung ausgehandelt. Die möglichen
Zielsetzungen der Beratung sind abhängig vom jeweiligen Beratungsansatz. Humanistische
Ansätze ( Koch-Straube 2001, Hellige/Hüper 2002) zielen auf das psychosoziale Coping und
die Integration von Emotionen. Der verhaltensorientierte Ansatz (London 2003, Abt-Zegelin
2003) hat die Anpassungsprozesse im Bereich der Alltagskompetenz zum Fokus und leistet
damit einen wichtigen Beitrag in der konkreten Auseinandersetzung mit Krankheits- und
Therapiefolgen. Ergänzt werden diese beiden Ansätze durch den systemischen Blickwinkel
(Wörmann 2003), der besonders dadurch an Bedeutung gewinnt, dass von der Tumorer-
krankung alle im sozialen bzw. familiären Netz durch Rollenveränderungen, der eigenen
Krisenbewältigung und den neuen (pflegerischen) Aufgaben betroffen sind. Koch-Straube
(2001) versucht mit ihrem leiborientierten Beratungsansatz, diese verschiedenen Perspekti-
ven zu integrieren.
Das Entwickeln von Lösungen findet sowohl auf der Beziehungs- als auch Inhaltsebene
statt und kann als eine Verschränkung von Beziehungs- und Problemlösungsprozessen ver-
standen werden. Die Beziehungsebene ist geeignet, Patienten und ihre Bezugspersonen in
ihrem Bewältigungsprozess zu begleiten, Gefühle zu explorieren und subjektive Deutungen
nachzuvollziehen. Die Problemlösungsebene unterstützt diesen Prozess und ermöglicht
– unter Einbeziehung von Ressourcen und biographischem Kontext – konkrete Handlungs-
möglichkeiten zu erkennen.
Die abschließende Reflexion dient der Bewertung des Gesprächsverlaufs, der Zusammen-
fassung des Erkenntnisgewinns und der Vereinbarung von konkreten Handlungsschritten. Es
ist wichtig ein Beratungszyklus bewusst zu beenden und zu dokumentieren. Die Selbst-
reflexion der Beraterrolle findet zwar außerhalb des konkreten Gesprächs statt, gehört aber
zu einem professionellen Beratungsprozess.
Kontextbedingungen
Bei der Analyse der Beratungsliteratur zu Aussagen, die sich auf die Kontextbedingungen
von Beratungssituationen in der Pflege beziehen, sind vor allem zwei große Argumentati-
onsstränge bezogen auf die zeitlichen und räumlichen Bedingungen von Beratung in der
Pflege zu erkennen: Es wird eine kontroverse Auseinandersetzung zwischen formeller, insti-
tutionalisierter Beratung und informeller, spontaner Beratung geführt.
Viele Autoren betonen, dass es für die Beratung in der Pflege typisch ist, dass es kein klar
definiertes Beratungssetting (Beratungsraum, klare Terminvereinbarungen und abgesteckter
Zeitrahmen) gibt, sondern dass die große Chance der Pflege darin besteht, alltagsnah bera-
ten zu können und zwar immer dann, wenn vom Patienten Signale zu einem Beratungsbe-
dürfnis ausgehen. Beratung ist dann keine Spezialtätigkeit, sondern wird als Pädagogisierung
der stattfindenden Pflege in den alltäglichen Pflegeprozess bzw. den Arbeitsablauf integriert
(Koch-Straube 2000; 2003; Abt-Zegelin 2003). Dass sich Beratungsgespräche in der Pflege
ungeplant und unvorhersehbar entwickeln, hängt auch damit zusammen, dass Patienten in
ihrer Not mit ihren Anliegen sozusagen „herausplatzen“ und einer „zeitnahen interaktions-
orientierten Zuwendung“ (Stratmeyer 2001) bedürfen. Der Pflege kommt die besondere
Aufgabe zu, den pädagogisch günstigen Moment zu erkennen, d.h. auch indirekte und
implizite Anspielungen als Beratungsbedürfnis zu identifizieren und angemessen darauf zu
reagieren (London, 2003).
Einige Autoren hingegen plädieren dafür, gezielt geplante und strukturierte Beratungsan-
gebote in die Pflege zu implementieren. Nur wenn ein klarer zeitlicher Rahmen und ein ge-
schützter Raum zur Verfügung stehen, kann dem Beratungsbedarf von Patienten und ihren
Bezugspersonen ihrer Meinung nach entsprochen werden (Stratmeyer 2001, Koch-Straube
2003). Die Vorteile solcher institutionalisierten Angebote, wie z. B. Pflegebüros, Beratungs-
stellen, Angehörigensprechstunden und geplante eher alltagsdistanzierte Beratungsgesprä-
che in einem Beratungsraum auf Station, bestehen darin, dass Vorbedingungen (Kenntnisse,
Motivation des Patienten, individueller Stand der Krankheitsbewältigung), unterstützende
Medien (Broschüren, Infoblätter, Modelle) mit in die Beratung einbezogen werden können
und alle Beteiligten ausreichend Zeit mitbringen. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass umfassend und vollständig unter Einbeziehung verschiedener Perspektiven beraten
werden kann (Stratmeyer 2001, London 2003; Abt-Zegelin 2002).
Auffallend ist, dass in der Literatur kaum Aussagen bezüglich der Bezugspersonen gemacht
werden. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass im Rahmen der Pflegeversicherung eine
Beratung der Bezugspersonen bei alleinigem Bezug von Pflegegeld vorgesehen ist (George/
George 2003, 2004).
Die Literaturanalyse verdeutlicht, dass bei Beratung sowohl formelle, institutionalisierte als
auch informelle, spontane Beratungssituationen eine wichtige Rolle spielen. Die empirische
Untersuchung zeigt auf, dass Beratungsgespräche mit Patienten zum überwiegenden Teil
spontan stattfinden, nämlich zu knapp 70% meistens spontan und zu 15% fast immer spon-
tan. Onkologische Pflegekräfte planen ihre Beratungsgespräche mit Patienten lediglich zu
knapp 13% (meistens geplant: 8,6%; fast immer geplant: 4,3%). Bei den Bezugspersonen
werden Beratungsgespräche noch seltener geplant, insgesamt knapp 7%. Der Anteil der fast
210 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
immer spontan aus der Situation heraus geführten Beratungen liegt bei den Bezugspersonen
mit etwas über 22% höher als bei den Patienten.
Die Autoren kommen zum Schluss, dass die besondere Chance der Beratung in der Pflege
darin liegt, dass im Vergleich zu anderen Beratungsangeboten psychosozialer Berufsgruppen
ein lebensweltnaher, situationsintegrierter Ansatz verfolgt werden kann. Dieses situiertes
Beratungsverständnis nutzt die Nähe der Pflege zum Lebensalltag der Patienten und der Be-
zugspersonen und ermöglicht ihnen im Sinne des situierten Lernens eine alltagsdidaktische
Bewältigung der physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Folgen einer Erkrankung.
Darüber hinaus darf jedoch nicht vernachlässigt werden, dass gezielte institutionalisierte
Beratungsangebote von Bedeutung sind, um das breite Spektrum von Beratungsbedarfen
und -bedürfnissen abzudecken. Durch formelle Beratungsangebote wird sowohl den onko-
logischen Patienten als auch ihren Bezugspersonen signalisiert, dass sich die Pflege Zeit und
Raum für ihre Belange nimmt.
Derzeitige und zukünftige gesellschaftliche Anforderungen
Der zentrale „Knackpunkt“, der von vielen Autoren (George/George 2003, Abt-Zegelin
2002, 2003, Koch-Straube 2001, Thomas/Wirnitzer 2001a-c, Müller-Mundt et al. 2000)
aufgezeigt wird, ist das noch nicht weit genug ausgeprägte Bewusstsein der Pflegenden zu
ihrem Beratungsauftrag. Die meisten Autoren sind sich einig, dass beratende Tätigkeiten
schon immer immanenter Bestandteil der Pflege waren, jedoch durch die Berufssozialisation
der Pflegenden häufig der Fokus so sehr auf verrichtungsorientierte Aspekte der Pflege gelegt
wird, dass sich Pflegende der Bedeutung von beratendem und kommunikativem Handeln gar
nicht bewusst sind. Darüber hinaus fühlen sie sich durch ihre Ausbildung nicht ausreichend
auf Beratungsgespräche vorbereitet (Knelange/Schieron, 2000). Es fehlt den Pflegenden zum
einen an „methodischen Konzepten für die Gestaltung von Pflegeberatung“ (Hösl-Brunner/
Herbig 1998). Zum anderen besteht ein großes Qualifizierungsproblem, weil in Deutschland
anders als z. B. in den USA oder England, die Akademisierung der Pflegeausbildung nur in
ersten modellhaften Ansätzen vorhanden ist.
Abt-Zegelin betont, dass es erklärtes Ziel der nächsten Jahre sein solle, die patientenedu-
kativen Aktivitäten noch mehr in den direkten Pflegeprozess zu integrieren. Dazu sei es
notwendig, das Bewusstsein der Pflegenden zu erweitern, damit sie „Edukationsaufgaben
als normale Tätigkeit begreifen“ (Abt-Zegelin, 2002). Sie kritisiert, dass bereits viel über das
neue Handlungsfeld publiziert wird, aber in der Pflegepraxis Beratung eher zufällig, intuitiv
und unsystematisch stattfindet und die Tätigkeiten weder konzeptualisiert sind, noch kom-
muniziert, dokumentiert oder evaluiert werden. Institutionelle und personelle Bedingungen
seien so zu adaptieren, dass sich das neue Handlungsfeld weiter in der Praxis etablieren
könne.
Thomas/Wirnitzer (2001) prognostizieren einen steigenden Bedarf an Pflegeberatung vor
allem im Zusammenhang mit der Einführung der DRGs. Im Spannungsfeld zwischen Ver-
kürzung der Liegezeit und Unsicherheitsgefühlen von Betroffenen und Angehörigen ist
Beratung in der Pflege die zentrale Strategie, um Überforderung und Rehospitalisierung zu
reduzieren.
Dem gegenüber zeigen die Ergebnisse der empiri-
Beratungshäufigkeit pro Arbeitstag (n =116) schen Untersuchung auf, dass onkologische Pflege-
kräfte Beratung von Patienten und Angehörigen be-
80
70
reits als eine wichtige Aufgabe ansehen. So messen
60 49% aller Befragten der Beratung von Patienten einen
Prozent
50 sehr hohen und 38% einen hohen Stellenwert bei.
40
30
Beratung von Bezugpersonen gehört für 72% der Pfle-
20 gekräfte zu ihrem Aufgabenspektrum. Die Erhebung
10 der für Beratung aufgewendeten Zeit pro Arbeits-
0 tag ergibt, dass 62% der Befragten pro Arbeitstag
mehrmals pro ca. einmal pro ca. jeden 2.-3. ca. einmal pro weniger als keine Angaben
Arbeitstag Arbeitstag Arbeitstag Woche einmal pro mehr als 30 Minuten beraten. Ca. 19% beraten sogar
Woche mehr als eine Stunde pro Arbeitstag bzw. 8% mehr
Beratungshäufigkeit als zwei Stunden. Beratungsgespräche mit Patienten
finden bei knapp 70% der onkologischen Pflegekräfte
Patienten Bezugspersonen mehrmals bzw. bei knapp 25% ca. einmal am Tag
Abb. 3 statt. Angehörigenberatung findet jeweils zu ca. 25%
mehrmals oder einmal statt (Abb. 3).
Synthese: Beratungsmodell
Um die vielschichtigen Aspekte des Handlungsfeldes „Beratung in der onkologischen Pfle-
ge“ darzustellen, entwickeln die Autoren das Systemische Beratungsmodell HUGADO3
(Abb. 4). Es dient dazu die komplexen Interaktionen und Interdependenzen aller Beteilig-
211 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
ten im Beratungsprozess systematisch zu
veranschaulichen. Durch die graphische
Darstellung der interagierenden Systeme
können nicht-sichtbare Konstrukte veran-
schaulicht werden. Das Modell hat zum
Ziel trotz aller Verschränkungen und In-
terdependenzen im Beratungsgeschehen
eine Reduktion der Komplexität zu ermög-
lichen. Es wurde ein systemisches Modell
entwickelt um der Situation Rechnung zu
tragen, dass die Tumorerkrankung und ihre
Folgen alle Lebensbereiche des Patienten
und seiner Bezugspersonen beeinflusst.
Die Hauptkomponenten des Modells stel-
len die zwei in einer Interdependenz ste-
henden Systeme „Betreuungssystem“ und
System „Lebenswelt Patient“ dar. Beide
Systeme sind eingebettet in politische und
Abb. 4: Systemisches Beratungsmodell HUGADO gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
Im System „Lebenswelt Patient“ befinden
sich der Patient selbst, sein näheres Umfeld (Angehörige und Freunde), und sein weiteres
Umfeld wie z. B. Nachbarn, Bekannte oder Arbeitskollegen. Der Patient lässt sich beschreiben
als ein bio-psycho-sozio-spirituelles Wesen. Innerhalb des Modells spiegelt sich dies in der
körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Dimension wider. Die Tumorerkrankung
hat Auswirkungen auf alle diese vier Dimensionen und beeinflusst den Patienten in seinen
Bedürfnissen, Sorgen, Symptomen und Emotionen. Folglich lassen sich Beratungsanlässe in
allen vier Dimensionen identifizieren, wie beispielsweise:
Körperliche Dimension Erbrechen, Fieber, Schmerz
Psychische Dimension Angst, Hilflosigkeit, Schmerz
Soziale Dimension Familienkonflikte, finanzielle Sorgen, Arbeitsplatzverlust
Spirituelle Dimension Sinnfragen, Glaube/Religion
Dabei sind die Dimensionen nicht starr voneinander abgegrenzt in gleich große Teile, viel-
mehr stehen sie in einem Fließgleichgewicht und korrespondieren miteinander.
Eine weitere wichtige Komponente im System „Lebenswelt Patient“ stellt die Bezugsperson
dar. Auch bei ihr hat die Tumorerkrankung des Patienten Auswirkungen auf die eigene kör-
perliche, psychische, soziale sowie spirituelle Dimension. Für ihre eigene Krisenbewältigung
benötigen Bezugspersonen deswegen Unterstützung und Beratung durch Pflegekräfte. Anläs-
se sind beispielsweise Schlafstörung (körperliche Dimension), Trauer (psychische Dimension),
Rollendiffusion (soziale Dimension) und Sinnfragen (spirituelle Dimension). Darüber hinaus
brauchen Bezugspersonen aber auch Kompetenzen, um ihre veränderte Rolle auszufüllen.
Die Krankheit verändert das Interaktionsspektrum zwischen Bezugsperson und Patient, und
die Bezugspersonen müssen dazu befähigt werden, Pflege- und Betreuungsaufgaben ge-
genüber dem Patienten zu übernehmen. Beratungsanlässe sind beispielsweise Hintergrund-
wissen zum Thema Schmerz, Umgang mit Port, Fähigkeit, sich Unterstützung von z. B.
Selbsthilfegruppen oder Hospizdiensten zu holen und die Fähigkeit, seine eigenen Grenzen
zu erkennen. Bei der Beratung von Bezugspersonen ist es darum wichtig, dass Pflegende die
Doppelrolle der Bezugspersonen erkennen und berücksichtigen.
Die Interaktionen zwischen der Pflegekraft des „Betreuungssystems“ und dem System „Le-
benswelt Patient“ stellt der Beratungsprozess dar. Dieser Prozess ist zu verstehen als dyna-
misch und interdependent und nicht als statisch vorgegeben, linear und eindimensional.
Da die Pflegekraft im Beratungsprozess Informationen über die Beratungsbedürfnisse des
Patienten/der Bezugsperson bekommt, weitere Einflussfaktoren auf den Beratungsgegen-
stand erfasst und die Gesamtsituation mit dem Patienten/der Bezugsperson exploriert, ist
der Beratungsprozess mit einem Doppelpfeil dargestellt. Dabei durchläuft er unterschiedliche
aufeinander folgende, teilweise ineinander übergehende Phasen (vgl. Abb. 2). Der Bera-
tungsprozess wird beeinflusst von der Wechselbeziehung zwischen den Kompetenzen der
Pflegekraft auf der einen Seite und der im Vordergrund stehenden körperlichen, psychischen,
sozialen oder spirituellen Dimension des Patienten auf der anderen Seite.
Beratungsanlässe resultieren nicht nur aus originären Pflegehandlungen zwischen Pflegekraft
und Patient/Bezugsperson. Es gibt Beratungsanlässe, die sich auf Interaktionen zwischen Mit-
gliedern des therapeutischen Teams (vor allem den Ärzten) und den Patienten und ihren Be-
zugspersonen beziehen. Pflegekräfte nehmen wegen ihrer Lebens- und Alltagsweltnähe zum
Patienten/zur Bezugsperson eine Dolmetscherfunktion bezogen auf Diagnose und Therapie
212 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
ein. Weiterer Beratungsanlässe sind mit dem Entlassungs- und Versorgungsmanagement
verknüpft, das sich auf den Übergang des Patienten von einem Pflegesetting in ein anderes
(z. B. vom Krankenhaus in ein Hospiz/eine Pflegeeinrichtung oder von der stationären in die
häusliche Betreuung) bezieht.
Beschreibung des Lernfeldes
Das Systemische Beratungsmodell HUGADO wird als Analyseraster für die Entwicklung des
Lernfeldes „Beratung in der onkologischen Pflege“ genutzt. Dadurch nimmt es eine Schar-
nierposition zwischen Handlungs- und Lernfeld ein. Anhand der einzelnen Systemkomponen-
ten wird die Entwicklung der einzelnen Strukturmerkmale des Lernfeldes vorgenommen.
Im Lernfeldkonzept vollzieht sich ein Paradigmenwechsel vom reinen Erlernen fachsyste-
matischen Wissens hin zur Entwicklung von Handlungskompetenzen. Bei der Entwicklung
des Lernfeldes ging es um die Frage, welche Handlungskompetenzen Pflegende erwerben
sollten, um den Beratungsprozess inhaltlich und methodisch professionell zu gestalten.
Um den Kompetenzbegriff gibt es in der Pflegepädagogik kontroverse Diskussionen, die an
dieser Stelle nicht detailliert entfalten werden können. In Abgrenzung zum Qualifikations-
begriff sind Kompetenzen an die Person gebunden und lassen sich nicht zertifizieren. Als
Handlungskompetenzen lassen sich also die an das Subjekt gebundenen Voraussetzungen
verstehen, die notwendig sind um in konkreten Situationen zielgerichtet, reflektiert und
verantwortlich zu handeln.
Dem Lernfeld wird die Einteilung in Kompetenzbereiche nach Lay (2001) und Haas-Unmüßig
(2001) zu Grunde gelegt, da sie bereits den Kompetenzbegriff auf Beratung in der Pflege
übertragen haben. Sie nehmen die Unterteilung von Beratungskompetenz in Feldkompetenz,
Methodenkompetenz, Systemische Kompetenz und Selbstkompetenz vor. Lay macht deut-
lich, dass alle vier Kompetenzbereiche miteinander verwoben sind und nur aus didaktischen
Gründen differenziert dargestellt werden.
Unter Feldkompetenz (Tab. 2) verstehen Lay und Haas-Unmüßig Kenntnisse über das
spezielle Feld, in dem das Problem des Ratsuchenden identifiziert wird (Lay 2001). D.h.
die Beschreibung der Feldkompetenz bezieht sich auf das spezifische Fachwissen, das den
Beratungsgegenstand darstellt.
Voraussetzungen: Fachkenntnisse zur onkologischen Pflege bezogen auf alle sechs Kategorien
Feldkompetenz
• Fachkenntnisse in den sechs Kategorien (körperliche, psychische, soziale, spirituelle Dimen-
sionen der Patienten und ihrer Bezugspersonen), Dolmetscherfunktion Diagnose/Therapie,
Entlassungs- und Versorgungsmanagement anwenden
• Die Doppelrolle von Bezugspersonen im System „Lebenswelt Patient“ verstehen und die Be-
zugspersonen in den Beratungsprozess einbeziehen
Lerninhalte
• Inhalte anderer Lernfelder z. B. das Phänomen „Schmerz“ werden genutzt, um daran exem-
plarisch das Beratungshandeln und die Zusammenhänge aufzuzeigen:
o zum fachlichen Wissen bezogen auf die körperliche, psychische, soziale und spirituelle
Dimension des Patienten und seiner Bezugspersonen
o zu Kenntnissen bezogen auf die Dolmetscherfunktion Diagnose/Therapie und das Entlas-
sungs-/Versorgungsmanagement
Tab. 2
Die Pflegekraft muss im Bereich der onkologischen Pflege Fachwissen über die Auswirkungen
von onkologischen Erkrankungen auf die vier Dimensionen des Patienten und seiner Be-
zugspersonen haben. Die fachlichen Inhalte hierzu müssen an anderer Stelle im Curriculum
erworben werden. Innerhalb dieses Lernfeldes werden diese Inhalte genutzt um sie an ex-
emplarischen Lernsituationen z. B. „Eine Patientin mit Tumorschmerzen“ mit Beratungshan-
deln zu verknüpfen. Anhand des Phänomens „Schmerz“ können dann die Auswirkungen für
Patient und Bezugspersonen und die Beratungsbedarfe in allen vier Dimensionen analysiert
werden. Die Übersetzungsleistung bezogen auf Schmerztherapie und die Entlassungsbera-
tung können am Beispiel der Schmerzpatientin bearbeitet werden.
Die Feldkompetenz wird von der Methodenkompetenz (Tab. 3) unterschieden. Sie bezieht
sich auf die Gestaltung des Beratungsprozesses und seiner Kontextbedingungen. Diese Ein-
teilung wird dem besonderen Charakter von Beratung gerecht, der sich dadurch auszeich-
net, dass es zu einer Verschränkung von Fachkenntnissen (Beratungsinhalt) und interaktiven
Fähigkeiten (Beratungsmethoden) kommt.
213 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
Voraussetzungen: Grundlagen in Kommunikationstheorien (Sender-Empfänger-Modell, Watzla-
wik) und Gesprächsführung (Schulz von Thun), Gestaltung des Beziehungs- und Problemlöse-
prozesses, diagnostisches Denken, Biografiearbeit, Lebensweltenkonzept
Methodenkompetenz
• Beratung als Beziehungs- und Problemlösungsprozess verstehen
• Beratungsmodelle situationsgerecht und theoriegeleitet anwenden und begründen
• Beratungsangebote sowohl situiert und alltagsnah als auch geplant und strukturiert gestalten
• Beratungsprozesse bedarfs- und bedürfnisorientiert ausgestalten
• Kontaktaufnahme gestalten und eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen
• explizite und implizite Beratungsanlässe (Bedarfe und Bedürfnisse) erkennen
• analytisch bzw. pflegediagnostisch denken (Hermeneutisches Fallverstehen)
• komplexe Probleme effektiv differenzieren und strukturieren
• unterschiedlichste Formen der Gesprächsführung anwenden
• das Gegenüber in seinem biographischen und lebensweltlichen Kontext wahrnehmen und
akzeptieren und das Beratungsverhalten daran orientieren
• Nähe und Distanz innerhalb der professionellen Beratungsbeziehung gestalten
• eine wertschätzende, empathische und kongruente Beziehung aufbauen
• den Beratungsprozess retrospektiv reflektieren und bewerten (Evaluation)
• die Beratungsbeziehung beenden
• im therapeutischen Team auf der Metaebene kommunizieren
• rechtliche Bestimmungsgrößen der Beratung in der onkologischen Pflege anwenden
Lerninhalte
• Verschiedene Beratungsmodelle und die jeweiligen Beratungsverständnisse (humanistisches,
verhaltensorientiertes und systemisches Beratungsmodell)
• Kontexte von Beratung in der Pflege: situierte, spontane Beratung und geplante, institutiona-
lisierte Beratung (Grenzen und Chancen)
• Beratungsbedarfe und -bedürfnisse als explizite und implizite Beratungsanlässe
• Beratungsprozess (Phasen und Schritte)
• Gesprächsführung in Beratungsgesprächen: Basisvariablen von Beratung nach Rogers (Empa-
thie, Wertschätzung, Kongruenz); Bedeutung von Nähe und Distanz; Gesprächstechniken im
Beratungsgespräch (Spiegeln, Verbalisieren, Fragen)
• Bedeutung von Dokumentation, Teamkommunikation und Supervision im Kontext von Bera-
tung
Tab. 3
Kernelement der Methodenkompetenz ist das Verständnis, dass Beratung ein prozesshaftes
Geschehen ist und dazu – orientiert an den Phasen des Beratungsprozesses bzw. der voll-
ständigen Handlung – Teilkompetenzen notwendig sind, um diese Schritte ausgerichtet am
individuellen Bedarf bzw. Bedürfnis zu gestalten. Herausgehoben werden soll an dieser Stelle
die Fähigkeit zum diagnostischen Denken. Mehrere Theoretiker (Bartholomeyczik 2001a-c,
Koch-Straube 2001) haben betont, dass diese Kompetenz zentral ist, um überhaupt Bera-
tungsbedarfe bzw. -bedürfnisse identifizieren zu können und durch hermeneutisches Fallver-
stehen erst gesichert ist, dass die Ausgangssituation und die Umstände des Beratungsanlasses
in ihrer Komplexität und Wechselwirkung erkannt werden können. Pflegekräfte sollten sich
mit unterschiedlichen Beratungsmodellen und den Beratungsprozessen mit den unterschied-
lichen Phasen und deren Bedeutung beschäftigen. Neben der Einführung der Basisvariablen
von Beratung nach Rogers geht es vor allem um das Vertiefen und Üben unterschiedlicher
Gesprächstechniken im Beratungsgespräch. Zum Erwerb von beraterischer Methodenkompe-
tenz reicht eine rein inhaltliche Vermittlung bei Weitem nicht aus. Hier ist eine methodische
Umsetzung in handelndes Tun in simulierten Anwendungssituationen und die Reflexion
des Handelns im Lernprozess nötig (Simulation, Übung, Training, Handlungsorientierter
Unterricht). Zur Entwicklung von diagnostischen Kompetenzen ist fallbasiertes Arbeiten von
zentraler Bedeutung. Die Verzahnung von Theorie und Praxis durch Praxisaufträge wird als
wichtig angesehen.
Mit der Bezeichnung Systemkompetenz (Tab. 4) betonen Lay und Haas-Unmüßig, dass
es in der Beratung nicht nur um die Kommunikation zwischen zwei Individuen geht, son-
dern um interdependente Interaktionen von Mitgliedern von Systemen. Als Pflegekraft ist
es deshalb unabdingbar diese Verflechtungen verstehen, analysieren und mitgestalten zu
214 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
Literatur können. Die Pflegekraft braucht dazu Kenntnisse über ihr eigenes Betreuungssystem und das
System ihres Patienten und muss die Fähigkeit entwickeln diese Systeme zu vernetzen, die
Abt-Zegelin A: Neue Aufgaben für
Schnittstellen zu überbrücken und andere Netzwerke einzubeziehen, um sich dadurch selbst
die Pflege: Patientenedukation.
zu entlasten. Die zentrale systemische Kompetenz zeichnet sich dadurch aus, dass die eigene
Die Schwester/Der Pfleger 2000,
Position im System verstanden wird. D.h. die Pflegekraft kann nachvollziehen, dass die Positi-
39(1); 56-9.
onierung der Patienten und ihrer Bezugspersonen mit bestimmten Dimensionen gegenüber
Abt-Zegelin A: Patienten- und
Familienedukation in der Pfle-
der Pflegekraft sowohl mit dem Setting als auch der interdependenten Interaktion mit der
ge. Pflege und Gesellschaft.
Pflegekraft in Bezug steht und nicht dem „Zufall“ überlassen ist. Um nicht passives „Opfer“
Sonderausgabe. Frankfurt/Main: von systemischen Gegebenheiten zu sein/zu werden, ist es notwendig, Kompetenzen zum
Mabuse 2002; 103-15. Change Management bei der Pflegekraft anzubahnen, mit denen sie Team- und Organisati-
Abt-Zegelin A: Wer kommuniziert, onsstrukturen bis hin zu politischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln kann.
pflegt. Pflege Aktuell
2003, 56(12); 642-4.
Voraussetzungen: Grundlagen der Systemtheorie, der gesellschaftlichen und politischen Rahmen-
Ausbildungs- und Prü-
bedingungen und der Familien- und Gruppendynamik, sowie Rollentheorie und kooperatives
fungsverordnung für
die Berufe in der Kran-
Arbeiten in interdisziplinären Netzwerken
kenpflege (KrPflAprV). Systemkompetenz
Stand 15.03.2003.
Bartholomeyczik S: Pro- • systemische Zusammenhänge verstehen
fessionelle Kompetenz • Familien- und Gruppendynamik in den Beratungsprozess einbeziehen
in der Pflege Teil I.
• Mitglieder und Zusammenhänge im Betreuungssystem kennen
Pflege Aktuell 2001a,
54(5); 284-7. • Andere Pflegesettings kennen
Bartholomeyczik S: Pro-
• eigene Rolle im Betreuungssystem erkennen und in Bezug zum System „Lebenswelt Patient“
fessionelle Kompetenz
ausgestalten d.h. auf die dargebotenen Dimensionen des Patienten und seiner Bezugsperso-
in der Pflege Teil II.
nen durch eine entsprechende Positionierung mit den eigenen Kompetenzen und den Bera-
Pflege Aktuell 2001b,
tungsmethoden reagieren
54(6); 344-7.
Bartholomeyczik S: Pro- • Informations- und Kooperationsnetze aufbauen
fessionelle Kompetenz • Beratung an fachkompetente Berater innerhalb des Kooperationsnetzes weitervermitteln
in der Pflege Teil III.
Pflege Aktuell 2001c, • multifaktorielle Einflüsse im systemischen Geflecht identifizieren und systemimmanente Gren-
54(7-8); 412-4. zen erkennen
Bortz J, Döring N: For- • durch Team- und Organisationsentwicklung bzw. (gesundheits-) politischer Mitbestimmung
schungsmethoden Einfluss auf Systeme nehmen (Change Management)
und Evaluation. 2.
Aufl., Berlin: Springer, Lerninhalte
1995.
• Bedeutung von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen im Beratungskontext
Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (Hrsg.): • Stellenwert von Beratung in der Pflege im institutionellen, gesundheitspolitischen bzw. gesell-
Berufsausbildung in schaftlichen Rahmen (Gesetze, Finanzierung, Gesundheitsreform und Einführung der DRGs,
der Altenpflege: Lern- Forderung nach/Förderung von mündigen Patienten)
feldorientiertes Curri- • Change Management zur Implementierung von Beratung im Pflegealltag (Transfer)
culum für praktische
und schulische Ausbil- Tab. 4
dung auf der Grundla-
ge des Berufsgesetzes
für die Altenpflege(AltPflG).
Bielefeld. Bertelsmann, 2002. Mit dem Begriff Selbstkompetenz (Tab. 5) wird betont, dass der Berater sich mit seinem
Deutsches Netzwerk für Quali- „Selbst“ (seinen ‚Strickmustern’, biographischen Erfahrungen, seinen Werten, Haltungen
tätsentwicklung in der Pflege und Bewältigungsstilen) in den Beratungsprozess einbringt (Lay 2001). Der Fokus liegt dabei
(Hrsg.): Expertenstandard Entlas- auf der Reflexion eigener Haltungen und Positionen bezogen auf das eigene Menschenbild,
sungsmanagement in der Pflege. das eigene Gesundheits- und Pflegeverständnis und das eigene Beratungsverständnis. Nur
Osnabrück, 2004. wenn die Pflegekraft über sich „selbst“ reflektieren und über ihre eigenen Hintergründe
Deutsches Netzwerk für Qua- und Einstellungen nachdenken kann, ist sie in der Lage eine klare Beraterrolle einzunehmen
litätsentwicklung in der Pfle- und dabei Selbst- und Fremdbild differenziert wahr zu nehmen. Eine symbiotische, altru-
ge (Hrsg.): Expertenstandard istische Verschmelzung mit dem beratenen Patienten und seinen Bezugspersonen kann so
Schmerzmanagement in der vermieden werden. Eine professionelle Beratung mit einem klaren Blick für Kompetenzen,
Pflege. Osnabrück, 2004. Chancen aber auch Grenzen wird so möglich, und eine Überfrachtung der Beratung durch
Gaatz S, Doll A: Patienteneduka- den eigenen Anspruch an sich selbst oder Erwartungen des beratenen Patienten und seiner
tion in Curricula onkologischer Bezugspersonen kann vorgebeugt werden. Wenn der Erwerb von Beratungskompetenz als
Fachweiterbildungen. Projekt- ein lebenslanger Prozess verstanden wird, ist es möglich in realistischen Teilschritten die
arbeit, Institut für Medizin- und eigene Beratungskompetenz zu entwickeln und sich selbst einzuräumen, Erfahrungen in Be-
Pflegepädagogik/Pflegewissen- ratungssituationen als weitere Lernanlässe zu verstehen und zu nutzen. Die Differenzierung
schaft an der Humboldt-Univer- von Selbst- und Fremdwahrnehmungen bezogen auf Emotionen und Deutungsmuster sollten
sität zu Berlin 2003. sowohl theoretisch als auch durch Rollenspiele explizit vorgenommen werden. Mögliche
George U, George W: Angehöri- Konflikte im Beratungskontext und potenzielle Lösungsstrategien sollten thematisch erarbei-
genedukation als Inhalt der Aus- tet und geübt werden. Frustrations- und Ambiguitätstoleranz kann in institutionellen Wei-
und Weiterbildung. PrInterNet terbildungskontexten nur schwer angebahnt werden. Dazu müssten bei der methodischen
2004, 6(4); Pflegepädagogik Umsetzung professionelle Simulationspatienten zur Verfügung stehen oder in Supervision
210-4. oder Fallbesprechungen reale Erfahrungen reflektiert werden.
215 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
George W, George U:
Angehörigeninteg- Voraussetzungen: Ethik und Pflegetheorien (Metaparadigma der Pflege), eigene Haltung zum
ration in der Pflege. eigenen Menschenbild und Pflegeverständnis, Gesundheitstheorien, Emotionen im Zusammen-
München: Reinhardt, hang mit der Pflege und Begleitung von Tumorpatienten
2003.
Haas-Unmüßig P: Kom- Selbstkompetenz
petenzen in der Pfle- • das eigene Menschenbild und das eigene Pflege-, Gesundheits- bzw. Beratungsverständnis
geberatung: Neue reflektieren
Aufgaben erfordern
umfassende Weiterbil- • eigene Beraterrolle, Selbst- und Fremdbild, Kompetenzen und Grenzen reflektieren
dung. Pflegezeitschrift • eigene Deutungsmuster bzw. Emotionen (Ängste...) erkennen
2001, 54(4); 285-6.
Hellige B, Hüper C: Pfle- • Konflikte erkennen und aushalten oder lösen
gerisches Beratungs- • Frustrations- und Ambiguitätstoleranz entwickeln, um mit dem Spannungsfeld divergierender
modell für chronisch Erwartungen umzugehen, das durch das Entstehen von Beratungsbedarfen innerhalb von
kranke Menschen. Pflegesituationen verstärkt wird
Pflegemagazin 2002,
3(6); 8-16. • Ethische Normen reflektieren und eigene Wertvorstellungen entwickeln
Hösel-Brunner G, Her- • Erwerb von Beratungskompetenz als lebenslangen Lernprozess verstehen
big C: Das Pflegebera-
tungsverständnis von Lerninhalte
Pflegefachkräften. • Eigene Haltung und Rolle als Berater in der Pflege (Kompetenzen und Grenzen)
Pflegezeitschrift 1998,
51(10); 779-82. • Selbst- und Fremdwahrnehmung (Emotionen, Deutungsmuster)
Knelange C, Schieron • Konfliktmanagement im Beratungskontext
M: Beratung in der
• Frustrations- und Ambiguitätstoleranz
Pflege – als Aufgabe
erkannt und professi- Tab. 5
onell ausgeübt? Pfle-
ge und Gesellschaft
2000, 1(5); 4-11.
Knigge-Demal B: Curricula und
deren Bedeutung für die Aus-
bildung. In: Sieger M (Hrsg.):
Diskussion
Pflegepädagogik. Bern: Huber, In der empirischen Untersuchung des Handlungsfeldes wurde ein breitgefächertes Spektrum
2001 von Beratungsanlässen identifiziert. Es wird deutlich, dass Beratung in der onkologischen
Koch-Straube U: Beratung in der Pflege in einem Spannungsfeld steht zwischen einem ganzheitlichen Beratungsverständnis
Pflege – eine Skizze. Pflege und und einem zu Überforderung neigenden Omnipotenzanspruch. Hier wird es in Zukunft einer
Gesellschaft 2000, 1(5); 1-3. klaren berufpolitischen und folglich berufsbildungspolitischen Positionierung zum Aufgaben-
Koch-Straube U: Beratung in der profil von Beratung in der onkologischer Pflege bedürfen. Sollte einer Überfrachtung von
Pflege. Bern: Huber, 2001. Beratung in der onkologischen Pflege vorgebeugt werden, wäre eine klare Abgrenzung des
Koch-Straube U: Was verstehen Themenspektrums erforderlich. Sollte Pflege hingegen in Zukunft ganzheitlich beraten, so
wir unter Beratung in der Pflege? müssten dafür gesundheitspolitische und institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen
Vortragskript des Symposiums werden. Bezogen auf die Entwicklung von Beratungskompetenzen würde dies für die Aus-
„Beratung in der Pflege: Chance und vor allem Weiterbildung bedeuten, dass alle sechs Kategorien von Beratung als Bera-
und Herausforderung“, Bochum, tungsinhalt thematisiert werden müssten. Dies gilt insbesondere für die Feldkompetenz. Für
2003.
die Entwicklung der Methoden- und Systemkompetenz müssten dann konsequenterweise
Krankenpflegegesetz (KrPflG),
Beratungsmethoden in ihrer ganzen Bandbreite vermittelt werden, so wie es von den Au-
Bundesgesetzesblatt Jg. 2003,
toren im Lernfeld „Beratung in der onkologischen Pflege“ formuliert wurde. Nur so wären
Teil I Nr. 55, 19.11.2003.
onkologische Fachpflegekräfte methodisch ausreichend auf die Herausforderungen einer
Lay R: Beratungskompetenz in der
Pflege. PrInterNet 2001, 9(1);
ganzheitlichen Beratung vorbereitet.
Pflegepädagogik 195-200.
London F: Informieren, Schulen, In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Bildungsgänge die Pflege in Zu-
Beraten. Bern: Springer, 2003. kunft braucht. Es muss geklärt werden, welche Anforderungen ein Lernfeld mit 80 Stunden
Müller-Mundt G, Schaeffer D, innerhalb einer Fachweiterbildung erfüllen kann. Darüber hinaus ist es sicherlich sinnvoll,
Pleschberger S, Brinkhoff P: ein professionelles Beratungsprofil in expliziten Zusatzqualifikationen zum „Berater in der
Patientenedukation – (k)ein zen- Pflege“ oder in Studienanteilen in Bachelor- oder Masterstudiengängen zu entwickeln. Die
trales Thema in der deutschen Akademisierung ist vor allem im Hinblick auf die Entwicklung von Reflektionsfähigkeit der
Pflege. Pflege und Gesellschaft Pflegenden von entscheidender Bedeutung. Unabhängig davon, in welchen Bildungsgängen
2000, 5(2); 42-53. Beratungskompetenzen in Zukunft ausgebildet werden, ist zu bedenken, dass viele Kompe-
Reibnitz von C, Schnabel P, Hur- tenzen, die im Zusammenhang mit Beratung von Bedeutung sind, sehr komplex und nicht
relmann K (Hrsg.): Der mündige innerhalb einer kurzen Unterrichtssequenz vermittelbar sind, sondern vernetzt im gesamten
Patient. Weinheim: Juventa, Curriculum mit anderen Lernbereichen angebahnt werden müssen. Durch die ausschnitt-
2001. hafte Betrachtung des Lernfeldes „Beratung in der onkologischen Pflege“ sind dieser Arbeit
Rennecke S: Information, Schulung insoweit Grenzen gesetzt. Die vernetzte Kompetenzentwicklung kann nur bei der Gesamt-
und Beratung von Patienten und betrachtung eines Curriculums vollständig abgebildet werden.
Angehörigen. Köln: Kuratorium
Deutsche Altenhilfe, 2000.
Schaeffer D, Moers M: Bewälti- Bei der Bearbeitung des Handlungsfeldes wurde deutlich, dass eine bewusste Haltung der
gung chronischer Krankheiten Pflegekräfte zu Beratung als Pflegeaufgabe eine wichtige Rolle in der Umsetzung in berufli-
– Herausforderungen für die ches Handeln spielt. Die Bedeutung von Beratung in der onkologischen Pflege wurde in der
Pflege. In: Rennen-Allhoff B, empirischen Untersuchung von den onkologischen Pflegekräften sehr hoch eingeschätzt.
216 PRINTERNET 04/06
Axel Doll, Sonja Hummel-Gaatz: Lernfeld Beratung in der Pflege – Umsetzung des Lernfeldkonzeptes ...
PFLEGEPÄDAGOGIK
Schaeffer D (Hrsg.): Handbuch Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu vielen Aussagen in der Pflegeliteratur, die ein fehlen-
Pflegewissenschaft. Weinheim: des Bewusstsein für Beratung in der Pflege generell bemängeln. Dieser Widerspruch könnte
Juventa, 2000. einerseits auf ein an sozialer Erwünschtheit orientiertes Antwortverhalten der Befragten in
Schröck R, Drerup E (Hrsg.): Der der empirischen Untersuchung dieser Arbeit zurückgeführt werden, als auch auf die Auswahl
informierte Patient. Freiburg: der Probanden. Es ist davon auszugehen, dass die Kongressteilnehmer eine hochmotivierte
Lambertus, 2002. und engagierte Gruppe darstellen, in der auch ein deutlich höheres Bewusstsein für Bera-
Stratmeyer P: Pflegeberatung tung vorhanden sein könnte (Selection Bias). Darüber hinaus müssen auch die Grenzen
zwischen Patientenschulung, so- des gewählten Designs beachtet werden; mit Hilfe des Fragebogens können nur Selbstein-
zialer Arbeit und Psychotherapie. schätzungen der Probanden erhoben werden. Wie das konkrete Beratungsverhalten in der
Unveröffentlichtes Vortragsma- Pflegepraxis tatsächlich aussieht, kann nur mit Hilfe qualitativer Forschungsmethoden (z. B.
nuskript, 2001. teilnehmende Beobachtung) erfasst werden. Die unterschiedlichen Ergebnisse in Bezug auf
Thomas B, Wirnitzer B: Patienten das Bewusstsein von Pflegenden zum Stellenwert von Beratung könnte aber auch in den un-
und Pflegende in einer neuen
tersuchten Populationen liegen, was bedeuten würde, dass bei onkologischen Pflegekräften
Rolle. Pflegezeitschrift 2001a,
das Bewusstsein für Beratung bereits viel höher ausgeprägt ist, als in der allgemeinen Pflege
469-73.
(Hösl-Brunner/Herbig 1998, Knelange/Schieron 2000). In diesem Zusammenhang sehen die
Thomas B, Wirnitzer B: Pflegebera-
Autoren weiteren Forschungsbedarf zum Beratungsverständnis und -handeln in der Pflege.
tung im Krankenhaus München-
Neuperlach: Erste Ergebnisse des
Modellprojekts. Pflegezeitschrift Bei der kritischen rückblickenden Reflektion der vorgenommenen Übertragung des Lern-
2001b, 869-72. feldansatzes auf Weiterbildungskontexte kommen die Autoren zu dem Schluss, dass dieses
Thomas B, Wirnitzer B: Pflegebe- Vorgehen – trotz aller methodischer Grenzen – wichtige Potenziale für die Fachweiterbildung
ratung und Patientenschulung. beinhaltet. Die Analyse der Aufgabenbereiche, der Tätigkeitsprofile bzw. der Handlungsfel-
Heilberufe 2001c, 6(8); 34-5. der als Ausgangspunkt curricularer Konzeptionen zu setzen, wird als hilfreich eingeschätzt.
Wittneben K: Handlungsfelder- Werden die Handlungskompetenzen anhand der definierten Handlungsfelder abgeleitet,
Lernfelder- Bildungsinhalte. können inhaltliche und methodische Entscheidungen daran orientiert werden. Wirft man
PrInterNet 2003, 5(4); Pflege- in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Entstehung des Lernfeldkonzeptes in der Be-
pädagogik 124-136. rufspädagogik, zeigt sich, dass es in einer Zeit entwickelt wurde, in der sich die theoretische
Wörmann M: Personenzentrier- und praktische Berufsbildung im dualen System immer weiter auseinander bewegt hat.
te Beratung durch Pflegende. Betrachtet man die aktuelle Entwicklung der Fachweiterbildungen in der Pflege, können
In: Schneider K, Brinker-Mey- ähnliche Tendenzen diagnostiziert werden. Daher sehen die Autoren eine große Chance für
endriesch E, Schneider A (Hrsg.): die Fachweiterbildungen, sich rechtzeitig mit der Überbrückung der Theorie-Praxis-Brüche
Pflegepädagogik. Berlin: Sprin- zu beschäftigen. Dabei kann das Lernfeldkonzept hilfreich sein, da es seine Basis in der klaren
ger, 2003. Orientierung an Handlungskompetenzen hat, ohne eine falsch verstandene Ausrichtung von
Bildungsangeboten an die reine Ausbildung von Praxistauglichkeit vorzunehmen. Metho-
disch bedarf es beim Lernfeldkonzept jedoch einer weiteren Ausdifferenzierung und vor allem
einer Klärung der Analyseverfahren von Handlungsfeldern ebenso wie eines fachdidaktischen
Konstruktionsschrittes vom Handlungsfeld zum Lernfeld.
Für die (pflege)pädagogische Forschung wird in Zukunft Evaluationsforschung von Bildung-
sangeboten an Bedeutung gewinnen. Es wird zu evaluieren sein, welche Bildungsangebote
und Lehr-/Lernstrategien tatsächlich zur angestrebten Handlungskompetenzentwicklung
führen. Bezogen auf Beratung wäre es sinnvoll, die Implementierung von entsprechenden
Lernfeldern in die Weiterbildung wissenschaftlich zu begleiten.
PrInterNet Community
Sie finden weitere Informationen zu
diesem Artikel unter
http://www.printernet.info/artikel.asp?id=620
Anmerkungen
1 Pflegekräfte, die sich in einer zweijähriger berufsbegleitenden Fachweiterbildung auf die Pflege von Patienten
mit Tumorerkrankungen spezialisiert haben. (Onkologie = Lehre der Tumorerkrankungen)
2 Das komplette Lernfeld beinhaltet Gesprächsführung, Anleitung und Beratung; in dieser Arbeit wird nur
das Teilhandlungs- bzw. Teillernfeld „Beratung in der onkologischen Pflege“ bearbeitet. Zur sprachlichen
Vereinfachung werden in der ganzen Arbeit jedoch die Begriffe Handlungs- bzw. Lernfeld verwendet
3 benannt nach den Autoren HUmmel-GAatz/DOll
217 PRINTERNET 04/06
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Kollegiale Beratung im Pflegeteam: Implementieren - Durchführen - Qualität sichernVon EverandKollegiale Beratung im Pflegeteam: Implementieren - Durchführen - Qualität sichernAndreas KocksNoch keine Bewertungen
- Psychologie und Palliative Care: Aufgaben, Konzepte und Interventionen in der Begleitung von Patienten und AngehörigenVon EverandPsychologie und Palliative Care: Aufgaben, Konzepte und Interventionen in der Begleitung von Patienten und AngehörigenMartin FeggNoch keine Bewertungen
- Pflegebedürftigkeit: Beratung - Betreuung - ZusammenarbeitVon EverandPflegebedürftigkeit: Beratung - Betreuung - ZusammenarbeitNoch keine Bewertungen
- Curriculum Pflege Aktuell Maerz 2019.doc 2Dokument53 SeitenCurriculum Pflege Aktuell Maerz 2019.doc 2ilanmalinsky6072Noch keine Bewertungen
- Broschuere Community Health Nursing 09 2019Dokument80 SeitenBroschuere Community Health Nursing 09 2019jay dewanagnNoch keine Bewertungen
- Hochkomplexe Pflege von Kindern und Jugendlichen: Ein Weiterbildungscurriculum für PflegeberufeVon EverandHochkomplexe Pflege von Kindern und Jugendlichen: Ein Weiterbildungscurriculum für PflegeberufeNoch keine Bewertungen
- Der Bedarf an Prävention und Gesundheitsförderungsmaßnahmen bei Beschäftigten in Pflegeberufen: Validierung der Nurse-Work Instability ScaleVon EverandDer Bedarf an Prävention und Gesundheitsförderungsmaßnahmen bei Beschäftigten in Pflegeberufen: Validierung der Nurse-Work Instability ScaleNoch keine Bewertungen
- Betreuung von Dialysepatienten: Pflegerische und psychosoziale KompetenzenVon EverandBetreuung von Dialysepatienten: Pflegerische und psychosoziale KompetenzenChristina SokolNoch keine Bewertungen
- Expertenstandards in der ambulanten Pflege: Ein Handbuch für die PflegepraxisVon EverandExpertenstandards in der ambulanten Pflege: Ein Handbuch für die PflegepraxisNoch keine Bewertungen
- Kompetenzen älterer Menschen: Lehrbuch zur praktischen Umsetzung des umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs, Band 1Von EverandKompetenzen älterer Menschen: Lehrbuch zur praktischen Umsetzung des umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs, Band 1Noch keine Bewertungen
- Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 2: Psychologische Therapie bei Indikationen im ErwachsenenalterVon EverandLehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 2: Psychologische Therapie bei Indikationen im ErwachsenenalterNoch keine Bewertungen
- Gerontologische Pflegeforschung: Ansätze, Ergebnisse und Perspektiven für die PraxisVon EverandGerontologische Pflegeforschung: Ansätze, Ergebnisse und Perspektiven für die PraxisNoch keine Bewertungen
- Praxisleitfaden Patientenberatung: Planung, Umsetzung und EvaluationVon EverandPraxisleitfaden Patientenberatung: Planung, Umsetzung und EvaluationNoch keine Bewertungen
- Medizinische FachangeschtelteDokument20 SeitenMedizinische FachangeschtelteHatigzon ÇitakuNoch keine Bewertungen
- Pflegekompetenz in der Neonatologie: Erwartungen von Eltern und Ärzten an die Kompetenz von Pflegenden auf einer neonatologischen IntensivstationVon EverandPflegekompetenz in der Neonatologie: Erwartungen von Eltern und Ärzten an die Kompetenz von Pflegenden auf einer neonatologischen IntensivstationNoch keine Bewertungen
- Psychiatrische GesundheitsDokument408 SeitenPsychiatrische GesundheitsIsabella RitterNoch keine Bewertungen
- Pflegehabitus in der stationären Langzeitpflege von Menschen mit Demenz: Personzentrierte Pflegebeziehungen nachhaltig gestaltenVon EverandPflegehabitus in der stationären Langzeitpflege von Menschen mit Demenz: Personzentrierte Pflegebeziehungen nachhaltig gestaltenNoch keine Bewertungen
- Nichtmedikamentöse Therapie von herausforderndem Verhalten bei Demenz: MIBUK für Pflegekräfte und PflegemanagerVon EverandNichtmedikamentöse Therapie von herausforderndem Verhalten bei Demenz: MIBUK für Pflegekräfte und PflegemanagerNoch keine Bewertungen
- empCARE: Arbeitsbuch zur empathiebasierten Entlastung in Pflege- und GesundheitsberufenVon EverandempCARE: Arbeitsbuch zur empathiebasierten Entlastung in Pflege- und GesundheitsberufenLudwig ThiryNoch keine Bewertungen
- Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren und Rahmenbedingungen psychologischer TherapieVon EverandLehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 1: Grundlagen, Diagnostik, Verfahren und Rahmenbedingungen psychologischer TherapieNoch keine Bewertungen
- Skillslab in Pflege und Gesundheitsfachberufen: Intra- und interprofessionelle LehrformateVon EverandSkillslab in Pflege und Gesundheitsfachberufen: Intra- und interprofessionelle LehrformateAndrea KerresNoch keine Bewertungen
- Pflegedidaktik im Überblick: Zwischen Transformation und DiffusionVon EverandPflegedidaktik im Überblick: Zwischen Transformation und DiffusionNoch keine Bewertungen
- SturzprophylaxeDokument51 SeitenSturzprophylaxeIonela IsarieNoch keine Bewertungen
- Case Management in der Adipositaschirurgie: Manual für die perioperative PatientenbetreuungVon EverandCase Management in der Adipositaschirurgie: Manual für die perioperative PatientenbetreuungHanna Dörr-HeißNoch keine Bewertungen
- Physiotherapie in Der Traumatologie 5. Auflage by Margrit ListDokument461 SeitenPhysiotherapie in Der Traumatologie 5. Auflage by Margrit ListJens Heine100% (3)
- Fallbasierte Unterrichtsgestaltung Grundlagen und Konzepte: Didaktischer Leitfaden für LehrendeVon EverandFallbasierte Unterrichtsgestaltung Grundlagen und Konzepte: Didaktischer Leitfaden für LehrendeNoch keine Bewertungen
- Pflegewissen Stroke Unit: Für die Fortbildung und die PraxisVon EverandPflegewissen Stroke Unit: Für die Fortbildung und die PraxisNoch keine Bewertungen
- Integrative Medizin: Evidenzbasierte komplementärmedizinische MethodenVon EverandIntegrative Medizin: Evidenzbasierte komplementärmedizinische MethodenMichael FrassNoch keine Bewertungen
- Naturheilkundliche Anwendungen in der Pflege: Praxistipps für den PflegealltagVon EverandNaturheilkundliche Anwendungen in der Pflege: Praxistipps für den PflegealltagNoch keine Bewertungen
- Internationale Pflegefachkräfte in der akutmedizinischen Versorgung: Kulturelle Herausforderungen und SpannungsfelderVon EverandInternationale Pflegefachkräfte in der akutmedizinischen Versorgung: Kulturelle Herausforderungen und SpannungsfelderBewertung: 1 von 5 Sternen1/5 (1)
- Modulhandbuch HP 08 05 2023 1Dokument26 SeitenModulhandbuch HP 08 05 2023 1Isa OniateNoch keine Bewertungen
- POP - PraxisOrientierte Pflegediagnostik: Pflegediagnosen - Ziele - MaßnahmenVon EverandPOP - PraxisOrientierte Pflegediagnostik: Pflegediagnosen - Ziele - MaßnahmenNoch keine Bewertungen
- Portpflege: Hygiene, Verbandswechsel, Überwachung, KomplikationsmanagementVon EverandPortpflege: Hygiene, Verbandswechsel, Überwachung, KomplikationsmanagementRoland HennesNoch keine Bewertungen
- Selbstbestimmung älterer Menschen: Lehrbuch zur praktischen Umsetzung des umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs, Band 2Von EverandSelbstbestimmung älterer Menschen: Lehrbuch zur praktischen Umsetzung des umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs, Band 2Noch keine Bewertungen
- Beraten Und Anleiten AB 1 - Begriffsbestimmung Und GrenzenDokument6 SeitenBeraten Und Anleiten AB 1 - Begriffsbestimmung Und Grenzenalaa jabbarNoch keine Bewertungen
- Therapeutic Touch und deren Effektivität im onkologischen Bereich: Eine LiteraturanalyseVon EverandTherapeutic Touch und deren Effektivität im onkologischen Bereich: Eine LiteraturanalyseNoch keine Bewertungen
- L 0014342556 PDFDokument15 SeitenL 0014342556 PDFМиодраг ЈовановићNoch keine Bewertungen
- ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen BehandlungskonzeptsVon EverandADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen BehandlungskonzeptsNoch keine Bewertungen
- Praxis der Schlafmedizin: Schlafstörungen bei Erwachsenen und Kindern Diagnostik, Differenzialdiagnostik und TherapieVon EverandPraxis der Schlafmedizin: Schlafstörungen bei Erwachsenen und Kindern Diagnostik, Differenzialdiagnostik und TherapieNoch keine Bewertungen
- Lftl2021 PAHeterogenitt2Dokument5 SeitenLftl2021 PAHeterogenitt2zoranazdimaNoch keine Bewertungen
- Interaktionen zwischen Pflegenden und Personen mit Demenz: Ein pflegedidaktisches Konzept für Ausbildung und PraxisVon EverandInteraktionen zwischen Pflegenden und Personen mit Demenz: Ein pflegedidaktisches Konzept für Ausbildung und PraxisNoch keine Bewertungen
- Biographische Risiken und neue professionelle Herausforderungen: Identitätskonstitutionen – Wandlungsprozesse – HandlungsstrategienVon EverandBiographische Risiken und neue professionelle Herausforderungen: Identitätskonstitutionen – Wandlungsprozesse – HandlungsstrategienNoch keine Bewertungen
- Neurogeriatrie: ICF-basierte Diagnose und BehandlungVon EverandNeurogeriatrie: ICF-basierte Diagnose und BehandlungWalter MaetzlerNoch keine Bewertungen
- Selbstständigkeit älterer Menschen: Lehrbuch zur praktischen Umsetzung des umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs, Band 3Von EverandSelbstständigkeit älterer Menschen: Lehrbuch zur praktischen Umsetzung des umfassenden Pflegebedürftigkeitsbegriffs, Band 3Noch keine Bewertungen
- Stottern bei Kindern und Jugendlichen: Bausteine einer mehrdimensionalen TherapieVon EverandStottern bei Kindern und Jugendlichen: Bausteine einer mehrdimensionalen TherapieNoch keine Bewertungen
- Kompendium Begutachtungswissen Geriatrie: Empfohlen vom Kompetenz-Centrum Geriatrie der Medizinischen DiensteVon EverandKompendium Begutachtungswissen Geriatrie: Empfohlen vom Kompetenz-Centrum Geriatrie der Medizinischen DiensteNoch keine Bewertungen
- Untersuchung der Arbeitsbelastungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Pflegekräfte unter besonderer Berücksichtigung des MigrationshintergrundesVon EverandUntersuchung der Arbeitsbelastungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Pflegekräfte unter besonderer Berücksichtigung des MigrationshintergrundesNoch keine Bewertungen
- Pflegeinformatik: Die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Gesundheits- und KrankenpflegeVon EverandPflegeinformatik: Die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Gesundheits- und KrankenpflegeNoch keine Bewertungen
- Systemische Therapie jenseits des Heilauftrags: Systemtherapeutische Perspektiven in der Sozialen Arbeit und verwandten KontextenVon EverandSystemische Therapie jenseits des Heilauftrags: Systemtherapeutische Perspektiven in der Sozialen Arbeit und verwandten KontextenNoch keine Bewertungen
- Gesundheit im Betrieb: Handlungsfelder - Lösungen - ImplementierungVon EverandGesundheit im Betrieb: Handlungsfelder - Lösungen - ImplementierungNoch keine Bewertungen
- Tiefdermale Defekte bei Verbrennungen: Leitfaden für Physiotherapeuten und ErgotherapeutenVon EverandTiefdermale Defekte bei Verbrennungen: Leitfaden für Physiotherapeuten und ErgotherapeutenNoch keine Bewertungen
- Handbuch Beratungskompetenz: Mit Übungen zur Entwicklung von Beratungsfertigkeiten in Bildung und BerufVon EverandHandbuch Beratungskompetenz: Mit Übungen zur Entwicklung von Beratungsfertigkeiten in Bildung und BerufNoch keine Bewertungen
- Chronische Wunden Diagnostik Therapie Versorgung 1St Edition Joachim Dissemond Full ChapterDokument67 SeitenChronische Wunden Diagnostik Therapie Versorgung 1St Edition Joachim Dissemond Full Chapterjames.berganza787100% (7)
- Bodennahe Pflege: Grundlagen, praktische Umsetzung, FallbeispieleVon EverandBodennahe Pflege: Grundlagen, praktische Umsetzung, FallbeispieleNoch keine Bewertungen
- Pflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhaus: Konzepte, Methoden und Organisationsformen patientenorientierter HilfenVon EverandPflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhaus: Konzepte, Methoden und Organisationsformen patientenorientierter HilfenNoch keine Bewertungen
- B1 SCHREIBEN Sample EmailsDokument22 SeitenB1 SCHREIBEN Sample EmailsJeanette Dumagas100% (1)
- Human Hunt Trauma Based Mind Control & Ritual Abuse - Fall Sadegh Et Al. ÖsterreichDokument7 SeitenHuman Hunt Trauma Based Mind Control & Ritual Abuse - Fall Sadegh Et Al. ÖsterreichtraumabasedmindNoch keine Bewertungen
- September 2014 v2Dokument2 SeitenSeptember 2014 v2ererererrrrrrNoch keine Bewertungen
- Das Epstein-Barr-Virus Bei Brustkrebs (Brustkrebs Als Viruskrankheit?)Dokument5 SeitenDas Epstein-Barr-Virus Bei Brustkrebs (Brustkrebs Als Viruskrankheit?)Elisabeth Rieping (1950 - 2009)Noch keine Bewertungen