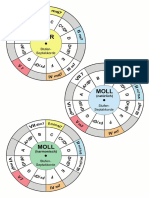Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Deutsches Brauchtum
Hochgeladen von
johnny0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
111 Ansichten9 SeitenDeutsches Brauchtum
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenDeutsches Brauchtum
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
111 Ansichten9 SeitenDeutsches Brauchtum
Hochgeladen von
johnnyDeutsches Brauchtum
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 9
ISELA MALER-SIEBER
JBrauchtum« — was ist das? Vor zwei oder drei Jahren waren am
jrcikonigstag, dem 6. Januar, die welthewegenden Ereignisse po-
sischer oder wirtschaillicher Natur so diinn gest, da im Zwei-
Deutschen Fernsehen Sendezeit fiir Folkloristisches blieb.
‘Auch in Bremen wurde heute ein Brauch gepflegt«, verkindete
‘Nachrichtensprecher im Anschlu8 an einen Filmbericht tiber
Sddeutsches Dreikonigstreiben und informierte die Zuschauer
yruber, da® in Bremen cin Schneider mit einem glithenden:
igeleisen getestet habe, ob die Weser zugefroren sei oder nicht.
wes damit auf die Bremer Fiswette hin, die seit 1829 2um jal
‘wiederkehrenden Brauchtum der Hansestadt gehort, Damals
exteten plustige Junggesellenw darum, ob der Strom zum 1. Jac
jar eisfrei und damit frei zum Auslaufen der lebenswichtigen
mer Handelsflotte sein wiirde ~ und die Chancen dafiir oder
szegen standen ungefahr gleich. Um Streit uber die Frage zu ver-
“iden, wann dic Weser »offen« und wann sie »zu« sei, wurde
sgelegt: wenn ein 99 Phund schwerer Schneider mitsamt seinem
jenden Bigeleisen trockenen FuBes am Punkendeich uber die
ser gehen kone, sei der Strom zus. Heute ~ nach der Weser-
srektion, die einen starken Tidenhub brachte - sind die Chan-
fn dafiir beinahe gleich Null, so da von Jahr zu Jahr ausgelost
‘rd, Wer bei der Eiswelte fir oder gegen das Zufrieren einzutre-
hat. Der Verlicrer zahlt das Festessen, an dem an die 600 Giste
Inchmen - neben der beriihmten »SchaiTermahlzeic« die Gele
theit, Prominenz von nah und fern hanseatisch zu bewirten.
fe Eiswette, vor 150 Jahren zum Zeitvertreb junger Burschen er-
eden und inzwischen auf den 6. Januar verlegt, um die Heiligen
i Kénige in das Spektakulum einzubezichen, wird heute von
sem Verein gehegt und gepflegt, vom Musikkorps der Polizei
ssikalisch umrahmt und von stidtischen Behorden organisato-
sh vorbereitet. »Das Gartenbauamt«, so meldete am 6. 1. 1979
»Weserkuriers, nsorgle schon gestern dafiir, da das abge-
rte Gebiet am Punkendeich weitgehend schnee- und eisfrei
Se Bremer Eiswette gehort zu den Veranstaltungen, die von we-
gen Aktiven fur viele Schaulustige inszeniert werden, was ihr ei-
Anflug von Unverbindlichkeit gibt, die der landlufigen Vor-
slung von Brauchtum eigentlich widerspricht. Ein Brauch, so
inen die meisten spontan, sollte nicht besonderer Pilege und
snisation bediirfen, sondern zur selbstverstandlichen Gepflo-
sneit der Menschen gehdren, die ihm anhangen — wie etwa das
Laternegehen« der Kinder am Martinstag, das Aufstellen eines
sistbaumes zu Weihnachten oder die Knallerei in der Silvester:
tht. »Es gehdrt zum Wesen des Brauches«, definiert Herbert
edt, »dali er mehr oder weniger regelmalhige Wiederholun-
erfahrt und dali er von einer Gemeinschaft getragen oder in
sm Auftrag geubt wird. Damit ist eine soziale und zeitliche Ko:
Jinate gegeben. Schliefilich gehdrt jeder Brauch einem ethni-
en Raum zu, und er gehdrt umgekehrt 2u den Elementen, die
i Kulturraum konstituieren, Das weist au einen Doppelcha-
‘er des Brauches hin: Indem er Ausdruck einer geschichtlichen
tur eines Raumes ist, trigt er gleichzeitig dazu bei, diesen
sum abzugrenzen, 2u gliedern und lberhaupt zu schaifen.«
deutsche Volkskunde, die sich wissenschaftlich mit Brauch-
beschaiftigt, verstand sich bis in die jlingste Zeit vor allem als
corische Disziplin. Entstanden aus der romantischen Suche
+h dem Ursprung kultureller Gegebenheiten, befaite sie sich
sugsweise damit, Zeugnisse der Vergangenheit zu rekonstruie-
. So schienen ihr jeweils die Brauchelemente besonders inter-
ant, die Uber sich hinauswiesen auf einen Alteren, mOglichst
»Uru-Zustand, und wena man dabei auf altgermanische My-
und Kultspuren stieB, hatte sich die Arbeit erst so sichtig ge-
. Dieser Trend, schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet,
sde 2ur Zeit des Nationalsozialismus noch erheblich verstarkt,
Deutsches Brauchtum
ebenso das Bestreben, Briuche neu zu beleben, die aufgrund sich
lindernder Wirtschafis- oder Gesellschaftsformen in Vergessen-
hit geraten w:
Heute mehren sich die sozialwissenschaftlichen Ansitze in der
Volkskunde. Wahrend die Rekonstruktion der »Urformen« von
Liedern, Tanzen, Trachten oder Volksfesten zwangsliufig die Sa-
che der Fachwissenschaftler war und das Verstindnis der unmit-
telbar mit diesen kulturellen Phinomenen Refaliten oft weit ber.
stieg, gewbhnt man sich heute daran, die Brauchausibenden als
die eigentlich »Kultur-Zustindigen« au betrachten ~ was die Ar-
beit des Wissenschaftlers nicht Uberflissig macht, ihr aber einen
anderen Stellenwert zuweist. Nicht das Alte, in unantastbarer Tra
dition Erstarrte steht im Vordergrund des Interesses, sondern die
lebendige, allen positiven und negativen Einflissen der Mode un:
terworfene Brauchausibung, und zwar sowohl yor als auch hinter
den Kulissen. Wie weit sich izgendein Brauch 2uruickverfolgen
lat, wird zur zweitrangigen Frage fir den, der wissen will, wer
sich heute aus wefchen Motiven und mit wie starkem Engagement
an brauchtiimlichen Veranstaltungen beteiligt. Das Bremer Dom:
lreppenfegen, mit dem heiratswillige Junggesellen die »Jung
frauen der Stadt auf sich aufmerksam machen wollen, ist unter
diesem Aspekt dann vielleicht trotz seines wenig imponierenden
Alters interessunter als der Oberstdorfer »Wilde-Mannle-Tanzs,
dersich als der »ilteste Kulttanz aus grauer Vorzeit« bis in unsere
Tage erhalten haben soll. Ein Kulttanz, soviel steht fest, ister je-
denfalls schon lange nicht mehe.
Brauchtum — unverbindlich geworden oder ausgestorben. Im Ge-
gensatz zu archaischen Gesellschaften, in denen die genaue Ein:
hhaltung bestimmter Briuehe zu bestimmten Terminen als unbe-
ddingt notwendig fr das Wohl der jeweiligen Gemeinschaft galt,
hhaben wir es in Deutschland cher mit unverbindlichem Brauch:
tum zu tun. Wer glaubt denn noch, daB der Lirm am Polterabend
vor der Hochzeit bose Damonen vertreibt? Wer verbindet mit dem
Verschenken oder Verzehren von Ostereiern noch Gedanken an
die Steigerung der Fruchtbarkeit von Mensch und Tier? Gewil)
sind derartige Interpretationsansitze fir das bessere Verstindnis
von Bréuchen in der Vergangenheit Uberstrapaziert_worden.
‘Trotadem liegt es bestimmt nicht an der plotalich erwachten Ra-
tionalitat der Deutschen und ihrer Brauchtumspfleger, wenn zahl-
lose, noch 2u Beginn unseres Jahrhunderts lebendige Briuche
heute ausgestorben sind oder nur noch in sparlichen Relikten, so
gut wie unbeachtet von allen nicht unmittelbar Betroffenea, ein
Schatiendascin fristen,
as gilt vor allem flr Brauche aus dem Arbeitsleben, die infolge
von Industrialisierung und Demokratisierung bedeutungslos wur-
den, In einer Gesellschaft, die schon das Wort »Lehrling« als dis-
ksiminierend empfindet und durch »Auszubildenders ersetzt, ha:
ben zeitraubende und vor allem den Statusunterschied awischen
Alten und Jungen, Konnern und Nichtkonnem betonende Ritu-
ale keinen Platz mehr. Die Feierlichkeit, mit der einst der Eintritt,
in die Berufsausbildung ebenso begangen wurde wie das Freispre
chen nach erfolgreicher Lehre oder die Aufnahme in die Zunftge
meinschaft nach Beendigung der Wanderzeit, ist heute niichterner
Routine gewichen, selbst in den alten Handwerksberufen, die sich
ing Industriezeitalter hinllbergerettet haben, Wandernde Hand:
werksgesellen sind so rar geworden, daB die wenigen »ziinftig
gekleideten Zimmermanns- oder Maurergesellen, die gelegentlich
in unseren Stidten auftauchen, wie lebendige Museumsstiicke be-
staunt werden, Und wer aus innerer Uberzeugung so altmodi
sehen Sitten anhingt wie der dreijahrigen Wanderschaft von
Handwerksburschen und aus diesem Grunde zu einer der Gesell:
schaften gehért, die dergleichen zu echalten bestrebt sind, der be-
folet zwar die traditionellen Briuche, spricht aber nicht dariiber ~
21
weder mit seiner eigenen Frau noch mit Journalisten, noch mit
den Leuten vom Heimatmuseum, die hoch und heilig versichern
sie wiirden das alles nicht verbffentlichen, sondern nur archiv
ren, um es flr die Nachwelt zu reiten, Zunfigeheimnis ist Zunftge-
hheimnis, und mag solche Auskunftsverweigerung den Fragenden
auch frustrieren, so ist es doch irgendwo wieder trdstlich, daB in
den perfekt durchorganisierten, von Meinungsforschern und
Marktanalytikern statistisch aufbercitcten Gesellschaften der Ge-
genwart noch Nischen flr solch unzeitgeméBes Engagement exi-
stieren,
In vielleicht noch starkerem Mae verlorengegangen sind di
bauerlichen Brauche, die sich einst um Saat und Ernte, Viehaus
trieb und Schlachtung, um landliche Hauswirtschait und Gemein-
doleben rankten. Die Griinde daitir iegen auf der Hand. Dorige-
imeinschaften, dic schon aufgrund ihrer Abgeschlosseneit von
der AuBenweit dazu vorbestimmt waren, auf Gedeih und Verderb
zusammenzuhalten, sind heute so gut wie nirgends mehr 2u fin-
den, Die allgemeine Motorisierung tragt ebenso wie die Massen-
medien Rundfunk und Fernsehen dazu bei, dali jeder einzeine,
‘wo immer er wohnen mag, allein oder im engsten Familicnkreis
zurechtkommt. Wer ist schon noch ernstlich auf Nachbarn ange-
wwiesen auBer im Katastrophentall, wenn das Auto nicht anspringt
oder die Stromversorgung zusammenbricht? Gegenseitige Hilfe
braucht nicht mehr durch geheiliste Traditionen garantiert 2u
‘werden, seit es den Sozialstaat und allgemein verbreitete Versiche-
rungen gibt, und gegenseitige Kontrolle findet zumindest kaum
noch difentlich statt. Die Verbindlichkeit gemeinsam geibter
Brauche wird zunehmend schwiicher, an ihre Stelle tritt das frei-
willige Engagement, die Brauchausiihung als Freizeitbeschdpit-
‘gung, Nicht der mehr oder weniger zufallig an einem Ort Woh-
nende tritt als Wahrer lokaler Traditionen auf, sondern das Ver-
einsmitglied. Das alles andert aber nichts daran, da nach wie vor
gerade ddrfliches, »bauerliches« Brauchtum als Inbegriff von gu=
ter alter Zeit und heiler Welt verstanden und entsprechend prop:
giert wird. »Einladung zur Bauernhochzeita ist um Beispiel die
Annonce eines Omnibusbetriebes Uberschrieben, die im Sommer
1978 in den »Lubecker Nachrichten« erschien. Und dann heiBt es,
unter ciner an Sonnenstrablen, Girlanden, Fachwerkhdusem und
Herzchen reichen Zeichnung mit typisch stidtischer Hochzeits-
kutsche: Mit dem Luxusbus fahren wir in Richtung Kiinstler-
dort Worpswede zum TevrtLsmoox. Sehen und erleben Sie in ei-
ner sagenumwobenen geheimnisvollen Moorlandschaft die uralte
Arbeit der Torfstecher. Am Nachmittag sind Sie eingeladen zu ei-
ner Bauern-Hochzeit mit OxiGiNat-TRACHTEN. In einem wins
gen, romantischen Dérflein, mitten im Teufelsmoor, feiemn Sie bei
Musik, Tanz und viel Stimmung die Trachten-Hochzeit mit dem
BraurPaak (an dieser Stelle weist ein Sternchen auf den am unte-
ren Rand der Anzeige stehenden Satz hin »Die Brautleute wiin-
schen keine Festkleidungs). Bine riesige Hoci2ettstarri mit vie-
Jen deitigen Hausmacher-Wurst- und Fleisehspezialititen steht
flir Sie hereit! Essen Sie, soviel Sie kinnen und wollen! Kleinge-
druckt findet sich hier ein »Im Fahrpreis enthalten« sowie das
Angebot, im Laufe des Tages an einer Verkaufsveranstaltung ei-
net Haushaltsgerdte-Firma teilzunehmen. Der Fahrpreis ein-
schlie@lich Bauernhoohzeit, Hochzeitsessen und Rundfahrten be-
trdgt 15 Mark, und die Abfahristabelle zeigt an, dal von Montag
bis Samstag taglich derartige Fahrten durchgelthrt werden. Fin
halbes Jahr spiter wirbt dbrigens die gleiche Firma fir eine »:
‘Tages-Erlebnis-Reisea in den Harz, wobei an zentraler Stelle ein
Harz-Heimatfest mit Folkloregruppe, Musik und Tanz in Aus-
sicht gestellt wird
Geworben wird hier im Grunde mit dem Versprechen, dem Teil-
nnehmer an einer solchen Falirt Zugang zu ciner Art Gegenwelt zu
verschaffen, die lange als Inbegriff des Unzuginglichen galt: Das
abgelegene Darfehen mitten im Moor, die uralte Arheit der Torf-
stecher (bequem vom vollklimatisierten Bus aus 2u beobachten
wie die exotische Tierwelt der Serengeti), die Trachten-Hochzeit,
auf der die Touristen sich wie Ehrengaste vorkommen sollen, ob-
gleich das Gunze nur inszeniert wird, um in den potentiellen Kun
den der Haushaltsgerite-Firma die freudig-geléste Stimmung zu
erzeugen, die einen KaufentschluB erleichiert
Natirlich gibt es da und dort auch noch echte Trachtenhochzei-
2m
ten, zu denen das Publikum nicht cigens mit Bussen angefahre=
\wird, sondern allenfalls vom Straenrand aus zuschaut, well =
obnehin in dieser Gegend wohnt oder gerade Urlaub macht.
sorbischen Dérfern der Lausitz beispielsweise kommt es hous
noch vor, da® das Brautpaar in traditioneller Tracht vor den Als
tritt, nachdem es sich wilhrend des Ganges zur Kirche den vee
den Hochzeitsgasten mit Blumengirlanden versperrien Weg f=
kaufen muBte. Aber die Sorben sind eben auch cine Kleine sla»
sche Minderheit in der DDR, und am stirksten hat wiederuim ==
Minderheit unter ihnen, ndimlich die zwanzig Prozent sorbisch=
Katholiken im Gebiet dstlich von Kameng, ihr altes Brauchta=
bewahrt. Das Osterreiten der jungen Burschen, dic aul e=
schmiickten Pferden von Ort 2u Ort die Auferstehung Christi =
kiinden, wird von der SED genauso toleriert wie die Prozession==
zu Himmelfahrt, mit denen Gott um Fruchtbarkeit fr die Fela
gebeten wird, Die Vagelhochzeit, die sorbische Kinder am 25.
nuar in Bautzen und Umgebung feiern, soll dagegen auf vorche=
liche Totenopfer zuriickgehen. An diesem Tag, det als Mitts =
Winters gilt und in Analogie 2u seinem Namen »Pauli Bebe
rungs andernorts als Termin fir Verkehrungsrituale gebrauchh==
war, maskieren sich die Kinder mit spitzen, schnabelihnlice==
Pappnasen und werden mit Geblick und Siifigkeiten aus =
Hochzeitskiiche der Vogelu beschenkt
Brauchtum als Demonstration. Ganz generell kann man wohl =
gen, daB Minderheitengruppen dazu neigen, sich durch Trae
und spezielle Brduche von ihrer Umgcbung abzuhcben, Das ©
keinesweas nur fllr ethnische Minderheiten wie die Sores =
Deutschland, die Deutschen in Ungarn und Ruminien ode= ==
Zigeuner in ihren jeweiligen Gastlandern, sondern auch far e=
sellschaftliche Untergruppen wie Rocker oder Hippies. H
Bausinger weist in seiner »Volkskunde« auf die demonstrat =
Funktion vieler Briuche hin und belegt das besonders mit
weisen auf die landsmannschaftlichen Veranstaltungen
Flichtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundes
bik ansissig wurden. Von den Trachten ausgehend, die fhe
tem Rang und Stand zur Geltung brachten und heute ext
Show-Funktionen erfillen, schreibt Bausinger: »Auch in
Briuche der Flichilinge drang zunehmend dies demonst
Element cin. Fs mufte cindringen, da viele dieser Briuche
Grunde sunbrauchbar« geworden waren... Verfolgt man
diesem Aspekt die innere Geschichte der Landsmannschalies
den beiden letzten Jahrzehnien, so wird deutlich, wie das e
sermalten Theatralische der Bréuche immer stirker in den V
rund tit, und es war dann nur noch cin kiciner Schrit vom
‘ealischen Brauch 2um Brauch als Theater. Schon Mitte der
ziger Jahre haufen sich Berichte, in denen davon die Rede is
in landsmannschaftlichen Feierstunden die vorweihnachil
Briuche der Sudetendeutschens, rdie alten Briuuche der se
schen Heimat« oder dal sdonauschwabische Hochzeitshea
sepflegt wurden ~ und erst bei genauerem Hinsehen wird
Jich, da® diese »Brauchpflege« auf Kleine Theatersticke |
Adventsabend — »Rubezahl besucht uns« ~ Evehens Hock
‘wansponiert (Ubertragen) war.«
Der Wandel vom alten Brauch zum folklorstisehen Hap;
Rechte Seite
Ein buntes Kaleidoskop deutschen Brauchtums.
Oben links: Bayerische Schuhplatiler
Oben rechis: Rottweiler Fasnet.
Mitze von links nach rechts:
‘Sternsiinger in Oberbayern;
Fronleichnamsprozession in Villingen/Schwarzwald:
Aufrichten des Maibaums am Chiemsee.
Daranter.
Fest der Birgergilde in Oldenburg
Unten
Schiitzenfest in Neuss.
Links unten:
Fasinachtsumzug in Garmisch/Partenkirchen,
abt sich nicht nur bel »Heimatvertriebenen« yerfolgen. »Zwar
geraten die aus dem Osten verpflanzten Traditionen leichter in
den Bannkreis des Minorititenfolklorismuss, bemerkt Bausinger,
haber dies ist kein kanstitutives Merkmal, Jedentalls entwickeln
auch die Einkeimischen ein Heimatbewubtsein, das sich in den
Formen des Folklorismus tuBert. Zwar sind sie nicht in die Welt
hinausgezogen, aber die Welt ist 2u ihnen gekemmen.« Das Be-
urnis, sich in seiner unverwechselbaren Eigenart Nachbarn und
Fremden au prasentieren, diirte bereits in der »guten alten Zeit
‘rutnindest bet all den brauchtimlichen Ritualen mit im Spiel ge-
swesen sein, die sich nicht auf den engeren Familienkreis oder Ar:
Jasse beschrinkten, die mit Besonderheiten der Arbeit zusammen
hhingen. Und damals wie heute kann man die Freude an der Selbst-
darsicliung kaum von vielleicht tiefer liegenden Motiven fr
Brauchhandlungen trennen, wenn man an dic mit Umziigen,
feierlichen Aufmirschen, Gottesdiensten oder Feuerbrinden ver-
‘bundenen Feste denkt, deren Prunkentfaitung auf Zuschauer an-
gelegt ist. Ob das fridher Kinder. Frauen, Gesinde und Unvermé-
xgende der cigenen Gemeinde waren oder ob es heute Touristen
sind, die, mit Reiseprospekten und Brauchtumskalender der Re-
‘sion ausgerdstet, plnkilich zum festgeseizien Termin erscheinen
es gilt zu zeigen, wer man ist und was man kann, Ob Alphorn=
blasen oder Leonhardifahrt, ob Schipperhoge, Fasching, Oster-
fouer, Maibaumstehlen, Ringreiten, Tag des Bergmanns, Alpab-
trieb oder Stephaniritt mit Prerdewethe ~ rund ums Jahr wiegt der
Stolz, dabeizusein, tir so manchen Teilnehmer schwerer als die
Last der Schulden, dic er dafiir auf sich nehmen mul
Brauchtum — organisiert und finanziert. Schauen wir uns unter
diesem Aspekt zuniichst einmal dic bayerischen Leonhardifahr.
ten oder -itte etwas genauer an, Der heilige Leonhard, der 559
starb und zuniichst als Patron der Gefangenen und Gebirenden
vyerehrt wurde, gilt seit dem 17, Jahrhundert als Tierpatron ganz
allgemein und seit dem 18. Jahrhundert speziell als Patron der
Pferde, Am 6, November wurden und werden noch heute Ritte
oder Fahrten mit Pferdewagen unternommen, deren Ziel ihm ge-
wweihte Walifahrskirchen und Kapellen sind, Bertihmt scit dem
19, Jahrhundert ist die Bad Tolzer Leonhardifahrt, die als Vorbild
fur viele dhnliche, wenn auch weniger spektakulare Veranstaltun-
zen zuim gleichen AnlaB diente, Es handelt sich dabei um eine
Prozession mit Pferden und geschmilckten Pferdewagen zu einer
rahe gelegenen Votivkapelle, die von den jungen Bursehen mit in
ren Wagen dreimal umrundet wird. Eine heilige Messe und die
anschlieBende Segnung der Pferde bilden den Hohepunkt des Fe-
Stes, das im ibrigen nicht nur von Tolzern, sondern von berittenen
Gasten aus Nachbarorten und mittlerweile auch Tausenden von.
Schaulustigen gemeinsam begangen wird. Traditionelle Trachten,
die dekorativen, zum Teil aus dem Heimatmuseum entlichenen
»Truhenwagen«, Musikkapellen und das Goailschnalzen (Peit-
schenknallen) der jungen Manner tragen zum Flair dieser Veran-
staltung bei, die den Eindruck uralten Brauchtums vermittelt,
aber in der heute Ublichen Form nicht viet alter als hundert Jahre
ist, da im Jahre 1856 cin Télzet Pfarrer den »durch Auswiichse in
Milkkredit geratenen Brauch« neu ordnete.
Die Leonhardifahrt in Benediktbeuern findet ~ wie es in dieser
Region auch andernorts vorkommt ~ mit Rcksicht auf die be-
rihmie Télzer Prozession einen Sonntag vor oder nach dem 6.
November statt, damit man am Leonharditag in Bad Tolz dae
sein und die Tolzer mit einer Abordnung von Trehenwagen mit
Frauen in Alt6lzer Tracht als Gaste bei der eigenen Wallfahrt be-
grilien kann, Der lexikalische Fuhrer »Brauchtum in den Alpen:
Tinderne 2ihlt auf: »Es kommen ua, aus folgenden Ortschaften
Festgespanne und Reiter: Bad Tolz, Beuerberg, Bichl, Burasburg,
Grofiweil, Habach, Kochel, Oberbuchen, Penzberg, Staatsgestit,
Schwaiganger, Sankt Heintich, Wallgau, und selbstverstandlieh
auch aus Benediktbeuern selbst. 15000 Besucher geben oft dem
Festzug einen eindrucksvollen Rahmen.« Und nach einem Ex-
kkars aber die auf das Jahr 1000 nach Christus zuriickgehenden
Kulanfiinge und die Entwicklung des Ortes zu einem Zentrum
der Pferdeweihe heifit es am SchluB des Beltrags: »Finanziert und.
organisiert von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Pfarr-
amt, ist diese aufwendige Fabrt mit ihren fast durchwegs stilvoll
274
sgchaltenen Motiven und den prichtig geschmiickten Festgespe=
fnen cin besonders eindrucksvolles Beispiel_oberbayerisches
Brauchtums.« In Pietzeakirchen im Landkreis Rosenheim wore
zat Sicherung des Rities 1972 der St-Leonhard. Verein zegrins=
der auch Mitglieder aus dem norddeutschen Raum hat, uné =
Kirchweidach im Landkreis AltOtting finanziert ein Leonhor®
verein den Transport der etwa hundert teilnehmenden Piers
durch den Verkau? van Festzeichen ~ eine Regelung, dic al
mein iblich sein soll, Zur Leonhardifuhrt in PeiBenbers, die
in »Verlobnis« swegen einer Maul- und Klauenseuche rare
‘eht und im Jahre 1898 erstmals stattfand, bemerkt der Beriche=
statter: »Ein ribriger Leonhardiverein, cin Peillenberger
stall, Reitelubs und Reitstalle aus Polling, Waitzacker, Ame
hafe und Huglfing sowie freundschafiliche Nachbarvercine ==
‘Ammerhofe, HohenpeiBenberg, Etting, Forst, Huglfing uné
bing, in manchen Jahren bis aus Murnau, sorgen mit ihrem PS
deangebot zusammen mit einer interessierten Bevolkerung be:
nnanzieller Unterstiteung durch Gemeinde und Privatleute fir
Gelingen der Fahrt.« Seit immer mehr Bauern ihre Arbeitsp
abgeschaift haben, verlagert sich offenbar in kleineren Orten
Teilnehmerkreis auf die Pierdebesitzer unserer Tage, auf Zc
und Hobbyreiter, die selbst weite Wege in Kauf nehmen, um
soleltes Fest nicht zu versdumen. Fine andere Variante der Ame
sung alter Brauchformen an moderne Bediirfnisse zeigen die
funktionierten Leonhardifahrten wie die zu Borwang im Ode
‘edu. Dort zahlte man Anfang der siebziger Jahre nur noch ©
‘Reitpferde und vier Pony’ als Teilnchmer an der Pferdeweihe
terdessen entwiekelte sich die spltgotische Leonhardskapelle
‘Wallfahrisort der motorisierten Landwirte, die hier am
hhardstag ihre Autos und Traktoren segnen lassen
Karneval und Schiitzenfest, Wahrend Leonhardiritte und
\Wwandte Briuche (Georgiritt am 23. April, Stephaniritt am 25,
zember oder die immer mehe 2ur Touristenattraktion gerate
‘Alpabtriebe und »Viehscheiden«) eher regional zur Geltung
men und in Norddeutschland schon als »Geheimtip« sche
werden, gehéren Fastnacht und Karneval 2 den itberst
Lande bekannten Volksfesten. Wirklich popular in dem S=
dali ein ganzer Ort sich fir ein paar nirrische Tage auf den
Ben und in Festsilen austobt, st die Fastnacht zwar nur in de=
tholischen Gebieten Std- und Westdeutschlands, doch es
auch im Norden Karnevalsvereine, die Prunksitzungen.
schingsbille und Kinderfeste organisieren, Seit das Fer
den Kilner Rosenmontagseug und »Mainz, wie es singt
Jacht« in abendftllender Ausfihrlichkeit abertrigt, drop
Bild des wohlausgewogenen, »sauberen« Kamnevals, der ni
dem weh tun und es jedem recht machen will, die arches
Grundlagen vollends zu uberdecken, die dem Fest cinst seine
gentlichen Sinn gegeben haben, Wenn Uberhaupt, dann labs
dies archaische Element wenigstens andeutungsweise i
sehwabisch-alemannischen Fastnacht wiederfinden, die
und Kleinstidte zwischen Schwarzwald und Bodensee &
‘Veranstaltungskalender mit genauen Orts- und Zeitangabes:
kommt man bei jedem Fremdenyerkehrsverband der R
denn bei allem Traditionsbewubtscin betrachten die Fi
schen doch den Zustrom auswirtiger Besucher keineswex
Stérfaktor. Sie kommen den Touristen sogar entgegen, ind==
‘twa den »groBen historischen Rottweiler Narrensprungs
zagsweise fur ortsfremde Interessenten auf drei Uhr nach
legen, wie erstmals 1936 geschehen. Wenn das ebenso bers
Stockacher Narsengericht tagt, in Elzach die Narrenfahne
‘dem Rathausfenster gehdngt oder in Uberlingen der Narr=
geschlogen und am Rathaus aufgestellt wird, sind die Strime
\Wirsiger Schaulustiger organisatorisch lingst eingeplant ~
spricht sicher fr die Substanz des fastnachtlichen Brauc!
dieser Region, wenn sich bis heute trotzdem der Eindruck
ten hat, die schwabisch-alemannische »Fasnet« sei etwas, was
Leute dort eigentlich ganz fur sich selbst veranstalten. Typise®
die alten »Narrestidtle« und Dorfer im Stidwesten sind die
voll geschnitzten und manchmal ilber Generationen vererote=
sichtsmasken, die sogenannten »Schemmenc, mit den daz:
senden Hise oder »Kleidle«, Da gibt es den »Hansele
»Hnsele« mit seinem glatten Lacheln und den »Narrow mit fal-
tenreichem Griesgram-Gesicht, das »Morbili«, eine Aitweiber-
maske mit Zahnlucken, und die »Wueschte in dick wattierten
Hanswurst-Kostamen, die immer im Rudel auftreten und gepri:
gclt werden, Der Elzacher »Schuddige ist eine furchteinflsBende
Damonengestalt im roten Zottelgewand mit einem aus Stroh ge.
figten Dreispitz, der mit Schneckenhdusern und Papierballen
beseizt ist, und dhnlich fratzenhaft wirken die zabllosen Hexen,
ie in den verschiedenen Fastnachtsumziigen mitlaufen, Viele
Kostiime sind mit Schellen besetzt, die im Narrensprung (im
Zveivierteltakt) zum Klingen gebracht werden. Peitschenknallen,
Gebriil und Blechmusik begleiten die Narrenlaufe, aus denen die
Maskierten auch gelegentlich ausbrechen, um einzelne Zu-
schauer, vor allem Kinder, zu »strahlen«, das heiBt, zu rigen und
su necken oder 2u beschenken,
Das fastnachtliche Ruigerecht, das sich im »Narrengericht« insti-
sationalisiert hat und das von ferne auch noch in den sorgfaltig
ach rechts und links ausbalancierten Bittenreden rheinischer
Natren anklingt, eehdrt cu den Indizien daft, da Fastnache ur-
spriinglich eine Revolution auf Zeit ist. Die Méglichkeit, wenig-
sens fir ein paar »tolle Tages aus der Rolle zu fallen ~ was ver-
sallende Masken im Prinzip erleichtern -, wird allerdings um so
Alusorischer, je strikter das Rollenyerhalten der Masken durch
Tradition und Organisation der narrischen Umaiige festgcleat
ssird. Und so drobt vielleicht auch der schwabisch-alemannischen
Fastnacht, was ihrer groBen Basler Schwester bereits widerfahren
daB die rebellische Jugend, anstatt sich dem Reglement narri-
schen Brauchtums zu fiigen, an den wegen Fastnacht schulfreien
‘agen lieber in die Berge fbrt, um sich dort im Schnee von ihren
slitéglichen Rollenspiclen zu etholen.
‘Was fiir den katholisch gepragten Siden und Westen Deutsch-
“ands die Fastnacht ist, das sind dem protestantischen Norden die
Selen Kleinstadtischen und dérflichen Schiitzenfeste, die vom
Maibis in den Spatsommer hincin gefeiert werden, Trager des Fe-
ses sind die Schiitzengilden, deren Traditionen teilweise bis ins
Mittelaiter zurtickreichen. Doch auch Neugriindungen oder Wie-
ergrindungen sind bis zum heutigen Tage keine Seltenheit,
Diese jiingeren Gilden unterscheiden sich von den lteren vor al-
fem darin, daB sie auf einige alte Zopfex ausdriicklich verzich-
es, zum Beispiel den Stechschritt beim feierlichen Aufmarsch
Saer die militirischen Kommandos beim Schiefien, Entstanden
as der Vereinigung von Mannern, die einander in bestimmten
Notlagen Beistand versprachen ~ in Schleswig-Holstein gab es
sam Beispiel Totengilden, Komngilden, Mobiliengilden, Schwei
segilden, Hagelgilden oder Strohgilden -, entstanden also aus ci-
ser Ant von Versicherungsverein, sind Gilden heute eher als Fo-
am fit Geselligkeit, SchicBsport und cyentucll Brauchtums-
Sfiege anzusehen. In Kleineren Orten meist einziger Honoratio:
Saclub, in dem keiner Mitglied werden kann, der junger ist als
Sibig Jahre, verstehen sich groBstadtische Gilden oft als Verein,
= dem jeder, oline Ricksicht auf Alter, Geschlecht, gesellschafi”
schen Rang oder Reichtum, Zugang haben soll
Dee jthrlich stattfindenden Schiitzenfeste dienen gleichermaBen
=r offentlichen Selbstdarstellung der Gilde, der Ermittlung ihres
“Konigs« durch ein Wertschieflen und dem allgemeinen Amiise-
Sent der Bevolkerung, vom Jahrmarkt fiir die Kinder bis zum
Tanz im Festzelt fr die Erwachsenen. Girlandengeschmiickte
Saustilren, Spruchbinder und bunte Lampenketsen uber der
Doristrafte sowie Buden, an denen es Wirsichen und Limonade,
Sauerlutscher, Liebesperlen und Teddybarchen zu kaufen gibt,
‘eachea auch dem durchfabrenden Fremden deuilich, daB hier
‘==ade Sehiitzentest gefeiert wird, Am Vagel- oder Scheibenschie.
“<2 teilnehmen dirfen normalerweise nur die ortsansissigen|
Schiitzen und Vereinsmitglieder. Erst neuerdings gibt es da und
‘Sent, vor allem in grGieren Gemeinden, ein »Volks-« oder »Kur-
‘etcchiellen«, bei dem ebenfalls cin Sehiltzenkéinig ermittelt
ed, Doch wilhrend hier nach Wettkampf, Siegerehrung und Er-
Sserungsmedaille alles vorbei ist, fngt flir den Schitzenkénig.
= Gilde alles erst an. Seine Reprasentationspflichten sind 50
sefengreich, da} er entweder lange auf die Kénigswirde gespart
eben oder sich dageyen versichert haben muB. In der Limebur-
‘= Heide, aber auch in Schleswig-Holstein gibt es »Konigskas-
sen, in die weniger begilterte Vereinsmitglieder regelmaBig Geld
einzablen, damit derjenige unter ihnen, den die Konigswiirde viel
leicht beim nachsten SchieBen ereilt, sich nicht finanziel ru
ren mu wenn er das halbe Dorf Ireihalt,
Wo das Schiitzenwesen floriert, gibt es in der Regel auch Kinder-
schitzenfeste, auf denen die schulpflichtige Jugend des Ortes ih-
ren eigenen KOnig und ihre K6nigin ermittelt. Das letzte Glied in
der Kette soleher Traditionen stellt das unabhiingig von einem ~
vielleicht einst iblichen ~ Schiitzenfest veranstaltete »Kindervo-
sgelschieRen« dar. Wer dabei nach einem Vogel oder nach Schie8-
gerdt sucht, wird meist enttduscht; an die Stelle dieses traditione!-
Jen Zubehors sind Wurfspiele mit Billen, Glicksspiele mit Wir-
feln oder Geschicklichkeitsspiele wie Balancieren auf einem Bal-
en oder Slalomfahren mit dem Fahrrad getreten.
Wo der Fremdenverkchr als Promoter brauchtiimlicher Aktivita-
ten ausfally, ist die Veranstaltung solcher Feste von Jahr zu Jahr
yon neuem in Frage gestell, da sie von der unermidlichen Ein-
satzbereitschaft weniger abhangt, die entschiossen sind, ihren
Kindern nicht vorzuenthalten, was sie selbst friher genossen ha-
ben. Doch da dic Kosten fiir Festzelt, Kapelle, Spielmannszug
und ~ last not least ~ die Gewinne, die jedes teilnehmende Kind
zu diesem AnlaB erwarten dart, permanent steigen, ist es zumin-
est in Kleineren Gemeinden eine Frage der Zeit, wie lange die El-
tem schulpflichtiger Kinder, aus deren Spenden das Fest finan-
zien wird, dergleichen noch fiir unterstiitzenswert halten, zumal
immer mehr »Zugezogene« den traditionellen Hintergrund so-
wieso nicht mehr kennen.
Brauch »ohne Glauben«, Die Frage, was die Teilnahme an einem
Volksfest fir den einzelnen heute noch bedeutet, muf hier ebenso
offenbleiben wie die nach der brauchtimlichen Gestaltung tradi-
tioneller Familienfeiern und Kalenderfeste. Geburt, Hochzeit und
Tod sind 2u individuellen Ereignissen geworden, an denen auBer
den nichsten Verwandten und Bekannten niemand mehr Anteil
rimmt ~ zumindest sind sie nicht mehr die zentralen Anlasse, die
der Volksglaube einst mit zabllosen Ritualen ausgeschmiickt
hhatte, Von den kirchlichen Feiertazen, die das Jahr gliedern, sind
nur noch Ostetn und Weihnachten von weiterreichender Bedeu:
tung, was sich nicht zuletzt an dem Stellenwert ablesen lit, den
diese Feste im kommerziellen Bereich haben. Maifeiern und Ern
tedankfest spielen in landlichen Gemeinden noch eine gewisse
Rolle, doch iberregional versteht man unter Maifeier vor allem
cine Veranstaltung der Gewerkschaften und unter Erntedankfest
gar nichts, es sei denn, man ist aktiver Gottesdiensthesucher. Halt
‘man sich an die vor jedem gréferen Festtermin einsetzende Kon-
sum- und Geschenkartikelwerbung, so witren noch der Vatentins-
tag am 14. Februar, der Muttertagz am zweiten Sonntag im Mai
und der Nikolaustag am 6. Dezember erwdhnenswert,
Der historische Hintergrund heute noch lebendiger Volksbriiuche
ist meistens verschiluet, und an die Stelle der Pflichten und Privi-
legien von einst ist das von Vereinen oder KulturbehOrden ge
plante, finanzierte und beaufsichtigte Festprogramm getreten, das
Heimatliebe neben internationale Parincrschaft stellt und spiele-
risch-sportlichen Wettbewerb neben Konsumffeude und Lustge-
\winn der Festbesucher. So weit sich die beiden deutschen Staaten
seit dem Krieg auch auseinanderentwickelt haben mégen ~ in der
Gestaltung von Volks- und Heimatfesten zeigt sich da wie dort der
aleiche Trend. Die DDR ladt ein zum Tonnenrciten in Althagen,
Prerow und Abrenshoop, zum Heisatsmarkt in Diesbar-SeuBlite,
zur Vogelwiese in Dresden oder zum Tag des Bergmanns in Eisle
ben oder Zwickau, die Bundesrepublik wirbt mit dem Oktoberfest
in Minchen, dem Karneval in Koln, der Dinkelsbihler Kinderze-
che oder dem Rochusfest zu Bingen. Da wie dort hasieren die
Volksfeste auf traditionellen Markten, Turnieren, Winzer- oder
Schiitzenfesten, und da wie dort besteht das Festprogramm aus
Trachtenparaden, Volkstanzdarbietungen, historischen Spielen
und Jahrmarktsrummel mit Verkaufsbuden und »Fahrgeschal-
ten, Mag der Glaube, dal von der Befolgung bestimmter Briu-
che 2u bestimmien Anldssen Wohl oder Weh des einzelnen ab-
hinge, auch [angst untergegangen sein, so sollte man doch den
Zugewang nicht unterschitzen, den »Brauch ohne Glauben« ge-
nnauso austiben kann und tatsdchlich ausiibt,
25
KSPEKTE
HANS EGGERS
Gesprochene und geschriebene Sprache. Wo Menschen miteinan-
der leben, haben sie auch eine gemeinsame Sprache, Denn damit
sie zusammenwirken konnen, missen sie sich dutch Sprache ver-
stdndigen. Soziologen haben fur das Zusammenleben und -wite
ken den Begriff »Verkehrsgemeinschait« geprigi. Flr die Men
sehen, die darin Icben, ist »Kommunikation« unerla@lich, und
das erz\ingt geradezu eine gemeinsame Sprache. Die cigene Fa-
milicist dic engste Verkehrs- und Sprachgemeinschalt, Aber jeder
Mensch verkehrt auch in grofieren Gemeinschatten, der Ge-
imeinde, der Stadt, der Landschaft. Man hat in diesen engeren
oder weiteren Gruppen viel Gemeinsames mitetnander, hat dic
agleichen Sitten und Gebriuche, wirtschafiet nach gleichem Mu-
ster, feiert die gleichen Feste, hat Uberhaupt viele gemeinsame In-
teressen, Die Sprache wird durch diese gemeinsamen Bedilrfnisse
gepriigt. Wer im Gebirge lebt, dem ist die Seefahrt fremd und er
hhat deshalb in sciner Sprache auch kaum Ausdriicke dafur, und
‘wer an der Meereskliste wohnt, braucht sich nicht aber Gemsiagd
und Almwirtschaft 2u verstindigen, So entstehen regionale Spra~
chen, die von den Lebensbedingungen und Lebensformen gepriigt
‘werden, Man nent sie »Mundarten« oder »Dialekte«. In der Re-
{gel bleiben sie »schriftlose Sprachen«, weil das Alltagsleben kei
ner Schrift bedarf
Dorf und Landschaft aber stehen in einem groferen politischen
Verband: sie sind Teile eines groflen Staates, in dem »National-
sprachens enistanden, die sich Uber die einzelnen Mundarten er.
oben, Dadurch wurde es notwendig, aufkommende Bedirtnisse
Uberregional zu regeln und sic schritlich zu fixieren,
‘Was gesprochen wird, ist rasch verklungen; nur das Geschriebene
hhat Dauer. Darum kann sich die Darstellung der Geschichte einer
Sprache nur auf geschrichene Zeugnisse stitzen. Nur an ihnen
kann man zeigen, wie sich eine Sprache im Laufe der Jabrinun-
derte verandert. Das bedeutet uber auch Finsehrankungen. Weil
nlimlich die Sprache des Alltags, die Mundart, det Niederschrift
selten gewiirdigt wurde, wissen wir nur wenig Uber die Alltagsrede
jeder Zeit. In der ySchriftsprache« erfassen wir nur eine Sprach-
Form, dic ter die tiglichen Badilrfnisse hinausgeht, eine Spra-
cche, in der abstrakte Vorstellungen ausgedriickt werden, in der
‘man philosophieren und ber hdchste Dinge nachdenken kann,
und in der die Schriftsteller thre Werke gestalten konnen.
Diesen hohen Stand haben die Kultursprachen in Ost und West
Lingst alle erreicht, Doch steht die Einheit der Schriftsprachen
fast Gberall nur auf dem Papier, Denn lange, bevor wir in der
Schule schreiben lernen, haben wir unserer Mutter die gespro:
chene Sprache mit all ihren Eigenheiten abgelauscbt. Damit ha
ben wir Sprachgewohnheiten angenommen, die wir im Laufe un-
seres Lebens nur sehr schwer ablegen. Mag ein Deutscher immer
»shochdeutsch« reden, die meisten verraten, sobald sie den Mund.
faufmachen, durch die Lautbildung und vor allem die Satzmelo-
die, den Tonfall, aus welcher Landschafl sie stammen, Seit dem
Anfang dieses Jahrhunderts gibt es zwar genaue Vorschrifie,
»Normen, fiir die »Bihnenaussprache« oder ~ wie es heute
hei - die »Hochlautunge. Bislang hat das nicht viel gentizt. Da
aber Schauspieler und Rundfunksprecher die Norm beherrschen,
ist anzunchmen, daB auch die hochdeutsche Aussprache allmab-
lich so einbeitlich werden kann, wie es die Schrift lingst ist
Die Fatstehung der deutschen Sprache. Auf deutschem Boden fin
xen gelehrte Schreiber ungefihr um das Jahr 750 an, Texte in der
Sprache des eigenen Volkes zu schreiben, Vorher hatten sie jah
hhundertelang nur lateinische Texte abgefast oder abgeschrieben.
So konnen wir heute auf zw6lf Jarhunderte schrifilicher und seit,
dem 15. Jahrhundert auch gedsuckter Oberlieferung zuriickblik-
Ken, Das bedeutet 2wolf Jahrhunderte deutscher Sprachge
schichte.
38
Die deutsche Sprache
‘Wurde aber wirklich um 750 schon »deutsch« geschrieben, und
hat Karl der Grofte, als er im Jahre 768 zum Kénig der Franken
gekednt wurde, sein Heer schon sau? deutsche begrifi? Kast
wurde auf einer der reichen Besitzungen seiner Familie im oberen
Moseltil, in der Gegend um Mev, geboren, und et selbst nani
seine Muttersprache »frinkisch«. Er beherrschtc cin gewaltizes
Reich, fast ganz Frankreich, das schon seine Vorfahren den RO:
‘mern abgewonnen hatten, Oberitalien und das germaniseie Lan
bis an die Elbe und die Saale. Der germanische Frankenstamm
hhatte die anderen Germanenstimme, die Alemannen und Baieta,
und Karl selbst dazu noch die Sachsen unterworfen. Sie gehbrten
seither zum Frankenreich, aber ihr Streben nach Selbstandigkeit
war ungebrochen, und ihre Sprachen nannten sie »frankisch, ale
mannisch, bairisch« und »sichsisch«. Im Westen und Stiden des
Reiches sprachen die Einheimischen wie schon vor der frank:
schen Eroberung itmmer noch die »Lingua Romana, die Sprache
Roms. Die Germanen konaten diese fremde Sprache niche verste
hhen, Wohl aber verstanden sie sich trotz ihrer verschiedenen
Mundarien untereinander. Darum nannte Karl in seinen (late
nisch geschrichenen) Urkunden und Erlassen diese Sprachen die
Lingua theudisca«, Das war ein klinsilich gebildetes Wort, abge
Ieitet von germanisch »theudaw = »das Voik«, bedeutet also »die
Sprache des eigenen Volkes« im Gegensatz 2u der Sprache der
Romanen, Erst um das Jahr 1000 tauchte die Bezeichmung vin
diutiscul, d.h, »auf deutsche auf. Der gelehrte Alemanne,
so schreibi, hat also begriffen, dai frinkisch, bairiseh, aleman
nisch und stchsiseh nur besondere Formen einer gemeinsamen
Sprache sind)
Deutlich erkennt man bier die Wickung der Verkehrsgemein:
schaft in einem politisehen GroBtaum. Denn nachdem das weite
Frankenreich unter den Nachfolgern Karls des Groflen mehemals
aufgeteilt wurde, entstand in seinem Osttel die grolbe politische
inheit, aus der das Reich der Deutschéh hervorgehen sollte. Die
politische Verbundeneie fihrt zu einem Gefthl der Einheit. Die
inzelnen Stimme erkennen, daf sie zwar etwas Eigencs darstel-
Ten, dab sie aber alle einem Reich angehoren und deshalb auch
nach anSen hin gemeinsame Interessen zu wahren haben.
Dabei ist die Entstehung der gemeinsamen Sprache innerhalb des
politischen Grofraums vor allem auf den kulturpolitisehen Wil
len Karls des GroBen zuriickzufilhren. Immer wieder schiirite er
den hohen Geistlichen ein, sie sollten fir die Ausbreitung uné
Vertiefung des Christentums sorgen, und sie sullten dic christliche
Lehre in den Landessprachen verkiinden. Das war im Westreich
nicht allzu schwierig, Wo ja die Sprache Roms, wenn auch in ge
wandelter Form, noch weiterlebte
Im germanischen Osten war dazu aber eine grindliche Neugestal-
tung der Sprache notig. Denn die vor kurzem noch heidnischen
Stiimme kannten die christlichen Glaubensvorstellungen und die
Lehre noch kaum. Tausende yon neuen Wortern mufiten gefun-
‘den werden, um die lateinischen Texte der Bibel und der Kirchen~
lehrer in die Volkssprache zu ubertragen, und diese dulerst
schwierige Aufgabe hatien die vier Stimme gemeinsam zu lsen
So entstand aus den vier noch heidnisch gepragten Stammesspra-
chen die christliche deutsche Kultursprache und gleichzeitig auch
das Bewuitsein der Gemeinsamkeit, das mit dem Wort »deutschs
ausgedriickt wird
Wollien wir sehr genau sein, so diirfien wir fur die ersten drei
Jalrhunderte unserer Sprachgeschichte noch nicht von einer
deutschen Sprache reden. Aber Karl der Grol hat den politi-
schen Raum geschaffen, der zum Sprachraum wurde, und er ha
die grofie kulturelle Aufgabe gestellt, die die vier Stimme gemein
sam bewaltigten, So rechnen wir auch fir diese Zeit bereits mit ei:
ner deutschen Sprache; denn es ist die Zeit des »werdenden
Deutsche.
Die Perioden der deutschen Sprachgeschichte, Zw6if Jahrhunderte
sind eine lange Zeit, in der mancherlei Veriinderungen in der
Sprache vorgehen. Schon wenige Zeilen aus dem Vaterunser kin:
ren das zeigen.
Um 825 schreibt ein Ménch im Kloster Fulda:
siheilagot thin namo, queme thin rihhi, si thin willo, so her in
Bmile ist, 50 st her in erdu,
4m Kloster Milstatt in Karten Iautet derselbe Text um 1200;
sscheiliget werde din namo, zuchom uns din rich. din wille werde
Sie af der erde als da ze himele
> Luthers Bibeldruck von 1544 hei es:
Dein Name werde geheiligel-Dein Reich kome. Dein Wille ge-
scbehe auff Erden wie im Himel,
seed so steht es auch heute noch, mit gelinderter Rechtschreibung.
‘Se den Ausgaben der Luther-Bibel
Man erkennt sofort, dali die Entwicklung der Sprache in Stufen
Ser sich geht, Die vollen Endvokale des Textes von 825 (namo,
illo, erdu, ribhi, giheilagot) sind um 1200 zu e gewordent oder
Serschwunden (name, wile, erde, rich, eheiliget). Aber das lange
er betonten Silbe (din, rahi) zeigt sich erst bei Luther als ¢i
ein, Reich), wie wir es heute noch sprechen. Auch Wortlaut und.
Wortolge der drei Texte sind verschieden; aber darauf wollen wir
sicht cingchen,
Sm auch das Nacheinander solcher Verlinderungen richtig ein-
Seen zu konnen, teilt man die Geschichte der deutschen Spra-
ip vier Perioden ein:
} Das Althochdeutsche (ctwa 750 bis 1050)
© Das Miticlhochdeutsche (etwa 1050 bis 1350)
i-Das Frihneuhochdeutsche (eta 1350 bis 1650)
9 Das Neuhochdeursche (etwa seit 1650)
Je thren Grundzigen geht diese Einteilung auf Jacob Grimm
785-1863) zuriick, den dlteren der beiden Brider, denen wir
‘SSemmlung der Kinder. und Hausmirchen verdanken. Er war
== bedeatender Gelehrter und der Begriinder der deutschen
Sprichwissenschaft. Allerdings hielt er Martin Luther
43-1546) fiir den eigentlichen Schopfer des Neuhochdeut-
Schon. Darum setzie er die Grenze zwischen Mittel- und Neu-
Sechdeutsch um das Jahr 1500 an. Viel spiter erst wurde erkannt,
$23 Luther cine Entwicklung auf die Hohe filhrte, die schon viel
“Seer begonnen hatte, Deshalb wird heute die Periode III »Frih-
Seshochdeussch« als eine eigene, selbstindige Sprachperiode in
‘Se anfangs nur dreiteilige Schema eingeschoben.
‘Lesigeschichte als Einteilungsprinzip. Jaco> und Wilhelm Grimm
‘serch lberzeugt, dab man die Sprachperioden allein nach den
Seedichen Merkmalen der Lautentwicklung einteilen kone.
‘Des eeicht zwar, wie wir heute wissen, bei weitem nicht aus. Doch
‘Seees darin Moglichkeiten, einen unbekannten Text zeitlich und
‘=> such riumlich wenigstens yorliufig einzuordnen.
“allem lassen sich die drei hochdeuischen Stammesmundarten
==! Grund des Lautbestandes von den niederdeutschen (dem
= Absichsischen«) unterscheiden, Die oben zitierten Gebetszeilen
‘Sen 2.8, im altsachsischen »Heliands, der um 840 entstand,
tsie folat
‘Geehid si thin namo. Cuma thin craftag niki, Werda thin willeo.
=> sama an erdo, s6 thar uppe ist an them hohon himilrikea
J Vereleich mit dem althochdeutschen Text nimmt man man-
‘Geel Unterschiede wahr, auch in der Wortwabl (gihellagot: g
eed = ngeweibtw) und in den Endungen (queme, willo, erdu :
‘Gere. Willeo, erdo). Aber wichtiger sind die Lautunterschiede. die
‘Sesserim Vergleich mit dem Text von 1200 2u erkennen sind, Statt
Seen und fu hat der Heliand »riki, uppe«. Und gegenber
‘See e2uchome« sichi in cinem altenglischen Text »tobecume«.
‘Ses den germanischen Lauten pk, die das Altenglische und das
Stsichsische behalten haben, sind im Frinkischen, Alemanni
‘ston und Bairischen nach bestimmten Regeln andere Laute ent.
‘Seeden. Man nennt diesen Vorgang die »althochdeutsche Laut-
Seschiebungs, und nennt die drei Mundarten, in denen diese
Sestanderungen varkommen, dic »hochdeutschen« Mundarten.
‘Des wir heute hochdeutsch » Wasser, sehlafen, Kuches sagen, wo
& siederdeutsch » Water, slapen, Koke« heiBi, ist eine Folge der
Leeperschiebung, Das Niederdeutsche hat die alten pt, k bis
heute zh festgehalien, Deshalls ist es, obwobl es an der deutschen
Verkehrsgemeinschait seinen Anteil hat, niemals nhochéeutsch«
geworden, und auch die hochdeutschen Sprachperioden lassen
Sich niche auf das Niederdeutache anwenden,
Uber dic Lautverignderngen des Hochdentschea ist hereits oben
bei Erdrtenung det drei Beispisle das Wichtigste pesaet worden.
Aithochdeutsch het die Periode, in der die volien Vokale der un-
betonten Sifben noch erhalten sind, mttelhochdeutsch diejenige,
in der diese Vokale zum unbetonten e geworden sind, die Vokale
der betonten Silben aber noch unverindeet waren, Im Frilaeu
hhochdeutschen werden dann dre alte Vokale 2 Zviclauten (min
niwes hds wird zu mein neves Haus) und umgekehet werden dee
tte Zwielaute(li-eben guoten brieder) 70 Langvokalen (lisbe
gute Braden)
Finige veitere Lautverinderungen miissen vir unerwathnt lassen,
tnd zwischen Frifneuhochdeuiseh und Neuhochdeulsch lassen
Sich Uberhaupt keine charakteistischen Lautunterschied= ange-
ben, im ubrigen gelten sie nur fur dic Schriftsprache, nicht aber
for die Mundarten. In dee Schweie (Schwizer Dutsch) und 7
Schen Schwarrvald und Vogesen werden noch heute die alten
Langvokale gesprochen, und in den sldbaierischen Mundarten
(Gia, guat) horen wit immer noch die alten Zwvielaute
Historisch-politische Grundlagen der Sprachgeschichte. Wenn
‘man eine Sprache nach der Veranderung ihrer Laute beschreibt,
stellt man nur den auficren Verlauf dar. Jede Sprache hat aber
auch ihre innere Entwicklung, die sch im politischen Raum und
unter sozialen Wandlungen sbspiel. Der deutsche Sprachruum
blieb in seinen Autoren Grenzen bis ie in die mittelhochdeutsche
Sprachperiode hinein unverindert. Die heiden neuhochdeut-
schen Perioden beruhen dagegen auf neuen politischen Grundla-
zen die sich hauptsdehlich in der Zeit von 1250 und 1350 heraus-
bildeten
Mit dem Untergang des Herrschergesclechts der Stauger (1254)
nimmt auch die Einheit des alten deutschen Reiches ihr Ende
Schon lange hatten die vielen Kleineren Firsten, die HerzOge und
Graten, die Bischéte und die Firstabte, nach Unabhiingiakeit ge-
strobt, Jetzt — in dor Zeit des Interregnums — haiten sie keinen ko-
nighchen Herr mehe uber sich, und das Reich zerfiel in Dut-
zende von kleinen Terstorien, die alle eifersuchtig ter ihre fan-
desherrliche Selbstandiskeit wachten
Ferner hatte wahrend der Stauferzeit cine gewaltige Wanderung
von deutschen Siedlem in die slawischen Lande dstlich von Elbe
rund Saale eingesezt. In diesem Weiten Raum entstanden, tells un-
ter einheimischen, 2um Teil auch unter deutsehen Firsten gut or
ganisierte, modern verwaltete Stauten, wie 2.B, Brandenburg,
Obersachsen, Bohmen, Schlesien, PreuBen. Das waren junse
Staatsgrindungen auf Kolonialboden, die die altmodisch eefiihr-
ten Kieinstaaten des Alreichs an Macht und Einflu® beld weit
uiberteafen, Das zeiate sich deutlich, als im Jahre 1346 der Luxem-
burger Karl TV. zum deutschen Konig gewahlt wurde. Von den
bohmischen Luxemburgern ging ein Jahrhundert spiter die Ké-
nigs- und Kaiserwirde auf die Osterreichischen Habsburger Uber
und verblieb bei dieser Dynastic, bis das Reich sich 1806 auilé-
ste
Seitetwa 1200 wurden auch mehe und mehr Stidte out altem und
kKolonislem deutschen Boden gegriindet. Damit kindigte sich al-
rahlich der Ubergang von der mittelalterlichen Agrarwirtschaft
zu stidtischen Wintschafistormen an, Um die Macht der Stidte
und ihren Reichtum zu ermessen, brauchs man nur an die groflen
Hansestidte 2u denken, wie Lubeck, Stralsund, Danzig und Riga
‘Aber auch Keln, StraSburg, Basel, Augsburg, Nirnberg und an-
Gere Sticte im Altcich gelangten 7u groBem influ.
‘Ohne Kenntnis dieser politschen Vorgiinge kann man den Ent-
‘viekdungsgeng der deutschen Sprache nicht verstehen, der nicht
ungestrt verlaufen ist, Was Karl der GroBe eingeeitet hatte,
Fihrte in der Blutezeit der mittelhockdeutschen Periode (um 1200)
Schon 2u einer nahezu cinheitlichen Schrifisprache, die aus den
Mundarten des Altreiches mit leichtem Ubergewicht des Aleman:
hen entstanden war
‘Aber diese Tradition war noch nicht genigend gefestit, und als
das Stauferreich unterging, zerfielen mit der poltischen Finheit
39
auch die Ansitze zu einer einheitlichen Hochsprache. verging die
BBlate der mittelhochdeutschen Sprache rasch. Oberall in den ge-
schriebenen Texten tauchten wieder die grobmundartlichen For-
men der cinzelnen Landschaften auf, So bedurfte es eines neuen
Anfangs, und nun verlagerte sich auch das Gewicht des sprachli-
chen Einflusses nach Osten. Die neue Binheitsbewegung nahm ih
ren Ausgang von der Reichskanzlei in Prag und wirkte in der Wie-
ner und in der obersfichsischen MeiBener Kanzlei weiter. Luther
bbrachte dann die Sehreibformen der MeiBener Kanzlei, nach de-
nen ersich richtete, in Fuhrung, So entstand allmiihlich eine neue,
‘inheitliche Schrifisprache. Unser Deutsch beruht deshalb nicht
aul den sprachlichen Traditionen des Altreichs, sondern auf dem
Schreibgebrauch des ostmitteldeutschen Koloniallandes,
‘Wir haben also die vier Perioden der deutschen Sprachzeschichte
za zu grolien Bpochen 2usammenzufassen:
IL. Altdeutsch, das den alt- und mittethochdeutschen Zeitraum
‘umfa6it und aus den hochdeutschen Mundarten des Altreichs
entwickelt wurde,
Ubersetzer als Mittler von Sprache und Literatur
August Wilhelm vor Schlegel
IL. Neudeutsch, seit etwa 1350 (Karl 1V.; Prager Kanzlci) auf ost-
‘mitteldeutschem Kolonialboden entstanden.
Dieses Neudeutsch allerdings beruht nicht unmitelbar auf den
{gesprochenen Mundarten, Es ist vielmehr aus den Kingst vorhan-
denen Schreibtraditionen der groRen Kanzielen entstanden, die
zwar landschaftlich gebunden sind, aber von Anfang an grob
‘mundartliche Formen 2u vermeiden suchen.
Kulearelle und sorlale Grundlagen. Niedergeschrieben wird, was
die Ze bewest und die kulturlion und geistigen Lntercesen
wechseln im Lauf der Zeiten. In unserer heutigen Sprache haben:
sie alle ine Spurenhineiaaen,
Trelitetidonottor Zt ets icing de Chto he
grote Aufgabe, und die sprachliche Leistung dieser Zeit besteht
Enin, die densche Sprache zum Avodvusk geste Inbal bee
40.
tet und ihr einen Platz im Kecise der christlich-abendlindischen
Kultursprachen errungen 2u haben.
‘Was einmal begonnen hat, wirkt weiter, und die religiose Ausein
andersetzung bereichert unsere Sprache bis heute. Aber in mittel-
hochdeutscher Zeit kommt Neves hinzu. Das Interesse am irdi-
sehen Weligeschehen erwacht, und eine Zcitlang steht die hofi-
sche Dichtung mit ihren Erzahlungen von Rittertat und -sitte und
mit ihren Minneliedern im Mitielpunkt der sprachlichen Weiter-
entwicklung.
Auf der Grenze zum Fridhneuhochdeutschen gewinnt dann cine
neue feligidse Bewegung auch sprachlich den Vorrang. In der
Scholastik wird die Theologie zur Wissenschaft ausgebaut. Scho:
lastische und dariber hinausstrebende mystische Schriften legen
den Grund zu einer deutschen Wissenschaltssprache. Zugleich
fentsteht eine volkstimliche, religidse Erbauungsliteratur, die bis
in die Reformationszeit weiterwirkt,
Ein Bild vom Sprachzustand des Fréhneuhochdeutschen gewin-
nen wir aus den Lehr-, Erbauungs- und Unterhaltungsschriften,
die diese sehreibsclige Zeit in Fille hervorbrachte. Vor allem aber
sind es bis zum Auftreten Luthers die vielen tausend Urkunden
der groBen Kanzleien, in denen die deutsche Sprache weiterent
swickelt wird, Mit der Erfindung der Buchéruckerkunst (um 1450)
kommt ein neues einigendes Element hinzu. Dena Kanzleien und
Christoph Martin Wieland
Hans Wollschlager
Carlo Schmid
er
Drueker haben das gemeinsame Interess, ihre Sprache so zu ge-
scalten, dab sie iberall verstanden wird, Das fuhrte zur Aufnahme
‘oglichst vieler Uherregionaler, nicht dialektacbundener Sprach-
So fand Luther in der Sprache der MeiBener Kanalei berets
Schreibformen vor, die weithin bekannt waren. Seine und seiner
Paniganger Schriften wurden dberall gelesen. Bald wurde das
Meibnische Deutsche im ganzen Sprachgehiet verstanden, aller
Sas nicht iberall angenommen. Im katholischen Siden wurde
‘em noch lange die »Reichssprache« der Wiener Kanzlei entze-
s-sacsetzt, und Kéln blicb bei scinem mittellrinkischen Scheifl-
Sialeke
Der Dreifigithrige Krieg (1618-1648) bedeutet auch kulturell ei-
fen tiefen Einschnitt. Danach lebt ~ im Zeitalter des Absolutis-
Ss ~ die Furstenherilichkeit noch einmal auf. Aber die Sprache
= Hole ise Franzosisch, Das Meifinische Deutsch wird vornehm-
S> von protestantischen Geistlichen, Geleheten und Dichiern ge-
Peat. Als dana die »Grundlegung ciner deutschen Sprachkunsts
Se: Leipziger Professors Gortsched auch in Osterreich als Lehr.
och der deutschen Sprache anerkannt wied, ist der Weg zu einer
Ssheilichen deutschen Schriftsprache geebnet, Zu ihrer vollen
Assbildung tragen dann die Dichter und Denker von Lessing bis
Scethe das meisie bei. Sie und ihre Zeitgenossen legen den
‘Geand zu dcrallgemcinen Schriftsprache des 19, Jabrhunderts.
Aber ds ist nicht das Ende der Entwicklung. Das wechselvolle
S2>en in der Grodstadt, die Ubermacht der Techaik, das Eingre.
‘Se der Wissenschatt in alle Lehenshereiche, das Gewicht der Ver
Sstiong und die internationalen Verflechtungen haben auch
Seeschlich 2u neuen Wegen gefuhit, die uns von der Schriftspra
“der Klassiker schon wieder weit entfernt haben
De8 der Zcitgeist sich in der schriflichen Hinterlassenschatt der
‘Seeshunderte kundtu, ist sicher. Aber man hat auch den soziolo-
‘eechen Aspekt zu bedenken, Welchen Standes sind die Schrei-
Sesden, und fiir welchen Leserkreis scheeiben sie? Schon das
‘Seerciben selbst ist eine Kullurerrungenschaft, und bis in unsere
‘Fes hinein blieb es ein Vorrecht privilegierter Stande. Die Schu-
‘= waren in der alideutschen Epoche ganz in geislicher Hand
S dicnten der Ausbildung der Geistichkeit. Erst in frihneu-
Secedeutscher Zeit gesellien sich in stindig wachsender Zahl die
“Sesserlichen Schulen der Stidtehinzu. Aber auch sie waren Stan-
Seschulen, die niche jedermann offenstanden. Die allgemeine
‘Scsuipilicht wuede etst nach 1870 bis in den leteten Winkel durch-
‘Set und erst seit wenigen Jahrzehnten stehen jedem Begabten
© ssabhiingig von finanziellen Mitteln und sozialem Status ~ die
| Sze sur hokheren Schulbildvng und ze den Hochschulen offen.
See Bildungsméglichkeiten entsprechend, haben die sozialen
SSopen an der Herausbildung unserer Sehrftsprache unter
‘SSedlichen Ante gchabt. In althochdeutscher Zeit schrieben
‘= Geisiliche flr Geistliche, Aber die Geistlichkeit stammte da-
‘Sets avsschlieBlich aus den Adelsgeschlechtern,und auch die ho-
“seen Dichter und die Mystiker der mittelhochdeutschen Pe
"Sete achorten dem Adelsstande an und schricben fir adelige
‘Tee und Zuhorer. So hatie in der alideutschen Epoche die
"-Ssssgesellschaft wie in allen andecea Bereichen auch im devt-
Schriftum die FUbrung
‘Des wird anders in der feihneuhochdeutschen Zeit, Die Stidte
"geeenen an Gewicht, und die Stadthirger gelangen zu Selbstbe-
Seescin. Von da an kommen dic meisten Schreibenden, 2.8.
55 Lather mit seinen Parteigingern und Gegnern, aus stadtbtr-
‘schon Kreisen. Birgerlicher Bildung dienen auch die Univer
Seen, deren alteste, die deutsche Universit in Prag, 1348 ge-
S21 wurde, Die’ meisten Autoren, die seitdem durch ibre
SeSofien an der Gestaltung unserer Sprache mitwirkten, hasten
“ser: und Gbten birgerliche Berufe aus. Gewif verstummie der
Se nicht; aber er pate sich der seven, breiteren Bildungs-
“hi an. In der neudeutsehen Epoche herrscht die Sprache des
Bicgess.
‘Sprache der Gegenwart. Um die Mitte des 19, Jabthunderts be-
‘Sein Deutschland die Industrialisierung. Mit den Arbeitermas-
© dic dic Industrie aus den damals ibervalkerten Landgebieten
‘Se entstanden mit unvorstellbarer Geschwindigkeit die neuen
Grolistadte. Im Jabre 1870 gab es im Reichsgebiet nur ache Stidte
‘mit mehr als 100000 Einwohnern, bis 1910 war ihre Zahl aur 48
angewachscn. Die Neubdrger, mittellos zugewandert, hatten in
bitterer Not um ihren Lebensunterhalt zu ringen. Die sozialen
Spannungen, die sich daraus ergaben, brauchen hier nur angedeu-
tet zu werden. Schrtt fiir Schritt erkdmpften sie sich ihre Rechte
in der Industriegesellschaft, erstritten sich ihren Anteil am 6ffent.
lichen Leben und an den’ allgemeinen Bildungsmdglichkeiten,
Auch die rasch wachsende Teilnahme der Frauen am Berufsleben,
und ihr Einbruch in die »Arbeitswelt der Manner ist eine spate
Folge der sozialen Umwalzungen
Bis zum Ende des Kaiserreichs im Jahr 1918 herrsehten im politi-
schen und kulturellen Leben und auch im Gebranch der Schrift-
sprache die burgerlichen Traditionen vor. Seitdem ist nach dem
Zusammenbruch der Monarchie und der Revolution von 1918
ine neu strukturierte Gesellschaft erstanden, in der die alten
Standesunterschiede keine Rolle mehr spielen. Nach cinigen
Jahrzehnten des Uberganges leben wir seit dem Neubeginn im
Jahre 1945 in ciner Gesamtgeselischaft, die man nicht mehr im
traditionellen Sinne »birgerlich« nennen kann, Noch hat diese
neue Gesellschaft ihre cigene, endgiltige Form nicht gefunden,
Die Suche danach zeigt sich jedoch in der oft krassen Abkehr der
Jugend vom Hlergebsachten, an dessen Stelle sic cinstweilen das
Experiment mit neuen MAglichkeiten setzt
Auf diese Enewicklung antwortel, wie zu jeder anderen Zeit, auch
unsere Sprache. Schiller und Goethe, Sprachmuster fiir die Schul-
crzichung der burgerlichen Zeit, sind {Ur unsere heutige Sprachge-
staltung keine Vorbilder mehr. Die Sprache unserer Gegenwart ist
direkter und derber geworden. Die Schrifisteller »nennen die
Dinge beim Namen, sie verhillen nichts, und die Schriftsprache
Yon heute nihert sich der Sprache des Alltags, von der sie im bir-
gerlichen 19. Jahrhundert weit entfernt war.
Den Fachmann erinnert das Sprachgeschehen unserer Tage an
die Anfange der frihneuhochdeutschen Zeit. Damals forderte im
soziaien Umbruch die junge Gesellschaftsschicht der Stadtbiirger
ihr Recht. Auch sie fand nicht sogleich die ihr angemessenen Le-
bensformen, und in ihrer einfachen, anfangs oft groben und unl
tigen Sprache meine man den Protest gegen das tiberfeinerte
Deutsch der Adelsgesellschaft zu sptiren, Derher Spott und bis-
sige Satire, mit denen die hergebrachten Lebensformen gegeiBelt
‘werden, lassen erkennen, dali auch damals an der nheilen Welt
der alten Gesellschait heftig Kritik gedbe wurde.
Genauso istinfolge der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklun-
gen des 20. Juhthunderts auch unsere heutige Sprache im Um-
‘bruch, und durch die Spaltung Deutschlands wird die Lage noch
vverschlirft. Quer durch Europas Mitte geht der Rif zwischen zwei
schacf unterschiedenen politischen, okonomischen und sozialen
Systemen. Davon kann auch die Sprache nicht unberthrt bleiben,
Die Amerikanismen im Deutsch der Bundesrepublik sind zahl-
reich, Ausdriicke wie »blue jeans, beat, talk show, city, manage-
‘ment, mulGinational« stammen aus dem amerikanischen Englisch,
und in der DDR beweisen Worter wie »Planerfllung, Selbsiver
pilichtung, Kombinat, Kader, Brigade, volkseigen« den ideologi-
schen EinfluB der Sowjetunion. Der dstlichen Ideologie entspre-
chend bezeichnen Wérer wie »Freiheit, Demokratie, soziali-
stisch«, jedenfalls im Sprachgebrauch der Einheitspartei und ih
rer Presse, neue einseitige Inhalte, und Worter wie »Aggressor,
revanchistisch, imperialistisch« (immer aur auf Staaten der west
lichen Welt angewandt), erinnern peinlich an die Propagunda-
sprache der Hitlerzeit,
Doch viele der sprachlichen Neuerungen machen an der inner-
deutschen Grenze nicht halt, Worter wie »Kollektiv« oder »Expa
nate werden auch in der Bundesrepublik gebraucht, und umge-
Kehrt spricht man in der DDR von »Computern« und »Contai-
ern, von »Rock« und »Dixiclanda. Birger der DDR und der
Bundesrepublik verstehen sich immer noch ohne Schwierigkeiten,
und sie werden sich auch weiterhin verstehen, Was haben und
riiben voneinander abweicht, sind geringfgige Unterschiede,
wie sie auch gegendber der deutschen Sprache in Osterreich, in
der Schweiz und in Luxemburg und sogar zwischen Nord- und
Siiddeutschland bestehen. Das tut der Ubernationalen Finheit der
deutschen Sprache keinen Abbruch,
41
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Grundwissen Und Aufgaben Mathematik Klasse 7Dokument6 SeitenGrundwissen Und Aufgaben Mathematik Klasse 7johnnyNoch keine Bewertungen
- Monsanto Produkte - 2016Dokument1 SeiteMonsanto Produkte - 2016johnnyNoch keine Bewertungen
- Chamland Aktuell 2020, Feb - 4 AgropholtaikDokument1 SeiteChamland Aktuell 2020, Feb - 4 AgropholtaikjohnnyNoch keine Bewertungen
- Der KreuzstoanerDokument1 SeiteDer KreuzstoanerjohnnyNoch keine Bewertungen
- Urgermanisch, Vorgeschichte Der Altgermanischen Dialekte - Friedrich Kluge, 1913Dokument310 SeitenUrgermanisch, Vorgeschichte Der Altgermanischen Dialekte - Friedrich Kluge, 1913johnnyNoch keine Bewertungen
- Altperlacher Brunnen-InschriftenDokument3 SeitenAltperlacher Brunnen-InschriftenjohnnyNoch keine Bewertungen
- Sektoren - Und Brancheneinteilung Kritischer InfrastrukturenDokument1 SeiteSektoren - Und Brancheneinteilung Kritischer InfrastrukturenjohnnyNoch keine Bewertungen
- Heinrich Scherrer - Lauten Und Gitarrenschule 1911Dokument72 SeitenHeinrich Scherrer - Lauten Und Gitarrenschule 1911johnnyNoch keine Bewertungen
- Karl Von Amira - Grundriss Des Germanischen Rechts - 1913Dokument322 SeitenKarl Von Amira - Grundriss Des Germanischen Rechts - 1913johnnyNoch keine Bewertungen
- A G'mueatlicherDokument1 SeiteA G'mueatlicherjohnnyNoch keine Bewertungen
- Theory 9.3Dokument5 SeitenTheory 9.3johnnyNoch keine Bewertungen
- Der AlteDokument1 SeiteDer AltejohnnyNoch keine Bewertungen
- HauswalzerDokument1 SeiteHauswalzerjohnnyNoch keine Bewertungen
- HirtenweiseDokument1 SeiteHirtenweisejohnnyNoch keine Bewertungen
- Epipremnum Aureum - EfeututeDokument7 SeitenEpipremnum Aureum - EfeututejohnnyNoch keine Bewertungen
- Fittonia AlbivenisDokument5 SeitenFittonia AlbivenisjohnnyNoch keine Bewertungen
- CrassulaDokument5 SeitenCrassulajohnnyNoch keine Bewertungen
- Theory 5.12Dokument3 SeitenTheory 5.12johnnyNoch keine Bewertungen
- EpiphyllumDokument3 SeitenEpiphyllumjohnnyNoch keine Bewertungen
- Peperomia CaperataDokument9 SeitenPeperomia CaperatajohnnyNoch keine Bewertungen
- Von Edlen RebenDokument2 SeitenVon Edlen RebenjohnnyNoch keine Bewertungen
- Zwei Jahrhunderte Zither in München (Auszug)Dokument65 SeitenZwei Jahrhunderte Zither in München (Auszug)johnnyNoch keine Bewertungen
- Tonart ZirkelDokument1 SeiteTonart ZirkeljohnnyNoch keine Bewertungen
- Die Deutschen StämmeDokument4 SeitenDie Deutschen StämmejohnnyNoch keine Bewertungen
- Die Entwicklung Der Deutschen WirtschaftDokument5 SeitenDie Entwicklung Der Deutschen WirtschaftjohnnyNoch keine Bewertungen
- Klavier SchuleDokument67 SeitenKlavier SchulejohnnyNoch keine Bewertungen
- Chlorophytum ComosumDokument3 SeitenChlorophytum ComosumjohnnyNoch keine Bewertungen
- Das Einmaleins Und Seine ZahlenphänomeneDokument1 SeiteDas Einmaleins Und Seine ZahlenphänomenejohnnyNoch keine Bewertungen
- Volk Der Dichter Und Denker ?Dokument7 SeitenVolk Der Dichter Und Denker ?johnnyNoch keine Bewertungen
- Die Zither (Ungarisch)Dokument3 SeitenDie Zither (Ungarisch)johnnyNoch keine Bewertungen