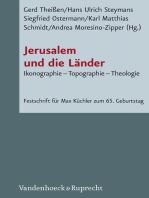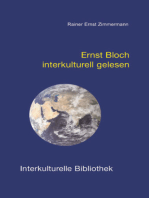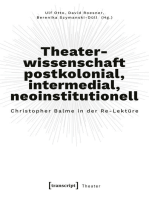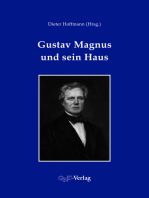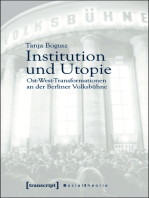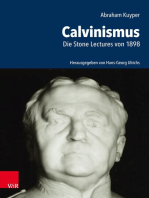Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
(Phänomenologisch-Psychologische Forschungen 16) Aron Gurwitsch, Alexandre Métraux - Die Mitmenschlichen Begegnungen in Der Milieuwelt-De Gruyter (1976,2012)
Hochgeladen von
marangoniphsCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
(Phänomenologisch-Psychologische Forschungen 16) Aron Gurwitsch, Alexandre Métraux - Die Mitmenschlichen Begegnungen in Der Milieuwelt-De Gruyter (1976,2012)
Hochgeladen von
marangoniphsCopyright:
Verfügbare Formate
ARON GURWITSCH
DIE MITMENSCHLICHEN BEGEGNUNGEN
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:06
PHÄNOMENOLOGISCH-PSYCHOLOGISCHE
F O R S C H U N G E N
Herausgegeben von
C. F. G R A U M A N N und A . MÉTRAUX
Band 16
W
DE
_G
1977
WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:06
A R O N GURWITSCH
DIE MITMENSCHLICHEN
BEGEGNUNGEN IN DER MILIEUWELT
Herausgegeben und eingeleitet von A. Métraux
W
DE
G_
1977
WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:06
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Gurwitsch, Aron
Die mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt / hrsg. u. eingeh von
A. Métraux. - Berlin, New York: de Gruyter, 1976.
(Phänomenologisch-psychologische Forschungen; Bd. 16)
ISBN 3-11-004939-2
Copyright 1976 by Walter de Gruyter & Co, Berlin, vormals G. J. Göschen'sche
Verlagshandlung · J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung · Georg Reimer · Karl J. Trübner ·
Veit & Comp., 1000 Berlin 30
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch
nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photo-
kopie, Mikrokopie, Xerokopie) zu vervielfältigen.
Satz und Druck: Hofmann-Druck KG, Augsburg
Bindearbeiten: Lüderitz & Bauer, Berlin
Printed in Germany
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:06
VORWORT
Kurz nach seiner Promotion am 1. August 1928 in Göttingen faßte Aron
Gurwitsch den Entschluß, das in seiner Dissertation Phänomenologie der
Thematik und des reinen Ich in Kapitel IV gestreifte Problem der Person
1
und der Intersubjektivität gesondert anzugehen und im Hinblick auf eine
Habilitation zu bearbeiten2. Er bewarb sich, damals noch Privatassistent
von Moritz Geiger, mit dessen sowie mit Husserls und Nicolai
Hartmanns Unterstützung um ein Forschungsstipendium beim dafür
zuständigen Preußischen Unterrichtsministerium. Wann genau das Sti-
pendium bewilligt wurde, hat sich nicht feststellen lassen, doch deutet
alles darauf hin, daß dies nicht später als im Frühjahr 1929 geschah.
Gurwitsch muß die Arbeit am Manuskript seiner Habilitationsschrift
im letzten Quartal 1931 abgeschlossen haben, wie aus einem am 14.
Dezember jenes Jahres an Max Dessoir gerichteten Brief folgenden
Inhalts hervorgeht :
Sehr verehrter Herr Professor!
Gemäß unserer Verabredung überreiche ich Ihnen anbei ein Exem-
plar meiner Arbeit „Die mitmenschlichen Begegnungen in der
Milieuwelt". An zwei Stellen fehlen aus technischen Gründen bei
Zitaten die Seitenangaben, da die betr. Werke in den Berliner Biblio-
theken nur nach sehr langem Warten zu erhalten sind. Ich hoffe, in
dem offiziellen Exemplar diese Eintragungen nachholen zu können.
Mit ergebener Hochachtung
Ihr A. Gurwitsch
Gurwitsch dürfte also etwas weniger als drei Jahre am Text seiner
Habilitationsschrift gearbeitet haben. Vorstudien hierzu lieferte ihm die
Dissertation, in der er sich gleichzeitig mit der Phänomenologie Husserls
1Die Dissertation erschien in der Zeitschrift Psychologische Forschung 1929, 12,
S. 279-381.
2 Wie unbefriedigend der Schluß der Dissertation Gurwitsch erschien, erhellt aus der
Tatsache, daß er die „Anmerkung" und „Schlußbemerkung" (a. a. O., S. 379-380 bzw.
380-381) für eine englischsprachige Ausgabe von Aufsätzen (Studies in Phenomenology
and Psychology, Evanston 1966) gar nicht übersetzen ließ; vgl. dazu auch GuRwrrscHs
Bemerkung in seiner „Introduction", a. a. O., S. XV.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vili Vorwort
und der Gestalttheorie auseinandergesetzt hatte. Doch weitete er den
Horizont seiner Analysen nach 1928 ganz entschieden aus. So betrieb er
Studien zum Erkenntnisproblem im Anschluß an Cassirer, ergänzte die
phänomenologische Betrachtungsweise durch eine kritische Einarbeitung
soziologischer Ideen, verglich die Bewußtseinskonzeption Husserls mit
derjenigen des klassischen Rationalismus - vor allem Descartes' und
Malebranches3 - , griff Gedanken von Scheler und Heidegger auf, befaßte
sich ferner mit religionsphilosophischen und -soziologischen Fragen 4 , mit
Problemen der Geometrie 5 usw. All dies schlug sich in der Habilitations-
schrift selbst nieder, in den frühen Veröffentlichungen oder in Arbeitsma-
nuskripten aus jener Zeit, die inzwischen im Nachlaß gefunden wurden 6 .
Und einzelne Themen, an denen er damals arbeitete oder zu arbeiten
begann, wurden teilweise erst viel später in Publikationen zur Darstellung
gebracht.
Die Habilitierung selbst wurde nicht durchgeführt. Bereits 1932
beschäftigte sich Gurwitsch mit dem Gedanken, angesichts der politi-
schen Zustände und der damit verbundenen Ungewißheit, die seine
zukünftige Laufbahn überschatten sollte, Deutschland zu verlassen. Nach
der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten beantragte er ein
französisches Visum und traf Anfang April 1933 nach einer umständli-
chen Reise, die eher einer Flucht glich, mit seiner Frau in Paris ein. Dort
erwirkten Alexandre Koyré (den Gurwitsch durch Husserl kennengelernt
hatte), Léon Brunschvicg und Lucien Lévy-Bruhl für den jungen
Forscher eine Berufung zum Dozenten am Institut d'Histoire des
Sciences et des Techniques, einer der Sorbonne angegliederten Abteilung
für Wissenschaftsgeschichte. Die an diesem Institut gehaltenen Vorlesun-
gen, die bei Kriegsausbruch 1939 eingestellt werden mußten, galten vorab
3 Vgl. dazu Phenomenology and the Theory of Science, hg. von L. EMBREE, Evanston 1974,
S. 154-158 und S. 211-220.
4 Vgl. dazu die beiden Texte GURWITSCHS „Zur Bedeutung der Prädestinationslehre für die
Ausbildung des .Kapitalistischen Geistes', Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpo-
litik 1933, 68, S. 616-622, sowie die Besprechung von LEO STRAUSS, Die Religionskritik
Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft, erschienen in Göttingsche gelehrte
Anzeigen 1933, S. 124-149.
5 Vgl. die Abhandlung „Ontologische Bemerkungen zur Axiomatik der Euklidischen
Geometrie", Philosophischer Anzeiger 1929/1930, 4, S. 78-100.
' Zum Problem des „Bewußtseinsseelenbegriffes" (vgl. in diesem Band S. 68, Zusatz) gibt
es ein handgeschriebenes, historischen Interpretationen gewidmetes Manuskript ; ferner
ist das Manuskript des Vortrages, der S. 116 erwähnt wird, erhalten geblieben; der
Vortrag beschäftigte sich mit dem Problem der Existenz.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort IX
Fragen der Gestalttheorie 7 , der phänomenologischen Konstitutionsana-
lyse 8 , der Biologie Kurt Goldsteins 9 , der Psychologie- und Philosophie-
geschichte. Das im Mittelpunkt der Habilitationsschrift stehende sozial-
theoretische Thema wurde jedoch aufgegeben, und selbst in späteren
Schriften finden sich nur spärlich, zudem ohne Verweis auf die frühere
Arbeit, Anklänge an einzelne im Text von 1931 entwickelte Gedanken 10 .
Im Spätsommer 1971 lenkte ich Gurwitsch in einem unserer Gespräche
auf die Habilitationsschrift. Einen Hinweis auf deren Existenz hatte ich
kurz zuvor von Lester Embree erhalten, der für eine von ihm besorgte
Edition ausgewählter Aufsätze Gurwitschs 11 die in die USA mitgenom-
menen Manuskripte gesichtet hatte. Ich bat damals um eine Kopie des
Manuskripts, die der Autor einige Zeit später bereitwillig zur Verfügung
stellte. Von der Kopie her zu schließen schien indes der Text des
Originalmanuskripts völlig unvermittelt in einem Satz abzubrechen.
Dennoch äußerte ich nach der Lektüre dieses „Fragments" Gurwitsch
gegenüber die Bitte, eine Edition seines Textes vorbereiten zu dürfen. Ich
ging damals - und gehe heute noch - von der Annahme aus, daß Die
mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt einen wertvollen Beitrag
zur Sozialphänomenologie, und damit auch zur sozialwissenschaftlichen
Grundlagendiskussion, darstellen. Dieser Beitrag hat zudem den Vorteil,
sich in das von der Konzeption der Organisation der Erfahrung bzw. des
Bewußtseinsfeldes beherrschte Werk Gurwitschs einzufügen. In diesem
Sinne sind Die mitmenschlichen Begegnungen in der Milieuwelt auch als
7 Die erste Pariser Vorlesung verarbeitete Gurwitsch zum Aufsatz „Quelques aspects et
quelques développements de la psychologie de la Forme", journal de Psychologie
normale et pathologique 1936,33, S. 413-470 ; englische Ubersetzung in Studies, S. 3-55.
Vgl. dazu auch „Développement historique de la Gestalt-psychologie", Thaies 1936, 2,
S. 167-176.
8 Auch die Vorlesung zur phänomenologischen Konstitutionsanalyse wollte Gurwitsch
zu einem Buch verarbeiten. Ein Fragment des in französischer Sprache geschriebenen
Manuskripts erschien in englischer Ubersetzung in Phenomenology and the Theory of
Science, S. 153-189.
9 Vgl. „Le fonctionnement de l'organisme d'après K. Goldstein", Journal de Psychologie
normale et pathologique 1939, 36, S. 107-138. Ferner auch „La science biologique
d'après K. Goldstein", Revue philosophique de la France et de l'étranger 1940, 129,
S. 126-151.
10 Ein Abschnitt in Phenomenology and the Theory of Science (S. 170-174) gleicht auf
weiten Strecken den Ausführungen des Textes von 1931; ebenso eine Passage im
Bewußtseinsfeld (in dieser Reihe Bd. 1, Berlin 1975), S. 260. In keinem der beiden Fälle
wird auch nur im geringsten auf den Text von 1931 verwiesen.
11 In Anm. 3, S. VIII erwähnt.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
χ Vorwort
Ergänzung zu dem beinahe ausschließlich an Wahrnehmungs- und
Denkphänomen ausgerichteten The Field, of Consciousness zu betrachten.
Hier wie dort vertritt Gurwitsch ein und dieselbe, von der Phänomenolo-
gie nicht weniger als von der Gestalttheorie entstammende Denkweise.
Nach einiger Bedenkzeit willigte der Autor schließlich, obgleich
angesichts des Entstehungsdatums seiner Arbeit nicht ganz ohne Zögern,
ein. Wenige Tage vor seinem Tode am 25. Juni 1973 wurden die
Modalitäten der Edition besprochen. Kürzungen erschienen ratsam,
Querbezüge zu ähnlichen oder verwandten Gedankengängen in anderen
Schriften sollten im Vorwort des Herausgebers angegeben, der Text selbst
in seinem geschichtlichen Kontext lokalisiert werden. Die Entscheidung
über Ausmaß der Kürzungen und Straffungen wie auch über die formale
Textgestaltung wollte der Autor dem Herausgeber überlassen, der im
Sinne dieser Vereinbarungen die Edition durchgeführt hat.
Eine erste editionstechnische Schwierigkeit bereitete der Aufbau des
Textes. Das im New Yorker Nachlaß befindliche Originalmanuskript
(wie übrigens auch dessen Durchschlag) bricht in der Tat inmitten eines
Satzes in Abschnitt IV ab. Der handgeschriebene, schwer lesbare Entwurf
weist eindeutig darauf hin, daß Gurwitsch ursprünglich eine vierteilige
Arbeit geplant und, zumal in einer ausgearbeiteten Erstfassung, auch
redigiert hat. Es stellte sich also die Frage, ob der Rest des vierten
Abschnittes verloren war (und, wenn ja, wie dieser Rest aufgetrieben
werden könnte), oder ob Gurwitsch die letzte Fassung dieses Abschnittes
gar nicht zu Ende geführt hat. Erst im Juni 1975 wurde die schon
bestehende Vermutung, daß lediglich drei, und nicht - wie vom Autor
zuerst beabsichtigt - vier Abschnitte eingereicht wurden, durch eine von
Claude Evans in der Bibliothek des Philosophischen Instituts der
Universität Bochum gefundene Manuskriptkopie endgültig bestätigt.
(Gurwitsch hatte diese Kopie zusammen mit dem eingangs zitierten Brief
an Dessoir gesandt 12 .) Anders gesagt: der Autor entschloß sich, noch
während er die Reinschrift des vierten Abschnittes besorgte, die bereits
fertigen Abschnitte I bis III einzureichen. Deshalb habe ich auch darauf
verzichtet, den unvollständig gebliebenen bzw. fragmentarisch überlie-
12 Wie die an Dessoir gesandte Kopie ins Bochumer Institut für Philosophie gelangte, läßt
sich nicht mit Exaktheit rekonstruieren. Fest steht, daß sie während einer Auktion in
Leipzig nach 1945 gekauft wurde. Die Kopie trägt den Stempel der Universitätsbiblio-
thek von Leipzig.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XI
ferten Abschnitt IV anhand des nicht immer eindeutigen Entwurfs und
der zusätzlich im Nachlaß gefundenen Arbeitsnotizen zu ergänzen oder
zu rekonstruieren.
Worauf bezieht sich nun aber der Brief an Dessoir, in dem von einem
„offiziellen Exemplar" die Rede ist? Ein Vergleich zwischen den
Textquellen (New Yorker Originalmanuskript, Bochumer Manuskript-
kopie und Durchschlag) zeigt, daß das New Yorker Manuskript keine
Lücken in den Seitenangaben der Anmerkungen aufweist (es sei denn an
solchen Stellen, an denen Gurwitsch mit Absicht auf einen ganzen
Abschnitt oder auf einen Artikel aus der Sekundärliteratur ohne genaue
Seitenangaben verweist, was bei ihm recht häufig geschieht 13 ). Dies legt
den Schluß nahe, daß das New Yorker Manuskript (dessen Umschlag mit
„Fremdseelisches I, II, I I I " betitelt ist) mit größter Wahrscheinlichkeit als
das „offizielle Exemplar" anzusehen ist. Dieses Manuskript wurde denn
auch der hier veröffentlichten Ausgabe zugrunde gelegt.
Eine zweite editionstechnische Schwierigkeit, für deren Lösung der
Herausgeber dieses Bandes allein die Verantwortung trägt, stellte sich
angesichts des Textumfanges und der für den jungen Gurwitsch bezeich-
nenden stilistischen Besonderheiten. Das New Yorker Manuskript
umfaßt, ohne den fragmentarischen Abschnitt IV, 304 Seiten (21 X 33
cm). Davon entfallen sieben Seiten auf die „Einleitung", die in diese
Edition nicht aufgenommen wurde, weil sie einerseits nicht wesentlich
zum Verständnis des Textes beiträgt, andererseits auf Gurwitschs Wunsch
durch das historisch-systematische Vorwort des Herausgebers dieses
Bandes ersetzt werden sollte.
Was nun die stilistischen Besonderheiten betrifft, so sind die teils etwas
langen, teils umständlich gebauten Sätze in kleinere Einheiten aufgeteilt
worden, um so dem Leser möglichst entgegenzukommen. Kürzungen
wurden nur dort vorgenommen, wo das Originalmanuskript Wiederho-
lungen enthält. Die Terminologie wurde geringfügig geändert und hier
und da dem heutigen Sprachgebrauch etwas angepaßt; gegenüber dem
Originalmanuskript sind die Paragraphen durchgehend numeriert; das-
selbe gilt hinsichtlich der Fußnoten; die Zusätze (S. 38-40, 68-72,
104-109, 114-116), die im Original von 1931 jeweils als „Anmerkung"
bezeichnet sind, wurden - da es sich nicht um untergeordnete Textpartien
handelt - als konstitutive Bestandteile des Textes aufgefaßt und in
demselben Schriftgrad gesetzt wie dieser. Die Ergänzungen des Heraus-
13 Vgl. ζ. B. Anm. 122 auf S. 95 oder Anm. 18 auf S. 149.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XII Vorwort
gebers in den Fußnoten stehen in eckigen Klammern [ ] ; diese Ergän-
zungen beziehen sich auf die heute verfügbaren Neuauflagen der wich-
tigsten, von Gurwitsch zitierten Quellen der Sekundärliteratur.
Es geht im folgenden darum, den Text von 1931 in seinem geschichtlichen
Zusammenhang zu betrachten und seine Relevanz für heutige Fra-
gestellungen aufzuzeigen. Letzteres soll jedoch nur an wenigen aus-
gewählten Beispielen erfolgen.
Die Motive, die für die Wahl des Intersubjektivitäts- und Interaktions-
themas entscheidend waren, sind Gurwitsch zufolge :
1. Die Hilflosigkeit der Analogieschlußtheorie bei der Lösung des
Intersubjektivitätsproblems. Diese Theorie, die vor allem im ausgehenden
19. Jahrhundert breit diskutiert wurde, hat - obschon unter veränderten
erkenntnistheoretischen Ausgangsbedingungen - noch in diesem Jahr-
hundert einige namhafte Vertreter gefunden.
2. Die Möglichkeit, die Konzeption der Thematik, wie sie in der
Dissertation von 1928 umrissen wird, zu verallgemeinern, d. h. nicht nur
auf den Bezug des Subjekts zur wahrgenommenen Ding- oder Körper-
welt, sondern auch - und darüber hinaus - auf den Bezug des Subjekts zu
anderen Subjekten anzuwenden. Dies würde dann bedeuten, daß der
Begriff des Themas und die begriffliche Unterscheidung zwischen Thema
und thematischem Feld als struktureller Aspekte des Bewußtseinsfeldes
für alle Erfahrungsbereiche Geltung haben könnten.
3. Der Versuch, die Typen der Herrschaft (zumindest der traditionalen
und der charismatischen) nicht mehr - wie bei Max Weber - im Sinne von
Idealtypen 14 , sondern als Handlungsdimensionen zu interpretieren, die
phänomenologisch erfaßbar sind und so die letzten handlungsanalyti-
schen Einheiten darstellen.
4. Der Gedanke, den Rahmen des traditionellen Erkenntnisproblems
zu sprengen, um so einen unverstellten Zugang zu der in gewissem Sinne
noch vorprädikativen, vortheoretischen Lebenswelt (Husserl) - Gur-
witsch verwendet hierfür mit Vorliebe den Schelerschen Terminus
„Milieuwelt" - zu gewinnen.
Neben diesen auf die Sache zielenden Motive spielten natürlich auch
biographische Faktoren eine gewisse Rolle, doch soll hier darauf nicht
speziell eingegangen werden.
14 Vgl. M. WEBER, Wirtschaft und, Gesellschaft, Tübingen 51972, S. 124.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XIII
Die genannten Motive sind in der Arbeit von 1931 alle mehr oder
weniger zum Tragen gekommen. Die Verallgemeinerung des Themabe-
griffes schafft die Kontinuität von der Dissertation zu den späteren
Schriften (vor allem zu The Field of Consciousness15), während die
anderen Motive eine kritische Einstellung zum traditionellen philosophi-
schen und sozialwissenschaftlichen Denken sichtbar machen, dessen
Voraussetzungen am Beispiel der Intersubjektivität und der Interaktion
nach und nach aufgedeckt werden.
An zwei in der Zeit zwischen 1928 und 1931 erschienenen Werken läßt
sich veranschaulichen, was für Gurwitsch - wie er einmal sagte - zum
„Stein des Anstoßes" wurde, nämlich einerseits an Rudolf Carnaps
Abhandlung Scheinprobleme in der Philosophie von 1928 16 , und anderer-
seits an Husserls 1931 in Paris veröffentlichten, damals nur in der
französischen Ubersetzung von Lévinas und Pfeifer erhältlichen Carte-
sianischen Meditationen17. Im Text von 1931 nimmt Gurwitsch im
Zusammenhang der Analogieschlußtheorie und ihrer Widerlegung an
zwei Stellen auf Carnap bezug (S. 9 und 43). Husserls Schrift wird
dagegen nicht erwähnt. Jedoch geht aus persönlichen Mitteilungen
hervor, daß Gurwitsch besonders der V. Cartesianischen Meditation
(wegen der dort entwickelten Theorie der „analogischen Apperzep-
tion" 18 ) ablehnend gegenüberstand, und daß er damals die Absicht hatte,
Husserls Buch zu besprechen.
Obwohl beide Autoren von extrem gegensätzlichen Positionen ausge-
hen - Carnap vom frühen Logischen Positivismus des Wiener Kreises,
Husserl vom transzendentalen Idealismus - gelangen sie, was das Wissen
vom anderen Ich betrifft, Gurwitsch zufolge wenn nicht zu identischen,
so doch zu sehr ähnlichen Erkenntnissen. Diese lassen sich dahin
zusammenfassen, daß das Verstehen und Erkennen des Anderen auf
einem Analogieschluß beruht. Dies bedeutet zugleich, daß die auf die
Ding- oder Körperwelt gerichtete Erfahrung in bezug auf die Fremder-
kenntnis als die fundierende bestimmt wird.
15 The Field of Consciousness, auf Englisch verfaßt, erschien zuerst in der französischen
Ubersetzung von Michel Butor 1957 in Paris, danach in der Originalfassung 1964 in
Pittsburgh, Pa. Deutsche Ubersetzung von W. D. Fröhlich, erwähnt in Anm. 10, S. IX.
" R . C A R N A P , Scheinprobleme in der Philosophie, [Neuausgabe hg. von G . P A T Z I G ] ,
Frankfurt a. M. 1966.
17 E. H U S S E R L , Cartesianische Meditationen, hg. von S. STRASSER, Den Haag 1950 [ =
Husserliana, Bd. 1],
18 Vgl. H U S S E R L , a.a.O., S. 138.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XIV Vorwort
Husserl setzt das ego als eine „Originalsphäre"19voraus, aus der „alles,
was für mich ist, seinen Seinssinn" schöpft, und versucht dann anhand der
„analogischen Apperzeption", d. h. über die Wahrnehmung ähnlicher
Tatbestände am eigenen wie am fremden Leib und in Analogie zu den
psychischen Ereignissen im Ich, das zu konstituieren, was im Anderen
vorgeht. Carnap dagegen führt die ,,Erkenntnis des Fremdpsychischen in
jedem einzelnen Falle auf die Erkenntnis von Physischem<<2° zurück, weil
das „Fremdpsychische . . . nur als (erkenntnistheoretischer) Nebenteil von
Physischem<<21 auftreten könne. Dies führt bei Carnap zu einer Stufenfol-
ge von „Primaritäten" 22 , die vom Eigenpsychischen über das Physische
zum Fremdpsychischen und schließlich zum Geistigen überleitet23. Doch
muß in jedem Falle der Zugang zum Anderen sekundär erst hergestellt
oder konstruiert werden. Dort muß von der Innerlichkeit des ego zu
derjenigen des alter ego über die Vermittlung der Körperwahrnehmung
eine Brücke geschlagen, hier auf der Basis des wahrgenommenen eigenen
und fremden Körpers ein analogischer Bezug zwischen den sozusagen
hinter oder im eigenen und fremden Körper sich zutragenden Ereignisse
hergestellt werden. Und Carnaps Formulierungen machen genügend
deutlich, daß das zu erkennende oder zu verstehende Fremdpsychische als
„entbehrlicher" 24 Nebenteil zu den Gegebenheiten der sinnlich erfahrba-
ren Dingwelt bzw. zu der in der Innerlichkeit des Subjekts wurzelnden
Selbstgewißheit summativ hinzutritt. Es ist ein leeres X, welches erst im
Lichte der bereits erworbenen Kenntnisse vom unmittelbar Gegebenen
nachträglich erschlossen, ermittelt, induktiv anhand von somatischen und
sonstigen Anzeichen festgestellt werden muß. Es ist aber mit Bestimmtheit
kein den Ding- und Selbstwahrnehmungen ebenbürtiges und diesen
gleichgestelltes Erfahrungsdatum. Und das heißt auch, daß die Fremder-
kenntnis abgeleitet ist: sie stammt nicht unmittelbar aus den - wie Russell
zu sagen pflegte - „hard data" (vgl dazu S. 8).
Hinter diesen (und ähnlichen) Konzeptionen verbirgt sich, immer nach
Gurwitsch, ein grobes Vorurteil, das unausweichlich zur Analogieschluß-
theorie führt. Zwischen diesem Vorurteil und der Analogieschlußtheorie
besteht ein Verhältnis gleich dem zwischen Ursache und Wirkung. Und
gerade deshalb ist nicht einmal primär die Analogieschlußtheorie selbst
" HUSSERL, a . a . O . , S. 1 3 5 .
20 CARNAP, a. a. O . , S . 6 4 .
21 CARNAP, a. a. O . , S . 3 2 .
22 V g l . CARNAP, a. a. O . , S. 7 6 - 7 7 .
23 Dies darf freilich nicht im Sinne einer ontologischen Stufenfolge verstanden werden.
24 V g l . CARNAP, S . 7 9 .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XV
ärgerlich, weil sie etwa der Alltagserfahrung zu widersprechen oder mit
anderen Theorien nicht vereinbar zu sein scheint. Vielmehr ist der Grund
der Analogieschlußtheorie ein Ärgernis, das Gurwitsch zu beschreiben
und zu überwinden versucht. In diese Richtungen weisen denn auch die
Überlegungen im ersten Abschnitt des Textes von 1931.
Worauf beruht nun dieses Vorurteil? Einerseits auf einem einseitigen,
höchst problematischen Wahrnehmungsbegriff, dem zufolge ausschließ-
lich physische Gegebenheiten (d. h. Zustände und Veränderungen von
Körpern) Gegenstand von Wahrnehmungen sein können 25 . Dieser
Wahrnehmungsbegriff wirkt sich bis in die Erkenntnistheorie hinein aus,
denn mit seiner Hilfe wird theoretisch festgelegt, was als unmittelbares
Erfahrungsdatum anzusehen ist und was nicht (vgl. S. 10 ff.). Andererseits
beruht jenes Vorurteil auf der angenommenen Ichbezogenheit (S. 3 und 5)
aller Erlebnisse. Diese Ichbezogenheit macht es aus, daß jeder Gedanke,
jeder Schmerz, jede Phantasie und Vorstellung, jede Erinnerung, aber
auch jedes Urteil usw. mit einem wesentlich zu diesen Akten gehörenden
Ichindex ausgestattet ist26.
Diese beiden Aspekte gehen in einen ganz bestimmten „bewußtsein-
sphänomenologischen Ansatz" oder „Befund" ein (vgl. S. 1, 7, 10-14).
Man muß diesen Ausdruck vorerst möglichst neutral interpretieren. Un-
ter einem,, bewußtseinsphänomenologischen Ansatz" versteht Gurwitsch
nämlich einen der „Erkenntnistheorie vorgelagerten" Inbegriff von
„Grundanschauungen über das Wesen des Bewußtseins". Diese Grund-
anschauungen können auch als „Leitprinzipien der Erkenntnistheorie"
gedeutet werden, weil „in bezug auf sie . . . deren leitenden Motive und
theoretischen Ansätze erst voll verständlich" werden (S. 11). Demnach
wäre in Lockes Auffassung des Bewußtseins als einer tabula rasa, die sich
nach und nach mit Sinneseindrücken füllt, ebenso ein „bewußtseinsphä-
nomenologischer Ansatz" zu erblicken wie in Kants Konzeption des
Bewußtseins als Synthesis des Mannigfaltigen, in Husserls Definition des
intentionalen Bewußtseins oder in Merleau-Pontys Begriff des inkarnier-
ten Bewußtseins usw. 27 In jedem dieser Ansätze wird - Gurwitschs
25
Vgl. dazu auch Das Bewußtseinsfeld, S. 51 ff.
26
Zu diesem Punkt vgl. GURWITSCHS Widerlegung der egologischen Auffassung des
Bewußtseins in „A Nonegological Conception of Consciousness", Studies, S. 287-300.
Zu dieser Frage auch A. MÉTRAUX, „Aron Gurwitsch's Non-Egological Conception of
Consciousness", Research in Phenomenology 1975, 5, S. 43-50.
27
Man darf sich aber auch fragen, ob denn diese „bewußtseinsphänomenologischen
Ansätze" (von denen Gurwitsch die ersten zwei selbst nennt) in der Tat vor-theoretische
Grundanschauungen über das Wesen des Bewußtseins sind, oder ob nicht auch hier
theoretische Überlegungen zu diesen „Ansätzen" geführt haben.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XVI Vorwort
Argumentation zufolge - eine Vorannahme sichtbar, die die Theorie in
eine bestimmte Richtung lenkt und darin auch zum Ausdruck kommt.
Und gerade auf diese formale Abhängigkeit der Erkenntnistheorie von
einer bestimmten Vorannahme hat es Gurwitsch in seiner Kritik der
Analogieschlußtheorie abgesehen. Darüber hinaus aber gilt diese formale
Abhängigkeit auch in bezug auf die Psychologie, da ja diese nicht weniger
als die Erkenntnistheorie auf einem „bewußtseinsphänomenologischen
Befund" aufbaut (vgl. S. 12-14).
Wenn nun also dem traditionellen, Ansatz zufolge die Perzeption nur
physische Zustände und Veränderungen am Anderen erfaßt (vgl. S. 42), so
wird damit zwar die Uberprüfbarkeit des so Wahrgenommenen gewähr-
leistet. Aber das so Wahrgenommene ist dem Anderen ebenso äußerlich
wie die somatischen Phänomene des Ichs, die dieses gleichsam an der
Außenseite seines Eigenleibes wahrnimmt. Wird zusätzlich dazu die
Ichhaftigkeit aller Erlebnisse behauptet, kann das Subjekt oder Ich zwar
seine (mentalen) Zustände und Veränderungen innerlich erleben, doch
auch hier bleiben ihm diejenigen des anderen Ich unerfahrbar, weil sich
dessen Körper jedem möglichen unmittelbaren Intersubjekti/vitätsbezug
in die Quere stellt. Der traditionelle Ansatz läuft mithin auf einen
uniiberwindbaren Ausschluß des Anderen nicht etwa als eines Dinges
unter anderen Dingen, sondern als einer dem Subjekt gleichgeordneten
Person hinaus.
Dies exemplifiziert Gurwitsch an so verschiedenartigen Autoren wie
Erdmann, Becher, Russell, Carnap, Stein, Cassirer und Husserl. Gewiß
hebt er die im Laufe der Zeit am traditionellen Ansatz unternommenen
Revisionsversuche hervor, verwirft sie letztlich aber als nicht radikal
genug.
In diesem Zusammenhang erscheint es lohnenswert, etwas genauer auf
Gurwitschs Ausführungen einerseits zur Theorie von Lipps, andererseits
zu Husserls Begriff der „Welt der natürlichen Einstellung" einzugehen.
1. Theodor Lipps hat darauf hingewiesen, daß der Vollzug von
Analogieschlüssen einen unerlaubten „Ubergang zu einer neuen Tatsache,
ja sogar zu einem neuen Tatsachenbereich" (S. 29) voraussetzt. Unerlaubt
ist dieser Ubergang deshalb, weil vom phänomenal Vorgefundenen, das ex
hypothesi jeweils nur physischer Natur sein kann, eine andere Dimension
- nämlich die des Fremdpsychischen - , also auch ein anderer ontologischer
Bereich erschlossen wird. Gurwitsch sieht in dieser Feststellung den
entscheidenden Einwand gegen die Analogieschlußtheorie (S. 32), auch
wenn er Lipps anschließend derselben Verfehlungen bezichtigt wie die
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XVII
Analogieschlußtheoretiker (S. 37). Hier ist also nicht so sehr der wunde
Punkt der Einfühlungstheorie, die bei Lipps an die Stelle der Analogie-
schlußtheorie getreten ist, von Interesse, sondern vielmehr die Folgerung,
die Gurwitsch aus der Feststellung zum unerlaubten Ubergang im
Vollzug von Analogieschlüssen zieht. So unterstreicht er die Notwendig-
keit einer Neubestimmung des Wahrnehmungsbegriffes·, gerade weil
dieser in seiner früheren Form sich am physikalisch definierten Reiz
orientiert, taucht das Problem des Zugangs zum Anderen (vgl. S. 27 ff.) als
zu einem jenseits des physischen Bereiches befindlichen (psychischen
oder mentalen) X überhaupt erst auf.
An dieser Stelle färbt die Gestalttheorie auf Gurwitschs Gedankengang
ab. Sowohl in der Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich wie
auch später im Bewußtseinsfeld opponiert er gegen das physikalistische
Modell der Wahrnehmung und führt in Abhebung dazu und im Hinblick
auf eine adäquate Bestimmung des Perzeptionsbegriffes die Aufgabe der
Konstanzannahmti28 in - wie es heißt - „erkenntnistheoretischer Inten-
tion" durch 29 . Diese Aufgabe der Konstanzannahme wird dabei in der
Weise interpretiert, daß die Wahrnehmung bzw. die Erfahrung nur dann
sinnvoll bestimmbar ist, wenn nicht vom (physikalisch definierten) Reiz
ausgegangen wird, sondern vom Wahrnehmungserlehnis. „Läßt man die
.Konstanzannahme' fallen und nimmt die Bewußtseinsgegebenheiten
,theorielos', so, wie sie sich in ihrem Eigenwesen geben, verzichtet man
darauf, sie von vornherein an objektiven Reizen zu orientieren, und läßt
gegenüber allen theoretischen Konstruktionen ihr deskriptives Wesen zu
seinem Recht kommen", dann ergibt sich daraus, „daß die Gegenständ-
lichkeiten, von denen als erlebten fortwährend die Rede ist, auch in der Tat
lediglich als erlebte in Anspruch genommen werden dürfen" und daß „es
sich nicht um Dinge, Sachverhalte, Vorgänge schlechthin . . . handelt,
sondern um all das, so wie es jeweils gegeben ist, wie es jeweils
erscheint"30.
Die Verbindung gestalttheoretischer Ideen und der von Theodor Lipps
an der Analogieschlußtheorie geübten Kritik macht eine zweite Folge-
rung Gurwitschs verständlich. Der aus der Aufgabe der Konstanzannah-
me resultierende Wahrnehmungsbegriff ist so beschaffen, daß er „psycho-
28
Vgl. W. KOHLER, „Uber unbemerkte Empfindungen und Urteilstäuschungen", Zeit-
schriftfür Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 1913, 66, 51-80.
29
GURWTTSCH, Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, S. 297.
30
GURWITSCH, a. a. O., S. 296. Vgl. hierzu auch Das Bewußtseinsfeld, §§11 und 12.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XVIII Vorwort
physisch indifferent" ist (wie man in Anlehnung an Max Scheler sagen
kann) : er ist für die Erfahrung von materiellen Gegenständen genau so gut
verwendbar wie für die Fremderfahrung oder Selbsterfahrung und
unterliegt damit keiner besonderen Einschränkung oder Beschränkung
auf diesen oder jenen Erfahrungsbereich.
So zeigt es sich, daß Gurwitsch über eine erkenntnistheoretische
Reflexion zur Wahrnehmung und zur Struktur der Erfahrung zweierlei
erreicht : einerseits die Klärung des Perzeptionsbegriffes, und andererseits
die Aufstellung eines methodischen Postulates, dem zufolge die Alltagser-
fahrung in ihrem vollen beschreibbaren und analysierbaren Gehalt (aber
auch nur so weit, wie dieser Gehalt selbst reicht) als Basis oder als
Ausgangspunkt zu nehmen ist, und nicht eine von bestimmten Vorannah-
men getragene Konstruktion derselben31.
2. Mit diesen Überlegungen ist die Ebene erreicht, auf der sich die
weiteren Reflexionen im Text von 1931 bewegen. Diese Ebene wird mit
Husserls Terminus der „Welt der natürlichen Einstellung" bezeichnet.
Freilich weist eine kritische Analyse selbst jener Autoren, die -
ähnlich wie Gurwitsch - die „Welt der natürlichen Einstellung" als
Ausgangsbasis ihres Systems anerkannt haben, auf die notwendige
Berücksichtigung gewisser Vorsichtsmaßnahmen bei einem solchen
Vorgehen hin. Es genügt schlechterdings nicht, den Rückgang zur „Welt
der natürlichen Einstellung" bloß zu vollziehen, ohne die daraus
erwachsenden theoretischen und methodischen Konsequenzen ernst zu
nehmen. Am Falle Cassirers dargelegt : dieser Autor charakterisiert die
Ausdrucksphänomene mit Recht nicht etwa als „Epiphänomene", die
„zu Empfindungsinhalten hinzutreten. Vielmehr gilt ihm [der] Bereich
der Ausdrucksphänomene als eine primitivere Schicht der Wahrneh-
mung" (S. 45). Demnach besteht - zumal auf der Stufe der Alltagserfah-
rung - kein wesentlicher Unterschied zwischen der Wahrnehmung von
Naturdingen und derjenigen von Kulturgegenständen und Mitmenschen.
Die „symbolische Form", die unmittelbar zugängliche, also nicht aus
irgendwelchen psychischen Prozessen hervorgehende und den physi-
schen Phänomenen auferlegte Bedeutung, wohnt den Erfahrungsgege-
benheiten inne. Dingliches und Ausdrucksmäßiges greifen ineinander,
sind miteinander verschränkt, - und erst der im Nachhinein erfolgende,
willkürliche, von gewissen Erkenntnisinteressen geleitete abstrahieren-
den Abbau der symbolischen Komponenten schält gleichsam das rein
31 Hier dürfte sich Gurwitsch von Husserls „Prinzip aller Prinzipien" geleitet haben
lassen; vgl. H U S S E R L , Ideen, Buch I, § 24.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XIX
Physische heraus. Cassirer zufolge ist für die Erkenntnis des Anderen
diese Wahrnehmung von Ausdrucksphänomenen als Leitfaden, ja sogar
als letzte Grundlage anzusehen. Mag diese programmatische Idee in ihrer
Allgemeinheit den Intentionen Gurwitschs noch so entgegenkommen, so
bemängelt er daran jedoch auch, daß hier - entgegen der Alltagserfahrung
- einem einzigen Phänomenbereich - demjenigen des Ausdrucks -
ausschließlich die tragende Rolle zugewiesen wird (S. 47), wie wenn nicht
auch andere Phänomene für die Fremderfahrung konstitutiv wären. Und
zudem sei in Rechnung zu stellen, daß sich bei Cassirer doch wieder
Spuren der früheren dualistischen Wahrnehmungstheorie fänden. Mit
anderen Worten : Cassirer operiert zwar anfänglich mit einem durchaus
annehmbaren Wahrnehmungsbegriff ; statt sich aber konsequent an ihn zu
halten, höhlt er ihn Schritt um Schritt wieder aus mit der alten Dichotomie
zwischen dem Chaos sinnleerer Empfindungen und dem ganz in der
Innerlichkeit des Subjekts zurückgezogenen Bewußtsein, das diese
Empfindungen durch Synthesen zu einem bedeutungsträchtigen Weltbild
gestaltet oder formt (vgl S. 84-85). Die Einsicht, daß die „Welt der
natürlichen Einstellung", in der von einer solchen Dichotomie nicht die
Rede sein könnte, in der Tat den richtigen Ausgangspunkt darstellt, ist
noch lange nicht gleichbedeutend mit der hierzu erforderlichen radikalen
Ausschaltung von Auffassungen, die mit dieser „Welt der natürlichen
Einstellung" kaum auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind.
Beinahe parallel zu seiner Cassirerkritik entwickelt Gurwitsch seine
Husserlkritik. Doch geht es in dieser nicht mehr allein um das
Wahrnehmungskonzept, sondern allgemeiner um das Verhältnis des
Subjekts zur Welt. Husserl vertritt im ersten Buch seiner Ideen zu einer
reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, auf die sich
Gurwitsch vor allem bezieht, einen noch ganz vom Cartesianismus
beeinflußten Standpunkt : das Subjekt verhält sich erfahrend in intentio-
nalen Akten zur Welt, wobei diese Akte im Sinne vergegenständlichender
cogitationes bestimmt werden. In der Ubergewichtung der vergegen-
ständlichenden Akte ist indes eine gewisse Verfehlung des phänomenal
Vorgefundenen zu erblicken, denn die symbolischen und Kulturbedeu-
tungen, die Werte und ästhetischen Qualitäten wie auch die Ausdrucks-
phänomene werden damit - so Gurwitsch - zu Gegebenheiten, die sich
sekundär auf die gegenständliche, als identisch angesetzte Unterlage
aufschichten (vgl. S. 63 ff.)32. In bezug auf diese sind dann jene Gegeben-
32
Vgl. eine ähnliche Kritik an Husserl in GURWITSCH, Das Bewußtseimfeld, S. 215 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XX Vorwort
heiten entbehrliche Momente. Trotz des im Grunde richtigen Ausgangs-
punktes, der mit der „Welt der natürlichen Einstellung" identifiziert
wird, schleicht sich bei Husserl eine dualistische Auffassung des
Subjekt-Welt-Bezugs ein, die von der Alltagserfahrung her überhaupt
nicht zu rechtfertigen ist. Gewiß darf der Wert der vergegenständlichen-
den Einstellung für wissenschaftliches Erkennen nicht geleugnet werden,
doch steht diese Einstellung bereits jenseits der „Welt der natürlichen
Einstellung", in der das Subjekt nicht Gegenständen und sich irgendwie
darauf aufschichtenden Werten und Bedeutungen gegenübersteht, son-
dern konkreten, sinnvollen „Gestalten".
Der zwischen der kritischen Auseinandersetzung mit wahrnehmungs-
theoretischen Problemen bzw. der Klärung des Verhältnisses des Subjekts
zur Welt der natürlichen Einstellung und der vollen Anerkennung des
sozialen Charakters dieser Einstellung (wie auch der darin gemachten
Erfahrungen) noch verbleibende Abstand ist nun nicht mehr sehr groß. In
der Tat dienen die Ausführungen zu Husserls Standpunkt zwar auch einer
notwendigen kritischen Ergänzung desselben; doch nicht weniger dienen
sie einer Vorbereitung der späteren Analysen im Text von 1931. Denn die
in der natürlichen Einstellung gemachten Erfahrungen vermitteln ja
zwischen dem Subjekt und einer von vornherein sozialen und geschichtli-
chen Umwelt, zu der die symbolischen Formen, die Ausdrucksphänome-
ne und Werte ebenso gehören wie die gleichgeordneten Mitsubjekte, die
in dieser oder jener Rolle auftreten, diese oder jene Funktion überneh-
men, sich an diese oder jene sozialen Spielregeln halten oder nicht usw.
Der Beschreibung der Strukturen dieser von Anfang an sozialen Umwelt
oder Lebenswelt gelten die ausführlichen Analysen Gurwitschs. Doch
bedurfte es zu deren Durchführung zuerst eines adäquaten Rahmens.
Und dieser Rahmen leitet sich ab aus einem Erfahrungsbegriff, der -
richtig verstanden - die Alternative von Rezeptivität und Aktivität, von
Verstehen und Handeln ablehnt. In dieser Hinsicht greift die Arbeit
Gurwitschs auf Themen vor, die in der gegenwärtigen handlungstheoreti-
schen Diskussion mehr denn je aktuell sind.
Rückblickend kann gesagt werden, daß die Widerlegung der Analogie-
schlußtheorie drei Stadien durchläuft: im ersten Stadium wird vom
physikalistischen Wahrnehmungsmodell abgerückt (das Wahrgenomme-
ne resultiert nicht aus einer Summe von sinnleeren Empfindungen, die
durch äußere Kräfte ausgelöst und nachträglich durch das Bewußtsein zu
sinnvollen Gegenständen geeint werden) ; im zweiten Studium wird - in
Einklang mit der Forderung nach einer deskripten Methode - der
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XXI
gestalthafte Charakter der Erfahrung herausgearbeitet; und im dritten
schließlich das soziale Moment im Verhältnis der Subjekte zueinander und
zur Lebenswelt betont.
Diese Erkenntnisse konkretisiert Gurwitsch in den beiden folgenden
Abschnitten seiner Arbeit, wobei der zweite einen Übergang vom eher
erkenntnistheoretisch angelegten ersten zum sozialtheoretischen dritten
Abschnitt schafft.
Es ist freilich nur scheinbar ein Paradox, wenn Gurwitsch, statt die
Phänomene der Interaktion und die Dimensionen derselben direkt
anzusteuern, vorerst den Weg über die Analyse der natürlichen Umwelt
einschlägt, denn: „Die Auslegung der Strukturen der .natürlichen'
Umwelt' erschließt den Horizont, in dem und von dem her wir den
Mitmenschen begegnen, und der den Sinn dieser Begegnung überhaupt
bestimmt und ausprägt" (S. 55). Und es liegt auch kein Widersinn darin,
wenn er die Art und Weise des praktischen Umgangs mit den Objekten in
der natürlichen Umwelt oder Milieuwelt von deren Struktur her in den
Griff zu bekommen sucht, um auf der Grundlage dieses Paradigmas über
den ganz ähnlichen Umgang mit dem Anderen zu reflektieren. Wie aus
den vorherigen Darlegungen inzwischen ersichtlich sein sollte, wird nicht
mehr der frühere, als radikal vermeinte Gegensatz zwischen der
(a-sozialen) Ding- und der (sozialen) Fremdwahrnehmung, sondern
vielmehr der Aufbau oder die Organisation der Erfahrung in Umweltsi-
tuationen selbst zum analytischen Leitfaden.
Dies manifestiert sich besonders in jenen Textpassagen, wo sich
Gurwitsch in freier Anlehnung an Heideggers 1927 erschienene Schrift
Sein und, Zeit und unter Heranziehung von entwicklungspsychologischen
und psychopathologischen Forschungsergebnissen mit der Zeugumwelt
befaßt (vgl. S. 95 ff.). Im Alltagsleben wissen wir je schon implizit um die
mannigfachen funktionalen Relevanzen der Objekte, mit denen wir
umgehen, die wir gebrauchen, in denen wir wohnen, an die wir uns stoßen
oder die uns Widerstand leisten usw. Wir erfahren diese Objekte nicht als
„bloße Sachen" (Husserl), sondern vorwiegend als Gebrauchsgegenstän-
de oder als Zeug (im umfassenden Sinne des Wortes). Mit Werkzeugen
erweitern wir unsere leiblichen Vermögen, schaffen uns die Möglichkeit,
zielgerechter in die Umwelt einzugreifen; mit Maschinen und anderen
technischen Hilfsmitteln beschleunigen wir einen Arbeitsprozeß oder
vereinfachen die Produktion von Gütern (wobei damit bekanntlich auch
soziale Probleme hervorgebracht werden) ; wir suchen Unterkünfte auf,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XXII Vorwort
die Schutz gewähren, bedienen uns der Transportmittel, kaufen Eßwaren
und verleiben sie uns ein, suchen Kleidungsstücke aus, die uns oder
Anderen gefallen oder mißfallen, beachten (meistens) die Signale, die die
Orientierung in der Umwelt erleichtern oder zur Befolgung bestimmter
Verhaltensregeln mahnen. An diese Zeugumwelt paßt sich das Verhalten
an; aber es verändert sie auch, indem es neue oder schon bestehende
Objekte produziert und reproduziert. Und schließlich ist diese Zeugum-
welt Zielpunkt von Deutungen und Typisierungen, die wir anhand
tradierter oder ausgehandelter Interpretationsschemata vollziehen. So
mag sich ein Hammer zwar metallisch hart und kühl anfühlen, schwer
oder leicht sein, nur daß Form, Gewicht, Härte usw. in der natürlichen
Umwelt nicht primär als „objektive", gegenständlich Qualitäten dieses
physischen Dinges erfahren werden, sondern als praktisch relevante
Eigenschaften innerhalb eines Netzwerkes von pragmatischen Funktio-
nen. Ein Hammer ist unter Umständen zu leicht, weil die Wand zu hart
ist, in die ein Nagel geschlagen werden soll, und eine Zange unter
Umständen zu klein, um einen zu tief ins Holz geschlagenen Nagel zu
entfernen. Derselbe Hammer kann, in einem anderen Zusammenhang,
zur Abrundung einer Backsteinkante verwendet werden, doch würde
auch eine Zange zu diesem Zwecke dienlich sein, sofern die Ausführun-
gen der Armbewegungen und die Weise, wie das Werkzeug angef aßt wird,
sich der neuen Verwendungsmöglichkeit der Zange anpassen. Doch nicht
nur dies : der Umgang mit dem Werkzeug verweist auf ein zu erreichendes
Ziel, und so auf einen Auftraggeber oder auf einen anonymen Käufer (vgl.
S. 101 ff.) ; die Arbeit erfolgt in einem Regelkontext, der die Verwendung
bestimmter Utensilien vorschreibt oder empfiehlt; sie steht in einem
zeitlichen Horizont, nämlich demjenigen der Arbeitszeit oder der
Freizeit, und schließlich dürfen die Verweisungen auf die technischen
Kompetenzen, auf die motorischen Vermögen und die leiblichen Fähig-
keiten des bzw. der Handelnden nicht übersehen werden. All das besagt
nun freilich nicht, daß das Werkzeug nicht auch in einer vergegenständli-
chenden Einstellung zum Thema von kognitiven Zuwendungen und
Erkenntnisinteressen zu werden vermöchte. Allein, Gurwitsch betont,
daß das Resultat dieser vergegenständlichenden Blickwendung und
Thematisierung sich sekundär aus dem praktischen Umgang mit den
Objekten in der natürlichen Umwelt erst ergibt: „Die Wurzel der
Gegenstandswelt liegt in der Lebenswelt, aus der sie sich durch
Thematisierung ergibt" (S. 144). Und dasselbe trifft auf den Anderen zu :
wenn immer eine vergegenständlichende Einstellung zum Anderen
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XXIII
eingenommen wird und das kognitive Interesse auf bestimmte Sachfragen
zielt - ζ. B. auf die Diagnose somatischer Symptome o. ä. - , dann
geschieht dies sekundär aus der bereits erfahrenen praktischen und
sozialen Lebenswelt heraus durch Einnahme einer objektivierenden
Erkenntnishaltung: „Für den Arzt ist der Kranke kein Situationspartner,
mit dem zusammen er in einer gemeinsamen Situation und gemäß dem
Sinne dieser Situation etwas tut, wie es etwa sein Kollege ist, mit dem er
den Fall berät. Vielmehr ist der Kranke ein Gegenstand, den der Arzt
erkennen und bestimmen will" (S. 27). Hier wie dort, und im Gegensatz
zum traditionellen Ansatz, wurzelt die Vergegenständlichung in der
lebensweltlichen Erfahrung, genau wie etwa bei Koffka dem geographical
environment, das der Forschungseinstellung des Psychologen entspricht,
das behavioural environment,3, d. h. die Welt der natürlichen Einstel-
lung, voraufliegt.
Ein Vergleich mit den Befunden der Psychopathologie, genauer: mit
den von Gelb und Goldstein vorgelegten psychologischen Analysen
hirnpathologischer Fälle, bestätigt in Gurwitschs Augen die Vorrangig-
keit der Lebenswelt auf indirekte Weise34. Gelb und Goldstein führten
einen Unterschied zwischen dem konkreten und dem kategorialen (oder
abstrakten) Verhalten ein. Der erste Ausdruck diente zur Bezeichnung der
sich vollständig an die konkrete Situationskonstellation heftenden, in den
Grenzen dieser Situation verharrenden Verhaltensformen, während der
zweite Terminus die generalisierenden, abstrahierenden und klassifizie-
renden Verhaltensformen bezeichnen sollte. Charakteristisch für das
Verhalten von Hirngeschädigten, ganz gleich, ob sie an konstruktiver
Apraxie, sensorischer Aphasie oder spezieller ζ. B. an Farbennamenam-
nesie leiden, ist nicht, daß sie eine Aufgabe beim Nachzeichnen einer
einfachen geometrischen Figur zu bewältigen, Wollsträhnen verschiede-
ner Farbnuance oder verschiedener Helligkeitsgrade nach einem eindeuti-
gen Klassifikationskriterium zu sortieren oder ohne den umständlichen
Umweg über die Erinnerung an konkrete Gegenstände den Namen einer
Farbe anzugeben nicht mehr imstande sind, sondern die Tatsache, daß
jedes dieser Symptome auf die Unfähigkeit hinweist, eine Einstellung zum
Abstrakten, Potentiellen, Kategorialen einzunehmen. Der Raum bricht
an den vier Wänden ab, in denen sich der konstruktive Apraxische
33 Vgl. K. KOFFKA, Principles of Gestalt Psychology,New York 2 1963, S. 42 ff.
34 Zu den Analysen des konkreten und kategorialen Verhaltens vgl. GURWTTSCH,
„Gelb-Goldstein's Concept of .Concrete' and .Categorial' Attitude and the Phenome-
nology of Ideation", Studies, S. 359-384.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XXIV Vorwort
aufhält ; ein Geschehen ist nur verstehbar, wenn es einen unmittelbaren
Bezug zur konkreten Situation bic et nunc des Patienten aufweist; die
roten bzw. rötlichen Farbnuancen der Wollsträhnen (oder anderer
Objekte) sind für den Farbennamenamnestischen keine Repräsentanten
von ,Röte' mehr, so wenig die Helligkeitsnuancen als Repräsentanten von
,Helligkeit' denkbar sind. Diese pathologischen Befunde interpretiert
Gurwitsch nun mit einem gewissen Recht als Bestätigung seiner
Feststellung, daß die Zeugumwelt oder Milieuwelt als ursprüngliche
anzusetzen ist, denn es liegt bei pathologischen Fällen ein Rückfall auf
eine primitivere, weniger komplexe Verhaltensorganisation vor.
Andererseits scheinen die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie,
die unter anderem die Entwicklung des sprachlichen, praktischen und
kognitiven Verhaltens von der distanzlosen Verschmelzung mit der
Umwelt bis hin zum abständigen Gegenüberstehen zur Lebenswelt zu
ihrem Forschungsgegenstand hat, die Vorrangigkeit oder Ursprünglich-
keit des konkreten Verhaltens zu bestätigen (vgl. S. 98 ff. und 111-112) 35 .
So scheint die Lebenswelt auch in zeitlicher, und nicht nur in logischer
Hinsicht, fundierend zu sein36. Das aber heißt nicht, daß das Stehen in
konkreten Situationen strukturell mit dem kindlichen bzw. mit dem
durch Hirnläsionen beeinträchtigten Verhalten zur Umwelt gleichzuset-
zen wäre (vgl. 109). Die Vorrangigkeit der Lebenswelt besagt nur, daß der
praktische Umgang mit Objekten innerhalb konkreter Situationen allen
im eigentlichen Sinne vergegenständlichenden Erkenntnisakten, allen
cogitationes voraufliegt, und daß damit die Organisation dieser Erfahrung
eben nicht abhängig ist von diesen cogitationes, sondern vielmehr von den
Strukturen dessen, was Gurwitsch entweder als „implizites Wissen", als
„Uberzeugung", als „Alltagsmeinung", als „Leben in . . ." oder auch als
„Wissen um . . . " (im Gegensatz zum „Wissen von . . .") bezeichnet. Was
der hirngeschädigte Patient nicht mehr, und was das Kind noch nicht
überschauen und meistern können, ist das Feld abstrakter Kategorien und
der Beziehungen zwischen diesen Kategorien und den konkreten
Objekten und Vorgängen in der Lebenswelt oder Milieuwelt. Ferner zeigt
sich an den Verhaltensstörungen der von Gelb und Goldstein analysierten
Fälle auch der Verlust der impliziten Kenntnis pragmatischer Relevanzen.
35 Zu weiteren entwicklungspsychologischen Aspekten vgl. G U R W I T S C H , Das Bewußtseins-
feld, S. 30 ff.
36 Zu Gurwitschs Konzeption der Lebenswelt vgl. u. a. „The Last Work of Edmund
Husserl", Studies, S. 397-447; ferner „The Life-World and the Phenomenological
Theory of Science" Phenomenology and the Theory of Science, S. 3-32.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XXV
Genauer gesagt: der pathologisch bedingte Rückfall auf die Stufe der
konkreten Einstellung bewirkt, daß ζ. B. dasselbe Werkzeug nicht mehr
als je nach Situation einmal zu diesem, einmal zu jenem Zwecke
verwendbar, oder daß dieselbe Rolle nicht mehr als von verschiedenen
Personen spielbar oder übernehmbar erfahren wird. Doch gerade
aufgrund dieser extremen Befunde wird erkennbar, daß das Verhalten in
der natürlichen Umwelt oder in konkreten Situationen nicht pathologi-
scher Art von Organisationsprinzipien beherrscht wird, die den Erfah-
rungssituationen selbst innewohnen, und nicht von außen an sie
herangetragen werden. Und wenn ein Hammer oder ein Schraubenzieher
zwar nicht ausschließlich in einer (und nur in einer), aber auch nicht in
jeder beliebigen Situation zu irgendeinem Zwecke verwendet werden
kann, eine Manipulation zwar nicht ausschließlich zur Erreichung eines
(und nur eines), aber auch nicht jeden beliebigen Zieles dient, eine Rolle
zwar von mehreren Personen übernommen, aber nicht in allen sozialen
Interaktionen gespielt werden kann, dann sind dies Hinweise darauf, daß
die Umweltsituationen nicht als Summen individueller Elemente, die
einmal so, einmal anders nach Belieben kombiniert werden, sondern von
Anfang an als „Gestalt" funktionaler Beziehungen, als in sich organisierte
oder strukturierte Konstellation aufzufassen sind.
Um den Ubergang von der allgemeinen Analyse der Umwelt-Person-
Beziehung im zweiten zur Untersuchung der drei Interaktions- bzw.
Begegnungsdimensionen im dritten Abschnitt und um den Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Abschnitten klarer hervortreten zu lassen,
empfiehlt es sich, an dieser Stelle auf das im Bewußtseinsfeld behandelte
Problem der Gestalt als der formalen Organisation der Erfahrung
einzugehen.
Gurwitsch hat im Anschluß an Wertheimer37 ausgeführt, daß eine
Gestalt - und man könnte bereits hier im Hinblick auf die Interaktion
verallgemeinern und hinzufügen: daß auch die Handlungssituation -
„nicht aus ,Teilen' zusammengesetzt gelten kann, wenn diese ¡Teile' als
autonome Elemente verstanden werden. Genauer gesagt: man kann der
Konfiguration [ = Gestalt] nicht gerecht werden, wenn man sich an die
Eigenschaften und Attribute hält, die ihre Komponenten aufweisen, oder
wenn man sie aus der Konfiguration herauslöst und isoliert betrachtet. Der
Grund dafür liegt. . . darin, daß eine Komponente der Konfiguration [ =
37
Vgl. M. WERTHEIMER, „Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt", I, Psychologische
Forschung 1 9 2 2 , 1, S. 4 7 - 5 8 .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XXVI Vorwort
Gestalt], isoliert oder als autonomes Element genommen, davon derart
radikal betroffen wird und so tiefgreifende Veränderungen erfahren kann,
daß sie ihre phänomenale Identität nicht mehr bewahrt. . ," 3 8 Das heißt
also, daß die Bestandteile einer Gestalt je schon aufeinander bezogen sind,
wobei die zwischen ihnen bestehende Beziehung von der Gestalt als
ganzer, und nicht von der Summe der einzelnen Elemente stammt:
„Unter Gestalt ist ein einheitliches Ganzes zu verstehen, das mehr oder
weniger Details in sich schließt, wegen seiner ihm eigenen Gliederung und
Strukturiertheit Kohärenz und Festigkeit aufweist und sich so . . . als
organisierte und geschlossene Einheit heraushebt." 39 Doch auch dies
genügt im Grunde zur Definition der Gestalt nicht. Selbst die Ablehnung
der Idee einer bloßen Und-Verbindung (Wertheimer) zwischen den
Bestandteilen schließt die Möglichkeit eines in sich ruhenden Gewimmels
von Elementen nicht aus. Deshalb müßte jedes dieser Elemente oder jeder
dieser Bestandteile innerhalb der Gestalt einen Stellenwert besitzen, so
daß für die Gestalt der Bezug des Ganzen zu den Teilen ebenso wie der
Bezug der Teile zum Ganzen und untereinander gleichursprünglich
konstitutiv sind. Erst mit dieser reziproken Beziehung läßt sich be-
stimmen, was zur Gestalt gehört und was nicht, welches ihre Komponen-
ten und Eigenschaften sind und welche nicht. Eine konstitutive Kompo-
nente bedeutet für Gurwitsch, daß sie „ . . . an einer ganz bestimmten
Stelle innerhalb der Struktur des Ganzen existieren und in der Organisa-
tion der Gestalt einen bestimmten Platz einnehmen [muß], der nur in
bezug auf die Topographie des betreffenden Gebildes bestimmt werden
kann. Wegen ihrer Aufhebung in der Struktur und Organisation eines
Ganzen erhält die betreffende Komponente eine funktionale Bedeutsam-
keit in bezug auf das Ganze." 40
Da es sich bei der funktionalen Bedeutsamkeit um einen formalen
Aspekt der Organisation von Erfahrung handelt, läßt er sich grundsätz-
lich auf das Phänomen der Interaktion übertragen und anwenden. Zum
Abschluß dieser Bemerkungen zum Text von 1931 sei der Versuch
gemacht, die drei von Gurwitsch behandelten Begegnungsdimensionen
mit Hilfe des Begriffes der funktionalen Bedeutsamkeit zu umschreiben,
bevor die Relevanz der Arbeit Gurwitschs für die heutige sozialwissen-
schaftliche Diskussion angegeben wird.
38 GURWITSCH, Das Bewußtseinsfeld, S. 9 6 - 9 7 .
39 GURWITSCH, a . a. O . , S . 9 7 .
40
Ibid.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XXVII
Der Satz, daß jede Interaktion irgendwie strukturiert ist, dürfte sich als
eine Binsenwahrheit ausnehmen. Wie aber Interaktionen strukturiert
sind, und welche Merkmale zu deren Beschreibung und Klassifizierung
als die entscheidenden gelten sollen, scheint eine überaus schwierige Frage
zu sein, wie die vielen sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen zu
diesem Problem beweisen. Welchen Standpunkt nimmt nun Gurwitsch
zu diesem Problem ein? Statt die Kategorien „Gesellschaft", „Gemein-
schaft" und „Bund" aus der Soziologie seiner Zeit zu übernehmen, um
mit deren Hilfe die verschiedenen Handlungstypen in den Griff zu
bekommen, verfolgt er vielmehr das Ziel, die Handlungserfahrung und
deren Organisation selbst einer möglichen Einteilung der mitmenschli-
chen Begegnungen in Partnerschaft, Zugehörigkeit und Verschmelzung
zugrunde zu legen. Schon daran ist die phänomenologische Orientierung
seines Vorgehens erkennbar: wie Handelnde sich und die Anderen in
konkreten Situationen auslegen, und wie sie aufgrund dieser Auslegung in
konkreten Situationen miteinander handeln, entscheidet darüber, mit
welchem Interaktionstypus wir es von Fall zu Fall zu tun haben.
1. In der Partnerschaft begegnen sich die Akteure in einem rollenbezo-
genen Situationskontext; ihr Verhalten ist zweckrational auf die Errei-
chung bestimmter Ziele orientiert. So ist in dem vom Autor genannten
Beispiel der Zusammenarbeit (vgl. S. 148 ff.) das Verhalten der einen
Person funktional auf dasjenige der anderen bezogen und umgekehrt.
Alles, was nicht auf die Arbeitssituation verweist, besitzt deshalb auch
keine Stelle innerhalb der Situationskonfiguration, ist kein Bestandteil mit
einer funktionalen Bedeutsamkeit. So wird der Sinn des Verhaltens von
der Situation bestimmt, und nicht von den daran teilnehmenden
Individuen, die austauschbar sind: „Wie wir uns verhalten, in welchem
konkreten Sinne wir Partner sind, das wird . . . durch die Situation
unseres Zusammenseins bestimmt. . . die Situation schreibt uns eine
Rolle vor, die wir übernehmen, so lange wir in der betreffenden Situation
stehen" (S. 154). Wenn zwei Personen (die aber durch andere ersetzbar
sind) einander in die Hände arbeiten, eine dritte Person ihnen dabei
zuschaut, dann ist diese letztere zwar ein real vorhandenes Element der
Umwelt (wie ein Baum oder ein Haus am Horizont es auch sind), besitzt
aber keine funktionale Bedeutsamkeit innerhalb der Arbeitssituation und
trägt damit zu deren Organisation nicht bei. Sobald diese dritte Person
jedoch im Wege steht, tritt sie zwar nicht als ein neuer oder zusätzlicher
Interaktionspartner in die Situation ein, sondern als ein zu umgehendes
oder zu beseitigendes Hindernis ; funktion und formal gesehen verhält es
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XXVIII Vorwort
sich mit ihr als einem Hindernis genau gleich wie etwa mit einem
Regenschauer, der die Arbeit beim Verlegen einer elektrischen Leitung auf
offener Straße stört. Für die Partnerschaft sind mithin sowohl die
funktionale Bedeutsamkeit innerhalb der Handlungssituation als auch das
Spiel und Widerspiel von Rolle und Gegenrolle konstitutiv (vgl. S. 154),
d. h. das, was Litt und Schütz unter dem Titel der „Reziprozität der
Perspektiven" beschrieben haben.
2. Von ganz anderer Art ist die zweite Dimension, nämlich die der
Zugehörigkeit. Gurwitsch charakterisiert sie zuerst negativ dadurch, daß
er sie von den rollenbezogenen Partnerschaftssituationen abhebt. Wie
man in die Begegnungssituationen des ersten Typus eintritt, so verläßt
man sie wieder auch. Dieses Woher und Wohin ist ein rollenfreier
Handlungsspielraum, in dem die unter die Zugehörigkeit fallenden
Begegnungen stattfinden (vgl. S. 166-167). Mit anderen Worten: was in
der Partnerschaft im Hintergrund stand und auch gar nicht zum Thema
gehörte, wird in der Zugehörigkeit zum umfassenden thematischen
Medium41. So erweisen sich die rollenbezogenen Interaktionen als
Episoden innerhalb eines umfassenden Kontextes, den Gurwitsch als
„Lebenszusammenhang" bezeichnet (vgl. S. 174 ff.). Man könnte, jedoch
im Bewußtsein, daß es sich dabei um eine eher metaphorische Redeweise
handelt, den Rubinschen Terminus „Grund" auf die Zugehörigkeit
zu einem Lebenszusammenhang anwenden, innerhalb dessen sich
die rollenbezogenen, funktional organisierten Handlungsepisoden als
„Figuren" abheben.
Als wichtige Momente der Zugehörigkeit nennt Gurwitsch den
gemeinschaftlichen Besitz, die Sprache, die Geschichte, die Sitten und
Bräuche. Alles, was jenseits des Lebenszusammenhanges steht, ist
irrelevant für die Organisation dieser Begegnungsdimension.
3. Weder für die Zugehörigkeit noch für die Partnerschaft sind
Gurwitsch zufolge Gefühle, Affekte oder Emotionen konstitutiv. Anders
verhält es sich bei der Verschmelzung. Dieser Kategorie entspricht die
soziologische des Bundes (Schmalenbach ; vgl. S. 197) bzw. der charisma-
tischen Herrschaft (Weber; vgl. S. 199). Sie gründet sich auf eine
emotionale Identifizierung mit einer charismatischen Person, und in der
Folge davon auf eine gefühlshafte Verschmelzung mit gleichgesinnten
Anderen (den Bundgenossen). Für die strukturelle Beschreibung dieser
Kategorie ist entscheidend, daß die Verschmelzung weder von den
41
Vgl. dazu eine ähnliche Überlegung in Das Bewußtseinsfeld, S. 260 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XXIX
Lebenszusammenhängen noch von konkreten, in partnerschaftlichen
Interaktionen vorherrschenden Situationsgegebenheiten motiviert wird.
Gerade deshalb kann Gurwitsch - darin Max Weber folgend - von der
Außergewöhnlichkeit oder Außeralltäglichkeit der Verschmelzung und
der sich darin konstituierenden Bünde sprechen (vgl. S. 215). Wenn er
freilich in historischer Beziehung im Charisma ein „Anfangsphänomen"
erblickt, das ein „neues Dasein" einleitet und der Welt einen anderen,
veränderten „Sinn" (S. 214) verleiht, so mag sich dies zwar stringent aus
seiner Argumentation ableiten; ob es tatsächlich auf die Sache zutrifft,
darf mit guten Gründen bezweifelt werden.
Die Ausführungen des dritten Abschnittes zeigen - ungeachtet der
kritischen Einwände, die dagegen erhoben werden mögen - , daß der Text
von 1931 auch gegenüber früheren Versuchen der Phänomenologie, die
Sozialwelt zu analysieren, einen Fortschritt darstellen. Denn es geht
Gurwitsch nicht um eine Ontologie der Lebenswelt, und noch viel
weniger um eine eidetische Soziologie, wie sie etwas von Sigfried
Kracauer 1922 in Soziologie als Wissenschaft entwickelt wurde42. So
erscheinen die Kategorien „Partnerschaft", „Zugehörigkeit" und „Ver-
schmelzung" nicht als „regional-ontologische Fundamentalkategorien,
die wesentlich auf einen bestimmt umschriebenen Gegenstandsbe-
reich . . . bezogen sind", sondern als „Modi des Seins mit Anderen"
(S. 219), weil sie in der Struktur der Erfahrung der Handelnden fundiert
sind. Und Ähnliches ließe sich auch in bezug auf die Soziologie sagen :
schon durch die Tatsache, daß Gurwitsch die mitmenschlichen Begegnun-
gen von der Lebenswelt her, und nicht auf der Grundlage vergegenständli-
chender Erkenntnisakte untersucht, beziehen sich die von ihm erarbeite-
ten Kategorien nicht auf „Formtypen . . . der sozialen Gebilde" wie die
soziologischen Kategorien (S. 219).
An diesem Punkt tritt die Verwandtschaft mit der 1932 von Alfred Schütz
publizierten Schrift Der sinnhafte Aufbau der sozialen We/t43 zutage, die
aber völlig unabhängig von Gurwitsch entstand. Schütz ging, anders als
Gurwitsch, von Max Webers Begriff des „subjektiven Sinnes"44 aus ; die
Frage der Organisation von Interaktionen in der Lebenswelt, wie
Gurwitsch sie verstand, lag ihm damals noch fern. Der Verschiedenheit
42 S. KRACAUER, Schriften, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1971.
43 Neuauflage Frankfurt a. M. 1974.
44 Vgl. SCHUTZ, a . a . O . , S.24ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
XXX Vorwort
der Ausgangspunkte und der Themenstellung ist jedoch wenig Gewicht
beizumessen, wenn man sich der in vielen. Gedanken bestehenden
Ähnlichkeit bewußt wird. So jedenfalls sah es Gurwitsch45.
Doch darf dies auch nicht über die bis ins Spätwerk der beiden Autoren
reichenden partiellen Divergenzen hinwegtäuschen. Eine dieser Diver-
genzen betrifft das Problem der Relevanz. Schütz zufolge sind Relevanz-
systeme konstitutiv für die „umschriebenen Sinngebiete" innerhalb der
Lebenswelt, in denen wir arbeiten oder träumen oder phantasieren oder
Wissenschaft treiben usw. Der Primordialität der Relevanzstruktur be-
herrscht also den Aufbau der Lebenswelt. Gurwitsch dagegen betonte im
Bewußtseinsfeld die Primordialität der Organisationsstrukturen, - eben
jener Strukturen, auf die bereits im Text von 1931 implizit oder explizit
Bezug genommen wird. So schreibt er: „Einheit durch GeStaltkohärenz
liegt der Einheit durch Relevanz zugrunde und macht die letztere
möglich. " 46 Damit wäre in der heutigen Zeit die Frage nach der Vorrangig-
keit der Einheit durch Gestaltkohärenz oder der Einheit durch Relevanz,
nunmehr aber im Lichte des gleichzeitig mit der von Schütz stammenden
Arbeit erneut zu stellen. Zieht man es vor, die Frage der Vor-
rangigkeit gar nicht erst aufzuwerfen, so bietet sich dennoch die
Möglichkeit, wenigstens Gurwitschs Ausführungen im dritten Ab-
schnitt seiner Arbeit durch Schützsche Gedanken zu ergänzen. Denn
Gurwitsch legt kein sehr reichhaltiges Material zum Begriff des Lebens-
zusammenhanges vor. Aber gerade zu diesem Punkt hat Schütz Wertvol-
les geleistet, indem er sich speziell auf die Probleme der Typik, der
biographischen Struktur, der Sprache, der Geschichtlichkeit, der Berufe,
der Rollen, der Typisierungen usw. konzentrierte. Mit Hilfe dieses
Materials könnten die noch sehr stark von der formalen Soziologie
beeinflußten Ausführungen Gurwitschs bereichert werden. Damit w ä r e -
45
Gurwitsch und Schütz begegneten sich erstmals im Pariser Exil. Zwischen ihnen
entwickelten sich, besonders nach 1940 in den USA, eine enge Freundschaft und ein
Gedankenaustausch, der intensiver war als es in den Veröffentlichungen zum Ausdruck
kommt. Zu Gurwitschs Interpretation von Schütz vgl. besonders „The Common-Sense
World as Social Reality and the Theory of Social Science", Phenomenology and the
Theory of Science, S. 113-131 ; in Ergänzung dazu vgl. auch „Social Science and Natural
Science. Methodological Reflections on Lowe's On Economic Knowledge", in: R. L.
HEILBRONNER (Hg.) : Economic Means and Social Ends, Englewood Cliffs, Ν . J. 1969, S.
37-55. Schließlich sei auf die vergleichende Studie von M. NATANSON, „The Problem of
A n o n y m i t y in Gurwitsch and Schutz", Research in Phenomenology 1975, 5, S. 5 1 - 5 6
verwiesen.
44 GURWITSCH, Das Bewußtseinsfeld, S. 284.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Vorwort XXXI
sozusagen innerphänomenologisch - die Aktualität von Gurwitschs
Arbeit von 1931 angedeutet.
Jedoch auch angesichts anderer, nicht auf die Sozialphänomenologie
beschränkter Fragestellungen könnte erwartet werden, daß der Text von
1931 neue Erkenntnisse fördern kann. Ich denke hier ζ. B. an die Proble-
me der Personwahrnehmung in der Sozialpsychologie, die weder in be-
grifflicher Hinsicht noch unter strukturellem Gesichtspunkt geklärt sind.
Sehr oft werden die Urteilsbildungen nach wahllos zusammengestellten
Merkmalen oder aufgrund theoretischer Überlegungen analysiert, aber
nicht im Lichte einer sorgfältigen Erfahrungsanalyse. Gerade wegen der
Betonung der Gestaltorganisation auch im Bereiche der Personwahrneh-
mung könnte der Beitrag Gurwitschs in diesem Punkte Hilfe leisten.
Und schließlich wären Die mitmenschlichen Begegnungen in der
Milieuwelt auch für eine Kritik der funktionalistischen Rollentheorie
heranzuziehen, um hier wenigstens ein rein soziologisches Thema zu
erwähnen.
Ich möchte an dieser Stelle Frau Alice R. Gurwitsch (New York) für die
bereitwillige Überlassung aller für die Vorbereitung dieser Edition
notwendigen Materialien aus dem Nachlaß von Aron Gurwitsch wie auch
für die Unterstützung in allen Phasen der Fertigstellung dieser Ausgabe
sehr herzlich danken. Hilfe und Rat erhielt ich von Lester Embree
(Duquesne University, Pittsbugh, Pa.), Fred Kersten (University of
Wisconsin, Green Bay, Wis.), S. IJsseling (Husserl-Archief te Leuven,
Belgien), C. Evans (New York). Ihnen wie auch den Mitarbeitern des
Verlages sage ich meinen verbindlichen Dank.
Alexandre Métraux
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort VII
ABSCHNITT I
DAS TRADITIONELLE PROBLEM
§ 1 Der Ausgangspunkt der traditionellen Theorien 3
§ 2 Die gemeinsame Wurzel der beiden traditionellen Probleme 6
§ 3 Bewußtseinsphänomenologie als Fundament von Erkennt-
nistheorie und Psychologie 10
§ 4 Zur Analogieschlußtheorie 14
§ 5 Die Bechersche Form der Analogieschlußtheorie 18
§ 6 Der Charakter des Problems als Zugangsproblem 27
§ 7 Die Ausweglosigkeit des traditionellen Problems und die
Richtung der weiteren Untersuchungen 40
ABSCHNITT II
ZUM PROBLEM DES BEGRIFFS EINER NATÜRLICHEN
UMWELT 49
§ 8 Die mitmenschlichen Begegnungen im Horizont der natür-
lichen Umwelt 51
§ 9 Das Ziel der weiteren Untersuchungen 54
§ 10 Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen
Einstellung" 57
§ 11 Der Mitmensch als Gegenstand 73
§ 12 Die Milieutheorie Schelers 82
§ 13 Die Zeugumwelt 95
§ 1 4 Das Aufgehen in der Situation 110
§ 1 5 Das Problem der Zeugidentität 116
§ 1 6 Das implizierte Wissen 120
ABSCHNITT III
DAS GEBUNDENE ZUSAMMENSEIN
§ 1 7 Die Verweisung auf die Mitwelt 137
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
VI Inhaltsverzeichnis
Kapitel I : Die Partnerschaft 148
§ 1 8 Das Zusammensein in einer gemeinsamen Situation 148
§ 1 9 Die Begegnung in der Rolle 153
§ 20 Das gegenseitige Verstehen in der gemeinsamen Situation . . 159
§ 21 Der Sinn der soziologischen Kategorie der Gesellschaft . . . . 165
Kapitel II : Die Zugehörigkeit 172
§ 22 Die Gemeinschaft als fundierte Gemeinschaft 172
§23 Die Geschichtlichkeit 179
§ 24 Die Grenze der Zugehörigkeit 187
§25 Das Zusammensein in der Gesellschaft 191
Kapitel III: Die Verschmelzung 197
§ 2 6 Die Einsfühlung ..197
§ 2 7 Zur phänomenologischen Interpretation und ihre Anwen-
dung auf die mitmenschlichen Beziehungen 208
§ 2 8 Das Charisma als Anfangsphänomen 210
§ 29 Die soziologischen Fundamentalkategorien als Strukturen
des „Lebens i n . . . " 216
Bibliographie 225
Namenregister 228
Sachregister 230
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
ABSCHNITT I
DAS TRADITIONELLE PROBLEM
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
§ 1 Der Ausgangspunkt der traditionellen Theorien
Daß es überhaupt ein Problem des Wissens vom Menschen als Mitmen-
schen, d. h. von einem beseelten und bewußten Wesen gibt, liegt an einem
bestimmten bewußtseinsphänomenologischen Ansatz, der in die traditio-
nellen Theorien eingegangen ist und ihnen als Ausgangspunkt dient.
Möglichst allgemein ausgedrückt, d. h. unter Absehen solcher Differen-
zen, denen in einer prinzipiellen Diskussion lediglich die Bedeutung von
Nuancen zukommt, läßt sich dieser Ansatz etwa folgendermaßen
explizieren : alles, wovon wir wissen, was in irgendeinem Sinne für uns in
Betracht kommt, ist uns in Erlebnissen gegeben. Gleichgültig, wie man
das Gegebensein von Gegenständen1 in Erlebnissen interpretiert, — damit
überhaupt etwas als Gegenstand für uns da sei, damit wir in irgendeiner
Weise davon sinnvoll sprechen können — auch wenn wir die Existenz des
Gegenstandes (ζ. B. eines geflügelten Pferdes) oder sogar seine Möglich-
keit (ζ. B. eines viereckigen Kreises) bestreiten — müssen wir Erlebnisse
haben, die in einer wie immer zu verstehenden Beziehung zu den
betreffenden Gegenständen stehen. — Die Erlebnisse, in denen uns etwas
bewußt wird, haben ferner eine Ich-Bezogenheit: sie sind meine
Erlebnisse. Genauso wie sich das Gegebensein von Gegenständen in
Erlebnissen und deren Beziehung auf die Gegenstände auf mannigfache
Weise deuten läßt und daher ein zentrales Problem bildet, ist die
Ich-Bezogenheit der Erlebnisse ein zweites zentrales Problem jeder
derartigen Phänomenologie, - und diese Ich-Bezogenheit ist denn auch in
der Tat in verschiedener Weise verstanden worden. Auf die Differenzen
dieser Interpretationen und Deutungen kommt es uns hier nicht an.
Vielmehr richten wir unser Augenmerk nur darauf, was ihnen deshalb
gemeinsam ist, weil es ihnen als Problem zugrunde liegt. Daß alle
Erlebnisse eine Ich-Bezogenheit haben, heißt : wenn uns ein Gegenstand
in einem Erlebnis gegeben ist, ist uns zugleich gegeben, daß wir den
1 Der Ausdruck „Gegenstand" wird hier zunächst in einem völlig vagen, in keiner Weise
theoretisch festgelegten Sinne verwendet und bedeutet nur: etwas, das für uns in
Betracht kommt. Diese Tatsache aber, daß alles, was immer für uns in Betracht kommt,
als Gegenstand angesprochen wird und eine obschon nie diskutierte und kaum
explizierte „Theorie" enthält (und welcher A n sie ist), wird in § 3 zur Sprache kommen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
4 Das traditionelle Problem
Gegenstand in bestimmter Weise erleben. Jede Wahrnehmung, Erinne-
rung, Phantasie, jeden Schmerz, jede Trauer, jede Freude usw. erlebe ich
als meine Wahrnehmung, als meine Erinnerung, als meinen Schmerz,
als meine Freude usw. Jedes Erlebnis trägt gewissermaßen einen Index,
durch den es als mein Erlebnis charakterisiert wird. Erst angesichts der
Frage nach den Interpretationsmöglichkeiten dieses Index beginnen die
erwähnten hier nicht in Betracht zu ziehenden Differenzen. — Unter den
Erlebnissen, in denen mir Gegenstände bewußt werden, gibt es nun
ausgezeichnete Erlebnisse. Es sind diejenigen, in denen ein Gegenstand
nicht bloß „vorgestellt", nicht bloß gemeint oder gar nur „symbolisch
repräsentiert" wird, sondern in denen er selbst „leibhaftig" und
„originär" zur Gegebenheit kommt 2 . An dem, was in solchen ausgezeich-
neten Erlebnissen gegeben ist, muß sich jede Aussage, jede Vermutung,
jede wissenschaftliche Theorie messen und bewähren. Beschränken wir
uns auf die dinglich-reale, raum-zeitliche Welt, in der wir uns befinden, so
stellen für deren Gegenstände die Wahrnehmungserlebnisse ausgezeich-
nete Erlebnisse dar, in denen uns die fraglichen Gegenstände „leibhaftig"
und „originär" gegeben sind. Was immer wir über diese Gegenstände
behaupten oder vermuten, das muß sich an den Gegebenheiten der
Wahrnehmung bewähren, wie andererseits alles, was wir mit Sicherheit
von ihnen sagen können, auf Wahrnehmungen zurückweist, aus denen
diese Sicherheit und Gewißheit ihr Recht schöpft. In Wahrnehmungen
kommen uns Steine, Bäume, Häuser, und was sonst noch in der
dinglich-realen Raum-Zeit-Welt vorhanden ist, zur Gegebenheit. Auch
unsere Mitmenschen gehören zu dieser Welt ; — auch von ihnen wissen
wir, indem wir sie wahrnehmen, und wir nehmen sie neben und unter
Dingen, Pflanzen und Tieren wahr. In der Wahrnehmung also wird uns
der Mitmensch „originär" gegeben.
Was ist uns nun vom Mitmenschen gegeben, wenn wir ihn wahrneh-
men? Die traditionelle Beschreibung bestimmt den Gehalt solcher
Wahrnehmungen folgendermaßen: wir sehen Bewegungen und andere
Veränderungen an Körpern, die mit denen unseres eigenen Körpers 3
2 „Leibhafte" und „originäre" Gegebenheit wird hier in dem Sinne verstanden, in dem
HUSSERL diese Termini geprägt und in seinen Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie [erstes Buch], Halle an der Saale 1913, durchgehend
verwendet hat [vgl. z . B . § 24, S. 43 — 44; Husserliana III, S. 52],
3 Das Verhältnis zwischen mir und meinem Körper gehört ebenfalls zu den aus dem
genannten bewußtseinsphänomenologischen Ansatz erwachsenen Problemen und ist
von verschiedenen Forschern verschieden gedeutet worden, — worauf hier nicht
einzugehen ist —.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Ausgangspunkt der traditionellen Theorien 5
weitgehend eine Ähnlichkeit aufweisen. Menschliche Körper und
Körperorgane bewegen sich in verschiedenem Tempo. Solche Bewegun-
gen meinen wir, wenn wir sagen, daß der andere Mensch langsam oder
schnell geht, läuft, usw. Wir sehen Bewegungen seiner Gliedmaßen : sein
Arm hebt sich, die Faust ballt sich, oder was es sonst noch an Gesten gibt,
die der Andere ausführt. Wir nehmen ferner Veränderungen seiner
Gesichtsmuskulatur wahr, die wir je nachdem als Lachen, Weinen,
Stirnrunzeln und dergleichen bezeichnen. Der andere Mensch verändert
zuweilen seine Gesichtsfarbe : er wird rot oder blaß. Alle diese Verände-
rungen kommen nicht nur einzeln, sondern auch in bestimmten
Kombinationen vor. Wenn der Mitmensch spricht, so sehen wir die
Bewegungen seines Mundes, Gesten, mit denen er sein Sprechen unter
Umständen begleitet, und hören die Laute, die er hervorbringt. Diese
Laute verstehen wir: sie haben für uns Bedeutungen, mittels deren sie
bestimmte Sachverhalte bezeichnen. Indem wir sie hören und verstehen,
erleben wir Gedanken über die betreffenden Sachverhalte. Diese Gedan -
ken sind — wegen der durchgehenden Ich-Bezogenheit aller Erlebnisse —
meine Gedanken, ich erlebe sie, mir sind sie jetzt gegeben usw. Daß der
Andere, der spricht und dem ich zuhöre, Gedanken (und zwar in
bestimmtem Sinne dieselben Gedanken wie ich) erlebt, das nehme ich
zwar an, indem ich ihm „diese Gedanken einlege", aber in der
unmittelbaren originären Wahrnehmung ist mir das nicht gegeben.
Letzteres gilt überhaupt und allgemein für das, was in der Wahrnehmung
des Mitmenschen originär gegeben ist. Was die traditionelle Beschreibung
an Beständen der Wahrnehmung vom Mitmenschen gelten läßt, betrifft
ausnahmslos physische Qualitäten und deren Veränderungen. Wenn wir
ein strahlendes Gesicht sehen, dann besagt das, daß wir bestimmte
Veränderungen der Gesichtsmuskulatur wahrnehmen. Die Freude oder
das Glück, das —wie man zu sagen pflegt — in dem strahlenden Gesicht
liegt, nehmen wir hingegen nicht wahr. Die Wahrnehmung richtet sich
durchwegs nur auf Physisches oder auf Veränderungen von Physischem ;
— seelische Vorgänge und Zustände kennen wir nur als unsere eigenen.
An fremdseelischen Geschehen enthält die Wahrnehmung nichts, — in
ihr sind uns allein die Mitmenschen originär gegeben. Daß es überhaupt
Seelisches gibt, und wie dieses beschaffen ist, daß es mannigfache und
verschiedene seelische Vorgänge und Geschehnisse gibt, und welche diese
sind, das alles wissen wir lediglich aus der eigenen „Innenerfahrung" und
der „Selbstbeobachtung", jedoch nicht aus unserer Erfahrung von
anderen Menschen. Wie weit die Wahrnehmung des Mitmenschen auch
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
6 Das traditionelle Problem
gehen und wieviele Einzelheiten sie auch umfassen mag, niemals kommen
wir über den Bereich physischer Qualitäten und Veränderungen hinaus,
niemals stoßen wir in der Wahrnehmung auf Fremdseelisches.
Dieser bewußtseinsphänomenologische Befund steht in Kontrast zu
den Gewohnheiten unseres alltäglichen Lebens. Wenn uns jemand mit
strahlendem Gesicht etwas erzählt, so erleben wir im Alltag nicht eine uns
verständliche Mitteilung eines Sachverhaltes, die außer von Mundbewe-
gungen auch noch von charakteristischen Verschiebungen der Gesichts-
muskulatur begleitet ist. Vielmehr meinen wir aus seinen Worten
u n m i t t e l b a r seine Freude herauszuhören, sie u n m i t t e l b a r seinem
Gesicht anzusehen. Niemals kommt uns im Alltagsleben der Gedanke,
daß wir das, was in unserem Mitmenschen vorgeht, nicht unmittelbar in
der Wahrnehmung selbst haben. Immer und überall ist unser alltägliches
Verhalten davon geleitet, daß wir u n m i t t e l b a r zu wissen glauben, was in
den Menschen psychisch vorgeht, mit denen wir in den mannigfachen
Weisen umgehen. Ob die anderen Menschen beseelte und bewußte Wesen
sind, wird uns ebenso wenig fraglich, wie der Umstand, daß wir der
Anderen u n m i t t e l b a r ansichtig werden. Es handelt sich hierbei um eine
„Überzeugung" unseres alltäglichen Lebens, die wir immer schon haben.
Wir können uns keiner Zeit erinnern, zu der wir diese Überzeugung
gewonnen hätten, während wir von anderen Uberzeugungen des alltägli-
chen Lebens wohl angeben können, daß sie uns dann und dann, aufgrund
jener bestimmter Umstände erwachsen sind; — ganz zu schweigen davon,
daß es keiner theoretischen oder sonstigen Überlegungen bedarf, noch je
bedurfte, um zu dieser „Uberzeugung" zu gelangen oder sie zu bestärken.
Diese „Uberzeugung" wird im alltäglichen Leben nicht einmal ausdrück-
lich ; wir leben und handeln nach ihr, aber wir pflegen in keiner Weise über
sie nachzudenken, um uns ihrer explizit zu vergewissern. Sie gehört zu
den Selbstverständlichkeiten unseres alltäglichen Lebens, die immer „da
sind".
§2 Die gemeinsame Wurzel der beiden traditionellen Probleme
Aus dem vorhin dargestellten Kontrast ergibt sich für jede von dem
umschriebenen Ansatz ausgehende Philosophie eine Problematik des
Wissens um Fremdseelisches. Genauer besehen stellen sich hier zwei
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die gemeinsame Wurzel der beiden traditionellen Probleme 7
Fragen. Wenn man auch die Meinung des alltäglichen Lebens, wir hätten
ein unmittelbares Wissen von Fremdseelischem, als Vorurteil und
Irrtum entlarvt, so muß jede auf dem angegebenen Befund aufbauende
Theorie zweierlei leisten : sie muß nicht nur aufzeigen, wie wir zu einem
Wissen von Fremdseelischem kommen, sondern auch den Ursprung jener
angeblichen „Täuschung" aufdecken ; sie muß zeigen, wie wir von dem
angegebenen bewußtseinsphänomenologischen Befund aus zu einem
derartigen Wissen kommen, daß wir glauben, wir entnähmen es
unmittelbar der Wahrnehmung unserer Mitmenschen. Wie komme ich,
dem unmittelbar nur meine eigenen Bewußtseinsinhalte gegeben sind,
dazu, von den Bewußtseinsinhalten eines anderen Menschen etwas zu
wissen? Wie gelange ich dazu, von einem anderen Menschen als von
einem anderen Ich zu sprechen, ihn als Menschen, d. h. als lebendiges,
bewußtes Wesen anzusprechen ? Wie tritt mir der Andere als anderes Ich
gegenüber, und zwar so, daß im alltäglichen Leben mir dieses Wissen in
keiner Weise als problematisch erscheint? — Das zweite Problem betrifft
die Begründung dieses Wissens. Wenn wir auf irgendeine Weise schon zu
dem Glauben gelangt sind, daß wir etwas von den seelischen Vorgängen
unserer Mitmenschen wüßten, wie kann sich dieser Glaube dann
legitimieren? Worin beruht sein Recht, das ihn von einer aufgrund
irgendwelcher psychologischer Mechanismen entstandenen Illusion un-
terscheidet? Wie weist er sich als vernünftig motivierter und fundierter
aus?
Diese beiden Probleme hat man als das psychologische und erkennt-
nistheoretische Problem bezeichnet und unterschieden. Auf diesen
Unterschied von psychologischer oder — wie es zuweilen heißt —
„psychogenetischer" und erkenntnistheoretischer Fragestellung und
Betrachtung ist gerade in neuerer Zeit das größte Gewicht gelegt worden.
Störring4 ζ. B. wendet sich unter Berufung auf diesen Unterschied gegen
die „Analogieschlußtheorie", die nur „psychologische Bedeutung" hat.
Zur erkenntnistheoretischen Rechtfertigung des Analogieschlusses be-
darf es nach ihm „fester Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Tatbestän-
den". Daher kann die Existenz eines fremden Ich nur mit Hilfe des
allgemeinen Kausalprinzips gesetzt werden ; aus diesem allein kann diese
Setzung ihr Recht schöpfen. Während Störring die Analogieschlußtheorie
(die nach ihm dem psychologischen Problem Genüge zu tun vermag)
durch das allgemeine Kausalpripzip erkenntnistheoretisch nur untermau-
4 G. STÖRRING, Einführung in die Erkenntnistheorie, Leipzig 1909, S. 60 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
8 Das traditionelle Problem
ern will, klafft bei anderen Forschern die psychologische und die
erkenntnistheoretische Betrachtung noch stärker auseinander. So findet
Russell5 im Analogieschluß eine einigermaßen zureichende Rechtferti-
gung für den „Glauben" (belief) an die Existenz von Fremdseelischem.
Aber er betont selbst, daß wir diesen „Glauben" immer schon haben,
„not because of any argument, but because the belief is natural to us".
Seine Entstehung scheint Russell, der sich über diesen Punkt nur
gelegentlich äußert, auf „intuition" zurückzuführen, die er als „an aspect
and development of instinct" bezeichnet, ohne dies näher zu analysieren6.
Jedenfalls können wir uns bei aller philosophischen Reflexion dieses
„Glaubens" nicht erwehren, „so that the question whether our belief is
justified has a merely speculative interest" 7 . Die philosophische Reflexion
stellt nur fest, daß dieser „Glaube" — obwohl er logisch ursprünglich ist,
da wir im aktuellen Vollzug keinen Analogieschluß und/oder sonstige
Schlüsse zu ziehen pflegen — dennoch psychologisch abgeleitet, d. h. kein
ursprüngliches Datum ist. Somit gehört er nicht zu den „hard data".
Vielmehr wird er von der Wahrnehmung der Körper anderer Menschen
abgeleitet" „and is felt to demand logical justification as soon as we
become aware of its derivateness"'. Am entschiedensten ist die Unter-
scheidung der psychologischen von der erkenntnistheoretischen Frage-
stellung bei Becher durchgeführt, weil dieser Autor10 für jedes der beiden
Probleme eine vollständig durchgeführte Theorie aufgestellt hat. Auch er
hält den Analogieschluß zur erkenntnistheoretisch-logischen Rechtferti-
gung und Begründung unseres Wissens um Fremdseelisches für notwen-
dig; — aber nur in dieser Funktion, nämlich als substituierte logische
Begründung eines Wissens, das faktisch auf anderem Wege entsteht und
zustande kommt, erkennt er den Analogieschluß an. Für das psychologi-
sche Problem verweist Becher auf die Theorie der „apperzeptiven
Ergänzungen" von B. Erdmann11.
5 B. RUSSELL, Our Knowledge of the External World, London 1922, S. 93 f.
6 RUSSELL, a.a.O., S. 21 ff.
7 RUSSELL, a.a.O., S. 96.
! Vgl. RUSSELL, a.a.O., S. 69: „from the expression of a man's face we judge as to what he is
feeling: we say we see that he is angry, when in fact we only see a frown."
' RUSSELL, a.a.O., S. 72.
10 Vgl. E. BECHER, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, München/Leipzig
1921, S. 119 und 288 ff.
11 Vgl. B. ERDMANN, „Erkennen und Verstehen", Sitzungsberichte der Kgl. Pr. Akademie
der Wissenschaften, Jg. 1912, S. 1240 ff. ; über Becher vgl. § 5 dieses Kapitels.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die gemeinsame Wurzel der beiden traditionellen Probleme 9
Gegenüber dieser von Becher pointierten, aber auch noch von anderen
Forschern12 außer der genannten vertretenen Unterscheidung des er-
kenntnistheoretischen und psychologischen Problems, müssen wir auf
die gemeinsame Wurzel dieser beiden Probleme hinweisen. Diese liegt
iii dem bewußtseinsphänomenologischen Ansatz beschlossen, auf dessen
Grundlage überhaupt eine Problematik des Wissens um Fremdseelisches
erst entsteht und die sowohl in die erkenntnistheoretische wie in die
„psychogenetische" Betrachtung eingeht. Beide gewinnen erst dadurch
ihren Sinn, daß sie erst auf der Grundlage dieses Ansatzes als eines
bewußtseinsphänomenologischen Befundes verständlich werden. Ge-
meinsame Uberzeugung aller Forscher ist, daß unmittelbar nur Körper-
liches wahrgenommen und erfahren wird. Infolgedessen ist das mit
diesem Körperlichen „verbundene" Fremdseelische ein zu erklärender
bzw. ein zu rechtfertigender Tatbestand13. Diese ursprüngliche Annahme,
die sich auf den genannten bewußtseinsphänomenologischen Befund
beruft und sich an ihm ausweist, ist das gemeinsame Fundament und
Motiv der beiden Betrachtungsweisen, auf deren Verschiedenheit und
Trennung man ein so großes Gewicht zu legen pflegt. So stellt sich das
Problem des Wissens um Fremdseelisches ursprünglich und seiner
Wurzel nach weder als ein erkenntnistheoretisches noch als ein
12 Vgl. z . B . den noch extremeren Standpunkt von R. CARNAP, Scheinprobleme in der
Philosophie, Berlin 1928. Im psychologischen Ablauf haben wir in „intuitiver
Einheit" die Wahrnehmung von Physischem und die Vorstellung von Fremdpsychi-
schem (allerdings ist diese Vorstellung von Fremdpsychischem, z.B. die eines
Freudegefühls eine Vorstellung „eines Freudegefühls in eigenpsychischem Sinne, ein
anderes kenne ich ja nicht", S. 37 [1966, S. 66]). Nehmen wir aber nachträglich eine
„rationale Nachkonstruktion" vor, so zeigt sich die Entbehrlichkeit der Vorstellung von
Fremdpsychischem: wir können aus der Wahrnehmung „der physischen Zeichen"
(gesprochener Wörter als Geräusche, geschriebener Wörter als Strichfiguren, gesehener
Gesichtsmuskelkontraktionen) und aus dem aufgrund früherer Erfahrungen erworbe-
nen Wissen um die Bedeutung dieser Zeichen das Fremdpsychische ableiten und
erschließen [vgl. 1966, S. 33 — 34]. Die Konsequenzen hieraus entwickelt Carnap im § 11
des genannten Werkes [1966, S. 64 — 73], Vgl. auch J . VOLKEIT, Das ästhetische
Bewußtsein, München 1920, S. 117ff.), für den die Gewißheit vom „Du überhaupt,
vom fremden Ich im allgemeinen" mit der „Gewißheit des Ich" von sich selber
„einen Wesenszusammenhang" bildet und also mit der Ichgewißheit mitgegeben ist;
dieser Autor ist geneigt, den Analogieschluß in dem Sinne gelten zu lassen, daß er den
„längst vorhandenen selbstverständlichen Glauben an eine Welt fremder Ichs wissen-
schaftlich beweisen oder . . . wenigstens wahrscheinlich machen" kann.
13 Auch Volkelt, für den die Gewißheit von Du eine unmittelbare, ursprüngliche, eine
„intuitive Gewißheit" ist, akzeptiert diesen Ausgangspunkt (vgl. a.a.O., S. 118) und
polemisiert von da aus gegen Scheler ; vgl. a.a.O., S. 142 f. — Über Volkelts Begriff der
intuitiven Gewißheit vgl. sein Buch Gewißheit und Wahrheit, Leipzig 1918, Abschnitt
X, 2.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
10 Das traditionelle Problem
psychologisches heraus. Es gründet vielmehr in einem bestimmten
bewußtseinsphänomenologischen Ansatz; — von diesem wird sowohl
die erkenntnistheoretische wie auch die psychologische Fragestellung
abgeleitet, da sie in ihm fundiert ist. Freilich : wenn dieser Ansatz einmal
gemacht ist, führt er zu diesen beiden gesonderten bzw. zu trennenden
Problemen und Betrachtungsweisen.
§ 3 Bewußtseinsphänomenologie als Fundament von Erkenntnistheorie
und Psychologie
Der Zusammenhang zwischen Erkenntnistheorie und Psychologie, auf
den wir hiermit stoßen, betrifft nicht dieses spezielle Problem als solches.
Genau wie die Trennung der erkenntnistheoretischen und psychologi-
schen Betrachtung in diesem Fall eine Folge der allgemeinen Unterschei-
dung dieser beiden Disziplinen ist und sich daraus ergibt, daß man
allgemein und überhaupt die erkenntnistheoretisch-logische von der
psychologischen Fragestellung zu sondern pflegt, ist umgekehrt der
gegenseitige Bezug in unserem speziellen Falle eine Konsequenz des
allgemeinen und überhaupt bestehenden Zusammenhangs dieser beiden
Disziplinen. Um die Bedeutung des Zusammenhangs für unser spezielles
Problem zu sichern, gehen wir mit einigen grundsätzlichen Bemerkungen
auf den allgemeinen Bezug ein, um von da aus zu unserer spezifischen
Frage vorzudringen.
In jeder Erkenntnistheorie spielt der Unterschied zwischen unmittel-
bar und mittelbar Gegebenem eine zentrale Rolle. Begründung und
Rechtfertigung beziehen sich jedoch nur auf solche Erkenntnisse, die das
unmittelbar Gegebene nicht schlicht explizieren. Die Legitimation des
unmittelbar Gegebenen ist kein sinnvolles Problem, denn dieses legiti-
miert sich durch sich selbst. Auch da, wo man den Begriff des unmittelbar
Gegebenen aus der Grundlegung der Erkenntnistheorie verbannen will
und die absolute Eigenständigkeit der Logik, d. h. des reinen, auf keinen
„Vorinhalt" sich stützenden Denkens behauptet (wie ζ. B. in der
Marburger Schule), macht sich — nun allerdings stillschweigend und
ungeprüft — eine ganz bestimmte als selbstverständlich genommene
Auffassung vom unmittelbar Gegebenen in der konkreten Ausarbeitung
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Bewußtseinsphänomenologie als Fundament von Erkenntnistheorie und Psychologie 11
einer so orientierten Erkenntnistheorie geltend14. Ist aber die zentrale
Bedeutung des Begriffes des unmittelbar Gegebenen für die Erkenntnis-
theorie nachgewiesen, so ist damit deren Wurzel in der Bewußtseinsphä-
nomenologie aufgedeckt. Denn je nach dem bewußtseinsphänomenologi-
schen Ansatz, der einer Erkenntnistheorie zugrunde liegt, je nachdem,
was sie stillschweigend oder ausdrücklich als unmittelbar Gegebenes faßt
und in ihre Untersuchungen einbezieht, stellen sich ihr die erkenntnis-
theoretischen Probleme und bestimmen sich ihr die Wege, die sie zur
Bearbeitung dieser Probleme einschlägt; — Sinn und Relevanz der
erkenntnistheoretischen Probleme erwachsen aus dem der Erkenntnis-
theorie vorgelagerten bewußtseinsphänomenologischen Bereich, sie be-
stimmen sich aus der Deutung der Struktur und allgemeinen Artung des
Bewußtseins als solchen. Diese Grundanschauungen über das Wesen des
Bewußtseins können auch als Leitprinzipien der Erkenntnistheorie
angesehen werden : in bezug auf sie werden deren leitenden Motive und
theoretischen Ansätze erst voll verständlich. Was und in welchem Sinne in
einer Erkenntnistheorie Problem ist und welche Lösungsmöglichkeiten
sich ihr darbieten, hängt in großem Umfange davon ab, was man als
Eigenschaft des Bewußtseins ansieht, wie man dieses bestimmt usw.
Wenn das Problem der „Synthesis des Mannigfaltigen" in der Erkennt-
nistheorie der Neuzeit eine derart zentrale Bedeutung erworben hat, daß
es im Grunde beinahe nur um dieses eine Problem zu gehen scheint, so
liegt das daran, daß man den phänomenologischen Urbefund als eine
Mannigfaltigkeit angesetzt hat, die einer Synthese erst bedarf. Ebenso
bestimmt sich der Sinn der Synthesis durch die Deutung dessen, als was
das Mannigfaltige, das da zur Einheit gebracht werden soll, seinem Wesen
nach angesetzt ist15. Daher gehen die entscheidenden Wendungen der
erkenntnistheoretischen Problematik auf Neubestimmungen bewußt-
seinsphänomenologischer Ansätze zurück und sind durch diese moti-
viert. So ist der Fortschritt von Hume zu Kant darin zu erblicken, daß der
letzte den bewußtseinsphänomenologischen Ansatz Humes entscheidend
14 Vgl. z. B. die Selbstverständlichkeit, mit der H. COHEN, Logik der reinen Erkenntnis,
Berlin 1914, S. 91, von der „Empfindung" behauptet, daß es für sie „nur Diskretion gibt,
oder gar nur die Einheit eines Haufens". — Zur Kritik dieser Lehre des „logischen
Idealismus" vgl. N. HARTMANN, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Berlin/
Leipzig 1925, Kap. 50; ferner die prinzipiellen Bemerkungen von W. DILTHEY,
Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 148 ff.
15 Vgl. A. GURWITSCH, „Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich", Psychologische
Forschung, XII (1929), S. 297f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
12 Das traditionelle Problem
modifiziert hat. Hume f aßte das Bewußtsein als Schauplatz von Gegeben-
heiten und als Chaos von Inhalten, wobei diese Inhalte als reine Daten, als
bloße Vorkommnisse im Bewußtsein verstanden wurden ; alle Sinnpro-
bleme, wie z. B. das der Einheit und Identität des Gegenstandes, wurden
damit in Tatsachenprobleme umgedeutet, die mit Hilfe der Gesetze
erklärt werden sollten, welche das faktische Auftreten der Bewußtseinsin-
halte als bloßer Daten beherrschen. Diesen Ansatz Humes nimmt Kant
zugleich auf und modifiziert ihn insofern, als das Mannigfaltige der
Vorstellung nun der Bedingung unterstellt wird, „ins Bewußtsein
aufgenommen" werden zu müssen : „wir sind uns a priori der durchgängi-
gen Identität unserer selbst in Ansehung aller Vorstellungen, die zu
unserem Erkenntnis jemals gehören können bewußt als einer notwendi-
gen Bedingung der Möglichkeit aller Vorstellungen.. ." 16 „ . . . das ur-
sprüngliche und notwendige Bewußtsein der Identität seiner selbst [ist]
zugleich ein Bewußtsein einer ebenso notwendigen Einheit der Synthesis
aller Erscheinungen nach Begriffen . . Damit ergibt sich ein Bewußt-
seinsbegriff, der den einheitlichen Vollzug der Synthesis des Mannigfalti-
gen als wesentlich erachtet. Bewußtsein haben bedeutet : die „zerstreute
Mannigfaltigkeit" zur Einheit bringen . . .
Was die Problematik der Psychologie angeht, so liegt es für diese auf der
Hand, daß ihre Probleme sich als Folge davon ergeben, was man als
Grundbestimmungen des Psychischen ansieht und worin man dessen
Wesen erblickt (das in der Neuzeit übrigens mit dem Bewußtsein
gleichgesetzt wird) 18 , wie sich ja umgekehrt aus den der Psychologie
zugrunde liegenden bewußtseinsphänomenologischen Ansätzen verste-
hen läßt, warum sich ihr gerade diese bestimmten P r o b l e m e stellen. So
ist es auch von diesem Hintergrund her zu erklären, daß und warum sich
ihr eben diese G e d a n k e n g ä n g e für den theoretischen Aufbau anbieten.
Die entscheidenden Fortschritte auch der Psychologie beruhen im
Grunde stets auf Berichtigungen bewußtseinsphänomenologischer Vor-
aussetzungen, d. h. darauf, daß die Prinzipienfragen der Psychologie
16 KANT, Kritik der reinen Vernunft, Akademie-Ausgabe, Bd. IV, S. 87 [A 116];
entsprechend in der 2. Auflage der Akademie-Ausgabe, Bd. III, S. 109.
17 KANT,a.a.O.,Bd.IV,S. 82,[A108];vgl.auchBd.III,S. 110[B134]:„ . . .nurdadurch,
daß ich das Mannigfaltige derselben [sei. der Vorstellungen] in einem Bewußtsein
begreifen kann, nenne ich dieselben insgesamt meine Vorstellungen, denn sonst würde
ich ein so vielfarbiges verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich
mir bewußt bin."
18 Vgl. hierzu H. SCHMALENBACH, „Die Entstehung des Seelenbegriffs", Logos, XVI (1927),
S. 313 f.; ferner „Das Sein des Bewußtseins", Philosophischer Anzeiger, IV (1930), § 2.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Bewußtseinsphänomenologie als Fundament von Erkenntnistheorie und Psychologie 13
erneut akut werden. Das gilt für die heutige Gestalttheorie ebenso wie für
Diltheys Idee einer „beschreibenden und zergliedernden Psychologie".
Hinter beiden" steht eine jeweils neue Auffassung der Struktur des
Bewußtseins — neu in bezug auf diejenige, welche den Aufbau der
traditionellen, von Dilthey als „erklärend" und „konstrutiv" bezeichne-
ten Psychologie beherrschte, — ohne daß sich freilich diese neue
Auffassung in Diltheys Arbeiten selbst restlos durchgesetzt hätte.
Aus dem Ausgeführten ergibt sich ¡weder E r k e n n t n i s t h e o r i e noch
Psychologie sind autark. Beide haben ihren U r s p r u n g in der
B e w u ß t s e i n s p h ä n o m e n o l o g i e . Auf den b e w u ß t s e i n s p h ä n o m e -
nologischen Boden als auf ihren U r s p r u n g sind die e r k e n n t n i s -
t h e o r e t i s c h e n und psychologischen Probleme z u r ü c k z u v e r f o l -
gen; sie sind in ihrer M o t i v i e r t h e i t durch bestimmte b e w u ß t -
seinsphänomenologische Fixierungen ihrem Sinne nach auf-
z u k l ä r e n . Weil diese Probleme bis zu ihrem Ursprung zurück verfolgt
werden können, erwächst ihnen gerade in dieser Relativierung hinsicht-
lich der zugrunde liegenden bewußtseinsphänomenologischen Ansätze
ein gewisses begründetes Recht. Von vorgegebenen bewußtseinsphäno-
menologischen Ansätzen aus wird man nämlich auf bestimmte erkennt-
nistheoretische und psychologische Fragestellungen geführt, die auf-
grund jener geradezu unabweislich sind.
Diese Einsicht muß für eine Interpretation der neuzeitlichen Psycholo-
gie und besonders der Erkenntnistheorie leitend sein. Von hier aus können
ferner die tieferen Gründe des Streites um den Psychologismus aufge-
deckt, wie auch die Motive aufgeklärt werden, die auf dem Boden einer
ganz bestimmten Bewußtseinsphänomenologie zu der Idee einer von aller
Psychologie (in jedem Sinne) emanzipierten „reinen" Erkenntnistheorie
führten. Daß es überhaupt zu einem „Erkenntnisproblem" und damit zu
einer Erkenntnistheorie in spezifisch neuzeitlichem Sinne kommen
konnte, liegt wiederum — was hier alles nicht näher ausgeführt werden
kann — an der das Denken der Neuzeit beherrschenden bewußtseinsphä-
nomenologischen Theorie.
Aus diesen Zusammenhängen erwächst auch der von Husserl inaugu-
rierten modernen Phänomenologie das Recht ihres Anspruchs, eine
Fundamentaldisziplin für alle philosophischen Wissenschaften zu sein.
Als Wesenslehre des reinen Bewußtseins und seiner Strukturen soll sie
" Für die Gestalttheorie vgl. besonders M. WERTHEIMER, „Untersuchungen zur Lehre von
der Gestalt", I, Psychologische Forschung, I (1922).
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
14 Das traditionelle Problem
„,erste* Philosophie . . .sein und aller zu leistenden Vernunftkritik die
M i t t e l . . . bieten" 20 . Mit Recht meint Husserl, daß die Ausbildung einer
strengen Bewußtseinspsychologie „die unabläßliche Vorbedingung ist für
jede Metaphysik und sonstige Philosophie — ,die als W i s s e n s c h a f t wird
auftreten können'" 21 . Auch die Psychologie findet demnach in der
Phänomenologie einen Rückhalt, indem sie zu ihr in einem analogen
Verhältnis steht wie die Physik zur Geometrie22. — All diese Feststellun-
gen Husserls entspringen der Einsicht, daß die philosophischen Diszipli-
nen insofern nicht autark sind, als sie inderBewußtseinsphänomenologie
ihre Wurzeln haben23. Damit die philosophischen Lehren der Idee der
Philosophie, nämlich der Idee absoluter Erkenntnis, gerecht werden,
müssen sie sich auf eine hinreichend ausgebildete Phänomenologie des
Bewußtseins stützen können. Dieses Fundament, das der Philosophie die
Absicherung ihrer wissenschaftlichen Entwicklung verbürgen soll, will
Husserl in und mit seiner Phänomenologie bereitstellen.
§4 Zur Analogieschlußtheorie
Aus der vorhergehenden Skizze ergibt sich im Hinblick auf unser
Problem, daß sich jede erkenntnistheoretische Untersuchung an den ihr
zugrunde liegenden bewußtseinsphänomenologischen Befunden orien-
tieren muß. Sie hat aufzuweisen, wie der an die allein unmittelbar
gegebenen Wahrnehmungen fremder Körper, ihrer Bewegungen und
sonstigen Veränderungen sich verknüpfende Glaube an Fremdseelisches
vom phänomenal Gegebenen her „vernunftgemäß" gerechtfertigt werden
kann. Sie muß ferner die dem Phänomenalen selbst innewohnenden
Vernunftmotive dieses vermeinten Wissens aufweisen und sie im Laufe
ihrer Untersuchung verwerten. Dabei ist der ständige Rückbezug auf
Phänomenales unerläßlich : jeder Schritt, jede Wendungen und Differen-
zierungen muß sich am entsprechenden Phänomen ausweisen lassen und
an diesem orientiert sein. Schließlich muß die Erkenntnistheorie auch dem
phänomenalen Charakter dieses unseres vermeintlichen Wissens selbst
20 HUSSERL. Ideen, S. 121 [Husserliana III, S. 151].
21 HUSSERL, a.a.O., S. 5 [Husserliana III, S. 8],
22 HUSSERL, a.a.O., S. 159 [Husserliana III, S. 193 f.].
23 Vgl. auch HUSSERL, „Philosophie als strenge Wissenschaft", Logos, I (1910/1911), S.
300ff. und 314ff. [1965, S. 20ff. bzw. S. 37ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Zur Analogieschlußtheorie 15
gerecht werden, d. h. dem Charakter, den es als „Überzeugung" unseres
alltäglichen Lebens hat. Dieses Wissen ist so darzustellen, wie es in
unserem alltäglichen Leben faktisch zur Auswertung gelangt. Durch die
Zusammenstellung irgendwelcher Gründe, die unserem Glauben an
Fremdseelisches eine geringere oder größere Plausibilität verleihen und
unser Wissen im Sinne einer Wahrscheinlichkeit begründen, ist nicht das
geleistet, was von einer Theorie zu erwarten ist. Es handelt sich nicht um
Gründe, die gewissermaßen „im Leeren" schweben, sondern um eine
vernunftgemäße Motivation unseres Wissens um Fremdseelisches vom
Phänomenalen her. Die Orientierung am phänomenologischen Befund ist
also ein prinzipielles Erfordernis sowohl der erkenntnistheoretischen wie
der psychologischen Untersuchung, wobei die Orientierung selbstver-
ständlich an dem bewußtseinsphänomenologischen Befund zu erfolgen
hat, auf dessen Basis das ganze Problem erst auftaucht.
Diesen Erfordernissen wird die Analogieschlußtheorie nicht gerecht.
Der phänomenologische Charakter unseres Wissens um Fremdseelisches,
das wir im Modus der Selbstverständlichkeit haben und von dem wir
ständig unausdrücklich Gebrauch machen, wird verfehlt, wenn man
beispielsweise wie J . St. Mill den Vollzug des Analogieschlusses als eine
Art von Interpolation betrachtet. Aus meiner eigenen Erfahrung — führt
Mill 24 aus - kenne ich gleichförmige Folgen von (1) „modifications of my
body", (2) „feelings", (3) „outward demeanour". An anderen Menschen
nehme ich (1) und (3) wahr, nicht aber „the intermediate link. I find
however, that the sequence between the first and last is as regular and
constant in those other cases as it is in mine." Nun habe ich die Wahl, den
„intermediate link" bei den anderen Menschen in Analogie zu meinem
eigenen Erleben zu interpolieren (dann halte ich die Anderen für die
Wesen, die gleich mir lebendig sind) oder diese Interpolation zu
unterlassen (dann sind die Anderen Automaten). Die erste Möglichkeit,
d. h. die Interpolation, empfiehlt sich dadurch, daß „by supposing the
link to be of the same nature as in the case of which I have experience, and
which is in all other respect similar, I bring other human beings as
phenomena, under the same generalizations which I know by experience
to be the true theory of my own existence." Dieses Vorgehen, das eine
einheitliche Auffassung der Welt ermöglicht25, ist streng induktiv und
24 J. St. MILL, An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy, London 1889, S. 243.
25 „ . . . the generalization merely postulates that what experience shows to be a mark of the
existence of something within the sphere of our consciousness, may be concluded to be a
mark of the same thing beyond that sphere." [S. 244.]
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
16 Das traditionelle Problem
e x p e r i m e n t e l l ; es liegt hier n i c h t anders als i m Falle der N e w t o n s c h e n
H y p o t h e s e der einen Gravitation : man braucht nicht nachzuweisen, daß
es kein anderes P r i n z i p z u r E r k l ä r u n g der P l a n e t e n b e w e g u n g e n geben
kann, m i t d e m m a n die F a l l e r s c h e i n u n g e n auf der E r d e e r k l ä r t ; es
genügt, d a ß m a n m i t d e m einen G r a v i t a t i o n s p r i n z i p a u s k o m m t und
infolgedessen kein anderes P r i n z i p a n z u n e h m e n braucht.
A b g e s e h e n v o n den B e d e n k e n , die sich gegen das Verfahren Mills
richten, Lücken im physischen Geschehen durch Einführung von
p s y c h i s c h e n F a k t o r e n z u interpolieren u n d aus diesem Verfahren ein
P r i n z i p z u machen 2 6 , erreicht die Millsche T h e o r i e gar n i c h t ihr Ziel. D a s ,
w o r a u f sie hinzielt, ist etwas charakteristisch anderes als u n s e r alltägliches
W i s s e n u m andere M e n s c h e n als M e n s c h e n . D e n n 1. h a b e n w i r niemals
die W a h l , o b w i r die M i t m e n s c h e n für M e n s c h e n o d e r f ü r A u t o m a t e n
halten w o l l e n . E s gibt keine Situation, in der w i r u n s v o r eine solche
Entscheidung gestellt sähen, und es gibt infolgedessen auch keine
„ G r ü n d e " , m i t denen w i r nachträglich unsere E n t s c h e i d u n g rechtfertigen
k ö n n t e n , die deshalb keine E n t s c h e i d u n g ist, weil es für u n s jederzeit u n d
implizit s c h o n a u s g e m a c h t ist, d a ß w i r es m i t M i t m e n s c h e n z u t u n
h a b e n . 2 . g e h ö r t es z u r p h ä n o m e n o l o g i s c h e n E i g e n a r t dieser u n s e r e r
26 Ähnlich wie Mill auch E. MACH, Die Analyse der Empfindungen, Jena 1922, S. 4 und 27 ;
vgl. auch S. 29 : „Die Vorstellungen . . . von dem Bewußtseinsinhalt unserer Mitmen-
schen spielen für uns die Rolle von Zwischensubstitutionen, durch welche uns das
Verhalten der Mitmenschen . . . soweit dasselbe für sich allein (physikalisch) unaufge-
klärt bliebe, verständlich wird." — Zur Kritik des Millschen Verfahrens vgl. A. PRANOTL,
Einführung in die Philosophie, Leipzig 1922, S. 65 f. — Die Millsche Interpolationstheo-
rie führt auf ein prinzipielles biologisches Problem. Wenn eine rein „mechanistische"
Erklärung gegenüber gewissen biologischen Phänomenen versagt, pflegen die „vitalisti-
schen" Forscher, zumal es sich bei diesen Phänomenen um für das betreffende
Lebewesen „sinnvolle" Leistungen, bzw. um „Zweckmäßiges" handelt, psychische
oder quasipsychische Faktoren einzusetzen, die zu dem rein Mechanischen hinzukom-
men und dort weiter helfen sollen, wo man mit einer rein „mechanistischen" Erklärung
nicht auskommen zu können meint. Um diesen Punkt — die Tragweite der
„mechanistischen" Prinzipien in der Biologie — dreht sich die Kontroverse zwischen
„Mechanismus" und „Vitalismus", auf die hier natürlich nicht eingegangen werden
kann. Bemerkt sei nur, daß gerade auf dem Boden der traditionellen strengen
Unterscheidung zwischen Physischem und Psychischem die vitalistische Einführung
psychischer oder quasipsychischer Faktoren eine unerlaubte μετάβασις εις αλλο γένος
darstellt. Ferner liegt diesem Gedankengang die als selbstverständlich genommene
Voraussetzung zugrunde, daß die Unterscheidung physisch/psychisch zusammenfällt
mit der von mechanisch/sinnvoll, so daß also die Alternative blind physisch oder
sinnvoll psychisch nicht nur erlaubt, sondern beinahe selbstverständlich ist. Aber diese
Voraussetzung ist nichts weiter als ein Vorurteil, und die genannte Alternative ist schief
gestellt. Vgl. hierzu W. KOHLER, Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären
Zustand, Erlangen 1924.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Zur Analogieschlußtheorie 17
alltäglichen „Uberzeugung", daß sie weder auf eine Überlegung zurück-
verweist, aus der sie erwachsen ist, noch auf Gründe, aus denen wir uns zu
ihr entschlossen hätten. Gerade darin liegt der Unterschied zwischen
dieser „Überzeugung" und etwa dem Fall, wo jemand aus irgendwelchen
Überlegungen und gestützt auf irgendwelche Gründe zu der Uberzeu-
gung gelangt, daß es einen Gott gibt, welch letzterer Fall noch von dem
echten religiösen „An-Gott-glauben" unterschieden werden müßte. Die
Uberzeugung, daß es einen Gott gibt, verweist (als Uberzeugungsphäno-
men) ihrem Sinne nach auf Überlegungen und Gründe, auf denen sie
beruht. Weil nun aber in der alltäglichen „Überzeugung", daß die
Mitmenschen Menschen sind, etwas Analoges fehlt, gibt sie sich gerade
ihrem phänomenologischen Sinne nach weder als Entscheidung noch als
Überzeugung im eigentlichen Sinne, wenn man diesen Begriff prägnant
verstehen will27. Schließlich ist unsere Alltagsmeinung von unseren
Mitmenschen ihrer phänomenologischen Eigenschaft nach von einer
Hypothese radikal verschieden. Diese Verschiedenheit liegt nicht nur
darin, daß jede Hypothese als solche auf theoretische Erwägungen wie die
eben erwähnten verweist, und ein derartiger Verweis zu ihren phänome-
nologischen Eigenschaften gehört. Bei unserer Alltagsmeinung handelt es
sich nicht, wie im Falle einer Hypothese, um ein Einheitsprinzip, das eine
Mannigfaltigkeit von Erscheinungen erklärt. Diesbezüglich läge ein
psychologisches Analogon zur Newtonschen Gravitationshypothese
etwa in den Prinzipien der psychoanalytischen Theorien Freuds vor,
wobei letztere hier nur als B e i s p i e l in Betracht kommen, auf deren
S t r u k t u r allein es uns ankommt. Das traditionelle Problem unseres
Wissens um Fremdseelisches erscheint vielmehr in folgender Weise : wir
vermeinen, von unseren Mitmenschen etwas zu wissen, das uns gemäß
dem zugrunde liegenden bewußtseinsphänomenologischen Ansatz nicht
unmittelbar gegeben ist. Dann ist — gerade auf dem Boden dieser
traditionellen Problematik — nach der Genese und dem Recht dieses
vermeintlichen Wissens zu fragen. Macht man aber aus letzterem eine
Hypothese, so hat man nicht nur seine phänomenologische Eigenschaft
verfehlt, sondern auch den Boden gerade der traditionellen Problematik
verlassen. Wenn hier kein Hypothesenproblem vorliegt, so ergibt sich
auch daraus, daß man stets nur nach der G e n e s e und L e g i t i m a t i o n
27 Diesem phänomenologischen Befund suchen wir dadurch auch äußerlich gerecht zu
werden, daß wir, wenn von dieser Überzeugung die Rede ist, immer „Überzeugung" in
Anführungszeichen setzen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
18 Das traditionelle Problem
unserer „Überzeugung" vom Bewußtsein der anderen Menschen fragte,
niemals aber danach, ob die anderen Menschen Menschen oder
Automaten seien. Schon die Möglichkeit des Solipsismus erschien als
Absurdität. Aber nur auf diese Frage hat es einen Sinn, mit einer
Hypothese zu antworten.
Diese Bemerkungen richten sich gegen Mill wie auch gegen alle
Theorien, die dem phänomenologischen Charakter der in Rede stehenden
„Uberzeugung" nicht gerecht werden, weil sie die Fiktion einer
Entscheidung einführen, als wäre es uns freigestellt, für oder wider den
Solipsismus uns zu entschließen, wobei die Gründe unseres Entschlusses
nicht im Phänomenalen selbst liegen, sondern vielmehr aus anderen
Quellen stammen28.
§5 Die Bechersche Form der Analogieschlußtheorie
Gegenüber diesen Lehren stellt die Analogieschlußtheorie in der Form,
die Becher ihr gegeben hat, insofern einen Fortschritt dar, als dieser Autor
aufgrund der mit äußerster Konsequenz durchgeführten Trennung
zwischen der psychologischen und der erkenntnistheoretischen Proble-
matik (der jeweils eine besondere, eigens auf das betreffende Problem
zugeschnittene Theorie gewidmet ist) sich bemüht, den phänomenologi-
schen Charakter unserer alltäglichen „Uberzeugung" in Rücksicht auf
den Mitmenschen gerecht zu zu werden. Auch Becher29 spricht von der
„Hypothese des Bewußtseins der Mitmenschen und Tiere" und meint,
daß diese Hypothese, die uns zu einer lückenlosen, streng gesetzmäßigen
Auffassung des „Gesamtwirklichen" als eines kausal geordneten Zusam-
menhangs verhilft, — zusammen mit der Annahme einer bewußtsein-
stranszendenten Körperwelt, — sich mannigfach bewährt und „darum
durchaus berechtigt und höchst wahrscheinlich, ja praktisch so gut wie
28 Vgl. z . B . R . AVENARIUS, Kritik der reinen Erfahrung, Leipzig 1907, Bd. I , S . 1 4 ; Der
menschliche Welthegriff, Leipzig 1912, S. 7 ff. und 255 ff. ; H. CORNELIUS, Einleitung in
die Philosophie, Leipzig/Berlin 1911, S. 325ff.; ebenso MACH, a.a.O., S. 12ff., der das
physikalische Gebiet für vertrauter hält als das des Fremdseelischen.
29 BECHER, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, S. 87 und 284.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Bechersche Form der Analogieschlußtheorie 19
gewiß" ist30. Wenn sich gegen Becher nicht die gleichen Einwände erheben
lassen wie gegen Mill, obwohl die Theorie des ersteren weitgehend mit der
Interpolationstheorie Mills übereinstimmt, so liegt das daran, daß Becher
seinen Ansatz ausdrücklich als „erkenntnistheoretisch-logische Analyse"
und nicht als „psychologische Beschreibung" angesehen haben will". Es
geht ihm weder um eine phänomenologische Kennzeichnung unseres
Glaubens an Fremdseelisches — in dieser Beziehung handelt es sich, wie
er sagt, um eine „im praktischen Leben und in einzelwissenschaftlicher
Forschung. . . selbstverständliche Grundannahme" 32 , noch um deren
psychologische Genese — hierfür verweist er auf „assoziativ-reprodukti-
ve Prozesse", welche die „logisch vollständigen Schlüsse" vertreten oder
abkürzen, ihnen zeitlich vorangehen, und denen wir ohne weiteres
vertrauen, wenn nicht besondere Umstände vorliegen33. Ausschließlich
um die erkenntnistheoretisch-logische Rechtfertigung der vermeinten
„Einsicht in die fremde Seele" geht es ihm. Für diese glaubt er allerdings,
auf den Analogieschluß angewiesen zu sein, insofern als dem nicht durch
Schlüsse vermittelten und anscheinend unmittelbaren Erfassen des
Fremdseelischen eine „logische Begründung substituiert" werden muß.
Diese Leistung kann nach Becher nur der Analogieschluß erbringen34. Er
legt selbst den größten Wert darauf, daß Überzeugungen durch diesen
Schluß nachträglich gerechtfertigt werden, die „nicht aus den logisch
erforderlichen Begründungen, sondern aus irgend welchen anderen
psychologischen Prozessen erwachsen"33. Von da aus wird er dem
phänomenologischen Charakter des betreffenden Wissens eher gerecht,
obwohl dies, wie sich zeigen wird, nur mit Vorbehalten zugestanden
werden kann. Jedenfalls deutet er dieses Wissen, indem er auf dessen
30 Vgl. BECHER, a.a.O., S. 287: „Die sicher wahrgenommenen Realitäten, die unzweifelhaft
gegebenen Bestandteile meines Bewußtseins weisen keineswegs strenge, lückenlose
Gesetzmäßigkeit auf. Soll das Gesamtwirkliche einen streng gesetzmäßigen Zusammen-
hang bilden . .., so müssen Realitäten außerhalb meines Bewußtseins angenommen
werden. Erst wenn ich eine bewußtseinstranszendente Körperwelt und eine Welt des
Fremdseelischen annehme, erscheint die vorausgesetzte strenge Gesetzmäßigkeit des
Gesamtwirklichen möglich."
31 BECHER, a . a . O . , S. 91, ANM.
32 BECHER, a.a.O., S. 293. Dem Sinn dieser Selbstverständlichkeit, den wir soeben
herauszustellen versuchten (vgl. S. 6 und 16 f.), geht Becher allerdings nicht nach.
33 BECHER, a . a . O . , S. 289 f.
34 BECHER, a.a.O., S. 119.
35 BECHER, a.a.O., S. 289 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
20 Das traditionelle Problem
Selbstverständlichkeit und Unmittelbarkeit36 hinweist, nicht in der Weise
der im vorigen § genannten Forscher um. Ebenfalls unter Berufung auf
den Unterschied von Psychologie und Erkenntnistheorie versucht er den
Einwand Schelers37 abzuwehren, daß auch da ein Wissen um Fremdseeli-
sches vorliegt, wo man den Vollzug von Analogieschlüssen kaum
annehmen darf, ζ. B. bei Tieren.
Gegen die Analogieschlußtheorie auch in dieser ihrer reifsten Gestalt
erheben sich schwerwiegende Einwände. Da es uns hier auf den
Zusammenhang der Theorie mit dem bewußtseinsphänomenologischen
Befund ankommt, wollen wir den von Cassirer3' erhobenen, rein
erkenntnistheoretischen Einwand, „daß sich zwar von der Gleichheit der
Ursachen auf die Wirkungen, nicht aber umgekehrt. . . schließen läßt, da
ein und dieselbe Wirkung von ganz verschiedenen Ursachen hervorge-
bracht werden kann", nur erwähnen und bemerken, daß dieser Einwand
sich auch gegen den Becherschen „Gesetzmäßigkeits-Ähnlichkeits-
Satz" 39 richtet. Dagegen muß auf ein anderes für Becher wie überhaupt für
die Analogieschlußtheorie zentrales Moment etwas näher eingegangen
werden. Der Analogieschluß gründet auf der Ähnlichkeit fremder
körperlicher Bewegungen und Veränderungen mit den meinen und
schließt auf ein Fremdseelisches, das den Erlebnissen im Vollzug meiner
entsprechenden körperlichen Bewegungen ähnlich sind. Worin liegt nun
im Phänomenalen selbst die Ähnlichkeit fremder leiblicher Bewegungen
und Veränderungen mit den meinen? Der Zusammenhang zwischen
meinen Erlebnissen und denjenigen körperlichen Bewegungen, die ich als
Ausdrucksbewegungen meiner Erlebnisse zu bezeichnen gewohnt bin,
wird von der Analogieschlußtheorie als assoziativer Zusammenhang
36 Vgl. BECHER, a.a.O., S. 119: Wir „meinen . . . den Schmerz eines weinenden Kindes
direkt zu erfassen, und jedenfalls brauchen wir ihn nicht erst durch Schlußprozesse
festzustellen, sondern mit der Wahrnehmung des Weinens . . . ist auch sofort unser
Wissen um den Schmerz da".
37 Vgl. M. SCHELER, Wesen und Formen der Sympathie [abgekürzt : Sympathie], Bonn 1923,
S. 274 ff. [G. W. 7, S. 232 ff.]. Vgl. ferner BECHER, a.a.O., S. 288.
38 Vgl. E. CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Bd. III, Berlin 1929, S. 97.
Inwiefern die weiteren Ausführungen Cassirers, daß der Analogieschluß nur eine
Hypothese, „eine provisorische Annahme, eine bloße Wahrscheinlichkeit" begründen
kann, so daß „damit ein Satz, der für das Ganze unseres Weltbildes und unserer
Wirklichkeitsauffassung von wahrhaft universeller Bedeutung ist, auf die denkbar
schmälste erkenntnistheoretische Basis gestellt" ist, die Position Bechers treffen, dem es
um eine nachträgliche Begründung einer bereits vorher und anderweitig, d.h.
unabhängig von dieser Begründung erwachsenen Überzeugung geht, bleibe hier
dahingestellt.
35 V g l . BECHER, a . a . O . , S . 2 7 9 f f .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Bechersche Form der Analogieschlußtheorie 21
angesehen40. Das hängt mit allgemeinen Anschauungen zusammen, auf die
hier nicht einzugehen ist. Ein assoziativer Zusammenhang ist ein solcher,
bei dem das eine zum anderen hinzukommt, ohne daß eine innere und
sachliche „Ingerenz" des einen auf das andere bestünde. Erlebnis und
körperliche Bewegung sind also nur zugleich da; — der Zusammen-
hang zwischen ihnen ist der einer Summe, sie stehen in einer „Und-Ver-
bindung" im Sinne Wertheimers41. „Assoziation" ist nichts anderes als ein
Titel für das rein summative und in diesem Sinne zufällige Zugleich-da-
sein von innerlich-sachlich Disparatem oder mindestens zueinander
Indifferentem. Wenn auch oft oder sogar immer ein bestimmtes Erlebnis
mit einer bestimmten körperlichen Bewegung zugleich da ist, so ändert
keine Häufigkeit dieses Zugleich-da-seins etwas daran, daß immer nur
„Erlebnis + Bewegung" vorliegt, d. h. eine reine Summe, bei der der eine
Summand zum anderen lediglich hinzukommt, jedoch aller sachlichen
Beziehung zu ihm entbehrt. Das bedeutet : meine eigenen „Ausdrucksbe-
wegungen" sind rein physische Vorkommnisse, die zu bestimmten
Erlebnissen summativ hinzukommen42. Nehme ich fremde „Ausdrucks-
bewegungen" wahr, so habe ich wiederum ausschließlich rein Physisches
(etwas anderes kann ich ja definitionsgemäß nicht haben) — und erst der
Analogieschluß soll mich darauf führen, daß mit diesem Physischen
Erlebnisse assoziiert werden, wie ich sie aus meiner eigenen Erfahrung
kenne. Aus dem Da- oder Dabei-sein des einen Summanden soll ich auf
den zu ihm hinzutretenden anderen Summanden schließen, der prinzipiell
nur mittelbar gegeben sein kann. Der sich dabei vollziehende Schluß
gründet darauf, daß der wahrgenommene Summand mit dem entspre-
chenden Glied der aus meiner Selbsterfahrung bekannten Summe
Ähnlichkeit besitzt. Versteht sich aber bei dieser Sachlage, die eine Folge
des ursprünglichen Ansatzes darstellt, die Ähnlichkeit der wahrgenom-
menen fremden Bewegungen mit meinen eigenen Bewegungen — beide
als physische Vorkommnisse verstanden — ohne weiteres und von selbst?
Oder entstehen nicht vielmehr schwere Probleme gerade in bezug auf die
als fraglos vorausgesetzte Ähnlichkeit? Ich kann wohl von der Ähnlich-
keit ζ. B. meines Lachens mit dem Lachen eines anderen Menschen
40 Vgl. z.B. A. Prandtl, Die Einfühlung, Leipzig 1910, S. 26 f.
41 Vgl. M. Wertheimer, a. a. O.
42 Vgl. die Bemerkungen von Th. Lipps, Das Wissen von fremden Ichen, S. 704 f.
(Psychologische Untersuchungen, Bd. I, Leipzig 1907) gegen diese Interpretation der
eigenen Ausdrucksbewegungen. Auf Lipps' eigene Stellung zu dieser Frage kommen wir
später (S. 31 ff.) zu sprechen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
22 Das traditionelle Problem
sprechen, wenn ich beide Phänomene als Äußerungen der Freude
verstehe, d. h. als Ausdrucksphänomene nehme, in denen sich der
Zustand der Freude kundgibt. Dies würde bedeuten, daß diese Bewegun-
gen und Äußerungen innerlich und sachlich mit dem Zustand des
Sich-Freuens verbunden sind. Faße ich sie aber als Koexistenzen und
Sukzessionen von Geräuschen, Mundbewegungen und Verschiebungen
der Gesichtsmuskulatur auf, so erhebt sich die Frage, inwiefern sich nicht
nur die „Elemente" der beidseitigen Koexistenzen und Sukzessionen,
sondern auch diese den letzteren selbst ähnlich sind. Um hier von einer
Ähnlichkeit sprechen zu können, müßte ich die einzelnen „Elemente",
ihre Teile, Stücke, Momente usw. vergleichen, so wie man es beim
Vergleich etwa von Farbnuancen tut, wenn man diese als reine Empfin-
dungsdaten deutet. Diese Vergleiche führen immer auf Ähnlichkeiten in
dieser und jener Hinsicht, denen die auf individuellen Differenzen
beruhenden Ungleichheiten gegenüberstehen. Diese individuellen Diffe-
renzen — der Andere „lacht auf seine Weise", wie ich „auf meine Weise
lache" — treten ebenfalls als Verschiedenheiten der „Elemente" und ihrer
Teile (Teile im allgemeinsten Sinne) auf, und es liegt kein einsichtiger
Grund vor, die Verschiedenheiten zugunsten der Ähnlichkeiten zu
vernachlässigen, zumal beide, wie gesagt, als Relationen zwischen den
„Elementen" der fraglichen Koexistenzen und Sukzessionen bzw. als
Relationen zwischen diesen selbst in Betracht kommen43. Erst wenn ich
beide Male das Lachen als Lachen, d. h. als Ausdrucksphänomen
wahrnehme, komme ich zu einer entscheidenen Ähnlichkeit: weil
nämlich die psychischen Zustände selbst, die sich in beiden Ausdruck-
sphänomenen kundtun, einander ähnlich sind. Das aber ist vom
Ausgangspunkt der Analogieschlußtheorie aus gesehen eine petitio
principii. Am deutlichsten zeigt sich das angesichts der Hinweise Bechers
auf Ähnlichkeiten etwa hinsichtlich der Ausdrucksbewegungen und
Handlungen bei Fisch und Mensch44. Diese Ähnlichkeiten erwachsen erst
dann, wenn man die betreffenden Handlungen ihrem biologischen Sinne
nach betrachtet. Ja, sie bestehen nur zwischen dem biologischen Sinn der
Handlungen, nicht aber zwischen den Handlungen selbst. Das bedeutet :
sie bestehen nicht, wenn man die betreffenden Handlungen als reine
Bewegungs- und Veränderungsvorkommnisse auslegt. Auch für die von
43 Vgl. hierzu auch SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik
[abgekürzt: Formalismus], Halle 1927, VI, 3, e [S. 413-431 ; G. W. 2, S. 397-412],
44 Vgl. BECHER, a.a.O., S. 290 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Bechersche Form der Analogieschlußtheorie 23
Becher ins Feld geführten vergleichend anatomischen Betrachtungen gilt
dasselbe. Selbst wenn man, zumal für den Bereich des Menschlichen, die
Existenz von Ähnlichkeiten zwischen eigenen und fremden körperlichen
Bewegungen zugesteht, ergeben sich in bezug auf diese Ähnlichkeiten im
Phänomenalen weitere Schwierigkeiten. Aufgrund der Ähnlichkeit eines
lächelnden Gesichtes mit einem lachenden soll nach Becher45, wenn
einmal das sichtbare Lachen zum Zeichen der Freude und Heiterkeit
geworden ist, auch das sichtbare Lächeln zum Zeichen eines ähnlichen
Gemütszustandes werden. Inwiefern ist aber, wenn es lediglich auf
Verschiebungen der Gesichtsmuskulatur ankommt, das lächelnde Gesicht
dem lachenden ähnlicher als etwa ein höhnisch grinsendes? Sind die
beidseitigen Verschiebungen der Gesichtsmuskulatur so voneinander
verschieden wie es Heiterkeit und höhnische Schadenfreude sind? Kann
dieser Differenz überhaupt eine solche des Mienenspiels entsprechen,
wenn man das letztere als reines Bewegungsphänomen nimmt ? Anderer-
seits : muß sich der Andere in seinem Zorn ähnlich gebärden wie ich es in
meinem Zorn tue, damit ich auf seinen Zorn schließen kann? Wenn der
Andere auf seine Art zornig ist (d. h. auf die Art, die spezifisch ihm
entspricht), so wäre damit nach Becher wie auch der Analogieschlußtheo-
rie zufolge überhaupt mein Wissen um seinen Zorn unbegründet und
jedenfalls unsicher, wenn es auch dank gewisser psychologischer Mecha-
nismen zustande käme.
Aus dem Ausgeführten ergibt sich : weil sich die Analogieschluß-
theorie auf Ähnlichkeiten von Bewegungen, Handlungen und
sonstigen leiblichen Veränderungen beruft, verläßt sie den
Boden, auf dem ihre Problematik erwächst und allein sinnvoll
ist. Denn die Berufung auf die betreffenden Ähnlichkeiten hat zur
Voraussetzung, daß das Physische nicht mehr nur als bloß Physisches
aufgefaßt werden kann. Bei einem konsequenten Beharren auf dem als
Basis dienenden phänomenologischen Befund würde die Ähnlichkeit,
von der die Analogieschlußtheorie Gebrauch macht, zu einem ausweglo-
sen Problem Werden.
Es sei noch anhand einer Auseinandersetzung zwischen Scheler und
Becher dargelegt, inwiefern die Analogieschlußtheorie gerade in ihrer
ausschließlich erkenntnistheoretischen Festlegung da auf Schwierigkeiten
stößt, wo es sich um die Rechtfertigung ihrer Ausführungen in bezug auf
45 Vgl. BECHER, a.a.O., S. 288 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
24 Das traditionelle Problem
die ihr zugrundeliegende phänomenologische Basis handelt. Scheler46
hatte eingewandt, „daß wir ,Analogieschlüsse' nur da machen, wo wir
bereits die Annahme der Existenz einiger beseelter Wesen machen und
Kenntnis ihrer Erlebnisse haben, aber bei Gelegenheit von Ausdrucksbe-
wegungen, die denen uns bekannter anderer Wesen ähnlich sind, Zweifel
haben, ob einer Bewegung der Sinn einer Ausdrucksbewegung zukommt
(ζ. B. bei niederen Tieren . . . analog auch bei der Beurteilung von
Bewegungen Geisteskranker oder im Falle, da wir Simulation fürchten)."
Gerade darin, daß wir im Zweifelsfalle auf Analogieschlüsse rekurrieren,
sieht Becher47 eine Bestätigung seiner Thesen. Im Zweifelsfalle verlassen
wir uns nicht auf den bloßen Glauben, der aus „assoziativ-reproduktiven
Vorgängen", d. h. aus psychologischen Mechanismen resultiert, sondern
gehen zurück auf das, was diesen bloßen Glauben logisch rechtfertigt.
Daraus ergibt sich, daß der Analogieschluß allein das erkenntnistheoreti-
sch-logische Fundament für diesen Glauben darstellt, und zwar auch in
jenen Fällen, wo „sich die Erfassung des Fremdseelischen durch
ergänzende Apperzeption so glatt und sicher vollzieht, daß wir keinen
Anlaß spüren, sie durch logisch wohlgefügte Analogieschlüsse zu
rechtfertigen". Gegenüber diesen Ausführungen Bechers ist darauf
hinzuweisen, daß der Zweifel, den wir in diesen besonderen Fällen haben,
doch nicht willkürlich von uns hervorgerufen ist: vielmehr ist er ein
irgendwie k o n k r e t m o t i v i e r t e r . Wie komme ich überhaupt in einem
bestimmten Falle zum Verdacht der Vortäuschung, da mich dieser
Verdacht doch nicht ständig begleitet, wenn ich mit anderen Menschen zu
tun habe ? Die Fälle, in denen die Erfassung des Fremdseelischen sich glatt
und sicher vollzieht, müssen von jenen anderen, in denen Zweifel sich
regt, verschieden sein, und zwar so, daß gerade diese Verschiedenheit den
Zweifel motiviert. Diese Verschiedenheit kann aber nur durch das in
beiden Fällen phänomenal Vorliegende begründet werden. Halte ich ζ. B.
den Zornesausbruch eines Menschen nur für „vorgespielt", so muß mir,
damit ich überhaupt an der Echtheit seines Zornes zweifeln und zum
Verdacht der Vortäuschung kommen kann, phänomenal etwas anderes
gegeben sein, als in den Fällen, wo ich auf einen derartigen Verdacht gar
nicht komme und den Zorn des Anderen ohne weiteres ernst nehme48.
Diese Differenz zwischen dem in beiden Fällen unmittelbar Gegebenen
ist es, die den Verdacht und überhaupt den Zweifel motiviert und fundiert,
w Vgl. SCHELER, Sympathie, S. 276 [G. W. 7, S. 234],
47 V g l . BECHER, a . a . O . , S . 2 8 9 .
48 V g l . h i e r z u SCHELER, a . a . O . , S . 3 0 2 f . [ G . W . 7, S . 2 5 4 ] ,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Bechersche Form der Analogieschlußtheorie 25
denn in den von Scheler und Becher betrachteten Fällen handelt es sich
nicht um einen gleichsam· von außen eingeführten Zweifel, d. h. nicht um
jenen Versuch des universalen Zweifels, den wir gegenüber jedem Meinen
und Glauben willkürlich üben können, wie er etwa von Descartes
entwickelt wurde. Vielmehr ist der Zweifel hier konkret und den
Phänomenen immanent, weil er aus ihnen selbst erwächst. Würde man
sich darauf berufen, daß der Andere, wenn ich seinen Zorn nicht für echt
halte, wo ich ihm seinen Zorn glaube, so führt diese Berufung lediglich auf
ein von jenem anderen und früheren Zornerlebnis qualitativ verschiede-
nes Zornerleben, wie etwa dem lächelnden Gesicht eine qualitativ andere
Freude entspricht als dem lachenden. Niemals aber reichen derartige
Verschiedenheiten aus, um im einen Fall einen glatten Glauben, im
anderen den Verdacht der Vortäuschung zu motivieren. — Wenn Becher
die Fälle, bei denen Zweifel und Verdacht aufkommen, zur Stützung
seiner allgemeinen Analogieschlußtheorie verwendet, so stellt er sie in
eine Reihe mit jenen anderen Fällen des glatten und sicheren Vollzugs4'.
Damit übersieht er einen tiefen phänomenologischen Unterschied. Die
selbstverständliche Alltags-„Uberzeugung" steht zum Zweifel und Ver-
dacht der Vortäuschung nicht in dem Verhältnis eines „Urglaubens" zu
einer „modalisierten Glaubensweise" 4 '; denn der Zweifel betrifft gar
nicht diese unsere Alltagsmeinung. Vielmehr zweifeln wir, ob der andere
Mensch wirklich das erlebt, was er zu erleben in Worten oder mimisch
vorgibt. Die „Urdoxa", die zum Zweifel als „modalisierter Glaubenswei-
se" gehört, und auf die er in „noematischer Intentionalität" zurückweist,
ist hier der „schlichte Glaube", daß nämlich der Andere das betreffende
Erlebnis wirklich hat. Gerade darin bekundet sich der Zweifel als ein im
angegebenen Sinne konkreter. „Urdoxa" und „modalisierte Glaubens-
weise" sind beide ihrem Sinne nach auf jene Alltagsmeinung zurückzu-
führen, dergemäß der andere Mensch ein beseeltes Wesen und kein
Automat ist. Erst auf dem Grunde dieser Alltagsmeinung sind „Urdoxa"
und Zweifel in ihrem Verhältnis zueinander möglich. Wenn der Mit-
mensch bereits als Mensch (und nicht als Automat) vorausgesetzt wird,
hat es überhaupt einen Sinn, ihm ein bestimmtes Erlebnis zu glauben oder
daran zu zweifeln. „Urdoxa" und „modalisierte Glaubensweise" impli-
zieren also jene Alltagsmeinung, um deren erkenntnistheoretische Be-
gründung es sich handelt, weil sie nämlich erst auf der Basis dieser
Voraussetzung „möglich", d. h. sinnvoll werden. Dann aber können
49 Vgl. hierzu HUSSERL, Ideen, §§ 103 ff. [Husserliana III, S. 256 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
26 Das traditionelle Problem
diejenigen erkenntnistheoretischen Motive, welche eine Entscheidung im
Zweifelsfalle rechtfertigen, nicht auch das Fundament tragen. Diese
Motive werden ja umgekehrt durch dieses Fundament gestützt, weil sie
nur innerhalb einer Überlegung, d. h. erst auf dem Boden des eben
genannten Fundaments einen Sinn haben und ,möglich' sind. (Wenn
Becher sagt: „Mit der Begründung der Existenz eines bestimmten
Fremdseelischen ist. . . nachgewiesen, daß es überhaupt Fremdseelisches
gibt", so ist folgendes daran richtig: im begründeten Glauben an ein
bestimmtes Fremdseelisches stoßen wir auf die diesem Glauben wie auch
dem entsprechenden Zweifel vorausliegende „Überzeugung" vom Mit-
menschen als Menschen, d. h. eben auf die uns ständig „begleitende" und
zumeist unausdrückliche alltägliche „Überzeugung", die den Charakter
der Selbstverständlichkeit hat)50. Wenn Becher also unsere selbstverständ-
liche Alltagsmeinung vom Mitmenschen neben den Zweifel stellt und sie
so mit der dem Zweifel entsprechenden Gewißheit im konkreten Fall
(d. h. mit der „Urdoxa", auf die der Zweifel in „noematischer Intentiona-
lität" zurückverweist) verwechselt, so zeigt sich, daß er trotz seiner
Hinweise auf die Unmittelbarkeit des Wissens um Fremdseelisches dem
phänomenologischen Charakter dieser unserer „Überzeugung" im
Grunde doch nicht gerecht geworden ist.
Zum Schluß sei noch vorgreifend auf einen Umstand aufmerksam
gemacht, der in seiner ganzen Bedeutung erst später zur Geltung kommen
wird, und der weder bei Becher noch bei Scheler zu seinem Recht
gekommen ist. Es ist doch etwas völlig anderes, ob ich mit einem anderen
Menschen in einer Situation zusammen bin51, ζ. B. wenn w i r uns
miteinander unterhalten (d. h. wenn wir in einer uns gemeinsamen
Situation etwas miteinander tun, wobei es allerdings auch vorkommen
kann, daß mir aus gewissen Gründen der Verdacht aufsteigt, der Andere
wolle mich täuschen und belügen), oder ob der Arzt einem Geisteskran-
ken gegenübersteht, dessen Zustand er ergründen will. Im letzteren
Falle besteht überhaupt keine dem Arzt und dem Kranken in dem Sinne
gemeinsame Situation, daß sie im Hinblick auf diese etwas miteinander
tun. Nur da aber sprechen wir von dem Bestehen einer gemeinsamen
Situation, wo Menschen miteinander etwas tun und so als Situationspart-
ner sich erleben. Der Arzt aber hat ein Objekt vor sich, das er erforscht ; —
50 Das im Vorstehenden Ausgeführte beziehen wir nur auf den Bereich des Mitmenschli-
chen. Die Frage der Beseeltheit der Tiere, zumal der niederen, können wir in dieser
Arbeit unerörtert lassen, was sich durch ihr Thema rechtfertigt. —
51 Uber das Zusammensein in einer Situation vgl. S. 148 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Charakter des Problems als Zugangsproblem 27
von dieser Intention her ist alles, was er mit dem Kranken tut und spricht,
geleitet. Der Kranke lebt seinerseits in seiner Welt, die wir eine
pathologische nennen ; von und aus ihr heraus spricht er zum Arzt. Für
den Arzt ist der Kranke kein Situationspartner, mit dem zusammen er in
einer gemeinsamen Situation und gemäß dem Sinne dieser Situation etwas
tut, wie es etwa sein Kollege ist, mit dem er einen Fall berät. Vielmehr ist
der Kranke ein Gegenstand, den der Arzt erkennen und bestimmen
will. Sowohl der Arzt wie der Kranke hat je seine eigene Situation, wobei
es der Sinn der Situation des Arztes ist, in die Welt des Kranken
einzudringen, die er aber mit dem Kranken nicht als gemeinsame teilt.
Daher besitzt das Sprechen des Arztes mit dem Kranken auch nicht die
Struktur des „Miteinandersprechens", wie sie Löwith52 herausgestellt hat,
weil Arzt und Kranker im eigentlichen Sinne gar nicht „miteinander
sind". Vielmehr dient dieses Sprechen (wie alles, was der Arzt sonst noch
an dem Kranken tut) der Erforschung und Bestimmung eines psychischen
Zustandes und erhält von dieser Intention her seinen Sinn, nicht aber —
wie beim echten „Miteinandersprechen" — aus dem konkreten Zusam-
mensein in einer konkreten Situation. Wenn nun der Arzt in dieser seiner
Haltung zum Kranken, die sich von derjenigen des alltäglichen Verkehrs
mit anderen Menschen prinzipiell abhebt53, Schlüsse und im besonderen
Analogieschlüsse verwendet, so schließt er, wie noch bemerkt sei, nicht
von sich auf den Patienten, sondern vielmehr von den durch hohe
Regelmäßigkeit ausgezeichneten Beobachtungen an anderen Kranken auf
das, was bei diesem Patienten zu vermuten ist. Dieser Schluß aber ist
etwas anderes als der von der Analogieschlußtheorie behauptete54.
§6 Der Charakter des Problems als Zugangsproblem
In den vorigen Ausführungen sind wir von der traditionellen Fragestel-
lung ausgegangen, um durch die Analyse der sich daraus ergebenden
52 K. LOWITH, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, München 1928, § 27.
53 Die hier zum Vorschein kommende radikale Differenz von „Sein-in . . ." und
„Stehen-gegenüber . . . " , wird, wie schon jetzt bemerkt sei, für die weiteren Untersu-
chungen dieser Abhandlung fundamental und entscheidend sein.
54 Vgl. TH. LIPPS, Zur Einfühlung, Leipzig 1913, S. 444; ferner SCHELER, Sympathie, S. 277
Anm. 1 [ G . W . 7, S. 2 3 4 , Anm. 3].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
28 Das traditionelle Problem
Analogieschlußtheorie den Sinn des vorliegenden Problems aufzuklären.
Dieser Aufgabe diente die eingehende Erörterung der Analogieschluß-
theorie; es ging uns um die Aufklärung des Sinnes der traditionellen
Problematik, nicht aber darum, auf dem überlieferten Boden weiterzuar-
beiten und eine Theorie durch eine andere zu ersetzen.
Die Analyse der Analogieschlußtheorie ergab zweierlei : einmal traten
Schwierigkeiten zutage, die der deskriptiven Eigenart unserer „Uberzeu-
gung" von den Mitmenschen entgegenstanden. Ferner zeigte sich, daß die
Analogieschlußtheorie, um überhaupt zu einem Ergebnis zu führen, das
phänomenal Gegebene anders interpretieren mußte, als sie es aufgrund
des vorausgesetzten Ansatzes tun durfte: sie nahm die physischen
Phänomene, an die der Analogieschluß anknüpft, als Ausdrucksbewe-
gungen, deren Sinn uns unbekannt ist, von denen aber feststeht, daß sie
Ausdrucksbewegungen sind. Mit anderen Worten : sie hält sich nicht an
ihren Ansatz, dem zufolge Ausdrucksbewegungen als physische Vor-
kommnisse zu fassen wären. Gelingt es nachzuweisen, daß vom
Grundansatz der Analogieschlußtheorie konsequenterweise kein Motiva-
tionszusammenhang zum Fremdseelischen hinführt, dann ist damit die
entscheidende Aufklärung über den Sinn gewonnen, den das Problem
aufgrund der Ausgangsposition besitzt. Ein solcher Nachweis würde
bedeuten, daß der Glaube an ein Fremdseelisches durch das phänomenal
Gegebene nicht motiviert werden kann. Es gäbe mithin keine phänome-
nologischen Befunde, deren Explikation den Glauben an Fremdseelisches
ausweisen würde. Selbst wenn er aufgrund irgendwelcher psychischer
Mechanismen entstünde55 — wobei wir das überaus fragwürdige Vorge-
hen einer solchen konstruktivistischen Psychologie bei der Annahme
derartiger Mechanismen hier nicht zu diskutieren haben —, so würde es
sich um einen blinden Glauben handeln, der sich uns unwiderstehlich
aufdrängt, und dessen wir uns nicht erwehren können. Letztlich wäre
dieser Glaube von einem beliebigen Aberglauben prinzipiell nicht
verschieden und hätte auch vor einem solchen nichts voraus56.
Diesen Nachweis hat Th. Lipps57 in seiner Kritik an der Analogie-
55 Vgl. z.B. B. ERDMANN, Erkennen und Verstehen, S. 1257ff.; ferner A. PRANDTL, Die
Einfühlung, S. 24 ff.
56 Über den blinden Zwang des Assoziationsgesetzes" vgl. PRANDTL, Das Problem der
Wirklichkeit, München 1926, S. 111.
Zur Parallele mit dem Aberglauben, vgl. H. TAINE, De l'intelligence, Paris 1878, Bd. II, S.
237, Anm.
57 Th. LIPPS, Das Wissen von fremden Ichen. Leitfaden der Psychologie, Leipzig 1909, S.
48 ff. ; Zur Einfühlung vgl. Kap. XIII.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Charakter des Problems als Zugangsproblem 29
schlußtheorie erbracht. Mit Recht sieht er das Problem darin, daß ein
Ubergang zu einer neuen Tatsache, ja sogar zu einem neuen Tatsachenbe-
reich vollzogen werden muß. Vom unmittelbar Gegebenen (d. h. von
meinen eigenen Erlebnissen, die in einer bestimmten Weise mit meinen
körperlichen Bewegungen verbunden sind, und von wahrgenommenen
physischen Vorgängen in der Welt, die mit meinen körperlichen
Bewegungen eine Ähnlichkeit besitzen) muß der Schritt in ein Gebiet
getan werden, das erst durch diesen Schritt zugänglich werden
kann. Damit hat Lipps das Problem, wie es sich vom traditionel-
len Ausgangspunkt her stellt, radikal umschrieben : es handelt
sich um das Problem des Zugangs zum Fremdseelischen. Die
Frage ist also nicht, wie man dazu kommt, einem anderen Menschen hic et
nunc gerade diesen und keinen anderen psychischen Zustand zuzuschrei-
ben, sondern vielmehr, wie man — vom vorgegebenen Ansatz aus —
überhaupt zum anderen Menschen als Menschen kommt, wie sich uns der
Andere als Mensch erschließt, wobei „erschließen" in dem hier gemeinten
Sinne immer „zugänglich" und „ausweisbar werden" heißt. Diese
Einsicht in den Charakter der vorliegenden Problematik erwuchs Lipps
aus der Kritik der Analogieschlußtheorie, die - wie er ausführt - niemals
auf das Erleben des Mitmenschen, d. h. nicht auf den Zorn „des von mir
verschiedenen Ich" führt, sondern stets nur auf eigene frühere
Erlebnisse, ζ. B. auf meinen früher erlebten Zorn. Das „fremde Ich"
wird von der Analogieschlußtheorie nicht erreicht, sie kommt an es nicht
heran. Aus dem Umkreis eigenen Erlebens vermag diese Theorie nicht
herauszuführen. Das aber bedeutet, daß sie den Zugang zum Fremdseeli-
schen nicht eröffnen kann58. Von dieser Kritik, die Sinn und Charakter des
traditionellen Problems vom Fremdseelischen sichtbar werden läßt, wird
prinzipiell jede Theorie betroffen, die sich auf irgendwelche psychischen
Mechanismen beruft, dank derer sich so etwas wie ein Glaube oder ein
Wissen von Fremdseelischem herausbildet. Keine derartige Theorie (wie
sogleich zu zeigen sein wird, gehört auch die Lippsche Einfühlungstheo-
rie zu diesem Theorietypus) kann das leisten, was von der traditionellen
Ausgangsposition her geleistet werden muß : nämlich den Schritt aufzu-
weisen, der vom phänomenal Vorgefundenen zum völlig neuen Bereich
einer beseelten Menschenwelt führt.
58 Ähnlich SCHELER, Sympathie, S. 277 [G. W . 7, S. 234], Der von J . GEYSER, Lehrbuch der
allgemeinen Psychologie, Münster 1912, S. 275 f. gegen die Lippssche Kritik erhobene
Einwand, den BECHER, a.a.O., S. 291 ff. sich zu eigen gemacht hat, verkennt die hinter
dieser Kritik stehende Einsicht in den Charakter des Problems als Zugangsproblem.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
30 Das traditionelle Problem
Die Frage des Zugangs zum Bereich des Fremdseelischen stellt sich als
der entscheidende Punkt der traditionellen Problematik insgesamt heraus.
Für jede Lehre, die auf diesem Boden aufbaut, geht es um die eine Frage :
wie kommt man an den Bereich des Fremdseelischen heran, wie vollzieht
man den Schritt, dessen Vollzug den Zugang zu dem fraglichen Gebiet erst
eröffnet? Ein derartiges Problem verweist seinem Sinne nach auf Akte, in
denen das betreffende Gebiet spezifisch erfahren wird. Den Zugang zu
einem Seinsgebiet eröffnen, bedeutet für eine phänomenologische Analy-
se : jene Akte angeben, die spezifisch diesem Gebiet zugehören5'. Das ist
der Aspekt, unter dem die „Einfühlungstheorie" von Lipps gesehen
werden muß : dieser Autor beabsichtigt, Akte aufzuweisen, die für das
Fremdseelische als erfahrende Akte fungieren. Gewiß ist seine Berufung
auf einen „Instinkt" ebenso unbefriedigend wie der Hinweis darauf, daß
es „eine ursprüngliche und nicht weiter zurückführbare, zugleich höchst
wunderbare Tatsache . . . i s t . . . , daß in der Wahrnehmung und Auffas-
sung gewisser sinnlicher Gegenstände, nämlich derjenigen, die wir
nachträglich als den Körper eines fremden Individuums oder . . . als die
sinnliche Erscheinung eines solchen bezeichnen, daß insbesondere in der
Wahrnehmung und Auffassung von Vorgängen oder Veränderungen an
dieser sinnlichen Erscheinung, unmittelbar von uns etwas miterfaßt wird,
das wir . . . Zorn . . . nennen" 60 . Das ist eher ein Versuch der gewaltsamen
Beseitigung des Problems als eine Analyse. Aber hinter dieser versuchten
Gewaltsamkeit steht die Einsicht, daß in dieser Sache anders als durch
Aufweis von Akten, die für das Fremdseelische als erfahrende und
gebende fungieren, nicht weiter zu kommen ist.
In der Art und Weise, wie Lipps diese „letzte Tatsache" des näheren zu
beschreiben und sie mit allgemeinen Tatsachen in Verbindung zu bringen
versucht, zeigt sich allerdings, daß er die durch die Kritik der Analogie-
schlußtheorie erworbene Einsicht in den Sinn des Problems insofern nicht
hinreichend radikalisiert hat, als seine Einfühlungstheorie dem gleichen
Theorietypus angehört wie die Analogieschlußtheorie. Auch Lipps weist
auf einen psychischen Mechanismus hin, aufgrund dessen ein vermeintli-
ches Wissen um Fremdseelisches resultieren soll. Daher erheben sich
gegen ihn prinzipiell die gleichen Einwände wie gegen die Analogie-
schlußtheoretiker. Sein Bemühen um eine adäquatere Deutung der
Ausdrucksbewegungen stellt einen ersten Versuch dar, jene Akte aufzu-
M Vgl. hierzu H U S S E R L , Ideen, S. 288 [Husserliana III, S. 340-341].
60 LIPPS, Das Wissen von fremden Ichen, S . 7 1 3 .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Charakter des Problems ab Zugangsproblem 31
weisen, die insofern für Fremdseelisches fungieren, als das in ihnen
erfahrungsgemäß Gegebene bereits in sich und seinem Sinne nach eine
Verweisung auf Fremdseelischen enthält. Wäre Lipps dieser Versuch
gelungen, dann hätte er den Zugang zum Fremdseelischen erfaßt. Doch
damit hätte er jene Perspektive verlassen, in welcher sich sein Problem
stellte und in der sich alle Forscher schon deshalb bewegen, weil sie es
unter dem Blickwinkel der traditionellen Theorie aufwerfen. Er hätte
zumindest die überlieferte Ausgangsposition selbst thematisieren
und diskutieren müssen. Da er jedoch am überlieferten Problem
unentwegt festhält, wird seine Interpretation der Ausdrucksbewegungen
unklar und inkonsequent. Er betont nachdrücklich, daß Ausdrucksbewe-
gungen „Gebärden" darstellen, an die in einer ganz eigentümlichen Weise
Erlebnisse „gebunden" sind". Sie sind nicht nur zugleich da und
miteinander assoziiert, wie z.B. Rauch und Feuer; vielmehr handelt es
sich um eine „eigenartige Einheit", die Lipps von „beliebiger erfahrungs-
gemäßer Zusammengehörigkeit", d. h. vom rein Summativen abhebt und
davon auch unterscheidet. Diese „Einheit" umschreibt er in Wendungen
wie : die Gebärde „drücke den Zorn" aus, es „liege" in ihr der Zorn, es
„gebe" sich Zorn darin „kund" usw. Soll damit angezeigt werden, daß
zwischen Zorn und Gebärde eine innere und sachliche Beziehung besteht
und etwas völlig anderes vorliegt als eine Gebärde neben einem Zorn,
d. h. etwas anderes als ,Zorn + Gebärde', die beide zusammengeraten
sind, ohne von sich aus aufeinander bezogen zu sein, so ergibt sich die
Aufgabe, diese „Einheit" selbst einer phänomenologischen Analyse zu
unterziehen. Es muß aufgezeigt werden, was diese „Einheit" phänomenal
ist, wie sie sich am Phänomen selbst ausweisen läßt, was sie für die „Teile"
des Phänomens, die miteinander „verbunden" sind, bedeutet. Es müßte
also gezeigt werden, in welcher Hinsicht die Gebärde als ein „Teil" jener
„Einheit" den Bezug oder Verweis auf das Erlebnis, auf das sie eine
„Ingerenz" hat, zur Erscheinung bringt und wie andererseits das Erlebnis
selbst und von sich aus auf die ihm zugehörige Gebärde verweist. All dem
ist Lipps nicht nachgegangen ; er hat sich mit den erwähnten Umschrei-
bungen begnügt. Geht man — unabhängig davon, welche Ergebnisse eine
eingehendere Analyse auch zeitigen mag — davon aus, daß Gebärde und
Erlebnis sich nicht summativ ergänzen, und d. h. daß zwischen ihnen eine
„innere Beziehung" besteht, dank der sie eine „Einheit" bilden, dann ist
zu folgern, daß die Gebärde nicht als rein physisches Vorkommnis
" LIPPS, a.a.O., S. 704ff. und 713 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
32 Das traditionelle Problem
erfahren wird. Sie hat an sich selbst einen wie immer näher zu
bestimmenden Bezug auf das Erlebnis, dem sie innerlich und sachlich
zugehört. Das trifft dann auf meine eigenen ebenso zu wie auf die
wahrgenommenen Gebärden anderer Menschen. Auch diese sind durch
den in der Wahrnehmung gegebenen Verweis auf jene „Einheit"
gekennzeichnet". Mit dieser Konsequenz wird aber die traditionelle
Problemstellung gesprengt. Wenn das, was die Wahrnehmung uns vom
Mitmenschen gibt, nicht mehr als rein Physisches (als bloße Bewegung,
die an und für sich von sonstigen ΒewegungsVorgängen in der Natur
prinzipiell nicht verschieden ist) angesprochen werden darf, dann hat das
traditionelle Problem, das gerade auf dieser Basis erwachsen ist, offenbar
seinen Sinn eingebüßt. Weil der frühere bewußtseinsphänomenologische
Ansatz nicht mehr ohne weiteres angenommen, sondern selbst in Frage
gestellt und vielleicht sogar durch einen anderen ersetzt wird, verliert das
Problem den Charakter, der ihm aufgrund des eben genannten Ansatzes
erwuchs. Da Lipps aber am traditionellen Ausgangspunkt festhält,
kommt er nicht zu dieser in der Linie seines eigenen Versuches gelegenen
Interpretation der Ausdrucksbewegungen und nähert sich wieder der
assoziationistischen Deutung. „Zunächst" gilt das, was in den erwähnten
Beschreibungen über die „Einheit" von Erlebnis und Gebärde ausge-
drückt werden soll, nur für meine Erlebnisse und Gebärden: ich erlebe
an mir selbst jene „Einheit und innere Beziehung", — an den Gebärden
anderer Menschen nehme ich jedoch den inneren Bezug der Gebärde auf
das Erlebnis nicht wahr. Damit ist die innere Einheit bereits zerstört.
Wenn dieser Bezug nämlich nicht als Phänomen selbst in der Gebärde liegt
und zu ihrem phänomenalen Bestand gehört, dann wird das Zusammen
von Erlebnis und Ausdruck doch wieder assoziationistisch63 gedeutet.
Dieser Deutung zufolge muß das eine zum anderen hinzukommen. Daran
ändert Lipps' Versuch einer Präzisierung der genannten Umschreibungen
nichts. Die Formulierung, eine Gebärde drücke Zorn aus, soll besagen,
„daß der Zorn die Gebärde ins Dasein ruft, aus sich hervorgehen
läßt". Das deutet auf eine Tätigkeit hin, die ich als Zorniger unmittelbar
erlebe, wenn ich ein zorniges Gesicht mache. Diese Tätigkeit geht aus
" Diesen Schritt hat SCHELER vollzogen, der in Sympathie, S. 301 ff. [G. W. 7, S. 253 ff.]
sagt, daß „wir im Lächeln die Freude, in den Tränen das Leid und den Schmerz des
anderen, in seinem Erröten seine Scham, in seinen bittenden Händen seine Bitten . . .
direkt zu haben vermeinen", und von Adäquatheit und Inadäquatheit von Erlebnis und
Ausdruck spricht.
63 „Assoziationistisch" im oben S. 21 dargelegten Sinne.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Charakter des Problems als Zugangsproblem 33
meinem Zorn hervor, sie zielt auf die Gebärde ab und vollendet sich in
deren Hervorbringung. Faßt man bei dem Nachdruck, den Lipps auf die
„Einheit" von Erlebnis und Gebärde legt, den Zusammenhang von
Erlebnis, Tätigkeit und Gebärde wirklich entsprechend dieser behaupte-
ten Einheit auf (sieht man also diese drei als Momente eines einheitlichen
Geschehensablaufes an), so muß jedes dieser Momente dadurch ausge-
zeichnet sein, daß der Bezug auf die anderen Momente, mit denen es in
jener Einheit steht, zur Gegebenheit kommt. Die Gebärde muß von sich
aus auf jene Tätigkeit zurückweisen, aus der sie hervorgegangen ist.
Anders gesagt: dieses ihr Hervorgegangensein muß phänomenal in ihr
selbst enthalten sein. Damit aber wird, wie eben erwähnt, der traditionelle
Problemansatz gesprengt. Da Lipps seinen Versuch einer adäquateren
Interpretation der Ausdrucksbewegungen nicht bis zu dieser Konsequenz
ausführt, können seine Darlegungen nur so verstanden werden: das
Hervorgehen der Gebärde aus der Tätigkeit besagt für die Gebärde selbst
nichts ; — es gehört gar nicht zu ihrer phänomenologischen Wesenseigen-
schaft. Die Verbindung zwischen Tätigkeitserlebnis und Gebärde ist nicht
von der Art, daß in der Gebärde selbst ein phänomenaler Bezug auf die
Tätigkeit und das Tätigkeitserlebnis liegt. Damit ist diese Verbindung,
mag sie noch so innig und stark sein, doch wieder nur eine assoziativ-sum-
mative. Tätigkeitserlebnis und Gebärde sind zusammen da, sie sind
miteinander verbunden, aber diese Verbindung tangiert sie in ihrem
eigenen phänomenalen Bestände nicht. Das wäre indes der Fall, wenn man
sie als Momente eines einheitlichen Ablaufs begreifen würde, die als solche
in einem sachlichen gegenseitigen Bezug stünden. Die Interpretation der
Ausdrucksbewegungen ist bei Lipps also trotz seiner in andere Richtun-
gen gehenden Intention wieder dieselbe wie bei den Analogieschlußtheo-
retikern. Diese Inkonsequenz ermöglicht es Lipps, an der traditionellen
Ausgangsposition festzuhalten : für mein Bewußtsein liegt „auch in der
wahrgenommenen Gebärde eines anderen Menschen eine solche Tätig-
keit. Aber diese Tätigkeit kann ich ebenso wenig sehen oder sonstwie
wahrnehmen wie den Zorn, ich kann sie nur in mir erleben. Meine
Tätigkeit also erlebe ich unmittelbar in der Wahrnehmung der Gebärde
des anderen. Aber wie nun kann ich eine eigene Tätigkeit in der
Wahrnehmung eines von mir verschiedenen Gegenstandes, eines Vor-
gangs in der Außenwelt finden?"64 Lipps sieht sich also wie die
Analogieschlußtheoretiker vor ein Zugangsproblem gestellt. Der Unter-
64 LIPPS, a . a . O . , S. 715.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
34 Das traditionelle Problem
schied, daß es sich dort um den Zugang zu den Erlebnissen des
Mitmenschen handelt, während es für Lipps zunächst um den Zugang zu
den aus den Erlebnissen hervorgehenden und auf Gebärden hinzielenden
Tätigkeiten geht, ändert an der p r i n z i p i e l l e n Kennzeichnung der
Problematik nichts.
Die von Lipps aufgestellte „Einfühlungstheorie" wird freilich den
Sachen noch viel weniger gerecht als die Analogieschlußtheorie. Diese
wollte „das Fremdseelische durch Analogieschlüsse unserem Erkennen
zugänglich"65 machen. Die Schwierigkeiten betrafen den phänomenologi-
schen Charakter der von uns ständig gespürten, wenn auch zumeist nicht
ausdrücklich gemachten „Alltagsüberzeugung" bezüglich der Sozialwelt,
in der wir leben. Worauf es die Lippssche Einfühlungstheorie abgesehen
hat, ist nun weder diese „Alltagsüberzeugung" noch das Wissen um das
konkrete Erlebnis eines bestimmten Menschen in einem konkreten Falle,
sondern etwas völlig anderes, wie hier im Anschluß an diese Ausführun-
gen noch gezeigt sei.
Eine wahrgenommene fremde Gebärde ruft in mir die Tendenz hervor,
diese Gebärde nachzuahmen. Und zwar ist diese Tendenz eine in der
Wahrnehmung der fremden Gebärde erlebte Tendenz auch dann, wenn
Hemmungen und Gegentendenzen sie nicht zur Auswirkung kommen
lassen. „So werde ich . . .in der fremden Gebärde meiner selbst als auf
die eigene Hervorbringung derselben tendierend inne.""
Aufgrund der inneren Beziehung und „Einheit", die zwischen Erlebnis
und Gebärde besteht und auf den „Trieb der Äußerung" zurückgeht —
„fühle ich Zorn, so fühle ich mich durch diesen Zorn getrieben, die
Zornesgebärde ins Dasein zu rufen" — ist die Tätigkeit, die auf das
Hervorbringen der betreffenden Gebärde abzielt, derart mit dem Erlebnis
verbunden, daß sie geradezu als eine „Seite", als ein Moment desselben
65 So ausdrücklich bei BECHER, a.a.O., S. 288.
" LIPPS, a . a . O . , S . 7 1 6 f f . - Z u r K r i t i k v g l . PRANDTL, Die Einfühlung, S . 1 9 f f . ; K . KOFFKA,
Die Grundlagen der psychischen Entwicklung, Osterwieck a. H. 1925, S. 232 ; SCHELER,
Sympathie, S. 7 [G. W. 7, S. 21 —22], Diese Autoren stimmen trotz ihrer verschiedenen
Gesichtspunkte alle darin überein, daß man nur nachahmen kann, was man bereits als
Ausdrucksbewegung erf aßt hat. Diese A u s d r u c k s b e w e g u n g wird nachgeahmt, nicht
ein purer Veränderungsvorgang an Linien und räumlichen Formen. — Auf die weitere
Frage, ob die Nachahmung wirklich einem „instinktiven" Trieb entspringt und ob es so
etwas gibt wie einen Trieb zur puren Nachahmung, d.h. einen Trieb, beliebig
Wahrgenommenes einfach nachzuahmen, gehen wir hier nicht ein. Die Erörterung
dieser Dinge setzt eine ausdrückliche phänomenologische Analyse dessen voraus, was
„Nachahmung" eigentlich ist. Vgl. hierzu auch W. KOHLER, Intelligenzprüfungen an
Menschenaffen, Berlin 1921, S. 160 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Charakter des Problems als Zugangsproblem 35
sich zeigt. Zum Erlebnis selbst gehört diese Tendenz zur Gebärde. Diese
Tendenz wird zum „Index" für diesen bestimmten Affekt; nachdem ich
ζ. B. den Zorn wirklich erlebt, geäußert und in der betreffenden Gebärde
kundgetan habe, hat die Tendenz zu gerade dieser Gebärde einen Index
erhalten, Ausdruck gerade des Zornes zu sein. Nehme ich nun an einem
anderen Menschen diese Gebärde wahr, so tendiere ich zur Nachahmung
der wahrgenommenen Gebärde ; an diese Bewegungstendenz ist aber ein
Affekt „gebunden", aus dem, als ich ihn tatsächlich erlebte, diese
Bewegungstendenz als seine Äußerung hervorging. So wird jetzt in der
Wahrnehmung der Gebärde an einem Anderen der früher erlebte
Affekt reproduziert. Dieser reproduzierte Affekt heftet sich an die
wahrgenommene Gebärde, und zwar in der gleichen Weise wie sich der
originäre, erlebte Affekt an die vollzogene Gebärde geheftet hatte „als
etwas, das darin sich kundgibt oder äußert". Der (reproduzierte) Affekt
ist von mir in die gesehene Gebärde hinein vorgestellt oder hinein
gedacht. Wenn ich die Gebärde eines anderen Menschen sehe, so ist mir
in dieser Gebärde unmittelbar ein reproduzierter eigener Affekt mitgege-
ben. Indem ich nun aufgrund des Nachahmungstriebes die Tendenz zur
Äußerung eines Affektes erlebe, erfahre ich jetzt einen Teil meines
früheren Gesamterlebnisses : die Tendenz zur Äußerung bildete mit dem
wirklichen Affekt die Einheit eines Gesamterlebnisses. Dieser Teil, den
ich jetzt habe, besitzt seinerseits die Tendenz, sich wieder zu einem
Gesamterlebnis zu vervollständigen, d. h. „den Affekt nicht nur vorzu-
stellen, sondern von neuem zu e r l e b e n " . Verwirklicht sich diese
Tendenz und kommt es zum Erleben des Affektes, dann liegt Mitfühlen
und Sympathie vor: „Ich erlebe . . . die innere Zuständlichkeit, welche ich
bei einem anderen sich äußern sehe, in mir." — So gibt es nach Lipps ein
allgemeines psychologisches Gesetz der Sympathie ; nicht das Auftreten,
sondern das Ausbleiben der Sympathie ist eigentlich das zu erklärende
Phänomen.
Für die Zwecke unserer Untersuchung kommt es nicht darauf an, auf
weitere Schwierigkeiten der Lippsschen Theorie aufmerksam zu machen.
Nur auf diese eine sei hingewiesen: wie kommt es, daß sich der
reproduzierende Affekt über die Tendenz zur Nachahmung einer
wahrgenommenen Gebärde hinweg an die wahrgenommene Gebärde
heftet und nicht bei dem Bewegungsimpuls bleibt, der infolge des
Nachahmungstriebes ausgelöst wird ? Wie kommt es also zur eigentlichen
Einfühlung oder dazu, daß ich meine reproduzierten Erlebnisse in den
Anderen hineinfühle? Von prinzipiellerer Bedeutung als diese und
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
36 Das traditionelle Problem
ähnliche Einwände sind die Fragen: worauf hat es Lipps' Theorie
überhaupt abgesehen ? Was erreicht sie ? Was wird durch sie beschrieben ?
Er selbst formuliert es so: „Mein Wissen von der Weise anderer
Individuen innerlich sich zu betätigen ist. . . der Tendenz nach eine
entsprechende eigene Weise der Betätigung." Die Wahrnehmung fremder
Gebärden reproduziert früher erlebte Affekte in mir, die sich unter
Umständen zu originären, jetzt wirklich erlebten auswachsen. Sehe ich
mir gegenüber einen zornigen Menschen, der sich entsprechend gebärdet,
so habe ich in der Erinnerung an eigene früher erlebte Zornausbrüche die
Tendenz, jetzt selber zornig zu werden. Ich gerate also in den gleichen
Zustand, in dem sich der mir gegenüberstehende Mensch befindet : ich
werde von seinem psychischen Zustand angesteckt. D a s Wissen um
F r e m d s e e l i s c h e s ist nach L i p p s ein A n g e s t e c k t w e r d e n von
F r e m d s e e l i s c h e m . Damit tritt Lipps in eine Reihe mit jenen älteren
Theoretikern, die die Ansteckung für das paradigmatische und in dem
Sinne grundlegende Sympathiephänomen halten. Demnach sind alle
anderen genetisch auf dieses eine zurückzuführen, das in ihnen auch als
Fundament und Kern enthalten ist. Als Repräsentant dieser Theorie,
der zufolge die Gefühlsansteckung im Grunde das eine S t a n d a r d p h ä -
nomen der Sympathie sein soll, kann die Lehre Spencer67 angesehen
werden, die beispielsweise eine notwendige Bedingung des Mitleids in der
Weise definierte, daß derjenige, der Mitleid fühlt, den Zustand, dem sein
Mitleid gilt, früher schon erlebt hat68. Gegen diese Vorrangstellung der
Gefühlsansteckung hat besonders Scheler69 protestiert, indem er aufgrund
seiner Analyse des „Mitgefühls" die Differenzen des „unmittelbaren
Mitfühlens" und des „Mitgefühls an etwas" gegenüber der Gefühlsan-
steckung herausgearbeitet und auf die Selbständigkeit der zuerst genann-
ten Phänomene gewiesen hat. In diesem Zusammenhang ist besonders
seine Bemerkung wichtig, daß weder die Ansteckung ein Wissen um den
fremden Zustand, von dem wir angesteckt werden, voraussetzt, noch daß
ein solches Wissen im Phänomen der Ansteckung selbst liegt. Vor Scheler
hat schon Groethuysen70 mit Nachdruck betont, daß ein Wissen um die
Gefühle des Anderen, von denen man angesteckt ist, für ein „Gleichge-
67 Vgl. H . SPENCER, The Principles of Psychology, London 1872, Vol. II, Part VIII, Chap. V,
§§ 505 ff.
" V g l . H . SPENCER, a.a.O., Chap. V i l i , § 529; ferner auch R. ν. SCHUBERT-SOLDERN,
Grundlagen zu einer Ethik, Leipzig 1887, S. 114 ff.
" SCHELER, Sympathie, Α. II [G. W. 7, S. 19-48],
70 B. GROETHUYSEN, „Das Mitgefühl", Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane, X X X I V (1904), S. 172 ff. und 188 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Charakter des Problems als Zugangsproblem 37
fühl" (wie etwa im Falle der Gefühlsansteckung) nicht konstitutiv ist. Wer
von einem bestimmten Gefühl angesteckt wird, der erlebt dieses Gefühl
und befindet sich in diesem Gefühlszustand. In diesem Vorgang ist weder
ein Wissen um die Herkunft noch ein solches um die Gleichheit seines
Gefühls mit dem des anderen Menschen beschlossen. Genau besehen ist
ein Wissen um die Gefühlszustände eines Anderen gar nicht impliziert.
Selber ein Gefühl haben und wissen, daß ein Anderer es hat, sind zwei
grundverschiedene Dinge. Weder ist im ersten das zweite enthalten noch
umgekehrt. Ich kann um die Trauer eines anderen Menschen wissen, ich
kann auch mit ihm Mitleid haben, ohne selber traurig zu sein, eine
Tendenz zur Trauer zu erleben oder mich an eine früher erlebte Trauer zu
erinnern. Erst recht ist die zuständige „Alltagsüberzeugung", die wir in
bezug auf andere Menschen haben, von der Gefühlsansteckung völlig
verschieden und beruht auch nicht auf ihr. Der andere Mensch wird nicht
erst dadurch für mich zum Menschen, daß ich seine Gebärden nachahme,
reproduziere bzw. wirkliche Affekte habe und diese anschließend auf den
Anderen übertrage71. Vielmehr ist er für micht schon vor aller Gefühlsan-
steckung und unabhängig von ihr ein Mensch. Die beiden Phänomene, auf
deren Klärung es ankommt (nämlich die „Alltagsüberzeugung" und das
Wissen um das Fremdseelische in konkreten Fällen) liegen also jenseits
der Theorie Lipps' und werden von dieser gar nicht erst geklärt.
Der gleiche Einwand, den Lipps gegen die Analogieschlußtheorie
richtete, erhebt sich somit auch gegen seine Theorie. Indem diese das
Wissen von Fremdseelischem als Ansteckung beschreibt, führt auch sie
nicht auf das Erleben des A n d e r e n , sondern nur auf Reproduktionen
eigener früherer Erlebnisse bzw. auf aktuelles eigenes Erleben72. Der
andere Mensch wird dadurch für mich „zum Menschen", daß ich in einem
Vollzug der Selbstobjektivation meine psychischen Prozesse „in ein Stück
Außenwelt hineinlege". Damit bin ich wieder in den Kreis meines eigenen
Erlebens gebannt und finde keinen Zugang zum Bereich des Fremdseeli-
schen73.
Weil für Lipps das aktuelle eigene Erleben sozusagen die vollendetste
Form des Wissens um Fremdseelisches ist, wird das Gebanntsein in den
Umkreis meiner eigenen Erlebnisse hier noch deutlicher spürbar als in der
Analogieschlußtheorie, die diesen Aspekt des Problems übersah. Lipps
hat zwar erkannt, worauf es ankâm, und die Problemstellung gegenüber
71
Vgl. LIPPS, Zur Einfühlung, S. 447 ff.
72
Vgl. PRANDTL, Die Einfühlung, S. 19 ff.
73
Vgl. VOLKEIX, Das ästhetische Bewußtsein, S. 119 ff., die Kritik an Lipps und Prandtl.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
38 Das traditionelle Problem
der Analogieschlußtheorie radikalisiert. So versuchte er, diejenigen Akte
aufzuweisen, die in bezug auf Fremdseelisches als Erfahrungsakte zu
gelten haben. Aber es gelang ihm nicht, diese Akte ausfindig zu machen.
Seine Theorie kehrte mithin zu reproduzierten bzw. aktuellen eigenen
Erlebnissen wieder zurück. Mit der Analogieschlußtheorie hatte er die
Ausgangsbasis gemeinsam. Deshalb stellt sich für ihn wie für diese das
Problem als Zugangsproblem. Am Charakter des Problems scheiterte
aber gerade seine Einfühlungstheorie, die den Zugang zum Fremdseeli-
schen, d.h. zu einem völlig neuen Bereich, nicht zu erschließen
vermochte. Auch Lipps konnte die Kluft zwischen dem Objekt und dem
Subjekt, das jenem qualitativ gleichgestellt ist74, nicht überbrücken.
Zusatz
Sowohl gegenüber der Analogieschlußtheorie wie auch der Einfühlungs-
theorie macht Cassirer75 geltend, daß diese Erklärungen lediglich auf einen
„Illusionismus" hinauslaufen. „Was versichert uns, daß jenes fremde Ich,
das wir aus unserem eigenen Sein gewinnen und hinausprojizieren, mehr
als ein Luftgebilde, als eine Art von psychologischer Fata morgana ist ?"
fragt er besonders in bezug auf Lipps. In der Tat läßt sich das
Realitätsproblem, auf das Cassirers Frage hinzielt, nicht nur angesichts
der traditionellen Theorien, sondern auch angesichts des Fremdseelischen
selbst stellen. Dieses letztere ist ja ein Teilgebiet der bewußtseinstranszen-
denten Realität. Erlebnisse anderer Menschen, die prinzipiell niemals die
meinen sein können (psychische Vorkommnisse in fremden Ichen) sind in
genau dem gleichen Sinne transzendent wie Bäume und Häuser. Auch
angesichts dieser besonderen Transzendenzen kann man die Frage stellen,
mit welchem Recht und aufgrund welcher Vernunftmotivation wir die
intentionalen Korrelate gewisser Akte, in denen wir Fremdseelisches
vermeinen, für mehr nehmen als nur für Korrelate von Akten. Das
allgemeine Realitätsproblem betrifft die Motive, Gründe und überhaupt
die Legitimation jener unterschiedlichen Behandlung von Akten, von
denen sich die einen dadurch auszeichnen, daß wir sie nicht bloß als
Erlebnisse im Sinne von bloßen Bewußtseinsvorkommnissen nehmen,
sondern als solche, die mit der Prätention auftreten, Transzendentes
vorstellig zu machen. Ihnen billigen wir diese Prätention auch zu, denn
wir sagen : in ihnen und durch sie kommt uns Bewußtseinstranszendentes
7< Vgl. LIPPS, Zur Einfühlung, S. 443 f.
75 CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Bd. III, S. 95 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Charakter des Problems als Zugangsproblem 39
zur Gegebenheit — während wir anderen Akten eine derartige Bevorzu-
gung versagen, weil wir sie lediglich als Vorkommnisse des Bewußtseins
betrachten, und das, was in ihnen zur Gegebenheit kommt, als bloßen
Schein, als Täuschung, als Phantasie usw. bezeichen76. Dieses allgemeine
Realitätsproblem betrifft das Fremdseelische schon deshalb, weil dieses
zur Außenwelt gehört. Es kommt in der Außenwelt vor, bildet ein
Bestandstück derselben wie irgend ein totes Ding. Aber es steht nicht
gewissermaßen als eigener Bereich von Transzendentem unvermittelt und
abgelöst neben dem Bereich des Dinghaften ; es ist an eine bestimmte Art
von Dinghaftem, an „menschliche und tierische Leiber" in eigenartiger
Weise gebunden, so daß diese „Leiber" als Träger des Fremdseelischen
erscheinen. Damit scheint das auf das Fremdseelische gehende Realitäts-
problem nicht nur ein Teil des allgemeinen, die „zunächst" als dinglich
verstandene Außenwelt betreffenden Problems zu sein; es zeigt sich
vielmehr in gewisser Weise abhängig vom Realitätsproblem der dingli-
chen Außenwelt. Erst muß die Realität des Trägers sich konstituiert haben
und gewährleistet sein, damit diejenige des an diesen Träger gebundenen
Fremdseelischen sich konstituieren kann77.
Obwohl das von Cassirer aufgeworfene Realitätsproblem durchaus
legitim ist, so ist es doch nicht das spezifische Problem des Fremdseeli-
schen. Wenn man den Sinn der Realitätsfrage auch nur skizzenhaft
exponiert, wie wir es soeben taten, so wird doch deutlich, daß hinter der
Realitätsfrage als zentralere die des Zugangs steht, und daß diese den
eigentlichen Sinn der Problematik des Fremdseelischen ausmacht. Bei der
Realitätsfrage handelt es sich um das R e c h t der B e v o r z u g u n g von
Akten und ihren Korrelaten gegenüber anderen Akten, um die Transzen-
denzprätention der in diesen Akten zur Gegebenheit kommenden und in
ihnen vermeinten Gegenständlichkeiten. Nicht aber handelt es sich um
diese Gegenständlichkeiten selbst, die in fungierenden Akten vorstellig
werden. Diese erfahrende Akte und ihre Korrelate sind jedoch unter dem
Blickwinkel des traditionellen Ausgangspunkts, gerade auch was das
Fremdseelische betrifft, problematisch. Bevor von einem Vernunftrecht
dieser Erfahrungen und von der Transzendenzprätention des in ihnen zu
76 Vgl. hierzu HARTMANN, Grundzüge zu einer Metaphysik der Erkenntnis, Kap. 1 0 ; ferner
SCHELER, „Idealismus — Realismus", Philosophischer Anzeiger, II (1927), S. 262 ff., über
den Unterschied von „intentionalem" (Scheler sagt dafür: „transzendentem") und
„ansichseiendem" (bei Scheler: „realem") Gegenstand. Wenn wir den letzteren im
Gegensatz zu Scheler als „transzendent" bezeichnen, so folgen wir der in der Tradition
und auch bei Husserl üblichen Terminologie.
77 Vgl. W . DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. V, S . 1 1 0 .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
40 Das traditionelle Problem
Gegebenen gesprochen werden kann, müssen sie selbst beschrieben,
analysiert, ihrem gebenden Sinne nach aufgeklärt und in die Ordnung
unserer anderen gebenden Erfahrungen einbezogen werden. Vor dem
Realitätsproblem steht also das Problem der gebenden Erfahrung. Damit
verdeutlicht sich der Vorrang der Zugangsfrage, die den Sinn der
Problematik des Fremdseelischen ausmacht.
Es steht hier nicht anders als im Falle des Kausalitätsproblems, wie
Hume es dargestellt hat. Der Sinn dieses Problems liegt für ihn darin, daß
„we never have any impression, that contains any power or efficacy. We
never therefore have any idea of power." 78 Das Fehlen einer derartigen
„impression" bedeutet einen Mangel einer originären Erfahrung von
„power" und „efficacy", an der sich der entsprechende Begriff ausweisen
könnte. So erhält das Kausalitätsproblem bei Hume den Charakter eines
Zugangsproblems. — Es sei schließlich auf die eigentümliche Parallele der
zentralen Gedanken Humes mit denen von Lipps aufmerksam gemacht79.
§7 Die Ausweglosigkeit des traditionellen Problems und die Richtung
der weiteren Untersuchungen
Die oben beschriebenen Eigenschaften der das Fremdseelische betreffen-
den Problematik gründen in der traditionellen, den Analogieschlußtheo-
retikern wie Lipps gemeinsamen Ausgangsposition. Gemäß dieser wird
jedes Erlebnis als mein Erlebnis verstanden. Jede Trauer, jede Freude,
jeden Schmerz erlebe ich als meine Trauer, meine Freude, meinen
Schmerz; jeder Gedanke, den ich vollziehe, ist mir im Vollzug als mein
Gedanke gegeben. Gleichgültig wie man diese „Ichzugehörigkeit"
interpretiert, sie ist für die traditionelle Position ein wesentliches
Charakteristikum der Erlebnisse als solcher. Jedes Erlebnis ist mir als
mein E r l e b n i s gegeben ; jedes trägt w e s e n s m ä ß i g einen Index, der es
als „mein Erlebnis" bestimmt. Damit aber sind die „Wir-Erlebnisse"
unverständlich geworden. Jene Erlebnisse, bei deren Vollzug wir nicht
78 D. HUME, Philosophical Works (hg. von GREEN und GROSE), Bd. I, pass. ; entsprechend
Bd. I V , S. 52 ff.
79 Vgl. HUME, a. a. O., Bd. I, S. 461 : „this a common observation, that the mind has a great
propensity to spread itself on external objects, and to conjoin with them any internal
impressions, which they occasion, and which always make there appearence at the same
time that these objects discover themselves to the senses."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Ausweglosigkeit des traditionellen Problems 41
etwa nur urteilsmäßig wissen, daß auch andere Menschen ähnliche
Erlebnisse vollziehen, in deren Sinn vielmehr die Mitanwesenheit jener
Anderen liegt, die durch das „Wir" mitbefaßt werden (und zwar der
Anderen als mit mir zusammen dieses Erlebnis vollziehend). Aus der dem
Sinn dieser Erlebnisse immanenten Mitanwesenheit der Anderen, mit
denen zusammen ich das betreffende Erlebnis vollziehe, bestimmen sich
diese Erlebnisse spezifisch als unsere und scheiden sich von solchen
Erlebnissen ab, die spezifisch die meinen sind. Ihrem Sinne nach
verweisen diese Erlebnisse auf ein „Wir" und bekunden ihre „Wirzuge-
hörigkeit" darin, daß in ihrem Vollzug die Mitanwesenheit der Anderen
als dasselbe Erlebnis vollziehend eine ihrer phänomenologischen Eigen-
schaften darstellt. Ich allein könnte dieses Erlebnis nicht haben. Weil ich
es aber habe, vollziehe ich es mit den Anderen, habe sie in seinem
Vollzug anwesend, lebe mit ihnen in ihm. Ist aber die Ichzugehörigkeit
ein konstitutives Moment an jedem Erlebnis als Erlebnis, so ist es
unmöglich, daß andere Menschen identisch dasselbe Erlebnis vollziehen
sollen wie ich. Wenn nämlich ein Erlebnis nur mein Erlebnis ist, kann es
schon gar nicht erst dasjenige eines Anderen sein. Nur als Gefühlsanstek-
kung ließen sich diese Phänomene deuten ; sie heben sich indes von dieser,
wie sich noch zeigen wird 80 , völlig ab. Auch der in dem Sinn der
betreffende Erlebnisse liegende Verweis auf ein „Wir" ist von der
Ichzugehörigkeit als einem Wesensmoment der Erlebnisse her nicht zu
begreifen: wie kann ein Erlebnis spezifisch als unser und nicht als
mein Erlebnis bestimmt werden, wenn es, weil ich es erlebe, wesentlich
den Index „mein" trägt81. Zu dieser Sachlage, auf die einzugehen wir
bisher keine Gelegenheit hatten, weil wir uns an Theorien orientierten, die
sich nicht auf das L e b e n mit . . ., sondern lediglich auf das Wissen
von dem anderen Menschen bezogen, tritt der bereits ausführlich
80 Vgl. weiter unten, S. 206 ff.
" Das vorstehend ausgeführte erfährt eine radikale Modifikation auf dem durch die Ιποχη
erschlossenen Boden der „konstitutiven Phänomenologie" Husserls. Auf diesem Boden
aber stehen wir hier und in dieser ganzen Abhandlung noch nicht. Zunächst haben wir es
mit der Deskription unseres Wissens vom anderen Menschen und unseres Lebens mit
ihm im Horizont des „natürlichen Daseins" zu tun. Diese Deskription, um die sich auch
die traditionellen Theorien bemühen, muß der Konstitutionsproblematik, für die sie die
ontologischen Leitfäden bereitstellt, vorangehen. Mit dieser Orientierung unserer
Untersuchungen hängt auch der im Zusatz zum vorigen § herausgestellte Vorrang des
Zugangsproblems vor der Realitätsfrage insofern zusammen, als die Realitätsfrage
r a d i k a l nur als konstitutiv-phänomenologische behandelt werden kann, während die
Zugangsfrage die Einordnung unserer „Erfahrungen" von Fremdseelischem in den
Gesamtbereich unserer „natürlichen Erfahrungen" und die mögliche Fundierung der
betreffenden „Erfahrungen" in anderen angeht.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
42 Das traditionelle Problem
besprochene, den traditionellen Theorien gemeinsame wahrnehmungs-
phänomenologische Befund hinzu. Wenn uns die anderen Menschen
lediglich als Körper gegeben sind, die sich von sonstigen Körpern und
Dingen in der Art der Gegebenheit selbst prinzipiell nicht unterscheiden,
und wenn die besondere Form dieser Körper und die besonderen
Bewegungsvorgänge an ihnen bei all ihrer Besonderheit eben doch nur
besondere Formen und Bewegungen von Körpern als solchen sind und
sonst nichts — wie sollen dann diejenigen Akte verstanden werden, die
das mit den Körpern „verbundene" Seelische zur Gegebenheit bringen?
Wenn diese Verbindung selbst nicht zum Bestände des unmittelbar
Wahrgenommenen gehört, so gibt es keine Möglichkeit eines Zugangs zu
ihr. Jedem Versuch in dieser Richtung fehlt die Basis, weil vom
unmittelbar angenommenen Gegebenen her kein Akt, der als erfahrender
fungieren könnte, motiviert wäre. Die unmittelbare Wahrnehmung bzw.
das, was von der traditionellen Theorie als unmittelbare Wahrnehmung
angesehen wird, enthält keinen Ansatzpunkt für eine Erfahrung von
Fremdseelischem. Anders gesagt: nicht an der Unzulänglichkeit der
theoretischen Gedanken, und noch viel weniger an irgendwelchen
Mängeln der Theorie selbst liegt es, daß man angesichts der betreffenden
Probleme hilflos war. Keine Verbesserung und Verfeinerung der Metho-
den und anderer theoretischer Hilfsmittel verspricht einen Fortschritt in
dieser Sache, so lange man an der traditionellen Ausgangsposition festhält.
Weil diese das Problem zu einem Zugangsproblem macht, begibt sie sich
auf ein völlig auswegsloses Gebiet82. Wenn im unmittelbar Gegebenen
selbst, so wie es von den beiden Theorien verstanden wird, kein Zugang
zum Fremdseelischen gegeben ist, dann ist dieses als solches unerreichbar
schlechthin. D i e s e A u s w e g l o s i g k e i t gründet m i t h i n in dem
u r s p r ü n g l i c h e n Verständnis als u n m i t t e l b a r G e g e b e n e n . Eine
Reihe von Forschern, welche die Analogieschlußtheorie vertreten, haben
diese Ausweglosigkeit in irgendeiner Weise auch gespürt. Das kommt bei
ihnen darin zum Ausdruck, daß sie auf eine gewisse Unsicherheit des
Analogieschlusses, auf einen Mangel an Bündigkeit und Uberzeugungs-
kraft und dergleichen aufmerksam machen83.
82 Vgl. hierzu CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Bd. III, S. 98 ff.
83 So z.B. STORRING, Einführung in die Erkenntnistheorie, S. 170, dem zufolge „die
Behauptung der Existenz fremder Iche . .. eine viel geringere erkenntnistheoretische
Dignität als die Behauptung der Existenz von transzendenten Seinsgrößen überhaupt"
besitzt; vgl. auch S. 286f.; CORNELIUS, Einleitung in die Philosophie, S. 330: „Einen
positiven oder negativen Entscheid über das Dasein eines fremden psychischen
Lebens . . . kann uns die Wissenschaft so wenig gewähren, wie über die Frage unseres
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Ausweglosigkeit des traditionellen Problems 43
Die ganze Ausweglosigkeit des Problems zeigt sich am klarsten in den
Ausführungen von Carnap84. Da die Erkenntnis von Fremdseelischem auf
der Wahrnehmung von Physischem basiert, kann jede Aussage über
Fremdseelisches in eine Aussage übersetzt werden, in der nur von
Physischem die Rede ist, nämlich von Ausdrucksbewegungen, Handlun-
gen, Wörtern und dergleichen, die Carnap aber als rein physische
Vorkommnisse versteht. Beide Aussagen enthalten den gleichen theoreti-
schen Gehalt und sind, soweit es allein auf diesen ankommt, einander
äquivalent. Nur eine einfacherere und bequemere Sprecheweise ist es,
wenn man „A freut sich" sagt statt „A zeigt Mienen von der und der
Gestalt", wobei aber in einer ausführlichen und exakten Beschreibung der
Mienen nur solche Ausdrücke Verwendung finden dürfen, die ausschließ-
lich Physisches meinen, wie z.B. Farbveränderungen, Verschiebungen
von Linien, Kontraktionen von Muskeln usw. In bezug auf den
theoretischen Gehalt unterscheiden sich beide Aussagen nicht voneinan-
der, und es sind sekundäre, vom Standpunkt der Theorie aus belanglose
Gründe, die uns die eine Sprechweise vor der anderen bevorzugen lassen.
Es steht hier genau wie bei den Irrationalzahlen : jede Aussage über eine
Irrationalzahl ist eine Abkürzung für Aussagen über Klassen von
rationalen Zahlen. Die Theorie Carnaps stellt die äußerste Konsequenz
dar, zu der man von der traditionellen Ausgangsposition her gelangen
kann — ; sie ist sogar eine notwendige Konsequenz. Nimmt man
einmal jene Ausgangsposition an, so wird man (wenn man streng und
einwandfrei vorgeht, d.h. die Ausdrucksphänomene wirklich als rein
physische Vorkommnisse faßt), unvermeidlich auf den Standpunkt
Carnaps geführt. Gerade darin zeigt sich, wie hoffnungslos sich das
Problem in seiner ursprünglichen Form als ein Zugangsproblem heraus-
stellt.
Fortlebens nach dem Tode . . . " ; O . KULPE, Die Realisierung, Leipzig 1920, Bd. II, Buch
II, Kap. II 11 ; M A C H , Analyse der Empfindungen, S . 12 und 14. RUSSELL, Our Knowledge
of the External World, S. 96 : „the hypothesis that other people have minds m u s t . . . be
allowed to be not susceptible of any very strong support from the analogical argument" ;
diese „Hypothese" gilt ihm als „a working hypothesis". Dagegen vgl. etwa W. SCHUPPE,
Erkenntnistheoretische Logik, Bonn 1878, S. 76 f. und W. JERUSALEM, Der kritische
Idealismus und die reine Logik, Wien/Leipzig 1905, S. 50 f., die beide dem Analogie-
schluß eine zum mindesten „überwältigende Wahrscheinlichkeit" zuschreiben und auf
die zahlreichen Bestätigungen verweisen, während PRANDTL, Einführung in die
Philosophie, S. 111 und F. JODL, Lehrbuch der Psychologie, Stuttgart/Berlin 1924, Bd. I,
Kap. II, 3, die unwiderstehlich sich aufdrängende Deutung der fremden menschlichen
Leiber in Analogie zu unserem eigenen Leib betonen.
84 CARNAP, Scheinprobleme in der Philosophie, § 1 1 [ 1 9 6 6 , S . 6 4 - 7 3 ] ,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
44 Das traditionelle Problem
Diese Problemsituation legt nahe, den ursprünglichen Ansatz selbst in
Frage zu stellen und zu ergründen, ob er in der Tat die unmittelbaren
Gegebenheiten adäquat zum Ausdruck bringt. Erweist sich das Problem
als ausweglos, weil von der Ausgangsposition her der Weg zum
Fremdseelischen prinzipiell verschlossen bleibt, so kann eine Lösung nur
dadurch erhofft werden, daß man die Frage nach dem phänomenal
Gegebenen neu stellt. Es ist zu fragen, inwiefern der traditionelle Ansatz
einzelne Gegebenheiten dadurch verfehlt, daß er sie übersieht oder nicht
getreu beschreibt. Das Ziel eines solchen Vorgehens wäre die Gewinnung
eines neuen und a n g e m e s s e n e n B e g r i f f s des u n m i t t e l b a r G e g e -
benen.
Diesen Weg ist Scheler (und nach ihm Cassirer) gegangen. Gerade die
zwei Momente des traditionellen Ansatzes, die wir oben herausgearbeitet
haben, hat Scheler85 in Frage gestellt. Gegenüber der „selbstverständli-
chen" Ichhaftigkeit aller Erlebnisse weist er darauf hin, daß wir
ausdrücklich „unsere" Gedanken und Gefühle von denjenigen unter-
scheiden, die wir uns angelesen oder sonst von unserer Umgebung
übernommen haben, daß ferner der Mensch besonders als Kind „zu-
nächst" in den Gefühlen und Gedanken seiner Umgebung (Familie,
Gruppe usw.) lebt, und daß es eines langen Entwicklungsprozesses
bedarf, bis es zur Scheidung zwischen Eigenem und Fremden, d.h.
letztlich zur Reflexion auf Erlebnisse kommt, die als Icherlebnisse im
eigentlichen Sinne zu charakterisieren sind86. Vor allem aber wendet sich
Scheler gegen die traditionelle Deutung der Wahrnehmung, der zufolge
wir am anderen Menschen lediglich Körperliches wahrnehmen sollen.
Dadurch, daß er die Ausdrucksphänomene und -einheiten nunmehr als
das primär Gegebene bezeichnet, eröffnet sich ihm (im Gegensatz zu den
früheren Theorien) die Möglichkeit eines adäquaten Verständnisses der
Ausdrucksphänomene, weil er sich diese Deutung durch einen konstruk-
tivistischen Ansatz nicht verbaut. Wenn seelischer Ausdruck in der
unmittelbaren Wahrnehmung selbst angelegt ist, und zwar „zunächst" als
eine psychophysisch indifferente Ganzheit, die sich dann je nach der
Wahrnehmungsrichtung („äußere" oder „innere" Wahrnehmung) in
Leibliches bzw. Seelisches differenziert, dann ist jedenfalls das Problem
des Fremdseelischen kein auswegloses Zugangsproblem mehr. —
Zu ähnlichen Ergebnissen in bezug auf die Ausdrucksphänomene
85 SCHELER, Sympathie, C I I I [S. 2 7 3 - 3 0 7 ; G . W . 7, S. 2 3 2 - 2 5 8 ] ,
86 Für eine konstitutive Phänomenologie bedeuten diese Aufweise Schelers jeweils Titel für
Konstitutionsprobleme. Vgl. hierzu E. STEIN, Zum Problem der Einfühlung, Kap. II, § 6.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Ausweglosigkeit des traditionellen Problems 45
kommt Cassirer"7 im Zusammenhang seiner Analysen des mythischen
Bewußtseins. Auch er sieht die Ausdrucksphänomene nicht als „Epiphä-
nomene" an, die zu Empfindungsinhalten hinzutreten. Vielmehr gilt ihm
der Bereich der Ausdrucksphänomene als eine p r i m i t i v e r e S c h i c h t der
Wahrnehmung, die der Ding- und Sachwahrnehmung vorgelagert ist.
Durch Abbau der Ausdrucksphänomene kommen wir zu den reinen
Dingwahrnehmungen und zu den Empfindungsinhalten — ; niemals aber
läßt sich von diesen Derivaten aus durch irgendeine Theorie das
Ausdrucksphänomen wieder erreichen. Geht man — darin besteht
Cassirers Kritik an der traditionellen Ausgangsposition — von diesen
Derivaten aus, dann bleibt der Bereich der Ausdrucksphänomene und
damit der des Fremdseelischen ein für allemal verschlossen. Dasselbe
ergab sich auch aus unserer Analyse der Analogieschlußtheorie sowie der
Lippsschen Einfühlungstheorie. Daher „muß die phänomenologische
Analyse hier die Ordnung und die Richtung der Betrachtung umkeh-
ren . . . Sie muß die Wahrnehmung bis zu dem Punkte zurückverfolgen, in
dem sie statt Dingwahrnehmung reine Ausdruckswahrnehmung, und in
dem sie daher Inneres und Äußeres in Einem ist." Der Abbau der
Ausdrucksphänomene, der zur naturwissenschaftlichen Welt der Dinge
mit ihren Sachbestimmungen und -eigenschaften führt, vermag jedoch die
Ausdruckswelt nicht zu vernichten. Wir können von den Ausdrucksphä-
nomenen „absehen", wir können sie beiseite schieben —, tilgen können
wir sie nicht. Auch für das entwickelte theoretische Bewußtsein bleibt die
Ausdruckswelt als ein eigenständiges Gebiet eigenen Rechtes und
selbständiger Geltung neben der Welt der bloßen Naturdinge bestehen.
Eigentlich aber nicht neben ihr, sondern vor ihr, - als eine primitivere
und in diesem Sinne ursprünglichere Welt, die in dieser ihrer Eigenstän-
digkeit, Ursprünglichkeit und Vorgelagertheit von der phänomenologi-
schen Analyse begriffen werden muß.
Dieser Vorstoß Schelers und Cassirers verspricht in der Tat, der
Diskussion eine entscheidende Wendung zu geben. Lassen sich diese
programmatischen Äußerungen konkretisieren, d. h. läßt sich die Aus-
druckswahrnehmung als die ursprüngliche Wahrnehmung aufweisen, als
die Cassirer sie hinstellt, dann hat das Problem des Fremdseelischen einen
völlig anderen Charakter gewonnen. Anstatt wie bisher auf künstlichen
Umwegen einen Zugang zum Bereich des Fremdseelischen zu suchen, der
darum nicht zu finden ist, weil man sich ihn durch den ursprünglichen
87 CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Bd. III, Teil I, Kap. II.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
46 Das traditionelle Problem
Ansatz verbaut hat, müßte nunmehr in der primitiveren, theoretisch
unzersetzten Wahrnehmung selbst ein solcher Zugang erblickt werden :
die ursprünglichen Gegebenheiten enthalten in sich diesen Zugang; — in
der Wahrnehmung der Ausdrucksphänomene stoßen wir auf Momente,
in denen Fremdseelisches zum Vorschein kommt88. Damit löst sich in der
Tat das Zugangs problem auf. Doch käme es jetzt darauf an, den
Gegebenheiten dieser primitiven und ursprünglichen Wahrnehmung
nachzugehen, diejenigen Momente aufzuspüren, in denen das Fremdsee-
lische sich gleichsam meldet, sie genauer im Hinblick auf ihre Bedeutung
zu analysieren, und die an sie anknüpfenden Wahrnehmungen, Wahrneh-
mungszusammenhänge und sonstigen Bewußtseinsgestaltungen heraus-
zustellen. Es ist der Weg aufzuzeigen, der von der ursprünglichen
Wahrnehmung etwa eines heiteren Gesichtes zum vollen und überschau-
enden Verstehen der Heiterkeit des betreffenden Menschen führt. Es muß
aufgewiesen werden, wie dieses Verstehen an bestimmte Wahrnehmungs-
momente gebunden ist, sich auf sie fundiert, von ihnen her motiviert und
so als volles Verstehen konstituiert wird, wobei alle Schritte dieses
Konstitutionsprozesses in ihrer Eigenart und Besonderheit, aber auch in
ihrem gegenseitigen Bezug aufzuklären wären.
Von der Scheler-Cassirerschen Bestimmung der ursprünglichen Aus-
druckswahrnehmung aus läßt sich das konkrete Wissen und Verstehen
eines bestimmten konkreten Fremdseelischen aufgrund der hic et nunc
vorliegenden Ausdrucksphänomene aufklären und begreiflich machen.
Darin liegt ein Fortschritt gegenüber der Analogieschlußtheorie und der
Einfühlungstheorie von Lipps. Worüber jedoch auch von hier aus keine
Rechenschaft gegeben werden kann, ist jene schon mehrfach erwähnte
„Alltagsmeinung", daß wir in einer menschlichen Umwelt leben und von
Menschen als Menschen umgeben sind. Zu den „Uberzeugungen"
unseres „natürlichen Lebens", die ihrem Sinne nach auf eine Begründung
gar nicht angewiesen sind, gehört das uns ständig begleitende Wissen, daß
wir in einer menschlichen Gesellschaft leben, in einer allen gemeinsamen
Welt sind. Nicht im Sinne dieser Alltagsmeinung liegt jedoch, daß wir uns
ständig einer Ausdruckswelt bewußt sind. Unser Wissen, in einer
menschlichen Gesellschaft zu sein, bedeutet nicht, daß wir ausschließlich
Trägern von Ausdrucksphänomenen begegnen. So ist auch auf der
einseitig orientierten Basis der Ausdrucksphänomene jene „Alltagsüber-
zeugung" nicht zu erreichen. Die Ausdrucksphänomene sind insofern
88 Vgl. hierzu weiter unten, S. 77 — 82, zur Darstellung der Analysen E. Steins.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Ausweglosigkeit des traditionellen Problems 47
spezifisch m e n s c h l i c h e Ausdrucksphänomene, an die sich ein volles
Verstehen des anderen Menschen anschließen kann, als sie jeweils
aufgrund jenes uns ständig begleitenden alltäglichen Gegenwärtighabens
der Umwelt als einer Menschenwelt auftreten. Bevor die Ausdrucksphä-
nomene zu ihrem Rechte kommen können, muß diese Alltagsmeinung
(die immer schon da ist, wenn sie auftreten, und nicht aus ihnen etwa erst
erwächst) aufgeklärt sein. Darin aber, daß die Menschwelt vom Aus-
drucksphänomen her nicht erreicht werden kann, läßt sich erkennen, daß
der Bereich der Ausdrucksphänomene nicht der einzige und vielleicht
nicht einmal der ursprüngliche ist, der für unser Wissen vom Mitmen-
schen als Menschen in Betracht kommt. Die Scheler-Cassirersche
Ausgangsposition zeichnet sich durch eine Einseitigkeit aus, die diese
Forscher mit den Analogieschlußtheoretikern und mit Lipps teilen89.
Diese Einseitigkeit besteht in der Annahme, daß es nur einen einzigen
Phänomenbereich gibt, der für das Wissen um Fremdseelisches von
Bedeutung ist. Uberall da, wo es sich um andere Menschen handelt, liege
demzufolge dasselbe Problem vor; damit müsse man p r i n z i p i e l l auf
dieselben Phänomene, nämlich die Ausdrucksphänomene, zurückgehen.
Wie entscheidend die Bedeutung der Ausdrucksphänomene für eine
bestimmte Art des Wissens um die anderen Menschen auch sein mag, so
muß man sich doch vor der Einseitigkeit hüten, das ganze Problem des
Mitmenschen auf diesen einen Phänomenbereich festzunageln. Vielmehr
sollten wir fragen, ob die m i t m e n s c h l i c h e n B e g e g n u n g e n je
vielfach v e r s c h i e d e n e n Sinnes sind, ob sie nicht gewissermaßen
in je verschiedenen D i m e n s i o n e n s t a t t f i n d e n , so daß der Sinn
einer j e w e i l i g e n m i t m e n s c h l i c h e n B e g e g n u n g sich nach d e r j e -
nigen D i m e n s i o n b e s t i m m t , in der sie e r f o l g t . Damit wird
„mitmenschliche Begegnung" zu einem Obertitel für eine Reihe geson-
derter Phänomene, deren jedes in seiner spezifischen Eigenart beschrie-
ben und analysiert werden kann. Es erwächst also die Aufgabe, die
verschiedenen Dimensionen herauszustellen, in denen wir es mit Mitmen-
schen zu tun haben und um sie wissen, und den Sinn des jeweiligen
Zu-tun-habens und Wissens entsprechend der jeweiligen Dimension
aufzuklären. Der Herausarbeitung dieser verschiedenen Dimensionen
gelten die weiteren Untersuchungen dieser Abhandlung, für die zunächst
die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen sind.
8, I n bezug auf Scheler gilt das im Text Ausgeführte mit einer gewissen Einschränkung ; vgl.
hierzu weiter unten, S. 145 — 147.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
ABSCHNITT II
ZUM PROBLEM DES BEGRIFFS EINER
NATÜRLICHEN UMWEIT
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
§ 8 Die mitmenschlichen Begegnungen im Horizont der natürlichen
Umwelt
Der Mitmensch ist uns primär nicht als Gegenstand im Sinne eines
Erkenntnisobjekts gegeben, den wir erfahren, beschreiben, bestimmen,
beurteilen oder in anderen Erkenntnisakten thematisieren. Wir können
solche Akte gegenüber Mitmenschen zwar auch vollziehen, und wir tun es
als Psychologen (im weitesten Sinne), als Soziologen, als Historiker usw.,
wobei wir jeweils bestimmte Erkenntnisziele verfolgen. Aber unsere
ursprüngliche Begegnung mit anderen Menschen stellt uns nicht als
erkennende Subjekte einem zu erkennenden Objekt (eben dem anderen
Menschen) gegenüber. Weder sind wir ursprünglich oder gar ausschließ-
lich erkennende Subjekte, die sich aufgrund wissenschaftlicher oder
philosophischer Erkenntnisintentionen auf Gegenstände richten, noch ist
es so, daß uns allererst dann der Mitmensch begegnet, wenn wir diese
Haltung einnehmen. Das würde nämlich bedeuten, daß wir ihm primär als
Gegenstand, als Zielpunkt unserer Erkenntnisintentionen begegnen
würden. Vorgängig aller spezifischen Erkenntnis und unabhängig davon
haben wir es in unserem „natürlichen Leben" des Alltags mit anderen
Menschen zu tun ; wir begegnen ihnen in der Welt, in der dieses unser
Alltagsleben sich abspielt. Wir erfahren sie in verschiedener Weise : wir
verhalten uns zu ihnen oder mit ihnen, sie stehen uns nahe oder fern, sie
gehören zu diesem oder zu jenem Kreis, in dem wir uns selbst bewegen
und zu dem auch wir gehören. Oder sie sind uns fremd, wir haben kein
Verhältnis zu ihnen und gehen in dieser Verhältnislosigkeit gleichgültig an
ihnen vorüber.
Alle diese Begegnungen aber finden statt in der Welt unseres
„natürlichen Lebens", in unserer Alltagswelt, — und zwar nicht allein in
dieser schlechthin, sondern in konkreten Bezirken derselben, in die
uns unser „natürliches", alltägliches Leben führt. Die ursprüngliche
Begegnung mit dem Mitmenschen bedeutet kein Zusammenkommen und
Zusammensein von isolierten Individuen, die in ihrer gegenseitigen
Begegnung sämtliche Bezüge zur Umwelt abgebrochen haben und sich als
abgelöste, als bloße Individuen sozusagen „horizontlos" zusammen-
finden, so daß eine solche Begegnung ein bloßes Zusammendasein
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
52 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
wäre. Vielmehr begegnen wir dem Mitmenschen stets in einem bestimm-
ten Horizont, nämlich in demjenigen der jeweils konkreten Bezirke
unseres „natürlichen Lebens". Wenn wir in einem dieser Bezirke stehen
und uns in ihm verhalten, stoßen wir auf andere Menschen, die jedoch
nicht zufällig auch noch da sind und gleichsam daneben stehen, sondern
vielmehr selbst in ihm sich bewegen und verhalten. Auf sie werden wir in
unserem, der konkreten Situation entsprechenden Verhalten verwiesen,
so daß wir uns auch zu ihnen verhalten. Dabei bedeutet das „auch" nicht
etwa das Hinzukommen des auf den Mitmenschen gerichteten Verhaltens
zu den übrigen Verhaltensformen in der konkreten Situation : wir treffen
den anderen Menschen nicht n e b e n , sondern gerade in dem konkreten
Bezirk, in dem wir jeweils stehen. Der Andere gehört zur jeweiligen
Situation, von ihr bestimmt und seinerseits auch sie bestimmend, so daß
unser Verhalten zu ihm durch unser gesamtes Situationsverhalten
mitbestimmt wird.
Daher e r g i b t sich die A r t u n d Weise der m i t m e n s c h l i c h e n
B e g e g n u n g , des m i t m e n s c h l i c h e n Z u s a m m e n s e i n s s o w i e der
Sinn d e r s e l b e n aus dem H o r i z o n t der k o n k r e t e n B e z i r k e und
S i t u a t i o n e n u n s e r e s A l l t a g s l e b e n s . Und selbst da, wo wir andere
Menschen als Fremde antreffen, an denen wir vorübergehen, und zu
denen wir uns also auch nicht verhalten — wenn man „sich verhalten" in
einem ausdrücklichen und prägnanten Sinne versteht —, begegnen wir
ihnen in der Welt unseres alltäglichen Lebens. Aus dem Horizont der
jeweiligen Bezirke dieser Welt bestimmt sich der Sinn, in dem sie die
„Anderen" (d.h. die uns Fremden) sind. Daß wir ihnen überhaupt
begegnen, besagt folgendes: wir sind mit ihnen in einer Situation
zusammen, auch wenn zu ihnen keine Beziehungen bestehen. Sie sind die
„Anderen", die „Fremden". Aber in welchem Sinne sie es sind, das
bestimmt sich aus dem Horizont, in dem wir ihnen als „Fremden"
begegnen. Niemals gibt es mitmenschliche Begegnungen, die a b s o l u t
horizontlos wären, bei denen zwei „Monaden" ohne Bezüge zur Umwelt
sich einfach gegenüberstünden, deren Zusammensein nicht in einen
Bezirk der gelebten Welt eingebettet wäre. Allerdings kann dieser
Horizont, in dem wir dem Mitmenschen begegnen, im Zusammensein
selbst zurücktreten; das mitmenschliche Zusammensein kann sich von
ihm so weit emanzipieren, daß dieser für es bedeutungslos wird. Dann
findet das Zusammensein seinen Sinn in sich selber, z.B. wenn wir mit
einem Menschen „um seiner selbst willen" zusammen sind. Es liegt
allerdings insofern ein r e l a t i v horizontloses Zusammensein vor, als es
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die mitmenschlichen Begegnungen im Horizont der Umwelt 53
einzig und allein auf den Menschen als solchen gründet, die um ihrer
selber willen zusammen sind, sich infolgedessen als reine I n d i v i d u e n
finden. Weil der Sinn dieses Zusammenseins allein auf den in dieser Weise
sich begegnenden Individuen gründet, ist es als solches v e r s e l b s t ä n -
di gt. Es birgt seinen Sinn in sich und empfängt ihn nicht erst von jenem
Horizont her, in dem es stattfindet. Das Zusammensein ist hier
verabsolutiert, d. h. ist abgelöst von den Bezügen zur Umwelt; es ordnet
sich ihr nicht mehr ein, sondern ruht verselbständigt in sich. Doch darf
diese spezifische Art von mitmenschlichem Zusammensein nicht verallge-
meinert werden; - man darf sie nicht als paradigmatisches Beispiel
mitmenschlichen Zusammenseins überhaupt ansehen. Schließlich kann
sie auch nicht als das ursprüngliche und primäre Zusammensein gelten.
Wenn sich nämlich ein mitmenschliches Zusammensein verselbständigt,
so ziehen sich die Menschen darin von der Umwelt zurück, um sich
ausschließlich als Individuen aufeinander einzustellen. Sie geben die
Bezüge zur Umwelt auf, weil ihr Zusammensein in sich selbst seinen Sinn
findet; gerade deshalb ordnet es sich in umweltliche Situationen nicht
mehr ein. Darin liegt aber ein Hinweis auf den u r s p r ü n g l i c h e n Bezug
zur Umwelt, von der man sich zurückziehen kann, wenn man mit einem
Anderen ausschließlich um seiner selbst willen zusammen ist. Mit
anderen Worten: das verselbständigte Zusammensein weist, da es sich
durch jenes Sich-von-der-Umwelt-abgelöst-haben kennzeichnet, auf ein
ursprüngliches In-die-Umwelt-eingeordnet-sein. Nur auf der Grundlage
dieses als vorgeordnet zu verstehenden Phänomens kann der Sinn jener
Ablösung aufgeklärt werden, — jener Ablösung, die zu einem verselb-
ständigten Zusammensein gehört: es setzt eine vorgängige Verflechtung
mit der Umwelt voraus.
Ferner begegnen wir dem Mitmenschen, mit dem wir in dieser Weise
Zusammensein können, „ z u n ä c h s t " nicht jenseits eines verselbständig-
ten Zusammenhangs. Vielmehr tritt er uns ursprünglich in der Umwelt
und in einer umweltlichen Situation entgegen. Anders ausgedrückt : das
verselbständigte Zusammensein löst sich von dem ursprünglichen, das
innerhalb einer Stuation stattfand, ab, um sich zu verselbständigen und
seinen Sinn in sich selbst zu finden. Daß es überhaupt zu verselbständig-
ten Begegnungen kommt, deutet auf eine ursprünglich horizonthafte
Begegnung hin, die durch diese Verselbständigung allerdings eine radikale
Modifikation erfährt.
Diese Vordeutungen werden erst im Gange der weiteren Untersuchung
zur vollen Klarheit gebracht werden können. Hier machen sie eines
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
54 Zum Problem des Beeriffs einer natürlichen Umwelt
deutlich : wenn die ursprüngliche Begegnung mit dem Mitmenschen im
Horizonte der Situationen unserer „natürlichen Umwelt" erfolgt, dann
muß zuvor der Sinn dieser letzteren geklärt sein, ehe wir daran gehen
können, die verschiedenen Dimensionen des mitmenschlichen Zusam-
menseins zu entwickeln. Die Analyse des mitmenschlichen Zusammen-
seins erfordert die Untersuchung eines Vorproblems, das wir in die Frage
kleiden: was bedeutet „natürliche Umwelt"? Diese Frage führt zu
weiteren Problemen : was sind Eigenschaften der „natürlichen Umwelt",
was sind Situationen in ihr, wie verhalten wir uns in ihnen und wie ist
dieses Verhalten zu beschreiben ?
§ 9 Das Ziel der weiteren Untersuchungen
Diese Vorfragen haben unter dem Titel des Problems eines „natürlichen
Weltbegriffs" bereits eine Geschichte in der Philosophie der Gegenwart.
R. Avenarius1 war der erste, der einen „natürlichen Weltbegriff"
herauszustellen unternahm, um für die Philosophie einen Ausgangspunkt
außerhalb ihrer selbst zu gewinnen. Dieser vor aller Philosophie liegende
„natürliche Weltbegriff" ist von philosophischen Theorien „unvariiert" ;
er entstammt dem „naiven", d.h. nicht philosophisch reflektierenden und
in diesem Sinne „natürlichen" Menschen. Dieser Weltbegriff „war auch
am Anfang meines Philosophierens"; zu ihm muß die philosophische
Theorie zumindest in der Weise zurückkehren, daß sie mit ihm anhebt.
Wie Avenarius hatte auch Husserl2 die „Welt der natürlichen Einstellung"
formal bestimmt, auf deren Grundlage er durch die εποκή den Weg zur
phänomenologischen Sphäre ebnete: ihm handelte es sich um die
Einstellung des naiv dahinlebenden und theoretisch unbekümmerten
Menschen, wie auch um die Welt, in der wir uns in dieser „natürlichen"
Einstellung bewegen, bevor wir überhaupt zu philosophieren beginnen
und wenn wir gerade nicht mehr philosophieren. Auf dem Boden der
natürlichen Welt erwachsen die „Wissenschaften der natürlichen Einstel-
lung", die die verschiedenen Regionen der „natürlichen Welt" sich zu
eigen machen und die deren Gegebenheiten umfassender, sicherer und
1
R. AVENARIUS, Der menschliche Weltbegriff, Leipzig 1912, Abschn. I.
2
HUSSERL,Ideen, § § 2 7 ff. [Husserliana I I I , S . 5 7 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das Ziel der weiteren Untersuchungen 55
vollkommener zu erkennen versuchen als es im bloßen Dahinleben
möglich ist. — Mit seiner Lehre vom „Milieu" und den „Milieudingen"
hat Scheler3 einen weiteren Beitrag zur Explikation der Welt geliefert, in
der wir als alltägliche Menschen leben. Mit seiner positiven Charakteristik
des „Milieus" unseres Lebens und Handelns ist er in gewisser, allerdings
nicht radikaler Weise über das von Husserl Erkannte hinausgegangen.
Eine wirkliche Radikalisierung des Fragens nach der „natürlichen
Umwelt" vollzog Heidegger4, als er das „In-der-Welt-Sein als Grundver-
fassung des Daseins" zum expliziten Thema seiner Analytik machte und -
wie zu zeigen sein wird - eine prinzipiell andere Bestimmung der
alltäglichen Welt als die der philosophischen Tradition eignende vorlegte.
Auf die von Heidegger stammende Analyse der Welt, „in" der wir als
Menschen immer schon sind, zielen wir hier hin. Dabei werden wir
bestimmte Befunde der Gestalttheorie, auf die später einzugehen ist,
berücksichtigen, — Befunde, an denen die von Heidegger herausgearbei-
tete Weltcharaktere prägnanter heraustreten, als dies in einer in naiver
Reflexion vollzogenen Analyse des Verhaltens möglich wäre. Heideggers
Untersuchung hatte es auf das Dasein, „das ich je selbst bin", abgesehen.
Mit Hilfe einzelner Beobachtungen an Hirnverletzten, Kindern und
Tieren werden wir die von Heidegger herausgearbeiteten Strukturen der
Welt unseres „natürlichen Daseins" zu konkretisieren und so zu einer
genaueren Charakterisierung derselben zu gelangen suchen. Diese
Aufklärung der Welt unseres Alltagslebens, die einige zusätzliche von
Heidegger nicht berücksichtigte Momente herauszustellen hat, wird die
Struktur dieser Welt und deren „Seinssinn" deutlich machen. Sie wird
deren kennzeichnenden Eigenschaften angeben und eine Antwort auf die
Frage zu geben versuchen, was die Situationsgebundenheit unseres
Verhaltens in der „natürlichen Umwelt" bedeutet. Mit der Darlegung
dieses unseres Verhaltens und dem Aufweis seiner Eigenart ist ein
Verständnis unseres Zusammenseins mit anderen Menschen in Situatio-
nen der „natürlichen Umwelt" angebahnt. Die Auslegung der Strukturen
der „natürlichen" Umwelt erschließt den Horizont, in dem und von dem
her wir den Mitmenschen begegnen, und der den Sinn dieser Begegnung
überhaupt bestimmt und ausprägt.
Zunächst knüpfen wir noch nicht an Heideggers Analyse des „In-der-
Welt-Seins" an. Vielmehr beginnen wir mit der Darlegung der Bestim-
J
Vgl. SCHELER, Der Formalismus, S. 139 ff. [G. W. 2, S. 153 ff.].
4 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Halle 1927, §§ 12 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
56 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
mungen, die Husserl am Leitfaden der „Welt der natürlichen Einstellung"
erarbeitet hat. Angesichts eben dieser Darlegung zeichnet sich der
Fortschritt ab, den Heidegger und die Gestalttheorie gemacht haben. Vor
allem aber wird von der Husserlschen Bestimmung der „natürlichen
Welt" her, die für den Ansatzpunkt der wissenschaftlichen und philoso-
phischen Tradition bis in die Gegenwart hinein repräsentativ ist, die oben
erwähnte Einseitigkeit 5 der Problemstellung in bezug auf den Mitmen-
schen in ihrem Grunde durchschaubar. Diese Einseitigkeit, durch die das
Problem des Mitmenschen auf die Gegebenheitsweise und Interpretation
von Ausdrucksphänomenen eingeengt wird', hat ihren tiefsten Grund in
einer ursprünglichen Deutung der Welt und des Seins-in-der-Welt. Für
diese Deutung ist Husserls Lehre von der „Welt der natürlichen
Einstellung" insofern repräsentativ, als sie explizit das zum Ausdruck
bringt, was als ursprüngliches Weltverständnis in der philosophischen
Tradition vor allem der Neuzeit 7 und in der Forschungsarbeit der
Gegenwart angesehen werden kann. Indem wir diesen in der Tradition
überall wirksamen „natürlichen Weltbegriff" darlegen, erkennen wir den
Grund jener einseitigen Problemstellung, die sich nur durch einen
5 Vgl. S. 46 f.
6 Infolgedessen läuft das Problem auf die eine Frage hinaus: Wie weiß ich, daß der
andere Mensch Bewußtseinserlebnisse vollzieht, und wie kann ich w i s s e n , um welche
Erlebnisse es sich im besonderen Fall handelt?
7 Wenn also die gesamte Tradition seit der griechischen Antike das „In-der-Welt-Sein"
und damit auch das „Phänomen der Welt" selbst übersprungen hat (vgl. HEIDEGGER,
a.a.O., S. 21 ff., 43 f. und 65), so ordnet sich Husserl, soweit es auf dieses welthistorische
„Versehen" ankommt, dieser philosophischen Tradition ein. — In diesem Zusammen-
hang erhebt sich allerdings die Frage nach dem Grunde dieses „Versehens". Als Aufgabe
historisch orientierter Forschungen müßte also aufgewiesen werden, in welcher Weise
und in welchem Sinne an den entscheidenden Wendepunkten in der Geschichte der
Philosophie das „Phänomen der Welt" und das „In-der-Welt-Sein" zugunsten anderer
Phänomene übersprungen wurde. Es ist kein Zufall, daß das Problem des Mitmenschen
niemals vor Descartes, jedoch sofort danach auf dem Boden seiner Philosophie
aufgetreten ist, z. B. bei N . MALEBRANCHE, De la Recherche de la Vérité]in: Œuvres de
Malebranche herausgegeben von M. J. Simon, Paris 1846, Série II, S. 311 f. (gerade für die
Problematik Malebranches ist das Übersehen des „In-der-Welt-Seins" grundlegend)
und bei A. AÄNAULD, Des vraies et des fausses Idées. Œuvres de Messire Antoine
Arnauld, Lausanne 1780, Bd. X X X V I I I , Kap. X X V . Im Rahmen dieser Abhandlung
können die historischen Wurzeln unseres Problems nicht freigelegt werden ; es sei nur
bemerkt, daß Descartes selbst ein s p e z i f i s c h e s Problem des Wissens um den anderen
Menschen nicht diskutierte, obwohl er nicht nur den Boden dieser Problematik im
allgemeinen bereitgestellt, sondern auch mit seiner Lehre vom Menschen als „unitas
compositionis" (Œuvres de Descartes, herausgegeben von Ch. Adam und P. Tannery,
Bd. VII, S. 423 ; vgl. auch S. 444 : „Nunquam vidi aut percipi humana corpora cogitare,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 57
prinzipiell anderen Ansatz von Welt und Sein-in-der-Welt überwinden
läßt.
Auf die Darlegungen von Avenarius brauchen wir hier darum nicht
besonders einzugehen, weil seine Bestimmung des „natürlichen Weltbe-
griffes" ihrem deskriptiven Gehalt nach sich nicht von dem unterscheidet,
was Husserl später ausdrücklicher und präziser vorgetragen hat. Die
vielen Divergenzen zwischen den genannten Denkern sind im Falle
unseres Themas nicht ausschlaggebend8.
§ 10 Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung"
Wesentlich für die „natürliche Einstellung"' ist Husserl gemäß ein naives
Hinnehmen der Welt und meiner selbst als eines in dieser Welt
befindlichen Menschen. Die Welt ist mir mit all ihren Vorkommnissen
gegeben ; ich nehme dieses Gegebene (von dem ich jederzeit weiß, daß
es nur einen Teilbereich, einen Ausschnitt der Welt darstellt) als G e g e -
benes hin; ich überlasse mich ihm, begnüge mich in natürlicher Naivität
damit, daß es mir gegeben ist. Mit anderen Worten: die Tatsache seiner
Gegebenheit wird mir in keiner Weise fraglich. Bei diesem Faktum bleibe
ich stehen; ich hinterfrage es nicht, so sehr ich sonst auch Fragen
aufwerfen mag, z . B . nach den Beziehungen und Zusammenhängen
zwischen einzelnen Beständen der naiv hingenommenen Welt. Eigentlich
ist mir stets nur jener Ausschnitt der Welt gegeben, den ich als meine
jeweilige U m g e b u n g bezeichne, z . B . das Zimmer, in dem ich mich
sed tantum eosdem esse homines, qui habent et cogitationem et corpus") direkt an das
Problem herangekommen ist, wie denn auch in ihr die oben (S. 21) dargelegte
assoziationistische Deutung der Ausdrucksphänomene ihren Grund und ihre Wurzel
hat. Wo Descartes auf die Wahrnehmung von anderen Menschen zu sprechen kommt
(vgl. a.a.O., S. 32 und 43), handelt es sich ihm nicht um ein spezifisch die Wahrnehmung
vom Menschen betreffendes Problem, wie auch Arnauld geneigt ist, das Spezifische
dieses Problems hinter dem allgemeinen Wahrnehmungsproblem zurücktreten zu
lassen. — Diesen Zusammenhang beabsichtigt der Verfasser in der Konstitution der
neuzeitlichen Philosophie, vor allem des Cartesianismus, auf dem Boden der religiösen
Positionen des 17. Jahrhunderts gewidmeten späteren Untersuchungen nachzugehen. In
dieser Abhandlung vgl. die Andeutungen im Zusatz zu diesem §, S. 68 — 72.
8 Diese Divergenzen berühren gerade auch jenes Moment am „natürlichen Weltbegriff"
nicht, auf das es uns hier ankommt.
' Zum Folgenden vgl. HUSSERL, Ideen, Abschn. II, Kap. I [Husserliana III, S. 57 — 69].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
58 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
gerade aufhalte, während ich von den Weltbeständen, die außerhalb
meiner aktuellen Umgebung liegen, nur „weiß". Dabei besteht kein
Unterschied zwischen der Hinnahme der gegebenen Umgebung und der
Annahme des nur „gewußten" Umkreises, der sich um meine aktuelle
Umgebung verteilt : auch dieser Umkreis wird hingenommen und ist für
mich einfach da. Prinzipiell kann ich alle Umkreise zur neuen aktuellen
Umgebung machen: von jeder gerade aktuellen Umgebung führen
kontinuierlich Wege zu prinzipiell jeder beliebigen neuen Umgebung.
Jederzeit lebe ich in einer derartigen gerade aktuellen Umgebung, die sich
in einen mehr oder minder bestimmten Umkreis von nur „Gewußtem"
einordnet und sich schließlich in einen nebelhaften Horizont totaler
Unbestimmtheit auflöst. In der Möglichkeit des kontinuierlichen Fort-
schrittes von meiner Umgebung zu jedem Bereich des „gewußten" und in
diesem Sinne mitgegebenen Umkreises meiner Umgebung, ferner auch in
der Möglichkeit der partiellen Aufhellung des dunkel-unbestimmten
Horizonts nach dieser oder jener Richtung, bekundet sich mir Einheit
und Form der Welt. Jederzeit in einer Umgebung leben, heißt so viel wie :
ich bin in ihr, ich finde sie vor, sie ist vorhanden, sie ist mir gegeben.
Was besagt nun dieses Vorfinden, Vorhandensein, Gegebensein? In
wahrnehmender Erfahrung ist mir etwa ein Schrank in meinem Zimmer
gegeben. Ich nehme ihn als etwas wahr, das mir gegenüber steht; ich bin
hier und blicke auf ihn, der dort steht. Er ist ein Gegenüber, auf dasich
mich richte10. Daß er mir gegenüber ist, macht den Sinn seines
Für-mich-da-Seins aus und bestimmt die Art und Weise, wie er
mir gegeben ist ; die Art und Weise des Vorfindens macht ihn zu
meinem Gegenstand. Der Sinn seines Gegenstand-Seins liegt darin, daß
er mir gegenüber ist als etwas, das nicht zu mir gehört, auf das ich mich
zwar richten, und mit dem ich mich beschäftigen kann, das aber immer,
auch wenn ich mich ihm zuwende, ein von mir Verschiedenes, mir in
einem gewissen Sinne Fremdes, ein Anderes ist und bleibt. Das
Gegenübersein, das den Sinn der Gegenständlichkeit ausmacht, besagt,
10 Vgl. auch AVENARIUS, Der menschliche Weltbegriff, Abschn. III, Kap. 2, II: „Die
Erfahrung, welche ich zu beschreiben vermag, umspannt.. .immer das Ich-Bezeichnete
und die Umgebung: Das Ich wird immer als ein Umgebenes, der Baum immer als ein
Gegenüber des Ich erfahren." Daß Avenarius damit im Grunde wieder die Subjekt-Ob-
jekt-Korrelation einführt und anstelle dieser Termini lediglich die neuen Ausdrücke
„Zentralglied" und „Gegenglied" der „empiriokritischen Prinzipalkoordination" setzt,
hat O. EWALD, „Welche wirklichen Fortschritte hat die Metaphysik seit Hegels und
Herbarts Zeiten in Deutschland gemacht?" Kantstudien (Ergänzungsheft 53), S. 28ff.
gesehen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 59
daß ich mich immer in einem Abstand zu meiner Umgebung aufhalte.
Dieses Vorfinden erfolgt also im Modus des D i s t a n z i e r t s e i n s . Stets ist
der Gegenstand das Andere, nicht zu mir Gehörige; er ist von mir
abgehoben und abgeschieden, steht in einem Gegensatz zu mir, —
nämlich im „fundamentalsten" Gegensatz, den es für mich gibt : er zeigt
sich während meines Zugewandt- und Beschäftigtseins als ein „Nicht-
Ich"11. Stets stehe ich in dieser Distanz zu ihm, die durch keine noch so
intensive Zuwendung je überbrückt werden kann ; immer befindet er sich
„gleichsam an der Peripherie, an der Grenze der psychischen Wirklich-
keit"12. Der Gegenstand steht zwar in einer Beziehung zu mir, weil er
Zielpunkt meiner Zuwendung ist, aber diese Beziehung gehört wesentlich
zur Distanz, die mich von ihm abhebt. Diese Distanz des Gegenstandes,
auf den ich mich richte, von dem ich Bewußtsein habe, kann durch keine
räumliche Annäherung je überwunden werden13 : sie ist ihrem eigentlichen
Sinne nach keine räumliche Distanz, obwohl sie sich auch im räumlichen
Abstand am prägnantesten bekundet. Vielmehr gehört sie wesenhaft zum
Gegenstandsein und „Gegenstandsbewußtsein"14.
Damit, daß ich als „natürlich" lebender Mensch immer und wesensnot-
wendig in Distanz zu meiner Umgebung und ihren Beständen bin und in
dieser mich auf sie richte, bestimmt sich das In-der-Welt-Leben der
„natürlichen Einstellung", wie Husserl sie expliziert und zum Ausgangs-
boden seiner Forschung gemacht hat, nämlich als ein der-Welt-Gegen-
überstehen15. Indem ich auch in „natürlicher Einstellung" einen Abstand
zur Welt wahre, wenn ich auf das in ihr Vorfindliche hinsehe, mich darauf
11
Vgl. LIPPS, „Bewußtsein und Gegenstände", Kap. II, Psychologische Untersuchungen,
Bd. I, Leipzig 1907 und Leitfaden der Psychologie, Leipzig 1909, S. 8 ff.
12
Vgl. A . PFANDER, Einführung in die Psychologie, Leipzig 1 9 0 4 , Teil I I , Kap. I I § 1.
13
Vgl. STEIN, Zum Problem der Einfühlung, S. 4 6 f.
14
Diesen Terminus hat PFANDER, a.a.O., S. 270, eingeführt.
ls
Vgl. AVENARIUS, Kritik der reinen Erfahrung, Bd. I, S. 10f.: der Philosoph „steht im
Gewühl des Marktes, aber nicht als Käufer oder Verkäufer, sondern als Beschauer des
ganzen Treibens . . . wir stehen einerseits den Bestandteilen unserer Umgebung,
andererseits den menschlichen Individuen in derselben örtlichen Bestimmtheit gegen-
über, wie der Reisende der fremden Landschaft und ihrer Bevölkerung, wie der
Zuschauer auf dem Markt oder im Theater dem Schauplatz und dem Publikum." Indem
der Philosoph diesen „Standpunkt" wählt, erwächst eine Problematik eben dieses
„philosophischen Standpunktes", der offenbar ein ganz anderer als der „natürliche" ist ;
vgl. auch § 14, S. 110 ff. Für Husserl aber ist das Teilnehmen am „Gewühl des Marktes"
fundiert auf dem Zuschauer-Sein; das kommt z.B. in dem sogleich zu besprechenden
Primat der Sacheigenschaften vor den Wertprädikaten, Brauchbarkeiten usw. zum
Ausdruck. Mit dem „Gegenstandsbewußtsein", dessen Korrelat die vorgefundenen
Gegenstände in ihrer Gegenständlichkeit sind, soll die tiefste, alles weitere tragende und
fundierende Schicht des „natürlichen" In-der-Welt-Seins getroffen und beschrieben
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
60 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
richte, und Bewußtsein davon habe, ist schon für die „natürliche
Einstellung" der Begriff des T h e m a s und entsprechend der des
thematischen Bewußtseins konstitutiv. D i e „ n a t ü r l i c h e E i n s t e l -
l u n g " zur Welt ist deren T h e m a t i s i e r u n g . I n dieser E i n s t e l l u n g
haben wir die B e s t ä n d e der Welt als G e g e n s t ä n d e , als Z i e l p u n k -
te t h e m a t i s c h e n B e w u ß t s e i n s vor uns. „ N a t ü r l i c h e s " Sein in
der Welt h e i ß t : G e g e n s t ä n d e n g e g e n ü b e r s t e h e n , sich mit G e -
genständen als mit T h e m e n b e s c h ä f t i g e n , t h e m a t i s c h e s B e -
w u ß t s e i n von G e g e n s t ä n d e n h a b e n , sich t h e m a t i s i e r e n d auf
Gegenstände richten.
Der mir gegenüberstehende Gegenstand als Zielpunkt meiner Zuwen-
dungen ist mein T h e m a . D a ß ich thematisches Bewußtsein von ihm als
Thema habe, bekundet die Beziehung, die zwischen ihm und mir besteht.
Der ursprüngliche Sinn des Begriffes „Gegenstand" bestimmt diesen als
G e g e n s t a n d meines B e w u ß t s e i n s . Diese ursprüngliche Bestimmung
des Gegenstandes als Thema (derzufolge Gegenstand und Thema
geradezu synonym sind) impliziert allerdings den oben erwähnten
Abstand. Nur was in diesem Abstand zu mir sich befindet, kann mein
Thema werden. Wird das „natürliche In-der-Welt-Sein" als Vollzug
thematischen Bewußtseins und entsprechend die Welt als I n b e g r i f f
p o t e n t i e l l e r und aktueller T h e m e n verstanden, dann enthält dieser
Ansatz bereits die Abständigkeit zur Welt als eine Eigenschaft der
„natürlichen Einstellung". —
Auf dem Boden des dargelegten „natürlichen Weltbegriffs" erhält der
unter dem Titel der Thematik stehende Problemkomplex eine zentrale
Bedeutung, vor allem aber auch der für diesen Bereich fundamentale
Begriff der I n t e n t i o n a l i t ä t " . Die Charakterisierung der „psychischen
Phänomene", der Akte, d. h. des Bewußtseins insgesamt, durch Intentio-
nalität, ist eine Konsequenz der oben dargelegten Bestimmung vom
„natürlichen In-der-Welt-Sein" 17 . Ist dieses wesentlich ein Bewußthaben
sein, wie korrelativ dazu Gegenständlichkeit als primäre ontologische Eigenschaft
dessen gilt, was in der Welt an Beständen angetroffen wird, und so schließlich auch der
Welt als omnitudo realitatum selbst.
16 Vgl. F. BRENTANO, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Buch II, Kap. I, § 5 ;
HUSSERL, Logische Untersuchungen, II, V, §§ 10f., Ideen, §§ 84f. Auf den Fortschritt,
den dieser von Brentano in die moderne Philosophie eingeführte Bewußtseinsbegriff
gegenüber dem von Hume und Kant bedeutet (vgl. S. 11 ff.), kann hier nicht
eingegangen werden.
17 Der Verfasser darf bemerken, daß er in seiner Arbeit Phänomenologie der Thematik und
des reinen Ich trotz mancher Einschränkungen und Relativierungen (vgl. S. 281 f. und
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 61
von Gegenständen und ein Sich-richten auf sie, so muß als wesentliche
Eigentümlichkeit der erfahrenden Erlebnisse der ihnen immanente
Charakter von Intention angesehen werden. Aufgrund dieser Intention
bestimmen sie sich als Erlebnisse von diesem oder jenem Gegenständli-
chen und zwar so, daß wir in diesem Intendieren (und nur in i h m )
dessen ansichtig werden, womit wir es gerade zu tun haben. Dabei wird
hier allerdings vorzugsweise an ein w a h r n e h m e n d e s Intendieren
gedacht. In besonders ausgezeichneter Weise kommt die unter dem Titel
„Intentionalität" stehende Eigentümlichkeit den Erlebnissen in der Form
des c o g i t o zu; jenen Erlebnissen also, in denen wir nicht nur
Gegenständliches bewußt haben, sondern in denen wir uns ausdrücklich,
aktuell und explizit mit einem Gegenstande beschäftigen. Diese Erlebnis-
se sind mithin im eigentlichen und prägnanten Sinne thematisches
Bewußtsein, d. h. B e w u ß t s e i n von einem a k t u e l l e n Thema 1 8 . Diese
ausgezeichnete Intentionalität der c o g i t a t i o n e s ist als eine ausgezeich-
nete „Modalität"von Intentionalität zu verstehen, da auch diejenigen
Bewußtseinserlebnisse, die nicht in der Form des c o g i t o auftreten,
jedoch einzelne zum Thema gehörige, d. h. mitgegebene Hintergrundsbe-
stände betreffen, intentionale Erlebnisse sind.
Auf die in dieser Weise ausgelegten Welt der „natürlichen Einstellung"
bezieht sich auch die konstitutive Phänomenologie Husserls. Sie faßt die
gegenständlichen Einheiten dieser Welt als „ontologische Leitfäden"
ihrer konstitutiven Analysen auf und betrachtet die auf sie bezogenen
Erlebnisse unter dem Gesichtspunkt der Leistung, d. h. der „teleologi-
schen Funktion" ihrer Intentionalitäten 1 '.
Im „natürlichen In-der-Welt-Sein" selbst liegt ferner die Wurzel
sowohl des Gegensatzes von S u b j e k t und O b j e k t wie auch ihrer
korrelativen Zusammengehörigkeit. Diese Korrelation bildet geradezu
380 f.) im Grunde doch an dem „natürlichen Weltbegriff" im Sinne Husserls festgehalten
hat ; das tritt besonders in der Wahl mancher Beispiele hervor. Wird dieser „natürliche
Weltbegriff" als n a t ü r l i c h e r in Frage gestellt, so bedeutet das noch keine radikale
Verfehlung der Lehre von der Intentionalität. Für einen bestimmten Bereich behält der
Begriff der Intentionalität nach wie vor seine grundlegende Bedeutung, wie auch der
Problemkreis der Thematik zentral für diesen Bereich bleibt. Es kann nicht darum
gehen, diesen Bereich zu leugnen, ihn schlechthin und überhaupt in Frage zu stellen.
Seine Existenz wird auch dann nicht zweifelhaft, wenn man ihn nicht bereits im
„natürlichen In-der-Welt-Sein" und als dessen wesentliche Eigenschaft aufweisen kann.
18 Vgl. HUSSERL, Ideen, § § 3 5 ff., 8 4 , 1 1 5 . Vgl. auch GURWITSCH, Phänomenologie der
Thematik und des reinen Ich, Kap. II, § 7.
" HUSSERL, a. a. O . , § § 149 ff., Formale und transzendentale Logik, § § 94, 97 u n d 100,
[Husserliana XVII, S. 239 ff., 251 f. und 261 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
62 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
die fundamentale Urstruktur des „natürlichen In-der-Welt-Seins". Daß
wir überhaupt Gegenständen gegenüberstehen und in diesem abständigen
Gegenübersein von ihnen „wissen", das eben ist es, was die Subjekt-Ob-
jekt-Korrelation zum Ausdruck bringt20. Die zentrale Bedeutung der
Subjekt-Objekt-Problematik in der neuzeitlichen Philosophie sowie die
durch diese Problematik orientierte Auseinandersetzung mit dem Er-
kenntnisproblem als dem fundamentalen und primären philosophischen
Problem hat ihre Wurzel darin, daß das Leben in „natürlicher Einstel-
lung" bereits durch diese Korrelation gekennzeichnet wird21. Wenn nun,
wie N. Hartmann22 ausdrücklich gezeigt hat, die Subjekt-Objekt-Korre-
lation für das Phänomen der Erkenntnis spezifisch ist, dann mündet die
Beschreibung des Lebens der „natürlichen Einstellung" mit Hilfe der
Begriffe von Subjekt und Objekt in eine Bestimmung des „In-der-Welt-
Seins" als „Welterkennen" ein23.
Die Bestimmung der „natürlichen Welt" als Inbegriff von Gegenstän-
den im Sinne aktueller und potentieller Themen kognitiven Bewußtseins
wie auch diejenige des „natürlichen In-der-Welt-Seins" als Vollzug
intentionaler Zuwendungen implizieren eine wechselseitige Unabhängig-
keit zwischen den Gegenständen und mir, dem „natürlichen" in der Welt
lebenden, d.h. mannigfache Zu- und Abwendungen vollziehenden
Menschen. Diese Unabhängigkeit kommt einerseits im „An-sich" der
Gegenstände, andererseits in der Freiheit des Ichs zum Ausdruck,
worunter hier immer der in „natürlicher Einstellung" lebende Mensch
verstanden wird.
Explizieren wir zunächst den Sinn des „An-sich" von Gegenständen.
Die kogitative Zuwendung stößt auf einen Gegenstand von gewissen
objektiven Bestimmtheiten, die ihm zukommen. Sie findet an ihm diese
oder jene Beschaffenheiten, Eigenschaften, Qualitäten vor, die in einer
gegenständlichen Beschreibung aufgezählt und verdeutlicht werden
können. In diesen seinen „objektiven" Bestimmungen wird der Gegen-
stand durch eine kogitative Zuwendung erfaßt, und zwar als der, der er ist,
und so, wie er ist. Dadurch wird er zu einem zeitweiligen Thema. Dieses
kogitative Erfassen findet den Gegenstand vor als einen, der so, wie er ist,
und mit allem, was ihm zukommt, dem erfassenden Ich gegenübersteht,
20 Vgl. P. HOFMANN, Das Verstehen von Sinn und seine Allgemeingültigkeit, Berlin 1929, S.
8 ff.
21 Vgl. M. GEIGER, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Bonn 1930, S.
20 ff.
22 N. HARTMANN, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Kap. 5.
23 Vgl. HEIDEGGER, Sein und Zeit, § 13.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 63
unabhängig davon, ob ihn eine cogitatio trifft oder nicht. Er bleibt der,
der er als identischer ist, bleibt also davon unberührt, ob sich cogitatio-
nes auf ihn richten oder nicht. Am Gegenstand wird nichts geändert,
wenn sich intentionale Akte auf ihn richten; es bedeutet für seinen
objektiv-gegenständlichen Bestand keine Modifikation, wenn er zum
Zielpunkt einer cogitatio wird24. Vielmehr trifft ihn die cogitatio in
seiner objektiven Bestimmtheit an; er ist in sich abgeschlossen und
„fertig", ruht ganz in sich und wird in seiner Selbstgenügsamkeit erfaßt.
Dadurch, daß er als „fertiges", abgeschlossenes, selbständiges und in sich
stehendes Gebilde uns gegenüber tritt und von uns „erblickt" werden
kann, bekundet sich sein „An-sich-sein". Dies verleiht der Rede vom
„An-sich-erfaßt-werden" ihren Sinn. Diesem Tatbestand entsprechend
hat man das Wesen des Bewußtseins geradezu als ein „Transzendieren"
seiner Grenzen, als ein „Springen über seinen Schatten" und als ein
Hinübergreifen in die ihm total heterogene Sphäre objektiver, an-sich-sei-
en-der Gegenstände bestimmt25.
Indem wir den Gegenstand in seinem selbstgenügsamen „An-sich"
erfassen, explizieren wir die ihm zukommenden Bestimmtheiten. Das
Ding, dem wir als Bestandteil unserer Umgebung zugewandt sind, hat ein
bestimmtes „Aussehen" : es ist so und so gefärbt, ist von dieser oder jener
Gestalt und Größe, hat Konturen einer bestimmten Art, fühlt sich rauh
oder glatt an usw. Was diese Beschreibung des in seinem „An-sich" und
seinen objektiven Bestimmtheiten vorgefundenen Dinges an derartigen
Eigenschaften zum Ausdruck bringt, sind lauter Sacheigenschaften, d. h.
solche, die dem Ding qua Naturding zukommen. Sie charakterisieren
das Ding in seinem „An-sich" und konstituieren es als gegenständliche,
identische, in unserem Falle dinghafte Einheit. Das Ding „hat" die
Eigenschaften, d.h. sie sind seine „objektiven", ihm ein für allemal
zukommenden Bestimmtheiten, die es zu dem machen, was es als dieses
konkrete Ding ist. Unter seinen Sacheigenschaften finden sich nun solche,
aufgrund derer es in bestimmten Situationen in dieser oder jener Weise
verwendet werden kann. Weil z.B. ein Hammer als Naturding seine
„objektiven", ihm zukommenden Bestimmtheiten hat, kann ich ihn
verwenden, um einen Nagel einzuschlagen. So erwächst ihm auf der Basis
bestimmter Sacheigenschaften ein Gebrauchs- und Nützlichkeitswert:
dank seiner Sacheigenschaften konstituiert sich das Naturobjekt zum
24 V g l . h i e r z u C h r . SIGWART, Logik, T ü b i n g e n 1 9 2 1 , 1 § 6 , 3 D. —
25 Vgl. ζ. B. LIPPS, Bewußtsein und Gegenstände, S. 83 ; Leitfaden der Psychologie, S. 12 ; N.
HARTMANN, a . a . O . , S. 4 3 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
64 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Gebrauchsgegenstand. Allgemein gilt für den hier gemeinten Begriff der
„natürlichen Welt" das Primat der Sacheigenschaften vor den Nützlich-
keits-, Gebrauchs- und anderen, z . B . ästhetischen Werten. Zwar „finde
ich die Dinge vor mir ausgestattet, wie mit Sachbeschaffenheiten, so mit
Wertcharakteren, als schön und häßlich, als gefällig und mißfällig, als
angenehm und unangenehm und dgl. Unmittelbar stehen Dinge als
Gebrauchsobjekte da, der ,Tisch' mit seinen .Büchern', das ,Trinkglas',
die ,Vase', das,Klavier' usw. Auch diese Wertcharaktere und praktischen
Charaktere gehören k o n s t i t u t i v zu den . v o r h a n d e n e n ' O b j e k t e n
als solchen . . . " 2 6 Aber diese letzteren Charaktere sind fundiert in den
Sachbeschaffenheiten. Wenn sie auch nicht hinzukommende Aspekte und
bloße „subjektive" Wertungen darstellen, die an die Dinge von uns
herantragen werden, so handelt es sich bei ihnen doch um „höhere"
Schichten, die sich auf die tragende Schicht der Sachbeschaffenheit lagern,
d. h. um „unselbständige Momente", die fortfallen könnten, ohne daß
dabei das Ding in seinem objektiven Sachbestande berührt würde27. Die
ursprüngliche Schicht der Dinge unserer Umgebung macht zunächst jene
Sacheigenschaften aus, aufgrund derer später Wertprädikate, Geeignet-
heiten, Verwendbarkeiten usw. hinzukommen, wenn auch als Prädikate
des Dinges selbst und nicht als bloße subjektive, in irgendeinem Sinn
„illusionäre" Zutaten. Das besagt: was das konkrete Ding in seinem
„An-sich" ist, das bestimmt sich durch diese Sachbeschaffenheiten, die es
als diese objektive und identische Einheit konstituieren, nicht aber durch
die möglicherweise vielfach wechselnden Funktionen, die ihm erst
aufgrund seiner objektiven Qualitäten in den verschiedenen Situationen
und Umständen zuwachsen. Bevor es eine dieser Funktionen annehmen
und eine Rolle in Lebenssituationen spielen kann, ist es in seinen
Sachbeschaffenheiten bereits als objektiv-identische Einheit konstituiert
und hält sich als solche in und gegenüber den wechselnden Funktionen in
verschiedenen Situationen durch. Weil ein Stock die objektive Eigenschaft
seiner Länge besitzt, kann ich ihn etwa zum Hervorholen eines Schlüssels
unter dem Sofa benutzen, kann mich aber ein anderes Mal auch beim
Gehen auf ihn stützen. Er ist und bleibt jedoch der i d e n t i s c h e und als
i d e n t i s c h gegebene Gegenstand, dasselbe Ding mit seinen objekti-
ven Bestimmtheiten, das zum „Träger" dieser und anderer Funktionen
werden kann. Nicht aber erhält der „Gegenstand" — man dürfte in
diesem Falle eigentlich gar nicht den Ausdruck „Gegenstand" verwenden
26 H U S S E R L , Ideen, S. 50 [Husserliana III, S. 59],
17 Vgl. HUSSERL, a.a.O., S. 67,197 ff. und 247 [Husserliana III, S. 83 f., 236 ff. und 293 f.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 65
— von seiner konkreten Funktion her die Bestimmung seines Seins28. In
diesem Falle wäre seine objektiv-gegenständliche Identität in keiner Weise
seinen Funktionen in Verwendungssituationen vorgelagert ; diese Identi-
tät wäre überhaupt keine schlichte, einfach hinzunehmende, selbstver-
ständliche „Tatsache", sondern würde uns vielmehr vor ein Problem
stellen, das — wie sich zeigen läßt — schwierige und weit ausholende
Untersuchungen erfordern würde.
Der Unabhängigkeit des Gegenstandes, die sich darin bekundet, daß
wechselnde Verwendungen ihn in seinem Seinsbestande nicht tangieren29,
entspricht die Freiheit des Ich, die in der gegenständlichen Ungebun-
denheit liegt. Daß meine cogitatio sich hic et nunc gerade auf dieses und
kein anderes Ding meiner Umgebung richtet, ist Sache meiner Freiheit.
Kein Gegenstand bindet mich an sich. Er kann mir „auffallen", sich mir
„aufdrängen", meinen „Blick auf sich ziehen" oder wie man sonst noch
zu sagen pflegt. Wenn ich aber einer solchen Tendenz folge und mich ihm
zuwende, aktualisiert sich mir in der Zuwendung selbst meine Freiheit.
An und für sich brauche ich einer derartigen Tendenz nicht nachzugehen :
ich sitze in Gedanken da und bin mit etwas beschäftigt, Geräusche von der
Straße dringen herauf und „stören" meinen Gedankenablauf. Ich habe die
Wahl - ohne daß im Normalfall ein ausdrückliches Wollen, Vorziehen und
Entscheiden vorläge, - bei dem Thema meiner Gedanken zu bleiben,
obwohl meine thematische Beschäftigung mit ihm vielleicht fortwährend
durch die Straßengeräusche „gestört" und „durchkreuzt" wird (eine
Bewußtseinsgestaltung, der wir hier nicht weiter nachgehen können,
obgleich sie eine eingehende Analyse sehr wohl verdienen würde) ; oder
ich kann mich den Geräuschen selbst thematisch zuwenden, sie zu einem
neuen und gegen das alte abgesetzte Thema machen. Welche dieser
Möglichkeiten ich aktualisiere, steht in meiner Freiheit, und gerade weil
ich eine von ihnen aktualisiere, bin ich frei. Im aktuellen Vollzug selber
bekundet und aktualisiert sich mir meine Freiheit: im thematischen
Sich-zu- und -abwenden — und nur in ihm — liegt meine Freiheit
gegenüber der Gegenstandswelt.
Wenn ich als freies Wesen in der Welt bin, besagt das mithin (wenn
man dessen inne wird, daß für den hier gemeinten Begriff der „natürlichen
28
Vgl. hierzu die §§13 und 15 in diesem Abschnitt.
29
Von „realen Eingriffen" aufgrund naturgesetzlicher Zusammenhänge ist hier selbstver-
ständlich nirgends die Rede; schon deshalb nicht, weil Naturgesetze sich auf
Naturdinge, d. h. auf die objektiv identischen Dingeinheiten in ihren Sachbestimmthei-
ten beziehen und sie voraussetzen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
66 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Welt" das „In-der-Welt-Sein" soviel heißt wie „Auf-die-Welt-hinschau-
en" oder „Als-Zuschauer-der-Welt-gegenüberstehen"), daß ich in der
Welt freie Umschau halten kann. Jederzeit befinde ich mich in einer
Umgebung und lasse meine Blicke nach Belieben in ihr wandern. Ich sehe
etwa aus dem Fenster auf die Straße; bald blicke ich auf das gegenüberlie-
gende Haus, dann auf die Baumgruppe dort, dann wieder auf einen
vorüberfahrenden Wagen, auf einen Passanten usw. Das, womit ich
soeben thematisch beschäftigt war, entlasse ich aus dem Blick, richte mich
auf etwas anderes, kehre wieder zu meinem alten Thema zurück30. In
dieser Weise sind mir alle Bestände meiner Umgebung jederzeit verfüg-
bar; jedem von ihnen kann eine Zuwendung gelten, jeder kann zum
Zielpunkt einer c o g i t a t i o , d.h. zu meinem aktuellen Thema werden
und so eine gewisse Bevorzugung erfahren. Alles, was sich in meiner
Umgebung befindet, ist potentieller Zielpunkt kogitativer Zuwendungen.
Damit ist gemeint, daß es mir v e r f ü g b a r i s t . So ist meine ganze
Umgebung ein Feld für freie Zu- und Abwendungen ; sie ist das Feld, in
dem ich mich frei und beliebig umsehen kann und das die Zielpunkte
meiner co g i t a t i o n e s enthält. Bin ich mit irgendeinem Bestandteil meiner
Umgebung thematisch beschäftigt, so sind mir tnit diesem meinem Thema
mannigfache Hintergrundsbestände „mitgegeben", von denen einige zu
meinem Thema bloß hinzukommen, während andere in verschiedener
Weise mit dem Thema „verflochten" sind, s a c h l i c h zu ihm gehören und
so sein thematisches Feld bilden 31 . Dieser ganze Bereich des Mitgegebe-
nen ist ein solcher für freie Blickwendungen: jederzeit habe ich die
Möglichkeit thematischer Zuwendungen zu den Beständen dieser Domä-
ne, indem ich mein bisheriges Thema aufgebe und einen dieser Bestände
zu meinem neuen Thema mache. Dabei unterstehen diese thematischen
Modifikationen streng gesetzlichen Regelungen, die ihren Grund in dem
phänomenologischen Befund des „thematischen Bewußtseins" haben
und die den genannten Modifikationen bestimmte Stilrichtungen ihrer
Möglichkeit nach vorschreiben 32 . Ich bin in der Freiheit meiner Blick-
wendungen aber nicht auf das beschränkt, was mir jetzt gerade
„mitgegeben" ist. Während ich etwa den Schrank in meinem Zimmer
betrachte und ihm thematisch zugewandt bin, kann mir eine Landschaft
„einfallen", die ich einmal gesehen habe; — auf sie kann ich mich
30 Vgl. PFANDER, Einführung in die Psychologie, S . 2 1 0 f. und LIPPS, Bewußtsein und
Gegenstände, S. 23.
31 Vgl. GuRwrrsCH, Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, Kap. II, §§ 3 ff.
32 Soweit diese Modifikationen im thematischen Bereich selber vor sich gehen, haben wir
sie a.a.O., Kap. 3, untersucht.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 67
thematisch richten. Das neue Thema braucht dabei mit dem alten in
keinerlei sachlichem Zusammenhang zu stehen. Völlig frei und unmoti-
viert kann ich von einem Thema und von einem thematischen Bereich zu
jedem anderen übergehen und habe so in dem dadurch bestimmten Sinne
die Welt, d. h. alles, was in der Welt vorhanden ist, verfügbar.
Diejenigen Erlebnisse, in denen wir von unserer Freiheit gegenüber den
Beständen unserer Umgebung und sogar gegenüber der ganzen Welt
Gebrauch machen, sind die Erlebnisse von der Form c o g i t o . Weil sich in
den c o g i t a t i o n e s diese unsere Freiheit aktualisiert, hat Husserl sie als
spezifische Ich-Akte beschrieben33. „Ist ein intentionales Erlebnis aktuell,
also in der Weise des cogito vollzogen, so richtet sich in ihm das Subjekt
(das ,Ich') auf das intentionale Objekt. Zum cogito selbst gehört ein ihm
immanenter ,Blick-auf das .Objekt', der andererseits aus dem Ich
hervorquillt, das also nie fehlen kann." 34 Auch die phänomenologisch
reduzierten Erlebnisse sind und bleiben spezifisch ichhafte Erlebnisse;
keine Reduktion vermag das ego aus dem c o g i t o herauszustreichen, sie
ändert nichts daran, daß das reine Ich, d. h. das transzendental reduzierte,
in den c o g i t a t i o n e s lebt. „Dieses Leben . . . bedeutet eine Mannigfal-
tigkeit von beschreibbaren Weisen, wie das reine Ich in gewissen
intentionalen Erlebnissen, die den allgemeinen Modus des cogito haben,
als das .freie Wesen', das es ist, darinnen lebt. Der Ausdruck ,als freies
Wesen' besagt aber nichts anderes als solche Lebensmodi des Aus-sich-
frei-herausgehens oder In-sich-zurückgehens, des spontanen Tuns, des
von den Objekten etwas Erfahrens, Leidens usw." 35
Ausdrücklich sei noch bemerkt, daß in diesem Zusammenhange die
Theorie der Intentionalität, des c o g i t o usw. nicht in ihrer spezifischen
Bedeutung in Betracht kommt, sondern nur insofern, als in ihr der
ursprüngliche Ansatz der „natürlichen Welt" und des Lebens in
„natürlicher Einstellung" zur konsequenten Entfaltung kommt. Dieser
Ansatz wird auch von solchen Forschern — stillschweigend oder
ausdrücklich — geteilt, welche die Theorie der Intentionalität als die der
Wesenseigenschaft von Erlebnissen nicht gelten lassen wollen, deren
33 Vgl. HUSSERL,Ideen, besonders §§ 57, 80, 84, 92, 112.
34 HUSSERL, a.a.O., S. 65 [Husserliana III, S. 81]; ebenso S. 168 — 169 [Husserliana III, S.
204]: „In jedem aktuellen cogito richtet sich ein von dem reinen Ich ausstrahlender
,Blick' auf den .Gegenstand' des jeweiligen Bewußtseinskorrelats, auf das Ding, den
Sachverhalt usw. und vollzieht das sehr verschiedenartige Bewußtsein v o n ihm."
35 HUSSERL, a.a.O., S. 192 [Husserliana III, S.231]. — Zur Kritik dieser Lehren Husserls sei
auf unsere in Anm. 31 genannte Arbeit verwiesen, die in dieser Frage zu dem von Husserl
in der 1. Auflage der Logischen Untersuchungen vertretenen Standpunkt zurückkehrt.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
68 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Bewußtseinsphänomenologie sich mithin vielmehr am Bewußtseinsbe-
griff Humes orientiert36. Insofern Husserl das, was der Konzeption der
„natürlichen Welt" immer schon zugrunde lag und die Problemstellungen
bestimmte, in voller Konsequenz darlegt, sind seine Darlegungen in der
Tat für den „natürlichen Weltbegriff" der philosophischen Tradition in
besonderer Weise repräsentativ. Auch bedeutet der von ihm und Brentano
eingeführte Bewußtseinsbegriff einen Fortschritt etwa gegenüber dem
Humes und Kants. Für uns kommt hier das Gebiet des intentionalen
Bewußtseins, dessen „Existenz" und Legitimität nicht bestritten werden
kann, lediglich aufgrund seines Zusammenhangs mit der Behandlung des
Lebens in der „natürlichen Welt" in Betracht, d. h. insofern, als das „Sein
in der natürlichen Welt" gleichgesetzt wird mit „in Akten intentional auf
Gegenstände gerichtet sein".
Zusatz
Im Rahmen dieser Abhandlung kann auf die h i s t o r i s c h e n W u r z e l n
des dargelegten Begriffs der „natürlichen Welt" und des Lebens in dieser
Welt nicht ausführlich eingegangen werden. Diese Wurzeln liegen in dem
die gesamte Philosophie der Neuzeit bestimmenden Ansatz von Descar-
tes und in der Entwicklung und Ausgestaltung, die dieser Ansatz im
Kreise der Cartesianer (vor allem bei A. Arnauld) gefunden hat.
Als Descartes das Seelische überhaupt mit den c o g i t a t i o n e s identifi-
zierte, gelangte er zu einem neuen Seelenbegriff, der von dem der
aristotelisch-scholastischen Tradition radikal verschieden war, nämlich
zum „Bewußtseinsseelenbegriff" 37 . Er bildete damit auch eine ganz
bestimmte Lehre vom Wesen des Menschen aus. Die „psycho-physische"
Einheit, als die der Mensch sich darstellt, die „unitas corporis ac mentis",
ist eine unitas lediglich c o m p o s i t i o n i s , nicht naturae 3 8 . Im Leibli-
chen liegt das Wesen des Menschen deshalb nicht, weil der menschliche
Körper eine res extensa wie jede andere ist. So liegt für die Bestimmung
des spezifisch Menschlichen alles daran, wie man mens und anima
versteht. Insofern bedeutet die Wendung „sum . . . praecise tantum res
36 Das gilt auch und gerade für die Versuche von Avenarius und Mach, den Subjekt-Ob-
jekt-Dualismus durch die philosophische Analyse zu überwinden, was sich sowohl an
dem Ansatz als auch in der Art und Weise ihres Vorgehens zeigt.
37 Diese Bezeichnung hat H . SCHMALENBACH, „Die Entstehung des Seelenbegriffs", S.
313 f., eingeführt.
38 AT VII, S. 423.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 69
cogitans, id est, mens, sive animus, sive intellectus, sive ratio" 39 und die
darin zum Ausdruck kommende Bestimmung der Seele (für die einzig und
allein das c o g i t a r e konstitutiv ist) nicht nur die Gewinnung einer,
wenngleich sehr wichtigen und für das Erkennen sogar zentralen Schicht ;
vielmehr wird damit etwas über das Sein des Menschen insgesamt
ausgesagt. Für das Sein des Menschen ist das c o g i t a r e , das Vollziehen
von c o g i t a t i o n e s charakteristisch40. Was den Menschen auszeichnet,
was ihn allerst zum Menschen macht, ist seine facultas cogitandi : im
c o g i t a r e und nur in ihm liegt sein Sein. Sum res cogitans bedeutet
„cogitatio . . . sola a me divelli nequit" 41 . Weil die „essence de l'âme est de
penser" 42 und weil ferner „ ce qui constitue la nature d'une chose est
tousjours en elle, pendant qu'elle existe" 43 , darum muß die anima immer
c o g i t a t i o n e s haben, selbst im Schlafe, in der Ohnmacht, usw. Sogar der
Embryo ist bereitsein res cogitans 4 4 . Würde der Mensch in irgendeinem
Zustand keine c o g i t a t i o n e s haben, so wäre das mit der Vernichtung
seiner Existenz gleichbedeutend : „il me seroit plus aisé de croire que l'âme
cesseroit d'exister, quand on dit qu'elle cesse de penser, que non pas
concevoir quelle fust sans pensée" 45 . Auch diese naturalistische Wendung
besagt nichts anderes als die Bestimmung des Menschseins durch das
penser = c o g i t a r e .
Daß es sich hierbei in der Tat um das spezifische Sein des M e n s c h e n
handelt, zeigt unter anderem Descartes' Theorie in bezug auf das Problem
des tierischen Seins. Es kommt ihm in erster Linie auf eine mechanistische
Biologie darauf an: denn auf den Einwand44, man könne doch nicht
„omnes operationes bestiarum absque sensu vita, et anima, ope mechani-
ce satis explicare", antwortet er47 mit der Interpretation des absque
sensu, vita, et anima im Sinne von absque c o g i t a t i o n e : „neque
39 Vgl. AT VII, S. 27.
40 Vgl. AT VII, S. 78 : „hoc ipso quod sciam me existere, quodque interim nihil plane aliud
ad naturam sive essentiam meam pertinere animadvertam, praeter hoc solum quod sim
res cogitans, recte concludo meam essentiam in hoc uno consitere quod sim res
cogitans."
41 AT VII, S. 27.
42 AT III, S. 273.
43 AT III, S. 478 ; vgl. auch 423 : „[nulla] res potest unquam propria essentia privan."
44 Vgl. AT III, S. 356. Ähnliches bei PFANDER, a.a.O., S. 221 ff.
45 AT III, S. 423.
46 AT VII, S. 414.
47 AT VII, S. 426.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
70 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
enim id quod vulgo vocatur anima, nec anima corporea, nec sensus
organicus, brutis a me denegatur."48
Die c o g i t a t i o selbst wird von Descartes in folgender Weise be-
stimmt : „cogitationis nomine, intelligo ilia omnia, quae nobis consciis in
nobis fiunt, quatenus eorum in nobis conscientia est." 4 ' Das c o n s c i u m
esse, das den Sinn des Menschseins ausmacht, „est quidem cogitare et
reflectere supra suam cogitationem." 50 Diese Bestimmungen hat Arnauld,
der in dieser Beziehung durchaus Descartes' Schüler ist, näher präzisiert :S1
„comme donc il est clair que j e pense, il est clair aussi que je pense à
quelque chose; c'est à dire, que je connais et que j'apperçois quelque
chose: car la pensée est essentiellement cela." Zu dieser pensée gehört
ihr „objet connu ou apperçu qui est objectivement dans l'âme". Damit ist
das penser wesentlich durch die Intentionalität charakterisiert: „la
nature de l'esprit est d'appercevoir les objets" und „je ne puis non plus me
demander à moi-même la raison pourquoi je pense à quelque chose, que
pourquoi je pense ; étant impossible de penser, qu'on ne pense à quelque
chose." 52 Die p e n s é e , die in bezug auf die stets wechselnde „chose
apperçue en tant qu'elle est objectivement dans l'âme" sich als eine
„modification de l'âme" darstellt, hat ferner zwei ständige unveränder-
liche Begleitgedanken aller „modification" : das ist einmal „la pénsee de
l'être universel. . . notre âme ne connaissant rien que sous la notion d'être
ou possible ou existant" und ferner „la pensée qu'a l'âme de soi-même . . .
parce que, quoi que ce soit que je connoisse, je connois que je le connois,
par une certaine reflection virtuelle qui accompagne toutes mes pensées",
denn „je me connois . . . moi-même, en connoissant toutes les autres
choses". 53 Von da aus gewinnt Arnauld die Bestimmung der êtres
i n t e l l i g e n t s als der Wesen „qui sunt conscii sui et suqe operationis".
48 Auf die Inkonsequenz dieser Äußerung gegenüber der Zweisubstanztheorie sei hier nur
hingewiesen.
49 AT VIII, S. 7.
50 A T V , S . 149.
51 ARNAULD, Ouvres, tome XXXVIII (Des vraies et des fausses idées), Kap. II.
52 Damit führt Arnauld die bekannte scholastische Lehre von der intentionalen (mentalen)
Inexistenz, die sachlich auch sonst in den Diskussionen mit Descartes (ζ. Β. in den
Primae O b j e c t i o n e s et Responsiones, AT VII, S. 91 ff.) eine Rolle spielt, explizite
in den Cartesianismus ein. Diese Lehre hat für ihn die Bedeutung, daß sie das Wesen
(nature) der Seele (esprit, âme) und überhaupt des Menschen bestimmt. In diesem
Zusammenhang entsteht das überaus wichtige historische Problem, welchen Sinn und
welche Bedeutung die Lehre von der Intentionalität für die Scholastiker hatte.
53 Vgl. dazu AT VII, S. 33 : „nullae radones vel ad cerae, vel ad cujuspiam corporis
perceptionem [possunt] iuvare, quin eaedem omnes mentis meae naturam melius
probent."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Husserls Bestimmung der „Welt der natürlichen Einstellung" 71
Weil das Sein des Menschen als penser (cogitare) b e s t i m m t
und als dessen f u n d a m e n t a l e S t r u k t u r das penser à quelque
chose sowie das conscium sui esse (je connois que je connois)
angesetzt wird, liegt das Menschsein wesentlich darin, daß der
Mensch in seinen pensées nicht n u r seiner, sondern auch der
G e g e n s t ä n d e b e w u ß t ist, oder a n d e r s : daß er als Subjekt den
O b j e k t e n gegenübersteht 5 4 . Damit ist im Prinzip derjenige Begriff
des In-der-Welt-Seins erreicht und ausgebildet, dessen Explikation durch
Husserl für die philosophische Tradition der Neuzeit repräsentativ ist.
Dieser Begriff ist als solcher seiner Herkunft nach und in seinem
ursprünglichen Sinn ein a n t h r o p o l o g i s c h e r : in ihm kommt eine
bestimmte anthropologische Konzeption zum Ausdruck.
Dies zeigen die konkreten Schlußfolgerungen, die Descartes aus den
genannten Bestimmungen gezogen hat. Da für das Sein des Menschen die
facultas cogitandi (und nur diese) konstitutiv ist, ergibt sich, daß
„nihil in me, cuius nullo modo sim conscius, esse posse".55 Was der
Mensch aber in cogitationes über sich erfährt, das kommt ihm in der
Tat auch zu. Diese Selbstbesinnung ist die legitime Instanz, von der er
Aufklärung über sich selbst erhalten kann. Als was er sich in gewissen
cogitationes e r f ä h r t , das ist er auch54. Ich erfahre in mir keine vis
„per quam possim efficere ut ego erre, qui jam sum, paulo post etiam sim
futurus : nam . . . si quae talis vis in me esset, ejus proculdubio conscius
essem. Sed et nullam esse experior, et ex hoc ipso evidentissime cognosco
me ab aliquo ante a me diverso pendere."57 So werde ich meiner inne als
abhängig und unvollkommen: indem ich mich an der idea Dei messe,
erfahre ich „ex . . . comparatione defectus meos"58 ; ich weiß mich in
meinem „dubitare, cupere, hoc est, aliquid mihi deesse" als begrenzt und
abhängig und nicht in der Lage, von mir aus diesen meinen Mängeln
abzuhelfen. In dieser meiner Endlichkeit und Kreatürlichkeit59, zu der
54
Wir können HEIDEGGER, Sein und Zeit, S. 4 6 , nicht zustimmen, daß Descartes „das sum
völlig unerörtert [läßt], wenngleich es ebenso ursprünglich angesetzt wird wie das
cogito". Im cogitare selbst ist für Descartes das esse des Menschen bereits
mitenthalten.
55
AT VII, S. 107.
54
Vgl. ARNAULD, a.a.O., S. 1 8 3 : „nous ne pouvons bien connaître ce que nous sommes que
par une sérieuse attention à ce qui se passe en nous", ferner S. 281 : „rien ne nous est plus
certain que la connoissance que nous avons de ce qui se passe dans notre âme, quand nous
nous arrêtons là".
57
AT VII, S. 49.
51
AT VII, S. 46.
59
Vgl. AT VIII, S. 24: „mens sive substantia cogitans creata".
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
72 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
folgt, daß ich ständiger Täuschung unterworfen bin60 und keine Sicherheit
der Entscheidung zwischen Traum und Wachsein besitze, erfahre ich mich
aufgrund der idea D e i , die ich in mir finde. Daß ich sie in mir finde,
bedeutet, daß sie „mihi sit innata, quemadmodum etiam mihi est innata
idea mei ipsius. Et sane nonmirum est Deum, me creando, ideam illam
mihi indidisse, ut esset tanquam nota artificis operi suo impressa; nec
etiam opus est ut nota illa sit aliqua res ab opere ipso diversa. Sed ex hoc
uno quod Deus me creavit, valde credibile est me quodammodo ad
imaginem et similitudinem ejus factum esse, illamque similitudinem, in
qua Dei idea continetur, a me percipi per eandem facultatem per quam ego
ipse a me percipior."" In all meiner Kreatürlichkeit bin ich nicht bloße
Kreatur; ich bin darin vielmehr Gottes Ebenbild. Zu meinem vollen Sein
gehört es, daß ich die idea D e i in mir habe („[existo] talis naturae qualis
sum, nempe ideam Dei in me habens").
Diese c o g i t a t i o n e s fungieren nicht als herausgegriffene und beliebig
ersetzbare Beispiele von c o g i t a t i o n e s überhaupt. In ihnen und durch
sie erfahre ich vielmehr mein Sein als das eines endlichen, beschränkten,
unvollkommenen und doch in bestimmter Weise Gott nahen Wesens.
Eine ganz bestimmte anthropologische Konzeption kommt in diesen
Darlegungen zum Durchbruch, wie denn auch das Hauptthema der
M e d i t a t i o n e s die Sicherung der Möglichkeit objektiver Erkenntnis für
ein abhängiges, endliches, der Täuschung und dem Irrtum ausgesetztes,
eines Wahrheitsgaranten bedürftiges und auf die v e r a c u n d i a seines
Schöpfers angewiesenes Wesen ist62. Eine eingehende Interpretation dieser
Gedanken Descartes' und der Cartesianer aus dem Horizont ihrer
Problemstellungen her hoffen wir in späteren Untersuchungen vorlegen
zu können.
60 In diesem Zusammenhang muß auch die von Descartes ins Auge gefaßte „Fiktion" des
„deceptor . . . summe potens, summe collidus, qui de industria me semper fallit" (AT
VII, S. 25) erwähnt werden.
61 AT VII, S. 51 f.
a Vgl. in diesem Zusammenhang noch die Diskussionen über die „scientia athei" in AT
VII, S. 125, 140f„ 414f., 428ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Mitmensch als Gegenstand 73
§11 Der Mitmensch als Gegenstand
Stellen wir nunmehr die Frage, was sich in Anbetracht des dargelegten
Begriffes der „natürlichen Welt" für die mitmenschlichen Begegnungen
und für das Phänomen des Mitmenschen überhaupt ergibt.
Wir begegnen dem anderen Menschen als einem der Welt zugehörigen
Lebewesen. Er ist ein Bestandstück der Welt, wie es alle Dinge, Tiere usw.
auch sind. Als solches ist er Gegenstand im dargelegten Sinne : er steht uns
in seinem An-sich als objektives Gebilde gegenüber, er ist von uns
unabhängig und uns gegenüber selbständig, er kann zum Zielpunkt
kogitativer Zuwendungen werden usw. Alles, was für den Gegenstand
überhaupt gilt, gilt auch für die Gegenstände dieses speziellen Bereichs,
den wir als die Gesamtheit unserer Mitmenschen, d. h. als unsere Mitwelt
bezeichnen.
Dieser mitmenschliche Bereich ordnet sich ohne weiteres unserer
„natürlichen Umwelt" und ihren Horizonten ein. Er bildet also keine
Welt für sich, losgelöst von der Dingwelt, die uns als unsere „natürliche
Umwelt" gilt, wie dies etwa für den Bereich der Zahlen oder sonstiger
mathematischer Gebilde, für das Gebiet der musikalischen Töne oder für
die Ordnung der reinen Farben der Fall ist. Innerhalb der Dingwelt selbst
befinden sich unsere Mitmenschen : die Passanten gehen auf der Straße
neben den Häusern, sie weichen einander aus, wie sie auch Dingen, ζ. B.
vorüberfahrenden Wagen, ausweichen; im Garten unter den Bäumen
spielen Kinder; mein Besucher sitzt auf einem Stuhl mir gegenüber, er
befindet sich in meinem Zimmer, in meiner augenblicklichen Umgebung,
in dieser nehme ich ihn mit und unter all dem wahr, was sonst noch in ihr
an Beständen vorhanden ist. Auch hat er zu diesen Dingbeständen gewisse
Beziehungen: er sitzt z . B . „nahe" am Schreibtisch und befindet sich
„weit weg" vom Schrank, wobei „nahe" und „weit weg" nicht Quanta
einer und derselben qualitätsfreien bloßen Distanz (d.h. des reinen
Abstandes im Sinne der analytischen Geometrie) bedeuten, sondern
bestimmte qualitative Beziehungen", die freilich auch in genau dem
gleichen Sinne zwischen den Dingen meiner Umgebung bestehen: der
Schrank ist ebenso „weit weg" vom Schreibtisch und ebenso „nahe" an
der Wand. So stellt sich der Bereich der Mitmenschen auch nicht als ein
Teilbereich der Welt heraus, wie dies etwa für mein Zimmer und
63 Vgl. GURWTTSCH, Phänomenologie und Thematik des reinen Ich, S. 300 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
74 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
überhaupt für jede Umgebung als ein räumlicher Ausschnitt innerhalb der
Umwelt gilt. In jedem derartigen Teilbereich treffen wir andere Menschen
an oder können sie dort antreffen ; in ihrer Gesamtheit bilden sie jedoch
keinen solchen Teilbereich.
Originäre Erfahrung von Dingen und Dingumgebungen haben wir in
Akten sinnlicher Wahrnehmung. In Akten prinzpiell der gleichen Art
erfahren wir auch den Mitmenschen, den wir in unserer Umgebung
erblicken. Das liegt daran, daß wir die Mitmenschen den Teilbereichen der
Welt, die wir als jeweilige Umgebung bezeichnen, restlos eingeordnet
finden. Wie wir am Ding Beschaffenheiten (Farbe, Größe und Form) und
Veränderungen dieser Beschaffenheiten wahrnehmen, so nehmen wir an
dem besonderen Ding „menschlicher Körper", der hier durchaus Ding
unter Dingen ist, Beschaffenheiten und deren Veränderungen wahr. Wir
sehen die Größe und Gestalt des uns gegenüber befindlichen menschli-
chen Körpers, die Farbe seiner Haare, seiner Augen, seiner Haut; wir
bemerken Bewegungen an ihm, sein Arm hebt sich, sein Kopf vollführt
eine Drehung, oder der ganze Körper ist in Bewegung, er „geht", er
„läuft" usw. Wie diese exemplarische Beschreibung der Gegebenheiten
der Wahrnehmung vom menschlichen Körper zeigt, sind diese Gegeben-
heiten prizipiell dieselben wie die der Dingwahrnehmung. Der Unter-
schied liegt lediglich in den Qualitäten der einzelnen Wahrnehmungsge-
gebenheiten, sowie ferner vor allem darin, daß bei der Wahrnehmung
menschlicher Körper die Bewegungen und Qualitätsvariationen häufiger,
vielgestaltiger und mannigfaltiger sind als bei der Dingwahrnehmung, was
aber an der prinzipiellen Gleichartigkeit der beiden Wahrnehmungsgege-
benheiten nichts ändert. Dabei ist es gar nicht erforderlich, die Wahrneh-
mungsgegebenheiten als pure Empfindungsdaten und entsprechend das
Wahrnehmungsobjekt (das Ding bzw. den menschlichen Körper) als
Empfindungsaggregat zu beschreiben, wie es z . B . Berkeley und Hume
taten. Man kann darauf verweisen, daß wir beim Sehen von Dingen nicht
Empfindungen haben, sondern gegliederte artikulierte Dingaspekte, von
denen jeder einzelne ein durchgegliedertes Ganzes ist, und daß ferner
diese Aspekte, wenn wir unsere Orientierung ändern, nicht beliebig
wechseln. Daraus resultiert keine reine Summe", kein bloßes Nacheinan-
der von Aspekten. Vielmehr gehen diese Aspekte kontinuierlich ineinan-
der über. Dabei bedeutet die hier angesprochene eigentümliche Kontinui-
tät, daß die verschiedenen Aspekte stets aufeinander verweisen; mit
64 „Summe" steht hier immer in dem durch WERTHEIMER, Untersuchungen zur Lehre von
der Gestalt, I, fixierten Sinne.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Mitmensch als Gegenstand 75
anderen Worten : daß jeder derselben in den anderen seine sinngemäße
Ergänzung findet. Diese Phänomenologie der Wahrnehmung b e t r i f f t
das W a h r n e h m u n g s o b j e k t als solches. An der prinzipiellen Gleich-
artigkeit der Wahrnehmung von Dingen und derjenigen anderer Men-
schen — und das gleiche gilt natürlich auch für die Wahrnehmung
tierischer Leiber — wird auf dem Boden der dargelegten Theorie der
„natürlichen Welt" durch keine Wahrnehmungstheorie etwas geändert65.
Der Mitmensch ist uns also als Wahrnehmungsgegenstand prizipiell
nicht anders als jedes „tote Ding" gegeben; sein Körper ist nichts
anderes als ein spezielles Ding in unserer Umgebung. Begnügt man sich
aber mit dieser Einsicht und weist man nicht an diesem speziellen
Wahrnehmungsobjekt selbst bestimmte Gegebenheiten, Charaktere und
ähnl. auf, die es zu einem b e s o n d e r e n und in dieser Besonderheit vor
den „toten" Dingen ausgezeichneten Gegenstande machen, so hat man
damit genau jenen bewußtseinsphänomenologischen Ansatz erreicht, der
dem traditionellen Problem des Wissens um Fremdseelisches zugrunde
liegt. Damit muß dieser bewußtseinsphänomenologische Ansatz in die
Frage gekleidet werden : wie komme ich dazu, die Körper der anderen
Menschen für mehr als bloße Dinge zu halten (nämlich für Leiber
beseelter und bewußter Lebewesen) und von dem seelischen Geschehen
dieser Wesen etwas zu wissen, und worin liegt das Recht jener Annahme
und dieses Wissens, wo mir doch in unmittelbarer Wahrnehmung die
betreffenden Körper als bloße Sachen gegeben sind? Die Problemsitua-
tion, die in dieser Frage zum Ausdruck kommt, haben wir im ersten
Kapitel als auswegslos bezeichnet : stellt man sich auf den Boden jenes
bewußtseinsphänomenologischen Ansatzes, dann erweist sich das Pro-
blem des Fremdseelischen als ein hoffnungsloses Zugangsproblem. Der
U r s p r u n g dieser P r o b l e m s i t u a t i o n und damit der traditionellen
P r o b l e m a t i k liegt — wie wir jetzt sehen — in dem bestimmt
umschriebenen Begriff der „ n a t ü r l i c h e n W e l t " , aber nicht n u r
darin allein: dazu k o m m t nämlich noch — und das ist hier
wesentlich — eine auf dem Boden dieses Weltbegriffs erwachse-
ne, von diesem her aber nicht eindeutig vorgezeichnete ganz
b e s t i m m t e B e w u ß t s e i n s p h ä n o m e n o l o g i e . Auf dem Boden des
erwähnten Weltbegriffs ist diese Form der Phänomenologie zwar
naheliegend, es bestehen gewissermaßen Versuchungen zu ihr, — wie es ja
65
Auch DESCARTES, AT VII, S. 30 ff., stellt bei der Darlegung seiner Wahrnehmungstheorie
das Beispiel des Wachses und das der Menschen, die man vom Fenster aus auf der Straße
vorübergehen sieht, nebeneinander.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
76 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
auch kein Zufall ist, daß sie in der Reihe der in der Neuzeit ausgebildeten
Phänomenologien historisch an so früher Stelle steht. Der Hang zu einer
Phänomenologie der puren Empfindungsdaten ist sogar recht stark, wie
sie am konsequentesten von Hume ausgebildet ist, und es gibt eine ganze
Reihe von Motiven, die in diese Richtung weisen, von denen nur eines,
nämlich das der damaligen Physik entlehnte und auf das Gebiet des
Bewußtseins übertragene „Ökonomieprinzip" („entia non sunt multipli -
canda praeter necessitatem"), genannt sei. Aber an und für sich
motiviert der dargelegte Weltbegriff nicht unbedingt jene „Sparsamkeit",
die zur Behauptung der prinzipiellen Gleichartigkeit der Befunde
unmittelbarer Wahrnehmung von menschlichen Körpern mit denen von
bloßen Dingen führt.
Der erörterte Weltbegriff vermag durchaus auch die Lebensphänome-
ne, das spezifisch Leibliche in sich aufzunehmen, auf dessen Unterschied
gegenüber dem Körperlichen ( = Dinghaftem) zuerst Scheler" aufmerk-
sam gemacht hat. Allerdings steht Scheler, wie noch zu zeigen sein wird67,
nicht auf dem Boden dieses Weltbegriffes, denn er modifiziert ihn gerade
in bezug auf dessen Ursprünglichkeit. Das bedeutet hier: er stellt die
Natürlichkeit der in ihm liegenden Absolutheitsprätention in Frage. Aus
diesem Grunde kann er „Leiblichkeit" als eine ,Kategorie' ansehen, als
„eine besondere materiale Wesensgebundenheit. . ., die in jeder fakti-
schen Leibwahmehmung als Form der Wahrnehmung fungiert". De-
mentsprechend gilt ihm die „Sphäre Lebewesen und Umwelt" als eine
eigenständige, auf den Bereich der Dinge „unreduzible Sphäre des Seins",
und zwar so, daß „die Realität der lebendigen Wesen . . . der Realität des
Toten sicher Wvorgegeben" ist48. Beharrt man dagegen auf dem Boden
des von Husserl explizierten Weltbegriffs, so kann von einer Selbständig-
keit der Lebens-, Ausdrucks- und ähnlicher Phänomene gegenüber den
dinghaften Gegebenheiten insofern nicht die Rede sein, als diese
Phänomene auf das Dinghafte als auf ihr Fundament angewiesen sind ; sie
sind n i c h t vor dem Dinghaften gegeben, vielmehr treten sie, wo sie
vorhanden sind, an ihm auf. Allerdings sind sie auf dinghafte Qualtitäten
und Vorgänge nicht reduzierbar ; sie sind, wenn auch fundierte Phänome-
ne, so doch Phänomene vollen Rechtes, die als solche hingenommen
werden müssen und nicht auf Andersartiges zurückgeführt, d. h. „fortin-
terpretiert" werden dürfen. Als Urschicht der Welt fungieren die Dinge
" SCHELER, Formalismus, S. 443 ff. [G. W. 2, S. 423 ff.].
67Vgl. § 5 dieser Arbeit.
68 Vgl. SCHELER, Idealismus-Realismus, S. 266 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Mitmensch als Gegenstand 77
mit ihren Eigenschaften und in ihren Bestimmtheiten. An einigen dieser
Dinge zeigen sich nun bestimmte Phänomene, die nicht allen Dingen
zukommen. Da sie an einzelnen von ihnen auftreten, zeichnen sie diese
insofern vor den anderen aus, als man sie im alltäglichen Sprachgebrauch
gar nicht als „Dinge" bezeichnet. Trotz dieser Auszeichnung bedürfen sie
selbst der dinghaften Gegebenheiten, um überhaupt sein zu können.
Treten aber an irgendwelchen Dingen diese auszeichnenden Phänomene
auf, so erfahren durch sie die dinghaften „Unterlagen" tiefgreifende
Modifikationen. Es konstituiert sich in der Tat so etwas wie ein neuer und
eigener Seinsbereich, für den jene Phänomene selbst, nicht aber ihre
dinghaften „ Unterlagen" charakteristisch und sinnbestimmend sind.
Dabei handelt es sich um sehr verschiedenartige Phänomene. Wenn wir
zwischen Bewegungs-, Ausdrucks-, spezifischen Lebensphänomenen
und dergleichen mehr unterscheiden, so zählen wir damit eine Reihe
solcher verschiedener und in gewisser Weise selbständiger, andererseits
wiederum in bestimmten Ordnungen gegenseitig fundierender Phäno-
mentypen auf. Auch die übliche Einteilung der Lebewesen in Pflanzen,
Tiere und Menschen hängt mit diesen Typen zusammen, ferner die
Unterscheidung höherer und niederer Tiere, die Abgrenzung verschiede-
ner Schichten innerhalb des Menschlichen und dgl. mehr. In dieser Weise
etwa läßt sich der gesamte Phänomenkomplex des Lebens vom dargeleg-
ten Weltbegriff her interpretieren, wobei immer die Bedeutung der
dinghaften Gegebenheiten als fundierender Unterlagen im Auge zu
behalten ist.
In ihren Untersuchungen zum Problem der Einfühlung, die bei ihr
etwas anderes bedeutet als bei Lipps, hat Edith Stein die soeben
bezeichnete Richtung eingeschlagen. Sehe ich eine fremde Hand auf
einem Tisch liegen, so ist mir mit den Gegebenheiten der „äußeren
Wahrnehmung", d. h. mit dem Dinghaften, „konoriginär" mitgegeben
etwa die schlaffe Lage dieser Hand, ihr Sich-gegen-den-Tisch-drücken,
-pressen usw. 69 Diese den Druck-Spannungsempfindungen „konorigi-
" STEIN, Zum Problem der Einfühlung, S. 64 f. — Die Gegebenheit des eigenen Leibes
beschreibt Stein, a.a.O., III, § 40, in gleicher Weise wie Scheler. — Wir gehen an dieser
Stelle auf Steins Begriff der Einfühlung nicht näher ein. Bei ihr bedeutet er: den in den
„konoriginären" Mitgegebenheiten implizierten Einfühlungstendenzen nachgehen, so
daß Einfühlung ein Titel für erfahrende, d.h. gebende Akte sui generis ist (vgl. a.a.O.,
S. 19). Wie immer man zu ihrer Theorie der Einfühlung stehen mag, so genügt hier die
Angabe, daß das unmittelbar Wahrgenommene selbst A n s a t z p u n k t e für die
weiterschreitende und erfüllende Einfühlung enthält, und daß in unmittelbarer
Wahrnehmung leibliche Organe als solche gegeben sind. Stein bringt diese Phänomene
mit der „Verschmelzung" in Zusammenhang, ohne daß sie damit etwas „fortinterpre-
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
78 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
nären" Mitgegebenheiten, die in der Wahrnehmung bloßer Dinge fehlen,
obwohl es auch da „konoriginär" Mitgegebenes anderer Art geben kann70,
zeichnen die fremde Hand als leibliches Organ aus. Uberhaupt konstitu-
ieren sie den Unterschied zwischen dem Fremdleiblichen und dem bloß
Körperlichen. — An fremden Leibern werden Bewegungsphänomene
wahrgenommen, die sich als „lebendige Eigenbewegung" von jeder Art
mechanischer Bewegung prinzipiell unterscheiden; die letztere kann
indes auch an Leibern vorkommen, z.B. wenn ich jemanden im Wagen
vorüberfahren sehe71. Auch hier ist es wichtig zu erkennen, daß schon die
w a h r g e n o m m e n e „lebendige" Bewegung etwas anderes ist als die
w a h r g e n o m m e n e mechanische Bewegung, wenn auch — nach Stein —
das volle und konkrete Phänomen erst in erfüllender Einfühlung zur
Gegebenheit kommt (wobei eine Bedingung ihrer Möglichkeit darin
beschlossen ist, daß die wahrgenommene „lebendige" Bewegung in
irgendeiner Allgemeinheitsstufe zum Typ meiner Eigenbewegungen
gehört)72. Diese Bewegungen fremder Leiber erscheinen nicht nur als
„lebendige Eigenbewegungen", zuweilen eignen ihnen auch gewisse
Färbungen und Tönungen. Der Gang eines Menschen kann frisch und
elastisch sein. Man spricht vom blühenden Aussehen eines Menschen.
Man findet einen Menschen gealtert oder erholt, wenn man ihn nach
einiger Zeit wiedersieht usw.73 Mit Recht spricht Stein hier von
„spezifischen Lebensphänomenen", die wir auch an Tieren und Pflanzen
wahrnehmen: der Flug eines Vogels erscheint uns matt, das Aussehen
eines Hundes krank, eine Blume sieht an einem Sommertag welk aus.
Ferner weist Stein auf die Bedeutung hin, welche diese unmittelbar an den
menschlichen Leibern wahrgenommenen „Lebensphänomene" für die
klinische Diagnose des Arztes haben. Gerade dem untersuchenden Arzt
sind nicht, wie Scheler74 meint, „fremde Körper" gegeben, sondern
Leiber, denen er ein gewisses Befinden ansieht, so daß diese unmittelbar
gesehenen Phänomene die Richtung seiner Diagnose und seiner weiteren
tieren" oder genetisch erklären will. Das ist aber insofern bedenklich, als Verschmelzung
immer Verschmelzung an und für sich disparater, auch in der Verschmelzung in
gewissem Sinne disparat bleibender Inhalte besagt (vgl. C . STUMPF, Tonpsychologie,
Leipzig 1890, Bd. II, S. 64 ff. ; ferner GURWITSCH, Phänomenologie der Thematik und des
reinen Ich, Kap. III, § 16 Anm.).
70 STEIN, a.a.O., S. 48 f.
71 STEIN, a . a . O . , I I I , § 5 h .
72 Das Gleiche gilt auch für die Einfühlung in fremde leibliche Organe; vgl. STEIN,a.a.O.,
III, § 5 b.
75 STEIN, a . a . O . , I I I , § 5 i .
74 Vgl. SCHELER, Sympathie, S. 6 und 304 [G. W. 7, S. 21 und 2 5 5 - 2 5 6 ] ,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Mitmensch als Gegenstand 79
Untersuchung bestimmen. Wäre das nicht der Fall, dann müßte die Frage
aufgeworfen werden, woran er die bei Gelbsucht veränderte Gesichtsfar-
be von einem „gelblichen Teint" unterscheiden könnte. Damit ist
natürlich nicht gesagt, daß der Arzt lediglich aufgrund derartiger Befunde
seine Diagnose stellt, aber sie geben ihm einen gewissen Anhaltspunkt für
die Richtung seiner Vermutungen. Was man den „ärztlichen Blick" nennt,
ist im wesentlichen die Fähigkeit, solche „Lebensphänomene" wahrzu-
nehmen und zu erkennen.
Ein anderer Typ phänomenaler Charaktere liegt vor, wo leibliche
Bewegungen als Ausdrucksbewegungen erscheinen; oder allgemeiner:
wo überhaupt irgendetwas Leibliches, z . B . eine Miene als Ausdruck,
gegeben ist". Dank einer derartigen Eigentümlichkeit verweist die
leibliche Gegebenheit, an der sie auftritt, auf etwas Psychisches zurück,
mit dem sie eine „natürliche Einheit" bildet. Das Psychische wird mithin
durch sie hindurch erfaßt, im Gegensatz etwa zu den „Lebensphänome-
nen", die in der Weise der Verschmelzung mit dem Leiblichen
mitgegeben sind und mit-wahrgenommen werden. Die „natürliche
Einheit" von Gefühl und leiblichem Ausdruck besteht darin, daß das
Gefühl den Ausdruck aus sich hervortreibt, sich in ihm entlädt, seinem
Sinne nach gerade dieses Ausdrucksphänomen motiviert, d. h. ein solches
eines bestimmt umgrenzten Bereiches und kein irgendwie beliebiges, so
besteht ein innerer, sachlicher Zusammenhang (ein Wesenszusammen-
hang) zwischen Erlebnis und Ausdruck, aufgrund dessen dieses konkrete
Ausdrucksphänomen adäquater Ausdruck eben dieses Erlebnisses ist76.
Das wird dort am deutlichsten, wo jemand absichtlich die „natürliche
Einheit" seines Erlebens und seiner Ausdrucksbewegungen stört, um
durch willentlich hervorgebrachte Ausdrucksphänomene ein nicht vor-
handenes Erleben vorzutäuschen. Das Gewollte, Gekünstelte, Unechte,
das den in dieser Weise hervorgebrachten Ausdrucksphänomenen eignet,
weist darauf hin, daß sie in keinem natürlichen, d.h. sachlichen und
sinngemäßen Zusammenhang mit den „hinter" ihnen stehenden Erlebnis-
sen stehen und das wirklich Erlebte eben nicht adäquat ausdrücken. Auch
hier können die Erlebnisse, deren Außenseite die Ausdrucksphänomene
bilden, erst in der mitvollziehenden Einfühlung zu voller konkreter
Gegebenheit kommen. Aber damit diese Einfühlung möglich wird,
müssen die wahrgenommenen Phänomene selbst als Ausdrucksphäno-
mene, d. h. eben als Außenseite eines Seelischen, gewissermaßen als in sich
75 Vgl. STEIN, a.a.O., I I I , § 4 d und § 51.
76 Vgl. hierzu SCHELEX, a.a.O., S. 6 ff. [G. W. 7, S. 21 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
80 Z u m Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
noch nicht fertiges, nicht abgeschlossenes Etwas gegeben sein. Wenn Stein
von Leervorstellungen spricht, die mit einer Miene bereits vor Vollzug der
Einfühlung mitgegeben sind oder davon, daß „das Symbol noch nicht in
bestimmte Richtung zeigt", ein „Hinweis ins Leere" ist77, wobei diese
Leervorstellung unter Umständen gar nicht zur Erfüllung kommen kann,
weil der Ausdruck mir unverständlich bleibt, so ist hierdurch jenes
charakteristische Moment an den wahrgenommenen Ausdrucksbewe-
gungen bezeichnet, die schon als w a h r g e n o m m e n e „ergänzungsbe-
dürftig" sind und auf ihre Ergänzung durch ein sinngemäß zu ihnen
gehöriges Seelisches verweisen. Sie zeigen sich als Momente einer
sachlichen Einheit und machen ihre Einbeziehung in diese volle und
konkrete Einheit erforderlich. Unter diesem Hinführen auf das sinnge-
mäß zu ihnen gehörige Seelische ist gemeint, daß die Ausdrucksphänome-
ne Ausdruck von etwas Seelischem sind, mit ihm in Symbolbeziehung
stehen, wobei noch auf den Unterschied zu den „Lebensphänomenen"
hingewiesen sei, die bezeichnenderweise nicht zu sachlich Dazugehöriges
führen. Die „Lebensphänomene" machen sich durch den „timbre"
bemerkbar, den sie dem leiblichen Geschehen verleihen.
Diese Darstellung einiger repräsentativer Punkte der Steinschen
Untersuchung zeigt jedenfalls dies : auch von dem bisher allein in Betracht
gezogenen Weltbegriff aus kann der Zugang zum Fremdseelischen in
seinen verschiedenen Schichten erschlossen werden78. Bedingung dafür ist
nur die „vorurteilslose" und adäquate Explikation der gegebenen
Phänomene selber, die schlichte Hinnahme und Anerkennung dessen,
was sich an ihnen findet. Für eine Deskription, die sich den phänomenalen
Gegebenheiten treu anmißt, sie als das nimmt, als was sie sich geben (und
nicht von irgendwelcher Theorie geleitet, das phänomenal Gegebene
verarmen läßt, indem sie gewisse Phänomene nicht in ihrem Eigenrecht
gelten läßt); — für eine Phänomenologie — meinen wir — die jedes
Phänomen als das nimmt, als was es in sich ist, besteht jene ausweglose
Zugangsproblematik zum Fremdseelischen nicht, die sich — wie wir
sahen — nicht allein aus dem explizierten Weltbegriff ergibt, sondern erst
aufgrund einer spezifisch ausgeprägten Bewußtseinsphänomenologie.
Die Bedeutung der Untersuchung Edith Steins erblicken wir darin, daß sie
in die Gegenstandswelt = Dingwelt7' die lebendigen, beseelten Wesen in
77
Vgl. STEIN, a.a.O., S. 88 : „das, was ich sehe, ist unvollständig, es gehört noch etwas
hinzu, ich weiß nur noch nicht, was."
78
Vgl. auch oben, § 7.
79
Die Gegenstände, die wir in unserer natürlichen Umwelt wahrnehmen, sind ja die
Dinge; insofern darf h i e r Gegenstand mit Ding gleichgesetzt werden.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Der Mitmensch als Gegenstand 81
all ihren Schichten eingeordnet hat und sie in dieser Welt selbst auffindet
und entdeckt, d. h. keiner theoretischen Konstruktion bedarf, um in die
phänomenalen Gegebenheiten etwas hineinzubringen, was in ihnen selbst
nicht liegt. Das Gelingen dieses ihres Unternehmens liegt an ihrem
wirklich phänomenologischen Vorgehen, wobei es für das Prinzipielle
nicht darauf ankommt, ob man mit allen Einzelheiten ihrer Beschreibun-
gen und ihrer Thesen übereinstimmt oder nicht. Dieses phänomenologi-
sche Vorgehen tritt besonders darin zutage, daß sie ihren Einfühlungsbe-
griff deutlich gegen den von Lipps abhebt. Einfühlung bedeutet für sie
nicht das Beseelen dessen, was an sich phänomenal als bloßes Ding
gegeben ist ; vielmehr ist Einfühlung das explizierende, mitgehende Nach-
und Mitvollziehen der Tendenzen, die in jeweils anderer Weise in dem
phänomenal Gegebenen implizit enthalten sind. Daher unterscheidet
Stein80 drei Vollzugsstufen der Einfühlung, von denen hier für uns vor
allem die erste in Betracht kommt, nämlich das Auftreten und Gegeben-
sein der implizierten Tendenzen als Ausgangspunkte des mitgehenden
Einfühlens. Denn dieses Auftreten bedeutet, daß an den unmittelbar
gegebenen Gegenständen phänomenale Charaktere sich manifestieren,
dank der die betreffenden Gegenstände b e r e i t s im P h ä n o m e n a l e n
selbst als etwas anderes denn als bloße Dinge erscheinen.
Gegenüber dieser von Edith Stein aufgezeigten Möglichkeit, vom
zugrundeliegenden Weltbegriff den Mitmenschen als Mitmenschen ins
Auge zu fassen, stellen wir die Frage : ist uns in unserem n a t ü r l i c h e n
und alltäglichen L e b e n der M i t m e n s c h w i r k l i c h als G e g e n s t a n d
gegeben, an dem wir diese oder j e n e P h ä n o m e n e von L e b e n d i g -
keit und B e s e e l t h e i t w a h r n e h m e n ? H a b e n wir in u n s e r e m
A l l t a g s l e b e n a u s s c h l i e ß l i c h oder v o r z u g s w e i s e in der Weise mit
anderen M e n s c h e n zu tun, daß wir ihnen als G e g e n s t ä n d e
g e g e n ü b e r s t e h e n , auf sie h i n s c h a u e n , dieses und jenes an ihnen
b e m e r k e n ? Gewiß, wir k ö n n e n den Mitmenschen auch in dieser Art
gegenüberstehen und sie zum Thema unserer c o g i t a t i o n e s machen.
Wir aktualisieren gerade diese Möglichkeit etwa als Ärzte. Daher haben
wir auch Wert auf die Bedeutung gelegt, die die Wahrnehmung der
Lebensphänomene für die Untersuchung des diagnostizierenden Arztes
besitzt. Ist aber die ärztliche Einstellung zum Patienten, die hier im Sinne
eines Paradigmas der distanzierten Haltung des Erkennenden zu seinem
Objekt gedeutet wird, wirklich repräsentativ für die Art, wie wir im
alltäglichen Leben den Mitmenschen begegnen, wenn wir ihnen nicht
80 V g l . STEIN, a . a . O . , S. 9 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
82 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
gerade als Beobachter und Erforscher mit der Intention auf Erkennen
gegenübertreten. Und allgemein: ist die Welt als Inbegriff von
Zielpunkten freier cogitationes in der Tat die Welt, in der wir
leben, mit deren Beständen wir umgehen und hantieren?
Wiederum soll nicht in Zweifel gezogen werden, daß eine Haltung zur
Welt, wie sie für das cogitare kennzeichnend ist, sich in der Tat
aufweisen läßt; demnach muß auch ein korrelatives Phänomen im Sinne
der Welt als Gegebenheit81 aufweisbar sein. Nicht auf das „Faktum" dieses
Phänomens zielt jedoch unsere Frage; sie bebetrifft vielmehr das Recht
seiner Ursprünglichkeit. Bedeutet unser natürliches und alltägli-
ches In-der-Welt-Leben ein Haben von Gegenständen und ein ihnen
Gegenüberstehen, so daß wir als freie Wesen in freien Akten uns auf
Gegenstände richten, die in diesen Akten in ihrem Eigensein an sich
„unabhängig" von unseren Zuwendungen zur Gegebenheit kommen?
Oder wird damit das In-der-Welt-Sein nicht viel eher und von
vornherein als ein Welterkennen interpretiert 8 2 , ohne daß dieser
Ansatz explizit diskutiert und in seinem Recht ausgewiesen wird ? Und ist
die in dem dargelegten Weltbegriff thematisierte Welt nicht etwa die, die
der Wissenschaftler am Anfang seiner Forschung (und bereits im
Hinblick auf diese) vorfindet, und die ihm, während er als Forscher auf sie
gerichtet ist, aber auch nur dann, „gegeben" ist?
§ 12 Die Milieutheorie Schelers
Die Gleichsetzung von „natürlicher" und Gegenstandswelt und die
daraus ableitbare Bestimmung des „natürlichen" In-der-Welt-Seins als
81 Die fundamentale Bedeutung, die dem Begriff der Gegebenheit in der neuzeitlichen
Philosophie zukommt, hat ihren Grund darin, daß mit Gegebenem immer ein als
Gegenstand Gegebenes (in dem spezifischen im § 3 angegebenen Sinne) gemeint wird.
Macht man diesen Begriff zum Fundamentalbegriff der Philosophie und betrachtet man
die Frage nach dem primär gegebenen als die prinzipiell „erste" Frage der anfangenden
Philosophie, so hat man den dargelegten Begriff der „natürlichen" Welt als „selbstver-
ständlich" bereits vorgegeben. Man nimmt ihn eben als Fundamentalbegriff in die
weiteren Untersuchungen auf, ohne ihn zu hinterfragen und seine Problematik deutlich
zu machen. Die Einseitigkeit der Fragestellung, die wir in § 7 an Scheler und Cassirer
kritisierten, gründet darin, daß diese Forscher an dem Begriff der Gegebenheit selbst
festhalten und nur zu einer adäquaten Bestimmung dessen, was unmittelbar gegeben ist,
zu kommen suchen.
82 Vgl. HEIDEGGER, Sein und Zeit, § 13.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Milieutheorie Schelers 83
ein freies Sich-richten auf gegebene Gegenstände bedeutet, anthropolo-
gisch gesehen, daß für die primäre und fundamentale Wesensschicht des
Menschen, gewissermaßen für sein „erstes" Sein, die erkennende
Gerichtetheit auf die Welt und die in dort enthaltenen Gegenstände
konstitutiv ist. Als natürliches Wesen steht der Mensch den Beständen
seiner Umgebung gegenüber und vollzieht in freien cogitationes
mannigfach verschiedene Bewußtseinsakte von ihnen. Darin, daß er sie
vollzieht und in dieser Weise „lebt", liegt sein „natürliches" Dasein. Der
Wahrnehmung kommt nun deswegen eine ausgezeichnete Bedeutung zu,
weil die perzeptiven Akte diejenigen sind, die die Gegenstände der
Umwelt originär „geben". In der Wahrnehmung erfahren wir die Dinge
unserer Umgebung in ihrem eigenständigen An-sich. Wahrnehmung ist
ein „interesseloses", „wertfreies", d.h. von keinerlei Wert- oder Triebein-
stellungen geleitetes originäres Zur-Kenntnis-nehmen dessen, was in
unserer Umwelt vorgefunden wird.
Gegen diese anthropologischen Konzeptionen hat Scheler unter
verschiedenen Gesichtspunkten Einwände erhoben. Hier ist für eine
systematische Darstellung der in seinen Schriften verstreuten anthropolo-
gischen Ansätze und Hinweise (die von ihm mehrfach in Aussicht
gestellte Anthropologie hat er nicht vollenden können) wie auch für eine
prinzipielle Diskussion des Themas „Phänomenologie und Anthropolo-
gie" nicht der geeignete Ort83. Wir greifen nur das aus dem genannten
Problemkreis heraus, was sich auf die Bestimmung der „natürlichen"
Umwelt bezieht. Obwohl die einschlägigen Lehren Schelers im Zusam-
menhang mit seinen anthropologischen Bemühungen stehen, sind sie
doch verhältnismäßig selbständig und können von seinen eigentlichen,
auf die Ausbildung einer umfassenden Anthropologie gerichteten Inten-
tionen getrennt betrachtet werden.
Scheler zufolge ist das primär und unmittelbar Gegebene nicht ein
gegenüberstehender Bereich von Dingen, die in wahrnehmenden Akten
in ihrem An-sich zugänglich werden, sondern vielmehr ein „ M i l i e u "
mit seinen „ M i l i e u d i n g e n " " . Für die Milieustruktur ist der Bezug auf
das System von Triebeinstellungen jenes Wesens konstitutiv, um dessen
Milieu es sich jeweils handelt: „Das jeweilige Milieu eines Wesens
ist . . . das genaue Gegenbild seiner Triebeinstellung und ihrer
93 Eine solche Darstellung müßte, da gerade die anthropologischen Ansichten Schelers
tiefgreifenden Wandlungen unterworfen waren, eine Geschichte seiner anthropologi-
schen Bemühungen und der Motive ihrer Wandlungen sein.
14 SCHELER, Formalismus, S. 139 ff. [G. W. 2, S. 153 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
84 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Struktur, d.h. ihres A u f b a u e s . " 8 5 Milieu überhaupt ist „daseinsrelativ"
auf ein Lebewesen überhaupt; das impliziert die „Daseinsrelativität"
jedes konkret vorliegenden Milieus auf ein Lebewesen bestimmter
Organisation und bestimmter Triebanlage86.
Infolgedessen ist die Frage nach einer „natürlichen Weltanschauung"
dann schief gestellt87, wenn man damit einen B e r e i c h k o n s t a n t e r
G e g e b e n h e i t e n meint, die immer und überalle da vorliegen, wo es
Menschen gibt ; anders gesagt, wenn diese Frage die Voraussetzung macht,
daß es eine ursprünglich allen Menschen gemeinsame „Weltgegebenheit"
gibt, die sich erst nachträglich nach verschiedenen Richtungen differen-
ziert und zu den eigentlich sekundär zu nennenden Weltbildern führt
(ζ. B. dem des „primitiven Menschen", den verschiedenen Weltbildern
der verschiedenen „Kulturen", dem Weltbild des Kindes usw.) bzw. zu
den „Variationen des natürlichen Weltbegriffes", um mit Avenarius88 zu
sprechen. Dabei würde nämlich vorausgesetzt werden, daß alle diese
„sekundären" Weltbilder ihrerseits die „natürliche" Weltgegebenheit zur
Basis haben, aus ihr sich entwickeln und auf ihr sich aufbauen. Besonders
naheliegend ist diese Voraussetzung — wie schon Schelers Hinweis auf
Berkeley und Kant zeigt — prinzipiell überall da, wo man die „natürliche
Weltgegebenheit" als ein „Gewühl von Empfindungen" ansetzt, dem erst
der menschliche „Geist" aufgrund seiner „Spontaneitäten" Ordnung und
Sinn verleiht. Bei dieser Bestimmung der „natürlichen Weltgegebenheit"
als Chaos von Empfindungen ist die fragliche Voraussetzung in beinahe
idealer Weise erfüllt: gerade das Chaos von Empfindungen ist in
eminentem Maße dazu geeignet, als konstante und natürliche, allen
Menschen immer und überalle gemeinsame „Weltgegebenheit" zu
fungieren, aus der dann durch die Funktionen und „Formgebungen" des
Bewußtseins oder des „Geistes" die verschiedenen Weltbilder, die
„geistigen Welten" hervorgehen89. Die Voraussetzung einer konstanten
85 SCHELER, a.a.O., S. 159 [ G . W . 2, S. 170],
86 Vgl. SCHELER, Die Wissensformen und die Gesellschaft [abgekürzt : Wissensformen],
Leipzig 1926, S. 296ff. [G. W. 8, S. 239ff.]; ferner Idealismus-Realismus, II 5.
87 Vgl. SCHELER, Wissensformen, S. 5 8 - 5 9 .
88 AVENARIUS, Der menschliche Welthegriff, Abschn. II.
89 Diese Denkweise ist auch noch in CASSIRERS Philosophie der symbolischen Formen
wirksam; vgl. die programmatischen und prinzipiellen Äußerungen z.B. in Bd. II, S. 19:
„Er [der Mythos] ist .objektiv', sofern auch er als einer der bestimmenden Faktoren
erkannt wird, kraft deren das Bewußtsein sich von der passiven Befangenheit im
sinnlichen Eindruck löst und zur Schaffung einer eigenen, nach einem geistigen Prinzip
gestalteten ,Welt' fortschreitet." Vgl. auch S. 39: „Die .Philosophie der symbolischen
Formen'. . . geht davon aus, daß . . . Kategorien überall dort wirksam sein müssen, wo
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Milieutheorie Schelers 85
„natürlichen Weltgegebenheit" überhaupt ist aber durchaus nicht allein
an die genannten inhaltlichen Bestimmungen gebunden. Zwar enthält
auch der traditionelle, von Husserl explizierte „natürliche Weltbegriff"
diese Bestimmungen, obgleich auf dessen Grundlage — wie hervorgeho-
ben wurde 90 — eine ganz anders geartete Phänomenologie des unmittelbar
Gegebenen entwickelt wird als diejenige, in welcher die Chaos-Theorie
der Empfindungen vertreten wird. Indem Scheler nun das jeweilige Milieu
auf die Triebstruktur des Menschen bezieht, wird ihm die Voraussetzung
einer „absolut konstanten natürlichen Weltanschauung" problematisch".
D e r gegenseitige Bezug von Milieu und Triebstruktur verbietet den
Ansatz einer konstanten, ursprünglich allen Menschen gemeinsamen und
daher natürlichen Weltgegebenheit. W o h l aber fordert er den Begriff einer
„relativ n a t ü r l i c h e n W e l t a n s c h a u u n g " : r e l a t i v darum, weil diese
Weltanschauung n u r in bezug auf eine jeweilige „ A r t " Mensch (Mensch
als Angehöriger eines Standes, eines Volkes, einer Kultur, als Vertreter
eines ,Typus' wie zum Beispiel desjenigen des Spießbürgers oder des
Bohemiens) eine natürliche Weltanschauung darstellt. F ü r diese e i n e in
Betracht gezogene Differentiationseinheit Mensch ist sie aber darum eine
natürliche Weltanschauung, weil sie ein Korrelat von dessen Trieb-
struktur ist' 2 . I n diese „relativ natürliche Weltanschauung" gehört alles
hinein, was als „ f r a g l o s .gegeben'gilt, . . .jeder Gegenstand und Inhalt
des Meinens in den Strukturformen des ohne besondere spontane A k t e
.Gegebenen', der allgemein für e i n e r R e c h t f e r t i g u n g n i c h t b e d ü r f -
überhaupt aus dem Chaos der Eindrücke ein Kosmos, ein charakteristisches und
typisches .Weltbild' sich formt. Jedes solche Weltbild ist nur möglich durch eigenartige
Akte der Objektivierung, der Umprägung der bloßen .Eindrücke' zu in sich bestimmten
und gestalteten .Vorstellungen'." Vgl. dagegen freilich ζ. Β. I. S. 39 f., wo Cassirer die
Gegebenheit einer „materia nuda", d.h. reiner und ungeformter „Eindrücke" bestreitet,
zu denen eine „Formgebung" erst hinzutreten muß (siehe auch Bd. II, S. 46 ; Bd. III, S.
18 f.). Hier meint er aber das faktische Gegebensein, die phänomenologische
Vorfindlichkeit einer solchen „materia nuda", ohne daß sich seine Kritik gegen die
prinzipielle Möglichkeit dieses Begriffes selbst richtet, den er vielmehr als „erkenntnis-
theoretischen Grenzbegriff" in gewissem Umfange gelten läßt. Vgl. auch HEIDEGGERS
Besprechung dieses Bandes der Philosophie der symbolischen Formen in der Deutschen
Literaturzeitung, IL (1928).
90 Vgl. oben S. 74 f.
" Als ein überaus wichtiges Problem sei hier die Frage nach der „Herkunft" und der
Wurzel der genannten Voraussetzung bezeichnet, die wohl mehr als eine bloß
theoretische ist.
92 Vgl. in diesem Zusammenhang auch SCHELERS Polemik gegen die Evolutionstheorie
Spencers, Formalismus, S. 157 Anm. [G. W. 2, S. 168, Anm. 2], 291 f. [G. W. 2. S.
2 8 7 - 2 8 8 ] und 300f. [G. W. 2, S. 294-295].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
86 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
tig und fähig gehalten und empfunden wird"' 3 . Entsprechend definiert
Scheler das Milieu als die Gesamtheit dessen, was von einem Lebewesen
— hier kann von der Beschränkung auf den Menschen abgesehen werden,
während Weltanschauung selbstverständlich immer nur auf Menschen
bezogen ist — als auf es wirksam erlebt wird — , im Unterschied zu dem
was o b j e k t i v auf dieses Lebewesen wirkt. Diese Bestimmung des
Milieus ziehen wir der erstgenannten der „relativ natürlichen Weltan-
schauung", obwohl beide sachlich dasselbe meinen 94 , darum vor, weil sie
nicht die Alternative „fraglos/fragwürdig" enthält — ; eine Alternative,
die jedenfalls nicht im Begriff der „relativ natürlichen Weltanschauung"
selbst ihre Wurzeln hat und für diese letztere nicht konstitutiv ist, sondern
zumeist von außen her an die betreffenden Gebilde herangetragen wird.
Dementsprechend bestimmen wir die „relativ natürliche Weltanschau-
ung" als ein „Wissen" um das jeweils als wirksam Erlebte.
Dieses Wissen ändert sich indes von Mensch zu Mensch und von
Menschengruppe zu Menschengruppe, ebenso aber auch für dieselben
Menschen und Menschengruppen im Laufe ihrer Entwicklung. So ist, wie
Scheler ausführt, „derselbe" Wald für den Förster ein anderes Milieu als
für den Spaziergänger und wieder ein anderes als für den Jäger, wie er ja
für den Menschen ein anderes Milieu ist als für den Rehbock und wieder
ein anderes für die im Walde lebende Eidechse. Jedes dieser Wesen trägt
mit seiner Triebanlage die Struktur seines Milieus als Korrelat eben dieser
Triebanlage mit sich herum'5. Zwar wechseln mit der Ortsveränderung die
einzelnen Milieudinge und -inhalte, die S t r u k t u r des Milieus aber bleibt
gegenüber allem Wechsel invariabel : denn sie bestimmt allererst, was von
den verschiedenen und wechselnden objektiven Weltbeständen in das
betreffende Milieu Eingang findet und in welchem Sinne es da aufgenom-
93 SCHELER, Wissensformen, S. 59 [G. W. 8, S. 61]. Der Bezug der „relativ natürlichen
Weltanschauung" auf ein „Gruppensubjekt" versteht sich aus dem Zusammenhang der
genannten Abhandlung, deren Thema die „Probleme einer Soziologie des Wissens"
bilden. Diese soziologische Wendung ist für die uns beschäftigende Problemstellung
kaum von entscheidender Bedeutung. —
94 Die „relativ natürliche Weltanschauung" eines Menschen ist die Explikation seines
Milieus; diese Explikation kommt nun nicht etwa zu seinem Leben im Milieu
nachträglich als dessen „Deutung" hinzu : vielmehr ist es ein Konstituens des Lebens im
Milieu, daß dieses Leben immer in bestimmter Weise um sich selbst weiß. Als Form
dieses „Wissens" sehen wir die „relativ natürliche Weltanschauung" in ihrem Bezug auf
das jeweilige Milieu an. Dieser Zusammenhang, dessen volle Darlegung wir späteren
Arbeiten vorbehalten müssen, hat seinen Grund in dem zum „Dasein" konstitutiv
gehörigen Seinsverständnis seiner selbst; vgl. auch HEIDEGGER, Sein und Zeit, § 4. Zum
genannten „Wissen" vgl. zudem § 16.
95 Hier liegt auch die Wurzel des Schelerschen Begriffes der „Daseinsrelativität".
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Milieutheorie Schelers 87
men wird". So ist das Milieu gleichsam eine „feste Wand", eine Mauer,
hinter die der betreffende Mensch gebannt ist. Keine Richtung der
Aufmerksamkeit oder des Interesses und keine Veränderung dieser
Richtung'7 vermag etwa den Spaziergänger in das Waldmilieu des Jägers
oder umgekehrt zu führen. Jeder bleibt in seinem, d. h. spezifisch ihm
zugeordneten Milieu gefangen, innerhalb dessen er auf dieses oder jenes
Milieuding oder bald auf diesen, bald auf jenen Zug des einen und selben
Milieudings seine „Aufmerksamkeit lenken" kann; aber der Umkreis
dessen, worauf er seine „Aufmerksamkeit zu richten" vermag, ist ihm
durch sein Milieu und dessen spezifische Struktur vorgezeichnet. Das
gleiche gilt für die Interessenrichtungen, die innerhalb des vorgegebenen
Milieus Interessensphären konstituieren, in denen dann die Aufmerk-
samkeit sich bewegen kann. „Die Aufmerksamkeitserlebnisse spielen sich
innerhalb von ,Interesseneinheiten' und ihren entsprechenden Wertein-
heiten ab; sie vermögen das Gefüge dieser Einheiten und ihrer
Gliederung nicht zu zerbrechen oder zu verändern."
Weil das Milieu, in dem ein Mensch lebt, seiner Struktur nach auf seine
Triebanlage und nicht auf seine Erkenntnisfunktionen bezogen ist, sind
die primären „Gegebenheiten" relativ primitiver Milieus nicht Dinge mit
sachhaften Bestimmtheiten (Totes), sondern A u s d r u c k s e i n h e i t e n
(Lebendiges). Das primäre Verhalten, d.h. das lebendige Verhalten im
Milieu, ist kein distanziertes Schauen auf Dinge und kein Vorstellig-wer-
den-lassen ihrer sachhaften Bestimmungen, sondern ein emotionales und
reaktives Verhalten zu Ausdruckseinheiten98. D i e s e aber k o n s t i t u -
ieren sich nicht erst auf dem B o d e n ding- und sachhafter
G e g e b e n h e i t e n ; sie sind (wie Scheler im Anschluß an Koffkas
kindespsychologische Untersuchungen und an die Forschungen Lévy-
Bruhls ausführt) das „Allererste, was der M e n s c h an außer ihm
96 „ E s sind dieselben Wertqualitäten, auf denen unsere besonderen Werteinstellungen
(oder Einstellungen auf Wertverhalte) in der besonderen Rangordnung der unsere
.Neigungen' beherrschenden Vorzugsregeln beruhen, mit denen wir an die wechselnden
empirischen Wirklichkeiten herankommen."
Zu den Problemen der Aufmerksamkeitsrichtung und der Veränderung dieser Richtung
vgl. GURWITSCH, Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, Kap. III. Der dort
gegebene Aufweis bewegt sich allerdings völlig in der Spähre des kogitativen
(intentionalen) Bewußtseins und bedürfte einer Weiterführung in die Dimension des
Lebens in der natürlichen Umwelt, welche Weiterführung in gewissem Sinne auch ihre
Fundierung wäre.
" Vgl. SCHELER. Formalismus, S. 2 0 0 f. [ G . W . 2, S. 203 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
88 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
b e f i n d l i c h e m D a s e i n erf a ß t " 9 9 . Das Drohende, Unheimliche, Graue-
nerregende, Lockende, Einschmeichelnde, Freundliche u. dgl. mehr sind
die primären „Gegebenheiten" des Milieus; sie sind dasjenige, was vom
Milieu sich zunächst „aufdrängt" und der jeweiligen Umgebung ihre
charakteristische Prägung gibt 100 . Gerade diese und ähnliche Phänomene
machen das aus, was in relativ primitiven Milieus als das „unmittelbar
Gegebene" anzusehen ist. Diese Ausdruckseinheiten sind selbst gegeben ;
sie „haften" an den Dingen und sind diesen als dinglichen Bestimmungen
vorgegeben. Die Ausdrucksphänomene sind in der Weise umfassend da,
daß das zugehörige Dinghafte auch nur höchst vage gegeben sein kann.
Das aber besagt : die Ausdrucksphänomene sind insofern nicht fundiert,
als sie keiner dinghaften Unterlagen bedürfen, um überhaupt vorhanden
zu sein. Infolgedessen können sie sich auch nicht auf das vorgegebene
Dinghafte sekundär aufschichten101. Statt nach der Konstitution der
Ausdrucksphönomene auf dem Boden einer vorgegebenen Dingwelt zu
fragen, ist umgekehrt jener „Ernüchterungsprozeß" zu verfolgen, in
dessen Verlauf die primäre Ausdruckswelt in gewissem Maße einer
Dekomposition verfällt und so die Welt der bloßen Sachen und Dinge mit
ausschließlich sachhaften Bestimmungen und Eigenschaften sich erst
herausbilden kann102. Dies ist ein Prozeß, in den sich die positive
Wissenschaft einschaltet, den sie übernimmt, radikalisiert und in gewis-
sem Sinne „zu Ende"führt 103 . Diese Richtung des Entwicklungsprozesses
" SCHELER, Sympathie, S. 275 f. [G. W. 7, S. 233 f.] ; vgl. ferner Wissensformen, S. 478 f. [G.
W. 8, S. 376 f.], zudem die bestätigenden Ausführungen bei KOFFKA, Die Grundlagen der
psychischen Entwicklung, S. 100ff., der auch theoretisch (innerer, d.h. sachlicher
Zusammenhang von äußerem Verhalten und phänomenal Erlebtem) Scheler sehr nahe
steht. Entsprechend auch die Befunde KOHLERS, vgl. Zur Psychologie des Schimpansen, S.
3 8 ff.
100 Vgl. die analogen Ausführungen hinsichtlich der Wertqualitäten in SCHELERS Formalis-
mus, S. 197ff. [G. W. 2, S. OOOff.] und Sympathie, S. 66 [G. W. 7, S. 69].
101 Ähnlich CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Bd. III, S. 73 ff., 80 ff., 84 ff.,
99 f. Allerdings bezieht Cassirer diese „Stufe der Wahrnehmung" nicht auf eine
Triebverfassung, sondern auf eine bestimmte Dimension in der „Welt des Geistes" (vgl.
a. a. O., S. 92 f.), eine Interpretation, die wir wegen ihrer Basis (vgl. oben S. 84, Anm.
89) nicht übernehmen können. — An dieser Stelle wird auch der Gegensatz zwischen
Scheler—Cassirer und Stein (vgl. bes. STEIN, a.a.O., S. 99 f. und 30 ff.) besonders
deutlich.
102 Vgl. SCHELER, Sympathie, S. 275 [G. W. 7, S. 233] und Wissensformen, S. 435 ff. [G. W. 8,
S. 343 ff.].
103 Bekanntlich bezieht Scheler auch die Arbeit der positiven Wissenschaft und das
„Weltbild", das sie entwirft, auf die Triebstruktur des Menschen, genauer: auf den
Herrschaftswillen eines „mit einem vernünftigen Geiste verknüpften Vitalwesens"
überhaupt, „eine Idee, für die der . . ..Mensch' . . .nur ein, wenn auch unser einziges
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Milieutheorie Schelers 89
von der Ausdruckswelt zur Sachwelt gründet in der von Scheler
behaupteten gesetzlichen „Ordnung in der Gegebenheit und Vorgegeben-
heit der Sphären", gemäß der ζ. B. „die als .lebendig' vermeinte Welt. . .
der als ,tot', d. h. nur ,nicht-lebendig* vermeinten Welt stets vor gege-
ben ist" 104 . Aufgrund dieses Sphärengesetzes ist jene Richtung des
Entwicklungsprozesses keine zufällige, keine bloß faktische ; vielmehr hat
sie ihren Grund in der apriorischen Wesensordnung der Sphären selber.
Diese Ordnung bekundet sich, wie in der psychogenetischen Entwick-
lung des Individuums (vom Kind zum Erwachsenen), so auch in der
Entwicklung der Art (vom Primitiven zum Zivilisierten) und in der
Geistesgeschichte (von der vitalistischen Auffassung der Welt in der
Antike und im Mittelalter zum spezifisch modernen „mechanistischen"
Naturbild).
Aus der Milieutheorie Schelers ergeben sich weitreichende Konse-
quenzen für die Theorie der W a h r n e h m u n g . Der Umkreis des
Wahrnehmbaren wird durch die betreffende Milieustruktur bestimmt.
Die Wahrnehmung bezieht sich also nicht auf objektive und an sich
seiende Dinge, sondern auf Milieudinge in ihrer „Daseinsrelativität".
Dadurch wird die Wahrnehmung in die Gesamtheit der biologischen
Funktionen des Organismus eingeordnet und durch die Triebverfassung
dieses Organismus bedingt105. Sinnesfunktionen sind nicht von den
übrigen Funktionen eines Organismus derart losgelöst, daß sie von den
Aufgaben jener anderen Funktionen befreit wären und eine spezifisch
eigene Leistung zu vollbringen hätten, die unabhängig wiederum von den
übrigen Organfunktionen vollzogen würde, — die Leistung nämlich, uns
ein bloßes, für die Lebensnotwendigkeiten indifferentes, daher für uns als
Lebewesen im Grunde überflüssiges Wissen um Dinge und Vorgänge in
der objektiven und an sich seienden Welt zu verschaffen. Dies gilt
ungeachtet des Umstandes, ob man — wie früher — von Abbildung oder
von einer streng eindeutigen Zuordnung zwischen physikalischen Reizen
und entsprechenden Sinnesempfindungen spricht106. Vielmehr stehen die
.Beispiel' ist", )Wissensformen, S. 299 ; vgl. ferner S. 99 ff., 126 ff ; 234 ff., 250 ff. [G. W. 8,
S. 242; vgl. ferner S. 92ff., 112ff„ 193ff., 205ff.]). Auf diese Interpretation der
Wissenschaft, die eines der Symptome der modernen „Krise" der Wissenschaft darstellt,
müssen wir uns in diesem Zusammenhang ein näheres Eingehen versagen. —
104 SCHELER. Wissensformen, S. 52 f. ; vgl. auch S. 475 ff. [G. W. 8, S. 56 f. ; vgl. auch S. 373 ff.].
105 Vgl. SCHELER, Wissensformen, S. 418ff. [G. W. 8, S. 331 ff.].
106 Zur Kritik dieser Theorie der Sinnesempfindungen aufgrund der Aufgabe der
Konstanzannahme, vgl. KÖHLER „Über unbemerkte Empfindungen und Urteilstäu-
schungen", Zeitschrift für Psychologie, LXVI (1913).
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
90 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Sinnesfunktionen und steht auch die Wahrnehmung völlig im Dienste des
Organismus und seines Lebens, d. h. des lebendigen Verhaltens innerhalb
des Milieus. Scheler betrachtet die Wahrnehmung nicht als ein Instrument
und Vehikel einer reinen, „uninteressierten" Erkenntnis, die um ihrer
selbst willen da ist und auf nichts außerhalb ihrer Bezug nimmt, sondern
vielmehr in ihrer biologischen Funktion als Regulator unseres triebmoto-
rischen Verhaltens zur Umwelt. Was die Wahrnehmung an Gegebenhei-
ten erschließt, sind nicht Empfindungsqualitäten, die als Elemente für den
Aufbau dinglicher Einheiten und einer objektiven Welt fungieren. Diese
von der traditionellen Psychologie und Erkenntnistheorie als letzte
Gegebenheiten angesetzten Empfindungsinhalte sind keineswegs einfach
und schlechthin vorhanden. Wo sie gegeben sind, da treten sie in einer
„Zeigefunktion" auf Milieudinge auf107. Ihr primärer Sinn liegt darin, daß
sie Schreck- und Lockmittel sind, die an den Milieudingen „haften" ; erst
in zweiter Linie werden sie zu Merkzeichen für das Sosein von
Milieudingen, verlieren mithin auch hier ihren Bezug auf die Triebanlage
des betreffenden Organismus nicht. Und nur über diejenigen Empfin-
dungsqualitäten, die es biologisch braucht, verfügt ein Lebewesen, in
ihnen hat es gewissermaßen ein „ A l p h a b e t , . . .die L o c k - und
M e r k z e i c h e n für O b j e k t e , . . .die für sein t r i e b h a f t m o t o r i -
sches Verhalten b e d e u t s a m " , d.h. förderlich oder schädlich sind108.
Da, wo Empfindungsinhalte (z.B. Farbqualitäten, Tastqualitäten) gege-
ben sind, handelt es sich nicht um einzelne, isolierte Daten, die
nebeneinander stehen, sich verbinden und Dingeinheiten aufbauen. Die
Empfindungsinhalte sind vielmehr Bestimmtheiten an den wahrgenom-
menen Aspekten der Dinge selbst, sie sind sozusagen „unselbständige
Teilmomente" an diesen Aspekten. Von der strukturierten Ganzheit
dessen, was da als Aspekt wahrgenommen ist, wird diesen Empfindungs-
inhalten eine Stelle zuerteilt; nur i n n e r h a l b dieser Ganzheiten und als
deren Momente sind sie überhaupt da10'. Die psychischen Vorgänge des
107 Vgl. SCHELER, Formalismus, S. 150ff. [G. W. 2, S. 162ff.]; Wissensformen, S. 432ff. [G.
W. 8, S. 341 ff.].
108 Selbstverständlich hat diese Wahrnehmungstheorie Schelers nichts zu tun mit der
geringschätzenden Ablehnung der Sinneswahrnehmung als Erkenntnisquelle seitens des
alten Rationalismus, wie sie etwa bei DESCARTES zum Ausdruck kommt; vgl. z.B. AT
VIII, S. 41 : „sensuum perceptiones in nobis ordinarie exhibent, quid ad illam [sci.
corporis humani cum mente conjunctionem] externa corpora prodesse possint aut
nocere, non autem, nisi interdum et ex accidenti, nos docent qualiain seipsis existant."
Bei aller Anerkennung einer „anima corporea" und dgl. bleibt Descartes das spezifisch
biologische Gebiet verschlossen.
109 SCHELER, Wissensformen, S. 398 f. [G. W. 8, S. 316 f.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Milieutheorie Schelers 91
Empfindens sind mithin keine isolierten Erlebnisse, keine letzten und
ursprünglichen Elementarerlebnisse ; nur eingeordnet in umfassenderen
Akten wie denen des Horchens, Spähens, Spürens usw. treten sie auf und
auch nur da, soweit sie in ihnen „Dienstleistungen" zu vollbringen haben
(wobei solche Dienstleistungen immer auf bestimmte Triebkonstellatio-
nen verweisen, von denen her sie jeweils ihren Sinn erhalten)'10. Die
Ganzheiten wiederum, deren unselbständige Momente Empfindungsin-
halte und -qualitäten sind, bilden ebenfalls kein phänomenal gegebenes
Material, aus dem sich die objektiven Dingeinheiten konstituieren111, wie
dies von der Lehre der „Dingabschattungen" angenommen wird112.
Überhaupt besteht die Funktion und Rolle der Wahrnehmung
nicht in einer Konstitution, sondern im Gegenteil in einer
Selektion. Gerade dies bedeutet die triebmotorische Bedingtheit der
Wahrnehmung und vor allem der Bezug der Milieustruktur auf eine
jeweilige Triebverfassung. Liegt der Bereich des Perzipierbaren, d. h. des
der Wahrnehmung Zugänglichen ganz in der Sphäre des „Milieuwirksa-
men", so ist damit die selektorische Funktion der Wahrnehmung
gegenüber dem vollen Bestände des Milieus gegeben113. Aber auch das
Milieu selbst stellt bereits eine Auswahl (und keinen Ausschnitt)
dar, was sich ebenfalls aus seiner Triebbezogenheit versteht. Nur das, was
den Triebeinstellungen, Interessen usw. eines Lebewesens entspricht und
für dieses relevant ist, kann für es Bestand seines Milieus werden. So
stellen sich die Umwelten=Milieus der verschiedenen Lebewesen und
der nach verschiedenen Richtungen (ζ. B. „Rasse", „Beruf", „Klasse"
usw.) differenzierten Menschentypen und Individuen als durch Triebein-
stellungen, -Verfassungen und -interessen bedingte Auswahlgebilde aus
dem einen all diesen Umwelten gemeinsam zugrundeliegenden „Naturge-
genstand", d. h. der einen „objektiven Welttatsache" dar114. Es sei noch
bemerkt, daß dieser für die Milieu- und Wahrnehmungstheorie Schelers
zentrale Gedanke eine spezielle Anwendung des von ihm aufgestellten
allgemeinen Gesetzes über das Verhältnis von „Realfaktoren" ist115. Auf
110 Vgl. SCHELER, Formalismus, S. 150f. [G. W. 2, S. 162ff.]; Wissensformen, S. 283 und 365
[ G . W . 8, S. 2 3 0 und 2 9 1 ] .
111 Vgl. hierzu SCHELER, Formalismus, S. 50 ff. [G. W. 2, S. 74 ff.].
112 Vgl. HUSSERL, Ideen, §§ 44 und 138.
113 Wir erinnern an die Schelersche Bestimmung des Milieus als das „als wirksam Erlebte",
unabhängig davon, „ob das ,als wirksam Erlebte* in irgendeiner Form auch perzipiert
worden ist oder nicht".
114 Vgl. z . B . SCHELER, Formalismus, S. 157 Anm. [G. W. 2, S. 168, Anm. 2],
115 Vgl. SCHELER, Wissensformen, S. 6 ff. [G. W. 8, S. 20 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
92 Zum Problem des Begriffs einer naturlichen Umwelt
den verschiedensten Gebieten, am nachdrücklichsten aber in der Soziolo-
gie, ist dieser Gedanke von ihm zur Geltung gebracht worden, auf dessen
Diskussion wir hier freilich verzichten müssen.
In Anbetracht der Schelerschen Wahrnehmungstheorie und besonders
des für sie so wichtigen Gedankens der Selektion läßt sich sein Versuch
kritisieren, mit Hilfe des Milieubegriffs das Problem der natürlichen
Umwelt zu explizieren. In der Tat liegt in diesem ein Fortschritt
gegenüber der traditionellen Bestimmung der Umwelt als Teilausschnitt
einer an-sich-seienden Gegenstandswelt ; dieser Fortschritt muß auch in
allen weiteren Bemühungen um das Problem zur Geltung kommen.
Indem aber Scheler das Milieu prinzipiell als Ergebnis einer von
Triebeinstellungen gelenkten Selektion bestimmt und entsprechend die
verschiedenen Milieus auf die den Lebewesen zugeordneten Triebanlagen
bezieht, hat er damit einen diesen Selektionen und den möglichen Milieus
vorgelagerten Seinsbereich vorausgesetzt, der gewissermaßen ein „abso-
lutes" Material bildet, an dem die Selektionen stattfinden. Damit die
Umwelt eines Lebewesens als Resultat einer Selektion verstanden werden
kann, muß bereits eine Welt als „absolute" vorhanden sein 1 ". Wie aber
kommen wir zu diesem allen Milieus vorgelagerten Seinsbereich ? Worin
liegt das Recht dieses Ansatzes ? Wie weist er sich aus ?
Gehen wir von den Gegebenheiten unseres Milieus aus, so ergibt sich
für eine philosophische Betrachtung das Problem des Zugangs und der
Konstitution der Gegenstände „höherer" Stufen und vor allem das
Problem der Konstitution des „absoluten" Seins. Selbst wenn gezeigt
werden könnte, wie sich von unseren Milieudingen her die Dinge der
positiven Wissenschaften konstitutieren und wie wir — um ein Scheler-
sches Beispiel"7 zu verwenden — vom Mond als Milieuding (das bald als
Kugel, bald als Sichel erscheint) zum Mond der Astronomie und
Astrophysik, ferner zu Elektronensystemen und Schwingungsvorgängen
gelangen, so würde uns dieser Aufweis für unser Problem wertlos sein.
Denn einmal ist das Seiende der positiven Wissenschaften gar nicht jenes
absolute Seiende, sondern es ist und bleibt relativ auf den „Menschen" als
konkretes Exemplar der Idee eines herrschwilligen vernünftigen Lebewe-
sens. Und ferner steht die Welt, wie sie durch die positive Wissenschaft
' " V g l . SCHELER, a.a.O., S. 427f. [G. W. 8, S. 337f.], wo die Forderung nach einer
„makroskopischen, vergleichenden und entwicklungstheoretischen Untersuchung" der
Wahrnehmung erhoben wird, die ihrem Sinne nach die Voraussetzung der einen Welt
impliziert.
117 Vgl. SCHELER, a.a.O., S. 368 ff. [G. W. 8, S. 293 ff.J und Idealismus-Realismus, S. 269 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Milieutheorie Schelers 93
dargestellt wird, völlig jenseits aller Milieuwelten. Mit größtem Nach-
druck weist Scheler118 darauf hin, daß es in meiner Milieuwelt weder
Luftschwingungen, elektromagnetische Vorgänge, noch sonstige physi-
kalische Prozesse gibt, es aber andererseits in der Welt der Elektronensy-
steme weder Umweltdinge noch einen Organismus mit Sinnesorganen
usw. gibt. Aber selbst wenn diese Auffassung der positiven Wissenschaft
als „Herrschaftswissen" nicht zu Recht bestünde, — oder anders : wenn
es, wie Scheler einmal andeutet1", andere Erkenntnishaltungen gäbe, die
zu einem „absoluten Wissen" und einem „absoluten Sein" führen, — so
muß dieses absolute Sein dennoch phänomenologisch ausgewiesen und in
seinem Recht aufgeklärt werden, ehe es in einer radikalen philosophischen
Betrachtung als Ausgangspunkt dienen kann. Die Schelersche Milieu-
theorie setzt den Menschen mit seiner Triebanlage sowie die „objektive
Welttatsache", aus der er sich seine Umwelt selegiert, voraus, ohne nach
dem Recht dieses Ansatzes zu fragen. An diesem Mangel radikaler
Voraussetzungslosigkeit, oder daran, daß Seiendes unbefragt hingenom-
men wird, krankt der Schelersche Versuch einer Bestimmung der
natürlichen Umwelt. Statt diese Umwelt adäquat zu beschreiben, in ihren
wesentlichen Charakteren herauszustellen und dann von ihr her nach
Lösungsmöglichkeiten zu suchen, bringt er diesen ersten Ansatz bereits in
Abhängigkeit von unbefragten Implikationen. Weil die Bestimmung der
natürlichen Umwelt bei Scheler gewissermaßen „von oben her" erfolgt,
kann die Milieutheorie, wie er sie entwickelt, trotz des unbestreitbaren
Fortschrittes, den sie bedeutet, nicht zur Basis einer radikalen philosophi-
schen Problematik gemacht werden.
Der Fortschritt, den die Milieutheorie Schelers bedeutet, oder richti-
ger: die positiven Anregungen, die sie vermittelt, liegen in der Einsicht,
daß wir „ursprünglich" nicht einer Welt von Gegenständen gegenüberste-
hen, die Zielpunkte unserer freien Zuwendungen werden können,
sondern jeweils in einem Milieu leben und uns in ihm verhalten. Diese
Einsicht, wie auch die Termini „Milieu", „Verhalten in einem Milieu"
usw., bezeichnen aber zunächst nur Problemtitel für die Analyse des von
Scheler gesehenen Phänomens. Dessen Beschreibung und Explikation ist
die erste und dringlichste Aufgabe, die sich stellt, wenn das Phänomen der
Umwelt und des Milieus überhaupt (zunächst natürlich nur vage) in den
Blick gekommen ist. Auf dem Stand, den die Forschung mit Scheler
erreicht hat, kann es sich nicht darum handeln, das gerade gesicherte
118 V g l . SCHELER, Wissensformen, S . 3 6 1 ff. [ G . W . 8, S . 2 8 8 ff.].
119 V g l . SCHELER, a . a . O . , S . 4 6 0 [ G . W . 8 , S . 3 6 2 ] ,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
94 Z u m Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Phänomen sofort metaphysisch zu überprüfen oder es für eine Anthropo-
logie zu verwerten. Geht man so vor, dann stützt man sich auf unbesehen
hingenommene und vorausgesetzte Seinsbereiche, deren Problematik erst
vom hinreichend explizierten Phänomen der natürlichen Umwelt her
entwickelt werden muß. Darin liegt ja die Bedeutung des Problems der
„natürlichen Umwelt". Begründet wird die Dringlichkeit seiner Analyse
dadurch, daß von diesem B o d e n aus der Z u g a n g zu allen anderen
Seinsbereichen e r s c h l o s s e n werden muß. J e d e r d e r a r t i g e Seins-
bereich muß in seiner K o n s t i t u t i o n von der „ n a t ü r l i c h e n
U m w e l t " her verstanden w e r d e n . Auf die d e s k r i p t i v e H e r a u s -
arbeitung des Milieuphänomens und seiner wesentlichen Charakteristi-
ka kommt es zunächst und vor allem an, nicht auf eine theoretische
Erklärung unter Berufung auf eine objektive Welt und auf Triebanlagen,
aufgrund derer die Lebewesen sich ihre je eigenen relativen Milieus
selegieren.
Sicherlich hat Scheler damit Recht, daß „die ,Dinge', die für unser
Handeln in Betracht kommen, . . .mit dem, was Kant ,Dinge an sich'
nennt, sowie mit den in der Wissenschaft gedachten Gegenständen (durch
deren Supposition sie die natürlichen Tatsachen .erklärt') selbstverständ-
lich nicht das mindeste zu tun haben. . . .das Fleisch, das gestohlen,
gekauft usw. wird, ist nicht eine Summe von Zellen und Geweben mit den
in ihnen stattfindenden chemischen und physischen Prozessen". Aber:
was ist es als M i l i e u d i n g ? Was charakterisiert es als s o l c h e s ?
Was ist ü b e r h a u p t f ü r ein M i l i e u d i n g qua M i l i e u d i n g k o n s t i t u -
tiv? Worin liegt sein Sein? Was macht es ü b e r h a u p t zu einem
Mili eu ding ? Und: wie ist ferner unser Verhalten zu den Milieudingen
zu charakterisieren, unser den Dingen „praktisch Rechnung tragen",
unser Umgang mit ihnen, die spezifisch „praktische Erfahrung", die
Scheler zu Recht von bloßer Übung und Gewöhnung abhebt, da aufgrund
dieser Erfahrung und des „praktischen Lernens" auch ganz neue
Situationen gemeistert werden können. Wenn schließlich „derselbe"
Wald für den Förster ein anderes Milieu ist als für den Spaziergänger,
wodurch begründet sich diese Verschiedenartigkeit, die doch die Ver-
schiedenartigkeit „desselben" ist ? Hier tritt übrigens ein Problem auf, an
dessen Vernachlässigung die prinzipielle Verkehrtheit der Orientierung
(von „oben" nach „unten", statt von „unten" nach „oben") der
Schelerschen Milieutheorie am deutlichsten zutage tritt. Gehen wir
nämlich von dem „zunächst Gegebenen", also dem Milieuding aus, dann
wird eben das „eine und selbe", das für verschiedene Wesen ein je anderes
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 95
Milieuding ist, gerade in seiner „Selbigkeit" zum Problem. Daß es ζ. B.
den einen und selben „Wald" gibt, der für den Menschen ein anderes
Milieu ist als für die Eidechse und wieder ein anderes für den Förster als
für den Spaziergänger, versteht sich nicht ohne weiteres und gleichsam
von selbst, und erst recht ist es keine Selbstverständlichkeit, „daß durch
Verschiebung eines Seienden durch die Stufen der Daseinsrelativitäten
seine .Selbigkeit' keineswegs verletzt wird"120. Vielmehr verbirgt sich
hinter der Redeweise vom „einen und selben" ein höchst komplexes
Problem. Es muß dargetan werden, wie wir vom Milieuding her zu dem
„einen und selben" gelangen, von dem nachher dann gesagt werden kann,
es sei für verschiedene Lebewesen ein je anderes Milieuding; — mit
anderen Worten: das Problem der Konstitution dieses einen und
identischen „Naturgegenstandes" vom Milieuding her muß gestellt und
verfolgt werden121. Dazu kommt eine weitere Schwierigkeit: ist dieser
„Naturgegenstand" von derselben Seinsweise wie das Milieuding, dessen
Seinsweise zunächst geklärt sein muß ? Wenn nicht, dann ergibt sich die
Frage, wie sich das Sein der „Naturgegenstände" vom Sein der
Milieudinge her konstituiert, wie es sich von dort ableiten läßt und dgl.
Den im Vorstehenden formulierten Problemen ist Scheler nicht
nachgegangen, und er hat sie auch kaum gesehen. Erst Heidegger122 hat sie
in seinen auf eine Ontologie des „zunächst begegnenden Seienden"
gerichteten Analysen in Angriff genommen. Diesen Analysen wenden wir
uns im folgenden zu.
§ 13 Die Zeugumwelt
Das „zunächst begegnende Seiende", worunter all das verstanden wird,
mit dem wir es in unserem alltäglichen Leben zu tun haben, wovon wir
Gebrauch machen, womit wir umgehen und hantieren, grenzt Heidegger
zunächst radikal von den Dingen als „vorhandenen" Naturdingen mit
120 SCHELER, Idealismus-Realismus, S. 273.
121 Vgl. GURWITSCH, Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, wo auf eine analoge
Problemlage im Gebiet des Kogitativen hingewiesen wird. Beide Probleme haben nicht
nur äußerliche Ähnlichkeiten; zwischen ihnen besteht ein innerer und sachlicher
Zusammenhang, der allerdings erst auf der Basis der vollzogenen Klärung des
Verhältnisses zwischen „Leben in . . . " und „ c o g i t a r e " aufgedeckt werden kann.
122 Vgl. HEIDEGGER. Sein und Zeit, §§ 12-18.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
96 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
den ihnen an sich zukommenden Sacheigenschaften und -Beschaffenhei-
ten ab. Die Abgrenzung gilt ebenso hinsichtlich der „wertbehafteten
Dinge", die ihrerseits jene Naturdinge schon voraussetzen und durch
„Aufschichtung" von Wertphänomenen und Wertprädikaten auf die
bloßen Sachdinge sich ergeben, mithin in den letzteren fundiert sind123.
Nun sind uns, wie bereits früher ausgeführt wurde, die Dinge als
Naturdinge in ihren sachhaften Bestimmungen gegeben, wenn wir freie
Umschau halten, auf das hinblicken, was „da" ist, uns dem Vorhandenen
zuwenden, es definieren, beschreiben usw., mit anderen Worten: uns in
freien c o g i t a t i o n e s auf das richten, was uns gegenübersteht. Der
positive und wertvolle Gedanke, der der Milieutheorie Schelers zugrunde
liegt, der allerdings in der Ausführung, die dieser Denker ihm gegeben
hat, nicht recht zur Geltung kommt, besteht darin, daß die Umwelt nicht
im Sinne eines Bereiches uns gegenüberliegender bloßer Dinge gesehen
wird, die so und so beschaffen sind, diese und jene ihnen an und für sich
zukommenden Eigenschaften besitzen. Wenn wir in einer Umweltsitua-
tion stehen, dann ist all das, was in dieser Situation vorliegt, nicht primär
Gegenstand der Betrachtung, Zielpunkt freier Zuwendung oder Thema
intentionaler und kogitativer Akte. Wie stehen nicht in Abstand zur
Situation und schauen nicht auf sie hin, die „dort" ist ; — wir haben nicht
als betrachtende und erkennende Subjekte die Situation zu unserem
Objekt, es sind uns überhaupt nicht Gegenstände gegeben, sofern man
diese Wendung in ihrem prägnanten Sinne versteht. Daß wir in einer
Umweltsituation stehen, besagt letztlich, daß wir in ihr leben : wir sind
in diese Situation „eingeschaltet", wir sind „in ihr", es kommt uns eine
bestimmte Funktion in ihr zu. Was mithin in einer solchen Situation zu
geschehen hat und was zu tun uns zufällt, das bestimmen wir nicht als
außerhalb ihrer Stehende, auf sie nur Hinblickende ; — es ist uns vielmehr
von der Situation und der ihr eigenen Struktur selbst vorgeschrieben ; und
wir werden ihr umso mehr und umso besser gerecht, je mehr wir uns von
ihr leiten lassen, d. h. je vorbehaltloser wir uns in sie hinein- und uns ihr
unterstellen. Wenn wir uns in einer Situation befinden und in sie
verwoben sind, von ihr umspannt, ja geradezu „absorbiert" werden, dann
weist dies auf einen prinzipiellen Gegensatz zum Gegenübersein,
In-Abstand-sein, Schauen-auf, Sich-Gegenstände-vorstellig-machen ver-
mittels des kogitativen Bewußtseins124. So wird ζ. B. ein Stock, den ich
123 Vgl. HEIDEGGER, a.a.O., S. 63 f. und 67 f.
124 Vgl. im Zusatz zu § 14, S. 114 ff. die Skizzierung der Problematik des Erkennens
gegenüber dem „Leben in . . .".
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 97
zum Heranholen von etwas gebrauche, im Heranholen zu einer Verlänge-
rung meines Armes ; er gehört nicht in dem Sinne zur Außenwelt, daß mir
da ein Ding gegenübersteht, auf das ich mich richte und das aufgrund
seiner dinglichen Sacheigenschaften gerade dieser Situation erst einen
„Gebrauchswert" erhält.
Die Seinsart von solchen Milieudingen, mit denen wir es im alltäglichen
Leben zu tun haben, hat Heidegger125 als „Zuhandenheit" bezeichnet.
Zuhanden ist Zeug: Schreibzeug, Eßzeug, Fahrzeug usw. Für die
Zeughaftigkeit von solchem Zeug ist ein „Um-zu . . ." konstitutiv : „Zeug
ist wesenhaft,etwas, um zu . . .'." Dieses „Um-zu . . beinhaltet einen
doppelten Verweis : zunächst den Verweis auf eine bestimmte Gebrauchs-
und Umgangsart, die dem betreffenden konkreten Zeug angemessen ist.
So verweist das Schreibzeug auf das Schreiben, das Messer als Eßzeug auf
das Schneiden usw. Zeug verweist stets darauf, was man mit ihm machen
kann, d.h. auf bestimmte Hantierungen. Seine Zweckmäßigkeit und
„Güte" richtet sich danach, wie es sich im Dienst der ihm entsprechenden
Funktion bewähn. Ein stumpfes Messer ist ein „schlechtes" Messer, weil
man mit ihm nicht schneiden kann ; aber ein Löffel, mit dem man auch
nicht schneiden kann, ist deshalb weder ein „schlechter" Löffel noch ein
„schlechtes" Messer. Wer ihn zum Schneiden verwenden will, „versteht"
ihn nicht. Dieses Nicht-verweisen ist noch durch Abgrenzung gegen ein
anderes Phänomen näher aufzuklären. Man kann vom Löffel noch einen
anderen sinnvollen Gebrauch machen ; das tut ζ. B. der Arzt, wenn er den
Löffel umdreht und ihn bei der Halsuntersuchung gebraucht; ebenso
kann man eine Kiste zum Einpacken verwenden; man kann sich aber
auch, wenn man sie kippt, auf sie stellen, um etwas vom Schrank zu holen.
An diesen Beispielen mehrfacher sinnvoller Verwendung zeigt sich die
Möglichkeit der Vieldeutigkeit der Zeughaftigkeit „eines und dessel-
ben"12' Zeuges und damit auch die Möglichkeit der Vieldeutigkeit seiner
Verweise. Verwende ich aber ein Zeug zu einem konkreten Gebrauch,
z. B. hic et nunc die Kiste zum Einpacken meiner Bücher, dann ist die
Kiste ein Packzeug, sie geht ganz in dieser Funktion auf und verweist
nicht über diese hinaus. Dieses zweite Beispiel ist vom vorherigen indes zu
unterscheiden. Wer den Löffel zum Schneiden benutzen will, entdeckt
damit keine neue Zeughaftigkeit und insofern auch keine neue Funktion.
Am Versuch, den Löffel im Sinne eines Messers zu verwenden, wird
deutlich, daß weder die konkrete Situation noch das Zeug verstanden
125 Vgl. HEIDEGGER, a.a.O., S. 18 ff.
126 Uber „ein und dasselbe" und das damit zusammenhängende Problem, vgl. § 15.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
98 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
wird. Dieser Fall, der überspitzt erscheinen mag, ist jedoch für ein
Verhalten beispielhaft, das wir in einem prägnanten Sinne „töricht"
nennen können. Wir weisen aber darauf hin, daß die von Köhler127
berichteten „groben Gewöhnungstorheiten" (vor allem im Gegensatz zu
den „guten Fehlern") der von ihm beobachteten Anthropoiden durchweg
vom Typus des angeführten Falles sind. Dabei ist es bemerkenswert, auch
und gerade in bezug auf daraus sich ergebende Folgerungen, daß — wie
Köhler ausdrücklich betont — derartige Torheiten ausschließlich als
Resultate freilich nicht beabsichtigter Dressuren auftraten.
Die Bestimmung des Milieudings als Zeug, welches durch seinen
Gebrauch gekennzeichnet wird, wird durch die Befunde der kindlichen
Sprache vor der Ausbildung der „Nennfunktion" bestätigt128. Anderer-
seits können die Beschreibungen Heideggers zum Verständnis nicht nur
der betreffenden kindlichen Sprachleistungen beitragen, sondern vor
allem auch zum Verständnis der gesamten „Welt" als Umwelt des Kindes,
der jene sprachlichen Leistungen entstammen und für die sie symptoma-
tisch sind. C. und W. Stern12' sprechen von einer „natürlichen Symbolbil-
dung" in diesem frühen Stadium der Kindersprache. Darunter verstehen
sie : „das Wort ,wau wau'. . . greift.. . aus der Gegenstandswahrneh-
mung direkt einen Teil, und zwar einen sehr auffälligen heraus, nämlich
die oft gehörte Lautäußerung des Tieres; so wird das Wort zu einem
natürlichen Symbol des Gegenstandes." Damit ist aber vorausgesetzt,
daß das Kind bereits vor der Ausbildung der „Nennfunktion" fertig
ausgebildete Gegenstände mit ihren Merkmalen wahrnimmt, unter denen
dieses oder jenes Merkmal besonders „auffällt", so daß die Ausbildung
der „Nennfunktion" eine lediglich sprachpsychologische Erscheinung
ist, jedoch nicht ein Symptom für eine vor sich gehende radikale
Veränderung der kindlichen Umwelt und ihrer Struktur insgesamt. Sieht
man die Entwicklung — im Großen und Ganzen — so, daß sich zunächst
auf einem diffusen, mehr oder weniger monotonen Hintergrund ganz
primitive, rohe, und relativ ungegliederte Strukturphänomene abheben
und sekundär ein Prozeß der fortschreitenden Differenzierung und
Artikulation der primitiven Strukturphänomene einsetzt, der schließlich
zu völlig durchgebildeten, bis ins letzte gegliederten und diskret sich
127
Vgl. KOHLER, Intelligenzpräfungen an Menschenaffen, S. 1 4 0 ff.
128
Vgl. K. BOHLER, Die geistige Entwicklung des Kindes, Jena 1922, S. 223 ff. und 393 ff. ;
vgl. auch C. und W. STERN, Die Kindersprache, Leipzig 1926, S. 190 ff.
129
Vgl. STERN, Die Kindersprache, Kap. X, 4, und W. STERN, Psychologie der frühen
Kindheit, Kap. VIII, 3.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 99
gegeneinander abhebenden „Gestalten" mit ihren Gestaltmomenten
führt130, dann erscheint die sich ausbildende „Nennfunktion" als Symp-
tom für ein bestimmtes Stadium dieses Prozesses. Weil das Kind
durchgebildete, sich voneinander eindeutig und prägnant abhebende
„stabile" Einheiten wahrnimmt, kann es nach den Namen dieser
Einheiten fragen, d. h. jeder solchen Einheit einen Namen zuordnen, aber
nicht als ein äußerliches Etikett, sondern eher als Eigenschaft dieser
Einheit131. Damit kommen wir aber zu einer ganz bestimmten Deutung
derjenigen sprachlichen Äußerungen des Kindes, die vor der Ausbildung
der „Nennfunktion" liegen. Indem es einen Hund, aber auch eine Kuh als
„wau wau" und alles was fliegt als „pip pip" usw. bezeichnet132,
verwendet es keine Gattungsnamen ; es handelt sich dabei aber auch nicht
— wie Stern meint — um eine Benennung, „die rein assoziativ an
irgendein beliebiges, immer wiederkehrendes Merkmal knüpfte". Für das
Kind ist in diesem Stadium der Hund nicht ein Wesen, das unter seinen
vielen Eigenschaften auch die hat, daß es bellt ; sondern er ist ein „Beller",
er geht ganz im Bellen auf, das Bellen macht sein Sein aus, wie
entsprechend „pip pip" das Fliegen des Fliegenden nicht als ein
Merkmal, das bei allem Fliegenden wiederkehrt, sondern als umfassende
Tatsache des Fliegens meint. Diese kindlichen Sprachäußerungen gehen
immer auf das, was die betreffenden „Dinge" tun oder was man mit ihnen
tun kann. Entsprechend gehen die Bestände der kindlichen Welt ganz in
dem Geschehen auf, das an ihnen vorgeht, sie sind geradezu nichts
anderes als dieses Geschehen, sie sind völlig darin hineingezogen133, was
natürlich nicht so zu verstehen ist, als wäre das Geschehen aufgrund seiner
Auffälligkeit von seinem Substrat losgelöst und abstrahiert, da auf dieser
Stufe der Entwicklung die Unterscheidung von einem Geschehen und
seinem Substrat keinen Sinn hat. „Natürliche Symbolbildung" verstehen
wir also dahin, daß die Lautäußerung, die zu dem betreffenden Geschehen
paßt, in der Tat das Wesen der Sache angibt. Daher ist diese Lautäußerung
auch nicht auf ein bestimmtes „Ding" beschränkt; — sie kann auf all das
130
Vgl. KOFFKA, Die Grundlagen der psychischen Entwicklungen, Kap. III, 13, ferner auch,
abweichend von Koffka, STERN, Psychologie der frühen Kindheit, Kap. VI, 1.
131
Vgl. KOFFKA, a.a.O., S. 244 f.
132
Vgl. STERN, a.a.O., S. 307 f.
133
Damit steht im Einklang, was KOFFKA, Die Grundlagen der psychischen Entwicklung, S.
242 f., über die „Kerngebilde" ausführt, die er als die Dinge der kindlichen Welt
bezeichnet. Eben auf diese ungegliederten „Kerne" mit ihren primitiven und rohen
Strukturen gehen die gemeinten kindlichen Äußerungen; diese „Kerne" sind aber auch
nichts anderes als ein nur ganz grob strukturiertes Geschehen. —
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
100 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
„übertragen" werden, woran etwas vorgeht, sofern der Laut zu diesem
Geschehen paßt134. Zum Geschehen im gemeinten Sinne ist nicht nur das
Ausführen charakteristischer Bewegungen, das Ertönen charakteristi-
scher Laute zu rechnen, sondern ebenso das Blinken, Glänzen, Strahlen
usw. — In diese Richtung weisen auch die in späteren Jahren sich
ausbildenden Kindesetymologien 1 ", wie z.B. die Benennung der Kondi-
torei als „Güterei". Hier liegt, nur prägnanter, eindeutiger und darum
auffälliger, bereits jene Art von Zeughaftigkeit vor, die auch dem
Umweltbeständen der Erwachsenen zukommt.
Weitere, und zwar sehr instruktive Veranschaulichungen der Zeughaf-
tigkeit von Umweltbeständen bieten die Befunde an amnestisch Aphasi-
schen136. Wenn diese Kranken die Namen konkreter Gegenstände nicht
angeben können und zu allen ihnen dargebotenen Gegenständen
„Dingle" oder „Stückle" sagen, so meinen sie damit die ganze konkrete
Situation, in der man den vorgelegten Gegenstand in der und der Weise
gebraucht. Sie nehmen die „Dinge" als Zeug im Heideggerschen Sinne
wahr. Anders gesagt : die Umweltbestände sind und bleiben für sie das,
was man in konkreten Situationen mit ihnen macht, sie sind wesentlich
und sogar ausschließlich charakterisiert durch ihre Verweisungen auf
bestimmte Hantierungen. Das zeigt sich noch deutlicher, wenn die
Kranken einen Federhalter geradezu mit „zum Schreiben", ein Metermaß
mit „zum Messen" bezeichnen. Das Umweltding ist hier d a s , wozu es
dient. Wie wir sehen werden137, ist es für die Hirnverletzten geradezu
charakteristisch, daß sie ausschließlich in einer solchen Zeug-Umwelt
leben, aus der sie niemals heraustreten können.
Wir sahen : Zeug verweist zunächst auf eine ganz bestimmte Art des
Hantierens. Der Federhalter als Schreibzeug verweist auf das Schreiben,
d. h. jene Funktion, die sich seiner in einer ihm angemessenen Weise
bedient. Solches Hantieren ist aber niemals ein bloßes Umgehen-mit. Im
Schreiben nehme ich den Federhalter nicht zur Hand, um an ihm als einem
spezifischen Zeug zu manipulieren. Wenn ich das tue, gebrauche ich ihn
nicht als das Zeug, das er ist. Im sinngemäßen Gebrauch benutze ich den
Federhalter zum Schreiben mit Tinte auf Papier. Auf Papier, Tinte,
Tintenfaß, Tisch usw. verweist der Federhalter ebenfalls. Er „gehört" zu
134 Beispiele bei STERN, Kindersprache, Teil I. —
135 Vgl. STERN, a.a.O., Kap. X X I V . -
136 Vgl. hierzu A. GELB und K. GOLDSTEIN, Psychologische Analysen hirnpathologischer
Fälle, Kap. X . Zur Geschichte des Aphasienproblems, vgl. CASSIRER, Philosophie der
symbolischen Formen, Bd. III, Teil II, Kap. VI, 10.
137 Vgl. den Zusatz zu diesem §, S. 104 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 101
diesen Requisiten des Schreibens, die ihrerseits hinsichtlich des Schrei-
bens „zusammengehören" und eine „Zeugganzheit" mit einer „Zeug-
struktur" bilden. Die zweite Art des Zeugverweises geht auf diese
Zeugganzheit ; auf diese ist das einzelne Zeug in dem Sinne bezogen, daß
es von ihr her zu dem Zeug wird, das es gerade ist.
„ E i n Zeug ,ist' streng genommen nie; zum Sein von Zeug gehört je
immer ein Zeugganzes, darin es dieses Zeug sein kann, das es ist. . . Zeug
ist seiner Zeughaftigkeit entsprechend immer aus der Zugehörigkeit zu
anderem Zeug."138 Daher ist der Bezug des einzelnen Zeugs auf seine
Zeugganzheit nicht eine im gewissen Sinne „nachträglich" hinzukom-
mende und kein in „inferiora" fundiertes „superius". Das einzelne Zeug
ist vielmehr das, was es ist, in seiner konkreten hic et nunc in Frage
stehenden Zeughaftigkeit. Sein konkretes Sein wird ihm von der Struktur
der Zeugganzheit zuerteilt, die ihm in dieser Ganzheit seine „Stelle" und
damit seine „Rolle"für sie vorschreibt13'. In diesem Sinne ist es zu
verstehen, daß „die Bewandtnisganzheit, die z.B. das in einer Werkstatt
Zuhandene in seinem Zuhandensein konstituiert, .früher' ist als das
einzelne Zeug"140. Dieses hat sein konkretes Sein aufgrund seiner
jeweiligen Stelle und Rolle im Zeugganzen. Das tritt besonders klar dort
zutage, wo sich wegen der möglichen Vieldeutigkeit der Zeughaftigkeit
„eines und desselben" Zeugs dieses „selbe" sich in verschiedene
Ganzheiten mit jeweils anderen Strukturen einordnet. Packe ich meine
Bücher in eine Kiste, so ist es die Kiste, auf die hin mein Tun gerichtet ist.
Steige ich dagegen auf die Kiste, um etwas herunterzuholen, so hat mein
Tun eine Richtung auf das, was oben liegt, und die Kiste ist hier eine
Vergrößerung meiner Körperlänge, sie gehört in einem gewissen Sinne zu
mir. Auf die Kiste hat mein Tun, das auf „das da oben" gerichtet ist, gar
keinen Bezug; ich hantiere über sie hinweg. So ist je nach dem konkreten
Sinn der Zeughaftigkeit „dasselbe" Zeug einmal das, woraufhin hantiert
wird, es bildet das Zentrum und Ziel des Hantierens ; das andere Mal dient
138 HEIDEGGER, a . a . O . , S. 6 8 f.
139 Vgl. hierzu auch die von E. WEIGL, „Zur Psychologie sogenannter Abstraktionspro-
zesse", Zeitschrift für Psychologie, CHI, S. 27 ff., berichteten Verhaltensweisen von
Kindern beim Ordnen und Zureichen geläufiger Gegenstände des alltäglichen Ge-
brauchs. Indem die Kinder die Gegenstände reichten, erzählten sie Geschichten, die sich
um die betreffenden Gegenstände drehten. Durch diese Geschichten stellten die Kinder
Situationen her, in denen die zugereichten Gegenstände als Zeug fungierten. Diese
Geschichten spielten sich — wie Weigl sagt — „ i n der realen Welt — aber in der des
Kindes, nicht in der unsrigen" ab. Bemerkenswert ist übrigens, daß sich auch eine
erwachsene Vp. ähnlich verhielt.
140 HEIDEGGER, a.a.O., S. 8; vgl. auch § 22 f. über die Raumphänomene.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
102 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
es dazu, „meine Körperlänge zu vergrößern" ; mein Tun geht über sie
hinweg auf etwas anderes hin141.
Das Sein des „Zuhandenen" und die „Weltlichkeit der Welt" bestimmt
Heidegger als „Bewandtnis" 142 . Mit dem jeweils Zuhandenen hat es bei
etwas sein Bewenden. Diesen „Bezug des ,mit. . . bei. . .' " bezeichnet er
mit dem Terminus „Verweisung". Womit es mit ihm sein Bewenden hat,
darauf verweist das zuhandene Zeug: dieses Wobei ist das Wozu seiner
Dienlichkeit. Mit diesem Wozu kann es wiederum bei etwas anderem sein
Bewenden haben: „Mit diesem Zuhandenen, das wir deshalb Hammer
nennen, hat es die Bewandtnis beim Hämmern, mit diesem hat es seine
Bewandtnis bei Befestigung, mit dieser bei Schutz gegen Unwetter." So ist
das Sein des Zuhandenen, das immer schon „umweltlich Zuhandenes" ist,
als Verweisungszusammenhang zu charakterisieren. Auf das in Herstel-
lung befindliche Werk verweisen die Werkzeuge als auf ihr Wozu ; das
Werk selbst „läßt in seiner ihm wesenhaft zugehörigen Verwendbarkeit je
schon mitbegegnen das Wozu seiner Verwendbarkeit. Das bestellte
Werk ist seinerseits nur auf dem Grunde seines Gebrauchs und des in
diesem entdeckten Verweisungszusammenhange von Seiendem." Das in
Herstellung befindliche Werk wird hergestellt aus . . ., und darin liegt
seine Verweisung auf „Materialien" ; diese wieder verweisen mehr oder
minder direkt auf die „Natur" in einem bestimmten Sinne143. Das
bedeutet, daß Zuhandenes immer auf die „Welt" hin freigegeben ist und
nur so allererst als „innerweltliches Seiendes" zugänglich werden kann. —
Die Verweisung aber, von der hier die Rede ist, ist von der Verweisung
des Zeugs sowohl auf ein ihm angemessenes Hantieren wie auch auf die
zugehörige Zeugganzheit zu unterscheiden. Und zwar handelt es sich um
einen p r i n z i p i e l l e n und p h ä n o m e n o l o g i s c h e n Unterschied. Der
Verweis des einzelnen Zeugs auf seine Zeugganzheit besagt, daß jenes von
dieser her und nur in ihr das ist, was es jeweils ist. Die Zeugganzheit
„enthält" das einzelne Zeug in dem Sinne, daß sie ihm seine Stelle in ihr
und darüber hinaus sein konkretes Zeug-sein zuerteilt. Die Verweisung
auf das Hantieren wiederum kennzeichnet das einzelne Zeug wie auch die
Zeugganzheit im Sinne der Z e u g h a f t i g k e i t als bloßer Vorhandenheit.
Der Gebrauch des Zeugs orientiert sich am Zeug selbst. Insofern nun
141 Die in der jeweils verschiedenen Zeughaftigkeit „eines und desselben" Zeugs enthalte-
nen Probleme, die Heidegger nicht gesehen hat, da er auf diese mögliche Vieldeutigkeit
nicht eingegangen ist, werden in § 15 zur Sprache kommen.
142 HEIDEGGER. a . a . O . , S . 7 0 f . u n d § 18.
143 „Im gebrauchten Zeug ist durch den Gebrauch die .Natur' mitentdeckt, die .Natur' im
Lichte der Naturprodukte."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 103
dieses einzelne Zeug vom Zeugganzen her zu dem konkreten Zeug wird,
das es hic et nunc ist, steht seine Verweisung auf den Umgang mit ihm
unter der anderen Verweisung auf die zugehörige Zeugganzheit, welch
letztere mithin die für Zeughaftigkeit fundamentale ist. Von dieser Art der
Verweisung ist aber prinzipiell verschieden der Typ jener Verweisungen,
die innerweltlich Seiendes „mitbeibringen". Das „Mitbeigebrachte"
gehört als solches nicht zur Zeugganzheit — ; es konstituiert die von dieser
gebildete Situation nicht mit. Infolgedessen besagt die Verweisung von
Zeug auf das „Mitbeigebrachte" nicht seine Bestimmung von diesem her
und sein Sein von „dessen Gnaden". Vielmehr bildet das „Mitbeigebrach-
te" einen H o r i z o n t um die Zeugganzheit wie auch um die Situation, in
der wir es mit der Zeugganzheit zu tun haben. Dieses „Mitbeigebrachte"
ist in der Situation „anwesend", aber in der Weise, in der ein Horizont
anwesend zu sein pflegt: weder ist er in die Situation aufgenommen noch
trägt er dazu bei, sie auszuprägen, wohl aber verweist die Situation selbst
auf ihn als auf ihren Horizont und verweist damit über sich selbst hinaus.
Diese Verweisung der Situation und der in ihr figurierenden Zeugganzheit
aus sich hinaus auf die Horizonte144 bedeutet die Möglichkeit eines
kontinuierlichen Hineingehens in diese verschiedenen Horizonte, wobei
das nur „Mitbeigebrachte" in neuen Situationen, in denen man es mit
neuen Zeugganzheiten zu tun hat, zu einem wirklich Zuhandenen werden
kann. So mag ich nach Fertigstellung des Werkes bei ihm bleiben und es
aus der Werkstatt hinausbegleiten zu dem Wozu seiner Verwendbarkeit,
ferner auch zu dem Wozu seiner Dienlichkeit usw. Ich mag aber
umgekehrt von der Verweisung auf die „Materialien" und von diesen auf
die „Natur" zurückgehen und so im kontinuierlichen Fortgang in die
Horizonte hinein immer neues und anderes „innerweltlich Seiendes" im
Sinne der „Zuhandenheit" entdecken. Die Kontinuität des Fortschrittes
liegt darin, daß der Fortgang durch den Akt der Herstellung geleitet wird :
im Fortgang selbst bin ich bei den Verwandlungen des Werkes zugegen
und vielleicht sogar an ihnen beteiligt. Und wenn ich umgekehrt der
Verweisung auf die „Materialien" folge, so lasse ich mich von den
„Vorbedingungen" der Entstehung des aktuellen Werkes führen. Im
Hineinschreiten in die Horizonte, das ein Gelangen zu neuen Situationen
ist, stellt die aktuelle Situation ihrerseits stets den Horizont der neuen
Situationen und der in ihnen zuhandenen Zeugganzheiten dar. Es besteht
ein ständiger Verweisungszusammenhang, der sich im Fortgang selbst
144
Das „Mitbeigebrachte" kann verschiedenen Horizonten angehören, die zudem noch in
verschiedenen Graden der Ausdrücklichkeit „anwesend" sein können.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
104 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
kontinuierlich modifiziert, wobei die ebenfalls der Modifikation unterlie-
gende Verweisung auf die Ausgangssituation so etwas wie eine Einheit des
ständig sich ändernden Verweisungszusammenhangs bedeutet und seinen
Kern ausmacht. Im kontinuierlichen Fortgang erfährt das Werk Wand-
lungen. Der Umstand, daß es sich um Wandlungen und Veränderungen
dieses selben Werkes handelt, verleiht dem Fortgang Kontinuität.
Daher sind diese Wandlungen von völlig anderer Art als die oben
erwähnte und später noch ausführlicher zu behandelnde145. Dabei ist noch
der Unterschied in Betracht zu ziehen, ob das „Mitbeigebrachte" kein
konstitutives Moment der entsprechenden Zeugganzheit und Situation
ist, oder ob es aufgrund der soeben dargelegten Verweisungen als im
Fortgang in die Horizonte nur e n t d e c k b a r angezeigt und „mitbeige-
bracht" ist. Der erste Fall liegt vor, wo etwa jemandem ein Rock auf den
Leib zugeschnitten wird. Auch wenn die betreffende Person bei der
Herstellung des Rockes gerade nicht anwesend ist, orientiert sich das
Hantieren des Schneiders auf sie hin und wird von der Rücksicht auf sie
(d. h. ihre Körpermaße) geleitet. Schauen wir dagegen auf die Uhr, so ist
von da aus der „Stand der Sonne" nur entdeckbar, aber unser Hantieren
ist in keiner Weise auf diesen Stand ausgerichtet. Wir machen dann auch
nicht — wie Heidegger meint — „unausdrücklich Gebrauch von ihm", im
Hantieren selbst ist die Umweltnatur zwar als entdeckbar angedeutet,
aber sie ist nicht zuhanden, auf sie ist nur (in dem hier spezifisch
gemeinten Sinne des Wortes) verwiesen. U m S e i e n d e s (immer handelt
es sich um eine Seinsart gemäß des Zuhandenen) e n t d e c k e n zu
k ö n n e n , darf es noch n i c h t e n t d e c k t s e i n ; es besteht ein
p r i n z i p i e l l e r e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der A n w e s e n h e i t von
Z u h a n d e n e m , das in einer b e s t i m m t e n S i t u a t i o n a u f t r i t t , u n d
der a u f g r u n d von V e r w e i s u n g s z u s a m m e n h ä n g e n m o t i v i e r t e n
M ö g l i c h k e i t der A n w e s e n h e i t ( = Entdeckbarkeit). — Dieser von
Heidegger nicht herausgestellte Unterschied wird sich im weiteren
Verlauf unserer Untersuchungen für das Problem der mitmenschlichen
Begegnungen als wichtig erweisen.
Zusatz
Die Explikation der „natürlichen Welt" als Zeug-Umwelt orientierte sich
am Gegensatz von „Leben in . . ." als „Stehen in Situationen" und
145 Vgl. S. 124 f. und § 8.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 105
„ c o g i t a r e " als „Gegenüberstehen und freiem Umschau-halten". In
seiner ganzen Radikalität tritt dieser Gegensatz am prägnantesten in
Befunden von Hirnverletzten zutage. Deswegen erwächst den genannten
Befunden und den auf sie bezogenen Analysen eine große Relevanz für die
phänomenologische und philosophische Problematik. Da das Verhalten
der Hirnverletzten im Vergleich zu dem der Gesunden völlig unter dem
Gegensatz von „Leben in . . . " und „Hinsehen auf . . . " steht, seien hier,
um diesen Gegensatz in seiner ganzen Eindringlichkeit klar hervortreten
zu lassen, einige dieser Befunde angeführt. Bei der Aufgabe146, geläufige
Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs zu ordnen, bestand zuweilen
auch bei normalen Vpn. das Kriterium der „direkten Benutzbarkeit" : sie
orientierten sich daran, ob dieser k o n k r e t e auf dem Tisch liegende
Hammer zu gerade diesem dargebotenen Nagel paßte, und bemühten
sich, Zeugganzheiten herzustellen. Aber ohne weiteres und gleichsam von
selbst substituierte sich dieses Kriterium dem der „idealen Benutzbar-
keit". Die Vpn. legten den Hammer zum Nagel, weil ein „Hammer
überhaupt" zum „Nagel überhaupt" paßt. Die normalen Vpn. ordneten
weitgehend unabhängig von der realen „Beschaffenheit" der vorgelegten
Gegenstände. Ferner lag bei den normalen Vpn. etwas vor, was Weigl eine
„jederzeit mögliche Labilität" nennt ; sie erlebten das Auch-anders-ord-
nen-können der vorgelegten Gegenstände, eine Fülle und einen Wechsel
von „Gesichtspunkten", nach denen man ordnen kann, so z. B. auch nach
demjenigen der Farbe" 7 . Im Verhalten dieser normalen Vpn. spielt auch —
wie wir meinen — der Charakter der Situation als Versuchssituation im
Unterschied zu einer Stuation des „alltäglichen Lebens" eine Rolle : im
einen Fall muß man der Situation Rechnung tragen und sich in ihr
zurechtfinden, man ist in sie gestellt und lebt in ihr; im anderen Fall steht
man von vornherein mit einer gewissen Freiheit ihr gegenüber, man ist
von ihr im eigentlichen Sinne gar nicht betroffen ; in noch ausgeprägterem
Maße hat man all die Freiheitsmöglichkeiten, die der Mensch als Mensch
auch „gegenüber" einer Situation des „alltäglichen Lebens" besitzt.
So verstehen wir auch die von Weigl berichtete Verlegenheit gegenüber
den gestellten Aufgaben. Dieser Unterschied einer Versuchssituation
gegenüber einer Situation des „realen Lebens" besteht für den Kranken
überhaupt nicht, weil er immer jede Situation als „real" nimmt. Daher
hat einer der von Weigl untersuchten Kranken die Gegenstände nach ihrer
146 Vgl. WEIGL, „Zur Psychologie sogenannter Abstraktionsprozesse", besonders I, § 3.
147 Vgl. aber die Ausführungen WEIGLS in Bezug auf die Distinctio rationis, a.a.O., S. 43 ff.
und über die Bedeutung der „Sphärenerlebnisse" für die „Abstraktion", a.a.O., Teil II.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
106 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
„direkten Benutzbarkeit" geordnet, so „ w i e sie in der m o m e n t a n e n
S i t u a t i o n t a t s ä c h l i c h gemeinsam v e r w e n d b a r " waren, und nur
so konnte er sie ordnen, da er „ganz auf das Hantierungsmäßige
eingestellt war", die dargebotenen Gegenstände für ihn ausschließlich
Zeug waren, mit dem man in bestimmter Weise umgehen kann148. Eine
Tendenz zu einer anderen Reaktion, die etwa dem typischen Verhalten des
Normalen sich annäherte, hatte der Kranke von sich aus nicht. Da er der
Situation gegenüber keinerlei Freiheit besaß, gab es für ihn keine
„Gesichtspunkte", die er an die Situation herantragen konnte. Der
Kranke ist völlig von der Situation und den Situationsbeständen in ihrer
Konkretheit eingenommen. Er ist nicht imstande, etwas als etwas anderes
„vorstellend" anzusehen, ζ. B. eine Schokoladenzigarre als Repräsentan-
ten einer echten, was die meisten normalen Vpn. ohne weiteres taten. Von
einem anderen Kranken berichtet Weigl, daß er auf die Aufforderung, von
drei Gegenständen (Virginiazigarre, Streichholzschachtel und leere
Pfeife) diejenigen zwei zusammenzulegen, die „am besten zusammenpas-
sen", die Zusammenstellung Zündholzschachtel/Pfeife ablehnte : „da ist
nichts drin" (in der Pfeife)14'. In der Tat gehört im hantierenden Umgang
mit Zuhandenem zu einem leeren Rauchzeug auch kein Feuerzeug. Die
dargebotenen Gegenstände haben für den Kranken eine ausschließlich
„hantierungsmäßige Bewandtnis", an diese ist er ständig gebunden und
kommt von ihr nicht los.
Die gleiche Gebundenheit an die konkrete Situation und das ihr
entsprechende rein hantierungsmäßige Verhalten tritt auch noch in
zahlreichen weiteren Befunden an Aphasikern, Apraktikern usw. zutage.
So konnte, wie Cassirer150 aufgrund einer Mitteilung Jacksons erwähnt,
ein Kranker zwar seine Zunge herausstrecken, um sich die Lippen
anzufeuchten, diese Bewegung aber nicht auf die bloße Aufforderung des
Arztes hin ausführen, d.h. als isolierte Bewegung, die nicht von der
Situation erfordert wird, in der er gerade steht. Weil der Kranke an die
konkrete Situation gebunden ist, vermag er nur aus dieser Situation heraus
zu handeln; — er kann lediglich das tun, was in eine solche lebendige
Situation, in der er sich gerade befindet, „situationsgerecht" hineinpaßt.
Er kann z. B. auf Anforderung an die Türe gehen und anklopfen, auf eine
bestimmte Person zeigen, aus einem gefüllten Glase trinken, jedoch nicht
141 Siehe die ähnlichen und entsprechenden Befunde bei GELB/GOLDSTEIN, Psychologische
_ Analysen hirnpathologischer Fälle, X, von denen die Untersuchungen WEIGLS ausgehen.
1 4 9 WEIGL, a.a.O., S. 33 ; vgl. auch S. 22 das „Vermissen" von Gegenständen.
150 Vgl. CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Bd. III, S. 304.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 107
„vormachen", wie man etwas derartiges „macht". Wenn er in der Mitte
des Zimmers steht, vermag er nicht zu zeigen, wie man klopft,
vorzumachen, wie man trinkt (aus einem leeren Glas oder ohne Glas),
oder nur einmal den Zeigefinger auszustrecken, ohne in der Situation
eines konkreten Zeigens zu sein151. Erzählt man einem Kranken eine
Geschichte als „bloße G e s c h i c h t e " , in der „irgendeinem HerrnX"
dieses oder jenes passiert, so ist er nicht in der Lage, unmittelbar nach der
Erzählung die Geschichte wiederzugeben; was er äußert, sind einzelne
Brocken, die auf die Pointe der Geschichte keinen Bezug haben : er hat die
Geschichte nicht verstanden. Erzählt man ihm aber dieselbe Geschichte
ein zweites Mal und führt nun statt des „Herrn X " eine ihm bekannte
Person ein, so reagiert er auf das Erlebnis seines Bekannten genau
wie ein Gesunder1". Voraussetzung für all das, was der Kranke in den
angeführten Fällen nicht leisten kann, ist ein gewisser Abstand zur
Situation, ein Gelöstsein vom Konkreten. Das, was der Kranke nicht zu
leisten vermag, wird vielleicht durch die paradigmatisch gemeinte
Gegenüberstellung Geschichte des Herrn X/Erlebnis meines Bekannten
am deutlichsten.
In ihrer bereits genannten und für die phänomenologischen Probleme
höchst wichtigen Abhandlungen „Über Farbennamenamnesie" haben
Gelb und Goldstein das Verhalten der Hirngeschädigten als „konkretes"
Verhalten im Gegensatz zum „kategorialen" Verhalten der Normalen
beschrieben153. Unter „konkretem" Verhalten verstehen sie dabei das
Gebundensein an die konkrete Situation und ihre Bestände, gewisser-
maßen ein Benommensein von ihr in ihrer Konkretheit. Das „konkrete"
151 Vgl. K. GOLDSTEIN, „Über die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen Vorgän-
gen", Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, Bd. LIV, S. 1923; ferner Davoser
Revue III, No. 8 (15/V. 1928), den Bericht von G E L B und GOLDSTEIN über ihre an den
Ersten Internationalen Hochschulkursen in Davos (1928) gehaltenen Vorträge ; vgl. auch
CASSIRER, a.a.O., Bd. III, S. 309 ff. : „Man sieht wie hier die einzelnen Handlungen
innerhalb ganz bestimmter konkreter Situationen ihren Sinn bewahrt haben, — wie sie
aber zugleich in diese Situation auch gleichsam eingeschmolzen sind, wie sie aus ihr nicht
herausgelöst und selbständig gebraucht werden können." Cassirer betont mit Recht die
„Bindung ans Objekt", die hier vorliegt.
152 Der Verfasser hatte die Gelegenheit, im Gelb-Goldsteinschen Seminar zu Frankfurt
a. M. einen Kranken demonstriert zu sehen, der, als er den Satz „heute ist Donnerstag"
nachsprechen sollte, mit der Verbesserung antwortete „nein, heute ist ja Freitag" (es war
in der Tat an einem Freitag). Das Nachsprechen war bei diesem Patienten dann nicht
gestört, wenn es sich um vorgesprochene „wahre" Sätze handelte; vgl. dazu auch
CASSIRER, a.a.O., S. 295f. und 314ff.
153 Vgl. GELB/GOLDSTEIN, Psychologische Analysen hirnpathologischer Fälle, X, besonders I,
§4.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
108 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Verhalten und Reagieren ist beherrscht von den „konkreten Kohärenzer-
lebnissen"154.
Im Gegensatz dazu wird beim „kategorialen" Verhalten ein Gegen-
stand, eine Farbe usw. nicht in singulärer und daher voller und absoluter
Konkretheit genommen, sondern als Repräsentant einer Spezies: der
konkrete gerade auf dem Tisch liegende Hammer als Vertreter von
„Hammer überhaupt", ein konkretes Rot als Fall von Röte, ein konkretes
Blau als Fall von Bläue usw.155 Daß der Hirngeschädigte sich immer
„konkret" und niemals „kategorial" verhält, deuten Gelb und Goldstein
als Herabsinken auf ein primitiveres Niveau, primitiv im Sinne größerer
„Lebendigkeit" und Wirklichkeitsnähe 156 . Dieses Absinken auf ein
„primitiveres, lebensnäheres Verhalten" gilt ihnen als die Grundstörung,
in der sämtliche Symptome der Kranken wurzeln. Die Begriffe „konkre-
tes" und „kategoriales" Verhalten entsprechen den von uns eingeführten
und für die Phänomenologie der Zeugumwelt als fundamental zugrunde
gelegten Begriffen „Leben in . . ." und „Hinsehen auf . . ." insofern, als
nur das „Leben in . . ." sich in der Tat mit dem deckt, was Gelb und
Goldstein „konkretes" Verhalten nennen. Das „kategoriale" Verhalten ist
hingegen nicht schlechthin mit dem identisch, was wir c o g i t a r e (im
prägnanten Sinne) nannten; das „kategoriale" Verhalten ist vielmehr ein
spezieller Modus des c o g i t a r e , der aber gerade als solcher in den
allgemeinen Strukturen des kogitativen fundiert ist und diese voraussetzt.
Weil nun für das kogitative Verhalten überhaupt die Distanz und freie
Umschau konstitutiv ist, interpretieren wir das Herabsinken der Kranken
auf ein primitiveres Niveau als Verlust der Freiheit und der Möglichkeit
zur Distanznahme gegenüber konkreten Situationen. Auch Cassirer157,
der die philosophische Relevanz der Hirnpathologie betont und wohl als
erster in eine „Phänomenologie der Erkenntnis" einbezogen hat, deutet
die betreffenden Befunde in ähnlicher Weise. Allerdings spielt in seine
Interpretationen der oben158 erwähnte Geistbegriff hinein ; dieser Geistbe-
154 Die Versuche, die zu der Bildung der Begriffe „konkretes" und „kategoriales" Verhalten
Anlaß gaben, betrafen das Ordnen und Zuordnen von Farben.
155 Vgl. hierzu HUSSERL, Logische Untersuchungen, I, S . 1 2 8 - 1 2 9 [Husserliana XVIII, S .
135] über das „Erfassen" der Spezies „Rot", wenn wir ein „konkretes Rotes" vor Augen
haben.
156 Vgl. GELB/GOLDSTEIN, a.a.O., S. 158 und 184. Auf die Tragweite dieser Befunde für das
„Realitätsproblem", dessen Diskussion von hier aus auf eine neue Grundlage gestellt
wird, kann in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden, wie wir überhaupt das
„Realitätsproblem" aus der vorliegenden Abhandlung ausschalten müssen.
157 Vgl. CASSIRER, a.a.O., Bd. III, S. 319 ff.
158 Vgl. oben, S. 84 Anm. 89.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Die Zeugumwelt 109
griff, für den die Gegenüberstellung des „Lebens" als der „Gesamtheit
der organisch-vitalen Funktionen" und der „spezifisch geistigen Funktio-
nen" konstitutiv ist, erschwert ihm sowohl eine Interpretation der
Sphären von „Leben in . . . " und c o g i t a r e , wie auch deren Gebietsbe-
stimmung15'; und schließlich hindert er ihn daran, die Problematik des
c o g i t a r e vom „Leben in . . . " her zu exponieren160. Denn was dem
„Leben in . . . " gegenübersteht, das sind nicht „symbolische Formen", in
denen der „Geist" sich „ein eigenes, ein intelligibles Reich innerer
Bedeutsamheit" aufbaut, sondern vielmehr das abständig Hinsehen und
freie Umschau-halten (das c o g i t a r e ) als eine neue und prinzipiell andere
„Haltung" zur Welt.
Mit der Berücksichtigung der pathologischen Befunde wollen wir nicht
etwa sagen, daß das primäre Verhalten in der Zeug-Umwelt von uns
Normalen genau von der Art sei wie dasjenige des Kranken 1 ". Was bei den
Patienten vorliegt, ist vielmehr eine Radikalisierung dessen, was es auch
beim Normalen gibt, wenn er in der Zeug-Umwelt hantiert und ihre
Bestände sinn- und sachgemäß als Zeug gebraucht. Diese Strukturen sind
beim Normalen um so deutlicher ausgeprägt, je stärker er ausschließlich
in der Zeug-Umwelt qua Z e u g - W e l t lebt, je „vorbehaltloser" und
hingebungsvoller er in den konkreten Situationen aufgeht. Gerade weil es
sich bei den Hirngeschädigten um eine Radikalisierung und um eine
Steigerung bis ins Extrem handelt, lassen die angeführten Befunde die
Strukturen des „Lebens in . . . " um so prägnanter erkennen, die dort, wo
immer schon die Möglichkeit zum kogitativen Verhalten besteht, gerade
von dieser Möglichkeit her verdeckt sind, so daß ihre Freilegung
Schwierigkeiten und Mißverständnissen ausgesetzt ist.
Daß aber bei den Hirngeschädigten eine derartig extreme Steigerung
vorliegt, hat seinen Grund darin, daß für sie die Möglichkeit der
Distanzierung und des freien Hinsehens schlechterdings nicht mehr
besteht. Indem der Kranke in der konkreten Situation völlig aufgeht und
sich von ihr nicht lösen kann, lebt er ständig und ausschließlich in der Welt
des hantierungsmäßigen Umgangs mit verwendbarem Zeug und wird
hilflos, sobald ihm ein anderes Verhalten zugemutet wird.
159 Der Mythos z. B. gehört (wie wir im Gegensatz zu Cassirer meinen, ohne es hier
begründen zu können) durchaus in das Gebiet des „Lebens in . . .", für das „mythische
Bewußtsein" ist eine Distanz zur Welt nicht konstitutiv.
160 Vgl. den Zusatz zu § 6, S. 38 ff.
161 Uber die Differenz der Sprache des amnestisch Aphasischen gegenüber der des Kindes,
v g l . GELB/GOLDSTEIN, a . a . O . , S. 1 8 4 .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
110 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
§ 14 Das Aufgehen in der Situation
Den Bereich des „Lebens in . . grenzten wir ab und stellten ihn in
Gegensatz zur Sphäre des kogitativen Verhaltens. Für die letztere ist die
Distanz und Freiheit gegenüber den Gegenständen konstitutiv, auf die
sich die c o g i t a t i o jeweils richtet. Im Bereich des „Lebens in . . ."gibt es
keine Freiheit und Distanz zur Situation, in der wir gerade leben. Dieser
Situation stehen wir nicht gegenüber ; vielmehr sind wir in sie einbezogen,
an sie hingegeben, und wir gehen in ihr auf. Richte ich mich z . B . in
meinem Zimmer ein, und bin ich gerade dabei, einen Nagel in die Wand
einzuschlagen, so stehe ich nicht den Wänden, den Nägeln, dem Hammer,
den Bildern, die ich aufhängen will usw. gegenüber und mache mir auch
nicht in verschiedenen Modis von c o g i t a t i o alles dies vorstellig.
Vielmehr bin ich „im Hämmern", d. h. in dieser spezifischen Situation
drin, die sich ihrerseits als Teilsituation einem Gesamtablauf („das
Zimmer einrichten") einordnet und von diesem her als ein Moment der
konkreten Gesamtsituation erscheint. Das bedeutet: ich selbst bin in
diesen Gesamtablauf mit seiner Gliederung einbezogen; all mein Tun,
Hantieren, Wahrnehmen usw. ist von der Struktur des Gesamtablaufs und
von den dadurch bestimmten Gesetzlichkeiten der Teilverläufe und
Gliederungen beherrscht und steht in deren Dienste. Indem meine
Hantierungen Momente der Situation sind, gehöre ich selbst"2 in diese
Situation hinein und werde von ihr bestimmt; ich bin der Situation
gegenüber in keinem Sinne souverän, ich verliere mich an sie und bin von
ihr eingenommen163. In einer konkreten Situation stehend, in sie
einbezogen, bin ich jeweils der, als den die S i t u a t i o n mich
b e s t i m m t . Es ist nicht so, daß dieses bestimmte Individuum mit seinen
konstanten Eigenschaften jetzt gerade hämmert und eine Stunde darauf —
als dieses selbe und identische Individuum — spazieren geht, wobei es
162 Vgl. GOLDSTEIN, „Über die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen Vorgängen", S.
174 ff. : „Ich erlebe, wie die Bewegungen aus der Situation, aus der Abfolge der
Geschehnisse selbst erfolgt; ich bin mit meinen Bewegungen gewissermaßen nur ein
Glied in der Abfolge . . ." Demgegenüber bei der Ausführung dieser Bewegungen auf
Aufforderung: „ . . . Ich stehe der Bewegung mehr als Zuschauer, affektlos gegenüber."
Vgl. HEIDEGGER, Sein und Zeit, S. 76.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das Aufgehen in der Situation 111
gewissermaßen als eine Substanz verstanden wird, die ihre ihr allemal
zukommenden Attribute besitzt. Vielmehr bin ich in einer konkreten
Situation jeweils der, den die Situation aus mir macht. Im
Hämmern ζ. B. bin ich „Hämmerer"; — Hämmerer zu sein ist der Sinn
meines konkreten Seins in dieser Situation. Der Sinn der aufgehenden
Hingabe an Situationen der Zeug-Umwelt liegt also darin, daß
man gewissermaßen nur in ihr und nur auf sie hin konkret
existiert.
Die prägnantesten Belege für das soeben Gesagte liefert die phänome-
nologische Analyse des kindlichen Spiels, und vor allem der Spiele, in
denen das Kind eine „Rolle spielt", d. h. eine Person seiner Umgebung
„darstellt". Das geläufigste Beispiel für die hier gemeinten Spiele ist das
Umgehen der Mädchen mit ihren Puppen1". Bei diesem Spielen ist es dem
Kinde durchaus ernst mit seiner Spielsituation, in der es lebt; es ist völlig
„bei der Sache"; kommt ihm in seinem Spiel etwas aus der „objektiven"
Welt störend dazwischen, so versteht es — wie besonders die Beispiele aus
Scupin zeigen — die Störung im Sinne der Spielsituation und bezieht sie in
diese als ein neues Moment ein. Anders gesagt : die Störung wird zu dem,
was sie in der Situation gemäß deren Struktur bedeuten kann, und erhält
so ihren situationsgerechten Platz. Das Kind selbst „ i s t " im Spiel die
„Rolle", die es „spielt". Sein konkretes Sein in dieser Situation wird ihm
von dieser selbst vorgeschrieben; — daher bezieht es die genannten
Störungen, soweit sie es selbst betreffen, nicht auf sich als auf das Kind,
das es „objektiv" ist, sondern auf seine „Rolle" (d. h. auf sein situations-
bestimmtes konkretes Sein) und reagiert von da aus im Sinne der Situation
auf sie. Aus diesem Grunde können wir uns der Meinung Bühlers1'5 nicht
anschließen, daß es sich bei diesen Spielen um „Scheindeutungen"
handelt, und daß dem Kinde auch im völligen Aufgehen in seinem Spiel
„im Hintergrunde des Bewußtseins doch die richtige Orientierung zu der
Lebenswirklichkeit [die Bühler als die „objektive" Wirklichkeit versteht]
gewahrt bleibt". Die von Bühler selbst angeführten Beispiele sprechen
jedenfalls nicht im Sinne seiner Theorie (auf die Tatsachen, die er zu ihrer
Uberprüfung heranzieht, werden wir noch weiter unten einzugehen
1M Weitere Beispiele bei STERN, Psychologie der frühen Kindheit, Kap. X I X ; siehe besonders
die von BÜHLER, Die geistige Entwicklung des Kindes, S. 331, angeführten Beispiele aus
den Tagebüchern Scupins.
Vgl. BÜHLER, a.a.O., S. 325 f.; vgl. auch S. 139, wo er in Orientierung an Lipps von
„primitiven Einfühlungen" des Kindes spricht. Mit Lipps haben wir uns oben (§ 6)
auseinandergesetzt.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
112 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
haben) 1 ". Wir können aber auch nicht Scheler"7 zustimmen, der nament-
lich im Puppenspiel eine „Einsfühlung" des Kindes mit der Mutter
(„enphorische Einsfühlung") und mit der Puppe („ekphorischer Einsfüh-
lung") sieht und diese „Einsfühlung" mit den anderen von ihm erwähnten
Daseins- und Soseinsidentifizierungen zusammenbringt. Bei den echten
„Einsfühlungen" und „Identifizierungen" (z.B. der des Primitiven mit
seinem Totemtier, des Mysten mit seinem Gotte usw.) handelt es sich um
ein Seinsverhältnis zwischen zwei Wesen, so daß das eine Teil hat am
anderen, in es aufgeht, in es hineingezogen wird und in ihm lebt, mit ihm
zusammen von einem gemeinsamen Lebensstrom durchpulst wird und
dgl. Von alledem ist bei dem genannten Spiel des Kindes keine Rede. Im
Puppenspiel steht das Kind nicht in einem Verhältnis zu seiner Mutter,
denn diese tritt in der Spielsituation gar nicht auf. Vielmehr wird es in der
Spielsituation aufgrund von deren Struktur zur „Mutter", es nimmt die
Stelle in der Situation ein, an der von der Gesamtsituation her eine
„Mutter" erfordert würde. Und weil es das tut, existiert es in der
konkreten Situation als „Mutter" ; — anders gesagt : es hat seine konkrete
Existenz in der Situation, in ihrem Sinne und von ihr her. Schon darin, daß
bei diesem Spiel die wirkliche Mutter gar nicht anwesend zu sein braucht,
zeigt es sich, daß hier keine „Einsfühlung" und „Identifizierung"
vorliegt. Durch den Hinweis darauf, daß das Kind doch mit seiner Puppe
so umgeht wie seine Mutter mit ihm, und daß deshalb so etwas wie
„Nachahmung" oder „Einsfühlung" mitwirken müsse, wird an dem
phänomenologischen Befund nichts geändert, für den es nicht darauf
ankommt, welche Umstände zu einem bestimmten Verhalten führen und
erforderlich sind, sondern vielmehr darauf, wie und als was in diesem
Falle das Kind sich in einer bestimmten Situation verhält.
Indem wir in einer Situation stehen und in ihr aufgehen, verhalten wir
uns in ihr in der von ihr vorgeschriebenen Weise. So erst entdecken wir
recht eigentlich die mannigfachen Verweisungen, die für das jeweilig
zuhandene Zeug konstitutiv sind, wie auch die spezifische Struktur der
Situation. Gerade im Umgehen und Hantieren wird die Situation und die
166 Siehe S. 118 f. - Gegen Bühler vgl. STERN, a. a. O., Kap. IX, 3. Obwohl STERN (Kap.
X X I , 2) die Spencersche Nachahmungstheorie als zu einseitig bezeichnet, ist er doch
geneigt, der Nachahmung eine „ungeheure Rolle" einzuräumen. Bei den Beispielen, die
er dabei anführt, handelt es sich aber teils um Sich-Einleben in Situationen und Rollen im
Sinne des Textes, teils um Ansteckungen, die wohl allein als echte „Nachahmungen"
gelten können. Damit diese Fragen entscheidbar werden, ist eine vorgängige phänome-
nologische Klärung dessen erforderlich, was „Nachahmung" eigentlich ist.
167 Vgl. SCHELER, Sympathie, S. 2 3 - 2 4 und 113 f. [G. W. 7, S. 35 und 105 f.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das Aufgehen in der Situation 113
zu ihr gehörige Zeugganzheit sichtbar. Indem ich meine Bücher in eine
Kiste packe, „erblicke" ich im Packen die mannigfachen Verweisungen,
die „da sind", in u r s p r ü n g l i c h e r Weise. Ich „entdecke" sie also,
indem ich mich ihnen unterstelle und ihnen folge. Dieses Entdecken im
Sicheinfügen in die Situation, das „Erblicken" der Verweisungszusam-
menhänge, diese „Sicht eines solchen Sichfügens" nennt Heidegger die
„Umsicht"" 8 . Daß die Verweisungszusammenhänge und die Struktur der
Situation dann in ursprünglicher Weise sichtbar werden, wenn ich in der
Situation aufgehe und mich in ihr in der mir von ihr vorgeschriebenen
Weise verhalte, besagt, daß nicht ich der „Stifter" der so entdeckten
Verweisungszusammenhänge bin. Das Hantieren stellt die Zeugstruktur
der Zeugganzheit nicht her, es bringt nicht Zeugstücke zu einer Einheit
zusammen, als wäre der hantierende Mensch Ursprung und Quelle der
Verweisungen und Bezüge zwischen Zeug, der sie erst aufgrund seiner
Zwecke schaffen müßte. Wenn Löwith 1 " meint, daß „etwas Zuhandenes"
sich zu etwas anderem Zuhandenen im Grunde gar nicht verhalten kann,
weil „Sachen an ihnen selbst kein Verhältnis zueinander haben" und sich
„streng genommen auch gar nicht aufeinander beziehen" können, so
daß „der sogenannte S a c h - Verhalt ein aus dem anthropologischen
Verhältnis abgeleiteter Begriff ist", und daß ferner das, was mit dieser und
ähnlichen „anthropomorphen Redeweisen" gemeint ist, seinen „Ur-
sprung" in den „sachlichen Zwecken des Menschen" hat, — so hat er
damit übersehen, daß erst das sich in die Situation einfügende Hantieren
die für die betreffende Situation konstitutiven Verweisungen und Bezüge
zwar in ursprünglicher Weise, sie aber als in der Situation selbst liegende
und sie ausprägende entdeckt. Denn um sie zu entdecken, muß es sich ja
selbst in die Situation einfügen, sich unter die von ihr bestimmten
Verweisungszusammenhänge stellen und den ihm von der Situations-
struktur zugewiesenen Platz in der Situation einnehmen. Ebenso ist unter
dem Sinn einer Situation nicht ihre Zweckmäßigkeit in praktisch-techni-
scher, äußerlicher Hinsicht zu verstehen; „sinnvoll" heißt vielmehr: vom
Ganzen her gefordert, ihm sich einfügend, seiner Struktur entsprechend,
aus ihm hervorgehend 170 , wie denn auch ein sinnvolles Verhalten ein
solches ist, das dasjenige Zeug so gebraucht, wie es die konkrete
Situation aufgrund ihrer Struktur und Ganzgesetzlichkeit erfordert.
168 HEIDEGGER, Sein und Zeit, S . 6 9 ; vgl. auch weiter unten, § 1 6 dieser Arbeit.
Vgl. LOWITH, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, S . 6 1 f.
170 Über die zwei Bedeutungen des Wortes „sinnvoll", vgl. KOHLER, „Bemerkungen zur
Gestalttheorie", Teil I, III und Teil II, VI, Psychologische Forschung, XI (1928).
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
114 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Zusatz
Wird das Stehen und Leben in Umweltsituationen als das ursprüngliche
und primäre Verhalten zur Welt angesetzt, gilt gerade das „Leben in . .
als das Sein in der „natürlichen" Welt und wird dementsprechend auch
der Begriff der „natürlichen" Welt bestimmt, nämlich im Sinne einer
Milieutheorie, so ergibt sich für das kogitative Bewußtsein und für das
Erkennen überhaupt ein Problem, das allerdings von demjenigen der
traditionellen Erkenntnistheorie völlig verschieden ist171. Das für das
Erkennen konstitutive In-Distanz-stehen hat dann nicht mehr den
Charaktereines u r s p r ü n g l i c h e n F e r n s e i n s von der Welt, so daß das
Problem entsteht, wie das der Welt ursprünglich ferne und ganz in sich
beschlossene Subjekt (die „Monade") an die Welt herankommt und in
seinem Erkennen ein „commercium"mit ihr herstellt. Das In-Distanz-
stehen besagt jetzt vielmehr ein Z u r ü c k g e t r e t e n s e i n , d.h. ein
Sich-in-Distanz-gestellt-haben. Insofern diese Distanz wesentlich und
konstitutiv zum Erkennen gehört, und zwar als eine Bedingung seiner
Möglichkeit, verweist das Phänomen des Erkennens selbst auf die
Vorgängigkeit und Ursprünglichkeit des „Lebens in . . . " gegenüber dem
kogitativen „Sich-richten auf . . .". Eben dieses Zurücktreten und Sich-
in-Distanz-stellen, auf das allererst das Erkennen sich gründet, wird
nunmehr zum Problem.
Dementsprechend faßt Heidegger das erkennende Hinsehen als nur auf
dem Grunde des „Nur-noch-verweilen bei" möglich und interpretiert es
als „Modus dieser Seinsart". „Damit Erkennen als betrachtendes
Bestimmen des Vorhandenen möglich sei, bedarf es vorgängig einer
D e f i z i e n z des besorgenden Zu-tun-habens mit der Welt. Im Sichent-
halten von allem Herstellen, Hantieren und dgl. legt sich das Besorgen in
den jetzt noch einzig verbleibenden Modus des In-Seins, in das
Nur-noch-verweilen b e i . . . " So gilt ihm Erkennen als „ein im In-der-
Welt-Sein fundierter Moâus des Daseins", „Erkennen ist ein Seinsmodus
des Daseins als In-der-Welt-Sein", und zwar ein als wesentlich defizient
zu charakterisierender Modus172. Obwohl Heidegger auf die Eigenstän-
digkeit dieser „neuen Seinsmöglichkeit" des Daseins, auf die Eigenstän-
digkeit des Erkennens hinweist, kommt das Erkennen gerade in seiner
171 HEIDEGGER. a.a.O., § 13.
172 Vgl. auch HEIDEGGER, a.a.O., S. 73 — 74 über die Modi der „Auffälligkeit", „Aufdring-
lichkeit" und „Aufsässigkeit", in denen sich an der „Unzuhandenheit" die „Vorhanden-
heit" meldet, - freilich noch keine reine, sondern eine „in der Zuhandenheit gebundene
Vorhandenheit".
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das Aufgehen in der Situation 115
Eigenständigkeit bei ihm nicht genügend zur Geltung. Zwar verweist das
Erkennen selbst auf die Vorgängigkeit des „Seins in der Welt" und
„gründet in einem Schon-sein-bei-der-Welt", als welches es das Sein vom
Dasein wesenhaft konstituiert. Darin liegt, daß das Erkennen seine
Themen in gewisser Weise dem „Sein in der Welt", dem Leben im Milieu
entlehnt: richten wir uns in der Erkenntnisintention auf die Welt und
machen wir uns ihre Bestände in intentionalen Akten vorstellig, dann
wird das zum Zielpunkt des thematischen Bewußtseins, mit dem wir
schon jeweils im „Umgang" zu tun hatten, und das wir so schon
kennengelernt haben, und zwar in einer spezifisch zum „Leben in . . ."
gehörigen Weise des Wissens173 ; nur erhält es infolge der neuen, radikal
veränderten Einstellung eine total andere Seinsweise: aus Zuhandenem
wird Vorhandenes. Es ist ferner richtig, daß das Erkennen nur auf dem
Grunde des Von-der-Welt-zurücktretens möglich wird, und daß die
„Defizienz des besorgenden Zu-tun-habens" eine Bedingung seiner
Möglichkeit bildet. Andererseits aber liegt die Eigenständigkeit des
Erkennens darin, daß es seine eigenen und durchaus positiven Strukturen
hat, die selbst nicht als Privationen verstanden werden können. Die in ihm
liegende Verweisung auf die Vorgängigkeit des „Lebens in . . ." besagt
nicht, daß es durch diese Verweisung als ein wesentlich privates
Phänomen charakterisiert würde. In der Tat kommt dem Erkennen an sich
selbst gar nicht der phänomenale Charakter der Defizienz und des
„Nur-noch" zu. Aufgrund der Strukturen, die seine Eigenständigkeit
konstituieren, ist es prinzipiell und radikal von dem „In-der-Welt-Sein"
im prägnanten Sinne verschieden, so daß man es in einem nur sehr
formalen Sinne als Seinsmodus des In-der-Welt-Seins bezeichnen kann.
Diese Differenz tritt mit besonderer Prägnanz im Gegensatz von
Einbezogensein und freier Umschau zutage, wie wir sie in § 3 als Moment
des traditionellen Weltbegriffes beschrieben haben. Die die Eigenständig-
keit des Erkennens begründenden Strukturen stehen unter Titeln wie
Intentionalität usw. Erst hier findet die unter diesen Titeln zu begreifende
Problematik ihre legitime phänomenologische Heimat : das spezifische
P r o b l e m f e l d der E r k e n n t n i s in seiner Eigenständigkeit ist der
legitime Boden der P h ä n o m e n o l o g i e , wie sie H u s s e r l i n t e n d i e r t
und auszubilden begonnen hat. — In diesem Zusammenhang muß
es bei den gegebenen Andeutungen über das Problem der Konstitution
der Erkenntnis auf dem Boden des In-der-Welt-Seins sein Bewenden
173
Zu diesem Wissen, vgl. weiter unten § 16.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
116 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
haben. Die Ausarbeitung dieser Problematik muß Thema eigener
Untersuchungen sein, von denen der Verfasser Stücke auf einem Vortrag
in der Göttinger Ortsgruppe der Kantgesellschaft im Winter 1929/30
mitgeteilt hat.
§ 15 Das Problem der Zeugidentität
Wir haben oben174 von der möglichen Vieldeutigkeit der Zeughaftigkeit
„eines und desselben" Zeugs gesprochen und dort bereits bemerkt, daß es
gerade wegen dieser möglichen Vieldeutigkeit jeweils einer anderen
Zeugstruktur sich einordnet und jedes Mal eine andere ihm von der
jeweiligen Zeugstruktur und Zeugganzheit zuerteilte Funktion hat.
Damit wird das Problem gestreift, welches das Recht der genannten
Redeweise in Frage stellt und gerade die Identität des in verschiedenen
Ganzheiten fungierenden Zeug betrifft. Ist die Kiste, wenn sie einmal zum
Einpacken dient und Mittelpunkt meines vektoriellen175 Verhaltens ist, ein
anderes Mal als Objekt verwendet wird, auf das ich mich stellen kann,
dieselbe Kiste? Handelt es sich um ein und dasselbe Zeug , das ist,
was es ist, und sich nur jeweils anders verwenden läßt, ohne daß die
Vielfältigkeit seiner möglichen Verwendung es in seinem An-sich und
seiner Identität tangiert? Und bleibt der Stock, auf den ich micht stütze,
identisch derselbe, wenn ich ihn zum Heranholen eines Gegenstandes
benütze, wo ich doch beide Male mit ihm hantiere und er sozusagen eine
„Ergänzung" meiner Glieder darstellt ?
Schon aus dem Sinn von Zeughaftigkeit und Zeug überhaupt ergibt
sich, daß die fragliche Identität nicht besteht. Das jeweilige konkrete Zeug
bestimmt sich #ls das, was es ist, nicht aufgrund von Eigenschaften und
Bestimmungen, die ihm an und für sich zukommen. Weil diese
Eigenschaften die „seinen" sind, heißt das, daß es in ihnen und durch sie
zu dem bestimmt wird, das es ist. Darin, daß dies für „Zeug" gemäß dem
174 Siehe S. 97 f.
175 Vektoriell nennen wir ein gerichtetes Verhalten, d. h. sowohl das „hin zu . . ." (wenn wir
auf etwas hinstreben in freundlicher oder feindlicher Weise) wie auch das „fort von . . . "
(etwa der Fluchtreaktion). Diesen aus der physikalischen Theorie des Kraftfeldes
stammenden Terminus hat Köhler in die Psychologie übernommen. Beispiele ausgespro-
chen vektoriellen Verhaltens gibt K O H L E R , Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, S.
63 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das Problem der Zeugidentität 117
Sinn von Zeughaftigkeit nicht gilt, sehen wir die entscheidende Differenz
der Zeughaftigkeit gegenüber der Dinghaftigkeit als Spezialfall von
Gegenständlichkeit. Nur wenn die Bestände der „natürlichen" Umwelt
Dinge wären, die so und nicht anders beschaffen sind, bestünde kein
Problem der Identität der Dinge in verschiedenen Situationen. Dann
könnte man auch sagen, das Ding mit diesen und jenen festen Eigenschaf-
ten werde in dieser Situation so, in jener anders verwendet, es selbst bliebe
aber in all diesen verschiedenen Verwendungen identisch und halte sich
aufgrund seiner Dinghaftigkeit in seiner Identität durch die verschiedenen
und wechselnden Situationen durch. Zeug aber hat die Bestimmung seines
Seins vom Umgang mit ihm her, es , , i s t " geradezu das, als was und wie
es in bestimmten Situationen gebraucht und gehandhabt wird. Indem nun
das Gebrauchen und Handhaben niemals ein isoliertes Zeugstück allein
betrifft, sondern stets auf es in einer Zeugganzheit und in seiner ihm von
dieser her zuerteilten Funktion geht, bestimmt sich das einzelne
Zeugstück in seiner hic et nunc vorliegenden Konkretheit aus der
Zugehörigkeit zu „seiner" Zeugganzheit mit der für sie spezifischen
Struktur, und damit auch aus der Situation. Damit ist bereits ausgespro-
chen, daß es eine Identität der Zeugstücke gegenüber wechselnden
Zeugganzheiten und Hantierungssituationen nicht gibt. Das einzelne
Zeugstück wird von Situation zu Situation je nach der betreffenden
Zeugganzheit ein anderes, es ist, was es ist, nur hinsichtlich seiner
Verwendung176. Für das, was ein konkretes Zeug hic et nunc ist, ist
bestimmend, was man in concreto mit ihm macht und als was man es
gebraucht, nicht aber, wozu es in anderen Konstellationen und Situatio-
nen dienen könnte177. Als Zeug geht das einzelne Zeugstück in seiner ihm
hic et nunc zuerteilten „lebendigen" Funktion auf.
Dort indes, wo das „Leben i n . . . " sich in bestimmter Weise
radikalisiert hat und deswegen in besonderer Schärfe faßbar wird, ist das
Fehlen der betreffenden Zeugidentität besonders auffällig. Wenn der
Hirnverletzte an einem leeren Glase nicht oder nur sehr schwer
176 Vgl. auch HEIDEGGER, a.a.O., S. 106 ; „Ein,objektiv' langer Weg kann kürzer sein als ein
objektiv* sehr kurzer, der vielleicht ein .schwerer Gang' ist und einem unendlich lang
vorkommt. — In solchem ,Vorkommen' aber ist die jeweilige Welt erst eigentlich
zuhanden. " Auf das Problem der Identität, das hierin liegt, geht Heidegger freilich nicht
ein und stellt es nicht einmal heraus.
177 Vgl. KÖHLER, Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, S . 26, über den „Funktionswert
von Gegenständen" : „Hutkrempe und Schuh sind für den Schimpansen gewiß nicht
immer optisch Stöcke . . ., sondern nur in gewissen Situationen treten sie ,als Stöcke' im
funktionellen Sinn auf, nachdem ein nach Form- und Konsistenztypus einigermaßen
verwandtes Ding, ζ. B. ein Stab, die Stockfunktion einmal angenommen hat."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
118 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
veranschaulichen kann, wie man trinkt, wohl aber spontan trinkt, sobald
man etwas Wasser in das Glas gießt, dann besteht der Unterschied
zwischen dem leeren und gefüllten Glase offenbar nicht darin, daß zu dem
identisch selben Glasding etwas Flüssigkeit additiv hinzukommt, wäh-
rend es selbst identisch bleibt. Vielmehr erhält das „Glas" durch das
Eingießen von Wasser seinen Charakter als Trinkzeug, und zwar aufgrund
der erst jetzt vorliegenden Trinksituation. Diesen Charakter des Trink-
zeugs hatte es vordem nicht, und weil es ihn nicht hatte, konnte der
Kranke an ihm das Trinken nicht vormachen. In Fällen wie diesen
vollzieht sich eine „Verwandlung" des zuhandenen Zeugs, es „kippt um"
und wird von einem Augenblick zum anderen etwas Neues. Dieses
Umschlagen stellt eine phänomenale Veränderung am Zuhandenen dar178.
Derartige Umschlagphänomene kennen die Normalen sogar im Bereich
des kogitativen Verhaltens, beispielsweise bei Inversionen, Vexierbildern,
der Rubinschen Figur17' usw. Denn auch im Gebiet dieses Verhaltens, das
seinerseits unter der „Gestaltthese"180 steht, gibt es das Problem der
Identität der Feile in wechselnden Gestalten181. Innerhalb des kogitativen
Bereiches erwächst auch das zusätzliche Problem der Konstitution des
identischen Dinges aus der Mannigfaltigkeit der sachhaltig differenten
Noemen182. An Umschlagsphänomenen nimmt — wie wir meinen — die
Erforschung dieser Konstitution ihren Ausgangspunkt.
Das Fehlen der Zeugidentität in dem hier gemeinten Sinne bildet ein
auszeichnendes Merkmal besonders der Welt des Kindes. Stern weist
darauf hin, daß das Kind mehr als der Erwachsene ein Augenblickswesen
ist, im Augenblick aufgeht und sich ihm hingibt1". Er macht auf die
„restlose Versenkung" des Kindes beim Anhören von Märchen aufmerk-
sam, auf den Ernst, mit dem es bei seinen Spielen verweilt. Gerade wenn
das Kind spielt, hat es eine solche Augenblickswelt und -Wirklichkeit, in
der es lebt und aufgeht, und die für es eine konkrete Wirklichkeit ist.
178
Über die „Kippe" vgl. WEIGL, Zur Psychologie sogenannter Abstraktionsprozesse, II, § 4;
ferner S. 36 ff. : „Nachdem ein Mal der hölzerne und der eiserne Haufen vom Kranken
zusammengestellt war, verlor das plötzlich hinzugekommene Tintenfaß den Charakter
des Gebrauchsgegenstandes — es wurde zu ,Glas'." (Der Kranke ist durch „besonders
.zwingende' Bedingungen" dazu gebracht, nach Material zu ordnen.)
179
Vgl. RUBIN, Visuell wahrgenommene Figuren, Berlin 1921, Abb. 3.
180
Vgl. WERTHEIMER, Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt, I, S. 52 ff.
181
Vgl. GURWITSCH, Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, Kap. III, III.
182
Vgl. HUSSERL, Ideen, §§ 130 ff. [Husserliana III, S. 318 ff.].
183
Vgl. STERN, Psychologie der frühen Kindheit, Kap. XIX. Demgemäß definiert Stern:
„real" ist für diese primitivste Lebensform einfach das, was intensiv erlebt wird, und es
bleibt „real", solange sich das Erleben dem Inhalt ganz hingibt.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das Problem der Zeugidentität 119
Dabei ist die Spielphantasie des Kindes von dem beherrscht, was Stern
ihre „Unbekümmertheit" nennt : ein Stückchen zerrissenes Papier wird
als Schuh angesprochen, eine Reihe von Stühlen stellt einen Eisenbahnzug
dar, ein Stock, den das Kind zwischen die Beine nimmt, ein Pferd usw.
Diese Augenblickswelten sind aber im höchsten Maße labil und lösen sich
sprunghaft ab : ein viereckiges Stück Holz ist bald ein Ball, denn ein Hut,
dann ein Geldstück usw." 4 Dasselbe Stückchen Holz, das soeben noch ein
„Kind" war und gepflegt wurde, wird im nächsten Augenblick vom
spielenden Kind selbst zerschnitzt und in den Ofen geworfen. Auf
Tatsachen wie die letztere beruft sich Bühler185 für seine Theorie der
„Scheindeutungen". Dabei ist vorausgesetzt, daß auch für das Kind das
Stückchen Holz ein so und so beschaffenes Ding ist, das nur bald in dieser,
bald in jener Weise „gedeutet" wird. Aber gerade diese Tatsachen lassen
die Voraussetzung der Bühlerschen Theorie problematisch werden, und
dies umso mehr, als der Ernst und die Hingabe, mit der das Kind spielt,
gegen die Theorie der „Scheindeutungen" sprechen. Weil das Kind das,
was wir als dasselbe Stück Holz bezeichnen, bald so und bald anders
behandelt, zeigt es sich, daß es für es kein konstantes Ding mit festen
Eigenschaften ist, sondern in ständigem Wechsel der Augenblickswelten
bald zu diesem und bald zu jenem wird. Eben das, was Voraussetzung der
Theorie der „Scheindeutungen" ist, nämlich das konstante Ding, liegt
beim Kinde nicht vor. Das Stückchen Holz ist eine Puppe, wenn es als
solche behandelt wird und so lange das Kind in entsprechender Weise mit
ihm umgeht ; es wird zu etwas anderem und verändert sich, wenn das Kind
es zerschnitzt und ins Feuer wirft : aus der Puppe ist ein gleichgültiges
Stück Holz geworden. Die Bestände der Umwelt, in der das Kind lebt,
sind nicht durch sachhafte, ihnen ein für allemal zukommende Beschaf-
fenheiten gekennzeichnet, sie sind keine Substanzen mit Attributen,
sondern jeweils das, als was sie behandelt werden.
Für das Leben in Augenblickswelten ist konstitutiv, daß man ihnen
ausgeliefert ist und es so lange bleibt, bis sie durch andere abgelöst
werden. Weil die Hantierungssituationen, in denen wir stehen, etwas vom
Charakter der Augenblickswelten haben (freilich nicht in so radikaler und
extremer Weise, wie das für den Hirnverletzten und für das Kind gilt), gibt
es auch in unserer Zeugumwelt keine Identität einzelner und isolierter
Zeugstücke.
184 Vgl. STERN, a.a.O., S. 213 und 227ff.; über die Sprunghaftigkeit beim Fabulieren, vgl.
auch Kap. XIV, 2. Siehe auch das Beispiel aus Scupin bei BOHLER, a.a.O., S. 332 f.
185 Vgl. BÜHLER, a. a. O., S. 324 ff. ; vgl. auch oben, S. 111.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
120 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Es sei noch an die Ausführungen des § 14 erinnert, in denen dargetan
wurde, daß auch wir selbst im Hantieren in die jeweilige Situation
aufgenommen und eingeordnet sind und von ihr her den Sinn unserer
konkreten Existenz haben. Das bedeutet, daß auch wir von Situation zu
Situation als andere bestimmt werden, daß das identische Individuum, das
sich als identisches durch die verschiedenen Situationen bewegt und in
ihnen sich in seiner Identität durchhält, mithin ein P r o b l e m darstellt.
Dieses Problem wird sich uns für eine Phänomenologie der mitmenschli-
chen Begegnungen als wichtig erweisen.
§ 16 Das implizite Wissen
Wenn wir in einer Situation der Zeug-Umwelt stehen, fügen wir uns in sie
ein. Dieses Sicheinfügen besagt, eine Stelle in der Situation einnehmen,
sich unter sie und unter die für sie konstitutiven Verweisungen und
Verweisungszusammenhänge stellen. Wir bemerkten oben184, daß wir
diese Verweise dann in ursprünglicher Art entdecken, wenn wir uns ihnen
unterstellen, d.h. in der betreffenden Situation aufgehen. Mit diesem
Entdecken im Aufgehen haben wir bereits von einem Strukturmoment
des „Lebens in . . Gebrauch gemacht, das nunmehr expliziert werden
muß.
Die ontische Auszeichnung des „Daseins" vor allem nicht daseinsmä-
ßigen Seienden liegt nach Heidegger" 7 darin, daß das „Dasein" ontolo-
gisch ist. Diesem Seienden geht es „in seinem Sein um dieses Sein selbst".
„Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann, daß es in seinem
Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis h a t . . . Dasein versteht sich in
irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein . . . S e i n s v e r -
ständnis ist selbst eine S e i n s b e s t i m m t h e i t des D a s e i n s . " Inso-
fern zum „Dasein" wesentlich und konstitutiv gehört, daß es immer „in
einer Welt" „ist", betrifft „das dem Dasein zugehörige Seinsverständ-
nis . . . gleichursprünglich das Verstehen von so etwas wie ,Welt' und
Verstehen des Seins des Seienden, das innerhalb der Welt zugänglich
186 Vgl.'S. 112 ff.
187 Vgl. HEIDEGGER, a.a.O., § 4; ferner auch § 31.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das implizite Wissen 121
wird" 188 . Mit diesem dem „Dasein" wesenhaft zugehörigen Seinsver-
ständnis deutet Heidegger auf eine bestimmte Art von „Wissen", das
gerade dem „Leben in . . . " als eines seiner Strukturmomente immanent
ist. Wenn wir in einer Situation stehen, so ist das kein bloßes Geschehen,
in das wir einbezogen sind. Gerade weil wir in der Situation aufgehen und
in ihr hinsichtlich unserer Funktion den konkreten Sinn unseres Seins
haben und von ihr erhalten, haben wir ein „Wissen" ganz bestimmter Art
um die Situation und ihre Bestände, zudem auch ein „Wissen" um uns
selbst in dieser Situation. Dieses „Wissen" regelt unser umsichtiges
Verhalten in der Situation ; von seiner Art sind die Entdeckungen der in ihr
liegenden Verweisungen und Verweisungszusammenhänge. Wenn wir ein
bestimmtes Werkzeug brauchen, das nicht zur Hand ist, jedoch ein
„Ding" „bemerken", das sich in der erforderten Weise verwenden läßt, so
bedeutet dieses „Bemerken" ein Entdecken des „Dinges" in einer
möglichen Funktion in der Situation, es bedeutet nicht ein Konstatieren
eines so und so beschaffenen Dinges (im eigentlichen Sinne), sondern es ist
ein .Sehen' dieses Zeugs in dessen Verweisungsbezug auf die konkrete
Situation189. Das „ D i n g " wird nicht in seinem An-sich wahrgenommen,
mit seinen ihm zukommenden und es als Ding konstituierenden
sachhaften Bestimmungen und Eigenschaften, sondern als das Zeug, als
das es hic et nunc fungieren kann, d. h. in seiner konkreten Dienlichkeit
und Brauchbarkeit. Es wird lediglich in bezug auf seinen „Funktions-
wert" bemerkt. Alles „Sehen", „Wahrnehmen", „Bemerken", „Wissen"
steht hier im Dienst des „Seins in der Situation" und ist nachgerade eines
ihrer Momente. Darin liegt denn auch der berechtigte Gedanke der
Schelerschen Wahrnehmungstheorie, daß die Wahrnehmung ursprüng-
lich kein Instrument eines „uninteressierten", distanzierten Erkennens
ist, sondern dem lebendigen Verhalten im Milieu eingeordnet ist, und daß
188 Vgl. ferner HEIDEGGER, a.a.O., S. 86: „Wenn dem Dasein wesenhaft die Seinsart des
In-der-Welt-Seins zukommt, dann gehört zum wesenhaften Bestand seines Seinsver-
ständnisses das Verstehen von In-der-Welt-Sein".
185 Bei den von KOHLER, Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, Kap. II, beschriebenen
Beispielen von „Werkzeuggebrauch", sowie bei den „Umwegen über selbständige
Zwischenziele" (Kap. VI), handelt es sich durchwegs um Entdeckung von Verweisungs-
zusammenhängen in dem im Text gemeinten Sinne. Köhler selbst schaltet die Frage aus,
ob bei den Schimpansen Bewußtsein vorliegt (was doch nur heißen kann, ob das Tier in
seinem Tun selbst um dieses Tun „implizit" weiß ; von Bewußtsein in einem anderen
Sinne kann doch wohl keine Rede sein), weil er diese Frage für nicht spruchreif und daher
für unfruchtbar hält; vgl. auch Optische Untersuchungen am Schimpansen und am
Haushuhn, S. 56. In der Tat ist diese Frage für die Köhler interessierenden Probleme
ohne Belang.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
122 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
sie ursprünglich diesem Verhalten dienstbar ist, d. h. aus ihrer biologi-
schen Funktion heraus verstanden werden muß"°.
Jedoch abgesehen von diesem Entdecken der Verweisungen und
Verweisungszusammenhänge, auf das alles Sich-orientieren in einer
konkreten Situation und alle Anpassung des Verhaltens an sie, alles
„praktische Rechnung tragen" und die spezifisch „praktische Erfahrung"
zurückgeht, gibt es im Stehen in einer Situation ein diesem „Leben in . .
„implizites" Wissen 1 ". Wenn wir gerade in einer Beschäftigung sind, bei
der unser Tun uns eindeutig vorgezeichnet ist und — sozusagen — glatt
abläuft (wenn es sich also etwa um ein bereits automatisiertes Tun handelt,
wie bei unzähligen Verrichtungen des alltäglichen Lebens), so „wissen"
wir, während wir in einer derartigen Beschäftigung stehen, um sie, wie um
die Situation, in die dieses Tun sich einordnet. Ein solches „Wissen" um
das automatisierte Tun haben wir auch dann, wenn wir gar nicht „bei ihm
sind", gar nicht auf es achten, nicht in ihm leben, sondern gedanklich mit
etwas völlig anderem beschäftigt sind. Wer sich beispielsweise beim
Rasieren überlegt, was er im Laufe des Tages vorhat, der „weiß" —
wiederum „implizit" — nicht allein davon, daß er jetzt Pläne macht, und
welche Pläne er entwirft, er „weiß" — ebenfalls „implizit" — davon, daß
er sich rasiert. Die Behauptung, daß es sich bei dem „Wissen" um die
Situation, in der wir stehen, und um unser Verhalten in ihr um ein und
dieselbe Weise des „impliziten" Wissens handelt, gleichgültig ob unser
Verhalten umsichtig oder automatisiert ist, verkennt und nivelliert den
Unterschied dieser beiden typisch verschiedenen Verhaltensweisen nicht.
Nur das soll hier gesagt sein, daß es ein ganz bestimmtes dem „Leben
in . . . " immanentes Wissen um sich selber gibt" 2 . Der genannte Unter-
schied wird (wie auch andere seiner Art) so wenig nivelliert, daß typisch
verschiedene Verhaltensweisen gerade in ihrer Verschiedenheit „implizit"
um sich selbst wissen. Wenn wir, wie in obigem Beispiel, in irgendwelchen
Plänen und Entwürfen leben und zugleich noch „nebenbei" mit einer
Vgl. oben, S. 89 ff.
Wir bezeichnen das hier in Rede stehende Wissen als „implizit" im Anschluß an die
weiter unten zu besprechende Abhandlung von H . SCHMALENBACH, „Das Sein des
Bewußtseins", Philosophischer Anzeiger, Bd. IV (1930).
192 Insofern als das kogitative Gerichtetsein auf Gegenstände ebenfalls in bestimmtem Sinne
als „Leben in . . . " zu interpretieren ist (nämlich als Leben in dem intentionalen Akt, der
die betreffende Gegenständlichkeit zur Gegebenheit bringt, und der selber nicht
wiederum Gegenstand eines auf ihn gerichteten Aktes der Reflexion ist), gibt es auch für
das kogitative Bewußtsein das „implizite Sich-selber-wissen des Wissens" (vgl.
SCHMALENBACH,a.a.O., §§ 5 f.) ein Phänomen, auf das bereits von PLATO in seinem
Charmides hingewiesen hat.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das implizite Wissen 123
automatisch ablaufenden Tätigkeit beschäftigt sind, so wissen wir
„implizit" um beides. In derselben Weise wissen wir auch von unseren
aktuellen affektiven und emotionalen Zuständen. Wer zornig ist, weiß,
indem er zornig ist und in seinem Zorn lebt, um seinen Zorn, ohne daß er
in einem Akte der Reflexion sein Zornerleben zum Gegenstand dieses auf
es gerichteten Aktes machen müßte ; und er weiß „implizit", in anderer
Weise darum, als wenn er ein intentionales (reflektierendes) Bewußtsein
von seinem Zorn vollzieht. Ebenso weiß derjenige, über den Trauer
gekommen ist, indem er sich im Zustand der Trauer befindet, darum, wie
er sich darin befindet.
Gerade das Affektive und Emotionale haben Brentano" 3 auf die
Unterscheidung von „innerer Wahrnehmung" und „innerer Beobach-
tung" geführt und ihn dazu veranlaßt, die letztere für alle „Gegenstände
der inneren Wahrnehmung" abzulehnen. Ist, wie dieser Autor meint, die
Zuwendung zum Beobachteten für die Beobachtung wesentlich, und darf
andererseits „Aufmerksamkeit" als Titel für Akte von ausgezeichneter,
nämlich kogitativer Intentionalität gelten" 4 , so bedeutet Brentanos
Ablehnung der „inneren Beobachtung", daß Erlebnisse im prägnanten
Sinne nicht Gegenstände sein können, in dem das von intentionalen
Korrelaten der Akte von der Form c o g i t o gilt. Selbst wenn man die
Möglichkeit in Betracht zieht, daß ein Zorn zum Gegenstand eines auf ihn
sich richtenden Aktes der Reflexion wird (und vielleicht sogar eines Aktes
von der Form c o g i t o ) während er noch aktuell ist, und daß er bei dieser
Vergegenständlichung nicht verraucht, so bedeutet dies eine tiefgreifende
Modifikation auch der Art und Weise unseres Wissens um den Zorn,
zumal im Vergleich zu jenem Fall, wo wir nicht reflektieren, sondern im
Zorn leben. Bei der betreffenden Möglichkeit, die hier nur als p r i n z i -
pielle, nicht als psychologisch reale diskutiert wird, treten wir gewisser-
maßen aus dem Zorn heraus, der als in jeder inhaltlichen und qualitativen
Beziehung unverändert fortdauernd vorausgesetzt wird. Wir stellen uns
in einem Akt der Reflexion unserem eigenen Erleben gegenüber und
erfassen es als Gegenstand eines intentionalen Aktes. Indem wir das tun,
vollziehen wir ein Bewußtsein von ihm. Das bedeutet dann aber: wir
leben nicht mehr im Zorn, obwohl unser zorniger Zustand unverändert
fortdauert und uns ganz erfüllt; — vielmehr leben wir in dem
reflektierenden Akt, in dem wir uns auf den Zorn als auf unseren
1.3 Vgl. BRENTANO, Psychologie vom empirischen Standpunkt, I, Kap. II, § 2.
1.4 Vgl. GURWITSCH, Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, Kap. II, § 7.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
124 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Gegenstand richten. Wir wissen hier von dem Zorn in der Weise, wie wir
überhaupt im Vollzug thematischen Bewußtseins von den Gegenständen
dieses Bewußtseins wissen ; während wir noch zornig sind, haben wir uns
bereits von unserem Zorn distanziert. Leben wir dagegen im Zorn selbst
und nicht in einem auf den Zorn sich richtenden thematischen Bewußt-
sein, so besagt das, daß wir uns nicht von unserem Zorneszustand
distanzieren, um ihn zum Gegenstand einer c o g i t a t i o zu machen. Wir
stehen dem Zorn in diesem Fall nicht gegenüber ; — und das bedeutet, daß
er kein G e g e n s t a n d für uns ist. Doch aber „wissen" wir um ihn : ganz
im Zorn lebend und nicht auf ihn reflektierend, „weiß" ich im Z o r n e
selber um meinen psychischen Zustand. Dieses mein „Wissen" ist
prinzipiell anderer Art als das Wissen des thematischen Bewußtseins. Es
ist dem Zorn „immanent" s , oder anders : indem ich um meinen Zorn weiß,
„bleibe" ich bei ihm. Dieses „Wissen" hat das, worum es „weiß", nicht
zum Objekt, — ein Phänomen, dessen sprachliche Formulierung, wie
Geiger bemerkt hat, aus Gründen der grammatikalischen Struktur auf
Schwierigkeiten stößt 1 ". Gerade weil mir in einer bestimmten Weise
zumute ist, weiß ich darum, wie mir zumute ist, ohne daß ich auf dieses
Zumutesein zu reflektieren brauchte. Ferner bemerkten wir, daß wir bei
jeder Hantierung ein Wissen um diese Hantierung haben, das ihr
immanent und implizit ist. In diesem „impliziten" Wissen um die Art und
Weise unseres Seins in einer Situation, und damit um sie selbst, treten wir
aus ihr nicht heraus und geben unsere Stelle in ihr nicht auf. So in der
Situation fungierend wissen wir um uns und unsere Funktion innerhalb
der Situation, und zwar wissen wir „implizit" darum, ohne daß wir uns
auf uns selbst und auf unsere Rolle in der Situation intentional richten. Da
wir aber unsere Stelle und Funktion von der Situationsganzheit zuerteilt
bekommen, bedeutet unser „implizites" Wissen um uns und unsere Rolle
zugleich ein ebensolches Wissen um die Situation und deren Bestände.
Auch um sog. „äußere Objekte" gibt es ein „implizites", dicht
vergegenständlichendes Wissen; allerdings sind dabei diese „äußeren
Objekte" weder „außen" noch „Objekte", wie denn auch das „Wissen
1,5 Vgl. die Interpretation der „immanenten Wahrnehmung" Husserls bei SCHMALENBACH,
a.a.O., S. 389 f., wobei sich Schmalenbach selbst seiner Divergenz mit Husserl bewußtist
(siehe besonders S. 400 f.). Vgl. ferner S. 378 über den Unterschied der „Gegebenheitsar-
ten" bei „implizitem" und bei „explizitem" Wissen.
Vgl. GEIGER, Fragment über den Begriff des Unbewußten und die psychische Realität, S.
43 f. Um das „implizite" Wissen auch sprachlich vom Wissen des thematischen
Bewußtseins zu unterscheiden, sprechen wir hier immer von „Wissen u m . . . " (bei
implizitem Wissen) im Gegensatz zum expliziten „Wissen von . . . " .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das implizite Wissen 125
um sie" kein „Wissen von Objekten" ist. In diesem „impliziten" Wissen
leben wir sozusagen nicht in einer zweiten Dimension (des kogitativen
Verhaltens), von der her wir auf die erste (das „Leben in . . .") hinsehen;
wir bleiben ganz im Bereich des „Lebens in . . .", das sich wesenhaft
immer schon selber weiß und aufgrund dieses ihm innewohnenden
„impliziten Sich-selber-Wissens" als ein im bestimmten Sinne nicht
blindes zur Geltung gelangt.
Wir haben bereits die Auffassung Brentanos berührt, der zufolge
Erlebnisse prinzipiell der Beobachtung unzugänglich sind. Doch inter-
pretierten wir dies dahin, daß Erlebnisse nicht zu Gegenständen von
ausgezeichneten intentionalen Akten werden können. Betrachtet man mit
Brentano die Intentionalität als das wesentliche Charakteristikum des
Bewußtseins, so ist die bestrittene Möglichkeit einer „inneren Beobach-
tung" unzweifelhaft paradoxal. Es entsteht aber eine zusätzliche Schwie-
rigkeit, wenn wir fragen, wie wir von Erlebnissen gerade im aktuellen
Vollzug selbst wissen. Dieses Problem des „impliziten" Wissens
kommt aus begreiflichen Gründen für Brentano nur so weit in Betracht,
als es sich um das „implizite" Wissen des selbst „expliziten" intentionalen
Bewußtseins von . . . handelt. Da aber, wie wir bereits bemerkten, das
„implizite" Wissen einen und vielleicht den einzigen gemeinsamen
Wesenszug sowohl des von der Intentionalität beherrschten Bereichs des
gegenständlichen Bewußtseins, wie auch des nicht intentionalen Berei-
ches des „Lebens in . . . " ausmacht, so daß es vielleicht zur allgemeinen
Beschreibung des Bewußtseins dienen kann197, mithin nicht nur für das
„Leben in . . . " , sondern auch für Stimmungen, Befindlichkeiten usw.
gelten würde" 8 , müssen wir auf Brentanos Theorie trotz ihrer Einseitig-
keit eingehen. Und dies umso mehr, als diese Theorie den Unterschied
zwischen explizitem „Wissen v o n . . . " und implizitem „Wissen
um . . . " ' " in seiner ganzen Radikalität hervortreten läßt. Die Macht des
Intentionalitätsbegriffes macht sich auch angesichts dieses Problems
bemerkbar.
1.7 Vgl. BRENTANO, a.a.O., II. Kap. I, § 6, der „eine weitere [neben und außer der
Intentionalität] Eigentümlichkeit aller psychischen Phänomene" darin sieht, daß sie
durch „innere Wahrnehmung" erfaßbar sind. Wie die zitierten Wendungen zeigen, hat
Brentano den im Text angedeuteten universalen Bewußtseinsbegriff nicht erreicht.
1.8 Vgl. HEIDEGGER, Sein und Zeit, § 29 ; Was ist Metaphysik Bonn 1929, ferner GOLDSTEIN,
„Zum Problem der Angst", Allgemeine ärztliche Zeitschrift für Psychotherapie und
psychische Hygiene, II (1927), S. 409-437 [Ausgewählte Schriften, S. 230-262],
lw Von anderen nicht intentionalen Bewußtseinsweisen wie Stimmungen und Befindlich-
keiten sehen wir in diesem Zusammenhang ab.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
126 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Wenn wir ζ. B. die Vorstellung eines Tones haben, sind wir uns dessen
bewußt, daß wir sie haben ; wir haben zugleich mit der Vorstellung des
Tones die Vorstellung von der Vorstellung des Tones200. Dabei liegen aber
nicht zwei gesonderte Akte vor, sondern nur ein einziger Akt : „In dem
selben psychischen Phänomen, in welchem der Ton vorgestellt wird,
erfassen wir zugleich das psychische Phänomen selbst. . Dieses hat
also, da es sich wesentlich durch Intentionalität auszeichnet, eine doppelte
intentionale Beziehung : einmal auf den Ton als auf das „primäre Objekt",
und ferner auf das Hören des Tones als auf das „sekundäre Objekt". Jedes
„psychische Phänomen" hat als intentionales diese doppelte Objektbe-
ziehung ; was immer sein eigentliches, sein „primäres Objekt" sein mag,
stets ist es selbst „in seiner Totalität" sein eigenes „sekundäres Objekt" 201 .
Jedes Bewußtsein von etwas ist „begleitet" von einem Bewußtsein seiner
selbst, das zu ihm gehört und mit ihm die Einheit eines Aktes bildet, so
daß hier eine „eigentümliche Verschmelzung von Bewußtsein und Objekt
des Bewußtseins" vorliegt. Mit dieser Unterscheidung von „primärem"
und „sekundärem" Objekt glaubt Brentano der Gefahr „unendlicher
Verwickelung", d.i. jenem regressus in i n f i n i t u m zu entgehen, auf
den bereits Aristoteles202 aufmerksam gemacht hat. Gleichzeitig macht
diese Lehre einsichtig, daß und warum es ein Wissen von aktuellen
Erlebnissen in „innerem Bewußtsein" und „innerer Wahrnehmung" auch
ohne „innere Beobachtung" geben kann. Selbst die Leugnung der
Möglichkeit „innerer Beobachtung" aktueller Erlebnisse soll durch die
Unterscheidung von „primärem" und „sekundärem" Objekt eine weitere
Stütze erhalten.
Doch wird diese Theorie nicht einmal dem „impliziten Sich-selber-
wissen" des „expliziten" (intentionalen) „Bewußtseins von . . . " gerecht,
ganz abgesehen davon, daß der Intentionalitätsbegriff Brentano daran
hindert, nicht-intentionale Bewußtseinsweisen wie das „Leben in . . . "
und die Befindlichkeiten in den Blick zu bekommen203. Auch ein
„sekundäres" Objekt ist ein Objekt im Sinne eines Gegenstandes, wie ja
ein mit seinem Objekt „verschmolzenes" Bewußtsein, wenn es als
Bewußtsein von seinem Objekt auftritt, eben ein intentionales Bewußt-
sein ist. Der phänomenologischen Eigenart des „impliziten Sich-selber-
200 BRENTANO, a.a.O., I I , Kap. II, §§ 8 ff.
201 BRENTANO, a.a.O., II, Kap. III, §§ 2 ff. Ebenso auch schon ARNAULD: „je connois que je
connois par une réflexion virtuelle" ; vgl. oben, S. 70 f.
202 Vgl. ARISTOTELES, De anima, Kap. 2, 425 b 12ff.
203 Vgl. die Auseinandersetzung SCHMALENBACHS, a.a.O., § 9, mit Brentano und Husserl.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das implizite Wissen 127
Wissens" und des „expliziten" Wissens ist Brentano nicht gerecht
geworden, weil er es abgelehnt hat, die Beziehung der „inneren
Wahrnehmung" zu dem Akt, den sie wahrnimmt, als eine „besondere
Weise von intentionaler Beziehung zu ihm" zu deuten, und sie stattdessen
als „besondere Weise der Verbindung mit dem Objekt", eben als
„Verschmelzung" verstanden wissen wollte204. Wenn man — wie er meint
— die Frage, ob bei der Vorstellung einer Vorstellung eine oder „mehrere
und verschiedenartige Vorstellungen" vorliegen, nach „der Zahl und
Verschiedenheit der Objekte" entscheiden will, dann müsse man
sagen, „wir hätten. . . mehrere Vorstellungen, und diese seien von
verschiedener Art; so zwar, daß eine von ihnen den Inhalt der anderen
bilde, während sie selbst ein physisches Phänomen [sc. den Ton] zum
Inhalt habe". Damit deutet Brentano indes das „implizite" Wissen doch
wieder als „explizites" und intentionales. Zudem entgeht diese Theorie
auch der Gefahr des regressus in infinitum nicht. Jedes psychische
Phänomen enthält prinzipiell ein mit ihm verschmolzenes Moment, dank
dem das Phänomen in seiner Totalität zwar als ein „sekundäres", aber
doch intentionales Objekt bewußt wird. Weil aber dieses Moment als
intentionales Bewußtsein beschrieben wird, wenn auch als Bewußtsein
des Gesamtphänomens und damit auch seiner selbst, muß es ein Wissen
gerade von der Intention geben. Diese Intention muß das „tertiäre"
intentionale Objekt eines weiteren Momentes sein, das mit dem betrach-
teten Moment und damit auch mit dem Gesamtphänomen wiederum
„verschmolzen" ist. Genau dieselben Gründe, die vom „primären"
Objekt zu einem „sekundären" führen, führen auch zu einem „tertiären",
„quartären" usw. Und weil das „begleitende Bewußtsein" als intentio-
nales Bewußtsein des Gesamtphänomens und damit auch seiner selbst
als mit dem Gesamtphänomen verschmolzen vorausgesetzt wird, ist
damit die in diesem Moment lebende Intention auf das Gesamtphänomen
bezeichnet. Diesen zutage tretenden regressus verdeckt die Wendung
Brentanos, daß das ganze Phänomen „nach seiner Totalität" und „nach
seiner doppelten Eigentümlichkeit" „sekundäres" intentionales Objekt
eines Teilmomentes am Gesamtphänomen ist, wobei die Unklarheit, daß
eine Intention in ihrem aktuellen, wenn auch nicht thematischen, d. h.
kogitativen Vollzug selbst ihr eigenes intentionales Objekt sein soll, an
dem dahinter verborgenen regressus liegt. Zwar entgeht Brentano mit
seiner Lehre von der eigentümlichen „Verschmelzung" und „Verwe-
204 BRENTANO, a . a . O . , II, S. 113.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
128 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
bung" „des Objekts der inneren Vorstellung mit dieser selbst" und „der
Zugehörigkeit beider zu einem und demselben psychischen Akte" 205 einer
sozusagen „äußeren Unendlichkeit" aufeinandergeschichteter, diskreter
Reflexionsakte. An die Stelle dieser Unendlichkeit tritt aber, und zwar bei
prinzipiell jedem psychischen Phänomen, gewissermaßen eine „innere
Unendlichkeit" von miteinander „verschiedenen" und „verwobenen"
Bewußtseinsmomenten, zwischen denen eine ganz bestimmte Ordnung
derart besteht, daß jedes solches Bewußtseinsmoment das ihm in dieser
Ordnung vorangehende zum intentionalen Objekt bestimmter Stufe hat,
während die Intention, in der das geschieht, das intentionale Objekt
nächsthöherer Stufe des nachfolgenden Bewußtseinsmomentes bildet.
Diese „innere Unendlichkeit" hat P. Hofmann zur Basis seiner Lehre
von der „unendlichen Schichtung des Ich" genommen, nachdem er den in
ihr liegenden r e g r e s s u s unschädlich gemacht hat206. Das letztere gelang
ihm aufgrund der für ihn fundamentalen Unterscheidung der Art und
Weise, wie wir von Gegenständen als Gegenständen wissen, wobei noch
zu bemerken wäre, daß diese zu unterscheidenden Momente prinzipiell
jedem Erlebnis zukommen. Das Wissen um ein aktuelles Erleben gerade
in dessen Vollzug, das „implizite Sich-selber-Wissen" des „expliziten"
Wissens bestimmt Hof mann als ein nicht vergegenständlichendes. Bei
diesem Wissen handelt es sich nicht um ein „Vorfinden", ein „innerliches
Wahrnehmen", „Anschauen", „Gegeben-haben" und dgl. Vielmehr ist
dieses „implizite" Wissen ein „Erleben", „Spüren" und „Inne-werden207.
Das Erlebnis, in dem wir einem Gegenstand zugewandt sind und die
„Sinngebung" der Gegenständlichkeit vollziehen, ist selbst in dem Sinne
bewußt, daß wir um es wissen, aber nicht in der Weise, wie wir von einem
Gegenstand wissen: dieses Erlebnis, in dem wir leben, ist „erlebendes
Erleben", es ist als solches „gespürt", wir „werden seiner inne", „haben
es aber nicht zum Gegenstand". Genauer : es ist „noch nicht" objektiviert.
Sobald sich die Reflexion auf die Gegenständlichkeit richtet, haben wir ein
„objektiviertes" und „erlebtes Erleben" in einem „erlebenden Erleben"
höherer Schicht, für das seinerseits nun all das gilt, was soeben über das
205 „Die Vorstellung des Tones und die Vorstellung von der Vorstellung des Tones bilden
nicht mehr als ein einziges psychisches Phänomen, das wir nur, indem wir es in seiner
Beziehung auf zwei verschiedene Objekte, deren eines ein physisches, und deren anderes
ein psychisches Phänomen ist, betrachten, begrifflich in zwei Vorstellungen zerglie-
derten."
206 P. HOFMANN, Das Verstehen von Sinn und seine Allgemeingültigkeit, Kap. I.
207 Vgl. HOFMANN, a.a.O., S. 16 f.; ferner Metaphysik oder verstehende Sinn-Wissenschaft ?
II, 11.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das implizite Wissen 129
„Spüren", „Innewerden", spezifische „Erleben" der Erlebnisse ausge-
führt wurde208. Mit der Unterscheidung von „Spüren", „Innewerden"
und „Erleben" in spezifischem Sinne hat Hofmann die erwähnten
Probleme Brentanos insofern entscheidend gefördert, als einmal der
r e g r e s s u s in i n f i n i t u m für ihn die M ö g l i c h k e i t eines unendlichen
Fortschreitens bedeutet, während es sich bei Brentano um eine bei jedem
psychischen Phänomen v o r l i e g e n d e , also gewissermaßen gegebene
„innere Unendlichkeit" handelt. Ferner wird Hofmann mit der genann-
ten Unterscheidung dem phänomenologischen Charakter des nicht
intentionalen „impliziten Sich-selber-Wissens" und des vergegenständli-
chenden „expliziten" Bewußtseins von den Sachen (d. h. Gegenständen)
gerecht. Allerdings beschränkt Hofmann diese seine Analyse eben auf das
„implizite Sich-selber-Wissen" des intentionalen Bewußtseins von Ge-
genständen. Diese Beschränkung ist bei ihm nicht zufällig. Eine der
Grundthesen Hofmanns ist nämlich, daß prinzipiell jedes Erlebnis
„implizit" sich selber weiß (seiner inne wird) : „In allem Erleben wird . . .
,etwas' erlebt : genauer etwas Gegenständliches . . . Jedes Erlebnis hat. . .
ein Doppelgesicht, es hat zwei Pole, die in untrennbarer Korrelation
zueinander stehen, einen objektiven (gegenständlichen) und einen subjek-
tiven (erlebenden) Pol." 20 ' Mit dieser These aber versperrt sich Hofmann
die Möglichkeit, die ihrem Sinne nach in keiner Weise intentionalen
Bewußtseinsweisen in Griff zu bekommen.
Vom Phänomen des bewußten Wollens her ist Moritz Geiger210 auf das
„implizite" Wissen geführt worden. Der Fortschritt seiner Ausführungen
gegenüber Brentano beruht auf der ausdrücklichen Darlegung des
Unterschiedes, wie wir einerseits von Gegenständen (Häusern, Farben,
aber auch von Werten, Relationen), andererseits von „psychisch-realen
Vorkommnissen" (Wollungen, Gefühlen, Einstellungen) wissen. Das eine
Mal handelt es sich um ein „ e x p l i z i t e s E r f a s s e n , bei dem Erfassen und
208 Im Rahmen dieser Abhandlung können wir auf die zahlreichen Konsequenzen nicht
eingehen, die sich für Hofmann aus der dargelegten Unterscheidung von „erlebendem
Erleben" und „erlebtem Erleben" ergeben, wie auch nicht auf seine mit auf dieser
Grundlage ruhende Ich-Theorie. Eine Auseinandersetzung mit der letzteren ist auch
darum noclinicht möglich, weil eine umfassende Darstellung der Hofmannschen Lehren
erst in Aussicht steht.
209 HOFMANN, Das Verstehen von Sinn und seine Allgemeingültigkeit, S. 7 f. ; vgl. ferner
Metaphysik . . ., S. 17: „Erleben ist seinem Sinne gemäß . . . einerseits Erleben von
Gegenständlichem, andererseits von sich selbst: das Erleben erlebt sich , a l s '
.Gegenstände' e r l e b e n d . "
210 GEIGER, „Fragment über den Begriff des Unbewußten und die psychische Realität",
Kap. 4 und 5.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
130 Zum Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
Erfaßtes deutlich geschieden sind; ein Bewußtseinsstrahl richtet sich von
einem Ich her auf ein Gegenständliches, auf ein G e g e n ü b e r s t e h e n -
des" 211 . Das andere Mal liegt gerade kein „abgesetztes Erfassen" vor,
sondern vielmehr ein „enges Verbinden von Erleben und Freude, ein
I n n e w e r d e n der Freude im Erleben". Während wir etwas wollen und
im Wollen selbst sind, nicht auf es reflektieren, haben wir ein Wissen um
dieses unser Wollen. In diesem Wissen aber wird das Wollen nicht
vergegenständlicht. Obwohl Geiger mit Brentano von der „engen
Verbindung" zwischen der Freude und dem Erleben der Freude spricht,
lassen seine zitierten Äußerungen den Fortschritt erkennen, den sie
gegenüber der Theorie des doppelten, (d.h. des „primären" und
„sekundären") Objekts bedeuten. Allerdings ist Geiger geneigt, das
Gewonnene wieder preiszugeben und zur Position Brentanos zurückzu-
kehren, indem er sowohl das Bewußtsein von Gegenständlichkeiten wie
auch das dem Erleben immanente Wissen um erlebte psychisch-reale
Vorkommnisse als intentional bezeichnet212. Damit hängt zusammen, daß
er eine „grundlegende Ähnlichkeit zwischen der Reflexion auf das Wollen
und dem im aktuell sich vollziehenden Wollen immanenten Innewerden
des Wollens" darin sieht, daß in beiden Fällen „das Ich doppelt vorhanden
ist": bei der Reflexion „als r e f l e k t i e r e n d e s Ich und als Ich, auf das
man reflektiert als gegenständliches Ich", beim „impliziten" Wissen des
Wollens „als erlebendes Ich und als wollendes Ich, als Ich, das erlebt
und als Ich, das w i l l " . Demgegenüber läßt ihn die gewonnene Einsicht
scharf unterscheiden zwischen der Reflexion und der „Reflexivität" (dem
dem Erleben immanenten Wissen um sich selber), wie er ja auch betont,
daß „das Ich . . . im Erleben nicht b e o b a c h t e t e r Gegenstand seiner
selbst, aber doch sein erlebter Gehalt" ist. Obwohl Geiger damit
scheinbar wieder ganz die Position Brentanos einnimmt, führt ihn das von
ihm Erarbeitete doch dahin, in der „Reflexivität" und nicht, wie er
ausdrücklich bemerkt, in dem „bloßen unreflexiven . . . Bewußtsein vom
Gegenständlichen" das für das Psychische konstitutive Wesensmoment
zu sehen. Damit freilich ist das „implizite" Wissen genau wie bei
Hofmann wieder beschränkt auf das Innewerden und Erleben des
Psychischen (das Geiger gemäß dem von ihm vertretenen „psychologi-
schen Realismus" faßt). Mit dieser Beschränkung ist wieder die Sicht auf
211
Wir können hier auf die Frage der Ichhaftigkeit des intentionalen Bewußtseins von
Gegenständlichem nicht eingehen; vgl. hingegen Gurwitsch, Phänomenologie der
Thematik und des reinen Ich, Kap. II, § 7, Kap. III, § 19 und Kap. IV, besonders § 4.
212
„In beiden Fällen ist ein .Bewußtsein von' bezogen auf etwas, das bewußt ist."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das implizite Wissen 131
Bewußtseinsweisen versperrt, die ihrem Wesen nach nicht-intentional
sind.
Erst Schmalenbach hat in seiner bereits erwähnten Abhandlung Das
Sein des Bewußtseins eine echte Einsicht in den Charakter des „implizi-
ten" Wissens gewonnen. Ausdrücklich grenzt er es ab gegen das explizite
„Wissen von . . ." als intentionales Bewußtsein213 und macht die Beto-
nung oder, wie er sagt, „Uberbetonung" des Intentionalitätsgedankens
für die Schwierigkeiten verantwortlich, das „implizite" Wissen in seinem
reinen Wesen zu fassen, ohne daß man der „fast nicht zu vermeidenden
Tendenz" verfällt, „das implizite Sich-selber Wissen in explizites Wissen
und Gewußtwerden zu verwandeln"214. Über die bereits von Hofmann
und Geiger vollzogene Unterscheidung des „impliziten" Sich-selber
Wissen des Bewußtseins, das für Schmalenbach ähnlich wie für Geiger die
Einheit des Bewußtseinsbegriffes begründet, von dem „expliziten"
Wissen in der Reflexion und „inneren Wahrnehmung" hinaus wird der
nicht vergegenständlichende Charakter des „impliziten" Wissens betont
und damit dieses ausdrücklich als nicht intentional beschrieben. Indem
Schmalenbach ferner das „implizite" Wissen zwar an der Art und Weise
entdeckt, wie etwa das Wollen und das „explizite" Wissen von einem
Gegenständlichen um sich selber weiß, es aber nicht darauf beschränkt,
sieht er die Bedeutung dieser Entdeckung darin, von ihr aus „nicht-inten-
tionale Bewußtseinsarten" in den Griff zu bekommen215. In der Uberwin-
dung dieser Beschränkung, an der noch Geiger, vor allem aber und
ausdrücklich Hofmann festhält, liegt die wichtigste Errungenschaft seiner
Abhandlung. Denn nun erst ist es möglich geworden, dem vollen
Phänomen des „Lebens in . . . " , und nicht nur dem ihm immanenten
Wissen um sich selber gerecht zu werden, wie auch jetzt erst ζ. B. die von
Bergson216 herausgestellte höchst wichtige Unterscheidung der „mémoire
qui revoit" von der „mémoire qui répète" in ihrer Bedeutung für die
Phänomenologie der Erinnerung zur vollen Geltung kommen kann. Die
„mémoire qui revoit" „enregistrerait, sous forme d'images-souvenirs,
tous les événements de notre vie quotidienne à mesure qu'ils se déroulent ;
. . .elle laisserait à chaque fait et à chaque geste, sa place et sa date . . . Par
elle deviendrait possible la reconnaissance intelligente, ou plutôt intelligi-
213 SCHMALENBACH, a.a.O., §§ 4 und 5 .
214 SCHMALENBACH, a.a.O., S. 384 ff. ; vgl. auch in § 9 die Auseinandersetzung mit Brentano
und Husserl.
215 SCHMALENBACH, a . a . O . , S . 3 8 0 f .
216 H. BERGSON, Matière et Mémoire, Paris 1896, S. 86 [Œuvres, S. 227].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
132 Z u m Problem des Begriffs einer natürlichen Umwelt
ble, d'une perception déjà éprouvée ; en elle nous nous réfugierions toutes
les fois que nous remontons, pour y chercher une certaine image, la pente
de notre vie passée." Damit ist genau auf das hingezielt, was Husserl217 als
„schlichte Vergegenwärtigung, die sich in ihrem eigenen Wesen . . .
als M o d i f i k a t i o n eines anderen gibt" beschreibt und analysiert. Im
Gegensatz dazu stellt die „mémoire qui répète" nicht eine „représenta-
tion" dar, sondern vielmehr „une action". Das, was in dieser Weise
erinnert wird, z. B. „la leçon une fois apprise, ne porte aucune marque sur
elle qui trahisse ses origines et la trace dans le passé ; elle fait partie de mon
présent au même titre que mon habitude de marcher ou d'écrire ; elle est
vécue, elle est ,agie', plutôt qu'elle n'est représentée". Hierbei handelt es
sich also nicht um Vergegenwärtigung, sondern um die Ausbildung eines
„mécanisme qu'ébranle tout entier une impulsion initiale, dans un
système clos de mouvements automatiques, qui se succèdent dans le même
ordre et occupent le même temps"218. Bergson sieht die hier vorliegende
Differenz darin, daß das eine Mal „images" vorliegen, während das andere
Mal aufgrund vorausgegangener Übungen und Wiederholungen Bewe-
gungsabläufe und Aktionseinheiten ausgebildet sind, die sich gewohn-
heitsmäßig abspielen ; daher bringt er auch die „mémoire qui revoit" mit
den Träumen in Zusammenhang. Aber diese Differenz ist gar nicht
entscheidend ; auch da, wo zweifellos „Bildhaftes" im Spiele ist, kann die
„mémoire qui répète" vorliegen, so etwa wenn ich „in der Erinnerung"
wieder in einer Situation meiner Kindheit lebe. Andererseits kann ich mir
auch in der „mémoire qui revoit" das Vergegenwärtigte nur symbolisch,
also nur bildhaft vorstellig machen. Die hier vorliegende Differenz ist nur
ein Spezialfall des Unterschieds zwischen dem „Leben in . . ."(z.B. in der
Vergangenheit: in meiner Kindheitssituation, oder in dem aufgrund
vergangener Übungen erworbenen Bewegungsautomatismus) und inten-
tionalem Bewußtsein haben von . . . (z. B. jener Kindheitssituation oder
einer Phase des Einübens jenes Bewegungsablaufs). Dieser Unterschied
ist es, der auch den von Bergson herausgestellten Phänomenen zugrunde
liegt und in seiner prinzipiellen Radikalität begriffen werden muß 2 ". Den
217 HUSSERL, Ideen, § 99 [S. 209; Husserliana III, S. 250].
218
„ . . . elle ne nous représente plus notre passé, elle le joue ; et si elle mérite encore le nom
de mémoire, ce n'est plus parce qu'elle conserve des images anciennes, mais parce qu'elle
en prolonge l'effet utile jusqu'au moment présent." [Bergson, a.a.O., S. 87; Œuvres, S.
228.
219
Vgl. in bezug auf das oben (S. 38 —40) Ausgeführte die von BERGSON, a . a . O . , S.
84ff. [Œuvres, S. 225 ff.] erwähnten Befunde aus der Pathologie, ferner auch S. 79f.
[Œuvres, S. 221—223] das Beispiel aus der Tierpsychologie.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Das implizite Wissen 133
Unterschied von „implizitem" und „explizitem" Wissen hat Schmalen-
bach herausgearbeitet, aber nicht als einen solchen von p r i n z i p i e l l e r
R a d i k a l i t ä t erfaßt. Denn er anerkennt nicht nur verschiedene „Arten
,expliziten' Wissens", das „seinen Gipfel in .gegenständlichem' Wissen
erreiche", sondern zieht auch die Möglichkeit „.expliziten' (hier als
.explizit' bezeichneten) Wissens auch ohne .Gegenständlichkeit'" in
Betracht, mithin auch die Möglichkeit, von bestimmten Arten „explizi-
ten" Wissens durch „ .graduelle' Ubergänge" zum „impliziten Sich-sel-
ber-Wissen" alles Bewußtseins zu gelangen220. Dabei wird die Tendenz
wieder sichtbar, wie etwa bei Hofmann das „implizite" Wissen auf das
„Sich-selber-Wissen" des Bewußtseins (und nur auf dieses) zu beschrän-
ken. Von verschiedenen Arten der Explikation und damit auch der
G e g e n s t ä n d l i c h k e i t zu sprechen, hat einen guten und berechtigten
Sinn, wenn man damit solche Unterschiede zwischen dem Sinn der
Gegenständlichkeit dessen, was „Thema" ist, und der Gegenständlichkeit
der Bestände des in Zonen gegliederten „thematischen Feldes" 221 im Auge
hat. Aber alle diese Arten der Explikation sind Arten intentionalen
Bewußtseins von Gegenständen, zwischen denen graduelle und vielleicht
sogar kontinuierliche Ubergänge stattfinden mögen. Niemals jedoch
führen derartige Ubergänge auf das „implizite", seinem Wesen nach nicht
intentionale „Wissen um", das von allen Explikationen als Weisen
intentionalen B e w u ß t s e i n s prinzipiell und radikal verschieden ist.
Aus diesem Grunde (wie auch wegen der oben222 gemachten Bemerkung)
können wir uns auch nicht der Meinung Heideggers223 anschließen, der die
„Erkenntnisart" sowohl des „Erklärens" wie auch des „Verstehens" „als
existenziales Derivat des primären, das Sein des Da überhaupt mit
konstituierenden Verstehens" interpretiert wissen will und sogar „die
Seinsfrage . . . als die Radikalisierung einer zum Dasein selbst gehörigen
wesenhaften Seinstendenzen, des vorontologischen Seinsverständnisses"
ansieht.
220 SCHMALENBACH, a . a . O . , S . 3 8 3 u n d 4 2 0 .
221 Vgl. hierzu GURWITSCH, Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich, Kap. II, §§
3 ff.
222 Vgl. den Zusatz zu § 13, S. 1 0 4 - 1 0 9 .
223 HEIDEGGER, Sein und Zeit, S. 15 und 143.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:20
ABSCHNITT III
DAS GEBUNDENE ZUSAMMENSEIN
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
§ 17 Die Verweisung auf die Mitwelt
Der Zeug-Umwelt, deren allgemeinste Strukturen wir im vorigen Kapitel
dargelegt haben, gehören wir, sofern wir in ihr leben, in dem Sinne an, daß
ihre Situation uns in bezug auf unser konkretes Sein bestimmt. Sie ist
unsere Umwelt in dem Sinne, auf den es Scheler in seiner Milieutheorie
abgesehen hat. In diesem Milieu begegnen wir auch unseren Mitmen-
schen. Wir treffen sie an, weil wir in bestimmten Situationen der
Zeug-Umwelt leben. Das besagt: in diesen Begegnungen sind wir mit
dem M i t m e n s c h e n in einer Situation z u s a m m e n . Die verschiede-
nen Dimensionen darzustellen, in denen dieses Zusammensein erfolgen
kann, seinen jeweiligen Sinn je nach der betreffenden Dimension
aufzuklären, sowie das ihm entsprechende Wissen um den Mitmenschen
zu beschreiben — das ist das Thema dieses Abschnitts.
Bevor wie an diese Aufgabe herangehen, muß aber noch ein Phänomen
zur Sprache gebracht werden, auf das wir bereits in den Ausführungen zur
traditionellen Theorie gestoßen sind und für dessen Aufklärung uns
nunmehr die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stehen. Es handelt
sich dabei um jene uns ständig begleitende, obschon selten und kaum
ausdrücklich werdende alltägliche „Uberzeugung", daß wir in einer
Menschenwelt leben; ein Phänomen, das — wie wir gezeigt haben —
weder von den Analogieschlußtheoretikern, noch von Lipps, noch auch
von Cassirer1 erkannt wurde. Wie steht es nun um diese unsere
Alltagsmeinung, von der wir oben2 nachgewiesen haben, daß sie deshalb
keine „Uberzeugung" im eigentlichen und prägnanten Sinne ist, weil sie
nicht auf Überlegungen und Gründe angewiesen ist ? Damit unterscheidet
sie sich übrigens auch schon von einer nur unbegründeten Uberzeugung,
d.h. einem bloßen Vorurteil, bei welchem jenes Angewiesensein sehr
wohl besteht, nur daß im konkreten Fall keine motivierenden und
fundamentalen Gründe beigebracht werden können.
Bei der Darlegung der Verweisungen, die in den Situationen der
Zeug-Umwelt enthalten sind, traten uns zwei Typen entgegen3. Wir
1
Über Scheler, vgl. weiter unten, S. 145 — 147.
2
Vgl. oben, S. 17 und 46.
3
Vgl. S. 102 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
138 Das gebundene Zusammensein
haben die Verweisung eines Zeugs auf die Zeugganzheit, zu der das
betreffende Einzelzeug gehört, von der Verweisung auf den Horizont
abgehoben, der die Situation umgibt. Während die Verweisungen des
ersten Typs die Situation, um die es sich gerade handelt, konstituieren und
deren Sinn ausprägen, „bringen" die Verweisungen des zweiten Typs nur
eben Horizonthaftes „mit bei", zeigen es als entdeckbar an und weisen
dem kontinuierlichen Fortschreiten in die Horizonte Richtung und Ziel.
Dabei war, wie noch erwähnt sei, im „Mitbeigebrachten" selbst eine
Scheidung hervorgetreten. — Derartige „mitbeigebrachte" Horizonte
gibt es nun in jeder Situation der Zeug-Umwelt; jedes Stehen in einer
solchen Situation spürt in „impliziter" Weise die Verweisungen auf diese
Horizonte. Keine Situation ist in dem Sinne „autark" und in sich
verselbständigt, daß sie nicht von sich aus auf außerhalb ihr Liegendes
verwiese und gerade in dieser Verweisung auf die „mitbeigebrachten"
Horizonte sich als „innerweltlich", d.h. eben als eine Situation der
U m w e i t bekundete 4 . Es gibt keine Situation, die lediglich in sich steht
und so gewissermaßen außerhalb der Welt ist; der phänomenologische
Charakter der Welthaftigkeit einer Situation liegt gerade in diesen
Verweisungen auf die „mitbeigebrachten" Horizonte, denen sich die
betreffende Situation einordnet, wobei diese Einordnung selbst von den
genannten Verweisungen her ihren Sinn erhält.
Wer in irgendeiner Arbeit begriffen ist, ζ. B. ein Werk herstellt, geht
ganz im aktuellen Hantieren auf, lebt in der Hantierungssituation und hat
in ihr sein konkretes Dasein. In dieser aufgehenden Hingabe ist er aber
nicht von der Welt abgeschnitten, nicht gleichsam der Welt entrückt ; —
vielmehr verweist die Situation selbst auf die Horizonte und auf das in
ihnen Gelegene. So etwa auf das, was später aus dem fertig gestellten
Werke wird, ζ. B. auf den Besteller, für den es hergestellt wird, bzw. auf
die anonyme Menge möglicher Käufer und Verbraucher; in anderer
Richtung wieder auf die Materialien, die bei der Herstellung Verwendung
finden, und damit auf den Lieferanten dieser Materialien; in wieder
anderer Richtung auf den, in dessen Auftrag man arbeitet und der
Anweisungen gegeben hat. In den H o r i z o n t e n , die zu einer
S i t u a t i o n „ m i t b e i g e b r a c h t " s i n d , b e f i n d e t sich also s t ä n d i g so
e t w a s w i e eine M i t w e l t . I n d e m j e d e S i t u a t i o n auf a u ß e r h a l b
i h r e r G e l e g e n e s v e r w e i s t , v e r w e i s t sie d a m i t auch stets auf
„andere Menschen".
4 Vgl. HEIDEGGER, Sein und Zeit, § [S. 72-76].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Verweisung auf die Mitwelt 139
Diese Anderen sind „mitbeigebracht", und zwar in größerer oder
geringerer Bestimmtheit, — ein Unterschied, der für das hier ins Auge
gefaßte Phänomen ohne Bedeutung ist. In der Tat macht es für den
phänomenologischen Charakter der in Rede stehenden Verweisung nichts
aus, ob der bestimmte Ν . N . als Besteller oder die unbestimmte und daher
anonyme Menge möglicher Käufer „mitbeigebracht" ist. Dagegen
bedeutet es einen Unterschied für das Verweisungsphänomen selbst, ob
die „mitbeigebrachten" Anderen „in der Nähe" d. h. in gewissem Sinne
„mitanwesend" sind, oder ob diese Anderen in den Horizonten sichtbar
werden, sich aber „in der Ferne" halten, wobei im Tun und Hantieren
zwar auf sie verwiesen, dieses aber nicht auf sie hin angelegt ist. Dieser
Unterschied von Nähe und Ferne liegt in einer anderen Ebene als der der
Bestimmtheit und Unbestimmtheit der „Mitbeigebrachten". Auch ein
bestimmter Besteller kann sich „in der Ferne" halten. Hat jemand einem
Uhrmacher, den er kennt, seine Uhr zur Reparatur gegeben, so kann
jener, während er an der Uhr arbeitet, sich auf diesen ihm gut bekannten
Kunden verwiesen finden, dieser aber lenkt die Arbeit des Uhrmachers
nicht und ist daher bei der Reparatur auch nicht „mitanwesend". Bereite
ich mich andererseits auf einen Vortrag vor, den ich in einer fremden Stadt
vor lauter mir unbekannten Menschen zu halten habe, so ist es die
anonyme und unbestimmte Zuhörerschaft, auf die ich während meiner
Vorbereitung mich verwiesen finde ; zwar kenne ich mein Publikum auch
als solches nicht, indem es aber dafür, wie ich meinen Vortrag anlege, von
Bedeutung ist, ob ich vor „gebildeten Laien" oder vor einem wissen-
schaftlichen Gremium usw. sprechen soll, ist die anonyme Zuhörerschaft
bei meiner Vorbereitung, die ich allein in meinem Studierzimmer
vornehme, insofern „mitanwesend", als ich ihr dadurch Rechnung trage,
daß ich meinen Vortrag auf sie hin anlege.
Die Bedeutungslosigkeit des Unterschiedes, ob die „mitbeigebrach-
ten" Anderen als die und die oder als anonyme auftreten, hängt damit
zusammen, wie und als was diese Anderen „mitbeigebracht" werden.
Sie tauchen nicht „plötzlich", „zufällig", „wie von ungefähr" auf. Es ist
nicht so, daß sich beispielsweise während der Verrichtung einer Tätigkeit
unerwartet so etwas wie eine Mitwelt meldet. Bei diesem Sichmelden der
Umwelt verweist die Situation selbst, in der wir gerade stehen, auf die
„mitbeigebrachte" Umwelt; deren „Erscheinen" ist durch die Situation
selbst motiviert. Was also in diesen Horizonten „mitbeigebracht" wird,
sind anderweitige Situationen, in denen es mit dem j e t z t in Herstellung
befindlichen Werk und überhaupt mit dem, was in der jetzt aktuellen
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
140 Das gebundene Zusammensein
Situation uns in Anspruch nimmt, etwas auf sich hat : darin bekundet sich
die Möglichkeit k o n t i n u i e r l i c h e n Fortschreitens von der aktuellen
Situation zu anderen horizonthaft „mitbeigebrachten". In diesen hori-
zonthaften Situationen erscheinen auch die „mitbeigebrachten" Anderen.
Daß sie in diesen Situationen zum Vorschein kommen und nicht
„nebenher", „außerdem noch" usw., bedeutet: sie erscheinen als
Situationszugehörige in ihrer spezifischen Rolle und Funktion. Die
Verweisung auf die Mitwelt bringt also nicht die Anderen lediglich als
Menschen zum Vorschein, und auch nicht als Individuen mit den ihnen
zukommenden konstanten Bestimmungen. Vielmehr kommen sie gerade
als die zum Vorschein, als welche sie in der „mitbeigebrachten" Situation
konkret existieren. Nicht irgend ein „Menschending" taucht unvermutet
und sporadisch im „mitbeigebrachten" Horizont auf, sondern es werden
Situationen im Horizonte sichtbar, in denen Besteller, anonyme Käufer,
Lieferanten, Arbeitgeber, Zuhörer, Leser, Vorgesetzte, Untergebene usw.
agieren. Als die Träger dieser R o l l e n in den „ m i t b e i g e b r a c h t e n "
Situationen (und nur in diesen ihren R o l l e n ) k o m m e n die
A n g e h ö r i g e n der Mitwelt in den genannten Verweisungen z u m
Vorschein 5 . Aus diesem Grunde ist es für das betreffende Verweisungs-
phänomen gleichgültig, ob die „mitbeigebrachten" Anderen bestimmte
oder unbestimmte „Individuen" sind. Genau so, wie die anonymen
Zuhörer nicht als Wesen von der „ F o r m " menschliches Individuum mit
unbestimmten (d. h. noch zu bestimmendem) Leergehalt zum Vorschein
kommen, wobei die Erfüllung der Leerstellen ihrem Sinne nach an die
vorgezeichnete „ F o r m " gebunden wäre, begegnet in dieser Verweisung
auch der „persönlich bekannte" Ν . N . nicht als Individuum von dieser
bestimmten, spezifisch ihm eigenen Konstitution, sondern als Besteller,
als Kunde, allgemein gesprochen: in seiner jeweiligen R o l l e .
Die hier in Betracht gezogene Verweisung auf die Mitwelt grenzten wir
gegen das störende Dazwischenkommen der Anderen oben bereits ab. Es
sei noch bemerkt, daß das Sichmelden der Mitwelt in den „mitbeigebrach-
ten" Horizonten ebenfalls von deren Gegenwart in der Öffentlichkeit
abzuschneiden ist (z.B. auf der Straße, in der Eisenbahn, in der
„öffentlichen" Bibliothek, im Theater — kurz: überall da, wo p r i n z i -
piell jeder unter Erfüllung gewisser, jedoch u n p e r s ö n l i c h e r Bedin-
gungen Zutritt hat). Das Sich-bewegen in der Öffentlichkeit ist eine ganz
5 Die Begegnung mit dem Mitmenschen in einer Rolle wird weiter unten, S. 153 — 159
expliziert werden.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Verweisung auf die Mitwelt 141
bestimmte Art und Weise mitmenschlicher Begegnung; es ist ein Sein
u n t e r den Anderen. Aber auf diese ganz spezielle Begegnung ist nicht
ständig und nicht einmal vorzugsweise verwiesen, wo sich uns von
aktuellen Umweltsituationen her die Mitwelt bemerkbar macht, auch und
vielleicht gerade dann, wenn wir allein sind. Unsere Alltagsmeinung von
der Mitwelt, inmitten derer wir leben, besagt ihrem Sinne nach nicht ein
ständiges Verwiesensein gerade auf die Öffentlichkeit, wie auch bei dem
hier gemeinten Verweisungsphänomen die in der Öffentlichkeit begeg-
nende Mitwelt am allerwenigsten und, wenn überhaupt, dann erst in
allerletzter Linie „mitbeigebracht" ist.
Diese Abgrenzung gegenüber anderen Phänomenen hat die Aufgabe,
das „Mitbeigebrachtsein" der Anderen in seiner Welthaftigkeit in klares
Licht zu setzen6. Diese Anderen werden nicht zu den gerade aktuellen
Situationen, den darin fungierenden Zeugganzheiten oder etwa zu
einzelnen Zeugstücken bloß „hinzugedacht" ; — sie tauchen ferner nicht
beliebig „neben" beliebigen Situationen und zu diesen hinzukommend
auf. Vielmehr kommt die Mitwelt in den „ m i t b e i g e b r a c h t e n "
H o r i z o n t e n zum Vorschein, die als solche den Charakter der Welthaf-
tigkeit der Situation konstituieren. Das bedeutet : die Mitwelt kommt in
der Welt und von den Weltzusammenhängen her zum Vorschein, auf
welche die aktuellen Situationen verweisen, und in welche sie sich in
dieser Verweisung als in ihre Welt und ihre Weltzusammenhänge
einordnen. In dieser Welt, in den Horizonten, welche die Welthaftigkeit
der Situation ausmachen, kommen die „mitbeigebrachten" Anderen zur
Geltung : „sie begegnen aus der Welt her, in der das besorgend-umsichti-
ge Dasein sich wesenhaft aufhält." Weil nun aber die Analyse des
zuhandenen Zeugs der Entfaltung der Strukturen der vergesellschafteten
Existenz voraufliegt, die sich aus den Dimensionen der mitmenschlichen
Begegnungen bestimmen und in der jeweiligen Eigenart derselben
gründen, lediglich methodische Gründe hat und nicht durch die
Rangordnung der Phänomene selbst motiviert ist, kann beim Ausgang
von den weiter unten zu explizierenden mitmenschlichen Begegnungen
das in diesen Begegnungen „mitbeigebrachte" zuhandene Zeug in seiner
Welthaftigkeit aufgeklärt werden, wie wir umgekehrt bei unserem
Vorgehen die „mitbeigebrachte" Mitwelt in ihrer Welthaftigkeit erfaßt
haben. Daher begegnen die „Dinge" aus der Welt her, in der sie für die
Anderen zuhanden sind, welche Welt im vorhinein auch schon immer die
6 Vgl. hierzu HEIDEGGER, a.a.O., S. 117 ff. ; vgl. ferner auch unsere Ausführungen auf S.
102 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
142 Das gebundene Zusammensein
meine ist. Genau wie die „Sachen" und Mitmenschen hat dies alles den
Charakter der Welthaftigkeit. Hierin liegt auch der Grund daiir, daß —
wie später7 noch zur Sprache kommen wird — die fundamentalen
Strukturen des Miteinanderseins auch für das „Seinsverhältnis" zu den
„Sachen" eine Bedeutung haben.
Die hier dargelegte Verweisung auf die „ m i t b e i g e b r a c h t e "
Mitwelt ist nun nichts anderes als jene uns ständig begleitende
Alltagsmeinung von der Mitwelt, inmitten derer wir leben. Weil
jede Situation, in der wir stehen, als solche auf die sie
umgebenden H o r i z o n t e verweist, und weil in diesen H o r i z o n -
ten ständig andere Menschen als Träger gewisser Rollen „ m i t b e i -
g e b r a c h t " sind, ist dieses „ W i s s e n " um die Mitwelt als
Menschenwelt eine uns ständig begleitende „ U b e r z e u g u n g " .
Weil ferner in den Situationen selbst die Mitwelt „mitbeige-
b r a c h t " ist, hat unser ständiges alltägliches „ W i s s e n " um sie
den oben' dargelegten Charakter des „ i m p l i z i t e n " , und zu-
meist gar nicht ausdrücklich werdenden Wissens, das als solches
überhaupt dem „Leben in . . . " innewohnt.
Bei diesem Wissen liegt kein intentionales „Bewußtsein von . . . " vor,
sondern bloß ein Innewerden der Mitwelt, das die gleichen phänomenolo-
gischen Eigenschaften aufweist wie das Wissen um die aktuelle Situation
und das in ihren Horizonten „Mitbeigebrachte". Daher hat das uns
ebenfalls ständig begleitende „Wissen" um eine Welt, in der wir leben,
genau die gleiche phänomenologische Eigentümlichkeiten wie unsere
Alltagsmeinung, inmitten einer Menschenwelt zu sein. Weil die
Mitwelt in welthaften Situationen „ m i t b e i g e b r a c h t " wird und
umgekehrt jedes mitmenschliche Zusammensein auf Bestände
und Situationen der Umwelt (im Sinne der Sachenwelt) verweist,
„ w i s s e n " wir uns ständig in einer Umwelt und inmitten einer
Mitwelt. Diese beiden Meinungen sind jeweils abstrakte M o -
mente an dem, was man unser allgemeines „ W e l t b e w u ß t s e i n "
nennen kann, wobei dann „Welt" in einem umfassenden, die Umwelt wie
die Mitwelt begreifenden Sinne verstanden werden muß'. Die aufgewiese-
7 Siehe § 28.
« Vgl. § 16.
' Diese Phänomene und Zusammenhänge hat auch LOWITH, Das Individuum in der Rolle
des Mitmenschen, § 5, im Auge, wo er von dem „Vorschein der Mitwelt in der Umwelt"
handelt. Aber er arbeitet dieses Zum-Vorschein-kommen in seiner phänomenologischen
Eigentümlichkeit nicht hinreichend scharf heraus, denn er versäumt, durch Analyse der
Phänomene selbst die notwendigen Scheidungen vorzunehmen und die jeweiligen
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Verweisung auf die Mitwelt 143
nen Phänomene und Phänomenbeziehungen machen sich in bestimmter
Weise auch in den Befunden des intentionalen Bewußtseins, also nach
vollzogener Thematisierung geltend, weil einerseits jedes Ding seinen
Phänomene in bezug auf das, was ihnen spezifisch eignet, zu fixieren. Vor allem kommt
das horizonthaft „Mitbeigebrachte" in seiner charakteristischen Eigenart nicht zur
Geltung, weil Löwith so wenig wie Heidegger die oben (S. 102 f. ) dargelegten Scheidungen
zwischen den verschiedenen Verweisungsphänomenen durchgeführt hat. Daher legt
Löwith nicht am Phänomen selbst die Art und Weise dar, wie und in welchem Sinne
„dem Möbel als Werk . . . die es herstellenden Werkleute zugehören". Wenn ferner
„diese Art zum Vorschein zu kommen nur beiläufig a m Zeug zur Geltung kommt, ohne
daß dieses selbst daran beteiligt ist", während „sich die Einrichtung eines Zimmers . . .
von vornherein als eine menschliche Einrichtung, als eines bestimmten Menschen
Umgebung präsentiert", so liegt hier der ebenfalls von ihm in seiner Eigenart nicht
herausgestellte Unterschied des „In-der-Nähe-mitanwesend-sein" gegenüber dem
„Sich-in-der-Ferne-halten-vor", — ein Unterschied, der — wie wir sahen — das
„Mitbeigebrachte" selbst betrifft. Es kommt bei Löwith auch nicht zu ausdrücklicher
Klarheit, was die Wendung von dem im Gebrauch befindlichen Zeug auf den zunächst
nur „in der Ferne" „mitbeigebrachten" Hersteller eigentlich phänomenal besagt: ein
„In-die-Nähe-rücken" und „Mitanwesend-werden" eben des Herstellers und das
Hineingehen des mit dem Zeug Hantierenden in die „mitbeigebrachten" Horizonte. —
Die ganzen Darlegungen Löwiths stehen im Dienste seiner „anthropologischen"
Tendenz, die Umwelt als wesentlich „human" zu begreifen, „in der Bedeutung von
menschlicher Umgebung", die eigens auf den Menschen, seine Bedürfnisse und Zwecke
hin angelegt ist und nur vom Menschen her verständlich werden kann (vgl. z. B. S. 4 : „die
Menschen . . . gehören . . . so sehr zur Welt, daß sie deren Charakter wesentlich
bestimmen" ; S. 39 über die „universale Bestimmtheit alles .innerweltlich' Seienden . . .
durch den in der Welt seienden Menschen . . . " ) . Das „Zum-Vorschein-kommen" des
Benutzers, Herstellers usw. an einem fertigen Zeug begründet aber keine Vorzugsstel-
lung des Menschen in der Welt : am Möbel kommt der Benutzer in genau der gleichen
Weise zum Vorschein wie das Getreide am Speicher, das Vieh am Stall, der Vogel am Nest
usw. Dieser These Löwiths widerspricht auch die im Text dargelegte „Verflochtenheit"
von Mit- und Umwelt. Es ist hier nicht der Ort für eine radikale Auseinandersetzung mit
dem Anthropologismus, der von Heidegger her in die Philosophie der Gegenwart
zunehmend Eingang findet; nur auf die Vergewaltigung der Phänomene, im Gefolge
dieser Tendenz sei noch aufmerksam gemacht, wenn es heißt, ein Stuhl könne eine Wand
nicht berühren, weil „Voraussetzung dafür wäre, daß die Wand ,für' den Stuhl
b e g e g n e n könnte" („Seiendes kann ein innerhalb der Welt vorhandenes Seiendes nur
berühren, wenn es von Hause aus die Seinsart des In-Seins h a t . . . " ; HEIDEGGER, a.a.O.,
S. 55) oder „zwei Punkte sind so wenig voneinander entfernt wie überhaupt zwei Dinge,
weil keines dieser Seienden seiner Seinsart nach entfernen kann. Sie haben lediglich einen
im Entfernen vorfindlichen und ausmeßbaren Abstand" — ( „ N u r sofern überhaupt
Seiendes in seiner Entferntheit für das Dasein entdeckt ist, werden am innerweltlichen
Seienden selbst in Bezug auf anderes .Entfernungen' und Abstände zugänglich" ; „ . . .
nur weil Dasein in der Weise von Ent-fernung und Ausrichtung räumlich ist, kann das
umweltlich Zuhandene in seiner Räumlichkeit begegnen"; HEIDEGGER, a.a.O., S.
105 —106 bzw. S. 110) — dann werden die Phänomene ihrer spezifischen Eigentümlich-
keiten und ihrer charakteristischen Qualitäten beraubt. So erscheinen diese Qualitäten
als den Phänomenen selbst nicht eignende, sondern als ihnen gewissermaßen vom Leben
des Menschen zukommende, von ihm eingerichtete, jedenfalls in ihm, d. h. in den
Tendenzen, Interessen seines Lebens begründete ; vgl. dazu noch LOWITH, a.a.O., §§ 12 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
144 Das gebundene Zusammensein
„Hof von Hintergrundsanschauungen" hat, aus dem es „herausgefaßt"
wird10, andererseits die Mitmenschen inmitten der Dingwelt auftreten und
deshalb keine Welt für sich bilden 11 . Die Wurzel der Gegenstandswelt
liegt in der Lebenswelt, aus der sie sich durch Thematisierung ergibt. Auf
die Probleme der Thematisierung sowie der Modifikationen, die durch
jene entstehen, können wir hier nicht eingehen, wie auch nicht auf die
„Entweltlichung" in ihren Stufenfolgen und Stadien, d.h. auf einen
Prozeß, den Heidegger mit Recht akzentuiert, und mit dem eine Reihe
von Problemen auch der Wissenschaftstheorie zusammenhängen.
Die vorstehenden Ausführungen klären den Sinn unseres alltäglichen
„Wissens" um die Mitwelt als Menschenwelt auch insofern auf, als sie den
Unterschied dieses „Wissens" gegenüber allem empirisch-induktiv be-
gründeten hervortreten lassen, ebenso aber auch seine phänomenologi-
sche Verflechtung mit unserem „Wissen" um die Lebenswelt. Nur in
jenem Sinne, der sich aus diesen Darlegungen ergibt, können wir so etwas
wie eine „ursprüngliche Du-Gewißheit" gelten lassen, wobei das „ D u "
hier aber nicht die fremde Persönlichkeit eines fremden, anderen Ich
bezeichnet, nicht ein Individuum in der ganzen Fülle persönlichen
Eigenlebens, nicht eine „strukturierte Lebenseinheit" im Sinne Diltheys,
sondern vielmehr den Mitmenschen so, aber auch nur so, wieerinden
genannten Verweisungszusammenhängen horizonthaft „mitbeigebracht"
ist. Die „Gewißheit vom Du ü b e r h a u p t , vom fremden Ich im
a l l g e m e i n e n " sieht Volkelt12 als mit dem „Ich-Gefühl", der „Ich-Ge-
wißheit" gleichursprünglich mitgegeben an, „Hand in Hand mit dem
Selbstgefühl" entstehend und „ e i n e n Wesenszusammenhang" mit ihm
bildend. Weil die „Gewißheit vom Du überhaupt" gewissermaßen ein
notwendiges Korrelat zur „Ich-Gewißheit" darstellt, ist sie ursprünglich
auch im Sinne der Unmittelbarkeit; es handelt sich bei ihr um eine
„intuitive Gewißheit" als die eines unmittelbaren Erfassens von erfahrba-
rem Seienden. Diese Theorie Volkelts beruht jedoch auf der traditionellen
Voraussetzung eines der Welt gegenüberstehenden Ichs, das insofern
„einsam" ist, als es „zunächst" in den Umkreis seiner Bewußtseinserleb-
nisse gebannt ist. Für dieses Ich entsteht dann das Problem, wie es über die
Kluft, die es von der Welt trennt, zur Welt gelangt. Als Sprungbrett über
10 Vgl. H U S S E R L , Ideen, S. 62 [Husserliana III, S. 76 - 78] ; siehe auch S. 84 [Husserliana III,
S. 105] über die „kontinuierlich-einstimmig motivierten Wahrnehmungsreihen". Vgl.
ferner oben, S. 65 ff.
11 Vgl. S. 7 3 - 7 4 .
12 Vgl. V O L K E L T , Das ästhetische Bewußtsein, Abschn. I V , I I .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Verweisung auf die Mitwelt 145
den ursprünglichen Abgrund zwischen Ich und Welt sieht Volkelt die
„intuitive Gewißheit" an. Insofern auch das Du ein „ewiges Jenseits" ist,
„in das ich, immerdar auf dem subjektiven Pole verharrend, mich nur
einzufühlen" vermag 13 , entsteht die „Gefahr des Solipsismus", die nur
durch den Sprung über den Abgrund vermittels der „intuitiven Gewiß-
heit" umgangen werden kann. Dies umso mehr, als bereits Volkelt in
seiner Kritik an der Analogieschlußtheorie zu dem gleichen Ergebnis
kommt, das wir in Abschnitt I herausgearbeitet haben : daß nämlich alle
diese Theorien, die er allerdings im Hinblick auf das psychologische
Problem betrachtet, die Du-Gewißheit entweder bereits voraussetzen
oder gar nicht erreichen, wenngleich er den Analogieschluß zu einer
„kritischen Rechtfertigung" der Du-Gewißheit für erforderlich hält. —
Unter völlig anderen Gesichtspunkten hat Scheler14 das Problem des
„ W e s e n s w i s s e n s um Gemeinschaft und um D u - E x i s t e n z ü b e r -
h a u p t " und dessen „objektiv und subjektiv apriorischen Evidenz" sogar
auf einen „Robinson" anzuwenden und eine „Anschauungsgrundlage"
für dieses Wissen bereitzustellen versucht. Indem dieser „Robinson"
gewisse emotionale „Geistes- und Gemütsakte vollzieht (ζ. B. echte Akte
der Fremdliebe), die nur mit möglichen sozialen Gegenakten z u s a m m e n
eine objekte Sinneinheit bilden können", geht ihm „an deren positiv
erlebtem ,Leergang'", d.h. am Auftreten von „Leerbewußtsein",
„Nichtdaseinsbewußtsein", „Mangelsbewußtsein" und „Nichterfül-
lungsbewußtsein" „die höchst positive Anschauung und Idee von etwas
auf, was als Sphäre des D u da ist und wovon er nur kein Exemplar
kennt". Die Geistes- und Gemütsakte, die Scheler hier im Auge hat,
bringen in der Tat ein Du zum Vorschein, insofern sie ihrem Wesen nach
korrespondierende „Gegenakte" und bestimmte Erfüllungen erfordern.
Wer einsam lebt und sich in dieser seiner Einsamkeit nach Menschen
sehnt, erfährt gerade in der Unerfülltheit seiner Sehnsucht die Anderen,
die da sind, ihm aber fehlen. Der Sinn dieser Befindlichkeit liegt gerade in
13 Vgl. die für Volkeits eigene Position überaus aufschlußreiche Kritik an Scheler, a.a.O.,
Abschn. IV, V: „Wenn Schelers Lehre der Kritik standhielte, so wäre . . . die
Scheidewand zwischen Ich und Du . . . gefallen . . . Ich und Du stünden einander nicht
wie zwei einsame, spröde Punkte gegenüber." Durch die beiläufige „psychologisch"
gemeinte Bemerkung, daß für das kindliche Ich „eine absolute Ich-Einsamkeit
überhaupt nicht existiert", wird die traditionelle Position nicht aufgegeben, denn es ist
die Frage, in welchem Sinne eine solche Ich-Einsamkeit nicht existiert. Es muß
aufgewiesen werden, bei welchem Seienden das Kind immer schon ist und in welcher
Weise es jeweils bei ihm ist.
" V g l . Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, C II [S. 269 - 273; G. W. 7, S.
228-232].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
146 Das gebundene Zusammensein
der Verweisung auf Andere. Die von Scheler gemeinten Akte bringen
wesenhaft eine Mitwelt zum Vorschein, weil sie ohne diesen so
„angezeigten" Anderen nicht die Akte wären, die sie faktisch sind. Wir
haben es hier mit einem speziellen Fall des von uns betrachteten
Zum-Vorschein-kommens der Mitwelt überhaupt zu tun, — mit einem
Phänomen, das sich den anderen von uns herausgestellten einordnet. Aber
eben nur ein spezielles, wenngleich sehr wichtiges und in anderer Hinsicht
sogar in gewisser Weise ausgezeichnetes Phänomen liegt hier vor, nicht
jedoch das Standard-Phänomen für die apriorische Evidenz des „Wesens-
wissens um Gemeinschaft überhaupt", wofür es Scheler hält. Er meint
nämlich, daß die betreffenden Akte die Sphäre der Gemeinschaft als eine
eidetische Sphäre zugänglich machen genau so, wie etwa die ideierende
Abstraktion einer konkreten Rotnuance die Spezies Rot zur Gegebenheit
bringt und sogar das eidetische Reich der Farben erschließt. Abgesehen
davon, daß auch die Wesenssphäre der Gemeinschaft überhaupt durch die
ideierende Abstraktion von einer konkreten Gemeinschaft zugänglich
wird, und daß es ferner noch fraglich ist, ob es ein Erfassen von
Eidetischem ohne konkrete singuläre Unterlagen gibt, betrifft unser
apriorisches Wissen um die Mitwelt gar nicht die eidetische Sphäre der
Gemeinschaft überhaupt. Vielmehr hat es den Sinn eines ständigen,
wenngleich meist unausdrücklichen Verweises auf die Mitwelt. Zwar wird
in den genannten Akten eine Dimension der Mitwelt in besonderer Weise
sichtbar — darin liegt die oben erwähnte Auszeichnung dieser Phänome-
ne — ; aber diese Auszeichnung bedeutet, daß in den genannten
Phänomenen ein „Wissen" im Sinne gesteigerter Prägnanz lediglich
radikalisiert wird. Anders gesagt: diese ausgezeichneten Phänomene
weisen auf jene durchschnittliche Alltagsmeinung zurück, und eben
darum sind sie keine Standard-Phänomene im Sinne Schelers. Nur auf der
Basis jenes Alltagswissens um eine umgebende Mitwelt sind Akte wie die
der Fremdliebe, der Sehnsucht nach Freunden usw. möglich; sie sind
sinnvoll nur für einen Menschen, der sich je schon ständig, wenn auch nur
„implizit", inmitten einer menschlichen Umgebung „weiß", der jeden-
falls „weiß", daß er nicht das einzige menschliche Wesen ist. Wie sollte ein
Mensch, dessen Welt ihn in keiner Weise auf Mitmenschen verweist, dazu
kommen, Akte zu vollziehen, die ihm durch seine Lebensverhältnisse
nicht nahegelegt werden ? Diese Akte brechen doch nicht „spontan" aus
dem Subjekt hervor, das als menschliches Subjekt über gewisse mögliche
emotionale Akte verfügt und nun „frei" derartige Möglichkeiten aktuali-
siert. Vielmehr ist der Vollzug solcher Akte jeweils von unseren faktischen
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Verweisung auf die Mitwelt 147
Lebensverhältnissen her motiviert. Ein „Robinson" hätte nicht nur keine
reale Möglichkeit der Aktualisierung dieser Akte, sie wären für ihn als
solche unmöglich in dem Sinne, daß sie unter den Umständen seines
Daseins sinnlos wären : sie hätten gewissermaßen keinen „ O r t " in seinem
Dasein. Daher bedeutet die von uns zugestandene Apriorität des Wissens
um eine menschliche Mitwelt ein Begegnen des jeweilig Zuhandenen aus
Horizonten, in denen immer schon so etwas wie Mitwelt „mitbeige-
bracht" ist; nicht aber ist damit gemeint, daß jedes menschliche Subjekt,
also auch ein wesenhaft einsames und „robinsonhaftes", im Vollzug
gewisser Akte, deren Aktualisierung in seiner Freiheit liegt, auf eine
eidetische Sphäre „Gemeinschaft" überhaupt stößt15. Nur mit dieser
Modifikation können wir das von Scheler beschriebene Phänomen in den
Gesamtbereich der ständigen phänomenalen Verweisungen auf die
Mitwelt aufnehmen.
Daß die Mitwelt in den Horizonten „mitbeigebracht" wird, die zu der
jeweils aktuellen Situation gehören, bedeutet — wie wir gesehen haben —
die Möglichkeit eines kontinuierlichen Fortschritts in diese Horizonte
hinein. Folgen wir den vorliegenden Verweisungen, gehen wir „wirklich"
(d. h. nicht nur „in Gedanken") in diese Horizonte und zu dem in ihnen
„Mitbeigebrachten" hinein, so kommen wir nicht nur zu den aktuellen
Situationen, in denen der vordem nur „mitbeigebrachte" Mitmensch am
Werke ist, wir gelangen auch zu Situationen unseres aktuellen Zusammen-
seins mit den Mitmenschen. Dem Sinn dieses Zusammenseins je nach den
Dimensionen, in denen es stattfindet, wenden wir uns nunmehr zu. Die
Herausarbeitung dieser Dimensionen gibt insofern die Möglichkeit einer
nachträglichen Ergänzung des über die ständige Verweisung auf die
Mitwelt Vorgetragenen, als diese sich entsprechend den herauszustellen-
den Dimensionen artikuliert. Auf diese Artikulation deutet das bespro-
chene und von Scheler herausgestellte Phänomen darum hin, weil es
gerade in ihr sich als ein besonderes und in gewissem Sinne sogar
ausgezeichnetes Verweisungsphänomen darstellt. Diese Ergänzung wer-
den wir aber nicht explizit durchführen, da sie das Verweisungsphäno-
men, insofern es in unserem Zusammenhang thematisiert wird, jedenfalls
nicht wesentlich tangiert.
15 Vgl. das Analoge zur Apriorität des Raumes bei HEIDEGGER, a.a.O., S. 111.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
KAPITEL I: DIE PARTNERSCHAFT
§ 18 Das Zusammensein in einer gemeinsamen Situation
Als erste Dimension aktuellen mitmenschlichen Zusammenseins betrach-
ten wir das Zusammensein von Partnern in einer ihnen gemeinsamen
Situation. Was das heißt, klären wir am besten anhand eines möglichst
einfachen Beispiels menschlicher Zusammenarbeit.
Bei einer Straßenpflasterung etwa setzt der eine Arbeiter den Pflaster-
stein ein, der andere klopft ihn fest. Jeder der beiden — wir beschränken
uns der Einfachheit unserer Analyse halber auf das Zusammensein
z w e i e r Menschen — steht in einer Situation, die seine Arbeitssituation
ist, und orientiert sich an den Verweisungen, die in ihr liegen. Weil aber
beide Arbeiter an ein und demselben Werk beschäftigt sind, stehen sie in
einer ihnen gemeinsamen Situation. Streng genommen jedoch ist die
Situation des einen nicht genau die des anderen : der eine stellt durch seine
Arbeit dem Anderen die Grundlage einer eigenen Tätigkeit bereit. Was
beiden gemeinsam ist, ist für den einen ein End-, für den Anderen jedoch
ein Anfangsstadium. So arbeiten sie sich wechselseitig in die Hände ; jeder
ist in seinem Umgang auf den Anderen und dessen Arbeit bezogen.
D i e s e r B e z u g macht den Sinn der M i t a r b e i t e r s c h a f t aus. Gerade
weil man sich ganz der Arbeit hingibt und in ihr aufgeht, begegnet der
Andere als Mitarbeiter, und zwar gemäß der Funktion, die er in der
konkreten gemeinsamen Arbeitssituation besitzt. Man trifft nicht von
ungefähr einen „fremden Menschen" an, der — wörtlich oder bildlich —
neben der Arbeit steht und im Sinne der Arbeitssituation selbst
überflüssig ist. Vielmehr bedeutet das Angewiesensein, daß man der
Situation nicht gerecht werden und seine eigenen Funktionen in ihr nicht
erfüllen kann, wenn der Andere in irgend einer Weise versagt. Man ist also
vom Mitarbeiter in dem Sinne abhängig, daß das eigene Situationsverhal-
ten sich an ihm und dessen Verhalten orientiert. Das aber heißt: der
Andere gehört mit in die Situation, in der ich stehe ; seine Anwesenheit in
ihr trägt mit dazu bei, die Situation zu konstituieren und sie zu der zu
machen, die sie i n c o n c r e t o ist. Erforderlich ist, daß ein Irgendjemand"
16 Uber den Sinn dieses „Irgendjemand", vgl. § 19.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das Zusammensein in einer gemeinsamen Situation 149
anwesend ist und bestimmte Funktionen in ihr übernimmt, — nämlich
die, die jetzt mein Mitarbeiter erfüllt. So ist mein Mitarbeiter ein
integrierendes und sinnvolles Situationsmoment.
Was anhand unseres Beispiels herausgestellt wurde (bei dem das
Einander-in-die-Hände-arbeiten wörtlich zu verstehen war), gilt auch
dort, wo man nur in einem übertragenen Sinne davon sprechen kann. So
etwa in einer Besprechung, wo es darum geht, sich über das gemeinsame
Verhalten und Vorgehen zu verständigen und darüber zu beraten. Oder
anders gesagt: wer auf die Anderen keine Rücksicht nimmt und ohne
Bezug auf das von anderer Seite Vorgebrachte seine Meinung äußert, der
steht außerhalb der gemeinsamen Beratung und spricht von außen her in
sie hinein, wenn er auch mitten unter den Anderen sitzt 17 ; ebenso ist der,
der nur passiv dabei sitzt und sich an der Beratung nicht beteiligt,
eigentlich gar nicht anwesend, sein Fehlen würde den Verlauf der
Besprechung nicht berühren. Ebenfalls hat das Zusammensein die
beschriebene Struktur, wo man nicht miteinander arbeitet, sondern
gegeneinander agiert, wie z . B . beim Schachspiel, wo jeder der Spieler
seine Züge an denen des Gegners orientiert, aus diesen die gegnerischen
Pläne und Kombinationen zu erraten sucht und sein eigenes Spiel darauf
abstellt, diese Pläne zu durchkreuzen, d. h. dem Gegner zuvorzukom-
men. Diese Art des Verhaltens, nämlich im Vorblick auf das, was von
Seiten des Partners zu erwarten steht, die eigenen Maßnahmen zu treffen
und dem Partner „vorentsprechend" zuvorzukommen, hat Löwith18 als
durchgehendes Strukturmoment allen Miteinanderseins und Miteinan-
dersprechens herausgearbeitet. Aber nur in dieser jetzt betrachteten
Dimension mitmenschlichen Zusammenseins der Partner hat diese
Struktur des Verhaltens ihre Stelle, sie ist in dem begründet, was das
Wesentliche der Begegnungen in dieser Dimension ausmacht; so fehlt sie
in den Begegnungen der anderen, später zu analysierenden Dimensionen.
Ist das „vorentsprechende" Zuvorkommen auf das als Partnerschaft
gekennzeichnete Zusammensein zu restringieren, so tritt selbst innerhalb
dieser Dimension die von Löwith herausgestellte und über Gebühr
akzentuierte Struktur in ihrer ganzen Prägnanz eigentlich erst da auf, wo
die Partner zusammen sind, weil sie „etwas voneinander wollen", z.B.
17 Darin liegt auch der wesentliche und charakteristische Unterschied zwischen einem
Vortrag und einer Diskussionsäußerung ; darum macht çine Diskussion, bei der die
Teilnehmer sich nicht aufeinander einstellen, sondern jeder monologisierend seinen
Standpunkt außen, einen chaotischen Eindruck.
18 Vgl. LOWITH, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, §§ 20 und 27.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
150 Das gebundene Zusammensein
wenn der eine den anderen überzeugen oder überreden will", oder wenn
man miteinander verhandelt, um sich zu einigen. Will man mit seinem
Partner einen Vertrag abschließen, oder sich mit ihm auf dem Boden eines
bereits bestehenden Vertrages über eine Streitfrage verständigen, so ist
man mit ihm in einer Verhandlungssituation zusammen, und zwar ist man
um des abzuschließenden Vertrages, um der strittigen Frage und dgl.
willen zusammen. Indem man miteinander verhandelt, stößt man auf die
Wünsche, Absichten und Interessen des Partners, die, auch wenn sie nicht
ausdrücklich geäußert werden, sich aus der Lage der Dinge ergeben. Aus
dem Verhalten des Partners während der Verhandlung können seine
Absichten, Motivationen usw. erschlossen werden. Auf diese erschlosse-
ne Position des Partners hin orientiert man sein Verhalten, indem man
dem Gegner „vorentsprechend" zuvorzukommen sucht, dessen Erwide-
rungen und Gegenmaßnahmen voraussieht und ihnen so begegnet, daß
man sie in die gewünschte bzw. in die am wenigsten unerwünschte
Richtung zu lenken sich bemüht. So ist das eigene Situationsverhalten auf
das des Anderen abgestellt und trägt ihm Rechnung. Hier wie in den
früher besprochenen Fällen ist man in seinem Verhalten auf den Partner
bezogen, indem man sich im Hinblick auf ihn und sein Verhalten verhält.
Man spürt in der gemeinsamen Situation die Anwesenheit des Partners ;
gerade dadurch wird die vorliegende Situation zu der bestimmt, die sie ist.
Schon in den zuletzt besprochenen Beispielen macht sich so etwas wie
ein „Druck der Außenwelt" geltend, ein Phänomen, auf das bekanntlich
Dilthey in seiner Theorie der Erfahrung von Realität besonders Nach-
druck gelegt hat20. Am offenkundigsten ist aber die Erfahrung von Druck
" Mit Recht weist Löwith mit besonderem Nachdruck auf das Phänomen der „Wechsel-
rede" in diesem Zusammenhang hin.
2 0 DIITHEY, Gesammelte Schriften, Bd. V ; vgl. für unseren Zusammenhang S. 110 ff. — Da
die Erfahrung von Druck und Widerstand unseren „Glauben an die Realität" sowohl der
„toten" Dinge wie der Mitmenschen konstituiert, beruft sich Dilthey, was die letzteren
in ihrer Besonderheit („diese besondere Klasse von Objekten") anbelangt, noch auf
Analogieschlüsse als logisches Äquivalent „ineinandergreifender Apperzeptionsprozes-
se". Die Vereinigung dieser beiden Motive ermöglich ihm eine eindimensionale Theorie
der mitmenschlichen Begegnungen. An die Erfahrung des Widerstandes, die „die
Voraussetzung jeder weiteren Erfahrung" bildet, schließen sich jene Prozesse an,
vermöge derer wir zu einem Wissen um das konkret vorliegende Fremdseelische
gelangen. Wir bilden „das fremde Innere" nach; dies aber ist untrennbar vom
„Mitfühlen". Indem unser „Mitgefühl" erwächst, kommen wir durch „Nachbilden und
Nachleben" „der von außen gewahrten, aber durch innere Ergänzungen nacherlebten
Vorgänge" auf die „innere Struktur" des anderen Menschen, auf eine „Lebens- und
Willenseinheit", die wir in ihrer Selbständigkeit und in der Kernhaftigkeit ihrer
„wertvollen Existenz" erfahren. Aus der E r f a h r u n g der Selbständigkeit der fremden
Person erwächst die A c h t u n g vor dieser Selbständigkeit: diese andere Person
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das Zusammensein in einer gemeinsamen Situation 151
und Widerstand in solchem Zusammensein, für das das Bestehen von
Uber- und Unterordnungsverhältnissen wesentlich ist. Den Druck seines
erkennen wir an „als einen S e l b s t z w e c k , wie wir selbst ein solcher sind." Die fremde
Lebenseinheit aber erfahren wir als uns gleichartig und verwandt, als homogen mit uns
(was übrigens auch gar nicht anders sein kann, da wir die fremde „Lebenseinheit" nur
durch „Übertragung unseres eigenen Seelenlebens" gewinnen und erfassen können ; vgl.
S. 198 f. und 249 ff.) und daher mit uns solidarisch. „Geschlossene kernhafte Realitäten,
der unseren verwandt, in Teilnahme und Solidarität mit ihr verbunden, doch aber jede ein
Sitz von Eigenwille, der uns beschränkt, bilden unseren sozialen Horizont." Sehen wir
von all dem ab, was bereits früher zur Sprache gekommen ist, ζ. B. von der Berufung auf
Analogieschlüsse und Apperzeptionsprozesse, von der „Untrennbarkeit" des „Nach-
bildens des fremden Inneren von dem Mitfühlen", sowie davon, daß auch hinter dieser
Theorie Diltheys der traditionelle Weltbegriff steht und sogar in sensualistischer
Färbung : „Der Begriff des Objektes ist bedingt durch die Beziehung von Sinneseindrük-
ken auf ein vom Selbst Unterschiedenes und die Verbindung dieser Eindrücke zu einem
Ganzen, das sonach dem Selbst unabhängig gegenüber liegt." (S. 248) und achten wir
stattdessen nur darauf, welche gerade dimensional verschiedenen Arten mitmenschli-
chen Zusammenseins Dilthey auf eine Linie zu stellen versucht. Darin, daß wir mit
einem anderen Menschen in einem „sozialen Verhältnis" stehen und „ein beständiger
leiser Wechsel von Druck, Widerstand und Förderung uns fühlen läßt, daß wir niemals
allein sind", ist nicht jene Haltung zum Mitmenschen begründet, in der wir die
„Lebenseinheit" in ihrer Struktur verstehen wollen, die seine „kernhafte Existenz" als
Individuum ausmacht. Auch wenn wir mit „demselben" Menschen einmal in einer
Situation der Partnerschaft zusammen sind, in der wir seinen Druck verspüren, und ein
anderes Mal uns in der Intention auf Verstehen auf ihn richten, so sind wir eben mit
„demselben" Menschen in zwei verschiedenen Dimensionen zusammen, und wir
können „demselben" Menschen in noch mehreren Dimensionen begegnen. Das ändert
nichts daran, daß diese verschiedenen Arten des Zusammenseins eben wegen der
Verschiedenheit ihrer Dimensionen nicht ineinander fundiert sind, sondern als
eigenständige und in ihrer jeweiligen spezifischen Eigenart begriffen werden müssen.
Für die Dimension der Partnerschaft ist es vielmehr wesentlich, daß in ihr der Mitmensch
als „strukturierte Lebenseinheit" nicht zugänglich wird (vgl. §§ 19 und 20). — Das
Verstehen des Anderen als „Lebenseinheit" läßt auch nicht notwendig das „Bewußtsein
von Verwandtschaft und Solidarität" erwachsen. Solidarität in einem spezifischen, von
Dilthey allerdings nicht intendierten Sinne, wurzelt in der Dimension der Gemeinschaft
(vgl. § 12); das dieser Dimension implizite und immanente Verstehen betrifft aber
wiederum nicht die individuelle „Lebenseinheit" (vgl. S. 194 f.), die auch im
„bundhaften" Zusammensein (vgl. §§ 26 und 27) nicht erfaßt wird. In diesen beiden
zuletzt genannten Dimensionen gibt es auch nicht die Achtung vor der Selbständigkeit
der fremden Individualität als eines Selbstzweckes, noch ist eine dahingehende
Forderung im Zusammensein dieser Dimensionen sinnvoll. Vielmehr hat die Forderung
der Anerkennung und Achtung fremder Selbständigkeit in gewissen Partnerschaftsver-
hältnissen ihren Ort (vgl. § 21), weshalb es auch völlig legitim ist, daß Löwith nach der
„Selbständigkeit des einen und des anderen . . . " gerade „innerhalb eines persönlichen
Verhältnisses" fragt(a.a.O., Kap. III). Obwohl Löwith sich auf Dilthey beruft und
dessen Gedankengänge fortführen will, begründet er die fragliche Selbständigkeit gerade
nicht durch Rekurs auf das Erfassen der strukturierten „Lebenseinheit", sondern durch
das Sichdurchsetzen im Verhältnis und durch die in diesem wirksam werdende freiwillige
Rücksicht auf den Anderen als einen „Ebenbürtigen". Daher münden Löwiths
Ausführungen auch in eine Interpretation der Lehre Kants von der Autonomie des
Menschen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
152 Das gebundene Zusammensein
Vorgesetzten spürt der Untergebene, wenn er mit ihm in Situationen
zusammen ist, die zu dem Bereich gehören, für welchen das Unterord-
nungsverhältnis besteht21. Dabei erfährt er den Partner als einen, dessen
Willen er sich in diesem Zusammensein fügt22, nach dem er sich richtet und
der auch dann für ihn von Bedeutung ist, wenn er sich negativ am
Vorgesetzten orientiert. In diesem letzteren Falle erfährt der Vorgesetzte
den Widerstand der Außenwelt; er findet sich in den gemeinsamen
Situationen, in denen er Vorgesetzter ist, gerade als solcher auf seine
Untergebenen bezogen und orientiert sich an ihnen und ihrem Verhalten
in der seiner Rolle als Vorgesetztem entsprechenden Weise. Dabei ist es
wesentlich, daß Druck und Widerstand von der Situation selbst her und
im situationsgemäßen Verhalten der Partner sich geltend macht.
So charakteristisch und wesentlich die Erfahrung von Druck und
Widerstand und das „vorentsprechende" Zuvorkommen für einige der
erwähnten Beispiele (wie auch für die Bereiche mitmenschlicher Begeg-
nungen insgesamt) sein mögen, als deren paradigmatische Repräsentanten
jene Beispiele in Anspruch genommen werden, so ist damit noch nicht
diejenige Struktur bezeichnet, welche durch alle Begegnungen der
betrachteten Dimensionen hindurchgeht und sich in allen dahingehören-
den konkreten Fällen aufzeigen läßt. Diese Struktur, die gleichzeitig den
Gesichtspunkt darstellt, unter dem die betreffenden mitmenschlichen
Begegnungen zusammengehören, liegt in dem von uns ständig hervorge-
hobenen B e z o g e n s e i n auf den Partner. Daß wir mit dem Partner in
einer gemeinsamen Situation zusammen sind, zu deren Konstitution seine
Anwesenheit und sein Verhalten in ihr einen wesentlichen Beitrag leistet,
das bedeutet, daß wir ihm nicht nur in der gemeinsamen Situation,
sondern auch im Sinne dieser so k o n s t i t u i e r t e n Situation begeg-
nen. Unser Zusammensein bestimmt sich seinem Sinne nach davon her,
was wir in der Begegnungssituation tun, wie wir uns in ihr in bezug auf
den Partner und umgekehrt verhalten. Für die Ausprägung der Situation
ist selbstverständlich auch das Ziel des Verhaltens konstitutiv. Man kann
das Zusammensein dieser Dimension geradezu durch den Umstand
beschreiben, daß die Partner um einer gemeinsamen Angelegenheit willen
21 N u r von den auf bestimmte Bereiche beschränkte Unterordnungsverhältnissen sprechen
wir hier, nicht aber von spezifisch gemeinschaftshaften, wie ζ. B. dem Patriarchat.
22 Es sei hier das horizonthafte „Wissen" erwähnt, daß man außerhalb dieses Zusammen-
seins vom Vorgesetzten frei, d. h. sein eigener Herr ist. Uber dieses „Wissen" und seine
„Möglichkeit" vgl. weiter unten, S. 165 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Begegnung in der Rolle 153
agieren. Aus den jeweiligen Stellungen der Partner zu dieser gemeinsamen
Angelegenheit bestimmt sich der Sinn, in dem ein jeder von ihnen mein
Partner ist. Daher kann die mitmenschliche Begegnung innerhalb der jetzt
zu besprechenden Dimension als gebundene Begegnung definiert werden.
Aus der dargelegten Situationsgebundenheit läßt sich ersehen, inwie-
fern die persönliche Anwesenheit der Partner für ein Zusammensein zwar
notwendig, aber doch nicht hinreichend ist. Notwendig ist sie, weil für
das Zusammensein der Bezug auf einen in der betreffenden Situation sich
verhaltenden Mitmenschen konstitutiv ist, der dadurch zum Partner wird.
Trifft der Vorgesetzte seine Anordnungen und geht dann fort, so mag er
für den Untergebenen, der die Anordnungen nunmehr ausführt, sich
noch so sehr „in der Nähe" halten; auch wenn der Untergebene, der jetzt
allein ist, sein Verhalten gerade im Hinblick auf die zu erwartende
Wiederbegegnung mit dem Vorgesetzten einrichtet, so liegt hier nur ein
extremer Fall von „In-der-Nähe-.mitbeigebracht'-sein" und vielleicht
sogar ein Grenzfall von „Mitanwesenheit", jedenfalls aber kein Zusam-
mensein im prägnanten Sinne des Miteinander-etwas-tun vor. Anderer-
seits reicht die persönliche Anwesenheit für die Konstitution einer
Partnerschaftsbegegnung dann nicht aus, wenn persönliche Anwesenheit
nur besagt, daß eine Reihe von Menschen sich in ein und demselben
Räume aufhalten. Stehen mehrere Arbeiter an je einer Maschine und
stellen sie alle, aber jeder für sich, an gleichen Maschinen dasselbe her, so
sind sie weder Mitarbeiter, noch sind sie auch im eigentlichen und
prägnanten Sinne miteinander zusammen. Weil sie nebeneinander arbei-
ten, macht sich das Arbeiten des einen dem anderen gerade nicht in seiner
Arbeit selbst bemerkbar, — das liegt ja im Sinne des Nebeneinander.
§ 19 Die Begegnung in der Rolle
Die Situationsgebundenheit der hier in Betracht gezogenen mitmenschli-
chen Begegnungen enthüllt ihren vollen Sinn erst, wenn wir fragen, als
was sich die Partner in ihrem Zusammensein begegnen.
Unter Berufung auf das oben23 über das Bestimmtwerden durch die
23 Vgl. § 14.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
154 Das gebundene Zusammensein
Situation Ausgeführte werden wir sagen: erhalte ich den Sinn meines
konkreten Seins von der Situation her, so bedeutet das für die
Bestimmung meines konkreten Seins angesichts der Anderen, daß ich
auch im Hinblick auf einen oder mehrere Partner bestimmt bin. So bin ich
durch das Verhältnis mitbestimmt, das ich zu meinem Partner habe. In
diesem meinem Verhältnis zu ihm begegne ich ihm als der, der ich für ihn
hic et nunc bin und in Betracht komme ; und in genau der gleichen Weise
begegnet er mir. Das Verhältnis, das ein jeder von uns zum Anderen hat,
entspringt daraus, daß wir uns wirklich in bestimmter Weise zueinan-
der verhalten. Wie wir uns verhalten, in welchem konkreten Sinne wir
Partner sind, das wird freilich durch die Situation unseres Zusammenseins
bestimmt. Unser Verhältnis zueinander ist insofern ein fundiertes
Verhältnis, als es in der genannten Situation seine Wurzel hat. Mit anderen
Worten: die Situation schreibt uns eine Rolle vor, die wir übernehmen,
so lange wir in der betreffenden Situation stehen. Das ist ja überhaupt der
Sinn der situationshaften Bestimmtheit unseres konkreten Seins, daß wir
in einer solchen Lage in der von ihr uns zuerteilten Rolle und als solche
Rolle existieren. In bezug auf die uns hier beschäftigenden Situationen
des Zusammenseins mit einem Partner ist es wichtig zu bemerken, daß die
Rolle von vornherein auf die Gegenrolle des Partners hin angelegt ist. Für
den Sinn dieser unserer Rolle ist konstitutiv die Gegenrolle, die sie ihrem
Sinn gemäß erfordert, da sie nur in bezug auf diese sinnvoll sein kann. Wir
haben also unsere Rolle immer und notwendig im Hinblick auf die Rolle
des Partners. Darin gründet der Bezug und das Angewiesensein auf den
Partner, die wir im vorigen § als Charakteristikum des Zusammenseins in
einer gemeinsamen Situation herausgestellt haben.
In diesen durch das Verhältnis zueinander konstituierten
Rollen begegnen sich Partner in ihren Partnerschaftssituatio-
nen; sie begegnen sich als die, die sie in den jeweiligen
gemeinsamen Situationen sind, z.B. als Mitarbeiter, als Käuferund
Verkäufer, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, als Vorgesetzte und
Untergebene, und zwar in genau den Rollen, die sie im konkreten Fall
haben, etwa als Kutscher, der seinen Fahrgast fährt usw. In dieser
Dimension begegnet mir also nicht ein Individuum mit seinen individuel-
len, spezifisch ihm zukommenden Eigenschaften, die es als dieses
bestimmte Individuum konstituieren, wobei es für das Individuum,
besonders wenn man es als „strukturierte Lebenseinheit" im Sinne
Diltheys faßt, in einem gewissen Sinne zufällig und irrelevant sein kann,
daß es jetzt in dieser konkreten Situation steht und gerade diese bestimmte
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Begegnung in der Rolle 155
Rolle in ihr hat24. Ebensowenig aber begegnet mir ein schlechthin anderer
Mensch, gewissermaßen ein zweites Exemplar der Gattung, zu der ich
gehöre, und das ich nur durch „Übertragung meiner eigenen Lebendig-
keit" und ihrer Struktur, meiner Erlebnisse und Erlebniszusammenhänge
(durch Analogie oder Einfühlung) deuten und mir verständlich machen
muß, so daß ich es in einem ganz bestimmten Sinne als alter
ego begreife25. Vielmehr begegnet mir der Andere als Partner in genau dem
konkreten Sinne von Partnerschaft, in dem er hic et nunc mein Partner ist.
Nur als die Rolle, die er in der jeweiligen Situation unseres Zusammen-
seins aufgrund seiner Funktion in dieser Situation darstellt und in einem
bestimmt zu verstehenden Sinne auch ist 26 , kommt er für mich in
Betracht. Er erscheint mir als ein durch die Situation motivierter, die ihm
eine Funktion und Rolle vorschreibt. Nur in dieser seiner Rolle habe ich
mit ihm zu tun. Sein Sein in dieser Situation erschöpft sich in der Rolle,
deren Träger er ist27. Was ich sonst noch über meinen Partner weiß, ist,
sofern es keinen sachlichen Bezug zur Situation aufweist, belanglos für
sein Verhalten zu mir. Ebenso ist es im Sinne unseres Zusammenseins
gleichgültig, in welchem Maße die Rolle in den beiderseitigen „Lebens-
einheiten" verwurzelt ist, die jeder von uns als Individuum darstellt. Wir
sind ja nur in unseren Rollen zusammen, nicht als Individuen. Daher
kommt es auch gar nicht darauf an, daß es gerade der bestimmte N.N. ist,
mit dem ich jetzt in dieser konkreten Partnerschaft stehe. Dieser N.N. ist
durch jeden beliebigen anderen ersetzbar, sofern dieser die situationsbe-
stimmte Funktion und Rolle übernimmt. In diesem Sinne kann man
sagen, daß mein Partner ein „Irgendjemand in dieser ganz bestimmten
24 O b diese konkrete Situation und Rolle für ein Individuum als „strukturierte
Lebenseinheit" relevant ist, in welchem Maße und in welchem Sinne sie es ist, hängt
davon ab, welchen Platz und Rang in der Struktur dieser „Lebenseinheit" die fragliche
Situation und Rolle sowohl ihrem Typ nach einnimmt, wie auch als die konkrete, die sie
im gegebenen Falle ist.
25 Sagt man in der gleichen Situation zu seinem Partner : „ich würde an ihrer Stelle das und
das tun", so bedeutet das, daß die Situation an der Stelle, an welcher der Panner in seiner
von der Situation an dieser Stelle ihm zuerteilten Rolle steht, ein bestimmtes Verhalten
erfordert, eben : „das und das zu tun", und daß der Partner, indem er sich anders verhält,
die Situation nicht völlig überschaut und versteht. Es hat aber nichts damit zu tun, was
mich als Person, Individuum und „Lebenseinheit", die ich bin, betrifft.
24 Siehe weiter unten.
27 Weil wir in dem Zusammensein der Partnerschaft uns in unseren Rollen begegnen, und
zwar in Rollen, die von vorherein aufeinander sinnvoll abgestimmt sind, ist die von
Löwith herausgestellte Struktur des „vorentsprechenden" Zuvorkommens überhaupt
möglich, die manche Bereiche dieser Dimension beherrscht. Aus dem gleichen Grunde
ist sie aber auch auf diese und nur diese Dimension zu restringieren.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
156 Das gebundene Zusammensein
Rolle" ist. Denn es bedeutete keinen Eingriff in die Situation, wenn ein
Irgendjemand die Rolle des N.N. übernähme2'.
In seinem bereits merhfach erwähnten Buche Das Individuum in der
Rolle des Mitmenschen gibt Löwith dem Gedanken Ausdruck, daß die
Menschen einander nicht als Individuen, d. h. nicht als in sich beschlosse-
ne „Monaden" begegnen, sondern wesenhaft in den „Rollen", die sie in
bezug aufeinander haben, und damit in „verhältnismäßiger Bestimmt-
heit". „Ein jeder der andern bestimmt sich zunächst also gerade darin an
ihm selbst, daß er zu bestimmten andern ein Verhältnis haben kann.
Die Mitmenschen begegnen nicht als eine Mannigfaltigkeit für sich
seiender Individuen sondern als personae, die eine Rolle haben,
nämlich innerhalb und für ihre Mitwelt, aus der heraus sie sich dann selbst
personhaft bestimmen."2' Dieser Gedanke der Bestimmtheit des Men-
schen durch seine verhältnismäßige Bedeutsamheit als „persona" ist in der
Tat zentral für die Untersuchungen Löwiths. Von ihm aus kommt es zur
Herausstellung des „vorentsprechenden" Zuvorkommens : „Das eigene
Verhalten richtet sich . . . nicht nur auf den anderen, sondern zugleich
nach dem anderen, es richtet sich selbst von vornherein nach dem
anderen ein. Die primäre Zweideutigkeit des eigenen Verhaltens zum
anderen ist also reflektiert, indem sich einer in seinem Verhalten (zum
andern) zum Verhältnis verhält. Sich im Verhalten zum Verhältnis
verhalten, das besagt : ich verhalte mich zu einem andern von vornherein
im Hinblick auf sein mögliches Verhalten zu mir."30 Hier sehen wir auch
den Grund dafür, daß Löwith diese Struktur insofern verabsolutiert, als er
sie ohne Einschränkung für die beherrschende Struktur aller mitmenschli-
chen Begegnungen hält. Da er ferner zwischen den verschiedenen
Dimensionen des Zusammenseins keinen Unterschied einführt, ist die
28 Vgl. HEIDEGGER, a. a. O., § 22 [S. 102-104], - Das „Man", das Heidegger [a.a. O.,
S. 114 ff.] in diesem Zusammenhang einführt, ist aber kein eindeutiger Begriff, sondern
eine ένας κατ' &ναλογίαν im Sinne von ARISTOTELES, Metaphysik, Δ, Kap. 6,1016 b 34,
die sich je nach den Dimensionen des mitmenschlichen Zusammenseins in ihrer
jeweiligen Bedeutung differenziert. Hier bedeutet „Man" den „Irgendjemand in einer
ganz bestimmten und konkreten Rolle (über eine weitere Bedeutung siehe S. 189).
Ώ LOWITH, a.a.O., S. 51.
30 LOWITH, a.a.O., S. 19f.: „Die prinzipielle Struktur der Verhältnisse besteht... darin,
daß das Sich-verhalten des einen mitbestimmt ist durch den andern ; es ist reflexiv in
Korreflexivität. Abgesehen von seinem Verhältnis zum andern ist, was einer tut und läßt,
nicht verständlich, denn er tut und läßt es ja nicht als abgeschlossenes Individuum,
sondern als persona, d.h. als einer, der eine,Rolle* hat, nämlich die, welche ihm durch
sein Verhältnis zum andern schon eo ipso erteilt ist, auch dann, wenn einer gar nicht
ausdrücklich im Sinne des ,wir' spricht und handelt."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Begegnung in der Rolle 157
Begegnung mit dem Mitmenschen nicht auf den Bereich beschränkt, in
dem nur diese Art von Begegnung ihren Ort und Boden („Grund") hat.
Durch diese Radikalisierung findet das Zusammensein in dem Sinne statt,
daß „sich der eine durch des andern Dasein in einem solchen Ausmaß
bestimmen läßt, daß sein eigenes Dasein seine existentielle Bedeutung
p r i m ä r aus dem Verhältnis zum andern empfängt und verliert" 31 . Daher
kommt es auch für ihn zu dem Problem der „Selbständigkeit des einen für
den andern im Verhältnis selbst als einem gerade nicht verabsolutier-
ten, sondern absoluten V e r h ä l t n i s " , ein Problem, das ihn über
Dilthey32 hinaus und zu Kant zurück führt.
So fruchtbar sich nun dieser Gedanke in mancher Hinsicht erweist
(beispielsweise in der Interpretation der „moralischen Qualitäten" des
Individuums, etwa „Egoismus" und „Altruismus" als „Lebensäußerun-
gen", als Weisen des Sichverhaltens zu andern Menschen und nicht als
„für sich bestehende innere Eigenschaften einer individuellen Substanz",
weil „ich und der andere keine gegeneinander gleichgültigen Objekte mit
immanenten . . . Eigenschaften sind" 33 ), so ist es ihm doch nicht gelungen,
die „verhältnismäßige Bedeutsamkeit und Bestimmtheit" in ihrer Eigen-
art und in ihrem vollen Sinne in phänomenologisch befriedigender Weise
aufzuklären. Schuld daran ist auch, aber nicht allein,der Umstand,
daß er die verschiedenen Dimensionen mitmenschlichen Zusammenseins
in ihrer Verschiedenheit wie auch in ihrer jeweiligen Eigenart übersieht34.
Die wesentlichen Mängel der Löwithschen Untersuchungen rühren
daher, daß er seine Ansichten nicht aufgrund eingehender Analysen an
31 Lcwrm, a.a.O., S. 22 f.
32 Über diese Abweichung siehe oben S. 150, Anm. 20.
33 LOWITH, a.a.O., S. 52; vgl. auch § 18. — Es sei hier nur auf die Frage aufmerksam
gemacht, was denn im Individuum als „strukturierter Lebenseinheit" der Grund und die
Wurzel dieser „moralischen Qualitäten" ist, die nicht nur faktisch im Zusammensein mit
Andern hervortreten und sich bekunden können, sondern zu denen auch der Hinblick
auf ein solchen Zusammensein konstitutiv mitgehört.
34 Dieses Übersehen macht sich auch in Lowrras Analyse von Pirandellos Cosi è (se vi pare)
bemerkbar (a.a.O., § 23), wo gerade die Pointe des Stückes nicht hinreichend zur
Geltung kommt. Diese Pointe besteht darin, daß Außenstehende drei Menschen, die in
einer „geschlossenen Welt" leben, durch Verhör und Konfrontation explorieren wollen,
ohne zu ahnen, daß sie es mit einer „geschlossenen Welt" zu tun haben. „Geschlossene
Welt" besagt dabei, daß jene drei Menschen eine gemeinsame Geschichte haben, aus der
her und durch die motiviert sie in bestimmter Weise zueinander stehen. Weil die
Außenstehenden die Geschichtlichkeit der „Welt der Drei" nicht würdigen, kommt ihre
Neugier kaum zum Ziel. Obwohl Löwith sieht, daß erst der Rückgang auf die
Geschichte des Verhältnisses dieses selbst verständlich machen würde, und es als eine
Schwäche des Stückes betrachtet, daß diese Geschichte im Hintergrund bleibt, bemerkt
er nicht, was es für die Art und Weise des Zusammenlebens der Drei in ihrer
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
158 Das gebundene Zusammensein
konkreten Phänomenen vorträgt. Hier wie auch anderswo35 orientiert er
sich an Eigentümlichkeiten des deutschen Sprachgebrauchs, den er so
ernst nimmt, daß er von der Untersuchung der „natürlichen Logik der
Sprache" her Aussagen über Phänomene und Phänomenzusammenhänge
zu gewinnen sucht. Statt also durch Beschreibung und Explikation des
Phänomenalen selbst nicht nur die „Sachen" auf ihre Differenzen,
Gemeinsamkeiten und die jeweils zwischen ihnen bestehenden Fundie-
rungs- und Derivationsverhältnisse hin zu erforschen, um erst so darüber
Klarheit zu schaffen, wo die Eigentümlichkeiten des Sprachgebrauchs
wirklich Phänomene und deren Zusammenhänge treffen und wo lediglich
sprachlicher Usus vorliegt, läßt sich Löwith durch die Selbstverständlich-
keit der Sprache leiten. Weil er als Beispiele „verhältnismäßiger Bestimmt-
heiten" Alte und Junge, Vorgesetzte und Untergebene als gleichberech-
tigte Beispiele auf dieselbe Ebene stellt", entgeht es ihm, daß das Wort
„Verhältnis" in diesen Fällen eine je andere Bedeutung hat. Das Verhältnis
zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ist dadurch gekennzeichnet,
daß beide in konkreten Situationen zusammenkommen und etwas
miteinander tun, während das zwischen Alten und Jungen bestehende
Verhältnis eine Relation zwischen Lebensaltern darstellt, die durchaus
phänomenalen Charakters sein kann und zumeist auch ist. Daß ein Mann
„in den besten Jahren" älter ist als ein Jüngling, der nur zufällig neben ihm
sitzt, und mit dem er gar nichts zu tun hat, drängt sich auf, auch ohne daß
man auf das exakte zahlenmäßige Verhältnis ihrer Lebensalter rekurriert.
Das eine Mal gründet das Verhältnis in einem wirklichen Sich-zueinander-
verhalten in konkreten gemeinsamen Situationen ; das andere Mal liegt ein
solches Sich-zueinander-verhalten gar nicht vor, sondern lediglich ein
objektiver Tatbestand, der unabhängig davon besteht, ob die betreffenden
Menschen sich sonst noch zufällig in konkreten gemeinsamen Situationen
begegnen. Daher kann das im letzteren Fall bestehende Verhältnis, eben
weil es nicht in einem Miteinander-zu-tun-haben gründet, ein „äußerli-
ches Verhältnis" genannt werden. Ebenso ist der Sinn, in dem ein Vater zu
Kindern „gehört", ein anderer als der, in dem ein Offizier zum Militär
„geschlossenen Welt" bedeutet, daß dieses Zusammenleben von „geschichtlicher
Selbstverständlichkeit" ist. Da ihr Zusammensein historisch verwurzelt ist, charakteri-
siert es sich gerade damit als ein Zusammensein in der Dimension der Gemeinschaft (vgl.
§ 23). Als solches ist es aber p r i n z i p i e l l , nämlich im Sinne der Dimension der
Begegnung „verhältnismäßig" aufeinander abgestellter Rollen anders geartet. Freilich
wird diese Verschiedenheit erst bei hinreichend ausgeführter Analyse deutlich werden.
35 Siehe die in Anm. 9, S. 142 angeführten Beispiele.
36 V g l . LOWITH, a . a . O . , S. 50 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das gegenseitige Verstehen in der gemeinsamen Situation 159
„gehört", und in einem wieder anderen Sinn „gehört" ein „alter Mann
(nicht) zu den jungen Leuten". Erst aufgrund des Unterschiedes zwischen
Verhältnissen, in denen Menschen interagieren, und solchen, die „objek-
tiv", d. h. ohne Zutun der Partner, zwischen diesen bestehen, vermag die
„verhältnismäßige Bestimmtheit" ihrem Sinne nach aufgeklärt zu wer-
den. Das kann aber nur in solchen Untersuchungen geschehen, welche die
Phänomene selbst analysieren, und darauf zurückgehen, was „Stehen in
einer Situation" überhaupt heißt. In derselben Weise, allerdings unter
Einbeziehung der Dimensionsunterschiede, kann und muß auch der
jeweils verschiedene Sinn, in dem wir von der „Zugehörigkeit" der
Menschen zueinander sprechen, seine Aufklärung erhalten.
§ 20 Das gegenseitige Verstehen in der gemeinsamen Situation
Das Leben in Umweltsituationen weiß in „impliziter" Weise sich selbst
und erhält seine Regeln von diesem seinem Wissen, d. h. vom Wissen um
die Situation37. Als ein vom ihm innewohnenden Wissen geregeltes ist
dieses Leben ein „umsichtiges Besorgen" im Sinne Heideggers. Selbstver-
ständlich verändert sich der Charakter dieses Wissens nicht, ob ich nun
allein in einer Situation bin, oder ob der Sinn der Situation gerade dadurch
konstituiert wird, daß ich einem Anderen begegne. In den vorangegange-
nen Analysen haben wir denn auch schon verschiedentlich von diesem
Wissen Gebrauch gemacht. Am prägnantesten trat es wohl im „vorent-
sprechenden" Zuvorkommen zutage. Dieses ist ja in der Tat nichts
anderes als eine ganz bestimmte Art des vom Wissen um die Situation und
den Anderen geleiteten Reagierens auf den Partner. Weil es also ein dem
„Leben in . . ." innewohnendes Wissen ist, erhellt dieses die Situation
genau so, aber auch nur so, wie sie für uns in Betracht kommen. Im
„impliziten" Sich-selber-wissen des „Lebens in . . ." verstehen wir das,
womit wir umgehen, als das, was es im Umgang selber ist. Darin liegt
schon die spezifische Eigenart des Verstehens des Partners in der
gemeinsamen Situation beschlossen, da dieses Verstehen ein Moment des
„impliziten" Wissens um die Situation darstellt.
In den hier zur Rede stehenden gemeinsamen Situationen begegnen wir
dem Partner als einem Rollenträger. Auf sein in dieser Rolle liegendes
" V g l . §16, S. 120-133.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
160 Das gebundene Zusammensein
konkretes Sein geht das Verstehen. Weder haben wir also — wie es die
Ausgangsposition der traditionellen Problematik meinte — ein „Stück
Außenwelt"38 vor uns, in das wir uns einfühlen usw. und das erst dann,
wenn wir es durch irgendeine Form der „Übertragung" unseres eigenen
Inneren verlebendigen, beseelen oder dergleichen, zu einem anderen
Menschen, einem fremden Ich wird ; noch bahnt sich hier so etwas wie ein
Verstehen der fremden Individualität an. In seinen posthum veröffent-
lichten Fragmenten über Das Verstehen anderer Personen und ihrer
Lebensäußerungen unterscheidet Dilthey „elementare" und „höhere
Formen des Verstehens"39. Mit dem, was er „elemantare Formen des
Verstehens" nennt, haben wir es eigentlich hier zu tun, d. h. mit einem
Verstehen, das aus „den Interessen des praktischen Lebens erwächst". Die
Situationen des „praktischen Lebens" sind uns in ihrer Bewandtnis aus
sich heraus verständlich: „Die elemantaren Akte, aus denen sich
zusammenhängende Handlungen zusammensetzen, wie das Aufheben
eines Gegenstandes, das Niederfallenlassen eines Hammers, das Schnei-
den von Holz durch eine Säge bezeichnen für uns die Anwesenheit
gewisser Zwecke. In diesem elementaren Verstehen findet sonach ein
Rückgang auf den ganzen Lebenszusammenhang, welcher das dauernde
Subjekt von Lebensäußerungen bildet, nicht statt. . . wir dürfen es auch
n i c h t . . . als ein Verfahren fassen, das von der gegebenen Wirkung zu
irgendeinem Stück Lebenszusammenhang zurückgeht, welches die Wir-
kung möglich macht. Gewiß ist dieses letztere Verhältnis im Sachverhalt
selber enthalten, und so ist der Ubergang aus jenem in dieses gleichsam
immer vor der Tür : aber er braucht nicht einzutreten."40 Stellen wir diesen
Gedanken Diltheys in den Zusammenhang unserer Ausführungen, so
werden wir sagen: das dem Sein in gemeinsamen Situationen
immanente Wissen versteht den Partner in seiner jeweiligen
Rolle aus der konkreten Situation heraus. Weder ist diesem
Verstehen der Kern einer fremden Person zugänglich noch erschließt es so
etwas wie Charakterzüge des Mitmenschen, noch stößt es schließlich auf
Bewußtseinserlebnisse, d. h. cogitationes eines fremden Ich. Was hier
in den Blick kommt, ist lediglich der Partner in genau dem Sinne von
Partnerschaft, in dem wir es jeweils mit ihm zu tun haben. Das Verstehen
38 Vgl. oben S. 38.
39 Diithey, Gesammelte Schriften, Bd. VII; siehe bes. S. 207f. Das Ineinandergehen auch
widersprechender Gedankenmotive erklärt sich aus dem Zustand dieser keineswegs
druckfertigen Entwürfe (siehe die Vorbemerkung des Herausgebers, S. 348 ff.).
40 Gerade dieser Umstand begründet für Dilthey (a.a.O., S. 212) die Differenz der
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
D a s gegenseitige Verstehen in der gemeinsamen Situation 161
betrifft mithin die Art und Weise, wie der Andere die ihm von der
Situation zuerteilte Rolle spielt. Diese Ausrichtung eignet diesem
Verstehen deshalb, nicht weil es primär auf den anderen Menschen geht,
sondern weil es ein Moment an dem Wissen um die gerade aktuelle
Gesamtsituation darstellt. Es erfaßt den Mitmenschen nur insofern, als
er ein Bestandteil der Situation ist. Mit anderen Worten : wir haben es mit
einem Funktionsverstehen zu tun. Daher erschließt sich hier der Partner
in seiner s i t u a t i o n s b e s t i m m t e n Existenz : in der Rolle, die er gerade
darstellt und „ist". In alledem kommt zum Ausdruck, daß dieses
Verstehen des Partners Verhaltensformen erschließt, Modi des „Lebens
in.. nicht jedoch Eigenschaften, die einem Menschen als Substanz
zukommen, auch wenn man diese Substanz als „strukturierte Lebensein-
heit" faßt.
In dieser Weise erfahre ich in der gemeinsamen Arbeit und von ihr her
meinen Mitarbeiter in der Rolle, die ihm im gemeinsamen Arbeiten
zuerteilt wird. Wenn er sich mir als brauchbar oder ungeschickt, als ein
geeigneter oder ungeeigneter Mitarbeiter zeigt, so brauche ich dazu nicht
vom fertigen Werk auf ihn als den an der Herstellung beteiligten
Menschen zuriickzuschließen. Indem ich mit dem Anderen in einer
gemeinsamen Situation stehe, diese überblicke und ihn von ihr aus
begreife, „weiß" ich immer schon um die Angemessenheit bzw.
Unangemessenheit seines Verhaltens. Von da aus bestimmt sich auch der
Sinn von Geeignetheit und Ungeeignetheit des Mitarbeiters : nämlich im
Hinblick auf das aktuelle gemeinsame Werk. Doch erschließt sich der
Andere freilich auch nur als Mitarbeiter; was er sonst noch ist, in
welchen Bezirken er sonst noch existiert, in welchem Sinne er in ihnen
existiert — das alles ist diesem dem Zusammensein immanenten Verstehen
unzugänglich41. Die Ausführungen zur Mitarbeiterschaft gelten in ent-
sprechender Weise für alle Formen des hier gemeinten mitmenschlichen
Zusammenseins. Wenn ich jemanden um etwas bitte, so erfahre ich an der
Art und Weise, wie der Gebetene mich anhört, auf mein Ersuchen eingeht,
Widerstand leistet, ausweicht, Bedingungen stellt oder nachgibt usw.,
nicht so etwas wie einen fremden und selbständigen Willen schlechthin.
Vielmehr begegnet mir ein Mensch, der sich in der betreffenden Situation
in bestimmter Weise verhält, abweisend oder zuvorkommend ist, diese
und jene Absichten durchscheinen läßt oder auch ausdrücklich äußert, zu
„elementaren" und „höheren Formen des Verstehens". — Was dieses „vor der Tür sein"
besagt, wird weiter unten (S. 195 ff.) noch aufzuklären sein.
41 Vgl. zu weiteren Aspekten dieser Fragen die Ausführungen auf S. 165 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
162 Das gebundene Zusammensein
dieser Angelegenheit eine bestimmte Stellungnahme erkennen läßt usw.
Auch der Gebetene erfährt nicht so etwas wie den „Anspruch eines D u "
schlechthin. Wo es sich nicht um Bitten handelt, sondern um Verhandeln,
da ist das Zusammensein von ähnlicher · Struktur. Nur tritt hier das
„vorentsprechende" Zuvorkommen deutlicher hervor und beherrscht
zuweilen das Zusammensein. Aber dieses Zuvorkommen ist nur möglich
aufgrund des „impliziten" Situationsverstehens und wird von diesem
geregelt. Es beruht darauf, daß sich im Zusammensein und Verhandeln die
Forderung des Anderen ergibt. An diesem Wissen orientiert sich das
eigene Verhalten, das gleichsam ständig auf dem Sprung ist, dem von der
Gegenseite Erwarteten in zweckmäßiger Weise zu entsprechen : das eben
macht das „vorentsprechende" Zuvorkommen aus. — In gemeinsamen
Situationen belauschen sich die Partner fortzu. Indem jeder seine Rolle
spielt, errät er die Absichten und Tendenzen des Anderen auch dann,
wenn dieser sich über sie nicht âufiért, wie dies am Beispiel der
Schachspieler deutlich wird.
In den hier in Rede stehenden Begegnungen treten auch Ausdrucksphä-
nomene auf. Während ich mich mit meinem Partner unterhalte, schüttelt
er etwa den Kopf oder runzelt die Stirn. Kopfschütteln wie Stirnrunzeln
sind an sich nicht eindeutige Gesten, sondern können vielerlei besagen.
Was die Geste im konkreten Fall bedeutet, kann man ihr nicht einfach
ablesen; es steht in ihr als dieser bestimmten Geste nicht „geschrieben".
Der Gedanke Schelers42, daß es eine „universale Grammatik" gibt, „die
für alle Sprachen des Ausdrucks gilt und oberste Verständnisgrundlage
für alle Arten von Mimik und Pantomimik des Lebendigen" ist, hat für
einen gewissen Bereich seine Berechtigung. Aber jene durchschnittlichen
und alltäglichen Ausdrucksphänomene, Gesten usw., die hier gemeint
sind, werden nicht aufgrund einer solchen „universalen Grammatik"
verstanden. Vielmehr verstehen wir sie aus dem Ganzen der gemeinsamen
Situation. Oder anders : das Verständnis dieser und ähnlicher Ausdrucks-
phänomene geht glatt aus dem Wissen um die Situation hervor, in der ich
mit den Anderen bin, und ordnet sich diesem Wissen als eines seiner
Momente ein. Auch wo ich unmittelbar spüre, daß eine Ausdrucksbewe-
gung nicht echt ist, sondern willentlich hervorgebracht wird, und daher
Verdacht schöpfe, mein Partner wolle mich täuschen, braucht dieser
Vermutung nicht eine Störung des „Wesenzusammenhangs" zwischen
Erlebnis und Ausdruck zugrunde zu liegen. In diese Situation und ihre
42 Vgl. SCHELER, Sympathie, S. 7 f. [ G . W. 7, S. 22 f.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das gegenseitige Verstehen in der gemeinsamen Situation 163
„mitbeigebrachten" Hintergründe „paßt" diese Reaktion des Anderen
nicht hinein. Das Nicht-hineinpassen, das Nicht-in-Ordnung-sein und
dgl. sind phänomenale Eigenschaften des betreffenden Ausdrucksphäno-
mens43, Eigenschaften freilich, die diesem Phänomen an und für sich nicht
zukommen. Vielmehr wachsen sie ihm erst aus der gesamten Situation zu.
Allein in dieser Gesamtsituation wird es zu dem Ausdrucksphänomen,
das es i n c o n c r e t o ist; — aus ihr und von ihr her erhält es seine jeweilige
Bedeutung. Das „selbe" Kopfschütteln kann, wie wir gesehen haben, in
verschiedenen Situationen verschiedene Bedeutungen annehmen und
außerdem noch in den einen echt, in anderen künstlich hervorgerufen
sein. Was ein Ausdrucksphänomen jeweils ist und bedeutet, wird mir aus
dem Ganzen der jeweiligen Situation verständlich. Aus diesem Situations-
verstehen heraus kann ich im gegebenen Fall hinter die wirkliche Reaktion
meines Partners kommen. Das Verstehen der Ausdrucksphänomene ist
als Verstehen aus Situationsbezügen von genau der gleichen Art wie das
Verstehen dessen, was gesamthaft in der Situation vorliegt. Das bedeutet
aber, daß es in dem hier in Betracht gezogenen Bereich mitmenschlichen
Zusammenseins ein spezifisches Problem der Ausdrucksphänomene
nicht gibt.
Das hier dargelegte Verstehen des Mitmenschen hat eine Bedeutung
über das Zusammensein in gemeinsamen Situationen hinaus. Wo wir von
einem Werk aus die jederzeit mögliche Wendung44 auf die an ihm
beteiligten Menschen vollziehen, kommen sie ebenfalls nur in den Rollen
in den Blick, die sie in den betreffenden Werksituationen übernommen
hatten. An einem nachlässig gearbeiteten Werk kommt der Hersteller als
der und der bestimmte Arbeiter, z. B. Uhrmacher, Baumeister usw., der es
an Sorgfalt hat fehlen lassen, zum Vorschein, wie an einem präzis
verfertigten ein gewissenhafter, geschickter, fleißiger. Immer aber handelt
es sich um einen Menschen in seiner Rolle. Das Verstehen ergibt sich hier
aus der Situation und ist damit auf das beschränkt, was in ihr selbst liegt.
Nun weist Spranger45 in seiner Analyse des Verstehens fremder
Willenshandlungen darauf hin, daß die „psychische Situation (die
Motive)" des Handelnden für den Verstehenden „zunächst unzugäng-
lich" ist; insofern aber in diese „innere Situation objektive Erkenntnisse
43 Damit ist der Forderung von S. 22 — 23 Genüge getan.
44 Jederzeit möglich ist diese Wendung darum, weil das Werk eben als solches auf
Menschen in den Weisen ihres Beteiligtseins verweist, und zwar im Sinne der
„mitbeibringenden" Verweisungen.
45 E . SPANGER, Zur Theorie des Verstehens und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie, S .
379 f. ; Festschrift für Johannes Volkelt, München 1918.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
164 Das gebundene Zusammensein
mit eingehen", d. h. insofern das Handeln sich an bestimmten Konstella-
tionen (Situationen in dem von uns gemeinten Sinne) orientiert, ist es
„nachkontrollierbar" und enthält eine Komponente, die als „rationaler
Teil der Handlung für den anderen [sei. den Verstehenden] als ein objektiv
Begründetes zugänglich" ist. Von dem her, was „nachkontrollierbar" ist,
wird die Handlung als Handlung in dieser ganz bestimmten Situation
verständlich; aufgrund seines Verstehens der Situation versteht der
Zuschauer diese konkrete Handlung46 und kann sie in bezug auf ihre
Angemessenheit beurteilen. Eben an diesem Verstehen der Handlung als
solcher, wobei die „innere psychische Situation" „zunächst" unzugäng-
lich bleibt, wird die eigenartige Beschränktheit dieses Verstehens deutlich,
das prinzipiell an die Situation und ihre Horizonte gebunden bleibt47.
Auch für die Geisteswissenschaften besitzt dieses Verstehen eine
gewisse Bedeutung. Wo immer es sich um eine bestimmte Leistung, um
das konkrete Auftreten einer historischen Figur handelt, wird diese von
der Situation her begriffen. Diese Situation ordnet sich ihrerseits einem
ganz bestimmten Horizont von Verweisungszusammenhängen ein48.
Dabei kommt die betreffende historische Gestalt in ihrer konkreten Rolle
in den Blick. Es handelt sich dabei also nicht um geschlossene und
„strukturierte Lebenseinheiten", sondern um eine j e w e i l s k o n k r e t e
Existenz 4 '. Jedoch wird der Historiker sich mit diesem Verstehen der
einzelnen Situationen und der historischen Personen in ihren einzelnen
konkreten Rollen zumeist nicht begnügen ; auch wenn er es nicht auf die
historischen Gestalten in ihrer Individualität abgesehen hat, wird er nach
den Untergründen sowohl der Menschen in ihren Rollen wie auch der
Situation selbst fragen. Ein neues Gesetzbuch etwa dient den Bedürfnis-
46 Vgl. hierzu DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 321 ; SPRANGER, a.a.O., S. 389:
„Alles Verstehen setzt ein Verstandenhaben voraus."
47 Die These Sprangers, „daß wir das Seelische nur verstehen durch das Geistige hindurch",
erfährt hier einige konkrete Durchführungen. Als „Geist" bezeichnet Spranger „den
[ideellen] Ort des Zusammentreffens" des „inselhaft in sich abgeschlossenen Ichs"
(a.a.O., S. 371 und 398).
48 Vgl. SPRANGER, a . a . O . , S. 389 f.
49 Die konkrete Existenz des „Siegers von Austerlitz" ist selbstverständlich nicht
identisch dieselbe, wie die „des Verfassers des Code Napoléon". Allgemein gilt für den
hier betrachteten Bereich : bestimmt sich die konkrete Existenz eines Menschen von der
Situation her, in der er eine Rolle hat, so ist die Identität des durch die verschiedenen
Rollen sich durchhaltenden „Individuums" als solchen so wenig eine Selbstverständlich-
keit und in genau dem gleichen Sinne ein Problem, wie das oben (§ 14) für mich, wenn ich
allein in einer Situation bin, dargelegt wurde. Da die Gründe, aus denen ein Problem der
Identität sich ergibt, im Prinzip hier die gleichen sind wie dort, begnügen wir uns mit der
Verweisung auf das im genannten § Ausgeführte.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Der Sinn der soziologischen Kategorie 165
sen einer bestimmten Zeit; von den veränderten Lebensbedingungen, der
veränderten Wirtschaft usw. her sind das Gesetzbuch und der Gesetzge-
ber in seiner gesetzgebenden Leistung zu verstehen. Aber der Historiker
kann, wie Dilthey50 bemerkt, vom Gesetzbuch aus auf den „Geist der
Zeit" zurückgehen und diesen erforschen. Dieser Rückgang steht nicht im
Belieben des Historikers ; er ist darum erforderlich, weil erst von dem her,
was Dilthey „Geist einer Zeit" nennt, Situationen wie auch Menschen in
ihren Rollen in einem tieferen Sinne verständlich werden. Bei diesem
Vorgehen des Historikers aber handelt es sich um ein Verstehen nicht
mehr nur aus Situationen heraus. Uber dieses nunmehrige Verstehen
werden wir weiter unten51 noch einiges anzumerken haben, obwohl die
Probleme des historischen Verstehens im Rahmen der vorliegenden
Arbeit nur gestreift werden können.
§ 21 Der Sinn der soziologischen Kategorie der Gesellschaft
Der jeweils konkrete Sinn, gemäß welchem wir und unsere Partner in
einer gemeinsamen Situation existieren, und die Rollen, die wir darstellen
und in gewissem Sinne auch sind, bestimmen sich, wie oben52 dargelegt,
aus der Situation selbst. Daher begegnen wir in der hier in Frage stehenden
Dimension dem Anderen als Partner in dem jeweils vorliegenden und von
der Situation des Zusammenseins her ausgeprägten Sinne von Partner-
schaft : wir begegnen ihm in seiner Rolle, in der er hic et nunc existiert.
„ K o n k r e t e Existenz hic et nunc" bedeutet, daß der Partner in der
Begegnungssituation zwar aufgeht, aber seine Rolle eben auch nur hic et
nunc hat. Damit ist darauf vorgedeutet, daß er in dieser Rolle nicht
schlechthin existiert : es meldet sich ein Bereich seiner Existenz außerhalb
der Situation wie auch außerhalb der Rolle.
Während des Zusammenseins existiert der Mitmensch lediglich in einer
bestimmten Rolle. Aber dieses Zusammensein selbst hat einen Anfang
50 DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 320 f. Wenn Dilthey bemerkt, „die Taten
geschehen im Drange des Willens, um etwas zu erwirken, nicht um den Zeitgenossen
oder den Nachkommenden etwas mitzuteilen" — so ist damit auf die auch von uns oben
betonte Notwendigkeit einer Wendung von den Institutionen, Werken usw. auf die in
bestimmter Weise daran beteiligten Menschen hingewiesen.
51
Vgl. S. 195 ff.
52
Vgl. § 14.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
166 Das gebundene Zusammensein
und ein Ende. Anfang und Ende bedeuten nicht nur, daß gemeinsame
Tätigkeit und Zusammensein überhaupt irgendwann beginnen und
einmal enden. Der Anfang des Zusammenseins ist primär bestimmt durch
das Herkommen des Anderen. Das Ende bedeutet sein Fortgehen. Für
unseren Zusammenhang macht es keinen Unterschied, ob das Woher und
Wohin bestimmt ist oder nicht. Am Anfang und Ende des Zusammenseins
melden sich Existenzbereiche, in denen der Mitmensch, was immer er
auch sein und tun mag, jedenfalls nicht mein Partner und damit in jedem
Sinne frei von den uns gemeinsamen Situationen ist. Weil Anfang und
Ende auf diese Bereiche situations- und rollenfreier Existenz verweisen,
besitzen sie eine qualitativ-phänomenale Eigenschaft und bedeuten nicht
nur objektive Zeitpunkte des Anfangens und Aufhörens. Anfang und
Ende aber sind sie in bezug auf die Situation des Zusammenseins selbst.
Vom Zusammensein und der gemeinsamen Tätigkeit in ihrem Ablauf gibt
es daher in der gemeinsamen Situation selbst gelegene Verweisungen, ζ. B.
auf das Ende des Zusammenseins. Auch an diesen Verweisungen
orientiert sich die „Umsicht". Beispielsweise muß man sich mit der
Arbeit, an der man zusammen beschäftigt ist, beeilen, weil das Ende der
Arbeitszeit naht. Oder man kann einen besonderen Punkt heute mit
Rücksicht auf die vorgerückte Zeit nicht angemessen durchbesprechen
und schneidet ihn daher erst gar nicht an usw. Wenn man aufgrund von
derartigen Verweisungen auf das Ende der Situation geführt wird, kommt
auch das in den Blick, was qualitativ-phänomenal als Ende des Zusam-
menseins zu charakterisieren wäre : die Verweisung auf solche Bereiche, in
denen der Partner nicht mehr Partner ist, d.h. in denen er von der
gemeinsamen Situation, seiner und meiner Rolle frei ist. Insofern als jede
Stelle und jedes Stadium des Zusammenseins auf das Ende verweisen,
besteht jederzeit die Möglichkeit, daß jene Bereiche zum Vorschein
kommen, die, vom konkreten Zusammensein aus gesehen, Bezirke der
Freiheit, sei es meines Partners, sei es meiner selbst, sind. Hier bekundet
sich die außerhalb der gemeinsamen Situation bestehende Freiheit des
Mitmenschen eben in der Durchschnittlichkeit und Alltäglichkeit, die
dem „Wissen" um diese Freiheit als phänomenologischer Eigenschaft
zukommt 53 . An jeder Stelle und zu jedem „Zeitpunkt" des aktuellen
Zusammenseins besteht die Möglichkeit, daß sich die genannten Bezirke
der Freiheit melden ; jederzeit kann von der Situation und von den ihr
53 Es liegt hier, was das Prinzipielle angeht, genau so wie bei unserem ständigen alltäglichen
Wissen um eine Um- und Mitwelt, in der wir leben; vgl. oben S. 146.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Der Sinn der soziologischen Kategorie 167
entsprechenden Rollen auf diese Bereiche verwiesen werden54. Wie der
Partner in der aktuellen Situation aufgeht und sein konkretes
Sein nur als die Rolle hat, die er in der Situation darstellt, so
besteht — wesentlich und notwendig — jederzeit die Möglichkeit,
daß er in seiner Freiheit zum Vorschein k o m m t : als einer, der
noch außerhalb der Situation etwas ist, und — was immer er da sein
mag — jedenfalls frei ist von der aktuellen Situation und von der
Bindung an den oder die Partner, die in ihren Rollen im
aktuellen Zusammensein auftreten. Von diesen Bezirken der
Freiheit aus erhält die Situation der aktuellen Begegnung den
Charakter einer Episode (unter Umständen auch einer ständig und
regelmäßig wiederkehrenden), die das Sein in der Freiheit unter-
bricht und sich in die Bezirke, in denen man von ihr frei ist, als
in einen . H o r i z o n t ' eigener Art einbettet.
Im soeben Dargelegten gründet die wesentliche Differenz zwischen
dem Zeug in seiner Funktion und dem Mitmenschen in seiner Rolle. Die
Bestimmung der Rolle und die Ausprägung ihres Sinnes von der
Gesamtsituation her ist prinzipiell davon nicht verschieden, wie ein Zeug
seine ihm hic et nunc zukommende konkrete Funktion erhält. Darum
besteht, wie wir bemerkten55, genau in demselben Sinn das Problem der
Identität des durch seine verschiedenen Rollen sich durchhaltenden
„selben" Menschen, wie das des Dinges, das als so und so beschaffenes
vielfach verwendet werden kann, durch diese Verwendungen aber als
identisches sich durchhält. Zeug wie Partner erhalten ihre konkrete
Existenz nur als was sie hic et nunc darstellen. Dagegen meldet sich am
Zeug prinzipiell kein Bereich eigener Freiheit. Am Ende der Arbeit wird
das Gerät fortgelegt; dadurch ändert sich sein Sinn. Am nächsten Tage
holt man es wieder her. Der Partner kann nach Beendigung des
Zusammenseins ebenfalls seinen Sinn modifizieren ; er wird aber am Ende
des Zusammenseins nicht so aus seiner Bedeutungsdimension „entlassen"
wie das Zeug, das versorgt wird. Dieses „Entlassen" des Partners hat den
54 Mit Absicht sagen wir nicht, daß die in Rede stehenden Bereiche „mitbeigebracht"
werden. Wir haben das „Mitbeigebrachte" hier durchwegs in dem Sinne genommen, daß
vom Aktuellen zum „Mitbeigebrachten" die Möglichkeit eines kontinuierlichen, d. h.
von sachlichen Bezügen und Bewandtnissen geleiteten Fortgangs besteht. Diese
Möglichkeit besteht gerade hier nicht. Für die gemeinten Bereiche ist es wesentlich, daß
sie völlig außerhalb der aktuellen Situation liegen und in keinem bewandtnishaften
Zusammenhang mit ihr stehen. Nur auf die Bereiche als solche, nicht auf das, was in
ihnen liegt, ist hier verwiesen.
55 S. 164, Anm. 49.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
168 Das gebundene Zusammensein
Sinn, daß er sich in den Bereich seiner Freiheit zurückziehen kann.
Umgekehrt tritt er aus seinem Freiheitsbereich in eine gemeinsame
Situation ein. Darin liegt also der Unterschied zwischen dem Zeug und
dem Partner, daß am Anfang und Ende der Begegnungssituation solche
Bereiche, wenn auch nur unbestimmt, in den Blick kommen, in denen der
Partner von der Partnerschaft frei und in diesem Sinne sein eigener Herr
ist56.
Weil das aktuelle Zusammensein der hier in Rede stehenden Dimension
in bezug auf die Bezirke der Freiheit als unterbrechende Episode eben
dieser Freiheit erscheint, erhält das Zusammensein mit dem Partner in den
wechselseitig aufeinander bezogenen Rollen den Charakter einer gewis-
sen Wurzellosigkeit. Nur durch die Begegnungssituation selbst wird das
Zusammensein motiviert. Auf eine bestimmte Angelegenheit hin ist man
lediglich zusammen. Deshalb ist man füreinander auch nichts anderes als
die Rolle, die einem hicet ««nczufällt. Eine solche Verbindung von
Menschen ausschließlich in ihren Funktionen für eine gemein-
same Sache ist genau das, was seit Tönnies als Gesellschaft
bezeichnet wird. „Gesellschaft.. . wird begriffen als eine Menge von . . .
Individuen, deren Willen und Gebiete in zahlreichen Beziehungen
zueinander, und in zahlreichen Verbindungen miteinander, stehen, und
doch voneinander unabhängig und ohne gegenseitige innere Einwir-
kungen bleiben . . . In diesem Begriff muß von allen ursprünglichen oder
natürlichen Beziehungen der Menschen zueinander abstrahiert wer-
den."57 Eben dieses Einander-begegnen ausschließlich in konkreten
Rollen, das Einander-nichts-weiter-sein als diese Rolle, besagt, daß die
Partner „wesentlich getrennt sind und . . . getrennt bleiben trotz aller
Verbundenheiten"58. Was die Partner verbindet, ist nichts weiter als die im
Zentrum ihres Zusammenseins stehende Sache, die sie miteinander
besorgen ; nach Erledigung dieser Sache gehen sie wieder auseinander und
haben keine weitere Verbindung mehr59, wie sie auch außerhalb dieser
56 Von hier aus muß — was hier freilich nicht näher dargelegt werden kann — die Frage
nach der Selbständigkeit des Mitmenschen auch und gerade in der Partnerschaft gestellt
werden. Das im Text explizierte Phänomen stellt den eigentlichen Boden dieser
Problematik dar.
57 F. TÖNNIES, Gemeinschaft und Gesellschaft, Berlin 1926, S. 51.
58 TONNIES, a.a.O., S. 39. Vgl. auch A. VIERKANDT, Gesellschaftslehre, Stuttgart 1928, § 21,
5 : „Die Berührung findet immer nur längs eines Punktes oder einer Linie statt (je nach
dem das Verhältnis vorübergehend oder dauernd ist)."
59 Vgl. LOWITH, a.a.O., S. 158, Fußn. : „Gemeinsames sachliches Verbundensein...
verhindert. . ., daß der eine mit dem andern über das sachlich Erforderliche hinaus
überhaupt in verbindlicher Weise zusammenkommt."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Der Sinn der soziologischen Kategorie 169
ihrer Begegnung keinen Bezug aufeinander haben und einander fremd
sind. Sie kommen aus den Bezirken ihrer Freiheit zu den gemeinsamen
Situationen und gehen von diesen wieder in ihre Freiheit zurück. Außer
den aktuellen Situationen gibt es nichts, was sie verbindet. In diesem Sinne
verstehen wir die „menschliche Gesellschaft... als ein bloßes Nebenein-
ander von einander unabhängiger Personen"' 0 , ohne daß wir die
„assoziationistische" Theorie übernehmen, die in diesen und anderen
Wendungen von Tönnies anklingt. Gegen diese assoziationistische
Deutung auch der Gesellschaft polemisiert vor allem Vierkandt, der in
seinen Analysen des Tausches und des Vertrages zeigt, daß es sich dabei
um einheitliche und sinnvolle Vorgänge handelt und nicht um Summen
von Willenserklärungen, Handlungen, Manipulationen und dgl." Ob-
wohl also auch ein gesellschaftliches Zusammensein keine bloße Anhäu-
fung von Menschen und keine Summe menschlicher Äußerungen ist,
sondern ganz bestimmte „gestalthafte" Strukturen aufweist, die wir im
Vorhergehenden herauszustellen versuchten, hat es einen guten Sinn zu
sagen, daß in der Gesellschaft „die Individuen dem Verbände vorher
gehen : die Verbindung ist nur nachträglich" 62 . Der Primat der Individuen
vor den gesellschaftshaften Ganzheiten und ihre „wesenhafte Separiert-
heit" auch in den betreffenden Verbänden haben nicht den Sinn, daß diese
Verbände bloße Akkumulationen von Menschen sind, die sich lediglich
zueinander gesellen und sonst in keiner sachlichen und sinnvollen
Beziehung zueinander stehen. Vielmehr ist darunter das rein sachlich
motivierte Zusammensein zu verstehen, das allein in den Begegnungssi-
tuationen begründet ist. Diese Begegnungssituationen sind in dem Sinne
verselbständigt, daß in ihnen allein das Zusammensein der Partner
motiviert ist und in nichts, was außerhalb ihrer liegt. Nur um der Sache
willen kommen die Parnter zusammen, die außerhalb dieses Sachlichen
keine Motive haben, durch die sie zusammengeführt würden. Sie sind
füreinander ferner nur das, was sie in der um der Sache willen
entstehenden Begegnungssituation einander in ihren Rollen bedeuten.
Versteht man die „wesenhafte Separiertheit" der Individuen in eben
60 TONNIES, a . a . O . , S . 4 .
61 VIERKANDT, a . a . O . , § 2 0 , 6 f f .
62 Vgl. SCHMALENBACH, „Die soziologische Kategorie des Bundes", Dioskuren, Bd. I
(1922), S. 71 ; vgl. auch S. 73, über das Gestelltsein der „gesellschaftshaften Beziehun-
gen . . . auf ein jeweiliges Bestimmtes und als solches Einmaliges . . . Sobald das
,Geschäft' erledigt ist, treten die Individuen voneinander zurück." Übrigens hat
„Individuum" bei Schmalenbach die Bedeutung von „Einzelwesen" und steht nicht —
wie wir diesen Terminus immer gebrauchen — für „strukturierte Lebenseinheit".
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
170 Das gebundene Zusammensein
diesem Sinne, so ist sie mit einer strukturierten Gestalthaftigkeit des
aktuellen Zusammenseins keineswegs unverträglich.
Daß Partner um einer gemeinsamen Sache willen und nur auf diese hin
zusammen sind, bedeutet, daß jeder von ihnen zu dieser Sache eine ganz
bestimmte Stellung einnimmt; jeder von ihnen hat seine Absichten,
Wünsche und Interessen, deren Vertretung, Verfolgung, Verteidigung
usw. den wesentlichen Sinn seiner Rolle in der Begegnungssituation mit
ausmacht. In dieser begegnet er dem Partner in dessen Rolle und mit
dessen den seinen unter Umständen zuwiderlaufenden Tendenzen. Wo
aber Wille gegen Wille steht und man der Sache wegen aufeinander
angewiesen ist, erwachsen jene Formen des Sichverständigens, Einander-
nach-gebens, Sich-miteinander-einigens, die alle unter dem Titel des
Vertrages stehen". Das Verbundensein durch ausdrücklich oder still-
schweigend angenommene Verträge ist wiederum konstitutiv für die
Verbände, die in der Soziologie unter dem Titel der Gesellschaft befaßt
werden". Von der zentralen und repräsentativen Bedeutung des Vertrages,
für den als solchen das Prinzip des „ D o ut des" wesentlich ist, ergibt sich
wiederum das, was wir als Wurzellosigkeit dieses Zusammenseins
bezeichnen. Hier sind die Begegnungen so wenig „naturgegeben" und in
einem noch näher zu charakterisierenden Sinne65 „selbstverständlich",
daß das gemeinsame Handeln bis in Einzelheiten hinein ausdrücklich
zwischen den Partnern abgesprochen und aufgrund ihrer Abreden
„künstlich" festgelegt werden muß. Dabei bedeutet „künstlich", daß
andere Abmachungen an und für sich auch möglich sind und es teilweise
dem „Zufall" überlassen bleibt, warum diese und keine anderen getroffen
werden. Der das Zusammensein begründende „Vertrag" ist nicht für alle
Partnerschaftsbegegnungen gleichermaßen zentral. Vielmehr ändert sich
die Weise der Absprache bei solchen Partnerschaftssituationen, bei denen
es sich um einen Vertrag selbst (Tauschvertrag, Dienstvertrag usw.)
handelt. Worauf es uns hier aber ankommt, ist nur, daß das Zusammen-
sein selbst keineswegs „selbstverständlich" oder „naturgegeben" ist, d. h.
durch umfassende Lebenszusammenhänge motiviert wird. Stets bedarf es
der audrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung. Oder anders : an
und für sich hat man nichts miteinander zu tun; weil man aber an der
63 Vgl. DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 61 f. ; TONNIES, a.a.O., S. 46.
M Vgl. TONNIES, a.a.O., III, I. § 7; ferner SCHMALENBACH, a.a.O., S. 72; „Der Gesellschaft
ist charakteristisch, daß die Relationen, in denen sie besteht, in dem ,Do ut des' ihr
Prinzip haben . . . Der .Vertrag' hat hier repräsentative Bedeutung."
65 Vgl. weiter unten, § 23.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Der Sinn der soziologischen Kategorie 171
gleichen Sache „interessiert" ist, verabredet man ein Zusammenkommen
als Partner. Damit hängt ferner zusammen, daß man in einer bestimmten
Rolle (ζ. Β. in der Ausübung eines Berufes) im allgemeinen nicht jederzeit
für jeden „da ist", der die entsprechende Gegenrolle zu spielen bereit ist.
Man hat seine Sprechstunden, Dienstzeiten, Arbeitsstunden usw. Außer-
halb dieser ist man sein „freier Herr", d. h. man ist frei von der Rolle, die
man in jenen Zeiten spielt. Die Festsetzung bestimmter Zeiten, in denen
man in einer gewissen Rolle prinzipiell jedem zur Verfügung steht, gehört
zu dem Inhalt des stillschweigend angesetzten und im allgemeinen ebenso
angenommenen Vertrages, aufgrund dessen das Zusammensein zustande
kommt. — In allen diesen Phänomenen bekundet sich die Wurzellosigkeit
des Zusammenseins in der hier in Betracht gezogenen Dimension.
Aus dem Zusammensein und dem Sinn des Sich-zueinander-verhaltens
in dieser Dimension entspringt die Bedeutung der soziologischen
Kategorie der Gesellschaft als einer — wie man zu sagen pflegt — nur
lockeren, kühlen, peripheren und in menschlicher Distanz sich haltenden
sozialen Verbindung. Von hier aus muß auch die Interpretation und Kritik
jener Staats- und Gesellschaftstheorien ansetzen, welche die „mensch-
liche Gesellschaft überhaupt", d.h. das Phänomen des Sozialen als
solches, wie auch die staatliche Organisation auf Vertragsschließung
zurückführen. Wie anfechtbar diese Theorien sind, besonders hinsichtlich
ihrer Grundannahmen eines ursprünglichen bellum o m n i u m c o n t r a
o m n e s , so bringen sie doch einen berechtigten Gedanken zum Aus-
druck, dem wir allerdings in diesem Zusammenhang nicht weiter
nachgehen können.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
KAPITEL II: DIE ZUGEHÖRIGKEIT
§ 22 Die Gemeinschaft als fundierte Gemeinschaft
Man pflegt seit Tönnies den gesellschaftlichen Beziehungen in ihrer
unpersönlichen Motiviertheit und sachlichen Orientierung die g e m e i n -
s c h a f t s h a f t e n Verbundenheiten gegenüberzustellen". Indem wir uns
nunmehr den der Dimension der Gemeinschaft zuzuordnenden mit-
menschlichen Begegnungen zuwenden, fragen wir zunächst, was Ge-
meinschaft selbst und als solche wesenhaft konstituiert.
Der Kühle und inneren Distanz des gesellschaftlichen Zusammenseins
steht entgegen die menschliche Wärme, das Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit und Gemeinsamkeit, die Gesinnung des Wohlwollens, der
Solidarität und der gegenseitigen Förderung usw., d. h. alles, was unter
den Ausdrücken „Sich-nahe-sein" und „Sich-nahe-fühlen" befaßt wer-
den kann67. Gefühle von der Art der genannten, besonders das Gefühl
„der Zusammengehörigkeit und inneren Verbundenheit", sind für G.
Walther68 geradezu das, was Gemeinschaft wesentlich konstituiert. Wenn
eine Anzahl von Arbeitern verschiedener Nationalität einen Bau errich-
ten, so besteht nach Walther keine Gemeinschaft zwischen ihnen. Sie
bilden lediglich einen gesellschaftshaften Verband, der so lange besteht, als
" Uber die dritte soziologische Kategorie, vgl. Kapitel III dieses Abschnittes. —
VIERKANDT meint (a.a.O., S. 233 f.), daß die Gegenüberstellung von „Gemeinschaft" und
„Gesellschaft" nicht „die Gesamtheit aller möglichen Sozialformen" erschöpft (vom
„Bunde" spricht er nicht) ; stellt selbst drei „außergemeinschaftliche Grundverhältnis-
se" auf („Rechts- oder Anerkennungsverhältnis", „Kampfverhältnis" und „Machtver-
hältnis"). Allerdings fallen, wie er selbst sagt, diese drei „Grundverhältnisse" unter den
Tönniesschen Begriff der „Gesellschaft", wenn man diesen nur hinreichend weit faßt.
" Vgl. VIERKANDT, a.a.O., § X X X , 20. Vgl. ferner S. 246: „Bei dem ersteren [dem
persönlichen Verhältnis] sind die Beteiligten durch Seele und Geist zusammen, bei dem
letzteren [dem sachlichen Verhältnis] nur durch den Geist verbunden."
68 G. WAUTHER, „Zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften", Jahrbuch für Philosophie
und phänomenologische Forschung, Bd. VI (1923). Ähnlich auch M. WEBER, Wirtschaft
und Gesellschaft, Teil I, Kap. I § 9 [S. 21]: „Vergemeinschaftung" soll eine soziale
Beziehung heißen, wenn und soweit die „Einstellung des sozialen Handelns. . . auf
subjektiv gefühlter (affektueller oder traditioneller) Zusammengehörigkeit der
Beteiligten beruht." Zu M. Weber vgl. SCHMALENBACH, a.a.O., S. 89.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Gemeinschaft als fundierte Gemeinschaft 173
sie auf ein ihnen gemeinsames intentionales Objekt (eben den Bau)
gerichtet sind, einander in die Hände arbeiten (in „intentionaler
Wechselwirkung"" stehen). All dies schließt nämlich nicht aus, daß diese
Arbeiter einander gleichgültig sind (weil sie beispielsweise verschiedene
Sprachen sprechen), noch daß ihre Beziehungen durch Feindseligkeiten
aller Art belastet werden. Tritt aber anstelle einer solchen negativen
Gesinnung oder der Gleichgültigkeit eine positive Gesinnung, kommt
ferner ein Gefühl „innerer Verbundenheit", „innerer Einigung" und
„Zusammengehörigkeit" hinzu, so konstituiert sich zwischen ihnen eine
Gemeinschaft. Mit dem Auftreten der genannten Gefühle und Gesinnun-
gen springt geradezu „Gesellschaft" in „Gemeinschaft" um. Danach
wären also G e f ü h l e und G e s i n n u n g e n für die Gemeinschaft konsti-
tutiv70. Dabei stellen diese Gefühle und Gesinnungen subjektive Zutaten
dar, die zu dem Miteinanderleben und -arbeiten hinzukommen und
deshalb auch fehlen könnten, weil sie selbst darin nicht fundiert sind. Am
Typus des vorliegenden Zusammenseins ändert das Hinzukommen der
erwähnten Gefühle und Gesinnungen gar nichts: unabhängig von allen
positiven oder negativen Gesinnungen und Gefühlen sind sie auf eine
gemeinsame Sache hin als Mitarbeiter orientiert. Für ihr Handeln besagt
das Hinzukommen jener Gefühle nichts, wenn wir einmal von der
Möglichkeit absehen, daß beispielsweise die Feindseligkeit ein Zusam-
menarbeiten unmöglich macht. Diese hinzukommenden Gesinnungen
sind für die Art des Zusammenseins um so bedeutungsloser, als die
Arbeiter — wie G. Walther ausdrücklich betont — genau wissen, daß ihre
Gemeinschaft von zeitlich begrenzter Dauer ist.
Aus all dem ergibt sich: Gemeinschaft ist gar nicht eine eigene und
besondere Dimension mitmenschlichen Zusammenseins. Vielmehr läßt
sie sich kennzeichnen als „gesellschaftliches Gebilde + hinzukommende
positive Gesinnungen und Gefühle". Das Recht, hier von bloß hinzu-
kommenden Zutaten zu sprechen, liegt darin, daß die betreffenden
Gesinnungen in der konkret vorliegenden Partnerschaft selbst, d. h. in der
Art und Weise, wie die Partner zusammen sind (im Beispiel: in ihrer
Mitarbeiterschaft an einem und demselben Bau) nicht begründet und
" Zur Definition der „intentionalen Wechselwirkung", siehe WALTHER, a.a.O., S. 22.
70 Daher ist es nur konsequent, wenn WAITHER (a.a.O., S. 33) sagt : „Alle sozialen Gebilde,
. . . Verbände, Anstalten usw. im Sinne Max Webers würden wir. . . unter dem
Sammelbegriff der gesellschaftlichen Gebilde zusammenfassen, so lange dieses
Merkmal fehlt." Aber gerade das, was Weber „Anstalt" nennt (vor allem „Kirche" im
Gegensatz zur „Sekte") hat spezifischen Gemeinschaftscharakter. Siehe auch weiter
unten S. 205 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
174 Das gebundene Zusammensein
motiviert sind. Daher kann jedes gesellschaftliche Verhältnis in ein
gemeinschaftliches übergehen, ohne daß an dem Zusammensein selbst
und überhaupt an seinem phänomenologischen Charakter sich etwas
ändert. Das ist insofern streng und wörtlich zu verstehen, als nach
Walther71 all das, was für eine Gesellschaft konstitutiv ist, auch bei der
Gemeinschaft vorliegt, nur daß dabei ein weiteres Merkmal wirksam ist.
Stellen wir nun diese Ansicht einer Uberprüfung willen einzelnen
sozialen Phänomenen gegenüber. Es zeigt sich, daß beispielsweise das
konkrete Zusammensein einer Bauernfamilie sich in weitere umfassende
Lebenszusammenhänge eingliedert und aus diesen her geradezu als eins
ihrer Momente erwächst. Deshalb liegt hier keine Begegnung von
Partnern in ihren Rollen vor, und deshalb sind sich die Gemeinschaftsan-
gehörigen auch in einer konkreten Arbeitssituation etwas anderes als
Rollen. Denn daß sie hic et nunc miteinander arbeiten, motiviert sich aus
dem Ganzen des gemeinsamen Lebens. Gerade darin liegt der entschei-
dende Unterschied gegenüber dem Verhältnis eines wohlwollenden
Arbeitgebers zu einem seiner Arbeitnehmer. Das Zusammensein in der
Arbeit ist hier bei allem Wohlwollen selbständig. Es erwächst nicht aus
übergreifenden Zusammenhängen und ist nicht in einer Lebensgemein-
schaft fundiert und durch diese motiviert. Nur in der gemeinsamen Arbeit
sind Arbeitnehmer und Arbeitgeberizusammen. Außerhalb ihrer gibt es
nichts Einendes. Bei allem Wohlwollen und aller menschlichen Teilnahme
gibt es hier keinen umfassenden Lebenszusammenhang, durch den der
Einzelne auch außerhalb der konkreten Partnerschaftssituationen ver-
bunden wäre. Sieht man, wie wir es tun, in einem solchen umfassenden
Lebenszusammenhang das Kennzeichen einer jeden Gemeinschaft, so
wird man weder bei unserem zweiten Beispiel noch bei dem von Walther
angeführten von „Gemeinschaft" sprechen, sondern von einer Partner-
schaft, zu der eben bestimmte Gefühle und Gesinnungen hinzukommen.
Aus dem Dargelegten folgt, daß die genannten Gefühle jedenfalls nicht
Gemeinschaft als solche begründet. Wo sie vorliegen, erwachsen sie aus
einer bereits bestehenden und anderweitig konstituierten Gemeinschaft.
Von hier aus ergibt sich eine weitere Bestätigung der These Schmalen-
bachs, der zufolge die Gemeinschaft in Gefühlen weder ihre Realität noch
ihre Basis hat, d. h. „die Gefühle selber auf eine Gemeinschafts-,Basis' als
auf ein ihnen Vorausliegendes" hinweisen : sie „sind nur die nachträgli-
chen, in die Sphäre des Bewußtseins heraufgekommenen Ausdrucksfor-
71 V g l . WAITHER, a . a . O . , S. 2 9 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Gemeinschaft als fundierte Gemeinschaft 175
men, ja sie sind Produkte, Erzeugnisse der an sich schon bestehenden
Gemeinschaft" 72 . Weil Gefühle nicht das Konstituens von Gemeinschaft
sind, ändert sich an dem Gemeinschaftscharakter eines konkreten
Verbandes als einer Gemeinschaft — wie Schmalenbach gegenüber
Tönnies geltend macht — dadurch nichts, wenn anstelle der positiven
Gesinnungen und Gefühle Streitigkeiten und Rivalitäten treten, z . B .
Familienhader, Nachbarschaftszwist usw. So wenig sich durch das
Hinzutreten positiver Gefühle ein Partnerschaftsverhältnis als solches
ändert, so wenig wird zunächst eine bestehende Gemeinschaft durch
jene negativen Einstellungen modifiziert. Allerdings kann sie im Verlauf
von negativen Einstellungen zerstört oder sogar aufgelöst werden. Das
alles aber erst i n f o l g e der inneren Auseinandersetzungen und nicht
schon in diesen selbst.
Das angeführte Beispiel der bäuerlichen Familie läßt erkennen, daß für
Gemeinschaft ein umfassender Lebenszusammenhang wesentlich ist.
Dieser Lebenszusammenhang, der die Gemeinschaft als solche ausmacht,
schwebt aber nicht sozusagen im Leeren. Vielmehr besitzt der Lebenszu-
sammenhang selbst eine Basis, auf der die Gemeinschaft gründet und in
der sie wurzelt. Diese Basis ist der g e m e i n s c h a f t l i c h e B e s i t z . So z.B..
für die Familie der gemeinschaftliche Wohnraum, der in einfacheren
Verhältnissen (in Europa: vor Ausbildung des Hochkapitalismus) gleich-
zeitig gemeinschaftliche Arbeitsstätte ist; für die Dorfgemeinde „das
D o r f " und der Gemeindebesitz (Allmend) ; für die Städter ihr gemeinsa-
mer Wohnort, „die Stadt", und der Besitz der Allgemeinheit usw." Wo
immer Gemeinschaft besteht, da ist ein solcher gemeinschaftlicher Besitz.
Daß es sich um g e m e i n s c h a f t l i c h e n B e s i t z handelt, besagt: die
71 SCHMALENBACH,'Die soziologische Kategorie des Bundes, S. 54 ff. Ähnlich VIERXANDT,
a.a.O., S. 211 f., der in der 1. Auflage seines Werkes (1923), § 25, noch „Wesensgemein-
schaft" und „Erlebnisgemeinschaft" unterschieden hatte (was dort „Erlebnisgemein-
schaft" heißt, beruht auf purer Gefühlsansteckung im Sinne SCHELERS, Sympathie, S.
12 ff. [G. W. 7, S. 25 ff.], und stellt eigentlich gar kein Miteinander im prägnanten Sinne
dar) : „Von einer Gemeinschaft kann bei einem gemeinsamen Erlebnis nur dann die Rede
sein, wenn dieses als eine Gemeinschaftsangelegenheit empfunden wird. Damit dies aber
eintreten kann, muß ein Gemeinschaftsbewußtsein bereits vorhanden sein." Weil dies
„radikal anders beim ,Bunde' ist", für den nämlich Gefühlserlebnisse konstitutiv sind,
kommt Schmalenbach zur Abgrenzung der Gemeinschaft vom Bunde, den er als eigene
und eigenständige soziologische Kategorie herausstellt. Aus diesem Grunde können wir
den von WAIXHER, a. a. O., S. 34 ff. beschriebenen Vorgang der „inneren Einigung", nun
abgesehen von Einzelheiten der Deskription und deren Voraussetzungen (d. h. dem
traditionellen Ansatz ursprünglich isolierter Subjekte), nicht als Entstehung von
Gemeinschaft gelten lassen.
73 V g l . TÖNNIES, a . a . O . , I ; § § 6 , 1 2 f . u n d 1 5 f f .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
176 Das gebundene Zusammensein
Angehörigen der Gemeinschaft haben nicht etwa gleiche oder proportio-
nale Anteile an ihm, wie das z.B. für den Besitz eines Konsortiums der
Fall ist. Vielmehr gehört der ganze ungeteilte Besitz jedem Angehörigen
der Gemeinschaft als einem, der dazu (d. h. zu den Anderen und zum
Besitz) gehört. Weil der gemeinschaftliche Besitz74 auf eine Gesamtheit
von Menschen bezogen ist, und weil diese Menschen in ihm die
Grundlage ihrer Gemeinschaft haben, ist „gemeinschaftliches Leben . . .
gegenseitiger Besitz und Genuß, und ist Besitz und Genuß gemeinsa-
mer Güter" 75 . Daher wird, worauf Vierkandt76 aufmerksam gemacht hat,
beim Austausch von Gütern und Dienstleistungen, der auch in der
Gemeinschaft, ζ. B. in der Familie, in der patriarchalischen Hausgemein-
schaft usw. vollzogen werden kann, nicht nach dem Prinzip „ D o ut
d e s " verfahren, so wenig wie Leistung und Gegenleistung ihrem
beiderseitigen Wert nach abgewogen wird77. Die herausgestellte Eigenart
von gemeinschaftlichem Besitz tritt noch deutlicher zutage, wo es sich
nicht um ökonomischen Besitz und nicht um Handgreifliches handelt78.
So ist eine Familie außer durch den Familienbesitz geeint auch durch die
Familien t r a d i t i o n . Es herrscht ein bestimmter „Geist" im Hause, der
einen bestimmten Lebensstil vorschreibt. In der Dorfgemeinde, in einer
Landschaft bestehen gewisse Bräuche und Sitten, z.B. Trachten, der
Dialekt der Gegend usw. Die antike πόλις hatte ihre Stadtgottheit, in
deren Schutz sie stand, und deren Kultur sie geweiht war79. Wenn wir
heute von der Atmosphäre einer Stadt sprechen, so meinen wir eine solche
Gemeinsamkeit der Bewohner, in der auch der „Gemeinsinn" seine
Wurzel hat. Als Grundlage der Gemeinschaft eines Volkes fungiert neben
dem gemeinsamen Land die nationale Sprache, die Vergangenheit des
74 Vgl. die Unterscheidung vom Besitz und Vermögen bei TONNIES, a.a.O., III, S. 5.
75 TONNIES, a . a . O . , S. 23.
76 VIERKANDT, a . a . O . , S. 2 5 1 .
77 Vgl. hierzu auch TONNIES, a.a.O., §§ 19 ff.
78 Wenn WALTHER, a.a.O., S. 24, meint, der „gemeinsame intentionale Lebensinhalt", der
für Gemeinschaft mit konstitutiv ist, könne „realer Besitz" sein, brauche es indes nicht
zu sein, müsse aber auch in diesem Falle irgend eine Beziehung zur Realität aufweisen
und könne nicht absolut losgelöst sein von aller „vergangenen, gegenwärtigen und
künftigen Realität" — so stimmen wir in der Sache mit ihr überein. Allerdings wollen wir
den an sich schon belasteten Terminus „Realität" hier um so mehr vermeiden, als auch
das, was außer dem „realen Besitz" in Betracht kommt, in einem bestimmten, hier nicht
näher darzulegenden Sinne „real" heißen muß. Der Sache nach ist das von Walther als
„real" Bezeichnete das ökonomische und überhaupt das Handgreifliche. Zu diesem hat
der sonst noch vorliegende gemeinschaftliche Besitz in der Tat immer eine bestimmte,
wenn auch jeweils andere Beziehung.
79 TONNIES, a . a . O . , S. 15.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Gemeinschaft als fundierte Gemeinschaft 177
Volkes, sein Staat, seine Kultur usw. Religiöse Gemeinschaften wiederum
beruhen auf dem Glauben, dem Kultus und den Riten. Durch diesen
Glauben konstituieren sich diese Gemeinschaften, die, wo es sich um rein
religiöse handelt (solche gibt es freilich erst in historisch relativ später
Zeit), geradezu solche im Glauben sind. Die Kultstätten werden zu
Zentren der Gemeinschaften und sind deshalb sichtbarer Gemeinschafts-
besitz, weil an ihnen das konkrete Gemeinschaftsleben sinnenfällig in
Erscheinung tritt.
Gerade die zuletzt genannten Besitztümer sind für das Dasein der
Gemeinschaft von größter Wichtigkeit. Man pflegt hier von „objektivem
Geist" zu sprechen, um die Unabhängigkeit von psychischen Aktualisie-
rungen zu betonen80. Demgegenüber ziehen wir den Vierkandtschen
Terminus „Lebensordnung der Gruppe" vor, weil er die wesentliche
Gebundenheit der in Rede stehenden Gebilde zum Ausdruck bringt81. Sie
sind Lebensordnungen nicht allein in dem Sinne, daß sie das Verhalten der
Gemeinschaft und der Gemeinschaftsangehörigen regeln; diese Bedeu-
tung können sie erst sekundär in Anbetracht möglicher Verstöße
gewinnen'2. Ihre zentrale Bedeutung liegt darin, daß sie die Gemeinschaft
zu dieser ganz bestimmten konstituieren. In diesen Lebensordnungen lebt
die Gemeinschaft in ausgeprägter Weise. Das Leben ist nicht nur auf die
betreffenden Gebilde hin gerichtet; — es verläuft auch in ihnen, wie es
nur von diesen Gebilden her zu verstehen ist. So bestimmt z . B . eine
Tradition die Art und Weise, wie Menschen leben. Primär ist sie keine
Norm, an der das Verhalten gemessen wird, denn dafür ist wesentliche
Voraussetzung, daß man von der Tradition abweichen kann, d. h. daß die
fraglose Selbstverständlichekt, in der die ungebrochene Tradition „exi-
stiert", irgendwie, indem sie befolgt wird, gelockert ist. Vielmehr besteht
ihre primäre Bedeutung darin, daß das Leben der betreffenden Menschen
ein solches in der Tradition ist, d. h. ein Leben ganz bestimmten Stils und
ganz bestimmter Art. Ferner tritt nicht zu „fertigen", voll ausgebildeten
Individuen Traditionelles gewissermaßen nachträglich hinzu, sondern die
80 Auf die Problematik des „objektiven Geistes" können wir in diesem Zusammenhange
nicht eingehen. Vgl. die Darlegung des Problems der „Existenz der Kultur" bei
SPRANGER, Zur Theorie des Verstebens und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie, § 3,
der diese Existenz ausdrücklich vom Sein der „idealen Gegenstände" abhebt.
81 VIERKANDT, a.a.O., § 33; vgl. auch S. 334 f. Hierher gehören auch die Ausführungen
SCHELERS über die „relativ natürliche Weltanschauung" ; vgl. Wissensformen, S. 59 ff. [G.
W. 8, S . 61 ff.].
82 Damit hängt übrigens die von SPRANGER, a.a.O., S. 383 f. bemerkte Nachträglichkeit des
„Wertungscharakters" zusammen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
178 Das gebundene Zusammensein
Menschen sind gerade die und keine anderen, weil sie in dieser Tradition
stehen. Die Bedeutung der hier gemeinten Besitztümer liegt also darin,
daß sie für das Leben der Gemeinschaft und für diese selbst sinnprägend
sind. Freilich hat das Leben in diesen Ordnungen den Charakter der
Selbstverständlichkeit.
Für die Konstitution von Gemeinschaft sind diese Gebilde vielleicht
noch entscheidender als der ökonomische Besitz. Denn erst aufgrund
ihrer erwächst die Möglichkeit eines gemeinschaftlichen Lebens im
gegenseitigen Einverständnis83. Indem das Leben so und so geordnet ist,
diese ganz bestimmte Gestaltung hat, aber als solches niemals zur Wahl
stand, niemals ausdrücklich angenommen oder irgendwie fraglich wurde,
führt man in dem daraus sich ergebenden Sinne ein Leben, eben das
gemeinschaftliche Leben, in dem man geeint ist. Man versteht einander im
Zusammenleben durch das unausdrückliche Gebrauchmachen dessen,
was sich so von selbst versteht und woran alle Anteil haben. Weil das
Einanderverstehen im Medium des Selbstverständlichen vor sich geht,
wirft es grundsätzlich keine Probleme und Schwierigkeiten auf. Aus
diesem Grunde aber ist das Verstehen eines „Fremden" zuweilen bis zur
Unmöglichkeit erschwert.
An diesem „geistigen" Besitz hat wie am ökonomischen jeder
Gemeinschaftsangehörige Anteil in dem bereits herausgestellten Sinne,
daß der ganze und ungeteilte Besitz ihm wie allen Anderen gehört. Der
Besitz aber, an dem er Anteil hat, ist in jedem Modus der Anteilhabe
gemeinschaftlicher Besitz und als solcher wesentlich charakterisiert. Das
bedeutet: die hier gemeinten Besitztümer, welcher Art sie auch sein
mögen, begegnen immer von der Gemeinschaft her und in einer
wesentlichen Bezogenheit auf diese. Auf dieser Bezogenheit, die eine
„selbstverständliche" und „naturhafte" ist, gründet der Charakter des
Gewohnten und Vertrauten". Insofern aber diese Zugehörigkeit eine
solche gemeinschaftshaften Charakters ist und keine persönlich-individu-
elle, verweist sie auf das „Mitbeigebrachtwerden" von Menschen, die
ebenfalls zu der betreffenden Gemeinschaft gehören85. Als Gemein-
83
Vgl. TÖNNIES, a.a.O., S. 19 f. und 224 f. über den „consensus".
84
Auf dasselbe weist auch TÖNNIES hin, obgleich er sich in seinen Ausführungen über
Gewohnheit und Gedächtnis (a.a.O., II, §§ 7 f.) auf Assoziation von Ideen und einen
entsprechenden Begriff von Erfahrung und Übung beruft. Was aber vertraut und
gewohnt ist, das sind Denkweisen, Handlungsabläufe, Lebensordnungen und dgl.,
niemals aber assoziierte Ideen, Vorstellungen, Lust- und Unlustempfindungen.
85
Darin liegt eine der Artikulationen der allgemeinen Verweisung auf die Mitwelt, von
denen auf S. 146 f. die Rede ist.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Geschichtlichkeit 179
schaftsangehörige werden sie „mitbeigebracht" ; und das bedeutet auch,
daß sie „Zugehörige" sind, freilich in einem Sinne, den aufzuklären den
folgenden Analysen vorbehalten ist.
§ 23 Die Geschichtlichkeit
Man kann in Gemeinschaftsverhältnisse nicht nach Belieben eintreten
noch sich aus ihnen lösen, wie dies in Bezug auf Partnerschaftsverhältnisse
möglich ist und jederzeit auch geschieht. Die für die Partnerschaft
charakteristische Freiheit des Zusammenkommens und Auseinanderge-
hens besteht hier nicht. In der Gemeinschaft befindet man sich je schon als
Angehörige. Man wird in die Gemeinschaft hineingeboren, wächst in ihr
auf und in sie hinein. Diese Wachstumsprozesse vollziehen sich nicht
allein ohne eigenes Zutun und damit ohne Freiheit, sie kommen als solche
auch gar nicht „zu Bewußtsein". Das bedeutet: das Hineinwachsen hat
phänomenologisch immer den Sinn eines Hineingewachsenseins, das
Dazugehören ist ein Von-jeher-dazu-gehört-haben usw. Zu der Gemein-
schaft gehört man in dem Sinne, daß man immer schon zu ihr gehört hat,
von jeher in ihr gelebt hat, mit ihr verwachsen, d. h. in sie hineingewach-
sen ist. In diesem Sinne begreifen wir mit Schmalenbach" die Gemein-
schaft als „den Verband . . ., der auf Grund der .natürlichen',,naturhaf-
ten' Zusammengehörigkeiten erwächst". Dabei ist, wie es auch Schmalen-
bach tut, das „Naturhafte" in dem modifizierten Sinne zu verstehen, daß
es alle „selbstverständlichen Gegebenheiten und Vorfindlichkeiten"
umfaßt, wozu Sitte, Brauch, Vorstellungsweisen und Traditionsgut aller
Art gehören, ferner aber auch ökonomischer Besitz, lokale Nachbarschaft
und dgl. „Alles, . . .was man gemeinsam ererbt hat, in das man
gemeinsam hineingeboren oder hineingewachsen und durch das man mit
anderen zusammengeboren oder zusammen-gewachsen ist." Solche
Gegebenheiten begründen und fundieren die Gemeinschaft als „naturhaf-
ten" Verband darum, weil sie selbst „naturhaft" im Sinne der Selbstver-
ständlichkeit und Fraglosigkeit sind. Für die hier gemeinte „Nahrhaftig-
keit" und Selbstverständlichkeit ist eben das „Von-jeher" kennzeichnend
86 SCHWALENBACH, a.a.O., S. 41 und 45 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
180 Das gebundene Zusammensein
und im „Schon-immer" besteht denn auch die Verbindlichkeit alles
Traditionalen als solchen87.
Wenn wir also einer bestimmten Gemeinschaft angehören, so bedeutet
dies, daß wir mit anderen Menschen zusammen in bestimmte Traditions-
güter hineingewachsen sind; entsprechend ist auch die menschliche
Zugehörigkeit zu den Anderen, wo sie ausdrücklich und „bewußt" ist 88 ,
ein traditionelles Miteinanderverwachsensein. Für Gemeinschaft ist also
Traditionales in einem doppelten Sinne konstitutiv : zum einen ist der die
Gemeinschaft fundierende gemeinschaftliche Besitz selber traditional,
wobei es gleichgültig ist, ob er den in ihr jetzt lebenden Menschen von
ihren Vorfahren her überkommen wurde, oder ob er sich in ihrem
Zusammenleben erst gebildet hat. Zum anderen hat auch der das
gemeinschaftshafte Zusammensein tragende umfassende Lebenszusam-
menhang, welcher die aktuellen Begegnungen und Begegnungssituatio-
nen umgreift, ein traditionelles Merkmal. Als solches ist das Zusammen-
sein weder im Sachlichen (wie die Partnerschaft) noch im Emotionalen
(wie der „Bund") 89 fundiert, sondern ruht in sich selbst und hat seinen
Grund wie seine Legitimation in der ihm eigenen Traditionalität. — Diese
Betonung des Traditionalen als Konstituens der Gemeinschaft steht in
einem gewissen Widerspruch zum Hinweis von Tönnies und von
Schmalenbach auf die Bindung durch die Blutsverwandtschaft90, ein
Hinweis, der um so näher liegt, als man die Familie als Paradigma von
Gemeinschaft anzusehen pflegt. Jedoch ist die Frage, ob die Blutsver-
wandtschaft für sich allein die Gemeinschaft zu begründen vermag,
darum eine eher belanglose Frage, weil das Zusammenleben der Familie
immer ein solches an einem gemeinsamen Orte und in einem gemeinsa-
men „Geiste" ist, d.h. ein in gemeinschaftlichem Besitz fundiertes
Zusammenleben. Das kommt auch bei den genannten Autoren zur
87 Im Hinblick auf einige von Schmalenbach angeführte Grenzfälle sei bemerkt, daß es
einzig und allein auf den p h ä n o m e n o l o g i s c h e n Charakter des „Von-jeher" und
„Schon-immer" ankommt und nicht darauf, auf welchen objektiven Zeitraum sich
dieses bezieht.
88 Daß es auch Gemeinschaften gibt, die nicht ausdrücklich werden und nicht einmal
„bewußt" sind, zeigt der Hinweis Schmalenbachs auf Sprachgemeinschaft, Rassege-
meinschaft und dgl. ; auch die Volksgemeinschaft gehört hierher. Allerdings können
diese Gemeinschaften unter besonderen Umständen nicht nur ausdrücklich bewußt
werden; vielmehr kann zu ihnen auch ein „Bund"-Verhältnis treten; vgl.'SCHMALEN-
BACH, a . a . O . , S. 6 8 .
89 Vgl. weiter unten, § 26.
90 TONNIES, a . a . O . , I , §§ 1 f. ; SCHMALENBACH, a . a . O . , S . 45 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Geschichtlichkeit 181
Geltung. Obwohl nach Tönnies'1 „Gemeinschaft, als Verbindung des
,Blutes', zunächst ein Verhältnis der Leiber" ist und erst sekundär zu
einer Beziehung auf Gegenstände sich modifiziert, „entwickelt und
besondert sich die Gemeinschaft des B l u t e s , als Einheit des Wesens, zur
Gemeinschaft des O r t e s , die im Zusammenwohnen ihren unmittelbaren
Ausdruck hat, und diese wiederum zur Gemeinschaft des G e i -
stes . . . " ' 2 . Die besondere „soziale Kraft und Sympathie, die Menschen
als Glieder eines Ganzen zusammenhält" ist das „Verständnis (consen-
sus)" als „der einfachste Ausdruck für das innere Wesen und die Wahrheit
alles echten Zusammenlebens, Zusammenwohnens und Wirkens"' 3 .
Noch klarer und schärfer als Tönnies betont Schmalenbach'4, daß die
bloße Tatsache der Blutsverwandtschaft nicht hinreicht, um Gemein-
schaft zu begründen, und daß auch das „Wissen" um diese nur darum nur
so etwas wie „Gemeinschaftsbewußtsein" entstehen läßt, weil „in der
,äußeren', ,physischen' Blutsverwandtschaft zugleich etwas ,Inneres',
.Psychisches' gesehen wird : eine .seelische Blutsverwandtschaft' " . Diese
„seelische Blutsverwandtschaft" bedeutet aber nichts anderes als das
Leben in und Teilhaben an einem gemeinschaftlichen „Geiste", der für die
betreffende Gemeinschaft ein tradierter ist, ohne als solcher ausdrücklich
bewußt zu sein.
In den vorstehenden Ausführungen tritt bereits die dem Zusammensein
in der Gemeinschaft immanente und wesentliche H i s t o r i z i t ä t hervor.
Der umfassende Lebenszusammenhang, den die Gemeinschaft darstellt,
und in dem wir mit den jeweiligen Anderen verbunden sind, beruht zwar
in sich selbst, ragt aber in die Vergangenheit hinein und hat in dieser seine
Wurzeln. Das hat schon Tönnies in seiner Theorie vom „Wesenswillen
und Kürwillen" bemerkt, mit der er die Unterscheidung von „Gemein-
schaft" und „Gesellschaft" psychologisch untermauert. Der der Gemein-
schaft entsprechende „Wesenswille beruht im Vergangenen und muß
daraus erklärt werden, wie das Werdende aus ihm"' 5 . Dagegen läßt sich
der „Kürwille", dem die Gesellschaft entspricht, „nur verstehen durch
das Zukünftige selber, worauf er bezogen ist". Wenn wir einer bestimm-
" TÖNNIES, a.a.O., S. 53.
92 TONNIES, a.a.O., I, § 6.
' 3 TONNIES, a.a.O., I, § § 9 f.
94 SCHMALENBACH, a.a.O., S. 49 f.
95 TONNIES, a.a.O., S. 86; vgl. auch S. 127. Auf diese psychologische Theorie des Willens
können wir hier nicht eingehen ; ihre Bedeutung für Tönnies wird in der Bemerkung
deutlich : „ebenso wie die Willensformen verhalten sich ganze Menschen zueinander" (S.
130).
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
182 Das gebundene Zusammensein
t e n G e m e i n s c h a f t a n g e h ö r e n , s o sind w i r an die Vergangenheit g e b u n d e n
u n d stehen m i t ihr u n d m i t v e r g a n g e n e n G e n e r a t i o n e n in einer e i g e n t ü m -
lichen Relation' 6 . D i e s e V e r b i n d u n g ist aber keine „ ä u ß e r l i c h e " . V i e l m e h r
hat sie d e n Sinn des Verwurzeltseins in der Vergangenheit u n d des
H e r k o m m e n s v o n ihr. D u r c h u n s e r e Z u g e h ö r i g k e i t zu einer b e s t i m m t e n
G e m e i n s c h a f t sind w i r je s c h o n als v o n da u n d da k o m m e n d , da u n d d a
v e r w u r z e l t , als aus diesen u n d jenen h i s t o r i s c h e n K r ä f t e n g e w a c h s e n
b e s t i m m t . Dieses h i s t o r i s c h e „ S c h i c k s a l " b e s t i m m t uns in u n s e r e m Sein' 7 .
Es b e s t i m m t die A r t u n d W e i s e , w i e w i r die W e l t u n d uns selbst
v e r s t e h e n " , u n d auferlegt u n s e r e m L e b e n eine R i c h t u n g . D i e s e existen-
tielle B e d e u t u n g hat die Vergangenheit d a r u m ( u n d k a n n sie n u r d a r u m
h a b e n ) , weil das Vergangene, v o n d e m hier die R e d e ist, n i c h t das n u r
G e w e s e n e ist, das fertig u n d abgeschlossen h i n t e r uns liegt. D a ß letzteres
n i c h t der Fall ist, hat S c h e l e r " m i t N a c h d r u c k h e r v o r g e h o b e n . Die
Vergangenheit, an die w i r angeschlossen sind, lebt in uns, w i r f ü h r e n sie
w e i t e r , h a b e n sie als u n s e r E i g e n e s . W i r sind — w i e H e i d e g g e r sagt —
" In primitiveren Verhältnissen gehören auch die Toten zur Gemeinschaft und bilden —
wie VIERKANDT, a.a.O., S. 444 f. ausführt — mit den Lebenden „eine einzige Familie und
zugleich eine einzige Gemeinschaft". Vgl. hierzu L. LÊVY-BRUHL, Les fonctions mentales
dans les sociétés inférieures, Paris 1928, Kap. Vili. V. — Das bekannteste Beispiel dafür
ist der Ahnenkult der Chinesen.
97 SCHMALENBACH spricht in diesem Zusammenhang von einer „Modifikation, die der
seelische .Grund' in uns, das .Unbewußte' erfahren hat" (a. a. O., S. 52).
98 Vgl. HEIDEGGER, Sein und Zeit, S. 20: „Das Dasein ist je in seinem faktischen Sein, wie
und . . . ,was' es schon war. Ob ausdrücklich oder nicht, ist es seine Vergangenheit. . .
Das Dasein ist in seiner jeweiligen Weise zu sein und sonach auch mit dem ihm
zugehörigen Seinsverständnis in eine überkommene Daseinsauslegung hinein- und in ihr
aufgewachsen." Auf die Konstitution der Geschichtlichkeit in der Zeitlichkeit und die
Probleme dieser Konstitution (a. a. Ο., II, Kap. V, VI) gehen wir hier nicht ein.
" SCHELER, Sympathie, S. 40 f. [G. W. 7, S. 49]: „Wir leben hier I Η der Vergangenheit -
ohne daß uns der Akt des Erinnerns mitgegeben ist, der uns in die Vergangenheit führte,
und eben darum, ohne zu wissen, es sei die Vergangenheit, in der wir leben." — Mit
Rücksicht auf die existentielle Bedeutung der Vergangenheit, kann man die Traditions-
bildung und -Übertragung nicht als Ansteckung begreifen, wie das Scheler tut. Denn hier
handelt es sich nicht um Übernahme von Gefühlszuständen, einzelnen Wertungen,
Urteilen usw., was bei der Ansteckung der Fall ist, sondern um das Sichhineinleben in
bestimmte Haltungen, Weltanschauungen, Lebensauffassungen und dgl. Eben weil das
Hineinwachsen des Kindes in die Tradition seines Elternhauses bestimmend ist,liegthier
etwas prinzipiell anderes vor als da, wo das Kind irgendwelche Urteile seiner
Umgebung mitvollzieht, die nur als einzelne Urteile in Betracht kommen und nicht aus
dem in seiner Umgebung herrschenden „Geist" hervorgehen. Daher ist alles, was wir
durch Ansteckung übernehmen, seinem Wesen nach vergänglich und flüchtig, während
die Tradition, in die wir gewachsen sind, von sich aus die Intention auf Dauer und
Bestand hat, wie auch das Zusammensein in der Gemeinschaft an sich selbst die Tendenz
auf Dauer hat.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Geschichtlichkeit 183
immer schon unsere Vergangenheit. Das Historische hängt uns nicht an,
sondern bestimmt uns unserem Wesen nach, weil es eine uns überkomme-
ne lebendige, d. h. in uns lebende Kraft ist.
Damit bestimmen wir uns als w e s e n t l i c h g e s c h i c h t l i c h e Wesen.
Die V e r g e m e i n s c h a f t u n g des Menschen bedeutet immer schon
seine V e r g e s c h i c h t l i c h u n g . Vergemeinschaftung wie Vergeschichtli-
chung sind aber keine äußeren, in irgend einem Sinne nachträglich
hinzukommende Bestimmungen; sie bezeichnen vielmehr Grundmo-
mente der menschlichen Existenz. Denn der Mensch befindet sich nicht
schlechthin in der Welt, weil er eine bestimmte Weise des Seins in der
Welt, damit aber immer schon gleichsam in eine „geistige Welt"
hineingewachsen ist. Das bedeutet: von v o r n h e r e i n ist der Mensch
k e i n solus ipse; indem er v e r g e m e i n s c h a f t e t und v e r g e s c h i c h t -
licht ist, gehört er immer schon zu anderen M e n s c h e n , z.B. zu
denen, unter welchen er aufwuchs, zu den Menschen seiner Generation
usw.100 Diese Zugehörigkeit bedeutet eine „Verwandtschaft", weil sie in
einer gemeinsamen Vergangenheit wurzelt und die gleichen historischen
Kräfte und Motive abgibt101. Daraus ergibt sich der Sinn, der bei der
Gemeinschaft die Vorgängigkeit des „Ganzen" vor den „Teilen" kenn-
zeichnet. Die Einzelnen „sind hier in ihren Verhältnissen zueinander nur
aus einem Ganzen zu begreifen, das in ihnen lebendig ist"102. Darum sind
die konkreten Situationen, in denen sie einander begegnen, nur aus dem
sie umfassenden Lebenszusammenhang zu begreifen und in einem
tieferen Sinn nur aus dessen Historizität. Aus diesem Grunde sind die
Gemeinschaftsangehörigen auch „verbunden . . . trotz aller Trennun-
gen"103. Weil die Zugehörigkeit hier ein „Wurzeln in . . ." und „Herkom-
men von . . . " meint, erscheint uns die in bezug auf Gemeinschaft häufig
verwendete Redeweise von einer „Erweiterung des Ich" inadäquat, weil
nämlich wieder die Vorstellung eines ursprünglich einsamen Ich nahege-
legt wird. Der Gemeinschaftsbesitz aber gehört mir in dem oben104
beschriebenen Sinne insofern, als ich in ihn hineingewachsen bin, aus ihm
herkomme, in ihm verwurzelt bin und dgl. Den gleichen Charakter des
100 Vgl. hierzu DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 39 ff.
101 Vgl. DIITHEY, a.a.O., Bd. VII, S. 278.
102 TONNIES, a . a . O . , S . 1 3 0 .
103 TONNIES,a.a.O., S. 39. Eine extreme Radikalisierung dieses Tatbestandes, die ihre
eigenen hier nicht zu untersuchenden Strukturen hat, ist die patriarchalische Gliederung
der Gesellschaft, in welcher dem einzelnen der Sinn seines Seins von dem Ganzen her
zugewiesen wird.
104 Vgl. S. 175-176.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
184 Das gebundene Zusammensein
Mit-einander-verwachsen-seins hat auch die Zugehörigkeit zu den
Gemeinschaftsmitgliedern: spricht man von „den anderen in mir" 105 , so
trifft das eigentlich nicht die Gemeinschaft, sondern den Bund.
Der Bezug zur Vergangenheit und das Leben aus deren Kräften hat den
prägnantesten Ausdruck in den Ideen des Grafen Yorck von Wartenburg
gefunden, die in seinem Briefwechsel mit Dilthey enthalten sind106. Einer
der zentralsten Gedanken Yorcks ist der von der wesenhaften Geschicht-
lichkeit als Konstituens der menschlichen Existenz : „ . . . eine Selbstbe-
sinnung, welche nicht auf ein abstraktes Ich, sondern auf die Fülle meines
Selbstes gerichtet ist, wird mich historisch bestimmt finden, wie die
Physik mich kosmisch bestimmt erkennt. Gerade so wie Natur bin ich
Geschichte und so einschneidend ist das Goethesche Wort von dem
mindestens dreitausend Jahre Gelebthaben zu verstehen."107 Geschichte
aber ist für Yorck nicht der Inbegriff des Vergangenen und Gewesenen im
Sinne des Nicht-mehr-Vorhandenen, sondern im Gegenteil : „Nur was
der Kraft nach gegenwärtig, in der Gegenwart aufzeigbar ist, gehört zum
Bereich der Geschichte." 108 Im wahrhaft geschichtlichen Sinne kommen
die historischen Figuren nicht als Gestalten, sondern als Kräfte und
Motive in Betracht. Gegenüber der Diltheyschen Abhandlung „Auffas-
sung und Analyse des Menschen im XV. und XVI. Jahrhundert" 109
bemerkt Yorck: „Noch mehr lassen sich die Gestalten in Kraft
verwandeln und damit das Vergangene vergegenwärtigen" ; Luther zumal
„muß als historische Kraft, als geschichtliches Motiv, nicht als Lehrgestalt
betrachtet werden und zwar gar nicht als Lehrgestalt"110. Der Begriff der
Geschichte, meint er in Ubereinstimmung mit Dilthey, „ist doch der eines
Kräftekonnexes, von Krafteinheiten, auf welche die Kategorie: Gestalt
nur übertragener Massen anwendbar sein sollte" 111 . Auf diese Kräfte und
105 So G. Walther, „Ontologie der sozialen Gemeinschaften", S. 71.
106
Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck v. Wartenburg
1877-1897, Halle 1923.
107 A.a.O., S. 71.
108 A.a.O., S. 167. Daher die Bemerkung, „daß die wissenschaftlich adäquate Darstellungs-
weise regressiv sein würde. Die Geschichtserkenntnis, welche von der eigenen
Lebendigkeit aus sich rückwärts wendet zu dem der Erscheinung nach Vergangenen, der
Kraft nach Aufbehaltenen würde in der Darstellung eine Analysis der Gegenwart der
Vergangenheit vorausschicken und damit zugleich eine Controlle bieten für das
Geschichtliche gegenüber dem Antiquarischen." Vgl. hierzu auch S. 68 : „ . . . das
Zeitalter des Mechanismus: Galilei, Descartes, Hobbes ist virtuell Gegenwart."
109 Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd. II; vgl. besonders die Anm. S. 519.
110 Brief vom 8. Juni 1892.
111 A.a.O., S. 193.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Geschichtlichkeit 185
Motive kommt es an, auf das Unsichtbare112, auf die „Lebensstellung", die
jeweils „eine neue Epoche einleitet und bestimmt"113. Weil das wahrhaft
Geschichtliche die historischen Motive sind, und weil die Geschichtlich-
keit der menschlichen Existenz unser Leben aus geschichtlichen Motiven
bestimmt, ist uns alles Geschichtliche „brüderlich und verwandt, ist der
geschichtliche Stoff eigen Fleisch und Blut" 114 . So liegen die Erkenntnis-
mittel für das Geschichtliche „in dem psychischen Capitale strukturierter
Lebendigkeit beschlossen" und ist das Leben selbst „das Organon für die
Auffassung der geschichtlichen Lebendigkeit"115. Diese Vertrautheit mit
allem Geschichtlichen besagt, da alles Geschichtliche menschlich und alles
Menschliche geschichtlich ist, zugleich eine Vertrautheit mit allem
Menschlichen : „ . . . meine strukturierte einheitliche Lebendigkeit... ist
das Organon für Erfassung und Erkenntnis aller Lebendigkeit". Im
Menschlichen oder Historischen „ist das Verhältnis ein unmittelbares"116.
In ausdrücklichem Gegensatz zu Diltheys Lehre von der „Transposition"
eigener innerer Erfahrungen in andere menschliche Körper117 betont
Yorck, daß der „Rapport"zwischen Mensch und Mensch ursprünglich
und unmittelbar ist118. Es bedarf keiner Übertragung, da eine „unmittelba-
re lebendige Zugehörigkeit" vorliegt. Dilthey hatte gemeint, daß „geistige
Tatsachen an sinnlichen Objekten gegeben sind und . . . zu psychischen
Zuständen und Vorgängen die geistigen . . . hinzutreten". Demgegenüber
erklärt Yorck, daß „dies ein ganz irrelevanter Bezug" sei. „Ein
Solipsismus wie er da in Ansatz gestellt wird, ist eine Abstraktion, die an
sich ein interessantes wohl zu erklärendes psychisches Phänomen ist".
„Luther, Augustin, Paulus wirken auf mich gegenwärtig und körperlos.
Die Wirkung ist eine unmittelbare und selbständige, welche mit der
unwirksamen Reflexion, daß ich ihren Körper würde sehen können, wenn
sie noch lebten, nichts zu tun hat. . . Die geschichtliche Wirkung von
Person zu Person, wie sie auch zwischen Zeitgenossen, persönlich
Bekannten stattfindet, ist nicht nur nicht ontisch, sondern auch somatisch
nicht bedingt" 11 '. Weil Yorck den Menschen als Wesen sieht, das aus
112 A.a.O., S. 26: „Die Nerven sind unsichtbar wie das Wesentliche überhaupt unsichtbar
ist."
113 A.a.O., S. 128.
1H A.a.O., S. 133 und 223.
115 A.a.O., S. 167.
116 A.a.O., S. 203.
116 A.a.O., S. 203.
117 DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 249.
118 Brief vom 21. Oktober 1895.
119 Vgl. hierzu DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. V, S. 114.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
186 Das gebundene Zusammensein
geschichtlichen Kräften und Motiven lebt, faßt er ihn von vornherein in
der für ihn wesentlichen Verbundenheit und Zugehörigkeit zu den
Mitmenschen, die gleichen Ursprungs sind und aus den gleichen
historischen Quellen her existieren. Aus der eigenen Existenz, für die
Vergemeinschaftung und Vergeschichtlichung konstitutiv sind, entspringt
im unmittelbaren „Rapport" ein ebenso unmittelbares Verstehen alles
Menschlichen. Hier gibt es weder eine Problematik in der Art der
Zugangsproblematik, noch bedarf es jener künstlichen theoretischen
Veranstaltungen, wie sie Analogieschluß, Übertragungen, Einfühlungs-
projektionen usw. darstellen. Im Sinne dieses unmittelbaren „Rapports"
zwischen Mensch und Mensch ist auch Yorcks Bemerkung über die
Erkenntnismittel für das Geschichtliche und Lebendige zu verstehen, die
„in dem psychischen Capitale strukturierter Lebendigkeit beschlossen"
liegen und „deren letzte methodologische Voraussetzung die eigene
Lebendigkeit" ist120.
Diese geschichtliche Vergemeinschaftung ist aber für Yorck nicht eine
Dimension mitmenschlichen Zusammenseins neben anderen, wie wir sie
hier verstehen; sie erscheint ihm vielmehr als das paradigmatische und
sogar normative Phänomen des Miteinander-seins, so daß jedes mit-
menschliche Zusammensein, das nicht als geschichtliche Vergemeinschaf-
tung zu charakterisieren ist, ihm als Zerfall des wahren und echten Lebens
gilt. Daher wendet er sich gegen Diltheys „Gleichartigkeit der Tatsachen
eigener innerer Erfahrung mit denen, welche wir in die anderen
menschlichen Körper zu verlegen genötigt sind", ein „Merkmal der
geistigen Tatsachen", das „die Identität der Vernunft in der spekulativen
Schule" ersetzen soll. Yorck will lieber von „Zugehörigkeit" sprechen121.
Von seinem einseitigen Standpunkt aus hat er damit insofern Recht, als die
„Gleichartigkeit" ihrem Sinne nach existentiell voneinander unabhängige
Menschen voraussetzt, die wesentlich unverbunden sind und um einer
bestimmten Sache willen und auf diese hin in konkreten Situationen
zusammenkommen. Bei aller gegenseitigen Angewiesenheit in den
betreffenden Situationen bleiben sie frei, d.h. hier: einander fremd.
„Gleichartigkeit" besagt dann die Anerkennung der Freiheit des Partners
und seiner selbst als Selbstzweck, der nicht in der Rolle, in der er hic et
nunc mit mir zusammen ist, sein volles Sein erschöpft. Diese Anerken-
nung hat ferner ihre Konsequenzen auch für das Verhalten zum Anderen
120
Briefwechsel, S. 256.
121
DILTHEY, a . a . O . , B d . V , S. 2 5 0 ; Briefwechsel, S. 192.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Grenze der Zugehörigkeit 187
in der gemeinsamen Situation. Geht man von diesem „gesellschaftshaf-
ten" Zusammensein aus und verabsolutiert es, so ergibt sich daraus eine
ganz bestimmte geisteswissenschaftliche, auf das Verstehen des anderen
Menschen bezogene Problematik. Für Yorck aber ist dieses „gesell-
schaftshafte" Zusammensein eine Zersetzung des ursprünglichen συν -
δεσμός, mitmenschlichen Daseins, jener geschichtlichen Vergemeinschaf-
tung als einer der Grundbestimmungen menschlicher Existenz. Diese
Einseitigkeit erfährt die die Schranke des Yorck'schen Denkens anzeigen-
de Radikalisierung dadurch, daß er allein die christliche Gemeinschaft als
den echten und vollen συνδεσμός, als die h i s t o r i s c h e Kraft par
excellence nur das Christentum gelten läßt; dem zufolge gilt ihm
menschliche Solidarität im eigentlichen Sinne als das solidarische Vor-
Gott-stehen (im lutherischen Sinne). Mit Recht hat Dilthey sich gegen
diese Einseitigkeit gewandt, indem er zu Yorcks Bemerkung : „Nicht ein
Anderer sondern ein Mensch und historische Kraft ist Jesus . . . Ohne
diese virtuelle Zurechnung und Kraftübertragung gibt es überhaupt keine
Geschichte" bemerkt : „umgekehrt : alle Geschichte ist bloße Kraftüber-
tragung, nicht bloß das Christusleben." m Im gegenwärtigen Zusammen-
hang müssen wir uns aber ein Eingehen auf die Motive und Wurzeln dieser
Yorckschen Einseitigkeit versagen.
§ 24 Die Grenze der Zugehörigkeit
Wir bestimmen die Zugehörigkeit zu einer jeweiligen Gemeinschaft als
„naturhaft" im Sinne der Selbstverständlichkeit geschichtlicher und
geschichtlich legitimierter „Gegebenheiten und Vorfindlichkeiten". Daß
man in gerade diesen und keinen anderen Lebenszusammenhang hinein-
gewachsen ist, zu gerade diesen und keinen anderen Menschen gehört, das
ist „Schicksal" und schlichte „Gegebenheit"; es ist und bleibt dem
persönlichen Wollen und Entscheiden entzogen. Die Menschen, zu denen
man im Sinne der Gemeinschaft gehört, hat man sich nicht in freier Wahl
ausgesucht, man hat sich nicht zu ihnen und für sie entschieden, weil sie
diese und jene persönlichen Qualitäten haben ; vielmehr ist die Zugehörig-
keit zu gerade diesen Gemeinschaftsgenossen darin begründet, daß man
122 Vgl. auch DIITHEYS Brief von Weihnachten 1892.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
188 Das gebundene Zusammensein
mit ihnen gleicher Herkunft ist, aus der gleichen Vergangenheit, d.h.
denselben geschichtlichen Kräften und Motiven lebt wie sie, in einen
Lebenszusammenhang hineingeboren ist, dem auch sie angehören usw.
Das alles gehört zu den Lebensumständen, die für jeden „Gegebenheiten"
darstellen und in Betreff derer er keine Freiheit der Wahl hat123. Das
bedeutet: auch das Z u s a m m e n s e i n in der D i m e n s i o n der G e -
meinschaft ist kein Z u s a m m e n s e i n von Individuen als I n d i v i -
duen. Weil die Zugehörigkeit in dem Gemeinschaftsbesitz begründet ist,
reicht sie so weit wie die Teilhabe und die Gebundenheit an diesen ; die
Mitglieder einer Gemeinschaft sind nicht einander verfallen, sie gehören
sich nicht absolut und unbedingt, sondern nur insofern, als sie durch den
gemeinschaftlichen Besitz verbunden sind.
Diese so geartete und begrenzte Zugehörigkeit wird gemeint mit dem
„Wir" der Gemeinschaft, mit dem der Wir-Sagende seine Zugehörigkeit
zu Anderen bekundet124, wobei er das ausdrücklich macht, was als
„implizites" Wissen jedem aktuellen Zusammensein in der Gemeinschaft
immanent ist, auch dann, wenn es nicht ausdrücklich wird. (Dieses
Ausdrücklichmachen ist aber keine Explikation im Sinne des intentiona-
len Bewußtseins, sondern eine Form oder Stufe des „impliziten" Wissens
selber im Sinne der früheren Darlegungen.) Wenn Oppenheimer125 das
„Wirbewußtsein" als „Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer Gruppe"
(wobei er Zugehörigkeit von Abhängigkeit unterscheidet) so beschreibt :
„das Individuum fühlt sich geradezu a 1 s Gruppe, a 1 s Gemeinschaft",
so ist mit diesem Einsfühlen eine bundhafte Einstellung gemeint, nicht
aber das dem Sein in der Gemeinschaft „implizite" Wissen um die eigene
Zugehörigkeit zu ihr126. Ebenso bezieht sich, wie noch zu zeigen sein wird,
das „Wirbewußtsein", wie es Vierkandt127 beschreibt, auf das Zueinander
spezifisch von Bundgenossen und nicht von Gemeinschaftsangehörigen.
— Einen entsprechenden Sinn wie das „Wir" hat das „Man" in der
Dimension der Gemeinschaft : es bezeichnet den Angehörigen gerade in
bezug auf seine Zugehörigkeit. Wenn es heißt: „das und das tut man
123 So bemerkt TONNIES, a.a.O., S. 195 : „Der Mensch findet sich in diese [sei. die Familie]
hineingeboren; er kann zwar das Verbleiben darin, aber keineswegs die Begründung
solches Verhältnisses als aus seiner willkürlichen Freiheit erfolgend mit irgendwelchem
Sinne denken."
124 Vgl. hierzu SCHMALENBACH, a.a.O., S. 53 ff.
125 OPPENHEIMER, System der Soziologie, I , Jena 1922, S. 101.
126 Vgl. SCHMALENBACH, a. a. O., S. 68. Daß Einsfühlung für das Bundhafte konstitutiv ist,
wird in § 26 dargelegt werden.
127 VIERXANDT, Gesellschaftslehre, S. 144 und 210.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Grenze der Zugehörigkeit 189
nicht", so bedeutet das, daß das gemeinte Verhalten zu dem durch
Traditionen (religiöse Vorstellungen, Sitte und dgl.) konstituierten
Lebensstil und der Lebensordnung der Gemeinschaft in Widerspruch
steht oder ihm mindestens nicht entspricht. Aufgrund seiner Zugehörig-
keit zu der Gemeinschaft und der darin implizierten Gebundenheit an
ihre Lebensordnung, die immer als normativ und verbindlich gilt, „darf"
einer, der zu der betreffenden Gemeinschaft gehört, gerade als Zugehö-
riger eben das und das nicht tun128. Aber nicht auf jedes Tun der
Gemeinschaftsangehörigen bezieht sich ein solches „ m a n darf" oder
„ m a η darf nicht", sondern nur auf dasjenige Tun, welches in die Bereiche
hineinfällt, die durch die Lebensordnung der Gemeinschaft geregelt
werden. Darin, daß nicht alle Lebens- und Handlungsbereiche von den
Lebensordnungen betroffen werden, bekundet sich die Grenze der
gemeinschaftshaften Zugehörigkeit. Diese Grenze tritt wohl am prägnan-
testen am Phänomen der gemeinschaftshaften Solidarität zutage, von der
Vierkandt129 gezeigt hat, daß sie den Gemeinschaftsangehörigen nur
insofern gilt, als es sich um Angelegenheiten handelt, die die betreffende
Gemeinschaft berühren. Von dieser gemeinschaftshaften Solidarität und
Hilfsbereitschaft ist die persönliche, die sich auf den anderen Menschen
als Individuum bezieht, zu unterscheiden.
Trotz aller Zugehörigkeit bleibt dem Gemeinschaftsangehörigen eine
private Sphäre130, d. h. ein Bereich des Lebens und Handelns, in bezug auf
den er nicht mit Anderen verwachsen ist und für den infolgedessen auch
keine aus dem Gemeinschaftsleben sich ergebenden Regelungen bestehen.
Lebt er in diesem B e r e i c h , so sind dann die Gemeinschaftsangehöri-
gen (wie auch die betreffende Gemeinschaft) als die bestimmt, die sie in
diesem gegebenen Falle sind, nämlich als „anwesend". Er verhält sich dort
ohne Rücksicht auf sie. Das bedeutet : in diesem Bereich ist er von der
Gemeinschaft frei. Das Bestehen derartiger gemeinschaftsfreier Bereiche
ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß zwischen einzelnen
128 Diese Interpretation bedeutet keine Abschwächung oder Relativierung der in den
Gemeinschaftsmoralen intendierten allgemeinen und unbedingten Verbindlichkeit : sie
will nicht besagen, daß im Sinne dieser Moralen eine Beschränkung auf die Gemein-
schaftsangehörigen gegenüber den „Fremden" liegt, die von vornherein ausgenommen
sind, obwohl es auch derartige Gemeinschaftsmoralen gibt. Eine derartige Abschwä-
chung liegt darum nicht vor, weil die betreffenden Moralen ihre Legitimation im
Traditionellen selbst haben : das Uberlieferte, das schon immer und von jeher gilt, ist
„selbstverständlich" und damit auch in einem durch diese „Selbstverständlichkeit"
bestimmten Sinne das Richtige und Verpflichtende.
129 VIERKANDT, a.a.O., S. 372 f. und 384; vgl. auch S. 357 f..
130 V g l . VIERKANDT, a . a . O . , § 18.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
190 Das gebundene Zusammensein
Gemeinschaftsmitgliedern neuartige persönliche, und zwar bundhafte
Beziehungen entstehen. Dabei sind diese neuen persönlichen Beziehun-
gen, die meistens bundhaften Ursprungs sind, in einem doppelten Sinne in
der bestehenden Gemeinschaft und der Zugehörigkeit zu dieser nicht
fundiert und von daher nicht motiviert, wenngleich ihre Anbahnung
faktisch dadurch erleichtert und unter Umständen sogar ermöglicht wird.
Zum einen liegt es nicht im Sinne eines Gemeinschaftsverhältnisses, daß
Mitglieder der Gemeinschaft überhaupt über die Gemeinschaftsbindun-
gen hinaus in neuartige persönliche Beziehungen zueinander treten : von
der „naturhaften" Zugehörigkeit zwischen Vater und Sohn her ist der
zwischen ihnen sich bildende Bund weder erfordert, noch ist er in ihr
motiviert131. Zum anderen ist das konkrete bundhafte Verhältnis gerade als
das, als welches es hic et nunc in Betracht kommt, nicht in der zwischen
Bundgenossen bestehenden Gemeinschaft begründet. Weder ergibt sich
also das neue Verhältnis aus der bestehenden Gemeinschaft, noch liegt es
in seiner konkreten Bestimmtheit im Sinne der vorliegenden Gemein-
schaft132. Das hängt mit dem Bezug der gemeinschaftsfreien Sphären zu
den gemeinschaftsgebundenen zusammen. Während das Zusammensein
in der Partnerschaft an seinem Anfang und an seinem Ende auf
partnerschaftsfreie Bereiche verweist133, liegt eine derartige Verweisung
weder im aktuellen Zusammensein in der Gemeinschaft noch in der
unabhängig von ihren Aktualisierungen bestehenden Gemeinschaft.
Vielmehr kommen hier die freien Bereiche als solche und abgesehen von
ihren inhaltlichen Bestimmungen zu den gemeinschaftsgebundenen
hinzu. Aus diesem Grunde ist es Sache des einzelnen Menschen,
inwieweit er sich über seine Gemeinschaftsgebundenheit hinaus freie
Bereiche schafft und sichert, die ihm individuell zu eigen sind und
innerhalb derer er mit anderen Menschen in neue und eigenständige
persönliche Beziehungen tritt (ohne daß diese Beziehungen eine gegen die
Gemeinschaft gerichtete Tendenz zu haben brauchen, wie wir ja
überhaupt immer schon zu mehreren, „windschief" zueinanderstehenden
Gemeinschaften gehören134). Ebenfalls ist es dem Einzelnen anheimge-
131 Vgl. dagegen das oben (S. 173 — 174) angeführte, aus dem umfassenden Lebenszusam-
menhang her motivierte Mit-einander-arbeiten.
132 Allerdings ist hier eine Einschränkung zu machen : für den unter Gemeinschaftszugehö-
rigen sich bildenden Bund spielt die Gemeinschaft, in der sie stehen, in ihrer
vorliegenden Bestimmtheit schon eine gewisse Rolle, zumal wenn die Bundgenossen
Angehörige der gleichen Generation sind. Vgl. hierzu auch weiter unten, S. 198 —199.
133 Vgl. oben, S. 165 ff.
134 Von dem Fall, wo jemand aufgrund seines individuellen Seins und seiner individuellen
Entwicklung über eine Gemeinschaft hinauswächst, sehen wir hier ab.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das Zusammensein in der Gemeinschaft 191
stellt, worauf er den Schwerpunkt seiner Existenz legt, ob da, wo er frei
und Individuum, oder da, wo er gebunden und zugehörig ist. Auf diese
Weise resultiert eine Fülle von Möglichkeiten, die aber alle zwischen zwei
extremen Polen stehen : den einen bildet ein fast völliges Verfallensein an
die gemeinschaftshaften Bindungen, eine fast ausschließliche Ausrichtung
des Verhaltens an das „selbstverständlich" Geltende ; der Gegenpol ist
repräsentiert durch die Idee des freien Individuums, das aus eigener
Selbstverantwortung handelt und in diesem Sinne autonom ist.
§ 25 Das Zusammensein in der Gemeinschaft
Wir wiesen oben1" auf das Zusammenarbeiten der Mitglieder einer
Familiengemeinschaft hin und betonten, daß die betreffenden Menschen
dabei aus dem Grunde nicht als Partner zusammenwirken, weil sich ihr
Zusammensein aus einem umfassenden Lebenszusammenhang ergibt.
Daher können wir sagen, daß in einem Zusammensein, für welches das
genannte Beispiel paradigmatisch ist, die zwischen den betreffenden
Menschen bestehende Gemeinschaft aktualisiert wird ; aktualisiert inso-
fern, als die Gemeinschaft als (im angegebenen Sinne) „naturhafte"
Zugehörigkeit unabhängig von solchen Aktualisierungen besteht. Ein
aktuelles Zusammensein in der Dimension der Gemeinschaft ist von dem
umgreifenden Lebenszusammenhang her, den sie darstellt, motiviert und
ordnet sich diesem als Moment ein. Das besagt: das jeweilige aktuelle
Zusammensein erhält von dem es „tragenden" und in diesem Sinne
fundierenden Zusammenhang her seine Prägung und die für es charakteri-
stische Struktur. In dieser Weise ist das „Ganze" (der umfassende
Lebenszusammenhang) vorgängig vor den „Teilen" (dem jeweiligen
aktuellen Zusammensein) und ist auch „früher" als diese. Das Vorgängig-
sein des „Ganzen" vor seinen „Teilen" und „Momenten" und das
„Herauswachsen" dieser aus dem „Ganzen" besagt ja immer ein
derartiges Enthaltensein des „Ganzen" in seinen „Momenten". Aus
diesem Grunde ist ein aus dem gemeinschaftlichen Leben herauswachsen-
des Zusammenarbeiten und die Art und Weise, in der hier die Beteiligten
miteinander zusammen sind, radikal verschieden von einer auf sich
135
Vgl. oben, S. 173 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
192 Das gebundene Zusammensein
gestellten und in diesem Sinne selbständigen Arbeitssituation, bei welcher
die Partner einander in ihren Rollen begegnen. Jedoch ist nicht jedes
Zusammensein von Gemeinschaftszugehörigen von dieser Art, sondern
nur als ein solches, das aus der zwischen ihnen bestehenden Gemeinschaft
hervorgeht und in dieser selbst motiviert ist. Spielen zwei Brüder
miteinander Schach, so sind sie dabei als Partner und nur als solche
zusammen; — in diese gemeinsame Situation ragt die zwischen ihnen
bestehende Gemeinschaft nicht hinein und trägt auch nicht zu ihrer
Ausgestaltung und Sinnbestimmung bei.
Veranschaulichen wir das Ausgeführte anhand der Analyse eines
konkreten gemeinschaftlichen Handelns. Als Beispiel für das hier
gemeinte Miteinander wählen wir das von Scheler136 herausgestellte
„unmittelbare Mitfühlen ζ. B. eines und desselben Leides mit jemand . . . :
Vater und Mutter stehen an der Leiche eines geliebten Kindes". Durch
diese Analyse eines als gemeinschaftshaft verstandenen Miteinanderfüh-
lens erhalten wir eine weitere Bestätigung unserer im Anschluß an
Schmalenbach aufgestellten These, daß das Fühlen für Gemeinschaft nicht
konstitutiv ist, vielmehr umgekehrt die Gemeinschaft „als schon vorhan-
dene vorfindet", „auf schon Vorhandenes hinblickt, . . . es unter und
hinter sich weiß"" 7 . Dieses Fühlen gründet derart in der schon vorhande-
nen Gemeinschaft, daß diese in ihm „anwesend" und enthalten ist und es
in seiner konkreten Bestimmtheit mit ausprägt. — Das Phänomen, um das
es sich hier handelt, charakterisiert Scheler dahin, daß es sich um ein
„Miteinandererleben nicht nur desselben Wertverhalts sondern auch
derselben emotionalen Regsamkeit auf ihn" handelt. „Das ,Leid' als
Wertverhalt und Leiden als Funktionsqualität ist hierbei eines und
d a s s e l b e . " Jedoch ist diese Charakteristik gerade in Hinsicht auf das,
worauf es uns hier ankommt, unvollständig. Als M i t e i n a n d e r l e i d e n
und als g e m e i n s a m e geht die Trauer — nicht nur objektiv, sondern auch
phänomenal — hervor aus dem gemeinsamen Leben, dem Miteinanderle-
ben in der Familiengemeinschaft. Der Unglücksfall, dem die Trauer gilt,
betrifft die Familie in ihrer Vergemeinschaftung. Infolgedessen ist, was
hier vorliegt, charakteristisch verschieden von dem Fall, wo „A. zunächst
allein dies Leid fühlt und B. dann ,mit ihm' mitfühlt"138, ganz davon zu
136 SCHELER, Sympathie, S. 9 f . [G. W. 7, S. 23],
137 SCHMALENBACH, a . a . O . , S . 5 9 u n d 6 8 .
138 Weil dieses letztere — wie Scheler betont — „die höchste Form der Liebe voraussetzt",
handelt es sich hier um Bundhaftes ; vgl. SCHMALENBACH, a.a.O., S . 72 : „Der Freund ist
das ,andere Ich'. Wir fühlen seine Freude und sein Leid als unsere ,eigene' Freude und
unser .eigenes' Leid."
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das Zusammensein in der Gemeinschaft 193
schweigen, daß „nicht A. dies Leid fühlt und B. fühlt es auch und
außerdem wissen sie noch, daß sie es fühlen". Eben das Herauswachsen
der aktuellen Trauer aus dem gemeinschaftlichen Leben bestimmt sie zu
der konkreten Trauer, die sie ist, und begründet das Recht der soeben
gemachten Unterscheidung. Indem die Gemeinschaft in eigentümlicher
Weise in der aktuellen Trauer enthalten ist, charakterisiert sich letztere als
ein Gemeinschaftserlebnis in einem ganz bestimmten Sinne. Dieses
Enthaltensein der Gemeinschaft in der aktuellen Trauer besagt unter
anderem : jedem der Beteiligten sind die „mit ihm" trauernden Gemein-
schaftszugehörigen gegenwärtig; gerade in seiner Trauer ist er auf die
anderen und ihre Trauer bezogen. Dieser Bezug kommt nicht nachträglich
zu dem Trauererlebnis des einzelnen hinzu; vielmehr ist dieses das
bestimmte konkrete Trauererlebnis durch diesen Bezug, der also wesent-
lich zu ihm gehört. Daß man miteinander etwas erlebt, besagt also, daß in
dem Erleben eines jeden die anderen Beteiligten und ihr Erleben
konstitutiv enthalten sind. Daraus ergibt sich auch die oben angeführte
Schelersche Charakterisierung, die aber - wie gesagt - nicht den Kern des
vorliegenden Phänomens trifft. Indem wir in dieser Trauer leben, haben
wir — wie immer und überhaupt — ein „implizites" Wissen um die
Anderen. Da die Anwesenheit der Anderen in unserem gegenwärtigen
Fühlen ein konstitutives Moment dieses Fühlens selber ausmacht, ist das
Wissen um diese Anwesenheit ein Moment an unserem „impliziten"
Wissen um unsere aktuelle Befindlichkeit.
Zu prinzipiell den gleichen Resultaten führt die Analyse eines
Verhaltens, das nicht von der Form des Miteinander, sondern von
derjenigen der Rücksichtnahme ist. Handelt der Angehörige einer
Gemeinschaft im Namen dieser und aus ihrem ,Geiste* heraus, so ist die
Gemeinschaft, in Rücksicht auf die er handelt, in seinem Handeln
gegenwärtig, auch ohne daß die „Zuschauer" ausdrücklich einen Druck
auf ihn ausüben159. Wiederum wird durch diese ihre Gegenwart sein
Handeln zu dem bestimmt, das es konkret ist: nämlich zu einem
Gemeinschaftshandeln. In beiden Fällen sind im eigenen E r l e b e n und
Verhalten selbst die G e m e i n s c h a f t s a n g e h ö r i g e n g e g e n w ä r t i g
und diese ihre G e g e n w a r t ist s i n n b e s t i m m e n d f ü r das E r l e b e n
und Verhalten. D a s „ i m p l i z i t e " Wissen um das eigene E r l e b e n
und Verhalten erschließt dann die A n d e r e n , so wie sie darin
anwesend s i n d .
139 Vgl. hierzu VIERKANDT, a.a.O., § 35.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
194 Das gebundene Zusammensein
Das Zusammensein in der Gemeinschaft schließt ein gegenseitiges
Verstehen der Gemeinschaftsangehörigen voraus. Indem dieses Verstehen
nicht allein aus dem gemeinsamen Leben herauswächst, sondern vor allem
in dessen Dienste steht, orientiert es sich an Gemeinsamkeiten. Es ist ein
Verstehen, in das man miteinander hineingeboren oder hineingewachsen
ist140. Es geht auf den Gemeinschaftsangehörigen als solchen, d. h. auf ihn,
sofern er als am gemeinschaftlichen Besitz (im Sinne des geschichtlichen
Gewordenseins) teilnehmend in Anspruch genommen wird. Aus dieser
strukturellen Gleichartigkeit des hier gemeinten Verstehens mit der
gemeinschaftshaften Zugehörigkeit ergibt sich, daß die Grenze des
Verstehens hier die gleiche ist wie dort. Der Andere wird als solcher und in
Hinsicht auf diese seine Zugehörigkeit verstanden, nicht in Hinsicht auf
das, was er an sich selbst als individuelle Lebenseinheit ist. All das, was
ihm als diesem bestimmten Individuum zukommt und angehört, entzieht
sich diesem Verstehen. Am deutlichsten tritt diese Grenze in der
Verständnislosigkeit zutage, welcher der Mensch begegnet, wenn er aus
den „naturhaften" Gemeinschaftsbindungen heraustritt. Diese Verständ-
nislosigkeit ist kein bloßes Nicht-verstehen im Sinne eines Sich-nicht-dar-
um-kümmerns. Vielmehr besteht sie darin, daß die Motive, Gedanken
und Handlungen des betreffenden Menschen von den Anderen in
„deren" Sinne, im Sinne ihrer Traditionen, Denkweisen ausgelegt werden.
Der Abseitsstehende wird von der Gemeinschaft her und in ihrem Sinne
verstanden und damit notwendigerweise auch mißverstanden. Das gilt
auch dort, wo es sich gar nicht um ein Herauswachsen und um eine
Loslösung handelt, sondern wo ein Gemeinschaftszugehöriger, ohne —
wenigstens zunächst — an seine Zugehörigkeit zu rühren, gegenüber dem
gegenwärtigen Status einer Gemeinschaft, der ihm als Verfall erscheint,
auf ihren vermeintlich eigentlichen Sinn (darauf, wie sie sein s o l l )
zurückgeht und diesen zu realisieren sucht, wofür Luthers Berufung „a
pape male informato ad papem melius informandum" ein klassisches
Beispiel ist. Wer sich so „im Namen" der Gemeinschaft und um ihrer
selbst willen gegen ihre gegenwärtige Verfassung wendet, wird von ihrem
gegenwärtigen Zustand, d. h. von ihrem Gewordensein her mißverstan-
den, weil dieser als historisch gewordener für die noch völlig Gemein-
schaftsgebundenen den Charakter der Selbstverständlichkeit und Richtig-
keit alles geschichtlich und „naturhaft" Gegebenen hat. — Diese
Begrenztheit des Verstehens durch die eigene geschichtliche Vergemein-
140 Vgl. hierzu DILTHEY, Gesammelte Schriften, Bd. VII, S. 208 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das Zusammensein in der Gemeinschaft 195
schaftung spielt — wie noch bemerkt sei — auch in den Wissenschaften,
zumal in den Geisteswissenschaften, eine Rolle, wofür als Beispiel die
bekannten Versuche gelten können, primitive Kulturen von westeuropäi-
schen Denkweisen und Kategorien aus zu deuten"'. Darin bekundet sich
eine Problematik, die für den Wissenschaftler gerade als Wissenschaftler
aus seiner Existenz, nämlich aus seiner geschichtlichen Vergemeinschaf-
tung erwächst.
Von der geschichtlichen Vergemeinschaftung der historischen Figuren
macht auch der Forscher Gebrauch, der sich diesen Figuren gegenüber-
stellt und sie zu Gegenständen seiner Erkenntnisintentionen erhebt.
Gerade indem der Historiker sich nicht auf die einzelne Situation und die
Leistung in ihr, d.h. auf die konkrete Existenz einer geschichtlichen
Person beschränkt, sondern die Personen auf dem Grund ihrer Zeit sieht,
fragt er nach ihren gemeinschaftshaften Zugehörigkeiten und sucht sie
von da aus zu verstehen. Jeder Rückgang auf den „Geist einer Zeit", auf
das Milieu, auf die geistigen Strömungen und Bewegungen bedeutet das
Hineinstellen des betreffenden Menschen in umfassende Lebenszusam-
menhänge, in denen er als geschichtliches Wesen wurzelt. Daß dieses
Vorgehen, wie wir oben bemerkten, jederzeit möglich und sogar
notwendig ist, liegt an der wesentlichen Geschichtlichkeit des Menschen,
der immer schon von einem bestimmten historischen Ursprung her und
aus bestimmten historischen Kräften existiert. Ein volles geschichtliches
Verständnis begnügt sich nicht mit dem Verstehen der einzelnen
konkreten Situationen, sondern fragt nach den Gründen und Zusammen-
hängen, aus denen heraus es zu diesen Situationen kam. Diese Wendung
von der konkreten zur h i s t o r i s c h e n E x i s t e n z konstituiert jede
eigentlich und prägnant so zu nennende geschichtliche Forschung in ihrer
Eigenart. Dabei macht der Historiker den „Geist" der betreffenden
Gemeinschaften und die Art und Weise ihrer Selbstauslegung ausdrück-
lich ; er expliziert also das, was für die Menschen der betreffenden Zeit
„selbstverständlich" und „naturgegeben" war und worum sie in ihrem
Leben und in ihren Handlungen ein nur mehr oder weniger „implizites"
Wissen hatten. Das gilt besonders für die Herausstellung der letzten und
entscheidenden Positionen, in denen diese und jene Art des Daseins und
des Daseinsverständnisses ihr Fundament hat. Indem der Historiker von
derartigen letzten Positionen wie auch von den für eine bestimmte
Menschengruppe bestehenden „Gemeinsamkeiten" aus geschichtliche
141 Vgl. ζ. B. die Kritik Lévy-Bruhls am Animismus.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
196 Das gebundene Zusammensein
Figuren gerade in bezug auf ihre historische Existenz aufzuklären
unternimmt, bedient er sich, wie Spranger142 andeutet, in der Tat eines
deduktiven Verfahrens. Und wenn dieses Verstehen es auf die historische
Existenz eines Menschen abgesehen hat, dann besagt dieses wiederum,
daß es ihn soweit, aber auch nur soweit erfaßt, als er an bestimmten
historischen „Gemeinsamkeiten" teil hat. Das bedeutet : der Mensch als
Individuum, als „strukturierte Lebenseinheit" entgeht diesem Verstehen ;
das, was ihm individuell eigen ist, was ihn zu gerade dem macht, der er als
dieser einmalige Mensch ist, bleibt hier unzugänglich. Nicht auf das
„individuelle Ich", sondern auf das „geistige Subjekt" geht dieses
Verstehen, korrekter gesagt : auf das individuelle Ich, soweit, aber auch
nur soweit, als és durch das in es „hineingeschlungene" „geistige Subjekt"
bestimmt ist"3. Dieses Verstehen, das die Gemeinschaften thematisiert
und sich in der entsprechenden Haltung ihnen zuwendet, hat genau die
gleiche Grenze wie das zum Sein in der Gemeinschaft gehörige Verstehen ;
diese Grenze ist eben die der gemeinschaftshaften Zugehörigkeit. Mit
Recht unterscheidet daher Spranger144 das Verstehen „aus der objektiven
Situation heraus" von demjenigen „aus der Einheit der Person heraus".
Dabei mußte beim zuerst genannten Verstehen noch eine weitere
Scheidung vorgenommen werden, je nachdem, ob die konkrete oder die
historische Existenz Thema war.
142 SPRANGER, Zur Theorie des Verstehens und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie, S.
395 ; vgl. DILTHEY, a.a.O., Bd. VII, S. 141 ff. — Darin liegt eine weitere Bestätigung der
These Sprangers, daß „wir das Seelische nur verstehen durch das Geistige hindurch", vgl.
oben S. 164, Anm. 47.
143
„Geistiges Subjekt" ist hier genau im Sinne SPRANGERS (a.a.O., S. 369) verstanden: als
subjektives Korrelat der „Kultur". Das Problem, „wie dieses geistige Subjekt in das
individuelle Ich hineingeschlungen ist", ist eben das Problem der wesentlichen
Vergeschichtlichung und Vergemeinschaftung des Menschen.
144
Vgl. SPRANGER, a.a.O., S. 389 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
K A P I T E L III : D I E V E R S C H M E L Z U N G
§ 26 Die Einsfiihlung
Den entscheidenden Unterschied zwischen dem „Bund" und der
„Gemeinschaft" sieht Schmalenbach145, dem diese dritte grundlegende
soziologische Kategorie zu verdanken ist, in der für den Bund konstituti-
ven Emotionalität. Gefühlserlebnisse gibt es, wie wir gesehen haben 1 *,
sowohl im Zusammensein der Partnerschaft wie auch in der Dimension
der Gemeinschaft. Dort kommen die betreffenden Gefühle, wie Wohl-
wollen, Herzlichkeit usw., zum rollenhaften Zusammensein in der
aktuellen Situation hinzu; sie sind für den Sinn dieses Zusammenseins
insofern ohne Bedeutung, als dieser durch ihr Auftreten oder Ausbleiben
nicht berührt wird: die Partner sind und bleiben Partner, gleichgültig, ob
sie herzlich oder rein geschäftmäßig-sachlich miteinander verkehren. Bei
der Gemeinschaft erwachsen die Gefühle nicht nur in dem Sinne aus dem
gemeinschaftshaften Zusammenleben, daß sie dieses als bereits „vorlie-
gendes" und ihnen „vorgegebenes" voraussetzen ; die Gemeinschaft ist in
dem betreffenden Fühlen in der beschriebenen Weise „anwesend". In
keinem dieser Fälle konstituieren die Gefühlserlebnisse selbst das
mitmenschliche Zusammensein. Wo daher — wie beim Bunde —
G e f ü h l s e r l e b n i s s e eine derartige k o n s t i t u t i v e B e d e u t u n g ha-
b e n , wo erst durch sie und w e s e n t l i c h in ihnen M e n s c h e n
z u s a m m e n k o m m e n , und wo ihr Z u s a m m e n s e i n darin seinen
Sinn hat, daß sie sich in G e f ü h l e n (wie wir sehen werden, handelt es
sich um eine ganz bestimmte Art von Gefühlen) einander zuwenden
und aufeinander b e z i e h e n , — da liegt in der Tat eine neue und
eigenständige D i m e n s i o n m i t m e n s c h l i c h e n Z u s a m m e n s e i n s
vor" 7 .
145 Siehe SCHMALENBACH, a.a.O., S. 59 ff.
Vgl. S. 173 und § 25.
147 Die ausführliche Begründung der Abhebung des Bundes von der Gemeinschaft hat
SCHMALENBACH gegeben, so daß wir in dieser Hinsicht auf seine Ausführungen sowie
Auseinandersetzungen mit Tönnies und M. Weber verweisen können.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
198 Das gebundene Zusammensein
Überall, wo Menschen von einer neuen „Idee", einem neuen Lebensge-
fühl, einem Gotte, Heros usw. ergriffen werden und sich als so Ergriffene
zusammenfinden, da entsteht ein neues soziales Gebilde zwischen ihnen.
Es ist nicht nur in dem trivialen Sinne als neu zu bezeichnen, daß es erst
entsteht, wenn die betreffende „Idee" (oder wie immer man derartiges
bezeichnen will) in Erscheinung getreten ist und die Menschen hingeris-
sen hat, während es vorher nicht bestand, sondern vor allem insofern, als
durch die Hingabe an das, wovon man hingerissen ist, bestehende
Gemeinschaften und Gemeinschaftsbindungen zerstört werden können
und sich die Bildung neuer Gemeinschaften anbahnt; — ja daß in
gewissem Sinne die „Welt", aus der die Bundgenossen herkommen und in
die sie gemeinschaftshaft hineinwachsen, sich „auflöst" und eine neue
„Welt" zu entstehen beginnt148. Weil die Bildung dieser neuen sozialen
Verbände die Auflösung und Zerstörung der überkommenen Gemein-
schaften besagen kann (es genügt hier die bloße M ö g l i c h k e i t ) , zeigtes
sich, daß es sich bei ihnen nicht um Gemeinschaftshaftes handelt. Erst
recht bekundet sich dies in der m ö g l i c h e n revolutionären und
revolutionierenden Bedeutung dieser Bünde, während im Gegensatz dazu
die Gemeinschaft den Charakter des Tradierten besitzt. Gewiß ist das
Vorhandensein von Gemeinsamkeiten und damit das Bestehen von
Gemeinschaft zwischen den Bundgenossen erforderlich, damit sich diese
überhaupt zu einem Bunde finden können : dabei ist etwa an Sprachge-
meinschaft als Voraussetzung der gegenseitigen Verständigung zu denken,
aber auch darüber hinaus an gemeinsames Schicksal, gemeinsame Not und
ähnliches. Obwohl diese Not eine solche einer Gemeinschaft ist oder sein
kann, ist der in der Reaktion auf diese Gemeinschaftsnot entstehende oder
besser gesagt : aufflammende Bund weder in der Gemeinschaft fundiert,
noch wird er von ihr getragen. Daß es überhaupt zu einem Bunde kommt,
ist gegenüber dem gemeinschaftshaften Verwachsensein etwas Neues.
Auch da also, wo eine Beziehung zum Gemeinschaftshaften in besonde-
rem Maße zu erwarten steht und auch in einer hier nicht darzulegenden
Weise besteht, wird das bundhafte Zusammensein nicht von dem her
bestimmt und ausgeprägt, was im Vergangenen liegt und wurzelt, sondern
von dem Neuen, das im bundhaften Zusammensein selber in Erscheinung
tritt. In jeder Beziehung bedeutet das Aufflammen des Bundes den
Einbruch von etwas Neuem.
148 Darauf werden wir mit Rücksicht auf das Prinzipielle (soweit es der Rahmen dieser
Abhandlung erlaubt) im nächsten § noch einzugehen haben.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Einsfühlung 199
Als Beispiele für das, was sich im bundhaften Zusammensein den
Beteiligten manifestiert, hatten wir bereits eine „Idee", ein Lebensgefühl,
einen Gott, einen Heros genannt. Was es im einzelnen konkreten Falle
auch sein mag, immer handelt es sich um etwas, das wesentlich
außergewöhnlich und unalltäglich ist. Unalltäglichkeit wie Außer-
gewöhnlichkeit meinen hier nicht so etwas wie ein nur seltenes
In-Erscheinung-treten und dergleichen. Außergewöhnlichkeit ist nicht
gleichbedeutend mit Ungewohnheit ; vielmehr ist damit ein Positives an
dem hier in Rede stehenden Phänomen gemeint. Ein „Heros" oder ein
„Genie" ist von den Menschen des Alltags unterschieden und vor ihnen
ausgezeichnet ; das, was den Betreffenden zum „ H e r o s " macht, hebt ihn
über die Durchschnittlichkeit und Alltäglichkeit hinaus, wobei es ganz
gleichgültig ist, ob solch ein Wesen oft oder selten vorkommt. Die innere
Artung und das Qualitative, auf dem die Auszeichnung gegenüber dem
Gewöhnlichen und Alltäglichen beruht, besagt primär eine Machtfülle,
die dem so Ausgezeichneten wesentlich zukommt. Weil ein „Zauberer"
oder ein „ H e r o s " Dinge tun kann, die über die Kräfte und Fähigkeiten
der gewöhnlichen Menschen hinausgehen, ist er vor diesen ausgezeichnet :
in seinen außergewöhnlichen Taten bekundet er sich als außergewöhnli-
ches Wesen. — Für den Gesamtbereich der hier gemeinten Phänomene
hat M. Weber den Terminus „Charisma" eingeführt, einen Terminus, den
wir übernehmen wollen. „Charisma" soll eine als außeralltäglich „ . . .
geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie als mit
übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch
außeralltäglichen, nicht jedem andern zugänglichen Kräften oder Eigen-
schaften [begabt] oder als gottgesendete oder als vorbildlich und deshalb
als F ü h r e r gewertet wird . . . Über die Geltung des Charisma entschei-
det die durch B e w ä h r u n g . . . gesicherte, freie, aus Hingabe an
Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Führer geborene A n e r -
kennung durch die Beherrschten. Aber diese ist (bei genuinem
Charisma) nicht der Legitimationsgrund, sondern sie ist Pflicht der
kraft Berufung und Bewährung zur Anerkennung dieser Qualität
Aufgerufenen. Bleibt die Bewährung dauernd aus, zeigt sich der
charismatisch Begnadete von seinem Gott oder seiner magischen oder
Heldenkraft verlassen . . . so hat seine charismatische Autorität die
Chance, zu schwinden." 14 ' Der Zusammenhang der Untersuchungen
149 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Teil I, Kap. III, § 10 [S. 140] ; vgl. auch Teil III,
Kap. I X [S. 753ff.; 1972, Teil I, Kap. III, S. 654ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
200 Das gebundene Zusammensein
Webers, dem es um die „Typen der Herrschaft" geht, bringt es mit sich,
daß er das Charisma von vornherein als an einen Menschen (den „Führer"
mit seiner „Sendung") gebunden in den Blick bekommt. Sehen wir
zunächst von dieser Bindung des Charisma an den „Begnadeten" ab, die
allerdings weder nebensächlich noch zufällig ist, und fragen wir nach der
Art und Weise, wie das Charisma in Erscheinung tritt.
Offenbar ist es denen, die es „aufruft", nicht in der Weise „gegeben"
wie dem Historiker und Soziologen, der in der Distanz der Erkenntnis auf
Charismatisches stößt und ihm als seinem Gegenstande gegenübersteht.
Auch hier macht sich der nachdrücklich herausgestellte Gegensatz von
„Leben in . . . " und „Stehen gegenüber . . . " geltend. Das Charisma tritt
in Erscheinung, indem es „aufruft"; es wird von den „Aufgerufenen"
erfaßt, wenn sie den „Ruf" vernehmen und ihm folgen, d. h. von ihm
gepackt und hingerissen werden, sich ihm hingeben, an es glauben, sich
ihm gläubig-vertrauend überlassen usw.150 Dabei sind Hingabe und
Ergriffenwerden nicht etwa fundierte Akte, die sich auf einem vorgängi-
gen Zur-Gegebenheit-kommen des Charisma aufbauen und dieses
Gegebensein als seine fundierende Unterlage voraussetzen. Vielmehr
kommt das Außergewöhnliche, Unalltägliche in den genannten Akten
selbst zur Erfassung; nur denen, die an es glauben und sich ihm
überlassen, manifestiert sich das Charisma; — es manifestiert sich ihnen
gerade i η diesen wesentlich emotionalen Akten. In diesem „Aufrufen",
das für das In-Erscheinung-treten des Charisma wesentlich und charakte-
ristisch ist, liegt es beschlossen, daß seine Manifestation nicht als ein
Sichpräsentieren, Sichdarbieten, nicht als ein einfaches Zum-Vorschein-
kommen und Gegenwärtig-werden zu verstehen ist; aus diesem Grunde
kann man auch nicht davon sprechen, daß es den Beteiligten „gegeben"
ist, wenn man Gegebensein in einem strengen und prägnanten Sinne
nimmt151. Es sind die genannten emotionalen Akte der Hingabe und des
„Glaubens an . . . " , in denen das Charisma sich den Beteiligten kundtut.
Auf diese Emotion ist es gewissermaßen angewiesen, um in einem ihm als
Charisma entsprechenden Sinne genuin erfaßt zu werden. Diese emotio-
nalen Akte sind aber nicht irgendwelche Gefühle ; — vielmehr handelt es
sich bei ihnen um „ E i n s f ü h l u n g e n " und I d e n t i f i z i e r u n g e n 1 5 2 . Das
150 Dieses „Glauben an . . ." im Sinne von „Vertrauen auf . . ." ist charakteristisch
verschieden vom „Glauben daß . . . " ; vgl. auch die Andeutung oben, S. 17—18.
151 Vgl. oben, S. 5 7 - 6 8 .
152 Vgl. hierzu SCHELER, Sympathie, A.V. [S. 90 - 1 1 2 ; G. W. 7, S. 8 7 - 1 0 4 ] ; ferner A II 4 [S.
16—40; G. W. 7, S.29 — 48], Jedoch handelt es sich bei den dort angegebenen Beispielen,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Einsfühlung 201
In-Erscheinung-treten des Charisma bedeutet, daß es als die Ubermacht,
die es seinem Wesen nach ist, Gewalt ergreift über die „Aufgerufenen".
D a s I n - E r s c h e i n u n g - t r e t e n des C h a r i s m a e r f o l g t in A k t e n der
E i n s f ü h l u n g mit i h m : es manifestiert sich genuin in der
H i n g a b e an es, diese H i n g a b e ist eine g e f ü h l s h a f t e I d e n t i f i k a -
tion mit ihm.
In erster Linie vollzieht sich die Einsfühlung mit der charismatischen
Macht beim „Verkünder", beim „Heros", „Meister", „Führer", oder wie
er sonst von seinen Anhängern erlebt und genannt wird. Bei ihm reicht
diese Einsfühlung am weitesten und geht am tiefsten. Schon seine
„Berufung" zum Verkünder bedeutet sein Einswerden mit der Macht, die
sich seiner „bedient" und aus ihm „spricht". Auf der dadurch sich
vollziehenden Daseinsmodifikation beruht die charismatische „Führer-
qualität". Der „Führer" ist deshalb und dadurch „Führer", d. h. vor
gewöhnlichen Menschen ausgezeichnet und ihnen überlegen, daß er in
Einheit mit der „aufrufenden" Macht steht, von der er kündet. Aufgrund
dieses Einsseins hat seine „Botschaft" „aufrufenden" und damit zur
Gefolgschaft verpflichtenden Charakter. Im Sinne dieses Einswerdens
und Einsseins ist auch seine Teilhabe am Charisma zu verstehen, d. h. als
reales Anteilhaben und In-Wesens-einheit-stehen. Diese tiefgehende
Einsfühlung, in der der Mensch sich verwandelt und sein ganzes Wesen
ausgefüllt wird von dem ihn ergreifenden und beherrschenden Charisma,
macht den vollen und konkreten Sinn der hier in Rede stehenden
„Begnadung" aus.
In ähnlicher, aber entsprechend modifizierter Weise stehen die
„Jünger" in Einsfühlung zur charismatischen Macht. Es ist dabei
gleichgültig, ob die „Jünger" „zunächst" von der charismatischen Macht
ergriffen werden und dann einen unter sich finden, dem sich diese Macht
in besonders ausgezeichneter Weise manifestiert, so daß er damit als der
„vorbestimmte Führer" qualifiziert wird, oder ob sie durch die Einsfüh-
lung mit dem „Führer" erst im vollen Sinne des Charisma teilhaftig
werden. Jedenfalls liegen beide Einsfühlungen im Sinne der „Jünger-
schaft" : indem die „Jünger" sich mit dem „Führer" eins fühlen, spüren
sie — ebenfalls in der Weise der Einsfühlung — das Charisma; in der
Einsfühlung mit dem Charisma fühlen sie sich eins mit dem „Führer" als
dem charismatisch besonders Ausgezeichneten und „Begnadeten". —
etwa dem unter e. [S. 23—24 ; G. W. 7, S. 35] genannten, nicht um Einsfühlung ; vgl. oben
S. 114 ff. Auf einiges an dieser Stelle von Scheler Behauptete werden wir noch zu
sprechen kommen.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
202 Das gebundene Zusammensein
Die Einsfühlung der „Jünger" mit dem „Führer", den „Jüngerglauben"
an eine charismatische Person, charakterisiert Scheierais „geistigprakti-
sche S e l b s t i d e n t i f i z i e r u n g mit einer Person — volles Sichselbstein-
setzen f ü r sie und i n sie . . . : Einssetzung der Personsubstanz hat
Einsdenkung, Einswollung, Einsfühlung dann allererst im Gefolge — und
damit Um- und Einsbildung des eigenen Selbst in Wesen und Gestalt des
Meisters ; eine dauernde dynamische Kette von immer neuen Gestaltre-
produktionen der geistigen Gestalt des Meisters im Material der eigenen
psychischen Gegebenheiten". Mit dem Hinweis darauf, daß es sich bei
diesem „Ergriffenwerden, Gepackt- und Uberwältigtwerden durch die
Wesensgestalt des Meisters" um eine „Gestalteinswerdung" handelt, „um
echte Wesens- und Gestaltidentifizierung . . . im Sinne . . . eines W e r -
dens, U m b i l d e n s , E i n b i l d e n s der eigenen Personsubstanz . . . kurz
eines ontischen Prozesses", ist zum Ausdruck gebracht, daß die „Jünger"
in der Einsfühlung mit dem „Führer" realen Anteil an ihm und dem durch
ihn verkörperten Charisma gewinnen153. Auch Scheler betont, daß
„solcher Glaube an" als Geschenk, als Gnade, als verliehen — nicht als
spontane Leistung der Person — erlebt werden muß.
Noch in einer anderen Hinsicht haben Einsfühlungen sowohl für die
Konstitution des Bundes wie auch für das aktuelle Zusammensein der
Bundgenossen eine Bedeutung. Dieses aktuelle bundhafte Zusammensein
ist selbst ein Zusammensein in Einsfühlungen. Die vom Charisma
Gepackten sind in ihm verbunden und geeint. Es ist nicht so, daß jeder der
Genossen für sich ergriffen ist und außerdem noch weiß, daß es auch die
Andern sind. Es kann allerdings so sein, daß sich die Genossen begegnen,
nachdem einem jeden von ihnen sich das Charisma manifestiert hat, und
zwar gerade einem jedem in seiner „Einsamkeit"; dem steht aber die
andere Möglichkeit gegenüber, daß erst im bundhaften Zusammensein
selbst, im gefühlshaften Miteinander das Charisma sich zeigt 1 ". Jedoch
153 SCHELER, Sympathie, S. 101 f. [G. W. 7, S. 96 f.]. Stellt man dieser Interpretation des
ένδυεIV χριστοί) [in G. W. 7, S. 96]: ίνδύεςθαι Χριστσν Pauli den Yorck'schen
Gedanken von der „virtuellen Zurechnung und Kraftübertragung" gegenüber, so zeigt
sich der Unterschied zwischen dem Leben aus historischen Motiven und der auf
Einsfühlung gehenden Emotion. YORCK („Ein Dogma lebt so lange als das intellektuelle
oder allgemein lebendige Motiv wirksam ist, welches es hervorgetrieben . . . All jene
dogmatischen Bestimmungen existieren noch in der lebendigen christlichen Gemeinde.
Sie müssen doch also einen Werth repräsentieren", Briefwechsel, S. 155) beschreibt das
zur Tradition gewordene und gewissermaßen geschichtlich eingewachsene Charisma,
was jedem Charisma unvermeidlich ist (vgl. darüber auch oben, § 11), während Scheler
es auf dessen genuines In-Erscheinung-treten abgesehen hat.
154 Vgl. hierzu SCHMALENBACH, a.a.O., S . 61 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Einsfühlung 203
auch im ersten Falle begegnen sich die Genossen nicht als gleichsam
„parallel" Entflammte; indem sie sich als Menschen eines „Geistes"
begegnen, bilden sie in der Begegnung selbst eine Gemeinde155. Dieses
„In-einem-Geiste-geeint-sein" ist bezeichnend für das Zusammensein im
Bunde. Es ist ein Gefühlsstrom, e i n e charismatische Manifestation, in
der die Menschen leben, und die sie zu einem Bunde werden läßt. Nicht
nur, daß jeder in der Manifestation des Charismatischen, die ihm zuteil
wird, die Anderen „spürt", welche mit ihm gleichen „Geistes" sind, wie
er auch den „Führer" „spürt" (Schmalenbach Sprichthier von einem „das
zentrale Gefühl" umgebenden, oft sogar einbettenden „Gefühls-Hof",
wenn nicht sogar von einem „Gefühls-Meer" in der „Verbundenheit mit
andern"). Worauf es für die hier gemeinte Einsfühlung ankommt, ist, daß
in der Wendung zu den Genossen diese als Menschen des gleichen
„Geistes", als Mitentflammte „erkannt" werden. Dabei ist dieses
„Erkennen" ein Einsfühlen mit dem gleichen Gefühlsstrom, der die in
gegenseitiger Einsfühlung stehenden Genossen zum Charismatischen
hinreißt. Weil es sich um ein und dieselbe charismatische Macht
handelt, die von ihnen Besitz ergriffen hat, und weil jeder in
dem Genossen diese Macht spürt, kann man sagen, daß so etwas
wie eine „Verschmelzung" zwischen ihnen sich e r e i g n e t D a b e i
tritt diese „Verschmelzung" nicht zu jenen Einsfühlungen hinzu, in
welchen die Genossen sich als „Brüder eines Geistes" „erkennen";
vielmehr werden sie, indem sie des einen sie beherrschenden „Geistes" in
Einsfühlungen innewerden, gefühlshaft zusammengeschweißt: sie ver-
schmelzen miteinander in der sie alle hinreißenden und einenden Hingabe
an das sich ihnen manifestierende Charisma. — Auch in diesem
bundhaften Zusammensein gibt es ein Miteinander, das aber von dem
oben157 herausgestellten in der Dimension der Gemeinschaft verschieden
ist. Während das gemeinschaftshafte Miteinander dadurch konstutiert ist,
daß in dem Miteinanderfühlen, -handeln usw. für jeden der Beteiligten die
Anderen gegenwärtig und darin enthalten sind, ist umgekehrt für das
bundhafte Miteinander die Einsfühlung mit dem „Geiste" konstitutiv,
durch den man miteinander geeint ist.
Weil das in Rede stehende Zusammensein die soeben herausgearbeite-
ten Eigenschaften besitzt, fallen hier gewissermaßen die Schranken
155 „Gemeinde", die WEBER (a.a.O., S. 14 [1972, S. 14] als „emotionale Vergemeinschaf-
tung" definiert, ist ein „Bund" im Sinne Schmalenbachs.
156 Vgl. SCHMALENBACH, a.a.O., S. 72.
157 Vgl. S. 188 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
204 Das gebundene Zusammensein
zwischen den einzelnen Beteiligten. Diese Schranken werden von den
Einsfühlungen durchbrochen; alle individualen Besonderungen und
Trennungen heben sich auf158. Hier ist denn auch der Ort für das von
Vierkandt analysierte „Wirbewußtsein" : „Die intentionale Scheidewand
zwischen den verschiedenen beteiligten Personen ist. . . niedergelegt, an
ihrer Stelle besteht ein eigenartiger Einheitszustand . . . das Ichbewußt-
s e i n . . . tritt zurück oder schwindet ganz, an seine Stelle tritt ein
Einheitsbewußtsein, das sich nicht nur auf den Akt bezieht, sondern die
darin tätigen Personen als solche zu einer Einheit zusammenklingen
läßt." 15 ' Gegenüber demjenigen in der Partnerschaft hat das bundhafte
Zusammensein insofern den Charakter der Freiheit, als es kein an
Umweltsituationen gebundenes Zusammensein im Sinne dieser Situatio-
nen und aus ihnen heraus ist, kein Zusammensein in situationsbestimmten
Rollen ; ebenso ist es, wie schon bemerkt160, im Vergleich zum Zusammen-
sein in der Gemeinschaft frei, weil nicht aus umfassenden Lebenszusam-
menhängen heraus erfolgend und nicht in ihnen motiviert. Indem der
Bund sich durch Gefühle der in ihn Eingehenden konstituiert, steht er
ganz und ausschließlich auf den Menschen, die ihn begründen; im
Gegensatz zu den beiden anderen Dimensionen finden sich die Menschen
zum Bunde aus sich selbst heraus und aufgrund „individueller Gescheh-
nisse"" 1 . Diese und keinerlei „natürlichen" Bindungen bzw. Umweltsi-
tuationen begründen das bundhafte Zusammensein. Obwohl die Men-
schen frei zum Bunde zusammenkommen, verlieren sie ihr individuelles
Sein, und zwar in einem viel radikaleren Sinne, als das in der Partnerschaft
oder in der Zugehörigkeit der Fall ist. Das Zusammensein in der
Partnerschaft verweist selbst an seinem Anfang wie auch an seinem Ende
auf partnerschaftsfreie Bereiche 1 "; die gemeinschaftshafte Zugehörigkeit
enthält zwar keine derartige Verweisung auf gemeinschaftsfreie Existenz-
bereiche, aber sie sind mit dieser Zugehörigkeit jedenfalls nicht unverträg-
lich, wenn sie auch zu der gemeinschaftshaften Gebundenheit hinzutre-
ten, so daß der Mensch hier u n d dort existiert 1 ". Dagegen widerspricht
158 Entsprechendes gilt für die „kosmovitale Einsfühlung" wie sie SCHELER, Sympathie, S.
92 ff. [G. W. 7, S. 89 ff.] beschreibt.
1 5 9 VIERKANDT, Gesellschaftslehre, S. 144; vgl. auch S. 210: mehrere Personen . ..
empfinden sich . . . in einer spezifischen Weise als eine Einheit, nämlich als ein ,Wir',
das an die Stelle des ,Ich' tritt oder dieses wenigstens in den Hintergrund treten läßt".
140 Vgl. S. 188-189 und 198.
1 6 1 SCHWALENBACH, a.a.O., S . 7 2 .
162 Vgl. oben, S. 165 ff.
163 Vgl. oben, S. 189 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Einsfühlung 205
die bloße Möglichkeit, der bloße „Gedanke" an Bundfreies dem
bundhaften Zusammensein. Wer im bundhaften Zusammensein auch nur
die Möglichkeit einer bundfreien Sphäre in Betracht zieht, wird eben
gerade damit, daß er sich nicht ganz und restlos hingibt, dem Bunde
„untreu", d. h.er stellt sich selber außerhalb des Bundes. Weil eine jede
Grenze der Hingabe und des Beteiligtseins dem Sinn des Bundes
widerspricht, gibt es innerhalb des Bundes die „Forderung" nach
völligem und vorbehaltlosem Sicheinsetzen1". Man kann in einer parado-
xen Weise sagen : beim Bunde kommen die Menschen frei zu einer Weise
des Zusammenseins zusammen, deren Sinn darin besteht, daß sie alle
Individualität aufgeben müssen.
Gerade weil — wie Scheler es beschrieben hat — die Einsfühlung mit
einer charismatischen Person (wie mit allem Charismatischen überhaupt)
den Sinn einer substantiellen Verwandlung, eines „ontischen Prozesses"
hat, sind die „im Namen" des Charisma und auf es hin Geeinten anders als
die übrigen Menschen. Sie sind durch die charismatische Macht selbst
„erwählt" und „auserlesen". Indem das Charisma sich ihnen manifestiert,
„begnadet" es sie in einer Weise, die nicht jedem Menschen zuteil wird.
Hierin bekundet sich die Unalltäglichkeit des Charisma und die damit
verbundene „Erwähltheit" der Angehörigen eines Bundes.
Weil das Religiöse, zumal an seinem Ursprung, charismatische
Eigenschaften aufweist (die Entstehung einer Religion ist ja nichts anderes
als das In-Erscheinung-treten eines Charisma1'5), lassen sich die dargeleg-
ten Strukturen in besonderer Prägnanz an religiösen bzw. religiös
orientierten sozialen Gruppen veranschaulichen. Jede derartige Gruppe
hat das Bewußtsein des „Andersseins" gegenüber denjenigen, die — von
ihr aus gesehen — „Ungläubige", „Abtrünnige", „Ketzer" sind. Beson-
ders gesteigert ist dieses Bewußtsein der „Erwähltheit" bei jungen
Religionen. Wir verweisen in dieser Hinsicht auf Webers Studien über den
Calvinismus und dessen „geistliche Aristokratie der durch Gott von
Ewigkeit her prädestinierten Heiligen i η der Welt, eine Aristokratie, die
mit ihrem character indelibilis von der übrigen von Ewigkeit her
verworfenen Menschheit durch eine prinzipiell unüberbrückbarere und
in ihrer Unsichtbarkeit unheimlichere Kluft getrennt war, als der
164
Damit hängt auch der von WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 761 [1972, S. 660-661]
so genannte „charismatische Kommunismus" zusammen.
145
Vgl. hierzu WEBER, a.a.O., Teil II, Kap. V [1972, Teil II, Kap. V, S. 245-381] und
SCHMALENBACH, a. a. O . , S. 43 f f .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
206 Das gebundene Zusammensein
äußerlich von der Welt abgeschiedene Mönch des Mittelalters" 1 ". Aber
auch bei relativ geschichtlich stabilisierten Religionen erfährt das Bewußt-
sein der „Auserwähltheit" dann eine besondere Betonung, wenn die
betreffende „Gemeinde" sich gegen das Institutionellwerden des Religiö-
sen, d. h. gegen sein Alltäglichwerden wehrt. Dies läßt sich bei Sekten
nachweisen. Das liegt daran, daß sie als „voluntaristischer Verband" eben
spezifisch bundhaft ist, während die „Kirche" als „Gnadenanstalt, . . . in
die man „hineingeboren" wird, als paradigmatisches Beispiel von
Gemeinschaft gelten kann167. An diesem Unterschied zwischen der
„Kirche" als einer Gemeinschaft und der wesentlich bundhaften „Sekte"
zeigt sich die Abwegigkeit aller Theorien, die sich nicht an den für einen
Verband konstitutiven Momenten orientieren, sondern vielmehr an
Gefühlen und Gesinnungen, welche die Angehörigen zueinander hegen,
ohne nach dem „ O r t " dieser Gefühle und Gesinnungen innerhalb der
vorliegenden sozialen Struktur zu fragen, — wie wir das oben168 in bezug
auf G. Walther ausgeführt haben.
Anhand dieser Darstellung des bundhaften Zusammenseins und der
konstitutiven Bedeutung der Einsfühlungen für diese Form des Zusam-
menseins läßt sich der Unterschied zwischen Einsfühlung und Gefühlsan-
steckung in seiner ganzen Tragweite erkennen. Scheler führt die „Einsfüh-
lung" und „Einssetzung" als „nur gesteigerten Fall, sozusagen Grenzfall
der Ansteckung" ein; für letztere dienen ihm die Massenerregungen als
Beispiel 1 ". Bei Massenerregungen braucht, wie Scheler selbst ausführt und
wie vorher schon Groethuysen gesehen hat170, ein Wissen um die
Stimmung der anderen Beteiligten nicht vorzuliegen. Die Gefühlsanstek-
kung beruht darauf, daß eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre sich
ausbreitet und den Neueintretenden ansteckt.
Darin liegt schon, daß die Ansteckung weder ein Seinsverhältnis zu
dem, wovon man gesteckt ist, begründet, noch daß sie aus einem
166 M. WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübingen 1922, Bd. I, S. 118 ff.
167 Diese Bestimmungen von „Kirche" und „Sekte" hat WEBER, Religionssoziologie, Bd. I, S.
152f. und 211 eingeführt; vgl. auch SCHMALENBACH, a.a.O., S. 44: „Kirche ist eine in
.Gemeinschaft' — oder auch sogar .Gesellschaft' — umgewandelte Sekte, ein reiner
Bund (beides relativ)." Allerdings führt Schmalenbach kein Beispiel einer gesell-
schaftshaften „Kirche" an.
168 Vgl. oben, S. 173 ff.
169 Vgl. SCHELER, Sympathie, S. 12 ff. [ G . W . 7, S. 25 ff.]. Auch WEBER, Wirtschaft und
Gesellschaft, S. 768 [1972, S. 667], meint, „daß alle emotionale Massenwirkung
notwendig gewisse .charismatische' Züge an sich trägt".
170 Vgl. oben, S. 3 8 - 4 0 .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Die Einsfühlung 207
Seinsverhältnis hervorgeht: in keinem Sinne und in k e i n e r H i n s i c h t
i m p l i z i e r t die A n s t e c k u n g ein z w i s c h e n m e n s c h l i c h e s S e i n s v e r -
hältnis 1 7 1 . Eben weil ein solches für die Einsfühlung konstitutiv ist, ist sie
nicht als Grenzfall von Ansteckung zu verstehen, sondern als von dieser
verschieden. Auf der Basis des eben herausgestellten Unterschiedes sind
die Ausführungen Webers172 über „massenbedingtes Handeln" zu korri-
gieren. Was bei ihm „bloße Beeinflussung" und „nur reaktive Nachah-
mung" heißt, ist im Sinne unserer Darlegungen als Resultat von
Ansteckungen zu verstehen; dagegen impliziert das, was er „sinnhafte
Orientierung des eigenen Verhaltens an fremdem Verhalten" nennt, ein
Seinsverhältnis zu Anderen in einer der hier aufgewiesenen Dimensionen,
ausgenommen den von ihm selbst erwähnten Fall, wo jemand eine
zweckmäßige Einrichtung bei einem Anderen sieht und übernimmt,
wofern die beiden nicht als Partner zusammen sind. Im letzteren Falle
handelt es sich um eine Orientierung des einen am Anderen im
Seinsverhältnis der Partnerschaft : ein „Nachahmen" liegt hier in Wirk-
lichkeit gar nicht vor, sondern der eine stellt sich in seinem Verhalten auf
das des Anderen ein. „Ahmt" jemand etwas nach, weil es „als
mustergültig, oder als ständisch vornehm gilt", so bekundet er damit
seinen Wunsch, zu dieser betreffenden Gruppe zu gehören : er trägt ihr
gewissermaßen einen Bund an. Ahmt er es dagegen nach, „weil es ,Mode'
ist", d. h. weil alle es tun, so liegt hier in der Tat „bloße Nachahmung"
vor : er ist von der „Mode" angesteckt, ohne daß darin ein Seinsverhältnis
zum Anderen oder auch nur der Wunsch nach einem solchen enthalten ist.
Eine „Nachahmung" dessen, was „als traditional gilt", gibt es überhaupt
nicht ; denn entweder handelt der Betreffende aus einer Tradition heraus,
in die er hineingewachsen ist (dann liegt keine Nachahmung vor), oder es
handelt sich gar nicht um eine ihm zugehörige Tradition (dann ahmt er
nicht etwas Traditionales nach, sondern es liegt der an erster Stelle
genannte Fall vor). Das alles faßt Weber in eins. Die Verwirrung rührt zum
171 Aus diesem Grunde vermag, wie VIERKANDT, a.a.O., S. 211 f. ausführt, „ein Erlebnis
von sich aus keine Gemeinschaft zu erzeugen". Dabei nehmen wir Gemeinschaft,
in der bei Vierkandt auch der Bund mitinbegriffen ist, als repräsentativ für ein
zwischenmenschliches Seinsverhältnis überhaupt. Allerdings kann, wie weiter ausge-
führt wird, „das gleiche Erlebnis . . . eine innere Annäherung der beteiligten Personen
hervorrufen" und so zu einem Bunde (Vierkandt sagt : Gemeinschaft) führen. Dann aber
handelt es sich nicht nur um ein allen gemeinsames Erlebnis ; vielmehr enthält dieses
Erlebnis schon eine gegenseitige Zuwendung der Beteiligten.
172 WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 11 f . [ 1 9 7 2 , S . 11 f . ] .
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
208 Das gebundene Zusammensein
einen von gewissen Punkten seiner Methodologie her, auf deren
Schwächen Schmalenbach aufmerksam gemacht hat173, zum anderen auch
von dem völlig ungeklärten Begriff von Nachahmung, mit dem er arbeitet.
§ 27 Zur phänomenologischen Interpretation und ihre Anwendung auf
die mitmenschlichen Beziehungen
Die vorstehenden Ausführungen über das Charisma und seine Manifesta-
tionen, über Einsfühlungen und ihren Sinn wollen insofern phänomeno-
logisch orientiert sein, als sie nach dem Sinn der betreffenden Phänomene
und Erlebnisweisen fragen. Was diese Erlebnisse sind, welchen Sinn sie
haben, was in ihnen liegt, wie und als was sie von den beteiligten
Menschen erlebt werden — das suchten wir in dem Umfang aufzuklären,
den unser Problem erfordert und erlaubt. Dabei ist unter dem Sinn der in
Rede stehenden Phänomene und Erlebnisweisen der volle konkrete Sinn
zu verstehen; sie dürfen nicht von irgend einem „Standpunkt" aus
„gedeutet" werden; vielmehr müssen sie ihrem vollen und konkreten
Gehalt nach genommen und expliziert werden. In dem so verstandenen
voll-konkreten Sinn der betreffenden Phänomene liegt es auch, daß sie
nicht als nur subjektive Zuständigkeiten (wie etwa Freude oder Trauer)
verstanden werden dürfen, und daß man in ihnen auch nicht Projektions-
prozesse sehen darf, durch die etwa bei der kosmovitalen Einsfühlung
spezifisch Menschliches in die an sich ganz anders geartete Natur
hineingefühlt, hineinphantasiert, jedenfalls hineingetragen wird. Für den
mit der Natur in Einsfühlung stehenden Menschen ist die Natur etwas
völlig anderes, als sie es dem ihr gegenüberstehenden und sie erforschen-
den Wissenschaftler ist. Sie ist in jenem Fall von eigenartigen lebendigen
Mächten beherrscht, deren er in der Einsfühlung inne wird, und an denen
er in dieser Weise real Anteil gewinnt. Entsprechend liegt es im Sinn jedes
Ergriffenwerdens von Charismatischem, daß sich dabei eine göttliche
oder sonstige außeralltägliche Macht manifestiert, zu der der betreffende
Mensch in ein Seinsverhältnis tritt und an der er eine Teilhabe gewinnt.
Das alles muß in der Deskription und Analyse der betreffenden
Phänomene zu seinem Rechte kommen.
173 SCHMALENBACH, a.a.O., S. 89 ff.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Zur phänomenologischen Interpretation 209
Aber diese Phänomene ihrem vollen konkreten Sinn und Gehalt nach
darlegen und sie a k z e p t i e r e n , sie gewissermaßen mitmachen, ist
zweierlei. G e r a d e das letztere liegt nicht in der Intention
unserer A u s f ü h r u n g e n . Wir nehmen diesen Phänomenen gegenüber
die Einstellung der „phänomenologischen εποχή" ein174. Wir stellen sie
dar, beschreiben und analysieren sie, suchen ihren Sinn für die Beteiligten
herauszustellen, fragen, inwiefern diese Erlebnisse für die Art und Weise
des Daseins bestimmend sind, aber wir eignen uns sie und die
entsprechenden Phänomene nicht an, wir machen von ihnen keinen
Gebrauch, bauen nicht auf ihnen auf, sie geben für uns keine Grundlagen
ab, auf die wir uns zu stellen haben. Wenn wir ζ. B. vom „Führer" und
seiner „Sendung" sprechen, so nehmen wir diese Phänomene als die und
genau die, welche sie für die betreffenden Menschen sind. Aber für uns hat
diese Manifestation gewissermaßen nichts Verbindliches, wir stellen uns
nicht auf ihren Boden, wir machen sie nicht mit, und zwar auch dann
nicht, wenn sie uns selbst betrifft175. In unserer Untersuchung kommt der
„Führer" nicht wirklich als Führer in Betracht, und es ergibt sich uns auch
nichts aus seiner „Sendung", die wir nicht als hinzunehmende und uns
verpflichtende Sendung verstehen. Das alles fungiert für uns nur als
Phänomen, d. h. als in bestimmten Erlebensweisen so und so vermeint.
Mit diesem Vermeinen rein als solchem haben wir es zu tun, wir ziehen
keinerlei Konsequenzen, die über die betreffenden Phänomene und
Erlebensweisen selbst hinausgehen. Aus diesem Grunde haben wir, wo
immer von charismatischen Kräften, Qualitäten, Personen und solchen
Seinsverhältnissen die Rede war, die ihren Sinn von dem betreffenden
Charisma her erhalten, die betreffenden Termini in Anführungszeichen
gesetzt.
Mit dieser Einstellung treten unsere Darlegungen in einen Gegensatz
zu den Intentionen Schelers. Obwohl er, wie wir bemerkten und
zurückweisen mußten, die Einsfühlung als Grenzfall der Gefühlsanstek-
kung betrachtet und das „Vitalbewußtsein" als ihren „ O r t " in der
Konstitution angibt176, will er sie als „echte und wahre" metaphysische
ln Vgl. HUSSERL, Ideen, § 32 [Husserliana III, S. 6 7 - 6 9 ] ,
175 Es kommt nicht darauf an, ob die betreffenden Erlebnisse unsere eigenen oder die
anderer Menschen sind, sondern nur darauf, daß sie wirklich und faktisch einmal
realisiert wurden. Für die phänomenologische Betrachtung genügt ihre Möglichkeit (vgl.
HUSSERL, a.a.O., § 70, über „die Vorzugsstellung der freien Phantasie [Husserliana III,
besonders S. 162], wobei die faktischen und historischen Beispiele Exemplifikationen
dieser Möglichkeiten darstellen.
176 SCHELER, Sympathie, S. 37 ff. [ G . W . 7, S. 45 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
210 Das gebundene Zusammensein
Erkenntnisquelle für gewisse nur so zu erfassende Seiten des an sich
bestehenden Universums angesehen wissen177. Da aufgrund seiner oben178
erwähnten Wissenschaftstheorie die positiven Wissenschaften ihrem
Sinne nach weder auf eine „reine" Erkenntnis abzielen noch auch eine
solche zu Wege bringen können, beruft er sich außer auf die „Wesens-
schau" (die aber bei ihm etwas anderes bedeutet als bei Husserl und
überdies auf einem Mißverständnis der „phänomenologischen Reduk-
tion" beruht179) auf die Einsfühlung mit dem trieb- und dranghaften
metaphysischen Urgrund der Welt als auf Vehikel einer reinen, oder —
wie er es auch nennt - „philosophischen" Erkenntnis. Im Rahmen dieser
Abhandlung können wir uns weder mit der Schelerschen Wissenschafts-
theorie noch mit der kognitiven Bedeutung, die er für die Einsfühlung in
Anspruch nimmt, auseinandersetzen; schon darum nicht, weil eine
prinzipielle Erörterung dieser Probleme erst auf dem Boden der
explizierten Problematik von Existenz und Erkenntnis möglich ist. Wir
müssen nur, um Mißverständnisse bezüglich unserer Darlegungen
auszuschließen, bemerken, daß die genannte Position Schelers sich nicht
ohne weiteres als Konsequenz aus der „Anerkennung" und phänomeno-
logischen Analyse der Einsfühlungsphänomene ergibt, wie denn auch
wir, auch wo wir die D e s k r i p t i o n e n und A n a l y s e n Schelers
übernommen haben, uns damit nicht seine genannte P o s i t i o n zu eigen
machen. Wenn auch von der Einsfühlung, wie überhaupt vom „Leben
in . . . " her, von dem sie einen Modus bildet, eine bestimmte, hier nicht
darzulegende Problematik der Erkenntnis erwächst, so ändert das nichts
daran, daß Erkenntnis in einem strengen und prägnanten Sinne aus-
s c h l i e ß l i c h auf dem Wege der Wissenschaft zu gewinnen ist.
§ 28 Das Charisma als Anfangsphänomen
Das bundhafte Zusammensein haben wir als Verschmelzung in dem Sinne
beschrieben, daß die daran beteiligten Personen sich als von einem
gleichen „Geist" beseelte erfahren. Das Charisma, in dem sie bundhaft
geeint sind, ist wesentlich ungewöhnlich und außeralltäglich. An dessen
177 SCHELER, a . a . O . , A . V I I [S. 1 2 0 - 1 5 4 ; G . W . 7. S. 1 1 1 - 1 3 7 ] ,
178 Vgl. S. 1 1 4 - 1 1 6 .
179 Vgl. SCHELER, Wissensformen, S. 160, 352f., 460f. [G. W. 8, S. 138, 260f„ 362i.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das Charisma als Anfangsphänomen 211
Qualitäten liegt es, daß es in seiner Manifestation die Betroffenen zu sich
hinreißt und gewissermaßen ganz mit sich erfüllt. Die Hingabe an das
Charisma und die Einsfühlung mit ihm haben immer den Charakter der
Ekstase : so mächtig und so überwältigend ist das Neue, welches hier in
Erscheinung tritt, daß es mit einer außergewöhnlichen Ausschließlichkeit
von den Menschen, denen es sich manifestiert, Besitz ergreift und nichts
anderes neben sich duldet oder gar aufkommen läßt. Daß das Charisma in
der Ekstase ergriffen und gespürt wird, bedeutet wörtlich: der, den es
„aufruft", „tritt heraus". Das, woraus er heraustritt, ist die
„ W e l t " , besonders sofern er mit ihr verwachsen und in ihr
verwurzelt ist. Indem man sich dem Charisma hingibt und
durch es ergriffen wird, verliert man die „ W e l t " . — Diese
ekstatische Weltentrücktheit ist selbstverständlich toto coelo verschieden
von dem Gegenübertreten und Hinschauen auf die Welt aus der Distanz
der Erkenntnis. In diesem Falle tritt man von der Welt zurück und löst
sich von ihr, indem man (im engsten Sinne verstanden) nicht mehr in ihr
lebt. Doch durch dieses Gegenübertreten, durch den sie zum Gegenstand
von intentionalen Akten wird, verliert man sie gerade nicht : die „Welt" ist
und bleibt da, und eben ihr gelten die Zuwendungen. In der Ekstase
hingegen wird man aus der „Welt" herausgerissen. Was sich hier
manifestiert, ist so übermächtig — die Unalltäglichkeit hat ja gerade den
Sinn einer unendlichen Überlegenheit über alles Alltägliche —, daß es
nichts vor sich bestehen läßt. Das Verlorengehen der „Welt" besagt dabei,
daß sie in eine dunkle, unbestimmte Ferne versinkt. Auf den Höhepunk-
ten der Ekstase ist sie nicht einmal mehr am Horizont sichtbar180. — Weil
das Charisma in seiner Manifestation die „Welt" verdrängt, reißen die
Bünde, die sich auf es hin bilden, die Bundgenossen aus ihren welthaft-all-
täglichen Bindungen heraus. Gerade gegenüber dem Gemeinschaftshaf-
ten bewährt sich die außergewöhnliche und unalltägliche Macht beson-
ders dann, wenn das Neue sich gegen den konkreten Status einer
bestimmten Gemeinschaft wendet, was zwar nicht der Fall sein muß,
aber häufig genug geschieht. Die vom Charisma Ergriffenen verlassen die
Gemeinschaften, denen sie angehören, und schließen sich in Bünden
zusammen, in denen sie eben durch das Charisma und in ihm geeint sind.
Diese Bünde stehen freilich nicht abseits der bestehenden Gemeinschaf-
ten, in denen die Personen herangewachsen sind. Vielmehr bedeutet das
180 Für ein Beispiel hierfür vgl. bei WEBER, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie,
Bd. I, S. 97 f. aus Bunyan's „The Pilgrim's progress from this world to that which is to
come".
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
212 Das gebundene Zusammensein
Hineingehen in die Bünde eine Abkehr von den „naturhaften" Zugehö-
rigkeiten : „die Träger des Charisma" stellen sich „außerhalb der Bande
dieser Welt"181. Für die von der „Sendung" Ergriffenen versinken mit der
alltäglichen Welt die in ihr bestehenden alltäglichen Bindungen an Besitz,
Heimat, Familie, Nation usw. Umgekehrt sind der Manifestation von
Charismatischem und dem Aufflammen der Bünde gerade solche
Epochen in besonderer Weise günstig, in denen aufgrund irgendwelcher
Not die Gemeinschaftsbindungen gelockert sind. Menschen, deren
Bindungen an das Hergebrachte und Überkommene sich auflockern, und
denen das Traditionale und daher Selbstverständliche in einem bestimm-
ten Sinne problematisch wird, sind in hervorragendem Maße geradezu
prädestiniert für den Eindruck des Neuen, den die Manifestation von
Charismatischem bedeutet : das, wogegen die neue Macht sich durchsetzt,
ist in diesen Fällen schon in sich schwach. — Mit dem Verlorengehen der
„Welt" hängt auch der oben182 herausgestellte Mangel an bundfreien
Sphären zusammen, der für das bundhafte Zusammensein charakteri-
stisch ist. Denn bundfreie Sphären wären ihrem Sinne nach Gebiete der
„Welt", die außer und neben dem Charismatischen und von ihm
unberührt bestehen blieben.
Die Einsfühlungen und Ekstasen, die für die Manifestation von
Charismatischem und für das bundhafte Zusammensein konstitutiv sind,
besitzen eine eigentümliche Labilität. Damit meinen wir primär nicht die
Möglichkeit, daß die Autorität eingebüßt wird, falls die charismatische
Herrschaft sich nicht „bewährt", d. h. nicht die Labilität jedes charismati-
schen Sozialverhältnisses, worauf Weber183 schon hingewiesen hat. Die
Einsfühlungen und Ekstasen sind vielmehr in sich selbst labil : sie können
nicht auf ihren Höhepunkten beharren, sie schwellen an und klingen ab,
vermögen jedenfalls nicht, unverändert anzudauern184. Sie wiederholen
sich ; aber schon damit büßen sie ihre ursprüngliche Kraft ein. Wenn das
Außeralltägliche sich immer wieder manifestiert, wird es damit zwar noch
nicht gewohnt und vertraut, aber die späteren Manifestationen haben
nicht mehr die hinreißende Ubermacht, die den ursprünglichen eignete.
Das bedeutet aber: die „Welt" kommt wieder zum Vorschein.
181
WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 755 [1972, S. 656]; vgl. auch S. 142 [1972, S. 142]
über die „Wirtschaftsfremdheit" des reinen Charisma.
182
Vgl. S. 2 0 4 - 2 0 5 .
183
V g l . WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 7 5 5 [ 1 9 7 2 , S. 6 5 6 - 6 5 7 ] ,
184
Vgl. SCHMALENBACH, a.a.O., S. 73 f.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Das Charisma als Anfangsphänomen 213
Allerdings ist die sich jetzt meldende „Welt" nicht identisch die, welche
vor dem In-Erscheinung-treten des Charisma bestand. Die von ihm
„Aufgerufenen" sind nicht einfach durch rauschhafte Erregungen hin-
durchgegangen, die abklingen und sich spurlos verlieren, wie das bei
Stimmungen, von denen man angesteckt war, der Fall ist185. Daß sie in
Einsftihlung mit Charismatischem standen und noch stehen und so realen
Anteil an ihm gewonnen haben, besagt : sie selbst haben in den Ekstasen
Verwandlungen durchgemacht ; das Neue, das sich ihnen manifestiert hat,
verwandelt sie insofern, als ihr Dasein jetzt von ihm her seinen Sinn erhält
und nicht mehr von dem traditional Überkommenen. So verwandelt
kommt ihnen die „Welt" wieder in den Blick : es ist aber nicht mehr die
alte „traditionale Welt", vielmehr wird auch sie und werden die in ihr
enthaltenen Ordnungen und Institutionen, ζ. B. die politischen, rechtli-
chen, sozialen von dem zum Durchbruch gekommenen Neuen her und in
seinem Sinne verstanden. Und wenn sich die „Welt" verändert hat,
bedeutet dies, daß das jeweils in Rede stehende konkrete Charisma in sie
hineingekommen ist; damit erfährt die „Welt" eine Umzentrierung, und
in dieser Umzentrierung besteht eben ihre Veränderung.
Indem das Charisma so in die „Welt" hineinkommt, entfaltet es sich zu
einer revolutionären Macht; wie Weber meint" 6 , zur „spezifischschöpfe-
rischen revolutionären Macht der Geschichte". Es revolutioniert nicht
primär die „Dinge" und Ordnungen. Vielmehr revolutioniert es „von
innen her" die Menschen, indem es sie verwandelt und ihnen einen neuen
Sinn des Daseins gibt — Weber spricht von einer zentralen „Metanoia der
Gesinnung" — und sie dann als so verwandelte die traditionale „Welt"
umstürzen läßt. Jeder Umsturz der geltenden, eingelebten Ordnungen,
jede Neuordnung der „Welt" gegenüber der Tradition geht nach Weber
zurück auf den Einfluß charismatischer Personen auf ihre Anhänger,
welche ihrerseits das „es steht geschrieben — ich aber sage euch" des
„Meisters" in der „Welt" durchsetzen und sie ihm entsprechend neu
aufbauen187. In diesem „es steht geschrieben — ich aber sage euch"
bekundet sich die Ubermacht und Überlegenheit der charismatischen
„Sendung". Zwar reißt das Charismatische die von ihm „Aufgerufenen"
nicht mehr aus der „Welt" heraus. Es geht im Gegenteil selbst in die
„Welt" ein und erobert sie, indem es nichts bestehen läßt, was ihm nicht
entspricht oder gar widerspricht. Die aufgrund seiner Manifestation
185 Vgl. oben, S. 206 ff.
186 WEBER, a . a . O . , S. 7 5 8 f. [ 1 9 7 2 , S. 6 5 7 f.],
187 WEBER. a . a . O . , S. 141 [ 1 9 7 2 , S. 1 4 1 ] u n d S. 3 7 5 [ 1 9 7 2 , S. 1 8 8 ] ,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
214 Das gebundene Zusammensein
entstehende und allmählich sich ausbildende „Welt" ist in dem Sinne „neu
und voraussetzungslos" orientiert, als die eingewachsenen traditionalen
„Voraussetzungen" umgestürzt werden und diese neue „Welt" allein auf
dem betreffenden Charisma und dem in ihm Enthaltenen, aus ihm sich
Ergebenden als auf ihrer einzigen Voraussetzung ruht. D a s C h a r i s m a
ist in h i s t o r i s c h e r B e z i e h u n g A n f a n g s p h ä n o m e n ; es leitet ein
neues D a s e i n ein und gibt einer „ W e l t " einen Sinn 188 .
Von dieser revolutionären Umwandlung bleibt prinzipiell kein Gebiet
verschont. Schrittweise dringt das Neue in alle Lebensgebiete ein,
allmählich werden alle Sphären der „Welt" und des Lebens in seinem
Sinne umgestaltet und erneuert. Diese Eroberung der „Welt" durch das
Charisma besagt aber sein Verfallen an die „Welt" : je mehr das Charisma
in die „Welt" eindringt und sich in ihr durchsetzt, desto mehr entfernt es
sich von diesem seinem Ursprung, verfällt der Verweltlichung18' und wird
legalisiert und traditionalisiert1'0. Dieser Prozeß ist für das Charisma „der
Weg. . . zum langsamen Erstickungstode" ; auf diesem Wege büßt es
seinen eigentlichen Charakter ein. Die charismatische Herrschaft mündet
ins „Institutionelle" ein ; zwar berufen sich diese „Institutionen" auf das
genuine In-Erscheinung-treten des Charismatischen, wie das Weber für
das Königtum, die Nobilität und anderes ausgeführt hat ; darin aber, daß
sie sich durch die Deszendenz von einem Vorfahren legitimieren, der
„berufen" und „gesendet" war, bekundet sich, daß sie ihre Legitimation
in einem Überkommenen und Eingewachsenen, und eben nicht in einem
genuinen Charismatischen haben. In dieser Entwicklung büßt das
Charisma seine revolutionäre Bedeutung ein und verwandelt sich ins
Gegenteil: es wird selbst zu etwas Tradierbarem, das in irgendeiner Weise
und nach irgendwelchen Regeln weitergegeben wird. Das, was ursprüng-
lich die Menschen „aufrief" und „erweckte", sie aus ihren Gemein-
schaftsbindungen herausriß und in freien Bünden einte, wird auf diesem
Wege selber zum Konstituens und Besitz einer Gemeinschaft, die aus dem
geschichtlich gewordenen „Geist" heraus lebt. Am Ende dieses Weges
steht immer die Umwandlung ins Gemeinschaftshafte, das selbstver-
ständlich ist, und in das man hineinwächst.
188 WEBER, a . a . O . , S. 146 f f .
18 ' An dieser Stelle liegt, worauf hier nur beiläufig hingewiesen werden kann, der Ursprung
des historisch so bedeutungsvollen Phänomens der Säkularisation.
Vgl. hierzu WEBER, a.a.O., Teil I, Kap. III, §§ 11 ff. und Teil III, Kap. X [1972, Teil I, Kap.
III, S. 657 ff.] für alles Nähere.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
D a s C h a r i s m a als A n f a n g s p h ä n o m e n 215
Die entsprechende Verwandlung machen auch die Bünde durch, in
welchen die vom Charisma „Aufgerufenen" geeint sind. Die dem Bunde
als solchem immanente Labilität zwingt, wie Schmalenbach1'1 ausführt,
zur Aufnahme des Ethos der „Treue", um dem betreffenden Bunde Dauer
zu verleihen. „Treue" aber hat bereits „gesellschaftshaften Charakter" ; —
sie bildet die Grundlage all der sozialen Gebilde, für welche das Prinzip
„pacta sunt servanda" konstitutiv ist, und die nur bei strikter Einhaltung
dieses Prinzips bestehen können, d.h. eben der „Gesellschaft" im
eigentlichen Sinne. Erst recht „gesellschaftshaft" ist das „Treue-Gelöb-
nis", das wie jedes Versprechen insofern „freie" und auf sich gestellte
Menschen voraussetzt, als nur derjenige etwas versprechen kann, der
nicht durch Dritte an der Einhaltung seines Versprechens gehindert wird.
Wichtiger als diese Durchsetzung des Bundes mit Momenten bundfrem-
der Provenienz ist das allmähliche Zusammenwachsen der Personen,
wodurch aus dem Bund „Gemeinschaft" wird. In das Charismatische, das
seinen genuinen Charakter verliert und zu einem Traditionsgut wird,
wachsen — in eins mit diesem Prozeß — die Bundgenossen hinein und
werden so einander zugehörig, wobei ihre Zugehörigkeit eben in dem zu
einem Selbstverständlichen und Traditionalen Werdenden ihr Fundament
hat. Ist dieser Prozeß abgeschlossen, dann sind reine Gemeinschaften
entstanden, deren bundhafter Ursprung kaum noch sichtbar ist. D i e s e
Veralltäglichung des u r s p r ü n g l i c h U n a l l t ä g l i c h e n und A u ß e r -
gewöhnlichen s o w i e die damit p a r a l l e l g e h e n d e Verwandlung
des B u n d e s in G e m e i n s c h a f t e r f o l g t nicht nur f a k t i s c h , so daß
das Gesetz dieser Umwandlung nicht den Sinn eines nur induktiv
gefundenen Gesetzes hat; vielmehr handelt es sich hier um
a p r i o r i s c h e und eidetische N o t w e n d i g k e i t e n , die in der allem
B u n d h a f t e n wesentlichen L a b i l i t ä t ihren G r u n d haben. So
werden religiöse Bünde, indem sie sich konsolidieren, zu „Kirchen" im
Sinne Webers, d. h. zu Anstalten mit traditionalem Charakter; charisma-
tiache Kriegsherrschaften wandeln sich in den Patrimonialismus1'2; die
Ehegatten wachsen zur Familie zusammen usw. Freilich, ob die „Tischge-
meinschaft eines Kriegsfürsten mit seinem Gefolge ,patrimonialen' oder
.charismatischen' Charakter hat, kann man ihr äußerlich nicht ansehen —
es hängt von dem .Geist' ab, der die Gemeinschaft beseelt und das heißt:
von dem Grunde, auf den sich die Stellung des Herrn stützt: durch
1.1 SCHMALENBACH, a . a . O . , S. 73 ff.
1.2 V g l . WEBER, a . a . O . , S. 145 ff. [1972, S. 145 ff.].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
216 Das gebundene Zusammensein
Tradition geheiligte Autorität oder persönlicher Heidenglaube""3. Aus
diesem Grunde können wir die von Scheler"4 genannten „Identifizierun-
gen des .primitiven' Denkens, Schauens, Fühlens der Naturvölker
unterster Stufe" nicht ohne weiteres als Beispiele für Einsfühlungen gelten
lassen, die wir hier immer im Sinne der bundhaften Einigung und
„Verschmelzung" verstehen. Denn es ist ein Unterschied, ob der
Primitive in die Einheit mit seinem Totemtier bereits hineingeboren wird,
diese Einheit als „gegeben" und selbstverständlich „vorfindet", oder ob
diese Einheit erst in aktuellen emotionalen Akten des Sich-eins-fühlens
und Verschmelzens, also erst in ausdrücklicher Einigung erwächst und auf
diese Akte angewiesen ist, um überhaupt zu bestehen. Dieser Unterschied
selbst wird weder dadruch flüssig, daß es eine notwendige und im Wesen
der Phänomene gegründete Entwicklungstendenz vom einen zum andern
gibt, noch dadurch, daß in den Stadien dieser Entwicklung die Unter-
scheidung nicht immer mühelos und zuweilen auch gar nicht möglich ist.
§ 29 Die soziologischen Fundamentalkategorien als Strukturen des
„Lebens in . . ."
Unsere Analysen über das Zusammensein mit anderen Menschen haben
uns zur Herausarbeitung dreier Dimensionen mitmenschlicher Begeg-
nung und mitmenschlichen Zusammenseins geführt, die wir als die
Dimension der Partnerschaft, der Zugehörigkeit und der Verschmelzung
unterschieden. Dabei haben wir ständig auf die sachlichen Beziehungen
und Verwandtschaften des hier Dargelegten zu dem hingewiesen, was mit
den soziologischen Kategorien Gesellschaft, Gemeinschaft und Bund
gemeint ist. Wenn wir nicht direkt an die betreffenden soziologischen
Forschungen anknüpften und auch nicht die genannten Begriffe der
Soziologie übernahmen, so geschah dies deshalb, weil wir meinen, von
den Analysen des jeweiligen Sinns mitmenschlichen Zusammenseins aus
auch den primären Sinn dieser soziologischen Fundamentalkategorien
aufklären zu können.
1.3 WEBER, a . a . O . , S . 7 6 2 [ 1 9 7 2 , S . 6 6 1 - 6 6 2 ] ,
1.4 Vgl. SCHELER, Sympathie, S. 17f. [G. W. 7, S. 30].
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Fundamentalkategorien als Strukturen des „Lebens i n . . . " 217
Daß diese keine Klassifikationsbegriffe konkreter sozialer Verbände
sind, wie etwa die Begriffe Aktiengesellschaft, Hausgemeinschaft, politi-
sche Partei und dgl. und auch keine diesen Begriffen übergeordnete
Gattungsbegriffe, wie etwa der eines wirtschaftlichen Verbandes über-
haupt, bedarf keiner Erörterung. Aber sie sind auch von prinzipiell
anderer Struktur als diejenigen Begriffe, die bestimmte soziale Schichten
bezeichnen, wie z.B. die Begriffe Bürgertum, Bauerntum, Proletariat.
Diese fundamentalen Kategorien meinen nicht, auch nicht in abstrakter
Allgemeinheit, bestimmte konkrete soziale Verbände ; die zwischen ihnen
bestehenden Unterschiede bedeuten keine Einteilungen der sozialen
Verbände. Vielmehr gehen sie auf die Arten und Weisen, wie die in
konkreten sozialen Verbänden stehenden Menschen miteinander sozi-
iert1,5 sind. Aus diesem Grunde hat Schmalenbach"6 die fraglichen
Kategorien als „allgemeinste modale Kategorien" bezeichnet; „sie
sind . . . Modi, Daseinsweisen, in denen . . . jedes . . . ,substantiate'
Gebilde . . . existieren kann", wobei diese drei Modi sich „von vornher-
ein" und „essentiell" gegenseitig bedingen. Obgleich „die ,substantialen'
sozialen Gebilde gegen die ,Modi' bis zu gewisser Grenze neutral sind,
. . . [haben] dennoch manche von ihnen . . . eine besondere Affinität zu
der einen oder der anderen oder der dritten der grundlegenden
soziologischen Kategorien", — so z.B. juristische und ökonomische
Beziehungen zur Kategorie der „Gesellschaft", familiäre und irgendwie
familienhafte Gruppen zu der „Gemeinschaft", religiöse Verbände zu der
des „Bundes". Da die Unterschiede der drei „modalen Kategorien" „fun-
damentale Differenzen in der rein ,eidetischen' Sphäre" 197 bezeichnen,
besagt diese Interpretation der soziologischen Fundamentalkategorien :
das Eidos „Societas" überhaupt schreibt den ihm unterstehenden
(eidetischen wie empirischen) Singularitäten das Sein in einem dieser
Modi vor, wobei noch die jeweilige Verklammerung der drei Kategorien
zu berücksichtigen ist, die sich aus ihrer wesenhaften gegenseitigen
Bedingtheit ergibt. Die drei „modalen Kategorien" sind regional-ontolo-
gische1" Fundamentalkategorien eben der Gegenstandsregion „Societas"
überhaupt. Sie bestimmten die jedem Gegenstande dieser Region
1.5 Wir gebrauchen den Terminus „soziiert" an Stelle von „vergesellschaftet", um
Miß Verständnisse, die daraus entspringen können, daß Vergesellschaftung selbst eine Art
und Weise des „Soziiert-Seins" ist, zu vermeiden.
1.6 SCHMALENBACH, a . a . O . , S. 79 f f .
1.7 SCHMALENBACH, a . a . O . , S. 70.
1.8 Vgl. HUSSERL, Ideen, §§ 9 und 16 [Husserliana III, besonders S. 2 3 - 2 4 und S. 3 7 - 3 8 ] ,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
218 Das gebundene Zusammensein
aufgrund eben seiner Regionalität spezifischen Weisen seiner Existenz ; sie
sind die grundlegenden Kategorien für dasjenige Sein, das den Gegenstän-
den der betreffenden Region zukommt. Es handelt sich also bei ihnen um
die fundamentale, material-ontologische Verfassung eines ganz bestimm-
ten Gegenstandsbereichs und des diesem zugehörigen Seins : sie k o n s t i -
tuieren die S e i n s v e r f a s s u n g eben dieses (und keines anderen)
Bereiches von G e g e n s t ä n d e n .
Diese gegenstandsontologische Interpretation der drei „modalen
Kategorien" der Soziologie hat in gewissen Grenzen ohne Frage ihre
Berechtigung. Daß sie aber nicht den primären und u r s p r ü n g l i c h e n
Sinn der drei Modi zum Ausdruck bringt, hat Schmalenbach selbst mit
einer späteren Arbeit 1 " gezeigt. Indem er das Problem einer „Soziologie
der Sachverhältnisse" aufwirft und als Modi möglicher Seinsverhältnisse
zu „Sachen" das „Eigentumsverhältnis", die „traditionale Verwachsen-
heit" und die „emotionale Verbundenheit" angibt, weist er selbst auf
deren Verwandtschaft mit den soziologischen Kategorien „Gesellschaft",
„Gemeinschaft" und „Bund" hin: „es sind die gleichen, die der
Soziologie allenthalben die grundlegenden modalen Kategorien bedeu-
ten"200. Damit ist aber die gegenstandsontologische Interpretation ge-
sprengt. Wenn man „wie mit Menschen, so . . . auch mit Sachen . . .
weiter übrigens auch mit Göttern, mit Ideen und mit noch sehr vielem
anderen sowohl in Gemeinschafts- wie in Gesellschafts- wie in Bundver-
hältnissen stehen" kann, dann sind diese Kategorien eben nicht an ein
spezifisches Gegenstandsgebiet gebunden und haben eine universalere
Bedeutung als nur die, die formale Verfassung des diesem Gegenstandsge-
biet zugehörigen Seins anzugeben. Vielmehr handelt es sich bei
ihnen um die allgemeinsten und f u n d a m e n t a l e n M o d i des
,,Seins mit . . . " , das gleichbedeutend ist mit dem „ L e b e n in . .
In ihrer G e s a m t h e i t und mit ihren V e r k l a m m e r u n g e n machen
sie die S t r u k t u r e n des „ L e b e n s in . . . " aus. Zu eben diesem
Resultat führen auch unsere Analysen des gebundenen Zusammenseins
mit den Mitmenschen, das wir deshalb ein gebundenes nennen, weil man
bei ihm nicht dem anderen Menschen gegenübersteht und ihn zum
Gegenstand von Erkenntnisintentionen macht, sondern mit ihm in etwas
lebt und ihm begegnet. Was wir unter den Titel P a r t n e r s c h a f t ,
Z u g e h ö r i g k e i t und Verschmelzung als drei D i m e n s i o n e n des
199 SCHMALENBACH, „Soziologie der Sachverhältnisse", Jahrbuch für Soziologie, Bd. III
(1927).
200 SCHMALENBACH, a.a.O., S. 44.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Fundamentalkategorien als Strukturen des „Lebens i n . . . " 219
Z u s a m m e n s e i n s beschrieben haben, sind eben Modi des Z u s a m -
menseins mit A n d e r e n , Modi mitmenschlicher B e g e g n u n g e n in
der M i l i e u w e l t , die dadurch charakterisiert ist, daß wir ihr nicht
gegenüberstehen, sondern in ihr leben.
Daß uns die fundamentalen soziologischen Kategorien primär als Modi
des Seins mit Anderen in den Blick kommen und nicht als regional-onto-
logische Fundamentalkategorien, die wesentlich auf einen bestimmt
umschriebenen Gegenstandsbereich (und nur auf ihn) bezogen sind, liegt
an der Differenz unserer Problemstellung gegenüber der der Soziologie.
Für die notwendig aus der Distanz hinschauende und vergegenständli-
chende Einstellung und Betrachtung der Soziologie ist der Mensch ein
Objekt, dem unter anderen Eigenschaften und Bestimmungen soziale
„Anlagen", „Triebe", „Tendenzen" und dgl. zukommen, aufgrund derer
er mit Anderen interagiert und sich in ganz bestimmten, wenngleich
differenzierten Weisen zu ihnen verhält. Indem sich die Menschen infolge
ihrer sozialen „Triebe" und „Tendenzen" zusammentun und in verschie-
dene Verbindungen eintreten, entstehen soziale Gebilde, und diese bilden
das Forschungsgebiet der Soziologie. Diese sozialen Gebilde sind ihre
Gegenstände sui generis201, nach deren Beschaffenheiten, Strukturen, den
sie beherrschenden Gesetzlichkeiten sie fragt. So kommt es zum Problem
der allgemeinsten und daher in einem gewissen Sinne „formalen"
Strukturen der sozialen Gebilde, zum Problem einer Typik der Verbin-
dungsformen, die die „formale Soziologie" untersucht. Bei allen
sozialen Gebilden bestehen zwischen den in die Gebilde eingehenden
Menschen bestimmte Verbindungen; als die allgemeinsten t y p i s c h e n
Formen dieser Verbindungen ergeben sich die als „Gesellschaft",
„Gemeinschaft" und „ B u n d " bezeichneten, wobei diese Formen sich
nicht auf die sozialen „Anlagen" und sonstigen Beschaffenheiten der die
Gebilde bildenden Menschen zurückführen lassen, da sie Formtypen
spezifisch der sozialen Gebilde sind, die eben als Gegenstände sui generis
auf keine anderweitigen Gegenstände reduziert werden können. Aus
diesem Grunde müssen die genannten Formtypen als Gegenstandsstruk-
turen gelten, die einer bestimmten Gegenstandsklasse spezifisch zugehö-
ren und auf diese zu restringieren sind. Geht man zur ideierenden
Abstraktion über, betrachtet man das in allen konkreten sozialen
Gebilden „enthaltene" Eidos „Societas" überhaupt, so ergeben sich, wie
wir gesehen haben, jene Formtypen als regional-ontologische Fundamen-
201 Vgl. VIERKANDT, a.a.O., § 27.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
220 Das gebundene Zusammensein
talkategorien. — Die in Rede stehenden Gegenständlichkeiten, die
sozialen Gebilde, konstituieren sich nun aber, indem Menschen in
bestimmten Weisen zusammen sind, und sich je nach der Art des
Zusammenseins zueinander verhalten. Dieser Bezug auf mitmenschliches
Zusammensein überhaupt ist auch für das oberste Eidos der fraglichen
Gegenstandsregion, für Societas überhaupt, konstitutiv. Daß aber Men-
schen überhaupt interagieren, in Seinsverhältnissen miteinander stehen
und aus diesen heraus sich zueinander verhalten, das liegt nicht daran, daß
der Mensch aufgrund ihm zukommender objektiver Gegenstandsbe-
schaffenheiten (in unserem Fall aufgrund der genannten „Anlagen",
„Triebe" und „Tendenzen") zu anderen Menschen getrieben wird, sich zu
ihnen hingezogen fühlt und dgl. Vielmehr gründet das Zusammensein mit
Anderen in dem In-der-Welt-Sein, welches immer auch ein Inmitten-der-
Mitwelt-Sein bedeutet.
Wir haben es also mit einem „Existential"202 zu tun. Erst auf dem
Grunde dieses In-der-Welt-mit-Anderen-Seins hat es einen Sinn, von
sozialen „Anlagen" usw. zu sprechen; sie konstituieren das mitmensch-
liche Zusammensein so wenig, daß sie es ihrerseits voraussetzen. Nur ein
Wesen, zu dessen Seinssinn es essentiell gehört, mit Anderen zu sein, kann
„Anlagen", „Triebe" und „Tendenzen" in bezug auf diese Anderen
haben. Auf der empirischen Ebene macht sich die Vorgängigkeit der
genannten Seinsstruktur vor den sozialen „Anlagen" darin geltend, daß
diese erst im Zusammensein mit Anderen zur Entfaltung und vollen
Ausbildung gelangen können203. Geht man — wie wir es versucht haben —
dem In-der-Welt-mit-Anderen-Seins als einem Moment des In-der-Welt-
Seins überhaupt nach und untersucht es auf seine Modalitäten hin, so
ergeben sich die herausgestellten Dimensionen der Partnerschaft, Zuge-
hörigkeit und Verschmelzung. Insofern nun das jeweilige mitmenschliche
Zusammensein in einer dieser Dimensionen ein soziales Gebilde konstitu-
iert, das in der Tat in thematisierender Betrachtung sich als Gegenstand sui
generis darstellt, ergeben sich die allgemeinsten Formtypen
dieser sozialen Gebilde — und bei ideierender Abstraktion die
material-ontologischen Fundamentalkategorien dieser Gegen-
standsregion — als konstituierte Derivate der Modalitäten des
In-der-Welt-mit-Anderen-Seins.
202 Vgl. HEIDEGGER, Sein und Zeit, § 12.
203 Dahin zielt auch VIERKANDT (a.a.O., S. 23), wenn er von den sozialen Anlagen, die er als
„angeborene Triebe . . . Eigenschaften und Verhaltungsweisen" faßt, sagt, daß sie „zu
ihrer Betätigung die Anwesenheit anderer Menschen oder genauer gesagt, den Zustand
der Gesellschaft voraussetzen".
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Fundamentalkategorien als Strukturen des „Lebens i n . . . " 221
Um diesem Zusammenhang gerecht zu werden, und um den ursprüng-
lichen Sinn der soziologischen Fundamentalkategorien herauszustellen,
haben wir für die Bezeichnung der Dimensionen des mitmenschlichen
Zusammenseins Ausdrücke gewählt, die ihrem Sinne nach die Modi des
Lebens mit Anderen in der Milieuwelt bezeichnen.
Wenn sich hier Gegenstandskategorien und sogar auch regional-onto-
logische als Derivate existentieller Modi ergeben, so liegt das daran, daß
die betreffenden Gegenstände sich konstituieren, indem Menschen in
bestimmten Modi in der Milieuwelt leben und interagieren. Keineswegs
darf das aber zur Meinung verführen, daß immer und überall regional-on-
tologische und sonstige Gegenstandskategorien Derivate von Existentia-
lien und deren Modis sind, wie denn auch der aufgewiesene Zusammen-
hang kein Spezialfall eines allgemeinen Derivationsgesetzes zwischen
Kategorien und Existentialien ist.
Weil es sich bei den herausgestellten drei Dimensionen um Modi und
um modale Differenzen des Zusammenseins mit Anderen handelt, ergibt
sich aus ihnen auch nicht so etwas wie eine Einteilung der Menschen, mit
denen wir handeln und in irgendeiner Weise soziiert sind. Wir können mit
„demselben" Menschen in jeweils verschiedenen Dimensionen zusam-
men sein, wobei die Identität des sich durch alle Situationen und alle
Dimensionen durchhaltenden „selben" Menschen allerdings zu einem
Problem wird. Bei der Analyse der Partnerschaft wiesen wir darauf hin204,
daß der Partner jeweils von der konkreten Situation her bestimmt wird.
Noch relevanter als die Verschiedenheiten dieser konkreten Situationen,
bei denen es sich immerhin noch um Begegnungen innerhalb ein und
derselben Dimension handelt, sind gerade die dimensionalen Differenzen
dafür, was der mir Begegnende jeweils ist. Sind etwa Gemeinschaftszuge-
hörige in einer Situation zusammen, die außerhalb ihrer Gemeinschafts-
gebundenheit liegt, so begegnen sie sich als Partner und sind einander hic
et nunc auch nichts weiter als Partner; entsprechend sind sie, wenn sich
ein Bund zwischen ihnen bildet, im bundhaften Zusammensein ; dagegen
sind sie in spezifisch gemeinschaftshaften Situationen Zugehörige, und
zwar unbeschadet aller Möglichkeiten des Zusammenseins in anderen
Dimensionen. — Daher kann man nicht, wie Löwith es will, die
Menschen, mit denen man soziiert ist, in einem einzigen Kreise sich
angeordnet denken. Nach Löwith205 unterscheidet sich „der .Bekannte',
204
Vgl. S. 164, A N M . 49.
203
LOWITH, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, S. 54.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
222 Das gebundene Zusammensein
der mir,unter anderen' auf der Straße begegnet, von allen anderen als den
Unbekannten. Innerhalb dieses ,Kreises' — dessen unausdrücklicher
Mittelpunkt man selber ist — von Z u g e h ö r i g e n unterscheiden sich
wiederum die Meinigen als die A n g e h ö r i g e n . Und innerhalb der
Angehörigen bist allererst ,Du' im eigentlichen Sinn der M e i n i g e . " Nur
weil Löwith die Dimensionen und ihre Differenzen übersieht und zu
einer eindimensionalen Deskription des Mitmenschen tendiert, die in
Wirklichkeit eine Verabsolutierung der Dimension der Partnerschaft
darstellt, erscheint ihm das Bild des Kreises als adäquate Darstellung
meiner Seinsverhältnisse zu den Anderen, die je nach ihrem Ort im Kreise
„Näher- und Ferner-Stehende, Angehörige und Fremde" sind. Die
Unterschiede, die hier in Betracht kommen, sind aber nicht quasiquantita-
tiv und graduell. Zunächst muß man die Differenzen der Dimensionen als
verschiedene Modi des Seins mit Anderen in Betracht ziehen. In jeder
dieser Dimensionen gibt es „Kreise", und zwar vielfach verschiedene, und
innerhalb jedes dieser „Kreise" kann man Näher- und Fernerstehende
unterscheiden. Die wichtigsten Differenzen sind aber die der Dimensio-
nen selbst. —
Weil das Zusammensein mit anderen Menschen immer ein Mit-ihnen-
in-der-Welt-sein ist, sind die Dimensionen des mitmenschlichen Zusam-
menseins zugleich Dimensionen des In-der-Welt-seins selbst. Bei der
Darlegung der Gemeinschaft als fundierter Gemeinschaft206 wiesen wir
auf den Besitz der Gemeinschaft (auch und gerade auf den ,,Sach"-besitz)
hin, in den man hineingewachsen ist und zu dem man in einem
Gemeinschaftsverhältnis steht; entsprechend galt uns die „kosmovitale
Einsfühlung" Schelers als Paradigma eines bundhaften Seinsverhältnisses
zur Natur. Als das gesellschaftshafte Seinsverhältnis zu „Sachen"
betrachten wir das bloße Hantieren und Umgehen mit Zeug207. Wenn
Schmalenbach hierfür auf das Eigentumsverhältnis verweist, so hat er
insofern Recht, als mit derart verwendetem Zeug die Anderen „mitbeige-
bracht" werden können, von denen es gekauft, eingetauscht, geschenkt
usw. wird. Weil eben Partnerschaftssituationen „mitbeigebracht"
werden, zeigt dies schon an, daß das in ihnen begründete Seinsverhältnis
206 Vgl. oben, S. 1 7 2 - 1 7 9 .
207 Dabei sei bemerkt, daß die Analysen von §§ 13 ff., wenn sie sich auch an diesem bloßen
Umgehen und Hantieren orientieren, nicht nur auf diesen einen bestimmten Modus von
Leben in der Milieuwelt gehen, sondern daß sie die Strukturen der Milieuwelt selbst und
des Lebens in ihr herausstellen. Was wir dort beschrieben haben, ist allen modalen
Besonderungen vorgängig, liegt ihnen allen zugrunde und ist in ihnen allen enthalten.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Fundamentalkategorien als Strukturen des „Lebens i n . . . " 223
zu dem betreffenden Zeug ein der Partnerschaft entsprechendes ist. Von
den oben208 aufgewiesenen Verweisungsphänomenen her läßt sich die
Identität der Modi des mitmenschlichen Zusammenseins und derjenigen
des In-der-Welt-Seins am prägnantesten fassen. Wenn zu dem Zeug, mit
dem wir umgehen und hantieren, in den Horizonten der jeweiligen
Hantierungssituation Begegnungssituationen mit anderen Menschen
(und damit auch diese selbst) „mitbeigebracht" werden, und wenn
umgekehrt vom konkreten aktuellen mitmenschlichen Zusammensein auf
Zeug und Situationen der Zeug-Umwelt verwiesen wird, so ist in all
diesen Fällen das Seinsverhältnis zum „Mitbeigebrachten" das gleiche wie
zu dem, zu welchem es „mitbeigebracht" wird. Darin, daß unser
ständiges alltägliches „Wissen" um eine uns umgebende Mitwelt und das
prinzipiell gleichartige „Wissen" um die „Sachen"-Welt jeweils abstrakte
Momente an unserem allgemeinen „Weltbewußtsein" sind, wird klar, daß
die Modi des „Lebens in . . . " überhaupt sowohl solche des Seins zu den
„Sachen" wie auch solche des Seins mit Anderen sind. Erfährt unsere
ständige Alltagsmeinung von der uns umgebenden Mitwelt eine Artikula-
tion durch die Dimensionen des mitmenschlichen Zusammenseins, so
betrifft diese Artikulation auch unsere Alltagsmeinung von der Zeug-
Umwelt, in welcher wir leben. Dabei werden beide Alltagsmeinungen in
genau derselben Weise artikuliert.
208 Vgl. oben, S. 137-147.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:11
BIBLIOGRAPHIE
ARISTOTELES: De anima, hg. von E. W A L L A C E , Cambridge 1882.
- Metaphysik, hg. von W. D. Ross, Oxford 1924.
ARNAULD, A . : Des vraies et des fausses Idées, in : Œuvres, Bd. 36, Lausanne 1780.
AVENARIUS, R . : Kritik der reinen Erfahrung, Leipzig 1907.
- Der menschliche Welthegriff, Leipzig 1912.
BECHER, E. : Gesiteswissenschaften und Naturwissenschaften, München/Leipzig 1921.
BERGSON, H . : Mattere et Mémoire, Paris 1 8 9 6 [Œuvres, hg. von A . ROBINET, Paris 1 9 6 3 ,
S. 1 5 9 - 3 7 9 ] ,
BRENTANO, F. : Psychologie vom empirischen Standpunft, hg. von O. K R A U S , Leipzig 1 9 2 4 .
BÜHLER, K . : Die geistige Entwicklung des Kindes, Jena 1922.
C A R N A P , R . : Scheinprobleme in der Philosophie, Berlin 1928 [Neuauflage, hg. von G . PATZIG,
Frankfurt a. M. 1966].
CASSIRER, E . : Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bde., Berlin 1922 ff.
C O H E N , H. : Logik der reinen Erkenntnis, Berlin 1914.
CORNELIUS, H . : Einleitung in die Philosophie, Leipzig/Berlin 1 9 1 1 .
DESCARTES, R. : Œuvres, hg. von A D A M und TANNERY, Paris 1897 ff.
DILTHEY, W.: Gesammelte Schriften, Bd. 2, 5 und 7, Berlin 1922 ff.
[DILTHEY, W . und YORCK VON WARTENBURG, P . ] Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und
dem Grafen Paul Yorck v. Wartenburg, 1877-1897, Halle a. d. S. 1923.
ERDMANN, B.: „Erkennen und Verstehen", Sitzungsberichte der Kgl. Pr. Akademie der
Wissenschaften, 1912.
EWALD, O. : „Welche wirklichen Fortschritte hat die Metaphysik seit Hegels und Herbarts
Zeiten in Deutschland gemacht?" Kantstudien, Ergänzungsheft Nr. 53.
GEIGER, M . „Fragment über den Begriff des Unbewußten und die psychische Realität",
Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 1921, 4, S. 1-137.
- Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik, Bonn 1930.
G E L B , A . und GOLDSTEIN, K . : Psychologische Analysen hirnpathologischer Fälle, Leipzig
1920.
- „Bericht über den am ersten Internationalen Hochschulkurs in Davos gehaltenen
Vortrag", Davòser Revue III, Nr. 8, 15. Mai 1928.
GEYSER, J.: Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, Münster 1912.
GOLDSTEIN, K . : „Uber die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen Vorgängen",
Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie 1923, 54, S. 141-194.
- „Zum Problem der Angst", Allgemeine Ärztliche Zeitschrift für Psychotherapie 1927, 2,
S. 409-437 [abgedruckt in Selected Papers/Ausgewählte Schriften, hg. von A. GURWITSCH,
E. M. GOLDSTEIN-HAUDEK und W. E. HAUDEK, Den Haag 1971, S. 231-262.]
GROETHUYSEN, B.: „Das Mitgefühl", Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der
Sinnesorgane 1904, 34, S. 161-270.
GURWITSCH, Α . : „Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich", Psychologische
Forschung 1929, 12, S. 279-381.
H A R T M A N N , N . : Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, Berlin/Leipzig 1 9 2 5 .
HEIDEGGER, M. : Sein und Zeit, Halle a. d. S. 1927.
H O F M A N N , P. : Das Verstehen von Sinn und seine Allgemeingültigkeit, Berlin 1929.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
226 Bibliographie
HUME, Ό . : Philosophical Works, hg. von GREEN und GROSE, L o n d o n 1 8 7 4 - 7 5 .
HUSSERL, E. : Logische Untersuchungen, Halle a. d. S. 1913 (1. Auflage 1900/1901) [1. Band
in Husserliana, Bd. 18, Den Haag 1975.]
- „Philosophie als strenge Wissenschaft", Logos 1910/1911, 1, S. 289-341 [Nachdruck hg.
von W. SZILASI, Frankfurt a. M. 1965.]
- Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, erstes Buch,
Halle a. d. S. 1913 [Husserliana, Bd. 3, Den Haag 1950.]
- Formale und transzendentale Logik, Halle a. d. S. 1929 [Husserliana, Bd. 17, Den Haag
1974.]
JERUSALEM, W. : Der kritische Idealismus und die reine Logik, Wien/Leipzig 1905.
JODL, F. : Lehrbuch der Psychologie, Stuttgart/Berlin 1924.
KAMT, I. : Kritik der reinen Vernunft. Akademie-Ausgabe, Berlin 1905.
KOFFKA, K. : Die Grundlagen der psychischen Entwicklung. Osterwieck a. H. 1925.
KOHLER, W. : „Uber unbemerkte Empfindungen und Urteilstäuschungen", Zeitschrift für
Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 1913, 66, S. 51-80.
- „Optische Untersuchungen am Schimpansen und am Haushuhn", Abhandlungen der
Klg. Pr. Akademie der Wissenschaften, 1915.
- Intelligenzprüfungen an Menschenaffen, Berlin 1921.
- Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationären Zustand, Erlangen 1924.
- „Bemerkungen zur Gestalttheorie", Psychologische Forschung 1928, 11, S. 188-234.
KÜLPE, O . : Die Realisierung, Leipzig 1920.
LÊVY-BRUHL, L. : Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris 1928.
LIPPS, TH. : Psychologische Untersuchungen, Leipzig 1907.
- Leitfaden der Psychologie, Leipzig 1909.
- Zur Einfühlung, Leipzig 1913.
LOWITH, Κ. : Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, München 1928.
MACH, E.: Die Analyse der Empfindungen, Jena 1922.
MALEBRANCHE, N . : De la Recherche de la Vérité, hg. von J . SIMON, Paris 1846.
MILL, J . ST. : An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy, London 1889.
OPPENHEIMER, F. : System der Soziologie, Jena 1922 ff.
PFANDER, A. : Einführung in die Psychologie, Leipzig 1904.
PLATO: Charmides, hg. von R . M . LAMB, London 1927.
PRANDTL, Α.: Die Einfühlung, Leipzig 1910.
- Einführung in die Philosophie, Leipzig 1922.
- Das Problem der Wirklichkeit, München 1926.
RUSSELL, B.: Our Knowledge of the External World, London 1922.
SCHELER, M. : Wesen und Formen der Sympathie, Bonn 1923 [ = Gesammelte Werke (abg. :
G. W.), Band 7, Bern 1975],
- Die Wissensformen und die Gesellschaft, Leipzig 1926 [ = G. W., Bd. 8, Bern I960].
- Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle a. d. S. 1927 [ = G. W.,
Bd. 2, Bern 1966].
- „Idealismus - Realismus", Philosophischer Anzeiger 1927/1928, 2, S. 255-324.
SCHMALENBACH, H . : „Die soziologische Kategorie des Bundes", Dioskuren 1922, 1,
S. 35-105.
- „Soziologie der Sachverhältnisse", Jahrbuch für Soziologie 1927, 3, S. 38-45.
- „Die Entstehung des Seelenbegriffes", Logos 1927, 16, S. 311-355.
- „Das Sein des Bewußtseins", Philosophischer Anzeiger 1929/1930, 4, S. 354-432.
SCHUPPE, W. : Erkenntnistheoretische Logik, Bonn 1878.
SIGWART, CHR.: Logik, Tübingen 1921.
SPRANGER, E. : „Zur Theorie des Verstehens und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie",
Festschrift J. Volkelt, München 1918.
STEIN, E. : Zum Problem der Einfühlung. Diss. Freiburg i. Br. 1917.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
Bibliographie 227
STERN, W. : Psychologie der frühen Kindheit, Leipzig 1914.
STERN, C. und W. : Die Kindersprache, Leipzig 1926.
STORRING, G. : Einführung in die Erkenntnistheorie, Leipzig 1906.
STUMPF, C . : Tonpsychologie, Bd. 1, Leipzig 1890.
TAINE, H. : De l'intelligence, Paris 1878.
TÖNNIES, F.: Gemeinschaft und Gesellschaft, Berlin 1926.
VIERKANDT, A. : Gesellschaftslehre, Stuttgart 1928.
VOLKEIT, J . : Gewißheit und Wahrheit, Leipzig 1918.
- Das ästhetische Bewußtsein, München 1920.
WALTHER, G. : „Zur Ontologie der sozialen Gesellschaft", Jahrbuch für Philosophie und
phänomenologische Forschung 1923, 6, S. 1-158.
WEBER, M.: Wirtschaft und Gesellschaft Tübingen 1922 [5. Auflage, hg. von J . WINCKEL-
MANN, 1 9 7 2 ] .
- Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, Tübingen 1920.
WEIGL, E. : „Zur Psychologie sogenannter Abstraktionsprozesse", Zeitschrift für Psycholo-
gie und Physiologie der Sinnesorgane 1927, 103, S. 1—45 und 257-322.
WERTHEIMER, M.: „Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt", I, Psychologische
Forschung 1922, 1, S. 47-58.
SPENCER, H . : Principles of Psychology, London 1872.
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:07
NAMENREGISTER
Aristoteles 126, 156 Husserl 4, 13, 14, 25, 30, 39, 41, 54-57,
Arnauld A. 56, 68, 70, 71, 126 59-61, 64, 67-68, 71, 76, 85, 91, 108,
Augustin 185 115, 124, 126, 131, 132, 144, 209-210,
Avenarius 18, 54, 57-59, 84 217
Becher 8, 9, 18-27, 29, 34 Jackson H. 106
Bergson 131-132 Jerusalem W. 43
Berkeley 74, 84 Jesus 187
Brentano 60, 123, 126, 127, 129-131 Jodl F. 43
Bühler K. 98, 111, 112, 119
Bunyan 211 Kant 11, 12, 60, 68, 84, 94, 151, 157
Koffka 34, 87-88, 99
Carnap 9, 43 Köhler 88-89, 98, 113, 116, 117, 121
Cassirer 20, 38, 39, 42, 44-47, 82, 84-85, Külpe O. 43
88, 100, 106-109, 137
Cohen H. 11 Lévy-Bruhl 87, 128, 195
Cornelius 18, 42 Lipps 21, 27-36, 38, 40, 45-47, 59, 63,
66, 77, 81, 111, 137
Descartes 25, 56, 68-72 , 75, 90, 184 Löwith 27, 113, 142-143, 149-151,
Dilthey 11, 13, 144, 150, 151, 154, 157, 155, 158, 168, 221
160, 164, 165, 170, 182, 184-187, 194 Luther 184, 185, 194
Erdmann Β. 8, 28 Mach 16, 18, 43
Ewald O. 58 Malebranche 56
Mill J . St. 15-16, 18
Freud S. 17
Newton 16, 17
Galilei 184
Geiger M . 62, 124, 129-131 Oppenheimer 188
Gelb 100, 106-109
Geyser J. 29 Paulus 185, 202
Goethe 184 Pirandello L. 157
Goldstein 100, 106-119, 110, 125 Pfänder 59, 66, 69
Groethuysen 36, 206 Plato 122
Gurwitsch 11, 60, 61, 66, 73, 78, 87, 95, Prandtl 16, 21, 28, 34, 36, 43
118, 123, 133
Rubin 118
Hartmann N. 11, 39, 62-63 Russell 8, 43
Heidegger 55, 56, 62, 71, 82, 85-87, Scheler 9, 20, 22-24, 26, 27, 29, 32, 36,
95-97, 100-102, 104, 110, 113, 114, 39, 44-47, 55, 76, 78, 82-86, 89-96,
117, 120, 125, 133, 138, 141, 143-144, 112, 121, 137, 145-147, 162, 175, 177,
147, 156, 182, 220 182, 192, 193, 200-202, 204-206,
Hobbes 184 209-210, 216, 222
Hofmann P. 62, 128, 131, 133
Hume 11, 12, 40, 60, 68, 74, 76 Schmalenbach 12, 68, 122, 124, 126, 131,
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:08
229 Namenregister
133, 169-170, 172, 174, 175, 179-182, Tönnies 168, 169, 170, 172, 175, 176, 178,
188, 192, 197, 202-206, 208, 215,' 217, 180-182, 188, 197
222
Schuppe W. 43 Vierkandt 168-169, 175-177, 182, 188,
Scupin 111 189, 193, 204, 207, 219-220
Sigwart 63 Volkelt 9, 36, 144, 145
Spencer 35, 85, 112
Spranger 163, 164, 177, 197 Walther G. 172-176, 184, 206
Stein E. 44, 46, 59, 77, 80-81, 88 Weber M. 172, 173, 197, 199, 200, 203,
Stern C. 98, 100 205-207, 212-216
Stern W. 98, 99, 100, 111, 112, 118, 119 Weigl E. 101, 105-106, 118
Störring 7, 42 Wertheimer 13, 21, 74, 118
Taine H . 28 Yorck 184-187, 202
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:08
SACHREGISTER
Akt 30, 38, 39, 42, 67, 74, 82 , 83, 115, Dinggewißheit 144-145
123, 125, 128, 146, 200, 201, 204, 211
Alltäglichkeit 199, 211 Einfühlungstheorie 30, 34, 38, 45-46
Alltagsmeinung 25, 26, 46, 47, 141, 142, Einsfühlung 200, 202, 204-205, 208-213,
146, 223 216
Alltagsüberzeugung (vgl. auch Ueberzeu- Erfahrung 40-41, 58
gung) 34, 37, 46 Erkenntnis 62, 211
Analogieschluß 8, 9, 28, 150, 186 Erkenntnistheorie 10-14, 20, 90, 144
Analogieschlußtheorie 7, 14-27, 28, 29, Erlebnis 3-5, 31, 35, 40, 41, 44, 61, 67,
30, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 145 91, 125, 126, 128, 130, 193, 207, 208
Andere, der 24-26, 29, 35, 37, 41, 52,
53, 139-140, 141, 145, 148-150, 154, Feld, thematisches 66, 133
155, 160, 162, 163, 166, 180, 188, 189, Freiheit 166-169, 188, 204
193, 194, 203, 207, 219-222 Fremdseelisches 5-9, 14, 17, 19, 20, 24,
Ansatz (oder Befund), phänomenologi- 26, 28-31, 36-38, 4CM6, 75, 80
scher 3, 6, 9, 10, 37, 75 Funktion 97, 100, 140, 148, 149, 155,
Ansteckung 36-37 167, 168
Ausdrucksphänomen 21-23, 44, 45, 47, Funktionsverstehen 161
77, 162-163
Außeralltäglichkeit 212 Gegenstand 3, 4, 58-62, 65, 73, 81-83, 96,
Außergewöhnlichkeit 199 100, 105, 124, 128, 129, 144, 200, 218
Automat 18, 25 Geist, objektiver 177
Gemeinde 203
Besitz 155-177, 179-180, 183, 188, 194, Gemeinschaft 172-178, 179, 180-183,
222 188-189, 191-196, 197, 198, 204-205,
Bewußtsein 10, 11, 63, 125, 126, 129-130 211, 214, 216, 218, 219, 222
- , intentionales 124, 127, 129, 131-133, Geschichte 183-184
143, 188 Geschichtlichkeit 179-187, 195
—, reines 13 Gesellschaft 168-171, 173, 174, 181, 216,
-thematisches 60-61, 124 218, 219
Bewußtseinsphänomenologie 10-14, 75, 80 Gestalt 99
Bewußtseinspsychologie 14
Bund 180, 183, 190, 197, 198, 202-205, Gestalttheorie 13, 55, 56
211, 212, 215, 216, 218, 219, 222
Bundgenosse 188, 190, 198, 202, 203, 211, Historizität 181
215 Horizont 103-104, 138-140, 141, 142,
147, 167, 223
Charisma 199-203, 205, 208, 209, 210-216 Ichbewußtsein 205
cogitatio 63, 65, 66, 68-72, 81-83, 96, 110, Ichbezogenheit 3, 5
124, 160 Icherkenntnis 44
cogito (oder cogitare) 6, 67, 104, 108, 109, Ichgewißheit 144
123 Ichhaftigkeit 44 x
Ding 74-77, 81, 87, 88, 90-92, 94-97, Individuum 51, 53, 154-156, 164, 169,
100, 117, 121, 167 189, 191
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:08
231 Sachregister
Intentionalität 60, 61, 67, 70, 115, 123, Solipsismus 118, 185
125, 126 Sympathie 35-36
- , noematische 25-26
Thema 60, 61, 65, 66, 67, 96, 133
Korrelat, intentionales 38-39 Thematisierung 144
Leben i n . . . 95, 104, 105, 108-110, 114, Tradition 189, 216
115, 117, 120-122, 124, 126, 131, 132, Traditionales 180, 207
142, 159, 200, 210, 216-223
Leben, alltägliches (oder Alltagsleben) 51, Ueberzeugung 6, 15, 17-19, 25, 26, 28,
52, 105 46, 137, 142
Lebensordnung 177 Unalltäglichkeit 205, 211, 215
Lebenswelt 144 Umwelt, natürliche 51, 55, 92, 94, 96,
Lebenszusammenhang 174-175, 180, 181, 104, 138
183, 187, 188, 191, 195, 204 Vergangenheit 181, 183, 188
Leib 39, 44, 75, 79 Vergemeinschaftung 183, 186, 187, 192,
Leiblichkeit 76 196, 203
Mileu 55, 83-88, 90-95, 115, 121, 137, Vergeschichtlichung 183, 186, 196
219, 221, 222 Verhalten, kategoriales 107-108
Mitbeigebrachtes 103, 105, 138, 139, 147, - k o n k r e t e s 107-108
223 Verstehen 160, 178, 187, 194
Mitmensch 4, 16, 17, 26, 47, 51, 53, 73, Vertrag 170-171
75, 81, 137, 144, 157, 186
Mitwelt 140, 142, 146 Wahrnehmung 4-8, 14, 32, 35, 36, 42-46,
Monade 52 74, 77, 83, 89, 90, 91, 121
Welt 67, 75
Partner 149, 150, 152-155, 159-162, 165, Weltbegriff, natürlicher (auch Welt der na-
167, 169, 170, 173, 191, 192, 197, 207, türlichen Einstellung) 54, 55, 56, 57-68,
218 82, 84-85
Phänomen 14, 32, 208-210 Wirbewußtsein 188, 204
Phänomenologie 3, 13, 61, 80, 208-210 Wirerlebnis 40
Psychologie 10-14, 20, 28, 90 Wissen 19, 46, 47, 115, 144, 146, 159,
Regel 159 160, 162, 188, 193, 195
Rolle 140, 153-156, 159, 161-168, 170, Wissen u m . . . 6-7, 9, 14, 17, 20, 26, 34,
171, 174, 192, 204 36, 37, 75, 86, 89, 121, 122, 125, 128,
130, 146, 159, 161, 162, 166, 181, 223
Sinn 52 , 55, 153, 154, 165, 167, 170, 213, Wissen v o n . . . 41, 125, 131
214, 216 Wissenschaft 88, 92, 93, 194, 195, 210
Sinnesempfindung 89
Sinnesfunktion 89-90 Zeug 98, 100, 103, 109, 111-113, 116,
Situation 26, 27, 52, 54, 96, 97, 100, 117, 138, 141, 167, 168, 222, 223
103-113, 117, 120, 121, 124, 137, Zeugganzheit 113, 117, 138
140-142, 145, 148-153, 154, 158, Zeugindentität 116-120
159-165, 161-164, 165, 166-169, 192, Zeugumwelt 137
195, 197, 204, 221, 223 Zusammensein 52 , 53, 148-153, 191, 219,
Situationsverstehen 162 220, 221
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:08
Bereitgestellt von | Saechsische Landesbibliothek - Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden (SLUB)
Angemeldet
Heruntergeladen am | 07.10.16 23:08
Das könnte Ihnen auch gefallen
- PTS 29 Johannes Von Damaskos V. Opera Homiletica Et Hagiographica (1988) PDFDokument628 SeitenPTS 29 Johannes Von Damaskos V. Opera Homiletica Et Hagiographica (1988) PDFCvrator Maior100% (1)
- Fragmente aus der Endzeit: Negatives Geschichtsdenken bei Günther AndersVon EverandFragmente aus der Endzeit: Negatives Geschichtsdenken bei Günther AndersNoch keine Bewertungen
- Pflanzen, Blüten, Früchte: Botanische Illustrationen in Kunst und WissenschaftVon EverandPflanzen, Blüten, Früchte: Botanische Illustrationen in Kunst und WissenschaftNoch keine Bewertungen
- PTS 26 Hilarius Von Poitiers Und Die Bischofsopposition Gegen Konstantius II (1984) PDFDokument420 SeitenPTS 26 Hilarius Von Poitiers Und Die Bischofsopposition Gegen Konstantius II (1984) PDFCvrator MaiorNoch keine Bewertungen
- Gestalt und Gestalten der Soziologie in Hamburg: 120 Jahre Wissenschaft vom SozialenVon EverandGestalt und Gestalten der Soziologie in Hamburg: 120 Jahre Wissenschaft vom SozialenNoch keine Bewertungen
- Das Prinzip »Osten«: Geschichte und Gegenwart eines symbolischen RaumsVon EverandDas Prinzip »Osten«: Geschichte und Gegenwart eines symbolischen RaumsGunther GebhardNoch keine Bewertungen
- Der Nationalsozialismus: Basis- und Prüfungswissen für Schülerinnen und SchülerVon EverandDer Nationalsozialismus: Basis- und Prüfungswissen für Schülerinnen und SchülerNoch keine Bewertungen
- Wilhelm Wundt – Völkerpsychologie: Ein Reader. E-BOOKVon EverandWilhelm Wundt – Völkerpsychologie: Ein Reader. E-BOOKChrista M. SchneiderNoch keine Bewertungen
- Äther: Ein Medium der ModerneVon EverandÄther: Ein Medium der ModerneAlbert Kümmel-SchnurNoch keine Bewertungen
- Gestalt und Gestalten der Soziologie in Hamburg.: Zum 100. Geburtstag der UniversitätVon EverandGestalt und Gestalten der Soziologie in Hamburg.: Zum 100. Geburtstag der UniversitätNoch keine Bewertungen
- Bloch-Jahrbuch 2022/23: Naturallianz in der Klimakrise. Zur Aktualität der Naturphilosophie Ernst BlochsVon EverandBloch-Jahrbuch 2022/23: Naturallianz in der Klimakrise. Zur Aktualität der Naturphilosophie Ernst BlochsFrancesca VidalNoch keine Bewertungen
- multiplicatio et varatio: Beiträge zur Kunst - Festgabe für Ernst Badstübner zum 65. GeburtstagVon Everandmultiplicatio et varatio: Beiträge zur Kunst - Festgabe für Ernst Badstübner zum 65. GeburtstagNoch keine Bewertungen
- Baumgartner. Die Mittlere Oder Die Patristische Und Scholastische Zeit. 1915. Volume 5.Dokument492 SeitenBaumgartner. Die Mittlere Oder Die Patristische Und Scholastische Zeit. 1915. Volume 5.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Spannungswechsel: Mediale Zäsuren zwischen den Medienumbrüchen 1900/2000Von EverandSpannungswechsel: Mediale Zäsuren zwischen den Medienumbrüchen 1900/2000Isabel Maurer QueipoNoch keine Bewertungen
- Depkat GeisteswissenschaftDokument7 SeitenDepkat GeisteswissenschaftIsak GashiNoch keine Bewertungen
- Inventing the EU: Zur De-Konstruktion von "fertigen Geschichten" über die EU in deutschen, polnischen und österreichischen SchulgeschichtsbüchernVon EverandInventing the EU: Zur De-Konstruktion von "fertigen Geschichten" über die EU in deutschen, polnischen und österreichischen SchulgeschichtsbüchernNoch keine Bewertungen
- (Quellen Und Studien Zur Geschichte Der Philosophie 5 - 6) Nikolaus Von Kues - Paul Wilpert (Ed.) - Werke-De Gruyter (1967,2011) PDFDokument821 Seiten(Quellen Und Studien Zur Geschichte Der Philosophie 5 - 6) Nikolaus Von Kues - Paul Wilpert (Ed.) - Werke-De Gruyter (1967,2011) PDFMauricio Sepulveda IturraNoch keine Bewertungen
- Jerusalem und die Länder: Ikonographie - Topographie - Theologie (FS Max Küchler)Von EverandJerusalem und die Länder: Ikonographie - Topographie - Theologie (FS Max Küchler)Noch keine Bewertungen
- Die Antrittsvorlesung: Wiener Universitätsreden der Philosophischen FakultätVon EverandDie Antrittsvorlesung: Wiener Universitätsreden der Philosophischen FakultätNoch keine Bewertungen
- 1 Spis Tresci 2019 WroclawDokument15 Seiten1 Spis Tresci 2019 WroclawKarmelka BaricNoch keine Bewertungen
- Kurz & Knapp: Zur Mediengeschichte kleiner Formen vom 17. Jahrhundert bis zur GegenwartVon EverandKurz & Knapp: Zur Mediengeschichte kleiner Formen vom 17. Jahrhundert bis zur GegenwartMichael GamperNoch keine Bewertungen
- (Lukács-Studien, Band 1) Werner Jung - Von Der Utopie Zur Ontologie - Zehn Studien Zu Georg Lukács-Aisthesis Verlag (2001)Dokument184 Seiten(Lukács-Studien, Band 1) Werner Jung - Von Der Utopie Zur Ontologie - Zehn Studien Zu Georg Lukács-Aisthesis Verlag (2001)KátharsisNoch keine Bewertungen
- Nachkriegserfahrungen: Exklusion und Inklusion von Opfer- und Täter-Kollektiven nach 1945Von EverandNachkriegserfahrungen: Exklusion und Inklusion von Opfer- und Täter-Kollektiven nach 1945Noch keine Bewertungen
- Hin und her - Dialoge in Museen zur Alltagskultur: Aktuelle Positionen zur BesucherpartizipationVon EverandHin und her - Dialoge in Museen zur Alltagskultur: Aktuelle Positionen zur BesucherpartizipationLeo von StieglitzNoch keine Bewertungen
- Fotoalben als Quellen der ZeitgeschichteVon EverandFotoalben als Quellen der ZeitgeschichteVida BakondyNoch keine Bewertungen
- Lehr, Adorno. Kleine Formen. Konstellation, Konfiguration Etc.Dokument268 SeitenLehr, Adorno. Kleine Formen. Konstellation, Konfiguration Etc.Ilias GiannopoulosNoch keine Bewertungen
- Theaterwissenschaft postkolonial, intermedial, neoinstitutionell: Christopher Balme in der Re-LektüreVon EverandTheaterwissenschaft postkolonial, intermedial, neoinstitutionell: Christopher Balme in der Re-LektüreNoch keine Bewertungen
- Astrologers and Their Clients in Medieval and Early Modern Europe PDFDokument230 SeitenAstrologers and Their Clients in Medieval and Early Modern Europe PDFIman Soleimany ZadehNoch keine Bewertungen
- Denkmale - Statuten - Zeitzeugen: Facetten Rostocker Universitätsgeschichtsschreibung (2)Von EverandDenkmale - Statuten - Zeitzeugen: Facetten Rostocker Universitätsgeschichtsschreibung (2)Noch keine Bewertungen
- Gesellschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Hochschuldidaktik, Politikwissenschaft, Forschungsverbund SED-Staat, Kommunikationswissenschaften, Soziologie und TourismusVon EverandGesellschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Hochschuldidaktik, Politikwissenschaft, Forschungsverbund SED-Staat, Kommunikationswissenschaften, Soziologie und TourismusKarol KubickiNoch keine Bewertungen
- "Zeitalter der Extreme" oder "Große Beschleunigung"?: Umweltgeschichte Österreichs im 20. JahrhundertVon Everand"Zeitalter der Extreme" oder "Große Beschleunigung"?: Umweltgeschichte Österreichs im 20. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (1816) und seine Darstellung in expressionistischen BuchillustrationenVon EverandE.T.A. Hoffmanns Der Sandmann (1816) und seine Darstellung in expressionistischen BuchillustrationenNoch keine Bewertungen
- Literatur und Kultur zwischen West und Ost: Imagination, Kommunikation und Wahrnehmung in regionalen KulturräumenVon EverandLiteratur und Kultur zwischen West und Ost: Imagination, Kommunikation und Wahrnehmung in regionalen KulturräumenArtur Dariusz KubackiNoch keine Bewertungen
- Klimaspuren der Bäume: Strahlungsschwankungen der Sonne als ImpulsgeberVon EverandKlimaspuren der Bäume: Strahlungsschwankungen der Sonne als ImpulsgeberNoch keine Bewertungen
- Jesus – Gestalt und Gestaltungen: Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und GesellschaftVon EverandJesus – Gestalt und Gestaltungen: Rezeptionen des Galiläers in Wissenschaft, Kirche und GesellschaftNoch keine Bewertungen
- Die Blauen Bücher: Eine nationale Architekturbiographie?Von EverandDie Blauen Bücher: Eine nationale Architekturbiographie?Noch keine Bewertungen
- Blütenstaub | Jahrbuch für Frühromantik, Bd. 8Von EverandBlütenstaub | Jahrbuch für Frühromantik, Bd. 8Dennis F. MahoneyNoch keine Bewertungen
- Parodie und Verkehrung: Formen und Funktionen spielerischer Verfremdung und spöttischer Verzerrung in Texten des Mittelalters und der Frühen NeuzeitVon EverandParodie und Verkehrung: Formen und Funktionen spielerischer Verfremdung und spöttischer Verzerrung in Texten des Mittelalters und der Frühen NeuzeitNoch keine Bewertungen
- Institution und Utopie: Ost-West-Transformationen an der Berliner VolksbühneVon EverandInstitution und Utopie: Ost-West-Transformationen an der Berliner VolksbühneNoch keine Bewertungen
- »Zwischenräume« in Architektur, Musik und Literatur: Leerstellen - Brüche - DiskontinuitätenVon Everand»Zwischenräume« in Architektur, Musik und Literatur: Leerstellen - Brüche - DiskontinuitätenJennifer KonradNoch keine Bewertungen
- Jenseits des Unbehagens: »Sublimierung« von Goethe bis LacanVon EverandJenseits des Unbehagens: »Sublimierung« von Goethe bis LacanNoch keine Bewertungen
- Weltmeere: Wissen und Wahrnehmung im langen 19. JahrhundertVon EverandWeltmeere: Wissen und Wahrnehmung im langen 19. JahrhundertAlexander KrausNoch keine Bewertungen
- Vom Text zum Bild: Die Collagen von Peter Weiss und ihr Verhältnis zum schriftstellerischen WerkVon EverandVom Text zum Bild: Die Collagen von Peter Weiss und ihr Verhältnis zum schriftstellerischen WerkNoch keine Bewertungen
- Die Konstitution der Dinge: Phänomene der Abstraktion bei Andreas GurskyVon EverandDie Konstitution der Dinge: Phänomene der Abstraktion bei Andreas GurskyNoch keine Bewertungen
- Abraham Kuyper: Calvinismus. Die Stone Lectures von 1898Von EverandAbraham Kuyper: Calvinismus. Die Stone Lectures von 1898Noch keine Bewertungen
- Fotografien im Geschichtsunterricht: Visual History als didaktisches KonzeptVon EverandFotografien im Geschichtsunterricht: Visual History als didaktisches KonzeptBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Musik Colleg 1 MusikepochenDokument116 SeitenMusik Colleg 1 Musikepochenrosi79100% (1)
- Von Massey FergusonDokument54 SeitenVon Massey FergusonLuka BornaNoch keine Bewertungen
- Eniserver Quickstart DDokument19 SeitenEniserver Quickstart DAlberto Souto MartínezNoch keine Bewertungen
- Die Fragmente Der Vorsokratiker Griechisch Und Deutsch Vol. 1 Diels Hermann PDFDokument483 SeitenDie Fragmente Der Vorsokratiker Griechisch Und Deutsch Vol. 1 Diels Hermann PDFdano0512100% (2)
- Grundwissen Technisches ZeichnenDokument9 SeitenGrundwissen Technisches ZeichnenAvemaster100% (1)
- Die 369 Tanzt Mit Der 44I8 Bis Zur 33Dokument8 SeitenDie 369 Tanzt Mit Der 44I8 Bis Zur 33Valakas DCNoch keine Bewertungen