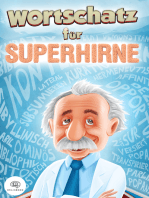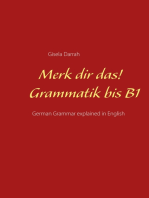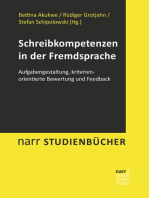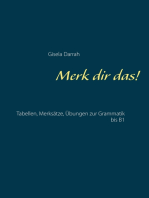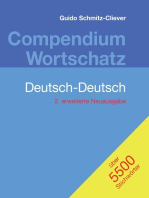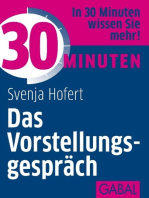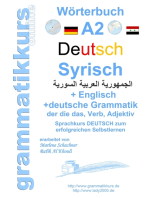Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Grundlagen Der Deutschen Sprache
Grundlagen Der Deutschen Sprache
Hochgeladen von
Vedran Stanetic0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
36 Ansichten94 SeitenCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
36 Ansichten94 SeitenGrundlagen Der Deutschen Sprache
Grundlagen Der Deutschen Sprache
Hochgeladen von
Vedran StaneticCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 94
Grundlagen der deutschen Sprache
Die Buchstaben sind die kleinsten Bausteine des geschriebenen Wortes.
Alle Buchstaben zusammen ergeben das Alphabet.
Das deutsche Alphabet, das auf dem griechisch-rmischen beruht, besteht aus 26
Buchstaben.
1eder Buchstabe kommt in groer und kleiner Schreibung vor. (Siehe auch: "Gro- und
Kleinschreibung"!)
A a
a
B b
bee
C c
:ee
D d
dee
E e
e
F f
eff
G g
gee
H h
ha
I i
i
1 j
fott
K k
ka
L l
ell
M m
em
N n
en
O o
o
P p
pee
Q q
ku
R r
er
S s
es
T t
tee
U u
u
V v
fau
W w
wee
X x
iks
Y y
psilon
Z z
:ett
Die rot gekennzeichneten Buchstaben des Alphabets knnen ohne Zuhilfenahme eines
anderen Lautes gesprochen werden,
man nennt sie daher Selbstlaute oder Vokale.
Die anderen Buchstaben werden mit Hilfe der Vokale ausgesprochen,
man nennt sie daher Mitlaute oder Konsonanten.
Beispiel: Das B ist ein schwach hrbarer, von den Lippen gebildeter Laut, der beim
Buchstabieren kaum zu verstehen ist.
Man spricht das B deshalb unter ZuhilIenahme des Vokals E - also nicht "b", sondern
"bee".
Zum Alphabet hinzu kommen:
` die Umlaute , ,
` das Sonderzeichen (ess-zett).
(Anstelle von kann ss nur dann treten, wenn z. B. auI der Tastatur das
Sonderzeichen nicht vorhanden ist.)
Beachte: Dieser Buchstabe kommt nur in kleiner Schreibweise vor.
Der Laut ist die kleinste Einheit des gesprochenen Wortes.
Es gibt mehr Laute als Buchstaben.
Laute werden unterschieden
1. nach ihrer Stellung im Wort:
` Anlaut (am Wortanfang)
` Auslaut (am Wortende)
` Inlaut (im Wort)
2. nach Krze oder Lnge
` Kurzlaute z.B. in Bett, ritt, fllen
` Langlaute z.B. in Beet, riet, fhlen (siehe auch unten: "Phonem")
3. nach Beteiligung der Stimmbnder:
` stimmhafte Laute z.B. b, d, g, l, m, n, r, w und alle Jokale
` stimmlose Laute z.B. f, h, p, ss, sch, :
4. nach Artikulationsart
` Verschlu- oder Explosivlaute z.B. p, t, k, b, d, g
` Frikative (Reibelaute) z.B. f, s
` Liquide (Gleitlaute) z.B. l, r
` Nasale z.B. m, n, ng
5. nach dem Ort ihrer Bildung:
` Labiale (Laute, die mit den Lippen gebildet werden, z.B. p, b, m, f, w bei f und w
sind zustzlich die oberen Schneidezhne beteiligt)
` Dentale (Laute, die mit den Zhnen gebildet werden, z.B. d, t, s, sch)
` Nasale (Laute, die in der Nase gebildet werden, z. B. n)
` Velare (Laute, die im hinteren weichen Gaumen gebildet werden, z.B. u, o)
` Palatale (Laute, die im vorderen harten Gaumen gebildet werden, z. B. g, k, ch in
"ich")
Die Phonetik (Lautlehre)ist der Teil der Sprachwissenschaft, der sich mit der
Lautbildung und den Eigenschaften der Laute unter physikalischen (akustischen) und
physiologischen (artikulatorischen) Gesichtspunkten beschftigt.
Das Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit des gesprochenen
Wortes.
Man spricht dann von einem Phonem, wenn sich durch den Austausch eines Lautes
durch einen anderen Laut die Bedeutung eines Wortes verndert.
Beispiel: Hand - Hund (Phonemtausch im Inlaut)
Watte - Latte (Phonemtausch im Anlaut)
hinauf - hinaus (Phonemtausch im Auslaut)
betten - beten (kurz gesprochenes e durch Doppelung des nachIolgenden
Konsonanten -
lang gesprochenes e)
Bett - Beet (kurz gesprochenes e durch Doppelung des nachIolgenden
Konsonanten -
lang gesprochenes e durch Doppelung des
Vokals)
kann - Kahn (kurz gesprochenes a durch Doppelung des nachIolgenden
Konsonanten -
lang gesprochenes a mit h als
Dehnungslaut)
ritt - riet (kurz gesprochenes i durch Doppelung des nachIolgenden
Konsonanten -
lang gesprochenes i mit e als
Dehnungslaut)
Hlle - Hhle (kurz gesprochenes durch Doppelung des nachIolgenden
Konsonanten -
lang gesprochenes mit h als Dehnungslaut)
Beachte: Die Lnge eines Vokals (die Dehnung) wird gekennzeichnet durch:
* Verdopplung des Vokals (Haar, Meer, Moor...)
* Dehnungs-h (Kohl, hohl, Mehl, Kuh...)
* e nach i ( ie ) (hier, Lied, Sieg...)
* gar nicht (aber, Hase, Igel...)
Die Krze eines Vokals (die SchrIung) wird gekennzeichnet durch
* Verdopplung des nachIolgenden Konsonanten (Kamm, Hammer, kommen,
rollen...)
Als Diphthonge (Doppellaute) kommen vor: au, u, eu, ei, ai.
Zudem werden noch folgende Laute durch Buchstabenkombinationen dargestellt:
ch, ck und der Reibelaut sch.
Beachte: Das ch kann Ir verschiedene Laute stehen, z.B. in: Chor, Rache, Charme.
Die Silbe ist die kleinste Lautgruppe, die sich aus dem natrlichen Sprechfluss ergibt.
Die zur Silbe verbundenen Buchstaben knnen nicht (z.B. am Zeilenende) voneinander
getrennt werden.
Die deutsche Rechtschreibung unterscheidet zudem zwischen Sprechsilben und
Sprachsilben.
Sprechsilben ergeben sich aus der lautlichen Gliederung (dem natrlichen
Sprechrhythmus) eines mehrsilbigen Wortes.
Sprachsilben sind die Bestandteile eines aus mehreren Silben zusammengesetzten
Wortes (zusammengesetzte Wrter).
Bei der Trennung folgt die reformierte Rechtschreibung strker als bisher den
Sprechsilben.
Beispiel Ir Sprechsilben: lie-ben, Sil-ben-tren-nung, Wei-ter-bil-dung
Beispiel Ir Sprachsilben: Haus-dach, stein-reich, Durch-Iahrt, hell-blau
1edes Wort hat eine Stammsilbe.
Durch Anfgen weiterer Silben vor (Vorsilbe bzw. Prfix)
und / oder nach (Nachsilbe bzw. Suffix) der Stammsilbe entstehen neue Wrter,
die alle zur selben Wortfamilie gehren. (Siehe auch: "Wortarten"!)
Beispiel: Tag ~ tagen - Tagung - tglich - betagt - vertagt - Jertagung
Beispiele Ir PrIixe: ge- ver- be- ent- zer- er-
Beispiele Ir SuIIixe: -ung -heit -keit -nis -bar -lich -ig -er -en -eln
Indirekte Rede
Rudi triIIt Heike und erzhlt ihr: "Denk dir, ich habe in der Lotterie gewonnen
und bin jetzt Millionr. Als erstes mache ich eine Weltreise, danach kauIe ich
mir ein neues Auto."
Heike kann nichts Ir sich behalten, Ilitzt soIort zu Klaus und berichtet ihm:
"Ich habe eben Rudi getroIIen, er hat mir erzhlt, er habe in der Lotterie gewonnen
und sei jetzt Millionr. Als erstes wolle er eine Weltreise machen und sich danach
ein neues Auto kauIen."
Im ersten Absatz werden Rudis Worte direkt wiedergegeben;
es handelt sich also um eine Direkte Rede.
Formal gilt hier die Zeichensetzung der Wrtlichen Rede.
Im zweiten Absatz spricht Rudi nicht selbst.
Seine Worte werden indirekt, nmlich durch Heike weitererzhlt;
hier liegt Indirekte Rede vor.
Um sprachlich zu verdeutlichen, dass man die Worte eines anderen weitergibt,
benutzt man bei der Indirekten Rede die Formen des Konjunktivs.
Die Indirekte Rede steht nicht in AnIhrungszeichen.
Rudi hat mir erzhlt, er habe in der Lotterie gewonnen und sei jetzt Millionr.
Als erstes wolle er eine Weltreise machen und sich danach
ein neues Auto kauIen.
Rudi hat mir erzhlt, er htte in der Lotterie gewonnen und wre jetzt Millionr.
Als erstes wrde er eine Weltreise machen und sich danach
ein neues Auto kauIen.
Hier steht im ersten Fall die Indirekte Rede im Konjunktiv I.
Heike bringt damit zum Ausdruck, dass sie Rudis Worte ganz neutral weitererzhlt.
Der Sachverhalt kann stimmen oder auch nicht.
Im zweiten Fall steht die Indirekte Rede im Konjunktiv II.
Heike bringt damit zum Ausdruck, dass sie am Wahrheitsgehalt
ganz erhebliche ZweiIel hat und eher glaubt, dass Rudi lgt.
Zeichensetzung bei Wrtlicher Rede
Wer etwas zu sagen hat, sollte diese Regeln beherrschen!
Sie rieI : ,Einen Augenblick!
,Einen Augenblick! , rieI sie.
Ich Iragte: ,Kommst du mit?
,Kommst du mit? , Iragte ich.
Sie erwiderte: ,Ich habe keine Zeit.
,Ich habe keine Zeit , erwiderte sie.
Diese Beispiele bestehen jeweils aus * der Erklrung, wer etwas sagt oder denkt
und * der eigentlichen Wrtlichen Rede.
Die Erklrung kann entweder vor oder nach der Wrtlichen Rede stehen.
Beachte im letzten Beispiel: Wenn die Erklrung nach der Wrtlichen Rede steht,
kommen erst die Anfhrungszeichen,
dann das Komma !
,Liebe Schler, sagte der Lehrer, ,morgen Illt die Schule aus.
Die Erklrung kann auch in die Wrtliche Rede eingeschoben sein,
das heit, die Wrtliche Rede wird durch eine Erklrung unterbrochen .
Das mu durch entsprechende Zeichensetzung verdeutlicht werden :
* AnIhrungszeichen unten (es Iolgt die Wrtliche Rede Teil 1)
* AnIhrungszeichen oben
* dann das Komma (es Iolgt die eingeschobene Erklrung)
* nach der Erklrung erst das Komma,
* dann die AnIhrungszeichen unten (es Iolgt die Wrtliche Rede Teil 2)
* wie gewohnt dann erst das Satzzeichen (Punkt, AusruIungszeichen, Fragezeichen)
* zuletzt die AnIhrungsstriche oben .
Merke: Die eingeschobene Erklrung steht zwischen Kommata!
Statt rief, fragte und erwiderte knnen natrlich auch andere Wrter stehen, z.B.
sagte, dachte, meinte, antwortete, entgegnete, widersprach, schrie, Ilsterte,
argumentierte, erklrte usw.
,Werner, du siehst so traurig aus! Was ist denn los?", Iragte die treusorgende EheIrau.
,Ach!", antwortete Werner. ,Ich habe ein Buch mit einem traurigen Schluss gelesen."
,Und welches Buch war das?", wollte seine Angetraute nun wissen.
,Mein Sparbuch" , seuIzte Werner.
KOMMAREGELN
1. Das Komma steht zwischen AuIzhlungen gleichartiger Satzglieder,
wenn diese nicht durch "und", bzw. "oder" verbunden sind.
Meine Freundin ist ein hbsches, schlankes, intelligentes Mdchen.
Sie liebt Musik, schicke Kleider und sportliche Autos.
2. Das Komma steht vor entgegengesetzten Konjunktionen.
Zum Beispiel: aber, sondern, allein, doch, jedoch, vielmehr
Ihr Vater war ein grober, aber gutmtiger Kerl.
Nicht nur seine Hnde, sondern auch seine Fe waren riesig.
3. Das Komma steht nach Anreden.
Herr Lehrer, ich bin gut vorbereitet!
Lieber Michael, ich schreibe dir...
4. Das Komma steht nach EmpIindungswrtern.
Oh je, war das eine Arbeit!
VerIlixt, schon wieder eine Sechs!
Aua, du tust mir weh!
5. Das Komma schliet Appositionen ein.
Der Direktor, ein alter Fuchs, lchelte.
Frau Mller, die Schulsekretrin, ist immer bestens inIormiert..
6. Das Komma schliet Erluterungen ein, die durch "d.h.", "nmlich", "z.B.",
"wie",
"und zwar" eingeleitet werden.
An einem Tag war der Biologieunterricht besonders interessent, nmlich am Freitag.
Bestimmte Themen , z. B. Balzverhalten und FortpIlanzung , interessieren uns
besonders.
7. In Satzreihen werden Hauptstze durch Kommata getrennt. (Beispiel 1)
Das Komma steht auch, wenn ein Hauptsatz in einen anderen eingeschoben
wird. (Beispiel 2)
Werden zwei vollstndige Hauptstze durch ,und" bzw. ,oder" verbunden,
kann das Komma stehen. (Beispiel 3 und 4)
Er rannte in den Klassenraum, er sah sich um, und er handelte. (1)
Du kannst, ich betone es noch einmal, nicht an dieser Schule bleiben. (2)
Er rieI den Schler zu sich, und dieser nahm sein Zeugnis entgegen. (3)
Er rieI den Schler zu sich und dieser nahm sein Zeugnis entgegen. (4)
8. Das Komma steht zwischen Satzteilen, die durch anreihende Konjunktionen
in der Art einer AuIzhlung verbunden sind.
Zum Beispiel: bald - bald
einerseits - andererseits
einesteils - anderenteils
teils - teils
je - desto
ob - ob
halb - halb
nicht nur - sondern auch
Einerseits verhlt sich Susi noch wie ein kleines Mdchen, andererseits mchte sie gern
schon erwachsen sein.
Teils spielt sie mit ihren alten Puppen, teils schminkt sie sich wie ein Model.
Ob sie mit Puppen spielt, ob sie sich schminkt - s ist sie allemal. :-)
9. Das Komma trennt den Gliedsatz vom bergeordneten Hauptsatz ab.
a) den Begrndungssatz
Weil es schellt, gehen die Schler in ihren Klassenraum.
Die Schler gehen in ihren Klassenraum, weil es schellt.
Die Schler gehen, weil es schellt, in ihren Klassenraum.
b) den indirekten Fragesatz
Niemand wusste, wann die nchste Klassenarbeit geschrieben werden sollte.
Wann die nchste Klassenarbeit geschrieben werden sollte, wusste niemand.
c) Relativsatz
Die junge Dame, die du mir vorstellen willst, kenne ich schon.
Ich kenne schon die junge Dame, die du mir vorstellen willst.
10. Das Komma steht zwischen AuIzhlungen gleichartiger Gliedstze,
wenn diese wenn diese nicht durch "und" bzw. "oder" verbunden sind.
Weil sie hbsch ist, weil sie mich liebt und weil sie zudem einen reichen Vater hat, werde
ich sie heiraten.
11. Das Komma steht nach herausgehobenen Satzteilen, die durch ein Pronomen
oder Adverb erneut auIgenommen werden.
Deine Schwester, die habe ich gut gekannt.
In meiner Studentenbude, da haben wir uns oIt geksst.
12. Das Komma kann den erweiterten InIinitiv mit "zu" abtrennen,
das gilt ebenso bei "um zu" , "ohne zu", "anstatt zu".
Der Lehrer bat den Klassensprecher ( , ) ihn zu vertreten.
Ohne zu zgern ( , ) sagte dieser zu.
13. Auch der einIache (nicht erweiterte InIinitv) mit "zu" wird durch das Komma
vom Satz getrennt,
wenn durch "es" darauI hingewiesen wird.
Es Iiel ihm nicht leicht, zu schweigen.
14. Das Komma kann das erweiterte Partizip vom Satz trennen.
Ist das erweiterte Partizip in den Satz eingeschoben, muss es durch Kommata
abgetrennt werden.
Vor Angst zitternd ( , ) stand der beltter da.
Aber: Der Direktor, verrgert durch den Lrm, eilte herbei.
15. Das Komma trennt zwei ungebeugte Partizipien vom Satz, wenn diese durch
"und" verbunden sind
. Die Sonne, hell und klar, ging ber ihnen auI.
Der Deutschlehrer, geachtet und geliebt, betrat den Klassenraum.
Die Schler, chzend und sthnend, schrieben eine Klassenarbeit.
16. Das Komma trennt zwei nachgestellte Adjektive vom Satz, wenn diese durch
"und" verbunden sind.
Alle Schler, groe und kleine, Irchten sich vor einer Sechs.
17. Das Komma gliedert mehrteilige Datums- und Zeitangaben.
Schwerte, den 28. Mai 2000
Mnchen, im Oktober 1999
Ich komme am Samstag, den 12. Dezember, (um) 18.30 am Dortmunder HauptbahnhoI
an.
REGELN ZUR ZEICHENSETZUNG
1. Der Punkt schliet Aussagestze ab.
2. Der Punkt steht bei Abkrzungen, die im vollen Wortlaut gesprochen werden;
ebenso bei Ordnungszahlen.
Dr.med. Doktor der Medizin
i.A. im AuItrag
Wilhelm III.. Wilhelm der Dritte
3. Kein Punkt steht nach Abkrzungen, die Mnzen, Mae oder Gewichte
bezeichnen
oder ein Kurzwort darstellen, nach berschriIten, Buch- und Zeitungstiteln
und nach Datumsangaben.
DM cm kg UNO
Vor Sonnenuntergang (Drama)
Die Welt (Zeitung)
Der Stern (ZeitschriIt)
21. 4. 2002
4. Der Doppelpunkt steht vor der angekndigten wrtlichen Rede;
vor angekndigten AuIzhlungen und Erklrungen;
vor Stzen, die eine ZusammenIassung des vorher Gesagten darstellen.
Der Kapitn sagte: "Wir legen morgen in Hamburg an."
Das SchiII wird mehrere HIen anlauIen: Rotterdam, Le Havre, London und
Bremen.
Mochte es Tage ohne warme Mahlzeiten, Wochen voller Sturm, Monate ohne Post
geben: Er liebte die SeeIahrt.
Merke: Werden Erluterungen durch "z.B.", "nmlich", "und zwar" eingeleitet, so
steht kein Doppelpunkt,
sondern ein Komma!
Fr ihn gab es nur ein Ziel,nmlich Hamburg.
In den Ferien Iuhr er nach Italien, und zwar nach Venedig.
5. Das Semikolon kann das Komma vertreten, wenn dieses zu schwach, der Punkt
hingegen zu stark trennt.
Drei Tage lang warteten wir auI Ladung; endlich rollte der Lastwagen an.
6. Das Semikolon steht zwischen lngeren Stzen, wenn diese durch
Konjunktionen,
z.B. "denn", "aber", "doch" usw. verknpIt sind.
Der Kapitn Iluchte und trieb uns zur Eile an; aber der Kran Iiel aus und zwei
Decksleute erkrankten.
7. Das Semikolon trennt in AuIzhlungen Gruppen zusammengehrender
BegriIIe.
Wir luden Bau- und Grubenholz; Zement und Kalksteine; Baumaschinen, Trecker und
Lastwagen.
8. Das Fragezeichen steht nach Fragestzen oder alleinstehenden Fragewrtern.
9. Das AusruIungszeichen schliet BeIehls-, Wunsch- und AusruIstze ab.
"Herhren!", rieI der Bootsmann. Wenn es doch Feierabend wre! Was Ir eine
Nachlssigkeit!
10. Das Auslassungszeichen (der Apostroph) steht an Stelle eines
ausgelassenen Buchstabens.
Heil'ger Strohsack!
So ist's richtig!
Merke: Kein Apostroph steht bei "aufs", "ins", "ans" "durchs" und anderen
Prpositionen,
die mit einem Artikel verschmelzen.
Es ging auIs Wasser und segelte durchs Weltmeer.
11. Der Bindestrich tritt an die Stelle wegIallender Grund- und
Bestimmungswrter;
er trennt Wortzusammensetzungen.
Vor- und Nachteile
Gepckannahme und -ausgabe
Donau-DampIschiIIahrts-GesellschaIt
I-Punkt
12. AnIhrungszeichen stehen vor und hinter einer wrtlichen Rede.
Sie stehen auch bei wrtlich wiedergegebenen Gedanken.
Friedrich der Groe sagte: "Ich bin der erste Diener meines Staates."
"Wenn alles nur schon vorber wre", dachte Uwe.
"Es ist schn", dachte er, "dass sie zurckgekommen ist."
13. In AnIhrungszeichen stehen Zitate, um zu kennzeichnen, was man wrtlich
aus anderen Texten bernommen hat.
"Das Lied von der Glocke" wurde im Jahre 1800 gedichtet.
Der BegriII "Zitat" wird im Deutschunterricht oIt verwendet.
Anmerkung: Anfhrungsstriche stehen grundstzlich am Anfang unten und nur am
Ende oben.
Nur bei Maschinenschrift, wo keine Anfhrungszeichen unten mglich
sind,
wird eine Ausnahme gemacht!
Siehe auch: "Zeichensetzng bei Wrtlicher Rede" !
Nebenstze
1. Konjunktionalstze
Satztyp zumeist eingeleitet durch Iolgende Konjunktionen
1.1 Temporalsatz als, whrend, seit, seitdem, solange, sobald
(Zeitsatz)
Als ich noch zur Schule ging, hatte ich viel mehr
Freizeit.
Whrend wir einkauIen waren, wurde bei uns
eingebrochen.
Seitdem er verheiratet ist, kommt Theo nicht mehr zum
Skatabend.
Solange man im Glashaus sitzt, soll man nicht mit
Steinen werIen.
1.2 Konditionalsatz wenn, Ialls
(Bedingungssatz)
Falls sie bis zum Ende des Monats nicht ihre Rechnung
bezahlen,
lasse ich die Ware wieder abholen.
Wenn ich mal gross bin, werde ich RennIahrer.
1.3 Kausalsatz weil, da
(Begrndungssatz)
Weil sie den Zug versumt hat, kommt sie erst heute
Abend an.
Ich habe die PrIung bestanden, da ich gut
vorbereitet war.
1.4 Konzessivsatz obgleich, obschon, wennschon, auch wenn
(Einrumungssatz)
Ich glaube dir nicht, auch wenn du es noch so
beteuerst.
Obgleich du so reich bist, glcklich bist du nicht.
1.5 Konsekutivsatz dass, so dass, ohne dass
(Folgesatz)
Es ist so kalt, dass die Fenster zuIrieren.
Der Jger schoss auI das Reh, ohne dass er es traI.
1.6 Finalsatz damit, dass, auI dass
(Absichtssatz)
Ich lerne die Vokabeln, damit ich den morgigen Test
bestehe.
Wir mssen Vorsorge treIIen, dass der Staat keine
Schulden macht.
1.7 Modalsatz indem, dadurch dass, ohne dass
(Art- und Weisesatz)
Der Tiger Ingt seine Beute, indem er sich vorsichtig
anschleicht.
Ohne dass es das OpIer merkt, nhert sich die tdliche
GeIahr.
Dadurch dass du vor einer GeIahr die Augen
verschliesst,
wehrst du sie nicht ab.
Der Vergleichssatz ist ein Sonderfall des
Modalsatzes.
Er wird eingeleitet durch: als ob, wie wenn, je ...
desto
1e mehr du nachdenkst, desto klarer erkennst du dein
Unrecht.
Ihr besucht mich, als ob ihr euch verabredet httet.
eingeleitet durch Relativpronomen
2. Relativstze der, die, das; welcher, welche, welches
Das alte Haus, das neulich ausgebrannt ist, wird
abgerissen .
Das alte Haus, welches neulich ausgebrannt ist, wird
abgerissen .
eingeleitet durch Interrogativpronomen
3. Indirekte Fragestze wer, was; welcher, welche, welches
wann; wo; ob; warum
Der Lehrer kann beim besten Willen nicht entscheiden,
wer von wem abgeschrieben hat.
Meine Frau Iragt mich stndig, welches Kleid sie anziehen
soll.
Er Iragte mich, wann wir uns treIIen.
Sie Iragte mich, wo ...
Ich Iragte ihn, warum ...
Beachte: Der Nebensatz (erkennbar an dem typischen Einleitungswort)
kann a) am Anfang oder b) am Ende des Satzgefges
stehen.
Er kann aber auch c) in den Hauptsatz eingeschoben sein (siehe
"Relativstze"!).
Stets wird der Nebensatz durch ein Komma vom Hauptsatz getrennt.
Syntax (Die Lehre vom Satzbau)
Satzbaustein: Frage: Beispielsatz:
1. Subjekt Wer oder was...? Ich arbeite.
(Satzgegenstand) Harry schlIt.
Der Lehrer lobt den guten Schler.
2. Prdikat Was tut...? Ich arbeite. Harry schlft.
(Satzaussage) Was erleidet...? Der arme Hund wird gebadet.
(Was wird vom Subjekt ausgesagt?)
3. Objekt
(Satzergnzung)
3.1 Akkusativ-Objekt Wen oder was...? Der Lehrer lobt den guten Schler.
Der Cowboy sattelt sein Pferd.
3.2 Dativ-Objekt Wem...? Ich schenke meinem Freund ein Buch.
Ich vertraue ihr.
3.3 Genitiv-Obj. Wessen...? Wir gedenken der Toten.
Unser Opa erinnerte sich gern
alter Zeiten.
4. Umstandsbestimmung
4.1 der Zeit Wann...? Gestern Abend waren wir im Kino.
Um fnf Uhr wollen wir uns treIIen.
Wie lange...? Ich warte schon seit drei Stunden
auI dich.
4.2 des Ortes Wo...? Gestern Abend waren wir im Kino.
und Am Stadtpark treIIen wir uns.
der Richtung Wohin...? Wir Iahren heute nach Dortmund.
Woher...? Wir kommen aus der Schule.
4.3 des Mittels Womit...? Ich schreibe mit dem Bleistift.
Wodurch...? Er rettete sich durch einen
Hechtsprung.
4.4 der Art und Weise Wie...? Er arbeitet wie ein Pferd.
AuI welche Weise...? Ich schreibe frhlich pfeifend
einen BrieI.
4.5 des Zweckes
und der Absicht Wozu...? Ich kmpIe um zu siegen.
Der Freund kam zu Hilfe.
5. Apposition - - - Mainau ,eine Insel , liegt im
(EinIgung) Bodensee.
Unser Lehrer ,ein strenger Mann ,
ist zuIrieden mit unserer
Leistung.
6. Attribut
(BeiIgung)
6.1 Adjektiv-Attribut einen langen BrieI
ein schnes Auto
die alte morsche Buche
6.2 Partizipial-Attribut ein hupendes Auto
das schlafende Kind
das singende klingende Mainz
6.3 Genitiv-Attribut die Trme der Stadt
das Auto meines Freundes
das Vermgen des Vaters seiner
Freundin
( doppelter Genitiv !)
Prpositionen (Verhltniswrter, auch: Beziehungswrter; sterr.
Vorwrter)
Prpositionen (von lateinisch "praeponere" vorangestellt) geben an, in welchem
Verhltnis Personen, Dinge oder Vorgnge zueinander stehen.
Du kannst z.B. vor, hinter oder neben, sogar auf einem Auto stehen; unter einem Auto
liegen oder zwischen zwei Autos sein. In welchem Verhltnis (hier: rtlichen Verhltnis) du
zu einem Auto stehst, sagt uns in diesem Beispiel das Verhltniswort. Es bezeichnet das
Verhltnis der Dinge zueinander.
Prpositionen knnen aber nicht nur lokale (rtliche) Angaben machen - die Art des
Verhltnisses kann sein:
* lokal (Ort): Der Schwamm liegt hinter der TaIel.
* temporal (Zeit): Er liegt schon seit drei Tagen dort.
* kausal (Grund): Dank deiner HilIe haben wir ihn wiedergeIunden.
* modal (Art und Weise): Peter hat ihn mit Absicht dort versteckt.
Prpositionen knnen zu verschiedenen Wortarten in ein Verhltnis treten:
* Verb: z.B. sich sorgen / kmmern um
* Adjektiv z.B. auf jemanden eiIerschtig sein
* Nomen z.B. die Sorge um...
Prpositionen bestimmen den Kasus:
* den Genitiv erIordern z.B. abseits, angesichts, anhand, auIgrund, auerhalb, diesseits,
inIolge,
innerhalb, oberhalb, unterhalb, zwecks,
* den Dativ erIordern z.B. aus, auer, bei, binnen, entsprechend, entgegen, gegenber,
gem,
mit, nach, nebst, samt, seit, von, zu,
* den Akkusativ erIordern bis, Ir, gegen, ohne, um, wider,
Beachte: Bei trotz, whrend, wegen ist neben dem Genitiv auch der Dativ erlaubt.
Vor, an, hinter, in, neben, unter, ber, vor, zwischen knnen mit dem Dativ oder
Akkusativ stehen.
Zum Beispiel: Ich gehe auf die Strae.. Frage "Wohin?" Also: Akkusativ.
Ich bin auf der Strae. Frage "Wo?" Also: Dativ.
Prpositionen knnen stehen:
* vor dem Nomen, dessen Kasus sie bestimmen (das ist meistens der Fall).
Zum Beispiel. Ich fahre nach Schwerte.
Ich fahre mit dem Auto dorthin.
* nach dem Nomen stehen
Zum Beispiel. des Spaes halber...
dem Geset: zuwider...
* vor oder nach dem Nomen stehen
Zum Beispiel. entlang der Strae...
die Strae entlang...
Prpositionen knnen mit einem Artikel verschmelzen:
an dem > am
bei dem > beim
in das > ins
durch das > durchs
hinter dem > hinterm
hinter den > hintern ;-)
zu dem > zum
zu der > zur
Beachte hierzu auch die Groschreibung von Verben.
Zum Beispiel. beim Radfahren, :um Wandern, ins Schwrmen usw.
Getrennt- und Zusammenschreibung
unter Bercksichtigung der "neuen Rechtschreibung"
Verbindungen aus Substantiv und Jerb werden getrennt geschrieben.
Beispiele: Auto Iahren, Rad Iahren, Eis lauIen, Klavier spielen,
Halt machen, Maschine schreiben, Acht geben,
Verbindungen aus Substantiv und Partizip werden getrennt
geschrieben.
Beispiele: AuIsicht Ihrend, Achtung gebietend, Handel treibend,
Erdl exportierend, Abscheu erregend, Fleisch Iressend,
Feuer speiend, Freude bringend / ~ spendend,
HilIe suchend, Ma haltend, Metall verarbeitend,
Musik liebend, Not leidend,
Verbindungen aus einem Jerb im Infinitiv und einem zweiten Jerb
werden getrennt geschrieben.
Beispiele: sitzen bleiben, kennen lernen, Iallen lassen,
bestehen bleiben, Ilten gehen, haIten bleiben,
Verbindungen aus einem Partizip und einem Jerb werden getrennt
geschrieben.
Beispiele: geIangen halten, verloren gehen,
Verbindungen mit "aneinander", "auseinander", "aufeinander",
"...einander"
werden getrennt geschrieben.
Beispiele: aneinander Igen, aneinander geraten, aneinander grenzen,
aneinander legen,
auseinander biegen, auseinander gehen, auseinander nehmen,
auseinander setzen, auseinander halten, auseinander leben,
gegeneinander prallen, gegeneinander stoen,
auIeinander liegen, auIeinander beien,
ineinander Ilieen, ~ greiIen, ~ schieben,
Verbindungen aus Adverbien mit "--wrts" und Jerb werden getrennt
geschrieben.
Beispiele: auIwrts gehen, vorwrts kommen,
Verbindungen mit "sein" werden getrennt geschrieben.
Beispiele: beisammen sein, auI sein, an sein,
Verbindungen aus Adjektiv und Jerb werden getrennt geschrieben,
wenn das Adjektiv steigerbar oder durch "sehr" oder "ganz"
erweiterbar ist.
Beispiele: ernst nehmen ~~ sehr ernst nehmen,
gerade sitzen ~~ ganz gerade sitzen,
gern gesehen ~~ sehr gern gesehen,
gut gehen ~~ besser gehen,
schlecht gehen ~~ schlechter gehen,
schwer Iallen ~~ schwerer Iallen,
Verbindungen aus einem Adjektiv und einem Partizip oder
Verbindungen aus zwei Adjektiven werden getrennt geschrieben.
Beispiele: kochend hei, drckend hei,
leuchtend blau,
schlecht gelaunt, weit verbreitet, ernst gemeint,
oben erwhnt, dnn besiedelt,
riesig gro, mikroskopisch klein,
Getrennt schreibt man auch:
berhand nehmen, anheim Iallen, vorlieb nehmen,
Getrennt- oder Zusammenschreibung ist mglich bei:
in Frage stellen / inIrage stellen,
in Stand setzen / instand setzen,
zu Stande bringen / zustande bringen,
zu Tage Irdern / zutage Irdern,
zu Grunde liegen / zugrunde liegen,
Zusammen schreibt man Jerbindungen mit "--irgend".
Beispiele: irgendein, irgendwann, irgendwer, irgendetwas,
irgendjemand,
Aber: irgend so ein / eine / einer, irgend so etwas,
Untrennbare Zusammensetzungen aus Substantiven, Adjektiven oder
Partikeln mit Jerben werden stets zusammengeschrieben.
Beispiele: handhaben (ich handhabe, ich habe gehandhabt),
wetteiIern, schlussIolgern, maregeln, lobpreisen,
schlaIwandeln,
wehklagen, sonnenbaden, schutzimpIen, notlanden,
bergsteigen,
wettlauIen, kopIrechnen, segelIliegen, seiltanzen,
Zusammensetzungen mit folgenden Bestandteilen + Jerb werden
zusammen geschrieben:
abndern, abbauen, abbeien, abbestellen, abbiegen, an-, auf-, aus-,
bei-, beisammen-,
da-, dabei-, dafr-, dagegen-, daher-, dahin-, daneben-, dar-, d(a)ran-,
d(a)rein-,
da(r)nieder-, darum-, davon-, dawider-, dazu-, dazwischen-, drauf-,
drauflos-,
drin-, durch-, ein-, einher-, empor-, entgegen-, entlang-, entzwei-, fort-,
gegen-,
gegenber-, her-, herab-, heran-, herauf-, heraus-, herbei-, herein-,
hernieder-,
herber-, herum-, herunter-, hervor-, herzu-, hin-, hinab-, hinan-, hinauf-,
hinaus-,
hindurch-, hinein-, hintan-, hintenber-, hinterher-, hinber-, hinunter-,
hinweg-,
hinzu-, inne-, los-, mit-, nach-, nieder-, ber-, berein-, um-, umher-,
umhin-,
unter-, vor-, voran-, vorauf-, voraus-, vorbei-, vorher-, vorber-, vorweg-,
weg-, weiter-, wider-, wieder-, zu-, zurecht-, zurck-, zusammen-, zuvor-,
zuwider-, zwischen-
Auch: auf- und abspringen, ein- und ausfhren, hin- und hergehen
Zusammensetzungen mit heim-, irre-, preis-, stand- statt-, teil-,
wett- werden zusammen geschrieben.
Beispiele: heimbringen, heimIahren, heimIhren, heimsuchen,
heimzahlen,
heimkehren, heimsuchen,
irreIhren, irreleiten, irrewerden,
preisgeben,
stattIinden, stattgeben,
teilhaben, teilnehmen,
wettmachen, wetteiIern,
Straennamen werden zusammengeschrieben, wenn sie aus einem
ungebeugten Adjektiv und einem Crundwort zusammengesetzt sind.
Beispiele: Altmarkt, Neumarkt, Hochstrae,
Aber: Alter Markt, Hohe Strae, Groe Bleiche, Langer Graben,
Getrennt schreibt man Straennamen auch bei Orts- oder Lndernamen auI -
er:
Hamburger Strae, Deutscher Ring,
In Buchstaben geschriebene Zahlen unter einer Million werden
zusammen geschrieben.
Beispiele: neunzehnhundertsiebenundneunzig,
InIundzwanzig, einhundertsiebenundvierzig,
Beachte: Zahlen bis 12 schreibt man in der Regel mit Buchstaben,
darber (also ab 13) in ZiIIern.
Auch zusammen: dreiIach, viermal,
Gro- und Kleinschreibung
unter Bercksichtigung der "neuen Rechtschreibung"
Groschreibung
Kleinschreibung
Groschreibung
1. SatzanInge werden grogeschrieben.
Das gilt Ir: * Aussagestze: Heiner ist unser Trainer.
* Fragestze: Ist Heiner unser Trainer ?
* AusruIe: Hallo' Aua ' Schn dich :u sehen '
* berschriIten: Mein schnstes Ferienerlebnis
* Buchtitel: Das Liebesleben der Maikfer.
ebenso: Titel von schriItlichen Arbeiten, ReIeraten, Filmen usw.
Auch: * Der AnIang einer wrtlichen Rede (siehe dort!).
* Das erste Wort nach einem Doppelpunkt, wenn nach dem Doppelpunkt
ein vollstndiger Satz Iolgt.
Zum Beispiel: Bitte beachten sie. Dieser Bus endet am Stadtpark.
2. Nomen (konkrete und abstrakte) werden grogeschrieben.
Konkrete Nomen bezeichnen gegenstndliche, materielle Dinge,
zum Beispiel: der 1isch, der Bleistift, die Uhr, der Berg, das Auto.
Abstrakte Nomen bezeichnen Dinge, die nicht gegenstndlich sind, nicht aus Materie
bestehen, sondern ihren Ursprung im Geiste haben,
zum Beispiel: die Cedanken, die Liebe, der Rhvthmus, die Mathematik.
3. Verben werden grogeschrieben, wenn ein bestimmter Artikel davorsteht.
Zum Beispiel: schreiben - das Schreiben,
arbeiten - das Arbeiten,
sehen - das Sehen,
bohren - das Bohren
4. Verben werden grogeschrieben, wenn ein unbestimmter Artikel davorsteht.
Zum Beispiel: klopfen - ein Klopfen,
lachen - ein Lachen,
singen - ein Singen
5. Kann zu einem Verb der bestimmte oder unbestimmte Artikel hinzugedacht
werden,
wird das Verb also wie ein Nomen gebraucht, so wird es grogeschrieben.
Zum Beispiel: hoffen - (das) Hoffen,
weinen - (das) Weinen,
lcheln - (ein) Lcheln,
:winkern - (ein) Zwinkern
6. Verben werden grogeschrieben, wenn ein Attribut davorsteht.
Zum Beispiel: heftiges Klopfen, lautes Lachen, nettes Lcheln
7. Verben werden grogeschrieben, wenn eine Prposition davorsteht.
Zum Beispiel: beim Essen, :um Schlafen, im Fallen, mit Faulen:en
8. Verben werden grogeschrieben, wenn ein Pronomen davorsteht.
Zum Beispiel: mein Suchen, ihr Lcheln, sein Sthnen, euer Warten
9. Adjektive werden grogeschrieben, wenn ein bestimmter Artikel davorsteht.
Zum Beispiel: das Aeueste, die Schnste (aber. die schnste Frau), das Cute
10. Adjektive werden grogeschrieben, wenn ein unbestimmter Artikel davorsteht.
Zum Beispiel: ein Rot / Celb / Crn, eine Hbsche und eine Hssliche, ein Lahmer
11. Adjektive werden grogeschrieben, wenn der bestimmte oder unbestimmte
Artikel
hinzugedacht werden kann. (Vgl. mit Regel 5!)
Zum Beispiel: Er servierte uns Schmackhaftes und Pikantes.
Es amsierten sich Croe und Kleine.
12. Adjektive werden grogeschrieben, wenn eine Prposition davorsteht.
Zum Beispiel: im Dunklen, ins Schwar:e, im Warmen (aber. im warmen Zimmer)
13. Adjektive werden grogeschrieben, wenn ein Pronomen davorsteht.
Zum Beispiel: meine Liebste (aber. meine liebste Freundin),
dieser Kleine (aber. dieser kleine Junge),
seine Alte, fener Alte
14. Adjektive werden grogeschrieben, wenn ein unbestimmtes Zahlwort
davorsteht.
Zum Beispiel: alles Cute, viel Schnes, nichts Besonderes, manches Bse
15. Nichtdeklinierte Adjektive in PaarIormeln zur Bezeichnung von Personen
schreibt man gro.
Zum Beispiel: Jung und Alt, Arm und Reich, Gleich und Gleich gesellt sich gern.
16. Adjektive werden grogeschrieben, wenn sie ein Iester Bestandteil
geschichtlicher,
geographischer oder sonstiger BegriIIe sind.
Zum Beispiel: das Kap der Cuten Hoffnung, die Jereinigten Staaten von Amerika,
der Kahle Asten, die Hohe Tatra,
der Schiefe Turm in Pisa,
der Kleine Br, der Croe Wagen, der Hallevsche Komet
17. Adjektive werden grogeschrieben, wenn sie von Orts- oder Lndernamen auI -
er
abgeleitet sind.
Zum Beispiel: die Berliner Morgenpost, der Schwei:er Kse, das Mnchner Bier
18. Im BrieI: Die HIlichkeitsanrede "Sie" und das entsprechende Possessiv-
Pronomen
"Ihr" (auch: "Ihre" , "Ihren" , "Ihnen" usw) schreibt man gro.
Zum Beispiel: Ich danke Ihnen noch einmal fr Ihre Einladung und lade Sie und Ihre
Gattin...
Beachte: Die Anredepronomen "du", "dein", "euch", "euer" usw schreibt man
nun auch
im BrieI klein.
Ich danke dir noch einmal fr deine Einladung und lade dich und deine...
19. Substantivierte Ordnungszahlen werden grogeschrieben.
Zum Beispiel: Als Erstes erledigst du deine Hausaufgaben.
Ich kam als Jierter am Ziel an.
Er kann arbeiten wie kein Zweiter.
20. Enden Wrter auI -heit, -keit, -ung, -schaIt oder -nis, werden sie
grogeschrieben.
Zum Beispiel: dunkel - die Dunkelheit
sauber - die Sauberkeit
schwanger - die Schwangerschaft
finster - die Finsternis
wissen - die Wissenschaft
ordnen - die Ordnung
ffnen - die Offnung
:ubereiten - die Zubereitung
21. Alle Wortarten knnen zum Hauptwort werden
(etwa durch das Davorsetzen eines Artikels) und werden dann grogeschrieben.
Zum Beispiel: das Du anbieten, die Hundert, das Fr und Wider,
das ewige Hin und Her, das A und O
Kleinschreibung
1. Ursprngliche Nomen, die wie eine Prposition benutzt werden, schreibt man
klein.
Zum Beispiel: der Dank, aber. dank seiner Aussage,
die Kraft, aber. kraft meines Amtes,
die Zeit, aber. zeit ihres Lebens,
die Statt, aber. an Kindes statt,
der Trot:, aber. trot: deiner Erkltung.
angesichts, abseits, anhand, anllich, anstelle, aufgrund, betreffs,
dank, infolge, inmitten, kraft, laut, lngs, mittels, namens, seitens,
statt, trot:, :ufolge, :wecks.
2. Adverbien, Prpositionen und Konjunktionen auI -s und -ens werden
kleingeschrieben.
Zum Beispiel: abends, anfangs, angesichts, falls, rechtens, willens, mangels,
donnerstags, teils...teils
3. Nomen werden kleingeschrieben, wenn sie zur Adjektivbildung bentigt werden.
Zum Beispiel: bildschn, wunderhbsch, sturmgeschdigt, zentimetergro,
bermudablau
4. Nomen werden kleingeschrieben, wenn sie zu unbestimmten Zahlwrtern
werden.
Zum Beispiel: ein bisschen Kleingeld, ein paar Spielsachen (sind aber konkret "zwei"
gemeint,
die zusammengehren, wird
daraus "das Paar"!)
5. Nomen werden kleingeschrieben in Verbindung mit -Ialls, -teils, -weise, -
maen, -seits .
Zum Beispiel: andernfalls, allenfalls, bestenfalls, fedenfalls, keinesfalls,
einesteils...andernteils, meistenteils, groenteils,
ausnahmsweise, haufenweise, korbweise, beispielsweise,
gleichermaen, erwiesenermaen,
einerseits...andererseits, ihrerseits
6. Adjektive werden kleingeschrieben, obwohl ein bestimmter oder unbestimmter
Artikel davorsteht,
wenn im selben Satz ein Bezugswort steht.
Zum Beispiel: Sie war die beste meiner Schlerinnen. (Be:ugswortSchlerinnen)
Dnne Bcher liest er in der Schule, dicke in den Ferien. (Bcher)
Die Jerkuferin :eigte uns viele Kleider, die gestreiften und die
gepunkteten
gefielen ihr am besten. (Be:ugswortKleider)
7. Superlative (3. SteigerungsstuIe) mit "am" werden kleingeschrieben.
Zum Beispiel: am hchsten, am besten, am liebsten ( "am" ist nicht "an dem..."')
8. Wendungen mit "auIs" und "auI das" werden kleingeschrieben.
Zum Beispiel: Er begrte uns aufs her:lichste.
Sie sind auf das schnste eingerichtet.
aufs beste, aufs schlechteste usw
9. Wendungen, die in Verbindung mit "sein", "bleiben" und "werden" stehen,
werden kleingeschrieben.
Zum Beispiel: angst haben, bange sein, schuld sein, pleite sein, etwas leid sein,
femandem gram sein
10. Von Personennamen abgeleitete Adjektive werden kleingeschrieben, wenn es
sich
nicht um Ieststehende BegriIIe handelt.
Zum Beispiel: die platonische Liebe, die darwinsche Lehre, die schillerschen Dramen
11. Kardinalzahlen unter einer Million werden kleingeschrieben.
Zum Beispiel: Was zwei wissen, wissen auch baldzwan:ig.
Er kann nicht bis drei :hlen.
Wir vier halten fest :usammen.
12. Bruchzahlen auI -tel und -stel werden kleingeschrieben.
Zum Beispiel: eine zehntel Sekunde, ein viertel Pfund, nach drei viertel Stunden,
in drei hundertstel Sekunden
Beachte: hier ist auch Zusammenschreibung mglich: eine Zehntelsekunde, ein
ViertelpIund,
nach drei Viertelstunden, in drei Hundertstelsekunden
ADVERB
das Adverb, plural: die Adverbien
Whrend das Adjektiv die Beschaffenheit einer Person oder einer Sache
beschreibt,
bezeichnet das Adverb die nheren Umstnde einer Ttigkeit, eines
Vorganges oder Zustandes.
Wichtig ist also zunchst die Unterscheidung zwischen Adjektiv und Adverb.
Beispiel fr den Gebrauch als Adjektiv:
Der tapfere Held...
n diesem Beispiel wird eine Person (hier "Held") nher beschrieben.
* * *
Beispiel fr den Gebrauch als Adverb:
Dieser Held kmpft tapfer.
n diesem Fall wird nicht unser "Held" selbst charakterisiert, sondern
das Adverb gibt uns nhere nformation darber, w i e er kmpft.
Es bezieht sich somit auf das Verb (hier: "kmpfen").
Merke: Das Adjektiv bezieht sich auf ein Nomen (und ausnahmsweise auch mal
auf ein Pronomen).
Das Adverb bezieht sich auf ein Verb.
Man unterscheidet foIgende Arten von Adverbien:
des Ortes auf die Frage: Wo? Woher? Wohin?
hier, dort, dorther, beraII, irgendwo, bergauf, bergab, rechts, heim,
weg, hinein...
der Zeit auf die Frage: Wann? Seit wann? Bis wann? Wie
lange?
heute, immer, bisher, beizeiten, noch, jetzt, einst, danach, morgen,
stets...
der Art und Weise auf die Frage: Wie? Wie sehr?
sehr, gern, kaum, vieIIeicht, heftig, beinahe, teiIweise, sogar, genug,
sonst, kopfber...
des Grundes auf die Frage: Warum? Weshalb?
darum, deshaIb, deswegen, daher, foIgIich, trotzdem, hierzu...
Man spricht auch von
LokaIadverb (des Ortes),
TemporaIadverb (der Zeit),
ModaIadverb (der Art und Weise),
KausaIadverb (des Grundes).
Bestimmte Umstnde knnen durchaus in unterschiedlichem Mae auftreten.
Deshalb lassen sich einige Adverbien auch steigern.
RegeImige Steigerung
frh
spt
oft
wenig
wohl
eh
frher
spter
fter / des fteren
weniger
wohler
eher
am frhesten
am sptesten
- - - (am hufigsten)
am wenigsten
am wohlsten
am ehesten, ehestens
UnregeImige Steigerung
gern
viel
wenig
bald
lieber
mehr
minder
eher
am liebsten
am meisten, meistens
am minstesten, mindestens
am ehesten, ehestens
Das Adverb kann sich aber nicht nur mit einem Verb verbinden, sondern auch mit
einem Adjektiv,
einem Adverb und sogar mit einem Nomen:
mit einem Verb: Meine Feundin kommt bald.
mit einem Adjektiv: Ihre Haare sind sehr lang.
mit einem Adverb: Sie kommt sehr bald.
mit einem Nomen: Meine Freundin dort...
* * *
Entsprechend unterschiedlich kann auch die Verwendung eines Adverbs im Satz sein:
aIs AdverbiaIe Ich denke oft an Piroschka.
aIs PrpositionaIobjekt Meine Ferien dort waren unvergessIich.
aIs Attribut Sie war ein sehr hbsches Mdchen.
zur EinIeitung eines ReIativsatzes Ich behaIte sie in Erinnerung, wie sie aIs
Siebzehnjhrige aussah.
zur EinIeitung eines Fragesatzes Ich wei nicht, warum ich sie niemaIs wieder
sah.
Indikativ - Konjunktiv
Peter hat gestern Abend 20 neue Vokabeln gelernt.
Susanne behauptet, sie habe gestern Abend 30 neue Vokabeln gelernt.
Peter hat wirklich 20 neue Vokabeln gelernt;
diese Tatsache wird deshalb sprachlich durch die "WirklichkeitsIorm",
den Indikativ,
zum Ausdruck gebracht.
Ob Susanne wirklich 30 neue Vokabeln gelernt hat, wei ich nicht so genau;
es ist aber immerhin mglich.
Um diese Ungewissheit, das heit die immerhin bestehende Mglichkeit,
sprachlich zum Ausdruck zu bringen, benutzt man die "MglichkeitsIorm",
den Konjunktiv.
Beachte: Beim Konjunktiv unterscheidet man zwei Formen:
den Konjunktiv I und den Konjunktiv II.
Susanne behauptet, sie habe gestern Abend 30 neue Vokabeln gelernt.
Susanne behauptet, sie htte gestern Abend 30 neue Vokabeln gelernt.
Im ersten Fall wird die Aussage ganz neutral weitergegeben;
der Sachverhalt kann stimmen oder auch nicht.
Sprachlich wird diese neutrale Haltung durch
den Konjunktiv I
zum Ausdruck gebracht.
Im zweiten Fall hat der Sprecher erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt
seiner Aussage; deshalb benutzt er
den Konjunktiv II,
um diese Ungewissheit sprachlich zu verdeutlichen.
Verwendung des Konjunktivs:
KON1UNKTIV I
BEISPIELE:
Indirekte Rede
(neutral)
Indirekte berlegung
Indirekte Frage
Vermutung
Forderung
Wunsch
Anweisung
Redewendungen
Martina hat mir erzhlt, sie sei schrecklich in dich
verliebt.
Sascha dachte pausenlos darber nach, wie er sie
ansprechen knne.
Er Iragte sie endlich, ob sie mit ihm ins Kino gehe.
Er glaubte, sie habe schon einen Iesten Freund.
Sie Iorderte von ihm, dass er ihr ewig treu sei.
Mge diese Liebe ewig whren!
Man beachte die versteckte Ironie!
Seien Sie doch bitte so nett ...
Seien wir doch mal vernnItig!
Herr, dein Wille geschehe!
KON1UNKTIV II
BEISPIELE:
Indirekte Rede
(starke ZweiIel)
Indirekte Rede
(ErsatzIorm Ir
Konjunktiv I )
(siehe auch unten!)
Unerfllbarer Wunsch
Unwirkliche Aussage
Unwirklicher
Vergleich
Unwirkliche
Bedingung
Hfliche Aussage
Dieser alte Schwindler sagt, er htte eine groe ErbschaIt
gemacht.
Ich schrieb dir, ich kme um zehn Uhr am Schwerter
BahnhoI an.
Wenn sie doch nur bald wieder gesund wrde!
Ohne deine HilIe wre ich nie rechtzeitig Iertig
geworden.
Ich hatte das GeIhl, als wrde das Experiment jeden
Moment explodieren.
Wenn ich das vorher gewusst htte, dann htte ich
anders gehandelt.
In diesem Fall htte ich mich anders verhalten.
Hfliche Frage
Hfliche Aufforderung
Zweifel
Potentialis
Einschrnkende
Aufforderung
Herr ProIessor, ich mchte sie etwas Iragen.
Wrdest du nicht auch so handeln?
Knnten Sie mir erklren, wie ich zum BahnhoI komme?
Wrden Sie bitte das Rauchen einstellen!
Das httest du wirklich getan?
So etwas htte ihm niemand zugetraut.
Fr diese AuIgabe wre ich wie geschaIIen.
Das knntest du doch auch!
Sie mssten mal dringend ein paar Wochen Urlaub
machen.
Er msste so schnell wie mglich ins Krankenhaus.
Prsens
INDIKATIV
KON1UNKTIV
I
KON1UNKTIV
II
ich komme komme kme
du kommst kommest kmest
er/sie/es kommt komme kme
wir kommen kommen kmen
ihr kommt kommet kmet
sie kommen kommen kmen
Perfekt
INDIKATIV
KON1UNKTIV
I
KON1UNKTIV
II
ich bin gekommen sei gekommen wre gekommen
du bist gekommen seiest gekommen wrest gekommen
er/sie/es ist gekommen sei gekommen wre gekommen
wir sind gekommen seien gekommen wren gekommen
ihr seid gekommen seiet gekommen wret gekommen
sie sind gekommen seien gekommen wren gekommen
Futur
INDIKATIV
KON1UNKTIV
I
KON1UNKTIV
II
ich werde kommen werde kommen wrde kommen
du wirst kommen werdest kommen wrdest kommen
er/sie/es wird kommen werde kommen wrde kommen
wir werden kommen werden kommen wrden kommen
ihr werdet kommen werdet kommen wrdet kommen
sie werden kommen werden kommen wrden kommen
Beachte: In bestimmten Fllen stimmen die Formen des Indikativs
und des Konjunktivs I berein.
(Z.B. 1. Person singular, Prsens und Futur oder
1. Person plural, Prsens und Futur)
Um dennoch die Mglichkeitsform unmissverstndlich zum Ausdruck
zu bringen, weicht man dann auf die entsprechende Form des
Konjunktivs II aus (Ersatzform).
Aktiv - Passiv
Herbert wscht seinen armen Hund.
Der arme Hund wird von Herbert gewaschen.
Das Subjekt im ersten Satz ist "Herbert".
Herbert ist selbst aktiv, das heit er bt eine Ttigkeit aus;
deshalb wird die Aktivitt auch sprachlich durch die "TtigkeitsIorm",
das Aktiv,
zum Ausdruck gebracht.
Im zweiten Satz ist "der arme Hund" das Subjekt.
Allerdings ist er nicht selbst aktiv, sondern es wird etwas mit ihm gemacht;
das heit, er "erleidet" etwas;
deshalb wird dieser Sachverhalt sprachlich durch die "LeideIorm",
das Passiv,
zum Ausdruck gebracht.
Merke: Nicht alle Verben knnen ein Passiv bilden.
Ein persnliches Passiv knnen nur transitive Verben bilden.
Das Akkusativobjekt (aus dem Aktiv-Satz) wird dabei zum Subjekt
(im Passiv-Satz).
1. Beispiel: lieben - liebte - geliebt (schwaches Verb)
Prsens
AKTIV PASSIV
ich liebe werde geliebt
du liebst wirst geliebt
er/sie/es liebt wird geliebt
wir lieben werden geliebt
ihr liebt werdet geliebt
sie lieben werden geliebt
Prteritum
AKTIV PASSIV
ich liebte wurde geliebt
du liebtest wurdest geliebt
er/sie/es liebte wurde geliebt
wir liebten wurden geliebt
ihr liebtet wurdet geliebt
sie liebten wurden geliebt
Perfekt
AKTIV PASSIV
ich habe geliebt bin geliebt worden
du hast geliebt bist geliebt worden
er/sie/es hat geliebt ist geliebt worden
wir haben geliebt sind geliebt worden
ihr habt geliebt seid geliebt worden
sie haben geliebt sind geliebt worden
Plusquamperfekt
AKTIV PASSIV
ich hatte geliebt war geliebt worden
du hattest geliebt warst geliebt worden
er/sie/es hatte geliebt war geliebt worden
wir hatten geliebt waren geliebt worden
ihr hattet geliebt wart geliebt worden
sie hatten geliebt waren geliebt worden
Futur I
AKTIV PASSIV
ich werde lieben werde geliebt werden
du wirst lieben wirst geliebt werden
er/sie/es wird lieben wird geliebt werden
wir werden lieben werden geliebt werden
ihr werdet lieben werdet geliebt werden
sie werden lieben werden geliebt werden
Futur II
AKTIV PASSIV
ich werde geliebt haben werde geliebt worden sein
du wirst geliebt haben wirst geliebt worden sein
er/sie/es wird geliebt haben wird geliebt worden sein
wir werden geliebt haben werden geliebt worden sein
ihr werdet geliebt haben werdet geliebt worden sein
sie werdet geliebt haben werden geliebt worden sein
2. Beispiel: waschen - wusch - gewaschen (starkes Verb)
Prsens
AKTIV PASSIV
ich wasche werde gewaschen
du wschst wirst gewaschen
er/sie/es wscht wird gewaschen
wir waschen werden gewaschen
ihr wascht werdet gewaschen
sie waschen werden gewaschen
Prteritum
AKTIV PASSIV
ich wusch wurde gewaschen
du wuschest wurdest gewaschen
er/sie/es wusch wurde gewaschen
wir wuschen wurden gewaschen
ihr wuschet wurdet gewaschen
sie wuschen wurden gewaschen
Perfekt
AKTIV PASSIV
ich habe gewaschen bin gewaschen worden
du hast gewaschen bist gewaschen worden
er/sie/es hat gewaschen ist gewaschen worden
wir haben gewaschen sind gewaschen worden
ihr habt gewaschen seid gewaschen worden
sie haben gewaschen sind gewaschen worden
Plusquamperfekt
AKTIV PASSIV
ich hatte gewaschen war gewaschen worden
du hattest gewaschen warst gewaschen worden
er/sie/es hatte gewaschen war gewaschen worden
wir hatten gewaschen waren gewaschen worden
ihr hattet gewaschen wart gewaschen worden
sie hatten gewaschen waren gewaschen worden
Futur I
AKTIV PASSIV
ich werde waschen werde gewaschen werden
du wirst waschen wirst gewaschen werden
er/sie/es wird waschen wird gewaschen werden
wir werden waschen werden gewaschen werden
ihr werdet waschen werdet gewaschen werden
sie werden waschen werden gewaschen werden
Futur II
AKTIV PASSIV
ich werde gewaschen haben werde gewaschen worden sein
du wirst gewaschen haben wirst gewaschen worden sein
er/sie/es wird gewaschen haben wird gewaschen worden sein
wir werden gewaschen haben werden gewaschen worden sein
ihr werdet gewaschen haben werdet gewaschen worden sein
sie werdet gewaschen haben werden gewaschen worden sein
Am Wahltag sagte der Kanzlerkandidat voller berzeugung:
"Heute werde ich gewhlt!"
Nach der Wahl verkndete er zufrieden:
"Ich bin gewhlt!"
In beiden Fllen handelt es sich um Passiv-Formen.
Im ersten Fall wird zum Ausdruck gebracht, dass ein Ereignis im Gange ist,
in dessen Verlauf etwas mit dem Kanzler in spe geschieht.
Man spricht hier vom Vorgangspassiv.
Im zweiten Fall wird kein Vorgang, sondern ein Zustand dargestellt.
Man spricht dann vom Zustandspassiv.
Merke: Das Vorgangspassiv wird mit dem Hilfsverb "werden" gebildet.
Beispiel: gewaschen werden; gewhlt werden; verschlossen
werden; gelobt werden; bestraIt werden
Das Zustandspassiv wird mit dem Hilfsverb "sein" gebildet.
Beispiel: gewaschen sein; gewhlt sein; verschlossen sein;
verbndet sein; betrunken sein
Konjugation von starken Verben
Aktiv
1. Beispiel: schreiben - schrieb - geschrieben (Wortstamm: -schreib- / -schrieb- )
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich schreibe schrieb
Du schreibst schriebst
Er / Sie / Es schreibt schrieb
Wir schreiben schrieben
Ihr schreibt schriebt
Sie schreiben schrieben
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe geschrieben hatte geschrieben
Du hast geschrieben hattest geschrieben
Er / Sie / Es hat geschrieben hatte geschrieben
Wir haben geschrieben hatten geschrieben
Ihr habt geschrieben hattet geschrieben
Sie haben geschrieben hatten geschrieben
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde schreiben werde geschrieben haben
Du wirst schreiben wirst geschrieben haben
Er / Sie / Es wird schreiben wird geschrieben haben
Wir werden schreiben werden geschrieben haben
Ihr werdet schreiben werdet geschrieben haben
Sie werden schreiben werden geschrieben haben
Merke: Die Formen des Prsens und Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "haben" "ge" den Wortstamm "en" (
Partizip PerIekt).
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" InIinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" Partizip PerIekt
InIinitiv des HilIsverbs "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: reiten - ritt - geritten,
Iliegen - Ilog - geIlogen,
glimmen - glomm - geglommen,
meiden - mied - gemieden,
sauIen - soII - gesoIIen,
lgen - log - gelogen,
schwren - schwor - geschworen,
gren - gor - gegoren,
quellen - quoll - gequollen
und alle starken Verben, die im Prteritum und im Partizip Perfekt den gleichen
Stammvokal haben.
2. Beispiel: ruIen - rieI - geruIen (Wortstamm: -ruI- / -rieI- )
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich ruIe rieI
Du ruIst rieIst
Er / Sie / Es ruIt rieI
Wir ruIen rieIen
Ihr ruIt rieIt
Sie ruIen rieIen
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe geruIen hatte geruIen
Du hast geruIen hattest geruIen
Er / Sie / Es hat geruIen hatte geruIen
Wir haben geruIen hatten geruIen
Ihr habt geruIen hattet geruIen
Sie haben geruIen hatten geruIen
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde ruIen werde geschrieben haben
Du wirst ruIen wirst geschrieben haben
Er / Sie / Es wird ruIen wird geschrieben haben
Wir werden ruIen werden geschrieben haben
Ihr werdet ruIen werdet geschrieben haben
Sie werden ruIen werden geschrieben haben
Merke: Die Formen des Prsens und Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "haben" Partizip PerIekt.
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" InIinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" Partizip PerIekt
HilIsverb "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: Iahren - Iuhr - geIahren
Iangen - Iing - geIangen
raten - riet - geraten
kommen - kam - gekommen
stoen - stie - gestoen
lauIen - lieI - gelauIen
heien - hie - geheien
und alle starken Verben, die im Prsens und Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal
haben.
3. Beispiel: bitten - bat - gebeten (Wortstamm: -bitt- / -bat- / -bet- )
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich bitte bat
Du bittest batest
Er / Sie / Es bittet bat
Wir bitten baten
Ihr bittet batet
Sie bitten baten
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe gebeten hatte gebeten
Du hast gebeten hattest gebeten
Er / Sie / Es hat gebeten hatte gebeten
Wir haben gebeten hatten gebeten
Ihr habt gebeten hattet gebeten
Sie haben gebeten hatten gebeten
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde bitten werde gebeten haben
Du wirst bitten wirst gebeten haben
Er / Sie / Es wird bitten wird gebeten haben
Wir werden bitten werden gebeten haben
Ihr werdet bitten werdet gebeten haben
Sie werden bitten werden gebeten haben
Merke: Die Formen des Prsens und Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "haben" Partizip PerIekt.
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" InIinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" Partizip PerIekt
HilIsverb "haben" oder "sein".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: schwimmem - schwamm - geschwommen
schwinden - schwand - geschwunden
liegen - lag - gelegen
helIen - halI - geholIen
gebren - gebar - geboren
hngen - hing - gehangen
und alle starken Verben, die im Prsens, im Prteritum und im Partizip Perfekt
verschiedene Stammvokale haben.
StammIormen von starken Verben
INDIKATIV PRTERITUM PARTIZIP PERFEKT
beIehlen beIahl beIohlen
bergen barg geborgen
bersten barst geborsten
blasen blies geblasen
braten briet gebraten
drIen durIte gedurIt
dreschen drosch gedroschen
empIehlen empIahl empIohlen
erwerben erwarb erworben
essen a gegessen
Iahren Iuhr geIahren
Iallen Iiel geIallen
Iangen Iing geIangen
geben gab gegeben
graben grub gegraben
helIen halI geholIen
laden lud geladen
lassen lie gelassen
lauIen lieI gelauIen
lesen las gelesen
messen ma gemessen
mgen mochte gemocht
nehmen nahm genommen
quellen quoll gequollen
sauIen soII gesoIIen
schelten schalt gescholten
schlaIen schlieI geschlaIen
schmelzen schmolz geschmolzen
schwellen schwoll geschwollen
sehen sah gesehen
sprechen sprach gesprochen
stechen stach gestochen
stehlen stahl gestohlen
stoen stie gestoen
tragen trug getragen
treten trat getreten
verderben verdarb verdorben
vergessen verga vergessen
wachsen wuchs gewachsen
waschen wusch gewaschen
waschen wusch gewaschen
werben warb geworben
werIen warI geworIen
Bei der Konjugation dieser Verben ist zu beachten, da sie nicht nur in den drei
Stammformen,
sondern auch innerhalb ihrer Prsens-Formen umlauten!
Ich beIehle berge blase braten dresche empIehle erwerbe
Du beIiehlst birgst blst brtst drischst empIiehlst erwirbst
Er/Sie/Es beIiehlt birgt blst brt drischt empIielt erwirbt
Wir beIehlen bergen blasen braten dreschen empIehlen erwerben
Ihr beIehlt bergt blast bratet drescht empIehlt erwerbt
Sie beIehlen bergen blasen braten dreschen empIehlen erwerben
Ich esse Iahre Ialle Iange gebe graben helIe
Du it Ihrst Illst Ingst gibst grbst hilIst
Er/Sie/Es it Ihrt Illt Ingt gibt grbt hilIt
Wir essen Iahren Iallen Iangen geben graben helIen
Ihr et Iahrt Iallt Iangt gebt grabt helIt
Sie essen Iahren Iallen Iangen geben graben helIen
Ich lade lasse lauIe lese messe mag nehme
Du ldst lsst luIst liest misst magst nimmst
Er/Sie/Es ld lsst luIt liest misst mag nimmt
Wir laden lassen lauIen lesen messen mgen nehmen
Ihr ladet lasst lauIt lest messt mgt nehmt
Sie laden lassen lauIen lesen messen mgen nehmen
Ich quelle sauIe schelte schlaIe schmelze schwelle sehe
Du quillst suIst schiltst schlIst schmilzt schwillst siehst
Er/Sie/Es quillt suIt schilt schlIt schmilzt schwillt sieht
Wir quellen sauIen schelten schlaIen schmelzen schwellen sehen
Ihr quellt sauIt scheltet schlaIt schmelzt schwellt seht
Sie quellen sauIen schelten schlaIen schmelzen schwellen sehen
Ich spreche steche stehle stoe trage trete verderbe
Du sprichst stichst stiehlst stt trgst trittst verdirbst
Er/Sie/Es spricht sticht stiehlt stt trgt tritt verdirbt
Wir sprechen stechen stehlen stoen tragen treten verderben
Ihr sprecht stecht stehlt stot tragt tretet verderbt
Sie sprechen stechen stehlen stoen tragen treten verderben
Ich vergesse wachse wasche werbe werIe
Du vergisst wchst wschst wirbst wirIst
Er/Sie/Es vergisst wchst wscht wirbt wirIt
Wir vergessen wachsen waschen werben werIen
Ihr vergesst wachst wascht werbt werIt
Sie vergessen wachsen waschen werben werIen
Bei der Konjugation dieser Verben ist zu beachten, dass sie nicht nur in den drei
Stammformen,
sondern auch innerhalb ihrer Prsens-Formen umlauten !
Konjugation von starken Verben
Aktiv
1. Beispiel: schreiben - schrieb - geschrieben (Wortstamm: -schreib- / -schrieb- )
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich schreibe schrieb
Du schreibst schriebst
Er / Sie / Es schreibt schrieb
Wir schreiben schrieben
Ihr schreibt schriebt
Sie schreiben schrieben
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe geschrieben hatte geschrieben
Du hast geschrieben hattest geschrieben
Er / Sie / Es hat geschrieben hatte geschrieben
Wir haben geschrieben hatten geschrieben
Ihr habt geschrieben hattet geschrieben
Sie haben geschrieben hatten geschrieben
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde schreiben werde geschrieben haben
Du wirst schreiben wirst geschrieben haben
Er / Sie / Es wird schreiben wird geschrieben haben
Wir werden schreiben werden geschrieben haben
Ihr werdet schreiben werdet geschrieben haben
Sie werden schreiben werden geschrieben haben
Merke: Die Formen des Prsens und Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "haben" "ge" den Wortstamm "en" (
Partizip PerIekt).
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" InIinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" Partizip PerIekt
InIinitiv des HilIsverbs "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: reiten - ritt - geritten,
Iliegen - Ilog - geIlogen,
glimmen - glomm - geglommen,
meiden - mied - gemieden,
sauIen - soII - gesoIIen,
lgen - log - gelogen,
schwren - schwor - geschworen,
gren - gor - gegoren,
quellen - quoll - gequollen
und alle starken Verben, die im Prteritum und im Partizip Perfekt den gleichen
Stammvokal haben.
2. Beispiel: ruIen - rieI - geruIen (Wortstamm: -ruI- / -rieI- )
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich ruIe rieI
Du ruIst rieIst
Er / Sie / Es ruIt rieI
Wir ruIen rieIen
Ihr ruIt rieIt
Sie ruIen rieIen
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe geruIen hatte geruIen
Du hast geruIen hattest geruIen
Er / Sie / Es hat geruIen hatte geruIen
Wir haben geruIen hatten geruIen
Ihr habt geruIen hattet geruIen
Sie haben geruIen hatten geruIen
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde ruIen werde geschrieben haben
Du wirst ruIen wirst geschrieben haben
Er / Sie / Es wird ruIen wird geschrieben haben
Wir werden ruIen werden geschrieben haben
Ihr werdet ruIen werdet geschrieben haben
Sie werden ruIen werden geschrieben haben
Merke: Die Formen des Prsens und Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "haben" Partizip PerIekt.
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" InIinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" Partizip PerIekt
HilIsverb "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: Iahren - Iuhr - geIahren
Iangen - Iing - geIangen
raten - riet - geraten
kommen - kam - gekommen
stoen - stie - gestoen
lauIen - lieI - gelauIen
heien - hie - geheien
und alle starken Verben, die im Prsens und Partizip Perfekt den gleichen Stammvokal
haben.
3. Beispiel: bitten - bat - gebeten (Wortstamm: -bitt- / -bat- / -bet- )
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich bitte bat
Du bittest batest
Er / Sie / Es bittet bat
Wir bitten baten
Ihr bittet batet
Sie bitten baten
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe gebeten hatte gebeten
Du hast gebeten hattest gebeten
Er / Sie / Es hat gebeten hatte gebeten
Wir haben gebeten hatten gebeten
Ihr habt gebeten hattet gebeten
Sie haben gebeten hatten gebeten
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde bitten werde gebeten haben
Du wirst bitten wirst gebeten haben
Er / Sie / Es wird bitten wird gebeten haben
Wir werden bitten werden gebeten haben
Ihr werdet bitten werdet gebeten haben
Sie werden bitten werden gebeten haben
Merke: Die Formen des Prsens und Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "haben" Partizip PerIekt.
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" InIinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" Partizip PerIekt
HilIsverb "haben" oder "sein".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: schwimmem - schwamm - geschwommen
schwinden - schwand - geschwunden
liegen - lag - gelegen
helIen - halI - geholIen
gebren - gebar - geboren
hngen - hing - gehangen
und alle starken Verben, die im Prsens, im Prteritum und im Partizip Perfekt
verschiedene Stammvokale haben.
Konjugation von schwachen Verben
Aktiv
1. Beispiel: lieben - liebte - geliebt (Wortstamm: -lieb- )
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich liebe liebte
Du liebst liebtest
Er / Sie / Es liebt liebte
Wir lieben liebten
Ihr liebt liebtet
Sie lieben liebten
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe geliebt hatte geliebt
Du hast geliebt hattest geliebt
Er / Sie / Es hat geliebt hatte geliebt
Wir haben geliebt hatten geliebt
Ihr habt geliebt hattet geliebt
Sie haben geliebt hatten geliebt
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde lieben werde geliebt haben
Du wirst lieben wirst geliebt haben
Er / Sie / Es wird lieben wird geliebt haben
Wir werden lieben werden geliebt haben
Ihr werdet lieben werdet geliebt haben
Sie werden lieben werden geliebt haben
Merke: Die Formen des Prsens und Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "haben" Partizip PerIekt .
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des Hilfsverbs "werden" InIinitiv.
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des Hilfwerbs "werden" Partizip PerIekt
die Formen des Hilfsverbs "haben".
Ebenso werden gebildet zum Beispiel: hoIIen - hoIIte - gehoIIt,
lachen - lachte - gelacht
weinen - weinte - geweint
sagen - sagte - gesagt
und alle Verben, die in allen drei Formen (InIinitiv - Prteritum - Partizip PerIekt)
den gleichen Stammvokal haben (typisch Ir schwache Verben).
Konjugation von HilIsverben
Konjugation des Hilfsverbs "haben"
Konjugation des Hilfsverbs "sein"
Konjugation des Hilfsverbs "werden"
Konjugation des Hilfsverbs "haben"
haben - hatte - gehabt
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich habe hatte
Du hast hattest
Er / Sie / Es hat hatte
Wir haben hatten
Ihr habt hattet
Sie haben hatten
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich habe gehabt hatte gehabt
Du hast gehabt hattest gehabt
Er / Sie / Es hat gehabt hatte gehabt
Wir haben gehabt hatten gehabt
Ihr habt gehabt hattet gehabt
Sie haben gehabt hatten gehabt
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde haben werde gehabt haben
Du wirst haben wirst gehabt haben
Er / Sie / Es wird haben wird gehabt haben
Wir werden haben werden gehabt haben
Ihr werdet haben werdet gehabt haben
Sie werden haben werden gehabt haben
Merke: Die Formen des Prsens werden gebildet durch
den Wortstamm "hab" (Ausnahme 2. und 3. Person singular)
Personalendung .
Die Formen des Prteritums werden gebildet durch
den Wortstamm "hat" Personalendung .
Die Formen des PerIekts und PlusquamperIekts werden gebildet durch
die Formen des HilIsverbs ,haben" Partizip PerIekt vom HilIsverb ,haben"
( "gehabt") .
Die Formen des Futur 1 werden gebildet durch
die Formen des HilIsverbs ,werden" InIinitiv vom HilIverb ,haben"
Die Formen des Futur 2 werden gebildet durch
die Formen des HilIwerbs ,werden" Partizip PerIekt vom HilIsverb ,haben"
InIinitiv vom HilIsverb ,haben".
Konjugation des Hilfsverbs "sein"
sein - war - gewesen
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich bin war
Du bist warst
Er / Sie / Es ist war
Wir sind waren
Ihr seid wart
Sie sind waren
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich bin gewesen war gewesen
Du bist gewesen warst gewesen
Er / Sie / Es ist gewesen war gewesen
Wir sind gewesen waren gewesen
Ihr seid gewesen wart gewesen
Sie sind gewesen waren gewesen
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde sein werde gewesen sein
Du wirst sein wirst gewesen sein
Er / Sie / Es wird sein wird gewesen sein
Wir werden sein werden gewesen sein
Ihr werdet sein werdet gewesen sein
Sie werden sein werden gewesen sein
Konjugation des Hilfsverbs "werden"
werden - wurde - geworden
PERSON PRSENS PRTERITUM
Ich werde wurde
Du wirst wurdest
Er / Sie / Es wird wurde
Wir werden wurden
Ihr werdet wurdet
Sie werden wurden
PERSON PERFEKT PLUSQUAMPERFEKT
Ich bin geworden war geworden
Du bist geworden warst geworden
Er / Sie / Es ist geworden war geworden
Wir sind geworden waren geworden
Ihr seid geworden wart geworden
Sie sind geworden waren geworden
PERSON FUTUR I FUTUR II
Ich werde werden werde geworden sein
Du wirst werden wirst geworden sein
Er / Sie / Es wird werden wird geworden sein
Wir werden werden werden geworden sein
Ihr werdet werden werdet geworden sein
Sie werden werden werden geworden sein
Gebrauch der TempusIormen
Die deutsche Sprache leistet sich
` eine Tempusform zur Darstellung von gegenwrtigen Ereignissen oder
Zustnden.
` zwei Tempusformen zur Darstellung von zuknftigen Ereignissen oder Zustnden.
` drei Tempusformen zur Darstellung von vergangenen Ereignissen oder Zustnden.
Die Frage ist: Bei welcher Gelegenheit mu man welche Tempusform benutzen ?
Prsens (Gegenwart)
` wird benutzt, um zum Ausdruck zu bringen, dass etwas jetzt, in diesem Augenblick
ist oder geschieht.
(Die tatschliche Gegenwart)
Beispiel. Die Sonne scheint, der Lehrer ist fleiig, Heiner bohrt in der Nase und die
anderen Schler schlafen.
* wird benutzt, um zum Ausdruck zu bringen, dass etwas allgemeine Gltigkeit hat.
(Was an keine besondere Zeit gebunden ist, sondern immer gilt.)
Beispiel. Der Mensch gehrt :u den Sugetieren. Der Mond ist 384000 km von der
Erde entfernt.
* wird benutzt, wenn es um sich stndig wiederholende Vorgnge geht.
(Was immer wieder geschieht und nicht an die Gegenwart gebunden ist.)
Beispiel. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Ute put:t sich tglich :weimal die Zhne.
` wird benutzt, als literarisches (dramatisches) Prsens:
wenn etwas besonders spannend und unmittelbar dargestellt werden soll.
Beispiel. Plt:lich steht der Einbrecher vor mir und bedroht mich mit der Pistole.
` wird benutzt als historisches Prsens:
fr groe geschichtliche Ereignisse.
Beispiel. Im Jahre 375 fallen die Hunnen in Europa ein.
Am 12. Oktober 1492 landet Kolumbus auf der Insel San Salvador.
` wird in der Umgangssprache auch benutzt fr Aussagen ber knftige (!) Ereignisse
oder Zustnde:
die ZukunIt wird durch bestimmte Zeitangaben ( morgen, nchste Woche usw.)
verdeutlicht.
Beispiel. Morgen schreiben wir eine Mathe-Klausur.
Nchstes Jahr besuche ich meine Schwiegermutter.
Perfekt (vollendete Gegenwart)
` wird benutzt fr alle Vorgnge, die in der Vergangenheit begonnen haben
u n d noch bis in die Gegenwart andauern
o d e r deren Auswirkungen noch bis in die Gegenwart andauern.
Beispiel. Jesus ist von den Toten auIerstanden.
Im Religionsunterricht haben wir von seinen Wundern erIahren.
` wird benutzt, um vom Prsens aus auf ein Ereignis hinzuweisen,
das zeitlich vorher stattgefunden hat (Vorzeitigkeit bei Texten im Prsens).
Wenn ein Ereignis in der PrsensIorm dargestellt wird, und es soll auI ein anderes
Ereignis,
das zeitlich v o r h e r stattgeIunden hat, verwiesen werden, mssen die Formen des
PerIekts
benutzt werden.
Das PerIekt verdeutlicht also Vorzeitigkeit bei Texten, die im Prsens stehen.
Beispiel. Ich wei, wie man das Gert bedient, weil ich vorher die Gebrauchsanleitung
gelesen habe.
Heiner hat fleiig gespart und kauft sich heute ein neues Fahrrad.
` bernimmt in der Alltagssprache oft die Funktion des Prteritums.
Beispiel. Joriges Jahr ist unser Urgrovater gestorben.
Bis ins hohe Alter hat er feden Tag die Zeitung gelesen.
Prteritum (Imperfekt / Erzhl-Vergangenheit)
` wird benutzt fr alle Vorgnge, die in der Vergangenheit begonnen haben
u n d auch in der Vergangenheit abgeschlossen worden sind.
Beispiel. Der Mond verbarg sich hinter Wolken, ein Kut:chen schrie - da fiel ein
Schuss.
` ist die typische Tempusform fr Erzhlungen (Mrchen, Kurzgeschichten, Romane
etc.)
Beispiel. Es war einmal eine wunderschne Prin:essin. Die lebte in einem
mrchenhaften Schlo. /.../
Plusquamperfekt (vollendete Vergangenheit)
wird benutzt, um vom Prteritum aus auf ein Ereignis hinzuweisen,
das zeitlich vorher stattgefunden hat (Vorzeitigkeit bei Texten im Prteritum).
Wenn ein Ereignis in der PrteritumsIorm dargestellt wird, und es soll auI ein anderes
Ereignis,
das zeitlich v o r h e r stattgeIunden hat, verwiesen werden,
mssen die Formen des PlusquamperIekts benutzt werden.
Das PlusquamperIekt verdeutlicht also Vorzeitigkeit bei Texten, die im Prteritum
stehen.
Beispiel. Die Astronauten unternahmen heute einen Weltraumspa:iergang,
vorher hatten sie sich grndlich ausgeschlafen.
Obwohl sie wochenlang fleiig gebt hatte, fiel sie durch die Prfung.
Futur I (Zukunft)
` macht deutlich, dass ein Ereignis in der Zukunft stattfindet.
Beispiel. Wir werden einen wunderschnen Urlaub verbringen.
Am Wochenende wird die Sonne wieder scheinen.
Wenn Heiner das Regal selbst :usammenbaut, wird es wohl nicht lange halten.
` macht deutlich, dass es sich um eine Vermutung oder Hoffnung handelt.
Beispiel. Ich vermute, Peter wird gerade in der Fahrschule sein.
Ich hoffe, er wird seine Fahrprfung bestehen.
` macht deutlich, dass es sich um eine Aufforderung oder ein Verbot handelt.
Beispiel. Du wirst fet:t sofort deinen Spinat aufessen'
Das wirst du sofort unterlassen'
` wird benutzt, um vom Prsens aus auf ein Ereignis hinzuweisen,
das zeitlich s p t e r stattfinden wird (Nachzeitigkeit bei Texten im Prsens).
Wenn ein Ereignis in der PrsensIorm dargestellt wird, und es soll auI ein anderes
Ereignis,
das zeitlich s p t e r stattIinden wird, verwiesen werden, mssen die Formen des Futur
I
benutzt werden.
Das Futur I verdeutlicht also Nachzeitigkeit bei Texten, die im Prsens stehen.
Beispiel. Wenn du mich gan: lieb darum bittest, werde ich dir dein Lieblingsessen
:ubereiten.
Jessica ist eine gute Schlerin, und sie wird auch spter im Beruf Erfolg
haben.
Futur II (vollendete Zukunft)
` wird benutzt, um deutlich zu machen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Zukunft
ein Ereignis bereits stattgefunden hat u n d beendet ist.
Beispiel. Morgen um diese Zeit werde ich meine Prfung berstanden haben.
Bis Weihnachten wird das alles vergessen sein.
` wird benutzt, um eine Vermutung ber Vergangenes (!) zum Ausdruck zu bringen.
Beispiel. Deine Jerlet:ung wird schon nicht so schlimm gewesen sein.
Christiane wird eure Jerabredung schon nicht vergessen haben.
` wird benutzt, um die Vorzeitigkeit bei einem Geschehen in der Zukunft zum
Ausdruck zu bringen.
Beispiel. Wenn sie mich morgen um die gleiche Zeit noch einmal anrufen,
wird die Entscheidung ber ihren Antrag bereits gefallen sein.
Vorzeitigkeit
Dargestellte Zeit
(Tempusform, in der erzhlt wird)
Vorzeitigkeit
(Tempusform, um Ereignisse darzustellen, die v o r h e
r geschehen sind)
PRSENS PERFEKT
PRTERITUM PLUSQUAMPERFEKT
FUTUR I oder PRSENS mit
Zeithinweis auf Zukunft
FUTUR II
Nachzeitigkeit
Dargestellte Zeit
(Tempusform, in der erzhlt
wird)
Nachzeitigkeit
(Tempusform, um Ereignisse darzustellen, die n a c h h e r geschehen
sind)
PRSENS FUTUR I
FORMENLEHRE bei VERBEN
Lateinische
Bezeichnung
Deutsche Bezeichnung BeispieIe:
A. Form
Aktiv
Passiv
Ttigkeitsform
Leideform
ich liebe,
ich schlage,
ich lobe
ich werde geliebt,
ich werde geschlagen,
ich werde gelobt
B.
NominaIformen
Infinitiv
Partizip
Prsens
Partizip
Perfekt
Grundform
Mittelwort der Gegenwart
Mittelwort d. Vergangenheit
lieben, schlagen,
loben, singen ...
liebend, schlagend,
lobend, singend ...
geliebt, geschlagen,
gelobt, gesungen ...
C. Tempus
Prsens
Prteritum
Perfekt
Zeit
Gegenwart
erzhlende Vergangenheit
Vergangenheit
ich lese,
ich schreibe,
ich liebe
ich las,
ich schrieb,
ich liebte
ich habe gelesen,
ich habe
geschrieben,
ich habe geliebt
PIusquamperfekt
Futurum I
Futurum II
vollendete Vergangenheit
einfache Zukunft
vollendete Zukunft
ich hatte gelesen,
ich hatte
geschrieben,
ich hatte geliebt
ich werde lesen,
ich werde schreiben,
ich werde lieben
ich werde gelesen
haben,
ich werde
geschrieben haben,
ich werde geliebt
haben
D. Modus
Indikativ
Konjunktiv
Aussageweise
Wirklichkeitsform
Mglichkeitsform
ich gebe,
ich singe,
ich schreibe
ich gbe,
ich snge,
ich schriebe
E. Stammformen bestimmen die Art der Konjugation. Zumeist werden die drei
Formen gegeben:
Infinitiv Prteritum Partizip Perfekt
lieben liebte geliebt (= schwaches Verb)
glauben glaubte geglaubt (= schwaches Verb)
spielen spielte gespielt (= schwaches Verb)
sagen sagte gesagt (= schwaches Verb)
gehen ging gegangen (= starkes Verb)
sitzen sa gesessen (= starkes Verb)
sterben starb gestorben (= starkes Verb)
stehlen stahl gestolen (= starkes Verb)
Beachte: Bei den schwachen Verben bleibt der Stammvokal (auch: ie, ei, au) in
allen drei Formen gleich.
Bei den starken Verben bleibt der Stammvokal nicht in allen drei
Formen gleich.
VERBEN
Wrter, die eine Ttigkeit, einen Vorgang oder einen Zustand angeben,
nennt man Verben.
Ttigkeitsverben geben demnach eine Ttigkeit an.
BeispieI: Peter schreibt einen Brief.
Lydia singt ein Lied.
Die Zwillinge spieIen mit dem Hund.
Vorgangsverben geben einen Vorgang an.
BeispieI: Die Sonne geht auf.
Die Blumen erbIhen.
Die Bume schIagen aus.
Zustandsverben geben einen Zustand an.
BeispieI: Schwerte Iiegt im Ruhrtal.
n London regnet es heute ohne Unterbrechung.
Wir wohnen auerhalb der Stadt.
Beachte: Je nach Aussagegehalt des Satzes kann dasselbe Verb als Ttigkeits-,
Vorgangs- oder Zustandsverb
verwendet werden:
Opa setzt sich (in diesem Moment) in den Sessel. (= Ttigkeit,
auch wenn es ihm schwer fllt)
Nach und nach setzten sich die Zuschauer auf ihre Pltze. (= Vorgang,
der sich oft hinzieht)
Eddy sitzt schon wieder im Gefngnis. (=
Dauerzustand bei Eddy)
Die Grenzen zwischen Ttigkeits-, Vorgangs- und Zustandsverben sind also
gleitend.
Transitive Verben erfordern im Satz ein Akkusativ-Objekt.
BeispieI: Mutter mht den Rasen.
Vater baut sich den Liegestuhl auf.
Intransitive Verben erfordern im Satz kein Akkusativ-Objekt.
BeispieI: Das Baby weint.
Der Hund stinkt.
Beachte: Einige Verben knnen transitiv oder intransitiv verwendet werden:
ch verbrenne meine Schulbcher.
ch verbrenne. (Hilfe, wo bleibt die Feuerwehr?)
RefIexive Verben treten in Verbindung mit nur einem Reflexivpronomen auf.
BeispieI: sich freuen
sich bedanken
sich wundern
sich einbilden
sich trauen
sich ergeben
sich bergeben
sich benehmen
sich verhalten
Bei diesen Verben bilden Verb und Reflexivpronomen eine feste Einheit.
Man spricht auch von "echten refIexiven Verben".
NichtrefIexive Verben knnen auch mit anderen Pronomina oder Nomina
verbunden werden.
BeispieI: ch wasche mich. - ch wasche die Socken.
Kati kmmt sich. - Kati kmmt ihre Puppe.
Rolf putzt sich die Zhne. - Rolf putzt sein neues Fahrrad.
Diese Verben sind also reflexiv (linke Beispiele) oder nichtreflexiv (rechte
Beispiele) verwendbar.
Man spricht hierbei von "unechten refIexiven Verben".
PersnIiche Verben knnen in aIIen PersonaIformen verwendet werden.
BeispieI: ch arbeite.
Du trumst.
Er / Sie / Es singt ein lustiges Lied.
Die Schler schlafen.
Der Lehrer putzt die Tafel
UnpersnIiche Verben sind fest mit "es" verbunden..
BeispieI: Es regnet.
Es schneit.
Es dunkelt.
Es brennt.
Es klopft.
Es freut mich.
Es steht geschrieben...
Es geschah...
Es heit, dass...
Beachte: Auch hier knnen einige Verben persnlich oder unpersnlich verwendet
werden:
Es klopft an der Tr. - Der Nikolaus klopft an die Tr.
Es freut mich sehr. - Er freut sich ber das Geschenk.
Die Pronomen (Frwrter)
"Pro" bedeutet "fr" - ein Pronomen steht also fr ein Nomen
(es ist der "Stellvertreter des Nomens").
BeispieI: Christine liest ein Buch. > Sie liest ein Buch.
Ein Pronomen kann aber auch ein Nomen begleiten und es genauer
bestimmen
(es ist dann der "Begleiter des Nomens").
BeispieI: Horst wscht sich. Der Bahnhof liegt in dieser Richtung. Welche Farbe
hat der Himmel?
Man unterscheidet je nach Verwendungszweck und Aussageabsicht:
Personalpronomen
Reflexivpronomen
Possessivpronomen
Relativpronomen
Demonstrativpronomen
Interrogativpronomen
Indifinitpronomen
Personalpronomen (persnliches Frwort)
1. Person singular Ich
2. Person singular Du
3. Person singular Er oder Sie oder Es (je nach natrlichem oder grammatischem
Geschlecht)
1. Person plural Wir
2. Person plural Ihr
3. Person plural Sie (die Menge)
Nun sagt man ja nicht "Ich liebe du!" , sondern "Ich liebe dich!"
Frage: Wen oder was liebe ich? Antwort: "dich". Also Akkusativ (4. Fall).
Was Iolgern wir daraus haarscharI?
Genau! Jedes dieser Personalpronomen kann nicht nur im Nominativ (1. Fall) , sondern auch
im Genitiv (2. Fall), Dativ (3. Fall) oder Akkusativ (4. Fall) vorkommen - man kann es
deklinieren:
Die Deklination der Personalpronomen
Singular
Kasus
Frage:
1. Person
sing.
2. Person
sing.
3. Person
sing.
maskulinum
3. Person
sing.
femininum
3. Person
sing.
neutrum
Nominativ
Wer oder was?
ich du er sie es
Genitv
Wessen?
meiner deiner seiner ihrer seiner
Dativ
Wem?
mir dir ihm ihr ihm
Akkusativ
Wen oder was?
mich dich ihn sie es
Plural
Kasus
Frage:
1. Person pl. 2. Person pl. 3. Person pl.
Nominativ
Weroder was?
wir ihr sie
Genitv
Wessen?
unser euer ihrer
Dativ
Wem?
uns euch ihnen
Akkusativ
Wen oder was?
uns euch sie
Reflexivpronomen (rckbezgliches Frwort)
Typisch Ir ein ReIlexivpronomen ist, dass es in einem Satz als Objekt steht und sich auI die
gleiche Person oder Sache bezieht wie das Subjekt.
Es verweist also auI das Subjekt zurck - es reIlektiert das Subjekt, deshalb spricht man von
"reIlexiv".
ReIlexivpronomen knnen nur im Dativ oder Akkusativ vorkommen.
Welcher Kasus jeweils benutzt werden muss, lsst sich durch Fragen schnell herausIinden.
1. Beispiel: Wie muss es auf gut Deutsch heien. "Ich wasche mir die Fe."
Oder. "Ich wasche mich die Fe." ?
Hier kann ich fragen. Wem wasche ich die...?
Also muss ich den Dativ benut:en. mir (und nicht mich').
Dativ:
Ich wasche mir die Fe.
Du wschst dir ...
Er wscht sich... / Sie wscht sich... / Es wscht sich...
Wir waschen uns...
Ihr wascht euch...
Sie waschen sich...
2. Beispiel: Wie muss es auf gut Deutsch heien. "Ich kmme mir ."
Oder. "Ich kmme mich." ?
Hier muss die Frage lauten. Wen oder was kmme ich?
Also muss ich den Akkusativ nehmen. mich (und nicht mir').
Akkusativ:
Ich kmme mich.
Du kmmst dich.
Er / Sie / Es kmmt sich.
Wir kmmen uns.
Ihr kmmt euch.
Sie kmmen sich.
Achtung: Wenn Unklarheiten oder gar Missverstndnisse mglich sind, sollte man zur
Sicherheit zustzlich ein Adverb oder gleich eine andere Formulierung benutzen!
Beispiel: Die badenden Kinder besprit:en sich.
Unklar bleibt hier, ob sich jedes Kind selbst nass macht oder ob die anderen nachhelIen.
Also. Die badenden Kinder besprit:en sich gegenseitig.
Oder. Die badenden Kinder besprit:en einander.
Possessivpronomen (besitzanzeigendes Frwort)
Mit dem Possessivpronomen stellt der Sprecher klar, wem (aus seiner Sicht gesehen) etwas
gehrt.
Derjenige / diejenige / dasjenige, dem / der etwas gehrt, kann maskulin, Ieminin oder
neutrum sein.
Zuordnung: 1. Person singular: ich
Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
mein Vater
meine
Mutter
mein Kind
Genitiv
meines
Vaters
meiner
Mutter
meines
Kindes
Dativ
meinem
Vater
meiner
Mutter
meinem
Kind
Akkusativ
meinen
Vater
meine
Mutter
mein Kind
Plural
fr alle Genera gleich
Nominativ meine Eltern
Genitiv meiner Eltern
Dativ meinen Eltern
Akkusativ meine Eltern
Zuordnung: 2. Person singular: du
Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
dein Vater
deine
Mutter
dein Kind
Genitiv
deines
Vaters
deiner
Mutter
deines
Kindes
Dativ
deinem
Vater
deiner
Mutter
deinem
Kind
Akkusativ
deinen Vater
deine
Mutter
dein Kind
Plural
fr alle Genera gleich
Nominativ deine Eltern
Genitiv deiner Eltern
Dativ deinen Eltern
Akkusativ deine Eltern
Zuordnung: 3. Person singular: er / es
Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
sein Vater
seine
Mutter
sein Kind
Genitiv
seines
Vaters
seiner
Mutter
seines
Kindes
Dativ
seinem
Vater
seiner
Mutter
seinem
Kind
Akkusativ
seinen Vater
seine
Mutter
sein Kind
Plural
fr alle Genera gleich
Nominativ seine Eltern
Genitiv seiner Eltern
Dativ seinen Eltern
Akkusativ seine Eltern
Zuordnung: 3. Person singular: sie
Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ ihr Vater ihre Mutter ihr Kind
Genitiv ihres Vaters ihrer Mutter ihres Kindes
Dativ ihrem Vater ihrer Mutter ihrem Kind
Akkusativ ihren Vater ihre Mutter ihr Kind
Plural
fr alle Genera gleich
Nominativ ihre Eltern
Genitiv ihrer Eltern
Dativ ihren Eltern
Akkusativ ihre Eltern
Zuordnung: 1. Person plural: wir
Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
unser Vater
unsere
Mutter
unser Kind
Genitiv
unseres
Vaters
unserer
Mutter
unseres
Kindes
Dativ
unserem
Vater
unserer
Mutter
unserem
Kind
Akkusativ
unseren
Vater
unsere
Mutter
unser Kind
Plural
fr alle Genera gleich
Nominativ unsere Eltern
Genitiv unserer Eltern
Dativ unseren Eltern
Akkusativ unsere Eltern
Zuordnung: 2. Person plural: ihr
Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
euer Vater
euere
Mutter
euer Kind
Genitiv
eueres
Vaters
euerer
Mutter
eueres
Kindes
Dativ
euerem
Vater
euerer
Mutter
euerem
Kind
Akkusativ
eueren Vater
euere
Mutter
euer Kind
Plural
fr alle Genera gleich
Nominativ euere Eltern
Genitiv euerer Eltern
Dativ eueren Eltern
Akkusativ euere Eltern
Zuordnung: 3. Person plural: sie
Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ ihr Vater ihre Mutter ihr Kind
Genitiv ihres Vaters ihrer Mutter ihres Kindes
Dativ ihrem Vater ihrer Mutter ihrem Kind
Akkusativ ihren Vater ihre Mutter ihr Kind
Plural
fr alle Genera gleich
Nominativ ihre Eltern
Genitiv ihrer Eltern
Dativ ihren Eltern
Akkusativ ihre Eltern
Relativpronomen (bezgliches Frwort)
Das Relativpronomen hngt von einem vorhergehenden Beziehungswort ab, dieses
Beziehungswort gibt vor, in welchem Genus und Numerus das Relativpronomen steht. Der
Kasus hingegen hngt vom Inhalt des Relativsatzes ab. Dieser Relativsatz wird vom
Relativpronomen eingeleitet; er ist durch Kommata vom Hauptsatz abgetrennt.
Beispiel: Michael Jackson, der heute in unserer Stadt ein Kon:ert gibt, hat meiner kleinen
Schwester ein Autogramm gegeben.
Be:ugswort. Michael Jackson (Genus maskulinum / Numerus singular)
Relativpronomen. Genus und Numerus also auch maskulinum / singular
Frage nach Kasus. "Wer oder was gibt ein Kon:ert?" ~ bei "Wer
oder was" steht der Nominativ
Also. Relativpronomen ~ der
Die Deklination der Relativpronomen: der - die - das Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
der Mann, der... die Frau, die... das Kind, das...
Genitiv
der Mann,
dessen...
die Frau, der... /
deren...
das Kind,
dessen...
Dativ der Mann, dem... die Frau, der... das Kind, dem..
Akkusativ
der Mann, den... die Frau, die... das Kind, das...
Die Deklination der Relativpronomen: der - die - das Plural
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
die Mnner, die... die Frauen, die... die Kinder, die...
Genitiv
die Mnner,
deren...
die Frauen,
deren...
die Kinder,
deren...
Dativ
die Mnner,
denen...
die Frauen,
denen...
die Kinder,
denen..
Akkusativ
die Mnner, die... die Frauen, die... die Kinder, die...
Die Deklination der Relativpronomen: dieser - welcher Singular
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
der Mann,
welcher...
die Frau,
welche...
das Kind,
welches...
Genitiv
der Mann,
dessen...
die Frau,
deren...
das Kind,
dessen...
Dativ
der Mann,
welchem...
die Frau,
welcher...
das Kind,
welchem...
der Mann, die Frau, das Kind,
Akkusativ
welchen... welche... welches...
Die Deklination der Relativpronomen: dieser - welcher Plural
maskulinum femininum neutrum
Nominativ
die Mnner, die /
welche...
die Frauen, die /
welche...
die Kinder, die /
welche...
Genitiv die Mnner, deren... die Frauen, deren... die Kinder, deren...
Dativ
die Mnner, denen /
welchen...
die Frauen, denen /
welchen...
die Kinder, denen /
welchen...
Akkusativ
die Mnner, die /
welche...
die Frauen, die /
welche...
die Kinder, die /
welche...
Demonstrativpronomen (hinweisendes Frwort)
Das Demonstrativpronomen weist mit Nachdruck auI eine(n) bereits bekannte(n) oder
besonders hervorzuhebende(n) Person (oder Gegenstand) hin.
Beim Sprechen wird das Demonstrativpronomen besonders stark betont.
Beispiel: Wenn ich den erwische' An dieser Stelle lag mein goldener Ring'
Derjenige, der den Diebstahl gesehen hat, soll sich melden.
Es war bestimmt derselbe, der auch dein Armband gestohlen hat.
Deklination der Demonstrativpronomen: der - die - das
Singular Plural
maskulinum femininum neutrum fr alle Genera gleich
Nominativ der die das die
Genitiv dessen deren dessen deren / derer
Dativ dem der dem denen
Akkusativ den die das die
Deklination der Demonstrativpronomen: dieser - diese - dieses (ebenso: jener - jene -
jenes)
Singular Plural
maskulinum femininum neutrum fr alle Genera gleich
Nominativ dieser diese dieses diese
Genitiv dieses dieser dieses dieser
Dativ diesem dieser diesem diesen
Akkusativ diesen diese dieses diese
Deklination der Demonstrativpronomen: derjenige - diejenige - dasjenige (ebenso:
derselbe - dieselbe - dasselbe)
Singular Plural
maskulinum femininum neutrum fr alle Genera gleich
Nominativ derjenige diejenige dasjenige diejenigen
Genitiv desjenigen derjenigen desjenigen derjenigen
Dativ demjenigen derjenigen demjenigen denjenigen
Akkusativ denjenigen diejenige dasjenige diejenigen
Deklination der Demonstrativpronomen: solcher - solche - solches > wie das Adjektiv
ohne Artikel.
Beispiel: Obelix klopfte mit solcher Kraft gegen die Tr, dass diese :usammenbrach.
Einen solchen Sturm... Ein solches Gewitter...
Solch ein Zeugnis...
selbst - selber: wird nicht dekliniert.
Interrogativpronomen (fragendes Frwort)
Das Interrogativpronomen Iragt nach einer Person / einer Sache / einem abstrakten BegriII.
Wer war das?
Wessen Kaugummi klebt hier auI meinem Stuhl?
Wem verdanken wir dieses Chaos?
Wen besuchen wir heute?
Welchen Lehrer bekommen wir in Mathe?
Was fr einen Wagen Ihrt dein Vater?
Indefinitpronomen (unbestimmtes Frwort)
Die IndeIinitpronomen stehen Ir eine nicht nher bekannte oder genauer bezeichnete Person
oder Sache.
Sie werden * substantivisch
oder * adjektivisch gebraucht.
Zu den IndeIinitpronomen gehren: einer, keiner, irgendein, irgendwer, jeder, jedermann,
jeglicher, jemand, niemand, kein(er), alles, nichts, man, einige, etliche, etwas, smtliche.
Whrend "man", "etwas", "nichts" unverndert bleiben, werden z. B. dekliniert:
jemand - niemand - jedermann - jemand anderer
Nominativ jemand niemand
Genitiv jemandes niemandes
Dativ jemand(em) niemand(em)
Akkusativ jemand(en) niemand(en)
Nominativ
jedermann jemand anderer
Genitiv
jedermanns
jemandes anderer
(Hund)
Dativ jedermann
jemand(em) anderer /
(von) jemand anderem
Akkusativ
jedermann
jemand(en) anderer /
andere / anderes
Die Steigerung der Adjektive
Wir lassen uns nicht gleichmachen -
es lebe der kleine Unterschied!
Das Handy ist wohl das einzige Ding,
bei dem sich die Mnner darum streiten,
wer wohl das kleinste hat.
,Mein Handy ist besonders klein~, freut sich
Heiko.
,Meines ist noch viel kleiner~, entgegnet Hasso.
,Aber am kleinsten ist doch zweifellos das
meine~, prahlt Mirko.
,Mein alter VW ist noch erstaunlich schnell~,
erzhlt Heiko.
,Mein frisierter Manta ist aber schneller~,
kontert Hasso.
,Mein tiefergelegter Rennsmart ist am
schnellsten~, stellt Mirko klar.
,Dafr ist meine neue Freundin besonders
hbsch~, trumpft Heiko auf.
,Du musst zugeben, dass meine deutlich
hbscher ist~, erwidert Hasso.
,Schon gut Mnner, aber ohne Frage ist meine
am hbschesten~, gibt Mirko an.
Da die Sachverhalte nun mal nicht gleich sind,
muss man das Gute vom Besseren
und das Schlechte vom Schlechteren
unterscheiden knnen.
Um das sprachlich verdeutlichen zu knnen,
kann man die meisten Adjektive (aber nicht alle)
steigern.
Man unterscheidet drei Steigerungsstufen:
die Grundstufe: Positiv
die Vergleichsstufe: Komparativ und
die Hchststufe: Superlativ.
Beachte: Einige Adjektive werden
unregelmig gesteigert.
Steigerungsstufe Positiv Komparativ Superlativ
regelmig
gro
klein
reich
arm
grer
kleiner
reicher
rmer
am grten
am
kleinsten
am
weit
kurz
schlau
dumm
hoch
tieI
nahe
weit
weiter
krzer
schlauer
dmmer
hher
tieIer
nher
weiter
reichsten
am rmsten
am
weitesten
am
krzesten
am
schlau(e)sten
am
dmmsten
am hchsten
am tieIsten
am nchsten
am
weitesten
unregelmig
gut
viel
besser
mehr
am besten
am meisten
Nur einmal gesteigert werden zum Beispiel:
innere - innerste
uere - uerste
vorder - vorderste
hintere - hinterste
untere - unterste
Car nicht gesteigert werden:
tot
einzig
einmalig
ganz
kein
golden
steinhart
himmelweit
riesengro
Wann sagt man ,als~ - wann
sagt man ,wie~ ?
Esther war genauso schnell wie Nora.
Hans ist genauso fleiig wie Hubert.
Die Reparatur ist ebenso teuer wie ein Neukauf.
Esther war schneller als Nora.
Hans ist fleiiger als Hubert.
Die Reparatur ist teuerer als ein Neukauf.
Merke: Wenn zwei Sachverhalte gleich
sind, sagt man ,wie~.
Wenn sie ungleich sind, sich also
voneinander unterscheiden,
sagt man ,als~.
Oft gehrt aber trotzdem falsch:
Du hast in keinster Weise recht.
Es war die einzigste Chance, die ich hatte.
Spinnen nehmen minimalste Erschtterungen
wahr.
Dieser Bankier verspricht maximalste Gewinne.
Er ist der erstklassigste F1-Fahrer aller Zeiten.
Dies ist wohl der einfallsloseste Satz dieses
Drehbuchs.
Letzten Endes kann man auch durch falsche
Beispiele etwas lernen.
Deklination von Adjektiven
1. Beispiel (mit bestimmtem Artikel)
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) der alte Mann die junge Frau das kleine Kind
Genitiv (2.Fall) des alten Mannes der jungen Frau des kleinen Kindes
Dativ (3. Fall) dem alten Mann(e) der jungen Frau dem kleinen Kind(e)
Akkusativ (4. Fall) den alten Mann die junge Frau das kleine Kind
Plural
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) die alten Mnner die jungen Frauen die kleinen Kinder
Genitiv (2.Fall) der alten Mnner der jungen Frauen der kleinen Kinder
Dativ (3. Fall) den alten Mnnern den jungen Frauen den kleinen Kindern
Akkusativ (4. Fall) die alten Mnner die jungen Frauen die kleinen Kinder
Beachte: Die Pluralformen der Adjektive sind bei allen drei Geschlechtern gleich .
2. Beispiel (mit unbestimmtem Artikel)
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1.
Fall)
ein alter Mann eine junge Frau ein kleines Kind
Genitiv (2.Fall) eines alten Mannes
einer jungen
Frau
eines kleinen Kindes
Dativ (3. Fall)
einem alten
Mann(e)
einer jungen Frau
einem kleinen
Kind(e)
Akkusativ (4. Fall) einen alten Mann eine junge Frau ein kleines Kind
Beachte: Bei Unbestimmten Artikeln entfllt das Plural.
Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel.
Beispiel: Singular Plural
Ich esse einen Apfel. Ich esse pfel.
Er schreibt einen Brief. Er schreibt Briefe.
3. Beispiel (mit bestimmtem Artikel und zweiAdjektiven)
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ der gute alte Mann
die hbsche junge
Frau
das spielende kleine Kind
Genitiv
des guten alten
Mannes
der hbschen jungen
Frau
des spielenden kleinen
Kindes
Dativ
dem guten alten
Mann(e)
der hbschen jungen
Frau
dem spielenden kleinen
Kind(e)
Akkusativ den guten alten Mann
die hbsche junge
Frau
das spielende kleine Kind
Plural
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ
die guten alten
Mnner
die hbschen jungen
Frauen
die spielenden kleinen
Kinder
Genitiv
der guten alten
Mnner
der hbschen jungen
Frauen
der spielenden kleinen
Kinder
Dativ
den guten alten
Mnnern
den hbschen jungen
Frauen
den spielenden kleinen
Kindern
Akkusativ
die guten alten
Mnner
die hbschen jungen
Frauen
die spielenden kleinen
Kinder
Beachte: Zwei oder mehrere Adjektive vor einem Nomen werden parallel ,
d.h. auf die gleiche Weise, dekliniert.
Bei unbestimmten Aktikeln gilt das ebenso.
Deklination von Nomen
1. Beispiel (mit Bestimmten Artikeln)
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) der Mann die Frau das Kind
Genitiv (2.Fall) des Mannes der Frau des Kindes
Dativ (3. Fall) dem Mann(e) der Frau dem Kind(e)
Akkusativ (4. Fall) den Mann die Frau das Kind
Plural
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) die Mnner die Frauen die Kinder
Genitiv (2.Fall) der Mnner der Frauen der Kinder
Dativ (3. Fall) den Mnnern den Frauen den Kindern
Akkusativ (4. Fall) die Mnner die Frauen die Kinder
Beachte: Die Pluralformen der Artikel sind bei allen drei Geschlechtern gleich.
2. Beispiel (alle mit Umlaut : Baum - Bume / Kuh - Khe / Buch - Bcher)
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) der Baum die Kuh das Buch
Genitiv (2.Fall) des Baumes der Kuh des Buches
Dativ (3. Fall) dem Baum(e) der Kuh dem Buch(e)
Akkusativ (4. Fall) den Baum die Kuh das Buch
Plural
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) die Bume die Khe die Bcher
Genitiv (2.Fall) der Bume der Khe die Bcher
Dativ (3. Fall) den Bumen den Khen den Bchern
Akkusativ (4. Fall) die Bume die Khe die Bcher
3. Beispiel (mit Unbestimmten Artikeln)
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) ein Mann eine Frau ein Kind
Genitiv (2.Fall) eines Mannes einer Frau eines Kindes
Dativ (3. Fall) einem Mann(e) einer Frau einem Kind(e)
Akkusativ (4. Fall) einen Mann eine Frau ein Kind
Bei Unbestimmten Artikeln entIllt das Plural.
Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel.
Beispiel: Singular Plural
Ich esse einen ApIel. Ich esse pIel.
Er schreibt einen BrieI. Er schreibt BrieIe.
Wie Iindet man nun heraus, welcher Kasus jeweils benutzt werden mu?
Der Nominativ wird immer angewendet, wenn man Iragen kann "Wer oder was...".
Beispiel Der Baum wird heute geIllt.
Frage: Wer oder was wird heute geIllt?
Der Genitiv wird angewendet, wenn man ein Besitzverhltnis zum Ausdruck
bringen will
und wenn man Iragen kann "Wessen..." .
Beispiel: Die ste des Baumes werden heute geschnitten.
Frage: Wessen ste werden heute geschnitten?
Der Dativ wird angewendet, wenn man Iragen kann "Wem..."
oder "Woher..." bzw. "Wo...".
Beispiel: Ich schenke dem Vater ein Buch.
Frage: Wem schenke ich ein Buch?
Beispiel: Ich komme aus dem Garten (...dem Wald, ... der Schule, ...
dem Haus)
Frage: Woher kommst du?
Der Akkusativ wird angewendet, wenn man Iragen kann "Wen oder was..." .
oder "Wohin..." .
Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroIIen?
Antwort: Du hast heute den Bundeskanzler in der Stadt
getroIIen.
Frage: Wohin gehst du?
Antwort: Du gehst in den Garten (...den Wald, ...die Schule,
...das Haus)
Andere Beispiele: Nominativ
Wer oder was...?
Der Schler ist im Unterricht eingeschlaIen.
Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel.
Das Auto muss in die Werkstatt.
Genitiv
Wessen...?
Er schneidet die ste des Baumes.
Sie hrte die Stimme der Operndiva.
Ich IIne die Tr des Autos.
Dativ
Wem...?
Ich vertraue dem Freund.
Das Buch gehrt der Schule.
Sie liest dem Kind ein Mrchen vor.
Akkusativ
Wen oder was...?
Wir treIIen heute den Finanzminister.
Viele Schler verIluchen die HausauIgabe.
Ich lese mit Begeisterung das Buch.
PLURALBILDUNG bei NOMEN
Unter Mitarbeit der KIasse 5c des CSG
Nomen stehen im SinguIar (EinzahI), wenn sie e i n e Sache bezeichen,
und im PIuraI (MehrzahI), wenn sie sich auf z w e i oder m e h r e r e Sachen
beziehen.
Man unterscheidet grundstzIich zwei Arten der PIuraIbiIdung:
die PIuraIbiIdung der schwachen DekIination
die PIuraIbiIdung der starken DekIination.
PIuraIbiIdung bei schwacher DekIination
Die Endungen -n oder -en werden an den Wortstamm angehngt.
Der StammvokaI wird nicht umgeIautet.
Zum Beispiel: der Hase - die Hasen
der Mensch - die Menschen
PIuraIbiIdung bei starker DekIination
1. die Endungen -e oder -er werden an den Wortstamm abgehngt,
dabei wird ein umIautfhiger StammvokaI (a, o, u, au) umgeIautet.
Zum Beispiel: die Bank - die Bnke
das Blatt - die Bltter
1.1 UmIaut von a nach
der BaII
die Bank
das BIatt
das Dach
der Damm
der Darm
das Fass
das GehaIt
der Gang
das Getrnk
die BIIe
die Bnke
die BItter
die Dcher
die Dmme
die Drme
die Fsser
die GehIter
die Gnge
die Getrnke
das GIas
das Gras
der Hahn
die Hand
der Hang
der Kamm
das Lamm
das Land
der Mann
das Rad
der Sarg
der Schrank
der
Schwamm
die Wand
die GIser
die Grser
die Hhne
die Hnde
die Hnge
die Kmme
die Lmmer
die Lnder
die Mnner
die Rder
die Srge
die Schrnke
die
Schwmme
die Wnde
1.2 UmIaut von o nach
das HoIz
der Storch
der Sto
der WoIf
die HIzer
die Strche
die Ste
die WIfe
1.3. UmIaut von u nach
der Bruch
das Buch
der Bund
der
EntschIuss
der FIuch
der FIuss
der Fuchs
der Furz
der Guss
der Hut
die Kuh
der Kuss
der Luchs
die Luft
der Mund
die Schnur
der Schuss
die Stadt
der Strumpf
der StuhI
das Tuch
der
VerschIuss
der Wurm
die Wurst
die Brche
die Bcher
die Bnde
die
EntschIsse
die FIche
die FIsse
die Fchse
die Frze
die Gsse
die Hte
die Khe
die Ksse
die Lchse
die Lfte
die Mnder
die Schnre
die Schsse
die Stdte
die Strmpfe
die SthIe
die Tcher
die
VerschIsse
die Wrmer
die Wrste
der Zug die Zge
1.4. UmIaut von au nach u
der Baum
das Haus
die Maus
der Raum
die Sau
der
Schaum
der Strau
der Traum
der Zaun
die Bume
die Huser
die Muse
die Rume
die Sue (Jger: die
Sauen)
die Schume
die Strue
die Trume
die Zune
Beachte: 1. Bei einigen Nomen wird der PIuraI o h n e UmIautung und
Anhnge gebiIdet!
In diesen FIIen kann der Numerus (SinguIar oder PIuraI) nur
durch
den voranstehenden ArtikeI erkannt werden.
Zum Beispiel: das Fenster - die Fenster
der Laster - die Laster (Lastwagen)
der Anhnger - die Anhnger
das Segel - die Segel
der Flgel - die Flgel
der Schler - die Schler
der Lehrer - die Lehrer
der Snger - die Snger
das Gebude - die Gebude
2. Bei einigen Nomen wird der PIuraI durch UmIaut, aber o h n e
Anhnge gebiIdet!
Zum Beispiel: die Tochter - die Tchter
das Kloster - die Klster
der Garten - die Grten
der Vogel - die Vgel
der Apfel - die pfel
3. Einige Nomen kommen n u r im SinguIar vor!
Zum Beispiel: der Regen, der Schnee,
die Milch, die Butter,
das Gold, das Silber,
die Wrme, die Liebe,
das Vertrauen, das Glck,
der Neid, der Aberglaube
4. Einige Nomen kommen n u r im PIuraI vor!
Zum Beispiel: die Gebrder, die Geschwister,
die Eltern, die Leute,
die Kosten, die Unkosten,
die Ferien, die Personalien,
die Lebensmittel, die Masern,
die Trmmer
5. Von einigen Wrtern gibt es verschiedene PIuraIformen
mit unterschiedIicher Bedeutung!
Zum Beispiel: die Bnke - die Banken
die Worte - die Wrter
die Bande - die Bnder
die Tuche - die Tcher
die Muttern - die Mtter
FORMENLEHRE bei NOMEN
Lateinische
Bezeichnung
Deutsche
Bezeichnung
BeispieIe:
A. Genus GeschIecht ....
1. MaskuIinum
2. Femininum
3. Neutrum
mnnIich
weibIich
schIich
der Mann, der Stein,
der Baum, der Berg,
die Frau, die Liebe,
die BIume, die Sonne,
das Kind, das Buch,
das Geschenk, das Heft
B. Numerus ZahI ....
1. SinguIar
2. PIuraI
EinzahI
MehrzahI
der Mann, die
Frau, das Kind
die Mnner, die
Frauen, die Kinder
C. Kasus FaII ...
1. Nominativ
2. Genitiv
3. Dativ
4. Akkusativ
Frage:
1. FaII Wer oder
was...?
2. FaII Wessen...?
3. FaII Wem...?
4. FaII Wen oder
was...?
MaskuIinum
Femininum Neutrum
der Mann die Frau
das Kind
des Mannes der
Frau des Kindes
dem Mann der
Frau dem Kind
den Mann die Frau
das Kind
D. DekIination Beugung
siehe unten!
Nomen knnen im SinguIar oder PIuraI jeweiIs in den vier verschiedenen Kasus
stehen.
Sie sind somit dekIinierbar, das heit sie und ihre ArtikeI und Adjektive sind an
den erfor-
derIichen AnwendungsfaII anpassbar.
Frage: Wann muss man weIchen Kasus (FaII) verwenden?
Im Nominativ
muss das Nomen stehen, das auf die Frage "Wer oder was...?" als Antwort folgt.
Beispiel: Der Junge schreibt einen Brief.
Frage: Wer oder was schreibt einen Brief?
Antwort: Der Junge!
"Junge" muss also
im Nominativ stehen.
Im Genitiv
muss ein Nomen stehen, wenn ein Besitzverhltnis zum Ausdruck gebracht werden
soll,
und wenn es auf die Frage "Wessen..."? antwortet.
Beispiel: Die Scheune des Bauern Mller ist abgebrannt.
Frage: Wessen Scheune ist abgebrannt?
Antwort: ...des Bauern MIIer!
"des Bauern
Mller" also im Genitiv.
Im Dativ
muss das Nomen stehen, das auf die Frage "Wem...?" als Antwort folgt.
Beispiel: ch gebe dem Baby das Flschchen.
Frage: Wem gebe ich...?
Antwort: dem Baby!
"dem Baby" also
im Dativ.
Im Akkusativ
muss das Nomen stehen, das auf die Frage "Wen oder was...?" als Antwort folgt.
Beispiel: ch schreibe ein Buch.
Frage: Wen oder was schreibe ich?
Antwort: ein Buch!
"ein Buch" also im
Akkusativ.
Deklination des Unbestimmten Artikels
1. Beispiel
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) ein Mann eine Frau ein Kind
Genitiv (2.Fall) eines Mannes einer Frau eines Kindes
Dativ (3. Fall) einem Mann(e) einer Frau einem Kind(e)
Akkusativ (4. Fall) einen Mann eine Frau ein Kind
Bei Unbestimmten Artikeln entIllt das Plural.
Die Nomen stehen dann bei unbestimmter Menge oder Anzahl ohne Artikel.
Beispiel: Singular Plural
Ich esse einen ApIel. Ich esse pIel.
Er schreibt einen BrieI. Er schreibt BrieIe.
Wie Iindet man nun heraus, welcher Kasus jeweils benutzt werden mu?
Der Nominativ wird immer angewendet, wenn man Iragen kann "Wer oder was...".
Beispiel Frage: Wer oder was wird heute geIllt?
Antwort: Heute wird ein Baum geIllt.
Der Genitiv wird angewendet, wenn man ein Besitzverhltnis zum Ausdruck
bringen will
und wenn man Iragen kann "Wessen..." .
Beispiel: Frage: Wessen ste werden heute geschnitten?
Antwort: Die ste eines Baumes werden heute geschnitten.
Der Dativ wird angewendet, wenn man Iragen kann "Wem..."
oder "Woher..." bzw. "Wo...".
Beispiel: Frage: Wem schenke ich mein Buch?
Antwort: Ich schenke einem Freund mein Buch.
Frage: Woher kommst du?
Antwort: Ich komme aus einem Garten (...einem Wald, ...
einer Schule, ... einem Haus)
Der Akkusativ wird angewendet, wenn man Iragen kann "Wen oder was..." .
oder "Wohin..." .
Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroIIen?
Antwort: Du hast heute einen Popstar in der Stadt getroIIen.
Frage: Wohin gehst du?
Antwort: Du gehst in einen Garten (...einen Wald, ...eine
Schule, ...ein Haus)
Andere Beispiele: Nominativ
Wer oder was...?
Ein Schler ist im Unterricht eingeschlaIen.
Eine Birne mu in der Deckenleuchte ausgetauscht werden.
Ein Auto ist eben in den Graben geIahren.
Genitiv
Wessen...?
Er schneidet die ste eines Baumes.
Sie hrte die Stimme einer Operndiva.
Ich IIne die Tr eines Autos.
Dativ
Wem...?
Ich vertraue einem Freund.
Das Buch gehrt einer Freundin.
Sie liest einem Kind ein Mrchen vor.
Akkusativ
Wen oder was...?
Wir backen heute einen Kuchen.
Viele Schler verIluchen eine SonderauIgabe.
Ich lese mit Begeisterung ein Buch.
Deklination des Bestimmten Artikels
1. Beispiel
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) der Mann die Frau das Kind
Genitiv (2.Fall) des Mannes der Frau des Kindes
Dativ (3. Fall) dem Mann(e) der Frau dem Kind(e)
Akkusativ (4. Fall) den Mann die Frau das Kind
Plural
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) die Mnner die Frauen die Kinder
Genitiv (2.Fall) der Mnner der Frauen der Kinder
Dativ (3. Fall) den Mnnern den Frauen den Kindern
Akkusativ (4. Fall) die Mnner die Frauen die Kinder
Beachte: Die Pluralformen der Artikel sind bei allen drei Geschlechtern gleich.
2. Beispiel (alle mit Umlaut : Baum - Bume / Kuh - Khe / Buch - Bcher)
Singular
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) der Baum die Kuh das Buch
Genitiv (2.Fall) des Baumes der Kuh des Buches
Dativ (3. Fall) dem Baum(e) der Kuh dem Buch(e)
Akkusativ (4. Fall) den Baum die Kuh das Buch
Plural
Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ (1. Fall) die Bume die Khe die Bcher
Genitiv (2.Fall) der Bume der Khe der Bcher
Dativ (3. Fall) den Bumen den Khen den Bchern
Akkusativ (4. Fall) die Bume die Khe die Bcher
Wie Iindet man nun heraus, welcher Kasus jeweils benutzt werden mu?
Der Nominativ wird immer angewendet, wenn man Iragen kann "Wer oder was...".
Beispiel Frage: Wer oder was wird heute geIllt?
Antwort: Der ApIelbaum wird heute geIllt.
Der Genitiv wird angewendet, wenn man ein Besitzverhltnis zum Ausdruck
bringen will
und wenn man Iragen kann "Wessen..." .
Beispiel: Frage: Wessen ste werden heute geschnitten?
Antwort: Die ste des Birnbaumes werden heute geschnitten.
Der Dativ wird angewendet, wenn man Iragen kann "Wem..."
oder "Woher..." bzw. "Wo...".
Beispiel: Frage: Wem schenke ich ein Buch?
Antwort: Ich schenke dem Vater ein Buch.
Frage: Woher kommst du?
Antwort: Ich komme aus dem Garten (...dem Wald, ... der
Schule, ... dem Haus)
Der Akkusativ wird angewendet, wenn man Iragen kann "Wen oder was..." .
oder "Wohin..." .
Beispiel: Frage: Wen oder was hast du heute in der Stadt getroIIen?
Antwort: Du hast heute den Bundeskanzler in der Stadt
getroIIen.
Frage: Wohin gehst du?
Antwort: Du gehst in den Garten (...den Wald, ...die Schule,
...das Haus)
Andere Beispiele: Nominativ
Wer oder was...?
Der Schler ist im Unterricht eingeschlaIen.
Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel.
Das Auto mu in die Werkstatt.
Genitiv
Wessen...?
Er schneidet die ste des Baumes.
Sie hrte die Stimme der Operndiva.
Ich IIne die Tr des Autos.
Dativ
Wem...?
Ich vertraue dem Freund.
Das Buch gehrt der Schule.
Sie liest dem Kind ein Mrchen vor.
Akkusativ
Wen oder was...?
Wir treIIen heute den Finanzminister.
Viele Schler verIluchen die HausauIgabe.
Ich lese mit Begeisterung das Buch.
WORTARTEN
Lateinische
Bezeichnung
Deutsche
Bezeichnung
Beispiele
A. Nomen (Substantiv)
1. Konkrete Nomen
2. Abstrakte Nomen
Hauptwort
Gegenstandshauptwort
Gedankenhauptwort
Haus, Hund, Stein,
Mbel, Rose, Hand
(...was materiell ist)
Liebe, Freude,
FreunschaIt, Hass,
Mut, Strke, HilIe (...was
nicht materiell ist)
B. Artikel
1. Bestimmter Artikel
maskulinum
femininum
neutrum
2. Unbestimmter Artikel
maskulinum
femininum
neutrum
Geschlechtswort
Bestimmtes
Geschlechtswort
mnnlich
weiblich
schlich
Unbestimmtes
Geschlechtswort
mnnlich
weiblich
der, des, dem, den (
singular)
die, der, den, die (
plural)
die, der, der, die (
singular)
die, der, den, die (
plural)
das, des, dem, das (
singular)
die, der, den, die (
plural)
ein, eines, einem, einen
(nur im Singular)
eine, einer, einer, eine
schlich
(nur im Singular)
ein, eines, einem, ein
(nur im Singular)
C. Adjektiv
Eigenschaftswort
gut, schn, gro, treu,
rot, blau, wei ...
D. Partizip
1. Partizip Prsens
2. Partizip Perfekt
Mittelwort
Mittelwort der
Gegenwart
Mittelwort der
Vergangenheit
lachend, hoIIend, liebend,
glaubend, schreibend,
lesend
gelacht, gehoIIt, geliebt,
geglaubt, geschrieben,
gelesen
E. Verb
1. Vollverb
2. Hilfsverb
3. Modalverb
Ttigkeitswort,
Zeitwort
lesen, schreiben, ben,
lieben, hassen,
hpIen, lauIen,
schwimmen
sein, haben, werden
wollen, sollen, mssen,
mgen, drIen
F. Adverb
1. lokal
2. temporal
3. modal
4. kausal
Umstandswort
des Ortes
der Zeit
der Art und Weise
des Grundes
hier, dort, da, bergauI
heute, morgen, bald
gern, vielleicht, ebenso
darum, deshalb,
vorsichtshalber
G. Prposition Verhltniswort
in, im, auI, unter, ber,
zwischen, mitten,
entlang, hinauI, hinab,
diesseits, jenseits ...
H. Numerale Zahlwort
ein, zwei, drei ...
1. Bestimmtes Numerale
2. Unbestimmtes
Numerale
3. Sonstige Numerale
Bestimmtes Zahlwort
Unbestimmtes
Zahlwort
Sonstige Zahlwrter
alles, nichts, wenig, viel,
manches, einiges, etwas
einIach, zweiIach ...
einmal, zweimal ...
I. Pronomen
1. Personalpronomen
2. Reflexivpronomen
3. Demonstrativpronomen
4. Possessivpronomen
5. Relativpronomen
6. Interrogativpronomen
Frwort
persnliches
rckbezgliches
hinweisendes
besitzanzeigendes
bezgliches
Iragendes
ich, du, er, sie, es, wir ihr,
sie
mich, dich, sich
der, die, das (betont')
mein, dein, sein, ihr, euer,
unser
der, die, das ;
welcher, welche, welches
Wer ? Was ? Wie ?
Welcher ? Welche ?
Welches?
Woher ? Wohin ?
Weshalb ? Wieso ?
1. Konjunktion
1. Nebenordnende
Konjunktionen
2. Unterordnende
Konjunktionen
Bindewort
und, zudem, auerdem,
sowohl - als auch,
oder, entweder - oder
als, wenn, weil, da, damit,
so dass, obwohl
K. Interjektion Ausrufewort
Aua ! Ach ! Hallo ! Oh
! Hoppla !
Das könnte Ihnen auch gefallen
- German PrepositionsDokument2 SeitenGerman Prepositionscwfordo91% (23)
- Wortschatz für Superhirne: Gehobene Sprache für alle Situationen / verbessern Sie Ihre Ausdrucksweise und erweitern Sie Ihren Wortschatz (inkl. E-Book mit lateinischen Redewendungen)Von EverandWortschatz für Superhirne: Gehobene Sprache für alle Situationen / verbessern Sie Ihre Ausdrucksweise und erweitern Sie Ihren Wortschatz (inkl. E-Book mit lateinischen Redewendungen)Bewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (10)
- Merk dir das! Grammatik bis B1: German Grammar explained in EnglishVon EverandMerk dir das! Grammatik bis B1: German Grammar explained in EnglishNoch keine Bewertungen
- Deutsche Grammatik: Die unverzichtbaren Grundlagen der SchriftspracheVon EverandDeutsche Grammatik: Die unverzichtbaren Grundlagen der SchriftspracheBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (10)
- Fragen Sie einfach!: Deutsche Grammatik in leichter SpracheVon EverandFragen Sie einfach!: Deutsche Grammatik in leichter SpracheBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Deutsche Verben Mit PräpositionenDokument26 SeitenDeutsche Verben Mit PräpositionenDanny Ferguson97% (31)
- Wortschatz A1-B2 DeutschDokument96 SeitenWortschatz A1-B2 Deutschixahh92% (12)
- Wortbildung des modernen Deutschen: Ein Lehr- und ÜbungsbuchVon EverandWortbildung des modernen Deutschen: Ein Lehr- und ÜbungsbuchBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- 250 Verben Mit PräpositionenDokument4 Seiten250 Verben Mit Präpositionenwolf-hearted100% (7)
- Deutsche AusdruckeDokument77 SeitenDeutsche Ausdruckecuguarfree100% (10)
- Schreibkompetenzen in der Fremdsprache: Aufgabengestaltung, kriterienorientierte Bewertung und FeedbackVon EverandSchreibkompetenzen in der Fremdsprache: Aufgabengestaltung, kriterienorientierte Bewertung und FeedbackBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (6)
- Grundwortschatz Englisch – Deutsch: Die wichtigsten 3.000 Wörter. Thematisch sortiert.Von EverandGrundwortschatz Englisch – Deutsch: Die wichtigsten 3.000 Wörter. Thematisch sortiert.Bewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (2)
- Merk dir das!: Tabellen, Merksätze, Übungen zur Grammatik bis B1Von EverandMerk dir das!: Tabellen, Merksätze, Übungen zur Grammatik bis B1Noch keine Bewertungen
- German IdiomsDokument1 SeiteGerman IdiomsStef83% (12)
- Sprachen lernen - Tolle Tipps und Tricks: Kreative Methoden für Motivation und maximalen ErfolgVon EverandSprachen lernen - Tolle Tipps und Tricks: Kreative Methoden für Motivation und maximalen ErfolgBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (3)
- Compendium Wortschatz Deutsch-Deutsch, erweiterte Neuausgabe: 2. erweiterte NeuausgabeVon EverandCompendium Wortschatz Deutsch-Deutsch, erweiterte Neuausgabe: 2. erweiterte NeuausgabeBewertung: 3 von 5 Sternen3/5 (7)
- Die 100 wichtigsten Fragen in Vorstellungsgesprächen: Mit den besten Antworten auf Deutsch und Englisch perfekt vorbereitet in das Gespräch gehenVon EverandDie 100 wichtigsten Fragen in Vorstellungsgesprächen: Mit den besten Antworten auf Deutsch und Englisch perfekt vorbereitet in das Gespräch gehenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- PräpositionenDokument23 SeitenPräpositionenAnnie Beatty100% (6)
- Wörterbuch Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 "Guten Tag": Lernwortschatz Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 Guten Tag + Kurs per InternetVon EverandWörterbuch Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 "Guten Tag": Lernwortschatz Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 Guten Tag + Kurs per InternetNoch keine Bewertungen
- Deutsche Grammatik in Algorithmen: Grund- und Mittelstufe mit Aufgaben, Tests und LösungenVon EverandDeutsche Grammatik in Algorithmen: Grund- und Mittelstufe mit Aufgaben, Tests und LösungenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- German 101Dokument18 SeitenGerman 101Jamila Colleen M. Briones100% (5)
- Wörterbuch Deutsch - Polnisch - Englisch Niveau B1: Lernwortschatz B1 DEUTSCH zum erfolgreichen Selbstlernen für DeutschkursTeilnehmerInnen aus PolenVon EverandWörterbuch Deutsch - Polnisch - Englisch Niveau B1: Lernwortschatz B1 DEUTSCH zum erfolgreichen Selbstlernen für DeutschkursTeilnehmerInnen aus PolenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Die 35 häufigsten Fehler im Deutschen: Wie man sie vermeidetVon EverandDie 35 häufigsten Fehler im Deutschen: Wie man sie vermeidetNoch keine Bewertungen
- Deutsche Unregelmäßige VerbenDokument2 SeitenDeutsche Unregelmäßige VerbenИгор Гала Божиноски83% (6)
- Deutsch-englisches Wörterbuch der Eins-zu-eins-Entsprechungen in zwei Bänden: Band 1: A - KVon EverandDeutsch-englisches Wörterbuch der Eins-zu-eins-Entsprechungen in zwei Bänden: Band 1: A - KBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Zur Standardisierung der DSH-Prüfungen: Bestandsaufnahme und Perspektiven des Online-AngebotesVon EverandZur Standardisierung der DSH-Prüfungen: Bestandsaufnahme und Perspektiven des Online-AngebotesNoch keine Bewertungen
- List Von Verben Mit PräpositionenDokument45 SeitenList Von Verben Mit PräpositionenLaith Hawamdeh100% (2)
- Wortschatz Für Das Zertifikat Deutsch Als FremdspracheDokument74 SeitenWortschatz Für Das Zertifikat Deutsch Als FremdspracheAli Najdawi100% (4)
- Besser lesen und schreiben: Wie Schüler effektiver mit Sachtexten umgehen lernenVon EverandBesser lesen und schreiben: Wie Schüler effektiver mit Sachtexten umgehen lernenNoch keine Bewertungen
- LeseübungDokument3 SeitenLeseübungStef100% (1)
- Texte schreiben: 50 Vorlagen von der Textagentur etexterVon EverandTexte schreiben: 50 Vorlagen von der Textagentur etexterBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Wörterbuch Deutsch - Syrisch - Englisch A2: Lernwortschatz A2 Sprachkurs Deutsch zum erfolgreichen Selbstlernen für TeilnehmerInnen aus SyrienVon EverandWörterbuch Deutsch - Syrisch - Englisch A2: Lernwortschatz A2 Sprachkurs Deutsch zum erfolgreichen Selbstlernen für TeilnehmerInnen aus SyrienNoch keine Bewertungen
- PassiveDokument15 SeitenPassiveStef100% (1)
- Das Kreuz mit den Präpositionen: Welche Präposition ist richtig?Von EverandDas Kreuz mit den Präpositionen: Welche Präposition ist richtig?Noch keine Bewertungen
- Wie schreibt man heute eigentlich?: 25 Antworten auf die alltäglichsten Fragen rund um Rechtschreibung, Sprachstil und KorrespondenzVon EverandWie schreibt man heute eigentlich?: 25 Antworten auf die alltäglichsten Fragen rund um Rechtschreibung, Sprachstil und KorrespondenzBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Wörterbuch Deutsch - Albanisch - Englisch A1: Lernwortschatz A1 für Deutschkurs TeilnehmerInnen aus Albanien, Kosovo, Mazedonien, Serbien...Von EverandWörterbuch Deutsch - Albanisch - Englisch A1: Lernwortschatz A1 für Deutschkurs TeilnehmerInnen aus Albanien, Kosovo, Mazedonien, Serbien...Noch keine Bewertungen
- Der Die DasDokument3 SeitenDer Die DasExuP69100% (4)
- Past Tense Verb ListDokument4 SeitenPast Tense Verb ListStef100% (7)
- Liste Von Verben Mit DativDokument2 SeitenListe Von Verben Mit DativKellyane Link100% (6)
- Lexikon Fremdwörter Synonyme: Nachschlagwerk für Schule, Studium, Alltag & BerufVon EverandLexikon Fremdwörter Synonyme: Nachschlagwerk für Schule, Studium, Alltag & BerufNoch keine Bewertungen
- Kinderbuch - Origami Ravens BurgerDokument44 SeitenKinderbuch - Origami Ravens Burgeranaxu4143100% (4)
- Die PronomenDokument11 SeitenDie Pronomenacox_mbs100% (1)
- Bleiben Sie GesundDokument3 SeitenBleiben Sie GesundStef100% (3)
- Integration durch Integrationskurse? Eine Verlaufsstudie bei iranischen Migrantinnen und MigrantenVon EverandIntegration durch Integrationskurse? Eine Verlaufsstudie bei iranischen Migrantinnen und MigrantenNoch keine Bewertungen
- e.driver Professional: TheorieprüfungVon Everande.driver Professional: TheorieprüfungWalter Systems AG / e-universityNoch keine Bewertungen
- Gloeckner 2013 Bildungswesen in ChinaDokument30 SeitenGloeckner 2013 Bildungswesen in China谢重霄Noch keine Bewertungen
- Mal 5.11.23Dokument32 SeitenMal 5.11.23kkmsNoch keine Bewertungen
- 2001 - Karch & Schroeder - Optionen Der ArbeitszeitpolitikDokument12 Seiten2001 - Karch & Schroeder - Optionen Der ArbeitszeitpolitikPic ColoNoch keine Bewertungen
- Beste Freunde Lektion 1 Test - PDFDokument1 SeiteBeste Freunde Lektion 1 Test - PDFHelene IntxaustiNoch keine Bewertungen
- Beyond The Sambatyon The Ten Lost TribesDokument39 SeitenBeyond The Sambatyon The Ten Lost TribesBrother IliaNoch keine Bewertungen
- LektürelisteDokument10 SeitenLektürelisteDominik PfaffingerNoch keine Bewertungen
- d100 v2.0Dokument9 Seitend100 v2.0Morning StarNoch keine Bewertungen
- Bambiland ObraDokument49 SeitenBambiland ObraApolo Meza VidalNoch keine Bewertungen
- La Filosofia de NietzscheDokument155 SeitenLa Filosofia de NietzscheRichard ContrerasNoch keine Bewertungen
- Patimokkha-Smallbook Pali OnlyDokument94 SeitenPatimokkha-Smallbook Pali OnlynyitiNoch keine Bewertungen
- Musiklexikon HDokument2 SeitenMusiklexikon HschnicklebopNoch keine Bewertungen
- Love - The System (Dating Dictionary)Dokument142 SeitenLove - The System (Dating Dictionary)Vlad ThalheimerNoch keine Bewertungen
- Mal 23.3.23Dokument32 SeitenMal 23.3.23acctive2016 thailandNoch keine Bewertungen
- (Ebook - German) Origami-WurfelDokument3 Seiten(Ebook - German) Origami-Wurfelanaxu4143Noch keine Bewertungen
- (Ebook - German) Origami-WurfelDokument3 Seiten(Ebook - German) Origami-Wurfelanaxu4143Noch keine Bewertungen
- Langenscheidt - Wechselspiel (Deutsch Als Fremdsprache) - ÜbungsbuchDokument140 SeitenLangenscheidt - Wechselspiel (Deutsch Als Fremdsprache) - Übungsbuchanaxu414394% (18)