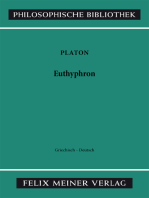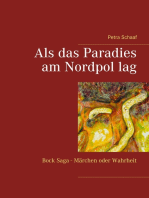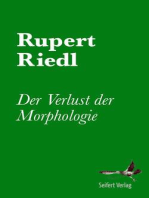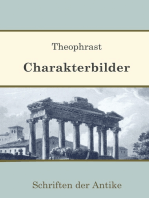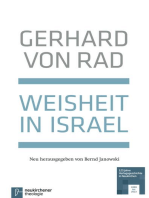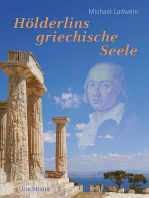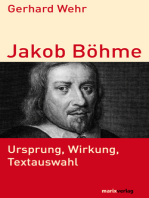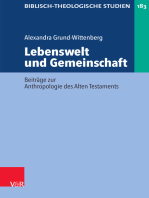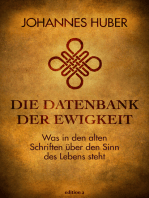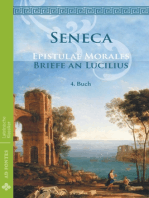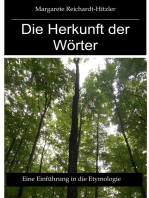Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
(1953) Seel, O. - Zur Vorgeschichte Des Gewissens-Begriffes Im Altgriechischen Denken
Hochgeladen von
Carlos Calvo Arévalo0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
231 Ansichten15 SeitenOriginaltitel
[1953] Seel, O. - Zur Vorgeschichte Des Gewissens-Begriffes Im Altgriechischen Denken
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
231 Ansichten15 Seiten(1953) Seel, O. - Zur Vorgeschichte Des Gewissens-Begriffes Im Altgriechischen Denken
Hochgeladen von
Carlos Calvo ArévaloCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 15
1
GEORG ScHREIBER, Der irische Seeroman des Brandan
gri:iBten hiifischen Romandichter ansprechen dad. Von dort zeichnen sich
Verbindungslinien ab, die in die Dichtungen Hartmanns von Aue und
Wolframs von Eschenbach fhren. Wiederum will der groBen literari-
schen Erscheinungen des Grals und der Geschichte Tristans gedacht sein.
Neuerdings ist es der Keltologe und Sprachforscher Julius Pokorny ge-
wesen, der die auBerordentliche und befruchtende Kulturkraft des Kelten-
tums betont und berzeugend herausgestellt hat. Die fnf Vortrage,, die
dieser weit ausgreifende Forscher im Sommer 1952 in Zrich hielt, haben
weiteste Beachtung gefunden. Wir weisen nur hin auf den Bericht ,,Das
Keltentum einst und jetzt", den die N eue Zrcher Zeitung vorlegte.
1
In diese Zusammenhange keltischer Fernwirkung mag man auch die
Brandanslegende einbeziehen.
An der Geschichte der Entdeckungsfahrten ist die amerikanische For-
schung von jeher starker interessiert. Sie hat neuerdings mit C. Selmer
den Namen Brandenburg mit Brandan in Beziehung gesetzt.
2
Es kann sein,
daB eine auch von Leo Weisgerber geforderte Kultgeographie der Iren-
wellen weitere Aufschlsse ermoglicht.
1
Nr. 1496 vom 7. Juli 1952.
2
Nach Leo Weisgerber, Die Spuren der irischen Mission in der Entwicklung der
deutschen Sprache, Rheinische Vierteljahres-Blatter 17 1952, S. 8-41. Dort S. 9
Erwahnung von Brendan, ebenso der Abhandlung von C. Selmer, The beginnings
of the St. Brendan legend on the continent. Cath. Hist. Rev. 29, 1943, p . 196ff. und
Th Brendan legend in old German .Jiterature, Journal of the Amer. Iri sh Hist.
Soc. 32, 194 J.
ZUR VORGESCHICHTE DES GEWISSENS-BEGRIFFES
IM ALTGRIECHISCHEN DENKEN
Von TTO SEEL, Erlangen
I.
Franz Dornseiffs Buch ber ,,Die griechischen Wrter im Deutschen"
(Berln 1950) bedeutet auch fr denjenigen, der nicht erst davon berzeugt
_werden muB, daB das griechische Erbe unauslosbar tief in den geistigen
.Besitz des Abendlandes eingebettet und verzahnt ist, eine berraschung;
denn schwerlich hat man zuvor geahnt, daB nicht nur im Bereich der
sogenannten hoheren Kultur die fruchtbarsten Problemstellungen, daB nicht
nur die Fachterminologien aller Wissenschaften auf die Griechen zurck-
gehen, sondern daB auch unser alltagliches Umgangsdeutsch so sehr durch-
setzt und erfllt ist von teils offenbarem, teils und vor allem ,,heimlichem"
Griechisch. Zu letzterem zahlen zunachst jene Lehnworter, die etymologisch
sich aus echtem Griechisch herleiten, aber ihre Lautgestalt bis zur Un-
kenntlichkeit gewandelt, der eigenen Phonetik angeglichen und sich so
gleichsam rnaskiert haben - wozu man etwa Worter wie ,,Almosen"
rechnen mag - ; aber zu dieser Gruppe tritt dann hinzu die der etymolo-
gisch rein deutschen Worter, die aber gleichwohl ihrer Bildung, Zusarnmen-
setzung und Bedeutung nach nicht original irn eigenen Sprachboden
wurzeln, sondern durch nachahmende bersetzung griechischer Begriffe
knstlich, sozusagen synthetisch gebildet, dann aber in uriser Sprach-
bewuBtsein so einbezogen und reibungslos eingebaut wurden, daB von
ihrer Knstlichkeit und Fremdheit nichts mehr zu verspren ist.
Zu den geistesgeschichtlich interessantesten dieser ,,Bedeutungslehn-
w6rter"1 gehort das zweifellos als gut, ja als eminent deutsch empfundene
Wort" ,,Gewissen".
2
Der Sachverhalt ist kurz formuliert bei Dornseiff a. O. S. 120 zu der
Wortreihe : ,,Ursprnglich in den drei
Sprachen ,das BewuBtsein'. Die ethische Sonderbeqeutung . aus der oft
yollzogenen Vorstellung heraus ,das BewuBtsein davon, daB ich etwas
1
Zu diesem Terminus vgl. Dornseiff, a . O. S. ro.
2
Wichtigste Literatur: Grundlegend M. Kahler, ,,Das Gewissen", Halle 1878;
dazu W. Bauer, Worterbuch zum Neuen Testament s. v. {dort di e altere Literatur).
F. Zucker, I:vve{ra1r;, J enaer Akad. Reden 6, J ena 1928; dazu B. Snell in:
Gnomon 6 1930, S. 21ff.; Gertrud Juug in: Archiv f. d. ges. Psychologie 89 1933,
525ff.; berhrt wird das Problem selbstverstandlich in allen Behandlungen der
a ntiken, meist auch der spateren Ethik.
rn
'\
292 TTO SEEL
Unrechtes getan habe', erscheint im Griechischen zuerst bei Diodoros von
Sizilien, Dionysios von Halikamass, Philon, Weisheit Salomos."
Der lexikalische Befund zeigt deutlich und unwidersprechlich, daB mit
dem Wort ein bedeutsamer Wandel vorgegangen ist: wenn
eine uns so leicht vom Munde gehende Verbindung wie ,.gutes Gewissen"
oder ,.reines Gewissen" sich im gesamten Griechisch nirgends findet, bis
sie, aus ganz anderem Geiste, im N. T. gewagt wird (Act. apost. 23, r;
r. ep. Tim. 3, 9), dann muB das Grnde ha ben, die tief in der Denkstruktur
des Griechen wurzeln. Und, um wenigstens eine der Ursachen anzudeuten,
weshalb sich hier und erst hier die volle Aussage de.s innerseelischen Sach-
verhaltes freispielt: im gleichen Augenblick wird auch die Begrenzung der
,Macht' des Gewissens oder seiner Zustiindigkeit forrnuliert: bei Paulus,
r. Kor. 4, 1-4 ist die metaphysische Insuffizienz des bloB GewissensmiiBigen
eindringlich formuliert: ... a.U.' ovoe eavr:()')J apa"env, ove'P yae eavr:i.[>
GV'POtOa. a.V.: oVi! E'P T:oVUp OEOti!aroat. oe avai!f!')J(J)ll E i!!f!t6, EaT:tV .. .
Damit ist von vomherein ein Gegengewicht geschaffen gegen das ewig
Selbstquiilerische, skrupul6s Gebrochene, an dem die Antike so beraus
starken, gerade auch ,.sittlichen" AnstoB nahrn; hierher geh6rt die Forde-
rung des Aristoteles, der sittlich Gute solle anaA.rw, sein, denn er
oyuooPEi fovr:i.[> (Eth. Nic. 1 n66 a 29; 13b 5ff.) ebenso wie die
stoische Reuelosigkeit, gegen die, als gegen eine Verkrampfung und Ver-
armung des Lebens, Cicero polernisiert (sapientem ... nullius rei paenitere:
Mur. 6off.) . Tatsiichlich kommt Ciceros conscientia dem, was wir unter
Gewissen verstehen, sehr viel niiher als alles, was sich bis zu seiner Zeit
im Griechischen mit der Komposition von aV'P und i;li5Pat ausspricht1,
was zweifellos wiederum damit zusammenhiingt, daB ein gewisses Sich-
gehen-Lassen, etwas von Hingegebenheit an gefhls- und stimmungsgetonte
Situationen, im Guten und Schlechten, als ein wesentlicher Zug Ciceros
auch sonst festzustellen ist.
Schon von hier aus driingt sich die Frage auf, ob es denn primar erkennt-
nismiiBige Grnde waren, was dem klassischen Griechentum den Weg zur
Bildung eines echten Gewissensbegriffes verwehrt hat; ob nicht vielmehr
Gegebenheiten und Notigungen der inneren Haltung dabei im Spiele
waren. Anders gesagt: ob bei den Griechen der Raum des Gewissens tat-
siichlich nicht vorhanden war, oder ob er bloB nicht betreten wurde. Man
hat festgestellt, daB das Wort avPEOrau; zuerst bei Demokrit (fr. 297 D. K.),
dasWort r:o aVPE106, zuerst beiDemosthenes (cor. no), und zwar letzteres
in rein intellektueller Funktion, als ,.Mitwissen", begegnet. Nun weiB man
zwar, daB es Vorstufen dazu gibt; so sagt etwa B. Snell : ,.Das schlechte
Gewissen ist allerdings ein Zustand, den erst Euripides entdeckt hat";
oder in der (1951 postum herausgegebenen) ,.Ethik der Griechen" von.
1
Wie stark das ,Gewissensmallige' in Cceros Denken verankert ist, mag die
- durchaus nicht vollstandige - Sammlung von Stellen in meiner .. Vox Humana"
(Stuttgart i949) Nr. 587-597 zeigen.
2
B. Snell, Die Entdeckung des Geistes 1948, S. 155.
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken 293
Eduard Schwartz liest man (S. 90) : ,.Vor allem darf man sich nicht darauf
berufen, daB Sokrates ein besonderes ,Gewissen' gehabt habe. GewiB ist
es richtig, daB der Begriff aus dem Griechischen stammt und schon im
5. Jahrhundert vorkommt, z. B. im Orestes des Euripides 396, wo Orestes
das avi:E106, zu sehen glaubt; aber man muB hinzufgen, daB das Gewissen
in der hellenischen Ethik nicht die geringste Rolle spielt; eine Lehre 1lE(!t
aV'PEt06r:o, gibt es nicht; man muB sich auch hier an die Gegebenheiten
halten ... ". UndF.Zucker (vgl.obenS.291,2) verallgememertdiesen,gerade
von ihrn mit dankenswerter Schiirfe herausgearbeiteten Tatbestand zu der
Feststellung, ,.daB in grundlegenden Fragen, in Fragen, bei denen man
ohne weiteres bereinstimmung vorauszusetzen geneigt sein wrde, eine
tiefe Fremdheit zwischen der Antike und uns besteht, eine vollkommene
Artverschiedenheit geistiger und sittlicher Haltung".
Damit ist eine besondere Situation der derzeitigen Antikendeutung be-
rhrt: nachdem bis zur Goethezeit hin die Begegnung mit dem Altertum
naiv als eine jenseits aller geschichtlichen Veriinderungen sich vollziehende
Begegnung von Mensch zu Mensch gesucht worden war, wobei bei aller
Verehrung jener vermeintlichen Welt von ,.edler Einfalt und stiller Gr6Be"
doch keinen Augenblick bezweifelt wurde, daB ,.eben alles Menschen ge-
wesen" sind, die uns zwar in vielem berlegen, aber in nichts Wesent-
lichem von uns strukturell verschieden waren, entdeckte man seitdem in
zunehmendem MaBe die Distanz, die. Fremdheit, die Eigengesetzlichkeit
einer Welt, deren exemplarische Bedeutung man zwar keineswegs bestritt,
aber deren Wiederholbarkeit oder Nachahmbarkeit eben durch die Ent-
deckung solcher Fremdheiten und Befremdlichkeiten nicht nur nicht mehr
denkbar, sondem, unausgesprochen, auch kaum mehrwnschbar seinkonnte;
mochte sich in dieser Freude an der m6glichst krassen Formulierung des
Abstandes nun Gegenwartskritik oder Flucht vor sich selber verbergen,
als Parallele zu den mancherlei Beglcktheiten einer durchgiingigen Primi-
tivenromantik und eines gegenwartsmden Exotismus, mochte sich ein,
durch Nietzsche und Stefan George angebahntes und ermutigtes, Streben
nach der reinen, unverstellten, sch6nen, gefiihrlichen Natur, nach Des-
involtura und arthafter Menschengr6Be hier der empirischen Rechtferti-
gungen versichern zu konnen glauben, denen die eigene Wirklichkeit nur
allzu offenbar nicht entsprach ... : das Ende muBte doch eine .,Ent-Frem-
dung" der Antike sein, eine esoterische Verdnnung der lebendigen Bezge
zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
berlege man, was diesen al ten Griechen doch alles gefehlt hat ! N ur
ein paar dieser Manken seien in Erinnerung gerufen: die Griechen hatten
z. B. eine Masse von Wortem fr die Gebiirden, die ,.Gesten" des Blickens,
aber sie hatten keines fr die aktive Funktion des Sehens: dieses als das
Eigentliche des Auges, ,.ist ihnen offenbar gar nicht als das Wesentliche
vorgekommen, - ja wenn sie kein Wort dafr hatten, existierte es fr
ihr BewuBtsein nicht": so B. Snell1; solche Thesen sind nur zu begreifen
1 Entd. d. G. S. 15ff. Naheres unten.
294
TTO SEEL
aus dem immer wieder als vordringlich bewertetenZiel, zu zeigen, ,, wodurch
sich die homerischen Anschauungen von den un.s gewohnten unterschieden",
das Andersartige ,,m6glichst deutlich abzugrenzen"
1
: ,,Je weiter wir die
Wortbedeutungen bei Homer abrcken von denen der klassischen Zeit,
desto greifbarer wird der Unterschied der Zeiten. "
2
DaB dieses Ziel einmal
gestellt werden durfte, ja muBte, ist unbestreitbar. Aber es darf nicht
dahin fhren, wohin es zu fhren droht oder bereits gefhrt hat; also der
vorklassische Mensch hat kein BewuBtsein vom Vorgang des Sehens (man
bedenke: die Griechen!) , er hat keine Vorstellung von der Zeit, zumal von
Gleichzeitigkeit3, er hat selbstverstandlich kein Verhaltnis zur Geschichte,
und vor allem ist der Begriff der Entwicklung ihm unzuganglich geblieben,
so daB die moderne Anwendung ,,entwicklungsgeschichtlichen Denkens"
auf das Altertum nur ,,eine Rckprojizierung einer Denkkategorie auf die
Antike, deren sich die Antike in dieser Form nicht bedient hat und nicht
bedienen konnte" , bedeutet.
4
Aber auBer diesen und anderen vorwiegend
intellektuell-noologischen Qualitaten fehlt dieser besonderen Spezies des
Bindestrich-Menschen5 eine erstaunliche Menge von psychischen, ethischen
wertgebundenen Valenzen: statt vieler (moglicher) anderer Stellen sei die
energischste davon angefhrt, auf die ich mich brigens selbst frher be-
rufen habe, und die auch bei Zucker eine Rolle spielt : die Feststellung
Julius Stenzels
6
, es fehle dem Griechen durchwegs ,,an dem notigen Be-
dacht auf innerliche, personliche Sachverhalte", er ,,bercksichtigt nicht
die Gesinnung"; wenn man ,,Begriffe wie etwa das Ich, Gefhl, Gemt,
Herzlichkeit, Demut, Selbstbestimmung, Verantwortung" .auf griechisch
wiedergeben wolle, dann habe das ,,merkwrdige Schwierigkeiten" - wobei
Stenzel, unter Berufung auf W. v. Humboldt, die Aushilfe mhseliger
Paraphrase mit Recht ablehnt; und er kommt zu dem SchluB, daraus
lasse sich doch wohl ,,auf ein gewisses seelisches Minus" der Griechen
1 So Snell in seiner Erwiderung auf Erwin Wolffs Kritik an Snells Buch .,Aischylos
und das Handeln im Drama", Philol. Suppl. 20, 1 1928 (E. Wolff, Gnomon 5 1929,
S. 386ff.) : ., Das Bewul3tsein von eigenen Entscheidungen im frhen Griechentum"
in: Philol. 85 1930, S. 14Iff. Die zitierten Stellen S. 143 u . 152.
2
Snell, Entd. d. G. S. 15.
3
Besonders herausgearbeitet bei Uvo Holscher, .. Untersuchungen zur Forro der.
Odyssee" (Hermes Einzelschr. 6) 1939.
4
So Franz Dirlmeier, .,Aristoteles", in: Jahrbuch fr das Bistum Mainz 5 1950,
S. 164; wozu bemerkt sei, dal3 gerade Dirlmeier das Problem der natrlichen Ent-
wicklung im antiken Denken wesentlich gefordert hat durch die von ihm a ngeregte
Mainzer Diss. von Rudolf Kassel, .,Quomodo quibus locis apud veteres script. Graec.
infantes atque parvuli i1'ducantur ... ", 1951 (hektograph. ).
Deren gibt es viele, also: der .,Barock-Mensch", der .,gotische Mensch" usw;
zwar haben sie alle ein bil3chen was gemeinsam, aber es lohnt nicht sehr, davon
zu reden; das Unterscheidende ist wichtiger.
6
Julius Stenzel, .,Die Gefahren des modernen Denkens und der Humanismus", in :
Die Antike 4 1928, S. 42ff .; vgl. mein Bchlein ber .. J acob Burckhardt und
die europaische Kri se" (Ankerbcherei Nr. 24). Stuttgart 1948, S. 24.
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken 295
schlechthin schlieBen. Nimmt man mm noch hinzu, daB, wie wir saben,
dem Griechen schlechthin das Gewissen, die Verantwortlichkeit, daB ihm
schlieBlich bis zur Zeit des Aischylos hin die Tragik, die echte Wahl und
Entscheidung, das BewuBtsein vom Zusammenhang der Pers6nlichkeitl
und dies und jenes andere abgegangen sein soll, dann drangt sich die Frage
auf: Was bleibt dann eigentlich brig? Ist dieser griechische, dieser archa-
ische, dieser homerische Mensch berhaupt noch Mensch? Und besteht
zwischen ihm und uns noch die Moglichkeit einer Verstandigung, oder
besser: von uns zu ihm die Moglichkei t des Verstehens?
GewiB: an ;i:lledem, oder doch an sehr vielem davon ist etwas hochst
Einleuchtendes. Und es war zweifellos notwendig und bleibt verdienst-
lich, ja es bezeichnet den eigentlichen Ertrag der tieferen Interpretations-
arbeit der letzten Jahrzehnte, daB man sich des nicht leichthin zu ber-
springenden Abstandes von zweieinhalb Jahrtausenden so genau bewuBt
zu werden versuchte. Aber wenn man die Bilanz zieht, kommt einem doch
der Verdacht, als konne da nicht alles stimmen, und als sei es sehr gut,
daB da nicht alles stimme, wenn anders nicht unsere ganze Arbeit sich
plotzlich zu dem Eingestandnis gezwungen sehen sol!, sie sei von einer
falschen und nicht langer haltbaren Pramisse ausgegangen.
Es verdient hervorgehoben zu werden, daB, gerade soweit es die Vor-
geschichte des Gewissens-Begriffes angeht, in diese Richtung gehende Be-
denken bereits angemeldet wurden von keinem anderen als von Snell
selber, der, im Widerspruch zu Zuckers scharfer Abhebung der Erinnyen
von jeder Gewissens-Vorstellung, doch an der ,,tieferen Identitat" festhalt
und betont, man werde ,,doch, ohne MiBverstandnisse befrchten zu
mssen, trotz der Bedenken Zuckers gegen diesen Terminus von einer
,Obj ektivierung des Gewissens' im frhen Denken sprechen k6nnen"
2
und
spater den Erinnyen-Glauben als die ,,mythisch-religiose Form" bezeichnet,
in der ,,das, was wir als Entsetzen ber die eigene Tat interpretieren
wrden" , begriffen werde.
3
Mir scheint, auch mit allen anderen, oder doch
l Dies etwa ist die Position, die Snell mit leidenschaftlicher Scharfe gegen E. Wolf(
verteidigt (o. S. 294, 1), die er in seinem Buch (Entd. d. G.), bes. im ersten (1939 erstmals
gedruckten: N Jbb 1939, 393) Kapitel (.,Die Auffassung des Menscheu bei Homer")
weiter ausbaut und vertieft. Wenu hier gegeu einzelne Punkte dieser Auffassung
Bedenkeu angemeldet werden, so moge nicht berh6rt werden, auf welcher Gruudlage
von Hochschatzuug uud Dank dies geschieht, und dal3 sich die Polemik weitgehend'
gegen bertreibungen richtet, deren sich Snell selbst nicht schuldig macht, die aber
d urch ihn nahegelegt sein konnten. Einzelne Modifikatiouen und Vorbehalte berei t s
bei A. Lesky in seiner - im ganzeu berechtigt positiven - Besprechu!l g im Gnomon
1952, ebenso in der bedeutsamen Abhandlung von Otto Regenbogen, ,,Llc<1vwv
tpv;u)i; rpwi;" in : Synopsis, Festgabe fr Alfred Weber, 1948, S. 377 u. 389.
2
So Snell gegen Zucker, Gnomon 6 1930, S. 28 ; dort a uch richtig das Problem
des h istorischen Verstehens einbezogen.
3
Snell, Entd. des Geistes, S. 156. Vielleicht darf zwischen dieser elastischen und
bergreifenden Interpret ation des .. Gewissens-Komplexes" (ausgezeichnet Gnomon
a. O. : ..... da!3 wi r mit diesen Schwierigkeiten an die Grenzen der Sprache sto13e n.
296 TTO SEEL
den meisten der anderen Befremdlichkeiten des ,,homerischen" Menschen
stehe es nicht wesentlich anders. Und man kame danlit erst wirklich in
die Erkenntnis der fruchtbaren Spannung, die zwischen Abstand und Nahe,
Befremdung und Vertrautheit bei jeder Begegnung mit Vergangenem im
Spiele ist, hinein. Wenn hier der Nachdruck mehr auf das BewuBtmachen
der Nahe, also auf die Bestreitung einer ,,vollkommenen Artverschieden-
heit" (F. Zucker) gelegt wird, so nicht, als ob damit gesagt sein sollte,
daB sich gar nichts verii.nderte; aber was sich verii.ndert, scheint vielfach
in einer falschen Richtung angezielt zu werden. Und vielleicht wii.re es
der Gegenwart, nach so viel erlebter ,Entwicklung', m6glich und dienlich,
sich ber das Verhaltnis von Konstanz und Variabilitii.t im Menschlichen
etwas klarer zu werden, als es bisher geschehen zu sein scheint; um wenig-
stens anzudeuten: was sich wandelt, ist einmal etwas zunii.chst Formales,
das freilich sehr schnell tief in den Gehalt seelischer Selbstbefindlichkeiten
einwirkt: die Weisen und Moglichkeiten der Selbstaussage, der Entdeckung,
Eroberung, Gestaltung upd Demaskierung eines - an und fr sich min-
destens der Anlage nach vorgegebenen, beharrenden - Sachverhaltes,
also die Moglichkeiten, eine elementar vorhandene anthropologische Land-
schaft zu entdecken und zu beschreiben; dem Wandel unterliegt aber
zweitens etwas, was zunii.chst mit der Form nichts zu tun hat, aber um-
gekehrt seinerseits die Form bedingt, bereichert, aktualisiert: die Welt
des Nomos, der Sitte, dessen, was als Recht oder Unrecht, als schicklich
oder unschicklich gilt (also genau das, was Jacob Burckhardt die ,,Lokation
der Werte" und die ,,Ethik der Postulate" nennt, aus der sich erkennen
lasse, ,,an welchen Stellen die Nation wenigstens hii.tte ein b6ses Gewissen
haben sollen"). Wie unendlich wandelbar jedes System der Werte, zumal
der soziologischen Spielregeln, ist, zeigt jeder Blick in die Geschichte;
aber sobald es gelingt, ein solches, vielleicht im h6chsten MaBe befremd-
liches oder gar abstoBendes System in seiner Gegebenheit zu erkennen
- es gengt ja wohl, an die konventionell-gesellschaftliche Grundlage des
platonischen Eros, oder an die im Hellenismus bliche Geschwisterehe,
oder an die durchgangige Abgestumpftheit der gesamten Antike gegenber
Sklaverei und Menschenraub zu erinnem - , sobald man also die Spiel-
regeln akzeptiert, wird sich sofort zeigen, daB innerhalb ihrer das schlecht-
hin Menschliche auf eine erstaunlich homogene, kontinuierliche Weise
reagiert: daB das BewuBtsein des Erlaubten oder Gerhmten mit Lust-
gefhl, das des Verbotenen und als schii.ndlich Geltenden mit Unlust
begleitet wird, daB die Notigung zur Entscheidung bei undurchschaubaren
Situationen mit innerer Zerrissenheit, die nachtrii.gliche Erkenntnis einer
Wir mBten schon einen gemeinsamen Ausdruck erfinden f ~ das, was sich uns als
Gewissen, den frhen Griechen etwa als Erinnyen darstellt") und der rigorosen
Polemik gegen Wolff ebenso wie bei den oft sehr hart ausschlieBenden Thesen, auf
die oben angespielt war, eine gewisse Unausgeglichenheit festgestellt werden. Das
ist kein Vorwurf; wenn irgendwo, so gilt hier notwendig das Goethesche ,,so bald man
spricht, beginnt man schon zu irren".
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken 297
falschen Wahl mit einem bedrckten, das Selbstgefhl einengenden Emp-
finden - also eben doch mit dem, was wir ,schlechtes Gewissen' und
,Reue' nennen - quittiert, daB vor allem das Erlebnis einer aus bestem
Wollen und Konnen getroffenen Wahl , die zur Katastrophe fhrt - wobei
offen bleibt, ob nicht die gegenteilige Wahl auch zur Katastrophe gefhrt
hatte - , den Menschen in einen Zustand metaphysischer Aufgerissenheit
versetzt, den wir dann, freilich erst seit dem 5. Jahrhundert, als ,,tragisches
BewuBtsein" bezeichnen ... usw. Das alles ist, unabhii.ngig von der jeweiligen
Aussageweise oder auch jenseits aller Aussagbarkeit, als gegeben voraus-
zusetzen, mag es sich nun symbolisch oder ,allegorisch', mag es sich in
Obj ektivationen welcher Art auch immer vermummen oder sich aus-
schweigen. Man hat Hektor die Tragik abgesprochen
1
und Priamos die
,Innerlichkeit' - ihm, weil jedem Griechen -, man findet an Helena
nichts von Reue und an Achill nichts von Entscheidung - Homer hat
das zwar alles gestaltet, aber als ,,homerischer Mensch" hat er nicht
wirklich gewuBt, was er damit tat - als ob die Trag6die des 5.Jahrhunderts
gerade aus den Stoffen des Epos, zumal jenes kyklischen Epos, das in Ilias
und Odyssee nur am Rande auftaucht, aber sehr genau bekannt ist, so
unendlich viel Tragik hatte herausgestalten k6nnen, wenn sie nicht primar,
wenn auch ohne viel Worte, darin gelegen hii.tte; oder sind die ,,Nibelungen"
erst durch Hebbel ,tragisch' geworden? Mir scheint, hier wird ein humanes
Kontinuum, etwas strukturell nicht Hinwegdenkbares, gefaBt; die Leistung
der griechischen Geistesgeschichte von Homer bis Platon besteht nicht
darin, all dies aus dem Nichts entdeckt und geschaffen, sondem es nach
1
Darum, daB Erwin Wolff in Hektor eine tragische Gestalt hat sehen wollen,
ist Snell (Philol. 1930) mit ihm besonders scharf ins Gericht gegangen und hat
gegenber einer ,,so banalen und verwaschenen Auffassung des Tragischen" (a. O.
i51, 9) erkl.rt: ,,Ich sehe wirklich nicht, warum es eine ,tragische' Schuld sein soll,
wenn jemand durch seine Torheit Unglck ber sich und seine Stadt gebracht hat.
Im allgemeinen nennt man das eine ganz gewohnliche Schuld" (a. O. 151). Aller-
dings modifiziert er kurz darauf : .,Nicht einmal von einer Schuld Hektors darf man
sprechen, denn Schuld fassen wir leicht zu eng moralisch. Bei Hektor dagegen ist
die Torheit hervorgehoben. Es ist wieder ein Hineintragen spii.terer Ge<lanken, wenn
wir diese Torheit ohne weiteres mit Schuld gleichsetzen"; wenn ich recht sehe, liegt
darin ein Bestreben, einer letztlich doch unvermeidlichen Konsequenz auszuweichen;
aber selbst, wenn man akzeptiert, daB ,,Homer die Rechnung von Schuld und Torheit
bei den GroBen nicht aufstellt", so fhrt doch das eine wie das andere auf ein - sei's
ethisches, sei's intellektuelles - Manko des ,Helden', das ohne einen gewissen
Spielraum von Freiheit, also von Auch-anders-entscheiden-konnen, also von der
Moglichkeit der Wahl berhaupt, nicht gedacht werden kann. Mit anderem steht es
ni cht anders: wenn etwa zu Odysseus' Entscheidung fr die Arete (A 404 ff .) gesagt
wird, der Wert sei etwas Objektives, dann trifft das zu; wenn hinzugefgt wird:
.,nicht aber etwas vom eigenen Denken Gesuchtes'', dann nicht : denn eben darin,
daB die reale Situation an einen von vielen moglichen ,objektiven Werten' an-
geschlossen wird, gerade an ihn.und an keinen anderen, liegt Krise, Wahl und Leistung,
durch die der Held sich als ,Held' qualifi ziert ... Und so durchwegs.
298
TTO SEEL
und nach, und zumeist viel frher als man wahrhaben will, durch ge-
staltende Aussage ins Bewuiltsein gerckt zu haben. Und wer in diesem
Betracht , um einer morphologischen Spezifikation willen allzu schroff
schneidet, schneidet ins lebendige Leben und behalt am Ende nichts
brig als eine asthetische Konstruktion und einen Schemen, der aus un-
menschlicher Erhabenheit und wert-indifferenter Absonderli chkeit ge-
mischt, zudem lebensuntchtig und weder der Bewunderung noch der
Verachtung zuganglich ware.
Das alles kann hier nur sehr grob angedeutet werden; dies aber war
notwendig, wenn die folgenden, sehr Beobachtungen den rechten
Beziehungspunkt , auf den hin sie gedacht sind, nicht entbehren sollten.
11.
DaB die Untersuchung des antiken Verhaltnisses zu dem seelischen
Sachverhalt, den wir ,,Gewissen" nennen, von dem Wort avYdOrau;, und,
da dieses im klassischen und alteren Griechisch vollig ausfllt, von dessen
verbaler Vorstufe <JVYt:tbYat avT<f>, ausgegangen ist, versteht sich von
selbst. DaB sie sich nicht darauf beschranken darf, ist auch bereits gesagt
- von Snell gegen Zucker - , aber frs erste sei auch hier nur danach
gefragt. Es scheint namlich, als seien die interpretatorischen Moglichkeiten,
die das avyoioa lavT<f> bietet, noch keineswegs ersch6pft, und das zu
zeigen, wird das erste Anliegen sein:
Das einfache, nichtreflexive avyoioa, im Sinne bloBer Mitwisserschaft,
potentieller Tatzeugenschaft , scheint wenig zu ergeben. Als altesten Beleg
dafr, daB avYota lavT:<f> so etwas wie eine Gewissensregung andeutet,
pflegt man den Vers Eurip. Or. 396 anzusprechen (so Zucker, auch Schwartz
o. S. 293 u. a.) : auf die Frage:
T Xefia nGXf.1'; T' a' nUvatv vao,;
antwortet Orest:
'H <1VVf.Gt,, OTL avvo1(}a (jf.iv' tleyaavoc;.
DaB hier zwar auch und noch - was brigens immer moglich blieb
die Bedeutung des bloBen ,Sich-bewuBt-Seins' vorliegt, sei unbestritten,
wenn man sich dadurch nur nicht verhindern IaBt anzuerkennen, daB zu-
gleich eine unverkennbare gefhlsmaBige, ,,ethische" Oberstimme mit-
klingt. Bedeutsam weist daraufhin auch die Emphasis des figurierten
<JVYWtf;- <JVYotoa, wobei je das eine Wort durch das andere eine gewisse
Triftigkeit, eine Art etymologischer Eindringlichkeit gewinnt. Man darf
das wohl so verstehen, daB dem Dichter sehr daran gelegen war, den
emotionalen Unterton der Aussage, ber das rein ,BewuBtseinsmaBige'
hinaus, zum Klingen zu bringen. DaB dabei ein innerer, ,psychologischer'
Sachverhalt an die Stelle der im Mythos gegebenen Erinnyen gesetzt ist,
daB also ein solches Quiproquo in der Auffassung, nicht nur des Euripides,
sondern seiner Zei t , von den ,,objektiven" Rachegottinnen seit langem
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begrilfes im altgr iechischen Denken 299
vorbereitet und funktional einleuchtend gewesen sein muB, versteht sich
von selbst: man nennt dergleichen mit Recht rationalistische Mythen-
deutung; diese aber setzt voraus, daB im Mythos selbst ein rationables
Moment erkennbar war. Welcher Art das im Falle der Erinnyen gewesen
ist, kann nicht zweifelhaft sein.
Aber dieses Beispiel ist keineswegs das alteste; der ,, Orestes" fllt ins
Jahr 408. Alter sind drei Aristophanes-Stellen, von denen in der bisherigen
Diskussion zwei zu leicht genommen und die dritte und wichtigste auBer
acht gelassen wurde. Es handelt sich um je eine Stelle aus den ,,Rittern"
(Jahr 424), den ,,Wespen" (Jahr 422) und den ,,Thesmophoriazusen"
(Jahr 4n); vor voreiligen Entwicklungsreihen kann dabei der Umstand
warnen, dail das am wenigsten ,,moderne" Beispiel gerade das jngste ist;
in den Thesmophoriazusen versucht der als Frau verkleidete Mnesilochos,
die Anklagen der anderen Frauen gegen Euripides dadurch abzuschwachen,
dail er erklarl: was Euripides gesagt habe, sei ja nur ein ganz geringer
Bruchteil der Wahrheit; um die innere Bewegung zu erfassen, muB man
nun freilich etwas frher einsetzen, als es geschehen ist: zuerst erklart sich
die angebliche Frau (Mnes.) mit den anderen Frauen solidarisch im HaB
auf den Dichter (466- 470). Dann kommt eine Einschrankung :
(471) ow, (j' lv ).).ila1<1' xe'1 (joiIJat lyov,
also: ,,Wenn wir's auch nach auBen nie zugaben: vor uns selber mssen
wir doch Rechenschaft ablegen." Lost man das aus dem Zusammenhang,
so ware schon damit die Situation des ,bosen Gewissens' ziemlich genau
gegeben; freilich, an der Stelle des individuellen Inneren steht hier die
kollektive Gemeinschaft, eben der Frauen; aber die Grenze zum indivi-
duellen Gegen-sich-selber-zeugen ist doch schon hier erreicht, die Denk-
bewegung intendiert in Richtung aufs Gewissen. Die Rechenschaftsablage
,,vor einander" bezeichnet eine Vorstufe zu einer reflexiven Form: ,,vor
sich"; der nachste Vers verstarkt das:
(4 72) airrai ye iaev, xov(}t' l x<poeo, lyov.
Es gibt also Dinge, die man nicht zwar nach auBen dringen lassen will,
vor denen man aber ,unter sich' nicht die Augen schlieilen, die man ,sich'
selber nicht verhehlen darf (Xl !). Und nun sagt sie: ,,Warum wollen wir
uns ber Euripides gar so arg aufregen, wenn er zwei oder drei ble Stck-
lein als Mitwisser bezeugt hat, da wir doch zahllose getan haben":
T .. . 1 {JaQw, -ce pi!ewtv, El (}' i1wv -rea
"" dnt (je<fJaa, vea.
Hier bezeichnet das die reine Tatzeugenschaft, ohne jede Refle-
xivitat; aber immerhin ist deutlich, daB es sich um ein Zeugnis gege n sie,
also um ein belastendes, nicht ein indifferentes oder gar entlast endes
Bezeugen handelt: Euripides sagt nicht bloB etwas aus, was er mitweiB,
sondern er bezichtigt sie, er schuldigt sie an. Das ist fr die Farbung des
Folgenden von Belang ; denn nun ,beweist' Mnesilochos (immer als Frau)
300 TTO 5EEL
die Richtigkeit des tJewaw; weta; und zwar sagt er : ,,Denn ich fr meine
Person, um einmal bei mir anzufangen, damit ich nicht eine andere nennen
(und, natrlich, dadurch diese blo/3stellen) mu/3 .. . "
(4 76) lyw ')'U(! avn' :newwv, va aV.rv ).fyw
- das Uyw vertritt euphemistisch geradezu ein zu erwartendes ,, beschul-
dige", ,,helaste" - ,,wei/3 mit mir selber zusammen vieles Arge":
lavr: :noV.d &v' . . .
und daran schlie/3t dann jener drollige Bericht eines geglckten Betrugs
ihres Mannes, den sie zum Gimpel macht, ganz im Stil der milesischen
Novell e oder des Bandello und Boccaccio. Wenn Zucker dazu nur bemerkt
(a. O. S. 8): ,,Nicht im Sinne eines Schuldbewu/3tseins, sondern ,ich
wei/3 von mir', hervorgerufen durch V. 474/5", so sind dabei die feinen
Nuancen verkannt: Natrlich fingiert Mnesilochos kein ,,Schuldbewu13t-
sein", aber es ist jaein Bekenntnis der schieren Schamlosigkeit: das schlechte
Gewissen ist zwar nicht da, aber es sollte dasein - es soll ja beileibe
nichts davon bekannt werden - und vor allem: Mnesilochos will durch
den fingierten Zynismus, den er bei den anderen Frauen gar nicht voraus-
setzt, erreichen, da/3 diese ein ,schlechtes Gewissen' bekommen und froh
und dankbar sind, da/3 Euripides immerhin noch so glimpflich mit ihnen
verfahren ist.
Deutlicher ist noch die Stelle aus den ,,Rittern": der Wursthandler,
also der Obergauner, wird examiniert, ob er auch wirklich Lump genug
sei, den Gauner von Paphlagonier zu bertrumpfen und sich so zum
politischen Fhrer zu qualifizieren. Er selber freilich begreift diese Spiel-
regel der verkehrten Welt nicht gleich, und angesichts dieser vollig absurden
Chance - sagen wir es ,modern': - regt sich auch in ihm so etwas wie
das ,. Gewissen": so frech er auch ist, hier glaubt er doch einmal Far be be-
kennen zu mssen, denn daB er Staatslenker werden soll, geht sogar ihm
zu weit; nun sagt er zwar nicht - was er denkt und was wahr ware - :
,.Aber ich bin doch der gro/3te Halunke, mich konnt ihr doch nicht zum
Politiker machen", sondern das Glimpflichste, was er, sogar er, der Wahr-
heit schuldig zu sein glaubt:
(182) ov" ' yw 'avr:ov luxvetv fya.
Schon hier eine reflexive Denkbewegung, ein Selbsturteil, und zwar ein
negatives. Jetzt aber wirft der Partner ein, und wir verdeutlichen gleich:
,,O wei - was liegt denn vor, da/3 du dir die Wrdigkeit aberkennst?
Hast du am Ende gar .etwas ,Gutes' auf dem Gewissen?"
oio1 Tl not"' la{}' on aavt"ov ov <flii;
Tl 01 clo"e; aavr:ip "aJ.v;
und dann folgt das drollige VerhOr seiner moglichen ,Snden': ,,Ehrb are
Familie?" ,,Wahrhaftig, wenn ich nicht von Gaunern stamme!", drauf
Seligpreisung wegen dieses Pluspunktes; aber noch einmal regt sich das
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken 301
bose Gewissen im Wursthandler, er macht einen neuen Einwand gegen
seine Ehrenerhohung zum Staatsmann: ohne ein bi/3chen Bildung geht
das doch nicht. ,,Ich versteh' von Kunst und Wissenschaft absolut nichts,
grad' schreiben kann ich, und auch das nur rniserabel, und auch so nur
mit Ach und Krach!", worauf der Partner, erschrocken, abwehrt: ,,Um
Gottes willen, das ist schon zuviel. . . "; Zucker (a. O.) bemerkt dazu nur:
""aMv ,vortreffliche Eigenschaft' geht nicht oder rnindestens nicht nur
auf etwas Sittliches". Damit ist der Beleg ausgeschieden! Dabei ist es
natrlich vollig richtig, da/3 das "aMv jede so gut wie die moralische
Qualitat meint ; aber darin li egt ja gar nicht die ,ethische' Farbung,
sondern in der kuriosen Situation, da/3 der Wursthandler in seiner Ana-
mnese eben berhaupt keine positive Eigenschaft, keine Leistung, kein
Taugen irgendwelcher Art ,mfweisen darf, daB also das xaMv in dieser
N arrenwelt dieselbe Funktion hat, die dem ""v zukame; da/3 man sich
seiner schamt, daB man es nur widerwillig sich selber und gar nicht den
anderen eingesteht.
Arn sprechendsten ist die dritte Stelle, aus dem Jahre 422 - also auch
immerhin vierzehn Jahre frher alsEuripides'Orestes ! - : In den ,,Wespen"
hat der alte, proze/3wtige Philokleon sich ganz wider seine heiligsten
Prinzipien bertolpeln lassen, in dem grotesken Haus-Proze/3 gegen den
Hund von Kydathen diesen Angeklagten freizusprechen; als er sich dessen
bewuBt wird, wie er so ganz von seiner Art abgefallen ist, und was er
Furchtbares angerichtet hat - ein Freispruch ! - , wird ihm zuerst schlecht,
er ruft nach einem Glas Wasser, dann jammert er in bitterster Selbst-
anklage; der wackere alte Seeger bersetzt, rnit Recht, ganz naiv;
.,Wie werd ich die Gewissensbisse tragen?
Weh, freigesprochen hab ich einen! oh!
Wie wird mir's gehn? Verzeiht mir, heil'ge Giitter !
, Unwissend tat ich's, meiner Art zuwider'"
Der entscheidende Vers:
(999) :nw, ovv lavnp t"oi'r' lyw
Dieser Fall liegt so klar, da/3 er keiner weiteren Worte bedarf.l Und
gerade ihn hat man bisher au/3er Betracht gelassen. Hinzuweisen ist aber
noch darauf, da/3 die drei Stellen sich gegenseitig kommentieren: Der
Dichter, der diese Stelle schreibt, mu/3 den hier gar nicht zu berh6renden
Oberton des ,Gewissensma/3igen' auch an den beiden anderen mitgemeint
haben, mu/3te auch voraussetzen, da/3 er in diesem Sinne verstanden
wurde; woraus sich ergibt, da/3 jener seelische lnnenraum, den wir meinen,
wenn wir ,,Gewissen" sagen, nicht nur vorhanden (dies ohnehin!), sondern
auch dem nachvollziehenden Bewu/3tsein ohne weiteres zuganglich war.
1 Hingewiesen sei wieder auf die Emphase, die sowohl in dem vorausgestellten
lavt'ip als auch in dem (. unnotigen') lyw liegt.
302 TTO SEEL
Zusammenfassend sei fest gestellt, daB die - bis jet zt - frhest en und
deutlichst en Belege fr die Formulierung jenes ,,krummen" Gefhls, das
man Gewi ssen nennt, sich in der Kom6die finden, also in einer dem vulgaren
Umgangston nahest ehenden, dem yvor; laxv6v angeh6rigen Stillage. DaB
unter den Tragikern Euripides dieser gleichen Stillage am nachsten steht,
ist bekannt genug. Fetner : bei Aristophanes handelt es sich in den drei
Fallen um Vertret er der soziologischen Unterschicht, also um das Gegenteil
von Adel : ein Ganove, ein alter Trottel und - Frauen. SchlieB!ich, bei
Euripides, eine rational-psychologische Transposition der in der Sage vor-
gegebenen Erinnyen, also ziemlich genau schon das gleiche, was Cicero
mehr als dreihundert J abre spater so formuli ert hat : nolite .. . ita putare,
. . . homines consceleratos impulsu deomm terreri furi alibus taedis ardenti bus :
sua quemqtte fraus, sui'm facinus, suum scels , siea audacia de sanitate
ac mente deturbant; hae s1mt impiomm /11riae, hae flammae, hae faces (Pis. 46) .
III.
Es hat sich gezeigt , daB das Aussagen eines Gewissensvorganges eine
besondere Weise der Reflexivitat vorauszusetzen scheint, wobei das Ich,
in einer deutlichen Spaltung und Schichtung, sowohl Subj ekt als auch
Obj ekt der Aussage ist. Die Frage, wo sich dieses Problem im Griechentum
zum ersten Male stellt, fhrt selbstverstandlich auf Homer. Hier sol! nun
nicht die Frage erneut aufgegriffen werden, was es bedeutet, wenn der
homerische Held seinen {)vi6r;, seine rprver; oder seine x ea[r anredet: auch
das {)vp fJv,u' O.rxvotat .. . des Archilochos (67 a D.) mag auf sich be-
ruhen.1 Vielmehr sei versucht , ein Motiv zur Selbstentdeckung und Selbst-
aussage des Menschen deutlich zu machen, auf das man bisher entweder
nicht oder doch zu wenig geachtet zu haben scheint .
Das wie ein Bumerang vom Ich ausgehende und zugleich das Ich
treffende ,BewuBtsein' drckt sich aus in der Forme! avvota lavu[J .
Wir gehen von dem Simplex ola aus und greifen ber dieses zurck auf
das zugrunde Iiegende t:lov. Und damit sind wir an dem gleichen Punkt,
von dem auch Snells Untersuchung der ,,Auffassung des Menschen bei
Homer " (Entd. d. G. S. r5ff.) ausgeht. Mit Recht wird dabei zunachst
die Flle von Verben, die das Sehen bezeichnen, hervorgehoben und an
einigen dieser, spat er z. T. ausgestorbenen, Verben berzeugend gezeigt ,
daB sie nicht die aktive Sehqualitat, nicht die ,,Funktion des Auges" be-
zeichnen, sondern vielmehr das, was am Auge des an d er en wahrgenommen
wird, also den Blick, den Glanz, das Erschreckende, Drohende usw. :
1
Vgl. B. Snell, Gnomon 6 1930, S. 26, und E ntd. d. G., bes. das erste Kapi t el.
Ferner: Christian Voigt , ., berlegung und E ntscheidung", Diss. Hamburg 1931
(Pan-Bcherei 16, Berlin 1933) ; J oachi m Bhme, .. Die Seele und das I ch im hom.
Epos",L eipzig 1929; Wi lh: Nestl e, .,Vom Myt hos zum.Logos" ; dazu Sncll in Gnomon
7 1931 und 19 1943.
Zur Vor geschichte des Gewissens-Begr ilfes im altgri echi schen Denken
303
die ,, Gesten" des Blickes ; der Zusammenhang von rHexeafJat und exwv
(,,das Tier mit dem unheimlichen Blick") spricht deutlich genug.1 Bei
anderen Verben des Sehens wird eine besondere Modalitat empfunden,
etwa bei J. evaaew das ,,Schauen" , das ,,st olze, freudige, freie Sehen" usw. :
das alles ist bedeutsam und mit Feinsinnigkeit und bewunderswerter
Ausdruckskraft formuliert. Aber dann heif es (S. 18) : ,,SchlieB!ich zeigen
die Worte fr sehen, die spater zum Konjugat ionssystem zusammen-
gezogen sind, eav, lbt:'iv, otpea{}at, daB frher nicht die Funktion des
Sehens als solche mit einem einheitlichen Verb bezeichnet ist, sondern
daB es mehrere Verben gab, die jeweils einen bestimmten Modus des
Sehens bezeichneten. Wieweit wir auch fr diese Verben bei Homer noch
die ursprngliche Bedeutung festst ellen k6nnen, soll 4ier beiseite bleiben,
da sich das so kurz nicht abmachen Ia.Bt. " An dieser Stelle wird gleich
die Kritik einzusetzen haben, aber zuerst seien die Folgerungen aus dem
so festgest ellten Befund vergegenwartigt ; Snell faBt namlich als Ergebnis
zusammen : ,, Selbstverstandlich ha ben auch den homerischen Menschen
die Augen wesentlich dazu gedient, zu ",sehen' . . . ; aber eben dies, was wir
mit Recht als die eigentliche Funktion, als das ,Sachliche' des Sehens
auffassen, ist ihnen offenbar gar nicht als das Wesentliche vorgekommen,
ja wenn sie kein Wort dafr hatten, existierte es fr ihr BewuBtsein nicht."
Darber, daB hier etwas nicht stimmt, waren kaum viele Worte notig,
aber die Bestimmung der Fehlerquellen hat nicht nur methodisches Inter-
esse, sondern wird fr das, worum es hier geht, etwas ausgeben. Zunachst
ist ja deutlich, daB Snell das ,, regulare" Verbum fr Sehen, das ja t at-
sachlich die Sehfunktion bezeichnet, eben die Reihe ew usw., aus der
Untersuchung eliminiert - was sein gutes Recht ist - , aber es dann wie
nicht :vorhanden behandelt (.,. . . wenn sie kein Wort dafr hatten" !) ; dabei
ist es ja gerade das gemeinsame Kennzeichen der unregelmaBigen, zumal
der aus verschiedenen Stammen kombinierten Verbalreihen, daB sie be-
sonders gut eingebt sind: nur dadurch kann sich die UnregelmaBigkeit
gegen natrliche Angleichungstendenzen behaupten - man denke an rprw
mit seinen Suppletiv-Stammen o'aw, fveyxov : m6glich, daB einzelne dieser
~ t a m m e (schwerlich alle ; z. B. ist die a-verbo-Reihe von rpeuv offenbar
aus Indogermanischem und Nicht-Indogermanischem gmischt, so daB
mit Bedeutungsnuancen ncht gerechnet zu werden braucht) ursprnglich
eine besondere Schattierung, einen anderen Aspekt u. dgl. gehabt haben
rn6gen ; aber sicher, daB davon nichts mehr empfunden wurde in der Zeit
der vollentwickelten Verbalreihe, und das ist bereits die homerische Zeit.
Ferner haben gerade die modalen Besonderheiten der anderen Verben,
die $neU mit Recht bewuBt macht , mit denen er aber nicht ausschlieB!ich
argurilentiet en durfte, diesen das Weit erleben vorerst gesichert und doch
1
Auch doe>< st a tt richti ger Coe><; oder ~ e ; ist volkset ymologisch a n (! ><oicr. i
angeglichen : a u ch an Reh und Gazelle wurde die Besonderheit des schnen,
scheuen Blickes ( .. Rehaugen" s agt auch im Deutschen et was !) al s das Kennzeich-
nende empfu nden ; vgl. ]. B. Hofmann , E t ymol. " ' rterbuch des Gri ech ., 1950, s. v.
304 TTO SEEL
auf die Dauer nicht sichern konnen, wahrend das eigentliche Verbum
des Sehens fr die nicht weiter zu modifizierende oder, bei Bedarf, durch
adverbiale Zusatze modifizierbare Funktion des Sehens jederzeit zur Hand
war und ausreichte.
1
Wenn wir also feststellen, daB es nicht angeht, b.er
den auf dem Aussterbe-Etat stehenden Spezialitaten das Regulare aus
dem Blick zu verlieren, so liegt darin, daB Untersuchungen, die es auf
die innere seelisch-sinnliche Struktur einer Sprache absehen, auf Berck-
sichtigung der Wirkungs breite, d. h. der relativen Frequenz
2
angewiesen
bleiben. Das aber fhrt auf eine andere Fehlerquelle: Was uns vorliegt,
ist die homerische Sprache, d. h. die Sprache des Epos, nicht die Sprache
der Zeit selber. GewiB ist der Stil - im weiteren und auch engeren Sinne -
der homerischen Dichtung ,,notwendiger Ausdruck einer bestimmten gei-
stigen Form"
3
, aber, mindestens im Sprachlichen, trotzdem oder gerade
deshalb nicht ohne weiteres zu anthropologischen Rckschlssen auf die
Sprache und die innere Struktur der Zeit geeignet: vom planmaBig Stilisier-
ten aus - und das ist doch die Sprache des Epos gewiB - laBt sich kein
Durchschnitt errechnen, lexikalisch sowenig wie etwa im Bereich der
Religion. Selbst angenommen, das Verbum fr die aktive Seh-Funktion
fele tatsachlich bei Homer aus - was durchaus nicht der Fall ist - , dann
lieBe sich immer noch keineswegs behaupten, ,,den" homerischen Menschen
sei das Sehen sowenig als ,,das Wesentliche" am Auge vorgekommen,
daB es ,,fr ihr BewuBtsein" berhaupt nicht existiert hatte: wenn der
Jager seine Beute nicht mehr traf, wenn der Fischer einen Thunfisch
von einem Wellenkamm nicht mehr zu unterscheiden vermochte, wenn
der Bettler die Laus nicht mehr tangen konnte, weil er sie nicht sah, dann
drfte der eine wie der andere sehr genau gewuBt haben, worauf es beim
Auge ankommt: ob auf den glanzvollen oder unheimlichen Blick, oder
eben auf das Sehen-Konnen.
1
Wenn man will, hangt es an der falschen Beziehbarkeit eines zu frh gesetzten
,,nicht"; wenn man in dem zitierten Satz die Negation so stellt, wie es eigentlich
gefordert ware: ... .. dall frher die Funktion des Sehens als solche nicht mit einem
einheitlichen .. . ", dann ist der Fehler ausgeschlossen.
Die Bedeutung der Frequenz-Statistik zur Bestimmung des eigentlichen Charalt-
ters eines Idioms ist besonders der Anglistik vertrau t : rein lexikalisch berwiegen
im modernen Englisch die romanischen Etyma erheblich die germanischen; der
Frequenz der gesprochenen Sprache nach aber ergibt sich das umgekehrte Verhaltnis:
ein Wort wie I go oder I will deckt an Wirkungsbreite und Charakterisierungskraft
ganze Worterbuchseiten selten verwendeter romanischer Derivate zu.
3
So Snell, Philol. 1930, S. 146 zur Abwehr des Einwandes, bei den von ihm
beobachteten .. psychischen Vorgangen" handle es sich um ,,epischen Stil", wobei er
rnit Recht davor warnt, diesen Begriff .,so eng zu fassen, wie es etwa in der Poetik
des 19. Jahrhunderts geschah"; ob und inwieweit eine Verallgemeinerung des epischen
Befundes im Sachlichen statthaft ist, mull hier auf sich beruhen (spater wird kurz
darauf zurckzukommen sein): fr reine Sprachobservation ist sie j edenfalls nur
mit sehr wohl zu berlegenden Kautelen statthaft. Nur darauf kommt es im Augen-
blick an.
1
1
l
1
\
,1
1
1
1J
f l
1
;'
. r
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken 305
Dies aber fhrt auf etwas anderes, das von groBer Tragweite sein konnte,
und gerade Snell ist es, der zuerst den Blick darauf gelenkt hat: das MaB
des BewuBtseins steht in keiner direkt korrelativen Proportion zu der
Frequenz des Aussagens; und zwar vor allem hinsichtlich der Verteilung
auf die verbalen ,, Personen"; zu den Verben narr:r:avetv und M e ~ e a 1 J a t
bemerkt Snell (Entd. d. G. 17): ,,Charakteristischerweise kommen diese
beiden W6rter (Ausnahme ist nur eine spate Stelle mit Uexea1Jai) nicht.
in der ersten Person vor; man beobachtet also das exw1Jrx.t und nanr:a-
vew am anderen eher, als daB man sich selbst es vollfhren fhlt " . Dagegen
kommt kvaauv, das offenbar bestimmte Gefhle mit bezeichnet, ,,die
man beim Sehen" hat, ,,verhaltnismaBig haufig in der ersten Person" vor.
DaB das so sein muB, ist unmittelbar evident: ,,ich sehe": das ist eine
Aussage, deren Kontrolle dem Sagenden selber zusteht; das IaBt sich
wissen; dagegen ,,du siehst", ,,er sieht": das sind heiklere Aussagen von
problematischer WiBbarkeit; damit wird ein Heraustreten aus der eigenen
Person, ein Sich-Substituieren in die fremde Person gefordert, ein Mut-
maBen, das eigentlich nur durch die Bestatigung des anderen {,,ja, ich
sehe") legitimiert werden kann, oder das hochstens in fragender oder
potentialer Form statthaft ist. Dieser bergang zum anderen, dem damit
eine bereinstimmung mit dem eigenen Erlebnis zugemutet wird, ist fr
gebundenes Denken um so problematischer, als nicht nur das menschliche
Gegenber, sondern die gesamte Umwelt personifiziert gedacht, als ein Du
ansprechbar war - das zeigen die maskulinen und femininen Sachbezeich-
nungen -. Umgekehrt ist ,,ich blicke'. ' eigentlich nicht anders sagbar als
im BewuBtsein einer nur von auBen, von einem Gegenber aus kontrollier-
baren Wirkung, setzt also seinerseits ein aus der eigenen Person heraus-
tretendes Sich-selbst-objektiv-nehmen voraus, also jenen Verlust der un-
befangenen Unschuld, den Kleist (.,ber das Marionettentheater") an dem
Jngling beobachtete, der, auf seine Anmut aufmerksam gemacht, diese
zugleich schlagartig verlor und bloB die Pose brigbehielt. Wogegen hier
die dritte Person ihre Stelle hat: ,,er blickt", das ist eine Aussage, die
nicht nur keine Durchbrechung der Naivitat fordert , sondern eine Flle
von anders nicht aussagbaren Gefhlsmomenten und Stimmungsobertonen
des Sagenden selber auffangt: Furcht, Bewunderung, Freude, Entsetzen,
Rhrung . . . Aber mehr noch: die Aussage ,,ich sehe" ist zwar jederzeit
moglich, aber nur selten notwendig; kein Kind wird sagen: ,,Ich sehe, daB
da ein Vogel fliegt", sondern es sagt einfach: ,,Da fliegt ein Vogel"; das
,,ich sehe" gibt den Sehinhalt nicht unmittelbar, sondern setzt dazu be-
reits ein differenziertes, distanziertes, abgeleitetes Verhaltnis voraus:
schlieBt entweder einen Vorbehalt oder Zweifel, oder umgekehrt die
polemische Zurckweisung eines vom Gegenber geauBerten Zweifels ein,
lenkt also die Aufmerksamkeit vom Wahrgenommenen auf den Akt des
Wahmehmens, und damit auf die wahrnehmende Person selber ab.
Was fr ,,ich sehe" gilt, trifft in erhOhtem MaBe fr ,,ich habegesehen" ,
also fr die Grundbedeutung von oUJa zu, und mehr noch fr dessen
20
306 TTO SEEL
Bedeutung ,,ich weiB". (Das ,,Gesehen-Haben" kann zwar bei E.lfisvai
immer wieder anschaulich empfunden werden, an anderen Stellen dagegen
ist es bereits viillig abgegriffen zurn wirklich abstrakten, rein gedanklichen
Wissen.) Ganz kompliziert aber wird der Denkvorgang, wenn E. lfivai in
der zweiten oder dritten Person verwendet wird. Wer kann wirklich rnit
Bestimmtheit etwas ber das Wissen des anderen aussagen? (Weshalb ja
auch bei ola{}a und olfJE.v wohl irnmer die interrogative oder potentiale
l<orm berwiegt.)
Das alles lieBe sich in mancherlei Richtung weiterdenken. Hier sei auf
eine allgemeine Beobachtung hingewiesen, die man vielleicht bisher zu
wenig bedacht hat und die doch an der Entwicklung der Aussagefhigkeit,
ja der Selbstentdeckung des Menschen und gerade auch an der Fixierung
des psychologischen Sachverhaltes des ,, Gewissens" einen betrachtlichen
Anteil hat: der Umstand namlich, daB die Sprache als Form, als grammati-
kalisches Schema dem Gedanken den Weg bahnt, ihrn vorauslauft, ihn
vor Fragen stellt. Das ware ein weitlaufiges Thema und kann hier nur
gerade angerhrt werden. In anderem Zusammenhang habe ich krzlich
darauf hingewiesen,
1
wie etwa die einmal angelaufene rhythmische Kadenz
einer Aussage den Gedanken in Bereiche zwingt , die er von sich aus kaum
betreten hatte. Noch mehr als fr den Rhythmus gilt dies aber von der
grarnmatischen Form: Von Danton wird erzahlt, er habe kurz vor seiner
Hinrichtung sich gewundert ber die Unmi.iglichkeit, das Wort ,,hinrichten"
durchzukonjugieren: man kiinne sagen: ,,Ich richte hin" und ,,ich werde
hingerichtet werden", aber niemals: ,,ich bin hingerichtet worden". Diese
Weise, von der Form her Inhalte aufzuschlieBen, macht etwa das Besondere
und Hintersinnige der Shakespearischen Silbenstechereien ebenso wie des
skurrilen Witzes bei Morgenstern oder Karl Valentin aus. Aber das sind
bewuBte, gesuchte Wege; als die Sprache noch im weichen Zustand des
Sich-Ausformens war, muBten sie ungesucht begangen werden. Und hier
ist zunachst der Entwicklung der Diathesen, der sogenannten genera verbi
in Verbindung mit der Person-Frequenz zu denken.
Bekanntlich ist das Medium als morphologisch alter zu betrachten als
das Passiv, dessen Bildungs-System sich ja aus medialen und aktiven
(Aorist !) Entlehnungen, Infixen u. a. zusammensetzt. Als Grundbedeutung
des Mediums hat man ermittelt, ,,daB das Subjekt die Handlung . .. mit
einer Stimmung, einer Gemtsbewegung begleitet".
2
Das Bedrfnis, ja
die Moglichkeit, solche gefhlsmaBigen Begleiterscheinungen einer Hand-
Jung auszudrcken, ist nun aber zunachst nur in der ersten Person voraus-
1
In der Einleitung zu mei ner Ausgabe von Ciceros Orator (Heidelberger Texte,
Bd. 21), 1952, S. 22!.; dort aucb ausfhrlicber die signifika nte Formulierung Tbomas
Manns: .,Beim Schreiben ... ist der Gedanke sehr oft das bloBe Produkt eines rhyth-
mischen Bedrfnisses ... " .
2
So O. Hoffmann, Bezzenbergers Beitrage 25, 178; ahnlich E . Schwyzer, Gr.
Gram. II (Debrunner) i950, 223; B. Snell, Der Aufbau der Sprache, 1952, S. 105fL
vgl. J. Stenzel, N Jbb 1921 Bd. 24, 163.
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriecbischen Denken 307
setzbar. Die - von der Form her bildbare - dritte Person hat zunachst
keinen ohne SelbstentauBerung vollziehbaren Inhalt. Aber eben deshalb,
weil hier ein Gef.B bereitstand, dem zunachst der Inhalt fehlte, muBte
der Gedanke sich urn einen mi.iglichen, adaquaten Inhalt bemhen. Von
hier aus wird klar, was dahintersteckt, wenn Snell, vollkommen richtig
und scharf beobachtend, feststellt: ,,Zweifellos hat das Passiv eine beson-
dere Affinitat zur sogenannten dritten Person, wie sich denn an der
homerischen Sprache zeigen la.Et, daB sich im Griechischen das Passiv
an der dritten Person des Perfekts ausgebildet hat."
1
Ein etwas anderer,
aber funktional ahnlicher ProzeB liegt dort vor, wo aus einem ursprng-
lichen Medium sekundar erst ein Aktiv, dann eine Passivbedeutung,
schlieBlich eine besondere, reflexive Nuance des Mediums, und am Ende
eine Kopulation von Aktiv mit Reflexivpronomen herausentwickelt wird,
besonders deutlich etwa an fnoai, das zunachst rein auf den Effekt
geht, wobei das bewirkende ,,Subjekt" ganz auBerhalb des Blickfeldes
bleibt; dann aber reiBt dieses Subjekt nach und nach den Akzent an sich
- zuerst doch wohl als das fremde, auf die eigene Person wirkende, dann
als das eigene, auf die fremde Person wirkende Subjekt: aber das ware
naher zu prfen - , so daB aus fnoai sekundar ein Aktiv fnw uva
miiglich und gefordert wird; ahnlich die Entwicklung. von ijboai zu ijfiw
und weiter zu unserem ,,ich freue mich"
2
, so daB die - in diesem Betracht
einheitlichen - modernen europaischen Sprachen die begleitenden ,,Ge-
mtsbewegungen nicht als eine Art von innerer Wallung oder von innerem
Wellenschlag bezeichnen, sondern als eine Tatigkeit des Menschen auf sich
hin".
3
Gerade das Reflexiv aber treffen wir in der homerischen Sprache
an in statu nascenti, unfertig - im alteren Griechisch bleibt die Nicht-
Kennzeichnung der Reflexivitat in allen Personen weithin moglich - ,
und erst allrnahlich werden die Beziehungen auf den ifv6r;, die rpvxf,
das awa abgeliist durch das sich langsam verfestigende Reflexiv-
pronomen.
Bei alledem, aber ist - und das sollte angedeutet sein - die Sprache
nicht nur nehmend, sondern auch gebend beteiligt: Sie stellt Miiglich-
keiten des Ausdrucks bereit, verlockt zu analogen Bildungen, denen dann
sekundar ein berraschender Sinn und Erlebniswert abgewonnen werden
kann, und bereitet so ein immer differenzierteres Verhaltnis zum lch,
1
Snell a. O. 107. Schwyzer-Debrunner geben zwar mit gewohnter Sorgfalt und
Genauigkeit das Ma t erial an die Hand (bes. etwa II 244 ber ,.Personen", 192 ber
Reflexivitat; 222 ber Diathesen usw.), doch laBt sich m. E. gerade in der syn-
taktischen AufschlieBung von Denkprozessen noch sehr viel weiter kommen; was
Sch.-D. herausarbeiten (etwa Impersonalitat bei 2. oder 3. Ps.) ist gewiB wichtig,
liegt aber vergleichsweise an der Oberflache; das Wesentliche dariiber schon bei
] . Wackernagel, Vorles. ber Syntax 2, i926, 8.
2
Naheres bei Sch.-D. II 228, 235!. ber die Vorstufen des Refl exivums: a. O.
192, 1; dazu Schwyzer I, 6o6c (auch fJtat;, mhd. lip gehrt hi erher) .
3 Snell, Der Aufbau der Sprache, S. 107.
20'
308 TTO SEEL
zum Mitmenschen und zur Umwelt vor.
1
Man konnte sagen, mit dem
bewul3ten Erlebnis der grundsatzlichen Auswechselbarkeit der ersten mit
der zweiten und dritten Verbalperson und der verbalen Diathesen beginnt
das Problem des Altruismus, der Sympathie und der human-solidarischen
Partnerschaft, ebenso wie im Bewul3twerden des verbalen Numerus: ,,Ich"
- ,,Wir", der Keim sozialer Verantwortung einerseits, individueller Aus-
gliederung andrerseits liegt. Und auch das Erlebnis menschlicher Auto-
nomie und Freiheit neben der vom Gott ausgehenden Heteronomie und
Bedingtheit spricht sich zunachst in einem gleitenden bergang von der
dritten zur ersten Person aus.
Wie flieBend dabei die Grenzen zunachst noch sind, mag ein kurzer
Vergleich zeigen : Od. y 26f. sagt Athene zu Telemach:
T17Uiax' , aV.a ev mhoc; lvi qieeui u7u1 v01ue1, ,
a.V.a fJe xai fJawv
Das sieht nach einer sauberen Trennung von Menschenwerk und Gotter-
anteil aus, so als liel3e sich das eine vom anderen abheben, als bestnde
zwischen dem und jenem ein Unterschied an Qualitat, Verbrgtheit u. dgl. ;
nimmt man aber daneben eine andere, vergleichbare Aussage, dann zeigt
diese ein sehr verschiedenes Bild : im X der Odyssee, 347f., sagt der Sanger
Phemios zu Odysseus:
mhofJfJai<To, fJ' el, i>eo-; fJi I'' iv qieeuiv oiac; / navt:oac; l vqivuev . . ,
Hier zeigt sich Menschenwerk und Gottergabe als identisch, das eine
ist lediglich ein anderer Aspekt auf den auch mit dem anderen gemeinten
Sachverhalt: Was der Gott wirkt, und was der Mensch ,,aus sich" heraus
wirkt, hebt sich, als das Namliche, ab von dem, was nur durch andere
Menschen, als blol3 zu imitierende technische Versiertheit, gewirkt ware.
Der Mensch erlebt sich als etwas Eigenes, nicht indem er sich vom Gotte
1
Man wende nicht ein, daB dabei ein vollentwickeltes grammatisches Konjuga-
tionssystem vorausgesetzt werde, das doch erst in hellenistischer Zeit ausgebildet
wiire ; was hier - unabhiingig von aller Terminologie - fr das Verbum voraus-
gesetzt wird, ist weit weniger als das, was Anakreon fr. 3 D. fr das Nomen leistet :
eine komplette Deklination des Namens Kleubulos (dazu Schwyzer I 6, 2. II 54) :
der Spiel- und Experimentiertrieb gerade gegenber der Sprache, roit Analogie-
bildungen u. dgl., ist eine menschliche, mindestens eine griechische Grundgegeben-
heit, der Umschlag voro zuniichst scheinbar Sinnlosen zum ganz anders Sinnvollen
kann fast zuro metaphysischen Erlebnis werden. Gleichsam um zwei Ecken herum
wird dieses Spiel des Fragwrdigroachens von der Forro her gespielt bei Hofmanns-
thal, .,Der weiBe Fiicher", Vers 26ff.: .,>Besitzc von allen Wtirtern ohne Sinn / Das
albernste, von einem Schullehrer / Ersonnen, welcher meinte, jedem Wort / MBt eins
entgegenstehn, wie WeiB dem Schwarz, / Und so gebildet, weil Besessenwerden /
Ein wirklich Ding .. "
Zur Vorgescbichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken 309
absetzt, sondern indem er sich in ihm findet und aufgehoben glaubt.
1
Dabei ist das als Wortbildung sehr aufschluBreich: Das
Verbaladjektiv steht aul3erhalb der Diathesen, kann also entweder aktive
oder passive Bedeutung ha ben oder sowohl die eine wie die andere.
2
Damit ist es besonders geeignet, sowohl den Belehrenden als auch den
Belehrten zu bezeichnen, wobei das ,,Selbst" gleichzeitig (logisches) Subjekt
und Obj ekt wird. Hier haben wir, und zwar unabhangig vom reflexiven
Pronomen, eine echte ,,Zurckbiegung", jenen ,,Bumerang", nach dessen
Anfngen wir (o. S. 302) gefragt haben.
IV.
Auf die Vorbereitung des ,,Gewissensbegriffes" im sittlichen Bewul3tsein
des alteren Griechentums einzugehen, wrde eine Auseinandersetzung mit
dem vielschichtigen Schrifttum ber dieses Thema, vor allem ber das
Rechtsdenken, fordern, die den Rahmen dieser Skizze sprengen wrde.
Es mul3 im wesentlichen bei den Hinweisen des ersten Abschnittes bleiben.
Immerhin kann eine dort generen umrissene Auffassung jetzt etwas spezieller
formuliert werden. Die grndliche Erorterung, die Kurt Latte
3
der
Frage des frhgriechischen Rechtsbewul3tseins gewidmet hat, versucht
- so wie man es schon frher immer wieder versucht hat - die Entwick-
lung dieses Sinnes fr Recht und Unrecht in seinen frhesten Etappen
zu verfolgen; Einsatzpunkt ist natrlich Hesiod: Die einsch!agigen Stellen,
besonders erga 248ff. und 220, werden gebhrend hervorgehoben. Nun
wortlich: ,,So stark dieses RechtsbewuBtsein ist, es . . . erwachst fr Hesiod
aus dem Unrecht , das andere ihm antaten. Umfassender erscheint es in
den schOnen Versen, die der Lyriker den Fuchs sprechen laBt, als der Adler
ihm seine ]ungen geraubt hat"; folgtArchil. fr. 88 Bgk. (= 94 D.) - worauf
brigens auch Snell, Entd. d. G. S. 17, eingeht - ; weiter Latte : ,,Hier ist
Recht und Unrecht aus der Verbindung mit Klage und Gerichtsverfahren
gelOst und zu einem Mal3stab geworden, an dem alles Tun gemessen wird.
In einem Gedicht der Odyssee, das schwerlich viel alter ist als die eben
angefhrten Verse" (se. Archil.) ,,taucht vielleicht zum ersten Male das
Empfinden fr Unrecht auf, das man selber beging: Auch Manner, die
an fremder Kste !anden und denen Zeus Beute verlieh, die mit beladenen
1
.,Das Perstinliche befreit sich nicht ohne das Religitise": K. Reinhardt, .,Von
Werken .. . ", S. 59, der auch vtillig zutreffend die prinzipielle hnlichkeit der psychisch
anthropologischen Situation in der Odyssee mit der spiiteren der Lyriker betont:
..... hier schon wie in spaterer Zeit, in einem freilich viel tieferen Sinn; in Solons
groBer Elegie der Einkehr, ,An sich selbst'. " auch das ungeheuere innere Gefalle
der Odyssee, der .. Unterschied der Tonarten", dort ( S. 60) nachdrcklich bewuBt
gemacht.
2
Vgl. Schwyzer I, 501 f. und 810.
3
Kurt Latte, ., Der Rechtsgedanke im archaischen Griechentum", in: Antike und
Abendland 2 1946, S. 63 ff.
310 TTO SEEL
Schiffen die Heimfahrt antreten, selbst denen kommt berwaltigende
Furcht vor der Strafe der Giitter, denn die Giitter ehren die Dike (Od. 14,
85). In der Furcht vor der Vergeltung, die gottgewollt und darum unaus-
bleiblich ist, wird noch in dem Hochgefhl des erfolgreichen Beutezuges
die eigene Rechtsverletzung gewuBt" usw.
Worum es dabei geht, ist offenbar ziemlich genau das, was wir im
vorigen Abschnitt im Auge hatten: namlich um die Miiglichkeit, die Verben
,,Unrechttun" und ,,Unrechtleiden" zu ,,konjugieren": daB namlich zu
dem - in jedem Leben einmal sich meldenden - ,,Ich leide Unrecht"
das ,,Er leidet Unrecht" hinzutritt, und umgekehrt zu dem entsprechenden
,,Er tut Unrecht" das ,,Ich tue Unrecht". Was aber dabei bedenklich
stimmt, ist die reine, glatte Abfolge der Etappen, also die ,Entwicklung'.
Einmal muB dabei, damit sie herausspringt, mit den Hexenknsten der
Odyssee-Analyse gearbeitet werden, und selbst damit ergibt sich die Ab-
folge ,,Hesiod-Archilochos-Odyssee 14" nur zur N ot; ich selbst glaube
nicht, daB es sich hier um ,,ein" Gedicht ,,der" Odyssee handelt, sondern
eben um ,,die" Odyssee, und ich freue mich, wenigstens insoweit mit
Merkelbach
1
bereinzustimmen, als auch er daran festhalt, daB die Frage
an einen Fremden, ob er Seerauber sei, ohne daB das als beleidigend emp-
funden wrde, und die Schilderung der Verruchtheit der Seerauber durch
Eumaios ein und demselben Dichter gehiiren: Hier liegen innere Spannun-
gen vor, die man nicht analytisch beseitigen darf, die vielmehr zu den
Wesensmerkmalen der Odyssee berhaupt gehiiren. Wie beraus deutlich
zeigt sich das VerantwortungsbewuBtsein des Odysseus gegenber seinen
Gefahrten - so sehr, daB gerade daraus die tiefstgreifenden sachlichen und
kompositionellen Modifikationen der vorauszusetzenden alten Heimkehrer-
geschichte erklarbar werden - , und doch : Wie wenig folgerichtig ist
dieses Motiv durchgefhrt! Wenn es also auf diese ,Entwicklung' hinaus-
laufen soll, dann muB man schon konsequent sein und sagen: Die Odyssee
ist jnger als Hesiod, ja jnger als Archilochos ! Aber nun Hesiod selber ,
dem man den Charakter des ,,Ethischen" doch wohl kaum absprechen
kann; und zwar eines Ethos, das denn doch, e ben weil es letzthin ,gno-
mischer' Art ist, grundsatzlicher verstanden werden muB, als daB ihm
die Miiglichkeit unpersiinlichen, von eigenen Interessen und aktuellen
Anlassen absehenden, auch dem Du zugute kommenden absoluten Rechts-
sinnes abgesprochen werden drfte. Liegt denn .hier wi1klich diese, ja
liegt berhaupt Entwicklung vor? Und selbst wenn man das Chronolo-
1
Vgl. Reinhold Merkelbacb, ,.Untersuchungen zur Odyssee" (Zetemata 2 1951) ,
der diese Szene seinem Dichter ,.A", also dem ,. Dichter der alteren Odyssee", zu-
weist , a. O. S. 235; dal3 ich sowohl die Analyse wie die Gesamtdatierung der Od., so
wie sie Merkelbach, freilich hochst geistreich, verficht, fr unhaltbar halte, dal3 mir
auch seine Wiederbelebung einer tiefergreifenden Redaktion (nicht blol3en Rezension)
in peisistratischer Zeit (Rhein. Mus. 95 1952, S. 23ff.) widerlegbar erscheint, sei
wenigstens angemeldet. Im Grundsatzlichen urteilt richti g und treffend Margarete
Riemschneider, Homer 1952, S. 224.
Zur Yorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgri echischen Denken 3ll
gische als so und nicht anders gegeben hinnahme, und selbst wenn man
die Positionen akzeptierte: wrde dann das Material ausreichen, um
echte Entwicklung zu bestimmen? Um es kurz zu sagen: !ch glaube, man
braucht das Problem der relativen oder absoluten Chronologie hier gar
nicht anzupacken, denn man wird von solchen allzu glatten ,Entwick-
lungsreihen' der frhgriechischen Dichtung ohnehin abkommen mssen.
Was zwischen Hesiod und Homer, ja zwischen Archilochos und Sappho
einerseits und der sogenannten ,,epischen Welt" andrerseits liegt, sind
nicht sosehr ein paar Jahrzehnte hin oder her, als ein anderes literarisches
Genos: Beide jedoch aufruhend auf einer soziologisch-anthropologischen
Wirklichkeit, die gewiB ihr inneres Gefalle hatte, in der aber gleichwohl
oder eben deshalb das eine wie das andere als simultan miiglich und als
wesentlich vorhanden vorauszusetzen ist.
Dann aber wird man einer gewissen Gemeinsamkeit der scheinbar
,spaten', also fortschrittlichen Stellen bewuBt werden, jener Aussagen
also, in denen sich etwas von Moralitat, von ,Gewissen', von ,Innerlich-
keit ' abzuzeichnen scheint: Hesiod ist Bauer, kein Krieger; das Rechts-
problem stellt sich ihm am energischsten in der Form eines ,,Ainos", der
Fabel von Habicht und Nachtigall (erga 202ff.); Fabel ist auch die an-
gefhrte Archilochos-Stelle fr. 89-94 D. :
atv<; TI<; av!>ecnwV ocle,
wi; d dMmrl; ><alml <; l;vvwvrv
leil;av .
Dergleichen ist nicht ,spat', aber volkstmlich, vulgar, jener Schicht
zugehiirig, die das heroische Epos zwar gewiB kennt, aber sorgfaltig von
sich fernhalt.1 Die Odyssee-Stelle, die Latte als die entwickelteste anfhrt,
ist dem schlichtesten Mann des Epos, dem Eumaios, in den Mund gelegt.
Die vielen anderen Aussagen in Ilias und Odyssee, in denen das ,Humane'.
das ,Individuelle', das ,Besinnliche' anklingt - es sind mehr als man
vermutet ! - sind allemal aus Situationen erwachsen, in denen entweder
eine Frau - etwa Andromache oder Helena oder Nausikaa - den Tonfall
bestimmt, oder in denen der Held, in eine grenzhafte Lage gestellt, die
Kruste von Wrde und adliger mze durchstiiBt, wo sie von ihm abfallt
und der humane Kern zutage zu treten Gelegenheit hat; Hektor vor
seinem Tod, Priamos vor Achill .. .
Wir treffen dergleichen also, im frhesten uns faBbaren Stadium, in
genau der gleichen Schicht, in der es uns im 5. Jahrhundert, als diese
Dinge pliitzlich virulent zu werden begannen und nach deutlicherem Aus-
druck rangen, ja ins Zentrum der Lebensproblematik eintraten, begegnet
ist: bei Aristophanes (o. S. 301).
1
Eindringlich klargestellt von Karl Reinhardt . .. Das Parisurteil ", 1938 ( .. Von
Werken und Formen", 1948, S. nff) .
312 TTO S EEL
J etzt bed eutet auch das alteste Zeugnis fr di e Formulierung avvEL-
Mvat fovnp nicht mehr wie bisher eine Verlegenheit: Bei der blichen
Auffassung, wonach alle diese Regungen innerseelischer Differenziertheit
eigentlich erst frhest ens im Zusammenhang mit der Tragodie zu erwarten
waren, ist es kaum begreiflich, dall eben diese hochentwickelte Wendung
schon bei Sappho vorkommt; zwar als klagliches Fragment, aber doppelt
bezeugt und deshalb un bezweifelbar:
. . . l yw ' l ' at'wi
TOVTO otvoufo. (fr. 37, II D.)
Zucker bergeht diese Stelle; Snell (Gnomon 1930 S. 24 und 27) bezieht
sie energisch ein ; wenn er zunachst feststellt , dall trotz des hier begeg-
nenden reflexiven Gebrauchs der erst spater belegte Gebrauch ohne
Reflexiv ,,doch offenbar der altere" sei (S. 25), dann leuchtet das zwar fr
die Genesis der Forme! ein, fhrt aber in eine uns nicht mehr fallbare
vorliterarische Vergangenheit; denn wenn uns das ,,spatere" schon bei
Sappho begegnet, so ist in diesem Falle einmal nicht keinmal, sondern
ein fr allemal: was Sappho sagt, konnte zu ihrer Zeit - und man
darf das ,,ihre" nach oben hin nicht so eng begrenzen, dall ,Homer'
als zuverlassig aullerhalb dieser Grenze stehend betrachtet werden konnte !
- jeder sagen oder doch zumindest nachvollziehen.
1
Wenn es uns nicht
begegnet, dann moglicherweise - wobei wir von der klaglichen Trmmer-
haftigkeit unserer Belege sogar absehen - nicht, weil es ,noch' nicht
sagbar war, sondern weil es im Rahmen der hohen yvr des Epos nicht
sagbar war, bewuBt ausgeschieden blieb, nicht anders als so viel Mythisches
und Religioses, von dessen Vorhandensein wir bestimmt wissen, ohne dall
im hohen Epos eine Spur davon geblieben ware. Weiter stellt Snell fest,
die Forme! bei Sappho ,,bezeichnet aber noch keine Regung des Gewissens"
(27), denn ,, fr die Bezeichnung des Gewissens wird die Wendung erst
wichtig, wenn sie nicht bedeutet, sich einer Lage, sondern sich einer Tat
bewuBt zu sein. Das begegnet uns erst im 5. Jahrhundert." Damit wird
der Akzent, wie blich, auf das rein WissensmaBige gelegt. Aber Snell
selbst erkennt ganz klar, dall in der Forme!, selbst ohne Reflexivum, der
,,erste Keim der Spaltung des Ich" liegt, die sich ,. dann weiterhin an der
1
Die Einschrankung ist wichtig, weil sonst die individuelle Leistung der Dichterin
aufgehoben scheinen konnte : gewil konnte nicht jeder eine Sappho werden; gewil
ist es Vorrecht und Schicksal ,des' Dichters, seiner Zeit voraus zu sein; aber doch
nur insofern, als er das Gesetz seiner eigenen Gegenwart tiefer und folgerichtiger
auszutragen und zu gestalten vermag, nicht aber dadurch, dal er aus diesem Gesetz
heraustrate oder herausfiele. Bezeichnend und durchaus zugehorig auch die Selbst-
anrede mit Namen (144b D: 'l':mpoi, -r: -r: av :;r;oJ.tioJ.{Jov 'Aqeirav), wobei der
bergang zwischen I. und 2. Person sich besonders leicht vollzieht, vgl. Schwyzer-
Debrunner II 246 ; brigens macht es prinzipiell keinen grolen Unterschied, ob solche
Selbstanrede als Selbstgesprach - wie dann erst wieder Eurip. Med. 401 f. - oder
in der Maske eines (selbst geschaffenen) Gegenbers (wie Sappho r , 20 D.) geschieht.
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgri echischen Denken 313
Wendung avvrn5b:at iavnp verfolgen lallt. " Das ist vollig richtig. Wir
knpfen an an das o ben ber oli';a Gesagte: wenn bereits darin ein distan-
ziertes Verhaltnis zum Wissensinhalt beschlossen ist, dann erst recht und
weit mehr bei avvou5a: Ein Mit-Wissen vollzieht sich an sich schon gegen
einen gewissen Widerstand, dessen namlich, mit dem man mit-weill, nam-
lich fast immer etwas mit-weill, wovon es dem primar Wissenden lieber
ware, er wllte es allein. Wir sahen bereits, wie sehr der Unterton des
,.Belastungszeugen" berwiegt. Beim Mit-sich-selber-Wissen nimmt dieses
Belastende, anklagende Moment von der einen, und das des Widerstandes,
des Nicht-Wahrhaben-Wollens von der anderen Seite eine besondere
Dringlichkeit an; schon dall es zwei Seiten gibt, ist der Anfang davon.
Beim affektfreien, rein intellektuellen Wissen weill ,,lch" - und zwar so
gewiB, dall schon die Aussage ,.ich weill" eine Minderung der Wissens-
Gewillheit andeutet (s. o. S. 306); hier aber gibt es zwei zum Wissens-
vollzug gleichermallen beteiligte Ich-Schichten, von denen die eine nicht
wissen oder nicht-gewullt-haben will, sich also dem Wissen an sich oder
doch dem Wissen der ,anderen' widersetzt, sperrt, opponiert: Daraus
gewinnt die Forme! eine sehr starke Affektbetontheit, einen emotionalen
Charakter. Wir wissen nicht, was das rovw bei Sappho meint; aber denkbar
ist nur zweierlei: entweder etwas wertmaBig Positives; dann bedeutet
die Forme! einen Widerspruch gegen fremde Kritik, etwas Polemisches
nach aullen; also etwa: ,.Wenn ihr mich auch um deswillen tadelt: ich
selber bin mir bewullt, dall ... " Dann bedeutet es ,.gutes Gewissen";
dieses aber wird nie anders aussagbar sein als in Abwehr eines von aullen
zugemuteten schlechten Gewissens, das also primar gedacht ist. Oder es
bedeutet: ,.Es fllt mir zwar schwer, es zuzugeben, aber ich kann nicht
umhin, trotz allem Widerstreben mir selber darber klar zu sein, dall
ich ... " ; dann bedeutet es das sittliche Dominieren eines noetischen
Ich-Teils ber ein sich straubendes, der Einsicht sich versperrendes lch;
also, mit allem Vorbehalt : das strafende, anklagende Mit-Wissen, das
Ge-Wissen.
Damit aber gewinnt auch Snells berechtigter Widerspruch gegen Zuckers
rigorose Abhebung der Erinnyen von allem GewissensmaBigen
1
erst seinen
rechten Zusammenhang: Gewill sind die Erinnyen nicht ,.Allegorien" im
Sinne etwa des Barock; genau so wenig, wie es ,. allegorisch" ist, wenn
Hesiod von Eros und Rimeros erzahlt und davon, wie die Nacht die Kinder
Tod, Schlaf und Traum gebar; aber : die N amen dieser - nicht hinterdrein
erst poetisch personifizierten, sondern primar personenhaft erlebten -
gottlichen Wesen haben doch wohl mit den spateren unpersonlichen Be-
griffen, also @vawc; mit Jvaroc;, nicht nichts zu tun
2
; vielmehr ist die
aus der Kraft bildhafter Phantasie heraus gestalthaft gesehene, in der Natur
erlebt e, als hochst real und existent gedacht e ,. Person", die gewill primare
1
Vgl. o. S. 295.
2
Di e richtige Deutung der ., Redenden Na men" Hesiods bei F. Dornseiff, Ztschr.
fr Namenforschung r6 1940, S. 29f.
314 TTO SEEL
und keiner Auflosung bedrftige, aber doch zugleicli auf das spii.tere
Abstrakte vorausdeutende, den gleichen seelischen Innenraum ausfllende
Erfahrensweise, mit der Wirklichkeit gestaltend fertig zu werden, in die
Flle der Erscheinungen Ordnung und Zusammenhang zu bringen, gefhltes
Erlebnis sagbar zu machen, Rangstufen, Ursachenreihen, Daseinsbedin-
gungen, ahnungsvolles Erschauern und beglcktes Schauen zu reprii.sen-
tieren - wenn man will: .,symbolisch" ...
Aber: Ist das denn ein Vorbehaltsrecht oder ein ,Noch-nicht' der archa-
ischen Zeit? Ein Gedicht HOlderlins beginnt :
Geh unter, schone Sonne, sie achteten
Nur wenig dein, sie kannten dich, Heilige nicht,
Denn mhelos und stille bist du
ber den iYihsamen aufgegangen.
Ist das ,,Allegorie'', will sagen, etwas, das zuerst anders gedach t und
dann, sek undii.r, so ,eingekleidet' wii.re? Und Holderlin gibt selbst die
Antwort , mit der ersten Strophe des Gedichtes ,,Die scheinheiligen Dich-
ter'':
Ihr kalten Heuchler, sprecht von den Gottern nicht !
Ihr habt Verstand ! Ihr glaubt nicht an Helios.
Noch anden Donnerer und Meergott;
Tot ist die Erde, wer mag ihr d anken? -
Alle echte Dichtung ist ,.Metapher" gewesen und geblieben - und
zwar: ,.bertragung" von etwas, das nie anders denn als bertragenes
gestaltet und aussagbar vorhanden war. Mogen die Erinnyen einmal ur-
sprnglich nur ,,die grollenden Seelen der Verstorbenen" gewesen sein
1
:
lhr Vorhandensein gengte, um spii.tere - nii.mlich ,schon' homerische -
ethischere Regungen in sich zu subsumieren, in ihnen sich gestalten zu
lassen, so daB wir gar nicht erwarten konnen, sie anders und ,deutlicher'
sich ii.uBern zu horen.
v.
Freilich begibt sich im 5. Jahrhundert mit alledem etwas Neues : Jetzt
tritt eine ganz andere Art des Sagen-Konnens und Sagen-Mssens in den
1
Darber, ob in vorliterarischer Zeit ein Erinnyenglaube denkbar ist, der rein
objektiv, ohne Anteil des nach aullen projizierten dumpfen BewuLltseins, daLl durch
die Bluttat eine Lebensordnung gestort wurde, entstehen konnte, mogen die Ethno-
logen entscheiden; auch hier aber scheint man das ,.ethische Element" solcher
Objektivationen wieder hoher zu veranschlagen als vor zehn J ahren; vgl. etwa
Ad. E. Jensen, ,.Der sittliche Gehalt primitiver Religionen", in: ,.Paideuma", Bd. 3
1949, S. 241 ff. ; weon Ilias T 418 die Erinnyen es sind, die die Rosse des Achill am
Weitersprechen hindern, weil sie damit die ,.Ordnungen" durchbrii.chen, so zeigt das,
daLl bereits hier die Erinnyen einen weiteren und prinzipielleren Zust ii.ndigkeitsbereich
habeo als den der Rachegeist er Erschlagener. Dasselbe gilt fr Heraklit fr . B 94
D. -K.: daLl die Erinnyen, der Dike Trabanten, die Sonne, so sie ihre Bahn verlieLle,
ausfindig machen wrden. Auch das berhmte Anaximander-Fragment 12 A 15
ware hier einzubeziehen.
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken
315
Vordergrund: nun zerbrechen die Ordnungen, in denen das - zuvor zwar
auch schon durchaus vorhandene und zur menschlichen Ganzheit ja auch
unerlii.Bliche - innerseelische Geschehen geborgen und gebunden gewesen
war. Jetzt sucht es sich proprie auszusagen, wird direkt, rational, saekulari-
siert, unmetaphysisch, moralisch, psychologisch. Gewandelt aber ist nicht
das Wesen, sondern die Form, so tief auch .,Form" in die menschliche
Grundbefindlichkeit einzugreifen vermag. Darin, daB aus dem, was wir
als immanente oder latente Tragik einer Gestalt wie Hektor bezeichnen
mochten, wirklich Tragodie wurde, liegt echte ,Entwicklung'. Der homeri-
schen Zeit fehlt durchaus das Bebende, Vibrierende, metaphysisch Er-
schreckte, bohrend Grblerische, die dringliche Intensitii.t des Anrufs, das
schreckliche Getroffensein vom Gotte ... Und damit aus dem, was wir als
latente Ethik, als .,Gewissen", ,,Verantwortung" oder dergleichen an-
zusprechen versuchen - durchaus wissend, daB damit etwas vorerst noch
Namenloses und nur als Metapher oder Gleichnis
1
sich Andeutendes allzu
rational mit einem erst spii.teren Terminus belegt wird -, die volle sittliche
Selbstbesinnung werden konnte, die bei Platon und Aristoteles begegnet,
bedurfte es des langen, mhe- und entsagungsvollen Weges, den wir als
griechische Geistesgeschichte kennen und dessen Risiko und Preis gerade
Platon empfunden hat: nirgends findet sich das Wissen um die Unersetz-
barkeit und Unwiederholbarkeit des Alten und um die Insuffizienz der
neuen Verbalitii.t so deutlich bewahrt wie bei ihm, der dem Mythischen,
Geoffenbarten, durch hohere Autoritii.t Verbrgten einen so schmerzhaft
unerfllten, aber sorgsam ausgesparten inneren Leerraum vorbehalten,
und das Aussagen nicht fr mehr als fr ein drftiges Provisorium gewertet
hat .
2
Aber a!l das, was spii.ter antithetisch und dialektisch auseinandertritt,
ist im archaischen Wesen noch wechselseitig, eines im anderen, aufgehoben,
und wer es nur von einer Seite her anspricht, macht immer den gleichen
Fehler - gleichviel von welcher er es ansprechen mag: Hier trifft von
den uns gelii.ufigen Wertbegriffen, die ja alle die Gabelung. und Spaltung
bereits als vollzogen voraussetzen, keines ganz und keines gar nicht; und
so verstii.ndlich, ja verdienstlich auch die Reaktion gegen die alle Distanzen
berspringende Sentimentalisierung der Antike oder gegen einen naiv-
christianisierenden Moralismus auch immer gewesen sein mag, so wii.re
es doch ebenso verfehlt, wenn man sich um eines esoterischen Trugbildes
von ungebrochener, unangefochtener reiner ,,Natur" willen dem geheimen
1
ber die Funktion des homerischen Gleichnisses, eine hohere, direkt noch un-
aussagbare Wirklichkeit der inneren Dynamis nach zu umfassen, vgl. jetzt Roland
Rampe, ,.Die Gleichnisse Homers nnd die Bildkunst seiner Zeit", (,.Die Gestalt", 22),
Tbingen 1952.
2
ber ,.Offenbarung" bei Platon: .Franz Dirlmeier in seiner .. Phaidon"-Ausgabe
(Heimeran: Tusculum) i949, S. 240 mit Berufung auf U. v. Wilamowitz, ,.Platon" I ,
1929, S. 337. Di e Unechtheitserklii.rung des 7. Briefes durch Gerhard Mller, ,.Die
Philosophie im pseudoplat onischen 7. Brief", Archiv fr P hilosophie 3 1949, S. 25 r ff.,
braucht hi er nicht erortert zu werden.
316 Orro SEEL
Gehalt des archaischen Griechentums auch an .,ethischen" Valenzen,
also auch an praformiertem ,,Gewissen", versperren wollte.
VI.
In seiner an sich trefflichen und vor allem fr die nachplatoni sche Zeit
sehr verdienstvollen Untersuchung hat Zucker sich nur mit dem Begriff
. der avvebratc; und mit dessen direkten Vorgangern befaBt. Snell hat
mit vollem Recht gefordert, daB man weiter greifen msse, und dabei
besonders auf avyyiyvwaxeiv hingewiesen, das eine ii. hnliche Funktion
hat; der wesentliche Unterschied scheint mir darin zu liegen, daB mit
avyyiyvwax;v das ingressive Umschlagen eines bisherigen Urteils in ein
anderes bezeichnet wird : meist das j ii.he ZerreiBen eines Schleiers von
Beschonigung und Selbsttii.uschung und das schmerzliche Innewerden
einer ganz anderen, fragwrdigeren, durch keine erbaulichen Illusionen
mehr verstellten Wirklichkeit, wii.hrend dem avveitJvat in hoherem MaBe
eine durative innere Spannung eignet. Darauf kann hier nicht mehr ein-
gegangen werden - das Gesamtbild wrde sich dabei zwar vertiefen,
aber in den Grundlinien nicht ii.ndern.
1
Aber selbst dies ist noch mit Hilfe der Lexika zu fassen. Wichtiger
scheint es, auf Zusammenhange zu achten, in denen mit an sich unschein-
baren und gelii.ufigen Worten der innere Sachverhalt umschrieben wird,
auf den es hier ankommt; um nur eine, freilich sehr eindrucksvolle der-
artige Stelle zu vergegenwii.rtigen: In der ersten Rede des Perikles, Thuk. 1
140, 4, wird das Ansinnen, das megarische Psephisma aufzuheben, ab-
gelehnt, obgleich es an und fr sich als eine Bagatelle zu bewerten wii.re,
um deretwillen kein Krieg entstehen drfte; aber, sagt Perikles: vwv be,
retc; 11oa17 :n:eel f3eaxoc; av :n:okeiv, el TO Meyagwv vn]rpiaa -Y xa{}-
).oiev .. . pr' lv vv mhoi; rxlTav v:n:o).:n:ra{)e wc; id: ixgov bw).efaa-re :
1
Besonders ergiebig ware hi er eine Interpretation von Soph. Antig. 926, wo die
Korrelation von Unglck und Strafe als vorauszusetzender, aber nicht einsehbarer
Schuld in das Problem der Theodizee einmndet, ganz ahnlich wie bei Herodot I 90,
nur unendlich viel aufgebrochener, verstrter, verzweifelter und ratloser. Bei Herodot
begegnet das avyyqvc.a>cta>ai lmrrip besonders haufig, was fr den geistigen
Standort Herodots aufschlullreich ist; auf eine Stelle sei hingewiesen, weil sie besonders
deutlich macht, dall auch die dem Worte nach positive Werthaltigkeit des avyy1-
yvc.a,. ta&at im Grunde doch auch negativ ist: I 89, am Ende: Kroi sos rat dem
Kyros, er solle den plndernden Soldaten ihre Beute wieder wegnehmen unter dem
Vorwand, Zeus msse erst den Zehnten davon bekommen: ... " il"tot avyyv6v-
n r; nottv ae MY.aia i"6vr:e<; also, sie werden, gegen ihren eigenen
(hchst begreiflichen) inneren Widerstand, zugestehen mssen, dall du recht hast,
und nicht dagegen sich aufl ehnen drfen als gegen ein Unrecht von dir, ja: sie werden
zugeben mssen, dall sie selbst im Begriffe gewesen sind, ein Unrecht zu tun .. .
Anderes - und es ware nicht weniges - mull hier auf sich beruhen: der Duktus
ist wohl deutlich; von hi er aus erhalt dann avyyvctr = ,,Verzei hung" erst seinen
emotionalen Hintergrund.
Zur Yorgeschich te des Gewissens6egriffes im altgriechi schen Denken
317
keine Vokabel, die auf ,,Gewissen" hindeuten konnte. Und doch tut man
der Stelle kaum Gewalt an, wenn man paraphrasiert : ,,und habt auch vor
euch selber kein schlechtes Gewissen". Almliches lieBe sich anla.13lich der
Mytilene-Diskussion Thuk. III 35 ff. zeigen. Dabei ist es wieder beidemal
derselbe simple Demos, dem dieses Anheimfallen an eine innere Zwie-
spaltigkeit und Verstrtheit unterstellt wird, wie es bei Aristophanes der
Fall war. Also die gleiche soziologische Situation, die uns wiederholt als
Wuchs- und Nahrboden des Gewissenskomplexes in seiner Ausdrcklich-
keit begegnet ist. ,,So macht Gewissen Memmen aus uns allen ... ", sagt
Shakespeares Hamlet ! Darin liegt im Grunde genau die gleiche Sorge
vor dem Verlust an geschlossener Personlichkeit, die Abwehr des Gebroche-
nen, Schwankenden, die uns auch im Griechentum begegnet (o. S. 292) und
um deretwillen der seelische Bereich des ,,Gewissens" sich nur zogernd,
nur in der Objektivation der Ordnungen aul3ert - nicht, als ob er ber-
haupt nicht vorhanden gewesen ware.
Dies gilt aber darber hinaus fr all das, was man dem Griechentum
an Werten der ,,Innerlichkeit" abgesprochen hat (o. S. 293ff.); das mag
zum SchluB ein Vergleich deutlich machen: In der thukydideischen
,,Leichenrede des Perikles" (11 35ff.) wird man, bei aller Bewunderung
ihrer GroBartigkeit, so etwas wie ein humanes Vakuum fast schmerzhaft
spren; keine moderne Gefallenenehrung konnte der Hinterbliebenen,
und vor allem der Frauen und Mtter, mit solch eiskalter Sachlichkeit
Erwahnung tun, wie es hier geschieht : sie werden, so scheint es, weder
verstanden noch getrostet, sondern nur auf ihre Pflicht verwiesen und
nach Hause geschickt. Auch hier sind, wie .,in der griechischen Kunst " ,
.,die Gesichter relativ leer; das Seelenleben tritt irgendwie zurck . .. "
(J. Stenzel, o. S. 294, 6). Aber man halte daneben eine ziemlich genau gleich-
zeitige Aussage, freilich aus anderem Munde und in anderer Stillage:
In Aristophanes' ,,Lysistrate" weist der Probule die politischen Ratschlage
der Lysistrate zurck: das gehe doch die Weiber nichts an, ale; aiJ{J8 erijv
:n:vv wv :n:oUov. Und nun folgt eine Replik der Lysistrate, ergreifend
und so voll verstehender und humaner Aufgeschlossenheit fr den Jammer
nicht nur ihrer selbst, sondern gerade auch der anderen Frauen und der
jungen Madchen, die ihre Jugendblte versaumen und die, nach kurzem
xaiec;, keiner mehr will, und dann sitzen sie daheim in der Kammer
und werden schrullig und legen Patiencen .. . (Lys. 589ff.): Hier, im Munde
der Frau, finden wir alles, was uns bei Thukydides zu fehlen scheint.
Aber diese Frau spricht ja nur, was ein Mann, eben Aristophanes, sie
sagen la.13t ! Das war also da - es fehlt keineswegs
1
; nur spricht es si ch
1
Was hier gefallt wird, ist jene ,,konomische Rollenverteilung", vermge deren
der griechische Geist die unvereinbaren Antinomien des Daseins als simultane Wirk-
lichkeiten zu bewahren vermochte; vgl. darber im Nachwort zu meiner Ausgabe
von Aristoph. Lys. (Seegers bersetzung, Ankerbcherei Bd. 46), Stuttgart 1949,
S. 72 ff. Zu gedenken ware hier auch der rhrend-zarten Intimitat zwischenmensch-
licher Beziehungen, wie sie sich etwa in Grabbeigaben bekundet; darber vortrefflich
318 Orro SEEL
nicht leichthin aus; daB dergleichen fr uns so ganzlich abwesend zu sein
scheint, ist weniger, ja gar nicht die Folge eines seelischen Mankos, als
vielmehr das Ergebnis einer ungeheuren Zucht tind Geordnetheit, einer
Diszipliniertheit, die auch dem Griechen nicht in den SchoB fiel, undeiner
Diskretion, die ein unendlich viel lebendigeres, blhenderes Gefhl ahnen
liiBt als viele Worte. Moglich freilich war auch dies nicht durch die Wirkung
einer gesellschaftlich-stiindischen Konvention, sondem einer Bezogenheit
auf das Normative berhaupt, die wir Religion nennen
1
, und die Rilke
tiefer versprt hat denn als Leere und Minus, wenn er (in der zweiten
Duineser Elegie) sagt:
Erstaunte euch nicht an attischen Stelen die Vorsicht
menschlicher Gest e? War nicht Liebe und Abschied
so leicht auf die Schultern gelegt . .. ?
Diese Beherrschten wu13ten damit: so weit sind wir 's,
dieses ist nser, uns so zu berhren; starker
stemmen die Gotter uns an. Doch di es ist Sache der Gotter.
Ernst Buschor, ., Grab eines attischen Madchens", 1939, 1941. .,Literarisch" ge-
worden ist das aber erst im Hellenismus, in der Neuen Komodie, in Idylle und
Mimiambos, Epigramm und Elegie, also dort, wo alles Standische und Haltungs-
ma!lige, zusammen mit den Ordnungen, abgebr6ckelt war - Gewinn und Verlust
zugl eich.
1
Die Verbindung von Gotterfurcht und der Forme! avvrnli vm lavnp zeigt be-
sonders eindrucksvoll Xenophon Anab. II 5, wo das .,b6se Gewissen" als inneres
Gejagtsein in grol3artigen Bildern gefal3t wird, die erstaunlich anklingen an Alt-
testainentliches, namlich an den 33. und 139 Psalm; wozu bemerkt sei, daLl auch
das Hebraisch-Aramaische kein Wort fr .,Gewissen" hat. Ganz ahnlich schon
Epicharm B 23 Diels-Kranz: oi<liv bpEVyf! -ro i>eiov rni-ro y1yvwaxnv ae t5e
mhi; lai>' wv lnnrri;, abvvare b' otibiv i>ci;. Auch im weiteren Zusammenhang
wiire wiederholt auf den yvco1xi; Epicharm hinzuweisen; freilich ware bei jedem
Einzelbeleg die Echtheitsfrage zu stellen (vgl. Diels-Kranz I a. O.; Schmid-Stiihlin
I, 1929, 646; G. Goldschmidt, .,Menander", Zrich 1949, S. XII); hier nur soviel:
Wenn man etwa Gnomen wie Epich. B 26. 41. 46 D. (xm'>aeov av -rov voiv lxr1i;,
anav TO uwa xai>aeoi; el. - ov eravoev al.Ad neovoeiv xei TOV avtlea TOV ao<pv . . .
nemo est enim innocens, nema reprehensionis expers) nur deshalb fr unecht erklart,
weil einem noch im 6. Jh. wurzelnden Dichter solche Aussagen nicht zuzutrauen
seien, dann geriit man in einen Zirkel: denn wenn man die, infolge ihrer Intimitat
notwendig seltenen Belege teils bersieht (Aristoph., Thuk.), teils bagatellisiert
(Sappho u. a.), teils in ihren Obert6nen berh6rt (Homer bis Xenophon), t eils gar
athetiert (Epich.), dann ist es kein Wunder, wenn man am Ende nichts brig behalt. -
Fr Epicharm ist erneut hinzuweisen auf die ,niedri ge' Stillage der ,Komodie', auf
die soziologische Situation und die ihr gemaLle, durch kein standisches Leitbild diszi-
plinierte didaktisch-ethische Ausdrcklichkeit, auf die Hemmungslosigkei t des Be-
kenntnisses zu sich selber: a ya <pt}aii; avoewv-r Jiv; aaxoi ne<pvaiavo1 (Epich . B roD.).
Vgl. o. S. 301 und 317.
Zur Vorgeschichte des Gewissens-Begriffes im altgriechischen Denken
319
Oder: Wenn Thukydides beim Bericht seines MiBerfolges von Amphipolis
kein Wort der Selbstbeschuldigung oder Selbstrechtfertigung findet, son-
dem es der Nachwelt berliiBt, zu richten oder freizusprechen : ist das darum,
daB er ,,noch" nicht das ,,Gefhl" besessen hiitte, aus dem heraus solche
Apologetik kiime, und ,,noch" nicht die Moglichkeit, davon zu reden?
lst es nicht vielmehr genau das, was Karl Reinhardt (Von Werken und
Formen, 269) so beraus richtig sagt: ,, ... daB wir mit einer Vomehmheit
zu rechnen haben, von der uns nicht leicht fiillt, uns einen Begriff zu
machen" ?
Die vertrauliche Zutunlichkeit eines moralistisch-ethisierenden Erbau-
ungshumanismus muBte einmal sehr grndlich ins Unrecht gesetzt werden;
das ist geschehen, und es ist verdienstlich, daB es geschehen ist. Aber
vielleicht ist es jetzt, gerade jetzt, angezeigt, sich von dem horazischen
dum vitant stulti vitia, in contraria currunt (sat. r, 2, 24) wamen zu lassen:
Die Griechen waren andere Menschen als wir; sie waren anders im Rahmen
menschenmoglicher Variabilitiit, und dies bei weitem nicht einmal bis an
die Grenzen dieser Moglichkeiten; nur deshalb haben sie uns mehr zu
sagen als Azteken und Primitive und Ostasiaten - womit, nebenbei
gesagt, nicht dem das Wort geredet sei, was mir als ,,humanistisch" ge-
tarntes klein-europiiisches Provinzlertum und als solches eine emste gegen-
wartige Gefahr erscheint - ; und vor allem: Sie waren Menschen, sie
waren nicht iisthetische oder antimoralische Konstruktionen, nicht wert-
indifferente Schemen aus starrer GroBe und roboterhaft-abstruser Sonder-
barkeit. Wenn unser Wort ,,Gewissen" ein ,,Bedeutungslehnwort" aus
dem Griechischen ist1, dann ist das am Ende doch mehr als ein dummer
Zufall; denn es bezeichnet einen anthropologischen Sachverhalt, fr den
das Griechentum nicht, wie man zu meinen scheint, taubstumm geboren
gewesen wiire, sondem von dem, als von einer humanen Grundbefindlich-
keit, auch das alte Hellas zeugt, vemehmlich und nachdenkenswert zeugt,
obwohl oder auch weil, und vor allem dadurch, wie und warum es davon
schweigt.
1
Die terminologische Ausgliederung und Verfestigung vollzieht sich in der Wende-
zeit ums Jahr 400 mit erstaunlicher Folgerichtigkeit, fast schlagartig; sucht man
zu uvveltlru1i; ein begriffliches Komplement, dann kommt man wohl zwangslaufig,
als auf die Privation und Negation von ,,BewuLltsein" und .,Zurechenbarkeit" zu-
gleich, auf das Wort lxaraat i; ; als Vorbereitung kame hier etwa den Bakchen oder
dem Herakles des Euripides eine ahnliche Funktion zu, wie fr uvvetlraii; dem
Orestes; vgl. a u ch das .,AuLlersich-Sein" des Philokleon, o. S. 301, in Aristophanes'
.,Wespen", mit der Euripides-Parodie Ar. vesp. 1002; .,obj ektive" Vorform zu lxara-
a1i; ware offenbar evi>ovuiaai; , so wi e die Erinnyen zu avvetlraii; (Het eronomie-
Autonomie 1); als Terminus begegnet lxaraaii; zuerst medizinisch, im Hippokrates-
Corpus; aber. dem avvei<lvai avrq, entsprechend, vgl. etwa Platon Ion 535 b:
l.;co uavwi yyvr. Die Genauigkeit der Parallelitat beweist, daLl es sich bei dieser
t erminologischen Fixierung um einen echten dialektischen ProzeLl handelt, bei dem
das Denken der These das Mit-Denken der Antithese er zwingt.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Gesammelte Aufsätze 3: Initiation, Einweihungsrituale und Wesensphänomene: Mit einem Vorwort von Wolfgang GiegerichVon EverandGesammelte Aufsätze 3: Initiation, Einweihungsrituale und Wesensphänomene: Mit einem Vorwort von Wolfgang GiegerichNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Als das Paradies am Nordpol lag: Bock Saga - Märchen oder Wahrheit?Von EverandAls das Paradies am Nordpol lag: Bock Saga - Märchen oder Wahrheit?Noch keine Bewertungen
- Elements Orientaux Dans La Religion Grecque AncienneDokument189 SeitenElements Orientaux Dans La Religion Grecque Anciennebyblostik100% (2)
- Der Mensch Und Seine Hoffnung Im Alten TestamentDokument193 SeitenDer Mensch Und Seine Hoffnung Im Alten TestamentM. G.Noch keine Bewertungen
- Aura des Augenblicks: Epiphanisches Erleben in Dorothy L. Sayers’ (1893-1957) Roman ,Aufruhr in Oxford’Von EverandAura des Augenblicks: Epiphanisches Erleben in Dorothy L. Sayers’ (1893-1957) Roman ,Aufruhr in Oxford’Noch keine Bewertungen
- Schicksalsmomente: Entscheidende Augenblicke im Leben großer PersönlichkeitenVon EverandSchicksalsmomente: Entscheidende Augenblicke im Leben großer PersönlichkeitenNoch keine Bewertungen
- Was ist (uns) heilig?: Perspektiven protestantischer FrömmigkeitVon EverandWas ist (uns) heilig?: Perspektiven protestantischer FrömmigkeitNoch keine Bewertungen
- Elf Briefe über Wiederverkörperung: Erweiterte NeuausgabeVon EverandElf Briefe über Wiederverkörperung: Erweiterte NeuausgabeNoch keine Bewertungen
- Philosophenspruche Van Ryssel Protagora SiriacoDokument16 SeitenPhilosophenspruche Van Ryssel Protagora SiriacoMichele CorradiNoch keine Bewertungen
- (Beiträge Zur Altertumskunde 279) Pietro Podolak, Jan Erik Heßler - Soranos Von Ephesos, ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Peri Psyches - Sammlung Der Testimonien, Kommentar Und Einleitung-De Gruyter (2010)Dokument207 Seiten(Beiträge Zur Altertumskunde 279) Pietro Podolak, Jan Erik Heßler - Soranos Von Ephesos, ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Peri Psyches - Sammlung Der Testimonien, Kommentar Und Einleitung-De Gruyter (2010)licenciaturafilosofiaunilaNoch keine Bewertungen
- Ralf Konersmann - Montaigne DescartesDokument11 SeitenRalf Konersmann - Montaigne DescartesMark CohenNoch keine Bewertungen
- Weisheit in Israel: Mit einem Anhang neu herausgegeben von Bernd JanowskiVon EverandWeisheit in Israel: Mit einem Anhang neu herausgegeben von Bernd JanowskiNoch keine Bewertungen
- ANNO 1694: Amüsantes und Wissenswertes aus dem späten MittelalterVon EverandANNO 1694: Amüsantes und Wissenswertes aus dem späten MittelalterNoch keine Bewertungen
- Epiphanie: Reine Erscheinung und Ethos ohne KategorieVon EverandEpiphanie: Reine Erscheinung und Ethos ohne KategorieNoch keine Bewertungen
- Sex, Erotik, Liebe. Der Umgang der Männer mit Frauen durch die Jahrtausende, ermittelt aus Sprachen und TextenVon EverandSex, Erotik, Liebe. Der Umgang der Männer mit Frauen durch die Jahrtausende, ermittelt aus Sprachen und TextenNoch keine Bewertungen
- Versuche in der Theodicée über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels: Philosophische Werke Band 4Von EverandVersuche in der Theodicée über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels: Philosophische Werke Band 4Bewertung: 3 von 5 Sternen3/5 (11)
- Hans Lewy Sobria Ebrietas Untersuchungen Zur Geschichte Der Antiken Mystik PDFDokument179 SeitenHans Lewy Sobria Ebrietas Untersuchungen Zur Geschichte Der Antiken Mystik PDFAntiqua SapientiaNoch keine Bewertungen
- Über uns Menschen: Philosophische SelbstvergewisserungenVon EverandÜber uns Menschen: Philosophische SelbstvergewisserungenNoch keine Bewertungen
- Stoizismus heute: Was uns die stoische Philosophie lehrte und wie wir diese in unserem Alltag nutzen können. Resilienz trainieren, Gelassenheit lernen und innere Ruhe finden.Von EverandStoizismus heute: Was uns die stoische Philosophie lehrte und wie wir diese in unserem Alltag nutzen können. Resilienz trainieren, Gelassenheit lernen und innere Ruhe finden.Noch keine Bewertungen
- E. Stein, Die Allegorische Exegese Des Philo Aus Alexandreia, Gießen 1929Dokument68 SeitenE. Stein, Die Allegorische Exegese Des Philo Aus Alexandreia, Gießen 1929rappolggo90Noch keine Bewertungen
- Lebenswelt und Gemeinschaft: Beiträge zur Anthropologie des Alten TestamentsVon EverandLebenswelt und Gemeinschaft: Beiträge zur Anthropologie des Alten TestamentsNoch keine Bewertungen
- Geschichte Der Griechischen Etymologika - Reitzenstein 1897 (425p) PDFDokument425 SeitenGeschichte Der Griechischen Etymologika - Reitzenstein 1897 (425p) PDFkrenari68100% (1)
- Der entgrenzte Kosmos und der begrenzte Mensch: Beiträge zum Verhältnis von Kosmologie und AnthropologieVon EverandDer entgrenzte Kosmos und der begrenzte Mensch: Beiträge zum Verhältnis von Kosmologie und AnthropologieNoch keine Bewertungen
- Gnosis 05Dokument129 SeitenGnosis 05Angelica LöweNoch keine Bewertungen
- Lohmann-Griechische KulturDokument18 SeitenLohmann-Griechische KulturTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Gott und der Urknall: Religion und Wissenschaft im Wechselspiel der GeschichteVon EverandGott und der Urknall: Religion und Wissenschaft im Wechselspiel der GeschichteNoch keine Bewertungen
- Volkstümliche Geschichte der Philosophie: Die Philosophie des Altertums + Die Philosophie des Mittelalters + Die Philosophie der NeuzeitVon EverandVolkstümliche Geschichte der Philosophie: Die Philosophie des Altertums + Die Philosophie des Mittelalters + Die Philosophie der NeuzeitNoch keine Bewertungen
- Mykene - Bericht über meine Forschungen und EntdeckungenVon EverandMykene - Bericht über meine Forschungen und EntdeckungenNoch keine Bewertungen
- Diels, Kranz, Die Fragmente, Vol 1Dokument462 SeitenDiels, Kranz, Die Fragmente, Vol 1kerbusar100% (4)
- Epiktet Encheiridion IIDokument24 SeitenEpiktet Encheiridion IIYana PotemkinNoch keine Bewertungen
- Zrgra 1880 1 1 1Dokument52 SeitenZrgra 1880 1 1 1Eduardo Gutiérrez GutiérrezNoch keine Bewertungen
- Schilder, Klaas - Zur Allgemeinen Begriffsgeschichte Des ParadoxenDokument467 SeitenSchilder, Klaas - Zur Allgemeinen Begriffsgeschichte Des ParadoxenLars KieselNoch keine Bewertungen
- Enthüllungen: Zur musikalischen Interpretation im Zeitalter ihrer technischen ReproduzierbarkeitVon EverandEnthüllungen: Zur musikalischen Interpretation im Zeitalter ihrer technischen ReproduzierbarkeitNoch keine Bewertungen
- Die Datenbank der Ewigkeit: Was in den alten Schriften über den Sinn des Lebens stehtVon EverandDie Datenbank der Ewigkeit: Was in den alten Schriften über den Sinn des Lebens stehtNoch keine Bewertungen
- Ehrlich, Hugo (1912) 'Untersuchungen Über Die Natur Der Griechischen Betonung' (Weidmann)Dokument296 SeitenEhrlich, Hugo (1912) 'Untersuchungen Über Die Natur Der Griechischen Betonung' (Weidmann)knossasNoch keine Bewertungen
- Versuch über den Menschen: Einführung in eine Philosophie der KulturVon EverandVersuch über den Menschen: Einführung in eine Philosophie der KulturBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (24)
- Briefe an Lucilius / Epistulae morales (Deutsch): 4. BuchVon EverandBriefe an Lucilius / Epistulae morales (Deutsch): 4. BuchNoch keine Bewertungen
- Die Herkunft der Wörter: Eine Einführung in die EtymologieVon EverandDie Herkunft der Wörter: Eine Einführung in die EtymologieNoch keine Bewertungen
- Rudolf Steiner - DAS CHRISTENTUM ALS MYSTlSCHE TATSACHEDokument14 SeitenRudolf Steiner - DAS CHRISTENTUM ALS MYSTlSCHE TATSACHEhenrygermainNoch keine Bewertungen
- Cohen 1914 - Über Das Eigentümliche Des Deutschen GeistesDokument46 SeitenCohen 1914 - Über Das Eigentümliche Des Deutschen GeistesheraklitNoch keine Bewertungen
- Sacris Erudiri - Volume 04 - 1952 PDFDokument412 SeitenSacris Erudiri - Volume 04 - 1952 PDFL'uomo della RinascitáNoch keine Bewertungen
- Scholz - 1880 - Die Alexandrinische U - Bersetzung Des Buches JesaiaDokument46 SeitenScholz - 1880 - Die Alexandrinische U - Bersetzung Des Buches Jesaiawong1266Noch keine Bewertungen
- Synopse Der Griechischen LiteraturDokument1 SeiteSynopse Der Griechischen LiteraturCarlos Calvo ArévaloNoch keine Bewertungen
- (1911) Nelz, C. F. - de Faciendi Verborum Usu PlatonicoDokument46 Seiten(1911) Nelz, C. F. - de Faciendi Verborum Usu PlatonicoCarlos Calvo ArévaloNoch keine Bewertungen
- Gadamer, H.-G. - Praktisches Wissen (1930)Dokument10 SeitenGadamer, H.-G. - Praktisches Wissen (1930)Carlos Calvo ArévaloNoch keine Bewertungen
- (1985) Angehrn, E. - Der Begriff Des Glücks Und Die Frage Der EthikDokument10 Seiten(1985) Angehrn, E. - Der Begriff Des Glücks Und Die Frage Der EthikCarlos Calvo ArévaloNoch keine Bewertungen
- (1978) Hinske, N. - Zwischen Fortuna Und Felicitas. Glücksvortellungen Im Wandel Der ZeitenDokument8 Seiten(1978) Hinske, N. - Zwischen Fortuna Und Felicitas. Glücksvortellungen Im Wandel Der ZeitenCarlos Calvo ArévaloNoch keine Bewertungen
- (1938) Waldmann, M. - Synteresis Oder Syneidesis¿Dokument20 Seiten(1938) Waldmann, M. - Synteresis Oder Syneidesis¿Carlos Calvo ArévaloNoch keine Bewertungen