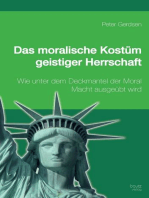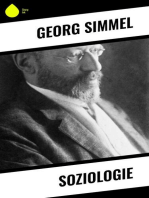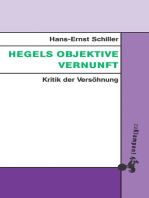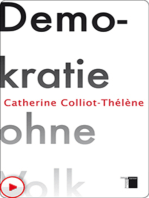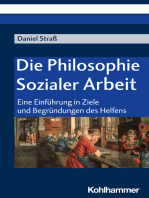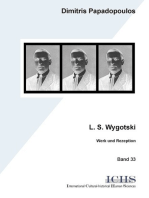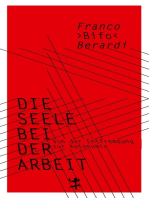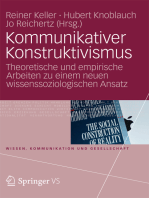Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Soziologie Des Ideologischen Leo Kofler
Hochgeladen von
Gespenst77Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Soziologie Des Ideologischen Leo Kofler
Hochgeladen von
Gespenst77Copyright:
Verfügbare Formate
Kohlhammer
Urban-
Taschenbcher
Reihe 80
Band 868
Leo Kofler
Soziologie
des Ideologischen
Verlag W. Kohlhammer
Stuttgart Berlin Kln Mainz
Alle Rechte vorbehalten
1975 Verlag W. Kohlhammer GmbH
Stuttgart Berlin Kln Mainz
Verlagsort: Stuttgart
Umschlag: hace
Gesamtherstellung W. Kohlhammer GmbH
Grafischer Grobetrieb Stuttgart
Printed in Germany
ISBN 3-17-001958-9
Inhalt
Einleitung ...........................................
7
1.
Was heit berhaupt Ideologie? ......................
9
2.
Das vorbrgerliche Verhltnis vonHerr und Knecht
. . . .
16
3.
Der Diener und der Arbeiter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4. Fetischismus und Verdinglichung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
5.
Fetischismus und Entfremdung
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
6.
Der Intellektuelle als Ideologe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
7. Naturalistische und dialektische Bildung
. . . . . . . . . . . . . .
45
8.Proletarische, kleinbrgerliche und brgerliche Bildung. .49
9. Die Ideologie der Entideologisierung
. . . . . . . . . . . . . . . . .
68
10. Zweite Natur und technologische Ideologie ..........
71
11.
Die ideologische Dialektik vonGenu und Askese
. . . . . .
82
12. Die sthetische Reflexiondes entfremdetenBewutseins
94
13.
Die pseudoreligise Ideologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
14.
Kriminalitt als Ideologie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
15.
Die Ideologie der progressivenElite
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
Anmerkungen ........................................ 139
Einleitung
In den Jahren 1972 bis 1974 habe ich in Verwaltung des Lehrstuhls
fr Soziologie an der Universitt Bochum vier Semester hinterein-
ander in Vorlesungen und Seminaren das Thema der Ideologie be-
handelt. Zur Grundlage nahm ich die in meinen methodologischen,
soziologischen, historischen und sthetischen Schriften verstreut
vorliegenden Untersuchungen zum Problem der modernen Ideolo-
gie. Bei der Studentenschaft entstand sehr bald der Wunsch, da
diese Materialien in einer geordneten und zusammengefaten Weise
vorgelegt werden. Eine Schrift, die in der im folgenden dargebote-
nen Weise das Problem der ideologischen Strmungen in der spt-
brgerlichen Gesellschaft gleichzeitig in seiner groen Differen-
ziertheit und bersichtlich zusammengefat vorlegt, gibt es im deut-
schen Sprachraum noch nicht.
Bei der Abfassung der vorliegenden Schrift bestanden mehrere
Schwierigkeiten. Zunchst mute in seiner Gesamtheit sehr umfang-
reiches Textmaterial organisch zusammengefgt, vielfach wesent-
lich gekrzt und stilistisch verbessert werden, wobei der kundige
Leser in einigen Passagen berschneidungen mit frheren Passagen
feststellen wird. Auch ergab sich die Frage, wie der neue Text sinn-
voll in bersichtliche Abschnitte aufgeteilt werden soll, was mit sich
brachte, da manche Zsuren mitten durch alte Texte gefhrt wur-
den. Endlich stellte sich die Aufgabe, aus der widerspruchsvol-
len Vielfalt der Themen ein theoretisch einheitliches Bild zu ge-
stalten.
Der Versuch, aus bereits vorliegenden Forschungsergebnissen eine
neue Schrift zu komponieren, ist zweifellos ein ebenso seltener wie
gewagter Schritt. Der Leser mge ihn mit Hinweis auf den Zwang,
den Studierenden wie dem brigen theoretisch interessierten Publi-
kum einen geschlossenen Text zum schlechthin schwierigsten Pro-
blem der modernen Soziologie, dem der Ideologie, anzubieten, ent-
schuldigen.
Dem Leser sei geraten, sich den aus systematischen Grnden an den
Anfang gesetzten Abschnitt Was heit berhaupt Ideologie? nach
der Lektre der Schrift (nochmals) vorzunehmen, da manche der in
diesem Abschnitt abgehandelten Begriffe und Probleme erst durch
die nachfolgenden Ausfhrungen voll verstndlich werden.
Leo Kofler
7
1 .
Was heit berhaupt Ideologie?
Das Verhalten des Menschen zur Objektwelt wird durch das Den-
ken hindurch, d. h. mittels der aktiven, zielgerichteten (teleologi-
schen) und whlenden Stellungnahme vollzogen. In Hinsicht auf die
Gesellschaft, der jeder Mensch als ein integrierender Bestandteil zu-
gehrt, bedeutet das aber, da sie ihm nicht als etwas blo uerli-
ches begegnet, sich in seinem Denken nicht blo widerspiegelt,
sondern mit ihm identisch wird: zum Denken dieses Gedachten. Die
gesellschaftliche Welt, der der Mensch einerseits als einzelner als ei-
ner ueren begegnet, ist andererseits dieses Denken selbst insofern,
als es sich in den Bestimmungen reflektierter Objekte geradezu ver-
wirklicht. In diesem
wohlverstandenen Sinne sind Denken und ge-
sellschaftliche
Wirklichkeit identisch.
Dies ist zu verstehen aus dem Charakter des gesellschaftlichen Seins,
das sich aus denkenden und ihre Beziehung zueinander durch ihr
Denken verwirklichenden Individuen zusammensetzt. In dieser
Weise reflektiert sich die Gesellschaft selbst, ist das Denken der In-
dividuen in seiner komplexen Vernetzung zugleich das Denken der
Gesellschaft.
Daraus resultiert, da alles gesellschaftliche Denken, sofern es sich
unvermeidlich das gesellschaftliche Sein zu eigen macht und den in-
dividuellen wie sozialen Bindungen, Bedrfnissen und Zielen ent-
sprechend reflektiert und formt, schon in dieser anthropologischen
Bestimmung allen menschlichen Verhaltens zu seiner eigenen Welt
sich als das erweist, was man ideologisch zu nennen pflegt. Ideolo-
gisch heit hier soviel wie: nicht unmittelbar durch das dem Den-
ken Entgegenstehende (den Gegen-Stand) bestimmt, sondern durch
das Denken dieses Gegenstandes, durch den denkenden Gegen-
stand, durch die in seinem Denken- sich richtig oder falsch- erken-
nende Gesellschaft selbst, woraus sich die oben behauptete Identitt
von Denken und Sein ergibt.
Dieser Sachverhalt kann auch folgendermaen formuliert werden:
Weil in anthropologischer
Sicht Denken und Sein dialektisch iden-
tisch sind, deshalb bestimmt im praktischen
Proze das Sein das
Denken. Das anthropologisch eingesehene Verhltnis von Denken
und Sein schlgt im praktischen Bereich seiner historischen Realisie-
rung um in das dem empirischen Schein nach entgegengesetzte
Verhltnis von Sein und Denken.
Der Widerspruch zwischen den beiden aufgewiesenen Formen von
Sein und Denken stellt als theoretisch aufgehobener und somit
9
in seiner Identitt eingesehener das dar, was das Ideologieproblem -
in seiner formalen und nicht inhaltlichen Seite betrachtet-insgesamt
ausmacht. Nichts, was den historischen Proze menschlicher Exi-
stenz betrifft, existiert auerhalb der Identitt dieses Widerspruchs;
nichts kann es geben, auch sogenannte philosophische Wahrheit
nicht, das sich hier heraushlt. Alles spielt sich innerhalb dieser dop-
pelten Identitt ab, ist somit unweigerlich ideologisch.
Auch die sogenannte philosophische, d. h. fr alles Sein gltige
Wahrheit ist standortgebunden insofern, als sie ermglicht und
erzeugt wird innerhalb einer gesellschaftlichen konkreten Sub-
jekt-Objekt-Beziehung. Auch sie ist das Ergebnis der gedanklichen
Assimilation eines bestimmten gesellschaftlichen Prozesses und sei-
ner Probleme. Das Spezifische dieses bestimmten Ausschnitts in der
gesellschaftlichen Entwicklung liegt eben darin, da er, aus welchen
Grnden immer, der Wahrheitsfindung gnstig ist. Eine fr eine
solche Wahrheitsfindung gnstige gesellschaftliche Situation bedeu-
tet zugleich, da sie die Tendenz ihrer berdauerung gebiert. Ein-
mal als Wahrheit erkannt und formuliert, pflegt sie lange Epochen
zu berdauern. Die soziologische Zuordnung im ideologischen
Proze des Entstehens dieser Wahrheit schliet ihre inhaltliche Ob-
jektivitt und ihre Objektivierung gegenber diesem Proze nicht
aus.
Dabei behlt die Zuordnung ihren Wert, nicht etwa, weil sie
ber den Wahrheitsgehalt selbst etwas aussagen wrde, sondern
umgekehrt, weil durch sie ein Licht geworfen wird auf den histori-
schen Stellenwert und den Charakter der gesellschaftlichen Krfte
und Tendenzen, die seine Findung ermglicht haben.
Mit dieser Form der Verselbstndigung der objektiven Wahrheit
dem Sein gegenber ist nicht zu verwechseln jener ideologische Ver-
selbstndigungsproze, der fr das falsche, den Trger tuschende
Bewutsein bezeichnend ist. Der Unterschied liegt in folgendem.
Die zur selbstndigen Geltung gelangte objektive Wahrheit bleibt
es, auch wenn sie zu einem gegebenen Zeitpunkt von der ffent-
lichkeit nicht akzeptiert ist. Dagegen beruht die Verselbstndigung
des falschen Bewutseins darauf, da es sich nur zum Schein zu einer
eigenen Kraft verdichtet und seinen sozialen Trger beherrscht, je-
doch von diesem in allen seinen Bestimmungen abhngig ist. Mit
dem Verschwinden dieser Schicht verschwindet auch dieses Be-
wutsein. Auch die objektive ideologische Wahrheit, vor allem jene,
die in einem gemeingltigen philosophischen und daher berhi-
storischen Sinne wahr ist, kann zu einer die Massen beherrschenden
Macht werden; aber sie wird nicht bedeutungslos und verschwindet
nicht mit dem Verschwinden dieser Massen von der geschichtlichen
Bhne oder mit der Abschwchung ihrer Fhigkeit, sie zu akzeptie-
10
ren. Daher ist die Behauptung Herbert Marcuses, da die philoso-
phische Wahrheit niemals soziologisch zugeordnet werden kann,1
dem wirklichen ideologietheoretischen Gehalt nicht angemessen, zu
allgemein und in der Formulierung bereits so gehalten, da sie der
definitionsmig vereinseitigten Apriori-Gleichsetzung von Ideo-
logie und falschem Bewutsein entgegenkommt. Es entsteht hier der
Schein einer totalen Unabhngigkeit der im geistesgeschichtlichen
Verlaufe entstandenen Wahrheitserkenntnis und einer sie tragenden
genialisch freischwebenden intellektuellen Elite.
Als ob bei-
spielsweise die Grundstze der Hegelschen Dialektik, die Marcuse
zum Bereich der objektiven philosophischen Wahrheit zhlen wr-
de, nicht ihre historischen Wurzeln in der scharfsinnigen Beobach-
tung der franzsischen Revolution und der englischen konomie
nebst den in ihnen wirkenden Herr-Knecht-Verhltnissen gehabt
htten.
Der Sinn der Erforschung des Ideologieproblems liegt darin, zu er-
fahren, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen falsches Be-
wutsein und unter welchen Wahrheit, also richtiges Bewutsein,
mglich geworden sind und artikuliert wurden. Womit gleichzeitig
die Wesenheit dieser Bedingungen selbst zur Erhellung gelangt.
Sprachen wir bisher von der ideologischen Wahrheit schlechthin, so
kompliziert sich das Problem dahingehend, da es im Bereich des
Ideologischen verschiedene, darunter auch historisch relativierte
Formen solcher Wahrheit gibt. Es sind drei Formen der ideologi-
schen Wahrheit zu unterscheiden. Erstens: Eine ideologische Aus-
sage kann sich im Lichte einer spteren theoretischen Analyse als ein
Gebilde zu erkennen geben, das mit verfehlten Vorstellungen ber
den Menschen und ber die Geschichte arbeitet, jedoch gleichzeitig
wahr sein in dem Sinne, da sie sich in den Dienst des Vollzugs des
notwendigen nchsten historischen Schritts stellt. Wir sprechen hier
von der relativen ideologischen Wahrheit. Zweitens: Sie kann wahr
sein, weil sie konkrete Teilbereiche des gesellschaftlichen und histo-
rischen Geschehens, bestimmte Epochen oder einzelne ihrer Ph-
nomene zur gleichen Zeit ihrer Existenz richtig deutet. Wir whlen
hierfr die Bezeichnung der konkreten ideologischen Wahrheit.
Drittens: Eine durch besonders gnstige Umstnde veranlate ideo-
logische Aussage kann wahr sein, wenn sie gemeingltige Erkennt-
nisse anthropologischer, philosophischer, sozialtheoretischer usw.
Natur enthlt, Wahrheiten, die in ihrer Entstehung, jedoch nicht in
ihrem Gehalt an bestimmte gesellschaftliche Konstellationen ge-
bunden sind und die, einmal formuliert, ihre Entstehungszeit ber-
dauern. Wir bezeichnen sie als die
objektiven ideologischen Wahr-
heiten. (Die berwindung des Stndestaates in der franzsischen
1 1
Revolution hat z. B. - zunchst fr Marat - die Klassenstruktur der
Gesellschaft sichtbar hervortreten lassen und erst zu diesem Zeit-
punkt theoretisch formulierbar gemacht.) Da sie stets ideologische
Gebilde bleiben, ist auch daran zu ermessen, da sie vielfach noch
mit wechselndem Schicksal der Anerkennung seitens solcher geisti-
gen Mchte unterworfen bleiben, die ihrerseits ideologischer Her-
kunft sind. Selbst als feststehenden Wahrheiten bleibt ihnen nicht
das Schicksal erspart, im Raume der spteren, d. h. ihrer ideologi-
schen Entstehungszeit folgenden Auseinandersetzungen noch im-
mer eine ideologische Rolle spielen zu mssen. (Wiederum ein Bei-
spiel:
Hat die berwindung des Vorrangs der stndestaatlichen Or-
ganisation der Gesellschaft das reine Heraustreten der Dialektik des
Umschlagens von subjektivem Handeln in den objektiven Pro-
ze und umgekehrt zur Folge gehabt, so bedurfte es nur der genialen
Kpfe, die diesen Proze analysierten und die Grundlage fr den
Historischen Materialismus schufen; nichtsdestoweniger ist er aus
ideologischen Grnden noch immer umstritten.)
Der begriffliche Unterschied zwischen dem richtigen und falschen
Bewutsein ist nicht aus dem Begriff der Ideologie selbst abzuleiten,
sondern begrndet sich ideologietheoretisch in der Form ihrer ideo-
logischen Verselbstndigung gegenber der Gesellschaft.
Das falsche Bewutsein verselbstndigt sich gegenber seinem ge-
sellschaftlichen Trger, indem es ihm wie eine ideelle Gewalt von
fremder Herkunft, aber versehen mit der Kraft, als Wahrheit An-
erkennung zu erzwingen, erscheint. (Denken wir beispielsweise an
den chauvinistischen Nationalismus.) Sowohl die Meinungs- und
Bekenntnisideologien, die eine subjektive Stellungnahme erfordern,
als auch die spontan-unbewut das Denken besetzenden fetischisti-
schen Ideologien, die sich um die Vorstellung der zweiten Natur
bewegen und das Handeln kategorial bestimmen (wir kommen
darauf ausfhrlich zurck), erscheinen unter der Bedingung der
strukturellen Verdinglichung in der doppelten Gestalt: das eine Mal
als ideelle und das andere Mal als praktische Mchte, denen sich zu
entziehen soviel bedeutet wie den Verlust der Fhigkeit, im ffentli-
chen wie privaten Leben zulrglich zu funktionieren. Zwar ist der
Weg des Entstehens beider ideologischer Formen ein irrationaler,
denn die eigentlichen Entstehungsgrnde bleiben dem Individuum
vollkommen unbewut. Aber das eine Mal pflegt es seine Ansichten
in eine rationale Form zu kleiden, whrend es die unmittelbaren Re-
flexionen des verdinglichten Daseins wie Naturgewalten, die man als
unbegreifliche ber sich ergehen lt, hinnimmt. Nur in der abgelei-
teten theoretischen Sphre wird der Versuch unternommen, sie ra-
tional zu begreifen. In beiden Fllen vollzieht sich die Verselbstn-
12
digung des ideologischen Himmels gegenber dem Individuum
mittels seines Verhaltens selbst, d. h. mittels seiner gesellschaftlichen
Ttigkeit unter der Bedingung der arbeitsteiligen und anarchischen
Warenstruktur (worber spter Nheres).
Genau umgekehrt verhlt es sich mit jener Form der ideologischen
Verselbstndigung, die wir der objektiven Wahrheit zurechnen. Sie
entspringt nicht unmittelbar dem verdinglichten Proze, sondern
der Anstrengung seines Durchschauens, wenn auch nicht in intel-
lektueller Freiheit, wie oft behauptet, sondern unter bestimmten
gnstigen Konstellationen fr eine soziale Gruppe innerhalb einer
ebenso fr diese Erkenntnis gnstigen Konstellation der ganzen Ge-
sellschaft. Im Durchschauen enthllt sich dem Denken die Sicht auf
solche Zusammenhnge wie Freiheit und Notwendigkeit, Kausalitt
und Norm, Ttigkeit und Telos, Proze und Moment usw. Es ent-
steht richtiges Bewutsein in der Bedeutung einer gleichzeitig ideo-
logischen und philosophischen Wahrheit.
Von diesen philosophischen, auf die allgemeinsten Bestimmungen
gesellschaftlicher Existenz ausgerichteten
Wahrheiten unterschei-
den sich die konkreten. Sofern sie ein besonders theoretisches Inter-
esse erwecken im Zusammenhang mit dem das gesamte Bewutsein
der brgerlichen Gesellschaft durchsetzenden Tatsachenfetischis-
mus - der darin besteht, da die infolge der arbeitsteiligen gesell-
schaftlichen Anarchie fr das falsche Bewutsein zerstrte Totalitt
durch ein System von ideologischen Tuschungen ersetzt wird, die
sich als Tatsachen geben-, insofern bestimmt sich das Wesen die-
ser konkreten Wahrheiten durch die Fhigkeit, die Tatsachen auf
ihren wirklichen Gehalt zu reduzieren und von ihren ideologischen
Hllen zu befreien. Aber diese Fhigkeit ist selbst wiederum und ge-
rade wegen ihres antiideologischen Affekts zum realen gesellschaft-
lichen Geschehen vermittelt und deshalb in der oben definierten Be-
deutung des richtigen Bewutseins ideologisch gebunden.
Die Erkenntnis eines jeglichen Denkens, auch des richtigen, als ei-
nes, das sich anthropologisch und erkenntnistheoretisch bestimmen
lt als nach allen Seiten hin an die gesellschaftliche Subjekt-Ob-
jekt-Beziehung gebunden und als die Form der konkreten Selbst-
erkenntnis wie auch Bedingung der darauf beruhenden Reproduk-
tion des gesellschaftlichen Lebens, lt keinen Begriff von Denken
zu, das sich auerhalb des Prozesses der allseitigen gesellschaftlichen
Bestimmtheit des Bewutseins durch das Sein hlt.
Damit stellt sich aber ein spezifisches Problem, ein Problem, das an
die Frage gebunden ist: Wie ist diese Bestimmtheit des ideologischen
Bewutseins durch das gesellschaftliche Sein des genaueren vorzu-
stellen? Erkenntnistheoretisch ausgedrckt: Wie ist sie berhaupt
1 3
mglich? Es geht hierbei um den Aufweis der konkreten Dialektik
von Sein und Bewutsein. Vorausgesetzt, da unsere oben entwik-
kelte These von der Bestimmtheit eines jeglichen Denkens durch die
gesellschaftlichen Verhltnisse richtig ist, bedeutet die These impli-
zit auch soviel, da die Gesamtheit des Bewutseins und die Ge-
samtheit des gesellschaftlichen Seins in einer dialektischen Vermitt-
lung zueinander stehen, somit das ausmachen, was unter den Begriff
der Totalitt fllt.
Alle konkrete Dialektik ist identisch mit der Vermittlung in der To-
talitt. Als Realdialektik ist sie schon im Hegelschen System zur
Entwicklung gelangt, denn fr Hegel war jede Vermittlung ein Ge-
setz der Wirklichkeit. Jedoch fehlte der Hegelschen Dialektik der
konkrete, in den realen Bedingungen des Geschichtsprozesses selbst
auffindbare Totalittsbegriff. Die blo spekulative Behauptung der
Totalitt macht noch nicht ihre Konkretheit aus. Um konkrete Tota-
litt zu sein, mu sie erst ein Gesetz erzeugen, und das Begreifen
dieses Gesetzes macht erst die Geschichte als Objekt der dialekti-
schen Totalitt begreiflich.
Die konkrete Totalitt realisiert sich durch die im Historischen Ma-
terialismus zur zentralen Kategorie erhobenen Produktionsverhlt-
nisse. Im Zusammenhang mit der so verstandenen Totalitt geben
sich die vielfltigen gesellschaftlichen und ideologischen Erschei-
nungen immer als im Rahmen eines durch die Produktionsverhlt-
nisse bestimmten Beziehungsganzen vermittelt. Hier erscheinen
auch die abseitigsten Phnomene der Geschichte als in einer funk-
tionalen Beziehung innerhalb der die Gesamtheit der Phnomene
zueinander vermittelnden Produktionsverhltnisse stehend. Das
bedeutet die Einsicht in ein Beziehungssystem, dessen ideologische
Ausdrucksform die in ihrer Gesamtheit sich deutlich als ideeller
Ausdruck innerhalb der durch bestimmte Produktionsverhltnisse
strukturell durchwirkten Totalitt ist. Mit anderen Worten: Pro-
duktionsverhltnisse und Gesellschaft einer bestimmten Epoche
sind Wechselbegriffe und umschreiben diese Epoche als Totalitt.
Das bedeutet, da die Beziehungen, die die Individuen und Klassen
in der Produktion ihres Lebens (Marx) eingehen, auch schon alle
brigen Erscheinungen der Gesellschaft mitbedingen, wenn auch
zumeist in einer sehr vermittelten Weise; somit kann nichts auer-
halb und neben den Produktionsverhltnissen bestehen, und des-
halb ist die Totalitt der gesellschaftlichen Erscheinungen bereits mit
den Produktionsverhltnissen funktional gegeben. Einer solchen
Betrachtungsweise kommt es nicht mehr darauf an, zu jedem ideo-
logischen einen eigenen konomischen Bezugspunkt zu finden, wie
ein weitverbreitetes Miverstndnis seit Eduard Bernsteins Kritik
14
am Historischen Materialismus (1896) vermeint. Im Gegenteil, da
konomie und Ideologie aufgrund der Tatsache, da es auch kein
konomisches Handeln ohne den Durchgang durch den menschli-
chen Kopf (Engels) gibt, ihrerseits Struktureinheiten darstellen, die
in einer funktionalen Abhngigkeit innerhalb der gesellschaftlichen
Totalitt zueinander stehen, die Ideologie als Ganzes daher immer
nur als Funktion der konomie erscheint, gengt es, wenn einzelne
ideologische Momente einem greren ideologischen Zusammen-
hang zugeordnet werden und dieser dann seinerseits konomisch
zugeordnet wird.
Dieses Begreifen der Gesellschaft einer bestimmten Epoche als funk-
tionales Beziehungsganzes oder als Totalitt macht der Hauptsache
nach die Materialistische Geschichtsauffassung aus; und das in der
populren Vorstellung so beliebte Schema von der direkten Be-
dingtheit eines jeglichen Teiles des berbaus von einer bestimmten
Sphre des Unterbaus ist nur ein verzerrter Ausdruck davon. Fr das
Verstndnis der Geschichte ist viel mehr damit gewonnen, wenn ei-
nem ideellen Faktor innerhalb der Totalitt der gesellschaftlichen
Beziehungen ein angemessener Platz zugewiesen wird, als wenn
man fr jede, sei es noch so abseitige, ideologische Erscheinung ei-
nen genau zu ihr passenden konomischen Faktor ausfindig zu ma-
chen versucht. 2 Aber abgesehen von der Richtigstellung, die hier mit
Hilfe der Totalittsvorstellung am vulgrmarxistischen Denken vor-
zunehmen war, zeigt sich die theoretische Fruchtbarkeit des Den-
kens in der Totalitt der Produktionsverhltnisse besonders dort,
wo man auf die vergeblichen Bemhungen brgerlicher Denker
stt, alle gesellschaftlichen Strukturelemente, Gegenstze und Wi-
dersprche ihres antagonistischen Charakters zu entkleiden und ei-
nem mehr oder weniger willkrlich herausgegriffenen Einzelmerk-
mal zumeist ideeller Art als einem die ganze Epoche formenden
Merkmal zu subsumieren. 3
Der konkrete Totalittsbegriff mu aber selbst genau analysiert
werden, bevor er zur theoretischen Anwendung gelangt. Die Pro-
duktionsverhltnisse sind, wie der Ausdruck sagt, Verhltnisse, und
zwar solche von Menschen, die diese in der Produktion ihres Lebens
eingehen mssen. Mit dieser Einsicht erschliet sich fr die dialekti-
sche Theorie eine neue Seite: Ausnahmslos wird jeder der sozialen
Welt zugehrige Begriff als gesellschaftliches Verhltnis oder als
vermittelter Ausdruck eines solchen Verhltnisses bestimmt. Hier
macht die Dialektik einen Sprung ber ihre ursprngliche Begrenzt-
heit, sich in der Neubestimmung der Begriffe zu erschpfen, hinaus.
Das Begriffsbild jener sozialen Erscheinungen wird vllig verndert,
die sich im ideologischen Bewutsein der Gesellschaft hartnckig
15
als nichtmenschliche und groe gesellschaftliche Macht ausbende
Gegenstnde darstellen. Es handelt sich dabei um die theoretische
Leistung, den Verdinglichungs- und Fetischcharakter - ber diese
Begriffe sprechen wir spter ausfhrlich - jener Kategorien, die
scheinbar als dinghafte Mchte den Gang des gesellschaftlichen Pro-
zesses beeinflussen, aufzulsen und ihr wahres Wesen zu erhellen.
Eine ganze Reihe vorwiegend konomischer Begriffe wie Kapital,
Ware, Wert, Profit und Technik werden als Ausdruck zwischen-
menschlichen Geschehens verstanden; sie werden zu sozialen Ver-
hltnisbegriffen und als Ausdruck von Verhltnissen zwischen den-
kenden, d.h. ideologisch gebundenen Individuen entlarvt.
Damit ist in einer auf die letzte Wurzel, nmlich auf das Bewut-
seinsmige menschlicher Existenz zurckgehende Weise geklrt,
da dasjenige, was wir als die gedankliche Welt des ideologischen
berbaus ansehen, vermittelt ist zu einer Gedankenwelt, die sich
blo auf einer niedrigeren Stufe des gesellschaftlichen Prozesses
vollzieht, der praktisch-konomischen. Das in der ideologisch tu-
schenden Begriffswelt des brgerlichen Individuums erscheinende
Verhltnis der Kontemplation (der Fremdheit) zwischen Sein und
Bewutsein erweist sich als faktisch aufgehoben: Es ist auf diese
Weise die Frage beantwortet, wie die Bestimmtheit des ideologi-
schen Bewutseins durch das gesellschaftliche Sein berhaupt mg-
lich ist. Verkrzt ausgedrckt: Sie ist mglich, weil Sein und Be-
wutsein nur verschiedene Ausdrucksformen ein und derselben
Qualitt sind, nmlich des zwischenindividuellen und durch den
Kopf hindurchgehenden, d.h. gedanklichen Reflektierens. Als ver-
schiedene Ausdrucksformen erscheinen sie das eine Mal als rein
konomische, das andere Mal als rein ideologische dadurch, da sich
der denkende Mensch das eine Mal auf den Mitmenschen auf der
Ebene der Auseinandersetzung mit der Natur, das andere Mal auf
der Ebene des reflektiv-ideologischen Austausches bezieht.
2.
Das vorbrgerliche Verhltnis von Herr und Knecht
Auer dem Vagabundenpaar Wladimir und Estragon erscheinen in
Becketts Warten auf Godot der Herr und der Knecht, Pozzo und
Lucky, auf der Bhne. Der aufflligste Teil in der Begegnung zwi-
16
schen Pozzo und Lucky ist jener, da Pozzo seinem Knecht in einem
herabwrdigenden Tone befiehlt, zu denken und zu sprechen:
Denke, Schwein... Denke! Lucky beginnt einen endlos langen
und nach Becketts eigenen Anweisungen monotonen Vortrag, der
sich aus verworrenen und unzusammenhngenden Sprachfetzen,
vor allem aber aus philosophischen, theologischen, psychologi-
schen, anthropologischen und naturwissenschaftlichen Fachaus-
drcken zusammensetzt. Er spricht berraschenderweise wie ein In-
tellektueller.
Damit lftet sich das Geheimnis des Knechts Lucky. Der Dichter er-
fat hier intuitiv ein bedeutendes Problem, das Problem des uner-
kannten Knechtdaseins des Intellektuellen. Faktisch fllt diese Deu-
tung mit der dialektisch-soziologischen zusammen. Die Totalitt
des gesellschaftlichen Prozesses, die auf der Dialektik von Ttigkeit
und Abhngigkeit oder, was dasselbe ist, auf der dialektischen Iden-
titt von Subjekt und Objekt (auf der Subjekt-Objekt-Beziehung)
beruht, duldet nicht den Begriff einer fr sich bestehenden Intelli-
genz, einer gleichsam auerhalb des Prozesses stehenden und ihn
kontemplativ interessiert betrachtenden Schicht von theoretischen
Produzenten. Die Haltung der Kontemplation fllt zusammen mit
der Einbildung der Kontemplation und ist selbst ein Moment des ar-
beitsteilig-verdinglichten Prozesses, fr dessen Durchsetzung und
Reproduktion der Schein der Selbstndigkeit des Denkens geradezu
Bedingung ist. Dieser Tatbestand lt sich aus der hypothetischen
Umkehrung des Zusammenhangs erhellen: Wre sich der Intellek-
tuelle seiner wahren Funktion in der ununterbrochenen Selbstre-
produktion des gesellschaftlichen Prozesses voll und ganz bewut,
so wrde er damit einen Standort gewinnen, von dem aus er diesen
Proze durchschauen knnte; die totale Kritik wre die Folge, aber
ebenso auch die totale Zerstrung dieses Prozesses, weil dieser dann
berhaupt kein Bewutsein htte, mit dessen Hilfe allein er sich zu
reproduzieren vermag. Die ideologische Tuschung der reinen Kon-
templation des ideologieproduzierenden intellektuellen Bewut-
seins ist selbst eine notwendige Voraussetzung der Unterwerfung
dieses Bewutseins in der Praxis dieses Prozesses, der Vernichtung
der rein kontemplativen Tendenzen. Oder anders ausgedrckt: Die
ihm zugestandene Freiheit bildet die Voraussetzung fr das Knecht-
dasein des Intellektuellen.
Erweist sich der Intellektuelle somit als der eigentliche Knecht in
einer
Welt, in der das Herr-Knecht-Verhltnis dominiert, so ist die-
ses Verhltnis selbst das des Klassenverhltnisses zwischen dem
praktisch ttigen Knecht, dem modernen Proletarier, und seinem
Herrn. Diesem Verhltnis, dem modernen Proletarier-Bourgeois-
1 7
Verhltnis, geht aber ein Herr-Knecht-Verhltnis historisch voraus,
das zu reflektieren fr jenes aufschlureich ist.
Brechts Grundbesitzer Puntila und sein Knecht Matti sind versp-
tete Reminiszenzen aus den vorbrgerlichen Zustnden, obgleich
mit der Absicht der Parallelisierung zu brgerlichen Verhltnissen.
Eine solche Parallelisierung kommt aber eigentlich erst durch den
Theaterbesucher zustande, der unwillkrlich das Dargebotene auf
seine eigene Zeit bertrgt. Die Verfremdung ist geglckt, die Pro-
bleme selbst jedoch sind nicht zulnglich genug die modernen. Denn
der Proletarier des 20. Jahrhunderts verbirgt hinter der Maske des
Dienenden eine, wegen der im Vergleich zum einstigen wirklichen
Diener vllig vernderten Beziehung zum Herrn, unvergleichbar
andersgeartete Wesenheit.
Will man den Unterschied, zunchst nur allgemein, einsehen, so ist
Till Eulenspiegels Gestalt heranzuziehen, die mit oft absichtlicher
Verblassung ihres wirklichen Kerns als bloes Sinnbild des Volks-
humors gedeutet zu werden pflegt. Der Eulenspiegel-Mythos hat,
sobald volkshafte oder brgerliche Bewegungen antifeudaler Natur
am Horizont sich abzuzeichnen begannen, stets und durch alle son-
stigen
Wandlungen hindurch einen sozialkritischen Charakter an-
genommen. Auch hier noch ergreift die Reminiszenz einen Brecht,
dessen Schweyk die soziale Note deutlicher hervortreten lt, wenn
auch nicht ohne die traditionelle und fr sich stehende schalkhafte
Tendenz, die zeitweilig ins Possenhaft-Kabarettistische ausartet,
wie Holthusen mit Recht bemerkt.4 Doch ist dies nicht weiter er-
staunlich, denn die Tragik des modernen Proletariers, die nur in ge-
ringem Mae den Humor und dessen naiveren Ableger, die Komik,
zult, ist ihm ebenso fremd wie dem Eulenspiegel, der die Posse
nicht weniger liebt. Wie sich berhaupt dieser humoristische Zug
des Knechts in vielen Darstellungen der Vergangenheit wiederholt.
Dies mit wenigen Ausnahmen eigentlich nur, wie beispielsweise
Tolstoi, der in seinen Novellen, die das menschlich problematische
Verhltnis zwischen dem Herrn und seinem Knecht behandeln, eine
eher sentimentale Stimmung aufkommen lt. Wir kennen die Tra-
gik auch aus vielen literarischen Zeugnissen des 19. und 20. Jahr-
hunderts, die nicht die vorbrgerliche, sondern die brgerliche Welt
in ihren dsteren Arbeitergestalten behandeln.
Doch ist dieser Unterschied zu erklren. Er liegt darin, da sowohl
die Tolstoische sptbuerliche als auch die industrielle Welt die
Frage der Revolution des leidenden Volkes als einer selbstndigen
Macht bereits stellen und den tragischen Charakter aller volkshaften
Befreiungsbewegungen erkennen. Es verhlt sich bei Gorki hnlich
wie bei Zola, bei Scholochow hnlich wie bei Georg Kaiser.
1 8
Dagegen wird in der vorbrgerlichen Epoche das Volkshafte nur sel-
ten in seinem tragischen Ernst genommen, sei es, da es noch von
keiner historischen Bedeutung ist und deshalb seine Kritik in den
Till Eulenspiegelschen Humor umsetzt, sei es - und darauf kommt
es hier wesentlich an -, da das sich zeitweilig mit den Volksmassen
verbndende revolutionre Brgertum sich der Gestalt des dem feu-
dalen Herrn Dienenden als sozialen Symbols bedient, um die ver-
sinkende mittelalterliche Gesellschaft zu desillusionieren. Soll aber
die
Kritik nicht auch die Basis des aufkommenden brgerlichen
Herr-Knecht-Verhltnisses selbst annagen, so setzt sich ideologisch
eine fast einheitlich durchgefhrte doppelte Linie durch: Einerseits
wird von der Vielfalt der Herr-Knecht-Beziehungen, zu denen bei-
spielsweise bereits die manufakturellen gehren, zugunsten des am
leichtesten gegen den adeligen Herrn ironisch auszuspielenden, weil
in einer unmittelbaren persnlichen Beziehung zu ihm stehenden
Dieners abstrahiert; anderseits wird dieses Problem, nebst seiner
Einkleidung ins Humoristische, ins Ironische gezogen. Durch letz-
teres
wird ihm der volle Ernst, durch den die Herr-Knecht-Frage
nicht als eine blo gegen den Feudalismus gerichtete relative, son-
dern als fr alle Klassengeschichte geltende grundstzliche gestellt
werden knnte, genommen.
Was immerhin bleibt und in diesem Rahmen, wie wir noch sehen
werden, in einer oft auerordentlich interessanten und scharf-
sinnigen
Weise behandelt wird, ist die ironische Aufhebung und
Kritik des Herrenrechts des feudalen Herrn. Da gelegentlich mehr
durchscheint, ist eher der intuitiven Genialitt einzelner Autoren als
der geltenden ideologischen Tendenz zuzuschreiben. Insbesondere
seit Diderot und speziell seit Hegel, der bereits die industrielle Revo-
lution in England voll erlebt, lt sich diese gelegentliche
Grenzberschreitung beobachten. Noch bei Voltaire, der auf die
Tatsache des Verhltnisses von Diener und Herrn fters Bezug
nimmt, wird sie nicht ernstlich zu einem Problem, obgleich eine ge-
wisse Ahnung von der spter zum wichtigen Argument erhobenen
berlegenheit des das praktische Leben besser beherrschenden
Knechts vorhanden ist. Beaumarchais' antiadeliger Vorsto ist zu
theatralisch-allgemein gehalten, um geistesgeschichtlich interessant
zu sein, selbstverstndlich abgesehen von der Bedeutung fr die
Aufklrung des vorrevolutionren Publikums.
In Wilhelm Hauffs Die Bettlerin vom Pont des Artsa findet sich die
folgende interessante Stelle: 5
Und der Diener, der ihm stolzen Schrittes folgt, erinnert er nicht ... an jene
Diener im spanischen Lustspiel, die ihrem Herrn wie ein Schatten treu fol-
1 9
gen, an Bildung tief unter ihm, an Stolz neben ihm, an List und Schlauheit
ber ihm stehen?
Da hier die Linie der Ironisierung der Beziehung zwischen dem
Herrn und dem Knecht zugunsten des letzteren fortgesetzt wird, ist
offensichtlich. Im Hinweis auf den Stolz wird eine Gleichsetzung
vollzogen, im Hinweis auf die Schlauheit, wie auch bei anderen Au-
toren, die Schwche des Knechts und seine Absicht, sich gegen das
vllige Unterliegen unter den Willen des Herrn zur Wehr zu setzen,
betont. Wir werden bei Diderots Jakob und bei Gontscharows Sa-
char hnliches zu beobachten haben. Aber diese Tendenz reicht
nicht zu einem Aufruhr gegen den Herrn. Indem in diesen Darstel-
lungen die Schlauheit des Dieners nicht nur gegen den Herrn gerich-
tet ist, sondern dieser von ihr gegenber der Auenwelt selbst profi-
tiert, wird gleichzeitig auf ein Treueverhltnis des Knechts zum
Herrn hingedeutet. Die schlaue Opposition sprengt nirgends die
Klassenbeziehungen. Und dies liegt ganz im brgerlichen Sinne.
In fast allen uerungen der brgerlichen Aufstiegszeit zum
Herr-Knecht-Problem steht am Ende trotz aller Sympathie fr den
Knecht die Vershnung. Damit erscheint das Klassenverhltnis
selbst als letztlich unaufhebbar. Das Paradigma des Volkswillens
i m Sinne des seit des Marsilius von Padua gesetzten Prinzips der
Volkssouvernitt ist keineswegs die Klassenlosigkeit. Deshalb
fallen sich in Diderots Jakob und sein Herr nach einem heftigen
Streit der Herr und sein Diener wieder um den Hals, wohl wissend,
da sie ohne einander nicht auskommen knnen.6 Deshalb auch
schildert Gontscharow in seinem Oblomow das Verhltnis zwi-
schen dem Herrn und seinem Diener als ein durch vielerlei Um-
stnde unlsbares. Deshalb schlielich kommt es in Lessings
Minna von Barnhelm trotz aller Idealisierung der Dienerfiguren
zu jenen Szenen, in denen sich auf der einen Seite Just und Tellheim,
auf der anderen Franziska und Minna, also Knecht und Herr und
Dienerin und Dame, als einander unentbehrlich erweisen. Selbst die
Erzhlungen Tolstois, in denen der Knecht als der Beschtzer des
Herrn erscheint (nicht umgekehrt), kulminieren im Ausklang der
menschlichen Harmonie zwischen beiden.
Aber trotz gegenseitiger Unentbehrlichkeit und scheinbar guten
Einvernehmens besteht ein dauernder Kampf gegeneinander, so we-
nigstens in der vorrevolutionren franzsischen Fassung, wo der
durch die erstarrten reaktionren Zustnde Deutschlands und Bu-
lands erzwungenen Abschwchung ins Sentimentale der Boden ent-
zogen ist. Jakob kmpft daher um seine durch Schlauheit bereits er-
reichten Rechte, whrend der Herr glaubt, ber sie nach eigenem
Gutdnken verfgen zu knnen:
2 0
Jakob: Ein Jakob, mein Herr, ist so gut ein Mensch wie jeder andere.
Herr:
Jakob, du tuschst dich; ein Jakob ist nicht so gut ein Mensch wie
ein anderer.
Jakob: Manchmal ist er sogar mehr wert als ein anderer.
Herr:
Jakob, du vergit dich...
Jakob:
Wenn in der Kneipe, wo wir die Gauner antrafen, Jakob nicht ein
bichen mehr wert gewesen wre als sein Herr...
Jakob kennt also seine berlegenheit infolge der besseren Kenntnis
des Lebens. Aber er pocht auch auf seine erworbenen Rechte, die
ihm der Herr streitig machen will:7
Jakob: Nachdem Sie mich am Tisch neben sich sitzen lassen, mich Freund
genannt haben.
Herr:
Du weit nicht, was das heit, wenn ein Hhergestellter seinen Un-
tergebenen Freund nennt.
Die Freundschaft zwischen Herr und Knecht besteht darin, da
sie sich gegenseitig brauchen, aber gleichzeitig mitrauen. Allenfalls
schtzen sie sich: der Herr den Knecht wegen dessen praktischen
Fhigkeiten, seiner Lebenserfahrung und Schlauheit, der Knecht
den Herrn, weil er sein Herr ist. Jakob fhlt sich nicht sicher, er
wnscht einen Vertrag. Aber die Weise, wie er den Vertrag auffat,
enthllt das Verhltnis zum Herrn ironisch als ein verkehrtes. Denn
als der eigentlich Abhngige erweist sich hierbei der Herr:
Jakob: ...da Sie den Titel fhren und ich im Besitze der Sache sein sollte.
Herr:
Aber unter diesen Umstnden wre dein Los ja besser als das meini-
ge.
Und als der Herr angesichts dieser verzwickten Lage erwgt, ob man
denn nicht die Rollen tauschen knnte, sagt Jakob klar heraus, da
das nicht ginge, denn der Herr verstnde von der Sache, nmlich
vom Leben, im Grunde nichts: 8
Jakob: Wissen Sie, was dann geschehen wrde? Sie wrden den Titel verlie-
ren und die Sache doch nicht besitzen. Lassen Sie uns bleiben, was
wir sind!
Wie spter der Historische Materialismus vertritt Diderot den
Standpunkt, da gegen alle abstrakten und mythologisierten, sub-
jektivistischen und praxisfremden Deutungen der Erscheinungen
die konkret vom Leben ausgehende Deutung die einzig richtige ist:
Herr: Wo zum Teufel hast du das alles her?
Jakob:
Aus dem groen Buche (des Lebens, L.K.). Ach Herr, man mag
noch so viel berlegen, sinnen und in allen mglichen Bchern stu-
dieren, man bleibt doch immer und ewig ein ABC-Schtze, wenn
man nicht in dem groen Buche gelesen hat.
2 1
Hiermit ist aber auch die uerste Grenze erreicht, die dem theoreti-
schen Bewutsein des revolutionren Brgertums gesetzt ist. Di-
derot selbst eilt sowohl in der Schrfe der ironischen Kritik des
Herr-Knecht-Verhltnisses als auch in der Anerkennung der gesell-
schaftlichen Praxis als der Grundlage der Erkenntnis seiner Zeit vor-
aus.
Das Ironische der Kritik liegt in der Selbstzurcknahme der
Konsequenzen der Aufhebung des antagonistischen Verhltnisses.
berdies werden beide Momente noch ganz im Sinne des Brger-
tums des 18. Jahrhunderts naiv aufgefat: das Herr-Knecht-Ver-
hltnis als ein ewig geltender Vertrag, die Praxis als unmittelbar em-
pirische Lebenserfahrung, wenn auch von Gesetzen geleitete.
Der Diener Sachar in Gontscharows Oblomow ist weitaus naiver
als Jakob, durch den eigentlich Diderot selbst spricht. Whrend Ja-
kob immerhin eine Philosophie hat - seiner Meinung nach ist z. B.
alles Gesetzen unterworfen und vorherbestimmt, woraus sich fr
ihn die dialektische Konsequenz der dauernden Aktivitt ergibt -,
verhlt sich Sachar extrem empirisch. Er folgt daher in seinem Han-
deln nicht irgendwelchen philosophischen Grundstzen, sondern
lt sich treiben. Dadurch wird ihm ermglicht, seinen Herrn in ei-
nem Punkte konsequent nachzuahmen: in der Faulheit. Whrend
aber die Faulheit fr den Herrn gleichsam ein Anspruch, eine nor-
male Folge seiner herrenhaften Mue ist und zum Alltag gehrt, wi-
derspricht die Faulheit des Dieners den Anforderungen, die an ihn
als Diener gestellt sind. Seine Faulheit hat einen verborgenen Sinn.
Sie ist eine Form der Aktivitt, nmlich des Widerstandes gegen die
totale Unterwerfung seines Menschentums, gegen die totale Ent-
fremdung. Zwar ist auch Sachar der Meinung, da sein Verhltnis
zum Herrn ein naturgegebenes ist und daher unaufhebbar:
Er ging mit Ilja Iljitsch grob und familir um, genauso, wie ein Schamane
mit seinem Idol grob und familir umspringt: er staubt es ab und lt es fallen
und versetzt ihm vielleicht manchmal im rger einen Schlag, aber dennoch
ist in seiner Seele stndig das Bewutsein von der berlegenheit der Natur
dieses Idols ber seine eigene gegenwrtig..9
Aber Sachar reflektiert dieses Gefhl nicht rational, sondern nimmt
es hin, wie es in jeder Klassengesellschaft hingenommen wird. Seine
Reflexion ist eine oberflchlich-naturalistische. Demgegenber be-
wegt sich das Denken Jakobs weiter. Zwar kann und will auch er aus
dem Herr-Knecht-Verhltnis nicht heraus, es bleibt auch fr ihn
natrlich; aber er versucht, es bewut zu gestalten, den Vertrag
zu seinen Gunsten zu interpretieren. Deshalb aber auch ist Jakob
ganz dem brgerlichen Gesellschaftsbild gem weitaus illusionrer
als Sachar, der bereits auf die Erfahrungen eines Jahrhunderts br-
gerlicher Entwicklung zurckblicken kann und sich in Hinsicht der
22
vertraglichen bertlpelung seines Herrn keinen Illusionen mehr
hingibt. Der Widerstand geht bei ihm nicht ber den Vertrag, son-
dern ber das mgliche Nichtstun, das er als die beste Form des Be-
stehens innerhalb der gegebenen Ordnung betrachtet.
Die Tragik Sachars liegt darin, da er, um sich gegen die vollkom-
mene Entfremdung schtzen zu knnen, keinen anderen Weg zur
Verfgung hat als den, seinen Herrn nachzuahmen. Damit unter-
wirft er sich ihm und seinen selbst entfremdeten Eigenschaften erst
recht. Der Widerstand ist schlielich ein milungener, und dies in
einem doppelten Sinne. Erstens ist die Nachahmung der Herren-
Faulheit kein Ausweg, sondern bestenfalls ein Surrogat fr die er-
strebte Freiheit, die deshalb ihrerseits zu einer Form der Fesselung
an das Knechtdasein wird. Zweitens mu die Nachahmung des
Herrn milingen, denn es fehlen alle Voraussetzungen dafr, und
der Knecht bleibt ein Knecht.
Diese Tragik ist die Tragik des Menschen in der modernen Entfrem-
dung. Mit ihr kommt der aufmerksame Leser des Oblomow be-
reits in Berhrung, whrend das Problem der Entfremdung in Di-
derots Jakob noch gar keine Rolle spielt. Insofern ist, obgleich Ja-
kob weitaus klger und weitblickender ist als Sachar, der Oblo-
mow insgesamt tiefer und hintergrndiger als der Roman Diderots.
Trotz seiner unphilosophischen Manier ist der Oblomow moder-
ner, denn er rhrt bereits an das Hauptproblem der modernen Klas-
sengesellschaft: das Problem der Entfremdung. Deswegen ist hier
der Humor weniger possenhaft als im Jakob, denn das Umschla-
gen des Humoristischen, das die versteckte Widersprchlichkeit
menschlichen Verhaltens unter entfremdeten Bedingungen aus-
drckt, in das blo Komische ist stets eine Begleiterscheinung des
teilweisen oder gnzlichen Steckenbleibens in der Oberflche der
Erscheinungswelt. Komik und Posse setzen ein, wo nichts mehr ist
auer dem bekannten Selbstverstndlichen; dagegen ist der Humor
im kleinen und widerspruchsvollen Alltag des tragisch-entfremde-
ten Lebens zu Hause. Als bloer Humor lt er allerdings nichts er-
scheinen, sondern alles blo durchscheinen. Insofern ist er der Iro-
nie verwandt, die auf der Bhne der greren Dimensionen arbeitet.
Das Gemeinsame der Literatur des aufsteigenden Brgertums ist die
Idealisierung und Sentimentalisierung des Knechts. Dem skepti-
schen Zug entsprechend, der der Anschauung Gontscharows eigen
ist, ist Sachar mehr oder weniger davon frei. Im allgemeinen lt sich
von dieser Epoche der Literatur sagen, da, je weniger die Ahnung
vom Entfremdetsein des Menschen hindurchdringt, die Sentimenta-
litt oder Idealisierung um so mehr Platz einnimmt. Umgekehrt ver-
hindert das Eindringen der Tatsache der Entfremdung des Menschen
23
in das knstlerische Bewutsein die Tendenz der Idealisierung des
Knechts im Zuge seines ironischen Ausspielens gegen den Herrn.
Diese These besttigt sich z.B. an Lessings Minna von Barnhelm.
Whrend die uerlich als Hauptfiguren auftretenden Personen
Tellheim und Minna in einem gewhnlichen und im Grunde un-
problematischen tragischen Licht erscheinen und recht bla wirken,
sind die drei dienenden Figuren Paul Werner, Just und Franziska die
eigentlich lebendigen, farbigen und interessanten des Stckes. Sie
sind es, die stets Rat wissen, schlau oder witzig, ehrlich und treu
sind, die Handlung beleben und vorwrts bringen. Ihre idealistische
und sentimentale Verklrung hat hier einen Hhepunkt erreicht.
Von tieferen, sozial-menschlichen, das Entfremdetsein wenigstens
zum Durchscheinen bringenden Problemen (wie schon ungefhr
gleichzeitig bei Schiller in seinen Untersuchungen zur sthetik) ist
hier keine Spur zu bemerken. Als eine in gewissem Sinne zweifellos
abstrakte Regel kann angesehen werden, da, je mehr sich das Den-
ken den reiferen brgerlichen Zustnden annhert, es um so mehr
von Ahnungen der Bedrohung des Menschen seitens der kapitalisti-
schen Entfremdung erfllt ist. Es geht hierbei nicht um die blo zeit-
liche Abfolge, sondern unter Voraussetzung des wirklichen ge-
schichtlichen Ablaufs auch um die Reife dieses Denkens bei den ein-
zelnen Autoren. Das Vorausahnen oder das Zurckbleiben spielen
eine entscheidende Rolle. Voll und ganz stellt sich die Frage der Ent-
fremdung erst auf dem Boden des modernen Proletariats.
Das brgerliche Bewutsein fat das Herr-Knecht-Problem vor-
nehmlich als ein solches der natrlichen Unter- und berordnung
auf. Zwar wurde die gegenstndliche Erscheinung des Eigentums
durch Jahrhunderte als die Voraussetzung der Freiheit erkannt und
deshalb bis zu den fortschrittlichen Denkern wie Kant, Schn oder
Lorenz von Stein dem eigentumslosen Knecht das politische Staats-
brgerrecht abgesprochen. Aber die Reduktion des Herr-Knecht-
Verhltnisses auf konkrete Arbeits- und das heit Ausbeutungsver-
hltnisse spielte kaum eine Rolle. Daher kommt die relative Ab-
straktheit der Behandlung dieses Problems und daher auch die oben
aufgezeigte Tendenz in der vorrevolutionren brgerlichen Kritik,
das Herr-Knecht-Verhltnis auf das Verhltnis des Herrn zu seinem
Diener einzuengen. Erzhlt John Locke, da das Eigentum entstan-
den ist, indem der einzelne dazu berging, den in der Natur vorge-
fundenen Dingen etwas von seiner Arbeitskraft zuzusetzen und auf
diese Weise in Besitz zu nehmen, [Anm.10] so blieb diese uerung mehr
oder weniger typisch fr die gesamte ideologische Ausrichtung der
brgerlichen Aufstiegszeit.
berall zeigt sich eine tiefsitzende Animositt gegen die Vorstel-
24
lung, da der Arbeiter es ist, der, indem er die Dingwelt verndert,
sich selbst aufopfert (verdinglicht) und den Herrn, wie Herbert
Marcuse in seiner Darstellung Hegels sagt, davor bewahrt, der ne-
gativen Seite< der Dinge begegnen zu mssen, derjenigen, wodurch
sie zu Fesseln des Menschen werden. 1 1 Womit gleichzeitig ausge-
drckt ist, da im Anschlu an die alte und im bergang zur neuen
Welt Hegel der erste auerhalb der rein konomischen und daher
einseitigen Betrachtung war, der das Problem des Arbeiters (des
Knechts, wie er noch immer sagt) modern stellt.
Die Verdinglichung des Arbeiters ist nicht, wie es auf den ersten
Blick scheinen mag, das Ergebnis seiner Beziehung zum Gegen-
stand, den er bearbeitet, sondern seiner Beziehung zum Herrn, fr
den er unter Aufopferung seiner menschlichen Belange produziert.
Dem Scheine nach tut er es fr sich, denn er mu leben, wie ebenso
dem Scheine nach der Herr als der eigentliche Produzent er-
scheint, denn er verfgt (sei es persnlich, sei es durch Mittelsmn-
ner) ber die notwendigen Kenntnisse und tut auch etwas. Der
Schein trgt darber hinweg, da dem verdinglichten Tun des Ar-
beiters der freie Genu des Herrn entspricht, der davor bewahrt
wird, der negativen Seite der Dinge, wodurch sie zu Fesseln des
Menschen werden, begegnen zu mssen. Das Problem der Ver-
dinglichung des Arbeiters ist also ein gesellschaftliches Problem,
wenn auch vermittelt durch die Dinge innerhalb der antagonisti-
schen Beziehungen. So wenig man Hegel vorwerfen kann, da er
diesen Antagonismus zwischen dem Herrn und dem Knecht berse-
hen hat, so sehr hat er sich durch seine Abstraktion dazu verleiten
lassen, die reine und isolierte Beziehung des Arbeiters zur Dingwelt
berzubewerten. Deshalb kann ihm Marx mit Recht vorwerfen, da
bei ihm das Bewutsein als reines Bewutsein nicht in der entfrem-
deten Gegenstndlichkeit, sondern in der Gegenstndlichkeit als
solcher seinen Ansto hat. 1 2
Die beiden zusammengehrigen Abschnitte der Phnomenologie
des Geistes,1 3 wovon der zweite Herrschaft und Knecht behandelt,
sind trotz ihrer Genialitt heute kaum noch zu halten. Vergleicht
man mit ihnen die ungefhr gleichzeitigen uerungen Schillers, so
ist
hinsichtlich des zentralen Begreifens der Entfremdung dessen
berlegenheit nicht zu bersehen.
1 4
I mmerhin beweist Hegel sei-
nen intellektuellen Kollegen bis zum heutigen Tage, wie man ernste
soziale Probleme ungeniert in Angriff nimmt, ohne vor den Macht-
habern zu errten. Aber in vielem konstruiert er idealistisch, so etwa
in der Aussage, da die Arbeit bildet, weil sie gehemmte Begier-
de. ist." Das luft auf eine Beschnigung des verdinglichten Be-
wutseins des Arbeiters hinaus.
2 5
Seit Aristoteles und folgend ber Chrysostomos (bei diesem wegen
seiner sonstigen Radikalitt merkwrdig genug) und Augustinus bis
Thomas von Aquin galt der Dienende (Sklave) als ein beseeltes Be-
sitzstck, gleichsam ein Werkzeug seines Herrn
16
und dies noch zu
einer Zeit, da die Parole Stadtluft macht frei bereits das ffentliche
Bewutsein erobert hatte. Jedoch hat auch diese neue brgerliche
Stadtluft nur eine negative Freiheit des abhngigen Individuums zu
bewirken vermocht, d.h. bis in das 19. Jahrhundert hinein nicht
seine Gleichberechtigung, nicht einmal die formale. Der Arbeitende
(es
wurde stets vom Eigentumslosen gesprochen) und Dienende
wurde als der menschlichen Wrde, die der Freiheit vorausgeht,
nicht mchtig deklariert. Diese Wrde sprach der Brger nur sich
zu, und zwar ausdrcklich kraft seiner Verfgungsgewalt ber Ei-
gentum. Auffallend ist allerdings die Offenheit, mit der man damals
i
m Gegensatz zu heute diesen Standpunkt vertrat, so etwa wenn
Wieland die unteren Klassen von der politischen Mitbestimmung
ausgeschlossen wissen mchte, weil sie unter dem Druck der Arbeit
und Armut sich nicht um hhere Dinge bekmmern knnen. 17 (zu
letzterem ist bemerkenswert die scharfe Kritik Hegels in seiner
Rechtsphilosophie -und der Tatbestand selbst erweist sich heute
noch als zutreffend, wenn man erfhrt, da mehr als 90 Prozent der
Arbeiter in der BRD noch niemals im Theater oder in einem Konzert
waren). Nach Kant sind Hausdiener, Ladendiener, Taglhner und
Friseure (als Beispiel fr das niedere Handwerk) nicht Brger,
weil dem Angehrigen dieser Schichten die Voraussetzung fehlt,
da er sein eigener Herr sei, mithin irgendein Eigentum habe.
18 Die ideologische Logik tendiert auf den folgenden Zusammenhang:
Knecht - kein Eigentum - keine Mue, durch die er sein eigener
Herr werden kann - keine Fhigkeit zum Gebrauch der Freiheits-
rechte (Marsilius von Padua, John Milton, John Locke, Theodor
von Schn und viele andere) - keine Person - kein Angehriger
der Gesellschaft (gehrt nicht zur Gesellschaft, sagt Cromwell) -
kein Anspruch auf das Wahlrecht-passives Objekt der Wohlgesin-
nung des Brgers (in den Stndever sammlungen werden die Bauern
und Dienenden vom dritten Stand vertreten) und der Gebildeten
( Kant). Zu welchen Ergebnissen diese Wohlgesinnung gefhrt hat,
zeigt die gewaltige Not des 19. Jahrhunderts und die ausnehmend
geringe Zahl der Intellektuellen, die darum in Sorge geraten waren
(von Lorenz von Stein bis zu den liberalen Kathedersozialisten); die
meisten bernahmen die Rolle der wortreichen Rechtfertigung.
Das seit dem 18 . Jahrhundert zu groer Bedeutung gelangende iro-
nische Ausspielen des Dieners gegen den Feudalherrn und die Ideali-
sierung der Dienerfigur als Symbol des dem Adeligen im Grunde
26
berlegenen Volkes verluft der obigen Tendenz vllig parallel.
Der Widerspruch ist offenbar und beweist, welcher Sprnge die
Ideologie fhig ist, wenn es ums Klasseninteresse geht. Die Figur des
Dieners, die die aufsteigende brgerliche Ideologie gegen den Adeli-
gen ausspielt, bringt den Vorzug mit, als unwiederholbar auftreten-
des Einzelindividuum dem Herrn zu widerstehen. Die Renitenz ist
hier noch subjektiv und nicht kollektiv wie beim Arbeiter, bei dem
selbst der subjektive Widerstand sich in bestimmten, vom rationali-
sierten Arbeitsraum her bestimmten Bahnen vollzieht. Der
Knecht ist in der Gestalt des Dieners kein produzierender, son-
dern ein nur dienender. Daher ist er nicht verdinglicht, sondern un-
terliegt ausschlielich der Kategorie der menschlichen Entfrem-
dung. Selbst sein gelegentlicher Kampf gegen diese Entfremdung
spielt sich stets auf der subjektiven Ebene ab.
3. Der Diener und der Arbeiter
Dichterisch ist auch der Widerstand des Arbeiters rein individuell
gestaltbar. Aber es treten sehr bald wesentliche Schranken auf: das
typische Arbeiterschicksal wirkt ins Zentrum der Handlung.
Auch in der geschichtlichen Realitt bleibt dieser Unterschied ent-
scheidend.
Nach der anderen Seite hin bedeutet das Gesetzmig-
Verdinglichte im Schicksal des Arbeiters den Gewinn einer gewissen
Macht. Der Knecht ist vereinzelt, er mu die Situation dem Herrn
gegenber von Fall zu Fall beherrschen lernen und ist von dessen
Willkr und Laune weitgehend abhngig. Er ist sozial schwach; sein
bestes Kampfmittel ist daher nicht die kollektive Drohung, sondern
die subjektive Schlauheit. Andererseits entsteht auch eine gewisse
Abhngigkeit des Herrn vom Knecht dadurch, da er ihm persn-
lich vertrauen mu, whrend im Verhltnis zum Arbeiter der Vor-
gesetzte nicht so sehr persnlich zur Geltung kommt, sondern
berwiegend ber den streng geordneten und objektiv sich darstel-
lenden Arbeitsproze. Daher fhlt sich der Knecht eigentlich nur
beim Herrn zu Hause, der Arbeiter aber im Kollektiv der Fabrik und
in der Gewerkschaft. Die Freiheiten des Knechts sind seine unver-
dinglicht eigenen. Die Freiheiten des Arbeiters dagegen sind nor-
miert und in ihrer verborgenen Bedeutung Freiheiten der Integra-
2
7
tion in die verdinglichte Welt. Kann der Knecht in gewisser Weise an
den Freiheiten seines Herrn teilnehmen, etwa indem er mit ihm reist,
so ist der Arbeiter nur auerhalb der Ordnung, die ihn aber ber-
allhin verfolgt, dem Herrn gleich. Deshalb geht der Kampf des
Knechts darum, am Bewutsein des freien Herrn, es sogar mitgestal-
tend und es zeitweise beherrschend, teilzunehmen. Der Kampf des
Arbeiters dagegen strebt danach, sich vom Bewutsein des Herrn
berhaupt zu lsen, es zu berwinden und auf diese Weise den
Herrn selbst zu berwinden.
Weil der Knecht qua Diener vereinzelt dasteht, stellt sich sein Ver-
hltnis zum Herrn weniger als ein soziales denn als ein moralisches
dar. Es gibt fr ihn keine Verabredung, keine Verschwrung wie
beim Arbeiter. Will der Diener gegen seinen Herrn bestehen, so
mu er als Trger eines moralischen Prinzips erscheinen, mge es
welcher Art immer sein: das des Vertrauens, der moralischen ber-
legenheit, der greren Schlauheit oder der Sach- und Lebenskennt-
nis usw. Deshalb variiert er die Anwendung dieses Prinzips unun-
terbrochen, sei es auch, wie z. B. bei Sachar (vgl. S. 22), um zu be-
weisen, da er sich gegen die totale Unterwerfung durch schlaues
Nichtstun zur Wehr setzen kann.
Im Gegensatz zum Diener ist der Herr nicht wegen irgendwelcher
Kenntnisse und lebenswichtigen Erfahrungen ausgezeichnet, son-
dern durch sein bloes Dasein als Herr. Ja, noch mehr als das: Er
darf sich durch keine besonderen verwertbaren Kenntnisse aus-
zeichnen, soll seine Wrde, die ihn als Herrn auszeichnet, keinen
Schaden nehmen. In der adeligen Gesellschaft wird der einer beson-
deren Bettigung Zuneigende zum Auenseiter gestempelt:
Unter diesen Herren galt Don Fabrizio als ein extravaganter Mensch; sein
Interesse fr die Mathematik wurde nahezu als eine sndige Perversion be-
trachtet, und wre er nicht der Frst von Salina gewesen, htte man ihn nicht
als vorzglichen Reiter und als unermdlichen Jger gekannt, htte man
nicht gewut, da er ganz durchschnittlich Frauen liebt, so wre er Gefahr
gelaufen, dank seinen Parallaxen und Teleskopen aus der Gesellschaft ver-
bannt zu werden.-
Die unnachahmlichen Vorzge des Herrn, die in ueren Eigen-
schaften, aber unter keinen Umstnden in besonderen Kenntnissen
bestehen drfen, schlieen nicht nur den Diener aus dem Herrenda-
sein aus, sondern jedes nichtadelige Individuum, so auch den Br-
ger, selbst den durch Vermgen hervorragenden. So gert der Br-
ger unversehens auf die Stufe mit dem Knecht, er gehrt zum Vol-
ke. Diese beleidigende Behandlung des Brgers ist einer der An-
lsse fr seinen Kampf gegen den adeligen Herrn, mit der gleichzei-
tigen ideologischen Ausntzung dieser vom Feudalismus gezogenen
28
Grenze zwischen dem Adel und den brigen Klassen, sich mit dem
Volke wenn ntig gleichzustellen und es gegen den Adel auszuspie-
len. Wagen es die Brger gelegentlich der Einberufung der franzsi-
schen Stndeversammlungen, den Stand des Adels um eine sporadi-
sche Zusammenarbeit zu bitten, so ist die Antwort zumeist kalt ab-
lehnend und hhnisch. Mit ein Grund fr den Brger und dessen in-
tellektuelle Ideologen, dem Herrn angesichts der angeblichen besse-
ren Eigenschaften des Dieners eins auszuwischen.
Wie und wodurch sich der Herr dem Brger berlegen dnkt, cha-
rakterisiert
Goethe in der folgenden Weise. Der Herr verhlt sich
nach dem Prinzip: Was bist du?, der Brger dagegen, der nichtwie
der Herr, fhrt Goethe aus, etwas scheinen soll, sondern etwas
sein - was er scheinen soll (d.h. indem er den Herrn nachahmt,
L.K.), ist lcherlich und abgeschmackt - nach dem Prinzip: Was
hast du? welche Einsichten, welche Kenntnisse, welche Fhigkeiten,
wieviel Vermgen?20 Was dagegen den Herrn zum Herrn macht,
ist seine Persnlichkeit, die in ihrer Art unnachahmlich ist durch
folgende Eigenschaften: Je ausgebildeter seine Bewegungen, je so-
norer seine Stimme, je gehaltener und gemessener sein ganzes Wesen
ist, desto vollkommener ist er. In Wilhelm Meisters Lehrjahren
lt Goethe die Heldin von Widerwillen geschttelt sein, weil der
Bischof der Herrnhuter Gemeinde sich als ehemaliger Handwerker
von einer Majorin die Hand kssen lt.
Dieses starrsinnige Bestehen auf der Anerkennung des Bevorzugt-
seins durch blo uere Merkmale hat- obgleich es auch seine Apo-
logeten gefunden hat .21 - selbstverstndlich erst recht die ironische
Kritik der brgerlich oppositionellen Intellektuellen gefunden. Das
naheliegende literarische Werkzeug dieser Kritik war aus den er-
whnten Grnden der Diener. Wie der Arbeiter befindet auch er
sich mit seinem Herrn in einem Kampf auf Leben und Tod (He-
gel). Aber am Ende steht stets die Vershnung - da in Becketts
Endspiel und in Brechts Puntila die Diener ihre Herren verlas-
sen, ist eine moderne Version-, whrend beim Arbeiter an die Stelle
der Vershnung bestenfalls die zeitweilige Unterwerfung in der
Form der Integration in die verdinglichten Verhltnisse tritt.
Der Arbeiter steht stndig an der Grenze der Revolte gegen seine
Welt, gegen das Herr-Knecht-Verhltnis berhaupt; eine wirkli-
che Vershnung kennt er nicht. Seit Gerhard Hauptmann, Emile
Zola und Arno Holz ber die von Arbeitern selbst hervorgebrachte
Arbeiterdichtung bis zu den Zwanziger Jahren und ihren zahllosen
dichterischen uerungen zum Arbeiterproblem wiederholt sich
diese Tendenz in endlosen Variationen. Das Erlebnis der dsteren
Macht der Arbeiterwelt im begrenzten Felde zwischen Flieband
29
und Revolte beunruhigt heute die Herrschenden unserer Zeit wie
ehedem. Konnte der Diener nach dem Begriff der aufsteigenden
brgerlichen Ideologie eine kritische Funktion bernehmen wegen
seiner menschlichen Eigenschaften, so der Arbeiter wegen seiner
unmenschlichen. Marx unterstreicht diesen Tatbestand energisch:
Wenn die sozialkritischen Schriftsteller dem Proletariat die weltgeschichtli-
che Rolle zusprechen, so geschieht dies keineswegs. ..weil sie die Proletarier
fr
Gtter halten. Vielmehr umgekehrt.
Weil die Abstraktion von aller
Menschlichkeit, selbst von dem Schein der Menschlichkeit (der bei den besit-
zenden Klassen, wie Marx vorher ausfhrt, als Schein noch vorhanden ist,
L.K.) im ausgebildeten Proletariat praktisch vollendet ist, weil in den Le-
bensbedingungen des Proletariats alle Lebensbedingungen der heutigen Ge-
sellschaft in ihrer unmenschlichen Spitze zusammengefat sind... 22
Wie Marx die Entmenschlichung wesentlich versteht, nmlich nicht
blo konomisch, wie ihm die kritische Kritik (Marx) gerne un-
terstellt, zeigt der folgende, an Schillers Definition des Menschen als
eines spielenden erinnernde Ausspruch - der allerdings heute da-
hingehend zu variieren wre, da die gewonnene Zeit, von der Marx
spricht, zu sehr in den Proze der kapitalistischen Entfremdung hin-
eingezogen ist, als da sie als echte freie Zeit Bedeutung gewnne:
Zeit zu menschlicher Bildung, zu geistiger Entwicklung, zur Erfllung so-
zialer Funktionen, zu geselligem Verkehr, zum freien Spiel der physischen
und geistigen Lebenskrfte...reiner Firlefanz. 23
Die brgerliche Theorie (fhrend die Grenznutzentheorie) rechnet
uns vor, da der Profit des Unternehmers nichts anderes sei als der
gerechte Entgelt fr das Risiko und den Entgang des Genusses, den
der Kapitalist beim sofortigen Verbrauch des Profits haben knnte.
Ist es schon einmal dieser Theorie eingefallen, das Risiko zu berech-
nen, mit dem der Arbeiter seine Freiheit, seine Gesundheit, seine ge-
samte menschliche Existenz einsetzt! Hat man schon jemals das
Ausma des Genusses berechnet, das dem Arbeiter entgeht, sobald
er die Tore der Fabrik durchschritten hat! Das Kapital des Arbeiters
ist sein Menschentum, das zu genieen er ebenso Anspruch hat wie
angeblich der Kapitalist sein Kapital.
3 0
4. Fetischismus und Verdinglichung
Die moderne Entwicklung der Produktivkrfte ermglichte die
Umgestaltung der Klassengesellschaft in der Richtung des Verzichts
auf den unmittelbaren konomischen Zwang, der in der feudalen
Ordnung noch vorherrschte. Aufrechterhaltung der Klassenord-
nung und formale individuelle Bewegungsfreiheit widersprechen
sich in der brgerlichen Gesellschaft nicht, sondern sie ergnzen
sich.
Da aber gleichzeitig jede Klassenordnung eine Ordnung der
Herrschaft und der Ausbeutung ist, ist diese Ergnzung keine solche
der vollendeten bereinstimmung, sondern verdeckt im Gegenteil
nur den in allen Teilen herrschenden Widerspruch von Klassenge-
gensatz und Freiheit, d.h. sie macht ihr wahres Wesen unsichtbar.
Das wichtigste Moment, mit dessen Hilfe, wenn auch unbewut
und spontan, die Verschleierung dieses Widerspruchs gelingt, ist die
Verdinglichung des gesellschaftlichen Prozesses zur zweiten Na-
tur, deren primre Grundlage der von Marx im Kapital analy-
sierte Fetischcharakter der Ware ist.
Die Wesenheit des Fetischismus und der Verdinglichung liegt darin,
da die ihnen zugrundeliegenden menschlichen Beziehungen in der
Arbeit als solche von berindividuellen und ueren dinglichen Be-
ziehungen erscheinen. Dafr gibt es hauptschlich vier Wurzeln.
Er-
stens
die Individualisierung des gesellschaftlichen Prozesses in auto-
nome Handlungen freier Individuen, wodurch das Zusammen-
wirken dieser Handlungen, ihr Verschmelzen zu einem geschlosse-
nen Proze undurchschaubar wird.
Zweitens die weitgehende ge-
sellschaftliche Arbeitsteilung, wodurch sich die einzelnen Gebiete
der subjektiven Ttigkeit stark verselbstndigen und die Tatsache
der Individualisierung bis zur Atomisierung steigern; Erscheinung
der kapitalistischen Anarchie. Drittens
die Arbeitsteilung innerhalb
der einzelnen Produktionssttten, wodurch das innere Band zwi-
schen dem unmittelbaren Produzenten, d.h. dem Arbeiter, und dem
Produkt zerrissen wird; kein Arbeiter kann angesichts des fertigen
Produkts sagen: das habe ich gemacht. Viertens
die nicht zuletzt
auch auf der Grundlage dieser Trennung von Arbeiter und Produkt
gleichsam als naturgem sich ergebende Mglichkeit fr den Un-
ternehmer, sich dieses Produkt anzueignen und auf dem Markte zu
veruern,
wodurch zudem die dahinterstehende Tatsache ver-
schleiert wird, da er es sich kraft seiner mit Hilfe des Besitzes an den
Produktionsmitteln bestehenden Verfgungsgewalt ber Menschen
bemchtigt. Auf dem Markte wird die Herkunft aus dem arbeitstei-
ligen Zusammenwirken vieler unsichtbar.
3 1
Im konomischen Bereich ist das Ergebnis des unter den vier Punk-
ten aufgewiesenen Geschehens der Fetischcharakter der Ware. Was
wir unter den Bedingungen der kapitalistischen Arbeits- und Aus-
tauschverhltnisse Ware nennen, ist nichts anderes als Ausdruck
zwischenindividuellen Geschehens, das sich um die Produktion von
Gegenstnden der Bedrfnisbefriedigung dreht. Marx spricht von
einem festgeronnenen Extrakt von Beziehungen. Die Ware ist
somit eine gesellschaftliche Beziehungen ausdrckende konomi-
sche Kategorie. Sie ist in dieser Gestalt zugleich die Zelle der Entfal-
tung des gesamten konomischen und letztlich gesellschaftlichen
Prozesses im Kapitalismus. Obgleich die Ware das Produkt unab-
hngig betriebener Privatarbeit ist, wie Marx sagt, dient sie nicht
unmittelbar dem Konsum der an ihrer Herstellung beteiligten Pro-
duzenten; in diesem Falle wre sie gar nicht Ware. Sondern sie wird
zum Zwecke des Austausches auf dem anonymen Markt hergestellt.
Hier auf dem Markte tauscht sie sich nach eigenen Gesetzen gegen
andere Waren aus, was sich in einer Preisgestaltung ausdrckt, deren
(ungefhre) Herkunft aus der in der Produktion verausgabten
Menge von lebendiger Arbeit undurchsichtig bleibt. Dieser Schein
des gegenseitigen Austausches nach dinglich und unabhngig von
der lebendigen Arbeitskraft sich vollziehenden Gesetzen macht
das Wesen des Fetischismus aus.
Im brgerlichen Bewutsein ist die Ware eben nichts anderes als
Ware, ein Gegenstand der Bedrfnisbefriedigung, dessen Preis sich
danach richtet, ob die einzelnen Individuen viel oder wenig davon
haben und nach der Menge der mit diesen Gegenstnden zu be-
friedigenden Bedrfnisse (Grenznutzentheorie). Den durch die
Ware verdeckten Gehalt erkennt daher dieses Bewutsein nicht,
woraus jene eigenartige Vorstellungswelt resultiert, in welcher die
gegenstndlichen Beziehungen auf dem Markte Selbstndigkeit er-
halten, sich als bermenschliche Macht darstellen, denen sich der
Mensch bestenfalls als Vermittler, Spekulant, Kalkulant oder als
kluger, die Widersprche mildernder Arzt zugesellt. Der Bruch
zwischen Mensch und Proze, zwischen individuellem Wollen und
objektivem Geschehen ist vollzogen und innerhalb der kapitalisti-
schen konomie durch nichts zu berbrcken. Marx drckt das so
aus, da er sagt, die der Ware eigene Tuschung bestehe darin, da
das gesellschaftliche Verhltnis der Produzenten zur Gesamtheit
als ein auer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhltnis von
Gegenstnden erscheint.
Ist die Tuschung aber schon der Ware, der Zelle des konomischen
Prozesses eigen, so ist klar, da sie auf den weiteren Stufen der Ent-
faltung des gesellschaftlichen Prozesses noch allgemeiner wird. Der
32
brgerliche Intellektuelle unterliegt im Grunde genau demselben
ideologischen Gesetz wie der Geschftsmann und der einfache
Mann der Strae. Dieses Gesetz besteht im Widerspruch zwischen
dem aus der arbeitsteiligen Warenstruktur entspringenden, ber-
schaubaren und stets rationalisierbaren Teilgebiet und dem totalen
Proze. Selbst da, wo der brgerliche Betrachter dem Teilgebiet -
oder was fr ihn oft dasselbe bedeutet, dem Problem - mit kriti-
scher Absicht begegnet, nimmt er die ihm innewohnende Eigenheit
hilflos hin.
Das Teilgebiet kann als Teilgebiet nur funktionieren, und das heit
in das ihm grundstzlich fremd gegenberstehende uere Ge-
schehen einigermaen integriert werden, weil stndig irrationale, fr
den Beteiligten als soseiend hingenommene Faktoren der Au-
enwelt als Voraussetzungen seines Funktionierens in es eindrin-
gen. Was allein erkannt wird, sind die berschaubaren und im In-
neren des Teilgebiets berechenbaren Vorgnge, jedoch nicht diese
Voraussetzungen, aus denen sich dieses Gebiet erst wahrhaft begrei-
fen lt. Daher wohnt dem Teilgebiet die Tendenz inne, sich zu ver-
festigen, eine eigene Gesetzmigkeit hervortreten zu lassen. Die-
ser Schein einer inneren und unabhngigen Gesetzmigkeit ent-
steht aus der Starrheit der Oberflche, die das eigentliche Wesen, das
sich nur aus der Inbezugsetzung zu den aus der Totalitt erflieen-
den Voraussetzungen erkennen lt, verdeckt.
Weil der empiri-
sche oder rationalistisch vorgehende Teildenker diese Voraus-
setzungen ihrerseits nicht rational zu begreifen vermag, sondern nur
irrational als gegeben hinnimmt- z. B. den Preis des Rohstoffs
in einer an sich durchrationalisierten Schuhfabrik oder auf einer
hheren Ebene der Reflexion, die Tatsache der Demokratie bei
der Beurteilung eines durchaus rationalisierbaren politischen oder
institutionellen Vorgangs (als Teilgebiet)-abstrahiert er in Wahrheit
nicht nur von einem der wesentlichsten Momente der Realitt ber-
haupt, sondern auch des in Frage stehenden Teilgebiets. Schon aus
diesem Grunde kann er nur beschreiben und nicht verstehen. Und
da Beschreibung und Verstehen sich unterscheiden wie Stehenblei-
ben beim verdinglichten Schein und Enthllung des verborgenen
Wesens, so gelangt er nur zu solchen Lsungen der gestellten Pro-
bleme (z.B. des Problems der Jugendkriminalitt), die nur Scheinl-
sungen, mit dem Ergebnis der noch besseren Integration in das Ge-
gebene und dem Effekt der weiteren Verschrfung des Problems,
anbieten knnen. Anders ausgedrckt: Der Tatsachenschein obsiegt
und heftet das Denken an die verdinglichte Oberflche fester als
Prometheus an den Felsen.
Zunchst ist die Erscheinung der Verdinglichung eine kategoriale
33
Bewutseinstatsache - wobei wir hier den Begriff der Kategorie
im spezifisch Marxschen Sinne gebrauchen. Marx spricht von den
konomischen und soziologischen Kategorien als den ideellen
Daseinsbedingungen fr das praktische Verhalten der Individuen.
Diese gesellschaftlich gltigen, also objektiven Gedankenformen
oder auch Daseinsformen nehmen die Festigkeit von Naturfor-
men an. 24 Fast alle konomischen Begriffe stellen solche ideologi-
sche Kategorien dar, denn hinter dem verdinglichten Schein ver-
birgt sich nichts anderes als ein Verhltnis konomisch ttiger Men-
schen, also ein lebendiges Verhltnis. Innerhalb der unendlichen
Vielfalt verdinglichter und zugleich kategorialer Vorstellungen,
die von der dinglichen und wertmigen Selbstndigkeit der arbeits-
teilig fr den Markt produzierten Warenverhltnisse bis zur Herr-
schaft der Technik und zur angeblich autonomen Kraft der Ver-
massung reichen, bleibt primr das kategoriale Auseinanderbre-
chen von individueller, durch Freiheit bestimmter Zuflligkeit und
objektiver, Dingcharakter aufweisender Notwendigkeit. Die kate-
goriale Wesenheit dieser unvermittelten Entgegensetzung liegt dar-
in,
da sie die ideologische Bedingung bildet fr das praktische
Funktionieren des Individuums im Dienste der Reproduktion des
kapitalistischen Prozesses.
Kennt die kapitalistische Ordnung im
Prinzip keinen ueren Zwang - dieser Zwang erscheint erst da, wo
ihre Gesetze verletzt werden -, ist der Zwang nicht nur durch die
unabdingbare Notwendigkeit fr die groe Mehrheit der Bevlke-
rung zum Verkauf ihrer Arbeitskraft, sondern ebenso durch die
Verdinglichung des gesellschaftlichen Prozesses gegeben - z.B. Er-
setzung der individuellen Beziehungen durch die anonymen
Marktgesetze -, so kann sich die gesellschaftliche Reproduktion
nur vollziehen, wenn der neue Zwang der objektiven Notwendig-
keiten die subjektiven freien Entscheidungen ebenso hervor-
bringt, wie diese die objektiven Gegebenheiten. Das bedeutet, da
zu dieser Gegenseitigkeit das kategoriale Bewutsein der Herr-
schaft totaler Freiheit hier und verdinglichter Notwendigkeit dort
als ideologische Voraussetzung gehrt.
Das hat jedoch weitere Konsequenzen. Entsteht aus der arbeitstei-
lig-anarchischen Atomisierung ein fr den einzelnen undurchschau-
barer objektiver Proze, dem Naturcharakter anzuhaften scheint, so
wird das Denken und damit das Bewutsein berhaupt nur dem Be-
reich des individuellen Geschehens zugesprochen, jedoch der Be-
reich des gesamtgesellschaftlichen Geschehens als naturhaft-gedan-
kenlos aufgefat. Dem Scheine nach mu es so sein, denn denken
kann nur der einzelne innerhalb des von ihm berschaubaren und
beherrschten Teilbereichs und dieses nur durch ihn. Hier gibt es
34
noch eine Identifizierung von Sein und Denken. Diese Identitt ver-
leugnet sich aber, sobald die Grenzen des Teilgebiets berschritten
werden. Hier erscheint die objektive Wirklichkeit als naturhaft-
dinglicher Proze, obgleich auch sie, die durch denkende Indivi-
duen reprsentiert wird, in der Philosphie, der Religion, dem Recht,
der Politik usw. ihre eigenen Gedanken artikuliert.
Einerseits ist Verdinglichung eine bloe Bewutseinstatsache, denn
das dahinterstehende ttige und denkende Individuum bleibt mit
seiner Beziehung zu den anderen Individuen unangetastet als solches
bestehen. Andererseits wird sie zu einer das Leben im Kapitalismus
beherrschenden realen Macht dadurch, da sich die zum Objektiven
verdichtenden zwischenindividuellen Beziehungen dem Menschen
gegenber als eine eigene Macht erscheinen und ihn sich unterwer-
fen.
Marx schreibt:
Das Nachdenken ber die Formen des menschlichen Lebens... beginnt post
festum und daher mit den fertigen Resultaten des Entwicklungsprozesses.
Die Formen... besitzen bereits die Festigkeit von Naturformen des gesell-
schaftlichen Lebens, bevor die Menschen sich Rechenschaft zu geben su-
chen... ber den Gehalt. 2 5
In diesem Nachdenken erhlt das zwischenindividuelle Verhalten
nicht nur die Festigkeit von Naturformen, sondern diese Formen
gewinnen auch kategoriale Bedeutung:
Derartige Formen sind... gesellschaftlich gltige, also objektive Gedanken-
formen fr die Produktionsverhltnisse... der Warengesellschaft. 2 6
5 . Fetischismus und Entfremdung
Georg Lukacs nimmt Bezug auf die unterste Basis des Verding-
lichungsprozesses und weist auf die diesem Proze zugeordneten
zwei Stufen hin: Erstens tritt der Fetischcharakter der Waren auf
als
Gegenstndlichkeitsform, d.h. als durch quantifizierte Bezie-
hungen von Gegenstnden verschleierte Beziehungen zwischen
produzierenden Personen; zweitens entwickelt sich daraus das ihr
zugeordnete Subjektverhalten . 2 7 Das kontemplative Verhalten
des Individuums zu der sich mechanisch verselbstndigenden Arbeit
in der Produktion wird, allerdings vermittelt durch viele gesell-
schaftliche Faktoren, zur Grundkategorie des unmittelbaren Ver-
35
haltens des Menschen zur Welt. 2 8
Dieses kontemplative Verhalten
birgt aber auch den Schein der absoluten Freiheit des einzelnen, so
da je nach historischer Situation und persnlicher Position des re-
flektierenden Geistes einmal das verdinglichte Schicksal, zum an-
deren die absolute Freiheit zum Thema der Reflexion erhoben
werden: z.B. Beckett gegen Sartre, der absurde Mensch gegen je-
nen, der absolut frei ist zu allem und zu nichts
2 9
und der schlecht-
hin das ist, wozu er sich macht, 30
wie Sartre wrtlich sagt.
Selbstverstndlich wei auch Sartre von den Abhngigkeiten, denen
das Individuum unterworfen ist. Was er unter Freiheit versteht, ist
vor allem die innere Freiheit, die sich von den Zwngen der Auen-
welt, die nach Sartre dem einzelnen als Natur begegnet, freihlt.
Sartre unterliegt damit dem ideologisch irrefhrenden Gegensatz
von Verdinglichung und Freiheit (Versubjektivierung, wie Marx
sagt). Das genaue Gegenteil ist wahr. Wo das Wissen von der dialek-
tischen Bezglichkeit zwischen der subjektiven Erlebniswelt und
dem objektiven gesellschaftlichen Geschehen fehlt, unterliegt die er-
stere erst recht den Einflssen der ueren und reflektiert deren
Phnomene - in der sptbrgerlichen Epoche in erster Linie die
morbiden und dekadent-nihilistischen - spontan und unbewut in
einer doppelten
Weise: unkritisch-naturalistisch und subjektivi-
stisch-willkrlich. Die willkrliche und haltlose Manipulation und
Verarbeitung der blo oberflchenhaft naturalistisch reflektierten
Momente der gesellschaftlichen Auenwelt ist es vornehmlich, die
die Illusion der vollkommenen Unabhngigkeit und unauslotbaren
Tiefe der seelischen Erlebniswelt bei den hierfr disponierten In-
dividuen erzeugt. Diese subjektive Erlebniswelt ist nichtsdestowe-
niger das vermittelte Produkt der Auenwelt. Deshalb stellt sich das
- besonders intellektuelle - Individuum der hochkapitalistischen
Epoche in einer hchst widerspruchsvollen sozialpsychologischen
Gestalt dar. Einerseits ist die Veruerlichung in der Form des Aus-
geliefertseins an die Verdinglichung total, vor allem infolge der Zer-
reiung des einheitlichen Prozesses in Denken hier und Sein dort.
Anderseits steigert sich das Erlebnis der Verinnerlichung bis zum
Erlebnis der totalen Isolation. Letzteres bedeutet aber nichts we-
niger als die unbewute Inbezugsetzung zu den dsteren und be-
drohlichen Seiten des Lebens unter dem Schein, da sie (auf der
Grundlage der bereits besprochenen Tendenz der Versubjektivie-
rung) ausschlielich dem isolierten einzelnen zugehren, dem
Ich. Zu den beiden Wesensmomenten in der ideologischen Haltung
des modernen Menschen ist etwas zu sagen.
1 .
Hinsichtlich der Veruerlichung unterscheiden wir die primren
von den sekundren Erscheinungen.
3 6
Zu den primren Erscheinungen der Veruerlichung gehren die
folgenden.
Der gesellschaftliche Proze verselbstndigt sich dem
Menschen gegenber als eine naturhaft-dingliche Macht, um ihn als
Schicksal zu bedrohen. Die Fhigkeit, diese Macht zu durch-
schauen, sinkt auf ein Minimum. Die weitere Folge ist die Unfhig-
keit des Individuums, seine eigene Situation zu begreifen. Damit
hngt zusammen das Beherrschtsein durch das verdinglichte Reali-
ttsprinzip: Es besteht darin, da immer neue und dem Menschen
von daran interessierten Mchten aufgedrngte Ziele ihn zur frei-
willigen
Unterwerfung unter die verdinglichte und entfremdete
Arbeit veranlassen, ohne da jedoch das mit diesen Zielen einherge-
hende Versprechen des Glcks wahrhaft eingelst wird. Hierher ge-
hrt der Widerspruch zwischen der erstrebten Fortbewegung dem
Ziel der Erotisierung und sthetisierung des Lebens entgegen und
dem starren Verhaftetbleiben in der sozial verdinglichten und
menschlich pauperisierten Position.
Oder was dasselbe bedeutet,
der
Widerspruch zwischen der oft geradezu als hysterisch zu be-
zeichnenden Ttigkeit, dem extremen Subjektsein, und dem fakti-
schen Scheintun (sogar Nichtstun), dem bloen Objektsein des In-
dividuums. Eine der wichtigsten Triebkrfte im Dienste des negati-
ven Realittsprinzips ist das Streben nach Eigentum, das Freiheit
verspricht, jedoch gerade im Dienste der Reproduktion dieses Ei-
gentums das Individuum lebenslang an die entfremdete Ttigkeit
fesselt.
Daraus entspringt wiederum die Herrschaft der sterben-
den, d.h. unschpferischen, deshalb das Leben zu einem stndigen
Sterben verurteilenden Zeit. An sie schliet sich organisch die ver-
dinglicht-entfremdete Freizeit und Kultur, die ihrer Wirkung nach
das Individuum nicht befreit, sondern erst recht unter den allgemei-
nen Proze der Verdinglichung unterwerfen hilft. Schlielich reflek-
tiert sich die so gestaltete Situation des Menschen insgesamt in einer
verdinglichten Ideologie, mit deren Hilfe alle vorangehend erwhn-
ten Momente zum schlechthin Natrlichen verklrt und ontologi-
siert werden.
Als sekundre Erscheinungen der Veruerlichung sind die folgen-
den zu erwhnen. Der Mensch wird von der Pauperisierung total be-
setzt,
worunter nicht in der blichen Bedeutung die blo konomi-
sche Verarmung zu verstehen ist, sondern eine die gesamte Indivi-
dualitt bis tief in das Seelisch-Geistige hinein ergreifende Verarmse-
ligung. Ihre wichtigsten Kennzeichen sind die Verengung der Intel-
ligenz und des Horizonts der Reflexion, wenn auch zunchst infolge
der Arbeitsteilung und des Spezialistentums, so des weiteren durch
alle als primre Erscheinungen der Veruerlichung aufgezhlten
Momente; die Herabminderung der selbstndigen Urteilsfhigkeit
3 7
bis fast auf den Nullpunkt- selbst bei Intellektuellen zu beobachten,
sobald sie ihr Spezialgebiet verlassen -, wie die Uniformierung der
Sprache und die Verengung des Sprachraums auf einige hundert zu-
meist sehr gewhnliche Stze. Des weiteren ist hier zu erwhnen die
verheerende Verengung der ethischen Urteilsfhigkeit, an deren
Stelle die Gewhnung an die von der verdinglichten und entfremde-
ten Umwelt geforderten Verhaltensregeln und Normen, der ver-
dinglichte-pathologische Zustand tritt, das fr richtig zu halten, was
die im Zustand der Verdinglichung lebenden vielen fr richtig hal-
ten. Trotz der verdinglichten Zweiteilung in Denken und Proze
gibt es keine ideologische Spannung zwischen ihnen, keinen, wie
Gnther Anders bemerkt, Unterschied zwischen dem >objektiven
Proze< und seiner >subjektiven Beurteilung< - die Zweiteilung ist
dem gut Integrierten schlechthin unverstndlich, so da Sitten als
Dekrete erlebt werden.
31 Da der Mensch die Form des freien
subjektiven Verhaltens, dessen Endzweck nichts anderes als die Un-
terwerfung unter den verdinglichten Proze ist, auf die Dauer nicht
aushlt, vollzieht sich in Konsequenz dieses Tatbestandes ein Um-
schlagen in die subjektive Renitenz in vielfltigen Variationen bis
zum Verbrechen hin. Die totale Integration unter dem Schein der
Freiheit bedeutet gleichzeitig eine totale Uniformierung unter dem
Schein der Vereinzelung. Die scheinhafte Vereinzelung wird zur
Einsamkeit; dies nicht etwa, weil die Individuen wirklich allein sind
(das sind sie nur selten), sondern weil im Zustand der Uniformie-
rung das Gesprch nicht mehr mglich ist: Wo alle letztlich dasselbe
denken, fhlen und tun, gibt es keine Diskussion mehr. Die Veru-
erlichung ist total geglckt.
2.
Das dialektische Pendant der Veruerlichung ist die als eine selb-
stndige Gewalt erscheinende Verinnerlichung. Sie uert sich am
greifbarsten im Erlebnis der subjektiven Zeit. Als bloe und fr
sich bestehende subjektive Zeit mte sie eine erfllte und schp-
ferische sein, mit dem Glck identisch. Tatschlich ist, wie die mo-
derne Theorie und Kunst zuzugeben sich nicht scheut - woraus sie
allerdings bestens Grnde fr die Rechtfertigung der entfremdeten
Gesellschaft herauszuinterpretieren versteht -, der heutige Mensch
hchst unglcklich. Das bedeutet, da er auch als verdinglichter,
entgeistigter und entseelter sein Mibehagen empfindet und leben-
dig, wenn auch sehr widerspruchsvoll reflektiert, d.h. verinnerlicht.
Dem Proze der Veruerlichung entspricht eine spezifische Form
der Verinnerlichung; eine Verinnerlichung, ohne die das Gelingen
der Veruerlichung oder Verdinglichung, vor allem die freiwilli-
ge Unterwerfung unter diese, in Frage gestellt wre. Das lt sich
am besten einsehen an dem von uns bereits erwhnten Realittsprin-
38
zip und der daraus erflieenden Ersetzung des ethischen Verhaltens
durch angenommene Normen. Denn bei beiden ist der vermittelnde
Bezugspunkt die Freiwilligkeit, d. h. der nicht direkt von auen
aufgezwungene Vollzug, sondern der Umweg ber tiefgreifende
seelische Reaktionen, z. B. hinsichtlich der Verflechtung von Kon-
sum und Prestige. Da der mageblich bleibende Faktor der Veru-
erlichung zusammenfllt mit Verdinglichung und Entfremdung,
kann der ihm entsprechende Proze der Verinnerlichung nur ein ne-
gativer, ein ideologisch nihilistischer sein. Die an sich durchaus le-
bendige innere Spannung geht der Leere kongruent, das Nichts
wird getragen von Schuldkomplexen, Renitenzneigungen und Unsi-
cherheits- wie Minderwertigkeitsgefhlen. Die Flle der seelischen
Erlebnisse mndet in die verdinglichte Pauperisierung der geistigen
und seelischen Potenz.
Weil Pauperisierung des Innenlebens so viel bedeutet wie seine Pr-
gung durch die verdinglichten und gorgonischen Phnomene der
Auenwelt, kann sie einhergehen mit einer formal lebendigen Refle-
xibilitt.
Das ist der Grund, weshalb auch der Intellektuelle in die
Verdinglichung hineingezogen werden kann; der Reichtum seiner
Erlebnisse und Gedanken widerspricht nicht der verdinglichten Ein-
falt und Einseitigkeit seiner Ideenwelt. Weil die Reflexion der eige-
nen Existenz ber die Verdinglichung der Auenwelt sich vollzieht,
daher verkehrt und verzerrt, vermag das Individuum dem unge-
hemmten Eindringen der aus der Verdinglichung einer in die Deka-
denz geratenen sptbrgerlichen Welt erflieenden bedrohlichen
und bedrckenden Einflsse und ihrer pathologischen Verhrtung
keinen Widerstand entgegenzusetzen. Einmal in den seelischen Er-
lebnisbereich geraten univerinnerlicht, entsteht leicht ein Komplex
von irrationalen Reaktionen und Ideen, der vom Individuum als
Ausdruck seiner blo eigenen Welt, als Isolation, erlebt und aus-
gegeben wird. Der Dialektik von uerer und innerer Welt bewut-
los begegnend, wird die Verinnerlichung der Phnomene der Au-
enwelt zum hervorragendsten Mittel der Unterwerfung des Indivi-
duums unter diese, d.h. unter deren Tendenzen der Verdinglichung
Lind Entfremdung.
Deshalb dominieren in der seelischen Innenwelt nicht etwa solche
Vorstellungen wie Schnheit, Hoffnung, Erhabenes und Humanis-
mus, sondern Angst, Sorge, Bedrcktheit, Mibehagen, Vereinsa-
mung, Bedrohung, Verzweiflung usw. Diese reflektiven Erschei-
nungen pflegen sich zustzlich zu spontanen Ideologien zu verfesti-
gen, vor allem derart, da aus ihnen Bestimmungen des Menschen
und der Geschichte berhaupt gemacht werden; am Ende steht eine
nihilistische
Weltanschauung-vom Nichts des Existentialismus
3 9
bis zur ethologischen Setzung des Aggressionstriebes als das Leben
primr beherrschender Erscheinung in vielerlei Gestalt.
Die Relation ist stets eine gegengleiche. Je mehr die Individuen sich
einbilden, in Beschrnkung auf die Pflege ihres Ich, seines Inneren
und des darauf beruhenden Privatlebens der Auenwelt nicht oder
nur zu praktischem Nutzen zu achten, desto spontaner und irratio-
naler, desto unkritischer werden deren entfremdete Phnomene re-
zipiert und zu Erlebnissen des reinen Inneren umgewandelt, um
auch desto gewisser die schreckhaften Phnomene des verdinglich-
ten gesellschaftlichen Prozesses in ihrer blo oberflchenhaft-natu-
ralistischen Erscheinungsform zu reflektieren. Die zustzliche, aus
dem haltlos-flieenden Charakter des Seelischen sich ergebende
willkrliche Verzerrung der Reflexionen zu dster-farbigen und ka-
leidoskopartig wechselnden Bildern des nihilistischen Abgrundes,
zu einer zunchst unbestimmten weltanschaulichen Tendenz, die
dann ihrerseits zu philosophischen oder anthropologischen An-
schauungen stilisiert und systematisiert wird, ndert prinzipiell an
dem naturalistischen Charakter so gut wie nichts; denn der faktische
Gehalt bleibt derselbe wie in der die Wirklichkeit verkehrt und ver-
zerrt widerspiegelnden verdinglichten Ideologie. Die oberflchen-
hafte naturalistische Reflexion, die das Subjektive kennzeichnet, ist
nichts als eine Reflexion eben dieser ideologischen Inhalte. Es ent-
steht eine komplizierte Dialektik der Reflexion: Der subjektivisti-
sche Naturalismus besteht in der naturalistischen Reflexion von ver-
dinglichten ideologischen Reflexionen und in deren zustzlichen
bersteigerungen zu willkrlichen Erlebnismomenten des reinen
Inneren.
Die bereits im realen Entfremdungsproze ideologisch
verkehrten und verzerrten Phnomene dieses Prozesses, ihre ideo-
logische Spiegelung als Vermassung, Isolation, Schicksal,
Technisierung und anderem werden nochmals subjektivistisch
umgeformt zu gleichsam mythologisch-unbestimmten Formen des
inneren Erlebens, wo sie als Verzweiflung, Angst, Sorge, Bedro-
hung usw. ihr morbides und pathologisches Spiel treiben.
Der sozialpsychologische Proze der Verinnerlichung erweist sich
also, sobald im Lichte der dialektischen Analyse betrachtet, zugleich
als ein Proze der Veruerlichung. Dies in der zweifachen Bedeu-
tung, da nicht blo das psychische Innere zum, wenn auch zustz-
lich verzerrten, Spiegelbild der entfremdeten ueren Welt wird,
sondern auch in der Bedeutung der Veranlassung einer Haltung und
eines Verhaltens, durch die die Individuen selbst zu einem deus ex
machina eben derselben Welt werden, die sie zu verachten und von
der sie sich abzuwenden whnen. Oder anders ausgedrckt: Der
sich sozialpsychologischer Umsetzungen bedienende ideologische
40
Proze der dialektischen Vermittlung von Verdinglichung und Ver-
subjektivierung einerseits und von Verinnerlichung und Veruerli-
chung anderseits gewinnt kategoriale Bedeutung auf jener Stufe
der kapitalistischen Gesellschaft, auf der unter Bedingung hchst
komplizierter Voraussetzungen die Freiheit und die Freiwilligkeit
zum ideologischen Anla werden zur dauernden Reproduktion die-
ser Gesellschaft. Damit werden zugleich Freiheit und Freiwilligkeit
zur Voraussetzung der Reproduktion einer verdinglichten, und das
bedeutet die Freiheit aufhebenden Gesellschaft. Die drei analysier-
ten Geschehenssphren: 1. des Umschlagens des extremen Indivi-
dualismus in extreme Vermassung; 2. die Integration kraft Identifi-
kation und 3. der Veruerlichung mittels der Verinnerlichung
durchdringen einander und bilden zusammen jenen gleichzeitig psy-
chologischen wie ideologischen Komplex, der zur unabdingbaren
kategorialen
Voraussetzung der dauernden Selbstreproduktion
der Realitt wird. Das bedeutet letztlich, da die subjektive Inkarna-
tion dieses Komplexes, nmlich das freie Individuum, dazu be-
ntzt wird, um es mit seiner eigenen Hilfe zu unterwerfen.
ber die spontane und unmittelbare ideologische Reflexion im der
Dialektik von Verdinglichung und Versubjektivierung wirken, von
dieser Dialektik veranlat, Ideologien auf einer hohen Ebene der Re-
flexion, nmlich der theoretischen und philosophischen. Ihre Expo-
nenten wie Produzenten sind die Intellektuellen.
6.
Der Intellektuelle als Ideologe
Die innerhalb der Klassengesellschaft menschlich freieste, weil ihre
Krfte schpferisch spielend gebrauchende Schicht ist die Intelli-
genz.
Die Herrschenden aller Epochen bedurften der Intelligenz
nicht nur, um sich ihrer als Werkzeug zu bedienen, sondern nicht
minder, um an ihrer geistigen Freiheit, an ihrem Wissen, ihrer intel-
lektuellen berlegenheit, ihrem Schpfertum teilzuhaben und auf
diese Weise in den Bereich menschlicher Freiheit, die ihnen als den
Herrschenden, was so viel heit wie als die Unfreiheit der unteren
Klassen dauernd Reproduzierenden, versagt blieb, einzutreten.
Diese Beziehung der Intelligenz zur herrschenden Klasse wirkte sich
aber unheilvoll auf jene aus. Denn sie geriet dadurch in die eigenar-
41
tige Lage, in ihrer Freiheit die zugleich am tiefsten in die Unfreiheit
geworfene Schicht der Gesellschaft zu sein. Das Ma der Unfreiheit
der Intelligenz ist anders zu messen als das des Sklaven. Es ist zu
messen an ihrer prinzipiellen Freiheit, von der wir soeben sprachen.
Die Situation des Sklaven ist total die des Unfreien. Die Unfreiheit
des Intellektuellen tritt als solche dadurch in Erscheinung, da die
noch nachzuweisende Abhngigkeit von den Herrschaftsverhltnis-
sen in eine unendliche Spannung tritt zur intellektuellen Freiheit und
diese dialektisch aufhebt. Wodurch aber verdeckt der Intellektuelle
als ein absolut Freier seine faktische Unfreiheit?
Der Intellektuelle verdeckt und verleugnet seine Unfreiheit sich und
der Welt gegenber, indem er sich auf den Standpunkt der reinen ob-
jektiven Kontemplativitt stellt, der reinen, an der Praxis nur als ei-
nem Gegenstand des Wissens, aber nicht als Ziel interessierten be-
schaulichen Neugier. Er vermeint dadurch auerhalb der Praxis zu
verbleiben, an ihr unschuldig zu sein. Aber allein schon durch die
ideologische Spaltung des Geschehens in Proze und distanzierte
Betrachtung, Praxis und Kontemplation, wodurch sich der Geist des
Intellektuellen als auerhalb des realen Prozesses befindlich erlebt,
wird die Wirklichkeit als soseiend, als quasi-naturgesetzliche Reali-
tt hingenommen und zum starren Ausgangspunkt, d.h. Objekt des
intellektuellen Denkens erhoben. Das Denken erhebt sich scheinbar
ber die Wirklichkeit, die als solche schlechthin gegeben und nicht
als von diesem Denken selbst in dauernde Bewegung gebracht er-
scheint. Der seinserhaltende Charakter der Intelligenz resultiert also
nicht blo aus der uralten Gewhnung an die Prpotenz der Herr-
schaft, die es berdies verstanden hat, sie durch Beeinflussung und
subtile Methoden des Zwangs an sich zu ketten. Sie resultiert zum
Zwecke der Vortuschung der ungehemmten Freiwilligkeit aus der
zur schpferischen Freiheit des Geistes gehrigen Haltung der
Kontemplation und der Objektivitt, das bedeutet, aus der sich
irrtmlich als auerhalb des praktischen Prozesses verstehenden
Kontemplation. Indem auf diese Weise die Realitt als soseiendes
Objekt und nicht als durch das Denken, das einen integrierenden
Bestandteil dieser Realitt selbst ausmacht, dauernd reproduziert er-
lebt wird, kommt dabei heraus, da ohne (kritisches) Wissen der In-
telligenz die intellektuelle Objektivitt in praxisgerichtete Gebun-
denheit umschlgt und sich dieser Realitt blind unterwirft. Da sich
dieser Vorgang unter der Voraussetzung der Unfhigkeit des Durch-
schauens der Totalitt, der Verdinglichung, der zweiten Natur
vollzieht, haben wir bereits dargelegt - womit zugleich ausgedrckt
ist, da die kritische progressive Intelligenz, die um die dialektische
Beziehung von Denken und Realitt wei, somit auf die Haltung der
42
Kontemplativitt verzichtet, eine ideologisch gerade entgegenge-
setzte Position einnimmt.
In der kontemplativen Distanz zur Realitt stehend, vermag die
konservative Intelligenz nicht aus der Realitt heraus zu urteilen,
sondern nur ber sie, und das bedeutet weitgehend spekulativ-will-
krlich. Zu dieser Willkr gehrt auch das bersehen vieler Zu-
sammenhnge und Faktoren, z. B. des Klassencharakters der mo-
dernen brgerlichen Gesellschaft, die ohne jeglichen zureichenden
Grund als eine pluralistische oder formierte definiert wird.
Deshalb geht das brgerlich-intellektuelle Denken an den Beson-
derheiten jener ideologischen Strmungen gedankenlos vorbei, die
aus der spezifischen Situation der verschiedenen Klassen erflieen.
Da zudem in der neuesten Zeit, besonders in Deutschland, Impulse
zu einer neuen Formierung der Klassenideologien, insbesondere auf
der untersten, noch nicht politischen, sondern ihr spontan voraus-
gehenden Ebene zu beobachten sind, vollzieht sich deren theoreti-
sche Reflexion ausschlielich seitens der progressiven kritischen In-
telligenz.
Die Philosophie ist, sagt Martin Heidegger, aus dem Blickpunkt
des gesunden Menschenverstandes gesehen, nach Hegel die ver-
kehrte Welt<. Ob Philosophie nur vom Standpunkt des alles ver-
kehrenden gesunden Menschenverstandes die verkehrte Welt
ist, ist die groe Frage. Sie verweist auf das Problem des Scheins und
auf die weitere Frage, ob das, was man Bildung nennt, der Welt der
Wahrheit oder der verkehrten Welt angehrt.
Im gngigen Bewutsein der Zeit steht Bildung dem subjektiven In-
teresse und dem Streben nach Vorteil entgegen. Sie hat, meint man,
mit der die objektive Wahrheit und die gesicherte Ordnung des
Denkens intendierenden Vernunft etwas zu tun. Vom Alltag trennt
sich Bildung durch seine Sonntglichkeit, die Feierlichkeit des Au-
erordentlichen.
Diese Vorstellung beherrscht das gngige Bewutsein und verhin-
dert zu erkennen, da in der entfremdet-repressiven Ordnung auch
die Bildung in die Niederungen des Vernunftlosen gelangt. Daran ist
Vernunft, die Trgerin der Bildung, nicht ganz so unschuldig, wie ihr
abstrakter und von aller soziologischen Relevanz gereinigter Begriff
es scheinen lt. Nicht ohne Grund wei die Bibel davon zu erzh-
len, da der Genu vom Baume der Erkenntnis nicht etwa eine
Grotat war, sondern der Sndenfall. Doch letztlich ist der Schul-
dige der historisch aktive Mensch, nicht die Vernunft. Ihrem ratio-
nalen Charakter entsprechend ist ihr eine enthllende und deshalb
aller Unterdrckung opponierende humanistische Funktion inne.
Trotzdem bernimmt sie ihre herrschende Rolle gerade beim Ein-
4 3
tritt des Menschen in die Klassengeschichte. Vor Beginn dieser Epo-
che lebte der Mensch in irrationaler Einheit mit sich und der Natur.
Der Bericht der Bibel, da der Mensch durch den Genu der Frchte
der Erkenntnis, d.h. der Vernunft, sndig wird, trifft das Richtige.
In ihrer geschichtlichen Wirkung freilich zeigt die Vernunft ein wi-
derspruchvolles Gesicht. Sie ist die Seele des kulturellen, schpferi-
sche Fhigkeiten systematisierenden und ordnenden Fortschritts ei-
nerseits, anderseits aber und aus dem gleichen Grunde dient sie der
Herrschaft und der mit ihr verbundenen systematischen Unterdrk-
kung der Mehrheit der Gesellschaft. Die gleichzeitigen humanisti-
schen und repressiven Tendenzen kennzeichnen das Janusgesicht
der Vernunft, sofern sie historisch und praktisch wird. Ihrem ab-
strakten Begriff nach ist sie neutral. Welche Rolle sie wirklich spielt,
ist eine Frage der geschichtlichen Situation.
Wir bezeichnen als Vernunft die Fhigkeit des Geistes zu rationali-
sierender und systematisierender Verhaltensweise. In der repressi-
ven Ordnung stt dieser Geist auf tabuierte Grenzen, und nur in
der kritischen Opposition versucht er, diese Grenzen zu durchbre-
chen. Die Arbeit des Intellektuellen mndet ungeachtet der inneren
Vielfalt der Aussagen darin, das gesellschaftlich tabuierte Vorrecht
zum intellektuellen Tabu zu erheben. Das fllt nicht schwer, weil die
gesellschaftliche Realitt selbst die entscheidende Vorarbeit leistet.
Die Zeit ist es, die die repressive Ideologie vorbereitet. Herbert
Marcuse schreibt: 32
Die Ideologie unserer Zeit besteht darin, da Produktion und Konsum die
Beherrschung des Menschen rechtfertigen und ihr Dauer verleihen. Ihr ideo-
logischer Charakter ndert aber nichts an der Tatsache, da ihre Vorteile real
sind. Da das Ganze zu einer immer strkeren Unterdrckung fhrt, liegt in
erster Linie an seinem guten Funktionieren, an seiner tatschlichen Wirk-
samkeit: es erweitert den Raum der materiellen Kultur, erleichtert die Be-
schaffung des Lebensnotwendigen, verbilligt Bequemlichkeit und Luxus,
bezieht weitere Gebiete in den Einflubereich der Industrie ein - und unter-
sttzt gleichzeitig das System mhseliger Arbeit und Zerstrung. Der ein-
zelne zahlt dafr mit dem Opfer seiner Zeit, seines eigenen Bewutseins, sei-
ner Trume; die Kultur zahlt dafr mit der Preisgabe ihrer eigenen Verspre-
chungen von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden fr alle. - Die Diskrepanz
zwischen mglich gewordener Befreiung und tatschlicher Unterdrckung
ist zur vollen Reife gelangt: sie durchdringt alle Lebenssphren auf der ge-
samten Erde.
Der Widerspruch kn
nte durchschaut und berwunden werden.
Aber, sagt Marcuse, der einzelne wei nicht wirklich, was vor sich
geht. Auch wenn er sich um Bildung bemht, ergeht es ihm zumeist
nicht besser. Die komplizierte Struktur des realen Prozesses, die
44
Gewhnung an bestimmte Perspektiven und Ideologien, verstrkt
durch die Gewhnung an die repressive Lebenssituation selbst, und
der traditionell-repressive Gebrauch der Ratio erzwingen dieses Re-
sultat.
Die Vernunft, als Bildung ihr Recht anmeldend, schlgt selbst
in ein Mittel der Repression, der Unvernunft um. Als Unvernunft
deklariert sie sich, weil in keiner Epoche der Menschheitsgeschichte
j
emals die Mglichkeit einer repressionslosen Ordnung so gro ge-
wesen ist wie heute. Doch Bildung bleibt, auch als unvernnftige. So
wird Bildung selbst zu einer Bedrohung, die nur da gebannt werden
kann, wo die Neigung zum kritisch-humanistischen Durchschauen
siegt.
7. Naturalistische und dialektische Bildung
Das Bewutsein der Bildung oder das gebildete Bewutsein durch-
luft, verallgemeinert und auf einen theoretischen Begriff gebracht,
drei Stufen. Als spontane naive Bildung klammert sie sich an die un-
mittelbare Erfahrung: Hier unterliegt sie dem geltenden realen und
ideologischen Schein, hat aber den Vorzug, in bestimmten engen,
dem unmittelbaren Leben des Individuums zugehrigen Sparten
unbefangen zu urteilen und in diesem Sinne gebildet zu sein. In
der Gestalt eines allgemeinen gesellschaftlichen Bewutseins ist Bil-
dung Ideologie im Sinne von falschem Bewutsein, folgt sie der re-
pressiven Ratio.
Als kritisches, auf das unnachsichtige Durch-
schauen gerichtetes Bewutsein ist Bildung erst wahre und eigentli-
che. Aber niemand bleibt es erspart, durch diese drei Stufen hin-
durchgehen zu mssen. Die Frage ist nur, wo er unter dem Drucke
der repressiven Zustnde stehenbleibt. Soll sie ihren Zweck errei-
chen, hat die Bildungsarbeit unserer Zeit bis zur letzten vorzudrin-
gen. Aber gerade daran hindert sehr oft die zweite Stufe, die des fal-
schen Bewutseins, die repressiv-ideologische.
Da auf der zweiten Stufe des Bildungsprozesses, die als die natrli-
che erlebt wird, nicht die Wahrheit erscheint, deshalb nicht das
Subj ekt ergreift, um es mit der Leidenschaft der Erkenntnis und der
Tat zu erfllen, wie dies bei j eder aus dem kritischen Bewutsein ge-
borenen Wahrheit der Fall ist, nicht aus dem blo Subj ektiven ins
Obj ektive umschlgt, bleibt Bildung dem Subj ektiven verhaftet; sie
4 5
wird hier vornehmlich zum Mittel des subjektiven Glanzes, der
Selbsterhhung, der Selbsterlsung. Sie wird zum subjektiven
Gebrauchsmittel, zum Mittel der Gewinnung von Prestige. Aber da
sie gesellschaftlich vermittelte Ideologie bleibt, spielt ihr diese Ver-
mittlung einen Streich und gibt ihr hinterrcks die objektive Rolle,
die sie im subjektiven Bewutsein und gegen dessen Wissen verloren
hat, zurck: Objektiv erfllt diese Art der Bildung den Zweck der
Einordnung in das Gefge der Repression, der Freiwilligkeit der
Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die das Subjekt ihrer
Struktur gem deformieren und in Unbildung halten.
Indem Bildung der zweiten Stufe zwar die Phnomene der Entfrem-
dung und der Verdinglichung zum Problem erhebt, zugleich aber
die Lsung im Sinne kritischen Durchschauens verhindert, wird sie
zur vornehmsten Form der Vershnung des Subjekts mit der vor-
handenen Wirklichkeit, die sich so als die einzig mgliche und na-
trliche dem Gebildeten offenbart. Die Tragdie unserer Zeit ist
nicht die, da der Mensch in seiner Masse, als Arbeiter, Kleinbrger
und Brger, sich nicht das Wissen aneignen kann, dessen er bedarf,
um gebildet zu erscheinen, sondern eher, da trotz der wachsenden
Mglichkeit solcher Wissensaneignung das Individuum ungebildet
bleibt, weil innerhalb der aufgezeigten Tendenz der Vershnung mit
der entfremdeten Wirklichkeit jeder Ausbruch ins kritische Bewut-
sein verhindert wird, welcher wahre Bildung erst mglich macht.
Bildung im landlufigen Sinne, und das heit im Sinne der zweiten
Stufe, enthllt sich als ein Begriff des falschen Bewutseins. Der kri-
tisch Wissende will nicht gebildet, sondern ein Wissender sein. Nur
der auerhalb dieses Wissens Stehende wird ihn einen Gebildeten
nennen. Was die Masse der Gebildeten oder nach Bildung Streben-
den betrifft, liegt die Einbildung ihrer Bildung darin, mehr innere
und uere Freiheit gewonnen zu haben im Vergleich zur Masse der
Ungebildeten. Das ist Tuschung. Whrend die Ungebildeten we-
nigstens auf der ersten Stufe der Bildung stehen, nmlich der unmit-
telbaren und daher ein echtes Bildungselement enthaltenden prak-
tisch-dinglichen Erfahrung, so geht dem Gebildeten der zweiten
Stufe selbst dieses Ma der Bildung verloren. Ausgerichtet auf die
komplizierten Phnomene der Erscheinungswelt und so ihrem ent-
fremdeten Schein unmittelbar unterliegend, wird er unter dem
Schein der Wahrheitsfindung vollendet ein Opfer des Scheins.
Abgetrennt vom Zweck echter (kritischer) Bildung, die Tendenzen
der geschichtlichen List der Vernunft zu erkennen und freimachen
zu helfen, wird Bildung zum Selbstzweck, zum Genu, zum
sthetischen Spiel, zum Element der Kultur, von der Adorno sa-
gen kann, sie drckt die Objektivitt des herrschenden Geistes
46
aus, und ber die Intellektuellen: Sie weben mit am Schleier. Was
Wunder, wenn Bildung in der Gestalt von Selbsterhhung und Ge-
nu mehr dem Prestige als der Erkenntnis dient und das Individuum
nicht befreit, sondern noch tiefer in die Misere schleudert, so da die
dumpfe Ahnung der Identifizierung des gebildeten Bewutseins mit
Repression und Herrschaft entsteht und damit das immer wieder
aufbrechende Gefhl der Schuld - zumeist unter den harten Schl-
gen, die ihnen die progressiven Kritiker erteilen. Befreit allein das
kritische Bewutsein von dieser Schuld, so wird mit dem vershnten
Bewutsein die Schuld des Ganzen zur Schuld des Einzelnen. Das
zeitweilige unbewute Manver der Ablenkung durch nicht auf das
Prinzip gerichtete, nur sporadische und ethische Schuldigspre-
chung von Brokratie, Staat und Unternehmertum, die sich zu bes-
sern haben, hilft wenig, denn die Vershnung mit der Totalitt
bleibt,
wenn auch unter dem Schein der Kritik. Da diese Kritik
bloer Schein ist, hngt mit der prinzipiellen Position zusammen,
die die zweite Stufe der Bildung bezogen hat und die genauer zu de-
finieren ist.
Konnte Schiller noch sagen: Naiv ist das Genie oder es ist keins,
und verstand er unter Naivitt das unbefangene und kritische Offen-
sein der Totalitt gegenber, so ist in der zweiten Stufe der Bildung
das Denken zwar in einer gewissen Weise auch naiv, aber in einem
schlechten Sinne. Die schlechte Naivitt besteht darin, da das Den-
ken noch
ber (!) die Wirklichkeit reflektiert und sich so abstrakt
verhlt. Es befindet sich in der Einbildung, vllig autonom zu sein,
whrend es in Wahrheit den dialektisch-einheitlichen Proze in zwei
Sphren zerreit, in die Wirklichkeit hier und das Denken dort. Man
versteht diesen Mangel, durch den das Denken der ihm scheinbar
gegenber-stehenden Wirklichkeit erst recht unterworfen wird,
am besten bei einem Vergleich mit der dritten Stufe.
Auf dieser Stufe, wo das Denken zum vollen Verstndnis seiner ei-
genen Funktion gelangt ist, setzt sich das Begreifen der geschichtli-
chen Totalitt als eines Tuns durch, worin das Denken selbst enthal-
ten ist, nicht ber dieses Tun reflektiert und ihm gegenber steht,
sondern-auch als wissenschaftliches und philosophisches-sich als
ein Wesensmoment des praktischen Prozesses selbst zu erkennen
gibt. Hier gibt sich das Denken zu erkennen als ein Denken der (!)
Wirklichkeit (und nicht wie in der zweiten Stufe und oben dargelegt
als ein Denken ber die Wirklichkeit). Whrend in der scheinhaften
Denkweise die reale Totalitt zerrissen wird in die betrachtete Wirk-
lichkeit hier und das betrachtende Denken dort, wird in der diesem
Schein widerstrebenden Denkweise die Wirklichkeit als denkende
und das Denken als der Wirklichkeit angehriges, als wirkliches
4 7
begriffen (vgl. auch Kap. 1). Mit letzterem ist ein Standpunkt der Be-
trachtung gewonnen, der den Schein zu berwinden erlaubt. Die
Bildung verliert das Subjektive und wird objektiv: Sie tritt aus der
blo kontemplativen Haltung heraus und erkennt sich als das, was
sie tatschlich ist, als praktisch relevante, als praktische Bildung.
Sie ist deshalb befhigt, sich der gegebenen Realitt, sie denkend-t-
tig verndernd, zuzuordnen und aus dieser neuen Position heraus in
ihrem Schein zu durchschauen.
Bei unserer kritischen Beurteilung der zweiten und der positiven
Beurteilung der dritten Stufe der Bildung mu es berraschen, wenn
hinzugefgt wird, da die zweite Stufe die der Philosophie ist, die
dritte Stufe dagegen alle Philosophie im traditionellen Sinne zu
berwinden sich anschickt .
3 3
Die erste Stufe enthlt die unmittelbar empirische, naturalistische
Bildung. Sie ist beengt, aber insofern wahr, als der empirische Schein
das Leben nicht in Widerspruch zum Wesen setzt. Die zweite Stufe
der abstrakten Bildung, ist erfllt von der Neigung, den Schein als
falsches Bewutsein in philosophischen Systemen zur Geltung
kommen zu lassen. Zwar sind diese Systeme nicht ohne Beziehung
zur Realitt, zwar spiegeln sie nicht nur philosophisch, sondern
auch wissenschaftlich diese Realitt wider, aber in verkehrter und
verzerrter, eben scheinhafter und dem falschen, besonders verding-
lichten und fetischisierten Bewutsein entsprechenden Weise wider.
Erst die dritte Stufe vollzieht einen qualitativen Sprung in die Sphre
voller Erkennbarkeit der Realitt. Das dieser Stufe angehrige Sich-
selbstbewutwerden der Tatsache, da das Denken nicht kontem-
plativ auerhalb der Wirklichkeit steht, sondern selbst ein prakti-
sches Moment der zwar dialektisch-widerspruchsvollen, aber un-
teilbaren Totalitt ist, und da deshalb die Probleme und Inhalte die-
ses Denkens auf diese Totalitt des menschlich-gesellschaftlichen
Seins zurckgefhrt werden mssen, sollen sie wahrhaft und nicht
blo spekulativ im Sinne des falschen Bewutseins verstanden wer-
den, macht den erwhnten qualitativen Sprung aus. Indem das Den-
ken begreift, da es ein Denken der menschlich-gesellschaftlichen
Wirklichkeit selbst ist, fhrt es auch die Philosophie und Wissen-
schaft auf diese Wirklichkeit zurck, erklrt ihre Probleme und Aus-
sagen als ideologische Reflexe und lst so die Philosophie und Wis-
senschaft als kontemplativ-abstrakte Gedankenarbeit ber die
Wirklichkeit auf. Verschwindet hier Philosophie berhaupt, so be-
deutet das zugleich, da nicht auch Wissenschaft verschwindet, im
Gegenteil diese an Bedeutung dadurch gewinnt, da sich jene zu-
gunsten dieser auflst; noch genauer, sie lst sich zugunsten der wis-
senschaftlichen Bearbeitung der dialektisch begriffenen mensch-
48
lich-gesellschaftlichen Totalitt auf. Sollte diese Stufe der Bildung
unter vernderten historischen Verhltnissen allgemein werden
knnen, dann wird man auf die Philosophie und ihre sich endlos ab-
lsenden Systeme mit einem blo geistesgeschichtlichen Interesse
zurckblicken, wie man das heute hinsichtlich der antiken Mytho-
logie tut. Die Philosophie wird zu einem geistigen Schauobjekt der
Vergangenheit.
Was von ihr brigbleibt, ist allenfalls die Erkennt-
nistheorie samt der ihr zuzuzhlenden Methodologie, die aber nur
noch als Dialektik Bestand haben kann; jedoch auch dies nur in der
Gestalt streng realistischer Wissenschaft ohne spekulativen Beige-
schmack.
Individuelle Tragdien wird es immer geben. U nglckliche L iebe ist
auch in harmonischen Gesellschaften denkbar. Aber Tragdien gan-
zer Schichten, Klassen und Gesellschaften sind eine Erscheinung an-
tagonistischer Ordnungen und treten, sonst latent verborgen, be-
sonders in krisenhaften Niedergangsepochen hervor. Von den heute
in die tragische Situation geratenen drei gesellschaftlichen Klassen
des Brgertums, des Kleinbrgertums und der Arbeiterschaft trifft
sie die letztere am schwersten. Da dies bei dieser in einem besonde-
ren Sinne geschieht, wodurch sie sich in einer eigenartigen Weise
ber die beiden brigen Klassen erhebt, werden wir spter zeigen.
Das in dialektischer U mkehrung des L oses des Arbeiters hervortre-
tende Besondere in seiner Wesenheit hat schon Hegel bemerkt und
analysiert.
Allerdings hat Hegel noch den Adeligen als Herrn und
den noch halb in Traditionen der L eibeigenschaft steckenden
Knecht vor Augen gehabt. Das Herr-Knecht-Verhltnis bot sich
ihm noch rein als das Verhltnis von Miggang und Ttigkeit dar.
Indem Kojeve und Sartre die Hegelsche Dialektik des Herr-
Knecht-Verhltnisses unkritisch auf die moderne Zeit bertragen,
gelangen sie zu Schlssen, die in ihrer den Arbeiter idealisierenden
Gestalt nicht haltbar sind.
In Anknpfung an Hegel bemerkt Sartre folgendes:34 Der Arbeiter
ist zwar der negativste, der abhngigste Teil der Gesellschaft. Aber
indem er als einziger die Dingwelt durch seine Arbeit beherrscht, sie
4 9
umgestaltet, mit seiner Geschicklichkeit umzubilden in der Lage ist,
sie in den Griff bekommt und verndert, hat er in seiner Weise Bil-
dung. Zwar schreibt ihm der Herr vor, was er zu tun hat, manch-
mal bis in alle Einzelheiten hinein. Jedoch macht ihn gerade wie-
derum diese aufgezwungene Regelmigkeit seiner Arbeit auch frei-
er, denn er mu nicht mehr wie der Angestellte auf die Eigenarten,
die Psychologie des Herrn Rcksicht nehmen, er braucht ihm nicht
zu schmeicheln; es gengt, wenn er der inneren und vorgeschriebe-
nen Gesetzmigkeit der Arbeit folgt. - Wir mssen uns mit diesen
wenigen Hinweisen begngen, aber sie zeigen bereits, da ange-
sichts der wirklichen Lage des Arbeiters im Kapitalismus die zugun-
sten des Arbeiters kritisch sein wollenden Analysen Sartres nichts als
eine Art Sophisterei ausmachen, die, wenn auch ungewollt, fast auf
eine Art Beschnigung der Lage des Arbeiters hinausluft. Als So-
phisterei entpuppt sich vor allem die These von der Bildung des Ar-
beiters,
weil er die gegenstndliche Welt umbildet. So sinnvoll eine
solche dialektische, weil den Umschlag der tiefsten Abhngigkeit
Und Unbildung in eine Art von Bildung nachweisende Perspektive
noch in Hegels Philosophie sein mochte, so wenig verweisen ihre
Resultate auf die soziologische Wahrheit gegenwrtiger Zustnde.
Der Arbeiter lt sich nicht begreifen aus der einfachen Beziehung
zur Dingwelt, die er bearbeitet, sondern aus den allgemeinen zwi-
schenindividuellen Verhltnissen der gesellschaftlichen Totalitt, in
denen das Problem der Dingbezogenheit in der Arbeit allerdings
nicht bersehen werden darf. Gerade als Phnomen der allgemeinen
gesellschaftlichen Verhltnisse betrachtet, lt sich diese Dingbezo-
genheit in genau entgegengesetzter als der von Sartre herausgestell-
ten Wirkung einsehen: als verdinglichte Versachlichung der Indivi-
dualitt des Arbeiters, als eine Form der Unterwerfung seiner
menschlichen Eigenschaften unter dinglich-sachliche Erfordernisse
des kapitalistischen Produktionsprozesses. Da ein Gran Wahrheit
in der These liegt, der Arbeiter wrde die dingliche Welt im Griff
haben, sie und damit in einem wohlverstandenen Sinne sich selbst
bilden, was oft seinen berechtigten Stolz ausmacht, haben wir
oben aufgewiesen, ist aber eine andere Sache und verliert innerhalb
des allgemeinen kapitalistischen Entfremdungsprozesses seinen bis
zur Verkehrung ins Gegenteil ihm in der isolierten Betrachtung zu-
kommenden Sinn.
Fnf konkrete Symptome sind es, die die Tragik des heutigen Arbei-
ters erkennen lassen.
Erstens die totale menschliche Verarmseligung, der proletarische
Pauperismus, der vllig unabhngig von der Lohnhhe unverndert
bleibt. Er ergreift das emotionale Leben des Arbeiters bis hin zur
50
Erotik, ebenso sein Bewutsein, das jene auffallende dialektische
Form zeigt, wonach bei steigender Verbrgerlichung der Arbeiter-
organisation er zwar hinsichtlich der Anpassung an die brgerlichen
Lebensformen - hoffnungslos - mitzumachen versucht, jedoch sich
stets ein klares
Wissen um seine proletarische Situation und Wesen-
heit erhlt (auch wenn er es selten ohne ueren Ansto artiku-
liert),
36
Zweitens ist die Bindung an das Eigentum zu erwhnen. Wir mei-
nen hier nicht die Gebundenheit an das kapitalistische Eigentum in
der Weise, da der Arbeiter gentigt ist, seine Arbeitskraft anzubie-
ten, um leben zu knnen und damit in Abhngigkeit vom kapitalisti-
schen Eigentum gert. Wir meinen im Gegenteil das Eigentum des
Arbeiters selbst, das, um in seiner Beengtheit und Armseligkeit er-
halten oder um weniges vermehrt zu werden, die stndige Anforde-
rung zu rastloser Ttigkeit und Aufopferung der Arbeiterindividua-
litt stellt.
Dieses Eigentum erfllt jene gesellschaftliche Aufgabe,
die seit Freud unter den Begriff des repressiven Realittsprinzips
subsumiert wird. Indem es zum autonomen Ziel im Arbeiterleben
wurde, wirkt es als treibende dynamische Kraft, die dem einzelnen
einredet, im Dienste seines Glcks dieses Ziel erreichen zu mssen,
um ihn am Ende seines Lebens wissen zu lassen, da er ein Opfer ei-
nes ideologischen Phantoms geworden ist.
Drittens ist ein zuverlssiges Kennzeichen des proletarischen Paupe-
rismus der Schutz, der ihm durch die Sozialgesetzgebung gewhrt
wird.
Nur der Gefhrdete und Schwache bedarf eines solchen
Schutzes. Der Brger bedarf seiner nicht. Schon die Sprache verrt
diesen Tatbestand, wenn gesagt wird, da sich der Arbeiter etwas
leistet,
whrend der Brger z. B. einen Wagen erwirbt.
Viertens haben scharfsinnige Beobachter bemerkt, da die wichtig-
ste
Zeit im Leben des Arbeiters, die Arbeitszeit, eine sterbende
Zeit ist. Sie ist unschpferisch und von Langweile erfllt, so da auf
den Europischen Gesprchen der Gewerkschaften in Recklinghau-
sen Kasnacich-Schmid unter Zitierung von Walter Rathenau sagen
konnte:
Das Arbeitsleid ist eine sehr reale Gegebenheit. Wer mechanische Arbeit am
eigenen Leib kennengelernt hat, wer das Gefhl kennt, das sich ganz und gar
in einen einschleichenden Minutenzeiger einbohrt, das Grauen, wenn eine
verflossene Ewigkeit sich auf einen Blick auf die Uhr als eine Spanne von
zehn Minuten erweist, wer das Sterben eines Tages nach einem Glockenzei-
chen mit, wer Stunde um Stunde seiner Lebenszeit ttet, mit dem einzigen
Wunsch, da sie rascher sterbe, der wird das Mrchen von der Arbeitslust
mit Hohn beiseite schieben...
5 1
Fnftens verweisen wir auf das vieldiskutierte Problem der Freizeit
und der Kultur, auf jene heute herrschende und fr den Arbeiter
in seiner groen Mehrzahl geltende Kultur, die sich bei genauer Pr-
fung als ein verdinglichtes Schema erkennen lt, ausgestattet mit
dem Zweck, das Individuum nicht durch Befreiung aus seiner
menschlichen Entfremdung zu wandeln, sondern umgekehrt es in
den entfremdeten Proze einzuordnen.
Bei diesem Punkt setzt die eigentliche Frage der Bildung in ihrer Be-
ziehung zum Arbeiter ein. Auf der pauperisierten Lebensebene ist
Bildung entweder nicht mglich oder bestenfalls als Bildung der
zweiten Stufe beobachtbar. Jedoch lehnt der Arbeiter diese Bildung
konsequent ab, er zieht die vllige Unbildung der Scheinbildung, die
er berraschenderweise als solche - wenigstens gefhlsmig -
durchschaut, vor. Vielleicht liegt in diesem ahnungsweisen Durch-
schauen der Scheinbildung seine eigentliche Bildung, oder besser,
die Grundlage zu einer knftigen echten Bildung.
Wie Philosophie, Theologie, Literatur und Alltagsbewutsein be-
weisen, kann Schicksal in dreifacher Weise erlebt und aufgefat
werden: als gesellschaftlich-kollektives Schicksal, dem der einzelne
unterworfen ist, mehr oder weniger ohne seine eigene Schuld; als in-
dividuelles Schicksal, wobei der gesellschaftliche Hintergrund nicht
geleugnet wird, aber die Verantwortung fr die Begegnung mit die-
sem Schicksal dem Individuum aufgelastet wird; als subjektives (ver-
subjektiviertes) Schicksal, dessen Normen voll und ganz von den
Bedingungen der objektiven Welt abgetrennt und in das Innere des
Menschen verlegt werden. Der allgemeinen Tendenz nach lt sich
sagen, da die erste Form des Schicksalserlebens fr den Arbeiter,
die zweite fr den Kleinbrger, die dritte fr den Brger charakteri-
stisch ist- wobei stets hinzugefgt werden mu: in der Epoche der
brgerlichen Dekadenz, in der sich diese drei Formen schrfer als
sonst voneinander abgrenzen. brigens ist die dritte brgerliche
Form eine Neuerscheinung der Dekadenz selbst, dem Brgertum
des 19. Jahrhunderts noch fremd. - So wenig dies auf den ersten
Blick einleuchtet, so mu doch unterstrichen werden, da mit diesen
verschiedenen Formen des Schicksalserlebens die verschiedenen
Formen der Bildungsauffassung eng zusammenhngen, und in wei-
terer Folge die verschiedenen geistigen Tragdien, die sich den so-
zialen anschlieen und die sich im Bildungsproblem, wie es sich als
ideologisches Problem darbietet, widerspiegeln.
Vom Arbeiter wird entsprechend seiner kollektivistischen Arbeits-
und Lebenssituation das Schicksal als von objektiven gesellschaftli-
chen Mchten abhngig begriffen. Von unserem Standpunkt des dia-
lektischen Totalittsdenkens sind wir geneigt, dem zuzustimmen,
52
wenngleich sich theoretisch die Vermittlungen zwischen dem Indi-
viduellen und dem Objektiven komplizierter darstellen, als dies dem
naiven Bewutsein des Arbeiters zugnglich sein mag.
Erscheint dem Arbeiter das Schicksal als objektive gesellschaftliche
Macht, dann folgt fr ihn daraus, da Wissen und Bildung keine an-
dere Aufgabe zu erfllen haben als die, diesem Schicksal, das er als
bedrckend empfindet, kritisch und verndernd gegenberzutreten,
was nichts anderes heit als eine praktische Aufgabe. Bildung ist ihm
nichts anderes als ein praktisches Werkzeug. Daraus resultiert eine
eigenartige Dialektik im Denken des Arbeiters, die als eine tragische
zu erkennen ist. Dies uert sich darin, da der Arbeiter den Trger
des Wissens und der Bildung, den Intellektuellen, hoch einschtzt
und achtet, ihm gleichzeitig aber als dem gefhrlichen Verfhrer
des Menschen im Dienste etwaiger Konservierung der schicksalhaf-
ten sozialen Verhltnisse mitraut. Aber diese Dialektik geht weiter.
Gerade weil der Arbeiter in der Bildung eine praktische Einrichtung
erblickt, bekmmert er sich um sie nur so weit und nur zu jenen Zei-
ten, als er die berzeugung gewinnen kann, sie praktisch-politisch
auswerten zu knnen; er resigniert und wendet sich von ihr ab in
Zeiten des Versagens seiner Bewegung, wobei sich das Mitrauen
gegen die sonst von ihm geschtzten Intellektuellen steigert. Einer-
seits ist er gerade wegen seiner praktischen Ausrichtung den anderen
Klassen insofern berlegen, als er in seiner naiven, ja primitiven
Weltansicht und aus seinem unmittelbaren Erleben heraus das heu-
tige gesellschaftliche
Verhltnis als ein Herr-Knecht-Verhltnis
durchschaut; dieses Durchschauen, das gleichfalls der ersten, unmit-
telbar empirischen Stufe der Bildung angehrt, macht seine Bildung
aus. Anderseits lehnt er wegen seiner praktischen Einschtzung aller
Bildung im heutigen Zustand der resignierten Dekadenz die Bildung
im gegebenen historischen Augenblick als fr ihn irrelevant ab, zieht
er ganz bewut die Unbildung vor. Das ist die Lsung des vieldisku-
tierten Geheimnisses, weshalb der Arbeiter sich weigert, die bereit-
stehenden Bildungsinstitute auszuntzen (z. B. die Volkshochschu-
len).
Das bewute Aufsichnehmen der Unbildung, so sehr sie die Tragik
des Arbeiters kennzeichnet, hat eines fr sich: Er gibt sich keiner Il-
lusion hin. Das Wissen um die ideologische Gebundenheit des Wis-
sens und das Wissen um die eigene Primitivitt verleiht dem Arbeiter
eine illusionslose Klarheit, die bewirkt, da er, besonders im Gegen-
satz zum Kleinbrger, keine subjektiven Minderwertigkeitsgefhle
kennt, sondern nur solche, die aus seiner gesellschaftlichen Lage,
seiner sozialen Inferioritt kommen, also durch die objektive Reali-
tt veranlat sind. Deshalb kennt der Arbeiter keine subjektiven
5 3
Schuldgefhle, was ihm jenen eigenartigen Gleichmut verleiht, der
oft beobachtet worden ist. Illusionslos, versucht natrlich auch der
Arbeiter sich vom allgemeinen Brotlaib ein Stck abzuschneiden
und verlegt seine Trume, die sich in einem krassen Widerspruch zu
seiner resignierten Anpassung an die gegebene Ordnung befinden
und deshalb bewutseinsmig mehr oder weniger zurckgedrngt
werden, in eine ferne Zukunft. Aber diese beiden Momente: das
klare Wissen um die eigene gesellschaftliche Inferioritt und der
Hang zum Sozialutopischen, der unter Ablehnung der Bildung fr
sich selbst ihr trotzdem fr die ttige Vernderung der Welt in der
Zukunft einen hohen Wert zuspricht, bilden die Grundlage fr die
Ermglichung jenes dialektischen Umschlags der resignierten Passi-
vitt in Aktivitt, die noch heute gefrchtet wird, die Grundlage fr
den Widerstand, wenn die Umstnde dies erlauben.
Bei der Einschtzung der Mentalitt des Arbeiters wird diese oft mit
der Mentalitt der Arbeiterbewegung verwechselt. Beide sind kei-
nesfalls identisch. Das resignierte Aufsichnehmen der Unbildung,
die geschichtliche und erfahrungsmige Grnde hat, hatte zwei
vernichtende Folgen: das Verschwinden des in der Arbeiterbewe-
gung unentbehrlichen und einst groartigen Volkstribunentums
und die Beseitigung der direkten und indirekten Kontrolle der Or-
ganisationen seitens der Mitgliedschaft. Das Ergebnis war die Bro-
kratisierung der Arbeiterbewegung. An die Stelle der Bewutseins-
bildung trat der Praktizismus, an die Stelle der Theorie, die zu befra-
gen war, die Brokratie, die ungefragt entschied. Die Bewegung und
die Mitgliedschaft wurden nicht mehr durch Ideen, sondern durch
Manipulation geleitet. Bewirkte der ideelle Einflu die zustimmende
geistige Gefolgschaft, so setzt die brokratische Manipulation die
resignierte Gleichgltigkeit voraus. Auf dieser Basis wird selbst je-
nes Ma von Bildung berflssig, das frher unabdingbare Voraus-
setzung der Gefolgschaft der Arbeiter gewesen ist. Verstrkt der B-
rokratismus die Resignation, so erlaubt diese Resignation den bil-
dungsfeindlichen Brokratismus. Und da aus dem kollektiven, ob-
jektivistischen Bewutsein der Arbeiter heraus Bildung nur den Sinn
gewinnt, wenn sie praktisch relevant wird, so lehnt er auch aus die-
sem zustzlichen Grunde der Bedeutungslosigkeit der Bildung in
den brokratischen Organisationen sie ab. Ihrerseits bedrfen diese
auf brokratischem Wege gesellschaftlich integrierten Organisatio-
nen keiner Bildung, denn Bildung wrde infolge ihrer kritisch-tti-
gen Wirkung diese Integration stren. Selbst als gngige Bildung der
zweiten Stufe hat sie fr den Brokratismus nicht einmal den aufge-
zeigten illusorischen Sinn, denn aller Brokratismus ist seiner Natur
nach bildungsfeindlicher Praktizismus.
5 4
Spricht man, wie oft zu hren, von der Verbrgerlichung der heuti-
gen Arbeiter, so steckt zumeist die Verwechslung mit der fort-
schreitenden
Verbrgerlichung der Arbeiterbewegung dahinter;
wobei die Tatsache zur tuschenden Beurteilung beitrgt, da tat-
schlich im unvermeidlichen Anpassungsproze an verschiedene
Lebensformen der heutigen Gesellschaft gewisse uerliche
Zge
der Verbrgerlichung den Habitus des Arbeiters mitformen. uer-
liche,
weil eine genaue Beobachtung zeigt, da es zu einem als tra-
gisch zu beurteilenden Widerspruch zwischen diesen Tendenzen zur
Verbrgerlichung und der verbleibenden innersten Wesenheit des
Arbeiters kommt.
Grndet sich ein gewisser Stolz des Arbeiters auf seine Hand- und
technischen Fertigkeiten, so hat der Kleinbrger keinen Grund zu
einem solchen Stolz, denn seine Arbeit ist zumeist formale und ab-
strakte
Manipulation, die an der Sachwelt nichts ndert. Den Kern
des Kleinbrgertums bildet die Angestelltenschaft in ihren verschie-
denen Formen. Das Schicksal kleinbrgerlicher Arbeit ist nicht die
Produktivitt, sondern die Sterilitt. Von der kollektiven Einord-
nung des Arbeiters in den Arbeitsproze unterscheidet sich der ar-
beitsmige Individualismus des Angestellten grundstzlich. Be-
sonders seinem Bewutsein nach. Die relative Entfernung dieser
Arbeit vom produktiven Proze verstrkt diese individualistische
Tendenz. Damit hngt auch zusammen das Gefhl des Bewahrtblei-
bens von den Unbilden der krperlichen Arbeit und deshalb des
Anders- und Besserseins im Vergleich zum Arbeiter. Interessant an
dieser Haltung ist auch, da trotz der blichen verbalen Ableugnung
der Existenz eines Proletariertums in unserer Zeit diese Existenz zu-
gleich durch ein fanatisch zu nennendes Bemhen, sich von diesem
Proletariertum abzugrenzen, zugegeben wird. Daraus ergibt sich die
Neigung des Kleinbrgers, es dem Brger gleichzutun, die Neigung
zur Verbrgerlichung.
Was dem Arbeiter nur uerlich bleibt, ist
hier echt; von einer Verbrgerlichung des Kleinbrgertums kann
durchaus gesprochen werden.
Trotzdem bleibt eine unaufgelste Differenz zwischen dem Brger
und dem Kleinbrger, die dem gewissenhaften Beobachter nicht
entgehen kann - z.B. beim Studium der brgerlichen Wohnung
des Kleinbrgers, die stets einen eigenen, eben kleinbrgerlichen
Geschmack hinterlt. Mag in Kleidung und Gestik, in der Rede
und in der Weltansicht die Nachahmung mehr oder weniger als ge-
lungen erscheinen, es bleibt ein auf den ersten Blick erkennbarer
Unterschied. Da ist zunchst die kleinbrgerliche Unsicherheit, die
durch das Gehabe durchscheint und sich von der Sicherheit des
echten Brgers abhebt. Der Kleinbrger hat mit dem Arbeiter unge-
5 5
achtet aller darin liegenden unterschiedlichen Nuancen das Inferio-
rittsgefhl gemeinsam. Vom Brger unterscheidet er sich durch die
Unfhigkeit, der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit der gleichen
Distanz zu begegnen wie jener. Der Brger beherrscht die Realitt,
aber er unterliegt ihr - wenigstens in seinem subjektiven Bewut-
sein - nicht, whrend der Kleinbrger bis in seine subtilsten seeli-
schen Erlebnisse hinein dem Gefhl, von den ueren Mchten ab-
hngig zu sein und sich ihnen geschickt anpassen zu mssen, nicht
entrinnt. Auch dies ist geeignet, die Kluft von brgerlicher Sicher-
heit und kleinbrgerlicher Inferioritt zu vertiefen. Was daraus noch
folgt, weist auf die verfeinerte Versubjektivierung des Brgers auf
der einen Seite und auf das gleichzeitig manische wie milungene
Bemhen des Kleinbrgers zur Aneignung dieser versubjektivierten
Technik der Lebens- und Erlebensgestaltung. Was beim Kleinbr-
ger herauskommt, ist ein Surrogat, das mehr die Sehnsucht nach ver-
innerlicht-verfeinertem Leben verrt als das Gelingen.
Wir haben es mit einer Dialektik des Widerspruchs zwischen der ge-
reizt-fanatischen Neigung zur Nachahmung des Brgerlichen und
dem Versagen, dem ueren Gelingen und dem grundstzlichen
Milingen dieser Nachahmung in den zentralsten Belangen des ei-
gentlich Brgerlichen zu tun. Sehen wir nher zu, so lt sich erken-
nen, da diese Dialektik nur die Kehrseite einer anderen ist, nmlich
der Dialektik der fanatischen Neigung zur Abgrenzung gegen alles
Proletarische und des im letzten nicht zu vermeidenden stndigen
Rckfalls auf dessen menschlich-pauperisierte Position, wenn auch
mit den entsprechenden Unterschieden, die aus der strkeren Ver-
brgerlichung des Kleinbrgers resultieren. Es gengt, darauf hin-
zuweisen, da in einer, wenn auch nuancenmig abgewandelten,
Gestalt die aufgewiesenen fnf Momente der menschlichen Tragik
des Arbeiters auch fr den Kleinbrger gelten, was sich am leichte-
sten am Angestellten demonstrieren lt:
Erstens die Pauperisierung der menschlichen Totalitt als Folge von
Beruf, Spezialistentum, Inferioritt und Integration in das allge-
meine entfremdete Bewutsein. Zweitens der notwendige Schutz
durch die Sozialgesetzgebung, denn nur der Schwache und Abhn-
gige mu geschtzt werden. Drittens die Bindung an das Eigen-
tum, das in Wahrheit keines ist, denn es gewhrt nicht Freiheit im
Sinne der brgerlichen Unabhngigkeit, sondern fesselt im Sinne des
Realittsprinzips den einzelnen an die Notwendigkeit der Repro-
duktion dieses Eigentums. Viertens die sterbende Zeit, die sich
von jener des Arbeiters kaum unterscheidet. Fnftens die Funktion
der Freizeit als eine Funktion der zweiten Stufe der Bildung, der
Einordnung in das Schema verdinglichter Kultur.
5 6
Von besonderer Bedeutung wird fr den Kleinbrger der fnfte
Punkt der Freizeit und Kultur, der sich in der kleinbrgerlichen
Denkweise zum Problem der Bildung verdichtet. Um das zu verste-
hen, mssen wir auf das Problem des Schicksals zurckgreifen.
Wir haben gesehen, der Arbeiter erlebt das Schicksal als eine gesell-
schaftliche Macht. Daraus resultiert sein praktischer Bildungsbegriff
und das bewute Aufsichnehmen der Unbildung. Der Arbeiter, der
sich seiner Inferioritt und ihres gesellschaftlichen Grundes bewut
ist, hat
Minderwertigkeitsgefhle, aber keine Schuldgefhle. Der
Schuldige ist fr ihn die Gesellschaft. Daraus entspringt seine offene
oder, wie heute, in Westdeutschland, verborgene Haltung gegen die
Gesellschaft. Der Kleinbrger dagegen hat nicht nur Minderwertig-
keits-, sondern auch ihn zutiefst beunruhigende Schuldgefhle. Sie
entstehen dadurch, da er in ideologischer Abwehr der kollektivisti-
schen proletarischen - gewerkschaftlichen, hrt man ihn oft sa-
gen - Denkweise und in Zuneigung zum brgerlichen Subjektivis-
mus die gesellschaftliche Bedingtheit seiner menschlichen Misere
nicht oder nicht primr gelten lt und in weiterer Folge die subjek-
tivistische, durch den allgemeinen brgerlichen Individualismus zu-
stzlich genhrte, Neigung entwickelt, diese Misere aus dem
eigenen Versagen zu erklren. Er verlegt die vom objektiven Sein
ihm aufgezwungene Schicksalsfrage in den Bereich des Individuel-
len,
wo er sie zu bewltigen und zu lsen versucht.
Eingeklemmt zwischen die Pole der brgerlich-individualistischen
Anreizung zur Ausntzung der freien Konkurrenz, aus sich et-
was zu machen, auf der einen Seite, der tragischen Gebundenheit
an die erwhnten Momente des menschlichen Pauperismus und der
Entfremdung auf der anderen Seite, findet der Kleinbrger aus die-
sem verhexten Kreis nicht heraus. Da er dem kleinbrgerlichen In-
dividualismus zuneigt, der einzelne eher schuldig erscheint als das
Ganze, schlagen die aus dieser widerspruchsvollen Situation em-
porwachsenden
Gefhle der Verzweiflung leicht in subjektive
Schuldgefhle um.
Die Neigung, etwas aus sich zu machen, mndet in das bekannte
kleinbrgerliche Bildungsstreben aus. Erscheint das Schicksal dem
Kleinbrger in der doppelten irrational-mystischen Gestalt: als
objektiv-undurchdringliches und als subjektiv-verschuldetes, so
gibt beides Anla zur Fortsetzung der grundstzlich individualisti-
schen Haltung in einem Tun; nicht etwa die Gesellschaft zu ver-
ndern, denn das scheint angesichts der undurchdringlichen objek-
tiven
Mchte und des Aufrufs zur subjektiven Selbsterlsung irrele-
vant oder von sekundrer Bedeutung, sondern sich von seinem
Schuldgefhl zu befreien durch Bewhrung im Sinne des indivi-
5 7
dualistischen Aufrufs zur Entfaltung der Persnlichkeit. Das Heil
liegt in der Selbsterlsung. Der Weg dahin kann aber nur der sein,
der dem Kleinbrger zur Verfgung steht, der der Bildung. Da aber
unter den gegebenen pauperisierten Lebensbedingungen dieses Ziel
nur relativ, nur sehr unbefriedigend zu erreichen ist, wird das
Schuldgefhl nicht getilgt, sondern es verstrickt sich nur noch mehr
in die bedrckende subjektive Problematik und bedrngt den ein-
zelnen, je ernster er sich nimmt und je bemhter um die Selbsterl-
sung er ist, desto schwerer.
Der mit Hilfe der Bildung zu erzwingende Durchbruch durch die
dem Kleinbrger eigene Welt des Scheins wird erschwert und ver-
hindert durch die Tatsache, da die erstrebte Bildung im gegebenen
geschichtlichen Stadium nur die Bildung der zweiten Stufe sein
kann, der Stufe des Scheins und der spekulativen Philosophie. Um-
gekehrt kann der Kleinbrger diese Stufe nicht berwinden, weil alle
seine geschilderten situationsbedingten und habituellen Eigenschaf-
ten ihn auf diese Stufe verweisen, ihn an sie fesseln.
Die unerfllte Sehnsucht weist in die Utopie, die aber nicht wie beim
Arbeiter einen wesentlich realen Charakter annimmt, sondern einen
subjektivistisch-irrealen. Vorlufig, im Diesseits, soll die Verbes-
serung der materiellen Besitzlage zu erhhtem Prestige verhelfen.
Prestige und Sicherheit erfordern ein gesteigertes materielles Stre-
ben. Aber da im Vergleich zum nachgeahmten Brger die Erl-
sung durch materiellen Genu nur halb gelingt, ergnzt das klein-
brgerliche Bewutsein dieses Streben durch das Gegenteil davon,
nmlich durch die sehnsuchtsvolle utopische Hoffnung auf eine
knftige Erlsung sowohl in materieller als auch in persnlicher Be-
ziehung. Dieser kleinbrgerliche Utopismus ist der typischen klein-
brgerlichen Mentalitt entsprechend verschwommener und wider-
spruchsvoller Natur. Seinem eigenen Utopismus begegnet der
Kleinbrger bald mit glubigem Ernst, bald mit hhnender Ironie, je
nach den gesellschaftlichen und persnlichen Umstnden. Zeigt der
Utopismus des Arbeiters eine deutliche Realittsbezogenheit und
Konstanz, wobei er sich besonders im Umkreis des Sozialen und
Technischen bewegt, so steht der kleinbrgerliche Utopismus auf
einer unbestimmten, schwankenden Grundlage.
Das Trumen des Kleinbrgers ist haltloser und verschwommener
als das des Arbeiters. So wenig es aus der seelisch-geistigen Welt des
Kleinbrgers weggedacht werden kann, und so wahr es ist, da er
sich in diesem Trumen selbst verwirklicht, weil sein ganzes Leben
auf illusionrer Grundlage basiert, was sich aus seiner Zwischenstel-
lung zwischen Proletariat und Brgertum und aus seinem ungefe-
stigten Subjektivismus erklrt, so wahr ist es aber auch, da er un-
58
vermittelt in eine Stimmung ironischens Verneinens gert, wenn
man ihm seine traumhaft-utopischen Neigungen vorhlt. Er schmt
sich seines kritischen Utopismus, der an den proletarischen erin-
nert und der Utopielosigkeit des Brgers widerspricht, um desto z-
her an dem utopischen Selbsterlsungsbedrfnis festzuhalten. Es
bleibt jedoch kennzeichnend, da der Kleinbrger infolge der ihm
eigenen subjektivistischen Tendenzen auch seinen Utopismus ver-
subjektiviert, d.h. aus dem Bereich des Real-Zukunftsgerichteten
ins Irrational-Subjektive ausbricht und unter Zukunft nur sekundr
die soziale versteht, primr die persnliche Zukunft, grundstzlich
eine Zukunft innerhalb der vorhandenen Beziehungen und Verhlt-
nisse.
Es ist nicht leicht, diesen verschwommenen und ambivalenten Uto-
pismus genau zu beschreiben. Wie der Kleinbrger zwischen allen
Extremen hin und her schwankt, so schwankt auch sein Utopismus
zwischen der Hoffnung auf materielle Sicherstellung und der Befrie-
digung des Bedrfnisses nach Erhhung seiner Individualitt mittels
der Zugnglichmachung aller Bildungsmglichkeiten. Der klein-
brgerliche Bildungsphilister, ein Produkt der Verbindung von ver-
brgerlichtem Individualismus und der zweiten Stufe der Bildung,
sieht die Erfllung seiner Sehnsucht nach Prestige und subjektivem
Glanz zeitweilig auch in einer neuen sozialen Ordnung, von der er
sich aber einen mehr sentimentalen Begriff macht, und wird revolu-
tionr. Man unterschtze aber anderseits diese Haltung nicht, denn
sie macht unter gnstigen Umstnden gewisse kleinbrgerliche
Schichten zugnglich fr ernste humanistische Parolen, deren An-
liegen gleichfalls, wenn auch nicht aus Grnden des Prestiges, son-
dern aus Grnden der Emanzipation durch die Wiederherstellung
der Einheit von Mensch und Spiel, die individuelle Persnlich-
keit ist.
Der Kleinbrger hat sich stets von einer kraftvollen und
nicht integrierten, von einer humanistischen und nicht ethisch
verwsserten, von einer mit kritischer Theorie gesttigten, vor allem
aus allen diesen Grnden selbstbewut auftretenden gesellschaftli-
chen Bewegung imponieren lassen. Die Diskussion darber, wie der
Kleinbrger in seiner Masse fr den Humanismus zu gewinnen sei,
findet in diesem Aspekt ihre Antwort. Allerdings hat der ambiva-
lente Habitus des Kleinbrgers auch seine gefhrliche Seite. Ge-
neigt, jedem zu folgen, der in irgendeiner Weise seinem sehnsuchts-
vollen Utopismus entgegenzukommen bereit ist, geht er leicht auch
dem Faschismus, dessen hohl-deklamatorischen Revolutionarismus
nicht durchschauend, auf den Leim.
Die eigentliche Tragik des Kleinbrgers ist zu suchen im Wider-
spruch zwischen seiner Neigung zur Anpassung an die vorhandenen
59
gesellschaftlichen Lebensbedingungen und der gleichzeitigen Nei-
gung zur Revolutionierung seiner subjektiven, insbesondere intel-
lektuellen Existenz. Die kleinbrgerlichen Minderwertigkeitsgefh-
le, die den subjektiven Bildungsbegriff des Kleinbrgers provozie-
ren - und der ihm anhaftet wie die Lge dem Sophisten -, zwingen
ihm die Vorliebe dafr auf, etwas zu scheinen, was er nicht ist. Ver-
gleicht man ihn mit dem Arbeiter und dem Brger, so ergibt sich eine
subjektiv ganz verschiedene Haltung. Der Arbeiter will nicht mehr
scheinen als er faktisch ist, weil er aus seinem mehr oder weniger kla-
ren Wissen um seine menschliche Inferioritt heraus sich keiner Illu-
sion hinsichtlich der Realisierbarkeit eines prestigeerzeugenden
Scheins hingibt. Was er ist, das will er auch solange zu sein scheinen,
solange unter den fr ihn unabdingbar geltenden Lebensbedingun-
gen seine armselige Gestalt durch die ideologischen Manver, die
ihm das auszureden versuchen, sich unverkennbar zu erkennen gibt.
Der Brger wiederum will nicht etwas anderes scheinen, weil er in
dem Bewutsein einer besonderen menschlichen Bevorzugtheit lebt
und sich damit begngt, dieses Bewutsein bestehen zu lassen, aller-
dings nicht ahnend, da es gerade da, wo diese Illusion der menschli-
chen Bevorzugtheit herrscht, dem Schein unterliegt. Es geht hier
nicht um die Feststellung dieses Scheins, sondern um die bewute
Haltung zu sich selbst, die beim Arbeiter wie beim Brger eine sol-
che der Ablehnung des bewut erzielten Scheins ist. Anders der
Kleinbrger. Nur er fhrt einen stndigen Kampf gegen sich selbst,
gegen sein eigenes Wesen, sowohl gegen das, was er ist, als auch ge-
gen das, was er scheint. Stndig ist er bemht, unter Zuhilfenahme
von allerlei ueren und inneren Kunststcken, aus sich etwas zu
machen. Gibt ihm das Streben nach Bildung gelegentlich den stol-
zen Schein, ein Gebildeter zu sein, so heftet er sich um so gewaltsa-
mer an diesen Schein, als ihm sein Bemhen, diese Bildung mit dem
des angesehenen Brgerlichen gleichzusetzen, stets milingt. Aber
er harrt aus, so da seinem Selbstverstndnis nach der Schein, den er
sich gewollt gibt, der Wahrheit entspricht: Die Illusion ist hier
ebenso widerspruchsvoll wie vollkommen.
Auf die Frage, was der Kleinbrger eigentlich sei, lt sich antwor-
ten: er ist die menschliche Inkarnation der vollendeten Illusion, der
zweiten Stufe der Bildung. Auch der Brger bleibt, in gewissem
Sinne noch extremer (wie wir noch sehen werden), der zweiten Stufe
der Bildung verhaftet. Aber er leidet nicht darunter, weil er sich als
Brger, als Herrschender fhlt. Seine menschliche Problematik ist
eine andere.
Spricht man vom Brger, so mu man sich gegenwrtig halten, da
vom liberalen Brger des vorigen und beginnenden 20. Jahrhunderts
60
heute nur noch Reste briggeblieben sind. Der moderne Brger ent-
steht mit der imperialistischen Periode, er ist der Brger der Deka-
denz. Seine klarste und schrfste Ausprgung erhlt er in seiner Eli-
te. Verwischen sich die Grenzen vom Kleinbrgerlichen zum Br-
gerlichen ber das Mittelstndische, so ist die Masse des heutigen
Brgertums nicht ohne gewisse mittelstndische Zge, was das Pro-
blem erschwert. Andererseits ist aber das eingestandene Ideal dieser
Mehrheit des Brgertums seine ausgeprgte und gebildete Elite;
deshalb ist an dieser Elite das eigentlich Brgerliche zu studieren und
zu analysieren.
Auch das Brgertum kennt einen Schicksalsbegriff, der fr es cha-
rakteristisch ist. Schicksal ist hier das vllig andere, das das Innere
nicht berhrt, es ist deshalb auch nicht das im Leben Wesentliche,
sondern das Profane, mit dem man rechnet, das zugleich als bloe
Natur zu betrachten ist. Das Brgertum kann sich ein solches
Schicksalserlebnis erlauben, weil ihm als Herrschendem ein groer
Raum individueller Freiheit gewhrt ist, so da die ueren Ein-
flsse ihm als allgemeine, naturhafte Bedingungen des Lebens gel-
ten, jedoch nicht als bestimmende Merkmale dieses Lebens selbst.
Da das Brgertum sich eine solche Entgegensetzung von innerem
freien und uerem naturhaften Geschehen leisten kann, hngt so-
ziologisch mit der ideologischen Entwertung des realen geschichtli-
chen Prozesses infolge der tiefgehenden historischen und geistigen
Krisenerscheinungen, des allgemeinen Einbruchs der Dekadenz
seit Beginn der Epoche des Imperialismus zusammen. Der Glaube
an den Fortschritt in der Geschichte, von dem noch das liberale Br-
gertum durchdrungen war, ist verlorengegangen. Die menschlich-
geschichtliche Welt scheint nicht fhig, echte und den Menschen tra-
gende Werte hervorzubringen. Wenn sie berhaupt noch zu finden
sind, so im Innern des einzelnen, im esoterischen Subjekt, im elite-
haften Ich.
Dieser gefhlsmigen und ideologischen Tendenz der Trennung
von Objektivem und Subjektivem, bei sehr verschiedener Einscht-
zung beider, schlgt sich nieder in einem neuartigen und gewisse in-
nere Werte bejahenden, widerspruchsvollen Nihilismus. Dieser Ni-
hilismus deckt sich mit dem brgerlich-dekadenten Schicksalsbe-
griff, der wiederum mit dem brgerlichen Bildungsbegriff eng ver-
knpft ist. Wir definieren diesen Bildungsbegriff als sowohl der
Scheinbildung wie der Verbildung verhaftet (worber spter mehr).
Die nihilistische Entwertung der ueren Welt bleibt nicht ohne
Einflu auf die subjektiv innere. Sie erscheint trotz ihrer Entspre-
chung zur Freiheit hin als dster und von Schuld erfllt. Es ist dies
die vom brgerlichen Bewutsein als unheimlich erlebte Allmacht
6 1
der ueren Welt, die unbewut die innere beherrscht und ihr den
Schein der unauslotbaren wechselvollen Tiefe verleiht. Mit dieser ir-
rational-dsteren inneren Welt, die der rational auszuntzenden
und zu beherrschenden ueren unvermittelt entgegensteht, wird
das brgerliche Individuum nicht so leicht wie mit jener fertig. Bil-
dung besteht fr diese Reflexionsform in der Beschftigung mit den
Problemen dieser versubjektivierten Welt, in der Aufnahme und
Bewltigung der hier entstehenden Fragen an das Leben, in der
Pflege einer sich um diese Fragen bewegenden Kultur und im Auf-
sichnehmen der nihilistisch-gorgonisch das Individuum bedrngen-
den Antworten. Das sich darin artikulierende Lebensschicksal
soll begriffen und bewltigt werden. Es ist somit keine Bildung, die
sich auf die als nur dem Nutzen dienende uere Welt bezieht, son-
dern eine der verinnerlichten Verjenseitigung (woraus sich z.B.
die weitlufige Begeisterung fr Wagners mystische Operndramatik
in diesen Kreisen erklrt). Die vulgren Probleme der Auenwelt
drfen die tiefen der Innenwelt nicht verflschen.
Damit wird aber nicht blo der besprochene Gegensatz zwischen
Denken und Sein, der fr die zweite Bildungsstufe des kontemplati-
ven Scheins und der spekulativen Philosophie charakteristisch ist,
bis ins Extrem gesteigert, sondern zudem das Individuum selbst bis
in sein Handeln hinein in zwei Teile zerrissen: in ein Individuum der
abstrakten und subtilen Kontemplation einerseits und ein Indivi-
duum des ungeschminkt praktisch-egoistischen Alltagsverhaltens
andererseits. Fr das brgerliche Subjekt wird damit nicht nur der
auf dieser Trennung von Denken und Sein beruhende Schein ver-
tieft, die Schein-Bildung zur beherrschenden geistigen Haltung,
sondern darber hinaus die Einheit der Individualitt gestrt, so da
man geradezu von einer Verbildung des geistigen Habitus des Br-
gers sprechen kann.
Gibt es fr den Kleinbrger noch immer eine enge Sparte des Zu-
rckfindens zu den Fragen der Totalitt wenigstens einer wider-
spruchsvollen Tendenz gem - denn der Kleinbrger mu bemht
sein, seine Reflexionen unmittelbar der Praxis anzupassen, will er
sich in ihr bewhren (Beruf, Familie usw.) -, so besiegelt die zweite
Bildungsstufe der unberschaubar gewordenen und zerrissenen To-
talitt das Schicksal des Brgers. Die bewutseinsmige Zerrissen-
heit der Totalitt, die tief in die Individualitt des Brgers hinein-
wirkt und sie deformiert, habituell und bildungsmig verbildet, ist
ihrerseits wiederum nur Schein. Denn in Wahrheit und ihm unbe-
wut sind es die Phnomene und Probleme der Auenwelt, der To-
talitt (die innerhalb dieser Totalitt gleichzeitig auch solche der In-
nenwelt sind), die das individuelle Bewutsein des Brgers beherr-
62
schen und beschftigen. Die menschliche Tragik des Brgers liegt in
der doppelten Selbsttuschung. Einerseits dnkt er sich hherste-
hend als die brigen Klassen, obgleich er derselben Entfremdung,
die im Unterworfensein unter das Weltbild der zweiten Bildungs-
stufe ihren Ausdruck findet, unterliegt; anderseits glaubt er ber
eine hhere Geistigkeit zu verfgen, obgleich sie wegen ihrer unkri-
tischen oder nihilistisch-scheinkritischen Begegnung mit der Au-
enwelt dem naturalistischen Oberflchenschein dieser Auenwelt
unterliegt.
Gewi gelten fr ihn nicht oder nur in anderer Weise als fr den Ar-
beiter und fr den Kleinbrger die aufgezhlten fnf Punkte der
Entfremdung - weshalb Marx sagen kann, da sich der Bourgeois
wohler fhlt als die brigen Klassen, jedoch an anderer Stelle ebenso
vermerkt, da auch er befreit werden msse. Gehen wir die fnf
Punkte nochmals mit dem Blick auf den Brger durch:
Erstens ist der Pauperismus zu erwhnen, den wir zunchst aus der
menschlichen Armseligkeit des Arbeiters deduziert haben. Kenn-
zeichnet sich eine solche Armseligkeit auch durch den Mangel an ob-
jektiver Erkenntnisfhigkeit und durch die Unfhigkeit, sich selbst
zu erkennen, so ist auch der Brger ein Pauper. Seine menschlich
tragische Situation, die sich unter anderem durch den weltabge-
wandten, damit abstrakten verinnerlichten Nihilismus kennzeich-
net, ist nur eine vermitteltere und verdecktere, eine durch den fein-
gewobenen Schleier des Gebildetseins weniger erkennbare.
Zweitens bedarf der Brger gewi nicht des sozialen Schutzes. Aber
indem er ihn unter Zwang oder freiwillig gewhrt, anerkennt er den
Knecht als ein Wesensmerkmal seiner eigenen Existenz, denn ohne
den Arbeiter wre er kein Brger. Damit wird er schuldig am
Herr-Knecht-Verhltnis, das er zu verewigen versucht, statt es auf-
zuheben. Er wird selbst zu einem Objekt dieses Verhltnisses, letzt-
lich selbst zu einem Knecht, zu einem Pauper mit umgekehrten Vor-
zeichen.
Drittens: Die Bindung an das Eigentum, das nicht nur zu reprodu-
zieren, sondern auch zu vermehren und zu verteidigen ist, ist offen-
sichtlich; die stndige Reproduktion des Knechts im Dienste der
Reproduktion des brgerlichen Eigentums wird deshalb zu einer
zentralen Aufgabe im sowohl praktischen als auch geistigen Leben
des Brgers, wodurch er in einer den brigen Klassen fremden Weise
zustzlich in die Entfremdung hineingezogen wird. Der Zwang der
Reproduktion des Herr-Knecht-Verhltnisses drngt ihn in eine
unkritisch-apologetische Position diesem gegenber und hindert ihn
deshalb, sein Wesen zu durchschauen, wie auch andererseits die dar-
63
aus entspringende praktische Haltung jegliche dieses Verhltnis hu-
manisierende Tendenz paralysiert.
Viertens ist die Zeit fr den Brger zwar keine sterbende im Sinne
der Zeit des Arbeiters, aber sie ist eine ebenso unschpferische, weil
blo unttig-genossene (orgiastische). Die Voraussetzung fr die
Artikulation eines schpferischen Zeiterlebens ist die unzerstrte
Dialektik von Subjekt und Objekt, von Ttigkeit und Totalitt. Im
Zuge der Verjenseitigung und subjektivistischen Asthetisierung der
Probleme werden diese beiden Seiten ideologisch voneinander ge-
trennt, so da die an die subjektivistische Tendenz anknpfende Be-
ttigung in eine leer-spielerische umschlagen mu, whrend die (so-
fern berhaupt noch von Angehrigen des parasitr gewordenen
Brgertums ausgefhrte) praktische Ttigkeit zur rationalistisch-fe-
tischistischen entartet. Wir haben in den Ausfhrungen ber den
Arbeiter dargelegt, da dessen Zeit eine unschpferische und daher
sterbende Zeit ist. Das Gegenteil davon wre die erfllte Zeit in der
Gestalt der Erfllung eines jeden Augenblicks der Ttigkeit im Zeit-
flu, das heit in der Gestalt des Spiels; oder was dasselbe ist, der
Aufhebung der Zeit in der Zeit. Da der dekadente Brger die Ttig-
keit vom Genu (Spiel) trennt und diesen, weil ihm eigentlich ange-
messenen, als jener berlegen deklariert, zerstrt er die Vorausset-
zung fr die wirkliche Aufhebung der Zeit in der Zeit, fr das Schp-
fertum, und gert damit in die Fnge einer falschen Kontemplation,
womit er einer nur anderen Form der sterbenden Zeit als der Arbei-
ter unterliegt. Die scheinbare berwindung der sterbenden Zeit in
der Mue und Kontemplation des Brgers entpuppt sich in letzter
Beziehung wiederum als eine dialektische Komponente der sterben-
den Zeit selbst, als eine Form der sterbenden Zeit mit umgekehrten
Vorzeichen. So kommt es trotz aller Verschiedenheit zu einer ber-
raschenden Annherung des Zeitgefhls des dekadenten Brgers an
jenes des Arbeiters: In beiden Fllen ist die Langweile das eigentliche
Erlebnis, d.h. die Zeit eine unerfllt-sterbende. Nur da im einen
Falle die Form dieser Langweile die angestrengte unschpferische
Ttigkeit ist, im anderen Falle die anstrengungslose unschpferische
Kontemplation.
Fnftens: Daraus und im Zusammenhang mit den brigen Punkten
konstituiert sich die brgerliche Kultur nicht als befreiende, sondern
als verinnerlicht-(sthetisiert-)nihilistische. Das Eindringen der de-
kadenten und morbiden Auenweltsphnomene in das Seelisch-In-
nere des brgerlichen Individuums vollzieht sich nicht etwa in der
Weise, da diese Phnomene in voller Konkretheit erscheinen, son-
dern bla und abstrakt, in Anpassung an die flieende irrationale
Gefhlswelt. Nur in dieser vernderten irrationalen Gestalt knnen
64
sie berhaupt zu Objekten der verinnerlichten Erlebniswelt werden,
ohne da die Subjekte ihre objektive Herkunft bemerken. Nur auf
diesem
Wege knnen die drohenden und dsteren Erscheinungen
der sptbrgerlichen Geschichte zu irrationalen Erlebnissen der
scheinbar rein subjektiv gebundenen Verzweiflung, Angst, Leere,
Todesfurcht usw., zu erlebnismigen Abgrnden von schreck-
haft-interessanter Tiefe umgemnzt werden.
Vergleicht man die faktische Flle und Konkretheit der objektiven
Realitt
mit ihrem verinnerlichten und abgeblaten Spiegelbild,
dann erscheint dieses als von aller objektiven Herkunft gereinigt und
vollstndig selbstndig. In diesem Schein wurzelt die Einbildung des
brgerlichen Individuums von der Bezugslosigkeit der inneren zur
ueren Welt. Georg Lukcs spricht in einem hnlichen Zusam-
menhang geradezu von einem leer-abstrakten Flieen der von al-
ler Gegenstandswelt befreiten Zeit. Treffend verweist er auf die
Dialektik von leer-abstraktem Flieen und Starrheit (Zustndlich-
keit) im verinnerlichten Zeiterlebnis, und er fgt hinzu, da aus
dieser Erstarrung das Schreckenauslsende und Unheimlich-Welt-
lose der inneren Zeit sich erklrt. Wir wrden eher sagen, da dieses
scheinbar rein verinnerlichte leer-abstrakte Flieen der Zeit die Vor-
aussetzung bildet fr das unbewute und widerstandslose Eindrin-
gen der nihilistischen Schicksalserlebnisse, wie sie in der Epoche der
brgerlichen Dekadenz die ganze Gesellschaft beunruhigen; denn
eine wirklich leer-abstrakte, eine vllig von aller Objektivitt gerei-
nigte Erlebniswelt kann es nicht geben, weil ein jeglicher seelischer
Proze seine Materialien von der Auenwelt bezieht.
Die Illusion der reinen Innerlichkeit ist gleichzeitig gesellschaftlich
wirkungsvolle Ideologie, falsches Bewutsein. Ist das Bildungsbe-
wutsein des Brgers von dieser Illusion durchdrungen, trennt er
deshalb den Kulturgenu vollkommen vom Alltag, den es blo aus-
zuntzen gilt, ist ihm darum auch jeglicher auf die Humanisierung
der gesellschaftlichen Totalitt ausgerichteter Kulturgenu fremd,
so konstituiert sich seine Bildung als eine sthetisch-jenseitige und
damit als Scheinbildung, der das einseitig genieerische und kon-
templative Zeiterlebnis organisch zugeordnet ist.
Das Problem, das sich dem Menschen in der repressiven Gesellschaft
bewut oder unbewut stellt, ist das Problem der Wiedergewinnung
der zur Freiheit fhrenden schpferischen, im Spiel sich verwirk-
lichenden Zeit. In der entfremdet-repressiven Zeit ist die in diesem
Zeiterlebnis ablaufende Ttigkeit dazu verurteilt, ohne Erfllung
der Zukunft zuzustreben. Das Versprechen knftiger Erfllung hat
den Zweck des Anreizes zu Opfern im Sinne des geltenden Reali-
ttsprinzips: Indem auf dem Wege dahin immer neue Ziele produ-
6 5
ziert werden in endloser Progression, bernimmt das Versprechen
knftiger Erfllung keine andere Aufgabe als die, das Individuum in
stndigem Trab im Dienste der repressiven Ordnung zu halten. In-
dem jeder Augenblick im Flusse der Zeit unerfllt vergeht und sich
dem Tode nhert, erscheint der Tod als der eigentliche Herr der Zeit,
sie selbst erscheint als eine sterbende. Die berwindung der ster-
benden Zeit verweist auf die Wiederherstellung des erfllten Augen-
blicks. Die stndige Flucht von Augenblick zu Augenblick in der re-
pressiven Zeit, der sterbenden, wird abgelst vom Wechsel der in
sich ruhenden glckhaften Augenblicke, in denen der Mensch gerne
verweilt, von der Aufhebung der Zeit in der Zeit. Indem jeder Au-
genblick, jedes Tun und jedes Erlebnis seinen spielenden Sinn in
sich trgt, verliert der zeitliche Flu seinen Schrecken und gibt auch
dem Tode seine ursprngliche Bedeutung wieder, nmlich Abschlu
eines erfllten Lebens zu sein.
Dem Schein nach kann der Brger glauben, sich im Besitze der
schpferisch-erfllten Zeit zu befinden, denn seiner Freiheit und
seiner Verfgung ber materielle Gter gem kann er ber seine
Zeit nach eigenem Ermessen verfgen. Aber auf der Grundlage der
berwiegend parasitren Lebensform, die den spten Elitebrger
kennzeichnet, verschrft die zweite Bildungsstufe noch mehr den
Gegensatz von Denken und Sein, Erkennen und Tat. Der Gebrauch
der Zeit wird hier unvermittelt passiv, d.h. einseitig genieerisch,
was uerliche und hektische Scheinaktivitt, etwa aus Langweile,
nicht ausschliet. Das Ziel ist nicht das Erfllung spendende einheit-
liche Denken-Tun, sondern die genieend-spielerische - man be-
achte den Unterschied zwischen spielend und spielerisch -
Kontemplation. Die hier erstrebte und scheinbar gelungene Aufhe-
bung der Zeit in der Zeit ist aber nur Schein, weil diese Form des Ge-
nusses um des Genusses willen auf die Dauer unbefriedigend wirken
mu. Fehlt die schpferische Tat, die dem Genu Sinn verleiht, wie
auch umgekehrt der Genu der Tat Sinn verleiht (Erotisierung des
Werkes), so blickt hinter der Fassade der scheinbar geglckten
Aufhebung der Zeit in der Zeit die Fratze der sterbenden Zeit her-
vor. Anstelle der erfllten Zeit siegt die Zeit der Langeweile, wenn
auch in einer anderen, ja entgegengesetzten Gestalt als dies beim Ar-
beiter der Fall ist, dessen Zeit keine genieerisch-kontemplative,
sondern leer-angespannte ist.
Der Schein, in dem der Brger lebt, wird allerdings dadurch unter-
sttzt, da er sich in ihm als dem Ausdruck der hastlosen und mi-
gen Kontemplation selbstverstndlich wohler und freier fhlt, als
sich der Arbeiter im Zustande der nackt hervortretenden Repression
seiner Ttigkeit fhlen kann. Der Brger hat Zeit zur Langeweile,
66
was sich gelegentlich darin uert, da er Zeit und Langeweile, oder
was fr ihn dasselbe bedeutet, Bildung und Langeweile gleichsetzt.
Hierbei wird fr ihn das Bedrfnis entscheidend, dem in der ue-
ren, als naturgesetzlich erlebten Zeit ablaufenden drohenden
Schicksal, dem er unbewut seine Erlebnisse der Verzweiflung und
des Nichts entnimmt, den Rcken zu kehren und sich einen nach
rein subjektiven Mastben abgegrenzten Raum der Bettigung,
d.h. subtiler Bildung und des genieerischen Ausschpfens der Ab-
grnde des morbid-dsteren Seelenflusses zu reservieren - was zu-
meist mit Hilfe der dieser Tendenz entgegenkommenden Produkte
der bildenden und darstellenden Kunst zuwege kommt. Freiheit
heit hier nicht Rckkehr zur Dialektik von unentfremdetem Ge-
nu und ebensolcher Ttigkeit, 36 sondern Flucht in die verinner-
licht-verjenseitigende und sthetisierte Kontemplation, in die
scheinttig-genieerische Unttigkeit. Die Langeweile weicht daher
auch nicht, wenn diese Unttigkeit irgendeine Form der hektischen
Scheinttigkeit annimmt - es sei denn, da sie sich in Ausnahmefl-
len auf das dem subjektiven und als dem eigentlichen erlebten Privat-
leben entgegengesetzten Gebiet der konomischen, rein der Ntz-
lichkeit dienenden Praxis richtet, wo sie aber nicht einmal den Schein
der frei-spielenden Bettigung vorzutuschen vermag, sondern
sichtbar der ent-werteten Welt der Entfremdung angehrt.
Ist die zweite Stufe der Bildung, der auch das Bewutsein des Br-
gers angehrt, gleichzeitig die Stufe der spekulativen Philosophie, so
spiegelt sich in dieser Philosophie (z.B. im Existentialismus) nicht
nur das Sein der ganzen Gesellschaft scheinhaft-verkehrt wider,
sondern in einer gewissen Verteilung der Gewichte zugunsten des
herrschenden Brgers und kraft Herrschaft die allgemeine Ideologie
starkprgenden Denkweise das spezielle Sein des Brgers. Da aber
diese ideologische Widerspiegelung der brgerlichen Existenz als
allgemein gltige ausgegeben werden kann, erklrt sich daraus, da
gewisse Zge der Entfremdung allgemeine, alle Schichten der Ge-
sellschaft erfassende Geltung besitzen.
6 7
9.
Die Ideologie der Entideologisierung
Auch den obigen ideologischen Tendenzen kommt nicht blo die
Rolle eines passiven ideellen Verhaltens gegenber dem praktischen
Proze zu, sondern sie bilden ihrerseits ein wesentliches Moment
seiner Selbstreproduktion, ein Moment der Identifikation des Indi-
viduums mit der bestehenden Wirklichkeit im Dienste dieser Selbst-
reproduktion.
Der Form nach ist diese Ideologie extreme Rationalitt. Denn der
einzelne macht sich sehr klare Vorstellungen von den Grnden, dem
Weg und den Zielen seiner Haltung. Grnde, Weg und Ziel sind
gleichzeitig die der objektiven Wirklichkeit. Darin besteht das We-
sen der Identifikation mit der objektiven Wirklichkeit. Da aber diese
Wirklichkeit in ihrer widerspruchsvollen und verborgenen Struktur
unerkannt bleibt, ist das eigentliche Wesen der ideologischen Ratio-
nalitt die Irrationalitt. Der formalen Rationalitt entspricht die in-
haltliche Irrationalitt. Der an der Oberflche haftende gesunde
Menschenverstand nimmt die verdinglichten Tuschungen fr
bare, d.h. rationale Mnze. Diese ideologische Identifikation mit
der Wirklichkeit schliet eine scheinkritische Opposition zu ihr
nicht aus; auf einer abgeleiteten Stufe werden Kritiken an den Prei-
sen, den Vorgesetzten, den Lhnen, den Schulen, der Brokratie,
der lgnerischen Presse usw. durchaus artikuliert.
Ermglicht wird dieser Umschlag von rationaler Identifikation mit
der Wirklichkeit in Mitrauen gegen einige abgeleitete Erscheinun-
gen durch den prinzipiell irrationalen Charakter, durch die un-
durchschaubar-schicksalhafte Dunkelheit dieser Wirklichkeit, die
durch die vordergrndige Rationalitt der Teilgebiete nicht aufge-
hoben wird. Diese, die Rationalitt des Teilgebietes hintergrndig
begleitende Irrationalitt wird ideologisch als mythisch-schicksal-
hafter Untergrund allen Seins erlebt und hingenommen. Wo die
Wirkung dieses als dunkles Schicksal erscheinenden Untergrundes
fr die Rationalisierbarkeit der Teilgebiete als schdlich erscheint
oder den unmittelbaren und alltglichen Interessen des Individuums
widerspricht, artikuliert das ideologische Bewutsein die Vorstel-
lung des mehr oder weniger zuflligen Auswuchses. Diesen zustz-
lichen ideologischen Faktor beschreibt Paul A. Baran folgenderma-
en: 37
Zwar wenden sich die Menschen gegen die Beschneidung ihrer Hoffnun-
gen, ihres Glcks und ihres Freiheitsbegehrens; aber da sie vom >gesunden
Menschenverstand< gepeinigt sind, auf den alle Agenturen der brgerlichen
68
Kultur setzen und der das oberste Gebot der kapitalistischen Rationalitt
darstellt, knnen sie kaum vermeiden, die Rationalitt des Kaufens, Verkau-
fens, Profitmachens mit der Vernunft selbst zu identifizieren. Allzu leicht
wird der Protest gegen die kapitalistische Rationalitt der Mrkte und Ge-
winne ein Protest gegen die Vernunft selbst, schlgt um in Antiintellektua-
lis mus und schrt Aggressivitt gegenber denjenigen, die, um Reichtmer
anzuhufen, zu ihrem Fortkommen und zu ihrem Vorteil nach den kapitali-
stischen Spielregeln handeln.
Was Baran hier den Protest gegen die Vernunft selbst nennt, ist
nichts anderes als der gelegentlich durchbrechende Protest gegen das
verdinglichte Schicksal auerhalb der Rationalitt der Teilgebiete,
mit dem man sich prinzipiell identifiziert. Solche ideologischen
Vorgnge variieren nur den Proze der Identifikation, heben ihn
nicht auf.
Allerdings vermgen sie ideologische Hebel des Durchbruchs durch
das herrschende Identifikationssystem zu bilden und den Umschlag
des scheinkritischen in ein, wenn auch von theoretischer Aufklrung
untersttztes, echt kritisches Bewutsein einzuleiten. Im Lichte die-
ser Feststellung wird z.B. der folgende Bericht verstndlich:
3 8
Bei einer soziologischen Untersuchung unter den Arbeitern der FIAT-
Werke... zeigen die Mitglieder der kommunistisch-sozialistischen Gewerk-
schaft CGIL die geringste Neigung zu autoritrem Verhalten; nach ihnen
rangieren die Mitglieder der christlichen, danach die der sozialdemokrati-
schen und schlielich die der werksinternen, paternalischen FIAT-Gewerk-
schaft.
Die am strksten auf die Identifikation mit der bestehenden Ord-
nung ausgerichteten sozialdemokratischen Gewerkschaften zeigen
somit die ausgesprochene Neigung zu autoritrem Verhalten, im
Gegensatz zu den aufgeklrteren kommunistischen und den aus ei-
nem christlich-humanistischen Fundus schpfenden christlichen
Gewerkschaften. Bezeichnend fr die integrierten sozialdemokrati-
schen Gewerkschaften ist die hier vorherrschende Einbildung, im
Gegensatz zu den weltanschaulich geschulten und einer festen Ideo-
logie folgenden fortschrittlichen Christen und Kommunisten ber-
haupt keiner Ideologie verhaftet und daher von aller Ideologisierung
frei zu sein. Die sich hierin offenbarende dialektische Umkehrung,
da sich die zu einer systematisierten Ideologie Bekennenden ge-
genber der Gesellschaft ideologisch freier fhlen als diejenigen, die
sich einbilden, keiner ideologischen Bindung zu folgen, gibt ein
Problem auf, das sich als Problem der Ideologie der Entideologisie-
rung umschreiben lt.
Wir haben bereits die Tatsache aufgewiesen, da sich die moderne
brgerliche Freiheit nur als eine dialektisch vermittelte Form der
69
Fesselung des Individuums an den verdinglichten Proze darstellt.
Das Geheimnis dieser dialektischen Vermittlung ist die Aktivitt in
der Abhngigkeit, das Getriebensein. Obgleich stndig etwas ab-
luft, geschieht nichts qualitativ Neues. Das Handeln vollzieht sich
in der Gestalt des bereits Feststehend-Vollziehbaren. Der ttige
Mensch enthllt sich als ein getaner.
In der totalen Identitt des scheinbar versubjektiviert freien Ich mit
der objektiven Auenwelt ist fr eine selbstndige ideologische Stel-
lungnahme kein Platz. Diese Tatsache spiegelt sich wiederum ideo-
logisch darin, da das Individuum vortuscht, auerhalb aller ideo-
logischen Reflexion zu agieren, ein entideologisiertes zu sein, wie
das moderne Schlagwort lautet. Die subjektiven Entscheidungen er-
scheinen als rein nach persnlichen Mastben vollzogene, als un-
ideologische. Im Scheine der vollendeten Entideologisierung ist die
Ideologisierung vollendet geglckt. Das Resultat ist die allesbeherr-
schende Ideologie der Entideologisierung. Die ideologische Maske-
rade gibt sich nicht mehr wie einstmals phantastisch bis theoretisch
und philosophisch, nicht mehr als nationale, politische, religise,
sthetische oder soziale Wahrheit. Sie gibt sich nchtern und pro-
fan, sie tritt gegen alle Verklrungen, Wertungen und Idealisierun-
gen wie insbesondere gegen alle Ideale mitrauisch auf, kurz sie will
der Wahrheit ohne alle ideologische Voreingenommenheit ins Auge
blicken. Als Wahrheit wird ausschlielich die empirische der be-
stehenden Realitt ausgegeben. Alle theoretischen Systeme, die die
Grenzen des aufs empirisch Unmittelbarste bezogenen, also am ex-
tremsten ideologisierten Tatsachenfetischismus berschreiten, wer-
den auf den groen Haufen der - a priori als unwahr definierten -
Ideologien geworfen, die nunmehr Gott sei Dank auszusterben
beginnen, um dem angeblich bereits weit fortgeschrittenen Proze
der Entideologisierung Platz zu machen. Das glckliche Nirwana
des klaren, nchternen und unbestechlichen Geistes nicht nur in der
Wissenschaft, sondern auch im Alltagsmenschen hat begonnen und
die humanistisch-kritischen Systeme als lebensfremde Ideologien
berfhrt. Dies vermeint die Ideologie der Entideologisierung.
Es ist klar, da fr einen so gearteten ideologischen Identifikations-
proze sich jegliche ausgeprgte Weltanschauung oder Theorie ge-
radezu als ein Hindernis erweisen mu. Allzu komplizierte ideolo-
gische Vermittlungen wrden die Haltung der Identifikation vor die
Aufgabe der dauernden Begrndung und Rechtfertigung stellen und
deshalb stren. Die totale und aus dem realen Proze selbst spontan
erflieende Identifikation des Individuums mit diesem Proze be-
darf keiner Vermittlung seitens einer religisen, politischen oder
theoretischen Ideologie. Zu dieser in dieser Schrift bereits analysier-
70
ten spontanen Identifikation, die aus der Verdinglichung erfliet,
kommen die scheinbaren Vorteile" in materieller, sozialer und
ideeller Beziehung (z.B. ins Haus getragene Unterhaltung) hinzu.
Die teilweise realen (z.B. Sozialversicherung), berwiegend aber
heuchlerisch-repressiven Fortschritte (z.B. Bildung und Erotik)
werden gleicherweise zu Fesseln des Durchschauens der Wirklich-
keit.
Als nicht oder postideologisch erscheinen solche Haltungen wie re-
ale Nchternheit, sensualistische Reflektibilitt und ideologische
Nchternheit. Aber gerade sie sind wiederum ideologische Sublima-
te, denn Nchternheit, reflektive Spiegelhaltung (naturalistische
Oberflchenreflexion), Kritikschwche und kultureller Pauperis-
mus sind ihrerseits ideologische Produkte eines verdinglichten und
sptkapitalistisch-konsumtechnischen Prozesses. Als ideologische
Produkte stellen sie genaugenommen so etwas wie eine Weltan-
schauung dar, wenn auch eine hchst oberflchliche und primitive.
So erweist sich die These von der Entideologisierung als die ideolo-
gischste aller Ideologien. In seinem Buch Die Antiquiertheit des
Menschen beschreibt Gnter Anders diesen Tatbestand folgen-
dermaen:
3 9
Unsere Welt ist >post-ideologisch, das heit ideologisch unbedrftig. -
Womit gesagt ist, da es sich erbrigt, nachtrglich falsche, von der Welt ab-
weichende, Welt-Ansichten, also Ideologien, zu arrangieren, da das Gesche-
hen der Welt selbst sich eben bereits als arrangiertes Schauspiel abspielt.
Wo
sich die Lge wahrlgt, ist ausdrckliche Lge berflssig.
10. Zweite Natur und technologische Ideologie
Die verdinglichte Ideologie macht in bestimmten Fllen auch vor
prinzipiell kritischen Geistern nicht halt. Auch da, wo Philoso-
phie als dialektisches Totalittsdenken anerkannt ist, kann sie frag-
lich werden, wenn sie in zwar kritischer, aber gleichzeitig gehemm-
ter Vermittlung zum verdinglichten Proze der hochbrgerlichen
Gesellschaft in ihrer Kritik nicht bis zu Ende geht. Hier wird das dia-
lektische Totalittsdenken, wenn auch durchaus nicht ohne Ver-
mittlung zur verdinglichten Realitt, berspannt bis zur totalen
Machtlosigkeit alles Subjektiven gegenber dem Objektiven, ge-
7 1
genber der zweiten Natur. Das gelegentliche Offenlassen gewis-
ser Ventile zum Utopischen hin (z.B. Marcuse) ndert daran nur
wenig, denn in der theoretischen wie praktischen Konsequenz ver-
dichtet sich hier die Perspektive der zweiten Natur zu einer Art
nihilistischer Weltanschauung. Es entsteht eine quasi-naturphiloso-
phische berspannung des Totalittsdenkens: prinzipiell richtige
Einsicht in die herrschende Verdinglichung wird zur geschichtsphi-
losophischen Manie, in die nunmehr weit ber den gegenwrtigen
Verdinglichungszustand hinaus auch die Vergangenheit und die Zu-
kunft, kurz alle Geschichte, hineingezogen wird. Etwa wenn
Adorno sagt:40
Aber gegen diese Problematik des Fortschritts, also da der Fortschritt
nicht gleichsinnig, einstrhnig, verluft, sondern da es Regressionen gr-
ten Mastabs gibt und ebenso, durch Korrespondenzen, die Wiederkehr des
Vergangenen, dagegen ist das Gegengift des Zeitlosen (der Vernunft, L.K.)
nicht gewachsen.
Diese Aussage verweist auf geschichtsphilosophische Reminiszen-
zen, die sich im Schrifttum Adornos zu bestimmenden verdichten,
besonders in der bekannten und fr den kritischen Nihilismus der
Frankfurter Schule bezeichnenden Formulierung von der Progres-
sion der Regression.
Seit Jahrtausenden bot sich der gesellschaftliche Proze wegen sei-
nes unkomplizierten konomischen Charakters und der damit zu-
sammenhngenden Durchschaubarkeit der gesellschaftlichen Tota-
litt unverdeckt dar. Andererseits provozierte er wegen seines anta-
gonistischen Charakters ideologische Reflexe, die zugleich das an-
schauliche Durchdringen der gesellschaftlichen Wesenheit verhin-
derten. Einerseits traten die sozialen Austauschverhltnisse als Aus-
druck der einfachen Arbeitsverhltnisse klar zutage, hatte die Ver-
dinglichung noch keine Gewalt ber das Bewutsein. Anderseits
verschleiert die Soziett, gleichsam beschmt ber das unmenschli-
che Fundament ihrer Existenz, das Herrschafts- und Ausbeutungs-
verhltnis, indem sie an die Stelle der mibrauchten und mibrau-
chenden Klasse den von Natur und subjektiver Vorherbestimmtheit
geprgten Stand setzt: Die Klasse erscheint bis zur Franzsischen
Revolution nirgends als Begriff: Marat ist der erste, der ihr eine be-
griffliche Gestalt verleiht und sie ins Bewutsein hebt. War Zeus ein
Begriff, so die Klasse keiner. Die Konkretion des Abstrakten war
ideologisch ebenso geglckt wie die Abstraktion vom Konkreten.
Im Gefolge von Marat waren es die frhen Utopisten des 19. Jahr-
hunderts und erstaunlicherweise liberale bis konservative Historiker
in Frankreich, die den Begriff der Klasse in die Geschichtsschrei-
72
bung einfhrten. Als die wichtigsten sind solche Namen wie Thiers,
Thierry, Mignet, Guizot, Michelet anzufhren.
Zudem bestand die Abstraktheit des ideologischen Bewutseins
frherer Epochen in der Reflexion des historischen Geschehens als
eines Neben- und Durcheinanders von Zuflligkeiten wie auch in
der Vorstellung des vorrangigen Einflusses der mehr oder weniger
machtvollen Persnlichkeit. Wo sich ihr die Ahnung eines subjekti-
ven Schicksals entgegensetzte, konnte es gleichfalls nur abstrakt
begriffen werden, mythologisch wie in der Antike oder mit Hilfe der
auf nichtmenschliche Krfte zurckgreifenden Astrologie wie in der
Renaissance. Ungeachtet gewisser unausgereifter Vorstadien im cal-
vinistischen Prdestinations-Mythus, in der konservativen Theolo-
gie Giambattista Vicos (den Marx sehr schtzte) und in der Gesell-
schaftsphilosophie des 18. Jahrhunderts - zu allen drei Punkten vgl.
meine Geschichte der brgerlichen Gesellschaft
4 1
- wirkte die
subjektivistische Vorstellungsweise bis in das 19. Jahrhundert hin-
ein. Erst von da ab wird zunehmend bewut, da objektive Ge-
setzmigkeiten die Geschichte leiten. Es entsteht das Bild einer
objektiven,
wenn auch widerspruchsvollen Vernnftigkeit des hi-
storischen Geschehens (Comte, Spencer, Hegel, Marx), welche Per-
spektive zunchst den zugleich genialsten und extremsten Ausdruck
fand.
Hegel wurde die Dialektik, die er der geschichtlichen Beobachtung
entnahm, aber ins Weltgeistige der Zusammenschau von Natur- und
Menschenwelt transportierte, die Dialektik von subjektiver Ttig-
keit und objektivem Proze, der Totalitt, prsent. Die Position des
Weltgeistes hinderte ihn daran, zum wirklich Konkreten vorzudrin-
gen.
Man erinnere sich nur an ein so unmittelbar praktisches Pro-
blem wie Herrschaft und Knechtschaft aus der Phnomeno-
logie, wo er dem entsprechenden Abschnitt unter Bezugnahme auf
den vorangehenden rein philosophischen den abstrakten Titel Selb-
stndigkeit und Unselbstndigkeit des Selbstbewutseins gibt 4 2
Erst nach Hegels Tode haben Marx und Engels das ganze Instru-
mentarium des konomischen und gesellschaftlichen Geschehens
des aufsteigenden Kapitalismus vor Augen, was ihnen mglich
macht, die Dialektik von Subjektivem und Objektivem, Ttigkeit
und Proze, Denken und Sein am ausgereiften konkreten Material
zu studieren. War fr Hegel das Geheimnis der Wirklichkeit die To-
talitt der Vernunft, so fr Marx und Engels das Geheimnis der Ver-
nunft die Totalitt der Wirklichkeit. Nicht ohne da solche Hegel-
sche Bestimmungen wie Negation der Negation, der Identitt des
Sichwidersprechenden, des Begriffs als des Wesens, des Ganzen als
der Wahrheit, der Erscheinung als der Tuschung und gleichzeitig
7 3
des in der Vermittlung zum Proze erscheinenden Wesens aus-
drcklich oder unausdrcklich in die marxistische Denkweise Ein-
gang gefunden htten.
In unserer Zeit gibt es fr die dialektische Theorie entweder nur ein
Weiterschreiten auf dieser Ebene oder einen Rckschritt hinter die
bereits erreichte
Hhe gesellschaftstheoretischen Denkens. Zwei
Formen dieses Rckschritts sind heute schon festzustellen: den in
den mechanischen Materialismus des 18. Jahrhunderts, wenn auch
mit den Begrenzungen, die einen totalen Rckfall hinter Marx nicht
mehr erlauben; und den in den Hegelschen Idealismus, wenn auch
mit den gleichen Begrenzungen. Nur mit einigen Erscheinungen des
letzteren werden wir uns im folgenden beschftigen.
Diese neben der hegelschen und der marxistischen dritte Stufe der
dialektischen Gesellschaftsphilosophie fllt in die Epoche der br-
gerlichen Dekadenz. Als die aufflligsten Vertreter sind zu nennen
Theodor Adorno in vollkommener Gleichgesinnung mit Max
Horkheimer, der mit beiden gleichfalls seit Jugend befreundete,
aber in manchen Tendenzen von ihnen abweichende Herbert Mar-
cuse, schlielich Gnther Anders, der eine eigene Position bezieht.
Mit letzterem werden wir uns hier, da er weniger typisch ist (wir ha-
ben uns anderweitig mit ihm bereits auseinandergesetzt), nicht be-
schftigen. Ihre Eigenart besteht in der, durch marxistische Remi-
niszenzen allerdings behinderten, Rckkehr zu einem System von
verallgemeinernden quasi-philosophischen Bestimmungen der ge-
sellschaftlich relevanten Phnomene und Begriffe. Als quasi-philo-
sophisch ist diese Haltung deshalb zu charakterisieren, weil sie die in
der hochbrgerlichen Gesellschaft extrem in Erscheinung tretenden
Tendenzen der Verdinglichung und Fetischisierung in quasi-philo-
sophischer Manier zum allgemeinen negativen Schicksal von unent-
rinnbarer Gewalt mythologisiert und sich um die Vielzahl der Ein-
zelerscheinungen entweder gar nicht oder von Fall zu Fall nur so
weit kmmert, als sie ihre nihilistischen Thesen zu besttigen schei-
nen. Die philosophische Manier der Analysen nimmt hier den Cha-
rakter eines Quasi-Weltgeistes an, deutlicher als bei Marcuse (auf
dessen nihilistische Technologie-Ideologie wir bald ausfhrlich zu-
rckkommen), verfolgbar an Adornos These des Immerglei-
chen,
4 3
wodurch die Identitt von Aufklrung und nihilistischem
Mythus in der folgenden Weise konstruiert wird. Ist alles Fort-
schreiten der rationalen Naturbeherrschung als Aufklrung zu
werten, so schlgt sie stets in Herrschaft des Menschen ber den
Menschen um; dieser negativ zu wertende Zusammenhang sei so alt
wie der Mensch selbst und bildet ein unausweichliches Schicksal
auch in aller Zukunft. Dazu bemerkt Tomberg:
4 4
7 4
Der Fluch des unaufhaltsamen Fortschritts ist die unaufhaltsame Regres-
sion. - Die Idee des Fortschritts bleibt, nur da sie negativ gefat wird: als
Regression, die als stetige Investierung des Immergleichen gedacht ist.
Adornos Weltgeist-Ideologie, die sich ungeachtet seiner oftmals
proklamierten Systemfeindschaft 4 5 zu einem System verfestigt, stellt
eine Art Umkehrung der Hegelschen Weltgeist-Philosophie dar. Ist
fr Hegel der Weltgeist identisch mit der Vernunft, so fr Adorno
mit der Unvernunft. Das Ergebnis ist eine quasi-naturphilosophi-
sche Theorie. Gewi hat sich seit Marx die Verdinglichung erheblich
verschrft, sie ist total geworden. Der Fehler der Frankfurter Schule
liegt im Steckenbleiben in der die Verdinglichung unvermittelt wi-
derspiegelnden abstrakten Verallgemeinerung von quasi-naturphi-
losophischer Relevanz. Diese Abstraktheit bewirkt, da die einzel-
nen Phnomene, die ungeachtet der Gewalt, die ihnen Verdingli-
chung antut, eine weitgehende Differenziertheit aufweisen, nur we-
nig Beachtung finden, zu wenig einbezogen werden in das System,
in dem Aufklrung und Herrschaft identifiziert werden-durch wel-
che Einbeziehung dieses System in Frage gestellt wre. Die Ver-
mittlung dieser Phnomene zum Ganzen findet keine dialektische
Entsprechung in der Vermittlung des Ganzen zu ihnen. Im dialekti-
schen Spannungsfeld zwischen Verdinglichung und der trotz ihrer
lebendigen Innerlichkeit des gesellschaftlichen Lebens sind solche
Phnomene wie Proletariat, Brgertum, Parteiwesen, Brokratie,
Managertum und viele andere Erscheinungen bis hin zu den kri-
tisch-oppositionellen Krften auf ihre konkrete Wirksamkeit in
konkreten historischen Situationen - z.B. Unterschied zwischen
Frankreich und Deutschland-nicht ohne weiteres der zweiten Na-
tur zu opfern; sie sind nicht blo als gleichartige Tropfen in einem
einheitlichen Flu mitzudenken, sondern differenziert zu vermit-
teln.
Die Vermittlung der zweiten Natur zu sich selbst ist keine.
Erst das Aufsuchen der vielen Qualitten und ihre Vermittlung zum
Fetischistisch-Ganzen macht sie zur eigentlichen.
Nehmen wir das Proletariat. Nicht es selbst ist - in Deutschland -
verbrgerlicht, sondern seine Organisationen. (Vgl. dazu u. a. meine
Schriften Der proletarische Brger und Der asketische Eros
4 6
) .
Lt sich bei genauer Kenntnisnahme der Texte selbst unterschiedli-
cher Herkunft der Beweis fhren, da das moderne Proletariat auch
in seiner verdinglichten und integrierten Gestalt zwar an den brger-
lichen Vorteilen teilzuhaben versucht, aber durchaus nicht der
Verbrgerlichung zum Opfer gefallen ist, so geht dies nicht in den
Kopf der brgerlichen wie Frankfurter Theoretiker. Der letzteren
nonkonformistisch maskierter Konformismus, wie Georg Lukcs
7 5
sagt,47 wird damit offenbar. Auch die zweite Natur hat nicht die
Kraft, Geschichte gegenstandslos zu machen. Dies zu prponieren,
ist
Eschatologie mit umgekehrten Vorzeichen: Der Endzustand
wird nicht in die Zukunft, sondern in die Gegenwart verlegt. Die ge-
schichtsphilosophische These von der immergleichen Wiederkehr
der Identitt von Fortschritt und Regression, Naturbeherrschung
und Unterdrckung, Aufklrung und repressivem Mythus weist
nach dieser Richtung.
Es geht nicht darum, mit Sturheit, wie Adorno formuliert, zu be-
haupten, seit Marx habe sich nichts gendert. Aber Klassengesell-
schaft ist geblieben. Die Mglichkeit, da diese Gesellschaft im
Ernstfall mit berwltigender Chance sich zu behaupten in der
Lage ist, wie Adorno sagt,48 hat sich auch in der Vergangenheit
durch ganze Epochen bewhrt. Geschichte ist trotzdem weiterge-
gangen. Meint Adorno zudem, da das Proletariat, an das sich Marx
wandte, keineswegs zusehends verelendete 49,so rekurriert er auf
die im brgerlichen Bewutsein als Vorwurf gegen Marx gngige
absolute Verelendungstheorie, um fr unsere Zeit aus der Falsch-
heit dieser Theorie deduzieren zu drfen, da heute das Proletariat
integriert und deshalb entschrft sei. Abgesehen davon, da sich aus
dem Schrifttum von Marx nur eine relative Theorie der Verelendung
ablesen lt - schon im Kommunistischen Manifest sagt Marx aus-
drcklich, da sich die Arbeiter zwecks Verbesserung ihrer Lage or-
ganisieren, und er fhrt als Beweis die Zehnstundenbill an; auch sol-
che Hinweise wie die auf die goldene Kette des Arbeiters in der
Gestalt von Spareinlagen usw. sprechen eine andere Sprache-, steht
fest, da auch das heutige Proletariat sich ein tiefgreifendes Bewut-
sein von seiner inferioren sozialen Lage und von den scharfen Unter-
schieden zwischen den Klassen erhalten hat. Der ganz in der Manier
der quasi-naturphilosophischen Gleichschaltung aufgefate Begriff
der Integration verschmiert die sozialen Gegenstze zum Unifor-
men und sieht daher die Mglichkeit nicht mehr, da eine kraftvolle
und von Volkstribunen (Lukacs) geleitete Organisation an die
spontanen Bewutseinselemente des Proletariats anknpfen und es
zur Artikulation eines vollen Klassenbewutseins fhren knnte.
Geht es doch auch nicht allein um das Einkommen; die Dialektik
von Konsum und Askese, armseligem Wohlstand und dauerndem
Verzicht, Freiheit und Entfremdung, allgemeiner Kulturakkumula-
tion und proletarischer Kulturlosigkeit (z.B. 90 Prozent aller Arbei-
ter waren noch niemals im Theater) gehrt ebenso zu dieser Artiku-
lation.
Wir wissen sehr Genaues ber das Mibehagen, die dumpfe
Aversion gegen die da oben und ber die unbestimmten Sehn-
schte der Arbeiter, die ins Utopische weisen, um nicht verwundert
76
zu sein ber die unentwegte Treue, die die groe Mehrheit des Prole-
tariats den sozialistischen Parteien und den Gewerkschaften zu hal-
ten pflegt. Das nennen wir Klassenbewutsein, wenn auch in einer
nicht traditionellen, aber den modernen Problemen angemessenen
Version. F. Weltz stellt in einer gewissenhaften Untersuchung fest,
da dem Arbeiter das proletarische Schicksal als eine unbeeinflu-
bare Kraft erscheint. 50 Als die einzige Mglichkeit, eine sehr be-
scheidene Verbesserung zu erwirken, wird von den Arbeitern kri-
tisch die totale Unterwerfung ausgegeben. 51
Auf dieser Grundlage soziologischer Erkenntnis, die hier nur ange-
deutet werden konnte, knnte gesellschaftliche Vernderung auf
lange historische Sicht durchaus ins Auge gefat werden, wenn
hierzu geeignete organisatorische und aufklrerische Krfte - die es
brigens berall bereits gibt - sich der Anstrengung des Begriffs,
d.h. der ideologischen Durchbrechung der verdinglichten zweiten
Natur unterziehen wrden. Adornos Votum: Die Realitt produ-
ziert den Schein, sie entwickelt sich nach oben, und bleibt au fond,
was sie war,
52
wrde dann der Nichtigkeit anheimfallen.
Obgleich Herbert Marcuse sich spter von der Frankfurter Schule,
aus der er kommt, distanziert hat und seinen eigenen Weg gegangen
ist, bleibt er mit einer Tendenz an ihr hngen, mit seiner Theorie der
technologischen Rationalitt. 53 Diese Theorie bewegt sich zwi-
schen drei Polen: l . Er prjudiziert einen anfnglichen und bereits in
der Antike gesetzten existentiellen Entwurf 54 logisch-wissen-
schaftlicher Rationalitt, die durch die historischen Epochen hin-
durch und sie bergreifend Herrschaft impliziert. 2 . Er verbindet
mit dieser Theorie die Vorstellung eines sich stets aus sich selbst er-
neuernden technologischen Progresses, der in der Fassung, die ihm
Marcuse gibt, als schlechte Unendlichkeit zu interpretieren ist.
3. Er vernachlssigt-teilweise in kritischer Auseinandersetzung mit
Marx-den alle Geschichte auszeichnenden Dreiklang von Entwick-
lung der Produktivkrfte, der gesellschaftlichen Entwicklung der
Produktionsverhltnisse und des geistigen Oberbaus, wodurch er
dahin gedrngt wird zu bersehen, da die seit dem 17./18. Jahr-
hundert eine neue Entwicklung der Produktivkrfte ermglichende
Naturwissenschaft ihrerseits in einer bereits erreichten Hhe der
Produktivkrfte wie der allgemeinen Produktionsverhltnisse wur-
zelt: in jenen, indem sie eine neue Form rationellen Denkens hervor-
riefen, in diesen, indem sie durch neue Bedrfnisse der Akkumula-
tion von Kapital gefrdert wurde. Der entscheidende Durchbruch
zur wissenschaftlichen Rationalitt in technologischer Absicht ver-
dankt sich somit nicht einem althergebrachten anfnglichen Ent-
wurf, sondern einer qualitativ vernderten historischen Situation.
77
Zunchst folgt Marcuse hinsichtlich des Verhltnisses von Natur
und gesellschaftlicher Entwicklung Marx: ... das metaphysische
Sein als solches (d. h. die auerhalb des Menschen existierende Na-
tur, L.K.) weicht einem Instrumenten-Sein.
5 5
Aber aus der Tatsa-
che, da aus der fortgesetzten teleologischen Setzung im menschli-
chen Handeln die Individuen sich stets nur Ziele setzen, die bereits
bestehenden Bedingungen entsprechen, somit nicht auerhalb aller
Kausalitt stehen, macht Marcuse eine Theorie des Entwurfs. Er
sagt:5 5
Die Wissenschaft von der Natur entwickelt sich unter dem
technologischen
Apriori, das die Natur als potentielles Mittel, als Stoff fr Kontrolle und Or-
ganisation entwirft.
Marcuse fhlt wohl, da an seiner Theorie etwas nicht stimmt und
gibt zu, da er sich hier nicht mit dem historischen Verhltnis von
wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Rationalitt zu Beginn der
Neuzeit beschftigt.5 7 Daher mssen wir selbst einen Blick auf die
Entwicklung der modernen Welt, soweit sie unser Problem betrifft,
werfen.
Die Denkergebnisse der antiken Welt, wie sie Marcuse beschreibt, 5 8
wurden mit dem Untergang der Antike so gut wie vergessen oder
theologisch entrationalisiert. Die neue europische Kultur wchst
gleichsam aus dem Nichts empor. Die antiken Stdte hatten sich zu
feudalen Gebilden zurckentwickelt, 5 9 und erst allmhlich entwik-
keln sie sich auf der Grundlage der sich durchsetzenden Arbeitstei-
lung zwischen agrarischer und handwerklicher Produktion wieder
zu echten Stdten. Ihr und keinem Entwurf verdankt sich die neu
einsetzende Rationalisierung des Lebens. Im bergang zu Verlag
und Hausindustrie und schlielich zur Manufaktur verstrkt sich
dieser Proze. Mit dieser Entwicklung eng verquickt rationalisiert
sich das Denken in der Zeit zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert
als Folge der Ausbreitung der individualistischen Marktordnung,
die durch Handel und Grohandel ermglicht wird. Erst diese indi-
vidualistisch-rationalistische gesellschaftliche Situation drngte da-
hin, das naturwissenschaftliche und technische Denken anzuregen
und zur Entfaltung zu bringen. Der szientifische Zwang war nicht
die Ursache, sondern die Folge entwickelter gesellschaftlicher Zu-
stnde.
Sofern also die Entwicklung naturwissenschaftlichen Denkens ge-
sellschaftlich bedingt gewesen ist, mu es den Ideologien zugerech-
net werden. Gerade dies bestreitet Marcuse, 60 was sich aus seiner
These, da rationale Vernunft als Entwurf aller knftigen Ge-
schichte vorausgegangen ist, ergibt. Vielfach wird auch von anderer
78
Seite die Naturwissenschaft von aller ideologischen Bindung freige-
sprochen, was sich daraus erklrt, da diese Wissenschaft eine an-
dere ideologische Rolle bernimmt als die Geisteswissenschaft. Be-
vor wir auf diesen Unterschied eingehen, sind die nheren Ursachen
fr das Entstehen der modernen Naturwissenschaft kurz zu be-
schreiben. Es sind dies hauptschlich die folgenden: Rationalisie-
rung des individuellen Bewutseins durch die Warenwirtschaft der
Stadt, zunehmende Rationalisierung der handwerklichen Arbeit,
Befreiung des stdtischen Menschen von der irrationalistischen Un-
terworfenheit unter die ueren lndlichen Naturbedingungen bei
gleichzeitiger Steigerung des Interesses an der Erkenntnis der Natur
infolge der stdtischen Distanzierung von ihr, Erleichterung der Na-
turerkenntnis durch die Fortschritte der neuen Arbeitsmethoden
(z.B. Wasserrad, das bereits Leonardo studierte), Interesse an der
naturwissenschaftlichen Erkenntnis im Dienste der Produktion und
ihrer Technik, was wiederum praktisch erst bedeutsam wurde, als
die handwerklichen und manufakturellen Produktionsformen sich
als nicht mehr zureichend erwiesen und die Entwicklung neuer Pro-
duktivkrfte nicht mehr zu umgehen war.
Die Naturwissenschaft ist somit das Produkt der brgerlichen Ent-
wicklung und deshalb Ideologie. Jedoch eine Ideologie, die nur als
mit den Interessen der feudalen Klassen unvertrglich erschien, je-
doch innerhalb der brgerlichen Gesellschaft selbst gleichermaen
den Interessen sowohl der brgerlichen wie der proletarischen Klas-
sen entgegenkam. Dadurch schied sie, seitdem sie die Anfechtungen
des Feudalismus hinter sich gelassen hatte, aus dem ideologischen
Interessenkampf der Klassen der brgerlichen Gesellschaft aus,
wenn man von den philosophischen Schlufolgerungen, fr die die
Naturwissenschaft selbst nicht direkt verantwortlich zu machen ist
(philosophischer, geschichtsphilosophischer und politischer Mate-
rialismus), absieht. Das gleiche kann von der Gesellschaftswissen-
schaft, die eine unmittelbare Rolle im Kampfe der Klassen in der ent-
falteten brgerlichen Gesellschaft spielt, nicht gesagt werden. Dazu
kommt, da die Naturwissenschaft infolge des allgemeinen Interes-
ses aller Klassen der brgerlichen Gesellschaft an ihr davor bewahrt
wurde, einem ideologischen Richtungskampf zum Opfer zu fallen;
sie wurde im Gegensatz zur Gesellschaftswissenschaft davor be-
wahrt, in den Verdacht des falschen Bewutseins zu geraten. Ist die
Naturwissenschaft also ideologischen, weil gesellschaftsbestimmten
(historischen) Ursprungs, so erscheint sie wegen ihrer ideologischen
Neutralitt im Kampfe der Klassen untereinander als auerideolo-
gisch. Dafr gibt es aber noch einen weiteren Grund.
Die Schwierigkeit der Bewltigung des Gegensatzes von Sein und
79
Denken ist in der Gesellschaftslehre nicht so geartet, da sie von An-
fang an wie die Naturwissenschaft in der Sache liegt, denn dieser Ge-
gensatz ist kein faktischer, sondern ein ideologischer. Da das gesell-
schaftliche Sein stets Subjekt und Objekt, Umstand und Ttigkeit,
Wirklichkeit und Denken zugleich ist (s.o.), konstituiert sich ein
grundlegender Gegensatz zur Naturwissenschaft, wo sich Kosmos
(Sein).und Betrachtung naturgem ausschlieen. Gesellschaftli-
che Erkenntnis ist prinzipiell Selbsterkenntnis. Fr die Naturwis-
senschaft ist die sachliche Schwierigkeit mit der Beseitigung eventu-
eller ideologischer Hemmnisse durchaus noch nicht berwunden.
Im Gegenteil beginnen sie erst da, denn Erkenntnis des auer-
menschlichen kosmologischen Seins besagt, da sie nicht wie in der
Gesellschaftstheorie Selbsterkenntnis des Objekts ist, sondern
Fremderkenntnis. In der Gesellschaftswissenschaft ist Erkenntnis
mit der Selbsterkenntnis der in Frage stehenden Gesellschaft gera-
dezu identisch. In der Naturwissenschaft ist eine solche Identitt a
priori ausgeschlossen. Das schliet aber nicht aus, da ihre Entste-
hung und gewisse Stadien ihrer Entwicklung gesellschaftlich be-
dingt, somit als ideologisch gebunden zu interpretieren sind.
Jede historisch-gesellschaftlich bestimmte Entwicklungsphase ra-
tionalwissenschaftlichen Denkens baut sich auf den Ergebnissen
vorangehender Phasen auf, bildet ihren logisch rationalen Fortgang.
Da in mglicher Verzweigung dieses Vorgangs nicht a priori fest-
liegt, nach welcher genauen Richtung er sich im einzelnen bewegen
wird, entscheidet darber (wie auch ber seinen Stillstand und ber
sein Tempo) das gesellschaftliche, teleologische Bedrfnis. A poste-
riori entsteht jedoch der Schein einer totalen logischen Autonomie
sowohl des Denkinhalts wie der Denkrichtung, die sich verstrkt,
wenn der gesamte Entwicklungsgang dieses Denkens rein geistes-
geschichtlich rekonstruiert wird.
Bei Adorno und Marcuse kehrt Hegels Weltgeist-Philosophie mit
umgekehrten Vorzeichen wieder. Ist fr Hegel der Weltgeist iden-
tisch mit der Vernunft, so fr Adorno und Marcuse mit der Unver-
nunft. Das Ergebnis ist eine quasi-naturphilosophische Theorie bei
beiden: die zweite Natur folgt ihren eigenen Gesetzen. Zwar kann
jeder gesellschaftliche Proze, insbesondere der moderne, zunchst
so betrachtet werden, als ob wir es mit einer naturgesetzlichen Er-
scheinung zu tun htten, was eben die Mglichkeit von Gesell-
schaftswissenschaft berhaupt ausmacht. Gewi hat sich seit Marx
die Verdinglichung noch weiter verschrft. Der Fehler der Frankfur-
ter Schule liegt nicht in der Beschftigung mit diesem Phnomen, er
liegt vielmehr im Steckenbleiben in der die Verdinglichung unver-
mittelt
widerspiegelnden abstrakten Verallgemeinerung zu einer
80
quasi-naturphilosophischen Perspektive.
Diese Abstraktheit be-
wirkt, da die einzelnen Phnomene, die ungeachtet der Gewalt, die
ihnen Verdinglichung antut, eine konkrete Differenziertheit aufwei-
sen, zu wenig Beachtung finden und ihre Vermittlung zum Ganzen
keine zureichende dialektische Entsprechung aufweist in der Ver-
mittlung des Ganzen zu ihnen. Nur Unzureichendes ist ber die
Vielfalt der Erscheinungen ausgesagt, wenn man sie der techno-
logisch interpretierten zweiten
Natur schematisch unterwirft
und damit in ihrem Wesen vergewaltigt. Die abstrakte Vermittlung
der zweiten Natur zu sich selbst widerspricht aller sozialtheoreti-
schen Dialektik, wie der Dialektik berhaupt.
Im letzten Sinne erweist sich die Auflsbarkeit der Ideologie der un-
ausweichlich-schicksalhaft wirkenden zweiten Natur an anthro-
pologische berlegungen gebunden. In welcher Weise sich das Pro-
blem der modernen kapitalistischen Technik, der der Schein geradli-
niger und aus ihren eigenen Eingeweiden erflieender Progression
i
m Gewande einer zweiten Natur anhaftet, mittels des Rckgriffs
auf anthropologische Voraussetzungen erhellen lt, zeigt die Ein-
beziehung des Begriffs des Telos. Menschliche Ttigkeit, hier als
formale Voraussetzung menschlicher Existenz berhaupt begrif-
fen
,61
ist nicht zu trennen von der Erscheinung des Teleologischen,
des auf Ziele gerichteten Tuns. Die Ziele entstehen aus dem Drang
nach Verwirklichung sich wiederholender oder sich verndernder
Bedrfnisse, woraus der unendliche Progre menschlicher Ttig-
keit sich erklrt. Allerdings mu dieser Begriff des unendlichen Pro-
gresses hier verstanden werden als im dauernden Kontakt und in
Vermittlung zu den konkreten gesellschaftlichen Verhltnissen einer
jeden historischen Epoche stehend. Auf der Hhe der zum uer-
sten differenzierten Arbeitsteilung der brgerlichen Gesellschaft
entsteht eine mit maschineller Ausrstung versehene Form der Ar-
beit, in der sich das Prinzip des Teleologischen gegenber den wirk-
lichen Bedrfnissen der Arbeitenden verselbstndigt und damit die
Arbeit gegenber den Arbeitenden. Es entsteht jene
schlechte Form
des unendlichen Progresses, die sich ideologisch als Herrschaft
der
Technik zum Ausdruck bringt und die faktischen Vermittlun-
gen dieses Progresses zum selbst in einen schlechten Progre gera-
tenen
und damit abstrakt gewordenen Profitinteresses ver-
schleiert.
Die Loslsung des teleologischen Prinzips und seine Umformung
zum schlechten Progre, der einerseits infolge seiner Nichtachtung
der wahren Interessen der Arbeitenden eine Realitt darstellt, ander-
seits aber infolge des ihm anhaftenden Scheins naturgesetzlicher
Notwendigkeit seiner Bewegungsrichtung blo ideologischer We-
8 1
senheit ist, bertrgt eben diesen Schein auf die Technik. Da der
technische Progre sein Hinwegschreiten ber die wahren Bedrf-
nisse nicht offen zutage legt, sondern im Gegenteil den Schein der
progressiven Befriedigung der Bedrfnisse erzeugt, ist er ideolo-
gisch.
11. Die ideologische Dialektik von Genu und Askese
Das falsche Bewutsein des automatischen technischen Progresses
in der Gestalt der schicksalhaften zweiten Natur schafft gleichzei-
tig eine der wichtigsten Voraussetzungen fr die unkritische Selbst-
integration des Individuums unter diese Natur. Zwei ideologische
Entwicklungstendenzen sind zunchst getrennt ins Auge zu fassen.
Auf der einen Linie setzt sich durch der Proze des Umschlagens des
extremen brgerlichen Individualismus in eine ebenso extreme Ent-
individualisierung und Vermassung. Auf der anderen Linie stoen
wir auf die Erscheinung der kraft bestehender Freiheit vollzogenen
Integration in den repressiven Proze als Folge der freiwilligen Iden-
tifikation mit diesem Proze.
Unter der Voraussetzung der zunehmenden fetischistischen Irratio-
nalisierung des Prozesses, der Verfestigung des gesellschaftlichen
Naturcharakters, der sowohl vom Alltagsbewutsein wie auf der
intellektuellen Reflexionsebene als undurchschaubar bedrohliches
Schicksal erlebt wird, verschrft sich auch der Widerspruch von
Irrationalismus der Auenwelt und der Neigung zur rationalen
Ordnung und Beherrschung des individuellen Lebens bis ins Ex-
trem. Auch hier, im subjektiven Bereich des privaten Lebens, wer-
den wie im geschftlichen oder beruflichen Teilbereich die von au-
en hineinwirkenden Gegebenheiten als irrationale und gleichsam
naturhafte Voraussetzungen hingenommen. Diese Voraussetzungen
erscheinen in abgeleiteter Weise auch als solche des ffentlichen
Lebens im Gegensatz zum privaten Leben, in dem allein wirkliche
Freiheit zu herrschen scheint. Aber in der sich dem ffentlichen Le-
ben ideologisch entgegensetzenden privaten Sphre kann Ausnt-
zung der Freiheit nur bedeuten die mglichste Ausnutzung aller ra-
tionellen Mglichkeiten des Lebensgenusses, der seit Gewhrung
dieser F[r]eiheit nicht mehr als das ausschlieliche Monopol bestimm-
ter Schichten erscheint, sondern als prinzipiell allen zugnglich. Ge-
82
lingt dies, wie wir noch sehen werden, nur in einem sehr begrenzten
Mae, nur nach dem Zuschnitt eines asketischen Eros, so wird die
Begrenzung ihrerseits wieder zum Anreiz, die Anstrengungen nach
dieser Richtung zu steigern.
Die sich daraus ergebende widerspruchsvolle Situation ist die fol-
gende. Einerseits steht die im Vergleich zu frheren Epochen gestei-
gerte
Mglichkeit des Konsums im Dienste des Genusses. Ander-
seits nimmt der Weg der Genubefriedigung jene Richtung, die die
enterotisierte repressive Gesellschaft den Massen stets als Surrogat
der Freiheit anbietet, nmlich den am leichtesten, weil reibungslose-
sten zu akzeptierenden Weg des erotischen Ventils. Das infolge der
allgemeinen repressiven Umsetzung von Befriedigung erotischer
Bedrfnisse (diese im weitesten Sinne begriffen) in Leistung entero-
tisierte Individuum greift nach jedem, unter den repressiven Bedin-
gungen nur Ersatzbefriedigung erlaubenden, Ventil. Ideologisch
spiegelt sich der verbreitete Gebrauch solcher Ventile als Ausflu
geltender brgerlicher Freiheit. Zudem ist in der brgerlichen, indi-
vidualistischen Gesellschaft der private Lebensbereich vor dem Zu-
griff uerer Mchte gesicherter als in frheren Epochen. Eine Gret-
chentragdie zum Beispiel ist kaum denkbar. Schon vor den Ha-
beas-corpus-Akten bestimmte das Bedrfnis des aufsteigenden Br-
gers, sich vor dem Zugriff des alles beherrschenden feudalen Abso-
lutismus zu schtzen, seine Mentalitt. Den radikalsten ideologi-
schen Niederschlag fand dieses Bedrfnis im brgerlichen Natur-
recht von Althusius (sein Hauptwerk erschien 1610) bis Rousseau.
Diese Tendenz wurde aber im Verlaufe der Entwicklung der indu-
striellen Klassengesellschaft dahingehend verndert, da die Hei-
ligung des privaten Lebensraumes als eine Konzession des herr-
schenden Brgertums an die Massen begriffen wurde. Allerdings
und sinnvollerweise an jene Massen, die in gleicher, steigender Pro-
gression zur passiven Akkommodation an die repressiv rationali-
sierte Ordnung des Arbeitsplatzes gezwungen wurden, woran ge-
werkschaftlicher Einflu und Mitbestimmung nur sehr wenig n-
derten. Je grer die im privaten Bereich gewhrte Freiheit wurde,
desto sicherer fhlten sich die herrschenden Mchte im ffentlichen,
in jenem, in dem die Gefahr der Kritik und der Rebellion immer wie-
der aufbrach. Im privaten Bereich erschpften sich die aus dem so-
zialen Unbehagen erflieenden Renitenzneigungen an privaten
Gegenstnden und bildeten hier ein Ventil fr die sozialen Renitenz-
bedrfnisse. Vor allem ist es das erotische, weil begehrteste Ventil,
das sozial bedingte Spannungen auf den privaten Lebensraum ab-
lenkt und hier durch Inanspruchnahme des kraft individueller Frei-
heit gngig gewordenen enttabuisierten Genusses paralysiert. In
8 3
keiner Gesellschaft ist die den Charakter des Surrogats aufweisende
Erotisierung des privaten Bewutseins so weit gediehen wie in der
sptbrgerlichen.
Fr das sptbrgerliche Bewutsein ist die Enttabuisierung traditio-
neller Vorstellungen und die Durchbrechung eingebter morali-
scher Bindungen zum Hauptmerkmal der Freiheit geworden. Der
Neigung zur Enttabuisierung steht aber wegen der Begrenztheit der
Mittel die Neigung zur Rationalisierung entgegen. Im Kampfe die-
ser beiden Tendenzen siegt ebenso oft der asketische Rationalismus
ber den Hang zum erotischen Genu wie dieser ber jenen. Der ir-
rationale Drang nach Bentzung der durch die moderne brgerliche
Freiheit fr den Bereich des Privatlebens gngig gewordenen Ventile
steht in Widerspruch zu der als asketisch anzusprechenden und von
auen, dem Berufs- und sonstigen ffentlichen Leben aufgezwun-
genen rationellen Selbstbeschrnkung. Gerade um in einer von der
Konsumindustrie den Massen eingeimpften und dem Bedrfnis nach
Enttabuisierung entgegenkommenden Weise konsumieren zu kn-
nen, mu eine die Krfte weitreichend rationalisierende Askese da-
mit Hand in Hand gehen. Genu auf Kosten knftigen Genusses
und Verzicht zugunsten knftigen Genusses bedingen einander.
Diese Dialektik des Konsums und des Genusses bildet einen Spezial-
fall der Dialektik des falschen Bewutseins, in dem Freiheit und Re-
pression zugunsten der letzteren zur Aufhebung gelangen. Ist der
gesteigerte Konsum in der hochbrgerlichen Gesellschaft nur ein
Spezialfall der Beschrnkung auf jenes Ma des Konsums, das der
unterdrckte Mensch nicht berschreiten darf, soll er dem dauern-
den Anreiz zur Steigerung des freiwilligen Arbeitsvollzugs folgen,
so ist das Bewutsein der Teilnahme an diesem Konsum nur ein Spe-
zialfall des herrschenden ideologischen Scheins, der totalen Freiheit
teilhaftig zu sein.
Die empirische Verifikation dieser Behauptung liegt zunchst in der
empirischen Verifikation der Tatsache, da trotz des herrschenden
Konsumbewutseins die Massen der Menschen armselig leben: in
engen Wohnungen mit schmucklos normierten Mbeln, verratend
nicht nur die Kulturlosigkeit der Ausstattung, sondern des Geistes
insgesamt, die sich nicht nur in den Bildern an den Wnden besch-
mend demonstriert. Der Fernsehapparat, der Khlschrank und der
(brigens gar nicht so verbreitete, wie angenommen wird) Kleinwa-
gen gehren, der erreichten zivilisatorischen Entwicklungsstufe ent-
sprechend, bereits zu den gewhnlichen Gebrauchsgegenstnden
und stehen daher in der Konsumstufe an letzter Stelle, wenn auch im
Bewutsein der Konsumierenden an erster, worin sich gerade seine
ideologische und ihn irrefhrende Bindung uert. Es geht in Wahr-
84
heit um etwas anderes, als sich dieses Bewutsein vormacht. Es geht
darum, da die bezeichneten materiellen Einrichtungen nur dann
der Freiheit dienen, wenn sie die Voraussetzung fr den Genu in ei-
nem wirklich befreienden Sinne bilden und nicht Selbstzweck blei-
ben. Das heit, wenn sie die Voraussetzung bilden fr den Genu
der Kultur- und der geistigen Gter, der sthetischen Angebote ins-
besondere, ohne die die erotischen Belange zu entwrdigenden
Schemen werden, von den wirklichen sich unterscheidend wie der
Besuch bei einer Prostituierten von einem bedeutenden erotischen
Erlebnis. Konsum um des Konsums willen wird zur Schranke statt
zur Bedingung der Freiheit. Die widersprchliche Dialektik des ka-
pitalistischen Konsums besteht also darin, das Bewutsein durch
mige Steigerung zu manipulieren, das bedeutet, ihm Befreiung
vom Zwang vorzutuschen zu dem Zweck, dem Individuum immer
grere Opfer abzuringen und es um so gewisser an die Erforder-
nisse des repressiven Prozesses zu fesseln.
Auf die Dauer mte dieser Widerspruch die repressiven Fesseln der
gegenwrtigen Gesellschaft sprengen. Die aus der Repression erflie-
enden Neigungen zur Renitenz mten sich gegen diese Repres-
sion selbst wenden. Diese Konsequenz wird aber (insbesondere in
Lndern, in denen kein politisches Bettigungsfeld fr die Opposi-
tion und die Kritik vorhanden ist, was vor allem fr Deutschland zu-
trifft) nicht gezogen. Im Gegenteil, der verbreiteten Demoralisation
des privaten Lebens entspricht ein nicht minder verbreitetes Spieer-
tum im ffentlichen Leben - mit der gegengleichen Tendenz der
ngstlich-spieigen moralischen Tarnung des Privatlebens und der
moralischen Zersetzung des ffentlichen. Wir sprechen von Demo-
ralisation,
weil die durch die allgemeinen repressiven Zustnde er-
zwungene Umwandlung der erstrebten erotischen Freiheit in
Scheinerotik, und das heit in eine zustzliche Form der Repression,
nicht befreiend, sondern zersetzend auf die einzelne Individualitt
sich auswirkt. Die Frage, die hier entsteht, ist die, wie dieses auffal-
lende Umschlagen von tabufeindlicher Inanspruchnahme der gel-
tenden Freiheit in die freiwillige Unterwerfung unter die gesell-
schaftlichen Tabus zu erklren ist.
Die groen brgerlichen Humanisten der Zeit vor der Franzsi-
schen Revolution trumten davon, da dereinst, wenn das Individu-
um von den stndischen Bindungen befreit sein werde, es sich die
neuen Lebensbedingungen zunutze machen wrde, um seine Per-
snlichkeit allseitig zu entfalten. Dieser Traum erfllte sich nicht.
Denn unter der Notwendigkeit, sich nach der Befreiung von der
Stndeordnung mehr als zuvor um seine materielle Sicherheit km-
mern zu mssen und im harten Kampf der freien Konkurrenz zu
8 5
bestehen, geriet unvermittelt und entgegen der brgerlich-humani-
stischen Erwartung das materielle Interesse so sehr in den Mittel-
punkt der individuellen Existenz, da die emotionalen, kulturellen
und geistigen Interessen dagegen weit zurckgedrngt wurden. Die
totale Vermaterialisierung des Bewutseins wie der Individualitt
stand am Ende der Entwicklung. Die Konsequenz war die Fesselung
des Individuums an das niedrigste kulturelle Niveau und seine Aus-
prgung zur uniformen Schablone, die in der nachfolgenden ideolo-
gischen Reflexion die Bezeichnung der Vermassung erhalten hat.
Das Individuum erkaufte seine Freiheit durch Integration in den
kapitalistischen Proze und durch Entindividualisierung seiner sub-
jektiven Eigenschaften. Der wahre Grund der Vermassung ist einzu-
sehen im Proze der extremen Entindividualisierung unter der Be-
dingung der extremen Individualisierung des Lebens in der brgerli-
chen Gesellschaft. Das Umschlagen des extremen Individualismus
in eine ebenso extreme Entindividualisierung oder Vermassung voll-
zieht sich vllig organisch. Vermassung wurzelt somit nicht, wie die
ideologische Tendenz der Rechtfertigung sie plausibel zu machen
versucht, in der Massengesellschaft (welche Erklrung einem Pleo-
nasmus gleichkommt), sondern in der Atomisierung des Lebens in
der kapitalistischen
Warengesellschaft.
Vermaterialisierung und Entindividualisierung sind aber nicht die
einzigen negativen ideologischen Ergebnisse der in ihrem Wesen wi-
derspruchsvollen brgerlichen Freiheit. Als solche Ergebnisse bil-
den sie ihrerseits die Voraussetzung fr eine weitere ideologische
Entwicklungslinie sozialpsychologischen Charakters, die darin be-
steht, da wiederum brgerliche Freiheit in Integration umschlgt,
jedoch diesmal aus einer anderen Wurzel des individuellen Verhal-
tens heraus.
Das Individuum der hochbrgerlichen Gesellschaft hat es gelernt,
das private Leben kraft ihm zugestandener Freiheit nach eigenen
Grundstzen, die den auf repressiver Sublimierung beruhenden
psychischen Fesseln instinktiv widerstreben, gestalten zu wollen.
Dies gleichzeitig nicht zu knnen, wird noch zu zeigen sein. Tradi-
tionelle Tabus, die von den auf Verdrngung beruhenden psychi-
schen Vorgngen bis zu sichtbaren des sozialen Geschehens reichen,
werden vor allem da, wo sich ihnen der einzelne am leichtesten ent-
ziehen kann, im privaten Lebensbereich, am ehesten verletzt. Zu-
nchst steigert die Mglichkeit der Enttabuisierung, als Mglichkeit
gegeben durch das Einverstndnis aller, das Freiheitsgefhl ge-
genber den gesellschaftlichen Mchten und dem verdinglichten
Naturproze, der als unentrinnbares objektives Schicksal er-
scheint. Aber dieser Drang zur Verletzung von tief ins Psychische
86
versenkten Tabus und moralischen Grundstzen gelingt nicht rest-
los, ja hinsichtlich der gesellschaftlich relevanten - z.B. hinsichtlich
des Pflichtgefhls - in einem uerst eingeschrnkten Mae. Dies
'erklrt sich aus dem unaufgehobenen Widerspruch des zur totalen
Freiheit drngenden Enttabuisierungsstrebens zu der faktisch unan-
getastet bleibenden repressiven Ordnung, die die Unterwerfung des
Individuums und seine entsprechende moralische Anpassung vor-
aussetzt. Seit Freud wissen wir, da die Moral und die Tabus zu den
die repressive Ordnung schtzenden und das Individuum unter-
drckenden Einrichtungen der Psyche gehren. Keine Klassenge-
sellschaft kann auf ihre Fortwirkung verzichten. Das durch die be-
wute Enttabuisierung zunchst gesteigerte Freiheitsbewutsein
verstrkt gleichzeitig das auf der Lockerung der Disziplin beruhende
Gefhl, nicht richtig zu funktionieren, vor allem der Gefahr aus-
gesetzt zu sein, gesellschaftlich als guter Brger, wovon auch das
ffentliche Ansehen abhngt, zu versagen. Die extreme Versubjek-
tivierung des individuellen Erlebnisbereichs bewirkt bei allem Ge-
fhl der freien Verfgung ber das eigene Ich eine gleichzeitige Stei-
gerung des Gefhls isolierter Verantwortlichkeit, subjektiver Isola-
tion. Die eben wegen der zunehmenden bewutseinsmigen Isola-
tion des einzelnen hilf- und widerstandslose Projektion der verding-
lichten und entfremdeten Phnomene der Auenwelt auf das Seelen-
leben mystifiziert, verwirrt und verunheimlicht dessen Erlebnis-
welt, die als eine subjektiv-eigene empfunden wird, und beunruhigt
das Individuum insbesondere da, wo die unberwundenen schick-
salhaften Ordnungsfaktoren der ueren repressiven Realitt ihre
unerbittlichen Anforderungen anmelden.
Innerhalb der Ideologie der Tabuisierung der Enttabuisierung ist
letztere gleichzeitig weitgehend nur Schein. Da das Tabu der gesell-
schaftlichen Verantwortung und Zuverlssigkeit gegenber der re-
pressiven Ordnung bestehen bleibt, kommt es zu einer rcklufigen
Tendenz, zu einer Behinderung der Inanspruchnahme der nur ideo-
logisch verfestigten Enttabuisierungstendenz, die gleichsam auf hal-
bem Wege stecken bleibt. Von der ideologischen, sich vielfach nur in
einer geistigen Teilnahme (Film, Zeitschriften usw.) uernden Ent-
tabuisierungstendenz bis zu deren praktischen Verwirklichung ist
ein weiter und verworrener Weg. Wo anderseits die praktisch get-
tigte Enttabuisierung fortgeschritten ist, ruft sie psychische Reak-
tionen hervor, die aus dem Gegensatz zur weiterbestehenden und
anerkannten repressiven Ordnung, die an sich kein erotisch freies
Individuum duldet, entstehen. Diese Reaktionen uern sich wie-
derum in einer zweifachen Weise: in der eigensinnigen Fortsetzung
des einmal beschrittenen Weges bis hin zu antisozialen Renitenzak-
8 7
tionen oder in Schuldgefhlen,
die zur Abtragung und Wiedergut-
machung drngen. Soll proklamierte und vom Individuum stolz be-
anspruchte Freiheit diesem etwas gestatten, so in der repressiven
Ordnung nur unter der Bedingung, da diese die Rechnung pr-
sentiert und etwas davon
hat. Freiheit, selbst erotische, erweist sich
als ein Faktor der Ordnung.
Das durch die Verletzung traditioneller Tabus hervorgerufene
Schuldgefhl entsteht also nicht aus dieser Haltung selbst, denn sie
entspricht der als grundstzlich berechtigt erlebten Freiheit, es
kommt vielmehr aus der anderen Ecke: aus der faktischen Weiter-
existenz der gesellschaftlichen, ideologischen und psychischen Bin-
dung an eine Ordnung, die den einzelnen total an sich fesselt. Dieser
Widerspruch wirkt sich regressiv auf den schwcheren der beiden
Pole aus, auf den des individuellen Privatsektors, woraus sich der
blo partielle und eingeschrnkte Charakter des Dranges nach Ent-
tabuisierung erklrt. Ja noch mehr als das. Der gegen die verfestigten
Traditionen, tabuierten Gewohnheiten, moralischen Systematisa-
tionen und psychischen Bindungen sich auflehnende Mensch ber-
schreitet in Wahrheit nirgends die von ihm von der repressiven Ord-
nung wirksam ber das Pflichtgefhl - als Ausdruck seiner Identifi-
zierung mit dem Vorhandenen - und ber sein Schuldgefhl - als
Ausdruck seiner Teilnahme am Proze der Enttabuisierung - psy-
chisch gesetzten Grenzen. Sowohl der Drang, trotz genieeri-
scher Lebensfhrung seine Leistungsfhigkeit unter Beweis zu stel-
len, als auch diese Lebensfhrung selbst wirken in die Richtung der
Akkommodation an die repressive Gesellschaft.
Die Pflicht- und Schuldgefhle entstammen nicht erst der Jetztzeit,
sondern sind so alt wie die Klassengesellschaft selbst. Der erfolg-
reichste Ausdruck ist das Gewissen. Jedoch nicht das aus der prim-
ren Ich-Du-Beziehung stammende und neutrale (formal-anthropo-
logische), 6 2
sondern das mit Hilfe eines tief eingewurzelten und die
Psyche des Individuums total beherrschenden negativen Menschen-
bildes inhaltlich manipulierte Gewissen.
Die Moral ist nichts anderes als das repressiv systematisierte Gewis-
sen. Sie ist das System des im Dienste der repressiven Anforderun-
gen gebndigten und seiner freien intuitiven Entscheidungsfhigkeit
beraubten Gewissens. War das Gewissen in seiner vormoralischen
urzeitlichen Epoche Ausflu der spontanen und rein intuitiv erleb-
ten Identitt von Individuum und Gesellschaft und der entsprechen-
den harmonischen Interessenssituation, so wird es in seiner klassen-
gesellschaftlich
manipulierten Gestalt zur Grundlage der Moral.
Die berzeugende Kraft der Moral ist nicht zuletzt darin begrn-
det, da sie sich auf ein Gewissen sttzt, das als reines Gewissen
88
seinen repressionsfreien Ursprung nicht verleugnen kann. Denn in
aller
Gewissensfunktion steckt die Frage nach dem Du in seiner
menschlichen Integritt. In dieser Ausrichtung auf das Du wird alles
Gewissen vom Individuum erlebt, und gerade damit wird seine in-
haltliche
Manipulation verschleiert. Fr das repressiv manipulierte
Bewutsein des einzelnen ist die Gewissensregung, d. h. die Orien-
tierung auf das Du, abgetrennt von der Antwort, die gegeben wird
und die aus den gesellschaftlichen Normen und der sie tragenden
Moral entspringt. Der dialektische Widerspruch zwischen der re-
pressionsfreien Wurzel und der repressiven Funktion des Gewissens
schlgt sich im Janusgesicht der Moral nieder. Du sollst nicht steh-
len z. B. impliziert eine berechtigte Forderung im Dienste des
Schutzes des Bruders, der denselben Anspruch auf materielle Le-
benssicherung hat, aber es impliziert auch den Schutz des Eigen-
tums, das durch Ausbeutung zustande gekommen ist. Die Dialektik
von originrem und manipuliertem Gewissen ist identisch mit der
Dialektik von schtzender und repressiver Funktion der Moral.
Sofern diese Dialektik tief ins Psychische versenkt ist, findet sie hier
noch andere Faktoren vor, die in der gleichen Richtung wirksam
sind und die unter dem Anschein des Menschlichen, Natrlichen,
Selbstverstndlichen und Rechtmigen (woraus sich z. B. viele Na-
turrechtssysteme ableiten) das Individuum an die Repression fes-
seln.
Diese Versenkung ins Psychische ist von einer gleichsam ar-
chaischen Gewalt. Eine der wichtigsten dieser quasi-archaischen Er-
scheinungen ist das repressive Menschenbild, ber das wir weiter
unten ausfhrlich berichten werden. Zunchst ist eine Klrung vor-
zunehmen.
Der Begriff des Archaischen, von C. G. Jung erstmals psychologisch
geprgt, ist umstritten. Er verweist (ber Jung hinaus) auf urtmli-
che und gleichsam in den noch vorpsychischen oder, phylogenetisch
gesehen, frhpsychischen Schichten verankerte unauslschliche
Kollektiverlebnisse. In ihren bereits fabaren Formen stoen wir
hierbei auf solche archaische Vorstellungen wie das Gttliche, das
Kosmische, das Vterlich-Weisheitliche, das Heldentmliche usw.
Geht man mit dem Begriff des Archaischen mit der erforderlichen
wissenschaftlichen Vorsicht um und reinigt ihn von den mythologi-
schen und metaphysischen berresten, die ihm in der irrationalisti-
schen Psychologie - die den irrationalen Gegenstand mit der Me-
thode verwechselt und deshalb diese selbst irrationalisiert- noch an-
haften, dann ist ihm ein bedeutender rationaler Wert fr die Er-
kenntnis kollektivpsychologischer und ideologischer Prozesse nicht
abzusprechen. Durch viele Generationen fortgepflanzt und psycho-
logisch bis tief ins Ideologische hinein verfestigt, sind die gegenstz-
8 9
lichen Komponenten der Urerinnerung an das Goldene Zeitalter
oder das Paradies und das repressive Menschenbild die wichtigsten
Phnomene des Quasi-Archaischen (das eigentliche Archaische ist
das Triebhafte). Die quasi-archaische Vorstellung vom Goldenen
Zeitalter scheint in einem solchen urtmlichen Erlebnis (dessen
Herkunft wir hier nicht zu diskutieren haben) zu wurzeln, und sie
bewirkt im Zusammenhang mit zeitbedingt veranlaten ideologi-
schen Tendenzen bewutseinsmige Reminiszenzen von groer
Strke und vielerlei Gestalt, wie die zahllosen Rckwrts- und Vor-
wrtsutopien, die alle bewut oder unbewut an die Vorstellung ei-
nes einmal existierenden harmonischen Zeitalters, in dem nur die
Gttin der Liebe und der Harmonie (Hesiod) herrschte und in dem
die Altre nicht mit Stierblut benetzt werden durften (Empedokles),
anknpfen. In Gebruchen, Mrchen, Liedern, Tnzen und Festen,
in Religion, Mythus, Kunst und Philosophie finden gewisse Erleb-
nismechanismen, die sich psychologischer Wunsch-, Verdrn-
gungs-, Angst- und Lebenserhaltungsmechanismen bedienen, ihren
quasi-archaischen Niederschlag: Ihre wichtigsten Formen sind die
Urerinnerung an das Goldene Zeitalter und das repressive Men-
schenbild.
Beide quasi-archaischen Vorstellungskomplexe haben, obgleich die
erstere lter ist als die letztere, gemeinsam, da sie sich mit dem Be-
ginn der Klassenordnung zu entwickeln beginnen: die positive Vor-
stellung des Goldenen Zeitalters schlagartig (es hat ja dieses Zeitalter
in der jngeren Eiszeit wirklich gegeben), der negative, quasi-an-
thropologisch sich verfestigende Reflex erlebter repressiver Zu-
stnde in der Form eines natrlichen Bildes des Menschen allmh-
lich und je nach den Bedrfnissen der jeweiligen antagonistischen
Gesellschaft mit entsprechenden ideologischen Variationen und Zu-
stzen. Sich grundstzlich ausschlieend, erfllen beide Erschei-
nungen die Aufgabe, das durch den geschichtlichen Fortschritt er-
mglichte Eindringen utopischer, und das heit teilweise aus der
Vorstellung des Goldenen Zeitalters erflieender Tendenzen in das
sich diesem Fortschritt in einem ihn zurcknehmenden Sinne anpas-
senden Menschenbild aufzufangen oder gar selbst in den Dienst die-
ses Menschenbildes zu stellen (z. B. durch religise Verjenseitigung
der Paradiesvorstellung mit Hilfe des Sndenfallmythus). Das seit
Jahrtausenden ideologisch verfestigte und in der hochbrgerlichen
Gesellschaft extreme Zge annehmende repressive Menschenbild
zeigt die folgenden Hauptmerkmale:
1.
Das Leben kann nur so weit Freiheit und Genu bieten, so weit
sie erkauft werden durch Mhsal und Opfer.
90
2.
Die Snde (in theologischer und profaner Auffassung) ist der
Grund, die Schuld der Weg und die Arbeit im Schweie des Ange-
sichts das Schicksal des Lebens. In der ideologisch-modernen Ge-
staltstellen sich diese drei Faktoren wie folgt dar. Das Sndigsein des
Menschen hat seine Wurzel in der unausrottbaren Tatsache, da er
von Natur egoistisch und daher bse ist. Die Schuld erfliet aus
diesem Bsesein des Menschen, und das Schicksal, arbeiten zu ms-
sen, ist nicht nur dem im Irdischen und im beengten Naturdasein
wandelnden Menschen mitgegeben, sondern ebenso Komponente
seiner eigenen negativen Natur: Er kann sich nicht beschrnken und
hat daraus die Konsequenz zu ziehen.
3.
Das Beglckende erscheint als Versprechen in einem Strom von
Leid, und es ist niemals sicher, ob sich dieses Versprechen jemals er-
fllt. Wo das Beglckende oder Glckhafte ohne Leid erscheint,
wird es als seltene Ausnahme dem rein Zuflligen angelastet.
4. Die demtige Hinnahme des bedrohlichen und dsteren Lebens-
schicksals, das als das Alltgliche und Normale erscheint, ist als Fe-
stigkeit des Charakters und als Heroismus zu verstehen und dem
einzelnen abzufordern.
5 .
Da der Mensch von Natur sndig und bse ist, ist der Kampf aller
gegen alle natrlich.
6 . Die sich aus dem Kampf heraushaltende Ausnahme ist der lebens-
fremde Heilige, wiederum in religiser und profaner Gestalt.
7. Das normale und eigentliche Kennzeichen der Erhhung des In-
dividuums ist der Erfolg. Die daraus resultierende Ntzlichkeits-
ethik ist nur der unmittelbarste Ausdruck des Erfolgsdenkens.(Es ist
noch nicht erkannt worden, da die calvinistische Ntzlichkeits-
[
Prdestinations-]lehre in dieser Komponente des repressiven Men-
schenbildes eine ihrer Wurzeln findet.)
B. Im repressiven Menschenbild werden die hheren Werte als
nicht dieser Welt zugehrig begriffen und erscheinen dazu berufen,
das Individuum zu Disziplin, Unterwerfung und Opfer zu erziehen.
Als solche hhere Werte gelten vor allem Wahrhaftigkeit, Geduld,
Einsicht, Pflichtbewutsein, Gottesfurcht, Moralitt, Bescheiden-
heit usw.
9.
Kontemplation und Genu gelten als gleichsam auerhalb des ei-
gentlichen Lebens stehend. Sie werden in die neben dem eigentlichen
Leben der Arbeit und der Pflicht einherlaufenden Freizeit verlegt
oder in den Ruhestand des Alters. Ihre Bestimmung ist in diesem
Menschenbild entweder die Regeneration im Dienste der Leistung
oder der Abschlu, wenn die Leistung nicht mehr mglich ist. Sie
gelten hier als dem Schlaf und dem Tod nher stehend denn dem Le-
ben.
9 1
10. Damit hngt zusammen die Neigung zur Diffamierung der Frei-
zeit, die als zum Bsen verfhrend gewertet wird. Die aus der klas-
sengesellschaftlichen Wurzel herkommende Verkehrung der Frei-
zeit in eine Komponente der herrschenden Repression wird dazu
bentzt, um dem Individuum glaubhaft zu machen, da allzu groe
Freiheit lebenszerstrend und zersetzend wirkt.
11. Die Diffamierung der Freizeit ist eng verbunden mit jener des
Erotischen, des Lustvollen, insbesondere der Sexualitt. Selbst in
der hochbrgerlichen Gesellschaft, in der der Schein der totalen ero-
tischen Freiheit vorherrscht, verhlt es sich prinzipiell nicht anders.
(Es werden jene beispielsweise belchelt, die in erotischer Freiheit zu
leben versuchen.)
12. Die einseitige Gleichsetzung des vielschichtigen Eros, den wir
anderweitig als Dreiklang von Sexualitt, Sympathie (Geselligkeit)
und Kultur definiert haben,
63
mit bloer Sexualitt erstrebt nicht
nur deren Vulgarisierung und Diffamierung, sondern auch die Iso-
lierung der Massen von aller einheitlichen und damit anspruchsvol-
len erotischen Kultur, deren Anforderungen in Widerspruch stehen
zu den Anforderungen der repressiven Ordnung.
13.
Das mit der repressiven Lebensordnung identische Dahinster-
ben des Lebens schlgt sich nieder in der Idealisierung des Todes als
des Erlsers vom irdischen bel.
14. Darin steckt auch die Komponente, die in einer ebensolchen
Diffamierung des Todes besteht: Der Tod wird nicht als die Mg-
lichkeit des natrlichen Endes nach einem glckhaften Leben ver-
standen, sondern als bedrohlicher Endpunkt nach einem dsteren
Leben. Der Enterotisierung des Lebens entspricht die Enterotisie-
rung des Todes.
Wie immer sich der ideologische Proze im einzelnen gestalten
mge, so bleibt das tief in die Psyche versenkte repressive Men-
schenbild als ideologische Basis unaufgehoben und hilft die repres-
sive Ideologie besonders da befestigen, wo die Neigung zur Identifi-
kation mit der bestehenden Ordnung aus anderen, etwa entgegenge-
setzten Grnden sich durchsetzt, z.B. ber den im Vergleich zu fr-
her hhere materielle Befriedigung gewhrenden Konsummecha-
nismus. Da der verbesserte Konsum an sich eine hhere erotische
Freiheit gestattet, so wird er durch die nihilistischen ideologischen
Tendenzen, wie vor allem durch das tief in Psyche versenkte repres-
sive Menschenbild in sein Gegenteil verkehrt, d.h. seinerseits zu ei-
ner Bedingung der Abfindung mit der repressiven Lebensform.
Kommt ohnehin von Natur dem Menschen nur wenig an eroti-
scher Freiheit zu, so soll er zufrieden sein, wenn ihm einige uere
Gter der Sttigung und der Bequemlichkeit zufallen; der sozialen
92
Marktordnung sei dafr gedankt. So wird innerhalb des differen-
zierten Komplexes ideologischer Tendenzen auch der Markt zu
einem mitwirkenden Element der ideologischen Pervertierung des
ffentlichen Bewutseins. Dieser Proze setzt bei der untersten
Stufe des repressiven Menschenbildes an und geht seinen Weg ber
die Erscheinung der Verdinglichung bis hin zur oberflchlichsten al-
ler brgerlichen Ideologien, der Markt-Ideologie, die verschiedenen
sonstigen ideologischen Strmungen- z.B. die mit dem repressiven
Menschenbild eng verknpfte Moral - einbeziehend.
Es gehrt zum Verstndnis des ideologischen Prozesses, da der
Hinweis auf die Identifikation mit der repressiven Realitt ein ver-
krzter Ausdruck dafr ist, da sich das Individuum in Wahrheit
nur mit dem Schein, dem aus der fetischistischen Verkehrung erflie-
enden Reflex dieser Realitt identifiziert. Die Realitt selbst wird
nicht durchschaut und nicht in ihrem eigentlichen Wesen erkannt.
Womit sich das heutige Individuum identifiziert, das ist nicht der
klassengesellschaftliche Antagonismus, nicht die herrschende Un-
terdrckung, nicht die allumfassende Entfremdung und Verdingli-
chung des Lebens, sondern mit deren sie verschleiernden Ideologie,
mit ihrem Schein. Es identifiziert sich mit der Konsumideologie, die
die Ausbeutung und die Armseligkeit verschleiert, mit dem Wohl-
stand, der die tatschliche Askese verbirgt, mit der Freiheit, die ein
dialektisches Pendant zur effektiven Manipulation und Unterwer-
fung darstellt.
Jedoch bleibt die ideologische Entwicklung dabei nicht stehen. Da
in der hochkapitalistischen Gesellschaft Konsum, Wohlstand und
Freiheit - wohlgemerkt als bloe Ideologien - in einen stndigen
Widerspruch geraten mssen zu den realen Tendenzen der Konsum,
Wohlstand und Freiheit gleichzeitig einengenden Tendenzen der re-
pressiven Ordnung, und da ebenso die aus dem Antagonismus und
Fetischismus stammenden und als bedrohliches Schicksal erlebten
ideologischen Strmungen sich durchsetzen, bleibt letztlich der Pes-
si
mismus und Nihilismus herrschend. Die an sich optimistischen
ideologischen Tendenzen der Freiheits-, Konsum- und Wohlstands-
ideologie, die ihre Fortsetzung in der Enttabuisierungsideologie fin-
den, werden in den subjektiven Erlebnisbereich derart hineingezo-
gen und integriert, da die diesen Erlebnisbereich durchdringende
ideologische Mischung von repressivem Menschenbild und fetischi-
stischem Pessimismus siegreich bleibt. Nicht nur im praktischen
Vollzug setzt sich die Dialektik des asketischen Eros durch, sondern
auch ideologisch.
Die Repression wohl empfindend, wird unter Ausntzung der all-
gemeinen verdinglichten Bewutseinslage diese Empfindung in
93
scheinkritische Begriffe wie Vermassung, Herrschaft der Technik,
Vereinsamung umgesetzt. Aber als nur scheinbar kritische setzen
diese Begriffe die Tendenz zur Integration und Identifikation im f-
fentlichen Leben nicht auer Kraft, sondern werden zum ideolo-
gisch relevanten Sprachgebrauch im privaten Bereich, wo sie hch-
stens Akte der privaten und damit die ffentliche entlastenden Reni-
tenz provozieren. Das Renitenzbedrfnis, das grundstzlich gegen
die Repression gerichtet ist, widersteht daher nicht der repressiven
Ordnung, sondern luft parallel zu ihr und bildet ein bloes Ventil in
der Totalitt ihrer Durchsetzung. Es macht sich Luft in einer sprach-
lich
verdinglichten
Kennzeichnung der vermeintlich schuldigen
Mchte, die aber nur der Sphre des verdinglichten Scheins ent-
stammen, wobei es zu einer Verlagerung der gegen das Ganze ge-
richteten Renitenzakte ins Subjektive kommt.
Die unerschtterliche Grundlage fr diesen ideologischen Proze
bleibt die Dialektik von Genu und Askese sowohl auf konomi-
schem wie erotischem Gebiet. Was das erstere betrifft, wute schon
Marx zu sagen:64
Diese Wissenschaft der wunderbaren Industrie ist zugleich die Wissenschaft
der Askese, und ihr wahres Ideal ist der asketische, aber wuchernde Geizhals
und der asketische, aber produzierende Sklave. Ihr moralisches Ideal ist der
Arbeiter, der in die Sparkasse einen Teil seines Salair bringt...
Im Lichte der ideologischen Problematik, die uns hier vordergrn-
dig interessiert, ist zu sagen: Der Zwang zur Askese wird in den
Hintergrund des Bewutseins gedrngt, obgleich er praktisch ber
das Streben nach Konsum und Genu dauernde Siege davontrgt,
nicht ohne da das Versagen im Genu Minderwertigkeits- und
Schuldgefhle hervorruft, die ihrerseits wiederum das Streben nach
berwindung der Askese hervorrufen.
12.
Die sthetische Reflexion des entfremdeten Bewutseins
Das insgesamt in unseren Ausfhrungen gezeichnete, in sich kom-
plizierte und widerspruchsvolle Bild des ideologischen Prozesses im
Sptkapitalismus setzt sich verstndlicherweise auch in der knstle-
rischen Reflexion fort, am greifbarsten in der modernen Malerei und
94
in der absurden Literatur. Insbesondere im Begriff des Allegori-
schen fassen sich die wichtigsten Bestimmungen des von uns be-
schriebenen ideologischen Prozesses zusammen und finden hier ihre
Fortsetzung, d.h. da, wo sie fr das auf Unmittelbarkeit ausgerich-
tete Auge am wenigsten einsichtig sind. In der modernen Kunst stel-
len sie sich vornehmlich dar in Kategorien des Hlichen, Absurden
und Bizarren, was uns wiederum das Recht gibt, vom Allegorischen
zu reden.
Die Vorliebe der modernen Kunst fr das Hliche, Absurde und
Bizarre hat ihre tiefen Wurzeln in der Eigenart der sptkapitalisti-
schen Gesellschaft. Schon die Romantik neigte ihnen, wie Maurice
Nadeau zeigt,
6 5
zu, wobei zu unterstreichen ist, da Form und In-
halt wesentlich von dem abwichen, was sich heute sthetisch artiku-
liert. Diese Vorliebe fr das Hliche pflegt sich in der modernen
Kunst und Literatur in die Form des Grotesken und Dunkel-Allego-
rischen zu kleiden. Die psychischen Mittel, deren sich diese stheti-
schen Erscheinungen zu bedienen pflegen, um zu jener ideologi-
schen Kristallisation zu gelangen, die sich im Grotesken und Allego-
rischen niederschlgt, sind zunchst sporadisch zu skizzieren.
Die Fhigkeit der Psyche, bestimmte, fr das Individuum rational
nicht aufschliebare Erlebnisse in dunkle Symbole von allegorischer
Wesenheit umzuwandeln, erklrt sich aus der grundstzlich archai-
schen Struktur der Phantasie. Weitaus lter als die Ratio, die sich erst
viel spter als eine eigene Fhigkeit der Psyche abspaltet und sich der
Phantasie entgegensetzt, hat diese von Anfang an die spontane
Handlungsweise des Menschen geleitet - wie anfnglich berhaupt
alles Handeln irrational-spontan geartet war. Beim Urmenschen war
das Verhltnis von Handeln und Umwelt noch gnzlich an eine dun-
keltraumhafte Erlebnisweise gebunden, so da die dieses Handeln
ermglichende subjektive Selbstreflexion noch zwangslufig die
Form des Symbolhaften und Dunkel-Allegorischen aufwies (wie
heute noch in den Residuen der freisteigenden Vorstellungen und
des Traumes). Bei genauer Beobachtung stellt sich heraus, da auch
heute noch viele Bereiche des menschlichen Verhaltens einen hnli-
chen Charakter aufweisen, insbesondere bei den vorindustriellen
Vlkern und in den modernen Kulturen berwiegend bei den un-
ausgebildeten, der rationalen Reflexion nur in einem beschrnkten
Mae mchtigen Individuen.
Fr die Kunst aller Zeiten, in spezifischer Weise und in extremer Zu-
spitzung aber fr die in einer widerspruchsvollen und schwer durch-
schaubaren ideologischen Situation stehende moderne, bleibt in-
folge der grundstzlich irrationalistischen Eigenart des Kunstschaf-
fens diese Fhigkeit der Phantasie, unverstandene Erlebnisformen in
95
Ausdrcke von allegorischer Bedeutung umzuwandeln, von groer
Wichtigkeit. Je komplizierter der gesellschaftliche Proze wird, je
mehr die Tendenz zur Rationalisierung von Realitt und Bewutsein
auf enge spezialistische Bereiche zurckgedrngt wird und deshalb
dieser Proze auerhalb der rationalisierten Teilbereiche dem Be-
greifen durch die bloe Phantasie, der irrationalistischen Einfhlung
berlassen wird, desto mehr gewinnt die Arbeit der Phantasie wie-
der an Umfang und verstrkt sich die Neigung, der symbolhaften
Allegorisierung des Geschehens mehr Raum zuzugestehen als der
rationalen Analyse. Es ist klar, da da, wo die sthetische Irrationa-
litt (Intuition) auf einen gesellschaftlichen Proze von der erwhn-
ten irrationalen Dunkelheit stt, sie eben wegen dieses Charakters
der Irrationalitt um so energischer bemht ist, das undurchschaute
Geschehen in einer spezifischen Weise zu reflektieren, nmlich mit-
tels der allegorisierenden Symbolik.
Da die archaische Fhigkeit der Phantasie zur Allegorisierung von
Erlebnisinhalten diese knstlerische Arbeit untersttzt, besagt al-
lerdings nur so viel, da sie von ihr in Anspruch genommen wird, je-
doch mit ihr nicht zusammenfllt. Die inhaltliche Tendenz zur Alle-
gorisierung selbst entspringt der zeitbedingten ideologischen Situa-
tion und wirkt sich um so strker aus, je komplizierter, wider-
spruchsvoller und verworrener die letztere ist. Das Panorama des
menschlichen und gesellschaftlichen Grauens, die bis ins Pathologi-
sche reichende und zersetzte individuelle wie soziale Landschaft
bildet den unverstanden-geheimnisvollen Hintergrund und bietet
das denkbar geeigneteste Material fr die Allegorisierung. Dieses
Panorama des menschlichen Grauens wird in dsteren allegorischen
Bildern eingefangen. Es wird immerhin als solches verstanden.
Gleichzeitig wird die verborgene Wesenheit und Bedeutung nicht
verstanden und gerade deshalb allegorisiert; nicht verstanden infolge
der aus ideologischen Grnden mangelnden Vermittlung zur Totali-
tt des sptkapitalistischen Prozesses. Das Nichtdialektische, das
Positivistische aller modernen Allegorie kommt bereits an diesem
Punkte der Ableitung zum Vorschein und entlarvt sie als eine sthe-
tische Form brgerlicher Ideologie.
Ist somit die allegorisierende Verhaltensweise der modernen Kunst
und Literatur aus der ideologischen Position heraus, in der sie steht,
begreiflich zu machen, so heit das nicht, da sie die einzig mgliche
und damit richtige ist. Es drngt sich die Frage auf, ob jeder Knstler
notgedrungenermaen der gngigen Ideologie unterliegen mu,
oder ob nicht durch die rationale Zuordnung zum kritischen Be-
wutsein der Bann dieser Ideologie durchbrochen und der Weg frei
gemacht werden kann zu einem rationalen Wirklichkeitsverstnd-
96
nis, das die Allegorisierung der Thematik berflssig macht - dies
ungeachtet der irrational verfahrenden Phantasie, die die psychische
Voraussetzung aller Kunst ausmacht, d. h. ungeachtet der alle Kunst
hervorbringenden sthetischen Intuition. Den Weg aller echten
knstlerischen Arbeit stellt die Dialektik von intuitiver Methode als
Mittel und rationaler Aussage als Inhalt dar. Diese Dialektik stellt
die unaufhebbare Bedingung jener Kunst dar, die sich aus dem Ver-
sinken in das allegorische Dunkel der rational unkontrollierten Ar-
beit der Phantasie heraushalten will.
Die allegorisierende Unvermitteltheit der Aussagen der modernen
Kunst und Literatur bewirkt unter anderem, da sich die Figuren
nicht entwickeln, keine subjektive und keine objektive Geschichte
haben. Sie sind deshalb, um es einmal ganz abrupt zu sagen, falsch
gezeichnet. Das trifft sogar fr Kafka zu. An dem hier behandelten
Problem vorbeigehend, spricht dies Hans Mayer sehr deutlich aus: 6 6
Seine (Kafkas) Figuren verndern sich nicht, kennen keinerlei klassische
Wandlung, weder Schuld noch Shne, sie sind weder verstehbar noch unver-
stehbar.
Weder verstehbar noch unverstehbar , das ist zudem eine zutref-
fende Bestimmung das allegorischen Charakters der Dichtung Kaf-
kas. Noch deutlicher trifft, wiederum ohne das Problem in seiner
Gnze zu durchschauen, Gustav Rene Hocke den Sachverhalt : 6 7
In der Dichtung knnen diese Attribute einer Allegorie zu Metaphern wer-
den, die nun paralogisch kombiniert werden. Obwohl die Bedeutungsvor-
gnge, zumindestens fr den Kenner, zumeist noch rational erkennbar blei-
ben, werden die einzelnen Attribute bereits im 18. Jahrhundert vielfach der-
art alogisch und sinnsprengend kombiniert, da sich damals schon Vieldeu-
tigkeit und Sinn-Losigkeit ergaben.
Die Vorstufe der modernen Allegorie ist die moderne Groteske. Sie
ist in der modernen Malerei immer noch gegenstndlich und in der
Literatur immer noch rational vollziehbar. Dieses noch be-
zeichnet die Tatsache, da sie an der Grenze zum Allegorischen
steht-typisches Beispiel: die grotesk-allegorischen Frauenportraits
Picassos. Soweit das Groteske der modernen Kunst noch dem Ver-
stndlichen zugeordnet ist - eine Bestimmung, die, wie wir spter
zeigen werden, dem Allegorischen abgeht -, erlaubt es diese Ver-
stndlichkeit, eine konkrete soziologische Differenzierung vorzu-
nehmen.
In der klassengesellschaftlich vermittelten Kunst, weitlufig aber in
der modernen, beobachten wir eine dreifache Tendenz des Diszipli-
nr-Apollinischen, Orgiastisch-Dionysischen und
Harmonisie-
9 7
rend-Utopischen. Natrlich ist diese dreifache Bestimmung in der
Theorie leichter durchzufhren als in der knstlerischen Praxis.
Aber sie trifft die Sache wesentlich.
Da, wo sie sich noch gegenstndlich gibt, stellt die moderne Kunst ihr
Objekt - in erster Linie den Menschen selbst, erst in zweiter Linie
das Gegenstndliche, das allerdings zum Menschen vermittelt ist-in
der Form des Grotesken dar. Infolge der antagonistischen Differen-
zierung des gesellschaftlichen Lebens zerfllt die so geartete Grotes-
ke, entsprechend den beiden soziologisch und sozialpsychologisch
zu differenzierenden Formen der Entfremdung in das Apollinische
und in das Dionysische, in die entgegengesetzten Motive des Aske-
tisch-Apathischen einerseits - z.B. Munchs berhmte abendliche
Stadtstrae mit den gespenstisch abgehrmten Gesichtern (die
Zylinder sind allgemeine Tracht der Zeit) - und des Bacchantisch-
Orgiastischen andererseits - z.B. Noldes Tanz um das goldene
Kalb. Die Differenz wird bis in die figurale Ordnung, die Farbge-
bung (matte Farben dort und grelle hier) und in die Linienfhrung
sichtbar. Gemeinsam ist ihnen jedoch das Groteske, das nicht selten
bis ins Bizarre reicht.
Die Richtung, die sich naturgem dem Grotesken entzieht, ist die
harmonisierend-utopisierende-wofr als Beispiel mit gutem Grund
zahlreiche Bilder des weltflchtigen Gauguin oder auch des mehr
weltzugewandten Macke wie Renoirs mit ihren stets gut gekleide-
ten, in der Sonne wandelnden und harmonisch sich bewegenden
Menschen angefhrt werden knnen.
Doch je weiter der Knstler sich von der traditionellen Kunst ent-
fernt, je weniger er darauf bedacht ist, das Milieu seines Motivs (die
Totalitt) in seine Darstellung einzubeziehen, desto strker symbo-
lisiert und abstrahiert er und gert er in die Nhe des Allegorischen,
um sich schlielich ihm ganz zu ergeben. Und je strker die Allegori-
sierung vorwrtsschreitet, wird nicht nur um so abstrakter die Dar-
stellung in formaler Beziehung, sondern auch ungenauer und nach-
lssiger oder zumeist gar nicht die Zuordnung zum allgemeinen Mi-
lieu des gesellschaftlichen Hintergrundes vollzogen. Der Weg zur
Abstraktion wird nicht erst mit dem Ungegenstndlichen in die Mo-
derne eingeschlagen, sondern beginnt bereits mit der Tendenz zur
symbolisierenden Allegorisierung, die ihrerseits nicht zu verstehen
ist,
wenn man nicht beachtet, wie der Knstler den entfremdeten
und verdinglichten ideologischen Strukturen der sptbrgerlichen
Gesellschaft unterliegt. Erst mit dem endgltigen Siege der ideologi-
schen Verdinglichung im 20. Jahrhundert gelangt auch die allegori-
sierend-abstrakte Malerei zum Siege.
Ein sporadischer Vergleich zwischen dem vorangehenden Impres-
98
sionismus und dem ihn berwindenden Expressionismus als der
bergangsstufe zur abstrakten Malerei kann das dahinterstehende
ideologische Problem verdeutlichen. Der Impressionismus ist von
der Aussage her zu definieren als utopischer Realismus, der sich
ideologisch herausbildet aus dem optimistisch affizierten Liberalis-
mus und dem Sozialismus des 19. Jahrhunderts. Von der vorange-
henden Klassik, etwa der Renaissance, unterscheidet sich der Im-
pressionismus durch folgendes. Haben auch beide gemeinsam,
durch die sthetische Form auf den Beschauer verklrend zu wirken,
d.h. so, als ob die kritische Negation gar nicht in der Absicht dieser
Kunst lge, so trifft diese Tatsache nur fr die ltere realistische
Kunst zu. Die Kunst der Renaissance ist zwar auch durchschauend
kritisch - auch hier machen z. B. die Portrts das soziale und sozial-
psychologische Wesen der Gestalten hinter dem ueren Schein
sichtbar -, aber sie ist dies nur spontan, ohne Absicht.
Der Impressionismus dagegen setzt dem Negativen, der Unvoll-
kommenheit der Realitt, das Ideal realer Harmonie entgegen. Viele
Bilder zeigen diese idealisierende Tendenz: festlich gekleidete Br-
ger in Theaterlogen, Frauen mit ihren Kindern im sommerlichen
Felde, Gasthaus- und Tanzszenen von harmonischer Ausgeglichen-
heit und andere. Die Groteske erscheint noch nicht, auch nicht, wo
bereits Entfremdetes zum Thema gemacht wird. Sie findet keinen
Platz, weil diese Art des kritischen Realismus so sehr optimistisch
der Vernderlichkeit der Welt verhaftet ist, da alle Darstellungen
das gleiche meinen: nmlich die realistische Symbolisierung mgli-
cher Schnheit und Harmonie - dies unabhnig davon, ob die kon-
kret dem Leben entnommenen Gestalten sich in ein brgerliches,
kleinbrgerliches oder proletarisches Gewand kleiden. Der Impres-
sionismus ist die Kunst der kritischen Oberwindung des Bisherigen
in der Gestalt des Versprechens als mglich begriffener Harmonie.
Deshalb kennt er im allgemeinen nicht die Spaltung der Darstellung
in Apollinisches und Dionysisches, es ist fr ihn alles utopische Ein-
heit.
Dies wird erst so recht deutlich, wenn man ihn dem Expressio-
nismus gegenberstellt.
Der Expressionismus bricht mit der soeben beschriebenen Auffas-
sung des Impressionismus. Dies aus dem Grunde, weil er angesichts
derSteigerung und Verhrtung der Entfremdungstendenzen den op-
timistischen Glauben an die Mglichkeit der Harmonisierung des
Lebens verloren hat. Knstlerische Zerstrung verbunden mit der
Absicht restloser kritischer Oberwindung aller bisherigen Illusionen
ist sein letztes Motiv. Daher wird naturgem unter seinen Hnden
alles zur Groteske, selbst die scheinbar auerhalb des Menschlichen
existierende gegenstndliche Welt. Alles erscheint als hlich und
99
der Zerstrung wert. Wie aber die Einseitigkeit des Impressionismus
in seiner optimistischen Utopisierung liegt, so jene des Expressio-
nismus in seiner Ontologisierung des Negativen zur Welt ber-
haupt. Letzterem gelingt dies aber nur auf dem Wege des Ober-
springens der Vermittlung von uerer Erscheinung (Hlichkeit)
und gesellschaftlicher Totalitt (Kapitalismus), worin eben seine
Einseitigkeit begrndet ist.
Der unbefangene und aus der realistischen Tradition kommende Be-
trachter empfindet die Bilder der Moderne als hlich. Er hat zu-
mindest insofern recht, als er nicht blo das Formale meint, sondern
die Aussage und die entsprechende Darstellungsweise. Die moderne
Groteske ist nun tatschlich in dem Sinne hlich, als sie einseitig
und ungeniert das Hliche des fetischisierten Lebens betont und
mit Hilfe abstrahierend symbolischer Ausdrucksformen zum Ei-
gentlichen des Seins erhebt. In der alten realistischen Kunst ist das
Hliche, z.B. in den Gesichtern der sozial hhergestellten Perso-
nen auf den Gemlden von Carpaccio (um 1500) bis Goya, ein blo-
es Moment des Ganzen, ein Ergebnis der intuitiv-kritischen Be-
gegnung des Knstlers mit einer Welt, die nicht von vornherein,
nicht von Natur her hlich war, eher im Gegenteil sich durch Ma-
nier, Form und Ausstattung zu verschnern verstand. Da das
Hliche als Moment auf vielen Bildern deutlich sichtbar wird, ist
bloer Audruck der vom Apollinischen (und der anthropologi-
schen Dialektik von Apollinischem und Dionysischem) abgetrenn-
ten und daher sthetisch begriffenen Entfremdung des monopoli-
sierten, d.h. von den oberen Klassen beanspruchten Dionysischen.
Aber es bleibt ein bloes Moment im ganzen, manchmal mehr,
manchmal weniger hervortretend, je nach der historischen Situa-
tion, dem Thema und der Anschauung des Knstlers.
Gewi brauchte auch in einer extrem entfremdeten, verdinglichten
und dem Knstler daher vielfach als gespenstisch erscheinenden
Welt die Dialektik der Totalitt nicht zugunsten einer positivisti-
schen Ontologisierung des Hlichen zur Welt berhaupt zerstrt
zu werden, gewi ist grundstzlich auch im 20. Jahrhundert eine
nicht minder kritische, aber dialektisch-realistische Malerei mg-
lich. Jedoch begreift man, da ebenso wie in der theoretischen In-
terpretation der modernen Kunst sich noch mehr in ihr selbst das
verdinglichte Sein wie der ihm kongruente verdinglichte Schein in
einem Mae aufdrngen, da Inhalt und Form unter den totalen Ein-
flu des Hlichen und seiner nichtdialektischen Version geraten.
Das unkritische Uriterliegen ist ungeachtet eines Moments des Wah-
ren, das darin erscheint, die eigentliche Tragdie der modernen
Kunst und Kunsttheorie. Die positivistisch-hohle und gleichzeitig
100
gngige brgerliche Ideologie reflektiert sich in der modernen Kunst
gleichfalls positivistisch, d.h. ohne Vermittlung der Aussage zum
Ganzen, womit diese Aussage zugleich falsch wird. Das Reden vom
negativen und verworfenen Wesen des Menschen und die zustzlich
sie verfestigende Redewendung von der schockierenden Wirkung
der Kunst (Adorno und andere) beweist, bis in welche pseudokriti-
sche Bereiche der Theorie die verdinglichte Ideologie reicht. Versagt
vor dem Gtzen der Verdinglichung bereits die ihrer Natur nach ra-
tional-kritische Theorie, so ist es nicht verwunderlich, da die der
Welt intuitiv begegnende Kunst hierin erst recht versagt.
Die zunehmende Verdinglichung des gesellschaftlichen Lebens im
20. Jahrhundert verschluckt das Individuelle und ordnet es - ob-
gleich es in der dialektischen Analyse als Ttig-Individuelles nicht
wirklich verschwindet - dem undifferenzierten Uniformen der
Massengesellschaft unter. Das schon seiner spezifischen Eigenart
nach auf das blo Allgemeine tendierende Symbol wird daher sthe-
tisch ins Vordergrndige geschoben, und da es zudem, wie bereits
bemerkt, auf das mit der Massengesellschaft identische Verding-
licht-Hliche stt, vernichtet es nicht nur das in der alten Kunst
noch selbstverstndlicherweise psychologisch (individueller Cha-
rakter) und soziologisch (Durchscheinen der sozialen Zuordnung)
ausgeprgte Portrt, sondern jegliche Darstellung, die noch indivi-
duelle Menschen in einem konkreten Milieu sich zu eigen macht.
Der Mensch wird zur undifferenzierten Schablone, zur nature morte
degradiert, zudem zu einer des verdinglicht Hlichen. Der zur un-
differenzierten Allgemeinheit degradierte hliche Mensch zeigt
sich nicht mehr (wie z. B. in den Gemlden der Renaissance) hinter
seiner psychischen Maske und seiner individuellen Wrde, sondern
er grinst uns als ein jedem anderen fast Gleichartiger und Hlicher
ungeniert an. Mit seiner uniformierten Seele erscheint er seelenlos,
mit seinem nach auen gerichteten Geist erscheint er geistlos. So
zumindest begreift ihn die unter der Gewalt der Verdinglichung ste-
hende moderne Kunst - und da sie ihn gleichzeitig nicht in seiner
wirklichen
Konkretheit und Widersprchlichkeit begreift, weil
nicht in seiner konkreten Vermittlung zur gesellschaftlichen Totali-
tt, ergibt sich aus unseren vorangehenden Analysen des Verding-
lichungsprozesses, hinter dem die Dialektik der Subjekt-Objekt-
Beziehung steht, von selbst.
Wir haben gesagt: Die Symbolisierung des Hlichen des 20. Jahr-
hunderts ergibt die moderne Groteske. Was ist aber des genaueren
das Groteske daran? Oder und vor allem im engsten Zusammenhang
mit dem Problem des Humoristischen oder gar Komischen wird in
aller grotesken Darstellung die Frage formuliert: Warum wirkt die
10 1
moderne, als solche aber
nicht beabsichtigte Groteske so penetrant
komisch? (Wir drfen nicht davon ausgehen, da sie der bereits
theoretische voreingenommene Intellektuelle keineswegs als ko-
misch empfindet, sondern davon, da dies beim berwiegenden Teil
des naiv reagierenden Publikums der Fall ist.)
Zwischen der gewollten, besonders literarischen, und der ungewoll-
ten Groteske, in der das Groteske dem Werk blo passiert und das
beabsichtigt
Tragische durchbricht oder gar verdrngt, ist im
Grunde kein qualitativer Unterschied. Und doch besteht ein Gegen-
satz.
Auch die traditionelle, das heit beabsichtigte Groteske hat
ihre tragische Note, sonst wre sie eine Satire oder Humoreske; wir
htten es hier mit einem rein komischen Stck zu tun.
Die Groteske entsteht, wo die Aussage zum exponiert Tragischen
nicht reicht, gleichzeitig aber die herben oder gar verdinglichten
Zge des Lebens, die hlichen, sich vordrngen, deshalb das Komi-
sche nach sich ziehen. Wo hingegen unter den gleichen Vorausset-
zungen des verengert Tragischen dieses Tragische trotzdem das be-
herrschende Moment bleibt, entsteht das humoristische Stck (das
mit der ungenau so bezeichneten Humoreske nichts zu tun hat).
Zu einer Zeit, in der Verdinglichung und Fetischisierung noch Rand-
erscheinungen waren, blhte der Humor in einem weitaus breite-
ren Mae, als dies heute der Fall sein kann. An die Stelle des Humors
schiebt sich heute das Komische, dessen dialektische Bezglichkeit
zum Tragischen die Groteske ergibt; aber die zugleich ungewollte,
die sich von der beabsichtigten der frheren Zeiten durch das Ein-
dringen vordergrndiger und nicht blo randmiger oder erfunde-
ner absonderlicher Zge unterscheidet. Das Absonderliche oder
Hliche war frher im Grunde nicht weniger typisch als heute, je-
doch aus Grnden, die im damaligen gesellschaftlichen Raum lagen,
noch nicht als im Zentrum des Lebens stehend, nicht als typisch,
empfunden worden. Diese, wenn auch sozial-ideologisch veranla-
te, so doch die Dialektik der Vermittlung vernachlssigende ber-
spitzung des Hlichen bewirkt, da die Darstellung nicht wie beab-
sichtigt ernst, sondern komisch wirkt.
Gerade die Reduktion nicht irgendeines, sondern sich auf das Feti-
schisiert-Hliche konzentrierenden Gehalts zum Abstrakt-Allge-
meinen macht seinen Sinn zudem weitgehend oder ganz unverstnd-
lich, irrationalisiert und mythologisiert ihn bis zu jener Hhe, auf
der nur noch die ueren sthetischen Formen und Techniken sich
dem rationalen Verstndnis als erschliebar anbieten. Infolge der
Vernachlssigung der vielseitigen Vermittlungen gehen die einzel-
nen Gestalten der Vielfalt der Bestimmungen und der Genauigkeit
der ins Detail reichenden Charaktermerkmale verlustig, die sie in der
102
realistischen Literatur auszeichnen. Um das Wesentliche aufzuwei-
sen,
mu das Typische und nicht das Zufllige oder Abseitige er-
scheinen, und zwar in seiner mit einer groen Flle von Details aus-
gestatteten Vereinzelung wie ebenso in seiner Substantialitt als ge-
sellschaftliches
Moment. Die teilweise oder gnzliche Unverstnd-
lichkeit der figuralen wie der handlungsmigen Darstellung in der
absurden Literatur resultiert aus der Abstraktion von diesen Be-
stimmungen. Das dem verdinglichten Proze vom Dichter abge-
schaute Hliche gibt sich als Ontologisch-Allgemeines und jenseits
aller Konkretheit im Detail wie in der gesellschaftlichen Bezogenheit
existent. In dieser Gestalt kann es nur, wenn berhaupt, in allegori-
sierenden Symbolen ausgedrckt werden oder, was dasselbe bedeu-
tet, unverstndlich. Ist es dem ideologisch sich auf der gleichen
Ebene wie diese Literatur bewegenden Beschauer-und nur von die-
sem ist hier die Rede - verwehrt, die Aussage zu verstehen, fhlt er
sich gleichzeitig gedrngt, die sthetische Form als angemessenen
Ausdruck seiner eigenen ideologischen Bindung zu akzeptieren, so
akzeptiert er das Kunstwerk insgesamt. Dem Fehlen der dialekti-
schen Vermittlung zur Totalitt in seiner eigenen ideologischen Hal-
tung kommt das Kunstwerk durch die gleichartige ideologische
Ausrichtung ohnehin a priori entgegen. Es entsteht so notgedrungen
der Schein einer unmittelbaren sthetischen Wahrheit. Der im sthe-
tischen Bewutsein sich herausbildende und gleichzeitig zur Einheit
sich zusammenfassende Widerspruch von ontologisierend-abstrak-
ter Symbolisierung des Hlichen und als hochwertig empfundener
sthetischer Form (Originalitt des Knstlers) ergibt die moderne
Allegorie. Als Ergebnis stellt sich die Erkenntnis ein, da hier Gro-
teske, Symbolisierung und Allegorie zusammenfallen. Eine solche
Allegorisierung, die sich auf den verschiedenen Stufen der Intensitt
zwischen dem noch und dem nicht mehr Verstndlichen zum Aus-
druck bringt, wird ihrerseits zum Anla genommen, das Grauen
zum schlechthin Menschlichen zu erheben und damit das spezifische
Grauen, wie es nur als solches der bestehenden kapitalistischen
Ordnung begriffen werden kann, verschwinden zu lassen.
In dem gewhnlichen Sinne wird unter dem Allegorischen ganz all-
gemein das Sinnbildliche verstanden. In dieser Gestalt ist die Allego-
rie neutral. Sie erfllt hier ein spielerisches Bedrfnis nach sinnbild-
licher Darstellung berwiegend abstrakter Begriffe wie des Guten,
Schnen, Bsen, der Freiheit, Wollust, des Geizes und so weiter. In
dieser Gestalt ist ihr Platz auerhalb aller Ideologie im Sinne der Be-
friedigung eines dem Dekorativen nahestehenden Bedrfnisses, d. h.
eines allgemein menschlichen Bedrfnisses. Ihrer ganzen Natur
nach auf Verallgemeinerung und so verstanden auf Abstraktion an-
10 3
gelegt, gert die Allegorie seit dem beginnenden 20. Jahrhundert in
Beziehung zu jener Form der Abstraktion, die zum Wesen der mo-
dernen Kunst geworden ist. Sie wird somit in den Bereich der sthe-
tischen Ideologie gezogen und ihres ursprnglichen neutral-dekora-
tiven Charakters entkleidet. Sie gert in eine enge Beziehung zur
modernen Groteske, die in vielerlei Gestalt den Inhalt der abstrakten
Kunst und der absurden Literatur ausmacht.
Dieser Proze beginnt mit dem frhen Expressionismus vor dem er-
sten Weltkrieg und setzt sich ungeachtet der Tatsache, da sich diese
Richtungen untereinander oft heftig bekmpfen, im Dadaismus,
Surrealismus, Kubismus und Futurismus fort.
Die mit der Groteske dialektisch identische Allegorie ist aber nicht
zuflliger Natur, sondern wurzelt in einem tiefen ideologischen
Verhltnis des Knstlers zur entfremdeten und verdinglichten Wirk-
lichkeit. Die moderne Allegorie drngt sich berall da dem stheti-
schen Bewutsein auf, wo der Knstler mit dem Problem der ver-
dinglichten Entfremdung des Lebens nicht fertig wird, im Gegenteil
ideologisch unterliegt; wenn auch nicht in der gewhnlichen Weise,
nicht ohne Widerstand wie der durchschnittliche Alltagsmensch,
sondern sich subjektiv wenigstens die Neigung zum kritischen Ab-
seitsstehen erhaltend. Die moderne Allegorie wird geboren, wenn
der gesellschaftlich in die Opposition gedrngte Knstler ungeachtet
seiner kritischen Haltung dem verdinglichten Schein unterliegt, ins-
besondere die Dialektik von Schein und Wesen in der modernen,
zum hchsten komplizierten Gesellschaft nicht durchschauen kann.
ber die komplizierte Dialektik von Schein und Wesen der V erding-
lichung haben wir in den vorangehenden Abschnitten ausfhrlich
gesprochen, ebenso ber die damit eng zusammenhngende Dialek-
tik von Verinnerlichung und Veruerlichung. Bezglich der letzte-
ren bleibt die Relation stets eine gegengleiche. Je mehr der Knstler
sich einbildet, in Rckwendung zur eigenen Subjektivitt der ver-
dinglichten Auenwelt zu entfliehen, desto weniger merkt er, woher
es eigentlich kommt, da in seiner Erlebniswelt nicht etwa solche
Vorstellungen wie Hoffnung, Schnheit, Wunderbares und Erha-
benes dominieren, sondern im Gegenteil Angst, Sorge, Bedrckt-
heit, Verzweiflung, Mibehagen, Vereinsamung, kurz das Hli-
che, das der Auenwelt entstammt. Die zustzlich aus dem flieen-
den Charakter des Seelischen sich erklrende willkrliche Verzer-
rung dieser Reflexionen zu dsteren und kaleidoskopartig wech-
selnden Bildern des nihilistischen Abgrundes verschrft nur die Tat-
sache, da es sich hierbei um eine die verdinglichte Wirklichkeit ver-
kehrt und zustzlich verzerrt widerspiegelnde Ideologie handelt.
Das Ergebnis ist die Groteske. Da aber ihre Aussage rational nicht
104
bewltigt ist, bedient sie sich der Form nach der Allegorie. Ist also
der Form nach die Aussage allegorisch, so dem Inhalt nach auf das
Hliche bezogen und somit grotesk.
Obgleich der moderne Knstler sich selbst als unnachgiebig kritisch
einschtzt, hindert ihn seine ideologische Bindung an die verding-
lichte Auenwelt daran, den Weg der durchschauenden und damit
wirklich kritischen Vermittlung zu den strukturellen Bedingungen
dieser Welt zu beschreiten und auf diese Weise mit dem Phnomen
der Verdinglichung insgesamt fertig zu werden. Nicht die in ideolo-
gischen Reflexionen sich ausdrckenden Klassenverhltnisse und
deren individuellen Niederschlag erkennt er als die Bedingungen al-
ler Absurditt, sondern er setzt diese selbst als primr und wesent-
lich, sie selbst erhebt er zum schlechthinnigen Sein, zu dem des
Menschen berhaupt. Der starre und monotone Eigensinn des
modernen Knstlers erkennt nicht Individuen, sondern das Indivi-
duum, nicht gesellschaftliche Differenzierungen, sondern
di e Ge-
sellschaft, nicht historische Konkretionen, sondern den Menschen
in de r
Geschichte. Und da es dies alles nicht gibt, kann es nur sym-
bolisch dargestellt werden. Da aber der gewhnliche symbolische
Ausdruck zudem nicht zureicht, um das Individuum, di e Gesell-
schaft und di e
Geschichte so darzustellen, wie dies mit den verding-
lichten Vorstellungen einer brgerlich-abstrakten und die Realitt
verzerrenden Ideologie bereinstimmen soll, steigert er die Symbo-
lik ins
Mystifizierend-Allegorische.
Mit aller Energie ist hierbei zu unterstreichen, da trotz des uer-
lich entgegengesetzten Anscheins wir es insbesondere bei der absur-
den Literatur (wie ebenso beim Expressionismus, Surrealismus, Da-
daismus und Futurismus) mit einer neuartigen Form des Naturalis-
mus zu tun haben. Genauer definiert ist zu sprechen von einem alle-
gorischen Naturalismus oder naturalistischen Allegorismus. Die Be-
stimmung des Naturalistischen ist wesentlich daran erkennbar, da
das Material oder das Thema, das in den knstlerischen Produktio-
nen erscheint, den sporadisch-intuitiv erlebten Oberflchenerschei-
nungen der entfremdeten Welt entnommen ist; des weiteren fllt
hier auf, da wir es mit einem subjektivistisch-psychologischen Na-
turalismus zu tun haben: dies deshalb, weil die abseits aller dialekti-
schen Vermittlung vor sich gehende Reflexion der Oberflchenan-
sicht der verdinglichten und entfremdeten Welt mit ihrer sensualisti-
schen, d. h. subjektivistisch-verinnerlichten Ausformung zusam-
menfllt und nicht etwa mit ihrer rationellen des gesunden Men-
schenverstandes,
welch letzteres den Naturalismus des Alltags-
menschen und der entsprechenden Kunst ausmacht. Der subjektivi-
stisch-sensualistische Naturalismus reflektiert, genau besehen, die
10 5
naturalistische Oberflche geltender verdinglichter Ideologien, was
nur deshalb unsichtbar wird, weil er sich des allegorischen Dunkels
bedient, das zwar formelle Hintergrndigkeit und konstruierten
Tiefsinn nicht ausschliet, aber die Entfremdung ideologisch un-
vermittelt stehen lt. Der Tiefsinn ist ein blo subjektiver, ein
aus der Begabung und der Phantasie des Dichters erflieender, aber
kein die objektive Realitt entlarvender.
Was den Expressionismus, der die abstrakte Malerei und die absurde
Literatur
methodisch und sachlich einleitet, trotz aller sonstigen
Unterschiede z.B. mit dem sprachzertrmmernden Dadaismus
verbindet, das ist der Zweiklang des Psychologisch-Subjektivisti-
schen und Monomanisch-Expressiven einerseits und das ber die
ideologische Oberflchenerscheinung der Realitt nicht hinausdrin-
gende Reflektive anderseits, was insgesamt eben in den allegorisie-
renden Naturalismus ausmndet.
Im Gegensatz zur extrem abstrakten Malerei bleibt im absurden
Theater die Tendenz zur Allegorisierung insofern zum Teil durch-
brochen, als Einzelvorgnge in ihrer isolierten Bedeutung bei einiger
Anstrengung und bei einigem analytischen Vermgen auf ihren so-
zialen Sinn hin erkannt werden knnen. Das Schuhausziehen und
-anziehen wie das Htewechseln symbolisieren im Godot ebenso
das Scheintun im hektischen Tun wie das Nichtvorwrtskommen in
der dauernden Bewegung des modernen Menschen sehr anschau-
lich.
Auch bei Kafka gibt es viele solcher vereinzelten Szenen, die
sich wie rationalisierbare Inseln aus dem allegorischen Dunkel her-
ausheben. Aber sie geben sich zum Unterschied zur realistisch-dia-
lektischen Literatur nicht in einer direkt auf den konkreten Zusam-
menhang bezogenen, realistischen Handlung zu erkennen, sondern
blo mittels der Symbolisierung: Wladimir und Estragon demon-
strieren ihre Scheinttigkeit nicht an einem Akt des wirklichen Le-
bens (in einer Fabrik, im Bro, in der Familie, auf der Strae, im Par-
lament usw.), sondern an einem zum bloen Symbol fr etwas ande-
res erhobenen und hchst gleichgltigen. Die Handlung steht hier
an der Grenze der vollendeten Allegorisierung und leitet auch zu
dieser, die das Stck als Ganzes besetzt, unvermittelt ber. Das Al-
legorische bleibt das beherrschende Moment: Es sei an die Schwie-
rigkeit erinnert, den bltterlosen Baum, die sonstige Leere auf der
Bhne, die Prgelszene, die Rede Luckys, Godot und anderes dem
rationalen Verstndnis zugnglich zu machen.
Das Problem des Hlich-Grotesken gewinnt auch seine Bedeutung
i
m Zusammenhang mit der weiter oben gemachten Andeutung der
Differenzierung der Themen der modernen Malerei in eine d-
ster-apollinische und eine erotisch-orgiastische Thematik. Beide
106
Themenkreise, von uns demonstriert an Munchs Stockholmer
Strae und an Noldes Tanz um das goldene Kalb, meinen und
treffen das Hliche in seinen beiden, dem modernen Leben be-
kannten Haupttendenzen des Repressiven und des Orgiastischen. 68
Gerade weil diese beiden Strmungen nichts von der aus der Sehn-
sucht nach ihrer berwindung erflieenden Mglichkeit des Uto-
pisch-Schnen ahnen lassen, werden sie eine diesem zugewandte
Kunst provozieren (nicht zufllig extrem gettigt von einem aus der
modernen in die primitiv paradiesische Gesellschaft geflohenen
Knstler wie Gauguin). Aber auch in diesem letzteren Falle wird
trotz der manchmal unmittelbaren und klaren Form der Aussge der
allegorische Charakter nicht aufgehoben.
In aller Literatur geht es um das Ganze des Menschen und der
menschlichen Existenz. Das Ganze ist hierbei als dialektische Totali-
tt zu begreifen, die durch die Handlung, d.h. durch das dargestellte
individuelle Schicksal hindurchzuscheinen, den berall fhlbaren
Hintergrund zu bilden hat, soll sie nicht ein blo vereinseitigtes und
verzerrtes Bild des Menschen zeichnen. Die Gefahr, die Totalitt zu
verfehlen, liegt nicht allein darin, da diese zugunsten eines extrem
subjektivistischen Menschenbildes bersehen wird, sondern ergibt
sich ebenso daraus, da sie als Totalitt nur scheinbar beachtet wird,
sich nur als Scheintotalitt installiert. Ein markantes Beispiel ist
Joyce' Ulysses. Die gewaltige Flle der Ereignisse, Situationen,
Bezge, Gestalten und der psychologischen wie intellektuellen
Reaktionen bezeichnet, trotz oft interessanter und zutreffender Ef-
fekte im einzelnen, bei weitem noch nicht den wirklichen Charakter
der englischen Grostadtgesellschaft, die wirkliche Totalitt des
modernen, an Dublin exemplifizierten Lebens. Es ist nicht das wirk-
liche Ganze, das uns Joyce vor Augen fhrt, sondern eine Abstrak-
tion des Ganzen, als solche jedoch unkenntlich gemacht durch die
ungeheuere Flle von Bildern, eine Menge nur notdrftig geordne-
ten Materials, zusammengehalten vermittels der schematisch-ab-
strakten Idee des Gegensatzes zwischen dem vergeistigten und dem
vermaterialisierten Prinzip, Ddalus und Bloom, mit dem Effekt ei-
ner mythischen Versubjektivierung des Menschenbildes nach dem
Mastab der heute herrschenden nihilistischen Ideologie.
Wir werden noch darauf zurckkommen, da trotz des Eindringens
verstreuter realistischer Zge diese Kunst als Folge ihrer prinzipiel-
len subjektivistischen Mngel den Menschen nicht blo in irgendei-
ner Weise vereinseitigt und verzerrt, sondern - tendenzmig, d. h.
in den verschiedenen Werken in verschiedener Weise und Intensitt
- dies nach einer ganz bestimmten Richtung hin tut, nmlich der
niedrig-triebhaften und pathologischen, insgesamt sptbrgerlich-
10 7
nihilistischen. In seiner Begeisterung fr James Joyce' Ulysses ge-
steht der geschwtzige Essayist Ernst Robert Curtius ein: 69
In Uly sses wird nun alles freigelegt, und das macht das Buch zu einem Mu-
seum der Sexualpsychologie und der Skatologie. (Fr sthetisch nichtge-
schulte Leser bersetzen wir: Skatologie heit wissenschaftliche Kotkunde.)
Und das ist ebensowenig blo symbolisch oder philosophisch
gemeint (obgleich eine solche Philosophie das Gesagte nur besttig-
te)
wie die folgende Charakterisierung des gleichen Autors
:
7 0
Und da sind die anderen Snden... in jenem Gespensterreigen des
15. Kapi-
tels... Die uere Szene ist ein Bordell. Aber wir fhlen bald, da wir aus der
> wirklichen<
Welt herausgetreten sind in ein Reich monstrser und grauen-
hafter berwirklichkeit, einen Hexensabbat der Trume und Geister, eine
Orgie von lasterhaften, blasphemischen Halluzinationen, neben der Flau-
berts Versuchungen des heiligen Johannes zahm und literarisch wirken...
Kritiker haben sich ber den Wert und die Bedeutung des Kapitels gestrit-
ten.
Einer anderen Methode bedient sich, um zu einem hnlichen Resul-
tat eines subjektivistischen Nihilismus zu gelangen, z.B. Thornton
Wilder in seinem Stck Wir sind noch einmal davongekommen,
Besteht Joyce darauf, an Dublin in einem Zeitraum von 24 Stunden
vorzufhren, in welch aussichtsloser Lage, wie verloren sich der
Mensch als Mensch berhaupt findet, so zielt Wilder auf dasselbe
Resultat. Der Unterschied ist nur der, da er nicht einen besonderen
Punkt wie Joyce (Dublin zu einer ganz bestimmten Zeit) zur Schein-
totalitt ausbaut, sondern indem er umgekehrt seine konstruierte
Scheintotalitt ins berhistorisch-Malose ausdehnt und weit aus-
einanderliegende Epochen der Katastrophe so miteinander ver-
knpft, da der Zuschauer sich einer ewig wiederkehrenden und mit
schicksalhafter Gewalt sich durchsetzenden Ursituation gegen-
bergestellt sieht, die nur eine geringe Chance des Davonkommens
lt. Die wegen des Verfallens ins Abstrakt-berhistorische man-
gelhafte Konkretisierung lt nur einer scheinhaften, aufgebausch-
ten Konkretisierung Raum, einer Scheintotalitt, die das Publikum
ber die wahren Grnde der geschilderten Katastrophen vollkom-
men im dunkeln lt. Naturkatastrophen (Eiszeit und Sintflut) und
klassengesellschaftlich bedingte Katastrophen (Weltkrieg) werden
abstrakt auf die gleiche Stufe gestellt, auf diese Weise wird der br-
gerlich-dekadenten Stimmung der Unentrinnbarkeit entsprochen
und das Liedchen mitgesungen, da Einsamkeit, Melancholie, Nihi-
lis mus und Schuldgefhl nicht Symptome einer zerfallenen brgerli-
chen Gesellschaft seien, sondern es sie immer schon gegeben habe.
Warum aber die Dichter anderer Epochen von solchen alles ber-
10 8
deckenden Tendenzen einer dekadent-nihilistischen Stimmung frei
sind, knnen die nihilistischen immer-Ideologen nicht erklren.
Das zeitweilig extrem Pathetische in der bildenden Kunst seit dem
frhen Mittelalter und spter im Barockroman war selbst Ausdruck
einer weitreichenden Kontaktlosigkeit von Kunst und Leben. Er-
schien das Alltagsleben zu nchtern, um interessant zu sein, so
umging man es auf dem Wege der Auswahl besonderer Themen
und legte in diese Themen eine Stimmung hinein, die erst den
Wert der Dichtung ausmachen sollte. Diese unnatrliche oder
besser unrealistische Stimmung wurde vom Dichter gerne berstei-
gert und ergab im Resultat eine Kunst von weitreichend nichtreali-
stischer Struktur. Da unter der Voraussetzung der Einfachheit und
Durchsichtigkeit des Alltagslebens nur das fesselte, was den nch-
ternen Ablauf des Alltags unterbrach, wurden Liebe und Krieg zu
den beliebtesten Themen. Bis man dann im Barockroman ein ande-
res Auerordentliches zum herrschenden Thema erhob, nmlich
das auerordentliche Leben und die konstruierten Schicksale der
Frstenfamilien, die in der Zeit der neufeudalen absolutistischen Re-
aktion als allein noch des Interesses wert erschienen. Das arbeitende
und brgerliche Volk schien in die soziale Profanitt und Schicksals-
losigkeit versunken, bis Lessing, wenn auch nicht ganz ohne Vorlu-
fer, einen anderen Ton anzuschlagen begann. Wird spter auch der
Alltag der verschiedenen sozialen Klassen von den Knstlern beach-
tet, wird auch er interessant, so bleibt er noch immer ein durch-
sichtiger Alltag, der nichts Wesentliches verbirgt, weil seine ko-
nomischen Strukturen, seine sozialen Probleme und ideologischen
Wege noch wesentlich verstndlich sind. Das Werk gilt als gelungen,
wenn es der Dichter versteht, ausreichend konkret und vielseitig die
Bezglichkeit zwischen dem Individuellen und dem Allgemeinen,
dem Einzelnen und dem objektiven Schicksal darzustellen. Etwas
ausdrcken heit hier nicht mehr, etwas Gesuchtes mit einer ge-
fhlsgeladenen Sprache in eine interessante Stimmung zu verset-
zen, sondern wesentlich das Leben sich selbst erzhlen lassen.
Damit wird die Sprache selbst um ein starkes Ma nchterner, be-
sonders verglichen mit jener des Barock. Sie wird aber gleichzeitig
auch komplizierter, psychologischer, hintergrndiger und schlie-
lich epischer im Sinne der Einfgung von Interpretationen des Er-
zhlers selbst. An die Stelle der frheren pathetischen Oberflchen-
schilderung - man knnte von einem pathetischen Rationalismus
sprechen - tritt die nchterne Tief enschilderung, die auch dem Irra-
tionalen der Erlebnis- und Gefhlswelt einen gewissen Raum lt.
Schicksal ist jetzt nicht mehr wie im Barock das Ergebnis endloser
Zuflle, sondern letztlich das unter bestimmten Bedingungen sich
10 9
vollziehende Verhltnis des Menschen zum anderen Menschen; die
dialektische Subjekt-Objekt-Beziehung, die nicht zufllig Hegel zur
gleichen Zeit entdeckt. Aber noch immer bleibt das Leben, wenn
auch schicksalhaft verworren in seinem Ablauf, im Grunde ver-
stndlich und durchschaubar. Die Erkennungsszenen, ein wichti-
ges Mittel der dichterischen Handhabung der Handlung, wirken
(
mit Ausnahme von Kleist, wie Georg Lukcs zeigt) klrend und die
Miverstndnisse im Sinne der Durchsetzung normaler und greifba-
rer menschlicher Beziehungen aufhellend auf den Lauf der Hand-
lung.
Das Schicksal bleibt als ein vom Menschen selbst letztlich
gemachtes und verschuldetes verstehbar.
Mit der fortschreitenden Industrialisierung, spezialistischen Me-
chanisierung und Vermassung wird die Lebenssituation des einzel-
nen Individuums immer undurchsichtiger. Das Schicksal erscheint
zunehmend als gleichsam mystische Gewalt, als etwas mehr oder
weniger Unbeeinflubares, bermenschliches. Das Einzelschicksal
als solches scheint an Bedeutung zu verlieren. Es scheint nur inso-
fern interessant, als es zum wichtigsten Darstellungsmittel des all-
gemeinen Schicksals wird.
Gleichzeitig und aus genau demselben Grunde der zunehmenden
Undurchschaubarkeit des allgemeinen Schicksals zeigt der Dichter
die Neigung, sich in das Subjekt zurckzuziehen und die allgemeine
menschliche Situation von hier aus verstndlich zu machen. Der dia-
lektische Umschlag der knstlerischen Ideologie vom extrem Ob-
jektiven ( la Joyce und Wilder) als verdinglichter Entfremdung ins
extrem Subjektive ist zu verstehen als Flucht. Zwar gelingt sie nicht,
weil auch die Subjektivitt mit ihrer differenzierten Innerlichkeit
sich ( wie wir bereits gezeigt haben) bei genauer Analyse als Ab-
klatsch der verdinglichten Auenwelt erweist. Entweder bleibt die
Dichtung dabei stehen und schildert das Subjekt selbst als einen ent-
fremdeten Apparat, als ein Element der ueren Verdinglichung von
Existenz und Bewutsein; oder sie sucht einen Ausweg in der sub-
jektiven Freiheit, die sich der entfremdeten Welt entgegensetzt,
dann gert sie in die Fnge konstruierter Behauptungen ( worber
noch zu reden sein wird). Die drei Formen verdinglichter Ideologie
in der Literatur sind somit: 1. bersteigerung der Totalitt zur
Scheintotalitt; 2. Schilderung der verinnerlichten Subjektivitt als
veruerlichter; 3. Flucht in die Scheinfreiheit des Subjekts, das sei-
nerseits entweder als monologisierendes Ich oder als der absoluten
Freiheit mchtiges ber-Ich erscheint.
Diese knstlerische Haltung trgt ihrerseits zur gesteigerten Ideolo-
gisierung des Bewutseins bei. Der Knstler beobachtet mit oft gro-
em Scharfsinn das Geschehen, aber er verbleibt gedanklich auf dem
110
ihm unmittelbar erreichbaren Boden der Entfremdung, so da das in
Mythen, Symbolen und Allegorien eingefangene Geschehen nicht
wirklich verstanden, nicht zum wirklich Erkannten erhoben werden
kann. Die Wahrheit erscheint hier als blo ideologische, blo in
der Konfrontation mit dem gewohnten verdinglichten Bewutsein
des selbst entfremdeten Theaters und Leserpublikums sich bewh-
rende Wahrheit. Je genauer die verdinglichte Oberflche zur Repro-
duktion gelangt, je geistvoller sie wie z. B. in Becketts Godot aus-
gemalt wird, desto wahrer erscheint sie dem auf verdinglichte Refle-
xion geeichten Theaterbesucher. Da hier gleichzeitig - und das ist
das berzeugende an vielen modernen Theaterstcken-durchaus
auch Wahres dargestellt wird, beweist nur, da aller auf scharfer Be-
obachtung beruhender Schein eben nicht bloer Schein ist, sondern
da die Dialektik von Wahrheit und Unwahrheit des Scheins in der
modernen Literatur strafwrdig vernachlssigt wird. Statt der gan-
z en
Wahrheit erscheint nur die empirische, in der alltglichen
Oberflchenbetrachtung sich prsentierende
Wahrheit. Wre der
moderne Mensch in der von der absurden Literatur geschilderten
Art verdinglicht, dann wren Geschichte und gesellschaftlicher Pro-
ze nur noch als ein Naturproze begreiflich, jedoch nicht mehr als
durch Bewutsein und Ttigkeit sich vollziehende Subjekt-Ob-
jekt-Beziehung.
Bis zum 19. Jahrhundert beschftigte sich die Literatur mit dem
normalen Leben, auch wenn es bereits abnormal war im Sinne
zeitbedingter Entfremdung. Ihre Normalitt bestand darin, da sie
selten die Grenzen des Alltglich-Mglichen, des Empirischen,
berschritt. Die Entfremdung erscheint dem Knstler als das Pro-
blematische eines Lebens, das als prinzipiell normales weitergeht.
Im 20. Jahrhundert dagegen setzt sich in dynamischer Steigerung
das Bewutsein der mehr oder weniger vollkommenen Zerstrung
des Normalen bis zur Hhe der Zerstrung des Menschen selbst
durch. Gleichzeitig ist dieses Bewutsein seinerseits ein verkehrtes,
ein der Entfremdung unterlegenes, weil es in zunehmendem Mae
die Tatsache aus den Augen verliert, da alle gesellschaftliche Exi-
stenz, auch die extrem entfremdete, nur mglich ist unter der Bedin-
gung, da der Mensch innerhalb der gegebenen Verhltnisse arbei-
tet, strebt, denkt, liebt, sich nach Freiheit sehnt usw., d. h. sich nor-
mal verhlt. Es gibt keine Entfremdung fr sich, sondern nur eine
Entfremdung des Lebens, wie es immer in seinen primren Bedin-
gungen gewesen ist, sein mu und stets bleiben wird. Menschliches
Existieren steht nicht auerhalb der Geschichte. Bis zur Epoche des
anbrechenden Imperialismus im letzten Drittel des vorigen Jahr-
hunderts war es noch mglich, das in der Literatur oft als das Unver-
11 1
dorben-Naive sich gebende in ungenierter Spontaneitt dem All-
tagsleben selbst zu entnehmen und es in einer der humanistischen
Sehnsucht nach berwindung der Entfremdung befriedigenden
Weise darzustellen.
Die naiv-sehnsuchtsvolle, die elegische Tendenz ging dahin, die
tragischen Einzelschicksale als relative und vermittelte Spiegelbilder
des ebenso tragischen, weil entfremdeten Schicksals aller Menschen,
der ganzen Gesellschaft, deutlich zu machen und gleichzeitig das
Sittliche oder Gute als Mglichkeit der Erlsung von diesem
Schicksal durch die Einbeziehung positiver, den Kampf gegen das
Bse tragisch durchfechtender Gestalten in die Handlung durch-
scheinen zu lassen. Es ist hierbei zunchst ohne Belang, ob diese Ge-
stalten idealistisch bersteigert zu siegreichen Helden stilisiert oder
im tragischen Zusammenbruch endend dargestellt wurden. Selbst
wo das Gute oder das Ideal wieder ironisch zurckgenommen
wird, indem man es als unverwirklichbar-utopisch erscheinen lt,
geschieht dies nicht im Sinne des nihilistischen Pessimismus, son-
dern es bleibt als eine aus dem Leben nicht wegzudenkende positive
Utopie bestehen, um dieses Leben und in weiterer Folge die Kunst
selbst zu affizieren, in Bewegung zu halten, ja noch mehr als das,
berhaupt mglich zu machen. Das als Kampf zwischen dem Guten
und dem Bsen und damit gewollt oder ungewollt, direkt oder indi-
rekt humanistisch begriffene Leben bot die zureichende Grundlage
fr eine Kunst, die es noch nicht ntig hatte, ganz neue Formen zu
suchen, um sich ausdrcken zu knnen. Die gesellschaftliche Situa-
tion der Entfremdung im Liberalismus lie noch in spontaner Refle-
xion die Einsicht in den Widerspruch zwischen entfremdeter Reali-
tt und ihr kritisch entgegenstehendem Ideal zu.
Die Suche nach neuen Formen der knstlerischen Darstellung wur-
zelt berwiegend in dem Gefhl und der ihr entsprechenden Ideolo-
gie, die das sptkapitalistische Grauen zum Unwiderstehlichen und
Unberwindlichen erhebt und damit als absolut setzt. Unter ande-
rem entstehen in diesem Zusammenhang solche Fragen wie die fol-
genden: Kann der Mensch heute berhaupt noch >gespielt< wer-
den?, fragt Drrenmatt; Adorno stellt die Frage Ist Lyrik nach
Auschwitz noch mglich?, Hans Mayer fragt hnlich wie Drren-
matt Kann es heute noch Tragdien geben?
Zweifellos ist es uerst schwierig, den in der sptbrgerlichen Ideo-
logie seiner konkreten Zge beraubten und zum abstrakten Schema
des entfremdeten Individuums allegorisierten Menschen auf den
Bhnen und in den Romanen so darzustellen, da sich daraus Thea-
ter und Erzhlung in der Art dessen ergeben, was wir darunter tra-
ditionell verstehen. Aber als konkretes und dem historischen wie ge-
112
sellschaftlichen Diesseits entnommenes Wesen ist dieses Individuum
trotz aller mit Recht geforderten Neuerungen genauso darstellbar
wie in frheren Jahrhunderten - auch Lyrik ist nach Auschwitz wie-
dererstanden, womit ihre Mglichkeit erwiesen ist. Ziehen wir die
engere Frage in Betracht, ob es heute noch Tragdien geben kann.
Um diese Frage zu beantworten, nimmt Hans Mayer in seiner Es-
saysammlung Zur deutschen Literatur der Zeit Stellung zu Dr-
renmatts Hrspiel Die Panne
7 1
Der Inhalt dieses Hrspiels dreht
sich darum, da ein verirrter Vertreter sich einem zwecks bloer
Unterhaltung durchgefhrten Gericht unterwirft und des Mordes an
seinem Chef beschuldigt wird, den er mit einer fr die kapitalisti-
schen Konkurrenzverhltnisse charakteristischen halbbewuten
Rationalitt - man erinnere sich an Kafkas zwischen Schlafen und
Wachen handelnde Personen - in den Tod treibt. Der Vertreter
Traps handelt letztlich zwangslufig, seine Schuld ist eine nur zweit-
rangig persnliche. In Wahrheit fllt die Schuld auf die gesellschaft-
lichen Umstnde, die das einzelne Individuum kraft des in ihnen lie-
genden Zwangs, vermittels eines raffinierten Handelns erfolgreich
zu sein, in die Situation bringen, am Tode anderer symbolisch oder
effektiv schuldig zu werden.
Mit der Panne will Drrenmatt demonstrieren, da es in unserer Zeit
keine echten Tragdien mehr geben kann. Hans Mayer folgt ihm
hierin. Die Begrndung ist die folgende:
In der modernen Welt, so
will es Drrenmatt scheinen, ist das groe, tragi-
sche Spiel und Gegenspiel kaum noch mglich. Nichts mehr von Marquis
Posa, von Knig Philipp, von Egmonts Attituden, von Herzog Alba.
Diese Ansicht widerlegt sich zunchst - zunchst, weil hinter ihr
auch ein groes Stck Wahrheit steckt - dadurch, da Drrenmatt
die Protagonisten des tragischen Spiels ganz nach dem berlieferten
Zuschnitt des altklassischen Theaters auf die echten Reprsentan-
ten, die Helden mit Namen, das heit auf die historisch oder gesell-
schaftlich hervorstechenden Persnlichkeiten reduziert. Drren-
matt sagt - zitiert nach Hans Mayer:
Die echten Reprsentanten fehlen, die tragischen Helden sind ohne Namen.
Mit einem kleinen Schieber, mit einem Kanzlisten, mit einem Polizisten lt
sich die heutige Umwelt besser wiedergeben als mit einem Bundesrat, als mit
einem Bundeskanzler. Die Kunst dringt nur noch bis zu den Opfern vor,
dringt sie berhaupt zu Menschen, die Mchtigen erreicht sie nicht mehr.
Die Konsequenzen sind die folgenden:
Nicht die Schuld oder Shne des Herrn Traps soll gezeigt werden, sondern
die Struktur der >menschlichen Gemeinschaft< von heute. Zustand einer Ge-
1 1 3
meinschaft der totalen und allgemeinen Verantwortungslosigkeit, die nach
Drrenmatts Meinung in unserer Zeit das Schreiben von Tragdien unwei-
gerlich verbieten msse. Denn: >Denn die Tragdie setzt Schuld, Not, Ma,
bersicht, Verantwortung voraus. In der Wurstelei unseres Jahrhunderts, in
diesem Kehraus der weien Rasse, gibt es keine Schuldigen und keine Ver-
antwortlichen mehr. Alle knnen nichts dafr und haben es nicht gewollt...
Wir sind zu kollektiv schuldig, zu kollektiv gebettet...<
7 2
Die Ansicht Drrenmatts luft darauf hinaus, da es wirklich freie
Individuen in einer Zeit der durchschnittlichen Nivellierung des
Verhaltens auf der Ebene der alles nach Schema ausfhrenden Se-
kretre - die hier fr den schematisch verfahrenden Alltags- und
Berufsmenschen der sptbrgerlichen Gesellschaft stehen - nicht
mehr gibt. Daher gibt es kaum noch die wirklich freie Entscheidung
und Verantwortung, nicht die wirklich freie Tat, die Schuld, Not,
Ma usw. nach sich zieht. Erst durch eine solche freie Entscheidung
und Tat erhlt der Begriff der tragischen Verwicklung und Schuld
einen Sinn. Da im entindividualisierten Kollektiv, in der institutio-
nalisierten und uniformierten Gesellschaft alle Individuen unter
Druck gehalten werden, sind sie durch den anonymen Proze, der in
die Schuld drngt, zugleich aller Verantwortung bar und entschul-
digt. Die subjektive Schuld kann das Individuum nicht mehr treffen.
Die einstmals von profilierten, des Alleingangs fhigen und vom
Bewutsein der persnlichen Verantwortung getragenen Individuen
provozierte tragische Situation, die in der konfliktgeladenen Begeg-
nung mit anderen, prinzipiell hnlich gearteten Individuen das her-
vorbrachten, was man die Tragdien nennt, ist heute nicht mehr
mglich.
An dieser Argumentation ist zunchst etwas Wahres. Wrde man
dies leugnen, dann wrde man die tiefgreifenden Vernderungen der
brgerlichen Gesellschaft des 2 0. Jahrhunderts leugnen. Jedoch
bertreibt gleichzeitig die moderne theoretische und sthetische
Ideologie in einer ganz bestimmten, nmlich den dekadenten An-
sprchen der gegenwrtigen brgerlichen Epoche angemessenen
Weise, womit sie selbst zu einem Element der ideologischen
Akkommodation an die bestehenden Verhltnisse wird, denen sie
mit kritischer Distanz zu begegnen vermeint.
Diese Akkommodation zeigt eine doppelte Tendenz. Einerseits: In-
dem die sthetische Reproduktion moderner Tatbestnde der Ent-
fremdung und Verdinglichung alle Individuen als gleichermaen
und deshalb mechanisch funktionierende , aller subjektiven Ent-
scheidungsfhigkeit bare Sekretre begreift, wird der die verant-
wortlichen Mchte entschuldigende Schein erzeugt, als ob die ganze
Schuld dem anonymen und rein mechanisch ablaufenden Proze
114
zu Lasten fiele. Anderseits: Es wird auf diese Weise selbst jener un-
aufhebbare Raum individueller Entscheidung sistiert, der die allge-
meine anthropologische Voraussetzung menschlicher
Existenz
berhaupt darstellt. Es ist dem entgegenzuhalten, da es Gesell-
schaften ohne irgendeine Form individueller Entscheidung, zwi-
schenindividueller
Widersprche und ohne jeglichen tragischen
Konflikt schlechthin nicht geben kann.
Was sich in Wahrheit gendert hat, das ist die Form des tragischen
Konflikts. An die Stelle der einstigen Akteure dieser Konflikte der
feudalen und brgerlichen Welt von Egmont bis Buddenbrooks sind
moderne Akteure mit vernderten Eigenschaften und Tendenzen
getreten. Alles verluft weniger heroisch, die Konflikte spielen sich
viel nchterner, wenn auch nicht in einer weniger erregenden Atmo-
sphre ab. In einer Zeit der fast totalen ideologischen Manipulation,
verdinglichten Institutionalisierung und fetischistischen Verspiee-
rung - die nur eine begrenzte progressive Elite, ber die wir spter
sprechen werden, auslt - spielt
die einstmalige erhabene Pathe-
tik und Gestik nur noch eine geringe Rolle. Die fr jede Gesell-
schaft, auch fr die extrem verdinglichte, fortwirkende dialektische
Spannung zwischen den reaktiven und den, wenn auch zahlenmig
begrenzteren, progressiven Krften lt sich niemals ganz sistieren.
Der aus seiner Partei ausgeschlossene Intellektuelle, der um die
Rechte der Mitglieder isoliert kmpfende Gewerkschaftsfunktionr,
der in das Einzelgngertum gedrngte aufmuckende Arbeiter oder
Angestellte, der wegen seiner mutigen Haltung im Netz verwickel-
ter Schikanen zappelnde Student, ja selbst der gegen die Normen
verstoende Liebhaber wie der in die theoretische Arbeit sich flch-
tende Kritiker usw. - sie alle sind Gestalten von einer hchst tragi-
schen
Wesenheit, und die heutige Welt ist voll von ihnen.
Die entscheidende Bestimmung ist damit aber noch nicht gewonnen.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, da das Tragische unserer Zeit
einen anderen Charakter angenommen hat. Die Konflikte von Indi-
viduen, die der Entscheidung und der Tat, der Schuld und der Ka-
tharsis, der Not und des Maes fhig sind, nehmen weniger als fr-
her die Form von Konflikten zwischen wirklichen und individuellen
Exponenten entgegengesetzter Art an, als vielmehr die Form von
Konflikten mit einer zu verdinglicht-manipulierter Objektivitt er-
starrten
Welt, als deren selbst manipulierte Schatten ihre individuel-
len Exponenten agieren. Selbst ein sich zum demokratischen Sozia-
lis
mus bekennender Mann wie der deutsche Bundeskanzler Willy
Brandt versteht seine linken Kritiker nicht, wenn diese ihm vor-
werfen, unter dem Zwange des verdinglichten Prozesses sptkapita-
listischer Selbstreproduktion dem Grokapital dienstbar zu sein; er
11 5
vertritt nicht eine Idee, einen Standpunkt, ein Ideal gegen andere
Ideen, Standpunkte, Ideale und deren Exponenten, sondern er
funktioniert im Netz verdinglichter Profit- und Manipulations-
mechanismen. Seine individuellen progressiven Gegner finden in
ihm nicht ihresgleichen, sondern einen bloen subjektiven Ab-
klatsch objektiver Institutionalisierungen. Als konsequente Vertre-
ter der Ideologien einer verdinglichten Welt und ihrer Institutionen
erscheinen deren Exponenten als bloe selbst manipulierte Werk-
zeuge. Sie als profilierte Einzelne la Philipp, Macbeth oder Alba
ernst zu nehmen, ist hoffnungslos. Der Kampf gegen sie bleibt ein
Kampf gegen wesenlose Schatten. Von der verdinglichten Institutio-
nalitt bis in die intimsten Bereiche des Denkens und Handelns hin-
ein bestimmt, lassen sie sich nicht mehr wie einstmals in ein persn-
liches
Austragen der entstandenen Konflikte ein, sondern folgen
mechanisch der Schematik des Vollzugs, die dem objektiven Proze
i
mmanent ist. Innerhalb dieser Schematik wahren sie allerdings den
Schein der selbstndigen Entscheidung zum Zwecke der Selbst-
tuschung und der Tuschung ihrer Umwelt. Als verdinglichter Ra-
tionalismus stellt diese Haltung eine dar, der das tragische Moment
unmittelbar fremd sein mu.
Dieser verdinglichte Rationalismus ist es, der den Schein logischer
Konsequenz erweckt und das verdinglichte Selbstbewutsein der
ihm unterworfenen Individuen strkt. Sie ahnen nicht, da ihr Den-
ken nur in dem Sinne rational verluft, in dem auch der naive Na-
turmensch vermeint, einen Gegenstand begriffen zu haben, wenn er
sich ihn in seiner Gre, Gestalt und Farbe mit seinem Verstande
aneignet.
Als individuelle Verkrperung des Widerstandes gegen
den verdinglichten Rationalismus und seine Exponenten, die Se-
kretre, als Trger von Leid und Opfer, als Handelnde dauernd in
echte oder irrige Schuld sich verstrickend, als Initiatoren von Ent-
scheidung und Verantwortung, stellen die kritischen Individuen
tragische Figuren in der Weise dar, da der moderne Autor nur zu-
greifen mu, um Stoff fr seine Tragdien zu finden.
Die moderne Tragdie wartet noch immer auf ihren groen Dichter.
Trotz Bert Brecht, der in solchen Gestalten wie Galilei, Grusche,
Sehen Teh und Mutter Courage den gegen die objektiven Mchte
kmpfenden Helden genial vorausahnt, aber nur in einer romanti-
sierten, noch nicht zureichend modern-konkreten Form. Alle diese
Gestalten Brechts kennen das Problem der Bewutheit, der Verant-
wortung, der Entscheidung und der Schuld, sie alle sehen sich vor
die Frage der Katharsis gestellt. Aber sie sind noch nicht zureichend
moderne Gestalten, auf ihnen baut sich noch nicht die Tragdie des
Sptkapitalismus auf. Dieser Mangel pflegt den gngigen Irrtum zu
116
bestrken: Weil es solche Tragdien noch nicht gibt, ziehen Dr-
renmatt und Hans Mayer die Konsequenz, da es sie nicht geben
kann.
I
m Gegenteil, noch niemals zuvor ist dem humanistischen Kampf
gegen die klassengesellschaftliche Misere und damit dem tragischen
Konflikt zwischen I ndividuum und Gesellschaft, zwischen dem sich
nicht beugenden Heros und den menschenfeindlichen Umstnden
eine so groe Mglichkeit des breiten Sichauswirkens geboten wor-
den als in einer Epoche, in der das humanistische Pathos dieses
Kampfes sich nicht blo wie in den alten Tragdien auf den engen
Raum individueller Konflikte und Aktionen (wenn auch auf gesell-
schaftlichem Hintergrunde) beschrnken, sondern jene Breite ge-
winnen kann, die sich durch den Kampf gegen die Totalitt verding-
lichter Zustnde von selbst ergibt.
13.
Die pseudoreligise Ideologie
Die ideologische Entgegensetzung zu den verdinglichten Zustnden
ist nicht immer eine humanistische. I m vielschichtigen Bereich der
ideologischen Ausprgung des sptkapitalistischen Bewutseins ent-
stehen verschiedene Formen der versuchten Flucht aus den Zwngen
des verdinglichten Lebens, die auf eine Scheinflucht hinauslaufen.
Beispielgebend dafr sind die pseudoreligisen Strmungen, die die-
ses Bewutsein zumeist hin[t]ergrndig unterlaufen. Um dieses Ph-
nomen auf der Grundlage der marxistischen I deologienlehre unmi-
verstndlich darstellen zu knnen, ist eine vorgngige Klrung des
Begriffs der Religion, wie ihn Marx versteht, unumgnglich.
Eines der berhmtesten Schlagwrter lautet: Religion ist das
Opium fr das Volk. Es ist nicht genau bekannt, wann es entstan-
den ist. Jedenfalls hat es seine entschiedenste Wirkung ausgebt im
revolutionren Kampf des aufsteigenden Brgertums des 18. Jahr-
hunderts, als sich dieses darauf vorbereitete, seine groe Schlacht
gegen die feudalen Mchte und gegen die mit ihnen verbndete Kir-
che zu schlagen. I ndem die fhrenden brgerlichen Philosophen vor
der Franzsischen Revolution alles gesellschaftliche Denken entwe-
der aus den klimatischen Bedingungen oder aus dem egoistischen I n-
teresse ableiteten, konnten sie aus dieser naiv-materialistischen Posi-
11 7
tion heraus die Religion nicht anders erklren denn als ein knstli-
ches Produkt der in staatlicher und kirchlicher Gestalt das Volk un-
terdrckenden und bewut irreleitenden Mchte. Daher die Formu-
lierung: Opium, d.h. Gift, fr das unterdrckte Volk.
Da Marx und Engels einen weitaus subtileren Materialismus vertra-
ten als ihre brgerlichen Vorgnger und sie deshalb das uralte Ph-
nomen der Religion viel feinsinniger deuteten, wrde allein schon
durch die Tatsache zureichend belegt sein, da sie die Fortsetzer des
alten Materialismus im 19. Jahrhundert, nmlich Moleschott, Bch-
ner und Vogt, hhnisch als die naturwissenschaftlichen Reisepre-
diger des Materialismus (Engels) abtaten. Es macht deshalb einen
wesentlichen Unterschied aus, da der Marxsche Ausspruch aus der
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie an die Stelle des Opium
fr das Volk ausdrcklich den, einen anderen Sinn implizieren-
den, Satz setzt: Die Religion ist das Opium d e s Volks. Aus dem
Zusammenhang, in dem dieser Satz steht, lt sich noch deutlicher
erkennen, da Marx der Religion eine aus dem gesellschaftlichen
Sein selbst und keineswegs aus der subjektiven Absicht irgendwel-
cher bsen Mchte erflieende ideologische, d.h. seinsreflektierende
Bedeutung zumit. Marx sagt: Die Religion ist der Seufzer der be-
drngten Kreatur... der Geist geistloser Zustnde... sie ist das
Opium des Volks.
Stammt Marx aus einer jdischen Priesterfamilie und war Engels in
seiner Jugend noch selbst einer tiefen pietistischen Religiositt ver-
haftet, so waren sie der religisen Erlebniswelt zu nahe gewesen, um
sie in der Weise der alten brgerlichen Materialisten abzutun. Dazu
kommt, da ihre differenzierte geschichtsphilosophische Konzep-
tion bei ausnahmslos allen gedanklichen Strmungen, erst recht sol-
chen von weltgeschichtlicher Bedeutung, kategorisch nach den ver-
borgenen objektiven Wurzeln ihres Zustandekommens fragt. Eine
subjektivistische Erklrung der Religion bleibt mit den theoreti-
schen Ansprchen des historischen Materialismus unvereinbar. Der
vergesellschaftete und objektiven Gewalten - in der Urzeit der Na-
tur, in der Klassengesellschaft den herrschenden Mchten -ausgelie-ferte Mensch sucht, wie Marx deshalb weiter sagt, in der Religion
das Gemt einer herzlosen Welt, den Geist geistloser Zustnde.
Er sucht also etwas hinter dieser Welt, er sucht das Verborgen-H-
here, an dem sich sein leidendes und protestierendes Gemt em-
porranken kann; an ihm rankt sich, wie Marx bemerkt, der dem irdi-
schen Elend widerstrebende Enthusiasmus7 3
empor. Deshalb
kann Marx geistvoll bemerken, da, weil in der entfremdeten Welt
das menschliche Wesen keine Wirklichkeit besitzt, die Religion
die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens ist.
118
Zwar stellt sie, sagt Marx weiter, ein verkehrtes Weltbewutsein
dar, aber in dieser Gestalt ist sie gleichzeitig die allgemeine Theorie
dieser
Welt, ihr enzyklopdisches Kompendium, ihre Logik in po-
pulrer Form. Ihrer nichtpopulren Form, der Theologie, mitraut
Marx um so mehr und nennt sie die faule Ecke der Philosophie
.
74
Im Gegensatz zur Religion ist die Theologie nicht volkshaft, son-
dern akkommodiert sich in ihrer hauptschlichsten Tendenz den
herrschenden Mchten. Der bedeutende katholische Gelehrte Au-
gust Knoll hat in einer aufsehenerregenden Schrift im einzelnen
nachgewiesen, wie sehr sich die Theologie in den letzten anderthalb
Jahrtausenden den herrschenden Mchten unterworfen hat .7 5
Auch die Theologie hockt, sagt Marx, ebensowenig wie der
Mensch auerhalb der Welt. 7 6
Keine Kritik, auch nicht die im
Dienste ihrer eigenen Katharsis vollzogene Selbstkritik der Theolo-
gie ist vollziehbar ohne die Kritik der Erde, des Rechts und der
Politik. Die Kritik der Theologie, sagt Marx, ist die Kritik der
Politik.
7 7
Was Marx, der den Weg fr das Verstndnis des Religisen fr das
kritische Bewutsein frei gemacht hat, nicht voraussehen konnte,
das ist, da der entgeistigte und vermaterialisierte Mensch der spt-
brgerlichen Epoche sich selbst der oben aufgezeigten urwchsigen
Fhigkeit entschlgt, seinem bedrckten Herzen in einem Seufzer
seiner religisen Phantasie Ausdruck zu verleihen. An die Stelle der
ber die religis-phantastische Kritik an der Welt gehende Ver-
shnung mit dieser tritt die profane Vershnung, die keiner kriti-
schen Brcke mehr bedrftige. Die gelegentlich noch vollen Kir-
chen sind mit Unglubigen gefllt; die meisten bleiben drauen.
Marx hat zwar das religise Bewutsein als das Ergebnis des profa-
nen Elends nachgewiesen, aber ein anderes Ergebnis dieses selben
Elends, nmlich das sich immer weiter ausbreitende areligise Be-
wutsein, erklrbar aus der sich ausbreitenden Gleichgltigkeit und
Aversion gegen alles Geistige, bersehen. Der Marxsche Seufzer
der bedrngten Kreatur ist abgeflacht zum Nichts der totalen
Geistlosigkeit, unter deren alleszermalmendem Gleichschritt auch
die Religion begraben wird.
Das religise Bewutsein beginnt also nicht erst, wie Marx erwartet
hat, mit der klassenlosen Gesellschaft abzusterben, wenn auch aus
genau entgegengesetzten Grnden. Der den modernen humanisti-
schen Ideen mit groem Verstndnis begegnende Dominikaner
Marcel Reding weist in kritischer Absicht darauf hin, da Marx in
der Religion eine Angelegenheit des Volkes im Gegensatz zu den
Gebildeten gesehen hat .
7 8 Wre es fr einen Zeitgenossen des 20.
Jahrhunderts nicht interessant zu untersuchen, warum die Religion
1 1 9
faktisch und vor unseren Augen allmhlich aufhrt, eine Angele-
genheit des Volkes zu sein? Die naturwissenschaftlich-technische
Entwicklung, auf die man sich gerne beruft, hat in den frheren
Jahrzehnten nur zum geringsten das Volksbewutsein zu entmytho-
logisieren vermocht und ist in ihrer Wirkung weit hinter der allge-
meinen Gewalt der kapitalistischen Entgeistigung zurckgeblieben.
Nichtsdestoweniger wre es nicht ganz richtig, einem einfachen
Verschwinden der religisen Vorstellungen zuzustimmen. Richtiger
ist es, von einer Verdrngung des Religisen zugunsten primitiver,
das bedeutet im Niveau unter ihm stehender pseudo- und vorreligi-
ser - magischer - Formen zu sprechen. In erster Linie und ohne an
diesem Orte die gesamte, noch nicht untersuchte, Erscheinungs-
weise ausschpfen zu knnen, sind es die folgenden: die in einem er-
staunlichen Ausma sich ausbreitende Astrologie (in den USA ist
das anfngliche Dutzend der Bltter, die eine astrologische Spalte
fhren, im Laufe der letzten Jahre auf einige hundert angestiegen);
der, weil mit dem rationalen Alltagsdenken des naturwissenschaft-
lich aufgeklrten Menschen unvereinbare, verschmt in den subjek-
tiven Bereich zurckgenommene Aberglaube; der miverstandene
Zen-Buddhismus und verschiedene indische Ritual- und Konzen-
trationsriten; der mit magisch-religiser Kraft ausgestattete Umgang
mit Rauschgiften; die mit ebensolchem magischen Vertrauen ge-
handhabten Glcksspiele (Lotto, Toto usw.); neuerdings kommt
hinzu die Jesusbewegung Jugendlicher, die die frher Ekstasen und
Trancezustnde hervorrufenden Beatveranstaltungen abzulsen
scheint.
Solche soziologisch nur schwer fabaren pseudoreligisen und ins
Magische zurckfallenden Strmungen breiten sich im gleichen
Mae aus, wie das echte religise Bewutsein abnimmt. Der von
Marx mit der Religion gleichgesetzte Seufzer der bedrngten Krea-
tur macht unter dem Druck der allgemeinen Entgeistigung einer
magisch-primitiven Ideologie, mit der der Alltagsmensch auf die re-
pressiven Verhltnisse reagiert, Platz. Der Rckfall ins Magische
entspricht der Reflexion des verdinglichten Prozesses, wie wir ihn
oben eingehend analysiert haben, als eines bermenschlich-schick-
salhaften.
Was die oberen Klassen der modernen Gesellschaft betrifft, ist ih-
nen, wie dies bereits Max Weber bemerkt hat, das Religise im ei-
gentlichen Sinne fremd . 79 Aber die ihnen ideologisch zugeordneten
Intellektuellen, die ihre subjektiv kritische Aufmerksamkeit dem
Ganzen des Seins schenken und sich nicht blo mit praktischen
Rechtfertigungsnormen begngen, leiden unter der Entwertung ei-
ner gottlos gewordenen Welt, deren Wert- und Sinnfreundlich-
120
keit sie nicht als das Resultat brgerlicher Herrschaftsverhltnisse
durchschauen. Sie suchen nach einem neuen Halt. Ist auch fr ihr
Verstndnis die Entwertung des Geschichtlichen vollzogen durch
den Einbruch mythisch-verdinglichter Gewalten - die sie unter-
schiedlich beschreiben und definieren -, so erkennen sie das zu set-
zende Ziel nicht in deren Auflsung, sondern im Sichzurckziehen
auf das Personale, das subjektive Ich und seine ihm angeblich au-
tonom und unvermittelt zur Auenwelt innewohnende Kraft der
Gewinnung von Freiheit und der Lsung der Widersprche.
Sonst dem Religisen berwiegend mit Skepsis und Distanz begeg-
nend, ahnt diese Intelligenz und die von ihr beeinflute dekadente
Oberschicht gar nicht, da der subjektivistische Personal-Mythus
einen, wenn auch vom brigen Religisen deutlich unterschiedenen,
Rckfall in das Religise darstellt. Da aber gleichzeitig der ethische
Bezug zu einem hheren Wesen fehlt, weil an die Stelle Gottes das
eigene Ich als allmchtige personale Einheit getreten ist, entsteht
faktisch auch hier eine Art Pseudoreligion mit einem gleichfalls ma-
gischen Anflug. Zwar sind bei dieser Elite die magischen Tendenzen
nicht wie bei der Masse der abhngigen Schichten aus der allgemei-
nen Entgeistigung erflossen, sondern umgekehrt aus dem Bemhen
um eine Rettung des Geistes im Dienste der Selbstrettung des von
der Auenwelt bedrohten personalen Ich. Im Hintergrunde steht
jedoch dieselbe nihilistische Dekadenz der hochbrgerlichen Gesell-
schaft, dieselbe Geistfeindlichkeit der objektiven Realitt, der sich
das elitre Ich zu entziehen versucht. Wilhelm Emrich, einer der be-
rufenen Ideologen des dekadenten elitren Bewutseins, bietet fr
diese Haltung eine uerst treffende Formulierung: 80
Eine Bewutseinsstufe also ist zu gewinnen, in der der Mensch >seiner
selbst bewut< geworden ist, d. h. die dualistische Spaltung zwischen Empirie
und >Ding an sich< in seiner >Person< aufgehoben hat. Der Widerstreit zwi-
schen den Direktiven, die aus dem auerempirischen, absoluten Reich der
>Freiheit<
i
n Gestalt des (subjektivistischen, L.K.) kategorischen Imperativs
dem Menschen zukommen, und den empirischen Bedingungen und Not-
wendigkeiten, in die der Mensch als physisches und geschichtliches Wesen
zwangslufig gestellt ist, ist berwindbar durch ein personales Bewutsein,
das die Gegenstze als ihm eigene... begreift und damit die Widersprche
durch sich selbst als berlegene Bewutseinsinstanz zu durchschauen und zu
berwinden vermag.
Mnchhausen zieht sich selbst aus dem Sumpf. Der neue Gott ist
die berlegene Bewutseinsinstanz des Ich, der Person. Die be-
schwrende Magie bemchtigt sich der eigenen Person als der Zu-
stndlichkeit, in der angeblich das geheime Einverstndnis, die ge-
heime Identitt von Irrationalismus und Rationalismus durch-
12 1
schaut und berwunden wird, wie Emrich formuliert. Wobei nur
ein neuer extremer Irrationalismus von zudem pseudoreligiser Re-
levanz zustande kommt.
Es ist noch nicht lange her und gilt auch gegenwrtig noch, da die
pseudoreligise Hoffnung profanere Wege beschritt: Sie fliet aus
der Droge, aus LSD und dem Haschisch, nicht selten aus Schlimme-
rem. Es ist kein Zufall, da Anthroposophie, Zen-Buddhismus,
Konzentrationsbungen und verwandte magische Strmungen eine
groe Ausbreitung in der westlichen Welt gefunden haben. Schon
1954 beschrieb Aldous Huxley in seinem Buch Pforten der Wahr-
nehmung enthusiastisch seine Erfahrungen mit Meskalin und ande-
ren Halluzinogenen. Unvergessen ist der Harward-Psychologe Pro-
fessor Leary, der zwei Kolonien des Transzendentalen Lebens
und eine Internationale Vereinigung fr innere Freiheit auf der
Grundlage des Gebrauchs von Rauschgift grndete. Der amerikani-
sche Religionsprofessor Clark unternahm Versuche mit Theologie-
studenten, in denen sie mittels des LSD nher zu Gott gebracht
werden sollten.81
Die bedrngte Kreatur der unteren Klassen meidet in hoffnungs-
loser Resignation den religisen Geist geistloser Zustnde (Marx)
ebenso, wie sich die scheinoppositionelle, weil nur in eine Opposi-
tion gegen die Oberflche der brgerlichen Gesellschaft gedrngte
Schicht der brgerlichen Ideologen in einen pseudoreligisen per-
sonalen Atheismus flchtet.
14. Kriminalitt als Ideologie
Spricht Emrich von den Bedingungen und Notwendigkeiten, in die
der Mensch als physisches und geschichtliches Wesen zwangslufig
gestellt ist (s. Zitat S. 121), so sind sie implizit als negative begriffen,
denen ein ebenso negativer Mensch etwa im Sinne des Heidegger-
schen Man entspricht. Das nihilistische Weltbild, das der Epoche
der brgerlichen Dekadenz zugeordnet ist, ist automatisch mitge-
dacht. Neuerdings und unter dem Einflu der Ethologie wird dieser
Mensch mit Vorliebe durch die Aggressionsneigung definiert. Ein
neues biologistisches, und das heit vulgr-materialistisches Men-
schenbild ist entstanden, eine Ideologie, die den bisher von uns be-
schriebenen und in sich verzweigten ideologischen Strom fortfhrt.
In diesem Zusammenhang konstituiert sich eine schlechte Dialektik
122
von Anthropologie und Gesellschaftstheorie auf der Grundlage ei-
ner nihilistischen Verzerrung beider. Wenn Kriminalitt, Alkoho-
lis mus, Rauschgiftsucht, in Verbindung mit zunehmender Primiti-
visierung des Geistes- und des Empfindungslebens so offenbar wer-
den, da sie nicht mehr abgeleugnet werden knnen, so wird dieser
Sachverhalt nicht mehr retuschiert, sondern offen zugegeben, aber
auf eine Weise, da z. B. der Wohlstand es sei, der es dem von Natur
aggressiven Menschen leicht mache, sich gehen zu lassen. So vertritt
Erwin K. Scheuch ganz im Sinne dieser Ideologie die These, da in
einer Wohlstandsgesellschaft die Hemmungen abnehmen
. 8 2
Aber
schon Hegel hat gewut, da nicht die Kartoffel, sondern der Pflug
den Menschen bestimmt, womit die Unfhigkeit der Empfindung
und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der Vor-
teile
der brgerlichen Gesellschaft zusammenhngt
.
8 3 Woraus
wiederum faktische Aggression erfliet. Marx bemerkt, da mit Ab-
straktionen keine wirkliche geschichtliche Produktionsstufe be-
griffen ist.
8 4
Bereits zu einem frheren Zeitpunkt geht Marx direkt
auf die anthropologische Frage nach dem Verhltnis von Begier-
den zu den materiellen Umstnden ein und kommt zu dem Re-
sultat, da diese Begierden nur der Form nach verndert werden,
was so viel heit, da ihre inhaltliche Auswirkung in historischen
Umstnden ihre Wurzel hat. Erscheint auch die Aggression als eine
an die ihrer Natur nach aggressiv-anarchisch geprgten Primrtriebe
gebunden, also als eine Art Sekundrtrieb, 8 5 so ist nicht zu verheh-
len, da es ausschlielich entfremdete gesellschaftliche Situationen,
in unserem Falle die des entwickelten Kapitalismus, sein knnen, die
das Individuum zu Aktionen der Artikulation dieses Aggressions-
triebs in der Richtung der Kriminalitt usw. treiben.
Der angebliche Wohlstand, der seiner Eigenart nach dazu be-
stimmt ist, den Menschen durch Befreiung von Not und Sorge und
durch Gewhrung von Freiheit und Mue der gegen Not und Sorge,
Unfreiheit und Stre aufbegehrenden Aggression Widerstand zu lei-
sten, kann es also nicht sein, der ihn in die Renitenz drngt. Nur im
Zustand der kapitalistischen Entfremdung kann relativer, d.h. im
Vergleich zu frher von permanenter Not befreiender Wohlstand
den Anla bilden, da die bestehenden Herrschaftsverhltnisse sich
reproduzieren und ihrerseits die Bedingung abgeben fr die Auf-
rechterhaltung und Verschrfung gngiger Entfremdung. Unter die-
sen Umstnden mu, welche schrittweisen Konzessionen die br-
gerliche Gesellschaft im Verlaufe der konomischen Entwicklung
zwecks Sicherung ihrer Ordnung auch zu machen gewillt ist, selbst
eine bescheidene Zunahme des Wohlstandes sich gegen den Men-
schen wenden. Unter diesen Umstnden werden Verdinglichung,
12 3
Vermaterialisierung und Entfremdung zum ausweglosen Kerker der
Verkehrung aller konomischen und geistigen Fortschritte in ihr
Gegenteil, werden die neugewonnenen Mittel der Bereicherung des
Lebens zu Anlssen gesteigerter Aggression gegen den Mitmenschen
und gegen sich selbst. Darin liegt der Grund der sogenannten
Wohlstandskriminalitt, die einerseits kapitalistische
Realitt
ist, andererseits Ideologie, denn nicht der Wohlstand ist es, der die
zahlreichen Akte der Aggressionen hervorruft, sondern die beste-
hende Klassengesellschaft.
Und je perfekter die kapitalistische
Klassengesellschaft sich gestaltet, desto widerspruchsvoller gestaltet
sich das Leben der Massen.
Der perfekte Kapitalismus erscheint keineswegs als ein krisen-
freier und auch nicht als einer, der die Armut berwunden hat -
selbst in den USA leben zwei Fnftel der Bevlkerung in der Nhe
des Existenzminimums -, sondern als einer, der ber gewaltige ko-
nomische Krfte verfgt, demonstrierbar etwa an den USA, der
Schweiz und Schweden. Die zwischen ihnen und gesellschaftlich
verwandten Lndern wechselnden Weltrekorde an Ehescheidungen,
Selbstmorden,
Geisteskranken und psychisch Erkrankten (in
Deutschland sieben Millionen), Rauschgiftschtigen, Kriminellen
erscheinen angesichts des Wohlstandes rtselhaft und verleiten
dienstfertige Ideologen zu dem Kurzschlu, da dieser Wohl-
stand an allem schuld sei. Fr gewhnlich wird dieser zum Snden-
bock erhobene Wohlstand zustzlich in Verbindung gebracht mit
objektivistisch verallgemeinernden, das bedeutet von dem fakti-
schen gesellschaftlichen Proze abstrahierenden Begriffen wie sol-
chen der Vermassung und Technisierung (vgl. oben) unter
letztlicher Zugrundelegung eines anthropologisch negativen, zu-
meist biologistischen Menschenbildes. Da hier Vermassung und
Herrschaft der Technik als eine Art Naturkatastrophe interpre-
tiert werden, erscheint diese ohne Schuld der bestehenden Klassen-
ordnung ber die Menschen hereingebrochen.
Jedoch decken sich Verstdterung und Vermassung nicht einmal be-
grifflich. Zunchst ist nicht zu bersehen, da sich die im Gefolge
der konomischen Entwicklung einstellende Verstdterung keines-
wegs ausschlielich zuungunsten des Menschen ausgewirkt hat. Sie
hat ihn nach einem Worte von Marx dem Idiotismus des Landle-
bens entrissen. Obgleich autoritr berspannt und das Individuum
zu einem passiven Objekt einer gewaltigen verdinglichten Maschine
degradierend, zeigen sich die Fortschritte ber den mittelalterlichen
Romantizismus hinaus, ohne die ein modernes Leben undenkbar ist.
Als einer der bedeutendsten Kritiker des Kapitalismus hat Lenin die
berwindung
des irrationalistischen Schlendrians frherer Epochen
124
gepriesen. Trotz ihres weitreichenden Mibrauchs haben Presse und
anderer Lesestoff, Film und Rundfunk zur Erweiterung des Hori-
zonts wenigstens eines Teiles der Bevlkerung beigetragen. Schule,
Versammlungs- und Bildungswesen haben trotz ihrer berwiegen-
den Integration in den repressiven Ordnungsvollzug eine bedeu-
tende Wirkung auf die Bewutseinsformung des modernen Men-
schen gehabt und eine kritische progressive Elite ermglicht, die in
diesem Ausma in allen vorangehenden Epochen ausgeschlossen
gewesen wre. Ein Mozartkonzert, das ber das Fernsehen eine Mil-
lion Menschen erreicht, ist ein massenhaftes Ereignis und trotz-
dem das Gegenteil von Vermassung.
Die brgerlich-revolutionren Materialisten des 18. Jahrhunderts
ergaben sich der Erwartung, da der vom feudalen Joch zum auto-
nomen Individuum befreite Mensch in Anstrengung seiner Krfte zu
Eigentum, durch Eigentum zu Mue und durch Mue zur allseitigen
Entfaltung seiner Persnlichkeit gelangen werde. Die Rechnung
ging nicht auf, weil wegen der noch nicht zureichend entwickelten
Produktivkrfte die Frage nicht beantwortet war, wer fr die mi-
gen Eigentmer, die doch alle umfassen sollten, weiterproduzieren
soll. Es kam anders. Unter der fr die kapitalistische Gesellschaft
geltenden Voraussetzung der allgemeinen Konkurrenz, d. h. des
egoistischen Prinzips des Kampfes aller gegen alle im Dienste der
stets gefhrdeten materiellen Sicherheit, erwirkte die Bereitschaft,
auf Mue zugunsten der Arbeit zu verzichten oder diese zum Her-
ren ber jene zu machen, da an die Stelle der erwarteten allseitigen
Entfaltung der Persnlichkeit ihre Degradation zum einseitigen
Formular, wie Schiller sagt, trat. Die egoistisch-individualistische
Form der Beziehung der Individuen untereinander bildet die pri-
mre Bedingung fr die Entindividualisierung dieser Individuen,
oder, was dasselbe bedeutet, der Vermassung.
Als der Vermassung unterworfenes Individuum des freien Ge-
brauchs der eigenen libidinsen wie der ttigen Krfte nicht fhig,
strebt das heutige Individuum nach Befriedigung von angebotenen
falschen Bedrfnissen, nach Surrogaten, die es immer tiefer in den
Widerspruch von Anstrengung im Erwerb materieller Gter und
Unfhigkeit, sie spielend-libidins zu gebrauchen, strzen. Die
Konsequenz ist, wie die moderne Frustrationstheorie wei, der
Ausbruch in vielerlei Formen der Entlastung und des Widerstandes,
die sich dem Begriff der Aggression subsumieren lassen. Der Wohl-
stand hindert den Menschen nicht daran, zu spielen und sich li-
bidins zu verwirklichen. Er frdert die Aggression nur, weil er un-
ter den herrschenden Bedingungen der Repression die Mittel bereit-
stellt, entweder durch Aggression sich Freiheit zu verschaffen
12 5
oder mittels ihrer diese Mittel zu vermehren. Die Kriminalitt,
gleich ob die berchtigte der weien Kragen oder der schmutzigen
Hnde, ist nur ein extremer Ausdruck davon.
15. Die Ideologie der progressiven Elite
Voll bewut ist sich in der heutigen Gesellschaft der herrschenden
Problematik nur die progressive Elite. Sie ist gleichzeitig als die hu-
manistische zu definieren. Versucht man sie soziologisch zu fassen,
so fllt auf, da sie als fest umrissene oder gar organisierte Gruppe
gar nicht existiert. Sie setzt sich vielmehr aus allerlei Elementen zu-
sammen, die einander nicht selten in Anschauung, Zielsetzung und
Habitus entgegengesetzt sind. Zu ihren wesentlichsten Merkmalen
gehren berall da, wo keine mchtige Partei ihr den Rcken strkt
(Deutschland, USA), die Widersprchlichkeit und Unbestndig-
keit. Stets zwischen Optimismus und Verzweiflung hin und her
schwankend, sitzt sie zwischen allen Sthlen und ist scheinbar ohne
realen Einflu. Und doch ist sie da und nicht ohne Bedeutung. Ja, sie
existiert sprbar, denn sie wird von Zeit zu Zeit gefrchtet, unter
Druck gehalten, wenn notwendig verfolgt.
Die humanistische Elite der Epoche der brgerlichen Dekadenz ist
in Deutschland das Ergebnis zweier historischer Komponenten: der
Zersetzung des einst angesehenen und eindrucksvollen Volkstri-
bunentums der sozialistischen und gewerkschaftlichen Bewegung
einerseits und des Weiterwirkens eines in der Asche der Dekadenz
und des Nihilismus glimmenden Antinihilismus und Humanismus
anderseits.
berall finden sich in einer geringeren oder greren
Zahl selbstndig denkende Individuen, die sich weder mit dem Geist
der nihilistischen Verneinung noch des hochtrabenden, hohl-frei-
heitslsternen Subjektivismus abfinden knnen, so da die Front
zwischen Humanismus und Antihumanismus oft mitten durch die
sozialen, weltanschaulichen und sogar politischen Fronten hindurch
geht. Die Geschichte pflegt in ihrer Gesamtheit klger zu sein als ihr
individueller Exponent. Wo die revolutionren Krfte versagen,
schafft sie sich einen Ersatz. In Deutschland ist die humanistische
Elite dieser Ersatz. Ihre Vertreter finden sich, zumeist sich furcht-
sam tarnend, selten alles in die Waagschale werfend, in allen Institu-
126
tionen, in den Gemeinderten, schulen, Bildungsanstalten, Univer-
sitten, religisen Organisationen und in den politischen Verbn-
den, vor allem in den Reihen der Knstler, Schriftsteller und Wis-
senschaftler.
Die Widersprchlichkeit im Verhalten der progressiven Elite erklrt
sich aus der Tatsache der individuellen Isoliertheit, der sich die ein-
zelnen Eliteindividuen mehr oder weniger ausgeliefert sehen, und
aus dem sich daraus ergebenden Gefhl der Schutzlosigkeit. Sie
pflegt daher konsequent in ihrer inneren, aber ebenso inkonsequent
in ihrer ueren Haltung zu sein. Ihre Strke liegt, wie dies noch fr
die alte humanistische Elite des klassischen Sozialismus zutraf und
heute noch in den Lndern mit starken sozialistischen Bewegungen
und ihre politische wie intellektuelle Elite zutrifft, in ihrer unbe-
stechlichen Sehnsucht nach Herstellung wahrhaft humanistischer
Verhltnisse. Von dieser Position aus entfaltet sie das kritische Ver-
mgen, die Zustnde der gesellschaftlichen Verdinglichung und
Entfremdung zu durchschauen und eine ideologische Position
gleichsam auerhalb der Gesellschaft einzunehmen, die infolge der
Befangenheit ihrer Opponenten in der verdinglichten Ideologie (wie
wir sie in dieser Schrift ausfhrlich analysiert haben) ebensooft mi-
deutet wie gefrchtet wird.
Aus dem weitlufigen Streit darber, was als Elite anzuerkennen sei,
heben wir das Votum von Prof. Ernst Steinbach hervor, der in einer
1956 in der Evangelischen Akademie in Bad Boll veranstalteten Ta-
gung sagte:
Elite ist zunchst einmal dadurch ausgezeichnet, da sie sich in Zucht hlt...
denn jede Elite ist asketisch. Zu dieser Elite gehrt weiterhin, da man sich in
jedem Augenblick der Gesamtheit verantwortlich wei, da man nicht vom
nchsten Tagesgesichtspunkt ausgeht, sondern eine Sache durchdenkt und
seine Entscheidungen verantwortlich trifft.
Diese Definition der Elite ist offensichtlich auf revolutionre und re-
ligise Eliten ausgerichtet, schliet aber z.B. die herrschende deka-
dente Elite, die auch eine, wenn auch negative ist, aus. Was uns je-
doch in diesem Zusammenhang interessieren mu, das ist der Hin-
weis Steinbachs auf das asketische Moment im Elitebewutsein. Be-
reitschaft zum Verzicht und Unbestechlichkeit kennzeichnen zwei-
fellos eine jede humanistische Elite. Aber der Genu widerspricht
ihr nicht grundstzlich. Sie mitraut jeder a-priori-Verherrlichung
der Askese, hinter der sich zumeist die repressive Absicht verbirgt.
Nicht Askese oder Genu an sich entscheiden ber das Wesen und
den Charakter der historisch neue Qualitten setzenden (und des-
halb die reaktionren und faschistischen Eliten ausschlieenden)
12 7
Elite, sondern ausschlielich die humanistische Perspektive. Erst
innerhalb dieser Perspektive - die sich aus der konkreten Ideologie
dieser Elite deduzieren lt - entscheidet sich je nach den realen hi-
storischen Umstnden das Ma von Genu und Askese. Disziplin
und Selbstbeschrnkung betrachtet die humanistische Elite als uner-
lliche Bedingung fr den Erfolg ihres Kampfes, aber sie scheut
sich nicht, den Genu zu kultivieren, wo dies im Dienste einer re-
pressionslosen Heranbildung des Menschen als notwendig und den
Umstnden gem als mglich erscheint. Sie ist asketisch aus prakti-
schen, jedoch genieerisch aus anthropologischen und weltanschau-
lichen Grnden.
Die progressive Elite ist die Bewahrerin des Wissens von der prim-
ren Bedeutung der groen und durchgngigen, die Totalitt des Le-
bens, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als unzerreibaren
Zusammenhang im Auge behaltenden Menschheitsprobleme. Elite
heit hier menschliches Hhersein nicht aus formalen (ethischen)
und auch nicht aus subjektivistisch-nihilistischen Grnden, sondern
aus inhaltlichen, die der Geschichte angehren. Daraus ergibt sich
der entscheidende Gegensatz zwischen der brgerlich-dekadenten
und derprogressiv-humanistischen Elite. Die wrdelose Bindung an
das Vorhandene treibt die dekadente Elite in die Mythologie der
subjektiven Phantasie: Dem drren praktisch-materialistischen Ra-
tionalismus entspricht ein vergorener und krnklicher Irrationalis-
mus. Anders die humanistische Elite. Ihre unbestechliche Sehnsucht
nach humanistischer Freiheit lst sie trotz ihres Interesses fr alle
Gegenwartsfragen von der verdinglichten Oberflche los und treibt
ihr Denken in die Zukunft hinaus, in die Utopie. Fr die utopischen
Konstruktionen gibt es an sich keine Begrenzung, weshalb der halt-
lose Utopismus ein ernstes Moment derBedrohung des progressiven
Elitebewutseins darstellt. Da aber anderseits das unnachgiebige In-
teresse am wirklichen Menschen und seinen wirklichen Lebensver-
hltnissen die realistische Sicht sicherstellt, entsteht gleichzeitig die
ihr angemessene entgegengesetzte Neigung, die aus der humanisti-
schen Sehnsucht geborenen utopischen Vorstellungen einer stetigen
rationalen berprfung zu unterziehen. So entwickelt sich die dia-
lektische Tendenz, einerseits die Neigung zum berspannten Uto-
pismus mittels eines rationalen Realismus zu berprfen - reale
Utopie - und andererseits den engstirnigen verdinglichten Prakti-
zismus mittels der utopischen Perspektive zu berwinden.
Aber dies ist nur die ideologische Haupttendenz im Denken der hu-
manistischen Elite. In der ideologischen Praxis verhlt es sich damit
differenzierter.
Da die humanistische Elite nicht als einheitliche
Kraft organisiert ist, keine feste politische Macht hinter sich hat und
128
aus diesem Grunde dem Bewutsein totaler Ohnmacht unterliegt-
zum Problem der Ohnmacht vgl. meinen Beitrag Jesus und die
Ohnmacht86-, reagiert sie auf die entfremdeten Probleme der Rea-
litt vielfach mit tiefster Verzweiflung und Resignation. Zwar hlt
sie unerschtterlich an ihrem humanistischen Ideal fest, aber unter
dem Eindruck der steigenden Aushhlung, Vermaterialisierung und
Bestialisierung des Menschen siegt innerhalb des Spannungsverhlt-
nisses von Realismus und Utopismus ebensooft der letztere wie der
erstere, es siegt ebensooft die utopisierende Trumerei ber den rea-
listischen Sinn wie umgekehrt. Die diese Schwankungen begleitende
Stimmung pflegt die der Verzweiflung zu sein. Ihrerseits bleibt diese
Verzweiflung nicht ohne jegliche Rckwirkung auf den grundstzli-
chen humanistischen Optimismus. Indem das Ideal, gehemmt durch
die Verzweiflung, sich nicht voll, nicht radikal ausleben kann, son-
dern nur in sehr ferner Zukunft und deshalb gebrochen verwirklich-
bar erscheint, erfhrt es eine eigenartige Ironisierung, nicht unhn-
lich der romantischen Ironie, jedoch zum Unterschied von dieser
getragen von der unerschtterlichen berzeugung der letztlichen
Verwirklichbarkeit dieses Ideals, ja von der berzeugung, da es
der eigentliche und nicht zu vernichtende Zweck der Weltgeschichte
ist.
Vornehmlich in Bett Brecht findet die humanistische Elite der Epo-
che der brgerlichen Dekadenz ihren knstlerischen Ideologen, des-
sen
Werk gerade dem Problem der ironischen Brechung des Ideals
weitgehend entgegenkommt. Brecht zeigt das Wegweisende des
humanistischen Ideals in der Form auf, da er es am vorhandenen,
zwar widerspruchsvollen, jedoch im Lichte einer optimistischen
Anthropologie begriffenen Menschen in seiner Berechtigung nach-
weist und sich bewahrheiten lt. Als Mittel hierzu whlt er die so-
genannte positive Volksgestalt, die den zentralen Punkt seines gro-
en Theaters bildet. Weil aber diese Gestalt nicht auerhalb, son-
dern innerhalb der Entfremdung steht, verkrpert sie das Ideal nicht
in voller Reinheit, sondern es scheint gleichsam nur durch diese Ge-
stalt hindurch, gibt sich gebrochen. Damit entsteht in der Brecht-
schen Kunst ein Problem der Ironie, das sich aber auch hier von der
romantischen grundstzlich durch seinen realistischen Charakter
unterscheidet, d.h. durch seinen als in der geschichtlichen Realitt
selbst wirksam erkannten Aspekt der Verwirklichbarkeit des Ideals
( i m Gegensatz zur romantischen Ironie, in der das Ideal als letztlich
nicht verwirklichbar zurckgenommen wird). In dieser Sicht ist
nicht nur das humanistische Ideal ironisch, sondern auch die aus der
Verzweiflung kommende Ironie humanistisch ( optimistisch) gebro-
chen.
12 9
Wenn auch in einer sthetisch zu Ende gedachten Form, so ent-
spricht diese Perspektive vollkommen dem spontanen Bewutsein
der progressiven Elite. Die Ironisierung des eigenen Ideals bedeutet
nichts weiter als das Begreifen des grundstzlich optimistisch ver-
standenen Menschen, wie er zugleich in der kapitalistischen Praxis
ist und sein mu, bei gleichzeitiger Bejahung dieses Ideals gegenber
dieser Praxis. Einerseits sind Brechts positive Volksgestalten positiv,
weil sie beweisen, da sie in einer Welt der menschlichen Verwor-
fenheit und Charakterlosigkeit sich ein mehr oder weniger hohes
Ma an Selbstndigkeit und Haltung bewahrt haben, da sie subjek-
tiv nichts weiter verkrpern als die letztlich unverwstlichen ur-
wchsigen Krfte des Menschen. Andererseits entsteht aus dem Wi-
derspruch zwischen Entfremdung und Urwchsigkeit eine ins Tra-
gische spielende dialektische Spannung, womit brigens auch das
Schuldproblem in der Brechtschen Kunst zusammenhngt. Diese
Widersprchlichkeit ist es vornehmlich, die das Ideal nirgends voll
zum Durchbruch kommen lt, nirgends Gestalten erlaubt, die es
rein verkrpern, die bewirkt, da das Heroische, Selbstlose, Erha-
bene und Wrdige nur in ironischer Verkleidung vor den Zuschauer
tritt.
Da aber gleichzeitig dieses Heroische, Selbstlose, Erhabene
und Wrdige ein Ideal ausdrckt, das der Realitt nicht blo unver-
mittelt und abstrakt entgegengesetzt wird (wie in der reaktionren
Romantik), nicht als eine blo gedankliche Ergnzung fr eine fr
ewig verworfene Wirklichkeit aufgefat wird, sondern umgekehrt
trotz aller Widersprchlichkeit, trotz aller Dsternis und Tragik aus
ihr herausdestilliert wird, kann es bei Brecht niemals zur Grundlage
einer abstrakten romantischen Verzweiflung werden, sondern es
verbleibt auf dem festen Boden des prinzipiellen humanistischen
Optimismus. Das was wir als den ironisch gebrochenen Optimis-
mus in der Denkweise der humanistischen Elite erkannt haben, er-
scheint auch als das wesentlichste Moment in der Kunst Brechts.
Wir haben im vorangehenden die progressive Elite von ihrer prak-
tisch-ideologischen Seite her betrachtet, indem wir die Frage stell-
ten,
wie sie sich verhlt, sofern sie der heutigen Welt praktisch zu
begegnen gentigt ist. Es gibt aber auch eine theoretische Haltung
dieser Elite; sie fllt wesentlich mit dem Bekenntnis zum Marxismus
zusammen - sofern nicht auch gewisse Variationen, z.B. ins Anar-
chistische oder Christliche auftreten.
Wir werden im folgenden eine
Skizze der Hauptzge der marxistisch-theoretischen Eliteideologie
zu geben haben.
Die brgerliche Wissenschaft hat den Marxismus durch Jahrzehnte
als nicht existierend betrachtet, sie hat ihn, von einzelnen Anspie-
lungen und (oft miverstndlichen wie z.B. bei Woltmann, der ihn
130
in die Nhe des Darwinismus bringt) verstreuten uerungen abge-
sehen, bergangen und verschwiegen. Das nderte sich mit dem
Auftreten des hervorragenden brgerlichen Rechtsgelehrten Rudolf
Stammler im Jahre 1896. Stammler, der mehrere Jahre zum Studium
des
Marxismus verwendet hatte, erkannte dessen gewaltigen ge-
danklichen Wert und schrieb ein umfangreiches Werk mit der Ab-
sicht, sein eigenes Denken gegen den historischen Materialismus zu
verteidigen. Die unerwartete Folge war, da er das Interesse fr den
Marxismus in der ffentlichkeit weckte und ihn universittsfhig
machte. Der Epoche des Totschweigens folgte die Epoche der Aus-
einandersetzung. Erwhnenswert ist in diesem Zusammenhang die
groangelegte Arbeit des Kantianers und Darwinisten Woltmann,
der aber nicht nur wie Stammler dem Marxismus einen greren In-
teressenkreis gewann, sondern auch tiefgehenden Miverstndnis-
sen, die bis zum heutigen Tage nachwirken, Vorschub leistete. In
den Reihen der bedeutendsten Gegner des Marxismus reichen sich
solche Namen wie der Philosoph Rickert, der Wirtschaftstheoreti-
ker Sombart, der Rechts- und Staatstheoretiker Kelsen, der Sozia-
list und sptere Faschist de Man, der Staatsmann Masyrk und an-
dere die Hand. Der Hauptsache nach geht es zunchst weniger um
die marxistische Nationalkonomie als um den Historischen Mate-
rialismus, durch den der selbstgefllige und als Herr der Geschichte
sich dnkende Geist, das unentbehrliche metaphysische Ergn-
zungsstck zu einer brutalmaterialistischen Praxis, sich aus seiner
Stellung verdrngt fhlt.
Das Merkwrdige ist nun, da trotz aller kritischen Abwehr der ge-
schichtsmaterialistische Standpunkt direkt in die brgerliche Wis-
senschaft einzudringen beginnt. Wenn z. B. Max Weber die vordem
als blasphemisch angesehene Frage nach dem Zusammenhang von
Protestantismus und Kapitalismus aufwirft, so ist das schon deutlich
marxistischer Einflu. Mag er in Beantwortung dieser Frage noch so
sehr die Prioritt des Geistes betonen, er ist schlielich doch gentigt
zuzugeben, da er den Einflu der wirtschaftlichen Entwicklung
auf das Schicksal der religisen Gedankenbildung fr sehr bedeu-
tend halte. War man einmal so weit gekommen, stie man berall in
der Geschichte auf das Phnomen der Klasse, den Grundbegriff je-
der marxistischen Geschichtsbetrachtung. Je ehrlicher und bedeu-
tender, und das hie je demokratischer und humanistischer ein br-
gerlicher Gelehrter innerhalb der ihm auferlegten Schranken gesinnt
war, in um so strkerem Mae verfiel er der materialistischen Be-
trachtungsweise. Dafr haben wir ein glnzendes Beispiel in Ernst
Troeltsch, dessen Inbezugsetzung von Sozial- und Kulturgeschichte
einerseits und Geistesgeschichte andererseits sich als stark ge-
13 1
schichtsmaterialistisch durchtrnkt zu erkennen gibt. Selbst Som-
hart unterlag dem von ihm bekmpften Denksystem ebenso wie
etwa Lujo Brentano, dessen Geschichte der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Englands die zahlreichen historisch-materialistischen
Deutungen offenbart.
Wie war es nun mglich, da die bedeutende brgerliche Wissen-
schaft gleichzeitig dem historischen Materialismus Konzessionen
machte und ihn als Methode ablehnte? Daran war die irrtmliche
und durch eine ausgedehnte Literatur gesttzte Meinung schuld, der
Marxismus miachte mit seinem mechanischen konomismus
die wahre Rolle des Individuums in der Geschichte; der in gleicher
Weise miverstandene marxistische Gesetzesbegriff tat hierbei das
seinige. Aber bei Marx sieht die Sache vllig anders aus. In Anknp-
fung an den genialen, aber fast vergessenen Geschichtsphilosophen
Giambattista Vico aus dem frhen 18. Jahrhundert betont Marx
ausdrcklich, da sich die Menschheitsgeschichte grundstzlich von
der Naturgeschichte dadurch unterscheidet, da wir, die Men-
schen, die eine gemacht, die andere nicht gemacht haben. In den
Thesen ber Feuerbach, in denen sich Marx ausdrcklich gegen den
alten mechanischen Materialismus abgrenzt, erhebt er gegen die-
sen den Vorwurf, da er den Menschen nur als Objekt, nicht auch als
Subjekt betrachtet, d.h. das Moment der Ttigkeit auer acht lt.
In welcher Weise es Marx selbst gelingt, Subjekt und Objekt als Ein-
heit zu fassen, ist an anderer Stelle dargelegt. 87 Bereits in den Frh-
schriften heit es: Der Mensch macht seine Lebensttigkeit selbst
zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewutseins. Er hat be-
wute Lebensttigkeit. Oder: Anders der Mensch... Er tritt der
Natur als denkendes und denkend erkennendes Wesen gegenber.
Diese spezifisch menschliche, bewute, vom Geiste, von Ideen ge-
leitete Ttigkeit macht den Menschen zum Gattungswesen, sie ist
das Wesen des Menschen. Engels schreibt im Ludwig Feuerbach:
In der Geschichte der Gesellschaft sind die Handelnden lauter mit
Bewutsein begabte, mit berlegung oder Leidenschaft handelnde,
auf bestimmte Zwecke hinarbeitende Menschen; nichts geschieht
ohne bewute Absicht, ohne gewolltes Ziel.
Da dieser Standpunkt mit einem konsequenten geschichtsphiloso-
phischen Materialismus vereinbar ist, werden wir noch sehen. Be-
reits in der Vorgeschichte des modernen Materialismus zeigen sich
Tendenzen zur Auflsung der rein naturmechanischen Position,
was allerdings nach der anderen Seite in gewisse Inkonsequenzen
ausmndete. In der Erkenntnistheorie Quesnays zum Beispiel, der
als einer der bedeutendsten materialistischen Sozialtheoretiker des
18. Jahrhunderts anzusehen ist, spielt Gott noch eine erhebliche
132
Rolle. Turgot, der dem naturwissenschaftlichen Denken zugeneigt
ist und der als Physiokrat wie als Politiker zu den fortschrittlichsten
Mnnern derselben Zeit gehrt, kann sagen: Ich bin kein Enzyklo-
pdist, denn ich glaube an Gott. Der Materialismus ist einem New-
ton, der beim Aussprechen des Namens Gottes jedesmal den Hut
lftete, geradeso zu Dank verpflichtet wie einem Diderot oder La-
mettrie. Nicht selten schrnken Furcht und Konzessionen das Be-
kenntnis zum Materialismus erheblich ein. Bacon z.B., stellt Fueter
fest, schlo bekanntlich halb aus Respekt, halb aus ngstlichkeit
und Furcht vor den letzten Konsequenzen die Religion von seiner
philosophischen Reform aus. Komplizierter verhlt es sich damit
bei Descartes, dessen durch und durch mathematisch-naturwissen-
schaftlich angelegtes Denken mit einer Erkenntnistheorie einher-
geht, in der Gott noch eine Rolle spielt. Aber ebenso steht fest, da
Descartes, vom Schicksal Galileis gewarnt, sich in Holland vor der
Welt versteckt hielt und seine Bcher unter falschem Namen heraus-
gab, wie er sich berhaupt gedrngt sah, seine Werke nicht durch
eine allzu starre rationalistische Haltung zu gefhrden.
Was die Sozialtheorie betrifft, verwickelten sich die Materialisten
des 18. Jahrhunderts in den Widerspruch, neben der strengen kausa-
len Begrndung des historischen Prozesses durch Geographie und
Klima dem Reich geistiger Freiheit eine besondere Sparte zuzuge-
stehen. Am weitesten in der Entwicklung einer einheitlichen Sein-
Denken-Theorie kamen noch Montesquieu und Voltaire, die aller-
dings darin noch von Helvetius bertroffen wurden, dem einzigen,
der bereits die Ursachen fr die Bewegung der Gesellschaft nicht au-
erhalb der sozialen Realitt, sondern in ihr selbst zu suchen unter-
nimmt und sich deshalb methodisch dem spteren Marxismus ann-
hert; aber auch er gibt trotzdem noch dem Gedanken Raum, da es
einen unabhngigen Bereich der Wahrheitsfindung und der sie er-
mglichenden Vernunft gibt. War Helvetius eine Ausnahme, so
blieben die brigen materialistischen Sozialtheoretiker im prinzipiell
naturphilosophischen Denken befangen. Die Inkonsequenz, dem
Geist Freiheit zuzugestehen, blieb nicht aus. Noch in der zweiten
Hlfte des vorigen Jahrhunderts ist es vorgekommen, da konse-
quente Vertreter des mechanisch-naturwissenschaftlichen Materia-
lismus ebenso konsequente historische Idealisten gewesen sind. Der
Materialist Haeckel war nicht nur ein glhender Verehrer der reak-
tionren Politik Bismarcks, sondern auch von der autonomen ge-
schichtsgestaltenden Rolle der groen Mnner berzeugt. Engels
macht sich ber die verspteten Reiseprediger des Materialismus
lustig, und Marx uert sich im Kapital auf die folgende Weise:
Die Mngel des abstrakt naturwissenschaftlichen Materialismus,
13 3
der den geschichtlichen Proze ausschliet, ersieht man schon aus
den abstrakten und ideologischen Vorstellungen seiner Wortfhrer,
sobald sie sich ber ihre Spezialitt hinauswagen. 88
Marx und Engels, die gegen den heroisierenden Geschichtsidealis-
mus anzukmpfen hatten, konnten weder bei der Beziehung von
Krper und Geist noch bei jener zwischen Geographie und Ge-
schichte stehenbleiben, die beide, sobald man sie zu allgemeinen
theoretischen Prinzipien erheben will, ihre mechanistische Schranke
offenbaren. Ihr geschichtsphilosophischer Gedankengang lt sich
ungefhr folgendermaen zusammenfassen:
Das Wesentliche an aller menschlichen Geschichte ist die gesell-
schaftliche Ttigkeit. Diese Ttigkeit ist aber nichts Zuflliges und
wird nicht willkrlich gesetzt, sondern hat ihr historisches Gesetz,
dem sie unterworfen ist. Je nachdem, welche Mittel und damit wel-
che Mglichkeiten und Grenzen fr die Ttigkeit vorhanden sind,
erhlt sie ihren konkreten geschichtsgestaltenden Inhalt. Das gesell-
schaftliche
Grundelement aller Ttigkeit ist die Arbeit, die diese
Mittel erzeugt.
Marx lobt an der Hegelschen Phnomenologie,
da sie einmal die Selbsterzeugung (! L. K.) des Menschen als einen
Proze fat, die Vergegenstndlichung (d. h. die Abhngigkeit von
der Gegenstandswelt, L. K.) als Entgegenstndlichung (d. h. Ttig-
keit, L.K.), als Entuerung und als Aufhebung dieser Entue-
rung, da er (Hegel) also das Wesen der Arbeit fat und den gegen-
stndlichen Menschen, weil wirklichen Menschen als Resultat seiner
eigenen Arbeit begreift.
Aber auf welche Weise bringt es die Arbeit fertig, die Mittel fr die
Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens zu schaffen? Sie tut
es, indem sie die von ihr in Anwendung genommenen Naturkrfte,
die Produktivkrfte, in der Form von Produktionsmitteln nutzbar
macht. Die Hervorbringung dieser Produktionsmittel ist von be-
sonderer Bedeutung fr die Entwicklung der menschlichen Bezie-
hungen und fr die Menschheitsgeschichte berhaupt. Das aller-
wichtigste und von Marx am meisten betonte Moment in diesem
Proze ist aber die Gestaltung des Verhltnisses, das der Mensch
zum Menschen eingeht. Es wre nun vllig verfehlt zu meinen, Marx
lehrte, da es die Produktionsmittel seien, die aus eigenem, gleich-
sam wie in der Vorstellung des Wilden der Fetisch, die Art und
Weise erzeugten, wie der Mensch sich zum Mitmenschen verhlt. Es
wurde bereits darauf hingewiesen, da der Brennpunkt der marxisti-
schen Anschauung die durch den Kopf, d. h. durch das Bewut-
sein hindurchgehende Ttigkeit ist. Ist diese Ttigkeit auch nicht
willkrlich, sondern von den Mitteln abhngig, die ihr die materielle
Kultur zur Verfgung stellt, und von den vorgefundenen Ver-
134
hltnissen, die die Menschen zueinander bereits eingegangen sind,
bestimmt, so sind es doch wiederum diese Mittel und diese Verhlt-
nisse selbst, die Objekt der menschlichen Ttigkeit bleiben. Der Zu-
sammenhang von Produktivkrften, Produktionsmitteln und gesell-
schaftlichen
Verhltnissen subsumiert sich in der marxistischen
Theorie unter den Begriff des Materiellen - nicht, wie oft flschli-
cherweise unterstellt, unter jenen der Materie -, woraus sich die
Bezeichnung der materialistischen Geschichtsauffassung ableitet.
Indem der Mensch als ttiges Wesen seine materielle Kultur fort-
whrend umwlzt, und das heit wiederum nicht unwillkrlich,
sondern jeweils nach den vorgefundenen, durch die vorangehende
Ttigkeit der Gesellschaft erzeugten,
materiellen Bedingungen,
schafft er gleichzeitig jene neuen Voraussetzungen fr seine eigene
Ttigkeit, durch die diese selbst in Form und Inhalt eine Vernde-
rung erfhrt und so fort. Innerhalb dieses Prozesses artikulieren sich
Reflexionen und gedankliche Gebilde, die wir Ideologien nennen
und die ihrerseits mit entscheidend bleiben fr die Artikulation einer
bestimmten, den gegebenen Verhltnissen angemessene Ttig-
keit.
Entsprechend der stndig zunehmenden Komplizierung der gesell-
schaftlichen Beziehungen ist es selbstverstndlich, da sich auch die
ideologischen Reflexionen in stndig wachsendem Mae komplizie-
ren und die eigenartigsten und vielfltigsten Formen annehmen.
Aber die gesellschaftliche und geschichtliche Funktion des Denkens
bleibt immer dieselbe: das Denken dient letztlich der Selbsterkennt-
nis des gesellschaftlichen Menschen, der Gesellschaft, der Klassen
und Institutionen (z. B. des Staates), und es erfllt die bewute oder
unbewute Aufgabe, die Willensentscheidungen und Handlungen
praktisch mglich zu machen. Da diese Selbsterkenntnis, die sich
in wissenschaftliche, philosophische, religise, rechtliche, politische
usw. Formen kleidet, nicht immer, ja nur ausnahmsweise inhaltlich
richtig ist, bedeutet etwas ganz anderes und erfllt eine gleichfalls
ideologische Funktion. Das ideologische Denken ist nichts anderes
als das Werkzeug der dialektisch bestimmten gesellschaftlichen T-
tigkeit, mge die Art und Weise, wie es sich manifestiert, noch so ab-
strakt erscheinen. Diese Einbezogenheit des Denkens in den allge-
meinen, materiell bestimmten gesellschaftlichen Proze berechtigt,
von Materialismus zu sprechen.
Trotz seiner funktionalen Ausrichtung auf die Selbsterkenntnis der
Gesellschaft zum Zwecke ihrer Gestaltung und Vernderung und
daher auf das im weitesten Sinne Praktische trifft das Denken nicht
i
mmer, ja uerst selten, die Wahrheit. Die Spaltung der Gesell-
schaft in Klassen erzeugt vllig entgegengesetzte, den Ideologen nur
13
5
ausnahmsweise zum Bewutsein kommende Interessen; und da die
Wahrheit nur eine sein kann, ist ihre Verschleierung mit Hilfe gerade
dieses auf Selbsterkenntnis ausgerichteten ideologischen Denkens
unvermeidlich. Dabei ist zu beachten, da auch die falsche Selbst-
erkenntnis, die die Wahrheit verfehlt, gleichzeitig auch historisch
wirkliche Selbsterkenntnis in dem Sinne ist, als berhaupt erst durch
sie das konkrete geschichtliche Handeln bestimmter Klassen ermg-
licht wird und diese Klassen sich als Klassen geschichtlich konstitu-
ieren.
Auf dieses komplizierte Ideologieproblem kann in diesem
Rahmen nicht eingegangen werden; in den vorangehenden Ausfh-
rungen haben sich einige wesentliche Beispiele von selbst ergeben.
Marx nennt das sich von der Wahrheit entfernende, aber geschichtli-
che Notwendigkeit erlangende Denken falsches Bewutsein. Ei-
nes der groartigsten Ziele des Marxismus ist daher die Befreiung des
Denkens im Dienste der Befreiung des Menschen. Auch darin of-
fenbart sich der humanistische Charakter des Marxismus.
Wie die bisherigen Ausfhrungen beweisen, berschreitet die Theo-
rie des Historischen Materialismus nirgends die Grenzen mensch-
lich-denkender Aktivitt, nirgends ist ein Rckfall in den naturme-
chanischen oder biologisch-mechanischen Materialismus zu beob-
achten. So kann Marx sagen: Die Wurzel fr den Menschen ist der
Mensch selbst. Dieses groartige Programm hat zum erstenmal in
der Geschichte seine widerspruchslose theoretische Verwirklichung
gefunden. Wie sehr der Marxismus jedem Mechanismus und jedem
naturhaften, den Menschen zum Objekt unmenschlicher Vorgnge
degradierenden Materialismus gerade entgegengesetzt ist, beweist
die Kritik, die Marx an jener Seite der brgerlichen Vorstellungsseite
bt, die als Verdinglichung erscheint. (Wir haben dieses ideologi-
sche Phnomen der brgerlichen Gesellschaft in dieser Schrift aus-
fhrlich analysiert.) In seinen Frhschriften bereits formuliert Marx
seinen Standpunkt dahin, da er nur die folgenden zwei Mglichkei-
ten der menschlichen Ttigkeit zult: die eine ist die Bearbei-
tung der Natur durch den Menschen und die andere die Bearbei-
tung des Menschen durch den Menschen. Selbst da, wo Marx die
Analyse objektiver, die menschliche Ttigkeit scheinbar transzen-
dierender, unmenschlicher Mchte in Angriff nimmt, bleibt die
Ttigkeit des Menschen die einzige Grundlage fr die Begreifbarkeit
dieses Faktums und das heit, die mittels des Bewutseins sich akti-
vierende Ttigkeit. Zwar sagt Marx, da der Zustand, in dem sich die
Menschen befinden, nicht freiwillig, sondern naturwchsig ist,
nicht als ihre eigene vereinte Macht, sondern als eine fremde, auer
i
hnen stehende Gewalt, von der sie nicht wissen woher und wohin,
die sie also nicht mehr beherrschen knnen, die im Gegenteil nur
136
eine eigentmliche, vom Wollen und Laufen der Menschen unab-
hngige, ja dieses Wollen und Laufen erst dirigierende Reihenfolge
von Phasen und Entwicklungen durchlaufen. Aber wie erklrt
Marx sofort diesen Zustand? Als eine Artdes Zusammenwirkens der
Individuen, die durch die Arbeitsteilung, also durch eine Form der
menschlichen Ttigkeit selbst entstanden ist; auch hier ist also die
menschliche Ttigkeit die letzte Ursache, die Marx zur Erklrung
der Gesellschaft und ihrer gesetzlichen Strukturen heranzieht. In der
Konsequenz dieser Ansicht geht Marx so weit, da er z. B. - als Bei-
spiel unter vielen- im Kapital erklrt, man sehe es dem Gold oder
Silber nicht an, da es als Geld ein gesellschaftliches, also auf ttigem
Verhalten der Menschen zueinander beruhendes Produktionsver-
hltnis darstellt. Wie in seinem reifsten Werk lobt Marx bereits in
Philosophie und Nationalkonomie an Feuerbach, da dieser
das gesellschaftliche Verhltnis des >Menschen zum Menschen<
ebenso zum Grundprinzip der Theorie macht, d.h. nirgends hinter
die menschliche bewutseinsgebundene Ttigkeit zurckgreift; das
bedeutet nirgends auf geographische, klimatische oder biologische
oder gar physikalische (wie etwa Holbach und Lamettrie) Ursachen.
Ideologisch betrachtet, ist somit auch von dieser Seite her das marxi-
stische System als ein humanistisches zu verstehen. Denn in keinem
anderen System wird mit der gleichen Energie an der humanisti-
schen, allein vom Menschen ausgehenden und zu ihm zurckkeh-
renden Linie der Betrachtung festgehalten wie im marxistischen, in
keinem anderen System wird mit der gleichen Konsequenz der
Mensch zum Ma aller Dinge gemacht. Auch das unverwstliche
Gespenst aller lteren naturalistischen Gesellschaftsbetrachtung, die
uere Natur, erscheint im Marxismus ins Menschliche aufgehoben
- mge auch noch neuerdings ein Hans Barth Marx vorwerfen, da
er die geographischen Umstnde nicht gengend bercksichtige.
Plechanow drckt dies ganz im Sinne der marxistischen Auffassung
so aus: Indem der Mensch durch seine Arbeit auf die Natur auer
ihm wirkt, bewirkt er die Vernderung seiner eigenen Natur.8 9
(
Unter der Natur des Menschen ist hier nicht seine unvernderliche
biologische und anthropologische, sondern seine historische ge-
meint.) In der Einleitung von Zur Kritik der politischen kono-
mie formuliert Marx seine Auffassung ber das Verhltnis des
Menschen zur Natur folgendermaen: Alle Produktion ist Aneig-
nung der Natur von seiten des Individuums innerhalb und vermittels
einer bestimmten Gesellschaftsform.9 0
Sollte nichtsdestoweniger heute jemand noch immer auf die Idee
kommen, die Lehre des Marxismus, sei es als dogmatischer Marxist,
sei es als brgerlicher Kritiker, naturalistisch oder mechanistisch zu
13 7
interpretierten, dann sei ihm das
Wort Lenins entgegengehalten:
Der kluge Idealismus steht dem klugen Materialismus nher als der
dumme Materialismus. Wie berhaupt das letzte Wort, das hier zu
sprechen ist, das ist, da die sowohl methodologische wie geistesge-
schichtliche Leistung des Marxismus darin besteht, den uralten Ge-
gensatz zwischen einseitigem undialektischem Materialismus und
ebenso einseitigem undialektischem Idealismus dialektisch in ein
neues System aufgehoben zu haben. Von der ideologischen Perspek-
tive betrachtet, bleibt der Marxismus fr die Gegenwart wie fr eine
noch erhebliche Zeit in die Zukunft hinein die Ideologie der progres-
siven Elite.
13 8
Anmerkungen
1 H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft I, 1 1 1 973, S. 1 1 5 f.
2 Vgl. L . Kofler, Zur Geschichte der brgerlichen Gesellschaft, 5 1 974.
3 Z.B. Karl Joel, Wandlung der Weltanschauung.
4
H. E. Holthusen, Kritisches Verstehen, 1 961 , S. 96.
5 W Hauff, Die Bettlerin vom Pont des Arts, Meyers Klassiker-Ausgabe,
Werke III, S. 271 .
6 D. Diderot, Jakob und sein Herr, 1 953, S. 244.
7 Ebenda, S. 239 f.
8 Ebenda, S. 246.
9 J.
A. Gontscharow, Oblomow, 1 960, S. 69.
1 0 J. L ocke, Zwei Versuche ber die Regierung, 1 906, S. 1 04.
1 1 H. Marcuse, Vernunft und Revolution, 1 962, S. 1 1 0.
1 2 K Marx, Nationalkonomie und Philosophie, Frhschriften, Ausgabe
Krner, 1 . Band, 1 932, S. 336. Eigene Kursivsetzung.
1 3 G. W. F. Hegel, Phnomenologie des Geistes, 5 1 949, S. 1 33-1 50.
1 4 F. Schiller, Briefe ber die sthetische Erziehung des Menschen (niederge-
schrieben 1 793/94), 3. und 6. Brief.
1 5 G. W. F. Hegel, Phnomenologie des Geistes,
5 1 949, S. 1 49.
1 6 A. M. Knoll, Katholische Kirche und scholastisches Naturrecht, 1 962,
S. 26 f. und passim.
1 7 J. Habermas,
Strukturwandel der ffentlichkeit, 1 962, S. 1 1 6 f. - Aus-
fhrliches Material zu dieser Frage in meiner Schrift: Zur Geschichte der
brgerlichen Gesellschaft, 5 1 974.
1 8 Zitiert nach Habermas, ebenda, S. 1 25 f.
1 9 G.T. di L ampedusa,
Der L eopard, 1 962, S. 307.
20 Zitiert nach J. Habermas, Strukturwandel der ffentlichkeit, 1 962,
S. 24 f.
21 Hervorragend Hippolyte Taine (1 828-1 893), Die Entstehung des moder-
nen Frankreich, 1 936.
22 K Marx, Die heilige Familie, Frhschriften, Ausgabe Krner, 1 . Band,
1 932, S. 377.
23 K Marx, Das Kapital, 1 . Bd., 1 947, S. 1 86.
24 Ebenda S. 81 .
25 Ebenda.
26 Ebenda.
27 G. L ukacs, Geschichte und Klassenbewutsein, 1 923, S. 95.
28 Ebenda, S. 1 00.
29 H. H. Holz, Der franzsische Existentialismus, 1 958, S. 1 7.
30 J. P. Sartre, Ist der Existentialismus ein Humanismus? 1 947, S. 1 4.
31 G.
Anders, Kafka pro und contra, 1 951 , S. 27.
32 H. Marcuse, Eros und Kultur, 1 957, S. 1 02.
33
L .
Kofler, Ende der Philosophie, Dortmund 1 961 (Kulturamt) und: Dia-
lektik der Kultur, Frankfurt/M. 1 972.
34 J. P. Sartre, Materialismus und Revolution, in: Drei Essays, 1 963, S. 52 ff.
35 Diesen Sachverhalt habe ich an verschiedenen Stellen meines Schrifttums
ausfhrlich analysiert.
36 Zum Begriff dieser Dialektik vgl. meine Schrift: Aggression und Gewis-
sen.
1 39
37 P. A. Baran, Unterdrckung und Fortschritt, 1966, S. 87 ff.
38 Sozialist. Kurier, Oktober 1964.
39 G. Anders, Kafka pro und contra, 1951, S. 27.
40 Th. W. Adorno
und P.
v.
Haselberg, ber die geschichtliche Angemes-
senheit des Bewutseins, in: Akzente, Heft 6, 1965.
41 Leo Kofler,
Zur Geschichte der brgerlichen Gesellschaft, 5 1974.
42 G. F. W Hegel, Phnomenologie des Geistes, 5 1949, S. 141.
43 Th. W Adorno und M. Horkheimer, Dialektik der Aufklrung, 1947,
S. 22 und 40 f.
44 F. Tomberg,
Utopie und Negation, in: Das Argument, Juli 1963.
45 Th. W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, 1956, S. 32 f.,
193
f.
und andere.
46 Leo Kofler, Der proletarische Brger, 1964; ders., Der asketische Eros,
1967.
47 G. Lukcs, Die Theorie des Romans, Vorwort von 1962.
48 Th. W Adorno, Eingriffe, 1963, S. 23.
49 Ebenda.
50 F. Weltz, Der Arbeiter und sein Aufstieg, in: Neue Gesellschaft (theoret.
Organ der SPD), Januar/Februar
1965, S. 543
f.
51 Ebenda.
52 Th. W Adorno,
Stichworte 2, Frankfurt/M. 1969, S. 50.
53 H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch, 1967, S. 159 ff.
54 Ebenda, S.
166
f.
55 Ebenda, S. 166.
56
Ebenda, S. 168.
57 Ebenda, S. 172.
58 Ebenda, S. 140 ff.
59 Vgl. L. Kofler,
Zur Geschichte der brgerlichen Gesellschaft,
5 1974,
S. 64 f.
60 K. Marcuse, Der eindimensionale Mensch,
1967, S. 169.
61 Zum Begriff des Formalen in der Anthropologie vgl. L. Kofler, Aggres-
sion und Gewissen, Mnchen
1973.
62 Ebenda.
63 Vgl. dazu L. Kofler, Der asketische Eros, Wien 1967, 1. Abschnitt.
64 K Marx, Nationalkonomie und Philosophie, Kln 1950, S. 175.
65 M. Nadeau,
Geschichte des Surrealismus, Reinbek b. Hamburg 1965,
S. 41.
66 H. Mayer,
Zur deutschen Literatur der Zeit, Reinbek b. Hamburg 1967,
S. 50.
67 G. R. Hocke,
Manierismus in der Literatur, Reinbek b. Hamburg 1959,
S.153.
68 Vgl. zu dieser Unterscheidung Nheres bei L.
Kofler, Das asketische
Eros,
1967, 1. und 2.
Abschnitt; ders., Perspektiven des revolutionren
Humanismus, Reinbek b. Hamburg
1968, 1. und 2. Abschnitt.
69 E. R. Curtius, Kritische Essays zur europischen Literatur, Bern
2 1954,
S.294.
70 Ebenda.
71 H. Mayer,
Zur deutschen Literatur der Zeit, Reinbek b. Hamburg 1967,
S. 214 ff.
72 Ebenda, S. 216.
73 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Frhschriften,
Ausgabe Krner, 1. Bd., 1932, S. 264.
74 Ebenda, S. 287.
75 M. A. Knoll,
Katholische Kirche und scholastisches Naturrecht, 1962.
140
76 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Frhschriften,
Ausgabe Krner, 1. Bd., 132, S. 263.
77 Ebenda, S. 265.
78 M. Reding, Der politische Atheismus, 1957, S. 126.
79 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1964.
80 W. Emrich, Der Terror des Mystischen im technischen Zeitalter, in: Spra-
che im technischen Zeitalter, Heft 4, 1962, S. 326.
81 Der Spiegel, 1966, Nr. 18.
82 Klner Stadtanzeiger, 6./7. November 1972, S. 13 - hnlich Rheinischer
Merkur, 27. Juli 1956 und C. Czernetz, Wohlstandskriminalitt, in: Ar-
beiterzeitung,
Wien 19. Oktober
1956.
83 G. W. F. Hegel, Rechtsphilosophie, 234.
84 K Marx, Zur Kritik der politischen CSkonomie, Berlin 1951, S. 241.
85 Vgl. dazu L. Kofler, Aggression und Gewissen, Mnchen 1973.
86 L. Kofler, Jesus und die Ohnmacht, in: Marxismus und die Sache Jesu,
Matthias Grnewald-Verlag, Mnchen 1974.
87 Mehr darber in meiner Schrift: Geschichte und Dialektik, 3 1974.
88 K Marx, Das Kapital, 1. Bd.,
1947, S. 389.
89 N. Plechanow, Beitrge zur Geschichte des Materialismus, Berlin 1946,
S. 130.
90 K Marx,
Zur Kritik der politischen konomie, Ausgabe 1909, S.XVIII.
141
Politische Theorie
und
Sozialphilosophie
-
Eine Auswahl -
Werner Becker
W. D. Narr l F. Naschold
IdeaIistische und materialistische
Einfhrung In die moderne
Dlalektlk
politische Theorie
Das Verhltnis von
Band I
Herrschaft und Knechtschaft
Wolf- Dieter Narr
bei Hegel und Marx
Theoriebegriffe und
2 .
Auflage. 142 Seiten.
Systemtheorie
Kart. DM 2 8,-
3 .
Auflage. 2 10 Seiten.
I
SBN 3 - 17 - 2 3 6 07 1- 7
Kart. DM 19,80
ISBN 3 - 17 - 2 3 1111- 2
Rainer Elsfeld
Pluralismus zwischen Liberalismus
Band 11
und Sozialismus
Frieder Naschold
195 Seiten. Kart. DM 22,-
Systemsteuerung
I SBN 3 - 17 - 2 3 1011- 6
3 . Auflage. 187 Seiten.
Kart. DM 19,80
Wilhelm R. Glaser
I SBN 3 - 17 - 2 3 112 1- X
Soziales und Instrumentales
Handeln
Band III
Probleme der Technologie
W.- D. Narr/ F . Naschold
bei Arnold Gehlen und
Theorie der Demokratie
Jrgen Habermas
2 . Auflage. 3 00 Seiten.
2 16 Seiten. Kart. DM 32,-
Kart. DM 2 2 ,-
I SBN 3 - 17 - 2 3 6 011- 3
I SBN 3 - 17 - 2 3 117 1- 6
Hans Lenk (Hrsg.)
Frieder Naschold
Technokratie als Ideologie
Organisation und Demokratie
Sozialphilosophische Beitrge
Untersuchungen zum
zu einem politischen Dilemma
Demokratisierungspotential
2 40 Seiten. Kart.
DM 38,-
i n komplexen Organisationen
I SBN 3 - 17 - 2 3 6 06 1- X
3 . Auflage. 111 Seiten.
Kart. DM 15,80
Kurt Lenk
I SBN 3 - 17 - 2 3 1181- 3
Volk und Staat
Strukturwandel politischer
I deologien
i m 19. und 20. Jahrhundert
Auf Wunsch erhalten Sie
196 Seiten. Kart. DM 19,80
unseren Prospekt
I
SBN 3 - 17 - 09413 0- 5
Politik und Gesellschaft
Urban
Bernd Guggenberger
Wem ntzt der=?
Kritik an der neomarxistischen
Taschenbcher
Staatstheorie
Bd. 857. DM 10,-
Reihe 80
T. Koch / K.-M. Kodalle 1
H.Schweppenhuser
Negative Dialektik und
die Idee der Vershnung
Eine Kontroverse ber
Theodor W. Adorno
Bd. 850. DM 8,-
Leszek Kolakowski
Marxismus - Utopie und
Antl-Utopie
Bd. 865. DM 10,-
Leszek Kolakowskl
Der revolutionre Geist
R ene AhlbergBd. 833. DM 8,-
Das Proletariat
Die Perspektiven der Arbeiterklasse
i n der Industriegesellschaft
Bd. 861.
DM 10,-
D. Oberndrfer 1 W. Jger
Marx - Lenin - Mao
R evolution und neue Gesellschaft
2. Auflage. Bd. 841. D M 10,-
Helga Grebing
Aktuelle Theorien ber
Faschismus
und Konservatismus.
Gesine Schwan
Eine Kritik
Die Gesellschaftskritik von
Bd. 854. DM 8,-
Karl Marx
Politkonomische und
philosophische Voraussetzungen
2. Auflage. Bd. 855. DM 10,-
Helga Grebing
Linksradikalismus gleich
R echtsradikalismus.
Eine falsche Gleichung
Anselm Skuhra
2. Auflage. Bd. 819. DM 6,50
Max Horkheimer
Eine Einfhrung in sein Denken
Bd. 856. DM 8,-
H. Gudrich / St. Fett
Die pluralistische
Gesellschaftstheorie
Kurt P. Tudyka
Grundpositionen und Kritik
Kritische Politikwissenschaft
Bd. 863.
DM 10,-
Bd. 845. DM 6,50
Verlag W. Kohlhammer Auf Wunsch
erhalten Sie
unser
Stuttgart 1 Urbanstrae 12-16 Postfach 747 Urban-Taschenbuch-Verzeichnis
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Sozialkritik und soziale Steuerung: Zur Methodologie systemangepasster AufklärungVon EverandSozialkritik und soziale Steuerung: Zur Methodologie systemangepasster AufklärungNoch keine Bewertungen
- 10 Minuten Soziologie: BewegungVon Everand10 Minuten Soziologie: BewegungUte SamlandNoch keine Bewertungen
- Mängelwesen auf dem Mount Improbable: Soziologische EssaysVon EverandMängelwesen auf dem Mount Improbable: Soziologische EssaysNoch keine Bewertungen
- Systemtheorie und Gesellschaftskritik: Perspektiven der Kritischen SystemtheorieVon EverandSystemtheorie und Gesellschaftskritik: Perspektiven der Kritischen SystemtheorieNoch keine Bewertungen
- Gesellschaftstheorie zwischen Autologie und Ontologie: Reflexionen über Ort und Gegenstand der SoziologieVon EverandGesellschaftstheorie zwischen Autologie und Ontologie: Reflexionen über Ort und Gegenstand der SoziologieNoch keine Bewertungen
- Menschenwürde als heilige Ordnung: Eine Re-Konstruktion sozialer Exklusion im Lichte der Sakralität der personalen WürdeVon EverandMenschenwürde als heilige Ordnung: Eine Re-Konstruktion sozialer Exklusion im Lichte der Sakralität der personalen WürdeNoch keine Bewertungen
- Das moralische Kostüm geistiger Herrschaft: Wie unter dem Deckmantel der Moral Macht ausgeübt wirdVon EverandDas moralische Kostüm geistiger Herrschaft: Wie unter dem Deckmantel der Moral Macht ausgeübt wirdNoch keine Bewertungen
- Die Multipersonelle Gesellschaft: Der Versuch einer Gegenwartsdiagnose und deren Anwendung auf die RollentheorieVon EverandDie Multipersonelle Gesellschaft: Der Versuch einer Gegenwartsdiagnose und deren Anwendung auf die RollentheorieNoch keine Bewertungen
- Soziologien des Lebens: Überschreitung - Differenzierung - KritikVon EverandSoziologien des Lebens: Überschreitung - Differenzierung - KritikNoch keine Bewertungen
- Subjektdiskurse im gesellschaftlichen Wandel: Zur Theorie des Subjekts in der SpätmoderneVon EverandSubjektdiskurse im gesellschaftlichen Wandel: Zur Theorie des Subjekts in der SpätmoderneNoch keine Bewertungen
- Kritik des Habitus: Zur Intersektion von Kollektivität und Geschlecht in der akademischen PhilosophieVon EverandKritik des Habitus: Zur Intersektion von Kollektivität und Geschlecht in der akademischen PhilosophieNoch keine Bewertungen
- Soziale Arbeit aus Überzeugung: Ethische Perspektiven auf sozialpädagogische PraxisVon EverandSoziale Arbeit aus Überzeugung: Ethische Perspektiven auf sozialpädagogische PraxisNoch keine Bewertungen
- Kritik der ethischen Institution: Kant, Hegel und der Tod GottesVon EverandKritik der ethischen Institution: Kant, Hegel und der Tod GottesNoch keine Bewertungen
- 6.soziologische Aufklarung 6Dokument275 Seiten6.soziologische Aufklarung 6João Esteves SalgueiroNoch keine Bewertungen
- Kreativität und soziale Praxis: Studien zur Sozial- und GesellschaftstheorieVon EverandKreativität und soziale Praxis: Studien zur Sozial- und GesellschaftstheorieNoch keine Bewertungen
- Der Sozialismus einst und jetzt Streitfragen des Sozialismus in Vergangenheit und GegenwartVon EverandDer Sozialismus einst und jetzt Streitfragen des Sozialismus in Vergangenheit und GegenwartNoch keine Bewertungen
- QUESEL-Soziologie Und Soziale Frage - Lorenz Von Stein Und Die Entstehung Der Gesellschaftswissenschaft in Deutschland-Deutscher Universitätsverlag (1989)Dokument283 SeitenQUESEL-Soziologie Und Soziale Frage - Lorenz Von Stein Und Die Entstehung Der Gesellschaftswissenschaft in Deutschland-Deutscher Universitätsverlag (1989)StefanoChiarini100% (1)
- Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2012Von EverandJahrbuch der Luria-Gesellschaft 2012Willehad LanwerNoch keine Bewertungen
- Die spirituelle Hintertreppe. Eine Geschichte der Spiritualität. Band eins: AltertumVon EverandDie spirituelle Hintertreppe. Eine Geschichte der Spiritualität. Band eins: AltertumNoch keine Bewertungen
- Hegels objektive Vernunft: Kritik der VersöhnungVon EverandHegels objektive Vernunft: Kritik der VersöhnungNoch keine Bewertungen
- Welt BilderDokument48 SeitenWelt BilderFreie Waldorfschule Vaihingen-Enz100% (1)
- Jenseits der Person: Zur Subjektivierung von KollektivenVon EverandJenseits der Person: Zur Subjektivierung von KollektivenNoch keine Bewertungen
- Geschichte, Pädagogik und Psychologie der geistigen BehinderungVon EverandGeschichte, Pädagogik und Psychologie der geistigen BehinderungNoch keine Bewertungen
- Sozialisation und Geschlecht: Theoretische und methodologische AspekteVon EverandSozialisation und Geschlecht: Theoretische und methodologische AspekteBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)
- Urteilen lernen II: Ästhetische, politische und eschatologische Perspektiven moralischer Urteilsbildung im interdisziplinären DiskursVon EverandUrteilen lernen II: Ästhetische, politische und eschatologische Perspektiven moralischer Urteilsbildung im interdisziplinären DiskursNoch keine Bewertungen
- Weltanschauung und Menschenbild in der Kunst der GegenwartVon EverandWeltanschauung und Menschenbild in der Kunst der GegenwartNoch keine Bewertungen
- Kriminalität: Anforderungen an die Soziale ArbeitVon EverandKriminalität: Anforderungen an die Soziale ArbeitNoch keine Bewertungen
- Die Philosophie Sozialer Arbeit: Eine Einführung in Ziele und Begründungen des HelfensVon EverandDie Philosophie Sozialer Arbeit: Eine Einführung in Ziele und Begründungen des HelfensNoch keine Bewertungen
- Symbolische Verletzbarkeit: Die doppelte Asymmetrie des Sozialen nach Hegel und LevinasVon EverandSymbolische Verletzbarkeit: Die doppelte Asymmetrie des Sozialen nach Hegel und LevinasNoch keine Bewertungen
- Soziologie und Geschichtsphilosophie: Die Repräsentation historischer Wirklichkeit bei Emile DurkheimVon EverandSoziologie und Geschichtsphilosophie: Die Repräsentation historischer Wirklichkeit bei Emile DurkheimNoch keine Bewertungen
- Adorno Postscriptum TXTDokument4 SeitenAdorno Postscriptum TXTAlexander FrancoisNoch keine Bewertungen
- 10 Minuten Soziologie: MaterialitätVon Everand10 Minuten Soziologie: MaterialitätAnna HenkelNoch keine Bewertungen
- Soziologie: Untersuchungen über die Formen der VergesellschaftungVon EverandSoziologie: Untersuchungen über die Formen der VergesellschaftungBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (5)
- Subjektivierung und politische Handlungsfähigkeit: Althusser, Foucault und ButlerVon EverandSubjektivierung und politische Handlungsfähigkeit: Althusser, Foucault und ButlerNoch keine Bewertungen
- Die Seele bei der Arbeit: Von der Entfremdung zur AutonomieVon EverandDie Seele bei der Arbeit: Von der Entfremdung zur AutonomieNoch keine Bewertungen
- Essay Über Das GlückDokument9 SeitenEssay Über Das GlückAuraPazNoch keine Bewertungen
- Zirkel, Widerspruch, Paradoxon Das Denken Des Selbst in Der Klassischen Deutschen Philosophie Und in Der Gegenwart by Christoph Asmuth Wibke EhrmannDokument200 SeitenZirkel, Widerspruch, Paradoxon Das Denken Des Selbst in Der Klassischen Deutschen Philosophie Und in Der Gegenwart by Christoph Asmuth Wibke EhrmannGiordano BrunoNoch keine Bewertungen
- Bourdieu und die Frankfurter Schule: Kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des NeoliberalismusVon EverandBourdieu und die Frankfurter Schule: Kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des NeoliberalismusUllrich BauerNoch keine Bewertungen
- Enigma Agency: Macht, Widerstand, ReflexivitätVon EverandEnigma Agency: Macht, Widerstand, ReflexivitätHans-Herbert KöglerNoch keine Bewertungen
- Freiheit und ihre Dialektik: Kritik der Philosophie in der kritischen TheorieVon EverandFreiheit und ihre Dialektik: Kritik der Philosophie in der kritischen TheorieNoch keine Bewertungen
- Selbstentfaltung - Das Formen der Person und die Ausdifferenzierung des Subjektiven: Soziologische Übersetzungen IIVon EverandSelbstentfaltung - Das Formen der Person und die Ausdifferenzierung des Subjektiven: Soziologische Übersetzungen IINoch keine Bewertungen
- Philosophie und die Idee des Kommunismus: Im Gespräch mit Peter EngelmannVon EverandPhilosophie und die Idee des Kommunismus: Im Gespräch mit Peter EngelmannNoch keine Bewertungen
- Essay Identitätspolitik CK Philosophische ForschungDokument8 SeitenEssay Identitätspolitik CK Philosophische Forschungck oneNoch keine Bewertungen
- Freiheit und Liebe: Werde ein Mensch mit Initiative: RessourcenVon EverandFreiheit und Liebe: Werde ein Mensch mit Initiative: RessourcenNoch keine Bewertungen
- 10 Minuten Soziologie: FaktenVon Everand10 Minuten Soziologie: FaktenGianna BehrendtNoch keine Bewertungen
- Wir im All - das All in uns: Ken Wilbers Vision eines ungeteilten DaseinsVon EverandWir im All - das All in uns: Ken Wilbers Vision eines ungeteilten DaseinsNoch keine Bewertungen
- Kommunikativer Konstruktivismus: Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen AnsatzVon EverandKommunikativer Konstruktivismus: Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen AnsatzNoch keine Bewertungen
- Wilhelm Dilthey: Der Aufbau Der Geschichtlichen WeltDokument3 SeitenWilhelm Dilthey: Der Aufbau Der Geschichtlichen WeltМилорад ПрњићNoch keine Bewertungen
- Die Wahrheit Im Menschen: Rocco ButtiglioneDokument332 SeitenDie Wahrheit Im Menschen: Rocco Buttiglionealthusser68Noch keine Bewertungen
- Niklas Luhmann (1998) - Die Gesellschaft Der Gesellschaft (2. Band) PDFDokument583 SeitenNiklas Luhmann (1998) - Die Gesellschaft Der Gesellschaft (2. Band) PDFJuan José Solis Delgado100% (2)
- FP Neuzeit - Optionalteil - GeheimdiensteDokument8 SeitenFP Neuzeit - Optionalteil - GeheimdienstelordkafkaNoch keine Bewertungen
- InhaltsangabeDokument1 SeiteInhaltsangabesak400654Noch keine Bewertungen
- Einführung in Das Wirtschaftsprivatrecht I - ZSFDokument25 SeitenEinführung in Das Wirtschaftsprivatrecht I - ZSFhj5fwqcydyNoch keine Bewertungen
- Menschen B1 - Lektion 7Dokument22 SeitenMenschen B1 - Lektion 7Şeyda Uysal100% (1)
- Weihnacht AkkordeDokument36 SeitenWeihnacht AkkordeSabine RoperNoch keine Bewertungen
- Euroset 2010 PDFDokument2 SeitenEuroset 2010 PDFJodiNoch keine Bewertungen
- Gedankenkontrolle Und Die Neue Weltordnung - Info - Kopp - Verlag - deDokument16 SeitenGedankenkontrolle Und Die Neue Weltordnung - Info - Kopp - Verlag - deJosef-Anton-GeraNoch keine Bewertungen
- A1 Ubungen in Deutscher Grammatik Fur AnfangerDokument18 SeitenA1 Ubungen in Deutscher Grammatik Fur AnfangerZyra Desiree DomingoNoch keine Bewertungen
- Duden Oesterreichisches Deutsch PDFDokument52 SeitenDuden Oesterreichisches Deutsch PDFJovana Janjic100% (3)
- Freiheit Ausnahmegerichte Sind UnstatthaftDokument13 SeitenFreiheit Ausnahmegerichte Sind UnstatthaftFreigeist88Noch keine Bewertungen