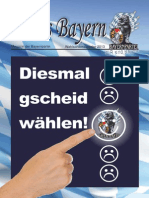Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Weigand Kriegerdenkmaler 201-218
Weigand Kriegerdenkmaler 201-218
Hochgeladen von
fonsocracia0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
53 Ansichten14 SeitenCopyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
53 Ansichten14 SeitenWeigand Kriegerdenkmaler 201-218
Weigand Kriegerdenkmaler 201-218
Hochgeladen von
fonsocraciaCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 14
IRSEER DIALOGE
Kultur und Wissenschaft interdisziplinr
Herausgegeben von
Markwart Herzog und Rainer lehl,
Schwabenakademie Irsee
Band 6
Markwart Herzog (Hrsg.)
Totengedenken und Trauerkultur
Geschichte und Zukunft
des Umgangs mit Verstorbenen
Mit Beitrgen von
Norbert Fischer, Markwart Herzog
Gerhard Hlzle, Amold Langenmayr
Lothar Mller, Klaus Raschzok
Gerhard Ries, Rdiger Schott
Katharina Weigand, Mario R. Zeck
Verlag W. Kohlhammer
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Totengedenken und Trauerkultur : Geschichte und Zukunft des Umgangs mit
Verstorbenen / Markwart Herzog (Hrsg.). Mit Beitrgen von Norbert Fischer
Stuttgart ; Berlin; Kln: Kohlhammer, 2001
(Irseer Dialoge; Bd. 6)
ISBN 3-17-016972-6
7 ~ , L t
44 H / 1 YJ6 ~
Alle Rechte vorbehalten
2001 W. Kohlhammer GmbH
Stuttgart Berlin Kln
Verlagsort: Stuttgart
Umschlag: Data Images GmbH
Reproduktionsvorlage: Textwerkstatt Werner Veith Mnchen
Gesamtherstellung:
W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. Stuttgart
Printed in Germany
Inhalt
Markwart Herzog
Einleitung: Totengedenken und Interpretation ........................................ 11
1. Trauer und Gedenken ................................................................................. 11
2. ,De mortuis nihil nisi bene' ........................................................................ 13
3. ,Damnatio memoriae' ................................................................................. 15
4. Grbergedenken und Gebetsgedenken .. .. ................................................... 18
Psychologische, sozialgeschichtliche und
ethnologische Perspektiven
Arnold Langenmayr
Trauer und Trauerverarbeitung aus psychologischer Sicht .................. 23
1. Trauer in prhistorischer Zeit ........... : .................... ..................................... 23
2. Das lteste Schriftzeugnis zur Trauerbewltigung ..................................... 24
3. Trauerphasen und Traueraufgaben ......................................... ..... ............... 25
4. Besonders belastende Faktoren des Trauerprozesses ................................. 27
5. Symptome im Gefolge von Trauerereignissen ........................................... 27
6. Trauerberatung und Trauertherapie ............................................................ 30
7. Fortbildung in Trauerberatung und Trauertherapie .................................... 38
Weiterfhrende Literatur ................................................................................. 39
Norbert Fischer
Zur Geschichte der Trauerkultur in der Neuzeit
Kulturhistorische Skizzen zur Individualisierung, Skularisierung
und Technisierung des Totengedenkens .......................... ...................... .41
1. Frhneuzeitliche Anfange ............... ........................................................... 41
2. Zur Entfaltung brgerlicher Trauerkultur im 18. und 19. Jahrhundert .... .45
6
3. Der Einbruch der Technik: Leichenhallen und Krematorien ............ ......... 46
4. Professonialisierung und Spezialisierung: Die Rolle der
Bestattungsunternehmen ....................... ...................................................... 49
-? 5. Feuerbestattung, Freidenkertum und Arbeiterbewegung:
Formen skularisierter Trauerkultur ........................................................... 50
6. Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert: Zwischen Pragmatismus und
fudividualisierung ............................................................ .... ......... .. ... ......... 52
Rdiger Schott
Die Lebenden und die Toten als Kommunikations-
und Solidargemeinschaft
Totenrituale in Afrika ............................ ........................................................ 59
1. Der Tod im Erzhlgut der Bulsa .................................................... .. ........... 59
2. Patrilineare Generationenfolge ............................................................ .. ..... 60
3. Die Totengedenkfeier als Ritus der Reise ins Totenreich .......................... 61
4. Das Schadentrachten bsartiger Totengeister ............................................ 63
5. Die Gefhrdung der Gruppensolidaritt durch Konflikte .......................... 65
6. Wechselseitige Frsorge zwischen Lebenden und Toten .......................... 67
7. Die Beteiligung von Frauen am Opferritual.. ............................................. 72
8. Der Opferritus als Kommunion der Lebenden und Toten ........ .. ................ 75
9. Glossar aus dem Buli, Sprache der Bulsa, Nordghana ............................... 76
Brauchtum, Literatur und bildende Kunst
~
Gerhard Hlzle ~ r 1 ~ 0-
,damit och unser gedechtnus { .. } nit mit dem glogken ton zergang"
, ''fotengedenken in Bruderschaften Bayerisch Schwabens
/ und Altbaierns anhand literarischer und liturgischer Quellen ............... 87
1. Literarische und liturgische Quellen ......................................................... 87
2. Geschichte der Memoria in religisen Gemeinschaften ........................... 90
3. Totengedchtnis in der Kalands-Bruderschaft Weienhom ..................... 93
4. Der Abla ........... .. ............... ......................................... ............................. 96
5. Die Totenmemoria ..................................................................................... 99
6. Die Seelenbruderschaften ........................................................................ 100
7
7. Die Vermehrung des Totengedenkens .......... .. ........................................ 102
8. Der Jahrtag, besondere Gebetsformen und Heilige ................................ 104
9. Zeiten des Totengedenkens ..................................................................... 106
10. Zusammenfassung ................................... ................................................ 110
Klaus Raschzok
Epitaphien, Totenschilde und Leichenpredigten
als Erinnerungszeichen
Bemerkungen zu einer protestantischen Frmmigkeitstradition ........ 111
1. ffentliche Prsenz privater Erinnerungszeichen .................................... 111
2. Rckzug der Toten aus der Gesellschaft der Lebenden ........................... 111
3. Totenschilde und Epitaphien nach der Reformation ................................ 114
4. Wappen, Name und Bildnis als Elemente der Reprsentation ................. 116
5. Militrische Ikonographie der Gedchtnismale fr Offiziere .................. 123
6. Die Auswirkungen der Reformation auf die ikonographische
Entwicklung des Epitaphs .. .. .................................................................... 123
7. Abschiedsschmerz der Hinterbliebenen - Lobpreis der Verstorbenen .... 146
8. konomische und gesellschaftliche Bedingungen der Totenmemoria .... 152
9. Erinnerungszeichen als Zeugnisse lutherischer Frmmigkeit.. ................ 153
Lothar Mller
Gelbe Immortellen
Grber, Tod und Totengedenken bei Theodor Fontane ...................... 157
1. Der physische und der symbolische Tod .. ................................................ 157
2. Die Grber und Toten der Mark Brandenburg ......................................... 159
3. Der Grberspezialist als Romanautor: ,Vor dem Sturm' ......................... 165
4. Andenken - Ahnung - Gegenwart: Der Tod im brgerlichen Alltag ...... 172
Mario R. Zeck
"Erschttert geben wir bekannt ... "
Zur Illokution standardisierter Trauersprache in Todesanzeigen ....... 181
1. Forschungsstand und methodische Entscheidungen ................................ 181
2. Zur Geschichte der Todesanzeige ............................................................ 183
3. Zur Makrostruktur von Todesanzeigen .................................................... 184
4. Zur Gesamtfunktion der Textsorte Todesanzeige .................................... 185
8
5. Die Textillokutionen der Todesmitteilung ........ ... ............ .. .. .... ........ .. ..... . 186
6. Die Illokution der Symbole ............. ... .... .. ...................... .... .. .. ... ..... .... .... .. 190
7. Vorteile und Nachteile von Standardelementen ............... .. ...... .. .. .... .. ...... 194
Kriegerdenkmler und ,damnatio memoriae'
Katharina Weigand
Kriegerdenkmler
ffentliches Totengedenken zwischen
Memoria-Stiftung und Politik ..................................................................... 201
1. Zum Denkmalbegriff ............. .. .. ........................................................... ... 201
2. berblick von der Antike bis ins 19. Jahrhundert .................................. 203
3. Funktionen des Denkmals ..... .. ........ .. ................................ .. .................... 204
4. Wesensmerkmale des Denkmals ............................................................. 205
5. Das Kriegerdenkmal als Sonderfall ........................................................ 206
6. Die Denkmalwrdigkeit des einfachen Soldaten ............ .. ........ .. ............ 208
7. Die integrationspolitische Funktion der Krieger- bzw.
Sieges denkmler nach den deutschen Einigungskriegen ........................ 211
8. Das Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges ...................... 213
9. Die politische Sinnstiftung des Todes nach der militrischen
Niederlage von 1918 ............................................................................... 214
10. Kriegerdenkmler in der Zeit des Nationalsozialismus .......................... 215
Katharina Weigand
Politische und religise Sinngebung des Gefallenengedenkens
Die Gedenktafeln und das Kriegerdenkmal in Markt Irsee .................. 219
1. Gefallenengedenken in der ehemaligen Klosterkirche Irsee .................. .. 219
2. Gefallenengedenken auerhalb der Kirche .... .. ........................................ 228
3. Gefallenengedenken zwischen religiser und politischer Sinngebung .... 234
Gerhard Ries
Damnatio memoriae
Die Vernichtung des Andenkens an Verstorbene in Politik
9
und Strafrecht. .. ... ........................................................................................ 237
1. Die Idee der ,damnatio memoriae' in altorientalischen Texten ............... 238
2. Die rechtliche Ausformung der ,damnatio memoriae' im Altertum ........ 239
3. Zur Begriffsgeschichte der Wortschpfung ,damnatio memoriae' .. ........ 240
4. Die gesetzliche Regelung der ,damnatio memoriae' ................... .. .......... 241
5. Vergttlichung und Verdammung: Elemente der rmischen
Kaiserideologie ........................................................ .. .............. .. ........ ..... .. 245
6. Die chtung des Totengedenkens in der Politik des 20. Jahrhunderts .... 246
Autoren und Herausgeber .......................... ....... .. .......................... ............ 249
Abbildungsnachweise ... .. .......... .. ........... .. .... .......................... .................... 251
Personenregister .. ... ............ .. ......................................... ................... .. .... .. . 253
Katharina Weigand
Kriegerdenkmler
ffentliches Totengedenken zwischen Memoria-Stiftung
und Politik
Die Geschichtswissenschaft befindet sich derzeit, wenn man mit solchen Dia-
gnosen auch vorsichtig sein soll, in einer Phase der Umorientierung. Ausge-
hend von einer intensiven Selbstreflexion der historiographischen Disziplin,
im Anschlu an den Abschied vom optimistischen Glauben des Historismus,
man knne zeigen, wie es wirklich gewesen ist, verlagert sich der Schwer-
punkt vom Ideal einer rational und an den Quellen berprfbaren Rekon-
struktion der Vergangenheit hin zu den Kategorien ,Erinnerung' und ,Erinne-
rungskultur' . I Mitunter gewinnt man in der aktuellen Debatte sogar den
Eindruck, als sei die Beschftigung mit dem Vorgang des Erinnerns wichtiger
als der Versuch, sich dem Obj ekt des Erinnerns - der Vergangenheit also -
zuzuwenden. Jenseits solcher berlegungen, die Neuorientierungen in einer
wissenschaftlichen Disziplin gleichwohl stets mit sich bringen, ist das Thema
der Erinnerung und auch der Erinnerungskultur unstrittig ein wichtiges The-
ma, auch wenn es um das traditionelle Anliegen der Historiographie, die Re-
konstruktion der Vergangenheit, geht. In besonderer Weise gilt das fr die
Probleme und Perspektiven, die im Umfeld meines Themas angesiedelt sind.
1. Zum Denkmalbegriff
Neben vielen anderen Medien, mit deren Hilfe Erinnerung bewahrt oder wie-
derbelebt werden soll- museale Prsentation, historische Ausstellungen, Film
und Fernsehen wren hier zu nennen -, waren und sind bis heute die Denk-
mler eine besonders weit verbreitete Form der absichtsvoll betriebenen Erin-
nerung, der Erinnerungskultur, der Erinnerungspolitik. Doch was ist ber-
haupt ein Denkmal und von welcher Art von Denkmal ist im folgenden die
I Aus der Vielzahl der in den letzten Jahren verffentlichten Titel sollen hier nur einige
wenige erwhnt werden: MAURICE HALBWACHS, Das kollektive Gedchtnis, Frankfurt
a.M. 1985; ALEIDA ASSMANN / DIETRICH HARTH (Hrsg.), Mnemosyne. Formen und
Funktionen der kulturellen Erinnerung, Frankfurt a.M. 1991; PATRICK H. HUTTON, His-
tory as an Art of Memory, Hannover / London 1993; TTO GERHARD EXLE (Hrsg.),
Memoria als Kultur, Gttingen 1995; HANNo LOEWY / BERNHARD MOLTMANN (Hrsg.),
Erlebnis, Gedchtnis, Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt a.M. /
New York 1996; ALEIDA ASSMANN, Erinnerungsrume. Formen und Wandlungen des
kulturellen Gedchtnisses, Mnchen 1999.
202 Katharina Weigand
Rede? Der scheinbar so eindeutige Begriff ,Denkmal' entpuppt sich bei nhe-
rem Hinsehen rasch als recht mehrdeutig.
Das DTV-Lexikon vermerkt hierzu: "Denkmal, ein Gegenstand der Kunst,
der Geschichte, der Natur, der von denkwrdiger Bedeutung ist."2 Das Wr-
terbuch zur Geschichte von Erich Bayer und Frank Wende unterscheidet Un-
tergruppen von Denkmlern, nmlich Bau- und Kunstwerke aller Art, In-
schriften, besonders aus dem Altertum und dem Mittelalter, Urkunden,
Mnzen und Medaillen, Siegel, Wappen, Waffen. Und als Definition ist hier
zu lesen: Denkmler seien nach J ohann Gustav Droysen "die Quellengruppe
zwischen den unentstellt berlieferten berresten und der mehr oder weniger
subjektiv gefrbten Tradition"3.
Hier - im Rahmen dieser knappen Skizze - soll der eben zitierte, eher in-
flationre Denkmalbegriff, wonach so gut wie alles, was uns aus der Vergan-
genheit berliefert ist, ein Denkmal sein kann, stark eingeschrnkt werden. Es
geht im folgenden also nicht um Baudenkmler (Schlsser, Klster, Kirchen
usw.) und die damit verbundenen Fragen des Denkmalschutzes. Es geht auch
nicht um antike Mnzen, die das Portrait des in ihrer Entstehungszeit regie-
renden Kaisers tragen, oder um Waffen, die man als berrestquellen der
Kriegstechnik vergangener Zeiten interpretieren kann. Statt dessen soll der
Denkmaltypus des 19. und 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt stehen, den das
englische Wort ,monument' treffend umschreibt. Gemeint sind also Denk-
male wie etwa Reiterstandbilder, Knstlerbsten oder grere Figurenensem-
bles, zudem aber auch Denkmale, fr die eine architektonische bzw. abstrakte
Form gewhlt wurde; Beispiele hierfr wren etwa das Mnchner Siegestor
oder - mit freilich ganz anderer inhaltlich-politischer Konnotation - das fr
Berlin geplante Holocaust-Mahnmal. Um solche Denkmler, die "im engeren
Sinn [ ... ] zum Gedenken an eine Person, auch ein Ereignis"4 gesetzt wurden,
soll es im folgenden gehen.
5
DTV-Lexikon, Mnchen 1980, Bd. 3, 270.
ERICH BAYER / FRANK WENDE, Wrterbuch zur Geschichte. Begriffe und Fachausdrk-
ke, Stuttgart 5 1995, 102.
DTV-Lexikon (Anm. 2), 270.
Auch zu dieser stark eingegrenzten Gruppe von Denkmlern existiert inzwischen eine
wahre Flut von wissenschaftlicher Literatur. Hier soll freilich nur eine kleine Auswahl
aufgelistet werden: Siehe u.a. FRANZ SCHNABEL, Die Denkmalskunst und der Geist des
19. Jahrhunderts, in: DERS., Abhandlungen und Vortrge 1914-1965, hrsg. von Heinrich
Lutz, Freiburg u.a. 1970, 134-150; THOMAS NIPPERDEY, Nationalidee und National-
denkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert, in: DERS., Gesellschaft, Kultur, Theorie. Ge-
sammelte Aufstze zur neueren Geschichte, Gttingen 1976, 133-173; HANS-ERNST
MITTIG / VOLKER PLAGEMANN (Hrsg.), Denkmler im 19. Jahrhundert. Deutung und
Kritik, Mnchen 1972; EKKEHARD MAI / GISELA SCHMIRBER (Hrsg.), Denkmal, Zei-
chen, Monument. Skulptur und ffentlicher Raum heute, Mnchen 1989; HANs-
MICHAEL KRNER / KA THARINA WEIGAND, Denkmler in Bayern, Augsburg 1997.
Kriegerdenkmler
203
2. berblick von der Antike bis ins 19. Jahrhundert
Solche Denkmler und Monumente gibt es seit langem. Schon in der Antike,
in Griechenland und vor allem in Rom stellte man sie auf. Das Mittelalter
kannte dagegen so gut wie keine derartigen Denkmler, galten sie doch - aus
christlicher Sicht - als zu verurteilender Ausdruck menschlicher Selbstherr-
lichkeit. Erst mit der Figur eines freistehenden Lwen, den Heinrich der L-
we in Braunschweig aufrichten lie, nherte man sich wieder der in rmischer
Zeit gebten Praxis, wenngleich man noch davor zurckschreckte, die Person
des Herrschers selbst darzustellen. Die ersten Monumente, bei denen dann !
wieder eine Statue des Herrschers auf einen Sockel gehoben wurde, finden
sich in Italien: die Denkmler fr Groherzog Cosimo 1. und Groherzog
Ferdinand 1. in Florenz, errichtet 1594 bzw. 1608. Andere Monarchien woll-
ten freilich nicht zurckstehen; 1614 wurde in Paris Knig Heinrich IV. mit
einem solchen Denkmal geehrt, Denkmler fr Knig Philipp IH. von Spani-
en sowie fr Philipp IV. in Madrid folgten nach. Einen Hhepunkt fand diese
Entwicklung mit Knig Ludwig XIV.: Seine Statuen verkrperten schlielich
auf den Pltzen fast aller greren Stdte Frankreichs seinen absolutistischen
Herrschaftsanspruch. Da diese Denkmler von den Zeitgenossen und Un-
tertanen auch ganz eindeutig als Verkrperung eines solchen Herrschaftsan-
spruchs verstanden wurden, zeigt nicht zuletzt, da sie whrend der Franzsi-
schen Revolution in groem Umfang zerstrt wurden.
6
In der Folge der Franzsischen Revolution, mit dem Aufstieg des Brger-
tums, mit dem Geniekult der Romantik, mit einer neuen Sicht der Geschichte
- um nur wenige Ursachen zu nennen - vernderte sich das europische
Denkmalwesen entscheidend. Einerseits wurden nun auch andere Personen-
gruppen (Heerfhrer, Generle und bald vor allem Knstler) denkmalfhig.
Das heit, sie wurden - zumeist auf Grund einer besonderen Leistung - als
wrdig betrachtet, mit einem Denkmal geehrt zu werden, welches das An-
denken an ihre Person und an ihre Verdienste der Nachwelt berliefern sollte.
Andererseits konnten Denkmler nun auch von Brgerlichen initiiert und in
Auftrag gegeben werden. Ergebnis dieser Vernderungen war, da im Laufe
des 19. Jahrhunderts eine wahre Flut von Denkmlern ber die europischen
Staaten hinwegging,
7
eine Flut, die freilich bis heute - wenn auch auf etwas
Zur Geschichte des Denkmals in Deutschland bis etwa zum Ende des 17. Jahrhunderts
vgl. THOMAS H. VON DER DUNK, Das deutsche Denkmal. Eine Geschichte in Bronze und
Stein vom Hochmittelalter bis zum Barock, Kln / Weimar / Wien 1999.
Vgl. hierzu GEORG LILL, ber Sinn und Bedeutung der Denkmler (Standbilder), in:
Schnere Heimat 38 (1942) 31-34, hier 33; SCHNABEL, Denkmalskunst (Anm. 5), 146-
150; HARTMUT BOOCKMANN, Denkmler. Eine Utopie des 19. Jahrhunderts, in: Ge-
schichte in Wissenschaft und Unterricht 28 (1977) 160-173, hier 165; WOLFGANG
HARDTWIG, Zeichen der Erinnerung. Zum Stand und zur Geschichte der Denkmalsde-
batte, in: DERS., Geschichtskulturund Wissenschaft, Mnchen 1990,310-314, hier 31Of.
204
Katharina Weigand
niedrigerem Niveau - anzudauern scheint. So wurden Denkmler in der er-
sten Hlfte des 19. Jahrhunderts vor allem in den Haupt- und Residenzstd-
ten, bald aber auch schon in kleineren Stdten und Gemeinden errichtet. Und
whrend es sich bis ber die Mitte des 19 . Jahrhunderts hinaus meist noch um
Monumente fr die jeweiligen Herrscher oder zumindest fr nationale Heroen
wie etwa Goethe oder Schiller handelte, die die belebtesten Pltze der Stdte
bevlkerten, so kamen schlielich sogar lokale Berhmtheiten hinzu, die mit
Statuen, Gedenktafeln, Bsten usw. geehrt wurden.
3. Funktionen des Denkmals
Der Befund der sprichwrtlichen Denkmalflut
8
des 19. und auch noch des
20. Jahrhunderts lenkt den Blick auf zwei besonders wichtige Fragen: zum
einen auf die Frage nach den Funktionen des Denkmals 1 zum anderen und
damit eng verbunden auf die Frage nach den Grnden, warum solche Denk-
mler berhaupt aufgestellt wurden und noch immer aufgestellt werden. ber
drei Zeitebenen erstrecken sich die Funktionen und Wirksamkeiten von
Denkmlern: Sie verweisen keineswegs nur auf . die Vergangenheit, auch
wenn das mit ihrer Aufstellung eng verknpfte Motiv, Erinnerung an eine
Person oder an ein Ereignis zu stiften, fr den Betrachter das vertrauteste und
das offensichtlichste sein drfte. Gleichzeitig wohnt Denkmlern ein starker
Bezug zur Gegenwart ihrer eigenen Entstehung inne. Denn indem sich die
Initiatoren und Auftraggeber bemhen, Erinnerung zu stiften oder wachzu-
halten, sprechen sie ber Personen, Ereignisse und Ideen ein Werturteil aus
und befinden, da diese der Erinnerung wrdig sind. Als dritte Ebene ist dar-
ber hinaus die Zukunft in jedes Denkmalprojekt einbezogen. Schlieli.ch soll
noch auf lange Zeit das einmal gesetzte Denkmal Erinnerung gewhrleisten.
Denkmlern kommen jedoch noch in ganz anderer Hinsicht Erinnerungs-
funktionen zu: Einerseits will man an die dargestellte Persnlichkeit, das dar-
gestellte Ereignis erinnern, wobei dies sowohl im Sinne von ,to remind' Ge-
manden an etwas erinnern) als auch im Sinne von ,to remember' (sich
erinnern) geschehen soll. Andererseits wnschen auch der oder die Initiatoren
des Denkmals selbst, im Gedchtnis nachfolgender Generationen erhalten zu
bleiben. Das bedeutet, da sich derjenige, der Erinnerung stiften oder bewah-
ren will, gleichzeitig ganz bewut in eine Traditionslinie hineinstellt, sei sie
nun kultureller oder politischer Natur. Wer also Denkmler plant, initiiert
oder frdert, gibt zumindest Teile seiner eigenen Weltanschauung zu erken-
nen. Er mchte aber zumeist auch als der Schpfer des in Rede stehenden
Monuments selbst in Erinnerung bleiben.
8 Vgl. HANS-ERNST MITTIG, ber Denkmalkritik, in: MITTIG / PLAGEMANN, Denkmler
(Anm. 5),283-301, hier 287f.
Kriegerdenkmler 205
Und noch zwei weitere Aspekte gehren zum Komplex ,Funktionen des
Denkmals'. So sollen Denkmler erstens eine besondere Form der Erinnerung
stiften, nmlich keine private Erinnerung, sondern eine, die in und von der
ffentlichkeit wahrgenommen wird. Das Ziel ist, persnliches Credo, Wert-
haltungen, Urteile ber die Vergangenheit bzw. die Gegenwart im Medium
des Denkmals einerseits ffentlich zu machen und andererseits der Nachwelt
zu berliefern. Damit setzt sich zweitens derjenige, der solch eine Initiative in
Angriff nimmt oder untersttzt, ganz bewut der Diskussion seines Projektes
aus; er will also in der ffentlichkeit (vorrangig whrend der Planungsphase)
sowie bei den nachmaligen Betrachtern (wenn das Denkmal dann errichtet
ist) Wirkungen erzielen, will bestimmte Urteile und Sichtweisen hervorrufen
oder unterdrcken, strken oder schwchen, er will Meinung machen und
beeinflussen.
4. Wesensmerkmale des Denkmals
Die Tatsache, da mit Hilfe von Denkmalsetzungen Meinungen beeinflut
werden sollen, lenkt den Blick auf einige besondere Wesensmerkmale des
Denkmals. Konzeption, Planung und Verwirklichung von Denkmlern sind
nicht der historiographischen Korrektkeit, nicht dem Anspruch des Histori-
kers nach mglichst groer Objektivitt verpflichtet - sie knnen und mssen
das auch nicht sein! Mit der Hilfe von Denkmlern wird vielmehr ein ganz
besonders selektiver Zugriff auf die Vergangenheit praktiziert, nicht nur was
die Auswahl der darzustellenden Person, des Ereignisses betrifft, sondern
auch hinsichtlich der zumeist ganz eindeutigen inhaltlichen Verortung dieser
Person, dieses Ereignisses. Multiperspektivitt der Interpretation wird im
Denkmal nicht angestrebt und ist wohl auch kaum zu verwirklichen. Der Um-
stand, da in parlamentarisch-demokratischen Staaten die Errichtung von
Denkmlern, im Vergleich mit monarchischen oder autokratischen Systemen,
ganz offensichtlich mit greren Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen
verbunden ist, hngt auch damit zusammen - man denke hier nur an den
langwierigen Meinungsbildungsproze fr das geplante Berliner Holocaust-
Denkma1.
9
Eine angemessene Beurteilung von Denkmlern erfordert es daher,
vor allem die politischen Wirkungszusammenhnge ihrer Entstehungszeit in
den Blick zu nehmen.
Die enge Verbindung zwischen dem im Medium des Denkmals ausgespro-
chenen Werturteil, der darin enthaltenen Botschaft und dem gesellschaftli-
9 Die Auseinandersetzungen um die Errichtung dieses Denkmals sind inzwischen bereits in
mehreren Bchern dokumentiert. Vgl. MICHAEL S. CULLEN (Hrsg.), Das Holocaust-
Mahnmal. Dokumentation einer Debatte, Zrich 1999; MICHAEL JEISMANN (Hrsg.),
Mahnmal Mitte. Eine Kontroverse, Kln 1999; LEA ROSH (Hrsg.), "Die Juden, das sind
doch die anderen". Der Streit um ein deutsches Denkmal, Berlin / Wien 1999.
206 Katharina Weigand
ehen, kulturellen, politischen Tagesgeschehen seiner Entstehungszeit hat frei-
lich zur Folge, da diese Erinnerungsmale, ganz entgegen der Absicht und
den Hoffnungen ihrer Auftraggeber, die Neigung haben, nach krzerer oder
lngerer Zeit gleichsam zu verschwinden. All diese Denkmler sind zwar
weiterhin materiell vorhanden, doch sobald die ffentliche Auseinanderset-
zung um sie leiser wird - was meist dann der Fall ist, wenn die Planungs- und
Bauphase des Denkmals abgeschlossen ist -, dann verschwindet auch das
eben noch hei umkmpfte Streitobjekt aus der Wahrnehmung, sptestens
also, wenn die Enthllungsfeier vorber ist. Die vielfltigen Bemhungen
whrend des 19., aber auch whrend des 20. Jahrhunderts, am Ort des Denk-
mals regelmig zu wiederholende Rituale (Feste, Kranzniederlegungen
usw.) zu initiieren, verweisen ganz eindeutig auf dieses Dilemma und auf den
Versuch, dem Vergessen entgegenzuwirken.
lo
Verstrkt wird diese der Absicht der Denkmalschpfer so kra entgegen-
stehende Eigenschaft des Denkmals noch durch den Umstand, da die an den
Denkmlern verwendete Bildsprache mit der Zeit unverstndlich wird. Denn
jede Epoche erfindet zumindest einen Teil ihrer Zeichen und Symbole, ihrer
Chiffren neu oder stattet sie wenigstens mit abgewandelten Inhalten aus. Die
Kenntnis der Bedeutung einer Vielzahl der an den Denkmlern des 19. Jahr-
hunderts verwendeten Sinntrger (besondere Assistenzfiguren, unterschied-
lich eingesetzte architektonische Grundformen usw.) wird zum Spezialwissen
von Historikern und Kunsthistorikern. Damit schwindet - um nur ein Beispiel
heranzuziehen - die Lesbarkeit der unzhligen Bismarck-Trme und Bis-
marck-Sulen, bei denen auf jegliche personenbezogene Darstellung des
Reichsgrnders, dessen Andenken sie gewidmet sind, vollstndig verzichtet
wurde.
ll
Ein nicht zu dechiffrierendes Denkmal aber mutiert zum reinen Ku-
riosum, im besten Fall zu einem Baudenkmal, das nur noch auf Grund seines
Alters schtzens wert erscheint.
5. Das Kriegerdenkmal als Sonderfall
Die bisher gemachten Bemerkungen zum Denkmal im allgemeinen gelten
auch fiir die Kriegerdenkmler.
12
Dennoch stellen diese gleichsam einen Son-
derfall des Denkmals dar.
10 Vgl. hierzu BOOCKMANN, Denkmler (Anm. 7), 168.
11 Vgl. hierzu VOLKER PLAGEMANN, Bismarck-Denkmler, in: MITTIG / PLAGEMANN,
Denkmler (Anm. 5), 217- 252; GNTER KLoss / SIEGLINDE SEELE (Hrsg.), Bismarck-
Trme und Bismarck-Sulen. Eine Bestandsaufnahme, Petersberg 1997.
12 Den Kriegerdenkmlern als eigenem Typ von Denkmlern hat sich zuerst Reinhart Ko-
selleck zugewandt. V gl. hierzu REINHART KOSELLECK, Kriegerdenkmale als Identitts-
stiftungen der berlebenden, in: DO MARQUARD / KARLHEINZ STIERLE (Hrsg.), Iden-
titt, Mnchen 1979, 255-276. Inzwischen ist freilich auch zu den Kriegerdenkmlern
eine Flle wissenschaftlicher Literatur erschienen. V gl. u.a. BERND NICOLAI / KRISTINE
Kriegerdenkmler
207
Das hngt erstens damit zusammen, da die Kriegerdenkmler, wenn man
es scharf formuliert, nur an den Tod, genauer an den gewaltsamen Tod von
einem oder zumeist von mehreren Menschen erinnern sollen. Hier steht also
nicht die whrend des Lebens vollbrachte Einzelleistung eines Menschen (ein
Beispiel sind etwa die Verfassungsdenkmler rur Knig Max 1. J oseph von
BayernB), hier steht nicht das gesamte Lebenswerk bestimmter Persnlich-
keiten (man denke an Goethe- und Schiller-Denkmler
I4
), und es steht auch
nicht ein bestimmtes Ereignis im Mittelpunkt der Erinnerung (zu nennen w-
ren hier Reichsgrndungsdenkmler wie etwa das Denkmal auf dem Kyffhu-
ser
IS
). Bei den Kriegerdenkmlern geht es statt dessen nur um eines, es geht
um den gewaltsamen Tod von Soldaten. Was diese Soldaten mglicherweise
in ihrem Leben vor diesem gewaltsamen Sterben geleistet hatten, steht dabei
nicht im Vordergrund. Erinnert wird - um es noch einmal zu wiederholen -
lediglich an ihr Sterben.
Der zweite Aspekt, der Kriederdenkmler zu einem Sonderfall des Denk-
mals macht, ist die Tatsache, da darber hinaus an einen gewaltsamen Tod
im Dienste einer Sache - um es noch ganz vage zu formulieren - gedacht
werden soll: Die Soldaten starben - und hier ist nun entscheidend, wann die
jeweiligen Kriegerdenkmler errichtet wurden - rur ihren Knig, fiir ihr Va-
terland, fiir ihre Heimat. Vor allem dieser Umstand, nmlich das Sterben fiir
Knig, Vaterland, Heimat und somit rur etwas, das als gut und sinnvoll inter-
pretiert wird, macht die Besonderheit der meisten Kriegerdenkmler aus. Da-
durch sind sie gleichzeitig in eine besonders enge Verbindung mit den politi-
schen Bedingungen ihrer Entstehungszeit gerckt. Auf die geschilderten
Besonderheiten der Kriegerdenkmler gilt es immer wieder zurckzukom-
men, wenn im folgenden die Entwicklung jener Denkmler in Deutschland
whrend der letzten zweihundert Jahre im Mittelpunkt steht.
POLLACK, Kriegerdenkmale - Denkmale rur den Krieg, in: Skulptur und Macht. Figura-
tIve Plastik im Deutschland der 30er und 40er Jahre, Berlin 1983, 61-93; MEINHOLD
LURZ, Kriegerdenkmler in Deutschland, Bde. 1-6, Heidelberg 1985-1987; VOLKER
PROBST, Bilder vom Tode. Eine Studie zum deutschen Kriegerdenkmal in der Weimarer
Republik am Beispiel des Pieta-Motives und seiner profanierten Varianten, Hamburg
1986; GERHARD ARMANSKI, " .. . und wenn wir sterben mssen". Die politische sthetik
von Kriegerdenkmlern, Hamburg 1988; REINHART KOSELLECK / MICHAEL JEISMANN
(Hrsg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenkmler in der Modeme, Mnchen 1994;
KATHARINA WEIGAND, Kriegerdenkmler im Wandel, in: KRNER / WEIGAND, Denk-
mler (Anm. 5), 25-28.
13 Vgl. hierzu HANS-MICHAEL KRNER, Max-I.-Joseph-Denkmler, in: KRNER/ WEI-
GAND, Denkmler (Anm. 5), 5-9.
14 Vgl. hierzu u.a. JRG GAMER, Goethe-Denkmler - Schiller-Denkmler, in: MITTIG /
PLAGEMANN, Denkmler (Anm.5), 141-162; ROLF SELBMANN, Dichterdenkmler in
Deutschland. Literaturgeschichte in Erz und Stein, Stuttgart 1988.
1S Vgl. hierzu u.a. GUNTHER MAI (Hrsg.), Das Kyffhuser-Denkmal 1896-1996. Ein natio-
nales Monument im europischen Kontext, Kln / Weimar / Wien 1997.
208 Katharina Weigand
6. Die Denkmalwrdigkeit des einfachen Soldaten
Besonders vertraut sind uns diejenigen Kriegerdenkmler, die wir - zumeist
errichtet fiir die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges - in so gut
wie allen Stdten bis hin zu den kleinsten Gemeinden und Drfern finden.
Auf ihnen sind die Namen aller Gefallenen des jeweiligen Ortes verzeichnet.
Und doch stellt dieser Typ eine recht spte Form in der Entwicklungsge-
schichte der Kriegerdenkmler dar. Denn erst die allmhliche Aufwertung des
Soldatenstandes an der Wende vom 18. auf das 19. Jahrhundert - eine der
Folgen der Franzsischen Revolution und der Revolutionskriege - lie auch
den einfachen Soldaten berhaupt erst denkmalwrdig
In den Jahrhunderten zuvor hatten sich die Armeen aus Sldnern zusam-
mengesetzt, die nicht um hherer Ziele willen, sondern fiir Geld, fiir Sold
kmpften. Soldat zu sein war damals also, um es kra zu formulieren, nichts
anderes als ein Beruf, ein Erwerbszweig. Etwa seit den 20er Jahren des
18. Jahrhunderts wurden die gefallenen Sldner zumindest in Massengrbern
bestattet, whrend man die Toten zuvor Vgeln und Hunden zum Fra ber-
lassen oder auf Scheiterhaufen verbrannt hatte.
17
Lediglich die Leichname der
hohen Offiziere, die meist adliger Abkunft waren, wurden mitunter in ihre
Heimat berfhrt und in der Familiengruft beigesetzt. Wenn zu dieser Zeit-
bis ins 19. Jahrhundert hinein - berhaupt gefallenen Soldaten Denkmler
gesetzt wurden, dann den verdienten Generlen. Die Statuen der Generle
Scharnhorst und Blow, die bis 1946 den Eingang der Neuen Wache in Ber-
lin flankierten, sind hierfiir Beispiele.
18
In den Befreiungskriegen gegen Napoleon (1813-1815) kmpften zum er-
sten Mal auch in Deutschland Freiwillige aus allen Bevlkerungsschichten
fr Werte, mit denen sich nicht nur diese Freiwilligen, sondern auch weitere
Kreise der Bevlkerung und vor allem die Angehrigen der Freiwilligen
selbst ideell indentifizieren konnten. Man kmpfte nun nicht mehr fiir Geld
und Sold, sondern fiir die Befreiung von napoleonischer Fremdherrschaft,
man kmpfte "fiir Knig und Vaterland". Ein Soldat aber, der nicht fr Mate-
rielles, sondern fiir die Rettung des Vaterlandes starb, der konnte weit eher
einer ehrenden Erinnerung fiir wrdig befunden werden. Gleichzeitig trugen
die angenommenen ideellen, ethischen Motive seines Sterbens sowie die
idealistische berhhung eines solchen Todes dazu bei, die Standesunter-
16 Vgl. hierzu KOSELLECK, Kriegerdenkmale (Anm. 12), 259f.
17 Vgl. hierzu KOSELLECK, Kriegerdenkmale (Anm. 12), 258; MEINHOLD LURZ, Krieger-
denkmler in Deutschland. Knstlerische Formen zwischen Totenkult und prospektivem
Anspruch, in: Freiburger Universittsbltter 68/19 (1980) 27-47, hier 28.
18 Vgl. hierzu JRGEN TIETZ, Schinkels Neue Wache Unter Den Linden. Baugeschichte
1816--1993, in: CHRISTOPH STLZL (Hrsg.), Die Neue Wache Unter Den Linden. Ein
deutsches Denkmal im Wandel der Geschichte, Berlin 1993,9-93, hier 16f.
Kriegerdenkmler 209
schiede der Gefallenen zurcktreten zu lassen. Somit konnten zum ersten Mal
alle Gefallenen, auch die einfachsten Dienstgrade, denkmalWfdig werden.
19
Wie unerhrt neu, anders und bedeutsam den damaligen Zeitgenossen die-
se Form der Kriegsfhrung auf der Basis der Freiwilligkeit erschienen sein
mu, lt sich auch daran ablesen, da Knig Friedrich Wilhelm IH. von
Preuen im Jahre 1813 befahl, in den Kirchen eigene Tafeln anzubringen, auf
denen die Namen der Gefallenen unter folgendem Spruch aufgezeichnet wur-
den: "Aus diesem Kirchspiel starben fiir Knig und Vaterland"20. Und drei
Jahre spter, 1816, fhrte der Knig in Preuen zustzlich einen eigenen Ge-
denktag fiir die Gefallenen der Befreiungskriege ein.
Aber auch in anderen deutschen Staaten wurde auf hnliche Weise jener
Gefallenen gedacht. So schlug 1830 Regierungsprsident Oettingen-W aller-
stein vor, in allen Kirchen des schwbischen Kreises Tafeln mit den Namen
der in den Napoleonischen Kriegen Gefallenen anzubringen.
21
Knig Lud-
wig 1. begrte die Initiative und verfgte, da dieser Vorschlag auch in den
anderen Kreisen des bayerischen Knigreiches aufzugreifen sei, jedoch nicht
in denjenigen, die zur fraglichen Zeit noch nicht zu Bayern gehrt hatten.
22
Und noch einmal griff der bayerische Knig dezidiert ein, als nmlich das
Innenministerium anregte, jhrlich, am Geburtstag des Knigs, zur "Befrde-
rung des vaterlndischen und des kriegerischen Geistes berhaupt'm die Na-
men der Gefallenen von der Kanzel zu verlesen. Nun bestimmte Ludwig 1.,
da in den Kirchen jeweils zwei Tafeln anzubringen seien: Auf der einen Ta-
fel sollten die Namen der Gefallenen der Kriege zwischen 1805 und 1815
aufgezeichnet werden, auf der anderen aber die Namen derer, die 1813, 1814,
1815 freiwillig in den Krieg gezogen waren, also die Namen der Freiwilligen
der Befreiungskriege.
24
Diese Unterscheidung, die der bayerische Knig an-
ordnete, verweist auf zweierlei: zum einen auf den uerst sensiblen Umgang
19 Vgl. hierzu KOSELLECK, Kriegerdenkmale (Anm. 12), 267-274; MICHAEL JEISMANN I
ROLF WESTHElDER, Wofiir stirbt der Brger? Nationaler Totenkult und Staatsbrgertum
in Deutschland und Frankreich seit der Franzsischen Revolution, in: KOSSELLECK I
JEISMANN, Totenkult (Anm. 12), 23-50.
20 Zitiert nach LURZ, Kriegerdenkmler (Anm. 17), 28.
21 Vgl. hierzu WOLFGANG SCHMIDT, Denkmler fiir die bayerischen Gefallenen des Ru-
landfeldzugs von 1812, in: Zeitschrift fiir bayerische Landesgeschichte 49 (1986) 303-
326, hier 318-322; HANS-MICHAEL KRNER, Staat und Geschichte im Knigreich
Bayern, Mnchen 1992, 227f.
22 Der Rheinkreis Z.B. befand sich damals unter napoleonischer, der Obermain- und der
Rezatkreis befanden sich noch unter preuischer Herrschaft.
23 MInn an MKr, 4.8.1830, BayHStA MK 14476, zitiert nach KRNER, Staat (Anm.21),
228.
24 Hier mu man freilich einschrnken, da nicht immer zwei Erinnerungstafeln angefertigt
wurden. Auf der Tafel, die inzwischen in der Irseer Klosterkirche hngt, sind aber im-
merhin die Gefallenen der Kriege von 1805 bis 1815 von denen, die ausdrcklich als
"Freywillige" tituliert wurden, getrennt verzeichnet.
210
Katharina Weigand
Ludwigs I. mit der jngsten Vergangenheit Bayerns und damit zum anderen
auf seine politisch motivierte, auf die Integration der neuen Gebiete seines
Knigreiches zielende Rcksichtnahme auf die Erinnerungsbestnde dieser
vormals nicht bayerischen Gebiete.
Doch warum kam es berhaupt - in Preuen und Bayern - zu derartigen
Initiativen vor allem fr diejenigen Soldaten, die freiwillig gegen Napoleon
gekmpft hatten? Einerseits konnte man mit solchen Gedenktafeln den Ange-
hrigen der Gefallenen und ihrem Wunsch nach privater Erinnerung entge-
genkommen. Gab es schon keine Grabsttten, an denen man des freiwillig in
den Krieg gezogenen Bruders, Ehemanns usw. gedenken konnte, so gab es
nun wenigstens die Tafel in der Kirche. Andererseits .wohnte den Gedenk-
tafeln aber auch ein groes politisches Potential inne. Nicht nur, da den
Kriegstoten in der Kirche eine strker herausgehobene Ehrung zuteil wurde
als den zivilen Toten. Gleichzeitig wurde auf Grund des Satzes "Aus diesem
Kirchspiel starben fr Knig und Vaterland" die christliche, auf das Jenseits
verweisende Deutung des Todes durch eine innerweltliche, politische Deu-
tung ersetzt. Und auerdem konnte die Opferbereitschaft der Gefallenen, ihre
patriotische Tat, die auch den Tod in Kauf nahm, nicht nur geehrt und dem
Vergessen entrissen, sondern den nachfolgenden Generationen geradezu als
leuchtendes Beispiel vor Augen gefhrt werden. Besonders deutlich zeigt dies
die Inschrift des 1818/1822 errichteten Berliner Kreuzberg-Denkmals, das
Knig Friedrich Wilhelm IH. allen preuischen Soldaten der Befreiungskrie-
ge widmete.
25
Die von dem Altertums- und Sprachenforscher August Boeckh
entworfene Inschrift lautet: "Der Knig dem Volke, das auf seinen Ruf hoch-
herzig Gut und Blut dem Vaterlande darbrachte, den Gefallenen zum Ge-
dchtnis, den Lebenden zur Anerkennung, den knftigen Geschlechtern zur
Nacheiferung."26 Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wurden auf diese
Weise sinnstiftend miteinander verknpft.
Darber hinaus ist das Berliner Kreuzberg-Denkmal eines der frhesten
kollektiven Kriegerdenkmler. Das heit, da es nicht einer Person allein,
sondern einer ganzen Gruppe - hier, wie schon erwhnt, allen preuischen
Soldaten der Befreiungskriege - gewidmet wurde. Man konnte also ohne
Blick auf Standes- oder Rangunterschiede an alle Gefallenen, an Offiziere
und einfache Soldaten gleichermaen, erinnern.
Das frheste Beispiel fr die Namensnennung aller Gefallenen auf einem
Kollektivdenkmal stellt das Hessen-Denkmal in Frankfurt a.M. von 1793 dar.
Es wurde von Knig Friedrich Wilhelm II. von Preuen fr die whrend des
Ersten Koalitionskrieges am 2. Dezember 1792 bei der Erstrmung des
25 Zum Kreuzberg-Denkmal vgl. MICHAEL NUNGESSER, Das Denkmal auf dem Kreuzberg
von Karl Friedrich Schinkel, Berlin 1987.
26 Zitiert nach NIPPERDEY, Nationalidee (Anm. 5), 141.
Kriegerdenkmler
211
Friedberger Tores in Frankfurt gefallenen Hessen gestiftet.
27
Der Regelfall
sah jedoch bis zu den deutschen Einigungskriegen von 1864, 1866 und
1870/71 anders aus: Namentlich verewigt wurden die Gefallenen der Revolu-
tions- wie auch der Befreiungskriege nur in ihren heimatlichen Kirchenge-
meinden, auf den bereits erwhnten Gedenktafeln. In einigen Hauptstdten
der deutschen Einzelstaaten aber wurden - so wie in Berlin - kollektive Krie-
gerdenkmler errichtet, bei denen man von einer individuellen Namensnen-
nung der gefallenen Soldaten Abstand nahm. Um noch ein bayerisches Bei-
spiel zu nennen: 1833 wurde in Mnchen auf dem Karolinenplatz der von
Knig Ludwig I. in Auftrag gegebene Obelisk enthllt, der die gefallenen
bayerischen Soldaten ehren sollte, die whrend des Rulandfeldzuges von
1812 an der Seite Napoleons ihr Leben gelassen hatten.
28
Der Umstand, da in Berlin und Mnchen nach 1815 Kriegerdenkmler er-
richtet wurden, die nicht als gesamtdeutsche Monumente zu deuten waren,
verweist erneut auf die politische Bedeutung dieser Denkmler. Denn das
einzelstaatliche Kriegerdenkmal entsprach in seiner Erscheinungsform der
politischen Realitt im Deutschen Bund. berlegungen, die direkt nach der
Leipziger Vlkerschlacht von 1813 darauf abhoben, ein staatenbergreifendes
Monument zu errichten, kamen dagegen ber das Planungsstadium nicht hin-
aus.
29
Erst 100 Jahre spter, 1913, konnte, nach mehrjhriger Bauphase, unter
vllig gewandelten nationalpolitischen Voraussetzungen und mit anderen
inhaltlichen Konnotationen versehen, das Leipziger Vlkerschlachtdenkmal
vollendet werden.
30
7. Die integrationspolitische Funktion der Krieger- bzw.
Siegesdenkmler nach den deutschen Einigungskriegen
Mit den deutschen Einigungskriegen vernderte sich der Charakter der Krie-
gerdenkmler erneut. Als besonders schwierig erwies sich hierbei der Um-
gang mit dem ffentlichen Gedenken an den Krieg von 1866, da sich bereits
27 Vgl. hierzu LURZ, Kriegerdenkmler (Anm. 12), Bd. 1, 61f.
28 Zum Mnchner Obelisken vgl. HANs REIDELBACH, Knig Ludwig 1. von Bayern und
seine Kunstschpfungen, Mnchen 1888,265; HANs ROTH, Mnchner Denkmler, Frei-
lassing 1981,40; KRNER, Staat (Anm. 21), 230f. Der Spruch, den Ludwig 1. an diesem
Denkmal anbringen lie, lautet: "Auch sie starben rur des Vaterlands Befreiung."
29 Vgl. hierzu NIPPERDEY, Nationalidee (Anm. 5), 145f.; PETER HUTTER, "Die feinste Bar-
barei". Das Vlkerschlachtdenkmal bei Leipzig, Mainz 1990,32-45.
30 Zur Entstehung des Leipziger Vlkerschlachtdenkmals von 1913 vgl. HUTTER, Barbarei
(Anm. 29), 80-182; STEFAN-LUDWIG HOFFMANN, Sakraler Monumentalismus um 1900.
Das Leipziger Vlkerschlachtdenkmal, in: KOSELLECK I JEISMANN, Totenkult (Anm. 12),
249-280; STEFFEN POSER, Die Jahrhundertfeier der Vlkerschlacht und die Einweihung
des Vlkerschlachtdenkmals zu Leipzig 1913, in: KATRIN KELLER (Hrsg.), Feste und
Feiern. Zum Wandel stdtischer Festkultur in Leipzig, Leipzig 1994, 196-213.
212
Katharina Weigand
wenige Jahre spter, im Krieg von 1870/71, die ehemaligen Gegner - etwa
Bayern und Preuen - nun pltzlich nicht nur als Waffengefhrten, sondern
geeint im deutschen Kaiserreich wiederfanden. Da sich aber, auf Grund der
raschen Abfolge der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71, die geplante Auf-
stellung von Denkmlern fr die Gefallenen von 1864 und 1866 zumeist erst
nach dem Krieg gegen Frankreich von 1870/71 realisieren lie, wurde der
gefallenen Soldaten aus zwei oder gar aus allen drei Kriegen schlielich hu-
fig in einem Sammelmonument gedacht.
31
Auf diese Weise konnte man aus-
blenden, da der Krieg von 1866 ein deutscher Bruderkrieg gewesen war, was
wiederum der Befrderung der Reichseinheit nach 1871 dienlich sein mute.
Diese Sammelmonumente waren somit geeignet, im Sinne der Strkung des
inneren Zusammenhalts des neuen deutschen Kaiserreichs gegen uere
Feinde vereinnahmt zu werden. Neben der Erinnerungsfunktion ist hier die
auf die Zukunft ausgerichtete politische Indienstnahme deutlich zu erkennen.
Auf den Gegenwart und Zukunft in den Blick nehmenden integrationspo-
litischen Aspekt der Denkmler fr die Gefallenen der deutschen Einigungs-
kriege verweist zudem der Umstand, da die geradezu massenhafte, zumeist
von militrischen Kreisen oder Angehrigen des Brgertums initiierte Er-
richtung derartiger Monumente von staatlicher Seite durchaus gefrdert wur-
de.
32
Diese geradezu massenhafte Errichtung von Kriegerdenkmlern schlug
sich nicht nur in den Haupt- und Residenzstdten, sondern selbst in kleineren
Gemeinden nieder. Deutlich mehr Menschen konnte man auf diese Weise mit
der politischen Botschaft jener Monumente konfrontieren. Verstrkt werden
mute die erhoffte Wirkung noch dadurch, da es sich ja nicht nur um Krie-
gerdenkmler, sondern vor allem auch um Siegesdenkmler handelte.
Zwei besondere Charakteristika der Kriegerdenkmler fr die Gefallenen
der deutschen Einigungskriege verdienen noch eigens erwhnt zu werden.
Der Umstand, da in vielen Stdten bzw. Gemeinden des neu gegrndeten
Deutschen Reiches ein solches Denkmal errichtet wurde, fhrte dazu, da auf
ihnen die Namen aller Gefallenen der jeweiligen Stadt, des jeweiligen Ortes
verzeichnet werden konnten. Oft wurden sogar Geburts- und Sterbetag sowie
der militrische Rang hinzugefgt. Diese individuelle Namensnennung wurde
dann auch bei den Kriegerdenkmlern fr die Gefallenen des Ersten und des
Zweiten Weltkrieges praktiziert.
Gleichermaen erwhnenswert ist, da die Erinnerung an die Gefallenen
nach 1871 viel seltener im sakralen Raum der Kirchen gepflegt wurde.
33
Man
31 Vgl. hierzu KOSELLECK, Kriegerdenkmale (Anm. 12), 267. Koselleck weist hier beson-
ders auf Denkmler in und um Bad Kissingen (Rhn) hin. V gl. dazu auch: Fhrer zu den
Kriegergrbern und Kriegermalen aus dem deutschen Bruderkriege 1866 in und um Bad
Kissingen, Bad Kissingen 1935.
32 h
Vgl. ierzu Lurz, Kriegerdenkmler (Anm. 12), Bd. 2, 144-167.
33
In den Drfern wurde allerdings oft noch die alte Tradition weitergepflegt; es wurde also
auch fiir die Gefallenen des Krieges von 1870/71 eine Gedenktafel in der Kirche ange-
Kriegerdenkmler
213
verzeichnete deren Namen vielfach nicht mehr auf den erwhnten Tafeln in
den Kirchen, sondern meielte sie auf Monumente, die auf ffentlichen Plt-
zen errichtet wurden. Somit verwandelte sich die Ehrung der Gefallenen end-
gltig zu einer Art von profanem Heiligenkult, der auch auf das hohe Identi-
fikations- und Integrationsbedrfnis im noch jungen kleindeutschen Kaiser-
reich von 1871 verweist.
8. Das Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Mit dem Ersten Weltkrieg kam eine weitere, eine neue Form des Gedenkens
an die gefallenen Soldaten hinzu. Schon am Ende des Krieges von 1870/71
hatten Deutschland und Frankreich vereinbart, den Toten, die im Feindesland
in Massengrbern bestattet worden waren, dort ein ewiges Ruherecht zu ge-
whren.
34
Doch erst im Laufe des Ersten Weltkrieges wurde diese Regelung
von allen kriegfhrenden Mchten als verbindlich anerkannt. Die gleichfalls
whrend des Ersten Weltkrieges eingefhrten Erkennungsmarken fr jeden
einzelnen Soldaten machten zum ersten Mal die Identifizierung fast aller To-
ten mglich. Unter diesen Voraussetzungen konnten Soldatenfriedhfe ent-
stehen, etwa an der ehemaligen deutsch-franzsischen Front, mit ihren schier
endlosen Reihen von Einzelgrbern, auf deren Stelen oder Kreuzen jeweils
nur ein Name verzeichnet ist. 35
Gleichzeitig waren weiterhin Stdte und Gemeinden, schlielich sogar ein-
zelne Vereine, Betriebe und Behrden bemht, das Gedenken an ,ihre' Toten
auch in der Heimat wachzuhalten. Erste Initiativen zur Errichtung von Denk-
mlern, auf denen die Namen der Gefallenen des Ersten Weltkrieges ver-
zeichnet wurden, gab es bereits 1914/15. Die staatlichen Behrden reagierten
jedoch ablehnend, da alle Anstrengungen der Bevlkerung auf die Erringung
des Sieges gerichtet bleiben sollten. Die Bemhungen um Kriegerdenkmler
noch whrend des Krieges wurden dagegen als dem Durchhaltewillen des
deutschen Volkes abtrglich angesehen. Es wurden im Frhjahr 1916
schlielich sogar eigene staatliche Beratungsstellen eingerichtet, die zumin-
dest auf die Gestaltung der neu entstehenden Monumente Einflu nehmen
34
35
bracht. Auf der in der Irseer Klosterkirche hngenden Tafel rur den Krieg von 1870/71
sind darber hinaus sogar alle 35 Kriegsteilnehmer verzeichnet, davon einer als vermit
und zwei als gefallen.
'!. gl. hierzu MEINHOLD LURZ, Architektur fiir die Ewigkeit und dauerndes Ruherecht.
Uberlegungen zu Gestalt und Aussage von Soldatenfriedhfen, in: MAI / SCHMIRBER,
Denkmal (Anm. 5), 81-91, hier 82.
Vgl. hierzu LURZ, Architektur (Anm. 34), 81-91; GEORGE L. MOSSE, Soldatenfriedhfe
und nationale Wiedergeburt. Der Gefallenenkult in Deutschland, in: KLAUS VONDUNG
(Hrsg.), Kriegserlebnis. Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und symboli-
schen Deutung der Nationen, Gttingen 1980, 241-261.
214
Katharina Weigand
sollten.
36
Folge dieser restriktiven Politik war, da eine Vielzahl von Krieger-
denkmlern fr die Gefallenen des Ersten Weltkrieges erst etliche Jahre nach
dem Kriegsende von 1918 errichtet wurden.
37
Eine Ausnahme bildeten ledig-
lich kleinere Gemeinden, wo man mitunter auf den bereits vorhandenen
Denkmlern fr die Toten des Krieges von 1870171 die Namen der Gefalle-
nen aus den Jahren 1914 bis 1918 hinzufgte.
9. Die politische Sinnstiftung des Todes nach
der militrischen Niederlage von 1918
Nach der militrischen Niederlage des Deutschen Reicnes und den politischen
Erschtterungen auf Grund des Sturzes der Monarchie mute eine politische
Sinnstiftung des Todes einer zudem so ungeuerlich groen Zahl von gefalle-
nen Soldaten uerst schwierig werden. Verklrende Siegesdenkmale wie
nach dem Krieg von 1870171, bei denen der Stolz ber die Taten der Gefalle-
nen den Schmerz der Angehrigen hatte mildem sollen, waren vorderhand
nicht mehr vorstellbar. Statt dessen herrschte bei ersten Denkmalinitiativen
Trauer, ja Sprachlosigkeit angesichts des Massensterbens an der Front vor. Je
mehr aber die Erinnerung an die Schrecken des Krieges verblate und die
nationalistische Emotionalisierung im Gefolge des Versailler Friedensvertra-
ges zunahm, umso strker traten Pathos und Heroisierung des einzelnen Sol-
daten in den Aussagen der neu errichteten Kriegerdenkmler in den Vorder-
grund. Die Gefallenen wurden oft geradezu sakralisiert und ausnahmslos,
ohne Unterscheidung der Dienstgrade, zu ,Helden' stilisiert. Thren Tod stellte
man als ein freiwilliges, zur Nachahmung aufforderndes Opfer fr Nation und
Vaterland dar. Da vor allem Veteranen- und Kriegervereine bei der Initiie-
rung und Gestaltung dieser Denkmler eine fhrende Rolle spielten, wurden
darber hinaus die Betonung und das Lob der Kriegskameradschaft zu einem
Thema der nach 1918 errichteten Monumente.
38
Auch diese Kriegerdenkmler lassen sich somit einerseits als nachmalige,
von der sich rasch wandelnden politischen Situation nach 1918 mageblich
beeinflute Deutung des vorausgegangenen Kriegsgeschehens interpretieren.
Andererseits - und auch hier spielten politische Zielsetzungen eine nicht zu
unterschtzende Rolle - mu man die Kriegerdenkmler gleichermaen als
36 V gl. hierzu GERHARD SCHNEIDER, " ... nicht umsonst gefallen"? Kriegerdenkmler und
Kriegstotenkult in Hannover, Hannover 1991, 125.
37 In Wrzburg wurde z.B. erst 1931 ein Denkmal fr die Gefallenen des Ersten Weltkrie-
ges errichtet. V gl. PETER SPRlNGER, Denkmal und Gegendenkmal, in: MAI I SCHMIRBER,
Denkmal (Anm. 5), 92-102, hier 92ff.
38 Beispiele sowohl fr Kriegerdenkmler, die Trauer und Sprachlosigkeit ausdrcken, als
auch fr solche, die fr Trotz und den Aufruf zur Revanche nach dem verlorenen Ersten
Weltkrieg stehen, bei: NICOLAI I POLLACK, Kriegerdenkmale (Anm. 12).
Kriegerdenkmler
215
Identifikationsangebot an die berlebenden und Nachgeborenen verstehen.
Bezeichnenderweise kam es, vor allem zum Ende der Weimarer Republik
hin, zur vermehrten Aufstellung von Monumenten, die mit Statuen des Typs
des ,trotzigen Kriegers' sowie dem Motto "Und Thr habt doch gesiegt" verse-
hen wurden.
Die bei den zwischen 1918 und 1933 errichteten Kriegerdenkmlern hu-
fig anzutreffende direkte Mahnung an die nachfolgende Generation, das "Op-
fer" der "Helden" des Ersten Weltkrieges nicht sinnlos werden zu lassen
(Motto: "Thr seid nicht umsonst gefallen"39), sondern statt dessen an der Wie-
deraufrichtung Deutschlands krftig mitzuwirken (Motto: "Deutschland mu
leben - und wenn wir sterben mssen"40), eignete sich dann freilich vortreff-
lich fr die Instrumentalisierung der Kriegerdenkmler im Dienst der natio-
nalsozialistischen Propaganda.
10. Kriegerdenkmler in der Zeit des Nationalsozialismus
Grundstzlich mu man festhalten, da Denkmler zu allen Zeiten Medien
der ffentlichen sowie der politischen Erinnerungskultur waren und sind.
Gleichwohl stehen die Jahre 1933 bis 1945 fr eine Zeitspanne, whrend der
in Deutschland Kunst und Kultur im allgemeinen, besonders aber die Archi-
tektur in zuvor unbekanntem Ausma politisiert sowie rcksichtslos fr Pro-
pagandazwecke mibraucht wurden.
41
Dazu zhlen auch die Denkmler. Und
doch entstanden zwischen 1933 und 1945, im nationalsozialistischen
Deutschland, vergleichsweise wenig Denkmler, die dem traditionellen Typ
des Herrscherdenkmals, dem Typ des Nationaldenkmals oder dem Typ des
Knstlerdenkmals entsprachen.
Einige knappe Stichworte hinsichtlich der Grnde fr diese Abstinenz
mssen in diesem Zusammenhang freilich gengen: Der revolutionre An-
spruch der nationalsozialistischen Ideologie spielte hier ebenso eine Rolle,
39 Dieser Spruch war etwa an dem 1933 fr die Gefallenen des Ersten Weltkrieges errich-
teten Kriegerdenkmal in Stralsund zu lesen. V gl. NICOLAI I POLLACK, Kriegerdenkmale
(Anm. 12), 80.
40 So lautet die letzte Zeile des "Soldatenabschiedsliedes" von Heinrich Lersch aus dem
Jahre 1914. Vgl. hierzu LURZ, Kriegerdenkmler (Anm. 12), Bd. 5, 16 sowie 407,
Anm. 24 und 408, Anm. 28. Gedruckt ist das "Soldatenabschiedslied" von Heinrich
Lersch in: KURT ZIESEL (Hrsg.), Krieg und Dichtung. Soldaten werden Dichter - Dichter
werden Soldaten. Ein Volksbuch, Wien 1943,20.
41 Vgl. hierzu u.a. HILDEGARD BRENNER, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Rein-
bek bei Hamburg 1963; GEORG BUSSMANN (Hrsg.), Kunst im 3. Reich. Dokumente der
Unterwerfung, Frankfurt a.M. 31975; JOST DLFFERI JOCHEN THIES I JOSEF HENKE,
Hitlers Stdte. Baupolitik im Dritten Reich, Kln I Wien 1978; JOSEPH WULF, Die bil-
denden Knste im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Frankfurt a.M. I Berlin 1983;
BARBARA MILLER LANE, Architektur und Politik in Deutschland 1918-1945, Braun-
schweig I Wiesbaden 1986.
216
Katharina Weigand
wie die Kritik an der statischen Unbeweglichkeit der Denkmler und vor al-
lem die Zurckweisung der in den meisten traditionellen Monumenten greif-
baren Inividualitt des oder der Dargestellten.
42
Ein zwischen 1933 und 1945 dagegen von Staat und Partei stark gefrder-
ter Typ von Denkmlern waren die Kriegerdenkmler. Das betraf sowohl
kleinere Denkmler in Stdten und Gemeinden als auch Gedenksttten in
Verbindung mit den rur viele Stdte geplanten Parteiforen, bis hin zu einem
fiir Berlin geplanten monumentalen Triumphbogen,43 auf dem die Namen
aller whrend des Ersten Weltkrieges gefallenen deutschen Soldaten einge-
meielt werden sollten. Das bekannteste Beispiel fiir den nationalsozialisti-
schen Toten- und Erinnerungskult im Medium des Denkmals sind die beiden
von Paul Ludwig Troost entworfenen "Ehrentempel" am Knigsplatz in
Mnchen. In zwei an Wachhuser erinnernden, offenen Pfeilerhallen wurden
1935 die Sarkophage der sechzehn, im November 1923 bei Hitlers geschei-
tertem Putschversuch vor der Mnchner Feldhermhalle umgekommenen
"Blutzeugen" aufgestellt. Die gleichzeitige architektonische Umgestaltung
des gesamten Knigsplatzes sowie seine Sperrung fiir den Verkehr sollten
eine zustzliche Sakralisierung des gesamten Areals bewirken. Alljhrlich am
Jahrestag des Putsches sowie am Geburtstag von Adolf Hitler wurde hier ein
militrisches Ritual zelebriert, das darauf zielte, alle "Volksgenossen" in die
Pflicht der sechzehn "Blutzeugen" zu nehmen und zur Nachahmung aufzu-
fordern. Der Mnchner Knigsplatz, der nun gleichzeitig zum Grabmal wie
zum militrischen Aufinarschgelnde mitten in der Stadt geworden war, pr-
sentierte sich damit als Mahn- und Ehrenmal fiir die "Mrtyrer der Bewe-
gung". Zudem hnelte der Platz einem berdimensionierten Kriegerdenkmal,
nicht zuletzt weil die Toten von 1923 bewut in den Rang von "Helden",
hnlich den Gefallenen des Ersten Weltkrieges, erhoben wurden.
44
42 Dies ist etwas ausfiihrlicher nachzulesen in: KATHARINA WEIGAND, Das Denkmal im
Nationalsozialismus, in: KRNER / WEIGAND, Denkmler (Anm. 5), 29-33. Vgl. hierzu
auch HUBERT SCHRADE, Das deutsche Nationaldenkmal. Idee, Geschichte, Aufgabe,
Mnchen 1934; HANS-ULRICH THAMER, Nationalsozialismus und Denkmalkult, in: Hi-
storische Denkmler. Vergangenheit im Dienste der Gegenwart?, Bergisch Gladbach
1994,9-35.
43 Vgl. hierzu u.a. WOLFGANG SCHCHE, Als aus Berlin "Germania" werden sollte. Zum
Verhltnis der "Neugestaltungsplanungen" zu Kriegs- und Todeskult, in: HELMUT EN-
GEL / WOLFGANG RIBBE (Hrsg.), Hauptstadt Berlin. Wohin mit der Mitte? Historische,
stdtebauliche und architektonische Wurzeln des Stadtzentrums, Berlin 1993, 161-168,
hier 164f.; WULF, Knste (Anm. 41), Abb. 33.
44 Zur Umgestaltung des Mnchner Knigsplatzes zur Zeit der nationalsozialistischen Herr-
schaft vgl. HANS-PETER RAsp, Eine Stadt fiir tausend Jahre. Mnchen - Bauten und
Projekte fiir die Hauptstadt der Bewegung, Mnchen 1981, 23-26; KARL ARNDT, Die
NSDAP und ihre Denkmler oder: das NS-Regime und seine Denkmler, in: MAI /
SCHMIRBER, Denkmal (Anm. 5), 69-80, hier 69-75; ANDREA BRNREUTHER, Revision
der Modeme unterm Hakenkreuz. Planungen fiir ein "neues Mnchen", Mnchen 1993,
82-94; HANS LEHMBRUCH, Acropolis Germaniae. Der Knigsplatz - Forum der
_ 1-
Kriegerdenkmler
217
Im Mittelpunkt des nationalsozialistischen Totenkultes standen gleichwohl
die Gefallenen des Ersten Weltkrieges selbst. Der fiir Berlin geplante Tri-
umphbogen wurde bereits erwhnt; ihm sollte noch eine riesige Kuppelhalle,
die "Soldatenhalle", zur Ehrung der Gefallenen zur Seite gestellt werden.
Aber auch rur andere Stdte, die lngst ein Kriederdenkmal rur die gefallenen
Soldaten von 1914/18 besaen, planten die Nationalsozialisten weitere Ge-
denksttten. In Mnchen wollte man neben dem Armeemuseum eine "Halle
der Helden" errichten.
45
Und selbst fiir kleinere Orte, wie z.B. rur Kochel am
See, existierten hnliche Planungen.
46
Die Totenehrungen, die dann bei solchen Kriegerdenkmlern htten insze-
niert werden sollen, zielten darauf ab, eine geradezu "kultische[n] Verbin-
dung von Menschenrnassen und Architektur"47 herzustellen, was in Anstzen
schon bei den jhrlichen Gefallenenehrungen auf dem Nrnberger Reichs-
parteitagsgelnde beobachtet werden kann. An diesen Orten verschmolz die
Ehrung der Gefallenen des Ersten Weltkrieges dann bezeichnenderweise doch
wieder mit derjenigen der "Mrtyrer der Bewegung".
Die bei Kriegerdenkmlern bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gene-
rell bliche Mahnung an die Lebenden, dem Opfer der Toten durch eigene
Anstrengung auch nachtrglich einen Sinn zu verleihen, wurde unter den Na-
tionalsozialisten dahin gesteigert, die Bevlkerung "gezielt durch Denkmal-
propaganda auf den kommenden Krieg"48 vorzubereiten. So gingen die Na-
tionalsozialisten weit ber den traditionell bei den Kriegerdenkmlern zu
konstatierenden Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hinaus.
Das wurde auch bei solchen Denkmlern angestrebt, die nicht zu den geplan-
ten Parteiforen gehrten und bei denen sich noch fters figrliche Darstellun-
gen finden - trotz aller Ablehnung des Individuellen sowie der Bevorzugung
rein architektonischer Denkmalformen.
49
Whrend in der Weimarer Republik,
wie bereits erwhnt, zumindest vereinzelt Trauer oder Verzweiflung ber
Krieg und Tod thematisiert worden waren, standen nun, zwischen 1933 und
1945, endgltig Trotz, Aufforderung zur Revanche und Kampfbereitschaft im
Vordergrund der Darstellung.
NSDAP, in: IRIS LAUTERBACH / JULIAN ROSEFELDT / PIERO STEINLE (Hrsg.), Brokratie
und Kult. Das Parteizentrum der NSDAP am Knigsplatz in Mnchen. Geschichte und
Rezeption, Mnchen / Berlin, 1995, 17-45. Zum nationalsozialistischen Totenkult im
allgemeinen vgl. SABINE BEHRENBECK, Der Kult um die toten Helden. Nationalsoziali-
stische Mythen, Riten und Symbole 1923 bis 1945, Vierow 1996.
45 Vgl. hierzu RAsp, Stadt (Anm. 44), 64f.; BRNREUTHER, Revision (Anm. 44), 216-220.
46 Vgl. hierzu WINFRIED NERDINGER (Hrsg.), Bauen im Nationalsozialismus. Bayern 1933-
1945, Mnchen 1933, 347.
47 BERTHOLD HINZ, Die Malerei im deutschen Faschismus. Kunst und Konterrevolution,
Mnchen 1974, 132.
48 LURZ, Kriegerdenkmler (Anm. 12), Bd. 5, 18.
49 Vgl. die Abbildungen in: SIEGFRIED SCHARFE (Hrsg.), Deutschland ber Alles. Ehren-
male des Weltkrieges, Knigstein i.T. / Leipzig 1940.
218
Katharina Weigand
Aber auch einige der kaum als aggressiv zu deutenden Kriegerdenkmler,
die in der Zeit der Weimarer Republik errichtet worden waren, fanden die
Billigung der Partei. Dazu gehrte z.B. das Mnchner Kriegerdenkmal vor
dem frheren Armeemuseum, das auf Grund der vllig entindividualisierten
Darstellung eines Gefallenen den Vorstellungen der Nationalsozialisten oh-
nehin weitgehend entsprach. 50 Thre letzte Steigerung erfuhr die Idee der Krie-
gerdenkmler im "Dritten Reich" in den von Wilhelm Kreis entworfenen
"Totenburgen". In bersteigerter Monumentalitt sollten sie rings an den
Grenzen eines siegreichen, vergrerten "Deutschen Reiches" entstehen, als
Ehrensttten rur die "Helden", die fiir Deutschland whrend des Zweiten
Weltkrieges gefallen waren, gleichzeitig aber auch als. martialische Monu-
mente der Abschreckung gegen alle noch verbliebenen Feinde.
51
Fr die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kann man, wenn es zu Denkmal-
neuschpfungen kam, von einem grundstzlichen Wandel in Aussage und
Form der Kriegerdenkmler in Deutschland sprechen. Heroisierung der Ge-
fallenen, trotziges Aufbegehren gegen die militrische Niederlage und der
Appell zur Nachahmung der Soldaten gehren inzwischen nicht mehr zum
gebruchlichen Repertoire. Die Trauer ber den Tod unzhliger Soldaten, nun
aber auch ber den Tod von Zivilisten, und darber hinaus die Einbeziehung
der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in das ffentliche Ge-
denken sind charakteristisch rur die nach 1945 entstandenen Denkmler. Fr
sie pat damit freilich die Bezeichnung ,Kriegerdenkmal' nicht mehr, fiir sie
erscheint vielmehr der allgemeinere Begriff ,Mahnmal' angemessen -
Mahnmale, die gegen den Krieg gerichtet sind.
50 Vgl. hierzu HELMUT SCHARF, Kleine Kulturgeschichte des deutschen Denkmals, Darm-
stadt 1984,274-277.
51 Vgl. hierzu EKKEHARD MAI, Vom Bismarckturm zum Ehrenmal. Denkmalformen bei
Wilhelm Kreis, in: MAI 1 SCHMIRBER, Denkmal (Anm. 5), 50-57, hier 55f.; EKKEHARD
MAI, Von 1930 bis 1945: Ehrenmler und Totenburgen, in: WINFRIED NERDINGERI
EKKEHARD MAI (Hrsg.), Wilhelm Kreis. Architekt zwischen Kaiserreich und Demokratie
1873-1955, Mnchen 1 Berlin 1994, 156-167.
_ 1-
Katharina Weigand
Politische und religise Sinngebung
des Gefallenengedenkens
Die Gedenktafeln und das Kriegerdenkmal in Markt Irsee
l
1. Gefallenengedenken in der ehemaligen Klosterkirche Irsee
In der ehemaligen Irseer Klosterkirche im Ostallgu (Patrozinien: Peter und
Paul und Mariae Himmelfahrt) findet man auer zahlreichen, seit 1860 in die
Vorhalle der Kirche transferierten Grabplatten von bten des vormaligen
Klosters eine Vielzahl von Tafeln, die die Erinnerung an die Gefallenen des
Ortes bzw. der Pfarrei Irsee
2
wachhalten sollen.
1 Der Schwerpunkt der zeitgeschichtlichen Irseer Erinnerungskultur liegt unstrittig im
Gedenken an die Euthanasieopfer der ehemaligen Heil- und Ptlegeanstalt Kaufbeuren-
Irsee whrend der Zeit des Nationalsozialismus. Zur Euthanasie in Irsee vgl. MARTIN
SCHMIDT 1 ROBERT KUHLMANN 1 MICHAEL VON CRANACH, Heil- und Ptlegeanstalt
Kaufbeuren, Psychiatrie und Nationalsozialismus, in: MICHAEL VON CRANACH 1 HANs-
LUDWIG SIEMEN (Hrsg.), Psychiatrie im Nationalsozialismus. Die bayerischen Heil- und
Ptlegeanstalten zwischen 1933 und 1945, Mnchen 1999, 265-325; ULRICH PTZL, So-
zialpsychiatrie, Erbbiologie und Lebensvernichtung. Valentin Faltlhauser, Direktor der
Heil- und Ptlegeanstalt Kaufbeuren-Irsee in der Zeit des Nationalsozialismus (Abhand-
lungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, Bd. 75), Husum 1995.
Zum Euthanasiemahnmal und zur Gedenksttte in Irsee vgl. RAINER JEHL, Kultur des
Gedenkens - Kunst des Erinnerns. Euthanasiemahnmal und -gedenksttte bei Kloster Ir-
see, in: Freiburger RundbriefNF (erscheint demnchst). - Doch auch fr die Gefallenen
der Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts lt sich in Irsee eine reiche Gedenkkultur beob-
achten. Hier sollen lediglich einige Beobachtungen zum Kriegergedenken in Irsee nie-
dergelegt werden; einen umfassenden berblick macht die eher schmale Quellenbasis
unmglich. Eine Vielzahl von Informationen wurde den drei Protokollbchern des Irseer
Veteranenvereins entnommen. Das erste Protokollbuch ("Chronik-Heft") des 1873 ge-
grndeten Irseer Veteranenvereins umfat die Jahre 1874 bis 1912, das zweite ("Jahr-
buch Veteranenverein") die Jahre 1913 bis 1943. Das aktuelle Protokollbuch ("Beschlu-
Buch") beginnt 1951 mit der Wiederbegrundung des Irseer Veteranenvereins nach dem
Zweiten Weltkrieg. Weitere Informationen stammen aus Zeitungsartikeln sowie mndli-
chen Ausknften von Irseer Biligern. Mein besonderer Dank gilt in diesem Zusammen-
hang dem 1. Vorsitzenden des Irseer Veteranenvereins, Herrn Gnter Fischer, der mir die
Benutzung der Protokollbcher ermglichte. Mein Dank gilt ferner den Herren Ignaz
Spingier und Willibald Mller aus Irsee sowie Dr. Dr. Artton Losinger, seit Juli 2000
Weihbischof in Augsburg und seinerzeitigem Pfarrer von Irsee, vor allem aber dem Wis-
senschaftlichen Bildungsreferenten der Schwabenakademie Irsee, Herrn Dr. Markwart
Herzog. Hilfreich waren darber hinaus einige zeitgenssische Photos aus der Sammlung
von Herrn Franz Abfalter (Irsee).
2 Mit der Skularisation des Klosters 1802/03 wurde die ehemalige Klosterkirche zur
Pfarrkirche von Irsee. Die ursprngliche Irseer Pfarrkirche St. Stephan wurde dem Ver-
Das könnte Ihnen auch gefallen
- BanksyDokument3 SeitenBanksytdaxueNoch keine Bewertungen
- Culture Stone FlyerDokument2 SeitenCulture Stone FlyerMiran FlegoNoch keine Bewertungen
- Daniil Charms deDokument24 SeitenDaniil Charms deXenia VargovaNoch keine Bewertungen
- Toki-Pona LehrbuchDokument96 SeitenToki-Pona Lehrbuchnecronirv100% (1)
- Das Deutsche Kaiserreich Von 1871 Als Nationalstaat PDFDokument188 SeitenDas Deutsche Kaiserreich Von 1871 Als Nationalstaat PDFWagaJabal0% (1)
- Dossier Migrationsliteratur PDFDokument95 SeitenDossier Migrationsliteratur PDFFedericaAbramoNoch keine Bewertungen
- FB 2013 Wahlsonderausgabe 2013 Web BayernparteiDokument24 SeitenFB 2013 Wahlsonderausgabe 2013 Web BayernparteikkrouchNoch keine Bewertungen
- Edel - Altägyptische GrammatikDokument778 SeitenEdel - Altägyptische GrammatikSa-Ra100% (5)
- Der Teufel War Ein NachrichtenmannDokument4 SeitenDer Teufel War Ein Nachrichtenmannborichdaco100% (2)
- TamiDokument3 SeitenTamimaggieNoch keine Bewertungen
- Römischer Kalender (Wikipedia)Dokument11 SeitenRömischer Kalender (Wikipedia)ThriwNoch keine Bewertungen
- FWTM Stadtplan deDokument2 SeitenFWTM Stadtplan demignonettemegNoch keine Bewertungen
- Geld - Und Münzgeschichte Des Bistums Minden / Von E. StangeDokument200 SeitenGeld - Und Münzgeschichte Des Bistums Minden / Von E. StangeDigital Library Numis (DLN)Noch keine Bewertungen
- Midgard - Konvertierung Abenteurer PDFDokument6 SeitenMidgard - Konvertierung Abenteurer PDFMatthew HaydenNoch keine Bewertungen
- Reflexionsarbeit Überzeugend ArgumentierenDokument3 SeitenReflexionsarbeit Überzeugend ArgumentierenFalkKaNoch keine Bewertungen
- Monopol (10-2017) - 1017Dokument148 SeitenMonopol (10-2017) - 1017JavierPerisSabater0% (1)
- 1 JagdfieberDokument35 Seiten1 JagdfieberfarmsteadNoch keine Bewertungen
- Amann Ermittlung NaehfadenbedarfDokument16 SeitenAmann Ermittlung Naehfadenbedarfnamedo9531Noch keine Bewertungen
- Kontaktversuche VoynichmanuskriptDokument4 SeitenKontaktversuche VoynichmanuskriptNico NeubauerNoch keine Bewertungen
- PenunsDokument24 SeitenPenunsQuant WellenbergNoch keine Bewertungen
- Forschungs - Und Reisebericht Nationale Denkmäler in BulgarienDokument10 SeitenForschungs - Und Reisebericht Nationale Denkmäler in BulgarienYvonne Chadde100% (1)