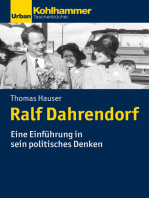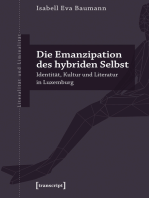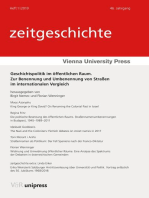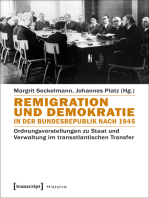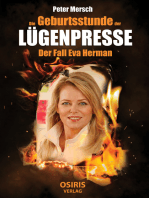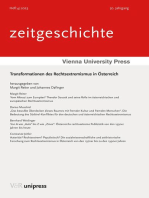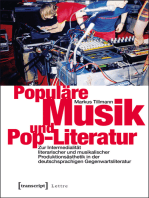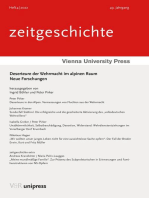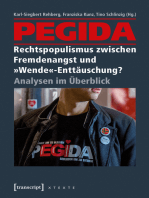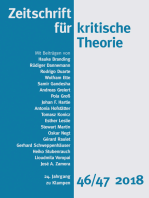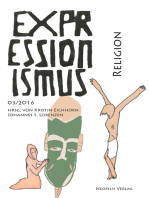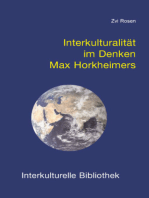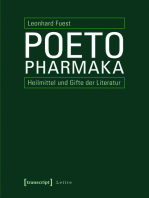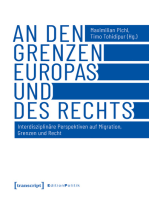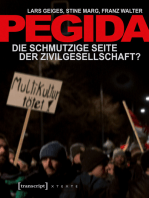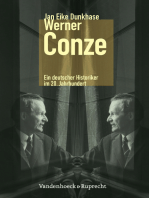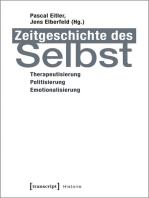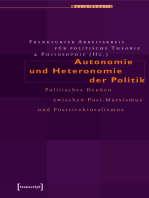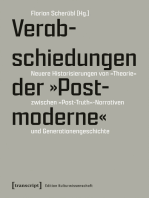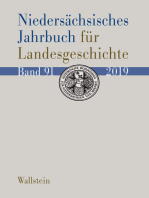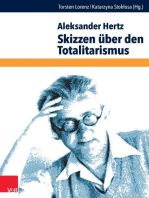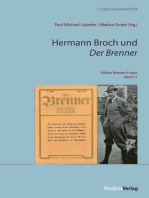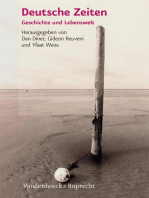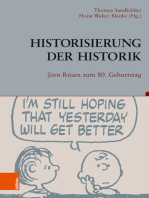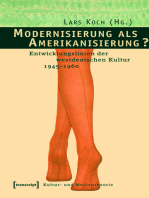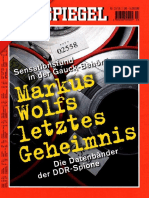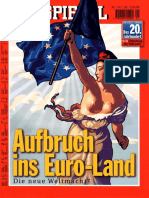Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ZFP 05 01
Hochgeladen von
artes2009Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
ZFP 05 01
Hochgeladen von
artes2009Copyright:
Verfügbare Formate
ZCOV_ZfP_1_2005_Druck
11.03.2005
10:38 Uhr
ZfP
Seite U1
Zeitschrift
fr Politik
Organ der Hochschule fr Politik Mnchen
Herausgeber
Schwerpunkt:
Dietmar Herz
Franz Knpfle
Peter Cornelius Mayer-Tasch
Armin Nassehi
Heinrich Oberreuter
Sabine von Schorlemer
Theo Stammen
Roland Sturm
Hans Wagner
Wulfdiether Zippel
Kultur und Politik.
Zum 20. Todestag von Eric Voegelin
Birgit Schwelling
Kulturwissenschaftliche Traditionslinien in der
Politikwissenschaft: Eric Voegelin revisited
Winfried Thaa
Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber
und Hannah Arendt
Horst Feldmann
Politische Implikationen der kulturellen
Evolution
2005
52. Jahrgang
Mrz 2005
Seite 1138
ISSN 0044-3360
8540 F
Nomos
Auerhalb des Schwerpunktes:
Yehudit Ronen
Religions at War, Religions at Peace: The Case
of Sudan
Ingo Juchler
Rationalitt, Vernunft und erweiterte
Denkungsart
00_ZfP_IVZ.fm Seite 1 Freitag, 11. Mrz 2005 2:22 14
ZfP Zeitschrift fr Politik
Organ der Hochschule fr Politik Mnchen
Gegrndet im Jahre 1907 durch Adolf Grabowsky und Richard Schmidt
1/2005
52. Jahrgang
(Neue Folge)
Seite 1138
Herausgeber: Prof. Dr. Dietmar Herz, Universitt Erfurt; Prof. Dr. Franz Knpfle, Universitt Augsburg; Prof. Dr. Peter Cornelius Mayer-Tasch, Universitt Mnchen; Prof. Dr. Armin
Nassehi, Universitt Mnchen; Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Oberreuter, Universitt Passau;
Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer, Technische Universitt Dresden; Prof. Dr. Theo Stammen,
Universitt Augsburg; Prof. Dr. Roland Sturm, Universitt Erlangen; Prof. Dr. Hans Wagner,
Universitt Mnchen; Prof. Dr. Wulfdiether Zippel, Technische Universitt Mnchen
Redaktion: Prof. Dr. Dr. Hans-Martin Schnherr-Mann, Universitt Mnchen
Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Ulrich Beck; Prof. Dr. Alain Besanon; Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Karl Dietrich Bracher; Dr. Friedrich Karl Fromme; Prof. Dr. Utta Gruber; Prof. Dr.
Dr. h.c. Werner Gumpel; Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hberle; Prof. Dr. Wilhelm Hennis;
Prof. Dr. Peter Graf Kielmansegg; Prof. Dr. Leszek Kolakowski; Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann
Lbbe; Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Maier; Prof. Dr. Harvey C. Mansfield; Prof. Dr. Dr. h.c.
Dieter Oberndrfer; Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Jrgen Papier; Prof. Dr. Roberto Racinaro;
Prof. Dr. Hans Heinrich Rupp; Prof. Dr. Dr. h.c. Fritz Scharpf; Prof. Dr. Charles Taylor
Inhalt
Schwerpunkt: Kultur und Politik. Zum 20. Todestag von Eric Voegelin
Birgit Schwelling
Kulturwissenschaftliche Traditionslinien in der Politikwissenschaft:
Eric Voegelin revisited .......................................................................................... 3
Winfried Thaa
Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt .......... 23
Horst Feldmann
Politische Implikationen der kulturellen Evolution ...................................... 57
Auerhalb des Schwerpunktes:
Yehudit Ronen
Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan ............................. 80
Ingo Juchler
Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.................................... 97
Buchbesprechungen.......................................................................................... 122
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 2 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Autoren dieses Heftes
PD Dr. rer. pol. Horst Feldmann, Privatdozent fr Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultt der Universitt Tbingen
Prof. Dr. Ingo Juchler, Professor fr Didaktik der Sozialkunde an der Universitt Augsburg
Dr. Yehudit Ronen, Senior Lecturer and Researcher, The Political Science Department, Bar-Ilan
University and the Dayan Center, Tel Aviv University
Dr. Birgit Schwelling, Wissenschaftliche Assistentin an der Kulturwissenschaftlichen Fakultt der
Europa-Universitt Viadrina Frankfurt (Oder)
Prof. Dr. Winfried Thaa, Professor fr Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universitt
Trier
ZfP
Zeitschrift
fr Politik
Organ der Hochschule fr Politik Mnchen
Redaktion: Prof. Dr. Dr. Hans-Martin Schnherr-Mann,
Hochschule fr Politik, Ludwigstrae 8, 80539 Mnchen.
Alle Beitrge sind an die Redaktion zu adressieren. Dasselbe
gilt fr Rezensionsexemplare. Beitrge werden nur zur ausschlielichen Alleinverffentlichung angenommen. Die
Annahme zur Verffentlichung muss schriftlich erfolgen.
Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle
Rechte zur Verffentlichung, auch das Recht der weiteren
Vervielfltigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Fr Manuskripte
und Bcher, die unaufgefordert eingesandt werden, wird
keine Haftung bernommen.
Internet: www.ZfP.mhn.de Email: ZfP@mhn.de
Verlag: NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Postfach 100 310, 76484 Baden-Baden, Telefon 0 72 21 / 21
04-0, Telefax 0 72 21 / 21 04-43.
Nachdruck und Vervielfltigung: Die Zeitschrift und alle
in ihr enthaltenen einzelnen Beitrge sind urheberrechtlich
geschtzt. Jede Verwertung auerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulssig. Das gilt insbesondere fr Vervielfltigungen,
bersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bezugsbedingungen: Die Zeitschrift erscheint viermal im
Jahr. Jahrespreis 69, , fr Studenten und Referendare
(unter Einsendung eines Studiennachweises) jhrlich 52,
zuzglich Versandkosten. Einzelheft 18, zuzglich Versandkosten. Kndigung nur vierteljhrlich zum Jahresende.
Anzeigen: sales_friendly, Verlagsdienstleistungen, Bettina
Roos, Reichsstr. 45-47, 53125 Bonn, Telefon 02 28 / 9 26 88
35, Telefax 02 28 / 9 26 88 36, roos@sales-friendly.de.
Druckerei: NOMOS Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,
Postfach 100 310, 76484 Baden-Baden, Telefon 0 72 21 / 21
04-24, Telefax 0 72 21 / 21 04-79
ISSN 0044-3360
Hinweise fr Autoren zur Gestaltung der
Manuskripte
1. Manuskripte sollten der ZfP-Redaktion in 3
Exemplaren sowie als Datei eingereicht
werden.
2. Der Umfang eines Artikel sollte bei etwa 25
Seiten DIN A4, 1 1/2-zeilig geschrieben,
liegen. Schriftgre: 12 pt, neue Rechtschreibung.
3. Am Ende des Manuskripts ist eine deutsche
und eine englische Zusammenfassung zu
bringen, wobei die deutsche Fassung 10 Zeilen nicht berschreiten soll.
4. Es gibt kein Literaturverzeichnis am Ende
des Manuskripts; vielmehr werden in der
ZfP Literaturverweise und zitierte Literatur
ausschlielich in den Funoten (FN) in normaler Gro- und Kleinschreibung genannt,
Reihenfolge der Angaben, Hervorhebungen (Kursivschrift, Anfhrungszeichen) und
Interpunktion entsprechend den folgenden
Beispielen:
Bcher:
Christine Landfried, Das politische Europa,
Baden-Baden 2005, S.
Artikel:
Niklas Luhmann, Das Gedchtnis der Politik
in: Zeitschrift fr Politik, 2/1995, S. 109-121
oder
in: Buchzitation wie oben angegeben
Bei zwei oder mehr Autoren und zwei oder
mehr Erscheinungsorten wird der Schrgstrich/ verwendet; bei den Autoren mit jeweils
einer Leertaste vor und nach dem Schrgstrich, bei den Erscheinungsorten ohne Leerstellen.
Verwendete Abkrzungen: ebd., S. und
aaO. (FN), S.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 3 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling
Kulturwissenschaftliche Traditionslinien in der
Politikwissenschaft: Eric Voegelin revisited
1. Einleitung
Seit geraumer Zeit macht sich in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Perspektivenwandel bemerkbar, der Kultur zunehmend in das Zentrum des analytischen
Interesses und der wissenschaftlichen Betrachtungsweise rckt, und damit andere
Schlsselbegriffe, wie z.B. Gesellschaft ergnzt bzw. ablst.
Als Auslser dieser hufig mit dem Schlagwort cultural turn versehenen Fcher
bergreifenden Tendenz lassen sich bestimmte Problemkonstellationen ausmachen,
die sich den von klassischen Theorien bereitgestellten Erklrungsanstzen entziehen. Entwicklungen wie die nach dem Ende des Kalten Krieges ausgebrochenen
ethnischen Konflikte, zunehmende Fundamentalismen, weltweit zu beobachtende
Migrationsstrme oder auch der postkoloniale Selbstbehauptungsdiskurs haben zu
einer zunehmenden Sensibilitt fr kulturelle Differenzen gefhrt und die Diskussion um die Vor- und Nachteile einer verstrkten Ausrichtung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung auf Fragen der Kultur angestoen.
Verglichen mit Fchern wie beispielsweise der Geschichtswissenschaft oder Soziologie, reagiert die deutschsprachige Politikwissenschaft bisher eher zgerlich auf
den skizzierten Trend.1 Grnde fr diese Zurckhaltung mgen sein, dass Fragen
der Kultur innerhalb der Zunft entweder ganz ignoriert oder aber dem Forschungsfeld Politische Kulturforschung zugeordnet werden, dessen Kernbereich sich im Wesentlichen mit der Analyse von Einstellungen beschftigt.
1 Ein Indikator dafr ist, dass die Politikwissenschaft in berblicks- und Einfhrungsbnden, die die Kulturwissenschaften zum Thema haben, selten erwhnt wird. In dem
von Heide Appelsmeyer und Elfriede Billmann-Mahecha herausgegebenen Sammelband (Kulturwissenschaft. Felder einer prozeorientierten wissenschaftlichen Praxis,
Weilerswist 2001), der die Entwrfe kulturwissenschaftlicher Orientierung in den einzelnen Disziplinen zum Thema hat, und in dem ein breites Fcherspektrum von der
Soziologie ber die Ethnologie, Religionswissenschaft bis zur Psychologie vertreten ist,
fehlt die Politikwissenschaft beispielsweise gnzlich. Wenn in thematisch vergleichbaren Bnden berhaupt auf die Politikwissenschaft eingegangen wird, dann hufig nur
mit einem kurzen Verweis auf die Politische Kulturforschung, ohne dass neuere, davon
unabhngige Anstze zur Kenntnis genommen werden.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 4 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
Trotz dieser zu konstatierenden Zurckhaltung lassen sich inzwischen Anstze
erkennen, die Anregungen aus dem breiten Feld der Kulturwissenschaften aufnehmen. Auch wenn in diesen Studien auf den cultural turn nicht immer explizit Bezug
genommen wird, knnen doch im Bereich der Methodologie, der Theorie, der empirischen Forschungsinteressen und der erkenntnisleitenden Begrifflichkeit zahlreiche Anlehnungen an kulturwissenschaftliche Perspektiven ausgemacht werden. So
finden sich beispielsweise im Forschungsfeld Internationale Beziehungen konstruktivistische Anstze, neo-institutionalistisch ausgerichtete Arbeiten analysieren
Institutionen als symbolische Ordnungen, und interpretative Methoden und wissenssoziologische Kategorien werden in der Policy-Forschung eingesetzt.2
Was aber ist gemeint, wenn von kulturwissenschaftlichen Perspektiven die Rede
ist? Welche inhaltlichen und institutionellen Konsequenzen sind damit verbunden?
Es ist kaum mglich, das Programm, dem sich kulturwissenschaftliche Anstze
verschrieben haben, exakt einzugrenzen. Dieser von manchen als Schwche interpretierte Mangel an scharfen Konturen zeichnet fr andere gerade die Strke dieser
neuen Forschungsperspektive aus: Ihrer Idee und ihrer Praxis nach sind die Kulturwissenschaften offen, hybrid und eklektizistisch. Ihre offene Elastizitt3 ermgliche es gerade, agiler als traditionelle Fcher auf aktuelle und bergreifende Fragen
zu reagieren4 und damit auf bestimmte Engpsse der gegenwrtigen Ordnung der
Disziplinen zu antworten.
Auch wenn sich die Kulturwissenschaften durch eine programmatische Vielfalt
an theoretischen Einflssen, Konzepten und begrifflichen Grundlagen auszeichnen,
lassen sich dennoch einige gemeinsame Fluchtpunkte identifizieren, denen sich kulturwissenschaftliche Anstze verpflichtet fhlen:
Erstens geraten gesellschaftliche Realitten wie z.B. Ereignisse oder Institutionen
weniger als harte Tatsachen in den Blick, sondern vielmehr in Form von Deutungen und Auslegungen der Akteure, die diese Tatsachen durch ihre Bezugnahme
konstituieren. Diese Deutungen wiederum lassen sich auf kollektiv geteilte Auslegungen von Wirklichkeit, die Wahrnehmungen ordnen und vor deren Hintergrund
Menschen handeln, rckbeziehen.
Aus diesen Formen des Handelns entstehen objektive Hervorbringungen wie
z.B. literarische und knstlerische Werke, Symbole, Sprache und Rituale, die zweitens zu den bevorzugten Gegenstnden kulturwissenschaftlicher Analyse zhlen.
Diese Hervorbringungen sind deshalb fr die kulturwissenschaftliche Analyse von
Interesse, weil sie immer wieder aufs Neue von individuellen und kollektiven Akteuren angeeignet oder abgelehnt, verstanden oder missverstanden, transformiert
2 Vgl. dazu die Beitrge in Birgit Schwelling (Hg.), Politikwissenschaft als Kulturwissenschaft. Theorien, Methoden, Problemstellungen, Wiesbaden 2004.
3 Horst Bredekamp, Neue Farben auf alter Leinwand. Kulturwissenschaft und Kulturgeschichte in: Bernd Henningsen / Stephan Michael Schrder (Hg.), Vom Ende der
Humboldt-Kosmen. Konturen von Kulturwissenschaft, Baden-Baden 1997, S. 117-127,
hier S. 119.
4 Ebd.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 5 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
und umgedeutet werden, und in ihnen kollektive Wertvorstellungen, Denkstrukturen, Mentalitten, Gefhle und Weltbilder sichtbar werden.
Mit dieser Forschungsperspektive verbindet sich drittens ein breit angelegter
Begriff von Kultur, der die Gesamtheit der Hervorbringungen des Menschen in
smtlichen Lebensbereichen, also in Wirtschaft und Politik, Religion und Kunst,
Recht und Technik umfasst. Kultur lsst sich demnach verstehen als Inbegriff aller menschlichen Arbeit und Lebensformen5, also als Grundzug eines jeden sozialen Handelns, und weniger als spezieller, von Politik und Gesellschaft abzugrenzender Bereich.
Viertens zeichnen sich kulturwissenschaftliche Anstze durch eine Hinwendung
zu interpretativen Methoden aus. Es ist, um mit Max Weber zu sprechen, die qualitative Frbung der Vorgnge6, fr die sich die Kulturwissenschaften interessieren.
Diese nacherlebend zu verstehen ist eine Aufgabe spezifisch anderer Art [...],
als sie die Formeln der exakten Naturerkenntnis berhaupt lsen knnen oder wollen7. Die Erkenntnis von Kulturvorgngen ist nach Weber daher nicht anders
denkbar als auf der Grundlage der Bedeutung, welche die stets individuell geartete
Wirklichkeit des Lebens in bestimmten einzelnen Beziehungen fr uns hat8. In
welchem Sinn und in welchen Beziehungen dies der Fall ist, so Weber weiter, enthlle aber kein Gesetz, sondern sei nur mittels verstehender Methoden mglich.
Auch wenn Weber hier von verstehenden Methoden spricht, bleiben Erklrungen in seinem Denken nicht ausgeschlossen. Eine Engfhrung auf das Verstehen
gilt auch neueren Anstzen in den Kulturwissenschaften als irrefhrend. Auch Kulturwissenschaften erklren, wenn unter dem Erklren nun wiederum nicht (viel zu
eng) naturwissenschaftliche Methodologien im speziellen Sinn verstanden sind9.
Der seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu beobachtende Prozess
der zunehmenden Etablierung und Entfaltung von Kulturwissenschaften lsst sich
institutionell und curricular vor allem an zwei Phnomenen beobachten:
Zum einen findet im deutschsprachigen Raum der Aufbau kulturwissenschaftlicher Studiengnge im Sinne eines transdisziplinr angelegten Einzelfaches statt.
Eine von Bhme, Matussek und Mller zusammengestellte bersicht10 fhrt allein
neun grundstndige Studiengnge und drei Aufbau- und Ergnzungsstudiengnge
an deutschen Hochschulen auf, die eine kulturwissenschaftliche Orientierung fr
sich in Anspruch nehmen. Ein wichtiger Ansto fr diese Entwicklung ging von ei-
5 Wolfgang Frhwald / Hans Robert Jau / Reinhart Koselleck / Jrgen Mittelstra /
Burkhart Steinwachs, Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift, Frankfurt a. M.
1991, S. 40.
6 Max Weber, Die Objektivitt sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis in: ders., Gesammelte Aufstze zur Wissenschaftslehre, hg. v. Johannes Winckelmann, 7. Aufl. Tbingen 1988, S. 146-214, hier S. 173.
7 Ebd.
8 Ebd., S. 180.
9 Wolfgang Frhwald u.a., aaO. (FN 5), S. 41.
10 Hartmut Bhme / Peter Matussek / Lothar Mller, Orientierung Kulturwissenschaft.
Was sie kann, was sie will, Reinbek bei Hamburg 2000, S. 230 ff.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 6 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
nem Projekt aus, das auf Anregung des Wissenschaftsrates und der Westdeutschen
Rektorenkonferenz an der Universitt Konstanz unter Mitwirkung von Wolfgang
Frhwald, Hans Robert Jau, Reinhart Kosseleck, Jrgen Mittelstra und Burkhart
Steinwachs entstand und mit der Verffentlichung der Denkschrift Geisteswissenschaften heute11 eine bemerkenswerte Wirkung hatte. Anhand der 1991 gegrndeten Kulturwissenschaftlichen Fakultt der Europa-Universitt Viadrina in Frankfurt (Oder), die eine integrative Verbindung von Geistes- und Sozialwissenschaften
verfolgt, lsst sich dies exemplarisch verdeutlichen. In der aus Anlass der Grndung
der Universitt vorgelegten Denkschrift12 wird ausdrcklich auf die Empfehlungen
der Kommission um Frhwald Bezug genommen und der Versuch unternommen,
diese in ein Studienprogramm zu bersetzen. Konkret bedeutet dies, dass Sprache,
Literatur und Geschichte ihre spezialisierte Errterung nicht jeweils fr sich finden, sondern im Rahmen umfassender Kulturthemen aufgenommen [werden], in
denen Gesellschaften und soziale Gruppen jene Diskurse fhren, mit welchen sie
sich verstndigen und auseinandersetzen, um ihren Weg durch Geschichte und Gegenwart in die Zukunft zu finden13.
Als weiteres Phnomen ist der seit den achtziger Jahren einsetzende Perspektivenwechsel innerhalb der etablierten Fcher zu nennen. Dem Begriff Kultur kommt
dabei der Status einer Fcher bergreifenden Orientierungskategorie zu, die den
etablierten Fcherkanon einer kritischen Revision unterziehen soll. Dabei verluft
die Entwicklung in den einzelnen Disziplinen nicht synchron und nicht nach einem einheitlichen Muster14. Vielmehr haben die Einzeldisziplinen je eigene Entwrfe einer kulturwissenschaftlichen Orientierung der Theoriebildung und Empirie ihres Fachgebietes15 entwickelt.
Fr die Politikwissenschaft war in diesem Zusammenhang lange Zeit kennzeichnend, dass Fragen der Kultur innerhalb einer mit einem engen, auf Einstellungen
konzentrierten Kulturbegriff operierenden Politischen Kulturforschung bearbeitet
wurden. Erst ab Mitte der 1980er Jahre u.a. mit Karl Rohes Forderung, den Blick
auf die Kultur auszuweiten und anstatt Einstellungen Vorstellungen zu untersuchen16 wurden Stimmen laut, die die Einbeziehung der symbolischen Ebene, von
Bedeutungen und Sinngehalten in die Erforschung von Politik und Kultur forderten
und damit die Perspektive auf neue, von der Politischen Kulturforschung bisher
11 Wolfgang Frhwald u.a., aaO. (FN 5).
12 Europa-Universitt Viadrina (Hg.), Denkschrift der Europa-Universitt Viadrina
Frankfurt (Oder), Frankfurt (Oder) 1993.
13 Ebd., S. 52.
14 Heide Appelsmeyer / Elfriede Billmann-Mahecha, Kulturwissenschaftliche Analysen
als prozeorientierte Praxis. Einleitung in: Dies., aaO. (FN 1), S. 7-17, hier S. 11.
15 Ebd.
16 Karl Rohe, Politische Kultur und der kulturelle Aspekt von politischer Wirklichkeit.
Konzeptionelle und typologische berlegungen zu Gegenstand und Fragestellung politischer Kulturforschung in: Dirk Berg-Schlosser / Jakob Schissler (Hg.), Politische
Kultur in Deutschland. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Opladen, S. 39-48; Karl
Rohe, Politische Kultur und ihre Analyse. Probleme und Perspektiven der politischen
Kulturforschung in: Historische Zeitschrift 250 (1990), S. 321-346.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 7 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
vernachlssigte Gegenstnde wie Architektur, Bilder, Filme oder Mentalitten auszuweiten suchten17. Unabhngig von diesen beiden Strngen der Politischen Kulturforschung entwickelten sich ab den neunziger Jahren in anderen Teilbereichen
der Politikwissenschaft kulturwissenschaftliche Herangehensweisen. Dazu zhlen
lassen sich die verstrkte Hinwendung zu interpretativen Verfahren in der PolicyAnalyse18, konstruktivistische Anstze in der Erforschung internationaler Beziehungen19, Forschungen zu Institutionen als symbolischen Ordnungen20 oder auch
der Versuch der Entwicklung einer Kulturgeschichte der Politik21.
Das Spektrum der Forschungen, die Politik zu ihrem konstitutiven Gegenstand
zhlen und diesen mit Kultur in Verbindung bringen, hat sich also demnach in den
letzten fnfzehn Jahren erheblich erweitert. Die fr lange Zeit geltende exklusive
Zustndigkeit der Politischen Kulturforschung fr Fragen der Kultur innerhalb der
Politikwissenschaft scheint sich zunehmend aufzulsen und durch eine Vielfalt anderer Anstze ergnzt zu werden. Dabei zeichnen sich zwei grundstzlich verschiedene Zugangsweisen ab:
Erstens geht es darum, Kultur mit sozialwissenschaftlichen Methoden zu erforschen. Dabei kann Kultur verschiedene Bedeutungen annehmen: Im Fall der Politischen Kulturforschung z.B. handelt es sich um als Einstellungen und Werte definierte Kultur, der vorzugsweise mit den Methoden der empirischen Sozialforschung
nachgesprt wird.
Bei der zweiten Zugangsweise ist das Verhltnis genau umgekehrt: Hier wird
Politik mit kulturwissenschaftlichen Theorien und Methoden untersucht. Ein Beispiel fr diese Vorgehensweise sind die sozialkonstruktivistisch verfahrenden
Untersuchungen im Forschungsfeld Internationale Beziehungen: Der traditionelle
Gegenstand, etwa die Auenpolitik, wird beibehalten; was sich verndert, ist die
Perspektive auf den Gegenstand insofern, als verstrkt kulturwissenschaftliche
17 Vgl. u.a. Andreas Drner, Politischer Mythos und symbolische Politik. Der Hermannmythos: Zur Entstehung des Nationalbewutseins der Deutschen, Reinbek bei Hamburg 1996; Andreas Drner / Ludgera Vogt (Hg.), Sprache des Parlaments und Semiotik
der Demokratie. Studien zur politischen Kommunikation in der Moderne, Berlin et al.
1995; Birgit Schwelling, Wege in die Demokratie. Eine Studie zum Wandel und zur
Kontinuitt von Mentalitten nach dem bergang vom Nationalsozialismus zur Bundesrepublik, Opladen 2001.
18 Ein berblick findet sich bei Frank Nullmeier, Interpretative Anstze in der Politikwissenschaft in: Arthur Benz / Wolfgang Seibel (Hg.), Theorieentwicklung in der Politikwissenschaft. Eine Zwischenbilanz, Baden-Baden 1997.
19 Ein berblick findet sich bei Thomas Schaber / Cornelia Ulbert, Reflexivitt in den
Internationalen Beziehungen. Literaturbericht zum Beitrag kognitiver, reflexiver und
interpretativer Anstze zur dritten Theoriedebatte in: Zeitschrift fr Internationale
Beziehungen 1 (1994), S. 139-169.
20 Vgl. u.a. Karl-Siegbert Rehberg, Institutionen als symbolische Ordnungen. Leitfragen
und Grundkategorien zur Theorie und Analyse institutioneller Mechanismen in: Gerhard Ghler (Hg.), Die Eigenart der Institutionen. Zum Profil politischer Institutionentheorie, Baden-Baden 1994, S. 47-84.
21 Thomas Mergel, berlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik in: Geschichte
und Gesellschaft 28 (2002), S. 574-606.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 8 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
Analysekategorien und Begrifflichkeiten wie etwa Symbolsysteme, Routinen und
Diskurse in das Zentrum der Untersuchung gerckt werden.
Neben den aufgezeigten Entwicklungen an der Schnittstelle von Politik und Kultur finden sich nun in jngster Zeit einige Hinweise auf eine verschttete Traditionslinie der Politikwissenschaft, die fr eine kulturwissenschaftlich inspirierte Herangehensweise an das Politische bisher wenig beachtetes Potential bietet und um die
es in den folgenden Ausfhrungen gehen soll: Gemeint ist das Werk von Eric Voegelin, einem der Grndungsvter der bundesrepublikanischen Politikwissenschaft.
Jrgen Gebhardt wagte im Jahr 1990 die Prognose, dass Voegelins Werk unter
dem Horizont einer universalgeschichtlich angelegten vergleichenden Kulturanalyse, welche die Wissenschaftskultur der Jahrhundertwende prgte und unter vernderten Fragestellungen zum gegenwrtigen Moment wieder hchstes wissenschaftliches Interesse erzeugt22, erneut in den Blick geraten werde. Gebhardt rckt hier
Voegelins Werk in die Nhe einer mit Namen wie Max Weber, Georg Simmel oder
Ernst Cassirer verbundenen Kulturwissenschaft um 1900 und prognostiziert ein
bisher allerdings nur in Anstzen erkennbares, neu erwachtes Interesse an Voegelin
und seinen Schriften. Und Michael Henkel konstatiert, dass die Wiederaufnahme
kulturwissenschaftlicher Fragestellungen in die Politikwissenschaft [...] ein
gnstigeres Klima fr die Beschftigung mit Voegelin23 schaffe.
Die angefhrten Autoren sind sich darin einig, dass Eric Voegelins Werk kulturwissenschaftliches Potential berge, das bisher innerhalb der deutschsprachigen Politikwissenschaft allerdings nicht ausreichend Bercksichtigung fand, ohne dass jedoch nher darauf eingegangen wird, worin genau dieses Potential besteht. Im
Folgenden soll daher der Versuch unternommen werden, das Werk Eric Voegelins
hinsichtlich der Frage nach Anknpfungspunkten fr eine kulturwissenschaftlich
inspirierte Politikwissenschaft zu lesen. Es wird sich zeigen, dass das Werk des 1985
verstorbenen, innerhalb der deutschsprachigen Politikwissenschaft wenig beachteten Voegelin tatschlich als eine wichtige kulturwissenschaftliche Traditionslinie gesehen werden kann und gerade heute, aufgrund der zunehmenden Hinwendung zu
Fragen der Kultur, interessante Anknpfungspunkte bietet, die vor allem auf der
Ebene des wissenschaftlichen Selbstverstndnisses, des Politikbegriffs und der Zugangsweise zum Gegenstand zu finden sind. Bevor diese Punkte im Einzelnen ausgefhrt werden, soll zunchst die Frage aufgeworfen werden, warum einem lange
Vergessenen heute wieder Aufmerksamkeit zuteil wird.
22 Jrgen Gebhardt, Die Suche nach dem Grund Eine zivilgeschichtliche Konstante
in: Peter Hampe (Bearb.), Symbol- und Ordnungsformen im Zivilisationsvergleich. Wissenschaftliches Symposium in memoriam Eric Voegelin, Tutzing 1990, S. 7-30, hier S. 8
(Akademie fr Politische Bildung, Materialien und Berichte Nr. 61); vgl. dazu auch Jrgen Gebhardt, Eric Voegelin und die neuere Entwicklung der Geisteswissenschaften
in: ZfP 36 (1989), S. 251-263.
23 Michael Henkel, Eric Voegelin zur Einfhrung, Hamburg 1998, S. 9.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 9 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
2. Eric Voegelin revisited
2.1 Voegelins Position innerhalb der deutschsprachigen Politikwissenschaft
Eric Voegelin ist ein unbekannter Bekannter24, er blieb innerhalb der deutschsprachigen Politikwissenschaft ein Fremder unter Fremden25. Mit diesen und vergleichbaren Stellungnahmen wird Voegelins Position innerhalb der deutschsprachigen Politikwissenschaft gekennzeichnet. 1958 als erster Lehrstuhlinhaber des
politikwissenschaftlichen Instituts der Universitt Mnchen aus der US-amerikanischen Emigration nach Deutschland zurckgekehrt, wurde sein umfangreiches
Werk in der deutschen Politikwissenschaft selten rezipiert und nur oberflchlich
wahrgenommen. Voegelin wurde bald in die Schublade des sogenannten normativontologischen Ansatzes gesteckt26, der von den Vertretern der dominierenden politikwissenschaftlichen Strmungen als konservativ und berholt angesehen wurde.
Henkel spricht in diesem Zusammenhang von einer nur oberflchlichen Verortung des Voegelinschen Werks, die lange Zeit eine wirkliche Auseinandersetzung
verhinderte27.
Wenn derartige Positionen geuert werden, drngt sich unmittelbar die Frage auf,
warum Voegelin in Vergessenheit geriet und aus welchen Grnden sein Werk nur selten rezipiert wurde. Immerhin zhlt Voegelin zu den ersten Lehrstuhlinhabern des
akademischen Fachs Politikwissenschaft in der Bundesrepublik. Grnde fr die Ignoranz gegenber Voegelins Werk scheint es viele zu geben. Sie finden sich zum Teil
in ueren Faktoren, scheinen aber auch im Werk selbst und in Voegelins akademischem Stil begrndet zu liegen. Wie Hans Maier aus der Perspektive des Mnchener
Kollegen berichtet, gab es groe Differenzen in der Auffassung von Politischer Wissenschaft zwischen Voegelin und seinen Kollegen. Voegelins Hoffnung, dass sich die
Politikwissenschaft in Deutschland zu einer philosophischen Zentraldisziplin entwickeln wrde universalistisch im Zugriff, ausstrahlend in viele Disziplinen, hnlich
der Max Weberschen Soziologie auf der Hhe ihrer Wirkung28 war ganz und gar
24 Ebd., S. 7.
25 Hans Maier, Eric Voegelin und die deutsche Politikwissenschaft in: Occasional Papers
des Eric Voegelin-Archivs der Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen XIV, hg. v.
Peter J. Opitz u.a., Mnchen 2000, S. 37-63, hier S. 37. Vgl. dazu auch Manfred Henningsen, Eric Voegelin und die Deutschen in: Merkur 48 (1994), S. 726-730; Peter J.
Opitz, Stationen einer Rckkehr. Voegelins Weg nach Mnchen in: Occasional Papers
des Eric-Voegelin-Archivs der Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen XIV, hg. v.
Peter J. Opitz u.a., Mnchen 2000, S. 5-36.
26 Peter J. Opitz, Spurensuche Zum Einfluss Eric Voegelins auf die Politische Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland in: ZfP 36 (1989), S. 235-250; zur sog.
Mnchener Schule vgl. Dietmar Herz / Veronika Weinberger, Die Mnchener Schule
der Politikwissenschaft in: Wilhelm Bleek / Hans J. Lietzmann (Hg.), Schulen der
deutschen Politikwissenschaft, Opladen, S. 269-291.
27 Michael Henkel, Staatslehre und Kritik der Moderne: Voegelins Auseinandersetzung
mit Ideologien und Autoritarismus in den dreiiger Jahren in: PVS 41 (2000), S. 745763, hier S. 746.
28 Hans Maier, aaO. (FN 25), S. 50.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 10 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
unzeitgem und mit den dominanten politikwissenschaftlichen Schulen der sechziger bis achtziger Jahre nicht vereinbar. Neben den quer zum Zeitgeist liegenden Vorstellungen von Politischer Wissenschaft, mssen die Grnde fr die Ignoranz gegenber seinem Werk jedoch auch bei Voegelin selbst gesucht werden. Seine polemische
Begabung29 muss auf viele, fhrt man sich die folgenden, von Maier beschriebenen
Szenen vor Augen, arrogant und verletzend gewirkt haben:
Nun hatte Eric Voegelin ein so forderndes Auftreten, eine so dezidierte Art, seinen Standpunkt zu vertreten, dass seine Wortmeldungen in der wissenschaftlichen
ffentlichkeit oft verwunderte und emprte Reaktionen auslsten. Kein Wissenschaftler hrt es gern, wenn ein anderer seine intellektuelle berlegenheit allzu
nachdrcklich ausspielt etwa mit der Bemerkung, die ich als Fakulttskollege oft
von ihm gehrt habe: Darf ich etwas Wissenschaft in die Debatte trufeln?30
Aber nicht nur durch derartiges Verhalten scheint sich Voegelin isoliert zu haben.
Auch das Werk selbst ist, im doppelten Sinn, nur schwer zugnglich. Zum einen
scheint die Tatsache, dass viele der Schriften Voegelins lange Zeit nur in englischer
Sprache vorlagen, auf die Verbreitung seiner Gedanken im deutschsprachigen Raum
nicht gerade frderlich gewirkt zu haben. Zum anderen machen es, darauf weist
Henkel hin, die Komplexitt und der Voraussetzungsreichtum seiner Argumentation31 dem Leser nicht eben leicht, den Intentionen Voegelins zu folgen. Auf den
heutigen Leser wirkt Voegelins Sprache fremd und unzugnglich, jedenfalls weit abseits der gebruchlichen Sprachgewohnheiten in den Sozialwissenschaften. Dies, die
Breite seines wissenschaftlichen Ansatzes und der interdisziplinre Charakter seines
Werkes scheinen auf viele eher abschreckend als einladend gewirkt zu haben.
Handelt es sich also bei dem sich seit Anfang der neunziger Jahre verstrkt regenden Interesse um die Rehabilitierung eines zu Unrecht Vergessenen? Vermutlich lsst
sich die Wiederentdeckung Voegelins darauf zurckfhren, dass seine Gedanken aus
verschiedenen Grnden heute zugnglicher sind als in den Jahrzehnten zuvor:
Zum einen scheinen die Aktivitten des 1990 in Mnchen gegrndeten, von Peter
J. Opitz geleiteten Eric-Voegelin-Archivs einen nicht unbedeutenden Einfluss auf
die Wahrnehmung der Schriften Voegelins zu haben. Mit den seit 1996 verffentlichten Occassional Papers32 wurde ein Forum fr die Auseinandersetzung mit Voegelins Werk geschaffen. Die seit 1993 im Wilhelm Fink Verlag erscheinende Schriftenreihe Periagoge macht wichtige, bisher nicht ins Deutsche bersetzte bzw.
vergriffene Teile des Voegelinschen Werks zugnglich, und seit dem Jahr 2001 erscheint Voegelins Hauptwerk Order and History33 in deutscher bersetzung.
Zum anderen hat sich das intellektuelle Klima dahingehend gewandelt, dass solchen Positionen, die nicht eindeutig in ein Schema gepresst werden knnen, offener
29
30
31
32
Stephan Sattler, Der groe Schwierige in: Die Zeit Nr. 40, 26. September 2002, S. 43.
Hans Maier, aaO. (FN 25), S. 49.
Michael Henkel, aaO. (FN 23), S. 10.
Zu den Occasional Papers vgl. auch Barry Cooper, Surveying the Occasional Papers
in: The Review of Politics 62 (2000), S. 727-751.
33 Zu Order and History vgl. auch Peter J. Opitz, Ordnung und Geschichte ein unbekannter Klassiker in: Sinn und Form 53 (2001), S. 611-622.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 11 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
11
und mit grerer Neugier begegnet wird. Die fr die deutschsprachige Politikwissenschaft lange Zeit gltige Einteilung in die Drei-Schulen-Lehre hat fr die jngere Generation unter den Sozialwissenschaftlern an Bedeutung verloren. Die eindeutige Zuordnung zu ausschlielich einer Schule bzw. einer Referenztheorie lsst
sich immer weniger beobachten; vielmehr ist fr den Umgang mit Theorien eine zunehmende Offenheit kennzeichnend, in deren Zusammenhang eher problem- als
schulenorientiert gedacht und geforscht wird.
Darber hinaus sind einige der grundlegenden Kategorien, die Voegelin in seinem
Werk entfaltet (z.B. Erfahrung und Symbol), einer nicht ausschlielich, aber
zunehmend auch an kulturwissenschaftlichem Vokabular geschulten Generation
von Wissenschaftlern heute vertrauter als dies in den Jahrzehnten vor 1990 der Fall
war. Die verstrkte Zuwendung zu Voegelins Werk scheint also auch darauf
zurckzufhren zu sein, dass Kategorien und Problemstellungen mit der kulturalistischen Wende in die wissenschaftliche Diskussion Eingang gefunden haben, die
Jahrzehnte zuvor in ganz hnlicher Form bereits von Voegelin entwickelt und aufgeworfen wurden.
Insofern war Voegelin seiner Zeit in gewisser Weise voraus. Diese Aktualitt lsst
sich beispielsweise auch am Begriff der politischen Religionen beobachten, den
Voegelin bereits in den dreiiger Jahren entwickelte und der in der zeitgenssischen
Forschung zu modernen Ideologien und den totalitren Bewegungen des 20. Jahrhunderts von zentraler Bedeutung ist34. Auch im Hinblick auf Huntingtons These
vom Zusammenprall der Kulturen haben Voegelins berlegungen, darauf hat Michael Henkel hingewiesen, eine erstaunliche Aktualitt: Mit Huntingtons [...] Thesen tauchen theoretische Probleme auf, die Voegelin bereits in den sechziger Jahren
ausfhrlich behandelt.35
Und dass Voegelin seiner Zeit voraus war, gilt auch fr diejenigen Aspekte seines
Werkes, auf die in den folgenden Abschnitten der Schwerpunkt gelegt wird: die
Ebene des wissenschaftlichen Selbstverstndnisses, der von Voegelin entwickelte
Politikbegriff und seine grundlegende Zugangsweise zum Gegenstand. Voegelin
entwickelte in den genannten Zusammenhngen Positionen, die heute unter dem
Stichwort kulturalistische Wende diskutiert werden. Darauf wird im Folgenden
nher eingegangen.36
34 Vgl. u.a. Hans Maier (Hg.), Totalitarismus und Politische Religionen. Konzepte des
Diktaturvergleichs, Paderborn et al. 1996, darin insbesondere Dietmar Herz, Der
Begriff der politischen Religionen im Denken Eric Voegelins, S. 191-209.
35 Michael Henkel, aaO. (FN 23), S. 167.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 12 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
12
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
2.2 Kulturwissenschaftliche Ansatzpunkte in Voegelins Schriften
2.2.1 Politikwissenschaft als Wissenschaft von der Ordnung des Menschen
Voegelin verstand Politikwissenschaft in einem sehr umfassenden Sinn als Wissenschaft von der Ordnung des Menschen in der Gesellschaft37. Jede Gesellschaft stehe vor der Aufgabe, eine Ordnung zu schaffen, die ihrer Existenz Sinn verleihe.
Dieser Prozess der Schaffung und Erhaltung von Ordnung ist von Versuchen begleitet, die symbolischen Formen zu finden, die diesen Sinn adquat ausdrcken38, die Bedeutung, die der Ordnung zukommt, also in Symbolen und anderen
Wissensformen festzuhalten und weiterzugeben.
Der Politikwissenschaft wies Voegelin die Aufgabe zu, dieses Ordnungswissen
anhand der groen politischen Kulturbereiche39 zu untersuchen, wobei das Spektrum der untersuchten Gesellschaften und ihrer Ordnungsformen, das Voegelin fr
relevant erachtete, enorm breit ist. Es reicht vom Bereich der konfuzianischen
Vlkerfamilie (China, Japan, Korea und Sdostasien), ber Indien, den islamisch-arabischen Bereich, Afrika, die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten
ber West- und Sdeuropa bis zu den Lndern des British Commonwealth und
schlielich den USA und Lateinamerika40. Aber nicht nur der geographische Rahmen, den Voegelin absteckt, ist breit; auch zeitlich reichen Voegelins Untersuchungen weit zurck. Nicht nur die modernen Nationalstaaten werden als symbolische
Ordnungsformen in den Blick genommen, sondern auch historisch sehr viel weiter
zurckliegende Formen gesellschaftlicher Ordnung sollen nach seinen Vorstellungen miteinbezogen werden. In seinen eigenen Untersuchungen werden beispielsweise die Reichsorganisationen des alten Nahen Ostens, das Auserwhlte Volk
36 Kenner der Voegelinschen Schriften werden in den folgenden Ausfhrungen zentrale
Elemente des Werkes vermissen. So bleiben etwa wichtige Kategorien wie Wahrheit
und transzendente Reprsentation unbercksichtigt. Insofern handelt es sich nicht
um einen umfassenden berblick ber Voegelins Werk, sondern vielmehr um einen
selektiven Zugriff auf diejenigen Kategorien, die vor dem Hintergrund der aktuellen
kulturwissenschaftlichen Debatte von besonderem Interesse sind. Gleichwohl erfolgt
der Zugriff auf Voegelins Werk nicht willkrlich; die im Folgenden aufgezeigten Punkte
ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Schriften und sind zu den grundlegenden
methodologischen und begrifflichen Einsichten zu zhlen. Fr einen einfhrenden
berblick ber Voegelins Werk vgl. Michael Henkel, aaO. (FN 23); Peter J. Opitz, Zur
Binnenstruktur eines ontologisch-normativen Theorieansatzes. Versuch einer systematischen Rekonstruktion der politischen Philosophie Eric Voegelins in: ZfP 36
(1989), S. 370-381.
37 Eric Voegelin, Memorandum betreffend die Entwicklung der Politischen Wissenschaften im Rahmen der Staatswirtschaftlichen Fakultt in: Occasional Papers des Eric-Voegelin-Archivs der Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen XIV, hg. v. Peter J. Opitz
u.a., Mnchen 2000, S. 64-81, hier S. 71 (zuerst 1959).
38 Eric Voegelin, Ordnung und Geschichte, Band 1: Die kosmologischen Reiche des Alten
Orients Mesopotamien und gypten, hg. v. Jan Assmann, Mnchen 2002, S. 27.
39 Eric Voegelin, Memorandum, aaO. (FN 35), S. 73.
40 Ebd.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 13 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
13
und seine Existenz in historischer Form41, die griechische Polis und die Entwicklung der Philosophie als deren symbolische Ordnungsform sowie die multikulturellen Reiche seit Alexander und die Entwicklung des Christentums42 bercksichtigt. Im Mythos, in der Philosophie, im Christentum, in der Gnosis und den
Nationalstaaten erkennt Voegelin die wichtigsten Typen von Ordnung, die jeweils
anhand der Symbole ihrer Selbstauslegung43 und in der Abfolge ihres Auftretens
in der Geschichte44 untersucht werden. Die Geschichte der von Menschen geschaffenen Ordnungen und ihrer symbolischen Formen weisen dabei den Weg zur
Ordnung der Geschichte: Die Ordnung der Geschichte enthllt sich in der Geschichte der Ordnung.45
Voegelins Betonung der Bedeutung eines weit zurckreichenden und breit angelegten historischen Wissens erfolgte nicht aus idiosynkratischer Vorliebe, sondern
war wesentlicher und unabdingbarer Bestandteil seines Verstndnisses von Politikwissenschaft, das sich auch in der Gestaltung seines Lehrprogramms widerspiegelte.46 Voraussetzung fr eine erfolgreiche Politikwissenschaft war fr ihn, dass man
wei, wovon man spricht47. Um dies zu erreichen, sollte man sich ein vergleichendes kulturgeschichtliches Wissen nicht nur von den modernen Zivilisationen [aneignen], sondern auch von den mittelalterlichen und den alten Zivilisationen und
nicht nur von den westlichen Zivilisationen, sondern auch von der Zivilisation des
Nahen und Fernen Ostens48. Dabei wollte Voegelin die Einbeziehung des kulturgeschichtlichen Wissens nicht als Versuch verstanden wissen, Kuriositten einer
toten Vergangenheit zu erkunden49, sondern vielmehr als Mittel, die Struktur der
Ordnung, in der wir gegenwrtig leben50 zu untersuchen und, mit dem Wissen
ber andere mgliche Ordnungsformen, berhaupt erst zu verstehen.
Der Bogen, den Voegelin in seiner Forschungs- und Lehrttigkeit spannte, war
also sowohl rumlich als auch zeitlich weit und grundstzlich kulturvergleichend
angelegt. Hinzu kommt, dass Voegelin eine Vorliebe fr Quellen hegte, die jenseits
des blichen politikwissenschaftlichen Zugriffs liegen. Neben literarischen Zeugnissen des Taoismus und des Buddhismus oder den Qumran-Texten griff er in seinen
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Eric Voegelin, Ordnung, aaO. (FN 36), S. 28.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 27.
Neben Veranstaltungen zur Institutionenlehre, zur Geschichtsphilosophie und Ideengeschichte, zur Amerikanischen Auenpolitik, zur Theorie der Politik finden
sich in den Vorlesungsverzeichnissen auch Seminare zur Ostasiatischen Politik, zum
Alten Orient und Israel und zur Fernstlichen Politik. Vgl. dazu Thies Marsen,
Zwischen Reeducation und Politischer Philosophie. Der Aufbau der Politischen Wissenschaft in Mnchen nach 1945, Mnchen 2001, S. 161.
Eric Voegelin, Autobiographische Reflexionen, hg. v. Peter J. Opitz, Mnchen 1994, S.
31.
Ebd.
Eric Voegelin, Ordnung, aaO. (FN 36), S. 32.
Ebd.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 14 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
14
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
Untersuchungen auch auf Werke der Weltliteratur zurck, etwa in einem Aufsatz
von 1921 auf das Werk von Wedekind51. In einem 1965 auf der Jahrestagung der
Deutschen Vereinigung fr Politische Wissenschaft gehaltenen Vortrag mit dem
Titel Was ist politische Realitt? merkt Voegelin an, dass wer sich heute z.B. in
Deutschland ber die groen Probleme des Ordnungsdenkens unterrichten will,
besser daran tue, sich mit den Romanciers wie Robert Musil, Hermann Broch,
Thomas Mann, Heimito von Doderer oder Dramatikern wie Frisch oder
Drrenmatt zu beschftigen, als die professionelle Literatur zur Politik zu lesen52.
Man mag diesen spezifischen Zugang zum Gegenstandsbereich der Politikwissenschaft fr abseitig und wenig aussagekrftig halten. Voegelin gelang es damit jedoch Kategorien zu entwickeln, die heute von erstaunlicher Aktualitt sind und insofern funktionieren, als damit Phnomene erfasst werden knnen, die sich
anderen Erklrungsanstzen entziehen. Neben der Kategorie politische Religion,
die zeitversetzt Eingang in die Sozialwissenschaften gefunden hat und auf die im
letzten Abschnitt bereits hingewiesen wurde, bieten Voegelins Ausformulierungen
der Begriffe Erfahrung und Symbol wichtige Ansatzpunkte fr eine kulturwissenschaftlich orientierte Politikwissenschaft. Auf diese beiden Begriffe soll im folgenden Abschnitt nher eingegangen werden.
2.2.2 Erfahrungen und ihre Symbolisierung
Ein fr die Kulturwissenschaften interessanter Ansatzpunkt, der gleichzeitig in
Voegelins Werk einen zentralen Stellenwert einnimmt, ist die Konzentration auf Erfahrungen, ihre bersetzung in symbolische Formen und deren Interaktion. Nachdem Voegelin die konventionelle Annahme [...], dass es Ideen gibt, dass diese eine
Geschichte haben und dass eine Geschichte der politischen Ideen einen Bogen der
klassischen Politik bis hin zur Gegenwart schlagen muss53 im Verlauf seiner Arbeit
an einem Lehrbuch zur Ideengeschichte verworfen hatte54, und damit Ideen im
konventionellen Sinn als zentralen Gegenstand seiner historischen Untersuchungen
aufgab, ersetzte er diese durch den Begriff der Erfahrung, der fortan im Zentrum
seiner Untersuchungen steht. Sie ist fr ihn nun diejenige Realitt, die es historisch zu erforschen gilt. Und sie ist dem Forschenden nur zugnglich in ihrer Artikulation in Symbolen.
51 Eric Voegelin, Wedekind. Ein Beitrag zur Soziologie der Gegenwart, Occasional Papers
des Eric-Voegelin-Archivs der Ludwig-Maximilians-Universitt Mnchen II B, hg. v.
Peter J. Opitz, Mnchen 1996.
52 Eric Voegelin, Was ist politische Realitt? in: ders., Anamnesis. Zur Theorie der
Geschichte und Politik, Mnchen 1966, S. 283-354, hier S. 331.
53 Eric Voegelin, Reflexionen, aaO. (FN 45), S. 98.
54 Vgl. zur Werksgeschichte der History of Political Ideas Thomas A. Hollweck / Ellis
Sandoz, General Introduction to the Series in: Eric Voegelin: History of Political
Ideas, Vol. I: Hellenism, Rome and Early Christianity, Columbia 1997, S. 1-47 (=The
Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 19).
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 15 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
15
Das Problem der Ideen wurde damit jedoch nicht hinfllig. Vielmehr ordnet Voegelin Ideen nun in das neu entworfene begriffliche Instrumentarium ein. Er unterscheidet fortan zwischen Ideen als Konstruktionen einerseits und menschliche Erfahrungen zum Ausdruck bringenden Symbolen andererseits. Ideen werden
insofern als Konstruktionen begriffen, als sie Symbole, welche Erfahrungen ausdrcken, in Begriffe [verwandeln]55. Zur Untersuchung von Ordnung genge es
nicht, sich auf Ideen zu konzentrieren, da diese Erfahrungen immer schon interpretiert und gewissermaen verzerrt wiedergeben. Zwar handelt es sich auch bei den
Symbolen um (Re-) Konstruktionen von Erfahrungen, aber im Gegensatz zu den
Ideen sieht Voegelin darin gewissermaen die erste, und nicht schon die zweite Ableitung bzw. Interpretation von Erfahrungen. Da dieser Unterschied in der Regel
nicht reflektiert wird, werde mit der Konzentration auf Ideen suggeriert, dass eine
andere als die erfahrene Realitt56 existiere. Nach Voegelins berzeugung ist dies
jedoch nicht der Fall: Aber eine andere als die erfahrbare Realitt existiert nicht57.
Der Perspektivenwechsel weg von den Ideen und hin zu den Erfahrungen und
ihren Symbolen ist darauf zurckzufhren, dass Voegelin das Feld der westlichen
Entwicklung erweiterte, zunchst um Erkenntnisse ber die alten Hochkulturen im
Nahen Osten. Dadurch aber traten zum einen Phnomene in den Blick, die unter
den Begriff Ideen nicht zu subsumieren waren. Man konnte, so Voegelin, unter der
berschrift Ideen nicht ein gyptisches Krnungszeremoniell oder das Vortragen
des Enuma Elish whrend der sumerischen Neujahrsfeiern abhandeln58. Zum anderen wurde durch den erweiterten geographischen und zeitlichen Horizont die
Annahme einer linearen Entwicklung hin zur westlichen Moderne unhaltbar:
Das Schema der linearen Entwicklung der politischen Ideen von dem vermeintlichen Konstitutionalismus Platons und Aristoteles ber den dubiosen Konstitutionalismus im Mittelalter hin zum glorreichen Konstitutionalismus der Moderne
brach zusammen59.
Voegelin trgt mehr und mehr empirische Belege zusammen, die die Interpretation einer Vielfalt sich unterschiedlich voneinander entwickelnder Vorgnge, die
sich zu verschiedenen Zeitpunkten und eigenstndig in konkreten Menschen und
Gesellschaften ereignen60, strken und ihn von der Vorstellung einer unilinearen
Geschichte der Menschheit Abstand nehmen lassen. Geschichte wird nunmehr als
ein komplexes Geflecht von Bedeutungslinien61, als dynamischer und pluraler
Prozess begriffen, in dessen Ablauf es zu Interaktionen zwischen verschiedensten
symbolischen Formen kommt. Dabei lsen, wie es unilineare Modelle historischer
55
56
57
58
59
60
61
Eric Voegelin, Reflexionen, aaO. (FN 45), S. 98.
Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 83.
Ebd.
Ebd., S. 103.
Peter J. Opitz, In Memoriam Eric Voegelin in: Eric Voegelin: Ordnung, Bewutsein,
Geschichte. Spte Schriften, hg. v. Peter J. Opitz, Stuttgart 1988, S. 215-225, hier S. 219.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 16 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
16
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
Entwicklung nahelegen, neu auftretende symbolische Formen von Ordnung ltere
nicht einfach ab:
Die lteren symbolischen Formen werden [...] nicht einfach von der neuen Ordnungswahrheit berholt, sondern behalten ihre Gltigkeit fr jene Bereiche, die von
den spter gewonnenen Einsichten nicht berhrt werden, wenn auch ihre Symbole
Bedeutungswandlungen erfahren, sobald sie in den Bannkreis der jngeren und nun
beherrschenden Form eintreten.62
An die Stelle des konventionellen Konzepts der Geschichte von Ideen, erzhlt
anhand einer chronologischen Auflistung bedeutender Denker und ihrer Theorien,
tritt nun eine Kulturgeschichte politischer Ordnung, die vor dem Hintergrund der
jeweiligen historischen Epoche und anhand von Erfahrungen und deren Symbolisierungen untersucht werden. In diesem Zusammenhang gewinnt der Begriff der
historischen Konfiguration63 seine Bedeutung. Eine Konfiguration bercksichtigt
die jeweiligen Ordnungsformen in ihrem Gesamtzusammenhang, den formalen institutionellen Aspekt, den Voegelin auch als deskriptive Reprsentation64 bezeichnet ebenso wie die korrespondierenden Leitideen65 bzw. Selbstinterpretationen66, die, um es mit Mary Douglas auszudrcken, Aufschluss darber geben, wie
Institutionen denken67, und die Voegelin mit dem Begriff der existentiellen Reprsentation zu fassen sucht68. Eine Bercksichtigung beider Aspekte ist von Bedeutung, wenn Wandel und Stabilitt von Institutionen untersucht werden sollen:
Um reprsentativ zu sein, gengt es nicht, wenn eine Regierung im konstitutionellen Sinn reprsentativ ist (unser deskriptiver Typ reprsentativer Institutionen);
sie muss auch im existentiellen Sinn reprsentativ sein, indem sie die Idee der Institution verwirklicht. [...] Wenn eine Regierung lediglich im konstitutionellen Sinn reprsentativ ist, wird ihr frher oder spter durch einen reprsentativen Herrscher
im existentiellen Sinn ein Ende bereitet.69
Wenn Voegelin nun davon spricht, dass Gesellschaften ihre Erfahrung von Ordnung durch entsprechende Symbole ausdrcken diese verstanden als Akte des
Selbstverstndnisses70 stellt sich die Frage, wie Voegelin diesen kollektiven Prozess der Verstndigung auf gemeinsame Symbole gedacht hat. Steckt dahinter die
Vorstellung eines Kollektivbewusstseins, das analog zum individuellen Bewusstsein funktioniert? Voegelin geht davon aus, dass das konkrete Bewusstsein des
konkreten Menschen das einzige [ist], von dem wir Erfahrung haben71. Wenn er
62 Eric Voegelin, Ordnung, aaO. (FN 36), S. 29.
63 Eric Voegelin, Configurations of History in: Paul G. Kuntz (Hg.), The Concept of
Order, Seattle 1968, S. 23-42.
64 Eric Voegelin, Die Neue Wissenschaft der Politik. Eine Einfhrung, hg. v. Peter J. Opitz,
4., unvernderte Aufl. Freiburg et al. 1991, S. 57 ff.
65 Ebd., S. 80 f.
66 Eric Voegelin, Configurations, aaO. (FN 61), S. 25.
67 Mary Douglas, Wie Institutionen denken, Frankfurt a. M. 1991.
68 Eric Voegelin, Neue Wissenschaft, aaO. (FN 62), S. 64 ff.
69 Ebd., S. 80 f.
70 Eric Voegelin, Realitt, aaO. (FN 50), S. 343.
71 Ebd., S. 342.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 17 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
17
davon spricht, dass Gesellschaften Symbole hervorbringen, durch die sie ihre Erfahrung von Ordnung ausdrcken, benutzt er diese und hnlich lautende Formeln als
abkrzende Ausdrcke fr Prozesse, in denen konkrete Menschen ein soziales
Feld schaffen, d.h. ein Feld, in dem ihre Erfahrungen von Ordnung von anderen
konkreten Menschen verstanden, als die ihren akzeptiert und zum Motiv habituellen Handelns gemacht werden72. Symbole werden also dann zu kollektiv geteilten
Phnomenen, wenn sie als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses akzeptiert und
handlungssteuernd internalisiert werden. Die Gruppen von Individuen, die an diesen Prozessen beteiligt sind, bezeichnet Voegelin dann als Gesellschaften, wenn
ihr Umfang und ihre relative Stabilitt in der Zeit sie identifizierbar machen73. Relative Stabilitt meint dann auch, dass Gesellschaften nicht ein fr alle mal gegeben,
sondern als prozesshaft und damit wandelbar zu verstehen sind. Als solche tragen
sie nicht nur die Prozesscharakteristika der Grndung und Erhaltung, sondern auch
die des Widerstandes und der Vernderung, der Tradition und der differenzierten
Entwicklung, der Erstarrung und der Revolte74 in sich.
Die Kategorie der Konfiguration nun deutet auch auf den Umstand hin, dass
Gesellschaft und Institutionen nicht notwendig deckungsgleich sind. Mit dem Begriff Konfiguration lenkt Voegelin den Blick auf das Zusammenspiel von Machtprozess und symbolischer Deutung75, denn zwar wird jede organisierte Gesellschaft [...] von einem Sozialfeld des Bewusstseins getragen [...], aber das tragende ist
nicht das einzige Sozialfeld innerhalb der Gesellschaft, und manche dieser Felder
gehen weit ber den Machtbereich hinaus76. Ferner sind die Felder des Bewusstseins nicht wechselseitig exklusiv; vielmehr kann das konkrete Bewusstsein mehreren Feldern gleichzeitig angehren. Ein Grieche des 4. Jahrhunderts z.B. kann
gleichzeitig Athener und Hellene, Sophist oder Philosoph und Mitglied eines Mysterienkultes sein.77
Mit dem Begriff der Konfiguration mchte Voegelin das Wechselverhltnis von
Ordnung und Deutung einfangen: Ordnung ist nur dann hinreichend zu verstehen,
wenn die kollektiven Selbstinterpretationen der Individuen, die in dieser Ordnung
leben, bercksichtigt werden. Institutionen sind, so knnte man den Gedanken auf
den Punkt bringen, keine menschenlosen Systeme. Sie sind Produkt von kollektiven
Aushandlungs- und Deutungsprozessen. Gleichzeitig sind Menschen keine gesellschaftslosen Individuen. Sie sind durch die Ordnung, in der sie sozialisiert wurden,
immer schon mitgeprgt.
72
73
74
75
76
77
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Jrgen Gebhardt, Suche, aaO. (FN 22), S. 25.
Eric Voegelin, Realitt, aaO. (FN 50), S. 342.
Ebd., S. 342 f.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 18 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
18
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
2.2.3 Erkenntnistheoretische Grundlagen
Als Ausgangspunkt der Analyse von Ordnung whlt Voegelin, wie bereits erwhnt,
die Selbstinterpretation der Gesellschaft, die kleine sinnhafte Welt78, die Voegelin
auch als Kosmion bezeichnet und die zum Gegenstand der Politikwissenschaft
werden soll. Diese kleine sinnhafte Welt konstituiert sich mittels Symbolen in verschiedenen Abstraktions- und Differenzierungsgraden etwa Riten, Mythen und
Theorien79 , die die innere Struktur (die Konfiguration) des Feldes sowohl fr
deren Mitglieder als auch fr den auenstehenden Beobachter transparent machen.
Da nun jede Gesellschaft ihre Erfahrung von Ordnung durch entsprechende Symbole ausdrckt, die Ergebnisse von Prozessen der kollektiven Selbstverstndigung
sind, gelangen Kollektive auch ohne Wissenschaft zu einem Verstndnis ihrer selbst:
Die Politikwissenschaft leidet unter einer Problematik, die in ihrer Natur als
Wissenschaft vom Menschen in historischer Existenz begrndet ist: der Mensch
wartet fr die Auslegung seines Lebens nicht auf die Wissenschaft, und wenn der
Theoretiker sich mit der sozialen Realitt befassen will, findet er das Feld bereits
von etwas beschlagnahmt, was man als die Selbstinterpretation der Gesellschaft bezeichnen kann.80
Die Politikwissenschaft steht also am Beginn ihrer Analyse nicht vor einer tabula rasa, auf der sie ihre Begriffe einritzen knnte81. Vielmehr muss sie von dem
reichen corpus der Selbstinterpretation einer Gesellschaft ausgehen, und sie wird
ihre Aufgabe auf dem Wege kritischer Klrung der gesellschaftlich prexistenten
Symbole lsen mssen82.
Eine sorgfltige Unterscheidung und Trennung der Kategorien und Begriffe der
Wissenschaft von den Selbstinterpretationen der Gesellschaft ist dabei der erste
Schritt in der wissenschaftlichen Analyse. Voegelin fhrt in diesem Zusammenhang
die Unterscheidung zwischen noetischen und nicht-noetischen Interpretationen ein, wobei die noetische Interpretation das Ergebnis wissenschaftlicher Bemhungen bezeichnet, mit nicht-noetischen Interpretationen hingegen die Akte
des Selbstverstndnisses, die sich in der politischen Realitt vorfinden83, gemeint
sind. Diese entstehen, wenn das Bewusstsein, aus welchem Anla immer, versucht,
sich selbst explizit zu werden84.
Fr das Verhltnis zwischen wissenschaftlicher Auslegung der Welt und Selbstinterpretation der Gesellschaft sind folgende Bedingungen konstitutiv:
Zum einen gehen die nicht-noetischen Interpretationen in der Geschichte der
Menschheit den noetischen um Jahrtausende voraus85. Der frheste bekannte Fall
78
79
80
81
82
83
84
85
Eric Voegelin, Neue Wissenschaft, aaO. (FN 62), S. 84.
Ebd., S. 52.
Ebd.
Ebd., S. 53.
Ebd.
Eric Voegelin, Realitt, aaO. (FN 50), S. 284.
Ebd., S. 288.
Ebd.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 19 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
19
noetischer Interpretation, den Voegelin anfhrt, ereignet sich im Kontext des hellenischen Philosophierens. Und eben dort habe die noetische Interpretation den Namen der Politischen Wissenschaft, der episteme politike, an die Voegelin anknpfen
will, erhalten.86
Zum anderen entsteht eine noetische Interpretation niemals unabhngig von den
Ordnungskonzeptionen der Gesellschaft, in der sie auftritt, sondern in kritischer
Auseinandersetzung mit ihr87. Dieses Wechselverhltnis gilt es in der wissenschaftlichen Analyse zu bercksichtigen.
Mit der Konzentration auf die Selbstauslegungen von Gesellschaften sind handfeste methodische Konsequenzen verbunden. Gerade aufgrund des besonderen
Charakters des Untersuchungsgegenstandes eignen sich nach Voegelin nur bestimmte methodische Herangehensweisen an den Gegenstand:
[...] die menschliche Gesellschaft ist mehr als eine Tatsache oder ein Ereignis in
der Auenwelt, das ein Beobachter wie ein Naturphnomen untersuchen knnte.
Zwar ist ihr Auenweltcharakter eine der Komponenten ihres Seins, aber im ganzen
ist sie eine kleine Welt, ein Kosmion, von innen her mit Sinn erfllt durch die
menschlichen Wesen, die sie in Kontinuitt schaffen und erhalten als Modus und
Bedingung ihrer Selbstverwirklichung.88
Die Untersuchung der Innenwelt erfordert andere Methoden als die der Auenwelt. Voegelin sieht darin keinen Mangel, der irgendwann behoben werden
knnte, sondern pldiert fr den Einsatz von Methoden, die ihrem Gegenstand angemessen sein sollen. Der Einsatz von Methoden, die auf nomologische Gesetzesaussagen zielen, kommt fr ihn in der Politikwissenschaft nicht in Frage, da ein
Gegenstck zur Axiomatisierung der Mathematik durch Russell und Whitehead fr
die Politische Wissenschaft nicht geleistet werden kann, weil es keinen politikwissenschaftlichen Bestand an Stzen, vergleichbar dem der Mathematik, gibt, der axiomatisiert werden knnte89. Wofr Voegelin vielmehr pldiert, ist der Einsatz der
von ihm sogenannten aristotelischen Methode90, von verstehenden Methoden
und interpretativen Verfahren, die ihren Ausgang von den Selbstinterpretationen
der Gesellschaft nehmen und einen Zugang zum Symbolbestand von Gesellschaften
ermglichen. Damit verbunden ist eine Absage an die Methoden des Positivismus,
die Voegelin fr die Erforschung der sozialen Welt fr ganz und gar ungeeignet hlt
und denen er eine zerstrende Wirkung91 nachsagt. Diese zerstrende Wirkung
komme auch dadurch zustande, dass im Positivismus die Auswahl der Referenztheorien und -begrifflichkeiten der Methode untergeordnet wrden. Dagegen bezieht
Voegelin Position. In einem Brief an Alfred Schtz vom 30. April 1951 formuliert
Voegelin, dass er sich von keinem Methodologen vorschreiben lasse, was mir in der
Wissenschaft zum Problem werden darf, und was nicht92. Die Unterordnung der
86
87
88
89
90
91
Eric Voegelin, Neue Wissenschaft, aaO. (FN 62), S. 13 ff.
Eric Voegelin, Realitt, aaO. (FN 50), S. 285.
Eric Voegelin, Neue Wissenschaft, aaO. (FN 62), S. 52.
Eric Voegelin, Realitt, aaO. (FN 50), S. 284.
Eric Voegelin, Neue Wissenschaft, aaO. (FN 62), S. 84.
Ebd., S. 22 ff.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 20 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
20
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
Theorie unter die Methode verkehre, so Voegelin an anderer Stelle, prinzipiell den
Sinn der Wissenschaft93. Die Auswahl der Methode will Voegelin in Abstimmung
mit den aus dem jeweiligen Gegenstand resultierenden Notwendigkeiten vornehmen. Und schlielich entscheide sich erst an den erzielten Ergebnissen, ob die Methode angemessen gewhlt wurde:
Die Frage, ob im konkreten Fall der eingeschlagene Weg der richtige war, kann
jedoch nur entschieden werden im Rckblick. [...] Wenn die Methode das anfangs
nur trbe Geschaute zu wesenhafter Klarheit gebracht hat, dann war sie adquat;
wenn sie diesen Zweck nicht erfllt hat, oder wenn sie nur zu wesenhafter Unklarheit etwas gebracht hat, woran wir ursprnglich konkret nicht interessiert waren,
dann war sie inadquat.94
Voegelins Hauptvorwurf gegen den Positivismus besteht also darin, dass dieser
durch seine Konzentration auf die methodische Exaktheit andere Fragen, etwa die
nach der Relevanz der Problemstellung, vllig verdrnge. Eine Studie gelte den Positivisten dann als wissenschaftlich, wenn sie methodisch exakt durchgefhrt ist. Ob
damit interessante und relevante Ergebnisse verbunden sind, sei vllig nebenschlich geworden. Diese Unterordnung der theoretischen Relevanz unter die Methode95 verkehre aber prinzipiell den Sinn der Wissenschaft.
3. Schlussfolgerung
Im Vorwort der deutschen Ausgabe der Neuen Wissenschaft der Politik erlutert
Voegelin die Wahl des Titels der Buchausgabe der Walgreen Lectures, die er im Wintersemester 1951 an der Universitt Chicago unter dem Titel Wahrheit und Reprsentation hielt:
Ich entschied mich fr Die Neue Wissenschaft der Politik, anklingend an die
Nuova Scienza des Giambattista Vico. Denn so wie Vicos neue Wissenschaft von
Politik und Geschichte in Opposition zu Galileis Nuova Scienza konzipiert war, so
sind die vorliegenden Vorlesungen ein Versuch, die Politische Wissenschaft im klassischen Sinn wiederherzustellen, im Gegensatz zu den vorherrschenden Methoden
des Positivismus.96
Bemerkenswert daran ist, dass Voegelin bereits im Jahr 1951 denjenigen, der fnfzig Jahre spter als der Grnderheld97 der Kulturwissenschaften wiederentdeckt
wird, als Referenz im Zusammenhang mit seiner Neuen Wissenschaft anfhrt.
Giambattista Vico, 1668 in Neapel geboren, ab 1699 Professor fr Rhetorik an der
Universitt seiner Geburtsstadt, lehnte in seiner 1725 erschienenen Scienza Nuova
92 Eric Voegelin / Alfred Schtz / Leo Strauss / Aaron Gurwitsch, Briefwechsel ber Die
Neue Wissenschaft der Politik, hg. v. Peter J. Opitz, Freiburg et al. 1993, S. 65.
93 Eric Voegelin, Neue Wissenschaft, aaO. (FN 62), S. 26.
94 Ebd., S. 25.
95 Ebd., S. 26.
96 Ebd., S. 13.
97 Friedrich Kittler, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, Mnchen 2000, S. 19.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 21 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
21
die Vorstellung ab, dass es eine Wissenschaft von der gemeinschaftlichen Natur der
Vlker geben knne. An die Stelle des Suchens nach dieser nicht existenten Natur
setzte Vico die Kultur, deren Ursprnge es zu erforschen galt. Er pldierte also nicht
fr eine Suche nach dem Gemeinsamen, sondern nach der Differenz, oder, um es
mit Clifford Geertz auszudrcken, nach den systematischen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Phnomenen, und nicht nach den substantiellen Identitten zwischen hnlichen98. Vicos Verstndnis zufolge ist Kultur nicht etwas der
menschlichen Natur von auen Hinzugefgtes, sondern eine den Menschen als solchen berhaupt erst konstituierende Instanz.
Nun ging es Voegelin mit seiner Referenz an Vico darum, auf die Bedeutung von
dessen Schriften fr die Entwicklung des eigenen Werkes hinzuweisen. Voegelins
Neue Wissenschaft lsst sich, so Barry Cooper in der Einleitung zum sechsten Band
der posthum erschienenen History of Political Ideas, als eine Hommage an Vico lesen99. Wie bereits Vico im 17. Jahrhundert, entwickelt auch Voegelin eine Gegenposition zu denjenigen Anstzen, die die Geistes- und Sozialwissenschaften nach dem
Modell der Naturwissenschaften betreiben wollen. Wie auch Vico, geht Voegelin
von einem Menschenbild aus, das Individuen immer im historischen Kontext, nie
isoliert von diesem, betrachtet. Und wie bereits Vico, lehnt auch Voegelin die Vorstellung von ausschlielich rational handelnden Individuen ab und wendet sich deshalb den unreflektierten Symbolisierungen zu, die ein tieferes Verstndnis des Menschen versprechen.100 So wie Voegelin Vicos Neue Wissenschaft als KulturPhilosophie klassifiziert, die neben einer Sprach- und Kunsttheorie auch eine politische Theorie bereitstelle101, lsst sich Voegelins Neue Wissenschaft als Auftakt zur
Begrndung einer kulturwissenschaftlich inspirierten Politikwissenschaft lesen. Wie
die vorangehenden Ausfhrungen deutlich machen sollten, findet sich das kulturwissenschaftliche Potential in den grundlegenden begrifflichen und methodologischen Annahmen, die Voegelins Schriften zugrunde liegen. Vor allem drei
Zusammenhnge sind dabei von Interesse:
Erstens erffnen Voegelins Schriften ein weites Panorama auf unterschiedliche
Ordnungsformen, die von ihm grundstzlich kulturvergleichend untersucht werden. Ergebnis dieser Bemhungen ist eine Kulturgeschichte der Ordnungen, auf die
sich Menschen ber die Jahrtausende in Aushandlungsprozessen geeinigt haben und
die durch die Schaffung von Symbolen stabilisiert und weitergegeben wurden. Wie
98 Clifford Geertz, Kulturbegriff und Menschenbild in: Rebekka Habermas / Nils
Minkmar (Hg.), Das Schwein des Huptlings. Sechs Aufstze zur Historischen Anthropologie, Berlin 1992, S. 56-82, hier S. 69.
99 Barry Cooper, Editors Introduction in: Eric Voegelin: History of Political Ideas, Vol.
VI: Revolution and the New Science, hg. und mit einer Einleitung versehen v. Barry
Cooper, Columbia 1988, S. 1-22, hier S. 1 (=The Collected Works of Eric Voegelin, Vol.
24).
100 Zu Vico vgl. Eric Voegelin, History of Political Ideas, Vol. VI: Revolution and the New
Science, hg. und mit einer Einleitung versehen v. Barry Cooper, Columbia 1988, S. 82148 (=The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 24).
101 Ebd., S. 144.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 22 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
22
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
Jan Assmann in der Einleitung zum ersten Band von Ordnung und Geschichte bemerkt, kann dieser Versuch einer Korrelation von politischer Ordnung, kultureller
Semantik und Gesellschaftsstruktur als ein bahnbrechender Schritt in Richtung einer kulturwissenschaftlichen Analyse gelten, die allenthalben und gerade in
Deutschland gefordert wird102. Die Quellenvielfalt, die Voegelin in seinen empirischen Studien heranzieht, verdeutlicht, dass kulturvergleichende Studien ohne
interdisziplinres Wissen nicht zu bewerkstelligen sind. Voegelin selbst betrieb Politikwissenschaft in enger Verwandtschaft zu anderen Disziplinen wie Religionswissenschaft, Philosophie, Geschichte, Islamistik und Klassische Philologie. Gerade
in Zeiten, in denen die Forderung nach Interdisziplinaritt in aller Munde ist, geben
Voegelins Schriften ein Beispiel dafr, wie interdisziplinre Erkenntnisse gewinnbringend genutzt werden knnen.
Zweitens lenkt Voegelin mit der Konzentration auf die kulturelle Semantik unsere Aufmerksamkeit auf die symbolische Auslegung von Ordnung. Kategorien wie
Erfahrung und Symbol, die er in diesem Zusammenhang entwickelt, gehren
heute zum Grundbestand kulturwissenschaftlicher Analyse. Mit ihnen wird der
Blick gelenkt auf Deutungen und Auslegungen, anhand derer Kollektive ihre Ordnung (mit-) konstituieren. Voegelin erffnet das Angebot, die Politikwissenschaft
an die Symbolanalyse anzuschlieen. Er verbindet Politik und Symbol, indem er
dem Symbolismus eine spezifische Funktion zuweist: Eine Gesellschaft wird politisch, indem sie sich artikuliert und ihre Ordnung symbolisiert. Am Begriff der Institution lsst sich verdeutlichen, worin der Ertrag einer solchen Perspektive auf
Ordnungen als kulturelle Formen besteht: Institutionen erschpfen sich nicht in
dem, was Voegelin deskripitive Reprsentation oder uere Realisierung einer
Gesellschaft103 nennt. Vielmehr besitzen Institutionen auch einen existentiellen
Kern, durch den sie ihre ordnende und orientierende Kraft erst erhalten, sofern der
damit verbundene Sinn den Akteuren einsichtig und verstndlich ist. Gerade dann,
wenn die Frage nach Wandel oder Stabilitt von Institutionen im Zentrum des Interesses steht, bieten Voegelins Kategorien einen interessanten Ansatzpunkt.
Mit dem Hinweis auf das Wechselverhltnis von noetischen und nicht-noetischen Interpretationen, also von wissenschaftlichen Interpretationen und Selbstinterpretationen der Akteure verdeutlicht Voegelin drittens, dass nomologische Gesetzesaussagen, die unabhngig von Zeit und Raum existieren, in den Sozialwissenschaften
problematisch sind. hnlich wie Alfred Schtz mit der Unterscheidung zwischen
Konstruktionen ersten und zweiten Grades104 oder Anthony Giddens, der in
diesem Zusammenhang von der doppelten Hermeneutik105 spricht, macht Voegelin
auf die grundlegende Verschiedenheit natur- und sozialwissenschaftlicher Untersuchungsgegenstnde aufmerksam und pldiert fr den Abschied vom naturwissen102 Jan Assmann, Zur Einfhrung in: Eric Voegelin, Ordnung, aaO. (FN36), S. 17-23,
hier S. 22.
103 Eric Voegelin, Neue Wissenschaft, aaO. (FN 62), S. 80.
104 Alfred Schtz, Gesammelte Aufstze, Band 1: Das Problem der sozialen Wirklichkeit,
Den Haag 1971, S. 6.
105 Anthony Giddens, Interpretative Soziologie, Frankfurt a. M. et al. 1984, S. 95.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 23 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
23
schaftlichen Ideal. Wie schon Max Weber will Voegelin den Sinnzusammenhang des
Handelns in das Zentrum des Erkenntnisinteresses rcken. Dieser aber lsst sich gerade nicht mit Methoden, die den Naturwissenschaften entlehnt sind, erfassen, da er Teil
einer von Akteuren bereits interpretierten Wirklichkeit ist, whrend diese Wirklichkeit, um eine Formulierung von Alfred Schtz aufzugreifen, den darin befindlichen
Moleklen, Atomen und Elektronen gar nichts [bedeutet]106.
Mit diesem Pldoyer fr den Einsatz einer dem Gegenstand angemessenen Methodik einher geht die Erkenntnis, dass auch wissenschaftliche Beobachtung immer
perspektivischen Charakter hat und somit keinen exklusiven Blick auf die Welt beanspruchen kann. Wissenschaftliche Beobachtung unterliegt denselben Regeln wie
jeder andere Blick auf die Welt auch: Realitt ist nichts Gegebenes, das man von einem Standpunkt auerhalb ihrer selbst beobachten knnte.107
Vieles von dem, was in den vorangegangenen Ausfhrungen vorgestellt wurde,
erscheint heute vertraut. Die Unterscheidung zwischen einer Innen- und Auenperspektive von Institutionen findet sich als zentraler Ausgangspunkt in neueren
berlegungen zu diesem Problemfeld.108 Auch der Gedanke einer doppelten Hermeneutik ist sptestens mit Giddens in das sozialwissenschaftliche Vokabular eingegangen. Der Ruf nach interdisziplinrem Austausch gehrt heute zum guten Ton
eines jeden Forschungsantrags und auch der prozesshafte Charakter sozialer und
historischer Entwicklungen ist sptestens mit dem cultural turn fast schon zum Allgemeinplatz in den Sozialwissenschaften geworden. Warum also diese Lektre von
Voegelins Schriften?
Zum einen soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die bereits von Voegelin
entwickelten theoretischen und methodischen Grundlagen mit einer Verzgerung
von einigen Jahrzehnten in die kultur- und sozialwissenschaftliche Diskussion Einzug gehalten haben.
Zum anderen fllt auf, dass Voegelins Name auch dann selten genannt wird, wenn
heute genau diese Thesen, manchmal als neu und innovativ deklariert, entwickelt
und dargelegt werden. Voegelin scheint heute weniger fr das kulturwissenschaftliche Potential, das seine Schriften bergen, bekannt zu sein, als vielmehr fr einige seiner hchst umstrittenen Thesen, wie etwa die vom gnostischen Charakter der Moderne. Diese von vielen als problematisch eingestufte Seite seines Werkes kann
durch den Verweis auf die kulturwissenschaftlichen Ansatzpunkte in seinen Schriften um wichtige Aspekte ergnzt werden. Dadurch rckt eine bisher wenig beachtete Seite des Werkes, an die sich zumal im Kontext der zeitgenssischen Debatten um
die Reform der Geistes- und Sozialwissenschaften anknpfen lsst, strker in den
Mittelpunkt.
106 Alfred Schtz, aaO. (FN 102), S. 6.
107 Eric Voegelin, quivalenz von Erfahrungen und Symbolen in: ders., Ordnung,
Bewutsein, Geschichte. Spte Schriften, hg. v. Peter J. Opitz, Stuttgart, S. 99-126, hier S.
107.
108 Vgl. u.a. Gerhard Ghler (Hg.), Die Eigenart der Institutionen. Zum Profil politischer
Institutionentheorie, Baden-Baden 1994; Gerhard Ghler (Hg.), Institutionenwandel,
Opladen 1997 (Leviathan Sonderheft 16).
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 24 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
24
Birgit Schwelling Kulturwissenschaftliche Traditionslinien
Die Erschlieung des kulturwissenschaftlichen Potentials in Voegelins Schriften
knnte dazu beitragen, eine inzwischen zumindest in Anstzen fr Fragen der Kultur sensibilisierte Politikwissenschaft auf die Spur ihrer fachimmanenten Traditionslinien zu setzen. Dies wre nicht nur fr die Geschichte des akademischen Fachs
Politikwissenschaft interessant, sondern wrde auch verhindern helfen, dass das
Rad in regelmigen Abstnden neu erfunden wird. Voegelins Schriften bieten Ansatzpunkte, die ausbaufhig und erweiterbar sind. Es wre schade, wenn sie ungenutzt blieben.
Zusammenfassung
Eric Voegelins Werk bildet eine Traditionslinie der Politikwissenschaft, die im Zusammenhang mit dem nun auch in dieser Disziplin zu beobachtenden zunehmenden Interesse an kulturwissenschaftlichen Anstzen bisher wenig beachtetes Potential aufweist. Vor allem auf der Ebene der Erkenntnistheorie, aber auch in
methodologischen und kategorialen Fragen finden sich wichtige Ansatzpunkte. Voegelins stets kulturvergleichend angelegte Studien der politischen Ordnung knnen
als eindringliche und berzeugende Beispiele interdisziplinrer Forschung gelten.
Seine Einbeziehung der kulturellen Semantik lenkt die Aufmerksamkeit auf die
symbolische Auslegung von Ordnung. Kategorien wie Erfahrung und Symbol,
die er in diesem Zusammenhang entwickelt, gehren heute zum Grundbestand kulturwissenschaftlicher Analyse. Die Rekonstruktion des kulturwissenschaftlichen
Potentials in Voegelins Schriften trgt nicht zuletzt dazu bei, eine inzwischen auch
fr Fragen der Kultur sensibilisierte Politikwissenschaft auf fachimmanente Traditionslinien aufmerksam zu machen.
Summary
The work of Eric Voegelin offers important insights for a political science know beginning to consider approaches related to the cultural turn. In this connection Voegelins interdisciplinary and comparative approach to political order becomes particularly relevant. With his considerations of cultural semantics, Voegelin draws our
attention to the symbolic interpretation of order. Categories he develops in this
connection, such as experience and symbol, belong to todays basic repertoire
of cultural analysis. The reading of Voegelins work regarding its potential for cultural analysis not only contributes to the development of a political science that is inspired by the cultural turn but also points to a theoretical tradition that has not been
considered in this perspective.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 25 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa
Kulturkritik und Demokratie bei
Max Weber und Hannah Arendt
Alle konomischen Wetterzeichen
weisen nach der Richtung
zunehmender Unfreiheit1.
1. Einleitung
Die letzten zehn, zwlf Jahre sahen den Aufstieg Hannah Arendts zu einer nahezu
unangreifbaren moralischen und politischen Autoritt. Einen nicht geringen Anteil
daran hatten Autoren der ehemaligen Neuen Linken, die Arendt bis weit in die
achtziger Jahre hinein noch als Vertreterin eines normativ-ontologischen Ansatzes unter Konservatismusverdacht gestellt hatten2. Im Zentrum dieser Neuentdeckung des Arendtschen Denkens steht ihr enthusiastischer Begriff des Politischen3, der zum einen Anschlussmglichkeiten fr eine Konzeptualisierung der
Neuen Sozialen Bewegungen bot, darber hinaus aber auch grundstzlicher verspricht, den gesellschaftskritischen Kern des Praxisbegriffes aus den Trmmern des
Marxismus zu retten.
Bemerkenswert scheint mir dabei, dass die kultur- und modernittskritischen Parallelen zwischen dem Denken Hannah Arendts auf der einen und dem von Max
Webers Rationalisierungstheorie geprgten Denken der Frankfurter Schule auf der
anderen Seite in der neueren Arendt-Diskussion kaum eine Rolle spielen. Schlielich war ja nicht nur die immense intellektuelle Wirkung der Frankfurter Schule
whrend der sechziger und siebziger Jahre aufs engste mit der Kritik instrumenteller Vernunft (Horkheimer) bzw. technologischer Rationalitt (Marcuse) verbunden.
Auch die politisch einflussreichen Bewegungen der siebziger und achtziger Jahre
zeichneten sich durch Fortschrittsskepsis und Modernittskritik aus. Wo die neuere
Diskussion explizit auf Arendts Kritik der Moderne eingeht, gilt ihr dies als hchst
1 Max Weber: Zur Lage der brgerlichen Demokratie in Russland in: ders., Gesammelte Politische Schriften, Tbingen 1988 (1921), S. 63.
2 Mit entscheidend hierfr war die Ablehnung der Totalitarismustheorie durch die groe
Mehrheit der linken Intellektuellen in Deutschland. Zu weiteren Grnden der versptet
einsetzenden Arendt-Rezeption vgl. Michael Greven, Hannah Arendt Pluralitt und
die Grndung der Freiheit in: Peter Kemper (Hg.), Die Zukunft des Politischen,
Frankfurt a.M. 1993, S. 97-123.
3 Ernst Vollrath, Hannah Arendt in: Karl Graf Ballestrem / Henning Ottmann (Hg.),
Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts, Mnchen 1990, S. 18.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 26 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
26 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
bedenklicher, auf den Einfluss Heideggers zurckgehender Aspekt ihres Denkens,
der dann in der Regel zugunsten einer diskurstheoretischen Lesart ihres Werkes relativiert wird4.
Der dominierende Einfluss des Habermasschen Verdikts gegen die hemmungslose Vernunftskepsis5 der ersten Generation der Frankfurter mag dazu beigetragen
haben, das Motiv der Modernitts- und Kulturkritik in den Hintergrund zu drngen, bzw. in ihm vor allem eine hochproblematische, auf den antiwestlichen deutschen Sonderweg verweisende Gemeinsamkeit zwischen den unterschiedlichsten
Denkern des deutschen Sprachraums zu sehen. So nachvollziehbar das jngste Interesse an Arendts Politikbegriff ist, so wenig kann jedoch ein Zweifel daran bestehen,
dass die Kritik der Moderne nicht am Rand, sondern im Zentrum ihres Denkens
steht. Mehr noch, der so ungemein populr gewordene Politikbegriff Arendts und
ihre aus der amerikanischen Geschichte gewonnene Konzeption einer republikanischen Demokratie lassen sich berhaupt nur verstehen als Antwort auf die von ihr
erfahrene Totalisierung von Herrschaft unter Bedingungen der Moderne. Whrend
die konservative Kulturkritik in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit ihrer Gegenberstellung von wahrer, an hheren Werten orientierter (und selbstverstndlich deutscher) Kultur auf der einen und verflachter, utilitaristischer und amoralischer westlicher Zivilisation auf der anderen Seite antipolitisch orientiert war
und in der Demokratie ein Symptom der Dekadenz und der naturwidrigen Nivellierung sah6, entfaltet Arendt ihren enthusiastischen Politikbegriff als Gegenkraft zu
den freiheitsbedrohenden Tendenzen der Moderne.
Darin liegt eine interessante Parallele zum politischen Denken Max Webers.
Auch Webers Auseinandersetzung mit der Moderne ist kulturkritisch geprgt, wie
die Bcher von Wilhelm Hennis und Lawrence Scaff, lange zuvor aber auch schon
4 Beispielhaft hierfr ist das Arendt-Buch von Seyla Benhabib. Obwohl Benhabib die
Bedeutung von Heideggers In-der-Welt-Sein fr Arendts pluralistische Theorie des
Politischen ausfhrlich wrdigt, ignoriert sie den Zusammenhang zwischen dieser
Grundlegung von Arendts Politikbegriff und der existentialphilosophischen Kritik am
neuzeitlichen Subjektivitts- und Rationalittsbegriff, um dann ber den vermeintlichen
anthropologischen Universalismus Arendts diese doch recht umstandslos in eine von
Kant bis zu neueren Diskurstheorien reichende Traditionslinie zu stellen. Noch bemerkenswerter scheint mir, dass das Buch an keiner Stelle auf die offensichtlichen Parallelen
zwischen Arendts Kritik der Moderne und derjenigen der ersten Generation der Frankfurter Schule eingeht (vgl. Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah
Arendt, Thousand Oaks 1996).
5 Jrgen Habermas, Die Verschlingung von Mythos und Aufklrung. Bemerkungen zur
Dialektik der Aufklrung nach einer erneuten Lektre in: Karl Heinz Bohrer (Hg.),
Mythos und Moderne, Frankfurt a.M. 1983, S. 429. Eine wirklich erstaunliche Kombination: hemmungslos skeptisch!
6 Vgl. dazu etwa Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr, Bern 1963. Speziell
zum Einfluss der religis orientierten russischen Kritik der Moderne auf das kulturkritische Denken in Deutschland auch Harald Bluhm, Dostojewski und Tolstoi-Rezeption auf dem semantischen Sonderweg. Kultur und Zivilisation in deutschen
Rezeptionsmustern Anfang des 20. Jahrhunderts in: Politische Vierteljahresschrift, 40.
Jg., 2/1999, S. 305- 327.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 27 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 27
Wolfgang Mommsen und Jrgen Habermas zeigen konnten7. Und auch Weber sieht
in der Demokratie kein Symptom der Dekadenz oder Krise, sondern einen Ausweg
aus dem durch Versachlichung und Brokratisierung drohenden Sinn- und Freiheitsverlust. Schlielich orientieren sich Weber wie Arendt an der westlichen, insbesondere der amerikanischen politischen Erfahrung. Wenn es um die jeweiligen Politik- und Demokratiekonzeptionen selbst geht, sind die Parallelen allerdings
erschpft. Arendt und Weber vertreten hier unterschiedliche, ja geradezu fr die
entgegengesetzten Pole der zeitgenssischen Demokratietheorie stehende Vorstellungen. Meine These lautet nun, dass Webers Pldoyer fr die plebiszitre Fhrerdemokratie auf der einen und Arendts Eintreten fr eine republikanische, partizipatorische Demokratie auf der anderen Seite sich nur durch die verschiedenen
theoretischen Grundlagen ihrer jeweiligen Kulturkritik erschlieen lassen. Dabei
mchte ich zeigen, wie Webers sozialwissenschaftliche Theorie der Rationalisierung
mit groer Konsequenz in die herrschaftliche Perspektive einer plebiszitren Fhrerdemokratie mndet, whrend Arendts existentialphilosophische und sozialwissenschaftlich gewiss nicht unproblematische Unterscheidung von Grundttigkeiten
es ermglicht, an die in den Revolutionen der Neuzeit gemachte Erfahrung des
Handelns Gleicher unter Bedingungen der Kontingenz anzuschlieen. Im Ergebnis
dieses Vergleiches wird m.E. auch klarer, weshalb der Webers Rationalisierungstheorie aufgreifende westliche Marxismus und insbesondere die Aufklrungs- und Vernunftkritik der Frankfurter Schule im Gegensatz zu Hannah Arendt nicht in der
Lage waren, eine positive Konzeption demokratischer Politik hervorzubringen.
Ich werde dazu zunchst auf Webers Doppelthese vom Sinn- und Freiheitsverlust
eingehen, um dann darzustellen, wie sehr sein politisches Denken, insbesondere
sein Dezisionismus und sein herrschaftszentrierter Politikbegriff daraus hervorgehen. Danach werde ich Arendts Kritik der Moderne unter den selben beiden Leitbegriffen des Sinn- und Freiheitsverlustes zusammenfassen, um von daher zu erlutern, weshalb sie zu einem gnzlich anderen Politik- und Demokratiebegriff
kommen konnte als Max Weber. Abschlieend werde ich dann Webers Dezisionismus und Arendts Konzeption des Urteilens als Alternativen der Kontingenzbewltigung in modernen Gesellschaften darstellen.
7 Vgl. etwa Wilhelm Hennis, Max Webers Fragestellung, Tbingen 1987; Lawrence A.
Scaff, Fleeing the Iron Cage. Culture, Politics and Modernity in the Thought of Max
Weber, Berkeley 1989; Jrgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I
und II, Frankfurt a.M. 1981; Wolfgang Mommsen, Weber und die deutsche Politik,
1890-1920, Tbingen 1959.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 28 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
28 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
2. Sinn- und Freiheitsverlust bei Max Weber
2.1. Sinnverlust als Transzendenzverlust
Nachdem Weber lange Zeit vor allem als Begrnder einer empirisch orientierten
wertfreien und strukturalistisch-funktionalen Sozialwissenschaft wahrgenommen
worden war, rckte whrend der achtziger Jahre Webers kulturtheoretisches Interesse, seine Frage nach der Entwicklung des Menschentums unter Bedingungen
gesellschaftlicher Rationalisierung strker in den Vordergrund. Hier sind insbesondere die bereits erwhnten Bcher von Wilhelm Hennis und Lawrence Scaff zu nennen. In der von Georg Lukcs geprgten marxistischen Rezeption wurde Weber allerdings immer schon als ein Theoretiker gelesen, der den Herrschaftscharakter
gesellschaftlicher Rationalisierung offen legt und, analog zur Marxschen Verdinglichungstheorie, ihre Verselbstndigung gegenber den handelnden Menschen beklagt8. Jrgen Habermas hat in seinem Hauptwerk 1981 die Kritik Webers am Rationalisierungsprozess westlicher Gesellschaften unter der Formel vom Sinn- und
Freiheitsverlust zusammengefasst9.
Am offensichtlichsten zeigt sich dieser kulturkritische Weber in den religionssoziologischen Aufstzen. Aber auch in den politischen Schriften und den Aufstzen
zur Wissenschaftslehre nehmen die Fragen nach Menschentyp und Lebensweise einen prominenten Stellenwert ein.
Fragen wir zunchst einmal, was genau Max Weber mit der zeitkritischen Diagnose des Sinnverlustes meinte. Legen wir seine allgemeine Definition von Sinn als
subjektive Handlungsabsicht zugrunde10, ist nicht recht einzusehen, weshalb moderne Gesellschaften Sinnverlust hervorbringen sollten. Schlielich zeichnen sie sich
nach gngiger Auffassung ja gerade durch die Erweiterung subjektiver Handlungsmglichkeiten aus.
Eine erste Antwort ergibt sich aus dem Kontext, in dem die These des Sinnverlustes mehrfach auftaucht, nmlich aus Webers religionssoziologischen Schriften. Sinnverlust entsteht hier aus der Spannung zwischen religiser Weltdeutung und empirischer Welt, genauer: er ist das paradoxe Resultat des religisen Bemhens, Leben
und Welt einen einheitlichen Sinn zuzuschreiben und die Lebensfhrung danach
auszurichten. Religionen erheben nach Weber den Anspruch, dass der Weltverlauf,
wenigstens soweit er die Interessen der Menschen berhrt, ein irgendwie sinnvoller
8 Zur marxistischen, durch Lukcs geprgten Weberrezeption vgl. etwa Jrgen Habermas, aaO. (FN 7), Bd. I und II sowie Michael Greven, Krise der objektiven Vernunft.
Entfremdung und ethischer Dezisionismus bei Georg Lukcs und Max Weber in: U.
Bermbach / G. Trautmann (Hg.): Georg Lukcs, Opladen 1987, S. 97-123.
9 In dieser zusammengezogenen Formulierung findet sich die These meines Wissens
nicht bei Weber. Habermas bringt damit jedoch die Hauptintentionen der Weberschen
Rationalisierungskritik zutreffend auf den Punkt. Vgl. Jrgen Habermas aaO. (FN 7),
Bd. I, S. 333.
10 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (WuG), Tbingen 1947 (1925), S.1.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 29 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 29
Vorgang sei11. Diesem Anspruch steht jedoch die empirische Welt mit ihrer ethisch
unmotivierten Ungleichverteilung von Glck und Leid entgegen. Religionen versuchen, auf diese als Theodizee-Problem bekannte Schwierigkeit rationale Antworten
zu geben das ist der Grund, weshalb sie fr Weber eine entscheidende Rolle im
universalhistorischen Prozess der Rationalisierung spielen. Allerdings gelingt es ihnen nicht, die religis begrndete Ethik mit der Realitt der Welt zu vershnen, und
zwar insbesondere nicht mit den Zwngen der wirtschaftlichen Welt. Nach Weber
fhrt das Bemhen, den Konflikt zwischen dem rationalen Anspruch der Religion
und der unvollkommenen, ungerechten und vergnglichen Wirklichkeit zu lsen,
vielmehr zu einer immer weiteren Entwertung der Welt einerseits sowie einem immer unweltlicheren, dem Leben fremden Inhalt des Religisen andererseits12. Einen
letzten, groangelegten Versuch, hier einen Ausweg zu weisen, sieht Weber in der
protestantischen Ethik, genauer in der puritanischen Berufsethik. Sie lst die Spannung zwischen den religisen Brderlichkeitsgeboten und den Erfordernissen rationalen Wirtschaftens auf, indem sie letztere zur Wirksttte des gttlichen Willens
umdeutet. Diese Umdeutung wird mglich, indem die puritanische Berufsethik
...auf den Universalismus der Liebe verzichtete, alles Wirken in der Welt als
Dienst in Gottes, in seinem letzten Sinn ganz unverstndlichen, aber nun einmal allein erkennbaren positiven Willen und Erprobung des Gnadenstandes rational versachlichte und damit auch die Versachlichung des mit der ganzen Welt als kreatrlich und verderbt entwerteten konomischen Kosmos als gottgewollt und
Material der Pflichterfllung hinnahm. Das war im letzten Grunde der prinzipielle
Verzicht auf Erlsung als ein durch Menschen und fr Menschen erreichbares Ziel
zugunsten der grundlosen, aber stets nur partikulren Gnade13.
Dieser Standpunkt der Unbrderlichkeit stellt fr Weber zwar keine eigentliche Erlsungsreligion mehr dar14. Dennoch vermochte es die puritanische Berufsethik, der Askese der modernen, auf spezialisierte Facharbeit beschrnkten Berufsarbeit einen hheren Sinn zu geben. Zwar sei die faustische Allseitigkeit des
Menschentums15 oder die Freude des mittelalterlichen Handwerkers an dem, was
er schuf, nun endgltig dahin16. Diesen Verlust des diesseitigen weltlichen Reizes
der Arbeit knne die puritanische Berufsethik jedoch durch den Gewinn einer unmittelbaren jenseitigen Orientierung der Arbeitsaskese kompensieren:
Die berufliche Arbeit als solche ist gottgewollt. Die Unpersnlichkeit der heutigen Arbeit: ihre, vom Standpunkte des Einzelnen aus betrachtet, freudlose Sinnlosigkeit, ist hier noch religis verklrt. Der Kapitalismus in der Zeit seiner Entste11 Max Weber, Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiser
Weltablehnung in: Gesammelte Aufstze zur Religionssoziologie, Tbingen 1920, S.
567.
12 Vgl. ebd., S. 567ff.
13 Ebd., S. 545f.
14 Ebd., S. 546.
15 Max Weber, Die protestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung. Hrsg. von Johannes
Winckelmann, Tbingen 19816 (1920), S. 187.
16 Ebd., S. 274, Anm. 299.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 30 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
30 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
hung brauchte Arbeiter, die um des Gewissens willen der konomischen
Ausnutzung zur Verfgung standen. Heute sitzt er im Sattel und vermag ihre Arbeitswilligkeit ohne jenseitige Prmissen zu erzwingen17.
Die freudlose Sinnlosigkeit, von der Weber hier spricht, ist keineswegs auf die
unter kapitalistischen Ausbeutungsverhltnissen verausgabte Arbeit beschrnkt. In
einer bekannteren, immer wieder zitierten Stelle desselben Textes fhrt Weber allgemeiner aus, dass der religise Geist lngst aus dem stahlharten Gehuse der von
ihm mit hervorgebrachten Wirtschaftsordnung entwichen sei18. Der einmal auf eigener Grundlage etablierte, oder wie Weber schreibt, der siegreiche Kapitalismus
bedarf der religisen Sttze eines jenseitigen Zweckes jedoch nicht mehr, er kann
schlielich sogar auf die rosige Stimmung der Aufklrung der lachenden Erbin
des religisen Geistes verzichten19. In den kapitalistischen Gesellschaften des Westens gewinnt damit die Durchsetzung formaler, d.h. von der Bindung an bestimmte
Zwecke gelsten Rationalitt eine eigene, von ihren religisen Ursprngen unabhngige Dynamik. In Formulierungen, die nicht zufllig an Marx erinnern, spricht
Weber von der zunehmenden und unentrinnbaren Macht der ueren Gter
dieser Welt ber den Menschen20.
Der moderne Kapitalismus kann demnach zwar wirtschaftlich rationales Verhalten erzwingen, aber er ist immer weniger in der Lage, ihm einen hheren Sinn zu geben.
Auf dem Gebiet seiner hchsten Entfesselung, in den Vereinigten Staaten, neigt
das seines religis-ethischen Sinnes entkleidete Erwerbsstreben dazu, sich mit rein
agonalen Leidenschaften zu assoziieren, die ihm nicht selten den Charakter des
Sports aufprgen21.
Im Anschluss an dieses Zitat findet sich Webers berhmte Warnung vor den
Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz als Kulminationspunkt
der Kulturentwicklung des Westens22.
Sinnverlust entsteht durch die Verselbstndigung der konomie gegenber religisen Weltbildern und den Handlungsorientierungen, die der einzelne Mensch aus
ihnen gewinnen konnte. Er steht am Ende des universalgeschichtlichen Prozesses
der Entzauberung der Welt und ihrer Verwandlung in einen kausalen Mechanismus, der nicht mehr als gottgeordneter, also irgendwie ethisch sinnvoll geordneter
Kosmos wahrzunehmen ist23. Zurck bleibt ein uerlich gewordener Zwang,
Versteinerung, Mechanisierung und tote Maschinerie, wie die immer wieder
benutzten Metaphern Webers fr die unpersnliche Herrschaft der rationalisierten
gesellschaftlichen Verhltnisse ber die Individuen lauten.
17
18
19
20
21
22
23
Ebd., S. 275, Hvhbg. von Max Weber.
Ebd., S. 188.
Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 188f.
Ebd., S. 189.
Vgl. Max Weber, Zwischenbetrachtung, aaO. (FN 11), S. 564.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 31 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 31
Hervorzuheben ist, dass Weber hier nicht etwa zweckrationales Handeln kritisiert, sondern im Gegenteil die Emanzipation des konomischen Handelns aus der
Unterordnung unter letzte, religis begrndete Zwecke. Die Kategorie der Zweckrationalitt ist bei Weber auch im Zusammenhang seiner Kulturkritik nicht negativ
besetzt24. Sinn und Zweck sind fr Weber identisch. Was ihn beunruhigt, ist die
Durchsetzung formaler Rationalitt in den Apparaten der Produktion und der Brokratie. Formale Rationalisierung meint einen Prozess der Durchstrukturierung,
Logifizierung und Systematisierung von Ordnungen und Handlungen25, kurz des
Beherrschbar- und Berechenbarmachens ohne Bindung an bestimmte Zwecke. Man
knnte auch sagen: formal rationalisierte Organisationen befreien sich von letzten
Zwecken, verkrpern hchste Zweckmigkeit ohne Zweck.
2.2. Sinnverlust als Verlust der Einheitlichkeit der Welt
Sinnverlust und Entzauberung der Welt meinen bei Weber jedoch nicht nur den
Verlust religiser Transzendenz, sondern mit ihr zugleich auch den Verlust der Einheitlichkeit der Welt und damit der Mglichkeit, die Lebensfhrung ethisch-methodisch an einer religis begrndeten Zweckhierarchie auszurichten. Denn Rationalisierung bedeutet Herausprparierung der spezifischen Eigenart jeder in der Welt
vorkommenden Sondersphre26. Es entstehen verschiedene Wertsphren, etwa der
konomie, der Kunst, der Ethik. Mit Hinweis auf Baudelaires Fleurs du mal unterstreicht Weber, dass etwas schn sein kann, nicht nur ohne gut zu sein, sondern
sogar gerade in dem, worin es nicht gut ist27. Fr Weber handelt es sich hier jedoch
nicht nur um die Verselbstndigung von Wertsphren, die untereinander wiederum
in ein Ergnzungs- oder Kompromissverhltnis zu setzen wren. Explizit betont er,
es gehe hier nicht nur um Alternativen, sondern um unberbrckbar tdlichen
Kampf28. In diesem agonalen Verhltnis grndet fr Weber die Unmglichkeit,
praktische Stellungnahmen wissenschaftlich zu vertreten und damit zugleich die
Unmglichkeit, ber letzte Zwecke in irgendeiner Weise rational zu entscheiden.
Nachdrcklich wendet er sich gegen die Vorstellung, das Abwgen von Grnden
und ethischen Prinzipien knne derartige Entscheidungen rationalisieren29.
24 So formuliert er in seinem berhmten Objektivittsaufsatz: Jede denkende Bestimmung auf die letzten Elemente sinnvollen menschlichen Handelns ist zunchst gebunden an die Kategorien Zweck und Mittel (Max Weber, Gesammelte Aufstze zur
Wissenschaftslehre (GAW), Tbingen 19887 (1922), S. 149).
25 Vgl. dazu Stefan Breuer, Brokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max
Webers, Darmstadt 1994, S. 39ff.
26 Vgl. Max Weber, Zwischenbetrachtung, aaO. (FN 11), S. 571.
27 Max Weber, GAW, aaO. (FN 24), S. 604.
28 Ebd., S. 507.
29 Ebd., S. 507ff., 602ff. Ausfhrlicher zu der damit verbundenen Ablehnung der praktisch-philosophischen Tradition durch Weber vgl. Hella Mandt, Tyrannislehre und
Widerstandsrecht, Darmstadt 1974, S. 267ff.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 32 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
32 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
Ohne Mglichkeit, sich auf eine einheitliche Weltanschauung zu beziehen und
aus ihr eine ethisch-methodische Lebensfhrung abzuleiten, bleibt dem auf sich zurckgeworfenen Individuum nur, dieses Schicksal der Zeit mnnlich zu ertragen und sich zwischen den letzten Standpunkten zum Leben zu entscheiden30. Individueller Heroismus und ethischer Dezisionismus treten bei Weber an die Stelle
eines religis verbrgten einheitlichen Sinnes.
Wie Wilhelm Hennis berzeugend darstellen konnte, gilt Webers zentrales Interesse der Entwicklung des Menschentums31. Ihn beunruhigt die Verdrngung des
Kulturmenschen durch den Ordnungs- oder Berufsmenschen bzw. den
zweifach, als Fachmenschen ohne Geist und als Genussmenschen ohne Herz
bestimmten Typus der Zukunft32. Weber entwickelt sein Gegenmodell, das Individuum als verantwortungsbewusste Persnlichkeit, aus der oben beschriebenen Entscheidungssituation. Unter den Bedingungen einer mechanisierten und in Wertsphren zerfallenden Gesellschaft whlt die Persnlichkeit den Sinn ihres Tuns und
Seins selbst33. Allerdings qualifiziert Weber diesen voluntaristischen Akt in Abgrenzung zur subjektivistischen Kultur der Moderne, indem er von ihr Konsequenz
bzw. Hingabe an die einmal gewhlte Sache sowie intellektuelle Rechenschaftspflicht, also Reflexivitt fordert34. Dies bildet den Hintergrund fr Webers Verantwortungsethik, die sich im klaren Bewusstsein der praktischen Folgen und der Rationalitt der Mittel im Verhltnis zum gewhlten Zweck zu erweisen hat35. In der
subjektivistischen Kultur der Moderne mit ihrer Suche nach authentischer Erfahrung und dem Jagen nach Erlebnis kann Weber dagegen nur eine Schwche, gewissermaen die Kehrseite der gesellschaftlichen Mechanisierung erkennen36. Fr
den Gewinn persnlicher Freiheit muss, hnlich wie im Puritanismus, der Preis der
Askese und Selbstbeherrschung entrichtet werden. Handeln ist fr Weber umso
freier, je mehr es den Charakter eines naturhaften Geschehens ablegt und in der
Konstanz eines persnlich gewhlten Verhltnisses zu letzten Werten und Bedeutungen steht37.
2.3. Freiheitsverlust
Damit ist nun allerdings die Frage nach dem zweiten Element in Webers Kulturkritik, dem Freiheitsverlust, aufgeworfen. In den bereits zitierten Metaphern vom
stahlharten Gehuse oder den vielen alten Gttern, die nach Gewalt ber unser
30
31
32
33
34
35
Max Weber, GAW, aaO. (FN 24), S. 612, S. 608.
Wilhelm Hennis, Max Webers Fragestellung, Tbingen 1987, S. 20.
Max Weber, Die protestantische Ethik I, aaO. (FN 15), S. 189.
Vgl. Max Weber, GAW, aaO. (FN 24), S. 180 und S. 508.
Ebd., S. 494 und S. 608.
Vgl. Max Weber, Gesammelte Politische Schriften (GPS) Tbingen 19885 (1921), S.
551f.
36 Max Weber, GAW, aaO. (FN 24), S. 605.
37 Vgl. ebd., S. 132.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 33 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 33
Leben streben, spricht Weber Freiheitsverlust als Folge der Verselbstndigung gesellschaftlicher Organisationen und ihrer Funktionsweise an. Und zwar
verselbstndigen sich insbesondere kapitalistische konomie und staatliche Brokratie gegenber den Individuen und deren moralisch-praktischen Handlungsmotiven. Es ist also zunchst einmal zu unterstreichen, dass Weber nicht nur in der Brokratisierung, sondern auch im Siegeszug der kapitalistischen konomie eine
Tendenz zur Zerstrung individueller Freiheit sieht. Dem heutigen Hochkapitalismus eine Wahlverwandtschaft mit Demokratie oder gar mit Freiheit (in irgend
einem Wortsinn) zuzuschreiben, bezeichnet er als hchst lcherlich38. Im Gegensatz zu den Fortschrittshoffnungen seiner Zeit (und in einem nicht minderen zu
heutigen neoliberalen Vorstellungen) erwartet er als Ergebnis konomischer Vergesellschaftung keinen Freiheitsgewinn, sondern eine Einschrnkung der Persnlichkeits- und Freiheitssphre des Individuums. Die modernen Vorstellungen von Freiheit, Individualismus und demokratischen Institutionen sind fr ihn das Ergebnis
einzigartiger, sich nicht wiederholender historischer Konstellationen in der westlichen Welt39, keineswegs das Ergebnis gesellschaftlicher Rationalisierung. Sie mssen
deshalb auch wider den Strom der materiellen Entwicklungstendenzen erobert
bzw. gesichert werden40.
Freiheitsverlust bildet fr Weber schon deshalb die unausweichliche Kehrseite gesellschaftlicher Rationalisierung, weil sowohl rationales Wirtschaften wie auch rationale Verwaltung erst durch Herrschaftsverhltnisse mglich werden. Die sozialstrukturelle Voraussetzung von Webers formaler Rationalitt bildet die Trennung des
Arbeiters von den sachlichen Produktionsmitteln in der Wirtschaft, von den Kriegsmitteln im Heer, den sachlichen Verwaltungsmitteln in der ffentlichen Verwaltung41. Gesellschaftliche Rationalisierung kann demnach nur in dem Mae voranschreiten, wie die Arbeitenden, oder allgemeiner die rational Ttigen, die Mglichkeit
verlieren, ihr Handeln nach eigenen Zielvorstellungen auszurichten und gezwungen
werden knnen, als Teil einer kalkulierbaren Maschinerie zu funktionieren.
Insbesondere die Brokratie charakterisiert Weber immer wieder als Maschine
oder als Mechanismus. Die formal rationale Brokratie basiert auf straffer arbeitsteiliger Organisation, hierarchisch abgestuften Gehorsamsverhltnissen, fachlicher
Schulung und vor allem auf einer sachlichen Erledigung ihrer Aufgaben nach berechenbaren Regeln42. Diese regelgebundene khle Sachlichkeit funktioniert ohne
Ansehen der Person und kann mit materialen Gerechtigkeitsvorstellungen kollidieren43, ganz hnlich wie die kapitalistische Geld- und Gewinnrechnung sich von
38 Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 64.
39 Neben religis bestimmten Wertvorstellungen zhlt Weber hierzu vor allem die berseeische Expansion der frhen Neuzeit, den anarchischen Charakter des Frhkapitalismus und die Vorstellung von einer wissenschaftlich gebildeten universellen
Persnlichkeit (vgl. Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), 64f.).
40 Ebd., S. 65.
41 Ebd., S. 322.
42 Vgl. ebd., S. 332; Max Weber, WuG, aaO. (FN 10), S. 661.
43 Max Weber, WuG, aaO. (FN 10), S. 664.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 34 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
34 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
gesellschaftlichen Bedrfnissen und Produktionszielen lsen kann. Auf die Funktionszwnge einer solchen Brokratie bezieht Weber sein berhmtes Gehuse der
Hrigkeit, in welches
vielleicht dereinst die Menschen sich, wie die Fellachen im altgyptischen Staat,
ohnmchtig zu fgen gezwungen sein werden, wenn ihnen eine rein technisch gute
und das heit: eine rationale Beamtenverwaltung der letzte und einzige Wert ist, der
ber die Leitung ihrer Angelegenheiten entscheiden soll44.
Es handelt sich bei diesem Zitat allerdings weder um eine Zustandsbeschreibung
noch um eine Prophetie. Weber sagt wenn ..., es gibt also Alternativen und Mglichkeiten, das Gehuse der Hrigkeit zu vermeiden.
2.4. Webers Lsung: Dezision und Herrschaft
Es ist diese Rckfhrung formaler Rationalitt auf ein gesellschaftliches Herrschaftsverhltnis, das Georg Lukcs die Mglichkeit bot, Webers Rationalisierungstheorie marxistisch umzuformulieren. Wenn Rationalitt ein Klassenverhltnis voraussetzt, dann muss sie sich auch so die logische Schlussfolgerung mit diesem
Klassenverhltnis aufheben lassen. Fr Lukcs ist Webers Durchsetzung formaler
Rationalitt das Ergebnis der voranschreitenden Subsumtion der Gesellschaft unter
die Wertabstraktion kapitalistischer Warenproduktion. Sie enthlt damit den Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, zwischen konkreter und abstrakter Arbeit oder politisch revolutionr gewendet, den Widerspruch der Arbeiter gegen den (ihnen aufgezwungenen) Warencharakter ihrer Arbeitskraft.
Am immanent widersprchlichen Charakter gesellschaftlicher Rationalisierung
hlt brigens auch Jrgen Habermas fest. Er erweitert dazu allerdings das Verstndnis gesellschaftlicher Rationalisierung um den Begriff der kommunikativen Verstndigung und gibt die Vorstellung von einer revolutionren Klasse auf, die als Verkrperung der materialen Vernunft bedrfnisorientierter Produktion gelten kann. In
den Kategorien von Habermas lsst sich der funktionalen Vernunft in den ausdifferenzierten Subsystemen der konomie und des Staates das durch die Rationalisierung von Lebenswelten freiwerdende Potential verstndigungsorientierten Handelns entgegensetzen45. An die Stelle des schicksalhaften Freiheits- und Sinnverlustes
bei Max Weber tritt dann die Gefahr des kolonialisierenden bergriffs der Steuerungsmedien Geld und Macht auf die Lebenswelt, eine Gefahr gesellschaftlicher Rationalisierung, zur der Habermas nun jedoch in der posttraditionalen Kommunikation moderner Gesellschaften eine ebenfalls rationale Gegenkraft identifiziert.
Wie wir wissen, konnte Weber in der Rationalisierung moderner Gesellschaften
keine immanente Dialektik entdecken, weder in revolutionr-sozialistischer noch in
evolutionr-demokratischer Form. Ausdrcklich verneint er die Mglichkeit, dass
irgendeine materielle oder gar die heutige hochkapitalistische Entwicklung die
44 Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 332.
45 Vgl. etwa Jrgen Habermas, aaO. (FN 7), II, S. 485ff.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 35 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 35
Bedingungen individueller Freiheit schaffen oder auch nur erhalten knne46. Bekannt ist auch Webers Urteil ber die sozialistischen Bewegungen seiner Zeit. Obwohl er im Sozialismus eine kulturkritische Bewegung sah, der es in erster Linie darum ging, die brgerliche Welt mit neuen Werten zu konfrontieren, prophezeite er
fr den Fall ihres Erfolges eine Verstrkung der freiheitszerstrenden Tendenzen
moderner Gesellschaften47. Die Ausschaltung des Privatkapitalismus fhre lediglich
zu einer Alleinherrschaft der staatlichen Brokratie und mache somit das sthlerne
Gehuse der Hrigkeit nur noch undurchdringlicher48.
Weber sucht die Gegenkrfte zum diagnostizierten Sinn- und Freiheitsverlust auerhalb seines Rationalittsbegriffes in den voluntaristischen wertsetzenden Entscheidungen des Individuums. Politisch bedeutsam wird diese bereits oben charakterisierte Perspektive dadurch, dass Weber insbesondere zwei Gruppen fr
persnlich qualifiziert und aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung auch fr fhig
hlt, als soziale Trger freiheitssichernder Dezision zu wirken: kapitalistische Unternehmer und politische Fhrer49. Beide verkrpern fr Weber das, was der rationalen Verwaltung, sei es im Wirtschaftsbetrieb, sei es im Staat, fehle, nmlich den
zur eigenverantwortlichen Entscheidung fhigen leitenden Geist50. Fr uns ist dabei in erster Linie der politische Fhrer von Interesse. Das galt brigens aber auch
fr Weber selbst, weil er anders als heutige Systemtheoretiker in der Politik noch
das Zentrum der Gesellschaft sah.
Im Folgenden mchte ich zeigen, dass dieses dezisionistische Heilmittel gegen
die Entfremdungserscheinungen moderner Gesellschaften a) formal und b) pessimistisch-elitr ist sowie c), worauf es mir hier besonders ankommt, den versachlichten Verhltnissen moderner Gesellschaften eine Vorstellung von direkter, durch Befehls-Gehorsamsverhltnisse bestimmter Herrschaft entgegensetzt und zwar auch
da, wo Weber fr die Demokratisierung Deutschlands nach westlichem, insbesondere amerikanischem Vorbild eintritt.
a) Die Fhigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln ist fr Weber nicht nur persnliche Begabung, sondern mehr noch das Ergebnis von Sozialisationsprozessen.
Unternehmer und Politiker stehen im Kampf um ihre eigene Sache und unterscheiden sich damit vom modernen Durchschnittsmenschen, der lngst zu einem Rdchen in Wirtschaft und Verwaltung wurde und innerlich zunehmend darauf abgestimmt (ist), sich als ein solches zu fhlen und sich nur zu fragen, ob er nicht von
diesem kleinen Rdchen zu einem greren werden kann51.
Dass gerade Unternehmer und Politiker Webers Ideal des Kulturmenschen retten
sollten, mag erstaunen. Aber Weber kommt es hier nicht auf die Inhalte unterneh46 Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 65.
47 Zu Webers Auffassung vom Sozialismus als kulturkritischer Bewegung s. Lawrence A.
Scaff, Fleeing the Iron Cage, aaO. (FN 7), S. 175ff.
48 Vgl. Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 331f.
49 Ebd., S. 334.
50 Ebd.
51 Max Weber, Gesammelte Aufstze zur Soziologie und Sozialpolitik(GASS), Tbingen
1924, S. 413.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 36 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
36 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
merischer oder politischer Ttigkeit an, sondern rein formal auf den Gesichtspunkt
der eigenverantwortlichen Entscheidung, zu der weder Pflichtbewusstsein noch
Fachwissen, sondern nur die Erfahrung des Machtkampfes in eigener Sache befhige. Kampf um eigene Macht und die aus dieser Macht folgende Eigenverantwortung fr seine Sache ist das Lebenselement des Politikers wie des Unternehmers52.
Freiheit ist hier gedacht als Autonomie der Entscheidung, Autonomiefhigkeit als
Ergebnis einer Schule des Kampfes.
b) Webers Kulturkritik oszilliert zwischen der pessimistischen Beschreibung unaufhaltsamer, schicksalhafter Tendenzen der gesellschaftlichen Versachlichung und
dem Pathos, mit dem er dazu aufruft, gegen die groe Maschinerie moderner Gesellschaften noch einen Rest des Menschentums freizuhalten von dieser Parzellierung der Seele, von dieser Alleinherrschaft des brokratischen Ideals53. Darauf bezogen spricht Greven von tragisch-heroischen Zgen in der Haltung Webers, von
einer historischen Rckzugsposition, oder auch vom Konzept einer historisch
defensiven Elite54.
Obwohl Weber in Unternehmern und politischen Fhrern soziale Trger der Gegenkrfte zu den freiheitszerstrenden Tendenzen der Moderne bestimmt, seine
Kulturkritik also nicht auf Appelle beschrnkt bleibt, knnen diese Gegenkrfte in
nennenswertem Mae nur dort entstehen, wo die Erfahrung des eigenstndigen
Kampfes um Macht mglich ist. Von vornherein sind sie deshalb auf Herrschaftseliten beschrnkt. Da die gesellschaftliche Rationalisierung und ihr prgender Einfluss
auf den Charakter der Massen unaufhaltsam voranschreitet, besteht keine realistische
Aussicht darauf, die Bedingungen gesellschaftlicher Unfreiheit zu beseitigen. Es
kann lediglich gehofft werden, durch die Haltung entscheidungsfhiger Eliten einen
begrenzten Raum des freien, verantwortungsbewussten Handelns zu retten. Insofern
bleibt Weber ganz dem elitr-pessimistischen Gestus konservativer Kulturkritik verhaftet, obwohl er ihr eine politische, demokratiebefrwortende Wendung gibt.
c) Die zitierte Formulierung Webers vom leitenden Geist deutet bereits darauf
hin, dass er der Verselbstndigung der versteinerten Mechanik oder der gesellschaftlichen Maschinerie durch eine Wiederbelebung direkter, das heit nicht durch
verselbstndigte Handlungsfolgen vermittelter Herrschaftsverhltnisse55 begegnen
will. Zwar gilt ihm die weitere Versachlichung gesellschaftlicher Verhltnisse als unentrinnbar. Jedoch kann die Maschinerie insgesamt, sei es der einzelne Wirtschaftsbe52 Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 335.
53 Max Weber, GASS, aaO. (FN 51), S. 414.
54 Michael Greven, Krise der objektiven Vernunft. Entfremdung und ethischer Dezisionismus bei Georg Lukcs und Max Weber in: U. Bermbach / G. Trautmann (Hg.),
Georg Lukcs, Opladen 1987, S. 118.
55 Die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Herrschaft stammt aus der
Debatte um den Charakter des sog. realen Sozialismus der siebziger Jahre. Insbesondere Renate Damus beschrieb in ihren Arbeiten mit dem Begriff der direkten Herrschaft
den Versuch der kommunistischen Staats- und Parteifhrungen, formale Rationalitt
unter Umgehung von Warenbeziehungen durch Befehls-Gehorsamsverhltnisse durchzusetzen (vgl. Renate Damus, Der reale Sozialismus als Herrschaftssystem am Beispiel
der DDR, Frankfurt a.M. 1978).
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 37 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 37
trieb oder der brokratisierte Staat, durch starke Fhrerpersnlichkeiten zur Verwirklichung bestimmter Zwecke genutzt werden. Dies ist allerdings nur in dem
Mae mglich, wie es gelingt, die Maschinerie in ein zweckrationales hierarchisches Befehls-Gehorsamsverhltnis einzufgen. Bekanntermaen bestimmt Weber
Herrschaft als Chance, fr einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden56. So definiert, erffnen Herrschaftsverhltnisse demjenigen, der an der Spitze steht, die Perspektive einer freien Entscheidung ber die Zwecke sowie ihrer Verwirklichung entlang von Befehls-Gehorsamsketten. Warum
Webers Denken um das Problem der Herrschaft kreist, warum er, wie Hennis formuliert, geradezu behext war vom Problem der Fhrung und Herrschaft57, findet
hier eine Erklrung in seiner Kulturkritik. Wie wir gesehen haben, fhrt Weber Sinnund Freiheitsverlust in modernen Gesellschaften auf die zunehmenden Schwierigkeiten zurck, das eigene Leben konsequent auf die Verwirklichung selbstbestimmter
Zwecke auszurichten. Die Mglichkeit von Sinngebung und Freiheit ist also an eine
zweckrationale Handlungsstruktur gebunden. Webers Lsung unter den Bedingungen einer rationalisierten Gesellschaft liegt nun darin, eine solche zweckrationale
Handlungsstruktur auf hherer, politischer Ebene wiederherzustellen.
Gewiss erinnert Webers Begriff der Herrschaft mit seiner Betonung von BefehlsGehorsamsverhltnissen an die vormoderne Beziehung zwischen Herr und Knecht.
Er kann auch durchaus plausibel als Ausdruck der autoritren Traditionen des preuischen Obrigkeitsstaates interpretiert, oder spezifischer noch auf den Einfluss der
deutschen Staatsrechtslehre zurckgefhrt werden58. Dennoch ist Max Weber
selbstverstndlich kein Apologet vorbrgerlich-aristokratischer Gesellschaftsverhltnisse. Entscheidend scheint mir vielmehr, dass er der versachlichenden Rationalisierung moderner Gesellschaften ein Modell zweckrationalen Handelns gegenberstellt, nach dem der Handelnde autonom, mglichst frei von Zwngen wie von
Affekten einen Zweck whlt und dann, nach Magabe der Situation, die zur Erreichung seiner Zwecke geeigneten Mittel bestimmt59. Der autonome Akt der Dezision und das distanzierte zweckrationale Kalkl bilden brigens, wie Weber selbst
betont, einen entscheidenden Unterschied zu romantischen Vorstellungen persnli56 Max Weber, WuG, aaO. (FN 10), S. 28.
57 Wilhelm Hennis, Max Webers Fragestellung, aaO. (FN 7), S. 219.
58 Im ersten Sinn etwa Dolf Sternberger, Max Weber und die Demokratie in: Herrschaft
und Vereinbarung, Frankfurt a.M.1986 oder Rigby, der Herrschaft als earthy German
word bezeichnet und den Herrschaftsbegriff wegen seiner Nhe zu agrarisch-feudalen
Verhltnissen fr ungeeignet hlt, moderne politische Systeme zu analysieren, die auf
Verhandlungen, Kompromissen etc. basieren (T.H. Rigby, Introduction: Political
Legitimacy, Weber and Mono-organisational Systems in: T.H. Rigby / Ference Fehr
(eds.), Political Legitimation in Communist States, London/Basingstoke 1982, S. 7).
Spezifischer zum Einfluss der deutschen Staatsrechtslehre auf Weber etwa Ernst Vollrath, Max Weber: Sozialwissenschaft zwischen Staatsrechtslehre und Kulturkritik in:
Politische Vierteljahresschrift, 31. Jg., 1/1990, S. 102-108.
59 Vgl. Max Weber, GAW, aaO. (FN 24), S. 132f. Dieses Handlungsmodell lsst sich mit
Habermas als teleologisch und monologisch charakterisieren (vgl. Jrgen Habermas,
Theorie des kommunikativen Handelns, aaO. (FN 7) Bd. I, S. 378).
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 38 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
38 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
cher Freiheit60, aber auch zur Position Nietzsches, der Zweckrationalitt als Quelle
des Nihilismus kritisiert61. Unschwer ist in diesem teleologischen Handlungsmodell
die neuzeitliche Vorstellung von Willensfreiheit und Souvernitt zu erkennen.
Ebenso eindeutig ist aber auch seine Nhe zur Gewalt, wo immer es auf den Bereich
des Politischen bezogen wird. Denn die Fhigkeit, eigene Ziele durchzusetzen, ist
umso grer, je effektiver ich die anderen, mit denen ich den politischen Raum teile,
von der Zielbestimmung ausschlieen und zur Verwirklichung meiner Zwecke instrumentalisieren kann. Dem teleologischen Handlungsmodell entspricht ein Verhltnis zwischen Befehlenden und Gehorchenden. Wie Arendt in ihrer expliziten
Auseinandersetzung mit Webers Herrschaftsbegriff in Macht und Gewalt zugesteht, ist der wirkungsvollste Befehl zwar derjenige, der mit Gewalt drohen kann.
Allerdings, so ihr Einwand, zerstrt die auf Gewalt gegrndete Fhigkeit, die eigenen Ziele auch gegen Widerstreben durchzusetzen, den politischen Raum und damit
die in ihm entstehende, auf Zustimmung gegrndete Macht62.
Gerade Webers spte politische Schriften, in denen er das wilhelminische Deutschland mit den parlamentarischen Demokratien des Westens vergleicht, lassen erkennen, wie stark sein Pldoyer fr die Parlamentarisierung Deutschlands durch ein Politikverstndnis geprgt ist, das Regierende und Regierte in ein arbeitsteiliges
Verhltnis von Entscheidung und Ausfhrung stellt. Zwar wrdigt er nach seiner
Amerikareise von 1904 die freiwilligen, dem Vorbild religiser Sekten folgenden Assoziationen auf kommunaler Ebene als Gegengewicht zur Atomisierung der Individuen in modernen Massengesellschaften63. Es sind letztlich aber gerade nicht diese
brgerschaftlichen Seiten der amerikanischen Demokratie, die Weber fr zukunftstrchtig hlt und in den Auseinandersetzungen ber die politische Entwicklung
Deutschlands als nachahmenswert propagiert64. Nach Weber luft die egalitre Logik
derartiger Zusammenschlsse der Logik der Zweckrationalitt zuwider und untergrbt damit konsistente und effiziente Entscheidungen, auf die es ihm politisch gera-
60 Vgl. Max Weber, GAW, aaO. (FN 24), S. 132.
61 Dazu ausfhrlicher Dana R. Villa, Arendt and Heidegger. The Fate of the Political,
Princeton 1996.
62 Aus den Gewehrlufen kommt immer der wirksamste Befehl, der auf unverzglichen,
fraglosen Gehorsam rechnen kann. Was niemals aus Gewehrlufen kommt, ist Macht
(Hannah Arendt, Macht und Gewalt (MG), Mnchen 19907, (1970), S. 54).
63 Vgl. dazu Wolfgang J. Mommsen, Max Weber. Gesellschaft, Politik, Geschichte, Frankfurt a. M. 1974 und Sung Ho Kim, In Affirming Them, He Affirms Himself. Max
Webers Politics of Civil Society in: Political Theory, Vol. 28, 2/2000, S. 197-229. Whrend Mommsen dieses Element in Webers Amerikabild relativiert, interpretiert Kim
Weber als Protagonisten einer aktiven Zivilgesellschaft.
64 Zum Begriff eines brgerschaftszentrierten im Gegensatz zu einem herrschaftszentrierten Politikbegriff vgl. Jrgen Gebhardt, Auf der Suche nach dem Politischen in:
Michael Greven / Rainer Schmalz-Bruns (Hg.), Brgersinn und Kritik, Festschrift fr
Udo Bermbach zum 60. Geburtstag, Baden-Baden 1998, S. 15-27.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 39 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 39
de ankommt65. Statt der egalitren Formen einer brgerschaftlichen Politik rckt
Webers Blick auf das demokratische Amerika vor allem die brokratisch organisierte
Massenpartei und ihren plebiszitr-charismatischen Fhrer ins Zentrum des Bildes.
Weber begrndet sein Eintreten fr die parlamentarische Regierungsform whrend des Ersten Weltkrieges zunchst damit, dass sie Berufspolitiker hervorbringe,
die durch den Machtkampf untereinander als starke Fhrer qualifiziert, d. h. zu Dezision und Verantwortung fhig seien66. In diesem Typ des Politikers sah Weber bekanntlich eine Voraussetzung der nationalen Selbstbehauptung Deutschlands67. Die
Bedeutung des Parlaments fr die Sozialisation und die Auslese dieser starken Fhrerpersnlichkeiten betont Weber whrend des Krieges strker als in den Schriften,
die unmittelbar danach entstanden. Sowohl in der spteren Fassung der Herrschaftssoziologie von 1919/20 als auch in Politik als Beruf verlagert sich der Akzent auf die plebiszitr-charismatischen Qualitten des Fhrers und seine Stellung
zum Parteiapparat. Es scheint, als sei Weber der parlamentarische Alltag nun zu
sehr durch Routine und Betrieb bestimmt. Er traut ihm jedenfalls nicht mehr ohne
weiteres zu, Politiker mit Berufung, d.h. mit der Fhigkeit zur Wertsetzung hervorzubringen68. Das erwartet er dagegen vom aueralltglichen Charisma des plebiszitren Fhrers. Die plebiszitre Fhrerdemokratie, in der die Massen einen rhetorisch begabten oder gar demagogisch agierenden Politiker ins Amt whlen, ist
deshalb eher geeignet, mit dem Verhltnis von Fhrer und Gefolgschaft zugleich
Dezision und Zweckrationalitt, und damit, aus Webers Perspektive, Freiheit und
Sinn in den politischen Bereich zurckzubringen69. Er macht berhaupt keinen
Hehl daraus, dass diese Fhrerdemokratie mit Maschine blinden Gehorsam erfordere und die Entseelung der Gefolgschaft, ihre geistige Proletarisierung bedinge70. Aber das nimmt er in Kauf, weil ihm unter Bedingungen gesellschaftlicher Rationalisierung das wertsetzende Charisma des Fhrers der einzige Weg scheint, dem
ehernen Gehuse der Hrigkeit zu entkommen. Weber pldiert zu Beginn des
letzten Jahrhunderts fr die Demokratisierung Deutschlands, weil er die Demokra65 Dies zeigt Kloppenberg in einem aufschlussreichen Vergleich Webers mit Dewey
(James T. Kloppenberg Demokratie und Entzauberung der Welt: Von Weber und
Dewey zu Habermas und Rorty in: Hans Joas (Hg.), Philosophie und Demokratie,
Frankfurt a.M. 2000, S. 44-80).
66 Vgl. Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 340ff., S. 364.
67 Zur Perspektive nationaler Selbstbehauptung in den politischen Schriften Webers etwa
Mommsen 1959. Mommsen zitiert zustimmend Lukcs, nach dem Demokratisierung
fr Weber eine technische Manahme zugunsten eines besser funktionierenden Imperialismus gewesen sei (Wolfgang Mommsen, Weber, aaO. (FN 7), S. 422).
68 Zu dieser Verschiebung ausfhrlich Peter Breiner, Max Weber and Democratic Politics,
Ithaca/London 1996 und Wolfgang Mommsen, Politik im Vorfeld der Hrigkeit der
Zukunft. Politische Aspekte der Herrschaftssoziologie Max Webers in: Edith Hanke /
Wolfgang Mommsen (Hg.), Max Webers Herrschaftssoziologie, Tbingen 2001, S. 302-319.
69 Mommsen verweist bereits 1959 auf diesen Zusammenhang, wenn er schreibt, dass
Weber den Weg der plebiszitr-charismatischen Herrschaft des groen Demagogen
einschlug, um der Gefahr der brokratischen Erstarrung der modernen Massengesellschaft zu entgehen (Wolfgang Mommsen, Weber, aaO. (FN 7), S. 436).
70 Vgl. Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 544.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 40 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
40 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
tie fr geeignet hlt, durch Fhrer-Gefolgschaftsverhltnisse die versteinerte Maschinerie der rationalisierten gesellschaftlichen und staatlichen Apparate unter die
Kontrolle persnlicher Dezision zu bringen und ihr einen wertrational bestimmten
Zweck vorzugeben. So gesehen ermglichen die Demokratien des Westens mit ihren plebiszitren politischen Fhrerpersnlichkeiten und den ihnen untergeordneten Parteiapparaten eine zugleich herrschaftlichere und freiheitlichere Politik als das
brokratisierte Deutschland unter Wilhelm II.71.
Ausgehend von einem aristotelischen Politikverstndnis wurde Max Weber vorgeworfen, seine Definitionen von Staat und Herrschaft verkehrten mit ihrer Konzentration auf Gewalt und Befehls-Gehorsamsverhltnisse das Despotische zum
Politischen72. Tatschlich steckt in Webers Herrschaftssoziologie ein platonisches
Element. In diesem Zusammenhang hat Edith Hanke jngst darauf hingewiesen,
dass Weber seinen Herrschaftsbegriff erst nach 1910 unter dem Einfluss von Georg
Simmel und Georg Jellinek przisiert habe. Dabei bemerkt sie, dass Simmel, Platon
zitierend, Herrschaft auf ihren Kern zurckfhre, nmlich auf ein und diesselbe
Fhigkeit, zu befehlen, die der politikos wie der basileus, der despotos wie der oikonomos besitzen msse73. Dennoch ist Webers Position im klassischen Gegensatz
zwischen aristotelischem und platonischem Denken nicht zu fassen. Weber will
Herrschaft nicht als Befehls-Gehorsamsverhltnis zwischen Wissenden und Unwissenden legitimieren. Wie bekannt, betont er ja immer wieder, die letzten wertrationalen Entscheidungen seien nicht rational begrndbar. Weber unterscheidet sich
grundlegend von platonischen Positionen durch seine Haltung zum Kontingenzproblem. Weber will die Unbestimmtheit politischen Handelns nicht durch eine in
letzten Wahrheiten grndende Herrschaftsstruktur ausschalten oder zumindest einschrnken, sondern, ganz im Gegenteil, Kontingenz im Sinne eines Anders-Handeln-Knnens gegenber den typisch modernen Zwngen der formalen Rationalisierung und Brokratisierung erhalten74. Weber, und darin liegt die Besonderheit
71 Dieser Zusammenhang wird in geradezu groteskem Mae banalisiert, wenn Stefan Breuer
Webers Eintreten fr die charismatische Fhrerpersnlichkeit in den Diskussionen um
die Weimarer Verfassung als bedauerliche Fehleinschtzung von Entwicklungstrends charakterisiert: Weber, so scheint es, hat einfach Michels Analysen ber die quasi-militrische Hierarchie der deutschen Sozialdemokratie und die ihm zur Verfgung stehenden
Informationen ber die plebiszitre Demokratie in Amerika addiert und zu einem Trend
hochgerechnet, ohne dabei die theoretisch von ihm durchaus erkannte Mglichkeit
einzubeziehen, dass die Demokratisierung auch zu einer ffnung der hierarchischen
Struktur, ja sogar zu ihrem Abbau fhren kann (Stefan Breuer, Brokratie und Charisma, aaO. (FN 25), S. 173). Einen solchen Abbau hierarchischer Strukturen konnte
Weber in seinem herrschaftskategorialen Verstndnis von Politik gerade nicht wollen.
72 Dolf Sternberger, Drei Wurzeln der Politik, Bd. II, Frankfurt a.M. 1978, S. 355.
73 Edith Hanke zitiert hier Georg Simmel: Zur Philosophie der Herrschaft, in: ders., Soziologie. Untersuchungen ber die Formen der Vergesellschaftung, Leipzig 1908, S. 197;
zitiert nach Edith Hanke, Max Webers Herrschaftssoziologie. Eine werkgeschichtliche Studie in: Edith Hanke / Wolfgang Mommsen (Hg.), Max Webers Herrschaftssoziologie, Tbingen 2001, S. 25.
74 Zum Kontingenzproblem bei Weber vgl. Kari Palonen, Das Webersche Moment. Zur
Kontingenz des Politischen, Wiesbaden 1998.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 41 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 41
seiner Position, hlt nun gerade das von Sternberger mit Aristoteles als despotisch
bezeichnete Verhltnis von Befehlen und Gehorchen, bzw. Entscheiden und Ausfhren fr das letzte Refugium der Freiheit. Bereits 1974 hat Wolfgang Mommsen
darauf bezogen Webers Position in der paradoxen Formel mglichst viel Freiheit
durch mglichst viel Herrschaft zusammengefasst75.
3. Sinn- und Freiheitsverlust bei Hannah Arendt
Auf den ersten Blick finden sich bei Weber und Arendt die selben Leitmotive der
Kulturkritik: Brokratisierung und Verantwortungslosigkeit, Funktionalisierung,
Vermassung und Konformismus sowie die Flucht in Subjektivismus und blinden
Genuss. Auch das parzellisierte, in den funktionierenden Fachmenschen und geistlosen Genussmenschen auseinanderfallende Individuum Webers und der sich nur
noch verhaltende, in quasi automatischem Funktionieren und Konsumieren aufgehende und seine Individualitt verlierende Animal laborans der Jobholder Society
bei Arendt76 scheinen sich allenfalls in Nuancen zu unterscheiden. Ohne groe interpretatorische Verrenkungen lsst sich deshalb Arendts Kritik der Moderne ebenfalls unter der Formel des Sinn- und Freiheitsverlustes zusammenfassen.
Die Nennung derselben Phnomene impliziert jedoch nicht unbedingt die Inkriminierung desselben Tatbestandes, derselben Gefahr oder Drohung. Zwar erzhlen
uns beide Autoren die Geschichte moderner Gesellschaften in dekadenztheoretischen Kategorien als Verlustgeschichte. Da sich ihr Ausgangspunkt unterscheidet,
unterscheidet sich jedoch auch der jeweils beklagte Verlust. Max Weber misst die
Moderne an der zu ethisch-methodischer Lebensfhrung fhigen Persnlichkeit,
die im Ergebnis der von ihr eingeleiteten gesellschaftlichen Rationalisierungsprozesse zu verschwinden droht. Arendt dagegen bezieht die Mastbe ihrer Kritik aus
der Mglichkeit des Handelns in pluralen ffentlichen Rumen, die sie in der antiken Polis und den politischen Revolutionen der Neuzeit verwirklicht sah.
Whrend Max Weber in der willkrlichen, aber wertbezogenen Zwecksetzung
durch das Individuum bzw. den charismatischen Fhrer Rettung vorm Sinn- und
Freiheitsverlust der Moderne sucht, bildet fr Hannah Arendt im Gegensatz dazu
die Verallgemeinerung von Zweck-Mittel-Beziehungen gerade das Grundbel neuzeitlicher Gesellschaften. Weber will formal rationalisierte Organisationen politisieren, indem er sie den wertrational bestimmten Zwecken starker Fhrer unterstellt.
Fr Arendt dagegen liegt zwischen Zweckrationalitt und politischem Handeln der
denkbar grte Widerspruch.
75 Wolfgang J.Mommsen, Max Weber. Gesellschaft, Politik, Geschichte, Frankfurt a.M.
1974, S. 138.
76 Hannah Arendt, Vita Activa oder vom ttigen Leben, Mnchen 1981, S. 314.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 42 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
42 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
3.1. Sinnverlust durch Zweckrationalitt
Fr Max Weber ist Sinn gleichbedeutend mit einem letzten, ursprnglich religisen
Zweck, auf den der einzelne Mensch seine Lebensfhrung ausrichten und rational
gestalten kann. Bereits in den religionssoziologischen Grundlagen seiner Kulturkritik identifiziert Weber also Sinnstiftung mit der rationalen Beziehung auf einen
Endzweck, der hier spezifischer als religise Heilsgewissheit bestimmt ist. Demgegenber polemisiert Hannah Arendt gegen die weitverbreitete Gleichsetzung von
Sinn und Zweck und versucht, die Bedeutung der beiden Begriffe grundstzlich zu
unterscheiden.
Ihr zufolge grnden die Pathologien der Moderne nicht zuletzt in der Unfhigkeit des Homo faber, den Unterschied zwischen dem Nutzen und dem Sinn einer
Sache zu verstehen. Ein Tun im Modus des Um-zu, d.h. um einen bestimmten
Zweck zu erreichen, gert, wie Arendt argumentiert, unweigerlich in einen Zweckprogressus ad infinitum. Denn ohne berwindung des Ntzlichkeitsdenkens bestehe keine Mglichkeit, die bereits von Lessing gestellte Frage: Und was ist der
Nutzen des Nutzens? zu beantworten77. Strker noch: da der Homo faber der
Neuzeit das Ntzlichkeitsdenken ber den Herstellungsprozess hinaus verallgemeinere, verursache er
die Degradierung aller Welt- und Naturdinge zu bloen Mitteln, die unaufhaltsame Entwertung alles Vorhandenen, das Anwachsen der Sinnlosigkeit, in dessen
Proze alle Zwecke verschlungen werden, um wieder zu Mitteln zu werden...78.
In der Tat kann ohne einen feststehenden Endzweck, wie ihn der religise
Mensch noch im Erlangen des ewigen Lebens hatte, jeder Zweck wiederum selbst
zum Mittel fr weitere Zwecke werden. Damit erweist sich zweckrationales Denken als unfhig, Sinn zu erzeugen, oder anders: wo der Nutzen sich als Sinn etabliert, (wird) Sinnlosigkeit erzeugt79.
Zweckrationales Handeln ist fr Arendt also nicht das Gegenmodell zum Funktionalismus moderner Gesellschaften, sondern bringt ihn hervor. Damit ist impliziert,
dass Arendts Sinnbegriff eine Qualitt jenseits der Struktur der Zweckrationalitt
aufweisen muss. Es fragt sich nur, woher sie kommen und worin sie bestehen soll?
Zunchst setzt auch Arendt am modernen Glaubensverlust an und betont, dass er
nicht nur die Gewissheit eines jenseitigen Lebens betrifft, sondern auch die diesseitige Welt in Frage stellt. Dabei denkt sie jedoch nicht nur an das Problem der beliebig gewordenen Wahl zwischen konfligierenden Werten, das Weber mit der Metapher des neuen Polytheismus immer wieder anspricht. Die Schrecken totaler
Herrschaft hatten ihr ganz andere Konsequenzen des Verfalls letzter Werte dramatisch vor Augen gefhrt. In einem Interview formuliert sie 1972: I am perfectly
sure that this whole totalitarian catastrophe would not have happened if people still
believed in God, or hell rather that is if there were still ultimates80.
77
78
79
80
Ebd., S. 141.
Ebd., S. 143f.
Ebd., S. 141.
Hannah Arendt on Hannah Arendt (AoA), in: Melvyn Hill (ed.), Hannah Arendt.
The Recovery of the Public World, New York 1979, S. 313f.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 43 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 43
Arendt wie Weber waren von Dostojewski und seiner religisen Kritik der Moderne beeinflusst. Die Formel, mit der Hannah Arendt das Selbstverstndnis totaler
Herrschaft auf den Punkt bringt, lautet: Alles ist mglich, gewissermaen eine
Steigerung von Dostojewskis Alles ist erlaubt. hnlich wie Weber hlt allerdings
auch Arendt daran fest, dass es allgemeinverbindliche letzte Werte nicht mehr gibt
und sie durch Rckbesinnung auf Tradition oder Religion auch nicht wieder zu beleben sind. Der Mensch der Neuzeit ist auf sich zurckgeworfen und muss seinem
Leben selbst einen Sinn geben. Sinn entsteht fr sie aber nicht aus der Willensentscheidung des einsamen Individuums oder des charismatischen Fhrers, sondern
nur im Zusammenwirken mit Anderen in einer interpersonal geteilten Welt. Genauer entsteht Sinn durch das Handeln mit und vor Anderen, die als Gleiche untereinander verkehren und ihre Angelegenheiten gemeinsam regeln. Whrend fr Weber
die Sinnhaftigkeit eines Tuns aus einer vorpolitischen und rational unbegrndbaren
Entscheidung fr bestimmte Werte folgt, besitzt fr Arendt das politische Handeln
selbst die Fhigkeit, Sinn zu erzeugen.
3.2. Neubeginn, Pluralitt und Weltlichkeit als Dimensionen des Handelns
Das ist nun allerdings erluterungsbedrftig. Die Antwort auf die Frage, weshalb gerade die Politik in der Lage sein sollte Sinnfragen zu lsen, liegt in Arendts emphatischem Begriff des Handelns. Handeln ist fr Arendt neben dem Arbeiten und Herstellen eine der drei Grundttigkeiten des ttigen Lebens. Grob vereinfacht lsst sich
Arbeiten als funktional, durch naturhafte Notwendigkeit bestimmt, Herstellen als instrumental und Handeln als interpersonal charakterisieren. Handeln ist zunchst einmal identisch mit dem Beginnen von etwas Neuem. Augustinus zitierend, damit ein
Anfang sei wurde der Mensch geschaffen, behauptet Arendt, der Mensch knne,
weil er ein Anfang und Neuankmmling in der Welt sei, auch Initiative ergreifen
und Neues in Bewegung setzen81. Durch diese Fhigkeit des Neuanfangens, durch
seine Spontaneitt kann der Mensch aus den quasi naturhaften Lebensprozessen der
Gesellschaft heraustreten und sich aller Absehbarkeit und Berechenbarkeit entziehen82. Handeln bildet die Alternative zum bloen Sich-Verhalten, zum reibungslosen
und automatischen Funktionieren der Arbeitsgesellschaft.
Anders als bei Weber haben wir es bei Arendts (fast idealtypischer) Unterscheidung von Ttigkeiten nicht mit einer sozialwissenschaftlichen Theorie gesellschaftlicher Rationalisierung zu tun, sondern mit einer existentialphilosophischen Bestimmung menschlicher Bedingungen und Mglichkeiten. Arendt weist zwar
explizit zurck, eine Anthropologie zu entwickeln, oder Aussagen ber die Natur des Menschen zu machen, weil ihr zufolge ein solches Vorhaben der prinzipiel-
81 Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 166.
82 Ebd., S. 167.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 44 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
44 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
len Offenheit menschlicher Existenz widersprche83. Dennoch bleibt festzuhalten,
dass sie ihre Gesellschaftskritik aus existentialphilosophisch begrndeten, normativen Aussagen ber Mglichkeiten des menschlichen Lebens entwickelt. Der Unterschied zur Rationalisierungstheorie Max Webers relativiert sich jedoch, wenn wir
uns erinnern, dass seine Kritik an der Durchsetzung formaler Rationalitt ebenfalls
auf normative, allerdings philosophisch nicht weiter begrndete Vorstellungen von
Menschentum und selbstbestimmtem Handeln rekurriert, die ihren Ursprung im
deutschen Idealismus schwerlich verbergen knnen.
Whrend Weber davon ausgehend eine freiheitssichernde Politik am Typ zweckrationalen Handelns orientiert und sich damit die Affirmation direkter Herrschaft
einhandelt, gilt es nun zu klren, ob Arendt mit ihrer existentialistischen Bestimmung menschlicher Bedingungen und Mglichkeiten einen tragfhigen Grund fr
eine sinnstiftende und freiheitsverwirklichende politische Praxis gewinnen kann.
Die bereits erwhnte Fhigkeit des Handelns zum Neubeginn allein reicht dazu
sicher nicht aus. Auch in anderen Ttigkeiten, etwa in der Produktivitt des
knstlerischen Herstellens, gibt es nach Arendt ein Moment der Spontaneitt84,
ohne dass diese dadurch bereits als politische Ttigkeiten qualifiziert wren. Die
weiteren Dimensionen des Handelns, die erst zusammen seine politische Qualitt
ausmachen, sind Pluralitt, Sprachlichkeit und Weltlichkeit.
Das Faktum der Pluralitt ist nach Arendt Grundbedingung des politischen Handelns nicht nur im Sinne einer conditio sine qua non, sondern auch als conditio
per quam85. Denn nur indem wir vor und mit anderen handeln, kann das Unterschiedensein jeder Person hervortreten und wirklich werden 86. Wir handeln nicht
nur weil wir verschieden sind, sondern auch damit wir unsere Verschiedenheit realisieren knnen.
Sprechen und Handeln gehren bei Arendt aufs Engste zusammen. Sie unterscheidet beides zwar insofern, als sie dem Handeln eher die Dimension des Beginnens, dem Sprechen die der Selbstenthllung des Handelnden zuordnet. Streng genommen aber gibt es fr sie ein Handeln ohne Sprechen gar nicht, und zwar zum
einen deswegen, weil es ein Handeln ohne Handelnden wre, ihm also die revelatorische Dimension des Wer der Tat fehlte, zum anderen aber, weil Handeln ohne
sprachliche Kommunikation mit anderen sinnlos bleiben msste und von zweckra-
83 Vgl. Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 16 und S. 18. Die Frage, ob es sich
bei Arendts Bestimmung der Grundttigkeiten um eine Anthropologie handelt oder
nicht, ist in der Sekundrliteratur umstritten. Benhabib spricht vom anthropologischen Universalismus Arendts, Estrada Saavedra dagegen widerspricht dem unter
Hinweis auf Arendts eigene Position sowie ihrer Ablehnung aller Aussagen ber den
Menschen als Gattung (Vgl. Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism, aaO. (FN 4)
S. 195; Marco Estrada Saavedra, Die deliberative Rationalitt des Politischen, Wrzburg
2002, S. 22).
84 Hannah Arendt, Was ist Politik? (WiP) Fragmente aus dem Nachla, Mnchen 1993, S. 51.
85 Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 15.
86 Ebd., S. 164.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 45 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 45
tionaler Ttigkeit oder Gewalt nicht zu unterscheiden wre. Erst durch das gesprochene Wort fgt sich die Tat in einen Bedeutungszusammenhang.87.
Sinnhaftes Handeln ist deswegen an ein Miteinander des Sprechens und Agierens
gebunden, das Arendt sowohl vom reinen Gegeneinander als auch von einem
selbstlosen Freinander abgrenzt88. Handeln bedarf der Referenz auf Andere. Es
bedarf einerseits eines sprachlich vermittelten Sinnhorizontes, konstituiert andererseits jedoch selbst das Gewebe menschlicher Bezge und Angelegenheiten89, in
dem es erst Bedeutung gewinnen kann.
In diesen Zusammenhang gehrt auch die bisweilen befremdliche Faszination
Arendts vom agonalen Geist der Griechen und deren Streben nach Ruhm und
Unsterblichkeit. Arendt sieht im politischen Raum einen Raum des Wettstreits, der
es den Individuen ermglicht, in Erscheinung zu treten und sich vor anderen auszuzeichnen. Das Bezugssystem zwischen den Menschen, das aus Handeln und Sprechen entsteht, ist zwar weniger handgreiflich und fluider als die vom Homo faber
geschaffenen Gegenstnde, aber in ihm knnen die Menschen ...Dinge tun und
Worte sprechen, ...die der Unsterblichkeit wrdig, also wert sind, fr immer erinnert zu werden90. Sehen wir vom elitren Aspekt dieses Gedankens ab, so bleibt,
dass Handeln einen pluralistisch geprgten ffentlichen Erinnerungsraum, einen
kommunikativen Ressonanzboden91 hervorbringt, der Narration und Sinnstiftung ermglicht.
Sinn entsteht bei Arendt deshalb nicht aus der einsamen Entscheidung ber ein
zu verfolgendes Ziel, sondern in der Perspektivenpluralitt einer mit anderen geteilten Welt. Umgekehrt folgt Sinnverlust dann nicht aus der Pluralisierung von Werten, sondern aus der Zerstrung dieser pluralen, aber gemeinsamen Welt durch
Herrschaft und Funktionalisierung. Dabei bedeutet der Funktionalismus der mo-
87 Ebd., S. 168.
88 Ebd., S. 169. Damit ist auch eine Begrenzung der whrend der letzten Jahre gefhrten
Debatten um eine agonale oder kommunikative Interpretation des Handelns bei Arendt
markiert. Das Erscheinen vor Anderen bleibt immer an einen gemeinsamen Sinnhorizont rckgebunden und kann deshalb trotz des vorhandenen Elements von Wettstreit
kaum im Sinne Nietzsches als agonal verstanden werden. Zu einer eher agonalen Interpretation Arendts, s. Bonnie Honig, Political Theory and the Displacement of Politics,
Ithaca/London 1993; Dana Villa, Arendt and Heidegger, aaO. (FN 61); Zur Kritik an
diesen Interpretationen etwa Lawrence J. Biskowski, Politics versus Aesthetics:
Arendts Critiques of Nietzsche and Heidegger in: The Review of Politics, Vol. 57, 1/
1995 und Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism, aaO. (FN 4).
89 Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 87.
90 Hannah Arendt, Kultur und Politik (KP) in: Zwischen Vergangenheit und Zukunft,
Mnchen 1994, S. 287.
91 Frank Nullmeier, Agonalitt Von einem kultur- zu einem politikwissenschaftlichen
Grundbegriff? in: Michael Th. Greven/Herfried Mnkler/Rainer Schmalz-Bruns
(Hg.), Brgersinn und Kritik. Festschrift fr Udo Bermbach zum 60. Geburtstag,
Baden-Baden 1998, S. 101. Nullmeier interpretiert das agonale Moment in Arendts
Politikbegriff berzeugend in diesem Sinn und grenzt es damit implizit vom potentiell
gewaltsamen Kampf bei Weber ab.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 46 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
46 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
dernen Arbeitsgesellschaft gegenber der Zweckrationalitt traditioneller Herrschaft fr Arendt eine neue Qualitt in der Zerstrung von Sinn und Freiheit. In ihrer Auseinandersetzung mit Marx bernimmt sie dessen Grundgedanken der
Verselbstndigung konomischer Verhltnisse. Sie kritisiert die funktionale Integration der Individuen in modernen Wirtschaftsgesellschaften als eine freiheitszerstrende Naturalisierung, die interpersonale Beziehungen dem Diktat der vermeintlichen Notwendigkeiten des gesellschaftlichen Lebensprozesses unterstellt. In dieser
Hinsicht sind Weber wie Arendt durch die Marxsche Kapitalismuskritik geprgt92.
Die Parallelen der Kritik verselbstndigter Handlungszusammenhnge bei Weber
und Arendt sind offensichtlich in Arendts Bezeichnung der Brokratie als Niemandsherrschaft, die die tyrannischte Staatsform berhaupt sei, weil in ihr keine
Person oder Gruppe mehr fr irgend etwas verantwortlich gemacht werden kann93.
Ausgehend von ihrer Unterscheidung zwischen den drei Grundttigkeiten des
Handelns, Herstellens und Arbeitens versteht Arendt die moderne Wirtschaftsgesellschaft als einen durch natrliche Notwendigkeiten bestimmten oikos im erweiterten Mastab der Nation94. Die Auslieferung der modernen Menschen an den
funktional bestimmten, naturhaften Reproduktionsprozess der Gesellschaft
zerstrt sowohl die Pluralitt ihres Bezugsgewebes als auch die Stabilitt und
Verlsslichkeit ihrer gemeinsamen Welt.
3.3. Arendts existentialphilosophischer Weltbegriff als Grundlage ihres Bruches
mit dem herrschaftszentrierten Politikverstndnis
Bei Weber ist die Welt stets Chiffre fr die dem Subjekt entgegengesetzten Zwnge
und Eigengesetzlichkeiten, wie sie letztlich aus dem, wie er formuliert, ewigen
Kampf des Menschen mit dem Menschen auf der Erde95 resultieren und an denen
sich jeder Versuch der ethischen Rationalisierung brechen muss96. Bei Arendt bezeichnet der Begriff der Welt ein Zwischen, ein Beziehungsgeflecht, das sinnhaftes Handeln erst ermglicht.
92 Arendt wirft Marx vor, mit seinem Begriff des Gattungswesens diese Naturalisierung
zum kollektiven Lebensprozess einer vergesellschafteten Menschheit befrdert zu
haben. Dabei lsst sie vllig auer acht, dass Marx den Charakter einer zweiten
Natur, den ihm zufolge die kapitalistische Warenwirtschaft angenommen hat, in der
Zweckrationalitt einer geplanten konomie auflsen wollte. Zu Arendts Fehlinterpretation der Marxschen Verdinglichungskritik vgl. Bikhu Parekh, Hannah Arendts Critique of Marx in: Melvyn Hill (ed.), The Recovery of the Public World, New York
1979, S. 67-100.
93 Hannah Arendt MG, aaO. (FN 62), S. 39f.
94 Vgl. Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 31, S. 105.
95 Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 29.
96 Webers Weltbegriff wird besonders deutlich in der Zwischenbetrachtung (ZB 552f.)
und in der bekannten Diskussion des Verhltnisses von Gesinnungs- und Verantwortungsethik (GPS 547ff.)
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 47 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 47
Damit sind wir bei dem vielleicht grundlegendsten Unterschied zwischen den
Politikbegriffen von Arendt und Weber angelangt. Ernst Vollrath hat darauf hingewiesen, dass sich im Weltverstndnis Webers nicht nur ein nietzscheanisches Willens-, Macht- und Kampfmotiv reflektiere, sondern grundstzlicher noch die im
deutschen Kulturraum dominierende realpolitische, herrschaftskategorial bestimmte Apperzeption des Politischen. Aus ihr folge ein komplementr-antagonistisches
Verhltnis von realistischer Macht- und ethischer Idealpolitik, in dessen Bezugsrahmen eine zivilpolitische, auf Zustimmung, Assoziation und differentielle Einheit bezogene Qualitt des Politischen nicht zu denken sei97. Es ist unschwer zu erkennen,
wie sich ein entsprechend komplementr-antagonistisches Verhltnis auch in Webers berhmter Gegenberstellung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik98
und, auf unser Thema bezogen, im Verhltnis zwischen der freien Willensentscheidung des Individuums fr letzte Werte und den Sachgesetzlichkeiten der Welt wiederfindet.
Arendt verortet den Ursprung der herrschaftskategorialen Wahrnehmung des
Politischen weit hinter irgendwelchen Besonderheiten der deutschen Geschichte in
den Anfngen der abendlndischen Philosophie. Bereits das Denken Platons habe
das plurale politische Handeln der griechischen Polis nach dem Vorbild des Herstellens transformiert und in Befehlen und Gehorchen aufgelst99. Wie zuvor nur im
Verhltnis zwischen Herr und Sklave knnen damit dann auch im politischen Bereich Gewalt sowie Befehls-Gehorsamsbeziehungen durch Zweckrationalitt und
Herrschaftswissen gerechtfertigt werden. Offenkundig grndet fr Arendt der
Herrschaftsbegriff des politischen Denkens in technischer Rationalitt und der ihr
entsprechenden Teilung von Wissen und Tun100.
Arendt scheint damit lediglich eine Variante der bekannten neoaristotelischen
Kritik an einem herrschafts- statt brgerschaftszentrierten Begriff des Politischen
zu vertreten. Die Originalitt ihres Denkens, insbesondere aber der von ihr hergestellte Zusammenhang von Kulturkritik und Demokratie erschliet sich jedoch, sobald wir ihre Uminterpretation des Heideggerschen Weltbegriffes bercksichtigen,
durch die sie den Bruch mit einer herrschaftskategorialen Wahrnehmung des Politischen vollzieht. Zunchst einmal bezeichnet der Begriff der Welt bei Arendt nicht
eine dem Willen des Subjektes und seinen Werten entgegengesetzte Wirklichkeit,
sondern ein Zwischen, das freiheitliches Handeln erst ermglicht. Mit diesem
Zwischen meint sie zweierlei: zum einen die gegenstndliche Welt, auf die sich
Menschen aus verschiedener Perspektive handelnd beziehen, zum anderen den Erscheinungsraum, in dem sich Menschen aneinander richten und ein Bezugsgewebe
97 Vgl. dazu auch Ernst Vollrath, Max Weber, aaO. (FN 58), S. 103.
98 Vgl. dazu ausfhrlich und kenntnisreich Lothar Waas, Max Weber und die Folgen. Die
Krise der Moderne und der moralisch-politische Dualismus des 20. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 1995.
99 Vgl. Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 219.
100 Mit explizitem Hinweis auf Heidegger formuliert Arendt dies auch in den
Denktagebchern in einer Interpretation des Gerechtigkeitsdialogs in Platons
Politeia (Hannah Arendt, Denktagebuch, 1950-1973, 2 Bde, Mnchen 2002, S. 206).
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 48 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
48 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
menschlicher Angelegenheiten101 bilden. Beide Aspekte des Weltbegriffes bedingen
sich gegenseitig. Whrend der Erscheinungsraum und ein Minimum des Vertrauens
in Sprechen und Handeln als Weisen des Miteinander fr uns erst Wirklichkeit konstituieren, kann umgekehrt der Erscheinungsraum berhaupt erst entstehen durch
die verschiedenen Bezge der Vielen auf ein ihnen gemeinsam Entgegenstehendes.
Arendt vergleicht diese Funktion der gegenstndlichen Welt mit einem Tisch, der
diejenigen, die um ihn herumsitzen, zugleich verbindet und trennt 102. Wo die Welt
diese Fhigkeit zu versammeln, das heit zu verbinden und zu trennen zugleich,
verliert, kommt es dazu, dass die Menschen atomisiert werden oder in eins fallen.
Beide Phnomene kennzeichnen die moderne Massengesellschaft und bilden nach
Arendt die Voraussetzung fr den Erfolg totalitrer Bewegungen103.
Mit Heideggers Begriff der Welt bernimmt Arendt auch dessen Kritik an der
Epistemologie der modernen Wissenschaft, insbesondere an der mit Descartes identifizierten Trennung zwischen Subjekt und Objekt der Erkenntnis. Die Welt ist
nicht der Gegenstand eines erkennenden oder wollenden Subjektes, sondern ein Bezugsgewebe, das stets Um-welt und Mit-welt zugleich ist104. Fr Arendt wie fr
Heidegger ist deshalb das In-der-Welt-Sein immer schon ein Mitsein mit Anderen. Whrend jedoch Heidegger im Mitsein eine inauthentische Form des Daseins
sieht, eine Verfallenheit an das Man, wertet Arendt den Weltbegriff so um, dass
das Mitsein mit Anderen sowohl zur Mglichkeitsbedingung als auch zum immanenten Ziel politischen Handelns wird. Der Begriff einer interpersonal konstituierten Welt, wie ihn Arendt aus den existentialphilosophischen Einflssen von Heidegger und Jaspers entwickelt105, erffnet ihr einen Weg aus der Zweckrationalitt von
Subjekt-Objekt-Beziehungen und damit aus den Aporien der Weberschen Rationalisierungstheorie. Er ermglicht es, politisches Handeln als diesseitige Erzeugung
von Sinn und wie gleich zu begrnden sein wird als Verwirklichung von Freiheit
zu verstehen. Mit anderen Worten, Arendt kann Politik als Praxis unter Gleichen
denken.
101 Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 173.
102 Ebd., S. 52.
103 Der Analyse der modernen Weltentfremdung kommt bereits in Arendts erstem Hauptwerk, in Elemente und Ursprngen totaler Herrschaft zentrale Bedeutung zu (vgl.
Hannah Arendt, Elemente und Ursprnge totaler Herrschaft, Mnchen 1986 (1958)).
Ausfhrlicher zur Weltentfremdung bei Arendt Winfried Thaa, Hannah Arendt. Politik und Weltentfremdung, in: Politische Vierteljahresschrift, 38 Jg., 4/1997, S. 695-715.
104 Der Weltbegriff bei Arendt und seine Wurzeln in der Philosophie Heideggers sind whrend der letzten Jahre verstrkt in den Mittelpunkt der Arendtforschung gerckt. Dazu
etwa: Dana R. Villa, aaO. (FN 61), insbes. S. 117-129; Rahel Jaeggi, Welt und Person:
Zum anthropologischen Hintergrund der Gesellschaftskritik Hannah Arendts, Berlin
1997; Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism, aaO. (FN 4) sowie Janita Hmlinen, Arendt und Heidegger Konvergenz in der Welt in: Hannah Arendt Newsletter, 3/2000, S. 18-23.
105 Zu Jaspers Einfluss auf Arendt vgl. Lewis P. Hinchman / Sandra K. Hinchman, Existentialism Politicized. Arendts Debt to Jaspers in: Lewis P. Hinchman / Sandra K.
Hinchman (eds.), Hannah Arendt. Critical Essays, Albany 1994, S. 143-178.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 49 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 49
3.4. Freiheit als nichtsouvernes Handeln
Entsprechend versteht Hannah Arendt Freiheit als ein politisches Phnomen, das
primr weder im Wollen noch im Denken, sondern im Handeln erfahren wird106.
Dabei geht sie von Montesquieus Unterscheidung zwischen philosophischer und
politischer Freiheit aus, wonach die erste eine Freiheit des Willens bezeichne, die
zweite eine des Knnens innerhalb gesetzlich begrenzter Mglichkeiten107.
Die politische Freiheit unterscheidet sich also von der philosophischen Freiheit
dadurch, da sie eindeutig eine Sache des Ich-kann und nicht des Ich-will ist. Da sie
dem Brger und nicht dem Menschen berhaupt zukommt, kann sie sich nur in Gemeinschaften zeigen, wo die vielen Zusammenlebenden in Wort und Tat miteinander verkehren, geregelt durch viele rapports Gesetze, Sitten, Gebruche und hnliches. Mit anderen Worten, die politische Freiheit ist nur mglich in der Sphre der
menschlichen Pluralitt ...108.
Gegen die philosophische und christliche Tradition, aber auch gegen moderne
Vorstellungen betont Arendt immer wieder, politische Freiheit sei nicht als Willensfreiheit oder Souvernitt, das heit als ein Phnomen des Selbstbezuges im Sinne
von Ich tu, was ich will zu verstehen. Vielmehr sei Freiheit ein Phnomen des
Verkehrs mit anderen109. Der Singularitt des Ich-will entspringe die Tyrannis110,
und die Souvernitt, die skularisierte Idee gttlicher Allmacht, stehe in diametralem Gegensatz zur politischen Freiheit, weil Souvernitt, nmlich unbedingte Autonomie und Herrschaft ber sich selbst, der menschlichen Bedingtheit der Pluralitt widerspricht111.
Wie die Souvernitt des einzelnen ist letztlich auch die Souvernitt einer
Gruppe oder eines politischen Krpers immer nur Schein; sie kann nur dadurch zustande kommen, da eine Vielheit sich so verhlt, als ob sie einer wre und dazu
noch ein einziger [...]. Wo Menschen, sei es als einzelne, sei es in organisierten
Gruppen, souvern sein wollen, mssen sie die Freiheit abschaffen. Wollen sie aber
frei sein, so mssen sie auf Souvernitt geradezu verzichten 112.
106 Hannah Arendt, Freiheit und Politik (FP) in: Zwischen Vergangenheit und Zukunft,
Mnchen 1994, S. 210.
107 Hannah Arendt, ber die Revolution (R), Mnchen 19863 (1965), S. 380, und hnlich
Hannah Arendt, Vom Leben des Geistes (LG), Mnchen 1998, S. 425
108 Ebd., S. 426.
109 In diesem Sinn etwa Hannah Arendt, FP, aaO., (FN 106), S. 201, 210ff; R aaO. (FN
107), S. 194; WiP, aaO. (FN 84), S. 38ff.).
110 Hannah Arendt, FP, aaO. (FN 106), S. 213.
111 Vgl. dazu u.a. Hannah Arendt, Vita Activa, aaO. (FN 76), S. 229. Auch hier liegt der
Argumentation Arendts eine existentialistisch geprgte Kritik an der Identittsphilosophie zugrunde. Sofern Freiheit vom Ideal der Selbstidentitt aus gedacht wird, kann sie
die Welt als Bedingung allen Handelns und damit auch Pluralitt nur als Schranke wahrnehmen. Zu diesem Zusammenhang ausfhrlicher Ernst Vollrath, Ein philosophischer
Begriff des Politischen? in: Neue Hefte fr Philosophie, 21. Jg., 1/1982.
112 Vgl. Hannah Arendt, FP, aaO. (FN 106), S. 215.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 50 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
50 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
Freiheit, die als Willensfreiheit gedacht wird, ist letztlich die Fhigkeit, die eigenen Ziele gegen andere durchzusetzen. Das aber ist nicht nur antipluralistisch und
fr Arendt damit antipolitisch, es verweist zugleich auf Gewalt als das wirkungsvollste Mittel, andere zu etwas zu zwingen, was sie nicht wollen.
3.5. Die amerikanische Revolution
Erst von dieser, im existentialphilosophischen Begriff der Welt grndenden Kritik
der Gleichsetzung von Freiheit und Souvernitt erschliet sich Arendts Interpretation der amerikanischen Revolution bzw. ihre fr eine deutsche Emigrantin so erstaunliche Entdeckung der Freiheit113 in der amerikanischen Demokratie. Fr
Arendt gelang es der amerikanischen Revolution, den Anspruch der Macht auf
Souvernitt im politischen Krper der Republik konsequent zu eliminieren114 sowie in Verfassung und politischen Institutionen einen pluralen ffentlichen Raum
zu schaffen, in dem Menschen handeln und ihre Macht im Rahmen von Regeln und
Gesetzen ausben konnten. Nach Arendt bestand bereits vor der Revolution die
Einzigartigkeit der amerikanischen Politik darin, dass die Siedler sich als civil Bodies Politick oder politische Brgerschaften zusammenschlossen, in denen es
keine Herrscher und Beherrschte gab, die vielmehr einen politischen Raum bildeten, in dem Macht und die Beanspruchung von Rechten mglich war, ohne dass
man doch Souvernitt besa oder auch nur nach ihr verlangte115. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung htten die Grndungsvter, und hierbei insbesondere Madison, Montesquieus Lehre von der Gewaltenteilung neu interpretiert und eine fderative republikanische Staatsform entwickelt, die als Zusammenschluss oder
cosociation verschiedener politischer Handlungsrume zu verstehen sei116.
Whrend Max Weber, wie wir vorne gesehen haben, diese brgerschaftlichen
Formen der Politik dazu verurteilt sah, dem doppelten Druck der unvermeidlichen
Rationalisierung und Brokratisierung auf der einen, sowie dem Element des
Kampfes in der groen Politik auf der anderen Seite zu weichen, erkannte Arendt
in ihnen eine neuzeitliche, pluralistische Form des Republikanismus, die nicht nur
eine Alternative zur Herrschaftslogik des abendlndischen politischen Denkens
bot, sondern ihr darber hinaus geeignet schien, den Zerfall verbindlicher Werte in
modernen Gesellschaften politisch, das heit durch plurales Handeln unter Gleichen, statt durch dezisionistische Willkr und Befehls-Gehorsamsbeziehungen zu
bewltigen. Bei aller Kritik an der amerikanischen Politik ihrer Zeit und dem Konsumismus der amerikanischen Gesellschaft, war Arendt doch berzeugt davon, in
den Institutionen der Republik und dem politischen Geist des amerikanischen Gemeinwesens das entscheidende Gegenprinzip zum Sinn- und Freiheitsverlust der
113 Vgl. dazu Winfried Thaa / Lothar Probst (Hg.), Die Entdeckung der Freiheit. Amerika
im Denken Hannah Arendts, Berlin 2003.
114 Vgl. Hannah Arendt, R, aaO. (FN 107), S. 200.
115 Ebd.
116 Ebd.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 51 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 51
Moderne gefunden zu haben: nmlich die dauerhafte Teilnahme an allen Angelegenheiten von ffentlichem Belang117. Diese Perspektive politischer Partizipation
richtet sich bei Arendt allerdings nicht auf die mglichst unverflschte Durchsetzung eines wie immer gearteten Volkswillens, sondern auf die Mglichkeiten der
Brger, sich im Austausch mit anderen eine Meinung zu bilden und an der Gestaltung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten teilzunehmen. Durch das Eindringen vermeintlicher Notwendigkeiten in den ffentlichen Raum, genauer durch die Naturalisierung der konomie zum gesellschaftlichen Lebensprozess werden diese
Handlungsmglichkeiten untergraben.
Ein entscheidendes Versumnis der amerikanischen Revolution liegt Arendt zufolge darin, dass sie die Mglichkeiten zur direkten Brgerbeteiligung nicht in dem
Mae, wie es Jefferson gefordert hatte, institutionalisierte118. In den dennoch vorhandenen Formen der Selbstverwaltung und Beteiligung, vor allem aber in den mit
der Brgerrechts- und Studentenbewegung der sechziger Jahre wieder strker hervortretenden informellen Zusammenschlssen und Vereinigungen konnte sie jedoch spezifisch amerikanische Phnomene sehen, die es dem Einzelnen zumindest
zeitweise erlaubten, in ffentlichen Rumen zu handeln und damit sowohl Gemeinsinn wie Urteilsfhigkeit auszubilden119. Mit Bezug auf die amerikanische Regierung stellte Arendt allerdings schon vor dreiig Jahren fest, dass sie nicht mehr im
Sinne der Grndungsvter, sondern im Sinne des europischen nationalstaatlichen
Denkens und dessen Souvernittsbegriff handle. Wenn wir an die jngsten Konflikte zwischen Europa und den USA denken, lsst sich darber hinaus behaupten,
die Fronten htten sich regelrecht umgekehrt: Ein auf Gewalt gegrndetes Politikverstndnis und das Prinzip nationalstaatlicher Souvernitt werden heute von den
USA vertreten (sofern es um die eigene Souvernitt geht), die Begrenzung nationaler Souvernitt durch das internationale Recht dagegen von Europa.
4. Autonome Dezision oder erweiterte Denkungsart
Der Gegensatz zwischen Max Weber und Hannah Arendt tritt nirgendwo klarer
hervor, als in den jeweiligen Lsungen, mit denen sie dem Verfall letzter Werte in
modernen Gesellschaften begegnen wollen. Zunchst einmal stimmen jedoch beide
darin berein, dass die Politik eine gesicherte normative Grundlage in Religion oder
Metaphysik verloren hat und uns kein Rckweg zu den unstrittigen Werten der Tradition offen steht. Insofern stellen sie sich der ernchternden Einsicht, wonach die
Moderne ihre Normativitt aus sich selbst schpfen (mu)120. Die Frage, wie dies
geschehen und nach welchen Kriterien Politik beurteilt werden kann, erhlt fr beide eine besondere Dringlichkeit daraus, dass sie politische Handlungsmglichkeiten
117 Hannah Arendt, Ziviler Ungehorsam in: Zur Zeit. Politische Essays, Mnchen 1989,
S.144.
118 Vgl. Hannah Arendt, R, aaO. (FN 107), S. 319f.
119 Vgl. Hannah Arendt, Ziviler Ungehorsam, aaO. (FN 117), S. 155f.
120 Jrgen Habermas Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a.M. 1988, S. 16.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 52 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
52 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
gegen die Versachlichungs- und Funktionalisierungstendenzen moderner Gesellschaften erhalten bzw. zurckgewinnen wollen.
Webers Lsung, die willkrliche Entscheidung des Individuums bzw. des charismatischen Fhrers zwischen letzten Werten, schliet in Verbindung mit seiner Ablehnung jedes Kompromisses oder Mittelwegs im Konflikt von Wertordnungen eine
wie auch immer geartete Rationalisierung ethischer Entscheidungen im politischen
Raum aus. Webers wiederholte Appelle zur ehrlichen und rckhaltlosen Selbsterforschung der eigenen Wertaxiome relativieren die radikale Individualisierung und Beliebigkeit der Entscheidung keineswegs. Ebenso wenig kann die nchterne Kalkulation mglicher Handlungsfolgen, die Weber von der empirischen Wissenschaft
erhoffte, normative Kriterien zu ihrer Beurteilung liefern. Das Augenma, das
Weber vom Politiker fordert121 als Urteilskraft oder praktische Klugheit zu interpretieren122, tuscht ber diese Schranke hinweg. Denn im Unterschied zur vormodernen praktischen Philosophie fehlen Webers Politiker die Mastbe des Urteils. In Politik als Beruf findet sich eine Anspielung auf Martin Luther: Mit einem
Ich kann nicht anders, hier stehe ich, kennzeichnet Weber die letzte Wertbindung
des verantwortlichen Politikers123. Der Protestant Webers ist allerdings eine hchst
dubiose Gestalt, kam ihm doch schon lange die Heilige Schrift abhanden, mit der er
seine Gewissensentscheidung vor sich und anderen begrnden knnte.
Im Gegensatz dazu lsst sich Arendts Werk als Versuch lesen, im Denken ohne
Gelnder, wie sie es wiederholt formuliert124, einen Weg zwischen dem Abgrund
dezisionistischer Willkr und der freiheitszerstrenden Suche nach einem neuen
Absoluten zu finden. Arendt ging es um die spezifische Rationalitt des Politischen
unter Bedingungen der Moderne, d.h. um die Mglichkeit, die Entscheidungen, die
im Bereich des Politischen gefllt werden, nicht in die Autonomie des Individuums
zu stellen, sondern nach interpersonal gltigen Mastben zu beurteilen125. Freiheit
im Sinne Arendts setzt voraus, dass die Menschen jenseits von individueller Dezision auf der einen, sowie der objektiven Rationalitt von Sachzwngen auf der anderen Seite, aus unterschiedlicher Perspektive zu gemeinsamen Urteilen gelangen knnen. An die Stelle des Rationalittsprinzips der Einheit mit sich selbst, der Identitt,
soll ein Vernunftprinzip der Pluralitt treten126.
Den Anknpfungspunkt hierzu findet Arendt in Kants Unterscheidung zwischen
bestimmender und reflektierender Urteilskraft127. Anders als die bestimmende Ur121
122
123
124
Max Weber, GPS aaO. (FN 35), S. 560.
So etwa Wilhelm Hennis, aaO. (FN 7), S. 229f.
Max Weber, GPS, aaO. (FN 35), S. 559.
So etwa in Hannah Arendt, Elemente und Ursprnge totaler Herrschaft, Mnchen
1986, S. 35, Arendt on Arendt, aaO. (FN 80), S. 336.
125 In diesem Sinn hat vor allem Ernst Vollrath das Werk Hannah Arendts interpretiert und
daran anknpfend seine philosophische Theorie des Politischen entfaltet. Vgl. dazu
insbesondere Ernst Vollrath, Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen, Wrzburg 1987.
126 Vgl. ebd., S. 20f.
127 Vgl. Imanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. Karl Vorlnder, Hamburg 1990, Einleitung, S. 15.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 53 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 53
teilskraft, die nach Regeln und Gesetzen verfhrt, das Besondere unter das Allgemeine subsumiert und zu zwingenden Schlssen gelangt, muss die reflektierende Urteilskraft, die nach Kant unseren Geschmacksurteilen zugrunde liegt, ohne feste
Mastbe und Regeln auskommen. Sie kann sich nicht auf logisch zwingende Verstandesoperationen grnden, sondern muss durch das Angeben von Grnden um
Zustimmung werben. Dazu bedarf es der erweiterten Denkungsart. Kant meint
damit, wir knnten in Fragen der sthetik zu verallgemeinerungsfhigen Urteilen
kommen, indem wir von den subjektiven Privatbedingungen unseres Urteils abstrahieren und den Gegenstand, um den es geht, aus der Sicht anderer betrachten 128.
Arendt glaubt, hier den Ansatzpunkt fr ein politisches Rationalittskonzept gefunden zu haben, das den Bedingungen skularisierter und unwiderruflich pluralisierter
moderner Gesellschaften entspricht. Wenn wir in der Lage sind, die Dinge nicht nur
aus der eigenen, sondern aus der Perspektive aller anderen, die prsent sind, zu sehen129, wird der Verlust fester, allseits anerkannter Mastbe weder zum normativen
Nihilismus noch zum unberbrckbaren tdlichen Kampf der Werte130 fhren.
Allerdings kann das reflexive Urteilen nicht so einfach funktionieren wie die
Ttigkeit des Verstandes beim logischen Schlieen und Kalkulieren. Es bedarf der
Prsenz anderer.
Was die Prsenz des Selbst fr die formale Widerspruchslosigkeit der Gewissensethik ist, ist die Prsenz der anderen fr das Urteilen. Ihm kommt daher eine gewisse konkrete Allgemeingltigkeit zu, aber niemals eine universale Gltigkeit
berhaupt. Der Anspruch auf Geltung kann nie weiter reichen, als die anderen, an
deren Stelle mitgedacht wird 131.
Damit liegt eine offensichtliche Schwche der Hoffnung auf die politische Rationalitt des reflexiven Urteils in dessen Voraussetzungen, die nach Arendts eigener kulturkritischer Analyse ja der Siegeszug der modernen Arbeitsgesellschaft und ihres Konformismus untergrbt. Zwar bentigt das reflexive Urteil weder eine verbindliche
Tradition noch gemeinsame letzte Werte. Damit es sein Rationalittspotential entfalten
kann, bedarf es jedoch eines pluralen ffentlichen Raumes, einer geteilten Welt,
einschlielich gemeinsamer politischer Institutionen sowie subjektiv der Bereitschaft
und des Vermgens der Individuen, sich in die Perspektive anderer zu versetzen. Obwohl Arendts Gesellschaftskritik das Schwinden dieser Voraussetzungen diagnostiziert, sieht sie in den Institutionen der amerikanischen Republik und dem Gemeinsinn
ihrer Brger noch Gegenkrfte, die ihr immer wieder Anlass zur Hoffnung geben132.
128
129
130
131
132
Ebd., 40.
Hannah Arendt, KP, aaO. (FN 90), S. 299.
Max Weber, GAW, aaO. (FN 24), S. 507.
Hannah Arendt, KP aaO. (FN 129), S. 298.
Am deutlichsten etwa in ihrer Interpretation der amerikanischen Studentenbewegung
(vgl. Hannah Arendt, Ziviler Ungehorsam, aaO. (FN 117). hnlich aber auch bereits
in ihren frhen Eindrcken von amerikanischen Durchschnittsbrgern, die Gemeinsinn
zeigten und sich etwa fr die Rechte ihrer Mitbrger einsetzten (Hannah Arendt, Hannah Arendt, Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969, Mnchen 1985, S. 66)
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 54 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
54 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
Ob Hannah Arendt mit ihrer Anleihe bei Kants sthetik tatschlich einen modernittsgerechten Ausweg aus dem Dilemma der Letztbegrndung weist, ist in der
Literatur grundstzlich umstritten133. Unabhngig davon, wie diese Frage beantwortet wird, liegt der fr uns entscheidende Gesichtspunkt in Arendts Bestimmung
des Politischen als eines Bereiches, in dem das Handeln Verschiedener eine eigene,
beschrnkt verallgemeinerbare Vernunft hervorbringt. Den Mastab fr die Rationalitt politischen Handelns bildet damit nicht mehr seine Zweckmigkeit fr willkrlich und vorpolitisch gewhlte Werte, sondern die Zustimmung im Urteil der
anderen.
5. Fazit:
Die dezisionistische Perspektive Webers habe ich weiter vorne als formal, pessimistisch-elitr und, im Gegensatz zu den versachlichten Verhltnissen moderner Gesellschaften, als direkt-herrschaftlich bezeichnet. Die ersten beiden Charakterisierungen treffen auf den ersten Blick auch auf Hannah Arendts Denken zu.
Tatschlich wurde ihr enthusiastischer Politikbegriff (Vollrath) wiederholt als formal und elitr kritisiert. Auf Unverstndnis stt insbesondere, dass Arendt das Politische nicht von Inhalten her bestimmt und spezifischer noch, dass sie das Gesellschaftliche als einen Bereich quasi naturhafter Notwendigkeit explizit aus dem
Bereich des Politischen ausschlieen will134.
133 Der Streit geht einmal darum, ob Arendt zu den anti-foundationalists zu rechnen sei,
oder aber ihr Denken in einem anthropologischen Universalismus grnde, der eine Ethik
radikaler Intersubjektivitt impliziere. Die erste Position vertritt etwa Margaret Canovan
(vgl. Margaret Canovan, Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thinking,
Cambridge 1992, S. 191), die zweite etwa Seyla Benhabib (vgl. Seyla Benhabib, The
Reluctant Modernism, aaO, (FN 4) 1996, S. 195). Untersttzt man die erste Position, so
lsst sich wiederum streiten, ob Arendt damit in gefhrliche Nhe zu Nietzsche und der
postmodernen Destruktion jeder Moralitt gert, oder aber mit ihrem auf eine gemeinsame, plurale Welt beschrnkten Anspruch der Verallgemeinerung nicht gerade einen
Ausweg zwischen den Absolutheitsansprchen eines moralischen Universalismus und
den jede Moral in Macht auflsenden Dekonstruktivisten weist. Fr den Vorwurf der
Amoralitt steht vor allem Kateb (George Kateb, Hannah Arendt. Politics, Conscience,
Evil. Totowa NJ 1984 und The Questionable Influence of Arendt (and Strauss) in:
Peter Graf Kielmansegg / Horst Mewes / E. Glaser-Schmidt (eds.) Cambridge/New
York 1995), fr die Gegenposition prominent Villa (vgl. etwa Dana R. Villa, Beyond
Good and Evil. Arendt, Nietzsche, and the Aesthetization of Political Action in: Political Theory, Vol. 20, 2/1992 u. ders., Arendt and Heidegger, aaO. (FN 61) sowie Curtis
(vgl. Kimberley Curtis, Aesthetic Foundations of Democratic Politics in the Work of
Hannah Arendt in: C. Calhoun / J. McGowan (eds.), Hannah Arendt and the Meaning
of Politics, Minneapolis 1997 und Kimberley Curtis, Our Sense of the Real. Aesthetic
Experience and Arendtian Politics, Ithaca/London 1999).
134 Entsprechende Einwnde finden sich knapp und verstndlich zusammengefasst im
Gesprch Arendts mit Richard Bernstein, Hans Jonas, Mary MacCarthy u.a. (vgl. AoA,
aaO. (FN 80) ).
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 55 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt 55
Diese Parallele hat einen Grund darin, dass Weber wie Arendt versuchen, das Politische durch einen Handlungstyp zu bestimmen, der gegen die Verselbstndigung
formaler Rationalitt hier, bzw. das automatische Funktionieren moderner Arbeitsgesellschaften dort, Sinn stiften und Freiheit ermglichen soll. Fr beide gilt
auch, dass der jeweilige Handlungstyp, bei Weber die willkrliche Entscheidung des
Individuums fr letzte Werte und deren zweckrationale Verwirklichung, bei Arendt
das Handeln vor und mit anderen, Selbstzweck ist. Dies setzt beide dem Vorwurf
der Amoralitt aus, was insoweit auch plausibel scheint, als sie in der Tat die Bindung der Politik an allgemeingltige letzte Werte ablehnen, bzw. unter modernen
Bedingungen fr unmglich halten. Im Gegensatz zu den Vertretern der Frankfurter Schule haben sich Weber wie Arendt von jeder, auch von einer melancholischen
Orientierung auf eine objektive Vernunft (Horkheimer) gelst. Whrend jedoch
Webers Dezisionismus die Gefahr birgt, mit der Lsung von allgemeingltigen letzten Werten Zweckrationalitt und Herrschaft normativ zu entgrenzen und zu radikalisieren, kann Arendt mit ihrer Bestimmung des Politischen als Sprechen und
Handeln vor und mit anderen nicht nur eine fundamentale Kritik der herrschaftskategorialen Wahrnehmung des Politischen leisten, sondern darber hinaus eine Perspektive seiner immanenten Rationalisierung und normativen Selbstbeschrnkung
weisen.
Erstaunlicherweise geht dieser Gegensatz einher mit einer positiven Wrdigung
der amerikanischen Demokratie, durch die sich beide Autoren deutlich von anderen
kulturkritischen Denkern des 20. Jahrhunderts unterscheiden. Bei Weber wie
Arendt lsst sich von einer Demokratisierung der Kulturkritik sprechen, und bei
beiden kommt dabei der jeweiligen Interpretation der amerikanischen Demokratie
eine Schlsselrolle zu.
Weber sieht in den zeitgenssischen Entwicklungen zur plebiszitren Fhrerdemokratie die Mglichkeit, die wertrationalen Entscheidungen der politischen
Fhrer herrschaftlich durchzusetzen. Fr ihn bildet dies das entscheidende Gegengewicht zur rationalisierten Fremdbestimmung des modernen Menschen durch
Markt und Brokratie.
Arendt geht zurck zur amerikanischen Revolution und sieht dort im freien
Handeln unter Gleichen, in den Formen politischer Selbstorganisation und Partizipation das neuzeitliche Gegenmodell zum Funktionalismus der Arbeitsgesellschaft.
In beiden Fllen handelt es sich um deutsche Lesarten der amerikanischen Politik: Webers herrschaftskategoriale, in der Tradition des deutschen Staatsrechts stehende Wahrnehmung des politischen Kampfes in der Demokratie kann das
brgerschaftliche oder zivilgesellschaftliche Element in den angelschsischen Lndern nur als unzeitgemes Relikt wahrnehmen. Demokratie wird zur Auslese von
dezisions- und herrschaftsfhigen Fhrern.
Arendt politisiert die existentialistische Kulturkritik, indem sie die brgerschaftlichen Formen der amerikanischen Republik als berwindung der bis zu Platon zurckreichenden Tradition interpretiert, Politik in den Kategorien von Subjekt und
Objekt, von Zweck und Mittel und damit herrschaftszentriert zu denken. Herrschaft und Gewalt kann sie so als Abweichung von den revolutionren Ursprngen
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 56 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
56 Winfried Thaa Kulturkritik und Demokratie bei Max Weber und Hannah Arendt
neuzeitlicher Politik normativ kritisieren, ohne auf eine wie immer geartete geschichtsphilosophische Verkrperung der Vernunft zurckgreifen zu mssen.
In Bezug auf beide, Weber wie Arendt, stellt sich allerdings die grundstzlichere
Frage, ob wir ihr kulturkritisches Ausgangsproblem, nmlich die zunehmende Erosion von Sinn und Handlungsmglichkeiten durch die funktionale Organisation
moderner Gesellschaften, berhaupt noch teilen.
Zusammenfassung
Max Weber wie Hannah Arendt sind stark beeinflusst von der deutschen Tradition der Kulturkritik. Im Gegensatz zur Frankfurter Schule sehen jedoch beide in demokratischer Politik die bedeutendste Gegenkraft zum kritisierten Sinn- und Freiheitsverlust in modernen Gesellschaften. Whrend jedoch Max Weber in der sich
damals in den Vereinigten Staaten abzeichnenden plebiszitren Fhrerdemokratie
einen letzten Hort von Wertrationalitt und freien Entscheidung sieht, interpretiert
Arendt die amerikanische Revolution des 18. Jahrhunderts als neuzeitliche Verwirklichung politischer Freiheit. Der Beitrag zeigt, dass die Modernittskritik von
Arendt und Weber, trotz auffallender Parallelen, auf grundverschiedenen theoretischen Konzepten basiert. Er argumentiert, dass die vermeintlich apolitischen, existenzialphilosophischen Begriffe der Kulturkritik Arendts es ihr ermglichen, politische Freiheit unter den Bedingungen moderner Gesellschaften zu denken, whrend
Webers sozialwissenschaftliche Theorie der Rationalisierung zu politischem Dezisionismus und einem herrschaftlichen Politikbegriff fhrt.
Abstract
Both, Max Weber as well as Hannah Arendt are strongly influenced by the German
tradition of cultural criticism. And both, unlike the first generation of the Frankfurt
School, see democratic politics as the most important counterforce to the loss of meaning and to the loss of freedom which they denounce in modern societies. However, whereas Max Weber understands the emerging plebiscitary leadership democracy in the United States of his time as a (last) resort of value rationality and free
decision, Hannah Arendt interprets the American Republic of the 18th century and
its institutions as a modern realm of acting with others, i.e. of political freedom. The
article shows that Arendts and Webers criticism of modernity are, in spite of striking parallels, based on very different theoretical concepts. It argues that Arendts
presumably a-political categories of Existenz-philosophy open up a perception of
political freedom under the conditions of modernity, whereas Webers scientific concept of rationality leads to political decisionism and a despotic concept of politics.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 57 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann
Politische Implikationen der kulturellen Evolution
1. Charakteristika und Bedeutung der kulturellen Evolution
Bis vor rund 250 Jahren lebten 90% der Menschheit in bitterer Armut; ihr Lebensstandard verharrte ber die Jahrhunderte auf einem extrem niedrigen Niveau. Ebenso blieben die Bevlkerungszahlen ber die Jahrhunderte gering; so lebten in ganz
Westeuropa im Jahre 1000 lediglich rund 25 Millionen Menschen nicht mehr als
um Christi Geburt. Zu einer nachhaltigen Besserung kam es erst infolge der Mitte
des 18. Jahrhunderts zunchst in Grobritannien einsetzenden Industriellen Revolution, die wenig spter auch auf den westeuropischen Kontinent und Nordamerika bergriff1. Die betreffenden Lnder erlebten eine rapide, bis dahin vllig unbekannte Zunahme ihres Wohlstands und ihrer Bevlkerung. In Westeuropa
beispielsweise stieg das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 1700 bis 2001 auf
das 19fache, die Bevlkerungszahl erhhte sich bis 2001 auf 392 Millionen2.
Die Industrielle Revolution und die Zunahme des Wohlstands und der Bevlkerung
in der westlichen Welt seit dieser Revolution waren die Folge einer weitgehenden
Durchsetzung bestimmter Institutionen: des Prinzips der individuellen Freiheit (vor
allem der Vertrags-, Handels- und Gewerbefreiheit), der Dominanz und des wirksamen staatlichen Schutzes des Privateigentums (auch und gerade an Produktionsmitteln) sowie der Herrschaft des Rechts. Die Steuern waren niedrig, und der Staat verzichtete weitgehend auf eine Gngelung der Wirtschaft durch Regulierungen.
Feudalismus, Zunftwesen und Merkantilismus wurden endgltig berwunden. Freies
privates Unternehmertum gewann im Wirtschaftsleben die Oberhand. Die Mrkte
waren offen, der Wettbewerb entsprechend intensiv. Erstmals in der Geschichte wurden den Menschen umfassend Freirume fr eigenstndiges, produktives Wirtschaften
erffnet, ihre wirtschaftlichen Aktivitten zugleich effizient koordiniert.
1
Zur Industriellen Revolution siehe Thomas S. Ashton, The Industrial Revolution 17601830, London/Oxford 1969; R. M. Hartwell, The Industrial Revolution and Economic
Growth, London 1971; Douglass C. North / Robert Paul Thomas, The Rise of the
Western World. A New Economic History, Cambridge 1973; Nathan Rosenberg /
Luther E. Birdzell, How the West Grew Rich. The Economic Transformation of the
Industrial World, London 1986; Douglass C. North / Barry R. Weingast, Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in
Seventeenth-Century England in: Journal of Economic History, Vol. 49 (1989), No. 4,
S. 803-832; David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So
Rich and Some So Poor, New York/London 1998.
2 Vgl. Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, Paris 2003, S. 256, 262.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 58 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
58
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
Die fr die Industrielle Revolution und den dadurch ausgelsten Aufstieg der
westlichen Welt entscheidenden Institutionen hatten sich zuvor im Laufe der kulturellen Evolution allmhlich und ungeplant entwickelt3. Zwar wurde jede dieser Institutionen immer wieder von Menschen bewusst verndert, doch diese bewussten
nderungen mussten sich genauso wie die unbewussten im Wettbewerbsprozess
3
Die Theorie der kulturellen Evolution, die die Grundlage der vorliegenden Analyse
darstellt, wurde mageblich von Friedrich A. von Hayek entwickelt. Siehe vor allem:
Friedrich A. von Hayek, Bemerkungen ber die Entwicklung von Systemen von Verhaltensregeln in: ders., Freiburger Studien. Gesammelte Aufstze, Tbingen 1969, S.
144-160; ders., Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung der liberalen
Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen konomie (1973-79), 3 Bde., Landsberg am Lech 1981 (Bde. II & III) und 1986 (Bd. I, 2. Aufl.); ders. Die berschtzte
Vernunft in: Rupert J. Riedl / Franz Kreuzer (Hg.), Evolution und Menschenbild,
Hamburg 1983, S. 164-192; ders., The Fatal Conceit. The Errors of Socialism, Chicago
(Ill.) 1988. Wichtige Beitrge zur Theorie der kulturellen Evolution haben darber hinaus geleistet: David Hume, A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects Vol. III: Of
Morals (1740) in: ders., The Philosophical Works, Vol. II, Aalen 1992, S. 229-374; Adam
Smith, Considerations Concerning the First Formation of Languages, and the Different Genius of Original and Compounded Languages (1761) in: ders., Lectures on
Rhetoric and Belles Lettres, Indianapolis (Indiana) 1985, S. 201-226; ders., Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen (1776),
Mnchen 1974; Adam Ferguson, Versuch ber die Geschichte der brgerlichen Gesellschaft (1767), Frankfurt am Main 1986; Wilhelm von Humboldt, Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung
des Menschengeschlechts (1836) in: ders., Werke in fnf Bnden, Bd. III: Schriften zur
Sprachphilosophie, 7. Aufl., Stuttgart 1994, S. 368-756; Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Rmischen Rechts, Berlin 1840-51; Henry Sumner Maine, Das alte
Recht Ancient Law. Sein Zusammenhang mit der Frhgeschichte der Gesellschaft und
sein Verhltnis zu modernen Ideen (1861), Baden-Baden 1997; ders., Lectures on the
Early History of Institutions, New York 1888; Charles Darwin, Die Abstammung des
Menschen (1871), 3. Aufl., Wiesbaden 1966; Carl Menger, Untersuchungen ber die
Methode der Socialwissenschaften, und der Politischen Oekonomie insbesondere, Leipzig 1883; L. T. Hobhouse, Morals in Evolution. A Study in Comparative Ethics (1906),
London 1951; A. M. Carr-Saunders, The Population Problem. A Study in Human Evolution, Oxford 1922; Armen A. Alchian, Uncertainty, Evolution, and Economic Theory in: Journal of Political Economy, Vol. 58 (1950), No. 3, S. 211-221; Leslie A. White,
The Evolution of Culture. The Development of Civilization to the Fall of Rome, New
York 1959; Carroll Quigley, The Evolution of Civilizations. An Introduction to Historical Analysis (1961), Indianapolis (Indiana) 1979; Donald T. Campbell, Variation and
Selective Retention in Socio-Cultural Evolution in: Herbert R. Barringer / George I.
Blanksten / Raymond W. Mack (Hg.), Social Change in Developing Areas. A Reinterpretation of Evolutionary Theory, Cambridge (Mass.) 1965, S. 19-49; ders., Evolutionary Epistemology (1974), in: Gerard Radnitzky / W. W. Bartley (Hg.), Evolutionary
Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge, La Salle (Ill.) 1987, S. 47-89;
ders., On the Conflict between Biological and Social Evolution and between Psychology and Moral Tradition in: American Psychologist, Vol. 30 (1975), No. 12, S. 11031126; ders., The Two Distinct Routes beyond Kin Selection to Ultrasociality: Implications for the Humanities and Social Sciences in: Diane L. Bridgeman (Hg.), The
Nature of Prosocial Development. Interdisciplinary Theories and Strategies, New York
1983, S. 11-41; Alexander Alland, Evolution and Human Behavior, Garden City (New
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 59 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
59
der kulturellen Evolution unter stndig wandelnden, nicht prognostizierbaren Umfeldbedingungen bewhren. Welche Rechtsnormen sich beispielsweise durchsetzen
wrden, konnten auch diejenigen nicht voraussehen, die bestimmte Rechtsnormen
bewusst erfanden und einfhrten. Tatschlich wurden die wohlfahrtssteigernden
Wirkungen der genannten Institutionen von denen, die sie einfhrten, meist nicht
vorausgesehen. So gingen die individuelle Freiheit und die Herrschaft des Rechts in
England im 17. Jahrhundert lediglich als Nebenprodukt aus dem seinerzeitigen
Machtkampf zwischen Knig und Parlament hervor, der mit der Glorreichen Revolution von 1688 zugunsten des Parlaments und damit zugunsten jener Institutionen
entschieden wurde4.
Die westlichen Gesellschaften, in denen sich auf welchen Wegen auch immer
produktivere Institutionen entwickelten, prosperierten und expandierten5. Sie zogen dabei Menschen anderer Gesellschaften an und verdrngten diese anderen Gesellschaften tendenziell, soweit diese nicht die produktiveren Institutionen bernahmen. Diejenigen Gesellschaften, die an weniger produktiven Institutionen
festhielten oder solche einfhrten, fielen im Wettbewerbsprozess der kulturellen
Evolution zurck. Einige liefen sogar Gefahr unterzugehen. Beispielhaft genannt
seien die Indianergesellschaften Nordamerikas, die Aztekenkultur Mittelamerikas
sowie das Reich der Inka in Sdamerika. Ein weiteres Beispiel ist das chinesische
Kaiserreich, das Westeuropa bis ins 15. Jahrhundert technologisch berlegen war.
Doch die zentralistische, totalitre und repressive Willkrherrschaft des Kaisers und
York) 1967; Karl R. Popper, Objektive Erkenntnis. Ein evolutionrer Entwurf (1972),
Hamburg 1984; Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York 1973;
Elman R. Service, Ursprnge des Staates und der Zivilisation. Der Prozess der kulturellen Evolution, Frankfurt am Main 1977; Wolfgang Wickler / Uta Seibt, Das Prinzip
Eigennutz. Zur Evolution sozialen Verhaltens (1977), Mnchen/Zrich 1991; Edna Ullmann-Margalit, The Emergence of Norms, Oxford 1977; John C. Eccles, Das Rtsel
Mensch. Die Evolution des Menschen und die Funktion des Gehirns (1979), Mnchen/
Zrich, 1989; ders., Die Evolution des Gehirns die Erschaffung des Selbst (1989), 3.
Aufl., Mnchen/Zrich 1994; H. Ronald Pulliam / Christopher Dunford, Programmed
to Learn. An Essay on the Evolution of Culture, New York 1980; John Tyler Bonner,
The Evolution of Culture in Animals, Princeton (New Jersey) 1980; Charles J. Lumsden
/ Edward O. Wilson, Genes, Mind, and Culture. The Coevolutionary Process, Cambridge (Mass.)/London 1981; Luigi Luca Cavalli-Sforza / Marcus W. Feldman, Cultural
Transmission and Evolution: A Quantitative Approach, Princeton (New Jersey) 1981;
Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, New York 1984; Robert Boyd / Peter J.
Richerson, Culture and the Evolutionary Process, Chicago (Ill.) 1985; C. R. Hallpike,
The Principles of Social Evolution, Oxford 1986; Allen W. Johnson / Timothy Earle,
The Evolution of Human Societies. From Foraging Group to Agrarian State, Stanford
(Cal.) 1987; Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for
Collective Action, Cambridge 1990; William H. Durham, Coevolution. Genes, Culture,
and Human Diversity, Stanford (Cal.) 1991; Stephen K. Sanderson, Social Transformations. A General Theory of Historical Development, Lanham (Maryland) 1999.
4 Vgl. David Hume, The History of England from the Invasion of Julius Caesar to The
Revolution in 1688 (1754-61), Indianapolis (Indiana) 1983-85; Thomas B. Macaulay, Die
Glorreiche Revolution. Geschichte Englands 1688/89 (1849), Zrich 1998.
5 Vgl. Wolfgang Reinhard, Geschichte der europischen Expansion, 4 Bde., Stuttgart 1983-90.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 60 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
60
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
seiner allmchtigen Mandarine, die aus Angst um ihre Machtstellung Privateigentum, individuelle Freiheit, privates Unternehmertum und offene Mrkte verboten
und smtliche individuelle Initiative unterdrckten, fhrte unweigerlich zu wirtschaftlichem Rckschritt und kulturellem Verfall6. Ein aktuelles Beispiel liefern die
sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts. Hier ersetzten die kommunistischen
Herrscher smtliche Institutionen, die sich im Laufe der kulturellen Evolution
spontan entwickelt und den Aufstieg der westlichen Welt ermglicht hatten, durch
neu konstruierte. So trat die zentrale Planung und Lenkung aller Wirtschaftsprozesse an die Stelle des freien Marktes, das staatliche an die Stelle des privaten Eigentums
an den Produktionsmitteln. Jede der Institutionen, die die Kommunisten als Ersatz
fr die von ihnen abgeschafften einfhrten, wies erhebliche Funktionsmngel auf
und trug damit zum schlielichen Zusammenbruch der sozialistischen Systeme bei7.
Wie der in historischer Perspektive vergleichsweise rasche Zusammenbruch der
sozialistischen Systeme des 20. Jahrhunderts zeigt, sind die Gesellschaftssysteme
heutzutage einem besonders starken Selektionsdruck ausgesetzt. Hierbei spielen die
im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts deutlich gesunkenen Transaktions- und
Transportkosten sowie die dadurch gestiegene Mobilitt von Mensch und Kapital
eine entscheidende Rolle. Praktisch berall auf der Welt knnen sich die Menschen
heutzutage ohne groe Kosten ber die Zustnde in anderen Lndern informieren,
etwa ber den dortigen Lebensstandard oder den Umfang individueller Freiheitsrechte. Auch wandern Mensch und Kapital heute schneller und in grerem Umfang als je zuvor dorthin, wo sie hhere Einkommen erzielen knnen. Weniger
wettbewerbsfhige Gesellschaften fallen dabei unweigerlich immer weiter zurck.
Die (Opportunitts-) Kosten einer die Wettbewerbsfhigkeit der jeweiligen Gesellschaft nicht angemessen bercksichtigenden Politik sind daher heutzutage wahrscheinlich so gro wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit.
Welche Lehren knnen aus diesen Charakteristika der kulturellen Evolution fr
die Politik gezogen werden? An welchen Leitlinien sollte sie sich orientieren, damit
die jeweilige Gesellschaft im Wettbewerbsprozess der kulturellen Evolution bestehen kann? Bevor diese Fragen beantwortet werden knnen, mssen zunchst zwei
weitverbreitete Irrtmer ber den Spielraum und die Rolle der Politik in der kulturellen Evolution ausgerumt werden (Abschnitt 2). Anschlieend werden aus den
Charakteristika der kulturellen Evolution drei konkrete Leitlinien abgeleitet, die die
Politik beachten sollte (Abschnitt 3).
6 Vgl. David S. Landes, aaO. (FN 1), S. 55 ff.; Erich Weede, Asien und der Westen. Politische und kulturelle Determinanten der wirtschaftlichen Entwicklung, Baden-Baden
2000, S. 86 ff.
7 Vgl. Horst Feldmann, Kulturelle Evolution und der Zusammenbruch des Sozialismus in: List Forum fr Wirtschafts- und Finanzpolitik, Bd. 23 (1997), Nr. 1, S. 82-101.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 61 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
61
2. Zwischen Panglossismus und Konstruktivismus
2.1. Die Gefahr des Panglossismus
In Voltaires Roman Candide behauptet der ehrwrdige Hofmeister und Hauslehrer Dr. Panglo, wir lebten in der besten aller mglichen Welten: Es ist erwiesen,
pflegte er zu sagen, da die Dinge gar nicht anders sein knnen, als sie sind. Denn
sintemal alles zu einem ganz bestimmten Zweck geschaffen ist, so ist alles notwendigerweise zum allerbesten Zweck erschaffen8. Die Auffassung, wir lebten in der
besten aller mglichen Welten, wenn man nur alle Probleme und Widerstnde bercksichtige, die denkbaren Verbesserungen entgegenstnden, wird dementsprechend heute als Panglossismus bezeichnet. Kritiker einer kulturevolutionren Sicht
der Welt behaupten, diese Sicht impliziere einen solchen kritiklosen Panglossismus.
Aus kulturevolutionrer Sicht sei alles, was im Laufe der kulturellen Evolution berlebt habe, berlegen; indem es berlebt habe, habe es sich als berlegen erwiesen.
Der Theorie der kulturellen Evolution fehle damit ein unabhngiger Mastab zur
Bewertung der Ergebnisse der kulturellen Evolution und zur Bewertung politischer
Reformvorschlge. Auch lieen sich aus ihr keinerlei politische Reformvorschlge
ableiten. Die Vertreter der Theorie schlssen implizit vom Sein auf das Sollen
und seien damit einem naturalistischen Trugschluss erlegen. Konsequenterweise
mssten selbst totalitre Regime, die im Laufe der kulturellen Evolution entstanden
seien, akzeptiert werden. Die Theorie der kulturellen Evolution sei fatalistisch9.
Tatschlich besteht die Gefahr des Panglossismus jedoch nicht. Die Vertreter der
Theorie der kulturellen Evolution sind keinem naturalistischen Fehlschluss erlegen.
Sie behaupten nicht, die Ergebnisse der kulturellen Evolution seien notwendigerweise gut, sondern vielmehr, dass die Menschheit in ihrer heutigen Gre und mit
ihrem heutigen Wohlstand ohne die erwhnten spezifischen Institutionen und deren
weitere Evolution nicht fortbestehen knnte. Wrden diese Institutionen zerstrt,
8 Voltaire, Candide oder Der Glaube an die beste der Welten (1759), Mnchen 1980, S. 8.
9 Vgl. James M. Buchanan, Mglichkeiten institutioneller Reformen im Rahmen kulturell geformter abstrakter Verhaltensregeln in: Viktor Vanberg, Liberaler Evolutionismus oder vertragstheoretischer Konstitutionalismus? Zum Problem institutioneller
Reformen bei F. A. von Hayek und J. M. Buchanan, Tbingen 1981, S. 45 f.; ders., Die
Grenzen der Freiheit. Zwischen Anarchie und Leviathan, Tbingen 1984, S. 237;
Geoffrey Brennan / James M. Buchanan, The Reason of Rules. Constitutional Political
Economy, Cambridge 1985, S. 9 f.; David Miller, The Fatalistic Conceit in: Critical
Review, Vol. 3 (1989), No. 2, S. 314; Stefan Voigt, On the Internal Consistency of
Hayeks Evolutionary Oriented Constitutional Economics Some General Remarks
in: Journal des Economistes et des Etudes Humaines, Vol. 3 (1992), No. 4, S. 465; Martin
De Vlieghere, A Reappraisal of Friedrich A. Hayeks Cultural Evolutionism in: Economics and Philosophy, Vol. 10 (1994), No. 2, S. 293; John N. Gray, Freiheit im Denken
Hayeks, Tbingen 1995, S. 141. Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser und weiterer Kritik, die an der Theorie der kulturellen Evolution gebt wird, findet sich bei
Horst Feldmann, Hayeks Theorie der kulturellen Evolution: Eine Kritik der Kritik
in: Thomas Eger (Hg.), Kulturelle Prgungen wirtschaftlicher Institutionen und wirtschaftspolitischer Reformen, Berlin 2002, S. 51-88.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 62 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
62
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
wrde dies einen Groteil der Menschheit zu Armut und Hungertod verurteilen.
Die Vorzge der genannten Institutionen rechtfertigen diese zwar nicht per se, aber
die Alternative bestnde fr viele Menschen in Armut und Tod10.
Akzeptiert man die Erhaltung der Menschheit und ihres Wohlstands als normativen Standard, lassen sich aus der Theorie der kulturellen Evolution sehr wohl konkrete politische Gestaltungsempfehlungen ableiten. Politische Reformen sind nicht
nur mglich, sondern auch ntig, denn obgleich die Institutionen im Prozess der
kulturellen Evolution grundstzlich nach ihrem Beitrag zum berleben und zum
Wohlstand der Menschen selektiert werden, wird diese Entwicklung zugleich immer wieder durch diverse Faktoren gestrt. So bestehen beispielsweise viele berlieferte Institutionen noch fort, wenn sie ihre Ntzlichkeit schon lange verloren haben, und sogar, wenn sie mehr ein Hindernis als eine Hilfe geworden sind etwa
dann, wenn sie nicht mit neuen Problemen fertig werden knnen. Auch entwickeln
sich einzelne Institutionen, wie etwa die richterliche Rechtsfortbildung, bisweilen in
kontraproduktive Richtungen, was eine Korrektur durch bewusste Gesetzgebung
erforderlich macht. Wie die Geschichte zeigt, kann der kulturelle Evolutionsprozess
sogar ganze Gesellschaften in Sackgassen fhren, aus denen sie sich nur schwer wieder befreien knnen.
Des weiteren ist es bisweilen notwendig, gewachsene Institutionen gezielt zu verbessern, um ihr volles Potential zu erschlieen. So ist beispielsweise die Institution
des Privateigentums, wie sie heute existiert, bei weitem noch nicht perfekt. Beim Eigentum an einem Gut handelt es sich um ein komplexes Bndel an Rechten, die auf
unterschiedliche Weise ausgestaltet und verschiedenen Personen oder Personengemeinschaften zugeordnet werden knnen11. Die verschiedenen Mglichkeiten der
Ausgestaltung und Zuordnung von Eigentumsrechten sind noch lange nicht ausgeschpft (etwa im Bereich von Finanzierungsinstrumenten oder naturwissenschaftlichen Entdeckungen und Erfindungen). Der Gesetzgeber muss die Voraussetzungen
dafr schaffen, dass diese Mglichkeiten voll genutzt werden knnen.
Gestrt wird die kulturelle Evolution darber hinaus immer wieder durch einen
mchtigen Staat. Mchtige Regierungen tendieren immer wieder dazu, ihre Macht
zu missbrauchen, indem sie ihre Brger unterdrcken und den Prozess der kulturellen Evolution aufzuhalten oder zu lenken versuchen. Man denke an die Beispiele
des chinesischen Kaiserreichs und der sozialistischen Regime des 20. Jahrhunderts.
Auch die heutigen reprsentativen Demokratien gefhrden die berlieferten Institutionen des Rechtsstaats und der Marktwirtschaft. Da die Macht der Politiker in den
heutigen Demokratien unzulnglich beschrnkt ist und sie auf die Untersttzung
durch organisierte Interessengruppen angewiesen sind, wird immer wieder unter
Verletzung rechtsstaatlicher und marktwirtschaftlicher Prinzipien zugunsten solcher Interessengruppen interveniert, wodurch die freiheitliche Ordnung des Wes10 Vgl. Friedrich A. von Hayek, The Fatal Conceit. The Errors of Socialism, aaO. (FN 3),
S. 27, 63.
11 Vgl. Horst Feldmann, Ordnungstheoretische Aspekte der Institutionenkonomik, Berlin
1999, S. 54 ff.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 63 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
63
tens gefhrdet wird12. Auch die Idee der sozialen Gerechtigkeit gefhrdet heutzutage die Funktionsfhigkeit dieser Ordnung, weil sie immer wieder zum Anlass fr
ordnungsinkonforme Interventionen genommen wird13. Daher sind ordnungspolitische Manahmen notwendig, die den Machtmissbrauch der Regierungen und den
schdlichen Einfluss der Interessengruppen mglichst effektiv unterbinden.
Ein weiterer Faktor, der die kulturelle Evolution immer wieder strt und dem daher durch geeignete politische Manahmen begegnet werden muss, sind die angeborenen Instinkte der Menschen. ber Millionen von Jahren haben der Mensch und
seine hominiden Vorfahren in kleinen Horden zusammengelebt, deren Mitglieder
sich persnlich kannten. Das Zusammenleben in einer solchen Gruppe, die von einem Anfhrer geleitet wurde, war durch gemeinsame, konkrete Ziele und eine
gleichartige Wahrnehmung der Geschehnisse gekennzeichnet, die den Gruppenmitgliedern gemeinsam sichtbar und von allen als potentielle Quelle von Nahrung oder
Gefahr erkannt wurden. Die Kooperation innerhalb der Gruppe war eng umschrieben. In dieser Zeit entwickelten und verfestigten sich bestimmte genetisch vererbte
Instinkte, die das Verhalten der Menschen leiteten. Sie waren dem Leben in der
Kleingruppe angepasst und auf die Sicherung ihres Zusammenhalts und Fortbestands ausgerichtet. Wichtige Beispiele sind die Instinkte der gleichmigen Einkommensverteilung, der Solidaritt und des Altruismus, die nicht auf alle Menschen
gerichtet waren, sondern nur auf die Mitglieder der eigenen Gruppe. Im Zuge der
kulturellen Evolution wurden diese angeborenen Instinkte immer mehr durch erlernte Verhaltensregeln beherrscht und verdrngt14. Nur dadurch ist die Entstehung
einer ausgedehnten Gesellschaftsordnung mglich geworden. Von Zeit zu Zeit lehnen sich die unterdrckten Instinkte indes gegen die Disziplin der anerzogenen Verhaltensnormen auf, etwa gegen die Regeln der Vertragstreue oder des Respekts vor
der Freiheit und dem Eigentum anderer. Beispielhaft kommt dies in den Lehren der
Kommunisten zum Ausdruck. Sie verdammten diese Normen und appellierten statt
dessen an die Urinstinkte der Gleichverteilung, der Solidaritt und des Altruismus.
Bei einer solchen Auflehnung besteht die Gefahr, dass die Menschen wieder in die
Vorstellungen der Stammesgesellschaft zurckfallen und damit den Bestand der Gesellschaftsordnung bedrohen, der sie nicht nur ihren Wohlstand, sondern sogar ihr
Leben verdanken15.
12 Vgl. Mancur Olson, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of
Groups, Cambridge (Mass.) 1965; ders., The Rise and Decline of Nations. Economic
Growth, Stagflation and Social Rigidities, New Haven (Conn.), London 1982; Fareed
Zakaria, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York
2003.
13 Vgl. Friedrich A. von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung
der liberalen Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen konomie, Bd. II: Die
Illusion der sozialen Gerechtigkeit, aaO. (FN 3).
14 Vgl. Friedrich A. von Hayek, Die berschtzte Vernunft aaO. (FN 3); ders., The
Fatal Conceit. The Errors of Socialism, aaO. (FN 3).
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 64 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
64
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
2.2. Die Gefahr des Konstruktivismus
Anders als der Panglossismus, der nur eine scheinbare Gefahr darstellt, stellt der
Konstruktivismus (oder auch konstruktivistische Rationalismus) eine reale Gefahr
dar. Die Vertreter dieser Richtung behaupten, gesellschaftliche Institutionen
knnten menschlichen Zwecken nur dienen, wenn sie absichtlich fr diese Zwecke
geschaffen worden seien. Institutionen, die nicht rational entworfen worden seien,
knnten nur durch Zufall wohlttig sein16. Irgendwann im Laufe der Evolution sei
die Vernunft entstanden, und seitdem habe der Mensch die gesellschaftlichen Institutionen immer systematischer rational gestaltet. Die Vertreter des Konstruktivismus sind der berzeugung, smtliche Institutionen einschlielich der Sprache, der
Moral und des Rechts und damit die gesamte Gesellschaftsordnung knnten mit
Hilfe der Vernunft neu konstruiert werden. Die Gesellschaft und ihre Institutionen
sollten so umgestaltet werden, dass sie bestimmten festgelegten Zwecken bestmglich dienten.
Seit der Aufklrung ist dieser konstruktivistische Glaube die dominierende Geisteshaltung der meisten Menschen, insbesondere der Intellektuellen und der Politiker. In besonders reiner Form zeigt er sich in den Lehren der Kommunisten. Diese
versuchten im 20. Jahrhundert in vielen Lndern, eine vollkommen neue Gesellschaftsordnung mit rational entworfenen Institutionen aufzubauen und dabei alle
traditionellen Institutionen, die ihrer Ansicht nach ohnehin nur der Ausbeutung der
Arbeiterklasse dienten, abzuschaffen. So wurde nicht nur der freie Markt durch die
Zentralplanung ersetzt und das Privateigentum an den Produktionsmitteln durch
das Staatseigentum; darber hinaus wurde die Herrschaft des Rechts durch ein sozialistisches Recht ersetzt, das nicht der Gewhrleistung individueller Freiheitsrechte,
sondern der Umsetzung der Direktiven der regierenden kommunistischen Partei
diente. Selbst die traditionellen Moralvorstellungen der westlichen Zivilisation sollten durch eine neue, sozialistische Moral ersetzt werden. Der Sozialismus des 20.
Jahrhunderts stellte den gigantischen Versuch dar, die gesamte Gesellschaft bis in
ihre letzten Verstelungen nach einer umfassenden Theorie neu zu gestalten. Diesem Zweck dienten die Abschaffung smtlicher bedeutender, spontan gewachsener
Institutionen und ihr Ersatz durch neue, zielgerichtet konstruierte. Genau in dieser
Hybris liegt auch der Grund fr den schlielichen Zusammenbruch der sozialistischen Systeme17.
Obgleich der Konstruktivismus in der reinen Form, in der er im real existierenden Sozialismus verwirklicht war, klglich gescheitert ist, ist er nach wie vor leben15 Vgl. Friedrich A. von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung
der liberalen Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen konomie, Bd. II: Die
Illusion der sozialen Gerechtigkeit, Bd. III: Die Verfassung einer Gesellschaft freier
Menschen, aaO. (FN 3).
16 Vgl. Ren Descartes, Discours de la Mthode / Von der Methode des richtigen Verstandesgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung (1637), Hamburg 1960.
17 Vgl. Horst Feldmann, Kulturelle Evolution und der Zusammenbruch des Sozialismus aaO. (FN 7).
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 65 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
65
dig. Immer wieder lehnt sich die menschliche Vernunft gegen berlieferte Verhaltensregeln auf, deren Sinn sie nicht versteht. Ein Beispiel ist der im 19. Jahrhundert
entstandene und auch heute noch einflussreiche Rechtspositivismus. Er hat keinerlei Verstndnis fr berlieferte Prinzipien und Regeln des Rechts, die nicht rational
erklrt werden knnen und die die gesetzgeberische Macht beschrnken. Fr ihn
besteht das Recht definitionsgem ausschlielich aus bewussten Befehlen des
menschlichen Willens. Es soll gezielt zur Erreichung bestimmter Zwecke gestaltet
werden18. Nach dem Rechtspositivismus darf die Macht des Gesetzgebers keiner
Beschrnkung unterworfen werden, konsequenterweise auch keiner Beschrnkung
durch die Respektierung individueller Freiheitsrechte. Der Rechtspositivismus
wurde damit nicht nur zu einem Wegbereiter des Sozialismus und Nationalsozialismus; er hat auch das Rechtsverstndnis in der westlichen Welt nachhaltig verndert.
Der konstruktivistische Glaube wird schlielich auch dadurch befrdert, dass
heutzutage immer mehr Menschen in groen Organisationen, wie etwa Grounternehmen oder staatlichen Behrden arbeiten. Der Erfolg der bewussten Schaffung
neuer Regeln fr solche Zweckorganisationen war so eindrucksvoll, dass die Bedeutung gewachsener Regeln und spontaner Ordnungen immer weniger erkannt wird.
Der Verstndnishorizont der Menschen, die in solchen groen, fr einen bestimmten Zweck geschaffenen Organisationen arbeiten, ist auf das eingeschrnkt, was
durch die interne Struktur derartiger Organisationen erfordert wird. Fr sie ist die
spontane Handelnsordnung einer ausgedehnten, marktwirtschaftlichen Gesellschaft
weitgehend unverstndlich; sie haben die Regeln, auf denen sie beruht, niemals angewandt; ihre Funktionsweise und ihre Verteilungswirkungen erscheinen ihnen irrational und unmoralisch. Daher fordern sie, dass die gesamte Gesellschaftsordnung
und deren Institutionen auf dieselbe Weise konstruiert werden sollten wie eine
Groorganisation und dass damit insbesondere eine gerechte Einkommensverteilung erreicht werden sollte.
Anders als der Konstruktivismus behauptet, knnen eine Gesellschaftsordnung
und ihre Institutionen jedoch nicht gnzlich neu konstruiert werden. Die kulturelle
Evolution insgesamt lsst sich nicht vernunftmig steuern. Die Vernunft selbst ist
erst im Laufe der kulturellen Evolution entstanden. Sie hat den Prozess der kulturellen Evolution nicht gelenkt, sondern hat sich selbst erst in der Frhphase dieses
Prozesses allmhlich entwickelt19. Der Mensch hat neue Verhaltensregeln nicht angenommen, weil er intelligent war; vielmehr wurde er dadurch intelligent, dass er
sich neuen Verhaltensregeln unterwarf. Der Mensch hat seine wohlttigsten Institutionen, von der Sprache bis zur Moral, dem Recht und dem Markt, nicht erfunden;
dazu war er nicht intelligent genug.
Auch heute noch kann der Mensch die Bedeutung und Interdependenz der Institutionen, die sein Verhalten leiten, nicht vollstndig erfassen. Er wei meist nicht,
aus welchen Grnden sie ursprnglich entstanden sind, warum sie sich im Vergleich
zu anderen besser bewhrt haben, welchen Beitrag sie zur Erhaltung der komplexen
Handelnsordnung einer groen Gesellschaft leisten, warum und auf welche Weise
18 Vgl. Hans Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 66 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
66
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
sie sich im Zeitablauf wandeln und inwiefern sie voneinander abhngen. Vielfach
sind die Verhaltensregeln den Menschen noch nicht einmal bewusst, obwohl sie sich
nach ihnen richten. Auch im Rahmen eingehender wissenschaftlicher Analysen knnen die Entstehung, die Funktionen, der Wandel und die wechselseitige Abhngigkeit der Institutionen einer groen Gesellschaft nur unvollstndig eruiert werden.
Auch lassen sich die knftigen Umfeldbedingungen, an die sich die Institutionen anpassen mssen, nicht vorhersehen. Aus all diesen Grnden kann die kulturelle Evolution nicht gelenkt oder kontrolliert werden. Der Irrtum der Konstruktivisten besteht in dem Glauben, all dieses Wissen in Erfahrung bringen und auf seiner
Grundlage eine vollkommen neue Gesellschaftsordnung errichten zu knnen. Wie
das Beispiel der sozialistischen Regime des 20. Jahrhunderts zeigt, wrde ein solcher
Versuch aber den inzwischen erreichten Wohlstand der Menschheit und sogar die
physische Existenz eines Teils der heutigen Weltbevlkerung gefhrden, weil dabei
zwangslufig traditionelle Institutionen zerstrt wrden, die fr die Erhaltung der
heutigen Weltbevlkerung und ihres Wohlstands unerlsslich sind.
Dies alles bedeutet selbstverstndlich nicht, dass die berlieferten Institutionen
nicht verbessert werden knnen. Da man sie nicht in vollem Umfang verstehen
kann, sollte man sie nur nicht unbesehen abschaffen, sondern im Falle erkennbarer
Mngel prfen, inwiefern sich durch die nderung einer Institution die Funktionsweise der Gesamtheit aller Institutionen voraussichtlich verbessern und die Erhaltung der komplexen Ordnung menschlichen Handelns in einer groen Gesellschaft
besser untersttzen lsst. Auf der Grundlage solcher Analysen knnen dann politische Reformen durchgefhrt werden.
19 Ein Repertoire erlernter Regeln, die ihm sagten, was richtiges und was falsches Handeln unter verschiedenen Umstnden sei, gab ihm in zunehmendem Mae die Fhigkeit,
sich an wechselnde Bedingungen anzupassen und insbesondere mit den anderen Mitgliedern seiner Gruppe zu kooperieren. So begann eine Tradition von Verhaltensregeln
das menschliche Dasein zu regulieren, die unabhngig von jedem einzelnen Individuum
galten, das sie erlernt hatte. Als diese durch Lernen erworbenen Regeln, die auch Klassifizierungen der verschiedenen Arten von Objekten einschlossen, anfingen, mit der Zeit
eine Art Umweltmodell miteinzubegreifen, das den Menschen befhigte, uere Ereignisse vorauszusagen und bei seinem Handeln zu antizipieren, erschien das, was wir als
Vernunft bezeichnen. Dieses System von Verhaltensregeln enthielt damals wahrscheinlich viel mehr Intelligenz als das Denken des Menschen ber seine Umwelt. [. . .] Der
Geist ist in eine traditionelle unpersnliche Struktur erlernter Regeln eingebettet, und
seine Fhigkeit, Erfahrungen zu ordnen, ist eine erworbene Wiederholung kultureller
Muster, die jeder individuelle Geist als Gegebenheit vorfindet. Das Gehirn ist ein
Organ, das uns befhigt, Kultur aufzunehmen, aber nicht, sie zu entwerfen. Friedrich
A. von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung der liberalen
Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen konomie, Bd. III: Die Verfassung
einer Gesellschaft freier Menschen, aaO. (FN 3), S. 213 f.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 67 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
67
3. Leitlinien fr die Politik
Wie die bisherigen Ausfhrungen bereits deutlich machen, spielt die Politik im Rahmen der kulturellen Evolution eine bedeutende Rolle. Angesichts des Selektionsdrucks, der gerade heute in der kulturellen Evolution herrscht, sollte sie sich dabei
fr Manahmen entscheiden, die fr die Erhaltung und den Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft, fr die die Politik Verantwortung trgt, frderlich sind. Die Entscheidung fr ein solches Ziel impliziert zwar ein Werturteil, das nicht wissenschaftlich bewiesen werden kann, jedoch muss sich jede Politik an bestimmten,
wissenschaftlich nicht beweisbaren Zielen orientieren20. Fr das genannte Ziel
spricht, dass seine Erreichung die Voraussetzung darstellt fr die Erreichung praktisch aller anderen Ziele, die die Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft haben mgen. Auerdem drfte es von praktisch allen Menschen bejaht werden.
Aus den Charakteristika der kulturellen Evolution knnen, wenn man das genannte Ziel akzeptiert, allgemeine Leitlinien fr die Politik deduziert werden. Die
Beachtung dieser im folgenden entwickelten Leitlinien erleichtert die Erreichung jenes Ziels. Zudem gewhrleisten sie Einheitlichkeit und innere Widerspruchslosigkeit der Politik. Dadurch werden kostentrchtige Friktionen vermieden, die ohne
Beachtung allgemeiner Leitlinien auftrten.
Die im folgenden entwickelten Leitlinien haben einen abstrakten Charakter, denn
sie legen nur einige Aspekte der Politik fest. Damit belassen sie fr die konkrete Gestaltung politischer Institutionen und praktischer politischer Manahmen einen
groen Spielraum, der gem den von Land zu Land unterschiedlichen geschichtlichen Erfahrungen, kulturellen Werten und Traditionen, Umfeldbedingungen und
Prferenzen der Menschen auf verschiedene Weise ausgefllt werden kann. Die
Leitlinien selbst hingegen sind nicht beliebig. Sie ergeben sich logisch schlssig aus
den Charakteristika der kulturellen Evolution. Sollen die Existenz der jeweiligen
Gesellschaft und ihr Wohlstand gesichert werden, mssen sie eingehalten und in
konkrete politische Manahmen und Institutionen umgesetzt werden. Je konsequenter dies geschieht, desto grer der Zielerreichungsgrad. Je weniger es geschieht, desto grer die Gefhrdung nicht nur des Wohlstands, sondern selbst des
langfristigen Bestands der jeweiligen Gesellschaft.
3.1. Individuelle Freiheit
Die wichtigste Leitlinie der Politik muss angesichts der Charakteristika der kulturellen Evolution in einer umfassenden Verwirklichung individueller Freiheit bestehen. Der einzelne Mensch muss sein Leben im Rahmen seiner Mglichkeiten weitestgehend nach eigenen Vorstellungen gestalten knnen. Dabei hat er
20 Vgl. Max Weber, Die Objektivitt sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer
Erkenntnis (1904) in: ders., Gesammelte Aufstze zur Wissenschaftslehre, 7. Aufl.,
Tbingen 1988, S. 146-214.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 68 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
68
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
selbstverstndlich zugleich die Konsequenzen seiner Handlungen zu tragen (Prinzip der Haftung), denn ohne persnliche Verantwortung ist eine freiheitliche Gesellschaftsordnung nicht funktionsfhig21. Auerdem darf der einzelne bei der Verfolgung seiner Ziele nicht die Freiheit anderer Menschen verletzen22.
Individuelle Freiheit ist ein gesellschaftlicher Zustand, in dem Zwang auf Menschen von Seiten anderer so weit herabgemildert wird, als dies im Gesellschaftsleben
mglich ist23. Andere drfen nicht die Macht besitzen, den Individuen ihren Willen
aufzuzwingen. Daher muss dem einzelnen ein privater Bereich gesichert sein, in den
andere nicht eingreifen knnen. Vor allem muss der einzelne frei ber eigene Mittel
verfgen knnen; erst dadurch wird es ihm mglich, eigene Ziele zu verfolgen. Daher bildet Privateigentum ein zentrales Element der individuellen Freiheit. Es ist
eine unabdingbare Voraussetzung fr deren Ausbung.
Zur individuellen Freiheit gehrt des weiteren die Vertragsfreiheit. Nur wenn die
Gesellschaftsmitglieder grundstzlich frei Vertrge mit anderen schlieen drfen,
knnen sie ihre Freiheit tatschlich im Gesellschaftsleben praktizieren. Beispielsweise muss der einzelne grundstzlich die Freiheit haben, Kaufvertrge ber den
Erwerb derjenigen Gter abzuschlieen, die er zu besitzen wnscht.
Ausdruck individueller Freiheit ist darber hinaus die Wettbewerbsfreiheit24. Jeder einzelne muss grundstzlich das Recht haben, seine Gter und Produktionsfaktoren auf einem Markt ungehindert anzubieten und damit in Konkurrenz zu anderen Anbietern zu treten. Die Mrkte mssen offen sein. Dieses Prinzip hat nicht nur
fr den Bereich der Wirtschaft zu gelten, sondern auch fr die Politik, die Wissenschaft, die Religion und andere wichtige Bereiche des Gesellschaftslebens. Es muss
also nicht nur Berufs- und Gewerbefreiheit herrschen, vielmehr mssen auch die
politische Wahlen frei und die Freiheit von Forschung und Lehre gewhrleistet sein,
ebenso die Glaubens-, Meinungs- und Pressefreiheit. Auch in diesen Bereichen der
Gesellschaft muss damit freier Wettbewerb herrschen.
Die zentrale Bedeutung der individuellen Freiheit im Prozess der kulturellen
Evolution besteht in ihren wohlfahrtssteigernden Wirkungen. Jeder einzelne hat die
Mglichkeit und den Anreiz, seine Mittel so einzusetzen, dass sie einen mglichst
groen Ertrag abwerfen. Wie bereits Adam Smith25 betont hat, hat ein jeder bei seinen Aktivitten zwar nur seinen eigenen Vorteil im Auge und nicht etwa den der
Gesellschaft, doch wird er durch den Wettbewerb wie von einer unsichtbaren Hand
dazu gefhrt, dabei gleichzeitig die gesellschaftliche Wohlfahrt zu erhhen. Der einzelne Unternehmer etwa wird dazu angehalten, Gter zu produzieren, die den
Konsumentenprferenzen entsprechen, und dabei Produktionsverfahren anzuwenden, die die grtmgliche Effizienz des Faktoreinsatzes gewhrleisten. Auch hat er
21 Vgl. Walter Eucken, Grundstze der Wirtschaftspolitik (1952), Tbingen 1990, S. 279 ff.
22 Vgl. John Stuart Mill, ber die Freiheit (1859), Stuttgart 1988, S. 16 ff., 77 f.
23 Vgl. Friedrich A. von Hayek, Die Verfassung der Freiheit (1960), 3. Aufl., Tbingen
1991, S. 13.
24 Vgl. Erich Hoppmann, Wirtschaftsordnung und Wettbewerb, Baden-Baden 1988.
25 Vgl. Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und
seiner Ursachen, aaO. (FN 3), S. 369 ff.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 69 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
69
einen Anreiz, auf nderungen von Beschaffungspreisen und anderen Daten durch
flexible Anpassung der Produktion zu reagieren sowie selbstndig kostengnstigere
Produktionsmethoden und neue, bessere Produkte zu entwickeln. Der einzelne Arbeitnehmer hat ebenfalls einen Anreiz, mglichst produktiv zu arbeiten, weil er auf
diese Weise sein persnliches Einkommen steigern kann. Eine hhere Produktivitt
fhrt wiederum zu einem greren Wohlstand der Gesellschaft.
Die wohlfahrtssteigernden Wirkungen der individuellen Freiheit sind auch darauf
zurckzufhren, dass jedes Gesellschaftsmitglied einen Anreiz hat, seine persnlichen Kenntnisse und Fertigkeiten einzusetzen. Auf diese Weise wird das Wissen aller Menschen zum Wohle der ganzen Gesellschaft genutzt. Dies gilt fr die Kenntnisse bestimmter Sachgebiete, Mrkte, Regionen etc. ebenso wie fr die
unterschiedlichen Begabungen der Menschen. Die individuelle Freiheit ist ein Anreiz und ein Mechanismus zur gesellschaftlichen Nutzung solchen von Mensch zu
Mensch unterschiedlichen Wissens26.
Voraussetzung fr den wirtschaftliche Fortschritt sind wissenschaftliche Entdeckungen, technische Erfindungen und konomische Innovationen. Dabei kommt es
jedoch oftmals zu Fehlschlgen. Daher ist es erforderlich, dass sich eine Vielzahl eigenstndiger, schpferischer Individuen unabhngig voneinander um Entdeckungen, Erfindungen und Innovationen bemht. Es bedarf vieler unabhngiger Experimente in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft, damit die Wohlfahrt der Menschen
permanent erhht werden kann. Voraussetzung dafr wiederum ist die Freiheit des
Individuums. Individuen, die nach neuen Wegen suchen und mit neuen Mglichkeiten experimentieren, bentigen Freiheit, weil sie das Althergebrachte in Frage stellen und berwinden mchten. Und je mehr Individuen sich an solchen dezentralen
Suchprozessen beteiligen, desto grer sind die Chancen, dass sich die gesellschaftliche Wohlfahrt erhht27.
Die Vorteile der individuellen Freiheit gelten nicht nur fr den Bereich der Wirtschaft. Sie kommen auch in der Politik, der Wissenschaft und in anderen wichtigen
Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zum Tragen. So fhrt der Wettbewerb alternativer Meinungen und Konzepte in der Politik zur Entwicklung berlegener Lsungen politischer Probleme. In der Wissenschaft fhrt die Unabhngigkeit der Forschung und der Wettbewerb zwischen den Forschern zu einem
permanenten Strom neuer Erkenntnisse und zur raschen Verbreitung der bedeutendsten dieser neuen Erkenntnisse. Das Prinzip der Haftung hlt Politiker und
Wissenschaftler grundstzlich genauso zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit der ihnen eingerumten Freiheit an wie Unternehmer und Arbeitnehmer im Bereich der Wirtschaft.
26 Vgl. Friedrich A. von Hayek, Die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft (1945)
in: ders., Individualismus und wirtschaftliche Ordnung, 2. Aufl., Salzburg 1976, S. 103121.
27 Vgl. Wilhelm von Humboldt, Ideen zu einem Versuch, die Grnzen der Wirksamkeit
des Staats zu bestimmen (1851) in: ders., Werke in fnf Bnden, Bd. I: Schriften zur
Anthropologie und Geschichte, 3. Aufl., Stuttgart 1980, S. 64 f.; John Stuart Mill, aaO.
(FN 22), S. 97.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 70 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
70
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
Da kulturelle Evolution selbst in einem permanenten Wettbewerb unterschiedlicher Werte, Institutionen und Gruppen besteht, ist individuelle Freiheit vor allem
deshalb von entscheidendem evolutionren Vorteil, weil sie Starrheit gesellschaftlicher Strukturen vermeidet und statt dessen Anpassungsfhigkeit frdert. Smtliche
Gesellschaftsmitglieder werden angehalten, sich rasch an Datennderungen anzupassen und kontinuierlich nach neuen Problemlsungen zu suchen. Da dabei praktisch ihre gesamten Kenntnisse und Fertigkeiten genutzt werden und ein groes
Ma an Wohlstand erwirtschaftet wird, hat eine Gesellschaft, in der das Prinzip der
individuellen Freiheit umfassend verwirklicht ist, besonders gute Aussichten, im
Prozess der kulturellen Evolution zu bestehen und zu prosperieren. Ihre Gesellschaftsmitglieder treiben den Prozess der kulturellen Evolution sogar aktiv mit voran wenn auch meist unbewusst , indem sie neue Institutionen (etwa neue Rechtsnormen oder neue Formen der Unternehmensorganisation) entwickeln und
wettbewerblich testen.
Um die Vorteile der individuellen Freiheit im Prozess der kulturellen Evolution
mglichst gut zu nutzen, sollte sie umfassend verwirklicht werden. Sie sollte in
mglichst vielen Gesellschaftsbereichen angewandt werden (vor allem in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft) und so ausgestaltet sein, dass smtlichen Gesellschaftsmitgliedern ein mglichst groer Freiheitsspielraum belassen wird. Eine solche umfassende Verwirklichung individueller Freiheit bedeutet nicht, dass die
kulturellen Werte und Traditionen des jeweiligen Landes und die Prferenzen seiner
Brger unbercksichtigt bleiben mssen. Im Gegenteil: Erstens knnen je nach den
kulturellen Werten und Traditionen und der jeweiligen historischen Situation, in der
sich das betreffende Land befindet, verschiedenartige Manahmen zur Umsetzung
des Prinzips der individuellen Freiheit ergriffen werden. Zweitens und vor allem
aber belsst gerade die individuelle Freiheit den Menschen einen grtmglichen
Spielraum, ihre persnlichen Ziele zu verfolgen Ziele, die wiederum von den kulturellen Werten und Traditionen sowie von der Geschichte des jeweiligen Landes
geprgt sind. Individuelle Freiheit gewhrleistet einen hohen Zielerreichungsgrad;
worin die konkreten Ziele der Menschen aber bestehen (welche Gter sie beispielsweise zu konsumieren wnschen), knnen sie selbst bestimmen.
3.2. Herrschaft des Rechts
Die zweite Leitlinie besagt, dass nicht Menschen, sondern das Recht herrschen sollte. Die rechtlichen Regeln mssen dabei folgenden Anforderungen gengen28:
Allgemeinheit: Es muss sich um langfristige Regeln handeln, die sich auf eine
Vielzahl unbekannter Flle und Personen beziehen.
Abstraktheit: Die Regeln drfen nur festlegen, dass die Handlungen der Individuen unter bestimmten Umstnden bestimmte Bedingungen zu erfllen haben;
28 Vgl. Friedrich A. von Hayek, Die Verfassung der Freiheit, aaO. (FN 23), S. 178 ff., 268
ff.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 71 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
71
alle Arten des Handelns, die diese Bedingungen erfllen, mssen statthaft sein.
Die Regeln beinhalten keine konkreten Anordnungen und gelten unabhngig von
den jeweiligen Zielen der Menschen.
Gewiheit: Die Regeln mssen bekannt und gewi sein, um Rechtssicherheit zu
gewhrleisten. Sie drfen daher auch nie rckwirkend gelten.
Gleichheit: Die Regeln drfen nicht gezielt bestimmte Personen begnstigen
oder benachteiligen. Alle Personen mssen gleich behandelt werden. Die Regeln
mssen fr die Regierung ebenso gelten wie fr die Regierten.
Erfllen die Rechtsnormen diese Anforderungen, wird willkrlicher Zwangsausbung der jeweiligen Regierung vorgebeugt und dem einzelnen ein groer Spielraum erlaubter Handlungen gesichert29. Er kann seine eigenen Ziele verfolgen und
dabei seine individuellen Fertigkeiten und Kenntnisse nutzen. Die Regeln des
Rechts schaffen fr ihn Rechtssicherheit; der einzelne kennt seine Rechte und
Pflichten sowie die seiner Mitbrger, ebenso die Konsequenzen regelwidrigen Verhaltens. Zusammen mit seinen persnlichen Fertigkeiten und Kenntnissen kann er
die Rechtsnormen als Grundlage seiner Entscheidungen verwenden. Sie sagen ihm,
mit welchem Verhalten anderer er rechnen kann und erweitern dadurch den Bereich, in dem er die Folgen seines eigenen Handelns voraussehen kann. Die Regeln
des Rechts bilden eine verlssliche Grundlage, die es dem einzelnen ermglicht, seinen geschtzten Bereich zu bestimmen und das Verhalten seiner Mitbrger abzuschtzen. Sie erleichtern es den Menschen damit zu planen, zu kooperieren und ihre
Handlungen aufeinander abzustimmen30. Auf diese Weise ermglicht das Recht die
spontane Bildung und Aufrechterhaltung einer komplexen Ordnung menschlichen
Handelns, die Millionen von Menschen umfassen kann. Jeder einzelne hat in einer
solchen Ordnung die Mglichkeit, seine persnlichen Ziele zu verfolgen, und gute
Chancen, sie zu erreichen. Gleichzeitig gewhrleisten Rechtsnormen der genannten
Art, dass die Menschen bei der Verfolgung ihrer Interessen zur Bedrfnisbefriedigung anderer Menschen beitragen. Durch die Rechtsnormen wird das eigeninteressierte Handeln der Menschen so kanalisiert, dass es der Gesellschaft nicht schadet,
sondern nutzt. Der einzelne kann seine Ziele nmlich nur erreichen, indem er den
geschtzten Bereich der anderen Individuen respektiert und ihnen Gter zum
Tausch anbietet, die diese tatschlich nachfragen. In der durch die Herrschaft des
Rechts geschaffenen Handelnsordnung nutzen die Brger ihr persnliches Wissen
zum Wohle der gesamten Gesellschaft, Ressourcen werden effizient alloziiert, die
Plne und Handlungen der Menschen effizient koordiniert. Dadurch wird ein groer Wohlstand erwirtschaftet, der die Ernhrung einer groen, zunehmenden Zahl
von Menschen ermglicht.
29 Vgl. John Locke, Two Treatises of Government: In the Former, The False Principles and
Foundation of Sir Robert Filmer, And His Followers, are Detected and Overthrown.
The Latter is an Essay concerning The True Original, Extent, and End of Civil-Government (1690), 2. Aufl., Cambridge 1988, S. 373 ff.
30 Vgl. David Hume, A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the
Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects Vol. III: Of Morals aaO.
(FN 3), S. 293 ff.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 72 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
72
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
Die Herrschaft des Rechts erhht nicht nur den Wohlstand der betreffenden Gesellschaft, sondern hilft ihr auch, im Wettbewerbsprozess der kulturellen Evolution
zu bestehen. nderungen der Umfeldbedingungen betreffen oft nur Teile der Gesellschaft und werden anfangs nur wenigen Individuen bekannt. Fr die Prosperitt
der Gesellschaft und unter Umstnden sogar fr ihr berleben ist es aber von entscheidender Bedeutung, dass sich diese Individuen so rasch wie mglich unter Nutzung ihres speziellen Wissens an diese nderungen anpassen. Weil die Regeln des
Rechts allgemein, abstrakt, bekannt und gewi sind, knnen sich die Individuen mit
Hilfe dieser Regeln und unter Nutzung ihrer Kenntnisse der besonderen Umstnde von Ort und Zeit31 flexibel an die Vernderungen ihres jeweiligen Umfeldes anpassen; zugleich wird ihr Handeln durch die Regeln so kanalisiert, dass sie dies zum
Nutzen der gesamten Gesellschaft tun. Auf diese Weise werden exogene Strungen
rasch dezentral absorbiert.
Anpassungen an vernderte Umfeldbedingungen knnen nicht nur in Vernderungen individuellen Handelns und der gesellschaftlichen Handelnsordnung bestehen, sondern auch in der Erfindung neuer oder der Modifikation bestehender innerer Institutionen, etwa in der Entwicklung neuer oder der Modifikation
existierender Formen der Unternehmensorganisation32. Auch dadurch knnen
exogene nderungen absorbiert sowie der Wohlstand und das berleben der Gesellschaft gesichert werden. Allgemeine abstrakte Rechtsnormen erleichtern die
Evolution solcher innerer Institutionen und erhhen auf diese Weise die Anpassungsfhigkeit der Gesellschaft noch weiter.
Da sich die meisten Regeln des Rechts evolutionr entwickelt haben (selbst solche, die ursprnglich bewusst eingefhrt wurden), verkrpern sie Ergebnisse frherer Erfahrungen, die genutzt werden, solange die Menschen nach diesen Regeln
handeln. Dabei handelt es sich oft um heute nicht mehr bewusste Erfahrungen vieler Generationen. Die Nutzung des in solchen Rechtsnormen gespeicherten Wissens ist mglich, obwohl das Wissen von den Vorzgen, die eine bestimmte allgemeine Regel unter verschiedenen Umstnden hat, sehr beschrnkt ist, vor allem das
artikulierbare Wissen. Die Regeln stellen evolutionre Anpassungen der ganzen Gesellschaft an ihr Umfeld und an die Wesenszge ihrer Mitglieder dar. Im Laufe der
kulturellen Evolution evolutionr gewachsene allgemeine Rechtsnormen verkrpern Wissen ber die zweckmigste Regelung des Zusammenlebens, die sich im
Laufe der Zeit unter wechselnden Umstnden bewhrt hat. Sie sind wichtige Manifestationen der kulturellen Evolution und erleichtern diese, sofern sie die genannten
Bedingungen erfllen. Auch deswegen sind sie fr eine Gesellschaft notwendig und
hilfreich, um im Prozess der kulturellen Evolution zu bestehen.
Da das Wissen, das in einer Gesellschaft zur Aufrechterhaltung der komplexen,
anpassungsfhigen und wohlfahrtsschaffenden Handelnsordnung teils in berliefer31 Friedrich A. von Hayek, Die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft aaO. (FN
26), S. 107.
32 Vgl. Ludwig M. Lachmann, Wirtschaftsordnung und wirtschaftliche Institutionen in:
ORDO, Bd. 14 (1963), S. 63-77.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 73 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
73
ten Rechtsnormen gespeichert, teils auf die Gesellschaftsmitglieder verstreut ist,
und da das in berlieferten Rechtsnormen gespeicherte Wissen nur teilweise bekannt ist und da sich das auf die Gesellschaftsmitglieder verstreute Wissen nicht
zentralisieren lsst, knnen Anpassungen einer solchen Handelnsordnung und innerer Institutionen an vernderte Umstnde nicht zentral durch den Staat vorgenommen werden. Vielmehr mssen traditionelle Rechtsnormen grundstzlich respektiert werden, und das Handeln der Menschen darf nur durch allgemeine,
bekannte und gleichbehandelnde abstrakte Regeln beschrnkt werden. Nur so kann
sich eine ausgedehnte Gesellschaft effizient an Umstnde anpassen, die sich laufend
auf nicht prognostizierbare Weise ndern. Die Alternative bestnde in einer Abfolge diskretionrer Einzelentscheidungen und Einzeleingriffe des Staates in die spontane Handelnsordnung. Dadurch wrden jedoch die adaptiven, wohlfahrtssteigernden Wirkungen der Rechtsnormen nicht zur Entfaltung kommen knnen;
Handelnsordnung und Kulturevolution wrden erheblich gestrt.
Obwohl der Staat daher an die Herrschaft des Rechts gebunden sein sollte, stehen
ihm im Rahmen dieses Prinzips als Gesetzgeber und in der Rechtsprechung wichtige Regelungsbereiche offen, so etwa das Vertrags-, das Arbeits-, das Schadens- und
das Verwaltungsrecht33. Auch bestehen bei der Entwicklung konkreter Rechtsnormen nicht unbetrchtliche Gestaltungsspielrume. Die Anforderungen, die aus
Sicht der kulturellen Evolution an die rechtlichen Regeln gestellt werden mssen,
sind abstrakter Natur; sie knnen durch unterschiedlichste Regeln erfllt werden.
Der konkrete Inhalt der Regeln kann und sollte je nach kulturellen Traditionen und
Prferenzen der Menschen von Land zu Land variieren. Da daneben ein weiter
Spielraum der Individuen bei der Nutzung der Regeln als Instrumente zur Verfolgung ihrer unterschiedlichen individuellen Ziele besteht, ist mit der Herrschaft des
Rechts eine groe Bandbreite rechtlicher Regeln sowie persnlicher Ziele und
Handlungsformen vereinbar.
An den rechtlichen Normen sollte die Politik grundstzlich konsequent festhalten, weil die Menschen ihr Verhalten darauf einstellen und daher die Erhaltung und
Anpassungsfhigkeit der gesamten spontanen Handelnsordnung von der Verlsslichkeit und Konstanz der rechtlichen Rahmenbedingungen abhngt. Zurckhaltung bei der nderung von Rechtsnormen sollte auch gebt werden, weil diese darber hinaus mit den historisch gewachsenen, tief verwurzelten und sich nur langsam
wandelnden Moralvorstellungen der jeweiligen Gesellschaft in Einklang stehen
mssen. Gleichwohl sind Reformen des Rechts notwendig, wenn das herkmmliche Recht Mngel zeigt oder genderte Umfeldbedingungen Reformen erforderlich
machen. Da die spontane Ordnung jeder ausgedehnten Gesellschaft auf einer Tradition berlieferter rechtlicher und moralischer Normen beruht, deren Bedeutung die
Menschen nicht vollstndig verstehen knnen, muss man dabei aber auf dieser Tradition aufbauen. Neue und novellierte Rechtsnormen mssen mit den brigen Regeln konsistent und kompatibel sein; sie mssen einen wirkungsvollen Beitrag zur
33 hnlich Heiko Geue, Sind ordnungspolitische Reformanstrengungen mit Hayeks
Evolutionismus vereinbar? in: ORDO, Bd. 49 (1998), S. 156.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 74 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
74
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
Erhaltung und Anpassungsfhigkeit der Gesamtordnung der Handlungen leisten,
der alle anderen Regeln dienen34.
3.3. Subsidiaritt
Die dritte Leitlinie besagt, dass die Staatsttigkeit eng begrenzt und dezentral organisiert sein sollte. Folgende Funktionen des Staates sind dabei allerdings unerlsslich:
Der Staat muss die Freiheit seiner Brger anerkennen und schtzen etwa die
Meinungs-, Vertrags- und Gewerbefreiheit.
Der Staat muss das Eigentum seiner Brger anerkennen und schtzen. Er muss
Regeln festlegen, nach denen die Individuen Eigentum erwerben und bertragen
knnen. Und er muss gewhrleisten, dass die Brger ihre Eigentumsrechte wahrnehmen knnen.
Der Staat muss freiwillig geschlossene Vertrge durchsetzen vorausgesetzt natrlich, sie verstoen nicht gegen Recht oder Moral.
Diese und einige weitere Aufgaben hat der Staat in erster Linie mit Hilfe des
Rechts zu erfllen. Die rechtlichen Regeln sollten so gestaltet sein, dass sie den Gesellschaftsmitgliedern die bestmglichen Bedingungen bieten, ihre eigenen Ziele zu
erreichen. Zu diesem Zweck mssen sie auch den in Abschnitt 3.2. genannten Anforderungen gengen. Vor allem staatliche Zwangsmanahmen mssen mit der
Herrschaft des Rechts vereinbar sein. Solche Manahmen sind auf die Durchsetzung allgemeiner, abstrakter, bekannter und gleichbehandelnder Rechtsnormen zu
beschrnken. Prinzipiell unstatthaft dagegen mssen Manahmen sein, mit denen
der Staat unter Verwendung seiner Zwangsgewalt gezielt bestimmte Individuen
oder Gruppen benachteiligt oder begnstigt, etwa durch Handelsbeschrnkungen
oder Privilegien. Unstatthaft mssen auch Rechtsnormen sein, die zwar allgemein,
abstrakt, bekannt und gleichbehandelnd sind, aber trotzdem die Freiheits- oder Eigentumsrechte der Brger stark beschneiden etwa Steuergesetze, die die Eigentumsrechte der Brger durch eine hohe Steuerbelastung aushhlen.
Neben der Durchsetzung allgemeiner freiheitssichernder Rechtsnormen sollte
der Staat noch fr die Bereitstellung bestimmter essentieller Gter Sorge tragen, die
von Privatunternehmen nicht auf eigene Initiative angeboten werden zumeist,
weil es sich dabei um ffentliche Gter handelt, bei denen es entweder unmglich
oder zu schwierig ist, den einzelnen Nutznieer dafr zahlen zu lassen. Die staatliche Bereitstellung solcher Gter sollte jedoch abgesehen von der zu ihrer Finanzierung erforderlichen Steuererhebung keinen Zwangscharakter besitzen. Vor allem sollte dem Staat kein Monopol eingerumt werden; Privatunternehmen sollten
stets die Mglichkeit besitzen, diese Gter ebenfalls anzubieten. Generell sollte der
34 Vgl. Friedrich A. von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung
der liberalen Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen konomie, Bd. II: Die
Illusion der sozialen Gerechtigkeit, aaO. (FN 3), S. 41 ff.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 75 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
75
Staat bei der Bereitstellung dieser Gter, wie auch sonst, den selben Rechtsnormen
unterworfen sein wie die privaten Wirtschaftssubjekte. Darber hinaus sollten die
staatlichen Gter der Ausbung der individuellen Freiheitsrechte der Brger frderlich sein; sie sollten einen gnstigen Rahmen fr individuelle Dispositionen
schaffen. Bevor der Staat ein Gut bereitstellt, sollte zudem sichergestellt sein, dass
dessen Nutzen die mit ihm verbundenen Kosten deutlich berwiegt. Dabei ist zu
bercksichtigen, dass Behrden und Staatsunternehmen, die blicherweise keinem
Konkursrisiko ausgesetzt sind, zu einer ineffizienten Wirtschaftsweise tendieren.
Daher sollte der Staat die entsprechenden Gter mglichst nicht selbst produzieren,
sondern mit Hilfe wettbewerblicher Verfahren (wie etwa Ausschreibungen oder
Auktionen) Privatunternehmen auswhlen, die dies im staatlichen Auftrag mglichst kostengnstig bernehmen. Und schlielich sollten sich die staatlichen Aktivitten auf eine geringe Zahl von Gtern beschrnken, um den staatlichen Machtbereich nicht ber das Notwendigste auszudehnen. Beispiele fr Gter, die der Staat
bereitstellen sollte, sind Infrastruktur, Bildung, soziale Sicherung und stabiles Geld.
Um die Staatsttigkeit wirksam zu begrenzen, sollten entsprechende Vorschriften
in die Verfassung aufgenommen werden. Solche konstitutionellen Normen knnen
(a) die Art der Aufgaben, die der Staat erfllen soll, bzw. die Art der Gter, die er
bereitstellen soll, beschrnken und/oder (b) den Umfang staatlicher Einnahmen
oder Ausgaben quantitativ begrenzen (etwa in Form von Obergrenzen in Prozent
des Bruttoinlandsprodukts)35.
Der Staat sollte also eine subsidire Rolle spielen: Nur dort, wo die Mglichkeiten des einzelnen bzw. einer kleinen Gruppe (z.B. der Familie) nicht ausreichen,
eine essentielle Aufgabe zu lsen, sollten staatliche Institutionen eingreifen. Dabei
ist Hilfe zur Selbsthilfe Vorrang vor einer unmittelbaren Aufgabenbernahme
durch den Staat zu geben. Das Subsidiarittsprinzip ist auch auf die Aufgabenverteilung innerhalb des Staatssektors anzuwenden: Muss eine Aufgabe vom Staat bernommen werden, ist die Verantwortung fr die Aufgabenerfllung der kleinsten dafr geeigneten Einheit zu bertragen (etwa der Gemeinde).
Durch die enge Begrenzung und dezentrale Organisation der Staatsttigkeit sollte
nicht zuletzt auch ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Institutionen ermglicht werden. Durch den groen Freiraum fr private Akteure sollten diese beispielsweise die Mglichkeit haben, unterschiedlichste Formen der Unternehmensorganisation oder verschiedene Vertragsformen zu entwickeln und wettbewerblich
35 Notwendigkeit und Mglichkeiten einer konstitutionellen Begrenzung der Staatsttigkeit werden in jngerer Zeit vor allem im Rahmen der Verfassungskonomik analysiert.
Ein berblick und eine kritische Wrdigung dieses Ansatzes findet sich bei Horst Feldmann, Ordnungstheoretische Aspekte der Institutionenkonomik, aaO. (FN 11), S. 80
ff., 230 ff. Der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes hat darber hinaus sowohl einen
konkreten Vorschlag zur konstitutionellen Begrenzung der Steuerbelastung als auch zur
Begrenzung der staatlichen Schuldenaufnahme unterbreitet. Vgl. Horst Feldmann,
Konstitutionelle Begrenzung der Steuerbelastung in: Steuer und Wirtschaft, 75. Jg.
(1998), Nr. 2, S. 114-123; ders., Warum der Stabilittspakt reformiert werden mu in:
Jahrbuch fr Wirtschaftswissenschaften, Bd. 51 (2000), Nr. 3, S. 197-221.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 76 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
76
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
auf ihre Eignung zu testen. Durch die dezentrale Organisation des Staates sollten
die Staatsorgane (z.B. die Gemeinden) in einem Wettbewerb untereinander stehen.
Aus welchen Grnden ist es erforderlich, die Staatsttigkeit auf die genannten
Funktionen zu konzentrieren und darber hinaus eng zu begrenzen? Durch die Sicherung der Freiheit und des Eigentums der Brger und die Durchsetzung freiwilliger Vertrge mit Hilfe allgemeiner Rechtsnormen wird nicht nur das verstreute Wissen der Individuen so genutzt, dass sich die gesellschaftliche Handelnsordnung
flexibel und kostengnstig an die sich laufend ndernden ueren Umstnde anpasst; darber hinaus werden auch Konflikte zwischen Individuen von vornherein
vermieden oder zu geringen gesellschaftlichen Kosten beigelegt. Zudem haben die
Individuen die Mglichkeit und den Anreiz, stndig neue Gter, Produktionsverfahren, Institutionen usw. zu entwickeln. Wegen der engen Begrenzung der Staatsttigkeit kann die Regierung bzw. die herrschende Mehrheit solche neuen Ideen und
Gebruche nicht unterdrcken. Dies ist deshalb wichtig, weil neue Gter, Produktionsverfahren, Institutionen etc. stets dadurch eingefhrt werden, dass zunchst nur
eine kleine Minderheit von den Gebruchen der Mehrheit abzuweichen beginnt
und zwar oftmals gegen deren Widerstand. Erst wenn sich die Neuerungen dem Alten als berlegen erweisen, wird auch die Mehrheit zu deren bernahme bewegt36.
Durch die Begrenzung der Staatsttigkeit kommt es somit zu mehr Neuerungen,
mit denen die Gesellschaft ihren Wohlstand erhhen und sich besser an genderte
uere Umstnde anpassen kann. Verfgt der Staat dagegen ber eine groe Machtflle, werden die Brger durch zahlreiche Vorschriften gegngelt und wird ein
Groteil ihres Einkommens durch hohe Steuern konfisziert, haben sie kaum die
Mglichkeit und den Anreiz, sich an genderte Umstnde unter Nutzung ihres jeweiligen Wissens anzupassen, etwa indem sie neue Institutionen entwickeln, die
diesen genderten Umstnden besser Rechnung tragen. Damit verliert die Gesellschaft insgesamt an Funktions- und Anpassungsfhigkeit; sie wird anfllig fr exogene Schocks oder eine allmhliche Erosion ihrer Wettbewerbsposition im Prozess
der kulturellen Evolution. Dabei verringert sich auch ihr Wohlstand oder zumindest
dessen Zuwachsrate.
Schdlich sind darber hinaus Manahmen, mit denen der Staat unter Verwendung seiner Zwangsgewalt gezielt bestimmte Individuen oder Gruppen benachteiligt oder begnstigt. Solche Interventionen widersprechen nicht nur der Herrschaft
des Rechts; vor allem be- oder verhindern sie die wechselseitige Anpassung der Individuen, auf der die spontane Handelnsordnung und die Evolution der gesellschaftlichen Institutionen beruhen: Diejenigen, die staatlichen Zwangsmanahmen ausgesetzt sind, werden daran gehindert, ihre eigenen Ziele zu verfolgen und dabei die
ihnen bekannten Umstnde zu nutzen. Diejenigen, die in den Genuss staatlicher
Vergnstigungen gelangen, werden einseitig von der Notwendigkeit befreit, sich den
Umstnden anzupassen, denen sie ohne Intervention ausgesetzt wren. Durch solche Interventionen kann daher die Anpassungsfhigkeit, die Evolution und damit
eventuell sogar der Bestand der jeweiligen Gesellschaftsordnung gefhrdet werden.
36 Vgl. Ludwig Mises, Liberalismus, Jena 1927, S. 48.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 77 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
77
Obwohl der Umfang der Staatsttigkeit aus den genannten Grnden grundstzlich eng begrenzt sein sollte, ist es wichtig, dass der Staat gleichwohl fr die Bereitstellung bestimmter essentieller, insbesondere ffentlicher Gter Sorge trgt, die
von Privatunternehmen auf eigene Initiative nicht angeboten werden. Solche Gter
knnen fr die internationale Wettbewerbsfhigkeit einer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sein. Zu denken ist hierbei etwa an eine Infrastruktur und ein
Bildungssystem, die der Produktivitt der Wirtschaft frderlich sind37. Aber auch
ein fundamentales Gut wie stabiles Geld ist von eminenter Bedeutung; es sichert
nominal fixierte Eigentumsrechte und stellt sicher, dass das System flexibler Marktpreise seine Signal- und Lenkungsfunktion erfllen kann. Dies ist nicht nur der Effizienz und dem Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft zutrglich, vor allem erhht
es ihre Anpassungsfhigkeit, weil die durch Preisnderungen bermittelten Informationen die Wirtschaftssubjekte zu einer den neuen Umstnden angemessenen
Reaktion veranlassen38.
Durch eine konsequente Verwirklichung des Subsidiarittsprinzips und einen intensiven institutionellen Wettbewerb wird laufend dezentral eine Vielzahl von Problemlsungen generiert, getestet und miteinander verglichen. Ungeeignete Manahmen und Institutionen knnen frhzeitig ausgesondert werden; sie verursachen
dadurch nur geringe gesellschaftliche Kosten. Diejenigen Problemlsungen, die sich
als berlegen erweisen, knnen wiederum allgemein bernommen werden; sie breiten sich in der Gesellschaft aus. Dieser Prozess des Experimentierens, der permanenten Hervorbringung einer Vielzahl insbesondere institutioneller Alternativen,
ihrer Selektion im Wettbewerb und der Verbreitung der am besten geeigneten ist fr
die Anpassungsfhigkeit einer Gesellschaft im Prozess der kulturellen Evolution
vor allem deshalb bedeutsam, weil es bei der bewussten Gestaltung, aber auch bei
der ungeplanten Evolution von Institutionen immer wieder zu Fehlentwicklungen
kommen kann. So knnen sich planmig entworfene Institutionen in der Praxis als
untauglich erweisen. Auch kann sich die institutionelle Evolution in einzelnen Bereichen ungeplant in eine Richtung entwickeln, die sich erst nach einer gewissen
Zeit als falsch herausstellt. Zudem knnen Evolutionshemmnisse auftreten. Je intensiver jedoch der institutionelle Wettbewerb, desto mehr institutionelle Alternativen werden generiert, desto strker ist der Selektionsdruck und desto grer ist damit die Wahrscheinlichkeit, dass ineffiziente Institutionen frhzeitig entdeckt und
ausgesondert sowie Evolutionssackgassen verlassen bzw. Evolutionshemmnisse
berwunden werden. Voraussetzung fr die Funktionsfhigkeit des institutionellen
37 Vgl. Horst Siebert, Zum Paradigma des Standortwettbewerbs, Tbingen 2000.
38 Der Autor des vorliegenden Aufsatzes hat ein Entlohnungssystem fr die Mitglieder
des Rates der Europischen Zentralbank entwickelt, das diese wirksam und nachhaltig
zu einer strikt stabilittsorientierten Geldpolitik anhalten knnte. Ein solches System
ist vor allem deswegen notwendig, weil in vielen Mitgliedslndern der Europischen
Whrungsunion noch nicht die gleiche Stabilittskultur existiert wie in Deutschland.
Vgl. Horst Feldmann, Stabilittsanreize fr Europas Zentralbanker in: Wirtschaftsdienst, 78. Jg. (1998), Nr. 2, S. 121-128.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 78 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
78
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
Wettbewerbs ist freilich eine Gesellschaft, die nach auen und innen stets offen
bleibt fr Neuerungen.
Die Umsetzung des Subsidiarittsprinzips kann nicht auf beliebige Weise erfolgen. Sie hat sich in erster Linie an den Erfordernissen der kulturellen Evolution auszurichten. Daher muss es mglichst konsequent umgesetzt werden. Beispielsweise
muss der Umfang der Staatsttigkeit durch geeignete Verfassungsvorschriften wirksam beschrnkt werden; der institutionelle Wettbewerb muss nicht nur zugelassen,
seine Ergebnisse drfen auch nicht durch andere Manahmen der Politik konterkariert werden. Soweit freilich den Anforderungen der kulturellen Evolution Genge
getan ist, besteht ein nicht unerheblicher Gestaltungsspielraum. Er kann in einer
Weise genutzt werden, die den Prferenzen der Gesellschaftsmitglieder entspricht.
Welche ffentlichen Gter beispielsweise in welcher Qualitt und Quantitt bereitgestellt, von wem sie produziert und wie sie finanziert werden, kann, soweit den Erfordernissen der kulturellen Evolution Rechnung getragen wird, nach den Prferenzen der Gesellschaftsmitglieder entschieden werden.
4. Fazit
Obwohl der demokratische Wettbewerb alternativer politischer Konzepte, wie ausgefhrt, ein wichtiges Mittel darstellt, mit dessen Hilfe eine Gesellschaft im Prozess
der kulturellen Evolution bestehen kann, unterscheiden sich die politischen Implikationen der kulturellen Evolution in einer Hinsicht fundamental von der Rolle, die
die Politik nach heute herrschender Meinung in der Demokratie spielen sollte. Es
gilt heute als selbstverstndlich, dass die Politik ausschlielich den jeweiligen Willen
des Volkes umzusetzen hat; die Prferenzen der Brger sollen in der Politik mglichst gut zum Ausdruck kommen39. Aus Sicht der kulturellen Evolution muss das
primre, bergeordnete Ziel der Politik jedoch die berlebensfhigkeit der jeweiligen Gesellschaft sein, fr die die Politik Verantwortung trgt, nicht der jeweilige
Wille des Volkes40. Zwar entsprechen die Wnsche der Menschen vielfach dem, was
die kulturelle Evolution erfordert; dies ist aber durchaus nicht immer der Fall. So
werden zur Verwirklichung der Idee der sozialen Gerechtigkeit und zur Befriedigung der Wnsche einflussreicher Interessengruppen heute vielfach politische Manahmen gefordert und durchgefhrt, die mit den Anforderungen, die die kulturelle
Evolution mit sich bringt, unvereinbar sind. Wenn eine Gesellschaft jedoch diesen
Anforderungen nicht entspricht, luft sie Gefahr, ihren Wohlstand einzuben und
im Extremfall sogar unterzugehen. Angesichts der entscheidenden Rolle, die die ge39 Siehe etwa Arno Waschkuhn, Demokratietheorien. Politiktheoretische und ideengeschichtliche Grundzge, Mnchen 1997.
40 Dies bedeutet selbstverstndlich nicht, dass hiermit irgendeiner Form autoritrer oder
totalitrer politischer Herrschaft das Wort geredet wird. Eine solche Form politischer
Herrschaft stnde im Gegensatz zu den im vorliegenden Aufsatz entwickelten Leitlinien. Statt dessen empfiehlt sich eine geeignete verfassungsmige Verankerung dieser
Leitlinien.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 79 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Horst Feldmann Politische Implikationen der kulturellen Evolution
79
nannten Institutionen beim Aufstieg der westlichen Welt gespielt haben, und des
starken Selektionsdrucks, den die kulturelle Evolution heute ausbt, sollten die hier
entwickelten Leitlinien konsequent verwirklicht werden selbst wenn dies manchen unmittelbaren Wnschen der Menschen widerspricht. Nur insoweit den Anforderungen der kulturellen Evolution Genge getan wird, besteht Spielraum, die
Wnsche der Brger zu befriedigen.
Zusammenfassung
Im Laufe der kulturellen Evolution haben sich in der westlichen Welt Institutionen
entwickelt und durchgesetzt, die zu einer frher unbekannten Zunahme des Wohlstands und der Bevlkerung gefhrt haben. Im vorliegenden Aufsatz werden zunchst die Charakteristika und die Bedeutung der kulturellen Evolution herausgearbeitet. Anschlieend werden der Spielraum und die Rolle der Politik in der
kulturellen Evolution grundstzlich beleuchtet sowie einige in diesem Zusammenhang weit verbreitete Irrtmer ausgerumt. Im letzten Schritt schlielich werden
aus den Charakteristika der kulturellen Evolution drei konkrete Leitlinien abgeleitet, die die Politik beachten sollte: Erstens sollte das Prinzip der individuellen Freiheit umfassend verwirklicht sein. Zweitens sollte die Herrschaft des Rechts gewhrleistet sein. Drittens sollte die Staatsttigkeit eng begrenzt und dezentral organisiert
sein. Wie im vorliegenden Aufsatz gezeigt wird, sind die Chancen einer Gesellschaft, im Wettbewerbsprozess der kulturellen Evolution zu bestehen und zu prosperieren, um so grer, je konsequenter diese Leitlinien befolgt werden.
Summary
In the course of cultural evolution, certain institutions have emerged and become
dominant in the Western world that have led to an unprecedented rise in prosperity
and population. This paper first explains the characteristics and significance of cultural evolution. Subsequently, it explains the fundamental role of politics and the
scope for political action in cultural evolution, clearing up some fairly wide-spread
misconceptions about this question. Finally, it derives three specific guidelines from
the characteristics of cultural evolution that should be followed in politics. First, the
principle of individual freedom should be realized as far as possible. Second, the rule
of law should be secured. Third, the scope of action of the state should be closely limited and the state should be decentrally organized. The more consistently these
guidelines are followed, the better the prospects of the respective society to survive
and prosper in the competitive process of cultural evolution.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 80 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen
Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
Allah wept when he created the Sudan.1
Sudan entered the twenty-first century mired in not one but many civil wars,
rightly noted one scholar, who had held a first-hand research on the state and its society.2 Indeed, what had been seen in the mid-1950s and with increased vigor during
the 1960s-1980s as a war between Sudans two starkly-different human blocs the
Arab Muslim majority living in the north of the country, and the African, Christian
and animist minority concentrated in the south has largely expanded beyond these
geopolitical, ethnic and religious bounds throughout the 1990s and early 2000s.
In fact, the longer the war has lasted, the greater it expanded both in scope and essence, assuming the pattern of interlocking civil wars while engulfing major areas of
the vast Sudanese landscape. Moreover, the more the war extended the deeper it has
encroached beyond the countrys borders, being transformed from an intrastate dispute to an interstate one and vice versa. This, in turn, has enormously strengthened
the pressure and threat upon Sudans territorial integrity, political and economic stability, human well-being and foreign relations, and, in fact, upon every facet of the
states life, dragging it into a frightful maelstrom of havoc.
It was of no surprise, therefore, that the northern society and the southern society, which for methodological convenience alone and notwithstanding the broadly
complex potential for inaccuracy, will henceforth be referred to as north and
south, breathed a particularly deep sigh of relief at the signing of the set of interim
peace agreements in mid-2004. These projected hope for an imminent end to the
protracted armed conflict. Yet, and not accidentally, just as the south-north conflict
has been paving its tormenting way to resolution, or at least toward a considerable
lull in the fighting, another war has been vigorously ravaging the western region of
Dafur, dizzying the state and its people in a new cycle of chaos and human tragedy.
Concurrently, other grievances, in the Nuba Mountains, the Blue Nile and the Red
Sea area, have continued to simmer, fueling the fire of belligerence across the vast
Sudanese territory.
One of Sudans political figures had once figuratively compared the war-torn state to a powerful eagle, yet suffering a broken wing, pointing out that without he-
1 An Arab proverb, quoted by Edgar OBallance, The Secret War in the Sudan: 19551972, Hamden, Connecticut: Archon Books, 1977, p. 32.
2 Douglas H. Johnson, The Root Causes of Sudans Civil Wars, Bloomington: Indiana
University Press, 2003, preface, p. xiii.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 81 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
81
aling its wound the eagle will never fly again, in which case its fate will be doomed.3
The still dangerously persevering north-south conflict, although largely muffled in
summer 2004, joined by all other local violent inflammabilities, have considerably
increased the concern for the eagles life.
This article focuses on Sudans dominant north-south armed conflict, surveying
its full continuum in the years 1955-2004. The study focuses its analysis on the role
and impact of religion in shaping the conflicts course and effects during both times
of war and of peace. More explicitly, the article examines to what extent this conflict
has been religious in its character, or rather, whether religion was merely one of the
factors, albeit a powerful one, in fueling the flames of war. While discussing this
challenging topic, particularly as interfaith tensions have always been tightly and almost inseparably interwoven into the most intricate Sudanese fabric of life, the paper also sheds light on, and maps relevant pre-independence historical junctions, as
well as central political, economic and foreign policy crossroads of Sudan during the
era of independence.
Background to the Conflict: The Fertile Soil for Sprouting Violence
The origins of Sudans civil war are deeply rooted in the 19th century. At the beginning
of the 1820s, the army of Muhammad Ali, the Ottoman-Egyptian Viceroy, occupied
the Arab-Muslim northern region of what later became known as the Sudan. Penetrating the south of this area, his forces enslaved many of its African animist peoples,
dwindled their economic resources and drained their means of subsistence. Muhammad Ali was assisted in these incursions by armed Arab Muslims from northern
Sudan, who cruelly suppressed the southerners and were, therefore, positioned in their
collective consciousness as responsible for their calamity. This was the first large-scale,
bitter encounter between people from the Muslim Arab north and the non-Muslim
and non-Arab south of Sudan, setting up the foundations for further enmity.4
The last two decades of the 19th century brought about the Mahdi pronounced Islamic uprising, which established the Mahdist state in the Sudan. The Mahdists
acted militantly to Islamize the people in the Sudanese realm and thus further sharpened the souths animosity toward the Arab Muslim north.5
3 Africa Contemporary Record 1977-1978, New York: Africana Publishing Corporation,
1979, Vol. X, p. B121, quoting Buth Diu, one of the veteran Southern politicians.
4 For the Ottoman-Egyptian period in the Sudan, see e.g., Richard Gray, A History of the
Southern Sudan, London: Oxford University Press, 1961; Abd al-Rahman Al-Rafi,
Misr wal-Sudan, Al-Qahira: Dar al-Qawmiyya Liltabaa wal-Nashr, 1966; Hasan
Ahmed Ibrahim, The Resistance of Southern Sudanese People During the first Imperialist Era, The Role of Southern Sudanese People in the Building of Modern Sudan, Juba
[Southern Sudan]: University of Juba 1986.
5 For the Mahdist period, see e.g., Robert Collins, The Southern Sudan, 1883-1898, New
Haven and London: Yale University Press, 1962; P. M. Holt, The Mahdist State in the
Sudan, 1881-1898, Oxford: Clarendon Press, 1970; and Dunstan M. Wai, The AfricanArab Conflict in the Sudan, New York: Americana Publishing Company, 1981.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 82 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
82
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
The liquidation of the Mahdist rule in 1898 following aggressive British-Egyptian
military pressures was immediately followed by the latters condominium rule over
Sudan (with Egypt being merely a formal partner). It was throughout this colonial
period that Christianity and the English language were increasingly spread across
the African animist south of Sudan, projecting, thereby, new significant variances
and potential rancor between the two regions societies.
Moreover, considering the whole of Sudan as highly important for their strategic
and political interests, primarily for maintaining the control of the Nile Basin and
the Suez Canal in neighboring Britain-controlled Egypt, the colonial British rule
treated the northern and the southern societies differently, thereby further widening
the gaps between them. The colonial rule even implied an effective separation policy
between the south and the north. It was only in the late 1940s that Britain canceled
this policy and referred to Sudan as a single territorial and administrative entity, yet
without actually incorporating the south in the unification process, nor in Sudans
political, administrative and economic advance towards independence. In stark contrast, however, the colonial rule closely collaborated with the Arab-Muslim elite in
the north, training it to assume the reins of leadership in the post-colonial period.6
This British attitude, actively fostered by the majority Arab Muslim elite in
Khartoum, was perceived by the minority society in the south as deliberate discrimination, suiting the norths self-imposed politico-religious and economic dominance over the Sudanese national identity.7
Also significant in inflaming north-south tensions was the arbitrary demarcation
of Sudans international boundaries by the colonial rule in complete disregard of local religious and ethnic affiliations and thus incorporating largely diversified ethnic
and religious populations within one Sudanese territory. Being located thus at the
crossroads of the Arab Middle East and sub-Saharan Africa, Sudan has constituted a
microcosm of both the Arab world and the African continent in terms of religions,
races, cultures, languages, as well as other basic characteristics.
Given all these historic circumstances and pluralistically diverse geographic and
human features, the Sudanese experience can clearly be defined as one of fluidity of
identity8 and of multiple marginality, being on the fringe of many cultural and
political zones, but central to none.9
6 For the British rule, the south and the north-south relations on the eve of independence,
see e.g., Muddathir Abdel Rahim, Imperialism & Nationalism in the Sudan, Khartoum:
Khartoum University Press, 1969; Oliver Albino, The Sudan: A Southern Viewpoint, London: Oxford University Press, 1970; Robert O. Collins, Land Beyond the Rivers, New
Haven and London: Yale University Press, 1971; Francis M. Deng and Robert O. Collins,
The British in the Sudan, 1898-1956, Stanford, Ca: Hoover Institution Press, 1984.
7 Bona Malwal, People & Power in Sudan, London: Ithaca Press, 1981; Joseph Lagu, The
Anya-Nya Struggle: Background and Objectives, January 1972.
8 John Obert Voll and Sarah Potts Voll, The Sudan Unity and Diversity in a Multicultural
State, Boulder, Co: Westview, 1985, p. 7.
9 Ali A. Mazrui, The Multiple Marginality of the Sudan, Sudan in Africa, Yusuf Fadl
Hasan ed., Khartoum: Khartoum University Press, 1971, pp. 2, 240-255.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 83 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
83
Against this backdrop it is no wonder that the conditions in Sudan have been a
fertile soil for the sprouting of the seeds of discord. On August 18th 1955, just on the
verge of independence and largely because of that specific timing, the souths political and economic grievances and even fears of the norths taking control over it, manifested themselves in an armed mutiny of southern soldiers serving in the Britishestablished Equatoria Corps. The intention to station them in the north, concurrent
with an intention to position northern troops at strategic points in the south, nourished by a cumulatively strong distress in other aspects and reinforced by an industry of hostile rumours, ignited the rebelliousness. Although the uprising was
promptly suppressed by the British, a hard core of southern troops escaped to reorganize later as a guerrilla army, calling itself Anya-Nya, literally meaning a snake
venom.10 From that juncture of affairs onwards, the southern rebels became the states nightmarish slant serpent, stinging the north and poisoning it, while paradoxically intoxicating itself as well.
The Role of Religion in the First Round of War: 1955-72
Perceiving itself as the sole legitimate ruler of the state since independence on January 1st 1956, the Arab-Muslim leadership in the north hegemonously engaged itself
in shaping Sudans political, religious and cultural identity in accordance with its
own image, ignoring the souths different, and sometimes contradicting, interests
and sensitivities. Moreover, the northern ruling elite increasingly imposed Arabization and Islamization on the south, striving to achieve national unity through uniformity. This determination was flagrantly illustrated among others at that stage by
the call of the Grand Qadi of Sudan, Hasan Muddathir, for the immediate adoption
of an Islamic constitution.11
Clearly, this monocentricly patronizing approach, which certainly included other
essential ingredients than religions, further inflamed the enmity of the large minority society in the south, numbering in early 1956 c. 3 million out of the total Sudanese population of c. 10 million and inhabiting a third of the 2.5 million square kilometers of the Sudanese territory.12
10 For details on the rebelliousness, the subsequent rise of southern nationalism and the
crystallization of the southern Anya-Nya guerilla army, see e.g., Report of the Commission of Inquiry into the Disturbances in the Southern Sudan, 1955, McCorquedale and
Co. (Sudan, 1956), an official British document; OBallance, pp. 32-67; K.D.D. Henderson, Sudan Republic, London: Ernest Benn, 1965, pp. 172-77; Elias Nyamlell Wakoson,
The Origin and Development on the Anya-Nya Movement, 1955-1972, Southern
Sudan: Regionalism & Religion, Mohamed Omer Beshir ed., Khartoum: University of
Khartoum, Graduate Colleague Publications, 1984, pp. 127-204.
11 Francis Mading Deng, War of Visions for the Nation, Sudan: State and Society in Crisis, John O. Voll, ed., Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1991, p.
25, and note no. 1, p. 39.
12 Albino, pp. 3-4 and M.O. Beshir, The Southern Sudan Background to Conflict, Khartoum: Khartoum University Press, 1970, p. 5. By the end of 2002, the IMF reckoned
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 84 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
84
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
During the 1960s, fighting between north and south deteriorated to a full-blown
civil war. The Government in the north, however, systematically belittled the severity of the war.13 Having turned a deaf ear to the souths growing belligerence, nourished by its demand to change the states agenda on a wide-range of issues, one of
them being the states recognition of the different ethnic-religious character of the
south, clearly mirrored the norths egocentricity, as well as self-confidence in crushing the rebelliousness. This, in turn, further reinforced the souths fighting spirit.
Meanwhile, as the war escalated, both conflicting sides increased their political and
military reliance upon foreign props, thus spilling the conflict over the national
boundaries to both the regional and international vicinities.
Concurrently at that juncture of bitter fighting routine at the turn of the 1960s1970s, Sudans domestic, regional and international arenas underwent coincidingly
dramatic substantial changes, which drastically affected the conflicts course.14 Topping these changes was the ascent to power in Sudan of Jafar Muhammad al-Numayri in a military coup on May 25th 1969. In contrast to previous Sudanese governments, the Numayri military regime appeared determined from its very inception to
bring about a political resolution to the armed dispute.
Most significant regionally, in neighboring Uganda Idi Amin Dada took power in
January 1971. Due to his dramatic ideological and political rapprochement towards
the Arab world, including the Sudanese Arab government (mainly under the pressure of Libya), he closed the Ugandan major route of foreign military supplies to
the fighting south, thus seriously eroding its military might.
Internationally, Numayris desertion of Sudans pro-Soviet orientation in favor of
the West in the wake of the Moscow-backed failed attempt to topple his regime on
July 19th 1971, also helped to reinforce the prospects for ending the war. From that
juncture onwards, maintaining Numayri in power became a vital interest of the
West, supporting him politically and financially, while goading him to reach a resolution to the armed conflict.
Also of great importance was the maturation of awareness of both Sudanese warring parties and particularly significant of the much more powerful north,15 of their inability to win on the battlefield and of their unwillingness to keep paying the terribly
high prices of bloodshed and devastation. Seemingly, both sides reached the stage of
conflict resolution, referred to by various scholars as the stage of conflict ripeness.16
13
14
15
16
that the Sudanese population had reached 32.9 m., about 60% Muslims. See Sudan:
Country Profile, London: The Economic Intelligence Unit, 2004, pp. 27-28. One should
bear in mind that holding a comprehensively reliable census throughout the war-torn
Sudanese territory in the early 2000s was a nearly impossible mission.
Prime Minister Ahmed Mahgoub, quoted in OBallance, p. 79.
For aspects related to Sudans war and its regional and international extensions, see e.g.,
Peter Anyang Nyongo, Crises and Conflict in the Upper Nile Valley, and Stephen
John Steadman, Conflict and Conflict Resolution in Africa: A Conceptual Framework, Conflict Resolution in Africa, Francis M. Deng, I. William Zartman eds., Washington D.C.: The Brookings Institution, 1991, pp. 95-114, and pp. 377-83.
OBallance, p. 115, quoting President Numayris statement from 1 August 1969.
E.g., Richard N. Haas, Ripeness and Settlement of International Disputes, Survival,
Vol. 30, No. 3, 1988, pp. 232-51.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 85 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
85
Religion at Peace Time: 1972-83
On February 27th 1972, after a period of short, yet intensive, mediation, mainly brokered by external actors led by US-backed Ethiopia and the World Council of
Churches, the conflicting sides reached a compromise embodied in the Addis Ababa Peace Agreement. This endowed the south with a Regional Self-Government
within a unified state, while perpetuating the Norths dominant control over the states foci of power and national resources.17
Among others, the Peace Agreement formally anchored the souths religious freedom, while stipulating that every person should enjoy freedom of religion ... and the
right to profess it publicly and privately.18 In fact, it was the first time since the inception of the dominantly-Islamic Sudanese state that Islam, Christianity and African traditional religions were acknowledged, at least formally, as being of equal legitimacy.
Considerably relieved, the south perceived this settlement of religious freedom as
predicting good chances of success for other fields of coexistence, most essentially the
political and economic spheres. Interestingly, the religious issue, which was not dominant on the north-south agenda during the war, assumed at the just-born, fragile peace
phase, a much more prominent role in shaping the post-war relations, serving mainly
for the south as a litmus test for examining the confidence-building process. Moreover, for the ethnically, culturally and politically segmented southern society, its nonMuslim characteristic became a major source of identification and cohesion.
Not surprising against this background, growing inter-religious suspicion over the
role of religion in the states life remarkably raised between north and south in mid1973. Most apprehensive in the souths eyes was the demand of militantly Islamic circles in Khartoums government, which have always been considered by the south as
explicit religious-political strongholds of the Arab Muslim north, that Islam be the
official religion of Sudan, including the south. This demand, undermining the principle of religious freedom as guaranteed by the Peace Agreement, was considered in
the south as a strong blow to its religious status and as a bad omen for its relations
with the north in other areas of common interest. The souths alarm increased not
only because the issue was raised only a short time after the end of the war, with its
tragedies still fresh in mind, but also because it was voiced during the debate over the
countrys draft constitution and not merely by a marginal political or religious group.
Most vociferous among the militant Islamic circles in the north were the Muslim
Brothers. While they had been intentionally excluded by Numayris northern-based
government during the conflict resolution process, the Muslim Brothers returned to
17 For details on the 1972 conflict resolution, see e.g., Hizkias Assefa, Mediation of Civil
Wars: Approaches and Strategies, The Sudan Conflict, Boulder, Co: Westview Press,
1987; Donald Rotchild and Caroline Hertzell, The Peace Process in the Sudan, 19711972, Stopping the Killing: How Civil Wars End, Roy Licklider ed., New York: New
York University Press, 1993.
18 For the full text of the agreement and related aspects, see Arab Report and Record, London, March 1972, Supplement, pp. 161-69 and Abel Alier, Southern Sudan: Too Many
Agreements Dishonored, Exeter: Ithaca Press, 1990, pp. 41-104.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 86 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
86
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
the center of politics towards the mid-1970s and assertively propagated to repair
what they perceived to be an unforgivable damage to the once superior position of
Islam in Sudan. They forcefully insisted that all legislation in the state must be based
on, or be in conformity with, Islamic jurisprudence.
The crisis over the draft constitution finally abated, apparently as the result of the
political zigzagging in Numayris position toward the Muslim Brothers to their
clear detriment. Yet inter-religious tensions continued to loom heavily over the Sudanese political mist. Moreover, in the first years of the 1980s, these tensions accumulated much greater weight, becoming, in fact, a prominent bone of contention
between the north and south. Interestingly, these tensions eclipsed, to a large extent,
other sources of crisis of much greater implications to both sides immediate and cumulative socioeconomic and political relief.
In fact, the erosion in the norths sensitivity viz-a-viz the religious as well as
economic and political position of the south was mainly a by-effect, albeit of great
importance, of the national reconciliation process. This was launched by Numayri since 1977 with the deeply Islamic-oriented opposition, which had attempted to
overthrow him, mainly with the collaboration of hostile Libya, in July 1976. Within
this context of reconciliation, the still potentially dangerous opposition leaders returned from exile in Libya and Ethiopia and were engaged in integration attempts
into Khartoums political system. Most successful among them was Dr. Hasan Abdallah al-Turabi, the militant and tough head of the Islamic Charter front a split of
the Muslim Brothers, who met the challenge.19
Eager to see Turabi as a part and parcel of the countrys political establishment
and thus not only demotivating him to topple the regime but also relying upon him
versus other hostile opposition forces, Numayri soon took up a series of moves to
placate the Islamic leader. Prominent among them was the establishment of a state
committee, composed of purely northern Muslims including Turabi himself, entrusted with the examination of the adjustment of the state laws to the Sharia, the
Holy Islamic Law. Thus, the president signaled not only his political interest but
also his sympathy to the strengthening of the states Islamic character, notwithstanding its adverse effect on the relations with the south. A short while later, Numayri
even went a step further, appointing Turabi to various senior executive posts, thus
providing him with greater influential political and religious levers.20
19 For the National Reconciliation Process, see Mohammed Beshir Hamid, The Politics
of National Reconciliation in the Sudan: The Numayri Regime and the National Front
Opposition, Washington D.C.: Georgetown University, 1984.
20 For the prominence of the Muslim Brothers in Sudans politics throughout the late
1970s- the 1980s, see Hasan Makky Muhammad Ahmed, Harakat al-Ikhwan al-Muslimin fi al-Sudan, 1944-1969, Kuwait: Dar al-Qalam lil-Nashr, 1986; Hasan al-Turabi, alHaraka al-Islamiyya fi al-Sudan: al-Tatawar wal-Kasb wal-Manhaj, al-Khartoum:
place of publication not written, 1989; Ibrahim Riad, Factors Contributing to the Political Ascendancy of the Muslim Brethren in Sudan, Arab Studies Quarterly, Vol. 12,
No. 3 and 4, Summer/Fall 1990 and Abdelwahab El-Affendi, Turabis Revolution:
Islam and Power in Sudan, London: Grey Seal, 1991.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 87 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
87
These moves coincided with increasing calls by the traditionally powerful politico-religious forces in the north, the Umma Party and the Unionist Democratic Party, which had chosen to remain outside the national reconciliation framework,
yet yielded a powerful position in domestic politics, to turn the Koran into the decisive source of legislation and to reevaluate the peace agreement so as to further enhance the position of Islam.21
The seriously distressed south, while embittered by growing socioeconomic and
political disappointments and further hardships more than anything else, channeled
its anxiety largely to the religious sphere. This was clearly echoed in massive protest
demonstrations against the north, calling Numayri to adhere to the principle of religion to the individual, the state for all.22 Notwithstanding, Numayris disregard for
the rights and needs of the south (as well as the north) grew steadily. Tragically for
the whole state, the Sudanese president shifted emphases from the countrys management to Islamic practices toward the mid-1980s. Being apparently affected by his severely deteriorating health and political fatigue, the president was encircled by his Islamic Sufi entourage rather than by political and economic advisory teams.23 This
injected into the already badly eroded north-south relations new doses of insolence.
Seriously worried and politically assertive than ever before, southern circles increased their pressure upon the north to fully comply with the peace agreement and supply
the south with its fair share of the economic and political national pie and to officially
honor the souths non-Muslim character. Numayri, however, politically incompetent,
ignored the souths growing ferment, as he did viz-a-viz various segments of populations in the north, concentrating his drained political attention on securing his immediate
position in power and on glorifying the position of Islam across the country.
The presidents failing functioning was alarmingly mirrored by his arbitrary national unity policy during 1982-83, acting to integrate the non-Muslim and non-Arab
south into the power holds of the state. This policy, starkly contrasting the peace
agreement, peaked in Numayris division of the south into three regions in June 1983,
thus eroding its political power versus the north, while securing the latters control
over the oil resources discovered in south Sudan at the beginning of the 1980s. The
souths distrust and fury heightened further, perceiving the oil as its own asset and
viewing it, precisely as did the Khartoum government, as a one-time opportunity to
extricate itself from the economic and political abyss. Thus, paradoxically, the newly
discovered oil significantly exacerbated the internal feud, having, in any case, a much
greater impact on its escalation than that of the intra-religious confrontation.
Accidentally or not, while Numayri was staying abroad for one of his many medical treatments in early 1983, having no idea of what was going on even in the political
arena in the north, the souths tiding frustration erupted in an armed insurgence, mar21 Arabia and the Gulf, London, April 10th 1978, p. 9.
22 Bona Malwal, a senior southern politician, Sudanow, Khartoum, October 1977, and
Africa, London, April 1978.
23 Numayri even published two books on Islam, titled Al-Nahj al-Islami Limadha?,
Cairo: al-Maktab al-Misri al-Hadith, 1980 and al-Nahj al-Islami Kayfa?, Cairo: alMaktab al-Misr al-Hadith, 1985.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 88 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
88
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
king the return of Sudan into the cycle of war. Totally incompetent, Numayri clinged
to his religious preoccupation, further fueling the fighting by implementing the
Sharia Islamic law as the core of a new legal system in Sudan in September 1983. This
move imprinted the final stamp on the souths long-feared Islamization of the country, violating constitutional provisions for the non-discrimination of the pluralistically-religious Sudanese society.24
While the imposition of the Sharia was widely, yet wrongly, assumed to have
played the dominant role in rekindling the north-south armed conflict, one should
bear in mind that the armed rebelliousness had erupted again already early in 1983
and gathered a steady momentum in the spring and summer of that year, in fact quite ahead of the imposition of the Sharia law.
United in its anti-Sharia position, notwithstanding Numayris sporadic and somewhat vague statements on the exclusion of the non-Muslim south from the
Sharias penalty practices, such as amputations and floggings, the souths spirit of
fighting was strengthened. Clearly, vociferous voices from the influential Islamist
hard-liner Turabi, insisting on enforcing the Sharia on all the Sudanese public,
even on the non-Muslim minorities, with no exception,25 intertwined by the carrying out of public amputations not only in Khartoum the stronghold of the Muslim north but also in the Muslim but non-Arab Nuba Mountains, Darfur and
other regions across Sudan, largely reinforced the souths bellicosity.
Soon, a new southern guerilla organization, calling itself the Sudan Peoples Liberation Army (SPLA) the military wing of the Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM), dominated the renewed armed conflict, dictating to a large extent
its pace and essence. Most prominently, the southern SPLA under the command of
Col. John Garang de Mabior increasingly spearheaded the fighting against government-operated oil installations, focusing, thereby, its armed struggle over the oil resources, which both the conflicting sides perceived as the only ray of hope for their
welfare and even survival.26
Already in the mid-1980s, the determined southern SPLA moved far beyond religious, political and economic demands pertaining to the south itself, being now committed to overthrow the Numayri regime and create a new comprehensive order in Sudan.27
24 For the imposition of the Sharia, see e.g., Scott H. Jacobs, The Sudans Islamization,
Current History, May 1985, pp. 205-32; John L. Esposito, Sudans Islamic Experiment, The Muslim World, Vol. 76, Nos. 3-4, 1986; and John O. Voll, Revivalism and
Social Transformation in Islamic History, both papers in Carolyn Fluehr-Lobban,
Islamization in Sudan: A Critical Assessment, The Middle East Journal, Vol. 44, No.
4, 1990, pp. 610-23, and Ann Mosley Lesch, The Sudan-Contested National Identities,
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998, pp. 54-58.
25 In a statement to Al-Sahafa, Khartoum, 2 October 1983.
26 For the role of oil in exacerbatin the north-south antagonism, see Salua Kamil Dallalah,
Oil and Politics in Souther Sudan, North-South Relations in the Sudan Since the
Addis Ababa, Mom K. N. Arou & Yongo-Burre B. eds., Khartoum: University of
Khartoum Press, 1988, pp. 430-55 and God, Oil and Country: Changing the Logic of
War in Sudan, Brussels: International Crisis Group Press, 2002.
27 R. SPLA, the clandestine radio of the southern rebels, established on 18 October 1984
and transmitted from hostile Ethiopia, 22 March 1985 (Daily Report [DR]: Near East
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 89 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
89
Indeed, it was not long before the souths flames of war liked off Khartoum, playing a significant role in the ousting of the regime in a military coup on April 6th 1985.
Religion at War Time: 1983-2002
The sharp controversy over the place of the Sharia law in the multi-religious and
widely diversified Sudanese society forcefully lingered further into the states politics and the north-south conflict during the second half of the 1980s. This was plainly discernable as the Transitional Military Government of Abd al-Rahman Siwar
al-Dahab, which headed Sudans Revolution of National Salvation in the immediate aftermath of Numayris ousting, shelved the Sharia issue out of deep concern
for the consolidating of its power and the calming of the countrys politics.
Indeed, the freeze of the Sharia issue was central in Dahabs success to largely
stabilize the political scene and hold the promised elections campaign in spring
1986. This was subsequented by the formation of a new government under Prime
Minister Sadiq al-Mahdi, the leader of the Umma Party. The Democratic Unionist
Party, another traditionally important politico-religious force in Sudan won the second place and joined Mahdis government. Turabis militant National Islamic Front
(NIF) a fresh split from the Muslim Brothers, emerged as the third significant
force in Khartoums politics, joining Mahdis coalition government.
It was not long before the euphoria over the return of the state to political democracy the first in eighteen years began to dissipate, mainly as a result of the rekindling of fierce dispute over the role of the Sharia in the Sudanese society, hitting
now not only north-south relations but also the very core of the norths politics.
While Turabis NIF spearheaded a vigorous campaign to revive the practical validity
of the shelved Sharia law, premier Mahdi acted to promulgate new legislation to replace it, positively responding thereby to one of the souths major prerequisites for
opening a political negotiation toward conflict resolution. Aware of the fragile position of his government, however, Mahdi wished to avoid a political clash with Turabis Islamists, which might have lead to the breakdown of his government and even
more serious to the collapse of the newly-born democratic system. The stormy
northern-based dissension, which manifested itself also in a series of controversial
agreements, signed in 1986 and 1988 between the southern SPLA and the northern
political and professional elite the National Forces for the National Salvation of
Sudan, paralyzed Mahdis government.28
Meanwhile, as the civil war escalated further and the regimes political prestige
lost height, Turabis NIF appreared more determined to fight for Jihad [holy war]
and South Asia, Monitoring reports published by the US). For more details on the SPLA
aims, see Mansour Khalid, John Garang Speaks, London and New York: KPI Ltd., 1987.
28 See Yehudit Ronen, Sudan in Middle East Contemporary Survey 1986, [and] 1988,
Boulder, Co.: Westview Press, Vols. X and XII, pp. 584-85 and pp. 715-16, respectively.
One of the main points in the 1986 Koka Dam agreement (after the name of the Ethiopian town where it was signed), was the repeal of the Sharia 1983 law. The 1988 agreement was in effect a repetition of the Koka Dam one.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 90 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
90
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
... until the governments fall or until it changes its decisions to obstruct the
Sharia.29 Mahdis government was obviously sitting on a volcano that was on the
verge of erupting.
The lava eventually burst on June 30th 1989. The ultra-hard-liner Turabi, fed up
with the stalemated Sharia law, jointly acted with Islamist circles in the army and
overthrew Mahdis government in a successful coup detate.30 Top-echelon military
officer Brigadier Umar Hasan Ahmad al-Bashir became the new head of state,
while Turabi preferred to stay behind the scenes, hiding the Islamist character of the
regime. On New Years Eve of 1991, however, after consolidating its power base
and with its self-confidence enhanced, the Turabi-Bashir Islamist regime officially
announced the re-implementation of Sharia law throughout the country in compliance with Allahs clear ordinance excluding the south, at least in the meantime.31 Sudan was now turned into a fully Islamic state.
The southern leadership, while growingly beset by ideological, political, ethnic
and personal schisms, considered the re-implementation of the Sharia as a fatal
obstacle to any dialogue. The political structure of the state should have been based
on secularism and equality of all people before the law and not on religious law,
protested Garangs SPLA, adding that with the re-implementation of the Sharia,
the desperate south seriously consider self-determination or even secession.32 The
SPLA further clarified in a later occasion that the issue on the agenda was not only
Sharia penalties but the entire NIF program of Islamicizing education, the mass
media and social life in the whole country.33
The souths separatist threat was flatly rejected by Bashirs government, stressing
its total commitment to the unity of Sudans soil [which] cannot be an object of
bargaining, trade or bartering.34 Bashir stressed at the same breath that there is no
God but Allah,35 thus echoing again his perception of having the right to shape the
states national identity in the image of the Arab-Muslim heritage.
In the mid-1990s, the sharp Sharia confrontation, although still maintaining its
prominent place on the conflicts agenda, was increasingly surmounted by the two
sides tough struggle for the oil resources and by the souths demands for self determination or secession. Moreover, loud voices in the divided southern leadership
even held up the 1991 Eritrean model of independence, which was the culmination
of almost three-decades of war against the Ethiopian governments, as an optional
formula for settling the conflict.36
29 Al-Fatih Abdun, a central NIF figure, and Turabi quoted in al-Sharq al Awsat, London, May 4th and 9th 1989, respectively.
30 For more details on the relations between the NIF and the armed forces, see Taha Haydar, al-Ikhwan wal-Askar: Qissat al-Jabha al-Islamiyya wal-sulta fi al-Sudan, alQahira: Markaz al-Hadara al-Arabiyya lilIlam wal-Nashr, 1993.
31 Al-Inqadh al-Watani, Khartoum, 5 January 1991.
32 Sudan Democratic Gazette, London, a southern publication, July 1992.
33 Sudan Democratic Gazette, July 1993.
34 Al-Inqadh al-Watani, January 15th 1993, quoting Bashir.
35 R. Omdurman (Khartoum), January 18 th 1995 (DR).
36 Al-Wastat, London, August 30th 1993, quoting Rick Mashar, the leader of the splinter
southern group SPLA-United. For details on the internal rivalries within the top
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 91 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
91
Throughout the second half of the 1990s, coinciding with sporadic and definitely
barren peace talks, the war heavily exacerbted, deteriorating in every respect to
the north detriment, while also demanding tragic human and other terrible prices
from the south. At that period, the war has considerably expanded from its internal
context, facing growing political and military involvement of regional and international forces. Most alarming for the north, the south enjoyed the political and military support of a US-supported front, which included Uganda, Ethiopia and Eritrea,
all of them strongly antagonistic to Bashirs Islamist regime.
Moreover, it was during this period that the intrastate map of the conflict was dramatically changed, again to the regimes detriment. Most significant was the unprecedented collaboration between the southern SPLA and various Muslim opposition parties from Khartoums political core, as well as other non-southern forces, either from
the Nuba Mountains, the Kassala region in eastern Sudan and other regimes, organizing themselves in an umbrella grouping the National Democratic Alliance (NDA).37
Clearly, this comprehensive alliance of non-Muslim and Muslim forces indicated
that the controversy over the Sharia law was shifted from the center of the conflicts
agenda and that Islam stopped to be a cementing common denominator for the diverse northern majority population, whereas opposition to further Islamization of
the state stopped to be a primary rallying point for the extremely heterogeneous
non-Muslim southern minority. Rather, the new NDA grouping, notwithstanding
the different religious affiliations of its members, joined forces in what appeared at
that stage as their first priority goal to overthrow the Turabi-Bashir regime and establish a new political order instead. Within this context, the NDA even targeted the
Sudanese oil industry in 1999, thus imperiling the focal element of the politico-economic agenda of the regime, and undermining the states economic prospects.
Notwithstanding with the escalating battles and the deteriorating political position of the government both internally and externally, Bashir and Turabi remained
captive in their Islamist vision and hegemonic leadership perception, not compromising on any of the thorny issues on the conflict agenda. Most noteworthy among
them were Sudans territorial integrity, the role of the Sharia in the states life, and
the sharing of oil resources, with the latter particularly assuming a much heavier
weight in the conflict in late 1990s. Encouraged by its military success, the south appeared tough alike. Not surprising, therefore, the new rounds of sporadic talks, held
in response to foreign pressures, remained entirely futile.
Meanwhile, in 1999, the genie of fierce power struggle between the two powerful
leaders, Turabi and Bashir, had been let out of the bottle. By the end of the year,
Bashir emerged triumphant, as Turabi was removed from power. We have reached
southern leadership, see Yehudit Ronen, Sudan in Middle East Contemporary Survey
1992-1994, pp, 707-8, 619-20 and 597-98
37 The northern pillar of the NDA was composed of the Umma Party (the political organ
of the Ansar sect), the Democratic Unionist Party, which derived a major support
mainly from the Khatmiyya sect, the Communists, the trade and professional unions
and others, encompassing thereby a dominant part of the northern religious and political fabric.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 92 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
92
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
the end of the road,38 Bashir stated, triggering hopes in Sudan and abroad of puncturing first and foremost the Islamist balloon and thus quickening the states progress toward the redefinition of its religious and cultural identity and toward the redistribution of its political and economic sources. Yet, still needing the political
support of Turabis camp and wishing to avoid any further tremor, while believing
in the pivotal role of Sharia in the countrys life, Bashir did not take, nor declare,
any demonstrative move of loosing the Sharias formal status in the wake of Turabis removal from power.
Yet, in effect, the impact of the Sharia in the Sudanese life seemed to abate in the
early 2000s. Turabi the ideological and major architect of Sudans Islamism has
mostly been staying in prison or house arrest, while Egypt, the Gulf states, the
neighboring African states and the US, each due to its own interests, exerted strong
pressures upon Bashir to lower his states Islamist profile. Bashir, even if for the sake
of his hold on power, was aware of the political expediency inherent in dimming Sudans Islamist trade mark.
In any case, the Sharia issue was not the major bone of contention on the northsouth agenda during the post-Turabi period. Moreover, the somewhat odd agreement
signed in mid-2001 between the Islamist Turabi and the non-Muslim southern SPLA
hitherto two most sworn enemies with strictly opposing positions towards the effect of the Sharia law in the states life and another cluster of substantial issues, indicated that when tactically required, the Sharia issue had been pushed to the margins,
even by Sudans most Islamist protagonist. While the SPLA and Turabis NIF committed themselves to escalate popular resistance to Bashirs government, the word
Sharia did not appear in their agreement, though it vaguely referred to the need to
respect Sudans religious diversity.39 This indicated, once again, that the Sharia division served mainly to fuel the conflict, being merely one of its sources, and definitely
not the major one, although steadily being in the limelights of public attention.
Meanwhile, tragically for the whole of Sudan, the beginning of the 21st century
witnessed ongoing heavy fighting not only in the chronic south-north war, but also
increasingly since early 2003, in the war in the Muslim but non-Arab western Darfur region, bordering Chad, thus adding a new potential component to the already
complex intra- and inter-state war. A group calling itself the Sudan Liberation Movement or Army (SLM/A), in a clear and presumably deliberate resemblance to the
name of the southern SPLM/A army, took up arms against Khartoums government, demanding that it would put an end to Darfurs chronic political marginalization, racial discrimination, economic deprivation and backwardness. The Darfur re38 R. Omdurman, December 12th British Broadcasting Corporation, London (BBC),
December 14th 1999. For more details, see Yehudit Ronen, The Struggle for Power
within Sudans Top Leadership, Policy Watch 432 (1999); idem, Sudan, Middle East
Contemporary Survey, Colorado: Westview Press 1999, pp. 529-31; J. Millard Burr and
Robert O. Collins, Revolutionary Sudan: Hasan al-Turabi and the Islamist State, Leiden, The Netherlands: Brill, 2003, pp. 265-74.
39 For more details on this short-lived episode, see Country Report: Sudan, No. 2, June
2001, p. 13.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 93 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
93
bellious SLA, joined by another rebel group, the Justice and Equality Movement,
further demanded that the Arab-Muslim elite in Khartoum halt the unceasingly
raids of the Darfurian nomadic Arab Muslim Baqqara militias known better as the
Janjaweed on the Darfurian Muslim farmers of Black African origin. Thus, the
war in Darfur was also tinged with strong ethnic colors, affecting, even if not directly, the north-south conflict.
Yet, while causing a horrible toll of civilian casualties and human atrocities, as
well as a frightful humanitarian crisis to the point of being even portrayed by various foreign media sources and US and UN officials as genocide, the Darfur war
has nothing to do with differing religious faiths; rather, the Darfur war serves as an
explicit illustration for the states multitudinously-interwoven intricacies and polarizations in many respects with no connection at all in the interfaith tension,40 nor
to the north-south conflict.
Religion at War Time, yet Lightened Up by Peace Initiatives: 2002-2004
Spurred by their own interests, as well as by strongly assertive foreign brokery with
the US as the major driving force, the south and north held a series of interim peace
talks, which eventually produced the Machakos agreement in July 2002 and the Naivasha agreement in September 2003 (both after the Kenyan towns where they were
signed). The bottom line of these accords was the decision in principle on holding internationally-monitored referendum after a six-year interim period on self-determination for the people of the south, giving them the option to decide whether to remain part of a unified Sudan, as Khartoums government so wished, or to secede.
During the six-year interim period, the agreements stipulated, the south, while enjoying a considerable autonomy, will be exempted from the effect of the Sharia law.
Notwithstanding the tremendous progress in the negotiation, still a cluster of pivotal issues remained unsettled in late 2003, among them the effect of the Sharia in
Khartoum the states capital and a stronghold of the northern Muslim society and
also a mega-city where millions of southerners live; the power- and wealth-sharing;
the inclusion of key northern Sudanese parties (members of the NDA) to the negotiating table and the status of other disputed areas, i.e. the Abyei oil-rich region and
the Nuba mountains, both in the Kordofan area, and the Ingassena region in the
southern Blue Nile region. The south viewed these regions as part and parcel of its
territory, basing its claim on geographically-ethnic succession and on the definition
of these regions during the end of the colonial era as southern ones. Another stumbling block was the exclusion of regional players from the agreements, as the major
40 For more on the war in Darfur, see Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia forces in Western Sudan, Human Rights Watch, May 2004, Vol. 16,
No. 6 (A); Robert O. Collins, Disaster in Darfur, Geopolitique Africaine (forthcoming) and Yehudit Ronen, The Tragedy in Darfur: Who is Going to Stop it? Tel
Aviv Notes, Mark Heller ed., Tel Aviv University, 1 August 2004.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 94 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
94
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
mediation player was the US and not the IGAD players,41 or Egypt and Libya,
which had been intensively involved in earlier mediation efforts.
Nevertheless, both of the warring sides did not sit idly by. On May 26th 2004,
while the Darfur warfare steadily escalated, a new breakthrough marked the northsouth conflict, manifesting itself in the signing, again in Naivasha, of another, complementary set of peace accords. These provided with compromises to some of
the hitherto hard nuts issues to crack, primarily the power-sharing one. In addition,
the agreements presented a compromise over the role of the Sharia in Khartoum,
stipulating that Sharia should continue to be implemented in the capital, whereas
the non-Muslim southerners living there would not be affected by it.42 The agreements also provided with a compromise over solution to the above-mentioned disputed areas, anchoring their option to demand a special status in due time,43 and also
incorporated the northern forces of the NDA to the negotiating table, holding talks
in Jidda and Cairo in mid-2004.
The 2004 peace agreements indicated a tangible progress on the road to conflict
resolution, or at least to conflict management, although the war was far from its
end. It seemed nevertheless that both of the warring sides, each due to its own good
reasons, has yearned for the termination of the civil war, the second longest in Africa after the war in Angola. This was plainly illustrated for example by Garangs
southern SPLA, who declared in June 2004: we have reached the crest of the last
hill in our tortuous ascent to the height of peace [and] there are no more hills ahead
of us.44 With Garangs statement in mind, one should add his own prayer and say
Inshallah, whether he is a Christian from the south or a Muslim from the north.45
Unfortunately, this conflict was still far from its resolution in summer 2004 and
whenever it will be achieved, and whatever prices it will require, still the danger of the
wars recurrence will be heavily looming on the state. Not only had Sudan itself shown
this danger in 1983 but also this danger of crumbling peace agreements was further indicated by other wars in Africa, most prominent in Angola, Rwanda, Liberia and
Congo during the 1990s-early 2000s all following the collapse of peace agreements.
41 IGAD, and in its full name the Inter-Governmental Authority on Development is an
east African regional security organization, consisting of Ethiopia, Eritrea, Kenya,
Uganda, Djibouti and Somalia. For more details on the IGAD mediation during the
1990s-2000, see Mansour Khalid, War and Peace in Sudan: The Tale of Two Countries,
London: Kegan Paul, 2003, pp. 369-401.
42 Al-Hayat, London, May 26th 2004.
43 For more details on the agreements, see al-Ahram Weekly, June 3rd-9th 2004, and Country Report: Sudan, June 2004, pp. 12-16.
44 Al-Ahram Weekly, June 3rd-9th 2004, quoted by Gamal Nkrumah.
45 For a profound discussion on the implementation of peace agreements and their failure,
see Ending Civil Wars, Stephen John Sedman, Donald Rothchild, and Elizabeth M.
Cousens, Boulder Co.: Lynne Rienner Publishers, 2002.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 95 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
95
Conclusion
Conflict is an inevitable aspect of human interaction, an unavoidable concomitant of
choices and decisions, stated one of the most outstanding social scientists in conflict
studies.46 Within that context of choices and decisions, the persistent determination of
the ruling Muslim elite in the north to the Islamization of the religiously and ethnically diversified Sudanese society during most of the period reviewed in this study, significantly nourished the flames of the south-north war. Yet, one should note that
this Islamization ardor did not ignite the war, nor served as its major source of nourishment. Therefore, the Sudanese armed conflict, notwithstanding the intractability
of its causes, should not be considered as a religious conflict per se, but rather as a
conflict, wherein fundamental religious sentiments have been deeply woven.
Both warring parties vigorously hoisted their different religious banners upfront, turning them to be a major symbol of their identity and in the case of the
north elite although not systematically encompassing all of it also a symbol of
the states identity. This waving of religious flags, while certainly reflecting both sides deep religious commitment, helped the two parties leaderships to consolidate
the cohesion of their heterogeneous and split societies and reinforce their motivation to fight for the sake of what they perceived as their essential interests, in any case
largely beyond religious matters.
Thus, while Islam has definitely been the dominant religion in the country, the
assumption that the whole Muslim society in the north so wished to turn Sudan
into a fully Islamic state notwithstanding the south unequivocal rejection is unequivocally untrue. This was demonstratably indicated by the resolute objection of politico-religious circles from the core of north to Numayris Sharia implementation
and by even more massive and active objection in the core of the north to the Bashir-Turabi mafiocracy, as it was depicted by a senior northern politician, who
himself had crossed the lines and joined the southern SPLA.47 Moreover, the carving
of the NDA on its flag the principle of separating the church and mosque from the
state, and religion from the Sudanese politics, served as another important refutation of the wrongly perceived monolithic religious approach of the Muslim north.
Yet, even so, the fierce religious confrontation, which always has assumed a much
greater weight than its real substantial significance on the north-south relations, has
yielded a particularly combustible effect. This in turn, exacerbated the conflicts ethnic
militancy and fueled the souths aspirations for self-determination or even secession.
This means that while conflicts are often represented as religious ones, it is the national
aspects of these conflicts that are their basic cause.48 Religious aspects are merely exacerbating factors and the Sudanese north-south war has not been an exception.
46 Francis M. Deng, I. William Zartman, Conflict Reduction: Prevention, Management,
and Resolution, Conflict Resolution in Africa, p. 299.
47 Mansour Khalid, War and Peace, p. 295.
48 See Jonathan Fox, Are Religious Minorities More Militant than Other Ethnic Minorities? Alternatives, Vol. 28, 2003, pp. 91-114, Idem, Religion and State Failure: An
Examination of the Extent and Magnitude of Religious Conflict from 1950 to 1996,
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 96 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
96
Yehudit Ronen Religions at War, Religions at Peace: The Case of Sudan
Summary
This article focuses on Sudans armed conflict, which has been waging between the
majority Arab-Muslim society and the Christian and Animist African minority society, dragging the whole state into a stormy maelstrom of havoc. The study surveys
this conflicts full continuum in the years 1955-2004, analyzing with a particular emphasis the role and impact of religion in shaping the conflicts course and effects during both times of war and of peace. More explicitly, the article examines to what
extent this conflict has been religious in its character, or rather, whether religion was
merely one of the factors, albeit a powerful one, in fueling the flames of war. While
discussing this challenging topic, particularly as interfaith tensions have always been
tightly and almost inseparably interwoven into the most intricate Sudanese fabric of
life, the paper also sheds light on, and maps relevant pre-independence histories
junctions, as well as central political, economic and foreign policy crossroads of Sudan during the era of independence.
Zusammenfassung
Dieser Aufsatz beschftigt sich mit dem bewaffneten Konflikt im Sudan zwischen
der arabisch muslimischen Mehrheitsgesellschaft und der Minderheit von christlichen und animistischen Afrikanern, der den ganzen Staat in einen Wirbelsturm der
Verwstung gerissen hat. Die Studie betrachtet den gesamten Zeitraum des Konflikts zwischen den Jahren 1955 und 2004 und analysiert dabei vor allem die Rolle
und die Triefkraft der Religionen, inwieweit sie den Konflikt hervorgerufen und
den Weg gewiesen haben und zwar sowohl whrend der Kriegs- als auch der Friedenszeiten. Genauer untersucht die Studie inwieweit der Konflikt berhaupt einen
religisen Charakter besitzt, bzw. inwieweit die Religion nur einer der Faktoren
war, wenn auch ein mchtiger, der l in die Flammen des Krieges goss. Indem man
dieses herausfordernde Thema diskutiert, zeigen sich besonders die religisen Spannungen in die Lebenszusammenhnge des Sudans eng und davon untrennbar verwoben, so wirft diese Studie dadurch auch Licht auf die relevanten historischen
Knotenpunkte vor der Unabhngigkeit als auch auf die politischen, konomischen
wie auenpolitischen Entwicklungen des unabhngigen Sudans.
International Political Science Review, Vol. 25, No. 1, 2004, pp. 55-76. For more on the
role of religion in conflict, see David Little, Religious Militancy, Managing Global
Chaos: Sources of and Responses to International Conflict, Chester A. Crocker and Fen
O. Hampson, eds., Washington D.C.: US Institute of Peace Press, 1996, pp. 79-91, and
Andreas Hasenclever and Volker Rittberger, Does Religion Make a Difference? Theoretical Approaches to the Impact of Faith on Political Conflict, Millenium, Vol. 29,
No. 3, 2000, pp. 641-74.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 97 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler
Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
Zur normativen Bestimmung politischer Urteilskraft fr die politische Bildung
Das politikdidaktische Theorem der politischen Urteilsbildung nimmt epistemologisch seinen Ausgang in der Epoche der Aufklrung. Immanuel Kants Ausfhrungen ber den Zusammenhang von Aufklrung und Mndigkeit in seiner Schrift Beantwortung der Frage: Was ist Aufklrung? (1783) bietet eine programmatische
Vorlage fr die weitere Auseinandersetzung mit Mndigkeit und politischer Urteilsbildung. Der Knigsberger Philosoph erklrte hierin eingangs: Aufklrung ist
der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmndigkeit. Unmndigkeit ist das Unvermgen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmndigkeit, wenn die Ursache derselben
nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschlieung und des Mutes liegt,
sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklrung.1
Von besonderer Relevanz fr den pdagogischen Diskurs wird Mndigkeit allerdings erst im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Vormrz und der Revolution von 1848/49. Adolph Diesterweg knpfte in seinem Wegweiser zur Bildung fr
deutsche Lehrer (1834) an die Tradition der Aufklrungsphilosophie an und erklrte
in seiner Vorrede: Als das Ziel der Entwicklung der Unmndigen durch Unterricht
und Erziehung betrachte ich Mndigkeit, welche sich durch die Fhigkeit, sich
selbst zu regieren und zu bestimmen, kundtut.2 In der Folge der Niederschlagung
der demokratischen Reformbestrebungen von 1848/49 erfuhr Mndigkeit erst wieder in den 1920er Jahren durch Erich Weniger eine spezifisch pdagogisch-politische Konturierung. Den Bemhungen um eine vom Begriff der Mndigkeit geleiteten Pdagogik in der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutschland wurde
allerdings durch die Machtbernahme der Nationalsozialisten ein jhes Ende gesetzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten Mndigkeit und politische Urteilsfhigkeit zum bergreifenden Ziel politischer Bildungsbemhungen in der Bundesrepublik. Auch heute noch stellt die politische Urteilsbildung nach bereinstimmender
Auffassung von Politik und Wissenschaft die zentrale Aufgabe der politischen Bil1 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklrung? in: ders.: Werkausgabe, Bd. XI: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pdagogik 1, hrsg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt/M. 91991, S. 53.
2 Zitiert nach Markus Rieger-Ladich, Mndigkeit als Pathosformel. Beobachtungen zur
pdagogischen Semantik, Konstanz 2002, S. 36.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 98 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
98
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
dung dar.3 Die hierzu bislang von der politischen Pdagogik und der Politikdidaktik
vorgelegten Konzeptionen erweisen sich vor den Ansprchen eines normativen politikdidaktischen Ansatzes jedoch als defizitr. Die vorliegende Untersuchung unternimmt vor diesem Hintergrund den Versuch, eine normative Grundlegung politischer Urteilskraft fr die politische Bildung vorzunehmen. Fr dieses
politikdidaktische Unterfangen bietet die politische Philosophie wegweisende Anstze. Mit dieser Orientierung an der politischen Philosophie bzw. an der Politikwissenschaft versteht sich der Beitrag auch als Stellungnahme in der derzeit virulenten politikdidaktischen Debatte um die wissenschaftstheoretische Zuordnung der
Disziplin.4 Gegen Tendenzen zur Vereinnahmung der politischen Bildung durch die
Pdagogik orientieren sich die folgenden berlegungen zur Konzeptualisierung politischer Urteilskraft an Anstzen der politischen Philosophie sowie der Politikwissenschaft und damit an den althergebrachten zentralen Bezugsdisziplinen der Politikdidaktik.
1. Politische Rationalitt
Nach den totalitren Verwerfungen auch in der schulischen Bildung wurde in der
Bundesrepublik Mndigkeit als wesentliche personale Anforderung der
Brgerinnen und Brger fr die gedeihliche Entwicklung der in statu nascendi befindlichen Demokratie ausgemacht. Entsprechend avancierte Mndigkeit zum erklrten Erziehungsziel der neuen Schule.5 Der exklusive Zusammenhang zwischen dem pdagogischen Ziel der Mndigkeit und dem politischen System der
Demokratie in der Bundesrepublik ist gleichfalls in der Politikwissenschaft betont
worden. Diese wird fr die Phase ihrer (Wieder-)Grndung von 1945 bis 1959 inzwischen als Demokratiewissenschaft charakterisiert.6 Mndigkeit wird hier als
3 Vgl. Darmstdter Appell, Aufruf zur Reform der Politischen Bildung in der Schule
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47/1996; Peter Massing / Georg Weieno (Hrsg.),
Politische Urteilsbildung. Zentrale Aufgabe fr den Politikunterricht, Schwalbach/Ts.
1997; Kerstin Pohl (Hrsg.), Positionen zur politischen Bildung 1. Ein Interviewbuch zur
Politikdidaktik, Schwalbach/Ts. 2004.
4 Vgl. Georg Weieno, Wo steht die Politikdidaktik als Wissenschaft? in: GPJE
(Hrsg.), Politische Bildung als Wissenschaft. Bilanz und Perspektiven, Schwalbach/Ts.
2002; Peter Henkenborg, Der 11. September ein Geschichtszeichen auch fr die politische Bildung in: kursiv, 3/2002.
5 So fhrte beispielsweise Theo Fruhmann zum pdagogischen Begriff der Mndigkeit
aus: Darin (im pdagogischen Begriff der Mndigkeit; I. J.) steckt das mittelhochdeutsche munt = Schutz, Bevormundung durch andere; der mndige Mensch ist der aus
der Munt entlassene, sich selbst in der Munt, in der Hand habende. Alle pdagogischen
Akte sind auf diesen Endzustand gerichtet. Der Akzent des pdagogischen Tuns liegt
auf dem Hinfhren zu stets grer werdender Selbstndigkeit und Selbsttgikgeit.
Theo Fruhmann, Mndigkeit als Erziehungsziel der neuen Schule in: Die Pdagogische Provinz, 2/1948, S. 260.
6 Vgl. Wilhelm Bleek, Geschichte der Politikwissenschaft in Deutschland, Mnchen 2001,
S. 305.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 99 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
99
die Fhigkeit der Brgerinnen und Brger zum politischen Urteil erachtet. So erklrte Arnold Bergstraesser, einer der Grndungsvter der Demokratiewissenschaft, in einem Artikel ber das Wesen der politischen Bildung (1956), dass die
Aufgabe der Politikwissenschaft und der politischen Bildung darin bestehe, die
sachlichen Voraussetzungen fr ein politisches Urteil der Brgerinnen und Brger
zu schaffen politische Bildung msse zur Selbstndigkeit des Urteils fhren. Die
Aufgabe des Lehrers bestehe darin, das politische Urteil in Bezug auf die Wahl zwischen verschiedenen Mglichkeiten von der Sache her zu schrfen und zu erhellen, wozu Einsicht in das Gefge der Gesellschaft notwendig sei. Der Zgling
solle zum urteilsfhigen Zeitgenossen sich selbst zu bilden die Gelegenheit haben.
Als politisch Urteilender soll er nach Grnden urteilen.7
Die hier angefhrte Bedeutung von Einsichten in grundlegende strukturelle politische Zusammenhnge fr die Urteilsbildung der Schlerinnen und Schler hatte
Wolfgang Hilligen bereits 1955 in seiner empirischen Untersuchung Plan und Wirklichkeit im sozialkundlichen Unterricht dargelegt. Als Ziel des sozialkundlichen
Unterrichts wird darin von Hilligen unter anderem vorgeschlagen, dass dieser Menschen heranbilden solle, die sich bemhen, gegrndet auf Wissen und Wgen selbstndig und einsichtsvoll zu urteilen und zu handeln. Methodisch eigneten sich
hierfr insbesondere Diskussionen, wobei die Schlerinnen und Schler erleben
sollten, dass ihre vorgefasste Meinung selten die ganze Wahrheit enthlt, dass diese
vielmehr erst durch die Meinung der anderen zum Ganzen reift. Hilligen fhrt in
diesem Zusammenhang weiter aus: Am Beispiel eines Fettfleckes, der gegen das
Licht gehalten hell, sonst dunkel erscheint, knnen die zwei Seiten jeder Erscheinung, die vom Standpunkt des Betrachters abhngen, erstmalig erlebt werden. Der
Sachverhalt lsst sich dramatisieren und als Beispiel fr ein sinnloses Streitgesprch
benutzen, in welchem jeder auf seiner Ansicht beharrt, weil er mit dem Partner
nicht die Rolle tauschen will.8
Wolfgang Hilligen, der in seinen politikdidaktischen Arbeiten stets aus seinem in
der schulischen Praxis gewonnenen Fundus schpft, hat hier durch seine pdagogische Intuition bereits implizit auf den grundlegenden und nicht hintergehbaren Zusammenhang von politischer Urteilsbildung und ffentlichkeit verwiesen,
der uns im Folgenden noch ausfhrlicher beschftigen wird. Zunchst soll hier
jedoch auf die weitere Entwicklung des politikdidaktischen Diskurses bezglich
politischer Urteilsfhigkeit eingegangen werden. In seiner kurzen Abhandlung Urteilsbildung im politischen Unterricht (1968) greift Rudolf Engelhardt die politikdidaktische Thematik der politischen Urteilsbildung wieder auf und benennt als Qualittsmerkmal eines politischen Urteils, dass dieses sich vor der Ratio ausweisen und
damit argumentierbar sein msse.9 Bernhard Sutor erweitert in seiner Didaktik des
7 Arnold Bergstraesser, Das Wesen der politischen Bildung in: Freiheit und Verantwortung, 1/1956, S. 6 und 10-12.
8 Wolfgang Hilligen, Plan und Wirklichkeit im sozialkundlichen Unterricht. Untersuchungen, Erfahrungen, Vorschlge, Frankfurt/M. 1955, S. 116-119 und 134.
9 Rudolf Engelhardt, Urteilsbildung im politischen Unterricht. Einbung kontroversen
Denkens als Aufgabe politischer Bildung, Essen 1968, S. 42.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 100 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
100
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
politischen Unterrichts (1971) dieses Qualittskriterium um die moralische Komponente. In der gewissenhaften politischen Urteilsbildung wrden die rationale und
die moralische Seite der Aufgabe politischer Bildung zusammengeschlossen, und
die auf solche Weise qualifizierte Urteilsbildung stelle das eigentliche, alle Teilziele
umfassende Ziel politischer Bildung dar.10
Die binre Strukturierung der normativen Anforderung an die Qualitt eines politischen Urteils durch Bernhard Sutor hielt sich wenn auch in gewandelter Form
bis in heutige berlegungen zur politischen Urteilsbildung. Statt der von Sutor
vorgenommenen Unterscheidung zwischen rationaler und moralischer Seite des
Urteils betonen Dieter Grosser, Manfred Httich, Heinrich Oberreuter und Bernhard Sutor in ihrer Arbeit Politische Bildung (1976), dass es das allgemeine Ziel der
politischen Bildung sei, den Menschen zur Rationalitt des Urteilens ber soziale
und politische Sachverhalte zu befhigen. Diese Formulierung siedelt die Zielsetzung politischer Bildung unbeschadet der Bedeutung des Emotionalen oder Affektiven primr im kognitiven Bereich an. Das spezifische Ziel politischer Bildung ist
es, jene Fhigkeiten zu frdern, welche die Dimensionen menschlichen Verhaltens
verstandesmig steuern. Rationalitt wird von den Autoren gleichwohl wiederum
differenziert in die auf Max Weber zurckgehende Typisierung von Zweckrationalitt und Wertrationalitt: Zum einen bewegen sich Urteile in einer Zweck-MittelRelation. Sie machen Aussagen ber die Richtigkeit oder Angemessenheit von Zwecken oder Zielen oder (und) ber Mittel oder Methoden zu deren Realisierung. (...)
Zum anderen sind Urteile in ihrer Struktur wertorientiert. Sie messen Sachverhalte
nicht so sehr an beschreibbaren konkreten Zielen, sondern unmittelbar an akzeptierten Werten oder an Wertvorstellungen.11
In vergleichbarer Weise fhrte Manfred Httich in seiner Arbeit Rationalitt als
Ziel politischer Bildung (1977) zur Unterscheidung von Wert- und Zweckrationalitt aus: Unter Wertrationalitt verstehen wir ein Verhalten, bei dem man von einem
Wert berzeugt ist und diesen in konkreten Situationen, ohne die Wirkungen des
Verhaltens zu erwgen, zu verwirklichen versucht. Bei der Zweckrationalitt hingegen berlegt man sich die Mittel zur Erreichung eines Ziels und die etwaigen Nebenfolgen und richtet sein Handeln auf das Ergebnis dieser berlegungen ein. Zur
Verdeutlichung der notwendigen Bercksichtigung beider Rationalittsaspekte rekurriert Httich im Folgenden auf die Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik, die ebenfalls auf Max Weber zurckgeht, und erklrt: Wenn ich
eine politische Entscheidung treffe, die ausschlielich davon bestimmt ist, meine
prinzipielle Gesinnung ohne jede Rcksicht auf die Wirkung meiner Entscheidung
zu verwirklichen, handle ich vielleicht wertrational, aber unter Umstnden politisch
unverantwortlich.12
10 Vgl. Bernhard Sutor, Didaktik des politischen Unterrichts. Eine Theorie der politischen
Bildung, Paderborn 1971, S. 271; Hervorhebungen im Original.
11 Dieter Grosser / Manfred Httich / Heinrich Oberreuter / Bernhard Sutor, Politische
Bildung. Grundlagen und Zielprojektionen fr den Unterricht an Schulen, Stuttgart
1976, S. 25-31.
12 Manfred Httich, Rationalitt als Ziel politischer Bildung, Mnchen 1977, S. 14 und 25 f.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 101 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
101
In der vorgngigen Betonung der Bedeutung von Rationalitt als Ziel politischer
Bildung kommt ein wissenschaftsgeschichtliches Moment der Politikdidaktik zum
Ausdruck, welches auf den Entstehungskontext der Arbeiten von Sutor, Httich u.
a. im Zusammenhang mit den politikdidaktischen Auseinandersetzungen in den
1970er Jahren im Anschluss an die Studentenbewegung verweist. Die Didaktik der
politischen Bildung war damals in die parteipolitische Polarisierung hineingezogen
worden, und die vorgenannten Autoren sind dabei der konservativen Seite politischer Bildung zuzurechnen.13 Sutor, Httich u. a. suchten in diesen politikdidaktischen Diskussionen die Rationalitt in Stellung zu bringen gegen die Emotionalitt,
Leidenschaft, Irrationalitt und Gesinnungsethik, wie sie ihrer Auffassung nach in
den politischen Auseinandersetzungen der 1970er Jahre allgegenwrtig waren.14
Diese Vertreter der Politikdidaktik nahmen damit ihre Akzentuierung der Rationalitt aus einer hnlichen Motivation heraus vor, die Max Weber zu seiner richtungsweisenden Auseinandersetzung mit Vertretern einer Gesinnungsethik im Jahre
1919 fhrte. Als deren Vertreter machte Weber in seiner vor studentischen Zuhrern in Mnchen gehaltenen Rede Politik als Beruf u. a. den politischen Pdagogen
Friedrich Wilhelm Frster aus, der einen christlich motivierten Pazifismus vertreten
hatte. Weber warnte die Mnchner Studenten davor, sich von einer schwrmerischen und illusionren Hypertrophierung der Gesinnungsethik hinreien zu lassen,
und mahnte dagegen die Ausrichtung des politischen Handelns an der Zweckrationalitt an.15
Eingedenk dieses spezifischen Entstehungskontextes der Bestimmung politischer
Urteilsfhigkeit an den von Weber vorgenommenen berlegungen zu Zweck- und
Wertrationalitt sowie zu Verantwortungs- und Gesinnungsethik durch Vertreter
der Politikdidaktik in den 1970er Jahren ist es einigermaen verwunderlich, dass
diese inhaltliche Bestimmung auch noch fr politikdidaktische Konzeptionen politischer Urteilskraft in den 1990er Jahren den einzigen ideengeschichtlichen Referenzpunkt darstellt. So greifen Paul Ackermann u. a. Mitte der 1990er Jahre in ihrer
von der Bundeszentrale fr politische Bildung herausgegebenen Schrift Politikdidaktik kurzgefasst die Frage nach der politischen Urteilsbildung erneut auf und verweisen dabei wiederum auf die bekannte Differenzierung von Zweck- und Wertrationalitt. Ein Mindestkriterium zur Beurteilung von Politik ergebe sich aus der
Frage, inwieweit politische Handlungen, insbesondere Entscheidungen, dem Anspruch politisch-gesellschaftlicher Rationalitt entsprechen. Der Urteilsmastab
politisch-gesellschaftlicher Rationalitt verknpfe zwei Idealtypen von Rationalitt: den der Zweckrationalitt und den der Wertrationalitt. Zweckrationalitt lasse sich in der Kategorie Effizienz und Wertrationalitt in der Kategorie Legitimitt
fassen und bndeln. Diese Kategorien akzentuierten zwar unterschiedliche Aspekte
13 Vgl. Walter Gagel, Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1989, Opladen 1994, S. 215.
14 Vgl. Sutor, aaO. (FN 10), S. 268; Grosser / Httich / Oberreuter / Sutor, aaO. (FN 11),
S. 29; Httich, aaO. (FN 12), S. 23.
15 Vgl. Max Weber, Politik als Beruf in: ders., Gesammelte Politische Schriften, hrsg. v.
Johannes Winckelmann, Tbingen 51988, S. 505-560.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 102 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
102
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
der Beurteilung, mssten aber beide bei der politischen Urteilsbildung bercksichtigt werden: Politische Urteile lassen sich nicht auf die eine oder andere Kategorie
und damit Rationalitt reduzieren. Erst die Bercksichtigung beider Kategorien
entscheidet darber, ob Politik dem Anspruch politisch-gesellschaftlicher Rationalitt entspricht. Dennoch kann es, je nach Art des politischen Problems, zu unterschiedlichen Gewichtungen kommen.16 Darber hinaus sei das politische Urteil
davon abhngig, aus welcher Perspektive Politik beurteilt werde eine Beurteilung
aus der Perspektive politische Handelnder werde unter Umstnden zu anderen Ergebnissen kommen, als eine Beurteilung aus der Perspektive der von der Politik Betroffenen.
In der Folgezeit griff Peter Massing bei seinen berlegungen bezglich der Frage
politischer Urteilsbildung gleichfalls auf die Differenzierung zwischen Zweck- und
Wertrationalitt zurck, welche sich in den Kategorien Effizienz und Legitimitt
bndeln lieen. Den oben genannten beiden Perspektiven der Beurteilung der
Perspektive der politisch Handelnden und der von der Politik Betroffenen fgte er
in seinem Ansatz eine dritte hinzu, die Perspektive des demokratischen Systems.
Jede Perspektive akzentuiere unterschiedliche Aspekte, die sich aber gegenseitig
nicht ausschlieen, sondern sich entweder ergnzen oder in einem Spannungsverhltnis zueinander stehen. Bezglich der im Politikunterricht bei den Schlerinnen und Schlern zu entwickelnden Fhigkeit zur politischen Urteilsbildung gelangt Massing deshalb zu dem Schluss: Je nach dem, auf welcher Dimension der
politisch-gesellschaftlichen Rationalitt Schlerinnen und Schler ihren Schwerpunkt setzen oder welche Perspektive der Betrachtung sie einnehmen, werden sie
auch bei Bercksichtigung der anderen Dimension und anderer Perspektiven zu unterschiedlichen Urteilen gelangen.17 In Fortentwicklung einer von Peter Weinbrenner erstellten vorlufigen Arbeitsdefinition18 schlgt Peter Massing deshalb folgende
Definition fr das politische Urteil vor: Ein politisches Urteil ist die wertende Stellungnahme eines Individuums ber einen politischen Akteur oder einen politischen
Sachverhalt unter Bercksichtigung der Kategorien Effizienz und Legitimitt mit
der Bereitschaft sich dafr ffentlich zu rechtfertigen.19
Die dargelegten politikdidaktischen Anstze zur politischen Urteilsbildung im
Unterricht stellen mithin insbesondere auf die Vermittlung des Urteilsmastabes
16 Paul Ackermann / Gotthard Breit / Will Cremer / Peter Massing / Peter Weinbrenner,
Politikdidaktik kurzgefasst. Planungsfragen fr den Politikunterricht, Bonn 1994, S.
83-87; Hervorhebungen im Original.
17 Peter Massing, Was heit und wie ermgliche ich politische Urteilsbildung? in: ders. /
Georg Weieno (Hrsg.), Politik als Kern der politischen Bildung. Wege zur berwindung unpolitischen Politikunterrichts, Opladen 1995, S. 223 f.
18 Weinbrenners Vorschlag lautete: Urteile im weitesten Sinne sind alle Aussagen eines
Individuums ber Menschen und Sachen, die konstatierenden und/oder qualifizierenden Charakter haben. Peter Weinbrenner, Politische Urteilsbildung als Ziel und
Inhalt des Politikunterrichts in: Peter Massing / Georg Weieno (Hrsg.), Politische
Urteilsbildung. Zentrale Aufgabe fr den Politikunterricht, Schwalbach/Ts. 1997, S. 74.
19 Peter Massing, Kategoriale politische Urteilsbildung in: Hans-Werner Kuhn, Urteilsbildung im Politikunterricht. Ein multimediales Projekt, Schwalbach/Ts. 2003, S. 94.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 103 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
103
politisch-gesellschaftliche Rationalitt ab, welche nach der Bestimmung von Max
Weber in Zweck- und Wertrationalitt zu unterscheiden ist. Letztgenannte enthalten die beiden politikdidaktischen Kategorien Effizienz und Legitimitt, und diese
sind je nach Perspektive des politischen Akteurs, des von Politik Betroffenen oder
des politischen Systems noch weiter zu differenzieren. Entsprechend der jeweils individuellen Gewichtung der Kategorien und der unterschiedlichen Perspektiven lassen sich auf diese Weise verschiedene politische Urteile ber einen politischen Gegenstand fllen.
Bei diesem Verfahren bleiben die von den Individuen getroffenen politischen Urteile allerdings wie Monaden unvermittelt nebeneinander stehen. Je nach eingenommener Perspektive kommt es zu einem von den anderen verschiedenen politischen
Urteil, und die vorgenommenen Urteile sind entsprechend der grundgelegten
Sichtweise mglicherweise auch in sich stimmig. Entscheidend fr ein politisches
Urteil sollte jedoch sein, dass es auf das politische Gemeinwesen gerichtet ist, welches sich in der Demokratie insbesondere durch das Vorhandensein einer Pluralitt
von Meinungen auszeichnet, die im Prozess der politischen ffentlichkeit aufeinander treffen und verhandelt werden. Der Mensch ist in seiner Existenz bedingt durch
das Faktum der Pluralitt, nmlich durch die Tatsache, so Hannah Arendt, dass
nicht ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevlkern.20 Diese anthropologische Grundbedingung stellt mithin auch die Voraussetzung fr das Vorhandensein eines ffentlichen politischen Raumes dar, in welchem
es aufgrund dessen pluraler und freiheitlicher Konstitutionsbedingungen keine
Wahrheit und kein objektives Wissen gibt, sondern nur menschliche Meinungen
und Urteile sowie Vereinbarungen untereinander.21 Der gesellschaftliche Pluralismus divergierender politischer Interessen und Wertvorstellungen bildet sowohl die
Grundlage wie die Herausforderung an eine politische Urteilskraft. Auf welche
Weise die in einem pluralistischen Gemeinwesen auftretenden verschiedenen politischen Urteile qualifiziert sein sollen, welches die mageblichen Komponenten fr
die Synthese eines politischen Urteils ausmachen, wird in den oben vorgestellten
politikdidaktischen Konzeptionen allerdings nicht dargelegt.
Darber hinaus sind die auf der Differenzierung von Zweck- und Wertrationalitt grndenden fachdidaktischen berlegungen zur politischen Urteilsbildung von
Max Webers Handlungstypologie hergeleitet, welcher dabei vier Typen des Handelns bestimmt: das zweckrationale, das wertrationale, das affektuelle und das traditionale Handeln.22 Max Webers Typologie des Handelns bezieht sich allerdings auf
jedwede Form sozialen Handelns. Diese Typen des sozialen Handelns stehen als anthropologische Zge des Menschen auerhalb der Geschichte, sie beziehen sich auf
20 Vgl. Hannah Arendt, Vita activa oder Vom ttigen Leben, Mnchen/Zrich 122001, S.
17 und 279.
21 Vgl. Michael Th. Greven, Hannah Arendt Pluralitt und die Grndung der Freiheit
in: Peter Kemper (Hrsg.), Die Zukunft des Politischen. Ausblicke auf Hannah Arendt,
Frankfurt/M. 1993, S. 78.
22 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie.
Erster Halbband, hrsg. v. Johannes Winckelmann, Kln/Berlin 1964, S. 17.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 104 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
104
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
universelle menschliche Fhigkeiten.23 Zweck- und Wertrationalitt stellen mithin
keinen spezifischen Mastab fr die politische Urteilsbildung dar. Vielmehr bilden
zweckrationales und wertrationales Handeln einen bestimmten Modus sozialen
Handelns allgemein.
Des Weiteren nahm Max Weber im Hinblick auf die Typen sozialen Handelns
eine dezidiert wertende Gewichtung hinsichtlich deren Rationalitt vor. So sei vom
Stand der Zweckrationalitt aus Wertrationalitt immer, und zwar je mehr sie den
Wert, an dem das Handeln orientiert wird, zum absoluten Wert steigert, desto mehr:
irrational, weil sie ja um so weniger auf die Folgen des Handelns reflektiert, je unbedingter allein dessen Eigenwert (reine Gesinnung, Schnheit, absolute Gte, absolute Pflichtmigkeit) fr sie in Betracht kommt.24 Jrgen Habermas konstatierte
deshalb, dass Webers Hierarchie der Handlungsbegriffe auf den Typus des zweckrationalen Handelns hin angelegt sei, so dass alle brigen Handlungen als spezifische
Abweichungen von diesem Typus eingestuft werden knnen.25 Zur Veranschaulichung der von Weber vorgenommenen Gewichtung hat Wolfgang Schluchter die
vier Typen des Handelns entlang einer Rationalittsskala angeordnet, welche anhand der Gesichtspunkte Mittel, Zweck, Wert und Folge aufgebaut ist. Schluchter
gelangt dabei zu dem Schluss, dass eine rational voll kontrollierte Handlung lediglich die zweckrationale zu sein scheine. Bei den brigen Handlungstypen werde wenigstens ein mglicher Gesichtspunkt rationaler Kontrolle vernachlssigt: Bei der
wertrationalen Handlung die Folge, bei der affektuellen Handlung die Folge und
der Wert und bei der traditionalen Handlung (...) die Folge, der Wert und der
Zweck.26 Diese wertende Gewichtung der zweckrationalen Handlung wird gleichfalls bei der Differenzierung Max Webers von Verantwortungs- und Gesinnungsethik evident hier kommt der Verantwortungsethik, welche wie das zweckrationale
Handeln und im Unterschied zur Gesinnungsethik die voraussehbaren Folgen des
Handelns in Betracht zieht und hierfr aufkommt, ein eindeutiges Pr zu. Damit
vertritt Weber letzten Endes ein konomisches Konzept von Rationalitt, in dessen
Mittelpunkt das abzuwgende Zweck-Mittel-Verhltnis steht.
Die durch kalkulierende Mittelwahl und zweckorientiertes Handeln bestimmte
Konzeption von Rationalitt durch Max Weber, der zeitweilig auch Nationalkonomie lehrte, fand in der Folge Eingang in die Sozialwissenschaften respektive in
die Politikwissenschaft und zeitigte einen erheblichen Einfluss auf deren Begriffsbestimmungen von Rationalitt.27 Diese auf die Grundbedeutung von Ratio als Rech23 Vgl. Stephen Kalberg, Max Webers Typen der Rationalitt: Grundsteine fr die Analyse von Rationalisierungsprozessen in der Geschichte in: Walter M. Sprondel / Constans Seyfarth (Hrsg.), Max Weber und die Rationalisierung sozialen Handelns, Stuttgart
1981, S. 10.
24 Weber, aaO. (FN 22), S. 18; Hervorhebungen im Original.
25 Jrgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1, Frankfurt/M. 21982, S. 22.
26 Wolfgang Schluchter, Die Entstehung des modernen Rationalismus. Eine Analyse von
Max Webers Entwicklungsgeschichte des Okzidents, Frankfurt/M. 1998, S. 259.
27 Vgl. Dietmar Braun, Theorien rationalen Handelns in der Politikwissenschaft, Opladen
1999.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 105 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
105
nung verweisende Bestimmung eignet sich allerdings nicht als Grundlage fr eine
politikdidaktische Konzeptualisierung politischer Urteilsfhigkeit. Danach wrde
die politische Urteilsfhigkeit eines Individuums lediglich auf der subjektiven Abwgung zweck- und wertrationaler Beurteilungskriterien grnden, wobei der
Zweckrationalitt stets ein Vorrang zukme. Das auf diese Weise gewonnene politische Urteil eines Individuums wrde letztlich stets in der geschlossenen Sphre des
subjektiven Interessenkalkls verbleiben. Die entscheidende Frage der Vermittlung
des eigenen Urteils mit demjenigen der anderen Mitglieder des pluralistischen Gemeinwesens bleibt damit genauso unbeantwortet wie diejenige nach den Werten,
welche auf der wertrationalen Seite Eingang in die Urteilsbildung finden sollten
die bei den Mitgliedern pluralistischer Gemeinwesen vorhandenen konkurrierenden
Auffassungen vom Guten knnen bei der politischen Urteilsbildung nicht schlicht
nach subjektivem Gusto miteinander verrechnet werden.
Fr die Politikdidaktik stellt sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe, politische
Urteilsfhigkeit mit der normativen Bestimmung zu konzeptualisieren, dass das politische Urteil eines Individuums in einem pluralistischen Gemeinwesen allen anderen Mitgliedern dieses Gemeinwesens angesonnen werden kann und damit prinzipiell zustimmungsfhig ist. Die solchermaen qualifizierte politische Urteilsfhigkeit
wrde sich durch ihre spezifische Gerichtetheit auf das Politische auszeichnen und
der Pluralitt der in der politischen ffentlichkeit aufeinander treffenden Meinungen gerecht werden. Den Schlerinnen und Schlern ermglichte dieses im Politikunterricht vermittelte Urteilsvermgen als sptere Brgerinnen und Brgern die
verstndigungsorientierte Teilhabe am Prozess der politischen ffentlichkeit. Fr
die Konzeptualisierung der mit dem vorgenannten Geltungsanspruch versehenen
Fhigkeit zur politischen Urteilsbildung vermag die politische Philosophie der Politikdidaktik eine normative Orientierung zu geben. Sie stellt eine der politikdidaktischen Bezugswissenschaften dar, mit deren Hilfe das Wissen ber die politische
Urteilsbildung28 vertieft werden kann.
2. Das Rationale und das Vernnftige
Als Ausgangspunkt fr die hier anzustellenden normativen politikdidaktischen
berlegungen bezglich politischer Urteilsfhigkeit sollen die bei den bisherigen
Konzeptionen politischer Rationalitt ausgemachten Unzulnglichkeiten dienen.
Danach muss eine normative Bestimmung politischer Urteilskraft das letztlich
durch zweckrationales Denken gekennzeichnete Urteilen berwinden und dem
Geltungsanspruch gerecht werden, wonach das politische Urteil eines Individuums
von allen Mitgliedern des pluralistischen Gemeinwesens als grundstzlich anerkennungswrdig erachtet werden kann. Zweck- und Wertrationalitt lassen sich
28 Gotthard Breit / Georg Weieno, Offene Fragen in: Peter Massing / Georg Weieno
(Hrsg.), Politische Urteilsbildung. Zentrale Aufgabe fr den Politikunterricht, Schwalbach/Ts. 1997, S. 300.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 106 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
106
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
mithin nicht einfach je nach den subjektiven Vorlieben eines Individuums willkrlich zu einem politischen Urteil verrechnen. Vielmehr sollen in dieses neben dem
kalkulierenden Eigeninteresse des Individuums auch die mglichen Interessen anderer sowie ein dem pluralistischen Gemeinwesen adquater Wertgehalt einbezogen
werden.
Einen richtungsweisenden Ansatz fr dieses Unterfangen kann John Rawls
bahnbrechende Unterscheidung29 zwischen dem Vernnftigen und dem Rationalen bieten. Rawls konstatiert in Politischer Liberalismus (1993), dass das Vernnftige
ein Element der Idee der Gesellschaft als eines Systems fairer Kooperation sei,
und dass deren faire Bedingungen von allen vernnftigerweise akzeptiert werden
knnen, gehrt zur Idee der Reziprozitt. Das Rationale dagegen sei eine von der
Idee des Vernnftigen verschiedene Idee und beziehe sich auf einzelne, einheitliche
Akteure (entweder Individuen oder Krperschaften), die in der Lage sind, zu urteilen und zu berlegen, welches ihre ureigensten Zwecke und Interessen sind.30 Die
Urteile, so Rawls im Weiteren, die wir als Vernnftige treffen, unterscheiden sich
von denen, die wir als Rationale treffen. Insofern wir rational sind, wgen wir unsere verschiedenen Ziele gegeneinander ab und bestimmen ihren angemessenen Platz
in unserer Art zu leben (). Als Vernnftige mssen wir demgegenber die Strke
der Ansprche von Menschen beurteilen, und zwar nicht nur gegenber unseren
Ansprchen, sondern auch untereinander und gegenber unseren vertrauten Handlungsweisen und Institutionen.31
Darber hinaus stellt in einer modernen demokratischen Gesellschaft das Faktum
des Pluralismus und damit die Verschiedenheit und Vielfalt allgemeiner umfassender Lehren ein dauerhaftes Merkmal der politischen Kultur dar.32 Im Hinblick auf
die Wertvorstellungen wird sich in dem rationalen Urteil des Individuums folglich
stets auch dessen persnliche Konzeption des Guten widerspiegeln. Diese je persnlichen Konzeptionen der Individuen stehen oftmals in einem kontrren Verhltnis zueinander und sind nicht miteinander vereinbar. Vor diesem Hintergrund kann
sich eine normative politikdidaktische Konzeption politischer Urteilsbildung nicht
auf die Benennung von Wertrationalitt als einer Ingredienz des politischen Urteils
beschrnken. Die Frage nach der Mglichkeit der Vermittelbarkeit der verschiedenen rationalen Urteile mit ihren zum Teil nicht miteinander vereinbaren Wertvorstellungen der vielfltigen religisen, philosophischen und moralischen Lehren im
Prozess der politischen ffentlichkeit mit dem Ziel einer Verstndigung bleibt damit unbeantwortet.
Einen Ausweg bietet hier wiederum die Unterscheidung Rawls. Whrend die Individuen bei ihren rationalen Urteilen ihre Eigeninteressen und je persnlichen
29 So Alessandro Ferrara, ffentliche Vernunft und Normativitt des Vernnftigen in:
Deutsche Zeitschrift fr Philosophie, 50/2002, S. 943.
30 John Rawls, Politischer Liberalismus, Frankfurt/M. 2003, S. 122 f.
31 Ebd, S. 129.
32 Vgl. John Rawls, Der Gedanke des bergreifenden Konsenses in: ders., Die Idee des
politischen Liberalismus. Aufstze 1978-1989, hrsg. v. Wilfried Hinsch, Frankfurt/M.
1994, S. 298.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 107 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
107
Wertvorstellungen ins Kalkl ziehen, sollten sie bei vernnftigen Urteilen die Interessen anderer bercksichtigen und lediglich die Werte des Politischen gelten lassen.
Nach Rawls berlegungen umfassen die Werte des Bereichs des Politischen diejenigen der gleichen politischen und brgerlichen Freiheiten und der Chancengleichheit, die Werte der sozialen Gleichheit und wirtschaftlichen Gegenseitigkeit.33 Diese Werte des Bereichs des Politischen werden im demokratischen
Rechtsstaat in der Verfassung reprsentiert. Rawls kommt deshalb zu dem Schluss:
Die Forderung des ffentlichen Vernunftgebrauchs liegt darin, dass Brger in der
Lage sein sollen, unter vernnftiger Abwgung ffentlicher politischer Werte zu
begrnden, wofr sie in grundlegenden Angelegenheiten stimmen, wobei alle Beteiligten natrlich davon ausgehen, dass diese Werte in einer Pluralitt vernnftiger
Lehren, wie sie von Brgern vertreten werden, eine tiefergehende und hufig transzendente Grundlage finden.34
Hinsichtlich der hier in Frage stehenden politikdidaktischen Konzeptualisierung
politischer Urteilskraft kann somit auf dem Hintergrund der Rawlsschen Unterscheidung des Rationalen und des Vernnftigen als Zwischenergebnis festgehalten
werden: Whrend sich ein rationales Urteil durch seine Gerichtetheit auf das kalkulierende Eigeninteresse auf der Grundlage persnlicher Wertvorstellungen des Individuums ausweist, qualifiziert sich ein vernnftiges Urteil durch seine Bercksichtigung der Interessen anderer Individuen sowie allgemein anerkannter politischer
Werte. Fr ein normatives Konzept politischer Urteilskraft bleibt nun allerdings
noch zu klren, wie die beiden komplementren Sphren rationalen und vernnftigen Urteilens so zusammengefhrt werden knnen, dass bei einem Urteil eines
Individuums im Bereich des Politischen weder das durch Eigeninteresse geleitete
rationale Urteil noch ein durch seine ausschlieliche Gerichtetheit auf die Allgemeinheit sich auszeichnendes vernnftiges Urteil dominant wird. Ein wegweisender
Ansatz zur berwindung dieses Dilemmas und fr die politikdidaktische Konzeptualisierung politischer Urteilskraft geht von Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft aus.
3. Die erweiterte Denkungsart
In dem fr die politische Urteilskraft relevanten 40 der Kritik der Urteilskraft legt
Kant dar, dass man unter dem sensus communis die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, d. i. eines Beurteilungsvermgens verstehen msse, welches in seiner
Reflexion auf die Vorstellungsart jedes andern in Gedanken (a priori) Rcksicht
nimmt, um gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten, und
dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedingungen, welche
leicht fr objektiv gehalten werden knnten, auf das Urteil nachteiligen Einflu ha-
33 Rawls, aaO. (FN 30), S. 326.
34 Ebd., S. 348.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 108 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
108
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
ben wrde.35 Voraussetzung fr die Bildung eines Urteils durch ein Individuum
stellt nach Kant mithin das Vorhandensein einer Pluralitt von Urteilen anderer Individuen dar, die ffentlich zugnglich sein mssen. Auf dieser Grundlage ermglicht das In-Bezug-Setzen des eigenen Urteils mit demjenigen anderer ein Absehen
von den jeweiligen partikularen Interessen des Individuums und den Einbezug derjenigen Interessen, die dem politischen Gemeinwesen frderlich sind und nicht unbedingt mit den Privatinteressen konvergieren.
Der Weg, auf welchem diese Urteilsbildung vonstatten gehen soll, wird von Kant
wie folgt beschrieben: Dies geschieht nun dadurch, da man sein Urteil an anderer,
nicht sowohl wirkliche, als vielmehr blo mgliche Urteile hlt, und sich in die Stelle jedes andern versetzt, indem man blo von den Beschrnkungen, die unserer eigenen Beurteilung zuflliger Weise anhngen, abstrahiert (...).36 Die Bildung von Urteilskraft ist nach Kant folglich verbunden mit einem vorgestellten Dialog des
Individuums. Dabei ist nicht Empathie als das gefhlsmige Hineinversetzen und
Erfassen des Standpunktes des oder der anderen gefordert. Vielmehr gilt es fr das
Individuum, sich die Perspektive des oder der anderen bewusst zu machen, mit dem
eigenen Standpunkt zu vergleichen beziehungsweise zu konfrontieren und schlielich in das eigene Urteil einzubeziehen.
Der Vorgang dieser geistigen Ttigkeit wird von Kant als Operation der Reflexion bezeichnet, welche von der Maxime der Urteilskraft, an der Stelle jedes andern
denken, bestimmt wird und auf diese Weise zu einer erweiterten Denkungsart
gelangt.37 Hannah Arendt charakterisierte das von Kant definierte Vermgen der
Urteilskraft an der Stelle jedes andern denken als politische Fhigkeit par excellence und erkennt diese Fhigkeit als bei den Brgern der griechischen Polis gegeben. Im Sinne der Polis, so Arendt, war der politische Mensch in seiner ihm
eigentmlichen Ausgezeichnetheit zugleich der freieste, weil er die grte Bewegungsfreiheit vermge seiner Einsicht, seiner Fhigkeit, alle Standorte zu bercksichtigen, hatte. Diese Freiheit des Politischen hing von der Anwesenheit und
Gleichberechtigung Vieler ab, mithin von der Existenz einer politischen ffentlichkeit und der Gleichheit der daran partizipierenden Brger: Wo diese gleichberechtigten anderen und ihre partikularen Meinungen abgeschafft sind, wie etwa in
der Tyrannis, in der alle und alles dem einen Standpunkt des Tyrannen geopfert ist,
ist niemand frei und niemand der Einsicht fhig, auch der Tyrann nicht.38 Der spezifische Bedingungszusammenhang von politischer Gleichheit und ffentlichkeit
sowie dem Vermgen der politischen Urteilsbildung wird hier in besonderer Weise
augenfllig. Die Ausbung politischer Freiheit grndet folglich auf dem Vorhandensein von politischer Gleichberechtigung und ffentlichkeit in einem Gemein35 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. Werkausgabe, Bd. X, hrsg. v. Wilhelm Weischedel, Frankfurt/M. 152000, S. 225; Hervorhebung, Orthographie und Interpunktion hier
wie im Folgenden im Original.
36 Ebd., S. 225.
37 Ebd., S. 226 f.
38 Hannah Arendt, Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlass, hrsg. v. Ursula Ludz,
Mnchen/Zrich 1993, S. 98.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 109 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
109
wesen, welche die Voraussetzungen fr die Bildung politischer Urteilsfhigkeit bei
den Brgerinnen und Brgern darstellen und somit die Praxis politischer Freiheit
ermglichen.
Fr den Weg zur Urteilsbildung essentiell ist nach Kant die Operation der Reflexion. In der Reflexion vermag das Individuum durch die Einbildungskraft das
gegenwrtig zu machen, was abwesend ist. Einbildungskraft ist mithin das Vermgen der Reprsentation. Diese Fhigkeit erlaubt dem Zuschauer beim Urteilen die
Abwgung mglicher Urteile von vorgestellten anderen und ermglicht ihm durch
diese erweiterte Denkungsart die politische Urteilsbildung. Hannah Arendt bezeichnet das Vermgen, vermittels der Einbildungskraft zu einer erweiterten Denkungsart zu gelangen, auch als kritisches Denken und veranschaulicht dieses wie
folgt: Kritisches Denken ist nur mglich, wo die Standpunkte aller andern sich
berprfen lassen. Kritisches Denken also isoliert sich nicht von allen anderen,
auch wenn es noch immer ein einsames Geschft ist. Um zu verdeutlichen: Kritisches Denken spielt sich nach wie vor in der Einsamkeit ab; doch durch die Einbildungskraft macht es die anderen gegenwrtig und bewegt sich damit in einem
Raum, der potentiell ffentlich, nach allen Seiten offen ist. Kritisches Denken
nimmt, mit anderen Worten, die Position von Kants Weltbrger ein.39 Hannah
Arendt erachtete die durch die erweiterte Denkungsart qualifizierte Urteilskraft im
Kontext ihrer berlegungen zur politischen ffentlichkeit als eine im spezifischen
Sinne politische Fhigkeit, als Grundfhigkeit, die den Menschen erst ermgliche, sich im ffentlich-politischen Raum, in der gemeinsamen Welt zu orientieren.40
Kant unterscheidet in seiner Einleitung in die Kritik der Urteilskraft weiterhin
zwischen bestimmender und reflektierender Urteilskraft. Unter bestimmender Urteilskraft versteht er das Vermgen, einen zum Grunde liegenden Begriff durch
eine gegebene empirische Vorstellung zu bestimmen.41 Das Allgemeine ist mithin
bei der bestimmenden Urteilskraft gegeben, worunter das Besondere subsumiert
werden muss.42 Hinsichtlich der reflektierenden Urteilskraft merkt Kant an: Reflektieren (berlegen) aber ist: gegebene Vorstellungen entweder mit andern, oder
mit seinem Erkenntnisvermgen, in Beziehung auf einen dadurch mglichen Begriff, zu vergleichen und zusammen zu halten. Die reflektierende Urteilskraft ist
diejenige, welche man auch das Beurteilungsvermgen (facultas diiudicandi)
nennt.43 Ernst Vollrath, der Kants Theorie der reflektierenden Urteilskraft fr seine Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen (1987) fruchtbar zu
machen sucht, erkennt in der reflektierenden Urteilskraft das eigentliche Vermgen
39 Hannah Arendt, Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald
Beiner, Mnchen 1985, S. 60.
40 Vgl. Hannah Arendt, Kultur und Politik in: dies., Zwischen Vergangenheit und
Zukunft. bungen im politischen Denken I, hrsg. v. Ursula Ludz, Mnchen/Zrich
1994, S. 299.
41 Kant, aaO. (FN 35), S. 24.
42 Vgl. Lutz Koch, Pdagogik und Urteilskraft. Ein Beitrag zur Logik pdagogischer
Vermittlungen in: Vierteljahrsschrift fr wissenschaftliche Pdagogik, 74/1998, S. 394.
43 Kant, aaO. (FN 35), S. 24.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 110 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
110
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
des Urteilens, denn die bestimmende Urteilskraft subsumiere lediglich unter eine
gegebene Regel, was noch kein Urteilen im eigentlichen Sinne sei. Urteilen zeichne
sich vielmehr durch die reflektierende Beurteilung des Einzelnen in seiner Besonderheit aus, und diese Beurteilung knne durch das Einbeziehen der Urteile anderer, durch die erweiterte Denkungsart, zur interpersonalen Universalitt des
Urteils fhren.44 Vollrath bezieht sich hier auf Kants Charakterisierung der erweiterten Denkungsart, wobei das Individuum sich ber die subjektiven Privatbedingungen des Urteils, wozwischen so viele andere eingeklammert sind, hinwegsetzt,
und aus einem allgemeinen Standpunkte (den er dadurch nur bestimmen kann, da
er sich in den Standpunkt anderer versetzt) ber sein eigenes Urteil reflektiert.45
Um dem eigenen Urteil interpersonale Universalitt zu erteilen, so Vollrath weiter, muss das eigene Urteil an die perspektivische Standorthaftigkeit des oder der anderen Urteile angemessen werden: Woran ich Ma nehme, ist die perspektivische
Standorthaftigkeit des anderen Urteils, genauer: das Zwischen, welches seine
Standorthaftigkeit ebenso wie die meines Urteils kennzeichnet. Dieses im vergleichend-reflektierenden Urteil sich bildende und erffnende Zwischen ist als das bei
aller Unterschiedlichkeit der Standorte Gemeinsame das Ma der Beurteilung der
interpersonalen Universalitt. Es hat den Charakter des allgemeinen Standortes
der erweiterten Denkungsart gem der Maxime der reflektierenden Urteilskraft: es
ist die universale Interpersonalitt.46 Das urteilende Individuum kann somit einen
Standpunkt einnehmen, der weder dem des homo oeconomicus noch dem des Gesinnungsethikers entspricht.47
Das Individuum legt durch dieses reflektierende Urteilen die private Subjektivitt
des eigenen Urteils ab und gelangt durch die Einbeziehung der Sichtweisen des oder
der anderen in seinem Urteil zu einem allgemeinen Standpunkte, wodurch sich
das individuelle Urteil gleichsam ffentlich bestimmt und mithin, so Ernst Vollrath, modal politisch qualifiziert, als ein Urteil, welches auf einem Stck zumindest
gemeinsamer Weltlichkeit beruht.48 Diese Qualifizierung eines politischen Urteils
durch Vollrath konvergiert folglich mit der von Kant vorgenommenen Charakterisierung des Beurteilungsvermgens als Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes vermittels der erweiterten Denkungsart. Fr Hannah Arendt ist die erweiterte
Denkungsart gleichfalls die conditio sine qua non des richtigen Urteils, welches
seine spezifische Gltigkeit durch den Appell an den Gemeinsinn, den sensus communis, erhlt. Arendt gelangt deshalb zu dem Schluss: Wenn man urteilt, urteilt
man als ein Mitglied einer Gemeinschaft.49
44 Ernst Vollrath, Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen, Wrzburg
1987, S. 271.
45 Kant, aaO. (FN 35), S. 227.
46 Vollrath, aaO. (FN 44), S. 283.
47 Vgl. Michael Becker, Reflektierende Urteilskraft und politische Philosophie in: Politische Vierteljahresschrift, 38/1997, S. 241.
48 Vollrath, aaO. (FN 44), S. 281.
49 Arendt, aaO. (FN 39), S. 96 f.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 111 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
111
Allerdings bedeutet die Einbeziehung von Standpunkten bzw. Perspektiven anderer in das eigene politische Urteil nicht die Angleichung desselben an jene. Einbeziehung meint hier nicht die Anpassung des eigenen politischen Urteils an dasjenige
anderer oder die Orientierung an der Mehrheit der politischen Urteile anderer. Mit
der Einbeziehung der politischen Urteile anderer im Sinne der erweiterten Denkungsart wird hier die Akkommodation des eigenen (Vor-)Urteils an die politischen
Urteile anderer in dem Sinne verstanden, dass diese fr die eigene politische Urteilsbildung eine angemessene Bercksichtigung finden. Durch die Akkommodation
des eigenen Urteils an diejenigen anderer bleibt jenes nicht lnger subjektiv und
zeichnet sich durch seine Gltigkeit im Prozess der politischen ffentlichkeit aus.
Der Grad der Akkommodation des eigenen Urteils an das politische Urteil anderer
kann freilich nicht im Voraus bestimmt werden, sondern obliegt der individuellen
Entscheidung der Schlerin oder des Schlers. Die Fhigkeit einer solchermaen
qualifizierten politischen Urteilskraft bedarf der unterrichtlichen bung, worauf
unten noch nher einzugehen sein wird.
Hannah Arendt hat die Entwicklung eines eigenstndigen Urteils, welches sich
gleichwohl durch intersubjektive Gltigkeit auszeichnet, in einer unverffentlichten
Vorlesung eindrucksvoll beschrieben: Stellen Sie sich vor, ich schaute auf ein bestimmtes Wohnhaus in einem Slum und wrde in diesem besonderen Gebude die
allgemeine Vorstellung, die es nicht direkt ausdrckt, erkennen: die Vorstellung von
Armut und Elend. Ich gelange zu dieser Vorstellung, indem ich mir vergegenwrtige, reprsentiere, wie ich mich fhlen wrde, wenn ich dort zu leben htte. Das
heit: Ich versuche, vom Standort des Slumbewohners aus zu denken. Das Urteil,
zu dem ich komme, wird keinesfalls unbedingt das gleiche sein wie das der Bewohner, bei denen die Zeit und die Hoffnungslosigkeit eine Abstumpfung gegenber ihren schndlichen Lebensbedingungen bewirkt haben mgen; aber es wird fr mein
weiteres Urteilen in diesen Angelegenheiten ein auergewhnliches Beispiel werden, auf das ich zurckgreife ... Mehr noch, auch wenn ich beim Urteilen andere bercksichtige, so heit das nicht, dass ich mich in meinem Urteil den Urteilen anderer anpasse. Ich spreche noch immer mit meiner eigenen Stimme und zhle nicht
eine Majoritt aus, um zu dem zu gelangen, was ich fr richtig halte. Allerdings ist
mein Urteil auch nicht lnger subjektiv.50
Bei ihrer Suche nach einer Erklrung fr die politischen bel des 20. Jahrhunderts ist fr Hannah Arendt die Analyse des Urteils gleichfalls zentral. Sie erachtet
die Weigerung zu urteilen, wie sie pointiert bei Adolf Eichmann zum Ausdruck
kommt51, als Ursprung der grten bel im Bereich des Politischen die Weigerung zu urteilen, d. h. Fehlen der Einbildungskraft, d. h. nicht die anderen, die man
reprsentieren muss, vor den eigenen Augen prsent haben und bercksichtigen.52
50 Zitiert nach Ronald Beiner, Hannah Arendt ber das Urteilen in: Hannah Arendt,
Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald Beiner, Mnchen
1985, S. 138; Auslassung im Original.
51 Siehe Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalitt des Bsen,
Mnchen 1964.
52 Hannah Arendt, zitiert nach Beiner, aaO. (FN 50), S. 144.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 112 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
112
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
Fr Arendt stellt in moralischer wie politischer Hinsicht die grte Gefahr fr die
Entwicklung eines Gemeinwesens die Indifferenz sowie die ihrer Ansicht nach heute weit verbreitete Tendenz, das Urteilen berhaupt zu verweigern, dar. Aus dem
Unwillen oder der Unfhigkeit, so Arendt, durch das Urteil mit anderen in Beziehung zu treten, entstehen die wirklichen skandala, die wirklichen Stolpersteine,
die menschliche Macht nicht wegrumen kann, weil sie nicht durch menschliche
oder fr die Menschen verstndliche Motive verursacht worden sind. Darin liegt der
Schrecken und, gleichzeitig, die Banalitt des Bsen.53
Die von Hannah Arendt indizierte Gefahr, die in einem Mangel an Urteilskraft
bzw. in der Weigerung zum Urteilen im politischen Bereich grndet und den Bestand demokratischer Gemeinwesen bedroht, wurde bereits in einer demokratiegeschichtlich sehr frhen Phase von Solon erkannt. In seinem sogenannten EunomiaGedicht macht er nicht die Gtter fr den gedeihlichen Fortbestand des athenischen Gemeinwesens, sondern dessen Brger selbst verantwortlich. Diese wrden
Athen zugrunde richten, weil sie vllig in der Verfolgung ihrer persnlichen und
nchstliegenden Interessen befangen seien. Dagegen erklrt Solon hier seine Grundvorstellung, wonach das Gemeinwesen als einheitliches Ganzes zu denken sei, welches gegenber den einzelnen Brgern ein eigenstndiges Beziehungsgefge bilde.
Das Fehlverhalten der Brger, von welchem die Gefahr fr den Bestand des Gemeinwesens ausgeht, besteht nach Solon demnach im Mangel der Brger an einer
realistischen Einschtzung ihres Verhaltens im Zusammenhang mit dem Verhalten
der anderen Brger.54 In der von Solon beschriebenen Krisensituation des athenischen Gemeinwesens fehlte es den Brgern mithin an Gemeinsinn, welcher sich
durch die Einbeziehung mglicher Perspektiven anderer in das eigene Urteil im Bereich des Politischen auszeichnet.
In der heutigen Gesellschaft ist die von Solon und Hannah Arendt beschriebene
Gefahr fr den Bestand von Gemeinwesen, zu deren Krisenphnomenen u. a. auch
ein zunehmender, lediglich die eigenen Interessen wahrnehmender Subjektivismus
gezhlt wird, welcher mit politischer Abstinenz bzw. Indifferenz einher geht, gleichermaen aktuell. Hierauf soll bei der nun vorzunehmenden politikdidaktischen
Konzeptualisierung politischer Urteilskraft ebenfalls nher eingegangen werden.
4. Politische Urteilskraft als zentrales Ziel politischer Bildung
Das Erkennen und gegebenenfalls die politisch aktive Wahrnehmung der eigenen
Interessen bildeten bereits seit lngerem einen Topos der Politikdidaktik. Auf der
Konferenz von Fachdidaktikern bei der Landeszentrale fr politische Bildung Baden-Wrttemberg in Beutelsbach im Jahre 1976 einigten sich die anwesenden Politikdidaktiker in ihrem dritten Grundsatz auf die Formel: Der Schler muss in die
53 Ebd., S. 145.
54 Vgl. Michael Stahl, Solon F 3D. Die Geburtsstunde des demokratischen Gedankens
in: Gymnasium, 99/1992, S. 406 ff.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 113 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
113
Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu
analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische
Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen.55 Dieser dritte Grundsatz des Beutelsbacher Konsenses wurde in der Folgezeit des fteren revidiert bzw. ergnzt. Im
Mittelpunkt dieser Kritik stand die als zu einseitig wahrgenommene Analyse und
Durchsetzung der eigenen Interessen der Schlerinnen und Schler. So pldierte
etwa Wolfgang Hilligen dafr, dass der Interessenbegriff des dritten Grundsatzes
aus seiner mglichen subjektivistischen Verengung gelst werden msse. Es sei,
so Hilligen, wenn es um Schlerinteressen geht, immer zugleich nach den Wirkungen zu fragen, die die Durchsetzung von Interessen auf vitale Interessen anderer
Personen oder Gruppen haben muss oder kann: Das wohlverstandene (Tocqueville;
fast gleichsinnig: verallgemeinerungswrdige, Habermas) Interesse ist im politischen Unterricht bei allen strittigen Fragen mitzubedenken, und sei es nur als heuristische Kategorie.56 Die Bercksichtigung der Interessen anderer bei der Bestimmung und Verfolgung der eigenen Interessen bildet auch fr Herbert Schneider das
Motiv fr sein Pldoyer zur Umformulierung des dritten Grundsatzes des Beutelsbacher Konsenses. Schneider schlgt hierzu folgende revidierte Fassung vor: Der
Schler soll dazu befhigt werden, politische Probleme zu analysieren und sich in
die Lage der davon Betroffenen hineinzuversetzen sowie nach Mitteln und Wegen
zu suchen, wie er die Problemlsung im Sinne seiner wohlverstandenen Eigeninteressen unter Bercksichtigung seiner Mitverantwortung fr das soziale Zusammenleben und das Gemeinwesen () beeinflussen kann.57
Diese Revisionen des dritten Grundsatzes des Beutelsbacher Konsenses durch
Hilligen und Schneider deuten mithin bereits auf den fr die erweiterte Denkungsart notwendigen Einbezug der Interessen bzw. Perspektiven anderer. Die sich
solchermaen durch Gemeinsinn auszeichnende politische Urteilskraft orientiert
sich zwar am Gemeinwohl, vernachlssigt dabei aber zugleich nicht in einem altruistischen, das Gemeinwohl hypostasierenden Sinne die partikulren Interessen des
Individuums. Die erweiterte Denkungsart ermglicht vielmehr in der politischen
55 Der Beutelsbacher Konsens stellt eine Einigung der bis dato entsprechend der jeweiligen parteipolitischen Affinitten gespaltenen Zunft der Politikdidaktiker auf unhintergehbare Grundstze dar. Die beiden ersten Grundstze das berwltigungsverbot (a)
und das Kontroversittsgebot (b) konnten ihre Gltigkeit bis heute behaupten (a) Es
ist nicht erlaubt, den Schler mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwnschter
Meinungen zu berrumpeln und ihn an der Gewinnung eines selbstndigen Urteils zu
hindern. (b) Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht
kontrovers erscheinen. Hans-Georg Wehling, Konsens la Beutelsbach? in: Siegfried Schiele / Herbert Schneider (Hrsg.), Das Konsensproblem in der politischen Bildung, Stuttgart 1977, S. 179 f.; Hervorhebungen im Original.
56 Wolfgang Hilligen, Mutmaungen ber die Akzeptanz des Beutelsbacher Konsenses
in der Lehrerschaft in: Siegfried Schiele / Herbert Schneider (Hrsg.), Konsens und Dissens in der politischen Bildung, Stuttgart 1987, S. 19; Hervorhebungen im Original.
57 Herbert Schneider, Gemeinsinn, Brgergesellschaft und Schule Ein Pldoyer fr
brgerorientierte politische Bildung in: Siegfried Schiele / ders. (Hrsg.), Reicht der
Beutelsbacher Konsens?, Schwalbach/Ts. 1996, S. 220.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 114 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
114
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
ffentlichkeit eine intersubjektive Verstndigung, welche sowohl die wohlverstandenen Eigeninteressen der Individuen als auch die der anderen bercksichtigt und in
das politische Urteil integriert. Zwar kann in einem demokratischen Gemeinwesen
den Brgerinnen und Brgern eine Gemeinwohlorientierung, so Jrgen Habermas,
nicht zur Rechtspflicht gemacht, sondern nur angesonnen werden. Doch ist diese in
einem gewissen Mae gleichwohl ntig, weil die demokratische Gesetzgebung ihre
legitimierende Kraft allein aus einem Prozess der Verstndigung der Staatsbrger
ber die Regeln ihres Zusammenlebens ziehen kann. Die Brgerinnen und Brger
drften deshalb nicht in der erfolgsorientierten Einstellung selbstinteressierter
Marktteilnehmer verharren, sondern mssten von ihren politischen Freiheiten
auch, im Sinne von Kants ffentlichem Vernunftgebrauch, einen verstndigungsorientierten Gebrauch machen. Dieses auch lasse es mithin zu, dass die Gemeinwohlorientierung nur noch in kleiner Mnze erhoben werden msse.58
Die politische Urteilskraft, welche sich durch die erweiterte Denkungsart qualifiziert, stellt somit einen wesentlichen Faktor fr den Fortbestand unseres demokratischen Gemeinwesens dar. Vor diesem Hintergrund muss die Methode des vergleichenden Abwgens zwischen dem eigenen interessengeleiteten Standpunkt und dem
oder der Standpunkte anderer in der Reflexion des Individuums bei der begrifflichen
Bestimmung politischer Urteilsbildung als essentielles Qualittsmerkmal Bercksichtigung finden. Erst die erweiterte Denkungsart erlaubt dem Individuum die Bildung
eines ffentlichen, den sensus communis ermglichenden politischen Urteils. Wird der
Standpunkt der anderen bei der eigenen Urteilsbildung nicht mit einbezogen, bleibt
der gebildete eigene Standpunkt die Vertretung des subjektiven Partikularinteresses
und kann schlechterdings nicht als politisches Urteil bezeichnet werden. Allein der
Prozess der Vermittlung des eigenen Standpunktes mit dem oder den der anderen im
vorgestellten oder wirklichen Dialog fhrt zur Bildung eines politischen Urteils, welches im ffentlich-politischen Raum als solches Gltigkeit beanspruchen kann.
Diese fr die politische Urteilsbildung erforderliche erweiterte Denkungsart
kann jedoch nicht stets mit der Sichtweise eines oder mehrer authentischer Gegenber vorgenommen werden, da hierzu nicht jederzeit ein entsprechender Gesprchspartner zur Verfgung steht. Darber hinaus stellt die Anwesenheit der
Kommunizierenden in der heutigen politischen ffentlichkeit aufgrund der Vermittlung der diversen politischen Positionen durch die Massenmedien ohnehin kein
notwendiges Erfordernis mehr dar. Fr die politische Urteilsfhigkeit etwa hinsichtlich der diversen politischen Problemlagen im Bereich der Auenpolitik ist angesichts der Ermangelung einer tatschlichen Perspektive eines anderen die geistige
Vergegenwrtigung einer vorgestellten Perspektive, eventuell angeregt durch die
massenmedial bermittelten politischen Standpunkte anderer, notwendig. Die politische Urteilsbildung des Individuums erfordert somit durch Einbildungskraft und
Antizipationsvermgen die Durchfhrung eines vorgestellten Dialogs, eines geisti58 Vgl. Jrgen Habermas, Replik auf Beitrge zu einem Symposion der Cardozo Law
School in: ders., Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie,
Frankfurt/M. 1996, S. 311 f.; Hervorhebungen im Original.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 115 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
115
gen Zwiegesprchs, unter Einbeziehung der vorgestellten oder massenmedial vermittelten politischen Positionen anderer. Durch diese geistige Ttigkeit gelangt das
Individuum schlielich zu einem politischen Urteil, welches ihm als Zuschauer die
Teilhabe an der politischen ffentlichkeit ermglicht. Diese Teilhabe gestaltet sich
in unserer reprsentativen Demokratie insbesondere als stetige Kontrolle der politischen Akteure. Darber hinaus dient die politische Urteilsbildung selbstredend den
Brgerinnen und Brger zur Entscheidungsfindung bei Wahlen sowie etwaigen
weiteren politischen Aktivitten wie der Beteiligung an Brgerinitiativen et cetera.
An dieser Stellte ist Tilman Grammes zu widersprechen, der bei seinen berlegungen zur Entwicklung von politischem Urteilsvermgen zu dem Schluss gelangt,
dass dieses erst in dialogischer Praxis entstehe politische Urteilskraft entfaltet
sich im Medium des demokratischen Gesprchs. Zwar ist Grammes Feststellung,
die Qualitt des politischen Urteilens sei auf die Einbeziehung mglichst vieler divergenter Perspektiven angewiesen, vor dem Hintergrund der hier vorgestellten erweiterten Denkungsart durchaus zuzustimmen. Doch bildet der demokratietheoretische Bezugspunkt seiner berlegungen das partizipatorische Demokratiekonzept
Benjamin Barbers, welches dieser als starke Demokratie tituliert. Grammes sieht
bei diesem Konzept Anschlussmglichkeiten fr die von ihm vorgestellte kommunikative Fachdidaktik (1998). Der Perspektivenwechsel zum Zwecke der politischen Urteilsbildung wird aufgrund der Anlehnung an das Konzept der starken
Demokratie Barbers von Grammes notwendiger Weise nur als tatschlicher Vorgang gedacht, der realiter zwischen einem Individuum und seinem wirklichen Gesprchspartner stattfindet. Entsprechend des partizipatorischen Prozesses der
Selbstgesetzgebung, der die starke Demokratie Barbers kennzeichnet, ist Politik
nach Auffassung Grammes die Transformation von Interessen in ffentlichkeitsfhige Anliegen, ber die kollektiv im Modus des politischen Dialogs geurteilt
wird.59 Vor diesem Hintergrund soll die politische Urteilsbildung nach Grammes
in der dialogischen Praxis durch den Einbezug der unterschiedlichen Perspektiven
der an dem Dialog tatschlich Beteiligten entstehen. Empirisch mag dieser Modus
der politischen Urteilsbildung in einigen Gremien der kommunalen Selbstverwaltung in den Vereinigten Staaten, wo Barbers Konzept seinen politischen Referenzpunkt hat, durchgefhrt werden, und vielleicht mag er seine Gltigkeit auch im
Prozess der politischen Positionsbildung in einigen hiesigen Brgerinitiativen haben. In unserer reprsentativen Demokratie allerdings dient die politische Urteilskraft der groen Majoritt der Brgerinnen und Brger nicht dem aktiven politischen Handeln, sondern als konstitutive Qualifikation von Zuschauern des
politischen Geschehens zur Kontrolle der politisch Handelnden.
Hinsichtlich der Frage, ab wann Kinder mit der Mglichkeit verschiedener Perspektiven rechnen und schlielich eine Koordination der Perspektiven anderer vornehmen, kam die Entwicklungspsychologie zu der folgenden Stufung einer Entwicklungssequenz: (a) Im Altersbereich zwischen vier und neun Jahren wird
59 Tilman Grammes, Kommunikative Fachdidaktik. Politik Geschichte Recht Wirtschaft, Opladen 1998, S. 264 f.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 116 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
116
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
zunchst die Subjektivitt von Perspektiven bewusst (Menschen denken unterschiedlich, weil sie sich in unterschiedlichen Situationen befinden). (b) Zwischen
sechs und 12 Jahren folgt ein reflexives Verstndnis der Subjektivitt (das eigene
Handeln kann aus der Perspektive eines anderen reflektiert und umgekehrt dessen
Reaktion auf eigenes Handeln antizipiert werden). (c) Wechselseitige Perspektivenkoordination zwischen neun und 15 Jahren bedeutet zu erkennen, dass beide Seiten
die Perspektive des jeweils anderen gleichzeitig bercksichtigen knnen (jeder kann
sich auf den Platz des anderen oder eines unabhngigen Dritten versetzen und sich
selbst von dort aus betrachten, bevor er sich fr ein bestimmtes Handeln entscheidet). (d) In der letzten Stufe, ab etwa 12 Jahren, gelingt es die Perspektive sozialer
Bezugsgruppen zu bernehmen. Erst die Einbeziehung der Perspektive des sozialen
Systems und seiner Normen erlaubt ein angemessenes Verstehen und Kommunizieren.60 Gem dieser entwicklungspsychologischen Stufung sind Schlerinnen und
Schler mit dem Verlassen der Grundschule potentiell fhig, eine wechselseitige
Perspektivenkoordination vorzunehmen. Ab etwa der sechsten Klassenstufe sind
sie darber hinaus im Stande, den Einbezug politischer Werte in die individuelle
Sichtweise vorzunehmen. Fr den Politikunterricht bedeutet dies, dass dieser die
Entwicklung politischer Urteilsfhigkeit im Sinne der erweiterten Denkungsart bei
den Schlerinnen und Schlern ab der sechsten Klassenstufe gezielt frdern kann.
Der Prozess der politischen Urteilsbildung bedarf neben der Einbeziehung der
politischen Sichtweise anderer einer regulativen Idee, welche als Soll-Instanz einen
wertenden Mastab fr die Angemessenheit der letztlich vom Individuum nach der
Abwgung und Einbeziehung verschiedener Perspektiven zu fllenden politischen
Entscheidung bietet. Die dabei in Betracht gezogenen Werte mssen allerdings angesichts der bei den Mitgliedern des Gemeinwesens vorhandenen Vielzahl konkurrierender Auffassungen vom Guten die prinzipielle Zustimmung aller Mitglieder
des politischen Gemeinwesens finden knnen. Ein qualifizierter Mastab kann mit
den vlkerrechtlich universalisierten Menschenrechten sowie mit den politischen
Werten, wie sie im Grundgesetz und in der Charta der Grundrechte der Europischen Union verankert sind, angegeben werden. Das solchermaen qualifizierte politische Urteil kann sich mithin durch einen auf das Wohl des gesamten politischen
Gemeinwesens gerichteten Gemeinsinn auszeichnen. Gemeinsinn wird hier mit
Herfried Mnkler und Harald Bluhm als eine motivationale Handlungsdisposition
von Brgern und politisch-gesellschaftlichen Akteuren verstanden, welche auf das
normative Ideal des Gemeinwohls ausgerichtet ist. Dabei bedarf es eines Mindestmaes an Gemeinsinn, damit wir berhaupt motiviert werden, uns fr ein normatives Gemeinwohl-Ideal zu interessieren.61 Die von Immanuel Kant dargelegte
60 Rainer K. Silbereisen, Soziale Kognition: Entwickeln von sozialem Wissen und Verstehen in: Rolf Oerter / Leo Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, Weinheim 41998,
S. 835 f.
61 Herfried Mnkler / Harald Bluhm, Einfhrung: Gemeinwohl und Gemeinsinn als
politisch-soziale Leitbegriffe in: dies. (Hrsg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn. Historische Semantiken politischer Leitbegriffe (=Forschungsberichte der interdisziplinren
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 117 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
117
Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes als Beurteilungsvermgen62, der Gemeinsinn, erweist sich vor diesem Hintergrund als politische Kategorie die erweiterte
Denkungsart vermag das politische Urteil des Individuums durch den entsprechenden Gemeinsinn zu qualifizieren, der fr das in unserer pluralistischen Gesellschaft
a posteriori zu ermittelnde Gemeinwohl erforderlich ist.
In diesem Abwgungsprozess zwischen dem eigenen politischen Standpunkt und
den Standpunkten der tatschlichen oder vorgestellten anderen knnen die in diesen
Standpunkten enthaltenen verschiedenen Interessen im Hinblick etwa auf die weitere Entwicklung der Demokratie, der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Umwelt
gleichfalls zur Geltung kommen. Erst durch diese Gerichtetheit auf die eigenen wie
auf die Interessen anderer im politischen Gemeinwesen sowie auf die dort gltigen
politischen Werte wird ein Urteil im Bereich der politischen ffentlichkeit zu einem explizit politischen Urteil. Das von dem Individuum gewonnene Urteil behlt
somit zum einen den Charakter der Eigenstndigkeit, zum anderen ist es durch die
Einbeziehung der politischen Perspektiven anderer nicht lnger nur subjektiv auf
die eigene Interessenlage bezogen. Der Geltungsanspruch fr das politische Urteil
eines Individuums besteht in dessen prinzipieller Zustimmungsfhigkeit durch die
anderen. Diese Akzeptabilitt ergibt sich aus der spezifischen Synthese des politischen Urteils durch die erweiterte Denkungsart, in welcher sowohl die Eigeninteressen des Individuums wie auch diejenigen der anderen und die gemeinsamen politischen Werte Bercksichtigung finden. Damit ist das politische Urteil auf das
pluralistische Gemeinwesen gerichtet und erfllt durch den Umstand, dass es idealiter allen anderen angesonnen werden kann, das Kriterium der Reziprozitt. Durch
seinen normativen Gehalt kann ein solches Urteil eines Individuums weder wahr
noch falsch sein, sondern muss sich im Prozess der Verstndigung mit anderen als
gerechtfertigt oder ungerechtfertigt erweisen.
Auf dieser Grundlage schlage ich fr das politische Urteil folgende Begriffsdefinition vor: Ein politisches Urteil eines Individuums zeichnet sich durch die reziproke Einbeziehung der tatschlichen oder vorgestellten Interessen anderer im vernnftigen Abwgungsprozess mit den eigenen Interessen unter Bercksichtigung
politischer Werte in Bezug auf einen in der politischen ffentlichkeit thematisierten
Sachverhalt aus, so dass es fr jedes Mitglied des politischen Gemeinwesens prinzipiell zustimmungsfhig erscheint. Die politische Urteilsbildung gestaltet sich dabei
vorwiegend als geistige Ttigkeit vermittels des inneren Zwiegesprchs, wodurch
sich die Brgerinnen und Brger als reflektierte Zuschauer in der reprsentativen
Demokratie qualifizieren, im politischen Rsonnement die aktiv Handelnden zu beurteilen und damit zu kontrollieren.
Die politische Bildung ist folglich insofern fr die Demokratie funktional, als sie
durch das Nachgehen ihrer zentralen Aufgabe, der Befhigung der Schlerinnen
und Schler zu politischer Urteilsbildung, die Grundlage fr die potentielle TeilhaArbeitsgruppe Gemeinwohl und Gemeinsinn der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Bd. I), Berlin 2001, S. 13.
62 Vgl. Kant, aaO. (FN 35), S. 225.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 118 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
118
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
be aller (spteren) Brgerinnen und Brger an der politischen ffentlichkeit legt.
Die Partizipation der Brgerinnen und Brger an der politischen ffentlichkeit ist
fr das demokratische Gemeinwesen konstitutiv, wenn die Demokratie nicht zu einer formalen Herrschaftsform ohne normativen Gehalt verkommen soll. Dabei ist
die Quantitt der zur Teilhabe an der politischen ffentlichkeit qualifizierten
Brgerinnen und Brger nicht ohne Belang. Arnold Bergstraesser, der in seinen
Ausfhrungen ber die Lehrgehalte der politischen Bildung der Bedeutung der Ausbildung zur Urteilsfhigkeit der Schlerinnen und Schler bereits in den 1950er Jahren nachging, gelangte in diesem Zusammenhang zu dem Schluss: Wollen wir einen urteilsfhigen politischen Zeitgenossen erziehen, dann muss er imstande sein,
mit anderen Staatsbrgern und gleichsam fr den handelnden Staatsmann die Entscheidung auf die Zukunft hin voraus zu denken. Je dichter und breiter die Basis der
Pyramide ist, an deren Spitze die dazu befugten ffentlichen Organe ihre Entscheidungen fllen, je weniger diese aus zahllosen Einzel- und Gruppenurteilen sich bildende ffentliche Meinung dem Gefhl und der Konvention, je mehr sie der begrndeten Einsicht entspringt, desto krftiger wird der innere Aufbau des
freiheitlichen Rechtsstaates und desto sicherer werden seine Entscheidungen sein.63
Untersuchungen der empirischen Politikwissenschaft weisen allerdings daraufhin,
dass es mit den Kenntnissen und Einstellungen der Brgerinnen und Brger bezglich der reprsentativen Demokratie derzeit nicht zum Besten bestellt ist. So sind
etwa Kenntnisse ber basale Strukturelemente unseres politischen Systems kaum
vorhanden.64 Die empirischen Untersuchungen lassen sich jedoch auch als Indiz fr
die Valenz von politischen Bildungsprozessen werten. So wird die Idee der Demokratie von Brgerinnen und Brgern aller Altersgruppen mit Hochschulreife deutlich hher geschtzt, whrend sich weniger gut gebildete Jugendliche und junge Erwachsene sich eher mit der Vorstellung einer Diktatur anfreunden knnen fr
Letztgenannte stellt Demokratie offensichtlich keinen absoluten Wert dar.65 Hierauf
wird unten noch nher einzugehen sein.
Die Befhigung der Schlerinnen und Schler zur politischen Urteilsbildung als
demokratiefunktionale Aufgabe der politischen Bildung fr deren sptere Teilhabe
an der politischen ffentlichkeit darf sich allerdings insbesondere angesichts der
neuen auenpolitischen Rahmenbedingungen Deutschlands seit der Wiedervereinigung und dem Ende des Ost-West-Konflikts nicht auf die diversen Politikfelder der
Innenpolitik beschrnken, sondern muss auch die Auenpolitik mit einbeziehen.
63 Arnold Bergstraesser, Die Lehrgehalte der politischen Bildung in: ders., Politik in
Wissenschaft und Bildung. Schriften und Reden, Freiburg 21966, S. 305.
64 Vgl. Jrgen Maier, Politisches Interesse und politisches Wissen in Ost- und Westdeutschland in: Jrgen Falter / Oscar W. Gabriel / Hans Rattinger (Hrsg.), Wirklich
ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich,
Opladen 2000, S. 152.
65 Vgl. Kai Arzheimer / Markus Klein, Gesellschaftspolitische Wertorientierungen und
Staatszielvorstellungen im Ost-West-Vergleich in: Jrgen Falter / Oscar W. Gabriel /
Hans Rattinger (Hrsg.): Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ostund Westdeutschen im Vergleich, Opladen 2000, S. 383 f.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 119 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
119
Dem Politikunterricht ist deshalb die Vermittlung derjenigen politischen Kenntnisse aufgegeben, welche den Schlerinnen und Schlern auch nach Beendigung ihrer
Schullaufbahn die Teilhabe am Prozess in der politischen ffentlichkeit in Europa
sowie auf weltpolitischer Ebene ermglichen. Auch fr die politische Urteilsbildung im Bereich der auswrtigen Politik stellt die Kompetenz der erweiterten Denkungsart eine konstitutive Fhigkeit der Schlerinnen und Schler dar. Die wachsende Interdependenz in der Staatenwelt erfordert fr die politische Urteilsbildung
heute einen Modus des Denkens, welcher den Standort von Brgerinnen und Brgern anderer Lnder einbezieht. Entsprechend sollte sich gleichfalls die auf die europische ffentlichkeit oder auf die Weltffentlichkeit bezogene politische Urteilskraft der Brgerinnen und Brger durch die abwgende Einbeziehung der
jeweils anderen Perspektiven unter der Magabe politischer Werte qualifizieren.
Dadurch kann ein verstndigungsorientiertes politisches Urteilen bzw. Handeln gefrdert werden, was gerade angesichts der Anschlge vom 11. September 2001 angezeigt ist, soll das verheerende Szenario eines clash of civilizations66 vermieden
werden. Die gegenseitige Perspektivenbernahme und die hierauf grndende abwgende politische Urteilsbildung kann hier als Mglichkeit erachtet werden, diese interkulturelle Verstndigung zu frdern.
Abschlieend bleibt hier die demokratietheoretisch-normative Frage zu klren,
ob denn die solchermaen qualifizierte politische Urteilskraft prinzipiell jeder
Schlerin und jedem Schler gleich welcher Schulart im Politikunterricht zu vermitteln ist. Mit dieser fr die demokratische Herrschaftsform konstitutiven Voraussetzung hatte sich bereits der Sophist Protagoras von Abdera in der zweiten Hlfte des
5. vorchristlichen Jahrhunderts auseinander gesetzt, indem er sich darum bemhte,
die Voraussetzungen fr die athenische Demokratie theoretisch herzuleiten. Protagoras stellte deshalb grundstzliche berlegungen zu den politischen Kompetenzanforderungen fr die athenischen Brger an, die mit der realen Praxis der demokratischen Herrschaftsform verknpft waren. In einem von Platon berlieferten
Dialog gelangte Protagoras gegenber seinem Gesprchspartner Sokrates zu dem
Schluss, dass die fr ein demokratisches Gemeinwesen notwendigen brgerschaftlichen Kompetenzen jedem Menschen zukommen, allerdings in einem Lernprozess
erworben werden mssten.67 Die prinzipielle Mglichkeit der Lehrbarkeit der fr
den Bestand der demokratischen Staats- und Regierungsform essentiellen politischen Kompetenzen fr alle Brgerinnen und Brger und hier ist zuvrderst die
politische Urteilsfhigkeit anzufhren stellt ein auf Protagoras zurckzufhrendes nicht hintergehbares Axiom einer sich normativ verstehenden Politikdidaktik dar.68
66 Vgl. Samuel Huntington, Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik
im 21. Jahrhundert, Mnchen 41997.
67 Vgl. Platon, Protagoras. bersetzung und Kommentar von Bernd Manuwald (=Platon:
Werke, VI 2), Gttingen 1999, 322 d 323 c.
68 Vgl. Ingo Juchler, Reprsentative Demokratie und politische Bildung Demokratiekompetenz als normative Herausforderung an die Politikdidaktik in: Karl Schmitt (Hrsg.),
Herausforderungen der reprsentativen Demokratie, Baden-Baden 2003, S. 204 ff.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 120 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
120
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
Ein weiterer Hinweis zur Lsung dieser normativen Frage findet sich wiederum in
Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft. Urteilskraft wird darin als Denkungsart
charakterisiert und vom Vermgen des Erkenntnisses abgegrenzt.69 Bei der Denkungsart handelt es sich mithin nicht um ein Vermgen im Sinne intellektueller Fhigkeiten, sondern um eine Art des Denkens, zu welcher alle Individuen unabhngig
von der Reichweite ihres Erkenntnisvermgens befhigt sind. Auf welche Weise dieses Vermgen nun vermittelt werden kann, beschreibt Kant in der Kritik der reinen
Vernunft (1781). Urteilskraft, so Kant, sei ein Talent, welches gar nicht belehrt, sondern nur gebt sein will. Diese bung ist nur exemplarisch mglich Beispiele
(sind) der Gngelwagen der Urteilskraft.70 Das ben anhand von Beispielen soll
mithin zu der von Kant fr die Urteilskraft als Charakteristikum ausgemachten Fhigkeit der Zuschauer, zur erweiterten Denkungsart, fhren, wobei diese beim Urteilen auch die Standpunkte bzw. Perspektiven anderer in Rechnung stellen.
Diese Relevanz des bens anhand von Beispielen fr die politische Urteilsbildung wird heute durch neurobiologische Untersuchungen untermauert. Der Ort im
menschlichen Gehirn, der fr die Unterscheidung von Gut und Bse, die Verfolgung von Zielen, die Unterdrckung unmittelbarer Bedrfnisse, das Handeln im
Rahmen eines bestimmten Kontextes wie auch fr das Sich-in-andere-Hineinversetzen zustndig ist, stellt der orbitofrontale Kortex, ein ber den Augen gelegener Bereich der Grohirnrinde, dar. Zur Ausbildung des orbitofrontalen Kortex als Bewertungszentrum ist die Varianz der frhen Erfahrungen von entscheidender
Bedeutung. Jede einzelne Bewertung, so Manfred Spitzer, schlgt sich in uns nieder, fhrt zum Aufbau langfristiger innerer Reprsentationen von Bewertungen, die
uns bei zuknftigen Prozessen der Bewertung zu rascheren und zielsichereren Einschtzungen verhelfen. Die Varianz der frhen Erfahrungen und Bewertungen
fhrt im spteren Leben zu Differenziertheit, Toleranz und Weitblick bei Bewertungen. Spitzer resmiert in diesem Kontext: Durch viele unterschiedliche Erfahrungen, durch unser Reiben an den Vorstellungen anderer und durch unser damit
verbundenes dauerndes Bewerten werden Rume fr Reprsentationen erffnet,
oder besser: aufgespannt. Je differenzierter diese Rume angelegt werden (und dies
geschieht noch bis nach der Pubertt), desto eher ist der Erwachsene spter zu Bewertungen komplexer Sachverhalte in der Lage.71
Zur Ausbildung politischer Urteilsfhigkeit ergibt sich aus diesen Untersuchungsergebnissen der Neurobiologie fr den Politikunterricht das Erfordernis
zum ben von exemplarischen Fllen, welche zum einen bedeutsame Inhalte der
gegenwrtigen politischen Wirklichkeit widerspiegeln und auch prospektiv versprechen von politischer Relevanz zu sein. Zum anderen sollten die Schlerinnen und
Schler auf der Grundlage dieser exemplarischen Flle dazu angeregt werden, eine
69 Vgl. Kant, aaO. (FN 35), S. 227.
70 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft 1. Werkausgabe, Bd. III, hrsg. v. Wilhelm
Weischedel, Frankfurt/M. 31977, S. 184 f.
71 Manfred Spitzer, Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg/Berlin 2002, S. 346 und 356.
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 121 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Ingo Juchler Rationalitt, Vernunft und erweiterte Denkungsart.
121
mglichst vielfltige Struktur innerer Reprsentationen dieser politischen Inhalte
und deren Bewertungen vorzunehmen. Die Varianz von Erfahrungen, welche eine
sptere Einseitigkeit der Bewertungen zu vermeiden hilft und statt dessen Umsicht
bei politischen Einschtzungen frdert, kann durch das ben politischer Urteile erreicht werden, die sich durch das vernnftige Abwgen von Eigeninteressen und
tatschlichen oder vorgestellten Interessen anderer sowie die Einbeziehung politischer Werte auszeichnen.
Zusammenfassung
Von der Grndung der Bundesrepublik an gilt die Befhigung der Schlerinnen und
Schler zur politischen Urteilsbildung gemeinhin als zentrale Aufgabe des Politikunterrichts. Politikdidaktische berlegungen zur Konzeptualisierung politischer
Urteilsfhigkeit wurden allerdings bislang vornehmlich im Rckgriff auf die Begriffsdefinition von Rationalitt durch Max Weber vorgenommen. Diese erscheint
jedoch fr eine normative Bestimmung politischer Urteilskraft als defizitr. Die
berlegungen John Rawls zur Unterscheidung des Rationalen und des Vernnftigen sowie Immanuel Kants und Hannah Arendts zur erweiterten Denkungsart vermgen der Politikdidaktik indes wegweisende Impulse fr ein normatives Konzept
politischer Urteilskraft zu geben, welche sich durch ihre Gerichtetheit auf das pluralistischen Gemeinwesen auszeichnet.
Summary
Since the establishment of the Federal Republic of Germany it has generally been
considered an essential task of political education to enable students to form political judgements. Up to now, ideas for political education aimed at conceptualizing
political judgement capability have been based largely on Max Webers definition of
rationality. This appears, however, to be inadequate for a normative ascertainment
of political judgement capability. Meanwhile, John Rawls opinions on the differentiation of the rational and the reasonable and those of Immanuel Kant and Hannah
Arendt on the enlarged mentality can give direction to a normative concept of political judgement capability characterized by its orientation towards the pluralistic
polity.
ZfP 52. Jg. 1/2005
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 122 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
BUCHBESPRECHUNGEN
Eric VOEGELIN: Ordnung und Geschichte,
hg. von Peter J. Opitz und Dietmar Herz.
Bd. 1: Die kosmologischen Reiche des Alten
Orients - Mesopotamien und gypten, hg.
von Jan Assmann. Mnchen 2002. Wilhelm
Fink Verlag. 286 S., geb., 25,90 EUR.
Darstellungen der Geschichte der Philosophie oder des politischen Denkens nehmen
ihren Ausgangspunkt gewhnlich bei den
vorsokratischen Theoretikern Thales, Anaximander, Anaximenes oder bei den griechischen Klassikern Platon und Aristoteles. Das
jetzt auf Deutsch vorliegende Werk von Eric
Voegelin weicht davon in zweierlei Hinsicht
ab: Zum einen greift es ber das antike Griechenland in den zeitlich voraus liegenden
Kulturkreis der kosmologischen Reiche des
Alten Orients zurck, zum andern beschrnkt es sich nicht auf die Rekonstruktion
der Abfolge beliebiger (politischer) Ideen,
sondern sucht die allem menschlichen Selbstund Weltverstndnis zugrunde liegenden
Ordnungserfahrungen aufzuspren und
verstndlich zu machen. Ordnung und Geschichte, der Titel von Voegelins Hauptwerk, bringt dies im Kern zum Ausdruck:
Die entweder unartikulierte oder meist nur
symbolisierte Erfahrung von Ordnung ist
konstitutiv fr den Gang der Geschichte,
welche sich ihrerseits nicht als bloes Produkt willkrlicher Entscheidungen oder historischer Zuflle abtun lsst, sondern stets
auf unterschiedliche Konstellationen eines
umfassenden Ordnungsrahmens verweist.
Dieser Ordnungsrahmen besteht aus vier
Komponenten: Gott und Mensch, Welt und
Gesellschaft. Die je neue Mischung und Gewichtung dieser Faktoren bestimmen die Eigenart historischer Epochen.
Whrend der Arbeit an seinem Hauptwerk identifiziert Voegelin insgesamt drei
groe Symbolformen die Reiche des Alten
Orients entdeckten den Mythos, Israel die
Geschichte und Griechenland die Philosophie. Der kosmologische Mythos von Mesopotamien und gypten ist das Hauptkennzeichen ihrer Kultur. Ist er in zeitlicher
ZfP 52. Jg. 1/2005
Hinsicht charakterisiert als die erste symbolische Form, die von Gesellschaften geschaffen wird, sobald sie sich ber die Stufe
von Stammesgesellschaften erheben (S. 53),
so zeichnet ihn inhaltlich insbesondere der
intensive Bezug von Gott und Mensch aus.
Die Beziehungen zwischen Himmel und
Erde werden als so eng erfahren, dass die
Getrenntheit ihrer Existenzbereiche vllig
unscharf wurde (S. 81). Das Leben empfinden die Menschen als geordnet durch dieselben Krfte, die den Kosmos ordnen, so dass
auf der Basis der Analogie von Makro- und
Mikrokosmos das Bemhen um Integration
der Gesellschaft in die vorgegebene Ordnung zu den wichtigsten Anliegen der Menschen zhlt.
Vor dem Hintergrund dieses Gefges verdeutlicht Voegelin die Gesellschaftsstruktur,
die politische Ordnung und die geistigen Errungenschaften (Codex Hammurabi, Epos
Enuma elish, u. a.) dieser Kulturen. hnlich
wie der von Menschen bewohnte Staat ein
verkleinertes Gebilde der ihn bergenden
Ordnung darstellt, ein Kosmion im Vergleich zum Kosmos, kommt dem Knig als
Herrscher stets die wichtige Rolle der Reprsentation des Kosmos und des Bindeglieds
zwischen transzendenter und immanenter
Ordnung zu; der gyptische Pharao als GottKnig wird eingehend diskutiert. Die Nhe
von Gott und Mensch in den Reichen des Alten Orients gibt Voegelin Gelegenheit, auf
eine wichtige anthropologische Konstante
hinzuweisen: Von der Schpfung des Menschen durch Gott ist der Schritt nicht weit
zur Schaffung der Welt durch den Menschen.
Als Geschpf mit Gotthnlichkeit spielt der
Mensch seit der Zeit der kosmologischen
Reiche die (Doppel-)Rolle der Kreatur wie
die des Konkurrenten Gottes. Beispiele fr
den drohenden Verlust der Balance zwischen
beiden Rollen zeigt bereits die Geschichte
von Mesopotamien und gypten.
Dieser von Voegelin bereits 1956 geschriebene Band enthlt neben einem Vorwort von
P. J. Opitz und D. Herz zur deutschen Ausgabe von Order and History eine Einfh-
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 123 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
rung und ein Nachwort des Herausgebers (J.
Assmann), einen Aufsatz von P. J. Opitz
ber die Entstehungsgeschichte von Ordnung und Geschichte und eine Untersuchung von P. Machinist ber Mesopotamien
in Voegelins Darstellung. Die Aufstze beleuchten nicht nur Strken und Schwchen
der Voegelinschen Interpretation der kosmologischen Reiche, sie erleichtern auch die
Beschftigung mit seiner Theorie des kosmologischen Mythos, die bis heute zu den
wichtigsten und einflussreichsten kulturwissenschaftlichen Konzepten (Assmann,
S. 17) zhlt.
Mnchen
Harald Bergbauer
Eric VOEGELIN, Ordnung und Geschichte,
Bd. 4: Die Welt der Polis Gesellschaft, Mythos und Geschichte, hg. von Jrgen Gebhardt. Mnchen 2002. Wilhelm Fink Verlag.
236 S. geb. 25,90 EUR; Bd. 5: Die Welt der
Polis vom Mythos zur Philosophie, hg. von
Jrgen Gebhardt. Mnchen 2003. Wilhelm
Fink Verlag. 306 S. geb. 29,90 EUR.
Es gilt, zwei weitere Bnde der deutschen
bersetzung des monumentalen Werkes
Order and History von Eric Voegelin anzuzeigen. Es geht Voegelin darum, das
Ordnungsverstndnis der sich wandelnden
Welt (hier: der hellenischen Polis-Welt) und
damit die symbolische Selbstverstndigung
der griechischen Kultur zu analysieren.
Dass Voegelin das gelungen ist, steht auer
Frage. Aus heutiger Sicht erstaunt, wie aus
der Distanz von fast einem halben Jahrhundert die Darstellung nicht nur frisch und unverbraucht, sondern auch wissenschaftlich
zu groen Teilen nicht veraltet wirkt.
Zunchst ist der Ansatz modern, insofern
Voegelin die Griechen nicht isoliert betrachtet, sondern in Relation zur Kosmologe des
Alten Orients und zur Offenbarungsreligion Israels. Jedoch sieht Voegelin die Griechen mit Recht nicht als Fortsetzer der
Weltbilder anderer Vlker, sondern als
Schpfer eines Ordnungsgefges, in dem
Gott als das unsichtbare Ma des Menschen
gilt. Die Entwicklung eines derartigen Ordnungsgefges vollzieht sich fr Voegelin in
Seinssprngen (19). Was mit diesem nicht
ZfP 52. Jg. 1/2005
123
sehr glcklich gewhlten Ausdruck (englisch: leap in being) gemeint ist, bleibt allerdings etwas unklar. Nach Voegelin ist es das
Ringen um die Wahrheit der Ordnung auf
einer anderen Seinsstufe. Das ist zu schematisch gedacht angesichts des nicht immer linear verlaufenden Flusses geschichtlicher
Ereignisse und Ideen. Voegelin kommt es
darauf an, sichtbar zu machen, dass mit dem
Seinssprung auch ein neues Geschichtsbewusstsein entsteht und eine Erinnerungskultur, welche mit der geistigen Entdeckung
einer Vergangenheit zugleich den offenen
Horizont der Zukunft freilegt und schlielich zum Respekt vor jeglicher Ordnung
und vor jeglicher Wahrheit ber die Ordnung (41) fhrt. Das klingt modern, ist
aber doch ein Konstrukt, das der Wirklichkeit aufgesetzt wird. Ein Seinssprung, der
durch den Bruch mit dem Mythos markiert
ist, lsst auer Acht, dass der Mythos weiterlebt, revitalisiert werden kann, dass es
auch einen Weg vom Logos zum Mythos
geben kann. Hier ist Voegelin einem Fortschrittsdenken verhaftet, wie dieses in Bezug auf die griechischen Verhltnisse auch
Autoritten wie Bruno Snell, Werner Jaeger
und andere in ihren Arbeiten erkennen lassen, auf die sich Voegelin gelegentlich bezieht.
Zu Bd. 4: In der Analyse des konkreten
Materials, d.h. hier: der frhen griechischen
Literatur, ist Voegelin vorsichtiger. Die Behutsamkeit, mit der er die Strukturen der
kretischen und achischen Gesellschaften
aus den Quellen rekonstruiert hat, ist auch
heute noch vorbildlich. Seinerzeit war gerade die minoische Linear-B-Schrift entziffert
(dazu Voegelin S. 88) und die Forschung ist
naturgem weiter vorangeschritten, vor allem im Zusammenhang mit den Grabungen,
die der Tbinger Archologe und Prhistoriker Manfred Korfmann seit 1985 in Troia
unternimmt. Gleichwohl kann die Darstellung Voegelins nicht als berholt angesehen
werden.
Die Untersuchung ber die Ordnungsstrukturen der homerischen Gesellschaft
wirft ein helles Licht auch auf das Homerische Epos als Dichtung. Voegelin begreift
die Ilias als Episode der Unordnung in
einer Gesellschaft (S. 139), also als ein soziologisches Problem insofern, als der Zorn
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 124 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
124
Buchbesprechungen
des Achilleus mit Recht nicht als ein privater
Gefhlszustand, sondern als juristisches
Phnomen wie eine Fehde und demnach als
Strung der Ordnung begriffen wird. Entstehung, Verlauf und Auflsung diese Zornes als Inhalt der Ilias lsst sich auf diese
Weise zwanglos in die Kategorien von Order and History einfgen. Gewinnbringend fr das Verstndnis der Dichtung
selbst sind die vorzglichen Analysen des
zweiten Buches (Regierungsmaschinerie in
Aktion) und des dritten Buches (Zweikampf: Paris Menelaos, Bruch der auf
bereinkunft beruhenden Ordnung
durch den Pfeilschuss des Pandaros), whrend der jngeren Odyssee mit nur 2 Seiten gerade ein Zehntel des Raumes gegenber der Ilias gewidmet ist, beschrnkt auf
die Darstellung der Ordnungsstrung auf
Ithaka in Abwesenheit des Odysseus.
Mit 42 Seiten nimmt die Behandlung Hesiods doppelt so viel Raum ein wie diejenige
Homers. Hesiod ist Voegelin deshalb wichtig, weil er die Vorbereitung des Seinssprungs reprsentiert, der durch die Entstehung der Philosophie markiert ist. In der
Theogonie Hesiods, die Voegelin berzeugend als Aristie des Zeus (wie die
Aristie eines epischen Helden) nmlich als
Sieg ber die lteren Gottheiten interpretiert, ist diese Vorbereitung die spekulative
Durchdringung des Mythos (S. 161) mit
Ordnungskategorien. Die Erga bieten
groe Probleme fr die Epistemonologie
der politischen Wissenschaft (S. 198). Worin diese Probleme liegen, wird nicht restlos
klar. Voegelin meint offenbar eine im Weltaltermythos der Erga sprbare Relation
zwischen Realittserfahrung und apokalyptischer Vision, wie sie dann im Geschichtswerk des Tukydides (hier in dem Dialog der
Athener mit den Meliern im 5. Buch) auftaucht.
Zu Bd. 5: Die einhundert Seiten umfassende Analyse der frhgriechischen Philosophen drfte der beste Teil der beiden Bnde
sein.
Unbegreiflich,
dass
die
Vorsokratikerforschung die Flle der subtilen Beobachtungen (aus der englischen Ausgabe) nicht aufgenommen hat. Hier liegt
nun fr Voegelin der Seinssprung, der
Bruch mit dem Mythos und die Entdeckung
des reflexiven Selbstbewusstseins. Mit Recht
hebt Voegelin hervor, dass die Entwicklung
der frhgriechischen Philosophie nicht linear erfolgt, weder gleichfrmig noch kontinuierlich (S. 17) und auch nicht in Schulen. Weil Hellas im Unterschied zu den
Staaten des Vorderen Orients keine Brokratien und keinen Druck von Hierarchien
kannte, konnte das intellektuelle Abenteuer (S. 19), der Ausbruch einer neuen
Kraft (S. 72) sich frei entfalten, sei es in er
Form des Angriffs auf den Mythos (wie bei
Xenophanes), sei es im Kampf zwischen
den Wegen der Wahrheit (S. 79), in der
Unnachgiebigkeit im Argumentationsverlauf (wie bei Parmenides) oder in der Erforschung der Seele (wie bei Heraklit, S. 85
ff.), wobei der Ausdruck Mystiker-Philosophen (S. 102) nicht ganz unproblematisch ist.
Leider ist das Kapitel ber die Tragdie
(S. 109-135) nicht auf der gleichen Hhe.
Neben einigen allgemeinen und unoriginellen Bemerkungen ber die Tragdie im
Ganzen behandelt Voegelin nur die
Schutzflehenden und den Prometheus
des Aischylos Tragdien, die fr die Thematik des Werkes wenig ergiebig sind , um
dann noch zwei Seiten ber Euripides anzufgen. Kein Wort ber Sophokles, ber
Antigone und Oedipus, Tragdien, die
von zentralem Interesse fr die Fragestellung Voegelins gewesen wren. Stattdessen
macht sich Voegelin die weit verbreitete, auf
Nietzsche zurckgehende Auffassung vom
Tod der Tragdie durch und nach Euripides
zueigen. Eine Formulierung wie: Mit dem
Geist von Marathon musste auch die Tragdie sterben (S. 119) ist schlechthin falsch,
erklrt aber das vllige Schweigen Voegelins
ber Sophokles. Die Tragdie blhte weiterhin auch nach Euripides im ganzen 4. Jhdt.
mit zahlreichen neuen, uns verlorenen Tragdien unter gewiss vernderten Rahmenbedingungen. Nur weil die berlieferung
abbricht, ist die Tragdie nicht gestorben.
Sehr viel ausfhrlicher (S. 137-208) werden die Sophisten behandelt, in durchaus
angemessener Weise. Obwohl Voegelin
stark von Platon aus argumentiert, folgt er
mit Recht nicht dem Platonischen Verdikt
der Sophistik, sondern sieht sehr wohl die
groe Leistung der Sophisten (S. 146), der
allerdings ein philosophisches Defizit
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 125 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
gegenberstehe. Insgesamt versteht er die
Sophistik als die Reaktion der hellenischen
Intelligenz auf die vorsokratische Seinserfahrung. Dem kann man weitgehend zustimmen, wenn auch die Vielfalt der sophistischen Strmungen nicht ganz auf diesen
Aspekt reduzierbar ist. Merkwrdigerweise
wird in diesem Kapitel auch Demokrit behandelt (S. 172-179), der weder Vorsokratiker noch Sophist war, sondern ein erst ca.
370 gestorbener lterer Zeitgenosse Platons,
der dessen Politeia noch gekannt haben
kann, ber den Platon jedoch vllig
schweigt.
Der Band wird beschlossen durch die Untersuchung der Historiker Herodot und
Thukydides. Hier zeigt sich am reinsten die
Intention Voegelins, das geistige Erfassen
der Welt der Polis als Erinnerungsgeschichte
zu begreifen, mit eigenwilligen und nachdenkenswerten Akzenten. Bei Herodot
wird ein Pessimismus hervorgehoben (S.
222), der in der Unerbittlichkeit in der Umdrehung des Schicksalsrades liege, entgegen der communis opinio vom Stolz und
Optimismus auch des Historikers ber den
Sieg der Griechen ber die Perser. An Thukydides interessiert die Relation von Macht
und Recht; sein Geschichtswerk gilt Voegelin als Pathographie der Unordnung, der
Platon ein symbolisches Ordnungsmodell
aus transzendentem Ursprung gegenberstellen sollte.
Wer die beiden Bnde Voegelins liest,
sieht die Welt der Polis mit anderen Augen.
Er wird nicht in allem zustimmen, aber immer aufs Neue mit Beobachtungen, Problemen und Urteilen vertraut gemacht, die sowohl in den Einzelheiten wie in den
sinnbergreifenden Zusammenhngen oft
unerwartet zu Bereicherungen fhren, immer aber zum Nachdenken anregen. Das
gilt auch fr den Philologen, in dessen Metier sich Voegelin in bewundernswertem
Ausma eingearbeitet hat. Ob die Wissenschaft von der Politik heute diesem Niveau
gewachsen sein kann oder berhaupt will,
vermag der dankbare Rezensent nicht zu beurteilen.
Mnchen
ZfP 52. Jg. 1/2005
Hellmut Flashar
125
Eric VOEGELIN:, Jean Bodin, Reihe Periagoge, Nachwort u. hg. von Peter J. Opitz.
Mnchen/Paderborn, 2003. Wilhelm Fink
Verlag. 147 S. franz. Broschur 19,90 EUR
Dem Herausgeber Peter J. Opitz ist es zu
danken, dass Eric Voegelins ursprnglich
fr die History of Political Ideas bestimmten Studien zu einem der Groen in
der Ehrengalerie der Politischen Denker,
dem viel zitierten aber kaum gelesenen
Franzosen Jean Bodin (1529/30-1596), nun
auch dem deutschen Leser in einer vorzglichen bersetzung zugnglich geworden
sind. Die beiden Studien setzen unterschiedliche Akzente, haben aber letztlich dieselbe
Blickrichtung. Die krzere aus dem Jahre
1941 befasst sich strker mit der Staatslehre,
streift aber auch die Klimatheorie und die
Entwicklung der Toleranzidee. Auch bei ihr
ist schon erkennbar, was dann in der lngeren Fassung von 1948 beherrschend wird
die religionsphilosophische Interpretation
und wohl auch Motivation. Fasziniert
scheint der Polyhistor Voegelin nicht nur
von dem Polyhistor Bodin, sondern auch
von dem aus der lebendige(n) Mitte seiner
Religiositt heraus seine Werke zwar umstndlich und ohne stilistische Eleganz, dafr meist punktgenau komponierenden
Kosmologen Bodin zu sein. Was bei den
meisten Bodin-Interpretationen (wenn
berhaupt) am Rande der Betrachtung steht
die Geschichtsphilosophie, die Klimatheorie und die Toleranzidee rckt in Voegelins
Interpretation ins Zentrum der Betrachtung.
Und auch die Staatstheorie mit dem Focus
der Souvernittslehre wird in ein (para)kosmologisches Gesamtbild eingefgt.
Nicht nur der knigliche Souvern, von Bodin als lieutenant de Dieu apostrophiert,
ist in seiner kraft der summa in cives ac
subditos legibusque soluta potestas Durchgriffsmacht ein gttliches Analogon, sondern auch die Stnde reihen sich in das Trabantensystem der Himmelsmchte. Wie
Opitz in seinem den Kontext erhellenden
Nachwort belegt, fhlte sich Voegelin sptestens seit 1934 von Bodin stark angezogen.
Und man mag nach der Lektre dieser beiden Bodin-Studien mit gutem Grunde den
Eindruck gewinnen, dass die Akzentsetzung
der Voegelinschen Bodin-Darstellung eben-
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 126 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
126
Buchbesprechungen
soviel ber Voegelin selbst wie ber Bodin
aussagt, zumal er bei seiner partiellen Verteidigung problematischer Positionen und Passagen der Dmonomanie wie bei der Deutung des Heptaplomeres recht deutlich
seine Partialidentifizierung mit der Bodinschen Haltung auch dort noch zum Ausdruck bringt, wo er ihre Grenzen betont:
Der geistigen Krise des 16. und 17. Jahrhunderts war so wenig durch Hexenverbrennungen zu begegnen wie heutzutage
dem totalitren Gestank des degenerierten,
aufgeklrten Liberalismus. Und noch deutlicher: Ihrem tieferen historischen Sinn zufolge ist Toleranz nicht die Gleichgltigkeit
jener geistigen Obskuranten, die heute unsere Landschaft verpesten (. .).
Was aber ist fr Bodin und den ihn deutenden Voegelin der tiefere Sinn der Toleranz jener Toleranz, die nicht nur im Mittelpunkt des Siebenmnnergesprchs
steht, die vielmehr den geistigen Ansprchen des um die Beendigung des konfessionellen Brgerkrieges bemhten Politique
und Autor der Six livres de la Rpublique
motiviert? In der zweiten Fassung der Bodin-Studie wird dies hinreichend deutlich;
es ist die Toleranz der die historischen Religionen bzw. Konfessionen lediglich als
Schleiersymbole erkennenden und durchdringenden vera religio, deren unablssiges Bemhen, den sich reinigenden oder
gar gereinigten Geist zu Gott aufsteigen zu
lassen, nichts mit der geistlos-mden Indifferenz eines angeblich aufgeklrten Agnostizismus zu tun haben will, Bodin aber (was
auch Voegelin einrumen muss) in der
Dmonomanie bers Ziel hinausschieen
lsst. Der tiefere Sinn erhellt die Sinnlosigkeit des Streites um konfessionelle Subtilitten, im Wortgefecht und erst recht in den
Greueln des konfessionellen Brgerkriegs,
den der nur mit knapper Not den Schlchtern der Pariser Bluthochzeit von 1572
entkommene Bodin schon existentiell in
hchstem Mae motivieren musste. Bodins
Toleranz ist eine wehrhafte Toleranz, eine
Toleranz die das Wort des Albericus Gentilis Silete theologi in munere alieno aufgreift und dieses Schweigen der Theologen
auf fremder Bhne nicht zuletzt dem souvernen Friedensstifter anvertrauen will
ein Traum, der mit dem Toleranzedikt von
Nantes Heinrichs IV wenigstens auf Zeit
wahr werden sollte.
Voegelin prsentiert das Bild eines sich
mehr oder minder bedeckt haltenden, aber
eben doch unverkennbaren Gnostikers, ja,
mehr noch Gottgesandten: Bodin war (. .)
ein Engelsbote, ein Prophet, dem es oblag
den Kern der wahren Religion zu bewahren und aufzudecken und die Gemeinschaft
zur Hinwendung zu Gott anzuleiten.
Voil.
Mnchen
Peter Cornelius Mayer-Tasch
Hans MAIER (Hrsg.): Totalitarismus und
Politische Religionen. Band III: Deutungsgeschichte und Theorie, Paderborn 2003,
Schningh Verlag, 450 S., kart. 34,90 EUR
Was bleibt, ist die dauernde Frage nach dem
Warum?: Warum kam es in der ersten
Hlfte des 20. Jahrhunderts zu gewaltttigen
Exzessen, zu Staaten- und Brgerkriegen, zu
Massenmorden in bislang unbekanntem
Ausma? Des weiteren: Aus welcher Quelle
speisten sich die ungeahnten Energien, mit
denen die totalitren Ideologien des italienischen Faschismus, vor allem aber des sowjetischen Kommunismus und des deutschen
Nationalsozialismus, ihre Wirkungskraft in
hchst unterschiedlichen Staaten- und Gesellschaftssystemen entfalten und ganze
Volksmassen zu Begeisterungsstrmen in Erwartung einer heilvollen Zukunft bewegen
konnten?
Seit Jahrzehnten wird bekanntlich um entsprechende Antworten in den verschiedenen
Geisteswissenschaften gerungen, werden
Kontroversen, inhaltliche wie begriffliche
um das adquate Deutungsmodell jener
1917, 1922 und 1933 in aufflliger zeitlicher
Koinzidenz entstandenen Herrschaftssysteme ausgetragen und immer wieder neue gegen alte Interpretationsanstze abgewogen.
Der deutsche Historikerstreit, am Vorabend des Zusammenbruchs der kommunistischen Diktaturen in Mittel- und Osteuropa
um die Frage der Zulssigkeit eines Vergleichs von nationalsozialistischem und sowjetkommunistischem Terrorregime im Zeichen der Totalitarismustheorie(n) gefhrt, ist
bis heute in unguter Erinnerung. Immerhin,
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 127 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
der antitotalitre Konsens, damals noch
heftig umstritten, eint heute die scientific
community, obgleich dessen theoretische
Grundlagen noch immer in der Luft hngen, wie Hans Maier in einem einfhrenden
Beitrag ber die Deutung totalitrer Herrschaft 1919-1989 zu dem nun vorliegenden
dritten Band ber die Deutungskonzepte des
Totalitarismus und der Politischen Religionen bemerkt. Bereits vor dem Erscheinen des abschlieenden Forschungs-Bandes
mit Beitrgen von Hans Maier, Juan J. Linz,
Hella Mandt und anderen, war klar: Das groe Verdienst des von 1992 bis 2002 am Institut fr Philosophie der Universitt Mnchen
angesiedelten und von Hans Maier federfhrend initiierten interdisziplinren Projekts
besteht nicht nur in einer fundierten, geradezu vorbildlichen Bilanz der bisherigen Totalitarismus-Forschung und ihrer Kontroversen, sondern vor allem auch in einer
zukunftsweisenden Rckerinnerung an das
Deutungskonzept der politischen Religionen, wie es sich heute mit den Namen Eric
Voegelin und Raymon Aron verbindet (dass
der Begriff der politischen Religion weit
lter ist und weder von Aron noch von Voegelin geprgt wurde, macht Hans Otto Seitschek in einem kenntnisreichen Beitrag ber
Campanella und George Thomson und deren Verwendung des Begriffs religio politica im vorliegenden Band deutlich).
Was Anfang der neunziger Jahre vereinzelt
noch als verstaubtes Interpretationsparadigma eines berwundenen Zeitalters ideologischer Staaten- und Brgerkriege samt deren
bis dato unbekannten Verheerungen belchelt wurde eben die interpretative Einbeziehung der subjektiven Glubigkeit von
Millionen Menschen und ihre daraus resultierende unbedingte Hingabe an die neuen
innerweltlichen Heilsbotschaften im Namen
der Reinheit der Rasse bzw. des historischen Sieges der Arbeiterklasse in die Aufklrung des totalitren Dunkels der Moderne , hat mit den grauenvollen Ereignissen
des 11. Septembers 2001 und der daraus resultierenden medialen Omniprsenz des
Phnomens islamistischer Fundamentalismus eine erschreckende Aktualitt gewonnen. Auch das letzte Lcheln war nun Rat suchendem Entsetzen gewichen. Tatschlich
lsst sich seither die Notwendigkeit einer
ZfP 52. Jg. 1/2005
127
eingehenden Beschftigung mit dem Verhltnis von Politik und Religion, von Glaube
und Vernunft, Ideologizitt, Transzendenz
und conditio humana, fr die der Herausgeber mit der nun vorliegenden Trilogie eine
wertvolle Grundlage geschaffen hat, kaum
ernsthaft bezweifeln. Die Dialektik der Aufklrung, wie es sie zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu begreifen gilt, sie verweist zurck auf die anthropologische Disposition
des Menschen, die einst in dem schlichten
Satz ihren Ausdruck fand: Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein. (Matthus 19, 26).
Bonn
Volker Kronenberg
Werner ABELSHAUSER: Kulturkampf. Der
deutsche Weg in die Neue Wirtschaft und die
amerikanische Herausforderung. Berlin,
2003. Kulturverlag Kadmos. 232 S., geb.,
19.90 EUR
Wie wirtschaftshistorische Analysen zu einer
Option fr die politische Zielrichtung der
Gegenwart gefhrt werden, das kann in der
vorliegenden Zusammenstellung der vom
Verf. am Kulturwissenschaftlichen Institut
Essen gehaltenen Pott-Vorlesung vorbildlich
nachgelesen werden.
Das dazu gewhlte Thema ein kulturhistorischer Vergleich von kontinentaleuropischem und angelschsichem Denken mit ihren Folgen fr das konomische Verhalten
der Individuen wie fr die Gestaltung der
Wirtschaftsordnung ist von aktuellster Brisanz. Die Amerikanisierung unseres kulturellen, politischen und konomischen Lebens wird allerorts beklagt, doch mangelt es
solchen Weherufen zumeist an analytischer
Fundierung und erst recht an aufgezeigten
Auswegen. Die aktuelle politische Diskussion scheint oft sprachlos angesichts rasanter
Vernderungsprozesse. Ein Lavieren zwischen Anpassung und Festhalten am Bewhrten ohne klare Linie ist gegenwrtig ein
Grund fr die Orientierungslosigkeit deutscher Kultur, Wirtschaft und Politik. Die als
Kulturkampf ebenso provokant wie treffend berschriebenen Studien beleuchten die
inneren Abhngigkeiten der Lebensbereiche
und zeigen davon ausgehend vor allem anhand des Vergleichs Deutschlands mit den
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 128 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
128
Buchbesprechungen
USA klare Entwicklungslinien auf, die in einem Pldoyer fr eine zeitgeme Renaissance traditionellen Denkens mnden.
Die Hysterie um die vermeintlich identittsgefhrdenden Folgen der aktuellen Globalisierungseffekte wird relativiert mit dem
Hinweis auf eine lange Tradition evolutionr
zunehmender internationaler Wirtschaftsverflechtungen. Der Grund fr die zunehmende Orientierungslosigkeit liege vielmehr
in einem mangelnden Bewusstsein der Qualitten, die in der Vergangenheit den Erfolg
deutscher Wirtschaft ausgemacht haben.
Ausgehend von einer Analyse der Wirtschaftshistorie in Deutschland gelingt so eine
prgnante Gegenberstellung zweier konkurrierender Paradigmen. Der korporative
(und weniger der liberale) Gedanke durchzieht die deutsche Kulturgeschichte. Zunftwesen und Verbnde entstanden anders als
im angelschsischen Raum aus Freiheitsbewegungen. Genossenschaften und Kartelle
hatten sich zwar mancher Kritik zu unterziehen, doch kristallisierte sich mehr und mehr
eine Identifikation mit dem Korporationsmodell heraus: Es beschreibt den Vorgang
des Interessenausgleichs nicht als Marktprozess, dessen Funktionsfhigkeit auf dem
Prinzip des Wettbewerbs beruht, sondern als
politisches Kartell der groen gesellschaftlichen Gruppen, die den Markt in enger Kooperation unter sich aufteilen (S. 58ff.). Aus
dieser Sicht heraus wurde schon frh die zunehmende Liberalisierung der Mrkte in
Grobritannien kritisch (Johann J. Becher)
kommentiert. Im deutschen Modell gelang
ber eine Weiterentwicklung traditioneller
feudaler Strukturen und starker Beamtenschaft im Kaiserreich der Aufbau einer konkurrenzfhigen Wirtschaft, die ihren Erfolg
gerade dem eigenen Weg von Qualittsproduktion, kooperativem Vertrauen, sozialen
Tugenden verdankt. Trotz der amerikanischen Einflsse (z. B. Fordisierung in der
Automobilindustrie) konnte stets das eigene
Profil gewahrt bleiben. Die radikalen konsensfeindlichen Krfte von links und rechts
erst fhrten zum Ende der Weimarer Republik. Nach dem Krieg ist jedoch z. B. im Ordnungsmodell der sozialen Marktwirtschaft,
dem Mitbestimmungsgedanken oder der Tarifautonomie in Fortfhrung traditioneller
Werte eine korporative Marktwirtschaft ent-
standen, die auf der Grundlage der Soziabilitt des Menschen zur Quelle des Wohlstands
wurde.
Die Versuchung ist gro, eine produktionsorientierte Ordnungspolitik dem amerikanischen Liberalisierungsdrang zu opfern.
Der Erfolg des deutschen Sonderwegs beruht aber gerade in einer dezentralisierten
Wirtschaft mit einem starken Mittelstand.
Diese Leistungspotenziale gelte es durch gezielte Ausbildung auszuschpfen, um die
komparativen Vorteile des deutschen Weges
auch in Zukunft international nutzbar machen zu knnen. Eine solche politische
Grundorientierung wird empirisch unterlegt zum realistischen Ziel internationaler
Arbeitsteilung empfohlen.
Der historisch fundierte Imperativ zum
Bekenntnis eigener Qualitten ermutigt zu
einer selbstbewussten deutschen Politik, die
ihr Profil aus einem mittel- und langfristigen
Verstehen ihrer komparativen Vorzge gewinnt und sich vom Populismus abwendet.
Diese Analyse sollte zum Brevier deutscher
Politiker und zum Ansto fr einen kultur-,
wirtschafts- und politikwissenschaftlichen
Patriotismus humaner Prgung werden.
Bochum
Elmar Nass
Mark JUERGENSMEYER, Terror im Namen
Gottes. Ein Blick hinter die Kulissen des gewaltttigen Fundamentalismus. Freiburg im
Breisgau 2004. Herder Verlag. 384 S. geb.
26,90 EUR.
Die sozialrevolutionren und ethnisch-nationalistisch motivierten terroristischen Organisationen sind weitgehend von der Agenda der ffentlichen Meinung verschwunden.
Dem gegenber zeigt sich die lteste der terroristischen Formationen von neuer und
ungekannter Schlagkraft. Der religis motivierte Terrorismus beherrscht die Berichterstattung in den Medien und damit auch die
ffentliche Diskussion. Ein entscheidendes
Manko der Auseinandersetzung mit dem religisen Fundamentalismus ist dabei seine
Einengung auf den Islamismus im Allgemeinen und das Netzwerk Al Qaida im Besonderen. Doch ist weder der Fundamentalismus und die durch ihn inspirierte Militanz
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 129 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
ein auf eine Religion beschrnkbares Phnomen noch leitet sich die Motivation Al Qaidas ausschlielich aus religisen Beweggrnden ab.
Beide Grundprobleme einer Differenzierung zuzufhren ist das Anliegen Juergensmeyers. Angereichert durch zahlreiche Interviews mit Exponenten und hochrangigen
Mitgliedern der jeweiligen Organisationen
entwirft er ein luzides berblicksbild des
religisen Terrorismus gestern und heute.
Zum einen schildert er die Genese religis
motivierter Formen der Gewalt in allen monotheistischen Glaubensrichtungen. Neben
den christlich motivierten, gewaltttigen
und organisierten Abtreibungsgegnern sowie den rechtsextremistischen Gruppierungen in den USA widmet er sich daher auch
dem jdischen Terrorismus, dem islamistisch inspirierten Aktionismus, der Militanz
der monotheistischen Sikhs in Indien wie
der buddhistisch-millenaristischen Endzeitsekte AUM-Shinriko in Japan. Im Anschluss daran entwirft Juergensmeyer eine
Logik religiser Gewalt, die sich durch verschiedene Variablen auszeichnet. Zunchst
betont er den inszenatorischen und dramaturgischen Charakter des religis inspirierten Terrorismus. Um zu einer grtmglichen medialen Verbreitung der eigenen
Anliegen zu gelangen, ist der Terrorist darauf angewiesen, den Anschlag ex ante generalstabsmig durchzuplanen und ihn einer strikten Organisation zu unterwerfen.
Der zweite Aspekt betrifft die zeitliche Dimension: Religis motivierte Terroristen
denken nicht in Zeitrumen von Legislaturperioden, sondern wissen, dass sie fr ihre
gttliche Mission faktisch unbegrenzt lange
Zeitperioden zur Verfgung haben, in welchen das eigene Leben eine nur nachrangige
Rolle spielt. Einen zentralen Aspekt bildet
hierbei der Symbolismus: Je mehr das getroffene Ziel stellvertretend fr die bekmpfte Ordnung ist, desto eher wird von
dem Ereignis Anschlag Notiz genommen.
Diese Variablen erhellend und lebendig dargestellt zu haben, gehrt zweifelsohne zu
den zahlreichen Strken des Buches.
Daneben ist jedoch auch auf mehrere Monita hinzuweisen. Dass sich Juergensmeyer
auf seinen eigenen Forscherdrang und besonders auf die von ihm im Laufe mehrerer
ZfP 52. Jg. 1/2005
129
Jahre durchgefhrten Interviews sttzt, erhht zweifellos die Authentizitt seiner
Darstellung. Problematisch wird diese Vorgehensweise allerdings dann, wenn er damit
nur bestimmte Flgel oder Faktionen innerhalb einzelner Gruppierungen bercksichtigt wie am Beispiel des Sikhismus, oder
wenn er seine Analyse vor allem auf einen
Aussteiger sttzt wie im Falle der AUMSekte. Auerdem ist sein Entwurf einer Logik religiser Gewalt kaum neu und unterscheidet sich darber hinaus auch nicht von
anderen Formen des Terrorismus. Die Fokussierung der terroristischen Aktion auf
symbolhaltige Institutionen und die Inszenierung der Gewalt kennen und verfolgen
auch ethnisch-nationalistische und sozialrevolutionre Organisationen. Die Nutzung
der Medien als Transmissionsriemen fr die
eigenen Anliegen ist also keine differentia
specifica religiser Terroristen. Auch fehlt
eine konsequente Einordnung der daraus resultierenden Eigendynamik. Dass von der
AUM-Sekte im Ausland niemand Notiz genommen htte, wre nicht Saringas zur Anwendung gekommen, verschweigt Juergensmeyer deshalb auch, ebenso wie die
Tatsache, dass das Gas uerst laienhaft ausgebracht wurde. Eine generelle technische
Schwierigkeit, die Terroristen jedweder
Couleur bis heute davon abgehalten hat,
groflchig Anschlge mit chemischen Waffen durchzufhren. Zynisches Faktum
bleibt: Wren die zwlf Opfer des Tokioter
Gasattentates durch Gewehrfeuer gettet
worden, wre es nur eine kurze Nachricht
wert gewesen und bereits heute der Vergessenheit anheim gefallen. Bleiben diejenigen
Ungereimtheiten, die Juergensmeyer nicht
zu verantworten hat. Zwischen der Terrorismusforschung diesseits und jenseits des
Groen Teiches tun sich begriffliche Grben
auf, welche auch der bersetzer nicht zu
berwinden vermag. Wird in der relevanten
deutschen Literatur stets zwischen Terror,
Terrorismus und Guerilla unterschieden,
verschwimmen die Grenzen in der angelschsischen Literatur und hinterlassen bei
der Lektre einen schalen Beigeschmack.
Der Gesamteindruck ist daher zwiespltig. Wie das Gros der angelschsischen Literatur besticht Juergensmeyer durch die Luziditt und Stringenz seiner Sprache und
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 130 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
130
Buchbesprechungen
Darstellung sowie seine Quellennhe. Keinesfalls aber kann dies ber die methodischen und logischen Schwchen seiner Darstellung hinwegtuschen. Das Buch richtet
sich in seiner gesamten Konzeption zwar
weniger an Wissenschaftler als vielmehr
auch an generell an der Thematik Interessierte, mitunter drngt sich dem aufmerksamen Leser allerdings der Eindruck auf, dass
hier auf der Welle der hektischen Aufmerksamkeit am religis motivierten Terrorismus
geritten wird. Der Anspruch der Differenzierung der religisen Problematik ist daher
nur teilweise geleistet.
Regensburg
Alexander Straner
Heinrich OBERREUTER / Armin A. STEIN/ Hans-Frank SELLER (Hg.): Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Perspektiven zur
neuen internationalen Staatenordnung. Festschrift fr Prof. Dr. Jrgen Schwarz. Wiesbaden 2004. Verlag fr Sozialwissenschaften.
567 S. kart. 49,90 EUR.
KAMM
Einen Gelehrten wie Jrgen Schwarz mit einer Festschrift zu ehren stellt fr die Herausgeber ein schwieriges Unterfangen dar.
Wie ehrt man wissenschaftlich einen Mann,
der sich im Verlaufe seiner mehr als vierzigjhrigen akademischen Laufbahn mit einem
breiten Spektrum an Themenfeldern, die
von der Rolle der deutschen Studentenschaft in der Weimarer Republik ber die
politische Rolle des Katholizismus hin zur
Internationalen Politik und hier insbesondere zur Rolle Asiens reichen? Den Herausgebern dieser Festschrift ist es gelungen, Beitrge aus diesem breiten Themenspektrum
in einem Buch zu versammeln, ohne dass die
Festschrift wie oftmals ein Sammelsurium
unterschiedlichster Beitrge darstellt, deren
einziger Zweck die Ehrung eines Gelehrten
ist. Vier Kapitel bilden den Rahmen, in dem
sich verschiedene Beitrge einordnen. Das
erste Kapitel befasst sich weitlufig gesprochen mit aktuellen Entwicklungen der Internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert.
Hier sind es vor allem Beitrge zur konomischen und politischen Globalisierung, die
versammelt werden, wobei sich zwei Autoren mit den Auswirkungen der Globalisie-
rung auf Transformationslnder (Alfred
Schller) sowie auf Ostasien und Lateinamerika auseinandersetzen (Manfred Mols).
Diese beiden Beitrge sind unter anderem
deshalb anregend, weil sie den Blick auf das
Phnomen der Globalisierung auf Regionen
lenken, die blicherweise nicht im Fokus
der deutschen Politikwissenschaft stehen.
Aber auch Fragen zur Rolle von Religionen
(Gottfried Kenzlen, Anton Rauscher) finden in diesem Kapitel ihren Platz.
Nach diesen eher generellen Perspektiven
wird das zweite Hauptkapitel der Festschrift konkreter und wendet sich der
Frage nach universeller Friedenssicherung
und internationaler Kooperation zu. Politikwissenschaftler,
Vlkerrechtler
und
Militrs gehen hier verschiedenen Aspekten
der Friedenssicherung und der Kooperation
nach, die von dem Einfluss der geistlichen
Traditionspflege beim Militr (Hans-Jrgen
Brandt) ber die Rolle und Aufgabe des
Hohen Flchtlingskommissars (Ursula
Mnch) bis hin zu den vlkerrechtlichen
Konsequenzen des Irak-Krieges (Armin A.
Steinkamm) reichen. Oftmals sind die Beitrge im Lichte der Ereignisse des 11. Septembers verfasst worden und versuchen, die
Implikationen dieses Ereignisses fr die Internationale Politik des 21. Jahrhunderts zu
erfassen (z.B. der Beitrag von Andreas Wilhelm).
Nachdem die beiden ersten Kapitel den
Blick auf generelle globale Fragen lenken,
wendet sich das dritte Kapitel Europa zu, einer Region, die im akademischen Schaffen
von Jrgen Schwarz seit jeher eine bedeutende Rolle eingenommen hat. Auch hier ist
es zum einen Aktualitt, die die verschiedenen Beitrge kennzeichnet (Thomas Jansen,
Kurt Schelter), und ein besonderes Augenmerk fr die Beziehungen der EU zu den
sogenannten Entwicklungslndern (Wulfdieter Zippel, Heribert Weiland). Das letzte
Kapitel widmet sich Aspekten unipolarer
und multipolarer Ordnungsgestaltung. Hier
erstaunt es allerdings, dass sich streng genommen nur die Beitrge von Christian Hacke und von Joachim Krause mit dieser Frage
auseinandersetzen,
whrend
sich
ansonsten Beitrge zur Herausforderung
durch Klimawandel (Rotte), zu den
deutsch-sowjetischen Verhandlungen von
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 131 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
1955 (Boris Meissner) sowie der Rolle von
Gerichtshfen in den USA (Wolf D. Fuhrig)
in diesem Kapitel versammeln. Hier wiederholt sich bedauerlicherweise das, was Festschriften oftmals kennzeichnet: ein Sammelsurium von Aufstzen, die einzig und allein
dadurch verbunden sind, dass ihre Autoren
dem zu Ehrenden freundschaftlich oder kollegial verbunden sind.
Dieses Monitum soll aber nicht die Tatsache verschleiern, dass es den Herausgebern
des zu rezensierenden Buches vortrefflich
gelungen ist, nicht nur eine wrdige Festschrift zusammenzustellen, sondern darber
hinaus auch Beitrge zu versammeln, die
sich aktuellen Fragen der Internationalen
Politik widmen und zugleich Anregungen
zur Reflexion und zu einer vertieften wissenschaftlichen Diskussion liefern.
Rom
Carlo Masala
Christian Graf von KROCKOW: Die Zukunft
der Geschichte. Ein Vermchtnis. Mnchen
2002. List Verlag. 208 S., geb., 20, EUR
Er war einer der groen Wissenschaftler und
Publizisten der Bundesrepublik Deutschland: Christian Graf von Krockow, im Jahre
2002 im Alter von 76 Jahren verstorben,
stellte in zweierlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung seiner Zunft dar. Zum einen
verstand er es wie wenige andere Gelehrte
ber Jahrzehnte hinweg, mit seinen oftmals
biographisch angelegten Werken eine groe
Leserschaft fr Grundfragen deutscher Geschichte zu interessieren. Zum anderen
tauschte Krockow 1969 - nach nur acht Jahren - seine akademisch gesicherte Position
als Professor fr Politikwissenschaft an der
Universitt Frankfurt a. M. zugunsten einer
unabhngigen Existenz als Wissenschaftler
und Publizisten ein. Die geistige, schpferische Freiheit, die ihm wichtiger war als institutionelle Anbindung und sonstige akademische Zugehrigkeiten, sie prgte die
zahlreichen Werke Krockows, deren letztes
nun, als Vermchtnis ausgewiesen, Die
Zukunft der Geschichte in den Blick
nimmt. Allgemeine Betrachtungen ber Geschichte, Geschichtsphilosophie, Utopie und
Anthropologie gipfeln in einer Analyse
ZfP 52. Jg. 1/2005
131
deutschen Geschichtsbewusstseins, das
Krockow durch zwei extreme Tendenzen
bedroht sieht: durch eine vor allem in der
jungen Generation zunehmende Geschichtsvergessenheit, welche in der Frage, ob Hitler
vor Asterix oder danach war, ihren traurigen Ausdruck findet; zum anderen durch
eine Geschichtsversessenheit, die, eifernd,
gar zu Hysterie neigend, deutsche Geschichte auf die Zeit von 1933 bis 1945, vor allem
auf den nationalsozialistischen Massenmord, zusammenschmilzt. Krockow sieht
letzteres Extrem einer tief verwurzelten Unsicherheit der Deutschen im Umgang mit ihrer eigenen Geschichte geschuldet, einer Art
Vergessenheitsangst
(Peter
Reichel).
Angst, Eifer, Hysterie Geschichte wird zur
Obsession oder zum Tabu.
Tatschlich legen die zahlreichen geschichtspolitischen Kontroversen der vergangenen Jahre, so auch jener um die Frage
der Singularitt der nationalsozialistischen
Judenvernichtung gefhrte Historikerstreit fr Krockow den Schluss nahe, dass
die Fixierung auf den Zivilisationsbruch
Auschwitz zu einem Denkverbot gefhrt
habe. Scheuen wir den Vergleich, weil er
uns noch einmal und endgltig zu Verlierern
machen, nmlich das Bewusstsein zerstren
knnte, wenigstens im Negativen einmalig
zu sein? Oder ngstigen wir uns insgeheim,
beinahe vorbewusst davor, unsere seit 1945
glcklich erreichte Ansiedlung in der offenen Gesellschaft der westlichen Zivilisation
wieder erschttert zu sehen? Der Autor
fhrt diesbezglich die Erfahrungen des
11. September 2001 an: Ebenso hufig wie
falsch seien die Terrorattacken auf New
York und Washington in Deutschland als
przedenzlose Ereignisse bezeichnet worden, obwohl die Parallelen der ideologischverblendeten Untaten zu den totalitren
Ideen und Taten in der ersten Hlfte des 20.
Jahrhunderts doch offenkundig seien. Wer
die bereinstimmung zwischen den Triebfedern der Gewaltherrschaft des Dritten
Reiches und denen der heutigen Terroristen bersehe, zeige eine Geschichtsblindheit, ber die man nur staunen kann und die
unserer Gedenkkultur ein verheerendes
Urteil ausstellt.
Cum grano salis: Was ntzt die stndige
Mahnung an die Lehren der Geschichte,
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 132 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
132
Buchbesprechungen
wenn an die Stelle historischer Einsicht nur
leere Formeln geschichtspolitischer Gesinnung treten, wenn Auschwitz volkspdagogisch verinselt wird statt Bezugspunkt
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts
zu bleiben. Nach wie vor gilt: Wer historische Ereignisse relationiert, relativiert damit keineswegs moralische Urteile.
Krockows wissenschaftliches Vermchtnis ist ebenso unbequem wie unmissverstndlich.
Unbequem
deshalb,
weil
Krockow, als Wissenschaftler ber jeden revisionistischen Zweifel erhaben, nicht als
geschichtsgrbelnder Exzentriker ignoriert
werden kann, der die Vergangenheit vergehen lassen will. Krockow kndigt keinen
Konsens mit dem Ziel einer moralischen Relativierung des Nationalsozialismus und
Hitlers Vernichtungspolitik auf, mitnichten. Er kndigt aber jenen stillschweigenden
Konsens auf, der deutsche Geschichte auf 12
Jahre totalitrer Herrschaft reduziert und
jeden vergleichenden, sprich relationierenden Forschungsansatz unter moralisierenden Generalverdacht stellt. Der Autor tut
dies in seinem letzten Buch, bei aller Konzilianz der Formulierungen, vielleicht entschiedener als in seinen vorangegangenen
Werken, weil er die Freiheit der Wissenschaft und damit die Freiheit der Menschen
durch Geschichtsvergessenheit ebenso sehr
gefhrdet sieht wie durch Geschichtsbesessenheit. Es schliet sich der Kreis: Die Zukunft der Geschichte, sie ist, im Bewusstsein
der conditio humana, fr Krockow allein
der Freiheit der Menschen, weder Utopien
noch Teleologien, geschuldet.
Krockows Vermchtnis, es verpflichtet zu
unbequemen Fragen und erinnert an das
Ethos von Wissenschaft. Unmissverstndlich.
Bonn
Volker Kronenberg
Giorgio AGAMBEN: Ausnahmezustand.
Frankfurt a.M. 2004. Edition Suhrkamp. 113 S.
9 EUR.
In Zeiten des seit dem Ersten Weltkrieg tobenden weltweiten Brgerkrieges stellt sich
die grundstzliche Frage nach der Legitimation von Herrschaft in neuer Dringlichkeit.
Agamben verortet diese Frage in der unbestimmten Zone zwischen Gewalt und
Recht, die sich in der immer deutlicher werdenden Biopolitik anzeigt, in der das
nackte Leben der Menschen, staatlichem
Terror oder auch nur Dispositionen der
technisch-konomischen Entwicklung in
Sozial- und Bevlkerungspolitik ausgesetzt
ist. Sein neues Buch schliet an die frheren
Publikationen Homo sacer und Was von
Auschwitz bleibt an und zeigt die rechtshistorischen und politischen Bezge der Legitimationskrise, in der wir uns befinden.
Hinter der Maske des Rechtsstaates lauert
stets sprungbereit die direkte Gewalt nicht
nur des Terrorismus, auch des Staates, der
aus dem Terror kommt. Freiheit und Wrde
des einzelnen konfligieren mit der Sicherheit
des Staates und der einzelnen im Staat in
den unterschiedlichsten Konstellationen.
Agamben sieht in dem spannungsreichen
Zusammenhang der auctoritas des Senates,
des politischen Pendants zur auctoritas patrum, mit der potestas des Magistrats, wie sie
sich im antiken Rom zeigte, die zum
Rechtszustand fhrende Kraft. Das Spezifische der auctoritas zeigt sich in Situationen
der Suspendierung des Rechts in denen
das Recht nicht gilt ohne aufzuhren Recht
zu sein - in Situationen, in denen die lebensweltliche Verankerung des Rechts sich zeigt.
Durchaus sieht Agamben, dass solche Verankerung auch in anderem Kontext zum
Tragen kommt in der Bestimmung des
Knigs als nomos empsychos, in der Machtbefugnis des Augustus etwa. Hier tritt der
Machthaber an die Stelle, die das Recht mit
Leben erfllt. Stirbt er, herrscht Ausnahmezustand, Trauer um den verstorbenen
Souvern. Diese Trauer hat Festcharakter,
hat anomische Zge. Sie ist zeitlich begrenzt. Mit Recht wird betont, dass es auf
die Korrelation von Macht und Recht, auctoritas und potestas ankommt, soll ein Zustand des Rechts herrschen wie dies im alten Rom, in anderer Weise in der
mittelalterlichen Dualitt von geistlicher
und weltlicher Macht der Fall war.
Heute aber herrscht der biopolitische
Ausnahmezustand, wird Agamben nicht
mde, uns einzuschrfen. Indirekt zeigt er,
dass dies seit der Moderne, seit Renaissance
und Revolution der Fall ist. Es gibt keine le-
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 133 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
bensweltliche Verankerung der Souvernitt mehr, vielmehr die eine biopolitische
Maschine, die jeden einzelnen bis ins Innerste von Leib und Seele bestimmt. Agamben gibt eine spannende Kurzfassung der
Geschichte des modernen Ausnahmezustandes, die wie zufllig mit der Entwicklung der franzsischen Revolution einsetzt
und ber die Weltkriege in unsere Zeit mit
den typischen Beschrnkungen der parlamentarischen
Gesetzgebung
durch
Verwaltungsmanahmen und dem Vorrang
der Sicherheit reicht. Er behandelt die im
Geflecht von Brgerkriegen, Aufstnden,
sich etablierenden Totalitarismen auftretende Berufung auf einen Notstand, der ein
Dauerphnomen geworden ist. Er erinnert
daran, dass der Ausnahmezustand gewollt
war und zwar im demokratisch-revolutionren Kontext, nicht im Absolutismus. Der
barocke Souvern sollte ja den Ausnahmezustand ausschlieen, wie Walter Benjamin
betont. Man knnte anfgen, dass der Renaissanceabsolutismus der Versuch war, die
Leerstelle, die im sptmittelalterlichen Konziliarismus, im politischen Scheitern der
Christianitas aufgetreten war, zu besetzen.
Mit dem modernen Ausnahmezustand ist
der Widerstand gegen Tyrannen, in denen
im Mittelalter lediglich bse Einzelerscheinungen gesehen werden konnten, sinnlos
geworden. Nunmehr herrschen die Aufstndischen total.
Damit wird die Ausnahme zur Regel. In
den Blick der Radikalen kommt die bloe
Existenz, der mit reiner Gewalt begegnet
wird. Kafkas Figuren werden als Kronzeugen eines Rechts im Ausnahmezustand zitiert. Das Recht wird zum Spiel in Variationen. Es klingt vermessen, einen reinigenden
Charakter dieses Spiels anzunehmen, denkt
man an das Geschehen im 20. Jahrhundert.
Das Unerbittliche, das Faszinierende der
Darstellung Agambens lebt vom Pathos des
Notstandes, der den Ausnahmezustand
rechtfertigen sollte damals, heute. Agamben nimmt teil an diesem Pathos, bertrgt
es auf uns, macht uns vergessen, dass es
doch die biopolitische Maschine ist, die uns
in diesem Pathos in Bann hlt auch wenn
er sie eher beilufig erwhnt. Das Anhalten
der Maschine soll stndig gebt werden, obwohl dies selbstredend sinnlos ist.
ZfP 52. Jg. 1/2005
133
Agambens biopolitische Rekonstruktion
unserer Rechtsgeschichte liest sich wie ein
apokalyptisches Menetekel. Nicht nur die
diachrone Sichtweise, auch die Bezugnahmen auf einzelne Texte und politische Phnomene geben ihm recht. Es ist das Pathos
der Unentrinnbarkeit, das hier spricht. Es
verstellt den Blick auf das, wovon der Ausnahmezustand Ausnahme ist, unterschlgt
die lebensweltliche und religise Verankerung von Recht. Es lsst bersehen, dass es
jenseits der Maschinenhaftigkeit, in der sich
Verordnungen in der konomisch-politischen Ordnung durchsetzen, Orte des Sprechens gibt. Es gibt den Mut von Dissidenten
bis heute, gelegentlich auch mutige Sondervoten gegen herrschende Tendenzen (wie
das Sondervotum des Supreme Court-Richters Scalia, der gegen die Tendenz der US-Sicherheitspolitik fr das verfassungsmig
garantierte Recht des einzelnen eintrat). Fr
Momente kehrt die mit der Revolution verleugnete auctoritas im Sinne lebensweltlicher Macht zurck und wendet sich gegen
die Usurpation derselben in der biopolitischen Maschine.
Salzburg
Helmut Kohlenberger
Paolo PRODI: Eine Geschichte der Gerechtigkeit. Vom Recht Gottes zum modernen
Rechtsstaat. Aus dem Italienischen von Annette Seemann. Mnchen 2003. Verlag
C. H. Beck. 488 S., Leinen, 44,90 EUR
Dieses Werk des Bologneser Historikers, der
viele Jahre Direktor des Istituto germano-italico in Trient war, ist in mehrfacher Hinsicht
ein Einschnitt in gewohnte Historiographie
von Recht und Rechtstheorie. Zum einen ist
es entschieden europisch orientiert. Dies
zeigt sich am Diskussionskontext. Nicht
durchwegs allgemein bekannte Autoritten
aus unterschiedlichen Diskursen der letzten Jahrzehnte wie Jean Gaudemet oder Pierre Legendre bilden einen selbstverstndlichen Hintergrund der Blickrichtung der
Darstellung. Das hindert nicht, dass viele Details anhand italienischer Sekundrliteratur in
den Anmerkungen ausgefhrt werden. Europa ist fr Prodi aber keineswegs etwas selbstverstndlich Gegebenes, schon gar nicht in
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 134 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
134
Buchbesprechungen
dem modernen Sinn, der etwa in der Prambel zum Entwurf des EU-Konvents fr eine
Verfassung der EU zum Ausdruck kommt.
Europa in dem spezifischen Sinn, in dem der
Autor die Gerechtigkeitsgeschichte als Geschichte eines Dualismus von konkurrierenden Rechtsordnungen von Kirche und Staat,
die zur modernen Freiheit des Gewissens gefhrt hat, nachzeichnet, ist vergangen. Hierfr steht etwa Jacques Elluls Diagnose, dass
die Allgegenwart des positiven Rechts in allen Lebensbereichen zu einem Selbstmord
des Rechts fhre. So wird das Buch zu einer
Retrospektive. Damit hngt eng zusammen,
dass Prodi nicht eine Ideengeschichte
schreibt, sondern eine Geschichte der Ordnungen, in denen Recht soziale Wirklichkeit
ist, in denen Begriffe und Worte oft unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Entsprechend vielfltig sind die Materialien, auf
die Prodi sich bezieht. Es geht ihm um eine
(keineswegs interdisziplinre) Zusammenhangsbetrachtung von der Vielzahl der Foren
aus, in denen Normen zu Zwang oder Strafe
werden. Das Normative ist aber keineswegs
auf das Strafrecht reduziert. Vielmehr kommt
der weite Horizont, der sich von der Schuld
zur Snde und Straftat im Umfeld der einschlgigen Einstellungen, Theorien und Institutionalisierungen erstreckt, in den Blick.
Insbesondere wird die Zeit seit dem Ende
des Imperium Romanum behandelt. Der
Westen trennt sich vom Osten Konstantinopels, in dem die Kirche vom Reich nicht getrennt ist und sich kein autonomes kirchliches Recht ausbildet. Prodi sieht den Beginn
der typisch europischen Rechtswirklichkeit in der frhmittelalterlichen Gesetzgebung bei den germanischen Vlkern, die in
einer offenen Ordnung von personengebundenen Treuebeziehungen besteht und nach
einer Verschmelzung mit der kirchlichen
Ordnung, die in der Erwartung des Jngsten
Gerichtes steht, strebt. Seither steht die Geschichte des europischen Rechts in der
wechselnden Beziehung zwischen kirchlichen und nichtkirchlichen Foren der
Rechtsprechung. Die kirchlichen Foren haben es mit einer spezifisch rmisch-juristisch
gefassten Bupraxis zu tun, die von anderen
religisen Reinigungsritualen deutlich unterschieden ist und wesentlich die durch Snde
in Frage gestellte Zugehrigkeit zur Ge-
meinschaft der Kirche, die sich im Unterschied zu Sekten nicht als Gemeinschaft von
Vollkommenen versteht, zum Thema hat.
Im Einheitsstreben der sich herausbildenden westeuropischen Ordnung wird der
Unterschied kirchlicher und nicht-kirchlicher Ordnungen deutlich. Immer strker
treten die zunchst sich nebeneinander entwickelnden lokalen und kirchlichen Foren
zueinander in Konkurrenz. Die altkirchliche
Buliturgie wird unter dem Einfluss der
Bubcher und der Privatbeichte im Umkreis der irischen Mnche zum Busakrament. Darin findet das mit Ablard zum
Thema gewordene Gewissen eine als Gerichtsverfahren institutionalisierte Form.
Diese ist von der kirchlichen Strafgerichtsbarkeit zu unterscheiden, die zunehmend das
Modell fr die neue weltliche Gerichtsbarkeit abgibt. Im Zusammenhang mit den casi
reservati, der dem Papst allein vorbehaltenen
Entscheidungsvollmacht, sieht Prodi die mit
dem Papsttum als Modell sich entwickelnde
Frstenherrschaft. Ein Kirche und weltliche
Herrschaft verbindendes Rechtssystem (wie
es etwa Ivo von Chartres im Blick hatte)
kommt nicht zustande. Es bildet sich ein Inund Gegeneinander universeller und partikularer Zustndigkeiten heraus. Das Naturrecht, das in Variationen seit Cicero
rmisches Rechtsdenken entscheidend geprgt hat, ist nicht stark genug, um eine institutionalisierte Uniformierung zu bewirken.
Nur im Inquisitionsverfahren wird der
Kompetenzenpluralismus, zugleich die Unabhngigkeit des Gewissensforums aufgehoben. Mit dem Einfluss der Aristotelesstudien
- insbesondere nach 1300 zeigt sich, dass es
der Kirche trotz Rekurs aufs Naturrecht
nicht gelingt, den gesamten Bereich des
Rechts zu beherrschen. Einerseits nimmt der
zivilrechtliche Einfluss auf das Kirchenrecht
zu, andererseits wird mit theologischen Gesichtspunkten eine Moralsphre Thema, die
von der nichtkirchlichen wie der kirchlichen
Rechtssphre unabhngig ist. Es scheint,
dass das Sakrament nicht mehr ueres und
Inneres vershnt. Ockham zeigt deutlich den
Unterschied zwischen gttlichem Recht und
Naturrecht auf. Jean Gerson warnte davor,
kirchliche Vorschriften ohne weiteres als
gttliches Gesetz auszugeben. Man ahnt,
dass der Dualismus zwischen der kirchlichen
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 135 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
und der weltlichen Ordnung zu einem Dualismus von Gewissen und kirchlicher bzw.
sich herausbildender staatlicher Autoritt
wird. Die ungeklrte Zuordnung von Gewissen, kirchlicher und weltlicher Rechtsprechung fordert aber eine epochale Wende.
Eine freie philosophische Diskussion ber
das Naturrecht unabhngig von theologischen Vorgaben setzt ein. Herrschaft wird
nicht mehr als ein notwendiges bel betrachtet, sondern als Gestaltung der Lebensbedingungen unter Bercksichtigung nicht
zuletzt konomischer Interessen. Prodi zeigt
die sich trennenden Wege in die neue Zeit. Im
katholischen Bereich und in den Lndern der
Reformation steht man vor derselben Aufgabe, die drei Foren Gewissen, Kirche und
Staat einander zuzuordnen. Mit der von
Cajetan entwickelten Lehre von der Kirche
als einer societas perfecta setzt sich die katholische Kirche als Reprsentation eines
gttlich-natrlichen Naturrechts. Dies zeigt
sich im Kirchenstaat, dem Modell absoluter
Herrschaft, dem Campanella eine ins Utopische weisende Gestalt verleiht. Der Vollzug
einer zentralistischen Kontrollfunktion
fhrt zu einem Staatsrecht in Kirchenfragen,
das sich insbesondere im Zusammenhang der
Konkordate (mit den Territorialstaaten) ausbildet. Zugleich wird in der nachtridentinischen Kirche eine eigenstndige normativethische Dimension beansprucht. Der spanischen Naturrechtslehre z. B. von Surez gelingt es, die Autonomie des staatlichen positiven Rechts mit dem ethisch-Normativen
zu verbinden. Dieses wird in den Orden der
Gegenreformation (z. B. bei den Jesuiten)
mit einer praktischen Theologie begrndet und in Kasuistik und einer juristisch verstandenen Beichtpraxis umgesetzt. In den
Lndern der lutherischen Reformation wird
die Kirche zu einem unsichtbaren Band zwischen einem autonomen Staat und einer sich
zunehmend autonomisierenden Moral, die
bei Kant ihre Hochform erreicht. Calvins
Auffassung zeigt die Tendenz zur Sakralisierung des positiven Rechts auf dem Hintergrund eines im Sinne des Dekalogs aufgefassten Naturrechts. Insgesamt lsst sich
erkennen, dass mit der Entsakramentalisierung des Buverfahrens eine Kriminalisierung der Snde einsetzt. In Absetzung von
Michel Foucaults Studien ber das neuzeitli-
ZfP 52. Jg. 1/2005
135
che berwachen und Strafen sieht Prodi in
der kirchlichen Zustndigkeit fr Familienfragen eine Art Schutz vor der bermacht
staatlichen Zugriffs.
In immer neuen Anlufen hlt der Autor
seine Sicht ber groe Zeitspannen in der
Geschichte der Ideen und Institutionen des
Normativen durch. Sein Sinn fr Ambivalenzen lsst Phnomene in den Blick treten.
Der Leser findet viele aufschlussreiche Seitenblicke auf magebende Autoren in einem
weniger vertrauten Kontext. So erscheint
Pascal mit seiner Kritik an der Mglichkeit
von Positivierung der gttlichen Gerechtigkeit als Wegbereiter revolutionren Denkens. Wer das Weiterwirken historischer
Dispositionen in Betracht zieht, ist in hherem Mae resistent gegenber vermeintlich
Neuem. Die Reformation versteht besser,
wer beachtet, dass die evangelischen Kirchen
das kanonische Recht als subsidires Recht
beibehielten.
Der Naturrechtsbegriff erweist sich als
entscheidendes Vehikel der Transformation
in der Auffassung des Normativen, das
gttliches Recht in positives Recht aufhebt.
Mit der franzsischen Revolution ist dieser
Prozess in sein entscheidendes Stadium getreten. Von daher empfiehlt sich ein neuer
Blick auf die Skularisierung. Man erfhrt
sie als einen atemberaubenden Positivierungsprozess, der in die gefhrliche Zensur des politisch Korrekten auf positivrechtlicher Ebene, die Moral und Gewissen
als eigenstndige Dimension nicht anerkennt, fhrt (vgl. S. 344). Prodi hat vielfach
nur dem Spezialisten vertraute Quellen und
Themen einem breiteren Publikum zugnglich gemacht. Er hat die Vielgestaltigkeit des
Normativen auf dem europischen Weg in
die Moderne gezeigt. Und er hat das Verdienst, das Gefhrdungspotenzial der sich in
der Gegenwart zuspitzenden Entwicklung
deutlich benannt zu haben.
Salzburg
Helmut Kohlenberger
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 136 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
136
Buchbesprechungen
Claus LEGGEWIE: Die Globalisierung und
ihre Gegner. Mnchen 2003. Verlag C. H.
Beck. 206 S. Softcover 9,90 EUR.
Das rosarote Image der Globalisierung ist
durch den Brsen-Crash der vergangenen
Jahre verblichen, die einstige Ablehnung des
Protestes gegen die Globalisierung wird dagegen schwcher: Die Gegner erhalten Zustimmung, Untersttzung und regen Zulauf.
Zu deutlich ist nmlich geworden, welche
negativen Konsequenzen die neo-liberale
Form der globalen wirtschaftlichen und finanziellen Verflechtungen zeitigen. Diese
Umkehrung der Bewertungen versucht
Claus Leggewie, der sich als teilnehmender
Beobachter versteht, zu belegen und zu begrnden, aber auch zu kritisieren, um dann
Wege in eine globale Demokratie zu skizzieren. Die konomische und finanzielle Globalisierung neo-liberaler Form, so wie wir
sie kennen gelernt haben, wird in dieser
Darstellung allerdings fast vollstndig ausgeblendet. Dafr zeigt der Autor positive
Aspekte, welche eine ausgewogene Globalisierung - zumindest potenziell - aufzuweisen hat.
Leggewie versucht, die Feinde, Gegner
und Kritiker der Globalisierung zu typisieren, um so zwei relevante Richtungen des
Protestes herauszuarbeiten. Da ist zunchst
der medien- und deshalb ffentlichkeitswirksame Protest der Strae; diese auerparlamentarische Protestbewegung hat
durch ihre auch gewaltsamen Aktionen
den Stein ins Rollen gebracht. Doch wie
schon bei den frheren sozialen Bewegungen ist es bei Ablehnung nicht geblieben,
vielmehr haben sie Gegen-Kompetenz gebildet, die als Nicht-Regierungs-Organisationen (NRO) bezeichnet inzwischen als
Lobbies wachsenden Einflu an den Verhandlungstischen vor allem international
einflussreicher Organisationen gewinnen.
Das Problem daran ist: Die NRO sind
von niemandem legitimiert, haben keinen
einsehbaren Proze der Meinungsbildung,
legen keine Rechenschaft ab, vertreten auch
keineswegs Mehrheiten. Problematisch ist
das deshalb, weil die echte Demokratisierung politischer Entscheidungen zu den
wichtigsten Forderungen der NRO zhlt,
die lngst in einem Netzwerk lokaler, regio-
naler und globaler Initiativen weltweit agieren und dadurch eine Vorform transnationaler Demokratie bilden. Denn je globaler
politisch-konomische
Entscheidungen
wirken, desto transnationaler mssen sie getroffen werden, fordert der Autor.
Die neo-liberal geprgte Form der Globalisierung scheint am Ende angelangt, nicht
zuletzt dank des Engagements dieser erstmals weltweit vertretenen Protestbewegung,
die sich als NRO Zutritt zu den Foren der
Macht verschaffte. Ihre Aufgabe sei es nun,
meint Leggewie, durch eine intelligente DeGlobalisierung auf die Erhaltung und Bereitstellung weltffentlicher Kollektivgter
zu dringen. Dazu mssten sie allerdings ihr
eigenes Demokratiedefizit abbauen, um in
nicht mehr territorial gebundener Form
transnationale Partizipation und Reprsentation zu ermglichen, die sich am besten in
regional verfassten Fderationen organisieren lasse.
Mnchen
Bernd M. Malunat
Martin R. SCHTZ: Journalistische Tugenden. Leitplanken einer Standesethik. Wiesbaden 2003. Westdeutscher Verlag, 250 S.,
kart., 49,90 EUR
Nach moralischer Domestizierung gesellschaftlicher Institutionen wird in demokratischen Gesellschaften immer dann gerufen,
wenn die Macht dieser Institutionen sich der
politischen Kontrolle zu entziehen scheint.
Die moralische Domestizierung der Massenmedien ist dementsprechend seit der Etablierung von Pressefreiheit und demokratischer
Staatsform in Westeuropa und den USA ein
Dauerthema, auch wenn der Ruf nach einer
eigenstndigen Medienethik als Teilbereich
der Angewandten Ethik eine verhltnismig
junge Erscheinung ist. In seinem ebenso gelehrten wie elegant geschriebenen Buch Journalistische Tugenden, das aus einer Basler
Dissertation hervorgegangen ist, verteidigt
Martin R. Schtz die moralische Selbstregulierungskraft der Medien gegen allfllige Domestizierungsversuche von staatlicher Seite.
Zugleich verschreibt Schtz Philosoph und
praktizierender Journalist in Personalunion
den medialen Akteuren, den Journalisten
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 137 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
Kritik
jedweder Sparte und jedweden Mediums,
eine eigentliche tugendethische Rosskur, die
ihnen dazu verhelfen soll, ihren Beruf verantwortungsvoll auszuben. Denn Schtz muss
feststellen, dass wohlfeile Appelle ans Gewissen der Journalisten allein nicht ausreichen,
um das Informationsinteresse der medienkonsumierenden ffentlichkeit und das
moralische Interesse einer demokratischen
Gesellschaft vor dem Profiterwirtschaftungsdruck der privaten Medieneigentmer zu
schtzen. Da mag es zwar Richtlinien journalistischer Sorgfaltspflicht geben, die von
den Journalisten aber immer dann beiseite
gelegt werden, wenn eine schlecht verbrgte,
jedoch sensationelle Nachricht Auflagensteigerung oder Zuschauerzustrom verspricht.
Schtz verbindet den individualethischen
Anspruch des aufklrerischen Denkens, wie
er in gngigen medienethischen Entwrfen
vorherrscht, mit einem dezidiert tugendethischen Rahmenwerk, ohne eben nach staatlichen Ordnungsmchten zu rufen, wo sie
seines Erachtens nicht hingehren. Die erkenntnistheoretischen Grundentscheidungen, die er fllt, tendieren in Richtung Konstruktivismus,
was
insofern
nicht
unproblematisch ist, als die harsche Kritik,
die er etwa unter dem Stichwort Boulevardisierung am gegenwrtigen Medienbetrieb
anbringt, eigentlich auf einem korrespondenztheoretischen Wahrheitsverstndnis beruht. Denn diese Kritik muss implizieren,
dass es eine Wahrheit, einen wahren Sachverhalt irgendwo da draussen gibt, dem eine
mediale Darstellung eben mehr oder weniger
entspricht je weniger, desto schlechter ist die
Darstellung. Massenmedien, insofern sie einen Informationsauftrag wahrnehmen (auf
dessen Wahrnehmung eine funktionierende
demokratische Gesellschaft vermutlich angewiesen ist), unterscheiden sich damit kategorial von fiktionaler Wirklichkeitsgestaltung,
wie sie etwa Belletristik betreibt. Also auch
wenn man wie Schtz mit konstruktivistischen Positionen liebugelt und den Massenmedien die Macht einrumt, Weltbilder zu
konstruieren (vgl. S. 49), wird man sich, will
man berhaupt eine Grundlage der Kritik haben, einen erkenntnistheoretischen Rest-Realismus erhalten mssen. Dies tut Schtz
durchaus (was brigens schon an seinen Motti, Platon, Politeia 485d, und Johannes 8, 32,
ZfP 52. Jg. 1/2005
137
deutlich wird), indem er nmlich im Konstruktivismus trotz seiner eigenen Sympathien so etwas wie eine journalistische Berufskrankheit entdeckt, die jede Manipulation des
zu bearbeitenden Materials zu erlauben
scheint, da ja unsere Bilder von der Wirklichkeit ohnehin nur konstruiert seien. Schtz
wird nicht mde, solches Vorgehen als
Selbsttuschung und Selbstkonditionierung (S. 52) der Medienschaffenden zu
brandmarken (Medienschaffende schaffen
offenbar nicht nur Meldungen und Medien,
sondern ganze Welten), die zu einer unbewusst sich einschleichenden Manipulation des
Manipulators (S. 54) fhrten. Als Leser htte
man sich neben den von Schtz gegebenen,
detailreichen wahrnehmungsphysiologischen
und wahrnehmungspsychologischen Errterungen des Medienschaffens und des Medienkonsums noch genauere Ausknfte zum
Zusammenhang zwischen dem von ihm selbst
privilegierten Konstruktivismus und dem latenten Rest-Realismus gewnscht.
Besonders eindringlich ist Schtzens Studie da, wo sie unmittelbar aus dem Medienalltag schpft und kontrapunktierend dazu
literarische Beispiele heranzieht etwa von
Aldous Huxley, Erich Kstner oder Friedrich Drrenmatt , die die Gefahren medialer Selbst- und Fremdmanipulation schonungslos offenlegen. Beiend wird Schtz in
einer kleinen Phnomenologie des Boulevards, dem er im einzelnen vorhlt, dass er
eine (falsche) Nhe von Rezipient und Gegenstand suggeriere, das Private ffentlich
mache, Ordnung zerstre, skandalisiere,
personalisiere und schlielich selbstreferentiell sei. Da ist der aufklrungskonservative
Mahner, der im Verlust der Literalitt (S. 7)
die Vernichtung der Grundlagen demokratischen Zusammenlebens erkennt, in seinem
Element auch wenn manch einer, wie der
Rezensent, die Gegenrechnung aufmachen
wrde, also z. B. gerne fragte, ob die Boulevardisierung nicht gerade zur Stabilisierung
bestehender Ordnungen einen erheblichen
Beitrag leiste.
Sein tugendethisches Programm entfaltet
Schtz im vierten und letzten Hauptteil des
Werkes, der die journalistisch Ttigen als
wichtige Elemente einer demokratischen ffentlichkeit in die Pflicht nimmt. Dazu setzt
er Leitplanken fr den [journalistischen]
ZU_ZfP_1_2005.book Seite 138 Donnerstag, 10. Mrz 2005 10:24 10
138
Buchbesprechungen
Berufsalltag (S. 128), und zwar in Gestalt
von Tugenden, die dem Akteur Orientierung
in konkreten Situationen geben sollen. Es
sind dies Besonnenheit, Tapferkeit, Weisheit
und Klugheit, Wahrhaftigkeit und Offenheit,
schlielich Gerechtigkeit. Zur Absicherung
dieser Tugenden dient Schtz die ganze tugendethische Tradition seit Platon und Aristoteles, ohne dabei doch deren metaphysischen Unterbau mitreproduzieren zu
mssen. Dies lsst den tugendethischen Teil
erfreulich praxisnah erscheinen: Selbst wer in
der Ethik allgemein nicht mehr so ganz an
die Erfolgsaussichten tugendethischer Konzepte glauben will, wird nach der Lektre
gerne einrumen, dass sie fr das ausgewhlte Segment menschlichen Handelns, eben das
journalistische Mediatorentum, viel Sinn ergeben.
Zweifellos ist Schtz mit seinem Werk ein
wesentlicher Beitrag zur medienethischen
Diskussion gelungen, das wichtige neue Akzente setzt und es daher verdient, breit rezipiert zu werden gerade auch von den journalistischen Praktikern, denen es ebensoviel
zu sagen hat wie den professionellen Ethikern.
Greifswald
Andreas Urs Sommer
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 24/25: 13. Jahrgang (2007)Von EverandZeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 24/25: 13. Jahrgang (2007)Noch keine Bewertungen
- Pietismus und Neuzeit Band 34 – 2008: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusVon EverandPietismus und Neuzeit Band 34 – 2008: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik: 4. Jahrgang, 2013, Heft 2Von EverandZeitschrift für interkulturelle Germanistik: 4. Jahrgang, 2013, Heft 2Dieter HeimböckelNoch keine Bewertungen
- Die Emanzipation des hybriden Selbst: Identität, Kultur und Literatur in LuxemburgVon EverandDie Emanzipation des hybriden Selbst: Identität, Kultur und Literatur in LuxemburgNoch keine Bewertungen
- Gruppenanalyse in Selbstdarstellungen: Teil 1Von EverandGruppenanalyse in Selbstdarstellungen: Teil 1Ludger M. HermannsNoch keine Bewertungen
- Pietismus und Neuzeit Band 38 - 2012: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusVon EverandPietismus und Neuzeit Band 38 - 2012: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusNoch keine Bewertungen
- Geschichtspolitik im öffentlichen Raum: Zur Benennung und Umbenennung von Straßen im internationalen VergleichVon EverandGeschichtspolitik im öffentlichen Raum: Zur Benennung und Umbenennung von Straßen im internationalen VergleichNoch keine Bewertungen
- Remigration und Demokratie in der Bundesrepublik nach 1945: Ordnungsvorstellungen zu Staat und Verwaltung im transatlantischen TransferVon EverandRemigration und Demokratie in der Bundesrepublik nach 1945: Ordnungsvorstellungen zu Staat und Verwaltung im transatlantischen TransferMargrit SeckelmannNoch keine Bewertungen
- Aktualität der Anfänge: Freuds Brief an Fließ vom 6.12.1896Von EverandAktualität der Anfänge: Freuds Brief an Fließ vom 6.12.1896Frank DirkopfNoch keine Bewertungen
- Demokratiewunder: Transatlantische Mittler und die kulturelle Öffnung Westdeutschlands 1945–1970Von EverandDemokratiewunder: Transatlantische Mittler und die kulturelle Öffnung Westdeutschlands 1945–1970Noch keine Bewertungen
- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik: 2. Jahrgang, 2011, Heft 2Von EverandZeitschrift für interkulturelle Germanistik: 2. Jahrgang, 2011, Heft 2Dieter HeimböckelNoch keine Bewertungen
- Kommunikative Freiheit: Interdisziplinäre Diskurse mit Wolfgang HuberVon EverandKommunikative Freiheit: Interdisziplinäre Diskurse mit Wolfgang HuberNoch keine Bewertungen
- Literarische Journalisten - Journalistische Literaten: Autorschaft und Inszenierungspraktiken bei Joseph Roth und Tom WolfeVon EverandLiterarische Journalisten - Journalistische Literaten: Autorschaft und Inszenierungspraktiken bei Joseph Roth und Tom WolfeNoch keine Bewertungen
- Pietismus und Neuzeit Band 35 – 2009: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusVon EverandPietismus und Neuzeit Band 35 – 2009: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusNoch keine Bewertungen
- Denkschrift über Dr. Robert Kempner: anlässlich 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland, anlässlich des 150. Geburtstages von Frau Prof. Lydia Rabinowitsch-Kempner sowie des 75. Jahrestages des Endes des Nürnberger Prozesses gegen die HauptkriegsverbrecherVon EverandDenkschrift über Dr. Robert Kempner: anlässlich 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland, anlässlich des 150. Geburtstages von Frau Prof. Lydia Rabinowitsch-Kempner sowie des 75. Jahrestages des Endes des Nürnberger Prozesses gegen die HauptkriegsverbrecherNoch keine Bewertungen
- Ideengeschichte heute: Traditionen und PerspektivenVon EverandIdeengeschichte heute: Traditionen und PerspektivenD. Timothy GoeringNoch keine Bewertungen
- Adorno-Handbuch: Leben – Werk – WirkungVon EverandAdorno-Handbuch: Leben – Werk – WirkungRichard KleinNoch keine Bewertungen
- Populäre Musik und Pop-Literatur: Zur Intermedialität literarischer und musikalischer Produktionsästhetik in der deutschsprachigen GegenwartsliteraturVon EverandPopuläre Musik und Pop-Literatur: Zur Intermedialität literarischer und musikalischer Produktionsästhetik in der deutschsprachigen GegenwartsliteraturNoch keine Bewertungen
- Wie wirkt Soteria?: Eine atypische Psychosenbehandlung kritisch durchleuchtetVon EverandWie wirkt Soteria?: Eine atypische Psychosenbehandlung kritisch durchleuchtetNoch keine Bewertungen
- Deserteure der Wehrmacht im alpinen Raum: Neue ForschungenVon EverandDeserteure der Wehrmacht im alpinen Raum: Neue ForschungenIngrid BöhlerNoch keine Bewertungen
- PEGIDA - Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung?: Analysen im ÜberblickVon EverandPEGIDA - Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung?: Analysen im ÜberblickNoch keine Bewertungen
- Das Unbehagen in der Kultur: Close Reading und RezeptionsgeschichteVon EverandDas Unbehagen in der Kultur: Close Reading und RezeptionsgeschichteNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 46/47: 24. Jahrgang (2018)Von EverandZeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 46/47: 24. Jahrgang (2018)Noch keine Bewertungen
- Rechte Wörter: Von "Abendland" bis "Zigeunerschnitzel"Von EverandRechte Wörter: Von "Abendland" bis "Zigeunerschnitzel"Noch keine Bewertungen
- Der österreichische Bundespräsident: Das unterschätzte AmtVon EverandDer österreichische Bundespräsident: Das unterschätzte AmtNoch keine Bewertungen
- An den Grenzen Europas und des Rechts: Interdisziplinäre Perspektiven auf Migration, Grenzen und RechtVon EverandAn den Grenzen Europas und des Rechts: Interdisziplinäre Perspektiven auf Migration, Grenzen und RechtNoch keine Bewertungen
- Werner Conze: Ein deutscher Historiker im 20. JahrhundertVon EverandWerner Conze: Ein deutscher Historiker im 20. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 15: 8. Jahrgang (2002)Von EverandZeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 15: 8. Jahrgang (2002)Noch keine Bewertungen
- Freiheit und Wirtschaft: Theorie der bürgerlichen Gesellschaft nach HegelVon EverandFreiheit und Wirtschaft: Theorie der bürgerlichen Gesellschaft nach HegelNoch keine Bewertungen
- Zeitgeschichte des Selbst: Therapeutisierung - Politisierung - EmotionalisierungVon EverandZeitgeschichte des Selbst: Therapeutisierung - Politisierung - EmotionalisierungNoch keine Bewertungen
- Geschichte und Region/Storia e regione 29/1 (2020): Bücher besitzen – Bücher lesen/Possedere libri – leggere libri (1750–1850)Von EverandGeschichte und Region/Storia e regione 29/1 (2020): Bücher besitzen – Bücher lesen/Possedere libri – leggere libri (1750–1850)Noch keine Bewertungen
- Displaced-Persons-Forschung in Österreich und Deutschland: Bestandsaufnahme und AusblickeVon EverandDisplaced-Persons-Forschung in Österreich und Deutschland: Bestandsaufnahme und AusblickeIngrid BöhlerNoch keine Bewertungen
- Autonomie und Heteronomie der Politik: Politisches Denken zwischen Post-Marxismus und PoststrukturalismusVon EverandAutonomie und Heteronomie der Politik: Politisches Denken zwischen Post-Marxismus und PoststrukturalismusFrankfurter Arbeitskreis für politische Theorie & PhilosophieNoch keine Bewertungen
- Verabschiedungen der »Postmoderne«: Neuere Historisierungen von »Theorie« zwischen »Post-Truth«-Narrativen und GenerationengeschichteVon EverandVerabschiedungen der »Postmoderne«: Neuere Historisierungen von »Theorie« zwischen »Post-Truth«-Narrativen und GenerationengeschichteFlorian ScherüblNoch keine Bewertungen
- Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte: Neue Folge der "Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen"Von EverandNiedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte: Neue Folge der "Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen"Noch keine Bewertungen
- Deutsche Zeiten: Geschichte und Lebenswelt. Festschrift zur Emeritierung von Moshe ZimmermannVon EverandDeutsche Zeiten: Geschichte und Lebenswelt. Festschrift zur Emeritierung von Moshe ZimmermannNoch keine Bewertungen
- Historisierung der Historik: Jörn Rüsen zum 80. GeburtstagVon EverandHistorisierung der Historik: Jörn Rüsen zum 80. GeburtstagNoch keine Bewertungen
- Pietismus und Neuzeit Band 42 – 2016: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusVon EverandPietismus und Neuzeit Band 42 – 2016: Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren ProtestantismusNoch keine Bewertungen
- Modernisierung als Amerikanisierung?: Entwicklungslinien der westdeutschen Kultur 1945-1960Von EverandModernisierung als Amerikanisierung?: Entwicklungslinien der westdeutschen Kultur 1945-1960Lars KochNoch keine Bewertungen
- Melanchthon deutsch I: Schule und Universität, Philosophie, Geschichte und PolitikVon EverandMelanchthon deutsch I: Schule und Universität, Philosophie, Geschichte und PolitikNoch keine Bewertungen
- Marcel Bois Kommunisten Gegen Hitler Und StalinDokument746 SeitenMarcel Bois Kommunisten Gegen Hitler Und StalinCiro PorebaNoch keine Bewertungen
- Die Unvollendete Revolution in Ägypten - BPBDokument4 SeitenDie Unvollendete Revolution in Ägypten - BPBartes2009Noch keine Bewertungen
- ZENITcamera - User Manual - ZENIT-TTLDokument10 SeitenZENITcamera - User Manual - ZENIT-TTLartes2009Noch keine Bewertungen
- Welt Ohne Weltordnung PDFDokument257 SeitenWelt Ohne Weltordnung PDFartes2009100% (2)
- Hüdayi Besmele Soz-NotaDokument1 SeiteHüdayi Besmele Soz-Notaartes2009Noch keine Bewertungen
- 2016 Sykes Picot Tagesspiegel 160515Dokument2 Seiten2016 Sykes Picot Tagesspiegel 160515artes2009Noch keine Bewertungen
- Hüdayi Besmele Soz-Nota PDFDokument1 SeiteHüdayi Besmele Soz-Nota PDFartes2009Noch keine Bewertungen
- 1999 03Dokument210 Seiten1999 03artes2009100% (1)
- Osteuropa in Der Flüchtlingskrise - Ungarn Und Kroatien Blockieren - SPIEGELDokument6 SeitenOsteuropa in Der Flüchtlingskrise - Ungarn Und Kroatien Blockieren - SPIEGELartes2009Noch keine Bewertungen
- Faz Net Aktuell Politik Fluechtlingskrise FluechtlinDokument3 SeitenFaz Net Aktuell Politik Fluechtlingskrise Fluechtlinartes2009Noch keine Bewertungen
- 1999 05Dokument210 Seiten1999 05artes2009Noch keine Bewertungen
- Flüchtlingsdebatte - Geißler Fühlt Sich An Weimarer Verhältnisse Erinnert - Flüchtlingskrise - FAZDokument3 SeitenFlüchtlingsdebatte - Geißler Fühlt Sich An Weimarer Verhältnisse Erinnert - Flüchtlingskrise - FAZartes2009Noch keine Bewertungen
- Kommentar - Krieg Oder Frieden - BPBDokument3 SeitenKommentar - Krieg Oder Frieden - BPBartes2009Noch keine Bewertungen
- Zahl Der Attacken Auf Asylbewerberheime GestiegenDokument8 SeitenZahl Der Attacken Auf Asylbewerberheime Gestiegenartes2009Noch keine Bewertungen
- Chronik - 10. - 23. November 2014 - BPBDokument3 SeitenChronik - 10. - 23. November 2014 - BPBartes2009Noch keine Bewertungen
- 1999 01Dokument178 Seiten1999 01artes2009Noch keine Bewertungen
- 1999 02Dokument194 Seiten1999 02artes2009Noch keine Bewertungen
- Angela Merkels Flüchtlingspolitik Schafft Den Westen Ab PDFDokument4 SeitenAngela Merkels Flüchtlingspolitik Schafft Den Westen Ab PDFartes2009Noch keine Bewertungen
- Deutschlands Flüchtlinge in GrafikenDokument13 SeitenDeutschlands Flüchtlinge in Grafikenartes2009Noch keine Bewertungen
- 1 - VorderdeckelDokument18 Seiten1 - Vorderdeckelartes2009Noch keine Bewertungen
- Dokumentation - Erklärung Des Kiewer Generalstaatsanwalts, Serhij JuldaschewDokument3 SeitenDokumentation - Erklärung Des Kiewer Generalstaatsanwalts, Serhij Juldaschewartes2009Noch keine Bewertungen
- Kommentar - Quo Vadis Ukraine - Die Neuerfindung Des Ukrainischen Staates - BPDokument3 SeitenKommentar - Quo Vadis Ukraine - Die Neuerfindung Des Ukrainischen Staates - BPartes2009Noch keine Bewertungen
- Analyse - Die Koalition Steht - BPBDokument4 SeitenAnalyse - Die Koalition Steht - BPBartes2009Noch keine Bewertungen
- DMG Kurz GeschichteDokument1 SeiteDMG Kurz Geschichteartes2009Noch keine Bewertungen
- Kommentar - Kein Endpunkt Der Wirtschafts - Und Finanzkrise in Sicht - BPBDokument3 SeitenKommentar - Kein Endpunkt Der Wirtschafts - Und Finanzkrise in Sicht - BPBartes2009Noch keine Bewertungen
- Kommentar - Kein Endpunkt Der Wirtschafts - Und Finanzkrise in Sicht - BPBDokument3 SeitenKommentar - Kein Endpunkt Der Wirtschafts - Und Finanzkrise in Sicht - BPBartes2009Noch keine Bewertungen
- Kommentar - Ein Kleiner Regimewechsel in Kiew. Reformpolitische ImplikationenDokument3 SeitenKommentar - Ein Kleiner Regimewechsel in Kiew. Reformpolitische Implikationenartes2009Noch keine Bewertungen
- Dokumentation - UN-Bericht Über Die Menschenrechtssituation in Der OstukraineDokument3 SeitenDokumentation - UN-Bericht Über Die Menschenrechtssituation in Der Ostukraineartes2009Noch keine Bewertungen
- Kommentar - Blühende Landschaften - BPBDokument3 SeitenKommentar - Blühende Landschaften - BPBartes2009Noch keine Bewertungen
- Frick KnoÌ LL Baukonstruktionslehre 2 PDFDokument778 SeitenFrick KnoÌ LL Baukonstruktionslehre 2 PDFDragisa Pejic100% (1)
- Comedy 10 Tipps!!!!!!Dokument6 SeitenComedy 10 Tipps!!!!!!DionysosNoch keine Bewertungen
- Nebensatzedass, Weil PDFDokument30 SeitenNebensatzedass, Weil PDFSofija PanovskiNoch keine Bewertungen
- FE Model Webhofer DokservDokument158 SeitenFE Model Webhofer DokservVănTiếnPhạmNoch keine Bewertungen
- GRUNDIG Apollo 2000Dokument16 SeitenGRUNDIG Apollo 2000qbix1111Noch keine Bewertungen