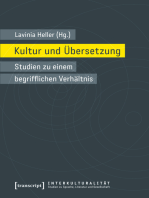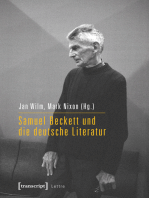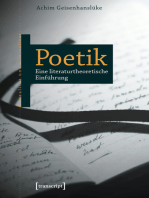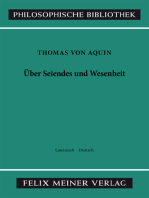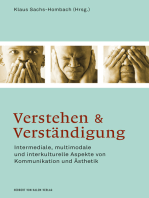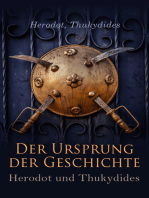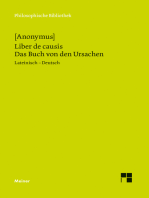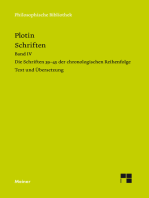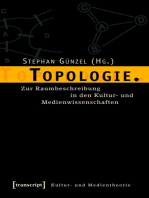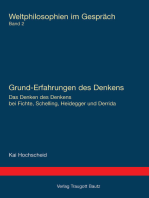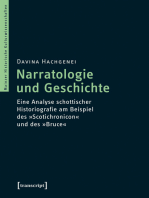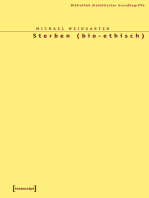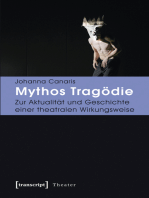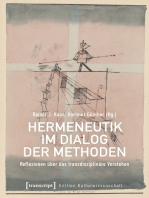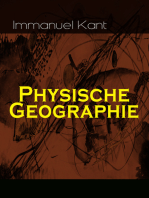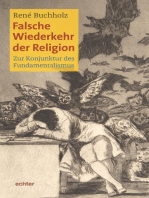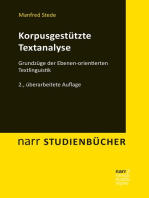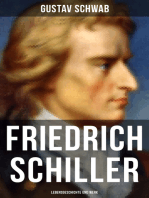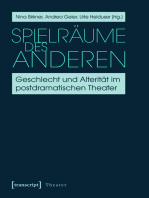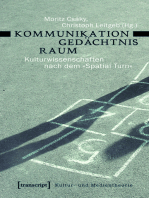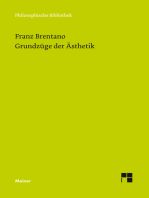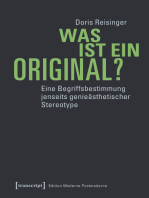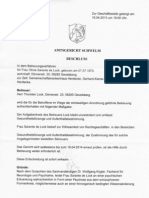Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Das Problem Des Übersetzens
Hochgeladen von
ramu_berlin_14047592Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Das Problem Des Übersetzens
Hochgeladen von
ramu_berlin_14047592Copyright:
Verfügbare Formate
Schriftenreihe des Frankreich-Zentrums
der Technischen Universitt Berlin
Band 1
Gnter Abel (Hrsg.)
Das Problem der bersetzung
Le probleme de la traduction
SONDERDRUCK
mni
0
BERLIN VERLAG Arno Spitz GmbH
Nomos Verlagsgesellschaft
Inhalt
GONTERABEL
bersetzung als Interpretation
HANS JORG SANDKHLER
Es redet der Redende, aber nicht Farbe oder Ding.
bersetzung und die Fragwrdigkeit realistischer Ontologie
31
THOMASGIL
Mglichkeiten und Grenzen der bersetzung.
Reflexionen in Anlehnung an Ortega y Gasset
57
ALFRED HIRSCH
bersetzung und Unentscheidbarkeit: bersetzungstheoretische
Anmerkungen zu Saussure, Husserl und Derrida
77
HANS-DIETER GONDEK
ber das bersetzen philosophischer Texte und ber
philosophische Theorien der bersetzung
10 J
ULRJCH]OHANNESSCHNEIDER
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
127
LUKAS K. SOSOE
Un regard allemand sur la Revolution franyaise.
August Wilhelm Rehberg: traduction et interpretation
151
VINCENT VON WROBLEWSKY
Reflexions heteroclites sur la traduction apartir de Sartre auf auch sprachlichen deutschen Sonderwegen
187
HEINRICH WALTER
Die Bildlichkeit und ihre Funktion in Walter Benjamins
"Die Aufgabe des bersetzers"
207
AUTORENVERZEICHNJS
237
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer
bersetzungen
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
1. Der Adressat philosophischer bersetzungen
Durch bersetzung werden philosophische Werke einem Publikwn zugnglich gemacht, das zwar ein Interesse an Philosophie besitzt, nicht
aber ausreichende Sprachenkenntnis. Mit dieser Minimaldefinition lt
sich die Geschichte der philosophischen bersetzung von der Antike bis
zur Frhen Neuzeit schon in einer ersten Phase charakterisieren, in der
das Publikum mit dem Gelehrtenstand identisch war. Griechische, arabische und zuletzt englische und franzsische Werke wurden ins Lateinische bersetzt, damit Gelehrte in der ganzen Welt sie leichter lesen konnten. Die bersetzung ins Lateinische stellte bis ins 17. Jahrhundert fr
viele Wissenschaftler den internationalen Diskussionskontext her. Eine
zweite Phase kann man daran festmachen, da das Lateinische sein
Kommunikationsprivileg verlor: Seit Herausbildung und Etablierung von
nationalen Literaturen, also sptestens seit dem 18. Jahrhundert, waren es
nicht mehr nur die Gelehrten, sondern die grere Gruppe der Gebildeten,
deren Streben nach Aneignung, Aufnahme und Anverwandlung die bersetzung auslndischer Denker in die verschiedenenen Landessprachen
zum Bedrfnis machte. Die bersetzung bereicherte die nationalen Diskussionskontexte. Davon noch einmal zu unterscheiden ist in einer dritten
Phase die Arbeit an der philosophischen bersetzung seit dem 19. Jahrhundert, als die Expansion der Buchproduktion sowie bestimmte urheberrechtliche Freistellungen dazu fhrten, da philosophische Werke in allen
europischen Sprachen vervielfliltigt wurden und eine noch breitere Leserschaft fanden. Die bersetzung dient nun jedem interessierten Leser
schlicht zur umweglosen Kenntnisnahme.
127
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
Grob skizziert, kann also die Geschichte der modernen bersetzung
philosophischer Werke in drei Phasen begriffen werden, wem;i man den
Adressaten als OrientierungspWlkt nimmt. Zunchst war es der Gelehrte,
dann der Gebildete und schlielich der allgemeine Leser, dessen Interesse
an der Philosophie die bersetzung diente. Diese Phasen sind vermutlich
zugleich Steigerungsstufen in quantitativer Hinsicht, weil der Adressatenkreis jeweils umfangreicher war. Die Geschichte der philosophischen
bersetzung ergibt sich so als ein Seitenstrang der Geschichte der Philosophie und ihrer modernen Popularisierung, als seit dem Aufklrungszeitalter auch jenseits wissenschaftlicher Kreise ein immer greres Publikum nach Philosophie verlangte.
Auch wenn diese Skizze grob ist, kann man wohl sagen, da die
Funktion der philosophischen bersetzung sich in den letzten drei Jahrhunderten grndlich erweitert hat. Die alte Aufgabe des Lateinischen
erfllt beute das Englische, jedenfalls fr eine groe Zahl von Texten, die
nicht zuerst in einer westeuropischen Sprache verffentlicht werden. Die
Bereicherung nationaler Diskussionskontexte ist nach wie vor ein wichtiger und erwnschter Effekt der bersetzung. Vor allem aber das simple
Wissenwollen steuert die bersetzungsttigkeit, wenn nicht unmittelbar,
dann ber Verlage und deren Gewinnabsichten vermittelt. Die grob skizzierte Drei-Phasen-Hypothese der Geschichte der philosophischen bersetzungen sagt also nicht, da im Wandel des Adressaten vom Gelehrten
ber den Gebildeten zum allgemeinen Leser eine Dekadenz zu konstatieren ist. Dennoch bedeutet die Vermehrung der Funktionen philosophischer bersetzung auch eine Verschiebung der Prioritten, die dazu fhrt,
da sie heute eben nicht mehr allein dem gelehrten oder auch nur dem
gebildeten Interesse gehorcht, sondern zuerst und zunchst d.e m allgemeinen Interesse einer an Philosophie im weiten Sinn interessierten Leserschaft.
bersetzungen werden hauptschlich fr Laien gemacht. Der moderne
Leser erwartet, Bcher konsumieren zu knnen, auch solche der Philosophie, auch solche aus anderen Sprachen. Der allgemeine Leser ist begierig
128
nach Philosophie, die zu ihm ohne Interpreten spricht, und eben darum
bedarf er der bersetzer. Man kann dieses Dilemma philosophisch beleuchten oder in einer Geschichte des Lesens problematisieren; im folgenden soll es allein praktisch aufgewiesen und historisch verortet werden.
Der Gesichtspunkt einer solchen historischen Annherung an die Praxis der philosophischen bersetzung mu im 19. Jahrhunderteingenommen werden, als die Geschichte der philosophischen bersetzungen einen
Sprung machte und verdeutschte Philosophen - darauf allein bezieht sich
das folgende - auf dem allgemeinen Buchmarkt zu florieren begannen.
Der Spinoza-bersetzer Berthold Auerbach bezeichnete 1871 die groe
Zahl der philosophischen bersetzungen als "ein statistisches Merkmal
unseres deutschen Culturstandes". 1 Unternehmen wie die "Philosophische
Bibliothek", die heute im Verlag Felix Meiner erscheint, oder die fast
zeitgleich Ende der 1860er Jahre entstandene "Universalbibliothek" im
Verlag Philipp Reclam bezeugen zur Genge Intensitt und Dauerhaftigkeit eines allgemeinen Interesses an Philosophie, das ganz selbstverstndlich auch auf bersetzungen zurckgreift. Seit gut hundert Jahren gelten
fr bersetzungen vor allem die Kriterien des Buchmarkts - Gelehrsamkeit und Bildung spielen bei der Produktion zwar noch eine gewisse Rolle, aber nicht die entscheidende. Da von den insgesamt zehn deutschen
bersetzungen von Spinozas "Ethica", die seit dem 18. Jahrhundert angefertigt wurden, nur bestimmte, und nicht die besten, nachgedruckt werden, hat buchhndlerische Grnde, keine wissenschaftlichen. Was man
also seit dem 19. Jahrhundert beobachten kann, ist die Tatsache, da es
keinen Fortschritt in der Geschichte philosophischer bersetzungen gibt,
wozu auch gehrt, da keine Kritik philosophischer bersetzungen entwickelt wurde.
Vgl. Auerbachs "Vorrede" zu Spinoza's Smtliche Werke, Stuttgart 1841,
2. Auflage 1871, Bd. 1, S. S (Funote).
129
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
2. Der Entfremdungseffekt der bersetzung
und verwendet durchgehend "Macht".3 "Venngen" ist in der deutschen
Die Idee einer "Philosophischen Bibliothek", wie sie im 19. Jahrhundert
philosophischen Sprache durch Kant entscheidend geprgt worden. Kant
konzipiert und umgesetzt wird, drckt sehr gut die virtuelle Zeitgenossen-
sprach vom Verstand als dem "Vermgen der Erkenntnis durch Begriffe",
schaft aus, die man durch bersetzung den Werken groer Denker verlei-
von der Vernunft als dem "Vermgen der Prinzipien" und leistete so einer
hen mchte. In der Zielsprache.vereint, treten die philosophischen Bcher
Psychologisierung Vorschub, die Verstand und Vernunft als Fhigkeiten
aus dem gelehrten Zusammenhang heraus der als Philosophiegeschichte
oder als Monographie deren wissenschaftliche Interpretation produziert
des menschlichen Geistes anspricht. Kants Wirkung bestand darin, die
"bloen Venngen" im Sinne innerer Anlagen gegenber der reell bzw.
und transfonniert.2 Sie gewinnen nicht nur sprachlich eine neue Existenz-
aktuell vollzogenen Erkenntnis oder Handlung getrennt zu haben. Genau
das Gegenteil ist bei Spinoza der Fall, der "potentia" nicht in ein Wesen,
weise, sondern damit auch historisch und der Idee nach. Das soll im folgenden an bersetzungsbeispielen illustriert werden, die deutsche Versionen von Spinoza und Leibniz betreffen.
An einigen Begriffen kann man demonstrieren, was es mit der neuen
sondern als Wesen setzt: "essentia est potentia".4
Die Radikalitt Spinozas, mit der er den scholastischen Begriff des
"Wesens" (essentia) durch einen ontologisch eingefhrten und im Gedan-
Existenzweise philosophischer Werke in bersetzung auf sich hat: "potentia" (lat.) und "puissance" (franz.), sowie "laetitia" (lat.) bzw. "joie"
Wirkungsmacht (potentia) ersetzt, geht in der deutschen bersetzung
(franz.) sind zwei bei Spinoza wichtige Begriffe, die zugleich auch in
verloren, wenn mit dem Ausdruck "Venngen" eine Welt jenseits der
anderen Texten des 17. Jahrhunderts prominent waren, etwa bei Leibniz.
strikt durch Ursache-Wirkungsverhltnisse bestimmten natrlichen Welt
kengang der Ethica immer strker allgemein verwendeten Begriff der
Unter "potentia" versteht Spinoza all das, was ein Ding verursachen
fr mglich gehalten wird. Spinoza wollte jede metaphysische Fiktion
kann, das heit alles, was es bewirken kann. "Potentia" ist so etwas wie
verborgener Krfte und Anlagen negieren, indem er den Begriff der "po-
ein Potential, eine Wirkungs- oder Ttigkeitsmacht, nicht allerdings als
tentia" einfhrte. Die Einheit des Seins verbietet bei ihm die Annahme
schlwnmemde Kiaft oder ruhendes Vermgen, sondern als tatschlich
wirkende Macht. Das englische "power'' und das franzsische "puissance"
enthalten viel von dem, was. bei Spinoza "potentia" meint. Im Deutschen
ist das Wort schwierig wiederzugeben, es wurde mit "Kraft" bersetzt
(dafr steht lateinisch auch "vis") und mit "Macht" (dafr steht lateinisch
auch "potestas"). Im 19. Jahrhundert ist es auch mit "Vermgen" bersetzt
worden (das ebenfalls fr "facultas" stehen kann). Von den vier bersetzungen der Ethica, die im 19. Jahrhundert in Deutschland entstehen, bringen drei diese Version. Nur Kirchmann bleibt der lteren Tradition treu
2
Vgl. dazu ausfhrlicher vom Verfasser: Philosophie und Universitt. Historisienmg der Vernunft im 19. Jahrhundert, Hamburg 1999, S. 292 - 317; Passagen
des folgenden Texts sind daraus entnommen.
130
Vgl. die bersetzungen von Schmidt: Spinozas Ethik, .Berlin und Stettin 1812;
von Berthold Auerbach als Bd. 3 in Smtliche Werke [Anm. 1], in der 2. Auflage leicht revidiert; von J. H. v. Kirchmann als Bd. 4 der "Philosophischen Bibliothek", Leipzig 1868; von Jacob Stern: Die Ethik von B. Spinoza, Leipzig
1888; auerdem gibt es eine bersetzung von M. Dessauer, die aber die Beweise und Anmerkungen etc. durchweg auslt: Der Sokrates der Neuzeit und sein
Gedankenschatz. Smtliche Schriften Spinozas gemeinverstndlich und kurzgefat, mit besonderer Hervorhebung aller Lichtstrahlen, Cthen 1877 (Ethica
S. 90 - 139, die bersetzung folgt fast wrtlich Auerbachs Version von 1841 ).
Vgl. im ersten Buch der Ethica Lehrsatz 34 ("Dei potentia est ipsa ipsius essentia") und im vierten Buch die allgemein auf die geschaffenen Dinge bezogene
Definition 8 ("Per virtutem et potentiam idem intelligo"), aus der sich dann im
Beweis von Lehrsatz 4 ergibt, da jedes einzelne Vermgen "ein Teil des unendlichen Vermgens Gottes" ist.
131
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
von Potentia1itten, die nicht zug1eich am Sein partizipieren. Aktua1itt
und Potentialitt sind identisch, und die Wirkungsmacht Gottes wird mit
den Wirkungsmchten der Dinge identifiziert. Da diese radikale Philosophie in das 19. Jahrhundert nur unvollkommen bersetzt wurde, sieht
man besonders daran, da die deutschen bersetzer sich mehrheitlich
gegen den lateinischen Text dafr entscheiden, einmal die "potentia Dei"
mit "Macht Gottes" zu bersetzen, ein andermal die "potentia" der Dinge
mit "Vermgen". So reproduzieren sie' eine theologische Vision des extramundanen Gottes, die Spinozas Immanenzdenken gerade aufheben
will. Davon ausgenommen sind nur Kirchmann, der 1868 durchgngig
"Macht" verwendet, und F. V. Schmidt, der 1812 durchgngig "Vermgen" setzt. 5
Das Dilerruna besteht, genauer besehen, darin, da das deutsche "Vermgen" nicht alle Bedeutungen des lateinischen "potentia" wiedergeben
kann, weil etwa im politischen Kontext und gelegentlich auch darber
hinaus das Wort eindeutig durch ''Macht" bersetzt werden mu. Ein
hnlicher Fall ist die bersetzung von lateinisch "ratio" (Franzsisch "raison" und Englisch "reason"), wo im Deutschen unvermeidlicherweise
unterschieden werden mu zwischen (unter anderem) "Grund" und "Vernunft". Sowohl Spinozas Theologisch-Politischer Traktat wie noch Rousseaus Discours sur l'inegalite verwenden "potentia" bzw. "puissance" im
Sinn der politischen "Macht". Die davon abweichende Verwendung des
Begriffs "potentia" in Spinozas Ethica ist vor allem im anthropologischen
Zusanunenhang wichtig, denn es geht dabei um den Nachweis, da der
menschliche Geist in die Maschinerie des affektiven Lebens eingreifen
kann, indem er dem menschlichen "Vermgen zu leiden" durch Erkenntnis entgegensteuert.
' Diese beiden bersetzungen sind im 20. Jahrhundert nicht mehr aufgelegt worden, im Gegensatz zu der von Auerbach und vier spteren (Stern 1888, Baensch
1905, Vogl 1909 und R. Borch 1924), die alle an der fraglichen Stelle im Deutschen "differenzieren".
132
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
Hier ist nun die Parallele zu Leibniz interessant, bei <;lern "potentia~
bzw. "puissance" im metaphysischen Zusammenhang der Substanzenlehre
auftaucht. Auch hier wird die scholastische Tradition explizit durchgestrichen, im Unterschied zu Spinoza aber nicht zugunsten eines modernisierten Tugenddiskurses (virtus = essentia = potentia), sondern zugunsten
einer an die griechische Philosophie anschlieenden Kraft- und Entelechietheorie, was im 19. Jahrhundert etwa Kuno Fischer herausgearbeitet
hat.6 Eine Stelle weiter im Regal der philosophischen Bibliothek findet
man also einen vernderten Gebrauch der gleichen Terminologie, wenn
man sich an die Originale hlt; in der deutschen bersetzung luft es
allerdings gleich auf ganz andere Begriffe hinaus.
Die bersetzung von Leibniz' Neue Abhandlungen ber den menschlichen Verstand, 1873 erschienen im Rahmen von Kirchmanns "Philosophischer Bibliothek", bers~tzt und kommentiert von Carl Schaarscbmidt,
ist noch die konsequenteste; ganz offensichtlich sah Schaarschrnidt den
Zusammenhang mit Spinoza und setzte bei Leibniz "Macht" fr "potentia", wie es Kirchmann bei Spinoza tat (was aber eben im 19. Jahrhundert
die Ausnahme war). Das Kapitel 21 des zweiten Buchs der Neuen Abhandlungen heit 1873 deshalb "Von der Macht und von der Freiheit"
("De la puissance et de 1a liberte"), und so lautet es auch in der Neubersetzung von Ernst Cassirer 1915. Cassirers Begriffsregister jedoch dokumentiert, da "puissance" von ihm auch mit "Fhigkeit" (ebenso wie
"faculte"), "Kraft" (ebenso wie "force") und "Vermgen" wiedergegeben
6
Fischer sah den "Gegensatz zu Spinoza" bei Leibniz (mit dieser ersten berschrift erffnet er sein Leibniz-Buch) so: "Von Spinoza, seinem nchsten geschichtlichen Vorgnger, entfernt sich Leibniz bis an die uerste Grenze; zu
Aristoteles und Plato, den Philosophen des Altertums, die zwei Jahrtausende
von ihm entfernt sind, setzt er sich . in die nchste Beziehung'' (K. Fischer,
"Gottfried Wilhelm Leibniz. Leben, Werke und Lehre", zuerst im Bd. 2 der Ge:hichte der neueren Philosophie, Mannheim 1855, selbstndig erschienen
erstmals in der 3. Aufl. Heidelberg 1888, hier zitiert nach der 4. Aufl. 1902,
s. 356). .
133
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
wird. Das kann nur bedeuten, da die deutsche bersetzung dem franz-
Was seit dem 19. Jahrhundert mit der intensiven Arbeit an der philo-
sischen Begriff entweder mehrere Bedeutungen unterstellt, die zu unterscheiden wren, oder da sie ihm gar keine tenninologische Prominenz
sophischen bersetzung mglich wird, ist also eine teilweise Zerstrung
des begrifflichen Feldes, das Philosophen wie Leibniz und Spinoza mit-
beimit.
einander teilen. Leibniz wird von Spinoza abgerckt, wie die deutschen
Das letztere scheint Schule gemacht zu haben, wenn man sich im 20.
Jahrhundert umsieht und etwa die seit kurzem abgeschlossene zweisprachige Studienausgabe der Philosophischen Schriften von Leibniz in die
Hand nimmt. Der Vorteil dieser Ausgabe ist, da man die Fehler eini-
Versionen der Ethica und der Neuen Abhandlungen zeigen. Man erhlt
einen mit Spinozas Philosophie inkompatiblen Sinn, wenn "potentia" bzw.
"puissance" bei Leibniz mit "Mglichkeit" oder "realer Mglichkeit"
bersetzt wird. Man erfindet eine Tenninologie, die insbesondere Leibniz
gennaen leicht durch den kontrollierenden Blick auf die linke Seite mit
interpretativ berlagert, indem sie in den Wortlaut seiner Texte vern-
dem lateinischen oder franzsischen Originaltext entdecken kann. So
dernd eingreift. Wenn Leibniz zwischen "puissance" und "possibilite"
erkennt man bei Leibniz, da die hufig vorkommenden Begriffe "faculte", "puissance" und "possibilite" im Deutschen nicht deutlich unterschie-
unterscheidet, beide Begriffe auch getrennt und unabhngig verwendet10,
den werden, denn bersetzt werden sie ziemlich freizgig mal mit "Fhigkeit", mal mit "Vermgen", mal mit "Mglichkeit". Dabei hat diese
dann wird deutschen Ohren solcher Unterschied zuletzt nicht mehr klar.
Die Bedeutung eines im 17. Jahrhundert gelufigen Begriffs wird durch
bersetzung eine Vorliebe fr "Mglichkeit", die auch in einer Anmerkung explizit gemacht wird8, wenn es beit, da Leibniz zwischen den
die bersetzung variiert und quasi vervielfltigt, so da man wesentliche
tenninologische Bezge zwischen der Scholastik, Descartes, Spinoza und
Leibniz verliert.1 1
drei genannten Begriffen zwar unterscheide, da aber im Deutschen der
Begriff ''Mglichkeit" aus sachlichen Grnden sowohl fr "possibilite" als
Bei Spinoza gibt es einen anderen Fall von aneignend-entfremdender
Interpretation in der bersetzung, nmlich die bersetzung von "laetitia"
auch fr "puissance" gebraucht werden msse, wobei erstere die Denkmglichkeit, letztere die reale Mglichkeit bezeichne. Das bereits erwhnte Kapitel 21 des zweiten Buchs heit hier also "ber die Mglichkeit und die Freiheit", wobei im Text "puissance" eine ganze Weile durch
"reale Mglichkeit" wiedergegeben wird. Wenn Leibniz - analog zu Spinoza - von "puissance passive" und "puissance active" spricht, erhlt der
10
So taucht "puissance" etwa in der Metaphysischen Abhandlung auf, wo es heit,
da sie "ausgebt" werde bzw. die Natur des Begrenzten im Menschen reprsentiere (Nr. 15 und 16). In den Philosophischen Schriften wird beidemal ''Vermgen" bersetzt (Bd. 1, hg. und bers. v. H. H. Holz, Darmstadt 1965, 2. Aufl.
1985, S. 103, 105), whrend Buchenau/Cassirer einmal "Macht" und einmal
"Fhigkeit" bersetzen; vgl. Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, bers. v. A. Buchenau, hg. v. E. Cassirer, Bd. 2 (Philosophische Bibliothek 497), Hamburg 1996, S. 360 und 362.
11
Mit Hans Poser kann man anerkennen, da Leibniz "Mglichkeiten" und "Verwirklichungsfhigkeiten" identifiziert, weil fr ihn die Ontologie eine Dimension der Logik ist (vgl. H. Poser, Zur Theorte der Modalbegrif!e bei Leibniz,
Wiesbaden 1969 [Studia Leibnitiana Supplementa VI], S. 87 f.), es bleibt
gleichwohl ein vom bersetzer zu respektierendes Faktum, da diese Identifizierung in den Texten von Leibniz vollzogen wird, gerade indem dort (noch) ein
Unterschied zwischen "possibilite" und "puissance" besteht.
deutsche Leser eine im Grunde unverstndliche Neubildung der bersetzer, die von "passiver" und von "aktiver Mglichkeit" bandeln.9
7
G. W. Leibniz, Philosophische Schriften, fnf in sieben Bnden, Frankfurt am
Main und Darmstadt 1985 - 1992.
Ebenda, Bd. 3/1: Neue Abhandlungen ber den menschlichen Verstand, hg. und
bers. v. Wolf von Engelhardt und H. H. Holz, Darmstadt 1959, 2. Aufl 1985,
s. 241.
Vgl. ebenda, S. 381.
134
135
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
ULRICH JOHANNES SCHNErDER
mit "Lust", die in der dritten Ethica-bersetzung am Anfang des 19.
Jahrhunderts aufkommt und im ganzen 19. Jahrhllndert beibehalten wird.
Durch diese bersetzung verliert der deutsche Leser Spinozas jeden Bezug von dessen Affektenlehre zu hnlichen Abhandlungen vor und nach
Spinoza - etwa zu Descartes' Passions de l'ame, wo "joie" Freude und
"tristesse" Trauer heit, ebenso wie an verschiedenen Stellen bei Leibniz.12
Es besteht kein Zweifel: "laetitia" heit im Deutschen "Freude", nicht
"Lust", wiewohl es natrlich Grnde dafr geben kann, beide begriffiich
zu identifizieren, was im 19. Jahrhundert auch einige Lexika nahelegen. 13
12
In den Neuen Abhandlungen wird von "joie" und "tristesse" (Buch 1, Kap. II)
gesprochen; sowohl der erste bersetzer fr die "Philosophische Bibliothek",
Schaarschmidt (1873), als auch der zweite, Cassirer (1915), haben sich dort fr
"Lust" und "Unlust" entschieden (vgl. 1873: S. 57, 59, 1915: S. 57, 59, 1996:
S. 52, 54); auch die neueste Teilbersetzung von Werner Schler ist in diesem
Sinne konsequent (Neue Abhandlungen, Vorrede und Buch 1, Stuttgart 1993),
whrend die Philosophischen Schriften einmal "Lust" und "Unlust", ein andermal "Freude" und "Traurigkeit" bersetzen [Anm. 7], Bd. 3/1, S. 51 und 55.
Vgl. zu den Fehlern beider bersetzungen und ihren Differenzen Klaus Jacobi,
"Bemerkungen zum Verstndnis der Leibniz'schen 'Nouveaux Essais sur l'Entendement humain' anllich des Nachdrucks der von E. Cassirer besorgten
Ausgabe'' in: Studia Leibnitiana 5 (1973), S. 196 - 232.
13
Vgl. Theodor Heinsius, Vollstndiges Wrterbuch der Deutschen Sprache, Bd.
2, Wien 1840, S. 833, und Joh. Christ. Aug. Heyse, Handwrterbuch der deutschen Sprache, Bd. 2, Magdeburg 1849, Neudruck Hildesheim 1968, S. 99 ff,
die beide die blichen psychologischen Bedeutungen (Lust haben zu etwas etc
Unlust haben) verzeichnen. Die zuvor bei Adelung noch gegebenen und philosophisch vom Wolffianismus beeinfluten Unterscheidungen (Freude als
"merklicher Grad der angenehmen Erkenntnis"; Lust als "uerung einer anschauenden Erkenntnis des Angenehmen oder der angenehmen Empfindung")
sind also verschwunden, bevor der Einflu Kants greift. Vgl. Johann Christoph
Adelung, Grammatisch-kritisches Wrterbuch der hochdeutschen Mundart, Bd.
2, Leipzig 1796, S. 279 ff 2134 f.; vgl. auch Deutsches Wrterbuch von Jacob
136
Da eine solche begriftliche Identifizierung bei der bersetzung auf die
sprachliche Ebene durchschlgt, ist an diesem Beispiel offensichtlich,
wobei die bersetzung sich hier streng genommen nicht unmittelbar auf
einen einzelnen Terminus bezieht, sondern eine systematische bertragung vornimmt: Man parallelisierte im 19. Jahrhundert Spinozas Paarung
von "laetitia" und "tristitia" mit Kants Begriffspaar "Lust" und "Unlust".
Fr Spinoza steht "laetitia" fr einen Affekt, also eine Leidenschaft, aber
eine solche, die die "potentia agendi" des Menschen untersttzt bzw. vergrert, den Menschen also zu einem aktiven macht. 14 "Trauer" dagegen
bedeutet im Gegenteil ein Verharren in Passivitt, eine Verminderung der
"potentia agendi". In der Kantischen Philosophie bedeutet "Lust" die
bereinstimmung eines Gegenstands mit den Bedingungen der Subjektivitt, ohne aber Erkenntnis zu konstituieren, ''Unlust" dagegen ist der
Mangel an bereinstimmung: So findet sich das Begriffspaar vor allem in
der Kritik der Urteilskraft erlutert. Im Licht dieser Auffassung wird
Spinozas Affektenlehre durch die deutsche bersetzung von der Transzendentalphilosophic her verstanden, fr die in jedem Fall feststeht, da
"Lust und Unlust [.) das Subjektive an einer Vorstellung (ist), was gar
kein Erkenntnisstck werden kann." 15 Das ist weit entfernt von Spinozas
Denken, vor allem weil bei Kant die Thematik von Lust und Unlust fr
das sthetische Urteil bedeutsam ist, bei Spinoza aber der Antagonismus
von Freude und Trauer im Rahmen der Ethik und der Theologie wichtig
wird. Bei Spinoza ist Freude zuletzt eine "Erkenntnis, begleitet von der
Idee Gottes als Ursache", die "hchste Freude" (summa laetitia) ist die
und Wilhelm Grimm, Bd. 6, Leipzig 1885, Neudruck als Bd. 12, Mnchen
1984, s. 1314 - 1327.
14
Vgl. Spinoza, Ethica III, 57, Beweis.
is Georg Samuel Albert Mellin, Enzyklopdisches Wrterbuch der kritischen Phi
losophie oder Versuch einer falichen und volfstndigen Erklrung der in Kants
kritischen und dogmatischen Schriften enthaltenen Begriffe und SIJtze, Bd. 4,
Jena 1801, S. 40; vgl. Bd. 2 (1799), S. 758 ff. und die ersten Abstze von Kants
Metaphysik der Sitten.
137
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
Erkenntnis Gottes. 16 Kirclunanns bersetzung war im 19. Jahrhundert die
einzige, die den "Kantianismus" vennied, in der bersetzung von "Lust"
und "Unlust" zu sprechen - F. V. Schmidt (1812), Auerbach (1841, 2.
Aufl. 1871) und Stern (1888) dagegen brachten ihn. So berlebt er bis
heute in den Nachdrucken ihrer bersetzungen 17, und prgt unsere heutige "Philosophische Bibliothek".
3. Der Verfremdungseffekt der bersetzung
Wenn man die bersetzung von philosophischen Texten ohne Rcksicht
auf den zeitgenssischen Kontext, also das Auseinanderreien des begrifflichen Feldes zeitgenssischer Philosophie, noch historisch verstehen
kann, indem man auf den Entstehungskontext der bersetzung selbst
eingeht, gibt es ein zweites Charakteristikum der philosophischen bersetzung, das sehr viel gewhnlicher ist und eigentlich nicht entschuldigt
werden kann: die Inkonsistenz, die immanente Unsauberkeit.
Wenn etwa Spinoza den Begriff der "Kraft" (vis) zu Beginn des vierten Buchs der Ethica pltzlich sehr hufig gebraucht, und zugleich den
Begriff des "Vermgens" (potentia) parallelfiihrt, ja beide sogar zu identifizieren scheint, darf das keinen bersetzer zur Nachlssigkeit veranlassen. Die bersetzung von Otto Baensch von 1905 geht in diese Falle,
wenn sie "vis" und "potentia" einerseits gleiclunig mit "Kraft" bersetzt, dann aber fr vis auch "Gewalt" nimmt, das hier sonst fr "potestas"
16
Spinoza, Ethica V, 32, Folgesatz, und 27, Beweis.
17
Jakob Stern hatte offenbar bereits Schwierigkeiten damit, denn er schreibt im
Vorwort, man msse Lust und Unlust bei Spinoza nicht als unmittelbare Gefhle verstehen, und fgt in seinen "Erluternden Bemerkungen" an, Freudigkeit und Traurigkeit wren wohl die besseren deutschen quivalente, weil "reflektierte Gemtsbewegungen" gemeint seien (Die Ethik ( 1888), S. 13, 405). In
den Nachdrucken seiner bersetzung sind diese Erklrungen smtlich weggefallen, sowohl in der Ausgabe Reclam Leipzig (1972, zuletzt 1987) wie in derjenigen aus Stuttgart ( 1977).
138
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
steht. 18 Aus solchen Passagen, in denen der Philosoph seine Begriffe aus
dem Unterschied zu anderen erklrt, lernt jeder Leser rasch und einfach
das Wesentliche der neuen Philosophie - wenn ilun die bersetzung dabei
nicht ein Bein stellt.
Differenzierungen im Vokabular sind eine gewhnliche Schwierigkeit,
so etwa wenn Spinoza im 14. Lehrsatz des zweiten Buchs "disponieren"
benutzt, im unmittelbaren Anschlu an Stellen, wo er von "bestimmen"
bzw. "affiziert werden" in bezug auf den menschlichen Krper spricht.
Auerbach bersetzt in der ersten Auflage (1841) korrekt, ndert aber in
der zweiten Auflage (1871) das "disponiert werden" in ein "bestimmt
werden", so da ein deutscher Ausdruck zwei lateinische abdeckt. Sachlich ist das nicht falsch, nur hat Spinoza sich eben verschieden ausgedrckt, und es ist wichtig zu sehen, da zwei Verben im Lateinischen
dasselbe aussagen, was sich berdies im Deutschen gut wiedergeben lt
(Krper knnen "bestimmt" bzw. "disponiert" werden). Eine rtselhafte
Nachlssigkeit, weil sie in der berarbeitung auftritt. Schwerer triffi eine
andere nderung das Verstndnis des deutschen Lesers: "notiones communes" (Ethica II, Anmerkungen zu Lehrsatz 40 und Anmerkung zu
Lehrsatz 47) hatte Auerbach 1841 angemessen mit "Gemeinbegriffe"
bersetzt und von den "notiones universales" (Anmerkung zu Lehrsatz
48) als den "Allgemeinbegriffen" abgesetzt. In der zweiten Auflage werden beide Ausdrcke an allen Stellen durch "Gesamtbegriffe" ersetzt und
damit der fr die Erkenntnistheorie zentrale Unterschied zwischen den
Begriffen des rationalen Denkens ("notiones communes") und den als
Einzelwesen hypostasierten Begriffen der Scholastik ("notiones universales") eingeebnet. Bei der Revision dieser zweiten Auflage fr eine Neuausgabe 1967 hat Konrad Blumenstock die Auerbachsche Verschlimmbesserung zu heben gesucht - und noch mehr Chaos produziert. Denn
18
Ethik, nach geometrischer Methode dargestellt, bersetzt und mit Anmerkun-
gen und Registern versehen von Otto Baensch, Leipzig 1905, 2. Aufl. 1910,
zuletzt aufgelegt 1989, S. 192 ff 273.
139
ULRJCHJOHANNESSCHNEIDER
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
zwar hat er an einigen Stellen (Lehrsatz 40) "Gemeinbegriffe" restituiert,
Gegenmeinung referiert) und Wirkungskraft (virtus agendi). Die berset-
an anderen aber "Gesamtbegriffe" gelassen (Lehrsatz 47, Anm.) Auer-
zungen des 19. Jahrhunderts waren hier noch genauer.20 Da "virtus" mit
dem heit es bei ihm einmal "Universalbegriffe", ein andermal "Allge-
"Kraft" bersetzt werden msse, hat Leibniz selbst in Klammem ange-
meinbegriffe", wenn von "notiones universales" die Rede ist. Eine andere
merkt, der deutsche Text der Studienausgabe redet dagegen zunchst, wie
Eigenkorrektur Auerbachs ist die nderung der bersetzung von "essentia" durch "Wesenheit" statt durch "Wesen", die aber nicht strikt durchgehalten wurde, was auch Blumenstock entgangen ist (vgl. "Wesen" und
schon bei der "facultas agendi", auch bei "virtus agendi" von "Vermgen
zu handeln", nur um einen Absatz weiter dann von der "Kraft zu handeln"
zu reden. Bedeutsam ist, und von der bersetzung letztlich entwertet, da
"Wesenheit" zugleich etwa in Lehrsatz und Beweis von Ethica I, 11; II, 46
und fter, vor allem in Buch V). 19
Leibniz diesen Abschnitt mit der Bemerkung beginnt, da der Begriff der
Kraft (vis bzw. virtus) sehr viel Licht beibringe, den wahren Begriff der
Bei Leibniz steht es um den begrifflichen Zusammenhang nicht bes-
Substanz zu verstehen. Im Anschlu daran fhrt er seine eigenen Defini-
ser. In der schon erwhnten Studienausgabe des 20. Jahrhunderts gibt es
ein Beispiel fr eklatante Inkonsistenz. Auf der letzten Seite einer latei-
tionen von vis und virtus, von potentia und facultas gegen die der scholastischen Tradition ein und stellt seine dynamische Theorie der Substanzen
nisch geschriebenen Studie ber die Verbesserung der Philosophie bringt
auf, die bis heute als eine seiner wichtigsten Lehren gilt.
Zur Verdeutlichung der grundstzlichen Problematik mgen noch
Leibniz eine fr sein Denken zentrale Unterscheidung an, nmlich die
zwischen "aktiver Kraft" (vis activa) und "bloem Vermgen" (potentia
zwei Beispiele von Leibniz-bersetzungen des 20. Jahrhunderts dienen,
nuda), wobei letzteres auf deutsch als "nackte Mglichkeit" erscheint.
zuerst die bersetzung der Schrift Das Neue System der Natur, die Leib-
Einen Satz weiter przisiert Leibniz, da das bloe Vermgen, von dem
niz 1695 im Pariser Journal des S~avans verffentlichte und von der es in
der "Einleitung des Herausgebers" in der zuletzt zitierten Ausgabe heit:
die Scholastiker reden, lediglich eine Handlungsmglichkeit (possibilitas
agendi) bezeichne, wohingegen sein Begriff der "aktiven Kraft" bereits
ein "Tun" (actus) bzw. ein "Streben" (conatus) einschliee, also nicht von
auen veranlat werden mu. Der deutsche Text bersetzt den Leibnizschen Ausdruck "possibilitas", nicht anders als zuvor den scholastischen
Ausdruck "potentia", mit "Mglichkeit", und macht den Sinn der Unter-
"Dies ist die einzige Darstellung seines philosophischen Systems, die
Leibniz selbst publiziert hat." Der Leser erwartet entsprechenden Respekt,
wird aber enttuscht. Der franzsische Originaltext hat eine klare begriffliche Struktur, die bersetzung verunldrt. So wenn "animal" auf deutsch
sowohl "Tier" als auch "Lebewesen" heit, oder wenn "action" einmal als
scheidung zunichte, ebenso wie den zwischen Wirkungs- oder Ttigkeits-
"Handlung", ein andermal ars "Einwirkung" oder als "Wirksamkeit'' wie-
befhigung (facultas agendi, wieder ein Ausdruck, mit dem Leibniz die
dergegeben wird. Meistens (und am zutreffendsten) wird "action" mit
"Ttigkeit" bersetzt, berflssigerweise aber dient dieser Ausdruck hier
zugleich der bersetzung von "activite", "acte" und "operation", also
19
Auerbach hat fr die zweite Auflage [Anm. 1] noch eine Reihe von anderen
Revisionen vorgenommen; so heit es seit 1871 auch "Vorstellung" (idea) statt
"Idee" und "Phantasievorstellung" (imaginatio) statt "Vorstellung"; zur Latinisierung der deutschen philosophischen Sprache trugen solche nderungen bei
wie "Affekt" (affectus) statt vorher "Seelenbewegung", "Affektion" (affectio)
statt "Erregung" "Modus" (modus) statt "Art", "intuitives Wissen" (scientia intuitiva) statt "anschauendes Wissen".
140
20
Vgl. Leibniz, Philosophische Schriften [Anm. 7], Bd. 1, S. 199, und dagegen
Leibniz, Die kleineren philosophisch wichtigeren Schriften, bers. und erlutert
von J. H. v. Kirchmann, Leipzig 1879 (Philosophische Bibliothek 81), S. 53;
Leibniz, Kleinere philosophische Schriften, hg. und bers. von Robert Habs,
Leipzig 1883 (Reclams Universalbibliothek), S. 175 t:
141
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
Ausdriicken, die durchaus eigene Entsprechungen im Deutschen verdienen. Auch in anderen Fllen. finden sich verschiedene franzsische Ausdriicke mit einem einzigen deutschen Terminus belegt. So steht "bereinstimmung" sowohl fr "accord" als auch fr "conformite", "Ausstrahlung"
sowohl fr "emanation" als auch fr "emission". Solche Fehler, wenn sie
wiederholt auftreten, verunsichern den Leser erheblich, weil er verkehrte
Bezge erkennt oder gar keine.
Das letzte Beispiel stammt aus den Neuen Abhandlungen von Leibniz.
Hier bemerkt der Leser zunchst, da "objet" zunchst durch "Gegenstand" wiedergegeben wird, pltzlich aber durch "Objekt", bevor nach
mehreren Seiten wieder die erste Version bernommen wird. rgerlicher
ist die bersetzung von "solidite", einem wichtigen Begriff der Physik bei
Leibniz, nicht nur mit dem zutreffenden Ausdruck "Festigkeit" (im Ge-
sind im Falle von Spinoza und Leibniz die Verfremdungseffekte der deutschen bersetzung auch nicht ganz so gravierend wie bei Jean-Jacques
22
Rousseau. Denn Spinoza und Leibniz gelten heute fr eher "akademische" Autoren, deren genaue Lektre in Universittsseminaren stattfindet,
wo jederzeit auf den Wortlaut der lateinischen und franzsischen Originale zurckgegriffen werden kann. 1m Gegensatz dazu ist Argwnentationstreue in der bersetzung sekundr, weil diese vor allem dem "ersten"
Kontakt mit einem Denker dient.
Das kann man noch genauer sagen: Was die zuletzt aufgewiesenen
Fehler rechtfertigt, ist ein Verstndnis von Philosophie, das den einzelnen
Denker mit einer "Position" identifiziert, eine Ansicht von geistiger Produktion als einer Art hherstufiger Meinung, deren Kenntnisnahme sich
der Detailprobleme entheben kann, die mit bestimmten Ausdrcken und
gensatz zu Flssigkeit), sondern auch mit "Widerstandskraft" (wofr
Leibniz ein eigenes Wort hat: "resistance", das auch vorkonunt) und, an
ganz entscheidender Stelle, mit "Dichtheit".21 Ganz durchsichtig sind die
Wendungen verbunden sind. In dieser populren Auffassung wird die
Textgestalt der Philosophie mit einer groben intellektuellen Beschreibung
Grnde dieser Wortwahl, denn das Wort "fermete" taucht auf und wird
vom bersetzer flugs mit "Festigkeit" bersetzt, ohne seinen frheren
Gebrauch zu bedenken ("fermete" wird bei Leibniz mit Kohsion zusammengedacht und bezeichnet die Geschlossenheit eines Krpers, der nicht
jederzeit auseinanderfllt). Ein deutscher Leser wird von der Krperlehre
hier rein gar nichts verstehen, weil die Begriffe nicht nach dem systematischen Verstndnis, das Leibniz selbst ganz offenbar besitzt, sondern nach
dem unmittelbaren Kontext bersetzt sind.
on. Das Verstndnis bleibt auf diese Weise oberflchlich, weil es eher am
Umri sich festhlt statt am ausgefllten Bild. bersetzung bedient diese
Oberflchlichkeit durch Nachlssigkeit, die dem genauen Nachvollzug
der Gedanken durch den Leser willkrliche oder unsichtbare Grenzen
zieht.
Dazu kommt, da es keine akademische Kontrolle der Gelehrten ber
das Bild gibt, das die allgegenwrtigen bersetzungen von der Philosophie groer Denker verbreiten. Bis ins spte 20. Jahrhundert luft die
Steigerung des gelehrten und editorischen Respekts fr die genaue Wrtlichkeit der philosophischen Rede neben ihrer ungenauen Vervielfltigung
im Mediwn der bersetzung einher. Exzessive Philologie und Freizgig-
4. Die zwei Grnde der bersetzungskritik
Nun knnte man denken, die zitierten Beispiele der Nachlssigkeit, Ungenauigkeit und Begriffsverwirrung lieen sich oft vermeiden. Vielleicht
ihrer Artikulation in eins gesetzt, nicht mit der Spezifik der Argumentati-
22
21
Leibniz, Philosophische Schriften [Anm. 7), Bd. 3/1, S. 105, 127 ff. Auch
Kirchmann (1873, S. 83, 95 ff.) und Cassirer (1915, S. 85, 97 ff.) haben "solidite" als "Festigkeit" und als "Dichtigkeit" bersetzt.
142
Vgl. J.-J. Rousseau, Diskurs ber die Ungleichheit/Discours sur l'inegalite, kritische Ausgabe des integralen Textes, ediert, bersetzt und kommentiert v.
H. Meier, Paderborn 1984. Im Vorwort legt Meier berzeugend dar, da vorhergehende bersetzungen die Begrifflichkeit Rousseaus entsteJlten.
143
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
ULRlCH JOHANNES SCHNEIDER
keit in der Kopie verdoppeln die groen Philosophen in studierte und
Interesses an Philosophie bercksichtigen mu, das vom Studium der
bewunderte Autoritten - zwei Gestalten, die in philosophiehistorischen
Philosophie zu unterscheiden ist, wie es ihre wissenschaftlich gebildeten
Synthesen immer wieder prekr zusammengehalten werden. Von der Seite
Liebhaber betreiben. Die Integration philosophischer Autoren in eine
sprachlich homogenisierte Gegenwart bezeugt ein Verlangen, die Autoren
des Lesers aus gesehen, heit das: Den schematischen Philosophie-Bildern der krzeren Grundri-Philosophiegeschichten korrespondieren gro-
als Zeitgenossen anzusehen und ihnen Bedeutung fr das eigene Fragen
be Philosophie-bersetzungen, die selten nur eine Annherung an die
originale Artikulation des Denkens darstellen. Die "Philosophische Bibliothek" reprsentiert durch Textwahl, die bersetzten Texte durch Wort-
und Denken zu verschaffen. In diesem Kontext hat insbesondere die
bersetzung philosophischer Schriften die Funktion, Texte unterschiedlicher Zeiten fr ein und dieselbe Welt aussagekrftig zu machen, was nicht
wahl eine literarisch ebenso greifbare wie deformierte Gestalt des Philo-
notwendigerweise mit groem Respekt fr den immanenten Sprachge-
sophierens. bersetzung ist Verfremdung, wenn der Text durch sie etwas
brauch des jeweiligen Autors verbunden ist. So bleiben verdeutschte
Begriffenes, nicht ein zum Nachdenken Aufgegebenes wird.
Angesichts der an Spinoza und Leibniz exemplifizierten Entfremdungs- und Verfremdungseffekte mu man also konstatieren, da es seit
dem 19. Jahrhundert keine Verbesserung der bersetzungsarbeit gab, nur
Denker der europischen Geistesgeschichte ihrem Kontext entfremdete
und dazu in der Terminologie verfremdete Gestalten des Geistes. Die
eine unkritische Vermehrung, und da akademische Aktivitten bis hin zu
Dissertationen, Habilitationen und historisch-kritischen Werkausgaben
bersetzung ist in ihrer Entstehung bereits Interpretation, durch ihren
Erfolg kann sie dominant werden und uns isolierte Monumente prsentieren, wo ein Problem- und Argumentationszusammenhang existiert.
insgesamt wenig Einflu auf die Kultur der philosophischen bersetzung
Vor allem fr die bersetzungskritik haben diese Einsichten aus der
Geschichte der philosophischen bersetzung eine wichtige Konsequenz.
gehabt haben. So werden weiterhin fehlerhafte Versionen vertrieben bzw.
blicherweise bleibt diese Kritik den Experten vorbehalten, die aus der
23
es bleiben neue bersetzungen ohne entscheidende Verbesserung.
Fr eine Geschichte der philosophischen bersetzung bedeutet dies,
da man seit dem 19. Jahrhundert die Selbstndigkeit eines allgemeinen
Kenntnis des Urtexts argumentieren. Weil die begriftlichen Anforderungen philosophischer Texte besonders hoch sind, kommt es in strittigen
Fllen zwar gelegentlich zum Expertenstreit, der aber meist ohne Auswirkungen auf die Ttigkeit philosophischer bersetzer bleibt. Nach dem
23
bisher Angefhrten ist es aber gar nicht notwendig, die Beurteilung von
Diese Aussage gilt grosso modo; lobenswerte Ausnahmen im Hinblick auf
Spinoza und Leibniz sind die inzwischen teilweise bereits realisierte zweisprachige Spinoza-Ausgabe im Verlag Felix Meiner und diverse Bemhungen um
Leibniz, wie die von Ursula Goldenbaum herausgegebene Studienausgabe (bisher erschienen: Philosophische Schriften und Briefe 1683 1687, Berlin 1992)
und die Neubersetzung des ersten Buchs der Neuen Abhandlungen fr Reclams Universal-Bibliothek durch Werner Schler [Anm. 12], der in seinem
Vorwort auch eine Kritik der vorangegangenen bersetzungen unternimmt. Ein
anderes Beispiel ist die durch Traugott Knig bcgoMen und durch Vincent von
Wroblewsky weitergefhrte Revision smtlicher deutschen Texte von Jean-Paul
Sartre im Rowohlt-Verlag.
144
bersetzungen allein den Experten der Terminologie vorzubehalten, weil
man auch in der Idee virtueller Zeitgenossenschaft einen Mastab der
Kritik finden kann. Denn insoweit es ein gemeinsamer Kontext ist,' in den
philosophische Werke durch die bersetzung gestellt werden, kann von
diesem her nach der bertragung zentraler Begriffe gefragt werden, also
danach, wieweit die bersetzer "externe" Zusammenhnge und "interne"
Differenzierungen respektieren. Es sind die historisch angehuften Ergebnisse der bersetzungsttigkeit, die uns heute nicht mehr nur fragen lassen, ob ein einzelnes Werk angemessen bersetzt worden ist, sondern
145
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
auch, ob der Autor, seine Sprache und seine Philosophie im richtigen
bersetzungskontext steht.
historisch nicht entschieden werden kann. Konsequent wre eine radikal-
Man mu allerdings unterscheiden und zwei Grnde der berset-
prsentistische bersetzungsmethode nur, wenn ununterbrochen alle
zungskritik auseinanderhalten. Die oben zuerst angefhrten Beispiele von
zungspraktisch in die Beliebigkeit, weil zwischen Vorverstndnissen
bersetzungen revidiert und den neuesten Vorurteilen angepat wrden.
Spinoza- und Leibniz-bersetzungen bezeugen interpretierende, genauer:
Das Aneignende und :Zugleich historisch Entfremdende jeder berset-
aktualisierend-aneignende bersetzungen, die im einzelnen eine zeitgeder Begriffe ignorieren und den Autor seiner Zeit entfremden. 24 Selbst
wenn man pragmatisch einrumt, da in vielen Fllen Verstndlichkeit
zung kann in einem prinzipiellen Sinn den Grund fr eine bersetzungskritik abgeben, in eben diesem prinzipiellen Sinn aber ist dieser Grund
immer schon relativiert. Eine nicht-prsentistische bersetzung ist unmglich, und so bleibt es eine dauernde und dauernd sich verndernde
durch "Prsentismus" in der Begriffswahl erreicht wird, kann man einwenden, da diese Verstndlichkeit sozusagen lokal bleibt: Spinoza von
Kant her zu verstehen, schliet ein Verstehen im Hinblick auf Leibniz aus.
Schwierigkeit philosophischer bersetzungen, den Zusammenhang der
bersetzungen untereinander und mit den Werken der bersetzungssprache herzustellen. Das ist ganz besonders schwierig, wenn wir mehrere
Selbst wenn man sich in Erinnerung ruft, da Spinoza und Leibniz in die
Autoren auf einmal in den Blick nehmen. Wie gesehen, wird durch die
philosophische Bibliothek eines Lesers seit dem 19. Jahrhundert nur unter
der stillschweigenden Voraussetzung aufgenommen worden sind, da .
Kant hergestellt und zugleich dadurch der Bezug zwischen Spinoza und
Kants Werke bereits Teil davon waren, kann man terminologische Ein-
Descartes, Leibniz und anderen geleugnet, bei denen "laetitia" auf deutsch
griffe der geschilderten Art als begrenzte hermeneutische Gewinne mit
mit "Freude" wiedergegeben wird. Die Praxis der bersetzung zerstrt
den Zusammenhang der Philosophien, den sie in der sprachlichen Angleichung vorstellt.
nssische Verstndlichkeit ermglichen, dabei aber das historische Feld
groem allgemeinen Schaden qualifizieren. Was philosophisch-systematisch sinnvoll war und ist, etwa wenn Adolf Trendelenburg den Begriff
"Lust" nur mit Bezug auf Aristoteles und Kant diskutiert25, fhrt berset-
24
ln dieser Hinsicht bezeichnend ist der Artikel "Lust/Freude" im Historischem
Wrterbuch der Philosophie, Bd. 5, Basel 1980, Sp. 551 - 562, bes. 558 ff
(Autor: W. Stempel), wo Lust und Freude samt ihren fremdsprachlichen Entsprechungen bereits im Titel identifiziert werden. Im deutschen Begriff der
"Lust" sind damit explizit aufgenommen: englisch "desire" (Locke) und "pleasure" (Hume), franzsisch "plaisir" (Leibniz) und ~oie" (Descartes), sowie lateinisch "laetitia" (Spinoza) und "voluptas" (Hobbes). Die These, da alle diese
Begriffe gleichbedeutend seien, wrde bei wrtlicher bersetzung sicher deutlicher werden als durch die vorausverfgte Einebnung der begriffiichen Unterschiede.
zs A. Trendelenburg, "Lust und das ethische Prinzip'', in: ders., Historische Beitr-
ge zur Philosophie, Band 3, Berlin 1867, S. 192 - 214.
146
bersetzung von "laetitia" mit "Lust" ein Bezug zwischen Spinoza und
Ein anderer Grund fr die bersetzungskritik macht sich nicht an der
starken Vernachlssigung des Zusammenhangs der Texte untereinander
fest, wenn deren Vokabular durchaus unterschiedlich angeeignet wird,
sondern an der Vernachlssigung des Vokabulars der einzelnen Texte
selbst. Was damit zugleich kritisiert wird, ist die Einstellung, vergangene
Philosophien als in sich selbst geschlossene Positionen zu verstehen,
weniger als voraussetzungsvolle Argumentationen. Eine bersetzungskritik, die hier Fehler anklagt und Versumnisse markiert, schlgt sich
nicht automatisch auf die Seite der Experten, denn sie kann sich ja ganz
einfach nur am Widerspruch, an der Ungenauigkeit oder Ungereimtheit
im bersetzten Text entznden. Begriffiiche Genauigkeit ist kein Selbstzweck der philosophischen bersetzung, sondern ein Mittel der Verdeutlichung von Bezgen und Argumentationen. Philosophische Texte sind
147
ULRICH JOHANNES SCHNEIDER
komplizierte Strukturen mit impliziten Zitaten, die nicht erklrt, vorlufigen Sprachregelungen, die im Verlauf aufgegeben, und ironischen Passagen, die nicht aufgelst werden. Wenn nun bersetzer hufig versuchen,
den Wortlaut zu vereinheitlichen und Spannungen zwischen Begriffen
aufzulsen, indem sie "sinngem" bersetzen, verlassen sie ihre Aufgabe
und beginnen zu gltten, was im Original keine Glttung vertrgt. Vernderungen des Textes an einer Stelle fhren auch oft zu Ungereimtheiten
an anderen, weil der in philosophischen Texten bliche strenge Begriffsgebrauch durcheinanderkommt. Die zweite Gruppe von Beispielen aus
bersetzungen von Spinoza und von Leibniz haben gezeigt, wie leicht
durch Miachtung terminologischer Differenzierungen Verwirrung gestiftet wird. Und die Geschichte der philosophischen bersetzung zeigt,
da es eine Tradition dieser Richtung gibt, da zumindest seit Beginn der
serienmigen philosophischen bersetzung im 19. Jahrhundert eine bis
heute nicht korrigierte Verfremdung der philosophischen Sprache stattfindet, und zwar hufig gerade da, wo alte Definitionen in neue berfhrt
werden, wo die jedem Philosophen eigene Wortwahl sich formt und ord-
Zur Geschichte und zur Kritik philosophischer bersetzungen
Allein die Geschichte der philosophischen bersetzung und deren Evidenz einer akkumulierten Heterogenitt machen heute diesen ersten und
prinzipiellen Grund einer bersetzungskritik strker als zuvor aktuell.
Wir mssen nmlich fragen: Was fr eine Sprache spricht eigentlich der
deutsche Spinoza, Platon, Rousseau? Den Experten, die sich an den originalen Text halten knnen, liegt diese Frage fern, fr die Leser einer immer
schon in bersetzung lebenden Welt ist sie dagegen eine praktische, naheliegende, und zuletzt auch eine philosophische Frage, denn ganz offenbar ist es unsicher, ob eine Sprache nicht fr die Philosophie zu wenig ist.
net.
Dieser zweite Grund einer bersetzungskritik bleibt also immer gltig: Die Konsistenz der Gedankenfhrung, die Strenge der Begriffsverwendung ist das Innerste des Philosophierens selbst. Wenn bereits der
allgemeine Leser mit dem philosophischen Buch genaues und klares
Denken begehrt, kann eben dieses Motiv zum guten Grund fr die immanente bersetzungskritik werden. Ein Begriffsglossar wre eine praktische Antwort auf diese Kritik, denn sie knnte in jedem einzelnen Fall
das originale sprachliche Gefge auch in der Zielsprache nachkonstruierbar machen.
Am Begriffsglossar wre freilich immer auch das Aneignend-Entfremdende der bersetzung erkennbar, und gleicliwohl kann man die Kritik
daran nicht wirklich fr die bersetzungsarbeit fruchtbar machen, da, wie
gesehen, unser Verstndnis unweigerlich von Begriffen getragen wird,
gegenber denen die des fremdsprachigen Originals verschieden sind.
148
149
Das könnte Ihnen auch gefallen
- De apice theoriae. Die höchste Stufe der Betrachtung: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 19)Von EverandDe apice theoriae. Die höchste Stufe der Betrachtung: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 19)Noch keine Bewertungen
- Kultur und Übersetzung: Studien zu einem begrifflichen VerhältnisVon EverandKultur und Übersetzung: Studien zu einem begrifflichen VerhältnisLavinia HellerNoch keine Bewertungen
- Explorationskino: Die Filme der Brüder Dardenne: Die Entdeckung des Menschlichen und die Forderung nach VerantwortungVon EverandExplorationskino: Die Filme der Brüder Dardenne: Die Entdeckung des Menschlichen und die Forderung nach VerantwortungNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Komparatistische Perspektiven: Zur Theorie der vergleichenden LiteraturwissenschaftVon EverandKomparatistische Perspektiven: Zur Theorie der vergleichenden LiteraturwissenschaftNoch keine Bewertungen
- Verstehen und Verständigung: Intermediale, multimodale und interkulturelle Aspekte von Kommunikation und ÄsthetikVon EverandVerstehen und Verständigung: Intermediale, multimodale und interkulturelle Aspekte von Kommunikation und ÄsthetikNoch keine Bewertungen
- Ästhetisches Verstehen und Nichtverstehen: Aktuelle Zugänge in Literatur- und MediendidaktikVon EverandÄsthetisches Verstehen und Nichtverstehen: Aktuelle Zugänge in Literatur- und MediendidaktikHendrick HeimböckelNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band I: Die Schriften 1-21 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band I: Die Schriften 1-21 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Der Ursprung der Geschichte: Herodot und Thukydides: Historien + Geschichte des peloponnesischen KriegsVon EverandDer Ursprung der Geschichte: Herodot und Thukydides: Historien + Geschichte des peloponnesischen KriegsNoch keine Bewertungen
- Konstruktion von Erfahrung: Versuch über Walter BenjaminVon EverandKonstruktion von Erfahrung: Versuch über Walter BenjaminNoch keine Bewertungen
- Die Wiederholung und die Bilder: Zur Philosophie des ErinnerungsbewußtseinsVon EverandDie Wiederholung und die Bilder: Zur Philosophie des ErinnerungsbewußtseinsNoch keine Bewertungen
- Liber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeVon EverandLiber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band IV: Die Schriften 39-45 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band IV: Die Schriften 39-45 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Das Trauerspiel-Buch: Der Souverän - das Trauerspiel - Konstellationen - RuinenVon EverandDas Trauerspiel-Buch: Der Souverän - das Trauerspiel - Konstellationen - RuinenNoch keine Bewertungen
- Topologie.: Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und MedienwissenschaftenVon EverandTopologie.: Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und MedienwissenschaftenNoch keine Bewertungen
- Grund-Erfahrungen des Denkens: Das Denken des Denkens bei Fichte, Schelling, Heidegger und DerridaVon EverandGrund-Erfahrungen des Denkens: Das Denken des Denkens bei Fichte, Schelling, Heidegger und DerridaNoch keine Bewertungen
- Die Maschine Mensch: Zweisprachige AusgabeVon EverandDie Maschine Mensch: Zweisprachige AusgabeBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (18)
- Über den Lehrer: De magistro. Zweisprachige AusgabeVon EverandÜber den Lehrer: De magistro. Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Narratologie und Geschichte: Eine Analyse schottischer Historiografie am Beispiel des »Scotichronicon« und des »Bruce«Von EverandNarratologie und Geschichte: Eine Analyse schottischer Historiografie am Beispiel des »Scotichronicon« und des »Bruce«Noch keine Bewertungen
- Schriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Mythos Tragödie: Zur Aktualität und Geschichte einer theatralen WirkungsweiseVon EverandMythos Tragödie: Zur Aktualität und Geschichte einer theatralen WirkungsweiseNoch keine Bewertungen
- Hermeneutik im Dialog der Methoden: Reflexionen über das transdisziplinäre VerstehenVon EverandHermeneutik im Dialog der Methoden: Reflexionen über das transdisziplinäre VerstehenRainer J. KausNoch keine Bewertungen
- Buch über die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache: Erstes Buch. Zweisprachige AusgabeVon EverandBuch über die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache: Erstes Buch. Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Physische Geographie: Mathematische Vorkenntnisse und die allgemeine Beschreibung der Meere und des LandesVon EverandPhysische Geographie: Mathematische Vorkenntnisse und die allgemeine Beschreibung der Meere und des LandesNoch keine Bewertungen
- Falsche Wiederkehr der Religion: Zur Konjunktur des FundamentalismusVon EverandFalsche Wiederkehr der Religion: Zur Konjunktur des FundamentalismusNoch keine Bewertungen
- Meditationen: Mit sämtlichen Einwänden und ErwiderungenVon EverandMeditationen: Mit sämtlichen Einwänden und ErwiderungenBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (382)
- Raum und Objekt im Werk von Samuel BeckettVon EverandRaum und Objekt im Werk von Samuel BeckettFranziska SickNoch keine Bewertungen
- Korpusgestützte Textanalyse: Grundzüge der Ebenen-orientierten TextlinguistikVon EverandKorpusgestützte Textanalyse: Grundzüge der Ebenen-orientierten TextlinguistikNoch keine Bewertungen
- Friedrich Schiller: Lebensgeschichte und Werk: Lebengeschichte einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker und LyrikerVon EverandFriedrich Schiller: Lebensgeschichte und Werk: Lebengeschichte einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker und LyrikerNoch keine Bewertungen
- Spielräume des Anderen: Geschlecht und Alterität im postdramatischen TheaterVon EverandSpielräume des Anderen: Geschlecht und Alterität im postdramatischen TheaterNina BirknerNoch keine Bewertungen
- Poetik Und Hermeneutik 01 - Nachahmung Und IllusionDokument251 SeitenPoetik Und Hermeneutik 01 - Nachahmung Und IllusionAlicia Nathalie Chamorro MuñozNoch keine Bewertungen
- Kommunikation - Gedächtnis - Raum: Kulturwissenschaften nach dem »Spatial Turn«Von EverandKommunikation - Gedächtnis - Raum: Kulturwissenschaften nach dem »Spatial Turn«Moritz CsákyNoch keine Bewertungen
- Aufklärung – Wissenschaft – Religion: Zur Genese und Struktur unseres neuzeitlichen SpannungsfeldesVon EverandAufklärung – Wissenschaft – Religion: Zur Genese und Struktur unseres neuzeitlichen SpannungsfeldesNoch keine Bewertungen
- Kritik der Ungleichheit: Eine Rekonstruktion von Rousseaus Zweitem DiskursVon EverandKritik der Ungleichheit: Eine Rekonstruktion von Rousseaus Zweitem DiskursNoch keine Bewertungen
- Ich glaub, ich krieg nen Vogel: Jeder kennt das Gefühl - Unglaubliche Geschichten aus der verrückten Welt eines TräumeverkäufersVon EverandIch glaub, ich krieg nen Vogel: Jeder kennt das Gefühl - Unglaubliche Geschichten aus der verrückten Welt eines TräumeverkäufersNoch keine Bewertungen
- Das bittere Brot: H.G. Adler, Elias Canetti und Franz Baermann Steiner im Londoner ExilVon EverandDas bittere Brot: H.G. Adler, Elias Canetti und Franz Baermann Steiner im Londoner ExilNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Träume eines Geistersehers. Der Unterschied der Gegenden im RaumeVon EverandTräume eines Geistersehers. Der Unterschied der Gegenden im RaumeBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Der Laie über die Weisheit: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 1)Von EverandDer Laie über die Weisheit: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 1)Bewertung: 2.5 von 5 Sternen2.5/5 (3)
- Was ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeVon EverandWas ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeNoch keine Bewertungen
- Adam 2006 Lacan PDFDokument173 SeitenAdam 2006 Lacan PDFramu_berlin_14047592100% (1)
- Ramischwili 1989Dokument33 SeitenRamischwili 1989ramu_berlin_14047592Noch keine Bewertungen
- Husserls Encyclopaedia-Britannica Artikel Und Heideggers Anmerkungen DazuDokument18 SeitenHusserls Encyclopaedia-Britannica Artikel Und Heideggers Anmerkungen Dazuramu_berlin_14047592Noch keine Bewertungen
- Nordische MetaphysikDokument8 SeitenNordische Metaphysikramu_berlin_14047592100% (1)
- BildtheorienDokument30 SeitenBildtheorienramu_berlin_14047592Noch keine Bewertungen
- Deussen Geschichte Bd. 1 - Abt. 2 PDFDokument421 SeitenDeussen Geschichte Bd. 1 - Abt. 2 PDFramu_berlin_14047592Noch keine Bewertungen
- Deussen Geschichte Bd. 1 - Abt. 1 PDFDokument382 SeitenDeussen Geschichte Bd. 1 - Abt. 1 PDFramu_berlin_14047592100% (1)
- Göbel 2001 PDFDokument77 SeitenGöbel 2001 PDFramu_berlin_14047592Noch keine Bewertungen
- Smart-Thermostat Anleitung 2024Dokument8 SeitenSmart-Thermostat Anleitung 2024sandrabartsch063Noch keine Bewertungen
- Die Bedeutung Der Eigennamen - VolksetymologienDokument9 SeitenDie Bedeutung Der Eigennamen - Volksetymologienboschdvd8122Noch keine Bewertungen
- Matemática PPT - Sekante - TangenteDokument17 SeitenMatemática PPT - Sekante - TangenteMatemática PPT100% (1)
- CymexDokument8 SeitenCymexbeneNoch keine Bewertungen
- 310000-009583-13 8 4Dokument2 Seiten310000-009583-13 8 4Brandon HarveyNoch keine Bewertungen
- Rudolf Steiner - TTB 14 - ChristologieDokument192 SeitenRudolf Steiner - TTB 14 - ChristologiePetitJerome100% (1)