Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Ameisen Können Krebs Erschnüffeln"
Hochgeladen von
Maria Grigoryan0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
4 Ansichten4 SeitenOriginaltitel
MA A3
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
4 Ansichten4 SeitenAmeisen Können Krebs Erschnüffeln"
Hochgeladen von
Maria GrigoryanCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 4
MA A3
Ameisen können Krebs „erschnüffeln“
Früherkennung ist sehr wichtig: In der Krebsmedizin kommt der Diagnostik eine
große Bedeutung zu. Doch die Verfahren zur Beurteilung von Gewebeproben sind
vergleichsweise aufwendig und teuer, deshalb sind Alternativ-Methoden stets
willkommen. Bereits seit einiger Zeit versuchen Forscher, dazu die Fähigkeiten von
Tieren zu nutzen – konkret: ihren Geruchssinn.
Damit die Tiere als Diagnostiker dienen können, müssen sie intensiv ausgebildet
werden. Dies ist kostspielig und zeitaufwendig, was das Einsatzpotenzial des
Konzepts deutlich einschränkt. Deshalb haben sich die Wissenschaftler um
Baptiste Piqueret von der Sorbonne-Universität in Paris Nord nun Tieren als
mögliche Alternativen zugewandt, die zunächst befremdlich wirken: Ameisen.
Inwieweit die Krabbler auch Krebs erschnüffeln können, hat das Team nun bei
Ameisen der Art Formica fusca ausgelotet, die in Mitteleuropa weit verbreitet ist
und sich leicht in künstlichen Systemen halten und vermehren lässt. Für die
Experimente stellten die Forscher unterschiedliche Riechproben her. Dazu wurden
Laborkulturen von verschiedenen Arten von Krebszellen sowie von gesunden
Vergleichszellen in Probematerial verwandelt. Auf die Krebs-Proben wurden die
Versuchstiere geeicht, indem die Forscher sie mit einer Zuckerlösung versetzten.
Wie sich zeigte, entwickelten die Ameisen innerhalb einer sehr kurzen
Trainingsphase eine besondere Vorliebe für die geruchlichen Merkmale der Krebs-
Proben: Wenn sie anschließend die Wahl zwischen Krebszell- Lösungen und den
ebenso süßen Kontrollzell-Lösungen hatten, liefen sie schnurstracks zu den zuvor
kennengelernten Proben mit dem speziellen Geruchsmuster. Wie weitere
Versuche zeigten, können die Insekten sogar verschiedene Krebsformen
unterscheiden. Die Forscher trainierten die Ameisen dabei auf die Erkennung von
zwei Arten von Brustkrebs, die bei Patientinnen zu unterschiedlichen Verläufen
führen. Auch in diesem Fall ergaben die Experimente, dass die Insekten die
subtilen Unterschiede im Geruch der unterschiedlichen Zelltypen erfassen
können. Wie die Forscher erklären, basieren die Fähigkeiten der Ameisen ebenso
wie die von Hunden auf der Wahrnehmungsfähigkeit krebsspezifischer Muster
bestimmter flüchtiger Substanzen.
Bis Ameisen in Diagnostik-Labore Einzug halten, wird es allerdings wohl noch
etwas dauern, denn das Konzept befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase:
Die Effektivität dieser Methode muss erst genauer geprüft werden. „Unsere
Forschung wird nun darauf abzielen, das Spektrum der krebsbedingten Gerüche,
die von Ameisen erkannt werden können, zu erweitern“, schreiben die Forscher.
Außerdem wollen sie ausloten, inwieweit die Insekten auch Hinweise in Gerüchen
erfassen können, die direkt vom Körper abgegeben werden.
Dunkle Infrastruktur soll Biodiversität
schützen
Die negativen Auswirkungen der Lichtverschmutzung gelten inzwischen als ein
Mitverursacher des weltweiten Insektensterbens und des allgemeinen Rückgangs
der Biodiversität. Zum Schutz der Tiere schlagen daher Romain Sordello von der
UMS PatriNat in Paris und seine Kollegen ein weltweites Netz von Schutzzonen für
den Erhalt der Dunkelheit in der Nacht vor. Sie haben auf der Basis
vorangegangener Studien bekannte negative Effekte von Licht
zusammengetragen und anschließend Lösungen für die Etablierung einer
sogenannten dunklen Infrastruktur ausgearbeitet.
Wie die Forscher erklären, beeinflusst das künstliche Licht bei Nacht das Leben
auf verschiedenen Ebenen – von den Genen einzelner Individuen bis hin zu ganzen
Ökosystemen. Doch trotz der bekannten und vermuteten ökologischen
Auswirkungen ist Lichtverschmutzung selbst in Naturschutzgebieten bislang kein
Bewertungskriterium. So hat sich gezeigt, dass zwischen 1992 und 2010 die
dunklen Flächen in Europa um 15 Prozent abgenommen haben, auch in den
Schutzgebieten. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sollten sich zukünftige
Maßnahmen gegen die Lichtverschmutzung an den bereits existierenden grünen
Infrastrukturen orientieren, so der Vorschlag des Forschungsteams.
Nach Ansicht der Forschenden sollte solche Netzwerke künftig auch die
nächtliche Dunkelheit als Schutzkriterium beinhalten und sicherstellen, dass ein
hoher Grad an Dunkelheit zum Schutz der Tiere gewährleistet ist. Für die
Umsetzung dieser dunklen Infrastruktur beschreiben Sordello und seine Kollegen
einen Prozess in mehreren Schritten: Zunächst soll die Lichtverschmutzung in all
ihren Formen und Dimensionen kartiert werden. Anschließend werden dann die
dunklen Rückzugsräume ausgemacht, die die Tiere der Region mindestens
benötigen. Im dritten Schritt sollen Maßnahmen zur Erhaltung dieser lichtarmen
Schutzräume umgesetzt werden. In der französischen Stadt Douai wurde
beispielsweise mithilfe einer akustischen Untersuchung der Fledermausaktivitäten
im Gemeindegebiet eine dunkle Infrastruktur ermittelt. Diese für die Fledermäuse
wichtigen Dunkelnonen wurden als eine Reihe von Zonen mit einem wechselnden
Grad an Dunkelheit in das Schutzkonzept mit aufgenommen. Die Stufen spiegeln
dabei die Intensität der Fledermausaktivität wider.
Der Geruch der Stadt
Jede Stadt dünstet eine Vielzahl flüchtiger organischer Verbindungen aus.
Diese Stoffe gelangen nicht nur aus biologischen Prozessen, beispielsweise
von Pflanzen, in die Luft. Sie entstehen auch beim Kaffeerösten oder
entweichen aus Lösungsmitteln – und prägen damit den Geruch der Stadt.
Doch nicht nur das: Viele dieser Verbindungen wirken sich auch auf das
Klima aus. Neue Messdaten zeigen nun, dass die Menge und somit der
Einfluss dieser urbanen Emissionen bislang wohl deutlich unterschätzt wird.
Denn diese Stoffe sind überall. Sie gelangen im Zuge von Stoffwechselprozessen
und Fäulnisvorgängen in die Luft, entweichen aus den Farben an unserer Wand,
entstehen beim Rauchen und Autofahren oder beim Rösten von Kaffee. Etwa die
Hälfte aller flüchtigen organischen Verbindungen in der nördlichen Hemisphäre
stammt aus natürlichen, die andere Hälfte aus menschengemachten Quellen. In
den Städten ist der Mensch noch für einen weitaus größeren Anteil dieser Stoffe
verantwortlich. Doch wie groß ist das Ausmaß der von Verkehr, Restaurants,
Lösungsmitteln und dem Rauchen verursachten Emissionen in den
Ballungsgebieten genau? Und was sind die wichtigsten Quellen?
Um diese Wissenslücke zu schließen, haben Thomas Karl von der Universität
Innsbruck und seine Kollegen nun erstmals einen chemischen Fingerabdruck von
urbanen VOC-Emissionsquellen erstellt. Von Juli bis Oktober 2015 maßen die
Forscher am Unicampus nahe der Innsbrucker Innenstadt laufend eine Vielzahl
von flüchtigen organischen Verbindungen und registrierten dabei selbst kleinste
Mengen der gasförmigen Stoffe. Mithilfe eines Verfahrens, das die Konzentration
von Gasen in Abhängigkeit von der Strömungsrichtung ermittelt, konnten sie aus
diesen Messdaten dann auf einzelne Emissionsquellen schließen.
Das Ergebnis: Wie nicht anders zu erwarten, reichte das Spektrum der
Emissionsquellen von der Bäckerei bis hin zur Klinik. Weil viele flüchtige
organische Verbindungen Duftstoffe sind, prägt dieses Spektrum auch den
Geruch der Stadt. „Innsbruck ist in dieser Hinsicht eine stinknormale Stadt“,
konstatiert Karl. Einige Überraschungen hielt die Auswertung der Daten aber dann
doch bereit: Erstaunt waren Karl und seine Kollegen beispielsweise darüber, wie
viele Verbindungen aus Kosmetika und Waschmitteln sie bei ihren Messungen
nachweisen konnten. „Wir fanden in unseren Daten deutliche Hinweise auf
Silikonöle, die in sehr vielen Kosmetik- und Reinigungsartikeln enthalten sind“, sagt
der Wissenschaftler. „Dass diese Silikonöle in der städtischen Luft so deutliche
Spuren hinterlassen, hat uns überrascht.“
Bei Stoffen aus Farben und Lacken konnte das Team die Auswirkungen der EU-
Gesetzgebung an ihren Messungen ablesen: Seit rund 15 Jahren reguliert die
Europäische Union flüchtige organische Verbindungen aus organischen
Lösungsmitteln. Viele der oft giftigen Lösungsmittel wurden in der Zwischenzeit
durch umweltfreundlichere, wasserlösliche Stoffe ersetzt. Aus diesem Grund sind
in den Messdaten kaum noch Kohlenwasserstoffe wie Benzol und Toluol zu finden.
„Dafür tauchen die wasserlöslichen Stoffe häufig in der Luft auf. Diese sind
weniger reaktiv, was sich auch positiv auf die Bildung von bodennahem Ozon
auswirken kann“, konstatiert Karl. Manche der heute eingesetzten Komponenten
bilden ihm zufolge allerdings sekundäre organische Aerosole und tragen damit zur
Feinstaubbildung bei. Wie hoch deren Anteil am städtischen Feinstaub ist, muss
aber erst noch ermittelt werden.
Noch interessanter als die Zusammensetzung der Emissionen ist jedoch
womöglich deren Menge. So zeigen die Messdaten, dass der Einfluss der
flüchtigen organischen Verbindungen global gesehen bisher wohl deutlich
unterschätzt wird. „Ist der für Innsbruck ermittelte Wert auch für asiatische Städte
repräsentativ – was eher optimistisch geschätzt ist, dann wären die VOC-
Emissionen mindestens doppelt so hoch wie angenommen“, betont Karl. Da
dadurch mehr Feinstaub in der Atmosphäre vorhanden wäre und dieser wiederum
Auswirkungen auf die Wolkenbildung hat, müssten die regionalen und globalen
Klimamodelle nun entsprechend angepasst werden.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Ein ganz besonderer Saft - Urin: Die Hausapotheke des Körpers. Inklusive "Erfahrungen mit Urin. Briefe zum besonderen Saft" & "Blick über den Zaun. Erfolge und Erfahrungen mit Urin"Von EverandEin ganz besonderer Saft - Urin: Die Hausapotheke des Körpers. Inklusive "Erfahrungen mit Urin. Briefe zum besonderen Saft" & "Blick über den Zaun. Erfolge und Erfahrungen mit Urin"Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Altex_2002_3_140_144_vanZutphenDokument5 SeitenAltex_2002_3_140_144_vanZutphenaybche90Noch keine Bewertungen
- Anwendung verdichteten Kohlendioxids in ausgewählten Prozessschritten der LederherstellungVon EverandAnwendung verdichteten Kohlendioxids in ausgewählten Prozessschritten der LederherstellungNoch keine Bewertungen
- 106 2021 Article 998Dokument9 Seiten106 2021 Article 998Ivan PerezNoch keine Bewertungen
- Kalter Atem schlafender Vulkane: Die unbekannte Welt der CO2-MofettenVon EverandKalter Atem schlafender Vulkane: Die unbekannte Welt der CO2-MofettenNoch keine Bewertungen
- Arzneimittelwirkstoffe Im WasserkreislaufDokument60 SeitenArzneimittelwirkstoffe Im WasserkreislaufISOE - Institute for Social-Ecological ResearchNoch keine Bewertungen
- Beurteilung Der InflammationDokument45 SeitenBeurteilung Der InflammationΕιρήνη ΑκριτιδουNoch keine Bewertungen
- Covid 19 ist nicht alles: Zum Umgang mit Viren und AerosolenVon EverandCovid 19 ist nicht alles: Zum Umgang mit Viren und AerosolenNoch keine Bewertungen
- Strafantrag Chemtrails SchweizDokument6 SeitenStrafantrag Chemtrails SchweizIsonWillisNoch keine Bewertungen
- Bekämpfung der Umweltkriminalität: Rechtsethnologische PerspektivenVon EverandBekämpfung der Umweltkriminalität: Rechtsethnologische PerspektivenNoch keine Bewertungen
- Dissertation Ortner Maria Online-VersionDokument87 SeitenDissertation Ortner Maria Online-VersionStefana DimitrieskaNoch keine Bewertungen
- Bildgebung Lymphologie: Sonographie, Lymphangiographie, MR und NuklearmedizinVon EverandBildgebung Lymphologie: Sonographie, Lymphangiographie, MR und NuklearmedizinWolfgang Justus BrauerNoch keine Bewertungen
- Forschungsmagazin Der Universität Innsbruck - 01/2015Dokument50 SeitenForschungsmagazin Der Universität Innsbruck - 01/2015Universität InnsbruckNoch keine Bewertungen
- Die Ultraschallsprechstunde: Eine Ethnografie pränataldiagnostischer SituationenVon EverandDie Ultraschallsprechstunde: Eine Ethnografie pränataldiagnostischer SituationenNoch keine Bewertungen
- Forschungsmagazin Der Universität Innsbruck - 01/2016Dokument52 SeitenForschungsmagazin Der Universität Innsbruck - 01/2016Universität InnsbruckNoch keine Bewertungen
- Daten, Fakten, Hintergründe und Hypothesen mit Aktionen zum Mitmachen gegen Wildbienensterben, Fluginsektensterben und Bienensterben: Das Buch zu meiner Webseite www.beeleaks.eu - 2. AuflageVon EverandDaten, Fakten, Hintergründe und Hypothesen mit Aktionen zum Mitmachen gegen Wildbienensterben, Fluginsektensterben und Bienensterben: Das Buch zu meiner Webseite www.beeleaks.eu - 2. AuflageNoch keine Bewertungen
- ChemtrailsDokument204 SeitenChemtrailsliamoguitar7250% (2)
- Atem- und Atemnebengeräusche bei Kindern und Erwachsenen - Akustische Langzeitregistrierung und -analyseVon EverandAtem- und Atemnebengeräusche bei Kindern und Erwachsenen - Akustische Langzeitregistrierung und -analyseNoch keine Bewertungen
- TRAF ROS TOT Laermwirkungen Von Infraschallimmissionen 0Dokument222 SeitenTRAF ROS TOT Laermwirkungen Von Infraschallimmissionen 0EliosNoch keine Bewertungen
- medizinpress.de LED Lichttherapie: Mikrostrom, Biokybernetik, BCR-TherapieVon Everandmedizinpress.de LED Lichttherapie: Mikrostrom, Biokybernetik, BCR-TherapieNoch keine Bewertungen
- Isolation, Characterisation, Modification and Application of Fucoidan From Fucus VesiculosusDokument179 SeitenIsolation, Characterisation, Modification and Application of Fucoidan From Fucus VesiculosusTuan Lam NgocNoch keine Bewertungen
- 122 PM MWK Experten AerosoleDokument4 Seiten122 PM MWK Experten Aerosolemichael.haibelNoch keine Bewertungen
- Forscherfragen: Berichte aus der Wissenschaft von morgenVon EverandForscherfragen: Berichte aus der Wissenschaft von morgenNoch keine Bewertungen
- Gefahr Durch Feinstaub - Drucker Machen Krank - Frontal21Dokument6 SeitenGefahr Durch Feinstaub - Drucker Machen Krank - Frontal21UDGARDNoch keine Bewertungen
- Schilddrüsen-Anomalien: bei Kindern und Jugendlichen in und um FukushimaVon EverandSchilddrüsen-Anomalien: bei Kindern und Jugendlichen in und um FukushimaNoch keine Bewertungen
- Abschlussbericht AZ28722Dokument112 SeitenAbschlussbericht AZ28722KostasNoch keine Bewertungen
- 18 01 2017''Dokument18 Seiten18 01 2017''Outmane LakhliliNoch keine Bewertungen
- Besser lernen mit Düften: Signalwirkung der AromatherapieVon EverandBesser lernen mit Düften: Signalwirkung der AromatherapieNoch keine Bewertungen
- PseudomonasDokument1 SeitePseudomonassafia garouiNoch keine Bewertungen
- Oxidativer_Stress_Harmloser_als_gedacht_Pressemitteilung_dkfz_pmDokument2 SeitenOxidativer_Stress_Harmloser_als_gedacht_Pressemitteilung_dkfz_pmdoebner.hermann889Noch keine Bewertungen
- Gen-Passagen: Molekularbiologische und medizinische Praktiken im Umgang mit Brustkrebs-Genen. Wissen - Technologie - DiagnostikVon EverandGen-Passagen: Molekularbiologische und medizinische Praktiken im Umgang mit Brustkrebs-Genen. Wissen - Technologie - DiagnostikNoch keine Bewertungen
- G4-Projekt Bach IIDokument19 SeitenG4-Projekt Bach IIJosé M.Noch keine Bewertungen
- Dr. Bergmann: Mobilfunk-Grenzwerte: Legalisierung Unbegrenzter Schädigung Von Mensch Und Natur.Dokument2 SeitenDr. Bergmann: Mobilfunk-Grenzwerte: Legalisierung Unbegrenzter Schädigung Von Mensch Und Natur.ulwedocumentsNoch keine Bewertungen
- Wissenswert Dezember 2016 - Magazin Der Leopold-Franzens-Universität InnsbruckDokument24 SeitenWissenswert Dezember 2016 - Magazin Der Leopold-Franzens-Universität InnsbruckUniversität InnsbruckNoch keine Bewertungen
- Die Quecksilber-Resonanz-HypotheseDokument6 SeitenDie Quecksilber-Resonanz-HypotheseAlexander WunschNoch keine Bewertungen
- JFSFQDokument35 SeitenJFSFQTaha OpedNoch keine Bewertungen
- Prof DR Fritz Albert PoppDokument7 SeitenProf DR Fritz Albert Poppralf.stein9265Noch keine Bewertungen
- Protokoll Zur Ausscheidung Von Neurotoxinen Von Dr. Med. KlinghardtDokument11 SeitenProtokoll Zur Ausscheidung Von Neurotoxinen Von Dr. Med. KlinghardtThomas MannNoch keine Bewertungen
- Biophotonen ArtikelDokument133 SeitenBiophotonen ArtikelGabrielNoch keine Bewertungen
- Wissenswert 21 - Magazin Der Leopold-Franzens-Universität InnsbruckDokument24 SeitenWissenswert 21 - Magazin Der Leopold-Franzens-Universität InnsbruckUniversität InnsbruckNoch keine Bewertungen
- Popp Fritz Albert Biophotonen Die Wissenschaft Entdeckt Die Lebensenergie in Den ZellenDokument101 SeitenPopp Fritz Albert Biophotonen Die Wissenschaft Entdeckt Die Lebensenergie in Den ZellenVril Geist92% (13)
- Hansen PDFDokument3 SeitenHansen PDFOrion Aramayo BaltraNoch keine Bewertungen
- Einführung in Die Physiologie Der Einzelligen (Protozoen)Dokument190 SeitenEinführung in Die Physiologie Der Einzelligen (Protozoen)peterNoch keine Bewertungen
- 00000091Dokument132 Seiten00000091Scary CreaturesNoch keine Bewertungen
- Der Satan Sitzt in Der SP (R) Itze - Deutsche ResistanceDokument26 SeitenDer Satan Sitzt in Der SP (R) Itze - Deutsche ResistanceStefanNoch keine Bewertungen
- UmwelttechnikDokument138 SeitenUmwelttechnikenvikon4766Noch keine Bewertungen
- Virtuelle Anthropologie ZusammenfassungDokument39 SeitenVirtuelle Anthropologie ZusammenfassungChiara HofbauerNoch keine Bewertungen
- Erx 082Dokument10 SeitenErx 082ilhm.ramadhan8Noch keine Bewertungen
- Nanotechnologie: Eine Übersicht. Vorarbeiten Zu Einer Sozial-Ökologischen RisikoforschungDokument60 SeitenNanotechnologie: Eine Übersicht. Vorarbeiten Zu Einer Sozial-Ökologischen RisikoforschungISOE - Institute for Social-Ecological ResearchNoch keine Bewertungen
- SolucionesDokument7 SeitenSolucionesJesus AranaNoch keine Bewertungen
- Strafanzeige Chemtrails SchweizDokument6 SeitenStrafanzeige Chemtrails SchweizIsonWillisNoch keine Bewertungen
- Biomimethik deDokument88 SeitenBiomimethik dewercanNoch keine Bewertungen
- Muster DSHDokument18 SeitenMuster DSHAlliance KabeneNoch keine Bewertungen
- Umweltprobleme ArbeitsblattDokument8 SeitenUmweltprobleme ArbeitsblattireneNoch keine Bewertungen
- Tugas Kimia D I S U S U N Oleh Nama: Muhammad Fatrio Kelas: X.HDokument9 SeitenTugas Kimia D I S U S U N Oleh Nama: Muhammad Fatrio Kelas: X.HAldo AgustusNoch keine Bewertungen
- Boeker GRDL 2010 Elektronische Nasen Teil 1Dokument7 SeitenBoeker GRDL 2010 Elektronische Nasen Teil 1leobonifacioNoch keine Bewertungen
- Borax: Das wundersame Heilmineral und basische Multitalent, welches sogar unsere Zirbeldrüse aktivieren, Testosteron steigern, Schwermetalle ausleiten oder unsere Sehkraft verbessern kannVon EverandBorax: Das wundersame Heilmineral und basische Multitalent, welches sogar unsere Zirbeldrüse aktivieren, Testosteron steigern, Schwermetalle ausleiten oder unsere Sehkraft verbessern kannNoch keine Bewertungen
- Psychedelische Chemie: Aspekte psychoaktiver MoleküleVon EverandPsychedelische Chemie: Aspekte psychoaktiver MoleküleBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Heißzeit: Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse tretenVon EverandHeißzeit: Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse tretenNoch keine Bewertungen
- Praktische Experimente mit alternativen Energien: Selbstbauprojekte mit Thermovoltaik und erneuerbaren KraftstoffenVon EverandPraktische Experimente mit alternativen Energien: Selbstbauprojekte mit Thermovoltaik und erneuerbaren KraftstoffenNoch keine Bewertungen
- Geist, Kosmos und Physik: Gedanken über die Einheit des LebensVon EverandGeist, Kosmos und Physik: Gedanken über die Einheit des LebensBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)
- Antidota: Handbuch der Klinischen MetalltoxikologieVon EverandAntidota: Handbuch der Klinischen MetalltoxikologieNoch keine Bewertungen
- Krank durch Früherkennung: Warum Vorsorgeuntersuchungen unserer Gesundheit oft mehr schaden als nutzenVon EverandKrank durch Früherkennung: Warum Vorsorgeuntersuchungen unserer Gesundheit oft mehr schaden als nutzenNoch keine Bewertungen
- Dem Krebs keine Chance geben: Mit gesunden Nahrungsmitteln optimal vorbeugen, das Immunsystem gezielt stärken und so den Krebs besVon EverandDem Krebs keine Chance geben: Mit gesunden Nahrungsmitteln optimal vorbeugen, das Immunsystem gezielt stärken und so den Krebs besNoch keine Bewertungen
- Offiziell geleugnet! [Das Buch zur Netflix-Sensation "Unacknowledged"]: Das größte Geheimnis der Regierungen enthüllt: Wir sind nicht allein!Von EverandOffiziell geleugnet! [Das Buch zur Netflix-Sensation "Unacknowledged"]: Das größte Geheimnis der Regierungen enthüllt: Wir sind nicht allein!Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)






















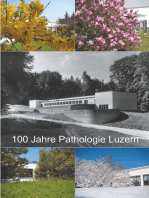





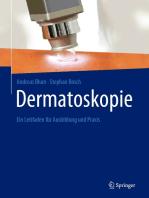





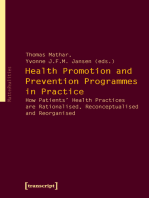


























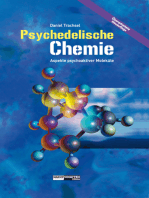







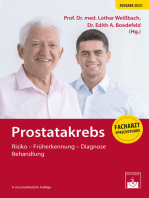

![Offiziell geleugnet! [Das Buch zur Netflix-Sensation "Unacknowledged"]: Das größte Geheimnis der Regierungen enthüllt: Wir sind nicht allein!](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/443583358/149x198/7ab9a84021/1682576307?v=1)