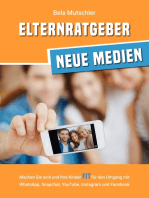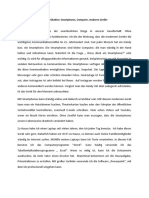Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Arbeitsblatter - Jugendliche Und Das Internet1
Hochgeladen von
Dzenana GrahicOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Arbeitsblatter - Jugendliche Und Das Internet1
Hochgeladen von
Dzenana GrahicCopyright:
Verfügbare Formate
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Interview: Wie ist dein Umgang mit Medien?
1. Beantworte die Fragen zunächst nur für dich und
schreibe deine Antworten in die erste Spalte.
Schreiben Einzelarbeit
Frage: Deine Antwort Deine Partnerin/Dein Partner
Welche Geräte hast
du, mit denen man
ins Internet gehen
kann?
Wie viel Zeit ver-
bringst du pro Tag
im Internet?
Welche Apps be-
nutzt du am häufigs-
ten? Aus welchen
Gründen?
Was genau machst
du im Internet?
Kontrollieren deine
Eltern, was du im
Internet machst und
wie lange du surfst?
Erzähle.
Würdest du sagen,
dass du internet-
süchtig bist?
Warum (nicht)?
2. Interviewe eine Partnerin/einen Partner. Trage ihre/seine Antworten in
die Tabelle ein. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede
stellt ihr fest?
Partnerarbeit
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
1/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Leseverstehen: Lies den Text „In der digitalen Welt zu Hau-
se: Jugendliche und das Internet“ und bearbeite anschlie-
ßend die folgenden Aufgaben.
Lesen Einzelarbeit
1. Verbinde die Halbsätze miteinander und trage die Buchstaben unten ein.
a) dass der überall verfügbare Zugang zum
1. Immer mehr Jugendliche in Deutschland
Internet Chancen und Risiken bietet.
b) dass Jugendliche zu lange online sind und
2. Jakob schätzt die Flexibilität von WhatsApp,
unkontrolliert surfen.
3. Zu den beliebtesten Apps bei Jugendlichen c) halten Facebook noch für nötig.
4. Nur noch gut ein Achtel der deutschen Ju- d) persönlichen Kontakt zu anderen Menschen
gendlichen zu haben.
5. Marie-Sophie achtet darauf, e) waren schon von Cybermobbing betroffen.
f) Kinder und Jugendliche im Umgang mit Me-
6. Experten und Eltern kritisieren,
dien kompetent zu machen.
7. Jonathan benutzt das Smartphone zielge- g) ist aber manchmal skeptisch wegen der
richtet, Ernsthaftigkeit der Gespräche.
8. Er zieht es vor, h) ihre Privatsphäre zu schützen
9. Marlene Mortler weist darauf hin, i) um sich mit seinen Freunden zu verabreden.
j) zählen vor allem Apps zur Kommunikation
10. Sie unterstreicht die Wichtigkeit,
und zum Austausch mit Freunden und Familie.
11. 20% der deutschen Jugendlichen k) gehen mit dem Smartphone ins Internet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und markie-
re im Text, wo du die Antwort gefunden hast.
Ri ch ti g F al sch
1. Immer weniger Jugendliche benutzen den Computer, um ins Internet zu
gehen.
2. Facebook gehört aktuell bei Jugendlichen zu den beliebtesten Apps.
3. Die meisten Eltern kontrollieren, was ihre Kinder im Internet machen.
4. Die Zahl internetsüchtiger Jugendlicher ist in den letzten Jahren stark
angestiegen.
5. Vor allem Mädchen leiden im Internet unter Cybermobbing.
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
2/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Vertiefung: Wortschatzarbeit
Schreiben Einzelarbeit
1. Trage die Wörter aus dem Wortschatzkasten in den Lückentext ein.
abhängig – Ansprechpartner – begrenzen – Chatten – Cybermobbing - Datenschutz –
Drogenbeauftragte – Einschränkung – Gerät – Medienkompetenz –
Mediennutzungsdauer – Schulpsychologen – Skandale – soziale Netzwerke –
süchtig – Vertrauenslehrer – Videoplattformen – virtuellen – Zugang
Jugendliche und das Internet
Die meisten Jugendlichen in Deutschland besitzen heutzutage ein
_____Gerät_______, mit dem sie _____________________ zum Internet haben. Am
liebsten benutzen die Jugendlichen ihr Smartphone zum _____________________
oder um Filme auf ____________________________ wie YouTube anzusehen. Auch
___________________________ wie Snapchat, Instagram oder Facebook zählen den
beliebtesten Anwendungen – trotz zahlreicher _____________________ in den letzten
Jahren, die Zweifel am ______________________ und an der Sicherheit der Pro-
gramme geweckt haben. Viele Eltern __________________________ die
___________________________ ihrer Kinder kaum, so dass diese – so lange sie wol-
len – online sein können. Die _________________________ der Bundesregierung kri-
tisiert diese fehlende ________________________ der Nutzung des Handys, da Ju-
gendliche dadurch in der Gefahr stehen, vom Internet ___________________ zu wer-
den, das heißt, sie können regelrecht ________________________ nach ständiger
Erreichbarkeit sein. Es sei daher besonders wichtig, die
__________________________ der Jugendlichen zu fördern. Ein weiteres Problem im
____________________ Raum ist _____________________________, also das Aus-
grenzen und Beleidigen anderer Menschen im Internet. Ein Fünftel der Jugendlichen
haben in Deutschland schon Erfahrungen damit gemacht. Daher ist es wichtig, dass
Jugendliche außer den Eltern weitere __________________________ haben, an die
sie sich bei Problemen wenden können, wie __________________________ oder
___________________________.
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
3/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Hörverstehen: Höre die Aussagen von drei Jugendlichen
zum Thema „Jugendliche und das Internet“.
Hören Schreiben Einzelarbeit
1. Höre die Aussagen und ordne sie der richtigen Fragestellung zu. Auf
welche Frage antwortet der Jugendliche?
Aus- Frage-
Fragestellung
sagen stellung
A: Was machst du, wenn du online bist?
Hörtext 1
B: Guckst du sofort nach, wenn das Handy „pling“ macht?
Hörtext 2
C: Hast du das Gefühl, dass man ständig erreichbar sein
muss? Hörtext 3
D: Was ist vielleicht nicht so toll an der Handynutzung? Hörtext 4
E: Wie siehst du das mit dem Datenschutz? Hast du Beden-
Hörtext 5
ken?
F: Woher weißt du, dass man im Internet vorsichtig sein Hörtext 6
muss?
Hörtext 7
G. An wen würdest du dich bei Problemen wenden?
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
4/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
2. Lies die Aussagen und kreuze an: richtig oder falsch.
Ri ch ti g F al sch
1. Jakob findet es wichtig, immer erreichbar zu sein.
2. Er hat als einer der letzten in seiner Klasse ein Handy gekriegt.
3. Seit er ein Handy hat, hat er weniger Zeit für andere Dinge.
4. Jakob findet es kein Problem, wenn Freunde Fotos von ihm weitersch i-
cken.
5. Er findet es wichtig, nur Fotos zu veröffentlichen, für die er sich später
nicht schämen muss.
6. Seine Freunde achten darauf, nicht zu viele Fotos von sich ins Internet
zu stellen.
7. Marie-Sophie schaut am liebsten Geburtstagsvideos auf YouTube.
8. Außerdem greift sie beim Lernen auf das Internet zurück.
9. Sie findet, dass man beim Lernen nicht von seinem Handy abgelenkt
wird.
10. Sie achtet auf ihre Privatsphäre.
11. Jonathan ist der Meinung, dass man es manchmal bereut, viel Zeit
am Handy zu verbringen.
12. Sein erster Ansprechpartner bei Problemen wären seine Lehrkräfte.
3. Wie ist es bei euch? Sprecht in der Klasse über die Impulsfragen.
Klassenge-
Sprechen
spräch
1. Wann hast du dein erstes Handy bekommen?
2. Wie lange benutzt du es pro Tag? Was machst du weniger, seitdem du ein Handy hast?
3. Inwiefern achtest du darauf, welche Fotos du veröffentlichst?
4. Welche Videos schaust du dir gern auf YouTube an? Warum?
5. Lenkt dich das Handy manchmal von anderen Tätigkeiten ab? Was tust du dagegen?
6. Wie schützt du deine Daten im Internet?
7. Hast du schon einmal Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht? Erzähle.
8. Gibt es Ansprechpartner (z.B. Vertrauenslehrer) an deiner Schule?
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
5/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Grafikanalyse (A): Analysiert die folgende Grafik mithilfe
der Redemittel. Bereitet euch darauf vor, eure Grafik einer
Partnergruppe vorzustellen.
Lesen Partnerarbeit
Mit freundlicher Genehmigung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs)
2. Präsentiert einer Gruppe, die die andere Grafik ausgewertet hat, eure
Grafikanalyse.
Sprechen Gruppenarbeit
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
6/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Grafikanalyse (B): Analysiert die folgende Grafik mithilfe
der Redemittel. Bereitet euch darauf vor, eure Grafik einer
Partnergruppe vorzustellen.
Lesen Partnerarbeit
Mit freundlicher Genehmigung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs)
2. Präsentiert einer Gruppe, die die andere Grafik ausgewertet hat, eure
Grafikanalyse.
Sprechen Gruppenarbeit
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
7/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Grafikanalyse (C): Analysiert die folgende Grafik mithilfe
der Redemittel. Bereitet euch darauf vor, eure Grafik einer
Partnergruppe vorzustellen.
Lesen Partnerarbeit
Mit freundlicher Genehmigung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs)
2. Präsentiert einer Gruppe, die die andere Grafik ausgewertet hat, eure
Grafikanalyse.
Sprechen Gruppenarbeit
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
8/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Tipps für die Grafikanal yse
Aufbau:
Rahmendaten: Gib zunächst einen Überblick über die Grafik. Dazu gehören: das Thema der
Grafik, die Befragtengruppe, die Fragestellung, die Quelle und das Datum der Veröffentl ichung.
Beschreibung: Beschreibe die Grafik so, dass sich jemand, dem sie nicht vorliegt, die Grafik vor-
stellen kann. Beschreibe daher die Art der Grafik (z.B. Säulendi agramm/Balkendiagramm/
Kreisdiagramm etc.), die Darstellungsform der Daten (absolut oder pr ozentual, Bedeutung
der Achsen) sowie ggf. Farben und ihre Bedeutung.
Vergleich: Setze die Daten zueinander in Beziehung. Das heißt, stelle aussagekräftige Daten
(z.B. die Extremwerte) einander gegenüber. Du musst dabei nicht auf alle Daten eingehen, son-
dern nur auf die für deine Auswertung relevanten! So zeigst du, dass du wichtige und unwichtige
Informationen unterscheiden kannst.
Auswertung: Interpretiere die dargestellten Daten und entwickele einen Erklärungsansatz,
wie die Daten zu verstehen sind. Bei Grafiken, die eine Situation zu verschiedenen Zei t-
punkten darstellen, kannst du über die Gründe für die Veränderung der Situation spekulie-
ren. Bei Meinungsumfragen kannst du darüber nachdenken, welche Motive bestimmte B e-
völkerungsgruppen haben, gerade diese Meinung zu vertreten.
Redemittel für die Analyse einer Grafik
In dem vorliegenden (Säulen/Balken/Linien/Kreisdiagramm), das von (Quelle) im Jahr (Jahr) publiziert
wurde, ist zu sehen, ...
Das im Jahr (Jahr) von (Quelle) publizierte (Säulen/Balken/Linien/Kreisdiagramm) gibt Auskunft über...
Die Daten beziehen sich auf das Jahr ... / den Die Daten wurden im Jahr ... / im Zeitraum von ...
Zeitraum von ... bis ... bis ... erhoben
Die Daten sind in absoluten Zahlen / in Prozent Auf der horizontalen Achse ist/sind ... zu sehen.
dargestellt. Auf der vertikalen Achse ist/sind ... angegeben.
Die Zahl / der Anteil der ... betrug / lag im Jahr... bei fast / knapp / mehr als / rund / ungefähr ...
An erster / letzter Stelle steht / liegt ... In der Mitte liegen / befinden sich ...
Die Zahl der ... ist in diesem Zeitraum von ... um ... auf ... angestiegen / gewachsen / hat zugenom-
men / hat sich vergrößert / hat sich erhöht.
Der Anteil ist um ...% gefallen / gesunken / zurückgegangen / geschrumpft / hat abgenommen / hat
sich verringert / hat sich verkleinert / hat sich reduziert.
Während der Anteil an ... im Jahr ... bei ... % lag, lag er im Jahr ... bei ... %.
Die Mehrheit der ... (...%) gaben an, dass...
Die Hälfte / ein Drittel / ein Viertel / ein Fünftel waren der Meinung, dass...
Ein Grund hierfür könnte sein, dass... Nach einer genauen Analyse fällt auf, dass...
Es lässt sich eine deutliche Tendenz in Richtung... erkennen.
Wenn man die Ergebnisse / die Grafiken miteinander vergleicht, fällt auf / springt ins Auge, dass...
,
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
9/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Kurzvortrag: Bereite mithilfe der Tipps und der Redemittel einen
Kurzvortrag zum Thema „Jugendliche und das Internet“ vor.
Schreiben Einzelarbeit
Geräte Datenschutz Cybermobbing
Jugendliche und
Medienkompetenz Suchtgefahr
das Internet
Kontrolle durch
beliebte Apps ...
die Eltern
Tipps für den Kurzvortrag
Vor dem Kurzvortrag hast du im DSD2 20 Minuten Zeit zur Vorbereitung des Kurzvo r-
trags. Du erfährst das Thema erst zu Beginn dieser Vorbereitungszeit.
Dir stehen zur Vorbereitung neben dem Aufgabenblatt Papier, Stifte und ein zweisprach i-
ges Wörterbuch zur Verfügung.
Von den Aspekten in dem Raster musst du drei Aspekte auswählen und näher auf diese
Aspekte eingehen. Wähle Aspekte, über die du leicht sprechen kannst und zu denen dir
spontan viel einfällt.
Es ist wichtig, zu diesen Aspekten Argumente zu formulieren, also nicht nur Beispiele zu
nennen. Ein vollständiges Argument besteht aus vier Teilen: These, Begründung, Beispiel
und Schlussfolgerung.
Es ist wichtig, dass du deine Meinung zum Thema deutlich machst.
Schreib zur Unterstützung deines Vortrags auf ein Blatt oder eine Folie die Struktur dei-
nes Vortrags und die wichtigsten Punkte stichpunktartig auf. Das hilft dir und den Zuhö-
rern, deinem Vortrag zu folgen.
Die folgenden Redemittel geben dir eine Struktur vor und sind während des Kurzvortrags
von großer Hilfe. Lerne sie daher gut.
Suche dir einen Partner und haltet euch gegenseitig eure Kurzvorträge. Nehmt d a-
bei Notizen und stellt euch danach gegenseitig Fragen zu eurem Kurzvortrag.
Partnerar-
Sprechen
beit
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
10/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Redemittel für den Kurzvortrag
Einleitung / Vorstellung des Themas / Definition / Kontextualisierung
Das Thema meines Vortrags lautet „ ... “
Darunter versteht man...
In letzter Zeit wird oft über dieses Thema diskutiert, weil...
Gliederung
Ich habe dazu eine Gliederung entworfen: / Ich habe den Vortrag folgendermaßen aufgebaut:
Zunächst spreche ich über „...“ / Im zweiten Teil gehe ich auf den Aspekt „...“ ein. / Zum Schluss komme
ich zum Punkt „...“. Ich komme nun zum ersten Teil.
Überleitung: Das führt uns zum nächsten Punkt. / Ein weiterer Aspekt ist: ...
Dieser Punkt ist eng mit dem nächsten Punkt verbunden.
Schluss: Abschließend kann man sagen, dass...
Zusammenfassend möchte ich betonen, dass...
Das war der letzte Punkt. Ich komme damit zum Ende meines Vortrags und danke für Ihre Aufmerksam-
keit.
Argumentieren
These: Die meisten Menschen sind der Meinung, dass...
Begründung: ..., weil... / ..., da... / ..., denn...
Beispiel / Beleg: Ich möchte das mit einem Beispiel untermauern / verdeutlichen. / Man kann bei-
spielsweise / zum Beispiel ... / Dies lässt sich mit folgenden Daten belegen: ...
Schlussfolgerung: Aus diesem Grund... / Deshalb... / Also...
Eigene Meinung
Meiner Meinung nach... / Ich bin der Auffassung, dass...
Mit der Prüferin / dem Prüfer diskutieren
Zustimmen:
Ich stimme Ihnen zu. / Da haben Sie Recht. / Das stimmt.
Relativieren: Im Großen und Ganzen bin ich Ihrer Meinung, aber... / Bis zu einem gewissen Grad
haben Sie Recht, aber... / Das ist zwar auch ein interessanter Aspekt, aber entscheidend ist doch ... /
Das mag sein, aber/allerdings...
Widersprechen: Dieser Behauptung kann ich in dieser Form nicht zustimmen. / Ich bin nicht davon
überzeugt, dass diese Behauptung stimmt. / Was Sie gesagt haben, klingt in der Theorie ganz wu n-
derbar, aber in der Praxis sieht das ganz anders aus.
Sich korrigieren: So habe ich das nicht gemeint. / Was ich eigentlich sagen wollte, ist...
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
11/ 12
ARBEI T SBLÄTT ER: Thema „Jugendliche und das Internet“
Kurzvortrag: Markiere im folgenden Kurzvortrag die vier Teile
der Argumente farbig.
Thesen = gelb Begründung = grün Beispiel/Beleg = rot Schlussfolgerung = blau
Beispiel für einen Kurzvortrag zum Thema „Jugendliche und das Internet“
Das Thema meines Vortrags lautet „Jugendliche und das Internet“. Darunter versteht man die Frage,
Einleitung
wie oft und mit welchen Geräten Jugendliche ins Internet gehen und was sie dort machen. In let zter
Zeit wird oft über das Thema diskutiert, weil immer mehr Jugendliche internetsüchtig sind. Das zeigt
sich zum Beispiel daran, dass praktisch alle Jugendlichen ein Handy haben und sich täglich mehrere
Stunden damit beschäftigen.
Ich habe den Vortrag folgendermaßen aufgebaut. Zunächst spreche ich über den Aspekt „Suchtge-
Gliederung
fahr“. Im zweiten Teil gehe ich auf den Aspekt „Medienkompetenz“ ein. Zum Schluss komme ich zum
Punkt „Kontrolle durch die Eltern“. Ich komme nun zum ersten Teil.
Smartphones haben ein hohes Suchtpotential, weil die Nutzungsdauer und der Zugriff auf die Inhalte
1. Aspekt
im Internet kaum von den Eltern kontrolliert werden können. Dieses Argument lässt sich mit folgenden
Daten belegen. Ein Großteil der Jugendlichen in Deutschland besitzt ein Handy und verbringt mehrere
Stunden täglich damit. Studien haben ergeben, dass eine hohe Anzahl an Jugendlichen in Deutschland
internetsüchtig ist. Aus diesem Grund sollten Eltern und Schulen dringend zusammen überlegen, wie
die Medienkompetenz der Jugendlichen gestärkt werden kann.
Dieser Punkt ist eng mit dem nächsten Aspekt verbunden. Heutzutage ist es Aufgabe von Sch ulen und
2. Aspekt
Erziehungsberechtigten/Eltern, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, kompetent im Umgang
mit Medien zu werden, denn diese benötigen angesichts des überall verfügbaren Internets Vorbilder
und Regeln, um einen angemessenen Umgang mit diesen Medien zu erlernen. Ich möchte das mit
einem Beispiel untermauern. An vielen Schulen werden Handyverbote ausgesprochen, um damit pro b-
lematische Verhaltensweisen wie z.B. Cybermobbing zu unterbinden. Jedoch wird dabei übersehen,
dass Cybermobbing vor allem außerhalb der Schulzeiten im virtuellen Raum geschieht. Es nützt also
nichts, die Augen vor diesem Problem zu verschließen, indem man Handys einfach verbietet. Deshalb
sollten Schulen lieber den richtigen Umgang mit Handys vermitteln und Schüler innen und Schülern die
Gelegenheit geben, sich in der Klassengemeinschaft über Probleme, die dabei entstehen können, au s-
zutauschen.
Das führt uns zum letzten Punkt: „Kontrolle durch die Eltern“. Viele Eltern haben vor dem Problem kap i-
3. Aspekt
tuliert und kontrollieren nicht, wie lange ihre Kinder online sind und was sie im Internet genau m achen,
weil es sich auch kaum kontrollieren lässt, wenn das Kind ein eigenes Handy mit freiem Zugang zum
Internet hat. Sie übersehen dabei aber, dass sie selbst auch Vorbilder für ihre Kinder sind und ihr M e-
diennutzungsverhalten von ihren Kindern imitiert wird. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutl i-
chen. Viele Eltern beschweren sich darüber, dass ihr Kind das Smartphone nie aus der Hand legt,
ständig auf das Display schaut und virtuelle Kommunikation der realen vorzieht. Sie selbst verhalten
sich aber oft ganz genauso, ohne es zu merken. Deshalb sollten Eltern klare R egeln mit den Kindern
vereinbaren, wann und wie lange sie das Smartphone benutzen sollen. Dabei sollten Eltern und Kinder
gemeinsam überlegen, in welchen Situationen eine „handyfreie“ Zeit sinnvoll wäre, etwa bei den Hau s-
aufgaben oder während der (gemeinsamen) Mahlzeiten. Selbstverständlich müssten sich dann auch
die Eltern an diese Regeln halten.
Ich bin der Auffassung, dass Smartphones große Chancen bieten, denn die Möglichke iten, sich zu
Eigene Meinung
informieren und zu kommunizieren sind großartig. Die Jugendlichen sollten z um Beispiel lernen, wie
sie im Internet gezielt Informationen suchen können. Wenn sie kompetent im Umgang mit dem Inte rnet
werden, dann werden sie das Handy auch nicht nur für den Zeitvertreib nutzen, um auf YouTube V i-
deos zu schauen oder Musik zu hören, sondern um zu gut informierten kritischen Bürgern zu werden.
Deshalb ist es Aufgabe von Eltern und Schule, Jugendliche hierbei zu unterstü tzen.
Abschließend kann man sagen, dass die Chancen des Internets überwiegen, da die Möglichkeiten, sich zu
Schluss
informieren und zu kommunizieren unheimlich groß sind. Deshalb bin ich dafür, dass Jugendliche in der
Schule lernen sollen, diese Medien zu nutzen. Das war der letzte Punkt. Ich komme damit zum Ende mei-
nes Vortrags und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
© w w w.pa sch -ne t.de | Aut or : Wolfh ar dt S ch äfer
12/ 12
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Arbeitsblatter Jugendliche Und Das InternetDokument12 SeitenArbeitsblatter Jugendliche Und Das InternetDzenana GrahicNoch keine Bewertungen
- Losungsblatter - Jugendliche Und Das InternetDokument8 SeitenLosungsblatter - Jugendliche Und Das InternetDzenana GrahicNoch keine Bewertungen
- Probleme Mit Der Virtuellen Welt, LVDokument3 SeitenProbleme Mit Der Virtuellen Welt, LVNikolinaKadijevićNoch keine Bewertungen
- Das Handy in Der SchuleDokument52 SeitenDas Handy in Der SchuleCristina Maria MoldovanNoch keine Bewertungen
- Elternratgeber Neue Medien: Machen Sie sich und Ihre Kinder fit für den Umgang mit WhatsApp, Snapchat, YouTube, Instagram und FacebookVon EverandElternratgeber Neue Medien: Machen Sie sich und Ihre Kinder fit für den Umgang mit WhatsApp, Snapchat, YouTube, Instagram und FacebookNoch keine Bewertungen
- Wie Jugendliche Medien Im Alltag Nutzen Leseverstandnis Schreiben Und Kreatives Schreiben 78363Dokument2 SeitenWie Jugendliche Medien Im Alltag Nutzen Leseverstandnis Schreiben Und Kreatives Schreiben 78363Guilherme SoaresNoch keine Bewertungen
- Das Elternbuch zu WhatsApp, YouTube, Instagram & Co.Von EverandDas Elternbuch zu WhatsApp, YouTube, Instagram & Co.Noch keine Bewertungen
- Probleme Mit Der Virtuellen Welt Diskussionen Dialoge Leseverstandnis 83579Dokument3 SeitenProbleme Mit Der Virtuellen Welt Diskussionen Dialoge Leseverstandnis 83579NikolinaKadijević0% (1)
- DaF Kompakt Neu B1-42Dokument1 SeiteDaF Kompakt Neu B1-42ismail abbamniNoch keine Bewertungen
- 1 EinleitungDokument2 Seiten1 EinleitungCorneliaBelescu100% (2)
- Beispiel KURZVORTRAGDokument3 SeitenBeispiel KURZVORTRAGTodor Rusev100% (1)
- Kind im Haus, WLAN aus: Weniger Internet für glückliche und erfolgreiche KinderVon EverandKind im Haus, WLAN aus: Weniger Internet für glückliche und erfolgreiche KinderNoch keine Bewertungen
- B2-Die Möglichkeiten Des InternetsDokument24 SeitenB2-Die Möglichkeiten Des InternetsMaggie ZhangNoch keine Bewertungen
- Internet Handy Text1Dokument7 SeitenInternet Handy Text1ilbars akdagNoch keine Bewertungen
- Dành nhiều time lên InternetDokument2 SeitenDành nhiều time lên InternetNguyễn ThuNoch keine Bewertungen
- AutoWiederherstellen - InternetabhängigkeitDokument4 SeitenAutoWiederherstellen - InternetabhängigkeitMicaela CadenaNoch keine Bewertungen
- B2 - Hören PDFDokument1 SeiteB2 - Hören PDFAlejandro Rodríguez RuizNoch keine Bewertungen
- Wie Jugendliche Medien Im Alltag Nutzen: Lies Den Ersten Abschnitt Und Finde Die Wörter FürDokument2 SeitenWie Jugendliche Medien Im Alltag Nutzen: Lies Den Ersten Abschnitt Und Finde Die Wörter FürAnh Hai ThắngNoch keine Bewertungen
- Sss PDFDokument3 SeitenSss PDFB1 Abhirami JoseNoch keine Bewertungen
- Tle All-Seq 4-FEV 2024 MedienDokument2 SeitenTle All-Seq 4-FEV 2024 MedienteddydongmoNoch keine Bewertungen
- Stellungnahme Time LimitDokument2 SeitenStellungnahme Time LimitmuzimuNoch keine Bewertungen
- Handy Verbot in Deutsche SchuleDokument2 SeitenHandy Verbot in Deutsche SchuleNirvanRandha0% (1)
- 8-1sozial Netzwerk - Docx 001 KorrigiertDokument2 Seiten8-1sozial Netzwerk - Docx 001 KorrigiertLinh LâmNoch keine Bewertungen
- Goethe InstitutDokument19 SeitenGoethe InstitutGiorgi KontselidzeNoch keine Bewertungen
- Unterrichtsmaterial Das Handy in Der SchuleDokument60 SeitenUnterrichtsmaterial Das Handy in Der SchuleMarc ZahlmannNoch keine Bewertungen
- Das Internet - Vor - Und Nachteile Für Unsere KinderDokument3 SeitenDas Internet - Vor - Und Nachteile Für Unsere KinderSoukaina Asaad100% (1)
- Dzexams 3as Allemand 1416769Dokument4 SeitenDzexams 3as Allemand 1416769ojenir73Noch keine Bewertungen
- Goethe B2 Lesen Teil 1Dokument5 SeitenGoethe B2 Lesen Teil 1Cứt ĂnNoch keine Bewertungen
- B1 - Skript - 13. WocheDokument9 SeitenB1 - Skript - 13. WocheLibernanNoch keine Bewertungen
- Grafik Beschreiben-Wer Macht Was Im NetzDokument7 SeitenGrafik Beschreiben-Wer Macht Was Im NetzjasinNoch keine Bewertungen
- Revolution Smartphone: Endlich mehr Zeit, weniger Zeit zu habenVon EverandRevolution Smartphone: Endlich mehr Zeit, weniger Zeit zu habenNoch keine Bewertungen
- InternetDokument1 SeiteInternetJaNoch keine Bewertungen
- Sprechen Teil 2.6 PDFDokument1 SeiteSprechen Teil 2.6 PDFYvine Roda Tchoufack KanaNoch keine Bewertungen
- Der programmierte Mensch: Wie uns Internet und Smartphone manipulierenVon EverandDer programmierte Mensch: Wie uns Internet und Smartphone manipulierenNoch keine Bewertungen
- Lektion 17 Text BDokument3 SeitenLektion 17 Text B19852821420Noch keine Bewertungen
- Lösungen + TranskriptDokument3 SeitenLösungen + TranskriptZhihao ZhangNoch keine Bewertungen
- ArbeitDokument37 SeitenArbeitAlex R.Noch keine Bewertungen
- Thema InternetDokument6 SeitenThema InternetK60 Ngô Thị Ngọc HânNoch keine Bewertungen
- ESA Übungsheft 2017Dokument57 SeitenESA Übungsheft 2017bernardNoch keine Bewertungen
- Haben Sie noch alle Neurone beisammen?: Über Gefahren gedankenlosen Gebrauchs digitaler Medien.Von EverandHaben Sie noch alle Neurone beisammen?: Über Gefahren gedankenlosen Gebrauchs digitaler Medien.Noch keine Bewertungen
- Das InternetDokument1 SeiteDas Internetsusu.asaliNoch keine Bewertungen
- SmartphonesDokument1 SeiteSmartphonesPetra Háló0% (1)
- Computer, InternetDokument4 SeitenComputer, Internetdancs krisztinaNoch keine Bewertungen
- Telc C1Dokument5 SeitenTelc C1tolgacabuk5Noch keine Bewertungen
- Facebook Snapsch-3as-Allemand-T3-20190-1086322Dokument4 SeitenFacebook Snapsch-3as-Allemand-T3-20190-1086322Amel BouaraNoch keine Bewertungen
- A KommunikationsmittelDokument4 SeitenA KommunikationsmittelÉva Kövérné PápaiNoch keine Bewertungen
- Kinder sicher im Internet: Die digitalen Gefahrenfür unsere Kinder und wie wir sie davor schützenVon EverandKinder sicher im Internet: Die digitalen Gefahrenfür unsere Kinder und wie wir sie davor schützenNoch keine Bewertungen
- Kinder Und HandyDokument2 SeitenKinder Und Handyohya3316Noch keine Bewertungen
- Moderne KommunikationsmittelDokument1 SeiteModerne KommunikationsmittelМазун Дарина ОлександрівнаNoch keine Bewertungen
- Brauchen Kinder MobiltelefoneDokument2 SeitenBrauchen Kinder MobiltelefoneSlađana MiloševićNoch keine Bewertungen
- Journalismus in Den Sozialen Medien: SprechenDokument26 SeitenJournalismus in Den Sozialen Medien: Sprechenyanko1215Noch keine Bewertungen
- Arbeitsblaetter MediennutzungDokument5 SeitenArbeitsblaetter MediennutzungKristina MickovskaNoch keine Bewertungen
- Schulprogramme Gegen CybermobbingDokument2 SeitenSchulprogramme Gegen CybermobbingGrisho DyankovNoch keine Bewertungen
- TestDaf Schriftlicher Ausdruck 3Dokument4 SeitenTestDaf Schriftlicher Ausdruck 3Guan GongNoch keine Bewertungen
- Kommunikation Und Moderne Geräte 1Dokument2 SeitenKommunikation Und Moderne Geräte 1Kitti Hüvely100% (1)
- B M2 Deutsch NOV13Dokument2 SeitenB M2 Deutsch NOV13ireneNoch keine Bewertungen
- Folder Digitale GeraeteDokument8 SeitenFolder Digitale GeraeteKatja B.Noch keine Bewertungen
- PSP Tlea Klass Smartphone 8. November 2023Dokument3 SeitenPSP Tlea Klass Smartphone 8. November 2023gibsonymgNoch keine Bewertungen
- Umgang Mit MedienDokument4 SeitenUmgang Mit MedienAnita Kádár0% (1)
- KTS530 540 570 PDFDokument96 SeitenKTS530 540 570 PDFCamilo Espinoza AedoNoch keine Bewertungen
- Hyperconvergence With Proxmox VE and Ceph (PDFDrive)Dokument15 SeitenHyperconvergence With Proxmox VE and Ceph (PDFDrive)Jason ludovic Nguema ondoNoch keine Bewertungen
- VDK - BeitrittserklärungDokument2 SeitenVDK - BeitrittserklärungkarlstewartmusicNoch keine Bewertungen
- Bericht Über Mein Praktikum Nomer 2Dokument5 SeitenBericht Über Mein Praktikum Nomer 2Andrii Beldiuhov (Anikkdot)Noch keine Bewertungen