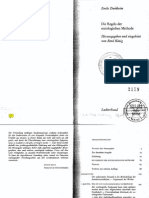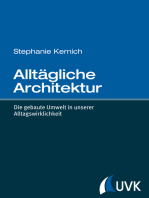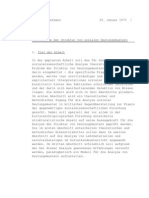Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Luhmann-1995-Das Paradox Der Menschenrechte
Luhmann-1995-Das Paradox Der Menschenrechte
Hochgeladen von
ghkyfCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Luhmann-1995-Das Paradox Der Menschenrechte
Luhmann-1995-Das Paradox Der Menschenrechte
Hochgeladen von
ghkyfCopyright:
Verfügbare Formate
i
,i ,, !,
, " ' {
Di e Deuche Bi bl i ot hek
-
CI P-Ei nhei t sauf nahme
Luhmnn, Ni kl as:
Sozi ol ogi sche Auf kl rung / Ni kl as Luhmann.
-
Opl aden:
' Westdt.
Verl
6. Di e Sozi ol ogi e und der Mensch.
-
1995
I SBN 3-53r-12727-6
Al l e Recht e vorbehal t en
@ 1995
\ Test deut scher
Verl ag GmbFI , Opl aden
Der
*West deut sche
Verl ag i st ei n [ Jnt ernehmen der Bert el smann Fachi nf ormat i on GmbH.
Das \ f erk ei nschl i el i ch al l er sei ner Tei l e i st urheberrecht l i ch gescht zt .
Jede
Verwert ung auerhal b der engen Grenzen des Urheberr. . ht sgeset zes
i st ohne Zust i mmung des Verl ags unzul ssi g und st raf bar. Das gi l t i nsbe-
sondere f r Vervi el f l t i gungen, berset zungen, Mi kroverf i l mungen und
di e Ei nspei cherung und Verarbei t ung i n' el ekt roni schen Syst emen.
Inhal t
Vorwort
Probleme mit operativer Schlie*g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
4.
5.
6.
7,
B.
9.
Die operative Geschlossenheit psychischer und sozialer
Systeme
Wi e i st Bewutsei n an Kommuni kati on betei l i gt?
Di e Au t o p o i e s i s d e s Be wu t s e i n s . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Was i st Kommuni kat i on? . o . o . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , o .
Die gesellschaftliche Differenzierung und das Individuum . , .
D i g F o r m
r r P e r s o n "
. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
Die Tcke des Subjekts und die Frage nach dem Menschen
Intersubjektivitt oder Kommunikation: Unterschiedliche
Ausgangspunkt e sozi ol ogi scher Theori ebi l dung . . . . .
Wahmehmung und Kommunikation sexueller Interessen . . . . .
Das Kind als Medium der Erziehung . . . . . . . .
Das Paradox der Menschenrechte und drei Formen
En t f a l t u n g . . . . .
Inkl usi on und Exkl usi on
Di e Sozi ol ogi e und der Mensch . . . .
Dr u c k n a c h we i s e . . . . . . . .
. a a a
selner
a o . a a a l a a
a a a a a a a a a a a
. 7
. 7 2 1.
2.
t j i
' +'
w-/
25
37
55
113
125
L42
155
169
189
204
229
237
265
275
ffi
10.
11.
72.
13.
14.
Umschl aggest al t ung: Horst Di et er Brkl e, Darmst adt
Umschl agbi l d: Uwe Kubi ak, St r ukt ur 1985 850507- 160
Sat z: I TS Text und Sat z GmbH, Herf ord
Druck und buchbi nderi sche Verarbei t ung: Lengeri cher Handel sdruckerei , Lengeri ch
Gedruckt auf suref rei em Papi er
Pri nt ed i n Germany
I SRN
j - 5 1 1 - 1 ) 7 ? 7 - 6
Da das Erziehungsmedium
technisch nicht annifemd so leistungsf-
hig ist wie beispielsweise Geld, ist durch das Fehlen einer binren Codie-
ruig leicht zu rklren. Auch fehlt jede ?arallele zu jenen hochentwickel-
ten Formen konomischer Rationalitt, die sich aus der Reduktion auf die
Entscheidung ber Zahlungen oder deren Unterlassen bei gegebenen Prei-
sen ergeben."Der Rationalittsdefekt, der i,m
_Vergleich
zum Geldmedium
auffflL wird dann nur allzu schnell durch Emphase, berschwTg-
Td
Enttuschung ausgeglichen. Vor allem erklrt dieser Unterschied die hohe
Interaktionsintensitt
der Erziehung, verglichen mit den extrem reduzier-
ten Interaktionsformen,
die die Geldwirtschaft allenfalls noch braucht' In
diesem vergleich gesehen, mssen die Medien-Defekte der Erziehung
durch Interaktion unter Anwesenden ausgeglichen werden; und zwar
durch Interaktion deshalb, weil dies die einzig angemessene Form des um-
gangs mit ,,Kindern"
ist.
"
D"i"r" ,p"ktuknlaren Unterschiede von Wirtschaft und Erziehung (und
man knnte zum Vergleich auch Wissenschaft, auch Politik, auch Recht
heranziehen) sollten n--icht verdecken, da es in all diesen Fllen um die
Ausdifferenzierung
von autonomen, oPerativ geschlossenen Funktionssy-
stemen geht. Es ritr"it t, da fr eine solche Evolution die Entwicklung
spezifiser Kommunikationsmedien
eine unerlliche Bedingung ist,
denn wie anders knnten systemspezifische
Formdifferenzen
entstehen
und den jeweiligen Funktionen zugeordnet werden? In all diesen Fllen
realisiert ri.r, ai" Differenzierungstypik
der modernen Gesellschaft; und
nur die Art und weise, in der das ermglicht wird, variiert von Funktions-
svstem zu FunktionssYstem.
228
229
Das Paradox der Menschenrechte und drei Formen
sei ner Entfal tung
I.
Das Problem der Begrndung der Menschenrechte ist ein Erbe, das uns
der Zerfall des alteuropischen Naturrechts hinterlassen hat. Im Natur-
recht war ein Naturbegriff wirksam gewesen, der sowohl kognitive als
auch normative Komponenten enthielt. Auch war Natur korruptibel ge-
dacht gewesen, da sie offensichtlich nicht immer das ihr immanente Per-
fektionsziel erreicht. Das wiederum galt auch fr die kognitiven und die
normativen Fhigkeiten der Natur, wie sie besonders (aber eben in der
Weise der Korruptibilit$ in der rationalen Natur des Menschen zum Aus-
druck kornmen. Die Begriffstechniken, die dieser Semantik zu entsprechen
suchten, waren Paradoxieeliminierungstechniken gewesen. Das gilt ganz
offensichtlich fr die Zeitproblematik, sofern sie nach dem Vorbild der
Physikvorlesung am ontologischen Schema von Sein und Nichtsein abge-
handelt wird.l Das gilt auch fr die ideengeleitete Abstraktion von Arten
und Gattungen, die, obwohl sie in jedes
,,gnos"
oerschiedene Individuen'
einbeziehen will, dennoch darauf insistiert, da ein bestimmtes gdnos kein
von ihm Verschiedenes sei und verschiedene nicht dasselbe.2
Dies sei nur vorausgeschickt, um den Leser zu versichem, da wir uns
in guter, oder jedenfalls altehrwrdiger, Gesellschaft befinden, wenn wir
von der These ausgehen, da jede Begrndung von Menschenrechten (und
Begrndung im Doppelsinne der Herstellung von Geltung und der Anga-
be von Grnden dafr) ein Paradoxiemanagement erfordere. Wenn ,,nor-
mal science" luft, braucht man daran nicht zu denken. Man verlt sich
dann auf eine historisch etablierte Weise, die Paradoxie nicht zu sehen.
Man hat es mit Unterscheidungen zu tun, die sie ersetzen und zugleich
verdecken. Aber in Krisensituationen, bei einem Auswechseln von Begrn-
dungsgrundlagen, bei der Suche nach prinzipiell andersartigen Formen
der Stabilitt, kommt die Paradoxie zum Vorschein, um den Paradigma-
1 Siehe Aristoteles, Physica IV 10. Aucll noch Flegel,
phischen Wissenschaften,
S
258.
2 Pl aton, Sophi stes 253 D.
Encyclopdie der philoso-
wechsel zu steuem. Und sie lehrt auch, da es dabei nicht beliebig zuge-
hen kann.
Wir gehen von der These aus, da man eine solche ,,Katastrophe"
im
Europa des 16.
Jahrhunderts
beobachten kann und da die
,,Menschen-
rechte" das Resultat der Dekonstruktion des Naturrechts sind (wobei zur
Selbsttuschung der Protagonisten das Wort Naturrecht beibehalten, aber
in ein Vernunfirecht umverstanden wird). Die Gninde fr diesen Ande-
rungsdruck, der sich auch im Normengefge und den Systematisierungs-
notwendigkeiten des gemeinen Rechts geltend macht, werden oft in der
Entwicklung der Geldwirtschaft gesehen.3 Aber es gibt andere Differen-
zierungsvorginge gleichen Ranges, die ebenfalls, und vielleicht sogar di-
rektet den Naturbegriff tahgieren
-
so die durch die Entwicklung der ma-
thematisch-experimentellen Wissenschaft erzwungene Differenzierung
von Wissenschaft und (schner) Kunst.a Auch an die Entwicklung des mo-
demen Territorialstaates und der zunehmenden Benutzung des Rechts als
Unifikations- nd Reforminstrument wre zu denken' Wir knnen in diese
Diskussion der Auslseursachen hier nicht eingieifen. Es mu die Fest-
stellung gengen, da der gesellschaftsstrukturelle Wandel bei aller Ver-
mutung, es sei ,,Fortschritt'1,
keine Begrndungsfolie fr die
$echtstheorie
liefert. (Erst in unserem
jahrhundert kommt der
]urist
auf die Idee, seine
Entscheidungen aus ihren Folgen, also aus der Zukunft heraus begrnden
zu mssen, und zwar genau deshalb, weil es jetzt an Fortschrittsvertrauen
fehlt). Was man faktisch beobachten kann, besttigt denn auch diese Un-
fhigkeit zu einer gesellsch4ftstheoretischen Begr'ndung des Rechts. Das
Recht mu sich selbst helfen, es mu sein eigenes Paradox selbst zu do-
mestizieren versuchen.
Je
nach dem, von welchen Unterscheidungen man ausgeht, stellt dieses
Problem sich auf verschiedene Weise. Als rechtsinteme Unterscheidung
kommt die Unterscheidung von Recht und Unrecht in Betracht, und die
Paradoxie lautet dann: ob diese U:rterscheidung.zu Recht oder zu Unrecht
benutzt wird. Das Problem wird seit dem 18.
Jahrhundert
abgeleitet auf
die Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung:s Der Gesetz-
3 Ygl. z.B. Gregorio Peces-Barbu Martinez, Trnsito a la modernidad y derechos
fundamentales, Madrid 1982. Fr die Systematisierungsbewegung im gemeinen
Recht entsprechende Andeutungen bei Hans Erich Troje, Die Literatur des ge-
meinen Rechts unter dem Einflu des Humanismus, in: Helmut Coing (Hg.),
Handbuch der Quellen
und der Literatur der neueren europischen Privat-
rechtsgeschichte II, 1, Mnchen 1977, S. 675-795,741ff. Solche Aussagen sind
zunchst einmal nicht mehr als alte Legenden, und man mte rechtsinstituts-
spezifisch nachprfen, wie weit sie berechtigt sind.
4 Siehe hierzu Gerhart Schrter, Logos und List: Zur Entwicklung der Asthetik
in der frLhen Neuzeit, Knigstein/Ts. 1985.
5 Vgl. zum Rahrnen dieses Arguments Niklas Luhmann, The Third Question:
The
230
geber kann sich entlasten mit dem Hinweis, da ber Flle nur der Richter
entscheiden kann. Der Richter findet umgekehrt sein Alibi darin, da dies
nach Regeln zu geschehen hat, die der Gesetzgeber allgemein festgelegt
hat.
Im Dogma der Menschenrechte wird ein ganz anderes Paradox abgelegt.
Hier geht es um die Unterscheidung von Lrdividuum und Recht, die eben-
falls mit der neuzeitlichen Gesellschaftsentwicklung an struktureller und
semantischer Brisanz gewinnt.6 Das Problem ist dadurch bedingt, da die
struktur- und herkunftsbedingte Identittszuweisung ersatzlos gestrichen
wird. Statt dessen entwickelt sich die Figur des subjektiven Rechts, das
aber nur als objektives Recht gilt. Wenn das Individutrm sein
'Recht
als
eigenes Recht in Anspruch nimmt, scheitert es daran wie Michael Kohl-
haas.7 Wenn das Recht seinerseits das Individuum bercksichtigt, das
nicht mehr als Entitt Teil der Gesellschft ist, dann mit psychisch nicht
validierten Abkrzungen, etwa ber den Begriff der Person.
Dies ist, formal gesehen, zunchst kein Paradox, sondern nur eine von
vielen Verschiedenheiten. Es wird aber zum Paradox, wenn man die Ver-
schiedenheit nicht als Letztantwort gelten lt, sondem nach der Einheit
des Verschiedenen fragt, hier also nach der Rechtsform fr die Einheit der
Differenz von Individuum und Gesellschaft. Der Begriff der Menschen-
rechte (im Unterschied zu Brgerrechten) deutet an, da man fr dieses
Paradox eine Lsung gefunden hat
-
und es daraufhin wieder vergessen
kann. Aber worin besteht die Lsung?
II.
Es gehrt zu den akzeptierten Meinungen in der Ideengeschichte der So-
zial- und Rechtsphilosophie, da die Entstehung des Konzepts der indi-
viduellen Menschenrechte in engem Zusammenhang steht mit den Lehren
vom ursprnglichen Sozialvertrag.S Es gehrt etwas mehr Mut dazu (aber
evolutionstheoretische tlberlegungen knnten dafr sprechen), das Fun-
dierungsverhltnis einfach umzukehren: Nicht die Individuen begri.rnden
Creative Use of Paradoxes in Law and Legal History, in:
fournal of Law and
Society 15 (1988), S. 153-165. Zu den Besonderheiten der Entwicklung im 18.
Jahrhundert
etwa Gerald
J.
Postema, Bentham and the Common Law Tiadition,
Oxford 1986; David Lieberman, The Province of Legislation Determined: Legal
Theory in Eighteenth Century Britain, Cambridge Engl. 1989.
6 Hierzu nher Niklas Luhmann, Individuum, Individualitt, Individualismus,
in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik, Bd. 3, Frankfurt 1989, S. 149-ZSB.
7 Siehe zu diesem, zumindest der Romantik noch bewuten Problem Regina Ogo-
rek, Adam Mllers Gegensatzphilosophie und die Rechtsausschweifuhgen des
Michael Kohlhaas, Kleist-Jahrbuch 1988/89, S. 96-125.
8 Siehe nur Peces-Barba (FN 3), S. 159ff.
231
den Sozialvertrag, sondern der Sozialvertrag begrndet die Individuen.
Oder genauer: Erst die Doktrin vom Sozialvertrag macht es mglich und
auch ntig, zu fragen, wer denn diesen vertrag abschliet und dank wel-
cher natrlichen Ausstattung (vernunft, Interessen, Triebe, natrliche
Rechte) die vertragsschlieenden ihren vorteil im Vertrag sehen. wie so
oft mag auch hier die vorhandene Problemlsung, der Sozialvertrag, es
ermglicht haben, das Problem zu definieren. Fr eine bekarurte Lsung
wird,
pil
anderen Worten, das Problem gesucht' Das Problem heit dann:
die Vielzahl der vorgesellschaftlich (= u""rgutellschaftlich) existierenden
Individuen. Aber dies Problem erzeugt ber den Sozialvertrag hinweg ein
zweites Problem: was wird aus den Individuen, nachdem sie den Vertrag
geschlossen haben? Dieses vorher/nachher-Problem beantwortet die Dok-
trin der Menschenrechte dadurch, da Menschenrechte von den vertrag-
lich konstituierten Rechten unterschieden werden. Und dies nicht nach
dem Muster von Naturzustand/Zivilzustand, sondern in der paradoxen
Form der Einheit dieser Differenz. Menschenrechte sind die Rechte, die
sich aus dem Naturzustand in den Zivilzustand hinberretten knnen,
und dies auch und gerade dann, werur der Sozialvertrag unkndbar ist.
Schon das ist ein nicht unmerkwrdiges Konzept' Es kommt hinzu, da
der Sozialvertrag selbst, wenn er als pactum unionis (und nicht nur mit-
telalterlich ak pctum subiectonis) begriffen werden soll, einen Begrn-
dungszirkel enthit, Der Vertrag ist nur dank seiner selbst verbindlich.
Ohne ihn gibt es nicht einmal die Norm des ,,pacta
sunt servanda". Auch
das ,,free
rider"-Problem, also das Problem der Rationalitt der Chancen-
ausnutzung, die mglich ist, wenn die anderen einen solchen Vertrag
schlieen, bleibt ungelst. Das Paradox, das eliminiert werden sollte, kehrt
also in sehr spezifischen Formen zurck. Die Frage ist dann: unter welchen
Bedingungen kann man es in dieser Form ignorieren
-
und wie lange,
wenn die sozialen Verhltnisse sich ndern?
Sptestens in der zweiten Hlfte des 18.
]ahrhunderts
verlieren die So-
zialvertragskonzepte an berzeugungskraft. Im Rckblick erscheint dieser
Einbau normativer Prmissen in einen offensichtlichen Zirkel heute als
,,Ideologie"
des aufstrebenden Brgertums.9 Aber das Problem der Men-
schenrechte bleibt. Es sucht sich jetzt ein neues uneingestehbares Paradox
und findet die Lsung in der Vertextung, schlielich in der Positivierung
dieser vorpositiven Rechte. Man denkt zunchst an rein deklaratorische
9 Siehe nur David Gauthier, The Social Contract as Ideology, in: Philosophy and
Public Affairs 6 (1,977), S. 130-164. Anzumerken wre noch, da die bloe Be-
zeichnung als ldeologie manche schon zufriedenstellt und von weiteren
119""
abhlt. Zi fragen wre aber dann, wie die Bezeichnung einer angeblichen Wahr-
heit als Ideolgie wahr sein kann; oder wie sie sicher sein kann, nicht selber
ei ne Ideol ogi e zu sei n.
232
Texte, die nur anerkennen, da es solche Rechte gibt, etwa in den ameri-
kanischen Bills of Rights oder in der franzsischen Dclaration.10 Alsbald
wird es aber blich und gegen systematische Bedenken auch notwendig,
solche Texte in die Verfassung einzubeziehen, um ihnen die Stabilitt des
Verfassungsrechts zu vermitter und sie juristisch zu normalisieren.
Jetzt
erscheint unser Paradox in der Form der Positivierungsbedrftigkeit des
vorpositiven Rechts. Eine Zeitlang karur man sich darber hinweghelfen,
indem man das, was die Texte meinen, immer noch als
,,Naturrecht"
be-
zeichnet und diese Referenz auf Natur auch in den Textformulierungen
anklingen lt, es in sie hineinlegt und dann wieder herausholt, etwa mit
,,ist"-Formulierungen
(statt
,,soll"-Formulierungen), zum Beispiel in Art. I
GG. Auch kann man sagen, da die Textformulierungen nur Anwendungs-
hilfen, nur akzidentelle Ausstattungen ohnehin bestehender Rechte sind.
Aber schon sieht man, da es keinen Unterschied macht, ob Aussagen
dieser Art zutreffen oder nicht. Und vor allem macht dies Positivierungs-
erfordernis das Paradoxiemanagement abl"rngig- von der Institution des
Territorialstaates. Das lt die Geltungsgrundlage der Menschenrechte fr
die Weltgesellschaft.ungeklrt
-
ein heute zunehmend dringliches Pro-
blem, das man wohl kaum dadurch lsen kann, da man die Existenz
eines weltgesellschaftlichen Rechts schlicht bestreitet. Auch intemationale
Konventionen bleiben an die Einzelstaaten gebunden, und dies auch dann,
wenn sie spezifisch auf die Achtung der Menschenrechte bezogen sind.
Wie man am Schicksal der American Convention on Hurnan Rights von
1988 ablesen kann: sie werden unterzeichnet oder nicht, ratifiziert oder
nicht, mit oder ohne Unterwerfung unter eine vorgesehene Gerichtsbarkeit
und natrlich all dies mit dem Souverinititsvorbehalt der Widerrufsmg-
l i chkei t.l l
Ist diese Form des Paradoxiemanagements, ist die Paragraphierung der
Menschenrechte heute noch zeitgem? Man wird darauf nicht verzichten
wollen, aber werur man den Paradoxiebezug dieser Figur im Auge behlt,
kann man vielleicht schon einen netien Gestaltswitch der Paradoxie beob-
10 Zu den so/orf anschlieenden Formulierungs- und Reformulierungskmpfen
sich Marcel Gauchet, Droits et l'homme, in:.Frangois Furet/Mona Ozouf (Hg.),
Dictionnaire de la R6volution Frangaise, Paris 1988, S. 685-695. Sobald Texte
produziert sind, sind sie auch kommentar- und nderungsbedrftig.
11 Im Falle der American Convention ist die Enthaltsamkeit der USA besonders
bemerkenswert, die soweit ich wei, bis heute nicht ratifiziert und sich jeden-
falls der Gerichtsbarkeit des Inter-American Court nicht unterworfen haben,
obwohl sie in anderen Zusammenhngen doch besonders und mit geradezu
weltpolizeilicher Anmaung sich der Menschenrechte annehmen. Siehe zur
gleichwohl bemerkenswerten Wirksamkeit den Annual Report of the Inter-
American Court of Human Rights 1989, Washington 1989. Ich danke fin zu-
stzliche Information anllich eines Gesprchs in Mdxico City (August 1990)
Herrn Prof. Hctor Fix-Zamudio.
achten. Sie versteckt sich auf andere Weise
-
entsprechend dem allgemei-
nen Eindruck, da Zivilisationsprodukte in ihren Grenzen erkennbar wer-
den.
Die aktuellste Form der Behauptung von Menschenrechten knnte zu-
gleich die urtmlichste (natrlichste) sein. Normen werden an Versten
erkannt, Menschenrechte daran, da sie verletzt werden. So wie Erwar-
tungen oft erst an Enttuschungen bewut werden, so auch Normen oft
erst an Verletzungen. Die Situation der Enttuschung fhrt bei Informa-
tionen prozessierenden Systemen zur Rekonstruktion ihrer eigenen Ver-
gangenheit, zu rekursivem Prozessieren mit Rckgriffen und Vorgriffen
uf etwas, was nur im Moment einleuchten mu. Und es scheint, da sich
die Aktualisierung von Menschenrechten heute weltweit primr dieses
Mechanismus bedient.
An Anlssen fehlt es nicht. Dds Ausma an Menschenrechtsverletzun.
gen in fast allen Staaten ist erschreckend, ebenso wie die Drastik der Vor-
iatte
-
das Foltem und Beseitigen von Menschen oder das Tolerieren sol-
cher Praktiken, die immer geringer werdende Garantie ffentlicher Sicher.
heit mit hoher Toleranz von physischer Gewalt, um nur unbestreitbar
deutliche Flle zu erwhnen. EJwre ,,geschmacklos",12
angesichts solcher
Atrozitten in Texten nachzuschlagen oder die lokal geltende Rechtsord-
nung zu befragen, ob dergleichen erlaubt ist oder nicht. Das Problem liegt
eher in der Kommunikation solcher Verletzungen und im Wachhalten der
ffentlichen Aufmerksamkeit angesichts der Massenhaftigkeit und der la-
fenden Reproduktion des Phinomens'
wie imer der sachstand in dieser Frage ist und wie immer er sich
ndern wird: jedenfalls ist wiederum eine Paradoxie impliziert. Die Gel-
tung der Norm erweist sich an ihrer Verletzung. Man mag das im Ausgang
von einer hochentwickelten Rechtskultur, die unsere Erwartungen be-
stimmt, als unzureichende Antwort auf das Problem beklagen' Man hat
aber schon oft bemerkt, da die weltrechtsordnung eher den ordnungs-
formen tribaler Gesellschaften gleicht, also auf organisierte Sanktionsge-
walt und auf authentische Definition der Rechtsverste an Hand bekann-
ter Regeln verzichten mu. Immerhin scheint mit der Einsicht in die ber-
lastung und Inadquitt gtaatsgarantierter Rechtspflege auch die Aufmerk-
12 Ich brauche diesen Begriff hier im Sinne von Kants Kritik Urteilskraft, also im
sinne eines Appells air Kriterien, die sich weder kognitiv noch praktisch an
entsprechenden Vernunftsorten ausweisen mssen. Die Berufung auf guten Ge-
schmack mag zynisch klingen, aber es ist nicht unplausibel, hier mit Rcksicht
auf das systm der drei Kritiken ein offenes Kriterienproblem zu sehen, da wir
kaum beieit sein werden, das Problem ber die unterscheidung von Vernunft-
ideen und sthetischen Ideen (Kritik der urteilskraft
$
49) abzulegen
-
was
berdies auch das Problem htte, da sthetische Ideen nicht den Anspruch
auf Konsensfhigkeit erheben.
234
samkeit ftir Phinomene der beschriebenen Art zuznnehmen; und jeden-
falls sollte man sich nicht scheuen, das Menschenrechtsparadox in seiner
gegenwrtig dominierenden Gestalt als Paradsx zu bezeichnen. Gerade
das fhrt ja vor die Frage, ob nicht auch neue Formen der
,,Entfaltung"
dieses Paradoxes durch darauf bezogenen Unterscheidungen bentigt wer-
den.
III.
Wie die klassische Mythologie lehrt, wird ein Beobachter, der eine Para-
doxie zu beobachten versucht, dran hingen bleiben. Er wird erstarren,
wenn es ihm nicht gelingt, mit der bekannten Spiegeltechnik des Perseus
die Medusa zu tten. Dann ist, der Sage nach, der Kopf bei Athena abzu-
liefem, und die Welt ist fr die Gttin der Kognition logisch-ontologisch
in Ordnung. Etwas voreilig, mchte der Soziologe kommentieren. Er be-
vorzugt denn auch ein Beobachten der Beobadrter der Paradoxie
-
ein
Beobachten zweiter Ordnung.
Er mchte wissen, wie und in welchen Formen der Direktblick auf Pa-
radoxien vermieden wird, wobei mitgesehen wird, da dies vermieden
werden mu.13 Im Metaphysikkritikprograrnm eines
Jacques
Derrida wr-
de das heien: die
,,omissions" der Philosophie zu studieren und den Blick
dafr zu schrfen, wie sich das Abwesende im Anwesenden gleichwohl
bemerkbar macht.l4
,,Dekonstruktion" ist ein ebenso berhmter wie auch irrefhrender Aus-
druck fr eine solche Vorgehensweise. Man knnte sie auch positiver se-
hen. Wenn man dem allgemeinen Theorieschema folgt, da Paradoxien
bei jeder operativ benutzten Unterscheidung auftreten, sobald man nach
ihrer Einheit fragt, also nach der Einheit dessen, was nur als Differenz
benutzt werden kann, wird die Frage aktuell, wie Paradoxien
,,entfaltet",
das heit durch unterscheidbare Identitten ersetzt und verdrngt werden.
Die Typenhierarchie der Logik oder die Ebenenunterscheidung der Lin-
guistik mgen hier als Muster dienen.
|edenfalls
kann die Paradoxieent-
faltung nicht logisch-deduktiv erfolgen. Ihre Kriterien liegen eher in der
Frage, welche Unterscheidungen fr welche Systeme in welchen geschicht-
lichen Zeiten so viel Plausibilitt aufweisen, da die Frage nach der Einheit
13 Siehe auch Niklas Luhmann, Sthenographie und Euryalistik, in: Hans Ulrich
Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hg.), Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbr-
che: Situationen offener Epistemologie, Frankfurt 1991, S. 58-82.
14 Aber dies sichbemerkbarmachen ist zugleich ein Auslschen des Sichbemerk-
barmachens und ein Bemerkbarmachen des Auslschens des Sichbemerkbar-
machens
-
eine ,,trace de l'effacement de la trace", wie es in
Jacques Derrida,
Marges de Ia philosophie, Paris 1972, S. 77 heit.
der Unterscheidung oder auch die Frag'e, wieso diese Unterscheidung und
keine andere benutzt wird, nicht gestellt wird. Anything may go, aber
nicht alles zu jeder ZeiL
Man kommt, das sollten die vorstehenden Analysen zeigen, zu einer
historisch-empirischen Semantik der Paradoxieentfaltungsformen.
Man
kann sie, wenn Soziologie mitwirkt, mit gesellschaftsstrukturellen Vern-
demngen korrelieren. Man karur auf diese Weise auch eine Kritik von [Jn-
terschidungsgewohnheiten
anregen mit den Fragen, welche Paradoxie sie
verdecken sollten und ob die dafr benutzten Formen noch berzeugen.
Daraus kann eine grere Unbefangenheit in der Wahmehmung von Neu-
entwicklungen resultieren, und dies wre in einer von Selbstunsicherhei-
ten geplagtn Gesellschaft kein kleiner Gewinn.
Da unsere wahmehmung von Menschenrechtsverletzungen
durch die
Massenmedien gesteuert (was einschliet im Hinblick auf
'die
Selektions-
weisen der Massenmedien manipuliert) wird, ist sinnvoll und nicht zu
beanstanden. Dasselbe gilt ja auch fr die Wahmehmung technisch-ko-
logischer Katastrophen.S In beiden Fllen befriedigen
jedoch die Resultate
niht.
pas
liegt offenbar daran, da ein Bezugspunkt und, im Falle der
Massenmedien, eine ausdifferenzierte Ebene fr Reflexion fehlt' Mit ge-
wissen Theorieanstrengungen knnte heute an diesem Defizit gearbeitet
werden. Eine dafr geeignete Theoriesprache lt sich entwickeln, wenn
man mathematische Theorien des Prozessierens von Formen (= Unter-
scheidungen) mit einer neokybernetischen Theorie der Beobachtung zwei-
ter Ordnung und mit operationsbasierten Systemtheorien kombiniert. So-
wohl fr die Rechtstheorie als auch fr die Soziologie erfordert das ein
Betreten unvertrauten Gelndes. Aber an einem so brisanten Thema wie
dem der Menschenrechte lt sich zeigen, da solch ein.Unternehmen
nicht ohne Aussicht ist'
@uchForschung,Si eheetwaRol fLi ndner,Medi enund
Katastrophe: Fnf Thesen, in: Hans Peter Dreitzel/Horst Stenger (Hg
)i
Y"-
gewollte^ Selbstzerstrung: Reflexionen ber den Umgang mit katastrophalen
Entwicklungen, Frankfurt 1990, S. 124-134.
Inklusion und Exklusion
I .
Im Theorieapparat der Soziologie spielt seit den Zeiten der Klassiker der
Begriff der sozialen Differenzierung eine wichtige Rolle. Er bezeichnet fast
das einzige Konzept, das fr die Darstellung des Gesellschaftssystems in
ununterbrochener Tradition zur Verfgung steht. Man kann Varianten un-
terscheiden, etwa solche, die mehr auf Klassenherrschaft, und andere, die
mehr auf die Vorteile der Arbeitsteilung setzen. Und es gibt theorieimma-
nente Entwicklungen, etwa von der Vorherrschaft einer Rollen- oder Grup-
penperspektive zu formaleren systemtheoretischen Darstellungsmitteln.
Auch und gerade in den letzten
Jahren
ist Differenzierung wiederum ein
bevorzugtes Thema soziologischer Theorie.l Im Zusammenhang damit
entstehen Fragen nach der Integration differenzierter Systeme. Wenn eine
Einheit differenziert gedacht wird, mu sie als Einheit doch noch erkenn-
bar sein; sie mu die Zusammengehrigkeit der Teile ausweisen knnen.
Durkheim hatte darin bekanntlich ein Ptoblem der (moralischen) Solida-
ritt gesehen und den Schwerpunkt seiner Theorie zunehmend. auf diesen
Aspekt verlagert. Parsons hatte im Anschlu an Durkheim einen evolu-
tionren Variationszusammenhang von Differenzierung und Generalisie-
rung der Einheitssymbolik angenommen.2 Dabei lief jedoch der Integra-
tionsbegriff gleichsam im Schatten der Differenzierungstheorie mit und
blieb begrifflich ungeklrt.3-Er wird nur durch das Covariationsschema
Differenzierung/ lntegration gehalten:
1 Siehe efwa Renate Mayntz et al., Differenzierung und Verselbstndigung: Zur
Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme, Frankfurt 1988;
Jeffrey
C. Alexan-
derlPaul Colomy (Hg.), Differentiation Theory and Social Change: Compara-
tive and Historical Perspectives, New York 1990.
2 Oder in der komplexeren, an das AGIL-Schema angepatert Formulierung von
Talcott Parsons, The System of Modern Societies, Englewood Cliffs NJ. 1971,
S. 11, 26ft., einen Zusammenhang von adaptive upgrading, differentiation, in-
clusion and value g-eneralization.
3 Fr einen knappen Uberblick siehe Helmut Willke Systemtheorie,3. Aufl. Stutt-
gart 199L, S. I67ff. Da die bekannte Unterscheidung social integration/system
integration von David Lockwood; Social Integration and System Integration,
.in: George K. Zollschan/Walter Hirsch (Hg.), Social Change: Explorations, Dia-
gnoses, and Conjectures, New York 1976, S. 370-383, nicht weiterhilft, liegt auf
der Hand. Sie vergrert nur die Spannweite des Begriffs, ohne ihn selbst zu
Das könnte Ihnen auch gefallen
- System - Und Handlungstheorie Bei Luhmann. Bemerkungen Zu Ihrem ZusammenhangDokument18 SeitenSystem - Und Handlungstheorie Bei Luhmann. Bemerkungen Zu Ihrem ZusammenhangJosé LiraNoch keine Bewertungen
- Lay, Rupert - Die Macht Der MoralDokument149 SeitenLay, Rupert - Die Macht Der Moralanon-692902100% (2)
- Luhmann, Niklas - Der Medizinische CodeDokument13 SeitenLuhmann, Niklas - Der Medizinische CodeHMLWSTNoch keine Bewertungen
- Luhmann, Niklas - Am Ende Der Kritische TheorieDokument6 SeitenLuhmann, Niklas - Am Ende Der Kritische TheorieDeDavidianNoch keine Bewertungen
- Medien - Und Kommunikationstheorie - MitschriftDokument50 SeitenMedien - Und Kommunikationstheorie - MitschriftHeroTwin100% (1)
- Mensch bleiben!: Lehrbuch Anthropologie, Ethik und Spiritualität für PflegeberufeVon EverandMensch bleiben!: Lehrbuch Anthropologie, Ethik und Spiritualität für PflegeberufeNoch keine Bewertungen
- 01 - Durkheim - Regeln Zur Betrachtung Der Soziologischen TatbestaendeDokument14 Seiten01 - Durkheim - Regeln Zur Betrachtung Der Soziologischen TatbestaendeLaurenz JetzingerNoch keine Bewertungen
- LuhmannDokument33 SeitenLuhmannMoritz MolodjezNoch keine Bewertungen
- Habermas, Die Kommunikative Planung Und Die AlternativenDokument6 SeitenHabermas, Die Kommunikative Planung Und Die AlternativenRitske DankertNoch keine Bewertungen
- Niklas Luhmanns Systemtheorie interkulturell gelesenVon EverandNiklas Luhmanns Systemtheorie interkulturell gelesenNoch keine Bewertungen
- Sozialkritik und soziale Steuerung: Zur Methodologie systemangepasster AufklärungVon EverandSozialkritik und soziale Steuerung: Zur Methodologie systemangepasster AufklärungNoch keine Bewertungen
- Hubig, Christoph - Natur Und Kultur - Von Inbegriffen Zu ReflexionsbegriffenDokument23 SeitenHubig, Christoph - Natur Und Kultur - Von Inbegriffen Zu Reflexionsbegriffenmaurice florenceNoch keine Bewertungen
- Baecker, Kommunikation Über Wahrnehmung ThesenpapierDokument6 SeitenBaecker, Kommunikation Über Wahrnehmung ThesenpapierkobbanNoch keine Bewertungen
- Mütherich - Speziesismus, Soziale Hierarchien Und Gewalt (TAN) PDFDokument32 SeitenMütherich - Speziesismus, Soziale Hierarchien Und Gewalt (TAN) PDFmaralenayiNoch keine Bewertungen
- Sachbuch - Psychologie - Lehner, Martin & Wilms, Falko E. P. - Systemisch Denken - Klipp Und Klar PDFDokument116 SeitenSachbuch - Psychologie - Lehner, Martin & Wilms, Falko E. P. - Systemisch Denken - Klipp Und Klar PDFCristian PascaNoch keine Bewertungen
- Pierre Bourdieu und die Kommunikationswissenschaft: Internationale PerspektivenVon EverandPierre Bourdieu und die Kommunikationswissenschaft: Internationale PerspektivenNoch keine Bewertungen
- Handout SoziologieDokument21 SeitenHandout SoziologieThomas MuellerNoch keine Bewertungen
- Der unsichtbare Wohnraum: Wohnsuffizienz als Antwort auf Wohnraummangel, Klimakrise und EinsamkeitVon EverandDer unsichtbare Wohnraum: Wohnsuffizienz als Antwort auf Wohnraummangel, Klimakrise und EinsamkeitNoch keine Bewertungen
- Armin Nassehi - Die Funktional Differenzierte Gesellschaft (02.06.08)Dokument15 SeitenArmin Nassehi - Die Funktional Differenzierte Gesellschaft (02.06.08)erhardmuesseNoch keine Bewertungen
- Der Antihumanist Niklas LuhmannDokument1 SeiteDer Antihumanist Niklas LuhmannmNoch keine Bewertungen
- Schwierigkeiten mit der kritischen Geographie: Studien zu einer reflexiven Theorie der GesellschaftVon EverandSchwierigkeiten mit der kritischen Geographie: Studien zu einer reflexiven Theorie der GesellschaftNoch keine Bewertungen
- SoziologiezusammenfassungDokument47 SeitenSoziologiezusammenfassungHelena Logodska100% (2)
- AkteurnetzwerktheorieDokument25 SeitenAkteurnetzwerktheoriemarkusdaeppenNoch keine Bewertungen
- Unternehmensfuehrung Und Chaostheorie PDFDokument11 SeitenUnternehmensfuehrung Und Chaostheorie PDFcondet74Noch keine Bewertungen
- Handout Luhamnn PDFDokument4 SeitenHandout Luhamnn PDFAnonymous FC26hX7xUNoch keine Bewertungen
- Mensch und Künstliche Intelligenz: Herausforderungen für Kultur, Wirtschaft und GesellschaftVon EverandMensch und Künstliche Intelligenz: Herausforderungen für Kultur, Wirtschaft und GesellschaftNoch keine Bewertungen
- Zur Emergenz Des Sozialen Bei Niklas Luhmann Simon Lohse Institut Für PhilosopDokument18 SeitenZur Emergenz Des Sozialen Bei Niklas Luhmann Simon Lohse Institut Für PhilosopFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- Verstehen statt Begründen: Warum es in der Ethik um mehr als nur um Handlungen gehtVon EverandVerstehen statt Begründen: Warum es in der Ethik um mehr als nur um Handlungen gehtNoch keine Bewertungen
- »Klimamigration«: Wie die globale Erwärmung Flucht und Migration verursachtVon Everand»Klimamigration«: Wie die globale Erwärmung Flucht und Migration verursachtNoch keine Bewertungen
- Gleisdreieck / Parklife BerlinVon EverandGleisdreieck / Parklife BerlinAndra LichtensteinNoch keine Bewertungen
- Habermas FinDokument54 SeitenHabermas FinVera SchneiderNoch keine Bewertungen
- Allgemeine TechnologieDokument363 SeitenAllgemeine Technologienallia25Noch keine Bewertungen
- Von der Umwelt zur Welt: Der Weltbegriff in der UmweltsoziologieVon EverandVon der Umwelt zur Welt: Der Weltbegriff in der UmweltsoziologieNoch keine Bewertungen
- Digitalität und Privatheit: Kulturelle, politisch-rechtliche und soziale PerspektivenVon EverandDigitalität und Privatheit: Kulturelle, politisch-rechtliche und soziale PerspektivenChristian AldenhoffNoch keine Bewertungen
- Existenzweisen Latour Die ZeitDokument1 SeiteExistenzweisen Latour Die ZeitlercheNoch keine Bewertungen
- Bürgermeister: Führungskraft zwischen Bürgerschaft, Rat und VerwaltungVon EverandBürgermeister: Führungskraft zwischen Bürgerschaft, Rat und VerwaltungNoch keine Bewertungen
- Luhmann Und BeckDokument8 SeitenLuhmann Und Beckjaya_nl7218Noch keine Bewertungen
- Architektur wahrnehmen (2. Aufl.)Von EverandArchitektur wahrnehmen (2. Aufl.)Alexandra AbelNoch keine Bewertungen
- Stadtlandschaften Entwerfen?: Grenzen und Chancen der Planung im Spiegel der städtebaulichen PraxisVon EverandStadtlandschaften Entwerfen?: Grenzen und Chancen der Planung im Spiegel der städtebaulichen PraxisNoch keine Bewertungen
- Die digitale Mobilitätsrevolution: Vom Ende des Verkehrs, wie wir ihn kanntenVon EverandDie digitale Mobilitätsrevolution: Vom Ende des Verkehrs, wie wir ihn kanntenNoch keine Bewertungen
- Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft: Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und KunstVon EverandKunstforschung als ästhetische Wissenschaft: Beiträge zur transdisziplinären Hybridisierung von Wissenschaft und KunstMartin TröndleNoch keine Bewertungen
- Handbuch OeffentlichkeitsbeteiligungDokument66 SeitenHandbuch OeffentlichkeitsbeteiligungDaniel GitauNoch keine Bewertungen
- Ansichtssache Stadtnatur: Zwischennutzungen und NaturverständnisseVon EverandAnsichtssache Stadtnatur: Zwischennutzungen und NaturverständnisseNoch keine Bewertungen
- Bürgerbeteiligung 3.0: Zwischen Volksbegehren und Occupy-BewegungVon EverandBürgerbeteiligung 3.0: Zwischen Volksbegehren und Occupy-BewegungNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift für Medienwissenschaft 25: Jg. 13, Heft 2/2021: SpielenVon EverandZeitschrift für Medienwissenschaft 25: Jg. 13, Heft 2/2021: SpielenGesellschaft für MedienwissenschaftNoch keine Bewertungen
- Alltägliche Architektur: Die gebaute Umwelt in unserer AlltagswirklichkeitVon EverandAlltägliche Architektur: Die gebaute Umwelt in unserer AlltagswirklichkeitNoch keine Bewertungen
- Tierethik transdisziplinär: Literatur - Kultur - DidaktikVon EverandTierethik transdisziplinär: Literatur - Kultur - DidaktikNoch keine Bewertungen
- Ulrich Oevermann Struktur Von Deutungsmuster 1973Dokument40 SeitenUlrich Oevermann Struktur Von Deutungsmuster 1973horstgunterzumretzulNoch keine Bewertungen
- Topos Tier: Neue Gestaltungen des Tier-Mensch-VerhältnissesVon EverandTopos Tier: Neue Gestaltungen des Tier-Mensch-VerhältnissesAnnette Bühler-DietrichNoch keine Bewertungen
- Buch Kleve Sozialarbeitswissenschaft Systemtheorie PostmoderneDokument232 SeitenBuch Kleve Sozialarbeitswissenschaft Systemtheorie PostmoderneschlotterbeckchenNoch keine Bewertungen
- Ant in Zehn MinutenDokument5 SeitenAnt in Zehn MinutenfleurettechenNoch keine Bewertungen