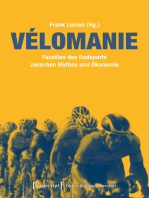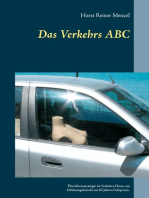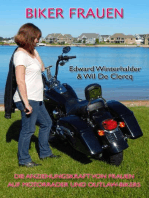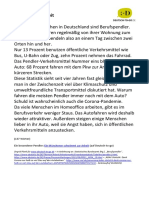Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Radfahren
Hochgeladen von
Endri HotajOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Radfahren
Hochgeladen von
Endri HotajCopyright:
Verfügbare Formate
Headline 1: Radfahren in der Stadt
Headline 2: Nur was für Hartgesottene
Headline 3: Für viele Radfahrer gehören Beinahe-Unfälle und Fast-Zusammenstöße
mit Autos oder Lastern zum Alltag. Mit den bisherigen Maßnahmen wird sich daran
nichts ändern.
Von Andrea Reidl
Radfahren ist nicht gefährlich. Gefährlich ist eine Infrastruktur, die Radfahrerinnen
und Radfahrer immer wieder in kritische Situationen zwingt. Das zeigt Rachel
Aldreds Studie Investigating the rates and impacts of near misses and related
incidents among UK cyclists sehr eindrucksvoll. Die Verkehrswissenschaftlerin an
der University of Westminster hat erstmals Radfahrende nach ihren täglichen
Erlebnissen im Straßenverkehr befragt, um zu verstehen, was Menschen tatsächlich
am Radfahren hindert.
Für die Studie haben insgesamt 2.586 Radlerinnen und Radler an zwei bestimmten
Tagen eine Art Fahrradtagebuch geführt und ihre unangenehmen Erlebnisse im
Straßenverkehr protokolliert. Etwa drei von vier Teilnehmern waren erfahrene
Fahrradpendler, überwiegend männlich (70 Prozent) und zwischen 30 und 59 Jahre
alt. Etwa jeder Dritte von ihnen war in London unterwegs, die anderen ebenfalls aus
Städten in Großbritannien.
Das Ergebnis ist aufschlussreich. Die Studienteilnehmer notierten insgesamt mehr
als 6.000 Zwischenfälle. Die meisten von ihnen erlebten an dem betreffenden Tag
also gleich mehrere Zwischenfälle. Jeder siebte Vorfall war ein Beinah-
Zusammenstoß mit einem Bus oder einem Lkw. Auf der Liste standen außerdem
Autos, die mit zu geringem Abstand überholten, blockierte Radwege, das
sogenannte Dooring – also das plötzliche Öffnen der Tür eines stehenden Autos –
sowie gefährliche Situationen beim Abbiegen oder andere Beinah-Unfälle.
Headline 3: Alltagsfahrer nehmen Konfliktsituationen selten wahr
Die routinierten Fahrerinnen und Fahrer habe die hohe Zahl an Vorfällen selbst
erstaunt, sagt Rachel Aldred. Ihre Erklärung: "Sie nehmen die Konflikte gar nicht
mehr als Bedrohung wahr." Im Umkehrschluss heißt das, für viele gehören
gefährliche Situationen auf dem Arbeitsweg oder der Einkaufstour zum Alltag, und
die Geübten reagieren routiniert auf die Vorfälle. Sie denken nicht weiter über die
kritische Situationen oder den Beinah-Zusammenstoß nach und haben sich an das
Risiko gewöhnt.
Als beängstigend wurden insbesondere die Beinah-Unfälle durch Dooring
empfunden, aber auch das zu enge Überholen von Autos – und die wenig
erfahrenen Radlerinnen und Radler notierten an dem Studientag rund doppelt so
viele "sehr beängstigende" Vorfälle wie die regelmäßig Radelnden.
Zu den in der Studie zitierten Aussagen gehören unter anderem: "Ich fühle mich
nervös, wenn Autos von hinten ankommen" und "Ich glaube inzwischen, dass es
nicht mehr reicht, einfach die Regeln zu befolgen, wenn man am Leben bleiben will –
man muss immer antizipieren, dass die anderen sorglos sein könnten". Andere
gaben an, sie würden künftig noch vorsichtiger radeln. Allerdings: Ungeübte und
unsichere Radfahrer habe die Verkehrssituation so erschreckt, dass sie das
Radfahren unverzüglich wieder aufgaben, berichtet Aldred.
Für die Forscherin ist das Verhalten nachvollziehbar. Sie zieht folgenden Schluss:
"Wer Radfahrer vor beängstigenden Situationen schützen will, muss die Wege
trennen und die Straßenkultur ändern." Der Wunsch, in der Infrastruktur die
Radfahrenden vom motorisierten Verkehr zu separieren, wurde vielfach geäußert.
Der nur auf die Straße gepinselte Radstreifen genügt vielen Radfahrenden nicht.
Headline 3: Jeder zweite Radler fühlt sich im Verkehr unsicher
Aldreds Forderung ist klar: Gefährdete Verkehrsteilnehmer müssen Vorrang haben.
Dafür sei ein umfassender Paradigmenwechsel nötig, außerdem mutige strukturelle
Veränderungen.
In London hat dieser Wandel begonnen, wenn auch langsam. 2013 wurden zunächst
Radstreifen mit blauer Farbe auf die Straße gemalt. "Den Leuten wurde gesagt: Es
ist sicher, auf den Wegen zu fahren", sagt Aldred, "aber auf dieser Infrastruktur sind
Menschen gestorben." Inzwischen werden immer mehr Radwege vom Autoverkehr
klar getrennt. Zudem hat die Londoner Stadtverwaltung das Budget für die
Radinfrastruktur von einem auf zwölf Euro pro Einwohner pro Jahr erhöht.
Aber das allein reiche nicht, urteilt Aldred. Ein generelles Umdenken sei wichtig,
neben der höheren Investition sei auch der gesellschaftliche Wandel wichtig. Der hat
in London ebenfalls begonnen. "Vor ein paar Jahren wurden bei Zusammenstößen
zwischen Auto- und Radfahrern stets die Radfahrenden zur Rechenschaft gezogen",
stellt die Wissenschaftlerin fest. Journalisten hätten in ihren Beiträgen den
Radfahrern indirekt eine Mitschuld an Unfällen unterstellt, indem sie anmerkten,
dass die Toten beispielsweise weder Helme noch Warnwesten getragen hätten. Das
habe inzwischen aufgehört.
Mittlerweile kontrollieren außerdem Polizeistreifen zu Fuß und per Auto, ob Pkw-
Fahrer die Radler mit ausreichend Abstand überholen. An manchen Baustellen
werden sogar extra Polizisten platziert, die darauf achten, dass Autofahrer den
Radfahrern so viel Platz einräumen wie einem Pkw.
Radstreifen auf der Straße schrecken ab
Diese Maßnahmen klingen aus Sicht der Radfahrerinnen und Radfahrer sehr
fortschrittlich. Aber sie sind erst ein Anfang und vor allem meist noch eine
Ausnahme. "London ist alles andere als ein Fahrradmekka", findet Rachel Aldred.
Sie plädiert für einen integrativen Ansatz: Das ist eine Radinfrastruktur, die selbst
den Menschen sicher erscheint, die zurzeit nicht Rad fahren. So entstehe ein
Radwegenetz und ein Verkehrssystem, das für alle funktioniere. Das ist
entscheidend, denn das Ziel ist ja, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen – und
da schrecken zum Beispiel Radstreifen auf der Straße rechts neben den Autos
potenzielle Radnutzer eher ab.
Auch in Deutschland vertreten inzwischen immer mehr Fahrradverbände und
Radaktivisten diesen Standpunkt. Der Berliner Volksentscheid Fahrrad, andere
ähnliche Initiativen und selbst der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)
fordern für die Städte sogenannte protected bike lanes. Radstreifen also, die
beispielsweise mithilfe von Plastikpömpeln oder Blumenkübeln vom Autoverkehr
getrennt werden. Auf diesen Wegen fühlen sich Radfahrer jeden Alters sicher.
Infobox:
Lange Zeit vertrat insbesondere der ADFC die Haltung, dass es für Radfahrer am
sichersten sei, wenn sie sich mit Autofahrern eine Fahrspur teilen. So würden sie gut
gesehen und Zahl der Abbiegeunfälle sinke. Allerdings zeigen Umfragen seit Jahren,
dass sich viele Radfahrer im Verkehr nicht sicher fühlen – 47 Prozent in einer
Befragung vom Sommer 2017. Für Unsicherheit sorgen demnach vor allem zu viel
Verkehr (71 Prozent) und rücksichtslose Autofahrerinnen und -fahrer (65 Prozent).
Wer also mehr Menschen zum Umsteigen aufs Rad bewegen will, muss die
Sicherheit von Radfahrern im Alltagsverkehr steigern. Wie, ist der Mehrheit auch
klar: 70 Prozent wünschen sich deutlich getrennte Fahrspuren.
+Statistik -> S8 (Radverkehr in Zahlen)
(Quelle: www.zeit.de/mobilitaet/2018-04/radfahren-stadt-risiken-gefahren-studie)
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Fahr Rad!: Alles über Kauf, Ausrüstung, Fahrtechnik und ReparaturenVon EverandFahr Rad!: Alles über Kauf, Ausrüstung, Fahrtechnik und ReparaturenNoch keine Bewertungen
- Vélomanie: Facetten des Radsports zwischen Mythos und ÖkonomieVon EverandVélomanie: Facetten des Radsports zwischen Mythos und ÖkonomieFrank LeinenNoch keine Bewertungen
- Vortrag 1 FahrradDokument1 SeiteVortrag 1 FahrradJulka ŁepczyńskaNoch keine Bewertungen
- Fahrradzukunft Ausgabe 4 Gelesen HelmstudienDokument5 SeitenFahrradzukunft Ausgabe 4 Gelesen Helmstudienforum_ubxNoch keine Bewertungen
- Mit dem Fahrrad ins Büro: Alles, was Fahrradpendler wissen solltenVon EverandMit dem Fahrrad ins Büro: Alles, was Fahrradpendler wissen solltenNoch keine Bewertungen
- LVB6 AutresDokument24 SeitenLVB6 AutresArthur TigreatNoch keine Bewertungen
- Kopiervorlage E-MobilitätDokument6 SeitenKopiervorlage E-MobilitätberenNoch keine Bewertungen
- DSH-M: M P: Odellprüfung Ündliche Rüfung Fahrradhelmpflicht - Pro Und ContraDokument1 SeiteDSH-M: M P: Odellprüfung Ündliche Rüfung Fahrradhelmpflicht - Pro Und ContraSisiNoch keine Bewertungen
- EPD Verkehr Der ZukunftDokument5 SeitenEPD Verkehr Der ZukunftPál KovácsNoch keine Bewertungen
- C Tests LoesungDokument2 SeitenC Tests LoesungAntonia GloryNoch keine Bewertungen
- RadfahreDokument1 SeiteRadfahreABSNoch keine Bewertungen
- Ältere Verkehrsteilnehmer – Gefährdet oder gefährlich?: Defizite, Kompensationsmechanismen und PräventionsmöglichkeitenVon EverandÄltere Verkehrsteilnehmer – Gefährdet oder gefährlich?: Defizite, Kompensationsmechanismen und PräventionsmöglichkeitenNoch keine Bewertungen
- DSD2 MK WordDokument3 SeitenDSD2 MK WordBerk YılmazNoch keine Bewertungen
- MobilitaetDokument2 SeitenMobilitaetBarbare GorduladzeNoch keine Bewertungen
- Projektvorschlag Zur Verwaltung Der Interessenvertretung Für Verkehrssicherheit (Vorlesung Mit Demonstrationsprogramm Zur Verkehrssicherheit)Dokument6 SeitenProjektvorschlag Zur Verwaltung Der Interessenvertretung Für Verkehrssicherheit (Vorlesung Mit Demonstrationsprogramm Zur Verkehrssicherheit)ScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Mein ClubDokument48 SeitenMein ClubchaparritoNoch keine Bewertungen
- Knigge Für Und Gegenüber VelofahrendenDokument24 SeitenKnigge Für Und Gegenüber VelofahrendenFatih KalkanNoch keine Bewertungen
- 22 MA ZH KZN W6l Nachhaltigkeit FahrzeugeDokument28 Seiten22 MA ZH KZN W6l Nachhaltigkeit Fahrzeugekenneth.borterNoch keine Bewertungen
- Das Sichere FahrradDokument20 SeitenDas Sichere Fahrradgattofix2Noch keine Bewertungen
- TextDokument1 SeiteTextkaren sanchezNoch keine Bewertungen
- Elektrisch + Autonom: Verstehen ohne Diplom: Die 40 wichtigsten Fragen und Antworten zum E-Auto und autonomen FahrenVon EverandElektrisch + Autonom: Verstehen ohne Diplom: Die 40 wichtigsten Fragen und Antworten zum E-Auto und autonomen FahrenNoch keine Bewertungen
- B2-C1 Modellsatz Nr. 2, HV HoertexteDokument6 SeitenB2-C1 Modellsatz Nr. 2, HV HoertexterdmNoch keine Bewertungen
- Car Sharing PresentationDokument10 SeitenCar Sharing PresentationCésar OrbeNoch keine Bewertungen
- E-Bike-Tuning – Alle Fakten und Infos: Pedelec – E-Bike – Rechtslage – Hardware – SoftwareVon EverandE-Bike-Tuning – Alle Fakten und Infos: Pedelec – E-Bike – Rechtslage – Hardware – SoftwareNoch keine Bewertungen
- B2 Präsentation Umweltfreundliches ReisenDokument3 SeitenB2 Präsentation Umweltfreundliches ReisenlovesnovelsNoch keine Bewertungen
- Sicher Autofahren nach Schlaganfall: Krankheitsbild. Symptome. Risiken. Gesetzeslage. Wahrnehmung. Kommunikation. Präsentation einer Überprüfungsmethode. Anwender - und Expertenedition.Von EverandSicher Autofahren nach Schlaganfall: Krankheitsbild. Symptome. Risiken. Gesetzeslage. Wahrnehmung. Kommunikation. Präsentation einer Überprüfungsmethode. Anwender - und Expertenedition.Noch keine Bewertungen
- Wer langsam macht, kommt eher an: Verkehr abrüsten - Mobilität gewinnenVon EverandWer langsam macht, kommt eher an: Verkehr abrüsten - Mobilität gewinnenNoch keine Bewertungen
- Diplom KleinDokument166 SeitenDiplom KleinManuel DreesmannNoch keine Bewertungen
- Revolutions: Wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt verändertenVon EverandRevolutions: Wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt verändertenNoch keine Bewertungen
- B2 - Goethe - Verkehrsmittel Im AlltagDokument1 SeiteB2 - Goethe - Verkehrsmittel Im AlltagTrang Jelena100% (13)
- Sportmedizin und Triathlon: Kongressband zum 2. Sportmedizinischen Symposium 2012Von EverandSportmedizin und Triathlon: Kongressband zum 2. Sportmedizinischen Symposium 2012Noch keine Bewertungen
- Das Verkehrs ABC: Überlebensstrategie im Verkehrs Chaos, ein Erfahrungsbericht aus 62 Jahren Fahrpraxis.Von EverandDas Verkehrs ABC: Überlebensstrategie im Verkehrs Chaos, ein Erfahrungsbericht aus 62 Jahren Fahrpraxis.Noch keine Bewertungen
- Ein Fahrlehrer packt richtig aus!: Über die Gefahren im Straßenverkehr und wie wir alle besser werden könnenVon EverandEin Fahrlehrer packt richtig aus!: Über die Gefahren im Straßenverkehr und wie wir alle besser werden könnenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Exercise Argument-1Dokument2 SeitenExercise Argument-1Bright EyesNoch keine Bewertungen
- Tempolimit Auf Der AutobahnDokument2 SeitenTempolimit Auf Der Autobahnmohsen wassim slamaNoch keine Bewertungen
- Deutsch Muster Leseverstehen 2Dokument3 SeitenDeutsch Muster Leseverstehen 2Minh Huyen TruongNoch keine Bewertungen
- Biker Frauen: Die Anziehungskraft Von Frauen Auf Motorräder Und Outlaw-BikersVon EverandBiker Frauen: Die Anziehungskraft Von Frauen Auf Motorräder Und Outlaw-BikersNoch keine Bewertungen
- Intelligente Städte, Intelligente Mobilität: Die Transformation Unserer Lebens- Und ArbeitsweltVon EverandIntelligente Städte, Intelligente Mobilität: Die Transformation Unserer Lebens- Und ArbeitsweltNoch keine Bewertungen
- Bahnhofstest Verkehrsverbund Oberelbe VVO VCDDokument58 SeitenBahnhofstest Verkehrsverbund Oberelbe VVO VCDKathrin_ViergutzNoch keine Bewertungen
- HV Text Der Weg Zur Arbeit Deutsch To Go IPDokument1 SeiteHV Text Der Weg Zur Arbeit Deutsch To Go IPabel magnaniNoch keine Bewertungen
- Vollbremsung: Warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiterkommenVon EverandVollbremsung: Warum das Auto keine Zukunft hat und wir trotzdem weiterkommenNoch keine Bewertungen
- Mobil sein in der Zukunft: Keine Emissionen, weniger Unfälle, weniger Besitz, mehr digitale VernetzungVon EverandMobil sein in der Zukunft: Keine Emissionen, weniger Unfälle, weniger Besitz, mehr digitale VernetzungNoch keine Bewertungen
- Motorrad Fahren Aber SicherDokument16 SeitenMotorrad Fahren Aber Sicher4lexxNoch keine Bewertungen
- Text Der PräsentationDokument3 SeitenText Der PräsentationMehrab RakhtarNoch keine Bewertungen
- MitfahrenDokument1 SeiteMitfahrendi vovdziaNoch keine Bewertungen
- Autofreie InnenstadtDokument1 SeiteAutofreie InnenstadtThinh Nguyen100% (1)
- Alter Beim FahrenDokument1 SeiteAlter Beim FahrenOlga DawidenkoNoch keine Bewertungen
- Estado Del ArteDokument33 SeitenEstado Del ArteYajaira PesantesNoch keine Bewertungen
- Kommt Zeit, kommt Rad: Kleine Geschichten und interessante Fakten zur Entwicklung des FahrradverkehrsVon EverandKommt Zeit, kommt Rad: Kleine Geschichten und interessante Fakten zur Entwicklung des FahrradverkehrsNoch keine Bewertungen
- Schmidt, Michael-BachelorarbeitDokument60 SeitenSchmidt, Michael-BachelorarbeitdiekettenreisserNoch keine Bewertungen
- 4.umweltfreundliche VerkehrsmittelDokument2 Seiten4.umweltfreundliche Verkehrsmittelmarija67% (3)
- Potenziale der Verkehrsverlagerung vom MIV zum ÖPNV: Beispielhafte Analyse von Park-and-Ride-Anlagen und Mobilitätsverhalten von Pendlern im Raum JenaVon EverandPotenziale der Verkehrsverlagerung vom MIV zum ÖPNV: Beispielhafte Analyse von Park-and-Ride-Anlagen und Mobilitätsverhalten von Pendlern im Raum JenaNoch keine Bewertungen
- Zukünftige Kraftstoffe: Energiewende des Transports als ein weltweites KlimazielVon EverandZukünftige Kraftstoffe: Energiewende des Transports als ein weltweites KlimazielWolfgang MausNoch keine Bewertungen
- Richtig sitzen - locker Rad fahren: Ergonomie am FahrradVon EverandRichtig sitzen - locker Rad fahren: Ergonomie am FahrradNoch keine Bewertungen
- Das E-Bike: Technik, Modelle, Praxis für Pedelecs und ElektrofahrräderVon EverandDas E-Bike: Technik, Modelle, Praxis für Pedelecs und ElektrofahrräderNoch keine Bewertungen
- ShanghaiDokument3 SeitenShanghaiEndri HotajNoch keine Bewertungen
- ApnoetauchenDokument2 SeitenApnoetauchenEndri HotajNoch keine Bewertungen
- IslandDokument6 SeitenIslandEndri HotajNoch keine Bewertungen
- Shell Youth Study Summary 2019 deDokument21 SeitenShell Youth Study Summary 2019 deEndri HotajNoch keine Bewertungen