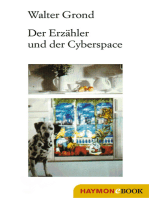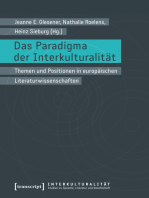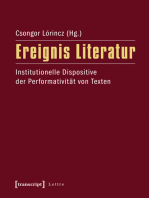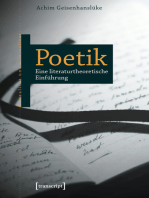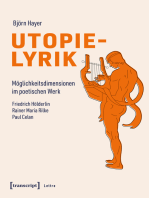Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Romain Racine - Literatur Als Spiegel Der Gesellschaft
Hochgeladen von
Rosalin Carla Dua Wisang rosalincarla.2019Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Romain Racine - Literatur Als Spiegel Der Gesellschaft
Hochgeladen von
Rosalin Carla Dua Wisang rosalincarla.2019Copyright:
Verfügbare Formate
Beitrag/Kurzartikel
Literatur als Spiegel der Gesellschaft
Der ewige Streit der Alten und der Neuen («La Querelle des Anciens et des Modernes»), bei welchem
sich seit Sonnenkönigs Zeiten die Anhänger einer stil- und normbewussten Literatur und jene einer
genieverpflichteten und vorbildfreien Literatur Gefechte liefern, gehört zum Kunstbetrieb der Moderne
wie die Auseinandersetzungen um die Reformen der Rechtschreibung zur Sprachdebatte.
Diese «Querelle» wirkt sich grundsätzlich stimulierend auf das Literatur- und Kunstschaffen aus, denn
jede Partei versucht, das Lesepublikum von ihrem Standpunkt zu überzeugen – entweder im Einklang
oder im Gegensatz zum öffentlichen Diskurs. Je nach Epoche wird die allmächtige «opinion publique»
die eine Strömung als zeitgemäss hochjubeln und die andere als verstaubt abstempeln. In diesem Streit
spiegeln sich also ideologische Machtverhältnisse wider, die der Gesellschaft zu Grunde liegen.
Obwohl naturgemäss jede Epoche in ihrem eigenen Zeithorizont eingeschlossen ist und nur
aussergewöhnlich kritische Distanz es ihr ermöglichen würde, einen Überblick und Ausblick zu
erhalten, hegt sie in der Regel kaum Zweifel daran, welche Haltungen und Vorstellungen ihrer Zeit als
modern oder als veraltet einzustufen sind. Ausserdem scheint es im Rückblick so, dass sich, nach dem
Untergang des Sonnenkönigs – und in Reaktion auf die damalige etikettenreiche Standesgesellschaft –
die «Modernen» allmählich durchgesetzt haben.
Die immer wieder aufkommenden Scharmützel – zum Beispiel, ganz kürzlich, zwischen Felix Philipp
Ingold und Martin R. Dean in der NZZ – sind sicher auch in diesem Zusammenhang zu bewerten,
obgleich wir es hier nicht mehr mit Racine und La Fontaine («les Anciens») oder Perrault und
Fontenelle («les Modernes») zu tun haben. Nach Ingold rührt die Stillosigkeit in der zeitgenössischen
Literatur daher, dass die Literatursprache sich immer mehr der Alltagssprache annähert, mit der Folge,
dass Literatur ihren Kunstcharakter, ihre eigene Sprache verliert. Dahingegen befindet Dean, dass eine
solche äussere Beurteilung von Stil veraltet sei, da sie eine wertende Norm setzt, die Kunstsprache von
Alltagssprache unterscheidet. Ihm zufolge gibt es «eine Literatursprache» gar nicht, sondern Schreiben
wird zur Literatur, wenn sich in unserem «Innenraum» eine eigene Sprache herausbildet.
Alltagssprache verwandle sich so in Kunst – und diese persönlichen Schreiberfahrungen werden heute
auch in (den) Schulen vermittelt. Was für den einen unreflektierte Plauderlyrik ist, bedeutet für den
anderen gute, wahre Literatur. Dichtung ist nicht Kunst und Stil, die der Leser durchaus auch objektiv
beurteilen könnte, sondern persönliche Sprache, die Dichtung als Wahrheit festschreibt.
Aber stellen wir uns zum Abschluss wieder in den historischen Ablauf, auch wenn dies schwerfällt.
Wenn wir unsere vom kulturellen Relativismus beherrschte Gegenwart betrachten, stellen wir fest,
dass die literarischen Normen seit mehreren Jahrzehnten dekonstruiert sind und einem Raum Platz
gemacht haben, wo die Normverneinung zur unausgesprochenen – und dadurch unanfechtbaren –
Norm geworden ist. Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass von Zeit zu Zeit Stimmen laut werden, die
versuchen, unter humanistischen Vorzeichen von diesem neonormativen Diskurs, der inkognito
daherkommt, abzuweichen und gewisse allgemein erkennbare und diskutierbare Kriterien als
Orientierungshilfen für den Kunst- und Literaturbetrieb in unserer Gesellschaft aufzustellen. «La
Querelle des Anciens et des Modernes» ist also aktueller denn je – und wir dürfen nicht vergessen,
dass noch nicht entschieden ist, wer schlussendlich zu den Alten und wer zu den Neuen zu rechnen ist.
Dr. Romain Racine
Université de Fribourg
Lektor für Französisch – Ausbildung «Bilingue plus-Recht» --------Fribourg, den 15. Februar 2017
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Gegenwartsliteratur - Weltliteratur: Historische und theoretische PerspektivenVon EverandGegenwartsliteratur - Weltliteratur: Historische und theoretische PerspektivenGiulia RadaelliNoch keine Bewertungen
- Was ist engagierte Literatur? Jean-Paul Sartres Theorie des literarischen EngagementsVon EverandWas ist engagierte Literatur? Jean-Paul Sartres Theorie des literarischen EngagementsNoch keine Bewertungen
- Warum werden Autoren vergessen?: Mechanismen literarischer Kanonisierung am Beispiel von Paul Heyse und Wilhelm RaabeVon EverandWarum werden Autoren vergessen?: Mechanismen literarischer Kanonisierung am Beispiel von Paul Heyse und Wilhelm RaabeNoch keine Bewertungen
- Poesie und Reflexion zwischen 1755 und 1848: Kulturwissenschaftliche SeitensprüngeVon EverandPoesie und Reflexion zwischen 1755 und 1848: Kulturwissenschaftliche SeitensprüngeNoch keine Bewertungen
- Jakobson 83 95Dokument8 SeitenJakobson 83 95katema9Noch keine Bewertungen
- Wortreiche Bilder: Zum Verhältnis von Text und Bild in der zeitgenössischen KunstVon EverandWortreiche Bilder: Zum Verhältnis von Text und Bild in der zeitgenössischen KunstNoch keine Bewertungen
- Jauss Literaturgeschichte Als Provokation Der LiteraturwissenschaftDokument2 SeitenJauss Literaturgeschichte Als Provokation Der Literaturwissenschaftvalentinabortolotto47Noch keine Bewertungen
- 02 Kanon GattungDokument5 Seiten02 Kanon GattungUddipan MondalNoch keine Bewertungen
- Urteilen und Werten: Interdisziplinäre Perspektiven auf narrative AxiologienVon EverandUrteilen und Werten: Interdisziplinäre Perspektiven auf narrative AxiologienNoch keine Bewertungen
- Literaturkritik heute: Tendenzen – Traditionen – VermittlungVon EverandLiteraturkritik heute: Tendenzen – Traditionen – VermittlungNoch keine Bewertungen
- Schrift und Herrschaft: Facetten einer komplizierten BeziehungVon EverandSchrift und Herrschaft: Facetten einer komplizierten BeziehungInes SoldwischNoch keine Bewertungen
- Ruttkowski - Gattungs Poetik Im LiteraturunterrichtDokument15 SeitenRuttkowski - Gattungs Poetik Im LiteraturunterrichtBorisNoch keine Bewertungen
- Text Als Bild Das "Bild" Der Lorelei - Heinrich Heine vs. Nina HagenDokument8 SeitenText Als Bild Das "Bild" Der Lorelei - Heinrich Heine vs. Nina HagenSnežana Mocović100% (1)
- Das Paradigma der Interkulturalität: Themen und Positionen in europäischen LiteraturwissenschaftenVon EverandDas Paradigma der Interkulturalität: Themen und Positionen in europäischen LiteraturwissenschaftenJeanne E. GlesenerNoch keine Bewertungen
- Textprofile stilistisch: Beiträge zur literarischen EvolutionVon EverandTextprofile stilistisch: Beiträge zur literarischen EvolutionUlrich BreuerNoch keine Bewertungen
- Allerhand Übergänge: Interkulturelle Analysen der regionalen Literatur in Böhmen und Mähren sowie der deutschen Literatur in Prag (1890-1918)Von EverandAllerhand Übergänge: Interkulturelle Analysen der regionalen Literatur in Böhmen und Mähren sowie der deutschen Literatur in Prag (1890-1918)Noch keine Bewertungen
- Zur Ästhetik der Provokation: Kritik und Literatur nach Hugo BallVon EverandZur Ästhetik der Provokation: Kritik und Literatur nach Hugo BallNoch keine Bewertungen
- Neue Perspektiven einer kulturwissenschaftlich orientierten LiteraturdidaktikVon EverandNeue Perspektiven einer kulturwissenschaftlich orientierten LiteraturdidaktikSigrid ThielkingNoch keine Bewertungen
- Raum und Bewegung in der Literatur: Die Literaturwissenschaften und der Spatial TurnVon EverandRaum und Bewegung in der Literatur: Die Literaturwissenschaften und der Spatial TurnWolfgang HalletNoch keine Bewertungen
- Der Akt Des LesensDokument1 SeiteDer Akt Des Lesensfernando_ninaNoch keine Bewertungen
- "Die Zunge kann man nicht überschminken ...": Der Schriftsteller Helmut Qualtinger und seine Texte 1945-1965Von Everand"Die Zunge kann man nicht überschminken ...": Der Schriftsteller Helmut Qualtinger und seine Texte 1945-1965Noch keine Bewertungen
- Ästhetische Transformationen der Gesellschaft: Von Hiob zu Patti SmithVon EverandÄsthetische Transformationen der Gesellschaft: Von Hiob zu Patti SmithNoch keine Bewertungen
- Skulpturale Texte: Literarische Texte zwischen Bildender Kunst und Erzählung am Beispiel von Jonathan S. Foers "Tree of Codes" und Mark Z. Danielewskis "Only Revolutions"Von EverandSkulpturale Texte: Literarische Texte zwischen Bildender Kunst und Erzählung am Beispiel von Jonathan S. Foers "Tree of Codes" und Mark Z. Danielewskis "Only Revolutions"Noch keine Bewertungen
- TB Kap1 001Dokument8 SeitenTB Kap1 001Martin LindnerNoch keine Bewertungen
- InterkulturalitätDokument6 SeitenInterkulturalitätMirjana ĐurićNoch keine Bewertungen
- Machen – Erhalten – Verwalten: Aspekte einer performativen LiteraturgeschichteVon EverandMachen – Erhalten – Verwalten: Aspekte einer performativen LiteraturgeschichteNoch keine Bewertungen
- Ausweitung der Kunstzone: Interart Studies - Neue Perspektiven der KunstwissenschaftenVon EverandAusweitung der Kunstzone: Interart Studies - Neue Perspektiven der KunstwissenschaftenNoch keine Bewertungen
- Ereignis Literatur: Institutionelle Dispositive der Performativität von TextenVon EverandEreignis Literatur: Institutionelle Dispositive der Performativität von TextenNoch keine Bewertungen
- Naturalismus 10 Thesen C2abdurchc2bbDokument1 SeiteNaturalismus 10 Thesen C2abdurchc2bbDanielaLuchianciucNoch keine Bewertungen
- BIERKÄMPFE, BAROCKENGEL UND ANDERE BAVARESKEN: Kein Twitter, kein Facebook • Von Menschen, Büchern und Bildern • Band 3Von EverandBIERKÄMPFE, BAROCKENGEL UND ANDERE BAVARESKEN: Kein Twitter, kein Facebook • Von Menschen, Büchern und Bildern • Band 3Noch keine Bewertungen
- Literatur - Gender - Konfession: Katholische Schriftstellerinnen I: ForschungsperspektivenVon EverandLiteratur - Gender - Konfession: Katholische Schriftstellerinnen I: ForschungsperspektivenNoch keine Bewertungen
- Übersetzungslandschaften: Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und MitteleuropaVon EverandÜbersetzungslandschaften: Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und MitteleuropaSchamma SchahadatNoch keine Bewertungen
- Essen, töten, heilen: Praktiken literaturkritischen Schreibens im 18. JahrhundertVon EverandEssen, töten, heilen: Praktiken literaturkritischen Schreibens im 18. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Ästhetik des Anderen: Minoritäre Perspektiven in Literatur, Theater und (neuen) MedienVon EverandÄsthetik des Anderen: Minoritäre Perspektiven in Literatur, Theater und (neuen) MedienAmelie BendheimNoch keine Bewertungen
- Im Zeichen des Unverfügbaren: Literarische Selbst- und Fremdbilder im 20. und 21. JahrhundertVon EverandIm Zeichen des Unverfügbaren: Literarische Selbst- und Fremdbilder im 20. und 21. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Weltliteratur und Welttheater: Ästhetischer Humanismus in der kulturellen GlobalisierungVon EverandWeltliteratur und Welttheater: Ästhetischer Humanismus in der kulturellen GlobalisierungNoch keine Bewertungen
- Gender im Gedicht: Zur Diskursreaktivität homoerotischer LyrikVon EverandGender im Gedicht: Zur Diskursreaktivität homoerotischer LyrikNoch keine Bewertungen
- Wie postdigital schreiben?: Neue Verfahren der GegenwartsliteraturVon EverandWie postdigital schreiben?: Neue Verfahren der GegenwartsliteraturHanna HamelNoch keine Bewertungen
- Schriftlichkeit: Aktivität, Agentialität und Aktanten der SchriftVon EverandSchriftlichkeit: Aktivität, Agentialität und Aktanten der SchriftMartin BartelmusNoch keine Bewertungen
- Mehrdeutigkeit als literarisches Thema: Strategien und Funktionen von der Romantik bis zur GegenwartVon EverandMehrdeutigkeit als literarisches Thema: Strategien und Funktionen von der Romantik bis zur GegenwartStefan DescherNoch keine Bewertungen
- Schweizer Literaturgeschichte: Die deutschsprachige Literatur im 20. JahrhundertVon EverandSchweizer Literaturgeschichte: Die deutschsprachige Literatur im 20. JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Utopielyrik: Möglichkeitsdimensionen im poetischen Werk. Friedrich Hölderlin - Rainer Maria Rilke - Paul CelanVon EverandUtopielyrik: Möglichkeitsdimensionen im poetischen Werk. Friedrich Hölderlin - Rainer Maria Rilke - Paul CelanNoch keine Bewertungen
- "Lauf los, Buch! Mal sehen, was die Welt aus dir macht!": WerkgesprächeVon Everand"Lauf los, Buch! Mal sehen, was die Welt aus dir macht!": WerkgesprächeNoch keine Bewertungen
- Die Lux-Lesebogen und Karlheinz Dobsky: Zur Wissens-Produktion für die Nachkriegs-JugendVon EverandDie Lux-Lesebogen und Karlheinz Dobsky: Zur Wissens-Produktion für die Nachkriegs-JugendNoch keine Bewertungen
- Beantwortung Der Frage: Was Ist Postmodern?: Jean-François LyotardDokument11 SeitenBeantwortung Der Frage: Was Ist Postmodern?: Jean-François LyotardERIC MONSIEURNoch keine Bewertungen
- Stillstand. Entrückte Perspektive: Zur Praxis literarischer EntschleunigungVon EverandStillstand. Entrückte Perspektive: Zur Praxis literarischer EntschleunigungNoch keine Bewertungen
- PragmatikDokument4 SeitenPragmatikRosalin Carla Dua Wisang rosalincarla.2019Noch keine Bewertungen
- Die Literaturepoche Empfindsamkeit - Kelompok PPT SuaraDokument20 SeitenDie Literaturepoche Empfindsamkeit - Kelompok PPT SuaraRosalin Carla Dua Wisang rosalincarla.2019Noch keine Bewertungen
- Madura Tradtioneler TrachtDokument9 SeitenMadura Tradtioneler TrachtRosalin Carla Dua Wisang rosalincarla.2019Noch keine Bewertungen
- ReisenDokument8 SeitenReisenRosalin Carla Dua Wisang rosalincarla.2019Noch keine Bewertungen
- Nomen Verb VerbindungenDokument24 SeitenNomen Verb VerbindungenShirayuki TanakaNoch keine Bewertungen
- German A2Dokument22 SeitenGerman A2NataliaNataliaNoch keine Bewertungen
- Bahasa JermanDokument11 SeitenBahasa JermanTumpak ManurungNoch keine Bewertungen
- 5014 b00 020101 - BibDokument8 Seiten5014 b00 020101 - BibSvetlana GrechkinaNoch keine Bewertungen
- Deutsch Perfekt 2024-05Dokument70 SeitenDeutsch Perfekt 2024-05Dmitri100% (1)
- 2012 Die Valenz in Der Zweisprachigen L PDFDokument10 Seiten2012 Die Valenz in Der Zweisprachigen L PDFMilenaNoch keine Bewertungen
- Din en 1294 2000-07Dokument5 SeitenDin en 1294 2000-07Ahmed AlzubaidiNoch keine Bewertungen
- SUBSTANTIVULDokument10 SeitenSUBSTANTIVULLast SummerNoch keine Bewertungen
- Vorbereitungsbuch Für Den TestAS Kerntest - Beziehungen Erschließen Und Zahlenreihen FortsetzenDokument126 SeitenVorbereitungsbuch Für Den TestAS Kerntest - Beziehungen Erschließen Und Zahlenreihen FortsetzenThảo Trần ThịNoch keine Bewertungen
- Partizip II Als Adjektiv: GrammatikDokument30 SeitenPartizip II Als Adjektiv: GrammatikAndrea GómezNoch keine Bewertungen
- Grammatik Und Fachbezug in Sprachtests FR Den HochschulzugangDokument386 SeitenGrammatik Und Fachbezug in Sprachtests FR Den HochschulzugangMelissa PenayeNoch keine Bewertungen
- Modalverben Perfekt Arbeitsblatter 54690Dokument3 SeitenModalverben Perfekt Arbeitsblatter 54690Esteban DavilaNoch keine Bewertungen
- A2 Übungen Neu PDFDokument6 SeitenA2 Übungen Neu PDFana chogovadze100% (1)
- LPE 13 KommunikationDokument9 SeitenLPE 13 KommunikationjuliastmsNoch keine Bewertungen
- Deutsch Als Fremdsprache - Niveau B1Dokument102 SeitenDeutsch Als Fremdsprache - Niveau B1Mirko Mex DimicNoch keine Bewertungen
- MärchlerdeutschDokument9 SeitenMärchlerdeutschLuis DimasNoch keine Bewertungen
- Kabantia InscriptionDokument19 SeitenKabantia InscriptionRodney AstNoch keine Bewertungen