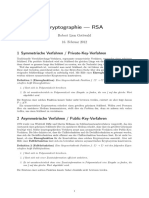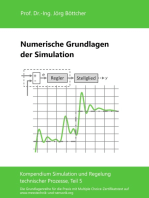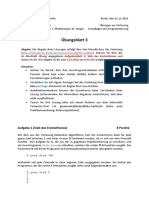Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Pet 1 II
Pet 1 II
Hochgeladen von
Ahmad Bader ObeidatOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Pet 1 II
Pet 1 II
Hochgeladen von
Ahmad Bader ObeidatCopyright:
Verfügbare Formate
Universitt
Duisburg-Essen
Prof. Dr. -Ing. Axel Hunger
SS 2009
Multiple Choice bungen Seite: 20
Vorname, Nachname Matrikelnummer Klausur Typ
A
Aufgabe 5 24 Punkte
Ein Mailbox-System mit zwei Verwaltungstasks (V1, V2) arbeitet im Zeitscheibenverfahren.
Die Zykluszeit des Zeitrades betrgt 200 ms. Jeder Verwaltungstask bentigt ein Rechenzeit
von 5 ms/Zyklus. Die verbleibende Rechenzeit wird gleichmig zwischen den auf das
Mailbox-System zugreifenden Prozessen vergeben. Die Zeit, die jeder einzelne Prozess
erhlt, wird nach jedem Zeitradzyklus neu berechnet (quasi statisch). Die Zeitdauer des
Kontextwechsels zwischen zwei Tasks betrgt 2 ms. (Anmerkung: Diese Angaben gelten
auch fr Aufgabe 4).
5.1 Wie viele Mail Prozesse knnen gleichzeitig auf dem System laufen, wenn jedem Prozess eine
Rechenzeit von 4 ms/Zyklus zugesprochen wird?
A: 5 Prozesse B: 10 Prozesse
C: 16 Prozess D: 23 Prozesse
E: 28 Prozesse F:6 31 Prozesse
G: 50 Prozesse H: Keine der Antworten
5.2 Wie gro ist der Wirkungsgrad des Systems, wenn 26 Mail-Prozesse laufen?
I: 0,14 J: 0,26
K: 0,28 L: 0,5
M: 0,86 N:8 0,72
O: 0,9 P: Keine der Antworten
Universitt
Duisburg-Essen
Prof. Dr. -Ing. Axel Hunger
SS 2009
Multiple Choice bungen Seite: 21
Vorname, Nachname Matrikelnummer Klausur Typ
A
5.3 Ein aktiver Mail-Prozess kann 50 Byte/ms senden oder empfangen. Wie lange dauert die
bertragung einer Botschaft bestehend aus 500 Byte, wenn das nachfolgende Zeitrad
zugrunde gelegt wird? Die Botschaft wird ausschlielich vom Prozess P1 bearbeitet. Der
Prozess bekommt eine Rechenzeit von 4 ms/Zyklus zugewiesen.
P1
t=0
KW
KW
Abbildung 3.1: Zeitrad zur Unteraufgabe 3.3
Q: 4 ms R: 6 ms
S: 10 ms T: 125 ms
U: 206 ms
V:1
0
402 ms
W: 600 ms X: Keine der Antworten
Universitt
Duisburg-Essen
Prof. Dr. -Ing. Axel Hunger
SS 2009
Multiple Choice bungen Seite: 22
Vorname, Nachname Matrikelnummer Klausur Typ
A
Aufgabe 6 18 Punkte
6.1 Im folgenden bedient das Mailbox-System aus Aufgabe 3 drei Prozesse (P1, P2, P3). Ein
Prozess wird beendet, sobald er seine Botschaft vollstndig bearbeitet hat. Die restliche
Rechenzeit dieses Prozesses verfllt fr den Zyklus, in dem der Prozess beendet wird. Sie steht
erst im nchsten Zyklus fr die Verteilung an andere Prozesse zur Verfgung.
P1 sendet eine Botschaft von 500 Byte.
P2 empfngt eine Botschaft von 3500 Byte.
P3 empfngt eine Botschaft von 5000 Byte.
P1
P2
P3
V1 V2
t=0
KW
KW
KW
KW
KW
Abbildung 4.1: Zeitrad zur Unteraufgabe 4.1 und 4.2
Geben Sie an, zu welchem Zeitpunkt der Prozess P1 beendet wird, wenn die Tasks wie in
Abbildung 4.1 auf dem Zeitrad angeordnet sind.
A: 10 ms B:6 17 ms
C: 105 ms D: 154 ms
E: 217 ms F: 268 ms
G: 340 ms H: Keine der Antworten
6.2 Geben Sie an, zu welchen Zeitpunkten die Task P2 beendet wird, wenn die Tasks wie in
Abbildung 4.1 auf dem Zeitrad angeordnet sind.
I: 105 ms J: 154 ms
K:1
2
217 ms L: 268 ms
M: 340 ms N: 402 ms
O: 514 ms P: Keine der Antworten
Universitt
Duisburg-Essen
Prof. Dr. -Ing. Axel Hunger
SS 2009
Multiple Choice bungen Seite: 13
Vorname, Nachname Matrikelnummer Klausur Typ
A
Nach dem Einschalten des Tempomats wird zunchst die zu haltende Geschwindigkeit Vmax
bestimmt. Hierzu wird in einem Prozess P1 die Anzahl der Radimpulse gemessen und in einen
Geschwindigkeitswert Vmax umgewandelt. Jede Geschwindigkeitsermittlung erfolgt anhand
einer konstanten Anzahl von Systemtakten und bentigt jeweils die Rechenzeit t1.
Das Abspeichern der Geschwindigkeit Vmax erfolgt in einem Prozess P2 der die Rechenzeit t2
bentigt. Der Wert Vmax wird in einem shared memory gespeichert auf den alle Prozesse
Zugriff haben.
Der Vergleich der aktuellen Geschwindigkeit V mit dem gespeicherten Wert Vmax erfolgt in
einem Prozess P3 der Rechendauer t3. Zuvor ist jedoch die aktuelle Geschwindigkeit zu
messen. Hierzu wird wieder der Prozess P1 verwendet.
Das erste Ergebnis der Vergleichs der aktuellen Geschwindigkeit V mit dem gespeicherten Wert
Vmax muss sptestens zum Zeitpunkt T nach dem Einschalten des Tempomats vorliegen.
Geben Sie die Echtzeitbedingung hierfr an, unter der Annahme eines multitasking fhigen
Einprozessor-Systems.
2.4 Welche der nachfolgenden Echtzeitbedingungen ist richtig
V: T 2 t1+t2+t3 W:5 T 2 t1+t2+t3 X: T = 2 t1+t2+t3
Y: T max {t1, t2, t3} Z: Keine der Lsungen
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ms ms ms ms t T T T T T
KW A A A A G
I I
ms ms ms T T T T T
A A A A R
I
I
I
I
Das könnte Ihnen auch gefallen
- ETHZ SRT Posten LösungenDokument21 SeitenETHZ SRT Posten LösungenLiridon1804Noch keine Bewertungen
- BetriebssystemeTheorie-StefanEbener Part4 NeuDokument70 SeitenBetriebssystemeTheorie-StefanEbener Part4 NeuMartin van BonnNoch keine Bewertungen
- Repetitionsdossier7 Wieweit WieschnellDokument12 SeitenRepetitionsdossier7 Wieweit Wieschnellnorma_fuentes_45Noch keine Bewertungen
- BS - Probeklausur - 2016Dokument7 SeitenBS - Probeklausur - 2016danik2002zNoch keine Bewertungen
- Automatisierungstechnik SkriptDokument92 SeitenAutomatisierungstechnik Skriptorinoco963Noch keine Bewertungen
- Algorithmen Und Datenstrukturen in Der Bioinformatik Siebentes Ubungsblatt WS 10/11Dokument3 SeitenAlgorithmen Und Datenstrukturen in Der Bioinformatik Siebentes Ubungsblatt WS 10/11Dethleff90Noch keine Bewertungen
- ET2 SS17 1. Versuch PDFDokument5 SeitenET2 SS17 1. Versuch PDFAnto NellaNoch keine Bewertungen
- Prüfung Grundlagen Der Regelungstechnik WS 08/09: Name, Vorname: MatrikelnummerDokument16 SeitenPrüfung Grundlagen Der Regelungstechnik WS 08/09: Name, Vorname: MatrikelnummerSSdSSNoch keine Bewertungen
- VO Mündliche FragenDokument5 SeitenVO Mündliche FragenHrvojeNoch keine Bewertungen
- MC AufgabenDokument13 SeitenMC AufgabenleonardNoch keine Bewertungen
- BS - Probeklausur - 2018Dokument6 SeitenBS - Probeklausur - 2018danik2002zNoch keine Bewertungen
- Blatt02 ws1920 AngabeDokument7 SeitenBlatt02 ws1920 AngabeallaNoch keine Bewertungen
- Physik Klausur Aus WS 2010/11Dokument9 SeitenPhysik Klausur Aus WS 2010/11LiK3_a_RoCkStArNoch keine Bewertungen
- Laplace-Transformation: Kompendium Simulation und Regelung technischer Prozesse, Teil 4Von EverandLaplace-Transformation: Kompendium Simulation und Regelung technischer Prozesse, Teil 4Noch keine Bewertungen
- Übung 2Dokument2 SeitenÜbung 2ScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- KV Testaufgaben Klausur k02.916972 2Dokument8 SeitenKV Testaufgaben Klausur k02.916972 2cftczehra20Noch keine Bewertungen
- Dsa U 6Dokument3 SeitenDsa U 6KoyalNoch keine Bewertungen
- PRT Skript WS 06 07 Kap 4Dokument15 SeitenPRT Skript WS 06 07 Kap 4Simon G CalloNoch keine Bewertungen
- Aufgaben BeschlDokument8 SeitenAufgaben BeschlMahdi salehiNoch keine Bewertungen
- Uebung 01Dokument2 SeitenUebung 01elmalimusa3Noch keine Bewertungen
- Time Period Library FürDokument31 SeitenTime Period Library FürJani GiannoudisNoch keine Bewertungen
- KryptographieDokument4 SeitenKryptographieMNoch keine Bewertungen
- Optimierungsmodelle ZF Wichtig Kapitel 3 Auflage 2020 07 14Dokument20 SeitenOptimierungsmodelle ZF Wichtig Kapitel 3 Auflage 2020 07 14Hans GuckingerNoch keine Bewertungen
- Zusammenstellung Von Cie-PrüfungsformelnDokument99 SeitenZusammenstellung Von Cie-PrüfungsformelnScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Exercise Details (Dragged)Dokument3 SeitenExercise Details (Dragged)fnewiufnoiewNoch keine Bewertungen
- LAT I UE3 MitschriftDokument22 SeitenLAT I UE3 MitschriftduccNoch keine Bewertungen
- Bit SortDokument6 SeitenBit SortSiggix64Noch keine Bewertungen
- Skript (Komplett)Dokument139 SeitenSkript (Komplett)Vu Thanh Hai PhamNoch keine Bewertungen
- Lineare Basisübertragungsglieder: Kompendium Simulation und Regelung technischer Prozesse, Teil 8Von EverandLineare Basisübertragungsglieder: Kompendium Simulation und Regelung technischer Prozesse, Teil 8Noch keine Bewertungen
- KL23 PT1 HTL Amt Ab H2 AuDokument24 SeitenKL23 PT1 HTL Amt Ab H2 AuJonas AssmayrNoch keine Bewertungen
- Hts1u C UebungDokument3 SeitenHts1u C Uebungaim9sidewinder7356100% (2)
- MTD 2 KlausurenDokument96 SeitenMTD 2 Klausurensahab12322Noch keine Bewertungen
- PRT Skript WS 06 07 Kap 1 Kap 2Dokument35 SeitenPRT Skript WS 06 07 Kap 1 Kap 2earl-e-birdNoch keine Bewertungen
- VL 2 SchedulingDokument46 SeitenVL 2 Schedulingsergio ospinaNoch keine Bewertungen
- Hausarbeit ATFDokument7 SeitenHausarbeit ATFmalteunland98Noch keine Bewertungen
- KL22 PT3 BBB Amt Ab P0 AuDokument19 SeitenKL22 PT3 BBB Amt Ab P0 AuPeter KuzadroNoch keine Bewertungen
- Loesung 3Dokument6 SeitenLoesung 3Simeon ValchevNoch keine Bewertungen
- EiP Uebung02Dokument5 SeitenEiP Uebung02Albertus HolbeinNoch keine Bewertungen
- A 06Dokument4 SeitenA 06Anonymous HQqVa0QvU5Noch keine Bewertungen
- Capture D'écran . 2022-03-15 À 09.28.07Dokument53 SeitenCapture D'écran . 2022-03-15 À 09.28.07Joyce NdamzoNoch keine Bewertungen
- Kurs 1802 SS2023 EA3Dokument3 SeitenKurs 1802 SS2023 EA3KarlFranz77Noch keine Bewertungen
- Uebung 05Dokument2 SeitenUebung 05Justus MulthaupNoch keine Bewertungen
- Littlefield SimulationDokument3 SeitenLittlefield SimulationScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Coma2 ss12 3Dokument1 SeiteComa2 ss12 3Dethleff90100% (1)
- Abiturpruefung Wahlteil 2004 Analysis I 2 Mit Loesungen Baden-Wuerttemberg 01 PDFDokument4 SeitenAbiturpruefung Wahlteil 2004 Analysis I 2 Mit Loesungen Baden-Wuerttemberg 01 PDFa99carlitos100% (1)
- Numerische Grundlagen der Simulation: Kompendium Simulation und Regelung technischer Prozesse, Teil 5Von EverandNumerische Grundlagen der Simulation: Kompendium Simulation und Regelung technischer Prozesse, Teil 5Noch keine Bewertungen
- Aufgabensammlung Inf-Prog1Dokument18 SeitenAufgabensammlung Inf-Prog1aphirite.percyNoch keine Bewertungen
- Uebung 2 Aufgabe Et2Dokument4 SeitenUebung 2 Aufgabe Et2Ufuk SummerNoch keine Bewertungen
- Klausur GPR SS21Dokument5 SeitenKlausur GPR SS21Dilay VuralNoch keine Bewertungen
- Netzwerkgeschwindigkeit Messen Mit PCATTCPDokument9 SeitenNetzwerkgeschwindigkeit Messen Mit PCATTCPMark LeetNoch keine Bewertungen
- Internetworking 2016 Woche 5Dokument59 SeitenInternetworking 2016 Woche 5pass.thyme2325Noch keine Bewertungen
- WinCC OA Redundante Systeme DE PDFDokument63 SeitenWinCC OA Redundante Systeme DE PDFInvisible-KidNoch keine Bewertungen
- EFEM Kapitel 3-BegleitmaterialDokument18 SeitenEFEM Kapitel 3-BegleitmaterialJonny SchnapsglasNoch keine Bewertungen
- GDP UE 3Dokument4 SeitenGDP UE 3Аноним АнониновичNoch keine Bewertungen
- AM RT2 So2222 (Name) (Vorname) Teil 2Dokument10 SeitenAM RT2 So2222 (Name) (Vorname) Teil 2Boris MakongNoch keine Bewertungen
- Trocknungskanal - AuswertungDokument11 SeitenTrocknungskanal - AuswertungSchandy2903Noch keine Bewertungen
- Thomson THG 571 Nachtest-Protokoll PDFDokument6 SeitenThomson THG 571 Nachtest-Protokoll PDFsalnasuNoch keine Bewertungen
- Optimaler ReglereinstellungDokument10 SeitenOptimaler Reglereinstellungpetrolhead85Noch keine Bewertungen
- Physik Rs 2019 SDokument8 SeitenPhysik Rs 2019 SDasha SharynskaNoch keine Bewertungen