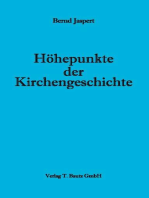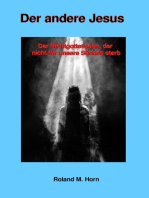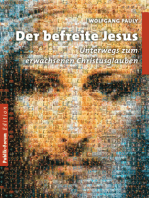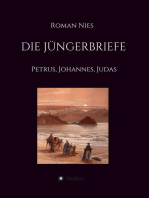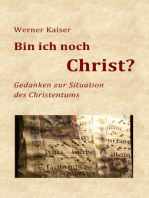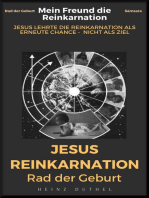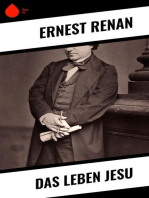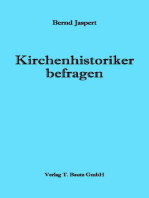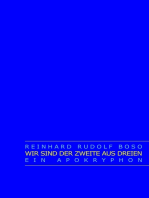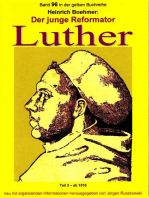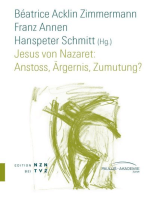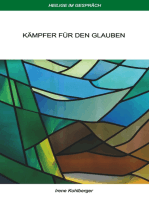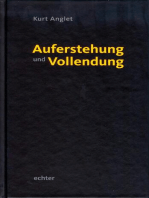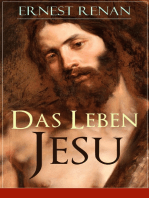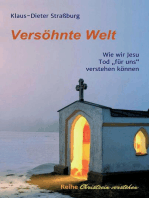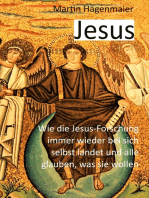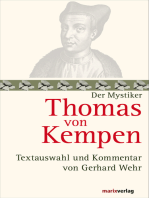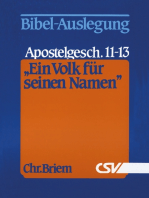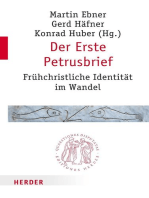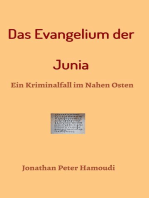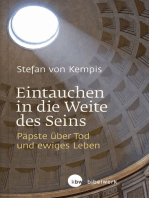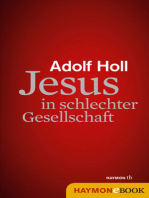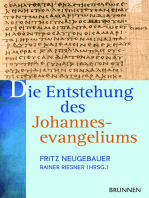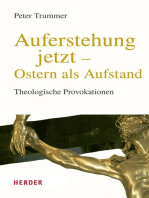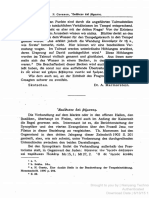Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Der Tod Jesu. Johann Michl
Hochgeladen von
Dolores Montero0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
52 Ansichten11 SeitenCopyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
52 Ansichten11 SeitenDer Tod Jesu. Johann Michl
Hochgeladen von
Dolores MonteroCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 11
5
Der Tod Jesu
Ein Beitrag zur Frage nach Schuld und Verantwortung eines Volkes(l)
von Johann M i c -h 1, Freising
Es ist landläufige Anschauung in christlichen Kreisen, daß die J u d e n
unseren H e r r n u n d Heiland ans Kreuz geschlagen haben. Solche Rede-
weise k a n n ein hohes Alter und ehrwürdige Zeugnisse für sich geltend
machen. Wer die Liturgie der Kirche liebt, wird die Lesungen der zweiten
Nokturn der Karfreitagsmette kennen; es sind Worte des hl. Augustinus
aus der Erklärung zum 63. Psalm: Nori dicant Judaei: N o n o c c i d i m u s
Christum. Etenim propterea eum dederunt iudici
P i l a t o , ut q u a s i ipsi a morte eius viderentur i m m u n e s
(Abschn. 4; ML 36, 762). Etwas später heißt es: S e d i l l e d i x i t i n e u m
s e n t e n t i a m et i u s s i t e u m c r u c i f i g i et q u a s i ipse occidit;
et v o s , o J u d a e i , o c c i d i s t i s . U n d e o c c i d i s t i s ? G l a d i o
l i n g u a e : a c u i s t i s e n i m l i n g u a s v e s t r a s . E t q u a n d o p*e r -
cussistis, nisi quando clamastis: Crucifige, crucifige
(ebd. 763)? Ein weiteres Beispiel aus derselben Mette ist das von Michael
Haydn so ergreifend in Musik gesetzte, in der Karwoche von unseren
Kirchenchören d a und dort z u hörende Responsorium: T e n e b r a e
factae sunt, dum crucifixissent Jesum Judaei .. .
Aber ist diese eingebürgerte Redeweise auch heute noch angebracht?
Wir sind feinfühlig geworden; es ist uns nicht recht, wenn in Bausch u n d
Bogen über die Deutschen geurteilt wird, daß sie das unsägliche Elend des
zweiten Weltkrieges und seiner Folgen über die Menschheit gebracht
hätten, wo es doch nur bestimmte hemmungslose Verbrecher in unserem
Volke waren; oder wenn m a n die in den Konzentrationslagern verübten
Greuel den Deutschen schlechthin vorwirft, wo es doch nur einzelne Men-
schenbestien waren, die sich solches erlaubten, während die meisten im
Volke davon nichts oder k a u m etwas Bestimmtes wußten. Wo es sich u m
Schuld und Verantwortung handelt, sind wir heute kritischer eingestellt,
J) In der in Zürich erscheinenden Zeitschrift „Judaica, Beiträge zum Verständnis des
jüdischen Schicksals in Vergangen ,eit und Gegenwart", 1 (1945), 1-40 erschien von dem bekann-
ten evangelischen Schweizer Theologen K. L. S c h m i d t ein Aufsatz: „Der T o d e s p r o -
zeß d e s M e s s i a s J e s u s . D i e V e r a n t w o r t u n g d e r J u d e n , H e i d e n u n d
C h r i s t e n für d i e K r e u z i g u n g J e s u * C h r i s t i." Nach einer Anzeige in der
- Theol. Literaturzeitung 74 (1949) 250, kommt >Sch. zu dem Ergebnis, daß „als Behörde in
erster Linie der jüdische Hohe Rat und in zweiter Linie der Prokurator" neben mit-
beteiligtem Volk und Soldaten die Verantwortung tragen» Ich hatte meine Untersuchung
bereits als Vortrag in der. Hochschule Weihenstephan, Februar 1949, gehalten, als ich von
diesem Aufsatz erfuhr; leider konnte ich ihn bei der Absperrung, in der die deutsche
Wissenschaft immer noch gegenüber dem Ausland leben muß, trotz vielfacher Versuche
nicht zur Hand bekommen. Doch hoffe ich, daß dies den Wert meiner Ausführungen nicht
beeinträchtigen wird, nachdem ich von den gleichen Quellen ausgehen kann wie Sch., näm-
lich vom Neuen Testament. Siehe auch H. d e L u b a c , J. C h a i n e , L. R i c h a r d ,
J. B o n s i r v e n , I s r a e l e t l a f o i c h r e t i e n n e , Paris 1942, M. S i m o n ,
Verus Israel. E t u d e s sur les r e l a t i o n s entre c h r e t i e n s e t j u i f s
d a n s l ' E m p i r e R o m a i n , Paris 1948.
6
als es vielleicht frühere Zeiten waren; wir verlangen eine individuelle Be-
urteilung, nicht eine kollektive Verurteilung.
Da ist es n u n interessant, aus solcher Einstellung heraus die Frage nach
der Schuld und Verantwortung des jüdischen Volkes am Tode Jesu auf-
zuwerfen: W a s s a g t d a s N e u e T e s t a m e n t , w a s s a g t d i e
älteste K i r c h e darüber? Die Beantwortung der gestellten Frage
wird nicht n u r interessante Einblicke in die Auffassung der ältesten Kirche
geben, sondern auch ein herrliches Bild der Barmherzigkeit Gottes ent-
hüllen; es wäre ja unmöglich, eine solche Frage n u r historisch zu behan-
deln, aber nicht auch theologisch. Die Erkenntnisse aber, die hier ge-
wonnen werden, sind nicht ohne Bedeutung, u m die Frage nach der
möglichen Verantwortung oder auch Schuld eines Volkes zu beantworten.
1. Urchristliche Äußerungen über die Schuld am Tode Jesu
Die früheste erhaltene derartige Äußerung ist die der beiden sogenann-
ten Emmausjünger, Lk 24,20; bereits am dritten Tag nach der Verurteilung
und Kreuzigung Jesu gesprochen, steht sie unter dem frischen Eindruck der
eben erlebten Vorgänge. Diese beiden Juden, die auf Jesus als den Messias
gehofft hatten, redeten von „unseren Hohenpriestern und Führern", die
Jesus zum Tod verurteilt und gekreuzigt hätten. Haben wir auch keine
Gewähr, daß die Worte in jenem Gespräche genau so, wie sie bei Lukas
stehen, gefallen sind, so erweisen sie sich doch in ihrer Art, die Schuldigen
zu nennen, wohl als sehr alt, als ein Zeugnis, wie m a n am Anfang die Er-
eignisse sah. Die Aussage entspricht dem Bild, das die Berichte der Evan-
gelien über den Prozeß Jesu ergeben.
Eine weitere fünf Wochen später von Petrus in der sogenannten Pfingst-
predigt gemachte Äußerung wird mitgeteilt Apg 2,23. Zu den „israelitischen
Männern", die ihm zuhörten, sagte der Apostel: „Diesen (Jesus) habt ihr,
nachdem er (euch) nach dem festgesetzten Plan und Vorauswissen Gottes
ausgeliefert war, durch die Hände von Gottlosen ans Kreuz schlagen u n d
umbringen lassen." Man mag hier etwas von einer Schuld des Volkes
heraushören, doch wird besonders der Frevler gedacht, die an erster Stelle
für den Messiasmord als dessen Ausführer verantwortlich sind.
Nur kurze Zeit später redete nach dem Bericht der Apostelgeschichte
Petrus ähnlich nach der Heilung des Lahmgeborenen zu jenen, die sich bei
der Salomonshalle im Tempel zu Jerusalem u m ihn gesammelt hatten,
Apg 3,13—15: „. . . Gott . . . hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den
ihr ausgeliefert und vor Pilatus abgelehnt habt, als dieser schon ent-
schlossen war, ihn freizugeben. Ihr habt den Heiligen und Gerechten a b -
gelehnt und verlangt, daß euch ein Mörder herausgegeben werde, aber den
Führer zum Leben habt ihr getötet." Hier denkt Petrus besonders daran,
daß das Volk es war, das vor Pilatus die Freigabe des Mörders Barabbas
und die Kreuzigung Jesu verlangte (Mt 27,15 ff. u. Parr.).
Nach dieser Ansprache wurden Petrus u n d Johannes von der Tempel-
behörde verhaftet. Nachdem am andern Morgen beide dem Synedrium
vorgeführt und wegen der Heilung des Lahmgeborenen zur Rede gestellt
7
wurden, hielt Petrus dieser Spitze des jüdischen Volkes offen vor Apg 4,10:
Jesus, „den ihr gekreuzigt habt"; auf das Synedrium traf das in erster
Linie zu.
Nach einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem Hohen Rat und den
Aposteln, als Petrus u n d seine Mitapostel wiederum vor dieses Gericht
geholt wurden, sagte Petrus diesen Männern ins Gesicht Apg 5,30: „Ihr
habt (Jesus) ans Holz gehängt u n d getötet."
Gleich Petrus klagte auch Stephanus das Synedrium an Apg 7,52: „Ver-
räter u n d Mörder (Jesu) seid ihr gewesen."
Dann sprach aber Petrus in Joppe vor dem Heiden Kornelius wieder
ziemlich unbestimmt A p g 10,39: „Ihn haben sie ans Holz gehängt u n d
getötet."
Bezeichnend äußerte sich Paulus in einer seiner frühesten uns über-
lieferten Ansprachen zur Frage, nämlich während der ersten größeren
Mbsionsreise Mitte oder zweite Hälfte der vierziger Jahre zu Antiochia in
Pisidien (mittleres Kleinasen). Z u den in d e r dortigen Synagoge ver-
sammelten Juden u n d Proselyten sagte Paulus Apg 13,27 f: „Denn die
Bewohner von Jerusalem u n d ihre Führer haben diesen (Jesus) nicht er-
kannt . . . Obwohl sie keine Todesschuld a n ihm fanden, haben sie von
Pilatus verlangt, daß e r hingerichtet werde."
Auch für diese Belege aus der Apostelgeschichte gilt, was schon zu der
eingangs angeführten Stelle aus dem Lukasevangelium zu bemerken war:
Wir sind nicht sicher, daß Petrus, Stephanus und Paulus sich genau so
ausgedrückt haben, wie wir es jetzt in der Apostelgeschichte lesen. Aber
die Fassung der Worte erweist sich im Vergleich m i t d e r späteren d e r
Paulusbriefe und bei Johannes als altertümlich und gibt z u m mindesten
die Beurteilung kund, die in sehr früher Zeit geherrscht hat.
Etwa im Jahre 52 schrieb Paulus den Christen in Thessalonike 1 Thess
2,14 f von den „Juden, die den Herrn Jesus getötet haben". Es ist die
früheste Stelle, die schlechthin den Juden den Tod Jesu zuschiebt; immer-
hin hat auch schon Petrus gelegentlich seine jüdische Zuhörerschaft in
Jerusalem allgemein als für d e n Tod des Herrn verantwortlich a n -
gesprochen.
2. Die Schuld am Tode Jesu nach der Darstellung der Evangelien
a)DienächstVerantwortlichen
Hier auf Einzelheiten einzugehen, ist nicht nötig, da sie zu bekannt sind.
Schuldig am Tode Jesu w a r einmal das S y n e d r i u m unter Führung
des damaligen Hohenpriesters Joseph Kaiaphas, das den H e r r n zum T o d .
verurteilte (Mt 26, 57 ff u. Parr.). Das Synedrium aber setzte sich zusam-
m e n a u s den drei Gruppen der „Hohenpriester", meist sadduzäisch ge-
sinnter Priester höherer Ordnung (apx P ). d e r vornehmsten Ge-
t£ £ta
schlechter d e r Stadt Jerusalem, der „Aeltesten" (Tcpeaßuxepot) u n d der
führenden, meist pharisäisch gesinnten „Schriftgelehrten" (*(pct\L\L<xxsio)
W e n n auch nicht alle Mitglieder dieses Kollegiums für den Tod Jesu
gestimmt haben — von Joseph von Arimathäa wird d a s eigens gesagt
(Lk 23,51) u n d von Nikodemus darf es sicher auch gelten —, s o waren
solche Ausnahmen doch n u r ganz wenige u n d fielen keineswegs ins Gewicht.
8
Schuldig am Tode Jesu war dann jene fanatisierte M e n g e , die als
V o l k von Pilatus den Tod Jesu forderte. Diese Elemente, die kein
eigenes Urteil in der Sache hatten, waren für ihre zweifelhafte Rolle
präpariert von den Männern des Hohen Rates, die wußten, was sie mit
einer solchen Volksdemonstration vom Prokurator erreichen wollten. Wir
haben heute gewisse Hemmungen, in diesem Haufen verantwortungsloser
Schreier eine legitime Vertretung des jüdischen Volkes oder auch, nur der
Bewohnerschaft von Jerusalem zu sehen. Jedoch kommt man nicht ganz
darum herum, wenn man vor allem auch noch die damalige mehr kollek-
tive Denkart gegenüber der m e h r individuellen modernen berücksichtigt,
jene häßlichen Rufer tatsächlich für so etwas wie eine Vertretung des
Volkes zu halten. So konnte Petrus mit Recht den Zuhörern im Tempel
ganz allgemein sagen, sie wären am Tode Jesu schuldig, nachdem eben
das „Volk" damals es so verlangt hat. So konnte auch Paulus den Bewoh-
nern von Jerusalem und ihren Führern diese Schuld zuschreiben.
Schuldig am Tode Jesu war dann der römische Prokurator P o n t i u s
P i l a t u s . Der spätere jüdische König Agrippa I. kennzeichnet in einem
bei Philon erhaltenen Brief diesen Beamten als „von Charakter unbeug-
sam und rücksichtslos hart" u n d wirft ihm in seiner Amtsführung vor
„Bestechlichkeit, Gewalttaten, Räubereien, Mißhandlungen, Kränkungen,
fortwährende Hinrichtungen ohne Urteilsspruch, endlose und unerträg-
liche Grausamkeiten" (Leg. ad Gaium 38, 301 f; Phil. VI, L. C o h n - S . R e i -
ter 211). Demgegenüber erscheint das Bild, das die Evangelien von Pilatus
als Richter Jesu entwerfen, geradezu noch freundlich; aber auch es genügt,
die Schuld dieses Prokurators aufzuzeigen. Nimmt m a n freilich die Men-
schen, wie sie nun einmal sind, so mag hier die Frage erlaubt sein: Hätte
man von diesem heidnischen Manne, der als Weltmensch nur auf Er-
langung und Erhaltung von Macht und Ansehen bedacht war, erwarten
dürfen, daß er u m Jesus willen, für ihn also u m eines einfachen, verachte-
ten Juden willen, zum Märtyrer hätte werden sollen? Pilatus hatte es in
der Hand, Jesus zum Tode zu verurteilen oder freizulassen; er hat, genau
gesehen, weder das eine noch das andere getan, jedoch Jesus, wie es
scheint, ohne eigentlichen Schuldspruch, dem Willen des Synedriums und
des versammelten Volkes zur Kreuzigung überlassen, wie alle vier Evan-
gelisten übereinstimmend berichten (Mt 27,26; Mk 15,15; Lk 23,25;
Joh 19,16). So wurde er schuldig am Tode Jesu.
Während nun die synoptischen Evangelien die Männer, die eigentlich
für jene Untat verantwortlich sind, genau angeben und nur von ihnen in
diesem Zusammenhang reden, tut das das vierte Evangelium zwar eben-
falls, aber es spricht auch vereinzelt, wie Paulus gegenüber den Christen
von Thessalonike, schlechthin von den J u d e n . So sind es die Juden, die
Pilatus eingestehen müssen, daß sie Jesus nicht aus eigener Machtbefug-
nis hinrichten lassen können (Joh 18,31); der Zusammenhang zeigt, daß
es sich u m die Synedristen handelt. Sogar der Herr selbst spricht von
seiner Auslieferung a n die J u d e n (Joh 18,36); diese Formulierung im
Munde Jesu muß aber nicht ursprünglich sein, kann vielmehr vom
Evangelisten stammen. Ebenso sind es die Juden, die von Pilatus gefragt
werden, ob sie Barabbas oder Jesus frei bekommen wollten, die dann
rufen, daß er ihnen den Aufrührer und Mörder geben solle (Joh 18, 38-40);
9
nach Ausweis der Parallelberichte bei Matthäus (27,20f) und Markus
(15,11) aber war es der von den Hohenpriestern (und Aeltesten Mt) be-
schwätzte Volkshaufen, der diese Forderung erhob. Wiederum heißen im
weiteren Verlauf der Verhandlung jene, die von Pilatus die Verurteilung
Jesu verlangen, einfach die Juden (so Joh 19, 7. 12. 14). Die Juden sind es
schließlich, die nach dem Verscheiden Jesu die Zerschlagung seiner Glieder
vom Prokurator verlangen (Joh 19,31).
Überhaupt kommt die Bezeichnung Juden anders als in den drei älteren
Evangelien, wo sie nur selten und i n ganz -bestimmten Verbindungen
steht, auffallend häufig bei Johannes vor (etwa siebzigmal gegenüber nur
fünfmal bei Matthäus und Lukas und sechsmal bei Markus). Nun drückt
das Wort hier oft nur aus, daß eine Person oder eine Gruppe von Leuten
dem israelitischen Volke angehörten, eine Verwendung des Namens Jude,
die genau SQ bei dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus begegnet.
Beide, Johannes und Josephus, schrieben ungefähr u m dieselbe Zeit und
sprachen so von jenem Volke in einem nationalen und zeitlichen Abstand,
obwohl sie beide von Haus aus Juden waren (vgl. W. Gutbrod bei
G. Kittel, Theol. Wörterbuch III, Stuttgart 1938, 378 ff). Darüber hinaus
aber hat sich bei Johannes nicht selten ein weiteres Moment der Ent-
fernung in die Bezeichnung eingeschoben: Jude ist jener Israelit, der den
• Herrschaftsanspruch Jesu ablehnt und eben dadurch i n der jetzt zur
neuen christlichen Religion gegensätzlich gewordenen alten jüdischen
Religion verbleibt; also Name für die Israeliten, die Jesus von Nazareth
als den Messias verwerfen. Ein Jude in diesem Sinne zu sein setzt natür-
lich voraus, Jude im völkischen Sinne zu sein, ist aber dann eine religiöse
Kennzeichnung, die aus der Entfernung geprägt ist, die durch die Ent-
wicklung zwischen der Christusgemeinde und der gegenüber Christus
ungläubig gebliebenen Judenschaft entstanden ist.
Die Aussagen des vierten Evangeliums, daß die Juden Jesus getötet
hätten, belasten wie die schon genannte ähnliche Aussage des Paulus mit
der Schuld an diesem Tode nicht das Volk als solches, sondern jene Kreise,
die Jesus ungläubig ablehnten. Ein solcher Sprachgebrauch konnte natür-
lich erst nach einer gewissen Zeit aufkommen, als die Kluft zwischen der
Kirche Christi und zwischen den Juden in diesem religiösen, christus-
gegnerischen Sinne größer und dauernd wurde. Tatsächlich ist die Rede-
weise erst später bezeugt, so im ersten Brief an die Thessaloniker zu An-
fang der fünfziger Jahre, auch sonst in Briefen des Paulus (z. B. 1 Kor
1, 22 f; 2 Kor 11, 24), in der Apostelgeschichte (im Petrusteil höchstens 12, 3,
aber häufig im Paulusteil, auch schon im Paulusstück 9, 22f) und schließ-
lich am Ausgang des ersten Jahrhunderts bei Johannes. Dabei ist es bei
dieser Verwendung des Wortes Jude genau so merkwürdig wie bei jener
im völkischen Sinne, daß es selbst Juden sein können, die so ihre religiös
von ihnen getrennten Volksgenossen bezeichnen; m a n sieht, wie vielseitig
der Name Jude verwendet werden konnte, was bei Bewertung der Aus-
sagen selbstverständlich genau beachtet werden muß. So kommt es
gelegentlich sogar vor, daß in unmittelbarer Nähe nebeneinander von den
J u d e n einmal in diesem religiösen und einmal in jenem völkischen Sinne
geredet wird (so 1 Kor 1, 22f gegenüber 1, 24). Die Bezeichnung Jude aber
bleibt trotz der Bedeutungsentwicklung im religiösen Sinne auch weiterhin
10
ein Ehrenname, wie das gerade eine Schrift des Johannes, die Apokalypse
(2, 9; 3, 9), lehrt. Wenn, wie eingangs gesagt, Augustinus und die Liturgie
und mit ihnen viele christliche Schriften den J u d e n den Tod Jesu vor-
halten, dann nehmen sie Juden in diesem religiösen, nicht im völkischen
Sinne. Es liegt freilich auf der Hand, daß solcher Sprachgebrauch seine
Gefahren hat. Man kann in solchem Sinne von den Juden reden und jene
meinen, die tatsächlich für den Tod Jesu verantwortlich waren; Juden in
diesem religiösen Sinne waren aber auch viele, die an jener Untat keinen
Teil hatten. Vor allem gilt das für die Millionen später Geborener, die so
oft von christlicher Seite jenes von einzelnen ihrer Ahnen begangenen
Verbrechens geziehen wurden, gerade als ob sie selbst dessen kollektiv
schuldig wären (2).
b) D i e e n t f e r n t V e r a n t w o r t l i c h e n
N u n waren es aber auch J u d e n in diesem Sinne des Wortes, die nicht
n u r die Schuld am Tode Jesu auf sich luden, sondern die schon vorher die
erbittertsten Gegner Jesu waren. Bei Johannes heißen sie bereits längst,
ehe es zum Todesleiden Jesu kam, vielfach schlechthin Juden (so wohl
schon 1, 19, sicher 2, 18, 20 und häufig in den Streitreden zwischen Jesus
und seinen Gegnern von Kap. 5 ab). Hier k o m m t hinter der juristischen
Schuld am Tode Jesu, die die zunächst daran Beteiligten auf sich luden,
die moralische Schuld weiterer Kreise ans Licht. Diese vielen Gegner, die
Jesus im Verlaufe seiner öffentlichen Wirksamkeit meist so feindselig
gegenübertraten, wollten im allgemeinen nicht unmittelbar seinen Tod.
Den hatten allerdings schon frühe, vielleicht u m das Paschafest des
zweiten Jahres, die Synedristen beschlossen (vgl. Joh 5,18), ohne freilich
vorerst diesem Ziele näher zu kommen. Aber die juristische Schuld jener,
die den Tod Jesu veranlaßten, hätte vielleicht nie dieses Ausmaß anneh-
m e n u n d diesen Erfolg haben können, wenn nicht dahinter die moralische
Schuld weiterer Kreise gestanden wäre; erst dadurch wurde sozusagen der
Boden für jenes vorbereitet. Diese moralische Schuld aber war der U n -
glaube gegenüber Jesus. Hier muß die Frage nach der Schuld und Ver-
antwortung am Tode Jesu die Ebene nur geschichtlicher Betrachtung ver-
lassen, u m in einer theologischen Schau das hintergründige Geheimnis
dessen, was damals u m Jesus geschah, zu erkennen. Das israelitische Volk
hatte vor Gott die Aufgabe, damit aber auch die Verantwortung, an den
längst verheißenen und erwarteten, nun i n der Person Jesu von Gott
gesandten Messias zu glauben. Diesen Glauben haben auch manche aus
dem Volke aufgebracht, es w a r e n Leute der verschiedenen Schichten und
Stände, während jedoch viele ihn nicht leisteten. Ja, gerade die berufenen
Führer des Volkes, die Priester u n d Schriftgelehrten, die das Volk zum
Glauben an Jesus als den Messias hätten bewegen sollen, hielten es im
ganzen gesehen sogar davon ab (vgl. Mt 23,13).
Im Lichte der göttlichen Heilsordnung erscheint das israelitische Volk
als einzig unter den Völkern der Erde dadurch ausgezeichnet, daß Gott
einen Gnadenbund mit ihm geschlossen hat; es sollte dem Messias die
2) Die Überlieferung in den Evangelien kennt zwar das Wort des „Volkes;! im Prozeß
Jesu: ,;Sein Blut auf uns und unsere Kinder!" (Mt. 27,25), aber nirgends tritt im Neuen
Testament die Auffassung hervor, daß deshalb das ganze Volk oder auch nur die Nach-
kommenschaft jener Rufer am Tode Jesu schuldig gesprochen würden.
11
Wege bahnen und an erster Stelle am kommenden Reiche Gottes teilhaben.
Was immer an göttlicher Huld dieses Volk in der Vergangenheit, vorab
unter Moses, David und den Propheten erfahren hatte, sollte n u r den
Charakter eines Interims, von etwas Ubergangsweisem haben, E r w a r t u n g
von etwas Neuem sein. Jedoch eine seit Jahrhunderten eingeleitete Ent-
wicklung, über die zu sprechen hier zu weit führte, brachte es mit sich,
daß sehr viele und gerade geistig einflußreiche Männer dieses Volkes sich
im vorhandenen religiösem Besitze in einer Weise verfestigten, als ob er
bereits das Endgültige wäre; so kamen sie nicht mehr zum Glauben an
Jesus als den Messias. Sie hatten die Hoffnung auf den kommenden Retter
keineswegs aufgegeben; aber sie hatten sich über ihn ihre eigenen A n -
sichten gebildet und dabei die gläubige Bereitschaft für die Verwirk-
lichung, die Gott ihnen einst schenken wollte, verloren. Menschlich gesehen
braucht eine solche Entwicklung nicht wunderzunehmen; der Fehler lag
zu tiefst djarin, daß man von eigener Einsicht aus, mit vorgefaßten Mei-
nungen die Erscheinung Jesu maß. statt einfach auf sein Wort zu ver-
trauen, das freilich in vielfacher Weise und ganz außerordentlich von
Gott durch Wunderzeichen und Kundgebungen bestätigt wurde. Im" Grunde
war es derselbe Fehler, der zu anderen Zeiten und unter anderen Ver-
hältnissen oft genug begangen wurde: Man überschätzt die eigene Ein-
sicht und vermeint, nicht mehr an das Wort von oben glauben zu können,
wie es die Geistesgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte zur Genüge
kennt.
Nicht wenige Angehörige des jüdischen Volkes, besonders aus seiner
Führerschicht, haben sich in diesem Unglauben gegenüber Jesus verfehlt
und sich so eine moralische Schuld an seinem Tode zugezogen. Aber auch
so entstand keine Kollektivschuld des ganzen Volkes; es ist bezeichnend,
daß von so etwas im Neuen Testament nie gesprochen, solches gar nicht
vorausgesetzt wird (3). Man muß sich auch vor Augen halten, daß, an der
Gesamtzahl der damals lebenden Juden gemessen, wohl nicht allzu viele
hi den paar Jahren der öffentlichen Wirksamkeit Jesu zu einer ernsten
Entscheidung für oder wider ihn aufgerufen waren. Die meisten Juden,
zumal jene aus der Diaspora, mögen in jener Zeit von ihm k a u m viel m e h r
als eine ziemlich unbestimmte Kunde vernommen haben, so aber zu einer
3) Allerdings wird die nationale Katastrophe der Zukunft (gedacht ist offenbar zunächst
<afl den Jüdischen Krieg der Jahre 66 bis 73) mit der Ablehnung Christi verbunden
(Mt 23,37 f; Lk 13,34 f; 19,4d-44; vgl. 23,28-31, auch Mt 27,25), Lk 19,44 sogar als Folge
<oder Strafe dafür erklärt (auch die sonstige bloße Zusammenstellung kann im Sinne einer
Folge verstanden werden, was* die im griechischen Sprachkleid semitische Denkweise nicht
ausdrücklich zu sagen braucht); Strafe aber setzt Schuld voraus. So sehr man nun im
Anschluß an das Neue Testament mit der herkömmlichen christlichen Auslegung in jenem
Unglück, das über das jüdische Volk, näherhin die Juden Palästinas und besonders Judäas
und Jerusalems hereingebrochen ist, ein Strafgericht Gottes für die Verwerfung des
Messias sehen mag, so kann man unmöglich aus einem solchen geschichtlichen Ereignis auf
eine Schuld aller davon Betroffenen vor Gott schließen. Da sicher nicht von einer persön-
lichen Schuld aller gesprochen werden könnte, zumal in den Tagen Jesu viele von ihnen
moch gar nicht lebten oder erst Kinder waren, so müßte die vermutete Schuld aller eine
^Kollektivschuld sein, die alle belastete, gleichgültig ob sie an jener Verwerfung mitschuldig
wären oder nicht. Nun wäre es aber ein anmaßendes Urteil und zugleich eine recht
Ikindische Vorstellung, daß, wenn ein Krieg oder ein ähnliches Unheil als Gottes Straf-
gericht (wann ist es schon als solches mit Sicherheit ohne Offenbarung von oben zu
(deuten?) über ein Volk hereinbricht, alle gefehlt haben müßten, weil alle mehr oder
jminder davon betroffen werden. So darf auch aus der Katastrophe des Jüdischen Krieges
inicht auf eine Kollektivschuld der Juden geschlossen werden, vielmehr unter Führung der
(evangelischen Texte nur darauf, daß manche gesündigt haben.
12
verantwortlichen Entscheidung für oder gegen ihn gar nicht veranlaßt
worden sein (4).
3. Die Möglichkeit der Vergebung für Israel
Menschen müssen zwischen juristischer und moralischer Schuld unter-
scheiden, während vor Gott solches weder notwendig noch berechtigt ist.
Vor ihm steht der Mensch in seiner Schuld, ob er sich dabei nach irdi-
schem Maßstab zur moralischen eine juristische Schuld zugezogen hat oder
nicht; vor dem Ewigen reicht eben Schuld tiefer und weiter als vor Men-
schen. Aber wie er die unerbittliche Gerechtigkeit ist, so ist er zugleich
auch die liebende und vergebende Barmherzigkeit, nachdem der Tod seines
Sohnes am Kreuze Sühne geleistet hat.
In derselben Pfingstpredigt, in der Petrus den Zuhörern vorhielt, daß
sie durch die Hände von Gottlosen Jesus ans Kreuz schlagen u n d u m -
bringen haben lassen, gab e r ihnen auch die trostvolle Verheißung
Apg 2, 38 f: „Tuet Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi, u m Vergebung der SündSri zu erlangen; unid ihr
werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die
Verheißung und euren Kindern und allen, die in der F e r n e sind, so viel
der Herr, unser Gott, herbeiruft."
In der Ansprache nach der Heilung des Lahmgeborenen wußte der
Apostel seine Zuhörer sogar wegen der Tötung Jesu z u entschuldigen,
während er sie im übrigen mit ähnlichen Worten wie in der vorigen Rede
zur Erlangung des Heiles einlud Apg 3,17-20: „Und nun, ihr Brüder,
weiß ich wohl, daß ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, ebenso wie eure
Führer. Gott aber hat das, was e r durch den Mund aller Propheten
vorherverkündigt hat, daß sein Messias leiden müsse, auf diese Weise
in Erfüllung gehen lassen. Tuet nun Buße und bekehret euch, auf daß
eure Sünden getilgt werden, damit die Zeiten der .Erquickung vom An-
gesicht des Herrn kommen, und e r den für euch bestimmten Messias Jesus
sende!" Es war also noch nichts verloren, vielmehr noch alles zu gewinnen,
wenn jene, die den Tod Jesu verschuldet hatten, wenigstens jetzt diese
Sünde büßen und an Jesus als den Messias glauben wollten. Es ist auch
hier wieder zu beachten, daß es u m keine Kollektivschuld des Volkes und
eine etwa ihr entsprechende kollektive Entsühnung geht; vielmehr wird
der einzelne aufgerufen, wie er sich vorher gegen Jesus entschieden und
gesündigt hat, so sich nun für ihn zu entscheiden und im Glauben an ihn
4) Die Frage nach der Verantwortung am Tode Jesu legt es nahe, über die Schuld der
unmittelbar oder entfernter daran Beteiligten hinaus sich dessen zu erinnern, daß die
ganze Menschheit durch die Sünde diesen Tod verschuldet hat (vgl. dazu jetzt
M. S c h m a u s . D a s Verhältnis d e r C h r i s t e n u n d J u d e n i n k a t h o -
l i s c h e r S i c h t , Judaica 5 [1949] 187). Allerdings ward Jesus der „Macht der Finster-
nis" (Lk 22,53) übergeben, trat der Satan, der auf Grund der .Sünden der Menschen „der
Herrscher dieser Welt" (Jon 12,31; 14,30; 16,11) war, gegen ihn an, ihm das Leben zu
rauben, freilich ohne gegen ihn in Wirklichkeit etwas zu vermögen (Jon 14,30), vielmehr
um sogar dadurch selbst die Herrschaft zu verlieren und dem Gerichte zu verfallen (Joh
12,31; 16,11). Jedoch liegt diese allgemeine, moralische, historisch überhaupt nicht mehr
faßbare Schuld am Tode Jesu auf einer ganz anderen Ebene als jene besondere, juristische
oder moralische der geschichtlich für jene Untat Verantwortlichen. Wie das Neue Testa-
ment diese Dinge auseinanderhält, so muß man hier auch unterscheiden, wenn man
Schuld und Verantwortung am Tode Jesu richtig sehen will. Vgl. auch J. D a n i e l o u ,
D i a l o g l i e s , Paris 1948.
13
die Nachlassung seiner persönlichen Sünden zu erhalten. Diese Art, in der
der einzelne für sich das begangene Unrecht sühnen soll, u m Vergebung
zu finden, macht deutlich^ daß es sich um Unrecht einzelner, nicht des
Volkes als solchen handelt. Schuld ist religiös gesehen immer Sünde, sicher
objektiv, vielleicht nicht immer subjektiv, Sünde aber ist eine Angelegen-
heit des einzelnen vor Gott. Das Neue Testament kennt keine kollektive
Sünde, w e n n m a n von der sogenannten Erbsünde oder Erbschuld, die eine
Sache ganz eigener Art ist und hier außer Betracht bleiben darf, absieht
(vgl. dazu Rom 5, 12-21); vielmehr muß der einzelne, aber auch nur er,
für seine schlechten Taten vor Gott einstehen (5).
Die eigentliche Entscheidung für oder gegen Jesus sollte und konnte
überhaupt erst jetzt nach seiner Verherrlichung fallen, und zwar als eine
Entscheidung des Glaubens an das Wort vom Christus; was vorher ge-
schehen war, w a r zu sehr n u r Sache einzelner Kreise der Führer wie des
Volkes, die m e h r von Unverstand als von wirklicher Einsicht geleitet
waren (vgl. L k 23,34; Apg 3,17; 13,27). Nachdem aber n u n die erste,
vorläufige Sendung Jesu durch seinen Tod u n d seine Verherrlichung ab-
geschlossen, in der Verherrlichung eine Beglaubigung durch Gott erfolgt
war, sollten die Apostel als Zeugen solchen Geschehens „in Jerusalem
und in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde" auftreten
(Apg 1,8). Ihnen hatte Jesus aufgetragen, von ihm „dem Volke zu predi-
gen u n d zu bezeugen,*daß er der von Gott bestellte Richter der Lebenden
und der Toten ist" (Apg 10,42). Diese Predigt der Apostel aber mochte
sich auf die Propheten stützen, die ihrerseits „bezeugen, daß jeder, der an
ihn glaubt, durch seinen Namen Nachlassung der Sünden empfängt" (ebd.
V. 43). Diese Mission unter dem Volke der Juden übertraf an räumlicher
und zeitlicher Ausdehnung wie auch an Erfolg das, was Jesus selbst in den
kurzen J a h r e n seiner Wirksamkeit erreicht hatte (vgl. Joh 14,12); das
Evangelium konnte sich überraschend schnell und weit verbreiten, und
zwar grundsätzlich zuerst als eine Botschaft an die Juden, dann erst an
die Heiden (vgl. Rom 1,16). Nicht wenige aus Israel schlössen sich damals
gläubig der Gemeinde Jesu an, so daß Jakobus von Jerusalem in einer
gelegentlichen Bemerkung einmal von vielen Zehntausenden sprechen
konnte (Apg 21,20). Die Judenchristen bildeten eine starke Säule im
Aufbau der jungen Kirche. ^
Aber ein großer Teil des Volkes — es waren wohl die meisten — ver-
schloß d e m Worte vom Christus das Ohr (vgl. Rom 10,16). Sie wurden
Juden in jenem Sinne, daß sie streng am überkommenen Judesein fest-
hielten u n d Jesus als Christus ablehnten; sie wurden es, die i n den
folgenden J a h r h u n d e r t e n schlechthin als die Juden bezeichnet werden.
So entstand jene Lage, die einen Paulus, der sein von Gott so außer-
ordentlich begnadetes Volk so heiß liebte, zu den erschütternden, schmerz-
5) Im Lichte dieser Erkenntnis dürfte es sich für einen Christen ziemlich verbieten, von
Schuld eines Volkes zu sprechen; solche wäre doch nur vorhanden in dem wohl kaum je
eintretenden Fall, daß alle Glieder eines Volkes ohne Ausnahme am gleichen Unrecht
beteiligt wären. Etwas anderes ist die Haftung eines Volkes für die Untaten einzelner,
etwa seiner Führer, wobei hier nicht untersucht werden soll, ob und wie weit sie dem
Geist des Evangeliums entspricht, etwa auch vor Gott besteht. Aber dieses Rechtsverhält-
nis setzt seiner Natur nach menschliche Partner voraus, weshalb es auf die Beziehung
eines Volkes zu Gott überhaupt nicht anwendbar ist. Darum läßt auch das Neue Testament
im Falle des Todes Jesu etwas derartiges nicht erkennen.
14
erfüllten, das Unerwartete und schier Unfaßbare im Lichte der göttlichen
Heilsordnung deutenden Ausführungen i n den Kapiteln 9 bis 11 i m
Römerbriefe veranlaßte. Schon i n der sogenannten Kindheitsgeschichte
bei Lukas spricht Simeon zur Mutter Jesu von der gegensätzlichen Wir-
kung, die ihr Kind einst in Israel auslösen werde: den einen wird er zum
Falle, den anderen zur Auferstehung sein, ein Zeichen des Widerspruches,
durch das die Gedanken der Herzen offenkundig werden (2,34f). Die
Vorhersage traf ein: Jesus stellte in eigener Person oder durch von ihm
beauftragte Apostel Israel vor die Entscheidung für oder wider ihn und
spaltete das Volk i n zwei geradezu feindliche Heerlager; nichts mehr
vermochte, diesen Riß zu schließen. Merkwürdig ist dabei die Tatsache,
daß das christlich gewordene Judentum, soweit es nicht zu längst unter-
gegangenen Sekten absank, völlig i n der übervölkischen Kirche aufging,
während jenes Judentum, das starr an der mosaischen Religion festhielt,
sich trotz unsäglicher Bedrückungen, die es immer wieder erleiden mußte,
fern dem Mutterland als Fremdling unter anderen Völkern i n einer
Weise erhielt, die z u m Nachdenken zwingt. So vieles m a n auch zur Er-
klärung dieser höchst eigenartigen Tatsache von allgemein geschichtlichen
und besonders religionsgeschichtlichen Gesichtspunkten aus anführen mag,
man wird ihr schwerlich gerecht werden, solange m a n sie nicht ins Licht
der Offenbarung rückt.
Dieses J u d e n t u m im völkischen und religiösen Sinne, an sich nur ein
Rest, freilich ein sehr ansehnlicher Rest des jüdischen Volkes von ehedem,
hat vor Gott seine große Berufung und Auszeichnung von früher keines-
wegs verloren und wird sich nicht immer gegen Jesus ablehnend ver-
halten, wie Paulus in den schon erwähnten tiefsinnigen Kapiteln 9 bis 11
des Römerbriefes lehrt. Als Nachkommen der Väterr mit denen Gott einst
seinen Bund geschlossen hat, werden die J u d e n sogar ganz besonderes
Erbarmen Gottes finden. Es ist, wie Paulus sagt, Verstockung über einen
Teil von Israel gekommen, bis die Vollzahl der Heiden durch Glauben in
die Kirche Christi eingeht, dann wird auch ganz Israel gerettet werden;
denn sie sind Geliebte Gottes u m der Väter willen. „Unbereubar sind
nämlich die Gnadengaben und die Berufung Gottes" (Rom 11,25-32). Wie
das alles näherhin sich verwirklichen wird, bleibt einstweilen ein Geheim-
nis der Zukunft; aber wer i m m e r die Lehren der Bibel glaubt, weiß hier
u m eine große und herrliche Aufgabe, die Gott seinem einst von ihm aus-
erwählten Volke, auch in jenem Reste, der bislang Christus nicht aner-
kennt, vorbehalten hat.
Wir erleben, wie in Palästina ein nationaler jüdischer Staat empor-
wächst, der die Zerstreuten Israels von überall her sammelt. Dieses Schau-
spiel wirkt u m so überraschender, als seit dem J a h r e 70, seit der Nieder-
lage der palästinischen Juden unter Titus und seinen Legionen, von einem
Versuch unter Bar Kochba in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts
abgesehen, es kein politisches Gebilde eines jüdischen Staates mehr ge-
geben hat. Im Gedanken an das, was Paulus über die kommende Hin-
wendung Israels an Christus schreibt, haben manche Christen längst
erwartet, daß vorher sich dieses Volk wieder in Palästina zusammen-
finden werde; Paulus, der es noch nicht erlebt hatte, daß Israel dort sein
Heimatrecht verlor, sprach nicht davon. Sicher aber kommt die Gründung
15
des Staates Israel nicht von ungefähr, sondern hat für den, der die Dinge
auch religiös im Lichte der Offenbarung zu sehen vermag, ihre Bedeutung
im Plane Gottes. Hat sich Israel auch in einem Teile an Christus ver-
gangen, so hat es in seinen Gliedern durch die Jahrhunderte Fürchter-
liches erlitten, vielleicht m e h r als ein anderes Volk der Erde. So wird,
wie Paulus im Anschluß an Isaias (vgl. 59,20 f; 27,9) sagt, auch für es
schließlich „von Sion der Retter kommen, wird abwenden die Gottlosig-
keiten von Juda; und dies wird ihnen der von mir gewährte Bund sein,
wenn ich ihre Sünden wegnehme" (Römll,26f).
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Musste Jesus für uns sterben?: Deutungen des Todes JesuVon EverandMusste Jesus für uns sterben?: Deutungen des Todes JesuNoch keine Bewertungen
- Warum starb Jesus Christus?: Was war der Plan des Vaters?Von EverandWarum starb Jesus Christus?: Was war der Plan des Vaters?Noch keine Bewertungen
- Windisch Die Orakel Des Hystaspes (1929)Dokument103 SeitenWindisch Die Orakel Des Hystaspes (1929)frankha1115Noch keine Bewertungen
- Christenverfolgung und Ökumene der Märtyrer: Eine biblische BesinnungVon EverandChristenverfolgung und Ökumene der Märtyrer: Eine biblische BesinnungNoch keine Bewertungen
- Religionskritische Schriften: Kompendium früherer WerkeVon EverandReligionskritische Schriften: Kompendium früherer WerkeNoch keine Bewertungen
- Der andere Jesus: Der Nichtgottessohn, der nicht für unsere Sünden starbVon EverandDer andere Jesus: Der Nichtgottessohn, der nicht für unsere Sünden starbNoch keine Bewertungen
- Der befreite Jesus: Unterwegs zum erwachsenen ChristusglaubenVon EverandDer befreite Jesus: Unterwegs zum erwachsenen ChristusglaubenNoch keine Bewertungen
- Paul Winter (1961) - On The Trial of Jesus. de Gruyter (Ocr, I)Dokument228 SeitenPaul Winter (1961) - On The Trial of Jesus. de Gruyter (Ocr, I)Olestar 2023-06-17Noch keine Bewertungen
- Arthur Drews - Leugnung JesusDokument90 SeitenArthur Drews - Leugnung JesusJoleanderNoch keine Bewertungen
- Bin ich noch Christ?: Gedanken zur Situation des ChristentumsVon EverandBin ich noch Christ?: Gedanken zur Situation des ChristentumsNoch keine Bewertungen
- Le Christ de L'apocalypseDokument17 SeitenLe Christ de L'apocalypseEmmanuel PolaNoch keine Bewertungen
- MEIN FREUND DIE REINKARNATION: JESUS LEHRTE DIE REINKARNATION ALS ERNEUTE CHANCE NICHT ALS ZIELVon EverandMEIN FREUND DIE REINKARNATION: JESUS LEHRTE DIE REINKARNATION ALS ERNEUTE CHANCE NICHT ALS ZIELNoch keine Bewertungen
- 14 Jesus Starb Nicht Am KreuzDokument9 Seiten14 Jesus Starb Nicht Am KreuzMaximilian PankaukeNoch keine Bewertungen
- Zurück zu Gott: Der Weckruf von Notre-Dame. Schriften zum Zeitalter der GottvergessenheitVon EverandZurück zu Gott: Der Weckruf von Notre-Dame. Schriften zum Zeitalter der GottvergessenheitNoch keine Bewertungen
- Jesús HistóricoDokument16 SeitenJesús HistóricoMario LainezNoch keine Bewertungen
- Löhde, Ludendorff, Engel - 1. Christliche Grausamkeit An Deutschen Frauen, 2. Der Jesuitismus Eine StaatsgefahrDokument69 SeitenLöhde, Ludendorff, Engel - 1. Christliche Grausamkeit An Deutschen Frauen, 2. Der Jesuitismus Eine StaatsgefahrEsausegenNoch keine Bewertungen
- Propheten und Begründer der Weltreligionen: Jesus und Mohammed: Biographie von Jesus Christus und Prophet MuhammadVon EverandPropheten und Begründer der Weltreligionen: Jesus und Mohammed: Biographie von Jesus Christus und Prophet MuhammadNoch keine Bewertungen
- Aus dem Zeitlichen in die Ewigkeit.: Das Leben der Seele nach dem Tode Gedanken eines russischen Theologen unserer ZeitVon EverandAus dem Zeitlichen in die Ewigkeit.: Das Leben der Seele nach dem Tode Gedanken eines russischen Theologen unserer ZeitNoch keine Bewertungen
- 14 Jesus Starb Nicht Am Kreuz PDFDokument9 Seiten14 Jesus Starb Nicht Am Kreuz PDFiftisweltNoch keine Bewertungen
- Jesus Römer Christentum: Makaberste Tragödie des AbendlandsVon EverandJesus Römer Christentum: Makaberste Tragödie des AbendlandsNoch keine Bewertungen
- rtp-001 1869 2 650 DDokument25 Seitenrtp-001 1869 2 650 DIsaia Herilanto RAMAROVAHINYNoch keine Bewertungen
- Der junge Reformator Luther - Teil 2 – ab 1518: Band 96 in der gelben Buchreihe bei Jürgen RuszkowskiVon EverandDer junge Reformator Luther - Teil 2 – ab 1518: Band 96 in der gelben Buchreihe bei Jürgen RuszkowskiNoch keine Bewertungen
- Vollenweider Diesseits Von Golgatha. ZumDokument15 SeitenVollenweider Diesseits Von Golgatha. ZumSabine KrollertNoch keine Bewertungen
- Vollenweider Ostern Der Denkwurdige AusgDokument19 SeitenVollenweider Ostern Der Denkwurdige AusgSabine KrollertNoch keine Bewertungen
- Das Leben Jesu: Aufsehenerregende Jesus-Biografie - Der historische Jesus (Kindheit und Jugend Jesu + Johannes der Täufer + Jesus zu Kapernaum + Predigten am See + Johannes Tod...)Von EverandDas Leben Jesu: Aufsehenerregende Jesus-Biografie - Der historische Jesus (Kindheit und Jugend Jesu + Johannes der Täufer + Jesus zu Kapernaum + Predigten am See + Johannes Tod...)Noch keine Bewertungen
- Versöhnte Welt: Wie wir Jesu Tod "für uns" verstehen könnenVon EverandVersöhnte Welt: Wie wir Jesu Tod "für uns" verstehen könnenNoch keine Bewertungen
- (Supplements To Novum Testamentum 006) Neotestamentica Et Patristica 1962Dokument352 Seiten(Supplements To Novum Testamentum 006) Neotestamentica Et Patristica 1962Novi Testamenti LectorNoch keine Bewertungen
- Relegi SPRDokument4 SeitenRelegi SPRAmelia SmugNoch keine Bewertungen
- Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums: Das Abendmahlsproblem auf Grund der wissenschaftlichen Forschung und der historischen BerichteVon EverandDas Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums: Das Abendmahlsproblem auf Grund der wissenschaftlichen Forschung und der historischen BerichteNoch keine Bewertungen
- Jesus: Wie die Jesusforschung immer wieder bei sich selbst landet und alle glauben, was sie wollenVon EverandJesus: Wie die Jesusforschung immer wieder bei sich selbst landet und alle glauben, was sie wollenNoch keine Bewertungen
- Predigte Christus Im Totenreich Ungläubigen Oder Gefallenen Engeln Die Gute Botschaft Jesus Christus Bibel KommentarDokument7 SeitenPredigte Christus Im Totenreich Ungläubigen Oder Gefallenen Engeln Die Gute Botschaft Jesus Christus Bibel KommentarTobiasGronauerNoch keine Bewertungen
- Thomas von Kempen: Nachfolge Christi. Textauswahl und Kommentar von Gerhard WehrVon EverandThomas von Kempen: Nachfolge Christi. Textauswahl und Kommentar von Gerhard WehrNoch keine Bewertungen
- Die Zeugen Jehovas - Friedlmayer, Helmut 1993Dokument81 SeitenDie Zeugen Jehovas - Friedlmayer, Helmut 1993eugen-karl0% (1)
- Der Erste Petrusbrief: Frühchristliche Identität im WandelVon EverandDer Erste Petrusbrief: Frühchristliche Identität im WandelNoch keine Bewertungen
- Die Tatsache Der Auferstehung Jesus Christus Kreuz Tod Golgatha Pfingsten Gott Bibel Religion Kirche Islam Koran SterbehilfeDokument5 SeitenDie Tatsache Der Auferstehung Jesus Christus Kreuz Tod Golgatha Pfingsten Gott Bibel Religion Kirche Islam Koran SterbehilfeTobiasGronauerNoch keine Bewertungen
- Das Evangelium der Junia: Ein Kriminalfall im Nahen OstenVon EverandDas Evangelium der Junia: Ein Kriminalfall im Nahen OstenNoch keine Bewertungen
- Gsmanuskript617 - Norddeutscher Rundfunk SkriptDokument8 SeitenGsmanuskript617 - Norddeutscher Rundfunk SkriptVicinia cal SaresNoch keine Bewertungen
- Eintauchen in die Weite des Seins: Päpste über Tod und ewiges LebenVon EverandEintauchen in die Weite des Seins: Päpste über Tod und ewiges LebenNoch keine Bewertungen
- Jesus in Neuem Licht: Mit einem ausführlichen Kapitel über das Turiner GrabtuchVon EverandJesus in Neuem Licht: Mit einem ausführlichen Kapitel über das Turiner GrabtuchNoch keine Bewertungen
- Sternstunden und Schandflecke der Kirchengeschichte: Licht- und Schattenseiten in 36 EpisodenVon EverandSternstunden und Schandflecke der Kirchengeschichte: Licht- und Schattenseiten in 36 EpisodenNoch keine Bewertungen
- Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums: Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis: Eine Skizze des Lebens JesuVon EverandDas Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums: Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis: Eine Skizze des Lebens JesuNoch keine Bewertungen
- Auferstehung jetzt - Ostern als Aufstand: Theologische Provokationen - NeuausgabeVon EverandAuferstehung jetzt - Ostern als Aufstand: Theologische Provokationen - NeuausgabeNoch keine Bewertungen
- Entgegning Auf Obige Berichtigung . Karl SchochDokument4 SeitenEntgegning Auf Obige Berichtigung . Karl SchochDolores MonteroNoch keine Bewertungen
- Der Stern Des Messias . Karl SchochDokument2 SeitenDer Stern Des Messias . Karl SchochDolores MonteroNoch keine Bewertungen
- ,,wir Haben Alles Verlassen" (Mc. X 28) : Novum Testamentum, Vol. XIX, Fasc. 3Dokument36 Seiten,,wir Haben Alles Verlassen" (Mc. X 28) : Novum Testamentum, Vol. XIX, Fasc. 3Dolores MonteroNoch keine Bewertungen
- Zwei Miszellen 1. Antik-Jüdische Münzdeutungen. 2. Zur Geschichtlichkeit Der Tempelreinigung. Joachim JeremiasDokument5 SeitenZwei Miszellen 1. Antik-Jüdische Münzdeutungen. 2. Zur Geschichtlichkeit Der Tempelreinigung. Joachim JeremiasDolores MonteroNoch keine Bewertungen
- 'Εκάϑιβεν επί βήματος. P. CorssenDokument3 Seiten'Εκάϑιβεν επί βήματος. P. CorssenDolores MonteroNoch keine Bewertungen
- Οὖς δεξιὸν ἀποτέμνειν. M. RostovtzeffDokument4 SeitenΟὖς δεξιὸν ἀποτέμνειν. M. RostovtzeffDolores MonteroNoch keine Bewertungen
- Φίλος τοῦ Καίσαρος. Ernst BammelDokument3 SeitenΦίλος τοῦ Καίσαρος. Ernst BammelDolores MonteroNoch keine Bewertungen
- Aborea-Abenteuer Der Rest Vom FestDokument4 SeitenAborea-Abenteuer Der Rest Vom FestStephan BöhmNoch keine Bewertungen
- Ramadan Plan 2020Dokument1 SeiteRamadan Plan 2020SimpleWay GroupNoch keine Bewertungen
- Adolf Hitler Und DjihadDokument21 SeitenAdolf Hitler Und DjihadHugãoNoch keine Bewertungen
- Die Völkerwanderung II.Dokument3 SeitenDie Völkerwanderung II.Sara Gigova100% (1)
- Pedro Ribeiro Martins Der Vegetarismus in Der Antike Im StreitgesprächDokument240 SeitenPedro Ribeiro Martins Der Vegetarismus in Der Antike Im Streitgesprächxolek63170atzefaraNoch keine Bewertungen
- LIMC GanymedesDokument18 SeitenLIMC GanymedesFevziŞahinNoch keine Bewertungen