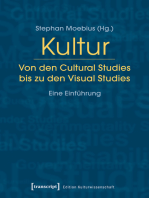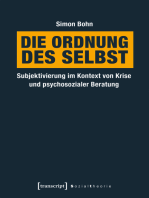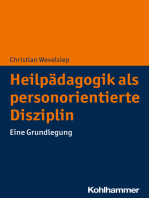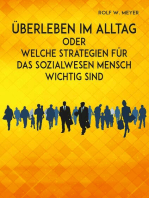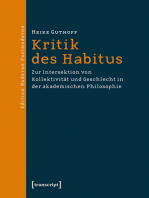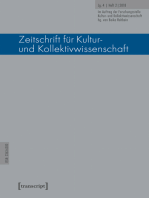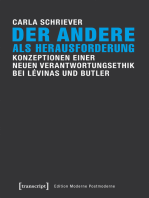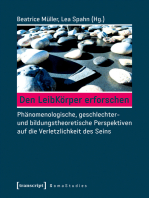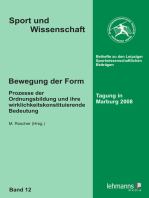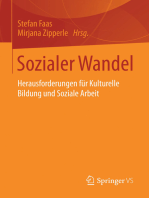Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Jaeggi Lebensformen Als Problemlosungsinstanzen
Hochgeladen von
Daichu CanaichuOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Jaeggi Lebensformen Als Problemlosungsinstanzen
Hochgeladen von
Daichu CanaichuCopyright:
Verfügbare Formate
PhJb 1/18 / p. 64 / 26.3.
2018
Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 1
Rahel JAEGGI (Berlin)
1. In a nutshell
Können wir Lebensformen als Lebensformen kritisieren? Können wir von Lebens-
formen sagen, dass sie schlecht, misslungen, defizitär, unangemessen, irrational –
oder umgekehrt gelungen, rational oder angemessen sind? Wenn ich im Folgenden
für die Möglichkeit und Notwendigkeit einer krisendynamisch orientierten imma-
nenten Kritik von Lebensformen 2 plädiere, so ist dieses Plädoyer unmittelbar mit der
These verbunden, dass Lebensformen auf eine bestimmte Weise verfasst sind. Le-
bensformen, die kulturell und historisch geprägten sozialen Gebilde aus Praktiken
und Institutionen, in denen Menschen ihr Leben führen, lassen sich bewerten und
kritisieren, weil sie sind, was sie sind: Von Menschen gestaltet und gestaltbar, dabei
normativ und reflexiv verfasst und gezeichnet von Problemstellungen, Krisen und
(manchmal) Lern- und Erfahrungsprozessen. Kurz: Lebensformen sind, bei allen
Momenten von Gewohnheitsbildung und Unzugänglichkeit, dennoch nicht einfach
das unhinterfragbar Gegebene, sie sind nicht einfach nur „Tatsachen des Lebens“ 3,
die so sind, wie sie eben sind. Lebensformen erheben Ansprüche – und sie können
(an diesen) scheitern. Sie sind dynamische Gebilde, die, mit ebenso normativen wie
funktionalen Problemen und Krisen konfrontiert, auf diese reagieren (müssen). Und
eben das gibt Anlass für Reflexion, Verteidigung und kritische Bewertung. Auf eine
sehr kurze Formel gebracht: Lebensformen sind Instanzen von Problemlösungen.
Sie reagieren auf Probleme, die sich (mit) ihnen stellen und sind bewertbar anhand
der Angemessenheit dieser Reaktion.
Wie leicht zu sehen ist, sind mit meinem Ansatz eine ganze Reihe von nicht
selbstverständlichen Voraussetzungen über das verbunden, was Lebensformen sind,
wie die in ihnen implizite Normativität beschaffen ist, sowie über das, was ich hier
Kritik nenne. Diese will ich im Folgenden erläutern und zur Diskussion stellen 4.
1 Für hilfreiche Hinweise bei der Konzeption und Überarbeitung dieses Textes danke ich Lukas Kübler, Eva
von Redecker und Marvin Ester.
2 Ich habe dies ausführlicher in meinem Buch Kritik von Lebensformen (2014) entwickelt.
3 Wittgenstein (1982), § 630, 122.
4 Das ist umso nötiger, als über den Begriff der Lebensform weder alltagssprachlich noch in der Philoso-
phie Einigkeit besteht. Zu einem Versuch, verschiedene Verwendungsweisen zu ordnen, siehe jetzt Fassin
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 65 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 65
2. Lebensformen
2.1 Lebensformen als Ordnungen kollektiver Gestaltung des menschlichen Lebens
Was also sind Lebensformen? Die Rede von Lebensformen bezieht sich, so wie ich
sie verstehe, auf kulturell geprägte Formen menschlichen Zusammenlebens, „Ord-
nungen menschlicher Koexistenz“ 5, die ein „Ensemble von Praktiken und Orientie-
rungen“ 6, aber auch deren institutionelle Manifestationen und Materialisierungen
umfassen. Unterschiede in Lebensformen drücken sich nicht nur in unterschied-
lichen Überzeugungen, Wertsetzungen und Einstellungen aus; sie manifestieren
und materialisieren sich in Mode, Architektur, Rechtssystemen und Weisen der Fa-
milienorganisation, in jenem von Musil so genannten „dauerhaften Stoff von Häu-
sern, Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen“ 7, der unser Le-
ben ausmacht. Dabei soll die Rede von „Lebensformen“ diese nicht etwa als „Kultur“
den materiellen, ökonomischen oder politischen Aspekten des gesellschaftlichen
Zusammenhangs entgegensetzen, vielmehr gehören ganz unterschiedliche öko-
nomische, kulturelle, soziale ebenso wie politische Konstellationen von Praktiken
zu dem, was eine Lebensform ausmacht. 8
Als Formen, in denen gelebt wird, gehören sie also (Hegel’sch verstanden) zur
Sphäre des objektiven Geistes oder auch, mit Hannah Arendt gesagt, zu der spezi-
fisch menschlichen Welt, in der sich unser Leben im Gegensatz zu anderem biologi-
schem Leben abspielt. Anders gesagt: Ich frage nach Lebensformen im Plural, also
den verschiedenen soziokulturellen Formen, die das menschliche Leben annehmen
kann, nicht (in ethisch-naturalistischer Perspektive) nach der Lebensform des Men-
schen – im Gegensatz etwa zu der des Löwen. Dieser Ausgangspunkt erklärt sich
nicht nur daraus, dass es mir naheliegend scheint, von ‚Lebensform‘ nur da zu spre-
chen, wo die Form, die das Leben annimmt, gestaltet ist und demnach auch umge-
staltet werden kann, also nicht schon da, wo etwas sich auf typische Weise immer
wiederholt oder einen durch Instinkte geleiteten notwendigen Verlauf hat. Mensch-
liche Lebensformen kommen immer schon im Plural vor, weil es zur menschlichen
Lebensform im Singular gehört, Lebensformen unter unterschiedlichen Vorausset-
zungen zu gestalten und weil diese deshalb historisch veränderlich sind und unter-
schiedliche Ausprägungen erfahren. Ob diese Unterschiede, wie Arnold Gehlen sagt,
von „so auffällige[r] Gegensätzlichkeit […], sozusagen bis in die Herzfalten der Men-
schen hinein“, sind, „dass man fast glauben könnte, man hätte es mit verschiedenen
Gattungen zu tun“ 9, mag dahingestellt sein. Dass wir aber „alles Natürliche am
Menschen nur in der Imprägnierung durch ganz bestimmte kulturelle Färbungen
(2017), Kapitel 1. Den wittgensteinianischen, neoaristotelischen und Foucault’schen Verwendungen des
Begriffs füge ich hier eine an der Hegel’schen Sittlichkeitstheorie orientierte Auffassung hinzu.
5 Liebsch (2003), 13–44, hier 17.
6 Wingert (1993), 174.
7
Musil (1987), 10.
8 Der Lebensformbegriff ist in diesem Sinne „materialistisch“ als er das Zusammen und die wechselseitige
Verflochtenheit der unterschiedlichen Sphären betont und darauf beharrt, dass Lebensformen eine mate-
riale Grundlage haben.
9
Gehlen (1958), 113.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 66 / 26.3.2018
66 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
erfahren können“ 10, ist eine Einsicht, die Gehlen mit Marx teilt, wenn dieser sagt:
„Hunger ist Hunger, aber Hunger, der sich durch gekochtes, mit Gabel und Messer
gegeßnes Fleisch befriedigt, ist ein andrer Hunger, als der rohes Fleisch mit Hilfe von
Hand, Nagel und Zahn verschlingt [Hervorh. R. H.]“ 11, oder wenn er – bezogen auf
die historisch sich etablierende materielle Produktion des menschlichen Lebens –
bemerkt, dass die Produktionsweisen immer schon „eine bestimmte Art der Tätigkeit
dieser Individuen, eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebens-
weise derselben“ [Hervorh. i. O.] 12 verkörpern.
Menschen sind also Produzenten ihrer eigenen Lebensform, sie sind Lebewesen,
die nicht nur eine Lebensform haben, sondern diese gestalten und sich reflexiv auf
sie beziehen. „Mensch sein“ bedeutet in dieser Perspektive, eine mit anderen geteilte
soziale Lebensform zu haben, in der dem „Leben“ eine „Form“ gegeben wird und in
der die aus dem „Leben“ (oder unserer natürlichen Existenz) resultierenden Bedingt-
heiten und Nötigungen, wie man sagen könnte, kulturell transformiert und bearbei-
tet werden. Es geht damit um die Schnittstelle zwischen erster und zweiter Natur des
Menschen – und anders als bei anthropologisch dichter oder auch neoaristotelisch
argumentierenden Ansätzen steht hier die Überzeugung im Zentrum, dass es sich
immer um ein historisch gewachsenes dynamisches Durchdringungsverhältnis han-
delt, dessen wesentliches Moment nicht nur die „Künstlichkeit“, sondern auch die
Reflexivität ist.
2.2 Lebensformen als träge Bündel sozialer Praktiken
Wenn wir Menschen als Produzenten ihrer eigenen Lebensform betrachten, auf
die sie sich reflexiv beziehen, ist allerdings Vorsicht geboten. Nicht nur sind sie, da
es ja um Formen menschlicher Ko-Existenz, um Formen menschlichen Zusammen-
lebens geht, allenfalls Ko-Produzenten oder Ko-Autoren ihrer Lebensform; weiter-
hin ist die Gestalt soziokultureller Lebensformen beeinflusst von materiellen Rah-
menbedingungen, die, wie Hegel in den Vorlesungen über die Philosophie des
Rechts sagt, „Autorität über uns [haben], an die wir uns anpassen müssen“ 13 (§ 146).
Und schließlich ist dem von Adam Ferguson notiertem Umstand Rechnung zu tra-
gen, dass soziale Formationen „the result of human action, but not the execution of
any human design“ 14 sind. Das bedeutet nicht nur, dass es Grenzen der Gestaltung
und der Gestaltbarkeit gibt, sondern auch, dass soziale Prozesse, einmal in Gang
gesetzt, sich verselbstständigen können. Die Autorschaft in Bezug auf unsere Le-
bensformen ist damit in mancher Beziehung geradezu anonym – und es geht in
mancher Hinsicht auch eher um aneignende Transformation als um „Produktion“.
Lebensformen sind dann aber in entscheidender Hinsicht beides, sowohl vorgängig
wie auch gestaltbar, oder anders: Sie sind gleichzeitig gegeben wie gemacht.
10
Ebd.
11 Marx (1971), 624, eigene Hervorhebung.
12 Marx (1970), 21, Hervorhebung im Original.
13 Hegel (1986), § 146.
14
Ferguson (1819), 222.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 67 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 67
Genau dieses komplexe Verhältnis nun lässt sich am besten mit einem Ansatz
verstehen, der mit Praktiken als der Basiseinheit des Sozialen rechnet und den Be-
griff der Lebensformen als den Formen, die wir unserem Leben geben, mithilfe eines
praxistheoretischen Ansatzes erklärt. Meine These ist: Lebensformen sind träge oder
inerte Ensembles sozialer Praktiken, die normativ verfasst sind. Diese These möchte
ich schrittweise erläutern.
2.3 Praxis
Zunächst zum Begriff der sozialen Praxis. Soziale Praktiken sind Weisen, in de-
nen wir etwas tun. Praktiken betreffen den Umgang mit den anderen, der materiel-
len Welt oder mit sich selbst, wobei diese Dimensionen auf vielfältige Weise mit-
einander verwoben sind. Eine Abendgesellschaft oder ein Versteckspiel ist ebenso
eine Praxis wie das Einkaufen in einem Geschäft, das Schreiben einer Klausur oder
das Einbringen der Ernte. Praktiken sind dabei Sequenzen einzelner Handlungen,
die mehr oder weniger komplex und umfassend und (mehr oder weniger) habituali-
siert sind. Sie sind mehr oder weniger verbindlich und repetitiv: Etwas, das nur
einmal oder nur von einem einzigen Menschen getan und niemals wiederholt wür-
de, ist keine Praxis. Diese Praktiken sind ‚sozial‘, weil sie nur vor dem Hintergrund
sozial konstituierter Bedeutungsräume existieren und verstanden werden können,
nicht etwa, weil sie im engeren Sinne kooperative Tätigkeiten betreffen. Also: Nicht
erst das gemeinsame Fußballspielen, auch das (alleine) Kochen oder Einkaufen-
gehen ist in diesem Sinne eine soziale Praxis. Dabei sind Praktiken Handlungsmus-
ter, Muster, die uns das Handeln erst ermöglichen und die gleichzeitig durch unsere
Aktivität hervorgebracht und immer wieder aktualisiert werden müssen. Deshalb
können sie unserem Handeln Grenzen setzen, aber auch handlungsermöglichend
wirken.
Drei Aspekte des Begriffs der Praxis sind für unseren Zusammenhang hervor-
zuheben:
Erstens basieren Praktiken, sofern sie ein repetitives und habituelles Moment
beinhalten, nicht nur auf willentlich und mit Absicht getätigten Handlungen. In
einem gewissen Maß, und solange sie nicht gestört werden oder mit Problemen
konfrontiert sind, beruhen sie eher auf implizitem denn auf explizitem Wissen.
Dementsprechend werden Lebensformen nicht immer bewusst, geplant oder reflek-
tiert praktiziert. In eine Lebensform tritt man nicht ein wie in einen Fußballverein.
Besser gesagt: In den Fußballverein kann man mit einer Beitrittserklärung eintreten.
In die mit diesem verbundene Lebensform hingegen, das dichte Geflecht von Üb-
lichkeiten und Prioritäten und Deutungsmustern, das diese ausmacht, wird man
mehr oder weniger bewusst und mehr oder weniger explizit hineinsozialisiert oder
eingeübt. An einige der damit gesetzten Praktiken gewöhnen wir uns schlicht, neh-
men wir vielleicht sogar teil ohne in jedem Moment zu wissen, was wir da tun oder
dass wir es tun.
Zweitens: Praktiken sind keine „nackten Tatsachen“; sie müssen als etwas ver-
standen und interpretiert werden. Wenn ich jemanden hinter einem Baum stehen
sehe, kann es unklar sein, ob diese Person sich vor der Polizei versteckt oder aber mit
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 68 / 26.3.2018
68 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
Kindern Verstecken spielt. Um das Verstecken hinter dem Baum als Teil eines Ver-
steckspiels zu verstehen, brauche ich zusätzliche Anhaltspunkte über den Umstand
hinaus, dass da jemand versteckt steht. Ich muss dazu das Spiel ‚Verstecken‘ kennen
(also seine Regeln) und es in dem beobachteten Geschehen identifizieren können.
Aber darüber hinaus verstehe ich, indem ich das Hinter-dem-Baum-Stehen als ‚Ver-
steckspiel‘ verstehen kann, auch implizit dessen Verhältnis zu anderen Praktiken
und entsprechenden Interpretationen. Ich verstehe dann das Konzept oder Interpre-
tationsschema ‚Spiel‘ (im Gegensatz zu Arbeit oder Ernst) und darüber hinaus mög-
licherweise das Konzept von ‚Kindheit‘ im Unterschied zum Erwachsensein und
vieles mehr. Dasselbe gilt für das Einkaufen, für das man basal mit den Regeln des
Warentauschs und des Geldverkehrs im Allgemeinen und mit den spezifischen Ab-
läufen im Supermarkt im Besonderen vertraut sein muss. Jemand, der nicht weiß,
dass man beim Einkaufen im Supermarkt erst an der Kasse zahlt, könnte das An-
häufen von Waren im Einkaufswagen als Diebstahl auffassen. Praktiken sind also
nur vor einem Deutungshorizont verständlich, der mit anderen Praktiken und Inter-
pretationen verbunden ist.
Drittens: Praktiken sind um die Kernidee der „Erfüllung“ der jeweiligen Praxis
herum organisiert; also dem Handeln gemäß den Erwartungen, die mit einer be-
stimmten Praxis einhergehen (wenn man nicht einmal versucht, sich zu verstecken,
dann wird sicherlich nicht Verstecken gespielt, wenn ich gar nicht erst den Versuch
mache, Waren in den Einkaufswagen zu häufen, sondern nur im Supermarkt he-
rumschlendere, gilt das nicht als Einkaufen). Damit haben Praktiken ein inhärentes
Telos. Sie sind auf ein Ziel gerichtet, das durch sie erreicht werden kann. An einer
Praxis teilzunehmen (wirklich teilzunehmen) setzt dann schon voraus, dass man mit
Blick auf ihr Ziel und ihre internen Maßstäbe der guten Realisierung des Ziels han-
delt. Dass Praktiken auf Ziele gerichtet sind, gilt selbst dann, wenn mehrere Ziele
mit einer bestimmten Praxis verfolgt werden und werden können, wenn diese also
überdeterminiert ist. Ich gehe einkaufen, um die Zutaten für das Abendessen zu
besorgen, aber auch, weil ich mit dem Ladenbesitzer plaudern möchte, da mir zu
Hause langweilig ist. Man kann also das Einkaufen unter dem Aspekt des Unter-die-
Leute-Kommens betrachten oder unter dem des Stillens von Hunger. Und die Vo-
raussetzung der Zielgerichtetheit gilt auch dann, wenn noch andere Praktiken zur
Erfüllung desselben Ziels denkbar wären, es also auch funktionale Äquivalente zu
seiner Erfüllung gäbe und dieses nicht lediglich durch diese eine bestimmte Praxis
erreicht werden kann.
2.4 Ensembles
Was bedeutet es nun, Lebensformen als Ensembles oder Bündel von Praktiken zu
verstehen? Die „Basiseinheit“ von Lebensformen sind Praktiken. Eine einzelne Pra-
xis macht aber noch keine Lebensform aus. An der Kasse bezahlen oder Versteck-
spielen alleine ist selbst keine Lebensform, aber es ist Bestandteil einer Lebensform
und wird, wie wir gesehen haben, auch aus dieser heraus – als einem Praxis- und
Interpretationszusammenhang – verstanden. Das, was wir eine Lebensform nennen
können, umfasst umgekehrt verschiedene und komplex aufeinander bezogene
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 69 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 69
Praktiken. Lebensformen als Zusammenhänge von Praktiken sind also zusammen-
gehalten und individuiert als interpretierte funktionale Zusammenhänge vor dem
Hintergrund sachlicher Ausgangsbedingungen. Das Feld des Sozialen ist „unter-
teilt“ in solche voneinander unterscheidbare Bereiche von Lebensformen, sofern es
hier unterschiedliche, aufeinander verweisende Zusammenhänge mit den entspre-
chenden komplexen Praktiken und Funktionszuschreibungen gibt.
Während manche Interpreten Lebensformen als die Gesamtheit der Praktiken und
Handlungsweisen, die in einer Gemeinschaft ausgeübt werden verstehen, plädiere
ich hier für eine ‚modulare‘ und offene Konzeption, die die Grenzen einer Gemein-
schaft nicht wie in einem Containermodell als bereits gegeben voraussetzt, sondern
von einem Geflecht von Praktiken ausgeht, das sich unter unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten betrachten lässt und in dem je unterschiedliche Zusammenhänge als
Lebensformen hervortreten können. 15 Die Größenordnung der zum Ensemble zu-
sammentretenden Praktiken kann dann ganz unterschiedlich sein. Die bürgerliche
Kleinfamilie ist eine Lebensform; aber als Lebensform bezeichnet man nicht ohne
Sinn auch größere Einheiten: den Kapitalismus, die Moderne, das städtische Leben.
Lebensformen sind deshalb auch in mancher Hinsicht „ineinander verschachtelt“:
Zum Beispiel ist die Lebensform der bürgerlichen Familie Teil der umfassenderen
Lebensform der Moderne, die umgekehrt auch durch bestimmte neue Typen fami-
liärer Organisation ausgemacht wird.
Wie genau aber stellt der Zusammenhang dieser Praktiken sich her? Im Fall der
funktionalen Verbindung und Abhängigkeit mehrerer Praktiken voneinander ist das
offensichtlich. Die Praxis des Wartens und Zahlens an der Supermarktkasse beruht
auf einer ganzen Reihe anderer Praktiken, die jene erst ermöglichen: auf dem Ein-
räumen der Supermarktregale, dem Produzieren der Milch als Ware und vielen wei-
teren Elementen. Das Passungsverhältnis lässt sich hier teleologisch (also ausgehend
von den mit den Praktiken gesetzten Zwecken) deuten: Wenn viele Praktiken ihren
Sinn und die Möglichkeit ihrer Realisierung erst durch die Einbettung in einen wei-
teren Zusammenhang von Praktiken und Interpretationen bekommen, wenn also
das Gut und der Zweck, die in einer Praxis realisiert werden sollen, sich nicht in
dieser alleine realisieren lassen, dann stellen sich Lebensformen als strukturierte
Zusammenhänge dar, in denen komplexe Güter oder Zwecke verfolgt werden. Etwas
als eine bestimmte Lebensform zu identifizieren, bedeutet demnach, Zusammenhän-
ge von Praktiken und Einstellungen als einen Zusammenhang zu identifizieren, der
zu etwas gut ist. Innerhalb eines solchen Zusammenhangs gibt es dann Praktiken,
die der Realisierung der damit gesetzten Zwecke dienen, und solche, die dieser zu-
widerlaufen. Und es gibt auch Praktiken, die diesbezüglich indifferent sind.
Andererseits sind Praktiken mit anderen Praktiken durch einen gemeinsamen
Interpretationshorizont verbunden, innerhalb dessen sie erst intelligibel werden.
Zu einer Lebensform wie derjenigen der bürgerlich mitteleuropäischen Kleinfamilie
gehören typischerweise das gemeinsame Abendessen oder der gemeinsame Urlaub
ebenso wie typische Formen der Intimität und der Konflikte, bestimmte Praktiken
15 Lebensformen transzendieren deshalb auch, oder liegen quer zu dem, was man manchmal in einem
essentialistischen Sinne „Kultur“ nennt.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 70 / 26.3.2018
70 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
des Vererbens und die damit einhergehenden Vorstellungen von Zusammengehö-
rigkeit, entsprechende familiäre Erziehungspraktiken oder auch die für diese For-
mation typische (aber keinesfalls selbstverständliche) Auslagerung der schulischen
und beruflichen Ausbildung an externe Institutionen wie Schule und Betrieb. Dabei
sind die einzelnen Praktiken nicht nur additiv gebündelt, sie kommen nicht nur
zusammen vor, sondern sind so aufeinander bezogen, dass sie sich mit der Konstel-
lation ändern, in der sie stehen.
Der Zusammenhang zwischen den Praktiken, die zusammen das „Ensemble“ einer
Lebensform ausmachen, ist dabei einmal stärker, einmal loser geknüpft. Lebensfor-
men stellen sich als offenes Netz aufeinander bezogener Praktiken dar. Einzelne
Cluster innerhalb des übergreifenden Zusammenhangs einer Lebensform haben eine
enge (und funktional aufzufassende) Verbindung miteinander; andere mögen in
einem lockereren und unspezifischeren Sinne „dazu passen“. Einige passen gut zu-
einander, sind aber auch voneinander (und überhaupt aus der Lebensform) weg-
zudenken, andere sind (um im Bild des „Netzes“ zu bleiben) „Knotenpunkte“. Lebens-
formen sind variable Zusammenhänge von Praktiken, keine geschlossenen und
umfassend integrierten Ganzheiten. Und so kann man sich auch die Dynamik der
Veränderung von Lebensformen so vorstellen, dass es zu Umgewichtungen, zu Neu-
konstellationen, aber auch zum Wegfall oder Austausch einzelner Praktiken kommt.
Es ist nicht leicht, zu sagen, wie genau der jeweilige Zusammenhang beschaffen
sein, welche Praktiken zu einer bestimmten Lebensform dazugehören und was hier
in welchem Sinne zueinander „passt“ oder passen muss. Ob das gemeinsame
Abendessen oder das Miteinander-Sprechen zu einer Familie zur Aufrechterhaltung
der familiären Konstellation wirklich dazugehört oder entbehrlich ist, mag Gegen-
stand von Auseinandersetzungen und auch von innerfamiliären Konflikten sein.
Dass Familie heute nicht mehr an heterosexuelle Orientierungen gebunden ist, ist
weitgehend akzeptiert aber immer noch Gegenstand gesellschaftlicher Konflikte
und Resultat einer umfassenden gesellschaftlichen Transformation. („Familie ist,
wo Kinder sind.“) Welche Praktiken sich zu einer Lebensform formieren, ist für diese
dennoch nicht beliebig. Die an ihnen partizipierenden Individuen müssen unter-
schiedliche Anforderungen miteinander in einen intelligiblen Zusammenhang brin-
gen können, der als Zusammenhang konsistent lebbar ist. Und die Lebensform muss
als Ensemble in der Lage sein, die mit ihr verbundenen Ziele zu realisieren. Deshalb
ist es auch möglich, Praktiken zu identifizieren, die in einen bestimmten Praxis-
zusammenhang nicht passen oder diesen gar – jeweils unter einer bestimmten Be-
schreibung – bedrohen.
2.5 Das Trägheitsmoment und die Unhintergehbarkeit
Wenn ich nun von Lebensformen als trägen (oder inerten) Bündeln oder Ensem-
bles sozialer Praktiken spreche, so will ich darauf hinaus, dass Lebensformen sich in
einem Zwischenreich zwischen Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit bewegen. Sie
sind Resultat unserer Aktivität, aber auch das, was diese ermöglicht; sie sind Resul-
tat unserer Handlungen, aber auch das Interpretations- und Handlungsmuster, das
diese prägt. Sie werden nicht am „grünen Tisch“ geplant; in eine Lebensform einge-
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 71 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 71
lassen verhalten wir uns zu dieser nicht wie zu einem vollkommen transparenten
und wählbaren set von Optionen.
Diese Unzugänglichkeit oder Trägheit hat mehrere Aspekte. Praktiken und ent-
sprechend Lebensformen enthalten einerseits, wie bereits gesagt, sedimentäre Ele-
mente, Gewohnheiten und andere Praxiskomponenten, die nicht ohne weiteres in
jedem ihrer Momente zugänglich, explizit oder transparent sind. Sie enthalten aber
auch Dimensionen der historischen Überlieferung, die die verfügbaren Handlungs-
muster prägen. Sie sind außerdem geprägt von materiellen Bedingtheiten, seien es
die natürlich vorgefundenen oder auch die Artefakte, die wiederum zu bedingenden
Voraussetzungen von Praxis werden. Soziale Praktiken und Lebensformen materia-
lisieren sich also in Form von sozialen Strukturen und Institutionen und darüber
hinaus auch – noch materialistischer – in Architektur, Werkzeugen, Körpern und
materiellen Strukturen, die uns auf bestimmte Weise handeln lassen, auch wenn sie
selbst das Ergebnis unserer Handlungen sind. So ist, um diese Verflechtung zu illus-
trieren, die Anlage der Plätze in einer typischen italienischen Stadt einerseits Resul-
tat eines bestimmten Umgangs mit dem Öffentlichen; sie prägt aber andererseits
ihrerseits die aktuellen Möglichkeiten städtischen Lebens und Zusammenkommens.
Und auch die Interpretationshorizonte, vor denen wir unsere Praktiken interpretie-
ren, sind so tief eingelagert und so sehr in die Selbstverständlichkeit hinein natura-
lisiert, dass sie üblicherweise nur dann überhaupt als solche erkennbar werden,
wenn diese Üblichkeit in irgendeiner Weise gestört oder unterbrochen wird. Lebens-
formen, als Moment der zweiten Natur, verhalten sich in dieser Hinsicht wie Natur:
als etwas Gegebenes, uns Bedingendes. „Träge“ oder inert sind Lebensformen dann
im Gegensatz zur nicht fluiden Beweglichkeit mancher weniger eingelebter Praxis-
vollzüge. Aber: Die Praktiken, aus denen Lebensformen bestehen, und die Lebens-
formen als spezifische Verbindungen solcher Praktiken können unterschiedliche
Aggregatszustände annehmen, die von flüssig bis beinahe gänzlich fixiert reichen.
2.6 Reflexion und Bewertung
Entscheidend ist aber nun auch noch folgender Umstand: In Lebensformen sind
wir praktisch eingelassen, wir haben zu ihnen kein objektivierendes Verhältnis,
sondern eines des praktischen Mitvollzugs vor einem zunächst selbst nicht thema-
tischen Interpretationsrahmen. Sind Lebensformen eingelebte Praktiken und Routi-
nen, die einen Kontext des unhintergehbar „Selbstverständlichen“ formen, den
Möglichkeitsraum, aus dem heraus wir uns und die Welt verstehen und handeln, so
sind wir in die Praxisvollzüge, die Lebensformen ausmachen, immer schon invol-
viert. Wir können deshalb nicht aus ihnen heraustreten, sie nicht auf die Weise vor
uns bringen und zu ihnen Stellung nehmen, dass wir von unserer Beziehung zu
ihnen abstrahieren könnten. Wir würden uns selbst falsch verstehen, wenn wir uns
auf unsere Lebensform objektivierend beziehen. Wie Jonathan Lear sagt: „We can’t
step outside of our form of life and discuss it like some objet trouvée.“ 16 Auch in
diesem Sinne können wir nicht gänzlich frei über sie disponieren.
16
Lear/Stroud (1984), 385.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 72 / 26.3.2018
72 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
Wie aber passt das zusammen mit der Behauptung eines in unsere Lebensformen
eingelassenen reflexiven Moments? Wie lassen sich Lebensformen evaluativ vor
uns bringen, wenn wir nicht von unserem Eingelassensein in sie abstrahieren kön-
nen? Müssen sie sich dann nicht darstellen als etwas unhintergehbar Gegebenes,
das Leben wie es eben ist und sein muss? Meine These ist: Als Praxiszusammenhang
ist der Zusammenhang einer Lebensform prinzipiell reflexiv zugänglich. Er ist mit
Blick auf die Ziele, die wir in unseren Praxiszusammenhängen verfolgen bzw. denen
wir in diesen Ausdruck geben, hinterfragbar – auf Gründe befragbar – und damit –
mit Gründen – veränderbar. Lebensformen sind also vorgängige „Tatsachen des
Lebens“ 17. Daraus zu folgern, dass sie eine vor-reflexive, nicht nicht weiter recht-
fertigbare und in diesem Sinne unhintergehbare Grundlage unseres Handelns sind
beruhte allerdings auf einem verkürzten Verständnis dessen, was hier Reflexivität
bedeutet.
Zu den „Tatsachen“ unseres Lebens selbst gehört nämlich, dass wir in unseren
Handlungsvollzügen zu diesen Stellung beziehen. Auch wenn sie nicht in jedem
ihrer Momente zugänglich und transparent sind, und auch wenn sie nicht per-
manent Gegenstand unserer Reflexion sind, sind Lebensformen Resultate mensch-
licher Tätigkeit, die als solche ohne die prinzipielle Möglichkeit der reflexiven Be-
gleitung nicht denkbar ist. Es handelt sich um etwas, das Menschen ‚tun‘, und das
deshalb auch anders ‚getan‘ werden könnte; das Bewusstsein darüber ist unserem
Tun inhärent. Die Gründe für dieses Tun werden spätestens in dem Moment rele-
vant, wo es in Frage gestellt wird. Die Selbstverständlichkeit unserer Lebensvoll-
züge kann nämlich an innere oder an äußere Grenzen geraten und tut dies auch
regelmäßig, sei es in Form von unscheinbaren Problemen, die der Adjustierung
bedürfen, sei es in Form dramatischerer Infragestellung und Krisen. Solche Störun-
gen sind, das sollte man sich klar machen, nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
Wo eine bestimmte Art von Praktiken und Selbstverständnissen sich nicht mehr
reibungslos vollzieht, sei es, weil andere (in der sozialen Welt) sie in Frage stellen,
sei es, weil ihre sachlichen Verwirklichungsbedingungen sich verändert haben, set-
zen Krisen unterschiedlichen Gewichts ein, infolge derer die entsprechende Praxis
und der entsprechende Zusammenhang von Praktiken zum Gegenstand von Refle-
xion wird. Das kann durch explizite und politische Thematisierung oder durch auf-
tretende Konfrontationen mit anderen Lebensformen verursacht sein, es kann aber
auch durch veränderte Hintergrundbedingungen oder die Veränderung in anderen
Praxiszusammenhängen motiviert sein. Männlich-chauvinistisches Verhalten und
männliche Rollenbilder können so zum Beispiel einerseits durch feministische Kri-
tik und den sich verbreitenden Widerstand von Frauen, herkömmlichen Rollen-
vorstellungen zu entsprechen, in die Krise geraten; sie können aber auch durch
veränderte Arbeitsbedingungen und Qualifikationsanforderungen allmählich un-
tergraben werden – und im Zweifelsfall spielen beide Faktoren zusammen. 18 Der
veränderliche und reflexive Charakter von Lebensformen wird dann offensichtlich,
17 Wittgenstein (1982), § 630.
18
Zu solchen sich verschränkenden Dynamiken als Motor sozialen Wandels siehe Jaeggi (2018; i. E.).
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 73 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 73
selbst wenn es noch so schwer sein mag, Änderungen vorzunehmen, selbst also
wenn sich die hier eingespielten Vorgänge nicht willkürlich ändern lassen. 19
Bei aller Anerkennung eines nichtreflexiven Moments von Lebensformen lässt
sich dann behaupten, dass diese nicht nur einen Spielraum für Reflexivität lassen,
sondern dass dieser Spielraum sogar zu den Konstitutions- und Erhaltungsbedin-
gungen von Lebensformen gehört. Sich in einer Lebensform zu bewegen, ist von der
Reflexion und der Stellungnahme, für die sich letztlich auch Gründe geben ließen,
nicht abzulösen. Wir leben nicht einfach; wir beziehen uns als „self-interpreting
animals“, 20 wertend und stellungnehmend auf das, was wir da tun – auch wenn
das nicht in jedem Moment transparent und auch nicht in jedem Moment nötig ist.
Bewertung und Kritik, sowie das Erstellen und Bestreiten normativer Ansprüche ist
dann etwas, das wir in unseren Lebensvollzügen – und das bedeutet: indem wir eine
Lebensform sowohl reproduzieren wie auch produzieren und uns die Bedingungen
unseres gemeinsamen Lebens aneignen – immer schon tun.
Die Antwort auf die oben gestellte Frage, wie sich der nicht-objekivierbare Cha-
rakter mit der Behauptung eines reflexiven Moments verträgt lautet dann: Das ist
eine falsche Alternative. Die immanent-reflexive Haltung, die ich hier skizziere, ist
gerade nicht gleichbedeutend mit der Behauptung, dass unsere Lebensformen uns
gewissermaßen optional zur Disposition stehen. Sie ist nicht mit der Imagination
eines archimedischen Punkts außerhalb jeder Lebensform identisch. Wenn der ein-
zige Standpunkt, von dem aus Lebensformen intelligibel sind, ein interner Stand-
punkt ist, wir also aus diesem nicht sinnvoll heraustreten können, so ist dieser den-
noch nicht lediglich einer der internen Beschreibung („So sind wir“). Gerade weil
wir involviert sind, ist dieser Standpunkt von der aus der Teilnehmerperspektive
gestellten Frage „Warum machen wir das hier eigentlich?“ begleitet oder kann stets
von dieser begleitet sein. Wir (als Subjekte, die in einer Lebensform leben und diese
in unseren Praktiken reproduzieren) erheben in Bezug auf das, was wir tun, Gel-
tungsansprüche. Das bedeutet wohlgemerkt nicht, dass sie sich auf gute Gründe
beziehen. Es bedeutet aber, dass wir zum Beispiel in Fällen, in denen die eine oder
andere praktische Orientierung in Frage gestellt wird oder vor Problemen steht,
nicht lediglich sagen: „so leben wir eben“, sondern von der Angemessenheit unserer
Praktiken auf die eine oder andere Weise ausgehen und sie verteidigen – und damit
gegebenenfalls in einen Konflikt um Lebensformen eintreten.
3. Die Normativität von Lebensformen
Da aber, wo etwas so, aber auch anders getan werden könnte, da, wo wir etwas
richtig oder falsch, angemessen oder unangemessen tun und dazu Stellung nehmen
19 Was wir beispielsweise für „privat“ oder „öffentlich“ halten, aber auch was wir für den richtigen räum-
lichen Abstand im Umgang mit Fremden halten, steht so lange wie eine verblasste Metapher im selbst-
verständlichen Hintergrund unserer sozialen Bezugssysteme und Handlungsoptionen und unseren kör-
perlich eingeübten Habitusformationen, bis es durch die Konfrontation mit ungewohnten Praktiken oder
der expliziten Thematisierung aus dieser Selbstverständlichkeit geholt wird.
20
Taylor (1985).
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 74 / 26.3.2018
74 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
können, sind wir in einem weiten Sinn im Raum des Normativen. Lebensformen
sind dann nicht nur (mit Wittgenstein) „Tatsachen des Lebens“ 21, sondern auch (mit
Hegel) Instanzen von Sittlichkeit. Damit kommen wir auf ein Merkmal zu sprechen,
das für mein Verständnis von Lebensformen, vor allem aber für ihre Kritisierbarkeit,
entscheidend ist: Lebensformen sind in einem anspruchsvollen Sinne normativ ver-
fasst. Dass Lebensformen überhaupt normativ verfasst sind, ist dabei eigentlich
selbstverständlich. Als Elemente des sozialen Lebens enthalten sie Regeln, Regulie-
rungen, normative Zugehörigkeitskriterien und implizite Annahmen darüber, was
richtig und falsch ist. Wenn Lebensformen sich als „lebendig wirksame Norm-
gefüge“ 22 verstehen lassen, so sind die hier angesprochenen Normen Bestandteil
alltäglicher Praxisvollzüge, drücken sich in diesen aus und realisieren sich in ihnen.
Meine These ist aber noch spezifischer: Lebensformen sind durch „sittliche“ Nor-
men bestimmt, die, im Unterschied zu Konventionen, einen Sachbezug haben und
ethisch-funktional auf das Bestehen und gute Funktionieren des jeweiligen Praxis-
zusammenhangs bezogen sind. Dass sie intern normativ verfasst sind, führt dazu,
dass sie (selbst) Ansprüche verkörpern, an denen sie auch scheitern können. Das soll
im Folgenden erläutert werden.
3.1 Sittliche Normen
Lebensformen befinden sich in einem Raum, in dem Menschen etwas tun, dabei
etwas richtig oder falsch machen können und sich zur Bewertung dessen auf Grün-
de beziehen. Menschliche Sozialität unterscheidet sich von anderen „natürlichen“
Lebensformen dadurch, dass sie nicht nur überhaupt normgeleitet ist, sondern von
Normen ausgemacht wird, die von bewussten Lebewesen bewusst befolgt werden.
Anders also, als es bei instinktgeleiteten sozialen Koordinationsprozessen der Fall
ist, an denen auch Ameisen, Bienen oder Wölfe partizipieren, gehen Menschen nicht
nur mit Regeln konform; sie wissen, implizit oder explizit, dass sie das, nämlich sich
zu diesen Regeln reflexiv verhalten, tun und können. Marx hat bekanntlich die
Arbeit der Biene und die des menschlichen Baumeisters anhand des Umstands ver-
glichen, dass die Biene, so großartig und diffizil die von ihr errichteten Gebilde auch
sein mögen, sich auf diese im Unterschied zum Menschen nicht planend bezieht.
Analog lässt sich formulieren: Auch Bienen leben in durch Regeln koordinierten
Lebensformen, sie wissen es aber nicht; Menschen dagegen tun es und wissen, dass
sie es tun. 23
Der „Raum des Normativen“ ist damit zunächst weit gefasst: Er bezieht sich (mit
einer Hegel’schen Unterscheidung gesagt) auf alles, was „Geist“, nicht „Natur“ ist. Er
besteht also nicht (nur) aus enger gefassten intersubjektiven Verpflichtungen, son-
dern umfasst die Einrichtung unseres Lebens überhaupt, die Gestalt der (mit Hegel)
21
Wittgenstein (1982), § 630, 122.
22 Vgl. Flitner (1990), 11.
23 Dass dieses Wissen auch durch verdinglichende oder (eben!) verdinglichend-naturalisierende Lebens-
umstände verdeckt werden kann, ist ein Umstand, der bereits zum Thema des Scheiterns und der defizitä-
ren Form von Lebensformen führt.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 75 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 75
sittlichen Institutionen, Praktiken und Einstellungen, in denen wir unser Leben füh-
ren: Wie wir arbeiten, wie wir lieben, wie wir wohnen, tauschen und vererben, wie
wir unsere Kinder erziehen oder unsere Toten beerdigen.
Wenn ich hier von „sittlichen Normen“ spreche, dann soll das aber nicht nur auf
den Thematisierungsbereich, sondern auch auf einen bestimmten und zu explizie-
renden Normtypus hinweisen. Die Normen, die Lebensformen konstituieren, wirken
nicht wie eine Anstaltsordnung auf die Anstalt oder die Schulordnung auf die Schu-
le. Von einer normativen Verfasstheit von Lebensformen zu sprechen bedeutet näm-
lich nicht, dass Lebensformen sich aus expliziten Vorschriften zusammensetzen. Für
eine Lebensform ist ein Geflecht aus mehr oder weniger ausdrücklichen Üblich-
keiten, Gebräuchen und Übereinkünften konstitutiv, das teils formell, teils infor-
mell, teils implizit, teils explizit, manchmal auch nur über Markierungen von Zu-
gehörigkeit und Intelligibilität das Verhalten der an ihr Teilhabenden lenkt und
formiert. Selten lässt sich hier ein distinkter Norm-Autor identifizieren, ein Großteil
der Normen ist anonym, wirkt qua Überlieferung und ist im Charakter viel zu selbst-
verständlich, als dass sie als Normen überhaupt auftreten und als solche erfahren
werden. Obwohl es für Lebensformen typisch ist, Zugehörigkeitskriterien (und ge-
nereller: den Raum des Intelligiblen) zu definieren – und obwohl sie als solche, wie
Normen es tun, auch Verhalten lenken – geschieht dies doch in einer Mischlage von
ausdrücklicher und unausgesprochener, beabsichtigter und unbeabsichtigter Len-
kung.
3.2 Sachbezug, Zielbestimmung und ethisch-funktionale Normen
Der „normative Druck“, den solche sittlichen Normen auf ihre Mitglieder ausüben,
funktioniert also in manchen Hinsichten subtil; dennoch handelt es sich, so will ich
jedenfalls behaupten, nicht um die schwache Normativität bloßer Regeln, die, ana-
log zu Spielregeln, lediglich definieren, „wie man das Spiel spielt“, sondern um Nor-
men der Gestaltung gesellschaftlicher Reproduktionsbedingungen, die einen Wider-
part in der Sache, d. h. in den materialen und sozialen Bedingungen der „Welt“, die
mittels der Normen und Praktiken gestaltet wird, haben. 24 Sind, wie Joseph Raz in
seiner Untersuchung Praktische Gründe und Normen definiert, Spiele und die diesen
entsprechenden normativen Gebilde „autonome normative Systeme“ 25, die in ent-
scheidender Hinsicht selbstbezüglich sind und deren Geltung sich nicht begründen,
sondern nur feststellen lässt, so sind Lebensformen und die diese konstituierenden
sittlichen Normen eben nicht autonom, sondern, wieder mit Raz Formulierung, mit
„umfassenderen menschlichen Interessen intrinsisch verbunden“ 26. Lebensformen
sind intern strukturiert durch die mit ihnen gegebenen Ziele und Aufgaben, die
24
In meinem Buch Kritik von Lebensformen entwickle ich diese Überlegungen ausführlicher anhand einer
Auseinandersetzung mit Georg von Wrights Unterscheidung von Regeln und Vorschriften und den „Ge-
bräuchen“ (die meinen „sittlichen Normen“ nahekommen) als Mischform der beiden.
25 Raz (2006), 159.
26
Raz (2006), 166.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 76 / 26.3.2018
76 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
ihnen gleichzeitig, bildlich gesprochen, einen über die internen Geltungsprinzipien
hinausgehenden ‚Anker‘ oder Bezugspunkt in der Welt verleihen.
Man versteht die Normativität von Lebensformen also im Anschluss an die oben
behauptete teleologische Struktur der Praktiken, die Lebensformen ausmachen.
Praktiken, so hatte ich oben gesagt, beziehen sich auf Ziele. Ich verstecke mich
hinter dem Baum, damit mich beim Versteckspielen niemand findet; ich bezahle an
der Kasse, um die Lebensmittel für die geplante Essenseinladung mit nach Hause
nehmen zu können. Ich veranstalte das Abendessen, weil ich zwei Freunde mit-
einander bekannt machen möchte, und genereller um meine Freundschaften zu
pflegen. Das alles geschieht im Kontext von weiterreichenden Praxisketten (bürger-
liche Gastlichkeit, Kinderspiel) und Interpretationen (Freundschaft, Kindheit), die
zusammen Lebensformen unterschiedlicher Größe und Zuschreibung ausmachen.
Nun haben solche Praktiken konstitutive interne Gelingensbedingungen: Wenn du
nicht wenigstens versuchst, dich zu verstecken, ist es nicht (oder gilt es nicht als)
Versteckspielen; wenn du die Lebensmittel lediglich fotografierst, im Geschäft nur
mit dem Besitzer plauderst und darüber das Aussuchen von Waren vergisst, ist es
nicht Einkaufen. Lebensformen haben aber nicht nur quasi definitorische Bedin-
gungen des Gelingens. Die hier involvierten Praxiszusammenhänge sind darüber
hinaus mit praxisimmanenten Zielen verknüpft. Wir spielen um miteinander Spaß
zu haben und gemeinsam Momente von Spannung zu erleben, indem wir einander
schwierige Aufgaben stellen. Dem widerspricht nicht nur ein Handeln, das die mit
dem Spiel gesetzten Regeln missachtet (wo eine solche Missachtung der Regeln
bedeutet: „das Spiel nicht zu spielen“), sondern auch eine Haltung, die dieses Ziel
untergräbt (wie zum Beispiel wenn jemand sich entweder gar nicht oder zu unver-
söhnlich darüber ärgert, wenn er verliert).
Der entscheidende Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass die Normen, die
Lebensformen strukturieren – oder vielmehr, die sich in ihnen ausdrücken – nicht
als Konventionen zu verstehen sind. Konventionelle Vereinbarungen können durch
ähnliche Vereinbarungen ohne Verlust ersetzt werden. Ob wir auf der linken oder
rechten Straßenseite fahren, macht keinen Unterschied, solange wir nur überhaupt
eine klare Regel einführen. Aber dies gilt nicht für die Normativität, die soziale
Praktiken strukturiert. Wenn es zum praktischen Ethos (wenn auch nicht immer
zur Wirklichkeit) der ärztlichen Tätigkeit gehört, Patienten gründlich zu unter-
suchen und umgekehrt nicht, mit Blick auf die Abrechnungsmöglichkeiten, über-
flüssige Diagnostik anzuordnen, dann ist diese Norm keine konventionelle Einigung
darüber, was es bedeutet, Arzt zu sein; sie hat Gültigkeit mit Blick auf die Sache und
das Ziel der Praxis, sie ist Bedingung für das angemessene Heilen. Damit ist diese
Norm Bedingung des Gelingens einer (ihrerseits normativ geprägten) Praxis. So
lassen sich in Verbindung der inhärenten Ziele der Praxis – die Gesundung des
Patienten – zusammen mit den sachlich-materialen Bedingungen, die das Erreichen
dieses Ziels bestimmen (hier: die menschliche Konstitution), bestimmte Anforde-
rungen an das, was zu tun ist, formulieren. Normen sind in diesem Sinne die Gelin-
gensbedingungen einer ihrerseits normativen Praxis. Praktiken spezifizieren mit
ihren Zwecken und durch die sie strukturierenden Normen auch die Rollen, die
Individuen einnehmen können, um an der Praxis teilzunehmen. Individuelle Hand-
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 77 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 77
lungen gelingen dann, wenn sie die kollektiven Zwecke der Praxis ausdrücken. Ich
tue, in einem bestimmten Kontext, das Richtige, wenn ich das mit der Praxis gesetz-
te Ziel erreicht habe.
Die Normen (in ihrer Rolle als Gelingensbedingungen) haben also einen materia-
len Sachbezug, sie sind auf das Funktionieren eines Praxiszusammenhangs gerich-
tet und für dieses konstitutiv. Die normative Angemessenheit meines Praxisvollzugs
wäre dann gewissermaßen unter dem Gesichtspunkt der Konstitution und Erhaltung
eines Praxiszusammenhangs „funktional“ bestimmbar. Angemessen ist ein be-
stimmter Vollzug, wenn er zur Realisierung des Ziels beiträgt oder, weniger instru-
mentalistisch, sofern er als Ausdruck des hier erstrebten Ziels verstanden werden
kann 27. Soziale Praktiken und Institutionen sind dabei aber nicht nur funktional
hinsichtlich bestimmter Ziele; in ihnen verkörpert sich auch etwas, das man als das
„Ethos dieser Praktiken“ bezeichnen kann. Warum sollte man als Vater seinem Kind
vorlesen oder ihm Dinge erklären? Und warum soll man als Ärztin seine Patienten
gründlich untersuchen? Weil es gut ist, dies zu tun und weil nur dasjenige Set an
Praktiken und Einstellungen als gute Erziehung gelten kann, das solche (Teil-)Prak-
tiken des Vorlesens oder Erklärens beinhaltet. Das Ethos einer Praxis definiert also
die Bedingungen, unter denen diese als gute Praxis ihrer Art gelten kann, und die
ethische Begründung sagt entsprechend, dass eine Praxis so oder so ausgeübt wer-
den sollte, weil diese Art der Ausübung den ethischen Anforderungen an diese Pra-
xis entspricht. Meine Behauptung ist nun, dass in Bezug auf die sittlichen Normen,
funktionale und ethische Dimensionen nicht getrennt voneinander auftreten, son-
dern einander durchdringen, konstitutiv aufeinander bezogen sind. Das Funktionie-
ren und das gute Funktionieren, Praxis überhaupt und gute Praxis, lassen sich nicht
voneinander trennen. Es gibt im Bereich menschlicher Aktivitäten kein Funktionie-
ren per se, sondern allein ein immer schon mehr oder weniger gutes Funktionieren.
Wir bewegen uns – anders als bei der Bestimmung der Funktionstüchtigkeit eines
Messers – in einem Bereich, in dem schon das Funktionieren normativ beschrieben
werden muss und Gelingensbedingungen hat, die mit der Art des Funktionierens
zusammenhängen. „Zu funktionieren“ bedeutet immer, mehr oder weniger gut zu
funktionieren, es gibt kein „Funktionieren pur“, ohne Bezug auf die einer Praxis
immanenten Kriterien des Gutseins, genauso wenig wie es in Bezug auf menschliche
Lebensformen so etwas wie „rohe Fakten“ oder „reines Überleben“ gibt. Was eine
Praxis überhaupt zu einer bestimmten Praxis macht, scheint sich an den Qualifika-
tionen zu orientieren, die sich auf das gute Ausüben einer Praxis richten. Auf der
anderen Seite fallen ethische Normen nicht vom Himmel, sie beziehen sich auf eine
Aufgabe oder ein Ziel und dessen Gelingensbedingungen. Deshalb lässt sich davon
sprechen, dass sittliche Normen (als diejenigen Normen, die Lebensformen konsti-
tuieren) sowohl ethischen wie auch funktionalen Charakter haben, ja in einer
Durchdringung von beidem bestehen. Ich möchte diese Normen, die Praktiken aus-
richten und konstituieren, also ethisch-funktionale Normen nennen.
27 Angelehnt an v. Wrights „Idealregeln“: Ich untersuche nicht gründlich, um ein guter Arzt zu sein, so wie
ich eine Leiter nehme, um an die oberen Regale heranzukommen; vielmehr ist die Gründlichkeit das, was
es bedeutet, ein guter Arzt zu sein.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 78 / 26.3.2018
78 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
3.3 Normatives Scheitern von Lebensformen: Seinem Begriff nicht entsprechen
Weil nun Lebensformen durch Normen der beschriebenen Art konstituiert sind,
können wir in Bezug auf sie etwas falsch machen, indem wir den mit ihnen gesetz-
ten Anforderungen nicht entsprechen oder ihren Sinn verfehlen. Wir sind dann
„keine richtige Familie mehr“, falls wir einander indifferent begegnen oder unsere
Zusammenkünfte nur durch Zwang oder finanzielle Interessen zusammengehalten
werden. Wir sind dann „keine richtigen Städter mehr“, wenn wir uns in öffentlichen
Räumen nicht zu bewegen wissen, die für Städte erforderliche Geschmeidigkeit und
den für diese typischen Umgang dem Fremden nicht aufbringen können.
Weil sie durch Normen konstituiert sind, können aber nicht nur wir an den Erfül-
lungsbedingungen einer bestimmten Lebensform scheitern; die Lebensform selbst
kann defizitär sein; sie kann daran scheitern, eine angemessene Instanziierung des
mit ihr gesetzten normativen Gebildes zu sein. Das tut sie dann, wenn wesentliche
der für sie konstitutiven Praktiken und Institutionen fehlen oder wenn sie von an-
grenzenden Praktiken so beeinflusst wird, dass sie sich selbst untergräbt. Wenn es
zum Beispiel in einer Stadt gar keine öffentlichen Räume mehr gibt, weil kommer-
zielle Angebote diese verdrängen oder wenn der soziale Druck dazu führt, dass das
„Miteinander von Verschiedenen“, das das normative Ideal der Stadt ausmacht 28,
sozialer Segregation Platz macht oder explosiv wird, kann man davon sprechen,
dass die Stadt als Lebensform gescheitert ist oder dass das, was wir hier vorfinden,
„keine Stadt mehr ist“. Ebenso könnte man von Universitäten, deren wissenschaft-
liches und pädagogisches Ethos von ökonomischer Wettbewerbslogik untergraben
wird, sagen, dass diese keine Universitäten mehr sind.
Es sagt nun etwas über die spezifische Normativität von Lebensformen aus, dass
sie auf diese Weise scheitern oder dass wir sie auf diese Weise verfehlen können.
Diese Normativität ist nämlich in zu erläuternder Hinsicht immanent. Mit der Span-
nung zwischen dem Begriff und seiner Verwirklichung wird nicht eine schlichte
Differenz zwischen normativ Gefordertem und empirisch Eingelöstem ausgemacht.
Vielmehr gewinnt eine solche Argumentation ihre Standards aus den mit einer Pra-
xis oder Lebensform gesetzten Bedingungen und aus ihren eigenen Ansprüchen.
In Lebensformen als „sittlichen“ Gebilden ist offenbar ein normativer Anspruch
eingelassen, der nicht den Charakter des bloßen freischwebenden Sollens hat: Wenn
wir in diesem Sinne sagen: „Aber das ist doch keine Stadt mehr“ (weil die öffent-
lichen Räume fehlen) oder „das ist doch keine Familie“ (weil etwa die Familienmit-
glieder einander indifferent gegenüberstehen und nicht mehr miteinander spre-
chen), so ist das eine beschreibende Bewertung. In eine Hegelsche Kurzform
gebracht, entspricht ein solches Gebilde nicht seinem ‚Begriff‘. Dieser Begriff be-
zeichnet, wie ich vorschlagen möchte, so etwas wie das Gesamt der „sozialen Gat-
tungseigenschaften“ eines sozialen Gebildes 29. Verfehlt eine soziale Lebensform
dieses, so fehlen ihr typische konstitutive Merkmale der mit ihr verbundenen Prak-
tiken; es ist dann „kein gutes Exemplar seiner Gattung“. Spricht man dem in Frage
28 Siehe zu einer solchen normativen Auffassung von Stadt: Young (1990), 236–241.
29
Siehe dazu ausführlicher Jaeggi (2014), Kapitel 3–4.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 79 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 79
stehenden Gebilde dann gewissermaßen die sozialen „Gattungseigenschaften“ ab,
so behauptet man, dass ihm die Eigenschaften fehlen, die das definieren, was es als
Institution oder Lebensform ausmacht. Entscheidend für die Art der Defizienz eines
solchen Gebildes ist aber, dass es durch das Fehlen dieser Merkmale nicht einfach
aufhört, eine Instanziierung des Begriffs zu sein: Die Gattungsmerkmale sind dann
zwar unreif, verkümmert, defizitär, bleiben dabei aber an ihre Charakterisierung
durch den Begriff gebunden. Die Familie, die „ihren Begriff verfehlt“, ist nicht ein-
fach keine Familie mehr; die Stadt nicht plötzlich etwas anderes als eine Stadt.
Nun findet man, nach oben Gesagtem, soziale Gattungseigenschaften, anders als
natürliche, nicht einfach vor. Gleichzeitig sind sie aber nicht willkürlich gesetzt und
entspringen nicht einer willkürlichen Vereinbarung. Man kann die hier wirkende
Normativität des Begriffs, die Autorität, die der Begriff damit über die Wirklichkeit
zu haben scheint, weder kontraktualistisch noch traditionalistisch verstehen 30. We-
der resultieren die Zuschreibungen sozialer Gattungseigenschaften lediglich daraus,
dass wir uns geeinigt haben, dass zu einer Stadt bestimmte Merkmale gehören, noch
daher, dass es nun einmal immer schon so war. Sie resultiert, und das ist entschei-
dend für meine weitere These, daraus, dass sich im Begriff eine ihrerseits soziale und
normativ geprägte Problemlösungsgeschichte sedimentiert hat. Die defizitäre Ver-
wirklichung eines ‚Begriffs‘ scheitert in diesem Sinne an der in diesem sich sedi-
mentierenden Aufgabenstellung. Der Begriff ‚fixiert‘ eine historisch erreichte Pro-
blemstellung, er ist der Platzhalter einer Problembeschreibung. Seinem Begriff nicht
zu entsprechen bedeutet dann in Bezug auf soziale Gebilde, die mit ihm gesetzten
Aufgaben nicht zu erfüllen und damit der Sache gegenüber und dem mit einer
Praxis gesetzten Ziel gegenüber unangemessen zu sein.
Der ethisch-funktionale Charakter nun der in Lebensformen implizierten Normen
sowie der Umstand, dass es sich hier um Ansprüche handelt, die auf bestimmte
Weise als Zielbestimmung immanent mit der Gestalt der entsprechenden Praktiken
und Lebensformen verwoben sind, führt also dazu, dass Lebensformen auf eine be-
stimmte Weise scheitern können, die ich als „normatives Scheitern“ bezeichne.
4. Lebensformen als Problemlösungsinstanzen
Die im Handlungskontext einer Lebensform leitenden Ziele einer Lebensform
spezifizieren also deren normativ interpretierte Gelingensbedingungen. Diese Ziele
(oder Zwecke) werden von uns aber nicht einfach willkürlich gesetzt: Sie kommen
als Anforderungen, die mit „umfassenden menschlichen Interessen“ (Raz) der Le-
bensbewältigung verbunden sind, ‚aus der Welt‘ ; allerdings sind sie als solche be-
reits historisch Teil einer Problemlösungsgeschichte (d. h. der Geschichte der Bewäl-
tigung solcher Aufgaben). Von den die Lebensformen strukturierenden Ziele her
gedacht bedeutet das: Diese sind weder einfach mit einer Lebensform gesetzt, noch
einfach von uns bestimmt, sondern immer schon Reaktionen der Lebensform auf die
30 Und, angesichts der mangelnden Fixiertheit der Eigenschaften und Funktionen, wie man sie bei natür-
lichen Gattungseigenschaften noch annehmen mag, natürlich auch nicht aus diesen selbst.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 80 / 26.3.2018
80 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
sich stellenden Anforderungen und Probleme – umgekehrt bleiben es aber Proble-
me, die sie sich immer auch selbst setzen, weil sie als die spezifischen und immer
schon als solche interpretierten Probleme, die sie sind, nur innerhalb einer bestimm-
ten Lebensform auftreten können.
Meine These ist also: Lebensformen stellen eine bestimmte Form des Problemlö-
sens dar, sie sind Problemlösungsinstanzen in Bezug auf immer schon normativ
imprägnierte und historisch situierte Probleme zweiter Ordnung. In Lebensformen
verkörpern sich Reaktionen auf Probleme, Versuche, die Probleme zu lösen, die sich
für sie und mit ihnen stellen. In ihnen sedimentieren sich Problemlösungsgeschich-
ten, eine Abfolge von Problemen oder Krisen und deren (mehr oder weniger gelun-
gene) Bewältigung, aus denen sich die folgenden Problemstellungen ergeben. Auch
diese Formel möchte ich jetzt schrittweise „entpacken“. Was sind im Kontext dessen,
was ich hier Lebensformen nenne, Probleme? Was sind deren Lösungen? Und in
welchem Sinne können Lebensformen als solche fungieren?
4.1 Probleme als Aufgabe und Schwierigkeit
Meine Verwendung des Problembegriffs macht sich eine charakteristische Dop-
peldeutigkeit zunutze: Wenn jemand sich „vor ein Problem gestellt sieht“, so kann
das entweder bedeuten: „Er steht vor einer Aufgabe“ oder: „Er steht vor einer
Schwierigkeit“. Die Rede von Lebensformen als Problemlösungsversuchen kann
entsprechend entweder bedeuten, dass sich die Formen des Zusammenlebens vor
bestimmte Aufgaben gestellt sehen, die sie zu lösen haben, ohne dass dabei immer
schon impliziert wäre, dass hier etwas bereits schwierig geworden ist. Oder aber sie
bedeutet, dass Lebensformen mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, also mit einem
Zustand, in dem etwas „problematisch“ geworden oder in eine Krise geraten ist. Ein
Problem in diesem Sinne tritt dort auf, wo bestimmte Handlungsabläufe ins Stocken
geraten, Interpretationen fehlgehen, uns das, was wir tun und wollen, nicht mehr
gelingt oder das, was wir geglaubt haben zu verstehen, unverständlich oder inkon-
sistent wird. Die hier vorgeschlagene Verwendung des Problembegriffs denkt beide
Bedeutungen als ineinander verwoben: Lebensformen stoßen bei der Bewältigung
von Problemen im Sinne von Aufgaben immer schon auf Probleme im Sinne von
Schwierigkeiten. Dabei wird die Aufgabenstellung manchmal nur über die auftre-
tenden Schwierigkeiten – oder auch Krisen – sichtbar. In beiden Hinsichten sind
Lebensformen reaktiv, also nicht aus dem Nichts und nicht frei entworfen – und in
beiden Hinsichten reagieren sie auf materielle Lebensbedingungen, sind also be-
dingt, dabei aber, gemäß der oben entwickelten These von der dynamischen Durch-
dringung von Natur und Kultur, bedingt durch immer auch schon sozial konfigu-
rierte, sowie normativ und historisch imprägnierte Voraussetzungen.
4.2 Der historisch, kulturell und normativ situierte Charakter der Probleme
Der immer schon historisch und kulturell situierte, aber auch der normativ ver-
fasste Charakter der Probleme, um die es in Bezug auf Lebensformen geht, lässt sich
hier anschließen. Man kann beispielsweise die Familie als Lösung des Problems der
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 81 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 81
sozialen Reproduktion auffassen, ein Problem, von dem sich behaupten lässt, dass
jede gesellschaftliche Formation es auf die eine oder andere Weise zu lösen hat. Nun
bedeutet Reproduktion im Zusammenhang menschlich-kultureller Lebensformen
aber nicht nur das Erzeugen und Erhalten von Nachwuchs im biologischen Sinn,
sondern dessen Einübung in die Praktiken, Gebräuche, Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Institutionen einer je bestimmten Gesellschaft – in eine immer schon spezi-
fische und historisch als solche gewachsene Lebensweise also. Das (biologische)
Leben hat dann immer schon eine bestimmte – nämlich gesellschaftlich und his-
torisch konkrete – Form. Diese wiederum ist von den Bedingungen und Bedingt-
heiten des Lebens und der Natur nicht unabhängig, als Überformung derselben aber
eben auch nicht mit ihnen identisch. 31
Auf die Familie zurückbezogen: Es ist nicht die ewige Naturnotwendigkeit der
familiären Reproduktion, um die es hier geht, sondern diese in einer konkreten und
bestimmten Gestalt, die in einer je bestimmten sittlichen Konstellation immer wie-
der neu gestaltet wird. In die oben eingeführte Unterscheidung von Problem als
„Aufgabe“ und „Schwierigkeit“ eingetragen: Lebensformen, wie ich sie hier be-
trachte, sind nicht (jeweils) mit einer ewig gleichbleibenden Aufgabe oder überhis-
torisch gleichbleibenden Konstanten konfrontiert, für die ihre historisch sich ver-
ändernden Varianten von der erweiterten Großfamilie des ‚ganzen Hauses‘ über die
bürgerliche Kleinfamilie bis zur posttraditionalen, nicht mehr ausschließlich hetero-
sexuell codierten Patchworkfamilie oder der polyamourös organisierten Beziehung
(um im Beispiel zu bleiben) sich als jeweils neue Lösungen darstellen. Sie sind, im
Gegenteil, immer schon mit Problemen konfrontiert, die sich aus vorhergehenden
Problemlösungen ergeben haben – und sind damit immer auch eine Reaktion auf
die sich ergebenden Krisen und Transformationsprozesse, die diese in der Bewälti-
gung ihrer Aufgaben durchmachen. Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist dann
nicht der imaginäre Nullpunkt eines von kulturellen Lebensformen unabhängigen
oder diesen zugrundeliegenden „nackten Bedürfnisses“, sondern gleich die kulturel-
len Formationen selbst und mit diesen die Probleme, in die sie geraten und deren
Lösung sie verkörpern.
„Probleme“, wie ich sie in diesem Zusammenhang verstehe, sind also erstens
kulturell spezifisch und historisch wie sozial formiert. Sie treten nur im Kontext
einer immer schon gestalteten und je bestimmten, historisch situierten und sozial
instituierten Lebensform auf, entstehen aus einer bereits gestalteten und interpre-
31 Wenn ich nun vorschlage, das Verhältnis zwischen beiden Seiten als dynamisches aufzufassen, so be-
deutet das, dass die Seite des Lebens, der Reproduktion, der menschlichen Bedürfnisse (wie auch immer
man das nennen will) den Formen, in denen dieses geschieht, nicht abstrakt und gleichbleibend gegen-
übersteht, sondern dass beide Seiten sich wechselseitig durchdringen. Die Natur oder, genereller gespro-
chen, die materialen Bedingungen unserer Existenz ragen also nicht statisch in die Sittlichkeit hinein; sie
sind dynamisch mit ihr verflochten. Lebensformen bilden das „Material“ des Lebensprozesses – sie sind
keine äußerlich bleibende oder dazukommende Form und nicht eine Form im Sinne eines Gefäßes, das die
Problemstellungen/Lebenslagen „aufnimmt“, sondern sie sind Form im Sinne der Formierung und „geis-
tigen“ Durchbildung des Vorgefundenen. Auch das ist ein mit Marx und seiner „materialistischen Ge-
schichtsauffassung“ kompatibler Gedanke: Die Veränderung der Bedürfnisse und der Mittel zu ihrer Be-
friedigung ist ein historischer Prozess der Auseinandersetzung mit der Natur, in dem sich beide Seiten, die
Natur und die Gesellschaft, wechselseitig durchdringen, weil und sofern sie sich durcheinander verändern.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 82 / 26.3.2018
82 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
tierten Situation heraus. Versteht man also Lebensformen als Problemlösungs-
instanzen, so fängt man in der ‚Mitte der Dinge‘, d. h. in einer schon durch Praktiken
und darin entstehende Probleme strukturierten Welt, in der Mitte eben jenes Ver-
hältnisses und jenes Prozesses der Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen
und damit auch in der Mitte eines bereits sich vollziehenden Problemlösungspro-
zesses an, den man als eine stetige Reaktion auf die in den jeweiligen Formationen
stets in neuer Form auftretenden Krisen und Probleme auffassen kann. Probleme
sind demnach nicht Probleme an sich – und sie sind keine ‚nackten Tatsachen‘. Sie
sind einer immer schon bestimmten Lebensform gestellt, aber auch mit ihr gestellt.
4.3 Probleme zweiter Ordnung
Die Probleme, mit denen Lebensformen es als Lebensformen zu tun haben – und
in Bezug auf deren Lösung sie sich als angemessen oder unangemessen darstellen
können –, sind nämlich Probleme zweiter Ordnung. Als Probleme zweiter Ordnung
verstehe ich Probleme in Bezug auf die konzeptionell-kulturellen Ressourcen, die
einer Lebensform zur Verfügung stehen, um Probleme erster Ordnung zu lösen.
Nehmen wir zum Beispiel eine agrarisch geprägte Gesellschaft, die von einer Hun-
gersnot heimgesucht wird, weil es seit Monaten nicht geregnet hat. Der Nahrungs-
mangel ist klarerweise ein Problem erster Ordnung für die Reproduktion dieser Ge-
sellschaft: Menschen verhungern. Zu einem Problem zweiter Ordnung hingegen
führt die Hungersnot, wenn sich herausstellt, dass die Gesellschaft aus irgendeinem
Grund nicht in der Lage ist, auf dieses Problem erster Ordnung zu reagieren. Pro-
bleme zweiter Ordnung betreffen also nicht den unmittelbar entstandenen Mangel,
sondern die Praktiken und Institutionen, die es möglich (oder eben unmöglich) ma-
chen, auf diesen zu reagieren. Sollten Dürreperioden ein regelmäßiges Vorkommnis
sein, die Gesellschaft aber dennoch nicht mit entsprechenden Maßnahmen – wie
dem Bau von Speicherhäusern – reagieren, so ist diese Reaktionsunfähigkeit ein
Problem zweiter Ordnung. Möglicherweise stellt sich die in Frage stehende Gesell-
schaft dem Problem nicht oder leugnet es; es mag sich auch herausstellen, dass dies
mit einer unzulänglichen Vorstellung von Naturvorgängen zu tun hat oder gar mit
der Glaubensvorstellung, dass Verhungern als Strafe Gottes hinzunehmen sei. Oder
aber eine Gesellschaft – wie dies für die selbstinduzierten Versorgungskrisen einer
global entwickelten Weltwirtschaft nicht selten der Fall ist – hätte zwar das Poten-
tial der Lösung einer Krise, nicht aber den (politischen) Willen, bestimmte Krisen
auslösende ökonomische Mechanismen oder die von diesen profitierenden Macht-
verhältnisse auszuhebeln. In all diesen Fällen sieht sich diese Gesellschaft dem ge-
genüber, was ich als ein Problem zweiter Ordnung bezeichne. Probleme zweiter
Ordnung beziehen sich also nie auf ‚nackte Tatsachen‘, sondern Fakten, die sich erst
aus etablierten Praktiken und Interpretation ergeben – selbst wenn diese Probleme
aus einem (kontingenten) Problem erster Ordnung erwachsen.
Es sind nun Probleme oder Krisen zweiter Ordnung, die ein Problem für die ent-
sprechende Lebensform als Lebensform darstellen. Ist die Tatsache, dass Leute ver-
hungern, im einen Fall (in dem es sich lediglich um ein Problem erster Ordnung
handelt) ein schreckliches Unglück, so ist es erst im zweiten Fall (in dem es sich
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 83 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 83
um ein ‚selbstgemachtes‘ Problem zweiter Ordnung handelt) ein Indiz für die Ver-
fehlung und das Scheitern einer Lebensform, mit dem die etablierten Institutionen
und Praktiken jener Gesellschaft fraglich werden.
Wohlgemerkt: Bei der Unterscheidung zwischen Problemen erster und zweiter
Ordnung geht es weniger um eine substanzielle Unterscheidung zwischen ‚objekti-
ver‘ Anforderung und den internen Problemen der Bewältigung. Vielmehr ist die
Unterscheidung analytischer Natur. Gesellschaften stellt sich das Problem der ersten
Ordnung selbst immer schon als interpretiertes. Die Unterscheidung von Problemen
erster und zweiter Ordnung ist in dieser Hinsicht eine lediglich analytische Unter-
scheidung; für uns fassbar sind die Probleme nur als Probleme zweiter Ordnung. Die
analytische Annahme einer Dimension erster Ordnung hält dabei allerdings offen,
dass es nicht nur immanent verfasste Probleme, sondern auch einen (in gewisser
Hinsicht) externen oder auch kontingenten Problemdruck geben kann.
Probleme sind dann aber immer auch schon normativ verfasst, die Problemwahr-
nehmung selbst von den normativen Erwartungen einer institutionellen Ordnung
geprägt. Hungern, als Resultat ungerechter Verteilung oder irrationaler Vorsorge
erkannt, ist ein Problem – bis hin zur Krise. Hungern, aufgefasst als Strafe Gottes,
ist Schicksal. Lebensformen geraten in Krisen oder stehen vor Problemen aufgrund
von normativ vordefinierten Situationsbeschreibungen.
4.4 Immanenter und normativer Charakter der Probleme:
Selbstgemacht und doch vorgefunden
Wenn man aber das Konzept des Problems so versteht, zeigt sich eine Schwierig-
keit. Um es als Frage zu formulieren: Sind Probleme oder Krisen nur ‚subjektiv‘
gegeben; sind sie von uns konstruiert oder sogar eine Fabrikation unserer Interpre-
tationen? Oder sind sie objektiv; existieren also unabhängig von unserer Situati-
onsinterpretation? Meine Antwort lautet: Beides – Probleme sind gleichermaßen
gegeben und gemacht. Probleme müssen zunächst einmal als solche aufgefasst und
dementsprechend auch so interpretiert werden. Die Probleme, die uns hier interes-
sieren können, sind, das hatte ich oben bereits angedeutet, nicht ‚nackt‘, keine brute
facts. Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich um reine Konstruktionen handelt. Pro-
bleme machen sich als Herausforderungen und Hindernisse bemerkbar, mit denen
sich die praktische Sphäre konfrontiert sieht, ohne dass jene schon die spezifische
Form eines „Problems“ angenommen haben. So lässt sich die scheinbare Paradoxie
meiner Beschreibung von Problemen auflösen. Ein Problem ist insofern gegeben, als
es in einer bestimmten Situation Anzeichen einer Krise gibt. Es ist insofern gemacht,
als die Identifizierung von etwas als Problem ein solches aus noch unbestimmtem
Material erschafft, präzisiert, spezifiziert und benennt. Selbst wenn das Problem
sich als ‚objektiv‘ darstellt, das nicht ignoriert werden kann, ist das, was erkennbar
ist, so unbestimmt, dass es nur durch eine Interpretationsleistung zu einem konkre-
ten Problem werden kann 32.
32John Deweys differenzierte Auffassung des objektiv-subjektiv oder gleichzeitig konstruiert wie gege-
benen Charakters von Problemen, die sich den Weg aus der Unbestimmtheit in die Bestimmtheit des
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 84 / 26.3.2018
84 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
Probleme sind, mit anderen Worten, weder einfach vorhanden, noch kann man
sie aus dem Nichts erschaffen. Eine angemessene Problemwahrnehmung muss auf
etwas basieren, das unabhängig von uns existiert und durch eine Störung der Nor-
malität auf sich aufmerksam macht. Deshalb können Probleme nicht einfach igno-
riert oder weggeredet werden. Ob ein Problem adäquat interpretiert und die angeb-
liche Lösung erfolgreich ist, lässt sich danach bemessen, ob der probleminduzierte
‚Druck‘ nachlässt. Und selbst, wenn es sich hierbei auch um eine Interpretations-
frage handelt, kann man doch den tatsächlichen Problemgehalt durch einen Anpas-
sungsprozess zwischen Problem und Problembeschreibung ermitteln.
4.5 Problemlösung als Emergenz und mögliche Missverständnisse
Inwiefern aber nun lösen Lebensformen Probleme? Was tun sie um das zu tun?
Sie organisieren unser Leben, stellen die Handlungsmuster und die Institutionen
bereit, in denen wir leben und sind dabei jeweils Ausdruck eines bestimmten Pro-
blemstands und jeweils Zwischenstand eines bestimmten Problemlösungsprozesses.
Die bürgerliche Familie transformiert, glaubt man Hegel, die traditional-patriarcha-
le Familie in Richtung einer Verwirklichung von Freiheit in einer Institution, in der
Bindung und Unabhängigkeit miteinander vereinbar werden oder in der (laut Neu-
houser 33) die individuellen Triebbedürfnisse als „geistige“ gelebt und die „flüchtige
Neigung“ als Moment von Sittlichkeit stabilisiert werden kann. Das Problem vor
dem sie steht ist die Vermittlung von Freiheit und Bindung, einer Unabhängigkeit,
die sich durch die Anerkennung der Abhängigkeit hindurch realisieren soll. Sofern
aber eben diese Familienformation, so die feministische Kritik, selbst patriarchal
bleibt, die Autonomie ihrer weiblichen Mitglieder untergräbt und auf einem fal-
schen Dualismus zwischen Natur und Geist, Besonderem und Allgemeinem, der
gefühlsbetonten Natur der Frau und der auf Allgemeinheit zielendenden Vernunft
des männlichen Prinzips beruht, gerät eben diese – moderne – Familienformation
aufgrund des von ihr selbst geschaffenen Konfliktpotentials, aber auch einer sich
um sie herum (erneut) verändernden Welt (zum Beispiel der Arbeit) unter Druck und
in vielfältige Krisen. Die unter diesen Bedingungen erfolgende Neubestimmung der
Geschlechterverhältnisse wie auch die Öffnung der Familie zu sexuell anderen als
heterosexuellen Orientierungen, aber ggf. auch zu polyamourösen Experimenten,
lassen sich als Reaktion auf den daraus resultierenden Problemdruck und die in
diesem deutlich werdenden Defizite des klassischen familiären Modells auffassen 34.
An dieser Stelle möchte ich einigen möglichen Missverständnissen vorbeugen,
die die Deutung von Lebensformen als Problemlösungsinstanzen kontraintuitiv er-
scheinen lassen könnten. So lässt sich bezweifeln, dass irgendjemand, der zum Bei-
spiel in die Lebensform der bürgerlichen oder auch der nachbürgerlich-postkonven-
tionellen Familie eingelassen ist oder der die Stadt als Lebensform preist, diese als
Lösungsprozesses bahnen, ist hier instruktiv. Vgl. Dewey (2002), S. 131 ff. und meine Darstellung Deweys
in Jaeggi (2014), Kapitel 4.2 und 9.1.
33 Vgl. Neuhouser (2000).
34 Zur Kritik an der Vorstellung, hier handle es sich um lineare Entwicklungsprozesse, siehe Jaeggi (2018),
Kapitel 2, Berlin, i. E.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 85 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 85
den Versuch der „Lösung eines Problems“ bezeichnen würde. Steht nicht ein viel
euphorischeres, positiv gefasstes und auch nicht weiter begründetes „so wollen wir
leben“ hinter der Affirmation bestimmter Lebensformen? Sind Lebensformen, wenn
ich sie als Problemlösungsinstanzen beschreibe, lediglich reaktiv, also: auf Pro-
blemstellungen reagierend, statt dass sie selbst positive Entwürfe setzen könnten?
Widerspricht das nicht meiner eigenen Auffassung von Lebensformen als Ausdruck
der Gestaltbarkeit der menschlichen Lebensbedingungen? Eine weitere Frage
schließt sich an: Kann die Problemlösungsauffassung wirklich dem Selbstverständ-
nis der Akteure (also der Perspektive der ersten Person) entsprechen oder handelt es
sich hier lediglich um die aus Sicht des Beobachters formulierbare Registrierung
von faktischen und funktionalen Effekten? Zum einen glaube ich, dass, selbst wenn
es nicht zum jederzeit präsenten Selbstverständnis einer Lebensform gehört pro-
blemlösend zu sein, diese Auffassung doch aktualisiert wird, sobald sich, anlässlich
einer Konfrontation oder Krise, die Notwendigkeit der Verteidigung einer bestimm-
ten Lebensform oder der Ablehnung einer anderen ergibt. Hier werden, wenn auch
manchmal im Nachhinein und nur in der Situation des krisenhaften „Ausdrücklich-
werdens“, Geltungsansprüche erhoben, die sich als Verteidigung der eigenen Praxis
als gegenüber anderen Varianten bessere Problemlösung verstehen lassen.
Hinter der Behauptung des reaktiven Charakters der Lebensform andererseits ver-
birgt sich gewissermaßen ein „materialistisches Element“. Immer auch reaktiv sind
Lebensformen, sofern sie auf etwas reagieren müssen und sich nicht im luftleeren
Raum einer Erfindung oder des ‚Einfach-anders-Lebens‘ entfalten. Indem wir Le-
bensformen mit bestimmten Zwecken haben, leben wir unser Leben (und gestalten
es dabei) immer in Auseinandersetzung mit Problemen, nicht, indem wir frei ir-
gendwelche Zwecke setzen. 35 Das aber widerspricht der Auffassung von Lebensfor-
men als gestalteten Lebensbedingungen nicht – und es bedeutet auch nicht, dass die
problemlösenden Lebensformen nicht in der Lage wären, menschliche Freiheit zu
realisieren 36. Jede Gestaltungsmacht trifft auf Bedingungen, ist eine Auseinander-
setzung mit Bedingungen, die für sie Ausgangspunkt und Grenze – und zwar gerade
einer verwirklichten Freiheit – darstellen. In abwandelnd-anverwandelnder Analo-
gie zu einer bekannten Marx’schen Phrase: Nicht nur die Anderen, auch das Andere
sind nicht (nur) die Grenze, sondern auch die Bedingung unserer Freiheit.
Dennoch ist bei der Rede vom Problemlösungscharakter der Lebensformen Vor-
sicht geboten: Sofern es sich bei Lebensformen um Praxiszusammenhänge handelt,
die vorgängig und nicht vollständig explizit sind und sofern wir in Lebensformen
immer schon verwickelt sind, darf man sich das Problemlösende an Lebensformen
nicht kognitivistisch, aber auch nicht instrumentalistisch und nicht voluntaristisch
vorstellen. Hier entscheiden sich nicht Individuen für eine bestimmte Praxis, mit der
sie einen bestimmten Zweck erreichen wollen. Nicht nur stellen sich die Probleme
immer schon in und aus der jeweiligen Praxis heraus, in der sich Problemstellungen
und Zwecksetzungen erst schrittweise konkretisieren und aus der heraus sie emer-
35 Menschliches Leben ist, in Anknüpfung an die Marx’schen Feuerbachthesen gesagt, „gegenständliche
Tätigkeit“, es findet nicht nur in der Welt statt, sondern ist welthaltig.
36
Auch hierzu instruktiv Khurana (2017).
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 86 / 26.3.2018
86 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
gieren. Auch sieht man, von den Ausnahmefällen des expliziten politischen Experi-
mentierens mit Lebensformen abgesehen, meist erst an den Effekten – und wieder-
um: erst in der Krise –, welche Probleme sich hier stellen und wie sie gelöst oder
nicht gelöst werden.
5. Kritik als immanente Krisenkritik der Problemlösungen
Wie lässt sich nun aber vom Ausgangspunkt dieser Auffassung von Lebensfor-
men als Problemlösungsinstanzen die normative Bewertung und Kritik von Lebens-
formen begründen? Auf den ersten Blick sieht es ja so aus, als entzöge die Histori-
sierung, Pluralisierung und Denaturalisierung des Lebensformenkonzepts diesem
gerade die Möglichkeit, als Maßstab für eine solche Kritik zu wirken. Wenn Lebens-
formen immer schon – kulturalistisch – im Plural aufgefasst und immer nur als
historisch-gesellschaftlich konkrete wie spezifische Formationen zugänglich wer-
den, dann lässt sich jedenfalls aus der Lebensform des Menschen nicht der Gegen-
part zu einer defizitären oder unangemessenen Instanziierung ableiten. Wenn um-
gekehrt die Probleme, mit denen Lebensformen konfrontiert sind, immer jedenfalls
auch konstruiert sind und wenn die Probleme selbst auch normativ verfasst sind,
dann wird es nicht nur häufig umstritten sein, ob eine Problemlösung gelungen ist;
die Beschreibung der Probleme selbst wird strittig und, ob so etwas wie eine Krise
oder ein normatives Scheitern von Lebensformen überhaupt zu verzeichnen ist,
wird tendenziell selbst zum Gegenstand der Debatte werden. Mein Ansatz versucht,
aus dieser Lage einen Ausweg zu finden. Es ist eine an den internen Krisendynami-
ken einer Lebensform ansetzende Form immanenter Kritik, die die Alternative zwi-
schen einer rein intern bleibenden Selbstkritik und einer bloß externen (bzw. sich
als extern missverstehenden) Kritik überwinden kann. Eine solche Kritik ist nicht
nur – im Modus interner Kritik – darauf gerichtet, die Übereinstimmung ihrer Prak-
tiken und Institutionen mit bereits vorhandenen Werten und Überzeugungen zu
überprüfen. Sie versteht sich aber auch nicht als externe Kritik miss, indem sie ver-
meintlich unabhängig gewonnene Maßstäbe an die existierenden Institutionen an-
legt. 37 Als immanente Krisenkritik setzt sie intern – bei den auftretenden systemati-
schen Problemen und Widersprüchen einer sozialen Konstellation – an und
entwickelt aus diesen die Kriterien einer kontextübergreifenden Kritik.
Meine These war: Lebensformen scheitern normativ, und sie scheitern als Lebens-
formen aufgrund ihrer normativen Defizienz. Diese normativen Defizite lassen sich
jetzt als Scheitern an der mit einer Lebensform gesetzten Problemstellung auffassen.
Die Schwierigkeiten, in die Lebensformen geraten können, ihre Krisen und das
37 Unterscheidet man in der Diskussion über Formen der Kritik häufig zwischen interner und externer
Kritik, so wäre angesichts der unausweichlichen normativen und historischen Eingebettetheit der Kritieren
externer Kritik danach zu fragen, ob es eine solche überhaupt geben kann oder ob diese nicht aus dem
Umstand heraus, dass sie sich nicht auf eine konkret existierende Gemeinschaft bezieht und dieser auf den
ersten Blick „extern“ oder unabhängig mit einem „Blick von Nirgendwo“ gegenübertritt den falschen
Schluss zieht. Oder anders: Es gibt eben keinen Blick von Nirgendwo und deshalb ist Kritik immer schon
in sozialer Realität verankert, sie weiß es nur manchmal nicht.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 87 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 87
„Nichtfunktionieren“, wären dann immer auch ein normatives (nicht nur funktio-
nales) Problem; normative Krisen erscheinen, umgekehrt, immer auch als Probleme
der Dysfunktionalität. Lebensformen scheitern als normative Gebilde, und sie schei-
tern umgekehrt durch das Scheitern an ihren normativen Ansprüchen auch als Le-
bensformen. Das Scheitern ist also kein „rohes“, kein rein faktisches Scheitern, son-
dern eines, das mit der Bewertung der Situation zusammenhängt. Dennoch lässt es
sich als faktisches Scheitern einer Problemlösung und als Nichtfunktionieren iden-
tifizieren. Der Unterschied, auf den es mir ankommt, ist einerseits der zu einer Si-
tuation, in der eine Lebensform einfach nur schlecht im Sinne von moralisch ver-
werflich ist, und andererseits der zu einer Vorstellung von bloßer (prä-normativer
und interpretationsfreier) Dysfunktionalität.
Lebensformen sind dann mit wechselnden Veränderungs- und Konfliktdynami-
ken konfrontiert, die als Problemstellungen auf verschiedene Weise bewältigt und
überwunden werden müssen. Der Ausgangspunkt der Beurteilung und Kritik von
Lebensformen, so wie ich sie hier konzipiere, ist also das Problematischwerden von
Lebensformen, die möglichen Krisen, in die sie geraten können. Dabei sind Proble-
me oder sogar Krisen gewissermaßen der Motor einer Dynamik, die sich nun als
solche betrachten lässt. Aus dieser Dynamik selbst nun, als Dynamik des Problem-
lösungsverlaufs und der Rationalität der Konfrontation mit den entsprechenden
Krisen und Problemen, lassen sich angesichts der beschriebenen Schwierigkeiten
die Kriterien für Kritik entwickeln. Eine gelingende oder angemessene Lebensform
bemisst sich dann am (progressiven oder regressiven) Charakter der entsprechenden
Krisen- oder Problemlösungsprozesse selbst. Das beruht auf einer einigermaßen
gehaltvollen Beschreibung dessen, was sich in dem Prozess der Problemlösung, also
der gesellschaftlichen Entwicklungsdynamik, abspielt. Einem sich anreichernden
Erfahrungsprozess – als Muster des Gelingens – stehen dabei von Verwerfungen
und Erfahrungsblockaden gekennzeichnete regressive Verläufe gegenüber, bei de-
nen bereits die Problemwahrnehmung systematisch blockiert ist.
Auf eine sehr kurze Formel gebracht lautet die von mir vorgeschlagene „Lösung“
also folgendermaßen: Lebensformen sind komplex strukturierte Bündel (oder Ensem-
bles) sozialer Praktiken, die darauf gerichtet sind, Probleme zu lösen, die ihrerseits
historisch kontextualisiert und normativ verfasst sind. Die Frage nach der Rationali-
tät von Lebensformen lässt sich dann in einer kontexttranszendierenden Perspektive
als Frage nach der Rationalität der Entwicklungsdynamik der jeweiligen Lebensform
stellen. Zum Kriterium des Gelingens macht eine solche Perspektive damit weniger
inhaltlich-substanzielle Gesichtspunkte als vielmehr formale Kriterien, die sich auf
die Rationalität und das Gelingen des so beschriebenen Prozesses als ethisch-sozia-
lem Lernprozess, oder als sich anreicherndem Erfahrungsprozess richten.
Damit sollen, so das Ziel meiner Überlegungen, die mit der Debatte um Lebens-
formen verbundenen Konflikte als etwas sichtbar gemacht werden, das sich nicht
auf das Muster von Konflikten zwischen unhintergehbaren Wertüberzeugungen –
oder „Glaubensmächten“ – reduzieren lässt, und die mit Lebensformen verbunde-
nen sozialen Praktiken als etwas, das sich nicht als unhinterfragbar „Letztes“ dar-
stellt, sondern als von Menschen gestaltete und transformierbare Lebensbedingun-
gen, deren Angemessenheit sich an der Sache des Problems misst.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 88 / 26.3.2018
88 Jahrbuch-Kontroversen IV: Zu Rahel Jaeggis „Kritik von Lebensformen“
6. Schlussbemerkung
Ich hatte eingangs behauptet, dass wir Lebensformen kritisieren können, weil sie
sind, was sie sind, dass sich also aus ihrer internen Verfasstheit die Möglichkeit ihrer
Kritik ergibt. Die Implikationen dieser Behauptung sollten im Verlaufe meiner Über-
legungen deutlicher geworden sein: Sofern Lebensformen als „self-interpreting so-
cial entity“ 38 reflexiv verfasst sind, ist Kritik und Kritisierbarkeit nicht ein empirisch
kontingenterweise an Lebensformen herangetragener Anspruch, sondern Ausdruck
ihrer internen Verfasstheit. Die Prozesse der Infragestellung und des Fluidwerdens
von Lebensformen sind diesen nicht äußerlich, sondern gehören zu ihrer gelingen-
den Form und ihrer gelingenden Dynamik dazu. Formen einer verdinglichenden
„Praxisvergessenheit“ 39 von Lebensformen umgekehrt, in denen die Reflexivität
und die innere Pluralität ausgesetzt sind, erscheinen dann als eine defizitäre Form
von Lebensformen 40. Lebensformen können, zugespitzt gesagt, ihrem Charakter als
Lebensformen, und damit als Instanziierungen von Selbstbestimmung, mehr oder
weniger gerecht werden.
Ich gehe also von der Annahme aus, dass wir Lebensformen nicht nur kritisieren
können, sondern dass wir sie (und damit uns im Vollzug unseres Lebens) auch kri-
tisieren sollten, aber darüber hinaus, dass wir das, in den praktischen Vollzug unse-
res Lebens eingelassen, immer schon tun. Lebensformen sind, diesem Verständnis
zufolge, nicht nur der Gegenstand, sondern, vermittelt über die Individuen, die ihr
Leben in diesen Formen führen, auch das Subjekt von Kritik und damit immer auch
bereits Resultat der durch Reflexion und Kritik in Gang gesetzten Prozesse. Zu be-
werten und zu kritisieren ist dann Teil dessen, was es bedeutet, eine Lebensform zu
haben und dabei mit Problemen, aber auch mit anderen Lebensformen konfrontiert
zu sein. Dass Lebensformen kritisierbar sind, ist insofern selbst keine beliebige nor-
mative Position, die bewertende Haltung gegenüber (unseren „eigenen“ und ande-
ren) Lebensformen nicht eine Haltung, die wir konsequenzenlos einnehmen oder
verlassen können. Und es handelt sich auch nicht um eine empirische Beobachtung,
die sich soziologisch auf den erhöhten Reflexionsgrad von sogenannten „posttradi-
tionalen Gesellschaften“ und die große Thematisierungsdichte und Aushandlungs-
not postkonventioneller Lebensformen bezöge.
Dann aber ist die aus Sicht eines liberalen Antipaternalismus so vordringliche
Frage, ob wir Lebensformen kritisieren sollen, oder ob wir uns lieber in neutraler
Haltung „ethisch abstinent“ zurückhalten, den „epistemischen Rückzug aus der
Auseinandersetzung“ 41 suchen sollten, in entscheidender Hinsicht falsch gestellt.
Kritik, die Thematisierung von Lebensformen jenseits des „Dunkels“ ihrer episte-
mischen Einklammerung, ist Teil dessen, was es bedeutet, Lebensformen zu Lebens-
38 Ich formuliere hier in Anlehnung an Taylor (1985), der von Menschen als „self-interpreting animals“
spricht.
39
Zur Rekonstruktion von Verdinglichung und Entfremdung als „Praxisvergessenheit“ vgl. Jaeggi (2005/
2016) und Stahl (2013).
40 Einen ähnlichen Gedanken formuliert Thomas Khurana (2017), 520 ff. wenn er von der „Kompliziert-
heit“ und inneren wie äußeren Pluralität unserer Lebensformen spricht.
41
Raz (1990), 4.
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
PhJb 1/18 / p. 89 / 26.3.2018
Rahel Jaeggi, Lebensformen als Problemlösungsinstanzen 89
formen zu machen und uns als Teil einer von uns gestaltbaren und transformier-
baren Welt verstehen zu können. In anderen Worten: Lebensformen als Lebensfor-
men zu kritisieren ist Teil dessen, was man als Prozess der Emanzipation bezeichnen
kann.
LITERATURVERZEICHNIS
Dewey, J. (2003) Logik. Die Theorie der Forschung, Frankfurt/M.
Fassin, D. (2017), Das Leben: Eine kritische Gebrauchsanweisung, Berlin.
Ferguson, A. (1819), An Essay on the History of Civil Society, Philadelphia.
Flitner, W. (1990), Geschichte der abendländischen Lebensformen. Gesammelte Schriften. Bd. 7, Hg. v.
K. Erlinghagen/A. Flitner/U. Hermann, Paderborn.
Gehlen, A. (1958), „Über Kultur, Natur und Natürlichkeit“, in: G. Funke (Hg.), Konkrete Vernunft. Fest-
schrift für Erich Rothacker, Bonn, 113–123.
Haucke, K. (2005), „Liberalismus politisch und metaphysisch“, in: Archiv für Rechts- und Sozialphiloso-
phie 91(1), 49–60.
Hegel, G. W. F. (1986), Grundlinien der Philosophie des Rechts, in, ders. Werke in 20 Bänden, Frankfurt/M,
Bd. 7.
Jaeggi, R. (2014), Kritik von Lebensformen, Berlin.
– (2005), Entfremdung – Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems, Frankfurt (Neuauflage
Berlin 2016).
– (2018), Fortschritt und Regression, Berlin.
Khurana, T. (2017), Das Leben der Freiheit, Berlin.
Lear, J./Stroud, B. (1984), „The Disappearing ‚We‘“, in: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplemen-
tary, Volume 58, 219–258.
Liebsch, B. (2003), „Lebensformen zwischen Widerstreit und Gewalt. Zur Topographie des Forschungs-
feldes im Jahr 2000“, in: ders./J. Straub (Hgg.), Lebensformen im Widerstreit. Integrations- und Identi-
tätskonflikte in pluralen Gesellschaften, Frankfurt/M., 13–46.
Marx, K. (1970), „Die deutsche Ideologie“, in: ders./F. Engels, Werke, Bd. 3, Berlin. Marx, K. (1971), „Ein-
leitung zur Kritik der politischen Ökonomie“, in: ders./F. Engels, Werke, Bd. 13, Berlin, 615–641.
Musil, R. (1987), Der Mann ohne Eigenschaften I (Erstes und zweites Buch), Reinbek bei Hamburg.
Neuhouser, F. (2000), Actualizing Freedom: The Foundations of Hegel’s Social Theory, Boston.
Raz, J. (1990), „Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence“, in: Philosophy and Public Affairs 19
(1), 3–46.
– (2006) Praktische Gründe und Normen, Frankfurt/M.
Stahl, T. (2013), Immanente Kritik, Frankfurt/M.
Taylor, C. (1985) „Self-Interpreting Animals“, in: ders., Philosophical Papers 1, Human Agency and
Language, Cambridge, S. 45–76.
Wingert, L. (1993), Gemeinsinn und Moral. Elemente einer intersubjektivistischen Moralkonzeption,
Frankfurt/M.
Wittgenstein, L. (1982), Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie. Schriften 8, Frankfurt/M.
von Wright, G. (1979), Norm und Handlung. Eine logische Untersuchung, Königstein.
Young, I. M. (1990), Justice and the Politics of Difference, Princeton.
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Philosophie
Unter den Linden 6
10117 Berlin
rahel.jaeggi@staff.hu-berlin.de
Phil. Jahrbuch 125. Jahrgang / I (2018)
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Soziologien des Lebens: Überschreitung - Differenzierung - KritikVon EverandSoziologien des Lebens: Überschreitung - Differenzierung - KritikNoch keine Bewertungen
- Symbolische Verletzbarkeit: Die doppelte Asymmetrie des Sozialen nach Hegel und LevinasVon EverandSymbolische Verletzbarkeit: Die doppelte Asymmetrie des Sozialen nach Hegel und LevinasNoch keine Bewertungen
- Kultur. Von den Cultural Studies bis zu den Visual Studies: Eine EinführungVon EverandKultur. Von den Cultural Studies bis zu den Visual Studies: Eine EinführungNoch keine Bewertungen
- Essay Über Das GlückDokument9 SeitenEssay Über Das GlückAuraPazNoch keine Bewertungen
- Die Mensch-Erklärungsformel (Teil 6): Warum der Mensch in Wirklichkeit unfrei ist und worin der Sinn des Lebens besteht!Von EverandDie Mensch-Erklärungsformel (Teil 6): Warum der Mensch in Wirklichkeit unfrei ist und worin der Sinn des Lebens besteht!Noch keine Bewertungen
- Lebenskunst - Therapie - EthikDokument18 SeitenLebenskunst - Therapie - EthikMax MarionetiNoch keine Bewertungen
- Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2014Von EverandJahrbuch der Luria-Gesellschaft 2014Willehad LanwerNoch keine Bewertungen
- Die Ordnung des Selbst: Subjektivierung im Kontext von Krise und psychosozialer BeratungVon EverandDie Ordnung des Selbst: Subjektivierung im Kontext von Krise und psychosozialer BeratungNoch keine Bewertungen
- Der Begriff Des Lebens in Der Klassischen Deutschen Philosophie - Eine Naturphilosophische Oder Lebensweltliche Frage?Dokument19 SeitenDer Begriff Des Lebens in Der Klassischen Deutschen Philosophie - Eine Naturphilosophische Oder Lebensweltliche Frage?Claudia AguilarNoch keine Bewertungen
- Heilpädagogik als personorientierte Disziplin: Eine GrundlegungVon EverandHeilpädagogik als personorientierte Disziplin: Eine GrundlegungNoch keine Bewertungen
- Überleben im Alltag: Welche Strategien für das Sozialwesen Mensch wichtig sindVon EverandÜberleben im Alltag: Welche Strategien für das Sozialwesen Mensch wichtig sindNoch keine Bewertungen
- Unheimliche Inskriptionen Der KoerperDokument66 SeitenUnheimliche Inskriptionen Der KoerperArtur VahrameevNoch keine Bewertungen
- Weite und Zuversicht: Leben leben im Bewusstsein der VergänglichkeitVon EverandWeite und Zuversicht: Leben leben im Bewusstsein der VergänglichkeitNoch keine Bewertungen
- Widerstand und Fürsorge: Beiträge zum Thema Psychoanalyse und GesellschaftVon EverandWiderstand und Fürsorge: Beiträge zum Thema Psychoanalyse und GesellschaftNoch keine Bewertungen
- Das Flow Prinzip: Perspektiven Einer Ökologie Des LebendigenDokument13 SeitenDas Flow Prinzip: Perspektiven Einer Ökologie Des LebendigenNovaQiiiNoch keine Bewertungen
- SelbstdarstellungDokument6 SeitenSelbstdarstellungWanderNoch keine Bewertungen
- Kritik des Habitus: Zur Intersektion von Kollektivität und Geschlecht in der akademischen PhilosophieVon EverandKritik des Habitus: Zur Intersektion von Kollektivität und Geschlecht in der akademischen PhilosophieNoch keine Bewertungen
- Die körperliche Konstruktion des Sozialen: Zum Verhältnis von Körper, Wissen und InteraktionVon EverandDie körperliche Konstruktion des Sozialen: Zum Verhältnis von Körper, Wissen und InteraktionNoch keine Bewertungen
- Süsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlDokument12 SeitenSüsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlGuacamole Bamako ShivaNoch keine Bewertungen
- Kultur Als Grundlage Und Grenze Des Sinns. E. AngehrnDokument11 SeitenKultur Als Grundlage Und Grenze Des Sinns. E. AngehrnLarissa Arancibia BetzNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift für Kultur- und Kollektivwissenschaft: Jg. 4, Heft 2/2018Von EverandZeitschrift für Kultur- und Kollektivwissenschaft: Jg. 4, Heft 2/2018Forschungsstelle Kultur- und KollektivwissenschaftNoch keine Bewertungen
- Menschen in existenziellen Krisen begleiten: Selbstbegegnung, Orientierung und HaltungVon EverandMenschen in existenziellen Krisen begleiten: Selbstbegegnung, Orientierung und HaltungNoch keine Bewertungen
- Neonomaden, Shuttles, Cybertouristen: Die Zukunft des Wohnens in der digitalen ZivilisationVon EverandNeonomaden, Shuttles, Cybertouristen: Die Zukunft des Wohnens in der digitalen ZivilisationNoch keine Bewertungen
- Organismen. Agenten zwischen Innen- und Außenwelten 1780-1860Von EverandOrganismen. Agenten zwischen Innen- und Außenwelten 1780-1860Noch keine Bewertungen
- Der Andere als Herausforderung: Konzeptionen einer neuen Verantwortungsethik bei Lévinas und ButlerVon EverandDer Andere als Herausforderung: Konzeptionen einer neuen Verantwortungsethik bei Lévinas und ButlerNoch keine Bewertungen
- Jaeggi - Philosophie Als KritikDokument8 SeitenJaeggi - Philosophie Als KritikDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Jahrbuch der Luria-Gesellschaft 2012Von EverandJahrbuch der Luria-Gesellschaft 2012Willehad LanwerNoch keine Bewertungen
- Verkörperungen des Sozialen: Neophänomenologische Grundlagen und soziologische AnalysenVon EverandVerkörperungen des Sozialen: Neophänomenologische Grundlagen und soziologische AnalysenNoch keine Bewertungen
- Wahrgenommene Individualität: Eine Theologie der LebensführungVon EverandWahrgenommene Individualität: Eine Theologie der LebensführungNoch keine Bewertungen
- Der Mensch - Ein mißlungenes Objekt der Schöpfung?: Anthropologische Reflexionen zum Status des MenschseinsVon EverandDer Mensch - Ein mißlungenes Objekt der Schöpfung?: Anthropologische Reflexionen zum Status des MenschseinsNoch keine Bewertungen
- Wir im All - das All in uns: Ken Wilbers Vision eines ungeteilten DaseinsVon EverandWir im All - das All in uns: Ken Wilbers Vision eines ungeteilten DaseinsNoch keine Bewertungen
- Forster 2014 Chapter - ReflexivitätDokument9 SeitenForster 2014 Chapter - ReflexivitätihdrilNoch keine Bewertungen
- Wirkungsmacht unter dem intersektionalen Ansatz: Was bedeuten subjektive Unterdrückungserfahrungen im Ansatz der Intersektionalität für die Funktion Sozialer Arbeit?Von EverandWirkungsmacht unter dem intersektionalen Ansatz: Was bedeuten subjektive Unterdrückungserfahrungen im Ansatz der Intersektionalität für die Funktion Sozialer Arbeit?Noch keine Bewertungen
- Lettow, Kunjuktur Des Politischen VitalismusDokument10 SeitenLettow, Kunjuktur Des Politischen VitalismusIlias GiannopoulosNoch keine Bewertungen
- Organisationsethische Experimente: 125 Anregungen für Führung, Ausbildung & BeratungVon EverandOrganisationsethische Experimente: 125 Anregungen für Führung, Ausbildung & BeratungNoch keine Bewertungen
- 01 2-2010 Editorial-KorrDokument3 Seiten01 2-2010 Editorial-KorracademicDNoch keine Bewertungen
- Körperregeln - #18Dokument77 SeitenKörperregeln - #18LinkeZeitschriftenNoch keine Bewertungen
- Biography Matters - Feministisch-phänomenologische Perspektiven auf Altern in BewegungVon EverandBiography Matters - Feministisch-phänomenologische Perspektiven auf Altern in BewegungNoch keine Bewertungen
- Die Körperlichkeit sozialen Handelns: Soziale Ordnung jenseits von Normen und InstitutionenVon EverandDie Körperlichkeit sozialen Handelns: Soziale Ordnung jenseits von Normen und InstitutionenNoch keine Bewertungen
- Körper Beratung: Beratungshandeln im Spannungsfeld von Körper, Leib und NormativitätVon EverandKörper Beratung: Beratungshandeln im Spannungsfeld von Körper, Leib und NormativitätNoch keine Bewertungen
- Den LeibKörper erforschen: Phänomenologische, geschlechter- und bildungstheoretische Perspektiven auf die Verletzlichkeit des SeinsVon EverandDen LeibKörper erforschen: Phänomenologische, geschlechter- und bildungstheoretische Perspektiven auf die Verletzlichkeit des SeinsBeatrice MüllerNoch keine Bewertungen
- Rudolf Steiner - TTB 04 - Vom Lebenslauf Des Menschen PDFDokument257 SeitenRudolf Steiner - TTB 04 - Vom Lebenslauf Des Menschen PDFPetitJerome100% (3)
- Menschenwürde als heilige Ordnung: Eine Re-Konstruktion sozialer Exklusion im Lichte der Sakralität der personalen WürdeVon EverandMenschenwürde als heilige Ordnung: Eine Re-Konstruktion sozialer Exklusion im Lichte der Sakralität der personalen WürdeNoch keine Bewertungen
- Karol Wojtylas Theorie der Teilhabe als sozialphilosophische Grundlage personalistischer PädagogikVon EverandKarol Wojtylas Theorie der Teilhabe als sozialphilosophische Grundlage personalistischer PädagogikNoch keine Bewertungen
- Bewegung der Form: Prozesse der Ordnungsbildung und ihre wirklichkeitskonstituierende BedeutungVon EverandBewegung der Form: Prozesse der Ordnungsbildung und ihre wirklichkeitskonstituierende BedeutungNoch keine Bewertungen
- 10 Minuten Soziologie: BewegungVon Everand10 Minuten Soziologie: BewegungUte SamlandNoch keine Bewertungen
- Körper-Bewusstsein: Für eine Philosophie der SomästhetikVon EverandKörper-Bewusstsein: Für eine Philosophie der SomästhetikNoch keine Bewertungen
- Am Anfang war der Sinn: Zur Naturgeschichte, Psychologie und Philosophie von Tätigkeit, Sinn und DialogVon EverandAm Anfang war der Sinn: Zur Naturgeschichte, Psychologie und Philosophie von Tätigkeit, Sinn und DialogNoch keine Bewertungen
- Verbindlichkeit: Stärken einer schwachen NormativitätVon EverandVerbindlichkeit: Stärken einer schwachen NormativitätNoch keine Bewertungen
- Aorist) ) ) ) ) : Diltheys Begriff Der Kultur Und Seine Implikationen Dilthey's Concept of Culture and Its ImplicationsDokument14 SeitenAorist) ) ) ) ) : Diltheys Begriff Der Kultur Und Seine Implikationen Dilthey's Concept of Culture and Its ImplicationsFrancisco WiederwildNoch keine Bewertungen
- Sozialer Wandel: Herausforderungen für Kulturelle Bildung und Soziale ArbeitVon EverandSozialer Wandel: Herausforderungen für Kulturelle Bildung und Soziale ArbeitNoch keine Bewertungen
- Tagträumerei, die Relativität des Seins: Was ist der Mensch und warum ist er wie er ist? Versuch einer Bestandsaufnahme und Erörterung von Möglichkeiten.Von EverandTagträumerei, die Relativität des Seins: Was ist der Mensch und warum ist er wie er ist? Versuch einer Bestandsaufnahme und Erörterung von Möglichkeiten.Noch keine Bewertungen
- Rahel Aeggi Kritik Von LebensformenDokument230 SeitenRahel Aeggi Kritik Von LebensformenDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- SOPHIE WENNERSCHEID Literatur Und EigensinnDokument11 SeitenSOPHIE WENNERSCHEID Literatur Und EigensinnDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Wenn Die Kritik Verdeckt ErmittelDokument10 SeitenWenn Die Kritik Verdeckt ErmittelDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Sich Selber Wählen" - Selbstwerdung Bei Sören A. Kierkegaard Und in Der Modernen ExistenzanalyseDokument110 SeitenSich Selber Wählen" - Selbstwerdung Bei Sören A. Kierkegaard Und in Der Modernen ExistenzanalyseDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Flugel-Martinsen-Die Normativitat Von KritikDokument17 SeitenFlugel-Martinsen-Die Normativitat Von KritikDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- (9783770566563 - Kollektives Schreiben) Sekretäre, Typographen Und BuchbinderDokument29 Seiten(9783770566563 - Kollektives Schreiben) Sekretäre, Typographen Und Buchbindermanu BobNoch keine Bewertungen
- Die Wende Zur Neuzeit (Dux)Dokument16 SeitenDie Wende Zur Neuzeit (Dux)Daichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Eva Birkenstock Sobre Kierkegaard PDFDokument28 SeitenEva Birkenstock Sobre Kierkegaard PDFDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Encarnar La Critica Garces AlemanDokument5 SeitenEncarnar La Critica Garces AlemanDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Das Unbeweisbare Dogma Von Der ExistenzDokument18 SeitenDas Unbeweisbare Dogma Von Der ExistenzDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Jaeggi - Philosophie Als KritikDokument8 SeitenJaeggi - Philosophie Als KritikDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- WEBER Protestantische Ethik Und Kapitalismus (Auszug)Dokument37 SeitenWEBER Protestantische Ethik Und Kapitalismus (Auszug)Daichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Analisis Pormenorizado de Cronopios en AlemanDokument32 SeitenAnalisis Pormenorizado de Cronopios en AlemanDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Reinhard KreckelDokument26 SeitenReinhard KreckelDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Konflikte Um Die Energiewende - Florian WeberDokument431 SeitenKonflikte Um Die Energiewende - Florian WeberDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Strukturwandel Der LegitimationDokument269 SeitenStrukturwandel Der LegitimationDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- John Locke - Essay Über Den Menschlichen VerstandDokument310 SeitenJohn Locke - Essay Über Den Menschlichen VerstandDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Jan Deck ZuschauerDokument11 SeitenJan Deck ZuschauerDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Finter StimmkörperbilderDokument12 SeitenFinter StimmkörperbilderDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Foucault Andere RäumeDokument13 SeitenFoucault Andere RäumeDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Gerhards, Ivo - Die Bedeutung Der Landschaftlichen Eigenart Für Die LandschaftsbildbewertungDokument238 SeitenGerhards, Ivo - Die Bedeutung Der Landschaftlichen Eigenart Für Die LandschaftsbildbewertungDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Die Dynamik Des Konflikts Um Den StromtrassenbauDokument73 SeitenDie Dynamik Des Konflikts Um Den StromtrassenbauDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- LEVINAS Totalität Und Unendlichkeit Kap. III (Antlitz)Dokument12 SeitenLEVINAS Totalität Und Unendlichkeit Kap. III (Antlitz)Daichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Kritik Der ÖffentlichkeitenDokument158 SeitenKritik Der ÖffentlichkeitenDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Interdisziplinäre Aspekte Der EnergiewirtschaftDokument313 SeitenInterdisziplinäre Aspekte Der EnergiewirtschaftDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Husserl Einführung in Die PhänomenologieDokument95 SeitenHusserl Einführung in Die PhänomenologieDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Der Staat Der Athener PDFDokument63 SeitenDer Staat Der Athener PDFDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Quer Schnitt S KlassenDokument4 SeitenQuer Schnitt S KlassenDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Platon AlkibiadesDokument55 SeitenPlaton AlkibiadesDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen
- Marx - Die Deutsche IdeologieDokument74 SeitenMarx - Die Deutsche IdeologieDaichu CanaichuNoch keine Bewertungen