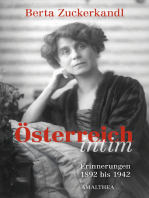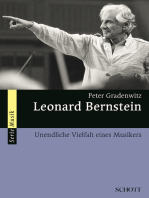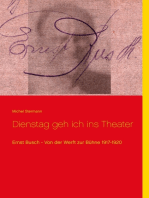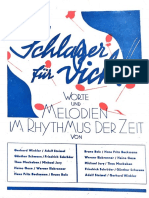Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Titelblatt Zu Liedern
Titelblatt Zu Liedern
Hochgeladen von
Florin ȚubucanCopyright:
Verfügbare Formate
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Sperger - Concerto N. 15 in ReDokument55 SeitenSperger - Concerto N. 15 in ReArya AdithyaNoch keine Bewertungen
- Келлер Северная жемчужинаDokument16 SeitenКеллер Северная жемчужинаАннаNoch keine Bewertungen
- Hindemith PDFDokument102 SeitenHindemith PDFstdoeringNoch keine Bewertungen
- Musikreferat: Béla Bartók Und Die VolksmusikDokument18 SeitenMusikreferat: Béla Bartók Und Die Volksmusikderjesko100% (2)
- Im Sog der Klänge: Gespräche mit dem Komponisten Jörg WidmannVon EverandIm Sog der Klänge: Gespräche mit dem Komponisten Jörg WidmannNoch keine Bewertungen
- Titelblatt Zu KunstliedernDokument2 SeitenTitelblatt Zu KunstliedernFlorin ȚubucanNoch keine Bewertungen
- 088 Peter Härtling - WikipediaDokument6 Seiten088 Peter Härtling - WikipediaJennifer RominNoch keine Bewertungen
- Begleitmaterial DreigroschenoperDokument11 SeitenBegleitmaterial DreigroschenoperVeronikaVeliNoch keine Bewertungen
- Anton Stadler. Wirken und Lebensumfeld des "Mozart-Klarinettisten".: Fakten, Daten und Hypothesen zu seiner Biographie. ADDENDA ZU BAND 1 & BAND 2Von EverandAnton Stadler. Wirken und Lebensumfeld des "Mozart-Klarinettisten".: Fakten, Daten und Hypothesen zu seiner Biographie. ADDENDA ZU BAND 1 & BAND 2Noch keine Bewertungen
- ...Als die Noten laufen lernten... 1.3 Komponisten R bis Z: Geschichte und Geschichten der U-Musik bis 1945Von Everand...Als die Noten laufen lernten... 1.3 Komponisten R bis Z: Geschichte und Geschichten der U-Musik bis 1945Noch keine Bewertungen
- Jonas Kaufmann - WienDokument22 SeitenJonas Kaufmann - WienapolodivinoNoch keine Bewertungen
- Mahler Sinfonia N 9 Leonard BernsteinDokument8 SeitenMahler Sinfonia N 9 Leonard BernsteinCarlos DaneriNoch keine Bewertungen
- Franz SchubertDokument5 SeitenFranz SchubertP ZNoch keine Bewertungen
- Exposeì - Anne MelzerDokument9 SeitenExposeì - Anne MelzertatasrbaNoch keine Bewertungen
- Und Nach Den Ferien Mache Ich Eine Beatband AufDokument322 SeitenUnd Nach Den Ferien Mache Ich Eine Beatband Aufgottesvieh100% (1)
- Guitar Recital Hoh Volker Schubert F Mertz JK Paganini N Regondi G Mendelssohn Felix Sor F Romantic MomentsDokument17 SeitenGuitar Recital Hoh Volker Schubert F Mertz JK Paganini N Regondi G Mendelssohn Felix Sor F Romantic MomentsQuangNoch keine Bewertungen
- Antikriegstag Wuppertal 2015 ProgrammheftDokument12 SeitenAntikriegstag Wuppertal 2015 ProgrammheftklannasophieNoch keine Bewertungen
- Referat Zum Thema Bertolt BrechtDokument4 SeitenReferat Zum Thema Bertolt BrechtKEKSI THE TASTYNoch keine Bewertungen
- Message in a book: Ein Porträt in Gesprächen mit Martin ScholzVon EverandMessage in a book: Ein Porträt in Gesprächen mit Martin ScholzNoch keine Bewertungen
- Die Liszt-Orgel in Denstedt Bei Weimar (WWW - Lisztorgel.de)Dokument2 SeitenDie Liszt-Orgel in Denstedt Bei Weimar (WWW - Lisztorgel.de)ragtimepianoNoch keine Bewertungen
- Anton Rubinstein Melodía en Fa (Piano)Dokument7 SeitenAnton Rubinstein Melodía en Fa (Piano)carololopezNoch keine Bewertungen
- Schostakowitsch: Sein Leben, sein Werk, seine ZeitVon EverandSchostakowitsch: Sein Leben, sein Werk, seine ZeitBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9)
- Till Eulenspiegel Strauss SaavedraDokument14 SeitenTill Eulenspiegel Strauss SaavedraEl RoloNoch keine Bewertungen
- Bertolt BrechtDokument25 SeitenBertolt BrechtErika Braun100% (1)
- 068 Gerhard Polt - WikipediaDokument5 Seiten068 Gerhard Polt - WikipediaMinka Penelope Zadkiela HundertwasserNoch keine Bewertungen
- Österreich intim: Erinenrungen 1892 bis 1942Von EverandÖsterreich intim: Erinenrungen 1892 bis 1942Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Lebendige Vergangenheit der Familie meiner Großmutter, 3. Buch: Hochzeiten und SchwesternzwistVon EverandLebendige Vergangenheit der Familie meiner Großmutter, 3. Buch: Hochzeiten und SchwesternzwistNoch keine Bewertungen
- Blickpunkt Musical Ausgabe 98 (02-2019)Dokument96 SeitenBlickpunkt Musical Ausgabe 98 (02-2019)Γιάννος ΚυριάκουNoch keine Bewertungen
- Hans PfitznerDokument12 SeitenHans PfitznerpalisekNoch keine Bewertungen
- 110 Jewish Cabaret in Exile BookletDokument33 Seiten110 Jewish Cabaret in Exile BookletMarisa MarinoNoch keine Bewertungen
- Leonard Bernstein: Unendliche Vielfalt eines MusikersVon EverandLeonard Bernstein: Unendliche Vielfalt eines MusikersNoch keine Bewertungen
- Booklet PDFDokument72 SeitenBooklet PDFA. Sebastián CarrizoNoch keine Bewertungen
- Gesang Im BordellDokument3 SeitenGesang Im BordellofficeNoch keine Bewertungen
- 150 Jahre Hans Pfitzner - Treudeutsch Und Bitterböse - News Und Kritik - BR-KLASSIK - Bayerischer RundfunkDokument12 Seiten150 Jahre Hans Pfitzner - Treudeutsch Und Bitterböse - News Und Kritik - BR-KLASSIK - Bayerischer RundfunkStanisław WelanykNoch keine Bewertungen
- TrafikantDokument24 SeitenTrafikantsnapmail187Noch keine Bewertungen
- Störtebeker: Gottes Freund und aller Welt FeindVon EverandStörtebeker: Gottes Freund und aller Welt FeindNoch keine Bewertungen
- Kammermusik Für Verschiedene ZupfinstrumenteDokument14 SeitenKammermusik Für Verschiedene ZupfinstrumenteMattia FogatoNoch keine Bewertungen
- Nestroy UnlockedDokument8 SeitenNestroy UnlockedNoemi ZappalàNoch keine Bewertungen
- Bernhard, Jandl, Jelinek: Österreichische Musikzeitschrift 05/2015Von EverandBernhard, Jandl, Jelinek: Österreichische Musikzeitschrift 05/2015Noch keine Bewertungen
- VierzeilerDokument52 SeitenVierzeilerChris HaerringerNoch keine Bewertungen
- Das wunderbare Schicksal: Aus dem Leben des Hoftyrolers Peter ProschVon EverandDas wunderbare Schicksal: Aus dem Leben des Hoftyrolers Peter ProschNoch keine Bewertungen
- JumuDokument17 SeitenJumudsdqdqNoch keine Bewertungen
- Schicksal des Peter Stern: Geschichte einer Flucht im Jahre 1945 aus der OstslowakeiVon EverandSchicksal des Peter Stern: Geschichte einer Flucht im Jahre 1945 aus der OstslowakeiNoch keine Bewertungen
- Bind Rietmann Steinerportrait 1916Dokument4 SeitenBind Rietmann Steinerportrait 1916Joseph B. SnyderNoch keine Bewertungen
- Dienstag geh ich ins Theater: Ernst Busch - Von der Werft zur Bühne 1917-1920Von EverandDienstag geh ich ins Theater: Ernst Busch - Von der Werft zur Bühne 1917-1920Noch keine Bewertungen
- Programm Städtischer Musikverein Bottrop: Mendelssohn & Rheinberger (01.12.2012)Dokument3 SeitenProgramm Städtischer Musikverein Bottrop: Mendelssohn & Rheinberger (01.12.2012)a_musicianNoch keine Bewertungen
- Bertolt BrechtDokument3 SeitenBertolt Brechtlutscher43Noch keine Bewertungen
- Tatort Schriftstellerhaus Stuttgart: Poesie und PorträtsVon EverandTatort Schriftstellerhaus Stuttgart: Poesie und PorträtsNoch keine Bewertungen
- Schlager Für Dich 1946Dokument17 SeitenSchlager Für Dich 1946Christoph KüstnerNoch keine Bewertungen
- Biografie Bill KaulitzDokument1 SeiteBiografie Bill KaulitzcassaplusNoch keine Bewertungen
- Wirén - Sinfonías 4 y 5 PDFDokument25 SeitenWirén - Sinfonías 4 y 5 PDFCésar SalazarNoch keine Bewertungen
- Pflichtprogramm 19Dokument1 SeitePflichtprogramm 19eke.ersanekeNoch keine Bewertungen
- 115 Wir Sagen Euch An Den Lieben Advent Intonation d1Dokument1 Seite115 Wir Sagen Euch An Den Lieben Advent Intonation d1PavolChlebanaNoch keine Bewertungen
- Reger Max - Nachtlied Op.138 n.3 (Coro)Dokument4 SeitenReger Max - Nachtlied Op.138 n.3 (Coro)AlbertitoNoch keine Bewertungen
- HerzbebenDokument1 SeiteHerzbebenUlrich PotrykusNoch keine Bewertungen
- OktoberfestDokument4 SeitenOktoberfestDavid LTMNoch keine Bewertungen
- Mein Herr Marquis, Klange Der HeimatDokument10 SeitenMein Herr Marquis, Klange Der HeimatOlolelyaNoch keine Bewertungen
- Gulda TubaDokument6 SeitenGulda TubaDomenico ZizziNoch keine Bewertungen
- Fairy Dance Reel Piano Accompaniment Klavier BegleitungDokument1 SeiteFairy Dance Reel Piano Accompaniment Klavier BegleitungAriaGeigeNoch keine Bewertungen
- Je Ne Parle Pas Français - NamikaDokument3 SeitenJe Ne Parle Pas Français - NamikaYps IlonNoch keine Bewertungen
- Jury 2023Dokument2 SeitenJury 2023corina.haeubleinNoch keine Bewertungen
- Danzón No. 2Dokument16 SeitenDanzón No. 2Berny Le CuontNoch keine Bewertungen
- Baumappe HAVOFAST StudioDokument2 SeitenBaumappe HAVOFAST StudioAntonioPalloneNoch keine Bewertungen
Titelblatt Zu Liedern
Titelblatt Zu Liedern
Hochgeladen von
Florin ȚubucanOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Titelblatt Zu Liedern
Titelblatt Zu Liedern
Hochgeladen von
Florin ȚubucanCopyright:
Verfügbare Formate
Emmerich Bartzer
(1895 – 1961)
Lieder
im Volkston
auf Texte von
Peter Jung
und
Hilda Martini-Striegl
Kopien der Manuskripte
Inhalt:
Ich denke dein Peter Jung 3
In deiner Nähe Peter Jung 4
In den Himmel… Peter Jung 5
Dein Auge Peter Jung 6
Wie a Roserl am Baum Hilda Martini-Striegl 7
Ich liebe Dich Peter Jung 8
Schlummerlied Peter Jung 9
Nach deinen Spuren Peter Jung 10
Ich hab in süßen Träumen Peter Jung 11
Deutsche Weihnacht Hilda Martini-Striegl 12
Liebeslied Peter Jung 13
Emmerich Bartzer erblickte am 1. September 1895 in Lovrin/Banat als zweiter von vier Söhnen des Rossmüllers Stefan Bart-
zer und der Kaufmannstochter Maria, geborene Reitter, das Licht der Welt. Nach der Trennung der Eltern besuchte er das
Gymnasium in Großsanktnikolaus, wo er Violinunterricht erhielt, danach die K.u.K. Höhere Industrieschule in Szegedin, wo er
bereits zu Schülerzeiten als Dirigent und Komponist hervortrat und strebsamer Schüler des städtischen Konservatoriums war.
Nach dem 1. Weltkrieg, der ihn an die italienische Front verschlagen hatte, war er Geiger im Theater- und im Kinoorchester in
Szegedin und nahm Unterricht in Komposition, Harmonielehre und Kontrapunkt. Erste Lieder erschienen im Druck. 1924 zog er
in seine Heimatgemeinde Lovrin, wo er mit seinen Brüdern eine Reparaturwerkstatt für Autos und landwirtschaftliche Maschinen
betrieb. Hier entstanden die meisten seiner Klavierlieder und eine Reihe von Chören für den „Lovriner Männergesangverein und
Frauenchor“, den er leitete. Er gründete das Orchester der „Lovriner Musikfreunde“, für welches ebenfalls eine Reihe von Stü-
cken entstand, überwiegend Walzer, Ländler und Tänze, wie man sie aus der Wiener Operettentradition kannte und liebte. Zwei
dieser Stücke wurden Anfang der 30er Jahre vom Budapester Rundfunk in der Interpretation des Budapester Opernorchesters
ausgestrahlt.
1933 zog er mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern in das nahe Hatzfeld, wo er den Gewerbegesangverein leitete, und als
Schulmusiker und Violinlehrer tätig war. Er war Mitglied im rumänischen Komponistenverband und engagierte sich leidenschaft-
lich für die Förderung der Banater deutschen Kultur. 1937 war er maßgeblicher Mitbegründer der „Werkgemeinschaft schwäbi-
scher Künstler und Kunstfreunde“. Die Aufführung seiner Operette „Grüßt mein Banat“ durch den Verein der Banater Schwaben
in Wien scheiterte nach dem Anschluss Österreichs an einer religiösen Erntedankszene, deren Streichung durch die Nazis er
nicht akzeptieren wollte.
Der 2. Weltkrieg bescherte der Familie eine verlustreiche Flucht nach Österreich und eine demütigende Rückkehr in ein leer
geplündertes Haus. Durch ein Missgeschick wurde Bartzer Mitglied der Rumänischen Arbeiterpartei und wagte es nicht, auszu-
treten. Er wurde sogleich vor den kommunistischen Karren gespannt, musste dem riesigen Bedarf an stalinistisch geprägtem
Repertoire gerecht werden, leitete mehrere Orchester und gründete mehrere Chöre, die aufgrund des ideologisierten Pflichtre-
pertoires keinen langen Bestand hatten. Ein letztes schöpferisches Aufbäumen des durch die Zeitumstände verbitterten Kom-
ponisten brachte die zwei Operetten „Annoncenliebe“ und „Wenn Herzen sprechen“ hervor, die sehr erfolgreich von Laien in
Hatzfeld und Umgebung aufgeführt wurden. Nach Stalins Tod entspannte sich die Lage etwas. Neben anderen wurde auch sein
Rat von der Redaktion der Tageszeitung „Neuer Weg“ eingeholt, als die Richtlinien für die Förderung der deutschen Kultur in
Rumänien erarbeitet wurden. Er veröffentlichte einige diesbezügliche Beiträge und leitete einige Fortbildungen für Laiendirigen-
ten und unterwies eine ganze Reihe von banatschwäbischen Komponisten. Späte Genugtuung erlebte er mit seinem „Banater
Volksorchester“, welches bei Laienwettbewerben regelmäßig die Konkurrenz ausstach. Während eines solchen Auftrittes erlitt
er einen Schlaganfall, an dessen Folgen er wenige Wochen später am 5. Mai 1961 in Hatzfeld verstarb.
Die Lebensumstände Bartzers ließen eine ungehinderte Entfaltung seiner Begabung nicht zu. Den hohen Anspruch, den er an
sich selbst und an das Komponieren hatte, konnte er in nur wenigen Werken umsetzen. Dazu gehören der Streichquartettsatz in
g-Moll, die Operette „Grüßt mein Banat“, der achtstimmige gemischte Chor „Am Felde“ und seine Klavierlieder. Rückblickend
kann man sagen, dass Emmerich Bartzer es wie kein zweiter verstanden hat, der banatschwäbischen Volksseele einen musika-
lischen Ausdruck zu verleihen. Dadurch steht er in einer Reihe mit dem Banater Heimatdichter Peter Jung, mit dem ihn eine
innige Freundschaft verband, und mit dem Banater Heimatmaler Stefan Jäger. Diese drei waren neben anderen maßgeblich
daran beteiligt, den Ruf des Heidestädtchens Hatzfeld als Banatschwäbische Kulturmetropole zu begründen.
Die hier vorliegenden Lieder hat Bartzer fast ausschließlich in seiner Lovriner Zeit verfasst. Sie sind das Ergebnis der Loslösung
vom ungarischen Einfluss der Szegediner Jahre und der Rückbesinnung auf sein doch sehr in seiner Banatschwäbischen Hei-
mat verwurzeltes musikalisches Empfinden. Es sind kleine Kostbarkeiten an melodischer Inspiration und weisen eine dem
Volkslied nahestehende Wahrhaftigkeit und Innigkeit des musikalischen Ausdruckes auf. Sie sind mit verhaltener Emotionalität
und größtmöglicher Schlichtheit zu interpretieren.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Sperger - Concerto N. 15 in ReDokument55 SeitenSperger - Concerto N. 15 in ReArya AdithyaNoch keine Bewertungen
- Келлер Северная жемчужинаDokument16 SeitenКеллер Северная жемчужинаАннаNoch keine Bewertungen
- Hindemith PDFDokument102 SeitenHindemith PDFstdoeringNoch keine Bewertungen
- Musikreferat: Béla Bartók Und Die VolksmusikDokument18 SeitenMusikreferat: Béla Bartók Und Die Volksmusikderjesko100% (2)
- Im Sog der Klänge: Gespräche mit dem Komponisten Jörg WidmannVon EverandIm Sog der Klänge: Gespräche mit dem Komponisten Jörg WidmannNoch keine Bewertungen
- Titelblatt Zu KunstliedernDokument2 SeitenTitelblatt Zu KunstliedernFlorin ȚubucanNoch keine Bewertungen
- 088 Peter Härtling - WikipediaDokument6 Seiten088 Peter Härtling - WikipediaJennifer RominNoch keine Bewertungen
- Begleitmaterial DreigroschenoperDokument11 SeitenBegleitmaterial DreigroschenoperVeronikaVeliNoch keine Bewertungen
- Anton Stadler. Wirken und Lebensumfeld des "Mozart-Klarinettisten".: Fakten, Daten und Hypothesen zu seiner Biographie. ADDENDA ZU BAND 1 & BAND 2Von EverandAnton Stadler. Wirken und Lebensumfeld des "Mozart-Klarinettisten".: Fakten, Daten und Hypothesen zu seiner Biographie. ADDENDA ZU BAND 1 & BAND 2Noch keine Bewertungen
- ...Als die Noten laufen lernten... 1.3 Komponisten R bis Z: Geschichte und Geschichten der U-Musik bis 1945Von Everand...Als die Noten laufen lernten... 1.3 Komponisten R bis Z: Geschichte und Geschichten der U-Musik bis 1945Noch keine Bewertungen
- Jonas Kaufmann - WienDokument22 SeitenJonas Kaufmann - WienapolodivinoNoch keine Bewertungen
- Mahler Sinfonia N 9 Leonard BernsteinDokument8 SeitenMahler Sinfonia N 9 Leonard BernsteinCarlos DaneriNoch keine Bewertungen
- Franz SchubertDokument5 SeitenFranz SchubertP ZNoch keine Bewertungen
- Exposeì - Anne MelzerDokument9 SeitenExposeì - Anne MelzertatasrbaNoch keine Bewertungen
- Und Nach Den Ferien Mache Ich Eine Beatband AufDokument322 SeitenUnd Nach Den Ferien Mache Ich Eine Beatband Aufgottesvieh100% (1)
- Guitar Recital Hoh Volker Schubert F Mertz JK Paganini N Regondi G Mendelssohn Felix Sor F Romantic MomentsDokument17 SeitenGuitar Recital Hoh Volker Schubert F Mertz JK Paganini N Regondi G Mendelssohn Felix Sor F Romantic MomentsQuangNoch keine Bewertungen
- Antikriegstag Wuppertal 2015 ProgrammheftDokument12 SeitenAntikriegstag Wuppertal 2015 ProgrammheftklannasophieNoch keine Bewertungen
- Referat Zum Thema Bertolt BrechtDokument4 SeitenReferat Zum Thema Bertolt BrechtKEKSI THE TASTYNoch keine Bewertungen
- Message in a book: Ein Porträt in Gesprächen mit Martin ScholzVon EverandMessage in a book: Ein Porträt in Gesprächen mit Martin ScholzNoch keine Bewertungen
- Die Liszt-Orgel in Denstedt Bei Weimar (WWW - Lisztorgel.de)Dokument2 SeitenDie Liszt-Orgel in Denstedt Bei Weimar (WWW - Lisztorgel.de)ragtimepianoNoch keine Bewertungen
- Anton Rubinstein Melodía en Fa (Piano)Dokument7 SeitenAnton Rubinstein Melodía en Fa (Piano)carololopezNoch keine Bewertungen
- Schostakowitsch: Sein Leben, sein Werk, seine ZeitVon EverandSchostakowitsch: Sein Leben, sein Werk, seine ZeitBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9)
- Till Eulenspiegel Strauss SaavedraDokument14 SeitenTill Eulenspiegel Strauss SaavedraEl RoloNoch keine Bewertungen
- Bertolt BrechtDokument25 SeitenBertolt BrechtErika Braun100% (1)
- 068 Gerhard Polt - WikipediaDokument5 Seiten068 Gerhard Polt - WikipediaMinka Penelope Zadkiela HundertwasserNoch keine Bewertungen
- Österreich intim: Erinenrungen 1892 bis 1942Von EverandÖsterreich intim: Erinenrungen 1892 bis 1942Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Lebendige Vergangenheit der Familie meiner Großmutter, 3. Buch: Hochzeiten und SchwesternzwistVon EverandLebendige Vergangenheit der Familie meiner Großmutter, 3. Buch: Hochzeiten und SchwesternzwistNoch keine Bewertungen
- Blickpunkt Musical Ausgabe 98 (02-2019)Dokument96 SeitenBlickpunkt Musical Ausgabe 98 (02-2019)Γιάννος ΚυριάκουNoch keine Bewertungen
- Hans PfitznerDokument12 SeitenHans PfitznerpalisekNoch keine Bewertungen
- 110 Jewish Cabaret in Exile BookletDokument33 Seiten110 Jewish Cabaret in Exile BookletMarisa MarinoNoch keine Bewertungen
- Leonard Bernstein: Unendliche Vielfalt eines MusikersVon EverandLeonard Bernstein: Unendliche Vielfalt eines MusikersNoch keine Bewertungen
- Booklet PDFDokument72 SeitenBooklet PDFA. Sebastián CarrizoNoch keine Bewertungen
- Gesang Im BordellDokument3 SeitenGesang Im BordellofficeNoch keine Bewertungen
- 150 Jahre Hans Pfitzner - Treudeutsch Und Bitterböse - News Und Kritik - BR-KLASSIK - Bayerischer RundfunkDokument12 Seiten150 Jahre Hans Pfitzner - Treudeutsch Und Bitterböse - News Und Kritik - BR-KLASSIK - Bayerischer RundfunkStanisław WelanykNoch keine Bewertungen
- TrafikantDokument24 SeitenTrafikantsnapmail187Noch keine Bewertungen
- Störtebeker: Gottes Freund und aller Welt FeindVon EverandStörtebeker: Gottes Freund und aller Welt FeindNoch keine Bewertungen
- Kammermusik Für Verschiedene ZupfinstrumenteDokument14 SeitenKammermusik Für Verschiedene ZupfinstrumenteMattia FogatoNoch keine Bewertungen
- Nestroy UnlockedDokument8 SeitenNestroy UnlockedNoemi ZappalàNoch keine Bewertungen
- Bernhard, Jandl, Jelinek: Österreichische Musikzeitschrift 05/2015Von EverandBernhard, Jandl, Jelinek: Österreichische Musikzeitschrift 05/2015Noch keine Bewertungen
- VierzeilerDokument52 SeitenVierzeilerChris HaerringerNoch keine Bewertungen
- Das wunderbare Schicksal: Aus dem Leben des Hoftyrolers Peter ProschVon EverandDas wunderbare Schicksal: Aus dem Leben des Hoftyrolers Peter ProschNoch keine Bewertungen
- JumuDokument17 SeitenJumudsdqdqNoch keine Bewertungen
- Schicksal des Peter Stern: Geschichte einer Flucht im Jahre 1945 aus der OstslowakeiVon EverandSchicksal des Peter Stern: Geschichte einer Flucht im Jahre 1945 aus der OstslowakeiNoch keine Bewertungen
- Bind Rietmann Steinerportrait 1916Dokument4 SeitenBind Rietmann Steinerportrait 1916Joseph B. SnyderNoch keine Bewertungen
- Dienstag geh ich ins Theater: Ernst Busch - Von der Werft zur Bühne 1917-1920Von EverandDienstag geh ich ins Theater: Ernst Busch - Von der Werft zur Bühne 1917-1920Noch keine Bewertungen
- Programm Städtischer Musikverein Bottrop: Mendelssohn & Rheinberger (01.12.2012)Dokument3 SeitenProgramm Städtischer Musikverein Bottrop: Mendelssohn & Rheinberger (01.12.2012)a_musicianNoch keine Bewertungen
- Bertolt BrechtDokument3 SeitenBertolt Brechtlutscher43Noch keine Bewertungen
- Tatort Schriftstellerhaus Stuttgart: Poesie und PorträtsVon EverandTatort Schriftstellerhaus Stuttgart: Poesie und PorträtsNoch keine Bewertungen
- Schlager Für Dich 1946Dokument17 SeitenSchlager Für Dich 1946Christoph KüstnerNoch keine Bewertungen
- Biografie Bill KaulitzDokument1 SeiteBiografie Bill KaulitzcassaplusNoch keine Bewertungen
- Wirén - Sinfonías 4 y 5 PDFDokument25 SeitenWirén - Sinfonías 4 y 5 PDFCésar SalazarNoch keine Bewertungen
- Pflichtprogramm 19Dokument1 SeitePflichtprogramm 19eke.ersanekeNoch keine Bewertungen
- 115 Wir Sagen Euch An Den Lieben Advent Intonation d1Dokument1 Seite115 Wir Sagen Euch An Den Lieben Advent Intonation d1PavolChlebanaNoch keine Bewertungen
- Reger Max - Nachtlied Op.138 n.3 (Coro)Dokument4 SeitenReger Max - Nachtlied Op.138 n.3 (Coro)AlbertitoNoch keine Bewertungen
- HerzbebenDokument1 SeiteHerzbebenUlrich PotrykusNoch keine Bewertungen
- OktoberfestDokument4 SeitenOktoberfestDavid LTMNoch keine Bewertungen
- Mein Herr Marquis, Klange Der HeimatDokument10 SeitenMein Herr Marquis, Klange Der HeimatOlolelyaNoch keine Bewertungen
- Gulda TubaDokument6 SeitenGulda TubaDomenico ZizziNoch keine Bewertungen
- Fairy Dance Reel Piano Accompaniment Klavier BegleitungDokument1 SeiteFairy Dance Reel Piano Accompaniment Klavier BegleitungAriaGeigeNoch keine Bewertungen
- Je Ne Parle Pas Français - NamikaDokument3 SeitenJe Ne Parle Pas Français - NamikaYps IlonNoch keine Bewertungen
- Jury 2023Dokument2 SeitenJury 2023corina.haeubleinNoch keine Bewertungen
- Danzón No. 2Dokument16 SeitenDanzón No. 2Berny Le CuontNoch keine Bewertungen
- Baumappe HAVOFAST StudioDokument2 SeitenBaumappe HAVOFAST StudioAntonioPalloneNoch keine Bewertungen