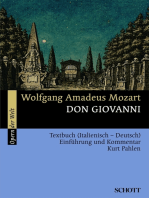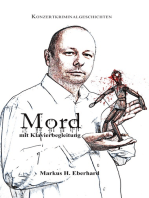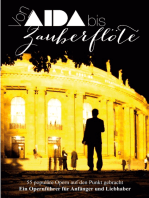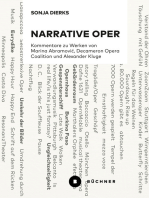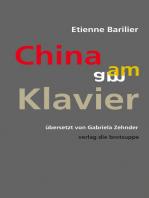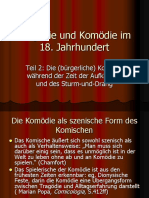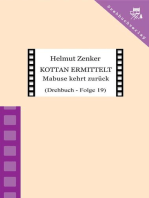Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Turandot
Hochgeladen von
Gabriel Pech0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
31 Ansichten2 SeitenReview of Turandot in Berlin
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
DOCX, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenReview of Turandot in Berlin
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
31 Ansichten2 SeitenTurandot
Hochgeladen von
Gabriel PechReview of Turandot in Berlin
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 2
Tolle Stimmen fragwürdig besetzt: „Turandot“ in der Deutschen Oper Berlin
Turandot, Giacomo Puccini
Deutsche Oper Berlin, 23. Mai 2019
Musikalische Leitung: John Fiore
Inszenierung: Lorenzo Fioroni
Bühne: Paul Zoller
Kostüme: Katharina Gault
Chöre: Jeremy Bines
Kinderchor: Christian Lindhorst
Turandot: Anna Smirnova
Altoum: Clemens Bieber
Calaf: Stefano La Colla
Liù: Meechot Marrero
Timur: Andrew Harris
Ping: Samuel Dale Johnson
Pang: Gideon Poppe
Pong: Michael Kim
Ein Mandarin: Byung Gil Kim
Erste Damenstimme: Cornelia Kim
Zweite Damenstimme: Amber Fasquelle
Chor der Deutschen Oper Berlin
Kinderchor der Deutschen Oper Berlin
Orchester der Deutschen Oper Berlin
Giacomo Puccinis letztes Werk kam erst nach seinem Tod zur Aufführung und vereint alles,
wofür der Maestro steht: komplexe Frauenrollen, Musik, die sofort unter die Haut geht, und
schließlich alles, was sich Puccini musikalisch und thematisch unter dem Orient vorstellte.
Vieles davon gibt es auch in der Deutschen Oper Berlin zu sehen und zu hören, ein paar
Dinge dieser Liste fehlen aber.
Stefano La Colla singt die Arie, für die wir alle hergekommen sind: „Nessun dorma“. Dabei
darf sich der Heldentenor im Smoking an die Rampe stellen und wie in der T-Mobile-
Werbung mit den Armen rudern. Singen kann er allerdings, das muss man ihm wirklich
lassen.
Als unbekannter Prinz (Calaf) tritt La Colla entschieden und energisch auf, seine Stimme
unterstützt das. Zuweilen klingt er etwas zu energisch, manche seiner Hochtöne wirken
unangenehm gehalten. Die positive Kehrseite davon ist, dass er kein arg zu breites Vibrato an
den Tag legt, sondern häufig auch einen schmaleren Klang verwendet.
Anna Smirnova gibt eine fabelhaft brutale Gewaltherrscherin Turandot. Sie ist dramatischer
Sopran durch und durch und beweist eine tonale Zielsicherheit bis in die Spitzentöne – hin
und wieder vielleicht etwas schrill. Ihr Mezzo füllt mühelos den Raum und schimmert über
das Orchester hinweg.
Was Smirnova allerdings wirklich nicht verkörpert, ist die Prinzessin Turandot, die ja trotz
allem noch jung ist. Denn eigentlich könnte man der Figur auch nahezu kindliche Naivität
zusprechen, wenn man bedenkt, dass sie eine 2.000 Jahre alte Gewalttat rächen möchte und
sich schließlich durch den Kuss eines hübschen Prinzen widerspruchslos umstimmen lässt.
Diese Seite der Medaille fehlt bei Smirnova leider gänzlich, eher noch hätte man eine
schallende Backpfeife nach diesem Kuss erwartet. Die Gewalt steht zwar auch durch die
Inszenierung im Vordergrund, trotzdem könnte man sich etwas mehr Verletzlichkeit für diese
Rolle vorstellen. Immer nur big und bad wird schließlich auch irgendwann langweilig.
Auch Meechot Marrero ist als Liù nicht unbedingt weich. Ihr Spiel und ihre Stimme besitzen
einen gewissen androgynen Charakter. Aktuell verleiht sie auch vermehrt kernigeren
Frauenrollen ihre Stimme, jüngst einer von Barry Kosky sehr taff gezeichneten Kunigunde in
Bernsteins Candide an der Komischen Oper Berlin. Weiterhin kann man sie erleben als
Frasquita (Carmen) oder Papagena (Zauberflöte), aber eben auch als Micaëla und Pamina.
Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich das junge Talent entwickeln wird – die
porzellanhafte Zerbrechlichkeit einer Liù kauft man ihr allerdings nicht ganz ab. Davon
abgesehen ist an ihrer Stimme natürlich nichts auszusetzen, nicht umsonst singt sie in Berlin
momentan alles, was halbwegs in ihr Stimmfach passt.
Der Sonnenkaiser Altoum bleibt dezent im Hintergrund. An ein paar Stellen zeigt Clemens
Bieber aber, was sein Tenor in Sachen herrschaftlicher Deklamation kann. Spielerisch gibt er
ein gesetztes, weises Staatsoberhaupt, das eigentlich die Faxen seiner Tochter schon lange
dicke hat.
Dann gibt es da noch drei Nebenrollen, die eigentlich Hauptrollen sind: die drei Chinesen
(ohne Kontrabass) Ping (Samuel Dale Johnson), Pang (Gideon Poppe) und Pong (Michael
Kim). Sie sind ein fantastisch eingespieltes Team, das auch klanglich hervorragend
harmoniert. Sie bringen es sogar zustande, dass selbst die etwas affigen Slapstick-Einlagen
wirklich witzig sind.
Der Inszenierung von Lorenzo Fioroni muss ich wirklich etwas zugestehen: hier habe ich zum
ersten Mal in einem Opernhaus ein ernst gemeintes erschrockenes Zusammenfahren des
Publikums erlebt. Wenn nämlich (Achtung, Spoiler!) zu Beginn des dritten Akts das
Bühnenbild nach vorne umkippt, stand für ein paar Sekunden die erschütternde Frage im
Raum: „War das Absicht?“
Diese Momente erschafft Fioroni an einigen Stellen im Stück, aber nicht immer sind sie so
eindrucksvoll. Sein Ansatz ist stark dekonstruktiv und dadurch manchmal ein bisschen
langweilig. Er hat Puccinis Vorlage von jeglichem exotistischen Pomp „befreit“, sodass man
zwischenzeitlich gar nichts mehr zum Gucken hat – auch schade. Seine Interpretation des
Endes gibt auf jeden Fall Gesprächsstoff. Ob man schließlich mit seiner Meinung mitgehen
möchte, bleibt wohl jedem selbst überlassen. Man kann ja notfalls immer noch die Augen
schließen, die Musik ist schön genug.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Don Giovanni: Einführung und KommentarVon EverandDon Giovanni: Einführung und KommentarBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (15)
- JijijijDokument18 SeitenJijijijTheVapingApeNoch keine Bewertungen
- Der Hölle Rache Kocht in Meinem HerzDokument2 SeitenDer Hölle Rache Kocht in Meinem HerzAlejandra SkinovaNoch keine Bewertungen
- Pierrot Lunaire - Der Charme Musikalischer AphorismenDokument22 SeitenPierrot Lunaire - Der Charme Musikalischer AphorismenJames WadeNoch keine Bewertungen
- DER TOD IM THEATER: Der Krimi-Klassiker aus Frankreich!Von EverandDER TOD IM THEATER: Der Krimi-Klassiker aus Frankreich!Noch keine Bewertungen
- Das Phantom Der OperDokument1 SeiteDas Phantom Der OperAnitaNoch keine Bewertungen
- Blues Fertig Web3Dokument23 SeitenBlues Fertig Web3Simone NavarroNoch keine Bewertungen
- Die Zauberflöte: Einführung und KommentarVon EverandDie Zauberflöte: Einführung und KommentarBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (14)
- Kritiken Heynen SS2003 IIDokument8 SeitenKritiken Heynen SS2003 IItatianaandreeaivanNoch keine Bewertungen
- Theaterkritik Matomena XwmataDokument2 SeitenTheaterkritik Matomena XwmataΓιώργος ΧρυσανθίδηςNoch keine Bewertungen
- Mord mit Klavierbegleitung: Kommissar Kurt Bammer ermitteltVon EverandMord mit Klavierbegleitung: Kommissar Kurt Bammer ermitteltNoch keine Bewertungen
- ROSTOCK PH - Barbier Von Sevilla - Ansicht PDFDokument11 SeitenROSTOCK PH - Barbier Von Sevilla - Ansicht PDFdippelmedienNoch keine Bewertungen
- Reminiscenzen aus Don Giovanni von W.A. Mozart op. 45: Piano SoloVon EverandReminiscenzen aus Don Giovanni von W.A. Mozart op. 45: Piano SoloNoch keine Bewertungen
- Blickpunkt Musical Ausgabe 99 (03-2019)Dokument88 SeitenBlickpunkt Musical Ausgabe 99 (03-2019)Γιάννος ΚυριάκουNoch keine Bewertungen
- Aida bis Zauberflöte: 55 populäre Opern auf den Punkt gebracht - Ein Opernführer für Anfänger und LiebhaberVon EverandAida bis Zauberflöte: 55 populäre Opern auf den Punkt gebracht - Ein Opernführer für Anfänger und LiebhaberNoch keine Bewertungen
- Spielzeit-Broschüre 14/15 - Hamburg BallettDokument140 SeitenSpielzeit-Broschüre 14/15 - Hamburg BallettNerita PokvytytėNoch keine Bewertungen
- Bernd Lafrenz - Mit Shakespeare unterwegs: Aus dem Leben des fulminanten Solo-KomödiantenVon EverandBernd Lafrenz - Mit Shakespeare unterwegs: Aus dem Leben des fulminanten Solo-KomödiantenNoch keine Bewertungen
- Flute Art Und BalladeDokument4 SeitenFlute Art Und BalladeAngelo Malerba100% (1)
- Romantika MűjegyzékDokument4 SeitenRomantika MűjegyzékdurodorkaNoch keine Bewertungen
- 72tod in Der OperDokument60 Seiten72tod in Der OperNoortje BoumanNoch keine Bewertungen
- Schumann! Aber auch Schubert und Chopin!: Leben mit den MeisternVon EverandSchumann! Aber auch Schubert und Chopin!: Leben mit den MeisternNoch keine Bewertungen
- Booklet - Fascination OperaDokument16 SeitenBooklet - Fascination OperaAdilson J. de AssisNoch keine Bewertungen
- Narrative Oper: Kommentare zu Werken von Marina Abramović, Decameron Opera Coalition und Alexander KlugeVon EverandNarrative Oper: Kommentare zu Werken von Marina Abramović, Decameron Opera Coalition und Alexander KlugeNoch keine Bewertungen
- J Vilsmaier Comedian Harmonists PDFDokument8 SeitenJ Vilsmaier Comedian Harmonists PDFPaulaRiveroNoch keine Bewertungen
- Carmen Nuñez - ContretempsDokument48 SeitenCarmen Nuñez - ContretempsAnonymous DkEIkyrNoch keine Bewertungen
- Volkstheater Rostock 2013 HAPPY BIRTHDAY, MR. PRESIDENT (UA) Kriss RussmanDokument11 SeitenVolkstheater Rostock 2013 HAPPY BIRTHDAY, MR. PRESIDENT (UA) Kriss RussmanRoland DippelNoch keine Bewertungen
- Begleitmaterial DreigroschenoperDokument11 SeitenBegleitmaterial DreigroschenoperVeronikaVeliNoch keine Bewertungen
- Tragödie Und Komödie Im 18. Teil 2Dokument27 SeitenTragödie Und Komödie Im 18. Teil 2Claudia RăuțuNoch keine Bewertungen
- Kommen Sie bitte weiter vor: Aufgezeichnet von Haide TennerVon EverandKommen Sie bitte weiter vor: Aufgezeichnet von Haide TennerNoch keine Bewertungen
- Kurt WeillDokument31 SeitenKurt WeillRoberto Cortés Mendoza0% (1)
- Dramaturgien der Phantasie: Dürrenmatt intertextuell und intermedialVon EverandDramaturgien der Phantasie: Dürrenmatt intertextuell und intermedialNoch keine Bewertungen
- TB ph107 Oper Luciadilammermoor Online GekuerztDokument10 SeitenTB ph107 Oper Luciadilammermoor Online GekuerztiNoch keine Bewertungen
- Oper in performance: Analysen zur Aufführungsdimension von OperninszenierungenVon EverandOper in performance: Analysen zur Aufführungsdimension von OperninszenierungenNoch keine Bewertungen
- Catherine Clément (Auth.) - Die Frau in Der Oper - Besiegt, Verraten Und verkauft-J.B. Metzler (1992) PDFDokument255 SeitenCatherine Clément (Auth.) - Die Frau in Der Oper - Besiegt, Verraten Und verkauft-J.B. Metzler (1992) PDFimanidanielle100% (1)
- Till Eulenspiegel Strauss SaavedraDokument14 SeitenTill Eulenspiegel Strauss SaavedraEl RoloNoch keine Bewertungen
- Alte Frauen in schlechten Filmen: Vom Ende großer FilmkarrierenVon EverandAlte Frauen in schlechten Filmen: Vom Ende großer FilmkarrierenNoch keine Bewertungen
- Abiturprüfung 2008: Deutsch, GrundkursDokument36 SeitenAbiturprüfung 2008: Deutsch, Grundkursmayarohin2004Noch keine Bewertungen
- 1 MusicologicaBrunensia 50-2015!1!4Dokument14 Seiten1 MusicologicaBrunensia 50-2015!1!4Henrik Valdemar ArupNoch keine Bewertungen
- Jeff Parc zwischen Realität und Fantasie: Erzählungen eines FilmschauspielersVon EverandJeff Parc zwischen Realität und Fantasie: Erzählungen eines FilmschauspielersNoch keine Bewertungen
- Kostenko Anna 4Dokument3 SeitenKostenko Anna 4Anna KostenkoNoch keine Bewertungen
- Der steinerne Gast: Die Begegnung mit Statuen als Vorgeschichte der BetrachtungVon EverandDer steinerne Gast: Die Begegnung mit Statuen als Vorgeschichte der BetrachtungNoch keine Bewertungen
- Melodi IDokument5 SeitenMelodi IMirevo DanielaNoch keine Bewertungen
- »Die Mörder sitzen in der Oper!«: Erkundungen zu einer unzeitgemäßen KunstVon Everand»Die Mörder sitzen in der Oper!«: Erkundungen zu einer unzeitgemäßen KunstNoch keine Bewertungen
- Programmheft 2022-05-19 Die Rache Der Berge Stummfilm Ensemble Recherche Nacho de PazDokument20 SeitenProgrammheft 2022-05-19 Die Rache Der Berge Stummfilm Ensemble Recherche Nacho de PazNacho de PazNoch keine Bewertungen
- Analyse SchumannDokument3 SeitenAnalyse SchumannGabriel Pech100% (1)
- Azoy LangDokument1 SeiteAzoy LangGabriel PechNoch keine Bewertungen
- Kottan ermittelt: Mabuse kehrt zurück: Drehbuch - Folge 19Von EverandKottan ermittelt: Mabuse kehrt zurück: Drehbuch - Folge 19Noch keine Bewertungen
- Azoy LangDokument1 SeiteAzoy LangGabriel PechNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Komödien & Tragikomödien von Jean Baptiste Molière: Der Misanthrop + Tartuffe + Die erzwungene Heirath + Der Geizige + Die Schule der Frauen…Von EverandGesammelte Komödien & Tragikomödien von Jean Baptiste Molière: Der Misanthrop + Tartuffe + Die erzwungene Heirath + Der Geizige + Die Schule der Frauen…Noch keine Bewertungen
- Gebrüllt Vor LachenDokument20 SeitenGebrüllt Vor LachenGabriel Pech50% (2)
- Antrag BZR GZRDokument1 SeiteAntrag BZR GZRGabriel PechNoch keine Bewertungen
- Komm Susser Tod Mili WIPDokument8 SeitenKomm Susser Tod Mili WIPFlorenciaAnabellaFleitasNoch keine Bewertungen
- Musik Term I No LogieDokument7 SeitenMusik Term I No LogieJoel Saavedra MuchaNoch keine Bewertungen
- Bryars - BrochureDokument72 SeitenBryars - Brochurembhngz100% (1)
- GWS Press Pack PDFDokument190 SeitenGWS Press Pack PDFCity SlangNoch keine Bewertungen
- Rep NS 2015Dokument18 SeitenRep NS 2015GaboHNoch keine Bewertungen
- SWR2 Zeitwort-2023-10-27Dokument3 SeitenSWR2 Zeitwort-2023-10-27Nils BeckerNoch keine Bewertungen
- August Klughardt - Sein Leben Und Seine WerkeDokument182 SeitenAugust Klughardt - Sein Leben Und Seine WerkeJustin MorganNoch keine Bewertungen
- Stanley Yates Beatles PDFDokument2 SeitenStanley Yates Beatles PDFDario Ibarra0% (1)
- Bist - Du - Bei - Mir in DDokument3 SeitenBist - Du - Bei - Mir in DJanNoch keine Bewertungen
- Bibl Roem LiebeselegieDokument139 SeitenBibl Roem LiebeselegieAEHNoch keine Bewertungen
- Ratsel Rallye - Lang - Mit - Lösung - DTDokument9 SeitenRatsel Rallye - Lang - Mit - Lösung - DTlucaciuancaNoch keine Bewertungen
- Genius Und DaimonDokument14 SeitenGenius Und DaimonAby_NMNoch keine Bewertungen
- IMSLP83324-PMLP04611-Pachelbel - Kanon Und Gigue Seiffert Edition - PartsDokument7 SeitenIMSLP83324-PMLP04611-Pachelbel - Kanon Und Gigue Seiffert Edition - PartsIrene BencioliniNoch keine Bewertungen
- Fuge B-Dur, BWV 866Dokument4 SeitenFuge B-Dur, BWV 866miautonNoch keine Bewertungen
- 2006 FestschriftDokument27 Seiten2006 Festschrifthappyscottlee6Noch keine Bewertungen
- Johann KanonDokument2 SeitenJohann Kanonvijay_music88Noch keine Bewertungen
- (Beiträge Zur Altertumskunde 320) Michael Erler, Jan Erik Heßler-Argument Und Literarische Form in Antiker Philosophie_ Akten Des 3. Kongresses Der Gesellschaft Für Antike Philosophie 2010-Walter de GDokument629 Seiten(Beiträge Zur Altertumskunde 320) Michael Erler, Jan Erik Heßler-Argument Und Literarische Form in Antiker Philosophie_ Akten Des 3. Kongresses Der Gesellschaft Für Antike Philosophie 2010-Walter de GTheaethetus100% (3)
- PADOVETZ J. - Variations Pour La Guitare Op. 25 - Ed. VFDokument11 SeitenPADOVETZ J. - Variations Pour La Guitare Op. 25 - Ed. VFfhhvfhng100% (1)
- Am 13.01.2024. VortragsabendDokument2 SeitenAm 13.01.2024. VortragsabendalvarompianoNoch keine Bewertungen
- Die Römisch-Sizilischen Münzen Aus Der Zeit Der Republik: Eine Nachlese / Von M. v. BahrfeldtDokument18 SeitenDie Römisch-Sizilischen Münzen Aus Der Zeit Der Republik: Eine Nachlese / Von M. v. BahrfeldtDigital Library Numis (DLN)Noch keine Bewertungen
- Das Lied Der Trennung (KV 519)Dokument5 SeitenDas Lied Der Trennung (KV 519)José PérezNoch keine Bewertungen
- BioDokument2 SeitenBioElena PlazaNoch keine Bewertungen
- JazzDokument28 SeitenJazzDieGo PrAdaNoch keine Bewertungen
- Cantata 147aDokument2 SeitenCantata 147aMarco LucatoNoch keine Bewertungen
- Adorno Ueber JazzDokument21 SeitenAdorno Ueber JazzMaria ShishkinaNoch keine Bewertungen