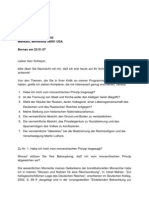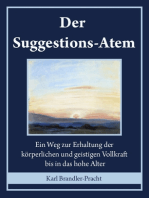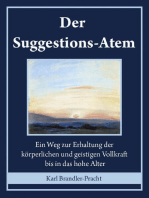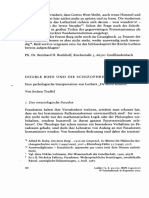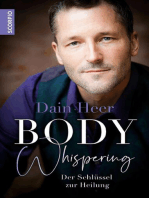Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Strack K.6
Hochgeladen von
Aldebarán GuzmánCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Strack K.6
Hochgeladen von
Aldebarán GuzmánCopyright:
Verfügbare Formate
6.
Kapitel
Die Macht der Nemesis und das Problem der Strafe
in Hölderlins frühem Denken
I. »Über den Begriff der Straffe«
(Text nach StA IV, 214-15)
Es scheint, als wäre die Nemesis der Alten nicht sowohl um ihrer
Furchtbarkeit als um ihres geheimnisvollen Ursprungs willen als
eine Tochter der Nacht dargestellt worden.
Es ist das nothwendige Schiksaal aller Feinde der Principien, daß
sie mit allen ihren Behauptungen in einen Cirkel gerathen. (Beweis).
Im gegenwärtigen Falle würd' es bei ihnen lauten: »Straffe ist das
Leiden rechtmäßigen Widerstands und die Folge böser Handlungen.
Böse Handlungen sind aber solche, worauf Straffe folgt. Und Straffe
folgt da wo böse Handlungen sind.« Sie könnten unmöglich ein für
sich bestehendes Kriterium der bösen Handlung angeben. Denn,
wenn sie konsequent sind, muß nach ihnen die Folge den Werth der
That bestimmen. Wollen sie diß vermeiden, so müssen sie vom Prin-
cip ausgehen. Thun sie diß nicht und bestimmen sie den Werth der
That nach ihren Folgen, so sind diese Folgen — moralisch betrachtet -
in nichts Höherem begründet, und die Rechtmäsigkeit des Wider-
stands ist nichts mehr, als ein Wort, Strafe ist eben Strafe, und wenn
mir der Mechanism oder der Zufall oder die Willkür, wie man will,
etwas unangenemes zufügt, so weiß ich, daß ich bösgehandelt habe,
ich habe nun weiter nichts mehr zu fragen, was geschiehet, ge-
schiehet von Rechts wegen, weil es geschiehet.
146
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Nun scheint es zwar, als ob wirklich so etwas der Fall wäre, da wo
der ursprüngliche Begriff der Straffe stattfindet, in dem moralischen
Bewußtsein. Da kündet sich uns nemlich das Sittengesez negativ an,
und kann, als unendlich, sich nicht anders uns ankündigen. Im Fac-
tum ist aber das Gesez thätiger Wille. Denn ein Gesez ist nicht thätig,
es ist nur die vorgestellte Thätigkeit. Dieser thätige Wille muß gegen
eine andre Thätigkeit des Willens gehen. Wir sollen etwas nicht wol-
len, das ist seine unmittelbare Stimme an uns. Wir müssen also etwas
wollen, dem das Sittengesez sich entgegensezt. Was das Sittengesez
ist wußten wir aber weder zuvor ehe es sich unserem Willen ent-
gegensezte, noch wissen wir es jezt da es sich uns entgegensezt, wir
leiden nur seinen Widerstand, als die Folge von dem, daß wir etwas
wollten, das dem Sittengesez entgegen ist, wir bestimmen nach dieser
Folge den Werth unseres Willens; weil wir Widerstand litten betrach-
ten wir unsern Willen als böse, wir können die Rechtmäsigkeit jenes
Widerstands, wie es scheint, nicht weiter untersuchen, und wenn diß
der Fall ist, so kennen wir ihn nur daran, daß wir leiden; er unterschei-
det sich nicht von jedem andern Leiden, und mit eben dem Rechte,
womit ich vom Widerstande, den ich den Widerstand des Sittengesezes
nenne, auf einen bösen Willen schließe, schließe ich von jedem erlit-
tenen Widerstande auf einen bösen Willen. Alles Leiden ist Strafe.
Es ist aber ein Unterschied zwischen dem Erkentnisgrunde und
Realgrunde. + Es ist nichts weniger, als identisch, wenn ich das Eine
mal sage: ich erkenne das Gesez an seinem Widerstande, und das
andre mal: ich erkenne das Gesez um seines Widerstandes willen an.
Die sind den obigen Cirkel zu machen genötiget, für die der Wider-
stand des Gesezes Realgrund des Gesezes ist. Für sie findet das Gesez
gar nicht statt, wenn sie nicht seinen Widerstand erfahren, ihr Wille
ist nur darum gesezwidrig, weil sie diese Gesezwidrigkeit empfinden;
leiden sie keine Strafe, so sind sie auch nicht böse. Strafe ist, was auf
das Böse folgt. Und bös ist, worauf Strafe folgt.
147
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Es scheint dann aber doch mit der Unterscheidung zwischen dem
Erkentnisgrunde und Realgrunde wenig geholfen zu seyn. Wenn
der Widerstand des Gesezes gegen meinen Willen Straffe ist und ich
also an der Straffe erst das Gesez erkenne, so fragt sich einmal, kann
ich an der Straffe das Gesez erkennen? und dann, kann ich bestraft
werden für die Übertretung eines Gesezes das ich nicht kannte?
Hierauf kann geantwortet werden, daß man, insofern man sich als
bestraft betrachte, nothwendig die Übertretung des Gesezes in sich
vorausseze, daß man in der Straffe, insofern man sie als Strafe beur-
theile, nothwendig des
+ ideal ohne Straffe kein Gesez
real ohne Gesez keine Straffe.
II. Analyse des Fragments
1. Der Stellenwert des Fragments in Hölderlins
frühem Denken
Noch weniger als das »Gesetz der Freiheit« wurde in der Forschung
der Entwurf1 über den »Begriff der Strafe« beachtet, obgleich er mit
jenem Fragment in engem Zusammenhang steht und sogar die Be-
dingungen formuliert, unter denen allein das >Gesetz der Freiheit seine
praktische Rechtfertigung erfahren kann. So stellt das Fragment Höl-
derlins keine Verirrung in rechtstheoretische Spekulationen während
seiner philosophischen Lehrjahre dar, sondern es bildet einen wichtigen
Baustein im System seiner ästhetisch-moralischen und geschichtsphilo-
sophischen Erwägungen, die ihn zur Zeit seiner Kant- und Platostudien
in Waltershausen bestimmen. Fichte, dessen Einfluß und dessen Bedeu-
tung für den Text man wahrnehmen zu können glaubte, hat den Ge-
dankengang des Fragments nicht entscheidend geprägt, obgleich einige
1
Der Entwurfscharakter des Fragments ist in diesem Falle an der schulmäßigen
Einführung »(Beweis)« STA IV, 214,6 leicht zu erkennen. - Vgl. Beissner
STA IV, 402,12.
148
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Passagen im Hinblick auf ihn konzipiert sind.2 Deswegen muß aber der
Text nicht in Hölderlins Jenaer Zeit verlegt werden; er hatte Fichte
bereits in Waltershausen gelesen, wie sein Brief an Hegel vom
26. Januar 1795 bezeugt (StA VI, 155,57ff.), und Charlotte von Kalb hatte
sogar schon im August 1794 »die gedruckten Aufsätze, die Fichte wö-
chentlich herausgiebt« (wohl die »spekulativen Blätter« der »Grundlage
der gesamten Wissenschaftslehre«) aus Jena angefordert, 3 sicherlich
nicht, ohne daß Hölderlin sie dazu veranlaßt hätte. So sind die fichti-
sierenden Abschnitte in dem Fragment ohne weiteres von Hölderlins
Waltershäuser Standpunkt aus zu begreifen. Der Text fügt sich bruchlos
in Hölderlins kantisch-platonische Beschäftigungen - wie sich weiterhin
zeigen wird- und legt deshalb eine frühe Datierung nahe.
Beissner hat in seinem Kommentar zur Stuttgarter Ausgabe den ge-
meinsamen »geistigen Habitus« von »Gesetz der Freiheit« und »Begriff
der Strafe« angedeutet, aber nicht näher ausgeführt.4 Er schränkt ihn
sogar dadurch ein, daß er das Fragment »Hermokrates an Cephalus«
beim Abdruck zwischen beide Texte stellt.5 Das erstaunt um so mehr,
als Beissner selbst auf handschriftliche Übergangsformen hinweist, die
in »Hermokrates an Cephalus« nicht mehr zu finden sind.6 - So ist auch
die Handschriftenlage ein Indiz für die behauptete Nähe beider Texte,
die zeitlich und inhaltlich zusammengehören und sogar eine systemati-
sche Einheit bilden: Neben dem Problem der Rückgewinnung des gött-
lichen Heils als einem Reich der Vernunft, das Hölderlin platonisch-
kantisch unter dem >Gesetz der Freiheit fordert, wird die Frage nach
dem Abfall von der ursprünglichen Gottesgemeinschaft, dem Heraus-
treten aus dem Stand der Natur - wie man rousseauistisch sagen könnte
- Dreh- und Angelpunkt seiner Waltershäuser Überlegungen. In eben
diesem Zusammenhang findet der vorliegende Text über die Strafe sei-
nen bestimmten Stellenwert: Er sucht das Problem zu fassen, »wie es
überhaupt dazu kommt, daß der erste ideale Zustand verloren« geht,7
2
Weniger der Abschnitt über >Erkenntnisgrund< und >Realgrund< - w i e Beiss-
ner meint (STA IV, 402,15) - w e i s t auf Fichte, als derjenige über die Wech-
seltätigkeit STA IV, 214,25f.
3
Vgl. STA VII, 2, S. 9, L D 136.
4
S T A IV, 401.
5
Dieses Bruchstück, das mit den beiden andern im »geistigen Habitus« nicht
zusammenhängt (vgl. im G e g e n s a t z dazu Beissner STA IV, 401) kann frühe-
stens im Herbst 1795 entstanden sein. D i e Gründe dafür habe ich in L 242a,
S. 140f. erläutert.
6
Vgl. ebd. STA IV, 401.
7
Vgl. L 66, Cornelissen, S. 25. - Cornelissen sagt treffend: »Es wurde zwar im
Fragment über das G e s e t z der Freiheit die Notwendigkeit einer A u f h e b u n g
des ersten Zustandes festgestellt, aber da der g a n z e S e i n s p r o z e ß so offensicht-
149
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
daß wir uns >losreißen< vom »friedlichen hen kai pan der Welt, um es
herzustellen, durch uns selbst« (StA III, 236). Die zentrale Frage der
Theodizee, der Ursprung des Bösen und seine mögliche Überwindung,
verklammert somit die beiden frühen Versuche über den »Begriff der
Strafe« und das »Gesetz der Freiheit«. Gelingt es, diese Beziehung und
den gemeinsamen Kontext beider Fragmente darzulegen, so wird auch
sichtbar, daß Hölderlins Denken in Waltershausen mit seinem Dichten
enger verflochten ist, als man bisher wahrnahm; 8 es zeigt sich sogar, daß
die beiden einzigen theoretischen Entwürfe dieser Zeit Hölderlins phi-
losophisch-ästhetisches Programm des >Hyperion< in nuce enthalten. Zu
Unrecht sind sie deshalb - ihrer vermeintlichen Abseitigkeit wegen - in
der Forschung vernachlässigt worden.
Liest man in dem frühen Entwurf (»Über das Gesetz der Freiheit«)
die Sätze:
Das erstemal, d a ß das G e s e z der Freiheit sich an uns äußert, erscheint es
strafend. Der A n f a n g all' unsrer Tugend geschieht v o m Bösen (IV, 1, 212,6-8),
so liegt die inhaltliche Verbindung beider Fragmente auf der Hand.
Hölderlin bezieht sich mit diesen Erläuterungen - wie früher ausge-
führt wurde 9 - auf Kants Abhandlung >Mutmaßlicher Anfang der Men-
schengeschichte<, in der eine rationale Deutung der biblischen Genesis
vorgelegt wird und in der Kant die Entwicklungsgeschichte des Men-
schen v o m Paradieseszustand über die Bewußtwerdung hin zum sozia-
lich das G e p r ä g e des Gesetzlichen trägt, ist auch für den Beginn der exzen-
trischen Bahn eine gesetzlich wirkende K r a f t zu postulieren, d u r c h die die
Bewegung ausgelöst wird.« - Eben diese »gesetzlich wirkende Kraft«, die die
» A u f h e b u n g des ersten Zustandes« einleitet, ist nach d e m »Begriff d e r Strafe«
als Ü b e r t r e t u n g des moralischen G e s e t z e s zu begreifen, die zu dessen
Erkenntnis und künftigen Befolgung führen muß. - Damit stellt sich die F r a g e
nach d e r Schuld des Menschen (vgl. A n m e r k u n g 14 dieses Kapitels).
8
Vgl. L 180, Müller, S. 116/17 in bezug auf das Thalia-Fragment des Hyperion:
»Eine g r o ß e Kluft besteht zwischen seinem Denken und seinem innersten
Fühlen und Wollen. Der kurze denkerische Anlauf führt zu einer Empfindungs-
und Gefühlswelt, in der das G e d a c h t e völlig u n t e r g e h t und überflutet wird von
tieferen Sehnsüchten und stärkeren Melodien.«
Ryan hat die Beziehung der Jenaer H y p e r i o n - F r a g m e n t e zu Fichtes Philo-
sophie näher untersucht (L 213, S. 33-57). - Dem Einfluß d e r »kantisch-ästhe-
tischen Beschäftigungen« auf die Thalia-Fassung ist bisher zu wenig nachge-
gangen worden. - Beissner sagt in bezug auf die Verflechtung von Philosophie
und Dichtung bei Hölderlin d e m g e g e n ü b e r (STA III, 433,32ff.): » G a n z fraglos
hat Hölderlin an der lebendigen Philosophie seiner Zeit leidenschaftlichen
Anteil g e n o m m e n , und diese Anteilnahme ist eine d e r G r u n d l a g e n seines
Dichtens und zumal des Hyperion.«
9
Vgl. S. 102ff. dieser Arbeit.
150
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
len Wesen beschreibt. In dieser »Geschichte der ersten Entwickelung
der Freiheit aus ihrer ursprünglichen Anlage in der Natur des Men-
schen« (A 2) ist zu lesen (A 13):
Ehe die Vernunft erwachte, war noch kein G e b o t oder Verbot, und also noch
keine Übertretung; als sie aber ihr Geschäft anfing und, schwach wie sie ist,
mit der Tierheit und deren ganzen Stärke ins G e m e n g e kam, so mußten Übel,
und was ärger ist, bei kultivierter Vernunft Laster entspringen, die dem Stande
der Unwissenheit, mithin der Unschuld, ganz fremd waren. Der erste Schritt
also aus diesem Stande war auf der sittlichen Seite ein Fall; auf der physischen
waren eine Menge nie gekannter Übel des Lebens die Folge dieses Falls, mit-
hin Strafe. Die Geschichte der Natur fängt also v o m Guten an, denn sie ist das
Werk Gottes; die Geschichte der Freiheit vom Bösen, denn sie ist Menschen-
werk.
Dieser Kantische Hintergrund des Mutmaßlichen Anfangs< bestimmt
Hölderlins Ausführungen zur Strafe sowohl im »Gesetz der Freiheit«,
als auch in der späteren Abhandlung.
Beidemale versucht er, die Strafe als Ursprungsmoment der »Ge-
schichte der Freiheit« zu deuten, die »vom Bösen« beginnen muß, weil
sie »Menschenwerk« - und somit Mißachtung des Gesetzes - ist, aber
zum »Guten« führen kann, wenn der rechte Maßstab gefunden wird.
Die »Menge nie gekannter Übel« und die »Laster« der »kultivierteren
Vernunft«, die sich beim Heraustreten aus dem Stande der Unschuld
und Unwissenheit einstellen und die gerechte Strafe zur Folge haben,
sollen zum Anlaß werden, einer vernünftigen Regel, d. h. dem Sitten-
gesetz, zu folgen, »bis vollkommene Kunst wieder Natur wird: als wel-
ches das letzte Ziel der sittlichen Bestimmung der Menschengattung ist«
( A 18).
Dieses umfassende kulturhistorische Programm, das Kant im Hin-
blick auf 1. Mose II skizziert hatte und das Hölderlin wohl auch über
Schillers Thalia-Schrift von 1790 bekannt war,10 stand auf dem Spiel,
sofern der Mensch nicht zur Erkenntnis des moralischen Gesetzes ge-
bracht werden konnte. Und eben darum kreisen die Gedanken im »Be-
griff der Strafe«: Über die Erfahrung der Strafe glaubte Hölderlin den
Menschen mit dem Kompaß des Gesetzes ausstatten zu können, um ihn
dadurch in die Lage zu versetzen, seine eigene Geschichte zu steuern.
Während er jedoch im »Gesetz der Freiheit« noch recht unproble-
matisch von der Erfahrung der Strafe und des Leides auf das moralische
10
Vgl. S. 103 dieser Arbeit und die Anmerkungen 89 und 91 zu Kapitel 3. -
(Schiller hatte in Anlehnung an Kants Text 1790 in der Thalia ähnliche Ge-
danken publiziert.)
151
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Gesetz und seine Übertretung schließt (»Das erstemal, daß das Gesez
der Freiheit sich an uns äußert, erscheint es strafend. Der Anfang all'
unsrer Tugend geschieht vom Bösen.« IV, 212,6f.), fragt er im späteren
Entwurf kritischer:
»Kann ich an der Straffe das Gesez erkennen?« (IV, 215,27) Darin
äußert sich eine Verschiebung der Perspektive: Nicht mehr die Mög-
lichkeit der emphatischen Realisierung einer progressiven »Geschichte
der Freiheit« auf Grund des erkannten Gesetzes steht jetzt für Hölder-
lin zur Debatte, sondern die Frage nach seiner Erkennbarkeit über-
haupt: Wie soll man des Gesetzes inne werden, wie soll man die Stufe
der Moralität erreichen, wenn man ursprünglich von keiner Verfehlung
wußte? Und wie kam es zum Abfall von der ursprünglichen Ordnung,
wodurch ein Gesetz erst notwendig wird? - Kant hatte dieses Stadium
der Menschheitsentwicklung als eine zwar revolutionierende, aber den-
noch natürliche Entfaltung der intellektuellen Anlagen des Menschen
gedeutet. Der Theologe Hölderlin aber fragt skeptischer:
kann ich bestraft werden für die Übertretung eines Gesezes das ich nicht
kannte? (IV, 215,27-28).
Fast einer Gottesanklage der ungerechtfertigten Paradiesesaustreibung
wegen gleicht dieser Satz. Das Prinzip der Strafe als einer gerechten
Instanz scheint aufgehoben oder doch sich im Dunkeln zu verlieren.
Wie »Reinentsprungenes« ist auch Strafe »ein Räthsel«.11 Und so be-
ginnt auch Hölderlins Text:
Es scheint, als wäre die Nemesis der Alten nicht sowohl um ihrer Furchtbar-
keit als um ihres geheimnisvollen Ursprungs willen als eine Tochter der
Nacht dargestellt worden.
Nach diesem Vorsatz, der später eingefügt ist,12 soll der Stachel der
Strafe gebrochen werden. Analog zu Schillers mythologischer Einlei-
tung in >Anmut und Würde<13 sucht Hölderlin die Abkunft der Nemesis
nicht als unberechenbare Schicksalsgewalt und damit als Ungerechtig-
keit zu deuten, sondern als schwer zugängliches, nahezu unergründli-
ches Prinzip: Nicht ihrer »Furchtbarkeit« wegen gelte sie als »Tochter
der Nacht«; ihre Rache muß somit einer vorausgegangenen Untat ange-
11
Rheinhymne, STA II, 143,46.
12
Vgl. Beissner STA IV, 735,11 f.
13
Zu Beginn von >Anmut und Würde< versucht Schiller, die »bewegliche Schön-
heit« der Anmut am Beispiel von Aphrodites Gürtel darzulegen. Er leitet da-
mit - neben Herder - eine Deutung antiker Mythen ein, die auch für Hölderlin
maßgebend wurde.
152
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
messen sein. Deshalb gilt es, den »geheimnisvollen Ursprung« aufzuhel-
len, wenn man der Übel Herr werden will. In fünf Argumentations-
schritten sucht Hölderlin die problematische Relation von Strafe und
G e s e t z zu klären, um damit zugleich die Voraussetzungen für die Ein-
sicht in das G e s e t z zu präzisieren, die im Freiheitsfragment unbestimmt
blieben. 14
In einem ersten Schritt will er die »Feinde der Principien« an den
Pranger stellen (214,5-21), die zwar auch die Strafe zu begründen such-
ten, dabei aber in einen »Cirkel« gerieten: Hölderlin wirft ihnen vor, sie
schlössen bedenkenlos von der Folge auf die Tat und könnten deshalb
»unmöglich ein für sich bestehendes Kriterium der b ö s e n Handlung an-
geben« (Z. 10-11). Hölderlins kritischer Eifer gegenüber der Tübinger
Orthodoxie bildet das Antriebsmoment der Polemik: Er m ö c h t e die
Strafe in ihrer Rechtmäßigkeit und im Prinzip erfassen, nicht doktrinär
verordnet wissen. Sie muß einen erkennbaren Grund haben, w e n n sie
nicht in Fatalismus ausarten und von Menschen stumm h i n g e n o m m e n
werden soll. Die Auslotung dieses Grundes jedoch bereitet ihm größere
Schwierigkeiten als sein rigoroser Urteilsspruch über die »Feinde der
Principien« vermuten läßt: Während er zunächst betont, daß nicht »die
Folge den Werth der That bestimmen« dürfe (214,12-13), daß man also
» v o m Princip ausgehen« müsse (Z. 13-14), heißt es überraschenderwei-
se im zweiten Argumentationsschritt (214,22-215,12):
14
Daß der »Schuld-Sühne-Gedanke an sich . . . der Hölderlinschen Welt . . .
fremd« sei - wie Allemann (L 5, S. 18) und Staiger (L 240) feststellen - wird
durch die Abhandlung über die Strafe nicht befestigt. Von den frühen Entwür-
fen her muß die Strafe als selbstverschuldet interpretiert werden, obgleich sie
andererseits mit unvermeidlicher Notwendigkeit erfolgt. Sie meint keine bare
Schicksalhaftigkeit, die nach Willkür der Götter verordnet wird, sondern sie
bleibt Index der Sittlichkeit. Wenn sie dennoch fast zwanghaft geschieht, so
daß Hölderlin im Hyperion sagen kann (STA III, 139): »Aber alles Thun des
Menschen hat am Ende seine Strafe, und nur die Götter und die Kinder trift
die Nemesis nicht«, so ist diese Unausweichlichkeit der Strafe Ausdruck der
menschlichen Schwäche, das heißt, seiner >gemischten< (sinnlich-vernünfti-
gen) Natur. Das Reich der Sittlichkeit als ein Reich des Willens kann erst über
einen unendlichen Prozeß, bei dem >Übermut< durch Strafe auszugleichen ist,
Eingang in die Realität finden. So muß »Von seines Ufers duftender
Wiese.. ilns blüthenlose Wasser hinaus der Mensch,...«(STA 1,264,29f.), um,
gleich dem Strom, seinem Schicksalsgesetz zu folgen und erst am Ende »allaus-
gleichend« mit >Vater Ozean< Versöhnung zu feiern. -Vgl. auch die Ode »Der
Frieden« (STA II, 7,25ff.).
Später freilich, nachdem es Hölderlin im »Begriff der Strafe« nicht gelun-
gen war, die Frage der Schuld prinzipiell zu klären, wirkt Strafe gleichsam als
Wachstumsreiz, als Innovation der Lebenskräfte. Sie wird zu einem Instru-
ment der >Zucht<. - Vgl. dazu die Ausführungen im Text.
153
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Nun scheint es zwar, als ob wirklich so etwas der Fall wäre (nämlich ein sol-
cher Schluß von der Folge auf den Wert der Tat), da wo der ursprüngliche
Begriff der Straffe stattfindet, in dem moralischen Bewußtsein.
In der Handschrift hatte Hölderlin zunächst sogar geschrieben: »Nun
scheint es zwar, als ob diß wirklich der Fall w ä r e . . .«1S und sich damit
n o c h mehr in den Fallstricken der Prinzipienfeinde verfangen. Offenbar
ist er der Auffassung, daß sich im »moralischen Bewußtsein« der Schluß
v o n der Folge auf die Handlung nicht vermeiden lasse, obgleich durch
die Textkorrektur angedeutet wird, daß in diesem Falle Sonderbedin-
gungen gelten sollen.
Hölderlin führt sie im folgenden j e d o c h nicht aus.16 Er unterstreicht
sogar noch einmal, daß sich im »moralischen Bewußtsein« das Sitten-
g e s e t z » n e g a t i v « und d. h. in diesem Falle wohl durch Strafe und Leid
ankündige und »als unendlich, sich nicht anders ankündigen« könne
(214,24-25)."
Im »Factum«, das Hölderlin v o m »moralischen Bewußtsein« unter-
scheidet, weil hier »das Gesez thätiger Wille« sei, müßte es demnach
gelingen, den Zirkel der Prinzipienfeinde zu durchbrechen. »Wir sollen
etwas nicht wollen«, sagt uns die »unmittelbare Stimme« des Sitten-
g e s e t z e s (214,28-29). 17 " D. h.: wir brauchen in diesem Falle nicht auf die
15
STA IV, 735,31 f.
16
Möglicherweise müssen die späteren Sätze von Z. 28 an: »Wir sollen etwas
nicht wollen...« nicht auf das »Factum« bezogen werden, wie ich es im fol-
genden nach dem Abdruck der Stuttgarter Ausgabe tue, sondern auf das »mo-
ralische Bewußtsein« selbst, weil Z. 25-28 (die Sätze über das »Factum«) in
der rechten Spalte nachgetragen sind (vgl. Beissner, STA IV, 736,4). Am Re-
sultat ändert das aber wenig, da in beiden Fällen Hölderlins Argumentation
auf einen Schluß von den Folgen auf die Tat hinausläuft.
17
Nach Kant wäre es unmöglich zu sagen, daß das »Sittengesetz« sich »negativ«
ankündige. Seiner sind wir uns »unmittelbar bewußt ... sobald wir uns Ma-
ximen des Willens entwerfen« (KpV A 53). Nur die Freiheit selbst kündigt
sich »negativ« an, da wir uns ihrer nur über das moralische Gesetz bewußt
werden können, »ohne sie jedoch einzusehen« (vgl. KpV, Einleitung, A 5). -
So zeigt sich auch von dieser Seite her wiederum Hölderlins sensualistisch
geprägte Moral, die von einem >moralischen Gefühl* (als Sinn) ausgeht und
deshalb in Kategorien der reinen Vernunftbestimmtheit gar nicht zu fassen
ist.
17
" Der Z. 25f. in der rechten Spalte nachgetragene Abschnitt (vgl. Beissner
STA IV, 736,4f.) weist auf den Einfluß von Fichtes Wechseltätigkeit, ohne daß
diese den zentralen Gedankengang des Fragments weiterhin bestimmte. Fich-
tes Einfluß wird überhaupt erst in den späteren Nachträgen spürbar. Mög-
licherweise greift Hölderlin erst auf ihn zurück, als er den Zirkelschluß der
>Prinzipienfeinde< selbst nicht zu umgehen weiß. Um so nachdrücklicher zeigt
sich daran, wie dringlich ihm das Problem der Möglichkeit der Erkenntnis des
Gesetzes gewesen sein muß.
154
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Folgen zu warten, um über die Rechtmäßigkeit der Handlung zu ent-
scheiden. Das Gesetz als die »vorgestellte Thätigkeit« (214,27) warnt
uns noch vor Ausführung der Tat.
Doch wußten wir »weder zuvor ehe es sich unserem Willen ent-
gegensezte, n o c h . . . jezt da es sich uns entgegensezt«, »was das Sitten-
gesetz ist«. »Wir leiden nur seinen Widerstand« und »bestimmen nach
dieser Folge den Werth unseres Willens« (214,30-215,5). So ist auch im
Falle des >moralischen Faktums< der Zirkel nicht zu durchbrechen. Ne-
mesis scheint mit Recht eine »Tochter der Nacht« zu sein, deren Rache
uns unvermeidlich und trotz bester Vorsätze trifft.
Hölderlin versucht dennoch, ihren dunklen Ursprung aufzuhellen, in-
dem er weiterhin den »Erkenntnisgrund« von dem »Realgrund« unter-
scheidet. Damit glaubt er sich schließlich von den »Feinden der Princi-
pien« absetzen zu können: In den Zirkel gerate nur derjenige, für den
»der Widerstand des Gesezes Realgrund des Gesezes« sei (215,17-18),
der also das Gesetz nur »um seines Widerstandes willen« anerkenne
(Z. 16). Für ihn finde das Gesetz ohne Strafe gar nicht statt.
Dieses Argument überrascht: Während Hölderlin den >Feinden< zu-
nächst den Schluß von der Folge auf die Tat zum Vorwurf machte, be-
hauptet er jetzt nur noch, die Folge ( = Strafe) dürfe nicht als Realgrund
betrachtet werden.
Nachdem er jenen Schluß (von der Folge auf die Tat) weder im »mo-
ralischen Bewußtsein« noch im »Factum« ausschließen konnte,
schwächt er die Position seiner fiktiven Gegner, um seine eigene zu
stärken. Offenbar soll die Strafe als»Erkenntnisgrund« des moralischen
Gesetzes gerechtfertigt werden.
So folgt die notwendige Frage: »kann ich an der Straffe das Gesez
erkennen?« (215,26). Damit wird der fünfte und entscheidende Argu-
mentationsschritt eingeleitet, doch bricht er bereits nach vier Zeilen,
gerade am wichtigsten Punkt der Beweisführung, ab, so daß man die
Gedankenfolge Hölderlins nur noch erschließen kann. Wahrscheinlich
ist in diesem Falle nicht eine Konzeptionslosigkeit für den fragmenta-
rischen Charakter des Textes verantwortlich zu machen, sondern der
Verlust eines Blattes.18
Der erste Halbsatz läßt noch erkennen, in welche Richtung Hölder-
lins Beweisführung zielte: Offenbar will er sagen, daß die Strafe, sofern
sie als solche anerkannt wird, »nothwendig die Übertretung des Gese-
zes« (IV, 215,30-31) und folglich auch seine faktische Wirklichkeit vor-
aussetzt. Das Bewußtsein der Strafe enthält analytisch, daß ein Gesetz
Geltung beansprucht.
'» Vgl. Beissner, STA IV, 214.
155
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
So ist die Strafe zwar als gerecht akzeptiert und gesetzlich verankert
und die scheinbare Gottesanklage zugunsten der Selbstverantwortung
des Menschen zurückgewiesen; aber die vorausschauende Einsicht in
das Gesetz und seine legale Handhabung, die das Freiheitsfragment po-
stulierte, um dadurch Strafe und Leid künftig aus der Welt zu schaffen,
kann Hölderlin nicht vermitteln. - Damit fällt er sogar im »Begriff der
Strafe« hinter die Voraussetzungen im Freiheitsfragment zurück: Wäh-
rend dort der Eindruck erweckt wurde, Freiheit kündige sich nur zum
»erstenmal« strafend an (IV, 212,6), könne dann aber zur »Tugend« und
zu einer progressiven »Geschichte der Freiheit« führen, bleibt Strafe
nach dem späteren Entwurf uneinholbar und unkalkulierbar, da sie vom
»Princip« her nicht vorauszusehen ist, sondern höchstens zum jeweili-
gen »Erkenntnisgrund« werden kann, der aber als Wirkung nur die
Rechtmäßigkeit des Leides bestätigt.
So endet das Fragment - trotz seines entgegengesetzten Anspruchs
- wie es begann: In der Nacht, aus der Nemesis unberechenbar und
strafend hervortritt. Das Wissen um das Gesetz allein genügt nicht, um
Leid auf Dauer zu vermeiden.
Das bedeutet aber für Hölderlins weitere Entwicklung: daß das
>Gesetz der Freiheit als Instrument der Kulturrevolution - bei allem
sittlichen Pathos Hölderlins - nur noch bedingt Anwendung finden
kann, so daß sein ungebrochener Aufklärungsoptimismus, den er mit
seinen Tübinger Freunden teilt, zum ersten Mal eine gewisse Einschrän-
kung erfährt, die seinem eigenen Denken eine neue, selbständige Rich-
tung gibt und seine Vereinigungsphilosophie vorbereitet. Strafe und
Leid sind von nun an nicht mehr zu eliminieren und dem selbstbewußten
Anspruch des Ich unterzuordnen, sie sind vielmehr zu akzeptieren und
zu integrieren. Dies verschafft Hölderlin für einige Zeit einen denkeri-
schen Vorsprung seinen Mitstreitern gegenüber, wobei dem Prinzip des
»Widerstreits« und seiner Vereinigung ein Vorrang gebührt.19 Später-
hin steht dem (menschlichen) >Gesetz der Freiheit sogar das >eherne
Gesetz< der Götter gegenüber, unter das sich der Mensch zu beugen
hat,19" so daß Hölderlin in der Ode >Lebenslauf< sagen kann (StA II, 22):
19 Vgl. L 111, Henrich, S. 11 ff.
19° W o l f g a n g Binder hat in einer neueren A r b e i t ( L 37a) einen W a n d e l in der
Struktur des G o t t e s b e g r i f f e s bei Hölderlin nachgewiesen; er kann zeigen, » d a ß
das S c h w e r g e w i c h t von der Subjektseite allmählich auf die Objektseite hin-
überwandert, daß also anfangs der sich orientierende Mensch, am Ende der
sich manifestierende G o t t im Vordergund steht« ( L 37a, S. 3). Eben dieser
W a n d e l im G o t t e s b e g r i f f hängt mit der Einschränkung der Freiheit und einer
stärkeren Betonung des Leids zusammen.
156
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt
All uns nieder, das Laid beuget gewaltiger,
D o c h es kehret umsonst nicht
Unser Bogen, woher er kommt.
Und weiterhin in der letzten Strophe:
Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
D a ß er, kräftig genährt, danken für Alles lern',
Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.
Es ist ganz und gar abwegig, diese Anerkenntnis des Leides, bei gleich-
zeitiger Rechtfertigung der Freiheit, sowie Hölderlins spätere »Demut«
vor einem umfassenden >göttlichen< Gesetz, dessen Anforderungen er
selbst nicht immer zu erfüllen vermag, als verhüllenden poetischen Chi-
liasmus aus politischer Resignation deuten zu wollen.20
2. Die Quelle für Hölderlins Argumentationsweise
Wäre das letzte und entscheidende Argument in Hölderlins Beweisgang
über den Begriff der Strafe nicht aus dem Fragment selbst zu entneh-
men, so gäbe es doch einen Bürgen dafür: »Wie immer, wenn (er sich)
nicht leiden kan«, nimmt Hölderlin »Zuflucht« zu Kant (VI, 187,40).
Diesmal ist es die >Kritik der praktischen Vernunft^ die ihm Asyl gewäh-
ren muß, um die Möglichkeit der Erkenntnis des Gesetzes zu sichern.
Dem IV. Lehrsatz der KpV (§ 8), der »die Autonomie des Willens«
als »das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen ge-
mäßen Pflichten« aufstellt (A 58), fügt Kant zwei »Anmerkungen« an,
von denen die eine (A 59ff.) >praktische Vorschriften< als »zum prakti-
schen Gesetze« untauglich, die andere (A 61 ff.) das Prinzip der »eigenen
Glückseligkeit« als das »gerade Widerspiel« zur Sittlichkeit erläutert.
In dieser zweiten Anmerkung findet der Begriff der »Straf würdigkeit«
seine angemessene Behandlung (A 66ff.), weil Strafe üblicherweise als
Mittel zur Besserung - und eben damit auch als Mittel zur Beförderung
der eigenen Glückseligkeit - verstanden wird.
Ein solcher Begriff von Strafe aber läuft nach Kant dem Prinzip der
Sittlichkeit zuwider, weil die Strafe selbst dann, wenn mit ihr die »gütige
Absicht« verbunden sein sollte, die Glückseligkeit des Bestraften zu be-
fördern (A 66),»doch zwar als Strafe, d. i. als bloßes Übel für sich selbst
20
Diese Tendenz herrscht in der vorwiegend sozialgeschichtlich orientierten
Hölderlindeutung der letzten Jahre vor. Vgl. besonders L 28, Bertaux, L 1,
Abusch, L 173, Mieth, L 193, Pezold und Rez. Bertaux' ebd„ S.213ff.
157
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
gerechtfertigt sein« muß, »so daß der Gestrafte, wenn es dabei bliebe,
und er auch auf keine sich hinter dieser Härte verbergende Gunst hin-
aussähe, selbst gestehen muß, es sei ihm recht geschehen, und sein Los
sei seinem Verhalten vollkommen angemessen«.
Strafe muß - wie in Hölderlins Entwurf - aus ihrem »Princip« ver-
standen werden, wenn sie >rechtmäßig< sein soll, so daß »Gerechtigkeit
. . . das Wesentliche (ihres) Begriffs« ausmacht (A 66). Deshalb ist Strafe
als ein »physisches Übel (zu betrachten), welches, wenn es auch nicht
als natürliche Folge mit dem moralisch-Bösen verbunden wäre, doch als
Folge nach Prinzipien einer sittlichen Gesetzgebung verbunden werden
müßte«. Strafe muß - wie Hölderlin sagt - »moralisch betrachtet« »in
etwas Höherem begründet« sein (IV, 214,15-16).
»Wenn nun alles Verbrechen, auch ohne auf die physischen Folgen in Anse-
hung des Täters zu sehen, für sich strafbar ist«, - so führt Kant weiter aus -,
»so wäre es offenbar ungereimt zu sagen: das Verbrechen habe darin eben
bestanden, daß er sich eine Strafe zugezogen hat, indem er seiner eigenen
Glückseligkeit Abbruch tat (welches nach dem Prinzip der Selbstliebe der
eigentliche Begriff alles Verbrechens sein müßte). Die Strafe würde auf diese
Art der Grund sein, etwas ein Verbrechen zu nennen, und die Gerechtigkeit
müßte vielmehr darin bestehen, alle Bestrafung zu unterlassen und selbst die
natürliche zu verhindern; denn alsdenn wäre in der Handlung nichts Böses
mehr, weil die Übel, die sonst darauf folgeten, und um deren willen die Hand-
lung allein böse hieß, nunmehre abgehalten wären.«
Die Argumente, die Kant hier vorträgt, um sicherzustellen, daß Strafe
nicht nach Prinzipien der Glückseligkeit und des Wohlergehens be-
urteilt werden darf, daß folglich Strafe zunächst »als bloßes Übel für
sich selbst gerechtfertigt« sein müsse, entsprechen denen, die Hölderlin
in seinem ersten Beweisschritt aufnimmt und den »Feinden der Princi-
pien« entgegenhält.
Doch ist die eigentümliche Aufbereitung der Kantischen Argumente
in Hölderlins Text nicht zu übersehen: Während Kant die »Autonomie
des Willens« als »alleinige(s) Prinzip aller moralischen Gesetze und der
ihnen gemäßen Pflichten« (A 58) von jeglichen Verunreinigungen frei
halten will (nichts anderes bezeichnen die beiden »Anmerkungen«),
stellt Hölderlin seine geborgten Argumente in einen Gedankenzusam-
menhang, dessen eigentliches Ziel es ist, die Möglichkeit der Erkenntnis
des moralischen Gesetzes zu erweisen.
Dies allerdings wäre nach Kant eine müßige Aufgabe, weil wir uns
des moralischen Gesetzes »unmittelbar bewußt werden (so bald wir uns
Maximen des Willens entwerfen)« (KpV A 53). Es darf als ein »Faktum
der Vernunft« gelten, »weil man es nicht aus vorhergehenden Datis der
158
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Vernunft, . . . , herausvernünfteln kann, sondern weil es sich für sich
selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori, der auf keiner, weder
reinen noch empirischen Anschauung gegründet ist,... Doch muß man,
um dieses Gesetz ohne Mißdeutung als gegeben anzusehen, wohl be-
merken: daß es kein empirisches, sondern das einzige Faktum der rei-
nen Vernunft sei, die sich dadurch als ursprünglich gesetzgebend... an-
kündigt.« (KpV A 56)
Diese inhaltliche Differenz kündigt - trotz analoger Argumente - für
Hölderlins Entwurf eine thematische Verschiebung an, die im folgen-
den näher zu erläutern ist und Hölderlins eigenartige Aufnahme der
Kantischen Moralphilosophie, die wir bereits im »Gesetz der Freiheit«
wahrnahmen, von einer anderen Seite beleuchtet. Zumindest wird hier
bereits sichtbar, daß Hölderlins Fragestellung im »Begriff der Strafe«
aus Kants transzendental-philosophischem Gedankengang zur Begrün-
dung der Autonomie des Willens ausbricht, und eine mehr anthropolo-
gisch-entwicklungsgeschichtliche und erzieherisch-pädagogische Rich-
tung einschlägt.
So fehlt in Hölderlins Entwurf auch die Frontstellung Kants gegen-
über der Glückseligkeitsmoral nicht ohne Grund; am Motto der >Hymne
an die Schönheit und im »Gesetz der Freiheit«wurde bereits sichtbar,
daß Hölderlins Moralkonzeption nicht frei ist von solchen Prinzipien,
und sie kehren hier wieder.
Dieser paradoxe Zug an Hölderlins Kantrezeption, einerseits dessen
Prinzipienstrenge voll zu akzeptieren, sie andererseits aber unbeabsich-
tigt durch >materiale Bestimmungsgründe<21 aufzuweichen, führt nun
auch im zweiten Beweisschritt, mit dem sich Hölderlin im »Begriff der
Strafe« wiederum an die Kantische Vorlage anschließt, zu entsprechen-
den Schwierigkeiten. In seinen weiteren Ausführungen versucht Kant
einer anderen Aushöhlungsgefahr des Autonomieprinzips zu begegnen
(A 68ff.):
Feiner noch, obgleich eben so unwahr, ist das Vorgeben derer, die einen ge-
wissen moralischen besondern Sinn annehmen, der, und nicht die Vernunft,
das moralische Gesetz bestimmete, nach welchem das Bewußtsein der Tu-
gend unmittelbar mit Zufriedenheit und Vergnügen, das des Lasters aber mit
Seelenunruhe und Schmerzen verbunden wäre, und so alles doch auf Verlan-
gen nach eigener Glückseligkeit aussetzen.
Diese Position scheint Hölderlin einzunehmen, wenn er im »moralischen
Bewußtsein« »so etwas«, d. h. einen Schluß von der Strafe auf das Ge-
setz, für unvermeidlich hält. Das »moralische Bewußtsein«, das nach
21
Vgl. dazu den wichtigen >Lehrsatz II< der K.pV, § 3, A 40ff.
159
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Kant mit dem Bewußtsein des moralischen Gesetzes identisch wäre,
hier aber überraschenderweise davon abgesetzt und nicht als Sollen,
sondern als Widerstand gegen das Wollen wahrgenommen wird, kann
bei Hölderlin nur als Erfahrung des Leides (Strafe) interpretiert werden.
Somit unterliegt er in diesem Falle dem Kantischen Verdikt, dem »Prin-
zip der Selbstliebe, oder eigenen Glückseligkeit« (KpV A 40) zu folgen,
obgleich er die Strafe vom »Princip« her rechtfertigen will.
Diese Ambivalenz seines moralischen Konzepts im »Begriff der Stra-
fe« läßt sich durch eine kurze Abschweifung erläutern: In der >Frie-
dens<-Ode (StA II, 6ff.) sagt Hölderlin von Nemesis, der strafenden Rä-
cherin, deren Abkunft als »Tochter der Nacht« er im Fragment über die
Strafe nicht auf ihre »Furchtbarkeit« zurückführt:
Die du geheim den Stachel und Zügel hältst
Zu hemmen und zu fördern, ο Nemesis,
Strafst du die Todten n o c h . . . « (II, 6,17-19)
Eben diese Attribute - »Stachel und Zügel« - schreibt Hölderlin auch
dem »Gefühl« zu: »Gefühl« sei »Zügel und Sporn dem Geist«, so heißt
es in dem Abschnitt, den Beissner mit »Reflexion« überschrieben hat
(StA IV, 233). »Durch Wärme« treibe »es den Geist weiter, durch Zart-
heit und Richtigkeit und Klarheit« schreibe »es ihm die Gränze vor«
und halte ihn, daß er sich nicht verliere; so sei es »Verstand und Wille
zugleich«.
Es ist nicht zu weit gegriffen, in diesem »Gefühl«, das im Hölderlin-
schen Sinne »moralische« zu sehen, von dem Kant in der >Grundlegung<
sagt, daß er es dem Prinzip der Glückseligkeit zurechne,»weil ein jedes
empirisches Interesse durch die Annehmlichkeit, die etwas nur gewährt,
es mag nun unmittelbar und ohne Absicht auf Vorteile, oder in Rück-
sicht auf dieselbe geschehen, einen Beitrag zum Wohlbefinden ver-
spricht«.22
Aber dieses »Gefühl« ist es auch, das Hölderlin die Übertretung des
Gesetzes ankündigt, so daß »die Quaal Echo wird«, wie es in der >Chi-
ron<-Ode heißt (StA II, 57,28) und damit zum Bestimmungsgrund der
Handlung werden kann, die den Menschen wieder auf die sittliche, die
göttliche Bahn zurückführen soll. »Gefühl« ist bei Hölderlin die richten-
de und strafende Instanz, während »Vernunft« als Gesetzgebung des
Willens die befreiende ist.23
22
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten BA 92, Fußnote; es ist zu beachten,
daß dieser Begriff vom >moralischen Gefühk bei Kant traditionelle Vorfor-
men aufnimmt, und noch nicht in dem transzendental bestimmten Sinne der
KpV zu verstehen ist. (Vgl. dazu das 1. Kapitel dieser Arbeit).
23
Vgl. Brief Nr. 97 an den Bruder vom 13. April 1795, w o Hölderlin das Gebot
160
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht verwunderlich, daß die
Frage, ob man an der Strafe das Gesetz erkennen könne, zum ent-
scheidenden Problem in Hölderlins Fragment wird, und es überrascht
auch nicht, daß er gerade dabei in Schwierigkeiten gerät: Hölderlin er-
kennt das Kantische Glückseligkeitsverdikt in dem Abschnitt über die
Strafwürdigkeit und muß deshalb nach neuen Hilfsmitteln suchen, es zu
umgehen. Er möchte nicht »feiner noch, obgleich ebenso unwahr« sein
wie jene, die einen »gewissen moralischen besonderen Sinn annehmen,
der, und nicht die Vernunft, das moralische Gesetz bestimmete«; so ist
es bezeichnend, daß er gerade an dieser entscheidenden Stelle seines
Entwurfs einen fichtisierenden Nachtrag vornimmt, der anscheinend
dazu beitragen sollte, den Schluß von der Folge auf die Tat zu vermei-
den. Darüberhinaus führt er die Unterscheidung von Erkenntnisgrund
und Realgrund ein, die in dem entsprechenden Kontext über die Strafe
bei Kant nicht zu finden ist, aber dennoch nicht auf Fichte zurückgeht
- wie man gelegentlich annahm 24 - sondern einen anderen Be-
gründungszusammenhang der Kantischen Moralphilosophie aufnimmt.
In einer Fußnote der Vorrede der KpV (A 5) sagt Kant, daß die Frei-
heit
die ratio essendi des moralischen Gesetzes, das moralische Gesetz aber die
ratio cognoscendi der Freiheit sei. Denn, wäre nicht das moralische Gesetz
in unserer Vernunft eher deutlich gedacht, so würden wir uns niemals berech-
tigt halten, so etwas, als Freiheit ist ( . . . ) anzunehmen. Wäre aber keine Frei-
heit, so würde das moralische Gesetz in uns gar nicht anzutreffen sein.
Diese Sätze passen sich der Argumentationsweise - nicht der Gedan-
kenführung - im »Begriff der Strafe« exakt an, und Hölderlin benutzt
sie, um - trotz des Kantischen Verdikts - einen Übergang von der Strafe
zum moralischen Gesetz finden zu können. Doch verwendet er die
Kantischen Begriffe wiederum nur analog: Bei Kant ist das Gesetz Er-
der Pflicht als das »heilige unabänderliche Gesez (unseres) Wesens« erläutert,
»wie jeder finden (könne), der sein Gewissen, das Gefühl jenes Gesezes, das
sich bei einzelnen Handlungen äußert, mit unparteiischem Auge« prüfe. Auf
»jenes heilige Gesez unserer Moralität« (das sich demnach im Gefühl an-
kündigt!) »gründest Du die Beurtheilung Deiner Rechte« (STA VI, 162,21 f.).
24
Vgl. L 180, Müller, S. 127; er verweist auf die Wissenschaftslehre 1,155. Dort
ist aber gar nicht von >Realgrund< und >Erkenntnisgrund< die Rede, sondern
von >Real-Grund< und >ldeal-Grund< und zwar in einem Zusammenhang der
Begründung der Vorstellung, der sich gar nicht in Hölderlins Beweisgang ein-
bringen läßt. So ist der abermalige Rückgriff auf Kantische Mittel (vgl. das
Folgende) ein zusätzliches Indiz für eine frühe Datierung des Fragments, das
sicherlich noch in Waltershausen geschrieben ist, wo Hölderlins Kantbeschäf-
tigung vielfach bezeugt ist, während sie in Jena merklich zurücktritt.
161
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
kenntnisgrund und die Freiheit Realgrund. Das Gesetz aber bedarf kei-
nes weiteren Erkenntnisgrundes, weil es sich unmittelbar im morali-
schen Bewußtsein ankündigt,25 und zwar »so unüberschreibar«, daß es
»selbst für den gemeinsten M e n s c h e n . . . vernehmlich« ist (KpV A 62).
Nach Hölderlin bedarf dagegen das Gesetz selbst eines Erkenntnisgrun-
des, der Strafe, und es gilt seinerseits als Realgrund. An die Stelle des
»einzigen Faktum(s) der reinen Vernunft« (KpV A 56) tritt so ein em-
pirisches Faktum, die Strafe, die ihrerseits zum Schlüssel der »Tugend«
werden soll, wie das Freiheits-Fragment lehrt (IV, 212,8). Freiheit war so
dazu bestimmt, ein handhabbares Instrument, ein Hebel der Kulturre-
volution zu werden, dessen man sich nur zu bedienen brauchte, sobald
einen die Strafe zur raison gebracht hatte, während sie (die Freiheit)
nach Kant »die einzige unter allen Ideen der spekulativen Vernunft (ist),
wovon wir die Möglichkeit a priori wissen, ohne sie doch einzusehen,
weil sie die Bedingung des moralischen Gesetzes ist, welches wir wis-
sen«. (KpV A 5). So war Hölderlin in der Nachfolge Kants einer der
ersten, der (in seiner frühen Periode) - unter Berufung auf Kant - einen
Vernunftbegriff zu installieren sich bemühte, der das Pathos der Frei-
heit aufnahm, der aber von Glückseligkeitsprinzipien nicht zu trennen
war und deshalb keine Moral gründen konnte, dafür aber bei einem
zweckorientierten (theoretischen) Denken Anleihen machte, die der in-
strumentellen Vernunft zugute kamen. - Daran, daß selbst der »ge-
meinste Verstand«, auch ohne Weltklugheit, dem moralischen Gesetz
entsprechen kann - Kants Beispiele beweisen das36 - und daß »dem
kategorischen Gebote der Sittlichkeit Genüge zu leisten«, nach Kant »in
jedes Gewalt (steht) zu aller Zeit« (KpV A 64), läßt sich ermessen, daß
Kants Begriff von moralisch-praktischer Vernunft unserem in-
strumentellen Vernunftbegriff vollkommen entgegensteht und nur aus
der Möglichkeit einer Autonomie des Willens begriffen werden kann.
Dieser Grund jedoch ist der Moderne unzugänglich geworden.
Auch Kant hatte in § 6 der KpV, in dem er die obige Unterscheidung
zwischen Erkenntnisgrund und Realgrund ihrem Inhalt nach noch ein-
mal aufgreift und erwägt, »wovon unsere Erkenntnis des unbedingt-
Praktischen anhebe« (A 52), die Frage gestellt, wie »das Bewußtsein
jenes moralischen Gesetzes möglich« sei?
Anders aber als Hölderlin im »Begriff der Strafe« gibt er zur Ant-
wort:
25
Vgl. dazu die Ausführungen S. 159 dieser Arbeit.
26
Vgl. zum Beispiel KpV, A 54 und A 63.
162
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
»Wir können uns reiner praktischer Gesetze bewußt werden, eben so, wie wir
uns reiner theoretischer Grundsätze bewußt sind, indem wir auf die Not-
wendigkeit, womit sie die Vernunft vorschreibt, und auf Absonderung aller
empirischen Bedingungen, dazu uns jene hinweiset, Acht haben.« (A 53)
Kant geht an dieser Stelle über eine bloß formale Bestimmung nicht
hinaus, aber es ist deutlich, daß er einen transzendentalen Weg vor-
schreibt, während Hölderlin den empirischen über die Strafe einschlägt.
- So zeigt sich im »Begriff der Strafe« noch klarer als im »Gesetz der
Freiheit«, wie unangemessen seiner sinnlichen Poetennatur Kants trans-
zendentale Erörterungen waren, auch wenn er sich ihnen nicht ver-
schließt. 27 Man darf an seine spätere, selbstkritische Bemerkung dem
Bruder gegenüber erinnern, dem Hölderlin in bezug auf seine frühe
Kant-Rezeption schreibt:
Der Geist des Mannes war noch ferne von mir. Das Ganze war mir fremd, wie
irgend einem.28
Mit seiner analogen Übertragung der Begriffe Erkenntnisgrund und
Realgrund auf das Verhältnis von Strafe und Gesetz im »moralischen
Bewußtsein« - bzw. im »Factum« 2 9 - glaubt Hölderlin, Kants Urteils-
spruch entgehen zu können, »feiner noch, obgleich eben so unwahr« zu
sein wie jene, die er selbst »die Feinde der Principien« nennt. Gleich
einem Versatzstück schiebt er diese Unterscheidung aus einem anderen
Kantischen Kontext in seinen Argumentationsgang hinein, um schließ-
lich wieder Gründe aus der gleichen Kantischen Beweisführung aufzu-
nehmen, die gegen ihn selbst gerichtet sein könnte.
So macht Kant im Fortgang seiner Erörterungen um den Begriff der
Strafe auf eine »Täuschung« aufmerksam, die bei denen zugrunde liege,
die einen »moralischen besondern Sinn« annehmen. Er sagt:
»Um den Lasterhaften als durch das Bewußtsein seiner Vergehungen mit Ge-
mütsunruhe geplagt vorzustellen, müssen sie ihn, der vornehmsten Grundlage
seines Charakters nach, schon zum voraus als, wenigstens in einigem Grade,
moralisch gut, so wie den, welchen das Bewußtsein pflichtmäßiger Handlun-
27
Daß Hölderlin die §§ 6 und 7 der KpV bei der Abfassung des Textes gegen-
wärtig waren, scheint auch das Vokabular zu beweisen: das Sittengesetz kün-
dige sich »negativ« an, sagt Hölderlin (214,24); bei Kant heißt es: »sein (des
Gesetzes?) erster Begriff« sei »negativ« (die Akad.-Ausg. verbessert in »ihr«,
der Freiheit erster Begriff, A 53). Auch das Wort »Factum« scheint Hölderlin
von A 56 aufzunehmen. Weiterhin hat wohl auch die >Grundlage zur Meta-
physik der Sitten< Hölderlin vor Augen gestanden: BA 104 ist von einem ent-
sprechenden »Zirkel« die Rede.
28
Brief Nr. 147 vom 2. November 1797, STA VI, 254,32f.
29
Vgl. Anmerkung 16 in diesem Kapitel.
163
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
gen ergötzt, vorher schon als tugendhaft vorstellen. Also mußte doch der
Begriff der Moralität und Pflicht vor aller Rücksicht auf diese Zufriedenheit
vorhergehen und kann von dieser gar nicht abgeleitet werden.«
Ferner fügt Kant hinzu, man müsse »das Ansehen des moralischen Ge-
setzes« und seinen »unmittelbaren Wert« doch »vorher schätzen«, um
»den bitteren Verweis, wenn man sich dessen Übertretung vorwerfen
kann, zu fühlen.« Deshalb sei es auch unmöglich, die »Zufriedenheit
oder Seelenunruhe« »vor der Erkenntnis der Verbindlichkeit« zu füh-
len, um sie »zum G r u n d e der letzteren zu machen«.
Eben diese Argumente sind es, zu denen Hölderlin in dem nicht mehr
vollständig überlieferten Satz ausholt, so daß man Kants Gedanken als
Kommentar zu dem intendierten Fortgang des Hölderlinschen Textes
wird lesen dürfen. Wegen dieser Schätzung des Gesetzes - >im Voraus<
- insofern man sich als bestraft betrachte(t) (StA IV, 215,29-30), nimmt
Hölderlin die Unterscheidung von Erkenntnisgrund und Realgrund aus
einem andern Kantischen Zusammenhang auf, um so schließlich doch
die Gültigkeit des Gesetzes vor der Strafe unanfechtbar zu inthronisie-
ren, so daß Strafe nur insofern Erkenntnisgrund sein soll, als sie auf die
Voraussetzung des Gesetzes verweist. Dabei läßt Hölderlin unberück-
sichtigt, daß Kant an der entsprechenden Stelle lediglich auf eine »Täu-
schung«, einen Widerspruch in der Argumentationsweise der >Prinzi-
pienfeinde< selbst aufmerksam machen möchte, ohne noch einmal zu
wiederholen, »was oben gesagt worden« (KpV A 67), nämlich daß die
Ableitung des Gesetzes von seinen empirischen Folgen die Moral im
Grunde vernichtet. Auch ist es keineswegs die Strafe, die nach Kant
notwendig »die Übertretung eines sittlichen Gesetzes begleitet«, son-
dern die »StrafWürdigkeit« (KpV A 65), so daß sich allein aus diesem
Grunde die Strafe als Erkenntnisinstrument des Gesetzes nicht eignet.
Kant will mit seinem »vorher schon« (KpV A 67) lediglich sagen, daß
über das Prinzip der Moralität bereits entschieden ist, sofern man sich
als bestraft betrachtet und von Gemütsunruhe geplagt wird, während
Hölderlin eben dieses Argument zum Anlaß nimmt, die Strafe als Er-
kenntnisgrund einzuführen. So wird erst an dieser Stelle die Raffinesse
der Hölderlinschen Beweisführung faßbar, die Kant gleichsam mit
Kantischen Mitteln zu überbieten trachtet.
Dennoch läßt die Verrückung der Bausteine im »Begriff der Strafe«
erkennen, d a ß die Frageperspektive von der Kantischen abweicht, so
daß man Hölderlins Entwurf auch wieder rechtfertigen muß, selbst
wenn sein Hantieren mit transzendentalen Versatzstücken bedenklich
bleibt.
164
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Besonders die letzten Fragen in dem Fragment - »kann ich bestraft
werden für die Übertretung eines Gesezes das ich nicht kannte?« (StA
IV, 215,27-28) - weist aus dem Begründungszusammenhang in der K p V
heraus und deutet - auch ohne den Bezug zum Freiheitsfragment her-
zustellen - auf die anthropologisch-geschichtliche Fragestellung in
Kants >Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte<. Dort war das
entscheidende Problem, wie der Mensch aus dem Zustand der Bewußt-
losigkeit, dem Naturzustand, in den Stand der Freiheit, die Stufe der
Moralität, versetzt werden könne. Und dies ist das Thema des >Hyperion<,
wie ein Blick auf die Thalia-Vorrede zeigt. Hölderlins letzte Frage in
dem Fragment hängt damit zusammen: Sie kann - nach den andeuten-
den Schlußsätzen des Fragments und deren Stützungsargumenten aus
der KpV - in zweierlei Hinsicht betrachtet werden: Sofern man sich
selbst als bestraft beurteilt, kann das Gesetz nicht so fremd gewesen
sein, daß man es nicht hätte achten können. Man kannte es also bereits
und übertrat es wissentlich, wenn auch mit Verschleierungsargumenten.
D. h. aber auch umgekehrt: daß die Übertretung eines Gesetzes, das
man in der Tat nicht kannte, auch kein Bewußtsein der Strafe hervor-
rufen kann. Strafe und Gesetz sind gleichursprünglich und bedingen
sich gegenseitig.
So zielt die letzte Frage in dem Fragment über die Strafe auf die
beiden entscheidenden Stadien in Hölderlins kulturhistorischem Mo-
dell: Den schuld- und straflosen Zustand einer instinktgeleiteten >Kind-
heit< (im einzelnen und im ganzen der Menschheitsentwicklung) und den
Zustand der erwachten Vernunft, in dem das >Gesetz der Freiheit »ge-
bietet«, um eine sittliche Ordnung zu garantieren.
Wie es dann aber zum >Übergang< von dem ursprünglichen Zustand
zum moralischen kommen kann, steht noch offen. Hier klafft eine >Lücke<
oder ein »Abgrund«, 30 der kaum zu überbrücken ist. Eben diese Brücke
sucht Hölderlin mit der vorausgehenden Frage zu bauen, o b man »an
der Straffe das G e s e z erkennen« könne. Sie wird zum Mittelglied, den
Naturstand mit dem Kulturstand zu verbinden. Das Bewußtsein des Lei-
des ist nach Hölderlin Ausdruck dafür, daß das Gesetz sein Recht bean-
sprucht. 31 Durch seine >negative< Ankündigung wird so die Lücke ge-
schlossen, so daß die Erkenntnis des Gesetzes eine progressive Hö-
herentwicklung einleiten kann:
30
Vgl. zu diesem Begriff im Hinblick auf Hölderlin: L 71, Doppler, S. 80ff.
31
Auch nach dem Brief vom 13. April 1795 führt das »vom Widerstande bewirk-
te Leiden zum Bewußtseyn« (STA VI, 164,84).
165
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
D a s e r s t e m a l , d a ß d a s G e s e z d e r F r e i h e i t sich a n uns ä u ß e r t , e r s c h e i n t es
s t r a f e n d . D e r A n f a n g all' u n s r e r T u g e n d g e s c h i e h t v o m Bösen. ( S t A IV, 212,6f.)
Da die Schwachheit eines sinnlich-vernünftigen Wesens jedoch eine ste-
tige Progression nicht garantiert, hat »alles Thun des Menschen... am
Ende seine Strafe, und nur die Götter und die Kinder trift die Nemesis
nicht« (StA III, 139).32
Entsprechend diesem grundlegenden Entwicklungsmodell vollzieht
sich nach Hölderlin der »große Übergang aus der Jugend in das Wesen
des Mannes« (StA III, 137.68).33
Auch seine Erziehungsprinzipien bestätigen diese, auf die »Revoluti-
on der Gesinnungen und Vorstellungsarten« (StA VI, 229) zielenden
kulturprogrammatischen Bemühungen: Im Brief an Ebel, dem Hölderlin
eine pädagogische Rechtfertigung schuldet für die zu vermittelnde Hof-
meisterstelle in Frankfurt, schreibt er am 23. Juli 1795 (StA VI, 178):
» I c h m u ß d a s Kind aus dem Z u s t a n d e s e i n e s schuldlosen aber eingeschränk-
ten Instinkts aus dem Zustande der Natur heraus auf d e n W e g f ü h r e n , w o es
der Kultur entgegenkömmt, ich m u ß s e i n e M e n s c h h e i t , sein h ö h e r e s Bedürf-
32
Vgl. zu d i e s e m Z u s t a n d der K i n d h e i t a u c h >Hyperion<, S T A III, 10: »Ja! ein
g ö t t l i c h W e s e n ist das Kind, s o l a n g es nicht in die C h a m ä l e o n s f a r b e d e r M e n -
s c h e n g e t a u c h t istVEs ist ganz, was es ist, und d a r u m ist es so s c h ö n i D e r
Z w a n g d e s G e s e z e s und des Schiksaals b e t a s t e t ( b e l a s t e t ? ) es nicht; im Kind'
ist Freiheit alleinVIn ihm ist F r i e d e n ; es ist n o c h mit sich selber nicht zerfallen.
R e i c h t u m ist in ihm; es kennt sein H e r z , d i e D ü r f t i g k e i t d e s L e b e n s nicht. Es
ist unsterblich, d e n n es weiß v o m T o d e nichts.«
33
Paul R e q u a d t h a t in L 201 auf eine B e z i e h u n g d e s >Hyperion< zu G o e t h e s
>Tasso< h i n g e w i e s e n . Sie läßt sich u n t e r d e m A s p e k t des Begriffes d e r S t r a f e
e r w e i t e r n : V o r allem 11,4 kreist um d a s P r o b l e m v o n Schuld und s t r a f e n d e r
G e r e c h t i g k e i t und zu Beginn v o n II, 5 sagt A n t o n i o :
» B e s c h r ä n k t und u n e r f a h r e n , hält die J u g e n d
Sich f ü r ein einzig a u s e r w ä h l t e s W e s e n
U n d alles ü b e r alle sich erlaubt.
E r (Tasso) f ü h l e sich gestraft, und strafen heißt
Dem Jüngling wohltun, daß der Mann uns danke.« ( H a m b . Ausg. 5 , 1 1 6 ) . . Stra-
f e e r s c h e i n t a u c h hier als das g e r e c h t e M a ß f ü r ein A b i r r e n von d e r » B a h n d e r
Sitten« (v. 1415), u n d so wie T a s s o f ü r seinen » E i g e n s i n n « (v. 2734) b e s t r a f t
w e r d e n muß, so die H ö l d e r l i n s c h e n G e s t a l t e n f ü r i h r e n » Ü b e r m u t « und »Stolz«.
- A u c h im e n d g ü l t i g e n >Hyperion<, in d e m Hölderlin die U n b e d i n g t h e i t s -
f o r d e r u n g d e r F r ü h f a s s u n g nicht m e h r teilt, m a c h t H y p e r i o n in d e m A u g e n -
blick mit d e n M ä n n e r n vom » B u n d d e r N e m e s i s « B e k a n n t s c h a f t , w o er zu
n e u e m L e b e n e r w a c h t , die » B e g e i s t e r u n g « ihn ü b e r s t e i g t und e r ins S c h w ä r -
m e n g e r ä t . Sie a b e r e r s c h e i n e n wie v o m Schicksal gestählt, eisern d e m G e b o t
d e r Pflicht g e h o r c h e n d (Vgl. S T A III, 32ff.). - A u c h d a s darf h e i ß e n : N e m e s i s
ist die M a c h t , die d e m M e n s c h e n seine G r e n z e zeigt und ihn a u f f o r d e r t , d e m
G e b o t d e r sittlichen Pflichterfüllung zu f o l g e n .
166
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
niß erwachen lassen, um ihm dann erst die Mittel an die Hand zu geben, wo-
mit es jenes höhere Bedürfniß zu befriedigen suchen muß, ist einmal jenes
höhere Bedürfniß in ihm erwacht, so kann und muß ich von ihm fordern, daß
es dieses Bedürfniß ewig lebendig in sich erhalten und ewig nach seiner Be-
friedigung streben soll...«
Freilich ist hier nicht von Strafe die Rede; das ist auch nicht zu erwar-
ten, w o eine leitende Hand die Katastrophe der Bewußtseinsverwirrung
vermeiden soll. Dafür aber wird das Moment der Forderung, nachdem
das »höhere Bedürfniß« erwacht ist, in ähnlicher Weise unterstrichen
wie im »Gesetz der Freiheit« und wie es vom Fragment über die Strafe
her zu erwarten ist. Mit diesem Moment der Forderung und Progressi-
on entfernt sich Hölderlin auch von Rousseauischen Erziehungsprinzi-
pien, die er mit Kant/Fichte hinter sich läßt.34
34
Hölderlins Aufnahme Rousseauischer Erziehungsprinzipien bedürfte einer
eingehenderen Analyse, als sie M. Cornelissen geleistet hat (vgl. L 66, S. 14ff,
bes. S. 3Iff.). Vor allem wird man nicht sagen können, daß Hölderlin nur des-
halb Abstand nehme von Rousseaus >negativer Erziehung<, »weil sie ihm nicht
die angemessene zu sein scheint angesichts der jetzt und hier dem Kinde mit-
gegebenen Umwelt« (S. 31). - Es sind zwei unterschiedliche Momente im Ver-
hältnis von Hölderlins und Rousseaus Erziehungsprinzipien festzuhalten: Zum
einen will er nicht wie Rousseau »abwarten«, »bis die Menschheit im Kinde
erwacht« (STA VI, 178,71); das allein wäre unter besseren Umweltbedingun-
gen vielleicht möglich. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen aber glaubt
er darauf hinwirken zu müssen, daß sie erwacht (nicht nur >böse Eindrücke<
abhalten, sondern >auf gute sinnen< - ebd. S. 178,73). - Vor allem aber - und
das ist das zweite und entscheidende Moment Rousseau gegenüber - will
Hölderlin nach dem Erwecken der Vernunft deren Anspruch auch einfordern,
um die Kultur voranzutreiben, während Rousseau gerade den negativen Ein-
fluß der Kultur auf die Entwicklung der Menschheit hervorhebt. Damit stützt
sich Hölderlin auf Fichte, der in der 5. der >Vorlesungen über die Bestimmung
des Gelehrtem, die Hölderlin schon in Waltershausen gelesen hatte, mit die-
sem Theorem Rousseaus scharf ins Gericht geht: » Vor uns also liegt, was
Rousseau unter dem Namen des Naturstandes, und jene Dichter unter der
Benennung des goldenen Zeitalters, hinter uns setzen ... Rousseau vergißt,
daß die Menschheit diesem Zustand nur durch Sorge, Mühe und Arbeit sich
nähern kann und nähern soll. Die Natur ist roh und wild ohne Menschenhand,
und sie sollte so sein, damit der Mensch gezwungen würde, aus dem untätigen
Naturstande herauszugehen und sie zu bearbeiten, damit er selbst aus einem
bloßen Naturprodukte ein freies vernünftiges Wesen würde.« - Freilich ist
nach Hölderlin wiederum die Natur nicht »roh und wild«, sondern das erste
Ideal unseres Daseins, voller Harmonie und Frieden. So hält er einerseits an
dem Naturstand Rousseaus fest, verbindet diesen aber im Fortgang der Ent-
wicklung mit dem Tätigkeits- und Progressionselement Fichtes.
Am ehesten wird dieser Synthese wiederum Kant gerecht, der in seiner
Schrift >Mutmaßlicher Anfang< auch auf Rousseau eingeht und - anders als
Fichte - sein Vorbild entgegenkommend beurteilt (vgl. A 14ff.). Kant will sa-
gen, daß bei Rousseau überhaupt kein Widerspruch bestehe zwischen der
167
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
W o die g e s c h i c k t e Hand des Erziehers j e d o c h keine Wirkung zeigt,
nachdem das » h ö h e r e Bedürfniß« e r w e c k t wurde, ist Hölderlin auch
d e r Strafe und G e w a l t als Mittel der Erziehung nicht abgeneigt: » Z w a n g
w ü r d e ich nur da gebrauchen« - s o führt er im Ebel-Brief weiter aus -
» w o ihn das Vernun/frecht überall behaupten m u ß . . . « (StA VI,
180,117f.) S o kann man auch hier nur bestraft w e r d e n für die Übertre-
tung eines G e s e t z e s , das man in der Tat kannte oder hätte kennen müs-
sen, w i e es der >Begriff der Strafe< fordert. D i e s e Prinzipien versuchte
Hölderlin auch s e i n e m eigenen Zögling g e g e n ü b e r in Waltershausen
durchzusetzen. 3 5
Behauptung des verderblichen Einflusses der Wissenschaften einerseits und
einem möglichen Fortgang der Entwicklung andererseits, sofern man die
Menschheit als »physische Gattung« von der »sittlichen« unterscheide: »In
seiner Schrift über den >Einfluß der Wissenschaftern und der über die
>Ungleichheit der Menschen< zeigt er ganz richtig den unvermeidlichen Wi-
derstreit der Kultur mit der Natur des menschlichen Geschlechts, als einer
physischen Gattung, in welcher jedes Individuum seine Bestimmung ganz er-
reichen sollte; in seinem >Emil< aber, seinem gesellschaftlichen Kontrakten
und anderen Schriften sucht er wieder das schwerere Problem aufzulösen:
wie die Kultur fortgehen müsse, um die Anlagen der Menschheit, als einer
sittlichen Gattung, zu ihrer Bestimmung gehörig zu entwickeln, so daß diese
jener als Naturgattung nicht mehr widerstreite. Aus welchem Widerstreit (da
die Kultur, nach wahren Prinzipien der Erziehung zum Menschen und Bürger
zugleich, vielleicht noch nicht recht angefangen, vielweniger vollendet ist) alle
wahre Übel entspringen, die das menschliche Leben drücken, und alle Laster,
die es verunehren ...«
Solche Gedanken entsprechen Hölderlins Erziehungsprogramm, so daß
man sagen kann, er habe Rousseau mit Kantischen Augen gesehen. - Zu Rous-
seaus Erziehungsprinzipien vgl. auch L 77, Fetscher, S. 194ff.
Hölderlins Beziehungen zu Rousseau sind in jüngster Zeit mehrfach be-
handelt worden. Vgl. bes. L 221, Scharfschwerdt; die hier dargelegten instruk-
tiven Verbindungen zu Rousseau lassen sich ebenfalls leicht in einen Kanti-
schen Rahmen stellen. - Weiterhin: L 159, Mahr, S. 84ff; gegenüber dem hier
entwickelten Rousseau-Bild Hölderlins in der Rheinhymne ist Vorsicht ange-
bracht. Keinesfalls ist Rousseau dort (v. 135f.) als »Halbgott« apostrophiert,
wie Mahr voraussetzt (S. 84 u. 88). Er steht vielmehr dem lyrischen Ich ge-
genüber, das die Halbgötter >denkt< und das sie »kennen muß«, »Weil oft ihr
Leben so/Die sehnende Brust (ihm) beweget« (v. 135-138), während Rousseau
(Dativ) »Unüberwindlich die Seele/Die starkausdauernde ward/Und sicherer
Sinn/Und süße Gaabe zu hören/Zu reden so, daß er aus heiliger Fülle/Wie der
Weingott, thörig göttlich/Und gesezlos sie die Sprache der Reinesten
giebt/...« (v. 140-146). - Hölderlin hat Rousseau als den Günstling der Natur
verehrt, dem die Gabe des Sehens und Sagens geschenkt ist, der nicht um das
>Gesetz< zu ringen brauchte wie er selbst. - Vgl. auch die Ode >Rousseau<,
STA II, 12ff., bes. v. 27.
35
Vgl. Hölderlins anfänglich zufriedene Äußerungen über sein Erzieherverhält-
nis im Brief an Neuffer vom Sommer 1794, STA VI, 126,75f., sowie die späte-
168
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Über den eigentlichen Grund, der den Menschen veranlaßt, aus dem
Naturstand, dem »glücklichen Zustande seiner Thierheit« (StA VI,
178,75f.) herauszutreten, gibt Hölderlin im »Begriff der Strafe« keine
Auskunft. Der zitierte Ebel-Brief läßt j e d o c h erkennen, daß er diesen
Vorgang als einen natürlichen, w e n n auch durch innere Umwälzungen
bestimmten Akt in der Entwicklung der Menschengeschichte begreift.
So völlig einer Kontrolle, ja, selbst einem Nachvollzug unzugänglich, kann der
erste Zustand nicht aus dem Wunsche seiner Aufhebung vom Individuum her
beendet werden. Er muß durch das organische Wachsen des Geistes, einem
Naturzustand zufolge, sein Ende finden. Es ist die Natur selbst, die diesen
Schritt im Menschen auslöst, damit er sich vom reinen Leben zum erkennen-
den zu steigern die Voraussetzungen erwerbe. 36
Auch späterhin kann man den Abfall v o m reinen Ursprung nur als un-
vermeidliche Gegebenheit, als natürliche Austreibung, hinnehmen. 37
N o c h in der >Friedens<-Ode heißt es (StA II, 7,25f.):
Wer hub es an? wer brachte den Fluch? von heut
Ists nicht und nicht von gestern, und die zuerst
Das Maas verloren, unsre Väter
Wußten es nicht, und es trieb ihr Geist sie.
Mit dieser Deutung des Sündenfalles wird die Frage der Schuld in die
des »Ärgernisses« transponiert, das nach Matthäus 18,7 unausweichlich
k o m m e n muß.
ren Mißfallenskundgebungen Charlottens von Kalb über zu harte Behandlun-
gen ihres Sohnes STA VII, 2, LD 144 und LD 147 (S. 16ff. u. 20ff.).
36
Vgl. L 66, Cornelissen, S. 31.
37
Selbst in den Gesprächen des Frankfurter Freundeskreises, im Beisein von
Hegel, scheint diese Frage noch diskutiert worden zu sein, wie Sinclairs Re-
portage-Gedicht beweist, das Hannelore Hegel im Anhang ihrer Arbeit, L 97,
S. 284ff. abdruckt. Dort läßt Sinclair den offenbar skeptischeren Hegel auf die
Frage nach dem »Ursprung« des Geistes - obgleich er dessen Wahrheit
»keineswegs« geleugnet zu haben scheint - antworten (v. 98ff.):
>»Aber< sprach er, >die Entwicklung<, -
>Was ist sie denn nun gewesen ?<
>Abgewichen von dem Ursprungs
>Wahrheit in den Schein verkehrte
>Böses Gutem selbst entsprossene
>Frieden der Natur entzweiet<,
>Und verderbt das Werk des Höchstem,
>Daß nur Heil zur Stelle Rückkehr^
>Die der irre Wahn verlassem,
>Suchend erst, was schon gewordene«
169
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Du weist nicht, wo Du hin mit Deiner Liebe sollst und mußt um Deines Reich-
thums willen betteln gehn. Wird so nicht unser Reinstes uns verunreinigt
durch Schiksaal, und müssen wir nicht in aller Unschuld verderben? O, wer
nur dafür eine Hülfe wüßte?
So schreibt Hölderlin am 2. November 1797 an den Bruder (StA VI,
254,24f.).38 - Die Frage der Schuld und Strafe wird für Hölderlin immer
unbeantwortbarer, sie ist ein >Faktum<, für das >Unmaß< und >Übermut<
zwar Auslösemomente sein können, das aber als solches eingebunden
ist in den unverrückbaren Gang des Weltgesetzes und »Sporn dem
Geiste« zu sein hat, das Schöpfungswerk zu vollenden. Die Frage nach
dem Grund der Strafe hat Hölderlin letztlich nie eindeutig zu lösen ver-
mocht. So heißt es noch in dem Gedicht >Der Mensch< (StA 1,264,25f.):
Ach! darum treibt ihn, Erde! vom Herzen dir
Sein Übermuth, und deine Geschenke sind
Umsonst und deine zarten Bande;
Sucht er ein Besseres doch, der Wilde!
Oder in der Ode >Stimme des Volks< (1. Fassung, StA II, 50,33f.):
Und wie des Adlers Jungen, er wirft sie selbst
Der Vater aus dem Neste, damit sie sich
Im Felde Beute suchen, so auch
Treiben uns lächelnd hinaus die Götter.
Mit solcher Interpretation des unschuldig-schuldhaften, aber ganz und
gar natürlichen Entwicklungsgangs der Menschheit nimmt Hölderlin -
zumindest in seiner frühen Waltershäuser Zeit - wiederum Argumente
aus Kants Deutung der Genesis auf, wie sie im >Mutmaßlichen Anfang<
niedergelegt waren. Auch hier werden die Übel und Leiden als natürli-
che Folge des Erwachens der Vernunft begriffen. Es liegt in deren We-
sen,
daß sie Begierden mit Beihülfe der Einbildungskraft, nicht allein ohne einen
darauf gerichteten Naturtrieb, sondern sogar wider denselben, erkünsteln
kann, welche im Anfange den Namen der Lüsternheit bekommen, wodurch
aber nach und nach ein ganzer Schwärm entbehrlicher ja sogar naturwidriger
Neigungen, unter der Benennung der Üppigkeit, ausgeheckt wird. Die Veran-
lassung, von dem Naturtriebe abtrünnig zu werden, durfte nur eine Kleinigkeit
sein; allein der Erfolg des ersten Versuchs, nämlich sich seiner Vernunft als
eines Vermögens bewußt zu werden, das sich über die Schranken, worin alle
38
Vgl. demgegenüber allerdings >Hyperions Jugend<, STA 111,234,27-29: »Ent-
schuldige sich keiner, ihn habe die Welt gemordet! Er selbst ists, der sich mor-
dete! in jedem Falle!«.
170
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Tiere gehalten werden, erweitern kann, war sehr wichtig und für die
Lebensart entscheidend. (A 6)
Durch diese Bewußtwerdung und der aus ihr sich ergebenden Kon-
sequenzen reift nach Kant der Mensch zum sozialen Wesen heran, in-
dem er 1) das Vermögen zu wählen ausbildet (A 7), 2) die Kraft entwik-
kelt, seine Triebe zu unterdrücken (A 8), 3) die Fähigkeit der »überlegten
Erwartung des Künftigen« wahrnimmt (A 9) und 4) die Erkenntnis sei-
nes Selbstzweckcharakters macht, »von jedem anderen auch als ein sol-
cher (ein Selbstzweck) geschätzt, und von keinem bloß als Mittel zu
andern Zwecken gebraucht zu werden« (A 10/11).
Hierin, und nicht in der Vernunft, wie sie bloß als ein Werkzeug zur Befrie-
digung der mancherlei Neigungen betrachtet wird, erkennt er die Würde des
Menschen, die ihn zum intelligiblen Wesen erhebt. Die Mühseligkeit des Le-
bens errege zwar künftig öfter den Wunsch nach einem Paradiese, dem Ge-
schöpfe (der) Einbildungskraft, um dort in ruhiger Untätigkeit und beständi-
gem Frieden sein Dasein zuzubringen; »aber es lagert sich zwischen (dem
mündigen Menschen) und jenem eingebildeten Sitz der Wonne die rastlose
und zur Entwicklung der in ihn gelegten Fähigkeiten unwiderstehlich treiben-
de Vernunft, und erlaubt es nicht, in den Stand der Rohigkeit und Einfalt zu-
rück zu kehren, aus dem sie ihn gezogen hatte. Sie treibt ihn an, die Mühe, die
er haßt, dennoch geduldig über sich zu nehmen, dem Flitterwerk, das er ver-
achtet, (nicht) nachzulaufen, und den Tod selbst, vor dem ihn grauet, über alle
jene Kleinigkeiten, deren Verlust er noch mehr scheuet, zu vergessen«. (A 12)
Diese Passagen fassen Hölderlins Kulturprogramm in toto zusammen.
Die >treibende< Kraft der Vernunft ist der Motor der Menschheitsent-
wicklung. Noch in der berühmten Athener-Rede des >Hyperion< er-
scheint sie (die Vernunft) »wie ein Treiber, den der Herr des Hauses
über die Knechte gesezt hat« (III, 83). Das klingt Kant gegenüber nun-
mehr etwas negativ; seit Hölderlins Frankfurter Zeit erscheint die Ver-
nunft dann autoritär, wenn ihr »Geistes«- und »Herzensschönheit« man-
gelt (ebd.). - Durch das platonische Moment der Schönheit modifiziert
er somit in der Frankfurter Zeit den spröden kantisch-christlichen Ent-
wicklungsgang und gibt ihm zugleich seine neue, sinnlich-lebendige An-
triebsstruktur.
Karl Löwith hat nachgewiesen, daß die Geschichtsphilosophie des
deutschen Idealismus (insbesondere die Hegels) »dem biblischen Glau-
ben an eine Erfüllung entspringt und ... mit der Säkularisierung ihres
eschatologischen Vorbildes endet«.39 Dieser Prozeß ist in Kants Deu-
tung der Genesis vorgebildet; Schiller führt sie weiter und Hölderlin
39
L 155, Löwith, S. 11 f.
171
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
begreift sie konsequent als geschichtlich-vernünftiges Heilsgeschehen.
So wird dieses - bereits vor Hegel - »auf die Ebene der Weltgeschichte
projiziert und die letztere auf die Ebene der ersteren e r h o b e n . . ,«40
Neben dem neu hinzugefügten Schönheitselement ist in Hölderlins
Projektion des Kulturverlaufs eine weitere Differenz Kant gegenüber
zu bemerken. Während dort der Prozeß vom Naturstand zum Stand der
Freiheit im ganzen gesehen stetig vor sich geht (obgleich einzelne
Rückschläge aus menschlicher Schwäche nicht zu vermeiden sind), ist
er bei Hölderlin durch einen einmaligen revolutionären Einschnitt ge-
kennzeichnet. 41 Die eigentümliche Betonung des ersten Erkenntnisaktes
der Freiheit (»das erstemal, daß das Gesez der Freiheit sich . . .
äußert...«, »der Anfang all' unsrer Tugend...«) und das hartnäckige
Ringen um seine Begründung im Fragment über die Strafe zeugen von
einer grundlegenden Umwälzung der Entwicklung, die sich vom para-
diesischen Ausgang bis zur Erkenntnis des Gesetzes als eine Geschichte
der >Seinsvergessenheit< vollzieht. Durch die neugewonnene Einsicht
ins Gesetz soll sie umgebogen werden in eine >Seinsandacht<, deren
Fernperspektive das »Vaterland« und der »Friede« ist.42
Kant hatte den einmaligen Erkenntnisakt für die progressive Kultur-
entwicklung nicht in dieser prononcierten Art gefordert. Die Natur
trifft ihre Einrichtungen so weise, daß sie den unvertilgbaren Anspruch
des moralischen Gesetzes im Widerspiel der Kräfte von selbst heraus-
treibt. Sie zwingt uns gleichsam durch Not und Übel, bei der Vernunft
Zuflucht zu suchen. Kant zögert nicht einmal, den Krieg, den er sonst
als verabscheuenswürdig zurückweist, dabei als »unentbehrliches Mit-
tel« anzuerkennen, um »diese (Entwicklung) noch weiter zu bringen«
(A 24).43 - Vielleicht wäre so der Freiheitskrieg im >Hyperion< zu recht-
fertigen.
Mit dem Versuch, das Gesetz unter seine Verfügungsgewalt zu brin-
gen, um der Geschichte Herr zu werden, erweist sich Hölderlin fast
kantischer als Kant. Sein unbändiger Wille zur Sittlichkeit, die ihren
Bestimmungsgrund jedoch von außen zu empfangen scheint - und sei
es auch nur von der seligen Erwartung eines neuen Friedens 432 - mußte
40
L 155, Löwith, S.60f.
41
Das entspricht wiederum eher Schiller und dessen Ausführungen zum Mut-
maßlichen Anfang< in der Thalia 1790. Hölderlins Beziehung zu dieser Schrift
hat auch Zinkernagel bereits klar herausgestellt (vgl. L 262, S. 45ff.).
42
»Verbotene Frucht, wie der Lorbeer, aber ist/Am meisten das Vaterland. Die
aber kost'/Ein jeder zulezt,« (STA II, 220,6f.).
43
Vgl. auch Urtkr. 393ff.
43,1
Vgl. zu diesem Prinzip: Kant, KpV, § 3, A 40ff.
172
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
ebenso herbe Enttäuschungen zur Folge haben. Das Erziehungsdebakel
in Waltershausen ist dafür ein geringes Beispiel. Anscheinend »forderte«
Hölderlin zu viel von seinem Zögling, nachdem er die Vernunft glaubte
erweckt zu haben. 44
Das Übermaß der >Forderung<, das Hölderlin unter dem Eindruck der
Kantischen Moralphilosophie - vor allem sich selbst gegenüber 4 5 - er-
hebt, um den Kulturprozeß weiterzubringen, läßt ihn recht bald auch
die Grenzen menschlicher Freiheit erkennen. So nimmt er später die
kühnen Ansprüche seiner Jugend als hybriden Übermut zurück und ver-
fällt nahezu ins entgegengesetzte Extrem einer radikalen Selbstentäuße-
rung. Die Phaethon- und Tantalus-Problematik klingt immer dann bei
ihm an, wenn er dem >ehernen Gesetz der Götter< nicht glaubt entspro-
chen zu haben. Hölderlins Entsagung führt so weit, daß er sogar die
»Trauer« zur Zeit der Götterferne als eine Art hybrider Eigenmächtig-
keit einstuft:
... Himmlische nemlich sind
Unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich
Zusammengenommen, aber er muß doch; dem
Gleich fehlet die Trauer (II, 198,48ff.)
Nicht »Trauer«, sondern »Treue« tut »Noth« (II, 197,14); Treue zu den
Göttern, gerade zur Zeit ihrer Ferne. 46 So mutet die späte Aufgabe sei-
ner Identität an wie ein willentlicher Akt der Selbstentäußerung, -
keineswegs aus politischer Enttäuschung, sondern aus der Anerken-
nung des gesetzlichen >Leides<, um es zu tragen »wie auf den Schultern
eine Last von Scheitern«, die »zu behalten« ist (Mnemosyne, II, 197,6f.).
Dem steht der frühe Anspruch nach Selbstverwirklichung unter dem
>Gesetz der Freiheit noch kontrastierend gegenüber. Dieses »gebietet,
44
Vgl. dazu Anmerkung 35 dieses Kapitels.
45
Diese Tatsache spricht sogar noch aus dem Brief Charlottens von Kalb an
Schiller nach der Lösung des Hofmeister-Verhältnisses. Vgl. STA VII, 2,
LD 147, S. 21,27f. Sie bittet Schiller, Hölderlin behilflich zu sein, um ihn von
den Sorgen zu befreien, »die wohl seine Praktische Philosophie vermehren
würden, aber nicht die Ruhe seines Lebens.«
46
Der notwendigen menschlichen >Treue< korrespondiert in der Spätzeit die
göttliche >Untreue<, weil sie »am besten zu behalten« ist. (Freilich gibt es da
auch noch menschliche Untreue). - Während in der Frühzeit die >Lücke< im
Kulturverlauf durch die menschliche Untreue, den Sündenfall, verursacht
wird und durch die Erkenntnis des Gesetzes überbrückt werden soll, scheint
die >Lücke im We!tlauf< durch göttliche Untreue geschlossen zu werden, weil
sie uns »das Gedächtniß der Himmlischen« erhält, (vgl. Anmerkungen zum
Oedipus, STA V, 202). - Auch Doppler spricht von einer »doppelten Erschei-
nungsform des Abgrunds« bei Hölderlin, vgl. L 71, S. 113).
173
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
o n e alle Rüksicht auf die Hülfe der Natur« ( S t A IV, 212,3f.), d e n Kultur-
p r o z e ß voranzutreiben. U n d das heißt: »die Organisation, die wir uns
selbst zu geben im Stande sind« ( S t A III, 163), nach b e s t e n Kräften zu
befördern.
3. D e r >Begriff der Strafe< und der Platonische >Phaidros<
N e b e n d e n vielfältigen Beziehungen zu Kants Schriften, fehlt im Frag-
m e n t über die Strafe auch d e r z w e i t e Z e u g e Hölderlinschen D e n k e n s
im Waltershausen nicht, nämlich Plato. U m diese Verbindung herzustel-
len, g e n ü g t ein Stichwort: N e m e s i s .
A u c h w e n n Hölderlin mit d e m n a c h g e t r a g e n e n ersten Satz d e s Frag-
m e n t s an Herder anzuknüpfen scheint, der 1786 in seiner
Nemesis-Abhandlung den »Begriff« der »Tochter der N a c h t « zu er-
läutern versuchte und von ihr schrieb: »Ihr furchtbarer N a m e ist nur
durch Mißverstand furchtbar geworden«, 4 7 s o motiviert g e r a d e dieser
Beitrag die Verbindung zum >Phaidros<. Herder nennt N e m e s i s hier,
nach einer Variante der Mythenüberlieferung, auch Adrasteia. 4 8
47
Herder, Nemesis, ein lehrendes Sinnbild. In: Zerstreute Blätter, 2. Sammlung
1786; vgl. ed. Suphan, Bd. 15, S.395ff. Vgl. Beissener STA IV,402,9f. u. ebd.
476,11 f. Herder führt in der Abhandlung an, daß die Nemesis von Smyrna als
eine »Tochter der Nacht« verehrt wurde (ed. Suphan 15, 406 u. 416). Man
wisse um diese Bedeutung auf Grund von Münzen. Möglicherweise hat Höl-
derlin hier die Anregung zu dem Münzmotiv in >Hyperions Jugend< erfahren.
(Vgl. STA III, 220,29f.).
48
Vgl. ed. Suphan 15, 397 u. 413. Herders Text konnte sogar eine zusätzliche
Rechtfertigung für Hölderlins Verbindung von Strafe und Schönheit bieten,
wie sie überraschenderweise im Freiheitsfragment sichtbar wurde: Herder
erwähnt die Sage von dem Bildhauer Alkamenes, der seine Nemesis mit den
Zügen der Aphrodite gestaltete. So sehr wir uns über diese Verwandlung der
Nemesisgestalt wundern könnten, meint Herder, weil dadurch »eine nach un-
sern Begriffen leichtsinnige Göttin zur ernstesten von allen« umgeschaffen
werde, - für die Denkart der Griechen sei das keineswegs bedenklich. Außer-
dem habe es schon eine irdische Venus gegeben, »die unter den Himmlischen
Nemesis geworden war«, nämlich Leda, die Mutter der Helena und der Dios-
kuren (Leda trage im Olymp den Namen der Nemesis). So sei »die Kunstge-
stalt der Nemesis als einer schönen Göttin gegeben«. »Ihr Ernst mischte sich
. . . mit aller liebreizenden Anmuth.« (Herder, ed. Suphan 15,399-403).
Nicht unwichtig scheint auch die Tatsache, daß Alkamenes seine Statue
aus einem Marmorblock schuf, den die Perser bei ihrem Ansturm auf
Griechenland als Trophäe fortschleppen wollten. Nach ihrer Niederlage bei
Marathon mußten sie den Block zurücklassen. Herder kommentiert: »Konnte
der Künstler aus diesem stolzen Marmor, aus dieser unreifen Trophäe etwas
Höheres und Schöneres als die Göttin bilden, die allen stolzen Übermuth, alle
kecke Siegesfreude vor dem Siege, ja jedes prahlende Wort, jeden phan-
tastischen Hochmuth hasset.« (ebd. 403.) So geht auch hier - wie bei Hölderlin
- aus dem gestraften Übermut die neue schöne Welt hervor.
174
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
So lassen sich nun die Bezugspunkte des >Phaidros< - einerseits zum
»Gesetz der Freiheit«, andererseits zum »Begriff der Strafe« - klarer
zuordnen:
Für die Rückführung zum göttlichen Ursprung, die nach Plato unter
der belebenden Wirkung des Irdisch-Schönen zu bewerkstelligen ist,
hatte Hölderlin mit Kantischen Mitteln das >Gesetz der Freiheit aufge-
stellt; das Moment des Abfalls vom Göttlichen aber, das im >Phaidros<
unter dem »Gesetz der Adrasteia« veranschaulicht wird (248c), sucht er
im »Begriff der Strafe« - wiederum mit Kantischen Mitteln - zu begrün-
den und interpretiert es als Verderbnis der sittlichen Prinzipien. - Kant
liefert somit die Philosophie, Plato die poetisch-bildliche Grundlage.
Auch hier erläutert Hölderlin beide wechselseitig und nur mit geringen
Verschiebungen, die das für ihn entscheidende Moment der Schönheit
betreffen, so daß er in der Tat den »Kommentar« zum >Phaidros<, den
er im Brief an Neuffer ankündigt,49 nicht schuldig geblieben ist.
Nach dem »Gesetz der Adrasteia«, der Göttin der sittlichen Weltord-
nung, die auch Hoch- und Übermut straft - wie Herder in seiner Analyse
ausführt - verliert diejenige Seele, die - bei den Götterauszügen »auf
dem Rücken des Himmels« (247c) - »als des Gottes Begleiterin«, nichts
»erblickt hat von dem Wahrhaften«, den Ort ihres Heils (248c). Sie wird
bestraft für » Vergessenheit und Trägheit« und für das Ungeschick ih-
res Führers, der Vernunft, welcher es nicht gelang, die >Seelenrosse<
ordnungsgemäß zu leiten (248c und 247c).50
So gibt der >Phaidros< nun auch einen Grund an für den Verlust der
ursprünglichen Vollendung: >Vergessenheit< und >Trägheit< bestätigen
das für Hölderlins Frühzeit so entscheidende Moment der Aktivität von
seiner Kehrseite; - selbstischer Eigennutz und Rücksichtslosigkeit kom-
men hinzu51 und - sofern man das Phaethon-Problem mit berücksichtigt,
das Hölderlin in den Platonischen Mythos einbezieht - auch Übermut
und Selbstherrlichkeit. Ein heilsames Mittel allen diesen Lastern gegen-
über scheint Hölderlin mit Plato in der Schönheit wahrgenommen zu
haben: Überraschenderweise stellte er seine transzendentalen Erör-
terungen im »Gesetz der Freiheit« vor einen heilsgeschichtlichen Hin-
tergrund. Mit den ästhetisch-moralischen Bestimmungen führte er so-
gar den Begriff der Strafe ein. Doch bezog er sich damit nicht auf Plato,
49
Vgl. Brief Nr. 88, STA VI, 137,90 und Kapitel 5 dieser Arbeit.
50
Vgl. dazu Piatos gleichnishafte Bestimmung des Wesens der Seele, Phaidros
246aff. und seine Ausführungen zur Beschaffenheit der beiden Seelenrosse,
253cff.
51
Die Selbstsucht des bürgerlichen Egoismus, die >l'amour propre< Rousseaus
könnte hier ebenfalls erwähnt werden.
175
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
sondern auf Kants Abhandlung Mutmaßlicher Anfang der Menschen-
geschichtet die ihrerseits den heilsgeschichtlichen Mythos der christli-
chen Genesis rational zu deuten versucht. Hier übernimmt die Schön-
heit keine Funktion im Verlauf der Gestaltung der «weiten Natur<. Die
moralische Kraft allein sollte die »mühesame Bahn« bewältigen (A 24).
- Eben dieses platonische Moment des Schönen aus dem >Phaidros<
aber fügt Hölderlin ein in die nach kantischem Muster gedachte Ent-
wicklung der Menschengeschichte.52
So werden unter dem Siegel der Vernunft christlicher und platoni-
scher Sündenfallmythos miteinander verwoben und die Schönheit er-
hält unter Kantischen Bestimmungen der Moral, deren Leitgedanken
Hölderlin übernimmt, ihren einzigartigen Stellenwert im Prozeß der ak-
tiven Wiedererringung des Göttlichen, als einem Reich der Freiheit.53
Unschwer ist hinter diesem Ab- und Aufschwung im heilsgeschicht-
lichen Prozeß, der für den christlichen Mythos ebenso gilt wie für den
platonischen, jener Bildungsgang wahrzunehmen, den Hölderlin im >Hy-
perion< als »exzentrische Bahn« gekennzeichnet hat. Deshalb lassen
sich die beiden Abhandlungen »Über den Begriff der Straffe« und »Über
das Gesez der Freiheit« in ihrer komplementären Bezogenheit nicht
zuletzt auch deuten als Hölderlins Versuch einer theoretischen Grund-
legung der »exzentrischen Bahn«: Im >Begriff der Strafe< sollte die
Übertretung des Gesetzes formuliert werden, die Strafe als »physisches
Übel« nach sich zieht (KpV A 66); diese Strafe aber führt zugleich zur
Erkenntnis des Gesetzes, mit dessen Hilfe eine unendlich fortschreiten-
de, progressive Kulturentwicklung praktisch eingeleitet werden kann.54
52
D a s läßt sich v o n den Jenaer Hyperionfragmenten her belegen: Dort verbin-
det Hölderlin den Abfall vom göttlichen Ursprung unmittelbar mit der Geburt
der Liebe und der Schönheit. Vgl. STA III, 192,11: »Als unser ursprünglich
unendliches W e s e n zum erstenmale leidend ward und die freie volle Kraft die
ersten Schranken e m p f a n d , . . . , da ward die Liebe. Fragst du, wann das w a r ?
Plato sagt: A m T a g e da Aphrodite geboren ward.« ( D a ß diese Jenaer Entwür-
fe bereits unter Prämissen Fichtischer Philosophie stehen, ist in diesem Falle
nicht entscheidend). - Dieses S c h ö n h e i t s m o m e n t ist in d e m heilsgeschichtli-
chen Entwurf Kants undenkbar.
53
Vgl. L 41, Böckmann, Einleitung S. VIII: »Erst w e n n man einen Zugang findet
zu dem, was Hölderlin mit den G ö t t e r n meint, läßt sich Gestalt und Form
seiner Dichtung verstehen.« S. 331/32: »Mit letzter Klarheit werden die auf
das Jenseits b e z o g e n e n Lehren in das diesseitige Leben hineingewiesen und
v o n ihm aus zu deuten gesucht.« In seinem neueren Aufsatz >Sprache und
Mythos in Hölderlins Dichtern bekräftigt Böckmann diese Interpretationsten-
denz (vgl. L 44, S. 9,13/14).
54
Vgl. das G e d i c h t >Das Schicksal^ 8. Str. (STA 1,186,61-64): »Wohl ist Arka-
dien e n t f l o h e n ^ D e s Lebens beßre Frucht gedeiht/Durch sie, die Mutter der
H e r o e n / D i e e h e r n e N o t h w e n d i g k e i t . « - » N o t h w e n d i g k e i t « kann hier geradezu
e t y m o l o g i s c h g e l e s e n werden als > Wende der Not<.
176
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Die Erkenntnis des Gesetzes ist der tiefe Scheitelpunkt der Kurve, in
dem sich die Abwärtsbewegung umkehrt,55 Er bedeutet Erfahrung der
Endlichkeit, Bewußtsein, Strafe, aber zugleich auch Geburt der Schön-
heit und damit Antrieb zu einem neuen göttlichen Aufschwung. Durch
die Erkenntnis des Gesetzes wird die Lücke im Heilsplan geschlossen,
und das >Gesetz der Freiheit< kann zum Schlüssel werden, die Pforten
55 M a n wird diese > Umkehr^ die m a n die > freie Umkehn n e n n e n könnte, unter-
scheiden müssen von der s p ä t e r e n , sog. > v a t e r l ä n d i s c h e n Umkehn, die Höl-
derlin in seinen » A n m e r k u n g e n « zum >Oedipus< und zur >Antigonae< entwik-
kelt (vgl. S T A V, 202f. und 271 f.). - Auch wenn e r dort die » v a t e r l ä n d i s c h e
U m k e h r « eine » U m k e h r aller V o r s t e l l u n g s a r t e n und F o r m e n « nennt ( 2 7 1 , 5 )
und andeutet, d a ß es m e h r e r e A r t e n der v a t e r l ä n d i s c h e n U m k e h n gibt
( 2 7 1 , 1 9 - 2 0 ) - die » k a t e g o r i s c h e « ist wohl eine davon (202,13) - b e d e u t e t d i e s e
s p ä t e F o r m e h e r eine U m k e h r im V a t e r l a n d bzw. eine /4Z>kehr von ihm ( v o m
» u n t e r g e h e n d e n V a t e r l a n d « spricht Hölderlin in >Das W e r d e n im V e r g e h e n <
- S T A IV, 282,2) - , w o g e g e n in d e r frühen Zeit die U m k e h r sich in der Fremde
vollzieht und auf das V a t e r l a n d hin erfolgt (vgl. T h a l i a - F r a g m e n t ,
S T A III, 164). W ä h r e n d bei j e n e r »das g r ä n z e n l o s e E i n e s w e r d e n durch grän-
zenloses S c h e i d e n sich r e i n i g e t « (V, 2 0 1 , 2 1 - 2 2 ) , führt bei dieser die a b s o l u t e
G e t r e n n t h e i t zu einer neuen Einheit (vgl. den Aufschwung der g o t t f e r n e n S e e -
len im >Phaidros<). D e r » a l l v e r g e s s e n d e n F o r m d e r U n t r e u e « dort (V, 202,5),
steht hier ein u n u m s c h r ä n k t e s Z u t r a u e n e n t g e g e n . Auch stehen sich >Verges-
sen< in der >vaterländischen< (V, 202,5 u. 7) und B e w u ß t w e r d e n durch >Erinne-
rung< (anamesis) in d e r >freien U m k e h n g e g e n ü b e r . - J e n e U m k e h r bedingt die
tragische F o r m ; diese b e g r ü n d e t e h e r die heroische. - D o p p l e r L 72, S . 79
weist in einer F u ß n o t e darauf hin, d a ß das W o r t >jezt< bei Hölderlin ein Ap-
pellativum ist und » e i n e V e r ä n d e r u n g anzeigt, den A n b r u c h d e s N e u e n « . - Es
k a n n für die >freie U m k e h n stehen.
V o n diesen beiden U m k e h r e n h e r ist überhaupt erst die zyklische Struktur
des Hölderlinschen D e n k e n s zu b e g r e i f e n (sofern man bei K e h r e n n o c h von
Zyklen s p r e c h e n kann). In ihr ist Progression m i t g e d a c h t . Zu ähnlichen Er-
gebnissen unter a n d e r e n V o r a u s s e t z u n g e n k o m m t U v o H ö l s c h e r , L 118,
S. 2 1 - 4 3 . - B e i d e - K r e i s b e w e g u n g und P r o g r e s s i o n - sind in der M e t a p h o r i k
des Wasserzyklus in Hölderlins D i c h t u n g k o n s e q u e n t d u r c h g e f ü h r t (auch hier
handelt es sich j a nicht um einen e i n f a c h e n >Kreis<-Lauf; - vgl. ζ. B. >Stimme
des Volks<, 1. Fassg., S T A 11,49,13-20).
Zu d e m wichtigen Begriff der >Umkehr< bei Hölderlin vgl. w e i t e r h i n : L 122,
H o f und die g e r m a n i s t i s c h e S t a a t s e x a m e n s a r b e i t von G e r h a r d Kurz, L 147,
die >Umkehr< als » P r i n z i p « bei Hölderlin b e h a n d e l t (sie wird in a b s e h b a r e r
Zeit e r w e i t e r t als Dissertation e r s c h e i n e n ) .
A u c h das Prinzip d e r >Revolution< in Hölderlins W e r k ist in d i e s e m umfas-
senden Z u s a m m e n h a n g zu e r ö r t e r n . Vgl. L 226, J o c h e n S c h m i d t , S. 121 und
Ryan, d e r ebenfalls die politischen Zielsetzungen einem » ü b e r g r e i f e n d e n Ent-
w i c k l u n g s p r o z e ß « u n t e r o r d n e t : L 214, S. 171. Ähnlich argumentiert
neuerdings auch S c h a r f s c h w e r d t , d e r aufgrund e i n e r e m p i r i s c h e n A n a l y s e d e r
B r i e f e Hölderlins zu den g l e i c h e n E r g e b n i s s e n ( e i n e r >Revolution< des » i n n e r e n
M e n s c h e n « ) k o m m t : L 222, S. 223.
177
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
des Paradieses wieder zu öffnen, in dem die goldenen Äpfel der He-
speriden am Abend der Zeit keine verbotene Frucht mehr sind.56
56
Vgl. den ersten Brief des Thalia-Fragments (STA III, 165): »wohl dem, der sie
überstanden hat, diese Feuerprobe des Herzens, der es verstehen gelernt hat,
das Seufzen der Kreatur, das Gefühl des verlorenen Paradieses.« Nach diesen
Voraussetzungen kann man zweifeln, ob Beissners Korrektur des Anfangs der
zweiten >Hymne an die Freiheit, in der er den Indikativ des Neufferschen
Druckes nach der Abschrift der Prinzessin Auguste in einen Konjunktiv ver-
wandelt, berechtigt ist (vgl. STA 1,157 und Kommentar S. 461).
Der Dichter mag durchaus »an des Orkus Thoren« gestanden haben, sofern
er »sein Gesez« verloren hatte, das ihm nun wieder »zartes Leben« gewährt.
Auch in der 2. Str. der ersten Fassung dieser Hymne heißt es: »Sint dem
Staube mich ihr Arm entrissen« (der Arm der Freiheit). Vgl. auch das Gedicht
>Lebenslauf< (STA II, 22): »Herrscht im schiefesten Orkus/Nicht ein Grades,
ein Recht noch auch?/Diß erfuhr ich ...« - Vgl. auch die Bedeutung der »Trüm-
mer der Vorzeit« für Hölderlin; dazu L 220, Schadewaldt, S. 716.
178
Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated
Download Date | 2/18/20 3:54 PM
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Quellen sinnvollen Lebens: Woraus wir Kraft schöpfen könnenVon EverandQuellen sinnvollen Lebens: Woraus wir Kraft schöpfen könnenNoch keine Bewertungen
- HORST MAHLER Brief An Ronald SchleyerDokument34 SeitenHORST MAHLER Brief An Ronald Schleyer485868100% (1)
- Keyserling, Das Buch Vom Persönlichen Leben 10 PDFDokument6 SeitenKeyserling, Das Buch Vom Persönlichen Leben 10 PDFAnne HolzapfelNoch keine Bewertungen
- Einsichten und Betrachtungen I: Handbuch des kritischen DenkensVon EverandEinsichten und Betrachtungen I: Handbuch des kritischen DenkensNoch keine Bewertungen
- Beiträge Negatives UrteilDokument30 SeitenBeiträge Negatives UrteilDavid HeNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band IV: Die Schriften 39-45 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band IV: Die Schriften 39-45 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Carl Leonhard Reinhold - Briefe Über Die Kantische Philosophie I-De Gruyter (1790)Dokument384 SeitenCarl Leonhard Reinhold - Briefe Über Die Kantische Philosophie I-De Gruyter (1790)Sergio Alexis BautistaNoch keine Bewertungen
- Arthur Schopenhauer - Gesammelte Werke: Die Welt als Wille und Vorstellung + Parerga und Paralipomena + Eristische Dialektik …Von EverandArthur Schopenhauer - Gesammelte Werke: Die Welt als Wille und Vorstellung + Parerga und Paralipomena + Eristische Dialektik …Noch keine Bewertungen
- Zu George Batailles KonzeptDokument17 SeitenZu George Batailles KonzeptBen GrafNoch keine Bewertungen
- Zwischen Kant Und de SadeDokument8 SeitenZwischen Kant Und de SadeHelmut Hampl [urspr. Clara]Noch keine Bewertungen
- Manfred FrankDokument84 SeitenManfred FrankvantinoNoch keine Bewertungen
- Wissenschaft und Demokratie: Wissenschafts- und DemokratietheorieVon EverandWissenschaft und Demokratie: Wissenschafts- und DemokratietheorieNoch keine Bewertungen
- Klein - FORMALE UND MATERIALS PRINZIPIEN IN KANTS ETHIKDokument15 SeitenKlein - FORMALE UND MATERIALS PRINZIPIEN IN KANTS ETHIKClaudioSehnemNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Werke: Die Quelle der ewigen Wahrheiten, Die Natur der Philosophie als Wissenschaft & Philosophie der OffenbarungVon EverandGesammelte Werke: Die Quelle der ewigen Wahrheiten, Die Natur der Philosophie als Wissenschaft & Philosophie der OffenbarungNoch keine Bewertungen
- Die Vier Edlen Wahrheiten Buddhas Und Di PDFDokument13 SeitenDie Vier Edlen Wahrheiten Buddhas Und Di PDFToma GaniaNoch keine Bewertungen
- Die Vier Edlen Wahrheiten Buddhas Und Di PDFDokument13 SeitenDie Vier Edlen Wahrheiten Buddhas Und Di PDFToma GaniaNoch keine Bewertungen
- Glaube an den stets größeren Gott: Karl Rahner als AnregerVon EverandGlaube an den stets größeren Gott: Karl Rahner als AnregerNoch keine Bewertungen
- Aus: Ascal L Om / Alfred I SC (.), Rich-Berlin: Diaphanes, 2005), 5-60Dokument9 SeitenAus: Ascal L Om / Alfred I SC (.), Rich-Berlin: Diaphanes, 2005), 5-60Kruks BeatsNoch keine Bewertungen
- Über Pflicht Und Neigung in Kants Moralphilosophie01Dokument14 SeitenÜber Pflicht Und Neigung in Kants Moralphilosophie01georggeismannNoch keine Bewertungen
- Einsichten und Betrachtungen II: Handbuch des kritischen DenkensVon EverandEinsichten und Betrachtungen II: Handbuch des kritischen DenkensNoch keine Bewertungen
- Die Genealogie Der Moral Bei Nietzsche - 3 EssaysDokument7 SeitenDie Genealogie Der Moral Bei Nietzsche - 3 EssaysHelli HellNoch keine Bewertungen
- (GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IIDokument255 Seiten(GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IICarolNoch keine Bewertungen
- Kant & de Sade: Paradigmen Intersubjektiven Begehrens Des Selben Im AnderenDokument8 SeitenKant & de Sade: Paradigmen Intersubjektiven Begehrens Des Selben Im AnderenDr. Ulrich KobbéNoch keine Bewertungen
- Die Entfaltung Des DaseinsDokument7 SeitenDie Entfaltung Des DaseinsJoelNoch keine Bewertungen
- Ausgewählte Werke von Friedrich Schelling: Die Quelle der ewigen Wahrheiten, Die Natur der Philosophie als Wissenschaft & Philosophie der OffenbarungVon EverandAusgewählte Werke von Friedrich Schelling: Die Quelle der ewigen Wahrheiten, Die Natur der Philosophie als Wissenschaft & Philosophie der OffenbarungNoch keine Bewertungen
- Strack K.5Dokument18 SeitenStrack K.5Aldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Sokel - Kafka and SartreDokument16 SeitenSokel - Kafka and SartreMartínNoch keine Bewertungen
- Der Suggestions-Atem: Ein Weg zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Vollkraft bis in das hohe AlterVon EverandDer Suggestions-Atem: Ein Weg zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Vollkraft bis in das hohe AlterNoch keine Bewertungen
- Drogentherapie: Arbeit An Den DiskursgrenzenDokument5 SeitenDrogentherapie: Arbeit An Den DiskursgrenzenDr. Ulrich KobbéNoch keine Bewertungen
- Butler Koerper Von Gewicht Fragen Der Aneignung Und Subversion 1993 173-197Dokument15 SeitenButler Koerper Von Gewicht Fragen Der Aneignung Und Subversion 1993 173-197anjitagrrrNoch keine Bewertungen
- Blut Ist Ein Ganz Besonderer SaftDokument13 SeitenBlut Ist Ein Ganz Besonderer Saftgeorg_vulcanelli100% (2)
- Hans Kelsen - Hauptprobleme Der Staatsrechtslehre - Entwickelt Aus Der Lehre Vom Rechtssatze. (1923, J.C.B. Mohr) PDFDokument752 SeitenHans Kelsen - Hauptprobleme Der Staatsrechtslehre - Entwickelt Aus Der Lehre Vom Rechtssatze. (1923, J.C.B. Mohr) PDFPedro de Oliveira AlvesNoch keine Bewertungen
- Martiana: Über die Anfänge: Prolegomena zu einer Philosophie der Genesis (3)Von EverandMartiana: Über die Anfänge: Prolegomena zu einer Philosophie der Genesis (3)Noch keine Bewertungen
- Loidolt, Sophie - Ist Husserls Späte Ethik Existenzialistisch?Dokument11 SeitenLoidolt, Sophie - Ist Husserls Späte Ethik Existenzialistisch?Pavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- Die Welt als Wille und Vorstellung: Band 1&2: Schopenhauers Hauptwerk über die Erkenntnistheorie, die Metaphysik, die Ästhetik und die EthikVon EverandDie Welt als Wille und Vorstellung: Band 1&2: Schopenhauers Hauptwerk über die Erkenntnistheorie, die Metaphysik, die Ästhetik und die EthikNoch keine Bewertungen
- Teuffel - Double Bind Und Die Schizophrenie Gottes (Luther)Dokument10 SeitenTeuffel - Double Bind Und Die Schizophrenie Gottes (Luther)Jochen TeuffelNoch keine Bewertungen
- Nietzche JenseitsvonGutundBoseDokument141 SeitenNietzche JenseitsvonGutundBoseOnur DülgerNoch keine Bewertungen
- Lapp WahrheitDokument96 SeitenLapp WahrheitTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Cassirer Form Und TechnikDokument39 SeitenCassirer Form Und TechnikmartinrboyerNoch keine Bewertungen
- Hegels Lehre Von Der Warheit Herbert SchnadelbachDokument30 SeitenHegels Lehre Von Der Warheit Herbert Schnadelbach0000DNoch keine Bewertungen
- Buchheim (2012) - Der Begriff Der 'Menschlichen Freiheit' Nach Schellings 'Freiheitsschrift'Dokument16 SeitenBuchheim (2012) - Der Begriff Der 'Menschlichen Freiheit' Nach Schellings 'Freiheitsschrift'mgarromNoch keine Bewertungen
- Die Straflosigkeit Der Actio Libera in Causa.: Inaugural - DissertationDokument284 SeitenDie Straflosigkeit Der Actio Libera in Causa.: Inaugural - DissertationAvaNoch keine Bewertungen
- Bollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFDokument33 SeitenBollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFGeorgy PlekhanovNoch keine Bewertungen
- Gilles Deleuze - Differenz Und Wiederholung. Das Bild Des DenkensDokument30 SeitenGilles Deleuze - Differenz Und Wiederholung. Das Bild Des Denkensa6dama6drian6Noch keine Bewertungen
- Interpretation 1Dokument2 SeitenInterpretation 1Alina SalatheNoch keine Bewertungen
- SartreDokument25 SeitenSartreStefan DacicNoch keine Bewertungen
- Fuchs DrakonischesRechtund 2011Dokument16 SeitenFuchs DrakonischesRechtund 2011gkgegkgNoch keine Bewertungen
- StrackDokument15 SeitenStrackAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Strack K.7Dokument42 SeitenStrack K.7Aldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Strack K.8Dokument24 SeitenStrack K.8Aldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Strack K.5Dokument18 SeitenStrack K.5Aldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- MK Prüfungsplan DSD I 2021Dokument2 SeitenMK Prüfungsplan DSD I 2021Aldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- BFR Transkriptionen AB A2 2Dokument4 SeitenBFR Transkriptionen AB A2 2Aldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Debattanten - Themeninfo Soll Im Sportunterricht Auf Notengebung Verzichtet WerdenDokument2 SeitenDebattanten - Themeninfo Soll Im Sportunterricht Auf Notengebung Verzichtet WerdenAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Satire Im UnterrichtDokument52 SeitenSatire Im UnterrichtAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Violetta Waibel - Hölderlin, Schiller, FichteDokument15 SeitenVioletta Waibel - Hölderlin, Schiller, FichteAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Debattanten - Themeninfo Soll in Den Schulen Der Verkauf Von Essen in Plastikverpackungen Grundsätzlich Verboten WerdenDokument2 SeitenDebattanten - Themeninfo Soll in Den Schulen Der Verkauf Von Essen in Plastikverpackungen Grundsätzlich Verboten WerdenAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Arbeit Berufe Taetigkeiten FindenDokument4 SeitenArbeit Berufe Taetigkeiten FindenAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Satira India Deutsch PDFDokument389 SeitenSatira India Deutsch PDFAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Österreichische SatireDokument110 SeitenÖsterreichische SatireAldebarán GuzmánNoch keine Bewertungen
- Narzissmus verstehen - Narzisstischen Missbrauch erkennen: Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung in ihren Ursachen und AuswirkungenVon EverandNarzissmus verstehen - Narzisstischen Missbrauch erkennen: Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung in ihren Ursachen und AuswirkungenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Systemische Fragetechniken für Fach- und Führungskräfte, Berater und Coaches: Die Bedeutung von Fragen im BerufVon EverandSystemische Fragetechniken für Fach- und Führungskräfte, Berater und Coaches: Die Bedeutung von Fragen im BerufNoch keine Bewertungen
- Die geistige Aufrichtung: Eine neue Dimension im geistigen Heilen nach dem Geistheiler Pjotr ElkunovizVon EverandDie geistige Aufrichtung: Eine neue Dimension im geistigen Heilen nach dem Geistheiler Pjotr ElkunovizNoch keine Bewertungen
- Menschen wie ein Buch lesen: Wie Sie die Gefühle, Gedanken, Absichten und Verhaltensweisen von Menschen analysieren, verstehen und vorhersagen könnenVon EverandMenschen wie ein Buch lesen: Wie Sie die Gefühle, Gedanken, Absichten und Verhaltensweisen von Menschen analysieren, verstehen und vorhersagen könnenBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (2)
- Das intellektuelle Toolkit der Genies: 40 Grundsätze, die Sie schlauer machen und Sie lehren, wie ein Genie zu denkenVon EverandDas intellektuelle Toolkit der Genies: 40 Grundsätze, die Sie schlauer machen und Sie lehren, wie ein Genie zu denkenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Deutsche Grammatik in Algorithmen: Grund- und Mittelstufe mit Aufgaben, Tests und LösungenVon EverandDeutsche Grammatik in Algorithmen: Grund- und Mittelstufe mit Aufgaben, Tests und LösungenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Wenn der Körper nein sagt: Wie verborgener Stress krank macht – und was Sie dagegen tun können. Internationaler Bestseller übersetzt in 15 Sprachen.Von EverandWenn der Körper nein sagt: Wie verborgener Stress krank macht – und was Sie dagegen tun können. Internationaler Bestseller übersetzt in 15 Sprachen.Noch keine Bewertungen
- Werde übernatürlich: Wie gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche erreichenVon EverandWerde übernatürlich: Wie gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche erreichenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (3)
- Deutsche Grammatik: Die unverzichtbaren Grundlagen der SchriftspracheVon EverandDeutsche Grammatik: Die unverzichtbaren Grundlagen der SchriftspracheBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (10)
- Formulierungshilfen für die Strukturierte Informationssammlung SIS und Maßnahmenplanung: Themenfeld Mobilität und BeweglichkeitVon EverandFormulierungshilfen für die Strukturierte Informationssammlung SIS und Maßnahmenplanung: Themenfeld Mobilität und BeweglichkeitNoch keine Bewertungen