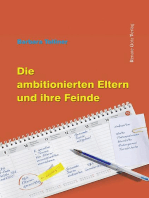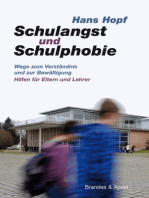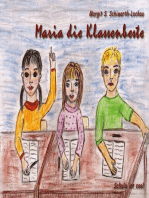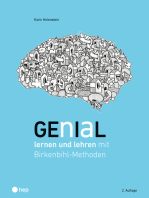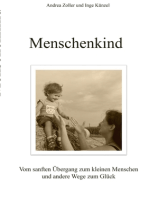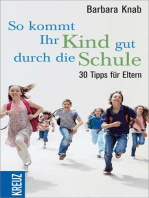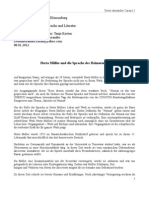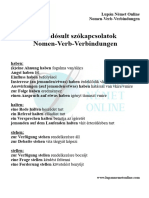Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Probeklausur Florian - Mit Erwartungshorizont
Probeklausur Florian - Mit Erwartungshorizont
Hochgeladen von
ahmad1994raghadOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Probeklausur Florian - Mit Erwartungshorizont
Probeklausur Florian - Mit Erwartungshorizont
Hochgeladen von
ahmad1994raghadCopyright:
Verfügbare Formate
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen PIA
und Inklusion fördern
Fachschule für Sozialpädagogik
Probeklausur: Fallbeispiel „Florian“
Sie machen ein vierwöchiges Praktikum in der Wohngruppe „Klippensteiger“, wel-
che sich in freier Trägerschaft in der Kleinstadt Mettmann befindet. Die Kinder und
Jugendlichen sind vollstationär untergebracht und haben aktuell ihren Hauptwohn-
sitz in der Gruppe. Es handelt sich hierbei um fünf Kinder im Alter von 2;5 – 8;9
5 Jahren und sechs Jugendliche im Alter von 10;2-15;9 Jahren.
Die Wohngruppe wird von Roger, einem Sozialarbeiter, geleitet, und Annette, eine
Heilpädagogin, ist die stellvertretende Leitung. Weiterhin sind noch Viola und So-
phie als pädagogische Fachkräfte in der Gruppe tätig. Außerdem arbeitet der Kin-
der- und Jugendtherapeut Dr. Brecht bedarfsorientiert mit den Kindern und Ju-
10 gendlichen.
In der ersten Woche erleben Sie direkt viele turbulente Situationen. Am Donners-
tagmorgen um kurz vor 7 Uhr ruft die Erzieherin Sophie: „Florian jetzt steh‘ endlich
auf. Du hast um 8 Uhr Schule!“ Zehn Minuten später ist noch immer kein Geräusch
aus Florians Zimmer zu hören und seine Tür bleibt verschlossen. „Florian!“ Sophie
15 wird langsam ärgerlich und reißt die Zimmertür des Jugendlichen auf: Florian
(15;9) liegt im Bett und brüllt: „Ich gehe nicht zur Schule, lass mich schlafen!“
Als Sie gemeinsam mit Sophie den Frühstückstisch decken, erzählt sie Ihnen, dass
Florian sich seit einiger Zeit verstärkt zurückzieht. Er verbringt viele Stunden al-
leine in seinem Zimmer und die Fragen, was er in dieser Zeit mache, beantwortet
20 er mit Computer spielen. Was genau er damit meint, kann Sophie Ihnen nicht sa-
gen, sie vermutet aber, dass es sich um online Spiele handelt, denn der Jugendli-
che hat ihr erzählt, dass er über das gemeinsame „Zocken“ neue Freunde kennen-
gelernt hat und mit diesen scheint er in den letzten Wochen seine Freizeit im virtu-
ellen Raum zu verbringen. Obwohl es in der Gruppe geregelte Schlafenszeiten
25 gibt, vermutet Sophie, dass der Junge nachts Computer spielt, sobald die pädago-
gische Fachkraft im Nachtdienst sich schlafen gelegt hat. Wie Florian es hinbe-
kommt, nachts aufzubleiben und tagsüber noch leistungsfähig zu sein, kann die
Erzieherin Ihnen nicht genau sagen, sie befürchtet aber, dass der Jugendliche,
zumindest am Wochenende ab und an zu aufputschenden Mitteln greift, um die
30 Nächte vor dem Bildschirm durchzumachen.
Weiterhin berichtet sie, dass Roger bereits in einem Gespräch mit Florian versucht
habe, herauszufinden, mit was für Menschen er im Rahmen der „Gamerszene“
Kontakt habe. In diesem Zusammenhang hatte Florian ihm erzählt, dass die meis-
ten etwas älter als er und männlich seien. Viele hätten die Schule geschmissen
35 oder seien aufgrund ihrer schlechten Leistungen entlassen worden. Auch das
Thema Drogen habe Roger in diesem Gespräch zum Thema gemacht – so Sophie
weiter – diesbezüglich hatte Florian zurückhaltend reagiert, aber zugegeben, dass
einige seiner neuen Freunde besonders Amphetaminen gegenüber nicht abge-
neigt seien, da diese eine aufputschende Wirkung haben und es ihnen ermöglich-
40 ten, über viele Stunden eine hohe Leistungsfähigkeit beim Computer spielen auf-
recht zu erhalten.
Sie bemerken, dass Sophie aufrichtig um Florian besorgt ist, denn sie sagt Ihnen,
dass der Jugendlichen sich stark verändert habe und sie nicht wisse, was dazu
geführt habe. Bis vor ein paar Monaten wäre Florian anders gewesen: Er hätte viel
45 Zeit mit Klassenkameraden verbracht und hätte sogar mal ein Mädchen, in das er
anscheinend verliebt war, am Wochenende mit in die Gruppe gebracht. Auch seine
schulischen Leistungen hätten sich verschlechtert, und dass, obwohl Florian doch
bis zur 9. Klasse leistungsmäßig immer im Mittelfeld gewesen wäre.
Um halb 8 kommt Florian aus seinem Zimmer gerannt, knallt die Tür hinter sich zu
50 und verlässt die Wohngruppe ohne zu frühstücken. Als Sophie und Sie im Flur
ankommen, sehen Sie nur noch den Schulrucksack des Jugendlichen auf dem
Lernsituation 7 Lernfeld 3 – Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie Jugend
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen PIA
und Inklusion fördern
Fachschule für Sozialpädagogik
Fußboden liegen. Ihnen kommen Zweifel, ob der Jugendliche die Schule an die-
sem Tag besuchen wird. Aus diesem Grund ruft Sophie um zehn Uhr im Sekreta-
riat der Schule an, um sich zu erkundigen, ob Florian in der Schule aufgetaucht ist.
55 Um 12 Uhr ruft seine Klassenlehrerin zurück und teilt Ihnen am Telefon mit, dass
Florian heute nicht in der Schule war. Auch den Rest der Woche war er dort nicht
erschienen, die Lehrerin hatte jedoch vermutet, dass der Junge aufgrund von
Krankheit der Schule ferngeblieben war. Als Sie sich nach Florians Leistungen er-
kundigen, teilt die Lehrerin Ihnen mit, dass der Jugendliche in den letzten Monaten
60 öfter gefehlt habe und Klassenarbeiten nicht mitgeschrieben habe. Außerdem sagt
sie, dass sie den Abschluss von Florian gefährdet sehe, da er in Mathe und
Deutsch fünf stehe und auch in den anderen Fächern über ein ausreichend nicht
hinauskomme.
Nach dem Telefonat treffen Sie sich mit Sophie, Roger und Viola im Mitarbeiter-
65 raum zur Übergabe, denn Sophie und Sie werden die Einrichtung um 13 Uhr ver-
lassen und Roger und Viola, die die Tagesschicht antreten, müssen insbesondere
über den Vorfall mit Florian informiert werden, weil sie am Nachmittag das Ge-
spräch mit dem Jugendlichen suchen müssen, um den Vorfall am Morgen zu klä-
ren. Sophie und Sie berichten von den Geschehnissen des Morgens und gemein-
70 sam beschließen Sie, bei der nächsten Teamsitzung mit allen pädagogischen
Fachkräften am kommenden Montag pädagogische Handlungsmöglichkeiten für
Florian zu entwickeln.
Quelle: Eigenentwurf 2021 in Anlehnung an das Kartenset „Die Klippensteiger“
Aufgabenstellung
1. Fassen Sie die pädagogisch relevanten Aspekte der beruflichen Handlungssituation zusam-
men. (30 Punkte)
2. Analysieren Sie die pädagogische Handlungssituation auf der Grundlage Ihrer fachtheoretischen
Kenntnisse. (40 Punkte)
3. Entwerfen Sie aus den Ergebnissen von Aufgabe 1 und 2 pädagogische Handlungsmöglichkeiten
für Florian. (30 Punkte)
Lernsituation 7 Lernfeld 3 – Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie Jugend
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen PIA
und Inklusion fördern
Fachschule für Sozialpädagogik
Erwartungshorizont zur Probeklausur: Fallbeispiel „Florian“
Name:
Aufgabe 1:
Der Prüfling Punkte
formuliert einen aufgabenbezogenen Einleitungssatz:
/3
Mögliche Lösung:
In dem Fallbeispiel „Florian“, welches eine Eigenkonstruktion aus dem Jahr 2021 in Anlehnung
an das Kartenset „Die Klippensteiger“ ist, geht es um problematische Formen der Lebensbe-
wältigung im Jugendalter.
fasst die pädagogisch relevanten Aspekte der beruflichen Handlungssituation zusammen:
• In einer Wohngruppe in Mettmann lebt der Jugendliche Florian, der 15 Jahre alt ist. Er /2
fällt in den letzten Monaten durch ein verändertes Verhalten auf, welches die Erziehe-
rin Sophie schildert (vgl. Z. 1-20).
• Florian weigert sich morgens aufzustehen und in die Schule zu gehen, er schreit die /2
Erzieherin an, als diese ihn weckt (vgl. Z. 12-16).
• Insgesamt zieht sich Florian seit einiger Zeit verstärkt zurück. Er verbringt viele Stun-
den allein in seinem Zimmer, in dieser Zeit spielt er nach eigenen Angaben Computer
(vgl. Z. 17-20).
• Sophie vermutet, dass es sich hierbei um Online-Spiele handelt, denn der Jugendliche
hat ihr erzählt, dass er über das gemeinsame „Zocken“ neue Freunde kennengelernt /4
hat. Anscheinend verbringt Florian seine Freizeit mit diesen neuen Kontakten im virtu-
ellen Raum (vgl. Z. 20-24).
• Obwohl es in der Gruppe geregelte Schlafenszeiten gibt, vermutet Sophie, dass der
Junge nachts Computer spielt, sobald die pädagogische Fachkraft im Nachtdienst sich
/4
schlafen gelegt hat. Es besteht außerdem der Verdacht, dass Florian gelegentlich zu
aufputschenden Mitteln greift, um nachts wach zu sein (vgl. Z. 24-30).
• Der Leiter der Einrichtung, Roger, hat von Florian erfahren, dass die Gamer, zu denen
er Kontakt hat, etwas älter als er und zumeist männlich seien. Viele haben die Schule
geschmissen oder seien aufgrund ihrer schlechten Leistungen entlassen worden. In /4
Bezug auf das Thema Drogen hat Florian eingeräumt, dass einige seiner neuen
Freunde besonders Amphetaminen gegenüber nicht abgeneigt seien (vgl. Z. 32-41).
• Nach Aussagen der Erzieherin hat sich der Jugendlichen stark verändert. Bis vor ein
paar Monaten habe Florian viel Zeit mit Klassenkameraden verbracht und hätte sogar
/4
ein Mädchen, in das er anscheinend verliebt war, am Wochenende mit in die Gruppe
gebracht. Auch seine schulischen Leistungen haben sich verschlechtert, bis zur 9.
Klasse sei Florian leistungsmäßig immer im Mittelfeld gewesen (vgl. Z. 43-48).
• An dem beschriebenen Morgen verlässt Florian die Wohngruppe ohne Frühstück und
Schulrucksack. Ein Anruf in der Schule bestätigt die Vermutung der Erzieherin, dass /4
Florian an diesem Tag nicht die Schule besucht. Auch den Rest der Woche ist er nicht
in der Schule gewesen (vgl. Z. 49-58).
• Die Lehrerin sagt, dass der Jugendliche in den letzten Monaten öfter gefehlt und Klas- /3
senarbeiten nicht mitgeschrieben habe. Außerdem ist der Abschluss von Florian ge-
fährdet (vgl. Z. 58-63).
Punkte /30
Lernsituation 7 Lernfeld 3 – Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie Jugend
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen PIA
und Inklusion fördern
Fachschule für Sozialpädagogik
Aufgabe 2:
Der Prüfling Punkte
analysiert die pädagogische Handlungssituation auf der Grundlage fachtheoretischen Kennt-
nisse, indem er/sie ….
die sozialisationstheoretischen Annahmen zum Jugendalter nach Hurrelmann in ihren Grund-
zügen erläutert:
• Klaus Hurrelmann beschäftigt sich mit der Sozialisations- und Identitätsentwicklung im Ju- /2
gendalter.
• Seine Überlegungen strukturiert er im Modell der produktiven Realitätsverarbeitung an-
/2
hand von zehn Maximen. Außerdem formuliert er vier Gruppen von Entwicklungsaufgaben
(qualifizieren, binden, konsumieren, partizipieren), die in ihrer spezifischen Ausprägung im
Jugendalter von Bedeutung sind.
• Er weist dem Jugendlichen im Zuge seines Sozialisationsprozesses eine aktiv handelnde
Rolle zu. Die individuelle Persönlichkeitsentwicklung wird verstanden als eine produktive /2
Verarbeitung der jeweiligen inneren und äußeren Realität.
• Hurrelmann beschreibt die Sozialisation Jugendlicher somit als weitgehend selbstgesteu-
/2
erten, dynamischen Prozess, der die Synthese von Individuation und Integration bzw. per-
sonaler und sozialer Identität zum Ziel hat.
problematische Formen der Lebensbewältigung nach Hurrelmann werden am Fallbeispiel „Flo-
rian“ erklärt. Hierbei wird ein Bezug zu den problematischen Formen der Problembewältigung
nach Hurrelmann hergestellt:
• Florian ist mit den Anforderungen, mit denen er konfrontiert wird, überfordert, wodurch
seine Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt werden und ein Ent- /2
wicklungsdruck entstehen kann, weil die alterstypischen Entwicklungsaufgaben (z.B.
Aufbau intellektueller Kompetenzen durch einen regelmäßigen Schulbesuch) nicht
hinreichend verfolgt werden (vgl. Z. 59-63).
• In diesem Zusammenhang kann von unproduktiver Realitätsverarbeitung gesprochen
/2
werden, weil eine Synthese zwischen Individuation und Integration, welche maßge-
bend für eine produktive Realitätsverarbeitung ist, nicht gelingt.
• Im Bereich der unproduktiven Realitätsverarbeitung lassen sich nach Hurrelmann drei /2
typische Ausprägungsformen für das Jugendalter unterscheiden (internalisierend, ex-
ternalisierend, evadierend).
• Florians Verhalten spricht für die dritte Bewältigungsform, für die evadierende Prob- /2
lemverarbeitung, welche auch als ausweichende Variante bezeichnet wird.
• Für diese problematische Verarbeitungsform ist der Konsum psychoaktiver Substan-
zen charakteristisch, also die Manipulation des zentralen Nervensystems, sowie wei- /2
tere ausweichende Suchtmuster, wie z.B. auch die Computersucht (vgl. Z. 24-30).
analysiert das Fallbeispiel „Florian“ mithilfe des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung,
indem ein Bezug zu den zehn Maximen von Hurrelmann hergestellt wird:
2. Maxime: Produktion der eigenen Persönlichkeit
Menschen sind „Produzenten“ ihrer eigenen Entwicklung, weil sie eine Verarbeitung der inne-
ren und äußeren Realität vornehmen, die ihren jeweils einmaligen und unverwechselbaren /5
Merkmalen und Fähigkeiten entspricht. Ihre Persönlichkeit formt sich dabei auf der Basis einer
angelegten Grundstruktur von Merkmalen ständig weiter. In diesem Sinne sind sie schöpferi-
sche Konstrukteure ihrer Persönlichkeit.
Für die Weiterentwicklung der Persönlichkeit ist es von Vorteil, sich der Möglichkeiten bewusst
zu sein, die durch die inneren Anlagen gegeben sind, zugleich aber auch alle Chancen der
Entfaltung wahrzunehmen, die sich aus den äußeren Bedingungen ergeben. Hierzu gehört
auch die Möglichkeit Verhaltensmuster auszuprobieren, die den eigenen Bedürfnissen beson-
ders entsprechen.
Lernsituation 7 Lernfeld 3 – Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie Jugend
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen PIA
und Inklusion fördern
Fachschule für Sozialpädagogik
Im Fall „Florian“ führt die selbstgesteuerte Lebensführung dazu, dass der Jugendliche sich
mehr und mehr in eine Cyberwelt zurückzieht, sich dort ausprobiert und neue Verhaltensmus-
ter entwickelt. Auch im Bereich Drogen befindet er sich sehr wahrscheinlich in einer Phase des
Experimentierens (vgl. Z. 17-20; 24-30). Dabei vernachlässigt er jedoch seine inneren Res-
sourcen, da trotz seiner angemessenen kognitiven Fähigkeiten, seine Leistungen in der Schule
nachlassen, weil er diese nicht mehr regelmäßig besucht (vgl. Z. 59-63).
3. Maxime: Bewältigung der Entwicklungsaufgaben
In jedem Lebensabschnitt gibt es kulturelle und gesellschaftliche Erwartungen an die Verar-
beitung der inneren und äußeren Realität. Diese Erwartungen lassen sich als „Entwicklungs-
aufgaben“ bezeichnen. Entwicklungsaufgaben, die in einem Kulturkreis definiert werden und /5
von jedem Menschen auf seine Weise zu bewältigen sind, beschreiben die von einer Gesell-
schaft als angemessen erachteten Verhaltensweisen.
Florian zeigt in dem Bereich „Qualifizieren“ kein angemessenes Verhalten, da er die Schule
schwänzt und seine Versetzung in Gefahr ist (vgl. Z. 59-63). Auch der Entwicklungsbereich
„Binden“ wird von ihm zunehmend vernachlässigt, da er die Zeit mit seinen neuen Freunden
im virtuellen Raum beim „Zocken“ verbringt und keine Treffen mehr mit seinen Klassenkame-
raden wahrnimmt. Hierdurch ist auch die Möglichkeit einer intimen Bindung an eine Partnerin
in den Hintergrund getreten, die zuvor wahrgenommen wurde, da er offenbar ein Mädchen in
die Gruppe mitgebracht hat, in das er sich verliebt hat (vgl. Z. 44-46). Der Bereich des „Kon-
sumierens“ wird zwar in einem erhöhten Maße in der medialen Welt umgesetzt, jedoch nicht
in einer angemessenen Art und Weise. Das nächtliche Zocken beeinträchtigt seinen Schlaf-
rhythmus und damit seine Gesundheit. Somit werden eigentlich angedachte Erholungsmög-
lichkeiten, die dieser Entwicklungsbereich bietet, durch einen überhöhten Konsum unterbun-
den (vgl. Z. 24-30).
4. Maxime: Spannung von Individuation und Integration
Durch alle Entwicklungsaufgaben zieht sich die Anforderung, die persönliche Individuation und
die soziale Integration aufeinander zu beziehen und miteinander zu verbinden. Zur „Individua-
tion“ gehört z.B. der Aufbau einer individuellen Persönlichkeitsstruktur, zur „Integration“ gehört
die Anpassung an die gesellschaftlichen Werte, Normen und Verhaltensstandards. /5
Im Laufe der Entwicklung entstehen immer wieder Spannungen zwischen den persönlichen
Bedürfnissen einer Person und den Anforderungen der Gesellschaft. Oft widersprechen die
persönlichen Bedürfnisse den Anforderungen der Gesellschaft. Das Individuum versucht sich
den Anforderungen der Umwelt anzupassen ohne die eigenen Wünsche aufzugeben und bei-
des somit in einer Balance zu halten.
Die Synthese aus Individuation und Integration misslingt Florian. Der Jugendliche gerät zuneh-
mend in eine gesellschaftliche Außenseiterposition und es besteht die Gefahr, dass es ihm
nicht gelingt, seine Persönlichkeitsentwicklung zu entfalten und eine stabile Ich-Identität, ver-
standen als personale und soziale Identität, aufzubauen, wenn er weiterhin seinen aktuellen
Lebensstil beibehält. (vgl. Z. 43-48). Anstatt sich produktiv mit den Herausforderungen der
Außenwelt auseinanderzusetzten, flieht er in eine künstliche Welt des Computerspiels (vgl. Z.
18-20).
6. Maxime: Personale und soziale Ressourcen
Um das Spannungsverhältnis von Individuations- und Integrationsanforderungen auszuglei-
chen, sind neben individuellen Bewältigungskompetenzen („personalen Ressourcen“) auch
/5
Unterstützungsleistungen aus der sozialen Umwelt („soziale Ressourcen“) notwendig. Sind die
personalen Ressourcen und/oder die sozialen Ressourcen ausreichend, ist eine autonome
und gesunde Persönlichkeitsentwicklung möglich. Sind die Ressourcen unzureichend, kann
es zu einer negativen und gestörten weiteren Persönlichkeitsentwicklung kommen.
Im Fallbeispiels zeigt sich, dass Florian durchaus über eine angemessene Intelligenz verfügt,
da er bis zur 9. Klasse leistungsmäßig immer im Mittelfeld gewesen ist. Außerdem scheint er
ein geselliger Mensch zu sein, da er bis zu dem Zeitpunkt, wo er in die Cyberwelt abgetaucht
Lernsituation 7 Lernfeld 3 – Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie Jugend
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen PIA
und Inklusion fördern
Fachschule für Sozialpädagogik
ist, viel Zeit mit Klassenkameraden verbracht hat (vgl. Z. 44-48). Dies sind beides wichtige
personale Ressource, die jedoch in der aktuellen Situation nicht genutzt und ausgebaut wer-
den. Im Hinblick auf seine sozialen Ressourcen ist Florian von pädagogischen Mitarbeitern
umgeben, die sich Sorgen um ihn und seine weitere Entwicklung machen. Ihre Fürsorge und
pädagogische Begleitung stellen eine bedeutsame soziale Ressource dar, denn gemeinsam
wird nach Handlungsmöglichkeiten gesucht, um Florian in seiner Situation zu helfen (vgl. Z.
31-41; 42-48).
Alternative Lösungsmöglichkeiten sind möglich, auch mit anderen Maximen, und werden nach
dem Grad ihrer differenzierten Darstellung bepunktet.
/5
→ Für jede korrekt dargestellte und auf das Fallbeispiel angewendete Maxime erhält der
Prüfling in Abhängigkeit von der Lösungsqualität bis zu maximal 5 Punkten für maximal
4 Maximen.
resümiert etwa wie folgt:
• Abschließend lässt sich festhalten, dass dem beschriebenen Jugendlichen die Identitätsbil-
dung zurzeit schwerfällt, da er Schwierigkeiten hat die Entwicklungsaufgaben zu bewälti-
gen und somit auch die Synthese von Integration und Individuation nicht gelingt. /2
Punkte /40
Lernsituation 7 Lernfeld 3 – Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie Jugend
Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen PIA
und Inklusion fördern
Fachschule für Sozialpädagogik
Aufgabe 3:
Der Prüfling Punkte
entwirft aus den Ergebnissen von Aufgabe 1 und 2 pädagogische Handlungsmöglichkeiten
für Florian, die exemplarisch hier aufgeführt werden.
Pädagogisches Handeln im Fall Florian sollte darauf abzielen, dem Jugendlichen Bewälti-
gungskompetenzen zu vermitteln, sodass er dazu befähigt wird, seine Realität „produktiv“ zu
bewältigen und die spezifischen Entwicklungsaufgaben hinreichend zu bearbeiten. Hier sind /5
pädagogische Handlungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen sinnvoll:
• Da die Kontakte, die Florian im virtuellen Raum geknüpft hat, verstanden als soziale
Umwelt, wenig entwicklungsförderlich sind, sollten die pädagogischen Fachkräfte der
Wohngruppe in ihrem pädagogischen Handeln darauf abzielen, den Jugendlichen an
entwicklungsförderliche Peergroups anzubinden, da diese ihn in seiner Persönlich- /5
keitsentwicklung positiv beeinflussen können. Möglich wäre z.B. Florian dazu zu mo-
tivieren, wieder mehr Zeit mit den Freunden aus seiner Klasse zu verbringen. Hier
könnten Treffen innerhalb und außerhalb der Wohngruppe initiiert werden. Gemein-
sam mit Florian sollte geguckt werden, wie diese aussehen könnten.
• Insgesamt sollten Situationen geschaffen werden, in denen Florian seine Bewälti-
gungskompetenzen, also seine Handlungskompetenzen, erweitern kann. Dies kann
zum Beispiel durch gezielte Aktionen in der Wohngruppe geschehen. Hierbei sollte bei /5
den Bedürfnissen und Interessen des Jungen angesetzt werden und ein Bezug zu den
Entwicklungsaufgaben hergestellt werden, um ihn in seiner produktiven Realitätsver-
arbeitung zu unterstützen. Je nach Interessenlage könnten nach Rücksprache mit Flo-
rian ein kulinarischer Abend, ein gemeinsamer Ausflug oder ein Spieleabend veran-
staltet werden, der nicht im virtuellen Raum stattfindet.
• Der Jugendliche sollte in seiner Resilienz gestärkt werden, sodass seine Belastbarkeit
erhöht wird, damit er in produktiver Weise mit dem Spannungsverhältnis umgehen
kann, welches in dieser Lebensphase besonders ausgeprägt ist. Hierfür eigenen sich /5
Sport- und Bewegungsangebote, aber auch verschiedene Entspannungsverfahren,
wie z.B. Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung. Diese stellen au-
ßerdem eine Alternative zum Drogen- und Medienkonsum dar (evadierende Problem-
verarbeitung). Florian lernt also einen produktiven Umgang mit Belastungssituationen,
indem er lernt Spannung mit Entspannung zu begegnen. Hier sollte gemeinsam mit
ihm geguckt werden, welche Freizeitangebote es in erreichbarer Nähe zur Wohn-
gruppe gibt. Dabei wird auch ein angemessener Umgang im Entwicklungsbereich
„Konsumieren“ gefördert.
• Seine Bewältigungskompetenzen können im Bereich der Entwicklungsaufgabe „Qua-
lifizieren“ darüber hinaus durch gezielte Nachhilfe gestärkt werden; diese kann ver- /5
standen werden als soziale Ressource, welche Florian dabei unterstützt, einen Schul-
abschluss zu erwerben.
• In Gesprächen mit Florian sollten Sinnperspektiven entwickelt werden, beispielsweise
indem er neue Impulse für berufliche Zielsetzungen bekommt. Florian könnte ggf. ein /5
Praktikum in einem Bereich absolvieren, der ihn interessiert, um auf diese Weise be-
rufliche Orientierung zu erlangen. Hierbei kann sein Interesse an digitalen Medien mit-
einbezogen werden.
• Andere alternative Aspekte können benannt werden…
Punkte /30
Lernsituation 7 Lernfeld 3 – Sozialisationstheorien und Entwicklungspsychologie Jugend
Das könnte Ihnen auch gefallen
- NEUMANN - Angst Und PolitikDokument21 SeitenNEUMANN - Angst Und Politikraphconcli870967% (3)
- Probeklausur Politische TheorieDokument8 SeitenProbeklausur Politische TheorieRed ReizerNoch keine Bewertungen
- Meine Welltour 2 Test Kapitel 1 4 PDFDokument2 SeitenMeine Welltour 2 Test Kapitel 1 4 PDFE50% (2)
- Schriftliche Vorbereitung Praxisbesuch 5 Geschichte EntwickelnDokument16 SeitenSchriftliche Vorbereitung Praxisbesuch 5 Geschichte EntwickelnSara Tkaczuk100% (1)
- Projektaarbeit (Automatisch Wiederhergestellt) ' With YouDokument27 SeitenProjektaarbeit (Automatisch Wiederhergestellt) ' With Younissrine khalaf100% (3)
- Unterrichtsentwurf Englisch AddictionDokument12 SeitenUnterrichtsentwurf Englisch AddictionNeila BeklijaNoch keine Bewertungen
- Reinfassung PDFDokument11 SeitenReinfassung PDFAnonymous 5y0PONUI6Noch keine Bewertungen
- !!!!!!!!!!!!!!!!!stichpunke BZW Antworten NotfallZusammenfassungDokument5 Seiten!!!!!!!!!!!!!!!!!stichpunke BZW Antworten NotfallZusammenfassungJohn RamboNoch keine Bewertungen
- Schulangst und Schulphobie: Wege zum Verständnis und zur Bewältigung Hilfen für Eltern und LehrerVon EverandSchulangst und Schulphobie: Wege zum Verständnis und zur Bewältigung Hilfen für Eltern und LehrerNoch keine Bewertungen
- Bericht Kesb Korrex 20230913Dokument3 SeitenBericht Kesb Korrex 20230913Janaina Fabiane Souza SchulzeNoch keine Bewertungen
- Lola FallDokument10 SeitenLola FallScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Vlas. Kapitel 1Dokument9 SeitenVlas. Kapitel 1Вадим Влас100% (1)
- Herausforderung schulische Inklusion: zwischen Anspruch und RealitätVon EverandHerausforderung schulische Inklusion: zwischen Anspruch und RealitätNoch keine Bewertungen
- Schule Der ZukunftDokument8 SeitenSchule Der ZukunftSteffi RetzarNoch keine Bewertungen
- Deutsch Echt Einfach KUB S 69Dokument1 SeiteDeutsch Echt Einfach KUB S 69ZhenkaHustiNoch keine Bewertungen
- 457 Gratisarbeitsblatt Deutsch Indirekte RedeDokument2 Seiten457 Gratisarbeitsblatt Deutsch Indirekte RedeHend RadwanNoch keine Bewertungen
- Ein Blick in die Schule und zwei dahinter: Geschichten aus dem Schulalltag - wissenschaftlich erklärtVon EverandEin Blick in die Schule und zwei dahinter: Geschichten aus dem Schulalltag - wissenschaftlich erklärtNoch keine Bewertungen
- Lernkontrolle II: Young World 1 - Unit 1 - Schools Around The World Hören - Lernkontrolle IIDokument2 SeitenLernkontrolle II: Young World 1 - Unit 1 - Schools Around The World Hören - Lernkontrolle IIan.schneider.27Noch keine Bewertungen
- HausarbeitDokument2 SeitenHausarbeitMichelle PickNoch keine Bewertungen
- Erziehungsstatus kompliziert: Pubertät im Anmarsch (ja, es geht wirklich schon los!). Für Eltern von Kindern von 8-12 JahreVon EverandErziehungsstatus kompliziert: Pubertät im Anmarsch (ja, es geht wirklich schon los!). Für Eltern von Kindern von 8-12 JahreNoch keine Bewertungen
- BindungsstoerungenDokument20 SeitenBindungsstoerungenTomNoch keine Bewertungen
- HalInBook Jana Und Dino 4774Dokument1 SeiteHalInBook Jana Und Dino 4774AnnyNoch keine Bewertungen
- Das Mädchen GenieDokument8 SeitenDas Mädchen GenieTakor MurlatowaNoch keine Bewertungen
- SchulartenDokument2 SeitenSchulartenyanny leeNoch keine Bewertungen
- Wie Lernen beginnt: Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter KinderVon EverandWie Lernen beginnt: Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter KinderNoch keine Bewertungen
- Beispiele Für Klinische Fälle Bei LernstörungenDokument11 SeitenBeispiele Für Klinische Fälle Bei LernstörungenScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Dr. Leon Blautaler: Drei romantische Arzt-/LiebesromaneVon EverandDr. Leon Blautaler: Drei romantische Arzt-/LiebesromaneNoch keine Bewertungen
- Skript M3 Lebensphasen KomplettDokument32 SeitenSkript M3 Lebensphasen KomplettMaria LomakinNoch keine Bewertungen
- MÃ Ndlich C1 HochschuleDokument20 SeitenMÃ Ndlich C1 HochschuleMamdouh Masoud100% (2)
- Hausarbeit PädagogikDokument17 SeitenHausarbeit PädagogikCamy LehNoch keine Bewertungen
- Genial lernen und lehren (E-Book): mit Birkenbihl-MethodenVon EverandGenial lernen und lehren (E-Book): mit Birkenbihl-MethodenNoch keine Bewertungen
- BL Loesungsschritte 22 09 08Dokument34 SeitenBL Loesungsschritte 22 09 08valentinadragomirNoch keine Bewertungen
- Das dumme Schülerlein: Über das Wunder der Spontan-Verwandlung in einen intelligenten MenschenVon EverandDas dumme Schülerlein: Über das Wunder der Spontan-Verwandlung in einen intelligenten MenschenNoch keine Bewertungen
- Das unerziehbare Kind oder Die Klaviatur des Unbegreiflichen: Eine Fallgeschichte über die totgeschwiegene Seite des AutismusVon EverandDas unerziehbare Kind oder Die Klaviatur des Unbegreiflichen: Eine Fallgeschichte über die totgeschwiegene Seite des AutismusNoch keine Bewertungen
- Test 1 Ujian ECLDokument8 SeitenTest 1 Ujian ECLMartha Julia AndreansNoch keine Bewertungen
- Transkription Ciza 3Dokument4 SeitenTranskription Ciza 3Michael SchmidtNoch keine Bewertungen
- Verstaatlichung der Erziehung: Auf dem Weg zum neuen Gender-MenschenVon EverandVerstaatlichung der Erziehung: Auf dem Weg zum neuen Gender-MenschenBewertung: 3 von 5 Sternen3/5 (2)
- Professor Pulin und Lorin: Berichte über die Erfahrungen und Erlebnisse der Reisen. SF.Von EverandProfessor Pulin und Lorin: Berichte über die Erfahrungen und Erlebnisse der Reisen. SF.Noch keine Bewertungen
- MutismusDokument11 SeitenMutismuspapus40Noch keine Bewertungen
- Menschenkind: Vom sanften Übergang zum kleinen Menschen und andere Wege zum GlückVon EverandMenschenkind: Vom sanften Übergang zum kleinen Menschen und andere Wege zum GlückNoch keine Bewertungen
- SystemzusammenbruchDokument12 SeitenSystemzusammenbruchИвайла ГеловаNoch keine Bewertungen
- Hausarbeit Kommunikation VideoanalyseDokument8 SeitenHausarbeit Kommunikation VideoanalysemNoch keine Bewertungen
- Der komische Erziehungsratgeber: Oder Hilfe meine Kinder sind in der PubertätVon EverandDer komische Erziehungsratgeber: Oder Hilfe meine Kinder sind in der PubertätNoch keine Bewertungen
- So kommt ihr Kind gut durch die Schule: 30 Tipps für ElternVon EverandSo kommt ihr Kind gut durch die Schule: 30 Tipps für ElternNoch keine Bewertungen
- Spielen in der frühen Kindheit: Grundwissen für den pädagogischen AlltagVon EverandSpielen in der frühen Kindheit: Grundwissen für den pädagogischen AlltagNoch keine Bewertungen
- Entwicklungsrisiken bei Kindern und Jugendlichen: Prävention im pädagogischen AlltagVon EverandEntwicklungsrisiken bei Kindern und Jugendlichen: Prävention im pädagogischen AlltagNoch keine Bewertungen
- Grundschultricks - Spielend leicht durch die Grundschule: Mit Spiel, Spaß und Spannung zur Bestnote. Von Lehrern entwickelt. inklusive Hörbuch. Spannende Lernspiele für Mathe und Deutsch!Von EverandGrundschultricks - Spielend leicht durch die Grundschule: Mit Spiel, Spaß und Spannung zur Bestnote. Von Lehrern entwickelt. inklusive Hörbuch. Spannende Lernspiele für Mathe und Deutsch!Noch keine Bewertungen
- Dein Kind, die Schule und Du: Ein Navi für den BildungswegVon EverandDein Kind, die Schule und Du: Ein Navi für den BildungswegNoch keine Bewertungen
- BPB - 312 DDR - Gesamt - ES - 20130110 PDFDokument84 SeitenBPB - 312 DDR - Gesamt - ES - 20130110 PDFsike1977Noch keine Bewertungen
- Bericht KommissionDokument103 SeitenBericht KommissionGeorgio RomaniNoch keine Bewertungen
- Herta MuellerDokument5 SeitenHerta MuellerdocazanNoch keine Bewertungen
- Georg Lukacs Zur Philosophischen Entwicklung Des Jungen Marx 18401844Dokument96 SeitenGeorg Lukacs Zur Philosophischen Entwicklung Des Jungen Marx 18401844Bruno Peixe DiasNoch keine Bewertungen
- Paret - Ironien Des Anti-AutoritärenDokument31 SeitenParet - Ironien Des Anti-AutoritärenPic ColoNoch keine Bewertungen
- A Leggyakoribb Állandósult Német Szókapcsolatok U1eh2dDokument4 SeitenA Leggyakoribb Állandósult Német Szókapcsolatok U1eh2dMas LovNoch keine Bewertungen
- Warum Hat Die National Party Im Jahre 1948 Die Wahlen GewonnenDokument2 SeitenWarum Hat Die National Party Im Jahre 1948 Die Wahlen GewonnenmiguelNoch keine Bewertungen