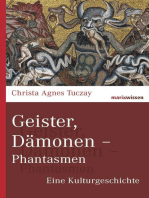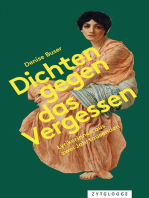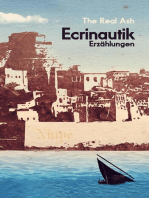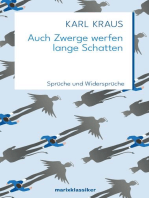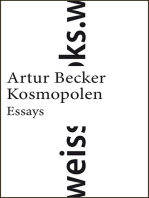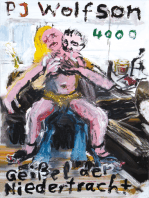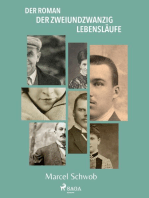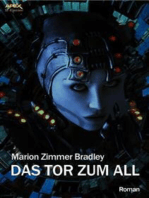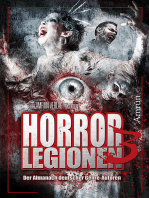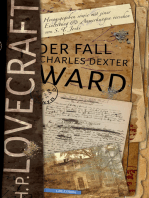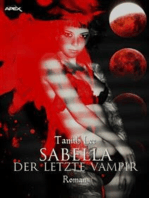Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Die Stimme Hinter Der Wand Uber Marlen Haushofer: Joachim Von Der Thusen
Die Stimme Hinter Der Wand Uber Marlen Haushofer: Joachim Von Der Thusen
Hochgeladen von
baurmanntOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Die Stimme Hinter Der Wand Uber Marlen Haushofer: Joachim Von Der Thusen
Die Stimme Hinter Der Wand Uber Marlen Haushofer: Joachim Von Der Thusen
Hochgeladen von
baurmanntCopyright:
Verfügbare Formate
Joachim von der Thusen
Die Stimme hinter der Wand
Uber Marlen Haushofer
Als Marlen Haushofer 1970 starb, kannten ihr Werk nur wenige.
Erst im Jahr 1983 setzte der posthume Erfolg mit der Neuauflage
ihres friihen Romans Die Wand (1963) ein. Es war zweifellos ein
kluges "timing" des Claassen-Verlags, die Neuausgabe von Marlen
Haushofers Werk gerade mit diesem Roman zu beginnen, denn der
Herbst 1983 stand im Zeichen des Raketenprotests: Endzeitvisio-
nen lieferten den Medien und auch der Frankfurter Buchmesse ihr
Thema. So fand Marlen Haushofers Buch vom Ende der Welt
seine Leserschaft; die darin beschriebene AuslOschung des Lebens
glich erstaunlich genau der Vorstellung, die wir uns heute von
einem Zustand der Welt nach dem Einsatz der Neutronenbombe
machen.
Inzwischen sind vier weitere Romane von Marlen Haushofer
neu aufgelegt worden. Zu dem spaten Interesse an dieser Autorin
tragt neben dem okologischen Grundtenor ihres Werks sicher
auch bei, daJ3 ihr Stil nicht !anger quer zu den literarischen Moden
steht. Es war vor allem die sanft-verdiisterte Innerlichkeit mancher
Romane, die in den sechziger Jahren kaum Anklang fand. Zwar
teilten Haushofers Bucher die kritische Haltungjener Jahre - auch
sie verhielten sich anklagend gegeniiber der Unbeweglichkeit und
Saturiertheit der "formierten Gesellschaft" -, <loch scheuten sie
das sprachliche Experiment der friihen Sechziger ebenso wie den
Stil des kollektiven Protests der spaten sechziger Jahre. Aus
diesem letzten Grund wurde das Werk auch lange vom
Feminismus iibersehen, dem die Haushoferschen Psychogramme
weiblicher Isolierung wohl zuviel Ratlosigkeit enthielten; trotz
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
158
ihrer Kritik am patriarchalischen System hatte Haushofer
bestimmte Rollenmuster nie in Zweifel gezogen. Inzwischen gibt es
Anzeichen dafiir, daB unter Marlen Haushofers Lesern die Frauen
in der Uberzahl sind, und die Rezensionen mehren sich, die in
ihren Romanen einen emanzipatorischen Grundzug erkennen.
Solche Ubereinstimmungen mit den Tendenzen unserer eigenen
Jahre lassen nun Marlen Haushofers Werk eher als modisches
Phanomen erscheinen, das lediglich in der Zeit versetzt ist.
Vergleiche mit der Hesse-Rezeption der siebziger Jahre drangen
sich auf; man konnte auch an den Erfolg von Michael Endes
Bilchern denken, der erst in den achtziger Jahren einsetzte. Wenn
solche Parallelen richtig sind, dann milBte auch Haushofers
Bedeutung eher darin liegen, Gebrauchsliteratur fiir eine
gleichgesinnte Lesergemeinde geschrieben zu haben und nicht so
sehr Werke, deren asthetische Qualitat es noch zu entdecken gilt.
Diese Vermutungen liegen nahe, doch fehlt die entscheidende
Ubereinstimmung mit modischer Bekenntnisliteratur: den Bilchern
Haushofers mangelt es an der positiven Botschaft. Haushofers
Werk kennt zwar auch ein stilles Pathos der Zivilisationskritik und
des einfachen Denkens, <loch kann man es nicht ohne Rest dem
Sektor "weltanschauliche Gebrauchsliteratur" zuschlagen. Das
Thema der Absonderung erscheint bei Haushofer oft in poetischen
Bildern und Ratseln, die sich dem lebensphilosophisch Eindeutigen
nicht fiigen. Solchen Bildern verdankt sich zum Beispiel die
literarische Qualitat des Romans Himmel, der nirgendwo endet
(1966, 3 1984). Ob das "Friedensbuch" Die Wand allerdings im
selben MaB gelungen ist, ob es dem Sog des lebensphilosophischen
Diskurses genauso widersteht, scheint mir eher die Frage. So
werden auch die folgenden Uberlegungen sich nicht nur auf die
Vorzilge des Buches Die Wand einlassen; auch weniger gelungene
Passagen sollen diskutiert werden. Wie allerdings ein einigermaBen
gerechtes Urteil iiber dieses Werk auszusehen hatte, laBt sich im
Augenblick nur schwer sagen. Zu nab ist dem heutigen Leser das
Thema, als daB er wilBte, wie es mit seiner Faszination bestellt
ware, wenn in ihr einmal die Angst und die moralische
Zustimmung nicht mehr dominierten.
Der Roman Die Wand besteht aus den fiktiven Aufzeichnungen
einer einsam im Wald lebenden Frau mittleren Alters, die sich Ober
die 2 1/2 J ahre ihrer abgesonderten Existenz Rechenschaft gibt.
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
159
Allein in einer Jagdhiltte, verbringt die Frau vier Wintermonate
mit der Niederschrift ihres Berichts. Ob diese Aufzeichnungen je
gefunden werden, bleibt die Frage. Wahrscheinlicher ist, daB die
Mause sich darilber hermachen werden, denn es wird immer
deutlicher, daB die Erzahlerin der letzte ilberlebende Mensch ist.
Zu verdanken hat diese Frau ihre trostlose Rettung einer
merkwilrdigen Tatsache: von der planetaren Katastrophe ist sie
<lurch eine durchsichtige feste Grenze, eine Art Wand, getrennt,
die ihr und einigen Tieren das Weiterleben in einer Enklave
ermoglicht.
Der Beginnpunkt des Erinnerns ist der Abend der Ankunft in
der Jagdhiltte. Die Erzahlerin, deren Namen der Leser nie erfahrt,
beschreibt, wie sie mit zwei wohlhabenden Verwandten in diese
gebirgige Gegend fahrt, um bier ein Wochenende zu verbringen.
Das Jagdhaus des Vetters, der in standiger Angst vor
Atomkatastrophen lebt, ist mit erstaunlichen Mengen an Vorraten
vollgestopft. Der Besitzer kommt allerdings selbst nicht in den
GenuB seiner Vorsorge, als die Katastrophe sich ereignet. Er ist
mit seiner Frau noch einmal ins Dorf gegangen und kehrt nicht
mehr zurilck. Als die Erzahlerin sich am nachsten Morgen auf den
Weg macht, um die beiden zu suchen, st5Bt sie schmerzhaft gegen
die "Wand": ein glattes, kilhles, nur <lurch Berilhrung
wahrnehmbares Hindernis, das nirgendwo durchlassig ist. Als die
Frau sich an dieser Grenze entlangtastet und auf eine Anhohe
klettert, sieht sie das erste Gehoft des Dorfes. Alles scheint vollig
intakt, bis auf die unbewegliche Figur eines Bauern, der am
Brunnen steht und mit der hohlen Hand Wasser schopfen will, den
Strahl aber nicht erreicht. Spater wird diese Gestalt umfallen: der
Tod ist als eine Art Mineralisierung zu begreifen. Auch alles
andere Leben ist verschwunden, doch liegen Gebaude, Garten und
Wiesen friedlich im Sonnenlicht. Diese sonnenbeschienene Rube
ist das beherrschende Bild, in das die Welt jenseits der Wand
gefaBt wird. Die Katastrophe hat das Ende der Menschheit
bedeutet, doch da die Katastrophe lautlos kam und nicht die Zilge
des Holocaust, des Weltenbrandes, tragt, entsteht eine beklem-
mende Identitat von Schrecken und Hoffnung. Hoffnung, weil die
Vegetation sich nun Raume zurilckerobern wird, die ihr von der
technikbesessenen Menschheit genommen wurden: Bilder gebor-
stener StraBen, aus denen das Grun wuchert, verrostender
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
160
Automobile, in deren Polster Nistplatze entstehen - der okologisch
eingestellte Leser kann sich der Faszination einer endlich in Rube
gelassenen Natur nicht entziehen. Auch die Erzahlerin besetzt
solche Visionen mit Hoffnungen, um gleich darauf dem
lahmenden Schrecken zu verfallen, daB sich an solchen Orten ja
kein BewuBtsein mehr einrichten kann. Das Problem, daB eine
nichtangeschaute Natur keine Naturist: bier ist es zum scharfsten
Paradox vorgetrieben. Was ist der Sinn der Rettung des Griinen,
wenn kein Funke des BewuBtseins in ihm mehr lebt, wenn kein
tierisches oder menschliches Leben sich· mehr zu ihm verhalten
kann? Die griine Utopie kommt zu spat; mit der aufgehobenen
Entfremdung ist das Leben selbst verschwunden.
Doch am Ende des Romans steht immerhin die Vermutung, daB
die Bache, die unter der Wand durchsickern und durchflieBen
konnen, Spuren des Lebens in die AuBenwelt bringen. Und wenn
zu beiden Seiten der Wand die Natur sich ahnlich wuchernd
durchsetzt, wird die Wand vielleicht nicht immer uniiberwindlich
bleiben. Freilich ist die Erzahlerin noch wenig daran interessiert, in
das Reich der steinernen Toten und der Hauser mit ihren
geborstenen Leitungen iiberzuwechseln. Lieber bleibt sie in ihrem
Jagdhaus, das in einem "Kessel" in der Nahe der Wand liegt. Von
bier aus kann man eine Lichtung iiberblicken, und mit ihrem
Gewehr in Reichweite fiihlt sie sich einigermaBen geschiitzt.
Diese Situation erinnert an Robinson Crusoe, wie iiberhaupt
Haushofers Roman wichtige Strukturen mit diesem altesten der
Berichte vom gliicklich-ungliicklichen Naturexil teilt. Auch
Robinson vertraut sich nicht der Gefahr des Ausbruchs aus seinem
Inselgefangnis an, vertraut aber auch nicht darauf, daB er auf
seinem Territorium sicher sei. Zu Recht verbarrikadiert er sich -
wie sich herausstellt - , und auch in Haushofers Roman wird es
einen einsam-wilden Eindringling geben. Auch Haushofers
Erzahlerin braucht nicht wie die Hohlenkinder in die Steinzeit
zuriick, da sie wie Robinson von einigen Vorraten leben kann,
wobei die Munition das wertvollste Gut ist. Sogar die Defoe'sche
Einzelheit, daB die Eintragungen im Kalender durch eine
Fieberkrankheit durcheinander geraten, laBt sich bei Haushofer
wiederfinden. 1
1. Vgl. Daniel Defoe: Robinson Crusoe (Norton Critical Edition; New
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
161
Mit dem klassischen Einsamen teilt Haushofers Erzahlerin den
ProzeB der Selbsterfahrung unter extremen Bedingungen und in
der Konfrontation mit Erinnerungen und vergangenen Wiinschen.
Ein wichtiger Zug beider Romane ist, daB der dieses Schicksal der
Absonderung erleidet, der dafilr gemacht ist: eine innere Starke
verbindet beide Figuren. Doch ist es Robinson gemaB, wieder in
die Gesellschaft zuriickzukehren. Sein groBtes Leiden war es, sein
grilnes Reich, das im iibrigen von der tropischen Natur mehr
begiinstigt ist als Haushofers standig von Kalte bedrohtes Leben,
mit niemandem teilen zu konnen. Dagegen wilnscht Haushofers
Erzahlerin sich die Nahe der Menschen nicht mehr, da sie filrchtet,
auf dem engen Raum milsse es notwendig zu Streit kommen. In
Robinson Crusoe droht die Gefahr von den Kannibalen und den
Meuterern, den Andersartigen also, bei Haushofer dagegen sind
die potentiellen Morder Menschen der gleichen Klasse und
Hautfarbe. Der versprengte Mann, der am Ende von Haushofers
Roman auftaucht und am "Tag X" offenbar auch hinter die Wand
geraten war, ist die verkorperte Aggression: mit seinem Beil totet
er Hund und Stier, bevor die Frau ihn erschieBen kann. Offenbar
stammt dieser Mensch aus derselben Schicht der biirgerlichen
Jagdpachter und Fabrikanten wie Hugo, der Verwandte der
Erzahlerin. Der ganze Roman ist durchzogen von diesem
MiBtrauen gegen die Menschen und dem gleichzeitigen Vorgefilhl
neuen Unglilcks. Und so geht die Trauer um die toten Tiere tiefer
als die Reaktion auf den Verlust der beiden erwachsenen Tochter,
die die Frau einmal groBgezogen hat und die in der Katastrophe
umgekommen sein milssen. Ein Ehemann, der zu dieser Familie
gehort haben konnte, wird in den Aufzeichnungen erst gar nicht
erwahnt.
In einem weiteren Punkt weicht Haushofers Roman von Defoe's
klassischem Muster ab: Robinson Crusoe steht selbst wieder in
einer textuellen Tradition, namlich der des harenen Einsiedlers in
der Hohle. Bei aller Rationalitat des Insel-Entrepreneurs ist
Robinson ein frommer Bibelleser, der aus seinem Glauben Kraft
York/London, 1975), S.76. Die entsprechende Stelle findet sich aufS.248
in Haushofers Die Wand (Diisseldorf: Claassen, 3 1983. (Im folgenden alle
Zitate nach dieser Ausgabe.)
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
162
schopft und sich im Gebet ein Surrogat des zwischenmenschlichen
Gesprachs verschafft. Diese Moglichkeit ist in Haushofers Roman
vollig abhanden gekommen, obwohl der BewuBtseinshorizont der
Erzahlerin eine traditionelle Glaubigkeit nicht von vornherein
ausschlieBt: es handelt sich um eine einfache Frau aus der
osterreichischen Provinz. Doch die UnfaBbarkeit der ZerstOrung
kann mit dem Gedanken einer Weltlenkung nicht mehr vermittelt
werden. War Robinsons Schicksal ein Einzelfall, der die groBe
christliche Ordnung <lurch die bedeutungstrachtigen Bilder von
Schiffahrt, Schiffbruch und wunderbarer Errettung gerade
bestatigte, so kann bei Haushofer ein Sinn aus dem Geschehenen
nicht mehr herausgelesen werden. Der Mensch hat all dies selbst
angerichtet. Das hieraus entstehende Sinnproblem wird auf
verschiedene Weise thematisiert und durchzieht als bohrende
Frage den ganzen Roman. Erst in der Abkehr von der Erinnerung
an die menschliche Gesellschaft entsteht zogernd die Hoffnung,
daB auch dieses letzte Leben noch eine Funktion haben konnte:
einmal in der Sorge fiir die "anvertrauten" Tiere und dann vor
allem - im Hinblick auf das eigene Ende - im Aufgenommenwerden
in den groBen Zyklus der Natur. Solcher Trost in der Tradition des
Lukrez2 hat freilich etwas Rudimentares; reduziert zur biologi-
schen Masse, wird der Mensch um den Sinn bewuBten Handelns
und damit um sein Menschsein gebracht. Doch kommt gerade
dieser bescheidenen Antizipation des Zerfalls und des Weiter-
lebens in organischer Form im Bildsystem von Haushofer eine
besondere Bedeutung zu: der Frau wird immerhin gelingen, was
den toten Korpern jenseits der Wand nie zuganglich sein wird -
denn die Leichname drauBen verharren ja in anorganischer Starre.
Resiimierend konnen wir sagen, daB - anders als Defoe -
2. Vgl. vor allem Buch III, De rerum natura. Das beriihmte
Lehrgedicht des Lukrez markiert den Beginnpunkt einer Tradition der
"Philosophie des Naturexils'', deren bedeutendste neuzeitliche Vertreter
Rousseau und Thoreau sind. Ihre unorthodoxen philosophischen Texte
sind vor allem gekennzeichnet durch die Mischung von Poesie,
wissenschaftlichem Interesse, Sozialpessimismus und Naturmeditation.
An der eigentiimlichen Stillage von Schriften aus dieser Tradition hat
auch Haushofers Roman teil, obwohl bier natiirlich die analytisch-
reflexive Dimension weit weniger entwickelt ist.
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
163
Haushofer keine Stiitze in den herrschenden Ideologien ihrer Zeit
findet. Der gesellschaftlich determinierte Blick ist die groBe Last,
die das Erkennen unmoglich macht und eine Anpassung an das
natiirliche Leben verhindert. So heiBt es:
Die Menschen batten mir immer vorgedacht und vorgetan. Ich muBte
nur ihrer Spur folgen. Die Stunden auf der Bank vor einer Almhiitte
waren Wirklichkeit ... Doch waren au ch hi er die Gedanken schneller
als die Augen ... Seit der Kindheit hatte ich verlernt, die Dinge mit
eigenen Augen zu sehen ... (Die Wand, S. 210)
Durch die alten Bedeutungen ist das Neue nicht sichtbar (S.
134). Wahrend Defoe's Held im Grunde ein altes Leben fiihrt,
versucht sich Haushofers Erzahlerin am neuen. Sinn erschlieBt sich
in Haushofers Welt erst dort, wo man sich abkehrt von den
Erinnerungen. Das Schreiben ist unter anderem der Versuch dieser
langsamen Abl6sung.
Der fremde Eindringling dagegen ist ein Mensch mit alten
Gedanken und alten Taten: sein Beilhieb ist nichts anderes als die
Fortsetzung des Krieges, der die Wand entstehen lieB. Besonders
furchtbar fiir die Erzahlerin ist, daB er gerade auf jenem Terrain
auftritt, das vorher in besonderem MaBe Erinnerungslosigkeit
ermoglichte: es ist die Alm. Auf ihren Streifziigen mit dem Hund
hat die Frau auch hoher gelegenes Gelande erkundet. Ganz ins
Gebirge wagt sie sich nie, und so ist undeutlich, wo nun eigentlich
die Wand hinfiihrt und ob sie sich tiberhaupt irgendwo schlieBt.
Das bringt eine standige Unsicherheit mit sich, und so ist auch am
Ende keineswegs sicher, ob es nicht einen weiteren Uberfall durch
einen dritten Uberlebenden geben kann.
Im zweiten und dritten Sommer zieht die Frau unter Mtihen mit
den Tieren hinauf auf diese Alm. In den Sommermonaten erlebt
sie eine tiefe Befriedigung, da die Traume und Erinnerungen von
ihr abfallen und sie gleichsam vergangenheits- und zukunftslos in
ihrer Sennhiitte haust. In Bildern kosmischer Harmonie wird diese
Zeitlosigkeit beschworen. Allerdings ist die sprachliche Gestaltung
solcher Erfahrungen nicht durchweg gelungen. Es wird eigentlich
kaum der Versuch gemacht, neue Formulierungen fiir neue
Erfahrungen zu finden. So bedient sich der Blick zu den Stemen, in
die griine Weite und hiniiber zu den Tieren des traditionellen
empfindsamen Vokabulars. Oder sind es letztlich doch alte
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
164
Empfindungen und Wahrnehmungen: Projektionen eines einsamen
Menschen, der sich eine neue Art von Gemeinschaft sucht, weil er
auf alte Art unvollstandig ist? Hier liegt wohl auch der Grund,
warum gerade die Darstellung des Zusammenlebens mit den
Tieren sprachlich oft problematisch ist. Vor allem die
anthropomorphe Perspektive auf Katzen und Rinder fiihrt zu
mancher Formulierung (das "warme Gliick" von Mutterkuh und
Kalb, der "emport schreiende" Kater etc.), die von einer neuen
Erfassung des natiirlichen Lebens weit entfernt ist.
Dieses Stilproblem in Haushofers Roman hangt unmittelbar mit
dem zweifachen Sinn des Uberlebens zusammen, von dem schon
die Rede war. Stellt die lukrezische Einbettung des individuellen
Lebens in den organisch-natiirlichen Zusammenhang eine radikale
Umkehr des Denkens dar und damit auch das Verlassen aller
sentimentalen Naturdiskurse, so entsteht dort, wo der Sinn des
Uberlebens in der Sorge fiir die unselbstandigen Haustiere gesucht
wird, die entgegengesetzte Bewegung. Wo die Erzahlerin glaubt,
diese familiale Gemeinschaft mit den Tieren sei eine Art
Wiedergutmachung an den Wesen, deren Artgenossen <lurch den
Menschen vom Erdboden getilgt wurden, bleibt sie ganz im alten
moraiisierenden Idiom. Auch in anderen Romanen der Marlen
Haushofer hangt die Schwache der Darstellung von Tieren mit
diesem Grundproblem zusammen. Ihr Blick auf animalisches
Leben entspricht allzu sehr den herrschenden Gefiihlsprojektionen
und dem allgemeinen schlechten Gewissen. Da die heutige
Gesellschaft sich nicht einzugestehen wagt, daB dem vom
Menschen gezahmten Tier kein Existenzrecht iiber seine
Nutzfunktion hinaus zukommt, erhalt sie das unselbstandige Tier
und den unselbstandigen Menschen in einer seltsamen Beziehung
des Mangels: das Tier braucht das Leittier Mensch, und der
Mensch braucht das Liebesobjekt Tier. Auch Haushofer beriihrt
dies Problem, doch auch bier verrat sie Naivitat und scheint sich
der Tragweite ihrer Formulierung kaum bewuBt, wenn sie ihre
Erzahlerin sagen laBt: "Es ist viel leichter, Bella oder Katze zu
lieben als einen Menschen" (Die Wand, S. 124).
Im fiktionalen Kontext des Romans werden die sich als spontan
gebenden Beschreibungen des Lebens mit den Tieren allerdings
damit begriindet, daB die Erzahlerin eine einfache Frau ist. Damit
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
165
erledigt sich das Stilproblem freilich nicht, doch hat die
Beschrankung des ErzahlbewuBtseins eine deutliche strukturelle
Funktion. Die Erzahlerin ist namlich eine Frau mit einem groBen
Erfahrungshunger. Zu ihrer geistigen Kost gehorten in ihrem
friiheren Leben Illustrierte und Kriminalromane, die sie aber nie
ganz befriedigten. Sie, die in gedanklicher Abhangigkeit von
anderen verharrte, hat die Normen ihrer Umwelt doch nie ganz
verinnerlicht. So blieb eine Distanz zwischen dem, was man in der
Gesellschaft so dachte, und dem, was sie erfuhr und empfand.
Besonders die Friedlosigkeit der Menschen im Umgang
miteinander, ihre Gleichgiiltigkeit gegen anderes Leben, hat schon
friih eine Fremdheit zwischen dieser Frau und ihrer Umgebung
entstehen lassen. Den Gegensatz trifft vor allem folgendes Zitat:
Waren alle Menschen von meiner Art gewesen, hatte es nie eine Wand
gegeben, und der alte Mann miiBte nicht versteinert vor seinem
Brunnen liegen. Aber ich verstehe, warum die anderen immer in der
Ubermacht waren. Lieben und fiir ein anderes Wesen sorgen ist ein
sehr miihsames Geschaft und vi el schwerer, als zu t6ten und zu
zerstoren. Ein Kind aufzuziehen dauert zwanzig Jahre, es zu t6ten
zehn Sekunden. (S. 161)
Da nun auch ihre eigenen Tochter sich von ihr entfernt haben,
die Normen der Gesellschaft iibernahmen, wird ihr Tod nicht
unter dem Aspekt der Vernichtung unschuldigen geliebten Lebens
gesehen, sondern als der Tod von zwei Menschen, die genauso
blind und mitschuldig geworden sind wie der Rest der Menschheit.
Um die Menschheit aber ist es nicht schade. Es liegt fiir die
Erzahlerin eine grausame Gerechtigkeit darin, daB die, die den
Wert des Lebens nicht erkannten, sich darum brachten. Und so
wird keine Sekunde darauf verschwendet, in der Erinnerung
irgendwelche politisch Verantwortlichen ausfindig zu machen.
lnbegriff des lieblosen Lebens sind die Kafige, die sich die
Menschen einst bauten: die kalten steinernen Hauser, in denen sie
isoliert voneinander hausten. In der Katastrophe verlagert sich
diese Bildlichkeit: die Menschen selber werden zu Stein, und die
Mauer, von der das Steinerne gleichsam subtrahiert wird, weil es in
die Menschen selbst iiberging, wird zur Wand, dem ratselhaften
Gebilde, das die Kuhle und Harte der Mauer bewahrt, ohne doch
ihre Materie zu besitzen. Das finale Werk der Menschheit ist ein
Zeugnis der Trennung.
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
166
Dieser Kiihle und dem Trennungsprinzip versucht nun die
Erzahlerin das grundsatzlich andere Leben entgegenzusetzen: das
Leben in der Warme und korperlichen Nahe. Doch bleibt zur
Erzeugung dieses Warmefelds eben nichts auBer ein paar
Haustieren, die auch im Lauf der zweieinhalb Jahre noch weniger
werden, so daB am Ende nur eine Kuh und eine Katze iibrig sind.
Gerade die mannlichen Tiere sind eingegangen oder wurden
erschlagen. DaB alles Mannliche verschwindet, hangt eng damit
zusammen, daB der Roman auch die Geschichte einer
Emanzipation ist. Da diese Frau erst in der Einsamkeit zu sich
selbst kommt, findet sie bier erst zu eigenen Gedanken und eigener
Sprache. Und so ist die Ablehnung des untergegangenen
gesellschaftlichen Treibens vor allem eine Kritik an der von
Mannern gesteuerten Welt. Wenn in diese Kritik andere Frauen
mit einbezogen werden, dann vor allem deswegen, weil sie das
Regime der Manner stiitzten, sich an sie "ranschmissen" wie zum
Beispiel die Kusine und so die Manner in ihrem Gewaltdenken
bestatigten. In ihrer Ablehnung des Mannlichen geht die
Erzahlerin so weit, daB sie sogar die Notwendigkeit der Zeugung
verflucht und auf ihrem Territorium am liebsten wohl eine Art
Parthenogenese am Werk sahe. Die Situation am Ende ist auch
nicht weit davon entfernt, da fiir die Katze im Wald ein Kater
haust, der sich sonst nicht blicken laBt, und da die Kuh auf
merkwiirdige Weise von ihrem kaum erwachsenen Stierkalb
geschwangert wurde. Grundsatzlich bleiben die mannlichen Tiere
in diesem Bereich unerwachsen oder so abhangig wie der Hund.
Wenn man von diesem Strang des Romans aus noch einmal auf
das Defoe-Modell zuriickblickt, zeigt sich auch bier, daB
Haushofers Buch nur teilweise iiber den Leisten der Robinsonade
zu schlagen ist. Eber noch wird man an Strukturen und Motive des
Marchens erinnert, vor allem jenes Marchentyps, der von
Madchen handelt, die eingemauert oder in den Wald geschickt
wurden. Es ist die besondere Kombination aus Furchtsamkeit und
Starke, die sowohl die Hauptfigur in Haushofers Roman wie im
Marchen auszeichnet. In den Marchen miissen oft diejenigen in die
Verbannung, die mit den Normen der Welt der Machtigen nicht
iibereinstimmen oder auf denen eine magische Verwiinschung
lastet. Ausgesetzt wird der wertvolle Mensch, der, seiner Rechte
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
167
beraubt, nur unter groBen Miihen zur Anerkennung und zur
Eingliederung in die Gemeinschaft findet. Gerade im Wald, im
finsteren Turm und auf der Wanderschaft gewinnt die Heldin des
Marchens an Selbsterkenntnis und an innerer Starke, wodurch sie
denen, die zu Hause blieben, oft iiberlegen wird. Neben dieser
thematischen Verwandtschaft zwischen Haushofers Roman und
dem Volksmarchen gibt es noch eine Reihe auffallender
motivischer Parallelen; man denke z. B. an die Motive des
glasernen Sarges, des glasernen Berges am Ende der Welt oder an
das der magischen Versteinerung.
Als Jugendbuchautorin hatte Marlen Haushofer sich schon friih
mit Marchenmodellen beschaftigt, aber auch die Figuren und
Erzahler ihrer Romane beziehen sich mitunter ausdriicklich auf die
Gattung des Marchens. So entstammt der Name, den sich die
kindliche Heldin in Himmel, der nirgendwo endet zulegt, einem
Lieblingsmarchen, dem "Von der kleinen Meta". 3 Und im Roman
Die Wand bleibt von allen erinnerten Diskursen nur der des
Marchens intakt, wenn die Erzahlerin sagt:
Die Apfel sahen sehr hiibsch aus, grasgriin, mit feuerroten scharf
abgesetzten Backen, wie der Apfel in der Geschichte von
Schneewittchen. An die Marchen erinnerte ich mich noch sehr genau,
aber sonst hatte ich viel vergessen. Da ich ohnedies nicht viel gewuBt
hatte, blieb nur wenig Wissen iibrig. Namen lebten in meinem Kopf
und ich wuBte nicht mehr, wann ihre Trager gelebt batten. (S. 224)
Zu vermuten ist, daB solche Ubereinstimmungen und
Anspielungen nicht zufiillig sind, sondern Ausdruck einer engeren
Beziehung. Demnach ware die Wand eine "Antwort" auf Texte der
Marchengattung. Man kann sicher an eine ganze Reihe von
Marchentexten des schon genannten Typus denken; insbesondere
das Grimmsche Marchen von den "Sieben Raben" (KHM 44)
findet mit den Motiven der unbedachten Vaterrede, der Sorge fiir
die Tiergeschwister und der Verbannung an das glaserne Ende der
Welt starke Anklange in Haushofers Roman. Starker aber noch ist
der Bezug zu Grimms Marchen von der "Jungfrau Maleen"
(KHM 11 ), bei dem so gar der Ti tel suggeriert, daB wir es mit einer
3. Himmel, der nirgendwo endet. Diisseldorf: Claassen 3 1984, S. 41
und 51.
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
168
personlichen Mythe der Autorin zu tun haben konnten. 4
Die Ubereinstimmungen des Marchens "Jungfrau Maleen" mit
dem Roman Die Wand sind verbliiffend. Die Prinzessin Mateen
wird auf Befehl ihres machtigen und unbedachten Vaters in einen
Turm gemauert - da sie einen Prinzen ihrer eigenen Wahl heiraten
wollte. Nach sieben Jahren, als die Vorrate aufgebraucht sind,
befreit sich Maleen, indem sie sich mit den Handen <lurch das
Mauerwerk hindurcharbeitet - unterstiitzt vom alter ego, ihrer
Kammerfrau. DrauBen findet sie eine vom Krieg vollig verwiistete
Gegend vor, in der keine Menschenseele mehr am Leben ist. Nun
beginnt eine lange Wanderschaft <lurch das verodete Reich, wobei
sie sich - wie Haushofers Frau - von Brennesseln nahrt. Als sie im
SchloB ihres ehemaligen Brautigams anlangt, verdingt sie sich als
Magd und wird schlieBlich als die rechte Braut erkannt. Auch in
diesem Marchen steht also der unbeherrschte Spruch des Vaters
am Anfang, der sich bier gegen die Tochter selbst richtet, dann sich
aber aggressiv verselbstandigt und in der Vernichtung des
Sprechers resultiert. Die Tochter, die die "Sprache der Liebe"
spricht, soll abgesondert und in ihrem Willen gebrochen werden;
<loch sie ist es, die iiberlebt, weil sie in sich und der Natur
besondere Krafte entdeckt.
Am intertextuellen Bezug von Haushofers Roman zu diesem
Marchen fallt auf, daB <lessen Grundstruktur zwar iibernommen,
<loch zugleich um ein wichtiges Element gekiirzt wird. Es fehlt bei
Haushofer die fiir Marchen entscheidende SchluBphase der
Erlosung und der Wiedereinsetzung in die alten Rechte und ins
kollektive Leben. 5 In der Wand endet die Handlungssequenz mit
4. Der Taufname der Autorin war iibrigens Marie Helene
(Frauendorfer), spater zusammengezogen zu "Marlen". Neben den
Hinweisen in Haushofers Werk auf personliche Mythen und Marchen
legen auch die Studien von Bruno Bettelheim und Hans Dieckmann
nahe, daB Marchen in bestimmten Lebensphasen eine Leitfunktion haben
konnen. Das reicht bis zur Selbsttherapie von Erwachsenen bei
psychischen Erkrankungen. B. Bettelheim: Kinder brauchen Marchen.
Miinchen: dtv 1980. H. Dieckmann: Gelebte Marchen (= Praxis der
analytischen Psychologie). Hildesheim: Gerstenberg, 2 1983.
5. In Marchen oft begleitet von Symbolen der resurrectio. Zur
psychologischen Deutung der Erzahlschliisse von Marchen des Typus
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
169
der Phase der Verbannung hinter die magische Linie, der
Vereinsamung und der Priifungen. So bleibt die Heldin
gewissermaBen im "Turm-und-Brennessel"-Stadium stecken (wo-
bei die im Marchen diachrone Anordnung von passiver Zeit im
Turm und aktiver Zeit der Wanderung in Haushofers Roman
weitgehend synchron wird). Die Linie, die die tiefenpsychologische
Marcheninterpretation vom Punkt der Desorientierung zum Punkt
der Reife zieht, IaBt sich zwar auch in der Wand erkennen: die
Heldin mit der psychischen Struktur der Kindfrau entwachst der
Opfer-Stufe und Passivitat und gelangt zur Stufe der "Ich-
Integration".6 Doch die Selbstfindung in Haushofers Roman, die
erst in den Schrecken der Absonderung moglich wurde, lauft
gleichsam leer. Was diese Frau nun gelernt hat und iiber sich selber
"weiB", kann in die menschliche Gemeinschaft nicht mehr
eingebracht werden.
Die raumlich-existentielle Situation in der Wand wird damit
ambivalent. Einerseits ermoglicht erst die Abtrennung von den
Menschen die Besinnung auf eigene Bediirfnisse und auf die eigene
Sprache. Andererseits aber konnen die Bediirfnisse nur in groBter
Beschrankung erfiillt werden, und die Sprache selbst wird um ihr
Wesentliches, den menschlichen Austausch, gebracht, wo sie
monologisch und vom Tagebuch absorbiert wird (dies jedenfalls
im Kontext der mit der Marchenhandlung vergleichbaren Fiktion).
Diese Grundsituation der positiv-negativen Absonderung, die -
anders als im Marchen - nie aufhebbar ist, kennzeichnet auch die
anderen Werke der Marlen Haushofer. Es fiillt auf, daB sie in den
meisten ihrer Bucher die raumliche Matrix der Handlung schon im
Titel benennt: Die Wand, Die Tapetentiir, Himmel, der nirgendwo
endet und Die Mansarde. Der Titel scheint jeweils das
Grundzeichen zu sein, das auf die Moglichkeit von sprachlicher
Zeichenproduktion iiberhaupt verweist, da erst in der raumlichen
Absonderung die Haushoferschen Heldinnen dem gesellschaft-
lichen Diskursdiktat entgehen, das sie sonst mundtot macht. Die
"Die Fahrt der Jungfrau': S. Hedwig von Beit: Symbolik des Marchens.
Versuch einer Deutung. Bern und Miinchen: Francke 4 1971. Besonders I,
713.
6. Grundlegendes zur Personlichkeitsintegration in (und mithilfe von)
Marchentexten bei Bruno Bettelheim, a.a.O., S.90-98.
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
170
Befreiung von dem Diskurs, der auch die Familie beherrscht und
dem Kinder und Frauen auf eine besondere Weise unterworfen
sind, wird erst hinter den Wanden, den Tiiren, in den Mansarden
moglich. Diese Abschottung bedeutet immer wieder Verlassenheit
und <loch das Gliick des Tagtraumens und Sprechens.
Unschwer erkennt darin der Leser, der mit der Biografie von
Marlen Haushofer vertraut ist, die Grundsituation der Autorin
selbst. Als Hausfrau in einer osterreichischen Provinzstadt begriff
sie den biirgerlichen Alltag mit seiner Sprache als eine Form von
Gewalt, der sie nur <lurch raumliche Absonderung und <lurch ihre
schriftstellerische Produktion entgehen konnte. Doch ist nicht
anzunehmen, daB die "Hartnackigkeit" des beschriebenen
raumlich-szenischen Grundmusters, <lurch das die poetischen
Sinnentwiirfe aller Werke von Marlen Haushofer hindurchgehen,
damit schon hinreichend erklart ist. Vielmehr ist hier eine
besondere Disposition zu vermuten, die vielleicht auf eine friihe
Traumatisierung zuriickgeht. Denn ahnlich obstinate raumlich-
szenische Muster kennen wir von anderen Autoren (z.B. bei Kleist:
der 'Raum des Vertrauens', bei Kafka: der 'Vorhof der Macht')
und wissen, daB es oft friihe Erlebnisse waren, die den
Mechanismus der Wiederholung im Werk in Gang setzen. 7 Ob die
besondere Erfahrung im Fall der Marlen Haushofer allerdings in
einer friihkindlichen VerstoBung besteht, wie es der Roman
Himmel, der nirgendwo endet nahelegt, 8 oder ob das Trauma den
Menschen erst spater trifft, wie es Die Mansarde suggeriert, 9 solche
psychologischen Fragen sind aus der Lektiire des Werks allein
kaum zu beantworten. So konnen wir nur konstatieren, daB
Marlen Haushofer mit der szenisch-raumlichen Matrix des
Ausgeschlossenseins eine poetische Formel der Verdichtung des
Erzahlsinns gelungen ist, die gerade in der Wand die Strahlkraft
des Unheimlichen gewinnt.
7. Zurn Begriff der "raumlich-szenischen Matrix", zum Vorgang des
Zusammenziehens von sozialer und psychischer Erfahrung in solchen
ambivalenten Grundmustern und zu den Moglichkeiten ihrer Interpreta-
tion: vgl. meinen Vortrag "Probleme der literatursoziologischen
Interpretation: Am Beispiel Kleists" (Rijksuniv. Utrecht, 1982, bisher
unveroffentlicht ).
8. Himmel. A.a.O., S. 39-41.
9. Die Mansarde. Diisseldorf: Claassen 2 1984, S. 58 und passim.
Joachim von der Thüsen - 9789004651746
Downloaded from Brill.com 01/23/2024 10:28:35AM
via University of Oxford - Bodleian Libraries
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Neumann - Franz Kafka-Experte Der MachtDokument303 SeitenNeumann - Franz Kafka-Experte Der MachtMartínNoch keine Bewertungen
- Lovecraft Namenlose-KulteDokument22 SeitenLovecraft Namenlose-Kultejohannes klausNoch keine Bewertungen
- Doktor FaustDokument186 SeitenDoktor FaustB.Bitterburg100% (2)
- Aufbau Und Inhalt Der SchimmelreiterDokument11 SeitenAufbau Und Inhalt Der SchimmelreiterEduard CaraginNoch keine Bewertungen
- Die Neuen Leiden Des Jungen WDokument16 SeitenDie Neuen Leiden Des Jungen WMarinaJošVučković100% (1)
- Die verlorene Bibliothek: Autobiographie einer KulturVon EverandDie verlorene Bibliothek: Autobiographie einer KulturNoch keine Bewertungen
- Reise B2. Nr. 1Dokument1 SeiteReise B2. Nr. 1dilansilavo62% (13)
- SC Himmel ReiterDokument3 SeitenSC Himmel ReiterPaul HotiuNoch keine Bewertungen
- Geister, Dämonen - Phantasmen: Eine KulturgeschichteVon EverandGeister, Dämonen - Phantasmen: Eine KulturgeschichteNoch keine Bewertungen
- Der ZauberbergDokument4 SeitenDer ZauberbergTijanaNoch keine Bewertungen
- Max Frisch - Homo FaberDokument2 SeitenMax Frisch - Homo FaberMaurice WendelNoch keine Bewertungen
- Lufthunde: Portraits der deutschen literarischen ModerneVon EverandLufthunde: Portraits der deutschen literarischen ModerneAnne HamiltonNoch keine Bewertungen
- Berühmt sein ist nichts: Marie von Ebner-Eschenbach - Eine BiographieVon EverandBerühmt sein ist nichts: Marie von Ebner-Eschenbach - Eine BiographieNoch keine Bewertungen
- Deutsch ReferatDokument1 SeiteDeutsch ReferatRosie OlafssonNoch keine Bewertungen
- Nach der Ironie: David Foster Wallace, Franz Kafka und der Kampf um AuthentizitätVon EverandNach der Ironie: David Foster Wallace, Franz Kafka und der Kampf um AuthentizitätNoch keine Bewertungen
- Medea - Ingeborg BachmannDokument7 SeitenMedea - Ingeborg BachmannAlieNoch keine Bewertungen
- Lauernde Mächte: Unheimlich-fantastische Novellen und KurzgeschichtenVon EverandLauernde Mächte: Unheimlich-fantastische Novellen und KurzgeschichtenNoch keine Bewertungen
- Veilchen-Anthologie Band 2: Lustige, traurige und gruselige Geschichten 2003-2017Von EverandVeilchen-Anthologie Band 2: Lustige, traurige und gruselige Geschichten 2003-2017Noch keine Bewertungen
- Jean Paul von Adam bis Zucker: Ein Abecedarium. Mit Holzschnitten und Federzeichnungen von Christian ThanhäuserVon EverandJean Paul von Adam bis Zucker: Ein Abecedarium. Mit Holzschnitten und Federzeichnungen von Christian ThanhäuserNoch keine Bewertungen
- Acht Thesen Zu Christoph Ransmayrs Roman Die Letzte Welt"Dokument10 SeitenAcht Thesen Zu Christoph Ransmayrs Roman Die Letzte Welt"Akissi Eugenie KouassiNoch keine Bewertungen
- Dichten gegen das Vergessen: Lyrikerinnen aus zwei JahrtausendenVon EverandDichten gegen das Vergessen: Lyrikerinnen aus zwei JahrtausendenNoch keine Bewertungen
- Sobre BobrowskiDokument8 SeitenSobre BobrowskiDaniel BencomoNoch keine Bewertungen
- HEINZ DUTHEL : MEIN FREUND MARCEL PROUST: AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEITVon EverandHEINZ DUTHEL : MEIN FREUND MARCEL PROUST: AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEITNoch keine Bewertungen
- Bachmann UndineDokument7 SeitenBachmann UndineHelena PavićNoch keine Bewertungen
- Auch Zwerge werfen lange Schatten: Sprüche und WidersprücheVon EverandAuch Zwerge werfen lange Schatten: Sprüche und WidersprücheNoch keine Bewertungen
- Michel TournierDokument18 SeitenMichel TournierEdgar MaierNoch keine Bewertungen
- 02 - Mandelstam - Über Den GesprächspartnerDokument7 Seiten02 - Mandelstam - Über Den GesprächspartnerАнастасия ЛымарьNoch keine Bewertungen
- Verpestete Bücher: Elf literarische Epidemien und ein Epilog. Boccaccio und Thomas Mann, Camus und Philip Roth ... Romane und Erzählungen, in denen Seuchen eine Hauptrolle spielen.Von EverandVerpestete Bücher: Elf literarische Epidemien und ein Epilog. Boccaccio und Thomas Mann, Camus und Philip Roth ... Romane und Erzählungen, in denen Seuchen eine Hauptrolle spielen.Noch keine Bewertungen
- Karl Kraus: Ich bin der Vogel, den sein Nest beschmutzt: Aphorismen, Sprüche und WidersprücheVon EverandKarl Kraus: Ich bin der Vogel, den sein Nest beschmutzt: Aphorismen, Sprüche und WidersprücheNoch keine Bewertungen
- Moellendorf Antike Vampir 2018Dokument22 SeitenMoellendorf Antike Vampir 2018iribaar 7Noch keine Bewertungen
- Homo Faber Presentation by Felix DyrekDokument7 SeitenHomo Faber Presentation by Felix DyrekFelixxx87Noch keine Bewertungen
- Tolle Leute: Eine literarische Reise durch Wolfgang Herrndorfs "tschick"Von EverandTolle Leute: Eine literarische Reise durch Wolfgang Herrndorfs "tschick"Noch keine Bewertungen
- GESPIEGELTE FANTASIE: Franz Rottensteiner zum 80. GeburtstagVon EverandGESPIEGELTE FANTASIE: Franz Rottensteiner zum 80. GeburtstagNoch keine Bewertungen
- »Madame Bovary, c'est nous!« - Lektüren eines JahrhundertromansVon Everand»Madame Bovary, c'est nous!« - Lektüren eines JahrhundertromansMarijana ErsticNoch keine Bewertungen
- Kubin From Sämtliche Werke in 22 Bänden NeuausgabeDokument14 SeitenKubin From Sämtliche Werke in 22 Bänden NeuausgabeNPC 1984Noch keine Bewertungen
- Milchfrau in Ottakring: Tagebuch einer russischen Frau - Mit einem Vorwort von Dietmar GrieserVon EverandMilchfrau in Ottakring: Tagebuch einer russischen Frau - Mit einem Vorwort von Dietmar GrieserBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- "Wo Leben ist, da ist Fortgang und wechselnde Phisiognomie": Caroline de la Motte Fouqué. Beiträge zur Forschung und BibliographieVon Everand"Wo Leben ist, da ist Fortgang und wechselnde Phisiognomie": Caroline de la Motte Fouqué. Beiträge zur Forschung und BibliographieNoch keine Bewertungen
- Der Fall Charles Dexter Ward: Herausgegeben sowie mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von S. T. JoshiVon EverandDer Fall Charles Dexter Ward: Herausgegeben sowie mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von S. T. JoshiNoch keine Bewertungen
- Der konservative Charakter: Walter Benjamin und die Politik der DichterVon EverandDer konservative Charakter: Walter Benjamin und die Politik der DichterNoch keine Bewertungen
- Die BlendungDokument8 SeitenDie BlendungSebastian DeppeNoch keine Bewertungen
- Franz Kafka Und Der MythosDokument7 SeitenFranz Kafka Und Der Mythos孙祺祺Noch keine Bewertungen
- Lotgerechtes Eigengrau: (parasophische Alltagsbefragungen)Von EverandLotgerechtes Eigengrau: (parasophische Alltagsbefragungen)Noch keine Bewertungen
- Und Theben liegt in Oberfranken.: Die Genese der literarischen Kulisse, aufgezeigt an Werken E.T.A. HoffmannsVon EverandUnd Theben liegt in Oberfranken.: Die Genese der literarischen Kulisse, aufgezeigt an Werken E.T.A. HoffmannsNoch keine Bewertungen
- Analysieren Homo FaberDokument2 SeitenAnalysieren Homo FaberalexendreNoch keine Bewertungen
- Tintenherz LesetagebuchDokument9 SeitenTintenherz LesetagebuchMaxi the SingerNoch keine Bewertungen
- Theodor Storm OktoberliedDokument10 SeitenTheodor Storm OktoberliedMartinNoch keine Bewertungen
- Idealpaar Kap 9 10Dokument3 SeitenIdealpaar Kap 9 10crislar21100% (1)
- Inter Textuali ItätDokument9 SeitenInter Textuali ItätBrigitta GenceanNoch keine Bewertungen
- Ts ChickDokument6 SeitenTs Chickvaltendo.kontaktNoch keine Bewertungen
- Kapitel 8-11Dokument2 SeitenKapitel 8-11PolinaNoch keine Bewertungen
- Undine - Inhalt (Kurzfassung)Dokument4 SeitenUndine - Inhalt (Kurzfassung)Nayvadius DeMun WilburnNoch keine Bewertungen
- Inhaltsangabe Zu "Ruhm" Von Daniel KehlmannDokument2 SeitenInhaltsangabe Zu "Ruhm" Von Daniel Kehlmannmynameisjennymaier100% (3)
- Die Wolke Zusammenfassung - OdtDokument2 SeitenDie Wolke Zusammenfassung - OdtJürgen Kainz0% (1)
- Lesetagebuch "Tschick"Dokument1 SeiteLesetagebuch "Tschick"LetrasdeltecladoNoch keine Bewertungen
- Die Herren Von WinterfellDokument2 SeitenDie Herren Von WinterfellTill B.Noch keine Bewertungen
- DerButt PDFDokument74 SeitenDerButt PDFDiede FranssenNoch keine Bewertungen
- Der SchimmelreiterDokument6 SeitenDer SchimmelreiterSebastian DeppeNoch keine Bewertungen
- Effi Briest ZusammenfassungDokument2 SeitenEffi Briest ZusammenfassungSilviotto100% (1)
- Charakterisierung OdtDokument1 SeiteCharakterisierung OdtBy 9eNoch keine Bewertungen
- Thomas MannDokument2 SeitenThomas MannION123452Noch keine Bewertungen
- Ts ChickDokument8 SeitenTs ChickЭрменкулова АсельNoch keine Bewertungen
- Aquis SubmersusDokument3 SeitenAquis SubmersusSnježana Nena HorakNoch keine Bewertungen
- Erich Kastner Das Doppelte Lottchen Als PDFDokument2 SeitenErich Kastner Das Doppelte Lottchen Als PDFElaine100% (1)
- Tschick LeseprobeDokument9 SeitenTschick LeseprobeDanailNoch keine Bewertungen
- Georges SimenonDokument16 SeitenGeorges SimenonpovilunasNoch keine Bewertungen