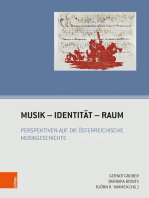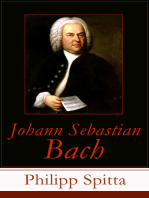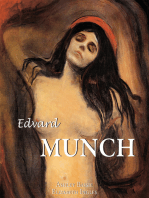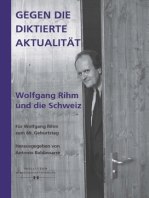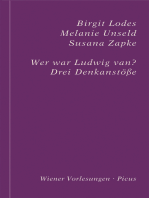Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Mann HeinrichHeineund 1962
Mann HeinrichHeineund 1962
Hochgeladen von
b9vhgkfxztOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Mann HeinrichHeineund 1962
Mann HeinrichHeineund 1962
Hochgeladen von
b9vhgkfxztCopyright:
Verfügbare Formate
Heinrich Heine und G. W. F.
Hegel zur Musik
Author(s): Michael Mann
Source: Monatshefte , Dec., 1962, Vol. 54, No. 7 (Dec., 1962), pp. 343-353
Published by: University of Wisconsin Press
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/30161714
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
University of Wisconsin Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Monatshefte
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
9tonatbjefte
FOR DEUTSCHEN UNTERRICHT,
DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR
Volume LIV December, 1962 Number 7
HEINRICH HEINE UND G. W. F. HEGEL ZUR MUSIK
MICHAEL MANN
University of California, Berkeley
Heines Entwicklung, als Kunstkritiker wie als Kiinstler, wire ohne
Hegel schwer denkbar. Einzelne Aspekte der Abhlingigkeit des Dichters
vom Philosophen sind immer wieder beleuchtet worden; die Gesamt-
beziehung harrt noch einer umfassenden Studie.
In Berlin will Heine in freundschaftlichem Kontakt mit Hegel ge-
standen haben. 1 GewiB ist, da3 er I822 Hegels Kolleg tiber Religions-
philosophie besuchte; wahrscheinlich hdrte er auch die Vorlesungen
iiber Aesthetik. 2 Von letzteren scheinen gerade Hegels Theorien iiber
Wesen und Aufgaben der Musik auf den jungen Heine den geringsten
Eindruck gemacht zu haben - oder er hat sich des Eindrucks geflissent-
lich erwehrt. 3 Erst viel spiiter dringt Heine auch zu Hegels philoso-
phischer Konzeption der Musik durch, auf sehr merkwiirdigen Um-
wegen: sie fiihren, iiber eine Apologie, zur Verurteilung des musikali-
schen Phinomens.
Der friihe Glaube Heines an eine, an der Gegenwart sich regenerie-
rende, im Zeitdienst stehend "demokratische" Kunst - gegeniiber einer
der Vergangenheit zugeh6rigen "aristokratischen"4 - entspricht Hegels
oberster Forderung fiir die Kunst: daB diese niimlich dem Geist eines
Volkes den kiinstlerisch gemliien Ausdruck finde (Aesthetik II 229)
und daB sich in ihr iiberall die Gegenwviirtigkeit des Geistes kundgebe
(Aesthetik II 235).- Dieser Forderung kann nun aber, nach Hegel, die
Musik unter allen Kiinsten am wenigsten nachkommen. Die gegenstands-
lose Innerlichkeit ihrer Natur beschr.inkt die Aufgaben der Musik darauf,
"die Innerlichkeit dem Innern fafbar zu machen" (Aesthetik III v43).
Die Musik bleibt demnach ganz im Subjektiven - oder wie Goethe
sagen wiirde: im "Dumpfen" stecken; sie entbehrt jedes objektiven In-
halts, ist nur "Spiel mit Seelenstimmungen." Erinnert man sich in diesem
Zusammenhang daran, daB Hegel den Umgang mit eigenen Stimmungen
als "Unzucht mit sich selbst" empfand, 5 so ist damit die fragwiirdige
Rolle, welche die Musik in Hegels System der Kiinste spielt, genugsam
gekennzeichnet. Nur durch den Tropfen Gift, den Hegel darein mischt,
unterscheidet sich eigentlich sein Begriff der Musik von der romanti-
schen Musik-Auffassung. Diese Beziehungen sind wichtig fiir unsere
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
344 Monatshefte
Untersuchung. Hegel untersch
vom "ganz idealischen Wesen
der Musik als "letzter Geister
mantikern fal3t er die Tonkuns
aber eben als solche irritiert sie ihn.
Wenden wir uns, ehe wir Hegels und Heines Musikanschauung
nebeneinanderhalten, der Bedeutung zu, welche der Musik in Heines
Werk zukommt, seinem essayistisch-journalistischen wie seinem dich-
terischen. Schon in den friihen Berichten iiber das Berliner Kulturleben
(HE VII, 176 ft. u. 560 ft.) zeigt Heine sein Interesse for den Musik-
betrieb seiner Zeit, wenn auch dort noch (ganz nach Art der damals
iiblichen "Kunstbriefe") 8 nur in oberflichlicher Weise. Tiefschiirfen-
dere Betrachtungen zur Musik finden sich in dem Aufsitzchen iiber
den Liederkomponisten Albert Methfessel (HE VII, 222). Einen philo-
sophischen Standpunkt bezieht Heine als Musikkritiker erstmalig im 9.
Brief "iiber die franz6sische Biihne" (HE IV, 540 ff.): hier wird zum
ersten Mal zwischen der Musik als Phanomen und der Realitit des
Musiklebens unterschieden. Dasselbe geschieht dann auch wiederholt
in den Berichten iiber "die musikalische Saison," welche Heine nach I840
regelmiBig einmal jihrlich fiir die Augsburger Allgemeine Zeitung
liefert.
Wie fiir Hegel so fiir Heine ist die Musik ein Erbstiick von den
Romantikern; aber jedenfalls der junge Heine verwaltet sein Erbe liebe-
voller. Deshalb "singt und klingt" es so gerne, besonders in seiner frii-
hen Lyrik.9 In Heines Prosadichtungen sind Musikbeschreibungen ein
wichtiges Mittel zur Herstellung traumhaft-dSimmriger Stimmungen. 1o
Ein romantischer Zug in Heines Musikschriftstellerei ist die Neigung
zur metaphorischen Darstellung der Musik ~' und zur Unterschiebung
phantastischer "Programme" in der Schilderung musikalischer Eindriik-
ke. 12 Verwunderlich ist es nur, wie lange Heine, in seiner philosophi-
schen Auseinandersetzung mit der Musik, allen romantischen Theorien
aus dem Wege ging.
Das Schwergewicht der Musikkritik Heines - wie der Musikkritik
seiner Zeit im Allgemeinen - fiillt auf die Opernkritik; und diese steht
noch weitgehend im Zeichen des Wettstreits zwischen italienischer und
deutscher Oper. In diesem Sinne gliedert sich Heines Stellung zur zeit-
gen6ssischen Musik wesentlich in drei Entwicklungsphasen: in der ersten
Phase steht Heine noch ganz auf der Seite all dessen, was ihn "deutsch"
diinkt - oder: alles, was ihn gut diinkt, scheint ihm "deutsch." 13 Die
zweite Phase beginnt I828, mit der Entdeckung Italiens als der eigent-
lichen "Heimat der Musik." '4 Die dritte Phase wird gekennzeichnet
durch Heines Wiederentdeckung der deutschen Oper; sie beginnt 1836
mit Heines Bekenntnis zu Meyerbeer (HE VII, 301), und endet ein
Jahrzehnt spiter mit seiner Abkehr von Meyerbeer. 15
In allen drei Phasen aber ist es Heine um die "Volkstiimlichkeit"
der Musik zu tun. Der junge Heine preist die "deutschen" Melodien
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Heine und Hegel 345
Methfessels, weil "sie sich Eingang bei de
VII, 222). Und mit der Volksverbundenhe
hat es noch eine andere Bewandtnis: "Dem
ist ja das Sprechen verboten, und es darf nur
seines Herzens kundgeben" (HE III, 251). A
sehen, wenn er schon nach der italienisch
merkt: "die Italiener miissen sich jetzt wiede
Aber Heine geht noch weiter: er begreift,
nach 'Genua," nicht nur den Enthusiasmus de
kunst, sondern auch die Kunst selbst als getar
Die "staatsgeffihrlichen Triller" oder "revolu
welche in diesem Sinne Heine aus den harmlosen italienischen Melodien
herausliest (HE III, 251), werden vielleicht weniger niirrisch erscheinen,
denkt man an Verdi und dessen Tribunat. 17 _ Noch in den "Florenti-
nischen Niichten" meint Heine, einzig in Italien sei "die Musik" ganz
eigentlich "Volk geworden," wiihrend "bei uns im Norden" sie nur
durch Individuen repriisentiert sei (HE IV, 334). Diese Betrachtungen
stehen nun freilich in direktestem Widerspruch zu Heines Auffassung
der italienischen Musik in der dritten Phase seines Musikerlebnisses. Und
eben dieser Widerspruch zeigt uns, in welchem Mal3e Heines musikali-
sche Urteile und Deutungen soziologisch orientiert sind: Heine lernt
in Paris die italienische Oper als Sammelplatz einer absterbend-aristokra-
tischen, genuBsiichtigen Gesellschaft kennen; und diesem neuen sozialen
Rahmen wird nun auch Heines Auffassung der italienischen Musik ange-
palt. Er liefert, in diesem Zusammenhang, eine eigentiimliche allegorische
Deutung der musikalischen Struktur: der melodiebetonte homophone
Stil der Italiener, besonders Rossinis, erscheint Heine jetzt als Ausdruck
eines "isolierten Gefiihls" und daher als charakteristisch fiir eine ver-
gangene Epoche, gegeniiber dem harmonischen Sil der Deutschen, be-
sonders Meyerbeer, wo Heine jetzt den Ausdruck eines "gesellschaftlich
modernen Empfindens" erblickt (HE IV, 542-3 u. 55i). Er ist in der
Acad6mie Royale Zeuge der Massenwirkungen der Meyerbeerschen
Opern gewesen:
Meyerbeers Musik ist mehr sozial als individuell; die dankbare Ge-
genwart, die ihre inneren und iiuleren Fehden, ihren Gemiitszwie-
spalt und ihren Willenskampf, ihre Not und ihre Hoffnung in seiner
Musik wiederfindet, feiert ihre eigene Leidenschaft und Begeisterung,
wihrend sie dem grol3en Maestro applaudiert . . . In dem Strome
der harmonischen Massen verklingen, ja ersdiufen die Melodien,
wie die besonderen Empfindungen des einzelnen Menschen unter-
gehen in dem Gesamtgefiihl eines ganzen Volkes. (HE IV 542-3)
Wir diirfen an diesem Punkt unser Thema, Heine und Hegel, wie-
der aufgreifen: Meyerbeers Musik entspricht Hegels oberster Forde-
rung, da3 die Kunst "dem Geist eines Volkes den kiinstlerisch gemli3en
Ausdruck finde" und daB sich in ihr "iiberall die Gegenwirtigkeit des
Geistes kundgebe." Heine hat also alle Bedenken Hegels, ob und wie-
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
346 Monatshdefte
weit iiberhaupt die Tonkunst dieser A
und er hat, im Widerspruch zu Hegel
Hegelschen Kunstideal gleichgeschal
schrittenen Phasen seines Musikerlebnisses lassen sich in diesem Lichte
verstehen: Ausgangspunkt war ein (noch stark Herderschem Geiste
verhafteter) Begriff des "Volkstiimlichen" in der friihen Stellungnahme
(1823) fiir die schlichte Volkskunst eines Methfessel. Eine neue Fiirbung
erhielt dieser Begriff in der politisch-aktivistischen Deutung der italieni-
schen Volks-Oper (i828): Heines Auffassung der italienischen Musik
als Ferment der gesellschaftlichen VerLinderung bedeutete einen entschei-
denden Schritt in der Anpassung der Musik an das Hegelsche Gesetz,
wenn dabei auch ein persiflierender Oberton freilich wohl kaum ent-
gehen konnte. Ein solcher Oberton fehlt nun aber durchaus in Heines
Meyerbeerbild, seiner Darstellung (1837) der Oper Meyerbeers, in ihrer
Wechselbeziehung zur "dankbaren Gegenwart," als Ausdruck des "Ge-
samtgefiihls eines ganzen Volkes." - Und zwar spricht Meyerbeer, fiir
Heine, nicht nur die Sprache "des Volkes" sondern "der V61ker." Seine
Sendung ist es zwischen diesen zu vermitteln - ja:
... durch ihre Universalsprache ist die Musik mehr als jede an-
dere Kunst geeignet zu solcher Vermittlung, und Meyerbeer konnte
sich daher ein Weltpublikum bilden, das trotz aller nazionaler Ver-
schiedenheiten sich versteht und begreift. Wir bemerken hier eine
der wunderbarsten Iniziazionen die der groBen Volkerverbriiderung,
der eigentlichen Aufgabe unseres Zeitalters, vorangehen muB. Der-
gleichen Iniziazionen waren von jeher der geheime Zweck aller Er-
denthaten des Genius, namentlich des deutschen Genius, dessen
kosmopolitische Richtung sich immer vorherrschend zeigte. 18s
Als der "groBen V61kerverbriiderung" vorangehende "Iniziazion" ist
die Musik an die grol3e "demokratische" Kunst-Bewegung angeschlossen;
sie ist nicht linger eine "rein romantische Kunst."
Heines Korrektur Hegels in der Auffassung des musikalischen Phli-
nomens hat in Deutschland Schule gemacht. In Schumanns Neuer Zeit-
schrift fiir Musik, wo Heines Musikberichte gelegentlich abgedruckt,
paraphrasiert und eifrig diskutiert wurden, 's erscheint zuerst 1842 ein
erbitterter Protest gegen die wenig ehrenvolle Rolle der Musik in Hegels
(nur wenige Jahre zuvor erschienenen) "Vorlesungen iiber Aesthetik."
Was bei Heine noch ungesagt blieb, wird hier voll ausgesprochen:
Manche Aul3erungen Hegels iiber Charakter, Inhalt, Bestimmung
der Musik beruhen deutlich auf Mil3verstindnissen. Und wenn er
auch den Weg der Wahrheit, den einzig richtigen, gefunden hat,
so schliel3t diese GewiBheit doch nicht die Mdglichkeit menschlicher
Irrtiimer im Einzelnen aus, und seine eigenen Gestlindnisse iiber
mangelhafte Kenntnis gewisser Kunstzweige bestiitigen das selbst
in den Augen seiner eifrigsten Anhinger. 20
Hegel, so sieht man es, habe der Musik ihren allgemeinen Charakter,"
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Heine und Hegel 347
ihre "Gedankenleere," die "Unbestimmtheit i
und so gelte es denn die Musik mit neuen "In
Gedanke wird einige Jahre spiter in der N
Hegels Name fillt dabei kaum noch. DaB e
terzeichneten um einen feurigen Jung-Hegel
heimnis. 21 Er will die Musik endlich ihrem "triumerischen Stilleben
entreiBen," in welchem sie das Volk "einschliifert und politisch untaug-
lich macht," und ihr einen "neuen Inhalt" geben; dieser muB, anstatt sich
kraftlos von der Wirklichkeit abzuwenden, in "Sympathie mit dem
Tagesleben" stehen. Die Tonkunst kann "Kraft und Frische nur aus
den Ideen und Bestrebungen der Neuzeit entnehmen." Der Musik wird
nun die Tagesdichtung als gutes Beispiel vorgehalten: besser mit der
Zekit zu leben und mit ihr voriibergehende Werke zu produzieren. An
Stelle eines "aristokratischen" Aesthetizismus ("GenuBsucht, Egoismus,
Schwelgen in Idealen, ohne damit der wirklichen Welt niiher zu treten"),
driicke die Musik "demokratischen" Geist aus, "daB die Stimmungen
des Kiinstlers diejenigen seien, . . . welche das ganze Volk bewegen." 22
Unser Referent bekiimpft Hegel mit seinen eigenen Waffen: sein Ret-
tungsversuch der Musik aus den Armen der Romantik bedeutet Kritik
an Hegels Musikiisthetik unter Berufung auf seine allgemeine Kunstlehre
und - kaum bedarf dies eines Hinweises - unter Verwendung Heine-
scher Terminologie.
Aber Heine war inzwischen andere Wege gegangen. Schon in der
"Romantischen Schule" war die Auseinandersetzung mit dem "aristokra-
tischen" und "demokratischen" Kunstprinzip durchaus nicht mehr so ein-
deutig zugunsten des letzteren verlaufen. Im 9. Brief "iiber die franzi5-
siche Biihne" erhlilt der Kiinstlerkonflikt nun schiirfste Formulierung;
und zwar entwickelt ihn Heine hier aus den verschiedenen, einander
scheinbar widersprechenden Tendenzen seines musikalischen Geschmacks.
Dabei unterlaufen Formulierungen iiber das Wesen der Musik, mit denen
Heine sich Hegels Aesthetik von einer ganz neuen Seite nihert.
Heine hat in diesem Brief seine Hochachtung fiir die "soziale" Kunst
Meyerbeers ausgesprochen; gleichzeitig aber erkliirt er seine "Sympathie"
- und das ist mehr - fiir die musikalische Idylle Rossinis. Heine hat seine
Grundbegriffe (demokratisch-aristokratisch, klassisch-romantisch, sensuali-
stisch-spiritualistisch, realistisch-idealistisch) zu verschiedenen Zeiten ver-
schieden gebraucht. Im 9. Brief "iiber die franzdsische Biihne" geht es
ihm gleichzeitig um die Gegensditze "aristokratisch"-"demokratisch" und
"sensualistisch"-"spiritualistisch"; und zur gegenseitigen Versohnung der
beiden letzteren Begriffe bietet sich Heine die Musik: "Sie steht zwischen
Gedanken und Erscheinung; als diimmernde Vermittlerin steht sie zwi-
schen Geist und Materie; sie ist beiden verwandt und doch von beiden
verschieden: sie ist Geist, aber Geist, welcher eines ZeitmaBes bedarf;
sie ist Materie, aber Materie, die des Raumes entbehren kann" (HE IV,
540).
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
348 Monatshefte
Der Zusammenhang mit Hegel
Bestimmung der Kunst als "in d
telbaren Sinnlichkeit einer Seits
(Aesthetik I, "Einleitung," 67). W
den der Dialektik, das Wesen d
Wesen der Kunst angepal3t. Ei
Musik-Aesthetik aber bedeutet dabei die vertinderte Rolle der italieni-
schen Musik. Heine, da die "staatsgeffihrlichen Triller" der italienischen
Oper erst einmal in Vergessenheit geraten sind, betont nun den idyllisch-
lieblichen Charakter der italienischen Musik; aber er entdeckt auch
gleichzeitig "Tiefe" unter den "Blumen" (HE VI, 306; vgl. HE III, 250)
- der Ausgleich zwischen Geistig-Sinnlichem scheint sich nun also fiir
Heine vorziiglich in der italienischen Musik zu verk6rpern. Und eben
in dieser Anschauung trifft Heine sich mit Hegel.
Hegel hat seine Kritik am Wesen der Musik im Allgemeinen von
seiner Kritik an der romantischen Musik im Speziellen nie ganz zu tren-
nen gewuBt: er kann sein Verstlindnis des musikalischen Phinomens am
besten an den musikalischen Romantikern demonstrieren. Und was er
dort, insbesondere an Deutschen wie Weber, auszusetzen hat, ist die
heftige Unmittelbarkeit des Ausdrucks - das "Herausschreien des
Schmerzes," die "abstrakte Trostlosigkeit," also das (berwiegen des
"Charakteristischen" (Expressiven) gegeniiber dem "Melodischen" (Schi-
nen) (Aesthetik I, 220, 221; III, 205-206). Zu solch deutschen Tenden-
zen erblickt Hegel in der italienischen Musik eine heilsame Gegenkraft;
und als solche stellt er die italienische "Sch6nheit, die wie Sinnlichkeit
aussieht," gegen die deutsche Musik in Vorteil: "Die Gegner verschreien
namentlich Rossini's Musik als einen leeren Ohrenkitzel, lebt man sich
aber niiher in ihre Melodieen hinein, so ist diese Musik im Gegentheil
hi6chst gefiihlvoll, geistreich, und eindringend fiir Gemiith und Herz,
wenn sie sich auch nicht auf die Art der Charakteristik einll3t, wie sie
besonders dem strengen deutschen musikalischen Verstande beliebt"
(Aesthetik III, 207). Heine hat dasselbe hiibscher gesagt, wenn er Ros-
sini um "Verzeihung" bittet fiir jene deutschen "Landsleute," welche
die "Tiefe" in Rossinis Musik nicht slihen, da sie "mit Rosen bedeckt"
sei (HE III, 250). Noch deutlicher formuliert Heine diese Auffassung
in einer Besprechung von Rossinis "Stabat": "das war der naivste Aus-
druck des tiefsinnigsten Gedankens, und die herablassend kindliche Form
verhinderte eben, daB der Inhalt vernichtend auf unser Gemiit wirkte,
oder sich selbst vernichtete" (HE VI, 306). Dieser Passus ist aber noch
in anderer Hinsicht wichtig: Er enthilt eine Andeutung von Schaudern
vor dem allzu unmittelbaren "Herausschreien des Schmerzes," den Hegel
an der romantischen Musik beanstandete - ein Schaudern, diirfte man
denn wohil sagen, vor dem Romantischen in der Musik.
Die letzten dreiBiger und ersten vierziger Jahre gelten gemeinhin
als die Zeit der Riickkehr Heines, als Kunstkritiker, von "einer revolu-
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Heine und Hegel 349
tioniren (als einer iiber die Aesthetik hinausg
zerst6renden) Einstellung" zu iilteren "aest
Diese Entwicklung bedeutet in vielen Hin
Hegel; aber sie bedeutet auch eine Revisio
Heines System der Kiinste, welche zur end
Hegels Musikaesthetik fiihrt.
Heines Glaube an eine, die Erfiillung der
f6rdernde Volkskunst ist erschiittert: im ehrlichen Volks-Knecht er-
kennt er zusehends den unehrlichen Erfolgs-Knecht. Das ist auch ge-
meint, wenn, was Heine friiher an Meyerbeer als musikalischer Ausdruck
"menschheitlicher Bewegtheit" galt (HE IV, 551), ihm 1847 nur noch
ein "prunkvoller Mantel" ist, unter dem die "diirftige Prosa der Meyer-
beerschen Art sich verbirgt." 24 Heine distanziert sich von Meyerbeer
wie von Gutzkow oder anderen Kiinstler-Demagogen.
Man hiitte vielleicht erwarten sollen, daB Heines Abkehr von dem
"Gegenwarts"-freudigen Meyerbeer durch zunehmende Sympathie fiir
die weltabgewandteren musikalischen Romantiker kompensiert worden
wiire. Dem ist nun freilich nicht so; dennoch aber nehmen sie mehr
und mehr Raum ein in Heines Musikerlebnis - bis sie dieses schlieBl1ich
ganz auszufiillen und zu beherrschen scheinen: Eben damit vollzieht
sich die bereits angedeutete Veriinderung in Heines philosophischer Kon-
zeption des musikalischen Phainomens. Und gleichzeitig nimmt seine
pers6nliche Beziehung zur Musik eine Wendung ins Feindselige: end-
lich wird
S. . auch zuwider ihm
die Musik, das edle Ungetiim. (HE II, 199)
Schon 1837 hat Heine, ziemlich freudlos, mit Liszt und Berlioz
Kontakt genommen: er bezeichnet das Dioskurenpaar der Romantik als
"die merkwiirdigsten, nicht die sch6nsten, nicht die erfreulichsten" Er-
scheinungen der Pariser musikalischen Welt (HE IV, 556). Seine Ab-
neigung gegen die Heftigkeit der Berliozischen Dynamik hat er sich nie
freundschaftlich ausreden lassen. Und wenn Liszt "nicht selten allzu toll
iiber die elfenbeinernen Tasten . . . stiirmt," so fiihlt Heine sich bald
"zugleich belingstigt und beseligt . . . aber doch noch mehr being-
stigt" (HE IV, 559). Die "Belingstigung" nimmt iiberhand, da Heine
nach I840 Beethovens spiites Klavierwerk durch Liszt kennenlernt. Dies-
mal wird Liszt von Heine als einer der merkwiirdigsten Repriisentanten
nicht etwa nur der Pariser musikalischen Welt sondern "der Musik"
schlechthin vorgestellt (HE VI, 559 - Lesarten zu 260). Und von Beet-
hoven heif3t es:
Dieser Componist mu3 in der That dem Geschmack eines Liszt am
meisten zusagen. Namentlich Beethoven treibt die spiritualistische
Kunst bis zu jener t6nenden Agonie der Erscheinungswelt, bis zu
jener Vernichtung der Natur, die rmich mit einem Grauen erfillt,
das ich nicht verhehlen mag, obgleich meine Freunde dariiber den
Kopf schtitteln. Fir mich ist es ein sehr bedeutungsvoller Umstand,
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
350 Monatshefte
daB Beethoven am Ende seine
sichtbare Tonwelt keine klingen
Tone waren nur noch Erinner
schollener Kliinge, nur seine
Stirne ein unheimliches Tote
Heine gibt sich selten so deutlich
ein romantischer Kritiker der R
Spiel als authentisch akzeptiert
romantischen Beethoven-Auffa
Erlebnis scheinen sich kaum voneinander trennen zu lassen.25 Man
vergleiche nun aber einmal Heines Beethoven-Bild mit einer wirklich
von Herzen romantischen Beethoven-Darstellung wie z.B. derjenfigen
E. T. A. Hoffmanns (XII, 16-17): ihnlich wie fiir Heine so auch fiir
Hoffmann bewegt Beethovens Musik alle "Hebel der Furcht, des Schau-
ers, des Entsetzens, des Schmerzes"; aber wo Hoffmann "holde Geister-
stimmen" h6rt, da sieht Heine nur noch "Gespenster verschollener
Kliinge"; wo Hoffmann sich als "entziickter Geisterseher" bekennt,
empfindet Heine nur "Grauen." Auch fiir Hoffmann wirft Beethovens
Musik "Riesenschatten," "die uns vernichten, aber nicht den Schmerz
der unendlichen Sehnsucht." Heine erblickt in ihr die villlige "Ver-
nichtung der Natur." - Man hat, nicht zu Unrecht, in dem von Heine
geschilderten Beethoven selbst Hoffmannsche Ziige erkannt: und zwar
ist es nicht einzig das "Totenmal" des Beethovenschen Sp~itwerkes, das
an Hoffmanns "Totenlarve" erinnert. 26
Aber mehr noch: nicht nur Heines Beethoven-, Liszt- und Hoff-
mann-Bilder fliel3en ineinander; sein Erlebnis der Romantik, der musika-
lischen Romantik und der Musik iiberhaupt. Heine ist an dem Punkt
angelangt, wo er, gleich Hegel, das eine vom anderen kaum noch zu
trennen weiB: Beethoven treibt die "spiritualistische Kunst" nur auf
die Spitze - das heift: die Musik, deren merkwiirdigster "Reprisentant"
Liszt ist, steht nicht liinger "als Vermittlerin zwischen Geist und Ma-
terie," sondern sie geh6rt nun ganz dem Geisterreich zu, ist "letzter
Geisterhauch." Zu Anfang desselben Aufsatzes hat Heine das deutlich
gemacht:
Mit der allmiihlichen Vergeistigung des Menschengeschlechts hal-
ten auch die Kiinste ebenmliiig Schritt. In der friihesten Periode
multe notwendigerweise die Architektur alleinig hervortreten, die
unbewul3te rohe Gr6oie massenhaft verherrlichend, wie wir's z.B.
sehen bei den Agyptiern. Spiterhin erblicken wir bei den Griechen
die Bliitezeit der Bildhauerkunst, und diese bekundet schon eine
iussere Bewliltigung der Materie: der Geist meilelte eine ahnende
Sinnigkeit in den Stein. Aber der Geist fand dennoch den Stein
viel zu hart fiir seine steigenden Offenbarungsbediirfnisse, und er
wiihlte die Farbe, den bunten Schatten, um eine verkliirte und dilm-
mernde Welt des Liebens und Leidens darzustellen. Da entstand die
grol3e Periode der Malerei, die am Ende des Mittelalters sich glin-
zend entfaltete. Mit der Ausbildung des Bewultseinlebens schwin-
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Heine und Hegel 351
det bei den Menschen alle plastische Be
sogar der Farbensinn, der doch immer
gebunden ist, und die gesteigerte Spirit
dankentum, greift nach Kliingen und Tbn
schwinglichkeit auszudriicken, die vielleic
die Auflosung der ganzen materiellen Wel
das letzte Wort der Kunst, wie der To
bens. (HE VI, 259)
Heine hat sich in die romantische Auffassun
mit den Augen Hegels, dessen System der
phrasiert wurde.
Hegels Anordnung der Kiinste wird, wi
relative Vergeistigung der Materie durch
"schdne Architektur" steht an erster Stelle,
Materielle selbst ist "in seiner unmittelbare
nisch schwere Masse" (Aesthetik I, 124 -
wulte, rohe Gr6Be massenhaft verherrli
sodann "schligt . . . der Blitz der Individ
und das "geistige Innere . . . wohnt sich i
deren ul3eres Material . . . hinein" (I,
"der Geist meiaelte eine ahnende Sinnigk
"die gediegene Einheit in sich des Gottes
sich in die Vielhekit vereinzelter Innerlichk
menschlichen Empfindens, Wollens und U
selber Gegenstand der kiinstlerischen Dar
gemilies Material "bietet die Farbe" (I, 12
wihlte die Farbe . . . um eine . . . Welt
darzustellen"). - Ihren ersten H6hepunkt e
keit und Beseelung der Materie" in der Musi
Klingen das Gemiith mit der ganzen Ska
Leidenschaften klingen und verklingen"
gesetzte Sinnliche, dessen abstrakte Sichtb
umgewandelt hat, indem der Ton das Idee
fangenheit im Materiellen losl6st" (I, I29
die gesteigerte Spiritualidt, das abstrakte
Klaingen . . . um eine lallende Yberschwi
die vielleicht nichts anderes ist als die Aufl6
Welt").
Hegels und Heines philosophische Auseinandersetzung mit dem
musikalischen Phinomen ist ein nicht leicht zu iiberspringendes Kapitel
in der Geschichte vom Siindenfall der Romantik. Auf Heines (noch
mit Hegel ringende) Einbeziehung der Musik in den funktionell-sozialen
Begriff der Kunst darf die materialistische Aesthetik, darf die Sowjet-
Aesthetik sich mit Fug berufen. Seine (mit Hegel ausgesdhnte) Auf-
fassung der Musik als wesentlich romantisches Phinomen - und dem-
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
352 Monatshefte
nach seine Verurteilung der Mu
(HE VI, 629 - Lesarten zu 447)
Kritik an der Romantik: Fiir
des Romantischen "Oberwindun
Heine und Hegel, einen "Spitlin
III). - Heine hat die Romantik
in Nietzsches Sinn, gerade in sei
Und, wie immer, iiberwindet
Kritik, alle seine Aul3erungen il
einziges schallendes Geltichte
seiner Zeit, eilt er selbst Nietz
iiber das Musikalisch-Dionysis
kritik") 28 ist forciert. Noch T
pathetisch an der "Musik" zugru
Persiflage des Musikalisch-Diony
zuriick.
1 Vgl. H. H. Houben, Gesprdiche mit
2 Dazu Heinrich Heine Briefe, Hrsg.
Brief vom r.XII.23 an Moser (dort wird
sungen iiber Religionsphilosophie auch d
Brief vom May 1823 an Moser (hier wir
1822 in Hegels Vorlesungen iiber Aesthe
3 G. W. F. Hegel, Siimtliche Werke
125-219. Aus der Gestalt, in der mehr
seinem Schiiler H. G. Hotho ver6ffentli
ermitteln, ob die Musik in den Berliner
einnahm, wie dies dann in der (aus ve
Buchausgabe der Fall ist.
4 Andeutungsweise schon im "Buch
Hrsg. E. Elster (Leipzig/Wien 1887-90;
UnmiBverstindlicher in der Besprechun
ft., und in "Franz6sische Maler," IV, bes
50. Paggeler, Hegels Kritik der Roma
SA. W. Schlegel nach W. Reich, Mu
7Aesthetik II, 3. Abschnitt ("Die ro
E. T. A. Hoffmann, Dichtungen und
romantischste aller Kiinste, fast m6chte
schon bei Wackenroder, Novalis, Sch
Hoffmanns Musikalische Anschauungen,
Die Philosophie der Musik von Kant b
82.
8 E. Meunier ii H. Jessen, Das deutsche Feuilleton (Berlin 1931), 75.
9 B. Fairley, Heimnrich Heine (Oxford 1954), vgl. bes. das Kapitel "Music and Dance,"
24.
loSo in der "Reise von Miinchen nach Genua," HE III, bes. 248 ff., oder den
"Florentinischen Niichten," HE IV, bes. 332 ff.
11 Dazu W. Siebert, "Heinrich Heine's Beziebungen zu E. T. A. Hoffmann (Marburg
1908), 72-83 ("Musik in metaphorischer Darstellung," "musikalische Visionen," "musi-
kalische Metaphern").
12 Vgl. z.B. schon das Gedicht "An eine Singerin," HE I, 5i, oder Heines Schilderung
von Liszts Spiel, HE IV, 559, oder Paganinis Spiel, HE IV, 344 if.
13 HE VII, 575 (1822Z, iiber Bernhard Kleins "Dido") "Diese Oper soil . . . die
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Heine und Hegel 353
wunderbarsten Sch6nheiten enthalten, und ein gen
Kleins Musik ist ganz original." Am deutlichsten wird
tung in dem Aufsatz "Albert Methfessel," VII, 222z.
14 HE IV, 334. Heines friiheste Stellungnahme fiir d
in der "Reise von Miinchen nach Genua" (1828).
15 Heines friihester scharfer Angriff auf Meyer
beginnend "Die zwei Foscari von Verdi," Neudruck in W
Literaturgeschichte, 1958, 86-87. Alle anderen Spitz
im Buch "Lutezia" in friihere Aufsitze hineinflocht,
Arbeit "Heinrich Heines Musikkritiken," Dissertatio
'6Nach F. Stoessinger, Heinrich Heine - Mein ve
1950), 576-577.
17 Schon Nabucco (1842) konnte politisch interpretie
Zum Barden des Risorgimento wurde aber Verdi erst m
(1849).
18 Die oben zitierte Stelle wurde von dem Redakteur der Alilgemeinen Zeitung nur
stark beschnitten gebracht und fehlt daher in den Lesarten der bisherigen Gesamtausgaben.
Wir verdanken Einblick in die Handschrift (Ms 5511i42) dem Institut fiir Marxismus-
Leninismus Berlin.
19 Siehe den Teilabdruck mit Kommentar von Heines Aufsatz "Meyerbeers Huge-
notten" in Neue Zeitschrift fiir Musik i8.III.x836, Bd. 4, 98. In derselben Zeitschrift
8.-I8.V.38, Bd. 8, Nr. 37-40, kritische Auseinandersetzung (von G. Wedel) mit dem
9. Brief "iiber die franz6sische Biihne" und 3. & Io.VII.38, Bd. 9, Nr. i & 3, Aus-
einandersetzung mit dem io. Brief.
20 Neue Zeitschrift fiir Musik 1842, Bd. 17, Nr. 7-16, gez. Ed Kriiger.
21 F. Brendel; iiber seine ideologischen Tendenzen vgl. A. Schering, "Aus der
musikalischen Kritik in Deutschland," Jahrbuch der Musik-Bibliothek Peters fiir 1928
(Leipzig 1929), 20zo.
22 Neue Zeitschrift fiir Musik 1848-49; "Fragen der Zeit," Bd. 28, 18I-184; Bd. 29,
rox-Io0; 213-216; Bd. 30, 221-224; gez. F. Brendel
23F. Gowa, "Heinrich Heines Aesthetik," Dissertation Miinchen 1923. (Auszug
aus der Dissertation im Heine Archiv Diisseldorf) Kap. II "Entwicklung."
24 Weimarer Beitrige, Zeitschrift fiir Literaturgeschichte, 1958, 86.
25 Was Heine in der oben zitierten "Lutezia"-Fassung von Beethoven sagt, bemerkt
er in der Urfassung desselben Artikels (HE VI, Lesarten zu 260) von Liszts Spiel ganz
unabhingig von Beethoven: "Ich spreche von Franz Liszt, dem genialen Pianisten, dessen
Spiel mir manchmal vorkommt wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt."
26 "Romantische Schule," HE V, 3o0: Hoffmann erblickt in der Natur nur seine
eigene "Totenlarve." - Zu weiteren leitmotivischen Verkniipfungen zwischen Heines
Hoffmann- und Beethoven-Bild siehe H. Uhlendahl, "Fiinf Kapitel iiber H. Heine und
E. T. A. Hoffmann, Dissertation Berlin 1919, 65.
27 E. Bertram, Nietzsche, Versuch einer Mythologie (Berlin 1919), z22.
28 Zur "Geburt der Tragbdie" (1870-71), "Versuch einer Selbstkritik" (x886).
29Vgl. W. Braun, Musil's Musicians," Monatshefte, Jan. 1960, LII (9-17), bes.
IO-I I.
This content downloaded from
134.76.3.174 on Sat, 25 Nov 2023 11:08:31 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Warum Willst Du Andre FragenDokument2 SeitenWarum Willst Du Andre FragenNatNoch keine Bewertungen
- Metamorphosen - Wilfried BrennckeDokument9 SeitenMetamorphosen - Wilfried BrennckeFriedrich Siemers100% (1)
- Wolfram Groddeck Uber Holderlin Brod Und WeinDokument4 SeitenWolfram Groddeck Uber Holderlin Brod Und Weindeutsch993Noch keine Bewertungen
- Joachim Lüdtke - Die Lautenbücher Philipp HainhofersDokument376 SeitenJoachim Lüdtke - Die Lautenbücher Philipp HainhofersAndre Nieuwlaat100% (1)
- Sound & Recording 2017-06Dokument85 SeitenSound & Recording 2017-06Ovi AngOneNoch keine Bewertungen
- Musik – Identität – Raum: Perspektiven auf die österreichische MusikgeschichteVon EverandMusik – Identität – Raum: Perspektiven auf die österreichische MusikgeschichteNoch keine Bewertungen
- Die Musik Soll Nicht Schmucken Sie SollDokument10 SeitenDie Musik Soll Nicht Schmucken Sie SollLeopoldo SianoNoch keine Bewertungen
- HeinrichheineclubDokument16 SeitenHeinrichheineclubhansNoch keine Bewertungen
- Brill Benjamin-Studien: This Content Downloaded From 80.187.72.22 On Thu, 04 Apr 2024 19:43:03 +00:00Dokument17 SeitenBrill Benjamin-Studien: This Content Downloaded From 80.187.72.22 On Thu, 04 Apr 2024 19:43:03 +00:00ERIC MONSIEURNoch keine Bewertungen
- Janina Klassen Musica Poetica + Mus Figurenlehre Produktives Misverständnis SIM-Jb - 2001-04Dokument11 SeitenJanina Klassen Musica Poetica + Mus Figurenlehre Produktives Misverständnis SIM-Jb - 2001-04Robert Hill100% (1)
- Paradestück Militärmusik: Beiträge zum Wandel staatlicher Repräsentation durch MusikVon EverandParadestück Militärmusik: Beiträge zum Wandel staatlicher Repräsentation durch MusikPeter MoormannNoch keine Bewertungen
- Musik und Subjektivität: Beiträge aus Musikwissenschaft, Musikphilosophie und kompositorischer PraxisVon EverandMusik und Subjektivität: Beiträge aus Musikwissenschaft, Musikphilosophie und kompositorischer PraxisDaniel Martin FeigeNoch keine Bewertungen
- Was aber neu ist, ist die Frage nach dem Satzbau: Die Gedichte Gottfried BennsVon EverandWas aber neu ist, ist die Frage nach dem Satzbau: Die Gedichte Gottfried BennsNoch keine Bewertungen
- Die Diskussion um den Fortschritt in der Musik unter besonderer Berücksichtigung der "Darmstädter Ferienkurse" von 1946 - 1985: Wenn die Musik den Biss verliert, besetzen die Zahnärzte die Konzertsäle. (frei nach Heiner Müller)Von EverandDie Diskussion um den Fortschritt in der Musik unter besonderer Berücksichtigung der "Darmstädter Ferienkurse" von 1946 - 1985: Wenn die Musik den Biss verliert, besetzen die Zahnärzte die Konzertsäle. (frei nach Heiner Müller)Noch keine Bewertungen
- Klang und Semantik in der Musik des 20. und 21. JahrhundertsVon EverandKlang und Semantik in der Musik des 20. und 21. JahrhundertsJörn Peter HiekelNoch keine Bewertungen
- BLIV HuelseDokument24 SeitenBLIV HuelseDaniel VissiNoch keine Bewertungen
- Jorn Peter Hiekel Christian Utz Eds LexiDokument21 SeitenJorn Peter Hiekel Christian Utz Eds LexiАнна ИглицкаяNoch keine Bewertungen
- Die Doppelte Wahrheit Von Nietzsches Tätigkeit 1870 - 1872Dokument18 SeitenDie Doppelte Wahrheit Von Nietzsches Tätigkeit 1870 - 1872hgarciaNoch keine Bewertungen
- Schopenhauerarthur HasseDokument3 SeitenSchopenhauerarthur HasseGrazia PozzutoNoch keine Bewertungen
- Holtmeier, L., Von Der Musiktheorie Zum Tonsatz, 2003Dokument25 SeitenHoltmeier, L., Von Der Musiktheorie Zum Tonsatz, 2003Henyakichi KaseinoNoch keine Bewertungen
- Wissen im Klang: Neue Wege der MusikästhetikVon EverandWissen im Klang: Neue Wege der MusikästhetikJosé GálvezNoch keine Bewertungen
- Volkslied NEU - Walter - Pichler PDFDokument41 SeitenVolkslied NEU - Walter - Pichler PDFZlatko SljivicNoch keine Bewertungen
- SCHEIT, Gerhard - Geist in Wien Auständig Und AbgängigDokument5 SeitenSCHEIT, Gerhard - Geist in Wien Auständig Und AbgängigSantiago AuatNoch keine Bewertungen
- Ums Morgenroth gefahren: Parodien, Politisches und Satire zu Bürgers LenoreVon EverandUms Morgenroth gefahren: Parodien, Politisches und Satire zu Bürgers LenoreNoch keine Bewertungen
- Beetz ExpressionismusDokument5 SeitenBeetz Expressionismussahra leesNoch keine Bewertungen
- SimonidesDokument34 SeitenSimonidesBert SchröderNoch keine Bewertungen
- Hildebrandt 1937 - Friedrich Nietzsche GedichteDokument8 SeitenHildebrandt 1937 - Friedrich Nietzsche GedichteOliver AdamNoch keine Bewertungen
- Im Laufe der Zeit: Kontinuität und Veränderung bei Hans Werner HenzeVon EverandIm Laufe der Zeit: Kontinuität und Veränderung bei Hans Werner HenzeNoch keine Bewertungen
- Biblio 2Dokument14 SeitenBiblio 2ClaudioSehnemNoch keine Bewertungen
- Poetik im technischen Zeitalter: Walter Höllerer und die Entstehung des modernen LiteraturbetriebsVon EverandPoetik im technischen Zeitalter: Walter Höllerer und die Entstehung des modernen LiteraturbetriebsNoch keine Bewertungen
- RomantikDokument13 SeitenRomantikele1020Noch keine Bewertungen
- Intermedialität – Multimedialität: Literatur und Musik in Deutschland von 1900 bis heuteVon EverandIntermedialität – Multimedialität: Literatur und Musik in Deutschland von 1900 bis heuteNoch keine Bewertungen
- Johann Sebastian Bach: Der größte Komponist der Musikgeschichte: Leben und WerkVon EverandJohann Sebastian Bach: Der größte Komponist der Musikgeschichte: Leben und WerkNoch keine Bewertungen
- Petersen - Neue SachlichkeitDokument3 SeitenPetersen - Neue Sachlichkeitsahra leesNoch keine Bewertungen
- Das Dictum Des Simonides: Der Vergleich Von Dichtung Und MalereiDokument34 SeitenDas Dictum Des Simonides: Der Vergleich Von Dichtung Und MalereiMax ElskampNoch keine Bewertungen
- Fuchs Sinn Und Sound Abstract Engl DeutschDokument3 SeitenFuchs Sinn Und Sound Abstract Engl Deutschfuchs.mathiasNoch keine Bewertungen
- Polyphonie des Lebens: Zu Dietrich Bonhoeffers "Theologie der Musik"Von EverandPolyphonie des Lebens: Zu Dietrich Bonhoeffers "Theologie der Musik"Noch keine Bewertungen
- Amila Ramovic. Heiner Goebbels. Musik Konzepte 179 PDFDokument29 SeitenAmila Ramovic. Heiner Goebbels. Musik Konzepte 179 PDFAmila RamovicNoch keine Bewertungen
- Jorg, - Vor Der Klassik 1Dokument54 SeitenJorg, - Vor Der Klassik 1Pedro F.Noch keine Bewertungen
- Zwischen Den GrenzenDokument19 SeitenZwischen Den GrenzenAnonymous zzPvaL89fGNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie – Studienausgabe: Herausgegeben und ergänzt um Aufsätze, Primärbibliographie und Nachwort von Matthias Bormuth und Martin VialonVon EverandGesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie – Studienausgabe: Herausgegeben und ergänzt um Aufsätze, Primärbibliographie und Nachwort von Matthias Bormuth und Martin VialonNoch keine Bewertungen
- Bergamo 1993Dokument7 SeitenBergamo 1993caiofelipeNoch keine Bewertungen
- Ludwig Van Beethoven-A Psychiatric PerspectiveDokument10 SeitenLudwig Van Beethoven-A Psychiatric PerspectiveeriayodarasimiNoch keine Bewertungen
- Gegen die diktierte Aktualität. Wolfgang Rihm und die Schweiz: Für Wolfgang Rihm zum 60. GeburtstagVon EverandGegen die diktierte Aktualität. Wolfgang Rihm und die Schweiz: Für Wolfgang Rihm zum 60. GeburtstagNoch keine Bewertungen
- Das Wirken Böhmischer Und Mährischer Musiker in Rußland Von 1720 Bis 1914Dokument19 SeitenDas Wirken Böhmischer Und Mährischer Musiker in Rußland Von 1720 Bis 1914Pedro Henrique Souza RosaNoch keine Bewertungen
- Hölderlin Zwischen Antike Und ModerneDokument18 SeitenHölderlin Zwischen Antike Und ModernePollyanna NunesNoch keine Bewertungen
- Verstreutes zu Literatur und Kunst: Beiträge aus zwei JahrzehntenVon EverandVerstreutes zu Literatur und Kunst: Beiträge aus zwei JahrzehntenNoch keine Bewertungen
- Gethmann-Siefert, Annemarie-Die Geschichtliche Bedeutung Der Kunst Und Die Bestimmung Der KuensteDokument350 SeitenGethmann-Siefert, Annemarie-Die Geschichtliche Bedeutung Der Kunst Und Die Bestimmung Der Kuenstecmshim100% (2)
- Knjizevnost 2Dokument44 SeitenKnjizevnost 2Aleksandar TodorovicNoch keine Bewertungen
- Goldenbaum, Jean: Neue Noten Unter Neuem Himmel.Dokument323 SeitenGoldenbaum, Jean: Neue Noten Unter Neuem Himmel.ChrisNoch keine Bewertungen
- Joke FertigDokument71 SeitenJoke FertigDaniel OsthoffNoch keine Bewertungen
- Ave MariaDokument4 SeitenAve MariaChorale Jeux d'YNoch keine Bewertungen
- Jazz Workshop 2023 KursunterlagenDokument16 SeitenJazz Workshop 2023 KursunterlagenAktolga GoztasNoch keine Bewertungen
- Bel Usellin Del BoschDokument1 SeiteBel Usellin Del BoschAltfrid WeberNoch keine Bewertungen
- La Question en FrançaisDokument12 SeitenLa Question en FrançaisDaniel Delgado García100% (1)
- Spider Valve User Manual - German (Rev A)Dokument28 SeitenSpider Valve User Manual - German (Rev A)HotteNoch keine Bewertungen
- Metal Hammer 6.23Dokument110 SeitenMetal Hammer 6.23Chris BrownNoch keine Bewertungen
- Vokaldreieck HTMDokument4 SeitenVokaldreieck HTMMattNoch keine Bewertungen
- Ista El Und VerdunstDokument12 SeitenIsta El Und VerdunstMilosTrbojevicNoch keine Bewertungen
- CapricciataDokument3 SeitenCapricciataDario FurnoNoch keine Bewertungen
- Einführung Generalbass 2Dokument2 SeitenEinführung Generalbass 2whatifNoch keine Bewertungen
- Fasching in Deutschland Und in RusslandDokument13 SeitenFasching in Deutschland Und in RusslandEspañol con AnaMelikNoch keine Bewertungen
- Medley Rocio Jurado REDUCIDO Piano y VozDokument3 SeitenMedley Rocio Jurado REDUCIDO Piano y VozJose Enrique de la Vega100% (1)