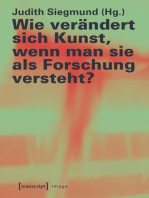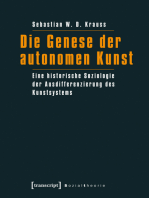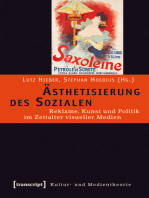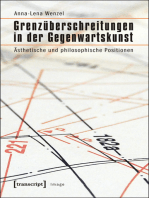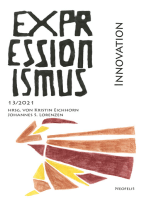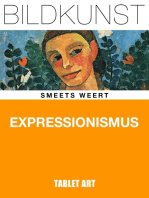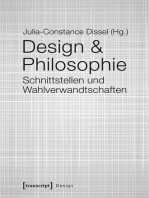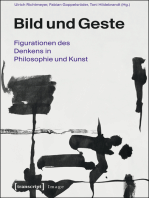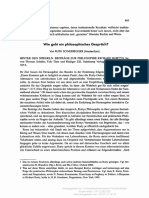Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
FEIGE, Daniel - Zwei Formen Des Sthetischen Zwei Formen Des Alltagsbezugs
Hochgeladen von
meacuerdoOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
FEIGE, Daniel - Zwei Formen Des Sthetischen Zwei Formen Des Alltagsbezugs
Hochgeladen von
meacuerdoCopyright:
Verfügbare Formate
Paragrana 26 (2017) 2 De Gruyter Verlag
Daniel Martin Feige
Zwei Formen des Ästhetischen, zwei Formen des
Alltagsbezugs
Der Beitrag zielt auf eine Unterscheidung von zwei Formen des Alltagsbezugs im Ästheti-
schen. Unter Rückgriff auf Motive vor allem der Ästhetiken Adornos und Hegels argumen-
tiert er dafür, dass wir den Alltagsbezug der Kunst vom Alltagsbezug des Designs kategori-
al unterscheiden sollten. Ist Design aufgrund der Tatsache, dass es in unserer Praxis be-
stimmte Funktionen erfüllt, von jeher auf unsere alltägliche Praxis bezogen, stellt die Kunst
einen Bruch mit dieser Praxis dar. Der Beitrag zeigt jedoch zugleich, dass daraus nicht
folgt, dass Kunst nicht auch auf unsere alltägliche Praxis rückwirken würde: Sind Kunster-
fahrungen performative Transformationen unserer selbst, so formen und bestimmen sie die
Praxis derjenigen, die sie machen.
Zu den Grundzügen der modernistischen Ästhetiken gehört der Gedanke, dass die
Kunst sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie sich im Gegensatz zum Alltägli-
chen konstituiert. Wer in einem Museum ein Gemälde betrachtet, im Theater dem
Spiel der SchauspielerInnen oder im Konzertsaal dem Spiel der MusikerInnen ru-
hig von seinem Sitzplatz aus folgt, und selbst wer nur zu Hause zu einem Roman
greift, begibt sich in Situationen, die eben nicht länger bruchlos in alltägliche Le-
bensvollzüge einzugliedern sind. Als konstitutives Moment des Begriffs der Kunst
selbst wird entsprechend verstanden, dass sie das Andere des Alltags ist. Dass in
den maßgeblichen modernistischen Ästhetiken viele Arten ästhetisch relevanter
Gegenstände und Aufführungen ausgespart geblieben sind, verwundert dann auch
nicht: In seinen wirkmächtigen Vorlesungen über die Ästhetik hat Hegel explizit
festgehalten, dass das Thema seiner Vorlesungen allein die „in ihrem Zwecke wie
in ihren Mitteln freie Kunst“ und eben nicht die „dienende Kunst“ (1986, S. 1) sei.
Und obzwar sich Kants Begriff der „anhängende[n] Schönheit“ (1974, § 16) poten-
ziell für Fragen einer Ästhetik alltäglicher Gegenstände fruchtbar machen ließe
(vgl. als Versuch etwa Forsey 2013), scheint zumindest seine Bestimmung des Äs-
thetischen als dem freien Spiel der Erkenntniskräfte aufgrund folgender Tatsache
problematisch zu sein: Eine Theorie des Ästhetischen, die am Paradigma eines
kontemplativen Verhältnisses zu den Dingen orientiert ist, ist wenig kompatibel
mit dem Gedanken, dass alltägliche Gegenstände auch ästhetische Gegenstände
sein können, denn offensichtlich sind sie zuallererst einmal Gegenstände des prak-
tischen Gebrauchs. Und der Alltag beginnt zumindest einem verbreiteten Ver-
ständnis nach dort, wo wir es mit eingespielten Handlungsmustern zu tun haben.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
16 Paragrana 26 (2017) 2
Für die Entwicklung der Künste ist spätestens seit den 1960er Jahren charakte-
ristisch, dass die These der Nicht-Alltäglichkeit von Kunst zumindest unter be-
stimmten Lesarten des Begriffs des Alltags fragwürdig geworden ist (vgl. Reben-
tisch 2015, Einleitung; mit Blick auf die Entwicklung des Theaters vgl. auch Fi-
scher-Lichte 2004, S. 31ff.; entsprechende Entwicklungen haben natürlich vielfälti-
ge Vorläufer in den künstlerischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts, so
dass in diesen bereits Momente der Entwicklung seit den 1960ern präfiguriert
sind). Wenn der Konzeptkünstler Rirkrit Tiravanija für die Ausstellungsbesucher
kocht oder die Ausstellungsbesucher sich an den aufgeschütteten Bonbons im
Rahmen einer Installation von Felix González-Torres bedienen können, scheinen
die Grenzen der modernistischen Autonomieästhetik zumindest fragwürdig gewor-
den zu sein (vgl. Bourriaud 2002). Haben nicht zuletzt die Tendenzen der Entgren-
zung der Künste in Deutschland die erfahrungstheoretische Wende in der philoso-
phischen Ästhetik angestoßen (vgl. v. a. Bubner 1994), so sind in diesem Gefolge
zugleich auch andere Bereiche als die Kunst in den Fokus gerückt und hier nicht
zuletzt der ganz alltägliche ästhetische Gegenstand (vgl. dazu etwa die Beiträge in
Küpper/Menke 2003. Es ist zudem erwähnenswert, dass der Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Ästhetik im Jahr 2008 das Thema „Ästhetik und Alltagser-
fahrung“ hatte). Aus anderen Gründen – aber vergleichbar, was die Expansionsbe-
wegungen angeht – sind in den letzten Dekaden auch in der angloamerikanischen
Ästhetik vermehrt andere Bereiche des Ästhetischen als die Kunst in den Fokus der
Aufmerksamkeit gerückt; besonders prominent sind Fragen der Alltagsästhetik, des
Designs und der Massenkultur geworden (vgl. dazu v. a. Parsons/Carlson 2008;
Saito 2010).
Zu den ästhetischen Gegenständen, die derzeit in diesen Debatten gehäuft in die
Aufmerksamkeit rücken, gehören die Gegenstände des Designs (vgl. im deutsch-
sprachigen Raum v. a. Dorschel 2003; Steinbrenner/Nida-Rümelin 2011). Anhand
ihrer lässt sich paradigmatisch studieren, was im Rahmen einer Ästhetik, die sich
ausschließlich auf kunsttheoretische Fragen beschränkt, übersehen wird: dass Äs-
thetik und eine Praxis, die letztlich mit funktionalen Gegenständen zu tun hat, sich
begrifflich nicht ausschließen, wenn man Ästhetik nicht länger nach dem Vorbild
eines kontemplativen Gegenstandsbezugs denkt. Zugleich lässt sich meines Erach-
tens anhand von Fragen einer Ästhetik des Designs gleichwohl ausweisen, dass wir
den Unterschied autonomer Kunstwerke von dienenden ästhetischen Gegenständen
intakt halten sollten: Design und Kunst sind nicht derart der Ästhetik zuzuschlagen,
dass wir zunächst in abstrakter Weise das Ästhetische definieren könnten und dann
beide im Sinne einer differentia specifica als Unterkategorien desselben begreifen.
Vielmehr sollten wir das Ästhetische als sich historisch entwickelnde Pluralität von
Praxisformen verstehen (vgl. dazu ausführlicher Feige 2018, Kap. 4).
Im ersten Teil meiner Überlegungen (I) werde ich entsprechend einen Vor-
schlag unterbreiten, was wir unter Ästhetik verstehen sollten, wenn sie es nicht al-
lein mit Kunstwerken zu tun hat, sondern auch mit Designgegenständen – d. h. ich
möchte vorschlagen, wie wir Kunst und Design begrifflich auseinanderhalten kön-
nen. Im kürzeren zweiten Teil meiner Überlegungen (II) werde ich daraufhin dafür
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
Daniel Martin Feige, Zwei Formen des Ästhetischen 17
argumentieren, zwei Formen der Alltäglichkeit zu unterscheiden, die sich jeweils
aus meiner Analyse der Kunst und des Designs ergeben: Wird im Design das Äs-
thetische dahingehend selbst praktisch, dass es mit Fragen des alltäglichen Gebrau-
chens von Gegenständen zu tun hat, ist die Kunst insofern eine andere Form der
Praxis, als sie Praktiken auf Seiten der Rezipierenden bzw. Partizipierenden an-
stößt, die aber eben nicht unumwunden auf unseren Alltag umzumünzen sind.
Noch im Fall partizipativer Kunst und solcher Kunstwerke, die in der Tradition von
Beuys’ Konzept der sozialen Plastik dieses sehr wörtlich fortzuführen scheinen, ist
es zudem so, dass entsprechende Praktiken nicht so sehr einen direkten und un-
problematischen Beitrag zur außerästhetischen Praxis darstellen, als dass sie viel-
mehr in je spezifischer Weise eine reflexive Auseinandersetzung mit der Frage des
Verhältnisses von Kunst und sonstiger Praxis sind. Anders gesagt werde ich mit
Blick auf die Kunst eine zentrale Einsicht der modernistischen Ästhetiken verteidi-
gen, die darin besteht, dass sich im Ästhetischen der Kunst eine gegenüber unserer
sonstigen Rationalität gegenwendige Rationalität ausdrückt. Indem sich die Kunst
gemessen an dem, was außerhalb ihrer Sinn heißt, durch Sinnferne auszeichnet, ar-
tikuliert sie zugleich eine bestimmte kritische Perspektive auf unsere außerästheti-
sche Rationalität. Mit Blick auf die Einbeziehung von Praktiken, die scheinbar der
Autonomie der Kunst zuwiderlaufen, möchte ich also mit Juliane Rebentisch fest-
halten, dass die Gegenwartskunst Ausdruck einer „sich kritisch selbst transformie-
renden, einer deshalb als wesentlich unvollendet zu denkenden Moderne“ (2015,
S. 20) ist. Entsprechend wäre diese Einbeziehung nicht so sehr eine Überschreitung
der modernistischen Ästhetik, als vielmehr eine Einlösung vormals an ihr noch ein-
seitiger und unverstandener Momente.
I. Zwei Formen des Ästhetischen
Der Begriff der Anwendung bzw. des Angewandten kennt mit Blick auf ästhetische
Phänomene selbst sehr verschiedene Anwendungen bzw. Verwendungen. Im vor-
liegenden Fragezusammenhang sind besonders solche Verwendungen relevant, die
ästhetischen Phänomenen einen direkten Nutzen hinsichtlich außerästhetischer
Praktiken zusprechen. Ist es angesichts von Kunstwerken nach wie vor umstritten,
ob sie tatsächlich als Kunstwerke das moralische Bewusstsein fördern oder der Er-
kenntnisgewinnung dienen können – um zwei in der Tradition vielfach diskutierte
paradigmatische Kandidaten zu nennen –, ist hinsichtlich einer anderen Art ästheti-
scher Gegenstände unstrittig, dass praktische Funktionen für sie konstitutiv sind:
Designgegenstände sind zu etwas da und sie werden als die Gegenstände, die sie
sind, durch die Zwecke individuiert, denen sie dienen. Ein Stuhl ist als Stuhl zum
Sitzen da, ein Plakat zur Verbreitung von Informationen für eine anonyme und oft
doch anhand bestimmter sozialer Kriterien ausgewählte Gruppe von BetrachterIn-
nen, intelligente Kleidung dazu da, getragen zu werden. Zwar ist es so, dass das,
was in Designklassen an Kunsthochschulen geschieht, in seinem forschenden wie
offenen Charakter mitunter ununterscheidbar von dem zu sein scheint, was in be-
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
18 Paragrana 26 (2017) 2
nachbarten Kunstklassen geschieht. Und natürlich gibt es auch Agenturen oder
Firmen, in denen offene, experimentelle und nicht schon per se auf bestimmte
Zwecke gerichtete Designprozesse praktiziert werden. All das widerspricht aber
keineswegs dem Gedanken, dass Designgegenstände selbst durch die Zwecke
individuiert werden, zu denen sie da sind. Dass der Prozess des Gestaltens kein
mechanischer und auch nicht immer ein zielgerichteter Prozess ist; dass er zumeist
einen auf habitualisierten Fähigkeiten beruhenden und dennoch auf diese nicht
rückführbaren Umgang mit konkreten Medien und Materialien meint (diese letzten
Punkte werden vor allem in den Debatten der Designforschung stark gemacht, die
meines Erachtens in weiten Teilen aber das Kind mit dem Bade ausschütten und
oftmals eine stark wissenschaftspolitische Schlagseite haben; vgl. zur Designfor-
schung u. a. Bayazit 2004), bestimmt somit nicht den Sinn des Gegenstandes derart,
dass dieser ein zweckfreier Gegenstand wäre. Mehr noch: Auch wenn der Prozess
des Gestaltens somit unzweideutig ein ästhetischer Prozess des Produzierens ist, so
folgt daraus noch nicht per se, dass Designgegenstände als Produkt solcher Prozes-
se selbst in gleichem Maße ästhetische Gegenstände sind. Denn gerade die Funkti-
onalität scheint hier der Ästhetik im Wege zu stehen.
Bevor ich dieser letzten Überlegung dezidiert widersprechen werde, zunächst
einige Bemerkungen zur Kunst; ich entwickele hier vor allem Motive, die in den
Philosophien Hegels und Adornos angelegt sind. Denn just aus dem Grunde, dass
man das Ästhetische ausgehend von der Kunst denkt, kommt es zu der Überlegung,
dass Funktionalität und Ästhetik unvereinbar sind. Auch dann, wenn Kunstwerke
vielfältige Funktionen erfüllen können, dienen sie als Kunstwerke keinen prakti-
schen Zwecken. Wenn Hegel zu Recht festgehalten hat, dass Zwecke „wie Beleh-
rung, Reinigung, Besserung, Gelderwerb, Streben nach Ruhm und Ehre [das
Kunstwerk] als solches nichts an[gehen] und [nicht] den Begriff desselben [be-
stimmen]“ (1986, S. 82), so darf diese These gleichwohl nicht derart verstanden
werden, dass Kunsterfahrungen nicht in irgendeiner Weise wertvoll für diejenigen
wären, die sie machen. Ich möchte mit Hegel vorschlagen, dass sich die Kraft der
Kunsterfahrung gegenüber praktischen Zwecken in Begriffen einer spezifisch ver-
körperten Reflexivität erläutern lässt (vgl. dazu ausführlicher Bertram 2005; Feige
2012). Kunst als Reflexionsgeschehen zu begreifen heißt, dass sie just deshalb ge-
genüber praktischen Zwecken autonom ist, weil ihre Erfahrung in einer Reflexion
auf solche Zwecke besteht. Das ist natürlich nicht so gemeint, dass in der Kunster-
fahrung einzelne praktische Zwecke reflexiv thematisiert würden. Vielmehr wird in
und durch sie in je spezifischer Weise thematisiert, was es überhaupt heißt, jemand
zu sein, der oder die sich im Rahmen praktischer Zwecke die Welt erschließt – je-
mand nicht in einem unqualifizierten Sinne, sondern jemand, der oder die eingelas-
sen ist in eine historische Lebensform mit ihren ganz spezifischen Praxiszusam-
menhängen. Kunsterfahrungen befördern als Kunsterfahrungen keine Erkenntnisse,
noch schulen sie unsere ethischen Sensibilitäten (ersteres hat etwa Goodman 1997
behauptet, letzteres Rorty 1998). Anstelle von Erkenntnissen zu handeln, verhan-
delt die Kunst unser Erkennen; anstelle von ethischen Orientierungen zu handeln,
verhandelt sie unsere Ansprechbarkeit für ethische Gesichtspunkte. Gegenüber epi-
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
Daniel Martin Feige, Zwei Formen des Ästhetischen 19
stemischen und ethischen wie gegenüber weiteren und hier natürlich auch alltägli-
chen praktischen Zwecken ist Kunst autonom. In ihrer Unabhängigkeit von solchen
praktischen Funktionen lassen sich Kunsterfahrungen aber für diejenigen, die sie
machen, selbst durchaus in Begriffen einer bestimmten Leistung erläutern: Sie
meinen eine Selbstthematisierung derjenigen, die sie erfahren.
Eine solche Thematisierung leisten für Hegel in anderer Weise auch die Religi-
on und die Philosophie. Von ihr unterschieden ist gleichwohl die Art und Weise,
auf welche sie in der Kunst geschieht: Vollzieht sich das Reflexionsgeschehen der
Philosophie im Medium des Begriffs, so gewinnen die artikulierten Gehalte in der
Philosophie eine Autonomie gegenüber ihrer Form. Philosophisches Verstehen be-
ginnt dort, wo ich Gedanken in eigenen Worten wiedergeben kann; es drückt sich
in Paraphrasen und Übersetzungsleistungen aus, nicht in einem Nachplappern von
Formulierungen eines Textes. Natürlich gibt es auch in der Philosophie keine
unverkörperten Gedanken – aber was es heißt, einen philosophischen Gedanken als
philosophischen Gedanken zu verstehen, muss in Begriffen der Paraphrase und
nicht der Nacherzählung erläutert werden. Und das ist in der Kunst offensichtlich
gänzlich anders: Ein Kunstwerk zu verstehen bzw. eine Erfahrung mit ihm zu ma-
chen, heißt, sich dergestalt auf es einzulassen, dass man seinen Elementen mit dem
Geist und Körper mimetisch nachfährt; Kunstwerke kann man nicht übersetzen,
sondern bloß hinsichtlich ihrer Form nachbuchstabieren. Mit Adorno ließe sich sa-
gen: „Machen Kunstwerke nichts nach als sich, dann versteht sie kein anderer, als
der sie nachmacht“ (1973, S. 190). In der Kunst ist nicht allein Sinn wie in der Phi-
losophie immer verkörperter Sinn; allein in ihr zeigt er sich just als irreduzibel ver-
körperter Sinn. Keinen paraphrasierbaren Gehalt und damit gar keinen Gehalt im
herkömmlichen Sinne haben Kunstwerke aufgrund ihrer je singulären Form. Ador-
no pocht anhand der von ihm entwickelten Kategorie des Formgesetzes darauf (vgl.
v. a. 1973, S. 205ff.), dass sie je singuläre Erarbeitungen ihrer Medien und Materia-
lien sind. Deshalb kann man ein Kunstwerk auch nur an dem messen, was es je-
weils durch seine Konstitution von Elementen zu leisten beansprucht; niemals ist
es Ausdruck einer gegenstandsübergreifenden Regel, eines Mechanismus, eines
Algorithmus. Noch im Fall des handgreiflichen Gebrauchs von Computeralgorith-
men in jüngeren Kunstwerken kommen diese nämlich nicht wiederum selbst algo-
rithmisch in die Welt. Und selbst Werke der Concept Art sind nicht so zu erläutern,
dass ihre jeweilige Form – auch im Sinne der Frage, was mereologisch überhaupt
zu ihnen gehört (vgl. dazu ausführlicher Danto 1991, Kap. 5) – mit Blick auf das,
was die entsprechenden Werke verhandeln, verzichtbar ist (vgl. Rebentisch 2015,
Kap. IV.2).
Kurz gesagt: Kunstwerke sind derart holistisch konstituiert, dass jedes Element
– Klänge, Geräusche, Töne, Gesten, Bewegungen, Pixel, Pausen usf. – dasjenige
ist, was es ist, aufgrund seiner vielfältigen Beziehungen zu allen anderen Elemen-
ten. Einen solchen Holismus sollte und darf man keineswegs im Sinne eines in sei-
nem Sinn geschlossenen Kunstwerks verstehen (vgl. dazu als klassische Studie Eco
1977): Die Form des Kunstwerks hat nicht allein in dem Fall, in dem es sich um
ein Werk der performativen Künste handelt, einen wesentlichen temporalen Sinn.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
20 Paragrana 26 (2017) 2
Vielmehr ist sie, wie Adorno anhand der Kategorie der Materialgeschichte geltend
macht, in Bewegung: Kunstwerke sind als in ihrem Sinn wesentlich unbestimmte
Elemente einer Serie von Kunstwerken zu verstehen (vgl. dazu ausführlicher Feige
2014, letztes Kap.). Ebenfalls zu Recht klagt Adorno ein, dass man, wenn man
sagt, dass der Inhalt des Kunstwerks seine Form sei, diese nicht formalistisch ver-
zeichnen darf. Unter Form darf nichts der unmittelbaren Wahrnehmung Gegebenes
und von seinen institutionellen und historischen Bedingungen Gelöstes verstanden
werden. Jede Form ist immer schon von weitergehenden Sinnbezügen derart gesät-
tigt, dass sie Gegenstand nicht der gewissermaßen reinen Wahrnehmung, sondern
Gegenstand einer verständigen Wahrnehmung ist; mehr noch: Entsprechende Sinn-
bezüge sind nichts, was von außen an das Werk herangetragen würde. Der Begriff
des Formgesetzes klagt ein, dass Elemente – und sei es die anhand ihres Gewichts
individuierte Menge von Bonbons in der Installation Untitled (Lover Boys) von
González-Torres – nicht mit ihren möglichen Gegenstücken außerhalb des Werks
identisch sind. Selbst das Readymade ist kein bloßer Alltagsgegenstand, sondern
vielmehr ein Kunstwerk, das die Grenze zwischen Alltagsgegenständen und
Kunstwerken in je spezifischer Weise vor bestimmten institutionellen Kontexten
neuverhandelt. Der Gedanke, dass ein solches Formgesetz nicht formalistisch in
dem Sinne erläutert werden darf, dass das Kunstwerk von der außerästhetischen
Wirklichkeit abgekoppelt wäre, kann mit Adorno so erläutert werden, dass es Aus-
druck eines gegenüber dem außerästhetischen Sinn gegenwendigen Sinns ist; eines
Gegensinns (vgl. systematisch in diesem Sinne Menke 2013).
Es sollte offenkundig sein, dass ausgehend von einer solchen Rekonstruktion
des Sinns der Kunst das Design ästhetisch nicht zu fassen ist. Darin sollte man aber
keinen Einwand gegen die vorgeschlagene Rekonstruktion sehen, sondern vielmehr
einen Grund für die These, dass Kunst und Design Ausdruck unterschiedlicher
Praxisformen des Ästhetischen sind. Anders als Kunstwerke sind Designgegen-
stände üblicherweise keine Gegenstände, die an uns die Frage stellen, was sie
überhaupt sind und was überhaupt zu ihnen gehört, sondern zumeist gehen sie in
einem unproblematischen Horizont praktischer Verständnisse auf. Ihre manifesten
ästhetischen Eigenarten zu bemerken heißt weniger, sich kontemplativ in ihnen zu
versenken, oder sich wie etwa im Fall vieler Performances unter Einbeziehung zu-
meist auch des eigenen Körpers wie seiner somatischen und affektiven Dimensio-
nen von ihnen attackieren zu lassen, sondern sie in Form eines – mit Benjamin
(1980) gesprochen – eher beiläufigen Bemerkens zu vernehmen. Allerdings wäre
es gerade eine Verkürzung, die ästhetischen Eigenarten von Designgegenständen
auf solche Eigenarten zu reduzieren, die manifest sind, d. h. Eigenschaften, die die-
se Gegenstände als der Wahrnehmung zugängliche haben – wie ansprechend etwa
ein Plakat aussieht, wie „schön“ eine Type aussieht. Auch wenn der Mainstream
der Designtheorie und Designforschung die Ästhetik des Designs nach wie vor in
dieser Weise missversteht, sollte man trotz des Unterschieds des Designs zur Kunst
die Einsicht ernst nehmen, dass wir das Ästhetische weder anhand eines alltägli-
chen Begriffs sinnlicher Wahrnehmung, noch anhand einer Reihe ästhetischer Prä-
dikate, deren Verwendung mit Wahrnehmungssituationen im herkömmlichen Sinne
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
Daniel Martin Feige, Zwei Formen des Ästhetischen 21
zu tun hat, rekonstruieren können (für einen anderen Begriff der Wahrnehmung
vgl. Shelley 2013). Vielmehr möchte ich vorschlagen, die ästhetische Dimension
von Designgegenständen darin zu sehen, dass gelungene Designgegenstände in je-
weils singulärer Weise Lösungen für funktionale Anforderungen entwickeln. An-
ders als bei Kunstwerken heißt die Ästhetik des Designgegenstandes zu beurteilen
eben nicht, von den Funktionen, die dieser in unserer Praxis erfüllt, abzusehen.
Vielmehr heißt es, die jeweils spezifische Art und Weise in den Blick zu nehmen,
wie diese Funktion erfüllt und damit durch den betreffenden Gegenstand zugleich
neubestimmt wird. Anders gesagt: Designgegenstände sind geformte Funktionen,
so dass die Form keineswegs ein bloßes Supplement für die Funktion ist (Bruno
Latour irrt meines Erachtens also, wenn er sich auf einen solchen Begriff des De-
signs festlegt, der besagt, dass Design eine unwesentliche Zutat sei; vgl. Latour
2009). Es gibt im Design nicht zwei Dinge, eine abstrakte Funktion und dann noch
diese äußerlichen ästhetischen Eigenarten, die sie ornamentieren. Aber ebenso we-
nig gibt es – anders als der klassische Funktionalismus behauptet hat (vgl. exemp-
larisch etwa Sullivan 1999) – eine gesetzesartige Relation zwischen Form und
Funktion, eine immanente Notwendigkeit derart, dass eine bestimmte Funktion ei-
ne bestimmte Form fordern würde. Vielmehr werden im Design Funktionen dahin-
gehend ästhetisch, dass sie irreduzibel an ihre Formgebungen gebunden sind. Kurz
gesagt: Ästhetisch gelungene Designgegenstände erfinden ihre Funktion im Medi-
um von Prozessen der Formgebung neu. Sich auf Designgegenstände als ästheti-
sche Gegenstände zu beziehen und sich damit ästhetisch zu beziehen, heißt also
just wie in der Kunst, sie als jeweils singuläre Gegenstände zu beurteilen. Anders
als mit Blick auf das eigensinnige Reflexionsgeschehen der Kunst heißt ein solcher
Bezug mit Blick auf das Design, sie als jeweils spezifische Neuerfindungen ihrer
Funktionen im Medium von Prozessen der Formgebung zu beurteilen.
Wenn diese Rekonstruktion zutreffend ist, so kann die Rolle des Designs in der
menschlichen Welt heute kaum überschätzt werden. Insofern Designgegenstände
auf praktische Funktionen bezogen sind und diese jeweils in spezifischer Weise er-
arbeiten, so formen sie dadurch zugleich unsere Praktiken. Designgegenstände ha-
ben einen wesentlichen Anteil an der Art und Weise unseres Weltbezugs und damit
an den Konturen unserer alltäglichen Welt. Im Rahmen von Martin Heideggers
Analyse von Alltäglichkeit (1967, v. a. § 15ff.), die diese im Sinne einer vorgängi-
gen Erschlossenheit des Sinns von Gegenständen der Welt deutet, lässt sich anhand
des Begriffs des Zeugs ein Ausgangspunkt für eine entsprechende Formung unserer
Welt durch das Design ausfindig machen. Festzuhalten ist dabei, dass sein Ver-
ständnis derselben erstens nicht länger anhand des neuzeitlichen Subjekt-Objekt-
Dualismus erläutert werden kann und zweitens nicht länger im Sinne eines theore-
tischen Wissens, eines Wissens-dass. Vielmehr ist für ihn Alltäglichkeit als Form
praktischen Wissens, als ein Können, zu erläutern. Unter dem Begriff des „social
design“ ist die Einsicht in den nicht-supplementären Charakter des Designs mit
Blick auf eine angemessene Beschreibung unserer alltäglichen Praxis heute in den
Debatten der Designtheorie einschlägig (vgl. dazu die Beiträge in Banz 2016): Die
Arbeit von DesignerInnen ist letztlich eine Arbeit an den Grundlagen der mensch-
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
22 Paragrana 26 (2017) 2
lichen Welt, die aus einer Ganzheit von systematisch aufeinander bezogenen Pra-
xiszusammenhängen besteht. Zwar ist die Welt keineswegs „designt“ (Friedrich
von Borries setzt den Begriff des „Designs“ letztlich einer umfassenden Inklusi-
onskrankheit anheim, wenn er Entsprechendes behauptet, vgl. 2016). Sie ist als
menschliche Welt aber wesentlich konstituiert durch Praxiszusammenhänge, die
heute in weiten Teilen von Designentscheidungen geprägt sind.
II. Zwei Formen des Alltagsbezugs
Die entwickelte Unterscheidung zweier ästhetischer Praxisformen legt nahe, dass
es die Kunst als Praxisform mit einer Unterbrechung alltäglicher Praktiken zu tun
hat, wohingegen es das Design mit einer bruchlosen Fortsetzung alltäglicher Prak-
tiken zu tun hat. Dass die Lage nicht ganz so einfach ist, möchte ich abschließend
kurz zeigen. Zunächst einige Bemerkungen zum Verhältnis von Design und Alltag
bzw. zur Alltäglichkeit des Designs: Trotz der Tatsache, dass gelungene Designge-
genstände ihre Funktionen im Medium von Prozessen der Formgebung neuerfin-
den, ist es nicht so, dass diese Neuerfindung sich in Form eines expliziten Aufmer-
kens im Rahmen unserer alltäglichen Praktiken auf Seiten der NutzerInnen artiku-
liert findet. Vielmehr gilt zumeist für Designgegenstände, was Heidegger vom
Zeug behauptet hat: dass sie in unsere Praxis in unthematischer Weise eingelassen
sind und diese dennoch zugleich bestimmen. Ist also, mit Lucius Burckhardt (2010)
gesprochen, Design unsichtbar, so kann es sich im Regelfall auch nicht als Design
reflexiv zu entsprechenden Praktiken verhalten, ohne nicht zugleich selbst wiede-
rum neue Praxiszusammenhänge zu stiften. So sind die Arbeiten des ökologischen
Designs natürlich dadurch, dass sie etwa den Prozess ihrer Herstellung exemplifi-
zieren, eine Reflexion über unseren gesellschaftlichen Umgang mit endlichen Res-
sourcen – aber wenn sie etwa im Fall von Ronan und Erwan Bouroullecs Vegetal
oder Richard Liddles RD21 in Stühlen bestehen, so sind diese durchaus selbst zum
Sitzen da. Anders gesagt: Bei Stefan Wewerkas Classroom Chairs – sie sind zwar
als Stühle zu erkennen, aber nicht länger als solche zu gebrauchen – könnte es sich
eher um zeitgenössische Skulpturen in Möbelform denn um Designgegenstände im
hier diskutierten Sinne handeln. Der ästhetische Witz bzw. die ästhetische Pointe
von Designgegenständen ist diejenige einer Formung unserer Praxis und nicht die-
jenige einer Reflexion dieser Praxis. Das heißt nicht, dass die Prozesse des Gestal-
tens selbst dahingehend blind wären, dass sie nicht Ausdruck entsprechender Re-
flexionen sind. Und es heißt auch nicht, dass es nicht viele Designgegenstände gä-
be, die solche Prozesse auch exemplifizierten. Sie aber als Designgegenstände zu
gebrauchen, heißt, dass sie in jeweils spezifischer Weise den ganz praktischen
Zwecken dienen, zu denen sie da sind.
Dass das in der Kunst als Reflexionsgeschehen anders ist, bedeutet nun aller-
dings nicht, dass Kunst mit unserer alltäglichen Praxis nichts zu tun hätte. Gerade
insofern die Kunst ein Reflexionsgeschehen auf unsere wesentlichen Orientierun-
gen im Sinne dessen ist, was uns als Partizipierende an einer historischen Lebens-
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
Daniel Martin Feige, Zwei Formen des Ästhetischen 23
form heute prägt, hat sie einen Bezug zu unserer alltäglichen Praxis (schon bei He-
gel erfährt das Subjekt der ästhetischen Erfahrung anders als bei Kant nichts über
seine allgemeinmenschlichen Vermögen, sondern vielmehr etwas über sich als je-
mand, der oder die sich im Rahmen einer historischen Lebensform bewegt). Denn
worauf wir in der Kunsterfahrung reflektieren, sind wir als praktische AkteurInnen
in einer menschlichen Welt. Wenn im Zuge der Gegenwartskunst in den bildenden
wie performativen Künsten die Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst immer
wieder in dem Sinne fragwürdig geworden ist, dass angesichts der meisten Werke
auf den ersten Blick unklar ist, was sie sind und was ein konstitutiver Aspekt der-
selben ist, so möchte ich vorschlagen, diese Entwicklung nicht im Sinne des Ein-
reißens der Grenzen zwischen Kunst und außerästhetischer Praxis zu sehen. Kunst
wird hier nicht auf einmal einfach eine Verlängerung alltäglicher Praktiken. Viel-
mehr radikalisieren nicht zuletzt Formen der partizipativen Kunst in Museumsräu-
men oder Theatersälen ein Moment, das von jeher wesentlich für die autonome
Kunst ist: ihren spezifischen Aushandlungscharakter. Allein bestimmte verkürzte
Verständnisse im Umfeld der modernistischen Ästhetiken haben dazu geführt (vgl.
Rebentisch 2015, Kap. 1), diejenigen, die Kunstwerke erfahren, zu passiven Zu-
schauerInnen einer ihnen entzogenen Eigenlogik des Werks zu verklären. Zwar ist
es richtig, dass ein Kunstwerk zu erfahren immer heißt, sich auf es interpretativ
derart einzulassen, dass man selbst in seiner bloßen Betrachtung immer schon Un-
terscheidungen hinsichtlich dessen vornimmt, was zu ihm gehört und was nicht und
wie sich seine – wie immer ephemeren – Elemente zueinander verhalten. Aber das
meint nicht, dass sich die Rezipierenden nicht immer schon ins Werk mitbringen
müssen. Anders und mit Hans-Georg Gadamer (1990) gesagt: Es gibt keine Ausei-
nandersetzung mit Kunstwerken, die nicht immer schon ein Moment der Anwen-
dung auf die eigene Situation durch diejenigen beinhalten würde, die sich mit ihm
auseinandersetzen; ein Kunstwerk zu erfahren, heißt immer schon eigene prakti-
sche Verständnisse in es einzubringen und ihm dadurch erst seine spezifische Kon-
tur zu geben (vgl. ebd., S. 312ff.). Man kann sagen, dass dieses Moment in der
Gegenwartskunst radikalisiert wird und hinsichtlich seiner sozialen, politischen, ju-
ridischen usf. Implikationen ausbuchstabiert wird, indem in einem ganz handgreif-
lichen Sinne Anwendungen Teil künstlerischer Praktiken werden. In diesem Fall
würde der Gebrauch von Verfahrensweisen, die in Begriffen der Anwendung zu er-
läutern wären, im zeitgenössischen Theater weniger dafür sprechen, dass die Kunst
sich nicht länger als verkörpertes Reflexionsgeschehen erläutern lassen würde. Er
würde vielmehr dafür sprechen, dass ein angemessenes Verständnis eines solchen
Reflexionsgeschehens dieses als performativ verstehen muss. In diesem Sinne wä-
ren entsprechende Entwicklungen im zeitgenössischen Theater kein Sonderfall der
Kunst und auch keine Bewegung weg von der Kunst. Vielmehr würden sie ein
Moment radikalisieren, dass immer schon in der Kunst angelegt war – dass Aus-
handlungen nicht durch vorgängig gegebene Spielregeln bestimmt sind, sondern
den Charakter eines Ereignisses haben. Zugleich würden sie zeigen, dass das Ref-
lexionsgeschehen der Kunst mit Blick auf verschiedenste gesellschaftliche Prakti-
ken von Relevanz sein kann und keineswegs – wie etwa Hegel tendenziell noch
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
24 Paragrana 26 (2017) 2
dachte – auf eine bestimmte Art privilegierter Gegenstände und Gehalte bezogen
ist.
Design und Kunst sind somit beide auf den Alltag bezogen. In der Kunst ist der
Alltag aber zugleich ein anderer Alltag als der Alltag des Designs: Es ist ein durch
die Thematisierung wie performative Neuaushandlung der Grenze zwischen Kunst
und Nicht-Kunst reflexiv thematisierter Alltag. Das heißt zugleich: Noch in ihren
Anwendungen zeigt sich die Kunst als eine Praxis, die wir nicht so beschreiben
sollten, dass sie bruchlos in eine außerästhetische Verwertungslogik eingehen wür-
de.
Literatur
Adorno, T. W. (1973): Ästhetische Theorie. Frankfurt/M.
Banz, C. (Hg.) (2016): Social Design. Gestalten für die Transformation der Gesellschaft. Bielefeld.
Bayazit, N. (2004): Investing Design: A Review of Forty Years of Design Research. In: Design Issue
20, S. 16-30.
Benjamin, W. (1980): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. In: ders.:
Gesammelte Schriften. Bd. 1.2. Frankfurt/M., S. 431-496.
Bertram, G. W. (2005): Kunst. Eine philosophische Einführung. Stuttgart.
Borries, F. von (2016): Weltentwerfen. Eine politische Designtheorie. Berlin.
Bourriaud, N. (2002): Relational Aesthetics. Paris.
Bubner, R. (1994): Ästhetische Erfahrung. Frankfurt/M.
Burckhardt, L. (2010): Design ist unsichtbar. In: Edelmann, K. T./Terstiege, G. (Hg.): Gestaltung
Denken. Grundlagentexte zu Design und Architektur. Basel, S. 211-217.
Danto, A. C. (1991): Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst. Frankfurt/M.
Dorschel, A. (2003): Gestaltung. Zur Ästhetik des Brauchbaren. Heidelberg.
Eco, U. (1977): Das offene Kunstwerk. Frankfurt/M.
Feige, D. M. (2012): Kunst als Selbstverständigung. Münster.
Feige, D. M. (2014): Philosophie des Jazz. Berlin.
Feige, D. M. (2018): Design. Eine philosophische Analyse. Berlin.
Fischer-Lichte, E. (2004): Ästhetik des Performativen. Frankfurt/M.
Forsey, J. (2013): The Aesthetics of Design. Oxford.
Gadamer, H.-G. (1990): Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tü-
bingen.
Goodman, N. (1997): Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symbolphilosophie. Frankfurt/M.
Hegel, G. W. F. (1986): Vorlesungen über die Ästhetik. Bd. 1. Frankfurt/M.
Heidegger, M. (1967): Sein und Zeit. Tübingen.
Kant, I. (1974): Kritik der Urteilskraft. Frankfurt/M.
Küpper, J./Menke, C. (Hg.) (2003): Dimensionen ästhetischer Erfahrung. Frankfurt/M.
Latour, B. (2009): A cautious Prometheus? A few steps toward a philosophy of design (with special
attention to Peter Sloterdijk). In: Hackne, F./Glynne, J./Minto, V. (Hg.): Proceedings of the 2008
Annual International Conference of the Design History Society. Falmouth, S. 2-10.
Menke, C. (2013): Die Kraft der Kunst. Berlin.
Parsons, G./Carlson, A. (2008): Functional Beauty. Oxford.
Rebentisch, J. (2015): Theorien der Gegenwartskunst zur Einführung. Hamburg.
Rorty, R. (1998): The Inspirational Value of Great Works of Literature. In: ders.: Achieving our
Country. Leftist Thought in Twentieth-Century America. Cambridge/Mass., S. 125-140.
Saito, Y. (2010): Everyday Aesthetics. Oxford.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
Daniel Martin Feige, Zwei Formen des Ästhetischen 25
Shelley, J. (2013): Das Problem nichtperzeptueller Kunst. In: Deines, S./Liptow, J./Seel, M. (Hg.):
Kunst und Erfahrung. Beiträge zu einer philosophischen Kontroverse. Berlin, S. 270-295.
Steinbrenner, J./Nida-Rümelin, J. (Hg.) (2001): Ästhetische Werte und Design. Stuttgart.
Sullivan, L. H. (1999): Das große Bürogebäude, künstlerisch betrachtet. In: Fischer, V./Hamilton, A.
(Hg.): Theorien der Gestaltung. Grundlagentexte zum Design. Bd. 1. Frankfurt/M., S. 142-146.
Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Angemeldet
Heruntergeladen am | 21.06.19 15:20
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Bubner A Sthetische Erfahrung PDFDokument80 SeitenBubner A Sthetische Erfahrung PDFHansNoch keine Bewertungen
- Ästhetik Franz Von KutscheraDokument587 SeitenÄsthetik Franz Von KutscheradawydNoch keine Bewertungen
- Vision ›Gesamtkunstwerk‹: Performative Interaktion als künstlerische FormVon EverandVision ›Gesamtkunstwerk‹: Performative Interaktion als künstlerische FormNoch keine Bewertungen
- G. Böhme - Aisthetik (2001)Dokument198 SeitenG. Böhme - Aisthetik (2001)Jaime AspiunzaNoch keine Bewertungen
- Kunst und Handlung: Ästhetische und handlungstheoretische PerspektivenVon EverandKunst und Handlung: Ästhetische und handlungstheoretische PerspektivenDaniel Martin FeigeNoch keine Bewertungen
- Praktiken ästhetischen Denkens: 9 Essays zur Neuverhandlung von Kunst und ÄsthetikVon EverandPraktiken ästhetischen Denkens: 9 Essays zur Neuverhandlung von Kunst und ÄsthetikSilvia HenkeNoch keine Bewertungen
- Welsch Philosophie Und KunstDokument21 SeitenWelsch Philosophie Und KunstnicolasberihonNoch keine Bewertungen
- Jacques Ranciere - Die Aufteilung Des Sinnlichen S21-73Dokument28 SeitenJacques Ranciere - Die Aufteilung Des Sinnlichen S21-73Christina MelchiorNoch keine Bewertungen
- Philosophie Der Modernen KunstDokument25 SeitenPhilosophie Der Modernen KunstPhilipp TschirkNoch keine Bewertungen
- Die Historische Avantgarde SoSe13 InnerhoferDokument72 SeitenDie Historische Avantgarde SoSe13 InnerhoferihdrilNoch keine Bewertungen
- Die Verwandlung der Dinge: Zur Ästhetik der Aneignung in der New Yorker Kunstszene Mitte des 20. JahrhundertsVon EverandDie Verwandlung der Dinge: Zur Ästhetik der Aneignung in der New Yorker Kunstszene Mitte des 20. JahrhundertsNoch keine Bewertungen
- Seminararbeit Über Die Macht Der BilderDokument25 SeitenSeminararbeit Über Die Macht Der BilderChristian JanusNoch keine Bewertungen
- (UTB 2088) Konrad Paul Liessmann - Philosophie Der Modernen Kunst. Eine Einführung-WUV (1999)Dokument225 Seiten(UTB 2088) Konrad Paul Liessmann - Philosophie Der Modernen Kunst. Eine Einführung-WUV (1999)Antonín PolicarNoch keine Bewertungen
- Künstlerische InterventionenDokument23 SeitenKünstlerische InterventionenJennifer ZeeroverNoch keine Bewertungen
- Rec A Boehme AisthDokument3 SeitenRec A Boehme AisthsertimoneNoch keine Bewertungen
- Der Abgrund im Spiegel: Mise en abyme - zur Aufhebung der ontologischen Dichotomien von Kunst und WirklichkeitVon EverandDer Abgrund im Spiegel: Mise en abyme - zur Aufhebung der ontologischen Dichotomien von Kunst und WirklichkeitNoch keine Bewertungen
- Autoritär, elitär & unzugänglich: Kunst, Macht und Markt in der GegenwartVon EverandAutoritär, elitär & unzugänglich: Kunst, Macht und Markt in der GegenwartNoch keine Bewertungen
- Sonderegger 1Dokument14 SeitenSonderegger 1meacuerdoNoch keine Bewertungen
- Ármin Tillmann - Dissens Als Garant Für Eine Emanzipatorische KunstDokument18 SeitenÁrmin Tillmann - Dissens Als Garant Für Eine Emanzipatorische KunstÁrmin TillmannNoch keine Bewertungen
- Kunst und Fremderfahrung: Verfremdungen, Affekte, EntdeckungenVon EverandKunst und Fremderfahrung: Verfremdungen, Affekte, EntdeckungenWerner FitznerNoch keine Bewertungen
- Kreativität als Beruf: Soziologisch-philosophische Erkundungen in der Welt der KünsteVon EverandKreativität als Beruf: Soziologisch-philosophische Erkundungen in der Welt der KünsteNoch keine Bewertungen
- Wie verändert sich Kunst, wenn man sie als Forschung versteht?Von EverandWie verändert sich Kunst, wenn man sie als Forschung versteht?Noch keine Bewertungen
- MARQUARD Aesthetica Und AnaestheticaDokument166 SeitenMARQUARD Aesthetica Und AnaestheticaihdrilNoch keine Bewertungen
- Kunst unterrichten: Die Vermittlung von Kunstgeschichte und künstlerischem ArbeitenVon EverandKunst unterrichten: Die Vermittlung von Kunstgeschichte und künstlerischem ArbeitenNoch keine Bewertungen
- Essay Dahlhaus Michael Feigl PDFDokument4 SeitenEssay Dahlhaus Michael Feigl PDFMichael FeiglNoch keine Bewertungen
- Installationskunst in China: Transkulturelle Reflexionsräume einer Genealogie des PerformativenVon EverandInstallationskunst in China: Transkulturelle Reflexionsräume einer Genealogie des PerformativenNoch keine Bewertungen
- Worringer, Wilhelm - Abstraktion Und Einfühlung - 1911Dokument164 SeitenWorringer, Wilhelm - Abstraktion Und Einfühlung - 1911Michael LückNoch keine Bewertungen
- Die Genese der autonomen Kunst: Eine historische Soziologie der Ausdifferenzierung des KunstsystemsVon EverandDie Genese der autonomen Kunst: Eine historische Soziologie der Ausdifferenzierung des KunstsystemsNoch keine Bewertungen
- Ästhetisierung des Sozialen: Reklame, Kunst und Politik im Zeitalter visueller MedienVon EverandÄsthetisierung des Sozialen: Reklame, Kunst und Politik im Zeitalter visueller MedienLutz HieberNoch keine Bewertungen
- Adornokunst PDFDokument17 SeitenAdornokunst PDFIlias GiannopoulosNoch keine Bewertungen
- Neuverhandlungen von Kunst: Diskurse und Praktiken seit 1990 am Beispiel BerlinVon EverandNeuverhandlungen von Kunst: Diskurse und Praktiken seit 1990 am Beispiel BerlinNoch keine Bewertungen
- Im Gefüge der Kunst: Affektive Performativität als kreative PraktikVon EverandIm Gefüge der Kunst: Affektive Performativität als kreative PraktikNoch keine Bewertungen
- Ausweitung der Kunstzone: Interart Studies - Neue Perspektiven der KunstwissenschaftenVon EverandAusweitung der Kunstzone: Interart Studies - Neue Perspektiven der KunstwissenschaftenNoch keine Bewertungen
- Subjektivitat Bei LeWitt Yvonne Rainer Und HODokument3 SeitenSubjektivitat Bei LeWitt Yvonne Rainer Und HOLeonardo MunkNoch keine Bewertungen
- Grenzüberschreitungen in der Gegenwartskunst: Ästhetische und philosophische PositionenVon EverandGrenzüberschreitungen in der Gegenwartskunst: Ästhetische und philosophische PositionenNoch keine Bewertungen
- FortisDokument11 SeitenFortisBen FortisNoch keine Bewertungen
- Das Werk – der Weg: Eine interkulturelle Begegnung zwischen Künstlerin und KuratorinVon EverandDas Werk – der Weg: Eine interkulturelle Begegnung zwischen Künstlerin und KuratorinNoch keine Bewertungen
- Bachelor ArbeitDokument50 SeitenBachelor ArbeitAnonymous VWlCr439Noch keine Bewertungen
- Optische Transzendenz: Beiträge zur Ideengeschichte der Fotografie und zur Praxis der Bild-KontemplationVon EverandOptische Transzendenz: Beiträge zur Ideengeschichte der Fotografie und zur Praxis der Bild-KontemplationNoch keine Bewertungen
- Die Kunst und ihre Folgen: Zur Genealogie der KunstvermittlungVon EverandDie Kunst und ihre Folgen: Zur Genealogie der KunstvermittlungNoch keine Bewertungen
- Politik der Kunst: Über Möglichkeiten, das Ästhetische politisch zu denkenVon EverandPolitik der Kunst: Über Möglichkeiten, das Ästhetische politisch zu denkenNoch keine Bewertungen
- Design & Philosophie: Schnittstellen und WahlverwandtschaftenVon EverandDesign & Philosophie: Schnittstellen und WahlverwandtschaftenJulia-Constance DisselNoch keine Bewertungen
- Bild und Geste: Figurationen des Denkens in Philosophie und KunstVon EverandBild und Geste: Figurationen des Denkens in Philosophie und KunstNoch keine Bewertungen
- HartmannDokument8 SeitenHartmannTorsten KnackstedtNoch keine Bewertungen
- Kunst Und Semiotischer KonstruktivismusDokument12 SeitenKunst Und Semiotischer KonstruktivismusInstitute for Communication & LeadershipNoch keine Bewertungen
- Ferencz Flatz-Bild Und Ding-2010 Husserl HeideggerDokument19 SeitenFerencz Flatz-Bild Und Ding-2010 Husserl HeideggerguangyangchrisNoch keine Bewertungen
- Zwischen Asthetik Und Epistemologie DasDokument16 SeitenZwischen Asthetik Und Epistemologie Daswr7md5b55fNoch keine Bewertungen
- Weibel - TransformationDokument41 SeitenWeibel - TransformationJL UrsumNoch keine Bewertungen
- Kunst und Wirklichkeit heute: Affirmation - Kritik - TransformationVon EverandKunst und Wirklichkeit heute: Affirmation - Kritik - TransformationLotte EvertsNoch keine Bewertungen
- Sehen als Vergleichen: Praktiken des Vergleichens von Bildern, Kunstwerken und ArtefaktenVon EverandSehen als Vergleichen: Praktiken des Vergleichens von Bildern, Kunstwerken und ArtefaktenNoch keine Bewertungen
- Arbeitspapier KuratierenDokument25 SeitenArbeitspapier Kuratierenjp45wwjqgvNoch keine Bewertungen
- StaltungDokument7 SeitenStaltungSonnyJinsNoch keine Bewertungen
- Soneregger 2Dokument4 SeitenSoneregger 2meacuerdoNoch keine Bewertungen
- Sonderegger 1Dokument14 SeitenSonderegger 1meacuerdoNoch keine Bewertungen
- AufklärungDokument4 SeitenAufklärungmeacuerdoNoch keine Bewertungen
- VOGT, Jürgen - Starke GefühleDokument17 SeitenVOGT, Jürgen - Starke GefühlemeacuerdoNoch keine Bewertungen
- Marx, K - Mega 32, 1Dokument53 SeitenMarx, K - Mega 32, 1meacuerdoNoch keine Bewertungen
- BEHRENS, Roger - Radikale AffirmationDokument7 SeitenBEHRENS, Roger - Radikale AffirmationmeacuerdoNoch keine Bewertungen
- 09.10.2022 Fabel Der KaterDokument2 Seiten09.10.2022 Fabel Der KaterTricxser trickstNoch keine Bewertungen
- Eirund SuicidDokument7 SeitenEirund SuicidjanpatockaNoch keine Bewertungen
- Die Kunst Des Gesprächs. Texte Zur Geschichte Der Europäischen KonversationstheorieDokument290 SeitenDie Kunst Des Gesprächs. Texte Zur Geschichte Der Europäischen KonversationstheorieMarccoNoch keine Bewertungen
- InterviewfragenDokument7 SeitenInterviewfragennorhan ahmedNoch keine Bewertungen
- 02 ZeidlerDokument9 Seiten02 ZeidlerIvana GreguricNoch keine Bewertungen
- Philosophie 4.20 PDFDokument116 SeitenPhilosophie 4.20 PDFPere-Ferran Andúgar LópezNoch keine Bewertungen
- Vigo - Praktische Wahrheit Und Dianoetische Tugenden Bei Aristoteles - Wieland Zum 70. Geburtstag PDFDokument34 SeitenVigo - Praktische Wahrheit Und Dianoetische Tugenden Bei Aristoteles - Wieland Zum 70. Geburtstag PDFricardoangisNoch keine Bewertungen