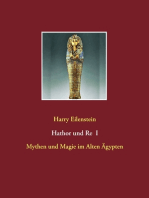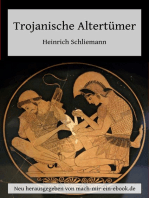Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Keramikstiele Im Antiken Griechenland
Keramikstiele Im Antiken Griechenland
Hochgeladen von
Kaya HeumannOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Keramikstiele Im Antiken Griechenland
Keramikstiele Im Antiken Griechenland
Hochgeladen von
Kaya HeumannCopyright:
Verfügbare Formate
Malstiele
(! Klausurrelevant !)
Kaliades epoiesen Do(u)ris egraphsen
ΚΑΛΙΑΔΕΣ ΕΠΟΙΕΣΕΝ ΔΟΡΙΣ ΕΓΡΑΦΣΕΝ
Kaliades hat es gemacht Douris hat es bemalt
John Beazley
Zuschreibungskriterien
• anatomische detailes,
Gesichtsprofile, Inskriptionen,
Faltensystheme
• Linienduktus, Figurentypen,
Flächen- und Bildorganisation,
Themenwahl und Erzählweise
Epochale und Stilistische Einordnungsübersicht
Griechische Frühzeit
Protogeometrisch
(Ende 11.Jh. - 900 v.Chr.)
Geometrischer Dekor
• Vor allem Halbkreise und konzentrische Kreise
• Rauten und Dreiecke
• Schachbrett- und Zickzackmuster
Griechische Frühzeit
Geometrisch
(900 - 700 v.Chr.)
• Geometrischer Dekor
• Kreise verschwinden
• Mäander in unterschiedlicher Komplexität
• Seit ca. 800 v.Chr. Figürliche Szenen
• Horror vacui (Angst vor freien Flächen)
• Herstellungszentren Athen und Argos
Archaik
Protokorinthisch
(720 - 625 v.Chr.)
• Entwicklung der Schwarzfigurentechnik zu beginn des 7.Jh. v. Chr.
• Binnengliederung durch zusätzliche Farben (Weiß, Purpurrot)
• Miniaturfriese
• Punktrosetten
• Vor allem kleine Gefäße wie Aryballoi und Alabastra
Archaik
Korinthisch
(625 - 550 v.Chr.)
• Verbesserung der Ritzungen
• Perfektion des Glanztons
• Massenproduktion seit Ende 7.Jh. v.Chr.
- Routinierter aber dadurch gröber
- -> aufgrund von aufwand später nur noch ein Tier oder Körper pro Gefäß
• Klecksrosetten
• Horror vacui
• Ab Mitte 6.Jh. v. Chr. nur noch Produktion nach lokalem bedarf.
Archaik
Ostgriechisch
(2.Viertel 7.Jh. - 600 v.Chr.)
• Kombination aus Umriss- und Sillhouettenmalerei
• Vor allem Körper als Silhouetten und Kopf und Bauch mit Umrisslinien
• Wildziegen-Stiel (Wild goat style) -> Tierfriese
• Keine Ritzungen sondern Binnenzeichnungen
• Zentren auf Rhodos, Samos, Chios, und in Milet
• im 6 Jh. im Fikellura-Stiel teilweise weitergeführt
Archaik
Lakonisch
(7 Jh. - 6 Jh. v.Chr.)
• Exportkeramik
- z.B. Rhodos, Samos, Cyrene und Tarent
• Feiner Ton mit Cremefarbenen Überzug
• Große Figürliche Innenbilder
• Granatapfelketten (vor allem Außenseite)
•
Archaik
Protoattisch
(Ca. 700 - 600 v.Chr.)
• Weiterentwicklung der Geometrischen Figuren
• Deutbare Mythologische Szenen
Archaik
Attisch-Schwartzfigurig
(Ca. 600 - 530 v.Chr.)
• In erster Ausprägung bei Amphoren des Nesso-Malers
• Ritztechnik wird verfeinert
- detailllierte Binnengliederung des Körpers, Gewändern und Mustern
• Klitias Krater als erster Höhepunkt
• Kalydonische Eberjagd
• Hochzeit von Peleus und Thetis
• Überfall auf Troilos
• Theseus und Ariadne
• Rückführung des Hephaistos
• Grabspiele des Patroklos
• Lapithen und Kentauren
• Perfektion der Ritztechnik durch Exekias
• Tritt als Töpfer und Maler auf
Archaik
Bilinguen
• Übertragung von Schwarzfigüriger- zu Rotfigürlicher Malerei um 530 v.Chr.
• In erster Generation auch Gefäße mit beiden Malstielen
•
Archaik
Attisch-Rotfigurig
(530 - 480 v.Chr.)
• Bis ende des 6. Jh. v.Chr. laufen att. Schwarzfig. und att. Rotfig. noch nebeneinander, danach setzt sich das Rotfigurliche
durch
• Binnenzeichnungen müssen nicht mehr geritzt werden
• Experimentelle Phase: gesteigertes Körpergefühl der Figuren
• Beliebte Themen hängen mit diesem Gefühl zusammen -> leben in den Palästra, rauschhafter tanz
Archaik
Six-Technik
• Deckfarben auf schwarzem Glanzton
• Mit oder ohne Ritzungen
• Experimentelle Phase am Ende des 6 Jh. v.Chr.
Archaik
Coral Red
(Ende 6 - Mitte 5 Jh. v. Chr.)
• Leuchtend Orangerote Farbigkeit
• Tritt am ende des 6 Jh. v. Chr. zusammen mit Schwarz- und Rotfigurlicher
wie auch Weißgrundiger Bemalung auf
• Herrausragende Maler: Exekias, Psiax, Douris, Berliner Maler,
Kleophrades-Maler und Euphronios
• Herstellungsprozess nicht eindeutig geklärt
• Schlechte Haltbarkeit
•
Klassik
Attisch-Rotfigurig: Strenger Stiel
• Weiterentwicklung des Stieles
• Fließende Gewänder mit sich abzeichnenden Körperformen
• Profildarstellung zuendegeführt
• Ab 460: Figuren nicht mehr nur
auf die Grundlinie des Bildfeldes
begrenzt
Klassik
Attisch-Rotfigurig: Hochklassik
• Beruhigtere Szenen
• Weniger Bewegung als in vorangegangenen Stielen
Klassik
Attisch-Rotfigurig: Reicher Stiel
• Faltenreiche und stark bewegte Gewänder mit deutlichen
Körperformen
Klassik
Attisch-Rotfigurig: Spätklassik
• Kertscher Vasen nach Fundort am Schwarzen Meer benannt
• Frauen und Eroten erneut mit weißer Deckfarbe dargestellt
• Verwendung von Hellblau, Grün und Gold
Klassik ( und Archaik)
Attisch-Weißgrundig
• Bildet sich am Ende des 6. Jh. v.Chr. zusammen mit der rotfigurigen und Six-Technik heraus
• In Athen hauptsächlich kleine Gefäße wie Lekythoi, Alabastra, Pyxiden und Schalen
• Wg. Lekythoi besonders in Athen im Grabkult
• Enden gegen 400 v.Chr.
Klassik
Apulisch
(430 - 300 v. Chr.)
• Nachahmung und Weiterentwicklung der att.-rf. Gefäßmalerei
• Unterteilung in Plaine Style und Ornate Style
• Plaine Style:
- Weitergehend Verzicht auf Deckfarben
- Glocken- Kolonettenkratere, kleine Gefäßtypen
- 1-4 Figuren
• Ornate Style:
- großflächige Volutenkratere, Amphoren, Loutrophoren, Hydrien
- viele “schwerelos” wirkende Figuren
- reichhaltige Ornamentalvierzierungen
- Deckfarben (Rot, Gelb, Weiß)
- Götterversammlungen, Theaterszenen, ausgewählte Helden
Klassik
Kampanisch
(5 - 4 Jh. v. Chr.)
• kleinere Gefäße
• Bügelhenkelamphore als Leitform
• Massig- bis gedrungen wirkende Figure
• Landschaftslinien
Klassik
Lukanisch
(430 - 400 v. Chr.)
• noch stark in attischer Tradition
• Nestoris als neue Gefäßform
• Mythische und Theaterdarstellung
•
Klassik
Paestanisch
(360 - 300. v. Chr.)
• in Paestum angesiedelte Maler aus Sizilien
• Glockenkratere, Halsamphoren, Hydrien, Lebetes Gamikoi, Lekaniden, Lekythoi, Kannen
• Deckfarben: Weiß, Gold, Schwarz, Purpur und Rottöne
•
Hellenismus
Westabhang-Ware (West-Slope)
• Arch. terminus technicus für Keramik hauptsächlich im östlichen Mittelmeerraum
• Nach Keramik, die am Westabhang der Athener Akropolis gefunden wurde, benannt
• Schwarzfirnis-Keramik mit Bemalung aus weißer, gelber und rosaner Farbe
• Pyxiden, Kratere, Hydrien, Amphoren, Peliken, Kannen,
Krateriskoi, Kantharoi, Kelchbecher, Schalen, Lebeten
Hellenismus
Gnathia
• terminus technicus abgeleitet vom Ort Egnazia in Apulien
• Exportware, beeinflusste wohl auch West Slope Ware
• Floraler Dekor mit Efeu- und Weinranken, Theatermasken
• Durch anwachsende Produktion lässt Qualität der Bemalung nach
Hellenismus
Canosinisch
(350 - 300 v.Chr.)
• Wasserlösliche Farben (Blau, Rot/Rosa, Gelb, Hellviolett, Braun)
• Volutenkrater, Kantharos, Oinochoe, Askos
• Plastische Figuren, Aplliken
• Hauptfunde Canosa, Arpi und Ordona
• Hauptsächlich im Grabkult verbreitet
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Lesen Und Schreiben Von E MAILS Und Multiple Choic 240122 1444081Dokument45 SeitenLesen Und Schreiben Von E MAILS Und Multiple Choic 240122 1444081Kristina Holstein100% (7)
- In Deinem Namen Wollen WirDokument12 SeitenIn Deinem Namen Wollen WirVeit VergaraNoch keine Bewertungen
- Jansson Tove - Willkommen Im MumintalDokument205 SeitenJansson Tove - Willkommen Im MumintalTotos TotopoulosNoch keine Bewertungen
- Die Keramik Der Jastorf KulturDokument5 SeitenDie Keramik Der Jastorf KulturStommeRikNoch keine Bewertungen
- Arbeitsblatt Daf Daz Studio21 b1 Einheit 10 GrammatikDokument3 SeitenArbeitsblatt Daf Daz Studio21 b1 Einheit 10 GrammatikFati MancerNoch keine Bewertungen
- DUDEN Abiwissen KunstgeschichteDokument26 SeitenDUDEN Abiwissen KunstgeschichteTom100% (1)
- Baugeschichte 2Dokument28 SeitenBaugeschichte 2Kinan ScreamoNoch keine Bewertungen
- Arh.3 Griechische ArchitekturDokument8 SeitenArh.3 Griechische ArchitekturMarius CristianNoch keine Bewertungen
- Säure/Basen TabelleDokument4 SeitenSäure/Basen TabellePsycholytic_elf100% (2)
- Marie-Louise. Vollenweider - Deliciae Leonis. Antike Geschnittene Steine Und Ringe Aus Einer Privatsammlung. (1984, Philip Von Zabern Verlag)Dokument451 SeitenMarie-Louise. Vollenweider - Deliciae Leonis. Antike Geschnittene Steine Und Ringe Aus Einer Privatsammlung. (1984, Philip Von Zabern Verlag)thierryNoch keine Bewertungen
- Essay KunstgeschichteDokument55 SeitenEssay Kunstgeschichtedilara aNoch keine Bewertungen
- Referat NotizenDokument7 SeitenReferat NotizenMert ÖzbilginNoch keine Bewertungen
- Bildschirmfoto 2023-01-30 Um 18.09.29Dokument60 SeitenBildschirmfoto 2023-01-30 Um 18.09.29stumbauer.sarahNoch keine Bewertungen
- Brenk-Reliefs Hadrianstemple EphesusDokument12 SeitenBrenk-Reliefs Hadrianstemple EphesusAnne Hunnell ChenNoch keine Bewertungen
- EpocheneinteilungDokument2 SeitenEpocheneinteilungTKNoch keine Bewertungen
- Offene Fragen - KG1Dokument13 SeitenOffene Fragen - KG1dilara aNoch keine Bewertungen
- Der Schalenstein Von Romanos, Provinz Zaragoza, Aragón, SpanienDokument8 SeitenDer Schalenstein Von Romanos, Provinz Zaragoza, Aragón, SpanienpelardaNoch keine Bewertungen
- PlastikDokument1 SeitePlastikSevinc CakircaNoch keine Bewertungen
- Atlasz, Synagogen-Baustil in Achtzehn Jahrhunderten (1940)Dokument29 SeitenAtlasz, Synagogen-Baustil in Achtzehn Jahrhunderten (1940)Dan PolakovicNoch keine Bewertungen
- Kunstgeschichte ZusammenfassungDokument17 SeitenKunstgeschichte Zusammenfassungdilara aNoch keine Bewertungen
- Gotik ZusammenfassungDokument3 SeitenGotik ZusammenfassungFranziNoch keine Bewertungen
- GGP MitschriftDokument10 SeitenGGP Mitschriftminecraft.progamer2736Noch keine Bewertungen
- Anmerkungen Zur Ausstellung "Meisterwerke Aus Oesterreich" Im Kunstgewerbemuseum ZürichDokument9 SeitenAnmerkungen Zur Ausstellung "Meisterwerke Aus Oesterreich" Im Kunstgewerbemuseum ZürichflorenciacolomboNoch keine Bewertungen
- Andreas Lippert, Das Archäologische Bild Der Frühen IllyrerDokument12 SeitenAndreas Lippert, Das Archäologische Bild Der Frühen IllyrerZijad Halilovic100% (1)
- Türk Arkeoloji Dergisi (1956) VI-2Dokument90 SeitenTürk Arkeoloji Dergisi (1956) VI-2Mustafa GünerNoch keine Bewertungen
- Vonkaenel FoFra-2012 02 83-88Dokument5 SeitenVonkaenel FoFra-2012 02 83-88schorleworleNoch keine Bewertungen
- Die Geburt Der Stadt - Teil1Dokument6 SeitenDie Geburt Der Stadt - Teil1Dmaina09uNoch keine Bewertungen
- Wilamowitz Glaube Hellenen PDFDokument1.093 SeitenWilamowitz Glaube Hellenen PDFvitalitas_1Noch keine Bewertungen
- Teil 3Dokument39 SeitenTeil 3Friederike KunathNoch keine Bewertungen
- Realismus Und Individualität in Griechischen Porträt Des 5. Und 4. Jh. v. Chr. - Stefanie Buder PDFDokument47 SeitenRealismus Und Individualität in Griechischen Porträt Des 5. Und 4. Jh. v. Chr. - Stefanie Buder PDFikchenNoch keine Bewertungen
- Loebbecke Etruskische Gräber 2017Dokument46 SeitenLoebbecke Etruskische Gräber 2017uctunninger17Noch keine Bewertungen
- Antike Maße Und GewichteDokument3 SeitenAntike Maße Und GewichteStefanBergNoch keine Bewertungen
- IK 4 AssosDokument150 SeitenIK 4 AssosupitiusNoch keine Bewertungen
- Architektur Und Baugeschichte 1 AntikeDokument40 SeitenArchitektur Und Baugeschichte 1 AntikeMustafa Bannoud100% (1)
- Romanik Bis BarockDokument20 SeitenRomanik Bis Barockcorinna.robinNoch keine Bewertungen
- Steinzeit Astronauten Reinhard HabeckDokument12 SeitenSteinzeit Astronauten Reinhard Habeck13christine100% (1)
- Historia Del Traje en Desarrollo Cronológico I de A. RacinetDokument490 SeitenHistoria Del Traje en Desarrollo Cronológico I de A. RacinetResidenciaGeriátricaLaManzanilla100% (1)
- Kriz Evi U Novovjekovnim Grobovima UpneDokument20 SeitenKriz Evi U Novovjekovnim Grobovima UpneAna Azinovic BebekNoch keine Bewertungen
- Die Antiken Münzen / Alfred Von Sallet Neue Bearb. Von Kurt ReglingDokument152 SeitenDie Antiken Münzen / Alfred Von Sallet Neue Bearb. Von Kurt ReglingDigital Library Numis (DLN)Noch keine Bewertungen
- Ant ArchDokument34 SeitenAnt Archapi-3753471Noch keine Bewertungen
- PDF of Die Archaisch Griechischen Skulpturen Der Staatlichen Museen Zu Berlin Carl Blumel Full Chapter EbookDokument69 SeitenPDF of Die Archaisch Griechischen Skulpturen Der Staatlichen Museen Zu Berlin Carl Blumel Full Chapter Ebookhildaportuguese6f6100% (5)
- Anadolu Hekate Korpusu Ve Cesitli Muzele-5119908 (PT)Dokument14 SeitenAnadolu Hekate Korpusu Ve Cesitli Muzele-5119908 (PT)adila trubatNoch keine Bewertungen
- Stengel-Die Griechischen KultusaltertumerDokument290 SeitenStengel-Die Griechischen KultusaltertumerIntyaleNoch keine Bewertungen
- Das Erbe Der Griechischen HochkulturDokument3 SeitenDas Erbe Der Griechischen Hochkulturedikkram5954Noch keine Bewertungen
- MA ARCHELAOS Teil 1Dokument172 SeitenMA ARCHELAOS Teil 1c.bayram1329Noch keine Bewertungen
- AKG 02 Objektblatt 08 Neolithische KeramikDokument2 SeitenAKG 02 Objektblatt 08 Neolithische KeramikMarsel SerikovNoch keine Bewertungen
- Die Gymnastik Und Agonistik Der Hellenen Volumen 1Dokument683 SeitenDie Gymnastik Und Agonistik Der Hellenen Volumen 1sehoar4060Noch keine Bewertungen
- Strebersdorf - Historicus.at Römische ArchitekturDokument10 SeitenStrebersdorf - Historicus.at Römische ArchitekturDourianaNoch keine Bewertungen
- Ebook Physical Chemistry For Jee Advanced Part 2 3Rd Edition DPP PDF Full Chapter PDFDokument67 SeitenEbook Physical Chemistry For Jee Advanced Part 2 3Rd Edition DPP PDF Full Chapter PDFernesto.ramos681100% (34)
- SahinDokument99 SeitenSahinGökhan ÇiçekliyurtNoch keine Bewertungen
- Griechische Literaturgeschichte 1 PDFDokument1.040 SeitenGriechische Literaturgeschichte 1 PDFPedro100% (1)
- Der Kessel von Gundestrup: Ursprünge der keltischen MythologieVon EverandDer Kessel von Gundestrup: Ursprünge der keltischen MythologieNoch keine Bewertungen
- Volbach Elfenbeiarbeitender Spatantikeunddesfruhen MittelaltersDokument137 SeitenVolbach Elfenbeiarbeitender Spatantikeunddesfruhen MittelaltersVrato ZervanNoch keine Bewertungen
- Wilke, G. Spiral - Mäander - Keramik Und Gefässmalerei. Hellenen Und Thraker. Würzburg 1910Dokument90 SeitenWilke, G. Spiral - Mäander - Keramik Und Gefässmalerei. Hellenen Und Thraker. Würzburg 1910Aranka MeyerNoch keine Bewertungen
- Korka E and Evaggeloglou P 2019 A CemeteDokument28 SeitenKorka E and Evaggeloglou P 2019 A CemeteDan ABNoch keine Bewertungen
- SI JournalDokument11 SeitenSI JournalbfarkinNoch keine Bewertungen
- Ulrich Arndt - Weg Der LebensenergieDokument5 SeitenUlrich Arndt - Weg Der LebensenergieborichdacoNoch keine Bewertungen
- Wiss Mitt Bosnien Hercegovina - 1 - 1893 - 0035 0038Dokument5 SeitenWiss Mitt Bosnien Hercegovina - 1 - 1893 - 0035 0038Azra SaricNoch keine Bewertungen
- LitzenkeramikDokument16 SeitenLitzenkeramikAndrei Stavilă100% (1)
- Römische Und Griechische ArchitekturDokument22 SeitenRömische Und Griechische ArchitekturlieelisabelowerstNoch keine Bewertungen
- Labyrinthe - Herkunft Und Literarische Varianten - Susanne LilienfeinDokument88 SeitenLabyrinthe - Herkunft Und Literarische Varianten - Susanne LilienfeinMetasepiaNoch keine Bewertungen
- Zinner, Ernst - Die Sternbilder Der Alten AegypterDokument11 SeitenZinner, Ernst - Die Sternbilder Der Alten AegypterRoy FuhrmannNoch keine Bewertungen
- Einheit 3 - Familie & FreundeDokument17 SeitenEinheit 3 - Familie & FreundeAzizul Aizat HalimNoch keine Bewertungen
- Am RothseeDokument5 SeitenAm Rothseethomas.kolb.1Noch keine Bewertungen
- Arabella Kiesbauer - Nobody Is PerfectDokument157 SeitenArabella Kiesbauer - Nobody Is Perfectpatheye2010Noch keine Bewertungen
- BaremDokument1 SeiteBaremMadaNoch keine Bewertungen
- Ticket Darmstadt Paris 3067681768Dokument2 SeitenTicket Darmstadt Paris 3067681768Niklas FentzahnNoch keine Bewertungen
- NTS Mehrwert-Broschüre 2018 Web DSDokument41 SeitenNTS Mehrwert-Broschüre 2018 Web DSAnonymous wOeoZBX2PoNoch keine Bewertungen