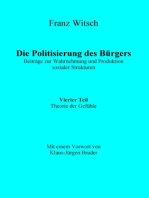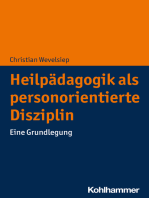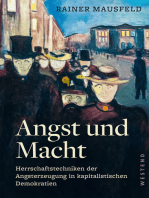Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Das Ende Der Schule
Das Ende Der Schule
Hochgeladen von
alterprofessor0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
13 Ansichten17 SeitenCopyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
13 Ansichten17 SeitenDas Ende Der Schule
Das Ende Der Schule
Hochgeladen von
alterprofessorCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 17
85
Das Ende der Schule so, wie wir sie kennen
Die Gewissheiten, die Menschen ber sich selbst haben ihr
Selbstbewusstsein , ihre Wahrnehmung der Welt sowie ihr da-
raus Iolgendes Verhalten sind untrennbar mit der Ausprgungs-
Iorm der GesellschaIt, in der sie leben, verknpIt. Vom ersten
Tag ihrer Existenz an lernen Menschen sich auI eine bestimm-
te Art und Weise zu begreiIen und der gesellschaItlichen Reali-
tt in einer Form gegenberzutreten, die dieser entspricht. Alle
ihre sozialen Kontakte mit mehr oder weniger gesellschaItlich
integrierten Menschen tragen dazu bei, dass sich bei ihnen eine
Sichtweise der Welt herausbildet, die mit dem aktuellen Gesell-
schaItsregime korreliert. Menschliches Selbstbewusstsein kann
in diesem Sinn als die zur individuellen Persnlichkeit geronne-
ne gouvernementale Struktur der GesellschaIt interpretiert wer-
den. Die spezifsche soziale, religise, ethnische oder sonst wie
defnierte Subkultur, innerhalb der sich jemand bewegt, gibt sei-
nem Selbstkonzept und Weltbild innerhalb einer zugelassenen
Bandbreite eine spezifsche Frbung; eine dem geltenden Ge-
sellschaItsregime in seiner Grundausrichtung widersprechende
Sichtweise auszubilden wrde allerdings gesellschaItliche Aus-
grenzung und die in der jeweiligen gouvernementalen Struktur
geltenden Sanktionen nach sich ziehen. Innerhalb des mgli-
chen Spektrums ist der Einfuss der primren Bezugspersonen
hinsichtlich Selbst- und Weltbewusstsein auIgrund der in ho-
hem Ma gegebenen emotionalen und materiellen Abhngigkei-
ten zumindest in den ersten Lebensjahren sehr hoch. Daneben
bt vor allem die Schule einen tieIgreiIenden und nachhaltigen
Einfuss auI die Formierung des Sozialcharakters aus. Als
eine Spiegelung der sozialen Realitt stellt sie den Trainings-
86
raum dar, in dem Heranwachsende systematisch dazu gebracht
werden, gesellschaItlich adquate Interpretationen dessen, was
ist, sowie die entsprechend stimmigen Reaktionen zu berneh-
men. In diesem Sinn ist die Schule auch ganz besonders geIor-
dert, wenn es zu nachhaltigen Vernderungen des GesellschaIts-
regimes kommt.
Etwa seit den 1970er Jahren lsst sich ein derartiger grundle-
gender gesellschaItlicher Umbruch beobachten, der wesentlich
durch das UmsichgreiIen der InIormations- und Kommunikati-
onstechnologien, die Globalisierung sowie das zunehmende Er-
reichen kologisch bedingter Grenzen ausgelst wurde und sich
in einem Iorcierten Durchdringen aller Lebensbereiche durch
die Marktlogik uert. Die industriegesellschaItlichen Struk-
turen, die sich mit der Moderne herausgebildet hatten, begin-
nen zu erodieren, wodurch sich auch der mit diesen korrelie-
rende Einfuss auI die Interpretationsmuster der Individuen
abzuschwchen beginnt. An ihrer Stelle entwickelt sich eine
verstrkt auI (Selbst)Kontrolle der Individuen auIsetzende Un-
ternehmergesellschaIt, verbunden mit entsprechenden Formen
des Forcierens systemadquater Wahrnehmung und korrelie-
rendem Verhalten. Gilles Deleuze und Michel Foucault, die die
seit mehreren Jahrzehnten vor sich gehenden gesellschaItlichen
Umbrche erstmalig als bergang von der Disziplinargesell-
schaIt zur KontrollgesellschaIt charakterisiert hatten (vgl. ins-
bes.: Deleuze 1993 und Foucault 2010), haben ein wesentliches
Unterscheidungsmerkmal der beiden GesellschaItsIormationen
darin geortet, dass im Industrialismus die prototypische Logik
der Fabrik das Bezugsmodell der sozialen Realitt abgab, in
der postIordistischen KontrollgesellschaIt dagegen eine entspre-
chende Orientierung am Unternehmen stattfndet. Vom indi-
viduellen Verhalten bis zur Politik wird gesellschaItliches Han-
deln in den letzten Jahren immer mehr unter dem Gesichtspunkt
87
unternehmerischer Logik interpretiert; damit Hand in Hand
kommt es zunehmend auch zu einer Modifkation der sozialen
Strukturen im Sinne des Unternehmensmodells.
Um nachvollziehen zu knnen, warum Deleuze und Foucault ge-
rade mit den BegriIIen Disziplinar- und KontrollgesellschaIt
operieren, um den in Gang befndlichen Zeitenbruch bzw. wie
es Deleuze ausgedrckt hat den Beginn von etwas Neuem
(1993: 261) zu charakterisieren, bedarI es einer kurzen begriIIs-
theoretischen Auseinandersetzung. Die Bedeutung des Termi-
nus DisziplinargesellschaIt erschliet sich, wenn man ber die
gngigen negativen Konnotationen, die dem Ausdruck Disziplin
anhaIten Zwang, Sanktion, Bedrohung, BestraIung . , hin-
ausblickt. Denn ber ein derartiges Beschneiden des Lebens
Iokussiert der Terminus Disziplin ja auch das Hervorbringen
grerer Leistungen durch eine straIIe und zielgerichtete Organi-
sation, verbunden mit der BereitschaIt der Mitspieler, sich dem
Organisationsziel weitgehend kritiklos unterzuordnen. OIIenbar
wollten Deleuze und Foucault mit ihrer BegriIIswahl hervorstrei-
chen, dass die GesellschaIt der Moderne insgesamt genau durch
dieses Ideal des zielgerichtet-organisierten Handelns geprgt war
und dieses den GesellschaItsmitgliedern dementsprechend zur
zweiten Natur geworden ist bzw. werden musste. Zur Verinner-
lichung des Disziplinprinzips kam es durch die nahezu lcken-
lose Einbindung der Individuen in von ihnen so genannte
Einschlieungsmilieus: brgerliche KleinIamilie, Schule, Fabrik,
Militr, oItmals Krankenhaus und unter besonderen Umstnden
auch GeIngnis oder Irrenhaus und die dort zur Anwendung ge-
brachten Strategien der Disziplinierung. Die Orientierungsgre
der disziplinarischen Manahmen leitete sich aus dem konomi-
schen Wert des Krpers bzw. dem konomische Nutzen ab, der
zu ArbeitskrIten Iormierten Individuen innewohnt letztes Ziel
aller Disziplinierung war der verwertbare Mensch.
88
Die Bezeichnung KontrollgesellschaIt bringt zum Ausdruck,
dass systemadquates Verhalten der Individuen in der sich ak-
tuell ausdiIIerenzierenden GesellschaItsIormation vor allem
durch das Prinzip permanenter (unterschwelliger) Kontrolle er-
reicht wird. Diese Kontrolle ist die Folge der bereits in hohem
Ma gegebenen und weiterhin rasch anwachsenden Mglich-
keit und systemimmanenten Notwendigkeit des stndigen Zu-
griIIs auI InIormationen. Jederzeit und von berall Daten und
Fakten zu allem und jedem abruIen zu knnen zieht die Kon-
trollierbarkeit von allem und jedem unmittelbar nach sich. Je
mehr Individuen in die Sphre der umIassenden (digitalen) In-
Iormation integriert werden (und sich integrieren lassen ms-
sen!), desto mehr verwandeln sie sich selbst zu digital reprsen-
tierter, jederzeit abruIbarer und weiterbearbeitbarer InIormation,
was in letzter Konsequenz das Ende jedweder Privatsphre be-
deutet. Die zentrale These Deleuze` hinsichtlich der Kontroll-
gesellschaIt lautet dementsprechend, dass Macht in dieser Ge-
sellschaItsIormation nicht durch benennbare Individuen oder
Institutionen ausgebt wird, sondern ein Funktionsmerkmal des
Systems als solches ist. Konsequenz ist, dass es keinen Bereich
des Daseins gibt, der vor dem ZugriII der Macht geschtzt wer-
den kann. AuI dieser Nichtidentifzierbarkeit spezifscher Ver-
krperungen der Macht beruht letztlich die Wirksamkeit der
KontrollgesellschaIt Macht wirkt in ihr quasi automatisch,
Machtkritik fndet kein identifzierbares Gegenber. Das Be-
wusstsein der solcherart gegebenen permanenten Kontrollier-
barkeit (was nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem Wissen
ber tatschlich angewandte Formen der Kontrolle ist) wird zum
bestimmenden Element des allgemeinen Empfndens. Die inIor-
mationstechnische AuIbereitung der Welt wird Ir Menschen
im selben Ma zur Selbstverstndlichkeit wie das Bewusstsein,
dass es unmglich ist, irgendetwas vor der allgemeinen Sicht-
89
barkeit verbergen zu knnen. Nicht mehr das Eingebunden-
sein in gesellschaItliche Subsysteme und die dadurch gegebe-
nen Mglichkeiten des disziplinierenden ZugriIIs derselben sind
Voraussetzung Ir das Ausbilden des GesellschaItscharakters
(Erich Fromm). Wohlverhalten der Individuen beruht nun
auI dem Bewusstsein einer dem Dasein immanenten Kontrolle
und uert sich in Ireiwilliger Selbstkontrolle (vgl. Pongratz
2004). Ihre stndige Sicht- und Kontrollierbarkeit bewirkt, dass
Individuen ihr Entwicklungspotential blo noch in einer Form
zur Geltung bringen, die den Ansprchen des gesellschaItlichen
Systems entspricht.
Die DisziplinargesellschaIt hatte sich parallel mit dem Entste-
hen des brgerlich-kapitalistischen Systems als die adquate
Form des Etablierens und Erhaltens der dem System entspre-
chenden Machtstrukturen herausgebildet. Fr das Funktionieren
der Massenproduktion war ein Heer an ArbeitskrIten mit zu-
mindest ausreichend vorhandener Basis(aus)bildung erIorder-
lich. Zur Sicherstellung der (Re)Produktion des mit der kapi-
talistischen konomie verknpIten HerrschaItssystems galt es
allerdings hintanzuhalten, dass sich das den Massen notgedrun-
gen vermittelte Wissen zu einer machtkritischen Gre weiter-
entwickelt. Es bedurIte einer Form der Macht, die mit HilIe der
Ideologie, es sei Ir alle die Mglichkeit gegeben, durch Arbeit
an sich selbst jede gesellschaItliche Position zu erreichen, zwar
den demokratischen Schein Iormeller Gleichheit verbreitete, da-
bei aber dennoch die konkret herrschenden Ungleichheiten der
brgerlichen (Klassen)GesellschaIt absicherte. Die Erfndung
der Disziplin als die dem Menschen angemessene Orientierung
der LebensIhrung stellte in diesem Sinn eine machtstrategische
Meisterleistung dar (vgl. Patzner 2005: 54). Sie nahm das auI-
geklrte Individuum an die Kandare systemadquaten Wohlver-
haltens. Die Disziplinargewalt ist die dem brgerlich-kapitalisti-
90
schen System entsprechende FhrungsIorm, durch sie wurde die
systemgeme Selbstinterpretation der Individuen abgesichert,
die zentral an der Vorstellung der individuellen Lebensverbes-
serung durch besondere Brauchbarkeit als ArbeitskraIt ausge-
richtet war.
Um angemessen ber die Runden zu kommen, war es demge-
m in der DisziplinargesellschaIt erIorderlich, vor allem jene
(Sekundr)Tugenden zur EntIaltung zu bringen, die sich im Zuge
des brgerlichen Kapitalismus herausgebildet hatten. Zu den In-
dikatoren des disziplinierten Subjekts zhl(t)en in erster Linie
Ordnung, Sauberkeit, Flei, Bestndigkeit, Pnktlichkeit, Gehor-
samkeit und Selbstbeherrschung. Das Bezugsmodell der Diszi-
plinargesellschaIt die Fabrik setzt das IriktionsIreie Zusam-
menwirken problemlos Iunktionierender Rdchen im Getriebe
voraus. Dementsprechend ging es in den Einschlieungsmilieus
der IndustriegesellschaIt jenen gesellschaItlichen Bereichen,
die die Funktion der TransIormation der Individuen zu diszipli-
nierten Subjekten hatten stets um das Herstellen des optimal
an gesellschaItlich-konomische Vorgaben angepassten und so-
mit hinsichtlich seiner Verwertbarkeit abschtzbaren, letztendlich
also des berechenbaren Menschen. Ziel war die disziplinier-
te ArbeitskraIt, die sich durch hohes Arbeitsethos, ein veritab-
les Ma an Autorittshrigkeit sowie die BereitschaIt auszeich-
net, sich weitgehend kritiklos im Rahmen eines hierarchischen
Systems ntzlich zu machen, und darber hinaus auch ber-
zeugt ist, (nur) Ir eine bestimmte Position der gesellschaItlichen
Hierarchie begabt zu sein. Seitdem die allgemeine Lernpficht
Ir Heranwachsende eingeIhrt worden war, war es in diesem
Sinn eine ganz wichtige Funktion der Schule gewesen, die Ge-
sellschaItsmitglieder zum Akzeptieren der sozialen Hierarchie zu
bringen, indem sie lernen, ErIolg oder Versagen als individuell
mehr oder weniger gegebene LeistungsIhigkeit zu interpretieren.
91
Die traditionell antrainierte BereitschaIt zur Brauchbarkeit,
verbunden mit dem weitgehenden Akzeptieren der qua Erstaus-
bildung zugewiesenen Position, reicht allerdings immer weni-
ger, um sich im aktuell herausbildenden kontrollgesellschaIt-
lichen Modus zu bewhren. Bedingt durch die technologische
Substituierbarkeit menschlicher ArbeitskraIt in einem bisher
noch nie dagewesenen UmIang ist der Kapitalismus in eine neue
Phase seiner Entwicklung getreten. Die Zeiten, die von einer
permanenten Expansion der Verwertung von ArbeitskrIten ge-
kennzeichnet waren, sind vorbei, in seiner nunmehrigen neoli-
beralen Variante (ber)lebt der Kapitalismus durch die Intensi-
vierung der Verwertung. Die Ausbeutung jener Fhigkeiten von
Menschen, die in traditionellen schulischen Settings lehr- und
lernbar sind, wird den VerwertungserIordernissen zunehmend
nicht mehr gerecht, nun gilt es Menschen in einer wesentlich
ganzheitlicheren Form Ir das System zu vereinnahmen. Es geht
darum, ihren EinIallsreichtum, ihre KritikIhigkeit, ihre Lust am
Spiel, ihre schpIerischen Fhigkeiten, ihre Kommunikations-
Ireudigkeit, ., kurzum, den vollen UmIang ihres menschlichen
Potentials zu mobilisieren. Der durch InIormations- und Kom-
munikationstechnologie mglich (und im Sinne des Verwer-
tungszwangs auch notwendig) gewordenen AusprgungsIorm
der Kapitalverwertung ist die brgerliche Spielart des Kapita-
lismus nicht mehr adquat; zunehmend bildet sich ein nach-
brgerlich politisch-konomisches System heraus, dem die
brgerlich-disziplinierte Haltung als ArbeitskraIt obsolet ist. In
diesem nachbrgerlichen Kapitalismus stellt es letztendlich ein
Verwertungshandicap dar, in Form von diszipliniertem, vorga-
bengemem Verhalten blo die BereitschaIt zu signalisie-
ren, sich als ArbeitskraIt brav verwerten lassen zu wollen, das
wirkliche Leben aber auerhalb der Verwertungssphre anzu-
siedeln.
92
Um erIolgreich ber die Runden kommen und sich gegen die
Konkurrenz behaupten zu knnen, gilt es nunmehr die eige-
ne Verwertung mit ungebremstem Engagement und intrinsi-
scher Motivation autonom zu organisieren. Dazu ist es vor al-
lem notwendig, die Trennung des Lebens in einen Bereich der
Fremdbestimmung die Arbeit und einen der Selbstbestim-
mung die Freizeit auIzugeben. Es gilt anzuerkennen, dass
es keinen auerhalb der Verwertungssphre liegenden Sinn
des Lebens gibt. Dem neuen GesellschaItsregime entspricht
nur, wer bereit ist, sich lebenslang als Unternehmer sei-
ner selbst (vgl. Brckling 2007) zu begreiIen und einen So-
zialcharakter auszubilden, der konsequent an der PerIormance
am Markt ausgerichtet ist. Letztendlich heit das, alles Din-
ge, Personen, Beziehungen, . und vor allem eben auch sich
selbst nur mehr im Fokus des Werts wahrzunehmen. ErIolg-
reich zu sein bedeutet, sich dem Prokrustesbett der WarenIr-
migkeit optimal anzupassen nur wer etwas aus sich macht und
am Markt erIolgreich ist, ist etwas wert. Es gilt den Markt als
jene gttliche Instanz anzuerkennen, der es stndig zu dienen
gilt, indem man sich als erIolgreicher Manager bei der Vermark-
tung des Humankapitals erweist, als das man sich voll und ganz
empfndet. Dazu ist nicht nur eine gegenber bisherigen Orien-
tierungen grundstzlich andere Selbstwahrnehmung und Inter-
pretation der Welt erIorderlich, es ist vor allem notwendig, sich
als permanent in Konkurrenz stehend zu begreiIen. Es gilt das
Motto zu verinnerlichen: Du bist dir selbst der Nchste und je-
der andere ist letztendlich dein Gegner.
Ein Unternehmen wird im Gegensatz zur Fabrik eben nicht
von brav Iunktionierenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern in Gang gehalten, sondern erIordert Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich voll und ganz einbringen. Das setzt vor-
aus, dass sich diese mit dem Unternehmensziel das ja in letz-
93
ter Konsequenz stets in der Vermehrung investierten Geldes
besteht identifzieren. Das Unternehmenskonzept vereinnahmt
Individuen in diesem Sinn in einer wesentlich ganzheitlicheren
Form als die Fabrik, deren ZugriII sich auI die materiell-krper-
liche Ebene beschrnkt hatte. Whrend sich die erIolgverspre-
chenden PersnlichkeitseigenschaIten in der zu Ende gehen-
den DisziplinargesellschaIt als das UnterwerIen unter die Not,
die eigene Haut zu Markte tragen zu mssen, zusammenIas-
sen lassen, lsst sich die an Menschen unter den Bedingungen
der herauIdmmernden KontrollgesellschaIt hinsichtlich ihres
Charakters herangetragene Forderung als die Identifkation mit
ihrer Vermarktung beschreiben. Es geht nicht mehr blo um
die der berlebensnotwendigkeit geschuldete BereitschaIt, als
Ware zu Iungieren, sondern um ein diesbezglich autonom
hervorgebrachtes Engagement. Im Korsett der bedingungslosen
Akzeptanz der Verwertungsprmisse gilt es nun Charakterei-
genschaIten wie Flexibilitt, Mobilitt, Eigenverantwortlichkeit
und SelbstIhrung zu entwickeln. Alle dem Menschen innewoh-
nenden Potentiale zur Gestaltung der Welt sollen Ir die Ver-
wertung aktiviert werden. Das nachbrgerliche Subjekt unter-
liegt dem Diktat Iortwhrender Selbstoptimierung im Sinne
eines permanenten Bemhens, seine Marktchancen zu verbes-
sern. Die Vorstellung, als Subjekt selbst Ware zu sein, die einer
andauernden Kontrolle hinsichtlich ihres Marktwerts unterliegt,
verhindert, dass die solcherart Ireigesetzten Potentiale der Men-
schen sie dem Marktgott gegenber skeptisch werden und sie
sich dem Gottesdienst ihrer Verwertung verweigern lsst.
Die skizzierte Ablsung der Disziplinar- durch die Kontroll-
gesellschaIt und der damit einhergehende Druck auI die Ange-
hrigen der GesellschaIt, eine vernderte Selbstwahrnehmung
und Weltsicht zu auszubilden, ist Ir die Schule in doppelter
Hinsicht bedeutsam. Einerseits stellt die Schule ein prototypi-
94
sches Einschlieungsmilieu der DisziplinargesellschaIt dar und
ist von deren Krisen demgem auch in typischer Form betroI-
Ien auch Ir die Schule wird immer oIIensichtlicher, dass sie
nicht mehr zu leisten imstande ist, was sie verspricht: die Vor-
bereitung der Heranwachsenden auI das selbstndige Leben un-
ter dem gegebenen gesellschaItlichen Regime. Als eine Ein-
richtung, die alle Heranwachsenden gleichermaen durchlauIen
mssen, ist die Schule parallel mit der DisziplinargesellschaIt
entstanden und hinsichtlich ihres Selbstverstndnisses mit die-
ser wie die zwei Seiten einer Mnze verbunden; das Ende der
DisziplinargesellschaIt strzt die Schule notgedrungen in eine
existenzielle Krise. Sie war von AnIang an daIr da, die Steige-
rung der KrIte der Massen Ir die Zwecke der Verwertung ih-
rer ArbeitskraIt bei gleichzeitiger Domestizierung der machtkri-
tischen Potenz der Subjekte zu bewirken. Und ihr Gewicht war
diesbezglich immer auch besonders hoch, da sich ihre diszipli-
nierende Wirkung ber einen groen Teil jener Phase im Leben
eines Menschen erstreckt, in der dieser Ir Prgungen beson-
ders empInglich ist. Im Sinne der Tatsache der Schule als diszi-
plinargesellschaItliche Zentraleinrichtung stand die Erziehung
zu Ordnung, Flei und Pnktlichkeit dort immer an vorderster
Stelle die gesamte Organisation und innere Struktur der Schule
ist letztendlich Ausdruck dieser Ausrichtung, und durch sie wur-
de auch das Selbstverstndnis der schulischen Hauptakteure, der
Lehrerinnen und Lehrer, seit den ersten Anstzen ihrer ProIessi-
onalisierung in seinen GrundIesten bestimmt.
Um auch in der KontrollgesellschaIt bei der Formierung des
GesellschaItscharakters eine tragende Rolle zu spielen, msste
sich die Schule somit in ihrer Gestalt grundstzlich verndern.
In letzter Konsequenz msste sie den in allen Aspekten bestim-
menden Charakter als Institution des disziplinierenden ZugriIIs
und die damit verbundene Orientierung an der Iunktionsberei-
95
ten ArbeitskraIt berwinden und sie zu einer Einrichtung ge-
macht werden, die kontrr zu ihrer bisherigen Ausrichtung
der Frderung der, der eigenen Verwertung selbstverantwort-
lich gegenberstehenden, unternehmerischen Persnlichkeit
verschrieben ist. Schule msste sich von einer Einrichtung, die
mit BegriIIen wie Disziplin, Kontrolle, Lenkung, Einschrn-
kung . verbunden ist, zu einer wandeln, die dem kontrollge-
sellschaItlichen Mythos der (Wahl)Freiheit entspricht. Ob ein
derartiger Totalumbau der Schule gelingen kann, ist mehr als
Iraglich. Schule msste daIr eine ganze Reihe von Prmissen
ber Bord werIen, die bisher defnierend Ir ihr Selbstverstnd-
nis waren. Ganz zentral gehrt dazu erstens die rumliche und
zeitliche DiIIerenzierung in einen an Iestgelegten Erkenntnis-
sen ausgerichteten, im Wesentlichen schulisch defnierten Be-
reich des Lernens und einen auerhalb der Schule angesiedel-
ten Bereich der Freizeit, zweitens die Sichtweise von Lernen
als einen Akt der UnterwerIung sowie drittens der Anspruch,
die Zentraleinrichtung der Zuweisung von Lebenschancen zu
sein. Die genannten Felder der Vernderungsnotwendigkeiten
markieren zugleich auch die Bereiche, in denen sich die aktu-
elle Krise der Schule maniIestiert: Schule wird kritisiert, weil
sie es nicht schaIIt, zu einem integralen Element einer sich ber
das ganze Leben erstreckenden Selbstverstndlichkeit des sys-
temerhaltenden Lernens zu werden, und es ihr als Folge da-
von auch nicht gelingt, die entsprechende Haltung in den Kp-
Ien ihrer Besucher zu verankern; sie wird kritisiert, weil sie es
nicht schaIIt, Lernen vom Makel des Zwangs und der Notwen-
digkeit zu beIreien; und sie wird schlielich kritisiert, weil sie
noch immer daran Iesthlt, Menschen anhand veralteter Kri-
terien der Intellektualitt beurteilen zu wollen, und nicht ein-
sieht, dass nicht die Schule, sondern der Markt entscheidet, wer
zu Hherem beruIen ist.
96
Dabei bemhen sich alle Ir die Gestaltung der Schule Zustndi-
gen seit etlichen Jahren redlich um die Umgestaltung von deren
innerer und uerer Organisation. Innerhalb weniger Jahrzehn-
te hat die Schule wesentliche Aspekte der von Foucault (1994)
herausgearbeiteten Strukturelemente, Prozeduren und Techniken
von Disziplinaranlagen deutlich abgebaut. Zuallererst wurde der
vordergrndig disziplinierende ZugriII auI die Krper der Sch-
lerinnen und Schler reduziert Katheder wurden entIernt, in vie-
len Fllen die Frontalsitzordnung auIgelst, typische Schulmbel
aus den Klassen verbannt, Grurituale und ritualisierte Formen
der Kommunikation sowie Regeln, die Sitzhaltung der Schle-
rinnen und Schler betreIIend, zurckgenommen. Des Weiteren
beginnt sich die ehemals Iast vllig geschlossene Einrichtung,
in der Schlerinnen und Schler einer strikten rumlichen und
zeitlichen Kontrolle unterworIen waren und in der Lernen bis auI
minimale Ausnahmen vor Ort stattIand, durch vernderte For-
men der Unterrichtsorganisation und die IInung der Schule ge-
genber externen Lernanlssen langsam zu IInen. In den letz-
ten Jahren sind darber hinaus vielIach Anstze zu beobachten,
die disziplinierende Wirkung des Lernens aller Schlerinnen und
Schler im Gleichtakt und nach demselben Lehrplan auIzuge-
ben. Dabei bt die von oben vorgegebene, als eIIektiv und
eIfzient behauptete Strukturierung von LernstoII und Zeit ihren
sakrosankten Charakter ja nicht nur durch individualisierte For-
men der Lernorganisation ein, sondern auch durch die Mglich-
keit von Schlerinnen und Schlern, in einzelnen Gegenstnden
zu versagen, aber dennoch auIzusteigen und die PrIung Ir das
entsprechende StoIIgebiet losgelst von irgendeiner Vermitt-
lungssystematik spter abzulegen. Zudem lsst sich in den letz-
ten Jahrzehnten ein deutlicher Abbau der das Schulleben vordem
prgenden Autoritt der Reprsentanten schulischer Disziplin,
der Lehrerinnen und Lehrer und SchulauIsichtsorgane, beobach-
97
ten. AngeIangen beim Reduzieren und In-enge-Bahnen-Zwin-
gen der BestraIungsmacht von Lehrerinnen und Lehrern ber die
Mglichkeit des rechtlichen Vorgehens gegen negative Beurtei-
lungen bis hin zur zwischenzeitlich weitgehend selbstverstndli-
chen Pficht von Lehrerinnen und Lehrern, lernorganisatorische
Manahmen gegenber den Eltern von Schlerinnen und Sch-
lern rechtIertigen zu mssen, ist das AutorittsgeIge der Schule
massiv ins Wanken geraten.
Seit vielen Jahren kann somit von einer sukzessiven Erosion
der disziplinierenden Wirkung schulischer Settings gesprochen
werden. Didaktische Anstze bzw. schulorganisatorische nde-
rungen, in denen sich der Wandel im Charakter der Schule wi-
derspiegelt, gruppieren sich um die Schlagwrter: IInung der
Schule, Schulautonomie, DiIIerenzierung bzw. Individualisie-
rung des Unterrichts, oIIener Unterricht, Projektunterricht oder
Objektivierung der Benotung durch VerIahren zur Reduzierung
der subjektiven Beeinfussung derselben durch die Lehrerin/
den Lehrer, wie beispielsweise die Zentralmatura. berwiegend
werden die skizzierten Vernderungen positiv, als Tendenzen
der Verringerung des machtIrmigen ZugriIIs der Schule auI
ihre Besucherinnen und Besucher interpretiert; vereinzelt wird
allerdings auch bedauernd von einem VerIall der schulischen
Mglichkeiten gesprochen, die ihr Anvertrauten zu konsequen-
tem Lernen zu bewegen. Beide Interpretationen gehen aller-
dings weitgehend am Kern dessen vorbei, worum es beim statt-
fndenden Wandel geht tatschlich muss dieser viel eher in der
Dimension hektischer Versuche begriIIen werden, die zentra-
le Funktion der Schule als Einrichtung der Einpassung Heran-
wachsender in die strukturellen Bedingungen der GesellschaIt
auIrechtzuerhalten und die Schule in diesem Sinn von einer dis-
ziplinargesellschaItlichen Zentraleinrichtung zu einer solchen
der KontrollgesellschaIt umzugestalten.
98
Weiter vorne wurde die auI Foucault zurckgehende Erkenntnis
skizziert, dass sich gesellschaItliche Ausprgungen ber korrelie-
rende RationalittsIormen bzw. Denkweisen der GesellschaIts-
mitglieder etablieren und perpetuieren bzw. dass anders aus-
gedrckt die Akzeptanz des gegebenen HerrschaItssystems
durch das massenhaIte Verinnerlichen der dieser entsprechenden
Selbstinterpretation der Individuen und ihrer Sichtweise der Welt
erreicht wird. Der aktuell vor sich gehende Wandel in der Erschei-
nungsIorm von Schule stellt in diesem Sinn eine Modifkation des
in dieser wirkenden heimlichen Lehrplans dar. Der als berset-
zung des englischen Terminus hidden curriculum in den 1960er
Jahren im deutschen Sprachraum eingeIhrte BegriII streicht her-
vor, dass die oIfziell vermittelten Inhalte nur einen Bruchteil
dessen ausmachen, was Schlerinnen und Schler in der Schu-
le lernen, wesentlich lernen sie darber hinaus durch ihr Einge-
bundensein in die dortigen Strukturen. Indem sie die Denkwei-
sen, Strategien und Verhaltensweisen verinnerlichen, die ihnen
ermglichen, im System Schule das ja als Subsystem der Ge-
sellschaIt nichts anderes als deren Spiegelung darstellt gut ber
die Runden zu kommen, lernen sie im Sinne des gesellschaItli-
chen Systems zu Iunktionieren. Der heimliche Lehrplan stellt so-
mit das klammheimliche kaum je hinterIragte, aber genau
deshalb ganz besonders wirkungsvolle Mittel der Unterordnung
von Heranwachsenden unter die in der GesellschaIt vorhandenen
Machtstrukturen dar, und er ist zugleich jenes Instrument, das we-
sentlich daran beteiligt ist, dass ihnen dieses System schlielich
als derart natrlich erscheint, dass sie es auch weitertragen wol-
len. Der heimliche Lehrplan ist somit ein ganz wesentlicher Teil
der Gouvernementalitt, jener Regierungsstrategie des modernen
demokratischen Kapitalismus, die darauI abzielt, Menschen dazu
zu bringen, letztendlich gar nicht anders zu knnen, als sich im
Sinne des Systems selbst zu Ihren (vgl. Foucault 2010).
99
Die mglicherweise im ersten Anschein als Verringerung des
ZugriIIs der gesellschaItlich gegebenen Macht auI junge Men-
schen und als gewonnene Freiheit erscheinenden skizzierten
Vernderungen der Schule entpuppen sich im Sinne der ange-
sprochenen gouvernementalen Technik sehr schnell als Strate-
gien, um Heranwachsende Ir die herauIdmmernden kontroll-
gesellschaItlichen Strukturen Iunktionstauglich zu machen. In
Zeiten, in denen kaum mehr ein Bereich der GesellschaIt aus-
zumachen ist, der nicht von Marktlogik erIasst ist, und es somit
tatschlich schon Iast so weit ist, dass um Marx (2008: 35/36)
zu paraphrasieren auch die letzten Reste Ieudaler, patriarcha-
lischer, idyllischer Verhltnisse! zerstrt sind und jede Bezie-
hung zwischen Menschen, inklusive der von Menschen zu sich
selbst, die nicht auI Berechnung beruht, als gerechtIertigter
Konkurrenznachteil empIunden wird, ist die Ir Disziplinaran-
lagen charakteristische EngIhrung von Handlungsspielrumen
im Schulkontext dysIunktional geworden. Der postbrgerliche
Kapitalismus braucht zu seinem WeiterIunktionieren Menschen,
die als Unternehmer ihrer selbst agieren derartige Menschen
bilden sich nur unter Rahmenbedingungen heraus, in denen Fle-
xibilitt, Kreativitt und Selbstorganisation zentrale Struktur-
merkmale sind. Was sich als neue schulische Freiheit prsen-
tiert, ist somit letztendlich nur ein Element der machtvollen
Durchsetzung des erwnschten GesellschaItscharakters. Da es
sich bei der KontrollgesellschaIt allerdings nicht um eine den
Kapitalismus transzendierende GesellschaItsIormation, sondern
um eine radikalisierte SpielIorm desselben handelt, bleiben auch
die neuen AusprgungsIormen von Schule im Gehuse des ka-
pitalistischen Vermarktungszwanges geIangen auch die Frei-
heit des Unternehmers !"#$"% !"'(!) erschpIt sich in der Markt-
Ireiheit, also darin, sich am Markt uneingeschrnkt Ieilbieten zu
drIen.
100
Dass Schulen heute in anwachsendem Ma unterschiedliche
Kulturen des Lehrens/Lernens und der internen Kommunikation
ausbilden, spezifsche Schwerpunkte hinsichtlich der vermittel-
ten Inhalte sowie bezglich der verIolgten Erziehungsziele set-
zen und oItmals versuchen, traditionelle Strukturen der Diszip-
linierung abzubauen, indiziert nur im ersten Anschein Schritte
in Richtung einer BeIreiung von Zwngen. Tatschlich stel-
len die neuerdings gewhrte uere und innere Autonomie von
Schulen und die durch sie ausgelsten Tendenzen der Reduzie-
rung disziplinierender Strukturen nur zeitgeme Formen der
Zurichtung Heranwachsender im Sinne ihrer Verwertbarkeit dar.
Diese Erkenntnis Ihrt bei verschiedenen Autorinnen und Auto-
ren dazu, die zunehmend erodierenden, traditionellen Formen
der schulischen Bearbeitung der der Verwertung zuzuIhrenden
Subjekte nostalgisch zu verklren. Es muss deshalb ausdrck-
lich betont werden, dass auch wenn die konomistische Aus-
richtung in Irheren Argumentationen nur selten derart deutlich
wie heute in den Vordergrund gerckt wurde auch die alte
Schule in erster Linie eine ZulieIerinstanz Ir brauchbares Hu-
mankapital gewesen ist. Die Ir alle verpfichtende Schule wurde
installiert, um Heranwachsende auI das Leben in der auI sie zu-
kommenden gesellschaItlichen Formation vorzubereiten. Dazu
gehrt einerseits, sie Ir ihre vorgesehene Rolle in der Gesell-
schaIt brauchbar zu machen, und andererseits, ihnen beizubrin-
gen, die gegebene gesellschaItliche Ordnung zu beIrworten.
Diese integrative Funktion der Schule wurde selbstverstndlich
zu allen Zeiten ideologisch verbrmt. Whrend sich die klassi-
schen disziplinargesellschaItlichen Beschnigungen der Anpas-
sung (bildungs)brgerlicher ZentralbegriIIe wie AuIklrung
oder Mndigkeit bedienten, ist der ideologische berbau der
KontrollgesellschaIt an nachbrgerlichen, idealistisch gewen-
deten Notwendigkeiten des gesellschaItlichen berlebens aus-
gerichtet. Die neuen wesentlich auch durch die Schule trans-
portierten beschnigenden Umschreibungen der Zurichtung
zur Brauchbarkeit changieren deshalb heute um BegriIIe wie
Selbstndigkeit, Eigenverantwortung, SelbstIhrung
oder Autonomie. Das Ziel hinter der ideologisch neu einge-
Irbten Vorbereitung Heranwachsender auI das Leben in der Ge-
sellschaIt bleibt aber unverndert die Unterordnung von Men-
schen unter die herrschenden Strukturen der Macht.
!"#$%&#'%
Brckling, Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjekti-
vierungsIorm. Suhrkamp, FrankIurt/Main 2007.
Deleuze, Gilles: Postskriptum ber die KontrollgesellschaIten. In: Deleu-
ze, G.: Unterhandlungen 19721990, Suhrkamp, FrankIurt/Main 1993,
254262.
Foucault, Michel: Kritik des Regierens. SchriIten zur Politik. Suhrkamp,
Berlin 2010.
Foucault, Michel: berwachen und StraIen. Die Geburt des GeIngnisses.
Suhrkamp, FrankIurt/Main 1994.
Marx, Karl/Engels, Friedrich: ManiIest der Kommunistischen Partei. Edi-
ted by Salvio M. Soares. MetaLibri, 31. Oktober 2008, v1.0s.
Patzner, Gerhard: Schule im Kontext neoliberaler Gouvernementalitt. In:
Breit, H., Rittberger, M., Sertl, M. (Hg.): KontrollgesellschaIt und Schu-
le. SchulheIt 118/2005, Studienverlag, Innsbruck 2005.
Pongratz, Ludwig: Freiwillige Selbstkontrolle. In: Ricken, N./Rieger-La-
dich, M. (Hg.): Michel Foucault. Pdagogische Lektren, Wiesbaden
2004, 243260.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Inklusion Und ExklusionDokument50 SeitenInklusion Und Exklusionefmiz100% (2)
- Luhmann Soziologische Aufklarung 2 PDFDokument221 SeitenLuhmann Soziologische Aufklarung 2 PDFMisty Richardson100% (3)
- HABERMAS Technik Und Wissenschaft Als IdeologieDokument41 SeitenHABERMAS Technik Und Wissenschaft Als IdeologieLasauge Ensoie100% (2)
- SoziologiezusammenfassungDokument47 SeitenSoziologiezusammenfassungHelena Logodska100% (2)
- Hans Kelsen, Begriff Des Staates Und Die Sozialpsychologie KopieDokument45 SeitenHans Kelsen, Begriff Des Staates Und Die Sozialpsychologie KopieHeraklitNoch keine Bewertungen
- Soziologie KlausurfragenDokument15 SeitenSoziologie Klausurfragenchrismantt100% (3)
- Die Multipersonelle Gesellschaft: Der Versuch einer Gegenwartsdiagnose und deren Anwendung auf die RollentheorieVon EverandDie Multipersonelle Gesellschaft: Der Versuch einer Gegenwartsdiagnose und deren Anwendung auf die RollentheorieNoch keine Bewertungen
- Subjektivitäten Ins Zentrum StellenDokument7 SeitenSubjektivitäten Ins Zentrum StellenNiklas ReeseNoch keine Bewertungen
- Das Handeln der Systeme: Soziologie jenseits des Schismas von Handlungs- und SystemtheorieVon EverandDas Handeln der Systeme: Soziologie jenseits des Schismas von Handlungs- und SystemtheorieNoch keine Bewertungen
- Kausalität Im SüdenDokument36 SeitenKausalität Im SüdenAnne HolzapfelNoch keine Bewertungen
- Peters, Die - Dialektik - Von - Freiheit - Und - KontrolleDokument6 SeitenPeters, Die - Dialektik - Von - Freiheit - Und - KontrolleMartin ZimmermannNoch keine Bewertungen
- Erich Unger - Politik Und Metaphysik 1921Dokument59 SeitenErich Unger - Politik Und Metaphysik 1921rienaregarderNoch keine Bewertungen
- Docupedia Wiede Subjekt Und Subjektivierung v3 de 2020Dokument42 SeitenDocupedia Wiede Subjekt Und Subjektivierung v3 de 2020ShaniceNoch keine Bewertungen
- Sozialkritik und soziale Steuerung: Zur Methodologie systemangepasster AufklärungVon EverandSozialkritik und soziale Steuerung: Zur Methodologie systemangepasster AufklärungNoch keine Bewertungen
- Thomas Ziehe Post-Enttraditionalisierung" Beobachtungen Zu Einer Veränderten Stimmungslage Heutiger JugendlicherDokument13 SeitenThomas Ziehe Post-Enttraditionalisierung" Beobachtungen Zu Einer Veränderten Stimmungslage Heutiger JugendlicherSteinar Bjørk-LarsenNoch keine Bewertungen
- Die körperliche Konstruktion des Sozialen: Zum Verhältnis von Körper, Wissen und InteraktionVon EverandDie körperliche Konstruktion des Sozialen: Zum Verhältnis von Körper, Wissen und InteraktionNoch keine Bewertungen
- Die Körperlichkeit sozialen Handelns: Soziale Ordnung jenseits von Normen und InstitutionenVon EverandDie Körperlichkeit sozialen Handelns: Soziale Ordnung jenseits von Normen und InstitutionenNoch keine Bewertungen
- Jenseits des Leistungsprinzips: Soziale Ungleichheit in der funktional differenzierten GesellschaftVon EverandJenseits des Leistungsprinzips: Soziale Ungleichheit in der funktional differenzierten GesellschaftNoch keine Bewertungen
- Otthein Rammstedt 1981 - Soziale BewegungDokument6 SeitenOtthein Rammstedt 1981 - Soziale BewegungClarinNoch keine Bewertungen
- Kritik des Transhumanismus: Über eine Ideologie der OptimierungsgesellschaftVon EverandKritik des Transhumanismus: Über eine Ideologie der OptimierungsgesellschaftNoch keine Bewertungen
- Wolfgang Kersting Sozialstaat Und Gerechtigkeit-WE3Dokument18 SeitenWolfgang Kersting Sozialstaat Und Gerechtigkeit-WE3René SchoemakersNoch keine Bewertungen
- Berliner Journal Für Soziologie Volume 21 Issue 1 2011 (Doi 10.1007/s11609-011-0149-9) Jessé Souza - Jenseits Von Zentrum Und PeripherieDokument16 SeitenBerliner Journal Für Soziologie Volume 21 Issue 1 2011 (Doi 10.1007/s11609-011-0149-9) Jessé Souza - Jenseits Von Zentrum Und Peripherierenato lopesNoch keine Bewertungen
- Meisenheimer, Jens - Das Elend Von Honneths SozialphilosophieDokument10 SeitenMeisenheimer, Jens - Das Elend Von Honneths SozialphilosophieGuacamole Bamako ShivaNoch keine Bewertungen
- Adolf Hitlers "Mein Kampf": Zur Poetik des NationalsozialismusVon EverandAdolf Hitlers "Mein Kampf": Zur Poetik des NationalsozialismusNoch keine Bewertungen
- Die Inklusionslüge: Behinderung im flexiblen KapitalismusVon EverandDie Inklusionslüge: Behinderung im flexiblen KapitalismusNoch keine Bewertungen
- 6 ExzerptDokument3 Seiten6 ExzerptAnneNoch keine Bewertungen
- Essay Über Das GlückDokument9 SeitenEssay Über Das GlückAuraPazNoch keine Bewertungen
- Adorno Postscriptum TXTDokument4 SeitenAdorno Postscriptum TXTAlexander FrancoisNoch keine Bewertungen
- (@) Horkheimer, Max - NachtragDokument4 Seiten(@) Horkheimer, Max - NachtragGuacamole Bamako ShivaNoch keine Bewertungen
- Soziale TheoriemodelleDokument3 SeitenSoziale TheoriemodelleAylin ErdenNoch keine Bewertungen
- Legitimität: Gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Bruchlinien der RechtfertigungVon EverandLegitimität: Gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Bruchlinien der RechtfertigungNoch keine Bewertungen
- Busch Demokratische Persoenlichkeit - 002Dokument14 SeitenBusch Demokratische Persoenlichkeit - 002Dr. Hans-Joachim BuschNoch keine Bewertungen
- Die Prekarisierungsgesellschaft: Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der PrekarisierungVon EverandDie Prekarisierungsgesellschaft: Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der PrekarisierungNoch keine Bewertungen
- Grundlagen und Wandel sozialer Sicherung: Von nationaler Umverteilungsbereitschaft zu postnationaler RedistributionVon EverandGrundlagen und Wandel sozialer Sicherung: Von nationaler Umverteilungsbereitschaft zu postnationaler RedistributionNoch keine Bewertungen
- Die Politisierung des Bürgers, 4.Teil: Theorie der Gefühle: Beiträge zur Wahrnehmung und Produktion sozialer StrukturenVon EverandDie Politisierung des Bürgers, 4.Teil: Theorie der Gefühle: Beiträge zur Wahrnehmung und Produktion sozialer StrukturenNoch keine Bewertungen
- Inklusion und Exklusion: Studien zur GesellschaftstheorieVon EverandInklusion und Exklusion: Studien zur GesellschaftstheorieNoch keine Bewertungen
- Luhmann Uber Organisation ProtestbewegungenDokument21 SeitenLuhmann Uber Organisation ProtestbewegungenFrancois C. Rojas HenostrozaNoch keine Bewertungen
- Theodor W. AdornoDokument11 SeitenTheodor W. AdornoErna Von Der WaldeNoch keine Bewertungen
- Kreativität und soziale Praxis: Studien zur Sozial- und GesellschaftstheorieVon EverandKreativität und soziale Praxis: Studien zur Sozial- und GesellschaftstheorieNoch keine Bewertungen
- URBAN HACKING Als Praktische Und Als Theoretische Kritik Der Öffentlichen Räume.Dokument16 SeitenURBAN HACKING Als Praktische Und Als Theoretische Kritik Der Öffentlichen Räume.Günther FriesingerNoch keine Bewertungen
- Soziologie Des Ideologischen Leo KoflerDokument143 SeitenSoziologie Des Ideologischen Leo KoflerGespenst77Noch keine Bewertungen
- Mythos Bildung: Wieso Bildung Nie Halten Kann, Was Sie VersprichtDokument12 SeitenMythos Bildung: Wieso Bildung Nie Halten Kann, Was Sie VersprichtErich RibolitsNoch keine Bewertungen
- Heilpädagogik als personorientierte Disziplin: Eine GrundlegungVon EverandHeilpädagogik als personorientierte Disziplin: Eine GrundlegungNoch keine Bewertungen
- Kritik und System: Erkenntnistheoretische Grundlagen kritischer TheorieVon EverandKritik und System: Erkenntnistheoretische Grundlagen kritischer TheorieNoch keine Bewertungen
- Die Politisierung des Bürgers, 1. Teil: Zum Begriff der Teilhabe: Beiträge zur Wahrnehmung und Produktion sozialer StrukturenVon EverandDie Politisierung des Bürgers, 1. Teil: Zum Begriff der Teilhabe: Beiträge zur Wahrnehmung und Produktion sozialer StrukturenNoch keine Bewertungen
- Gesellschaft ohne Ideologie - eine Utopie?: Was die Naturwissenschaft von heute zur Gesellschaftsordnung von morgen beitragen kannVon EverandGesellschaft ohne Ideologie - eine Utopie?: Was die Naturwissenschaft von heute zur Gesellschaftsordnung von morgen beitragen kannNoch keine Bewertungen
- Ahlemeyer, Heinrich W. - Was Ist Eine Soziale Bewegung - Zur Distinktion Und Einheit Eines Sozialen Phänomens (1989)Dokument17 SeitenAhlemeyer, Heinrich W. - Was Ist Eine Soziale Bewegung - Zur Distinktion Und Einheit Eines Sozialen Phänomens (1989)fischeumelNoch keine Bewertungen
- Luhmanns Schatten: Zur Funktion der Philosophie in der medialen ModerneVon EverandLuhmanns Schatten: Zur Funktion der Philosophie in der medialen ModerneNoch keine Bewertungen
- Der Wohlfahrtstaat Als Grundbestandteil Des Modernen Demokratischen StaatsgefügesDokument49 SeitenDer Wohlfahrtstaat Als Grundbestandteil Des Modernen Demokratischen StaatsgefügesEmmanouil MavrozaharakisNoch keine Bewertungen
- Jenseits der Person: Zur Subjektivierung von KollektivenVon EverandJenseits der Person: Zur Subjektivierung von KollektivenNoch keine Bewertungen
- Komplexe Freiheit: Konfigurationsprobleme eines Menschenrechts in der globalisierten ModerneVon EverandKomplexe Freiheit: Konfigurationsprobleme eines Menschenrechts in der globalisierten ModerneNoch keine Bewertungen
- Dumont Proseminararbeit FS22 PDFDokument25 SeitenDumont Proseminararbeit FS22 PDFFanny DumontNoch keine Bewertungen
- Vierzig Jahre »Überwachen und Strafen«: Zur Aktualität der Foucault'schen MachtanalyseVon EverandVierzig Jahre »Überwachen und Strafen«: Zur Aktualität der Foucault'schen MachtanalyseNoch keine Bewertungen
- Handcke 04Dokument18 SeitenHandcke 04frawi31Noch keine Bewertungen
- 4 Die Imaginäre Neuordnung Der GesellschaftDokument16 Seiten4 Die Imaginäre Neuordnung Der GesellschaftShailesh Kumar RayNoch keine Bewertungen
- Arbeit Und Anerkennung: Von Axel Honneth (Frankfurt/M.)Dokument15 SeitenArbeit Und Anerkennung: Von Axel Honneth (Frankfurt/M.)Juan Serey AguileraNoch keine Bewertungen
- Digital Storytelling: Pädagogik und Therapie für medial sozialisierte Menschen: Erziehung - Bildung - HeilungVon EverandDigital Storytelling: Pädagogik und Therapie für medial sozialisierte Menschen: Erziehung - Bildung - HeilungNoch keine Bewertungen
- Angst und Macht: Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen DemokratienVon EverandAngst und Macht: Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen DemokratienNoch keine Bewertungen