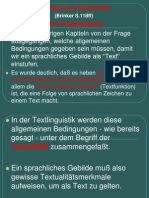Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Semantik
Hochgeladen von
NegarArastehCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Semantik
Hochgeladen von
NegarArastehCopyright:
Verfügbare Formate
Semantik / Semantics
Herausgegeben von / Edited by
Arnim von Stechow
Dieter Wunderlich
Walter de Gruyter
Semantik
Semantics
HSK 6
Handbcher zur
Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft
Handbooks of Linguistics
and Communication Science
Manuels de linguistique et
des sciences de communication
Mitbegrndet von
Gerold Ungeheuer
Herausgegeben von / Edited by / Edits par
Hugo Steger
Herbert Ernst Wiegand
Band 6
Walter de Gruyter Berlin New York
1991
Semantik
Semantics
Ein internationales Handbuch zeitgenssischer
Forschung
An International Handbook of Contemporary
Research
Herausgegeben von / Edited by
Arnim von Stechow Dieter Wunderlich
Walter de Gruyter Berlin New York
1991
Gedruckt auf surefreiem Papier, das die
US-ANSI-Norm ber Haltbarkeit erfllt.
Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme
Handbcher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / mit-
begr. von Gerold Ungeheuer. Hrsg. von Hugo Steger ; Herbert
Ernst Wiegand. Berlin ; New York : de Gruyter.
Teilw. mit Parallelt.: Handbooks of linguistics and commu-
nication science. Frher hrsg. von Gerold Ungeheuer u.
Herbert Ernst Wiegand
NE: Ungeheuer, Gerold [Hrsg.]; Steger, Hugo [Hrsg.]; PT
Bd. 6. Semantik. 1991
Semantik : ein internationales Handbuch der zeitgenssischen
Forschung = Semantics / hrsg. von Arnim von Stechow; Dieter
Wunderlich. Berlin; New York: de Gruyter, 1991
(Handbcher zur Sprach- und Kommunikationswissen-
schaft ; Bd. 6)
ISBN 3-11-012696-6
NE: Stechow, Arnim von [Hrsg.]; PT
Copyright 1991 by Walter de Gruyter & Co., D-10785 Berlin.
Dieses Werk einschlielich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschtzt. Jede Verwertung auerhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulssig und strafbar. Das
gilt insbesondere fr Vervielfltigungen, bersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Satz und Druck: Arthur Collignon GmbH, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Lderitz & Bauer, Berlin
V
Vorwort
Mit dem Ende der sechziger Jahre erlebte die Forschung zur Semantik natrlicher
Sprachen einen lebhaften Aufschwung. In der Linguistik selbst wurde er eingeleitet
durch Arbeiten wie An Integrated Theory of Linguistic Descriptions von Katz & Postal
(1964) und der sogenannten Generativen Semantik (zum Beispiel Lakoffs Linguistics
and Natural Logic and McCawleys A Program for Logic, beide in Davidson & Harman
1972). Die aus der Linguistik kommenden Versuche wurden Anfang der siebziger Jahre
rasch berholt durch drei klassische Aufstze Richard Montagues (English as a Formal
Language, Universal Grammar und The Proper Treatment of Quantification in Ordinary
English, smtlich in Montague 1974). Diese Arbeiten stellen den entscheidenden Durch-
bruch in der linguistischen Semantik dar.
Die Entwicklung der theoretischen Semantik in der Linguistik stand zunchst noch
entscheidend unter dem Einflu von Sprachphilosophen und philosophischen Logikern
(Frege, Russell, Carnap, Austin, Kripke, Montague, Lewis, Kaplan und viele andere),
deren Positionen und Methoden weitgehend bernommen wurden. Inzwischen hat die
Disziplin aber in der Semantik festen Fu gefat, und die differenzierten, aus der
Empirie der natrlichen Sprachen herkommenden Fragestellungen beeinflussen heute
ihrerseits die philosophische Logik und die Kognitionswissenschaften.
Unter den verschiedenen Konzeptionen der Semantik hat sich die Wahrheitsbedin-
gungen-Semantik als besonders einflureich erwiesen. Sie ist zum vorherrschenden
Paradigma der formalen linguistischen Semantik geworden. Die wahrheitskonditionale
Auffassung der Bedeutung von Stzen liegt in irgendeiner Variante allen Beitrgen des
Handbuchs zugrunde und erweist sich so als das einigende geistige Band. Fruchtbar
geworden fr die Linguistik ist vor allem eine spezielle Variante, nmlich die
sogenannte
Mgliche-Welten-Semantik. Sie erlaubt eine formale Rekonstruktion des fr natrliche
Sprachen zentralen Begriffs der Intension.
Die in diesem Rahmen entwickelten Theorien gehen davon aus, da die Bedeutung
eines komplexen Ausdrucks berechenbar sein mu, und verwenden deshalb formale,
insbesondere algebraische (modelltheoretische) Methoden, die die Konstruktion der
Bedeutung kompositional aufgrund des Satzbaus erfassen.
Das Handbuch soll den gegenwrtigen Stand der linguistischen Wahrheitsbedingun-
gen-Semantik verllich dokumentieren. Wir sind zuversichtlich, da die Darstellung
in weiten Teilen klassisch genug ist, um nicht alsbald zu veralten.
Die Teile I bis V des Handbuchs befassen sich mit allgemeineren Fragen der Semantik
(Grundlegung der Disziplin, alternative Konzeptionen wie Situationssemantik, Kom-
positionalitt, Stellung der Semantikkomponente innerhalb des Systems der Gramma-
tik, Allrounderscheinungen der natrlichen Sprache wie: Kontextabhngigkeit und
-vernderung, Vagheit und Mehrdeutigkeit, Prsupposition und Implikaturen, das Ver-
hltnis von Bedeutung und Gebrauch). Es geht also um die allgemeine semantische
Theoriebildung und deren Zuschnitt auf die besonderen Probleme der natrlichen
Sprache.
VI Vorwort
Die Artikel in den Teilen VI bis X befassen sich mit speziellen Erscheinungen
natrlicher Sprachen. Die Gliederung folgt weitgehend der Systematik der klassischen
Grammatik (partes orationis wie Nomen, Pronomen, Adjektiv, Verb usw. und gram-
matische Kategorien wie Tempus, Modus, Aspekt etc.), die allerdings so ergnzt wird,
da diejenigen semantischen Aspekte der Sprache abgehandelt werden, fr die heute
verlliche Ergebnisse vorliegen. Es versteht sich von selbst, da i n einer Disziplin, die
in stndiger Entwicklung begriffen ist, eine Vollstndigkeit der Systematik nicht zu
erreichen war.
Der in Teil XI enthaltene Service-Artikel Formale Methoden in der Semantik
erlaubt ein Nachschlagen von vielfach benutzten Definitionen.
Einer der leitenden Gesichtspunkte bei der Konzeption des Handbuchs war, da
jeder Artikel nach Mglichkeit in sich geschlossen sein sollte. Ausgehend von einzelnen
Sprachphnomenen sollten die vorgeschlagenen Theorien, die Probleme der semanti-
schen Analyse und die offenen oder strittigen Fragen dargestellt werden. Damit waren
gewisse berschneidungen unvermeidbar. Wir haben solche Redundanzen bewut in
Kauf genommen, nicht zuletzt aus der Erwgung heraus, da nur eine Geschlossenheit
der einzelnen Artikel die Gewhr dafr bietet, da sie als Arbeitsgrundlage fr ein-
schlgige akademische Lehrveranstaltungen benutzt werden knnen. Selbstverstndlich
enthlt aber jeder Artikel Querverweise auf andere einschlgige Artikel.
Ein weiterer Gesichtspunkt war die Eigenverantwortlichkeit der Autoren. Zwar liegt
mit der Wahrheitsbedingungen-Semantik eine gemeinsame Grundkonzeption vor, aber
dennoch ist bei dem heutigen Stand der Forschung noch vieles kontrovers. Die Her-
ausgeber haben deshalb nicht immer versucht, zwischen eventuellen Unvertrglichkeiten
verschiedener Positionen zu vermitteln. Ferner wurde darauf verzichtet, die Termino-
logie rigoros zu vereinheitlichen. Auch hat jeder Autor gewisse Vorliegen, was die Wahl
der logischen und grammatischen Notation betrifft. Dies sind Merkmale des persnli-
chen Stils, die wir erhalten wissen wollten.
In einem Punkt sind wir von der Konzeption der Geschlossenheit der Einzelartikel
abgegangen: In den Bibliographien gab es zahlreiche berschneidungen. Separate
Literaturlisten htten den Umfang des Handbuchs betrchtlich vergrert. Deshalb
enthalten die Einzelartikel die Literaturhinweise in Kurzform, whrend sich in Teil XII
die ausfhrliche Gesamtbibliographie befindet. Ein abschlieendes Namens- und Sach-
register soll die Arbeit mit dem Handbuch erleichtern.
Wir mchten den Autoren fr ihre groe Geduld und Mhe danken. Die Arbeit an
dem Handbuch hat viel lnger gedauert als beabsichtigt. Der erste Grund fr die
Verzgerung ist, da die erforderlichen Beitrge nicht in der gewnschten Zeit zusam-
mengebracht werden konnten. Ein weiterer Grund ist, da der Verlag, der das Handbuch
ursprnglich herausbringen wollte, kurz vor Abschlu der redaktionellen Arbeiten seine
Ttigkeit einstellte. Die Herausgeber der Handbuchreihe des Walter de Gruyter Verlages
haben dann dankenswerterweise das Unternehmen bernommen. Die berfhrung in
diese Reihe verlangte weitere nderungen am Handbuch, was erneut zu Verzgerungen
fhrte. Mge das Ergebnis die Beteiligten fr ihre langjhrigen Bemhungen entsch-
digen.
Unser Dank gilt auch den (bislang anonymen) Rezensenten der Beitrge, welche die
fr die Qualitt des Handbuchs entscheidende Arbeit des kritischen Kommentierens
unentgeltlich auf sich genommen haben. Es handelt sich um die folgenden Personen:
VII
R. Buerle, M. J. Cresswell, G. Carlson, J. Groenendijk, F. Hamm, I. Heim, J. Jacobs,
A. Kemmerling, E. Klein, E. Knig, F. von Kutschera, M. Krifka, G. Link, S. Lbner,
A. ter Meulen, M. Pinkal, R. van der Sandt, Ch. Schwarze, P. Staudacher, W. Sternefeld,
M. Stokhof, D. Zaefferer und E. T. Zimmermann.
Wir danken auch Ulrike Haas-Spohn, die die organisatorischen Kontakte mit den
Autoren ber Jahre untersttzt hat. Schlielich danken wir den Dsseldorfer Studen-
tinnen und Studenten, die bei der Anfertigung der Bibliographie und der Register und
beim Korrekturlesen geholfen haben: Esther Damschen, Carola Hhle, Gerhard Jger,
Birgit Gerlach, Steffi Klose und Ingrid Sonnenstuhl-Henning.
Was die beiden Herausgeber betrifft, so schlieen wir uns mit vollem Herzen den
Worten jenes mittelalterlichen Schreiberleins an, das da gesagt hat:
,
,
,
,
,
.
Wie der Fremde sich freut beim Anblick der Heimat,
der Seefahrer, gewahrt er des Hafens,
der Kmpfende, wenn der Sieg da ist,
der Hndler, wenn Gewinn sich einstellt,
der Kranke, wenn Gesundheit wiederkehrt,
So freut sich der Autor beim Anblick des Endes des Buches.
Juli 1991 Arnim von Stechow
Dieter Wunderlich
VIII
Preface
At the end of the sixties the investigation into the meaning of natural languages
developed rapidly. It started with works such as An Integrated Theory of Linguistic
Descriptions by Katz & Postal (1964) and the so-called Generative Semantics (e. g.
Lakoffs Linguistics and Natural Logic and McCawleys A Program for Logic; both in
Davidson & Harman 1972). Very soon these efforts were made obsolete by three
classical essays by Richard Montague (English as a Formal Language, Universal Gram-
mar and The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English, all in Montague
1974). These works constituted the crucial breakthrough in semantic theory.
In the beginning the development of theoretical semantics as a field of linguistics
was largely influenced by language philosophers and philosophical logicians (Frege,
Russell, Carnap, Austin, Kripke, Montague, Lewis, Kaplan, and many others), whose
positions and methods survive to a great extent. In the meantime, theoretical semantics
has gained a foothold in linguistics. From empirical research in particular languages
finely differentiated questions arise and now influence philosophical logic and cognitive
sciences.
Among the different concepts of semantics, truth-conditional semantics has proven
to be especially influential. It has become the predominant paradigm of theoretical
semantics. This approach in one way or another forms the basis for all articles in this
handbook and therefore constitutes its spiritual bond. A particularly productive variant
is Possible World Semantics, which allows a formal reconstruction of the concept of
intension which is crucial to natural languages.
The theories developed in this framework assume that the meaning of a complex
expression has to be computable, and therefore they use formal, especially algebraic
(model-theoretic) methods to construct the meaning compositionally in view of
syntactic
structure.
The aim of the handbook is to document the present state of truth-conditional
semantics in linguistics, which involves theories that can now be termed classical and
we hope will therefore remain valid in the future.
Parts I to V of this handbook deal with more general questions of semantic theory:
the conceptual and ontological foundations of the discipline, the common principles of
semantics, alternative approaches such as situation semantics, the role of composition-
ality, the place of semantics within the system of grammar, the relationship of meaning
and use as shown by all-around properties such as context dependence, context change,
vagueness, ambiguity, presupposition and implicatures.
The articles in parts VI to X are concerned with particular phenomena of natural
languages. They are arranged according to both parts of speech (nouns, pronouns,
verbs and adjectives, etc.) and grammatical categories (tense, mood, aspect, number,
etc.). This division is complemented by those semantic aspects of language which have
been proven to be crucial and particularly fruitful for research. It goes without saying
that in a rapidly changing discipline such as semantics, a completely systematic organ-
ization cannot be found.
Preface IX
Finally, there is a service article in part XI which provides central definitions in
semantics.
One of the main aspects in the conception of this handbook was that every article
should be as self-contained as possible. Focusing on individual linguistic phenomena,
the articles attempt to outline the proposed theories and the specific problems of the
semantic analysis as well as the disputed questions. Thus, to a certain extent overlap
could not be avoided. We allowed for such redundancies in part because only a self-
contained article can be used as a basis in academic lectures. Cross-references are
included in the text.
Another feature is the responsibility of the individual authors. The truth-conditional
semantics may form a common denominator but some of the more specific questions
are still controversial. The editors did not try to intervene when certain incompatibilities
between different authors arose. Each author has a particular preference with respect
to terminology and the logical and grammatical notation. These are features of personal
style which we wanted to maintain. Some articles are written in German, and some in
English.
However, because of numerous overlaps in the literature, all references are included
in one comprehensive bibliography at the end of the book. This final part also includes
an index of subjects and names.
We thank all the authors for their great effort and patience. The work on this handbook
took a lot longer than expected. One reason for this delay was that the required articles
could not be collected within the planned schedule. Another reason was that the original
publisher went out of business. Fortunately, the editors of the handbook series at
Walter de Gruyter were able to step in. This take-over required various changes in the
manuscript and therefore led to a further delay. We hope that the result compensates
all participants for the lenghty wait.
We also thank the referees (who have been anonymous up until now) who undertook
the important task of critically commenting on the articles: R. Buerle, M. J. Cresswell,
G. N. Carlson, J. Groenendijk, F. Hamm, I. Heim, J. Jacobs, A. Kemmerling, E. Klein,
E. Knig, F. von Kutschera, M. Krifka, G. Link, S. Lbner, A. ter Meulen, M. Pinkal,
R. van der Sandt, Ch. Schwarze, P. Staudacher, W. Sternefeld, M. Stokhof, D. Zaefferer
and E. T. Zimmermann.
Thanks also to Ulrike Haas-Spohn who, over the years, helped to organize the
contact with the authors. Finally we thank the students from Dsseldorf who helped
with compiling the bibliography and the indexes as well as the proof-reading: Esther
Damschen, Carola Hhle, Gerhard Jger, Birgit Gerlach, Steffi Klose and Ingrid
Sonnenstuhl-Henning.
As far as the two editors are concerned, we fully agree with the words of the medieval
writer who said:
,
,
,
,
,
.
X
In the same way as strangers are pleased to see their country
and sailors to see the harbour
and warriors to see the victory
and traders to see profit
and invalids to see their recovery
in this way writers enjoy seeing the end of the book.
July, 1991 Arnim von Stechow
Dieter Wunderlich
XI
Inhalt/Contents
Vorwort ........................................................................................................................ V
Preface .......................................................................................................................... VIII
I. Allgemeine Grundlagen
General Foundations
1. John Lyons, Bedeutungstheorien (Theories of Meaning) ............................ 1
2. M. J. Cresswell, Basic Concepts of Semantics (Grundbegriffe der Seman-
tik) ................................................................................................................
24
3. Dieter Wunderlich, Bedeutung und Gebrauch (Meaning and Use) ............. 32
4. Gisbert Fanselow/Peter Staudacher, Wortsemantik (Word Semantics) ........ 53
II. Probleme der ontologischen Grundlegung:
Welt versus Situation
Problems of Ontological Foundation:
World Versus Situation
5. M. J. Cresswell, Die Weltsituation (The World Situation) ........................... 71
6. John Barwise, Situationen und kleine Welten (Situations and Small
Worlds) .........................................................................................................
80
III. Theorie der Satzsemantik
Theory of Sentence Semantics
7. Arnim von Stechow, Syntax und Semantik (Syntax and Semantics) ........... 90
8. M. J. Cresswell, Syntax and Semantics of Categorial Languages (Syntax
and Semantik kategorialer Sprachen) ..........................................................
148
IV. Kontexttheorie
Context Theory
9. Thomas Ede Zimmermann, Kontextabhngigkeit (Context Dependence) .. 156
10. Ulrike Haas-Spohn, Kontextvernderung (Context Change) ....................... 229
11. Manfred Pinkal, Vagheit und Ambiguitt (Vagueness and Ambiguity) ....... 250
V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Semantic Foundations of Speech Acts
12. Gnther Grewendorf/Dietmar Zaefferer, Theorien der Satzmodi (Theo-
ries of Sentence Mood) ................................................................................
270
XII Inhalt/Contents
13. Pieter A. M. Seuren, Prsuppositionen (Presuppositions) ........................... 286
14. Andreas Kemmerling, Implikatur (Implicature) .......................................... 319
15. Rainer Buerle/Thomas E. Zimmermann, Fragestze (Interrogatives) ....... 333
VI. Nominalsemantik
Nominal Semantics
16. Jean-Yves Lerner/Thomas E. Zimmermann, Eigennamen (Proper Nouns) . 349
17. Greg N. Carlson, Natural Kinds and Common Nouns (Natrliche Arten
und Allgemeinnamen) ..................................................................................
370
18. Manfred Krifka, Massennomina (Mass Nouns) ........................................... 399
19. Godehard Link, Plural (Plural) .................................................................... 418
20. Veronika Ehrich, Nominalisierungen (Nominalizations) ............................. 441
VII. Semantik der Funktionswrter
Semantics of Functional Words
21. Jan van Eijck, Quantification (Quantoren) .................................................. 459
22. Irene Heim, Artikel und Definitheit (Articles and Definiteness) ................ 487
23. Tanya Reinhard, Pronouns (Pronomina) ...................................................... 535
24. Peter E. Pause, Anaphern im Text (Textual Anaphors) ................................ 548
25. Joachim Jacobs, Negation (Negation) .......................................................... 560
26. Ewald Lang, Koordinierende Konjunktionen (Coordinative Conjunctions)
......................................................................................................................
597
27. Kjell Johan Sb, Causal and Purposive Clauses (Kausale und finale
Nebenstze) ..................................................................................................
623
28. Ekkehard Knig, Konzessive Konjunktionen (Concessive Conjunctions) .. 631
29. Angelika Kratzer, Modality (Modalitt) ...................................................... 639
30. Angelika Kratzer, Conditionals (Konditionale) ........................................... 651
VIII. Adjektivsemantik
Adjectival Semantics
31. Cornelia Hamann, Adjectives (Adjektive) .................................................... 657
32. Ewan Klein, Comparatives (Komparativ) .................................................... 673
IX. Verbalsemantik
Verbal Semantics
33. Cathrine Fabricius-Hansen, Verbklassifikation (Classification of Verbs) ... 692
34. Rainer Buerle, Verben der propositionalen Einstellung (Propositional
Attitude Verbs) .............................................................................................
709
35. Cathrine Fabricius-Hansen, Tempus (Tense) ............................................... 722
36. M. J. Cresswell, Adverbial Modification in -Categorial Languages
(Adverbiale Modifikation) ...........................................................................
748
Inhalt/Contents XIII
X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
Residua: Prepositions, Degree Particles, Focus
37. Dieter Wunderlich/Michael Herweg, Lokale und Direktionale (Spatial
and Directional Prepositions) ......................................................................
758
38. Ekkehard Knig, Gradpartikeln (Degree Particles) ..................................... 786
39. Arnim von Stechow, Current Issues in the Theory of Focus (Probleme
der Fokustheorie) .........................................................................................
804
40. Angelika Kratzer, The Representation of Focus (Fokus-Reprsentation) ... 825
XI. Service-Artikel
Service-Article
41. Godehard Link, Formale Methoden in der Semantik (Formal Methods
in Semantics) ................................................................................................
835
XII. Bibliographischer Anhang und Register
Bibliographic Appendix and Indices
42. Bibliographie/Bibliography 861
43. Personenregister/Name Index....................................................................... 908
44. Sachregister/Subject Index............................................................................
915
1
I. Allgemeine Grundlagen
General Foundations
1. Bedeutungstheorien
Bezeichnung [signification] identifizieren und
solche, die das nicht tun. In diesem Zusam-
menhang ist erwhnenswert, da Brals be-
rhmter Essai de smantique (1877), der den
gerade erst geschaffenen Terminus populari-
sierte, in seinem Untertitel die Bezeichnung
science des significations enthielt. Das Fran-
zsische besitzt kein Wort der Alltagssprache,
welches alles abdeckt, was durch das deutsche
Wort Bedeutung (oder das englische Wort
meaning) abgedeckt wird und das nicht nur
von Bezeichung, sondern auch von Bedeut-
samkeit [significance] unterschieden werden
kann, wenn immer dies notwendig ist. Brals
Essai ist nicht ins Deutsche bersetzt worden,
aber die englische bersetzung, welche 1903
erschien, definierte den neu entdeckten Zweig
der Linguistik implizit mittels eines ziemlich
verschiedenen Untertitels: The Science of
Meaning. Auf deutsch schreibende Forscher
tendierten whrend der ersten Hlfte des 20.
Jhs dazu, eher das Wort Bedeutungslehre
als Semantik zu benutzen. Aus Grnden,
die alsbald klar werden werden drften, wird
heute paradoxerweise der Terminus Seman-
tik in einem sehr weiten Sinn benutzt, um
die Wissenschaft von der Bedeutung als sol-
che zu bezeichnen. Bedeutungslehre wird
im allgemeinen eingeschrnkt auf den Bereich
der Semantik, um den es Bral (und den mei-
sten Semantikern jener Zeit) ging: diachrone
lexikalische Semantik (siehe dazu 1.4).
1.2Geschichte der Semantik
Obwohl die Semantik erst als ein eigenstn-
diger Zweig der Linguistik anerkannt wurde,
als der Terminus Semantik und damit ver-
wandte Bezeichnungen im 19. Jh. fr das Ge-
biet eingefhrt wurden, ist das Interesse an
Bedeutung doch so alt wie die Sprachfor-
schung selbst. In Europa reicht es zurck bis
zu den eigentlichen Anfngen der traditionel-
len Grammatik und Logik in den Spekulatio-
nen Platos und seiner Zeitgenossen im 5. und
4. Jh. vor Christus. In anderen Teilen der Welt
1. Geschichte und Gegenstand der Semantik
1.1 Der Terminus Semantik
1.2 Geschichte der Semantik
1.3 Linguistische Semantik
1.4 Ebenen der Bedeutung und Kompositionalitt
1.5 Semantik und Pragmatik
2. Einige Zugnge zur semantischen Theorie
2.1 Bedeutungstheorien und semantische Theorie
2.2 Die Referenztheorie
2.3 Die Ideationstheorie
2.4 Verhaltenstheorie der Bedeutung und beha-
vioristische Semantik
2.5 Strukturelle Semantik
2.6 Kontextuelle Theorie der Bedeutung
2.7 Bedeutung und Gebrauch
2.8 Wahrheitsbedingungen-Theorien der Bedeu-
tung
3. Literatur (in Kurzform)
1. Geschichte und Gegenstand der
Semantik
1.1Der Terminus Semantik
Das Nomen Semantik ist eine relativ neue
Prgung. Zur Bezeichnung der Wissenschaft
von der Bedeutung wurde es erstmals im sp-
ten 19. Jh. benutzt. Es leitet sich von dem
griechischen Adjektiv semantiks her, das je
nach Kontext als bedeutsam [significant]
oder sinnvoll bersetzt werden kann. Es ist
etymologisch mit mehreren anderen Termini
verwandt, zu denen es bis in jngste Zeit in
Rivalitt stand. Dazu gehren unter anderen
Semiasologie, Semiotik und Semiolo-
gie. Alle diese Bezeichnungen gehen, ebenso
wie Semantik, letztlich auf eine Familie von
griechischen Wrtern zurck, die etwas mit
der Interpretation von Zeichen zu tun haben.
Der etymologische Gesichtpunkt, der so-
eben ins Spiel gebracht wurde, ist von einiger
Wichtigkeit. Unter den verschiedenen Theo-
rien der Semantik, die in diesem Artikel und
an anderen Stellen dieses Buches diskutiert
werden, gibt es solche, die Bedeutung mit
2 I. Allgemeine Grundlagen
nicht-psychologische Bedeutung. Erst in jng-
ster Zeit wurden darber hinaus Stze sowohl
von uerungen (Priscians Terminus oratio
wird vielleicht besser als uerung ber-
setzt) unterschieden als auch von Aussagen
(Propositionen). Diese Unterscheidungen
werden nun allgemein als wesentlich angese-
hen. Wie sie genau eingefhrt und gegenein-
ander abgegrenzt werden, das ist allerdings
von Theorie zu Theorie verschieden.
Aus Platzgrnden ist es ausgeschlossen, de-
tailliert auf die Geschichte der Semantik ein-
zugehen oder auch nur die Grundzge der
historischen Entwicklungen der verschiede-
nen Bedeutungstheorien nachzuzeichnen, die
uns in diesem Artikel beschftigen werden.
Gewisse historische Verbindungen zwischen
Theorien oder Gesichtspunkten werden in
den folgenden Abschnitten dann aufgezeigt,
wenn dies hilfreich oder angebracht zu sein
scheint. Hier geht es uns vor allem darum,
den Gesichtspunkt, der im Zusammenhang
mit traditionellen Definitionen der Wortar-
ten, der grammatischen Kategorien und des
Satzes ins Spiel gebracht wurde, hervorzuhe-
ben und zu verallgemeinern: das bis in die
neueste Zeit in der Linguistik anzutreffende
Unvermgen, die Semantik von der Syntax
und von anderen Teilen der Grammatik zu
trennen. Dasselbe gilt fr die linguistische Se-
mantik, die sich kaum von anderen Zweigen
der Semantik der logischen, der psycho-
logischen, der anthropologischen Semantik
oder Semiotik trennen lie, obwohl sich
diese Disziplinen sowohl untereinander wie
auch von der linguistischen Semantik unter-
scheiden, was Betrachtungsweise und Zielset-
zung betrifft. Wir werden im folgenden eine
solche Trennung durchfhren. Die wechsel-
seitigen Beziehungen zwischen den verschie-
denen Arten von Semantik sind, wie wir sehen
werden, komplex und bis zu einem gewissen
Grad kontrovers, sowohl in ihrer Geschichte
als auch in der Gegenwart. In diesem Buch
geht es in erster Linie um linguistische Se-
mantik, aber die die meisten Autoren arbeiten
in einem theoretischen Rahmen, welcher der
logischen Semantik viel verdankt. Es ist des-
wegen wichtig, diese Art der Erforschung der
Bedeutung in einem greren Zusammen-
hang zu sehen, und es ist der Zweck dieses
ersten Artikels, diesen breiteren Kontext zu
liefern.
1.3Linguistische Semantik
Definiert man Semantik als die Erfor-
schung der Bedeutung (die bliche Defini-
tion), dann lt sich der Begriff linguistische
hat dieses Interesse eine ebensolange, wenn
nicht lngere Geschichte, besonders in Indien
und China.
Zuerst eregte das, was wir heute lexikali-
sche Semantik nennen, die Aufmerksamkeit
der Gelehrten, insbesondere die Etymologie:
die Erforschung des Ursprungs und der Ent-
wicklung von Wrtern unter besonderer Be-
rcksichtigung ihrer Bedeutung. Aber auch in
den meisten zentralen Bereichen der gram-
matischen Theorie waren semantische Ge-
sichtspunkte von vitaler Wichtigkeit. Die
Wortarten [partes orationis] (Nomen, Verb,
Adjektiv, usw.) und grammatischen Katego-
rien (Tempus, Genus, Numerus, usw.) wurden
vollstndig oder zumindest teilweise seman-
tisch definiert. Ein Gleiches gilt fr die zen-
trale Einheit der syntaktischen Analyse, den
Satz, als dieser sich im Laufe einer jahrhun-
dertelangen Tradition als solcher etablierte,
eine Tradition, die ihre Anfnge bei Philoso-
phen, Rhetoren und Literaturkritikern hat.
Priscians klassische, aus dem 6. Jh. unserer
Zeitrechnung stammende Definition des Sat-
zes verwendet das lateinische Wort sententia,
wo seine griechisch schreibenden Vorlufer
dianoia benutzten (vgl. Matthews 1981: 27).
Beide Wrter werden in diesem Zusammen-
hang gewhnlich als Gedanke bersetzt,
aber beide Wrter sind auch als Bedeutung,
Intention oder Bedeutsamkeit interpretierbar.
Tatschlich kann man dafr argumentie-
ren, da Priscians klassische Definition des
Satzes (ordinatio dictionum congrua senten-
tiam perfectam demonstrans) am besten ber-
setzt wird als eine wohlgeformte Folge von
Wrtern, die eine vollstndige Aussage (Pro-
position) ausdrckt. Diese bersetzung ist
natrlich und zwar bewut anachroni-
stisch, insofern sie logische Terminologie des
20. Jhs benutzt, nmlich wohlgeformt und
Aussage anstelle der traditionellen Begriffe
des Grammatikers: kongruent und Ge-
danke. Nicht nur war Semantik nicht klar
von Grammatik getrennt (insbesondere nicht
von der Syntax), und zwar bis in das spte
19. oder frhe 20. Jh., nein, auch Grammatik
und Logik waren nicht scharf voneinander
abgegrenzt, auch nicht von Psychologie und
Erkenntnistheorie. In diesem Zusammenhang
sei im Vorbergehen bemerkt, da der deut-
sche Logiker Frege eine zentrale Gestalt
in der Entwicklung der modernen formalen
Semantik, wie wir sehen werden den Ter-
minus Gedanke verwendete, wo die meisten
heutigen Logiker von Aussage (Proposi-
tion) sprechen wrden. Allerdings hat bei
Frege Gedanke eine vollstndig abstrakte,
1. Bedeutungstheorien 3
chronen oder historischen Sprachwissen-
schaft, die Mikro- von der Makrolinguistik
(vgl. Lyons 1983 b: 3840). Fr jede dieser
Teildisziplinen gibt es einen entsprechenden
Zweig der linguistischen Semantik mit ihren
eigenen charakteristischen Zielen und Per-
spektiven und, in vielen Fllen, mit ihren eige-
nen speziellen Bindungen zu nichtlinguisti-
schen Disziplinen wie Philosophie, Logik,
Psychologie, Soziologie, Anthropologie, Sti-
listik, Geschichte usw. Aber selbst, wenn man
alle diese Zweige der linguistischen Semantik
zu einem Gesamtensemble vereinigt, wird
man doch nicht sagen knnen, da diese ver-
einigten Disziplinen alles, was unter den Be-
griff sprachliche Bedeutung fllt, erschpfend
und unter jedem mglichen Blickwinkel be-
handeln.
Wie wir sehen werden, machen heutzutage
viele Wissenschaftler einen terminologischen
Unterschied zwischen Semantik und Prag-
matik (1.5). Fr die Praxis, wenn auch nicht
unbedingt prinzipiell, fhrt dies zu einer en-
geren Definition von linguistischer Seman-
tik als derjenigen, die oben verwendet wurde.
Diese Beschrnkung des Gegenstandsbereichs
der linguistischen Semantik ist das Ergebnis
zweier ursprnglich voneinander unabhngi-
ger historischer Entwicklungen. Eine von die-
sen ist die Ausarbeitung und Formalisierung
der Wahrheitsbedingungen-Semantik als
Theorie der Bedeutung, die auf einer engeren
Definiton von Bedeutung beruht als derje-
nigen, fr die Linguisten bis in die jngste
Zeit eingetreten sind: Wir kommen darauf
spter zurck (2.8). Die andere Entwicklung
in der Linguistik ist die Aufgabe des Histo-
rismus des 19. Jhs zugunsten des Saussure-
schen oder nach-Bloomfieldschen Struktura-
lismus, spter zugunsten eines Chomskyschen
Generativismus, der dann zum Paradigma
dessen, was Kuhn normal science nennt, wird.
Weil der Terminus Bedeutungslehre (ebenso
wie Sprachwissenschaft) eng mit dem vor
allem historischen Ansatz des 19. Jhs assozi-
iert worden ist, pflegt man heute das Wort
Semantik zur Bezeichung dessen zu benut-
zen, was fr die Anstze des 20. Jhs charak-
teristisch ist.
Ob man eine breitere oder engere Defini-
tion von Linguistik oder Bedeutung ver-
wenden sollte, ist zur Zeit eine kontroverse
Frage. Es sei an dieser Stelle allerdings betont,
da eine Position, die fr eine breite Defini-
tion von Linguistik und eine enge Definition
von Bedeutung eintritt, keineswegs inkonsi-
stent ist, genau so wenig wie eine Position,
Semantik wiederum ganz einfach als die Er-
forschung der Bedeutung innerhalb der Lin-
guistik definieren. Man wrde nun denken,
da eine so definierte linguistische Semantik
notwendigerweise alle Aspekte der sprachli-
chen Bedeutung abdecken sollte. Dem ist aber
nicht so. Es gibt zwei Grnde, weshalb die
Linguistik sich nicht mit der Totalitt von
Bedeutung beschftigt, die sprachlich ausge-
drckt oder vermittelt wird (vgl. Lyons 1981 a:
Kap. 1).
Der erste und wichtigste Grund ist, da
sich die Linguistik in erster Linie, wenn nicht
gar ausschlielich, mit einer offensichtlich re-
lativ kleinen Teilmenge aller Sprachen be-
schftigt, nmlich mit Sprachen, welche die
folgenden Eigenschaften haben:
(i) Sie sind natrlich (im Gegensatz zu
knstlich) in dem Sinne, da sie nicht kon-
struiert sind (wie Esperanto auf der einen oder
die formalen Sprachen der Logiker und Com-
puterwissenschaftler auf der anderen Seite).
Ferner sind diese Sprachen entweder natr-
lich erworben oder erwerbbar (d. h. der Er-
werbsproze vollzieht sich ohne spezielle An-
weisungen als Teil des Reife- und Sozialisa-
tionsprozesses unter normalen Umweltbedin-
gungen).
(ii) sind die Sprachen menschlich in dem
Sinne, da sie von Menschen erworben wur-
den oder erwerbbar sind, nicht aber von Tie-
ren oder Maschinen. Diese Beschrnkung der
Linguistik auf die Erforschung von natrli-
chen, menschlichen Sprachen unterscheidet
die linguistische Semantik von anderen Arten
der Semantik, insbesondere von (i) reiner oder
logischer Semantik und von (ii) verschiedenen
anderen Zweigen der Semiotik und Semiolo-
gie.
Der zweite Grund besteht darin, da die
Linguistik, ebenso wie die anderen Wissen-
schaften auch, notwendigerweise die Phno-
mene, die sie auswhlt und als Daten ansieht,
idealisieren mu. Sie beschftigt sich mit
sprachlichen uerungen unter ihrer metho-
disch und theoretisch ausgezeichneten Per-
spektive. Tatschlich lt sich die Linguistik
als akademische Disziplin in mehrere ber-
lappende Teildisziplinen unterteilen, und zwar
sowohl hinsichtlich der zu untersuchenden
Phnomene als auch hinsichtlich der metho-
dologischen Abstraktionen, welche die Art
ihrer wissenschaftlicher Behandlung bestim-
men. Die allgemeine Sprachwissenschaft lt
sich von der deskriptiven Linguistik unter-
scheiden, die theoretische von der angewand-
ten Linguistik, die synchrone von der dia-
4 I. Allgemeine Grundlagen
schlich lag mit Ullmanns (1957) Principles
of Semantics das erste mehr oder weniger
umfassende Kompendium der zeitgenssi-
schen Forschung in der linguistischen Seman-
tik vor, welches dieses strukturalistische Prin-
zip annahm und Synchronie und Diachronie
in einem einheitlichen theoretischen Rahmen
zu vershnen versuchte. Dabei beschrnkte
sich Ullmanns Behandlung der Semantik auf
die lexikalische Semantik. Die gleiche Be-
schrnkung des Gebietes findet man auch bei
anderen Zeitgenossen Ullmanns, und auch
noch whrend des folgenden Jahrzehnts.
Die Feststellung, da der Terminus Se-
mantik von den Linguisten bis in die sech-
ziger Jahre hinein auf die Untersuchung der
Bedeutung von Lexemen entweder explizit
oder implizit eingeschrnkt wurde, bedeu-
tet nicht, da diese Linguisten nicht an gram-
matischer oder phonologischer Bedeutung in-
teressiert gewesen wren. Als eine von der
Phonetik verschiedene Wissenschaft existierte
die Phonologie kaum vor der Mitte des 20.
Jhs. Dagegen haben sich Gelehrte seit ber
zweitausend Jahren mit Grammatik (d. h. mit
Syntax und Flexion) beschftigt und beinahe
whrend dieser ganzen Zeit als selbstver-
stndlich vorausgesetzt, da die Bedeutung
eines Satzes das Produkt der ihn konstituie-
renden Wrter (genauer, seiner Lexeme) auf
der einen und seiner grammatischen Struktur
auf der anderen Seite sei. Wie wir bereits
gesehen haben, war ja die grammatische
Theorie von Anbeginn semantisch begrndet,
und sie blieb es besonders in den Schriften
der mittelalterlichen spekulativen Grammati-
ker (den sogenannten Modisten) und der Port
Royal Grammatiker, ihren Nachfolgern im
17. Jh. bis in das 20. Jh. hinein.
Die generative Grammatik wurde in ihrer
bekanntesten und einflureichsten Form
durch Chomsky (1957) initiiert und fhrte
ber die Arbeiten von Katz & Fodor (1963),
Katz & Postal (1964) zu Chomskys Aspects
of the Theory of Syntax (1965), also zu dem,
was heute die Standardtheorie genannt wird.
Die Standardtheorie enthlt Regeln fr die
Interpretation von Stzen und kann zurecht
behaupten, die erste von Linguisten vorge-
schlagene Theorie zu sein, die ernsthaft und
explizit die Kompositionalitt der Satzbedeu-
tung angesprochen hat.
Das Kompositionalittsprinzip, das manch-
mal Fregeprinzip
eine etwas fragwrdige Be-
zeichnung genannt wird, ist als solches
weder aufregend neu noch revolutionr. Ich
die eine enge Definition von Linguistik und
eine breite Definition von Bedeutung vertritt.
Es ist allerdings de facto so, da diejenigen
Linguisten, die mit einer Unterscheidung von
Semantik und Pragmatik arbeiten, im allge-
meinen eine enge Definition sowohl von Lin-
guistik als auch Bedeutung voraussetzen.
Wenn linguistische Semantik per defini-
tionem die Erforschung der Bedeutung in der
Linguistik bedeutet, dann bedeutet nicht-
linguistische Semantik dasselbe wie die Un-
tersuchung der Bedeutung in nichtlinguisti-
schen Disziplinen wie Philosophie, Logik,
Psychologie, Semiotik usw. All diesen Dis-
ziplinen geht es ebenso wie der Linguistik um
sprachliche Bedeutung. Aber sie interessieren
sich unter Umstnden auch fr nichtsprach-
liche Bedeutung oder fr Aspekte von sprach-
licher Bedeutung, die den Linguisten nicht
primr interessieren. Die meisten Bedeutungs-
theorien, die wir im folgenden betrachten,
haben ihren Ursprung in von der Linguistik
verschiedenen Disziplinen, und einige Theo-
rien wurden dazu entworfen, sowohl lingui-
stische als auch nichtlinguistische Bedeutung
abzudecken. Die Linguistik hat aus diesen
Theorien geschpft und hat sie in gewissen
Fllen verfeinert oder fr die eigenen Zwecke
reinterpretiert.
1.4Ebenen der Bedeutung und
Kompositionalitt
Eine Art, die linguistische Semantik in ver-
schieden Zweige zu untergliedern, ist soeben
erlutert worden. Eine andere geht von den
verschiedenen Ebenen aus, in welche Sprach-
uerungen analysiert werden knnen: die le-
xikalische, grammatische und phonologische
Ebene.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, da
der Terminus Semantik (fr gewhnlich als
Bedeutungslehre bersetzt) von denjenigen
Linguisten, die ihn zuerst benutzten, still-
schweigend auf die diachrone lexikalische Se-
mantik eingeschrnkt wurde, d. h. auf die Un-
tersuchung der Bedeutung von Lexemen (sol-
cher Wrter und Syntagmen, die man in
einem Lexikon zu finden erwartet) aus einer
historischen Perspektive heraus. In den fr-
hen 30er Jahren unseres Jhs wurden die ersten
Schritte unternommen, dem strukturalisti-
schen Prinzip der methodologischen Prioritt
der Synchronie ber die Diachronie auch in
der Semantik Geltung zu verschaffen. Aber
dieses Prinzip wurde in der Semantik nicht so
bereitwillig akzeptiert, wie dies fr die Pho-
nologie und Grammatik der Fall war. Tat-
1. Bedeutungstheorien 5
Ebenso wie die traditionelle Grammatik sehen
die meisten Versionen der generativen Gram-
matik den Satz als die grte Einheit der
grammatischen Analyse an. Tatschliche
sprachliche uerungen werden nicht direkt
betrachtet und a fortiori auch Texte nicht
(seien sie gesprochen oder geschrieben), die
aus einer oder mehreren uerungen beste-
hen. Dennoch bestand (und besteht noch) in
den Kpfen vieler generativer Grammatiker
eine nicht unbetrchtliche Verwirrung hin-
sichtlich der Relation zwischen Stzen und
uerungen. Diese kann man auf mindestens
drei Faktoren zurckfhren: (1) die Akt-Pro-
dukt-Mehrdeutigkeit des Wortes ue-
rung; (2) die Bloomfieldschen und nach-
Bloomfieldschen Vorlufer der Chomsky-
schen generativen Grammatik; (3) den Mi-
brauch der Mdchen fr Alles-Unterschei-
dung Kompetenz-Performanz. Aus Platz-
grnden knnen wir die komplexe Interaktion
dieser drei Faktoren hier nicht abhandeln.
Hier mge der Hinweis gengen, da die
Mehrdeutigkeit des Wortes uerung fr
eine grundlegende Inkonsistenz in Bloom-
fields (1926) Postulaten verantwortlich ist, die
offensichtlich unbemerkt bis in die jngste
Gegenwart fortlebte und durch Chomskys
(1965) Kompetenz-Performanz-Unterschei-
dung (und auch durch die Type-Token-Un-
terscheidung, die im Zusammenhang damit
evoziert zu werden pflegt) nicht berhrt
wurde (vgl. Lyons 1980: 2644; 1983 a:
235247). uerungen werden einerseits als
Sprechhandlungen und andererseits als For-
men definiert, d. h. als linguistisch analysier-
bare Produkte solcher Akte, die als Schall
manifestiert sind (oder, sekundr, in einem
anderen Medium). Fat man Stze im Sinne
der Bloomfieldschen Tradition als grte For-
men auf, dann sind sie eine Teilklasse aller
uerungen unter dem Gesichtspunkt des
Produkt-Aspektes.
Obwohl bisher noch keine Einigkeit dar-
ber besteht, wie die Unterscheidung zwi-
schen Stzen und uerungen genau zu tref-
fen ist, so wird doch in zunehmendem Mae
anerkannt, da diese Unterscheidung und
mglicherweise mehr als eine solche Unter-
scheidung getroffen werden mu, um die
kontextunabhngigen Aspekte der phonolo-
gischen, grammatischen und lexikalischen
Struktur innerhalb eines generativen Modells
der Satzstruktur behandeln zu knnen. Erst
dann wird es mglich, sich die Bedeutung
einer uerung (als Akt oder Resultat ver-
standen) als teilweise durch die Bedeutung des
habe bereits darauf hingewiesen, da es de
facto seit Jahrhunderten von den traditionel-
len Grammatikern stillschweigend vorausge-
setzt wurde. Ferner lst es die unmittelbare
intuitive Zustimmung von beinahe jedem aus
sei er Laie oder Spezialist , der jemals
ber diesen Gegenstand nachgedacht hat.
Denn das Kompositionalittsprinzip (auf die
Satzbedeutung angewandt) besagt ganz ein-
fach folgendes: die Bedeutung eines Satzes ist
das Produkt der Bedeutung der Einheiten, aus
denen er zusammengesetzt ist. Erst wenn wir
den halbtechnischen Terminus das Produkt
von durch den mathematisch przisen Ter-
minus eine Funktion von ersetzen, erhalten
wir die typisch moderne Formulierung des
Kompositionalittsprinzips, das sowohl in
diesem Buch als auch in der zeitgenssischen
linguistischen und logischen Semantik eine so
prominente Rolle spielt. Da die Bedeutung
eines Satzes eine Funktion der Bedeutung der
Wrter, Phrasen oder Teilstze ist, aus denen
er zusammengesetzt ist, heit nichts anderes,
als da seine Bedeutung (i) eine bestimmte ist
und (ii) Regeln gehorcht. Die sogenannten
Projektionsregeln der Aspects-Theorie der ge-
nerativen Grammatik waren entworfen wor-
den, um jedem wohlgeformten Satz eine oder
mehrere semantische Reprsentationen zu-
zuordnen, die seine eine oder mehrere Bedeu-
tungen wiedergeben sollten. Und zwar sollten
die Regeln dieses leisten, indem sie auf einer
tiefenstrukturellen Ausbuchstabierung so-
wohl der lexikalischen Bedeutung als auch der
grammatischen Struktur operierten.
In diesem Artikel wird nichts ber Details
der Aspects oder der generativen Grammatik
nach den Aspects gesagt. Wir mssen mit
Nachdruck auf die Wichtigkeit der Unter-
scheidung zwischen generativer Grammatik
(in irgendeiner ihrer zahlreichen Versionen)
als formaler Theorie der Sprachstruktur und
den philosophischen oder psychologischen
Theorien der Bedeutung hinweisen, die mit
ihr von ihren Vertretern assoziiert worden
sind, Chomsky inbegriffen. Dieser Gesichts-
punkt wird spter wieder aufgenommen, weil
alle im folgenden zu diskutierenden Bedeu-
tungstheorien im Prinzip mit dem Komposi-
tionalittsprinzip und seiner Formalisierung
im theoretischen Rahmen der generativen
Grammatik in Einklang gebracht werden
knnen.
Wie der Leser bemerkt haben wird, ist das
Kompositionalittsprinzip mit Bezug auf die
Bedeutung von Stzen, nicht aber mit Bezug
auf die von uerungen erlutert worden.
6 I. Allgemeine Grundlagen
chensystemen. Nach Morris und Carnap wird
durch diese Untergliederung des Gegen-
standsbereichs die Logik zu einem Zweig der
reinen und die Linguistik zu einem Zweig der
empirischen Semiotik.
Die Trichotomie Pagmatik-Semantik-Syn-
tax kann nun, jedenfalls fr die reine Semio-
tik, folgendermaen definiert werden: die
Pragmatik untersucht die Art und Weise, wie
Zeichen benutzt werden; die Semantik, indem
sie vom Gebrauch und von den Benutzern
abstrahiert, die Beziehung zwischen Zeichen
und dem, was sie bezeichnen; die Syntax un-
tersucht, indem sie auch noch von dem ab-
strahiert, was bezeichnet wird, die substitutio-
nellen und kombinatorischen Beziehungen
zwischen Zeichen. Man wird bemerkt haben,
da diese Formulierung, die dem Geiste,
wenn auch nicht dem Buchstaben nach, eine
Carnapsche ist, einerseits eine Unterschei-
dung zwischen Bedeutung und Gebrauch im-
pliziert, andererseits aber Bedeutung mit Be-
zeichnung gleichsetzt. Wie wir spter sehen
werden, trennt die Formulierung auch nicht
(obwohl Carnap das seinerzeit tat) zwischen
Referenz und Denotation als zwei zu unter-
scheidende Aspekte der Bezeichung.
In der Folge wurde bald deutlich, da die
Morris-Carnapsche Formulierung des Unter-
schieds von Semantik und Pragmatik (ge-
schweige denn die Unterscheidung von Syn-
tax und Semantik) zu hoffnungslos fehlkon-
zipiert war, als da sie als Grundlage fr die
Analyse von natrlichen, menschlichen Spra-
chen htte dienen knnen. Dennoch ist die
terminologische Unterscheidung von Seman-
tik und Pragmatik in den sechziger Jahren
von Linguisten bernommen worden und hat
seitdem zu einer verwirrenden Vielfalt von
verschiedenen Definitionen gefhrt (vgl. Le-
vinson 1983). Einige Definitionen basieren
auf der Unterscheidung zwischen Bedeutung
und Gebrauch; andere auf der Unterschei-
dung zwischen dem, was zu den Wahrheits-
bedingungen oder der Proposition gehrt und
dem, was nicht dazu gehrt; andere basieren
auf der Kompetenz-Performanz-Unterschei-
dung; andere auf dem Unterschied zwischen
Stzen und uerungen; andere schlielich
basieren auf dem Unterschied zwischen den
kontextunabhngigen im Gegensatz zu den
kontextabhngigen Schichten oder Kompo-
nenten der Bedeutung. Tatschlich haben
viele der Definitionen, mit denen Linguisten
in den letzten Jahren gearbeitet haben, explizit
oder implizit mehrere der genannten Unter-
scheidungen (wobei die Liste keineswegs voll-
geuerten Satzes bestimmt vorzustellen und
teilweise durch den Kontext, in dem der Satz
geuert wurde. Ob die uerungsbedeutung
ebenso wie die abstraktere, theoretisch ein-
gegrenzte Satzbedeutung als vollstndig be-
stimmt und kompositional angesehen werden
kann, ist zur Zeit noch unklar. Gewisse
Grnde sprechen dafr, da die uerungs-
bedeutung nur partiell regelbestimmt ist.
1.5Semantik und Pragmatik
Die Unterscheidung zwischen Semantik und
Pragmatik geht (ebenso wie die Unterschei-
dung zwischen Type und Token, die im Vor-
bergehen im letzten Abschnitt genannt
wurde) letztlich auf das Werk des amerika-
nischen Logikers, Philosophen und Semioti-
kers C. S. Peirce (18391914) zurck. Sie
wurde von Morris (1938) und Carnap (1938)
aufgenommen und reinterpretiert und ist seit-
dem von einer groen Zahl von Logikern und
einer vergleichsweise kleineren Zahl von Lin-
guisten bernommen worden.
Morris und Carnap haben in dieser Hin-
sicht sind sie Peirce gefolgt die Semantik
und die Pragmatik als zwei der drei Zweige
der Semiotik definiert, wobei der dritte Zweig
die Syntax (oder Syntaktik) ist. Semiotik (in
der Tradition, die uns im Augenblick beschf-
tigt) ist die Wissenschaft der Zeichensysteme,
von denen die Sprachen seien sie natrlich
oder nicht-natrlich, menschlich oder nicht-
menschlich eine echte Unterklasse bilden.
Sie kann in verschiedener Weise untergliedert
werden, je nach der Natur der fraglichen Zei-
chensysteme und ihrer definierenden Eigen-
schaften. Zum Beispiel unterscheidet die mo-
derne Semiotik die Zoosemiotik von der An-
throposemiotik aufgrund eines Kriteriums
(ob nmlich die Zeichensysteme von nicht-
menschlichen Lebewesen oder von menschli-
chen Wesen benutzt werden), sie unterscheidet
die Untersuchung von Sprachsystemen von
der Untersuchung anderer Zeichensysteme,
das Studium der Vokalsysteme von dem Stu-
dium visueller, taktiler und anderer Systeme,
usw. Eine Unterscheidung, der Morris und
Carnap besondere Wichtigkeit beimaen, ist
in dem gegenwrtigen Kontext besonders
wichtig, nmlich die Trennung von reiner und
empirischer Semiotik. Die erstere behandelt
frei konstruierte abstrakte Systeme, wobei es
ihr primr um die Konstruktion einer elegan-
ten allgemeinen Theorie der Bezeichnung
geht; die letztere beschftigt sich mit der Un-
tersuchung von existierenden natrlichen Zei-
1. Bedeutungstheorien 7
Semantische Theorie in diesem mehr ein-
geschrnkten Sinn arbeitet mit der Annahme,
da nichts als Theorie gilt, was nicht przis
formuliert ist, vollstndig artikuliert und
in gewissen Darstellungen wissenschaft-
lich ist in dem Sinne, da es empirisch ber-
prfbare Vorhersagen macht (Kempson
1977: 1). Gemessen an diesem Kriterium sind
die meisten der Bedeutungstheorien, mit de-
nen wir uns im zweiten Teil dieses Artikels
beschftigen werden, hchstens partiell Theo-
rien wenn nicht gar, wie ein Autor es
formuliert hat, reine Platzhalter fr eine
Theorie (Katz 1972: 3). Wir wollen hier aus
Grnden der Darstellung, aber ohne etwas
bezglich umfassenderer Anstze in Lingui-
stik und Wissenschaftstheorie im allgemeinen
zu prjudizieren, den Terminus Semantik
im engen Sinne verwenden.
Gleichgltig, ob sie wissenschaftlich oder
nicht sind: die Antworten, die die vorausge-
gangenen Generationen von Gelehrten auf die
Frage Was ist Bedeutung? gegeben haben
Antworten, die gewhnlich als Bedeu-
tungstheorien bezeichnet werden knnen
nicht kurzerhand von denjenigen abgetan
werden, deren Interesse auf dem Gebiet der
semantischen Theoriebildung liegt (was fr
die meisten Autoren dieses Bandes zutrifft).
Nach allgemeinem Konsensus ist die Frage
Was ist Bedeutung? die zentrale Frage fr
die semantische Theorie, ebenso, wie die
Frage, Was ist Sprache?, die zentrale Frage
fr die allgemeine Sprachtheorie ist, von der
die Semantik ein Teil ist. Aber Bedeutung
ist ein vortheoretischer Begriff. Sobald er ver-
feinert oder fr die Zwecke der semantischen
Theorie umdefiniert wird und dabei in eine
Reihe von konstitutiven Teilfragen aufgespal-
ten wird, die mit Begriffen zu tun haben wie
Synonymie, Ambiguitit, Implikation (von
verschiedener Art), Prsupposition, Wider-
sprchlichkeit, Analytizitt und Sinnlosigkeit
(verschiedener Art), haben wir es mit Begrif-
fen zu tun, von denen wir nicht einmal ein
vortheoretisches Verstndnis haben. All dies
sind Unterscheidungen, die ber Jahrhun-
derte hinweg von Philosophen, Etymologen
und Lexikographen geschaffen wurden und
in jngster Zeit durch die theoretischen Spe-
kulationen und die empirische Forschung von
Praktikern verschiedener Disziplinen ver-
schrft worden sind.
Jede der Theorien, die im folgenden
selektiv und allzu kurz, bedingt durch die
Grenzen des verfgbaren Platzes behandelt
werden, hat ihren Beitrag zu einer oder meh-
stndig ist) innerhalb einer Begrifflichkeit ver-
wischt, die, wie man nun allmhlich einsieht,
eine gnzlich untaugliche Konzeption von
sprachlicher Bedeutung darstellt.
Die Situation in der logischen Semantik
(gleichgltig, ob ihre Definition als Zweig der
reinen Semiotik ntzlich ist oder nicht) ist
prinzipiell vllig verschieden, da sie mit voll-
stndig formalisierten, nicht-natrlichen
Sprachen arbeiten kann, die eine eindeutig
bestimmte Struktur haben und frei von Vag-
heit, Mehrdeutigkeit und Inkonsistenz sind.
Aber logische und linguistische Semantik sind
nach einigen Jahrzehnten der Trennung und
unabhngigen Entwicklung in den letzten
Jahren wieder eng zusammengekommen, wie
die meisten anderen Artikel dieses Buches
deutlich zeigen. Aus dieser Perspektive heraus
werden wir deshalb an mehreren Stellen bei
der Diskussion von verschiedenen Bedeu-
tungstheorien auf Fragen eingehen, die rele-
vant fr die Grenzziehung zwischen Semantik
und Pragmatik sind.
2. Einige Zugnge zur semantischen
Theorie
2.1Bedeutungstheorien und semantische
Theorie
In Anbetracht der Tatsache, da wir Seman-
tik definiert haben als die Erforschung der
Bedeutung, knnte man denken, da Bedeu-
tungstheorie und semantische Theorie syn-
onym seien. Die meisten Linguisten und Phi-
losophen sehen diese beiden Ausdrcke ver-
mutlich als austauschbar und quivalent an,
wobei ganz spezielle Kontexte eine Ausnahme
bilden mgen. Es ist aber bemerkenswert, da
in jngster Zeit verschiedene Bcher und Ar-
tikel erschienen sind, in denen der Terminus
semantische Theorie eine engere Bedeutung
hat als der Terminus Bedeutungstheorie tra-
ditionell unter Linguisten, Philosophen, Psy-
chologen und anderen hatte. Nicht nur wird
er stillschweigend oder explizit auf linguisti-
sche Semantik eingeschrnkt (die, wie wir ge-
sehen haben, nicht unbedingt die Totalitt der
Bedeutung abdeckt, die sprachlich ausge-
drckt oder bermittelt wird: 1.3). Der Ter-
minus mit darber hinaus dem Wort Theorie
Konnotationen oder Prsuppositionen bei,
die damit nicht immer verbunden waren und
die unter einer historischen Perspektive als
fragwrdig und beinahe mit Sicherheit als
kurzlebig angesehen werden mssen.
8 I. Allgemeine Grundlagen
Abb. 1.1: Das semiotische Dreieck
verknpft ist. Referenztheorien unterscheiden
sich von Ideationstheorien darin, da sie C
als Bedeutung von A annehmen, whrend
letztere B als Bedeutung von A betrachten.
Die traditionell formulierten Referenztheo-
rien knnen nach ontologischen oder er-
kenntnistheoretischen Gesichtspunkten in
verschiedene Teilklassen unterteilt werden.
Eine derartige Unterteilung basiert auf der
alten, immer noch philosophisch und psycho-
logisch kontroversen Unterscheidung von
Nominalismus und Realismus. In seiner ein-
fachsten und traditionellsten Form ist der No-
minalismus die Lehre, da sprachliche Aus-
drcke lediglich Namen fr ihre Referenten
sind, wobei in dieser Formulierung ledig-
lich implizieren soll, da die Referenten eines
Ausdrucks nicht unbedingt mehr miteinander
gemeinsam haben als den Namen, den sie
tragen. Im Gegensatz zum Nominalismus ver-
wirft der Realismus das lediglich, aber nicht
unbedingt die Gleichsetzung von Bedeutung
und Benennung: der Realismus vertritt die
Ansicht, da den Referenten eines Namens
etwas gemeinsam ist, das ber ihr Verknpft-
sein mit demselben Ausdruck hinausgeht. Als
philosophische Lehre spaltet sich der Realis-
mus in verschiedene rivalisierende Richtun-
gen auf, wobei der platonische Idealismus das
eine und der Materialismus des 19. Jhs das
andere Extrem bildet. (Es ist wichtig, den
philosophischen Gebrauch von Realismus
und Idealismus nicht mit den populreren un-
technischen Bedeutungen zu verwechseln, die
diese Wrter erhalten haben, oder mit den
spezifischeren, oft tendenzisen Bedeutungen,
die ihnen viele moderne philosophische Sy-
steme zuschreiben.) Wir knnen hier nicht auf
die verschiedenen Spielarten des Realismus
eingehen.
Wir wollen lediglich nicht unerwhnt las-
sen, da zwischen den beiden Extremen, die
wir genannt haben, eine Lehre angesiedelt ist,
die fr die Entwicklung der modernen seman-
tischen Theorie von groer Wichtigkeit ge-
reren Varianten der heute existierenden se-
mantischen Theorien geleistet. In einigen Fl-
len ist der Betrag eher negativ als positiv
gewesen, in dem Sinn, da die betreffenden
Theorien unser Verstndnis von Bedeutung
insofern weitergebracht haben, als sie letztlich
an ihrem eigenen Beispiel gezeigt haben, was
Bedeutung nicht ist. Dies gilt zum Beispiel fr
die Ideationstheorie, die Referenztheorie und
vermutlich auch fr die behavioristische
Theorie. In allen Fllen war jedoch der Bei-
trag historisch bedeutsam, und genau dieser
Punkt wird in unserer Darstellung der jewei-
ligen Theorie betont werden. Wir werden
auch klarstellen, da die Theorien keineswegs
wechselseitig unvertrglich sind und einige
von ihnen als partielle und komplementre
Theorien von Erscheinungen angesehen wer-
den knnen, die vielleicht nicht semantisch im
engeren Sinne sind, die aber eng mit lingui-
stischer Bedeutung verknpft sind.
2.2Die Referenztheorie
Die meisten Bedeutungstheorien, die von Lin-
guisten, Philosophen, Psychologen und an-
deren vertreten wurden, knnen unter eine
der folgenden berschriften gruppiert wer-
den: Referenztheorie, Ideationstheorie oder
behavioristische Theorie (vgl. Alston 1964 a).
Wie wir gerade bemerkt haben, schlieen sich
diese Kategorien nicht wechselseitig aus; fer-
ner enthlt jede von ihnen verschiedene mehr
oder weniger gut entwickelte Varianten.
Die Referenztheorie hat eine lange Ge-
schichte und wird, wie andere traditionelle
Bedeutungstheorien oft als Teil einer allge-
meineren Theorie der Bezeichnung angesehen
(vgl. 1.1, 1.5). Man kann sie, ebenso wie die
konkurrierende oder komplementre Idea-
tionstheorie, anschaulich einfhren mittels
dessen, was in der Literatur unterschiedlich
mal semiotisches Dreieck, zuweilen Referenz-
dreieck beides Bezeichnungen von Gelehr-
ten, die es in neuerer Zeit popularisiert haben,
nmlich Ogden & Richards (1923) , bei
Ullmann (1957) dagegen Basisdreieck ge-
nannt wird. Das semiotische Dreieck wird
hier jedoch in einer allgemeineren Form wie-
dergegeben als bei Ogden und Richards oder
bei dem ihnen hier folgenden Ullmann (siehe
Abb. 1.1).
A ist ein sprachlicher Ausdruck allge-
meiner: ein Zeichen der einerseits mit B,
einer Idee, einem Gedanken oder Begriff und
andererseits mit C, dem wofr A steht oder
was es bezeichnet, d. h. seinem Referenten,
1. Bedeutungstheorien 9
nung), so ist heute allgemein anerkannt, da
diese auf einem Trugschlu beruht, trotz ihres
Alters und der hervorragenden Bedeutung der
vielen Philosophen, die sie verteidigt haben.
Namen sind ihren Trgern, zumindest in vie-
len Sprachen, willkrlich zugeordnet, nicht
aber vermittels dessen, was man sich norma-
lerweise als ihre Bedeutung vorstellen wrde,
falls sie eine haben. Die Arbitraritt der Be-
ziehung zwischen Namen wie z. B. Johann
und seinem Trger oder seinen Trgern stellt
natrlich kein Hindernis fr die Gleichset-
zung von Referenz (und Bedeutung) und Be-
nennung dar, falls wir den nominalistischen
Standpunkt akzeptieren. Aber Eigennamen
wie Johann scheinen vortheoretisch sehr ver-
schieden zu sein von dem, was traditionell
Gattungsnamen genannt wird, wie zum Bei-
spiel Junge. Sie verhalten sich verschieden be-
zglich bersetzung und Paraphrase, und in-
sofern sie berhaupt eine Bedeutung haben,
die durch einen standardisierten Wrterbu-
cheintrag definiert werden kann, so ist diese
(zumindest in vielen Kulturen) irrelevant fr
ihre Verwendung als bezeichnende Aus-
drcke. Zum Beispiel knnten wir Johann ety-
mologisch glossieren als Gott ist gndig ge-
wesen. Es ist schwierig zu sehen, welche an-
dere als diese etymologische Antwort auf die
Frage Was ist die Bedeutung von Johann?
gegeben werden knnte. Dennoch hilft die
Glosse Gott ist gndig gewesen nieman-
dem, wenn es darum geht, den Namen zu
verwenden, ganz im Gegensatz zur Glosse
geschlechtsreifes Weibchen einer Rinderart
fr Kuh. Tatschlich ist es zweifelhaft, ob man
von Eigennamen zurecht sagen kann, da sie
Bedeutung haben oder da sie zum Vokabular
einer Sprache in demselben Sinne gehren,
wie dies fr Gattungsnamen und andere Le-
xeme der Fall ist. Wir wollen deswegen die
Bedeutung-als-Benennung-Version der Refe-
renztheorie beiseite legen und lediglich fest-
stellen, das sie historisch sehr einflureich ge-
wesen ist und ihre Spuren am terminologi-
schen und begrifflichen Rstzeug des Seman-
tikers hinterlassen hat. Zum Beispiel haben
Frege, Russell und Carnap zeitweise ihre An-
sichten innerhalb des Rahmens der Bedeu-
tung-als-Benennung-Version der Referenz-
theorie ausgedrckt.
Es gibt verschiedene unabhngige Grnde,
weshalb die Referenztheorie der Bedeutung
(zumindest in der einfachen Form, in der die
Bedeutung eines Ausdrucks A als sein Refe-
rent C definiert wird) abgelehnt werden mu.
Der erste und wichtigste Grund ist, da sie
wesen ist: der Konzeptualismus. Er wird ge-
whnlich als eine Alternative sowohl zum No-
minalismus als auch zum Realismus darge-
stellt, und fr diese Charakterisierung gibt es
in der Tat eine gewisse historische Rechtfer-
tigung. Man tut aber wohl besser daran, den
Konzeptualismus als vertrglich mit bestimm-
ten Versionen sowohl des Nominalismus als
auch des Realismus (bezogen auf die hier for-
mulierte Unterscheidung zwischen den beiden
Theorien) zu betrachten. Denn der Konzep-
tualismus lehrt, da alle Referenten desselben
Ausdrucks unter denselben Begriff subsu-
miert werden (gleichgltig, ob sie als solche
etwas gemeinsam haben) und da Begriffe,
sowohl in Gedanken wie in Sprache, zwischen
sprachlichen Ausdrcken und dem, was sie
bezeichnen, vermitteln. Ein vielzitierter
brigens sowohl realistischer wie idealisti-
scher mittelalterlicher Slogan drckt dies
folgendermaen aus: Vox significat [res] me-
diantibus conceptibus. In der hier verwendeten
Terminologie kann dies so wiedergegeben
werden: Ein sprachlicher Ausdruck bezeich-
net [seine Referenten] mithilfe von Begriffen.
In der Terminologie von Abb. 1.1: A bezeich-
net C mittels B.
Wir werden auf die Position B des semio-
tischen Dreiecks erst im folgenden Abschnitt
nher eingehen. Bisher haben wir zwei Dinge
ber die Referenztheorie der Bedeutung ge-
sagt:
(i) Sie unterscheidet sich von der Ideations-
theorie nicht dadurch, da sie B als nicht-
existent oder als fr den Sprachgebrauch ir-
relevant verwerfen wrde, sondern darin, da
sie C (oder, in manchen Versionen, die Bezie-
hung zwischen A und C) als Bedeutung von
A definiert;
(ii) Sie ist neutral gegenber Nominalismus
und Realismus. Die Referenztheorie ist eben-
falls mit der ganz traditionellen Ansicht ver-
trglich wiewohl sie diese nicht unbedingt
impliziert , da Ausdrcke ihre Referenten
sowohl bezeichnen (sich auf sie beziehen) als
auch benennen. Man wird bemerkt haben,
da ich das lateinische significare in dem oben
zitierten mittelalterlischen Slogan als be-
zeichnen (oder sich beziehen auf) bersetzt
habe. In dem gegenwrtigen Kontext ist dies
verteidigbar, aber es bedarf zustzlicher Er-
luterung im Lichte der modernen Referenz-
theorien.
Was nun aber die Gleichsetzung von Re-
ferenz und Benennung betrifft (und folglich in
einer Referenztheorie der Bedeutung auch die
Gleichsetzung von Bedeutung und Benen-
10 I. Allgemeine Grundlagen
Gesichtspunkt der Paraphrasierbarkeit als
Satz (2).
(1) Johann wei nicht, da der Held von Ver-
dun der Chef der Vichy-Regierung war.
(2) Johann wei nicht, da der Held von Ver-
dun der Held von Verdun war.
Nimmt man ferner an, da Synonymie durch
Wahrheitsbedingungen-quivalenz erklrt
wird (vgl. 2.8), dann kann leicht bewiesen
werden, da (1) und (2) nicht dieselbe Bedeu-
tung haben knnen, denn sie haben nicht
dieselben Wahrheitsbedingungen.
Im Zuge dieses zweiten Argumentes kam
Frege (1892) dazu, seine berhmte, aber ter-
minologisch unglckliche Unterscheidung
zwischen Sinn und Bedeutung zu treffen. Er
whlte Bedeutung fr die Relation, die heut-
zutage Referenz genannt wird, denn er vertrat
eine Referenztheorie der Bedeutung. Anstatt
die Theorie im Lichte von Beispielen wie (1)
und (2) aufzugeben, verkomplizierte er sie,
indem er eine Trennlinie zwischen direkter
und indirekter (oder obliquer) Referenz zog.
Andere, insbesondere Carnap (1947), haben
eine im groen und ganzen vergleichbare be-
griffliche Trennung innerhalb der Referenz-
theorie der Bedeutung vollzogen, indem sie
zwischen Extension und Intension unterschie-
den.
Ein dritter Grund, der dafr spricht, we-
nigstens die geradlinigsten Versionen der Re-
ferenztheorie zu verwerfen, ist erst in jngster
Zeit von Philosophen ernst genommen wor-
den, und er ist auch in traditionellen Dar-
stellungen der lexikalischen Semantik nicht
mit gebhrendem Nachdruck herausgestellt
worden. Es geht darum, da Lexeme d. h.
Worteinheiten der Art, die (in ihrer Zitier-
form) in konventionellen Wrterbchern auf-
gelistet sind nicht als solche referierende
Ausdrcke sind. Diese Tatsache ist in man-
chen Sprachen (z. B. Latein, Russisch oder
Malaiisch) nicht so offensichtlich wie in an-
deren (z. B. Deutsch, Englisch oder Franz-
sisch), wo solche Nomina wie Kuh im Singular
nicht ohne Determinator, Quantor oder Klas-
sifikator benutzt werden knnen, sollen sie
sich auf bestimmte Dinge beziehen. Ganz un-
abhngig von der grammatischen Struktur
einer bestimmten Sprache mssen jedoch Le-
xeme auf jeden Fall von den referierenden
Ausdrcken unterschieden werden, deren
Komponenten sie sind oder sein knnen. Re-
ferierende Ausdrcke werden anllich be-
stimmter uerungsgelegenheiten nach den
grammatischen Regeln einer Sprache gebil-
det. Sie sind prinzipiell nicht auflistbar, weil
zu einer unorthodoxen und kontraintuitiven
Charakterisierung von Bedeutungsgleichheit
und Bedeutungsverschiedenheit fhrt, da (i)
derselbe Ausdruck dazu benutzt werden
kann, um sich auf verschiedene Entitten zu
beziehen (ohne da es zu einer Vernderung
der Bedeutung des Ausdruckes kme) und (ii)
verschiedene (nicht-synonyme Ausdrcke)
dazu benutzt werden knnen, um dieselbe
Entitt zu bezeichnen. Zum Beispiel kann (i)
mein Vater oder sogar der Eigenname John
Lyons beliebig viele Referenten haben, und
(ii) knnten der Held von Verdun und der Chef
der Vichy-Regierung beide dazu benutzt wer-
den, um Marschall Ptain zu bezeichnen.
Wenn wir sagen da (i) mein Vater seine Be-
deutung nicht mit jedem Wechsel des Refe-
renten ndert oder da (ii) der Held von Ver-
dun eine andere Bedeutung hat als der Chef
der Vichy-Regierung, dann knnen wir uns
hier auf unseren common sense verlassen oder
auf mehr oder weniger theorieneutrale Tests
wie Paraphrase oder bersetzung. Wenn sich
die Bedeutung von mein Vater mit dem Wech-
sel des jeweiligen Referenten ndern wrde,
dann knnten wir diesen Ausdruck nicht kon-
sistent durch einen einzigen Ausdruck in an-
dere Sprachen bersetzen, dessen Bedeutung
in gleicher Weise variiert, z. B. in my father,
mon pre usw. Und wenn der Chef der Vichy-
Regierung synonym mit der Held von Verdun
wre, dann mte jeder Ausdruck, der den
einen angemessen bersetzt, auch den ande-
ren angemessen bersetzen. Argumente dieser
Art gegen die Referenztheorie kann man auf
der Basis des gesunden Menschenverstandes
entwickeln. Was die Philosophen aber beein-
druckt hat, ist ein verwandtes, erkenntnis-
theoretisch aber viel weiterreichendes Argu-
ment.
Es hat mit der Intersubstituierbarkeit von
synonymen und nicht-synonymen Ausdrk-
ken in sogenannten intensionalen oder opa-
ken Kontexten zu tun. Beispielsweise stellt der
Skopus von Verben der propositionalen Ein-
stellung (wissen, glauben, usw.) einen derarti-
gen Kontext dar (vgl. dazu den Artikel 34).
Es wird allgemein angenommen und diese
Annahme wird im Kompositionalittsprinzip
(1.4) explizit gemacht , da die Substitution
von synonymen Ausdrcken freinander in
greren Ausdrcken, deren Konstituenten
sie sind, keinen Einflu auf die Bedeutung der
greren Ausdrcke haben sollte. Aber Satz
(1) hat zweifellos eine andere Bedeutung
und zwar sowohl nach den Kriterien des ge-
sunden Menschverstandes als auch nach dem
1. Bedeutungstheorien 11
positionell ist; vgl. 1.5) als zur Satzbedeutung
rechnen.
Jede solche Theorie htte sich auch dem
Problemkreis zuzuwenden, fr den Frege
seine Sinn-Bedeutung-Unterscheidung einge-
fhrt hat. Sowohl Referenz als auch Deno-
tation sind, so wie sie hier eingefhrt wurden,
von ihrer Natur her extensional und nicht
intensional. Im Zusammenhang mit solchen
Tatsachen wie die der Nicht-Synonymie von
denotationell quivalenten, zusammengesetz-
ten, nicht-referierenden Ausdrcken (wie
etwa ungefiederter Zweifler und vernunft-
begabtes Lebewesen, um ein Standardbeispiel
zu benutzen) kann man sich deshalb nicht auf
die Unterscheidung von Referenz und De-
notation berufen. Eine elaboriertere Version
der sogenannten Referenztheorie der Bedeu-
tung knnte prinzipiell mit diesen und hnli-
chen Phnomenen fertig werden, indem sie
das, was traditionell als die Intension eines
Ausdrucks beschrieben wurde, als Variation
der Extension in den verschiedenen mglichen
Welten interpretiert. Dies haben Montague
und seine Nachfolger getan (siehe 2.8 und
Artikel 7). Montagues Bedeutungstheorie ist
nur eine verfeinerte Version dessen, was tra-
ditionell etwas ungenau Referenztheorie der
Bedeutung genannt wurde.
2.3Die Ideationstheorie
Der Ideationstheorie brauchen wir weniger
Raum zu widmen. Dies nicht deshalb, weil sie
weniger wichtig als die Referenztheorie ist
oder gewesen ist, sondern einfach deswegen,
weil sich vieles, was in 2.2 gesagt wurde, ber-
tragen lt. Ebenso wie die Referenztheorie
tritt die Ideationstheorie in verschiedenen Ge-
stalten auf. Sie unterscheidet sich von ihr
darin, da sie in Abb. 1.1 nicht C, sondern B
als Bedeutung von A ansieht.
Die Ideationstheorie der Bedeutung ist
nachweislich die traditionellste aller Theorien,
sowohl in der Linguistik als auch in der Phi-
losophie. Zahllose Generationen von Sch-
lern sind ber die Jahrhunderte hinweg mit
Satzdefinitionen aufgezogen worden, die sich
auf die Kriterien der grammatischen Wohl-
geformtheit und der semantischen Vollstn-
digkeit beriefen und die den Begriff der se-
mantischen Vollstndigkeit vollstndig oder
fr sich sinnvoll zu sein dadurch umschrie-
ben, da der Satz einen einzelnen selbstndi-
gen Gedanken, eine Idee, ausdrckt. In der
westlichen Tradition knnen alle derartigen
Definitionen auf die von Priscian und seiner
sie in einigen vielleicht sogar allen natr-
lichen Sprachen von unendlicher Zahl sind
und ihre Referenz typischerweise je nach den
Umstnden der uerung und dem Redeu-
niversum variiert. Lexeme gibt es dagegen nur
endlich viele (und zwar relativ wenige), und
die Relationen, in denen sie zu Entitten in
der Auenwelt stehen, variieren nicht mit den
Umstnden der uerung.
Der gerade herausgearbeitete Punkt kann
anhand der terminologischen Unterscheidung
von Denotation und Referenz przisiert wer-
den. Wir wollen sagen, da das Lexem Kuh
die Klasse aller Khe (die jetzt existieren,
existiert haben und knftig existieren) deno-
tiert, und da seine Denotation ein Teil dessen
ist, was mit Recht als seine Bedeutung ange-
sehen wird. Ausdrcke wie diese Kuh, fnf
Khe, diese Kuhherde, Khe usw. enthalten das
Lexem Kuh (in der grammatisch und seman-
tisch angemessenen Form). Kraft ihrer De-
notation und der Bedeutung der anderen
Komponenten, mit denen sie kombiniert sind,
haben sie einen bestimmten Referenzbereich
bzw. ein Referenzpotential. Worauf sie sich
aber tatschlich beziehen, wenn sie als refe-
rierende Ausdrcke verwendet werden, wird
vom Kontext bestimmt. Es sei in diesem Zu-
sammenhang darauf hingewiesen, da Kuh
zwar die Klasse der Khe denotiert, aber den-
noch nicht zur Referenz auf diese Klasse be-
nutzt werden kann. Zu diesem Zweck mssen
wir die Pluralform verwenden (die allerdings
auch viele andere Verwendungen hat) oder
zusammengesetzte Ausdrcke (wie etwa die
Klasse der Khe). Es ist ferner eine Feststel-
lung wert, da nicht einmal Eigennamen (in
vielen natrlichen Sprachen und Kulturen, in
denen sie fungieren) mit einem einzigen Re-
ferenten verknpft sind, der durch alle mg-
lichen uerungskontexte hindurch konstant
ist.
Damit sollte deutlich geworden sein, da
die sogenannte Referenztheorie der Bedeu-
tung in ihrer einfachsten und traditionellsten
Form von einer Konfusion dessen, was wir
bei der Interpretation der AC-Relation in
Abb. 1.1 als Denotation und Referenz unter-
schieden haben, profitiert. Dies impliziert
nicht, da es prinzipiell unmglich ist, eine
elaboriertere Version dieser Theorie zu ent-
wickeln, in der denotationelle und referen-
tielle Bedeutung korrekt unterschieden und
dann systematisch aufeinander bezogen wer-
den. Jede Theorie dieser Art wrde wahr-
scheinlich Referenz eher zur uerungsbe-
deutung (die vielleicht nicht vollstndig kom-
12 I. Allgemeine Grundlagen
schaftlich aber nicht wnschbaren Vagheit
solcher Wrter wie Idee, Gedanke und Begriff
zu verdanken. Wenn man unter Idee in diesem
Zusammenhang etwas wie Bild versteht,
dann kann man wenigstens die Vorstellung
nachvollziehen, da die Bedeutung von Wr-
tern wie Baum, Tisch oder Berg das verall-
gemeinerte oder schematische Bild von Bu-
men, Tischen und Bergen ist, das von den
Personen geteilt wird, die die Bedeutung die-
ser Wrter kennen. Tatschlich sind die Ver-
hltnisse selbst inbezug auf die Dinge, von
denen wir uns ein mentales Bild machen kn-
nen, wenn wir wollen oder mssen, nicht so
selbstverstndllich, wie wir gerade suggeriert
haben. Auch ist keineswegs klar, da solche
Bilder eine Rolle beim Erwerb, bei der Spei-
cherung oder beim Gebrauch der fraglichen
Wrter spielen. Wie dem auch sein mag, klar
ist, da die berwltigende Mehrzahl der
Wrter in den Vokabularen von natrlichen
Sprachen keine Klassen von mental visuali-
sierbaren Entitten wie Bume, Tische und
Berge darstellen. Wenn aber die Idee (oder
der Begriff) kein mentales Bild ist, welche
andere Art von mentaler Entitt ist sie (bzw.
er) dann?
Es fehlt nicht an Theorien dessen, was ge-
meinhin Begriffsbildung genannt wird, und
einige dieser Theorien sind von Psychologen
entworfen worden und durch experimentelle
Ergebnisse gesttzt worden. Das Problem be-
steht jedoch darin, da solche Theorien ledig-
lich das Wort Begriff anstelle von Bedeutung
verwenden, ohne es unabhngig zu charak-
terisieren. Wenn die Ideationstheorie irgend-
einen Erklrungswert haben soll, dann ms-
sen zwei Bedingungen erfllt sein: (1) es mu
mglich sein, festzustellen, ob eine bestimmte
Idee, Gedanke oder Begriff im Kopf ist, wenn
ein Wort in einem bestimmten Sinn benutzt
wird, ohne einfach zu schlieen, da diese
Idee, dieser Gedanke oder Begriff deswegen
im Kopf ist, weil wir wissen, was das Wort
bedeutet; (2) es mu gezeigt werden, da es
ein notwendiger Bestandteil der Kenntnis der
Bedeutung eines Wortes ist, die betreffende
Idee (Gedanke oder Begriff) zu haben. Es ist
bemerkenswert, da die von Linguisten, Phi-
losophen, Psychologen und anderen bisher
entwickelten Ideationstheorieen der Bedeu-
tung diese beiden Bedingungen nie erfllt
haben.
Aus dem gerade Gesagten folgt nicht, da
mentale Reprsentationen und mentale Pro-
zesse der verschiedensten Art keine Rolle bei
der Sprachverwendung spielen wrden (ob-
griechischen Vorlufer zurckgefhrt werden
(vgl. 1.2, 1.5). Obwohl diese Definitionen
nicht notwendigerweise die Satzdeutung mit
dem Gedanken oder der Idee, die der Satz
ausdrckt, gleichsetzen mssen, so wird in der
Tradition dennoch Satzbedeutung auf diese
Weise erklrt. Was die lexikalische Bedeutung
betrifft, so wird diese mit den einfacheren,
unvollstndigen Gedanken oder Ideen iden-
tifiziert, welche mit Wrtern oder Phrasen
verknpft sind. Diese Gedanken oder Ideen
werden auch Begriffe genannt.
Auf den ersten Blick ist die Ideationstheo-
rie der Bedeutung sehr viel attraktiver als die
Referenztheorie, denn sie ermglicht es uns,
einerseits zwischen Bedeutung und Referenz,
anderererseits zwischen Intension und Exten-
sion zu unterscheiden. Wenn wir die konzep-
tualistische Betrachtungsweise der Bedeutung
annehmen (die wir mit Nominalismus, Rea-
lismus oder einer dazwischen liegenden Mi-
schung der beiden kombinieren knnen: vgl.
2.2), knnen wir die beiden Unterscheidungen
in einer zusammenfallen lassen: Wir knnen
sagen, da die Bedeutung eines Ausdrucks die
Intension der Klasse ist, die er bezeichnet und
da die Intension der Begriff, Gedanke oder
Idee ist, die mit dem Ausdruck im Geist des
Sprechers der fraglichen Sprache verknpft
ist. Diese Betrachtungsweise ist, wie wir ge-
sehen haben, in die scholastische Analyse der
Referenz als Bezeichnung integriert. Diese
Sehweise hat auerdem sowohl die linguisti-
sche Semantik als auch die Sprachphilosophie
der nachscholastischen Periode bis in das 20.
Jh. hinein beherrscht. In diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, da die klas-
sische Formulierung der Ideationstheorie
des im 17. Jhs lebenden Empiristen John
Locke The use, then, of words is to be
sensible marks of ideas; and the ideas that they
stand for are their proper and immediate sig-
nification [Der Gebrauch der Worte besteht
darin, wahrnehmbare Zeichen von Ideen zu
sein; und die Ideen, wofr sie stehen, sind ihre
eigentliche und unmittelbare Bedeutung]
nicht wesentlich verschieden ist von Formu-
lierungen der mittelalterlichen Scholastiker
oder von Lockes rationalistischen Zeitgenos-
sen (vgl. Alston 1964 a). Die Ideationstheorie
der Bedeutung ist von Nominalisten und Rea-
listen vertreten worden, und auch von Ratio-
nalisten und Empiristen.
Der Umstand, da sie so lange berlebt
hat (und wahrscheinlich noch immer die po-
pulrste Bedeutungstheorie unter Nicht-Spe-
zialisten ist), ist der praktischen wissen-
1. Bedeutungstheorien 13
terscheidung zwischen dem Allgemeinen und
dem Besonderen, dem Kontextunabhngigen
und dem Kontextabhngigen, quer zu der
Unterscheidung zwischen Bedeutung und Re-
ferenz auf der einen und der zwischen Inten-
sion und Extension auf der anderen Seite
verluft.
2.4Verhaltenstheorie der Bedeutung und
behavioristische Semantik
Unter Verhaltenstheorie der Bedeutung ver-
stehe ich jede Bedeutungstheorie, die auf der
Auffassung beruht, da Sprache nichts an-
deres als Verhalten ist, das ffentlich be-
obachtbar und seinem Wesen nach vollstn-
dig physikalisch ist, das ferner ausreichend
beschrieben werden kann, sowohl was seine
Form als auch was seine Bedeutung betrifft,
ohne die Existenz solcher nicht-physikali-
schen oder mentalistischen Entitten wie
Ideen, Begriffe oder Intentionen zu postulie-
ren. Unter behavioristischer Semantik verstehe
ich die speziellere Variante einer Verhaltens-
theorie der Bedeutung, die explizit auf der
psychologischen Theorie der Bedeutung be-
ruht, die von J. B. Watson (1924) und seinen
Anhngern entwickelt wurde.
Eine einflureiche Verhaltenstheorie der
Bedeutung, die allerdings nicht behaviori-
stisch ist, war die von Ogden und Richards
(1923), deren sogenanntes Basisdreieck in all-
gemeinerer Form in Abschnitt 2.2 wiederge-
geben wurde. Wie die meisten Verhaltens-
theorien der Bedeutung ist sie eine kausale
Theorie der Bedeutung: dies bedeutet, da sie
behauptet, da Wrter und uerungen kau-
sal mit den Situationen verbunden sind, in
denen sie vorkommen und da ihre Bedeu-
tung von dieser kausalen Verbindung ab-
hngt. Was die Referenz betrifft (die fr Og-
den und Richards eine Art von Bedeutung
ist), so behauptet die Theorie, da der Refe-
rent (d. h. C in Abb. 1.1) B verursacht (d. h.
im Kopf des Sprecher/Hrers einer gegebenen
Sprache den Begriff B hervorruft) und da B
A verursacht (d. h. eine uerung der Form
A, beziehungsweise den Ausdruck A, hervor-
bringt).
Bemerkenswert an dieser Analyse der Be-
zeichnung oder Bedeutung ist, da sie, ob-
wohl sie hinreichend traditionell darin ist, da
sie die Beziehung zwischen A und C als in-
direkt und konventionell ansetzt, die Kausa-
littsrichtung hinsichtlich der vermittelnden
Relation, die zwischen B und C besteht, um-
kehrt. Traditionell wird die Sprache als Aus-
wohl, wie wir sehen werden, die Behavioristen
und andere Antimentalisten diesen Schlu ge-
zogen haben: 2.4). Sie spielen im Gegenteil
ganz offensichtlich eine Rolle. Was zur Frage
steht ist, ob die Bedeutungen von Wrtern,
Phrasen, Stzen usw. mit mentalen Entitten,
seien sie mentale Bilder oder nicht, identifi-
ziert werden knnen im striktesten Sinne
von Identifikation , und, falls dies mg-
lich ist, ob eine nichtzirkulre Bestimmung
der Rolle solcher mentalen Entitten bei der
Explikation von Denotation und Referenz ei-
nerseits und sprachinternen Erscheinungen
wie Synonymie, Folgerung, Paraphrase usw.
andererseits mglich ist. Nicht nur traditio-
nelle Ideationstheorien der Bedeutung, son-
dern auch moderne generativistische Versio-
nen, die auf der Zerlegung von Wrtern in
ihre atomaren begrifflichen Komponenten be-
ruhen Theorien von der Art, wie sie von
Katz & Fodor (1963) und Katz (1972) in die
Linguistik eingefhrt wurden fallen den
heute allgemein akzeptierten Standardein-
wnden gegen die Ideationstheorie zum Op-
fer. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die angeblich
atomaren Begriffe explizit mithilfe der Be-
griffe Denotation und Referenz interpretiert
worden sind sofern dies mglich ist
bleiben diese Zerlegungen sogar geheimnis-
voller als die Bedeutungen von Wrtern und
Phrasen, die sie erklren sollen (vgl. Lewis
1970 und Artikel 2 und 4).
Ein letzter Punkt sollte beleuchtet werden.
Wir haben an frherer Stelle gesagt, da die
Ideationstheorie zunchst insofern attraktiv
ist, als sie die Mglichkeit bietet, zwischen
Bedeutung und Referenz (Freges Sinn und
Bedeutung) zu unterscheiden und/oder zwi-
schen Intension und Extension. Weiteres
Nachdenken zeigt aber bald, da die Theorie,
so wie sie traditionell dargestellt wird, den
obengenannten Unterschied zwischen der
kontextunabhngigen referentiellen Bedeu-
tung eines Lexems wie Kuh und der kontext-
abhngigen referentiellen Bedeutung von zu-
sammengesetzten Ausdrcken wie die Kuh
nicht zu behandeln vermag. Wenn es einen
allgemeinen Begriff Kuh gibt, der als Inten-
sion des Lexems Kuh dient und auch seine
Extension (d. h. seine Denotation bestimmt),
dann mu es auch einen besonderen Begriff
diese Kuh geben, der als Intension der
Phrase die Kuh dient und deren Extension
(d. h. ihre Referenz) festlegt. Traditionelle
Darstellungen der Ideationstheorie der Be-
deutung machen den Fehler, da sie nicht
dem Umstand Rechung tragen, da die Un-
14 I. Allgemeine Grundlagen
Unter dem Einflu Bloomfields und seiner
Schler wurde das Studium der linguistischen
Semantik fr etwa zwanzig Jahre entweder
vollstndig vernachlssigt oder, wie im Falle
des Distributionalismus (eine bestimmte
Spielart der kontextuellen Semantik: siehe
2.6), in unproduktive Forschungsrichtungen
abgelenkt, nmlich in die Richtung der da-
mals dominierenden Schule der amerkani-
schen Linguistik: die Schule des sogenannten
Nach-Bloomfieldschen Strukturalismus. In
dieser Schule lernte Chomsky seine erste Lin-
guistik. Er war es natrlich, der in seiner
berhmten Rezension von Skinner (1957;
siehe Chomsky 1959) behavioristischen Mo-
dellen des Sprachgebrauchs und -erwerbs den
Todessto gab. Es ist aber wichtig, sich klar
zu machen, da wie dies oft in der Dialek-
tik des wissenschaftlichen Fortschritts der
Fall ist das, was Chomsky unhinterfragt
von seinen nach-Bloomfieldschen Vorlufern
bernahm, genau so wichtig ist, wie das, was
er verwarf. Er mag zwar die Kompetenz an-
stelle der Performanz betont haben, aber
ebenso wie Bloomfield und einige der Nach-
Bloomfieldianer bernahm er ein letztlich
psychologisches Modell der Sprachstruktur.
Darber hinaus vertritt Chomsky, obwohl er
sich zugunsten des Mentalismus ausgespro-
chen und explizit den positivistischen Physi-
kalismus der Behavioristen verworfen hat,
einen sehr untraditionellen, antidualistischen
Mentalismus (vgl. Lyons 1971: 134 f.). Tat-
schlich ist es sehr schwierig zu sehen, ob es
letztlich einen Unterschied zwischen Quines
(1960) Physikalismus und Chomskys Menta-
lismus gibt: alles erweist sich letzten Endes als
angeboren und genetisch vermittelt, sowohl
kognitive Strukturen wie auch Verarbeitungs-
prinzipien, die beide Gelehrte als wesentlich
postulieren, seien sie nun fr den Sprachge-
brauch und -erwerb einschlgig oder nicht.
Wenige Linguisten oder Psychologen wr-
den heute die Prinzipien der Verhaltenstheorie
der Bedeutung oder der behavioristischen Se-
mantik in der Form, in der diese Theorien
von Ogden und Richards, Morris (1946),
Bloomfield oder Skinner dargestellt worden
sind, verteidigen. Und wenige Wissenschafts-
theoretiker wrden versuchen, die Verpflich-
tung zu dem in der Tat kruden Physikalismus
oder Positivismus des 19. Jhs zu rechtfertigen,
auf dem der radikale Behaviorismus von
Bloomfield und Skinner basiert.
Es mu deshalb betont werden, da der
verhaltenstheoretische, wenn nicht sogar der
behavioristische, Standpunkt in der moder-
druck oder uerliche Kundgabe des Denkens
angesehen; und von Gedanken oder Begriffen
glaubt man, da sie im Geist entstehen, und
zwar entweder unverursacht oder durch an-
dere Gedanken verursacht, nicht aber durch
uere Gegenstnde, Ereignisse oder Situa-
tionen. Alle Verhaltenstheorien der Bedeu-
tung tendieren dazu, die Sichtweise von Og-
den und Richards zu teilen, worin sich ihre
Verpflichtung zum Physikalismus zeigt. Der
Umstand, da Ogden und Richards solche
Termini wie Idee oder Begriff im Hinblick auf
B benutzen, bedeutet nicht, da ihre Theorie
eine Ausnahme zu der gerade aufgestellten
Generalisierung darstellt. Wenn man sie ge-
drngt htte, wrden sie ohne Zweifel argu-
mentiert haben, da scheinbar mentalistische
Termini wie Geist, Begriff oder Idee bloe
Platzhalter (oder intervenierende Variablen,
um einen Begriff der spteren Behavioristen
zu benutzen) sind, die man mit dem Fort-
schritt der Wissenschaft zu gegebener Zeit
durch offensichtlich eher nicht-mentalistische
Termini ersetzen knne, die sich auf Gehirn-
ablufe und Nervenaktivitt beziehen wr-
den. (Tatschlich diskutieren Ogden und Ri-
chards Referenz aus einer psychologischen
Sicht, die heutzutage als berholt und sim-
plistisch angesehen wrde, nmlich auf der
Basis der von ihnen so genannten Engramme:
hypothetische physikalische Gedchtnispuren
im Gehirn.)
Die Ansicht, da die Sprache einfach eine
bestimmte Art von kommunikativem Verhal-
ten ist, war unter Linguisten der ersten Hlfte
des 20. Jhs weit verbreitet. Wenige von ihnen
sind allerdings so weit wie Bloomfield gegan-
gen, der nicht nur fr eine Verhaltenstheorie
der Bedeutung, sondern fr eine im engeren
Sinne behavioristische Semantik pldiert hat.
Fr ihn besteht die Bedeutung einer ue-
rung in ihren Reiz-Reaktions-Merkmalen
(1926: 155) oder, anders formuliert, in der
Situation, in welcher der Sprecher sie uert
und in der Reaktion, die sie bei dem Hrer
hervorruft (1933: 139). Die Schlsseltermini
sind Reiz [stimulus] und Reaktion [re-
sponse], beide aus der behavioristischen Psy-
chologie bernommen. Hier wird die Ansicht
vertreten, da Bedeutung in letzter Instanz
durch bedingte Reaktionen auf Umweltreize
erklrbar ist, die zwar komplexer als die be-
dingten Reflexe von Pawlows speichelprodu-
zierendem Hund, in ihrer Art aber nicht ver-
schieden davon sind. Jede behavioristische
Lerntheorie beruht auf diesem Begriff von
Konditionierung.
1. Bedeutungstheorien 15
durch (ii) und die vorherrschende positivisti-
sche Einstellung, die fr die Sozialwissen-
schaften dieser Epoche charakteristisch war
(die Linguistik wird von den Nach-Bloom-
fieldianern normalerweise unter die Sozial-
wissenschaften eingereiht), versuchte sie, eine
Reihe induktiver Entdeckungsverfahren fr
die Beschreibung von Sprachen zu formulie-
ren;
(iv) Sie schlo die Untersuchung der Be-
deutung aus der eigentlichen Linguistik aus.
In dem gegenwrtigen Kontext ist selbst-
verstndlich (iv) von grtem Interesse; und
im Hinblick auf die Bedeutung, welche se-
mantische Erwgungen in der generativen
Grammatik ab der Mitte der sechziger Jahre
erlangt haben, ist dies der Ort, darauf hin-
zuweisen, da Chomsky (1957) zwar die nach-
Bloomfieldsche Linguistik zurecht fr die von
mir so bezeichneten Merkmale (i), (ii) und
(iii) kritisierte, (iv) aber nicht in Frage gestellt
hat. Dies ist ein weiteres Beispiel dafr, da
Chomskys Generativismus Haltungen und
Prinzipien mehr oder weniger unhinterfragt
bernahm, die derselben Tradition entstamm-
ten, gegen die er im allgemeinen heftig auf-
begehrt hat (vgl. Lyons 1983 b: 207214).
Der Terminus strukturelle Semantik ist
selbstverstndlich nicht widersprchlich,
wenn man den allgemeineren Sinn von struk-
turell zugrunde legt. Er bezeichnet ganz ein-
fach jeden Ansatz zur Erforschung der Be-
deutung (in der Sprache), der auf dem Prinzip
beruht, da Sprachen (genauer, Sprachsy-
steme Saussures langues) abstrakte Struk-
turen sind, deren Elemente ihre Identitt (ihr
Wesen und ihre Existenz) von den substitu-
tionellen und kombinatorischen Beziehungen
herleiten, die zwischen ihnen bestehen (d. h.,
um die Saussuresche Terminologie zu benut-
zen, von ihren paradigmatischen und syntag-
matischen Beziehungen). Wir mssen hier
keine ausfhrliche Darstellung des Struktu-
ralismus in der Linguistik liefern (vgl. Lyons
1980: 242261; 1983 b: 198207). Es mge
hier die Feststellung gengen, da der struk-
turelle Standpunkt in der Semantik erst spter
eingenommen wurde als in anderen Zweigen
der theoretischen und deskriptiven Linguistik
wie etwa der Phonologie, da aber sein Ein-
flu in einem groen Teil der interessantesten
Arbeiten zur Semantik der letzten fnfzig
Jahre sichtbar ist.
Was die zeitgenssische Forschung zur Se-
mantik betrifft, so ist ein guter Teil davon de
facto sowohl nach Methode als auch Geist
nen philosophischen Semantik noch stark
vertreten ist. Das klassische Werk von Quine
(1960) ist bereits genannt worden. Es sollte
auch bemerkt werden, da Grices (1957, 1968,
1969) einflureiche Analyse der Bedeutung
auf der Basis des Begriffes der kommunika-
tiven Intention stark behavioristisch beein-
flut ist obwohl sie sich auf scheinbar
mentalistische Begriffe wie Intention beruft.
Man kann dafr argumentieren, da Austins
(1962) ebenso einflureiche Theorie der
Spechhandlungen als verhaltenstheoretisch
klassifiziert werden kann. Bennetts (1976) Be-
handlung der Bedeutung, die bislang noch
nicht die ihr gebhrende Aufmerksamkeit von
Seiten der Linguisten erfahren hat, ist fraglos
eine verhaltenstheoretische und wird auch als
eine solche ausgegeben. Es wre deshalb
falsch, verhaltenstheoretische und dies gilt
vielleicht sogar fr behavioristische Se-
mantiken als veraltet und verfehlt abzuschrei-
ben.
2.5Strukturelle Semantik
Vielen Linguisten, die in der nach-Bloom-
fieldschen amerikanischen Tradition gro ge-
worden sind, hat der Terminus strukturelle
Semantik Kopfzerbrechen bereitet, ja er ist
ihnen widersprchlich vorgekommen. Aber
dies ist einfach deswegen geschehen, weil die
ursprnglich allgemeineren Termini Struktu-
ralismus und strukturelle Semantik in theore-
tisch und methodisch einflureichen Publi-
kationen der nach-Bloomfieldschen Schule
eine unberechtigte Bedeutungsverengung er-
fahren haben, besonders in Harris (1951).
Es gibt mehrere Kennzeichen der nach-
Bloomfieldschen Linguistik, die diese von
einigen oder allen anderen Anstzen zur Er-
forschung der Sprache unterscheiden, mit de-
nen sie in den fnfziger und den frhen sech-
ziger Jahren im internationalen Wettstreit
stand. Dazu gehren die folgenden:
(i) Sie war korpusbezogen und lehnte die
Unterscheidung zwischen Sprachsystem
(Saussures langue, Chomskys Kompetenz)
und Sprachuerungen (Saussures parole,
Chomskys Performanz) ab;
(ii) Sie war zugegebenermaen taxono-
misch oder klassifikatorisch, nicht aber erkl-
rend, und folglich mehr mit der Methodologie
der Beschreibung beschftigt als mit einer er-
klrungsadquaten Theorie der Sprachstruk-
tur;
(iii) Auf der Grundlage von (i), beschrnkt
16 I. Allgemeine Grundlagen
auf sehr originelle Weise von Philosophen wie
Putnam (1975) auf der einen und Psychologen
wie Rosch (1974, 1976) auf der anderen Seite
angegriffen worden. Sie haben mit starken
Argumenten berzeugend nachgewiesen, da
die Wrter fr sogenannte natrliche Arten
wie Tiger oder Zitrone eher ber ihre proto-
typische Bedeutung als ber eine Reihe von
notwendigen und hinreichenden Bedingun-
gen, die ihre Extension definieren, verstanden
werden (vgl. Lyons 1981 a: 6971). Ihre Ar-
gumente knnen fr den Groteil des Voka-
bulars verallgemeinert werden.
Nicht alle strukturellen Semantiker sind
Vertreter der Komponentenanalyse gewesen.
Insbesondere scheint keiner von den Entdek-
kern des Wortfeldbegriffes Ipsen (1924),
Jolles (1934), Porzig (1934), Trier (1934)
die Mglichkeit ins Auge gefat zu haben, die
Struktur solcher Felder komponentiell zu be-
schreiben. Es blieb ihren Nachfolgern vorbe-
halten, die Theorie in dieser Richtung zu ent-
wickeln (vgl. Coseriu & Geckeler 1974; Lehrer
1974). Den Feldtheoretikern ging es mehr
darum, den allgemeinen strukturalistischen
Grundsatz zu betonen, da die Bedeutung
eines Wortes das Produkt seiner Beziehungen
zu den Nachbarwrtern desselben Feldes ist:
da z. B. die Bedeutung von Stuhl das Pro-
dukt seiner Relationen zu solchen anderen
Wrtern wie Sessel, Hocker, Mbel, Sofa,
Couch, Bank usw. ist und nur mithilfe dieser
Relationen analysiert oder beschrieben wer-
den kann.
In den klassischen Formulierungen der
Wortfeldtheorie gibt es vieles, was zurecht
kritisiert werden kann: ihr Vertrauen auf
hochgradig rumliche Metaphern; ihr exzes-
siver Relativismus; ihre konzeptualistische
Ontologie usw. (vgl. Lyons 1980: 261271).
Es kann jedoch kaum bestritten werden, da
die Feldtheorie eine wesentlich anspruchvol-
lere Konzeption der semantischen Interdepen-
denz von Wrtern in die Linguistik eingefhrt
hat eine Konzeption von der Unmglich-
keit, die Bedeutung von Wrtern individuell
und in Isolation von anderen Wrtern zu de-
finieren als sie frheren Perioden gelufig
war. Sie hat uns auch eine Flle von detail-
lierten Untersuchungen verschiedener Berei-
che der Vokabulare einiger der greren euro-
pischen Sprachen gebracht, welche die Viel-
falt und den Reichtum der lexikalischen Be-
deutung sowie das chimrische Wesen der all-
gemein angenommenen bersetzungsqui-
valenz illustrieren.
strukturalistisch, obwohl die betreffenden
Forscher vielleicht manchmal erstaunt wren,
so charakterisiert zu werden. Zum Beispiel
hat die lexikalische Komposition, wie sie von
Katz & Fodor (1963) und ihren Anhngern
innerhalb des Rahmens der Chomskyschen
Grammatik praktiziert wurde oder wie sie von
Dowty (1979) auf der Grundlage der Mon-
tague-Grammatik betrieben wurde, in den
USA ihre historischen Vorlufer in den
Schriften von Gelehrten wie Goodenough
(1956) oder Lounsbury (1956) und in Europa
in den Schriften von Hjelmslev (1956) oder
Jakobson (1936) um nur einige der heraus-
ragendsten und einflureichsten zu nennen.
Es ist bedauerlich, da die europischen Ar-
beiten zur Komponentenanalyse die theo-
retischen wie die deskriptiven Katz & Fo-
dor (1963) weitgehend unbekannt waren, als
sie als letztes Ziel der generativen Grammatik
die Konstruktion einer integrierten Theorie
der linguistischen Beschreibung (vgl. Katz &
Postal 1964) ansetzten. Zumindest htte diese
Literatur die generativistischen Proponenten
der lexikalischen Dekomposition in der
Form, in der sie ab Mitte der sechziger Jahre
bis zur Mitte der siebziger Jahre oder sogar
noch spter vorgeschlagen wurde, von An-
beginn an und nicht erst etwa ein Jahrzehnt
spter auf mehrere offensichtliche Ein-
wnde gegen die zugrundeliegenden Annah-
men, auf denen sie beruht, sowie auf ihre
empirischen Inadquatheiten aufmerksam ge-
macht (vgl. Lyons 1965: 1235; 1971:
484492).
Heutzutage ist weitgehend anerkannt, da
die komponentielle Analyse der lexikalischen
Bedeutung und erst recht der grammatischen
Bedeutung zu unberwindlichen Schwierig-
keiten sowohl theoretischer wie deskriptiver
Art fhrt, wenn sie mit einer oder mehreren
der folgenden Annahmen verknpft ist:
(i) da die letzten Komponenten der Be-
deutung unversell sind (d. h. sowohl sprach-
wie kulturunabhngig);
(ii) da die Bedeutung eines jeden beliebi-
gen Wortes irgendeiner Sprache ausschlie-
lich und przise als mengentheoretische
Funktion seiner letzten Komponenten dar-
gestellt werde kann;
(iii) da die komponentielle Analyse der
Bedeutung eines Wortes eine intensionale De-
finition der Klasse der Entitten liefert, die
unter seine Extension fallen.
Jede dieser Annahmen war seit langem ver-
dchtig, und besonders (iii) ist in jngster Zeit
1. Bedeutungstheorien 17
Ausdrcke eine umso hnlichere Verteilung
ber ein reprsentatives Korpus von Daten
hinweg haben, je enger ihre Bedeutungen bei-
einander liegen. Dies hat intuitiv einiges fr
sich. Darber hinaus ist das Prinzip bis zu
einem gewissen Punkt nachweislich korrekt.
Aber insofern es korrekt ist, lt es sich weit-
gehend dadurch erklren, da man sagt, da
die Bedeutungsnhe, sofern sie unabhngig
definierbar ist, selbst der Grund fr die hn-
lichkeit der Distribution ist. Ein weiteres Pro-
blem besteht darin, da es viele verschiedene
Arten von Bedeutungsnhe gibt: Synonymie,
Hyponymie, Antonymie, Paronymie (ver-
schiedener Art) usw. Es gibt aber kein rein
distributionelles Ma des semantisch wichti-
gen Unterschiedes zwischen diesen Arten:
z. B. fr die Relation, die zwischen gut und
schlecht (Antonymie) und jene, die zwischen
nasty und unpleasant (Paronymie oder Bei-
nahe-Synonymie) besteht. Sobald wir damit
beginnen, gewisse Kontexte als symptoma-
tisch oder besonders normal auszuzeichnen,
haben wir eine rein distributionelle Theorie
der Bedeutung bereits verlassen (vgl. Hoe-
nigswald 1960: 16).
Der distributionellen Theorie jener Nach-
Bloomfieldianer die sie auf die Semantik
eher in einem programmatischen als in einem
eigentlichen Sinn angewandt haben hnelt
J. R. Firths (1957) Kollokationstheorie der le-
xikalischen Bedeutung (vgl. Lyons 1983 a:
220227; Gordon 1982: 106120). Firth
selbst gab niemals eine przise Definition von
Kollokabilitt oder ein detailliertes Beispiel
ihres Nutzens fr die Textanalyse an. Ihm
ging es darum, zu betonen, in welchem Ma
die Kollokation eines Wortes seine habi-
tuelle Assoziierung ... mit anderen bestimm-
ten Wrtern in Stzen (Robins 1971: 63)
einerseits unvorhersagbar sei aufgrund der
situativen (oder referentiellen) Bedeutung und
andererseits charakteristisch sei fr den Stil
gewisser sozialer Gruppen oder Individuen.
Es blieb Firths Nachfolgern berlassen, z. B.
Halliday (1966 b) und Sinclair (1966), seine
Ideen ber Kollokabilitt detaillierter auszu-
fhren und in der Folge mithilfe des Begriffs
der Wahrscheinlichkeit des Zusammen-Vor-
kommens zu przisieren. Es gibt allerdings
Grnde fr die Ansicht, da eine detailliertere
Entwicklung dieser Ideen lediglich dazu fhrt,
sie in den Wirkungsbereich der Kritik zu brin-
gen, die ich gegen die distributionelle Bedeu-
tungstheorie hervorgebracht habe.
Es ist gesagt worden, da Firths Begriff
der kollokationellen Bedeutung die Selek-
2.6Kontextuelle Theorien der Bedeutung
Es ist sinnvoll, die kontextuellen Theorien der
Bedeutung in zwei Klassen (von denen jede
aufgrund verschiedener Kriterien in mehrere
Unterklassen zerfllt) zu gruppieren: (a)
starke und (b) schwache Theorien. Eine
starke kontextuelle Theorie der Bedeutung
identifiziert die Bedeutung eines Ausdrucks
mit der Menge von Kontexten, in denen er
vorkommt; eine schwache kontextuelle Theo-
rie der Bedeutung sagt dagegen, da die Be-
deutung eines Ausdrucks durch die Kontexte
bestimmt wird (oder in diesen fr die Be-
schreibung sichtbar wird), in denen er benutzt
wird. Schwache kontextuelle Theorien werden
selbstverstndlich noch weiter abgeschwcht
und so fr den Theoretiker sukkzessive
uninteressanter , wenn die Bestimmung der
Bedeutung durch den Kontext nicht als total,
sondern als partiell angesehen wird.
Ein weiteres anzuwendendes klassifikato-
risches Kriterium hat mit der Interpretation
des Terminus Kontext zu tun. Soll er be-
schrnkt werden auf das, was gewhnlich,
wenn auch tendenzis, der linguistische
Kontext genannt wird, d. h. die gesproche-
nen oder geschriebenen uerungen, die der
betrachten uerung unmittelbar vorange-
hen und folgen, d. h. auf ihren Ko-Text? Oder
bezieht der Terminus den sogenannten situa-
tionellen Kontext der uerung mit ein? Aus
methodologischen Grnden ist fr Linguisten
der Versuch verfhrerisch, nur mit Ko-Text
zu arbeiten, so wie sie auch versucht waren,
bei der Untersuchung von solchen Phno-
menen wie Anapher und Koreferenz nur mit
Ko-Text zu arbeiten. Ich denke aber, da fai-
rerweise gesagt werden mu, da intensive
Forschungsarbeit whrend der letzten zwan-
zig Jahre gezeigt hat, da der einzige in der
Linguistik vertretbare Kontextbegriff einer
ist, der die uerungssituation und das wech-
selseitige Wissen, welche die Teilnehmer von-
einander haben, miteinbezieht (vgl. Smith
1982).
Es gibt eine historisch wichtige starke kon-
textuelle Kontexttheorie, die sich auf Ko-text
beschrnkt hat und die es wert ist, hier er-
whnt zu werden. Es handelt sich um die
distributionelle Theorie, die sich (etwas para-
dox) aus dem Versuch der Nach-Bloomfiel-
dianer entwickelt hat, den Bezug auf seman-
tische Erwgungen bei der Beschreibung der
phonologischen und grammatischen Struktur
von Sprachen zu vermeiden (vgl. Harris 1951;
1954). Sie beruht auf dem Prinzip, da zwei
18 I. Allgemeine Grundlagen
Was ber die Kollokationstheorie der le-
xikalischen Bedeutung gesagt wurde, lt sich
fr jede Art von kontextueller Bedeutungs-
theorie verallgemeinern. Starke kontextuelle
Theorien knnen aus den folgenden Grnden
als inadquat verworfen werden: die Bedeu-
tung vieler Ausdrcke ist weitgehend, wenn
nicht vollstndig ohne wesentlichen Rckgriff
auf den Kontext definierbar; aber Gleichheit
oder Verschiedenheit von Kontext knnen
nicht immer sichergestellt werden, ohne auf
eine unabhngig zu definierende Gleichheit
oder Verschiedenheit von Bedeutung zurck-
zugreifen. Schwache kontextuelle Theorien
sind sicher vertretbar, aber sie bedrfen der
Ergnzung durch andere Bedeutungstheorien
(Ideationstheorien, Referenztheorien, Verhal-
tenstheorien, strukturelle Theorien oder
Wahrheitsbedingungen-Semantik). Umge-
kehrt sind diese anderen Theorien als umfas-
sende Bedeutungstheorien inadquat, wenn
sie die Kontextabhngigkeit etlicher Aus-
drcke in den natrlichen Sprachen nicht zu
behandeln gestatten.
2.7Bedeutung und Gebrauch
Eine der einflureichsten Gestalten in der
Sprachphilosophie und philosophischen Lo-
gik der ersten Hlfte des 20. Jhs war Ludwig
Wittgenstein. Interessanterweise war er je-
doch zwei radikal verschiedenen Konzeptio-
nen von Struktur und Funktion der Sprache
verbunden.
Sein Fhwerk, der Tractatus Logico-Phi-
losophicus (1921), ist ein Meilenstein in der
Entwickung der sogenannten Wahrheitsbedin-
gungen-Semantik (siehe 2.8). Er beruhte auf
der Auffassung, da die einzige oder zu-
mindest primre Funktion der Sprache
darin bestehe, Sachverhalte in der Welt zu
beschreiben, abzubilden oder darzustellen;
ferner beruhte er auf der Auffassung, da
jeder aktuale oder potentielle Sachverhalt
darstellbar sei durch eine Menge von logisch
unabhngigen und unanalysierbaren (ato-
maren) Aussagen, die zu ihm isomorph sind,
oder alternativ durch eine zusammen-
gesetzte Aussage, die sich in ihre atomaren
Bestandteile mithilfe der wahrheitsfunktio-
nalen Operationen der Negation, Konjunk-
tion, Disjunktion usw. zerlegen lt.
In seinem spteren Werk, insbesondere
in seinen Philosophischen Untersuchungen
(1953), verwarf Wittgenstein beide gerade
skizzierten Teile seiner Auffassung von Spra-
che, und vertrat stattdessen die Version eines
tionsbeschrnkungen der transformationellen
generativen Grammatik und die Transfer-
merkmale von Weinreich vorwegnehmen
(Gordon 1982: 120). Aber diese Aussage of-
fenbart meiner Ansicht nach ein grundlegen-
des Miverstndnis von Firths theoretischer
Position. Firth interessierte sich fr die Kol-
lokationen eines Wortes nur deshalb, weil sie
ausschlielich durch das Wort bestimmt, nicht
aber aufgrund der unabhngig davon identi-
fizierbaren Bedeutung des Wortes vorhersag-
bar sind. Z. B. wrde die Tatsache, da
schwanger zusammen mit Mdchen oder Frau
und nicht (oder seltener) zusammen mit Junge
oder Mann vorkommt, Firth weniger inter-
essieren als die Tatsache um eines der Bei-
spiele aus Quine (1953) zu benutzen , da
addled [faul] in der Kollokationsbeziehung
zu egg [Ei], aber nur zu wenigen anderen
Nomina in dieser Beziehung steht [vgl. dazu
im Deutschen die Kollokation von ranzig und
Butter]. Wie Quine sagt, mssen wir uns bei
der Beschreibung der Bedeutung solcher Wr-
ter oft mit einem hinkenden partiellen Syn-
omym plus Regieanweisungen begngen
(1953: 58). Wenn wir in den Arbeiten der
Generativisten nach einem quivalent fr
Quines Regieanweisungen suchen, dann fin-
den wir als nchste Parallele vielleicht die
distinguishers von Katz & Fodor (1963). Aber
Firths Auffassung von Bedeutung ist so ver-
schieden von derjenigen der generativen
Grammatiker (und der meisten Semantiker),
da es verfehlt wre, eine zu enge Parallele
zu ziehen.
Das groe Verdienst der Kollokationstheo-
rie besteht darin, da sie die syntagmatischen
oder kombinatorischen Determinanten der le-
xikalischen Bedeutung hervorhebt. In dieser
Hinsicht berhrt sie sich eher mit Porzigs als
mit Triers Version der Wortfeldtheorie (siehe
2.5). Der Umstand, da Firth seine Aufmerk-
samkeit auf die eher idiosynkratischen Kol-
lokationen eines Wortes konzentriert und die
Kollokationstheorie als Teil einer umfassen-
den Kontextheorie formuliert hat, mag viele
seiner Zeitgenossen befremdet haben. Er
sollte uns aber nicht davon abhalten, uns
seine Einsichten sowie die seiner Nachfolger
oder sogar der nach-Bloomfieldschen Dis-
tributionalisten -als Korrektiv zu der oft ex-
zessiven Abstraktion und Allgemeinheit an-
derer Semantiker zu benutzen. Fr minde-
stens einige Wrter scheint es so zu sein, da
ihre Bedeutung teilweise, wenn nicht gar voll-
stndig, durch ihre Distribution definierbar
ist.
1. Bedeutungstheorien 19
nischen Sinn in der Ordinary-Language-
Bewegung in der Sprachphilosophie, die in
den fnfziger Jahren unseres Jhs besonders
an der Universitt Oxford in Blte stand.
(Wittgenstein selbst wirkte in Cambridge.)
Das einigende Band unter den Anhngern der
Ordinary-Language Bewegung war trotz
betrchtlicher Divergenzen in Einstellungen
und berzeugungen in Bezug auf andere
Aspekte ihr Glaube, da ein sorgfltiges
Beachten der Nuancen und Feinheiten beim
Gebrauch von Sprachuerungen in den
mannigfaltigen Situationen des tglichen Le-
bens produktiver sei als Systembauerei,
d. h. die Konstruktion von eleganten, aber
empirisch inadquaten und philosophisch
verdchtigen, vorschnell formalisierten allge-
meinen Theorien der Bedeutung.
Die Ordinary-Language Bewegung ist fast
vollstndig von der philosophischen Szene
verschwunden. Das Gleiche gilt fr den logi-
schen Positivismus (und logischen Atomis-
mus), der das Zentrum eines groen Teils
ihrer Kritik bildete. Beide Bewegungen haben
jedoch ihre Spuren in der heutigen philoso-
phischen und linguistischen Semantik (und
Pragmatik) hinterlassen. Die erstgenannte Be-
wegung hat u. a. Austins (1962) hchst ein-
flureiche Konzeption der Sprechakte und
Grices (1975) noch einflureicherere und
letztlich vielleicht produktivere Konzep-
tion der konversationellen Maximen und Im-
plikaturen hinterlassen (siehe die Artikel 12
und 14).
Austins Theorie der Sprechakte hatte ihren
Ursprung in dem, was in der Literatur der
deskriptive Trugschlu (Austin 1961: 71)
genannt wird. Es handelt sich um die Auffas-
sung, da die wesentliche Funktion der Spra-
che darin bestehe, die Welt zu beschreiben.
(Diese Betrachtungsweise wurde, wie wir be-
merkt haben, in der Theorie des logischen
Atomismus von Wittgensteins Tractatus for-
muliert und ausgearbeitet, und sie ist wie
wir sehen werden grundlegend fr Stan-
dardversionen der Wahrheitsbedingungen-Se-
mantik.) Austin machte darauf aufmerksam,
da nicht nur Nicht-Aussagestze wie Inter-
rogative und Imperative, sondern auch viele
Aussagestze insbesondere solche Stze
der 1.Ps.,Sing., Prs. wie Ich verspreche dir,
das Geld am Monatsende zurckzugeben oder
Ich erklre euch zu Mann und Frau in der
Regel nicht dazu benutzt werden, um auszu-
drcken, da ein bestimmter Sachverhalt be-
steht oder nicht besteht, sondern dazu, um
eine eine bestimmte konventionell etablierte
Zugangs zur Semantik, die ich Bedeutung-
als-Gebrauch-Ansatz nennen mchte. Bedeu-
tung-als-Gebrauch-Theorien hneln kontex-
tuellen Theorien und knnen in der Tat unter
diese subsumiert werden. Sie knnen ebenfalls
als stark oder schwach klassifiziert werden, je
nachdem, ob sie Bedeutung mit Gebrauch
identifizieren oder ob sie lediglich sagen, da
die Bedeutung eines Ausdrucks durch seinen
Gebrauch bestimmt und enthllt wird. (Witt-
genstein selbst scheint oft zwischen der star-
ken und schwachen Variante der Bedeutung-
als-Gebrauch-Theorie zu schwanken.)
Wittgenstein betonte die Verschiedenheit
der kommunikativen Funktionen, zu denen
Sprache benutzt werden kann, und die Un-
mglichkeit, eine einheitliche Bedeutungsde-
finition fr die vielen verschiedenen Klassen
natrlichsprachlicher Ausdrcke zu geben.
Eine Sprache benutzen, sagte er, sei wie das
Ausfhren von Spielen, deren Regeln dadurch
gelernt und sichtbar werden, da man das
Spiel tatschlich spielt. Der Muttersprachler
erwerbe seine Sprachbeherrschung nicht
durch das Erlernen eines einzelnen Regelsy-
stems, welches die Struktur seiner Sprache
und die Bedeutung ihrer Ausdrcke fr alle
Gelegenheiten des Gebrauchs festlegt, son-
dern dadurch, da er sich in eine Vielfalt von
Sprachspielen einlt, deren jedes auf eine
bestimmte Art von sozialem Kontext be-
schrnkt und durch besondere soziale Kon-
ventionen geregelt ist. Die Welt zu beschrei-
ben ist nur eine von unbestimmt vielen solcher
Sprachspiele, die wir als Mitglieder der Ge-
sellschaft, der wir angehren, lernen; und die-
sem Sprachspiel sollte kein bevorzugter Status
bei der Konstruktion einer allgemeinen Theo-
rie der Struktur und Funktion von natrli-
chen Sprachen eingerumt werden. Jedes
Sprachspiel habe seine eigene Logik (oder
Grammatik) und msse in gleicher Weise be-
rcksichtigt werden. Diese Einstellungen und
Annahmen die von denen des Tractatus
sehr verschieden sind stecken den Rahmen
ab, vor dessen Hintergrund Wittgenstein sei-
nen berhmten und kontroversen Ausspruch
Dont look for the meaning of a word, look
for its use! machte. Wie man bemerken wird,
identifiziert dieser Ausspruch nicht Bedeu-
tung mit Gebrauch; er ist mit einer strkeren
oder schwcheren Bedeutung-als-Gebrauch-
Theorie vertrglich.
Der Terminus Gebrauch, durch den Witt-
genstein den Terminus Bedeutung ersetzt hat
(ohne die beiden unbedingt zu identifizieren),
erlangte einen technischen oder halbtech-
20 I. Allgemeine Grundlagen
(Propositionen), welche sie ausdrcken. Wh-
rend aber Austin die Bedeutung von ue-
rungen in ihren propositionalen Gehalt auf
der einen und in ihre nicht-propositionale il-
lokutive Kraft auf der anderen Seite zerlegte,
setzte sich Grice fr die Unterscheidung zwi-
schen expliziter und impliziter Bedeutung ein:
zwischen dem, was tatschlich gesagt wird (in
der einschlgigen Bedeutung von sagen)
und dem, was impliziert (oder, um Grices
Terminologie zu benutzen) implikiert [impli-
cated] wird. Zum Beispiel knnte ein Sprecher
mit der uerung von Es ist dunkel hier drin-
nen implikieren, da er es gerne htte, wenn
der Adressat das Licht anmachen wrde; und
vom Adressaten knnte man erwarten, diese
spezielle Implikatur zu erschlieen, indem er
eine oder mehrere der von Grice (1975) so
genannten Gesprchsmaximen [maxims of
conversation] anwendet. Auf den ersten Blick
knnte es so scheinen, als wre das, was Grice
ber die Interpretation von uerungen sagt,
kaum mehr als eine informelle Commensense-
Analyse ohne jede philosophische Tragweite.
Seine Theorie ist aber von ihm und seinen
Anhngern mit groem Scharfsinn weiterent-
wickelt worden und wird gegenwrtig auf
einen beeindruckend breiten Bereich von Ph-
nomenen angewendet (einschlielich der so-
genannten indirekten Sprechakte durch
uerungen wie Kann ich Ihnen etwas zu
trinken anbieten?, die normalerweise nicht
dazu verwendet werden, um zu fragen, ob der
Sprecher physisch, moralisch oder sonstwie in
der Lage ist, dem Adressaten einen Drink
anzubieten, sondern um ihm einen anzubie-
ten). Von besonderem Interesse ist in diesem
Zusammenhang die Entwicklung einer Theo-
rie der Kommunikation und Kognition durch
Sperber & Wilson (1986), die auf einer Ge-
neralisierung von Grices Relevanzmaxime be-
ruht.
2.8Wahrheitsbedingungen-Theorien der
Bedeutung
Die Wahrheitsbedingungen-Semantik ist ge-
genwrtig das dominante Paradigma der se-
mantischen Theorie (vgl. 2.1). Aus diesem
Grund ist sie in diesem Band stark vertreten,
und sie wird in den folgenden Artikeln de-
tailliert abgehandelt. Der Zweck dieses kur-
zen Abschnittes ist es, sie mit den anderen
oben erwhnten Anstzen in Beziehung zu
setzen und die Aufmerksamkeit auf ihre all-
gemeinen Vor- oder Nachteile fr ihre Eig-
nung als theoretischer Hintergrund fr die
und sozial geregelte Ttigkeit zu verrichten:
Ihr Gebrauch ist typischerweise performativ,
nicht aber konstativ. Er behauptet ferner, da
alle uerungen, Behauptungen eingeschlos-
sen, diese Eigenschaft der Performativitt
haben und da wahre oder falsche Behaup-
tungen ber die Welt zu machen lediglich eine
der vielen Handlungen ist, die mithilfe der
Sprache verrichtet werden knnen und da
die Wahrheit oder Falschheit von Behauptun-
gen lediglich eine von den vielen Eigenschaf-
ten ist, mit deren Hilfe sie als geglckt oder
miglckt bewertet werden knnen. Austin
hat nicht lange genug gelebt, um die Details
seiner Theorie auszuarbeiten, deren Grund-
zge er in seinem posthum verffentlichten
Werk How To Do Things With Words (1962)
entwickelte. Seine Ideen sind aber von seinen
Anhngern, besonders von Searle (1969), zu
dem,was man heute in der Literatur im all-
gemeinen als Sprechakttheorie bezeichnet,
ausgearbeitet worden. Ob die Sprechaktheo-
rie als Semantik oder wie viele sagen wr-
den als Pragmatik zhlt, hngt davon ab,
wie man die Grenze zwischen Stzen und
uerungen auf der einen und zwischen ver-
schiedenen Arten von Bedeutungen auf der
anderen Seite zieht (alternative Interpretatio-
nen findet man z. B. in Bach & Harnish 1979;
Katz 1977; siehe auch Artikel 3). Von blei-
bendem Wert ist Austins Generalisierung des
Begriffs der illokutiven Kraft als ein Aspekt
oder eine Komponente des Gebrauchs, der
teilweise in der phonologischen, grammati-
schen und lexikalischen Struktur verschiede-
ner Sprachen konventionalisiert ist (und, wie
es nun einmal so ist, verschieden in verschie-
denen Sprachen). Es lohnt sich, im Vorbei-
gehen darauf hinzuweisen, da Austins Be-
griff der illokutiven Kraft reicher ist als Fre-
ges Begriff der Kraft, der in der Begriffs-
schrift, was Behauptungen angeht, durch
einen speziellen zweiteiligen Operator
symbolisiert wird, wobei der senkrechte Strich
fr den Urteilsakt steht und der waagrechte
Strich fr das, was sptere Forscher als Mo-
dus der Aussage bezeichnet haben. Wir wer-
den zu diesem Punkt im Abschnitt ber Wahr-
heitsbedingungen-Semantik zurckkehren
(2.8).
Grices Beitrag zur modernen Semantik
(oder Pragmatik) ist sehr verschieden von
demjenigen Austins, und viele wrden sagen,
da er tiefer ist. Wie Austin hat Grice erkannt,
da zur Bedeutung von natrlichsprachlichen
uerungen mehr gehrt als die Aussagen
1. Bedeutungstheorien 21
mantiker noch heute eine Definition der
Satzbedeutung benutzen, die nicht zwischen
einem Satz und seinem propositionalen Ge-
halt unterscheidet.
Die Bedeutung eines Satzes kann nach dem
frheren Wittgenstein mit seinen Wahrheits-
bedingungen identifiziert werden, d. h. mit den
Bedingungen, die die Welt erfllen mu, da-
mit der fragliche Satz als wahre Darstellung
des Sachverhaltes zhlt, welchen abzubilden
oder zu beschreiben er bezweckt. Daraus
folgt, da zwei Stze genau dann synonym
sind (d. h. da sie dieselbe Bedeutung haben),
wenn sie dieselben Wahrheitsbedingungen
haben. Neben der Synomymie knnen andere
traditionell anerkannte Begriffe der Semantik
etwa Widersprchlichkeit, Tautologie,
Analytizitt und Folgerung ebenfalls leicht
auf der Grundlage von Wahrheitsbedingun-
gen definiert werden, wie in spteren Artikeln
erklrt werden wird. Die erste Grundvorstel-
lung, auf der die Wahrheitsbedingungen-Se-
mantik basiert, ist also, da es einen engen
Zusammenhang zwischen Bedeutung und
Wahrheit gibt.
Die zweite Grundvorstellung ist, wie ge-
sagt, der Begriff der Kompositionalitt. Die
Behauptung, da die Satzbedeutung kompo-
sitional ist, impliziert, da die Bedeutung
eines beliebigen Satzes sei er einfach, zu-
sammengesetzt oder komplex vollstndig
durch die Bedeutung seiner Teilausdrcke
und durch die Art ihrer Verknpfung be-
stimmt ist. So formuliert, scheint die Kom-
positionalittsthese nichts weiter als eine Bin-
senwahrheit zu sein, der jeder klar Denkende
sofort zustimmen wrde. Die Hauptstorich-
tung der Wahrheitsbedingungen-Semantik
besteht aber darin, ein Verfahren zu entwik-
keln, welches jedem der unendlich vielen Stze
einer Sprache eine Bedeutung zuweist, die so-
wohl empirisch plausibel als auch systema-
tisch berechenbar ist, und zwar auf der
Grundlage der lexikalischen Bedeutung der
Bestandteile des Satzes sowie seiner gram-
matischen Struktur. Und diese Aufgabe ist
keineswegs trivial. Tatschlich ist bis heute
unklar, ob sie berhaupt prinzipiell lsbar ist.
So gro ist die Komplexitt von natrlichen
Sprachen, da bisher niemand die gramma-
tische Struktur von mehr als einem vergleichs-
weise kleinen Fragment von ihnen mit der
Strenge und Przision zu beschreiben ver-
mochte, welche die formale Semantik er-
heischt. Was die lexikalische Struktur von na-
trlichen Sprachen betrifft, so ist diese sogar
noch unvollkommener beschrieben. Es ist
Konstruktion einer Theorie der linguistischen
Semantik (vgl. 1.3) zu richten.
Die moderne Wahrheitsbedigungen-Se-
mantik hat ihren Ursprung nicht in der Lin-
guistik, sondern in der mathematischen Lo-
gik, ihre Grndervter Tarski und Carnap
waren skeptisch bezglich der Mglichkeit,
sie auf die Beschreibung natrlicher Sprachen
anzuwenden. Sie vertraten die Ansicht, da
sich natrliche Sprachen, die mit Vagheit, In-
konsistenz, Mehrdeutigkeit und Unbestimmt-
heit durchsetzt sind, nicht fr dieselbe Art
von prziser und vollstndiger Analyse eignen
wrden wie konstruierte Sprachen, wie z. B.
die Aussagen- oder die Prdikatenlogik. Erst
Ende der sechziger, Anfang der siebziger
Jahre wurde diese Ansicht ernsthaft angegrif-
fen, und zwar besonders von Richard Mon-
tague, der eine Reihe von einschlgigen Ar-
tikeln schrieb, von denen einer den program-
matischen (und provokativen) Titel English
as a formal language (1970 a) trug. Montagues
eigene Theorie der Semantik ist eine spezielle
Version der Wahrheitsbedingungen-Seman-
tik, die auf der modelltheoretischen Entwick-
lung des traditionellen Begriffs der mglichen
Welt beruht, auf den wir hier nicht einzugehen
brauchen (siehe Artikel 2). In diesem Zusam-
menhang geht es nur darum festzustellen, da
der Ansatz auerordentlich einflureich ge-
wesen ist, sowohl unmittelbar insofern er
eine betrchtliche Zahl von Anhngern unter
Logikern und Linguisten gefunden hat als
auch mittelbar, insofern er andere Forscher
inspiriert hat, ihre eigenen, etwas unterschied-
lichen Varianten einer Mgliche-Welten-Se-
mantik zu entwickeln (z. B. Cresswell 1973,
1985), oder sie zu Alternativen zur Mgliche-
Welten-Semantik, wie z. B. die Situationsse-
mantik (vgl. Barwise & Perry 1983) angeregt
hat. Die folgenden Bemerkungen sind fr die
Wahrheitsbedingungen-Semantik im allge-
meinen relevant.
Die beiden grundlegenden Begriffe der
Wahrheitsbedingungen-Semantik sind bereits
eingefhrt worden, als im vorhergehenden
Abschnitt auf Wittgensteins Tractatus einge-
gangen wurde. Der erste ist die Vorstellung,
da Bedeutung etwas wie Beschreibung, Ab-
bildung oder Darstellung ist; der zweite ist
das, was man heutzutage allgemein Kompo-
sitionalitt nennt. Diese Begriffe werden nun
in etwas anderer Form wieder eingefhrt, wo-
bei stillschweigend spterere theoretische und
terminologische Verfeinerungen bercksich-
tigt sind. Wir werden jedoch zuerst ebenso
wie Wittgenstein einst und viele formale Se-
22 I. Allgemeine Grundlagen
tungsstrich der Begriffsschrift. Austins Begriff
der illokutiven Kraft kann als eine Erweite-
rung und Generalisierung von Freges Einsicht
im Hinblick auf die uerungsbedeutung ins-
gesamt angesehen werden. Hier aber geht es
uns um die Satzbedeutung, welche mit dem
propositionalem Gehalt zu identifizieren die
Wahrheitsbedingungen-Semantiker geneigt
sind.
Nun ist allgemein akzeptiert, da nicht-
deklarative und nicht-indikativische Stze fr
die Wahrheitsbedingungen-Semantik proble-
matisch sind. Auf der anderen Seite ist die
Erkenntnis, da sich die Termini deklarativ
und indikativ (die oft durcheinander gebracht
werden), traditionell, und zwar zurecht, auf
voneinander unabhngige, variable Dimen-
sionen der grammatischen Struktur beziehen,
nicht so weit verbreitet, wie man sich es wn-
schen wrde. Tatschlich spricht nichts mehr
dafr, die Bedeutung eines deklarativen in-
dikativischen Satzes mit seinem propositio-
nalen Gehalt zu identifizieren, als diese Iden-
tifikation im Falle von Nicht-Deklarativen
(z. B. Interrogativen) oder Nicht-Indikativen
(z. B. Imperativen) vorzunehmen. Wenn eine
Sprache die Kategorie von Indikativstzen
besitzt, dann hat sie den waagrechten Teil von
Freges Strich grammatikalisiert, der von dem
propositionalen Gehalt des Satzes unterschie-
den werden mu und als sein (logischer) Mo-
dus beschrieben werden kann: Modus in die-
sem Sinne des Terminus drckt solche Eigen-
schaften wie Tatschlichkeit im Gegensatz zu
Hypothese, Wnschbarkeit usw. aus. In Spra-
chen, die einen Indikativ haben, ist der Indi-
kativ der Modus, der morpho-syntaktisch
Tatschlichkeit im Gegensatz zu verschiede-
nen Arten von Nicht-Realitt grammatikali-
siert. Realitt und Nicht-Tatschlichkeit auf
der einen und das Eingehen oder Nicht-Ein-
gehen einer Verpflichtung des Sprechers auf
der anderen Seite knnen nicht nur morpho-
syntaktisch, sondern auch lexikalisch oder
phonologisch (oder auch berhaupt nicht) in
den Stzen einer bestimmten Sprache kodiert
werden. Die Versuchung, deklarativ mit indi-
kativ zu verwechseln und die Bedeutung von
deklarativ-indikativischen Stzen mit ihrem
propositionalen Gehalt zu identifizieren, wird
dadurch vergrert, wenn nicht gar geschaf-
fen, da in einigen natrlichen Sprachen
einschlielich der Sprachen, die zufllig die
Muttersprachen der meisten Logiker und Se-
mantiker sind deklarativ-indikativische
Stze eingebettet werden knnen, ohne syn-
taktisch oder morphologisch als Konstituen-
deshalb bisher immer noch unkar, ob es
wie Montague und seine Anhnger gesagt
haben keinen wesentlichen Unterschied
zwischen natrlichen und nicht-natrlichen
Sprachen gibt, was ihre Formalisierbarkeit
und Bestimmtheit [determinacy] betrifft.
Was kann nun zusammenfassend ber die
Strken und Schwchen der Wahrheitsbedin-
gungen-Semantik gesagt werden? Ihre prin-
zipielle Strke liegt zweifellos in der intuitiven
Plausibilitt der Vorstellung, da Bedeutung
(oder zumindest ein grerer Teil von Bedeu-
tung) eine Sache der Korrespondenz mit En-
titten, Eigenschaften und Relationen in der
Auenwelt ist, ferner in der Mglichkeit, diese
einfache Vorstellung mithilfe der machtvollen
und wohlverstandenden Techniken der mo-
dernen mathematischen Logik zu formalisie-
ren und zu generalisieren. Sie hat dieselbe
prima facie Attraktivitt wie die Referenz-
theorie der Bedeutung, aber sie ist insofern
allgemeiner, als sie der Unterscheidung zwi-
schen Extension und Intension Rechnung tra-
gen kann und unabhngig von den kontro-
versen ontologischen und erkenntnistheore-
tischen Annahmen formulierbar ist, die histo-
risch mit der Referenztheorie der Bedeutung
in Verbindung gebracht worden sind (vgl.
2.2). Ferner kann kein Zweifel darber beste-
hen, da wie der zweite Teil dieses Bandes
zeigen wird unser Verstndnis eines weiten
Bereiches von Phnomenen betrchtlich
durch die Versuche gewonnen hat, die in den
letzten fnfzehn Jahren unternommen wur-
den und immer noch unternommen werden,
diese Phnome erschpfend und przise im
Rahmen der Wahrheitsbedingungen-Seman-
tik zu beschreiben.
Aber die Wahrheitsbedingungen-Semantik
hat ihre inhrenten Grenzen. Nach meiner
Meinung (die nicht notwendigerweise mit der-
jenigen der Herausgeber oder der anderen
Autoren bereinstimmt) ist sie zum Scheitern
verurteilt, wenn sie als eine vollstndige Theo-
rie der semantischen Struktur von natrlichen
Sprachen ausgegeben wird. Der Grund ist
ganz einfach der, da ein groer Teil der Be-
deutung, die lexikalisch, syntaktisch, morpho-
logisch oder phonologisch in den Stzen eini-
ger, wenn nicht aller natrlichen Sprachen,
kodiert ist, nicht-propositional ist. Wie im
vorhergehenden Abschnitt bemerkt wurde, ist
dies schon von Frege bemerkt worden und
hat seinen terminologischen und begrifflichen
Niederschlag in seinem Begriff der Kraft (die
er von Sinn und Bedeutung unterschied) ge-
funden sowie in seinem zweigeteilten Behaup-
1. Bedeutungstheorien 23
zweifellos zollt man ihrer offenen grammati-
schen Struktur mehr Achtung, wenn man die-
sen Standpunkt vertritt (siehe Artikel 12).
ber die inhrenten Grenzen der Wahr-
heitsbedingungen-Semantik als Theorie der
linguistischen Bedeutung knnte mehr gesagt
werden, als hier mglich ist, insbesondere
ber ihr Versumnis, die Subjektivitt von
uerungen und der Art ihrer Kodierung
nicht nur als pragmatische Implikatur, son-
dern im Lexikon und der grammatischen
Struktur vieler Sprachen die gebhrende
Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Lyons
1982, 1984). Aber ich mchte mit einer kon-
struktiven und kumenischen Bemerkung
schlieen. In diesem Kapitel haben wir ver-
schiedene Bedeutungstheorien betrachtet, die
fr gewhnlich als Rivalinnen angesehen wer-
den, von denen nur eine recht haben kann.
Meiner Ansicht nach ist es viel vernnftiger,
sie als komplementr anzusehen. Da ein Teil
der in natrlichen Sprachen kodierten Bedeu-
tung die Welt (oder mgliche Welten ein-
schlielich der wirklichen Welt) reprsentiert
oder beschreibt, kann nicht ernsthaft in Zwei-
fel gezogen werden. Es gibt auch Grnde fr
die Ansicht, da dies die prototypischste Art
von sprachlicher Bedeutung ist, da sie nicht
anders als sprachlich ausgedrckt werden
kann (vgl. Lyons, 1981: 3.1). Aber dies ist
sicher nicht die einzige Art von Bedeutung,
die systematisch in natrlichen Sprachen ko-
diert wird; und es scheint wenig sinnvoll zu
sein, die Unterscheidung zwischen Semantik
und Pragmatik so wie dies viele Vertreter
der Wahrheitsbedingungen-Semantik tun
nach dem Kriterium zu treffen, ob etwas auf
der Basis von Wahrheitsbedingungen defi-
nierbar ist oder nicht. Wenn man schon eine
deskriptiv ntzliche Unterscheidung zwischen
Semantik und Pragmatik treffen mchte,
dann sinnvollerweise eher auf der Grundlage
der Unterscheidung von Satzbedeutung und
uerungsbedeutung, wobei anerkannt wer-
den sollte, da beide Arten von Bedeutung
Propositionales und Nicht-Propositionales
beinhalten.
3. Literatur (in Kurzform)
Alston 1964 a Austin 1961 Austin 1970 Bach/
Harnish 1979 Barwise/Perry 1983 Bennett 1976
Bloomfield 1926 Bloomfield 1933 Carnap 1937
Carnap 1939 Carnap 1947 Chomsky 1957
Chomsky 1959 Coseriu/Geckler 1974 Cresswell
1973 Cresswell 1985 Dowty 1979 Dummett
1973 Firth 1957 Frege 1892 Goodenough
ten komplexerer Stze gekennzeichnet zu wer-
den. Dies ist aber keineswegs ein universaler
oder auch nur ein besonders hufiger Zug
quer durch die Sprachen der Welt hindurch.
Die linguistische Semantik sollte aber, wenig-
stens prinzipiell, die Totalitt der natrlichen
Sprachen nachbilden.
Die dreigeteilte Analyse der Satzbedeu-
tung, die in dem vorhergehenden Paragra-
phen skizziert wurde, aber aus Platzgrnden
nicht weiter ausgefhrt werden kann (vgl.
Lyons 1983: 16.2), verdankt viel dem Werk
von Hare (1960), einem ordinary-language-
Philosophen, der den Begriff Bedeutung-als-
Gebrauch etwas anders als Austin (vgl. 2.7)
ausgewertet hat. In der Literatur zur Wahr-
heitsbedingungen-Semantik ist eine zweige-
teilte Analyse gelufiger, welche zwischen den
etwas unterschiedlichen Termini Sinn, propo-
sitionaler Gehalt, deskriptiver Gehalt oder
Satzradikal auf der einen und Modus (in dem
erweiterten Sinn des Wortes) oder Kraft auf
der anderen Seite unterscheidet (vgl. Dum-
mett 1973; Katz 1977; Searle 1969; Stenius
1960 usw.). Die dreigeteilte Analyse ist hier
deshalb erwhnt worden, weil sie einmal
Aspekte von Freges Einsicht erfat, die durch
eine zweigeteilte Analyse nicht erfat werden,
und weil sie vor allem getreuer und direkter
den Unterschied zwischen Satztypmodus und
morphosyntaktischem Modus wiedergibt, der
sich in der grammatischen Struktur vieler,
wenn nicht aller Sprachen zeigt.
Es ist fraglich, ob eine befriedigende Wahr-
heitsbedingungen-Analyse einer dieser beiden
Dimensionen der semantisch relevanten
grammatischen Struktur von Stzen gegeben
werden kann, obwohl Versuche in dieser
Richtung unternommen worden sind und
weiterhin unternommen werden. Es steht si-
cher mehr im Einklang mit unseren unverbil-
deten philosophischen Intuitionen, wenn man
sagt, da sich entsprechende Deklarative und
Nicht-Deklarative (z. B. es regnet und regnet
es?) oder sich entsprechende Indikative und
Nicht-Indikative (z. B. lateinisch pluit, Indi-
kativ, es regnet und pluat, Konjunktiv, es
regne), die sich nach allgemeiner berein-
stimmung in ihrer Bedeutung unterscheiden,
denselben propositionalen Gehalt haben
(und, wenn sie in dem angemessenen Kontext,
der ihre Referenz festlegt, geuert werden,
dieselbe Proposition ausdrcken, sei sie wahr
oder falsch), sich aber in anderer Hinsicht als
in ihren Wahrheitsbedingungen unterschei-
den, als darauf zu insistieren, da sie ver-
schiedene Wahrheitsbedingungen haben. Und
24 I. Allgemeine Grundlagen
1970 a Morris 1938 Morris 1938 Morris 1946
Ogden/Richards 1923 Porzig 1934 Putnam
1975 Quine 1953 Quine 1960 Rosch 1974
Rosch 1976 Robins 1971 Searle 1969 Sinclair
1966 Skinner 1957 Smith (ed.) 1982 Sperber/
Wilson 1986 Stenius 1967 Ullmann 1957 Wat-
son 1924 Wittgenstein 1921 Wittgenstein 1953
John Lyons, Cambridge (Great Britain)
(bersetzt aus dem Englischen
von Arnim von Stechow)
1956 Gordon 1982 Grice 1957 Grice 1969
Halliday 1966 b Harris 1951 Harris 1954
Hjelmslev 1959 Hoenigswald 1960 Ipsen 1924
Jolies 1934 Katz 1972 Katz 1977 Katz/Fodor
1963 Katz/Postal 1964 Kempson 1977 Kripke
1972 Kuhn 1962 Lehrer 1974 Levinson 1983
Lewis 1970 Lounsbury 1956 Lyons 1965 Lyons
1971 Lyons 1977 (I: dt. 1980, II: dt. 1983 a)
Lyons 1981 a Lyons 1981 b (dt. 1983 b) Lyons
1984 Lyons 1988 Matthews 1981 Montague
2. Basic Concepts of Semantics
ities like promising, asserting, questioning
and so on.
The desideratum would of course be to find
an ability which is involved in, and underlies,
both the judgements that Katz thinks basic to
semantics, and the activities of language using
which the speech act theorists are interested
in. The most promising candidate for such an
ability seems to be the ability to distinguish
situations in which a sentence is true from
those in which it is false. For consider how
to distinguish someone who does from some-
one who does not know the meaning of the
English sentence
(1) The door is open
Presumably one does not need to be an Eng-
lish speaker to know the difference between
a situation in which a particular door is open
and a situation in which it is not. But one
does need to be an English speaker to know
that (1) is a sentence which is true in situations
of the former kind and false in situations of
the latter kind. This ability is sometimes ex-
pressed by saying that the English speaker
knows the following
(2) The door is open is true iff the door is
open.
(2) is apt to bemuse those who first come
across it, but if it is taken as no more than a
statement of the conditions under which (1)
is true, it can be seen that it is not simply a
tautology, but an empirical fact which would
not be so if English had been different.
This view of semantics embodies the truth-
conditional theory of meaning and to many
theorists it seems a good place to begin. Some
truth-conditional semanticists, notably Don-
ald Davidson and those the follow him, take
the axiomatic generation of sentences like (2)
1. The Subject Matter of Semantic Theory
2. Sentence Meaning
3. Compositionality
4. Interpretation
5. Structural Ambiguity
6. Wellformedness and Interpretability
7. Semantics and Psychology
8. Truth-Conditions and Use
9. Possible World Semantics and Logic
10. Bibliographical Appendix
11. Short Bibliography
1. The Subject Matter of Semantic
Theory
I suppose that the most embarrassing diffi-
culty in approaching the study of semantics
is to try to focus on what is its subject matter.
Or to put it in another way: what are we to
take as the basic data which we expect a
theory to describe? One way in which we
might proceed is to ask what it is that a person
who knows a language knows that one who
doesnt know that language doesnt? In par-
ticular what sort of ability is it that demon-
strates that the speaker knows the meanings
of the expressions in a given language? Many
linguists will say that it is the ability to make
judgements about whether an expression is
meaningful, whether two expressions mean
the same, and so on. Indeed Jerrold Katz,
probably the most influential semanticist
within linguistics, has made the prediction of
such judgements the defining goal of a se-
mantic theory. Many philosophers, on the
other hand, will say that the only proper
subject matter for a theory of meaning is a
description of the way in which a language is
used. They will concentrate on analysing what
are called speech acts such things as activ-
2. Basic Concepts of Semantics 25
3. Compositionality
But it is not enough just to say that the
meaning of a sentence is a set of possible
worlds. For a sentence, unlike a word, is not
something whose meaning must be learnt. A
sentence is something whose meaning is de-
termined from the meanings of the words in
it in conjunction with its syntactical structure.
So in order to articulate a theory of possible-
worlds semantics, it is necessary to say some-
thing about how the meaning of a sentence
is detemined from the meanings of the words
in it.
Article 7 of this handbook will be con-
cerned with particular syntactical frameworks
on which truth-conditional semantics may be
based. At present some rather simple illustra-
tions will have to suffice. Suppose that we
have a language whose words contain names
and one-place predicates. That is to say we
are to consider sentences like
(3) Lionel sleeps
From what was said above we are to assume
that the meaning of (3) is the set of all pairs
w, t, where w is a possible world and t a
moment of time, and Lionel is asleep at time
t in world w. In this language sleeps is a single
word, though in natural language a verb is
probably a rather semantically complex en-
tity. The simplest view of the meaning of a
name in truth conditional semantics is that it
is the thing it names. The name Lionel names
the person Lionel. So one can say that the
semantic value or meaning of the name Lionel
is the person it names. The semantic value of
sleeps then falls into place. For sleeps may be
seen as what Arthur Prior once called a sen-
tence with a hole in it. When the hole is filled
with the word Lionel we get (3). When the
hole is filled with Josephine we get
(4) Josephine sleeps
The meaning of sleeps can be seen as a prop-
osition with a hole in it, or in other words a
function which associates with each person
(or more generally with each thing of which
it makes sense to suppose that it might be
asleep) the set of world-time pairs at which
that person is asleep. In general then the
meaning of a name will be a thing and the
meaning of a one-place predicate will be a
function from things to sets of worlds (world-
time pairs).
A function of this latter kind can be called
a property. A thing a has the property in a
world w iff w (a). The extension of the
as the goal of a semantic theory. Other the-
orists argue that situations should themselves
be part of the framework of a semantical
theory. Some situations are actual, others
merely possible. A complete and total situa-
tion (whether actual or merely possible, there
being of course only one actual total situa-
tion) is called a possible world. Semantical
theories divide according as the situations
they base themselves on are worlds or less
than total situations. Theories of this latter
kind are perhaps best represented, for lin-
guistics at least, by the work of Jon Barwise
and John Perry on what they call situation
semantics. Situation semantics, in their sense,
is, however, relatively recent and the rest of
this article will be concerned with the more
traditional possible-worlds semantics. Read-
ers who want to know more of Barwise and
Perrys work should consult chapter II in this
handbook (articles 5 and 6) and the works
listed in the bibliography.
2. Sentence Meaning
In possible-worlds semantics the meaning of
a sentence is a set of possible worlds. The
meaning of (1) will be the set of worlds in
which the door is open. That set of worlds is
quite independent of English or of any other
language. Possible-worlds semantics must be
refined in a number of obvious ways. For
instance, in the very same world the door
may be open at one time and not at another.
So perhaps we should think of pairs of a
world and a time. Further the door will ob-
viously refer to different doors in different
contexts of use. So we should really think of
the meaning of a sentence as a function from
all the relevant contextual features to a set of
possible worlds. (Context dependence is dealt
with in article 9.) A set of possible worlds is
sometimes called a proposition. This is be-
cause there has been a tradition in philosophy
that a proposition is a language-independent
entity which is what a sentence expresses.
(There is dispute about whether propositions
are tensed or not. If you think a proposition
is tensed then you will take it to be a set of
world-time pairs rather than just a set of
worlds.) A proposition a is then said to be
true in a world w iff w a. (For tensed prop-
ositions a is true in w at time t iff w, t a.)
A sentence may be said (derivatively) to be
true in w iff the proposition which is its mean-
ing is true in w.
26 I. Allgemeine Grundlagen
reflected by a different assignment. So where
V and V are two assignments it could be that
V() = a while V() = b where b is some-
thing different from a.
Among the many different theoretically
possible value assignments there will be one
which corresponds to the meanings that the
words have in the natural language being
studied. Of course words in a natural lan-
guage are often used without precise mean-
ings or in a long-literal way. A semantic the-
ory will have to come to terms with this in
one way or another. Such matters are dis-
cussed elsewhere in this handbook.
In the name-and-predicate language de-
scribed above, a function V will assign to
each name a thing and to each predicate a
function from things to sets of world-time
pairs. The rule for obtaining the meanings of
sentences as described above then says that if
V() = a and V() = , then V() = (a).
Alternatively one can simply say
(5) V() = V() (V())
One reason why semantics should work this
way is because there are too many sentences
for their meanings to be learnt separately. The
number of words in a language will be finite
and in fact comparatively small. Small, that
is, in comparison with the number of sen-
tences which in theory can be infinite, and
even in practice will be far too large to learn
piecemeal. The name-and-predicate language
described so far does not have infinitely many
sentences unless it has infinitely many words,
but it is not difficult to describe a very small
extension to it which does. Assume a name-
and-predicate language with only a finite
number of names and predicates. Now add
one new word, not. The word not is such that
when it is put immediately after a sentence it
forms another sentence. Thus not only is (3)
a sentence but so is
(6) Lionel sleeps not
(Putting the not at the end of the sentence
gives something which is a little more like
English. If we were to follow the practice
followed in most of the languages of formal
logic it would come at the beginning of the
sentence. Nothing turns on this.)
Extending the language in this way has the
consequence that even with only one name a
and only one predicate the language has
infinitely many sentences; to be precise the
(infinite) sequence:
(7) , not, not not, ... etc.
property in a world w is simply the set of
those b such that w (b). The property itself
is sometimes called an intension. An intension
may be thought of as something which, in
conjunction with a possible world, determines
an extension.
The language so far has had only one-place
predicates. It could be extended by two, three
or in general n-place predicates. Transitive
verbs like kicks or loves might be examples
of two-place predicates, and verbs like gives
examples of three-place predicates. It is
doubtful whether there are any single words
in a natural language which are more than
three-place predicates. An n-place predicate
has as its meaning what may be called an
n-place property. This will be a function
such that for n-tuples a
1
, ..., a
n
of things
(a
1
, ..., a
n
) will be a set of world-time pairs.
For any world w the extension of the property
at w will be the set of n-tuples a
1
, ..., a
n
such that w (a
1
, ..., a
n
). The extension of an
n-place predicate is, in other words, an n-
place relation, in the sense in which a relation
is just a set of n-tuples.
The rules of combination can then be
stated in a quite general fashion:
If we have a sentence of the form in
which is a name and is a predicate
then, where the meaning of is the thing
a and the meaning of is the function ,
then the meaning of is (a), that is to
say it is the value (i. e. the output) that the
function takes when its argument (i. e.
the input) is the thing a.
4. Interpretation
The meanings of words are not worked out
but simply given. And we must remember one
important aspect of language, that is that it
is conventional. That is to say, although a
given word may happen to have the meaning
it does, it need not have it. Suppose that the
name in fact names a thing a, as in fact
Lionel names Lionel. It could well have been
the case that had named some quite differ-
ent thing. In other words, there is no instrinsic
connection between and what it names, the
connection has to be imposed. What effects
the imposition is a value assignment to the
words in the language. Such an assignment is
itself a function which associates with each
word in the language a meaning of the ap-
propriate kind. We write V() = a to mean
that assignment V gives to word the mean-
ing a. A different meaning for would be
2. Basic Concepts of Semantics 27
can be interpreted either to allow it to be a
different someone in each case (say everyone
loves the person to their left) or can be inter-
preted so that it means the same as
(10) There is someone everyone loves
which requires an object of universal admi-
ration. In first-order predicate logic these two
interpretations would be represented by two
different formulae
(11) (everyone x) ((someone y) (x loves y))
(12) (someone y) ((everyone x) (x loves y))
It would be on (11) and (12) that the value
assignments would operate, not on (10). The
relation between (10) and (11)/(12), and a
more explicit description of what the under-
lying language would be like are beyond the
scope of this section.
6. Wellformedness and Interpretability
Another feature that this kind of semantics
has is that it allows for a distinction between
grammatical well-formedness and semantic
interpretability. Take the sentence
(13) Saturday sleeps
Suppose that Saturday is a name whose se-
mantic value is the appropriate day of the
week (whatever kind of thing that is). From
this it follows that (13) is a well-formed sen-
tence. But many semanticists would want to
argue that (13) makes no sense. If they are
right then this must be because the function
which is the meaning of sleeps is one which
does not have Saturday in its domain. (The
domain of a function is just the set of things
that it will accept as input.) If so then there
will be no result of V(sleeps) operating on
V(Saturday) and (13) will not have a semantic
value.
7. Semantics and Psychology
It should be noticed that none of the entities
used in this semantical theory has psycholog-
ical content. Of course the theory is to be
used in explaining what we know when we
know a language. But that is not to explain
how we know these things or what kind of
knowledge it is. It is solely concerned to give
an account of what it is that we know. When
we know what a sentences means, it may well
be true, as Jerry Fodor and others have ar-
gued, that we represent this meaning in some
sort of internal code or language of thought;
The semantics of not is easy. Since not added
to a sentence forms another sentence, its
meaning would be a function which takes a
proposition (set of world-time pairs) as ar-
gument and gives another proposition as
value. In fact we can even say just what func-
tion it is. If V is the value assignment which
gives not the meaning it has in English then
V(not) will be the function such that where
a is a set of world-time pairs so is (a), and
further any pair w, t is in (a) just in case
it is not in a. (Put another way, (a) is the
set-theoretical complement of a in the set of
all world-time pairs.)
Where is any sentence (which may itself
of course include a number nots) then
(8) V(not) = (V())
which is to say that w, t V(not) iff w, t
V(). Surely a consumation devoutly to be
wished. In this particular case two occur-
rences of not bring us back to our original
proposition. Suppose y is a sentence. Then
and not express two different propositions.
But followed by an even number of nots
expresses the same proposition as , and
followed by an odd number of nots expresses
the same proposition as not.
This fact enables us to make an important
observation. For in a sentence followed by a
large number of nots a speaker may have lost
count of whether it is odd or even, and so
not know the truth conditions of the sentence.
Such a possibility should not lead us to sup-
pose that the speaker does not know the lan-
guage. Rather the truth conditions for every
sentence are not something that every speaker
actually knows, rather they are logical con-
sequences of what a speaker knows. (This
point has been stressed by Barbara Partee.)
The problem of how to give an account of
what sort of knowledge this is is actually a
crucial one in semantics. It is linked with the
problem of propositional attitudes and is dealt
with elsewhere in this handbook (see article
34).
5. Structural Ambiguity
A language capable of semantic treatment in
the way just described has to be one in which
there is no structural (or even lexical) ambi-
guity. So it cannot be identified with the sur-
face structures of a natural language. Con-
sider an example. It is often maintained
(though it is disputed too) that the sentence
(9) Everyone loves someone
28 I. Allgemeine Grundlagen
9. Possible World Semantics and
Logic
The data of semantics are often held to be
judgements which relate two or more sen-
tences, for instance that a pair of sentences
are incompatible to each other or entail each
other. On the truth-conditional theroy of
meaning, facts of this kind emerge as conse-
quences. Two sentences contradict each other
if there is no possible world in which they are
both true. A sentence a entails a sentence
iff there is no world in which a is true but
false.
Facts of this kind are often held to be the
province of formal logic, and truth-condi-
tional semantics is often described as logically
based semantics.
Logic has traditionally been concerned
with the validity of inferences. An inference is
the passage from a collection of sentences,
called the premisses of the inference, to a
sentence called its conclusion. Inferences di-
vide into those which are valid and those
which are not. In a valid inference the con-
clusion logically follows from the premisses.
Thus from (15) and (16) we may validly infer
(17):
(15) Jeremy is male
(16) Miriam is Jeremys sister
(17) Jeremy is Miriams brother
An example of an invalid inference is the
inference from (18) and (19) to (20):
(18) Beatrice dates Algernon
(19) Algernon dates Clarissa
(20) Beatrice dates Clarissa
In possible worlds semantics an inference
is valid iff when all the sentences in the infer-
ence have their standard meanings there is no
possible world in which the premisses are all
true but in which the conclusion is false. The
notion of validity used in formal logic is how-
ever a little different. Put in very general terms
the idea is that an inference in a system of
logic is valid iff every interpretation which
makes the premisses true also makes the con-
clusion true. In this respect the notion of
validity used in formal logic is like the notion
of entailment in possible worlds semantics in
that here too truth-preservingness is a crucial
element. However there is an important dif-
ference. The notion of entailment speaks
about truth-preservingness in every possible
world in that interpretation in which all the
words have their ordinary meaning. Validity
and no doubt the study of such a code is the
proper province of cognitive psychology. But
the existence of possible worlds semantics at
least suggests that semantics may be related
to psychology in much the same way that
Fodor thinks psychology is related to physics.
If a proposition is a set of possible worlds
then no doubt each person who entertains
that proposition will represent it in some way,
but the psychological features of the repre-
sentation will be no more the concern of
semantics than Fodor would think that the
physical description of a psychological state
need concern psychology.
8. Truth-Conditions and Use
It is often said that a sentence like
(14) I promise to pay you five dollars
cannot sensibly be assessed for truth or falsity.
This is usually claimed by those who think of
truth or falsity as a way of evaluating asser-
tions. For such people will (rightly) point out
that an utterance of (14) is not normally used
to assert or report that one is promising; it is
often used actually to promise. Certainly if
truth and falsity only made sense in conjunc-
tion with speech acts like asserting or report-
ing then (14) would not be a good candidate
for a sentence with truth conditions. But one
doesnt have to think of truth and falsity in
this way. One can say simply that (14) is true
iff the speaker promises to pay the hearer five
dollars, and that this is without prejudice to
the question of what a person is doing who
utters a sentence with those truth conditions.
Indeed the fact that (14) has those truth con-
ditions can actually give an explanation of
why it can be used to make a promise. For
what better way to make a promise than by
uttering (in the appropriate conditions) a sen-
tence which is true iff one promises? More
difficult cases for truth conditional semantics
are syntactically distinguished sentences like
imperatives and questions. They are discussed
elsewhere in the handbook (see the articles 3,
12, and 15) but a general observation is in
order here. It is this: the words and phrases
in all these sentences are ones which can occur
with the same meanings in sentences of all
types. This means that, if they have a truth-
conditional meaning at all, this meaning must
be involved in working out the meaning of
non-declarative sentences.
2. Basic Concepts of Semantics 29
even if we grant that, in some sense, there is
a correct logical form for each sentence
and perhaps any semantic theory might be
held to have to postulate such a level there
are still problems in tying the notion of en-
tailment to a particular system of logic; be-
cause there are serious problems in defining
what should count as the correct system of
logic.
An inference schema in the propositional
calculus is valid iff there is no assignment of
truth values to the variables which makes the
premisses true but the conclusion false. What
this means is that the interpretation of the
simple sentences is allowed to vary as much
as we please. The interpretation of (and
the symbols which represent or, not or if) is
however kept constant. If other symbols are
held constant, peculiar things can happen.
Suppose that s is a simple sentence symbol.
The analogy with is as follows. If is
properly to represent and it must make p q
true when, but unly when, p and q are both
true. Suppose then we want s to represent a
sentence which is true but only contingently
true, say
(21) The Sahara is desert
Since (21) is true, any truth-value assignment
which reflects this must assign it the value
true, and, since it is now a constant which is
always assigned the value true, it is not hard
to see that in this logic s logically follows
from any sentence whatsoever. But that is to
say that e. g. the inference from
(22) Christmas is in December
to (21) is a valid inference. What has gone
wrong of course is that, since it is a contingent
matter that the Sahara is desert, although the
constant s is entitled to be given the value
true in every interpretation, because the Sa-
hara is desert, yet its truth is not necessary,
and so does not logically follow from any
arbitrary proposition. It may be that s is true
in the actual world, but there will be other
possible worlds in which it is false.
It may be thought that no one would ad-
vocate such a silly logic. But in fact what has
been advocated is that those inferences in
natural language which do not fall out of
some standard system of logic, say the first-
order predicate calculus, can be made valid
by the addition of extra premises frequently
called meaning postulates. George Lakoff for
instance investigates the possibility of a nat-
ural logic to underlie natural language, and
considers meaning postulates as one way of
in formal logic is defined as truth-preserving-
ness in every interpretation. To state this pre-
cisely one must define what counts as an
interpretation for the logic in question. What
goes on can be illustrated by using the prop-
ositional calculus as an example. In this lan-
guage there are words which represent whole
sentences. They are called propositional var-
iables (or sometimes sentential variables) and
can be written as p, q, r ... etc. Then there
are sentential operators (or functors or con-
nectives) which are symbols to represent par-
ticles like and, or, not or if. If we take the
symbol to be a formal representation of
the word and, we want to explain the validity
of such principles as the passage from p q
to p. (This is not so trivial as it looks since if
were to represent or this inference would
not be valid.) In classical propositional logic
the propositional variables are assigned truth
values and p q is defined to be true if p
and q are both true but false otherwise. The
validity of the inference of p from p q is
then automatic, in that the conclusion p can
never be assigned the value false unless p q
is too; so that there is no case of the premiss
p q being true but the conclusion p being
false. By contrast p q cannot be validly
inferred from p because we can have p true
but p q false. (This will be so if q is false.)
Why is this different from the account of
valid inference in terms of possible worlds?
Well, suppose that p and q are the very same
proposition. In this case the worlds in which
p q is true are just the same as the worlds
in which p is true. So in this particular case
p does entail p q. But the inference is still
not valid in the propositional calculus because
we can re-interpret the letters p and q. The
crucial difference is that validity in a system
of logic strictly speaking relates sentence
forms or schemata, and a particular propo-
sition may be an instance of many schemata.
When p and q are the same proposition then
p q may be argued to have also the form
p p, and the trouble is that while the sche-
matic form p p does follow from p (in the
sense that you cant make p true without
making p p true too) the schematic form
p q does not.
Those who advocate analysing entailment
as validity in a system of logic are aware of
this problem. They would say that if p and q
are the same proposition then their conjunc-
tion should be represented as p p rather
than as p q. Only the former represents the
true logical form of the proposition. However,
30 I. Allgemeine Grundlagen
then the resulting inference would indeed be
valid but the decomposition would not be an
accurate conceptual representation of snow.
For, since it is merely contingent that snow
is white, it is not legitimate to assume that
whiteness is part of its meaning.
One might think that meaning postulates,
or lexical decomposition, could be reinstated
if we chose to work in an intensional logic,
say one of the modal logics, or the kind of
intensional logic that Richard Montague fa-
voured. These logics can be given a possible
worlds semantics and it is customary to define
validity as truth in every possible world in
every admissible interpretation. For infer-
ences, we can say that the inference is valid,
in the logic in question, iff the conclusion is
true in every world in every interpretation in
which the premisses are true. Meaning pos-
tulates are then required to be true in all
worlds, and their role is to narrow down the
class of admissible interpretations by impos-
ing constraints on what various expressions
can mean. For example, if (23) is adopted as
a meaning postulate, it says that the set of
worlds in which any given thing is a bachelor
is a subset of the set of worlds in which that
thing is male. The role of (23) is to tell us
that the interpretation which best reflects
English will be one in which (23) holds. In
the absence of any more detailed description
of the semantics of English it might perhaps
be helpful to note that (23) at least is true.
But it is not (23) which explains why bachelor
entails male. bachelor entails male because of
certain relations which hold between the sets
of worlds which are assigned to various ex-
pressions in the interpretation which best re-
flects English. These same relations also make
(23) true and therefore (23) accurately de-
scribes, in part, the meaning of bachelor, but
does not explain why it has that meaning.
The true explanation is that the word bachelor
is so used in English that certain things in
certain worlds count as bachelors and certain
other things do not.
It is sometimes said that logic is concerned
with form rather than meaning. But, at least
when validity is in question, this is nonsense.
E. g. in the classical propositional calculus,
and any logic based upon it, we must interpret
in certain ways, and not in other ways.
Similarly with , and . These words are
frequently called logical constants and are dis-
tinguished from the variables whose interpre-
tations are not so constrained. Now possibly
there is a sense in which some words are more
providing extra axioms. But if meaning pos-
tulates are to do their work then, for the same
reason as in the case of (21), they must be
not merely true but necessary, and we still
need an analysis of what it is for a meaning
postulate to be necessary. Systems of logic do
not provide this, and semantic theories which
do provide this, such as those based on pos-
sible worlds, render the meaning postulate
approach otiose, since they are able to pro-
vide a direct account of entailment.
The stock example of a meaning postulate
in the literature is
(23) x (x is a bachelor x is male)
(23) is supposed to explain the validity of
inferring (24) from (25):
(24) Sebastian is male
(25) Sebastian is a bachelor
This is because (24) logically follows from the
conjunction of (23) and (25) in first-order
predicate logic.
Unfortunately (23) can be paralleled by a
case that is not quite so clear. Presumably it
is a contingent truth that snow is white (ex-
cept in Manchester). But consider what hap-
pens if we were to add as a meaning postulate
(26) x (x is snow x is white)
If the inference from (24) to (25) is made
legitimate simply by the addition of (23) then
(26) would seem to validate any inference
from somethings being snow to that things
being white. But such an inference would not
be logically valid since the whiteness of snow
is merely contingent.
George Lakoff, in his article on natural
logic (1972), compared meaning postulates
with lexical decomposition and suggested that
the latter is explanatory in the way in which
the former is ad hoc. By decomposing bachelor
into male and unmarried we can replace (23)
as a premiss for deriving (24) by
(27) Sebastian is unmarried and Sebastian is
male
Now (24) does indeed follow from (27) in
classical propositional logic, but decomposi-
tion will only work if we have criteria for
distinguishing between cases where it repre-
sents a necessary truth and cases where it is
merely contingent. If we were to decompose
snow into predicates which included white and
frozen, in an attempt to shew the validity of
the inference from (28) to (29),
(28) This is snow
(29) This is white
2. Basic Concepts of Semantics 31
ing applications. A work not directly in the
style of Montague Grammar is Cresswell
(1973) though much of that has been super-
seded. Discussion of the connection between
truth-conditional semantics and our linguistic
knowledge is found in various articles by Bar-
bara Partee (1973 c, 1979 b and 1982). Partee
has also edited a collection of articles on
Montague Grammar (1976). An interesting
discussion of the connection between a se-
mantics for a language and the activity of
speaking that language is found in Lewis
(1975 b). Linguists who advocated a base for
semantics in formal logic include McCawley
(1971 b) and Lakoff (1972). Situation seman-
tics is most fully set out in Barwise & Perry
(1983). A great deal of their work is concerned
with the analysis of context.
Davidsons approach to truth-conditional
semantics is advocated in Davidson (1967 b)
and supported in Wallace (1972). An intro-
duction to this kind of semantics is given in
Platts (1979). Katz semantic views are set out
in Katz (1972) and elsewhere. Theories of
meaning in terms of language use have been
discussed in Grice (1968), Schiffer (1972),
Searle (1969) and by many other philoso-
phers. Typically such discussions contain no
formal semantic theories which could be ap-
plied to any fragment of a natural language.
Fodors views on the connection between
meanings and representation are found in Fo-
dor (1975, 1981). Quines most celebrated re-
jection of the analytic/synthetic distinction
(i. e. the distinction between truths of fact and
truths of logic) is in Quine (1953 a). His doubts
about translation are set out in Quine (1960).
11. Short Bibliography
Barwise 1981 Barwise/Perry 1980 Barwise/Perry
1981 a Barwise/Perry 1981 b Barwise/Perry 1983
Cresswell 1973 Cresswell 1978 c Cresswell
1978 d Cresswell 1982 Davidson 1967 b Dowty
1979 Fodor 1975 Fodor 1981 Grice 1968 Katz
1972 Lakoff 1972 Lewis 1970 Lewis 1975 b
McCawley 1971 b Montague 1974 Partee 1973 c
Partee (ed.) 1976 Partee 1979 b Partee 1982
Platts 1979 Quine 1953 a Quine 1960 Schiffer
1972 Searle 1969 Wall/Peters/Dowty 1981 Wal-
lace 1972
M. J. Cresswell, Wellington (New Zealand)
logical than others, but even if there is, it is
surely not a sense which should be important
for natural language semantics. In natural
language every word is a constant, or at least
is so within the limits tolerated by vagueness
and indeterminacy. This has the consequence
that the only kind of logical validity useful in
semantics is that explained as truth in all
worlds using a possible worlds semantical
framework.
This discussion has been addressing itself
to those who accept a distinction between
contingent and necessary truth. Those who
agree with Quines view that there is no such
distinction, and that the truths of logic rep-
resent no more than the last truths we would
be willing to give up, will not be bothered by
the foregoing argument that logic gives no
analysis of necessity. So much the better for
logic, they will say, and so much the worse
for necessity. It is, though, important to be
clear how much must be rejected if we want
to tread this path. Not only must we give up
the distinction between necessity and contin-
gency, we must also give up such notions as
synonymy and translation. Quine is willing to
tread this path, and a significant number of
philosophers have followed him. But it is a
path which in the end leaves no room for any
discipline of semantics. Perhaps the best reply
to Quine is that no argument, however ap-
parently persuasive, can be stronger than the
fact that there is much a thing as meaning,
that we can recognize synomymies and that
we can and do translate from one language
into another.
10. Bibliographical Appendix
One of the best introductions to truth-con-
ditional semantics in its possible worlds ver-
sion is probably still Lewis (1970). Some of
the points made in the present article are
made at greater length in Cresswell (1978 c,
1978 d and 1982). The most elaborate formal
work in this tradition has been done by those
influenced by Richard Montague. Mon-
tagues own work is collected in Montague
(1974) and a book-length introduction is
found in Dowty, Wall and Peters (1981) where
fuller bibliographical details may be found.
Dowty (1979) contains a number of interest-
32 I. Allgemeine Grundlagen
3. Bedeutung und Gebrauch
(1)
(A) Jack und Jill kommen vor die ver-
schlossene Haustr.
(B) Jill sagt: Der Schlssel liegt unter
der Matte.
(C) Jack bckt sich, holt den Schlssel
hervor und schliet die Haustr auf.
Es ist offensichtlich so, da es Jill mit ihrer
uerung gelingt, die Situation A in die Si-
tuation C zu berfhren: dadurch, da die
uerung in B relativ zur Situation A inter-
pretiert wird, kann der Folgezustand C er-
reicht werden. Fr einen Behavioristen (wie
es Bloomfield in manchen seiner Analysen
war) besteht die Bedeutung eines sprachlichen
Ausdrucks aus einem Paar von praktischen
Situationen: derjenigen, in der die Sprecherin
einen Ausdruck uert, und derjenigen, in der
im Hrer eine Reaktion hervorgerufen wird
(bzw. der Hrer eine Reaktion zeigt); kurz: in
dem Paar von stimulus und response. Diese
Abfolge der Situationen wre bei normalem
Verlauf der Ereignisse, also ohne die ue-
rung nicht erfolgt; insofern ist es berechtigt,
hier von einer nicht-natrlichen Bedeutung zu
sprechen. (Interessanterweise ist auch der In-
tentionalist Grice zum Teil ein Behaviorist;
vgl. dazu die Analyse in Grice (1957): Ein
Sprecher S meint mit x etwas in einer nicht-
natrlichen Weise genau dann, wenn S mit
der uerung von x beabsichtigt, beim Hrer
H einen Effekt zu produzieren dadurch, da
H die Absicht von S bemerkt.)
Der eben genannte Bedeutungsbegriff be-
zieht sich auf den Gebrauch sprachlicher Aus-
drcke in einer aktualen Situation. Er ist
komplex, andererseits undifferenziert und all-
zusehr von spezifischen Parametern der Si-
tuation abhngig; z. B. htte Jill noch vieles
andere uern knnen, um Jack zu derselben
Reaktion zu bewegen; und Jack htte bei der-
selben uerung noch vieles andere tun kn-
nen; und bei einer anderen Gelegenheit als A
htte Jills uerung B auch andere Effekte
als die in C gehabt. Aufgabe des Linguisten
ist es, den Bedeutungsbegriff differenzierter
zu analysieren (die verschiedenen Anteile, die
in Jacks Reaktion eingehen, systematisch von-
einander abzugrenzen), zugleich aber auch
allgemeiner: nmlich sich von der spezifischen
Art der Reaktion zu lsen. Die Entwicklung
der Semantiktheorie ist von dem Versuch ge-
prgt, von den mglichen Effekten einer
uerung immer weiter auf die sprachliche
Grundlage dieser Effekte zurckzuschlieen.
1. Satzbedeutung, uerungsbedeutung und
kommunikativer Sinn; verschiedene Aspekte
von Bedeutung und von Gebrauch
2. Struktur-Reprsentation versus Proze
3. Methodische Eingrenzung der Domne der
Semantik
4. Zweistufige Semantik
5. Modularitt des Sprachgebrauchs: Bedeutung
und Interaktionssystem
6. Modularitt der Bedeutung: Semantik und
konzeptuelles System
7. Literatur (in Kurzform)
1.
Satzbedeutung, uerungs-
bedeutung und kommunikativer
Sinn; verschiedene Aspekte von
Bedeutung und von Gebrauch
Fr jeglichen Bedeutungsbegriff ist es zentral,
da mit sprachlichen uerungen Informa-
tion ber nichtsprachliche Sachverhalte ver-
mittelt wird. Bedeutungen sind in Gebrauchs-
situationen fundiert und werden in Ge-
brauchssituationen aktualisiert. Daher ist es
unvermeidlich, da der intuitive Bedeutungs-
begriff immer auch Gebrauchsaspekte enthlt
(man denke nur an einen Begriff wie usuelle
Bedeutung) und der gesunde Menschenver-
stand geradezu nach einer Gebrauchstheorie
der Bedeutung schreit (siehe Abschnitt 5).
Aber auch in der logischen Semantik, die nach
allgemeiner Auffassung den restriktivsten
oder am weitesten abstrahierten Bedeutungs-
begriff entwickelt hat, spielen Gebrauchs-
aspekte eine wesentliche Rolle, und zwar in
der von ihr herangezogenen Referenztheorie.
Die Frage ist also nicht so sehr, ob Bedeutung
und Gebrauch etwas miteinander zu tun
haben, sondern wie die Grenzen gezogen wer-
den und ob sich daraus ein fruchtbares Ver-
stndnis grundlegender Probleme ergibt. In
einer mehr mentalistischen Perspektive wird
man Bedeutung wahrscheinlich enger ab-
grenzen als z. B. in einer behavioristischen
oder interaktionistischen Perspektive.
Eine der weitestmglichen Bedeutungsde-
finitionen ist von Bloomfield (1933) berlie-
fert. Dazu betrachte man die in (1) wieder-
gegebene Geschichte, die aus den beiden
praktischen Situationen A und C sowie dem
eingeschobenen Sprechereignis B besteht (zur
Differenz gegenber der Originalversion vgl.
Wunderlich 1979).
3. Bedeutung und Gebrauch 33
Abb. 3.1: Faktoren des Sprechaktes (aus: Lang
1983)
nicht befassen mu. Inskriptionen werden erst
relevant in uerungssituationen; aber auch
dort sind die eben genannten Aspekte eher
zweitrangig.
Die abstrakte Satzbedeutung reprsentiert
Identifizierungsbedingungen fr einen Sach-
verhalt. Die uerungsbedeutung liefert
dann eine Spezifizierung dieser Bedingungen
an einem Kontext. Es kann nun Kontexte
geben, wo die Satzbedeutung nicht anwend-
bar ist, es somit auch keine uerungsbedeu-
tung gibt (in unserem Beispiel, wenn der Kon-
text nichts enthlt, was auf das Vorhanden-
sein eines Schlssels oder einer Matte schlie-
en lt). uerungsbedeutungen sind also
nicht etwas, das man willkrlich zu einer
uerung hinzufgen kann; vielmehr mu
man die Satzbedeutung als das Potential (die
Funktion) verstehen, die fr einen Kontext
eine uerungsbedeutung festlegt (mgli-
cherweise aber auch keine).
Der Begriff des Kontextes erfat hier pri-
mr uerungs- oder Situationskontexte.
Man kann sich darunter aber auch sprachli-
che Kontexte vorstellen, deren Selektionswir-
kung auf die uerungsbedeutung oft ganz
dieselbe ist wie die eines Situationskontextes.
Daher ist es berechtigt, im Prinzip ganz un-
differenziert von Kontext zu sprechen.
Auch uerungsbedeutungen lassen sich
als Potential fr einen mglichen kommuni-
kativen Sinn betrachten: man kann mit einer
Zunchst kann man erkennen, da Jills
uerung fr Jack eine Aufforderung war:
dies ist der kommunikative Sinn, den Jack der
uerung entnommen hat. In der gegebenen
Situation A hat Jills uerung zunchst aber
nur bedeutet, da der Schlssel zu der Haus-
tr, vor der sie stehen, unter der Matte liegt,
die sich bei dieser Haustr befindet: dies ist
die im Kontext der Situation A vermittelte
Information bzw. uerungsbedeutung. Und
schlielich kann diese Information nur des-
wegen vermittelt werden, weil der geuerte
Satz eine bestimmte Bedeutung hat (die durch
die Situation A nur spezifiziert wurde).
Grob gesagt, kann man jeder Inskription
(einem akustischen oder graphischen Vor-
kommen) der Ausdruckskette der Schlssel
liegt unter der Matte aufgrund des gramma-
tischen Systems des Deutschen ein und die-
selbe Satzbedeutung zugrundelegen. Sie er-
laubt es, in jedem einschlgigen Kontext (z. B.
so wie in A, wo Sprecherin und Hrer vor
einer Haustr stehen) der Inskription eine
uerungsbedeutung zuzuschreiben. Und
diese erlaubt es, zu jeder dabei denkbaren
Interaktionsgelegenheit (z. B. wo der Hrer
Kavalier ist, der seine Freundin nach Hause
begleitet) der Inskription einen kommunika-
tiven Sinn zu geben. (Zu einer ausfhrlicheren
Diskussion dieser Begriffe siehe Bierwisch
1980, ebenfalls Wunderlich 1976 mit etwas
anderer Terminologie.) Die Satzbedeutung er-
gibt sich natrlich gem dem syntaktischen
Aufbau des Satzes aus verschiedenen Wort-
bedeutungen. Die uerungsbedeutung wird
manchmal auch als die wrtliche Bedeutung
der uerung angesprochen (vgl. aber die
etwas weitergehende Differenzierung in Bier-
wisch 1979, wonach es in der uerungsbe-
deutung wrtliche und nicht-wrtliche
Aspekte gibt).
Der hiermit angedeutete begriffliche Rah-
men lt sich z. B. durch das folgende Struk-
turschema aus Lang (1983) zusammenfassen
(vgl. Abb. 3.1).
Als erstes ist zu bemerken, da man das,
was man jeder Inskription einer Ausdrucks-
kette zuschreiben kann, dieser Ausdrucks-
kette selbst zuschreiben kann; man darf also
von der Tatsache der uerung bzw. Inskrip-
tion berhaupt abstrahieren. Die Satzbedeu-
tung ist neutral in Bezug darauf, ob ein aku-
stischer oder visueller Stimulus vorliegt, ob er
produziert oder wahrgenommen wird, ob er
in dieser oder jener Weise verarbeitet wird.
Alles dies sind leicht abgrenzbare Gebrauchs-
aspekte, mit denen sich die Semantik sicher
34 I. Allgemeine Grundlagen
bedingungen (nicht Wahrheitswerte) vor
Wahrheitsbedingungen sind eine mgliche
Fassung von Identifizierungsbedingungen.
Dieser Effekt wird durch die Bedeutungen der
Wrter und die syntaktische Konstruktion
des Satzes erreicht. Eine darauf aufbauende
Bedeutungstheorie heit Wahrheitsbedingun-
gen-Semantik. (Die meisten Autoren des vor-
liegenden Handbuchs sind ihr in der einen
oder anderen Variante verpflichtet.)
Die Bedeutung der Stze unter (2) ist durch
die Proposition, da der (jeweilige) Schlssel
unter der (jeweiligen) Matte liegt, noch nicht
erschpft. Die Proposition kann auf verschie-
dene Zeiten bezogen, sie kann behauptet, ihr
Wahr-sein als fraglich oder wnschenswert
hingestellt werden. In einem engsten Sinn von
Gebrauch macht der potentielle Sprecher
der Stze unter (2) einen (allerdings gram-
matisch indizierten) verschiedenen Gebrauch
der Proposition. Bei dieser Lesart von Ge-
brauch stellen Tempus und Modus bereits
Gebrauchsaspekte dar. Diese Lesart soll hier
aber nicht weiter verfolgt werden. Auch im
Rahmen einer Wahrheitsbedingungen-Se-
mantik kann man sehr wohl formulieren,
worin der Bedeutungsunterschied von (2a)
und (2b) liegt, der von (2a) und (2c) usw. Dies
setzt allerdings voraus, da man den Anteil
des Tempus, des Wortes ob und der Modal-
verben an den Wahrheitsbedingungen (oder
allgemeiner: an den Erfllungsbedingungen
siehe Abschnitt 5) spezifizieren kann.
Noch in einem anderen Sinn ist die Bedeu-
tung eines Satzes wie (2a) durch die Angabe
von Wahrheitsbedingungen der blichen Art
nicht erschpft. Man mu diesen Satz nm-
lich berhaupt nicht singulr-spezifisch (auf
einen bestimmten Sachverhalt hin) bzw. re-
ferentiell (nmlich auf einen bestimmten
Schlssel hin) verstehen. Man kann ihn auch
generisch verstehen in dem Sinne, da es eben
allgemein fr (Haustr-) Schlssel gilt, da
sie unter einer Matte liegen. Fr einen Satz
wie (3a) wre die generische Lesart wohl die
prferierte, fr einen Satz wie (3b) knnte
man sich auf eine Typ-Lesart einigen, fr (3c)
drfte beides problematisch sein.
(3)
a. Der Schlssel dient zum Trffnen.
b. Der Schlssel wurde von den Rmern
erfunden.
c. Der Schlssel ffnet den Weg zum
Herzen.
In diesen Fllen fallen Satzbedeutung und
uerungsbedeutung oft zusammen (wie na-
trlich auch in allen kontextunabhngigen
bestimmten uerungsbedeutung nicht Belie-
biges meinen wollen; das, was man mit ihr
meinen will, mu im Rahmen des Interak-
tionszusammenhangs irgendwie naheliegend
und relevant sein. Jedoch ist die Systematik
des Zusammenhangs von uerungsbedeu-
tung und kommunikativem Sinn eine ganz
andere (und weit komplexere) als die des Zu-
sammenhangs von Satz- und uerungsbe-
deutung; und die Variation dessen, was man
mit einer uerungsbedeutung alles meinen
kann, ist betrchtlich.
Die Frage, an welcher Stelle eine sinnvolle
Grenze zwischen Bedeutung und Gebrauch
zu ziehen ist, ist schon nach dem bisher Ge-
sagten nicht trivial; und sie wird eher noch
problematischer, je mehr man in das Thema
eintaucht. Die Mehrheit der Linguisten wird
wahrscheinlich ganz grob der Auffassung zu-
neigen, da uerungsbedeutungen im we-
sentlichen in die Domne der Semantik (also
der Bedeutungstheorie) fallen, der kommu-
nikative Sinn in die Domne der Pragmatik
(der Gebrauchstheorie, unter einer Lesart von
Gebrauch).
Vergleicht man Stze wie in (2) unter der
kontextuellen Voraussetzung, da es genau
einen Schlssel und genau eine Matte gibt, so
erkennt man, da sie alle etwas gemeinsam
haben. Es geht um eine rumliche Relation
zwischen diesen beiden Gegenstnden bzw.
um eine rumliche Lokalisierungseigenschaft
des Schlssels, kurz: um den Sachverhalt, da
der Schlssel unter der Matte liegt. Dieser
Sachverhalt kann bestehen oder nicht. Aber
ob er besteht, gehrt weder zu der Satzbedeu-
tung noch zu der uerungsbedeutung.
(2)
a. Der Schlssel liegt unter der Matte.
b. Der Schlssel lag unter der Matte.
c. Ob wohl der Schlssel unter der Matte
liegt?
d. Der Schlssel soll aber unter der Matte
liegen!
In Bezug auf den ausgedrckten Sachverhalt
gibt es fr die uerungsbedeutung genau
zwei Flle: je nach der tatschlichen Beschaf-
fenheit der Welt gibt es den Sachverhalt in
ihr oder nicht (wobei u. U. ein sehr kleiner
Weltausschnitt, hier z. B. die Situation vor der
Haustr gengt). In etwas anderer Formulie-
rung: die mit der uerungsbedeutung gege-
bene Proposition (bzw. auch Information) ist
entweder wahr oder falsch. Entsprechendes
gilt allgemein fr die Satzbedeutung in Bezug
auf jeden der mglichen Kontexte. Der Satz
gibt durch seine Bedeutung also Wahrheits-
3. Bedeutung und Gebrauch 35
(P5) Pragmatik = Theorie der Sprechakte
(P6) Pragmatik = Theorie der Diskursstruk-
tur
(P1) umfat eigentlich alle anderen Varianten,
aber ist in Form der negativen Abgrenzung
eine letztlich uninteressante Fassung des Ge-
genstandsbereiches. Die brigen Versionen
beziehen sich auf verschiedene, aber doch zum
Teil eng zusammenhngende und ineinander
bergehende Aspekte. Deren jeweilige Rolle
wird in den Abschnitten 4 und 5 deutlicher
werden.
2. Struktur-Reprsentation versus
Proze
Unter psychologischem Gesichtspunkt stehen
Bedeutungen einer sprachkompetenten Per-
son zur Verfgung, wenn sie ber abrufbare
mentale Reprsentationen der Bedeutungen
verfgt, die sie dann prozedural (in der Pro-
duktion oder Wahrnehmung sprachlicher
uerungen) einsetzen kann. Wenn Lingui-
sten von semantischer Kompetenz sprechen,
so haben sie im allgemeinen den Aufbau von
Bedeutungsreprsentationen im Auge und
nicht deren prozedurale Verwendung; sie be-
trachten Reprsentationen als neutral gegen-
ber dem prozeduralen Aspekt. Dies schliet
allerdings nicht aus, da sie psychologische
Experimente bercksichtigen, sofern daraus
etwas ber Prinzipien beim Aufbau von Re-
prsentationen hervorgeht.
Die Aufgabe einer Semantiktheorie ist es,
die systematische Zuordnung von sprachli-
chen Ausdrcken und Bedeutungen zu expli-
zieren. Dazu whlt sie sich ihrerseits eine Re-
prsentationssprache fr Bedeutungen, mit
der die strukturellen und z. T. auch funktio-
nalen Aspekte mentaler Bedeutungsreprsen-
tationen erfat werden, aber natrlich nicht
deren physische Natur. (Dies steht, jedenfalls
gegenwrtig, auerhalb der Reichweite jeder
kognitiv orientierten Wissenschaft.) Sofern
die Semantiktheorie relevante semantische
Urteile (ber Bedeutungshnlichkeiten und
-differenzen, semantische Beziehungen, Am-
biguitten, Anomalien, Implikationen usw.)
zu rekonstruieren vermag, kann man ihren
grundstzlichen Realittsgehalt (in Bezug auf
semantische Kompetenz und damit auch men-
tale Verfgbarkeit) nicht abstreiten. Im bri-
gen knnen die Forschungen im Bereich der
Psycholinguistik und der Knstlichen Intelli-
genz auch dazu dienen, mgliche Irrtmer des
Linguisten zu korrigieren.
Aussagen, z. B. Definitionen). Mglicher-
weise wird man sagen mssen, da die Wahr-
heitsbedingungen der blichen Art einen Ef-
fekt der Satzbedeutung darstellen fr den
Fall, da der Satz spezifisch (bzw. referentiell)
verstanden wird; es gibt aber noch andere
mgliche Modi des Bezugs von Stzen auf die
Welt (wie den generischen oder fiktionalen
Modus) deshalb wurde oben allgemeiner
von Identifizierungsbedingungen gesprochen.
In diesem Abschnitt wurden bereits meh-
rere Varianten des Begriffs Gebrauch ange-
deutet. In den folgenden Abschnitten sollen
einige davon etwas systematischer dargestellt
werden. Im Abschnitt 2 wird Gebrauch als
prozeduraler (psycholinguistischer) Aspekt
verstanden. Abschnitt 3 ist systematisch-re-
konstruktiv (damit gleichzeitig zum Teil auch
historisch-rekonstruktiv) angelegt; es geht um
die Abgrenzung dessen, was in die Domne
der Semantik vor jeder Theorie des Ge-
brauchs zu fallen hat. Im Abschnitt 4 wird
nher ausgefhrt, da sich die Wahrheitsbe-
dingungen-Semantik auf eine Referenztheorie
sttzt, die ihrerseits bereits einen Gebrauchs-
aspekt darstellt. Im Abschnitt 5 wird Ge-
brauch auf Interaktionshandlungen bezogen
(vielleicht die naheliegendste Auffassung von
Gebrauch). Im Abschnitt 6 wird die Unter-
scheidung von Satzbedeutung und ue-
rungsbedeutung in einer anderen Form wie-
der aufgegriffen, und zwar unter dem Ge-
sichtspunkt, welche Bedeutungsaspekte von
der Sprache her und welche vom begrifflichen
System her vorgegeben sind.
blicherweise wird es als Aufgabe der
Pragmatik verstanden, eine Theorie des
Sprachgebrauchs zu entwickeln (vgl. Morris
1938). Da es verschiedene Gebrauchsaspekte
gibt (prozedurale, referentielle, konzeptuelle
und interaktionale), ist von vornherein keine
homogene Domne der Pragmatik zu erwar-
ten. Dies wird auch deutlich von Levinson
(1983) hervorgehoben, der mindestens fol-
gende Varianten von Pragmatik unterschei-
det:
(P1) Pragmatik = Bedeutungstheorie minus
Semantik
(P2) Pragmatik = Theorie der kontextab-
hngigen Bedeutung sprachlicher For-
men
(P3) Pragmatik = Theorie der kontextspe-
zifischen Inferenzen aus sprachlichen
Formen
(P4) Pragmatik = Theorie der Angemessen-
heitsbedingungen fr uerungen
36 I. Allgemeine Grundlagen
Neben den logischen Reprsentationen
gibt es Vorschlge fr Bedeutungsreprsen-
tationen in einer weniger standardisierten
Weise, meistens in der Form, da gewisse
Begriffselemente als semantische Merkmale
gewhlt werden (innerhalb der verschiedenen
Richtungen der strukturellen Semantik, ein-
geschlossen die Theorien von Katz, z. B. Katz
& Fodor 1963 bis hin zu Katz 1972), neuer-
dings auch in der Form einer durch konzep-
tuelle Strukturen fundierten Reprsentations-
sprache (wie bei Jackendoff 1983). Letztlich
ist es aber wohl angemessen, auch bei diesen
Autoren eine Przisierungsmglichkeit in
Ausdrcken der (geeignet erweiterten) Prdi-
katenlogik zu unterstellen.
Mit dem Rekurs auf die Prdikatenlogik
wird die Verpflichtung zu einer realistischen
Deutung eingegangen, d. h. die Prdikate sol-
len Mengen einer bestimmten Sorte in der
Realitt reprsentieren und die Variablenbe-
legung soll jeweils reale Elemente dieser Sor-
ten herausgreifen (Individuen, Eigenschaften,
Sachverhalte usw.). Diese realistische Sicht
wird typischerweise durch ein Modell rekon-
struiert (das aus einem Redeuniversum U
die jeweiligen Individuen enthaltend und
den mglichen Belegungen bezglich U be-
steht), anhand dessen sich dann berprfen
lt, ob die Wahrheitsbedingungen der Aus-
drcke und die Relationen zwischen den Aus-
drcken, wie z. B. die Implikation, erfllt
sind. Bei der expliziten Ausformulierung sol-
cher Modelle spricht man von modelltheore-
tischer Semantik. (Dabei bleibt offen, ob die
Elemente von U real, z. B. durch Wahrneh-
mung, oder nominal, z. B. durch den Ge-
sprchskontext, zur Verfgung stehen. Er-
folgreich referieren kann ein Sprecher nur im
realen Kontext vgl. dazu die Unterschei-
dung von attributivem und referentiellen Ge-
brauch in Abschnitt 4).
Die Konstanten der semantischen Repr-
sentation (also vorwiegend Prdikatskonstan-
ten) mssen einem geeigneten Inventar ent-
nommen werden, ebenfalls die mglichen Va-
riablensorten. Man kann hier relativ zu einer
Sprache z. B. ziemlich arbitrre Konstanten
annehmen, die (im Sinne der strukturellen
Semantik) gewisse Klassifikationsaufgaben
erfllen. Man kann auch Konstanten suchen,
die sich in vernnftiger Weise konzeptuell be-
grnden lassen, d. h. auf allgemeine mensch-
liche Wahrnehmungs- und Kognitionsleistun-
gen beziehbar sind. Letztlich wird man aber
Konstanten annehmen wollen, die sprachuni-
versell sind: konzeptuell begrndbar, aber
In Erledigung ihrer Aufgaben macht die
Semantik weitgehenden Gebrauch von Ein-
sichten der Logik. Die Logik, als eine philo-
sophische Disziplin, befat sich mit der Frage,
inwiefern Bewutseinsinhalte (Gedanken,
Ideen) Tatsachen und Sachverhalte der Welt
darstellen; es geht ihr um das objektive und
nicht das subjektive Bewutsein. Da nun
sprachliche uerungen dazu dienen, Be-
wutseinsinhalte zu vermitteln, kann man Be-
deutungen (jedenfalls weitgehend) mit den
Bewutseinsinhalten identifizieren, die Ge-
genstand der Logik sind.
Objektives Bewutsein ist in einer be-
stimmten Art von Metaphysik bzw. Ontologie
verankert, also grundstzlichen Annahmen
darber, wie man Erkenntnisse ber die Welt
haben kann. Zentral dafr (fr die Logik und
somit auch die Semantik) ist der Begriff des
Prdikats: Prdikate dienen dazu, Individuen
oder geordnete Paare (Tripel usw.) von Indi-
viduen, evtl. auch Eigenschaften oder Paare
von Individuen und Eigenschaften, schlielich
auch Situationen bis hin zu Weltzustnden zu
sortieren. Daraus ergibt sich der jeweilige Auf-
bau der Logik. Das, was jeweils sortiert wird,
kann durch eine Variable reprsentiert wer-
den, die ber dem betreffenden Bereich ran-
giert. Jede Art von Sortierung stellt eine Ja/
Nein-Entscheidung dar (etwas fllt unter das
Prdikat oder nicht) und somit auch eine (po-
tentielle) Information. Es ist natrlich klar,
da jemand, der die Sortierung beansprucht
oder tatschlich durchfhrt, ber begriffliche
Schemata oder Kriterien verfgen mu. Die
Prdikate einer Sprache mssen also konzep-
tuell (perzeptiv, motorisch usw.) fundiert sein,
damit die Information ber die Welt zum
Tragen kommen kann.
Eine semantische Standardreprsentation
fr Bedeutungen ist, konsequent in der an-
gedeuteten philosophischen Verwandtschaft,
ein Ausdruck der Prdikatenlogik oder einer
passenden Erweiterung von ihr (z. B. in der
Sprache des Lambda-Kalkls, der Typenlogik
oder der intensionalen Logik), die gewisse
Konstanten (als Trger der spezifischen Be-
deutung) und Variablen (als Trger der syn-
kategorematischen oder kontextabhngigen
Eigenschaften des betreffenden Ausdrucks)
enthlt, mglicherweise auch Operatoren
ber den Variablen (wobei Lambda-Abstrak-
toren eine mgliche Form von Operatoren
zur Reprsentatation funktionaler Zusam-
menhnge darstellen; daneben spielen Quan-
toren, modale Operatoren, der Definitheits-
operator usw. eine Rolle).
3. Bedeutung und Gebrauch 37
deren Komposition umfat. Der Hrer setzt
somit die prdikatenlogische Struktur in eine
Serie von Prozeduren um. In diesem Sinne
enthlt auch schon der Definitheitsoperator
D eine Anweisung an den Hrer: versuche,
das betreffende Individuum in der von dir
reprsentierten Situation (die den sprachli-
chen und nichtsprachlichen Kontext berck-
sichtigt) zu verankern eine Sichtweise, die
z. B. im Rahmen der Situationssemantik und
der Diskursreprsentationstheorie eine Rolle
spielt. Auch die Prdikatskonstanten las-
sen sich prozedural interpretieren. BAHN-
HOF ist zunchst nichts anderes als die un-
analysierte Abkrzung fr eine komplexe Be-
griffskonfiguration. Wenn man fr BAHN-
HOF eine geeignete komplexe Reprsentation
in Ausdrcken primitiverer Prdikate sucht,
kann man sich insbesondere fragen, welche
Identifizierungsleistungen jemand erbringen
mu, um ein Objekt als Bahnhof zu erkennen.
Unter dem Aspekt des Sprachgebrauchs
ergeben sich aus semantischen Reprsentatio-
nen Verstehensanweisungen an den Hrer. In
psychologischen Bedeutungstheorien (z. B.
Johnson-Laird 1982, vgl. auch die Kontro-
verse Johnson-Laird 1977, 1978 und Fodor
1978 b) wird dieser prozedurale Aspekt
manchmal als der wesentliche oder primre
genommen. Falls man diesen Aspekt in geeig-
neter Weise standardisiert, sollte sich aber
erweisen, da er zu Resultaten fhrt, die mit
der prdikatenlogischen Reprsentation qui-
valent sind.
Unter der oben angefhrten universal-
grammatischen Perspektive gibt es allerdings
einen gravierenden Unterschied zwischen se-
mantischen Reprsentationen und semanti-
schen Prozeduren. Semantische Prozeduren
unterliegen generellen kognitiven Strategien
der Informationsverarbeitung, die nicht auf
sprachliche Informationen beschrnkt sind.
Falls sich herausstellen sollte, da es geneti-
sche Prdispositionen fr die Struktur sprach-
licher Prdikate gibt, so wre damit eine
Ebene der semantischen Reprsentation de-
finiert, die der konzeptuellen Verarbeitung
solcher Reprsentationen vorgelagert ist
(siehe Abschnitt 6).
3. Methodische Eingrenzung der
Domne der Semantik
Die traditionelle grammatische Begriffsbil-
dung geht von der Parallelitt (wenn nicht
sogar Identitt) formaler (morphologisch-
syntaktischer) Kategorien und inhaltlicher
auch generell in den Sprachen verwendet wer-
den, z. B. BELEBT, PERSON, TEIL-VON,
VERTIKAL, DISTANZ, MOVE. Ein inter-
essantes Beispiel ist das Prdikat CAUSE, das
konzeptuell als Ursache-Relation zwischen
zwei Ereignissen zu verstehen ist, sprachuni-
versell aber eher als Relation zwischen einem
Agens (als Instantiator des verursachenden
Ereignisses) und einem Ereignis-Sachverhalt.
Eine derartige Relation wird jedenfalls allge-
mein von Kausativkonstruktionen, quer
durch alle bekannten Sprachen, ausgedrckt.
Die hierbei zugrundeliegende Annahme ist,
da Form und Inhalt semantischer Reprsen-
tationen universalgrammatisch bedingt sind
(Universalgrammatik im Sinne der gattungs-
spezifischen genetischen Anlage).
Jemand, der Ausdrcke einer ihm bekann-
ten Sprache hrt, reagiert darauf in spezifi-
scher Weise, wobei den ueren Reaktionen
zunchst notwendigerweise mentale Reaktio-
nen vorhergehen: er versteht diese Aus-
drcke. Man kann annehmen, da der Hrer
kraft der sprachlichen Ausdrcke in die Lage
versetzt wird, sich ein Bild der betreffenden
Sachlage zu machen; er lernt, was nach An-
sicht des uerers der Fall ist, der Fall sein
soll oder als Fall fraglich ist. Der Hrer wird
also durch Dekodierung der sprachlichen
uerung in die Lage versetzt, sich ein eige-
nes Modell der Realitt aufzubauen. Bei die-
ser Verstehensleistung benutzt der Hrer die
sprachliche Bedeutung in gewisser Weise pro-
zedural. Er fat sie als Anweisung auf, sein
Modell so oder so einzurichten.
Betrachten wir eine mgliche uerung der
Nominalphrase in (4a) und deren vereinfachte
Reprsentation in Form von (4b).
(4)
a. ein kleines Caf gegenber dem Bahn-
hof
b.
LOC(x, GEGENBER (Dy (BAHN-
HOFy))) & CAFx & KLEINx
Fr den Hrer ergibt sich dabei folgende
Identifizierungsaufgabe: (a) finde den Bahn-
hof (d. h. dasjenige y in der relevanten Situa-
tion, auf das das Prdikat BAHNHOF zu-
trifft); (b) finde die GEGENBER-Nach-
barschaftsregion zu diesem Bahnhof; (c) lo-
kalisiere innerhalb dieser Region etwas, auf
das sowohl das Prdikat CAF wie auch das
Prdikat KLEIN (z. B. in Bezug auf gastro-
nomische Rumlichkeiten) zutrifft. Diese
Aufgabe des Hrers ist offensichtlich aus
einer Reprsentation wie in (4b) ableitbar, die
nmlich die Identifizierungsbedingungen und
38 I. Allgemeine Grundlagen
im wesentlichen der semantische Typ einschl-
gig. Fr eine nicht unbetrchtliche Anzahl
von Lexikoneinheiten lie sich in diesem Rah-
men berhaupt keine Bedeutung rekonstru-
ieren, dazu gehren insbesondere Gradparti-
keln (wie schon, noch, nur) und Modalparti-
keln (wie denn, doch, aber).
Schon die Untersuchung indexikalischer
(bzw. deiktischer) Ausdrcke (wie ich, hier,
jetzt, das Tempus usw.) mu in wesentlicher
Weise auf den Kontext einer Sprechsituation
Bezug nehmen (vgl. Bar-Hillel 1954). Darum
hat Montague ganz folgerichtig die erste for-
male Theorie indexikalischer Ausdrcke
Pragmatik genannt (Montague 1968). Es
stellte sich jedoch heraus, da der Aufbau
dieser Theorie im Prinzip von denselben for-
malen Mitteln Gebrauch macht wie die Theo-
rie der kontextinvarianten Bedeutung, also
letztlich auch Wahrheitsbedingungen (relativ
zu Bewertungen an einem Kontext und in
einem Modell) formuliert. Somit schien es
vernnftig, die Domne semantischer Unter-
suchungen etwas weiter abzustecken.
(S2) Semantisch an der Bedeutung eines Aus-
drucks ist der Anteil, der sich modell-
theoretisch rekonstruieren lt.
(S2) formuliert die inzwischen wohl am wei-
testen verbreitete Auffassung unter Semanti-
kern. Mit dieser Auffassung konnte man nun
daran gehen, den Topf Pragmatik wieder
zu leeren. Auf diese Weise gelang es, viele
zunchst rtselhafte Aspekte der Bedeutung
im Rahmen semantischer Theorien zu expli-
zieren: z. B. die Tatsache, da viele Ausdrcke
nur dann verwendbar sind, wenn gewisse Pr-
suppositionen erfllt sind (Peters 1979), oder
die Tatsache, da die Modalwrter je nach
beanspruchtem Redehintergrund variable Be-
deutung haben (Kratzer 1978), oder die Vag-
heit von Ausdrcken als Przisierungsmg-
lichkeit relativ zu bestimmten Kontextdimen-
sionen (Pinkal 1985).
Diese Entwicklungen haben zum Ergebnis,
da sich ein Aspekt des Gebrauchs von Aus-
drcken bereits semantisch reprsentieren
lt. Zentral dafr ist die Entwicklung eines
formalen Kontextbegriffs. Ein Kontext enthlt
z. B. (a) eine Menge ausgezeichneter Indivi-
duen (wie Sprecher, Sprechzeit, Sprechort,
verschiedene gestisch oder deiktisch kennzei-
chenbare Objekte; mglicherweise auch Ob-
jekte, auf die sich anaphorisch beziehen lt),
(b) eine strukturierte Menge von Propositio-
nen (die als Prsupposition, Redehintergrund
o. . infragekommen) und (c) eine Menge von
Aspekte, also letztlich ontologischer Katego-
rien, aus. Dies wird deutlich an Bezeichnun-
gen wie Eigenschaftswort (Wrter, die Eigen-
schaften denotieren) oder Tempus (morpho-
logische Kategorien, die die Einordnung in
die Zeit ausdrcken). (Noch bei Jackendoff
(1983) findet sich eine derartige, nur etwas
subtilere, Parallelitt, z. B. zwischen den ver-
schiedenen Fragewrtern und den angenom-
menen ontologischen Sorten.) Bei der Ent-
wicklung morphologisch-syntaktischer Theo-
rien konnte der inhaltliche Aspekt aber mit
guten Grnden ausgeklammert werden (was
letztlich zur These der Autonomie von Syntax
und Morphologie fhrte). Ebenso ist der tra-
ditionelle Bedeutungsbegriff zunchst unge-
teilt, er umfat alle mglichen inhaltlichen
Aspekte (Bedeutung und Gebrauch sind par-
allel oder sogar identisch). Erst bei der Ent-
wicklung einer theoretisch orientierten Se-
mantik ergab sich die Notwendigkeit, die in-
haltlichen Aspekte differenzierter zu betrach-
ten.
Semantische Theorien werden in der Regel
mit dem formalen Apparat der Prdikaten-
logik (oder einer passenden Erweiterung von
ihr) formuliert. Da fr diese das Konzept der
Bewertung relativ zu einem Modell zentral
ist, mu in einem solchen Rahmen Bedeutung
letztlich in Form von Wahrheitsbedingungen
rekonstruiert werden knnen. Ein Ausdruck
soll aber nicht mal diese, mal jene Bedeutung
aufweisen, sondern in stabiler, d. h. kontext-
invarianter Weise immer dieselbe Bedeutung
haben. Daraus ergab sich ein recht prakti-
kables Kriterium fr die Abgrenzung derje-
nigen inhaltlichen Aspekte, die innerhalb der
Semantiktheorie zu behandeln sind:
(S1) Semantisch an der Bedeutung eines
sprachlichen Ausdrucks ist der kontext-
invariante Anteil dieses Ausdrucks an
Wahrheitsbedingungen.
Alle brigen Bedeutungsaspekte des Aus-
drucks wurden recht undifferenziert prag-
matisch genannt. Sie haben im weitesten
Sinne mit der Verwendung des Ausdrucks zu
tun, mit raumzeitlichen Eigenschaften des
Kontextes, mit mglichen Sprecherannah-
men, mit der Etablierung von Interaktions-
beziehungen usw.
Die Bedeutung lexikalischer Einheiten re-
duziert sich dabei weitgehend auf eine (meist
nicht weiter interessierende) Konstante eines
speziellen semantischen Typs; fr das wahr-
heitskonditionale Verhalten des Ausdrucks ist
3. Bedeutung und Gebrauch 39
(5)
a. Wer dirigierte die Berliner Philhar-
moniker?
b. ! x (Dx K(Dx))
(Es sollte der Fall sein, da ich von
allen, die die BP dirigierten, wei, da
sie die BP dirigierten)
c. ! x K(Dx & x = b)
(Es sollte der Fall sein, da ich von
jemandem wei, da er die BP diri-
gierte und identisch mit b ist)
Dies war nur ein illustrierendes Beispiel dafr,
da mit einer formallogischen oder sogar mo-
delltheoretischen Analyse durchaus mehr ge-
leistet werden kann, als man vernnftiger-
weise in die Domne der Semantiktheorie auf-
nehmen mchte. Man kann offenbar vieles,
was zur uerungssituation oder zur passen-
den Eingliederung von uerungen gehrt,
formal genauso behandeln wie die Bedeutung
der Ausdrcke selbst. Es gibt noch viele an-
dere Beispiele dieser Art. Auch die Vagheits-
analyse von Pinkal (1985, siehe Artikel 11) ist
vielleicht nicht semantisch zu nennen. hn-
liches knnte man von anderen Analysen be-
haupten, die unter Zuhilfenahme des Kon-
textbegriffs partielle Gebrauchsaspekte ein-
bezogen haben.
Der Kontext selbst ist nicht Teil der sprach-
lichen Bedeutung. Zur Bedeutung der Aus-
drcke knnen aber Bedingungen an den
Kontext gehren von der folgenden Art:
Wenn der Kontext so-und-so strukturiert ist,
kommt eine erungsbedeutung so-und-so
zustande, wodurch dann der Kontext so-und-
so verndert wird; wenn diese Bedingungen
nicht erfllt sind, kommt gar keine ue-
rungsbedeutung zustande. Dies fhrt uns zu
der folgenden Abgrenzung der Domne der
Semantik.
(S3) Semantisch an der Bedeutung eines Aus-
drucks ist sein Anteil an Wahrheitsbe-
dingungen und an Kontextbedingungen.
Mit der Formulierung Anteil an ... ist un-
terstellt, da die Anteile der verschiedenen
Ausdrcke in einem Satz geeignet kombiniert
werden knnen. Man knnte sich vorstellen
(wie das in rein semantischen Untersuchun-
gen ja auch vielfach geschieht), da die Be-
deutungsanteile der Wrter in einem Satz zum
Schlu irgendwie zusammengesammelt wer-
den. Dies wrde den Aspekt der grammati-
schen Struktur, wie er in den morphologisch-
syntaktischen Theorien erarbeitet wird, mehr
oder weniger ignorieren. In der Sprache der
Prdikatenlogik und ihrer Erweiterungen
folgt die semantische Kombination immer
Prdikaten, die als Przisierungsdimensionen
verwendbar sind. (Siehe Artikel 9)
Eng verbunden mit dem Begriff der Kon-
textabhngigkeit ist der Begriff der Kontext-
vernderung. Ein Ausdruck ist kontextabhn-
gig, wenn er sich nur relativ zu bestimmten
Kontextparametern bewerten lt. Diese
Kontextparameter sind selbst jedoch nicht
einfach invariant gegeben, sondern unterlie-
gen der Vernderung durch vorhergehende
uerungen. Wir lernen aus einer ue-
rung, was der Fall ist. Dieser Fall stellt somit
fr folgende uerungen einen passenden
Kontext dar. Die durch einen Ausdruck er-
reichbare Kontextvernderung ist also nichts
zur Bedeutung dieses Ausdrucks Zustzliches,
sondern eine Funktion dessen Bedeutung
(und zwar mu z. B. die ausgedrckte Pro-
position mit dem vorhandenen Kontext pas-
send vereinigt werden, neu eingefhrte Indi-
viduen mssen dem vorhandenen Redeuni-
versum passend hinzugefgt werden). (Siehe
Artikel 10)
Die Festlegung (S2) ist u. U. zu weit. Man
kann auch offensichtliche Gebrauchsaspekte
der Sprache im Rahmen einer Logiksprache
explizieren und dann eine modelltheoretische
Bewertung vorsehen. Ein typisches Beispiel
ist die Fragetheorie von Aqvist (1965) im
Rahmen einer deontisch-epistemischen Lo-
gik. An dieser Theorie lt sich gleich zwei-
erlei zeigen: (a) man kann natrlich auch
sprachlich unbestimmt gelassene Aspekte der
Referenz modelltheoretisch spezifizieren; (b)
ebenso kann man sprachlich unbestimmt ge-
lassene Aspekte eines Sprechaktes, hier die
Gelingensbedingungen fr Fragen, im Prinzip
auch modelltheoretisch spezifizieren. Aber
daraus mu nicht folgen, da diese Aspekte
zum Gegenstand der Semantiktheorie (statt
Pragmatiktheorie) gehren.
Aqvist analysiert die Bedeutung eines Fra-
gesatzes wie in (5a), wenn er als Informations-
frage verwendet wird, in Form von (5b) (falls
wer alles gemeint ist) oder (5c) (falls wer
genau ist derjenige, der gemeint ist). Wenn
der Fragesatz als Prfungsfrage, didaktische
oder rhetorische Frage verwendet wird, mu
er jeweils andere Bedeutungen haben. Hier
wird einmal eine Spezifizierung des Bezugs-
bereiches fr das Fragepronomen verlangt,
die in wer selbst noch nicht gegeben ist; auer-
dem mssen die jeweiligen Sprechereinstellun-
gen differenziert werden. Damit wird aber
offensichtlich, ber die Bedeutung von (5a)
hinausgehend, schon der jeweilige kommuni-
kative Sinn einer uerung von (5a) erfat.
40 I. Allgemeine Grundlagen
(im Konzept der sog. typengesteuerten Inter-
pretation) braucht man gar nicht die spezielle
Art der syntaktischen Kombination zu be-
rcksichtigen, sondern nur den Umstand, da
zwei Ausdrcke syntaktisch kombiniert wer-
den, und den jeweiligen Bedeutungstyp dieser
Ausdrcke (siehe Artikel 7, Abschnitt 4.3).
Wenn man sowohl (S3) wie auch (K) in
Rechnung stellt, dann mu fr einen komple-
xen Ausdruck nicht nur sein Anteil an den
Wahrheitsbedingungen aus den jeweiligen
Anteilen der Teilausdrcke errechenbar sein,
sondern auch sein Anteil an den Kontextbe-
dingungen. Soweit z. B. Prsuppositionen als
semantische Bedeutungsbestandteile rekon-
struiert wurden, mute man zugleich versu-
chen, die Prsuppositionen der komplexen
Ausdrcke daraus abzuleiten. Dies ergab das
sog. Projektionsproblem der Prsupposition,
ein Problem insofern, als offenbar nicht alle
Prsuppositionen im komplexen Ausdruck
bewahrt werden (vgl. besonders Karttunen
1973 und Gazdar 1979; siehe Artikel 13).
Das Kompositionalittsprinzip in (K) hat
sich als eine uerst fruchtbare methodolo-
gische Forderung erwiesen, da es dazu fhrte,
bisherige semantische Analysen u. U. aufzu-
geben und durch bessere zu ersetzen. Gleich-
zeitig wurden allerdings auch viele Probleme
entdeckt, wo zwar (S3), aber nicht (K) in
seiner starken Version einzuhalten war
(vgl. Partee 1984 a). Bei manchen dieser Pro-
bleme (wie z. B. dem der sog. Eselsstze) war
man stillschweigend berzeugt, da es sich
um genuin semantische Probleme handelt, da
sie in den Kernbereich der prdikatenlogi-
schen Explizierung fielen. Dies veranlate
manche Semantiker, (K) nur als eine empiri-
sche Hypothese aufzufassen, die in einigen
Fllen vielleicht verletzt wird. (Hierbei han-
delte es sich wohl immer um die starke Lesart
von (K), da nur sie einen interessanten em-
pirischen Gehalt beanspruchen kann.) Erst
sptere Entwicklungen (siehe Abschnitte 4
und 6) erlauben eine andere Sicht der Dinge.
Fr die methodische Eingrenzung der Do-
mne der Semantik erscheint mir (K) in
der schwachen Version unverzichtbar. Des-
halb wird zunchst abschlieend die folgende
Formulierung vorgeschlagen.
(S4) Semantisch an der Bedeutung eines Aus-
drucks ist sein Anteil an Wahrheitsbe-
dingungen und an Kontextbedingungen,
soweit diese kompositional sind.
Daraus ergibt sich: Falls ein Ausdruck zwar
zu den Wahrheitsbedingungen oder zu den
Kontextbedingungen in spezifischer Weise
den syntaktischen Kombinationen; diese
Sprachen sind so eingerichtet, da ihre Syntax
semantisch transparent ist. Dies ist fr die
natrlichsprachige Syntax aber keineswegs
evident; u. a. deshalb werden natrliche Spra-
chen oftmals als unlogisch betrachtet. Schon
wenn man (6a) und (6b) gegenberstellt und
alle einfach durch den Allquantor interpre-
tiert, ist die Diskrepanz deutlich: der NP alle
Hunde entspricht keine Konstituente in der
semantischen Reprsentation.
(6)
a. Alle Hunde bellen.
b. x (HUNDx BELLx)
Man kann dieses Problem aber vermeiden,
indem man (6b) aus einer Reprsentation ab-
leitet, in der die Entsprechung von alle Hunde
tatschlich eine Konstituente bildet, und zwar
ein Prdikat 2. Stufe zu dem Prdikat BELL
1. Stufe; diese Technik geht auf Montague
zurck.
Montague hat das Postulat aufgestellt, na-
trliche Sprachen einfach so wie formale
Sprachen der Logik zu behandeln (z. B. Mon-
tague 1970); damit verbunden ist die Forde-
rung auf (rekursive) Kompositionalitt.
(K) Die Bedeutung eines komplexen Aus-
drucks ist eine Funktion aus den Bedeu-
tungen seiner Teilausdrcke. (Komposi-
tionalittsprinzip)
Die Art dieser Funktion ergibt sich nach
Magabe der jeweiligen syntaktischen Regel,
mit der die Teilausdrcke zusammengefgt
werden. Fr das Kompositionalittsprinzip
gibt es eine starke (sog. Fregesche) Version
(die von Montague vertreten wurde) und eine
schwache Version. Die starke Version be-
hauptet einen Homomorphismus zwischen
syntaktischem Aufbau und dem Aufbau von
spezifizierten Bedeutungen, whrend die
schwache Version nicht die Bedeutungen
selbst, sondern die Bedeutungsreprsentatio-
nen (eingeschlossen evtl. Variablen) meint.
Die starke Version unterstellt letztlich eine
Parallelitt zwischen sprachlicher und onto-
logischer Struktur, die schwache Version lt
zu, da erst weitere, z. B. konzeptuelle, Fak-
toren die Bedeutung spezifizieren (siehe Ab-
schnitt 6). Generell akzeptiert (und mgli-
cherweise auch ganz trivial) ist nur die schwa-
che Version von (K).
Montagues Syntax-Konzeption mu heute
aus verschiedenen Grnden als berholt gel-
ten. Man braucht nach heutiger Auffassung
auch nicht fr jede Syntaxregel eine eigene
semantische Funktion anzugeben; im Idealfall
3. Bedeutung und Gebrauch 41
Das Entscheidende ist, da bei Ausdrcken
wie ich zwischen variablem referentiellen Wert
und fester Grundbedeutung (dem Charakter)
unterschieden werden mu. In der Termino-
logie der Situationssemantik (vgl. Barwise &
Perry 1983) lt sich sagen, da der Ausdruck
ich in der angegebenen Weise in der Sprech-
situation verankert werden mu.
Man knnte ich also semantisch als situa-
tionsbeschrnkte Variable ansehen. In hnli-
cher Weise reprsentiert auch der Ausdruck
er eine Variable, mit dem Unterschied, da
nicht der jeweilige Sprecher, sondern ein be-
liebiges Individuum, das durch eine definite
Singular-Maskulinum-NP bezeichenbar ist,
als Referent infrage kommt. Die Definitheit
erfordert, da auch hier der Referent relativ
zu einem Kontext eindeutig bestimmbar sein
mu; mit anderen Worten, auch er mu in
jeder Situation eindeutig verankert werden
knnen. Und hnliches gilt fr alle definiten
Nominalphrasen. (Siehe hierzu und im fol-
genden Artikel 22)
Russell (1905) analysierte den definiten Ar-
tikel (z. B. in der Mann) als Kombination von
Existenz- und Einzigkeitsbehauptung; statt-
dessen kann man sagen, da es sich um eine
Kontextbedingung (bzw. um eine Prsuppo-
sition) handelt: in der betreffenden Situation
soll es genau ein Individuum geben, das unter
das Prdikat MANN fllt; mit anderen Wor-
ten, der Mann mu in der betreffenden Situa-
tion eindeutig verankert werden knnen.
Mithin verlangen auch alle definiten NPn
eine zweistufige Interpretation: der Mann
schlft drckt eine Funktion aus Kontexten
(mit jeweils genau einem Mann) in Proposi-
tionen aus; jede dieser Proposition stellt eine
Funktion aus mglichen Welten in Wahrheits-
werte dar; der Mann drckt einfach die Funk-
tion aus Kontexten (mit jeweils genau einem
Mann) auf ein Individuum (nmlich diesen
Mann) aus; und der drckt eine Funktion aus
Nominalbedeutungen in die soeben genannte
Kontextfunktion aus. (Dabei ist Kompositio-
nalitt bewahrt.) Der definite Artikel ist also
ein termbildender Operator; der Mann iden-
tifiziert relativ zu einem Kontext ein bestimm-
tes Individuum. Die Redeweise, da der Mann
eindeutig in der betreffenden Situation ver-
ankert werden mu, heit, da ein beschrnk-
ter Kontext gefunden werden mu, in dem
genau ein Mann vorkommt. (Dies beinhaltet
allerdings noch nicht, da man dann den re-
ferentiellen Wert von der Mann kennen mu,
also auch in anderen Kontexten auf den be-
treffenden Mann referieren kann siehe
beitrgt, dies sich aber gem sonst gut be-
grndeter morphologisch-syntaktischer Theo-
rien nicht kompositional (sondern nur global)
auswirkt, so handelt es sich nicht um einen
semantischen, sondern um einen pragmati-
schen Bedeutungsanteil. Im brigen ist es
wichtig, (S4) nur als eine notwendige, nicht
auch unbedingt hinreichende Bedingung zu
verstehen, um den Gegenstandsbereich der
Semantik abzugrenzen. Im weiteren (siehe
Abschnitt 6) wird sich herausstellen, da diese
Einschrnkung uns ermglicht, die Bedeu-
tung sprachlicher Ausdrcke zunchst im
Hinblick auf konzeptuelle Reprsentationen
zu analysieren und erst diese auf Wahrheits-
bedingungen zu beziehen.
4. Zweistufige Semantik
Die Analyse indexikalischer (deiktischer)
Ausdrcke hat dazu gefhrt, eine zweistufige
Interpretation anzunehmen (ungefhr in dem
Sinne von Satzbedeutung versus ue-
rungsbedeutung). Unterstellt wird, da je-
dem Ausdruck eine einigermaen feste Grund-
bedeutung in Form einer Funktion (Charakter
oder kontextinvariante Bedeutung) zukommt;
so sollte ich z. B. immer dieselbe Funktion
ausdrcken, egal ob Arnim von Stechow oder
Dieter Wunderlich den Ausdruck uert: ich
bezeichnet relativ zu einem Sprechereignis im-
mer den jeweiligen Sprecher. Der Beitrag von
ich zu den Wahrheitsbedingungen wird also
erst deutlich, wenn man das Sprechereignis
kennt. Und hnliches gilt fr alle indexikali-
schen Ausdrcke.
Die Interpretation von Stzen mit indexi-
kalischen Ausdrcken ist im folgenden Sinne
zweistufig: ich esse drckt eine Funktion aus
mglichen Kontexten (mit jeweils genau
einem Sprecher) in Propositionen aus; jede
dieser Propositionen stellt eine Funktion aus
mglichen Welten (Modellen) in Wahrheits-
werte dar (siehe Stalnaker 1970, Kaplan
1979). Whrend die Extension von Prdikats-
ausdrcken wie essen in der Regel nur in den
verschiedenen Auswertungswelten variiert,
variiert die Extension (der referentielle Wert)
von indexikalischen Ausdrcken nur mit dem
Kontext: dementsprechend drckt ich einfach
eine Funktion aus Kontexten (mit genau
einem Sprecher) auf ein Individuum (nmlich
diesen Sprecher) aus. (Hier und im folgenden
wird auf die Intension, rekonstruiert als
Funktion mglicher Welten in Extensionen,
nicht weiter eingegangen.) (Siehe Artikel 9)
42 I. Allgemeine Grundlagen
interpretiert und erst in einem zweiten Schritt
eine passende (existentielle oder universelle)
Bindung vornimmt (letztlich ber einen gan-
zen Diskursabschnitt bindet). Die Quelle der
Quantifikation liegt also primr nicht in der
Bedeutung des indefiniten Artikels, wenn-
gleich sie ohne ihn auch nicht zustandekme.
(8)
a. Jeder Bauer, der einen Esel hat, schlgt
ihn.
b. Wenn ein Bauer einen Esel hat, schlgt
er ihn.
c. x y (MANNx & ESELy & BE-
SITZ(x,y) SCHLAG(x,y))
Dieser zweistufige Ansatz in der Interpreta-
tion des jeweiligen Beitrags des indefiniten
Artikels wurde in der Diskursreprsentations-
theorie weiter ausgebaut (die im wesentlichen
auf Kamp (1981 a) basiert).
Das Gemeinsame der besprochenen Flle
einer zweistufigen Interpretation besteht
darin, die engere Bedeutung von NPn von
ihrem referentiellen Wert zu trennen. Die NPn
referieren noch nicht von sich aus auf be-
stimmte Individuen, sondern stellen nur Va-
riablen bereit, die dann weiter zu verarbeiten
sind. Die Variablen mssen in einem bestimm-
ten beschrnkten Kontext belegt bzw. die
NPn in einer Situation verankert werden. Da-
mit hat die ursprnglich ganz am Vorgehen
der Prdikatenlogik orientierte Sicht der Se-
mantik eine erhebliche Umdeutung erfahren.
Die semantischen Reprsentationen der
sprachlichen Ausdrcke enthalten noch kei-
nerlei Angaben ber Individuenkonstanten.
Die eigentliche Referenztheorie ist weniger an
den sprachlichen Ausdrcken selbst festzu-
machen als an der Konzeptualisierung mg-
licher Kontexte; sie stellt somit kein im en-
geren Sinne sprachliches, sondern ein konzep-
tuelles Modul dar (siehe Abschnitt 6 zu dieser
Unterscheidung); es wre also gar nicht ver-
fehlt, die Referenztheorie als eine Theorie des
Gebrauchs anzusehen.
Nach der hier dargestellten Sicht sind we-
der definite noch indefinite NPn als Quan-
toren anzusehen (siehe Lbner 1987 b, 1990);
definite NPn sind Terme, indefinite NPn sind
Prdikatsausdrcke. Dies widerspricht der
von Montague (1973) eingefhrten und be-
sonders in der Theorie der Verallgemeinerten
Quantoren (Barwise & Cooper 1981) vertre-
tenen Auffassung, da alle NPn Quantoren
sind. Dies schliet allerdings nicht aus, da
es unter den NPn auch genuine Quantoren
gibt; fr einen Ausdruck wie jeder Mann legt
das Wort jeder die Quantoreneigenschaft be-
dazu unten ber attributive vs. referentielle
Verwendung definiter NPn.)
In vielen semantischen Analysen wird der
indefinite Artikel durch einen Existenzquan-
tor reprsentiert. Dies wrde dann zu einer
einstufigen Interpretation fhren: ein Mann
schlft drckt die Proposition x (MANNx
& SCHLAFx) aus, somit direkt eine Funktion
aus mglichen Welten in Wahrheitswerte. Tat-
schlich ist diese Annahme ziemlich proble-
matisch. Die indefinite NP kann auch als
Prdikatsausdruck vorkommen (z. B. in
Helge ist ein Mann) und mte dann eine
andere Bedeutung haben (vgl. Doron 1988).
Mglicherweise sollte man den Ausdruck ein
Mann einfach als Eigenschaftsausdruck re-
prsentieren: entweder so wie in (7a) mit
als Lambdaoperator und CARD-1 als Kar-
dinalittsprdikat, oder so wie in (7b), wo
jedes Vorkommen der freien Variablen x in
allen Belegungen denselben Wert erhalten
mu (vgl. Lbner 1987 b, 1990).
(7)
a. x(MANNx & CARD-1x)
b. MANNx & CARD-1x
Wenn der Ausdruck ein Mann als Prdikats-
ausdruck vorkommt, so bindet der jeweilige
Subjekt-Term die Variable x. Kommt der Aus-
druck in referentieller bzw. Argument-Posi-
tion vor, so mu die Variable beliebig belegt
werden knnen; das heit das jeweilige Re-
deuniversum mu mindestens einen Mann
enthalten; wegen der Kardinalittsforderung
ist es nicht zugelassen, da das Redeuniver-
sum gar keinen Mann enthlt (in einem sol-
chen Fall wrde ein Mann keinen Wert er-
halten knnen, somit auch der Satz keinen
definiten Wahrheitswert). Dadurch kommt
automatisch die Lesart mit Existenzquantor
zustande.
Besonders die Probleme im Zusammen-
hang mit den sog. Eselsstzen wie in (8a, 8b)
sprechen fr eine solche Behandlung des in-
definiten Artikels (siehe besonders Heim
1982). Die einzig sinnvolle Lesart (8c) (vor-
ausgesetzt, wir geben das Konditional durch
eine Implikation wieder) lt sich komposi-
tional nicht ableiten, wenn man fr die Be-
deutung des indefiniten Artikels schon im er-
sten Schritt eine Existenzquantifikation an-
nimmt. Das Problem ist nicht nur, da der
indefinite Artikel in (8c) ja offensichtlich
durch einen Allquantor bersetzt werden
mu, sondern auch, da der Quantorensko-
pus ber den jeweiligen Teilsatz hinausgeht.
Diese Probleme lassen sich vermeiden, wenn
man die indefinite NP zunchst so wie in (7)
3. Bedeutung und Gebrauch 43
BRECH-UG)x die semantische Reprsenta-
tion der NP mit D als Definitheitsoperator.
Dann kann D z. B. blo die Funktion haben,
als Wert der NP den einzigen Agens einer
spezifischen Situation vom Typ EINBRECH-
UG (in das Uhrengeschft einbrechen) her-
auszugreifen, oder die Funktion, mithilfe des
Prdikats AGENS(EINBRECH-UG) im
Kontext der Sprechsituation einen referen-
tiellen Wert, also eine Person, festzulegen.
(Zur semantischen Analyse des definiten Ar-
tikels vgl. Lbner 1985 a).
(b) In vielen Analysen deutet man die In-
terpretation des Pronomens durch einen In-
dex an. Man unterscheidet dabei zwischen
einem gebundenen und einem freien Prono-
men, und zwar relativ zu der Satzdomne, in
dem das Pronomen vorkommt. (Auch das
freie Pronomen mu natrlich irgendwie ver-
ankert werden.) In einem Fall wie (9a) ist das
Pronomen gebunden, in (9b) ist es frei. Die
semantische Reprsentation fr einen Satz
wie jeder hoffte, da er gewinnt sollte demge-
genber aber neutral sein; er ist in jedem Fall
durch eine Individuenvariable wiederzugeben,
die definit, nach Magabe der Kongruenzin-
formation, zu belegen ist. Erst je nach Kon-
text, und zwar im genuinen Sinne pragma-
tisch, hat man sich fr die eine oder die andere
Lesart zu entscheiden. Der Unterschied ist im
Rahmen der Referenztheorie zu bestimmen,
und dies kann interessanterweise dazu fhren,
da in (9b) er auf ein fixiertes Individuum
referiert, in (9a) aber nicht.
(9)
a. (Viele Gromeister versammelten sich
zum Turnier.)
Jeder
i
hoffte, da er
i
gewinnt.
b. (Kasparov
i
mute seinen Titel vertei-
digen.)
Jeder hoffte, da er
i
gewinnt.
Die durch Indizierung festgelegte Interpreta-
tion des Pronomens ist natrlich nichtkom-
positional, wie man aus den beiden Mglich-
keiten in (9) leicht erkennt. Andererseits
scheint es fr die satzinternen Bindungsmg-
lichkeiten des Pronomens rein syntaktische
Beschrnkungen zu geben (siehe Artikel 23
Pronouns). Dies weist darauf hin, da die
satzinterne Bindung des Pronomens ein typi-
sches Schnittstellenphnomen ist, bei dem
einerseits syntaktische Informationen, ande-
rerseits kontextuelle Informationen verwertet
werden.
(c) Generische Stze sind im allgemeinen
sprachlich nicht eigens gekennzeichnet. So-
wohl definite wie auch indefinite NPn knnen
reits lexikalisch fest. Nun ist jeder Mann kein
referentieller Ausdruck; jeder Mann bedeutet
nicht die Gesamtheit der Mnner, sondern
beinhaltet die Mglichkeit, die vorkommende
Variable mit jedem beliebigen Mann eines
kontextuell evtl. eingeschrnkten Rede-
universums zu belegen. Diese Belegung selbst
ist aber, wie in Artikel 7 Syntax und Seman-
tik gezeigt wird, weder kompositionell noch
unterliegt sie dem sog. Monsterverbot. Beides
sind gut motivierte Bedingungen fr seman-
tische Reprsentationen. Deshalb darf man
schlieen, da die Variablenbelegung auch
beim Allquantor kein genuin sprachlich-se-
mantisches Verfahren darstellt, sondern letzt-
lich auch ein Verfahren zur referentiellen Be-
wertung, das sprachunabhngig ist, was
natrlich vllig im Einklang mit den Auffas-
sungen der Logiker steht. Die Probleme des
Allquantors hinsichtlich Kompositionalitt
und Monsterverbot sind im Lichte der zwei-
stufigen Semantik also keineswegs berra-
schend, sondern eher erwartbar.
Im Rahmen einer zweistufigen Interpreta-
tion erscheinen dann auch einige weitere, oft
diskutierte Probleme in einem neuen Licht.
(a) Eine NP wie der Einbrecher in das Uh-
rengeschft kann attributiv oder referentiell
gebraucht werden (siehe Donnellan 1966 und
die Rekonstruktion im Rahmen der Situa-
tionssemantik von Barwise & Perry 1983).
Die genannte NP wird attributiv gebraucht,
wenn sie nur als Prdikat hinsichtlich derje-
nigen Person fungiert, die einziger Tter einer
bestimmten Einbruchssituation ist wer im-
mer es ist; wenn man nicht irgendwie Zeuge
dieser Situation gewesen ist, hat man keine
Mglichkeit, diese Person auch unabhngig
zu identifizieren. Die NP wird referentiell ge-
braucht, wenn sie dazu dient, auf eine be-
stimmte Person wirklich zu referieren; um
darin erfolgreich zu sein, bentigt man zu-
stzliches Wissen zur unabhngigen Identifi-
zierung dieser Person. Angenommen, wir ken-
nen Moritz, dann kann man z. B. mit der
Frage Was ist Moritz? die attributive Ver-
wendung der NP herausfordern. Angenom-
men, wir kennen Moritz nicht, dann kann
man mit der Frage Wer ist Moritz? eine
referentielle Verwendung der NP herausfor-
dern. Die semantische Reprsentation der NP
sollte gegenber diesen beiden Lesarten neu-
tral sein; die Lesarten ergeben sich erst bei
unterschiedlicher Ausnutzung der Identifizie-
rungsbedingungen eines Prdikats im Rah-
men der Referenztheorie, also in gewisser
Hinsicht pragmatisch. Sei Dx AGENS (EIN-
44 I. Allgemeine Grundlagen
5. Modularitt des Sprachgebrauchs:
Bedeutung und Interaktionssystem
Der Bereich sprachlicher Phnomene, dem ich
mich jetzt zuwenden will, hat mit den bisher
errterten Problemen relativ wenig zu tun. Es
ist dieser Bereich, der Anla zu der sog. Ge-
brauchstheorie sprachlicher Bedeutung, zur
Theorie der performativen Akte und zur
Sprechakttheorie gegeben hat (siehe Artikel
12). Im Sinne der Unterscheidungen in Ab-
schnitt 1 handelt es sich primr um Theorien,
die den kommunikativen Sinn von ue-
rungen zu explizieren suchen, womglich un-
ter Bercksichtigung der Form der ue-
rungen.
Die Gebrauchstheorie der Bedeutung
(Wittgenstein 1953/67, aber auch frhe So-
ziolinguisten wie Malinowski 1923) leugnet
letztlich so etwas wie die Mglichkeit seman-
tischer Reprsentationen; dies hngt mit ihrer
behavioristischen Sichtweise zusammen. Be-
deutungen sind, dieser Theorie zufolge, im
Leben, in den Ttigkeitsfeldern des Menschen
verankert; sie sind an soziale Akte gebunden;
uerungen selbst stellen soziale Akte dar.
Eine wesentliche Przisierung hat die Vor-
stellung von uerungen als sozialem Akt
durch Alston (1963, 1964 b), Hare (1970) und
vor allem Austin (1956, 1962) erfahren. Pa-
radigmatisch fr die Analysen Austins ist die
Untersuchung der sog. explizit performativen
uerungen. Mit der uerung von Stzen
wie in (11) macht der Sprecher normalerweise
nicht nur eine Aussage, sondern er vollzieht
eine Bitte, eine Frage usw.
(11)
a. Ich bitte dich, zu schweigen.
b. Ich frage dich, ob du sie kennst.
Die Mglichkeit dieses sog. performativen
Modus ist an das Prsens, den assertiven Cha-
rakter und die Art und Verteilung der Per-
sonalpronomina gebunden. Mit den Stzen in
(12) lassen sich keine explizit performativen
uerungen vollziehen.
(12)
a. Ich bat dich, zu schweigen.
b. Ich bitte dich nicht, zu schweigen.
c. Du bittest mich, zu schweigen.
Es hat viele Versuche gegeben, den merkwr-
dig speziellen Modus der Stze unter (11) zu
klren. Da der performative Modus nicht
zur Satzbedeutung gehren kann, ergibt sich
schon daraus, da selbst Stze wie (11) auch
nicht-performativ verwendbar sind, z. B. in
einem Dialog wie (13).
eine generische Lesart annehmen. Parallel zu
(8a,b) kann der Satz (8d) betrachtet werden,
der entweder generisch (hnlich wie (8a,b),
jedoch bezogen auf irgendeinen beliebigen
Mann) oder auch spezifisch, bezogen auf
einen im Kontext identifizierbaren Mann, in-
terpretierbar ist.
(8)
d. Ein Bauer, der einen Esel hat, schlgt
ihn.
Nur in der spezifischen Lesart referiert ein
Bauer auf ein Individuum; in der generischen
Lesart kann der Ausdruck durch eine belie-
bige Referenzinstanz belegt werden. Wie-
derum sollte die semantische Reprsentation
von (8d) gegenber diesem Unterschied im
Referenzmodus neutral sein; erst die Refe-
renztheorie htte diesen Unterschied zu kl-
ren. (Im Rahmen der modelltheoretischen Se-
mantik kann immer nur ein spezifischer Si-
tuationsbezug hergestellt werden; daraus rh-
ren die Probleme bei der Analyse generischer
Stze.)
(d) Bei der uerung eines Satzes wie (10)
kann die Hauptbetonung (der Satzakzent)
z. B. auf Arnim, Seepferd oder geschlachtet
liegen. Damit wird die Gesamtinformation
des Satzes jeweils unterschiedlich auf Hinter-
grundsinformation und fokussierte Informa-
tion verteilt. Der Satz drckt aber in allen
Fllen die gleiche Proposition aus; allerdings
ist diese Proposition jeweils unterschiedlich
aufgebaut bzw. strukturiert (zum Konzept der
strukturierten Proposition vgl. u. a. Lewis
1970, Cresswell & von Stechow 1982). Man
kann z. B. annehmen, da das jeweils betonte
Wort die ranghchste Prdikation des Satzes
ausdrckt.
(10) Arnim hat ein Seepferd geschlachtet.
Offensichtlich tritt die jeweils fokussierte In-
formation in der Proposition selbst gar nicht
mehr in Erscheinung; die Proposition nivel-
liert diese Information, sie ist semantisch r-
mer als die jeweiligen Informationsverteilun-
gen. In einer einstufigen Interpretation htte
man fr (10) nur die Proposition bzw. den
Wahrheitswert zur Verfgung und knnte die
gewnschte Differenzierung gar nicht treffen.
Bei der zweistufigen Interpretation knnte
auf der ersten Stufe der jeweilige semantische
Aufbau bercksichtigt werden; unter Hinzu-
fgung der referentiellen Eigenschaften er-
gbe sich dann die zweite Stufe, also die Sor-
tierungsqualitt des Satzes in Bezug auf die
Realitt. (Siehe hierzu Artikel 39 und 40)
3. Bedeutung und Gebrauch 45
Im Prinzip denselben Effekt wie mit einer
uerung der Stze unter (11) kann ein Spre-
cher auch mit den Stzen unter (14) zustan-
debringen.
(14)
a. Schweig!
b. Kennst du sie?
Austin hat solche uerungen primr per-
formativ genannt. Bei einem falschen Ver-
stndnis der Quelle von Performativitt hat
man versucht, in die syntaktische Reprsen-
tation der Stze Elemente des expliziten Per-
formativs einzubauen (z. B. Ross 1970; Sa-
dock 1968, 1974). Diese Auffassungen wur-
den allerdings bald mit guten Grnden zu-
rckgewiesen (z. B. Grewendorf 1972, Gazdar
1979). Allenfalls lt sich sagen, da der je-
weilige Satzmodus hnlich wie ein explizites
Performativ zu interpretieren ist (so z. B. Le-
wis 1972); vorteilhafter ist es allerdings, da
die Satzmodi mindestens in Ausdrcken von
allgemeinen Sprechereinstellungen und nicht
in Ausdrcken von Sprechhandlungen inter-
pretiert werden (siehe unten; vgl. auch Lang
1983).
In der Theorie der Sprechakte (beginnend
mit Austin 1962, vor allem aber Searle 1969,
Bach & Harnish 1979) wurde dann ein ge-
nereller Versuch unternommen, alle Arten
von sprachlichen uerungen als Kommu-
nikationsversuche des Sprechers zu betrach-
ten. Dies beinhaltet natrlich, da der Spre-
cher einen spezifischen Effekt beim Zuhrer
erreichen will. Somit stellt die Sprechakttheo-
rie zunchst einen genuinen Ansatz zu einer
Gebrauchstheorie der Sprache dar. Und es
war natrlich klar, da die erreichbaren
Effekte nur dadurch zustandekommen kn-
nen, da der Hrer die uerungen interpre-
tiert, letztlich also semantische Reprsentatio-
nen zugrundelegt. In der tatschlichen Aus-
fhrung der Sprechakttheorie ist dieser Ge-
sichtspunkt allerdings weitgehend zurckge-
treten, teils auch deswegen, weil die semanti-
schen Probleme (jedenfalls damals) nicht zu
lsen waren.
In ihrem Kern hat sich die Sprechakttheo-
rie (von Searle und an Searle orientierend)
mit einer Fundierung der Gebrauchsbedin-
gungen von Sprache und, darauf aufbauend,
mit einer Klassifikation der berhaupt mg-
lichen Sprechakte befat. Beide Aufgaben
sind aus heutiger Sicht nicht befriedigend ge-
lst. Wie die Untersuchungen von Meggle
(1981, anknpfend an die Arbeiten von Grice)
zeigten, ist die handlungstheoretische Fundie-
rung von Sprechakten wesentlich diffiziler als
(13) Und was machst du, wenn ich anfange,
auszuplaudern?
Ich bitte dich, zu schweigen.
Aus der Sicht einer Semantiktheorie sollten
Stze wie (11) im Prinzip dieselbe Reprsen-
tation wie die Stze unter (12) erhalten. Es
handelt sich um Aussagestze; daher sollte
die Auffassung von Lemmon (1962), da es
sich beim performativen Modus dem Wesen
nach um selbstverifizierende uerungen (in
anderer Terminologie: um tokenreflexive
uerungen) handelt, am meisten Plausibili-
tt erhalten. Angenommen, da der ber
einer Proposition operierende Aussagemodus
die Sprechereinstellung Ich betrachte diese
Proposition als wahr ausdrckt. Dann
drckt (11a) aus, da der Sprecher es als wahr
betrachtet, da er (ich) den Zuhrer (dich)
darum bittet, zu schweigen. Nun bezieht sich
das Verb bitten auf Sprechereignisse, deren
Agens der jeweilige Sprecher ist; und die De-
fault-Interpretation des Prsens bezieht das
Ereignis auf die Gegenwart. Die Interpreta-
tion von Verb, Verbargumenten und Tempus
zusammen mit der Annahme von Wrt-
lichkeit kann den Hrer also schlieen
lassen, da das im Satz beschriebene Ereignis
mit dem uerungsereignis identisch ist: da
der Sprecher tut, was er sagt, indem er sagt,
was er tut. (Bei den Stzen unter (12) ist ein
solcher Schlu, aufgrund der Interpretation
von Prteritum, der Negation und den Verb-
argumenten, unter keinen Umstnden mg-
lich: das uerungsereignis kann nicht ver-
gangen sein, es kann nicht der Zustand sein,
in dem ein bestimmtes Ereignis nicht stattfin-
det und es kann nicht ein Ereignis sein, dessen
Agens der Hrer ist.)
Die Wrtlichkeits- oder Ernsthaftigkeits-
annahme ist zulssig, soweit nicht kontex-
tuelle Bedingungen vorliegen, die sie auer
Kraft setzen (wie der hypothetische Kontext
in (13)). Der scheinbar exzeptionelle Charak-
ter der explizit performativen uerungen er-
gibt sich also als ein ganz normaler Effekt
aus den blichen Interpretationsbedingungen
fr Aussagestze und allgemeinen Auffassun-
gen ber die Ernsthaftigkeit von Kommuni-
kation. Man braucht sich nicht auf einen spe-
ziellen performativen Modus oder eine spe-
zielle Konvention des Sprachgebrauchs zu be-
rufen. Der performative Modus ist nichts als
die spezielle (nmlich tokenreflexive) Verwen-
dung des deklarativen Modus; man kann da-
her in diesen Fllen auch immer den token-
reflexiven Ausdruck hiermit hinzufgen.
46 I. Allgemeine Grundlagen
geln); interessanterweise fehlt auch eine ana-
loge Gebrauchsregel fr interrogative Stze
(siehe Wunderlich 1976). Regeln wie in (15)
erfassen auch nur einen Standardgebrauch
der Satzmodi und nicht die tatschlich vor-
kommende pragmatische Variation. Natr-
lich sind solche Regeln im Rahmen des Vo-
kabulars der Sprechakttheorie weiter diffe-
renzierbar; die Frage aber bleibt, ob es nicht
eine genuin semantische Grundlage gibt, die
das Spektrum pragmatischer Gebrauchsre-
geln erst ermglicht.
Eine inzwischen verbreitete Auffassung ist,
da ein Satzmodus eine sehr allgemeine Spre-
chereinstellung (und damit ein mgliches
Sprechaktpotential) ausdrckt. Aber auch
eine Sprechereinstellung ist etwas, das erst in
der jeweiligen uerungsbedeutung in Er-
scheinung tritt: mit dem wrtlichen Gebrauch
des Satzes beansprucht der Sprecher, ein be-
stimmtes Verhltnis zwischen Proposition
und Welt ausgedrckt zu haben. Die seman-
tische Grundlage dafr lt sich noch ein
Stck weiter in Richtung auf dieses Verhltnis
selbst abstrahieren. Ein Satzmodus knnte
jeweils ber einem bestimmten semantischen
Typ operieren und auf einer zugehrigen Er-
fllungsdimension einen von zwei Werten
festlegen einen Vorschlag dazu enthlt (16).
Die Semantik der satzmodusindizierenden
Ausdrcke lt sich dementsprechend in
Form von Erfllungsbedingungen formulie-
ren; wie man aus (16a) ersieht, sind dann die
Wahrheitsbedingungen ein spezieller Fall von
Erfllungsbedingungen.
(16)
a. Der deklarative Modus operiert ber
einer Proposition p und drckt aus,
da p wahr ist (mglicherweise
schwcher: da p nicht bezweifelt
wird).
b. Der imperative Modus (der 2. Person)
operiert ber einem Prdikat A und
drckt aus, da es relativ zu einem
Interesse I positiv ist, wenn der
Adressat das Prdikat A erfllt.
c. Der interrogative Modus operiert
ber einer Menge M von Propositio-
nen und drckt aus, da es relativ zu
einem Wissensstand W unentschieden
ist, welche Proposition pi aus der
Menge M wahr ist.
Wenn man (16) zugrundelegt, ergeben sich
daraus die Sprechereinstellungen bei einer nor-
malen wrtlichen uerung sehr einfach: der
Sprecher gibt das als seine Einstellung zu ver-
stehen, was der Satzmodus ausdrckt.
dies ursprnglich angenommen wurde. Und
aus linguistischer Sicht mu die Klassifika-
tion der Sprechakte von Searle in wesent-
lichen Punkten als verfehlt betrachtet werden
(siehe Wunderlich 1976, 1979, 1986 a; Lang
1983).
Die Deutung, da mit einer uerung die-
ser oder jener kommunikative Sinn verbun-
den wird, kann nur relativ zu allgemeinen
oder institutionellen Auffassungen ber In-
teraktion und den speziellen Bedingungen
einer Interaktionssituation erfolgen (siehe
Wunderlich 1976). Bierwisch (1980) hat dies
dahingehend przisiert, da Kenntnisse ber
das Interaktionssystem vorausgesetzt werden
mssen (und diese Kenntnisse haben mit den
sprachlichen Kenntnissen nichts zu tun, da
Interaktionen auch vor- und auersprachlich
erfolgen knnen); Interaktionskenntnisse bil-
den ein eigenes Modul unserer Kenntnisse,
mit denen sich u. a. die Handlungstheorie be-
fat.
Auerdem mu jede interaktive Deutung
einer uerung auf der Bedeutung der ge-
uerten Stze aufbauen. Die Sprechakttheo-
rie mte also primr von einer Analyse der
verschiedenen Satztypen ausgehen, die formal
durch die Kategorie des Satzmodus gekenn-
zeichnet sind. (14a) ist ein Imperativsatz,
(14b) ein Fragesatz; neben dem Aussagesatz
sind dies die sprachuniversell dominanten
(formal gekennzeichneten) Satzmodi. Die zu-
nchst zu bearbeitenden Probleme sind also:
welche Satzmodi weist eine Sprache auf? und
was ist ihre Bedeutung?
Fr einige Logiker haben die Satzmodi, da
sie oberhalb von Propositionen operieren,
berhaupt nur eine Gebrauchs-Bedeutung,
d. h. sind direkt auf bestimmte Interaktions-
aspekte bezogen. Ein typisches Beispiel dafr
stellen die von Stenius (1967) formulierten
Gebrauchsregeln dar:
(15)
a.
uere einen Satz im deklarativen
Modus nur, wenn sein Satzradikal
wahr ist.
b. Reagiere auf einen Satz im imperati-
ven Modus, indem du sein Satzradi-
kal wahr machst.
hnlich sind die Wahrhaftigkeitskonventio-
nen von Lewis (1969) einzuschtzen, die ein
Gesprchsteilnehmer beachtet, wenn er dekla-
rative Stze uert oder imperative Stze
hrt. berraschen mu die Asymmetrie von
Sprecher- bzw. Hrerregel (fr den Hrer de-
klarativer Stze und den Sprecher imperativer
Stze gibt es offenbar keine Gebrauchsre-
3. Bedeutung und Gebrauch 47
hin zu stilistischen, poetischen oder figurati-
ven Verwendungen) aufgrund von Implika-
turen grundstzlich zuneigen, stagniert die
ntige theoretische Entwicklung. Die einzige
Untersuchung der letzten Jahre, die einen
theoretischen Fortschritt verspricht, ist Sper-
ber & Wilson (1986); diese Autoren fhren
die Vielfalt von Implikaturprinzipien in ein-
heitlicher Weise auf die Relevanz von Kon-
textannahmen zurck.
(18) zeigt eines von vielen mglichen Bei-
spielen fr eine konventionelle Implikatur.
(18)
a. Sie kriegten ein Kind und heirateten.
b. Sie heirateten und kriegten ein Kind.
Jemand, der (18a) uert, scheint anzudeuten,
da sie heirateten, nachdem (oder sogar: weil)
sie ein Kind kriegten, whrend jemand, der
(18b) uert, wohl eher auf den sanktionier-
ten Gang der Dinge abhebt. Man mchte aus
guten Grnden nicht annehmen, da und
manchmal so viel wie und dann bedeutet
(vgl. Posner 1979). Deshalb beruft man sich
hier gerne auf eine Modalittsmaxime von
Grice: Berichte Geschehnisse in der Reihen-
folge, in der sie sich ereigneten. Es ist frag-
lich, ob dies wirklich eine sinnvolle Maxime
von Sprechern (und nicht Schulmeistern) ist.
Eine bessere Erklrung wrde sich vielleicht
im konzeptuellen Rahmen ergeben: sofern
nichts anderes indiziert ist, spiegelt die Se-
quenz von Teilstzen (die Erwhnungsab-
folge) die jeweils einschlgige Sequenz von
Bewutseinsinhalten wieder (Ereignisabfolge,
Kausalkette, Wichtigkeitshierarchie). (Solche
Phnomene werden auch unter dem Aspekt
der Ikonizitt, d. h. bildhaften Abbildung in
der sprachlichen Formulierung, behandelt.)
Etliche Phnomene, fr die Gricesche Impli-
katuren (beruhend auf Rationalittsmaxi-
men) angenommen werden, lassen sich viel-
leicht durch normale konzeptuelle Prozedu-
ren erklren (siehe den folgenden Abschnitt
6).
Mithilfe von Implikaturen lt sich auch
die Wirkung sog. indirekter Sprechakte erkl-
ren (vgl. Searle 1975). Wenn jemand beim
Abendessen sagt: Kannst du mir die Butter
geben?, so meint er natrlich Gib mir die
Butter. Das Fragen nach der Fhigkeit im-
plikatiert hier wie in vielen anderen Kontex-
ten das Ausben der Fhigkeit. Derartige Im-
plikaturen knnen z. T. standardmig vor-
genommen werden, wobei Elemente der ge-
uerten Stze oft zu Routineformeln (z. T.
mit elliptischem Charakter) abgeschwcht
werden: der kommunikative Sinn der ue-
(17)
a. deklarativer Modus: S betrachtet die
Proposition p als wahr.
b. imperativer Modus: S betrachtet es
relativ zu einem Interesse I als vor-
zuziehen, da der Adressat das Pr-
dikat A erfllt.
c. interrogativer Modus: S betrachtet es
relativ zu einem Wissensstand W als
unentschieden, welche Proposition p
i
aus einer Menge von Propositionen
wahr ist.
Mit (16) bzw. (17) ist nur ein sehr allgemeines
Bedeutungspotential formuliert, das eine
breite Variation des kommunikativen Sinns
aufgrund der Interaktionsumstnde zult.
Insbesondere mssen die Variablen I und W
in der betreffenden Sprechsituation belegt
werden. In (14b) kann das Interesse I z. B.
ein Interesse des Sprechers oder ein Interesse
des Adressaten sein; dementsprechend ergibt
sich eine Differenzierung von Imperativ-
uerungen entweder als Bitten oder als Vor-
schlge, Ratschlge, Warnungen. In (14c)
kann es sich um einen Wissensstand des Spre-
chers oder des Adressaten handeln; dement-
sprechend ergibt sich eine Differenzierung in
Informationsfragen oder didaktische/Pr-
fungsfragen.
In das Problemfeld dieses Abschnitts ge-
hren zum Teil auch die Phnomene des
Sprachgebrauchs, die seit Grice (1967, 1975)
unter dem Stichwort Implikaturen behandelt
werden, besonders die konversationellen Im-
plikaturen (siehe Artikel 14). Ein Sprecher
kann etwas meinen, ohne dies wrtlich aus-
zudrcken; er veranlat dann seine Zuhrer
zu Schlufolgerungen, die ber die ue-
rungsbedeutung hinausgehen. Reguliert wird
das Verstndnis von Implikaturen durch ein
bergeordnetes Kooperationsprinzip, das
Grice so formuliert hat: Mache deinen Ge-
sprchsbeitrag jeweils so, wie es von dem ak-
zeptierten Zweck oder der akzeptierten Rich-
tung des Gesprchs, an dem du teilnimmst,
gerade verlangt wird. Dies ist offensichtlich
ein Prinzip der sprachlichen Interaktion (un-
ter dem Gesichtspunkt von rationalem Han-
deln) und nicht der Semantik. Diesem Prinzip
unterstehen einzelne Maximen, die Grice in
kantischer Art als Maximen der Quantitt,
der Qualitt, der Relation und der Modalitt
unterschieden hat. Die inhaltliche Ausfllung
und theoretische Entfaltung dieser Maximen
ist nicht immer evident (siehe dazu Gazdar
1979). Obwohl viele Linguisten einer Erkl-
rung sprachlicher Gebrauchsphnomene (bis
48 I. Allgemeine Grundlagen
lat wie (19a) ist z. B. dadurch gerechtfertigt,
da die Menge der Welten, in denen x eine
Gromutter ist, eine Teilmenge der Welten ist,
in denen x weiblich ist.
(B) Man kennzeichnet die Konstanten
durch semantische Merkmale (genommen aus
einer Auswahl von Prdikatskonstanten, die
als primitiv und relativ universell verstanden
werden) und leitet daraus die Bedeutungsbe-
ziehungen ab. Dieses Verfahren einer Bedeu-
tungszerlegung charakterisiert die verschie-
denen Spielarten der strukturellen Semantik.
Ein Problem dabei ist, da die Deutung der
semantischen Merkmale in ihrer Rolle fr die
Deutung des Gesamtprdikats meistens offen
bleibt.
(C) Man versteht die Konstanten als Ab-
krzung fr eine komplexe semantische Kon-
figuration. Auch hier wird die Bedeutung zer-
legt, aber nicht in eine Liste von Merkmalen,
sondern in eine offene prdikatenlogische
Formel (die ihrerseits geeignete primitive Pr-
dikatskonstanten enthlt). Dies erlaubt dann
wiederum, die Bedeutungsbeziehungen abzu-
leiten, und zwar aufgrund allgemeiner logi-
scher Regeln. Dieses Verfahren wurde teils im
Rahmen der sog. generativen Semantik (z. B.
Lakoff 1971) entwickelt, teils in Auseinan-
dersetzung mit Positionen der strukturellen
Semantik, eingeschlossen die Theorien von
Katz (siehe besonders Bierwisch 1969). Zwi-
schen dem Aufbau von Wortsemantik und
Satzsemantik gibt es dann keinen wesent-
lichen Unterschied abgesehen von den
Effekten, die daher rhren, da Teile von
Wrtern fr syntaktische Beziehungen nicht
zugnglich sind; Stze wie (20a) und (20b)
knnen dieselbe Reprsentation erhalten
(20c) vs. (20d) veranschaulicht die Beschrn-
kung durch syntaktische Inseln. Fr diese Ar-
gumentation ist es irrelevant, ob die Wort-
bedeutung aufgrund der Interpretation mor-
phologisch sichtbarer Affixe abgeleitet wird
oder nicht. (Zur Integration der Wortseman-
tik in die Montague-Grammatik vgl. Dowty
1979; siehe auch Artikel 8.)
(20)
a. Das Problem ist unlsbar.
b. Das Problem kann nicht gelst wer-
den.
c. * Das Problem ist unlsbar, sondern
mu offen bleiben.
d. Das Problem kann nicht gelst wer-
den, sondern mu offen bleiben.
Aktuell verfolgt werden heute nur Positionen,
die durch die Verfahren (A) oder (C) charak-
terisierbar sind. Dabei ist es wohl so, da
rung wird zur idiomatischen Standardbedeu-
tung einer sprachlichen Formel (vgl. Brown
& Levinson 1978; Coulmas 1981). Mgli-
cherweise lassen sich indirekte Sprechakte
auch im Rahmen der Gesprchsorganisation
in turns erklren (vgl. Levinson 1983; die zu-
nchst im soziologischen Rahmen entwickelte
Konversationsanalyse ist primr an den in-
teraktiven Prinzipien des Gesprchsablaufs
interessiert vgl. z. B. Schegloff 1972; Scheg-
loff & Sacks 1973; Sacks/Schegloff/Jefferson
1974; Wunderlich 1978 und kann daher
fr eine Reihe von Diskursphnomenen er-
klrend herangezogen werden.)
6. Modularitt der Bedeutung:
Semantik und konzeptuelles System
Bei der Behandlung satzsemantischer Pro-
bleme gengt es oft, nur den Bedeutungsanteil
der sog. logischen oder Funktionswrter (wie
z. B. jeder, oder) explizit zu bercksichtigen,
whrend man sich bei den sog. Inhaltswrtern
(Nomina, Verben, Adjektive, Prpositionen)
auf die Angabe einer Konstanten eines gewis-
sen semantischen Typs beschrnken kann.
ber diese Konstanten braucht man nur an-
zunehmen, da sie irgendwie konzeptuell
(also im Begriffs- oder Erfahrungssystem)
festgelegt sind.
Zwischen den Inhaltswrtern gibt es aber
eine Reihe von Bedeutungsbeziehungen, die
natrlich auch in die Domne der Semantik
fallen. (19) gibt eine kleine Auswahl davon
wieder:
(19)
a.
A ist Gromutter / rztin A ist
weiblich
b. A ist rot A ist nicht blau
c. A ist grer als B B ist kleiner als
A
d. A ist unter B B ist ber A
e. A sucht seine Brille A versucht,
seine Brille zu finden.
f. A khlt das Bier Das Bier wird
khl
g. A rollt das Fa in den Keller Das
Fa rollt in den Keller
Grundstzlich gibt es drei Verfahren, solche
Bedeutungsbeziehungen zu bercksichtigen.
(A) Man formuliert sie in Form von Be-
deutungspostulaten, die sich als empirische Be-
schrnkungen in der Interpretation auswirken
(vgl. Carnap 1947 a). In ihrer Gesamtheit cha-
rakterisieren sie den inhaltlichen Gehalt der
jeweiligen Konstanten. Ein Bedeutungspostu-
3. Bedeutung und Gebrauch 49
aufweisen oder nicht). Was hier vorliegt, ist
also offensichtlich komplizierter als in der
bisher angenommenen zweistufigen Seman-
tik. Die Stze sind nicht einfach an einem
Kontext als wahr oder falsch zu bewerten,
sondern zunchst ist aufgrund der lexikali-
schen Bedeutung der Ausdrcke (evtl. relativ
zu einem Kontext) die Reprsentation einer
spezifizierten rumlichen Situation aufzu-
bauen, die dann zu bewerten ist.
hnliches wie in (21) lt sich anhand der
dimensionalen Adjektive beobachten (siehe
Lang 1987 a, 1988 a). Z. B. gelten die in (22)
genannten Implikationen. Aber anders als die
Bedeutungsbeziehungen zwischen polaren
Adjektiven wie in (19c) knnen diese Impli-
kationen nur schwerlich aus der lexikalischen
Reprsentation der Adjektive abgeleitet wer-
den. (Lang zeigt berzeugend, da dafr eine
ungeheuer komplizierte und letztlich nicht be-
grndbare Semantik vonnten wre). Viel-
mehr mu man annehmen, da die Vorder-
stze eine bestimmte rumliche Anordnung
des Objektes voraussetzen (Spiegel bzw.
Stange mssen aufrecht stehen), whrend die
Hinterstze neutral zur rumlichen Anord-
nung sind. Wiederum ist zunchst aufgrund
der lexikalischen Bedeutung der Ausdrcke
die Reprsentation einer spezifizierten rum-
lichen Situation aufzubauen, die dann zu be-
werten ist.
(22)
a. Der Spiegel ist 2 m breit und 1 m
hoch Der Spiegel ist 2 m lang und
1 m breit
b. Die Stange ist 3 m hoch
Die Stange ist 3 m lang
Lang nimmt an, da die nominalen Prdikate
wie SPIEGEL, STANGE usw. nur auf Ge-
genstnde zutreffen knnen, die ein bestimm-
tes konzeptuelles Objektschema erfllen. Zu
dem Objektschema gehren Informationen
ber Dimensionalitt, Desintegrierbarkeit der
Achsen sowie Achsenauszeichnung (als ma-
ximale, vertikale usw.). Die Anwendbarkeit
eines Adjektivs auf den betreffenden Objekt-
term hngt dann davon ab, ob das Adjektiv
(aufgrund seiner lexikalischen Bedeutung) auf
die ausgezeichneten Achsen zutrifft oder vor-
handene Leerstellen im Objektschema pas-
send festlegt und dadurch z. B. eine spezifi-
sche rumliche Anordnung des Objektes er-
zwingt. Diese sog. Parameterbelegungsregeln
dienen also dazu, eine konzeptuelle Reprsen-
tation fr den Satz aufzubauen.
Bierwisch & Lang (1987, 1989) unterschei-
den strikt zwischen semantischer Reprsenta-
Anhnger von (A) gewisse Fragen gar nicht
stellen, die fr Anhnger von (C) gerade wich-
tige Fragen sind. Im Rahmen der Position (C)
knnen nun auch Probleme angegangen wer-
den, die sich der theoretischen Behandlung
bisher entzogen haben.
Man betrachte die in (21) formulierten Be-
deutungsbeziehungen. Wenn sich A und B
face to face gegenber stehen, gilt (21a); wenn
sie hintereinander in einer Schlange stehen,
gilt (21b); unter noch anderen Umstnden
braucht keines von beidem zu gelten.
(21)
a. A steht vor B B steht vor A
b. A steht vor B B steht hinter A
In (21a) mu vorausgesetzt werden, da A
und B jeweils intrinsische Frontseiten haben
und da die dadurch definierten Richtungen
entgegengesetzt sind. In (21b) sind A und B
in derselben Richtung orientiert, entweder
aufgrund ihrer intrinsischen Frontseiten oder
aufgrund einer speziellen Ausrichtung der
Schlange oder aufgrund einer Beobachterper-
spektive. Dieses Problem der Richtungsab-
hngigkeit findet sich auch, wenn jemand die
Aufforderung Parke hinter dem Peugeot!
wahr machen will: er kann seinen Wagen vor,
hinter oder sogar neben dem Peugeot abstel-
len, je nach dem, was er als die definierende
Richtung ansieht. Man kann daher anneh-
men, da vor und hinter in der lexikalischen
Reprsentation eine Richtungsvariable erhal-
ten, die in der entsprechenden Situation zu
belegen ist: entweder intrinsisch durch Aus-
richtung der Achsen des betreffenden Objekts
oder extrinsisch durch eine Beobachterper-
spektive bzw. eine sonstwie einschlgige Rich-
tung. Bei konstanter Festlegung der Richtung
sind vor und hinter im Sinne von (21b) kon-
vers zueinander, d. h. hinter kann so wie vor,
aber mit umgekehrter Richtung reprsentiert
werden.
Zunchst sieht es so aus, als knne die
Richtungsabhngigkeit einfach im Rahmen
der zweistufigen Semantik beschrieben wer-
den; die Ausdrcke vor, hinter enthalten eine
Kontextbedingung, die durch die zulssigen
Kontexte in der einen oder anderen Weise
erfllt werden mu. Das Problem ist aber
verwickelter, weil die Kontextbedingung ent-
weder an Eigenschaften der Objekte oder an
der Einfhrung eines Beobachters festge-
macht werden mu; und dazwischen bestehen
Abhngigkeiten, die eigens kontrolliert wer-
den mssen. Insbesondere mssen A und B
im Hinblick auf ihre Objekteigenschaften in-
terpretiert werden (ob sie eine passende Achse
50 I. Allgemeine Grundlagen
schrieben hat. Die Beispiele in (23) knnen
den ersten Typus, den der konzeptuellen Dif-
ferenzierung, belegen.
(23)
a. Die Schlange steht bis kurz vor das
Rathaus.
Es regnete bis kurz vor unserer Ab-
fahrt.
Sie erhitzten die Substanz bis kurz
unter 2000 Grad.
b. Sie ist schon im Bett.
Wir sind schon in Holland.
Er ist schon 5 Jahre alt.
Er hat schon 100 Mark gespart.
Es ist sinnvoll, die Ausdrcke bis, vor und
schon nicht als ambig anzusehen. Sie enthal-
ten in ihrer semantischen Reprsentation
einen Parameter, von dem die Sprecher einen
unterschiedlichen konzeptuellen Gebrauch
machen, d. h. unterschiedlich spezifizieren
knnen. (Vgl. dazu das Beispiel (5) von oben
fr die unterschiedlichen Spezifizierungen von
wer.) Bis ordnet das Ende eines Zustands/
Prozesses auf einer Skala ein: diese kann z. B.
als rumliche oder zeitliche Dimension, aber
auch als Temperaturskala spezifiziert werden;
und vor relationiert einfach zwei Elemente auf
einer ziemlich beliebigen (horizontal gedach-
ten) Skala. Die spezielle rumliche oder zeit-
liche oder noch andere Deutung der Dimen-
sion beruht auf einem wechselseitigen Selek-
tionseffekt des sprachlichen Kontextes, der
hier insbesondere durch das Objekt der Pr-
position gestellt wird: Rathaus bezieht sich
auf ein rumliches Objekt, Abfahrt auf ein
zeitliches Ereignis und 2000 Grad auf einen
Temperaturwert. Schon bedeutet, da et-
was auf einer Skala nach dem bergang der
negativen Flle zu den positiven Fllen ein-
geordnet wird: diese Skala kann als zeitliche
oder rumliche Dimension, als Skala der Le-
bensalter, Geldbetrge usw. spezifiziert wer-
den (vgl. Lbner 1989, 1990).
Der Typus der konzeptionellen Verschie-
bung (der ebenfalls oft mit Differenzierung
einhergeht) kann an Beispielen wie in (24)
demonstriert werden.
(24)
a. Die Schule beginnt um 8 Uhr.
Die Schule ist gleich um die Ecke.
Die Schule bietet neuerdings auch
Kochkurse an.
Die Schule hat ein strenges Regle-
ment.
Die halbe Schule versammelte sich
auf der Strae.
Die Schule spielt fr die Reproduk-
tion (semantischer Form) und konzeptueller
Reprsentation. Dies sind zwei verschiedene
Module der Bedeutung, die auf ganz verschie-
denen Kentnissystemen beruhen. Semantische
Reprsentationen unterliegen ausschlielich
sprachlichen (mglicherweise universellen)
Prinzipien und insbesondere dem Komposi-
tionalittsprinzip. Die darin vorkommenden
Konstanten sind sowohl grammatisch deter-
miniert wie auch konzeptuell fundiert, letz-
teres aber nicht notwendigerweise in der Bio-
graphie des Sprechers, sondern aufgrund der
gattungsspezifischen konzeptuellen Anlage.
Der kompetente Sprecher macht Gebrauch
der durch das sprachliche System bedingten
semantischen Reprsentationen, indem er sie
im Lichte seiner individuellen Erfahrungen
auf konzeptuelle Reprsentationen abbildet.
(Dies ist also ein weiterer Gebrauchsaspekt
der Sprache; man kann natrlich auch um-
gekehrt sagen, da der Sprecher Gebrauch
von seinen Erfahrungen macht, wenn er
sprachliche Ausdrcke interpretiert.) Konzep-
tuelle Reprsentationen unterliegen allgemei-
nen (also nichtsprachlichen) Prinzipien des
konzeptuellen Systems, im Fall von lokalen
Prpositionen und Adjektiven speziell des
konzeptuellen Systems des Raumes. Im Auf-
bau von konzeptuellen Reprsentationen
kann nun in natrlicher Weise diverses Welt-
wissen (und natrlich auch der jeweilige Kon-
text) bercksichtigt werden. Insbesondere ge-
hren Stereotype und prototypische Sche-
mata zum konzeptuellen Inventar, das hierbei
herangezogen werden kann.
Auch konzeptuelle Reprsentationen sind
propositional (obwohl sie ihrerseits mit an-
deren Reprsentationsformen in Wechselbe-
ziehung stehen), also grundstzlich mit den
Mitteln der Prdikatenlogik formulierbar.
Der Aufbau dieser Reprsentationen mu
aber nicht kompositional dem Aufbau von
Stzen folgen. Soweit Bedeutungseffekte au-
genscheinlich nichtkompositional sind, sollte
man also annehmen, da sie aus dem kon-
zeptuellen System herrhren. Auch sog. Um-
weginterpretationen (bei semantisch zunchst
abweichenden Stzen, z. B. solchen, die eine
Sortenverletzung aufweisen) lassen sich als
Reparaturen im Rahmen des konzeptuellen
Systems verstehen (hnlich so wie gewisse Im-
plikaturen als Reparaturen innerhalb des In-
teraktionssystems gelten knnen).
Die Unterscheidung von semantischer und
konzeptueller Reprsentation ist ebenfalls
hilfreich in der Analyse der zahlreichen Flle,
die Bierwisch (1983) als konzeptuelle Differen-
zierung und als konzeptuelle Verschiebung be-
3. Bedeutung und Gebrauch 51
text) wie auch anaphorisch (im sprachlichen
Kontext) gebraucht werden knnen. Der re-
ferentielle Wert eines Ausdrucks mu in dem
jeweiligen Kontext identifiziert werden; auch
dies ist mithin eine konzeptuelle Leistung.
Man kann es vielleicht so formulieren: kon-
zeptuelle Reprsentationen beziehen sich di-
rekt auf die externe Welt, semantische Repr-
sentationen nur indirekt, nmlich nach ber-
setzung in konzeptuelle Reprsentationen.
Die Referenztheorie (die festlegt, wie seman-
tische Individuenvariablen zu belegen sind)
expliziert demnach im wesentlichen die
Schnittstelle zwischen semantischen und
konzeptuellen Reprsentationen (nicht not-
wendigerweise exklusiv). Prdikatskonstan-
ten werden auf konzeptuelle Schemata bezo-
gen; konzeptuelle Differenzierung und Ver-
schiebung sind dann als Operationen ber
solchen Schemata zu verstehen.
Im Lichte dieser Betrachtungen gewinnen
berlegungen der prozeduralen Semantik
(siehe Abschnitt 2) eine neue Perspektive: die
Belegung von Variablen sowie die konzep-
tuelle Differenzierung / Verschiebung stellen
Prozeduren dar, deren Resultat konzeptuelle
Reprsentationen sind.
Natrlich werden auch Interaktionskon-
texte konzeptuell reprsentiert; sie unterliegen
aber ganz anderen regulierenden Prinzipien in
Verbindung mit Motivationsstruktur und der
sozialen bzw. interaktiven Kompetenz. Des-
halb kann man die in Abschnitt 5 besproche-
nen Probleme wohl zurecht gegenber Pro-
blemen der Referenz oder der konzeptuellen
Schematisierung deutlich abgrenzen. Aller-
dings knnten sich aus den hier betrachteten
Entwicklungen der Semantik auch neue Ge-
sichtspunkte fr die Sprechakttheorie erge-
ben. Ein Sprecher, der mit seiner uerung
einen spezifischen Effekt beim Hrer errei-
chen will, mu die Sprechsituation gewisser-
maen inkremental reprsentieren: nmlich
als eine Situation, die durch gewisse weitere
Informationen in eine dementsprechend mo-
difizierte Situation bergefhrt werden kann.
Aus der Sicht einer grundstzlichen Unter-
scheidung von semantischer Kompetenz (als
Teil der grammatischen Kompetenz) und ge-
nerellen konzeptuellen Fhigkeiten ergibt sich
ein Spektrum mglicher Grenzziehungen zwi-
schen Bedeutung und Gebrauch. Auf der
einen Seite knnte alles, was innerhalb des
konzeptuellen Systems geleistet wird, Ge-
brauch genannt werden, auf der anderen
Seite nur das, was spezifizische weitere Mo-
tion der Gesellschaft eine zentrale
Rolle.
b. Seine Schrift ist unleserlich.
Eine Punkt 8 Schrift ist mir zu klein.
Die Koreanische Schrift wurde im
Dezember 1443 eingefhrt.
Wenn Schule eine Institution zum Lernen
bedeutet, so lt sich nach generellen konzep-
tuellen Kriterien zwischen Typ und Exemplar
unterscheiden, zwischen Verfahren, Agenten
und Klienten, ferner lassen sich Gebude, Ak-
tivitten und zeitlicher Ablauf zuordnen. Na-
trlich sind Institutionen, Gebude, Personen
und Prozesse ganz andere Arten von Entit-
ten, die somit unterschiedliche Sortenbedin-
gungen erfllen. Der jeweilige Kontext von
Schule stellt solche Sortenbedingungen, deren
Verarbeitung fhrt dann zur konzeptuellen
Verschiebung. Man mu also nicht anneh-
men, da Schule mehrfach ambig ist. Dies
wre schon deshalb nicht wnschenswert, weil
Nomina wie Universitt, Kirche, Amtsgericht
usw. ein ganz hnliche Variation aufweisen.
Und die Beispiele in (24b) zeigen, da die
Variationsmglichkeit schon bei den Nomina
viel weiter verbreitet ist. So kann man fr
Schrift die semantische Reprsentation Mit-
tel zur optischen Reprsentation von Sprache
annehmen, um daraus die verschiedenen ak-
tualen Verwendungsvariationen konzeptuell
abzuleiten. Fr Nomina wie Buchstabe, Zei-
tung, Roman, Oper usw. lt sich dies dann
leicht fortfhren. Das Problem der Polysemie
beruht also im wesentlichen in dem aktualen
Gebrauch der Wrter, bei dem im Rahmen
von konzeptuellen Reprsentationen das je-
weilige Weltwissen zur Differenzierung und
Verschiebung eingesetzt werden kann. Dies
schliet nicht aus (sondern macht es geradezu
erwartbar), da gewisse Verwendungen pr-
feriert oder stigmatisiert werden und dadurch
neue semantisch idiomatische Lexikonein-
trge fixiert werden knnen.
Abschlieend sei nochmals auf die ber-
legungen zur zweistufigen Semantik in Ab-
schnitt 4 eingegangen. Ein Situations- oder
Interaktionskontext wird konzeptuell und
nicht sprachlich reprsentiert insbesondere
natrlich ein visueller Kontext; aber auch
sprachliche Kontexte stehen, wenn sie ge-
braucht werden, in der Regel wohl konzep-
tuell, also bereits verarbeitet, zur Verfgung;
fr die Einheitlichkeit des Kontextbegriffs
ob visuell oder sprachlich sprechen insbe-
sondere die indexikalischen Ausdrcke, die in
der Regel sowohl deiktisch (im visuellen Kon-
52 I. Allgemeine Grundlagen
einstufigen (mithin wohl konzeptuellen) Be-
deutungsreprsentation zuneigen. Die aktua-
len Entwicklungen in der Kontext- und Re-
ferenztheorie (insbesondere der Diskursrepr-
sentationssemantik) deuten aber darauf hin,
da eine Konzeption wie die hier dargestellte
an Gewicht zunehmen wird.
Ich danke Ewald Lang, Sebastian Lbner und Ar-
nim von Stechow fr hilfreiche Kommentare.
7. Literatur (in Kurzform)
Alston 1963 Alston 1964 b Aqvist 1965 Austin
1956 Austin 1962 Bach/Harnish 1979 Bar-Hil-
lel 1954 Barwise/Cooper 1981 Barwise/Perry
1983 Bierwisch 1969 Bierwisch 1979 Bierwisch
1980 Bierwisch 1983 Bierwisch/Lang (eds.)
1987 Bierwisch/Lang (eds.) 1989 Bloomfield
1933 Brown/Levinson 1978 Carnap 1947 a
Coulmas 1981 Cresswell/von Stechow 1982
Donnellan 1966 Doron 1988 Dowty 1979 Fo-
dor 1978 b Grewendorf 1972 Grice 1957 Grice
1967 Grice 1975 Hare 1970 Heim 1982 Jak-
kendoff 1983 Johnson-Laird 1977 Johnson-
Laird 1978 Johnson-Laird 1982 Kamp 1981 a
Kaplan 1979 Karttunen 1973 Katz 1972 Katz/
Fodor 1963 Kratzer 1978 Lakoff 1971 Lang
1983 Lang 1987 a Lang 1988 a Lemmon 1962
Levinson 1983 Lewis 1969 Lewis 1970 Lbner
1985 a Lbner 1987 b Lbner 1989 Lbner
1990 Malinowski 1923 Meggle 1981 Montague
1968 Montague 1973 Morris 1938 Partee
1984 a Peters 1979 Pinkal 1985 Posner 1979
Ross 1970 Russell 1905 Sacks/Schegloff/Jeffer-
son 1974 Sadock 1968 Sadock 1974 Schegloff
1972 Schegloff/Sacks 1973 Searle 1969 Searle
1975 a Sperber/Wilson 1986 Stalnaker 1970
Stenius 1967 von Wittgenstein 1953/1967 Wun-
derlich 1976 Wunderlich 1978 Wunderlich 1979
Wunderlich 1986 a
Dieter Wunderlich, Dsseldorf
(Bundesrepublik Deutschland)
dule (wie z. B. die Motivationsstruktur und
Interaktionskompetenz) in Anspruch nimmt.
Die in diesem Abschnitt dargestellte Kon-
zeption wird nicht von allen Semantikern ge-
teilt. Einmal gibt es Autoren, die eine eigene
Ebene der semantischen Reprsentationen
(oder semantischen Form in der Termino-
logie von Bierwisch und Lang) berhaupt ab-
streiten, also Bedeutungen grundstzlich in
Form von konzeptuellen Strukturen repr-
sentieren (z. B. Jackendoff 1983). Neben allen
spezifischen (hier zum Teil dargestellten) Ar-
gumenten gibt es gegen diese Art der Kon-
zeption auch den generellen Einwand, da
eine merkwrdige Asymmetrie des gramma-
tischen System behauptet wird. Die Gram-
matik ordnet Lautsequenzen Bedeutungen zu.
Sowohl Laute wie auch Bedeutungen (reali-
stisch verstanden) sind der Sprache extern.
Als komplexe Schnittstelle zwischen syntak-
tisch-morphologischer Form und phoneti-
scher Struktur (als Reprsentationsform fr
artikulatorische und auditive Prozesse) fun-
giert nach einhelliger Auffassung aller Lin-
guisten die phonologische Struktur; eine ana-
loge komplexe Schnittstelle zwischen syntak-
tisch-morphologischer Form und der konzep-
tuellen Struktur (als Reprsentationsform der
Welt) knnte die semantische Struktur dar-
stellen.
Viele Semantiker stellen sich der Frage
nach der konzeptuellen Vermittlung gram-
matischen Wissens gar nicht, vielleicht weil
sie Erwgungen dieser Art nicht als besonders
relevant fr die Entwicklung formaler Theo-
rien halten. In der Regel nehmen diese Auto-
ren einen direkten Bezug semantischer Repr-
sentationen zur Welt an. Tatschlich enthalten
ihre Analysen oft sehr differenzierte konzep-
tuelle Aspekte, die nicht kompositional in Be-
zug auf die syntaktisch-morphologische Form
sind. Es ist deshalb einfach unklar, ob sie eher
der hier dargestellten Konzeption oder einer
4. Wortsemantik 53
4. Wortsemantik
(2) Regnet es denn?
(3) Leider regnet es.
aufgrund der deskriptiven Bedeutung von
regnen uerungen gemacht werden, in denen
ein und derselbe Sachverhalt, nmlich da es
regnet, jeweils als Bedingung, als Gegenstand
einer Frage bzw. als Inhalt einer Mitteilung
behandelt wird.
Nicht-deskriptive Bedeutungskomponen-
ten dagegen tragen neben anderen Faktoren
dazu bei, sprachlichen uerungen den Cha-
rakter mehr oder weniger spezifizierter Hand-
lungen zu verleihen, wie etwa den von Fest-
stellungen (vgl. (1) und (3)), Fragen (vgl. (2))
oder dergleichen. Zum andern ermglichen
sie es, die Darstellung von Sachverhalten in
unterschiedlicher Weise zu beleuchten (vgl.
die Funktion von leider in (3)), sowie deren
Verwendung in einen umfassenden Hand-
lungskontext einzugliedern (so die Modalpar-
tikel denn in (2), mit der zum Ausdruck ge-
bracht wird, da eine positive Antwort auf
(2) als Begrndung fr etwas akzeptiert
wrde, was vorher gesagt oder getan wurde).
Die letzten beiden Beispiele legen nahe, da
die Bedeutung bestimmter Wrter mit ihrer
nicht-deskriptiven Bedeutung zusammenfllt.
Bei anderen Wrtern ist ein komplexes Ne-
beneinander deskriptiver und nicht-deskrip-
tiver Bedeutungskomponenten anzunehmen.
Die Unterscheidung deskriptiv nicht-de-
skriptiv entspricht dabei nicht einem Gegen-
satz im Bereich der semantischen Modi (etwa
Feststellung vs. Aufforderung, Frage usw.).
So ist, wie die Beispiele (1) bis (3) zeigen, die
deskriptive Bedeutung von regnen durchaus
mit verschiedenen Modi vereinbar.
Der von hier aus naheliegenden Verallge-
meinerung, da deskriptive Bedeutungskom-
ponenten grundstzlich modusneutral sind,
scheinen nun aber bestimmte Vorkommen der
sog. performativen Verben entgegenzustehen.
Ein explizit performativer Satz wie (4)
(4) Ich fordere Sie hiermit auf, die Strae zu
rumen.
hat zwar die Form einer Aussage, dennoch
drckt er in der Regel eine Aufforderung aus.
Nimmt man nun an, da dieser Gegensatz
zwischen der Form eines Satzes und seiner
uerungsbedeutung schon auf der Ebene
der systematischen Satzbedeutung konstitu-
iert wird, so ergibt sich, da die Bedeutungs-
struktur von (4) vllig verschieden ist von der
Bedeutungsstruktur von (4)
(4) Er forderte sie damit auf, die Strae zu
rumen.
1. Begriffliche Unterscheidungen
1.1 Deskriptive vs. nicht-deskriptive Bedeutung
1.2 Bedeutung vs. Extension
2. Das Problem der logischen Wrter
3. Die Semantik der Inhaltswrter: Wortbildung
3.1 Komposition
3.2 Ableitungen
4. Die Semantik der Inhaltswrter: Simplizia-
bedeutungen
4.1 Dekomposition der Simpliziabedeutungen
bedeutungen
4.2 Einschrnkungen ber die Inhaltskerne
bedeutungen
4.3 Dekomposition im engeren Sinne
bedeutungen
4.4 Stereotypen- und Prototypensemantik
bedeutungen
4.5 Natrliche Begriffe vs. mgliche Wortbedeu-
tungen
bedeutungen
5. Literatur (in Kurzform)
1. Begriffliche Unterscheidungen
Der Begriff der Wortbedeutung lt sich,
wenn berhaupt, nur im Rahmen einer all-
gemeinen Bedeutungstheorie fr alle Arten
sprachlicher Einheiten, seien sie einfach oder
komplex, explizieren. Das ergibt sich schon
allein daraus, da die vortheoretische Einheit
des Wortes in jeweils theorieabhngiger Weise
als Nahtstelle zwischen der Semantik syntak-
tisch komplexer Phrasen (der Konstruktions-
semantik) und der Semantik der Wortbildung
(der Derivations- und Kompositionsseman-
tik, s. u.) zu rekonstruieren ist. Aus dem Be-
reich der allgemeinen Bedeutungstheorie kn-
nen jedoch im folgenden nur wenige elemen-
tare Begriffe errtert werden; fr eine aus-
fhrliche Behandlung der Probleme sei daher
auf die einschlgigen Artikel (1 bis 3, 7) ver-
wiesen.
1.1Deskriptive vs. nicht-deskriptive
Bedeutung
Ebenso wie fr die gesamte Semantik, ist auch
fr die Theorie der Wortbedeutung die Un-
terscheidung zwischen deskriptiver und nicht-
deskriptiver Bedeutung grundlegend.
Die deskriptiven Bedeutungskomponenten
sprachlicher Einheiten gestatten die Darstel-
lung von Sachverhalten unabhngig von der
Verwendung dieser Darstellung fr bestimmte
Zwecke, wie die des Feststellen, Fragens oder
Aufforderns. So knnen etwa mit den Stzen
(1) Wenn es regnet, ist Hans zuhause.
54 I. Allgemeine Grundlagen
dingungen erfat werden.
Wie die performativen Stze zeigen, kn-
nen zwar wesentliche Aspekte eines sonst
durch Modusindikatoren (z. B. Imperativ-
form) ausgedrckten Verhltnisses auch zum
Inhalt einer Sachverhaltsdarstellung gemacht
werden, was wohl eine spezifische Leistung
sprachlicher Darstellung ist, aber niemals
restfrei (auch (4) hat als Aussagesatz eine
nicht-darstellende bzw. nicht-deskriptive Mo-
duskomponente). Fr die nicht eliminierba-
ren Ausdrucksmittel nicht-darstellender Art
ist also ein eigener Begriff nicht-deskriptiver
Bedeutung erforderlich. Wie er zu fassen ist,
darber gibt es keine allgemein akzeptierte
Theorie.
Erwgenswert scheint uns ein Ansatz zu
sein, der durch Arbeiten von Bierwisch
(1980), Lang (1983) und Doherty (1985) na-
hegelegt wird. Danach knnen so heterogen
erscheinende Ausdrucksmittel wie Modusin-
dikatoren, Modalpartikel (z. B. doch, ja, etwa,
wohl, denn), evaluative (z. B. leider) und epi-
stemische (z. B. vermutlich) Satzadverbien un-
ter einem einheitlichen Aspekt gesehen wer-
den: mit ihnen werden Einstellungen, die sich
prreflexiv auf Sachverhalte beziehen in
nicht-propositionaler Weise ausgedrckt,
d. h. die Einstellung wird nicht als Kompo-
nente eines Sachverhalts dargestellt, der durch
Wahrheitsbedingungen charakterisierbar ist,
sondern durch sprachlichen Ausdruck gleich-
sam gezeigt und zu erkennen gegeben.
Da die jeweils ausgedrckten Einstellun-
gen, einschlielich der durch Modi ausge-
drckten, untereinander konkurrieren, kn-
nen bei einer Reihe von Distributionsbe-
schrnkungen, vgl. die Beispiele (5) von
Doherty (1985: 63) die sonst blichen ad
hoc-Stipulationen weitgehend vermieden wer-
den.
(5)
a. *Konrad ist nicht ja verreist.
b. *Ist Konrad ja verreist?
c. *Konrad ist nicht doch verreist. (ohne
Kontrastakzent)
d. *Ist Konrad nicht denn verreist?
e. *Konrad ist denn verreist.
Ferner weist die Unterscheidung von nicht-
propositionalem Ausdrcken und proposi-
tionalem Sagen (E. Lang) zumindest die
Richtung auf, in der eine Erklrung fr Kon-
traste wie in (6) (vgl. Doherty 1985: 16 f.) zu
suchen ist.
(6)
a. Ich bedauere/vermute nicht, da Kon-
rad verreist ist.
In diesem Sinne geht man in Anstzen, die
der Sprechakttheorie (Austin 1962, Searle
1969) verpflichtet sind, davon aus, da etwa
in (4) im Gegensatz zu (4) die deskriptive
Bedeutung von auffordern zur deskriptiven
Bedeutung von (4) nichts beitrgt, insofern
die sonst (etwa in (4)) mit auffordern lediglich
beschriebene Handlung mittels einer ue-
rung von (4) gerade vollzogen und nicht be-
schrieben werde. M. a. W., das Verb auffordern
wrde in (4) nicht mit seiner blichen deskrip-
tiven sondern einer performativen oder Voll-
zugsbedeutung vorkommen.
Demgegenber hat u. a. Bierwisch (1980)
gezeigt, da man den performativen Effekt
von uerungsvorkommen der Art (4) sehr
wohl rekonstruieren kann, ohne etwa fr (4)
und (4) vllig verschiedene Bedeutungsstruk-
turen anzusetzen (siehe auch Artikel 3). Ins-
besondere ergibt sich aus der Analyse von
Bierwisch, da die Annahme performativer
Bedeutungskomponenten auf der Ebene der
Wortsemantik nicht erforderlich ist, und da
die deskriptiven Komponenten von Wortbe-
deutungen in modusneutraler Weise in die
deskriptive Bedeutung komplexer Ausdrcke
eingehen. Bierwisch geht freilich u. E. mit
Recht davon aus, da der Handlungscha-
rakter sprachlicher uerungen im Rahmen
einer allgemeinen Handlungstheorie zu be-
handeln ist, die nicht als natrliche Erweite-
rung der linguistischen Theorie der sprachli-
chen Kompetenz angesehen werden kann.
Wie noch auszufhren ist, kann der Begriff
der Wahrheitsbedingung als grundlegend fr
die Explikation der deskriptiven Bedeutung
angesehen werden. Gebilde wie die sprachli-
chen, die aufgrund ihrer Struktur Sachver-
halte darstellen knnen, in die ein kognitives
System seine Welt gliedert, lassen sich hin-
sichtlich ihrer Darstellungsleistung dadurch
charakterisieren, da angegeben wird, wie die
Welt aussieht, wenn der dargestellte Sachver-
halt besteht (vgl. Wittgenstein 1921, 4.022,
4.024). In welchem Verhltnis der dargestellte
Sachverhalt zur Welt tatschlich steht, z. B.
ob er der Fall ist oder der Fall sein soll, ist
eine ber die reine Darstellung hinausgehende
Frage (auch einer Architekturzeichnung kann
nicht entnommen werden, ob sie einen ge-
planten oder bestehenden Grundri darstellt).
Wahrheitsbedingungen als Mittel der Expli-
kation einer Darstellungsleistung sind also
modusneutral, also z. B. nicht an den Aus-
sagemodus von Behauptungsstzen gebun-
den, andernfalls knnte z. B. der Inhalt eines
Bedingungssatzes nicht durch Wahrheitsbe-
4. Wortsemantik 55
nen von Subjekt und Prdikat von (7), so
wei man, ob der Satz (7) wahr ist. Es liegt
daher nahe, mit Frege die Extension eines
Satzes mit seinem Wahrheitswert gleichzuset-
zen, da er es ist, der jedenfalls in Fllen
wie (7) durch die Extensionen der Satz-
bestandteile festgelegt wird.
Analog wird man fr die Bedeutung des
Satzes annehmen, da sie etwas ist, was sich
aus der Bedeutung seiner Bestandteile ergibt.
Im Falle des Subjekts und Prdikats von (7)
garantiert, wie eben ausgefhrt, die Kenntnis
allein ihrer Bedeutung nicht die Kenntnis ih-
rer Extension; es mssen also zustzliche Fak-
ten bekannt sein, um diese Kenntnis herbei-
zufhren. Fakten welcher Art dafr unter
normalen Umstnden in Frage kommen, er-
gibt sich jedoch durchaus aus ihrer Bedeu-
tung. Ihre Bedeutung legt also mit die Bedin-
gungen fest, die erfllt sein mssen, um die
Person bzw. die Personen identifizieren zu
knnen, welche ihre jeweilige Extension aus-
machen. Da nun aber mit der Extension sei-
ner Bestandteile auch die Extension, also der
Wahrheitswert von Satz (7) gegeben ist, sind
in den Bedingungen, die die Bedeutungen sei-
ner Bestandteile gleichsam der Welt auferle-
gen, um ihre Extension identifizierbar zu ma-
chen, auch die Bedingungen enthalten, die
erfllt sein mssen, um den Wahrheitswert
des ganzen Satzes (7) zu bestimmen. Was so-
mit durch die Bedeutung von Subjekt und
Prdikat von Satz (7) festgelegt wird, ist zwar
nicht sein Wahrheitswert, aber seine Wahr-
heitsbedingungen.
Versteht man nun ausgehend von dieser
berlegung allgemein unter der deskriptiven
Bedeutung eines Satzes etwas, was seine Wahr-
heitsbedingungen festlegt, so erhlt man einen
einheitlichen Begriff deskriptiver Bedeutung
fr alle Ausdrcke, bei denen sinnvoll zwi-
schen Bedeutung und Extension unterschie-
den werden kann: Die Bedeutungen derartiger
Ausdrcke sind danach dasjenige, was die
Bedingungen fr die Feststellung ihrer Exten-
sion festlegt. Auf die Probleme der mit diesem
Bedeutungsbegriff verbundenen Idealisierung
soll spter zurckgekommen werden.
Es fragt sich nun, ob die Unterscheidung
zwischen Bedeutung und Extension bei allen
Ausdrcken gemacht werden mu, insbeson-
dere ob sie bei allen Wrtern zu machen ist.
2. Das Problem der logischen Wrter
Die Unterscheidung von Bedeutung und Ex-
tension wurde oben durch Beispiele von St-
zen zu motivieren versucht, deren Wahrheits-
b. *Konrad ist nicht leider/vermutlich
verreist.
c. Bedauere/Vermute ich, da Konrad
verreist ist?
d. *Ist Konrad leider/vermutlich verreist?
Fr die Entwicklung eines Begriffs nicht-de-
skriptiver Bedeutung scheint uns jedenfalls
die weitere Ausarbeitung des Konzepts nicht-
propositionaler Ausdruck einer Einstellung
lohnend zu sein.
1.2Bedeutung vs. Extension
Als erster Schritt bei der Klrung dessen, was
hier deskriptive Bedeutung genannt wurde,
wird in fast allen Anstzen eine Unterschei-
dung gemacht, deren begriffliche Fixierung
vor allem Frege (1892) zu verdanken ist. Es
handelt sich um die Unterscheidung zwischen
dem Sinn oder der Bedeutung eines Ausdrucks
und seinem Bezug oder seiner Extension
fr letzere benutzt Frege den etwas eigenwil-
ligen Terminus Bedeutung.
Was damit gemeint ist, lt sich etwas ver-
einfacht so verdeutlichen: Damit jemandem
mit der uerung des Satzes
(7) Marias Mutter arbeitet im Rot-Kreuz-
Krankenhaus.
etwas mitgeteilt werden kann, was er noch
nicht wei, ist trivialerweise zweierlei erfor-
derlich: er mu die uerung verstehen, aber
er darf nicht schon vorher wissen, da der
mit ihr dargestellte Sachverhalt der Fall ist.
Wte er nun sowohl, auf welche Person es
zutrifft, da sie Marias Mutter ist, als auch
auf welche Personen es zutrifft, da sie im
Rot-Kreuz-Krankenhaus arbeiten oder
mehr technisch ausgedrckt: wrde er die Ex-
tension von Marias Mutter und die Extension
des Prdikats arbeitet im Rot-Kreuz-Kranken-
haus kennen, so wte er schon vorher, was
ihm mit (7) erst mitgeteilt werden soll. Das
Verstehen einer uerung von (7), also das,
wozu die Sprachkenntnis wesentlich beitrgt,
kann somit nicht in der Kenntnis der Exten-
sionen smtlicher in (7) vorkommender Aus-
drcke bestehen. M. a. W., allein schon die Ver-
wendbarkeit der Sprache fr Zwecke der Mit-
teilung setzt voraus, da der Sinn oder die
Bedeutung, also das, dessen Kenntnis fr das
Verstehen erforderlich ist, zumindest im Falle
einiger Ausdrcke von ihrer Extension ver-
schieden ist.
Die eben durchgefhrte berlegung zeigt
auch, in welcher Richtung die Unterschei-
dung von Bedeutung und Extension ganzer
Stze zu suchen ist. Kennt man die Extensio-
56 I. Allgemeine Grundlagen
schaften von Stzen wie (8) erfat werden
knnen.
Der Vorwurf der Willkr gegenber der
Standardauswahl der logischen Wrter er-
weist sich jedoch als unberechtigt, wenn man
das Augenmerk nicht auf eine Abgrenzung
der logischen Wahrheiten richtet, sondern
darauf, was die sog. nicht-logischen oder In-
haltswrter von den logischen Wrtern in
kontingenten Stzen unterscheidet: Kennt
man lediglich die Bedeutung von schlafen und
die Extension von der Professor, so kann man
den Wahrheitswert von
(10) der Professor schlft.
nicht bestimmen: Wei man etwa, da Ein-
stein in einem Kontext von (10) die Extension
von der Professor ist, so reicht die bloe
Kenntnis des Deutschen (also insbesondere
von schlft) nicht, um festzustellen, ob (10)
wahr ist. Andernfalls knnte mit (10) ber
Einstein nichts mitgeteilt werden, was man
nicht schon wte. Kennt man hingegen in
einer Situation die Extension von Kursteilneh-
mer und diejenige von Regensburger Student,
so braucht man keine zustzliche Extensions-
kenntnis mehr, um den Wahrheitswert von
(11) Alle Kursteilnehmer sind Regensburger
Studenten.
bestimmen zu knnen. Das aristotelische lo-
gische Wort alle verhlt sich also anders also
das Inhaltswort schlft.
Allgemeiner: kennt man den Umfang
zweier Prdikate A und B, so lt sich der
Wahrheitswert von Alle A sind B bestimmen,
ohne da man zustzlich zur Bedeutung von
alle noch eine etwaige Extension von alle ken-
nen mte (entsprechend fr einige, kein etc.).
Ebensowenig bentigt man bei einem wahr-
heitsfunktionalen Satzverknpfer wie und bei
gegebenen Wahrheitswerten der verknpften
Stze noch eine ber die Bedeutung des Satz-
verknpfers hinausgehende Extensionskennt-
nis, um den Wahrheitswert des mit ihm ge-
bildeten komplexen Satzes feststellen zu kn-
nen. M. a. W., die Unterscheidung von Bedeu-
tung und Extension ist, jedenfalls so wie sie
im letzten Abschnitt vorgenommen wurde,
nur fr nichtlogische oder Inhaltswrter wie
schlafen, Junggeselle, unverheiratet, etc. wohl-
begrndet, nicht aber fr die herkmmlichen
logischen Wrter.
Schrnkt man die Klasse potentieller logi-
scher Wrter auf solche mit Operatorencha-
rakter ein, so knnte man sagen:
wert im Normalfall nur dann bestimmt wer-
den kann, wenn die Extension gewisser syn-
taktischer Bestandteile bekannt ist. Nun gibt
es bekanntlich Stze, deren Wahrheitswert
man auch dann bestimmen kann, wenn die
Extension ihrer Bestandteile nicht bekannt ist.
Zuweilen spricht man bei solchen Stzen auch
von Bedeutungswahrheiten. Dabei werden
hufig zwei Arten solcher Stze besonders
ausgezeichnet: diejenigen Stze, die analy-
tisch in einem engeren Sinne heien, wie
(8) Alle Junggesellen sind unverheiratet.
und die logisch wahren Stze wie
(9) Wenn Hans unverheiratet ist, dann ist
Hans unverheiratet.
Beiden Satztypen ist, wie gesagt, gemeinsam,
da man ihren Wahrheitswert ohne besondere
Extensionskenntnisse ihrer Wrter bestimmen
kann, bei (8) und (9) also ohne Wissen dar-
ber, wer Junggeselle oder unverheiratet ist,
oder wer Hans ist. Whrend man jedoch die
Bedeutung aller Wrter von (8) kennen mu,
um sagen zu knnen, ob (8) wahr ist, gengt
bei (9) lediglich das Wissen darber, was
wenn-dann bedeutet, sowie da durch wenn-
dann zwei syntaktische Varianten desselben
Satzes verknpft werden, weshalb man auch
sagt, da (9) aufgrund seiner Form, spezieller
seiner logischen Form als wahr bestimmt wer-
den kann.
Ausdrcke wie wenn-dann, zu denen es
Stze wie (9) gibt, die ihren Wahrheitswert
bewahren, wenn man unter Konstanthaltung
der Deutung von a die Deutung der brigen
Ausdrcke formgerecht variieren lt, wer-
den von der Logik als logische Konstanten
oder logische Wrter rekonstruiert. Die bri-
gen Ausdrcke werden als auerlogisch ein-
gestuft und nur hinsichtlich ihrer Formklas-
sen unterschieden. Damit ist freilich nur ein
Hinweis, kein Kriterium fr die Unterschei-
dung logischer und auerlogischer Wrter
und Ausdrcke gegeben. Denn was konstant
bleiben und was alles variieren darf in einer
logisch wahren Satzform, bleibt letztlich of-
fen. So gesehen ist es durchaus verstndlich,
wenn Katz (1972) den Begriff der logischen
Form, der sich aus dem herkmmlichen Ka-
talog logischer Partikel wie nicht, oder, und,
alle etc. ergibt, fr willkrlich und allenfalls
historisch bedingt hlt, und fr einen umfas-
senden logischen Formbegriff pldiert, mit
dessen Hilfe auch die semantischen Eigen-
4. Wortsemantik 57
W(a
1
,...,a
n
), wobei vorausgesetzt
ist, da W ein n-stelliger Operator
ist.
Das ist natrlich nur dann eine sinnvolle Be-
dingung, wenn in der vorausgesetzten Syntax
das fragliche Wort w nicht als synkategore-
matisches Element behandelt wird; umge-
kehrt formuliert: da die logischen Wrter
hufig synkategorematisch behandelt werden
(vgl. Montague 1973), kann damit gerecht-
fertigt werden, da ihre Deutung gegen-
standsneutral ist.
Benutzt man die von van Benthem (1983 b)
bei seiner Rekonstruktion des generalized-
quantifier-Ansatzes von Barwise und Cooper
(1981) entwickelte durchsichtige Darstel-
lungsweise, und lt determinatorenartige
Quantorenwrter wie alle, kein etc. der Ein-
fachkeit halber Relationen zwischen Teilmen-
gen des Universums U denotieren, so ergibt
sich z. B. fr jeder folgendes Bild:
(12) jeder = {A,B; A,B U & A B}
(Also etwa: jeder(Student,arbeitet) =
wahr gdw. Student, arbeitet je-
der gdw. Student arbeitet.)
Ist p der oben eingefhrte von einer Permu-
tation induzierte Automorphismus, so gilt:
(13) p(jeder) = {p(A),p(B); A,B U &
A,B jeder}
mit (12) also:
(14) p(jeder) = {p(A),p(B); A,B U &
A B}
Da Inklusionsverhltnisse bei Permutationen
erhalten bleiben, ergibt sich
(15) p(jeder) = {p(A),p(B); A,B U &
p(A) p(B)}
mit (12) also:
p(jeder)(p(A),p(B)) = jeder(A,B).
jeder erfllt also die Bedingung (PERM);
und ebenso wird (PERM) von allen Deter-
minatoren erfllt, die als Extensionsrelatio-
nen deutbar sind, welche bei Permutationen
des Universums erhalten bleiben. Ausdrcke
hingegen, die intuitiv schon immer als Inhalts-
wrter angesehen wurden, erfllen (PERM)
offensichtlich nicht.
In der Bedingung (LOG), in der die For-
derung nach Gegenstandsneutralitt, wie sie
durch (PERM) teilweise verdeutlicht wird,
implizit enthalten ist, wird wesentlich von epi-
stemischen Begriffen Gebrauch gemacht, ins-
besondere von dem des Extensionswissens. Je
nachdem, wie man diesen Begriff expliziert,
(LOG) Ein Operatorwort W ist nur dann ein
logisches Wort, wenn fr beliebige
syntaktisch zu W passende Operan-
denausdrcke a
1
,...,a
n
die Kenntnis le-
diglich der Bedeutung von W sowie
das Wissen darber, was die Exten-
sionen von a
1
,...,a
n
sind, ausreicht, um
die Extension von W(a
1
,...,
n
) festzu-
legen.
(Zu einem hnlichen Vorschlag in einem etwas
anderen Rahmen vgl. Peacocke 1976).
Demnach sind logische Operatoren nicht nur
in dem blichen Sinne extensional, da sie fr
extensionsgleiche Operanden dieselbe Exten-
sion der mit ihnen gebildeten komplexen Aus-
drcke festlegen Extension(W(a
1
,...,a
n
)) =
Extension(W(b
1
,...,b
n
), falls Extension(a
i
) =
Extension(b
i
) das gilt auch fr viele In-
haltswrter. Vielmehr mssen sich die Exten-
sionen der mit ihnen bildbaren komplexen
Ausdrcke fr alle Folgen von Operanden-
Extensionen mit einer gemeinsamen hchst
allgemeinen Struktur in gleicher Weise finden
lassen. Es geht also um Extensionsverhlt-
nisse, die von den besonderen Eigenschaften
der in den Extensionen enthaltenen Objekten
unabhngig sind, kurz um gegenstandsneu-
trale Verhltnisse.
Fr die Prdikatenlogik 1.Stufe findet die-
ser Sachverhalt in dem bekannten Satz seinen
Ausdruck (vgl. Kutschera 1967:147): Ist eine
Formel F in einem k-zahligen Universum U
erfllbar, so auch in jedem k-zahligen Uni-
versum U (in der Prdikatenlogik ohne Iden-
titt zustzlich in jedem k-zahligen Univer-
sum mit kk). Dabei spielt der Gedanke eine
Rolle, da zu einer Extensions-Struktur ber
einem Universum U eine isomorphe Struktur
ber einem gleichzahligen Universum U kon-
struierbar ist. Man knnte daher die Gegen-
standsneutralitt logischer Operatorenwrter
mit einer Reihe von Forschern (McCarthy
1981, van Benthem 1983 b, Keenan & Moss
1984, Westersthl 1985) mit folgender Bedin-
gung erfassen:
(PERM) Es sei p die von einer Permutation
des Universums induzierte isomor-
phe Abbildung der Menge der mg-
lichen Denotate auf sich selbst und
W die von der vorausgesetzten
Interpretation bestimmte Extension
von W am jeweiligen Referenz-
punkt; dann gilt
W ist nur dann ein logisches Wort,
wenn p(W)(p(a
1
),...,p(a
n
)) =
58 I. Allgemeine Grundlagen
Cresswell lehnt in dem genannten Artikel die
Unterscheidung zwischen logischen und
nicht-logischen Wrtern allerdings explizit ab.
3. Die Semantik der Inhaltswrter:
Wortbildung
hnlich wie fr die logischen Wrter stellt
sich fr die Inhaltswrter das Problem einer
Explikation des Begriffes mgliche Bedeu-
tung. Offenkundig kann nicht jede beliebige
Kollektion von Dingen als Extension eines
Nomens gedeutet werden. Eine Theorie ber
die hier wirksamen Einschrnkungen ist bis-
lang jedoch erst in Anstzen vorhanden.
Noch am ehesten knnen Aussagen ber
die mglichen Bedeutungen zusammengesetz-
ter Wrter als theoretisch abgesichert gelten.
Dabei scheint ein wesentlicher Unterschied
zwischen zwei Klassen von Wrtern zu beste-
hen, der sich in der terminologischen Schei-
dung geschlossene vs. offene Klasse nieder-
schlgt. Zur offenen Klasse werden Vollver-
ben, Nomina und in der Regel Adjektive und
Adverbien gerechnet. Diese Kategorien kn-
nen in verschiedenen Sprachen freilich in
unterschiedlichem Ausma durch Kom-
position (Farb-bild-schirm) oder Derivation
(Trink-er) systematisch erweitert werden. Die
geschlossene Klasse umfat in der Regel Pr-
positionen, Artikel, Hilfsverben, Konjunktio-
nen und Pronomina. Produktive Regeln zur
Erweiterung dieser Kategorien scheinen nicht
vorzuliegen. Die Unterscheidung zwischen ge-
schlossener und offener Klasse fllt offenkun-
dig nicht zusammen mit der zwischen logi-
schen und Inhaltswrtern. Doch scheint es
uns erwgenswert zu sein, die geschlossene
Klasse durch systematische Relativierung des
in der Bedingung (PERM) (s. o.) verwendeten
Automorphismus auf konstantgehaltene Di-
mensionen (wie z. B. Raum, Zeit und Index-
parameter) als quasilogische Wrter zu
charakterisieren.
3.1Komposition
Gewhnlich unterscheidet man bei den zu-
sammengesetzten Wrtern zwischen Kompo-
sition, d. h. der Zusammensetzung zweier
freier Morpheme oder Morphemkomplexe,
und Derivation, d. h. der Kombination eines
freien Morphems oder Morphemkomplexes
mit einem nicht-freien Affix (cf. Fleischer
1969 und Pesetsky 1985 fr einige Abgren-
zungsprobleme). Bildungen aus drei oder
ergibt sich ein mehr oder weniger reichhaltiges
Inventar logischer Wrter. Nimmt man z. B.
an, da das Wissen um die Extension zweier
extensiongleicher Individuenterme die Kennt-
nis ihrer Extensionsgleichheit umfat, so ist
damit das identifizierende ist automatisch als
logisches Wort klassifiziert. Es drfte dann
aber schwer sein, der unbegrenzten Flle von
numerischen Quantoren, die in genau k A sind
B fr k einsetzbar sind, den Charakter von
logischen Wrtern abzusprechen, da sie ber
Identitt definierbar sind.
Trgt man dem empirischen Charakter be-
stimmter Identittsaussagen (Dr. Jekyll ist
Mr. Hyde) Rechnung, indem man jedem In-
dividuenterm nicht einfach ein Individuum,
sondern gleichsam einen Aspekt oder eine
Manifestation eines Individuums als wibare
Extension zuordnet, so trennt man den Be-
griff der Extension von dem der Referenz.
Eine Identittsaussage wie A ist (mit) B
(identisch) wre dann im Sinne von der Ge-
genstand, der sich als A manifestiert, ist der-
selbe wie der, der sich als B manifestiert kurz
als G(A)=G(B) zu interpretieren. Die Re-
lation x y[G(x)=G(y)] wre dann (anders
als x y[x=y]) keine logische im Sinne von
(LOG).
Fat man analog die Kenntnis der Exten-
sion prdikativer Ausdrcke nicht als Wissen
darber auf, welche Gegenstnde sondern
welche Gegenstandsmanifestationen unter
das betreffende Prdikat fallen, so bleibt z. B.
der logische Charakter der aristotelischen
Satzformen bzw. der darin enthaltenen Quan-
torenwrter (alle, kein, einige) erhalten, da
ihre Deutung nicht davon abhngt, ob sich
derselbe Gegenstand mehrfach manifestiert,
vorausgesetzt freilich, die Aspekt-Extension
eines Prdikats umfat alle Manifestationen
der Gegenstnde, die das Prdikat erfllen.
Fr eine weitergehende und von anderen
Gesichtspunkten aus vorgenommene Diffe-
renzierung innerhalb der Klasse potentieller
logischer Wrter sei auf van Benthem (1983 b,
1984 b) und Westersthl (1985) hingewiesen.
(Vgl. ferner Artikel 9, Abschnitt 1.3)
In diesem Zusammenhang sei auf die Aus-
fhrungen in Artikel 2 hingewiesen, wo logi-
sche Wrter allgemein als bedeutungsinva-
riant charakterisiert werden, d. h., sie werden
unter jeder Interpretation gleich gedeutet.
Diese allgemeine Konzeption erlaubt es auch,
intensionale Operatoren wie notwendig und
mglich als logische Wrter zu charakterisie-
ren, die durch den hier vorgefhrten Rekon-
struktionsversuch noch nicht erfat werden.
4. Wortsemantik 59
Die Konstituierung der Bedeutung komplexer
Wrter ist diesen Vorstellungen zufolge also
eine Angelegenheit der phrasalen Semantik,
d. h. die Tiefenstrukturen der Komposita
knnen mit den blichen Regeln der phrasa-
len Semantik interpretiert werden.
Die Hypothese der ausschlielichen Rele-
vanz der Tiefenstruktur fr die Bedeutungs-
analyse wurde freilich bald wieder aufgegeben
(cf. Chomsky 1972; Jackendoff 1972). Es wur-
den Verfahren entwickelt, die erlauben, Ober-
flchenstrukturen direkt zu deuten, und dabei
Synonymie oder Mehrdeutigkeit zu erfassen.
Damit verloren aber die Argumente fr eine
transformationelle Herleitung der Komposita
ihre Gltigkeit. Auerdem lt sich zeigen,
da einerseits transformationelle Erklrungen
semantisch inadquat sind (cf. Rohrer 1967 b;
Fanselow 1981), andererseits aber die Mecha-
nismen der Wortzusammensetzung sich be-
trchtlich vom theoretischen Inventar der
Satzsyntax unterscheiden (Selkirk 1982). Da-
her ist es nicht sinnvoll, die Wortbildung als
Teil der Satzsyntax zu behandeln.
Es liegt nun nahe, Komposita direkt mit
ihrer binren Oberflchenverzweigung zu er-
zeugen und als minimales wortsyntaktisches
Prinzip das sogenannte Kopfprinzip voraus-
zusetzen, wonach wesentliche syntaktische Ei-
genschaften von einem der Bestandteile (dem
Kopf) an das Kompositum vererbt werden
(vgl. Williams 1981 b; Toman 1983). Die je-
weiligen Bedeutungen der Komposita sind
dann als mehr oder weniger komplexe Funk-
tionen der Bedeutungen ihrer Bestandteile
darzustellen. Dabei lassen sich v. a. drei
Hauptklassen von Komposita unterscheiden.
Am einfachsten sind die sog. Rektionskom-
posita zu behandeln, bei denen ein Bestandteil
semantisch als Argument des anderen, funk-
tionalen Gliedes dient, also etwa LKW-Fahrer
oder Professorenbruder, knigstreu (cf. Lieber
1984; Fanselow 1981). Seinem Argumentcha-
rakter entsprechend bezieht sich der Erstbe-
standteil entweder (generisch) auf eine Gat-
tung oder Art oder auf einen Vertreter dieser
Art. Nicht befriedigend geklrt ist die Frage,
warum Rektionskomposita im eben genann-
ten Sinn bei Verben so gut wie nicht vorkom-
men (cf. jedoch Pesetsky 1985).
Die zweite Klasse lt sich durch die Ad-
dition mehr oder minder logischer Bedeu-
tungselemente beschreiben, ohne da dabei
die beiden Kompositumsbestandteile in ir-
gendeine Rektionsbeziehung zueinander tr-
ten, wie etwa bei Dichter- Komponist durch
mehr Bestandteilen (Landeplatzbefeuerung)
sind intern binr strukturiert, d. h. minde-
stens ein Bestandteil der Zusammensetzung
ist selbst komplex aufgebaut ([[Lande-
platz]befeuerung]). Neuere grammatiktheore-
tische Untersuchungen stellen die Unterschei-
dung zwischen Derivation und Komposition
in Frage (so Lieber 1980; Hhle 1982 b, 1985;
aber cf. Reis 1985). Unter semantischer Per-
spektive ist es jedoch durchaus sinnvoll, die
beiden Prozesse auseinanderzuhalten.
Bei der Kompositionssemantik mu man
sich auf die zusammengesetzten Wrter be-
schrnken, deren Interpretation(en) vollstn-
dig motiviert ist, d. h. aus der Bedeutung der
beiden Bestandteile und der Bedeutung der
Zusammensetzungsregel vorhergesagt werden
kann. Morphologisch komplexe Bildungen
wie Steinpilz fallen also nicht in den Bereich
der Theoriebildung (aus der Bedeutung von
Stein und der von Pilz allein kann die Bedeu-
tung von Steinpilz nicht abgeleitet werden).
Bei den vollmotivierten Zusammensetzun-
gen ist die nominale Komposition am besten
untersucht. Hier existiert eine Forschungs-
richtung, begrndet durch Lees (1960) und
fortgefhrt durch Krschner (1974), Rohrer
(1967 a), Brekle (1970) und Levi (1978),
die die Wortkomposition unter allgemeine
(semanto-)syntaktische Prozesse einordnen
mchte, d. h. der Kompositionsregel den glei-
chen Status zuschreibt wie etwa der Passivie-
rungs-Regel. Ein Kompositum wie Holzhaus
wrde dabei aus einer relativsatzhnlichen
Struktur wie Haus, das man aus Holz gemacht
hat abgeleitet, und zwar ber eine Reduk-
tionstransformation. Die zugrundeliegende
Struktur wird dabei entweder als syntaktische
Struktur im Sinne von Chomsky (1965) an-
gesehen, oder aber als semantische Reprsen-
tation im Sinne der generativen Semantik.
Primr wurde der Ansatz ber den Gedanken
motiviert, da Tiefenstrukturen die Eingabe
der semantischen Reprsentationskompo-
nente seien bzw. selbst semantische Reprsen-
tationen darstellten. Mit Motsch (1970) lassen
sich die beiden Hauptargumente fr eine syn-
taktische Beziehung zwischen Komposita und
Relativstzen wie folgt zusammenfassen:
a) Komposita sind synonym zu syntaktischen
Gruppen. Diese Synonymie kann durch
eine gemeinsame Tiefenstruktur erfat
werden.
b) Komposita sind ambig. Diese Mehrdeutig-
keit kann durch die Zuweisung unter-
schiedlicher Tiefenstrukturen erfat wer-
den.
60 I. Allgemeine Grundlagen
mantisch gezogen werden, da deutsche Deri-
vationssuffixe wie Diminuativa in anderen
Sprachen flexivisch sind (Fula), umgekehrt
deutsche Flexionsprozesse wie Pluralbildung
auch derivationell geregelt sein knnen (Ka-
wakwala, cf. Anderson 1982). So bleibt nur
der Schlu zu ziehen, da Flexion genau die
Prozesse umfat, die in einer Sprache syntak-
tische Relevanz besitzen (Anderson 1982).
Wegen ihrer Nhe zur Syntax ist es nicht
berraschend, da bei der Derivation die
Strategie, eine nicht (quasi-)logische Relation
zu ergnzen, nur eine marginale Rolle spielt,
etwa bei dem Muster Lyriker (jemand, der
Lyrik schreibt). Wichtiger erscheinen zwei
Prozesse: Erstens kann eine Operation auf die
Bedeutung der Ableitungsbasis angewendet
werden, die die Argumentstruktur des Prdi-
kats verndert. So wird zwar bei der er- No-
minalisierung des Deutschen das externe Ar-
gument des Verbs zum externen Argument
des Nomens (vgl. Williams 1981 a zu diesem
Begriff), die ung- Nominalisierung hingegen
lt im Falle der nomen-actionis-Lesart ein
neues Argument entstehen oder verwandelt
ein internes Argument des Verbs (das Objekt)
in ein externes Argument. Alternativ dazu
kann logisches Material wie die Negation (un-
lsbar) oder quasilogisches wie Aspektmerk-
male, Kausativelemente, Mglichkeitsopera-
toren etc. addiert werden. Beide Optionen
knnen kombiniert sein, wie bei bar: das ver-
bale Objekt wird externes Argument des Ad-
jektivs, und ein Mglichkeitsoperator wird
hinzugefgt. (x y [(y,P[P{x}])], cf.
Dowty 1979: 300). Da weder beliebige Ma-
nipulationen an der Argumentsstruktur mg-
lich sind (Williams 1981 a), noch beliebige
(quasi-)logische Operatoren addiert werden
drfen, ergibt sich eine weitere Einschrn-
kung des Begriffes mgliche Wortbedeutung.
Insgesamt kann man also davon ausgehen,
da fr alle komplexen Wrter (zu den Ein-
schrnkungen cf. Kanngieer 1985) die lexe-
matische Bedeutung weiter zergliedert werden
kann, und zwar in
a) eine Menge logischer und quasi- logischer
Operatoren,
b) eine (bei der Derivation) bzw. zwei (bei
der Komposition) zunchst nicht weiter
zergliederte Simpliziabedeutungen, die wir
Inhaltskerne nennen wollen,
c) (v. a. bei Komposita) eine ergnzte Inhalts-
kernrelation, welche jedoch zu den In-
haltskernen in einer engen Beziehung ste-
hen mu
die Addition von und. In Abweichung von
der klassischen Einteilung kann man auch
Bildungen wie Nachtarbeit oder Kstenstadt
zu dieser zweiten Klasse rechnen, wobei nun
Beziehungen wie ist lokalisiert an oder
whrend aus dem quasilogischen Bereich
stammen, insofern sie bei entsprechender Vor-
gabe einer Ontologie von Orten und Zeiten
auf logische Beziehungen reduzierbar sind.
Die dritte Klasse bilden die sog. Determi-
nativkomposita. Hier ergnzt die Interpreta-
tionsregel nicht nur logisches oder quasilogi-
sches Material, sondern deskriptive Prdi-
kate, wie befrdern bei Lastauto. Die bei-
den Bestandteilsbedeutungen treten dann in
aller Regel in eine Rektionsbeziehung zur er-
schlossenen Relation (cf. Dowty 1979; Fan-
selow 1981). Dabei knnen nicht beliebige
Relationen erschlossen werden (cf. Rohrer
1967 b), sie mssen bezglich der Bedeutungen
der Bestandteile appropriately classifica-
tory sein (Downing 1978; Dowty 1979). An-
ders formuliert impliziert dies, da die Aus-
wahl der ergnzten Relation von den Bestand-
teilsbedeutungen entscheidend mitbestimmt
wird (Behaghel 1907; Fanselow 1981). An-
dererseits treten auch vom Ko- und Kontext
bestimmte Faktoren hinzu (Herbermann
1981; Brekle et al. 1985). Hinzu kommen Be-
schrnkungen im modalen oder temporalen
Bereich (cf. Brekle 1973; Krschner 1974).
Nebentypen von Komposita wie Quasi-
dvandva-Bildungen (etwa der Erstbestandteil
in Benzin-l-Gemisch) ergnzen dieses Bild
nurmehr unwesentlich (cf. Toman 1985). Die
Interpretationsregeln fr Komposita scheinen
sich allgemein auf eine Klasse von Deutungs-
prinzipien reduzieren zu lassen, die auch in
der Satzsemantik Verwendung findet, so z.B
Funktionalapplikation, Durchschnitt, Rela-
tionsergnzung etc. (cf. Fanselow 1985).
3.2Ableitungen
Ableitungen zeichnen sich den Komposita ge-
genber dadurch aus, da nur ein freies Mor-
phem bzw. ein freier Morphemkomplex in
ihnen vorkommt. Wrter wie Lastwagenfah-
rer sind als sekundre Komposition von ab-
geleiteten Wrtern verstehbar (cf. Lieber 1984
zu dieser Problematik).
Ableitungsstrukturen stehen an der Grenze
zu Flexionsprozessen, und die Grenzziehung
zwischen Derivation und Flexion ist in jn-
gerer Zeit hufig in Frage gestellt worden
(Lapointe 1979; Kiparsky 1982; Jensen &
Stong-Jensen 1984). Keinesfalls kann sie se-
4. Wortsemantik 61
gen. So ist der englische Satz John hid the
treasure again ambig zwischen den Lesarten
es trat erneut ein, da Hans den Schatz
versteckte und Hans verursachte, da der
Schatz erneut verborgen war, wobei die
zweite Lesart nicht impliziert, da Hans den
Schatz bereits einmal versteckt hatte. Hier hat
again nur Skopus ber verborgen, d. h. einen
Teil der mutmalich komplexen Bedeutung
verursachen, da y verborgen ist von hide.
Gewisse Operatoren scheinen also die Zerle-
gung von Simpliziabedeutungen zu erfordern.
Allerdings ist diese Interaktion von phrasaler
und lexikalischer Semantik auf wenige Wrter
beschrnkt, und auch dabei stark restringiert.
Legt man etwa fr kill die oben anskizzierte
Bedeutung zugrunde, so sollte der Satz John
almost killed Bill vier Lesarten besitzen, was
jedoch nicht der Fall ist.
Zweitens zeigen durch Bedeutungszerle-
gungen miteinander verbundene Wrter hu-
fig ein aufflliges syntaktisches Gleichverhal-
ten. Etwa bilden sie in Idiomen Gruppen aus
(cf. Binnick 1971), und sie teilen wie dt. haben,
geben (verursachen, da jemand hat) und
kriegen (in den Zustand kommen, da man
hat) bestimmte syntaktische Muster (cf.
Abraham 1986):
(17)
a. ich habe/ kriege/ gebe ein Buch
b. wir haben /kriegen/ geben die Tr im/
ins Auto
c. ich habe/ kriege / gebe etwas zu lesen
Eine synchron-grammatische Erklrung sol-
cher Fakten setzte allerdings voraus, die Sub-
kategorisierungsrahmen von geben bzw. krie-
gen vollstndig aus denen von haben abzulei-
ten, was nicht mglich ist, da sich in vielen
Fllen in unvorhersagbarer Weise semantisch
aufeinander bezogene Verben syntaktisch un-
terschiedlich verhalten:
(18) sie haben/ kriegen / *geben (uns) eine
Erklrung ins Bild eingeblendet
Lokalisiert man darber hinaus die Erklrung
von Zusammenhngen wie den eben angedeu-
teten in der Satzsemantik, so erhlt man das
Syntaxmodell der Generativen Semantik, wel-
ches sich als vllig inadquat erwiesen hat (cf.
Newmeyer 1979).
4.1.3Adquatheitsprobleme der Zerlegung
Das Hauptproblem einer Zerlegungsanalyse
liegt jedoch in ihrem semantischen Kernbe-
reich, nmlich in der Frage der Adquatheit
der vorgeschlagenen Analysen. Die Beziehung
zwischen der Zerlegungsstruktur und der
Wortbedeutung kann keine der Synonymie
4. Die Semantik der Inhaltswrter:
Simpliziabedeutungen
4.1Dekomposition der
Simpliziabedeutungen
4.1.1Rechtfertigung ber wortsemantische
berlegungen
In der traditionellen Wortsemantikforschung
wurde eine strenge Dichotomie zwischen der
Theorie der Bedeutung zusammengesetzter
Wrter und der Theorie der Simpliziabedeu-
tungen postuliert (cf. Coseriu 1978). Diese
strikte Scheidung ist jedoch problematisch, da
die Bedeutung zumindest eines groen Teils
komplexer Wrter auch durch Simplizia wie-
dergegeben werden kann. Dies wird auch
durch die Beobachtung nahegelegt, da mor-
phologisch komplexe Wrter einer Sprache
eine nicht-komplexe Entsprechung in einer
anderen Sprachen finden knnen, cf. timber
vs. Bauholz. In dem Mae nun, wie es fr die
Sprache A gerechtfertigt ist, dem komplexen
Wort eine komplexe Bedeutung zuzuweisen,
mu dies auch fr Sprache B gelten, in der
die bersetzung von zuflligerweise nicht
wortstrukturell komplex ist.
Wir haben also anscheinend Anla dazu,
auch Simpliziabedeutungen wie die Bedeutun-
gen komplexer Wrter in Inhaltskerne und
logische bzw. quasilogische Komponenten zu
zerlegen. Dies ist etwa plausibel fr Dieb als
nomen agentis zu stehlen, oder fr tten/
kill als semantisches Kausativum zu sterben/
die, die man als semantische Inchoativa zu
tot/dead auffassen knnte. Man kann also fr
tten etwa folgende Bedeutungsanalyse vor-
schlagen:
(16) X ttet Y bedeutet: X verursacht, da
der Zustand eintritt: Y ist tot
4.1.2Rechtfertigung durch
phrasalsemantische berlegungen
Neben berlegungen, die sich direkt auf die
Bedeutung der betroffenen Wrter beziehen,
lassen sich vor allem zwei weitere Argumente
zumindest fr eine moderate Version der Zer-
legung von Simpliziabedeutungen formulie-
ren.
Die erste berlegung bezieht sich auf die
Tatsache, da die phrasale Semantik anschei-
nend in die interne Struktur von Wortbedeu-
tungen einwirken kann bzw. auf sie Zugriff
hat (vgl. Morgan 1969). Wrter wie almost
oder again tendieren dazu, nicht nur Phrasen-
und Wortbedeutungen als Argumente zu neh-
men, sondern auch Teile von Wortbedeutun-
62 I. Allgemeine Grundlagen
die Bedeutung eines Wortes zu kennen. Diese
Kenntnis der Bedeutung eines Wortes versetzt
ohne weiteres in die Lage, Schlsse zu ziehen,
wie sie in den Bedeutungspostulaten ausge-
drckt sind. Schlielich kann durch sprach-
spezifische Bedeutungspostulate der sprach-
bergreifende Charakter vieler Bedeutungs-
beziehungen nicht erfat werden (Dies gilt
nicht fr den Begriff des Bedeutungspostulats
wie er in der Montague-Grammatik verwandt
wird). Entsprechend konnte auch durch psy-
chologische Experimente nicht festgestellt
werden, da neben der Kenntnis der Bedeu-
tung die Kenntnis von Bedeutungspostulaten
irgendeine Rolle im menschlichen Folge-
rungsvermgen spielt (cf. etwa Johnson-Laird
1983 fr eine Zusammenfassung).
Insbesondere in Anstzen, die mit Varian-
ten der generativen Grammatik verbunden
sind, wurde versucht, das Problem durch die
Annahme zu umgehen, da die Elemente der
Bedeutungszerlegung nicht den Bedeutungen
der gleichlautenden Wrter der natrlichen
Sprache entsprchen, sondern da es sich da-
bei um abstrakte Operatoren handele (cf.
etwa Hall 1965).
Da zumindest in der Generativen Semantik
die Bedeutung dieser Operatoren nicht spe-
zifiziert wird, wird diese Vorgehensweise hu-
fig als empirisch leer angesehen (cf. Lewis
1972; Dowty 1979, Pulman 1983). Da nicht
bekannt ist, welche Interpretation CAUSE
zukommen kann, scheint es nicht mglich, zu
entscheiden, ob die Analyse von kill als
CAUSE TO DIE adquat ist. Folglich
wurde versucht, eine modelltheoretische In-
terpretation fr solche Operatoren im Rah-
men der Montague-Grammatik zu entwickeln
(cf. etwa Dowty 1979), oder die Operatoren
wurden in Zusammenhang zu einer language
of mind gebracht (Jackendoff 1983).
Fr die Bewertung der Adquatheit einer
Dekomposition ist jedoch die Frage ab-
strakte Reprsentation oder modelltheoreti-
sche Interpretation sekundr, solange beide
Anstze berhaupt in der Lage sind, Intuitio-
nen ber Bedeutungsbeziehungen systema-
tisch zu rekonstruieren. Zwar hat sich der
modelltheoretisch definierte Folgerungsbe-
griff in dieser Hinsicht als uerst fruchtbar
erwiesen, aber es ist nicht auszuschlieen, da
ein Ansatz, der mit der Syntax abstrakter
Bedeutungs-Konfigurationen arbeitet sieht
man einmal von der Vollstndigkeitsproble-
matik ab zumindest in der Wortsemantik
zu interessanten Alternativen fhrt, da es hier
darauf ankommt, einen engeren Begriff des
sein, wenn die Terme der Zerlegungsstruktur
die Bedeutung der entsprechenden deutschen
oder englischen Wrter haben sollen. Nicht
in jeder Situation, in der x verursacht, da y
stirbt, wrde man davon sprechen, da x y
gettet hat, es mu ein Moment der direkten
Verursachung hinzukommen (cf. Hall 1965,
Shibatani 1976). Auf dieselbe Weise scheiter-
ten bislang auch alle Verbesserungsversuche.
Wenn jedoch Paraphrase und Wort nicht ein-
mal bezglich der Wahrheitsbedingungen
bereinstimmen, knnen sie unmglich
gleichbedeutend sein. Die Paraphrase ist dann
aber auch keine Bedeutungsangabe.
Prinzipiell besteht jedoch die Option, den
Anspruch aufrechtzuerhalten, da Wort und
Paraphrase in einem technischen Sinne syn-
onym sind, die Intuitionen ber Bedeutungs-
gleichheit aber von einer Interferenz mit prag-
matischen Faktoren beeinflut werden. An-
ders als fr can ist es beispielsweise nicht
mglich, das anscheinende Synonym be able
to in indirekten Aufforderungen zu verwen-
den (cf. Searle 1975), d. h. anders als der Satz
(19) Can you open the door
kann die uerung
(20) Are you able to close the door
nicht als Bitte verstanden werden, sondern
nur wrtlich oder in sarkastischem Sinne.
Searle versucht dies pragmatisch zu erklren.
Wird eine nicht-idiomatische Ausdrucksweise
fr eine Bedeutung gewhlt, so kann der H-
rer annehmen, da der Sprecher einen Grund
dafr hat, sich nicht idiomatisch auszudrk-
ken, so da sich konversationelle Implikatu-
ren ergeben knnen, die die uerungsbedeu-
tung entsprechend beeinflussen. Analog
knnte (cf. McCawley 1978 u. Pulman 1983)
versucht werden, Interpretationsunterschiede
zwischen kill einerseits und cause to die an-
dererseits durch konversationelle Implikaturen
zu erklren. Allerdings ist dieser Ansatz prak-
tisch nicht ausgearbeitet.
Andererseits knnte man die Nicht-Syn-
onymie von Paraphrase und Wort akzeptie-
ren, und nurmehr eine Folgerungsbeziehung
zwischen Wortbedeutung und Paraphrase po-
stulieren. Dies wrde bedeuten, fr jedes Wort
eine Menge sog. Bedeutungspostulate anzu-
setzen, wie: x ttet y impliziert: x verursacht,
da y stirbt.
Damit expliziert man wohl einen Teil der
in einer Sprache gltigen Folgerungsbezie-
hungen. Allerdings gibt man damit von vor-
neherein das eigentliche Ziel einer Wortse-
mantik auf, nmlich zu klren, was es heit,
4. Wortsemantik 63
Wortbedeutungen. Die Denotatsbereiche der
einzelnen Kategorien sind praktisch disjunkt,
wobei es freilich sprachspezifische Unter-
schiede geben kann, so sind japanische Verben
hufig mit deutschen Adjektiven zu berset-
zen und japanische Adjektive manchmal
durch deutsche Verben. Weitere Restriktionen
ergeben sich durch die Domnen mglicher
Subkategorisierung, Aspektklassifizierungen
bei Verben, die strikte Scheidung zwischen
Massen- und Gattungsnamen bei den No-
mina u. s. w.
Durch Bedeutungspostulate, die im Sinne
von Montague (1973) nicht einzelne Wrter
sondern ganze Klassen von Wrtern betref-
fen, kann die logische Einordnung der ein-
zelnen Prdikate weiter differenziert werden,
etwa kann man zweistellige Verben dahinge-
hend unterscheiden, ob sie NP-Bedeutungen
(i. e. Intensionen von Eigenschaftsklassen)
oder Individuen als Objektsargumente akzep-
tieren u. s.w. Wenngleich diese logische Typi-
sierung und weitergehende Einschrnkungen
semantische und syntaktische Erklrungs-
kraft besitzen (cf. Jackendoff 1983, Fanselow
1985), sind immer noch zu viele semantische
Entitten als mgliche Inhaltskerne ausge-
zeichnet.
Dowty (1979) schlgt fr seine als Inhalts-
kerne nicht weiter dekomponierten stativi-
schen Prdikate vor, sie dadurch der Belie-
bigkeit zu entziehen, da der zugrunde gelegte
Modellbegriff durch Hinzufgung eines viel-
dimensionalen logischen Raumes eine rei-
chere Struktur erhlt. Jedem stativischen
Grundprdikat soll eine Region im logischen
Raum so zugeordnet sein, da deren Punkte
die Werte der in die Extension des Prdikats
fallenden Objekte im logischen Raum repr-
sentieren.
4.3Dekomposition im engeren Sinne
Ein weiterer Versuch zur Lsung dieses Pro-
blems besteht in der weiteren Zerlegung der
Inhaltskerne in atomare Bedeutungseinhei-
ten. Ebenso wie eine Dekomposition die Be-
ziehung zwischen tten und sterben sichtbar
machen kann, so kann eine solche auch fr
die Explikation der Bedeutungsbeziehung
zwischen Junggeselle und unverheiratet, der
Hyponymie-Beziehung zwischen Turm und
Gebude, berspringen und berwinden, oder
der Antonymie-Beziehung zwischen hei
und kalt herangezogen werden. Man kann
also die Hypothese vertreten, da sich auch
Inhaltskerne weiter strukturieren lassen, also
etwa Junggeselle semantisch als mnnlich,
semantischen Enthaltenseins zu entwickeln
als ihn die logische Folgerung bereitstellt.
Hlt man nun in welchem Ansatz auch
immer an der Dekomposition kill =
CAUSE TO DIE fest, so kann der Nicht-
Synonymie von kill und cause to die freilich
nur dann Rechnung getragen werden, wenn
der Operator CAUSE bei der Analyse der
Bedeutung des englischen Wortes cause selbst
nicht verwendet wird. Letztendlich wird also
die Beseitigung des Adquatheitsproblem der
Paraphrase damit erkauft, da die offenkun-
dige Implikationsbeziehung zwischen kill und
cause to die von der Theorie im Unklaren
gelassen wird. Anstze zur Lsung dieser
Schwierigkeit scheinen bislang im Detail nicht
entwickelt worden zu sein.
4.2Einschrnkungen ber die Inhaltskerne
Gesttzt auf eine modelltheoretische Defini-
tion quasilogischer Operatoren scheint eine
Dekompositionstheorie zumindest in dem Be-
reich mglich zu sein, der Analogien zu Ab-
leitungsstrukturen aufweist. So wird von
Dowty (1979) die Vendlersche Verbklassifi-
kation (vgl. Artikel 33, 36) ber eine intensio-
nallogische Dekomposition der Verbbedeu-
tungen rekonstruiert. Dabei werden neben
den blichen logischen Operatoren als qua-
silogische Operatoren lediglich die ihrerseits
modelltheoretisch gedeuteten CAUSE, BE-
COME, DO, sowie AT herangezogen und im
Sinne eines sog. Aspektkalkls zum Aufbau
komplexer Verbbedeutungen verwendet. Als
unanalysierte Inhaltskerne dienen dabei Be-
deutungen stativischer Prdikate.
Damit stellt sich das Problem einer weite-
ren Einschrnkung ber mgliche Inhalts-
kerne. Selbst durch eine starke Einschrn-
kung der Zahl mglicher logischer oder qua-
silogischer Operatoren in Wortbedeutungen
erfat man natrlich nicht die offenkundige
Tatsache, da nicht jede beliebige Kollektion
von Dingen als Extension mit einer Wortbe-
deutung verbunden sein kann, solange keine
Restriktionen ber die Inhaltskerne selbst for-
muliert werden.
Eine erste Restriktion ergibt sich aus dem
Zusammenhang zwischen syntaktischer Ka-
tegorie und semantischem Typ, wie er bei-
spielsweise in Montague (1973) formuliert ist.
Danach entspricht jeder (feinen) syntakti-
schen Kategorie genau ein semantischer Typ.
Da die Zahl mglicher syntaktischer Kate-
gorien jedoch universal beschrnkt ist (cf. Jak-
kendoff 1983), ergibt sich somit schon eine
erhebliche Einschrnkung ber mgliche
64 I. Allgemeine Grundlagen
(Eine Rekonstruktion des Wortfeldbegriffs
findet sich in Lutzeier 1981).
Da verschiedene Sprachen verschiedene
Seme in den Wortfeldern realisieren, ergibt
sich mithin eine gewisse Form sprachlicher
Relativitt: die Seme sind nicht objektiv vor-
gegeben, sondern sprachspezifisch konstitu-
iert. Dabei ist freilich zu bercksichtigen, da
alle Sprachen ineinander bersetzbar sind (cf.
Kutschera 1975), so da die Relativitt hch-
stens in der Auswahl von Semen aus einem
universal gltigen System prinzipiell dem
Menschen zugnglicher Unterscheidungen
bestehen kann. Ebenso beruhen alle weiter-
gehenden Behauptungen ber sprachliche Re-
lativitt (z. B. Whorf 1956) auf einer empi-
risch falschen Einschtzung der Datenlage (cf.
etwa Malotki 1983).
4.3.2Die Merkmalssemantik von Katz und
Fodor
Fr das 1963 von J. J. Katz und J. A. Fodor
entwickelte System von Merkmalen wurde
der Anspruch erhoben, da diese letztlich auf
ein universal gltiges Inventar primitiver
Konzepte zurckgefhrt werden knne. Am
konsequentesten hat Katz in einer Reihe von
Arbeiten (1966, 1972, 1977) das Ziel verfolgt,
semantische Eigenschaften und Beziehungen
von Ausdrcken, wie Analytizitt, Synony-
mie, entailment etc. auf strukturelle Inklu-
sionsbeziehungen zwischen nichtsprachlichen
autonomen Entitten, genannt semantic mar-
kers, zurckzufhren. So sei z. B. der Satz
(21) John wants to have the things that he
desires
analytisch, da der semantic marker von x
wants to have y enthalten sei im semantic
marker von x desires y, insofern desires als
wants to have very badly analysiert werden
knne und die readings von John und he bei
der korreferenten Lesart bereinstimmen (vgl.
Katz 1972: 175). Die Zurckfhrung seman-
tischer Eigenschaften und Relationen auf for-
male Beziehungen zwischen Konzeptstruktu-
ren mu freilich solange als programmatisch
angesehen werden, wie die Wohlgeformtheits-
bedingungen dieser Strukturen im Unklaren
bleibt; so konnte z. B. auch durch die Selbst-
auslegungsversuche von Katz (1972, 1977)
und die Deutungsbemhungen von Janet D.
Fodor (1977) nicht befriedigend geklrt wer-
den, welcher Status dem semantic marker
(22) von chase angesichts der kategorialen
Diversitt der darin verwendeten Begriffsty-
pen zukommt, soweit sie durch die Knoten-
erwachsen, nicht verheiratet analysieren. Die
beiden wichtigsten Vertreter dieser Dekom-
positionstheorie im engeren Sinne sind einer-
seits die strukturalistische Semantik (insbe-
sondere auch die Theorie der Wortfelder) und
andererseits die Merkmalstheorie von Katz
und Fodor. (Vgl. Artikel 1, Abschnitt 2.5;
Artikel 2, Abschnitt 9.)
4.3.1Strukturalistische Semantik
Die strukturalistische Semantik geht von
einer tiefen Parallelitt von Phonologie und
Semantik aus. In der Phonologie sind die
einzelnen Phoneme durch distinktive Merk-
male (stimmhaft, nasal, etc.) unterschieden.
Die Merkmalsunterschiede sind minimal,
d. h. fr jedes postulierte Merkmal mssen
sich Phoneme finden lassen, die sich nur in
diesem Merkmal unterscheiden. Sie sind ex-
haustiv, insofern sich alle Phoneme durch eine
Spezifikation der Merkmale unterscheiden
lassen; sie entstammen einem universalen In-
ventar mglicher Unterscheidungen, doch
werden fr einzelne Sprachen nicht alle Merk-
male herangezogen.
Ganz hnlich stellte man sich vor, da in-
nerhalb eines Sinnbezirks (Trier 1931), d. h.
einer bestimmten, nicht sprachlich vorgege-
benen Gliederungseinheit des Gegenstands-
bereiches, Wortbedeutungen definiert sind
durch distinktive Merkmale, auch Seme ge-
nannt. So wre innerhalb eines vorstellbaren
Sinnbezirks der Einrichtungsgegenstnde das
Merkmal Vorhandensein einer Lehne denk-
bar, das z. B. Hocker von Sthlen oder Ses-
seln trennt. Die Bedeutung eines Wortes ist
wie ein Phonem definiert durch die Menge
der verwendeten Merkmale und die jeweils
dafr spezifizierten Werte. Wie im lautlichen
Bereich knnen sich Sprachen dahingehend
unterscheiden, welche Seme berhaupt ver-
wendet werden. Die Gesamtheit der nach se-
mantischen Merkmalen spezifizierten Wrter
eines Sinnbezirks konstituiert das sog. Wort-
feld (Trier 1931). Da die Bedeutung eines
Wortes festgelegt ist durch die Gesamtheit der
sie charakterisierenden Seme, und diese je
nach der Ausgestaltung des Wortfeldes wie in
der Phonologie verschieden sein knnen, er-
gibt sich, da die Bedeutung immer nur in
Opposition zu den anderen im Wortfeld vor-
kommenden Lexemen angegeben werden
kann. Das Standardbeispiel hierfr ist die No-
tenskala. Sind nur vier Notenwerte vorhan-
den, so hat eine zwei einen geringeren Wert
als in einem System mit 15 Notenwerten.
4. Wortsemantik 65
Objekte. Er stellte fest, da die deutliche Aus-
prgung eines Merkmals weder hinreichend
noch notwendig fr die Zuordnung eines Ob-
jektes zu einem Begriff wie Tasse oder Vase
ist. Nach welchem Begriff kategorisiert wird,
ist bestimmt vom zusammengenommenen
Grad der Ausprgung verschiedener Merk-
male. Man kann versuchen, mit Hilfe einer
fuzzy logic den Grad der Ausprgung einzel-
ner Merkmale zu metrisieren und dann einen
allgemeinen Schwellenwert fr Mitgliedschaft
im Konzept angeben, gert damit aber u. a. in
die bekannten Probleme dieses Logiktyps (cf.
Smith & Medin 1981).
In die gleiche Richtung deuten auch psy-
chologische Untersuchungen ber die mentale
Reprsentation von Begriffen und Konzep-
ten. Aus der Vielzahl empirischer Ergebnisse,
die Smith & Medin referieren, seien zwei Bei-
spiele herausgegriffen: Einmal sind sog. Ty-
pikalittseffekte nachzuweisen, d. h. da be-
stimmte Vertreter einer Art wie Rotkehl-
chen fr Vogel als typischerer Vertreter
angesehen werden als andere (z. B. Huhn);
dies kann eine Merkmalssemantik, die etwa
nur das Merkmal + Vogel kennt, nicht aus-
drcken. Zweitens ergab sich, da Menschen
bei ihrer Kategorisierung auch nicht-notwen-
dige Merkmale (wie fliegt bei Vogel) ver-
wenden, was ebenfalls mit der Merkmalsse-
mantik schwer vertrglich ist, da die Merk-
male als analytische ja notwendig sein ms-
sen. Nimmt man fliegt bei Vogel auf, so
schliet man jedoch inkorrekt Laufvgel aus
der Klasse der Vgel aus.
Diese Beobachtungen beziehen sich zu-
nchst nur auf die Anwendung und nicht auf
den Inhalt von Begriffen bzw. die Zusammen-
setzung von semantischen Reprsentationen.
Ein Festhalten an der strikten Merkmalsse-
mantik erfordert dann aber die Entwicklung
einer Theorie der konzeptuellen Performanz,
die die Kluft zwischen analytischen Merk-
malskomplexen und variablen Nherungs-
schematismen zu schlieen imstande ist.
4.3.4Konzeptuelle Probleme
Selbst wenn man diese Probleme noch um-
gehen knnen sollte, ist die Merkmalsanalyse
schwerwiegenden Einwnden ausgesetzt. Mit
den Bedeutungsanalysen werden ja eine
Menge von Stzen (die nicht vom trivialen
Typ alle Junggesellen sind unverheiratet sein
mssen) als Bedeutungswahrheiten bzw. als
analytisch ausgezeichnet. Die Existenz solcher
Bedeutungswahrheiten, ja die Existenz von
einer Entitt Bedeutung schlechthin ist je-
doch nicht unumstritten, am konsequentesten
etiketten erkennbar sind (vgl. zu diesem Pro-
blem auch Kutschera 1975).
Betrachtet man nun ausgehend von einer
Menge von Merkmalen die Klasse der logisch
denkbaren Zerlegungsstrukturen von Wort-
bedeutungen, so kann man Prinzipien dar-
ber zu formulieren versuchen, welche dieser
Zerlegungsstrukturen als mgliche Wrter
fungieren knnen. Solche berlegungen ent-
stammen zunchst der generativen Semantik
(McCawley 1971 a), die sie auf allgemeine in
der Syntax gltige Beschrnkungen reduzie-
ren wollte (siehe dazu jedoch Newmeyer
1979). In anderer nicht der generativen Se-
mantik verpflichteten Weise versucht Jacken-
doff (1983), Prinzipien darber zu formulie-
ren, welche konzeptuellen Konstituenten in
einer Zerlegungsstruktur als Variablen offen-
gelassen werden, d. h. als Argumente der re-
sultierenden Prdikatsbedeutung fungieren
knnen.
4.3.3Adquatheitsprobleme
Wie fr die Dekomposition der Simpliziabe-
deutungen in Inhaltskerne und quasilogische
Operatoren stellt sich natrlich auch fr die
weitergehende Merkmalszerlegung das Pro-
blem, da nur in den seltensten Fllen Para-
phrase und Wort als synonym betrachtet wer-
den knnen, wenn die Paraphrasenbestand-
teile die Bedeutung ihrer natrlichsprachli-
chen Pendants besitzen (cf. Pulman 1983; Fo-
dor 1981). Fodor 1981 zieht daraus den
Schlu, da die meisten scheinbar komplexen
Prdikate wie to paint unanalysierte primitive
Bestandteile einer Semantik, fr ihn einer
language of mind, sein mssen.
Labovs Untersuchungen zu Begriffen wie
Vase oder Tasse deuten auf eine grund-
stzliche Schwierigkeit der Zerlegungsanalyse
hin. Labov variierte auf bildlichen Darstel-
lungen systematisch das Verhltnis von Gre
und Breite, Ausprgung des Vorhandenseins
eines Henkels fr vasen- bzw. tassenhnliche
66 I. Allgemeine Grundlagen
gewisser bersetzungen nur einen Fall von
Unterdeterminierung einer Theorie durch em-
pirische Daten darstelle, wie sie in allen em-
pirischen Disziplinen gegeben ist. Im brigen
knnte man mit Chomsky sagen, da die
gavagai-Problematik nur von anderer Seite
her die These beleuchtet, da die bei der Er-
lernung jeder menschlichen Sprache voraus-
zusetzenden analytischen Hypothesen selber
nicht erlernt werden knnen.
Putnam (1975 b) wendet sich grundstzlich
gegen die Annahme, da das, was herkmm-
lich unter Bedeutung verstanden wird, sich
im Kopf befinde. Er setzt dabei voraus, da
Bedeutungen (Intensionen im traditionellen
nicht-intensionallogischen Sinne) zumindest
die Bedingung erfllen mssen, die Extension
eines Wortes in einer vorgegebenen Welt fest-
zulegen. Die im Gehirn reprsentierten Merk-
male knnen in diesem Sinne aber nicht die
Bedeutung eines Wortes sein. Die Bedeu-
tungsanalyse fr Wasser kann im psycholo-
gischen Sinne nicht das Merkmal + H
2
O
enthalten, da sonst die der Chemie unkundi-
gen Menschen die Bedeutung von Wasser
nicht kennen wrden und sich die Bedeutung
der natural kind Wrter mit dem naturwis-
senschaftlichen Fortschritt permanent ndern
wrde. Nehmen wir also an, die Bedeutung
von Wasser sei ein wie immer geartetes Kon-
glomerat aus Eigenschaften wie farblos, ge-
schmacksfrei, flssig u. s. w., und dies wre
mental reprsentiert. Nehmen wir weiter an,
es gebe eine Zwillingserde, die sich von unse-
rer nur dadurch unterscheidet, da der Stoff
mit den wahrnehmbaren Eigenschaften von
Wasser dort nicht H
2
O sondern XYZ ist. Die
Zwillingsmenschen besitzen dann dieselbe
mentale Reprsentation der Bedeutung von
Wasser. Dennoch referieren sie mit Wasser
nicht auf H
2
O, sondern auf XYZ.
Die mental reprsentierten Eigenschaften
knnen also die Extension von Wasser nicht
festlegen, es sei denn, man liee die Extension
von Wasser mit der jeweiligen Weltumgebung
so variieren, da auch fr uns Wasser in
der Zwillingswelt XYZ bezeichnen wrde; es
ist aber nach Putnam offensichtlich, da wir
im Zweifelsfalle nur das als Wasser anerken-
nen wrden, was stofflich mit unserem Was-
ser hier bereinstimmt, selbst wenn dazu
mhsame empirische Untersuchungen erfor-
derlich sind, deren Ergebnisse mit den im
Kopf reprsentierten Eigenschaften unver-
trglich sind. In diesem Sinne seien natural-
kind Wrter indexikalische Ausdrcke. Im
Unterschied zu den blichen indexikalische
hat gegen sie Quine (1960) argumentiert. Was
unreflektiert als Bedeutung angesehen wird,
stellt ihm zufolge nur ein System von allge-
mein geteilten Glaubensannahmen ber die
Welt dar. Begriffe wie Analytizitt, Synonymie
und Bedeutung bilden nach ihm aufgrund ih-
rer Interdependenz einen durch Definitionen
nicht auflsbaren Zirkel. Versucht man je-
doch diese Begriffe durch Bedingungen be-
obachtbaren Verhaltens festzulegen, so ge-
langt man allenfalls zu Definitionen fr so
etwas wie Stimulus-Analytizitt bzw. Sti-
mulus- Synonymie einer sehr eingeschrnk-
ten Klasse unanalysierter uerungen. Die
Zerlegung von uerungen in bedeutungs-
volle Bestandteile setzt hingegen immer sog.
analytische Hypothesen voraus, die ihrer-
seits (abgesehen von den wahrheitsfunktio-
nellen Konnektoren) von den Daten her prin-
zipiell nicht abgesichert werden knnen. Das
scheitert allein schon daran, da die bei der
elementaren Referenz vorausgesetzten onto-
logischen Grundkategorien, fr die ja alter-
native Systeme vorstellbar sind, aus dem be-
obachtbaren Verhalten nicht ermittelt werden
knnen.
Quine veranschaulicht diese These mit dem
(radikalen) bersetzungsproblem fr das
Wort gavagai in einer auerhalb unserer kul-
turellen Tradition stehenden erdachten Spra-
che. Linguistische Analysen knnten ergeben,
da gavagai immer dann verwendet wird,
wenn man als Deutscher Hase uern wrde.
Dennoch ist nach Quine der Schlu nicht
berechtigt, gavagai die Bedeutung Hase zu-
zuschreiben. Die Eingeborenen knnten ber
eine vllig andere Ontologie verfgen, in der
nicht Objekte die Grundlage darstellen, son-
dern Ereignisse, oder Teile von Objekten den
Objekten ontologisch vorgeordnet sind, so
da gavagai auch unabgetrennter Hasenteil
oder Hasungsereignis bedeuten knnte.
Empirisch seien aber diese verschiedenen Be-
deutungszuweisungen nicht voneinander zu
unterscheiden, d. h. mit empirischen Daten
kann die ontologische Grundlegung nicht er-
kannt werden. Diese Unterdeterminiertheit
durch Beobachtung gilt aber letztlich fr Be-
deutungszuweisungen in allen Sprachen. Da-
mit gibt es aber auch kein empirisches Datum,
das fr deutsch Hase die Annahme eines
Merkmals physikalisches Objekt rechtfer-
tigte.
Quines Argumentation ist von verschiede-
ner Seite angegriffen worden (cf. Pulman 1983
fr ein Referat). Chomsky 1980 wendet ein,
da die fehlende Evidenz zur Rechtfertigung
4. Wortsemantik 67
stimmter Ausdrcke verbunden sind, die aber
in keinem Falle den Charakter notwendiger
Merkmale haben und daher auch im Bedarfs-
falle ignoriert werden knnen. Man mu le-
diglich damit rechnen, da die mit dem Ste-
reotyp verbundene Eigenschaft (z. B. ge-
streift bei Tigern) als typisch gilt. Inwieweit
die Stereotype das allgemeine kognitive Ver-
halten der Menschen ber das rein Kommu-
nikative hinaus bestimmen, ist unklar.
Da Putnam daran festhlt, da die Bedeu-
tung eines Ausdrucks seine Extension festlegt,
andererseits aber mentale Reprsentationen
dies nicht leisten knnen, fat er die Bedeu-
tung eines Wortes als nichtmentales mehrdi-
mensionales Gebilde auf, in das soziale, in-
dividuelle und weltbezogene Faktoren einge-
hen. Neben syntaktischen und semantischen
Merkmalen hoher Zentralitt, die zwar nicht
analytisch, aber doch schwer revidierbar sind,
enthlt das Bedeutungsgebilde die sozialver-
bindlichen Stereotype sowie als Beitrag der
Welt die Extension. Die letztlich nicht auf-
hebbare Kluft zwischen der Extension und
den brigen Faktoren wird durch eine soziale
Kooperation, der linguistic division of la-
bor zu berbrcken versucht, indem die Eru-
ierung der kriterialen Eigenschaften fr die
Zugehrigkeit zur Extension an Experten de-
legiert wird, die ber den jeweiligen For-
schungsstand verfgen.
Whrend Putnam der Meinung zu sein
scheint, da alle (nichtextensionalen) Bedeu-
tungskomponenten nichtanalytisch, da revi-
dierbar sind, schlgt Pulman ein differenzier-
teres Modell vor. Einen Ansatz von Schwartz
(1977, 1978, 1980) modifizierend, unterschei-
det er (vorlufig) drei semantische Katego-
rien: natural kinds, nominal kinds und
primary kinds. Natural kinds werden im
wesentlichen wie bei Kripke und Putnam ge-
fat, sie sind vor allem dadurch ausgezeich-
net, da ihre Terme im Sinne von Schwartz
als Subjekte stabiler Generalisierungen fun-
gieren knnen, d. h. solcher Generalisierun-
gen, die zwar prinzipiell korrigierbar sind
(Katzen knnten sich als etwas anderes als
Tiere erweisen, was aber nur heit, da wir
ber die vorausgesetzten notwendigen Eigen-
schaften keine absolute Gewiheit haben
knnen), aber angesichts singulrer Gegen-
beispiele nicht aufgegeben werden. Sie werden
primr durch die Vermittlung von Stereoty-
pen verstanden.
Terme fr primary kinds, wie z. B. flssig,
fest, trocken, gelb, hei, glatt etc., lassen zwar
stabile Generalisierungen zu, aber im Gegen-
Ausdrcken (wie ich, du, hier) designieren sie
jedoch starr im Sinne von Kripke (1972),
d. h. sie haben in jeder mglichen Welt die-
selbe Extension, da die Vertreter einer natr-
lichen Art aufgrund ihrer inneren Konstitu-
tion durch Eigenschaften charakterisiert
sind, die ihnen mit Notwendigkeit zukom-
men, ob wir diese nun kennen oder nicht.
Gegen den analytischen Charakter seman-
tischer Merkmale wendet Putnam ein, da
fast jedes von ihnen aufgrund von Erfahrung
revidierbar erscheint. So wrden selbst Merk-
male wie belebt im Falle von Wrtern wie
Katze aufgegeben, wenn sich herausstellen
sollte, da Katzen in Wirklichkeit Maschinen
sind. Da Katzen Tiere sind, wre demnach
eine empirische, keine analytische Wahrheit.
Analoge Argumente lieen sich nach Putnam
fr alle Merkmale bei allen natural kind terms
formulieren, und prinzipiell auch fr Arte-
fakte. Hier besteht fr Putnam ein wesent-
licher Unterschied zu Ausdrcken, die aus
Ableitungsprozessen resultieren: x ist lsbar
ist unrevidierbar als x kann gelst werden zu
deuten, was natrlich nichts ber die Revi-
dierbarkeit der Merkmale von lsen impli-
ziert. Putnams Argumentation setzt also die
Akzeptabilittsgrenze fr Zerlegungsstruktu-
ren exakt dort, wo sie sich auch linguistisch
motivieren lt.
4.4Stereotypen- und Prototypensemantik
Bevor man eine Konklusion aus den Argu-
menten gegen die Merkmalssemantik ziehen
kann, ist eine Einschrnkung angebracht. Wie
Johnson-Laird (1983) betont, knnen wir
durchaus verabreden, Wrter so zu verwen-
den, da ihre Bedeutung durch eine Merk-
malsmatrix festgelegt ist. Dies gilt insbeson-
dere fr den technischen, wissenschaftlichen
oder juristischen Bereich. Diese Wrter schei-
nen mit ihrer Zerlegungsbedeutung auch
durchaus Eingang in den normalen Wort-
schatz finden zu knnen. Insbesondere schei-
nen auch die Verwandschaftsbezeichnungen,
ein beliebtes Feld wortsemantischer Unter-
suchungen, zu diesen sog. Terminologien zu
gehren, deren Aufbau auch Coseriu (1978)
als verschieden von denen natrlicher Begriffe
ansieht. Die Angriffe gegen eine Zerlegungs-
analyse knnen sich also nur auf nicht-ter-
minologische Bestandteile des Wortschatzes
richten.
Putnam geht nun davon aus, da zum
sprachlichen Wissen die Kenntnis von sog.
Stereotypen gehrt, die konventionell in einer
Sprachgemeinschaft mit dem Gebrauch be-
68 I. Allgemeine Grundlagen
rung im Bereich der Grundfarben, frher
eines der Standardbeispiele linguistischer Re-
lativitt. Oberflchlich betrachtet variieren
die Sprachen hinsichtlich der Anzahl und Ex-
tension ihrer Farbwrter erheblich. Sorgfl-
tige Untersuchungen (Berlin & Kay 1969)
haben jedoch gezeigt, da die Extension von
Farbwrtern mit einem universalen System
von prototypischen Segmenten im Farbspek-
trum, den sogenannten focal points ein-
heitlich erfat werden kann. Jedem Grund-
farbwort (z. B gelb aber nicht blond oder quit-
tengelb, zur Abgrenzung vgl. Berlin & Kay
5 ff.) ist ein focal point zugeordnet, der als
Basis einer hnlichkeitsordnung zur (un-
scharfen) Abgrenzung der Extension dient. Es
werden maximal elf solcher focal points mit
Grundfarbwrtern verbunden (z. B. Englisch:
black, white, red, green, yellow, blue, brown,
purple, pink, orange, grey), mindestens jedoch
zwei, nmlich die focal points fr Schwarz
und Wei (solche Sprachen finden sich z. B. in
Neu-Guinea). Wie Rosch (1973) jedoch zei-
gen konnte, sind diese elf focal points auch
dann perzeptuell ausgezeichnet, wenn sie
nicht mit einem Grundfarbwort belegt sind.
Aus der Anzahl der Grundfarbwrter einer
Sprache lt sich relativ gut vorhersagen, wel-
che der natrlichen focal points lexikalisiert
sind. Das dritte Farbwort wird ausnahmslos
dem focal point fr Rot zugeordnet. Es
folgen Grn und Gelb in beliebiger Reihen-
folge, sodann Blau, danach Braun; fr die
restlichen vier sind keine Vorhersagen mg-
lich. Bei gleichem Grundfarbwortschatz sind
die Zuordnungsdifferenzen zwischen Spre-
chern verschiedener Sprachen nicht grer als
die zwischen Sprechern derselben Sprache.
Sind weniger als elf focal points lexikali-
siert, so werden nicht-lexikalisierte focal
points in den Bereich der lexikalisierten ge-
zogen. Der prototypische Charakter der le-
xikalisierten focal points bleibt davon un-
berhrt.
Im Farbwortbereich mssen also nicht-tri-
viale Vorkategorisierungen unserer Umwelt
bereits vorgegeben sein, und damit auch die
Fixierung mglicher Prototypen und die Be-
deutung mglicher Wrter. Dies scheint sich
auf weite Bereiche der Wahrnehmung zu
bertragen (Rock 1985, Bower 1979). Sollte
es der kognitiven Psychologie mglich sein,
eine Theorie ber Kombinationsmechanis-
men fr primitive Begriffe zu entwickeln, so
wre ansatzweise erkennbar, was ein mgli-
cher natrlicher Begriff ist.
satz zu natural kind-Termen auch analyti-
sche Spezifikationen (trocken schliet na
aus). Es handelt sich meist um Adjektive mit
Bezug zum sensorischen Bereich, die keine
Arten bezeichnen, sondern allenfalls solche
kreuzklassifizieren. Auch ihr Verstndnis sei
durch Stereotype vermittelt.
Terme fr nominal kinds, wie z. B. Aus-
drcke fr Artefakte, Verwandschaftsbezeich-
nungen, Institutionen etc. sind dagegen allen-
falls mit Stereotypen verbunden, die fr ihr
Verstndnis nicht konstitutiv sind, sie gehen
klare analytische Beziehungen ein, und kn-
nen nur in einem abgeleiteten Sinne in stabilen
Generalisierungen auftreten, insofern in ihren
Spezifikationen ein Bezug auf natural kinds
oder primary kinds vorkommen kann, der
jedoch nur deren oberflchliche Eigenschaf-
ten betrifft (Boote sind zwar Mittel fr den
Transport auf Wasser, aber die innere Kon-
stitution von Wasser ist nicht entscheidend
dafr, was als Boot gilt; Fahrzeuge, die auf
Putnams Zwillingserden-XYZ schwimmen,
sind immer noch Boote).
Psychologische Theorien ber die Repr-
sentation von Konzepten stimmen mit dem
Ansatz von Putnam darin berein, da Kon-
zepte nicht durch die Angabe einzeln notwen-
diger und zusammengenommen hinreichen-
der Merkmale charakterisiert werden knnen.
Sie unterscheiden sich von Putnam insofern,
als sie die Auswahl der bestimmenden Fak-
toren primr nicht durch soziale Konventio-
nen, sondern durch Eigenschaften der
menschlichen Kognition bestimmt sehen. Ein
aufflliges Phnomen ist dabei, da viele
Konzepte durch Prototypen reprsentiert wer-
den, d. h. durch einen als zentral ausgezeich-
neten Vertreter des Konzepts, der dazu ver-
wendet wird, eine hnlichkeitsordnung zu in-
duzieren, auf deren Grundlage die Entschei-
dung ber die Konzept-Mitgliedschaft getrof-
fen wird (vgl. Rosch 1973, 1975). Aus dem
exemplarischen Charakter des Prototyps er-
gibt sich, da auch nicht-notwendige Merk-
male in die Reprsentation eingehen. Wenn
sich die Ergebnisse dieser Untersuchungen
auch auf die Reprsentation von Wortbedeu-
tungen bertragen lassen, was nicht selbst-
verstndlich ist (siehe unten), so ist in der
Wortsemantik mit hnlichkeitsordnungen
und Prototypie zu rechnen.
Ein elementares Beispiel von Prototypie,
das vermutlich mit Eigentmlichkeiten unse-
res Perzeptionsvermgens zusammenhngt,
zeigt sich in der unterschiedlichen Lexikalisie-
4. Wortsemantik 69
einander ausschlieende Klassen (in Gro-
buchstaben) kategorisieren, die man erhlt,
wenn man die unter die Begriffe fallenden
Objekte hinsichtlich kategoriengerechter Pr-
dikation (fettgedruckt) zusammenfat.
Auf diese Weise ergibt sich aus einem sog.
Prdikabilittsbaum (fettgedruckte Knoten)
ein ontologischer Baum (Knoten in Gro-
buchstaben).
4.5Natrliche Begriffe vs. mgliche
Wortbedeutungen
Keil (1979) hat einige Gesetze fr natrliche
Begriffe aufgestellt und durch experimentelle
Untersuchungen berprft. Wie der Baum
(23) veranschaulicht, lassen sich natrliche
Begriffe (Terminalknoten) beispielsweise in
mens, das Bierwisch konzeptuelle Verschie-
bung nennt, nicht gerecht. Die Annahme, eine
der Bedeutungen sei grundlegend und die an-
deren daraus abgeleitet, kann in vielen Fllen
nicht begrndet werden und zwingt zu will-
krlichen Entscheidungen.
Bierwisch schlgt daher vor, nur die allen
nicht-metaphorischen Verwendungen gemein-
samen Bedeutungsaspekte zur lexikalischen
Bedeutung zu rechnen, die berfhrung in
die vollspezifizierten Konzepte hingegen einer
Menge von konzeptuellen Operationen zu
bertragen. So knne etwa als im Lexikon zu
verzeichnende semantische Charakterisierung
von Schule die Struktur
(25) x [ZWECK(x)(W) & W = LEHR-
UND LERNPROZESSE]
angesetzt werden. Die konzeptuellen Opera-
tionen knnen als Schemata wie (26) repr-
sentiert werden:
(26) x [INSTITUTION(x) & SEM(x)]
x [GEBUDE(x) & SEM(x)]
x [PROZESS(x) & SEM(x)]
Natrliche Prdikate knnen sich nun, wie
Keil (1979) feststellte, nur auf Teilbume von
(23) beziehen, d. h. es gibt Begriffe, die nur
ber Organismen prdizierbar sind, aber
nicht solche, die man nur von Tieren und
Ereignissen prdizieren knnte.
Betrachtet man nun aber Wrter wie
Schule, so ergibt sich, da sie sich je nach
Verwendungsweise (cf. Bierwisch 1983) auf
ganz unterschiedliche Typen von Objekten be-
ziehen knnen, die zusammengenommen kei-
nen zusammenhngenden Teilbaum in einem
ontologischen Baum ergeben.
(24) Die Schule hat ein Flachdach.
(Gebude)
Die Schule spendete letztes Jahr einen
greren Betrag. (Institution)
Die Schule macht ihm groen Spa.
(Ensemble von Prozessen)
Traditionell spricht man hier von der Poly-
semie eines Wortes. Die Auflistung mehrerer
Bedeutungen im Lexikon wird dem systema-
tischen Charakter dieses hufigen Phno-
70 I. Allgemeine Grundlagen
Stokhof 1982 Hall 1965 Herbermann 1981
Hhle 1982 b Hhle 1985 Jackendoff 1972 Jak-
kendoff 1983 Jensen/Stong-Jensen 1984 John-
son-Laird 1983 Kanngieer 1985 Katz 1966
Katz 1972 Katz 1977 Katz/Fodor 1963 Kee-
nan/Moss 1984 Keil 1979 Kiparsky 1982
Kripke 1972 Krschner 1974 Kutschera 1967
Kutschera 1975 Labov 1973 Lang 1983 La-
pointe 1979 Lees 1960 Levi 1978 Lewis 1970
Lieber 1980 Lieber 1984 Lutzeier 1981 Malotki
1983 McCarthy 1981 McCawley 1971 a Mc-
Cawley 1978 Montague 1973 Morgan 1969
Motsch 1970 Newmeyer 1979 Peacocke 1976
Pesetzky 1985 Pulman 1983 Putnam 1975 b
Quine 1960 Reis 1985 Rock 1985 Rohrer
1967 a Rohrer 1967 b Rosch 1973 Rosch 1975
Schwartz 1977 Schwartz 1978 Schwartz 1980
Searle 1969 Searle 1975 Selkirk 1982 Shibatani
1976 Smith/Medin 1981 Trier 1931 Toman
1983 Toman 1985 Westersthl 1985 Whorf
1956 Williams 1981 a Williams 1981 b Wittgen-
stein 1921
Gisbert Fanselow, Passau/Peter Staudacher,
Regensburg (Bundesrepublik Deutschland)
Setzt man in (26) fr SEM die lexikalische
Spezifikation (25) fr Schule ein so erhlt man
die verschiedenen in (24) von Schule bezeich-
neten vollspezifizierten Konzepte.
Da eine semantische Lexikonspezifizierung
wie (25) mit Hilfe der genannten konzeptuel-
len Operationen eine Familie von natrlichen
Konzepten determiniert, die, wie oben be-
merkt, nicht durch eine gemeinsame Menge
von Prdikabilia erfat werden kann, sind
sie nach Bierwisch selbst keine natrlichen
Begriffe, sondern etwas Abstrakteres.
5. Literatur (in Kurzform)
Abraham 1986 Anderson 1982 Austin 1962
Barwise/Cooper 1981 Behaghel 1907 van Ben-
them 1983 a van Benthem 1984 a Berlin/Kay
1969 Bierwisch 1980 Bierwisch 1983 Binnick
1971 Bower 1979 Brekle 1970 Brekle 1973
Brekle/Boase-Beier/Toman 1985 Chomsky 1965
Chomsky 1972 Chomsky 1980 Coseriu 1978
Doherty 1985 Downing 1978 Dowty 1979 Fan-
selow 1981 Fanselow 1985 Fleischer 1969 Fo-
dor 1981 Fodor 1977 Frege 1892 Groenendijk/
71
II. Probleme der ontologischen Grundlegung:
Welt versus Situation
Problems of Ontological Foundation:
World Versus Situation
Das Handbuch enthlt keine systematische Darstellung der Situationssemantik: einmal war sie
noch nicht bekannt, als das Handbuch konzipiert wurde, zum andern basiert kein Artikel direkt
auf dieser Theorie. Die folgenden beiden Beitrge sind eine Kontroverse zwischen einem enga-
gierten Vertreter der Mgliche-Welten-Semantik M. J. Cresswell und einem der Vter der
Situationssemantik J. Barwise. Cresswells Beitrag wurde nicht speziell fr dieses Handbuch
geschrieben. Er erschien erstmals als Kapitel 5 von M. J. Cresswell, Semantic Essays: Possible
Worlds and their Rivals, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1988. Barwises Antwort ist
dagegen fr dieses Handbuch konzipiert.
Die Herausgeber
Its a small world after all
5. Die Weltsituation
schiedlicher Art dargestellt werden. Und ich
mchte weiter zeigen, da keine Entitt alle
diese Rollen zugleich spielen kann.
2. Situationssemantik
In der Mgliche-Welten-Semantik ist die Be-
deutung eines in einem Kontext geuerten
Satzes die Klasse der Welten, in denen der
Satz wahr ist. Ich sage in einem Kontext,
weil natrlich viele, wenn nicht alle Stze,
einen Kontext erfordern, der allerlei Art von
Information liefern mu etwa ber Zeit,
Ort und Sprecher , bevor man zu einer
bestimmten Proposition gelangt, die in einer
mglichen Welt wahr oder falsch sein kann.
In der Situationssemantik beschreiben Stze
im Kontext Situationen. Wie in der Mgliche-
Welten-Semantik mssen wir nicht-reale Si-
tuationen zulassen, weil keine der Situatio-
nen, die von einem falschen Satz beschrieben
wird, tatschlich der Fall ist.
Ich gehe hier davon aus, da die Version
der Situationssemantik, die mit Barwise und
Perrys Situations and Attitudes (1983) vor-
liegt, die verbindliche ist. Alle Literaturhin-
weise beziehen sich wenn nicht anders an-
gegeben darauf. Barwise und Perry unter-
1. Ziel
2. Situationssemantik
3. Situationen als Propositionen
3.1. Die Erzeugunggseigenschaft
3.2. Propositionen und groe Mengen
3.3. Die Unvollstndigkeit von Propositionen und
Situationen
4. Situationen als Welten
5. Situationen als Ereignisse
6. Schlu
7. Literatur (in Kurzform)
1. Ziel
Ich mchte in diesem Beitrag einen Vergleich
anstellen zwischen der Mgliche-Welten-Se-
mantik und der semantischen Theorie, die Jon
Barwise und John Perry neuerdings entwik-
kelt haben und die sie Situationssemantik
nennen. Obwohl die Mgliche-Welten-Se-
mantik zweifellos ihr strkster Konkurrent
ist, vermeidet die Literatur zur Situationsse-
mantik erstaunlicherweise hartnckig direkte
Vergleiche der beiden Theorien. Ich werde zu
zeigen versuchen, da die sogenannten Si-
tuationen geschaffen wurden, um bestimmte
Rollen zu spielen, die in der Mgliche-Welten-
Semantik durch Entitten von recht unter-
72 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
der Mgliche-Welten-Semantik sind Aussa-
gen wahr oder falsch in Welten, und die Be-
deutung (oder wie Barwise und Perry sagen
wrden, die Interpretation) einer Aussage
ist die Klasse der Welten, in denen sie wahr
ist. Klassen von Welten werden oft Proposi-
tionen genannt, und die Bedeutung einer Aus-
sage ist eine einzelne Proposition. Die Stra-
tegie dieses Beitrages ist die folgende: Ich
werde plausibel zu machen versuchen, da
eine der Aufgaben, die Barwise und Perry
Situationen zuweisen, darin besteht, die Rolle
von Propositionen zu spielen. Ich werde zei-
gen, da gewisse Schwierigkeiten entstehen,
wenn sie diese Rolle spielen. Ich werde weiter
zu zeigen versuchen, da einige andere Auf-
gaben, die nach Barwise und Perry Situatio-
nen erfllen, verlangen, da sie sich wie Wel-
ten verhalten. Meine Schlufolgerung wird
sein, da man von Situationen zu viele in-
kompatible Aufgaben verlangt.
3.1Die Erzeugungseigenschaft
Man betrachte die Situation, die lediglich aus
Mollies Bellen besteht:
e* : = an l: bellt, Mollie; ja
In gewisser Hinsicht beschreibt eine ue-
rung von Mollie bellt in einer Diskurssitua-
tion, die l als Bezugslokation spezifiziert, ge-
nau e*. Nicht mehr und nicht weniger. Die
Aussage spricht Mollie Bellen an l zu und
sagt nichts darber aus, was sonst noch ge-
schieht. Sie beschreibt eine Situation e genau
dann, wenn e* e. Ich mchte von Stzen
dieser Art sagen, da sie die Erzeugungseigen-
schaft haben. Ein Satz hat die Erzeugungs-
eigenschaft bezglich eines Kontextes u genau
dann, wenn es eine Situation e* gibt, so da
u [[]] e gdw. e* e
hat die Erzeugungseigenschaft schlechthin
genau dann, wenn sie in jedem Kontext hat.
In den formalen Sprachen, die Barwise und
Perry im Anhang zu Situations and Attitudes
betrachten, haben alle atomaren Stze die
Erzeugungseigenschaft (siehe auch Kapitel 7
meines Buches Adverbial Modification,
1985 a), und wenn Situationen wie Propositio-
nen behandelt werden sollen, wre es auch
wnschenswert, da alle Stze sie haben. Bar-
wise und Perrys Semantik fr die wahrheits-
funktionalen Satzoperatoren erhalten diese
Eigenschaft aber im allgemeinen nicht einmal
in den beschrnkten Sprachen, die sie disku-
tieren. Genauer: Die Konjunktion erhlt sie,
die Disjunktion aber nicht. Um dies zu zeigen,
nehmen wir an, da u ein Kontext ist, der fr
scheiden mehrere Typen von Situationen:
Sachverhalte, Ereignisverlufe, Diskurssitua-
tionen, usw. (siehe S. 5357). Tatschlich
handelt es sich dabei aber immer um nicht-
leere Kollektionen von Konstituenten der fol-
genden Form:
(a) an l: r, a
1
, ..., a
n
; ja
oder
(b) an l: r, a
1
, ..., a
n
; nein
wobei l eine Lokation, d. h. eine raum-
zeitliche Region ist, r eine n-stellige Relation
(Relationen und Situationen sind Grundbe-
griffe der Theorie.) und a
1
, ..., a
n
Objekte
sind (Die Objekte knnen Individuen sein, die
ebenfalls Grundbegriffe sind, oder sie knnen
Relationen oder Situationen sein.). Ja und
nein sind die beiden Wahrheitswerte. Eine
wesentliche Eigenschaft von Situationen ist,
da sie partiell sein knnen. Zum Beispiel gibt
es viele Situationen, die weder (a) noch (b)
enthalten. Falls eine Situation beide enthlt,
heit sie inkohrent (S. 54). Wenn (a) oder (b)
Teil von e an einer Lokation l ist, schreiben
Barwise und Perry
in e: an l: r, a
1
, ..., a
n
; ja
(oder nein); und wenn weiter e nur aus einem
Eintrag besteht, schreiben sie z. B.
e: = an l: r, a
1
, ..., a
n
; ja
Falls ein Satz ist, dann ist seine Bedeutung
[[]] eine Relation zwischen Situationen, und
wir lesen
u [[]] e
als , geuert in der Situation u, beschreibt
die Situation e. Die Situation u hat man sich
als Diskurs-Situation vorzustellen, deren Auf-
gabe typischerweise darin besteht, Dinge
zweierlei Art zu liefern: Erstens die mehr
oder weniger ffentlichen Aspekte einer
uerung (S. 121) wie den Sprecher, die Zeit
und den Ort, usw.; und zweitens die Spre-
cherverbindungen (S. 125), d. h. worauf sich
der Sprecher in u durch Namen, Pronomina
oder andere derartige Ausdrcke bezieht, die
in vorkommen. Die Situation u ist von der
Art, die Barwise und Perry Sachverhalt nen-
nen, das bedeutet, da die Lokation l dieselbe
in allen Konstituenten von u ist und man
somit von dem einzigen l in u als der Dis-
kurslokation sprechen kann.
3. Situationen als Propositionen
Barwise und Perry nennen einen Satz im Kon-
text eine Aussage, und ich werde diese be-
queme Abkrzung manchmal benutzen. In
5. Die Weltsituation 73
schlft. Wir wollen sagen, da zwei Situatio-
nen e und e quivalent sind, e e, wenn
sie auseinander alleine durch die nderung
der Wahrheitswerte der Konstituenten ge-
wonnen werden knnen. Mit anderen Wor-
ten, e und e entscheiden genau dieselben Al-
ternativen, obwohl die von ihnen getroffenen
Entscheidungen nicht gleich ausfallen ms-
sen. Wenn uns nun ein Satz cp gegeben ist, so
knnen wir die Klasse der Situationen, in
denen cp in einem Kontext u definiert ist,
folgendermaen definieren:
u [[]]
+
e gdw. fr ein e e gilt: u [[]]e
Die formale Definition der Negation wrde
dann besagen, da
u [[nicht-]] e
gdw. u [[]]
+
e aber nicht: u [[]] e.
Das wrde heien, da e ber alle mglichen
Alternativen entscheidet, die mit zu tun
haben, ohne selbst zu verifizieren.
Diese Art der Negation ist, genau wie die
Disjunktion, ein Operator, der die Erzeu-
gungseigenschaft nicht erhlt. Sei nmlich e*
wie folgt:
an l: r
1
, a; ja
an l: r
2
, a; ja
Nehmen wir weiter an, da fr ein gegebenes
u gilt
u [[]] e gdw. e* e
Nun werden wir unter e e auch solche mit
e
1
: = an l: r
1
, a; ja
an l: r
2
, a; nein
und
e
2
: = an l: r
1
, a; nein
an l: r
2
, a; ja
finden. Da nun e* e
1
und e* e
2
, aber e
1
e* und e
2
e* gilt, so erhalten wir u [[nicht-
]] e
1
und
u [[nicht-]] e
2
.
Aber e
1
und e
2
haben keinen nichtleeren
Schnitt, und daher ist die Klasse aller e, fr
die gilt
u [[nicht-]] e
nicht erzeugbar, obwohl die Klasse der e, fr
die
u [[]] e
gilt, erzeugt wird.
Man knnte meinen, da eine Situation
dadurch negiert werden kann, da man die
alle kontextabhngigen Namen in einem Satz
Denotate bereitstellt. Wir haben die
Regel (siehe S. 137), da
u [[ ]] e gdw. u [[]] e und u [[]] e.
Nehmen wir nun an, es gbe ein e
1
und ein
e
2
, so da
u [[]] e gdw. e
1
e
und
u [[]] e gdw. e
2
e.
(Dies bedeutet gerade, da und die Er-
zeugungseigenschaft haben.) Damit gilt fr e*
= e
1
e
2
:
e* e gdw. e
1
e und e
2
e
gdw. u [[]] e und u [[]] e
gdw. u [[ ]] e
Dies beweist, da von e* generiert
wird. Also hat die Erzeugungseigen-
schaft, wenn sowohl als auch sie haben.
Die Disjunktion verhlt sich dagegen an-
ders, zumindest wenn ihre Semantik klassisch
ist. Und die Semantik fr die Disjunktion, die
Barwise und Perry vorlegen, ist klassisch. An-
genommen, die Werte fr alle Namen werden
vom Kontext u geliefert, dann knnen wir die
Regel fr definieren als:
u[[ ]] e gdw. u [[]] e oder u [[]] e.
Nun sieht man, wieso ein disjunktiver Satz
die Erzeugungseigenschaft eventuell nicht
hat: Angenommen, es gelte u [[]] e
1
und
u [[]] e
2
, wobei
e
1
: = an l: bellt, Jackie; ja
e
2
: = an l: schlft, Jackie; ja
Nun sind e
1
und e
2
in gewissem Sinne Atome,
und zwar insofern, als es kein e* gibt so, da
e* e
1
und e* e
2
. Aber
u [[ ]] e
1
und u [[ ]] e
2
Damit kann es kein e* geben, so da
u [[ ]] e gdw. e* e gilt.
Wie steht es mit der Satznegation? Hier
stehen wir zunchst vor dem Problem, da
Barwise und Perry sich nicht sicher sind, ob
es sie berhaupt gibt. Wenn wir ihrer klassi-
schen Behandlung der Disjunktion folgen,
wrden wir einfach sagen, da u [[nicht-]] e
gdw. nicht u []] e. Aber wir knnten nicht
u [[]] e auch in einer Situation vorfinden, in
der nicht so sehr falsch, als vielmehr un-
definiert ist. Das knnte etwa fr Mollie
schlft in unserer obigen Situation
e* : = an l: bellt, Mollie; ja
der Fall sein. Man kann ebenso wenig herlei-
ten, da Mollie in e* schlft, wie da sie nicht
74 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
vllig unplausibel, da die Struktur der Welt
die Sprache auf diese Weise beeinflussen
sollte. Ich htte gedacht, da die Suche nach
einer logisch perfekten Sprache, welche die
Strukturen der Wirklichkeit genau widerspie-
gelt, seit dem Tractatus zu den Akten gelegt
sei.
Wenn wir die Satznegation haben wollen
und gleichzeitig die Erzeugungseigenschaft er-
halten wollen und folglich die Idee auf-
rechterhalten, da eine Situation insofern et-
was wie eine Proposition ist, als eine einzelne
Situation die Bedeutung eines Satzes im Kon-
text sein kann knnten wir zunchst un-
tersuchen, ob der von Barwise und Perry zu-
gelassene Apparat es gestattet, eine Art von
Negation oder eine Art von Disjunktion zu
haben, die aus einer Situation eine andere
herstellt, die genau deren Negation ist oder
aus einem Paar von Situationen eine andere,
die genau deren Disjunktion ist.
Es ist am einfachsten, mit der Negation zu
beginnen. Barwise und Perry lassen unter an-
derem Relationen zwischen Situationen zu. So
verwendet etwa ihre Semantik fr weil eine
zweistellige Relation, in der
an l: weil, e
1
e
2
; ja
bedeutet, da an le
2
der Fall ist, weil e
1
der
Fall ist. Auf hnliche Weise knnten wir die
Negation ausdrcken, indem wir eine einstel-
lige Relation einfhren, die ber Situationen
operiert. Wenn e eine Situation ist, dann ist
ihre Negation e, wobei
e : = an l: neg, e; ja
(mit l als der kleinsten Lokation, die alle Orte
in e umfat). Die Idee ist, da e einfach die
Situation von es Falschsein ist.
Ein ernsthaftes Problem fr neg ist das
Problem der Iteration. Betrachten wir zu-
nchst das satzeinbettende nicht, das wir oben
eingefhrt haben. Es sollte nicht allzu schwie-
rig sein, einzusehen, da [[]] und [[nicht-
nicht-]] dieselbe Relation sind. Diese Tatsa-
che wurde in Structured Meanings (Cresswell
1985 b: 170) dazu benutzt, zu zeigen, da
entgegen Barwise und Perrys Behauptung
die Situationssemantik das Problem logisch
quivalenter Stze nicht immer lst; aber zu-
mindest bedeutet dies, da kein Problem fr
die Semantik der doppelten Satznegation be-
steht. neg dagegen verhlt sich anders. Was
wre denn die doppelte Negation in einer
Situation e? Wir htten
e
1
:= an l: neg, e; ja
e
2
:= an l: neg, e
1
; ja
Wahrheitswerte ihrer Konstituenten einfach
vertauscht. Es ist aber leicht einzusehen, da
dies nur das Kontrre einer Situation ergbe,
nicht aber das zu ihr Kontradiktorische: Sei
e die Situation von Mollies Bellen und Schla-
fen. Eine Umpolung der Wahrheitswerte in e
ergbe die Situation e, in der Mollie nicht
bellt und nicht schlft. Das Kontradiktorische
von e ist aber vielmehr die Situation von
Mollies entweder Nicht-Bellen oder Nicht-
Schlafen. Es gengt, den Wahrheitswert nur
einer Konstituenten umzupolen. Und die
Schwierigkeit besteht daraus, da man dies
auf mehr als eine Weise machen kann, es sei
denn, die Situation besteht aus nur einer Kon-
stituenten. Bei Situationen, die nur aus einer
Konstituenten bestehen, gibt es natrlich
keine Probleme. Die Negation von
(a) an l: r, a
1
, ..., a
n
; ja
ist einfach
(b) an l: r, a
1
, ..., a
n
; nein
und umgekehrt. Das ist nun tatschlich die
einzige Negation, die Barwise und Perry zu-
lassen, und ich mu gestehen, da ihr Stand-
punkt ein wesentlich festeres Band zwischen
Sprache und Ontologie schmiedet, als ich fr
vertretbar halte. Wenn nmlich berhaupt
nur solche Situationen negiert werden kn-
nen, die aus einer einzigen Konstituente, die
eine atomare Relation involviert, bestehen,
dann hngt die Antwort auf die Frage, ob
eine Aussage negiert werden kann, davon ab,
ob sie eine solche Situation beschreibt oder
nicht. Barwise und Perry behaupten, sie
wten, wann das der Fall sei. Zum Beispiel
behaupten sie auf S. 76, da es zwar die
atomaren Eigenschaften, mde zu sein, hung-
rig zu sein und ein Philosoph zu sein, gibt,
da aber kein Grund fr die Annahme be-
steht, da es die atomare Eigenschaft, ein
mder, hungriger Philosoph zu sein, gibt.
Whrend es also fr eine gegebene Person
und Lokation jeweils einzelne Situationen des
Hungrigseins, des Mdeseins und des Philo-
sophseins und ebenso einzelne Situationen des
Nicht-Mdeseins, des Nicht-Hungrigseins
und des Nicht-Philosophseins gibt, und wh-
rend es sogar eine einzelne Situation, ein
hungriger, mder Philosoph zu sein, gibt, gibt
es keine Situation, kein hungriger, mder Phi-
losoph zu sein. Demnach gibt es kein Prdi-
kat, welches
ist kein mder, hungriger Philosoph
bedeutet! Was mich angeht, so finde ich es
5. Die Weltsituation 75
positionen in Propositionen. Der Grund dafr
liegt in ihrer Einstellung zur Mengenlehre. In
jeder Mengenlehre, die diese Unterscheidung
zult, sind Mengen die Klassen, die klein
genug sind, um Elemente von anderen Klas-
sen zu sein, und echte Klassen sind zu gro,
als da dies passieren knnte. Aber trotzdem
knnen Mengen in der Standardmengenlehre
sehr gro sein; sicher gibt es Mengen von
transfiniter Mchtigkeit, und ihre Verwen-
dung stellt fr die Mgliche-Welten-Semantik
in aller Regel kein Problem dar. Aber Barwise
und Perry mgen nur kleine Mengen. Auf
S. 52 schreiben sie: Alles, was wir ber Men-
gen sagen, stimmt, wenn man es auf endliche
Mengen von Grundbegriffen, endliche Men-
gen dieser Mengen, usw. anwendet. Es zeigt
sich, da das der Grund dafr ist, da sie
Propositionen nicht mgen, denn es stellt
sich heraus, da die Interpretation einer
uerung die realistische Proposition, die
sie bezeichnet eine echte Klasse ist
(S.178). Sicherlich werden die Mengen von
Welten, welche die meisten Propositionen bil-
den, unendlich sein. Wenn eine Proposition
eine einzelne Situation ist, dann ist sie
entgegen dem, was Barwise und Perry sagen
vielleicht nicht unendlich; wenn aber die
Negation eine Funktion sein soll, deren De-
finitionsbereich die Klasse aller Propositionen
ist, dann mte diese Funktion sicherlich un-
endlich sein. Die Frage, wie man Semantik
mit einer sehr schwachen Mengenlehre be-
treiben kann, ist meiner Ansicht nach von
vitalem Interesse. Ein Gleiches gilt fr die
Frage, ob man das auch tun sollte, und wenn
ja, warum. Es ist eine unglckliche Praxis der
Situationssemantik, da diese Frage mit einer
groen Menge von anderen Fragen vermengt
worden ist, wie etwa der Frage, welche
Grundbegriffe man verwenden soll, oder
warum die Sprachphilosophie seit Frege und
Russell vllig fehlgelaufen ist. Die Frage nach
den angemessenen Grenzen der mengentheo-
retischen Konstruktionen kann und sollte ge-
stellt und diskutiert werden, und zwar fr
jeden semantischen Ansatz. Ich wre der al-
lererste, der mehr Licht in diesem Bereich
begren wrde.
3.3Die Unvollstndigkeit von
Propositionen und Situationen
Ich habe bisher zu zeigen versucht, da die
Situationen die Rolle von Propositionen ber-
nehmen knnen, wenn auch nicht problemlos.
Die Motivation fr diese Rollenzuweisung ist
die, da Situationen partiell oder unvollstn-
Jetzt kommt das Problem: e
1
ist eine Menge
von Konstituenten, von denen eine neg ent-
hlt, und doch ist auch e
1
selbst Argument
von neg. Wenn die Relationen mengentheo-
retisch konstruiert wren, dann wrde dies
dem Fundierungsaxiom widersprechen. Bar-
wise und Perry behandeln Relationen als
Grundbegriffe. Damit ist nicht klar, was sie
auf diesen Einwand antworten wrden, zumal
sie keine Theorie fr Relationen entwickeln,
die mit der normalen Mengenlehre vergleich-
bar wre.
Auch die Disjunktion knnen wir als Re-
lation zwischen Situationen behandeln. Die
Disjunktion von e
1
und e
2
ist
e
3
:= an l: oder, e
1
, e
2
; ja
wobei l die kleinste Lokation ist, welche die
Lokationen von e
1
und e
2
umfat. Diese Dis-
junktion leidet zwar noch am Iterationspro-
blem, aber wie neg erhlt sie die Erzeugungs-
eigenschaft.
3.2Propositionen und groe Mengen
Ich bin bisher davon ausgegangen, da Situa-
tionen in der Situationssemantik die Rolle
spielen, welche in traditionellen Theorien den
Propositionen zukommt ob sie als Mengen
von mglichen Welten aufgefat werden oder
nicht. In diesen traditionelleren Theorien ist
das Problem der Negation einfach. Die Be-
deutung der Negation wre eine Funktion,
die etwa aus der Proposition, da Perry ein
mder, hungriger Philosoph ist, die Proposi-
tion, da Perry kein mder, hungriger Phi-
losoph ist, macht. Nach wie vor bleibt aller-
dings das Problem bestehen, zu entscheiden,
was das ist. Richmond Thomason hat vor
kurzem vorgeschlagen, Propositionen als
Grundbegriffe anzusehen, zumindest fr die
Zwecke der Logik und Semantik. Ich selbst
bin vor zwanzig Jahren ebenso verfahren.
Aber Barwise und Perry wren mit keiner
Analyse der Negation zufrieden, die deren
Bedeutung zu einer Funktion von Propositio-
nen in Propositionen macht. Sie haben viel-
mehr eine herablassende Einstellung zu Pro-
positionen. Auf S. 178 nennen sie diese ein
Artefakt der semantischen Anstrengungen,
whrend selbstverstndlich ihre eigenen
Grundbegriffe alles reale Dinge sind. (Es
berrascht nicht, da einer ihrer liebsten Bei-
spielstze Ich habe recht; du hast Unrecht
ist.) Sie wrden zum Beispiel auch eine Ei-
genschaft nicht als Funktion von Dingen in
Propositionen behandeln, oder die Bedeutung
einer Satzkonjunktion als Funktion von Pro-
76 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
bin. In einer Hinsicht ist es einfach, sich vor-
zustellen, wie das aussehen soll, denn die Pro-
position, die durch (1) in einem Kontext aus-
gedrckt wird und welche in der Mgliche-
Welten-Semantik die Klasse der Welten ist, in
denen (1) wahr ist, hat gerade diese Eigen-
schaft. Jedes Element der Klasse ist entweder
eine Zuhause-Welt oder eine Universitts-
Welt, aber es ist nicht wahr, da jedes Element
eine Zuhause-Welt ist, und es ist nicht wahr,
da jedes Element eine Universitts-Welt ist.
Die Proposition ist unvollstndig.
Die Schwierigkeit, Situationen auf diese
Weise zu betrachten, liegt darin, da sie rger
macht, wenn man sie mit Barwise und Perrys
klassischer Semantik fr oder kombiniert. Es
ist klar, da (1) dieselbe Bedeutung hat wie
(2) Entweder bin ich morgen zwischen 9 und
12 zuhause, oder ich bin morgen zwischen
9 und 12 in derUniversitt.
Und es ist weiter klar, da (2) eine Satzdis-
junktion ist. Wie wir gerade gesehen haben,
ist Barwise und Perrys Semantik fr das Wort
oder die klassische wenn die kontextuellen
Merkmale einmal festgelegt sind. Demzufolge
beschreibt (2) in einem Kontext u, der alle
Denotate liefert, eine Situation e genau dann,
wenn entweder
(3) Ich bin morgen zwischen 9 und 12 zu-
hause
die Situation e beschreibt, oder wenn
(4) Ich bin morgen zwischen 9 und 12 in der
Universitt
e beschreibt. Das aber bedeutet, da e nicht
in demselben Sinne unvollstndig ist, in dem
die Menge der Welten, in denen (1) wahr ist,
unvollstndig ist. Die Unvollstndigkeit der
Proposition, die durch (1) ausgedrckt wird,
entsteht dadurch, da (1) nicht durch mein
Zuhausesein wahr gemacht werden mu
(denn ich knnte in der Universitt sein),
noch mu (1) durch mein In-der-Universitt-
Sein wahr gemacht werden (weil ich zuhause
sein knnte).
Aber nehmen wir an, eine Situation htte
die Art von Unvollstndigkeit, die eine Pro-
position hat. Sei e eine Situation, in der ein
bestimmtes Eisenbahnsignal in Betrieb ist.
Angenommen, es ist ein Zweifarbensignal,
das heit, wenn es in Betrieb ist, zeigt es
entweder Rot oder Grn an. Jetzt stelle ich
mir jemand vor, der fragt: Wenn du sagst,
da es in Betrieb ist, meinst du dann blo,
da es Rot oder Grn anzeigt, oder meinst
du, da es den Zustand der Strecke korrekt
dig sind. Wenn wir aber gewisse andere Dinge
betrachten, die Barwise und Perry von Situa-
tionen verlangen, dann zeigt es sich, da die
Frage der Vollstndigkeit mitnichten so klar
liegt, wie es zunchst scheint. Ein Teil des
Problems besteht darin, wie
u [[]] e
zu verstehen ist. Dieser Ausdruck ist zu lesen:
Im Kontext u beschreibt die Situation e.
Bisher habe ich so getan, als sei e die Pro-
position, die im Kontext u ausdrckt. Aber
man kann sich eine Situation ebenso gut als
eine mgliche Welt vorstellen, so da u [[]] e
dann eher zu lesen ist als: Bezglich des
Kontexts u ist wahr in e. Was ich nun
zeigen mchte, ist, da Barwise und Perrys
Haltung gegenber der Disjunktion zu
Schwierigkeiten fhrt, falls wir uns die Be-
deutung eines Satzes als eine einzelne Situa-
tion vorstellen; ferner, da ihre Behandlung
der Disjunktion erfordert, da man Situatio-
nen als Welten rekonstruiert. Damit wrde
die Situationssemantik zu einer Version der
Mgliche-Welten-Semantik.
In der Mgliche-Welten-Semantik sind
Propositionen Mengen von Welten. In diesem
Rahmen ist es ziemlich einfach zu definieren,
was es fr eine Proposition bedeuten soll,
unvollstndig oder partiell zu sein. Angenom-
men ich sage zu dir:
(1) Morgen vormittag zwischen 9 und 12 Uhr
bin ich entweder zuhause oder in der Uni-
versitt.
Wenn der Kontext einmal den Sprecher, das
Datum und was sonst noch gebraucht werden
knnte, geliefert hat, zerfallen die mglichen
Welten in zwei Klassen, nmlich in jene, in
denen (1) wahr ist, und in jene, in denen (1)
falsch ist. Unter den Welten, in denen (1) wahr
ist, knnen sehr wohl welche sein, in denen
ich an beiden Orten bin, wenn auch vermut-
lich nicht zur selben Zeit, aber es wird sicher
einige Welten geben, in denen ich an dem
einen Ort bin, nicht aber an dem anderen.
Satz (1) ist in einem gewissen Sinn unvoll-
stndig: Er kann auf verschiedene Arten wahr
gemacht werden. Dies ist der Sinn, in dem
eine Proposition unvollstndig ist, und wenn
eine Situation etwas wie eine Proposition ist
und eine Situation in dieser Weise unvollstn-
dig wre, dann mten wir eine einzelne Si-
tuation haben, die durch (1) beschrieben wird,
welche die Situation meines Zuhause-oder-
an-der-Universitt-Seins ist, ohne eine Situa-
tion zu sein, in der ich zuhause bin, oder eine
Situation zu sein, in der ich in der Universitt
5. Die Weltsituation 77
wir weiter, wenn wir uns die obige Argumen-
tation genauer ansehen. Denn der entschei-
dende Punkt bei der Situation e, in der das
Signal in Betrieb ist, ist der, da man eine
solche Situation nicht haben kann, ohne zu-
gleich eine rot-anzeigende Situation oder eine
grn-anzeigende Situation zu haben. Wenn
man sie haben knnte, dann wre die Un-
vollstndigkeit von e sehr radikaler Natur. Es
wrde dann nmlich zum Wesen von e ge-
hren, da e in einer der beiden Weisen ver-
vollstndigt werden mte. Ich werde eine
Situation wesentlich unvollstndig nennen,
wenn sie es erfordert, Teil einer Situation zu
sein, die zu einer Kollektion von spezifische-
ren Situationen gehrt. Die bisher durchge-
fhrte Argumentation zeigt, da keine Situa-
tion wesentlich unvollstndig sein kann.
4. Situationen als Welten
Wenn eine Situation nicht wesentlich unvoll-
stndig sein kann, auf welche andere Weise
kann sie dann unvollstndig sein? Ziehen wir
ein Beispiel aus Barwise und Perrys Arbeit
ber Einstellungen heran. Betrachte den Un-
terschied zwischen
(5) Fritz kam herein
(6) Fritz kam herein, und Sandra rauchte
oder nicht.
Barwise und Perry stellen sich die bloen
Infinitive, die (5) und (6) entsprechen, als
Objekte eines Verbs der Wahrnehmung vor,
wie etwa bei Sepp sah ... in (5 a) oder (6 a):
(5)
a. Sepp sah Fritz hereinkommen
(6)
a. Sepp sah Fritz hereinkommen und
Sandra rauchen oder nicht rauchen.
Sie betonen, da (5) und (6) obwohl logisch
quivalent dennoch verschiedene Situatio-
nen beschreiben. Denn (5) erwhnt Sandra
berhaupt nicht es knnte sein, da es
berhaupt keine Person dieses Namens gibt.
Und (5 a) mu (6 a) sicherlich nicht implizie-
ren, denn wenn Sepp Fritz hereinkommen
sah, dann folgt daraus nicht, da er Sandra
irgendetwas hat tun sehen, rauchen oder nicht
rauchen sie knnte ja gar nicht dagewesen
sein, selbst wenn es eine solche Person gbe.
Im Falle von (6 a) behaupten Barwise und
Perry, da Sepp, um Sandra rauchen oder
nicht rauchen sehen zu knnen, sie entweder
rauchen oder nicht rauchen sehen mte, und
beide Aussagen implizieren wrden, da San-
dra anwesend wre und von Sepp gesehen
anzeigt? Die Antwort knnte lauten: Wenn
ich sage, da es in Betrieb ist, dann meine
ich, da es Rot oder Grn anzeigt. Sei nun
a ein Satz mit der Bedeutung, da das Signal
Rot anzeigt, und , da es Grn anzeigt.
Dann wird jede Situation, in der das Signal
in Betrieb ist, durch a oder beschrieben.
Wir nehmen aber an, da e eine Situation ist,
die dieselbe Art von Unvollstndigkeit auf-
weist wie die Proposition, da das Signal in
Betrieb ist. Das bedeutet aber, da e keine
Situation sein mu, in der das Signal Rot
anzeigt (denn es knnte eine sein, in der es
Grn anzeigt), noch mu es eine Situation
sein, in der das Signal Grn anzeigt (denn es
knnte eine sein, in der es Rot anzeigt). Und
dies ergibt einen Widerspruch. Denn a oder
beschreibt e, und das kann nur so sein,
wenn a die Situation e beschreibt, oder wenn
es tut. Wenn aber a die Situation e be-
schreibt, dann ist e eine Situation, in der das
Signal Rot anzeigt, und wenn die Situation
e beschreibt, dann ist e eine Situation, in der
das Signal Grn anzeigt.
Oder betrachten wir ein Beispiel, das nher
an denen von Barwise und Perry liegt eine
Situation, in der Mollie bellt. Ich habe oben
gezeigt, da, wenn e* genau die Situation von
Mollies Bellen an l ist, dieses e* auch geeignet
wre, die Proposition, da Mollie an l bellt,
darzustellen und damit die Bedeutung eines
einschlgigen Satzes sein knnte. Aber natr-
lich wird Mollie in jeder Situation, in der sie
bellt, entweder laut oder leise bellen. Folglich
scheint es so zu sein, da man keine Situation
e haben kann, in der Mollie einfach nur bellt.
Situationen knnen unvollstndig sein, aber
es sieht so aus, als knnten sie nicht allzu
unvollstndig sein. Sie knnen nicht so un-
vollstndig wie Propositionen sein.
Die hier angefhrte Argumentation hat
von einer Situation Gebrauch gemacht, die
auf genau zwei Weisen spezifisch gemacht
werden konnte; es ist aber nicht schwer, ein-
zusehen, da dasselbe Resultat aus einer Si-
tuation folgt, die auf endlich viele Weisen
spezifisch gemacht werden mu. Was schlie-
lich eine Situation betrifft, die auf eine von
unendlich vielen Weisen spezifisch gemacht
werden mu, kann nicht durch eine unendli-
che Disjunktion dargestellt werden weil es
in der natrlichen Sprache keine gibt aber
es scheint unvernnftig, allein daraus einen
prinzipiellen Unterschied herleiten zu wollen.
Wenn also Situationen nicht in dem Sinne
unvollstndig sein knnen, in dem Proposi-
tionen es sind, welche Art von Unvollstndig-
keit knnen sie dann haben? Hier kommen
78 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
Propositionen, die in der kleineren Welt wahr
sind, die aber aufhren, wahr zu sein, wenn
die Welt erweitert wird. Es knnte wahr sein,
da Fred die einzige Person im Raum in der
kleineren Welt ist; dies ist aber nicht mehr
wahr, sobald die rauchende oder nicht-rau-
chende Sandra angekommen ist. Eine Weise,
eine Welt zu erweitern, besteht darin, da man
einfach mehr Dinge hinzunimmt, die gewisse
Eigenschaften haben und in gewissen Bezie-
hungen stehen. Situationen, die Kollektionen
von Konstituenten sind, knnen in der nor-
malen mengentheoretischen Weise erweitert
werden, und Aussagen, die ihren Wahrheits-
wert unter solchen Erweiterungen beibehal-
ten, werden von Barwise und Perry persistent
genannt.
Barwise und Perry benutzen den Unter-
schied zwischen (5) und (6), um ein Argument
hochzuziehen, da in der Situationssemantik
die Ersetzung von logisch quivalenten St-
zen nicht gilt. Da ich argumentiere, da Si-
tuationen Welten sind, mu ich zeigen, was
mit diesen beiden Stzen geschieht, wenn Si-
tuationen Welten sind, denn es wird als ein
Mangel der Mgliche-Welten-Semantik be-
trachtet, da sie die Ersetzung von logisch
quivalenten Stzen zult. Obwohl Propo-
sitionen in der Mgliche-Welten-Semantik
normalerweise als Klassen von Welten ange-
sehen werden, mit der Konsequenz, da jede
Welt entweder in einer gegeben Proposition
ist oder nicht, knnte man sie stattdessen als
Funktionen von mglichen Welten in Wahr-
heitswerte auffassen. Das wrde die Mglich-
keit erffnen, da eine Proposition fr ge-
wisse Welten nicht definiert ist, und damit fr
diese Welten berhaupt keinen Wahrheitswert
hat. Nun besteht laut Barwise und Perry der
Unterschied zwischen (5) und (6) darin, da
(5) Situationen beschreiben kann, die Sandra
berhaupt nicht enthalten, wogegen (6) das
nicht kann. Die einfachste Art, dies zu ver-
stehen d. h. die klassische Semantik fr
oder beizubehalten und dennoch die qui-
valenz von (5) und (6) verwerfen zu wollen
scheint die folgende zu sein: Wir lassen
(7) Sandra rauchte
undefniert fr Welten, in denen es keine der-
artige Person gibt, und lassen (6) diese Eigen-
schaft erben. Damit gibt es zwar keine Welten,
in denen (5) und (6) unterschiedliche Wahr-
heitswerte haben, dagegen kann es sehr wohl
Welten geben, in denen (5) einen Wert hat,
(6) aber nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher,
ob ich dies fr den besten Weg halte, das
wrde. In der Terminologie der Unvollstn-
digkeit ist jede Situation, die (6) genau be-
schreibt (d. h. jede Situation, die nicht mehr
und nicht weniger ist, als (6) beschreibt), we-
sentlich unvollstndig, indem sie danach ver-
langt, entweder zu einer Situation erweitert zu
werden, in der Sandra raucht, oder zu einer
Situation, in der sie nicht raucht. Nun mag
auch (5) (wie Mollies Bellen) wesentlich un-
vollstndig sein, aber nicht auf dieselbe Weise
wie (6). Nehmen wir nmlich einmal an, es
gbe niemand wie Sandra. Dann mte eine
Situation, die (5) beschreibt, nicht auf dieselbe
Weise erweitert werden wie (6). Dennoch
knnte eine solche Situation in einer bestimm-
ten Hinsicht als unvollstndig beschrieben
werden. Stellen wir uns dazu vor, da Fritz
hereinkme. In gewissem Sinne ist es logisch
mglich, da dies alles ist, was passiert. Nun,
vielleicht nicht ganz alles. Vermutlich mu
Fritz ein Ding oder eine Person mit einigen
bestimmten Eigenschaften sein. Aber sie ms-
sen nichts ber Sandra beinhalten. Wir wollen
das so ausdrcken: Wenn e eine Situation ist,
die durch (5) im Kontext beschrieben wird,
dann knnte e zwar zu einer Situation erwei-
tert werden, in der Sandra raucht, oder zu
einer, in der sie nicht raucht, aber sie mu
nicht derart erweitert werden. Sie knnte alles
sein, was es gibt. Und damit sind wir endlich
bei der zentralen Behauptung dieses Beitrags.
Wenn e schon alles sein knnte, was es gibt,
dann knnte e eine mgliche Welt sein. Und
alles, was eine mgliche Welt sein knnte, ist
eine mgliche Welt. Mit anderen Worten: Si-
tuationen sind Welten. Und hier kommen wir
zu einem Punkt, den Hintikka in seinem
Kommentar zum Artikel von Barwise (1981 a)
im Journal of Philosophy angesprochen hat.
Warum mssen wir annehmen, da Welten
groe Dinge sind? Die wirkliche Welt ist zwei-
fellos ein groes Ding aber es gibt sicher-
lich keinen logischen Grund, auszuschlieen,
da es nur einige wenige Objekte geben
knnte, die nur ein paar Eigenschaften haben
und in nur wenigen Relationen zueinander
stehen. Wie klein eine Welt sein kann, ist eine
metaphysische Frage, auf die ich keine Ant-
wort wei. Alles was ich behaupte, ist, da
sie so klein sein kann wie eine von Barwise
und Perrys Situationen.
Manche Welten sind Teile von anderen.
Eine Welt ohne Sandra kann zu einer Welt
mit einer rauchenden Sandra oder zu einer
Welt mit einer nicht-rauchende Sandra erwei-
tert werden. Das ist natrlich eine sehr irre-
fhrende Art der Darstellung, denn es gibt
5. Die Weltsituation 79
geben, aufzeigen. Wenn Situationen so etwas
wie spezielle Individuen sind, dann mssen sie
in gewisser Weise vollstndig sein. Angenom-
men, a sei so ein spezielles Individuum. Dann
mchte ich behaupten, da es fr eine Welt
mglich sein mu, genau dieselben Individuen
wie eine Welt mit a zu enthalten und dennoch
eine Welt ohne a zu sein. Natrlich wrden
die verbleibenden Individuen nicht mehr in
Relationen zu a stehen, wie sie es jetzt tun,
und sie knnten deshalb andere Eigenschaf-
ten haben als die, die sie jetzt haben, aber es
gibt kein Individuum, dessen Existenz logisch
von der Existenz eines anderen Individuums
abhngt.
In hnlicher Weise sollte auch eine Situa-
tion als ein selbstndiges Objekt einer be-
stimmten Wahrnehmung eine Szene, wie
Barwise sie in seinem Artikel ber Perzeption
nennt etwas sein, das fr sich existieren
kann, als etwas, das als Teil entweder Ortcutts
Verstecken des Briefs oder Hortcutts Verstek-
ken desselben enthlt.
Es gibt viele, die bloe Infinitivkonstruk-
tionen als Relationen zwischen Personen und
Ereignissen ansehen wrden. Und viele von
diesen wrden die Ereignisse als individuelle
Einzeldinge betrachten wollen. Diejenigen,
die das tun, wrden beinahe mit Sicherheit
disjunktive Ereignisse verwerfen. Sie wrden
sagen, man knne nur dann ein Ereignis des
-ens oder -ens haben, wenn dieses entweder
ein Ereignis des -ens oder ein Ereignis des
-ens sei. Im Falle des Bahnsignals: Falls es
tatschlich Rot anzeigen wrde, dann wre
sein In-Betrieb-Sein einfach sein Rot-Anzei-
gen, und wenn es Grn anzeigen wrde, dann
wre sein In-Betrieb-Sein sein Grn-Anzei-
gen. Der Grund dafr ist der, da man keine
Ereignisse haben kann, die in dem oben de-
finierten Sinne wesentlich unvollstndig sind.
Da man kein Ereignis des -ens oder -ens
haben kann, ohne da es ein Ereignis des -
ens oder ein Ereignis des -ens ist, kann
Ralph auch kein solches Ereignis sehen, ohne
ein -en zu sehen oder ein -en zu sehen.
Diese Betrachtung bloer infinitivischer Stze
mag richtig oder falsch sein; aber keiner ihrer
Verteidiger mu annehmen, da Ereignisse
die Bedeutungen von Stzen sind, und ich
vermute, da die meisten von ihnen das auch
nicht annehmen wrden. Die Art der Un-
vollstndigkeit, welche Satzbedeutungen zu-
kommt, ist in aller Regel die wesentliche Un-
vollstndigkeit. Wenn zum Beispiel jemand
bei mir eingebrochen hat, dann mu es eine
bestimmte Person gewesen sein, die das zu
Problem zu behandeln, aber die Methode lie-
fert zumindest eine Lsung, die mit der Be-
handlung von Situationen als Welten vertrg-
lich ist.
Das Argument, das ich gegen wesentlich
unvollstndige Situationen entwickelt habe,
hngt entscheidend von der Semantik ab, die
Barwise und Perry fr oder angeben. Im Rest
dieses Artikels werde ich zeigen, da diese
Semantik in keinster Weise eine isolierte
Eigenart ist, die ohne substantielle nderun-
gen des gesamten theoretischen Rahmens mo-
difiziert werden knnte.
5. Situationen als Ereignisse
Die Semantik fr oder, die Barwise und Perry
bereitstellen, spielt eine Schlsselrolle fr die
Begrndung eines Schlusses, dessen Gltig-
keit fr bloe Infinitivkonstruktionen sie be-
haupten. Auf S. 182 ist ihr Beispiel der Schlu
von (8) auf (9):
(8) Ralph sah Ortcutt oder Hortcutt den
Brief verstecken
(9) Ralph sah Ortcutt den Brief verstecken
oder Ralph sah Hortcutt den Brief ver-
stecken.
Ihre Semantik fr sehen, auf das ein bloer
Infinitiv folgt (nicht aber ein da-Satz) be-
hauptet eine Relation zwischen einem Subjekt
und einer Situation. Angenommen nun, (8)
sei wahr. Was Ralph dann sieht, ist eine Si-
tuation, in der entweder Ortcutt oder Hort-
cutt den Brief versteckt. Nach der Semantik
fr oder mu dies entweder eine Situation
sein, in der Ortcutt den Brief versteckt, oder
eine, in der Hortcutt das tut. Damit sieht
Ralph eine dieser Situationen, und das ge-
ngt, um (9) zu sttzen.
Tatschlich sieht man, selbst wenn man
sich nicht mit der Semantik fr oder genauer
auseinandersetzt, da Barwise und Perrys
Auffassung von perzeptionellen Stzen we-
sentlich unvollstndige Stze ausschliet.
Dies ist so, weil sie sich Situationen als Ein-
zeldinge vorstellen. Was Ralph in jeder Situa-
tion sieht, die (8) beschreibt, ist eine be-
stimmte Situation, etwas, was tatschlich vor
seinen Augen liegt. Ich fr meinen Teil bin
nicht davon berzeugt, da Perzeption so
stattfindet. Vielmehr glaube ich, da Stze
ber Wahrnehmungsstze ein groes Stck
Intensionalitt mit beinhalten. Aber das ge-
hrt nicht hierher, und ich mchte lediglich
einige der Konsequenzen, die sich aus dem
individuellen Charakter der Situationen er-
80 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
handeln versucht hat. Es gibt mgliche Wel-
ten, die individuell und vollstndig sind und
bezglich derer die Wahrheit bestimmt wird.
Dann gibt es Propositionen Klassen von
Welten , die in logischen Relationen zuein-
ander stehen und die Bedeutungen von Stzen
im Kontext sind. Propositionen hnlich sind
Eigenschaften und Relationen. Schlielich
gibt es individuelle Einzeldinge, zu denen
manche auch die Ereignisse zhlen mchten.
Ich haben zu zeigen versucht, da man Situa-
tionen als Entitten von jeder dieser Arten
ansehen kann. Wenn man dies tut, knnte
man unter Umstnden eine Semantik erhal-
ten, die ebenso gangbar ist wie traditionellere
Anstze. Die Probleme treten auf, wenn man
versucht, dieselbe Art semantischer Entitten
fr alle drei Aufgaben zu verwenden. Un-
glcklicherweise besteht die Originalitt der
Situationssemantik gerade in diesem Versuch.
7. Literatur (in Kurzform)
Barwise 1981 a Barwise/Perry 1983 Cresswell
1985 a Cresswell 1985 b
M. J. Cresswell, Wellington (New Zealand)
(bersetzt aus dem Englischen
von Arnim von Stechow)
einem bestimmten Zeitpunkt mit bestimmten
Werkzeugen tat. Aber es gibt nichts in der
Bedeutung des Satzes
(10) Jemand hat bei mir eingebrochen,
was mir diese Dinge erzhlt. Genauso wie es
nichts in (1) gibt, was dir sagt, ob ich zuhause
oder in der Universitt sein werde. Somit
scheint es kein Zufall zu sein, da die we-
sentliche Unvollstndigkeit ein Auf keinen
Fall! fr Situationen ist. Aber sie scheint das
Resultat eines Irrtums zu sein, nmlich das
Ergebnis des Wunsches, da die Entitten,
die durch bloe Infinitivstze bezeichnet wer-
den, dieselben sind wie die von Stzen be-
zeichneten. Wenn wir Situationen nur fr
bloe Infinitive verwenden, dann werden sie
wie Ereignisse. Das gibt uns die Freiheit, tra-
ditionellere Entitten als Werte von Stzen zu
benutzen.
6. Schlu
In der Bewertung der Situationssemantik als
eines Konkurrenten zur Mgliche-Welten-Se-
mantik komme ich zu folgendem Ergebnis: In
der Mgliche-Welten-Semantik gibt es Enti-
tten von mindestens dreierlei Art, welche die
Situationssemantik als eine einzige Art zu be-
6. Situationen und kleine Welten
genberstellungen von Situationssemantik
und Mgliche-Welten-Semantik finden sich
als Hauptgegenstand oder Nebenaspekt
in den Aufstzen Barwise & Perry (1980),
Barwise (1981 b), Barwise & Perry (1985),
Perry (1986), Barwise (1986 a), Barwise
(1986 b) und Cooper (1987).
Zunchst eine Binsenwahrheit: Ein Aussa-
gesatz kann dazu benutzt werden, eine Aussage
zu machen, das heit, eine Behauptung, da die
reale Welt (oder ein Teil davon) so oder so
geartet ist. Die Mgliche-Welten-Semantik
und die Situationssemantik sind sich darin
einig, da ein Verstndnis des behauptenden
Gebrauchs von Aussagestzen grundlegend
fr ein Verstndnis ihrer Bedeutung ist. Fol-
gerichtig wird denn auch in beiden Anstzen
versucht, aus dieser Binsenwahrheit eine ma-
thematisch przise, philosophisch vertretbare
1. Vorbemerkungen
2. Die Grundbegriffe der beiden Theorien
3. Die wirkliche Welt und ihre Tatsachen
4. Weltausschnitte
5. Effizienz, Kontext und die relationale Bedeu-
tungstheorie
6. Propositionen und Situationen
7. Schlu
8. Literatur (in Kurzform)
1. Vorbemerkungen
In diesem Artikel mchte ich drei Dinge zu-
gleich tun: Ich mchte eine kurze Einfhrung
in die Situationssemantik geben, die Situa-
tionssemantik mit der Mgliche-Welten-Se-
mantik vergleichen und auf einige Punkte der
Kritik eingehen, die Cresswell (in Artikel 5)
an der Situationssemantik bt. Andere Ge-
6. Situationen und kleine Welten 81
zugrundelege, ist die klassische, wie sie von
der Mgliche-Welten-Semantik als einer Se-
mantik fr Modaloperatoren und natrliche
Sprache verkrpert wird. Die grundlegenden
Annahmen, von denen man hier ausgeht, sind
die folgenden:
1. Die Grundbegriffe der Theorie sind in-
dividuelle Einzeldinge und mgliche Welten.
Alles andere wird durch mengentheoretische
Objekte dargestellt, die daraus aufgebaut wer-
den knnen.
2. Es gibt eine bestimmte Welt w
0
, die wirk-
liche Welt, welche die Grundtatsachen fest-
legt. Diese Tatsachen definieren gewisse
Grundalternativen [basic issues] in einem
Mglichkeitsraum, z. B. welche Eigenschaf-
ten verschiedene Dinge (oder Folgen von Ob-
jekten) haben oder nicht haben.
3. Es gibt eine Menge W aller mglichen
Welten mit w
0
W. Die von w
0
verschiedenen
Welten w in W entsprechen den anderen Wei-
sen, wie die Grundalternativen des Mg-
lichkeitsraumes htten ausfallen knnen.
4. Der primre semantische Wert, der
einem Aussagesatz S zugewiesen wird, ist eine
Proposition p
S
. Propositionen sind Funktio-
nen von mglichen Welten in Wahrheitswerte
(oder knnen damit identifiziert werden).
Eine Proposition p ist genau dann wahr, wenn
p(w
0
) = T (T wie true).
Ich mchte dem die Grundannahmen der
Situationssemantik gegenberstellen. Dabei
formuliere ich diese Grundkonzepte so, da
sie sowohl mit Barwise & Perry (1983) als
auch mit den neuesten Arbeiten zur Situa-
tionssemantik vertrglich sind, die von der in
Barwise & Perry (1983) eingenommenen Po-
sition zum Teil abweichen.
1. Die Grundbegriffe der Theorie sind in-
dividuelle Einzeldinge (die sowohl die nor-
malen Dinge umfassen, wie auch Situationen,
einschlielich Ereignisse und raum-zeitliche
Lokationen), ferner Eigenschaften und Rela-
tionen. Somit werden Eigenschaften und Re-
lationen nicht mengentheoretisch dargestellt,
sondern sind Grundbegriffe.
2. Es gibt eine einzige Welt w
0
, die wirkliche
Welt, welche die Grundtatsachen festlegt,
nmlich welche Einzeldinge in welchen Bezie-
hungen zueinander stehen.
3. Zulssige Behauptungen sind solche ber
die wirkliche Welt oder ber Teile davon.
Diese Teile sind Situationen. Jeder einzelnen
Situation S entspricht die Menge von Tatsa-
chen, die in S der Fall sind. Im allgemeinen
wird die Menge der Tatsachen, die einer ge-
gebenen Situation zugeordnet ist, eine echte
und empirisch adquate Theorie der Bedeu-
tung zu entwickeln. Beide Anstze unterschei-
den sich jedoch in der Art ihres Vorgehens in
mindestens fnf wesentlichen Punkten:
1. Die Lcke, die zwischen dem Satz und
der Behauptung oder Feststellung, die damit
gemacht wird klafft, wird unterschiedlich be-
wertet. Die Mgliche-Welten-Semantik be-
trachtet sie als eine lstige Kleinigkeit, wh-
rend die Situationssemantik annimmt, da sie
ein zentraler Punkt der Bedeutung ist.
2. Die Strategien zur Behandlung von Ei-
genschaften und Relationen unterscheiden
sich. Die Mgliche-Welten-Semantik definiert
sie mengentheoretisch, whrend die Situa-
tionssemantik sie als Grundbegriffe ansieht.
3. Der Mglichkeit, Aussagen ber Teile
der Welt zu machen, wird unterschiedliche
Wichtigkeit zugemessen. Wie schon im ersten
Punkt nimmt die Mgliche-Welten-Semantik
sie als rgerliche Nebensache in Kauf, die
Situationssemantik betrachtet sie als zentral.
4. Die Mgliche-Welten-Semantik hlt den
Parameter fr die wirkliche Welt (oder fr
einen Teil davon) implizit in der semantischen
Reprsentation des Inhaltes einer Aussage,
wogegen ihn die Situationssemantik explizit
macht.
5. Die beiden Anstze verwenden ganz un-
terschiedliche Techniken, um das oben in der
Binsenwahrheit angesprochene so oder so
geartet sein zu klassifizieren. Die Mgliche-
Welten-Semantik klassifiziert es vermittels
Mengen von totalen mglichen Welten, wo-
gegen die Situationssemantik einen Kalkl
von Situationstypen (oder Eigenschaften von
Situationen) verwendet.
Jeder dieser fnf Unterschiede ist von gr-
ter Bedeutung und knnte Gegenstand eines
lngeren Aufsatzes sein. Anstatt einen Recht-
fertigungsversuch fr die der Situationsse-
mantik zugrundeliegenden Entscheidungen
zu unternehmen, mchte ich einen anderen
Weg einschlagen und zugrundeliegende An-
nahmen der beiden Theorien vergleichen, um
zu sehen, wie sich die obigen Unterschiede
daraus ergeben.
Was sind mgliche Welten? Wenn immer
man sich einem Raum von Mglichkeiten ge-
genbergestellt sieht, kann man die Mglich-
keiten mgliche Welten nennen, sogar wenn
dieser Raum lediglich das Ergebnis eines
Mnzwurfs ist. Sicher hat das auch schon
jemand getan. Offenbar brauchen wir einen
prziseren Begriff, wenn wir einen fruchtba-
ren Vergleich durchfhren wollen. Die Ver-
sion der Mgliche-Welten-Semantik, die ich
82 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
warum Cresswell dies meint. Zunchst sollen
hier einige gegenstzliche Grundannahmen
diskutiert werden.
2. Die Grundbegriffe der beiden
Theorien
Die Grundbegriffe der Mglichen-Welten-Se-
mantik sind Einzeldinge und Mgliche Wel-
ten. Alles weitere wird durch Objekte der
Mengenlehre dargestellt, die daraus gebaut
werden. Im Gegensatz dazu ist die Situations-
semantik einerseits grozgiger, andererseits
restriktiver in ihren Grundbegriffen. Sie hat
keine alternativen Welten, lt aber alle Arten
von Dingen als Objekte zu. Vor allem aber
sind Eigenschaften und Relationen als
Grundbegriffe zugelassen. Es wird nicht ver-
sucht, sie zu definieren oder durch irgendet-
was anderes mittels der Mengenlehre darzu-
stellen.
Diese unterschiedlichen Ausgangspunkte
sind wichtig. Man erinnere sich in diesem
Zusammenhang an die Behandlung von Ei-
genschaften. In der Logik erster Stufe benut-
zen wir Mengen (oder ihre charakteristischen
Funktionen), um Eigenschaften darzustellen,
und zwar indem wir die Menge der Dinge
whlen, welche die Eigenschaft haben, bzw.
die Funktion, die den Objekten, welche die
Eigenschaft besitzen, den Wert T und denen,
die sie nicht haben, den Wert F zuweist. Aber
das ist natrlich zu grobkrnig fr viele
Zwecke, einschlielich der semantischen Ana-
lyse der natrlichen Sprache. Die von der
Mgliche-Welten-Semantik gewhlte Strate-
gie besteht darin, Eigenschaften als Funktio-
nen von nicht analysierten mglichen Welten
in die Menge solcher charakteristischen
Funktionen darzustellen. Diese Strategie setzt
stillschweigend zwei Dinge voraus: Da es
nmlich erstens fr jede Welt w und Eigen-
schaft P eine Funktion F
P,w
gibt, die allen
Elementen des Bereichs aller Objekte den
Wert T oder F zuweist, je nachdem, ob das
Objekt die Eigenschaft in dieser Welt hat oder
nicht; und zweitens, da es fr zwei verschie-
dene Eigenschaften P
1
, P
2
zwei mgliche Wel-
ten w, und w
2
gibt, wo etwas die eine Eigen-
schaft hat, die andere aber nicht, so da F
P
1
w
1
F
P
2
w
2
.
Jede dieser beiden Annahmen ist von Be-
deutung. Die zweite luft auf das bekannte
Problem hinaus, da man zu der Konsequenz
gezwungen ist, da logisch quivalente Pr-
dikate dieselbe Eigenschaft ausdrcken. Wel-
Teilmenge der Menge aller Tatsachen von w
0
sein.
4. Genauso wie es Eigenschaften von und
Relationen zwischen anderen Einzeldingen
gibt, gibt es Eigenschaften von und Relatio-
nen zwischen Situationen, und Relationen
zwischen Situationen und anderen Einzeldin-
gen. Eine Eigenschaft von Situationen nennen
wir zuweilen einen Situationstyp. Da diese
Eigenschaften nicht extensional sind, gibt es
keinen Grund dafr, anzunehmen, da zwei
verschiedene Situationstypen Typen von ver-
schiedenen wirklichen Situationen sind. Auch
gibt es keinen Grund zu der Annahme, da
jeder Situationstyp Typ irgendeiner wirkli-
chen Situation ist. (In Barwise & Perry (1983)
entsprechen diesen Situationstypen die Ereig-
nistypen.)
5. Der primre semantische Wert, den ein
Aussagesatz erhlt, ist seine Bedeutung, eine
Relation U
S
D
S
zwischen dem Typ U
S
von
Situationen, in denen S behauptend geuert
wird, und dem Situationstyp D
S
, der damit
beschrieben wird. Eine zulssige behauptende
uerung u vom Typ U
S
ist wahr, falls die
Situation s
u
, von der u handelt, vom Typ D
S
ist. Der Informationsgehalt (oder die Inter-
pretation, wie wir in Barwise & Perry (1983)
gesagt haben) der uerung u ist, da s
u
vom
Typ D
S
ist.
In dieser allgemeinen Formulierung kann
die Theorie als ein Versuch betrachtet werden,
etwas Fleisch an die Wahrheitstheorie von J.
L. Austin zu bringen. In einer Hinsicht jedoch
weicht die Situationssemantik sowohl von
Austin als auch von der Mgliche-Welten-
Semantik ab. Sie versucht nmlich, eine all-
gemeine Theorie der Bedeutung zu formulie-
ren, innerhalb derer die Theorie der Bedeu-
tung natrlicher Sprachen als ein Spezialfall
hergeleitet werden kann. Sie beabsichtigt aber
auch, uns ein Verstndnis der Bedeutung der
mentalen Zustnde zu ermglichen. Die Be-
deutung eines mentalen Zustandes wird also
ebenfalls als eine Relation U D zwischen
Situationstypen angesehen.
Ich habe versucht, die Grundannahmen
beider Theorien derart einander gegenber-
zustellen, da die Unterschiede und hnlich-
keiten der Anstze deutlich werden. Ich hoffe,
da selbst diese kurze Zusammenfassung klar
macht, da die Situationssemantik keines-
wegs Situationen mit Propositionen ver-
mengt, wie das von Cresswell (in Artikel 5)
behauptet wird. Ich werde spter darauf zu-
rckkommen und Grnde dafr suchen,
6. Situationen und kleine Welten 83
ten-Semantik an die Existenz eines solchen
eindeutig bestimmten Raumes gebunden sei.
Mein Versuch, die Inkonsistenz der Mgliche-
Welten-Semantik zu beweisen, beruhte auf
dieser Annahme, wie Stalnaker (1984) ganz
richtig bemerkt. Grob gesagt war meine Ar-
gumentation etwa die folgende: Mit dieser
Annahme mte der Alternativenraum eine
echte Klasse sein und der Versuch, Mglich-
keiten durch Mengen mglicher Welten dar-
zustellen, folglich fehlschlagen.
Die Annahme eines solchen maximalen
Raumes scheint mir eine recht naheliegende
Konsequenz der Vorstellung Lewis zu sein,
Welten als alternative Realitten aufzufassen.
Jedoch legt Stalnaker (1984) dar, da es fr
den Mgliche-Welten-Semantiker keinen
Grund gibt, diesen Weg zu beschreiten. Wenn
man sich die mglichen Welten nur als eine
formale Technik zur Modellierung von alter-
nativen vollstndigen Weisen vorstellt, wie die
Welt htte sein knnen, und nicht als alter-
native konkrete Realitten, dann gibt es
nichts, was dagegen sprche, den ganzen tech-
nischen Apparat relativ zu einem bestimmten
Alternativenraum zu betrachten, so da
vollstndig im Sinne von vollstndig be-
zglich dieses gegebenen Raums von Alter-
nativen gemeint ist. Auf diese Weise, denkt
Stalnaker, sollten wir uns die Angelegenheit
vorstellen, und das scheint mir auch durchaus
vernnftig zu sein. So gesehen habe ich nichts
gegen die intuitive Vorstellung von mglichen
Welten einzuwenden und werde sie im folgen-
den auch so verwenden. (Ich mchte aller-
dings anmerken, da sich diese Vorstellung
von mglichen Welten nicht ganz mit dem
vertrgt, was Stalnaker und andere vor Augen
haben, wenn sie mit mglichen Welten arbei-
ten, insbesondere wenn es darum geht, Pro-
positionen darzustellen. Ich habe dies in Bar-
wise (1986 b) zu zeigen versucht.)
4. Weltausschnitte
Ich mchte nun noch kurz einige Grnde
dafr angeben, weshalb ich meine, da Situa-
tionen, also Weltausschnitte, die kleiner als
das Ganze sind, fr die Semantik wichtig sind.
Da sind zunchst die NI-Perzeptionswie-
dergaben wie Johannes sah Maria laufen
zu nennen, deren nchstliegende Analyse
darin besteht, da sie Teilstze enthalten,
die solche Ausschnitte beschreiben, und
zwar als in einer gewissen perzeptionellen
chen weiteren philosophischen Ballast diese
zweite Annahme mit sich fhrt, hngt davon
ab, was man sonst noch ber mgliche Welten
annimmt. Wenn man, wie Lewis, davon aus-
geht, da es sich dabei um wirkliche Dinge
handelt, alternative Wirklichkeiten, die aber
genauso real wie unsere eigene sind, dann
fhrt diese Annahme entweder zu einigen sehr
bizarren Wirklichkeiten, oder aber die Anzahl
der uns umgebenden Eigenschaften wird
ernsthaft beschnitten. Ein Beispiel: Entweder
es gibt Welten, in denen jemand ein Jungge-
selle, aber kein unverheirateter Mann ist (oder
umgekehrt), oder aber die Eigenschaft, ein
Jungeselle zu sein, ist die Eigenschaft ein un-
verheirateter Mann zu sein. Jede dieser An-
sichten zieht wohlbekannte Probleme nach
sich. Um aber nachzuvollziehen, wo Cresswell
fehlgeht, mssen wir uns die erste der beiden
Annahmen merken.
3. Die wirkliche Welt und ihre
Tatsachen
Wenn man vergleicht, wie sich die beiden An-
stze in Bezug auf Punkt (2) oben verhalten,
knnte es so scheinen, als ob die Mgliche-
Welten-Semantik und die Situationssemantik
in diesem Punkt bereinstimmen, so da wei-
ter nichts zu diskutieren wre. Aber die Dinge
liegen nicht so einfach. Der Inhalt von (2)
kann nmlich nicht unabhngig von dem
Mglichkeitsraum gesehen werden, den die
Welt festlegt. In der Mgliche-Welten-Seman-
tik wird angenommen, da der Raum durch
eine Menge von Individuen und eine Samm-
lung von Prdikaten bestimmt ist. Ein be-
liebiger Punkt im Raum wird bestimmt,
indem man ein n-stelliges Prdikat und eine
Folge von Individuen a
1
, ..., a
n
fixiert. Diese
Punkte in wurden von Perry (1986) Alter-
nativen [issues] genannt, weshalb ich als
den Alternativenraum bezeichnen werde. Fr
jede solche mgliche Alternative liefert uns
die wirkliche Welt eine Tatsache, indem sie
festlegt, ob die Objekte in dieser Relation
zueinander stehen oder nicht.
Die Situationssemantik geht davon aus
oder ist zumindest vertrglich mit der An-
nahme da es (bezglich eines gegebenen
Individuationssschemas, das durch eine ge-
gebene Population bestimmt ist) einen inten-
dierten, maximalen, ausgezeichneten Raum
von Alternativen gibt. Ich gebe zu, da ich in
meinen Anmerkungen in Barwise & Perry
(1985) davon ausging, da die Mgliche-Wel-
84 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
nachdachte. Ich habe ihn aus zwei Grnden
verworfen. Ich kam zu dem Schlu, da er (i)
nicht mit dem deskriptiven Grundansatz der
Mgliche-Welten-Semantik vertrglich ist
und da er (ii) auch nicht alle Situationen
liefert, die man braucht. Hier mchte ich zwei
weitere Grnde hinzufgen, die gegen diesen
Schritt sprechen. Der eine hat mit der Theorie
der Bedeutung zu tun, der andere mit seman-
tischen Paradoxien. Ich werde zuerst die er-
sten beiden Punkte diskutieren, um dann auf
die beiden letztgenannten zurckzukommen.
In bezug auf den ersten Punkt wre zu-
nchst zu sagen, da das Vorgehen der Mg-
liche-Welten-Semantik, Eigenschaften als
Funktionen von mglichen Welten in charak-
teristische Funktionen zu rekonstruieren, auf
zwei Annahmen beruht. Die erste ist, da eine
Welt w zusammen mit einem Prdikat oder
einer Eigenschaft P eine totale Funktion F
w,P
von in die Wahrheitswerte bestimmt. Ein
Augenblick des Nachdenkens zeigt jedoch,
da Cresswell gerade diese Annahme aufgibt,
indem er kleine Welten zult. Denn wenn w
eine kleine Welt ist, in der die Alternative, ob
P(a) gilt oder nicht, gar nicht zu den Alter-
nativen von
w
gehrt, dann mu F
w,P
(a)
undefiniert sein! Wenn man also tatschlich
kleine Welten zult, mu man die Behand-
lung von Eigenschaften und Relationen neu
durchdenken und damit den gesamten de-
skriptiven Rahmen im Herzen der Mgliche-
Welten-Semantik. Keine schlechte Idee, aber
vermutlich nicht unbedingt das, was Cresswell
im Sinn hatte. (Die Probleme vervielfachen
sich, wenn man versucht, in diesem Rahmen
so etwas wie Montague-Grammatik nachzu-
spielen. Denn dann braucht man zustzlich
Funktionen hheren Typs von solchen par-
tiellen Funktionen, da man die Funktionale
hheren Typs erblich konsistent halten
mchte.)
Nehmen wir nichtsdestoweniger an, der
Mgliche-Welten-Semantiker sei gewillt, die-
sen Schritt zu tun, und er durchdenke die sich
daraus ergebenden Folgen erneut. Hat er nun
alles zugelassen, was er braucht, um Situa-
tionssemantik zu treiben? Ich behaupte nein;
zumindest, wenn ich Cresswells Vorschlag
verstanden habe. Denn selbst, wenn man zu-
lt, da eine kleine Welt w ihren eigenen
Alternativenraum
w
festlegt, so ist dieser
Raum immer noch rechteckig. Das soll hei-
en, da ich denke, da er die Idee nicht
aufgibt, der Raum
w
werde durch eine
Menge
w
von Objekten und einer Menge
w
,
von Prdikaten bestimmt. Wenn eine kleine
Relation zum wahrnehmenden Subjekt
stehend (siehe Barwise 1981 a oder Kapitel
7 von Barwise & Perry 1983).
Es gibt prima facie Grnde dafr, anzu-
nehmen, da Konditionale Relationen
zwischen Situationen beschreiben.
Stze werden in bestimmten Sprechakten
verwendet, Ereignissen, die in der Welt
stattfinden. Solche Ereignisse sind ihrem
Wesen nach begrenzte Teile der Welt,
Teile, die typischerweise von anderen Tei-
len handeln. (Siehe dazu die Literaturan-
gaben zur Effizienz in Barwise & Perry
1983 oder Barwise 1987b.)
Man kann zu zeigen versuchen, da die
semantischen Paradoxien daher rhren,
da man die prinzipielle Unmglichkeit,
Aussagen ber die ganze Welt zu machen,
auer acht lt. Unter dieser Annahme
machen Stze wie der Lgner-Satz immer
Aussagen ber Fakten, die auerhalb des
Teils der Welt liegen, ber den der Satz
redet.
Cresswell gesteht (in Artikel 5) zu, da man
Situationen braucht, aber er glaubt, da die
Mgliche-Welten-Semantik, und zwar so wie
sie ist, diese in naheliegender Weise behandeln
kann. In dem nach Cresswells Meinung we-
sentlichen Teil seines Aufsatzes argumentiert
er, da die Mgliche-Welten- Theoretiker er-
lauben, da der Alternativenraum von Welt
zu Welt variiert, so da eine mgliche Welt
sehr wohl nur ein Ausschnitt der ganzen wirk-
lichen Welt sein knnte, selbst relativ zu den
betrachteten Alternativen. Insbesondere ar-
gumentiert er, da alleine die Tatsache, da
man in einem Rahmen arbeite, in dem die
wirkliche Welt w
0
eine bestimmte Alternative
regele, etwa ob a die Eigenschaft P hat oder
nicht, noch lange kein Grund dafr sei, da
der Ausgang dieser Alternative in jeder Welt
festgelegt sein msse. Nach seiner Meinung
sind manche Welten sehr gro, andere dage-
gen recht klein daher sein Untertitel.
Folgen wir Cresswell und nennen eine Welt,
welche die Alternativen in einer echten Teil-
menge des Raums festlegt, welcher die wirk-
liche Welt festlegt, eine kleine Welt. Wir be-
nutzen
w
, fr den durch die kleine Welt w
bestimmten Alternativenraum. Cresswell be-
hauptet, da es mit der Mgliche-Welten-Se-
mantik konsistent sei, kleine Welten zuzulas-
sen, und da man mit ihnen all die Situatio-
nen habe, die man brauche.
Diesen Schritt zu tun hatte auch ich er-
wogen, als ich vor einigen Jahren zum er-
sten Mal ber NI- Wahrnehmungswiedergaben
6. Situationen und kleine Welten 85
tuationssemantik sein soll, und nicht nur eine
Replik auf den Artikel von Cresswell, und
weil des weiteren der oben erwhnte Aufsatz
nie in einer allgemein zugnglichen Form ver-
ffentlich worden ist, mchte ich hier die bei-
den Hauptargumente wiederholen.
Erstens zeigt die Geschichte der Mathe-
matik und Logik, wie wichtig es ist, sich der
Partialitt Auge in Auge zu stellen und sie
nicht durch einen Trick zu vermeiden. Man
betrachte den analogen Fall partieller versus
totaler Funktionen. Eine partielle Funktion
von A nach B wird Eigenschaften haben, die
keine ihrer Vervollstndigungen hat, Eigen-
schaften, die durchaus relevant sind. Zum
Beispiel wird die Eigenschaft, da eine Funk-
tion f auf den natrlichen Zahlen fr ein n
nicht definiert ist, von keiner ihrer Vervoll-
stndigungen g geteilt. Nun knnte man den-
ken, diese Eigenschaft von f durch eine andere
Eigenschaft der Kollektion aller Vervollstn-
digungen von f darzustellen, nmlich da
diese fr das Argument n nicht bereinstim-
men. Aber es gibt Flle, wo man sich darauf
nicht verlassen kann. Angenommen, unser
Grundbereich ist die Menge der stetigen
Funktionen auf den reellen Zahlen, und wir
betrachten die Funktion f, die folgenderma-
en definiert ist:
f(x) = x(x + 1)/x
fr alle x 0, wobei f(0) nicht definiert ist.
Offensichtlich gibt es nur eine einzige stetige
Funktion g, die f fortsetzt, und zwar mit g(0)
= 1. Damit gibt es wichtige Eigenschaften
von f, die allein durch die Betrachtung der
Vervollstndigung von f nicht erfat werden
knnen.
Warum sollte etwas hnliches nicht in der
Semantik vorkommen? Warum knnte es
nicht Quellen fr Regelmigkeiten im Raum
der mglichen Weisen, wie die Welt sein
knnte, geben, die analog zur obengenannten
Beschrnkung stetiger Funktionen festlegen,
da in allen totalen Welten die Dinge in einer
gewissen Weise geartet sind, selbst wenn ein
gegebener Weltausschnitt nicht festlegt, da
sie so geartet sind? Knnten wir nicht die
logische Wahrheit als eine solche Art von
Regularitt ansehen? Der Umstand, da jede
totale Welt
R(a) v R(a)
erfllt, ist noch kein Grund dafr, da dies
jeder Weltteil tun sollte.
Der obige Vorschlag, eine Situation mit den
Welten zu identifizieren, mit denen sie ver-
trglich sind, erzeugt ein weiteres Problem.
Welt die Alternative regelt, ob a die Eigen-
schaft P hat oder nicht, und die Alternative,
ob b die Eigenschaft Q hat, dann wird sie
auch die Alternative regeln, ob a die Eigen-
schaft Q hat, und die Alternative, ob b die
Eigenschaft P hat. Die Situationen in der
Situationssemantik mssen diese Abgeschlos-
senheitseigenschaft nicht erfllen. Das kn-
nen sie gar nicht, wenn sie den Zweck erfllen
sollen, fr den sie ursprnglich erfunden wor-
den sind. Denn ich kann eine Szene sehen, in
der Alice rennt und Bill redet, ohne da diese
Szene die Alternative regelt, ob Alice redet
oder nicht. Eine Situation kann im Gegenteil
eine ganz beliebige Menge von Alternativen
regeln.
Zusammenfassend denke ich also, da
Cresswells Ansatz in die richtige Richtung
geht, da aber zwei Probleme dabei auftau-
chen.
Erstens wird die Kohrenz des grundlegen-
den deskriptiven Rahmens der Mgliche-Wel-
ten-Semantik unterminiert. Wenn man diesen
Weg einschlgt, wird man nmlich Relationen
und Eigenschaften irgendwie anders darstel-
len mssen; deswegen scheint es mir, da man
sie ebenso gut als Grundbegriffe einfhren
kann. Aber wenn man schon Eigenschaften
und Relationen als Grundbegriffe aussetzt,
dann ist es ziemlich berflssig, auch mgli-
che Welten als Grundbegriffe zu haben.
Zweitens geht dieser Ansatz nicht weit ge-
nug. Man mu auch die Idee aufgeben, eine
mgliche Welt regele alle Alternativen in
einem rechteckigen Alternativenraum.
Aber genau diese beiden Schritte waren der
Ausgangspunkt auf dem Weg zur Situations-
semantik. Wenn Cresswell gewillt ist, sie zu
tun, wrde mich das sehr freuen, denn dann
htte er die ausgetretenen Pfade der Mgli-
che-Welten-Semantik wirklich verlassen und
verdiente eine ehrenvolle Aufnahme im Lager
der Situationssemantik.
Es gibt noch einen zweiten, viel populre-
ren (aber viel schlechteren) Vorschlag, Situa-
tionen in der Mgliche-Welten-Semantik zu
behandeln. Und zwar soll eine partielle Situa-
tion durch die Menge all der totalen Welten
dargestellt werden, mit denen sie vertrglich
ist. Hintikka hat dies bei verschiedenen Ge-
legenheiten vorgeschlagen. Perry und ich
haben diesen Vorschlag ausfhrlich in Bar-
wise & Perry (1980) diskutiert. Da dieser
Handbuchartikel ein allgemeiner Vergleich
der Mgliche-Welten-Semantik und der Si-
86 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
Propositionen sind.
Was aber sind nun diese Kontext-Folgen,
und warum stoen sie den Mgliche-Welten-
Semantikern so sauer auf? Ich denke, sie sind
nichts anderes als Reprsentationen einer Si-
tuation, dem Teil der Welt, der fr die Bestim-
mung des Inhaltes der fraglichen uerung
relevant ist. Der Kontext c = a,t,p,b, ...
stellt eine Situation dar, in der a zur Zeit t
am Ort p etwas sagt und sich DIES auf den
Gegenstand b bezieht. Der Grund, weshalb
Kontexte in der Mgliche-Welten-Semantik
behandelt werden, ist deshalb gerade darin zu
sehen, da dieser Ansatz keine handliche Me-
thode zur Verfgung stellt, mit solchen be-
grenzten Ausschnitten der Welt umzugehen.
Einer der Hauptpunkte in Barwise & Perry
(1983) war die Behauptung, da diese kon-
textuellen Elemente nicht nur ein lstiges
technisches Problem sind. Wir meinen, da
das allgemeine Phnomen, das sie darstellen,
in den Vordergrund gerckt werden mu, um
eine systematischere und zentralere Rolle ge-
nau im Herzen einer Analyse der Bedeutung
zu spielen. Das ist es, was wir mit dem Begriff
Effizienz gemeint haben. Die Behauptung
war, auf derlei ad-hoc-Konstrukte verzichten
zu knnen, wenn man Situationen in der
Theorie zult. Dieselben Objekte, die zur
Darstellung dessen dienen, worber Behaup-
tungen handeln, knnen auch als Kontexte
der Behauptungen dienen, ferner fr die Be-
gleitumstnde anderer bedeutungstragender
Einheiten. Auf diese Weise erhlt man eine
relationale Theorie der Bedeutung, in der die
Dinge, die zueinander in Relation gesetzt wer-
den, Dinge derselben Art sind.
Natrlich wurde, sobald Kontext-Folgen
in der Mgliche-Welten-Semantik auftauch-
ten, angenommen, da nun die Bedeutung
eines Satzes (oder sein Charakter, um Kaplans
Terminus zu benutzen) eine Funktion von
diesen Kontexten c = a,t,p,b, ... in Pro-
positionen sei. Funktionen sind eine gewisse
Art von Relationen, und damit gab es implizit
eine relationale Theorie der Bedeutung in der
Mgliche-Welten-Semantik. Die Zulassung
von Situationen gestattet es, da die Relatio-
nen zwischen Dingen derselben Art bestehen
und nicht zwischen ad hoc Folgen einerseits
und Funktionen von mglichen Welten in
Wahrheitswerte andererseits.
Cresswell anerkennt zhneknirschend die
Relevanz von Kontexten und sagt, da ein
Kontext eine Situation sei. Ich mchte mir
hier Gedanken darber machen, ob der Vor-
Wenn man ihn nmlich im Rahmen der Mg-
liche-Welten-Semantik ausfhrt, dann werden
offensichtlich Propositionen mit Situationen
verwechselt, weil diese auf dieselbe Weise dar-
gestellt werden, nmlich als Mengen von
mglichen Welten. Die Vermeidung einer sol-
chen Verwechslung war einer der Grnde ge-
gen diese Rekonstruktion von Situationen,
die wir in Barwise & Perry (1980) angegeben
hatten. Es liegt eine gewisse Ironie darin, da
nun Cresswell behauptet, die Situationsse-
mantik selbst mache sich dieser Verwechslung
schuldig, weil er nmlich denkt, wir wrden
versuchen, Situationen und Propositionen
durch Situationen darzustellen.
5. Effizienz, Kontext und die
relationale Bedeutungstheorie
In den ersten Arbeiten ber mgliche Welten
und Modalitt wurde angenommen, da
Stze Propositionen ausdrcken, und da
eine derartige Proposition durch eine Funk-
tion darzustellen sei, die den Welten T zuord-
net, in denen der Satz wahr ist, und F jenen
Welten, in denen er falsch ist. Als jedoch
dieser Rahmen fr die Untersuchung von na-
trlichen Sprachen benutzt zu werden be-
gann, stellte sich dies als unhaltbar heraus.
Stze, in denen Wrter wie ich, jetzt, hier, dies
... vorkommen, drcken keine einzelne Pro-
position aus. Was sie ausdrcken, hngt viel-
mehr von den Umstnden ab, unter denen sie
benutzt werden: von der Person a, die den
Satz geuert hat, vom Zeitpunkt t der ue-
rung, vom Ort p, wo er geuert wurde, vom
Objekt b, auf das a sich bezog usw. So wurden
nach und nach verschiedene kontextuelle Ele-
mente zu einer Kontextfolge c = a,t,p,b, ...
von Objekten zusammengefat, die eine Rolle
spielten, um von einem Satz zum propositio-
nalen Gehalt zu gelangen, fr jede besondere
Verwendung des Satzes. Immer noch stand
die Proposition im Mittelpunkt des Interesses.
Das strende c, das verschiedene kontextuelle
Elemente darstellte, bekam gewhnlich die
Rolle eines Indexes zugewiesen oder wurde
vollstndig unterdrckt. Cresswell zum Bei-
spiel besteht darauf, von der Bedeutung eines
Satzes im Kontext zu sprechen, welche er als
eine Proposition ansieht. Dies ist es auch, was
mich dazu veranlat, zu denken, da die
Mgliche-Welten-Semantik immer noch da-
von ausgeht, da die primren semantischen
Objekte, die Stzen zugeordnet sein sollen,
6. Situationen und kleine Welten 87
es sicher nicht sinnvoll, sich uerungen als
mglicherweise alles, was es gibt, vorzustellen.
Wir werden vielmehr zugeben mssen, da
Kontexte im allgemeinen Teilsituationen von
greren Situationen oder Welten sind, um
die Wahrheit oder Falschheit einer uerung
behandeln zu knnen. So liefern uns die
uerungskontexte ein weiteres Beispiel einer
Situation, die keine kleine alternative Welt ist,
sondern vielmehr ein begrenzter Ausschnitt
der wirklichen Welt.
Die Notwendigkeit, Situationen als be-
grenzte Teile der wirklichen Welt ansehen zu
mssen, war selbstverstndlich eine der ur-
sprnglichen Motivationen fr die Situations-
semantik. Wenn man Situationen (oder kleine
Welten) zult und sie dazu verwendet, den
semantischen Wert von NI-Wahrnehmungs-
wiedergaben zu bestimmen (wie Cresswell
vorschlgt), dann mu man auch in der Lage
sein, die Tatsache darzustellen, da Situatio-
nen Teile der Welt sind. Insbesondere mu
man die Tatsache darstellen knnen, da eine
Welt w Teil der wirklichen Welt w
0
ist. Damit
braucht man als einen neuen Grundbegriff
die Teilweltbeziehung w w. Wenn man
aber dieses zult, dann scheint das wirklich
quer zu Cresswells Begrndung dafr, da
Situationen mgliche Welten sind, zu liegen,
nmlich da es mglich ist, da sie alles sind,
was es gibt.
6. Propositionen und Situationen
Schlielich kommen wir zu Cresswells anderer
Behauptung, nmlich da die Situationsse-
mantik Situationen und Propositionen ver-
mengt.
Es gibt mehrere Grnde dafr, weshalb
Cresswell dies denken mag. Unglcklicher-
weise liegt in Perry (1980) genau diese Ver-
mengung vor, insofern dort gesagt wird, die
Gegenstnde des Glaubens seien Situationen.
In der Arbeit Barwise & Perry (1980) (die
etwas spter als Perry 1980 geschrieben
wurde) sahen wir Propositionen als Mengen
von alternativen Situationen an. In Barwise
& Perry (1983) jedoch haben wir die Rede
von Propositionen vollstndig vermieden.
Grund dafr waren Probleme mengentheo-
retischer Natur, die auftauchten, als wir ver-
suchten, Propositionen als Mengen alternati-
ver Situationen darzustellen.
In Barwise & Perry (1983) wollten wir Pro-
positionen mithilfe von zwei Dingen klassifi-
zieren, nmlich einem Situationstyp und einer
schlag Cresswells, Situationen als kleine
Alternativwelten zu behandeln, es ihm wirk-
lich gestattet, Kontexte als Situationen zu be-
handeln. Dies gliedert sich in drei Einzelfra-
gen: (i) Gibt es einen festen Raum von Alter-
nativen, der fr alle solche Kontexte verwen-
det werden kann? (ii) Falls nein, gibt es dann
wenigstens fr jeden Kontext c einen recht-
eckigen Raum
c
von Mglichkeiten? (iii) Ist
es vom philosophischen Standpunkt aus sinn-
voll, den Kontext einer uerung als eine
eigene kleine Welt aufzufassen? Es wird nicht
berraschen, da ich vorschlagen mchte, alle
diese Fragen mit nein zu beantworten.
Die Antwort auf Frage (i) ist sicherlich
negativ. Wenn wir in den letzten zehn Jahren
in der Semantik berhaupt irgendetwas ge-
lernt haben, dann ist es das: Kontexte haben
einen gewaltigen und in seiner Vielfalt uner-
schpflichen Einflu auf die Interpretation
von uerungen. Es ist heutzutage vllig un-
plausibel, da es eine feste Menge kontex-
tueller Merkmale gibt, die ein fr alle Mal
festgelegt werden kann. Selbst hinsichtlich der
Frage (ii) scheint es einfach zu sein, sich Flle
vorzustellen, fr welche die oben formulierte
Bedingung nicht gilt. Nehmen wir an, sowohl
John als auch ich wrden zugleich sprechen.
Er wrde etwas Schmeichelhaftes ber mich
sagen, sich aber weitschweifig ausdrcken,
und ich wrde sagen: Ich finde, er ist heute
weitschweifig. Der Kontext meiner ue-
rung mte also den Tag beinhalten, mich,
John, die Tatsache, da ich spreche, und da
ich mich mit ER auf John beziehe. Aber wenn
der Alternativenraum rechteckig wre, dann
mte mein Kontext auch die Alternative re-
geln, ob John spricht. Und da dies tatschlich
der Fall ist, mte diese Tatsache in den Kon-
text einbezogen werden. Dann aber wren
zwei Sprecher im Kontext und nicht lediglich
einer, was wir brauchen, um zu erreichen, da
ich die Interpretation meines Gebrauches von
Ich bin.
Die entscheidende Frage ist jedoch nach
meiner Meinung (iii). Denn was wir verstehen
mchten, ist ja dieses: Wie schaffen es Leute,
die gemeinsam in der allgemeinen wirklichen
Welt leben, darber zu kommunizieren?
Cresswell sagt, es sei sinnvoll, sich eine Situa-
tion als eine kleine Welt vorzustellen, wenn
sie alles sein knnte, was es gibt. Aber wenn
wir Kontexte als kleine Welten behandeln,
dann ist berhaupt nicht mehr klar, wie die
Beziehung des Kontextes zum Rest der Welt,
die beschrieben wird, aufrecht erhalten wer-
den kann. Wenn es uns um Wahrheit geht, ist
88 II. Probleme der ontologischen Grundlegung:Welt versus Situation
7. Schlu
Die menschliche Sprache ist ein extrem rei-
ches, komplexes Werkzeug fr die Kommu-
nikation, das Denken und Handeln. Das Ziel,
ihre Semantik zu verstehen, ist eine auer-
ordentliche Herausforderung. Die Situations-
semantik versucht, den Schwerpunkt der For-
schungen zu verlagern, indem sie zwei ver-
wandte Phnomene in den Mittelpunkt des
Interesses stellt: die Effizienz der Sprache, und
die Partialitt der Information. Diese beiden
Aspekte werden in der relationalen Bedeu-
tungstheorie vereint, einer Theorie, welche die
Bedeutung als eine Beschrnkung ansieht, die
zwei echten Teilen der Welt auferlegt wird,
der uerung und der beschriebenen Situa-
tion. Dies ist in nuce der Gehalt der Situa-
tionssemantik. Immerhin ist es noch ein wei-
ter Weg von diesem intuitiven Bild bis zu einer
streng detailierten Ausarbeitung. Man knnte
sich vorstellen, die Details im theoretischen
Rahmen der Mgliche-Welten-Semantik aus-
zuarbeiten. Mir scheint jedoch, da hat
man einmal die entsprechende Perspektive
die Motivation fr einen groen Teil des tra-
ditionellen Rahmens verloren geht. Ferner
sieht man, weshalb der Ansatz in die Pro-
bleme gert, in die er geraten ist. Deshalb
steht eigentlich nicht die Alternative Mgli-
che-Welten-Semantik oder Situationsseman-
tik zur Debatte. Es geht vielmehr um zwei
verschiedene Einstellungen zur semantischen
Theoriebildung. Eine nimmt eine wohl ver-
standene Theorie an, eine, die in der Vergan-
genheit sehr fruchtbar war, hngt fest an ihr
und versucht, die Sprachdaten damit in Ein-
klang zu bringen. Die andere Einstellung geht
von einigen Grundeinsichten, wie Sprache
funktioniert, aus und ist bereit und willens,
den Grundansatz in jeder Hinsicht zu ber-
denken, wo es fr den Fortschritt in der Se-
mantik ntig scheint.
Beide Einstellungen haben ihren Ort. Man
kann nicht stndig wieder ganz von vorne
anfangen, oder es wird nie einen Fortschritt
geben. Andererseits mu man auch in der
Lage sein, den bisherigen theoretischen Rah-
men zu verndern, wenn die Daten dies ver-
langen. Im Moment bevorzugt Cresswell die
erstgenannte Geisteshaltung, diejenigen unter
uns, die ber Situationssemantik arbeiten, da-
gegen die letztgenannte. Er glaubt, die Fakten
erforderten kein berdenken, whrend wir
meinen, da sie es tun. Fr uns sieht es so
aus, als ob die alte Maschinerie endlich knir-
schend zum Stehen kommt angesichts der bei-
realen Situation, die von diesem Typ sein
sollte. An einer Stelle ziemlich am Anfang des
Buches verwenden wir Kollektionen von al-
ternativen Situationen, um Situationstypen
darzustellen. Damit wre es natrlich gewe-
sen, ein Paar s,T, das aus einer Situation s
und einer Kollektion T von Situationen be-
steht, zu verwenden, um eine Proposition dar-
zustellen. Eine solche Proposition wre wahr,
falls s T. Weil wir aber davon ausgingen,
da Situationen in der Lage sein sollten, alle
Alternativen und nicht nur die einer vorab
ausgewhlten Menge von Alternativen zu
regeln, wren diese Kollektionen T im allge-
meinen zu gro, um Mengen sein zu knnen.
Folglich konnten sie nicht Konstituenten von
Fakten oder anderen Situationen sein. Aus
diesem Grund meinten wir, dieses Problem
dadurch umgehen zu mssen, da wir die
Rede von Propositionen vllig vermieden und
uns stattdessen mit ihren beiden Konstituen-
ten getrennt befaten.
Ich glaube, da der folgende Umstand
Cresswell zu der Annahme veranlat, wir ver-
mengten Situationen mit Propositionen in
Barwise & Perry (1983): Ziemlich oft (jedoch
keineswegs immer) haben diese Kollektionen
T die Erzeugungseigenschaft (um mit Cress-
well zu reden), das heit, sie bestehen aus all
den Situationen, die eine gegebene Situation
S
T
enthalten. Aus diesem Grund denkt er,
vermengten wir die Proposition mit S
T
. Aber
das stimmt einfach nicht. Hufig gibt es gar
keine erzeugende Situation S
T
fr T, und
selbst wenn es eine gibt, dann wre die Pro-
position die, da s vom Typ T ist, d. h. da
s
T
eine Teilsituation von s ist.
Eigentlich gab es aber gar keinen Grund
dafr, in Barwise & Perry (1983) Propositio-
nen zu vermeiden. Schon lange bevor das
Buch fertiggeschrieben war, gingen wir von
Kollektionen alternativer Situationen ber zu
unserem Ereignistyp-Kalkl, um Situations-
typen darzustellen. Nachdem wir Ereignisty-
pen zur Verfgung hatten, htten wir unsere
Entscheidung, Propositionen zu vermeiden,
berdenken sollen. Wir htten nmlich Pro-
positionen als Paare, die aus einer Situation
und einem Ereignistyp bestehen, darstellen
knnen. Dies ist eines jener Versehen, die
einem zustoen. Das geben wir offen zu und
knnen daran leider nichts mehr ndern. Aber
dieser Fehler bedeutet nicht, da die Situa-
tionssemantik, und zwar selbst in der Version
Barwise & Perry (1983), Propositionen mit
Situationen vermengt.
6. Situationen und kleine Welten 89
Barwise 1986 b Barwise 1986 c Barwise/Etche-
mendy 1987 Barwise/Perry 1980 Barwise/Perry
1983 Barwise/Perry 1985 Cooper 1987 Perry
1980 Perry 1986 Stalnaker 1984
Jon Barwise, Bloominton, Indiana (USA)
(bersetzt aus dem Englischen
von Regine Eckhardt
und Arnim von Stechow)
den verwandten Probleme der Partialitt und
Effizienz, die sich in der relationalen Bedeu-
tungstheorie treffen, dem Herzstck der Si-
tuationssemantik.
8. Literatur (in Kurzform)
Barwise 1981 a Barwise 1981 b Barwise 1986 a
90
III. Theorie der Satzsemantik
Theory of Sentence Semantics
7. Syntax und Semantik
Auffassungen, zum anderen kann man in die-
sem Typ von Grammatik mit einfachen Mit-
teln eine strikte Parallelitt von Syntax und
Semantik erzwingen die Idealvorstellung
vieler Semantiker. Drittens werden in neuerer
Zeit gewisse Verallgemeinerungen von kate-
gorialen Grammatiken fr die syntaktische
und semantische Analyse nutzbar gemacht,
so da dieser Typ von Grammatiken erneut
das Interesse vieler Theoretiker erweckt.
Schlielich sind einige Beitrge dieses Bandes
kategorialgrammatisch formuliert, z. B. die
Cresswells.
Montagues Grammatiktheorie und
ebenso die Theorie der kategorialen Gram-
matik ist semantisch motiviert: Sie sieht die
einzige Aufgabe der Syntax darin, eine rekur-
sive Interpretation fr alle Ausdrcke einer
Sprache zu ermglichen. Die meisten Lingu-
isten insbesondere die generativen Gram-
matiker sind dagegen der Auffassung, da
die Form von Ausdrcken nach Prinzipien
organisiert ist, die von semantischen Erw-
gungen unabhngig sind. Dieser Standpunkt
ist als Autonomie der Syntax bekannt. Fr ein
solches System ist die Frage nach dem Ver-
hltnis von Syntax und Semantik wesentlich
schwieriger zu beantworten als fr die erst-
genannten Systeme, die auf Parallelitt zwi-
schen Syntax und Semantik hin angelegt sind.
Abschnitt 5.3 ist deshalb der Frage gewidmet,
wo der Ort der Semantik in der sogenannten
Rektions- und Bindungstheorie Chomskys
(1981) ist, denn bei diesem Entwurf handelt
es sich um ein System mit autonomer Syntax.
Die Frage wird in grundstzlicher Weise noch
einmal in Abschnitt 6 aufgenommen.
Nicht speziell eingegangen wird auf kon-
textfreie Phrasenstrukturgrammatiken, ob-
wohl diese in der linguistischen Tradition
sie knnen als Formalisierung der unmittel-
baren Konstituentenanalyse des amerikani-
schen Strukturalismus angesehen werden
sowie zum Beispiel fr die Theorie der Pro-
grammiersprachen eine hervorragende Rolle
1. Vorbemerkungen
2. Allgemeine Grundlagen
2.1 Syntax, Bedeutungen, Interpretation
2.2 Syntaktische und semantische Kategorien
2.3 Kompositionalitt und Rekursivitt
2.4 Mehrdeutigkeit
3. Montagues Universalgrammatik
3.1 Allgemeine Konzeption
3.2 Syntax
3.3 Semantik
3.4 Beschrnkungen
4. Kategorialgrammatik
4.1 Vorbemerkungen
4.2 Das klassische Modell
4.3 Verallgemeinerte Kategorialgrammatiken
5. Generative Grammatik
5.1 Vorbemerkungen
5.2 Das GB-Modell
5.3 Interpretation
5.4 Thetatheorie
6. Syntaktische und semantische Struktur
7. Literatur (in Kurzform)
1. Vorbemerkungen
Die Stoffauswahl dieses Artikels ist weitge-
hend durch die Beitrge dieses Bandes be-
stimmt. Fast alle Autoren stehen in der Tra-
dition der logisch orientierten Semantik, die
mit den sprachtheoretischen Schriften Mon-
tagues (siehe Thomason, ed. 1974) ihren Ein-
zug in die Linguistik gehalten hat. Dement-
sprechend steht die Montaguesche Konzep-
tion des Verhltnisses von Syntax und Se-
mantik im Vordergrund, insbesondere Mon-
tagues Universalgrammatik (vgl. Abschnitt 3).
Montagues Sprachtheorie ist der Logik
verpflichtet, insbesondere der Typentheorie.
Auf die Grundlagen der Typentheorie wird in
dieser Darstellung nicht eingegangen, dage-
gen wohl auf eine spezielle, typentheoretisch
aufgebaute Art von Syntax, nmlich die ka-
tegorialen Grammatiken (siehe Abschnitt 4).
Einmal beruht nmlich Montagues Sprach-
theorie selbst auf kategorialgrammatischen
7. Syntax und Semantik 91
Akzeptiert man die Trennung, dann ergibt
sich fr diesen Beitrag die folgenden Syste-
matik: Auf der einen Seite gibt es die Syntax
als Theorie von der Kombinatorik der Zei-
chen, auf der anderen Seite gibt es die Se-
mantik als Theorie der Bedeutungen der Zei-
chen. Wir wollen im folgenden die Kollektion
der Bedeutungen, die man fr eine Sprache
ansetzt, Ontologie nennen. Schlielich gibt es
eine Abbildung, Interpretation, die Ausdrk-
ken Bedeutungen zuordnet. Eine Diskussion
des Verhltnisses von Syntax und Semantik
wird also ber drei Dinge zu reden haben: die
Organisationsprinzipien der Syntax natrli-
cher Sprachen, die Organisationsprinzipien,
die den Aufbau der Bedeutungen regeln,
und die Organisationsprinzipien, denen die
Interpretation, welche Ausdrcke auf Bedeu-
tungen abbildet, gehorcht.
Fr die folgende Diskussion insbeson-
dere die ersten Abschnitte ist die Lektre
von Artikel 2 Basic Concepts of Semantics
und Artikel 8 Syntax and Semantics of Ca-
tegorial Languages hilfreich. Ferner wird die
Kenntnis der wichtigsten Begriffe der Theorie
der formalen Sprachen vorausgesetzt, mit an-
deren Worten, der Begriff des Baumes, der
Phrasenstrukturregel, der Ableitung und der-
gleichen mehr.
Fr die eben genannte dreiteilige Gliede-
rung ergibt sich das folgende Problem: Die
meisten Linguisten sind der Auffassung, da
die Erforschung der Prinzipien der syntakti-
schen Form eine empirische Frage ist. Das
Sprachvermgen stellt bestimmte syntakti-
sche Organisationsprinzipien zur Verfgung,
von denen in verschiedenen Sprachen ein un-
terschiedlicher Gebrauch gemacht wird. Es
handelt sich aber auf einer gewissen Ab-
straktionsebene um dieselben, kognitiv
vorgegebenen Prinzipien, welche erforscht
werden knnen und welche die Beschrnkun-
gen fr einzelsprachliche Grammatiken deter-
minieren. Man wrde per analogiam erwar-
ten, da es auch fr die Organisation der
Bedeutungsbereiche allgemeine Gesetzmig-
keiten gibt, die empirisch ermittelt werden
knnen. Die Interpretationsrelation, welche
die beiden Bereiche Syntax und Bedeutun-
gen verbindet, sollte auch bestimmten Be-
schrnkungen gengen; zumindest mte sie
auf die Restriktionen der beiden Bereiche, die
sie verbindet, Rcksicht nehmen und wre
insofern empirisch bedingt.
Ein derartiges Bild ist aber nach dem ge-
genwrtigen Stand der Dinge unrealistisch: Es
gibt eine Vielzahl von koexistierenden Onto-
spielen. Diese Auslassung ist insofern berech-
tigt, als in Abschnitt 3.2 an einem Beispiel
skizziert wird, da diese Art von Grammati-
ken ein trivialer Spezialfall von Montagues
allgemeiner Grammatik ist. Analoges gilt fr
die sogenannten generalisierten Phrasenstruk-
turgrammatiken von Gazdar et alii (1985), auf
die in Abschnitt 6 beilufig eingegangen wird.
Ebenso wie Artikel 1, in dem ein berblick
ber die verschiedenen, zur Zeit existierenden
Bedeutungstheorien gegeben wurde, mit dem
Ziel, die Praxis der Semantiker zu relativieren,
versucht auch dieser Artikel, die in diesem
Band vorherrschende Theoriebildung in einen
allgemeineren Kontext einzubetten. So wird
bereits aus Abschnitt 2, in dem allgemeine
Grundlagen der semantischen Theorie dis-
kutiert werden, deutlich werden, da der Ver-
fasser die autonome Auffassung von Syntax,
wie sie der generativen Grammatik Chomskys
zugrundeliegt, prinzipiell fr richtig hlt, ob-
wohl es gerade in dieser Theorie bisher keine
ausgearbeitete Semantik gibt, die den Theo-
rieentwrfen Montagues oder der Katego-
rialgrammatiker vergleichbar wre.
Weitgehend orthodox wird in dieser Dar-
stellung die Frage abgehandelt, was Bedeu-
tung ist. Wir fhren die in der Mglichen-
Welten-Semantik blichen semantischen En-
titten der Extension und Intension ein, sowie
die kontextabhngigen Pendants der Intensio-
nen, d. h., Montagues (UG) Bedeutungen
bzw. Kaplans (1977) Charaktere. Andere
traditionelle Bedeutungsbegriffe werden hier
nicht diskutiert, was nichts ber deren Wert
oder Unwert implizieren soll (vgl. dazu Arti-
kel 1). Die vielversprechende Bedeutungskon-
zeption von Heim (1983), wonach die primre
Bedeutung eines Satzes sein kontextvern-
derndes Potential ist, aus dem die Wahrheits-
bedingungen sekundr ableitbar sind, wird in
Artikel 10 dargestellt.
2. Allgemeine Grundlagen
2.1Syntax, Bedeutungen, Interpretation
Die Trennung zwischen Syntax auf der einen
und Semantik auf der anderen Seite, wie sie
von den logisch orientierten Semantikern all-
gemein vorausgesetzt wird, ist in der Lingu-
istik keine Selbstverstndlichkeit, sondern
wissenschaftsgeschichtlich neueren Datums.
Sie ist erst durch Ch. Morris und R. Carnap
allmhlich in das allgemeine Methodenbe-
wutsein der Sprachwissenschaftler gedrun-
gen (vgl. dazu Artikel 1, Abschnitt 1.5).
92 III. Theorie der Satzsemantik
ten Quantoren um allgemeine semantische
Beschrnkungen, die festlegen sollen, was ein
mglicher Quantor einer natrlichen Sprache
ist (Vgl. dazu Artikel 21 Quantification).
Eine andere nichttriviale Beschrnkung ist
das in Artikel 9 Kontextabhngigkeit, Ab-
schnitt 1.3, formulierte Prinzip L, welches be-
sagt, da eine Wortbedeutung entweder
deiktisch oder absolut ist, nicht aber bei-
des zugleich. Wir kommen darauf in Ab-
schnitt 3.4.2.4 zurck.
Eine Mittelstellung zwischen der empiri-
schen Prinzipien gehorchenden Syntax und
dem logischen Prinzipien unterliegenden Be-
deutungsaufbau nimmt die Interpretations-
beziehung ein. Einmal gehen hier die Restrik-
tionen der Syntax insofern ein, als die Aus-
drcke einer Sprache den Vorbereich dieser
Beziehung bilden. Zum anderen hat man ver-
sucht, die Relation selbst empirisch zu be-
schrnken, z. B. durch mehr oder weniger
strikte Kompositionalittsforderungen (vgl.
dazu Abschnitt 3.4.2.1) oder Einschrnkun-
gen fr zulssige semantische Operationen
(Monsterverbot, vgl. Abschnitt 3.4.2.3).
2.2Syntaktische und semantische
Kategorien
Den meisten logisch orientierten Anstzen zur
Semantik ist gemeinsam, da sie einen Paral-
lelismus von syntaktischen und semantischen
Kategorien annehmen. Die neueren Wurzeln
dieser Auffassung gehen ber Ajdukiewicz
(1935) und Leniewski (1929/38) auf Husserl
(1901/2) zurck, wobei allerdings anfangs
nicht klar zwischen syntaktischen und seman-
tischen Kategorien unterschieden wurde (vgl.
Casadio 1987). Eine klare Formulierung des
Parallelismus liegt in den grammatiktheore-
tischen Schriften Montagues (z. B. UG) vor.
Unter einer Kategorie kann man sich in die-
sem Zusammenhang eine Menge vorstellen.
Die folgenden Aussagen mgen exemplarisch
den genannten Parallelismus verdeutlichen:
1. Der syntaktischen Kategorie der intran-
sitiven Verben entspricht die semantische Ka-
tegorie der einstelligen Eigenschaften.
2. Der syntaktischen Kategorie der transi-
tiven Verben entspricht die semantische Ka-
tegorie der zweistelligen Eigenschaften.
3. Der syntaktischen Kategorie der Eigen-
namen entspricht die semantische Kategorie
der Individuuen.
4. Der syntaktischen Kategorie der Nomi-
nale (Nominalphrasen) entspricht die seman-
tische Kategorie der einstelligen Eigenschaf-
logiekonzeptionen, ohne da auch nur
prinzipiell gefragt und beantwortet werden
knnte, ob einige von ihnen empirisch rea-
ler als andere seien. Zur Zeit ist es berhaupt
nicht klar, ob die Frage nach der empirischen
Adquatheit einer hinreichend starken On-
tologie sinnvoll ist. Der Grund ist darin zu
sehen, da die logisch orientierten Semantiker
wozu die Mehrzahl der Autoren dieses
Bandes gehrt sich fast ausschlielich fr
die Wahrheitsbedingungen von uerungen
interessieren, beziehungsweise fr den Bei-
trag, den ein Wort oder eine Phrase zu den
Wahrheitsbedingungen eines komplexen Aus-
drucks leistet. (Vgl. dazu Artikel 1, Abschnitt
2.8 und Artikel 2.)
Nun sind aber Wahrheitsbedingungen
nichts Psychisches, sondern etwas Objektives,
worauf in Artikel 1 anllich des Fregeschen
Gedankens hingewiesen wurde. In der
Mgliche-Welten-Semantik wird der Frege-
sche Gedanke, d. h. die Proposition, als
Menge von mglichen Welten rekonstruiert.
Wie aber soll man z. B. die Bedeutung von
intransitiven Verben also einstellige Eigen-
schaften rekonstruieren: als Funktionen
von Welten in Mengen von Individuen (Mon-
tague) oder als Funktionen von Individuen in
Mengen von Welten (Cresswell)? Beide Re-
konstruktionen sind mathematisch gesehen
quivalent, und es gibt zur Zeit keine empi-
rischen Kriterien, die eine Wahl zwischen den
beiden Vorschlgen erlauben wrden.
Dies gilt fr den Aufbau von Bedeutungs-
bereichen ganz allgemein: Unter den formalen
Semantikern sind gegenwrtig funktional auf-
gebaute Bedeutungsbereiche, die zu einer ty-
pentheoretischen Syntax passen, blich. Es
gibt aber keinerlei empirische Kriterien, wes-
halb nicht ein flacher Bereich, wie er etwa
fr die Semantik der Prdikatenlogik (z. B.
der zweiten Stufe) blich ist, genauso geeignet
sein sollte. Ebenso kann man sich fragen,
wieso Bedeutungsbereiche nicht relational
oder gemischt statt blo funktional aufge-
baut sein sollten. Mit anderen Worten, die
Kriterien fr den Aufbau von Bedeutungs-
bereichen sind zur Zeit meistens rein logischer
und methodologischer Art (z. B. Wider-
spruchsfreiheit und Einfachheit), nicht aber
empirischer Natur, von der globalen Forde-
rung abgesehen, da die Ontologie reich ge-
nug sein mu, um die Wahrheitsbedingungen
aller Stze ausdrcken zu knnen.
Das besagt aber nicht, da keine empiri-
schen Restriktionen mglich wren: Zum Bei-
spiel bemht sich die Theorie der generalisier-
7. Syntax und Semantik 93
gern Es gibt eine Dame, welcher Klaus-Jrgen
die Hand kt. Ein analoger Schlu von
Klaus-Jrgen sucht eine echte Dame auf Es
gibt eine echte Dame, die Klaus-Jrgen sucht
ist dagegen im allgemeinen nicht mglich. Die
Bedeutungen dieser Verben gehren also ver-
schiedenen semantischen Kategorien an. Das-
selbe gilt fr Stze: Finite Aussagestze drk-
ken Propositionen aus, infinite Stze ohne
Subjekt drcken Eigenschaften aus, W-Fra-
gen drcken Eigenschaften aus. Stze haben
also heterogene Bedeutungen. hnliche
Nicht-Parallelitten zwischen syntaktischer
und semantischer Kategorie kann man prak-
tisch fr jede Wortart feststellen.
In der Literatur gibt es zwei Strategien, die
a priori geforderte Parallelitt von syntakti-
schen und semantischen Kategorien zu er-
zwingen. Einmal kann man von der Semantik
her argumentieren, indem man zwei Aus-
drcke immer dann syntaktisch verschieden
kategorisiert, wenn ihre Bedeutungen intuitiv
gesehen verschiedenen semantischen Katego-
rien angehren. Dieses Verfahren ist unter
Kategorialgrammatikern blich (vgl. dazu
etwa Lewis 1970 und Cresswell 1973; siehe
auch Artikel 8). Wir haben bereits gesagt, da
wir die aus dieser Strategie resultierenden
in der Regel sehr einfachen kategorialen
Syntaxen semantisch motivierte Syntaxen nen-
nen wollen. Auf sie wird in Abschnitt 4 nher
eingegangen.
Die zweite Strategie, einen Parallelismus
zwischen syntaktischen und semantischen Ka-
tegorien zu erzwingen, ist die seit Montague
populre Technik der Typenanhebung (siehe
Montagues UG und PTQ sowie Artikel 21).
Wir wollen sie hier nicht allgemein, sondern
anhand von zwei Beispielen erlutern. Das
erste Beispiel betrifft Nominalien. Das No-
minal Fritz bezeichnet zunchst ein Indivi-
duum, z. B. Fritz. Niemand bezeichnet dage-
gen eine Eigenschaft zweiter Stufe, nmlich
die Menge aller Eigenschaften, die niemand
hat. (Eine Eigenschaft zweiter Stufe kann
man als die Menge der erststufigen Eigen-
schaften auffassen, auf welche die zweitstufige
Eigenschaft zutrifft.) Man kann nun auch
dem Individuum Fritz eindeutig eine Eigen-
schaft zweiter Stufe zuordnen, nmlich die
Menge aller Eigenschaften, die Fritz hat. Auf
diese Weise kann man Nominalphrasen ein-
heitlich die Menge aller Eigenschaften zweiter
Stufe als semantische Kategorie zuordnen.
Es versteht sich von selbst, da nicht alle
Eigenschaften zweiter Stufe vernnftige Kan-
didaten fr Typenanhebung sind. Fr an-
ten zweiter Stufe, d. h. der Eigenschaften von
Eigenschaften.
5. Der syntaktischen Kategorie der Adver-
bien entspricht die semantische Kategorie der
Funktionen von einstelligen Eigenschaften in
einstellige Eigenschaften.
6. Der syntaktischen Kategorie der Aus-
sagestze entspricht die semantische Katego-
rie der Propositionen.
Auf der Grundlage eines solchen Paralle-
lismus stellt sich das Verhltnis von Syntax
und Semantik folgendermaen dar: Die Auf-
gabe der Syntax besteht darin, die syntakti-
schen Kategorien einer Sprache zu definieren.
Die Aufgabe der Semantik besteht einmal
darin, die semantischen Kategorien einer
Sprache zu definieren, zum anderen darin, die
Relation zwischen syntaktischen und seman-
tischen Kategorien anzugeben (also die Inter-
pretationsrelation). Falls die Sprache eindeu-
tig ist, wird diese Relation jedem Ausdruck
einer syntaktischen Kategorie genau einen
Ausdruck in der entsprechenden semanti-
schen Kategorie zuordnen. Falls die Sprache
mehrdeutig ist, wird die Relation einem Aus-
druck mehrere Bedeutungen aus der entspre-
chenden Bedeutungskategorie zuordnen.
Gewisse Komplikationen entstehen da-
durch, da die Parallelitt zwischen syntak-
tischen und semantischen Kategorien
selbst, wenn es sich dabei nicht um eine eine
1-1-Beziehung, sondern um ein Viele-1-Bezie-
hung handelt eine Idealisierung ist, die fr
Grammatiken von natrlichen Sprachen nur
durch Kunstgriffe zu erreichen ist, da Aus-
drcke derselben syntaktischen Kategorie Be-
deutungen verschiedener semantischer Kate-
gorien haben knnen. Zum Beispiel gehren
Eigennamen wie Fritz, die ein Individuum
bezeichnen, und Quantorenphrasen wie nie-
mand, die eine Eigenschaft zweiter Stufe be-
zeichnen (siehe unten), derselben syntakti-
schen Kategorie an, da es sich in beiden Fllen
um Nominalphrasen handelt. Ebenso verhlt
es sich mit intransitiven Verben: Unpersnli-
che Verben wie regnen bezeichnen bereits Pro-
positionen im Gegensatz zu persnlichen Ver-
ben, wie z. B. schlafen. Transitive Verben un-
terteilen sich z. B. in objekttransparente und
objektopake Verben: Erstere drcken zwei-
stellige Relationen zwischen Individuen aus
(z. B. kssen), letztere bezeichnen Relationen
zwischen Individuen und Eigenschaften zwei-
ter Stufe (z. B. suchen; vgl. dazu Artikel 33).
Diese Verben haben verschiedene logische Ei-
genschaften. Zum Beispiel kann man aus
Klaus-Jrgen kt einer Dame die Hand fol-
94 III. Theorie der Satzsemantik
Format der Bedeutungsregel fr suchen
bringt:
(2) kssen drckt diejenige Relation aus, die
zwischen einem Individuum x und einer
Eigenschaft zweiter Stufe Q genau dann
besteht, wenn Q auf die Eigenschaft erster
Stufe, von x gekt zu werden, zutrifft.
Nach dieser zweiten Bedeutungsregel ist der
Satz Klaus-Jrgen kt eine Dame genau dann
wahr, wenn die durch eine Dame ausgedrckte
Eigenschaft zweiter Stufe auf die Eigenschaft
erster Stufe, von Klaus-Jrgen gekt zu wer-
den, zutrifft. Dies ist genau dann der Fall,
wenn die Eigenschaft, von Klaus-Jrgen ge-
kt zu werden, zu den Eigenschaften gehrt,
welche eine Dame hat. Man macht sich leicht
klar, da diesmal der Schlu auf die Wahrheit
des Satzes Es gibt eine Dame, welche Klaus-
Jrgen kt erlaubt ist.
Durch Typenanhebung kann man oft einen
gemeinsamen Bedeutungstyp erzwingen, al-
lerdings um den Preis der Komplizierung der
Bedeutungsregeln. Die Strategie ist in der so-
genannten Montaguegrammatik als genera-
lizing to the worst case bekannt. Man kann
auf diese Weise die syntaktischen Kategorien
in vielen Fllen unabhngig von semantischen
Gesichtpunkten definieren, ohne den Paral-
lelismus zwischen syntaktischen und seman-
tischen Kategorien aufzugeben. Das Verfah-
ren fhrt aber zu Schwierigkeiten, wenn se-
mantisch offensichtlich heterogene Aus-
drcke in derselben syntaktischen Kategorie
sind. Dies ist zum Beispiel fr Nomina der
Fall.
Man vergleiche etwa Motorrad und Bruder:
das erste Nomen bezeichnet eine einstellige
Eigenschaft, das zweite dagegen eine zwei-
stellige. Nach allgemeiner Auffassung geh-
ren die beiden aber zu derselben Wortklasse
und deshalb auch zu derselben syntaktischen
Kategorie. Ein strikter Parallelist mu diese
Nomina also verschiedenen syntaktischen
Kategorien zuordnen. Auch hier mag es wie-
der Kunstgriffe geben. Zum Beispiel knnte
man einstellige Nomina wie Motorrad formal
als zweistellig klassifizieren. Man mu dann
allerdings sicherstellen, da im Unterschied
zu Edes Bruder in Edes Motorrad das Subjekt
Ede nicht das erste Argument abbindet. Im
zweiten Fall handelt es sich ja nicht um eine
Argumentstelle von Motorrad, sondern um
ein Argument der kontextuell zu erschlieen-
den Besitzer-Relation. Lsungen dieser Art
wird man getrost als epizyklisch bezeichnen
knnen. Das Fazit dieser berlegung ist, da
gehobene Denotate wird man verlangen, da
sie sich semantisch genau so wie nicht ange-
hobene Denotate verhalten. Zum Beispiel
trifft eine Eigenschaft P genau dann auf Fritz
zu, wenn P zur Menge der Eigenschaften ge-
hrt, welche Fritz hat. Deswegen ist die zu-
letzt genannte Menge ein vernnftiges De-
notat fr Fritz mit angehobenem Typ. Da-
gegen wre es nicht sinnvoll, wenn man als
Denotat z. B. die Menge {{Fritz}} whlen
wrde. Diese Eigenschaft zweiter Stufe ko-
diert zwar das Individuum Fritz eindeutig,
eignet sich aber nicht fr eine einheitliche
Interpretation der Subjekt-Prdikats-Bezie-
hung. Die vorher gewhlte Kodierung lt
sich dagegen gem der Leibniz zugesproche-
nen Idee, praedicatum inesse subjecto, deuten.
Das zweite Beispiel betrifft die transitiven
Verben. Man kann sich den erwhnten se-
mantischen Unterschied zwischen objekttran-
sparenten und objektopaken Verben an den
folgenden beiden Bedeutungsregeln klarma-
chen:
(1)
a. kssen bezeichnet diejenige Relation,
die auf ein Paar von Individuen x und
y genau dann zutrifft, wenn das Indi-
viduum x das Individuum y kt.
b. suchen bezeichnet diejenige Relation,
die auf ein Paar, bestehend aus einem
Individuum x und einer Eigenschaft
zweiter Stufe Q, genau dann zutrifft,
wenn fr jede Welt, in der x mit der
Suchaktivitt, in welcher x in der wirk-
lichen Welt begriffen ist, Erfolg hat,
gilt: Q trifft dort auf die Eigenschaft
erster Stufe, von x gefunden zu wer-
den, zu.
Nach der recht komplizierten Bedeutungsre-
gel (1 b) ist zum Beispiel der Satz Klaus-Jrgen
sucht eine echte Dame in der wirklichen Welt
wahr, wenn Klaus-Jrgen in allen denjenigen
Welten eine echte Dame findet, in denen er
findet, wonach er in der wirklichen Welt
sucht. Man sieht sofort, da diese Bedeu-
tungsregel nicht erlaubt, auf die Wahrheit des
Satzes Es gibt eine echte Dame, die Klaus-
Jrgen sucht zu schlieen, denn aus der Tat-
sache, da Klaus-Jrgen nur in den Welten
eine echte Dame findet, in denen er mit seiner
Suche Erfolg hat, folgt nicht, da er in jeder
dieser Welt dieselbe Person findet.
Man kann nun durch Typenanhebung ks-
sen ebenfalls als eine Relation zwischen In-
dividuen und Eigenschaften zweiter Stufe auf-
fassen. Dies macht man sich am besten klar,
indem man die Bedeutungsregel (1 a) in das
7. Syntax und Semantik 95
sie mit wenigen Silben unbersehbar viele Gedan-
ken ausdrckt, da sie sogar fr einen Gedanken,
den nun zum ersten Male ein Erdenbrger gefat
hat, eine Einkleidung findet, in der ihn ein anderer
erkennen kann, dem er ganz neu ist. Dies wre
nicht mglich, wenn wir in dem Gedanken nicht
Teile unterscheiden knnten, denen Satzteile ent-
sprchen, so da der Aufbau des Satzes als Bild
gelten knnte des Aufbaues des Gedankens. ...
Sieht man so die Gedanken an als zusammengesetzt
aus einfachen Teilen und lt man diesen wieder
einfache Satzteile entsprechen, so wird es begreif-
lich, da aus wenigen Satzteilen eine groe Man-
nigfaltigkeit von Stzen gebildet werden kann, de-
nen wieder eine groe Mannigfaltigkeit von Ge-
danken entspricht. Hier liegt es nun nahe zu fragen,
wie der Aufbau des Gedankens geschieht und wo-
durch dabei die Teile zusammengefgt werden, so
da das Ganze etwas mehr wird als die vereinzelten
Teile.
Zum zweiten Punkt von Lyons Kommentar
ist allerdings zu bemerken, da gerade fr
einen Logiker das Kompositionalittsprinzip
alles andere als selbstverstndlich ist. Prono-
mina, die sich wie gebundene Variablen ver-
halten, scheinen nmlich Gegenbeispiele zu
sein. Man betrachte dazu den folgenden Satz:
(4) [
S
[
NP
Jeder junge Politiker] [
VP
glaubt, da
er die Weltprobleme lsen kann]]
Nehmen wir einmal an, der Satz habe die
angegebene Struktur. Ferner setzen wir vor-
aus, da sich er anaphorisch auf das Subjekt
jeder junge Politiker bezieht. Nach dem Kom-
positionalittsprinzip liegt die Erwartung
nahe, da wir die Satzbedeutung aus den Be-
deutungen des Subjekts und des Prdikats
ermitteln. Hier liegt eine Vagheit in der For-
mulierung. Man knnte unter Umstnden bis
auf die Wrter oder gar Morpheme zurck-
gehen. Wir wollen fr das folgende davon
ausgehen, da nur auf die unmittelbaren
Konstituenten zurckgegriffen werden darf.
Wie aber soll das in diesem Falle mglich
sein? Damit das Prdikat eine Bedeutung
haben kann, mu das Pronomen er eine Per-
son bezeichnen. Aber das ist gerade nicht
gegeben. Er hat erst im Verbund mit dem
Subjekt eine Bedeutung, wird also synkate-
gorematisch verwendet, wie man sagt. Diese
Art des Gebrauchs von Pronomina wird in
der Prdikatenlogik bekanntlich als Varia-
blenbindung rekonstruiert. (4) hat im wesent-
lichen die folgende logische Form:
(5) (x) Px
Schon Ajdukiewicz (1935) hat beobachtet,
da sich Ausdrcke dieser Gestalt nicht kom-
die Postulierung eines Parallelismus nicht
ohne Epizyklen um die Konsequenz herum-
kommt, da zumindest in einigen Fllen syn-
taktische Kategorien semantisch motiviert
werden mssen.
Die meisten Linguisten besonders die
generativen Grammatiker lehnen nun al-
lerdings eine semantische Fundierung von
syntaktischen Kategorien ab zugunsten
eines Standpunktes, der als Autonomie der
Syntax bekannt ist. Demnach sind fr die
Bestimmung von syntaktischen Kategorien
rein formale Kriterien magebend wie zum
Beispiel morphologische Merkmale, welche
gem den Prinzipien der sogenannten X-bar-
Theorie projiziert werden (vgl. dazu z. B.
Chomsky 1981). Vom autonomen Stand-
punkt aus ist es keineswegs von vornherein
notwendig, einen Parallelismus von syntakti-
schen und semantischen Kategorien anzuneh-
men. So gibt es in den letzten Jahren tatsch-
lich auch Theorien, die grundstzlich von
einer Nicht-Parallelitt der beiden Systeme
ausgehen (siehe dazu die Bemerkungen ber
typengesteuerte Interpretation in Abschnitt
3.4.2.2). Andererseits ist es eine Erfahrungs-
tatsache, da man fr die prototypischen
Flle mit der Parallelittsforderung gut fhrt.
Es scheint also so zu sein, da das Zusam-
menfassen von bestimmten Ausdrcken unter
dieselbe syntaktische Kategorie im allgemei-
nen semantisch motiviert ist.
2.3Kompositionalitt und Rekursivitt
Gottlob Frege wird ein Prinzip zugeschrieben,
das sich folgendermaen formulieren lt:
(3) Die Bedeutung eines zusammengesetzten
Ausdrucks ist eine Funktion der Bedeu-
tungen seiner Teile und der Weise ihrer
syntaktischen Verbindung.
Dieses Prinzip wird in der Literatur Kompo-
sitionalittsprinzip oder Fregeprinzip genannt.
John Lyons meint in Artikel 1, Abschnitt 1.4,
da es erstens ziemlich fragwrdig sei, Frege
als Urheber dieses Prinzips anzusehen und
da zweitens das Prinzip als solches nicht
besonders aufregend, sondern vielmehr in der
grammatischen Tradition von allen Gelehrten
als Selbstverstndlichkeit vorausgesetzt wor-
den sei.
Zum ersten Punkt ist zu sagen, da Frege
dieses Prinzip tatschlich niemals explizit for-
muliert hat, da es aber in mehreren seiner
Argumente implizit vorhanden ist. So heit
es zu Beginn von Frege (1923):
Erstaunlich ist es, was die Sprache leistet, indem
96 III. Theorie der Satzsemantik
zip allgemeiner zu verstehen ist und deshalb
durch dieses Gegenbeispiel nicht widerlegt
wird. Wir greifen die Bedeutung eines Satzes
wie (4) schlielich nicht aus der Luft. Sie mu
sich also irgendwie aus der Bedeutung der
Satzteile und deren Verknpfung ergeben. Es
mag also schon so sein, wie Lyons behauptet,
da jeder Theoretiker, der einmal ber Be-
deutung nachgedacht hat, das Kompositio-
nalittsprinzip in irgendeiner Form als selbst-
verstndlich akzeptieren wird. Es ist aber gar
nicht klar, was genau ein solcher Theoretiker
damit akzeptiert. Wie Partee (1984 a) zurecht
bemerkt, geben przise Formulierungen des
Prinzips leicht zu Kontroversen Anla.
Bereits eine Przisierung der Fassung (3)
ist alles andere als trivial. Bei nherem Hin-
sehen zeigt es sich nmlich, da hier sowohl
syntaktische wie auch semantischen Verknp-
fungsoperationen vorausgesetzt sind, die auf-
einander bezogen werden mssen. Man ma-
che sich das an einem sehr einfachen Beispiel
klar, nmlich der Koordination von Stzen
durch oder.
Die einschlgige syntaktische Verknp-
fungsregel sei folgendermaen formuliert:
(6) F ist diejenige syntaktische Operation,
welche beliebigen Stzen S
1
und S
2
den
Satz S
1
oderS
2
zuordnet.
Mit andern Worten, wenn die Stze S
1
und S
2
gegeben sind, dann ist F(S
1
,S
2
) der Satz S
1
oderS
2
. Eine adquate Interpretation wird
nun diese Art der sytaktischen Verknpfung
als mengentheoretische Vereinigung deuten,
denn die Vereinigung der Welten, in denen S
1
wahr ist, mit den Welten, in denen S
2
wahr
ist, ist gerade die Menge der Welten, in denen
S
1
oder S
2
wahr ist (vgl. dazu Artikel 8). Mit
anderen Worten, die syntaktischen Operation
F mu durch die folgende semantische Ope-
ration G interpretiert werden:
(7) G(p,q) ist p q, fr beliebige Propositio-
nen p und q.
Aufgrund dieser berlegung kann das Kom-
positionalittsprinzip (3) auf die folgende
Weise formuliert werden:
(8) Kompositionalittsprinzip (UG)
Sei ein Ausdruck, der mithilfe der syn-
taktischen Operation F aus den Ausdrk-
ken
1
,...,
n
gewonnen ist, d. h., =
F(
1
,...,
n
). Seien ferner b
1
,...,b
n
die Be-
deutungen von
1
,...,
n
respektive. Sei
schlielich G die semantische Operation,
durch welche die syntaktische Operation
positionell deuten lassen. Zwar lt sich der
Quantor (x) syntaktisch als ein Funktor be-
schreiben, der aus einem Satz wieder einen
Satz macht. Die Bedeutung dieses Funktors
kann aber keine Funktion sein, welche der
Bedeutung des eingebetteten Satzes, d. h. von
Px, wieder eine Bedeutung zuordnet: Wre
dem nmlich so, so mte (x) eine Wahr-
heitsfunktion denotieren, denn Px bezeichnet
einen Wahrheitswert und (x)Px ebenfalls.
Wir wissen aber, da der Wahrheitswert von
(x)Px von allen Wahrheitswerten abhngt,
die Px denotieren kann. Die Annahme, da
Px eine feste Bedeutung hat, auf die bei der
Ermittlung der Satzbedeutung zurckgegrif-
fen werden kann, ist also nicht haltbar. Genau
diese Annahme scheint das Kompositionali-
ttsprinzip aber zu implizieren.
Man beachte, da Px in unserem Beispiel
fr einen komplexen Ausdruck steht. Man
kann sich also nicht dadurch herausreden,
da man den Wahrheitswert von (x)Px
durch Rckgriff auf die Bedeutung von P
allein ermitteln kann. Abgesehen davon, da
wir vorausgesetzt haben, da die kompositio-
nale Interpretation nur auf die unmittelbaren
Konstituenten zurckgreifen darf, mten
wir erst einmal die Bedeutung von P bestim-
men. Eine genauere Betrachtung wrde zei-
gen, da dabei genau dasselbe Problem wie
eben auftritt.
In diesem Zusammenhang verdient er-
whnt zu werden, da Ajdukiewicz (1935) die
im allgemeinen Montagues PTQ zugeschrie-
bene Erfindung des Nominals vorweggenom-
men hat, indem er vorschlug, den Ausdruck
(x)Px durch die Analyse (Px) zu ersetzen,
wobei ein Funktor der Kategorie s/(s/n) ist,
der aus einem einem Verbal (s/n) einen Satz
s macht. Der Russellsche Zirkumflexoperator
ist die -Abstraktion, die hier aus dem offenen
Satz Px das Verbal Px abstrahiert. Dies ist
die entscheidende Idee von Montagues PTQ-
Analyse. Zur Kategoriennotation, vgl. Ab-
schnitt 4.2.1. Der Sache nach ist die Trennung
zwischen Quantor und Funktionalabstrak-
tion brigens schon bei Frege angelegt. Frege
sieht Quantoren als Begriffe zweiter Stufe an.
Ferner liefert seine -Abstraktion den Wer-
teverlauf einer Funktion. Frege hat Quanto-
ren und -Abstrakte aber nicht syntaktisch
verbunden, weil -Abstrakte keine Begriffe
sondern Gegenstnde sind und deshalb in sei-
nem System keine Argumente eines Begriffs
von Begriffen sein knnen.
Man kann gegen die obige Argumentation
einwenden, da das Kompositionalittsprin-
7. Syntax und Semantik 97
smtliche klassischen Definitionen des Satzes
gescheitert oder zumindest wenig aussage-
krftig sind (vgl. dazu Ries 1931).
Die Montaguesche Formulierung (6) ist
eine sehr allgemeine Przisierung des Kom-
positionalittsprinzips: Sie lt vllig offen,
welcher Art die semantischen Operationen
sind, welche die Syntaxregeln deuten. Mgli-
cherweise gibt es hier empirische Beschrn-
kungen. Wir kommen in Abschnitt 3.4.2.3
(Monsterverbot) noch einmal auf diese
Frage zurck.
Die Przisierung des Kompositionalitts-
prinzips zeigt schlielich, da man innerhalb
des Prinzips einen syntaktischen und einen
semantischen Aspekt unterscheiden mu: die
syntaktische Seite der Kompositionalitt wird
durch die syntaktischen Operationen, der se-
mantische Aspekt dagegen durch die seman-
tischen Operationen rekonstruiert. An dieser
Stelle wird eine Idealisierung sichtbar, die
mglicherweise mit dem modularen Ansatz
der modernen generativen Grammatik nicht
vertrglich ist. Die Idealisierung besteht
darin, da Syntaxregeln vorausgesetzt wer-
den, nmlich Operationen, die aus Ausdrk-
ken wieder Ausdrcke machen. Die moderne
generative Grammatik, z. B. die sogenannte
Rektions- und Bindungstheorie, kennt aber
gar keine Syntaxregeln mehr in diesem Sinne.
Es gibt nur noch eine Reihe von unter ein-
ander unabhngigen Wohlgeformtheitsprin-
zipien, deren komplexes Zusammenspiel die
Grammatikalitt eines Ausdrucks oder einer
Struktur bestimmt (vgl. etwa Chomsky 1981).
Es ist die Frage, ob sich diese Prinzipien in
algebraische Operationen umformulieren las-
sen, wie dies in der Montagueschen Przisie-
rung vorausgesetzt ist. Selbst wenn diese Um-
formulierung prinzipiell mglich ist, bleibt
noch die Frage, ob sie im Sinne der genera-
tiven Grammatik erhellend ist. Auf jeden
Fall stellt sich das Problem, wie das Kom-
positionalittsprinzip fr die generative
Grammatik formuliert werden kann. Darauf
wird in Abschnitt 6 eingegangen werden.
Selbst wenn man Montagues Formulierung
(8) akzeptiert, wird man doch nicht behaup-
ten knnen, da sie in allen Punken eine Ex-
plikation des Fregezitates darstellt. Nach
Frege hat der Gedanke ebenso wie der Satz
Teile. Die Proposition der Mgliche-Welten-
Semantik hat aber keine Teile, sondern ist
eine ungegliederte Menge von Welten, der
man die Proposition, aus denen sie gewon-
nen worden ist, nicht ohne weiteres ansehen
kann. Ebensowenig kann man z. B. der Zahl
F gedeutet wird, dann ist die Bedeutung
von gleich G(b
1
,...,b
n
).
Diese Formulierung die Montagues UG
zugrundeliegt zeigt mehrerlei: Erstens wird
przisiert, auf welche Weise das, was in (3)
die Art der syntaktischen Verbindung ge-
nannt wurde, die Bedeutung beeinflussen
kann, so da das Ganze etwas mehr wird
als die vereinzelten Teile. Wenn immer aus
bereits erzeugten Teilausdrcken ein komple-
xerer Ausdruck gebildet wird, dann gibt es
eine syntaktische Operation (Regel), die dies
leistet. Diese Regel wird durch eine semanti-
sche Operation gedeutet, die den Bedeutun-
gen der Teilausdrcke eine neue Bedeutung
zuordnet, diejenige des Resultatsausdrucks.
Man sieht hier deutlich, da Syntaxregeln
semantisch interpretiert werden mssen, eine
Notwendigkeit, woran man bei umgang-
sprachlichen Formulierungen wie (3) zu-
nchst gar nicht denkt.
Das zweite wesentliche Merkmal der Pr-
zisierung (8) ist, da es sich um eine rekursive
Definition handelt: Es wird vorausgesetzt,
da bereits auf syntaktisch aufgebaute Teil-
ausdrcke und ihre Bedeutungen zurckge-
griffen werden kann. Am Anfang einer sol-
chen Rekursion stehen natrlich syntaktisch
nicht weiter zerlegbare Bestandteile, die Wr-
ter, deren syntaktische Kategorien und deren
Bedeutungen im Lexikon festgelegt werden
mssen.
Da der Begriff Kompositionalitt nur re-
kursiv definiert werden kann, ist in der gram-
matischen Tradition sicher nicht gesehen oder
zumindest nicht thematisiert worden. Ein
Gleiches gilt bereits fr so selbstverstndliche
Begriffe wie syntaktische Kategorie. Man
denke etwa an den Satzbegriff selbst. Die in
Artikel 1 zitierte klassische Definition Pris-
cians, nach der ein Satz eine wohlgeformte
Folge von Wrtern ist, die eine vollstndige
Aussage ausdrckt (ordinatio dictionum con-
grua sententiam perfectam demonstrans) ist
bezeichnenderweise nicht rekursiv: Weder ist
gesagt, was Wohlgeformtheit bedeutet, noch
ist der Satzbegriff formal, d. h. ohne Rck-
griff auf Bedeutung, definiert. Und eine nicht-
rekursive Definition dessen, was die Wohl-
geformtheit eines Satzes ausmacht, ist auch
grundstzlich nicht mglich, einfach deshalb,
weil es unendlich viele Stze gibt und diese
beziehungsweise deren Wohlgeformtheit
nur mit Rekurs auf die Regeln definiert wer-
den knnen, die sie erzeugen. In diesem Um-
stand ist der tiefere Grund zu sehen, weshalb
98 III. Theorie der Satzsemantik
che berlegungen eine Rolle gespielt. Heut-
zutage kmmern sich die meisten generativen
Grammatiker kaum mehr darum, da Fragen
der Formalisierung in dieser Theorie whrend
der letzten Jahre in den Hintergrund getreten
sind zugunsten von grundstzlichen berle-
gungen.
Ein ernsthafteres Problem fr das Thema
dieses Artikels stellt die semantische Mehr-
deutigkeit dar. Solche Mehrdeutigkeiten kn-
nen einmal dadurch entstehen, da ein Wort
mehrdeutig ist, z. B. Flgel, womit die
Schwinge eines Vogels, eine Art von Klavier,
ein Gebudeteil, die Hlfte einer Doppeltr
und anderes gemeint sein kann. Diese Art von
Ambiguitt kann man lexikalische Mehrdeu-
tigkeit nennen. Daneben gibt es aber einen
anderen Typ von Mehrdeutigkeit, der bli-
cherweise strukturelle Mehrdeutigkeit genannt
wird. (Die Benennung ist insofern proble-
matisch, als sie bereits eine bestimmte Art von
theoretischer Analyse suggeriert, nmlich die
Subsumption unter den Begriff der syntakti-
schen Mehrdeutigkeit.) Ein Standardsatz, an-
hand dessen diese Art von Mehrdeutigkeit
illustriert zu werden pflegt, ist (10 a), der die
Lesarten (10 b) und (10 c) hat:
(10)
a. Jeder Mann liebt eine Frau.
b. Fr jeden Mann gibt es eine Frau,
die er liebt.
c. Es gibt eine Frau, die jeder Mann
liebt.
Es handelt sich bei diesem Beispiel um einen
Fall von Skopusmehrdeutigkeit. In (10 b) hat
der Allquantor jeder Mann weiten Skopus
bezglich des Existenzquantors eine Frau, in
(10c) hat der Allquantor dagegen engen Sko-
pus bezglich des Existenzquantors. (Fr die
hier benutzte Terminologie vgl. Artikel 21.)
Wir diskutieren nun, wie die beiden Typen
von Mehrdeutigkeiten rekonstruiert werden.
Bereits lexikalische Mehrdeutigkeiten stellen
fr eine Theorie, welche eine Interpretation
als Funktion auffat, ein gewisses Problem
dar. Die verbreitetste Strategie, diese Flle
abzuhandeln, besteht darin, Homonyme le-
xikalisch zu desambiguieren, indem man z. B.
zwischen Flgel
1
, Flgel
2
usw. unterscheidet.
Eine solche Theorie fat also Flgel nicht als
ein einziges Wort auf, sondern als verschie-
dene. Jedem dieser Wrter kann dann durch
die Interpretationsfunktion problemlos genau
eine Bedeutung zugeordnet werden. Dieses
Verfahren wird z. B. in Montagues UG oder
in Cresswell (1973) benutzt. Man knnte ein-
12 ansehen, da sie im konkreten Fall das
Resultat der Addition von 7 und 5 ist. Sie
knnte auch auf andere Weise bestimmt wor-
den sein. Analog dazu kann man eine Pro-
position auf verschiedene Weise ausdrcken.
Wer also genau den Fregeschen Kompositio-
nalttsbegriff rekonstruieren mchte, mu
den syntaktischen Aufbau noch mit zum Ge-
danken zhlen (vgl. dazu Lewis 1970 und
Cresswell 1985 b).
Die in diesem Abschnitt andiskutierten
Fragen sollten deutlich gemacht haben, da
die mit dem Kompositionalittsprinzip zu-
sammenhngenden Probleme alles andere als
trivial sind. Sie betreffen vielmehr das Herz-
stck der semantischen Theoriebildung, nm-
lich den Interpretationsbegriff selbst. Die
Formulierung (8) ist ja nichts anderes als die
Kernklausel, welche eine lexikalisch gegebene
Interpretation rekursiv auf alle Ausdrcke
einer Sprache fortpflanzt.
2.4Mehrdeutigkeit
Es gibt zwei Arten von Mehrdeutigkeit, syn-
taktische und semantische. Syntaktische
Mehrdeutigkeit liegt dann vor, wenn die Re-
geln der Grammatik einem Ausdruck mehr
als eine Struktur zuweisen, d. h., falls es meh-
rere verschiedene Ableitungen gibt. Semanti-
sche Mehrdeutigkeit ist gegeben, wenn ein und
derselbe Ausdruck mehr als eine Bedeutung
hat.
Ein einfaches Beispiel fr syntaktische
Mehrdeutigkeit ist ein Satz der Form oder
oder . Aufgrund der oben angegebenen
Regel (6) kann er auf zweierlei Weise herge-
leitet werden, nmlich als F(,F(,)) oder als
F(F(,),). Diesen beiden Ableitungen ent-
sprechen die folgenden syntaktischen Struk-
turen:
(9)
a. (
F
oder (
F
oder ))
b. (
F
(
F
oder ) oder )
Syntaktische Mehrdeutigkeiten sind eine
Folge des Regelsystems. Sie brauchen keine
semantischen Mehrdeutigkeiten nach sich zu
ziehen. Fr das gerade diskutierte Beispiel
garantiert unsere Interpretationsregel (7) die
semantische Eindeutigkeit.
Wendet man formale Systeme zur syntak-
tischen Analyse von natrlichen Sprachen an,
so stellt sich die Frage, inwieweit syntaktische
Mehrdeutigkeiten reine Artefakte des For-
malismus sind und inwieweit sie empirisch
gerechtfertigt sind. Zu Beginn der Entwick-
lung der generativen Grammatik haben sol-
7. Syntax und Semantik 99
kalische Ambiguititen auch bei Zugrunde-
legung einer Interpretationsfunktion erklrt
werden knnen.
Konsequenzenreicher ist die Problematik,
die mit strukturellen Mehrdeutigkeiten, ins-
besondere der Skopusmehrdeutigkeit verbun-
den ist. Wir haben bereits darauf hingewiesen,
da die Benennung strukturelle Mehrdeutig-
keit insofern nicht unproblemantisch ist, als
sie die theoretische Behandlung des Phno-
mens bereits vorwegnimmt. Betrachten wir
dazu Satz (10a). Um die Diskussion nicht zu
belasten, wollen wir von den Komplikationen
der deutschen Syntax (Finitumvoranstellung
mit anschlieender Topikalisierung eines
Satzgliedes) absehen und diesen Satz wie sein
englisches Gegenstck gliedern. Unter diesen
Annahmen hat er die folgende Gestalt:
(12) [
S
[
NP
jeder Mann] [
VP
liebt [
NP
eine Frau]]]
Die relevanten Regeln, welche diese Struktur
aufgebaut haben, sind die folgenden kontext-
freien Phrasenstrukturregeln:
(13)
a. S NP VP
b. VP V NP
Im Gegensatz zu der oben eingefhrten Regel
(6) kann dieses Regelsystem keine Quelle fr
irgendwelche syntaktischen Mehrdeutigkeiten
sein, wie man beim ersten Hinschauen er-
kennt. Nimmt man einmal an, diese Analyse
sei die einzig empirisch vertretbare, dann
scheidet scheinbar der Weg aus, die semanti-
sche Mehrdeutigkeit von (10a) durch eine
strukturelle, d. h. syntaktische Mehrdeutig-
keit zu erklren, die fr die verschiedenen
Bedeutungen verantwortlich ist.
Montague hat das Problem zu umgehen
versucht, indem er eine semantisch motivierte
syntaktische Analyse vorgelegt hat, nach der
Nominalphrasen wie in der Prdikatenlogik
als Quantoren auf offene Stze angewandt
werden. In Montagues PTQ wird Satz (10a)
von Details der technischen Ausformulie-
rung einmal abgesehen durch Anwendung
der Quantoren jeder Mann x und eine Frau y
auf die offene Formel x liebt y hergeleitet.
Wendet man zuerst eine Frau y und dann erst
jeder Mann x an, so erhlt man die Lesart
(10b), whrend eine umgekehrte Anwendung
die Lesart (10c) ergibt. Die Regel der Quan-
torenanwendung (Hineinquantifizieren
bzw. quantifying in) wird im folgenden Q
genannt. Die beiden Ableitungen von (10a)
sind demnach:
wenden, da bei einem derartigen Vorgehen
das empirische Faktum der Mehrdeutigkeit
definitorisch aus der Welt geschafft wird. Es
bedarf aber nur einer geringfgigen Zusatz-
technik, um diesem Einwand zu begegnen,
nmlich einer Komponente der Grammatik,
in der die desambiguierten Wrter wieder
identifiziert werden, etwa durch Indextilgung.
Mit Bezug auf die nicht-desambiguierten
Wrter kann man dann die Relation der
Mehrdeutigkeit in naheliegender Weise defi-
nieren.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
da die Methode der Desambiguierung durch
Indizierung nicht zwischen verschiedenen Ar-
ten von lexikalischer Mehrdeutigkeit zu un-
terscheiden vermag. Man betrachte zunchst
wieder Flgel. Smtliche Spielarten dieses
Wortes haben eine gemeinsame etymologische
Herkunft. Deshalb bezeichnet man ein sol-
ches Wort in der Literatur auch als polysem,
d. h. als ein Wort mit vielen Bedeutungen. Im
Gegensatz dazu wird ein Wort wie Ton ho-
monym genannt, da die beiden Bedeutungen
Klang bzw. eine bestimmte Art von
Erde auf verschiedene Etyma zurckge-
hen, die durch die historische Entwicklung zu
einer Lautform geworden sind. Im letzteren
Fall handelt es sich, intuitiv gesehen, eher um
zwei Wrter, die zufllig dieselbe Lautgestalt
haben. Wir lassen die Frage, auf welche Weise
Polysemie und Homonymie rekonstruiert
werden knnen, in diesem Artikel offen.
Eine andere Methode, lexikalische Mehr-
deutigkeiten zu erfassen, besteht darin, die
Interpretation als Relation anzusehen, die ein
Wort unter Umstnden mit mehreren Bedeu-
tungen verbindet. Die meisten Semantiker
vermeiden diese Art von Analyse, um nicht
in technische Schwierigkeiten zu geraten.
Man mu die Bedeutungsrelation ja rekursiv
fr komplexe Ausdrcke definieren, wobei
sich die Mehrdeutigkeiten unter Umstnden
multiplizieren. Man betrachte zum Beispiel
den Satz:
(11) Hubertus ersteigerte ein Schlo und
einen Flgel.
Nehmen wir einmal an, Schlo sei zweideutig
und Flgel sei vierdeutig. Dann mu die Be-
deutungsrelation diesem Satz acht verschie-
dene Bedeutungen zuordnen. Es ist sicher
kein Problem, eine Relation zu definieren, die
so etwas leistet, aber die Definition wird um-
stndlich und ist zudem entbehrlich, da lexi-
100 III. Theorie der Satzsemantik
bitrary interpretation as the basic goal of serious
syntax and semantics; and the developments ema-
nating from the Massachusetts Institute of Tech-
nology offer little promise to that end.
Dieses Zitat ist ein besonders klarer Beleg fr
die Auffassung von Syntax, die wir seman-
tisch motiviert genannt haben.
In der GB-Theorie Chomskys (1981) wer-
den Skopusmehrdeutigkeiten ebenfalls ber
syntaktische Mehrdeutigkeiten erklrt, aller-
dings auf einer besonderen Reprsentations-
ebene der Theorie, nmlich der sogenannten
logischen Form (vgl. dazu Abschnitt 5.2). Auf
andern Reprsentationsebenen der Gram-
matik ist ein Satz wie (10a) dagegen syntak-
tisch eindeutig. So hat (10a) auf der Ebene
der sogenannten S-Struktur die angegebene
Analyse (12). Die beiden Strukturen (14a)
und (14b) erzeugt man, indem man die Regel
Q rckwrts anwendet: Bei Montague wird
die Quantorenphrase an die Stelle der gebun-
denen Variablen eingesetzt, whrend sie bei
Chomsky aus dieser Position herausbewegt
wird und eine entsprechende Variable hinter-
lt. In der Chomskyschen Theorie heit die
Regel Q deswegen auch Quantorenanhe-
bung (vgl. May 1977 fr Details). Diese Re-
gel wird auf der Ebene der logischen Form
angewandt. Die entsprechenden logischen
Formen fr die beiden Lesarten sind von
irrelevanten Einzelheiten wieder abgesehen
die folgenden:
(16)
a. [[
NP
jeder Mann]
x
[[
NP
eine Frau]
y
[
S
x liebt y]]]
b. [[
NP
eine Frau]
y
[[
NP
jeder Mann]
x
[
S
x liebt y]]]
Man erkennt, da diese Strukturen isomorph
zu den Montagueschen Strukturen (14) sind.
Die Behandlung von Skopusmehrdeutigkei-
ten in der Chomskyschen Theorie ist also mit
derjenigen Montagues zunchst quivalent.
Der Vorteil der GB-Theorie besteht darin,
da sie eine autonome Auffassung von Syntax
ermglicht: Die Ebene der S-Struktur enthlt
die nach Voraussetzung empirisch gerechtfer-
tigte Struktur (12), whrend in der semantisch
motivierten Syntax Montagues diese Struktur
nirgends erscheint.
Ein hnlicher Weg wie in der GB-Theorie
ist bereits in Cooper & Parsons (1976) be-
schritten worden. Die Autoren nehmen fr
einen Satz wie (10a) eine einzige syntaktische
Struktur an, nmlich (12). Diese wird mit
Skopusindizes versehen, die den Bezugsbe-
reich eines Nominals anzeigen. Jeder NP-
Knoten wird mit einem S-Knoten koindiziert,
und dies besagt, da das gesamte S der Wir-
Man sieht sofort, da zwischen diesen beiden
syntaktischen Strukturen und den prdika-
tenlogischen Ausdrcken (15a) und (15b) eine
Eins-zu-Eins-Beziehung besteht:
(15)
a. (x)[Mann(x)(
y)[Frau(y) & liebt(x,y)]]
b. (y)[Frau(y) & (
x)[Mann(x) liebt(x,y)]]
Damit ist klar, da die Strukturen so gedeutet
werden knnen, da sie die genannten Les-
arten (10b) und (10c) ausdrcken.
Die folgenden Einwnde gegen diese Art
der Behandlung liegen auf der Hand. Erstens
gibt es keinerlei von semantischen Gesichts-
punkten unabhngige Evidenz fr syntakti-
sche Analysen dieser Art. Keine der beiden
syntaktischen Analysen, entspricht der nach
Voraussetzung empirisch gerechtfertigten
Struktur (12). Zweitens kann man einwenden,
da die Erklrung von Skopusmehrdeutig-
keiten mithilfe von syntaktischer Mehrdeutig-
keit als solche erst zu rechtfertigen sei. Diesen
Einwand kann man aber so lange beiseite
schieben, wie keine alternativen, nichtstruk-
turellen Theorien in Sicht sind.
Der erste Einwand wird von Montague
selbst durch eine bewute Absage an die
These von der Autonomie der Syntax beant-
wortet. Fr den Kalifornier hat die Syntax
lediglich den Zweck, eine rekursive Bedeu-
tungsdefinition fr die gesamte Sprache zu
ermglichen. Jede syntaktische Beschreibung,
die das leistet, ist zunchst adquat. Die Syn-
tax wird so zur reinen Hilfswissenschaft der
Semantik. Die klassische Formulierung dieses
Standpunktes findet sich zu Beginn von Mon-
tagues EFL:
I do not regard as successful the formal treatments
of natural languages attempted by certain comtem-
porary linguists. Like Donald Davidson I regard
the construction of a theory of truth or rather,
of the more general notion of truth under an ar-
7. Syntax und Semantik 101
An dieser Stelle ist brigens genau das Fre-
geprinzip (vgl. Abschnitt 2.3) in die Theorie
eingebaut. Die algebraischen Operationen der
Syntax sind die Operationen, welche Zeichen-
folgen zu neuen Zeichenfolgen kombinieren.
Die algebraischen Operationen der Semantik
sind semantische Operationen, die Bedeutun-
gen Bedeutungen zuordnen.
Die allgemeine Theorie, welche in Monta-
gues UG dargestellt ist, enthlt lediglich die
folgenden Beschrnkungen:
1. Ein komplexer Ausdruck, d. h. ein Ele-
ment der Syntaxalgebra, ist eindeutig zerleg-
bar. Damit ist gemeint, da man ihm die
syntaktische Operation und die Teilausdrcke
ansehen kann, mit deren Hilfe er gebildet
ist. Beliebige algebraische Systeme erfllen
eine solche Beschrnkung im allgemeinen
nicht, z. B. wird nichts dergleichen fr die
Semantikalgebra gefordert (vgl. dazu die Be-
merkungen am Ende von Abschnitt 3.3.1).
2. Aus der Forderung, da die Interpreta-
tion eine Abbildung ist, ergibt sich, da keine
semantischen Mehrdeutigkeiten zugelassen
sind. Mehrdeutigkeiten mssen also durch
einen zustzlichen Apparat analysiert werden
(vgl. dazu Abschnitt 2.4).
3. Die Forderung, da die Interpretation
homomorph ist, erweist sich als eine spezielle
Rekonstruktion des Fregeprinzips (vgl. die
Formulierung (8) in Abschnitt 2.3).
4. Der in Abschnitt 2.2 diskutierte strikte
Parallelismus zwischen syntaktischen und se-
mantischen Kategorien wird von Montague
explizit gefordert. Eine Interpretation, die die-
ser Forderung gengt, wird Fregesche Inter-
pretation genannt werden. Diese Einschrn-
kung wird sich als einigermaen einschnei-
dend erweisen.
Insgesamt sind die Einschrnkungen aber
unerheblich. Die Syntaxtheorie ist so stark,
da unter anderem alle rekursiv aufzhlbaren
Sprachen erzeugt werden knnen. Ebenso
gibt es keinerlei Einschrnkungen fr seman-
tische Operationen. Das System ist also nicht
in demselben Sinne eine Universalgrammatik,
wie die Chomskysche. Whrend Chomskys
Theorien einen universellen Rahmen fr mg-
liche natrliche Sprachen abstecken mchte,
zielt Montagues Theorie auf einen Rahmen
fr alle Sprachen ab. Auf mgliche, empirisch
motivierte Beschrnkungen der Theorie kom-
men wir noch zu sprechen.
3.2Syntax
Montagues UG nimmt zwei Ebenen der syn-
taktischen Reprsentation an, die wir die
Ebene der DA-Struktur und die der OF-
kungsbereich der betreffenden NP ist. Wenn
ein S mit mehr als einem Skopusindex verse-
hen ist, legt die Reihenfolge der Indizes den
relativen Skopus der koindizierten NPs fest.
Fr unser Beispiel sind die beiden Lesarten
in diesem System folgendermaen zu desam-
biguieren:
(17)
a. [
Sij
[
NPi
jeder Mann] [
VP
liebt [
NPj
eine Frau]]]
b. [
Sji
[
NPi
jeder Mann] [
VP
liebt [
NPj
eine Frau]]]
Die beiden Strukturen unterscheiden sich nur
durch die Reihenfolge der Skopusindizes an
S, welche den relativen Skopus der beiden
Nominale kodiert. Offensichtlich sind diese
Reprsentationen wiederum isomorph zu de-
nen der Montague-Grammatik und denen der
GB-Theorie, d. h. sie sind 1-zu-1 in jedes die-
ser Systeme bersetzbar. Damit ist auch klar,
da sie auf dieselbe Weise gedeutet werden
knnen. Genau wie die GB-Theorie hat dieser
Ansatz den Vorteil, da es eine autonome
syntaktische Ebene gibt: Die syntaktische
Struktur ist unabhngig von Skopusmehrdeu-
tigkeiten motiviert, die Desambiguierung fin-
det ber Indizes auf einer eigenen Ebene statt,
die an der eigentlichen syntaktischen Struktur
nichts ndern, die Interpretation aber beein-
flussen.
Als Ergebnis dieses Abschnittes halten wir
fest, da smtliche Theorien Skopusmehrdeu-
tigkeiten als strukturelle Mehrdeutigkeiten re-
konstruieren, wobei sich die verschiedenen
Vorschlge lediglich darin unterscheiden, ob
eine autonome syntaktische Ebene ohne
strukturelle Mehrdeutigkeiten angenommen
wird oder nicht. Sowohl fr lexikalische als
auch fr Skopusmehrdeutigkeiten gilt also,
da sie in einer speziellen Komponente des
Systems desambiguiert werden. Im Zuge die-
ser Praxis hat es sich eingebrgert, Skopus-
mehrdeutigkeiten als strukturelle Mehrdeu-
tigkeiten anzusehen.
3. Montagues Universalgrammatik
3.1Allgemeine Konzeption
Montagues Sprachtheorie ist so allgemein
formuliert, da sie als begrifflicher Bezugs-
rahmen fr die meisten Beitrge dieses Bandes
dienen kann. Die Grundkonzeption ist de
facto in dem Abschnitt ber allgemeine
Grundlagen bereits vorgestellt worden. Auf
den einfachsten Nenner gebracht, besagt die
Theorie folgendes: Syntax und Semantik sind
algebraische Systeme, und die Interpretation
ist eine homomorphe, d. h. strukturerhal-
tende Abbildung der Syntax auf die Semantik.
102 III. Theorie der Satzsemantik
(20) Eine (auf Kat und , basierende)
DA-Syntax (desambiguierte Syntax)
besteht aus einem Lexikon (X
)
Kat
,
einer Menge von Syntaxregeln S, einer
Menge von syntaktischen Kategorien
(C
)
Kat
und einem ausgezeichneten Ka-
tegorienindex
0
, wobei die folgenden
Bedingungen gelten:
a. Das Lexikon ist ein Mengensystem
(X
)
Kat
. Jedes dieser X
ist eine Teil-
menge von A und heit (die zu
gehrige) lexikalische Kategorie. Le-
xikalische Kategorien drfen leer
sein, sich aber nicht berschneiden.
Sie enthalten die Grundausdrcke
oder Lexeme.
b. Jede Syntaxregel hat die Form
F,
1
,...,
n
, , wobei F eine n-stel-
lige syntaktische Operation aus ist
und
1
,...,
n
, aus Kat sind.
c. Das System (C
)
Kat
der syntakti-
schen Kategorien ist durch die fol-
genden beiden Bedingungen be-
stimmt:
(i) Fr jeden Kategorienindex ist
X
eine Teilmenge von C
.
(ii) Wenn F,
1
,...,
n
, eine Syn-
taxregel ist und
1
,...,
n
Aus-
drcke sind, die in den Katego-
rien C
1
,...,C
n
respektive liegen,
dann liegt der Ausdruck
F(
1
,...,
n
) in der Kategorie C
.
Die Elemente von C
heien Aus-
drcke der Kategorie , fr jedes
aus Kat.
Die beiden folgenden Bedingungen (d) und
(e) beinhalten die eindeutige Zerlegbarkeit der
Ausdrcke:
d. Es ist verboten, da eine Syntaxregel
ein Resultat liefert, das in einer lexi-
kalischen Kategorie liegt (Fundiert-
heit).
e. Zustzlich wird verlangt, da es zu
jedem Ausdruck eindeutige Vorgn-
gerausdrcke gibt. Wenn also zwei
Operationen zum selben Wert fhren,
dann mssen sie gleich sein:
Falls F(
1
,...,
m
) = G(
1
,...,
n
), so F
= G und
1
,...,
m
=
1
,...,
n
(folglich auch m = n,
1
=
1
,...usw.).
f. Der ausgezeichnete Kategorienindex
0
kennzeichnet die Kategorie der
Stze des Systems.
Zunchst ist zu bemerken, da Montague in
UG ein System dieser Art nicht desambi-
guierte Syntax sondern desambiguierte Spra-
Struktur nennen wollen. DA-Strukturen bil-
den den Input fr die semantische Interpre-
tation. Da es sich bei letzterer um eine Funk-
tion handelt, mssen DA-Strukturen vollstn-
dig desambiguiert sein (daher die Bezeichnung
DA). DA-Strukturen entsprechen also nicht
den D-Strukturen der GB-Theorie, sondern
eher deren logischen Formen (vgl. dazu die
Ausfhrungen in Abschnitt 2.4). Die Bezeich-
nung OF soll an Oberflche erinnern.
DA-Strukturen werden durch eine DA-
Syntax erzeugt. Dabei handelt es sich in
einem noch zu przisierenden Sinne um
eine Algebra, deren Elemente also gerade
die DA-Strukturen strukturell eindeutig
sind und die aufgebaut werden durch sukzes-
sive Anwendung von syntaktischen Operatio-
nen, wobei die durch ein Lexikon vorgege-
benen Elemente den Bodensatz bilden. Eine
DA-Syntax kann man sich als ein System von
Regeln vorstellen, die von der folgenden
Form sind:
(19) Wenn
1
,...,
n
Ausdrcke der Katego-
rien
1
,...,
n
respektive sind, dann ist
F(
1
,...,
n
) ein Ausdruck der Kategorie
.
Jede solche Regel ist nichts anderes als eine
n-stellige (beschrnkte) algebraische Opera-
tion F. Das gesamte System ist also eine par-
tielle Algebra. Diesen einfachen Grundgedan-
ken sollte man bei den folgenden beiden etwas
umstndlichen Definitionen vor Augen
haben, deren relative Kompliziertheit techni-
sche Grnde hat, auf die wir spter noch kurz
eingehen.
Fr die folgende Definitionen bezeichnet
Kat eine Menge von Kategorienindizes. Sie
dienen zur Bezeichnung der syntaktischen
Kategorien des Systems. Ferner setzen wir
voraus, da ein Paar A, gegeben ist, das
aus einer Menge von Ausdrcken A und einer
Menge von syntaktischen Operationen be-
steht, die auf A definiert sind. Im Unterschied
zu Montagues Originaldefinition in UG lt
die folgende Definition die Frage offen, wel-
che Elemente in A sind. Montague selbst ver-
langt, da A die kleinste vom Lexikon er-
zeugte Menge ist. Dieser Sachverhalt ist nur
umstndlich auszudrcken und erschwert ein
Verstndnis der Definition. Wir erlutern,
was damit gemeint ist, am Ende dieses Ab-
schnittes. Wer mit dieser restriktiveren Be-
griffsbildung arbeiten mchte, kann die Er-
luterungen als Zusatzbedingungen zur De-
finition auffassen.
7. Syntax und Semantik 103
Eindeutigkeitsbegriff. Wir kommen auf die-
sen Punkt zurck.
In diesem Zusammenhang wollen wir auf
die oben angeschnittene Frage eingehen, wie
man sich die Trgermenge A der Algebra
A, vorzustellen hat, auf welcher die DA-
Syntax basiert. Es handelt sich dabei um alle
Ausdrcke, die man mithilfe der unbe-
schrnkten Operationen in aus lexikali-
schen Ausdrcken bilden kann. Die DA-Syn-
tax whlt durch Beschrnkung der Operatio-
nen aus diesem Vorrat aus, ist also eine Teil-
algebra dieses Systems. Strukturell ndert sich
dabei nichts. Wenn F als einzige Operation
zum Beispiel die zweistellige Verkettung ist
und wir ein Vokabular V vorgegeben haben,
dann ist A das freie Monoid ber V, die
bliche Situation, die wir bei Ersetzungssy-
stemen vorfinden, etwa in dem Beispiel, das
wir gleich diskutieren. Im allgemeinen Fall
sind die syntaktischen Operationen aber kom-
plizierter als die Verkettung. Man kann sich
die Ausdrcke in A dann als Terme der Form
F(
1
,...,
n
) reprsentiert vorstellen, wobei F
ein Name fr eine syntaktische Operation ist,
die auf die Argumentausdrcke
1
,...,
n
an-
gewandt ist. So ein System ist in der Literatur
als Termalgebra bekannt. Diese Erluterun-
gen sollten auch verdeutlicht haben, weshalb
Montagues Begriffsbildung so kompliziert
anmutet: Syntaxregeln sind beschrnkte Ope-
rationen. Mengentheoretisch kann man die
Beschrnkungen aber nur formulieren, indem
man zunchst die gesamten Operationen an-
gibt. Fr das folgende wollen wir stets davon
ausgehen, da die Trgermenge in dieser
Weise definiert ist. Wir nennen das System
A, im folgenden zuweilen auch syntakti-
sche Algebra. Die Elemente von A heien DA-
Ausdrcke.
Zur Veranschaulichung von Definition (20)
wollen wir nun die folgende kleine kontext-
freie Syntax in Montagues Formalismus ber-
tragen.
(22)
a. S NP VP
b. VP V NP
c. NP Art N
d. N Mann, Frau
e. V liebt
f. Art jeder, eine
Als Kategorienindizes knnen wir die nicht-
terminalen Symbole der kontextfreien Syntax
whlen, d. h. wir setzen Kat als S, NP, VP, V,
Art, N. Die lexikalischen Kategorien sind die
folgenden:
che nennt. In gewisser Weise ist die Wahl der
Terminologie willkrlich, da in dem System
beides steckt: sowohl die Syntaxregeln als
auch die dadurch erzeugten Mengen von Aus-
drcken.
Der nchste Kommentar betrifft die For-
derung (d) nach der Fundiertheit der Syntax.
Sie ist fr natrliche Sprachen beinahe selbst-
verstndlich, da sie besagt, da jede Kon-
struktion aus unzerlegbaren Grundausdrk-
ken eben den Lexemen mithilfe von
Syntaxregeln aufgebaut ist. Wrde man auf
die Fundiertheit verzichten, wre die Eindeu-
tigkeit des Aufbaus der Ausdrcke nicht si-
chergestellt: Ein Ausdruck knnte dann so-
wohl zum Grundbestand des Lexikons ge-
hren, als auch durch eine syntaktische Ope-
ration dort hinein gelangen, sagen wir, durch
Anwendung der Operation F auf die Aus-
drcke
1
,...,
n
. In diesem Fall htte der ge-
nannte Ausdruck zwei Gestalten, nmlich a
und F(
1
,...,
n
). Damit wrde die Syntax den
Ausdruck sowohl als unzerlegbar wie als zer-
legbar klassifizieren. Diese Mglichkeit wird
durch die Bedingung verhindert.
Bedingung (e) besagt, da jeder Ausdruck
auf nur eine Weise aus Teilausdrcken ge-
wonnen werden kann.
Die Fundiertheitsbedingung (d) und die
Forderung nach Eindeutigkeit der Vorgn-
gerausdrcke (e) garantieren, da ein kom-
plexer Ausdruck auf genau eine Weise mithilfe
von Operationen aus Grundausdrcken ge-
wonnen werden kann. Deshalb kann man
diese Art von Syntaxen zu Recht desambi-
guiert nennen. Hier handelt es sich brigens
um eine echte Einschrnkung der Theorie, die
nicht von allen denkbaren algebraischen Sy-
stemen erfllt wird. So lt sich etwa bei
Zugrundelegung der ganzen Zahlen die
Zahl 2 auf unendlich viele Weisen durch die
Additionsoperation erreichen (0 + 2 = 2,
1 + 3 = 2,...usw.).
Die Eindeutigkeit des syntaktischen Auf-
baus macht rekursive Definitionen ber den
Aufbau von Ausdrcken mglich. Die Defi-
nition der Interpretation wird von dieser
strukturellen Eigenschaft wesentlichen Ge-
brauch machen. Die Eindeutigkeitsbedingung
(e) ist allerdings unntig stark formuliert. Von
den konkreten Grammatikfragmenten fr das
Englische, die Montague ausgearbeitet hat,
gengt nur das Fragment aus UG dieser Be-
dingung. Das bekannteste Fragment die
englische Grammatik in PTQ verstt ge-
gen (e), gengt aber einem etwas liberaleren
104 III. Theorie der Satzsemantik
Worten, die Operation F
oder
ist durch die Ope-
ration F*
oder
zu ersetzen, die zwei Stzen
und den geklammerten Satz ,[
S
oder
] zuordnet. Die revidierte Regel erzeugt
nach wie vor die beiden Strukturen (26 a) und
(26 b). Aber jede dieser Strukturen ist auf ein-
deutige Weise aus Vorgngerstrukturen auf-
gebaut: (26 a) ist aus [
S
oder ] und auf-
gebaut, (26 b) dagegen aus und [
S
oder].
Eindeutigkeit des Aufbaues ist also in jedem
Fall gegeben.
Dieses Verfahren ist aber nicht allgemein
genug: es versagt zum Beispiel fr den mehr-
deutigen Satz jeder Mann liebt eine Frau. Wir
erinnern uns daran, da dieser durch die Sub-
stitutionsregel Q (s. Abschnitt 2.4) auf zwei
wesentlich verschiedene Vorgngerpaare
zurckgefhrt werden kann, nmlich auf je-
der Mann x, x liebt eine Frau und eine Frau
y, jeder Mann liebt y (vgl. die Ableitungen
(14)). Da es auf die spezielle Wahl der betref-
fenden Variablen nicht ankommt es mu
sich nur um dieselbe Variable handeln er-
hlt man sogar noch unendlich viele alpha-
betische Varianten fr beide Vorgngerpaare.
Im Geiste von UG wo die Regel Q aller-
dings nicht eingefhrt wird, sie findet sich erst
in PTQ wre es, die Desambiguierung
mithilfe von Variablen und geeignet indizier-
ten Klammern zu leisten. Zum Beispiel
knnte man die Ableitung (14 a) eindeutig ko-
dieren als (
Q,x
(
Q,y
jeder Mann x liebt eine Frau
y)). An dieser Notation kann man festma-
chen, da Q zuerst an der Stelle y und dann
erst an der Stelle x angewandt worden ist
(vgl. dazu die anhand von Beispiel (17) illu-
strierte Methode von Cooper & Parsons
1976).
Eindeutigkeit des Aufbaus lt sich durch
die Einfhrung von geeigneten Hilfssymbolen
immer erzwingen. Strukturierte Ausdrcke,
wie die soeben hergeleiteten, wird man aber
nicht als Stze im blichen Sinne ansehen
wollen, da die Klammern im allgemeinen
keine phonetische Substanz haben. Montague
sieht deswegen eine Relation vor, die diese
Klammern tilgt. Diese Idee steht hinter der
folgenden Definition:
(28) Eine OF-Syntax (Oberflchensyntax)
ist ein System DA, R, wobei DA eine
desambiguierte Syntax und R eine Re-
lation ist, deren Vorbereich die Aus-
drcke der desambiguierten Sprache ist.
Montague nennt ein solches System in UG
brigens nicht Syntax sondern Sprache (vgl.
dazu die Ausfhrungen zu Beginn des Ab-
schnitts). Fr unsere Beispiele wird man R als
(23) X
N
= {Mann, Frau}
X
V
= {liebt}
X
Art
= {jeder, eine}
Die einzige Operation, die wir fr die For-
mulierung der Syntaxregeln bentigen ist die
zweistellige Verkettung, die auf die einschl-
gigen Kategorien beschrnkt werden mu. Sei
fr das folgende F
verk
diese Operation, d. h.,
F
verk
(,) = . Die Menge der Syntaxregeln
die wir diesmal mit R bezeichnen, da S
bereits fr das Satzsymbol steht lt sich
dann folgendermaen formulieren:
(24) r
1
= F
verk
, NP, VP, S
r
2
= F
verk
, V, NP, VP
r
3
= F
verk
, Art, N, NP
Die desambiguierte Syntax, welche dieselben
Strukturen, wie die kontextfreie Gramma-
tik (22) erzeugt, ist also das (auf Kat und
der Algebra A,F
verk
basierende System
(X
)
Kat
, R, S , wobei A die Menge aller
Zeichenfolgen ber dem Terminalvokabular
ist.
Bereits die dieser Syntax zugrundeliegende
kontextfreie Syntax (22) war keine Quelle von
Mehrdeutigkeiten, und deshalb ist die soeben
konstruierte Montague-Syntax sicher desam-
biguiert im Sinne von Definition (20). Wir
erhalten aber ein Problem, wenn wir die kon-
textfreie Syntax um die folgende Regel fr
oder-Koordinationen erweitern:
(25) S S oder S
Diese Regel analysiert einen Satz der Form
oder oder auf zwei Weisen:
(26)
a. [
S
[
S
oder ] oder ]
b. [
S
oder [
S
oder ]]
Diese strukturelle Mehrdeutigkeit bleibt er-
halten, wenn wir die Regel nach der bisher
skizzierten Methode in das Montague-For-
mat bertragen:
(27) F
oder
, S, S, S, wobei F
oder
(,) =
oder fr beliebige Stze und .
Diese Regel ist identisch mit der in Abschnitt
2.3 eingefhrten Regel (6) einer Quelle fr
syntaktische Ambiguitten, wie wir wissen. In
dieser Form ist die Regel in einer DA-Syntax
deshalb nicht zulssig, und man mu also auf
irgendeine Weise die Eindeutigkeit des Auf-
baus erzwingen.
Im Falle des vorliegenden Beispiels ist eine
Lsung sehr einfach: Es gengt, da man die
durch die verschiedenen Anwendungen der
Operation (25) induzierte Klammerstruk-
tur im Ausdruck selbst kodiert, mit anderen
7. Syntax und Semantik 105
Unterschied, da keine desambiguierenden
Hilfssymbole eingefhrt werden. Durch den
Homomorphismus wird jede Operation, die
Hilfssymbole einfhrt, auf die entsprechende
ohne Hilfssymbole abgebildet. Das ist die al-
gebraische Simulation der Streichung. Eine
restriktivere Formulierung der Relation R fin-
det sich in Janssen (1983), auf die wir am
Ende dieses Abschnitts eingehen.
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, da
sich Montague selbst in seinen Englischfrag-
menten in PTQ und EFL nicht an die Ein-
deutigkeitsbedingung (20e) gehalten hat. Zum
Beispiel werden in PTQ Koordinationsregeln
des in Abschnitt 2.4 exemplifizierten Typs ver-
wendet: Man darf aus zwei NPs (VPs) und
eine NP (bzw. VP) der Form oder
bilden, ohne da Klammern hinzugefgt wr-
den. Wie wir wissen, fhren diese Regel zu
strukturellen Mehrdeutigkeiten. Auerdem
wird in PTQ die mehrfach angesprochene
Substitutionsregel Q benutzt, die eine unend-
liche syntaktische Mehrdeutigkeit zur Folge
hat.
Man kann aus dem folgenden Grund auf
eine buchstabengerechte Erfllung von Mon-
tagues Eindeutigkeitsforderung verzichten.
Die Klammern kodieren ja lediglich die Ab-
leitungsgeschichte. Definiert man nun die
Struktur eines Ausdrucks ber die Ablei-
tungsgeschichte selbst das in der genera-
tiven Grammatik seit Anbeginn bliche Ver-
fahren hat man smtliche Informationen
zur Verfgung, die man bentigt. Ein Aus-
druck lt sich mglicherweise auf zwei we-
sentlich verschiedene Weisen herleiten, aber
eine konkrete Ableitung determiniert eindeu-
tig eine Struktur. Wir haben bei unserem
Kommentar zur Eindeutigkeitsforderung ge-
sagt, da ihr Sinn darin besteht, rekursive
Definitionen ber den Aufbau der Ausdrcke
zu ermglichen. In einer mehrdeutigen Spra-
che sind solche Definitionen nicht ohne wei-
teres mglich, weil nun nicht mehr garantiert
ist, da die rekursive Definition auf eindeutig
bestimmte Teilausdrcke eines Ausdrucks zu-
rckgreifen kann. Durch eine kleine Kompli-
kation erreicht man aber dasselbe, wie Mon-
tagues Eindeutigkeitsforderung: Man lt die
Rekursion nicht mehr ber die Ausdrcke
sondern ber deren Ableitungen, d. h. die syn-
taktischen Strukturen der Ausdrcke, laufen.
Wir gehen in Abschnitt 3.3.1 kurz auf diesen
Punkt ein. Die in der Praxis vorgeschlagenen
Montague-Syntaxen sind also in aller Regel
mehrdeutig, d. h. sie ignorieren die Bedingung
(20e).
Streichung der Hilfssymbole (indizierte
Klammern und Variablen) auffassen wollen,
d. h. die Zeichenfolge steht zur Zeichenfolge
in der Relation R, wenn aus durch
Streichung aller in vorkommenden Hilfs-
symbole entsteht.
Man kann nun in naheliegender Weise die
Begriffsbildungen der desambiguierten DA-
Syntax auf die OF-Syntax bertragen. Ins-
besondere kann man den Begriff der syntak-
tischen Mehrdeutigkeit (vgl. Abschnitt 2.4)
przisieren:
(29)
a. Die Ausdrcke der OF-Syntax sind
die Elemente des Nachbereichs von
R.
b. Die Stze der OF-Syntax sind die
Elemente im Nachbreich von R, die
durch R mit einem Satz der DA-Syn-
tax verbunden sind. Allgemein:
Ein Element aus dem Nachbereich
von R ist ein Ausdruck der Kategorie
der OF-Syntax, wenn durch R
auf einen Ausdruck der Kategorie
der DA-Syntax zurckgefhrt wird.
c. Ein OF-Ausdruck ist syntaktisch
mehrdeutig, wenn er ber R mit mehr
als einem DA-Ausdruck verbunden
ist. Analog ist syntaktische Eindeutig-
keit und n-fache syntaktische Mehr-
deutigkeit zu definieren.
d. Zwei OF-Ausdrcke sind syntaktisch
homonym, wenn sie durch R auf den-
selben DA-Ausdruck zurckgefhrt
werden.
Syntaktische Homonymie knnte zum Bei-
spiel bei elliptischen Konstruktionen vorlie-
gen: R kann bestimmte Bestandteile eines
Ausdrucks optional tilgen, wobei allerdings R
eine Relation sein mu, die mehr leistet, als
nur Klammern zu streichen. Bei Montague
gibt es keinerlei Beschrnkungen fr die Re-
lation R, und es ist auch nur schwer zu sehen,
wie solche in seinem algebraischen Rahmen
formuliert werden knnen. Die einfachste
Modifikation des Montagueschen Ansatzes
scheint die folgende zu sein: Es gibt eine Ober-
flchensyntax, die wie eine DA-Syntax defi-
niert ist, die aber mehrdeutig sein darf. Die
Relation R ist dann als ein Homomorphismus
von der DA-Syntax auf die Oberflchensyn-
tax definiert. Es ist klar, da man mit einem
solchen Ansatz alle Hilfssymbole beseitigen
kann: Die syntaktischen Operationen der
Oberflchensyntax sehen im einfachsten Fall
genau so aus, wie die der DA-Syntax mit dem
106 III. Theorie der Satzsemantik
ken gezhlt werden. Diese Zeichen werden
vielmehr durch die Regel eingefhrt und ge-
hren deswegen mit zum Aspekt Art der
syntaktischen Verbindung, der als wesent-
licher Parameter in das Fregeprinzip eingeht.
Dieser Aspekt ist in der algebraischen Rekon-
struktion die syntaktische Operation selbst.
Damit ist deutlich, da die Bedeutung von
[
S
oder ] nicht nur von den Bedeutungen
von und abhngt, sondern auch von
F*
oder
. In einem algebraischen Ansatz kann
man die letztgenannte Abhngigkeit so for-
mulieren, da man F*
oder
durch eine seman-
tische Operation interpretiert, welche den Be-
deutungen der Teilstze die Bedeutung des
zusammengesetzten Satzes zuordnet. Diese
semantische Operation kann man als Bedeu-
tung der Syntaxregel F*
oder
auffassen. Syn-
taktische Regeln haben also selbst auch Be-
deutungen und zwar hherstufige: Sie drk-
ken Funktionen von Bedeutungen in Bedeu-
tungen aus.
Man kann freilich einwenden, da die Ein-
fhrung von oder durch eine syntaktische Re-
gel unnatrlich ist. Oder hat, intuitiv gesehen,
sicher eine eigenstndige Bedeutung. Sugge-
stiver wre wohl eine Regel, die aus zwei
Stzen a und und einer Konjunktion einen
Satz der Form [
S
] machen wrde. An
den allgemeinen berlegungen wrde sich da-
durch aber nichts ndern. Die fragliche Syn-
taxregel htte ebenfalls eine Bedeutung, nm-
lich die Funktionapplikation der Bedeutung
von auf die Bedeutung von und .
Die obige Regel (30) folgt der Praxis der
Logiker, die oder synkategorematisch, d. h.
durch eine Syntaxregel einfhren. Die Ana-
lyse ist insofern bedenkenswert, als sie zeigt,
da die Trennung zwischen Syntax und Le-
xikon keineswegs selbstverstndlich ist. Der
Montaguesche Begriff der syntaktischen Ope-
ration ist so allgemein, da man im Prinzip
mit einem leeren Lexikon auskommen und
jedes Wort durch eine eigene Syntaxregel ein-
fhren kann. A priori ist gegen ein solches
Vorgehen nichts einzuwenden. Man knnte
das intendierte Lexikon nmlich als die
nullstelligen Operationen rekonstruieren, wel-
che Konstanten einfhren. Man hte sich also
davor, die theoretischen mit den vortheoreti-
schen Begriffen zu vermengen.
Diese berlegungen stehen hinter der al-
gebraischen Formulierung (8) des Fregeprin-
zips, das der besseren bersicht halber hier
noch einmal wiederholt werde:
(31) Zu jeder (n-stelligen) syntaktischen Ope-
ration F gibt es eine entsprechende (n-
Gem eines Vorschlags von Janssen(1983)
kann man Montagues Analysen zur Formu-
lierung der Desambiguierungsrelation R be-
nutzen. Man geht dazu von einer im allge-
meinen mehrdeutigen Oberflchensyntax G
aus. Man konstruiert auf die beschriebene
Weise die desambiguierte Syntax G*, deren
Objekte gerade die Analysen sind (bei Janssen
Terme genannt). Die Relation R ist der Ho-
momorphismus von G* nach G, der die Ana-
lysen auswertet, d. h. jede Analyse wird auf
ihre Endkette abgebildet. (Eine Oberfl-
chensyntax ist hier natrlich kein Objekt im
Sinne von Definition (28), sondern im Sinne
von Definition (20) ohne die Eindeutigkeits-
bedingung.) Diese Definition der Relation ist
restriktiver als die oben skizzierte, weil man
die Relation R in kanonischer Weise aus einer
gegebenen Oberflchensyntax gewinnt. Ge-
genber Montagues UG liegt hier allerdings
insofern eine kleine Akzentverschiebung vor,
als man nicht mehr von einer DA-Syntax
ausgeht, sondern von einer potentiell mehr-
deutigen Oberflchensyntax. Die Janssensche
Formulierung hat den Vorteil, im Einklang
mit der etablierten Praxis der Syntaktiker zu
stehen, gem der eine Desambiguierung
durch eine unterschiedliche Anwendung von
Syntaxregeln gleistet wird.
3.3Semantik
3.3.1Kompositionale Interpretation
Eine Interpretation einer Sprache geht in zwei
Schritten vor: Im ersten Schritt wird jedem
Grundausdruck der Sprache eine Bedeutung
zugeordnet, und im zweiten Schritt wird das
Verfahren angegeben, welches die Bedeutun-
gen von zusammengesetzten Ausdrcken aus
den Bedeutungen ihrer Teile und der Art ihrer
syntaktischen Verbindung berechnet, also das
Kompositionalittsprinzip (vgl. die Formulie-
rung (3)).
Wir wollen nun erlutern, wie dieses Prin-
zip algebraisch ausbuchstabiert wird. Dazu
betrachten wir einen DA-Satz der Form [
S
oder ]. Wir wissen, da es genau eine syn-
taktische Operation gibt, die diesen Satz aus
Teilausdrcken aufbaut, sagen wir, die im
vorhergehenden Abschnitt eingefhrte Ope-
ration F*
oder
. Fr unsere angenommene DA-
Syntax gilt also:
(30) F*
oder
, (,) = [
S
oder ]
Diese Operation fhrt den Satz [
S
oder ]
auf die Bestandteile und zurck, whrend
die beiden Klammern [s und ], sowie das
Wort oder nicht zu den Vorgngerausdrk-
7. Syntax und Semantik 107
lieren, da zwischen den beiden Operations-
mengen S und T eine 11-Beziehung besteht,
die Operationen derselben Stelligkeit verbin-
det. Das ist hier stillschweigend vorausgesetzt.
Es sollte klar sein, da (34) das bliche
Schema einer rekursiven Bedeutungsdefini-
tion ist. Zum Beispiel ist auch die in dem
Artikel 8, Syntax and Semantics of Catego-
rial Languages, angegebene Interpretation
fr -kategoriale Sprachen ganz offensicht-
lich nach diesem Muster gebaut.
Ein Homomorphismus lt sich intuitiv als
strukturerhaltende Abbildung charakterisie-
ren. Allerdings werden nicht alle Aspekte der
Eingangsstruktur bewahrt. Den strukturer-
haltenden Effekt der semantischen Bewertung
knnen wir uns veranschaulichen, indem wir
DA-Ausdrcke durch Montague-Bume dar-
stellen.
Wir setzen voraus, da F
0
und F
1
die syntak-
tischen Operationen sind, die diese Struktur
aufbauen. Aus der Tatsache, da die Bewer-
tungsfunktion b ein Homomorphismus ist,
folgt, da die Bedeutung von (35) analog zu
dieser Struktur aufgebaut ist, da sie also die
Form
(36) G
0
(b(Orangen),G
1
(b(sind),b
(Apfelsinen)))
hat, wobei G
0
und G
1
die semantischen Ope-
rationen sind, welche den syntaktischen Ope-
rationen F
1
bzw. F
2
entsprechen. Nun ist zu-
nchst zu bemerken, da (36) streng genom-
men berhaupt keine Struktur hat, sondern
ein Element der Menge B der semantischen
Algebra ist. Ebenso ist der syntaktische Baum
(35) kein Ausdruck der Syntax: nur die Aus-
drcke an den Knoten gehren zur Aus-
drucksmenge. Wegen der Eindeutigkeit der
Syntax besteht aber ein 11-Beziehung zwi-
schen Ausdrcken und ihren syntaktischen
Bumen. Wir mssen hier also nicht unter-
scheiden. Man kann in Analogie zu den syn-
taktischen Bumen semantische Bume ein-
fhren und (36) zu dem folgenden semanti-
schen Baum umschreiben:
stellige) semantische Operation G derart,
da die Bedeutung einer beliebigen DA-
Struktur F(
1
,...,
n
) gleich G(b
1
,...,b
n
)
ist, wobei b
1
,...,b
n
die Bedeutungen von
1
,...,
n
respektive sind.
Schreibt man b() fr die Bedeutung des DA-
Ausdrucks , so lt sich der wesentliche Teil
von (31) durch die folgende einprgsamere
Formel wiedergeben:
(32) b(F(
1
,...,
n
)) = G(b(
1
),...,b(
n
))
(32) besagt, da die Bedeutungen der DA-
Ausdrcke eine Algebra die semantische
Algebra bilden, die der syntaktischen Al-
gebra hnlich ist (d. h. sie hat ebensoviele
Operationen mit derselben Zahl von Argu-
menten) und da der Bedeutungsbegriff b ein
Homomorphismus von der syntaktischen Al-
gebra in die semantische Algebra ist, d. h.,
da er (32) erfllt. Diese berlegungen mo-
tivieren den Interpretationsbegriff, der in UG
definiert wird:
(33) Eine Interpretation der syntaktischen Al-
gebra A,S ist ein System B,T,f, wo-
bei B,T eine zu A,S hnliche Alge-
bra ist und f eine Funktion ist, die jedem
Grundausdruck aus A einen Wert in B,
d. h. eine Bedeutung, zuordnet.
Durch die Interpretation ist der genannte Ho-
momorphismus bereits eindeutig bestimmt.
Er ist das, was man die semantische Bewertung
der Syntax (oder Sprache) A,S nennt, die
explizit durch die folgende Rekursion defi-
niert wird:
(34) Seien A,S und B,T,f wie beschrie-
ben. Die Bewertung b, die jedem Aus-
druck aus A eine Bedeutung in B zuord-
net, ist durch die folgenden beiden Be-
dingungen definiert:
a. Wenn a ein Grundausdruck ist, dann
ist b() = f().
b. Wenn ein zusammengesetzter Aus-
druck ist, der mithilfe der syntakti-
schen Operation F aus den Ausdrk-
ken
1
,...,
n
gewonnen ist, dann ist
b() = G(b(
1
),...,b(
n
)), wobei G die
F entsprechende semantische Opera-
tion ist.
Genau genommen mu man terminologisch
zwischen der Bedeutungszuweisung f, der In-
terpretation B,T,f und der Bewertung b un-
terscheiden. Wir benutzen im folgenden die
Bezeichnung Interpretation als Mdchen fr
alles. Ferner mu man letztlich auch formu-
108 III. Theorie der Satzsemantik
Beispiels klarmachen:
(38) [
S
[
NP
Apfelsinen] [
VP
sind [
NP
Orangen]]]]
Die zugehrige DA-Struktur ist verschieden
von (35), denn die NPs Apfelsinen und Oran-
gen haben die grammatischen Funktionen ge-
tauscht. Der zu (38) gehrende semantische
Baum ist aber identisch mit (37), denn wir
haben vorausgesetzt, da b(Orangen) =
b(Apfelsinen). Damit ist ein Unterschied, der
in der Syntax noch vorhanden war, durch die
Abbildung eingeebnet worden.
Da bei Abbildungen prinzipiell Informa-
tion verloren gehen kann, ist nicht weiter ver-
wunderlich. Der Informationsverlust lt sich
unter der Voraussetzung, da es Synonyme
gibt, prinzipiell nicht vermeiden. Diese ber-
legung ist insofern wichtig, als sie der Frege-
schen Analogie zwischen der Gliederung des
Gedankens und der Gliederung des ihn aus-
drckenden Satzes Grenzen setzt: Selbst,
wenn der Gedanke gegliedert sein sollte, dann
ist er im allgemeinen doch weniger gegliedert
als sein Ausdruck.
Zum Schlu dieses Abschnittes wollen wir
auf einen Punkt eingehen, der im vorherge-
henden Abschnitt angesprochen worden ist,
die Forderung nach der Eindeutigkeit des
syntaktischen Aufbaues. Diese Bedingung ist
fr die rekursive Definition der Bedeutungs-
funktion wesentlich: Wenn sich von einem
Ausdruck nicht eindeutig auf seine Vorgn-
ger schlieen lt, kann die Rekursion nicht
auf diese zurckgreifen. Eben dieser Rck-
griff ist aber in der Definition (34) voraus-
gesetzt. Wir haben gesagt, da Montague-
Grammatiken in der Praxis dennoch nicht
desambiguiert sind. Es ist nun ohne weiteres
nachzuvollziehen, warum dies mglich ist.
Die Idee ist, da man nicht die Ausdrcke
der mehrdeutigen Sprache analysiert, sondern
deren Bume. Auch wenn ein Ausdruck auf
verschiedene Weise erzeugt werden kann, so
ist doch sein Analysebaum eindeutig, denn
dieser Baum beschreibt ja gerade, auf welche
Weise der Ausdruck gebildet worden ist.
Die rekursive Definition der Bewertungs-
funktion b fr syntaktische Bume in EFL
Analysen genannt geschieht ganz analog
zu Definition (34): Falls ein Ausdruck a das
Etikett eines Endknoten ist, ist b() = f().
Falls wir dagegen einen Knoten mit dem Eti-
kett ,F vorliegen haben, der n Knoten mit
den Etiketten
1
,F
1
,...,
n
,F
n
unmittelbar
dominiert, dann ist b() gleich G(b(
1
), ...,
b(
n
)), wobei G die semantische Operation ist,
die F entspricht. Es hat sich also nichts ge-
ndert. Der Analysebaum dient lediglich
In (37) haben alle nicht-terminalen Knoten k
die Form b(), G
i
und knnen gelesen wer-
den als b() ist das Resultat der Anwendung
von G
i
auf (die linken Teile) der Etikette der
Knoten, die k unmittelbar dominiert. Unter
dieser Interpretation drckt (37) offensicht-
lich die Bedeutung der DA-Struktur (35) aus.
Die augenfllige Parallelitt zwischen dem
syntaktischen Baum (35) und dem semanti-
schen Baum (37) ist ganz im Geist des in
Abschnitt 2.3 wiedergegebenen Fregezitates:
(37) kann als Rekonstruktion der Rede vom
Aufbau des Gedankens aus Gedankenteilen
angesehen werden. Semantische Bume dieser
Art sind erstmals in Carnap (1947) unter dem
Begriff der intensionalen Isomorphie einge-
fhrt worden. Sie sind in der Literatur wie-
derholt aufgenommen worden immer, um
als Gegenstnde propositionaler Einstellun-
gen zu dienen (vgl. dazu Artikel 34) zum
Beispiel in Lewis (1970) als meanings und in
Cresswell (1985 b) als strukturierte Bedeutun-
gen.
Es sieht zunchst so aus, als wrde der
Homomorphismus von der syntaktischen in
die semantische Algebra die syntaktische
Struktur vollkommen in die semantische
Struktur projizieren. Der Schein trgt jedoch.
Wir haben bereits gesagt, da die Bedeu-
tungsalgebra im allgemeinen berhaupt nicht
in derselben Weise strukturiert ist wie die Syn-
taxalgebra: wenn zum Beispiel (36) eine Pro-
position ist, sagen wir die Menge aller mg-
lichen Welten, dann kann (36) auf recht ver-
schiedene Arten gewonnen sein. Wenn wir
voraussetzen, da Orangen und Apfelsinen
synonym sind, d. h. da b(Orangen) =
b(Apfelsinen) ist, dann kann (36) auch als
G
0
(b(Apfelsinen), G
1
(b(sind),b(Orangen))) be-
stimmt werden. Aus dieser berlegung folgt,
da semantische Algebren im allgemeinen
wesentlich weniger Struktur haben als ihre
syntaktischen Algebren. Selbstverstndlich
haben semantische Bume mehr Struktur als
unstrukturierte Bedeutungen. Aber auch hier
geht im allgemeinen Struktur durch die Ab-
bildung der Syntax in die Semantik verloren.
Wir knnen uns das anhand des folgenden
7. Syntax und Semantik 109
Wahrheitswerte, , den Typ der Funktio-
nen von Dingen des Typs in Dinge des Typs
T und s, die Kategorie der Funktionen von
Welten in Dinge des Typs T, die sogenannten
Intensionen. Die folgende Definition drckt
dies przise aus:
(40) Sei E die Menge der mglichen Indivi-
duen, W die Menge der mglichen Wel-
ten. Dann gilt:
a. D
e,E,W
ist E.
b. D
,E,W
ist {0,1}, wobei 0 fr das Fal-
sche und 1 fr das Wahre steht.
c. D
,
ist die Menge der Funktionen
aus der Menge D
,E,W
in die Menge
D
,E,W
.
d. D
s,,E,W
ist die Menge der Funktio-
nen von W in D
,E,W
.
Kategorien dieser Art heien bei Montague
Denotatsbereiche, ihre Elemente folglich De-
notate. Einige der wichtigsten Arten von De-
notaten sind die folgenden:
Die Denotate vom Typ , sind Mengen
von Denotaten des Typs , beziehungsweise
die charakteristischen Funktionen dieser
Mengen. Sie heien Extensionen. So ist bei-
spielsweise ein f aus e,t die Extension eines
einstelligen Prdikats von Individuen. f trifft
auf ein Individuum a zu, falls f(a) = 1. Zu
jeder Extension gibt es eine Intension. Zum
Beispiel ist die Intension eines einstelligen
Prdikats ein Denotat g vom Typ s,,.
g trifft auf ein Denotat des Typs a in einer
Welt w zu, falls g(w)(a) = 1. Die Begriffsbil-
dungen erlauben es, mehrstellige Relationen
(Relationen in extenso) und deren Intensionen
(Relationen in intenso) zu rekonstruieren: Eine
n-stellige Relation von Denotaten der Typen
1
, ... ,
n
hat den Typ
n
,
n1
, ....
1
,t ... .
Die korrespondierende Intension hat den Typ
s,
n
,
n1
, ....
1
, t ....
Es ist blich, Relationen in intenso Eigen-
schaften zu nennen. Eine Eigenschaft ist also
stets eine Funktion von Welten in Relationen
in extenso.
Nullstellige Eigenschaften, d. h. Denotate
vom Typ s,t, heien Propositionen. Eine
Proposition p ist wahr in der Welt w, wenn
p(w) gleich 1 ist. Die Folgerungsbeziehung
zwi-
schen Propositionen lt sich in diesem An-
satz als Teilmengenbeziehung rekonstruieren:
Aus der Proposition p folgt die Proposition
q, wenn fr jede Welt w, in der p(w) gleich 1
ist, auch gilt, da q(w) gleich 1 ist.
An dieser Stelle sei auf eine Eigenart des
Montagueschen Denotatensystems hingewie-
dazu, die Teilausdrcke eindeutig zu identi-
fizieren. Diese berlegung zeigt, da es zwar
fr die algebraische Theorie, nicht aber fr
die Praxis erheblich ist, ob Montague-Spra-
chen desambiguiert sind oder nicht. Monta-
gue selbst war sich ber den angesprochenen
Sachverhalt vllig im klaren, wie seine Ab-
schlubemerkung zum Syntaxfragment in
(PTQ: 255) zeigt:
Thus our fragment admits genuinely (that ist, se-
mantically) ambiguous sentences. If it were desired
to construct a corresponding unambiguous lang-
uage, it would be convenient to take the analysis
trees themselves as the expressions of that lang-
uage.
3.3.2Semantische Kategorien
Der allgemeine Interpretationsbegriff (35)
sagt nichts darber aus, was Bedeutungen
sind. Das einzige, was verlangt wird, ist, da
der Bedeutungsbereich zusammen mit den se-
mantischen Operationen eine zur Syntaxal-
gebra hnliche Algebra bildet. In der Praxis
der sogenannten Mgliche-Welten-Semantik,
die in irgendeiner Form den meisten Beitr-
gen des Handbuchs zugrundeliegt, wird aber
mit ganz speziellen Bedeutungen gearbeitet,
die im ersten Abschnitt dieses Artikels vor-
ausgesetzt, nunmehr aber explizit eingefhrt
werden. Es handelt sich um Extensionen und
Intensionen und den darauf aufbauenden
Charakteren. Montagues semantische Kate-
gorien sind typentheoretisch aufgebaut, eine
Praxis, die heute in den meisten Arbeiten zur
Semantik blich ist. Wir stellen im folgenden
das semantische System von UG vor. Alter-
native Bedeutungssysteme liegen in Monta-
gues EFL, Lewis (1970) und Cresswell (1973)
vor (vgl. auch Artikel 8).
Montagues System setzt eine spezielle
Menge Typ von Typen voraus. Die Typen sind
das semantische Pendant der Kategorien-
indizes. Wir erinnern daran, da die Katego-
rienindizes dazu dienen, die syntaktischen Ka-
tegorien einer Sprache zu indizieren (vgl. De-
finition (20)). Im folgenden geht es um die
Indizierung der semantischen Kategorien, das
sind Mengen von Bedeutungen. Die Menge
Typ wird folgendermaen definiert.
(39)
a. e und t gehren zur Menge Typ.
b. Wenn und zu Typ gehren, dann
auch ,.
c. Wenn zur Menge Typ gehrt, dann
auch s,.
Im sogenannten Denotatensystem, das gleich
eingefhrt wird, indiziert e die Kategorie der
(mglichen) Individuen, t die Kategorie der
110 III. Theorie der Satzsemantik
Die Kategorien der Charaktere sind die se-
mantischen Kategorien, die den syntaktischen
Kategorien entsprechen. Die Charaktere sind
also die eigentlichen Bedeutungen. Die De-
notate sind Hilfsbegriffe, die zur Definition
der Charaktere dienen. Der in Abschnitt 2.2
diskutierte Parallelismus von syntaktischen
und semantischen Kategorien wird durch eine
Einschrnkung erzwungen, die wir im nch-
sten Abschnitt als Fregesche Interpretation
kennenlernen werden.
Wir wollen uns den Begriff des Charakters
anhand eines einfachen Beispiels veranschau-
lichen:
(42) Ich bin durstig
Der Charakter dieses Satzes ist diejenige
Funktion
1
aus M
s,tE,W,K,
die einem Kon-
text k aus K die Menge der Welten w aus W
zuordnet, so da die Person, welche (42) am
Kontext k uert, in w zur Zeit der uerung
durstig ist. Der Charakter von ich ist die
Funktion
2
aus M
e,E,W,K,
die jedem Kontext
k die Person in D
e,E,W,K
zuordnet, die ich in k
uert. Der Charakter von bin durstig ist die-
jenige Funktion
3
aus M
s,e,t,E,W,K,
die
einem Kontext k diejenige Eigenschaft P aus
D
s,e,t
zuordnet, die jeder Welt w die Indi-
viduen zuordnet, die in w durstig sind.
Satz (42) ist aus ich und bin durstig mittels
einer syntaktischen Operation F aufgebaut.
In einer kompositionalen Semantik mu es
also eine korrespondierende semantische
Operation G geben, welche dem Paar (
2
,
3
)
den Charakter
1
zuordnet. G kann zum Bei-
spiel als diejenige Operation definiert werden,
die einem beliebigen aus M
e,E,W,K
und einem
beliebigen aus M
s,e,t
denjenigen Charak-
ter aus M
s,t,E,W,K
zuordnet, der einem be-
liebigen Kontext k diejenige Proposition p aus
D
s,t,E,W,K
zuordnet, so da fr ein beliebiges
w aus W gilt: p(w) = 1 genau dann, wenn
(k) zur Menge (k)(w) gehrt.
Der Charakter von ich bin durstig ist also
eine Funktion, die von zwei Argumenten ab-
hngt. In Abhngigkeit vom ersten Argument
dem Kontext erhlt man die durch den
Satz an diesem Kontext ausgedrckte Pro-
position. Kaplan nennt den Wert des Charak-
ters fr das erste Argument Inhalt. Whlt man
als zweites Argument die Welt, in welcher der
betreffende Kontext situiert ist, und wendet
die soeben bestimmte Proposition darauf an,
so erhlt man einen Wahrheitswert, die Re-
ferenz des Satzes. Ein aus einem Kontext und
sen: Es gibt keine Kategorie D
s
, welche die
mglichen Welten als Elemente enthlt. Dafr
gibt keine logischen Grnde. Man mte s
lediglich als weiteren Grundtyp zulassen und
D
s
entsprechend definieren. Der empirische
Grund, weshalb Montague sein System nicht
in dieser naheliegenden Weise aufbaut, ist ver-
mutlich der, da in der natrlichen Sprache
nicht explizit ber Welten geredet oder quan-
tifiziert wird. Zum Beispiel haben Verben
ebensowenig ein offenes Weltargument wie
sie ein offenes Zeitargument haben. In der
formalen Sprache der Intensionalen Logik, die
in Montagues UG und PTQ zur Bezeichnung
der Denotate von Ausdrcken der natrlichen
Sprache benutzt wird, ist der Weltparameter
nur implizit vorhanden und dient lediglich
dazu, den Begriff der Intension zu rekonstru-
ieren.
Die Bedeutungen natrlichsprachlicher
Ausdrcke knnen nicht schlechthin als De-
notate der angegebenen Art rekonstruiert
werden, da indexikalische Ausdrcke in ver-
schiedenen Kontexten verschiedene Denotate
haben. Zum Beispiel bezeichnet das Perso-
nalpronomen ich in verschiedenen ue-
rungssituationen im allgemeinen verschiedene
Personen, nmlich die jeweiligen uerer die-
ses Wortes. Trotzdem wird man sagen, da
die sprachliche Bedeutung von ich in allen
diesen Kontexten dieselbe ist. Sprachliche Be-
deutungen in diesen Sinne werden bei Mon-
tague als Funktionen von Kontexten in De-
notate rekonstruiert und Bedeutungen (mea-
nings) genannt. Um terminologische Ver-
wechslungen mit dem umgangsprachlichen
Begriff Bedeutung auszuschlieen, wollen wir
Kaplans (1977) terminus technicus Charakter
bernehmen. Die folgenden Ausfhrungen
lehnen sich terminologisch ebenfalls an Ka-
plan an, sind aber in den allgemeinen Rahmen
von Montagues UG eingebettet.
Kaplan benutzt Kontext als Grundbegriff.
Man kann sich darunter einen zeitlich und
rtlich fixierten Weltausschnitt vorstellen,
also eine Situation. Unter den Kontexten in-
teressieren fr die Interpretation einer natr-
lichen Sprache die uerungskontexte. Die
Menge aller uerungskontexte nennen wir
K. Der Begriff des Charakters ist nun folgen-
dermaen definiert:
(41) Sei E eine Menge von Individuen, W
eine Menge von mglichen Welten, K
eine Menge von uerungskontexten.
Wir definieren fr jeden Typ die Ka-
tegorie der Charaktere vom Typ
notiert als M
,E,W,K
als die Menge der
Funktionen von K in D
,E,W
.
7. Syntax und Semantik 111
Einschrnkung mte aber empirisch moti-
viert werden, ein Unterfangen, da direkt in
das Forschungsprogramm der generativen
Grammatik fhrt.
Partee (1976) hat versucht, die zulssigen
Ableitungen in einer Montague-Grammatik
durch eine Natrlichkeitsbedingung zu be-
schrnken, die besagt, da als Zwischen-
schritte einer Ableitung nur im intuitiven
Sinne wohlgeformte Ausdrcke erzeugt wer-
den drfen. Eine solche Bedingung verbietet
zum Beispiel die Herleitung der Oberfl-
chenstruktur (43b) aus der Tiefenstruktur
(43a), da (43a) kein wohlgeformter Ausdruck
des Englischen ist:
(43)
a. e was arrested John
b. John
i
was arrested e
i
Wenn man, wie viele generative Grammatiker,
der Ansicht ist, da es Argumente dafr gibt,
eine Reprsentation wie (43a) auf einer gram-
matischen Ebene als real anzusehen, dann
wird man die Natrlichkeitsbedingung als zu
restriktiv ablehnen mssen.
Als Ergebnis dieses Abschnittes halten wir
fest, da die Syntaxtheorie Montagues in kei-
ner Weise auf irgendwelche Beschrnkungen
hin angelegt ist. Wir wenden uns deshalb der
interessanteren Frage zu, ob die Montague-
sche Semantikkonzeption Beschrnkungen
nahelegt, die durch die Empirie gerechtfertigt
sein knnten.
3.4.2Semantische Beschrnkungen
3.4.2.1 Kompositionalitt
Auf den ersten Blick scheint die strikt lokale
Kompositionalittsanforderung, die in in der
Bedingung (34b) enthalten ist, eine gravie-
rende Einschrnkung zu sein. Tatschlich ver-
stoen die Montague-Semantiker in der Pra-
xis gegen diese Bedingung, zum Beispiel,
wenn es um die Deutung von gebundenen
Variablen geht. Darauf wurde bereits in Ab-
schnitt 2.3 hingewiesen. Wir betrachten er-
neut Satz (4), der hier als (44) wiederholt wird,
wobei wir die Variablenbindung in der Syntax
symbolisiert haben (vgl. die Abschnitte 2.4
und 3.2).
(44)
a. [
S
[
NP
Jeder junge Politiker]
x
[
VP
glaubt,
da er
x
die Weltprobleme lsen
kann]]
b. (x)Px
(44a) hat im wesentlichen die Form des pr-
dikatenlogischen Ausdrucks (44b). Um die
Diskussion zu vereinfachen, diskutieren wir
nur den letzteren. Hier tritt die Kompositio-
einer Welt bestehendes Paar k,w legt also
die Referenz eines Satzes eindeutig fest und
heit deswegen in Montagues UG Referenz-
punkt. Inhalt und Referenz mssen brigens
nicht immer auseinander fallen. So kann man
bei Charakteren vom Typ e die Bedeutung
von ich war ein Beispiel dafr prinzipiell
nicht zwischen Inhalt und Referenz unter-
scheiden. Ausdrcke dieses Charakters heien
direkt referentiell. Man kann das formale
Auseinanderfallen zwischen Inhalt und Re-
ferenz dadurch erzwingen, da man fr In-
halte grundstzlich Intensionen eventuell
starre ansetzt, eine weithin bliche Praxis.
Wir gehen in Abschnitt 3.4.2.3 auf den Begriff
des Charakters ausfhrlicher ein.
3.4Beschrnkungen
3.4.1Syntaktische Beschrnkungen
Die Syntaxtheorie Montagues ist keine em-
pirische Theorie, sondern ein mglichst all-
gemeiner Rahmen, dessen Beschrnkungen
an Ausdruckskraft sich allenfalls aus der ma-
thematischen Natur der verwendeten Begriffe
ergeben. Montague-Syntaxen sind von kaum
vorstellbarer generativer Kraft. Man kann
leicht zeigen, da sich jede aufzhlbare Spra-
che durch eine Montague-Syntax darstellen
lt. Damit ist es aber nicht genug: Montague
formuliert keine Einschrnkungen fr die An-
zahl oder die Stelligkeit der benutzten Ope-
rationen. Man kann damit Sprachen von
transfiniter Kardinalitt und mit Ausdrcken
von transfiniter Lnge analysieren, ein Vor-
haben, das ohne linguistisches Interesse ist.
Somit stellt sich die Frage, ob der allge-
meine Rahmen geeignet ist, um empirisch mo-
tivierte Einschrnkungen zu formulieren. Zu-
nchst ist an Einschrnkungen zu denken, die
sich aus dem Formalismus selbst ergeben. Als
Analogie bietet sich diejenige Beschrnkung
fr unbeschrnkte Ersetzungsgrammatiken
an, die zum Begriff der kontextfreien Spra-
chen gefhrt hat (Nur ein Nonterminal links
vom Pfeil). Der Begriff der syntaktischen
Operation ist aber so allgemein, da diese
Analogie versagt. Es sind alle denkbaren Zei-
chenmanipulationen zugelassen, so da in-
hrente Beschrnkungen nicht auf der Hand
liegen. Die Beschrnkungen mssen also die-
ser Theorie offenbar von auen auferlegt
werden. Beispielsweise knnte man als syn-
taktische Operationen Verkettungen und Per-
mutationen zulassen, Substitutionen von der
durch Regel Q aus Abschnitt 2.4 exemplifi-
zierten Art dagegen verbieten. Eine solche
112 III. Theorie der Satzsemantik
schafft. Auf diese Weise kann man auch eine
kompositionale Semantik fr die -Abstrak-
tion erreichen (vgl. fr die Einzelheiten UG,
Abschnitt 6).
Das zunchst als recht einschneidende Be-
dingung anmutende Kompositionalittsprin-
zip erweist sich bei nherem Hinsehen also
als keine echte Beschrnkung des Systems
vorausgesetzt, man verkompliziert die Onto-
logie in der beschriebenen Weise. Man kann
allerdings einwenden, da diese Lsung zwar
nicht gegen den Buchstaben, wohl aber gegen
den Geist des Kompositionalittsprinzips ver-
stt. Man steckt den nichtkompositionalen
Teil der Semantik in die Ontologie. Die Me-
tasprache zeigt deutlich, da auch hier sub-
stitutionell gearbeitet wird, da man modifi-
zierte Denotatsfunktionen benutzt. In gewis-
ser Weise verschleiert diese Formulierung
also, da die Semantik der Variablenbindung
nicht kompositional zu behandeln ist. Dies ist
vermutlich der tiefere Grund, weshalb die
meisten Semantiker die Variablenbindung
nicht auf die beschriebene Weise interpretie-
ren. Montague selbst hat in seiner fr die
Linguistik einflureichsten Schrift PTQ ge-
bundene Variablen als strukturelle Symbole
behandelt, die in Abhngigkeit von einem Zu-
satzparameter der Belegung interpre-
tiert werden.
Als Fazit dieser Diskussion halten wir fest,
da dem Kompositionalittsprinzip durch
eine Bereicherung der Ontologie zwar immer
Genge getan werden kann, da es aber
falls man eine plausible Ontologie quasi em-
pirisch vorgibt zu restriktiv ist. Bei dieser
Interpretation ist man also zu dem Schlu
gentigt, da diese zentrale Restriktion des
Systems empirisch problematisch, wenn nicht
gar inadquat ist.
3.4.2.2 Fregesche Interpretation
Die zweite einschneidende Beschrnkung, die
Montague in UG fr den Interpretationsbe-
griff formuliert hat, ist unter dem Namen
FregescheInterpretation bekannt. Sie be-
inhaltet zwei von einander unabhngige Re-
striktionen:
1. Die systematische Mehrdeutigkeit von
Stzen: Uneingebettete Stze denotieren an
einem Kontext einen Wahrheitswert (Freges
gerade Bedeutung), eingebettete Stze deno-
tieren an einem Kontext dagegen eine Pro-
position (Freges ungerade Bedeutung). Diese
Restriktion wird durch die gleich anzuge-
bende Definition fr die Typenzuweisung im-
pliziert (siehe (45)). Sie ist eine reine Frege-
nalittsproblematik bereits in voller Schrfe
auf. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Aus-
druck gem dem Montagueschen Kompo-
sitionalittsprinzip (34) zu interpretieren, ge-
lingt dies erst recht nicht fr den komplizier-
teren natrlichsprachlichen Satz (44).
Die syntaktische Regel F, nach der (x)Px
aufgebaut ist, besagt, da er aus den beiden
Teilausdrcken (x) und Px gebildet ist. Eine
kompositionelle Interpretation gem Defi-
nition (34) mte die Bedeutung von (x)Px
aus der Bedeutung von (x) und der von Px
berechnen. Es ist bereits gesagt worden, da
die Schwierigkeit fr eine solche Interpreta-
tion darin liegt, da die Bedeutung von
(x)Px nicht alleine von dem Wert abhngt,
den Px unter einer bestimmten Belegung hat,
sondern von jedem Wert, den Px fr irgend-
eine Belegung annehmen kann. Hier scheint
Montagues Kompositionalittsprinzip zu ver-
sagen.
Man kann aber auch fr diese Flle lokale
Kompositionalitt erzwingen, indem man
eine Technik anwendet, die auf Tarski (1952)
zurckgeht. Die Grundidee ist diese: Man
nimmt als Bedeutungen der prdikatenlogi-
schen Zeichen nicht deren bliche Denotate
(Wahrheitswerte fr Stze, Mengen und Re-
lationen fr Prdikate, und Individuen fr
Variablen und Konstanten), sondern vielmehr
Funktionen von Belegungen in die blichen
Denotate. Sie werden in EFLDenotatsfunk-
tionen genannt. Zum Beispiel ist die Bedeu-
tung b(x) einer Variablen x diejenige Deno-
tatsfunktion, die einer beliebigen Belegung h
den Wert h(x) zuordnet. b(Px) ist diejenige
Denotatsfunktion, die einer Belegung h das
Wahre zuordnet, wenn h(x) in b(P)(h) einer
von h unabhngigen Menge von Individuen
ist. b(x)(h) schlielich ist diejenige Funk-
tion, die auf einen Satzwert d - ebenfalls eine
Denotatsfunktion angewandt das Wahre
ergibt, wenn fr jedes Individuum a gilt, da
d(h
x
/a) das Wahre ist. Dabei ist h
x
/a wie h
definiert mit der eventuellen Ausnahme, da
x auf a abgebildet wird. b(x)(h) angewandt
auf b(Px) ist also genau dann das Wahre,
wenn fr jedes a gilt, da b(Px)(h
x
/a) das
Wahre ist. Dies ist die bliche Wahrheitsbe-
dingung. Die semantische Operation G, wel-
che der syntaktischen Operation F entspricht,
ist die Funktionalapplikation. Damit knnen
wir die Bedeutung von (x)Px vllig im Ein-
klang mit dem Kompositionalittsprinzip (35)
definieren als b((x)Px) = G(b((x)),b(Px)),
und das Gegenbeispiel ist aus der Welt ge-
7. Syntax und Semantik 113
Wir wollen uns diese Definition anhand der
Interpretation einer Satzkonstante der bereits
erwhnten Sprache der intensionalen Logik
verdeutlichen. In dieser Sprache sind die Ka-
tegorienindizes identisch mit den Typen. Die
Typenzuweisung bildet jeden Typ auf sich
selbst ab. Insbesondere ist h(t) = t. Wir un-
terscheiden deshalb nicht zwischen Katego-
rienindizes und Typen. Wir nehmen nun an,
der Ausdruck
(47) pluit
sei eine Konstante dieser Sprache vom Typ t,
also ein Satz von Montagues berhmter in-
tensionalen Sprache IL, deren Einzelheiten
uns hier nicht weiter interessieren. Aus dem
Begriff der Fregeschen Interpretation folgt,
da die Interpretationsfunktion f diesem Satz
einen Charakter in M
t
zuordnet, also eine
Funktion aus der Menge der Kontexte in die
Menge D
t
, welche die beiden Wahrheitswerte
enthlt. (Die Relativierung auf die Mengen
W,E und K ist hier als selbstverstndlich vor-
ausgesetzt.) Wenn wir (47) wie den deutschen
Satz es regnet deuten, dann wird f(47) der
Charakter sein, der einem Kontext das Wahre
genau dann zuordnet, wenn es in der Welt
dieses Kontextes zur Zeit des Kontextes am
Ort des Kontextes regnet.
In der Sprache der IL gibt es nun einen
Operator, den sogenannten Intensor , der
jedem Ausdruck die Intension zuordnet, die
er an seinem uerungskontext hat. Man be-
trachte dazu die intensionalisierte Version von
(47):
(48) pluit
Eine Fregesche Interpretation der eben skiz-
zierten Art wrde diesem Ausdruck, denjeni-
gen Charakter zuordnen, der einem Kontext
k und einer Welt w (also einem Referenz-
punkt) die Menge der Welten w zuordnet, so
da es in w zur Zeit des Kontextes k am Ort
des Kontextes k regnet.
In UG und PTQ werden natrlichsprach-
liche Ausdrcke indirekt dadurch interpre-
tiert, da man sie in Ausdrcke der genannten
Sprache IL bersetzt, wobei sich die Bedeu-
tungen der bersetzungen auf die natrlich-
sprachlichen Ausdrcke bertragen (vgl. dazu
Artikel 41). In diesen Fragmenten werden nun
uneingebettete natrlichsprachliche Stze in
Ausdrcke der intensionalen Logik vom Typ
t bersetzt, eingebettete dagegen in deren in-
exegese und ergibt sich keineswegs zwingend
aus der allgemeinen Theorie.
2. Die Forderung nach Parallelitt von syn-
taktischen und semantischen Kategorien, die
wir in Abschnitt 2.2 bereits kennengelernt
haben. Sie ist durch Definition (46) gewhr-
leistet.
Beide Restriktionen sind durch die Praxis
der Semantiker in Frage gestellt worden.
Montague selbst hat in EFL ein Fragment
des Englischen vorgelegt, dessen Stze
seien sie eingebettet oder nicht einheitlich
durch Charaktere interpretiert werden, die
Kontexte in Propositionen abbilden. hnlich
sind z. B. Cresswell (1973), Kaplan (1977),
Kratzer (1978) und viele andere vorgegangen.
Einwnde gegen die Parallelismusforde-
rung sind in Abschnitt 2.2 diskutiert worden
und werden am Ende dieses Abschnitts unter
dem Stichwort typengesteuerte Interpretation
noch einmal aufgenommen.
Fr die folgenden Definitionen setzen wir
eine DA-Syntax (X
)
Kat
, S,
0
und ein
System von Charakteren der oben beschrie-
benen Art voraus.
(45) Eine Fregesche Typenzuweisung fr diese
Syntax ist eine Funktion h von Kat in
die Menge Typ mit der Einschrnkung,
da h(
0
) = t ist.
Eine Typenzuweisung indiziert also alle syn-
taktischen Kategorien mit Typen. Das Attri-
but Fregesch bezieht sich auf die Ein-
schrnkung, da die Kategorie der Stze
das sind die DA-Ausdrcke der Kategorie
0
mit dem Typ t indiziert werden. Die fol-
gende Definition legt den Parallelismus von
syntaktischen und semantischen Kategorien
fest.
(46) Eine (durch die Typenzuweisung h ver-
mittelte) Fregesche Interpretation fr
unsere Syntax ist eine Interpretation
(B,T,f), die den folgenden Bedingungen
gengt:
a. B enthlt fr jeden Grundausdruck a
der Syntax einen Charakter des ent-
sprechenden Typs, d. h. falls zur
Kategorie gehrt, ist seine Bedeu-
tung f() vom Typ h().
b. Die semantischen Operationen ms-
sen ebenfalls die Typenzuweisung
respektieren. Mit anderen Worten:
Die semantische Operation G, welche
der Syntaxregel F,
1
....,
n
, ent-
spricht, ist eine Operation, die Bedeu-
tungen der Typen h(
t
),...,h(
n
) eine
Bedeutung vom Typ h() zuordnet.
c. B ist unter den semantischen Opera-
tionen, d. h. den Elementen von T,
abgeschlossen.
114 III. Theorie der Satzsemantik
halb geredet, weil der einfachste Typ, der eine
adquate Interpretation von Fritz zult, der
Typ e ist, der zum eben erwhnten kompli-
zierteren NP-Typ angehoben worden ist.
Falls die Technik des Anhebens nicht verfngt
als Beispiel hatten wir unter anderem ein-
stellige Nomina wie Motorrad versus mehr-
stellige Nomina wie Bruder genannt bleibt
nichts anderes brig, als die betreffenden Aus-
drcke syntaktisch verschieden zu kategori-
sieren, will man der Parallelismusanforderung
gengen.
Whrend die Typenanhebung in der Regel
zu unntig komplizierten Bedeutungsregeln
fhrt, ist die Technik der unterschiedlichen
Kategorisierung nicht mit einer autonomen
Begrndung von syntaktischen Kategorien
vertrglich. Klein & Sag (1981) haben deshalb
ein Analyseverfahren vorgeschlagen, das
heute als typengesteuerte Interpretation be-
kannt ist. Die Grundidee besteht darin, da
man Ausdrcke nach rein semantischen Ge-
sichtspunkten typisiert und zwar auf mg-
lichst einfache Weise. Die Typen steuern dann
unabhngig von der syntaktischen Kategorie
der Ausdrcke die Interpretation. Die folgen-
den beiden Beispiele mgen verdeutlichen, wie
dies funktionieren kann.
(49) a. [
S
[
NP
Fritz] [
VP
schlft]]
e s,e,t
b. [
S
[NP Niemand [
VP
schlft]]
s,e,t,t s,e,t
Hier sind also die NPs verschieden typisiert.
Dies setzt voraus, da die Typen nicht an
syntaktische Kategorien, sondern an Aus-
drcke der betreffenden Kategorien zugewie-
sen werden. Wir betrachten hier eine exten-
sionale Deutung und nehmen an, da f(Fritz)
der Charakter ist, der jedem Kontext Fritz
zuordnet. Ferner ist f(schlft) der Charakter,
der jedem Kontext die Eigenschaft zu schlafen
zuordnet, d. h. die Funktion, die jeder Welt
die Menge der Schlfer dieser Welt zuordnet,
bzw. die charakteristische Funktion dieser
Menge. f(niemand) schlielich ist der Charak-
ter, der jedem Kontext die Menge der Eigen-
schaften zuordnet, die keine Person in der
Welt des Kontextes hat. Eine Interpretation
mu diesen Charakteren einen Satzcharakter,
d. h. eine Funktion von Kontexten in Wahr-
heitswerte, zuordnen. Eine typengesteuerte
Interpretation ist nichts anderes als eine Me-
thode, den Teilcharakteren des Satzes auf
mglichst einfache Weise einen Satzcharakter
zuzuordnen. Die restriktivste Interpretations-
strategie besteht darin, da man als einziges
tensionalisierte Pendants, die vom Typ s,t
sind. Dies ist notwendig, weil z. B. intensio-
nale Operatoren wie es ist notwendig nicht
nur vom Wahrheitswert eines eingebetteten
Satzes abhngen, sondern von dessen Inten-
sion (vgl. dazu den folgenden Abschnitt). Die
Einschrnkung, da man Stze der ausge-
zeichneten Kategorie durch Wahrheitswerte
deutet, impliziert also, da nicht alle Stze
der ausgezeichneten Kategorie t angehren
drfen: Wren die eingebetteten Stze von
diesem Typ, knnte man Stze unter intensio-
nalen Operatoren nicht interpretieren. (Mon-
tague selbst deutet brigens nicht alle inten-
sionalen Operatoren auf die hier skizzierte
Weise. In PTQ wird der Notwendigkeitsope-
rator als ein logisches Symbol synkategore-
matisch eingefhrt. Bei diesem Vorgehen ge-
hrt der Operator keiner lexikalischen Kate-
gorie an. Wir knnen auf diese Alternative
hier nicht eingehen.)
Freges Lehre von der kontextuellen Mehr-
deutigkeit wird bei Montague folgenderma-
en rekonstruiert: Der Charakter von unein-
gebetteten Stzen bildet Referenzpunkte in
Wahrheitswerte ab, der von eingebetteten St-
zen bildet dagegen Referenzpunkte auf Pro-
positionen ab. Es besteht wie schon gesagt
keinerlei Notwendigkeit, so vorzugehen.
Man kann als Satzcharaktere vielmehr ein-
heitlich Funktionen von Kontexten in Pro-
positionen nehmen (vgl. z. B. Artikel 8). Es
ist also durchaus mglich, die in (45) formu-
lierte Einschrnkung fr die Typenzuweisung,
da der ausgezeichnete Kategorienindex auf
den Typ t abgebildet werden mu, wegzulas-
sen.
Wir kommen nun auf die in Definition (46)
enthaltene Forderung nach Parallelitt von
sytaktischen und semantischen Kategorien zu
sprechen. Wir haben in Abschnitt 2.2 bereits
darauf hingewiesen, da man in vielen Fllen
diese Forderung durch Typenanhebung er-
zwingen kann, eine Technik, die wir als ge-
neralizing to the worst case kennengelernt
haben. Wir erinnern daran, da es mglich
ist, Eigennamen wie Fritz und Quantoren-
phrasen wie niemand beide syntaktisch als
NPs zu klassifizieren und trotzdem der Pa-
rallelismusforderung gerecht zu werden, in-
dem man nmlich der Kategorie NP zum
Beispiel den Typus s,e,t,t zuweist, des-
sen Denotate Mengen von Eigenschaften sind
(hier: die Mengen der Eigenschaften, die Fritz
hat, beziehungsweise die Menge der Eigen-
schaften, die niemand hat). Von Typenan-
hebung wird in diesem Zusammenhang des-
7. Syntax und Semantik 115
natrlicher Sprachen nicht haltbar, denn eine
wesentliche Motivation der typengesteuerten
Interpretation besteht ja gerade in der Ableh-
nung eines strikten Parallelismusprinzips.
3.4.2.3 Monsterverbot
Der bekannteste Versuch, eine Beschrnkung
fr semantische Operationen zu formulieren,
geht auf Kaplan (1977) zurck. Er ist als
Monsterverbot bekannt. Diese Beschrnkung
luft darauf hinaus, da die semantischen
Operationen natrlicher Sprachen hchstens
intensional sein drfen. Wir werden zunchst
erklren, was darunter zu verstehen ist. An-
schlieend werden wir diskutieren, ob diese
Einschrnkung nicht zu weitgehend ist, da sie
empirisch motivierte Operationen wie Stal-
nakers (1973) Diagonaloperator ausschliet.
Der Stoff dieses Abschnittes ist in grerer
Ausfhrlichkeit in Artikel 9 abgehandelt.
Wir erinnern daran, da ein Charakter
vom Typ s, eine Funktion ist, die fr einen
gegebenen Kontext zunchst eine Intension
des Typs s, bestimmt, die dann in Abhn-
gigkeit vom Weltparameter der im folgen-
den Auswertungswelt genannt wird, um eine
Konfusion mit der Welt des Kontextes zu
vermeiden eine Extension vom Typ fest-
legt. Schema (50) veranschaulicht den geschil-
derten Sachverhalt:
(50) Kontext Auswertungswelt
Charakter Intension Extension
Der in (50) erkennbare Doppelschritt wurde
erstmals in Stalnaker (1970) explizit thema-
tisiert, ist aber bereits in Montagues UG im-
plizit vorhanden (vgl. dazu Zimmermann
1977). Fr die folgende Diskussion machen
wir die Annahme, da zumindest alle unter
einem Operator eingebetteten Ausdrcke
einen Charakter dieser Art haben, da sie an
einem Referenzpunkt also immer eine Inten-
sion und eine Extension haben. Diese An-
nahme ist unproblematisch, denn Charaktere
vom Typ T knnen immer durch solche vom
Typ s, ersetzt werden. Zum Beispiel kann
man als Bedeutung von ich anstelle des in
Abschnitt 3.3.2 angegebenen Charakters
1
,
der dem Typ e angehrt, ebensogut den Cha-
rakter
ich
vom Typ s,e whlen, der einem
Kontext k diejenige (konstante) Intension f
vom Typ s,e zuordnet, die einer beliebigen
Welt den Sprecher im Kontext k zuweist. Um
eine handliche Terminologie zur Verfgung
zu haben, vereinbaren wir die folgenden Ab-
krzungen: Wenn ein Ausdruck,
der Cha-
rakter von ist und k,w ein beliebiger
Mittel der semantischen Komposition die
funktionale Applikation zult.
Fr die beiden Beispiele sehen die dieser
Strategie entsprechenden Interpretationen
folgendermaen aus. Offensichtlich ist der
Charakter von (49 a) die Funktion g
1
, welche
einem Kontext k das Wahre genau dann zu-
ordnet, wenn Fritz in der Welt des Kontextes
schlft. Mit Rckgriff auf die beiden ange-
gebenen Komponentencharaktere lt sich g,
wie folgt definieren: Fr einen beliebigen
Kontext k gilt: g
1
(k) = 1 genau dann, wenn
f(Fritz)(k) ein Element der Menge
(f(schlft)(k))(w
k
) ist, wobei w
k
die Welt des
Kontextes k ist. Dies ist genau dann der Fall,
wenn (f(schlft)(k))(w
k
) angewandt auf
f(Fritz)(k) das Wahre ist.
Betrachten wir nun (49 b). Der Charakter
dieses Satzes ist diejenige Funktion g
2
, die
einem Kontext das Wahre zuordnet, wenn
niemand in der Welt des Kontextes schlft. g
2
lt sich ber die Komponentencharaktere
wie folgt definieren: Fr jeden Kontext k
ist g
2
(k) das Wahre genau dann, wenn
f(niemand)(k) angewandt auf f(schlft)(k) das
Wahre ergibt.
Beide Interpretationen haben nur mit funk-
tionaler Applikation gearbeitet. Allein das
vorgebene Ziel, da nmlich der Satzcharak-
ter vom Typ t sein mu, hat bestimmt, in
welcher Weise appliziert wird. Es ist nicht
mglich, die Satzcharaktere durch Funktio-
nalapplikation anders zu gewinnen als eben
beschrieben. Insofern steuern die Typen den
Interpretationsproze.
Die typengesteuerte Interpretation ist in
dieser Form natrlich noch keine allgemeine
Theorie: Welcher Charakter zwei oder mehr
vorgegebenen Charakteren zugeordnet wer-
den kann, hngt davon ab, was man als se-
mantische Operation zult. In den disku-
tierten Beispielen hatten wir als einzige Ope-
ration die funktionale Applikation zugelas-
sen. Beschrnkt man die zulssigen Operatio-
nen nicht, kann grundstzlich jeder Charakter
als Wert einer semantischen Operation auf-
tauchen, folglich knnen auch beliebige Ty-
pen kombiniert werden (siehe Abschnitt 4).
Fr die allgemeine Thematik dieses Ab-
schnitts ist aus dieser Diskussion folgendes
festzuhalten: Sollte sich eine przisierte Vari-
ante der typengesteuerten Interpretation als
empirisch korrekt erweisen, dann ist die im
Begriff der Fregeschen Interpretation enthal-
tende Parallelismusforderung fr die Deutung
116 III. Theorie der Satzsemantik
tung des Operators identifizieren und die
Klassifikation auf die Operatoren, d. h. die
sprachlichen Zeichen, bertragen. Diese Pra-
xis wird in Artikel 9 stillschweigend befolgt,
und auch wir sprechen im folgenden manch-
mal von der Extensionalitt bzw. Intensio-
nalitt eines Operators. Betrachten wir nun
einige Beispiele.
Klassische extensionale Operationen sind
die Wahrheitsfunktionen: Sie ordnen den Ex-
tensionen der eingebetteten Stze das sind
Wahrheitswerte wieder einen Wahrheits-
wert zu. Wir verdeutlichen dies an der Ne-
gation. F
nicht
sei die Operation, die aus einem
Satz a den Satz nicht macht. Die Bedeu-
tung dieser Operation sei die semantische
Operation G
nicht
, die einen Wahrheitswert in
sein Gegenteil verkehrt. Diese Operation ist
extensional, denn Ext
nicht
(k,w) ist das Gegen-
teil des Wahrheitswertes von Ext
(k,w).
Wir knnen F
nicht
auch als intensionale
Operation klassifizieren, wenn wir als Deu-
tung die Operation G*
nicht
ansetzen, welche
der Intension des eingebetteten Satzes einer
Proposition ihr mengentheoretisches Kom-
plement zuordnet. Technisch: G*
nicht
(Int
(k))(k,w) ist das Wahre, falls Int
(k) von w
das Falsche ist. Diese Formulierung zeigt, da
Ext
nicht
(k,w) durch Rckgriff auf Int
(k) for-
mulierbar ist. Aus diesem Beispiel sollte klar
sein, da sich smliche extensionale Operatio-
nen stets intensional umdeuten lassen, eine
Vorgehensweise, fr die Cresswell (1973) ex-
emplarisch ist (vgl. auch Artikel 8).
Andererseits ist eine intensionale Opera-
tion im allgemeinen nicht extensional. Ein
Beispiel ist die die sogenannte Leibniznotwen-
digkeit, eine Operation, die der Intension des
eingebetteten Satzes dann das Wahre zuord-
net, wenn diese mit der Menge aller Welten
identisch ist. Eine Analyse im UG-Rahmen
kann folgendermaen aussehen: F
notwendig
sei
diejenige syntaktische Operation, die einem
Satz den Satz notwendig zuordnet. Als
Interpretation whlen wir die semantische
Operation G
notwendig
, die einer Proposition p
das Wahre zuordnet, falls p in jeder Welt wahr
ist. F
notwendig
ist eine intensionale Operation,
denn Ext
notwendig
(k,w) ist das Wahre, falls
Int
(k) die Menge aller mglichen Welten ist,
d. h. falls Int
(k)(w) das Wahre fr jede Welt
w ist. Es ist klar, da wir Ext
notwendig
(k,w)
nicht alleine durch Rckgriff auf Ext
(k,w)
bestimmen knnen: Ext
(k,w) ist zwar das-
selbe wie Int
(k)(w), aber Ext
notwending
(k,w)
hngt eben nicht nur von Ext
(k,w) ab, son-
dern von Ext
(k,w) fr jedes w.
Referenzpunkt also ein Paar aus Kontext
und Auswertungsindex ist, dann gilt:
(51)
a. Int
(k) ist
(k).
b. Ext
(k,w) ist
(k)(w), d. h. Int
(k)(w).
Dabei steht Int
(k) natrlich fr die Inten-
sion von a am Kontext k, whrend Ext
(k,w)
fr die Extension von a am Referenzpunkt
k,w steht. Es kann sein, da die Begriffe
Intension und Extension nicht fr alle Arten
von Ausdrcken definiert sind (Was ist zum
Beispiel die Intension/Extension eines Mo-
daloperators?). In der Regel werden aber die
Ausdrcke, die mithilfe von Operatoren bzw.
syntaktischen Operationen gewonnen wer-
den, wieder eine Intension und eine Extension
haben. Nur solche Flle haben wir im folgen-
den im Auge. Wir fhren nun eine semanti-
sche Klassifizierung von (interpretierten) syn-
taktischen Operationen ein:
(52) Sei ein Ausdruck der Form F(
1
,...,
n
),
d. h. ist aus
1
,...,
n
mithilfe der Ope-
ration F gewonnen.
a. F ist extensional, wenn sich Ext
(k,w)
durch Rckgriff auf Ext
1
(k,w), ...,
Ext
n
(k,w) bestimmen lt.
b. F ist intensional, wenn sich Ext
(k,w)
durch Rckgriff auf Int
1
(k), ...,
Int
n
(k) bestimmen lt.
c. F ist ein ein Monstrum falls F
weder extensional noch intensional
ist.
Die eingangs genannte Restriktion von Ka-
plan lt sich nun folgendermaen formulie-
ren:
(53) Monsterverbot
Monster kommen in der natrlichen
Sprache nicht vor.
Wir weisen zunchst darauf hin, da bei der
Klassifikation (52) wesentlich die (nicht ge-
nannte) semantische Operation G eingeht,
welche die syntaktische Operation F interpre-
tiert. Letzlich wird die Bedeutung G dieser
Operation klassifiziert. Eine syntaktische
Operation als solche hat keine der genannten
Eigenschaften. Wir haben die Klassifikation
deshalb fr die syntaktischen Operationen
eingefhrt, um den terminologischen Zusam-
menhang mit den entsprechenden Ausfhrun-
gen in dem Artikel 9 zu wahren. Es besteht
ja im allgemeinen eine 11-Beziehung zwi-
schen der syntaktischen Operation F
, die
einen Operator einfhrt und der semanti-
schen Operation G
, die F
deutet. Man kann
G
also in den meisten Fllen mit der Bedeu-
7. Syntax und Semantik 117
chend ist: in w
k
gibt es im allgemeinen mehr
als einen Sprecher. Man darf die Welt, in
welcher der Kontext situiert ist, nicht mit dem
Kontext gleichsetzen. Eine intuitiv adquate
Formulierung des Kaplanschen Operators
verlangt deshalb, als zweiten Parameter von
Referenzpunkten Situationen statt Welten zu
whlen. Diese Verfeinerung findet man in Ar-
tikel 9, wo man auch mehr ber den dthat-
Operator nachlesen kann.
Die bisher betrachteten Operationen sind
alle zulssig. Wir kommen nun zu einem
Monstrum, nmlich dem sogenannten Dia-
gonaloperator, den wir durch symbolisieren
wollen. Dieser Operator ist in einem gewissen
Sinne die Umkehrung des dthat-Operators:
Whrend letzterer aus einer Kennzeichnung
einen starren Designator macht, macht erste-
rer aus einem starren Designator eine Kenn-
zeichnung. (Die Bezeichnung Diagonalope-
rator fr ist insofern ein wenig irrefh-
rend, als sie suggeriert, da der alleinige
Diagonaloperator ist. dthat ist aber ebenfalls
ein Diagonaloperator: Er ersetzt das zweite
Argument des Charakters durch die Welt des
ersten Arguments. Wie wir sehen werden, er-
setzt dagegen die Welt des ersten Argu-
ments durch das zweite Argument. Diago-
nalisierung einer Funktion ist aber gerade
diese Gleichsetzung von Argumenten.) Trotz
einer gewissen formalen Analogie zum zuls-
sigen Operatorenpaar Extensor/Intensor fllt
der Diagonaloperator unter das Monsterver-
bot. Wir wollen uns dies nun klarmachen.
Zunchst stehen wir vor einer formalen
Schwierigkeit: Innerhalb des bisher gewhlten
semantischen Rahmens knnen wir die Se-
mantik des Operators gar nicht ohne wei-
teres formulieren. Die folgende Beschreibung
ist nicht problemlos, drckt aber den wesent-
lichen Zug der Operation aus, nmlich die
Identifikation der uerungswelt mit der
Auswertungswelt.
F
ist die syntaktische Operation, die
aus einem Namen den Term macht.
G
)(k,w) ist
(k
w
k/
w
,w) fr einen beliebi-
gen Referenzpunkt k,w, wobei k
w
k/
w
der
hypothetische Kontext sein soll, der aus k
entsteht, indem man die Welt des Kontextes
durch die Auswertungswelt w ersetzt. Wir
werden weiter unten kurz auf die Problematik
dieser Redeweise eingehen.
ist natrlich der
Charakter von . Der Diagonaloperator wird
in Stalnaker (1978) brigens fr Stze defi-
niert. Wir haben ihn hier fr Namen einge-
fhrt, um die bereits genannte Beziehung zum
dthat-Operator zu betonen, dessen Umkeh-
rung ist.
Ein weiteres Beispiel fr einen intensiona-
len Operator ist Montagues berhmter Inten-
sor , welcher der Intension des unter ihm
eingebetteten Satzes eben diese Intension als
Extension zuordnet. Die Operation kann fol-
gendermaen beschrieben werden: F ordnet
dem Satz den Ausdruck a zu. Ext
(k,w)
ist die Intension f, so da fr eine beliebige
Welt w gilt: f(w) = Ext
(k,w). Dies bedeutet
nichts anderes, als da Ext
(k,w) = Int
(k)
ist. Damit ist der Operator intensional.
Montagues Extensor ist dagegen ein ex-
tensionaler Operator: Er operiert auf einem
intensionalisierten Satz, dessen Extension eine
Intension ist. Er nimmt diese Extension (eine
Intension!) und macht daraus einen Wahr-
heitswert. Der Extensor wird durch die Regel
F eingefhrt, die dem intensionalisierten Satz
den Satz zuordnet. G ist die seman-
tische Operation, die Ext
(k,w) als Wert
Ext
(k,w)(w) zuordnet. (Man denke daran,
da Ext
(k,w) eine Proposition ist!)
Wir haben diese beiden letzten Operatio-
nen hier aufgefhrt, um zu zeigen, da sie
nicht durch das Kaplansche Monsterverbot
betroffen sind. Wie man sich denken kann,
fllt auch der in Kaplan (1977) eingefhrte
Operator dthat, der aus einer Kennzeichnung
einen starren Designator macht (vgl. dazu Ar-
tikel 16: Eigennamen) nicht unter das Mon-
sterverbot. Er ist vielmehr als intensional zu
klassifizieren.
Kaplans Operator kann in erster Nherung
folgendermaen beschrieben werden: F
dthat
ist
diejenige Operation, die einem Kennzeich-
nungsterm den Term dthat zuordnet.
Wir nehmen an, da das Denotat einer Kenn-
zeichnung ein sogenanntes Individuenkonzept,
d. h. eine Funktion in D
s,e
ist. Die Deutung
dieser syntaktischen Operation ist die seman-
tische Operation G
dthat
, so da fr einen be-
liebigen Referenzpunkt k,w gilt: G
dthat
(Int
(k))(w) ist Int
(k)(w
k
), wobei w
k
die Welt
des Kontextes k ist. Die Formulierung macht
zunchst deutlich, da F
dthat
eine intensionale
Operation ist. Weil nun die Welt der ue-
rung w
k
im allgemeinen verschieden von der
Auswertungswelt w ist, stimmt Int
(k)(w
k
) im
allgemeinen auch nicht mit Int
(k)(w) (= Ext
(k,w)) berein. Deswegen kann die Opera-
tion nicht extensional sein. Zum Beispiel
ist G
dthat
(Int
der Sprecher
(k))(k,w) = Int
der Sprecher
(k)(w
k
) = der Sprecher in der Welt w
k
des
Kontextes k.
Man sieht brigens an dieser Stelle, da
die Formulierung des Operators unzurei-
118 III. Theorie der Satzsemantik
einen unsichtbaren Operator ansetzen, den
man aus pragmatischen Grnden braucht.
Wir kommen nun auf das oben angespro-
chene Problem mit der Formulierung des Dia-
gonaloperators zu sprechen: es handelt sich
um die Interpretation der Operation k
w
k/
w
.
Was soll es schon heien, da man einen
Kontext dadurch verndert, da man seine
Welt durch eine andere ersetzt, wo wir doch
den Kontext als Teil dieser Welt eingefhrt
hatten? Stalnaker (1978) vermeidet dieses
Problem, indem er fr beide Komponenten
eines Referenzpunktes Welten ansetzt. Die
Diagonalisierungsoperation kann dann defi-
niert werden als G
)(w
k
,w) =
(w,w).
Diese Definition setzt ganz offensichtlich
einen andern Weltbegriff voraus, als die gro-
en Welten der Mgliche-Welten-Semantik.
Welten mssen so etwas wie Situationen sein:
Sonst wren Redeweisen wie der Sprecher in
w
k
bzw. der Sprecher in w sinnlos. Eine solche
Revision hat weitreichende Konsequenzen,
die sorgfltig bedacht werden mssen. Unter
anderem erhlt man das Problem, da eine
Auswertungssituation im allgemeinen keine
uerungssituation ist. Die Diagonalisierung
ich, deren Resultat die Kennzeichnung der
Sprecher ist, setzt aber gerade dieses voraus
(vgl. dazu Artikel 10).
Eine Methode, die Unterscheidung zwi-
schen Kontexten und Welten quasi beizube-
halten und doch mit der genannten Erset-
zungsoperation zu arbeiten, besteht darin,
Kontexte durch geeignete Merkmale zu iden-
tifizieren, z. B. durch ein Tripel w
k
,z
k
,o
k
, das
aus der Welt, der Zeit und dem Ort des Kon-
textes besteht (vgl. Lewis 1980 a). Die Ko-
ordinaten eines solchen Tripels kann man
durch andere ersetzen. Damit hat die ge-
nannte Substitutionsoperation zwar einen
Sinn, aber man handelt sich das Problem ein,
da viele solche Tripel unmgliche Kontexte
sind: Man erhlt einen solchen unmglichen
Kontext zum Beispiel dadurch, da man die
Zeitkoordinate auf ein Datum zurckver-
schiebt, zu dem die Welt des Kontextes noch
gar nicht bestand (vgl. dazu die Ausfhrungen
in Artikel 9). Die konzeptuellen Konsequen-
zen der Diagonalisierung sind also in jedem
Fall problematisch. Insofern ist die Konse-
quenz des Kaplanschen Monsterverbotes als
solche sicher begrenswert. Die Frage ist
allerdings, ob die Operation nicht aus empi-
rischen Grnden unverzichtbar ist.
Man htte ein starkes Argument fr den
Diagonaloperator, wenn die geschilderte L-
sung Stalnakers die einzig mgliche Analyse
von propositionalen Einstellungen wre. Es
gibt aber rein intensionale Analysen, die al-
Wir berlegen uns zunchst, da die Ope-
ration F
tatschlich ein Monstrum ist. Wenn
die Operation extensional wre, mte
(k
w
k/
w
,w) (= Ext
(k
w
k/
w
,w)) mit Ext
(k,w)
identisch sein. Das ist im allgemeinen Fall
aber sicher nicht gegeben. Ebenso ist Int
(k)
im allgemeinen von
(k
w
k/
w
,) verschieden,
weshalb der Operator nicht intensional sein
kann. Mit anderen Worten, Ext
(k,w) hngt
wirklich echt von
selbst ab.
Stalnaker (1978) benutzt diesen Operator
(bzw. dessen satzeinbettende Variante) dazu,
um Stze, die bei der blichen Interpretation
nicht informativ sind, informativ zu machen.
Zum Beispiel drckt unter der Vorausset-
zung, da Hesperus und Phosphorus starre
Designatoren sind Satz (54 a) an jedem
Kontext k eine Tautologie oder einen Wider-
spruch aus: die Menge aller Welten, wenn
Hesperus und Phosphorus in der uerungs-
welt w
k
dasselbe bezeichnen, die leere Menge
sonst. Demnach wrde (54 b) ausdrcken, da
Ptolemus an die Wahrheit der notwendigen
(bzw. unmglichen) Proposition glaubte.
(54)
a. Hesperus ist identisch mit Phospho-
rus
b. Schon Ptolemus glaubte, da Hes-
perus identisch mit Phosphorus sei
Eine solche Analyse ist aber nicht adquat.
Ptolemus glaubte, da der Hesperus hei-
ende (Stern) identisch mit dem Phosporus
heienden sei. Dieser Glaubensinhalt ist kon-
tingent und daher informativ, denn was in
einer Welt Hesperus oder Phosphorus
heit, kann in einer anderen Welt anders hei-
en. Man erhlt die gewnschte kontingente
Lesart durch Diagonalisierung:
(55) Schon Ptolemus glaubte, da (Hespe-
rus) identisch mit (Phosphorus) sei
Wir setzen voraus, da
Hesperus
(k,w) der Ge-
genstand ist, der in k Hesperus heit. Dann
ist
Hesperus(k,w) =
Hesperus
(k
w
k/
w
,w), d. h. der
Gegenstand, der in der Auswertungswelt w
Hesperus heit. Dies bedeutet, da
Hesperus
als eine Kennzeichnung f aufgefat werden
kann, die einer beliebigen Welt w den in w
Hesperus genannten Gegenstand zuordnet.
Analoges gilt fr die Interpretation von Phos-
phorus. Damit ist ohne weiteres einzusehen,
da der in (55) unter den Glaubensoperator
eingebettete Satz eine informative Proposition
ausdrckt, und zwar die intuitiv korrekte. Der
Diagonaloperator wird in der natrlichen
Sprache nicht ausgedrckt; man kann ihn als
7. Syntax und Semantik 119
potentielle Gegenbeispiele gegen Kaplans
Monsterverbot werden in Artikel 9 diskutiert,
aber als nicht zwingend verworfen. Dieses
bleibt also ein ernsthafter Kandidat fr eine
tragfhige empirische Beschrnkung seman-
tischer Operationen.
Man kann das Monsterverbot leicht in die
allgemeine Referenztheorie einbauen. Unter
der Voraussetzung, da die Bedeutung eines
Ausdrucks ein Charakter ist, mu man den
Rekursionsschritt des Kompositionalitts-
prinzips (34) auf S. 107 lediglich durch die
restriktivere Bedingung
(34) b* ...dann ist
b()(k) = G(b(
1
)(k), ... ,b(
n
)(k)),
fr einen beliebigen Kontext k
ersetzen. Genau diese Formulierung wird in
Kaplan (1977) vorgeschlagen.
3.4.2.4 Beschrnkungen der Referenz
In Abschnitt 3.3.2 haben wir darauf hinge-
wiesen, da deiktische Wrter (ich, dies, hier,
jetzt) direkt referentiell sind, d. h. da ihre
Extension alleine vom uerungskontext ab-
hngt. Der Begriff ist genauer folgenderma-
en definiert:
(56) Ein Ausdruck referiert direkt, falls
Ext
(k,w) = Ext
(k,w), fr jedes k,w
und w.
Falls man fr solche Ausdrcke berhaupt
die Unterscheidung zwischen Intension und
Extension machen will vgl. dazu unsere
Bemerkungen zu Beginn des vorhergehenden
Abschnitts dann haben direkt referentielle
Ausdrcke eine konstante Intension, aber in
der Regel an verschiedenen Kontexten eine
verschiedene. Im Gegensatz dazu drckt ein
Wort wie Sense an jedem Kontext dieselbe
Intension aus, die aber fr verschiedene Aus-
wertungswelten im allgemeinen verschiedene
Extensionen liefert. Man sagt, da solche
Wrter absolut referieren.
(57) Ein Ausdruck referiert absolut, falls
Int
(k) = Int
(k), fr jedes k und k.
Es ist klar, da komplexe Ausdrcke in der
Regel weder direkt noch absolut referieren.
Zum Beispiel hngt der Wahrheitswert des
Satzes Ich wei das sowohl vom uerungs-
kontext als auch von der Auswertungswelt
ab. Anders steht es jedoch fr Lexeme. Man
ist versucht, die folgende allgemeine Be-
schrnkung anzunehmen, die in dieser expli-
ziten Form nach unserer Kenntnis erstmals
in Artikel 9, Abschnitt 1.3 formuliert worden
ist, sich aber nach Auskunft von Wolfgang
lerdings mit dem Begriff der strukturierten
Bedeutung arbeiten (vgl. Cresswell & von Ste-
chow 1982 und Artikel 34).
Als weiteres Beispiel fr ein Monstrum
wre die Variablenbindung zu nennen. Be-
trachten wir etwa den in Abschnitt 3.4.2.1
diskutierten Ausdruck (x)Px. Wie in Mon-
tagues UG setzen wir hier voraus, da jeder
Kontext eine Belegung festlegt wobei nicht
darber gegrbelt werden soll, ob das eine
sinnvolle Annahme ist. Betrachten wir nun
die Syntaxregel F
(x)
, die aus einem Satz a den
Satz (x) macht. Die in 3.4.2.1 beschriebene
kompositionale Deutung ist die Operation
G
(x)
, welche
am Referenzpunkt k,w das
Wahre zuordnet, falls
(k[
h
/h
k
x/a]) fr je-
des das Wahre ist. h
k
ist die durch den
Kontext k festgelegte Belegung, die in der
blichen Weise variiert wird. Wir haben hier
im Einklang mit den Ausfhrungen in 3.4.2.1
vorausgesetzt, da der Charakter uns eine
Denotatsfunktion fr einen Kontext liefert,
woraus wir durch Anwendung auf eine Bele-
gung eines der blichen Denotate hier eine
Proposition erhalten. Die Operation wre
intensional, wenn Ext
(x)Px
(k,w) alleine von
(k)(h
k
) dem Pendant der Intension in
einer Ontologie die mit Denotatsfunktionen
arbeitet abhngen wrde. Das ist aber
nicht der Fall: sie hngt von allen x-Varianten
von h
k
ab. Damit ist diese Operation und
die Variablenbindung ganz allgemein ein
Monstrum.
Bereits in Abschnitt 3.4.2.1 haben wir dar-
auf hingewiesen, da der Variablenbindung
praktisch von jedermann ein Sonderstatus
eingerumt wird. Man kann sie aus sportli-
chem Ehrgeiz zwar formal in das Komposi-
tionalittsprinzip (34) zwngen: Eine Ad-hoc-
Komplikation der Ontologie ist die Folge.
Und auch im Zusammenhang mit Kaplans
Beschrnkung erweist sich diese Operation als
auergewhnlich: sie ist ein Monstrum. Die
Variablenbindung sollte man also weder ge-
gen das Kompositionalittsprinzip noch ge-
gen das Monsterverbot ins Feld fhren.
Hinzu kommt, da Stalnaker die Diagonali-
sierung gar nicht als semantische Operation
verstanden wissen will, sondern als pragma-
tische Hilfsoperation, die eine Proposition in-
formativ macht oder die Interpretation eines
deiktischen Wortes ermglicht, dessen Bezug
in einem Kontext nicht klar ist (vgl. dazu
Artikel 8: Abschnitt 3). Es handelt sich also
gar nicht um eine genuine semantische Ope-
ration, welche eine Regel interpretiert. Andere
120 III. Theorie der Satzsemantik
Temporaladverbien wie dort der Ort wo der
Sprecher nicht ist oder vorher ein Zeitpunkt
vor jetzt keine Gegenbeispiele sind. Sie ent-
halten zwar Relationen, also scheinbar abso-
lute Bestandteile. Diese werden aber in bezug
auf den uerungskontext ausgewertet.
Die Konsequenzen von Prinzip L sind nach
unserer Kenntnis bisher in der Literatur nicht
ausgelotet worden. Bereits das erste Beispiel
zeigt, da das Prinzip insofern interessant ist,
als es Restriktionen fr die lexikalische Zer-
legung und die Syntax impliziert und deshalb
empirisch nicht leer ist.
4. Kategorialgrammatik
4.1Vorbemerkungen
Kategorialgrammatiken sind Spezialflle von
Montague-Grammatiken. Die erste explizite
Formulierung eines solchen Systems wurde in
Ajdukiewicz (1935) vorgelegt. Vermutlich ist
dies der frheste Entwurf einer formalen
Grammatik, die ausdrucksstark genug ist, um
in erster Approximation eine Analyse von
natrlichen Sprachen zu ermglichen. Ajdu-
kiewiczs ursprngliche Konzeption der Ka-
tegorialgrammatik ist rein syntaktisch. Die
Ausdrcke des Systems wurden aber still-
schweigend als interpretiert vorausgesetzt,
wobei die Notation klarmacht, da es zwei
Arten von Ausdrcken gibt: Funktoren, die
als Funktionen gedeutet werden, und Namen,
welche nichtfunktionale Objekte bezeichnen.
Rekonstruiert man Ajdukiewiczs System mit
den Methoden der Montagueschen Univer-
salgrammatik, dann hat es drei wesentliche
Merkmale.
1. Es gibt einen strikten Parallelismus zwi-
schen syntaktischen und semantischen Kate-
gorien. Nicht einmal zwischen syntaktischen
Kategorien und Typen wird unterschieden.
2. Als einzige syntaktische Operation ist
die Verkettung zugelassen, die so beschrnkt
ist, da ein Funktor stets mit dazugehrigen
Argumenten verkettet werden darf.
3. Jede solche Syntaxregel ist als funktio-
nale Applikation der Bedeutung des Funktors
auf seine Argumente interpretierbar.
Eine Kategorialgrammatik, die gem die-
sen drei Prinzipien aufgebaut ist, wollen wir
klassisch nennen (vgl. Casadio 1987). Im
nchsten Abschnitt werden wir diesen Typ
von Grammatiken nher diskutieren.
Mit klassischen Grammatiken kann man
bereits relativ interessante Ausschnitte von
natrlichen Sprachen beschreiben. Aufgrund
Klein der Sache nach bereits in Bhler (1934)
findet.
(58) Prinzip L
Lexikalische Grundeinheiten referieren
entweder direkt oder absolut.
Auf den ersten Blick gibt es zahlreiche Ge-
genbeispiele. Man betrachte etwa ein finites
Verb wie schimpfte. Dieses Wort hat sowohl
einen absolut referierenden Teil, nmliche den
Stamm schimpf- als auch eine direkt referen-
tielle Komponente, nmlich das in der En-
dung -te enthaltene Prteritum (zur deikti-
schen Analyse des Tempus, siehe Artikel 35).
Um Prinzip L durchhalten zu knnen, ist man
also zu der Annahme gezwungen, da
schimpfte keine lexikalische Grundeinheit ist,
sondern zumindest in die Bestandteile
schimpf + Prteritum zerlegt werden mu. Ge-
nau diese Zerlegung wird aus syntaktischen
Grnden in der generativen Grammatik (und
wohl jeder traditionellen Grammatik) seit
langem angenommen, wo der Satz Niko
schimpfte als (59) analysiert wird.
(59) [
IP
Niko [
I
[
VP
schimpf] [
I
Prteritum]]]
AGR
Mit anderen Worten, es gibt eine eigenstn-
dige Grundeinheit I(NFL), welche die Tem-
pusinformation (und die Kongruenzmerk-
male AGR) enthlt, whrend das Verb nur
aus einem Stamm besteht. Diese Analyse ist
mit Prinzip L vertrglich.
Ein anderes Gegenbeispiel gegen Prinzip L
ist das Possessivpronomen in meine Htte.
Paraphrasiert man diese Nominalphrase als
die Htte von mir, dann wird deutlich, da
meine das direkt referierende ich und die Be-
sitzerrelation hier durch von ausgedrckt
beinhaltet. Die Relation wird aber offen-
bar absolut bezeichnet, wie man sich an der
metasprachlichen Formulierung der Bedeu-
tung von meine Htte klarmachen kann: die
Htte in der Auswertungswelt w, welche der
Sprecher am uerungskontext k in der Aus-
wertungswelt w besitzt. Somit scheint mein
ein sowohl deiktisch als auch absolut referie-
rendes Wort zu sein. (Wir bergehen die
Komplikation, da mein zustzlich noch die
Information der Definitheit zu beinhalten
scheint.) Aber auch diese Argumentation ist
nicht zwingend. Man denke daran, da mein
keineswegs immer mit der Besitzerrelation
verbunden ist: mein Sohn. Eine alternative
Analyse ist deshalb, mein als ich zu deuten,
also als ein direkt referierendes Wort und die
infrage kommende Relation aus dem Kontext
zu erschlieen. Man beachte, da Lokal- und
7. Syntax und Semantik 121
(61) Ajdukiewicz Montague Bezeichnungen
a. n e Eigennamen
b. s t Stze
c. (s/n) e,t einstellige Pr-
dikate
d. ((s/n)/n) e,e,t zweistellige
Prdikate
e. (s/(s/n)) e,t,t Nominale,
Terme
f. (n/n) e,e Attribute
g. ((s/n)/(s/n)) e,t,e,t Adverbien
h. (s/s) t,t Satzadverbien
g. ((s/s)/s) t,t,t Satzkonjunk-
tionen
Das Lexikon der Grammatik ist eine Funk-
tion BC (Basiskategorie), die jedem Typ X
eine endliche Menge BC
X
zuordnet. Fr die
meisten Typen ist diese Menge leer. Als
syntaktische Operation ist lediglich die zwei-
stellige Verkettung zugelassen. Die einzige
Syntaxregel der Grammatik ist die folgende:
(62) X/Y Y X
Diese Regel ist folgendermaen zu lesen:
Wenn ein Ausdruck vom Typ X/Y und
ein Ausdruck vom Typ Y ist, dann ist ein
Ausdruck vom Typ X.
Im Format von Montagues UG wre diese
Regel als eine Menge von Regeln zu schrei-
ben, nmlich als:
(63) F, X/Y,Y, X, wobei F die zweistellige
Verkettung ist und X/Y,Y, X Typen sind.
Als Stze der Sprache, die von einer solchen
Grammatik erzeugt werden, zhlen alle Ket-
ten ber dem Lexikon, d. h. der Vereinigung
aller BC
X
, die vom Typ s sind.
Eine klassische Kategorialgrammatik lt
sich in der folgenden Weise als Montague-
Grammatik schreiben (die brigens nicht des-
ambiguiert ist; vgl. Definition 20):
(64) A, F, BC
X, X ein Typ
, S, s
Dabei ist F die zweistellige Verkettung, S ent-
hlt alle Regeln der unter (63) angegeben
Form und A ist die Menge aller Ketten, die
sich aus Grundausdrcken, d. h. aus Elemen-
ten der Basiskategorien durch Verkettung bil-
den lassen. s ist der ausgezeichnete Index des
Systems.
Um die Definition zu veranschaulichen,
setzen wir das folgende kleine Lexikon BC
voraus:
(65)Lexem Typ Abkrzung
a. niemand (s/(s/n)) NP [= (s/IV)]
b. schlafen (s/n) IV
c. lange ((s/n)/(s/n)) IV/IV
d. konnte ((s/n)/(s/n)) IV/IV
e. sehen ((s/n)/n) TV [= (IV/n)]
der sehr starken Einschrnkungen des For-
malismus ist man oft zu recht knstlichen,
empirisch nicht motivierbaren Analysen ge-
zwungen (vgl. z. B. Kratzer et alii 1974: Bd.
2, Kap. 2.4). Lewis (1970) hat deswegen die
Ansicht vertreten, da man kategorialgram-
matisch erzeugbare Strukturen als logische
Formen (bei ihm Tiefenstrukturen genannt)
ansehen soll, welche die Bedeutung von Ober-
flchenstzen ausdrcken und durch Trans-
formationsregeln in letztere berfhrt wer-
den. In Montagues Terminologie knnen Le-
wis kategoriale Strukturen als desambi-
guierte Sprache (bzw. DA-Grammatik) auf-
gefat werden (vgl. Definition 20). Die Trans-
formationsregeln definieren dann Montagues
Relation R, welche die Strukturen in Aus-
drcke einer Sprache berfhrt (vgl. Defini-
tion 28). Mehr oder weniger die gleiche Kon-
zeption liegt Cresswell (1973) zugrunde. Die
kategorialgrammatische Analyse natrlich-
sprachlicher Ausdrcke ist fr Logiker des-
wegen so interessant, weil die Syntaxregeln
des klassischen Modells in wenigen Minuten
eingefhrt sind und der Logiker sich nicht
ernsthaft mit syntaktischen Feinheiten der na-
trlichen Sprache beschftigen mu. Er ber-
lt deren Ausbuchstabierung der Relation
R, um die sich die Linguisten zu kmmern
haben.
In neuerer Zeit haben Theoretiker, die
ernsthaft an Syntax interessiert sind, versucht,
die Ausdruckskraft des Formalismus zu er-
weitern, ohne gleich bei dem uneingeschrnk-
ten Begriffssystem Montagues zu landen. Sol-
che erweiterten Systeme lassen sich nach den
Syntaxregeln und deren Interpretationen
klassifizieren. In Abschnitt 4.3 skizzieren wir
derartige Erweiterungen. Die Ideen dazu fin-
den sich brigens praktisch smtlich bereits
bei Lambek (1958).
4.2Das klassische Modell
4.2.1Syntax
Wir fhren nun die klassische Version der
Kategorialgrammatik ein.
Die Typen sind folgendermaen definiert:
(60)
a. s und n sind Typen.
b. Wenn X und Y Typen sind, dann ist
(X/Y) ein Typ.
Die Montaguesche Definition (39) ist natr-
lich nur eine notationelle Variante dieser De-
finition (erweitert um intensionale Typen). s
ist der Typ der Stze, n der Typ der Namen.
Beispiele fr Typen mit den Montagueschen
Ensprechungen sind die folgenden:
122 III. Theorie der Satzsemantik
TV = IV/n angehrt. (68a) zeigt zunchst,
da wir dann fr Pronomina in Subjekt- und
Objektstelle einen verschiedenen Typ anneh-
men mssen: Wir knnen aus einem IV nur
einen Satz machen, wenn das Subjekt ein NP
= (s/IV) ist.
Weil ein Nominal wie nichts aus semanti-
schen Grnden ebenfalls vom NP-Typ sein
mu, mu sehen in (68b) vom Typ IV/NP
sein. In diesem speziellen Fall kann man die
Argumente des Verbs einheitlich vom Typ NP
ansetzen ein Fall von Montagues gene-
ralizing to the worst case (vgl. Abschnitt
2.2). Schon bei geringfgigen Stellungsvaria-
tionen versagt diese Strategie aber. Man be-
trachte dazu das folgende Beispiel:
Um diesen Satz herzuleiten, haben wir dich
neben dem Typ n und dem Typ NP auch noch
dem Typ IV/TV zugeordnet, der aus einem
transitiven ein intransitives Verb macht; dich
gehrt also bereits drei Typen an. Diese Ty-
penmehrdeutigkeit ist alleine durch den For-
malismus erzwungen: Es gibt weder empi-
risch-syntaktische noch semantische Grnde
dafr. Unter der Annahme, da das zuerst
abgebaute Argument des Verbs das Objekt,
das zuletzt abgebaute Argument das Subjekt
ist, knnen wir den folgenden Satz berhaupt
nicht mehr in plausibler Weise herleiten:
(70) Siehst du mich?
Das klassische System ist also gegenber Stel-
lungsphnomenen recht unflexibel, und ist
deswegen um weitere Regeln bereichert wor-
den, die wir in Abschnitt 4.3 kennenlernen
werden. Zunchst wollen wir uns aber der
Interpretation des Systems zuwenden.
4.2.2Semantik
Anders als das Montaguesche Typensystem
unterscheidet die klassische kategoriale Syn-
tax nicht zwischen extensionalen und inten-
sionalen Typen. Die den Typen zugeordneten
Denotate mssen deshalb entweder smtlich
Extensionen oder smtlich Intensionen sein.
Da eingebettete Stze auf jeden Fall Propo-
sitionen denotieren und nichts dagegen
spricht, da auch nichteingebettete Stze Pro-
positionen denotieren, ist die zweite Alterna-
tive geboten. Die folgende Definition benutzt
dieselben Konventionen, wie Definition (40)
aus 3.3.2. Wir setzen also fr das Denotaten-
system folgendes fest:
Die Grammatik vermag die folgende Strukur
herzuleiten:
Den Baum erhlt man in naheliegender Weise
durch sukzessive Anwendung der Syntaxregel
(62). Aus Platzersparnisgrnden haben wir
die unter Kategorialgrammatikern weithin
bliche flache Notation fr Bume benutzt.
Die Grammatik erlaubt es, die ungram-
matische Wortfolge (67a) herzuleiten, wh-
rend die Nebensatzstellung (67b) nicht er-
zeugbar ist:
(67)
a. *niemand lange konnte schlafen
b. niemand lange schlafen konnte
Bar-Hillel, Gaifman und Shamir (1960),
haben gezeigt, da man jede kontextfreie
Sprache durch eine klassische Kategorial-
grammatik erzeugen kann. Es ist kein grund-
stzliches Problem, (67a) in einer kontext-
freien Grammatik als ungrammatisch zu klas-
sifizieren und (67b) zu erzeugen. Man mu
dazu allerdings eine sehr groe Anzahl von
im Prinzip voneinander unabhngigen
Grundkategorien einfhren, deren eventuelle
semantische Gemeinsamkeiten erst auf einer
Metaebene charakterisiert werden knnen.
Das widerspricht der semantischen Motiva-
tion, die hinter dem System steht. (Katego-
rialgrammatiken in komplexer Notation wur-
den erstmals in Kratzer et alii 1974 diskutiert.)
Das Beispiel illustriert Lewis (1970) Stand-
punkt, da plausible Systeme dieser Art nur
zur Charakterisierung von logischen For-
men geeignet sind.
Hinzukommt, da geringfgige Erweite-
rungen der Datenbasis zur Einfhrung von
Kategorienmehrdeutigkeit zwingen, sofern
die grammatische Analyse semantisch sinn-
voll sein soll. Man betrachte etwa Stze, in
denen transitive Verben vorkommen:
Da intransitive Verben dem Typ IV = (s/n)
angehren, ist die einfachste Analyse fr ein
transitives Verb wie sehen, da es dem Typ
7. Syntax und Semantik 123
haltliche Gesichtspunkte konzentrieren.
Das erste, was wir bemerken, ist, da in
dieser Art von Semantik Kaplans Monster-
verbot direkt eingebaut ist. Dies folgt aus der
Definition der Charaktere vom Typ X/Y, wie
sich der Leser berlegen mge. Von der Sache
her ist ein solches Vorgehen aber keineswegs
notwendig. Es ist durchaus mglich, katego-
riale Sprachen so zu deuten, da Monster
ausdrckbar werden. Dieser Weg wird zum
Beispiel in Cresswell (1973) beschritten. Er
definiert die Menge der Charaktere vom Typ
X/Y dazu als die Menge der Funktionen, die
einem Charakter vom Typ Y einen Charakter
vom Typ X zuordnen. Legt man eine solche
Ontologie zugrunde, kann man den in Ab-
schnitt 3.4.2.3 eingefhrten Diagonaloperator
A ohne weiteres als Funktor analysieren.
(73) Sei ein Symbol vom Typ n/n. g() ist
der Charakter
1
in M
n/n
, so da fr
einen beliebigen n-Charakter
2
gilt:
1
(
2
)(k)(w) =
2
(k
w
k/
w
)(w), fr beliebige
k und w.
Dies ist genau die Deutung, die wir in 3.4.2.3
diskutiert haben.
Die Definition ist insofern instruktiv, als
wieder einmal deutlich wird, da eine Kom-
positionsregel wie die funktionale Applika-
tion unabhngig von der zugrundeliegenden
Ontologie wenig ber die Einfachheit oder
Kompliziertheit der semantischen Operation
besagt: Im gerade diskutierten Fall steckt die
Kompliziertheit der Operation im Bedeu-
tungsbegriff selbst: g() ist ja keineswegs ein
Kaplanscher Charakter, d. h. eine Funktion
von Kontexten in Denotate. Vielmehr ist g()
eine Funktion, die aus einem Kaplanschen
Charakter wieder einen Kaplanschen Charak-
ter macht. Man kann sich darber streiten,
ob man solche Funktionen noch Charaktere
nennen soll. Als Terminus bietet sich z. B.
Cresswellscher Charakter oder monstrser
Charakter an.
Die hier vorausgesetzte Semantik erlaubt
es nicht, die Fregesche Vorstellung, da Stze
(in einem Kontext) einen Wahrheitswert de-
notieren, zu rekonstruieren, wohl aber den
blichen Wahrheitsbegriff. Man legt dazu
fest, da der Satz unter der Interpretation
[[ ]] am Kontext k wahr ist, wenn die Propo-
sition [[]](k) in der Welt des Kontexts w
k
wahr
ist.
Es sind noch weitere Interpretationsvarian-
ten mglich: Cresswell (1973) steckt alle De-
notate auch die funktionalen in D
n
, was
zur Folge hat, da die funktionalen Denotate
partielle Funktionen sein mssen. Fr die fol-
(71)
a. Dn,
E,W
= E.
b. Ds,
E,W
= Die Menge Funktionen von
W in {0,1}
c. D
X/Y,E,W
= Die Menge der Funktio-
nen von D
Y,E,W
in D
X,E,W
.
D
n
ist also Montagues D
e
, und D
s
ist Monta-
gues D
s,t
. Die Indizes E,W sind hier und im
folgenden weggelassen.
Was die Definition der Charaktere betrifft,
so spricht nichts dagegen, Montagues (bzw.
Kaplans) Definition zu bernehmen, d. h. fr
jeden syntaktischen Typ X ist M
X
die Menge
der Funktionen aus der Menge der Kontexte
in die entsprechende Denotatenmenge D
X
.
Wenn eine Funktion ist, die den Grund-
ausdrcken der kategorialen Sprache ein ty-
pengerechtes Denotat zuordnet, mu die re-
kursive Definition der von g abhngigen In-
terpretation [[ ]]
g
fr alle Ausdrcke der ka-
tegorialen Sprache folgendermaen aussehen:
(72)
a. Falls ein Grundausdruck ist, dann
ist [[]]
g
= g().
b. Falls ein Ausdruck der Form
mit vom Typ X/Y und vom Typ
Y ist, dann gilt fr einen beliebigen
Kontext k: [[]]
g
(k) = [[]]
g
(k) an-
gewandt auf [[]]
g
(k).
Man kann diese Rekursion als Fregesche In-
terpretation (B,{G},g) auffassen (vgl. Defini-
tion 48). Dabei ist g eine Funktion die jedem
Grundausdruck einen Charakter des entspre-
chenden Typs zuordnet. G ist die Operation,
die wir im Zusammenhang mit Kaplans Mon-
sterverbot kennengelernt haben. (Die Opera-
tion G fllt brigens nicht unter Kaplans
Monsterverbot, da man sie in das Schema
(34b*) bringen kann: Sei
1
ein Charakter
vom Typ X/Y und
2
einer vom Typ Y ist,
dann ist G(
1
,
2
) = k[
1
(k)(
2
(k))].) In B
sind die Charaktere, die als g-Wert eines
Grundausdrucks vorkommen, ferner ist B un-
ter der Operation G abgeschlossen.
Man sieht ohne weiteres, da (72) eine
gleichwertige Formulierung zu einer Frege-
schen Interpretation ist: Der Rekursionsan-
fang, Bedingung (a), ist die Auflistung der
Funktion g. Klausel (a) sagt, da die Grund-
elemente der Trgermenge B der Bedeutungs-
algebra durch Grundausdrcke benannt wer-
den. Klausel (b) besagt, da die Menge B
unter der Operation G abgeschlossen ist. Wir
wollen im folgenden darauf verzichten, stets
nachzuweisen, wie derartige Begriffsbildun-
gen in die Montaguesche Sprechweise ber-
tragen werden knnen, sondern uns auf in-
124 III. Theorie der Satzsemantik
des Funktors auf die Bedeutung des Argu-
mentes besteht. Wir werden im folgenden
nicht immer terminologisch zwischen den bei-
den Regeln unterscheiden sondern zuweilen
einfach von funktionaler Applikation (FA)
sprechen.
Mithilfe des erweiterten Formalismus ist
die deutsche Grundwortstellung einfach
auszudrcken:
(75) weil ich dich sehe
n n n\(n\s)
Eine wichtige Erweiterung besteht in der Hin-
zunahme von Regeln der funktionalen Kom-
position (Theorem i des Lambekkalkls):
(76) Funktionalkomposition (FK)
a. nach rechts:
X/Y Y/Z X/Z
b. nach links:
X\Y Y\Z X\Z
Die Namen ergeben sich wieder aus der in-
tendierten Deutung, die fr (76 a) folgender-
maen aussieht: Einer Funktion f vom Typ
X/Y und einer Funktion g vom Typ Y/Z wird
die Funktion x[f(g(x))] zugeordnet. Wir be-
nutzen hier und im folgenden fette Typen zur
metasprachlichen Charakterisierung von De-
notaten. Analog wird (76 b) interpretiert. Es
gibt einige weitere Varianten der Funktional-
komposition, z. B. X/Y Z\Y Z\X, die sich
mithilfe der unten eingefhrten Regel AR her-
leiten lassen. Fr das folgende wird eine eng
mit der Funktionalkomposition verwandte
Regel wichtig werden, die als Geachsche Re-
gel eine historische Fehlattribution be-
kannt geworden ist (Theorem j des Lambek-
kalkls):
(77) Typenexpansion (G wie Geach)
X/Y (X/Z)/(Y/Z) (analog fr \).
Die Kompositionsregeln und die Geachsche
Regel erhhen die Ausdruckskraft des Sy-
stems betrchtlich. Geach (1972) weist zu-
nchst darauf hin, da man die Negation als
Satzoperator auffassen kann und sie trotzdem
verschiedende Konstituenten negieren kann.
Die von ihm diskutierten aristotelischen Bei-
spiele sehen, auf das Deutsche bertragen,
folgendermaen aus:
gende Diskussion wollen wir jedoch eine stark
vereinfachte Semantik voraussetzen: Wir
ignorieren Kontextabhngigkeit und nehmen
an, da die Ausdrcke der kategorialen Spra-
che direkt durch Denotate gedeutet werden.
4.3Verallgemeinerte
Kategorialgrammatiken
In der neueren Literatur wird mit verallge-
meinerten Kategorialgrammatiken gearbeitet
(vgl. z. B. Bach 1984, Ades & Steedman 1982,
Szabolcsi 1987; eine umfassende bersicht
ber linguistische Anwendungen findet sich
in Bach, E., Oehrle, R. und Wheeler, D. 1987).
Die Verallgemeinerungen bestehen darin, da
weitere Syntaxregeln zugelassen werden. Dies
fhrt zu einer wesentlich greren Flexibilitt
des Formalismus. Praktisch smtliche der
heutzutage diskutierten Erweiterungen, ins-
besondere die sogenannte Geachsche Re-
gel, finden sich bereits in Lambeks (1958)
syntactic calculus. Lambek skizziert fr die
wesentlichen Operationen auch eine extensio-
nale Semantik. Der Fortschritt gegenber
Lambek besteht vor allem in der Erprobung
des Systems anhand von komplizierten Bei-
spielen.
In diesem Abschnitt demonstrieren wir zu-
nchst die Tragfhigkeit einiger mglicher Er-
weiterungen. Anschlieend weisen wir auf ge-
wisse theoretische Konsequenzen der Verall-
gemeinerungen hin: Plausible Prinzipien fh-
ren dazu, da die Regeln hoffnungslos ber-
generieren, d. h. nichtgrammatische Stze
erzeugen, ohne da zu sehen ist, wie dies
durch natrliche Beschrnkungen des For-
malismus verhindert werden knnte. Diese
Konsequenzen machen es sehr zweifelhaft, ob
verallgemeinerte Kategorialgrammatiken zur
syntaktischen Analyse von natrlichen Spra-
chen geeignet sind. Der Formalismus scheint
eher ein guter Kandidat zur Darstellung der
logischen Form zu sein, die noch flexibler
gestaltet werden kann als bei Lewis (1970)
oder Cresswell (1973).
Die erste Erweiterung besteht darin, da
neben Funktorentypen der Form Y/X nun
auch solche der Form X\Y mit der entspre-
chenden Syntaxregel zugelassen sind:
(74) Linksapplikation (LA)
X X\Y Y
Die Regel (62) des klassischen Modells wollen
wir entsprechend Rechtsapplikation (RA)
nennen. Die Namen erinnern an die inten-
dierte Interpretation, die in beiden Fllen in
der funktionalen Applikation der Bedeutung
7. Syntax und Semantik 125
einschlgige Analyse angedeutet: Um einen
Relativsatz wie who loves Sokrates oder that
every Greek loves zu bilden, mu loves Soc-
rates bzw. every Greek loves der Kategorie IV
angehren. Das Relativwort macht dann dar-
aus einen Satz. Fr ein etwas komplizierteres
Beispiel das aus gutem Grund dem Eng-
lischen entnommen ist, da die bisherigen Me-
thoden fr das Deutsche noch nicht ausrei-
chen zeigen wir, wie lange Abhngigkeiten
mithilfe der Kompositionsregel FK analysiert
werden:
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, da
ein so erweiterter Formalismus viele syntak-
tischen Ambiguitten erzeugt. Zum Beispiel
lt sich (81) auch auf die folgende Weise
analysieren:
Diese syntaktischen Mehrdeutigkeiten, die
kein semantisches Korrelat haben, sind alleine
durch den Formalismus erzeugt. Das Beispiel
zeigt auch, da die Kategorien nicht den b-
lichen Konstituentenbegriff rekonstruieren:
Nach gngigem Verstndnis sind die Ketten
you believe, you believe (that) Mary und you
believe (that) Mary likes keine Konstituenten.
Gegen diese Auffassung ist allerdings bereits
schon von Geach (1972) eingewandt worden,
da der Koordinationstest zeige, da es sich
doch um Konstituenten handele:
a. you believe and I disbelieve that Otto likes
Mary.
b. you believe that Mary likes and Peter be-
lieves that Mary hates Emil.
Wir wollen auf diese Problematik nicht ein-
gehen, sondern nur darauf verweisen, da
man leicht verallgemeinerte Koordinations-
regeln in die Kategorialgrammatik einfhren
kann, die solche Kategorien koordinieren. Be-
reits Lambek hat in der genannten Arbeit die
einschlgigen Techniken vorgefhrt. Smtli-
che Theorien der verallgemeinerten Koordi-
nation (z. B. Geach 1972; von Stechow 1974;
Keenan & Faltz 1978; Rooth & Partee 1982)
(78b) hat zwei Analysen: Einmal kann nicht
die Konstituente jeder Mensch modifizieren.
Dazu wird FKR angewendet. Das Resultat
wird dann auf das IV angewendet. Das zweite
Mal kann nicht das s jeder Mensch fliegt mo-
difizieren. Dies geschieht mittels der Regel
FAR.
Die Analyse von (78a) und die erste Ana-
lyse von (78b) kann man nun auch mithilfe
der Geachschen Regel nachspielen und erhlt
(79a) bzw. (79b):
Die offensichtliche Parallelitt der fraglichen
Ableitungen gibt den Hinweis, wie die
Geachsche Regel zu deuten ist. Das Denotat
des Satzoperators nicht ist die Negation
nicht. Entsprechend mu in (79 a) das durch
die Regel G gewonnene Negationsadverb
vom Typ (s/n)/(s/n) die Bedeutung
Px[nicht(P(x))] haben, wobei P vom Typ
(s/n) und x vom Typ s ist. Allgemein ordnet
also die Geachsche Regel einer Funktion f
vom Typ X/Y die Funktion gxf(g(x)) zu,
wobei g vom Typ Y/Z und x vom Typ Z
ist. Man berzeugt sich, da die Deutung
der beiden Stze die erwnschten Resultate
liefert. Zum Beispiel liefert die Verbalnega-
tion die Funktion x[nicht(fliegt(x))], wh-
rend die Nominalnegation die Funktion
P[nicht(jeder Mensch(P)) liefert.
Die Deutung der Geachschen Regel zeigt
den erwhnten engen Zusammenhang mit der
Funktionalkomposition: Regel G erzeugt in
gewisser Weise diese Operation. Dies sieht
man sofort anhand des Umstandes, da sich
FK aus G herleiten lt:
Man kann also theoretisch ohne die Regel
FK auskommen. Kompositionsregeln sind
auch dazu benutzt worden, um lange Ab-
hngigkeiten wie z. B. W-Bewegung kate-
gorial nachzuspielen (vgl. z. B. Szabolcsi
1987). Bereits in Geach (1972: 486) ist die
126 III. Theorie der Satzsemantik
Funktion zx[f(x)(z)] zu xz[f(x)(z)] bzw.
umgekehrt. Die Herleitung von (70) unter
der Annahme, da sehen die lexikalisch fest-
gelegt Kategorie n\(n\s) hat sieht nun fol-
gendermaen aus:
Man sieht ohne weiteres ein, da diese Ab-
leitung das semantisch korrekte Resultat lie-
fert: die Regel AR ndert an der Bedeutung
nichts, die Regel AV vertauscht die beiden
Argumente der Relation sehen und sorgt so
dafr, da die Funktion zuerst auf das Sub-
jekt du angewandt werden kann.
In der neueren Literatur wird ein weiteres
Prinzip angenommen, das als Verbindung
(connection) bekannt ist (vgl. Steedman 1987):
(88) (X/Y)/Z Y/Z X/Z (Con)
Die Interpretation dieser Regel ist die fol-
gende: Einer Funktion f vom Typ (X/Y)/Z
und einer Funktion g vom Typ Y/Z wird
die Funktion x[f(x)(g(x))] zugeordnet. Eben-
falls Varianten der Verbindung sind offen-
bar Regeln wie Z\(X/Y) Z\Y Z\X,
Y/Z (Y\X)/Z X/Z oder Z\Y (Y\X)/Z
Z\X, die gleich gedeutet werden.
Mit Hilfe der Verbindung lassen sich Kon-
struktionen mit sogenannten parasitren
Lcken (vgl. Engdahl 1980) korrekt analy-
sieren:
ber die Kompositionsregel FK erhalten wir
aus dem (IV\IV)/IV without und dem IV/n
reading zunchst das (IV\IV)/n without rea-
ding, welches die Funktion
x[without(reading(x)] denotiert. Die Inter-
pretation der Verbindungsregel sorgt dafr,
da file without reading die Funktion
y[(x[without(reading(x)](y))(file(y))], d. h.
y[without (reading(y))(file(y))] denotiert.
Schlielich sei noch darauf hingewiesen,
da man Bindung variablenfrei nachspielen
kann. Man betrachte zunchst ein Reflexiv-
pronomen:
sich macht aus einer zweistelligen Relation
eine einstellige, indem sie die beiden Argu-
sind letztlich in Lambek (1958) bereits ange-
legt.
Es sei an dieser Stelle auch darauf hinge-
wiesen, da man das im vorhergehende Ab-
schnitt angesprochene Problem der Mehr-
fachkategorisierung teilweise auf sehr ele-
gante Weise durch die Regeln der Typenan-
hebung (type raising) bewltigen kann:
(83) Typenanhebung (TA)
X Y/(Y/X), X Y/(X\Y), ... usw.
fr die verschiedenen Kombinationen
von / und \.
Fr den Fall, da Y = s ist, erhalten wir die
Montaguesche Sternoperation, die folgen-
dermaen gedeutet wird: wenn ein Denotat
vom Typ X ist, dann ist das hochgestufte
Denotat a* die Funktion ff(a), wobei f vom
Typ s/X ist. Zum Beispiel ist *Ede =
PP(Ede), also gleich der Menge der Eigen-
schaften, die Ede hat. Man kann also Ede je
nach Bedarf als n oder als NP mit geeigneten
Schrgstrichen im Inneren auffassen. Das-
selbe gilt auch fr Personalpronomen. (Die
Regel X Y/(X\Y) entspricht Theorem h
des Lambekkalkls. Die Regel X Y/(Y/X)
ist im Originalkalkl nicht herleitbar. Sie er-
weitert seine generative Kraft erheblich, wie
wir unten sehen werden.)
Die Typenanhebung knnen wir auch fr
Funktoren verallgemeinern, indem wir z. B.
aus Verben des Typs (s/n)/n solche des Typs
(s/NP)/NP machen usw.
In einer Sprache mit freier Wortstellung
wie dem Deutschen oder dem Lateinischen
kann ein Funktor sowohl links als auch rechts
von seinen Argumenten stehen. Man kann
diese Stellungsfreiheit durch die folgende
quivalenzregel formulieren:
(84) Applikationsrichtungsnderung (AR)
X/Y Y\X.
Der Doppelpfeil bedeutet Ableitbarkeit in
beiden Richtungen. Semantisch hat diese Re-
gel keinen Effekt. Mithilfe von AR kann man
z. B. aus Satz (85a) den Satz (85b) herleiten:
Um Satz (70) Siehst du mich? herzulei-
ten, bentigen wir eine Regel, welche die Ar-
gumente eines Funktors vertauscht.
(86) Argumentvertauschung (AV)
(X\Y)/Z X\(Y/Z)
Die Deutung besteht im bergang von der
7. Syntax und Semantik 127
Beispiel:
Um die Reihenfolge von Funktor und Argu-
ment zu vertauschen, mssen wir Ede nur zum
Typ s/(s/n) anheben. Wir erhalten so:
Betrachten wir nun einen Satz, in dem der
Funktor ein Nominal qua lexikalischer Ein-
trag ist:
Um die umgekehrte Reihenfolge zu erhal-
ten, heben wir die Verbphrase einfach zu
s/(s/(s/n)) an und erhalten:
In einem System, das die Regel TA kennt
ein fr alle Kategorialgrammatiker unver-
zichtbares Prinzip ist also die Regel AR
redundant, d. h., Funktor und Argument las-
sen sich immer vertauschen.
Da eine typenexpandierende Regel wie
TA als eine Bewegungsregel aufgefat wer-
den kann, macht man sich am besten folgen-
dermaen klar. Einen Funktor der Gestalt
X/Y kann man sich als eine Struktur vom
Typ X vorstellen, in der ein Y fehlt. Zum
Beispiel kann man sich das Wort trumt als
ein s mit fehlendem Subjekt n, hier als t
n
dargestellt, denken:
Ein zu einem Nominal (s/(s/n)) angehobenes
Nomen, sagen wir, Irene, kann man sich aus
dieser Lcke herausbewegt vorstellen (die
syntaktische Krzung erfolgt hier nach oben):
Mit anderen Worten, die Anhebung von n zu
s/(s/n) kann gelesen werden Verlangt rechts
einen Satz, in dem ein n fehlt. Und die Se-
mente der Relation identifiziert, d. h. sich ist
die Funktion f(x[f(x)(x)]). Damit ist Satz
(90) offenbar korrekt gedeutet. Die Interpre-
tation lt sich fr n-stellige Relationen ver-
allgemeinern (vgl. von Stechow 1979a).
Auf die Mglichkeit, Reflexivpronomina
auf diese Weise zu deuten, wurde erstmals in
Quine (1960) hingewiesen (vgl. auch Geach
1972, von Stechow 1979a und Szabolcsi
1987). In Quines Arbeit ist ebenfalls darge-
legt, wie man in der skizzierten Weise gebun-
dene Variablen grundstzlich eliminieren
kann. Letztlich handelt es sich um nichts an-
deres als um eine Anwendung der Verfahren
der kombinatorischen Logik (vgl. Schnfin-
kel 1924). Dementsprechend kann man ein
gebundenes Personalpronomen wie ein Refle-
xivum interpretieren (vgl. Szabolcsi 1987):
er ist hier ein Operator, der aus einer Funk-
tion f vom Typ IV/s die Funktion
gx[f(g(x))(x)] macht, die vom Typ IV/IV
ist. er ordnet der Funktion hofft also die
Funktion gx[hofft(g(x))(x)] zu. Wenn man
diese auf gewinnt anwendet, erhlt man
x[hofft(gewinnt(x))(x)]. Wendet man jeder
darauf an, so erhlt man offenbar eine Lesart,
bei der das Subjekt des eingebetteten Satzes
durch den Quantor gebunden ist.
Mglichkeiten wie diese haben eine Reihe
von Forschern (z. B. Lambek 1958; Geach
1970; Ballmer 1975; Ades & Steedman 1982;
Bach et al. 1987; Szabolcsi 1987) so fasziniert,
da sie die These vertreten haben, man solle
verallgemeinerte Kategorialgrammatiken di-
rekt zur Analyse natrlicher Sprachen benut-
zen. Diese Ansicht ist aber fragwrdig, weil
bereits Systeme, mit wesentlich weniger Re-
geln als den hier vorgefhrten, so stark sind,
da der folgende Permutationssatz gilt (van
Benthem 1984a):
(92) Gegeben sei ein System, das nur die Re-
geln der Rechtsapplikation (RA), der Ty-
penanhebung (TA) und die Geachsche
Regel (G) benutzt. Dann gilt: Wenn die
Folge von Ausdrcken x vom Typ X ist,
dann ist jede Permutation von x vom
Typ X.
Bevor wir diesen Satz zeigen und seine Im-
plikationen fr die Grammatiktheorie disku-
tieren, wollen wir an zwei Beispielen ein Ge-
fhl fr die kombinatorische Vielfalt des Sy-
stems erwecken. Zum Beispiel lt sich das
Prinzip AR, also die nderung der Applika-
tionsrichtung, direkt aus der Typenanhebung
herleiten. Man betrachte dazu das folgende
128 III. Theorie der Satzsemantik
tegorialgrammatik im Gegensatz zur ge-
nerativen Grammatik (vgl. Abschnitt 5). Die
berlegungen dienen hier der Anschaulich-
keit.
Das andere strukturaufbauende Prinzip,
welches van Benthems Permutationstheorem
mantik der Typenanhebung stellt sicher, da
dies quivalent mit der Auffassung ist, da
das Nominal gerade das fehlende n ist. Dies
bedeutet aber, da man es sich als heraus-
bewegt vorstellen kann. Natrlich ist die
Lcke t
n
keine theoretische Einheit der Ka-
(93), denn die Permutationen einer Folge las-
sen sich stets durch geeignete Vertauschung
von benachbarten Gliedern erreichen.
Um den ersten Teil zu zeigen, gengt der
Nachweis, da sich eine Folge (X/Y)/Z, Z, Y
von rechts krzen lt. Man betrachte dazu
die Ableitung (101):
Um zu verstehen, wie man zu dieser Ableitung
gelangt ist, arbeiten wir wieder mit der Be-
wegungsmetapher. Betrachten wir zunchst
den Baum, der die Ausgangskette nur mithilfe
der Rechtsapplikation krzt:
Wie wir sehen, ist die Folge (X/Y)/Z, Z
ein X/Y. Stellen wir uns nun den Funktor
(X/Y)/Z aus dieser Folge herausbewegt vor
und notieren wir die Lcke unter dem
Strich, so ist die Folge t, Z ein (X/Y)/
((X/Y)/Z). Das ist die Kategorie, die wir unter
Z in der zweiten Zeile der Ableitung sehen. t
steht hier wieder als mnemotechnisches Sym-
bol fr die ((X/Y)/Z)-Lcke. Ebenso knnen
wir Y als ein X mit fehlendem Funktor X/Y
auffassen. Mit unter dem Strich notierter X/
Y-Lcke erhalten wir so ein X/(X/Y). Dies
ist die Kategorie, die wir unter Y in der zwei-
ten Zeile des Beweises finden. Die zweite Zeile
kodiert also, da der jeweils linke Funktor
fehlt: Z wrde vom Knoten X/Y dominiert,
htte man (X/Y)/Z darauf angewandt, Y
wrde vom Knoten X dominiert, htte man
den fehlenden Funktor X/Y darauf ange-
wandt. Schaut man sich die dritte Zeile der
Ableitung an, dann sieht man, da man die
beiden rechten Glieder (X/Y)/a, X/(X/Y) mit-
hilfe der Funktionalkomposition FK zu X/a
zusammenfassen kann, vorausgesetzt, man
kann ihre Reihenfolge vertauschen. Dieses
voraussetzt, ist die Geachsche Regel. Machen
wir uns an einem Beispiel klar, da auch diese
Bewegungen bewirkt. Man betrachte das
folgende Beispiel, wobei man sich nicht an
der Wortordnung stren mge:
(99) scheint (zu trumen) Irene
s/s s/n n
Diese Folge krzt sich zu s. Mithilfe der Ge-
achschen Regel kann man nun Irene an den
Anfang bewegen, wie die folgende Struktur
zeigt.
Man kann die Regel G als einen Mechanismus
ansehen, der es gestattet, die n-Lcke an den
hheren s-Knoten zu vererben. Dort kann sie
dann durch das uerste Nominal gesttigt
werden. Diese berlegungen sollten ein Ge-
fhl fr die gewaltige kombinatorische Kraft
erzeugt haben, die dem System innewohnt, so
da wir uns nun dem Beweis des Permuta-
tionssatzes (92) zuwenden knnen.
Der Beweis vollzieht sich in zwei Schritten
(vgl. van Benthem 1984a: 74 f.): Zuerst wird
gezeigt, da sich jeder kategoriale Baum einer
Grammatik, die den in (93) genannten Vor-
aussetzungen gengt (d. h. nur AR, TA und
G als Regeln hat), in einen lediglich nach
rechts verzweigenden Baum transformieren
lt. Im zweiten Schritt wird gezeigt, da sich
beliebige Endknoten eines solchen Baumes
vertauschen lassen, ohne da sich am End-
resultat etwas ndert. Daraus folgt sofort Satz
7. Syntax und Semantik 129
same Lesart:
(106)
a. Die Mutter riet der Tochter, dem
Vater zu schmeicheln
b. Die Mutter riet dem Vater, der Toch-
ter zu schmeicheln
Die beiden Stze sind aber auf keinen Fall
synonym. Verallgemeinerte Kategorialgram-
matiken erzeugen also in aller Regel uner-
wnschte Lesarten. Das Problem ist in unter-
schiedlichen Varianten in von Stechow
(1979 a), Zimmermann (1986) und van Ben-
them (1987) angesprochen worden. Der Any-
thing-goes-Eindruck wird erhrtet durch ein
zweites Theorem von van Benthem (1984 a),
das folgendermaen lautet:
(107) Ein Paar von zwei beliebigen Katego-
rien X,Y lassen sich stets zu einer Ka-
tegorie Z krzen.
Der Beweis sieht folgendermaen aus:
Y
Z/(Z/Y)
TA, fr beliebiges Z
(Z/X)/((Z/Y)/X) Geach
(Z/X)/a Geach, mit a = ((Z/Y)/X)
RA
Aus dem Krzungstheorem (108) folgt sofort,
da es fr jede beliebige Folge von Kategorien
eine Kategorie gibt, zu der sie sich krzen
lt. Mit anderen Worten, jede beliebige
Wortfolge ist eine Konstituente.
Diese Aussagen zeigen, da verallgemei-
nerte Kategorialgrammatiken in der vorlie-
genden Form zu stark sind und beschrnkt
werden mten. Es ist aber nicht zu sehen,
wie plausible Beschrnkungen aussehen
knnten. Man bedenke, da die Vorausset-
zungen fr das Permutationstheorem uerst
plausible Prinzipien sind: die Rechtsapplika-
tion ist notwendig, die Geachsche Regel
die eine querkategoriale Behandlung z. B. der
Negation erlaubt ist der Stolz der Kate-
gorialgrammatiker, und die Typenanhebung
ist zumindest dem Montaguegrammatiker
heilig. Da man offenbar keine dieser Regeln
aufgeben kann, mssen sie in ihrer Globalitt
eingeschrnkt werden. Es liegt nicht auf der
Hand, wie solche Beschrnkungen inhrent
mit den Mitteln der Kategorialgrammatik
formuliert werden knnen. Es steht vielmehr
zu erwarten, da die Restriktionen von
auen an den Formalismus herangetragen
werden, durch Merkmale, welche die blichen
in der generativen Grammatik erarbeiteten
Restriktionen in komplexen Kategorien ko-
dieren. Ein solches Verfahren hat mit dem
Formalismus der Kategorialgrammatik offen-
Ziel wird in den nchsten vier Zeilen erreicht,
wobei Geachs Regel zur Herleitung von FK
benutzt wird, wie oben beschrieben, und die
Vertauschung durch TA simuliert wird, was
auch bereits diskutiert wurde. Die folgenden
beiden Zeilen vertauschen wieder Funktor
und Argument. Jede Ableitung lt sich also
in einen nur nach rechts verzweigenden Baum
bringen. Dieses Normalformtheorem ist der
erste Teil des Beweises.
Als nchsten Schritt berlegen wir, da wir
beliebige Glieder a
n2
, a
n1
eines solchen Ab-
leitungsbaumes vertauschen knnen, ohne
da sich etwas am Gesamtresultat der Kr-
zung ndert.
Betrachte zum Beweis die folgende Ableitung
mit vertauschten Positionen von a
n2
und a
n1
:
Damit ist van Benthems Permutationstheo-
rem vollstndig abgehandelt. Kommen wir
also auf die Konsequenzen des Satzes fr die
linguistische Theoriebildung zu sprechen. Sie
sind nach Meinung des Verfassers schwerwie-
gend: Das Theorem beinhaltet, da die wohl-
geformten Ausdrcke einer natrlichen Spra-
che unter Permutation abgeschlossen sind
bei Erhaltung der Wohlgeformtheit! Dem-
nach wre beispielsweise mit (105a) auch
(105b) wohlgeformt.
(105)
a. Die Maus pfeift ein Lied
b. Maus pfeift ein Lied die
Mit einem solchen Wohlgeformtheitsbegriff
knnen die Grammatiker aber nichts anfan-
gen. Hinzukommt, da die Regeln TA und G
die Bedeutung nicht verndern. So htten
z. B. die Stze (106a) und (106b), die in der
Permutationsbeziehung stehen, eine gemein-
130 III. Theorie der Satzsemantik
kein Skopuseffekt zustande. Eine Analyse
dieser Art ist in Levin (1982) vorgeschlagen
worden. Die Analyse liefert dasselbe Resultat
wie die im nchsten Abschnitt diskutierte Be-
wegungsanalyse der GB-Theorie. Wir lassen
das Problem offen, nach welchen Kriterien
man zwischen den beiden Anstzen gegebe-
nenfalls zu whlen hat.
Auch gebundene Pronomina mssen in die-
ser Theorie nicht unbedingt als gebundene
Variablen im Sinne der Prdikatenlogik inter-
pretiert werden. Fr die Deutung von agglu-
tinierenden Sprachen, die z. B. Reflexivaffixe
habe, ist die oben skizzierte Analyse (90) der
Reflexivierung durchaus plausibel. Wir kn-
nen uns dies anhand des Kompositums Selbst-
beherrschung klarmachen Unter der Voraus-
setzung, da selbst vom Typ (s/n)/((s/n)/n)
ist und die Bedeutung selbst = fx[f(x)(x)]
hat, kann man die Komposition
selbst + beherrsch analysieren als
selbst(beherrsch) = x[beherrsch(x)(x)].
Ferner lassen sich kausativierte komplexe
Verben, wie zum Beispiel das japanische
tabe + sase essen machen als Funktional-
komposition der beiden Verben analysieren.
Wir nehmen dazu an, da das (n\s) tabe die
Bedeutung essen hat, whrend das Kausativ-
verb sase, das vom Typ s\(n\s) ist, die Be-
deutung cause hat. Die Komposition dieser
beiden Funktionen ergibt die Funktion
yx[cause(essen(x))(y)], die vom Typ des
transitiven Verbs, also ein n\(n\s) ist. Man
sieht an dieser Analyse, da man keineswegs
verlangen mu, da sase in der Syntax einen
Satz einbettet. Der propositionseinbettende
Effekt wird semantisch nachgespielt: essen(x)
gehrt zwar dem semantischen Typ s an, man
darf aber nicht vergessen, da es sich dabei
um einen Ausdruck der Metasprache handelt,
der keine syntaktische Entsprechung hat.
Auch das sogenannte Applikativ kann man
kategorialgrammatisch leicht nachspielen.
Die folgenden Beispiele des Chichewa illu-
strieren das Phnomen (zitiert nach Baker
1988: 69):
bar nichts zu tun. Die dabei einschlgigen
Gesetzmigkeiten sind prinzipiell anderer
Art.
Daran ndert auch die Tatsache nichts, da
smtliche Restriktionen am Ende vielleicht
technisch in einer Kategorialgrammatik mit
komplexen Kategorien formuliert werden
knnen. Dies gilt analog fr die verallgemei-
nerten Kategorialgrammatiken und selbstver-
stndlich auch fr kontextfreie Grammatiken
in komplexer Notation (vgl. z. B. Kratzer et
alii 1973, Gazdar et al. 1985); vgl. auch Rut-
tenberg (1976) und von Stechows (1979 a) Kri-
tik an Cresswells Intention, Wortstellungspro-
bleme durch -Konversion zu behandeln (vgl.
dazu Artikel 8: Abschnitt 5).
Wir wollen hier die Frage offenlassen, ob
die genannten Schwierigkeiten durch geeig-
nete kategorialgrammatische Beschrnkun-
gen prinzipiell behebbar sind. Was man von
der kategorialen Grammatik auf jeden Fall
lernen kann, ist das folgende: Es lt sich
wesentlich mehr lokal interpretieren, als
sich die Theoretiker trumen lassen, die nur
die Prdikatenlogik der ersten Stufe im Kopf
haben, die weithin bliche GB-Position.
Betrachte als erstes Skopusmehrdeutigkei-
ten. Um eine Quantorenphrase mit einem
Verb zu kombinieren, mu man sie nicht un-
bedingt in der logischen Form bewegen. Zum
Beispiel kann man die starke Lesart von
(109 a) die als (109 b) wiedergegeben wird
, so erklren, da man zuerst das Subjekt
mit dem Verb durch Funktionalkomposition
kombiniert und dann das Objekt auf das Re-
sultat anwendet:
Es ist wichtig, da das Verb als (s/n)/n kate-
gorisiert wird. Wrde man die Kategorie mit
angehobenem Objekt (s/n)/NP whlen, kme
deutet, wie Vgel fliegen mit Flgeln. Ka-
tegorialgrammatisch wird eine Prposition
wie mit als ein (IV/IV)/n klassifiziert. Dem-
nach hat (110a) die folgende kategoriale
Struktur:
APPL ist ein Operator, der aus dem intran-
sitiven fliegen das transitive mit (hilfe) fliegen
macht, wobei die Interlinearversion Vgel
mitfliegen Flgel(Akkusativ) dasselbe be-
7. Syntax und Semantik 131
schlagen wurden (vgl. Newmeyer 1980 und
1983). Wir diskutieren hier das sogenannte
GB-Modell, eine Bezeichnung, die von dem
Buch Lectures on Government and Binding
(Chomsky 1981) herrhrt. Fr dieses Modell
gibt es keine verbindliche semantische Theo-
rie, sondern lediglich systematische Hinweise,
an welchen Stellen die Semantik anzuschlie-
en ist. Kennzeichnend fr die Haltung vieler
Theoretiker dieser Richtung ist das folgende
Zitat aus Riemsdijk & Williams (1986: 177):
About semantics, too little is known, to
speak with any assurance. Die folgenden
Bemerkungen ber den Ort der Semantik in
der GB-Theorie haben deshalb teilweise einen
spekulativen Charakter.
In unserer Darstellung verzichten wir dar-
auf, die recht komplexe GB-Theorie detail-
liert einzufhren. Uns interessiert diese Gram-
matikkonzeption lediglich unter dem Gesicht-
punkt, was sie fr das Verhltnis von Syntax
und Semantik impliziert. Insbesondere wer-
den wir uns in dem zusammenfassenden Ab-
schnitt 6 mit dem folgenden Problem beschf-
tigen: Mu das Verfahren von Montagues
UG, welches syntaktische Regeln durch se-
mantische Operationen interpretiert, fr eine
Theorie ausscheiden, in der es berhaupt
keine Syntaxregeln im bisher eingefhrten
Sinne gibt?
5.2Das GB-Modell
Die GB-Theorie oder zumindest eine Ver-
sion derselben ist ein Ebenenmodell, das
folgende Ebenen der syntaktischen Reprsen-
tation annimmt.
Die D-Struktur kodiert die Funktor-Argu-
ment-Relation: Sie stellt die Konfigurationen
zur Verfgung, in denen die Argumente eines
Funktors in einer kanonischen Konfiguration
zum Funktor stehen (vgl. Abschn. 5.3).
Auf der Ebene der S-Struktur kann ein
Argument oder ein Funktor bewegt worden
sein, und zwar durch die Regel Bewege-.
Diese Struktur bildet die Eingabe fr die pho-
nologischen Regeln einerseits, welche die
phonetische Form (P-Struktur) aufbauen,
und fr die Interpretationsregeln, welche die
Die Applikativkonstruktion (110 b) lt sich
nun folgendermaen analysieren:
Als einziges Zusatzprinzip bentigen wir die
folgende Lckenvererbungsregel:
(113) (IV/IV)/n IV IV/n
welche durch die Operation fgx[f(x)(g)]
gedeutet wird, wobei f vom Typ (IV/IV)/n
und g vom Typ IV ist. Man kann sich leicht
berlegen, da (111) und (112) synonym sind.
Diese berlegungen zeigen, da die Prin-
zipien der verallgemeinerten Kategorialgram-
matik besonders fr die Interpretation von
morphologisch komplexen Wrtern geeignet
sind. Fr die Anwendung der Funktional-
komposition in der Morphologie haben z. B.
Bach (1984) und Di Sciullo und Williams
(1987) pldiert. Fr eine lexikalische Behand-
lung der deutschen Applikativverben pldiert
Wunderlich (1987). Ich bin allerdings nicht
sicher, ob sein Vorschlag auf die hier vorge-
schlagene Analyse hinausluft. Einen zu den
genannten Autoren vllig entgegengesetzten
Standpunkt nimmt Baker (1988) ein, der
(110b) aus (110a) syntaktisch herleitet, indem
die Prposition ber Bewegung in das Verb
inkorporiert wird.
Das vorsichtige Fazit der Diskussion dieses
Abschnittes ist, da Kategorialgrammatiken
wohl nicht so sehr die syntaktische Struktur
natrlicher Sprachen rekonstruieren, sondern
eher die semantischen Operationen widerspie-
geln, die wir bei der Interpretation durchfh-
ren. Der Eindruck, da die kategoriale Struk-
tur mit der syntaktischen Struktur gleichzu-
setzen ist, rhrt vermutlich daher, da syn-
taktische und kategoriale Struktur oft parallel
verlaufen. Wir kommen auf diesen Punkt in
Abschnitt 6 noch einmal zu sprechen.
5. Generative Grammatik
5.1Vorbemerkungen
Die generative Grammatik hat eine lange Ge-
schichte, in der verschiedene Modelle vorge-
132 III. Theorie der Satzsemantik
Hier ist who zyklisch zuerst an die periphere
(sog. COMP-)Position des untergeordneten
Satzes und dann an die periphere Position des
bergeordneten Satzes bewegt worden. (Auf
die Eigenart der do-Bewegung gehen wir nicht
ein.) NP-Bewegung und W-Bewegung haben
syntaktisch recht verschiedene Eigenschaften.
NP-Bewegung ist, was die Reichweite betrifft,
ein wesentlich restriktiverer Proze. Ebenfalls
haben NP-Spuren und W-Spuren verschie-
dene distributionelle Eigenschaften. Diese
Details interessieren in diesem Zusammen-
hang aber nicht (vgl. dazu Chomsky 1981).
Wir wollen fr die folgende Diskussion ledig-
lich voraussetzen, da die Syntax Reprsen-
tationen dieser Art liefert.
Wir betrachten nun noch ein Beispiel fr
eine Konstruktionsregel, welche logische For-
men aufbaut. Es handelt sich um die Regel
der Quantorenanhebung (QR), die bereits in
Abschnitt 2.4 als Q erwhnt worden ist (vgl.
dazu May 1977). Diese Regel besagt, da man
eine NP an eine satzperiphere Position unter
Hinterlassung einer koindizierten Spur be-
wegen darf. Zum Beispiel kann man aus
(119a) die beiden LFs (119 b) und (119 c) her-
leiten:
(119)
a. [
S
every man [
VP
loves a woman]]
b. [
S
every man
i
[
S
a woman
j
[
S
t
i
[
VP
loves
t
j
]]]]
c. [
S
a woman
j
[
S
every man
i
[
S
t
i
[
VP
loves
t
j
]]]]
Die Idee ist natrlich, da durch die beiden
LFs die Skopusambiguitt der S-Struktur
(119 a) rekonstruiert wird. Bevor wir uns Ge-
danken ber die Interpretation der Theorie
machen, wollen wir auf zwei wichtige Punkte
hinweisen:
1. Die Konstruktion dieser Reprsentatio-
nen unterliegt strengen syntaktischen Restrik-
tionen, welche die bergenerierung verhin-
dern, die wir fr die verallgemeinerten Kate-
gorialgrammatiken konstatiert haben.
2. Die syntaktischen Kategorien NP, VP
usw. sind autonom motiviert. Sie kommen
dadurch zustande, da morphologische
Merkmale des Kopfes projiziert werden.
Eine NP hat die morphologischen Merkmale
des N-Kopfes, eine VP die Merkmale des V-
Kopfes usw. Auf das Schema, welches diese
Projektion leistet, das sogenannte X-bar-
Schema, wird in Abschnitt 6 kurz eingegangen
(vgl. dazu Chomsky 1970 und 1981). Seman-
logische Form (LF) erzeugen. Die logische
Form bildet die Eingabe zur eigentlichen Se-
mantik.
Wir machen uns die Organisation an einem
klassischen Beispiel, der Chomskyschen Ana-
lyse der Passivkonstruktion, klar.
Auf der D-Struktur wird der Passivsatz John
was arrested mit John als direktem Objekt der
VP konstruiert. Das Subjekt des Satzes ist
leer, symbolisiert als e (empty). Die Regel
Bewege- bewegt dieses Nominal an die Sub-
jektstelle und hinterlt eine koindizierte
Spur t
i
. Diese Struktur ist der Input fr die
semantische Interpretation.
Die Idee, die hinter diesem Vorgehen steht,
ist die folgende: Auf der S-Struktur kann ein
Argument sehr weit von seinem Funktor weg-
bewegt sein. Die bei der Bewegung hinterlas-
senen Spuren erlauben es, seinen Funktor
wiederzufinden. Die Spuren kodieren also
die Ableitungsgeschichte eines Satzes. Im
Falle des obigen Beispiels ist noch die Nhe
von Argument und Funktor gegeben. In den
folgenden Beispielen ist aber zyklisch be-
wegt worden, was zu einer greren Distanz
zwischen Argument und Funktor fhrt:
(116)
a. [
S
John
i
seems [
S
t
i
to have been ar-
rested t
i
]]
b. [
S
John
i
is believed [
S
t
i
to have been
arrested t
i
]]
Bei den bisherigen Beispielen handelt es sich
um eine sogenannte NP-Bewegung, die unter
anderem dadurch gekennzeichnet ist, da aus
einer Argumentposition in eine Argu-
mentposition bewegt worden ist. Wir ver-
zichten auf eine allgemeine Definition des Be-
griffs Argumentposition. Fr die Zwecke
dieser Darstellung gengt es zu wissen, da
das Subjekt eines Satzes, ferner die Objekt-
positionen des Verbs Argumentpositionen
sind, also die Positionen NP
1
, NP
2
und NP
3
in der folgenden Struktur fr das Englische:
(117) [
S
NP
1
[
VP
[
V
V NP
2
] NP
3
]]
Auf hnliche Weise wird die sogenannte W-
Bewegung geregelt, die sich von der NP-Be-
wegung unter anderem dadurch unterschei-
det, da immer nur in eine Nicht-Argument-
Position, eine satzperiphere Position, bewegt
werden darf. Ein Beispiel dafr ist die fol-
gende Ableitung:
7. Syntax und Semantik 133
Individuenvariablen x
i
und x
j
respektive, die
durch die beiden Quantorenphrasen im Stil
von Montague gebunden werden. Dies fhrt
zur folgenden Deutung:
(121) jeder Mann(x
i
[eine Frau(x
j
[liebt
(x
j
,x
i
)])])
Anhebungskonstruktionen wie die unter (116)
genannten stellen uns vor etwas andere Pro-
bleme. Man richte sein Augenmerk etwa auf
(116 a), hier wiederholt als (122a). Eine an-
gemessene Interpretation ist (122b):
(122)
a. [
S
John
i
seems [
S
t
i
to have been ar-
rested t
i
]]
b. scheint((x)(verhaftet(x, John))
Man erhlt diese Deutung, wenn man John
an seine D-Position zurckbewegt und den
Passivoperator als Existenzquantor, der das
Subjekt abbindet, interpretiert. Die Ausfh-
rungen motivieren die folgende Semantik fr
Bewege-:
(123) Deutung von Bewege-
[YP
i
XP] = y
i
XP(YP), falls y
i
vom
YP-Typ ist,
= YP(y
i
XP), falls y
i
von
dem niedrigeren Typ ist,
aus dem der YP-Typ
durch Typenanhebung
entsteht.
Mit bezeichnen wir den semantischen Wert
der Konstruktion . Wie im Kapitel ber Ka-
tegorialgrammatik benutzen wir fr meta-
sprachliche Zeichen fette Buchstaben mit
Apostroph am Wort- oder Phrasenende. Die
erste Interpretation von Bewege-a nennen wir
skopusneutral, die zweite skopusbildend.
Wir setzen ferner voraus, da alle Spuren
durch Variablen interpretiert werden:
(124) Spurendeutung
t
i
= x
i
, wobei x
i
entweder vom Typ
der Spur t
i
, d. h. der bewegten Phrase
ist, oder von dem niedrigeren Typ, aus
welchem der t
i
-Typ durch Typenanhe-
bung entsteht.
Wir erlutern die Interpretationsregeln nun
an einem Beispiel.
(125)
a. [
S
a unicorn
i
seems [
S
t
i
to be in the
garden]]
b. ein Einhorn (x
i
scheint (im Garten
(x
i
))
c. scheint(ein Einhorn(im Garten))
Die transparente Lesart, welche die Existenz
eines Einhorns impliziert, erhalten wir, indem
wir die Spur t
i
durch eine Variable vom Typ
tische Gesichtspunkte spielen fr die Projek-
tion keine Rolle.
Beide Punkte illustrieren, was in Abschnitt
2.2 Autonomie der Syntax genannt wurde.
5.3Interpretation
Setzen wir einmal voraus, da die semantische
Interpretation der Kombination von Funktor
und Argumenten typengesteuert funktioniert
wobei neben der Funktionalapplikation
auch die brigen Interpretationsprinzipien
der verallgemeinerten Kategorialgrammatik
einschlgig sind dann interessiert vor allem
die Deutung von Bewege-, der wesentlichen
Transformationsregel, welche die Ebenen des
Modells verbindet. In Artikel 8, Abschnitt 5,
wird gezeigt, da man Bewegung stets durch
-Abstraktion nachspielen kann. Wird eine
Quantorenphrase vom Typ s/(s/n) bewegt,
gibt es zwei Mglichkeiten: Abstrahiert man
ber eine Variable vom Typ s/(s/n), kommt
kein Skopuseffekt zustande; die Interpreta-
tion liefert dann dasselbe Ergebnis, als wre
die Phrase nicht bewegt worden. Dieser Fall
entspricht der sogenannten -Konversion (vgl.
Art. 8). Abstrahiert man dagegen ber eine
Variable vom Typ n, kommt ein Skopuseffekt
zustande (analog zum Hineinquantifizieren,
das wir in Abschnitt 2.4 kennengelernt
haben). Bewege- kann grundtzlich auf beide
Arten interpretiert werden. Die Idee, Bewe-
gung als -Abstraktion zu interpretieren, fin-
det sich bereits in der verallgemeinerten Phra-
senstrukturgrammatik von Gazdar et alii
(1985). Allerdings sagt diese Theorie nichts
zu Skopuseffekten, d. h., nur die erste der
geschilderten Optionen wird betrachtet.
Mit der Interpretation der Bewegung ist
der entscheidende Teil einer Semantik fr die
GB-Theorie geliefert. Es gibt dann noch rein
syntaktische Prinzipien (Bindungstheorie,
ECP), die eine Konstruktion eventuell als
nicht wohlgeformt ausweisen, die aber mit
Semantik im eigentlichen Sinne des Wortes
nichts zu tun haben und die deshalb hier nicht
behandelt werden mssen. Die Bindungstheo-
rie wird in Artikel 23 Pronouns behandelt;
das ECP ist z. B. in von Stechow & Sternefeld
1988, Kap. 8 ausfhrlich diskutiert. Eine ent-
scheidende Schnittstelle zwischen Syntax und
Semantik ist durch das sogenannte Theta-
Kriterium gegeben, auf das wir in Abschnitt
5.4 eingehen werden.
Wir betrachten zunchst die Interpretation
einer LF wie (119 b), hier wiederholt als (120):
(120) [
S
every man
i
[
S
a woman
j
[
S
t
i
[
VP
loves
t
j
]]]]
Den beiden Spuren t
i
und t
j
entsprechen die
134 III. Theorie der Satzsemantik
(129)
a. Nobody
i
was arrestet t
i
b. nobody(x
i
(x)[arrest*(x,x
i
)])
c. (x)[arrest*(x,nobody)]
Wir lassen offen, wie dieses Problem zu lsen
ist (vgl. dazu Partee 1984).
Die Analyse (129 b) setzt brigens voraus,
da arrest* vom Typ (s/n)/NP ist. Wir haben
im vorhergehenden Abschnitt bereits darauf
hingewiesen, da man die Argumente eines
Funktors immer durch eine geeignete Ope-
ration hochstufen kann. Fr das vorliegende
Beispiel she diese Hochstufung folgender-
maen aus: arrest* = PxP(y[arrest(x,y)]).
Diese Operation ndert an der Bedeutung
und den Skopusverhltnissen berhaupt
nichts. Deswegen wollen wir im folgenden die
verschiedenen semantischen Typen von Ver-
ben nicht unterscheiden.
Wir kommen nun zur Interpretation von
Strukturen mit W-Bewegung. Die folgende
Konstruktion ist eine Wiederholung von (118-
S).
(130) [
CP
who
i
do [
S
you believe [
CP
t
i
[
S
Mary
likes t
i
]]]]
Statt S haben wir diesmal CP geschrieben
(COMP-Phrase), um nicht mit der hier ver-
wendeten semantischen Terminologie in Kon-
flikt zu kommen, nach der S die Bedeutung
eines Satzes ist. Eine in erster Approximation
vernnftige Deutung von (130) ist die Eigen-
schaft
(131) x[Person(x) & glaubst (du, mag
(Mary,x))].
Wir erhalten diese Bedeutung mithilfe der fol-
genden Annahmen.
n interpretieren, die opake Lesart rekonstru-
ieren wird, indem wir die Spur durch eine
Variable vom Typ s/(s/n) deuten. Dazu die
beiden Interpretationen in (126), siehe unten.
Nehmen wir uns als nchstes die Interpre-
tation der Anhebungskonstruktion (122a)
vor, wobei wir die folgende Semantik fr den
Passivoperator been voraussetzen:
(127) been(VP) = xVP(x), wobei VP die
einstellige Eigenschaft ist, die durch die
VP ausgedrckt wird, die unter been
eingebettet ist).
Wenn wir das Tempus vernachlssigen, ergibt
diese Passivsemantik als Bedeutung fr die
VP been arrested t
i
die Proposition
(x)[verhaftet(x,x
i
)]. Wir nehmen dabei an,
da verhaftet vom Typ (s/n)/n und John vom
Typ n ist. Aufgrund dieser Voraussetzungen
drckt dann (122a) tatschlich die ge-
wnschte Proposition (122b) aus, wie die
Rechnung in (128) zeigt.
Die Interpretation des Passivs wird pro-
blemlos mit Passiviterationen wie John is be-
lieved to have been arrested fertig, wie sich der
Leser berlegen mge. Allerdings gibt es an
einer anderen Stelle Schwierigkeiten: Die In-
terpretation von Bewege- nimmt an, da jede
NP zurckbewegt werden kann. Diese An-
nahme fhrt im Verbund mit der Passivregel
zu unerwnschten Resultaten. Zum Beispiel
wird fr Satz (129a) neben der erwnschten
Lesart (129b) auch die abwegige Lesart (129 c)
vorausgesagt, bei der nobody im Skopus des
indefiniten Subjekts ist.
7. Syntax und Semantik 135
kein Parallelismus wie bei Montague oder der
Kategorialgrammatik zu erwarten ist: Es han-
delt sich hier um eine autonome Syntax. Man
wird sich die Interpretation im allgemeinen
so vorzustellen haben, wie dies fr die typen-
gesteuerte Interpretation erlutert worden ist
(vgl. Abschnitt 3.4.2.2). Abschlieend sei
noch einmal darauf hingewiesen, da es fr
die GB-Theorie keinerlei allgemein akzep-
tierte Semantik gibt. Die hier diskutierten In-
terpretationsprinzipien die keineswegs
vollstndig sind knnen deshalb keine Ver-
bindlichkeit beanspruchen. Sie illustrieren le-
diglich, wie man sich den Anschlu der Se-
mantik an eine autonom konzipierte Syntax
vorstellen kann.
5.4Theta-Theorie
5.4.1Thetakriterium und Thetamarkierung
Die in der GB-Theorie formulierten Be-
schrnkungen sind, mit Ausnahme des The-
takriteriums, rein syntaktisch und erbringen
daher keine neuen Gesichtspunkte fr das
Verhltnis von Syntax und Semantik. Das
Thetakriterium und die Theorie der The-
tamarkierung ganz allgemein ist dagegen
die wesentliche Schnittstelle zwischen Syntax
und Semantik und verdient eine eingehendere
Diskussion.
In die Terminologie der Logik bersetzt,
beinhaltet das Thetakriterium eine Trivialitt,
nmlich, da ein n-stelliges Prdikat genau n
Elemente bentigt, um einen Satz zu bilden.
In der GB-Terminologie wird dieser Gedanke
so ausgedrckt.
(132) Die Bedeutung von who
i
ist die Funk-
tion P(Person(x
i
) & P(x
i
)), wobei P
vom Typ (s/n) ist.
Wir mssen ferner noch verlangen, da die
Variable x
i
an der Stelle -abgebunden wird,
die ihren Skopus markiert. Dies ist die Stelle,
an der sich who
i
in LF befindet. Wir nennen
diese Abbindung Skopusmarkierung. (131) er-
halten wir nun aus (132) durch die folgende
Herleitung in (133), siehe unten.
Die Interpretationsregeln behandeln auch
sogenannte Rattenfngerbeispiele das sind
Flle, in denen ein W-Wort aus syntaktischen
Grnden Material mitnimmt, das semantisch
nichts mit dem W-Wort zu tun hat korrekt.
(134)
a. [
CP
[Mit wessen
i
Schwester]
j
[
S
geht
Martin t
j
aus]]
b. x
i
[Person(x
i
) & [(mit x
i
s Schwe-
ster)(geht-aus)(Martin)]]
Der Witz an diesem Beispiel ist, da mit x
i
s
Schwester eine Adverbialbedeutung vom Typ
IV/IV ist. Um die Bedeutung (134 b) aus
(134a) zu gewinnen, mu die W-Phrase in
COMP so interpretiert werden, als stnde sie
an der Stelle der Spur t
j
. Ferner mu die
Variable x
i
, welche dem Fragepronomen wes-
sen
i
entspricht, an der COMP-Position durch
den -Operator abgebunden werden. Dies er-
reichen wir zum Beispiel dadurch, da wir die
LF in (135) erzeugen.
Wir wollen abschlieend einige Bemerkun-
gen zum Verhltnis von syntaktischen und
semantischen Kategorien machen. Es ist deut-
lich geworden, da in dieser Art von Theorie
136 III. Theorie der Satzsemantik
chen wir nicht sonderlich ernst zu nehmen.
Was soll es schon heien, da ghnen ein
Agens hat? Die Wahl einer intuitiveren Be-
zeichnung hilft vielleicht fr dieses Beispiel,
ntzt aber insgesamt wenig: Man wird immer
wieder auf Verben stoen, die mithilfe eines
etablierten, kleinen Rolleninventars nicht
klassifizierbar sind, falls man die inhaltlichen
Vorstellungen, die hinter den Rollenbezeich-
nungen stehen, wirklich ernst nimmt.
Wichtig ist lediglich, da die thematischen
Rollen geordnet sind: In (137c) ist Agens die
erste, Thema die zweite und Ziel die dritte
Rolle. Durch Unterstreichung wird gekenn-
zeichnet, da eine thematische Rolle auer-
halb der VP des Verbs zugewiesen wird. Es
gibt pro Lexikoneintrag maximal eine solche
Rolle; sie heit externe Thetarolle. Die nicht
unterstrichenen thematischen Rollen werden
innerhalb der VP zugewiesen und heien in-
terne Thetarollen. Die Thetamarkierung oder
Thetazuweisung geschieht durch Koindizie-
rung einer Thetarolle mit einem Argument,
Thetakoindizierung genannt. Fr eine einfa-
che transitive VP sieht das folgendermaen
aus:
Hier ist das direkte Objekt seinen Hund mit
der Rolle Thema von schlgt koindiziert.
Durch diesen Mechanismus wird ausge-
drckt, da das Verb dem Objekt diese Rolle
zuweist. Wir wollen sagen, da das Objekt
seinen Hund und das Verb schlgt Thema-
koindiziert sind.
Das externe Argument Agens mu an ein
Argument auerhalb der VP zugewiesen wer-
den. Dazu kommt nur das Subjekt in Frage.
Der Einfachheit halber nehmen wir an, da
ein deutscher Nebensatz die Struktur [
S
NP
VP] hat, d. h. der sogenannte INFL-Knoten
wird unterschlagen. Die Zuweisung der Rolle
Agens an das Subjekt sieht dann folgender-
maen aus:
(136) Fr jede Argumentposition GF eines
Funktors F gilt: In GF befindet sich ein
Argumentausdruck genau dann, wenn
GF durch F thematisch markiert wird.
Zum Begriff der Argumentposition vgl. die
Bemerkungen in Abschnitt 5.2 In der GB-
Theorie heien brigens Positionen eines
Baumes grammatische Funktionen (GFs). Die-
ser Begriff ist unproblematisch, von der Be-
rechtigung der Benennung einmal abgesehen.
Problematischer ist, wie man den Begriff der
thematischen Markierung mittels der bli-
chen logischen Methoden explizieren soll.
Klar ist, da er etwas mit Stelligkeit oder
Valenz eines Funktors zu tun hat: Ein ein-
stelliges Verb wie ghnen vergibt nur eine the-
matische Rolle, und zwar an das Subjekt NP
1
(vgl. (117)). Ein transitives Verb wie schlagen
thetamarkiert darber hinaus das direkte Ob-
jekt NP
2
und ein dreistelliges Verb weist auch
dem indirekten Objekt, also der grammati-
schen Funktion NP
3
, eine Thetarolle zu.
Das ist die Redeweise.
Dem Leser, der sich an dieser Stelle fragt,
wieso man sich so gewunden ausdrckt und
nicht einfach mit dem Begriff der Stelligkeit
eines Prdikats arbeitet, knnen wir nur mit
einer Vermutung antworten: Wahrscheinlich
liegt das an der Wahl der Grundbegriffe.
Wenn man die Stelligkeit als Grundbegriff
ansieht, dann ist die platte logische Formu-
lierung des Thetakriteriums mglich, die oben
angegeben wurde. Allerdings mu man auch
dann noch ber die Art der verlangten Ar-
gumente reden. In der GB-Theorie will man
die Stelligkeit aber wohl mithilfe eines ande-
ren Grundbegriffes erklren, nmlich gerade
mit dem der Thetamarkierung, d. h. der Ver-
gabe von thematischen Rollen.
Wir wollen hier zeigen, da sich die ein-
schlgigen Begriffsbildungen der Theorie der
Thetamarkierung kategorialgrammatisch re-
konstruieren lassen. Dies fhrt zu der These,
da die Thetamarkierung ein kategorialgram-
matisches Prinzip ist. Die kategorialgram-
matische Reformulierung der thematischen
Markierung kann man am besten einsehen,
wenn man sich an die in Di Sciullo & Williams
(1987: 29) benutzte Terminologie anschliet,
die sich in hnlicher Form in Baker (1988)
und in vielen anderen neueren Publikationen
findet. Dort wird angenommen, das jedes
Verb ein Thetaraster hat, in dem seine the-
matischen Rollen aufgelistet sind.
(137)
a. ghnt(A(gens))
b. schlgt(A,Th(ema))
c. schenkt(A,Th,Z(iel))
Die Namen fr die thematischen Rollen brau-
7. Syntax und Semantik 137
ein n-Subjekt zu sich nimmt. In der Funk-
torenkategorie n\(n\(n\s)) wollen wir das
uerste n den dritten Argumenttyp, das
mittlere n den zweiten Argumenttyp und das
innerste n den ersten Argumenttyp nennen.
Die Terminologie lt sich offensichtlich fr
Funktorenkategorien beliebiger Art verallge-
meinern. Wir legen fest, da der erste Argu-
menttyp extern zugewiesen wird, falls
nichts anderes gesagt wird. Damit bentigen
wir keine Zusatzkonvention zur Charakteri-
sierung der externen Rolle.
Wir knnen nun die Thetakoindizierung
als Typenkoindizierung rekonstruieren:
(141) Ein Funktor ist Y-koindiziert mit dem
Argument , falls vom Typ X/Y (bzw.
vom Typ Y ist, vom Typ Y\X) ist
und sich die beiden zu X krzen lassen,
d. h. nebeneinander stehen.
Wir bertragen zunchst das Beispiel (138) in
diese Terminologie:
Unter der Annahme, da seinen Hund den
Typ n hat, ist in dieser Struktur das direkte
Objekt mit dem Funktor schlgt n-koindi-
ziert. Die kategorialgrammatische Notation
hat den Vorteil, da wir keinen zustzlichen
Mechanismus fr die Koindizierungsrelation
bentigen; sie ist in dem Formalismus der
Kategorialgrammatik bereits angelegt. In
(142) befindet sich die Kategorie n, welche
durch den Koindizierungsmechanismus ver-
braucht wird, sowohl bei dem Funktor als
auch bei dem Argument. Man kann nun in
naheliegender Weise den Begriff der Typen-
markierung (oder Typenzuweisung) als Expli-
kat der Thetamarkierung einfhren:
(143) Der Funktor weist dem Argument
den Typ Y zu, falls und Y-koindi-
ziert sind.
(143) bedeutet natrlich, da vom Typ X/Y
(bzw. Y, vom Typ Y ist und die beiden
nebeneinander stehen. Offensichtlich weist
in (142) der Funktor schlgt dem Argument
seinen Hund den Typ n zu.
Zur Vervollstndigung der Rekonstruktion
fehlt uns noch die kategorialgrammatische
Zuerst wird der Index der Rolle Agens an den
VP-Knoten projiziert, und zwar entlang der
Kopflinie im Sinne des X-bar-Schemas (vgl.
Abschn. 6). Dies wird Thetaprojektion ge-
nannt. Anschlieend wird die VP mit dem
Subjekt thetakoindiziert. Auf diese Weise
wird dem Subjekt die externe Rolle zugewie-
sen.
Generell lt sich folgendes sagen: Durch
Projektion vererbt sich eine Theta-Rolle
nach oben, also an eine Phrase. Durch
Koindizierung wird sie zugewiesen oder
verbraucht.
Man bentigt freilich noch syntaktische
Prinzipien, welche den dargestellten Indizie-
rungsmechanismus einschrnken. Dazu wird
angenommen, da die erste interne Rolle mit
dem direkten, die zweite interne Rolle mit
dem indirekten Objekt koindiziert wird. Die
beiden Objektpositionen sind strukturell cha-
rakterisierbar (vgl. 5.2). Eine Phrase selbst
wird mit einem Argument innerhalb der
nchsthheren Phrase koindiziert, in der
Regel mit dem Subjekt.
5.4.2Eine kategorialgrammatische
Rekonstruktion
Es ist sicher wnschenswert, diese metapho-
rischen Redeweisen weiter zu przisieren. In
der Literatur der generativen Grammatik ge-
schieht dies in aller Regel nicht. Wir wollen
zeigen, da sich die Thetakoindizierung und
die Theta-Projektion kategorialgrammatisch
ausdrcken lassen. Diese Umformulierung ist
insofern eine echte Rekonstruktion, als sie
eine klare Aussage darber macht, was the-
matische Markierung eigentlich ist, nmlich
nichts anderes als die Funktionalapplikation
eines Funktors auf ein passendes Argument.
Wir behaupten zunchst, da ein Theta-
raster dasselbe ist wie eine Funktorenkate-
gorie. Das sieht man daran, da sich die Le-
xikoneintrge (137) kategorialgrammatisch
folgendermaen darstellen lassen:
(140) a. ghnt n\s
b. schlgt n\(n\s)
c. schenkt n\(n\(n\s)
Da es bei den Thetarastern nicht so sehr auf
die Namen der Rollen, als vielmehr auf die
Reihenfolge ankam, mssen wir uns berle-
gen, da die Funktorenkategorien ebenso wie
die Eintrge (137) die Reihenfolge kodieren.
Das ist aber durch die Klammerung sicher-
gestellt. Zum Beispiel ist schenkt ein dreistel-
liger Funktor, welcher der Reihe nach ein
indirektes n-Objekt, ein direktes n-Objekt und
138 III. Theorie der Satzsemantik
Struktur verbinden. Man htte natrlich auch
wie Di Sciullo & Williams (1987) vorgehen
und den externen Argumenttyp auszeichnen
knnen; da dies aber der Normalfall ist,
scheint die hier dargestellte Vorgehensweise
allgemeiner zu sein.
Damit haben wir den gegenwrtigen Stand
der Theorie der Thetazuweisung vollstndig
kategorialgrammatisch rekonstruiert. Wir
wollen uns das noch einmal anhand von Bei-
spiel (139) hier wiederholt als (146)
verdeutlichen. Wir notieren die thematischen
Markierungen in beiden Formalismen:
Dieses Schaubild zeigt, da eine 11-Ent-
sprechung zwischen dem Index j und dem
ersten Argumenttyp n sowie zwischen dem
Index i und dem zweiten Argumentyp n be-
steht.
Die kategorialgrammatische Rekonstruk-
tion hat meines Erachtens den Vorteil, da
sie eine Interpretation der Thetakoindizierung
und der Thetaprojektion darstellt. Man ver-
steht nunmehr, warum der Indizierungsme-
chanismus so aussehen mu, wie er in der
zitierten generativen Literatur angenommen
wird.
Die kategorialgrammatische Reformulie-
rung des Thetakriteriums besagt also dieses:
Jede Folge der Form NP
1
,((NP
3
), NP
2
), V mit
der entsprechenden Typenfolge X
1
, X
2
, X
3
,
Z\s lt sich zu s krzen. Umgekehrt gibt es
zu jeder solchen Typenfolge eine Folge aus
NPs + V, welche erstere instantiiert.
Nach dem Kriterium sind zum Beispiel die
folgenden Ketten ungrammatische D-Struk-
turen:
(147)
a. *[
S
Niemand [
VP
beleidigt]]
b. *[
S
e [
VP
[
V
e beleidigt]]]
c. *[
S
e [
VP
beleidigt]]
d. *[
S
Ede [
VP
dem schwarzen Ritter
[
V
niemand beleidigt]]]
Die ersten drei Strukturen haben zu wenig
Argumente, die letzte hat eins zu viel wobei
Umformulierung der Thetaprojektion. Dazu
legen wir folgendes fest:
(144) Ein Funktor hat den Projektionstyp Y,
falls er den Typ X/Y (bzw. Y\X) hat.
Nach dieser Definition hat sowohl das V als
auch die VP von (142) den Projektionstyp n,
wobei der Index von V die zweite n-Rolle von
schlgt, der von VP die erste n-Rolle von
schlgt ist. Die Definition stellt also sicher,
da hchstens ein Typ an den nchsthheren
Knoten einer Konstruktion projiziert wird.
Diese Definition dient brigens lediglich
dazu, die Redeweise von der Thetaprojektion
zu rekonstruieren. Aus kategorialgrammati-
scher Sicht ist die Begriffsbildung berflssig.
Ebenfalls wird kein Kategorialgrammatiker
die vom Standpunkt seiner Theorie aus re-
dundante Definition der Typenkoindizierung
benutzen.
Wir mssen nun noch sagen, was es heit,
da ein Funktor einen Typ hat, da Definition
(144) diese Redeweise voraussetzt. Es ist klar,
da dieser Begriff rekursiv definiert werden
mu. Wir wollen hier keine allgemeine Defi-
nition versuchen, sondern das Gemeinte an
Beispiel (142) erlutern. Der Knoten V erbt
den Typ n\(n\s) aus dem Lexikon, d. h. von
schlgt. Die VP erhlt den durch Krzung
mit dem Typ des direkten Objektes entstan-
denen Typ n\s.
Die Zuordnung von Typen an Projektionen
(im Sinne des X-bar-Schemas) ist in geeigne-
ter Weise zu verallgemeinern. Da ber The-
taprojektion in der generativen Grammatik
aber kaum etwas gesagt wird, was ber das
hier Dargestellte hinausgeht, knnen wir die-
sen Punkt fr die Zwecke unserer Diskussion
als abgeschlossen betrachten.
Wir kommen nun noch kurz auf Funkto-
ren zu sprechen, die keine externe Thetarolle
vergeben. Eine Paradebeispiel sind die soge-
nannten ergativen Verben. Es wird ange-
nommen, da z. B. kommen nur die interne
Rolle Thema vergibt. Kategorialgrammatisch
mu diese durch ein diakritisches Zeichen,
zum Beispiel durch den Exponenten i, ge-
kennzeichnet werden. Der GB-Eintrag und
der kategorialgrammatische Eintrag shen
also folgendermaen aus:
(145) kommen (Th)
n
i
\s
Beide Eintrge besagen, da die Rolle bzw.
der Argumenttyp von kommen VP-intern rea-
lisiert werden mu. Das diakritische Merkmal
i gehrt nicht zum eigentlichen Formalismus
der Kategorialgrammatik, sondern zu den
Prinzipien, die kategoriale und phrasale
7. Syntax und Semantik 139
geraucht hat gebildet. FK stellt sicher, da
sich die Subjektrolle an den Verbalkomplex
vererbt. Es ist also nicht das Verb geraucht,
welches das Subjekt thetamarkiert, sondern
der gesamte Verbalkomplex geraucht hat.
Dies ist mit kompositionaler Thetamarkie-
rung gemeint.
Wir wollen uns anhand des Deutschen ge-
nauer berlegen, wie eine Theorie der kom-
positionalen Thetamarkierung aussehen
kann, wobei wir die Terminologie der gene-
rativen Grammatik und zwar in der bei Di
Sciullo & Williams (1987) vorliegenden Form
mit der hier vorgeschlagenen kategorial-
grammatischen Rekonstruktion in Einklang
bringen. Analysieren wir zunchst eine Kau-
sativkonstruktion unter Vernachlssigung des
Tempus:
Im Anschlu an Bech (1955/57) und Hhle
(1978) setzen wir hier voraus, da abrumen
lie einen Verbalkomplex bildet, der in der
Syntax direkt generiert wird, also nicht durch
Transformationen aus einer satzeinbettenden
Struktur erzeugt wird. Die Ordnung der The-
tarollen ist absteigend von links nach rechts,
d. h., die erste Rolle ist die des Subjekts, die
zweite die des direkten Objekts, usw. Die In-
dizes auf der linken Seite der Rollen beziehen
sich auf die Subordinationstiefe, die mit den
Zahlen steigt.
Die Argumentvererbung vollzieht sich
nach Di Sciullo & Williams (1987) folgender-
maen. Lassen wird als Funktor klassifi-
ziert. Funktoren stehen bei den beiden Auto-
ren im Gegensatz zu Prdikaten: Ein Prdikat
thetamarkiert seine Argumente, whrend sich
ein Funktor mit seinem Modifikat kompo-
sitional verbindet, z. B. so, wie das in (151)
angedeutet ist. Unter anderem vererbt sich
die externe Rolle
1
Agens des Funktors an den
Verbalkomplex. Da ein Verbal nur eine ex-
terne Rolle haben kann, wird die
2
Agens-Rolle
des Modifikats internalisiert, d. h., die Un-
terstreichung wird getilgt. Die Rollen des Mo-
die Interpretation von NP
3
als freier Dativ
hier einmal aus dem Spiel bleibe.
Wir fragen nun: Ist das Thetakriterium ein
syntaktisches oder ein semantisches Prinzip?
Die Frage ist vllig analog zu beantworten,
wie die nach dem Status der Syntaxregel der
Prdikatenlogik, die besagt, da man ein n-
stelliges Prdikat mit n Argumenten zu einem
Satz verknpft. Das Theta-Kriterium ist in
seiner Substanz diese Regel. Sofern man die
Angabe der Stelligkeit als ein syntaktisches
Merkmal auffat das bliche Verfahren
wird man das Kriterium syntaktisch nennen.
Sofern man hier einen Reflex der Semantik
sieht die Stelligkeit des Prdikats und die
der ausgedrckten Relation entsprechen sich
, wird man das Prinzip zumindest teilweise
zur Semantik rechnen wollen. Die adquate
Betrachtungsweise scheint demnach zu sein,
da das Prinzip eine Schnittstelle von Syntax
und Semantik markiert.
5.4.3Kompositionale Thetamarkierung
In der generativen Grammatik wird zwischen
direkter und kompositionaler Thetamarkie-
rung unterschieden. Unter anderem wird ge-
sagt, da das Subjekt eines Satzes durch die
VP kompositional thetamarkiert wird. In die-
sem Abschnitt wollen wir klren, was damit
gemeint ist. Betrachte dazu den folgenden
Satz:
(148) weil Zeno wie ein Trke geraucht hat
Er drckt bei Vernachlssigung der Ver-
gleichsphrase wie ein Trke die folgende
Proposition aus:
(149) prt(rauchen(Zeno))
Nehmen wir einmal an, das Prterium prt
sei
ein Satzoperator, habe also den Typ (s\s, der
durch hat ausgedrckt wird. Wir erhalten die
gewnschte Bedeutung (149), wenn wir mit
Funktionalkomposition arbeiten:
Diese Analyse zeigt, da geraucht das Subjekt
nicht direkt thetamarkiert. Es wird zunchst
das komplexe Verb Verbalkomplex genannt
140 III. Theorie der Satzsemantik
whnt, obwohl sie angenommen werden mu,
weil lassen hier als cause, d. h. als z veran-
lat da p interpretiert wird. Die katego-
rialgrammatische Rekonstruktion zeigt so-
fort, warum diese Rolle vom Verbalkomplex
nicht projiziert wird:
difikats vererben sich ansonsten an den Kom-
plex. Die Propositionsrolle von lassen ver-
schwindet dabei, ohne da von den Autoren
ausgefhrt wird, warum das so ist. Sie wird
von Di Sciullo & Williams nicht einmal er-
Ganz generell lt sich zu diesem Typ von
Argumentverschmelzung sagen, da die Pro-
positionsrolle des bergeordneten Verbs
verbraucht wird also nicht mehr vom
Verbalkomplex projiziert wird whrend
sich die brigen Rollen an den Komplex ver-
erben. Nach demselben Schema werden An-
hebungsverben wie scheinen und pflegen mit
dem subordinierten Verb komponiert.
Anders verhlt es sich mit Kontrollverben.
Betrachten wir dazu die folgende Analyse, die
wieder im Stil von Di Sciullo & Williams
gehalten ist:
Di Sciullo und Williams drcken Kontrolle
durch Koindizierung von thematischen Rol-
len aus. Dabei wird verlangt, da die kon-
trollierte Rolle als verbraucht gilt, also
nicht vom Verbalkomplex projiziert wird. An-
sonsten gelten die Kompositionsregeln fr
Funktoren und Modifikat: Die Rollen verer-
ben sich, wobei das externe Argument des
Funktors das externe Argument des Verbal-
komplexes wird. Wie schon im vorhergehen-
den Beispiel schweigen sich die beiden Auto-
ren ber die Objektrolle von wollen aus. Sie
wird lediglich durch Punkte angedeutet, ver-
schwindet aber bei der Komposition auf ge-
heimnisvolle Weise, ein Geheimnis, das die
Zur Interpretation des Verbalkomplexes
haben wir zunchst zweimal die Geachsche
Typenanhebung angewandt. Die Semantik
dieser Operation stellt sicher, da das Resul-
tat die Bedeutung Tyxz(cause(z,T(x,y)))
ist, wobei T fr eine zweistellige Relation
steht, also vom Typ (n\(n\s)) ist. Diese Be-
deutung wenden wir mittels FA auf abrumen
an und erhalten yxz (cause (z, abrumen
(x,y))), ein dreistelliges komplexes Verb.
Die zweimalige Anwendung der Geach-
schen Regel simuliert brigens lediglich die
funktionale Komposition eines Funktors mit
einem mehrstelligen Prdikat. Wrde man
den Typ von abrumen ohne Klammern no-
tieren als (n,n\s), so knnte man an eine
verallgemeinerte Regel FK denken, welche di-
rekt den bergang von (n,n\s) + (s,n\s) zu
(n,n,n\s) gestattet.
Schaut man sich das Resultat dieser Deu-
tung nher an, dann ist vllig klar, wo die
propositionale Rolle von cause geblieben
ist: Sie wird der Proposition abrumen(x,y)
zugewiesen. Das y-Argument der Bedeutung
des Verbalkomplexes wird natrlich ber FA
an den-Tisch zugewiesen, whrend das x-Ar-
gument an seine-Frau geht, ebenfalls ber
FA.
Die kategorialgrammatische Analyse legt
nahe, die von Di Sciullo & Williams vorge-
schlagene Notation folgendermaen zu mo-
difizieren:
Durch die Koindizierung der Rolle Prop mit
der Klammer, welche die Rollen des subor-
dinierten Verbs abrumen umschliet, wird
ausgedrckt, da diese Rolle an die Proposi-
tion zugewiesen wird, die durch abrumen
bestimmt ist.
7. Syntax und Semantik 141
den oder folgt vielleicht aus allgemeineren
Prinzipien der Kontrolltheorie.
Man berzeugt sich leicht, da diese Ana-
lyse das gewnschte Resultat liefert. Die
Geachsche Typenanhebung ordnet der Funk-
tion Px[wollen(x,P(x))] nmlich die Funk-
tion Tyx[wollen(x,T(x,y))] zu, woraus
man durch Funktionsapplikation auf rau-
chen schlielich yx[wollen (x,rauchen
(x,y))] erhlt, das korrekte Resultat.
Eine Rckbertragung dieser Analyse in
den Formalismus von di Sciullo und Williams
knnte nun folgendermaen aussehen:
Wie in der Notation (153) ist durch die Koin-
dizierung der propositionalen Rolle mit der
Klammer, welche die Rollen von rauchen ent-
hlt, ausgedrckt, da diese Rolle an die
durch rauchen bestimmte Proposition zuge-
wiesen wird und deshalb verbraucht ist.
Wie bei di Sciullo und Williams ist schlielich
die Kontrollbeziehung durch Koindizierung
ausgedrckt, wobei das kontrollierte
2
Agens
ebenfalls als verbraucht gilt. Ihre eigent-
liche semantische Interpretation erhalten
diese Indizes freilich erst durch die vorge-
fhrte kategorialgrammatische Deutung.
Es sollte deutlich sein, da die vorgefhrten
Prinzipien es erlauben, viel kompliziertere
Verbalkomplexe des Deutschen kompositio-
nal zu deuten, zum Beispiel den Verbalkom-
plex in des folgenden Satzes:
(158) weil Ede Caroline den Tisch abrumen
lassen wollen haben wird
Wir bergehen den mangelhaften Stil dieses
Satzes, der normalerweise durch gewisse In-
versionen im Verbalkomplex bereinigt wird
(Oberfeldbildung). Unsere Prinzipien be-
sagen, da der Verbalkomplex abrumen las-
sen wollen haben wird in einer Lesart die Be-
deutung
(159) yxz (fut(prt(wollen (z,cause
(z,abrumen(x,y)))))
hat. Der Verbalkomplex vergibt also drei the-
matische Rollen, die korrekt an die entspre-
chenden Argumente in (158) zugewiesen wer-
den. Das Beispiel illustriert eindrucksvoll, wie
komplex die kompositionale Thetamarkie-
rung sein kann.
Die kompositionale Thetamarkierung ist
nicht etwa eine Ausnahmeerscheinung, son-
kategorialgrammatische Rekonstruktion zu
lften vermag.
Schauen wir uns dazu zunchst an, was
eine Analyse der Kontrolle zu leisten hat. Eine
vernnftige Deutung von (154) ist die fol-
gende:
(155) x [ wollen (x,rauchen (x, die-letzte-
Zigarette)] (Zeno)
Das Entscheidende ist, da das Subjekt des
subordinierten Verbs mit dem Subjekt des
Matrixverbs durch Variablenbindung identi-
fiziert wird. In gewisser Weise wird durch
diese Abstraktion tatschlich eine themati-
sche Rolle verbraucht, denn der Verbal-
komplex rauchen wollen projiziert nicht zwei
Subjektsrollen, sondern nur noch eine. Die
Formalisierung zeigt aber, da die Redeweise,
da nur die Rolle von wollen projiziert wird,
streng genommen sinnlos ist. Durch -Kon-
version ist nmlich sichergestellt, da Zeno
sowohl logisches Subjekt von rauchen als
auch von wollen ist. Die Analyse (155) gibt
schlielich Aufschlu ber den Verbleib der
Objektrolle von wollen: Es handelt sich um
eine propositionale Rolle, die an die Pro-
position rauchen(x,die-letzte-Zigarette) ver-
geben wird. Damit liegt es nahe, wollen als
ein (s\(n\s)) zu kategorisieren.
Bei der Deutung des Verbalkomplexes rau-
chen wollen knnen wir nun nicht lediglich
mit Funktionalkomposition arbeiten, weil
dieses Prinzip zur Folge hat, da sich die
Subjektsrolle des eingebetteten Verbs an den
Verbalkomplex vererbt. Dies haben wir bei
der Analyse der Kausativkonstruktion (152)
bereits festgestellt. Wir mssen eine Konstel-
lation schaffen, die es erlaubt, die Subjekte
der beiden Verben durch Abstraktion zu iden-
tifizieren. Die folgende Analyse leistet dies:
Die Regel SK fhrt wollen in
Px[wollen(x,P(x))] ber. Allgemein bildet
sie eine Funktion f vom Typ (s\(n\s)) in die
Funktion Px[f(x,P(x))] ab, wobei P vom
Typ (n\s) und x vom Typ n ist. (Der besseren
bersicht halber ist diese Funktion in der
Argumentschreibweise der Prdikatenlogik
notiert.)
Da auf wollen diese Regel angewandt
werden kann, mu im Lexikon stipuliert wer-
142 III. Theorie der Satzsemantik
ausgedrckt werden. Dies ist in der Notation
durch ein entsprechendes Subkategorisie-
rungsmerkmal ausgedrckt. Die Kasusmerk-
male beziehen sich auf den Kasus, der von
der Prposition regiert wird. (161 a) wird also
gedeutet als Wladimir hat eine Wohnung,
die auf dem Berg/in der Stadt ist und (161 b)
wird interpretiert als Wladimir geht einen
Weg, der an einem Ort endet, der auf dem
Berg/in der Stadt ist. Die vorgeschlagene
Analyse macht klar, da die Ergnzungen
dem/den Berg bzw. der/die Stadt durch die
Prposition thetamarkiert werden, whrend
die betreffenden PPs durch das Verb subka-
tegorisiert, aber nicht eigentlich thetamarkiert
werden, da sie in der logischen Reprsenta-
tion kein Argument des Verbs, sondern ein
Prdikat eines Argumentes desselben sind.
Die Analyse zeigt, da es sich letzlich nicht
um einen Fall von kompositionaler Theta-
markierung handelt, da nirgends thematische
Rollen verschmolzen werden. Es soll hier
nicht behauptet werden, da diese Art der
Analyse die einzig mgliche ist (vgl. dazu
Artikel 37).
Die kategorialgrammatische Rekonstruk-
tion der Thetamarkierung ist eine Explikation
der generativen Redeweisen in mehrfacher
Hinsicht. Sie zeigt erstens, warum gewisse
Thetarollen bei Koindizierung verbraucht
werden. Sie zeigt ferner, da die blichen Re-
deweisen nicht fein genug sind, sondern durch
kompliziertere Koindizierungsmechanismen
ersetzt werden mssen (vgl. die Koindizierung
der propositionalen Rolle mit der Klammer
des subordinierten Verbs). Schlielich wird
klar, da es mit einer bloen Notation nicht
getan ist. Es geht um die Interpretation der
einschgigen Koindizierung. In diesem Sinne
ist auch Bechs (1955/57) Theorie der Orien-
tierung unvollstndig die erste formale
Theorie des Verbalkomplexes , da die ver-
schiedenen Flle von Argumentvererbung
(Kontrolle versus Anhebung) nicht seman-
tisch unterschieden werden (vgl. dazu von
Stechow 1984).
Hier sei noch einmal darauf hingewiesen,
da die Theorie der kompositionalen Theta-
markierung mit dem Thetakriterium durch-
aus vertrglich ist. Man mu das Kriterium
lediglich dahingehend verallgemeinern, da
Verbalkomplexe und Projektionen dersel-
ben thetamarkieren. Dies geschieht im Ein-
klang mit dem Thetakriterium.
Zum Abschlu dieses Abschnittes weisen
wir darauf hin, da wir hier zwar gezeigt
haben, da man den Verbalkomplex des
Deutschen direkt kompositional interpretie-
dern eher der Normalfall. Zum Beispiel ist sie
in der Wortbildung gang und gbe. Wir haben
derartige Beispiele in 4.3 mit den Applikativ-
konstruktionen, der morphologischen Refle-
xivierung und Kausativierung kennengelernt.
Die Beispiele lassen sich beliebig vermehren
(vgl. dazu etwa Moortgat 1988). Hier ist es
um die Komposition von Rollen in der Syntax
gegangen. Andere Beispiele, die ebenfalls in
der Syntax mit diesen Methoden behandelt
werden knnen, sind etwa die folgenden:
(160)
a. Wir halten ihn fr inkompetent
b. Er hrte sie leise sthnen
Halten fr nimmt semantisch ein propositio-
nales Objekt, ist also vom Typ s\(n\s). In-
kompetent ist vom Typ n\s. Mithilfe von G
und FA lt sich daraus der Verbalkomplex
fr inkompetent halten bilden, der vom Typ
des transitiven Verbes ist. Diese Analyse ist
ebenfalls von Di Sciullo & Williams vorge-
schlagen worden. Auf dieselbe Weise kann
man sthnen + hren zu sthnen hren ver-
schmelzen und den Verbalkomplex als tran-
sitives Verbal auffassen. Ein anderes Beispiel
fr kompositionale Thetamarkierung in der
Syntax soll angeblich das folgende Satzpaar
sein:
(161)
a. Wladimir wohnt auf dem Berg/in
der Stadt
b. Wladimir geht auf den Berg/in die
Stadt
In der generativen Literatur findet man die
Redeweise, da dem Berg bzw. der Stadt in
(161 a) durch das Verb wohnen und die Pr-
position auf bzw. in kompositional thetamar-
kiert werden. Entsprechendes gilt fr (161 b).
Der Grund fr diese Redeweise ist der fol-
gende: das Verb enthlt die Information, ob
die prpositionale Ergnzung lokal oder di-
rektional zu deuten ist. Die Prposition be-
inhaltet eine rumliche Beziehung. Die se-
mantischen Verhltnisse werden korrekt wi-
dergespiegelt, wenn man etwas wie die fol-
genden beiden Bedeutungen fr wohnen bzw.
gehen annimmt:
(162)
P luft in beiden Fllen ber Eigenschaften
von Orten, die durch Prpositionalphrasen
7. Syntax und Semantik 143
Fehlen der Syntaxregeln ein Einwand zur Pra-
xis der Semantiker, Regeln zu interpretieren,
hergeleitet werden kann.
Den Ausgangspunkt unserer Diskussion
bilden die folgenden einfachen englischen
Stze
(163)
a. Max left
b. Everyone left
die in der GB-Theorie die Struktur
haben. Wir knnen diesem Baum die kon-
textfreie Regel, die ihn aufbaut, direkt able-
sen. Es handelt sich um
(165) S NP INFL VP.
Wir haben es mit einer Subjekt-Prdikat-
Konstruktion zu tun, die als NP(VP) bzw.
VP(NP) interpretiert wird, je nachdem, ob
NP eine Quantorenphrase oder ein Eigen-
name ist. Wir wollen (165) Prdikation nen-
nen.
Betrachten wir als nchstes Anhebungs-
konstruktionen.
(166)
a. Max seems to leave
b. Everyone seems to leave
Verschiedene Prinzipien der GB-Theorie sa-
gen uns, da diese Stze die Struktur (167)
haben:
ren kann. Wir lassen aber offen, ob man das
auch stets tun soll. In von Stechow & Ster-
nefeld (1988, Kapitel 12) sind Argumente an-
gefhrt, da man im Falle von Kontrollver-
ben wie wollen nicht so vorgehen soll, da
diese vielmehr einen Satz mit leerem Subjekt
einbetten. Dabei handelt es sich allerdings um
syntaktische Gesichtspunkte, auf die hier
nicht eingegangen werden kann.
6. Syntaktische und semantische
Stuktur
Wir beschlieen den Artikel mit einigen
grundstzlichen Betrachtungen zum Verhlt-
nis von Syntax und Semantik. Insbesondere
wollen wir die Frage erneut aufgreifen, was
eigentlich syntaktische Struktur ist. Was ist
genauer gemeint, wenn wir gesagt haben, da
notwendige Restriktionen sich nicht in natr-
licher Weise aus einem Formalismus, zum
Beispiel dem der verallgemeinerten Katego-
rialgrammatiken, ergeben, sondern von
auen an ihn herangetragen werden mssen?
Zuchst greifen wir ein Problem auf, das
sich fr eine autonome Syntaxkonzeption wie
die der GB-Theorie stellt: Smtliche formalen
Semantiker haben ber die Schriften Ri-
chard Montagues die Praxis der Logik
bernommen, syntaktische Regeln durch se-
mantische Operationen zu deuten. In der GB-
Theorie gibt es nun berhaupt keine Syntax-
regeln im eigentlichen Sinn, sondern eine An-
zahl von interagierenden Wohlgeformtheits-
prinzipien. Eben dies ist unter Modularitt
das Markenzeichen dieses Ansatzes zu ver-
stehen. Wir wollen uns berlegen, ob aus dem
das Matrixsubjekt durch NP-Bewegung aus
dem untergeordneten Satz hinausbewegt wor-
den ist, nicht enthlt. Man kann diese Infor-
mation durch ein Lckenmerkmal X/NP ko-
dieren, das wir bereits aus der verallgemei-
Man knnte zunchst denken, da die Wur-
zelregel dieses Baumes wiederum die Prdi-
kation (165) ist. Eine solche Auffassung greift
aber zu kurz, da (165) die Information, da
144 III. Theorie der Satzsemantik
genannten
verallgemeinerten Phrasenstruktur-
grammatiken bekannt geworden sind (vgl.
Gazdar et al. 1985). Mithilfe dieses Merkmals
kann der Baum (167) notiert werden als:
nerten Kategorialgrammatik kennen und das
bedeutet, da in der Kategorie X eine NP
fehlt, also herausbewegt worden ist. Dies
ist die wesentliche Technik, durch die die so-
(170)
a. Max wants to leave
b. Everyone wants to leave
Einschlgige Prinzipien der GB-Theorie be-
inhalten, da diesmal das Subjekt nicht be-
wegt worden ist, sondern da die Struktur
(171) anzunehmen ist.
Fr diese Struktur sind die Interpretatio-
nen (172) (a) und (b) erwnscht:
Nun sind wir in der Lage, die Spitzenregel
(169) S NP INFL VP/NP
zu interpretieren, und zwar als Bewege-, so
wie wir das in (123) beschrieben haben. Die
Rolle des Bewegungsindex ist in dieser Nota-
tion von dem Lckenmerkmal bernommen
worden. Wir wollen (169) Anhebung nennen.
Vor ganz andere Probleme stellen uns so-
genannte Kontrollkonstruktionen:
ten die intendierten Interpretationen, wenn
wir als Spitzenregel
(173) S NP
i
INFL VP
ansetzen und diese Regel durch die Operation
x
i
[VP(x
i
)](NP) bzw. NP(x
i
[VP(x
i
)]) deu-
ten, je nachdem, ob das Subjekt vom Typ n
oder s/(s/n) ist. Wir wollen diese Regel Sub-
jektkontrolle nennen.
Fr die sogenannte Objektkontrolle ms-
sen wir eine analoge Regel annehmen, nm-
lich
(174) VP V NP
i
CP.
(172)
a. x
i
[mchte(gehen(x
i
))(x
i
)](Max)
b. jeder(x
i
[mchte(gehen(x
i
x
i
)])
Eine Methode, diese zu erreichen, besteht in
dem folgenden Vorgehen. Wir legen zunchst
fest, da ein mit i indiziertes PRO als x
i
in-
terpretiert wird, wobei x
i
vom Typ n ist. (PRO
ist das phonetisch unsichtbare Subjekt eines
Infinitivsatzes, dessen weitere Eigenschaften
uns in diesem Zusammenhang nicht zu inter-
essieren brauchen.) Aufgrund dieser An-
nahme drckt die VP in (171) die offene Ei-
genschaft mchte(gehen(x
i
)) aus. Wir erhal-
7. Syntax und Semantik 145
Diese Regeln sind noch nicht fein genug,
da noch der semantische Typ des Subjekts zu
vermerken ist, der die Applikationsrichung
steuert. Beispielsweise mte die Prdika-
tionsregel aufgespalten werden in die folgen-
den beiden Regeln:
Der Regel (177 a) wre dann die semantische
Operation f(NP,VP) = VP(NP) zuzuord-
nen, whrend die Regel (177 b) durch
g(NP,VP) = NP(VP) zu interpretieren
wre.
So wie sie stehen, sind die Regeln noch
immer nicht vollstndig, denn der Knoten
INFL enthlt die Tempusinformation und die
morphologischen Merkmale, welche die Kon-
gruenz von Subjekt und Prdikat regeln. Es
gibt GB-Mechanismen, die dafr sorgen, da
diese Merkmale korrekt weitergegeben wer-
den (vgl. etwa von Stechow & Sternefeld
1988, Kap. 5). Kontextfrei knnen diese Me-
chanismen beispielsweise so notiert werden,
da man die Kategorien mit den entsprechen-
den Merkmalen indiziert, wobei Variablen fr
eine identische Merkmalsspezifizierung sor-
gen. So wre etwa Regel (177 b) zu notieren
als
wobei die Variable die Werte erste,
zweite und dritte, die Variable
die Werte Singular und Plural und die
Variable die Werte Prsens und Pr-
teritum annehmen kann.
Diese Regel in komplexer Notation steht also
fr eine Schar von kontextfreien Regeln, de-
ren einzelne Instanzen sich durch Spezifizie-
rung der Person-, Numerus- und Tempusva-
riablen , und ergeben (Vgl. dazu Kratzer
et alii 1974 oder Gazdar et alii 1984; heute
nennt man diese Art von Merkmalspezifika-
tion Unifikation.). Die Instanzen werden
allerdings gleich gedeutet, da die morpholo-
gischen Merkmale die Interpretation nicht be-
einflussen. (Der INFL-Knoten in (178) ist ein
abstrakter Knoten, der nur Merkmale ent-
hlt. In Chomsky (1981) wurde er in das Verb
durch eine Regel inkorporiert, spter wurde
dann das Verb nach INFL bewegt was zu
Schwierigkeiten bei Stzen wie John always
Diese Regel ist durch die Operation
x
i
[V(x
i
,CP)](NP) bzw. y[NP(x
i
[V(x
i
,
CP) (y)])] zu interpretieren, je nachdem, ob
NP vom Typ n oder s/(s/n) ist. Diese Regel
interpretiert die Matrix-VP von (175 a) kor-
rekt als (175b), whrend die Matrix VP von
(175c) die Interpretation (175 d) erhlt:
(175)
a. John [
VP
asked Mary
i
[
CP
PRO
i
to
leave]]
b. bat(Mary,gehen(Mary))
c. John [
VP
asked everyone
i
[
CP
PRO
i
to
leave]]
d. y[ jeder (x
i
[bat(x
i
,gehen(x
i
))](y)]
Um die Bedeutungen fr die vollstndigen
Stze zu erhalten, mssen wir im nchsten
Schritt die Prdikation anwenden.
Die Reprsentationen der Kontrollkon-
struktionen werden also korrekt gedeutet.
Wir haben allerdings nichts dazu gesagt, wie
man zu den betreffenden Reprsentationen,
d. h. zur korrekten Koindizierung von PRO
und einem Kontrolleur kommt. Die nahe-
liegende Annahme ist, da die Kontrolle se-
mantisch durch das jeweilige kontrollie-
rende Verb gesteuert ist. Demnach htte
z. B. want den semantischen Eintrag
Px[mchte(x,P(x))], whrend ask den Ein-
trag Pyx[bitten(x,y,P(y))] htte. P ist hier
die Eigenschaft, die durch den Infinitivsatz
ausgedrckt wird. Man gelangt zu dieser Ei-
genschaft, indem man jeden Infinitivsatz mit
PRO
i
-Subjekt duch x
i
abbindet. (Man kann
das PRO
i
-Subjekt auch ganz weglassen und
Infinitivstze einfach als VPs auffassen.)
Analysen der Kontrolle dieser Art sind seit
langem in der Literatur vorgeschlagen wor-
den (siehe z. B. von Stechow 1979a). Sie lie-
fern fr die prototypischen Flle die korrek-
ten Ergebnisse, haben aber Schwierigkeiten
mit Beispielen wie Der Leutnant bat den
Oberstleunant, nun endlich mal befrdert zu
werden. Obwohl bitten ein prototypisches Ob-
jektkontrollverb ist, legen inhaltliche Erw-
gungen eine Interpretation mit Subjektkon-
trolle nahe (vgl. zu derartigen Problemfllen
von Stechow & Sternefeld 1988: Kap. 9).
Wir resmieren nun, was wir bisher ber
die Interpretation des Spitzenknotens eines
Baumes festgestellt haben: Wir erhalten den
korrekten Input fr die Deutung, wenn wir
die folgenden drei Regeln aus den Struk-
turen ablesen:
(176)
a. S NP INFL VP/NP (Anhebung)
b. S NP
i
INFL VP (Subjektkon-
trolle)
c. S NP INFL VP (Prdikation)
146 III. Theorie der Satzsemantik
werden.
Als nchstes greifen wir die Frage nach
dem Verhltnis von kategorialer und phra-
saler Struktur auf. Insbesondere fragen wir
uns, wieso wir die Phrasenstruktur nicht mit
der kategorialen Struktur identifizieren, da
man ja letztere auf jeden Fall fr die Inter-
pretation bentigt.
Wir rekapitulieren zunchst ein wesent-
liches Bauprinzip fr Phrasen: Jede Phrase
hat genau einen Kopf. So sind in (179) die
Kpfe der Reihe nach das Nomen Oma, die
Prposition in und das Verb bckt.
Das Prinzip, genau einen Kopf zu haben, ist
ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten
X-bar-Schemas, welches die Forderung ent-
hlt, da man fr alle Verzweigungen den
Kopf stets eindeutig bestimmen kann. Man
kann dies erreichen, indem man verlangt, da
die Verzweigungen stets die Form
(180)
X
m
... X
n
... (m n)
haben, wobei die Exponenten den Grad der
Komplexitt der Kategorie X symbolisieren
sollen und die Punkte fr Phrasen das sind
Kategorien von maximaler Komplexitt
stehen (vgl. von Stechow & Sternefeld 1988,
Kap. 4). Der Kopf der Verzweigung (180) ist
natrlich X
n
.
Der Kopf ist von groer syntaktischer Be-
deutung, da er die morphologischen Merk-
male einer Phrase trgt. Man denke etwa an
die Regel der Kongruenz von Subjekt und
Prdikat: Sowohl das Subjekt als auch das
Prdikat knnen sehr komplex sein, die Kon-
gruenzmerkmale erscheinen aber jeweils an
genau einer Stelle, die keineswegs unbedingt
das erste oder letzte Wort des Subjektes oder
des Prdikates sein mu.
In der X-bar-Syntax lt sich der Kopf
einfach definieren, da das X-bar-Schema im
wesentlichen eine Formalisierung des Kopf-
begriffes ist. Schauen wir nun, wie sich dieser
Begriff in einer Kategorialsyntax bestimmen
lt.
sleeps fhrt , whrend man aber heute in
der GB-Theorie meistens annimmt, da dieser
Knoten lediglich dazu dient, eine eigene syn-
taktische Kategorie zu projizieren und an-
sonsten die Merkmalskongruenz zwischen
Subjekt und Prdikat regelt. Wir gehen hier
nicht auf die Frage ein, ob man diesen Knoten
berhaupt braucht.)
Kommen wir nun zu der eingangs gestellten
Frage zurck. Man kann die strukturaufbau-
enden Prinzipien offenbar immer in der Form
von Regeln komprimieren, die dann durch
semantische Operationen gedeutet werden
knnen. Die Regeln liest man den Verzwei-
gungen der erzeugten Strukturen in der vor-
gefhrten Weise ab. Die Antwort auf unsere
Frage scheint somit zu sein, da man die GB-
Theorie in den allgemeinen Rahmen von
Montagues UG einbetten kann und folglich
die Semantik mit den dort entwickelten Me-
thoden anschlieen kann, indem man die re-
levanten Verzweigungstypen der Strukturen
als Regeln interpretiert.
Ein generativer Grammatiker wird diese
relevanten Verzweigungstypen allerdings
nicht Regeln nennen wollen, da er dieses
Wort zur Bezeichnung von sprachlichem Wis-
sen verwendet, das wir im Kopf haben. Es
ist aber sehr unwahrscheinlich, da wir Re-
geln wie (178) wobei es sich noch um einen
sehr einfachen Fall handelt im Kopf haben.
Im Kopf haben wir wohl eher die einzelnen
Prinzipien, die diese Strukturstcke aufbauen.
Diese Prinzipien sind die eigentlichen Regeln.
Aus der Theorie der kontextfreien Gramma-
tiken ergibt sich nichts ber das Zusammen-
spiel der einzelnen Module. Insofern kann
man sagen, da die verschiedenen Merkmale
von auen an diese Regeln herangetragen
werden.
Allerdings ist zuzugeben, da ein solcher
Einwand als eine Frage der Nomenklatur ab-
getan werden kann. Vom theoretischen Stand-
punkt des Semantikers ist es zunchst gleich-
gltig, ob man die fr die Interpretation be-
ntigten Strukturteile Regeln nennt oder Ver-
zweigungstypen. Wichtig ist hier nur, da
man eben diese Information fr den Anschlu
der Semantik bentigt. Offen bleibt aller-
dings, wie man zu den relevanten Verzwei-
gungstypen gelangt. In einer modularen
Grammatik drfen wir uns diese nicht als von
vornherein gegeben vorstellen, etwa als riesige
Schar von kontextfreien Regeln in komplexer
Notation. Wir mssen diese vielmehr kon-
struieren. Nach welchen Strategien dabei ge-
nau vorzugehen ist, soll hier nicht ausgefhrt
7. Syntax und Semantik 147
derartige Definition liefert zwar die korrekten
Resultate, ist aber vllig unnatrlich im Rah-
men des gewhlten kategorialgrammatischen
Formalismus. Hier haben wir wieder ein Bei-
spiel dafr vorliegen, da eine wichtige struk-
turelle Unterscheidung sich nicht aus dem
Formalismus ergibt, sondern von auen her-
angetragen werden mu.
Versuchen wir nun zu einem Resmee be-
treffs des Verhltnisses von phrasaler und ka-
tegorialer Struktur zu kommen. Aufgrund der
Diskussion scheint es vernnftig zu sein, die
phrasale Struktur als die vorrangig syntakti-
sche anzusehen. Diese Struktur scheint den
Rahmen fr die kategoriale Kombination zur
Verfgung zu stellen. Man kombiniert die se-
mantischen Typen innerhalb dieses Rahmens
soweit, wie das mglich ist. Das Subjekt bleibt
dabei in aller Regel (d. h. auer fr den Fall
ergativer Verben, den wir in Abschnitt 5.4.2
kurz angesprochen haben) innerhalb der
Phrase ungesttigt, weil keine syntaktische
Position dafr vorhanden ist. Fr die Kom-
bination selbst werden je nach Gegebenheit
recht verschiedene Prinzipien gewhlt. In der
Syntax scheint man weitgehend mit Funktio-
nalapplikation und Abstraktion auszukom-
men, wobei allerdings auch hier mir Kompli-
kationen zu rechnen ist, wie die Ausfhrungen
zum Verbakomplex in 5.4.3 gezeigt haben. In
der Morphologie ist dagegen auf jeden Fall
mit weiteren Kompositionsprinzipien zu rech-
nen, wie aus den Beispiele zur Kausativierung
und zum Applikativ in Abschnitt 4.3 deutlich
geworden sein drfte.
Die Diskussion legt nahe, da sich die se-
mantische Struktur also die Wahl be-
stimmter Kompositionsprinzipien nach der
syntaktischen richtet und nicht umgekehrt.
Das genaue Verhltnis von semantischer, d. h.
kategorialer, und syntaktischer, d. h. phrasa-
ler Struktur ist aber bisher weitgehend unge-
klrt und wird mit Sicherheit Gegenstand in-
tensiver wissenschaftlicher Forschung der
kommenden Jahre sein.
Dieser Beitrag verdankt den Kommentaren der fol-
genden Kolleg(inn)en auerordenlich viel: Urs Egli,
Ulf Friedrichsdorf, Ulrike Haas-Spohn, Tilman
Hhle, Wolfgang Klein, Barbara Partee, Wolfgang
Sternefeld, Dieter Wunderlich und last but not
least Ede Thomas Zimmermann, der mir ein
unverffentlichtes Manuskript zur Verfgung ge-
stellt hat, das fr die Abschnitte 3.2 und 3.3.1
wesentlich benutzt wurde. Klaus von Heusinger hat
die Korrekturen gelesen. Niemand von den ge-
nannten Freunden ist fr verbleibende Mngel, ins-
besondere fr die exzessive Lnge, verantwortlich.
Der Kopf der VP ist das Verb, also ein Funk-
tor. In (181 b) ist der Kopf des N dagegen
nicht der Funktor putzige, sondern dessen
Argument Tier. Eine einheitliche Definition
des Kopfbegriffes ist also in der Kategorial-
grammatik nicht mglich. Es bleibt nichts
anderes brig, als zwischen exozentrischen
Funktoren (das sind solche, die die Kategorie
verndern) und endozentrischen Funktoren
(das sind solche, die die Kategorie nicht ver-
ndern) zu unterscheiden und festzulegen,
da erstere Kpfe sind, letztere dagegen nicht.
Die Notwendigkeit dieser Fallunterscheidung
zeigt, da ein wichtiges Bauprinzip von auen
an den Formalismus herangetragen wird (vgl.
dazu von Stechow & Sternefeld 1988, Kap.
5).
Da der Formalismus der Kategorialgram-
matik nicht auf Phrasalitt hin angelegt ist,
sieht man ferner daran, da man Phrasen wie
die obengenannten berhaupt nicht natrlich
kategorialgrammatisch definieren kann. Die
natrlichen Kategorisierungen von Oma, in
und bckt sind n\s, n\(n\s) und n\(n\s) re-
spektive. Dies bedeutet, da sich die gesttig-
ten Kategorien jeweils zu einem s reduzieren.
Hier steht man erstens vor dem Problem, wie
man die kategorialen Unterschiede zwischen
z. B. Substantiven und intransitiven Verben
die beide einstellige Eigenschaften denotie-
ren oder den von transitiven Verben und
Prpositionen die jeweils zweistellige Ei-
genschaften denotieren ausdrcken soll.
Montague hat in PTQ zu einem Ad-hoc-Ver-
fahren gegriffen, indem er z. B. fr die Kate-
gorie der Substantive einen neuen Typ n\\s
einfhrte. Auf hnliche Weise knnte man
Prpositionen und transitive Verben unter-
scheiden. Noch problematischer als dieser
notationelle Schlenker ist die Tatsache, da
man den Kategorien nicht ansehen kann, da
das letzte Argument das Subjekt in
aller Regel nicht in der durch den Kopf pro-
jizierten Phrase realisiert werden darf. Mit
anderen Worten, Phrasen mssen definiert
werden als Syntagmen vom Typ X/Y bzw.
Y\X, wobei X ein Grundtyp ist. Die durch
das n\(n\s) bckt induzierte Phrase ist also
nicht das s die Oma einen Guggelhupf bckt,
sondern das n\s einen Guggelhupf bckt. Eine
148 III. Theorie der Satzsemantik
Frege 1923 Gazdar/Klein/Pullum/Sag 1985
Geach 1970 Heim 1983 Husserl 1901/2 Jansen
1983 Kaplan 1977 Keenan/Faltz 1978 Klein/
Sag 1981 Kratzer 1978 Kratzer/Pause/von Ste-
chow 1974 Lambek 1958 Landman/Veltman
(eds.) 1984 Lesniewski 1929/38 Levin 1982 Le-
wis 1970 Lewis 1980a May 1977 Montague
1970 a (EFL) Montague 1970b (UG) Montague
1973 (PTQ) Newmeyer 1980 Newmeyer 1983
Partee 1976 Partee 1984a Reinhart 1983 Ries
1931 Rooth/Partee 1982 Ruttenberg 1976
Schnfinkel 1924 Szabolcsi 1987 Stalnaker
1970 Stalnaker 1978 von Stechow 1974 von
Stechow 1979a von Stechow/Sternefeld 1988
Steedman 1987 Tarski 1952 Thomason (ed.)
1974 Williams 1981 a Wunderlich 1987 Zim-
mermann 1979 Zimmermann 1986
Arnim von Stechow, Konstanz
(Bundesrepublik Deutschland)
Als einzige Entschuldigung habe ich anzugeben,
da ich einen kohrenten, verstndlichen und
gleichzeitig einigermaen umfassenden berblick
ber den Stand der Kunst geben wollte, der ver-
schiedenen Sehweisen innerhalb der formalen Syn-
tax und Semantik gerecht wird. Jeder, der so etwas
einmal versucht hat, wei, da ich Unmgliches
angestrebt habe.
7. Literatur (in Kurzform)
Ades/Steedman 1982 Ajdukiewicz 1935 Bach
1984 Bach/Oehrle/Wheeler (eds.) 1987 Baker
1988 Ballmer 1975 Bar-Hillel/Gaifman/Shamir
1960 van Benthem 1984a van Benthem 1987
Bhler 1934 Carnap 1947 Casadio 1987
Chomsky 1965 Chomsky 1970 Chomsky 1981
Cooper/Parsons 1976 Cresswell 1973 Cresswell
1985b Cresswell/von Stechow 1982 Curry/Feys
1958 Di Sciullo/Williams 1987 Engdahl 1980
8. Syntax and Semantics of Categorial Languages
2. Syntactic Categories
The syntax of a categorial language makes
use of the idea of a syntactic category. Syn-
tactic categories are either basic categories or
functor categories. In most presentations
there are two basic categories, the category
of name and the category of sentence. Various
authors have considered other basic catego-
ries (for instance Lewis (1970/72: p. 171) has
an additional basic category of common noun)
but our purposes will be served with just those
two. The category of names will be referred
to as n and the category of sentences as s.
Functor categories are categories which
make more complex expressions out of sim-
pler ones. For instance, the word and in Eng-
lish has the function of making a sentence
out of two simpler sentences. Thus
(1) Gwendolen pauses and Earnest smiles
is made up, using and, from the two sentences
(2) and (3):
(2) Gwendolen pauses
(3) Earnest smiles.
The symbol underlying and in a categorial
language would therefore be put into a syn-
tactic category labelled (s/ss) to indicate that
it makes an s (sentence) out of two others.
1. Preliminary Remarks
2. Syntactic Categories
3. Lambda-Abstraction
4. Interpretation
5. Lambda-Conversion and Transformations
6. Short Bibliography
1. Preliminary Remarks
One interest in categorial languages is syntac-
tic. In fact a great deal of early work on such
languages was concerned with their syntactic
properties. While the study of such properties
is certainly important, the spirit of this hand-
book would make it subordinate to the ques-
tion of how to give a truth-conditional se-
mantics for a categorial language. That will
be the goal of this article.
An early presentation of categorial lan-
guages is found in Ajdukiewicz (1935). They
were then taken up by, among others, Bar
Hillel (1964) and Geach (1970). However the
earliest formal semantics for categorial lan-
guages appears to be that given in Lewis
(1970) though its an obvious generalization
of work in intensional logic, e. g. that being
done by Richard Montague in the sixties
(Montague 1974).
8. Syntax and Semantics of Categorial Languages 149
finitely many of them will be empty. (As will
be seen in a moment, the fact that there are
no symbols in a given category does not pre-
vent there being complex expressions in that
same category.)
The set of well-formed expressions of a ca-
tegorial language can be defined as follows.
Let E
be the set of all expressions of category
. Expressions will turn out to be finite se-
quences of other expressions leading back
until symbols are reached. This is defined by
the following two rules:
F
(This just means that any symbol in category
is also an expression in category .)
If E
(/
1
...
n
)
and
1
E
1
, ...,
n
E
n
(where and
1
, ...,
n
are all catego-
ries, not necessarily all distinct) then
the sequence
,
1
, ...,
n
is in E
, i. e. it is a well-formed expres-
sion in category .
This can be illustrated using examples (1) and
(4). Let Gwendolen and Earnest be symbols
in category n which represent the English
words Gwendolen and Earnest. In other
words, Gwendolen and Earnest are both in F
n
.
Let pauses and smiles be in F
(s/n)
and and in
F
(s/ss)
.
Since Gwendolen is in F
n
, then, by E1, it is
in E
n
. Similarly, pauses E
(s/n)
. So by E2, (6)
is in E
S
, and similarly (7) is in E
S
.
(6) pauses, Gwendolen
(7) smiles, Earnest
Since and E
(s/ss)
then E2 gives (8) as a mem-
ber of E
s
.
(8) and, pauses, Gwendolen, smiles, Ear-
nest
The word order of (8) is not English, but this
fact does not affect the categorial structure.
Indeed we could easily rearrange the word
order to get
(9) Gwendolen, pauses, and, Earnest,
smiles
In (9), as in (8), provided the categories of
the symbols remain unchanged, it is clear that
and forms (9) out of two simpler sentences.
And each of these simpler sentences is formed
by a one-place predicate (i. e. a member of
E
(s/n)
) combining with a name.
(8) and (9) can alternatively be represented
as phrase markers:
The syntactic rules which define wellformed
expressions would state this fact.
An explicit definition of the categories
based on s and n can be given by the following
two rules:
s and n are categories.
If and
1
, ...,
n
are categories then
so is (/
1
...
n
).
The idea is that the only syntactic categories
are those generated by these rules. Thus (s/
ss) is a syntactic category because s is one by
S1 and (s/ss) is made up out of s in the way
allowed by S2. (/
1
...
n
) is the category
which forms an expression of category T out
of expressions of categories
1
, ...,
n
respec-
tively.
Categories can get complex. For instance
(s/n) is the category of a one-place predicate.
(This might be a word like pauses which
makes a sentence like (2) out of a name like
Gwendolen.) Since (s/n) is a syntactic category,
so is ((s/n)/(s/n)). This is the category which
forms a one-place predicate out of a none-
place predicate, and it has been suggested that
an adverb like invitingly might be represented
by a symbol in this category so that
(4) pauses invitingly
would be a (complex) one-place predicate ex-
pression (an (s/n)) made up by an adverb
combining with another one-place predicate
pauses. (4) could then combine with the name
Gwendolen to produce the sentence
(5) Gwendolen pauses invitingly.
In a categorial language every well-formed
expression is in some syntactic category. Fur-
ther, it is convenient to insist that an expres-
sion be in no more than one category. The
simple expressions out of which all the others
are made can be in any category. Where is
a syntactic category, then F
will denote the
class of symbols (i. e. simple expressions) in
category . When a categorial language is
described in this abstract way, it is not said
what a symbol is. A symbol can be anything
we please. It is a symbol merely in virtue of
playing a certain structural role in a syntactic
system. It is often assumed that a language
should have only finitely many symbols. This
is because the meaning of each symbol must
be separately learnt, as opposed to the com-
plex expressions, whose meanings will be de-
termined by the meanings of the simple sym-
bols in association with the rules of combi-
nations in a way soon to be described. Each
F
will then be finite and, further, all but
150 III. Theorie der Satzsemantik
sight it might seem that they are names. This
is because we can get sentences like (13) and
(14):
(13) someone, smiles
(14) no one, smiles
However, even if it is plausible to treat some-
one as the name of someone, it is impossible
so to treat no one. When Alice saw no one
on the road it was Carrolls logical joke that
the White King should congratulate her on
her sharp eyesight. In fact no one seems to
mean the same as not someone where not is a
symbol in category (s/s). (14) is equivalent to
(15) not, someone, smiles
But in (15) not someone is not a constituent
of (15) and is not in any syntactic category.
In fact it is better to follow Freges idea
here and say that someone is a higher-order
predicate. In (15) someone is the property of
a predicate to the effect that there exists a
person of whom the predicate is true. And no
one means that there is no such person. Now
if an ordinary predicate makes a sentence out
of a name and is therefore in category (s/n)
a predicate of predicates ought to make a
sentence out of a predicate and so be in cat-
egory (s/(s/n)). Expressions in this category
are what linguists call noun phrases or NPs.
Assigning this category to someone and no
one makes (13) and (14) well-formed sen-
tences. Further, it allows us to give a meaning
to no one which makes (14) equivalent to (15).
But consider the sentence
(16) Someone doesnt smile
One use of (16) might be equivalent to (15).
But it has another use. For (16) might mean
simply that there is a least one person who
doesnt smile, leaving it open that there are
The grammar which generates such phrase
markers can be expressed in a system of con-
text-free rewrite rules which correspond to
E1 and E2.
(s/ss) {and}
n {Gwendolen, Earnest}
(s/n) {pauses, smiles}
(/
1
, ...,
n
)
1
...
n
E2a is actually a rule schema which gives a
particular rule for each collection of catego-
ries ,
1
, ...,
n
.
To generate (4) we need to have invitingly
in F
((s/n)/(s/n))
. Then E2 puts (10) in E
(s/n)
and
so by E2 again, (11) is in E
s
.
(10) invitingly, pauses
(11) invitingly, pauses, Gwendolen
And as with (9) we can use the equivalent
(12) Gwendolen, pauses, invitingly
(Of course, if the interest is syntactical rather
than semantical, a particular word order may
be important, and rules to effect this will need
to be part of the grammar.)
3. Lambda-Abstraction
Categorial languages as described up to this
point are certainly extremely powerful, but
they are not they stand quite rich enough. To
get the extra flexibility we add what is called
an abstraction operator. This is denoted by
the Greek letter . is not a functor and is
in no syntactic category. A categorial lan-
guage with an abstraction operator can be
called a -categorial language.
In order to motivate and describe the use
of we shall look at the symbols someone
and no one. These symbols seem both to be
in the same syntactic category, and at first
8. Syntax and Semantics of Categorial Languages 151
If x X
and E
then , x,
E
(/)
The complex predicate which underlies
doesnt smile can now be represented as
(18) , x, not, smiles, x
where x X
n
. E3 and E2 make smiles, x a
member of E
s
and therefore so is
(19) not, smiles, x
So by E4, (18) is in category (s/n). I. e. it is a
predicate. So the appropriate sense of (16)
can be represented as
(20) someone, , x, not, smiles, x
(20) means that someone is an x such that x
does not smile.
This device enables -categorial languages
to deal with the kind of phenomena logicians
have become very familiar with. That is the
two senses of
(21) Everyone loves someone
(In the strong sense, (21) means that there is
a person who is the object of universal ad-
miration, while the weak sense allows a situ-
ation in which each person, say in a circle,
loves the person to their left, so everyone
loves someone without there being anyone
whom everyone loves. Some linguists have
disputed that (21) has a strong sense in Eng-
lish, but we could easily suppose a language
in which there were these two senses.)
In (21) loves is a rather more elaborate
kind of predicate than smiles and pauses, for
loves requires two names to turn it into a
sentence.loves is therefore called a two-place
predicate, by contrast with predicates like
smiles and pauses which are one-place predi-
cates.loves can be put in category (s/nn). This
means that if x and y are both in X
n
then
(22) loves, x, y
is in E
s
. With everyone and someone both in
F
(s/(s/n))
then the two senses of (21) can be
represented by (23) and (24).
(23) everyone, , x, someone, , y,
loves, x, y
(24) someone, , y, everyone, , x,
loves, x, y
(23) says that everyone is an x which satisfies
the predicate x loves someone. (24) says that
there exists a y for which everyone loves y
is true.
This completes the syntactic aspects of -
categorial languages. It is time to move on to
semantics.
others who do. The problem is to express this
sense using not, someone and smiles. Now
someone when applied to a predicate is to
mean that the predicate is true of someone.
So what predicate is involved in (16)? The
predicate is does not smile, and our problem
is to express it using not and smiles. One way
of doing this would be to allow not to be in
more than one syntactic category. Not only
would it be in category (s/s), it would also be
in category ((s/n)/(s/n)). In fact Geach (1970)
proposes a general law to the effect that any-
thing in category (/) is also in category
((/
1
...
n
)/(/
1
...
n
)). Such a practice
would contradict the stipulation that a sym-
bol be in no more than one syntactic category
and so the question is whether we can get the
same effect without giving up this restriction.
This can be done in the following way:
We are to think of the predicate does not
smile as being short for some such expression
as is an x such that x does not smile where
the x is what is called a variable. That is to
say we are not thinking of any particular non-
smiling thing, we are thinking of what it is
for anything x to be such that x does not
smile. In natural languages the effect of a
variable is often obtained by means of a pro-
noun, as when one says
(17) Every time I come to a traffic light it is
red.
(The point about (17) is that no particular
traffic light is being referred to.)
We shall use the notation , x, to mean
is an x such that . , x, will be in
category (s/n).
Actually, the notion of abstraction is more
general than that. In the above example
,x, is in category (s/n) because a is in
category s and the variable x is in category
n. In general where x is a variable in category
and an expression in category then
, x, is in category (/). This can be
made precise:
We first must supplement the language
with a set of variables for each syntactic cat-
egory. The variables play a structural role in
manufacturing new expressions and we can
never be sure that we may not need more, so
we shall assume that with each category a
there is associated a denumerably infinite set
X
of variables of category . Each member
of X
counts as an expression in category .
This can be made precise by adding two more
rules to E1 and E2:
X
152 III. Theorie der Satzsemantik
that Algernon pauses in w at t. In other words
the meaning of pauses will be a function (or
infinite correlation) which associates with
anything a the set of worlds and times at
which a pauses. Denote this function by .
(a) will then be the set of w, t pairs such
that a pauses in w at t. In (a), a is said to
be the argument of the function and (a)
is the value of the function for the argument
a. There will of course be many members of
D
n
for which will not make sense. Such an
a will not be in the domain of . This just
means that (a) does not exist or is not
defined for a. Thus
(25) Saturday, pauses
might have no semantic value.
In general D
(s/n)
will consist of functions
whose domains are taken from (i. e. whose
arguments are in) D
n
and whose values are
in D
s
. The domains of these functions are
unlikely to be the whole of D
n
. I. e. they will
be partial functions. This is necessary not only
to account for the semantic anomaly of sen-
tences like (25) but also to prevent certain
set-theoretical problems. For instance, take
the case of a function in D
(s/n)
. This function
might well be named by an expression in
category n and should therefore itself be a
member of D
n
. So at least one of the members
of D
n
for which would not be defined would
be itself.
This can be generalized for every functor
category. A member of D
(/
1
...
n
) will be a
function from D
1
... D
n
to D
. That
is to say its first argument will be in D
1
, its
second in D
2, ...,
its nth in D
n
, and its value
will be in D
. And there will of course be
some arguments from the appropriate cate-
gory for which it will not be defined.
A value assignment V for a -categorial
language is a function such that for any
F
; V
()
D
. I. e. V assigns to every sym-
bol a meaning from the appropriate category.
Notice that V does not give values to the
variables. This is because ultimately we will
be interested only in expressions whose final
value is unaffected by the value given to the
variables. Associated with a language and
a system D of domains there is a set N of
value assignments to the variables. If N
then for any x X
,
(x)
D
. We now show
how to define a function V
which gives a
semantic value for every expression of ,
whether simple or complex. V
is defined as
follows:
4. Interpretation
Actually semantics at an informal level has
been in the picture all the way through. What
must be done is make it explicit. The kind of
semantics to be provided is what is often
called model-theoretic, that is to say one first
specifies a system of entities which are the
things eligible to be the meanings of the ex-
pressions in any syntactic category in any -
categorial language. Such a system of domains
of interpretation will be denoted by D. One
then interprets a particular language in D
by means of an assignment function V which
assigns values of the appropriate kind to each
symbol. The rules of combination then shew
how to determine a semantic value for each
expression of . By varying V, the very same
can be given different interpretations, and
expressions in two different s can end up
with the same interpretation.
D is a function which associates with each
syntactic category a set or domain D
of
things which are possible meanings for ex-
pressions of category a. The first question is
what are D
n
and D
s
. D
s
is the domain of
sentence meanings. These can be called prop-
ositions, and in article 2 it was suggested that
they be taken as sets of possible worlds, or
perhaps, in order to take tense into account,
as sets of world-time pairs; or maybe even
something more complex. Sets of world-time
pairs is good for starters anyway. Where W
is the set of all world-time pairs then a D
s
iff a W. I. e. the members of D
s
are all and
only sets of world-time pairs.
D
n
is the domain of things than can be
named. But what can be named? Well I guess
anything can be named. But what is anything?
Maybe questions like this are metaphysical
rather than semantical. The idea is that D
n
contains everything that there is. And this
doesnt just mean individual objects. For we
often talk about sets, characteristics, events,
tendencies, attitudes and aspirations. They
are all things in the extended sense which is
appropriate to D
n
.
The situation for the functor categories is
a little different. Consider a (one-place) pred-
icate. This will be an expression in category
(s/n) and it will form a sentence out of a
name. Suppose it is the predicate pauses. The
meaning of (6), in a value assignment V which
is to mirror English, will be the set of pairs
w, t in which Gwendolen pauses in world
w at time t. If Gwendolen had been replaced
by the name of someone else, say of Algernon,
then it would have been the set of pairs such
8. Syntax and Semantics of Categorial Languages 153
x, y)
and w, t will be in this set iff a loves some-
one at w, t.
Finally consider V
((23)). V
((23)) is (by
V3) V(everyone) () so w, t V
((23)) iff
for every person a who exists in w at t, w, t)
(a). And this last is so iff every person
loves someone at w, t.
The meaning of (24) can be worked out
analogously. It will be seen to yield the strong
interpretation.
In (23) and (24) the dependence on v finally
disappears. The assignment to y no longer
matters in
, y, loves, x, y
and the assignment to x becomes irrelevant
in the final expression. In , y, loves, x, y
the y after the binds the y in loves, x, y.
By contrast the x remains free. Of course in
loves, x, y both the x and y are free. In
general in , x, the x after the binds all
free occurrences of x in . The following
theorem is easy to prove:
If and are two assignments which agree
on the variables free in an expression ,
then for any assignment V, V
() = V
().
If contains no free variables (like (23) or
(24)) then V
() = V
() for all assignments
to the variables and so we may simply speak
of V(). The sentences which underly natural
language are usually considered not to con-
tain free variables and so their meanings are
determined by V alone.
5. Lambda-Conversion and
Transformations
In -categorial languages there are certain
principles which state conditions under which
certain expressions have the same semantic
value in all interpretations. These are known
as the principles of -conversion (Cresswell
1973: pp. 8890), and state that certain ex-
pressions are synonymous purely as the result
of the semantics of -conversion. The prin-
ciple concerned here is
(*) , x, , is equivalent in every in-
terpretation to [/x].
In this principle x and must both be of the
same category, say . Let be in category .
[/x] is with replacing all free occurrences
of x, provided obvious releterring is done to
prevent anything in being bound as a result.
Since , x, is in category (/) then both
sides of the principle are in category and
V1 If F
then V
() = V
()
V2 If x X
then V
(x) = (x)
V3 If is ,
1
, ...,
n
then
V
() = V
() (V
(
1
), ..., V
(
n
))
V4 If is , x, , with x X
and E
,
then V
() is the function such that
for any a D
, (a) = V
(, a/x)
(), where
(v, a/x) is the function exactly like v
except that (, a/x) (x) = a.
V2 and V3 may require a little comment. The
idea is that when combines with
1
, ...,
n
to form an expression, the meaning of that
expression is got by letting the function which
is the meaning of (i. e. V
()) operate on the
meanings of
1
, ...,
n
respectively. (And these
are V
(
1
), ..., V
(
n
).) Of course it may hap-
pen that V
() is not defined for these argu-
ments, as in (25) if V(Saturday) is Saturday
and Saturday is not in the domain of
V(pauses). In such a case the whole expression
will lack a value. If we think of , x, as
meaning is an x such that then the idea is
that a satisfies this iff a is an x such that ,
which is to say that is true when x is given
the value a, which is just what (v, a/x) does.
These rules can be illustrated by working
through an example. Take (23). By V1V3
it is not hard to see that
V
(loves, x, y) = V(loves) (v(x), v(y))
So V
v
(y, loves, x, y) is the function
such that for any a D
n
:
(a) = V
(v, a/y)
(loves, x, y)
= V(loves) ((v, a/y) (x), (v, a/y) (y))
= V(loves) (v(x, a)
So w, t (a) iff v(x) loves a in w at t.
Now
V
(someone, , y, loves, x, y
= V(someone) (V
(, y, loves, x, y
= V(someone) ()
And, since V is supposed to give someone its
English meaning:
V(someone) () is the set of pairs w, t
such that there exists at t in w a person a
such that w, t (a).
And this latter is so iff v(x) loves a at w, t.
So w, t V
(someone, , y, loves, x,
y) iff v(x) loves someone at w, t.
Now consider
V
(, x, someone, , y, loves, x, y)
This will be the function , again in D
(s/n)
,
such that, for any a D
n
,
(a) = V
(, a/x)
(someone, , y, loves,
154 III. Theorie der Satzsemantik
enables us to go from (28) to (29) can be
described as a grammatical transformation on
structures. It would have something like the
following form
This looks perhaps rather unfamiliar as a
transformation, but it is surely conceivable
that transformational theory could be rewrit-
ten so that the transformations might all
emerge as complex sequences of -conver-
sions. (At the very least an investigation of
this possibility would seem a viable research
project.)
One important difference between trans-
formations and -conversions may be seen by
looking at (29). What we notice is that its
structure actually seems to tell us how it has
been obtained. For one may think of the
variable x as a trace indicating the place
where smile used to be in (28). This means
that a sentence of a -categorial language in
a sense carries its structure with it. Some
authors seem to consider this a bad thing.
For instance Levin (1982) extends ordinary
categorial languages by allowing more liberal
principles of combination and on p. 147 ap-
pears to prefer this to adding an abstraction
operator precisely on the ground that a -
categorial treatment puts too much structure
into the sentence itself. Categorial languages
do of course have quite restricted formation
rules and there is nothing to prevent more
general kinds of phrase structure rules from
being semantically interpreted. In a way this
is just what Montague Grammar is all about
(see Montague 1974 and also Suppes 1973
and von Stechow 1974). Levins work is in-
teresting in that he advocates a categorial
syntax but with more general semantic rules.
As a way of illustrating the transforma-
tional power of the principles of -conversion,
we shall look at how they may be used to
change the linear order of strings of symbols.
There is a grammatical operation known as
preposing or topicalization, whereby one
might take a sentence like
(30) Gwendolen loves Earnest
and stress the fact that it is Earnest that
Gwendolen loves by bringing the name Ear-
nest to the beginning of the sentence to get
the principle simply says that they have the
same value in every interpretation. Intuitively
(*) says that the statement that is an x such
that x s means simply that s. For in-
stance, Gwendolen is an x such that x smiles
iff Gwendolen smiles.
The connection was mentioned earlier be-
tween categorial languages and phrase struc-
ture grammars. When an abstraction opera-
tor is added, we get something which looks
much more like a transformational grammar.
To see this we can look at some simple trans-
formations. In particular let us look at the
transformation which gets (26) from (27).
(26) Gwendolen and Earnest smile
(27) Gwendolen smiles and Earnest smiles
There is of course a difference between smile
and smiles and it may even be a semantic
difference. For now however it is simpler to
treat it as a surface difference and suppose
that there is only one symbol at the -cate-
gorial level. The principles of -conversion
enable one occurrence of smile to do the work
of two, and thus, in a sense, have the same
effect as a transformation which deletes a
symbol under appropriate conditions of iden-
tity with a symbol elsewhere in the structure.
In (27) we suppose that Gwendolen and Ear-
nest are each in category n, run is in category
(s/n) and and is in category (s/ss). This means
that its categorial structure is
(28) Gwendolen, smile, and, Earnest,
smile
What the principle (*) of -conversion does
is assure us that (28) is semantically equiva-
lent to
(29) , x, Gwendolen, x, and, Earnest,
x smile
Here x is a variable in category (s/n), and we
can read (29) in some such manner as smile
is an x such that Gwendolen xs and Earnest
xs. At any rate, using variables in category
(s/n) enables one to abstract on the verb and
supply it, using only one occurrence of the
symbol, as an argument of the abstract.
In the case of (28) and (29) the principles
of -conversion tell us that an expression
containing a , (29), is equivalent to one with-
out any , (28). This does not mean that every
expression with s can be converted into an
equivalent one without. For instance, sen-
tence (20) cannot be converted into an equiv-
alent sentence without s, by any number of
-conversions.
The principle (*) of -conversion which
8. Syntax and Semantics of Categorial Languages 155
tence means loves is an x such that Gwen-
dolen xs Earnest, i. e. Gwendolen loves Ear-
nest.
These last remarks (made at greater length
in Cresswell 1977 a) indicate how one might
use categorial languages in a theory of syntax
as well as semantics. They would then become
part of the syntactic base of a linguistic de-
scription of a natural language. At the other
extreme they could be regarded in much the
way Montague regarded his intensional logic,
as the language of semantic representation
into which the syntactic structures were
mapped.
6. Short Bibliography
Ajdukiewicz 1935 Bar Hillel 1964 Cresswell
1973 Cresswell 1977 a Geach 1970 Levin 1982
Lewis 1970 Montague 1974 von Stechow 1974
Suppes 1973
M. J. Cresswell, Wellington (New Zealand)
(31) Earnest Gwendolen loves
(31) is a little less natural than
(32) It is Earnest whom Gwendolen loves
but with the right kind of stress (on EAR-
NEST) a sentence like (31) is surely possible
with the meaning of (30). The categorial
structure of (30) is
(33) loves, Gwendolen, Earnest
where loves is in category (s/nn) and Gwen-
dolen and Earnest are both in category n. -
conversion gives
(34) , x, , y, x, y, Earnest, Gwen-
dolen, loves
Now, since x and y are two (distinct) variables
of category (s/nn) and n respectively, this
makes x,y, Earnest an expression of cate-
gory s. This in turn puts , y, x, y, Earnest
into category (s/n), meaning is a y such that
y xs Earnest which becomes (when Gwen-
dolen is added as argument) Gwendolen is a
y such that y xs Earnest; in other words,
Gwendolen xs Earnest. So the whole sen-
156
IV. Kontexttheorie
Context Theory
9. Kontextabhngigkeit
wandte Bezugsrahmen werden im darauffol-
genden Teil kurz vorgestellt. Erst danach gibt
es (im dritten Teil) einen berblick ber den
Phnomenbereich; dabei sollen vor allem die
deskriptive Spannweite und Flexibilitt der
klassischen Theorie und ihrer Varianten er-
kennbar werden. Ihre Grenzen sind Gegen-
stand von Teil 4.
1. Die klassische Theorie
Die hier zum Ausgangspunkt erkorene klas-
sische Theorie der Kontextabhngigkeit lt
sich nur verstehen, wenn man sie auf dem
Hintergrund eines bestimmten Bildes des Zu-
sammenhangs zwischen Sprache und Welt
sieht. Als grobe Skizze steht dieses Bild am
Anfang der folgenden Darstellung. Nach dem
Begriff Kontext wird man in dieser Darstel-
lung der klassischen Theorie brigens vergeb-
lich suchen: er gehrt in der hier bevor-
zugten Terminologie zu einer erst in Ab-
schnitt 2.1 zu besprechenden Variation des
klassischen Rahmens.
1.1Extension und Intension
Durch die Verwendung sprachlicher Aus-
drcke beziehen sich Sprecher oft auf Perso-
nen oder Dinge. Wenn z. B. Erwin den Satz:
(1) Ich bin Vertreter.
uert, so bezieht er sich mit dem Subjekt ich
auf sich selbst, also Erwin. In dieser Situation
ist Erwin der Referent oder, wie man auch
sagt, die Extension des Wortes ich. Fr das
Substantiv Vertreter lt sich ebenfalls eine
Extension angeben, wenn auch nicht in so
naheliegender Weise. Ist die von Erwin auf-
gestellte Behauptung wahr, so knnte man
zunchst vermuten, da dieses Substantiv ge-
nau wie das Subjekt auf den Sprecher Erwin
verweist. Doch worauf soll sich das Wort
Vertreter beziehen, wenn Erwin Unrecht hat?
Eine mgliche Antwort wre, da es sich in
diesen Fllen auf unbestimmte Weise auf alle
1. Die klassische Theorie
1.1 Extension und Intension
1.2 Intension und Charakter
1.3 Arten der Referenz
1.4 Arten der Kombination
2. Varianten und Alternativen
2.1 Parametrisierung
2.2 Extensionalisierung
2.3 Zweidimensionale Modallogik
2.4 Tokenanalyse
2.5 Erkenntnistheoretische Umdeutung
3. Aspekte des Kontexts
3.1 Standardaspekte unter der Lupe
3.2 Demonstrativa
3.3 Einschlgiges
4. Probleme
4.1 Bindung
4.2 Perspektivische Verschiebungen
4.3 Skopismus, Holismus und quantifizierte Kon-
texte
4.4 Mibrauch
5. Historisch-bibliographische Anmerkungen
5.1 Zur klassischen Theorie
5.2 Zu den Varianten und Alternativen
5.3 Zu den Aspekten des Kontexts
5.4 Zu den Problemen
5.5 Zu den historisch-bibliographischen Anmer-
kungen
6. Literatur (in Kurzform)
Die in diesem Artikel besprochenen seman-
tischen Phnomene knnte man statt unter
Kontextabhngigkeit ebensogut unter den
Begriffen Deixis oder direkte Referenz abhan-
deln. Es geht jedenfalls um eine bestimmte
Art der Situationsabhngigkeit der Bedeu-
tung sprachlicher Ausdrcke. Um allerdings
diese Situationsabhngigkeit genauer fassen
zu knnen, bedarf es eines allgemeinen theo-
retischen Rahmens fr die Beschreibung des
Verhltnisses der Sprache zur Welt. Ein sol-
cher Rahmen wird von der in Teil 1 darge-
stellten allgemeinen Referenztheorie bereitge-
stellt, die zugleich auch die klassische Theorie
der Kontextabhngigkeit ist. Andere, grten-
teils mit der klassischen Theorie eng ver-
9. Kontextabhngigkeit 157
ergibt sich unmittelbar eine interessante Kon-
sequenz fr einfache Stze wie (1): ihre Ex-
tensionen lassen sich aus den Extensionen
ihrer jeweiligen Teilausdrcke ermitteln. Sie
erfllen also ein
Naives Kompositionalittsprinzip
Die Extension eines komplexen Ausdrucks
ergibt sich aus den Extensionen seiner Teile
und der Art ihrer Kombination.
Dieses Kompositionalittsprinzip fr Exten-
sionen lt sich aber nicht auf beliebige Stze
ausdehnen. Typische Gegenbeispiele sind vor
allem Stze mit eingebetteten da-Stzen:
(3) Monika vermutet, da Erwin Vertreter
ist.
Aus dem Naiven Kompositionalittsprinzip
und der Annahme, da die Extension des
Teilsatzes Erwin Vertreter ist gleich dem
Wahrheitswert dieses Satzes ist, folgt sofort,
da man ihn durch jeden beliebigen deutschen
(Neben-)Satz mit demselben Wahrheitswert
ersetzen knnte, ohne da sich am Wahrheits-
wert der Gesamtaussage (3) etwas nderte.
Doch das ist natrlich absurd.
Um die im Zusammenhang mit (3) auftre-
tenden Schwierigkeiten zu umgehen, mu
man entweder das Naive Kompositionalitts-
prinzip oder die Annahme, da Satzextensio-
nen Wahrheitswerte sind, aufgeben. Hier wird
nur die erste Alternative weiterverfolgt. (Fr
die zweite siehe den Artikel 6.) Eine minimale
Abschwchung des Naiven Kompositionali-
ttsprinzips besteht nun darin, fr solche Pro-
blemflle wie die Satzeinbettung in (3) eine
Art Ersatzextension vorzusehen: der Wahr-
heitswert von (3) hngt dann nicht vom Wahr-
heitswert des eingebetteten Satzes, wohl aber
von der durch ihn ausgedrckten Proposition
(dem Satzinhalt) ab, und letztere bernimmt
die Rolle der Ersatzextension bei einer kom-
positionellen Beschreibung der Extension von
(3). Statt von Ersatzextensionen spricht man
blicherweise von Intensionen. Propositionen
sind also Satzintensionen. Die entsprechende
Abnderung des Naiven Kompositionalitts-
prinzip lautet dann:
Fregesches Kompositionalittsprinzip
Die Extension eines komplexen Ausdrucks
ergibt sich aus den Extensionen bzw. den
Intensionen seiner Teile und der Art ihrer
Kombination.
Syntaktische Konstruktionen, bei denen (wie
etwa bei den meisten Anwendungen der Sub-
jekt-Prdikatsregel) die Extensionen der Teil-
ausdrcke zur Ermittlung der Extension des
beliebigen Vertreter bezieht oder was auf
dasselbe hinausluft auf die Gesamtheit
aller Vertreter. Die Extension des Substantivs
Vertreter ist nach der letzteren Sichtweise, der
wir uns hier anschlieen, die Menge der Ver-
treter, also etwas Abstraktes. Diese Sichtweise
erlaubt es auch, fr die Verwendung der Ko-
pula bin eine Extension anzugeben: Erwins
Behauptung besagt, da er ein Element der
Extension von Vertreter ist, so da man als
Kopula-Extension die Elementschaftsbezie-
hung ansehen kann.
In hnlicher Weise kann man jetzt versu-
chen, fr beliebige Verwendungen beliebiger
sprachlicher Ausdrcke Extensionen zu fin-
den. Eine notorische Schwierigkeit bereiten
dabei vor allem Stze. Auf den ersten Blick
scheint es hier keine intuitiv vorgegebenen
Referenten zu geben. Eine berlegung aus
der Prdikatenlogik zeigt aber, da man ber
Umwege auch Satz-Extensionen bekommen
kann. Betrachtet man nmlich Satzschemata
wie:
(2) x liebt y.
oder in prdikatenlogischer Notation
(offene) Formeln wie:
(2) LIEBEN(x,y),
so liegt es nahe, als ihre Extension die Menge
aller geordneten Paare a,b festzulegen, die
(2) bzw. (2) erfllen, fr die also gilt: a liebt
b. Bei mehr als zwei freien Variablen be-
kommt man dementsprechend Mengen von
Tripeln, Quadrupeln etc. als Extensionen. Im
allgemeinen ist dann die Extension einer For-
mel mit n freien Variablen die Menge aller
n-Tupel a
1
,..., a
n
, die erfllen. Da nun das
einzige 0-Tupel die leere Menge ist, bleibt
fr eine Formel ohne freie Variablen als
Extension entweder die Einermenge {}
falls wahr ist oder aber die leere Menge
(fr ein falsches ). Natrlichsprachliche
(Aussage-)Stze entsprechen insofern ge-
schlossenen Formeln, als sie offenbar keine
freien Variablen enthalten. Als Extensionen
von Stzen kmen somit die mengentheore-
tischen Objekte {} und infrage: {} ist die
gemeinsame Extension der wahren Aussagen,
die falschen haben alle zur Extension. Diese
beiden abstrakten Objekte bezeichnet man
auch als die beiden Wahrheitswerte. In der
Mengenlehre und im folgenden werden sie
berdies mit den Zahlen 0 (= ) und 1 (= {})
identifiziert.
Mit den bisher getroffenen Festlegungen
ber die Extensionen sprachlicher Ausdrcke
158 IV. Kontexttheorie
nen vorausgesetzt, man identifiziert cha-
rakteristische Funktionen jeweils mit den
Mengen der Argumente, fr die sie den Wert
1 ergeben. Demnach besagt Satz (3), da Mo-
nika in der durch das Verb vermuten ausge-
drckten Einstellung V zu einer gewissen
Menge p steht; dabei ist p die Menge derje-
nigen Situationen, in denen Erwin Vertreter
ist, und die Beziehung V lt sich ungefhr
so beschreiben: x steht in V zu p, falls x eine
Vermutung hegt, bei deren Zutreffen eine Si-
tuation aus p vorliegt. Das Zutreffen der Be-
ziehung V ist natrlich selbst wieder situa-
tionsabhngig, so da sich als Intension des
Verbs vermuten eine Funktion ergibt, die Si-
tuationen Relationen zwischen Personen und
Propositionen zuordnet. Unter der (in diesem
Zusammenhang harmlosen) vereinfachenden
Annahme, da die Gesamtheit aller von einer
Person gehegten Vermutungen selbst wieder
eine Vermutung dieser Person bildet, gelangt
man zu der folgenden (provisorischen) Be-
deutungsregel:
(R*) Die Intension des Verbs vermuten ist
eine Funktion V, die jeder Situation s
eine zweistellige Relation V
s
zuordnet,
so da fr beliebige Individuen x und
Propositionen p gilt:
(*) x steht zu p in der Relation V
s
, falls
p in jeder Situation s gilt, die mit
den von x in s gehegten Vermutun-
gen vereinbar ist.
(R*) ist eine typische Regel fr die Deutung
einer intensionalen Konstruktion. Wendet
man sie auf Stze wie (3) an, verweist die
Variable s auf die Situation, an der der be-
treffende Ausdruck geuert wird und fr die
seine Extension ermittelt werden soll; s be-
zieht sich dagegen auf Situationen, die fr die
Ermittlung der Intension eines der Teilaus-
drcke zu Rate gezogen werden mssen. Es
empfiehlt sich fr das folgende, diesen Unter-
schied in der Rolle von s und s festzuhalten:
man sagt, da sich s bei einer (einfachen)
Anwendung von (R*) auf eine uerungssi-
tuation bezieht, whrend s fr Auswertungs-
situationen steht.
(R*) ist ein Beispiel fr eine recht gngige
Analyse von Einstellungsverben wie vermu-
ten. Es ist bekannt, da diese Analyse wegen
der logischen Inkonsequenz propositionaler
Einstellungen zu Schwierigkeiten fhrt, die
sich durch einen logisch feineren (aber kom-
plizierteren) Propositionsbegriff umgehen las-
sen. (Vgl. dazu Artikel 34.) Dieses Phnomen
ist jedoch weitgehend (genauer: abgesehen
Gesamtausdrucks ausreichen, nennt man ex-
tensional, die anderen heien dementspre-
chend intensional. Satzeinbettungen wie in (3)
sind also intensionale Konstruktionen. An-
dere intensionale Konstruktionen sind z. B.
der Anschlu des direkten Objekts bei Verben
wie suchen oder schulden sowie die Attribu-
tion gewisser Adjektive wie angeblich oder
vorstzlich. Es ist bemerkenswert, da sich die
meisten dieser intensionalen Konstruktionen
(wenn nicht sogar alle) durch geeignete Pa-
raphrasen auf Satzeinbettungen zurckfhren
lassen. Propositionen sind also mglicher-
weise die einzigen Intensionen, die man tat-
schlich braucht.
Aber was sind Propositionen? Die bisherige
Charakterisierung als Satzinhalte ist ausge-
sprochen vage. Eine traditionelle, aber (wie
sich noch herausstellen wird) nicht ganz hin-
reichende Przisierung des Propositions- und
allgemein des Intensionsbegriffs besteht in
einer Gleichsetzung von Inhalt und Infor-
mation: die Intension eines Ausdrucks ist da-
nach die Information, die bentigt wird, um
seine Extension zu bestimmen. Da die Exten-
sion eines sprachlichen Ausdrucks im allge-
meinen von den Umstnden seiner uerung
abhngt, kann man sich die Intension als ein
Verfahren vorstellen, das unter beliebig ge-
gebenen Umstnden eine Spezifikation der
jeweiligen Extension liefert. Oder, abstrakter
und allgemeiner: als eine Funktion (durchaus
im mathematischen Sinne des Wortes), die
sich auf mgliche Situationen anwenden lt
und deren Werte stets Extensionen sind. Die
Intension eines Substantivs wie Spion lt sich
etwa auf die Situation der Bundesrepublik
Deutschland in den frhen siebziger Jahren
anwenden und liefert eine Menge, deren pro-
minentestes Mitglied wohl Gnter Guillaume
ist (wer wei?), whrend der Wert derselben
Intension fr die Romanwelten von Ian Fle-
ming eine hufig von Roger Moore und Sean
Connery verkrperte Gestalt enthlt: in jedem
Falle ist der Wert der Intension die Menge
der Geheimagenten. Insbesondere ist also in
diesem Beispiel die Intension stets dieselbe
Zuordung von Situation zu Extension, selbst
wenn erstere nicht von dieser Welt und letz-
tere nur in den seltensten Fllen vollstndig
bekannt ist.
1.2Intension und Charakter
Propositionen sind also charakteristische
Funktionen, d. h. Funktionen von Situationen
in Wahrheitswerte, oder, was praktisch auf
dasselbe hinausluft: Mengen von Situatio-
9. Kontextabhngigkeit 159
win behauptet mit seiner uerung von (4)
nmlich keineswegs, da Monika vermute,
die Person, die jetzt gerade im Nebenzimmer
spreche, sei in Radolfzell. Die Vermutung, die
Erwin meint, bezieht sich vielmehr auf ihn
selbst, den augenblicklichen Sprecher; es han-
delt sich also um eine sog. singulre Proposi-
tion, eine Proposition ber ein bestimmtes
Individuum. Die bisherigen Festlegungen zur
Bestimmung von Intension und Extension
tragen dieser Tatsache offenbar nicht Rech-
nung. Eine Revision tut not.
Es bieten sich hier im Prinzip zwei Mg-
lichkeiten an, diese im Zusammenhang mit
(4) aufgetretenen Schwierigkeiten aus dem
Weg zu rumen: (A) entweder man ndert die
Deutung (R*) des Verbs vermuten und be-
schrnkt sich in der Klausel (*) auf solche
Auswertungssituationen, in denen dieselbe
Person spricht wie in der uerungssituation;
(B) oder man gibt die Voraussetzung auf, da
(5) ausdrckt, da sich der (jeweilige) Spre-
cher in Radolfzell aufhlt und nimmt statt-
dessen an, (5) besage, da sich Erwin in Ra-
dolfzell aufhalte. Wir werden beiden Mg-
lichkeiten nachgehen und dabei feststellen,
da (A) wieder zu neuen Problemen fhrt,
whrend man mit (B) zu einem neuen Inten-
sions-Begriff gelangt, der es dann erlaubt,
diese Probleme zu umgehen. Spter (in Ab-
schnitt 2.1) wird sich allerdings herausstellen,
da sich die Alternative (A) bei einer abstrak-
teren Betrachtungsweise wieder retten lt.
Untersuchen wir also zunchst die Alter-
native (A). Dabei handelt es sich lediglich um
eine leichte Verfeinerung der Regel (R*); die
Klausel (*) mte ersetzt werden durch:
() x steht zu p in der Relation V
s
, falls p in
jeder Situation s gilt, die mit s den Spre-
cher gemeinsam hat und die mit den von
x in s gehegten Vermutungen vereinbar
ist.
(+) ist natrlich noch etwas unfertig: variiert
man nmlich das Beispiel (5) ein wenig, so
stellt sich schnell heraus, da die in (+) her-
angezogenen Auswertungssituationen s ne-
ben dem Sprecher auch beispielsweise die Ge-
sprchspartner, den uerungstag, den Ort
der Handlung u. a. m. von der uerungssi-
tuation s bernehmen mssen: ihr, heute, hier
etc. verhalten sich in dieser Hinsicht nmlich
ganz analog zu ich. Die Aspekte der ue-
rungssituation, die in dieser Weise von den
Auswertungssituationen bernommen wer-
den, nennen wir hier einmal die [fr (R+)]
festen Situationsaspekte, whrend wir die an-
deren Aspekte als [durch (R
+
)] verschiebbar
von einem in Abschnitt 4.2 noch anzuspre-
chenden mglichen Zusammenhang) unab-
hngig von Fragen der Kontextabhngigkeit.
Wir werden uns deshalb weiter auf (R*) be-
ziehen und stillschweigend voraussetzen, da
die gleich zu diskutierenden Probleme auch
im Zusammenhang mit logisch strukturierten
Propositionen auftreten und sich dann in ana-
loger Weise lsen lassen.
Wenden wir nun (R*) auf das folgende
Beispiel an:
(4) Monika vermutet, da ich in Radolfzell
bin.
Um das Problem, das sich fr eine Analyse
von (4) nach (R*) ergibt, klar zu sehen, sei
hier eine bestimmte (etwas verquere) ue-
rungssituation s
0
von (4) betrachtet, deren
Vorgeschichte sich folgendermaen abgespielt
hat: Erwin ruft aus Schwbisch-Hall Monika
an, um ihr mitzuteilen, da er nach Radolfzell
fahren will. Unterwegs berlegt er es sich
jedoch anders und fhrt stattdessen nach
Konstanz, wo Monika die beiden fhren
dort einen gemeinsamen Haushalt an ih-
rem Schreibtisch im Arbeitszimmer sitzt, wh-
rend ihre Eltern im Wohnzimmer fernsehen.
Bei seiner Ankunft trifft Erwin als erstes Mo-
nikas Eltern und uert nun (4). Monika hrt
dies zwar durch ein Loch in der Wand zwi-
schen Wohn- und Arbeitszimmer, hlt es je-
doch fr eine (etwas abwegige) uerung ih-
res Vaters; die Stimmen der beiden hneln
sich nmlich, und Monika whnt Erwin in
Radolfzell. So weit die Beschreibung der uns
interessierenden uerungssituation s
0
von
(4). Versuchen wir nun, (R*) zur Ermittlung
des Wahrheitswertes von (4) in s
0
heranzuzie-
hen. Die Bedingung (*) luft in diesem Falle
darauf hinaus, da in jeder (Auswertungs-)
Situation s, die mit den von Monika in s
0
gehegten Vermutungen vereinbar ist, die
durch (5) ausgedrckte Proposition wahr ist:
(5) Ich bin in Radolfzell.
(5) ist aber offenbar in einer Situation s ge-
rade dann wahr, wenn sich (in s) die in s
sprechende Person in Radolfzell aufhlt. Da-
mit (4) gem (R*) in s
0
wahr ist, mten
also Monikas Vermutungen darauf hinaus-
laufen, da sich der uerer von (4) in Ra-
dolfzell befindet. Doch das ist natrlich ab-
surd: Monika ist in Konstanz, und sie kann
ja hren, da der Sprecher nebenan ist. (R*)
sagt also die Falschheit von (4) in s
0
voraus,
wo doch Erwin ganz offensichtlich recht hat.
Es ist klar, was hier schiefgelaufen ist: Er-
160 IV. Kontexttheorie
und genauso ist es ja wohl auch. Eine Kom-
plikation bei dieser Lsung besteht nun aller-
dings darin, da die Annahme, (5) besage,
da Erwin in Radolfzell sei, vollkommen ad
hoc ist und schon in der nchstbesten Situa-
tion s
1
, in der jemand anders als Erwin
spricht, zu offenkundigem Unsinn fhrt: hier
kann ja die durch (5) ausgedrckte Proposi-
tion unmglich besagen, da Erwin in Ra-
dolfzell ist, sondern allenfalls, da sich eine
gewisse Person, die in s
1
Sprecher ist, in Ra-
dolfzell befindet. Damit wrde aber (5) in s
1
eine andere Proposition ausdrcken als in s
0
,
d. h. die Intension von (5) hinge von der
uerungssituation ab. Die Alternative (B)
luft also letztlich darauf hinaus, die Inten-
sion eines Ausdrucks hnlich wie die Ex-
tension als etwas mit der uerungssitua-
tion Variierendes aufzufassen: (5) drckt
je nach dem, wer diesen Satz gebraucht
einmal diese, einmal jene (singulre) Propo-
sition aus, wie auch der Wahrheitswert dieses
Satzes von Situation zu Situation schwanken
kann.
Um zu gewhrleisten, da die durch (5)
ausgedrckte Proposition in der gewnschten
Art und Weise von der uerungssituation
abhngt, mssen die oben dargestellten Prin-
zipien zur Bestimmung von Extension und
Intension verfeinert werden. Was man
braucht, ist ein Schema, nach dem ein Satz
wie (5) in jeder uerungssituation s eine fr
s charakteristische Intension bekommt
oder, anders ausgedrckt: Festlegungen fr
die Bestimmung der funktionalen Abhngig-
keit der Intension von der jeweiligen ue-
rungssituation. Diese Abhngigkeit werden
wir von nun an den Charakter des betreffen-
den sprachlichen Ausdrucks nennen. Der
Charakter
5
von (5) ist also eine Funktion,
die jeder uerungssituation s die Menge der-
jenigen Situationen s zuordnet, fr die gilt:
der Sprecher in s befindet sich in der Situation
s in Radolfzell.
Um den Charakter
5
systematisch mit dem
Aufbau von (5) in Verbindung zu bringen,
mu schon unterhalb der Satzebene zwischen
uerungs- und Auswertungssituation unter-
schieden werden. Denn die Extension des
Subjekts ich in (5) wird in der uerungssi-
tuation bestimmt, whrend sich die Extension
des Prdikats (bin in Radolfzell) nach der Aus-
wertungssituation richtet. Dieser Unterschied
in der Gewichtung von uerungs- und Aus-
wertungssituation liegt nicht an den Rollen
von Subjekt und Prdikat, sondern an dem
Wort ich. (Das lt sich z. B. anhand von
bezeichnen. (Man beachte, da Aspekte von
Situationen gewissen Eigenschaften derselben
entsprechen: s und s stimmen im Aspekt
Sprecher berein, falls sowohl s als auch s
die Eigenschaft zukommt, da eine gewisse
Person X in ihr spricht; Genaueres zu diesem
Aspekt-Begriff erfhrt man in Abschnitt 2.1.)
Die Revision (A) besagt also einfach, da
(R+) bestimmte Aspekte der uerungssitua-
tion festhlt. Um welche Aspekte handelt es
sich dabei? Das Beispiel (4) legt nahe, da der
Sprecher auf jeden Fall dabei ist: nach (
+
)
mssen ja uerungs- und Auswertungssitua-
tion den Sprecher gemeinsam haben. Doch
das ist nur die halbe Wahrheit, wie eine kleine
Erweiterung des obigen Beispiels zeigt. Erwin
knnte nmlich seiner uerung von (4)
durchaus wahrheitsgem folgendes hinzu-
fgen:
(6) Monika vermutet, da nicht ich spreche,
sondern jemand anders.
Nach (R
+
) wrde aber Erwin mit (6) im we-
sentlichen behaupten, da es keine Situation
gibt, die mit Monikas Vermutungen vereinbar
ist und in der Erwin spricht: die durch den in
(6) eingebetteten Satz ausgedrckte Proposi-
tion besteht aus den Situationen s, in denen
jemand spricht, dieser Jemand aber nicht
Sprecher in s ist; solche s kann es offenbar
nicht geben, so da die Bedingung (
+
) in
diesem Falle darauf hinausluft, da es keine
Situation s gibt, die mit Monikas Vermutun-
gen vereinbar ist und die mit s
0
den Sprecher
Erwin gemein hat. Doch Monika mag in der
skizzierten Situation s
0
sogar der Meinung
sein, da Erwin gerade etwas sagt; auf jeden
Fall widerspricht diese Annahme nicht ihren
Vermutungen ber Erwin, so da die be-
schriebenen Situationen s doch existieren. Sie
glaubt eben nur nicht, da Erwin der Sprecher
ist, den sie gerade, also in s
0
, hrt aber in
irgendwelchen anderen Situationen kann sie
ihn sich durchaus als Sprecher vorstellen.
(R
+
) funktioniert also auch nicht.
Wie ist es nun um die Alternative (B) be-
stellt? Danach ist (R*) vollkommen in Ord-
nung, und der Fehler ist in der Voraussetzung
zu suchen, da der in (4) eingebettete Satz (5)
die Proposition ausdrcke, nach der sich der
(jeweilige) Sprecher in Radolfzell aufhlt:
nehmen wir nmlich stattdessen an, die durch
(5) ausgedrckte Proposition bestnde aus
den Situationen, in denen Erwin in Radolfzell
ist, so wrde (4) laut (R*) besagen, da sich
Erwin in allen mit Monikas Annahmen kom-
patiblen Situationen in Radolfzell aufhlt;
9. Kontextabhngigkeit 161
werden. Um das Schema (K) allgemein an-
wendbar zu machen, kann man somit einfach
vereinbaren, da falls keine Auswertungs-
situation als solche deklariert wurde immer
die uerungssituation als Default-Wert her-
halten mu:
(D) Auerhalb intensionaler Konstruktionen
fungiert die uerungssituation als Aus-
wertungssituation.
Anhand von (D) lt sich ein interessanter
Aspekt des Unterschiedes zwischen den bei-
den weiter oben betrachteten Mglichkeiten
(A) und (B) zur Deutung eingebetteter da-
Stze aufzeigen. Nach (D) zeichnen sich nm-
lich intensionale Konstruktionen dadurch
aus, da man bei ihnen neben der uerungs-
situation noch weitere Situationen zur Exten-
sionsbestimmung heranzieht: die Auswer-
tungssituation kann hier gegenber dem Aus-
gangspunkt verschoben werden. Dies erinnert
an die nach der verworfenen Alternative (A)
postulierte Verschiebung situationeller
Aspekte. Nach (D) werden sogar (innerhalb
intensionaler Konstruktionen) Situationen als
ganze verschoben. Da dies aber nicht wieder
zu den im Zusammenhang mit (6) angetrof-
fenen Schwierigkeiten fhrt, liegt daran, da
durch die Unterscheidung zwischen ue-
rungs- und Auswertungssituation der Aus-
gangspunkt der Verschiebung, die ue-
rungssituation, immer erhalten bleibt: wenn
auch das Hauptverb vermutet in (6) bewirkt,
da der eingebettete Nebensatz in diversen
Auswertungssituationen betrachtet wird, so
kann sich sein Subjekt ich dennoch nach der
uerungssituation des Gesamtsatzes rich-
ten.
Normalerweise wird (D) nur fr den spe-
ziellen Fall eines nicht eingebetteten Aussa-
gesatzes gefordert; auf die allgemeine Ver-
sion kann man dann mit irgendwelchen Hilfs-
annahmen schlieen. In jedem Falle erhlt
man auf diese Weise ein einfaches Rezept zur
Ermittlung der Extension (des Wahrheitswer-
tes) v von in einer uerungssituation s
0
:
v =
(s
0
)(s
0
), wobei
der Charakter von
ist. Stellt man sich Charaktere als Tabellen
vor, in denen fr jede Kombination von
uerungs- und Auswertungssituation die je-
weilige Extension eingetragen ist, so besagt
also (D), da fr extensionale Konstruktio-
nen (insbesondere auch fr Stze in Isolation)
nur die Eintrge auf der Diagonalen von In-
teresse sind. Dieses Bild von Charakteren als
Tabellen sollte man fr das folgende stets im
Auge behalten. An ihm wird besonders deut-
lich, da der ursprnglich (in einem in Ab-
Stzen mit mich in Objektsposition oder Ei-
gennamen als Subjekt unmittelbar einsehen.)
Soll also die Extension e des Subjekts ich
angegeben werden, so mu bekannt sein, wel-
che Situation s uerungssituation ist, wh-
rend die Auswertungssituation keine Rolle
spielt: e ist der Sprecher in s. Der Charakter
ich
von ich lt sich dann als eine Funktion
auffassen, die fr beliebige uerungssitua-
tionen s und Auswertungssituationen s als
Wert stets den Sprecher in der Situation s
liefert.
ich
ist also wie
5
eine Funktion, die
auf uerungssituationen angewandt wird
und deren Werte Intensionen sind, d. h. Funk-
tionen von Auswertungssituationen in Exten-
sionen. Dies gilt fr Charaktere im allgemei-
nen. Es ergibt sich somit das folgende Bild:
Die Pfeile sind dabei in folgendem Sinne zu
lesen: [am Ursprung des Pfeils] legt in [rechts
vom Pfeil] eindeutig [am Ziel des Pfeils] fest.
K steht fr die Klassische Kontexttheorie
von David Kaplan aus Kalifornien.
(K) ist natrlich nur dort anwendbar, wo
berhaupt sinnvoll zwischen uerungs- und
Auswertungssituation unterschieden werden
kann, also bei intensionalen Konstruktionen.
Doch lt sich das Schema leicht auf exten-
sionale Konstruktionen ausweiten: dazu ber-
legt man sich z. B., was passiert, wenn ein
Satz wie (5), dessen Charakter
5
wir ja jetzt
ungefhr kennen, als solcher behauptet wird.
Zunchst kann natrlich
5
auf die ue-
rungssituation s unmittelbar angewandt wer-
den; das Ergebnis ist die durch (5) in s aus-
gedrckte Proposition
5
(s), die aus den Si-
tuationen besteht, in denen die Person, die (5)
in s uert, in Radolfzell ist. Was aber ist die
Extension, der Wahrheitswert von (5) in s?
Das Schema (K) sagt, da man zur Beant-
wortung dieser Frage noch eine Auswertungs-
situation hinzuziehen mte; eine solche
scheint aber zunchst gar nicht gegeben zu
sein. Andererseits ist klar, da (5) in der
uerungssituation s natrlich genau dann
wahr ist, wenn die Person, die (5) in s uert,
in der Situation s selbst in Radolfzell ist, wenn
also s zu
5
(s) gehrt. Die durch (5) in der
uerungssituation ausgedrckte Proposi-
tion mu in diesem Fall also im Hinblick auf
die uerungssituation selbst ausgewertet
162 IV. Kontexttheorie
kleinen Teil der mglichen Situationen. Diese
Beobachtung ist insofern interessant, als sie
zeigt, da das obige Schema (K) keineswegs
dazu geeignet ist, die Extension von Aus-
drcken bezglich beliebiger Paare s,s von
Situationen zu ermitteln, wobei dann s als
uerungssituation fungiert und s als Aus-
wertungssituation. (Solche Paare s,s wer-
den wir ab jetzt als Referenzpunkte bezeich-
nen.) Wenn in s beispielsweise kein Sprecher
(oder uerer) zugegen ist, ist (K) berhaupt
nicht anwendbar. Charaktertabellen sind also
nicht quadratisch, und ihre Diagonalen
durchkreuzen nur die den uerungssituatio-
nen vorbehaltene Hlfte:
schnitt 2.3 noch zu vertiefenden Sinne) zwei-
dimensionale Wahrheitsbegriff der klassi-
schen Theorie durch (D) auf eine Dimension
reduziert und somit berhaupt erst wieder mit
dem vortheoretischen Wahrheitsbegriff ver-
gleichbar wird.
Die Unterscheidung zwischen uerungs-
und Auswertungssituation markiert einen
Unterschied in der Rolle, die Situationen bei
der Bestimmung der Extension sprachlicher
Ausdrcke spielen knnen. Doch whrend of-
fenbar jede nur denkbare Situation in einer
Regel wie (R*) als Auswertungssituation her-
angezogen werden kann sind uerungssitua-
tionen nur solche, in denen eine sprachliche
uerung stattfindet; sie bilden nur einen
uerungssituation keine Rolle. Auf diese
Weise ergibt sich eine natrliche Klassifika-
tion sprachlicher Ausdrcke nach ihren Cha-
raktereigenschaften:
Definition:
(a) Ein sprachlicher Ausdruck a referiert di-
rekt, falls fr beliebige uerungssitua-
tionen s
0
und Auswertungssituationen s
und s gilt:
(s
0
)(s) =
(s
0
)(s).
(b) Ein Ausdruck referiert absolut, falls fr
beliebige uerungssituationen s
0
und
Auswertungssituationen s und s gilt:
(s
0
)(s) =
(s
1
)(s).
Direkt referentielle Ausdrcke sind also sol-
che, bei denen man die Auswertungssituation
1.3Arten der Referenz
Die Extension eines sprachlichen Ausdrucks
a ergibt sich nach (K) aus seinem Charakter
, einer uerungssituation s
0
und einer
Auswertungssituation s. Wie die bisher be-
trachteten Beispiele schon zeigen, gengt in
einigen Fllen neben
bereits die Kenntnis
einer der beiden Situationen, um die Exten-
sion
(s
0
)(s) eindeutig festzulegen. So ist es
beispielsweise fr das Wort ich vollkommen
gleichgltig, was s ist, da
ich
(s
0
)(s) stets der
Sprecher in der (uerungs-) Situation s
0
ist;
ganz analog spielt fr die Ermittlung der Ex-
tension eines Substantivs wie Vertreter die
9. Kontextabhngigkeit 163
Einerseits hngt der Wahrheitswert von (7)
immer von der Auswertungssituation ab. So
war die bislang bekannteste uerung von
(7) sicherlich falsch, denn der Sprecher
stammte aus Brookline (Mass.). Dennoch ist
es natrlich vorstellbar und insofern in einer
mglichen Situation s der Fall, da John F.
Kennedy in Berlin zur Welt gekommen ist.
Das beweist, da (7) nicht direkt referentiell
ist, denn
7
(s
0
)(s
0
)
7
(s
0
)(s), wenn s
0
die
entsprechende tatschliche Situation vor dem
Schneberger Rathaus ist und s so ist wie
beschrieben. Andererseits ist (7) natrlich
auch kein absoluter Ausdruck. uert nm-
lich etwa Arnim von Stechow den Satz (7),
so drckt er damit offenbar eine andere Pro-
position aus als der US-amerikanische Pr-
sident seinerzeit; findet die uerung in dieser
Welt statt, wird sie sich sogar im Wahrheits-
wert von ihrer berhmten Vorgngerin unter-
scheiden.
Es sollte beachtet werden, da (7) ein kom-
plexer Ausdruck ist. Eindeutige Flle von
Wrtern, die weder (a) noch (b) erfllen, sind
weitaus schwieriger zu finden. Es gibt aller-
dings gewisse Verwendungsweisen absoluter
Wrter, die eine Abhngigkeit der Extension
von der uerungssituation nach sich ziehen.
So kann man bei zweistelligen, also auf Re-
lationen oder Funktionen bezogenen Sub-
stantiven wie Bruder oder Mutter das Argu-
ment weglassen, das dann aus der uerungs-
situation ergnzt werden mu:
(8) a. Bevor er zum Familientreffen fuhr, ra-
sierte sich Karl Marx. Nicht einmal die
Brder haben ihn daraufhin erkannt.
(8) b. Vor der Schwarzwaldklinik wurde ein
Sugling gefunden. Die Mutter ist nach
wie vor unbekannt.
Bei einer uerung von (8a) versteht man
zumindest normalerweise Brder im Sinne
von Brder von Karl Marx; ebenso bezieht
sich Mutter in (8b) natrlich auf die Mutter
des Findelkindes, von dem gerade die Rede
war. Genauer: die durch den zweiten Satz von
(8a) in einer uerungssituation s
0
ausge-
drckte Proposition
8
(s
0
) besteht aus den
(zeitlich vor s
0
liegenden) Situationen s, in
denen die Brder der in s
0
nahegelegten Person
den Referenten von ihn (also Karl Marx) nicht
erkennen; genauso besteht in einer ue-
rungssituation s
1
die durch den zweiten Satz
von (8b) ausgedrckte Proposition aus den
Situationen s, in denen die Mutter des in s
1
zur Debatte stehenden Kindes unbekannt ist.
im Schema (K) berspringen kann: sie bezie-
hen sich direkt, ohne Vermittlung einer In-
halts- oder Intensionsebene, auf die Welt. Ab-
solute Ausdrcke sind hingegen solche, die
inhaltlich, also auf der Intensionsebene, stets
dasselbe besagen, und zwar unabhngig da-
von, zu welcher Gelegenheit sie geuert wer-
den. Da beide Begriffe nur den Charakter
eines Ausdrucks a betreffen, kann man sie
auch direkt auf
beziehen, was wir gele-
gentlich tun werden.
Die obigen Begriffsbestimmungen schlie-
en nicht aus, da ein und derselbe Ausdruck
a sowohl direkt als auch absolut referiert.
Allerdings mu a dann per definitionem eine
konstante Charaktertabelle besitzen, seine
Extension mu also an allen Referenzpunkten
gleich sein:
(s
0
)(s) =
(s
1
)(s), fr beliebige s
0
, s
1
, s
und s.
Ausdrcke, die dieser harten Bedingung ge-
ngen, sind nicht gerade hufig, aber es gibt
sie: logische Wrter wie und, oder, nicht, jedes
etc. sowie tautologische Stze (wie es regnet
oder es regnet nicht) gehren zumindest nach
landlufiger Auffassung dazu; auch Eigen-
namen werden oft als absolut und direkt ana-
lysiert; wir schlieen uns dieser Praxis an.
Beide Auffassungen sind allerdings nicht ganz
unumstritten. (Siehe Abschnitt 4.4 bzw. Ar-
tikel 16.) Es sei darauf hingewisen, da die
Definition (a) nur verlangt, da die Extension
des betreffenden Ausdruckes nicht von der
Auswertungssituation abhngt, woraus aber
natrlich nicht folgt, da sie von der ue-
rungssituation echt abhngt. Diese Konse-
quenz lt sich aber erreichen, wenn (a) um
die Zusatzklausel erweitert wird:
(a)
fr irgendwelche uerungssituationen
s
0
und s
1
:
(s
0
)
(s
1
).
Direkt referentielle Ausdrcke a, die zustz-
lich der Bedingung (a) gengen, heien deik-
tisch. Typische deiktische Wrter sind du, ge-
stern und hier.
Die in (a) und (b) definierten Begriffe sind
gnzlich unabhngig voneinander. Ein Aus-
druck kann nicht nur (a) und (b) zugleich
erfllen oder (wie die deiktischen Ausdrcke)
direkt referentiell sein, ohne absolut zu refe-
rieren. Auch das Umgekehrte ist mglich, wie
rein inhaltliche Wrter wie essen oder Ver-
treter zeigen. Und schlielich gibt es eine
ganze Reihe von Ausdrcken, die weder di-
rekt noch absolut referieren. Schon bei einem
einfachen Satz wie (7) ist das der Fall:
(7) Ich bin ein Berliner.
164 IV. Kontexttheorie
Lehrwerken fr das Chemiestudium oder von
Lesefibeln die Rede ist. Sowohl den von eini-
gen Adjektiven unterdeterminierten Dimen-
sionen als auch den bei allen steigerbaren
Adjektiven zu beobachtenden schwankenden
Standards wird gelegentlich eine Abhngig-
keit von der uerungssituation nachgesagt.
Andererseits ist unbestritten, da der Aus-
wertungssituation bei der Bestimmung der
Extension von Adjektiven immer eine zentrale
Rolle zukommt: sie liefert die einschlgigen
Fakten. Betrachten wir dazu ein Beispiel. Bei
einer uerung von
(10) Die Studenten meinen, da das Hand-
buch Semantik ein zu schweres Buch ist.
kann die Sprecherin irgendeiner Gruppe von
Studenten entweder eine Meinung ber das
Gewicht des vorliegenden Werkes zuschreiben
oder aber eine Einstellung zu dessen intellek-
tueller Zumutbarkeit; doch sie kann damit
nicht zum Ausdruck bringen, da die besag-
ten Studenten dieses Buch fr in jedem Sinne
zu schwer halten. Die Proposition, zu der in
(10) eine Einstellung konstatiert wird, besteht
also (in erster Annherung) entweder aus den-
jenigen (Auswertungs-) Situationen, in denen
das Handbuch Semantik mehr wiegt als man
tragen kann, oder sie ist die Menge der Si-
tuationen, in der dasselbe Buch von der Le-
serschaft zu viel abverlangt. Um welche Pro-
position es sich handelt, hngt dabei offenbar
davon ab, auf welche Dimension sich die
Sprecherin mit schweres bezieht; und das wie-
derum wird vom Thema des Gesprchs und
insofern von der uerungssituation zumin-
dest beeinflut. Auf hnliche Weise argumen-
tiert man dafr, da auch die Wahl des Ver-
gleichsstandards der uerungssituation ob-
liegt. Doch stehen Dimension und Standard
erst einmal fest, so hngt die Extension von
schwer immer noch von der Auswertungssi-
tuation ab: ob etwa eine Auswertungssitua-
tion s zur Menge der Situationen gehrt, in
denen das Handbuch Semantik ein greres
Gewicht hat als Barwise (ed.) (1977) (oder ein
anderer akzeptierter Standard), hngt von
den Fakten in s selbst ab und nicht von dem,
was in der uerungssituation der Fall ist.
Wir mten demnach fr schwer folgenden
Typ von Bedeutungsregel ansetzen:
(R
schwer
)
Es sei s
0
eine uerungssituation, s
eine Auswertungssituation, und X sei
diejenige Vergleichsdimension aus
der Menge {Gewicht, Schwierigkeits-
grad, ...}, die in s
0
am wichtigsten ist.
Dann ist
schwer
(s
0
)(s) eine Funktion,
In beiden Fllen mu also das fehlende Ar-
gument aus der uerungssituation erschlos-
sen werden. Wie dies genau geschieht, soll an
dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden
(siehe aber Abschnitt 3.3). Hier sei lediglich
darauf hingewiesen, da fehlende Argumente
nicht immer aus der uerungssituation er-
gnzt werden knnen und drfen. Oft bleibt
das Argument nmlich unbestimmt:
(9) Vater werden ist nicht schwer.
Hier wird Vater wie Vater von jemand oder
Vater eines Kindes benutzt und eben nicht im
Sinne von Vater von x, wobei x dann eine
durch die jeweilige uerungssituation na-
hegelegte Person ist. (Zu Stzen wie (9) vgl.
Abschnitt 4.3).
Ein anderer Fall, in dem die Extension
eines einzelnen Wortes von uerungs- und
Auswertungssituation zugleich abhngt, liegt
bei flektierten Verbformen wie schlfst vor:
anders als bei dem absoluten Wort schlafen
hngt die Extension der finiten Form von der
uerungszeit (und mglicherweise auch vom
Sprecher) ab. Doch dieses Wort lt sich als
Produkt einer syntaktischen Regel bzw. eines
morphologischen Prozesses und nicht als
nacktes Lexem einstufen; unter Verwendung
der grammatischen Terminologie: schlfst zer-
legt sich in V + INFL, wobei letzteres deik-
tisch, ersteres aber absolut referiert. hnlich
kann man das Possessivpronomen mein in das
deiktische Wort ich und ein possessives Ele-
ment zerlegen (vgl. dazu Abschnitt 3.3). Wir
haben damit Anla zu der folgenden Hypo-
these ber das Lexikon:
(L) Lexikalische Grundeinheiten sind immer
deiktisch oder absolut.
Von den Extensionen gewisser Adjektive wird
gelegentlich eine doppelte situationelle Ab-
hngigkeit behauptet. Ein einschlgiges Bei-
spiel ist das Adjektiv aus (9). In Verbindung
mit einem Substantiv verweist es in seiner
Grundform (Positiv) auf eine Menge, deren
genaue Zusammensetzung von vielerlei Fak-
toren abhngt. Ob ein bestimmter Gegen-
stand in der durch schweres Lehrbuch deno-
tierten Menge liegt, hngt unter anderem da-
von ab, auf welche Dimension sich der Spre-
cher mit schwer bezieht: also etwa auf den
Schwierigkeitsgrad der Lektre oder einfach
auf das Gewicht des Papiers; und innerhalb
derselben Dimension gibt es unterschiedliche
Standards: die Standards fr Lesbarkeit
schwanken mit der vom Sprecher ins Auge
gefaten Leserschaft, und die Gewichtskrite-
rien haben auch etwas damit zu tun, ob von
9. Kontextabhngigkeit 165
Verb wissen ausgedrckten Relation steht.
Der Unterschied zwischen den beiden Vari-
anten besteht lediglich darin, da in letzterem
der Sprecher zustzlich zu verstehen gibt, da
er selbst das betreffende Tier nicht gerade
verehrt. Doch dieser Unterschied spielt keine
Rolle bei der Ermittlung der Intension p
des
eingebetteten Satzes und insofern auch nicht
fr den Charakter der in ihm vorkommenden
Wrter. Hund und Kter sind charaktergleich
und referieren absolut; sie besttigen somit
die Hypothese (L). Die Frbung gehrt of-
fenbar einer vom Charakter unabhngigen
semantischen Dimension an.
Die Hypothese (L) sagt etwas darber aus,
wie sich die kleinsten sprachlichen Bedeu-
tungstrger auf die Welt beziehen. Im Falle
eines deiktischen Wortes wird die Extension
direkt aus Merkmalen (Aspekten) der ue-
rungssituation ermittelt. Dies gilt auch dann,
wenn das Wort in eine intensionale Konstruk-
tion eingeht: der Beitrag, den ein deiktisches
Wort zur Bestimmung der Intension eines
Ausdrucks leistet, in dem es vorkommt, er-
schpft sich in seiner Extension:
(12) Caroline htte fast bersehen, da heute
die Sonne scheint.
Mit einer uerung dieses Satzes am
26. 12. 1953 wird beispielsweise gesagt, da
Caroline in einer bestimmten Relation (des
Beinahe-bersehens) zu der Menge p der
Situationen steht, in denen am 26. 12. 1953 die
Sonne scheint. Das deiktische Wort heute
bringt in die Proposition p lediglich den Tag
der uerung ein; p ist also eine singulre
Proposition ber den 26. 12. 1953. Im Gegen-
satz dazu trgt z. B. das Verb scheint zu p wie
zur Intension des Gesamtsatzes auch einen
Inhalt, eine Intension, bei: die bloe Kenntnis
der Extension von scheint in der uerungs-
situation reicht zur Bestimmung von p nicht
aus. Die Fhigkeit, Extensionen direkt in den
Aufbau von Intensionen (wie p) einflieen zu
lassen, ist das semantische Hauptcharakteri-
stikum deiktischer Wrter und motiviert die
Redeweise von der direkten Referenz. Ge-
legentlich wird sogar gesagt, da deiktische
Wrter wie heute dafr sorgen, da ihr Re-
ferent aufgrund der Singularitt ein Teil
der ausgedrckten Proposition ist. Dieser Re-
deweise werden wir uns nicht anschlieen, da
sie auf Schwierigkeiten bei der Przisierung
stt; der Begriff der singulren Proposition
ist, nebenbei bemerkt, schon heikel genug.
Der Beitrag deiktischer Wrter zum Inhalt
der Ausdrcke, in denen sie vorkommen, be-
die einer beliebigen Menge M die-
jenigen Gegenstnde y zuweist, fr
die gilt:
y ist in M, und in s kommt y bezg-
lich X ein hherer Wert zu als dem
in s
0
einschlgigen X-Standardwert.
(M ist die Extension des Bezugsnomens.) Ad-
jektive wie schwer scheinen also auf doppelte
Weise gegen die Hypothese (L) zu sprechen.
Doch so einfach ist die Sache wiederum auch
nicht. Wie wir im nchsten Abschnitt sehen
werden, wird die unterdeterminierte Dimen-
sion keineswegs immer von der uerungs-
situation beigetragen. Und was den Standard
angeht, so wird er bei der Extensionsbestim-
mung des Positivs stets vergleichend heran-
gezogen: ein Lehrbuch ist schwer (in welchem
Sinne auch immer), wenn es (in diesem Sinne)
schwerer ist als der situationell vorgegebene
Standard. Damit wird offensichtlich der Po-
sitiv des Adjektivs auf den Komparativ (bzw.
ein allen Steigerungsfomen zugrundeliegendes
Grundlexem mit komparativischer Bedeu-
tung) zurckgefhrt. Und der Komparativ
referiert absolut. Der Positiv liee sich also
auch als das Ergebnis eines morphologischen
Prozesses auffassen und fiele damit nicht in
den Zustndigkeitsbereich von (L). (Siehe die
Artikel 31 und 32.)
(L) ist so gemeint, da sich das Lexikon
einigermaen einfach und plausibel so dar-
stellen und interpretieren lt, da (L) gilt; es
soll keineswegs behauptet werden, da (L) ein
zwingendes Prinzip ist, ohne das keine empi-
risch korrekte Beschreibung des Deutschen
auskommen kann. Weiterhin sei beachtet, da
sich (L) definitionsgem nur auf die Frage
der Extensionsbestimmung bezieht und keine
anderen semantischen Dimensionen wie Stil,
Prsuppositionen etc. erfat. Es ist z. B. klar,
da bei einem pejorativ gefrbten Wort wie
Kter die Extension nur von der Auswer-
tungssituation abhngt, whrend die Frbung
von dem in der uerungssituation zu be-
stimmenden Sprecher beigesteuert wird, wie
man sich an einem einfachen Beispiel klar-
machen kann:
(11) Hermann wei, da Hellas Hund ge-
storben ist.
(11) Hermann wei, da Hellas Kter ge-
storben ist.
In (11) und (11) wird ber den Trger des
Namens Hermann jeweils dasselbe ausgesagt,
da er nmlich zu einer gewissen Proposition
p
, die aus den Situationen besteht, in denen
Hellas Hund gestorben ist, in der durch das
166 IV. Kontexttheorie
beitsweise von dthat macht man sich am be-
sten anhand metasprachlicher Beschreibun-
gen der Charaktere absoluter Ausdrcke klar:
angenommen,
der Angesprochene
(s
0
)(s) sei die in s
angesprochene Person. Dann ergibt sich
dthat(der Angesprochene) als die in s
0
ange-
sprochene Person. Das Ergebnis des dthat-
Operators lt sich immer als eine solche Ein-
setzung von uerungs- fr Auswertungssi-
tuationen darstellen. Mehr dazu erfhrt man
in Abschnitt 2.3.
1.4Arten der Kombination
Das Schema (K) fhrt nicht nur zu einer
natrlichen Klassifikation sprachlicher Aus-
drcke nach ihren referentiellen Eigenschaf-
ten. Man kann es auch benutzen, um ver-
schiedene Typen syntaktischer Konstruktio-
nen zu unterscheiden. Dafr ist es ntzlich,
sich der Begriffsbildungen der algebraischen
Semantik zu bedienen [vgl. dazu auch Artikel
7] und diese Konstruktionen als Operationen
ber sprachlichen Ausdrcken oder ihren Tie-
fenstrukturen aufzufassen. Danach gibt es
z. B. im Deutschen eine Operation R, die aus
einem Nomen und einem (kongruenten) Re-
lativsatz ein komplexes Nomen erstellt:
R(Kind,das weint) = Kind, das weint, etc. Im
allgemeinen nimmt eine syntaktische Kon-
struktion F eine bestimmte Anzahl n von Aus-
drcken (oder Tiefenstrukturen)
1
,...,
n
als
Argumente und liefert als Ergebnis wieder
einen Ausdruck (bzw. eine Tiefenstruktur).
Im Rahmen der hier favorisierten komposi-
tionellen Semantik geht man davon aus, da
sich der Charakter des Ergebnisses F(
1
,...,
n
)
aus den Charakteren der Argumente mit Hilfe
einer der Konstruktion F entsprechenden se-
mantischen Operation
F
bestimmen lt. Wir
haben also ein:
Allgemeines Kompositionalittsprinzip
Der Charakter eines komplexen Ausdrucks
ergibt sich aus dem Charakter seiner Teile
und der Art ihrer Kombination.
Im Falle der Relativsatzanbindung R ist die
entsprechende semantische Operation die
Schnittmengenbildung:
R
(
1
,
2
)(s
0
)(s) =
1
(s
0
)(s)
2
(s
0
)(s). Dabei wird vorausgesetzt,
da die Extension eines Relativsatzes wie die
eines Nomens eine Menge ist. R ist also (im
Sinne des Abschnitts 1.1) extensional, da an
jedem Referenzpunkt die Kenntnis der Exten-
sionen der beiden Argumente ausreicht, um
die Extension des Ergebnisses festzulegen. Im
allgemeinen ist eine n-stellige syntaktische
Konstruktion F extensional, falls extensions-
gleiche Teilausdrcke stets zu extensionsglei-
steht also lediglich in ihrem jeweiligen Refe-
renten. Aber mit der Angabe des Referenten
ist natrlich nicht die Bedeutung oder Funk-
tion eines deiktischen Wortes hinreichend be-
schrieben. Denn die Extension variiert von
(uerungs-) Situation zu Situation, und die
Art und Weise der Variation macht gerade
den Charakter eines solchen Wortes aus: die
Ebene der Auswertungssituation kann ja bei
direkter Referenz getrost bersprungen wer-
den. Bei dieser Betrachtungsweise stellt sich
der Charakter eines deiktischen Wortes als
eine Art Mini-Intension dar: als eine partielle
Funktion von Situationen in Extensionen,
aber eben als eine solche Funktion, die nur
fr uerungssituationen definiert ist. Die so
durch berspringen der redundanten Aus-
wertungs-Ebene aus dem Charakter
eines
direkt referentiellen Ausdrucks a gewonnene
Mini-Intension nennen wir den deskriptiven
Gehalt
von : fr direkt referentielle ,
beliebige uerungssituationen s
0
und Aus-
wertungssituationen s und s gilt also:
(s
0
)
=
(s
0
)(s) =
(s
0
)(s). Der deskriptive Ge-
halt eines deiktischen Ausdrucks entspricht
meistens mehr oder weniger der Intension
irgendeines absoluten Ausdrucks. So ist die
Intension von der Angesprochene ungefhr
gleich dem deskriptiven Gehalt von du:
der Angesprochene
(s
0
)
du
, fr beliebige ue-
rungssituationen s
0
. In diesem Falle nennt
man den absoluten Ausdruck eine Umschrei-
bung des entsprechenden deiktischen Aus-
drucks: der Angesprochene ist also eine Um-
schreibung von du. Man beachte, da deik-
tische Ausdrcke und ihre Umschreibungen
niemals [!] charaktergleich sind. Die Um-
schreibung hebt lediglich die Variabilitt des
deiktischen Charakters auf eine begriffliche
Ebene. Oder, etwas prosaischer: die Abhn-
gigkeit der Extension eines deiktischen Aus-
drucks von der uerungssituation wird in
der Umschreibung zu einer Abhngigkeit von
der Auswertungssituation.
Der Zusammenhang zwischen deiktischem
Charakter und Umschreibung kann als das
Werk eines an der sprachlichen Oberflche
unsichtbaren Operators aufgefat werden,
der alle Situationsabhngigkeiten auf die
uerungssituation bezieht. Dieser Operator
hat den etwas umstndlichen und schwer zu
artikulierenden Namen dthat [phonetisch:
dt]. Die Extension eines Ausdrucks der Ge-
stalt dthat() bestimmt sich fr uerungs-
situationen s
0
und Auswertungssituationen s
wie folgt:
dthat()
(s
0
)(s) =
(s
0
)(s
0
). Die Ar-
9. Kontextabhngigkeit 167
der Relativsatz-Anbindung. Der Grund dafr
liegt in dem unterschiedlichen Verhalten von
Einstellungsverb und Nebensatz: whrend
letzterer seine gesamte Intension besteuert,
interessiert bei ersterem lediglich die Exten-
sion. Die Konstruktion ist damit sozusagen
ex-intensional. Auf solche gemischten Kon-
struktionen lt sich der Begriff der Kano-
nizitt dann bertragen, wenn man sie immer
auf dieselbe Operation ber Extensionen (von
Einstellungsverben) und Intensionen (von
Stzen) reduzieren kann. Dieser Art von Ka-
nonizitt gengen wiederum mglicherweise
alle in diesem Sinne gemischten Konstruktio-
nen.
Man kann sich leicht berlegen, da jede
extensionale Konstruktion auch intensional
ist; das Umgekehrte gilt natrlich nicht. Aber
gibt es eigentlich Konstruktionen, die nicht
einmal intensional sind? Die bisherigen De-
finitionen schlieen das nicht aus. Dennoch
geht allein die Idee einer nicht-intensionalen
Konstruktion gegen den Geist der hier dar-
gestellten Theorie, weswegen man semanti-
sche Operationen, bei denen die Extension
des Ergebnisses nicht durch die Intensionen
der Argumente festgelegt wird, als Monster
bezeichnet. Die klassische Theorie der Kon-
textabhngigkeit legt das folgende Prinzip
nahe:
(M) In der natrlichen Sprache gibt es keine
Monster: syntaktische Konstruktionen
sind immer (hchstens) intensional.
(M) ist lediglich eine Reformulierung des Fre-
geschen Kompositionalittsprinzips im Rah-
men des Schemas (K) und als Einschrnkung
des Allgemeinen Kompositionalittsprinzips.
Aus den bisherigen Betrachtungen lt sich
(M) etwa folgendermaen motivieren: ein
Monster mte fr mindestens eines seiner
Argumente die Abhngigkeit der Extension
von der uerungssituation in Betracht zie-
hen; die uerungssituation wird damit aber
hypothetisch verschoben, durch eine andere
Situation ersetzt, womit sie letztlich zur Aus-
wertungssituation wird: das vermeintliche
Monster entpuppt sich so als falsch verstan-
dene intensionale Konstruktion. Dieses Ar-
gument, das sich weiter ausbauen und przi-
sieren liee (vgl. Artikel 7), mutet schon fast
wie eine definitorische Wegerkrung jeglicher
Monster an. Da sich die Sache dennoch
nicht so einfach verhlt, kann man anhand
eines Beispiels einsehen. Wir kommen dazu
auf die im vorhergehenden Abschnitt erwhn-
ten dimensionell unterbestimmten Adjektive
zurck. Auch wenn die fehlende Dimension
chen Gesamtausdrcken fhren, falls also fr
alle Charaktere
1
,
1
...,
n
,
n
und Referenz-
punkte s
0
,s gilt:
1
(s
0
)(s) =
1
(s
0
)(s), ...,
n
(s
0
)(s) =
n
(s
0
)(s) impliziert
F
(
1
, ...,
n
)(s
0
)(s)(s) =
F
(
1
, ...,
n
)(s
0
)(s). Natrlich
ist nach dieser Definition eine solche Kon-
struktion F genau dann extensional, wenn
sich die entsprechende semantische Operation
F
jeweils, also an jedem Referenzpunkt
s
0
,s, in dem Sinne auf eine Operation
ber Extensionen zurckfhren lt, da fr
beliebige Charaktere
1
, ...,
n
, gilt:
F
(
1
, ...,
n
) (s
0
) (s) = (
1
, (s
0
) (s), ...,
n
(s
0
) (s)).
Bei dem Relativsatz-Beispiel ist natrlich
immer die Schnittbildung und hngt
somit insbesondere nicht vom Referenzpunkt
ab. F ist in diesem Sinne kanonisch extensio-
nal; mglicherweise ist jede (tatschliche) ex-
tensionale Konstruktion kanonisch.
Wie wir bereits in Abschnitt 1.1 am Beispiel
der Satzeinbettung unter Einstellungsverben
gesehen haben, kommt man mit dem Naiven
Kompositionalittsprinzip nicht aus: nicht
alle tatschlich vorkommenden syntaktischen
Konstruktionen sind extensional. Manchmal
mu man auch die Intensionen der beteiligten
Ausdrcke kennen, um die Extension des Ge-
samtausdrucks zu bestimmen. Immerhin
braucht man aber im Falle einer intensionalen
Konstruktion nicht die gesamten Charaktere
der Teilausdrcke zu kennen, um die Exten-
sion des Ergebnisses zu ermitteln. Im allge-
meinen ist eine n-stellige syntaktische Kon-
struktion F intensional, falls jeweils inten-
sionsgleiche Teilausdrcke stets zu exten-
sionsgleichen Gesamtausdrcken fhren, falls
also fr alle Charaktere
1
,
1
, ...,
n
,
n
und
Referenzpunkte s
0
,s gilt:
1
(s
0
) =
1
(s
0
),
...,
n
(s
0
) =
n
(s
0
) impliziert
F
(
1
, ...,
n
) (s
0
)
(s) =
F
(
1
, ...,
n
) (s
0
) (s). Natrlich ist nach
dieser Definition eine solche Konstruktion F
genau dann intensional, wenn sich die ent-
sprechende semantische Operation
F
jeweils,
also in jeder uerungssituation s
0
, in dem
Sinne auf eine Operation ber Intensionen
zurckfhren lt, da fr beliebige Charak-
tere
1
,...,
n
gilt:
F
(
1
, ...,
n
) (s
0
) =
(
1
(s
0
), ...,
n
(s
0
)). Im Falle der erwhnten
Satzeinbettung entspricht die semantische
Operation stets einer bestimmten Art von (in-
tensionaler) Funktionalapplikation; die ge-
naue Spezifikation dieser Operation und ihrer
intensionalen Entsprechung wird der Leserin
berlassen. Sie wird dabei auch hier eine ge-
wisse Kanonizitt beobachten, die jedoch
nicht so leicht zu definieren ist wie im Falle
168 IV. Kontexttheorie
gewissen (in Abschnitt 2.1 zu besprechenden)
Variante der gegenwrtigen Theorie auf be-
friedigendere Art und Weise geben. Doch wie
immer s
1
genau ermittelt wird: es handelt sich
dabei um eine von s
0
verschiedene Situation,
und diese Verschiebung der uerungssitua-
tion macht zum Monster.
Das gerade diskutierte Beispiel ist ein Ver-
treter eines Typs montrser Konstruktionen,
wie sie in der Literatur vorgeschlagen wurden.
Weitere mgliche Monster werden wir noch
kennenlernen. Auch die Frage, ob und wie
sich zumindest einige von ihnen vermeiden
lassen, wird uns noch beschftigen. Schon in
Abschnitt 2.1 werden wir eine Mglichkeit
kennenlernen, dem soeben beschriebenen
Monster durch einen theoretischen Schlen-
ker zu entkommen.
2. Varianten und Alternativen
Die klassische Theorie ist nicht konkurrenz-
los. Vieles, was man mit ihr machen kann,
lt sich ebensogut oder sogar noch besser
im Rahmen anderer Theorien erreichen, deren
Begriffsbildungen zwar teilweise mit den klas-
sischen verwandt sind, die aber dennoch an-
dere Sichtweisen einbringen. Die folgende
Synopse soll den Leserinnen einen groben
berblick ber die wichtigsten mglichen Ab-
weichungen von der klassischen Perspektive
vermitteln. Aus Platzgrnden ist die Darstel-
lung allerdings weniger ausfhrlich als in Teil
1; mitunter kommt sie nicht einmal ber den
Rang einer groben Skizze hinaus. Fr tiefere
Einsichten mu daher auf die in Abschnitt
5.2 genannte Literatur verwiesen werden.
2.1Parametrisierung
Aus den bisher betrachteten Beispielen wird
deutlich, da sich die Rolle der uerungs-
situation s
0
bei der Extensionsbestimmung
(durch den Charakter) jeweils auf den Beitrag
gewisser Aspekte beschrnkt: fr ich bentigt
man den Produzenten der in s
0
gettigten
uerung, gestern verweist auf den Vortag
des Tages von s
0
, hier bezieht sich auf den
Ort, an dem sich s
0
abspielt, etc. Was sind
nun Aspekte von (uerungs-) Situationen
im allgemeinen? Diese Frage lt sich wohl
auf mehrere quivalente Arten beantworten.
Wir werden jedenfalls situationelle Aspekte als
Werte gewisser Funktionen auffassen, die
(konkreten) Situationen irgendetwas zuord-
nen; die Funktionen selbst bezeichnen wir
dabei als situationelle Parameter. So verstehen
wir unter dem Orts-Parameter eine Funktion,
oft irgendwie aus der uerungssituation er-
schlossen werden kann, kann es passieren,
da keine der vom Adjektiv her denkbaren
Dimensionen in einer gegebenen Sprechsitua-
tion sonderlich naheliegt. Um nicht miver-
standen zu werden, mu sich der Sprecher in
so einer Situation klarer ausdrcken, als es
das betreffende Adjektiv erlaubt. Dazu kann
er auf ein expliziteres Adjektiv zurckgreifen:
neben schwer gibt es z. B. das dimensionell
determinierte schwierig bzw. das (in der ein-
schlgigen Lesart) etwas angestaubte gewich-
tig. Oft besteht auch die Mglichkeit, die feh-
lende Dimension durch Hinzufgung eines
Adverbs zu explizieren:
(13) Der zeitlich krzeste Weg nach Paris
fhrt ber Landau.
Wenn allerdings die von kurz unterbestimmte
Dimension (Dauer, Lnge, ...) von der ue-
rungssituation abhngen soll, dann wre die
in (13) eingesetzte Konstruktion der Modifi-
kation eines Adjektivs durch ein (Dimen-
sions-) Adverb ein Monster! Denn wird (13)
z. B. in einer Situation s
0
geuert, in der die
Lngendimension nher liegt als die Dauer,
so bezieht sich nach dieser Analyse das bloe
Adjektiv krzeste in s
0
auf die Lngenskala;
in der komplexen Adjektivphrase zeitlich kr-
zeste wird die Lnge dann aber durch die
Dauer ersetzt:
krzeste
(s
0
)(s) bezeichnet in Ver-
bindung mit einem Nomen a die Menge der-
jenigen Gegenstnde aus der Extension
(s
0
)(s) von , denen bezglich der durch s
0
bestimmten Dimension der geringste Wert zu-
kommt, die also von minimaler Lnge sind;
zeitlich krzeste
(s
0
)(s) liefert dagegen (in Verbin-
dung mit a) die Menge derjenigen Gegen-
stnde aus der Extension
(s
0
)(s) von , de-
nen bezglich der durch die Bedeutung von
zeitlich bestimmten Dimension der geringste
Wert zukommt, die also von minimaler Dauer
sind. Das Adverb zeitlich operiert somit in
der Weise auf dem Adjektivcharakter, da
statt der eigentlichen Extension am betrach-
teten Referenzpunkt die Extension des
(eingebetteten) Adjektivs an einem anderen
Referenzpunkt ermittelt wird, nmlich an
einem solchen, dessen uerungssituation fr
das eingebettete Adjektiv die Dimension der
Dauer nahelegt: die fragliche Kombintion
aus
zeitlich
und
krzeste
liefert also fr den
Punkt s
0
,s die Extension
krzeste
(s
1
)(s), wo-
bei s
1
wie s
0
ist auer da die fr kurz
nchstliegende Dimension in s
1
die Dauer ist.
Diese Bestimmung von s
1
ist mglicherweise
etwas unklar und liee sich im Rahmen einer
9. Kontextabhngigkeit 169
So wie die uerungssituation auf ihre
kontextuellen Aspekte reduziert werden kann,
lt sich auch die Auswertungssituation im
Prinzip auf das wesentliche zurechtstutzen
und somit als Liste von (fr die Bestimmung
der Extensionen sprachlicher Ausdrcke we-
sentlichen) situationellen Aspekten auffassen.
Aus der Auswertungssituation wird dann ein
Index. Ganz analog zu dem soeben Gesagten
gilt natrlich auch hier, da eine Auswer-
tungssituation s im allgemeinen mehreren In-
dizes entspricht, wobei die Frage, wieviele es
sind, vor allem wieder davon abhngt, welche
situationellen Parameter und Aspekte in-
dexikalisch sind. Die allgemeine Referenz-
theorie gibt darber keine Auskunft: ein In-
dex knnte ebensogut nur aus einem einzigen
Aspekt (etwa einer mglichen Welt) bestehen
wie aus einer Vielzahl von Aspekten, die in
ihrer Gesamtheit die Auswertungssituation je-
weils eindeutig festlegen. (Natrlich ist die
Anzahl der Aspekte nicht entscheidend fr
diese Mglichkeit der eindeutigen Festlegung:
der Aspekt, mit s identisch zu sein, legt s
ganz allein eindeutig fest; es ist allerdings
fraglich, ob und wann ein dermaen spezieller
Aspekt bei der Bestimmung einer Extension
jemals wirklich bentigt wird.) Allerdings sei
im folgenden stets vorausgesetzt, da indexi-
kalische Parameter und Aspekte automatisch
als kontextuell gelten. Diese Annahme ist so-
wohl theoretisch sinnvoll als auch empirisch
gerechtfertigt. Was den theoretischen Sinn an-
geht, so wird man im nchsten Absatz sowie
im Abschnitt 2.3 einige Hinweise finden; die
empirische Rechtfertigung wird auf Abschnitt
3.1 vertagt. Kontextuelle Parameter und
Aspekte, die nicht zugleich auch indexikalisch
sind, heien echt kontextuell. Echt kontex-
tuelle Aspekte sind naturgem solche, deren
Existenz mit der Tatsache zusammenhngt,
da in der betrachteten Situation eine ue-
rung stattfindet. Das typische Beispiel ist ein-
mal mehr der Sprecher.
So wie sich die uerungssituation in (K)
durch den von ihr determinierten Kontext
ersetzen lt, kann natrlich die Rolle der
Auswertungssituation von dem ihr entspre-
chenden Index gespielt werden; entsprechend
mu man dann Intensionen als Funktionen
von Indizes statt von (Auswertungs-)Situatio-
nen in Extensionen definieren. Diese Erset-
zung ist allerdings fr die klassische Theorie
nicht ganz so folgenlos wie der bergang von
uerungssituationen zu Kontexten. Denn
nicht alle kontextuellen Parameter tauchen
auch im Index auf, wodurch letzterer stets
die jeder Situation ihren Ort zuweist, der Vor-
tags-Parameter liefert fr ein gegebenes s den
Tag vor dem Tag von s, der Sprecher-Para-
meter ist eine partielle Funktion, die nur fr
uerungssituationen definiert ist und
macht, was man von ihr erwartet, usw.; und
Sprecher, Vortag und Ort einer (uerungs-)
Situation s
0
sind als Werte der entsprechenden
Parameter Aspekte von s
0
. Nach dieser De-
finition besitzt natrlich jede Situation eine
Unzahl von abwegigen und uninteressanten
Aspekten, von denen nur einige fr die Be-
stimmung von Extensionen relevant sind.
Welche dies ungefhr sind, wird uns noch in
Teil 3 beschftigen. Im folgenden werden wir
erst einmal so tun, als sei die Liste der ein-
schlgigen Parameter wohlbekannt; die Pa-
rameter selbst werden wir sogar gelegentlich
mit ihrer Stelle in dieser Liste identifizieren:
wenn also der Sprecher-Parameter die erste
Stelle einnehmen sollte, so werden wir ihn als
Parameter 1 bezeichnen etc.
Diejenigen situationellen Aspekte, die (in
einer bestimmten Sprache) fr die Bestim-
mung von Intension und Extension als Bei-
trag der uerungssituation herangezogen
werden, heien kontextuell; wir werden diesen
Begriff ebenso auf die entsprechenden situa-
tionellen Parameter anwenden. Im Schema
(K) knnte man also die uerungssituation
getrost durch die Gesamtheit ihrer kontex-
tuellen Aspekte ersetzen, ohne da sich am
Kern der klassischen Theorie irgendetwas n-
derte. Man knnte sogar Charaktere als
Funktionen auffassen, die Listen (also n-Tu-
peln oder Folgen) c von kontextuellen Aspek-
ten Intensionen zuordnen. Solche c bezeichnet
man blicherweise als Kontexte. Jeder ue-
rungssituation entspricht demnach genau ein
von ihr determinierter Kontext, aber derselbe
Kontext kann im Prinzip einer Unzahl von
uerungssituationen entsprechen wie-
viele es genau sind, hngt natrlich von An-
zahl und Art der kontextuellen Aspekte ab:
wre der Sprecher der einzige kontextuelle
Parameter, so bestnden Kontexte im we-
sentlichen aus Personen, und alle uerungen
Ronald Reagans fnden in diesem Sinne im
selben Kontext statt. Die Tatsache, da die
Determination nicht unbedingt eine ein-ein-
deutige Beziehung ist, zeigt, da der soeben
eingefhrte Kontextbegriff nicht immer ganz
dem intuitiven entspricht das ist wohl eher
bei dem Begriff der uerungssituation der
Fall doch gerade dieser Kontextbegriff ist
der in der logischen Semantik heutzutage b-
liche.
170 IV. Kontexttheorie
denen sich die klassische Theorie schwertut:
(14) Vor hundert Billionen Jahren hat es hier
geregnet.
Um zu sehen, wo hier die Schwierigkeit liegt,
stellen wir uns eine reale uerungssituation
s
0
von (14) vor, die zu irgendeinem Zeitpunkt
in der Vergangenheit stattfand. (14) ist dann
sicherlich insbesondere aufgrund des Al-
ters unseres Universums falsch. Doch was
sagt die klassische Theorie dazu? Nach (D)
ist zunchst die Auswertungssituation mit s
0
gleichzusetzen. Die den restlichen Satz ein-
bettende Prpositionalphrase vor hundert Bil-
lionen Jahren sorgt nun offenbar dafr, da
man sich bei der Auswertung auf Situationen
beschrnken soll, deren Zeit 10
14
Jahre zu-
rckliegt. Da der Satz jedoch keine Aussage
ber eine andere Welt o. . macht, mu man
offenbar die restlichen Aspekte von s
0
beibe-
halten. Aufgrund dieser berlegung mte
man die Konstruktion vor n Jahren + im
Rahmen der klassischen Theorie so deuten,
da das Ganze wahr wird, wenn die durch
ausgedrckte Proposition fr diejenige Aus-
wertungssituation den Wahrheitswert 1 lie-
fert, deren Zeit vor n Jahren liegt, die aber
ansonsten mit s
0
bereinstimmt. Da es nun
fr unser s
0
keine solche Situation gibt, kme
(14) wie erwnscht als falsch heraus.
Doch leider erginge es (15) in derselben Si-
tuation nicht anders:
(15) Vor einer Billiarde Jahren hat es hier
nicht geregnet.
Denn es gab (zumindest nach landlufiger
physikalischer Auffassung) keine Situation,
die sich zu dem in (15) angegebenen Zeitpunkt
tatschlich hier zugetragen hat; insbesondere
gab es dann auch keine solche regenfreie Si-
tuation. (15) wre also nach dieser klassischen
Analyse falsch. Diese sicherlich unerwnschte
Konsequenz liee sich wohl nur durch die
unabhngig nur schwer zu motivierende An-
nahme vermeiden, da die Negation in (15)
den gesamten Restsatz in ihren Skopus neh-
men msse.
Verschbe man stattdessen den Zeitaspekt
in der Bedeutungsregel fr vor n Jahren +
unabhngig vom Rest der Auswertungssi-
tuation, kme zwar ein Index heraus, der kei-
ner realen oder fiktiven Situation entspricht
weil er unter dem Aspekt Welt unsere harte
Realitt liefert, andererseits aber vor Big
Bang liegt; doch die Wahrheitsbedingungen
von (14) und (15) knnten dann korrekt er-
fat werden: da der besagte Index keiner Si-
weniger spezifisch ist. Whrend also die Aus-
wertungssituation wie in der Darstellung
(X) in Abschnitt 1.2 eigens hervorgehoben
wurde gelegentlich selbst eine uerungs-
situation sein kann, ist eine solche berein-
stimmung zwischen Kontext und Index prin-
zipiell unmglich. Insbesondere gibt es in der
Kontext-Index-Variante der klassischen
Theorie keine Diagonale im eigentlichen
Sinne. Allerdings entspricht natrlich (weiter-
hin unter der Annahme, da indexikalische
Aspekte auch immer kontextuell sind) jedem
Kontext c eindeutig ein durch Streichung der
rein kontextuellen Aspekte entstehender In-
dex i(c). Diese Entsprechung kann als Dia-
gonalen-Ersatz zur Reformulierung des Prin-
zips (D) herangezogen werden: Default-Wert
fr die Auswertung in s
0
ist dann nicht der
Punkt s
0
,s
0
, sondern c(s
0
),i(c(s
0
)), wobei
c(s
0
) der von s
0
determinierte Kontext ist.
Doch nicht alle Funktionen der Diagonalen
knnen in dieser Theorie-Variante simuliert
werden; wir werden das in Abschnitt 2.3 nach-
weisen.
Die Ersetzung von Auswertungssituatio-
nen durch Indizes liee sich natrlich auch
unter Beibehaltung der Abhngigkeit der In-
tension von der uerungssituation vorneh-
men, wodurch sich nichts Wesentliches gegen-
ber der Kontext-Index-Variante nderte.
Fr eine solche Beibehaltung der konkreten
uerungssituationen knnte der Umstand
angefhrt werden, da die Gesamtheit der
kontextuellen Parameter prinzipiell offen und
insofern nicht durch Auflistung darstellbar
ist. Ob dem allerdings wirklich so ist, hngt
nicht zuletzt von der bis zu einem gewissen
Grade frei zu whlenden Parametrisierung der
uerungssituation ab, ber die in Teil 3 noch
einiges zu sagen sein wird.
Die Einfhrung von Kontexten und Indizes
kann auch als Ausgangspunkt fr eine echte
Erweiterung des in Abschittt 1 dargestellten
Rahmens genutzt werden. Denn nach den
obigen Festlegungen sind Kontexte und In-
dizes Listen von situationellen Aspekten. Bis-
her sind wir zwar davon ausgegangen, da
die einzelnen Aspekte eines Kontexts oder
Index in dem Sinne aufeinander abgestimmt
sind, als sie jeweils Aspekte ein und derselben
(uerungs- bzw. Auswertungs-)Situation
sind; prinzipiell besteht aber natrlich die
Mglichkeit, neben derartigen stimmigen
Kontexten und Indizes auch solche Aspekt-
listen zu bercksichtigen, die jeweils keine
mgliche Situation determinieren. Und da
dies Sinn macht, zeigen Beispiele wie (14), bei
9. Kontextabhngigkeit 171
determiniert wird). Doch gilt hier wie stets
beim Umgang mit der Technik der unstim-
migen Indizes: man sollte sie nur im uersten
Notfall anwenden, wenn wirklich keine an-
dere Beschreibungsmethode mehr fat. Sie
kann nmlich allzu leicht dazu verleiten, jeden
Konflikt mit dem Monsterverbot durch eine
steigende Zahl von unabhngig variierenden
indexikalischen Aspekten zu umgehen. Das
Ergebnis wre einerseits eine anekdotisch an-
mutende und unbegrenzt erweiterbare Auf-
listung von zufllig gefundenen situationellen
Parametern anstelle der klaren klassischen
Trennung in uerungs- und Auswertungs-
situation. Zugleich wrde der Unterschied
zwischen Index und Kontext (bzw. ue-
rungssituation) immer mehr verwischt oder
zumindest graduell: ein Aspekt wie die nchst-
liegende Dimension ist natrlich beinahe kon-
textuell, weil die ihn verschiebenden Kon-
struktionen sehr selten und uerst gesucht
sind, und vielleicht ist es nur eine Frage der
Zeit, bis man fr einen beliebig gegebenen
kontextuellen Aspekt eine entsprechende Ver-
schiebungs-Konstruktion findet. Wir werden
uns deshalb im folgenden bemhen, mglichst
ohne Unstimmigkeiten in den Indizes auszu-
kommen und uns stattdessen im Rahmen der
klassischen Theorie von Teil 1 (bzw. einer
ihrer zu Anfang des gegenwrtigen Abschnitts
angedeuteten Varianten) bewegen. Auf die
grundstzliche Frage der Tragweite dieser
Strategie werden wir erst am Ende des Ka-
pitels (in Abschnitt 4.3) zurckkommen.
Fr den Kontextbegriff macht die Erwei-
terung auf unstimmige Aspektlisten keinen
guten Sinn. Zumindest lt sich in diesem
Falle kein Argument nach dem obigen Strick-
muster vorbringen, da ja kontextuelle
Aspekte niemals verschoben oder abgewan-
delt werden. Und der Ausgangspunkt ent-
springt stets der uerungssituation; er ist
daher von Natur aus stimmig. Diese berle-
gung kann gemeinsam mit den Beobach-
tungen zu (14) und (15) dazu benutzt wer-
den, eine Kontexttheorie zu favorisieren, die
auf uerungssituationen und teilweise un-
stimmigen Indizes basiert, in der also die In-
tension mit Hilfe einer konkreten Situation
ermittelt wird, whrend man zur Bestimmung
der Extension ein abstraktes Merkmals-Bn-
del, den Index, heranziehen mu. Anderer-
seits werden wir in Abschnitt 2.3 einige sehr
elegante semantisch-pragmatische Techniken
kennenlernen, die ohne eine Aufspaltung der
uerungssituation in Aspekte nicht aus-
kommen.
tuation entspricht, kann man davon ausge-
hen, da es an ihm auch nicht regnet, womit
(15) im Gegensatz zu (14) wahr wrde.
Wie man leicht nachprft, spielt fr diese
Analyse der Skopus der Negation in (15)
keine Rolle; die betreffende uerung wrde
in jedem Falle als wahr bewertet. Das spricht
offenbar fr eine Erweiterung des Index-
Begriffs auf Listen von indexikalischen
Aspekten, die mglicherweise untereinander
nicht stimmig sind.
Die obige Argumentation ist nicht absolut
stichhaltig. Wir haben nur angedeutet, da
eine bestimmte Anwendung der klassischen
Theorie auf Beispiele wie (14) und (15) zu
Schwierigkeiten fhrt. Es ist natrlich denk-
bar, da sich diese Schwierigkeiten durch
Rckgriff auf andere Ebenen der Semantik
(wie etwa eine Prsuppositions-Ebene) oder
andere semantische Regeln im Rahmen der
klassischen Theorie prinzipiell lsen lieen.
Diesen Punkt wollen wir hier allerdings of-
fenlassen.
Das Beispiel (15) ist natrlich weit herge-
holt, doch lt sich an ihm die Grundidee
hinter den unstimmigen Aspektlisten gut ein-
sehen. Eine etwas realistischere, aber dafr
weniger durchsichtige Anwendung derselben
Technik kann den zu Ende von Teil 1 aufge-
zeigten Konflikt um den Status der Dimen-
sions-Adverbien (bzw. der sie einfhrenden
syntaktischen Konstruktion) lsen. Man
braucht dazu nmlich nur die relevante Di-
mension als eigenen indexikalischen Parame-
ter zu fhren, der von den genannten Adver-
bien (aber nicht durch satzeinbettende Ver-
ben) verschoben wird. Das Ergebnis der Ver-
schiebung ist dann oft ein Index, der nicht
genau eine Situation determiniert (sondern
zumeist mehrere), womit die Frage der Be-
stimmung dieser Situation gegenstandslos
wrde. Diese Lsung des Problems der Di-
mensions-Adverbien ist allerdings nicht die
einzige Mglichkeit der Vertreibung des Mon-
sters aus Abschnitt 1.4; eine Alternative ergibt
sich durch Adaption der in Abschnitt 3.3 zu
diskutierenden Beschreibungstechniken.
Die Ersetzung von Auswertungssituatio-
nen durch unstimmige Indizes erlaubt es bri-
gens auch, intensionale Konstruktionen im
Sinne der Alternative (A) aus Abschnitt 1.2,
also durch Verschiebung einzelner Aspekte,
zu deuten, ohne da man auf die dort ange-
troffenen Schwierigkeiten stt: der Trick be-
steht darin, da das Ergebnis der Verschie-
bung nicht notwendigerweise eine (Auswer-
tungs-)Situation ist (bzw. von einer solchen
172 IV. Kontexttheorie
situation belegt werden. Man beachte, da
auf diese Weise die Unterscheidung zwischen
Charakter, Intension und Extension als ver-
schiedene Ebenen der semantischen Analyse
berflssig wird: ICH(x)(y) benennt einfach
die Extension des Wortes ich, whrend
ICH(x) und ICH Namen fr seine Intension
bzw. seinen Charakter sind; fr die zugrun-
deliegende logische Form gibt es also nur die
Ebene der Benennung, der Extension. Die
Darstellung der Situationsabhngigkeit der
Extension natrlichsprachlicher Ausdrcke
mit Hilfe von nur in der logischen Form sicht-
baren Variablen bezeichnet man daher als Ex-
tensionalisierung.
Bereits an der Deutung eines einzelnen
Wortes lt sich verdeutlichen, da der Un-
terschied zwischen der klassischen Charakter-
analyse (K) und der Tiefenanalyse vermittels
Extensionalisierung nicht so haarspalterisch
ist, wie er zunchst wirken mag: anstatt nm-
lich dem Pronomen ich analog zu (K) eine
Funktion zugrundezulegen, fr die dann ge-
zeigt werden kann, da eines ihrer Argumente
(die Auswertungssituation) leerluft, hat man
im Rahmen der Extensionalisierung die Mg-
lichkeit, dieses Argument einfach wegzulassen
und das Wort auf eine einstellige Funktion
zurckzufhren. Ganz allgemein lt sich
dann der in Abschnitt 1.3 eingefhrte Begriff
der direkten Referenz als Fehlen der der Aus-
wertungssituation entsprechenden Variablen
in der logischen Form darstellen; und ganz
analog zeichnet sich absolute Referenz durch
die Abwesenheit der uerungssituation aus.
Die so gewonnenen logischen Formen erlau-
ben also eine redundanzfreie und durchsich-
tige Darstellung der Situationsabhngigkeit
der Extension eines natrlichsprachlichen
Ausdrucks. Dies zahlt sich besonders im Falle
komplexer Ausdrcke mit gemischten Refe-
renzweisen (direkt, absolut etc.) aus: der Satz
ich bin Vertreter wird dann nicht als eine
Kombination der jeweils von zwei Argumen-
ten abhngigen Charaktere analysiert, son-
dern wenn man einmal das Tempus ver-
nachlssigt etwa so:
(16) VERTRETER(s)(ICH(s
0
))
Dabei sind s und s
0
wie bereits in den bishe-
rigen Ausfhrungen Variablen, die fr die
Auswertungs- bzw. die uerungssituation
stehen. Neu ist nur, da in der extensionali-
sierten Darstellung (16) der Charakterbegriff
eliminiert worden ist und die unterschied-
lichen Referenzweisen von Pronomen und
Substantiv direkt durch die verschiedenen Va-
riablen zum Ausdruck gebracht werden. Die
Bevor wir uns nach weiteren Alternativen
zur klassischen Theorie der Kontextabhngig-
keit umsehen, sei darauf hingewiesen, da es
sich bei dem soeben diskutierten Problem
nicht um die Frage der unstimmigen Refe-
renzpunkte handelt, also darum, ob man viel-
leicht gelegentlich mit Kontext-Index-Kom-
binationen arbeiten mu, die keiner gemein-
samen Situation entsprechen; denn das pas-
siert ja bereits im Prinzip schon in der klas-
sischen Theorie: die meisten Referenzpunkte
liegen nicht auf der Diagonalen (der Charak-
tertabellen), doch braucht man sie zur Er-
mittlung der Intension. Die durch (14) und
(15) aufgeworfene Frage lt sich berhaupt
erst sinnvoll stellen, wenn man die klassische
Theorie zu verlassen bereit ist und auf jeden
Fall Situationen durch entsprechende Aspekt-
listen ersetzt.
Auf die in diesem Abschnitt vorgenom-
mene Zerlegung von Situationen in Aspekte
werden wir im Rest dieses Kapitels immer
dann zurckgreifen, wenn es aus darstellungs-
technischen Grnden ratsam erscheint. Wir
gehen dann solange nichts Gegenteiliges
gesagt wird stets von einer Zerlegung so-
wohl der uerungs- als auch der Auswer-
tungssituation aus. Die so entstehende Vari-
ante der klassischen Theorie bezeichnen wir
von nun als Parametrisierung.
2.2Extensionalisierung
Die Extensionen sprachlicher Ausdrcke hn-
gen von irgendwelchen Situationen bzw. si-
tuationellen Aspekten ab. Um die Art und
Weise dieser Abhngigkeit im konkreten Fall
anzugeben, haben wir uns mit Hilfe meta-
sprachlicher Variablen auf die jeweils beteilig-
ten Situationen bezogen: der Charakter
ich-
des Personalpronomens ich wurde z. B. als
eine Funktion beschrieben, die fr beliebige
uerungssituationen s
0
und Auswertungssi-
tuationen s die in s
0
sprechende (oder schrei-
bende) Person liefert. Um die Extension von
ich festzustellen, bedarf es demnach der Funk-
tion
ich
, die ihrerseits gewisse Argumente be-
ntigt, um ein Ergebnis zu liefern. Stattdessen
knnte man das Wort ich selbst als Namen
der Funktion
ich
auffassen, deren Argumente
auf der sprachlichen Oberflche unausgespro-
chen bleiben. Anstatt also das Wort ich ver-
mittels seines Charakters zu deuten, wrde
man ihm dann eine logische Form der Gestalt
ICH(x)(y) zugrundelegen, wobei ICH ein
Funktionssymbol ist und die Variablen x und
y mit der uerungs- bzw. der Auswertungs-
9. Kontextabhngigkeit 173
Was diese Reformulierung des Monsterver-
bots besonders attraktiv macht, ist ihre groe
Anschaulichkeit und die Tatsache, da mit
ihr die zunchst etwas ungewohnten und ab-
strakten Betrachtungen aus Abschnitt 1.4 auf
die altvertraute Unterscheidung zwischen
freien und gebundenen Variablen zurckge-
fhrt werden. Die Tatsache, da (EM) eine
Darstellung in einer extensionalisierten logi-
schen Form voraussetzt, sollte man dabei
brigens nicht berbewerten: worauf es in
(EM) ankommt, ist das Verhalten gewisser
Variablen, und das kann man wenn man
den Umweg ber die logische Form vermei-
den mchte natrlich genausogut in den
metasprachlichen Bedeutungsregeln studie-
ren.
Die obige Formulierung (EM) spielt sich
im klassischen Rahmen (K) ab. Eine analoge
Formulierung lt sich fr die in Abschnitt
2.1 diskutierten Parametrisierungen finden,
insbesondere auch dann, wenn von unstim-
migen Aspektlisten Gebrauch gemacht wird.
In allen diesen Fllen mu man verschiedene
Sorten von Variablen fr kontextuelle und
indexikalische Aspekte einfhren und in dem
(EM) entsprechenden Prinzip von den kon-
textuellen Variablen (anstatt von solchen fr
die uerungssituation) sprechen.
Prdikatenlogische Formeln wie (16) las-
sen sich bekanntlich rein formal, also als Aus-
sagen ber einen beliebigen Individuenbe-
reich, interpretieren. Auf diese Weise gelangt
man zu einer abstrakten Referenztheorie, in
der die verschiedenen Situationstypen (oder
Aspekte) lediglich die Rolle von zunchst
nicht weiter spezifizierten Individuen spielen.
In einer solchen Theorie unterscheidet man
zwar normalerweise verschiedene Sorten von
Individuen (Objekte, Situationen etc.), doch
macht man ber die Vertreter der einzelnen
Sorten so wenig Annahmen wie mglich. Auf
diese Weise ist man gezwungen, alle fr die
logisch-semantische Analyse wesentlichen
Voraussetzungen in der Argumentation expli-
zit zu nennen. Darin liegt ein Vorteil dieser
abstrakten Betrachtungsweise. Zu ihren
Nachteilen gehrt, da sie den Unterschied
zwischen Situationen und Aspekten derselben
allzu leicht verwischen kann: die Werte der
entsprechenden Variablen sind eben beliebig.
Diese Beliebigkeit kann sogar den Neben-
effekt haben, da sich das fr die klassische
Theorie wesentliche Prinzip (D) nicht mehr
Beibehaltung der Notationskonventionen soll
betonen, da die zur Formulierung der Be-
deutungsregeln benutzte Metasprache in der-
selben expliziten Weise auf Situationen Bezug
nimmt wie die (extensionalisierten) logischen
Formen.
(16) ist nicht nur eine logische Form, son-
dern auch eine Formel der Logik oder
genauer gesagt: eine notationelle Variante
einer prdikatenlogischen Formel. Die Varia-
tion besteht lediglich darin, da man in der
(erststufigen) Prdikatenlogik normalerweise
keine Ausdrucksmglichkeiten fr Funktio-
nen besitzt, deren Werte wieder Funktionen
sind; stattdessen hat man Namen fr Relatio-
nen, was aber in unserem Fall auf dasselbe
hinausluft. Wir werden deshalb die Form
(16) fr das folgende mit der aus der Logik
vertrauteren Darstellung (16) identifizieren:
(16) VERTRETER(s, ICH(s
0
))
Abgesehen von der nicht besonders aufregen-
den Reduktion der Stellenzahl fr die Cha-
raktere direkt oder absolut referierender Aus-
drcke verhilft die Extensionalisierung noch
zu einer anderen Einsicht in das Zusammen-
spiel der zentralen Begriffe der klassischen
Kontexttheorie. Die Rede ist von der Unter-
scheidung zwischen uerungs- und Auswer-
tungssituation sowie dem in diesem Zusam-
menhang besonders wichtigen Prinzip (M) der
Monsterfreiheit. Wie wir gesehen haben,
zeichnen sich intensionale Konstruktionen
dadurch aus, da in ihnen die Extensionen
der beteiligten Ausdrcke in ihrer Variation
ber verschiedene Auswertungssituationen
betrachtet werden. Bezieht man dies auf die
Darstellung vermittels extensionalisierter lo-
gischer Formen, so heit das nichts anderes,
als da man bei diesen Konstruktionen von
der konkreten Belegung der entsprechenden
Variablen abstrahieren mu, da also diese
Variablen gebunden werden. (Abstraktion
vom konkreten Wert ist die allgemeinste
Form der Variablenbindung.) Das Prinzip (M)
wiederum besagt, da sich uerungssitua-
tionen in dieser Hinsicht grundstzlich anders
verhalten: es kann danach keine Konstruktio-
nen geben, die eine Verschiebung der konkret
vorgegebenen uerungssituation verlangen.
Dieser von (M) postulierte Unterschied in der
Rolle von uerungs- und Auswertungssitua-
tion lt sich auf die folgende griffige For-
mulierung bringen:
(EM)
Die uerungssituation ist ein freier
Parameter: die ihr in der logischen
Form entsprechenden Variablen dr-
fen nicht gebunden werden.
174 IV. Kontexttheorie
Darstellung (X), so erscheint dthat als waa-
gerechter Diagonaloperator, denn die Auswer-
tungssituation wird unter dthat in waagerech-
ter Richtung auf die Diagonale verschoben.
Das senkrechte Pendant zu dthat haben wir
indes noch nicht kennengelernt. Kein Wun-
der: ein solcher Operator verschiebt die ue-
rungssituation und ist damit ein nach (M)
gechtetes Monster. ber die Rolle dieses
Monsters in der logischen Sprachanalyse wird
noch in den Abschnitten 2.5 und 4.2 zu ver-
handeln sein. Hier sei zunchst einmal nur
festgehalten, da sich im Vergleich zwischen
waagerechter und senkrechter Diagonalisie-
rung die in der klassischen Theorie postulierte
Asymmetrie zwischen uerungs- und Aus-
wertungssituation offenbart: nur die letztere
kann auf die Diagonale verschoben werden.
Eine solche Asymmetrie wird in der zweidi-
mensionalen Modallogik normalerweise nicht
angenommen; sie ist ein zustzliches, fr diese
Anwendung charakteristisches Merkmal.
Die Asymmetrie zwischen uerungs- und
Auswertungssituation ist nicht nur eine Folge
des Monsterverbots (M). Sie besteht ohnedies
aufgrund der Tatsache, da die Charakterta-
bellen (X) nicht quadratisch sind, weil die
uerungssituationen nur einen Teil aller
(Auswertungs-) Situationen darstellen. Ins-
besondere durchkreuzt die Diagonale nicht
die gesamte Tabelle, so da es strenggenom-
men nicht nur einen, sondern eine ganze
Reihe von senkrechten Diagonaloperatoren,
aber nur einen waagerechten, nmlich dthat,
gibt: senkrechte Diagonalisierung sagt nur et-
was ber das Verhalten eines Operators auf
der linken, von der Diagonalen durchzogenen
Seite von (X) aus; verschiedene senkrechte
Diagonaloperatoren knnten sich in der rech-
ten Hlfte verschieden verhalten.
Die Analogie zwischen der zweidimensio-
nalen Modallogik und der Theorie der Kon-
textabhngigkeit wird interessanter, wenn
man von der klassischen Version zu der in
Abschnitt 2.1 skizzierten Parametrisierung
bergeht. Nimmt man nmlich wie dort
bereits vorgeschlagen an, da indexikali-
sche Aspekte immer auch zugleich kontextuell
sind, so ergibt sich eine natrliche Aufspaltung
i,i,c der (durch Aspektlisten vertretenen)
Referenzpunkte: in i sind die von der Aus-
wertungssituation determinierten Aspekte
i
1
,...,i
n
aufgelistet, i umfat die indexika-
lischen Aspekte i
1
,...,i
n
der uerungssi-
tuation, und c besteht aus den rein kontex-
tuellen Aspekten c
1
,...,c
m
derselben. Bei
dieser Aufspaltung der Referenzpunkte erge-
ohne weiteres formulieren lt; dafr mu
dann erst der Begriff der Diagonalen axio-
matisiert werden.
2.3Zweidimensionale Modallogik
Geht man von der Darstellung (X) in Ab-
schnitt 1.2 aus, dann lassen sich Charaktere
als Funktionen auffassen, welche Referenz-
punkten, also Paaren s
0
,s aus uerungs-
und Auswertungssituationen, irgendwelche
Objekte zuordnen. Wenn man auerdem ein-
mal fr einen Augenblick von dem Umstand
absieht, da nicht jede beliebige (Auswer-
tungs-) Situation zugleich auch eine ue-
rungssituation ist, dann erscheinen die De-
notate sprachlicher Ausdrcke einfach als in
doppelter Weise situationell abhngig. Dieser
Art Doppelabhngigkeit von Extensionen be-
gegnet man auch in der zweidimensionalen
Modallogik, wo einerseits logische Formeln
relativ zu Paaren von mglichen Welten ge-
deutet werden und wo andererseits gewisse
Modaloperatoren ber diese Weltenpaare
quantifizieren. Die klassische Theorie der
Kontextabhngigkeit lt sich also auch als
angewandte zweidimensionale Modallogik
verstehen: die Rolle der Welten wird hier von
den Situationen bernommen, und als Mo-
daloperatoren hat man beispielsweise die satz-
einbettenden intensionalen Konstruktionen,
deren Aufgabe es ist, von den jeweils betrach-
teten Auswertungssituationen zu abstrahie-
ren.
Zu den wichtigsten in der zweidimensio-
nalen Modallogik untersuchten Operatoren
gehren die sog. Diagonaloperatoren, die den
Auswertungspunkt auf die Diagonale (die
Menge der Weltenpaare der Gestalt w,w)
verschieben: diagonalisiert man einen Aus-
druck a der zweidimensionalen Modallogik
d. h. wendet man einen Diagonaloperator
auf ihn an so ist die Extension des resul-
tierenden Gesamtausdrucks an einem Wel-
tenpaar w,w einfach as Extension am ent-
sprechenden Punkt auf der Diagonalen. Es
gibt demnach genau zwei Diagonaloperato-
ren, von denen der eine den Auswertungs-
punkt auf w,w projiziert, whrend der an-
dere auf w,w verschiebt. Ersetzt man nun
Welten durch (Auswertungs-)Situationen, so
stellt sich heraus, da wir einen dieser beiden
Diagonaloperatoren bereits kennengelernt
haben: es handelt sich um den in Abschnitt
1.3 eingefhrten Operator dthat, der es ge-
stattet, einen deiktischen Charakter aus dem
einer entsprechenden absoluten Umschrei-
bung zu gewinnen. Orientiert man sich an der
9. Kontextabhngigkeit 175
eindeutiges Resultat. Die klassische Theorie
vermeidet dieses Problem, weil sie auch die
lokaleren, c und c determinierenden ue-
rungssituationen als Auswertungssituationen
zult. Diese Unumschreibbarkeit einiger
deiktischer Ausdrcke lt sich offenbar nur
dann vermeiden, wenn kontextuelle und in-
dexikalische Parameter zusammenfallen. Dies
lt sich dadurch erzwingen, da man einfach
jeden kontextuellen Parameter fr indexika-
lisch erklrt und jeden aufgespaltenen Refe-
renzpunkt i
1
,...,i
n
, i
1
,...,i
n
, c
1
,...,c
m
durch das lngere i
1
,...,i
n
,c
1
,...,c
m
,
i
1
,...,i
n
,c
1
,...,c
m
, ersetzt. ( ist die leere
Liste.) Wir bezeichnen diese knstliche Auf-
blhung der Indizes und Referenzpunkte als
Quadratur, weil sie die Charaktertabellen in
eine quadratische Form bringt. In Abschnitt
2.5 kommen wir darauf zurck.
Aus der Aspektlisten-Sicht lassen sich
auer den groen und kleinen Diagonalisie-
rungen auch noch mittelschwere Operatoren
definieren, die simultane Verschiebungen
mehrerer, aber nicht aller Aspekte auf die
Diagonale bewirken. In der Praxis kann man
diese sehr umstndlich zu definierenden Ope-
ratoren immer meiden, indem man z. B. meh-
rere Aspekte zu einem neuen vereinigt.
Die in Abschnitt 2.2 skizzierte Technik der
Extensionalisierung lt sich auch auf Sy-
steme der zweidimensionalen Modallogik an-
wenden. Man erhlt dann eine zweisortige
Logik, deren Ausdrcke die Eigentmlichkeit
aufweisen, da in ihnen hchstens zwei (be-
stimmte) Variablen der Sorte Situation frei
vorkommen drfen. Und die Diagonalope-
ratoren entpuppen sich dann als spezielle Er-
setzungsoperatoren, also solche, die alle freien
Vorkommen einer (bestimmten) Variablen
durch solche einer anderen Variablen erset-
zen. Der waagerechten Diagonalisierung
durch dthat entspricht z. B. ein Operator
DTHAT, der die Situationsvariable s bindet
und sich mit beliebigen Ausdrcken verbin-
det; die Extension von (DTHAT s) hngt
dann von der Variablenbelegung g ab und ist
dieselbe wie die von an der Belegung g, die
wiederum so ist wie g, auer da sie fr die
Variable s als Wert g(s
0
) liefert. Danach hat
(DTHAT s) stets dieselbe Extension wie das
durch Ersetzung aller freien Vorkommen von
s durch s
0
aus a hervorgehende [s/s
0
]. In der
Aspektlisten-Variante bewirkt DTHAT ent-
sprechend eine Ersetzung der indexikalischen
Variablen durch ihre kontextuellen Gegen-
stcke: aus der Auswertungswelt wird die
Realitt, die Zeit wird zum Jetzt etc. Per Ana-
ben sich diverse Diagonalen und dementspre-
chend verschiedene Mglichkeiten, Diagonal-
operatoren zu definieren. Zunchst einmal
gibt es natrlich nach wie vor den dthat-Ope-
rator, der am aufgespaltenen Referenzpunkt
i,i,c die Extension an i,i,c liefert. Doch
daneben kann man noch fr jeden indexika-
lischen Parameter j die entsprechende kleine
Diagonale
j
betrachten, die aus den Punkten
(bzw. Listen) besteht, fr die i
j
= i
j
, bei denen
also Auswertungs- und uerungssituation
im Aspekt j bereinstimmen. Fr jede solche
kleine Diagonale gibt es dann entsprechende
Operatoren, die die Auswertung vom vorge-
gebenen Referenzpunkt i,i,c auf den ent-
sprechenden
j
-Punkt verschieben und
zwar entweder (in waagerechter, zulssiger
Richtung) auf i
1
,...,i
j
,...,i
n
,i,c oder
(senkrecht und ungeheuerlich) auf
i,i
1
,...,i
j
,...,i
n
,c. Whrend also durch An-
wendung von dthat ein komplexer absoluter
Ausdruck wie am Ort und zur Zeit auf hier
und jetzt hinausluft, vermag eine (kleine)
Orts-Diagonalisierung die Bezge auf die
uerungssituation feiner zu differenzieren;
das Ergebnis kme inhaltlich dem Ausdruck
hier und zur Zeit gleich. Ein weniger gekn-
steltes Beispiel ist die waagerechte Weltenver-
schiebung, also das auf den Weltenparameter
eingeschrnkte dthat. Sein Effekt auf Stze
entspricht in etwa einer Modifikation durch
das Satzadverb tatschlich. Man beachte bri-
gens, da Verschiebungen vermittels kleiner
Diagonalisierungen im allgemeinen auf un-
stimmige Aspektlisten fhren.
Die in c enthaltenen echt kontextuellen
Aspekte entbehren offensichtlich jeder Mg-
lichkeit zur Diagonalisierung. Daraus folgt,
da sich deiktische Wrter im Rahmen
der Kontext-Index-Variante der klassischen
Theorie im allgemeinen nicht nach der gegen
Ende von Abschnitt 1.3 angedeuteten Me-
thode durch waagerechte Diagonalisierung
entsprechender absoluter Umschreibungen
gewinnen lassen. Der tiefere Grund dafr liegt
in dem unterschiedlichen Spezifikationsgrad
von Kontext und Index. Durch Streichung
der rein kontextuellen Aspekte knnen z. B.
zwei sich im Sprecher unterscheidende Kon-
texte c und c zusammenfallen: Sprecher(c)
Sprecher(c), aber i(c) = i(c). Damit ent-
spricht dem Index i(c) ein s, das mehrere
uerungen verschiedener Sprecher enthlt.
Wegen dieser berbesetzung der Sprecher-
Rolle fhrt von i(c) kein Weg zurck zum
Sprecher von c: die Auswertung der Um-
schreibung der Sprecher liefert an i(c) kein
176 IV. Kontexttheorie
Alains uerung von (17) bezieht sich die
Anrede auf Fabian, der im selben Moment
mit seiner uerung desselben Pronomens
seinen Freund Alain anspricht. Die ganze
Szene ist allerdings in dem Sinne vielleicht gar
keine uerungssituation, als in ihr mehr als
eine uerung stattfindet und wir bisher (zu-
mindest implizit) immer davon ausgegangen
waren, da sich uerungssituationen gerade
dadurch auszeichnen, da in ihnen genau eine
sprachliche uerung stattfindet. Man kann
nun vielleicht die beiden uerungen von (17)
und (18) in verschiedenen Situationsausschnit-
ten ansiedeln: Fabians uerung findet da-
nach in einem anderen Ausschnitt derselben
Situation statt als Alains, und die jeweiligen
Charaktere werden dann als Funktionen ber
diesen Ausschnitten definiert. Allerdings
funktioniert diese Strategie nicht immer so
glatt. Die gerade betrachtete Situation knnte
nmlich etwa durch den klrenden Auftritt
der Erzieherin Doris bereichert werden, die
im Verlaufe ihrer uerung von (19) zunchst
auf Fabian und anschlieend auf Alain zeigt:
(19) Whrend du das Haus wieder aufbaust,
kannst du ja den Flitzer holen.
Auch hier besitzt du offensichtlich zwei Ex-
tensionen, nmlich dieselben wie in den vor-
her betrachteten uerungen von (17) und
(18). Wollte man nun die beiden Teiluerun-
gen deshalb an verschiedenen Situationsaus-
schnitten a und a auswerten, bruchte man
noch zustzliche (der klassischen Theorie eher
fremde) Prinzipien zur Deutung komplexer
Ausdrcke. Denn was immer der relevante
Situationsausschnitt fr den Gesamtsatz (19)
sein soll er kann nicht sowohl mit a als
auch mit a zusammenfallen.
Beispiele wie (17)(19) legen den Ver-
dacht nahe, da die kleinsten deutungsrele-
vanten Situationsausschnitte aus uerungen
einzelner Wrter bestehen; man kann sie so-
gar mit solchen Wortuerungen identifizie-
ren. Was aber sind (Wort-) uerungen? Eine
naheliegende und bliche Antwort auf diese
Frage lautet: uerungen bestehen aus Aus-
drcken und (uerungs-) Situationen. Die-
ser uerungsbegriff ntzt uns hier allerdings
nicht viel, weil er gerade in den eben disku-
tierten Fllen nicht anwendbar ist: hier gab
es ja pro Situation mehr als eine uerung
von du. Eine Alternative ergibt sich, wenn
man die bisher als Grundeinheiten fungieren-
den sprachlichen Ausdrcke als (disjunkte)
Klassen von uerungen, ihren Realisierun-
gen oder Token, auffat. Danach wren etwa
logie knnte man jetzt erwarten, da [s
0
/s]
einer senkrechten Diagonalisierung ent-
spricht. Das stimmt jedoch nur ungefhr: das
ursprngliche a kann nmlich Bedingungen
enthalten, die wesentlich voraussetzen, da
sich die Variable s
0
auf eine uerungssitua-
tion bezieht etwa wenn in a vom Sprecher
in s
0
die Rede ist. Beim bergang zu [s
0
/s]
machen diese Bedingungen dann nicht mehr
fr jede Belegung von s einen Sinn; [s
0
/s]
definiert also nur eine partielle Funktion.
Doch jede Ausweitung dieser Funktion auf
den gesamten Bereich der Auswertungssitua-
tionen ist eine Diagonalisierung im Sinne der
obigen Festlegung.
In der Extensionalisierung zeigt sich bri-
gens eine elementare logische Eigenschaft, die
allen Diagonalisierungen ob gro, ob klein
oder mittelschwer gemeinsam ist: indem
sie alle von irgendwelchen situationellen
Aspekten abstrahieren, machen sie dieselben
berflssig. Das soll heien, da ein Aus-
druck, dessen Extension von einem gewissen
Aspekt abhngt, diese Abhngigkeit durch
Diagonalisierung verlieren kann. In gewisser
Weise haben wir diesen Effekt bereits kennen-
gelernt: das in Abschnitt 1.2 eingefhrte Prin-
zip (D) luft mit seiner Einsetzung der ue-
rungs- fr die Auswertungssituation auf eine
waagerechte Diagonalisierung, also ein un-
sichtbares dthat, hinaus und bewirkt so eine
Unabhngigkeit der Extension von der Aus-
wertungssituation womit letztere fr den
Extensionsbegriff (und speziell auch fr die
Wahrheit) entbehrlich wird. In Abschnitt 2.5
werden wir uns diesen Abstraktions-Effekt
der senkrechten Diagonalisierung zunutze
machen.
2.4Tokenanalyse
Die klassische Theorie geht in der in Teil 1
dargestellten Form davon aus, da die ue-
rungssituation die Extension eines deiktischen
Wortes wie du jeweils eindeutig festlegt. Oft
scheint dies aber gar nicht der Fall zu sein.
Betrachten wir z. B. einmal eine fr den Kin-
dergartenalltag typische Auseinandersetzung
zwischen Alain und Fabian, bei der (absolut
gleichzeitig) die folgenden Vorwrfe zu hren
sind:
(17) Du hast mein schnes Haus kaputt ge-
macht.
(18) Du hast meinen Flitzer versteckt.
Es ist offenbar unsinnig, von einer solchen
Situation zu behaupten, sie determiniere ein-
deutig einen Referenten fr das Wort du: in
9. Kontextabhngigkeit 177
nik der Extensionalisierung lt sich ebenfalls
mit der Tokenanalyse kombinieren. In diesem
Fall bentigt man allerdings eine weitere
Sorte von Variablen fr Realisierungen
sprachlicher Ausdrcke, was man als Indiz
dafr werten kann, da die Parallelitt zur
klassischen Theorie doch recht oberflchlich
ist. Whrend nmlich nach klassischer Auf-
fassung die uerungssituationen einen Teil
der Gesamtheit aller Auswertungssituationen
ausmachen, verlangt die Tokenanalyse zwei
unabhngige Sorten von Variablen fr Rea-
lisierungen und Situationen. Insbesondere
sind alle mit dem Begriff der Diagonalen
und somit auch die aus der zweisortigen Mo-
dallogik entlehnten Betrachtungen nicht
ohne weiteres auf die Tokenanalyse bertrag-
bar; dasselbe gilt fr die in Abschnitt 2.1
gemachte Annahme, indexikalische Aspekte
seien zugleich auch immer kontextuell. (Auf
einen weiteren substantiellen Unterschied
zwischen der klassischen Theorie und der To-
kenanalyse werden wir in Abschnitt 2.5 hin-
weisen.)
Angesichts dieser durch die Tokenanalyse
eingebrachten theoretischen Komplikationen
und ihrer (teilweise noch zu demonstrieren-
den) Defizite stellt sich die Frage, ob sich die
Vorzge der klassischen Theorie nicht doch
irgendwie mit einer (nicht allzu komplexen
oder knstlichen) Lsung der mit (17)(19)
angesprochenen Probleme vereinbaren lassen.
Dies ist in der Tat der Fall. Denn die klassi-
sche Theorie lt sich als Spezialfall einer
geeignet formulierten Tokenanalyse auffas-
sen. Zunchst kann man sehen, da die To-
kenanalyse fr die Mehrzahl der diskutierten
Beispiele in dem Sinne zu fein ist, als bei ihnen
eine Differenzierung nach verschiedenen Rea-
lisierungen desselben Ausdrucks nicht ntig
ist: die betrachteten uerungssituationen
waren meist so gewhlt, da sie die Extensio-
nen der in ihnen geuerten deiktischen Wr-
ter eindeutig festlegten. Solche uerungssi-
tuationen bezeichnen wir als homogen. Der
klassischen Theorie (in der in Teil 1 darge-
stellten Form) liegt die Idealisierung zu-
grunde, alle uerungssituationen seien ho-
mogen. Wenn es nun gelingt, diesen Homo-
genittsbegriff im Rahmen der Tokenalyse zu
rekonstruieren, dann sollte eine Beschrn-
kung auf homogene uerungssituationen
gerade auf die klassische Theorie hinauslau-
fen. Eine begriffliche Zurckfhrung der ho-
mogenen uerungssituationen auf Token
setzt nun allerdings voraus, da der Zusam-
menhang zwischen Realisierungen komplexer
die vier in den obigen Kindergarten-Situatio-
nen geuerten Anreden d
1
d
4
allesamt
Realisierungen desselben Wortes: {d
1
,d
2
,d
3
,d
4
}
du. Die unterschiedlichen Extensionen lie-
en sich dann dadurch erklren, da der Cha-
rakter
du
jedem dieser vier Token einen eige-
nen Wert zuordnet. Charaktere wren nach
dieser Auffassung Funktionen, die jeder Rea-
lisierung (d. h. jedem Element) eines Aus-
drucks eine Intension zuweisen.
In diesem Sinne lassen sich alle bisher ein-
gefhrten lexikalischen Bedeutungsregeln
leicht modifizieren. Fr absolute Lexeme n-
dert sich dadurch nicht viel; die Unabhngig-
keit der Extension von der uerungssitua-
tion wird lediglich durch eine Unabhngigkeit
vom Token ersetzt. Aber auch bei direkt re-
ferentiellen Wrtern bereitet diese neue Be-
trachtungsweise keine Schwierigkeiten. So
lt sich z. B.
ich
(I)(s) als Produzentin des
Tokens I ich charakterisieren,
heute
(D)(s) ist
der Tag, an dem die uerung D ( du) statt-
findet, usw. Dabei ist s immer eine beliebige
(Auswertungs-) Situation; auf der Intensions-
ebene bleibt also alles beim Alten.
Da Bedeutungsregeln fr deiktische Wrter
(nach dieser Auffassung) auf die Realisierun-
gen derselben Bezug nehmen, werden diese
Wrter auch als tokenreflexiv bezeichnet. Die
diskutierte Ersetzung von uerungssituatio-
nen durch uerungen luft also auf eine
Analyse der Deixis als Tokenreflexivitt
(kurz: Tokenanalyse) hinaus. Da die Token-
analyse keine triviale Variation der klassi-
schen Theorie ist, wird deutlich, wenn man
von lexikalischen zu komplexen Ausdrcken
bergeht. Wie wir bereits im Zusammenhang
mit (19) gesehen haben, bentigt man dafr
eine zustzliche Theorie-Komponente, die
den Zusammenhang zwischen verschiedenen
Teiluerungen herstellt. Theorien dieser Art
zeichnen sich in der Regel durch ein groes
Miverhltnis zwischen begrifflicher Komple-
xitt und Erkenntnisgewinn aus; wir werden
uns diesen Teil der Tokenanalyse deshalb er-
sparen.
Es fllt auf, da auch bei der Tokenanalyse
die Extensionen immer nur von bestimmten
Eigenschaften oder Aspekten des Tokens ab-
hngen. Um dem Rechnung zu tragen, kann
man nach dem Vorbild des Abschnitts 2.1
Aspekte von Realisierungen definieren und
Charaktere auf den entsprechenden Aspekt-
listen operieren lassen; auch hier gibt es dann
die Mglichkeit einer Theorie-Erweiterung
durch Hinzunahme unstimmiger Aspekt-
listen. Die in Abschnitt 2.2 beschriebene Tech-
178 IV. Kontexttheorie
erffnenden philosophischen Perspektiven
strenggnommen nicht die Semantik der na-
trlichen Sprache betreffen; andererseits pas-
sen sie gerade deshalb hierher, denn sie zeigen,
da der Anwendungsbereich der klassischen
Theorie weit ber die deskriptive Semantik
hinausgeht. hnlich wie die Russellsche
Kennzeichnungstheorie [vgl. dazu Artikel 22]
oder die Davidsonsche Adverbialsemantik [s.
Artikel 36] lt sich nmlich auch die Ka-
plansche Theorie der Kontextabhngigkeit
zur Darstellung und Untermauerung be-
stimmter philosophischer Thesen und Positio-
nen heranziehen. Diese philosophische Di-
mension macht einen Groteil der ursprng-
lichen Motivation hinter dem Begriffsapparat
dieses Kapitels aus, und ihr Studium trgt auf
jeden Fall zu dessen besserem Verstndnis bei.
Darberhinaus spielen einige der in diesem
Zusammenhang zu diskutierenden Beispiele
und Analysen durchaus eine wichtige Rolle
in der linguistischen Anwendung der klassi-
schen Theorie; doch darber wird erst in Ab-
schnitt 4.2 zu reden sein.
Als Einstieg mag eine Rckbesinnung auf
die Einfhrung des Intensionsbegriffs in Ab-
schnitt 1.1 dienen. Dort haben wir gesagt,
da man sich die Intension eines Ausdrucks
im wesentlichen als eine Methode zur Bestim-
mung seiner Extension vorstellen kann: an-
gewandt auf eine beliebig vorgegebene Situa-
tion oder Tatsachenkonstellation liefert die
Intension die jeweilige Extension. Im Falle
eines Satzes ist die Extension ein Wahrheits-
wert, womit die Intension in diesem Falle
auch Proposition genannt als eine Menge
von (Auswertungs-)Situationen aufgefat
werden kann. Solche Mengen mglicher Tat-
sachenkonstellationen lassen sich wiederum
in naheliegender Weise als Informationen ver-
stehen: eine Menge entspricht der Informa-
tion, da alle ihre Elemente in dem Sinne
mglich sind, da ihr Bestehen nicht ausge-
schlossen werden kann, da also die Wirk-
lichkeit zu ihr gehrt. (Genauere Ausfhrun-
gen zu dieser Betrachtungsweise findet man
in Artikel 2.) Damit liegt nun der Verdacht
nahe, da die durch einen Satz (in einer ue-
rungssituation) ausgedrckte Proposition
also seine Intension gerade die durch ihn
bermittelte Information ist. Halten wir dies
in Form einer Hypothese fest:
(F) Der Informationsgehalt eines Satzes ist
seine Intension.
Ein Groteil dieses Abschnittes wird der Wi-
derlegung und Modifikation der Hypothese
(F) gewidmet sein; danach werden wir uns
Ausdrcke und denen ihrer Teile bereits pr-
zisiert ist. Unter dieser Voraussetzung kann
man eine homogene uerungssituation als
eine uerung a eines komplexen Ausdrucks
auffassen, fr dessen Teilausdrcke stets
gilt: wenn die Realisierungen b und b von
Teile von a sind, so sind b und b intensions-
gleich. Die restliche Rekonstruktion der klas-
sischen Theorie im Rahmen der Tokenanalyse
ist eine mhselige Arbeit am Begriff.
Eine ganz andere Mglichkeit der Rettung
der klassischen Theorie basiert auf der Be-
obachtung, da Inhomogenitt verschiedene
Ursachen haben kann. Einmal kann sie wie
in (17) und (18) auftreten, wenn in einer ge-
gebenen Situation mehr als eine Gesamtu-
erung eines Satzes, Textes etc. vorliegt. In
diesem Fall kann man die Situation in meh-
rere Situationsausschnitte aufspalten, mit de-
nen man dann jeweils klassisch verfhrt.
Diese Aufspaltung mag in manchen Fllen
knstlich erscheinen, ist aber offenbar immer
mglich und erspart eine Tokenanalyse. Die
zweite Art der Inhomogenitt wird durch (19)
vertreten: hier liegt eine mehrfache Realisie-
rung eines deiktischen Lexems innerhalb der-
selben Gesamtuerung vor. Nun ist zunchst
einmal festzustellen, da diese Art der Inho-
mogenitt nicht von jedem deiktischen Wort
hervorgerufen werden kann. Wenn z. B. (20)
als Satz geuert wird, referieren die beiden
Vorkommen von ich niemals auf verschiedene
Personen:
(20) Wenn ich noch ein Bier trinke, kann ich
nicht mehr fahren.
Hier hilft auch kein Gestikulieren wie im Falle
von du: ich bezieht sich jeweils auf den Pro-
duzenten der uerung von (20). Deiktische
Wrter, bei denen Gesten etwas ausrichten
knnen, heien auch Demonstrativa. Der
Trick ist nun der folgende: fr Demonstrativa
lt sich ein kontextueller Parameter anneh-
men, der das Problem der Extensionsfindung
auf eine begleitende Zeigehandlung verweist;
nicht das Token ist ausschlaggebend, sondern
die Demonstration. (Natrlich bedarf es dann
noch einer Sonderregelung fr die vielen
Flle, in denen die Zeigehandlung weggelas-
sen wird.) Es sollte klar sein, da diese Me-
thode zur Darstellung inhomogener ue-
rungssituationen die vom klassischen Stand-
punkt aus einfachste ist. (Weiteres ber De-
monstrativa in Abschnitt 3.2.)
2.5Erkenntnistheoretische Umdeutung
Dieser letzte Abschnitt fllt insofern etwas aus
dem thematischen Rahmen, als die gleich zu
9. Kontextabhngigkeit 179
interessieren.
Nach diesen Vorklrungen sind wir in der
Lage, die Hypothese (F) anhand einiger Bei-
spiele zu berprfen. (F) fllt j a nicht vom
Himmel, und so erstaunt es wenig, da sich
dieses Prinzip bei vielen Beispielen gar nicht
schlecht ausnimmt. So etwa bei:
(21) Tom pennt.
Der Einfachheit halber nehmen wir an, da
es sich bei (21) um einen absoluten Satz han-
delt, dessen Intension p also nicht von der
uerungssituation abhngt; p besteht also
aus den Situationen, in denen der Referent
des Eigennamens Tom der durch das Prdikat
pennt bezeichneten Ttigkeit nachgeht. Nach
(F) besteht dann der Informationsgehalt von
(21) gerade in dieser als Information verstan-
denen singulren Proposition p: wer ber
keine weiteren Informationen auer p verfgt,
wei damit nur, da nicht ausgeschlossen wer-
den kann, da Tom schlft. Dies ist offenbar
eine korrekte Aussage ber den maximalen
Informationsgehalt der wrtlichen Interpre-
tation von (21).
Betrachten wir als nchstes einen Satz, der
in verschiedenen uerungssituationen ver-
schiedene Propositionen ausdrcken kann:
(22) Ich bin mde.
Um (F) zu testen, bentigen wir zumindest
eine Information ber die uerungssitua-
tion: wir mssen wissen, wer (22) uert. Neh-
men wir also an, es handele sich um Tom.
Dann drckt (22) im wesentlichen die Pro-
postion aus, die aus allen Situationen besteht,
in denen Tom mde ist. Was den Informa-
tionsgehalt angeht, so htte Tom also eben-
sogut (22) uern knnen:
(22) Tom ist mde.
Dabei setzen wir voraus, da Tom ein Stan-
dardname ist ein Name, der sich per
sprachlicher Konvention direkt und absolut
auf Tom bezieht. Diese Voraussetzung ist
nicht ganz unproblematisch (siehe Abschnitt
1.3). Doch dient (22) hier lediglich der Illu-
stration einer Inadquatheit von (F): nach (F)
ist der Informationsgehalt einer uerung
von (22) durch Tom gleich dem Informations-
gehalt, den (22) htte, wenn man Tom als
Standardnamen versteht.
Natrlich ist eine uerung von (22) aus
Toms Mund etwas befremdlich oder allenfalls
babyhaft. Doch knnte man und sei es nur
zur Aufrechterhaltung von (F) annehmen,
da der Grund fr diese Abweichung stilisti-
endlich den philosophischen Implikationen
zuwenden.
Um besser zu verstehen, wie (F) berhaupt
gemeint ist, ist es ntzlich, einige nahelie-
gende, hier aber nicht intendierte Interpreta-
tionen dieser Hypothese zu verwerfen. Mit
(F) ist z. B. nicht gemeint, da ein (in einer
bestimmten Situation geuerter) Satz der
Hrerschaft genau die durch ihn ausge-
drckte Proposition als Information bermit-
telt. Welche Information tatschlich bermit-
telt wird, hngt von vielerlei, insbesondere
auch pragmatischen Faktoren ab, die uns hier
nicht weiter interessieren: die uerung kann
z. B. ironisch gemeint sein und im wesent-
lichen nur Informationen ber die Einstellung
des Sprechers vermitteln; sie kann etwa in
einer Prfung die Wohlinformiertheit des
Sprechers oder bei einer Parlamentsrede
dessen Schlagfertigkeit unter Beweis stellen
und insofern sehr aufschlureich sein; sie
kann zeigen, ob es sich bei der Sprecherin um
eine Muttersprachlerin handelt usw. In all
diesen Fllen wird jedoch die im engeren
Sinne vom Satz bermittelte Information
durch andere, die uerung begleitende Um-
stnde ergnzt oder berlagert. Doch nur um
erstere geht es in (F): um die gem der wrt-
lichen Bedeutung des betreffenden Satzes
bermittelte Information. [Siehe Artikel 3.]
Selbst wenn man sich strikt an die wrtli-
che Bedeutung hlt, ist (F) nicht ganz eindeu-
tig. Denn was ein Satz im wahrsten Sinne des
Wortes in einer uerungssituation besagt,
kann fr die Hrerschaft je nach deren Vor-
wissen mehr oder weniger informativ sein. Die
korrekte Antwort auf eine Frage im mndli-
chen Staatsexamen sollte dem Prfer bekannt
sein, dem ministeriellen Beisitzer vermittelt sie
vielleicht neue Erkenntnisse: in diesem Sinne
ist ihr Informationsgehalt stark hrerabhn-
gig. Doch darum geht es nicht. Wir werden
idealerweise von solchen Unterschieden in der
Informiertheit abstrahieren und fr die Dis-
kussion des Prinzips (F) keinerlei Vorausset-
zungen ber den Informationsstand der Kom-
munikationsteilnehmer machen. Insofern in-
teressieren wir uns hier nur fr den maximalen
Informationsgehalt eines Satzes also die-
jenige Information, die er bei wrtlicher In-
terpretation einer gnzlich desinformierten
und desorientierten Hrerschaft bermitteln
wrde. Es ist natrlich fraglich, ob man dieser
Art von Hrerschaft berhaupt irgendwelche
Informationen bermitteln kann; doch soll
uns diese rein heuristische Idealisierung nicht
bis in die letzten Verstelungen des Details
180 IV. Kontexttheorie
Informierten ausben kann. Diese Unmittel-
barkeit der Information geht (23) ab: was
dieser Satz besagt, ist sommers wie winters
dasselbe (nmlich
23
) und hilft vor allem
denen nicht weiter, denen das Datum der
uerung nicht gegenwrtig ist, die also die
uerung zeitlich nicht genau genug lokali-
sieren knnen. In (23) wird das Kommen des
Nikolaus aus der uerungssituation heraus,
also vom Standort des Sprechers aus, be-
schrieben und insofern mit sprachlichen Mit-
teln lokalisiert; die Beschreibung in (23) ent-
behrt dieser Perspektive. Diese zustzliche lo-
kalisierende Dimension im Informationsge-
halt ist nun offenkundig ein Effekt der Varia-
bilitt der Intension von (23), die wiederum
auf die direkte Referentialitt des Temporal-
adverbs morgen zurckgefhrt werden kann,
das dazu beitrgt, den der uerungszeit fol-
genden Tag und insofern auch die ue-
rungszeit selbst relativ zum Nikolaustag
zu lokalisieren. Whrend also (23) lediglich
eine absolute Information
23
ber die Be-
schaffenheit der Welt liefert, setzt (23) dieselbe
Information zum Standort des Sprechers in
Beziehung. Dieser Unterschied in der Per-
spektive, aus der die durch die beiden Stze
ausgedrckte Proposition prsentiert wird,
wird in (F) bergangen.
Eine Modifikation von (F) mu also die
durch mgliche deiktische Teilausdrcke ein-
gefhrte Perspektive der bermittelten Infor-
mation bercksichtigen. Eine sich aus diesen
Betrachtungen nahelegende Verbesserung von
(F) besteht somit in einer Differenzierung des
Informationsgehalts in einen absoluten, von
der Intension beigesteuerten Teil und die
durch den Charakter verliehene lokalisierende
Perspektive. In dem soeben diskutierten Bei-
spiel ergibt sich dann fr (23) einerseits die
auch durch (23) ausgedrckte Information
23
und andererseits die lokalisierende Infor-
mation
23
, da der Nikolaustag dem Tag der
uerung folgt, d. h. die Menge der Situatio-
nen s, die sich an einem 5. Dezember abspie-
len. Diese Proposition
23
ergibt sich wie-
derum einfach aus dem Charakter
23
von
(23) durch Einsetzung der Auswertungssitua-
tion s fr die uerungssituation s
o
:
23
liefert
ja fr den Referenzpunkt s
o
,s gerade dann
den Wahrheitswert 1, wenn am Tag nach s
o
(in s) der Nikolaus kommt. Nach einer am
Schlu von Abschnitt 2.3 gemachten Beob-
achtung ergibt sich somit
23
aus
23
durch
senkrechte Diagonalisierung. Wir erhalten
damit die folgende Modifikation von (F):
scher oder pragmatischer, nicht jedoch se-
mantischer Natur ist: (22) und (22) besagen
zwar in dieser Situation dasselbe, ihr Infor-
mationsgehalt ist damit nach (F) auch gleich,
aber sie unterliegen unterschiedlichen Ge-
brauchsbedingungen, die dafr sorgen, da
(22) einigermaen inakzeptabel ist. (F)
scheint damit frs erste gerettet.
Ganz so einfach ist es nicht. Denn (22) und
(22) bermitteln nur dem dieselbe Informa-
tion, der ber die Identitt des Sprechers in-
formiert ist, der also wei, da sich der Name
Tom auf den Sprecher von (22) bezieht. Dieses
Wissen ist aber keine notwendige Vorbedin-
gung fr das Verstndnis der beiden Stze:
(F) verlangt hier offensichtlich zu viel vom
Hrer. Da es sich hierbei nicht nur um einen
marginalen Schnheitsfehler, sondern um eine
substantielle Inadquatheit der Hypothese
(F) handelt, sieht man besser, wenn man vom
Sprecher-Parameter auf Beispiele mit anderen
Kontextabhngigkeiten bergeht, bei denen
Desinformiertheit an der Tagesordnung ist:
(23) Morgen ist Nikolaustag.
(23) Am 6. Dezember 1985 ist Nikolaustag.
In diesem Falle scheinen stilistische Unter-
schiede oder Zweifel am Standardnamen-Sta-
tus des Datums weniger angebracht als bei
den vorherigen Beispielen. Bei einer ue-
rung von (23) am 5. 12. 1985 wird aber im
allgemeinen eine andere Information ber-
mittelt als durch eine uerung von (23). In
unsererm Kulturkreis ist die in (23) enthaltene
Information fr die Eltern kleiner Kinder un-
gleich wichtiger als der relativ banale Inhalt
von (23): erstere knnte sie zu einem Panik-
Kauf von pfeln, Nssen und Mandelkernen
veranlassen, whrend letztere in der Regel ihr
Verhalten kaum beeinflussen drfte. Dieser
banale Inhalt von (23) da am 6. 12. 1985
der Nikolaus kommt ist aber gerade die
durch beide Stze am 5. 12. 1988 ausge-
drckte (singulre) Proposition
23
. (23)
scheint aber darberhinaus noch mehr zu be-
sagen. Und dieses Mehr an Information, die-
ser Unterschied im Informationsgehalt zwi-
schen (23) und (23), wird von (F) nicht er-
fat.
Worin besteht nun eigentlich die Informa-
tion, die (23) gegenber (23) so interessant
erscheinen lt? Und was macht sie so inter-
essant? Der Unterschied zwischen den beiden
Stzen hat offenbar etwas damit zu tun, da
die von beiden ausgedrckte Proposition
durch (23) unmittelbar in Beziehung zur
uerungssituation gesetzt wird und gerade
deshalb einen Einflu auf das Verhalten der
9. Kontextabhngigkeit 181
Der in (E) fr die Kodierung der lokalisie-
renden Information geforderte volle Charak-
ter ist eigentlich etwas zu viel des Guten. Das
sieht man am besten anhand einer Extensio-
nalisierung im Stil von Abschnitt 2.2 ein. Cha-
raktere lassen sich dann durch Formeln be-
schreiben, die entsprechend der Referenz-
punkt-Aufspaltung aus Abschnitt 2.3 im
wesentlichen drei Typen von Variablen ent-
halten: indexikalische, indexikalisch-kontex-
tuelle (kurz: mittlere) und rein kontextuelle.
Die Charakterformel fr Ich schlafe jetzt ent-
hlt beispielsweise eine indexikalische Variable
fr die Auswertungswelt (wegen der Fakten-
abhngigkeit der Extension von schlafen),
eine mittlere (von jetzt eingefhrte) Variable
fr die uerungszeit und eine rein kontex-
tuelle Variable fr den Sprecher. Welche (lo-
kalisierende) Information beinhaltet nun der
Charakter dieses Satzes? Grob gesprochen
informiert darber, da der Sprecher in der
uerungswelt zur uerungszeit schlft.
Insbesondere gibt es also in dieser Hinsicht
keinen Unterschied zwischen indexikalischen
und mittleren Variablen: beide drfen dem
Prinzip (D) gem direkt auf die ue-
rungssituation bezogen werden. Fr die Er-
mittlung der lokalisierenden Information ist
also die Unterscheidung zwischen den Aspek-
ten der Auswertungssituation und den indexi-
kalischen Aspekten des Kontexts berflssig.
(Das uert sich brigens auch darin, da das
Wort jetzt in diesem Falle nicht zur lokalisie-
renden, wohl aber zur absoluten Information
beitrgt.) Der Charakter lt sich damit in
(E) insoweit reduzieren, als man (in der ex-
tensionalisierten Darstellung) indexikalische
und mittlere Variablen miteinander identifi-
ziert. Von der Formulierung (S) ausgehend
liegt es nun nahe, diese Identifikation durch
eine senkrechte Diagonalisierung vorzuneh-
men und dementsprechend die mittleren Va-
riablen durch indexikalische zu ersetzten.
Doch fhrt natrlich der umgekehrte Weg
zum selben Ziel: eine Ersetzung der indexi-
kalischen Variablen durch mittlere, also kon-
textuelle. Das ist aber nichts anderes als eine
Anwendung des DTHAT-Operators! Natr-
lich ist das Ergebnis einer solchen waagerech-
ten Diagonalisierung strenggenommen immer
noch ein Charakter , so da auf den ersten
Blick gegenber (E) nichts gewonnen scheint.
Dieser Schein trgt aber. Denn das durch
DTHAT modifizierte ist direkt referentiell
und lt sich daher auf eine Funktion von
Kontexten in Wahrheitswerte oder quivalen-
terweise als Menge von Kontexten auffassen.
(S) Der Informationsgehalt eines Satzes be-
steht aus zwei Komponenten:
a) seiner perspektivelosen Intension und
b) einer durch senkrechte Diagonalisie-
rung seines Charakters kodierten Lo-
kalisierung.
Man beachte, da die Monstrositt der senk-
rechten Diagonalisierungen an dieser Stelle
keine Rolle spielt: (S) dient ja nicht der In-
terpretation einer bestimmten syntaktischen
Konstruktion.
Mit (S) wird klar, warum man in Beispielen
wie (23) keine Zweiteilung der Information
findet: bei absoluten Ausdrcken luft die
Diagonalisierung leer ihr Charakter kann
ja unabhngig von der uerungssituation
beschrieben werden, womit diese auch nicht
durch die Auswertungssituation ersetzt wer-
den kann:
23
=
23
(=
23
).
Wir haben in Abschnitt 2.3 festgestellt, da
senkrechte Diagonalisierungen nicht in jeder
Referenztheorie mglich sind. (S) macht nur
fr die klassische Theorie aus Teil 1 sowie fr
die in Abschnitt 2.3 skizzierte Quadratur der
Parametrisierung Sinn. Will man ein zu (S)
analoges Prinzip im Rahmen der nichtqua-
dratischen Parametrisierung aus Abschnitt
2.1 formulieren, so mu man bercksichtigen,
da die ansonsten durch Diagonaliserung er-
hltliche Information nicht in dem Sinne aus
dem Charakter herausdestilliert werden kann,
da sie wie das Ergebnis einer senkrechten
Diagonalisierung wieder einer Proposition
entspricht. Wenn einige kontextuelle Aspekte
(nach dieser Theorie-Variante) unumschreib-
bar sind, sollte man fr die lokalisierende
Information also lieber den vollen Charakter
veranschlagen. Wir erhalten damit:
(E) Der Informationsgehalt eines Satzes be-
steht aus zwei Komponenten:
a) seiner perspektivelosen Intension und
b) einer durch seinen Charakter kodier-
ten Lokalisierung.
Im Unterschied zu (S) postuliert (E) einen
kategorialen Unterschied zwischen den bei-
den Informationskomponenten. Der Unter-
schied zwischen Perspektivelosigkeit und Lo-
kalisierung ist nach (E) nicht nur einer des
Inhalts, sondern auch ein Unterschied in der
Form der Information: erstere entspricht
einer Menge von Indizes, whrend letzterer
ein Charakter, also eine Funktion von Kon-
texten in Intensionen ist. (S) ist dagegen
durchaus mit der Annahme vertrglich, da
jede Information propositional ist.
182 IV. Kontexttheorie
tuell sogar emotional gefrbte Einstellungen)
umfat. Aus dem Sprecher wird so ein wahr-
nehmendes und denkendes Wesen oder
philosophischer ausgedrckt ein erkennen-
des Subjekt; und die uerungssituation wird
zum kognitiven (bzw. epistemischen) Zustand.
Das ist die erkenntnistheoretische Deutung
der klassischen Theorie.
Es ist ntzlich, sich an dieser Stelle einige
terminologische und inhaltliche Subtilitten
einzuprgen. Zunchst sollte man sich den
Unterschied zwischen Bewutseinsinhalt und
epistemischem Zustand klarmachen. Ersterer
ist abstrakter Natur; es handelt sich um eine
bestimmte (perspektivische) Information.
Prinzipiell aber wohl nicht praktisch ist
es mglich, da die Bewutseinsinhalte zweier
Personen miteinander identisch sind. Doch
befinden sich diese Personen niemals im sel-
ben epistemischen Zustand. Denn letzterer ist
die tatschliche Situation, in der sich das je-
weilige erkennende Subjekt befindet; und
wenn es sich um zwei verschiedene Subjekte
handelt, dann hat diese Verschiedenheit defi-
nitionsgem einen Unterschied im episte-
mischen Zustand zur Folge eben einen
Unterschied im Subjekts-Aspekt. Der Be-
wutseinsinhalt entspricht also dem subjek-
tiven Bild, das sich die jeweilige Person von
ihrer Situation, also von ihrem epistemischen
Zustand, macht. Dazu gehrt dann insbeson-
dere eine Lokalisierung von sich selbst als
Subjekt in Raum, Zeit und Welt. Ob diese
Lokalisierung korrekt ist oder etwa das Sub-
jekt einem Irrtum oder einer Tuschung un-
terliegt, hngt dann davon ab, ob der tat-
schliche epistemische Zustand des Subjekts
mit dem Bewutseinsinhalt vertrglich ist
ob also der Charakter fr diese Situation eine
in dieser Situation wahre Proposition liefert.
Bei der Bestimmung und Bewertung dieser
Proposition werden die kontextuellen und in-
dexikalischen Parameter an der Wirklichkeit
(und nicht etwa am subjektiven Bild dersel-
ben) ausgewertet.
Wir knnen diese philosophische Interpre-
tation auf einige der oben besprochenen Bei-
spiele anwenden, indem wir diese als innere
Monologe deuten. Wenn sich Tom (22) sagt
oder wenn man von Tom zu Recht sagen
kann, er sage zu sich (22) dann klassifiziert
sich Tom als mde Person. Das heit natr-
lich nicht unbedingt, da Tom sich damit in
einem (krperlichen) Zustand von Mdigkeit
befindet: er knnte ja einem Irrtum unterlie-
gen. Es heit, da sich Tom in einem (kog-
nitiven) Zustand des sich fr mde Haltens
Da ein Kontext nichts anderes ist als eine n-
stellige Liste von Aspekten, entspricht diese
Menge von Kontexten wiederum einer n-stel-
ligen Relation !; in unserem Beispiel ist !
die Relation, die zwischen einem Individuum
x (dem Sprecher), einem Zeitpunkt z und
einer Welt w besteht, wenn x in w zu z schlft.
(E) Der Informationsgehalt eines Satzes be-
steht aus zwei Komponenten:
a) seiner perspektivelosen Intension
und
b) einer durch die der waagerechten
Diagonalisierung seines Charakters
entsprechende Relation kodierten
Lokalisierung.
Wir werden zwar im folgenden von der klas-
sischen Formulierung (E) ausgehen, dabei
aber diese Reduktion (E) von auf die Re-
lation ! nicht ganz aus den Augen verlieren:
in Abschnitt 4.2 wird sie uns gute Dienste
leisten.
Was hat das nun alles mit Philosophie zu
tun? Der Zusammenhang ergibt sich aus einer
Verallgemeinerung bzw. Umdeutung einiger
zentraler Begriffe der Referenztheorie. Zu-
nchst nehmen wir zur Kenntnis, da sich
das Analyse-Instrumentarium der klassischen
Theorie ohne groe Verrenkungen von der
Beschreibung ffentlicher uerungen auf in-
nere Monologe bertragen lt. Die Rolle des
Sprechers wird dann von der den inneren
Monolog fhrenden Person gespielt sie ist
ja die intendierte Referentin des Wortes ich
und zhlt (in einem in Abschnitt 3.1 noch
nher zu untersuchenden Sinn) als Sprecherin
und statt einer intersubjektiv zugnglichen
uerungssituation mit in der Regel mehreren
Kommunikationsteilnehmern haben wir es le-
diglich mit dem inneren Zustand zu tun, in
dem sich die betreffende Person befindet. In-
nere Monologe finden allerdings nur sehr sel-
ten in dem Sinne statt, da sich eine Person
den Wortlaut einer an sie selbst gerichteten
fiktiven uerung vergegenwrtigt. In der
Regel begegnet man dieser asozialen Form
von Kommunikation wohl eher in Romanen,
Berichten und anderen Texten, wo sie als
Kunstgriff angewandt wird, um den Bewut-
seinszustand einer Person zu beschreiben: der
innere Monolog soll auf plastische Weise ver-
deutlichen, was dem Protagonisten gerade
durch den Kopf geht. Die sprachliche For-
mulierung steht also fr ihren Inhalt als
Denkinhalt oder allgemeiner als (mo-
mentanen) Bewutseinsinhalt, der neben dem
Gedankengut auch Wahrnehmung (und even-
9. Kontextabhngigkeit 183
weise diagonalisierte) Charakter von (23) be-
schreibt also, wie Caroline die Welt sieht; die
sich am tatschlichen Zustand Carolines
ergebende Intension dagegen beschreibt,
wie die Welt ist. Der Unterschied zwischen
(diagonalisiertem) Charakter und Intension
bzw. der zwischen lokalisierender und abso-
luter Information wird so, in der erkenntnis-
theoretischen Deutung der klassischen Theo-
rie, zu einem Unterschied zwischen epistemi-
scher und metaphysischer Perspektive. Hlt
man sich nun an die diagonalisierungsfreie
Variante (E), so ist dieser Unterschied wieder
kategorialer Natur. Der Bewutseinsinhalt
des erkennenden Subjekts kann dann prinzi-
piell nicht als Information im Sinne des zu
Anfang des gegenwrtigen Abschnitts the-
matisierten propositionalen Wissens aufge-
fat werden. Bei der Caroline im Falle des
inneren Monologes vorliegenden Information
23
handelt es sich nicht nur um eine andere
als die, da der 8. Dezember 1985 dem Ni-
kolaustag vorangeht (
23
) es handelt sich
um einen anderen Typ von Information, nm-
lich um lokalisierende Information, um In-
formation aus der Sicht des Subjekts in sei-
nem momentanen kognitiven Zustand.
Die Alternative (S) ist in dieser Hinsicht
weniger radikal: nach ihr ist der Unterschied
zwischen epistemischer und metaphysischer
Perspektive rein inhaltlicher Natur. Caroline
befindet sich zwar nicht im Besitz der per-
spektivelosen Information
23
, sie vertraut
aber wohl einer anderen, ebenso propositio-
nalen Information, nmlich
23
. Heit das,
da nach (S) Carolines Bewutseinsinhalt jeg-
licher epistemischen Perspektive entbehrt?
Natrlich nicht! Die Perspektive ist bei
23
nur ein Teil des Inhalts: an die Stelle des
kontextuellen Zeit- (bzw. Tages-) Parameters
in
23
tritt in
23
die Zeit der Auswertungssi-
tuation.
Der Unterschied zwischen lokalisierender
und absoluter Information lt sich am ein-
drucksvollsten am Grenzfall der Nullinfor-
mation oder Trivialitt illustrieren. Triviale
Informationen sind solche, die unter beliebi-
gen Umstnden zutreffen, deren Kenntnis-
nahme also nichts lehrt. Die in (E) geleistete
Przisierung der Unterscheidung zwischen
Lokalisierung und Perspektivelosigkeit lt
nun prinzipiell zwei Trivialittsbegriffe zu:
Trivialitt eines Charakters versus Trivialitt
einer Proposition. Im Lichte der erkenntnis-
theoretischen Umdeutung der klassischen
Theorie entsprechen diese Begriffe (cum
befindet ein Zustand, in dem sein Be-
wutseinsinhalt dem erkennendem Subjekt
eine bestimmte Eigenschaft (Mdigkeit) zu-
schreibt. Damit befindet sich Tom nicht not-
wendigerweise auch in einem Zustand, in dem
Tom als Individuum diese Eigenschaft zuge-
schrieben wird. Dieser subtile Unterschied
kommt vor allem im Falle einer (in der ein-
schlgigen philosophischen Literatur deshalb
auch gerne diskutierten) Identittskrise zum
Tragen.
(23) ist in dieser Hinsicht durchsichtiger.
Wenn (23) in einem von Caroline gefhrten
inneren Monolog auftaucht, dann ordnet Ca-
roline ihren momentanen Zustand zeitlich in
den Tag unmittelbar vor dem Nikolaustag
1985 ein. Selbstverstndlich ist damit nicht
unbedingt der 5. Dezember angebrochen; ein
Irrtum ist hier wesentlich leichter mglich als
beim vorhergehenden Beispiel. I n Carolines
Bewutsein besitzt lediglich der Tag ihres mo-
mentanen Zustandes eine gewisse Eigenschaft
(direkter Vorgnger des Nikolaustages zu
sein). Nehmen wir einmal an, sie irrt sich
tatschlich: in Wirklichkeit haben wir bereits
den 8. Dezember. Heit das, da Caroline
und sei es auch nur momentan den 8.
Dezember fr den Vorgnger des Nikolausta-
ges hlt? Wohl kaum. Oder eben nur: insofern
sie den 8. Dezember als Tag ihres momenta-
nen epistemischen Zustands, als Heute, klas-
sifiziert. Im momentanen Weltbild ihres Be-
wutseinszustands liegt also der Tag des mo-
mentanen Zustands vor dem Nikolaustag;
und in Wirklichkeit ist der Tag ihres momen-
tanen Zustands der 8. Dezember.
Die Differenz zwischen Carolines Perspek-
tive auf den 8. Dezember als Heute und der
Tatsache, da es sich in Wirklichkeit um den
achten Tag des Monats Dezember handelt,
entspricht natrlich genau dem zuvor disku-
tierten Unterschied zwischen lokalisierender
und perspektiveloser Information. Der im in-
neren Monolog (23) beschriebene kognitive
Zustand Carolines ist das epistemische Ana-
logon zum Charakter in (E) bzw. zur Dia-
gonalisierung desselben in (S). Fr den Ver-
gleich der Carolineschen Vorstellungswelt mit
der Wirklichkeit mu die in (23) gemachte
Aussage als Aussage ber die Wirklichkeit
gewertet werden. Aus dem Heute der Caro-
lineschen Perspektive wird dann der Tag, an
dem sich der innere Monolog (bzw. die ihm
entsprechende berlegung) tatschlich ab-
spielt gerade so, wie sonst aus dem Cha-
rakter durch Auffllung der kontextuellen
Aspekte die Intension wird. Der (mglicher-
184 IV. Kontexttheorie
An der Analyse von (25) wird bei nherem
Hinsehen deutlich, wie man mit Hilfe der
klassischen Theorie weitere a priorische und
zugleich kontingente Wahrheiten konstru-
ieren kann: geht man von einer extensionalen
Darstellung des Charakters im Stil von Ab-
schnitt 2.2 aus, so liegt A Priorizitt dann
vor, wenn die Einsetzung von s
0
fr s, also
das Ergebnis der Anwendung des Operators
DTHAT zu einer fr uerungs- bzw. Er-
kenntnissituationen s
0
allgemeingltigen Aus-
sage fhrt; Kontingenz wiederum ergibt sich,
wenn zumindest fr eine Belegung von s und
s
0
etwas Falsches herauskommt. Diese Be-
obachtung lt sich auf eine griffige Formu-
lierung bringen: wenn ein Charakter als Ei-
genschaft (von uerungssituationen), nicht
aber als Relation (zwischen uerungs- und
Auswertungssituationen) trivial ist, so liegt
ein kontingentes A Priori vor. (Man beachte
nebenbei, da bei Parametrisierung der als
Eigenschaft von uerungssituationen auf-
gefate Charakter nichts anderes ist als die in
(E) erwhnte, ihm entsprechende Relation.)
Im vorliegenden Fall ergab sich der Effekt
durch eine Interaktion des deiktischen Sub-
jekts mit dem absoluten Prdikat: erst die
Ersetzung des Auswertungs-Parameters im
Prdikat lt die Aussage fr uerungssi-
tuationen trivial werden. Prinzipiell ist jedoch
auch A Priorizitt mglich, ohne da Deixis
vorliegt wenn nmlich die durch den Cha-
rakter ber die Auswertungssituation ge-
machte Aussage fr alle uerungssituatio-
nen trivial ist; und kontingent ist ein solches
A Priori dann, wenn diese Trivialitt nicht
auf beliebige Situationen zutrifft. Ein Beispiel
fr so ein deixisfreies kontingentes A Priori
ist etwa der Charakter des Satzes Es gibt ein
denkendes Wesen.
Wie nicht anders zu erwarten, verhlt sich
(26) genau entgegengesetzt zu (25). Denn ei-
nerseits kann dieser Satz heutzutage nicht
mehr wahrheitsgem geuert werden:
26
(s
0
)(s
0
) = 0 fr alle (diesseitigen) s
0
nach
dem 11. Februar 1650. Damit gilt (26) auch
nicht a priori. Andererseits besteht die mit
einer uerung von (26) durch Descartes
hchstpersnlich ausgedrckte Proposition
aus den Situationen s, fr die gilt: der Spre-
cher, also Descartes, ist mit dem Trger des
(hier wieder als Standardnamen verstande-
nen) latinisierten Namens Renatus Cartesius,
also mit Descartes, identisch. Diese Bedin-
gung wird offensichtlich von allen s erfllt.
Descartes konnte also mit (26) eine notwen-
dige Wahrheit ausdrcken.
grano salis) zwei alten Bekannten aus der
Philosophie:
Definition:
(a) Eine epistemische Information gilt a
priori, falls fr beliebige kognitive Situa-
tionen s
0
gilt:
(s
0
)(s
0
) = 1.
(b) Eine metaphysische Information p gilt
notwendig, falls fr beliebige Situationen
s gilt:
p(s) = 1.
Wir haben diese Begriffe hier im Rahmen der
erkenntnistheoretischen Deutung der klassi-
schen Theorie gegeben, doch werden sie hu-
fig auch direkt fr Charaktere und Proposi-
tionen im blichen Sinne definiert. Den Un-
terschied zwischen den beiden Begriffen
macht man sich am besten an drei einfachen
Beispielen klar:
(24) Es regnet oder es regnet nicht.
(25) Ich existiere.
(26) Renatus Cartesius sum.
(24) ist eine Tautologie und insofern im
Sinne von (D) in allen uerungssituatio-
nen wahr. Also gilt
24
a priori. In einer ue-
rungsituation (bzw. relativ zu einem Bewut-
seinsinhalt) s
0
ist aber die durch (24) ausge-
drckte Proposition
24
(s
0
) ebenfalls trivial:
sie trifft auf eine Situation s zu, falls es in s
regnet oder nicht regnet. (24) drckt somit
immer eine notwendige Wahrheit aus. Die
Unterscheidung zwischen a priorischer und
notwendiger Geltung greift also in diesem
Falle nicht.
Ganz anders bei (25). Wird nmlich (25)
in einer Situation s
0
von einem beliebigen
Individuum geuert, so existiert diese Person
insbesondere auch in s
0
. Also gilt
25
a priori.
Daran ndert sich auch nichts, wenn man von
der uerung zum Denken bergeht und ich
auf das Subjekt desselben bezieht: die Exi-
stenz lt sich hier mit Hilfe eines altehrwr-
digen Descarteschen Arguments nachweisen.
Andererseits sind fr jeden uerer oder
Denker Situationen s denkbar, in denen er
nicht existiert. Fr solche s ist aber
25
(s
0
)(s)
= 0 und somit die durch (25) ausgedrckte
Proposition keine notwendige Wahrheit. Man
beachte, da in diesem Falle s
0
s sein mu;
zum Nachweis der A Priorizitt gengte aber
die Wahrheit an allen diagonalen Referenz-
punkten. Der Charakter von (25) ist also ein
kontingentes A Priori:
25
gilt a priori, aber
es gibt Referenzpunkte, an denen sich der
Wahrheitswert 0 ergibt.
9. Kontextabhngigkeit 185
kann sich um einen unmittelbar gegebenen
kontextuellen Aspekt (Ego, Hic, Nunc), eine
kausal vermittelte Bekanntschaft (Wahrneh-
mung, Erinnerung) oder einen im wesent-
lichen deduktiv erschlossenen Sachbezug han-
deln. Letzterer liegt etwa vor, wenn ein De-
tektiv aufgrund der Inspektion eines Tatorts
auf die Existenz eines Einzeltters schliet
und diesen einer bestimmten Personengruppe
zuordnet. Die entsprechende perspektivelose
Information ist dann eine singulre Proposi-
tion ber den tatschlichen beltter; in
einem gewissen, trivialen Sinn wei der De-
tektiv, um wen es sich dabei handelt, nur
reicht diese schwache Identifikation nicht fr
eine Festnahme aus. Das Beispiel und fr
andere Arten der direkten Referenz lassen
sich analoge Flle konstruieren soll ver-
anschaulichen, da direkte Referenz und Sin-
gularitt von der praktischen Identifizierbar-
keit des Referenten durch das Subjekt unab-
hngige Eigenschaften des objektivierten
(= am epistemischen Zustand ausgewerteten)
Bewutseinsinhalts sind. Der objektivierende
Schritt von der perspektivischen Information
zur singulren Propositon ist im allgemeinen
mit einem Informationsverlust verbunden:
mehreren Arten des Gegebenseins entspricht
in Wirklichkeit oft dasselbe Individuum. Es
kann daher leicht passieren, da dasselbe
Subjekt dieselbe perspektivelose Information
mehrfach vorliegen hat, ohne dies merken zu
knnen; oder es liegen widersprchliche sin-
gulre Informationen ber dasselbe Indivi-
duum vor, das aber dem Subjekt jeweils auf
verschiedene Art gegeben ist. (Im zweiten Fall
knnen natrlich nicht alle Informationen
richtig sein.) In dieser Differenz zwischen epi-
stemischer und entsprechender (d. h. objek-
tivierter) metaphysischer Information liegt ein
Groteil des Erklrungspotentials der er-
kenntnistheoretischen Deutung der klassi-
schen Theorie.
Eine der in diesem Teil diskutierten Alter-
nativen zur klassischen Theorie widersetzt
sich einer erkenntnistheoretischen Umdeu-
tung. Die Rede ist von der in Abschnitt 2.4
skizzierten Tokenanalyse. Der Grund dieser
Unvertrglichkeit mit der im vorliegenden
Abschnitt eingenommenen Perspektive wird
deutlich, wenn wir ein typisches Beispiel einer
uerung betrachten, fr die sich die Token-
analyse besonders gut eignet:
(27) Jetzt ist es siebenundzwanzig Sekunden
frher als jetzt.
Offensichtlich kann man (27) so verzgert
aussprechen, da in dem Sinne etwas Wahres
Wir haben die obige Definition auf dem
Hintergrund der These (E) getroffen. Die Be-
griffsbildungen sowie die Analyse der Bei-
spiele lassen sich jedoch auch sinngem auf
(S) bertragen. Die erkenntnistheoretische
Wendung der klassischen Theorie fhrt somit
auf das aus traditioneller philosophischer
Sicht zumindest berraschende Ergebnis, da
A Priori und Notwendigkeit zwei voneinan-
der unabhngige Begriffe sind. Dies ist die
eingangs dieses Abschnittes angekndigte
philosophische Implikation der klassischen
Theorie.
Die in (a) und (b) definierten Begriffe las-
sen sich im Prinzip auf Charaktere beliebiger
Ausdrcke (im Gegensatz zu Stzen) bertra-
gen. Dazu bedarf es lediglich der Einsicht,
da in beiden Fllen eine Invarianz der Ex-
tension ber gewisse Referenzpunkte hinweg
gefordert wird. Eine natrliche Verallgemei-
nerung (a) des A Priori auf beliebige Cha-
raktere ergibt sich demnach aus der Bedin-
gung, da fr uerungssituationen s
0
und s
1
stets gilt: (s
0
)(s
0
) = (s
1
)(s
1
). Zur Illustration
des A Priori in diesem weiteren Sinne mag
der Charakter der Kennzeichnung die Sprache
dieser uerung dienen: jede uerung dieses
Ausdrucks referiert auf das Deutsche, doch
ist es in praktisch jeder uerungssituation
zumindest denkbar und insofern (metaphy-
sisch) mglich, da das Gesprch auf Alt-
islndisch gefhrt wird. Die entsprechende
Verallgemeinerung (b) des Notwendigkeits-
begriffs fhrt auf einen der Kernbegriffe von
Abschnitt 1.3, direkte Referenz: eine Intension
(s
0
) ist notwendig, wenn (s
0
)(s) = (s
0
)(s)
= 1 (fr beliebige s und s), wenn also der
betreffende Ausdruck direkt auf den Wahr-
heitswert 1 referiert und die Auswertungs-
situation keine Rolle spielt. Als weiterer be-
grifflicher Zusammenhang zwischen den oben
gegebenen Definitionen und den Referenz-
arten sprachlicher Ausdrcke sei hier noch
die Unvertrglichkeit von Deixis und A Prio-
rizitt auch im erweiterten Sinne (b)
erwhnt, deren Nachweis eine Fingerbung
ist.
Die direkte Referenz bedarf im Rahmen
der erkenntnistheoretischen Deutung der
klassischen Theorie besonderer Aufmerksam-
keit. Direkte Referenz fhrt bekanntlich auf
der Intensions-Ebene zu singulrer Informa-
tion, Information ber den Referenten. Da es
sich dabei um perspektivelose Information
handelt, ist damit nichts ber die Art des
Gegebenseins, d. h. die Identifikation des Re-
ferenten aus Sicht des Subjekts gesagt: es
186 IV. Kontexttheorie
wutseinsinhalten als Charakteren berhaupt
tragfhig ist. Weiterhin mte die obige De-
finition auf ihre Brauchbarkeit als Rekon-
struktion entsprechender klassischer Begriffs-
bildungen berprft werden. Sonst htte man
mit (25) und (26) vielleicht nur eine These
belegt, die zwar im Wortlaut, aber nicht im
Inhalt gngigen philosophischen Positionen
widerspricht. Und schlielich ist auch dann
noch nicht gezeigt, da diese Art von Unter-
mauerung der umstrittenen These fr das Un-
terfangen berhaupt wesentlich ist: vielleicht
lt sich der Nachweis ja auch ganz unab-
hngig von dem aus der Referenztheorie ber-
nommenen Begriffsapparat fhren. In diesem
Falle wre die erkenntnistheoretische Umdeu-
tung bestenfalls ein irrefhrender Umweg.
Von der klassischen Theorie der Kontextab-
hngigkeit zur sprachanalytischen Fundie-
rung der Unabhngigkeit von A Priorizitt
und Notwendigkeit und insbesondere des
durch (25) angeblich illustrierten kontingen-
ten A Priori ist also noch ein weiter Weg,
dem zu folgen fr uns hier allerdings nicht in
Frage kommt.
3. Aspekte des Kontexts
Dieser Teil soll in erster Linie einen Eindruck
von den Anwendungsweisen und -mglich-
keiten der klassischen Theorie und ihrer Va-
rianten vermitteln. Ein dafr geeigneter Rah-
men ist die in Abschnitt 2.1 skizzierte Auf-
schlsselung der uerungssituationen in
eine Liste semantisch relevanter Aspekte. Da-
bei werden zunchst, im ersten Abschnitt, die-
jenigen Parameter nher untersucht, die uns
oben schon fters begegnet sind: neben den
fr die erste und zweite Person zustndigen,
kommunikative Rollen beschreibenden
Aspekten gehren dazu vor allem auch die
fr jede Situation definierten, sie lokaliseren-
den Eigenschaften: Welt, Zeit und Ort. Der
darauffolgende Abschnitt ist solchen deikti-
schen Ausdrcken gewidmet, die in der Regel
auf eine die uerung begleitende Zeigehand-
lung Bezug nehmen und insofern von einem
Zeige-Aspekt abhngen. Im letzten Ab-
schnitt dieses Teils werfen wir noch einen klei-
nen Blick in den Abgrund derjenigen sprach-
lichen Ausdrucksmittel, die anstatt von
einem konkret fabaren Aspekt des Kontexts
abzuhngen sich etwas diffus auf durch
die uerungssituation Nahegelegtes zu be-
ziehen scheinen.
Wir haben zu Beginn des Abschnitts 2.1
festgestellt, da der dort definierte Aspekt-
herauskommt, da das zweite Token von jetzt
exakt siebenundzwanzig Sekunden nach dem
ersten geuert wird. Mit der Tokenanalyse
bereitet die Deutung dieser selbsterfllenden
uerung auch keine Schwierigkeiten: jedes
Token von jetzt wird an seinem Zeitpunkt
und als auf diesen verweisend gedeutet. Ver-
sucht man jedoch, (27) als inneren Monolog
aufzufassen was ja nicht sonderlich schwie-
rig ist versagt die in diesem Abschnitt
dargestellte Umdeutung. Zumindest ist es
nicht mehr ohne weiteres mglich, den Cha-
rakter von (27) als Momentaufnahme eines
entsprechenden Bewutseinsinhalts aufzufas-
sen. Denn einerseits fhrt die klassische Auf-
fassung des Charakters zu einer offenkundig
falschen Deutung: dem Wort jetzt entspricht
ein einziger kontextueller Parameter, so da
sich beide Token auf das eine Jetzt des kogni-
tiven Zustands bezgen. Andererseits ist aber
die von der Tokenanalyse vorgenommene
Aufspaltung in zwei Jetzt-Zeiten nicht mit der
Auffassung vertrglich, da
27
einem in die-
sem Zustand gefaten Gedanken entspricht,
der vermge der in (27) vorkommenden deik-
tischen Wrter irgendeinen propositionalen
Inhalt aus der Perspektive des Subjekts in
dieser Situation beschreibt: der Witz an (27)
ist ja gerade, da er seinen mehr oder weniger
trivialen Inhalt portionenweise aus der Sicht
zweier verschiedener Situationen prsentiert.
Ein mglicher Ausweg ist hier die am Ende
des vorhergehenden Abschnitts angespro-
chene Deutung einiger deiktischer Wrter als
Demonstrativa mit unsichtbarer (innerer)
Zeigehandlung. Ob diese Strategie generell
genug ist, mssen wir dahingestellt sein las-
sen. Um jedenfalls die Tokenanalyse fr die
erkenntnistheoretische Deutung der klassi-
schen Theorie fruchtbar zu machen und damit
auch die Charaktere solcher Stze wie (27)
als Bewutseinsinhalte aufzufassen, bedarf es
mglicherweise einer subtileren Entsprechung
zwischen Charakter und epistemischer Infor-
mation, als wir sie hier angedeutet haben.
Wir beschlieen unseren philosophischen
Exkurs mit einer Reihe von Warnungen. Zu-
nchst einmal ist aus den obigen Betrachtun-
gen hoffentlich klar geworden, da die mit
der klassischen Theorie in Verbindung ge-
brachten philosophischen Thesen strengge-
nommen auf einer Umdeutung derselben be-
ruhen. Diese Umdeutung ist fr sich genom-
men noch keine Begrndung dieser Thesen.
Dafr mte vor allem erst einmal gezeigt
werden, da die aus der Idee des inneren
Monologs gewonnene Auffassung von Be-
9. Kontextabhngigkeit 187
auch immer: der Entscheidung zugunsten
eines bestimmten kontextuellen Parameters in
der semantischen Beschreibung wird immer
etwas Willkrliches anhaften. Das sollte bei
der folgenden exemplarischen Auswahl stets
bedacht werden.
3.1Standardaspekte unter der Lupe
Das aus der Sicht der klassischen Theorie
typische deiktische Wort schlechthin ist das
Personalpronomen der ersten Person Singu-
lar. Es taucht in praktisch allen Darstellungen
und Anwendungen der klassischen Theorie
auf. Auch wir haben es zur Motivierung der
Unterscheidung von uerungs- und Aus-
wertungssituation herangezogen. Wir werden
deshalb den Sprecher-Aspekt als erstes unter
die Lupe nehmen. Zunchst ist zu vermerken,
da das Wort ich da es auch in schriftlichen
uerungen vorkommen kann nicht im-
mer wirklich auf den Sprecher verweist. Etwas
neutraler knnte man vom uereraspekt
sprechen (bzw. schreiben), der den Produzen-
ten des (in der uerungssituation eindeutig
bestimmten) sprachlichen Ausdrucks heraus-
greift. Doch auch das ist mglicherweise nicht
allgemein genug, will man etwa den in Ab-
schnitt 2.5 bereits thematisierten Gebrauch
von ich in inneren Monologen oder sonstigen
Denk-Zitaten auf einigermaen plausible
Weise erklren:
(28) Habe ich heute eigentlich schon gefrh-
stckt? fragte sich Wolfgang.
Auch wenn man in Beispielen wie (28) fr die
Ermittlung der Extension von ich die ue-
rungssituation in Richtung Auswertungs-
situation verschiebt, ist immer noch nicht ge-
sagt, wie man denn den Referenten genau
bestimmt: der beschriebene Denkakt ist ja
nicht notwendigerweise der einzige in der be-
trachteten Situation stattfindende. (Aller-
dings ist der Gedanke, der in dem Satz um-
schrieben wird, in dem das fragliche Prono-
men vorkommt, eindeutig bestimmbar: man
sieht, da man hier auf hnliche Probleme
stt wie im Zusammenhang mit der Token-
analyse.) Doch abgesehen davon, da ich
nicht unbedingt auf den Urheber eines gewis-
sen sprachlichen Produktes verweist, mu es
sich auch nicht unbedingt um den Urheber
des betreffenden sprachlichen Produktes han-
deln:
(29) Nimm mich mit!
Diese eindeutige Aufforderung soll man in
Krze auf in ffentlichen Herrentoiletten
bereitgestellten Prservativpackungen lesen
Begriff extrem liberal ist. So lt sich bei-
spielsweise eine Funktion definieren, die jeder
Situation s das nchste Schaltjahr nach s zu-
ordnet, ohne da es in irgendeiner Sprache
einen Ausdruck gibt, dessen Extension von
diesem Aspekt abhngt; ein Gleiches gilt fr
konstante Aspekte wie den, der jeder Situa-
tion die Kreiszahl zuweist. Die Charaktere
sprachlicher Ausdrcke sind eben nicht fr
alle Aspekte von uerungssituationen sen-
sibel. Welche Aspekte semantisch einschlgig
sind, ist berdies keine absolut zu beantwor-
tetende Frage, sondern hngt zum Teil von
metatheoretischen Faktoren (Einfachheit der
semantischen Beschreibung, Kompatibilitt
mit anderen Theorien, ...) ab. So gibt es kei-
nen zwingenden Grund dafr, die Extension
von ich als vom Sprecher-Aspekt abhngig zu
beschreiben: man knnte stattdessen bei-
spielsweise eine Funktion f heranziehen, die
jedem s
0
Geburtsort und -datum des Produ-
zenten der uerung zuweist. Die Extension
von ich lt sich dann in s
0
als die Person
beschreiben, die (in der Welt von s
0
) an dem
von f(s
0
) spezifizierten rumlich-zeitlichen
Koordinatenpunkt geboren wurde; nur
scheint es keinen vernnftigen Grund dafr
zu geben, den fr ich naheliegenden Sprecher-
Aspekt durch das bizarre f zu ersetzen. Doch
schon bei gestern ist es einigermaen zweifel-
haft, was denn nun der fr die Extensions-
bestimmung einschlgige situationelle Aspekt
ist: statt des Vortags knnte man ebensogut
den Tag der uerung selbst nehmen und
dann in einer fr gestern zustndigen seman-
tischen Regel festlegen, wie die Abhngigkkeit
von diesem Tages-Aspekt genau aussieht. Auf
diese Weise knnte man gestern, heute und
morgen als auf jeweils unterschiedliche Weise
von demselben Aspekt abhngig beschreiben.
Ja, man kann noch einen Schritt weitergehen
und die genannten Ausdrcke lediglich von
dem fr jetzt und gleich bentigten Aspekt
des Sprechzeitpunkts abhngen lassen: morgen
bezieht sich auf den Tag nach dem Sprech-
zeitpunkt etc. Die Betrachtungen in Abschnitt
2.4 legen schlielich nahe, da sich ein Gro-
teil der kontextuellen Aspekte ohne groe
Verrenkungen auf den Token-Aspekt reduzie-
ren lt, der einfach jedem s
0
die in s
0
ge-
machte uerung zuweist. Schlielich lassen
sich sogar alle Aspekte auf einen einzigen
reduzieren, nmlich den Identitts-Aspekt, der
jeder Situation s einfach s selbst zuordnet;
doch diese Reduktion trivialisiert den Aspekt-
Begriff und fhrt zu einer unntig kompli-
zierten Variante der klassischen Theorie. Wie
188 IV. Kontexttheorie
barkeiten der Pluralsemantik aus [diese sind
Gegenstand des Artikel 19], so scheint wir
keine sonderlich interessanten Probleme auf-
zugeben: es bezieht sich offenbar auf eine in
der uerungssituation naheliegende
Gruppe, die den Sprecher (oder den, der als
Sprecher zhlt) und mindestens eine andere
Person (oder ein anderes als Person geltendes
Wesen) umfat. Bei nhrerem Hinsehen stellt
sich dann heraus, da (i) nicht alle Mitglieder
dieser Gruppe in der Auerungssituation zu-
gegen oder (ii) berhaupt am Leben sein ms-
sen, da (iii) die Bestimmung der wir-Gruppe
in der Praxis oft eine recht vage Angelegenheit
ist und da es (iv) nebenbei auch andere,
ebenso naheliegende, den Sprecher umfas-
sende Personengruppen geben kann. Das fol-
gende Beispiel dient als Illustration von (i)
(iv):
(30) Wir sind wieder wer.
Bei einer uerung von (30) durch einen bun-
desdeutschen Richter in der Nachkriegszeit
konnte sich dieser mit wir natrlich auf die
Gruppe der Deutschen beziehen. Wenn diese
uerung im engsten Kollegenkreis stattfin-
det, ist (i) erfllt. (ii) gilt auch, wenn man
einmal unterstellt, da sich der Sprecher auf
die Deutschen als Gesamtheit und nicht auf
die berlebenden bezieht. Eine Vagheit
kommt ins Spiel, wenn man sich fragt, ob zu
dieser Gesamtheit etwa auch alle kurz vor
Ende des zweiten Weltriegs geborenenen
Deutschen gehren. Und unter den genannten
Umstnden htte der Jurist natrlich eben-
sogut sich und seine Kollegen vom Volksge-
richtshof meinen knnen. Man erkennt an
diesem Beispiel auch, da die gelegentlich
vorgeschlagene (und in manchen Sprachen
markierte) Aufspaltung des wir in eine die
Hrerschaft umfasssende und eine sie aus-
schlieende Lesart nicht immer weiterhilft.
Das Gleiche gilt fr andere Disambiguie-
rungsversuche: die konkrete Auswahl der
Gruppe, auf die sich wir bezieht, ist eine hoch-
gradig situationsabhngige Angelegenheit.
Es gibt keinen zwingenden Grund dafr,
fr die erste Person Plural einen eigenen kon-
textuellen Parameter anzusetzen. Ebensogut
knnte man die Extension von wir unter
Rckgriff auf den Sprecher-Aspekt und eine
(in Abschnitt 3.3 noch nher zu erluternde)
situationsabhngige Ordnung der Dinge nach
ihrer Prominenz (oder Einschlgigkeit) be-
schreiben: wir bezieht sich dann auf die im
Sinne dieser Ordnung ranghchste Gruppe,
der der Sprecher angehrt.
knnen. Wer aber ist der Urheber dieser
schriftlichen uerungen? Das jeweilige To-
ken wird zweifellos von einer Maschine er-
stellt; die Aufschrift gleicht also in dieser Hin-
sicht einem Geschftsbrief, wo sich ich auf
den Chef als den geistigen Urheber und nicht
auf die Sekretrin als Produzentin des tat-
schlichen Briefes bezieht. Doch (29) ist wohl
kaum als zweideutige Aufforderung seitens
der Bundesgesundheitsministerin gemeint.
Das Wort mich bezieht sich vielmehr auf den
von ihrer Behrde bereitgestellten Gummi-
schutz. Der wiederum kommt wohl kaum als
Produzent der genannten uerung in Frage.
Dennoch ist klar, da er in diesem Falle als
Referent von ich verstanden wird: das Kon-
dom zhlt als Sprecher.
Der Sprecher-Parameter liefert also einfach
das, was immer in dieser Situation als Spre-
cher zhlt. Analoges wird fr alle im folgen-
den zu besprechenden kontextuellen Para-
meter gelten. Es sei allerdings darauf hinge-
wiesen, da diese Aufweichung der Aspekte
kein rein semantisches Phnomen ist, sondern
grtenteils in der Pragmatik unter dem
Stichwort Akkomodationsregeln abgehandelt
werden kann: in einer Situation, in der ber-
haupt niemand spricht, mu die Hrerin
will sie das Ausgesagte verstehen das Wort
ich eben auf irgendjemand (oder irgendetwas)
anderes beziehen; und beim Ausfindigmachen
dieses Sprecher-Ersatzes helfen ihr die ge-
nannten Regeln. Solche Regeln bewirken of-
fenbar eine Verschiebung eines rein kontex-
tuellen Aspekts, womit sie auf den ersten
Blick das in Abschnitt 1.4 verhngte Mon-
sterverbot zu unterlaufen scheinen. Doch
handelt es sich bei den Akkomodationsregeln
nicht um semantische Operationen: solche
Verschiebungen kommen nur vor, wenn die
im engeren Sinne semantischen Regeln ver-
sagen. Um das zu unterstreichen, werden wir
in solchen Fllen von pragmatischen Verschie-
bungen der entsprechenden Aspekte spre-
chen.
Mehr wollen wir an dieser Stelle ber den
Sprecher-Aspekt nicht sagen, da wir ihn
schon ausfhrlich kennengelernt haben. Es
sollte nur erwhnt werden, da dieser Aspekt
im Deutschen wie in vielen (wenn nicht sogar
allen) anderen Sprachen rein kontextueller
Natur ist, sich also stets auf die uerungs-
situation bezieht und nicht verschoben wer-
den kann.
Ausgehend von der ersten Person Singular
liegt natrlich die erste Person Plural, das wir,
nahe. Blendet man einmal smtliche Unweg-
9. Kontextabhngigkeit 189
regnet zu deuten, also durch einen Charakter
:
, der an einem Referenzpunkt s
0
,s den
Wahrheitswert 1 ergibt, falls es in s regnet.
Die in (31) angewandten Modifikatoren ver-
schieben dann die Auswertungssituation: das
Perfekt fhrt auf ein vergangenes s, mit der
Prpositionalphrase gelangt man in ein s in
Rottweil, und fr den gesamten Satz (31) wer-
den dann mgliche Auswertungssituationen
herangezogen, die nicht mit Sicherheit aus-
geschlossen werden knnen. Im Rahmen einer
Parametrisierung (im Sinne von Abschnitt
2.1) sieht dann die gesamte Extensionsbestim-
mung einer uerung von (31) in einer Situa-
tion s
0
also ungefhr so aus:
Man beachte, da bei dieser Auswertung von
(31) von s
0
als uerungssituation nur im
ersten Schritt wesentlicher Gebrauch gemacht
wird nmlich dort, wo s
0
in den Index
eingefhrt wird. Man htte also (31) eben-
sogut im Rahmen einer pr-klassischen Theo-
rie deuten knnen, die lediglich zwischen Ex-
tension und Intension unterscheidet, wobei
erstere von letzterer und einem in Aspekte
aufgeschlsselten Index abhngt. Das liegt
daran, da die von den intensionalen Ope-
ratoren in (31) also von sicherlich, in Rott-
weil und dem Perfekt tangierten indexi-
kalischen Aspekte nicht gleichzeitig durch
deiktische Ausdrcke belegt werden. Aber
warum sollten sie auch? Warum wollte man
z. B. den ursprnglich (ber (D)) kontextuell
gegebenen Ortsaspekt zunchst ersetzen und
Wenden wir uns den Personalpronomina
der zweiten Person zu. Einige der Phnomene,
die man hier beobachten kann, sind den der
ersten Person gleich oder analog: Ansprech-
partner werden oft nicht wirklich angespro-
chen, sondern lediglich als solche gedacht (wie
etwa im Selbstgesprch oder bei einer Anru-
fung der Gtter), der tatschliche Leser oder
Hrer mu nicht der Angesprochene sein (wie
beim Abhren eines Telefongesprchs), die
Bestimmung der im Plural angesprochenen
Gruppe ist nicht immer ganz eindeutig usw.
An grundstzlich Neuem gegenber der er-
sten Person kommt wohl nur die im Deut-
schen (und vielen anderen Sprachen) vorge-
nommene Unterscheidung zwischen Familiar-
und Hflichkeitsform hinzu. Die wiederum
spielt fr die Extensionsbestimmung in der
Regel keine Rolle, sondern gehrt hnlich
wie die in Abschnitt 1.3 angesprochene Fr-
bung einer anderen semantischen Ebene,
dem Register, an; der (durchaus hufige) Fall,
in dem die Referentin von du aufgrund der
Tatsache ermittelt wird, da es sich um die
einzige Anwesende handelt, die vom Sprecher
geduzt wird, lt sich im Rahmen pragmati-
scher berlegungen abhandeln und zwar
analog zu der Situation, in der jemand eine
Aufforderung in franzsischer Sprache auf
sich bezieht, wenn ihm und der auffordernden
Person klar ist, da er der einzige weit und
breit ist, der des Franzsischen mchtig ist.
Die Register-Unterschiede bei den Personal-
pronomina der zweiten Person schlagen sich
also nicht in den Charakteren nieder: du und
Sie im Singular sind ebenso charaktergleich
wie das Personalpronomen ihr und das plu-
ralische Sie.
Neben den Produzenten und Rezipienten
der uerungen spielen Ort, Zeit und Welt
der uerungssituation eine wichtige Rolle
bei der Extensionsbestimmung. Der aus Sicht
der Referenztheorie wichtigste Unterschied
zwischen diesen Situationsparametern einer-
seits und den fr die Deutung der Personal-
pronomina der ersten und zweiten Person zu-
stndigen besteht darin, da letztere rein kon-
textuell sind, whrend Ort, Zeit und Welt
jeweils verschoben werden knnen:
(31) Sicherlich hat es in Rottweil geregnet.
Wir gehen davon aus, da (31) das Ergebnis
einer sukzessiven Modifikation des Verbs reg-
nen durch das Vergangenheitstempus Perfekt,
das komplexe Ortsadverb in Rottweil und das
Satzadverb sicherlich ist; das Subjekt spielt
semantisch offenbar keine Rolle. Es liegt dann
nahe, regnen selbst etwa im Sinne von es
190 IV. Kontexttheorie
techniken noch etwas verfeinert werden. Eine
naheliegende, aber in die Irre fhrende Stra-
tegie besteht in einer Abnderung der Perfekt-
Semantik nmlich, indem man das Tempus
(pr-klassisch) auf die Zeit vor der Auswer-
tungszeit bezieht. Das beschert uns zwar
mit der angedeuteten Skopus-Vertauschung
eine andere Lesart fr (33), aber noch lange
nicht die erwnschte: der Satz wrde besagen,
da es irgendwann vor dem Tag der ue-
rung geregnet hat. (Ohne Skopus-Vertau-
schung erhielte man wieder die alte, uner-
wnschte Lesart.) Die Quantifikation mu
dagegen richtigerweise ber die Zeit vor der
uerung, aber am Tage derselben, also im
Rahmen der Auswertungszeit, laufen:
An dieser exemplarischen und stark verein-
fachten Darstellung der semantischen Inter-
aktion von Tempus und Temporaladverb
kann man gleich mehreres auf einmal erken-
nen. Erstens setzt das Perfekt die Zeit der
Auswertungssituation (oft auch Betrachtzeit
genannt) zu der der uerungssituation
(= Sprechzeit) in Bezug. Zweitens mssen of-
fenbar diese Zeiten Intervalle und nicht etwa
Zeitpunkte sein; sonst knnnte man ja nicht
die eine Auswertungszeit in die andere ein-
betten. Und drittens verhlt sich der Zeitpa-
rameter komplizierter, als man vielleicht zu-
nchst erwartet htte; dies wird besonders
deutlich, wenn man sich an die Analyse kom-
plexerer Beispiele mit anderen Tempora oder
anderen Typen von Zeitadverbien (insbeson-
dere Frequenzadverbien) heranwagt. [Dafr
mu jedoch auf den Artikel 35 verwiesen wer-
den.]
dann wieder zurckverschieben? In der Tat
scheint ein Nebeneinander von absolutem (in
Rottweil) und deiktischem Adverbial (hier)
nur dann angemessen zu sein, wenn schon
eines von beiden ausreichen wrde. Allerdings
machen solche Hin- und Herverschiebungen
von indexikalischen Aspekten dann durchaus
Sinn, wenn einer der beteiligten intensionalen
Operatoren in dem Sinne undifferenziert ist,
als er auf mehr als einen Aspekt Bezug nimmt:
der undifferenzierte Operator verschiebt dann
vielleicht zunchst den gesamten Index, was
durch gezielte Bindung einzelner Aspekte teil-
weise wieder rckgngig gemacht werden
kann. Das typische Beispiel fr so einen un-
differenzierten Operator ist das satzeinbet-
tende da. Denn es macht einen Unterschied,
ob etwa Angela (32) oder (32) uert es
sei denn, sie befindet sich gerade in Rottweil:
(32) Die Leute in Rottweil rgern sich dar-
ber, da es stndig regnet.
(32) Die Leute in Rottweil rgern sich dar-
ber, da es hier stndig regnet.
In beiden Fllen verschiebt das da den Welt-
Aspekt im eingebetteten Satz auf die Welt der
jeweiligen Auswertungssituation. Doch wh-
rend in (32) der eingebettete Nebensatz
ebenfalls aufgrund des da auch am Ort
der Auswertungssituation bewertet wird, wird
dieser Nebeneffekt in (32) gerade durch das
hier wieder rckgngig gemacht: der Auswer-
tungs-Ort ist der Ort der uerung.
Was fr den Ort gilt, gilt nicht fr die Zeit.
Entgegen den obigen Behauptungen sind
nmlich im Falle des Zeitparameters Dop-
peltbelegungen durchaus mglich: neben ein
Vergangenheitstempus wie dem Perfekt in
(31) kann z. B. noch ein Temporaladverb tre-
ten, ohne da eine der beiden Zeitbestimmun-
gen fr sich allein ausreichte:
(33) Heute hat es in Rottweil geregnet.
Deutet man (wie oben) das Perfekt als Quan-
tor ber vor der Sprechzeit Vergangenes, so
kommt heraus, da (33) besagt, da es
(irgendwann) vor der uerung in Rottweil
geregnet hat; das Adverb heute wre dann
redundant. Auch eine Vertauschung des Sko-
pus von Tempus und Zeitadverb hilft hier
nicht weiter: danach wre das Perfekt ber-
flssig, und (33) wrde bedeuten, da es in
Rottweil am Tag der uerung irgendwann
regnet. Das ist jedoch nicht korrekt; der Re-
gen mu vor der uerung von (33) fallen,
damit diese wahr ist. Um die Interaktion von
Tempus und Zeitadverb zu erfassen, mssen
offenbar die bisher betrachteten Deutungs-
9. Kontextabhngigkeit 191
gemein bekannter Fall ist das sog. historische
Prsens, das dem Gymnasiasten gerne als
Grammatikfehler, dem Literaten indes als
Stilmittel ausgelegt wird. Eine Verschiebung
des Ortsaspekts scheint allerdings nur mg-
lich zu sein, wenn die Zeit mitverschoben
wird. Verschiebungen der Welt findet man
schlielich dort, wo gleich die gesamte ue-
rungssituation ausgetauscht wird, wie etwa
bei einer Opernauffhrung: als Sprecher zhlt
die (in der Regel fiktive) Person, die vom
jeweiligen Snger dargestellt wird, als Sprech-
zeit die Zeit, in der die Oper spielt, und die
Welt ist auch nicht die, in der wir leben.
Die Analyse der Beispiele (31)(33) hatte
gezeigt, da die drei betrachteten Parameter
Ort, Zeit und Welt jeweils (semantisch) ver-
schiebbar, d. h. indexikalisch, sind. Damit
sind sie zunchst nur aufgrund einer in Ab-
schnitt 2.1 vereinbarten Konvention auch
kontextuelle Parameter. Doch sind sie auch
echte kontextuelle Parameter? Gibt es m. a. W.
Wrter oder Konstruktionen, deren semanti-
sches Verhalten man nur unter der Annahme
beschreiben kann, da sie auf jeweils einen
der drei genannten Aspekte des Kontexts Be-
zug nehmen? Angesichts der Relativitt der
Zerlegung von Situationen in Aspekte mu
wohl die Antwort auf diese beiden Fragen
strenggenommen negativ ausfallen. Dennoch
lohnt es sich, nach Ausdrcken und Kon-
struktionen zu suchen, die sich auf natrliche
und naheliegende Weise durch einen Bezug
auf Ort, Zeit und/oder Welt der uerungs-
situation beschreiben lassen. Und in der Tat
haben wir zumindest fr den Zeitparameter
ein solches Beispiel kennengelernt: bei der
Deutung von (33) hat es sich ja herausgestellt,
da das Perfekt auch dann auf die ue-
rungszeit Bezug nimmt, wenn die Auswer-
tungszeit bereits (in diesem Falle durch ein
Zeitadverb) verschoben wurde. Damit ist die
Kontextualitt der Zeit auch empirisch unter-
mauert. Fr den Ortsaspekt sind eindeutig
deiktische Ausdrcke schon schwieriger zu
finden. Das bereits erwhnteWort hier ist na-
trlich ein guter Kandidat, doch werden wir
in Abschnitt 3.3 noch sehen, da es keines-
wegs unbedingt durch Bezug auf den Orts-
aspekt gedeutet werden mu. Bei Orientie-
rungsangaben wie links und unten ist zumin-
dest zu beachten, da sie eher die Perspektive
des Sprechers (und insofern allenfalls den
Sprecher-Aspekt) als den Ort der uerung
bercksichtigen. Doch knnte man den Be-
griff des Ortsparameters dahingehend przi-
sieren, da er sich auf den Sprecher mit dessen
Neben Ort und Zeit ist in unsere Muster-
analyse von (31) noch der Weltparameter ein-
gegangen, der zur Deutung des Modaladverbs
sicherlich benutzt wurde. Die allgemeine Idee
hinter diesem Umgang mit mglichen Welten
ist bereits in Abschnitt 1.2, bei der Darstel-
lung der Deutung satzeinbettender Verben,
dargestellt worden. (Die obige Deutung von
sicherlich ging natrlich davon aus, da es
sich bei der Einbettung unter dieses Adverb
um ein vergleichbares Phnomen handelt.)
Genauere Ausfhrungen zum Weltenbegriff,
von denen alle Versionen der klassischen
Theorie Gebrauch machen, wrden leider den
Rahmen des vorliegenden Artikels sprengen.
Es sei lediglich darauf hingewiesen, da in der
Literatur weitgehend Einigkeit darber
herrscht, da jede mgliche Welt alle Fakten
vollstndig determiniert wenn auch jede
auf ihre Weise: vielleicht gibt es eine Welt, in
der die Anzahl der Haare auf David Lewis
Kopf doppelt so gro ist wie tatschlich, aber
es gibt keine, in der sie unbestimmt ist. Un-
einigkeit herrscht dagegen unter den Meta-
physikern ber die Frage, ob man sich nicht-
reale Welten als konkrete Universen oder als
abstrakte Mglichkeiten vorzustellen hat.
Von der Beantwortung dieser Frage hngt
unter anderem ab, ob etwa ein und dieselbe
Person in einer nicht-realen Welt existieren
kann und ob es strenggenommen berhaupt
Sinn macht, fiktive Welten zu betrachten, in
denen diese Person Eigenschaften besitzt, die
ihr in Wirklichkeit nicht zukommen. Solange
diese und hnliche philosophische Fragen
zum Weltenbegriff noch ungeklrt sind, steht
natrlich die klassische Theorie auf recht
wackligen Fen.
Fr Ort, Zeit und Welt gelten wieder hn-
liche Vorbehalte wie fr den Sprecherpara-
meter. Solange keine lokalen Angaben den
Auswertungsort verschieben, gilt der ue-
rungsort als solcher; doch letzterer ist oft nur
sehr vage umrissen. In verschiedene ue-
rungen von (34) kann man sich bei verschie-
denen Gelegenheiten jeweils auf das Zimmer,
in dem man sich befindet, auf die Region in
einem Umkreis von etwa 150 Kilometern oder
sogar auf den gesamten Kontinent beziehen,
in dem die uerung stattfindet:
(34) Im Frhjahr wird es nur selten wrmer
als 34 Celsius.
Diese Art von Vagheit lt sich auch beim
Welt- oder Zeitparameter nachweisen. Und
auch vor pragmatischen Verschiebungen sind
die genannten Aspekte nicht sicher. Ein all-
192 IV. Kontexttheorie
worauf der Sprecher zeigt, und das ist den
Umstehenden nicht immer klar, wohl aber
dem Sprecher. Was mit einem Satz wie (35)
in einer Situation s
0
gesagt wird, was also die
durch ihn ausgedrckte Proposition ist, hngt
teilweise davon ab, was die Sprecherin in s
0
mit das meint. Allerdings kann sie mit ihrer
uerung (plus Zeigegeste) nicht Beliebiges
meinen; sie mu sich schon an die bei Zeige-
handlungen blichen Gepflogenheiten halten:
ein substantieller Teil des Gegenstandes sollte
also in angemessener Entfernung auf einer als
Verlngerung des zeigenden Fingers gedach-
ten Linie liegen; Abweichungen von dieser
Regel sollten zumindest durch besondere Um-
stnde gerechtfertigt sein. Weiterhin gilt, da
es natrlich im eigenen Interesse der Spreche-
rin liegt, Formulierung und Zeigehandlung so
eindeutig wie mglich zu gestalten. Man kann
also davon ausgehen, da das Ziel der Zeige-
Geste fr den Adressatenkreis als solches
identifizierbar sein mu und im Normalfall
auch ist. Dem Zeige-Aspekt kommt somit ein
gewisses Ma an Intersubjektivitt zu.
Um die Nachvollziehbarkeit ihrer Inten-
tion auch wirklich sicherzustellen, kann die
Sprecherin zur Untersttzung ihrer Zeige-
handlung zustzliche sprachliche Mittel ein-
setzen. So kann sie beispielsweise das De-
monstrativpronomen in Artikelfunktion ver-
wenden und mit einem Nomen versehen. Eine
solchermaen gebildete, im folgenden als de-
monstrativ bezeichnete Nominalphrase (wie
diesen Fra) hilft dann, eventuell beim nack-
ten Demonstrativum (plus Zeigegeste) zu be-
frchtenden Miverstndnissen von vornher-
ein aus dem Weg zu gehen. Eine aus theore-
tischer Sicht interessante Frage betrifft nun
die Referenzweise demonstrativer Nomi-
nalphrasen: wie bestimmt sich etwa die Ex-
tension von diesen Fra? Wenn wir einmal
davon ausgehen, da es sich bei diesen in der
Tat um ein echt deiktisches Wort (mit Bezug
auf einen Zeige-Aspekt) handelt, reduziert
sich die Frage nach der Referenzweise der
Gesamt-NP auf die nach dem Einflu des
Artikels auf die Auswertung des Nomens:
Substantive referieren normalerweise nicht
deiktisch, und so wrde man fr diesen Fra
zunchst eine gemischte Referenzweise erwar-
ten; eine Auswertung an der uerungssitua-
tion wre also nur durch einen Einflu des
deiktischen Artikels erklrbar. Wegen des
Prinzips (D) kann man diese Frage natrlich
nur unter Heranziehung intensionaler Kon-
struktionen klren. Und in der Tat scheint
dann einiges fr die Annahme zu sprechen,
Orientierung bezieht; dafr spricht auch, da
bei Telefongesprchen als Ort der uerung
der Ort gilt, an dem sich die Sprecherin be-
findet. Was schlielich die Welt angeht, so
wurde bereits im Zusammenhang mit der
zweidimensionalen Modallogik (in Abschnitt
2.3) bemerkt, da der waagerechte Diagonal-
operator (dthat) in der Anwendung auf Stze
dem Modaladverb tatschlich entspricht.
Eine Lupe ist kein Mikroskop, und so kn-
nen diese Bemerkungen nur einen Eindruck
von den Problemen vermitteln, die sich der
klassischen Theorie bei ihrer Anwendung auf
die Beschreibung verschiedener Typen von
Kontextabhngigkeit stellen. Die Details sind
oft ungleich komplexer.
3.2Demonstrativa
Den im vorangehenden Abschnitt diskutier-
ten kontextuellen Aspekten ist eine gewisse
uerlichkeit gemeinsam: sie alle betreffen
objektive, mehr oder weniger leicht feststell-
bare Merkmale konkreter Situationen. Doch
die Extensionen sprachlicher Ausdrcke hn-
gen nicht immer nur von solchen einfachen
Aspekten des Kontexts ab. Deixis ist das grie-
chische Wort fr Zeigen, und viele deiktische
Ausdrcke werden charakteristischerweise
von Zeigehandlungen begleitet. Ganz typisch
ist die Verwendung von Zeigegesten im Zu-
sammenhang mit den (wohl auch deshalb so
genannten) Demonstrativa:
(35) Das mag ich nicht!
Wer einen Satz wie (35) uert, kann dabei
mit dem Finger auf irgendetwas zeigen, und
genau dieses Objekt ist dann in der Regel die
Extension des Demonstrativpronomens das.
Natrlich ist die Zeigegeste oft nicht eindeu-
tig. So kann z. B. unklar sein, ob das Klein-
kind bei seiner uerung von (35) den h-
lichen Plastikteller oder den darauf liegenden
leckeren Spinatbrei meint. Geht man nun da-
von aus, da sich der Charakter von das (im
wesentlichen) durch die Kennzeichnung das-
jenige Ding, auf welches der Sprecher zeigt
umschreiben lt, so liegt es nahe, das Ziel
der Zeigehandlung als kontextuellen Para-
meter anzusehen; Demonstrativa wrden auf
diese Weise insofern einheitlich behandelt, als
ihre Extension dann jeweils von diesem Zeige-
Aspekt abhngt. Was nun aber diesen Zeige-
Aspekt von den in Abschnitt 3.1 betrachteten
harten Aspekten unterscheidet, ist das fr
mgliche Miverstndnisse verantwortliche
subjektive Moment: worauf sich ein Demon-
strativpronomen bezieht, hngt davon ab,
9. Kontextabhngigkeit 193
bertrgt, nur noch erhrten.
Die dem Zeige-Aspekt inhrente Subjekti-
vitt haftet auch demonstrativen Nominal-
phrasen an allerdings in weit geringerem
Mae: im Normalfall determinieren nmlich
die Zeige-Geste und die durch das Nomen
ausgedrckte Eigenschaft gemeinsam gerade
einen Gegenstand bzw. (im Plural) eine
Gruppe von Gegenstnden. Aber es gibt auch
Flle, in denen das Nomen nicht die er-
wnschte Disambiguierung der Zeigehand-
lung bewirkt. Wer etwa auf die Frage des
Kellners, welches der Getrnke denn fr ihn
bestimmt sei, etwas vage auf das Tablett weist
und dabei:
(38) Dieses Bier!
artikuliert, drckt sich mglicherweise des-
halb nicht eindeutig aus, weil sich auf dem
Tablett drei Bierglser verschiedenen Inhalts
befinden. Die Ungenauigkeit kann verschie-
dene Ursachen haben. Zum einen kann der
Gast bersehen haben, da sich mehrere Biere
auf dem Tablett befinden; andererseits ist es
aber auch mglich, da ihm lediglich die Zei-
gegeste milungen ist. Im ersten Fall referiert
(38) auf nichts. Im zweiten Fall hngt die
Frage, ob (38) eine Extension besitzt von den
Referenzbedingungen fr Zeigehandlungen
ab. Da fr letztere die Absichten des Spre-
chers eine wichtige Rolle spielen, bertrgt
sich die Intentionsabhngigkeit der Zeige-
handlung auf die Extensionsbestimmung von
(38). Das ist das subjektive Element in der
Deutung demonstrativer Nominalphrasen.
Man beachte, da es sich dabei um einen
subjektiven Aspekt in der Bestimmung der
Extension nach allgemeinverbindlichen
sprachlichen Regeln handelt und nicht etwa
um die Absicht des Sprechers, sich auf ein
bestimmtes Ding zu beziehen. Es ist ntzlich,
diesen Unterschied terminologisch festzuhal-
ten. Den vom Sprecher angenommenen Bezug
eines Ausdrucks auf einen Gegenstand wer-
den wir als subjektive Referenz bezeichnen.
Der den Sprachregeln geme tatschliche
Bezug heit objektive Referenz. Letztere ist
gemeint, wenn von der Extension und ihren
subjektiven Aspekten die Rede ist.
Fassen wir nun unsere Betrachtungen zur
Extensionsbestimmung demonstrativer No-
minalphrasen im Singular in Form einer Re-
gel zusammen:
(R
)
Es sei ein Nomen, s
0
eine uerungs-
situation und s eine Auswertungssitua-
tion. Dann ist
dieses
(s
0
)(s) dasjenige
Ding x, fr das gilt:
da Nominalphrasen mit deiktischem Artikel
selbst wieder deiktisch sind, wie die nchsten
Beispiele zeigen werden:
(36) Vor fnf Minuten war dieser Wasser-
tropfen noch gefroren.
In (36) verschieben die temporale Prpositio-
nalphrase und das Tempus gemeinsam die
Auswertungszeit vor die uerungszeit. Die
Extension des Subjekts sollte eigentlich dem-
entsprechend fr diesen vergangenen Zeit-
punkt ermittelt werden. Doch offenkundig
bezieht sich die Spezifikation der Form der
besagten Flssigkeitsmenge auf die Zeit der
uerung von (36): ob diese schon im gefro-
renem Zustand in Tropfenform war, spielt fr
die mit Hilfe von (36) gemachte Ausssage
offenbar gar keine Rolle. Im Gegenteil: wer
statt (36) den Satz (36) uert und dabei auf
einen Wassertropfen verweist, sagt selbst
dann nichts Richtiges, wenn selbiger erst 5
Minuten vor der uerung aufgetaut ist; es
ist sogar fraglich, ob unter diesen Umstnden
mit (36) berhaupt eine Behauptung aufge-
stellt wird.
(36) Vor fnf Minuten war dieses Eisstck-
chen noch gefroren.
Diese Beobachtungen lassen sich auch auf
andere Typen intensionaler Konstruktionen
bertragen: der in (37) eingebettete da-Satz
mu an den mit des Paten Vorstellungen ver-
einbaren Situationen ausgewertet werden:
(37) Der Pate geht davon aus, da dieser von
uns eingeschleuste Mann absolut ver-
trauenswrdig ist.
Doch wenn etwa ein Polizeiinspektor (37) be-
nutzt, um seinen Kollegen einen neuen Un-
der-Cover-Agenten vorzustellen, sollte im
Interesse der Polzeibehrden der besagte
Mafioso gerade nicht auf die Idee kommen,
da es sich um einen Maulwurf handelt. Um-
gekehrt htte der Polizeibeamte keine ledig-
lich aus Sicht des Gangster-Bosses korrekte
Charakterisierung der vorgestellten Person
mit einem deiktischen Artikel versehen kn-
nen. Wenn es sich bei dem Spitzel um einen
tessinischen Bauernsohn handelt, wre (37)
auf hnliche Weise unangemssen wie schon
zuvor (36):
(37) Der Pate geht davon aus, da dieser
ehemalige sizilianische Chorknabe ab-
solut vertrauenswrdig ist.
Weitere Beispiele wrden den Verdacht, da
sich die Eigenschaft, deiktisch zu referieren,
vom Artikel auf die gesamte Nominalphrase
194 IV. Kontexttheorie
Finger auf der Landkarte, der bewirkt, da
mit einer uerung von (40) nicht unbedingt
etwas Wahres gesagt wird:
(40) Wir sind jetzt hier.
Dieses, in der Literatur gelegentlich als Deixis
am Phantasma bezeichnete Phnomen kann
mitunter Verwirrung stiften. Denn zum einen
kann es passieren, da in einer konkreten
Situation einmal tatschlich unklar ist, ob auf
das Symbol oder auf das symbolisierte Objekt
verwiesen wird; und zum anderen kann, durch
diese Art von Miverstndnis angeregt, der
Theoretiker auf die abwegige Idee kommen,
es handele sich hier um eine sprachliche Am-
biguitt wo doch die Unbestimmtheit im
Akt des Zeigens liegt.
Die zuletzt diskutierten Beispiele sollten
verdeutlichen, da begleitende Zeigegesten
bei der Extensionsbestimmung fr sprachliche
uerungen oft eine wichtige Rolle spielen,
die Ausbung dieser Rolle aber ganz offen-
sichtlich durch semantische Faktoren be-
schrnkt und kontrolliert wird.
3.3Einschlgiges
Ein Groteil der soeben im Zusammenhang
mit demonstrativen Nominalphrasen beob-
achteten Phnomene lt sich ebensogut an-
hand (singularischer) Kennzeichnungen, also
definiter Nominalphrasen des Typs der/die/
das + Nomen, illustrieren. Auch diese knnen
bekanntlich mit Zeigehandlungen verknpft
werden, und sie weisen dann wie man leicht
durch Variation der obigen Beispiele sieht
dieselben referentiellen Eigenschaften wie de-
monstrative Nominalphrasen auf. Man kann
also von einem demonstrativen Gebrauch der
betreffenden Kennzeichnungen sprechen. De-
monstrativ gebrauchte Kennzeichnungen sind
insbesondere immer deiktisch. Eine nahelie-
gende Frage ist nun, ob man mit einer Kenn-
zeichnung auch dann deiktisch referieren
kann, wenn man nicht gleichzeitig auf irgend-
etwas zeigt.
Man kann. Um das zu sehen, braucht man
lediglich eines der obigen Beispiele etwas ab-
zuwandeln:
(37) Der Pate geht davon aus, da der von
uns eingeschleuste Mann absolut ver-
trauenswrdig ist.
Der Kriminalinspektor kann (37) seinem
Vorgesetzten gegenber uern, ohne da der
besagte Agent anwesend ist; er braucht also
nicht auf ihn zu zeigen. Doch wie schon bei
einer uerung von (37) sind fr die Kenn-
x wird in s
0
(durch den Sprecher in s
0
)
gezeigt, und x ist in
(s
0
)(s
0
).
Mit der fr den definiten Artikel in der Logik
blichen Notation lt sich (R
) auch so
paraphrasieren:
(R') Es sei ein Nomen. Dann lt sich
dieses auch so paraphrasieren:
dthat(x (x wird gezeigt & x ist ein )).
Gibt es neben den traditionell als demonstra-
tiv bezeichneten Artikeln und Pronomina
(dieses und jenes) noch weitere sprachliche
Ausdrcke, die sich auf den kontextuellen
Zeigeparameter beziehen? Prinzipiell kann
natrlich jede sprachliche uerung von einer
Zeigegeste begleitet werden. Doch das macht
den betreffenden Ausdruck deshalb noch
nicht zum Demonstrativum. Wenn Rumpel-
stilzchen auf sich selbst zeigt und dabei
(39) Ich bin der Schnste im ganzen Land!
ruft, spricht er nicht deshalb von der eigenen
Person, weil er auf sich zeigt, sondern weil er
das Personalpronomen der ersten Person Sin-
gular verwendet; wrde er stattdesssen auf
der Knigin Kind zeigen, knnte er dadurch
allenfalls Verwirrung stiften, keineswegs aber
die (objektive) Referenz des Subjekts von (39)
verschieben. Wenn sich jemand auf die Stirn
tippt und dabei sein Gegenber mit den Wor-
ten Du hast sie wohl nicht alle! beleidigt, so
mag der Fingerzeig vielleicht zur Verdeutli-
chung der Mitteilung beitragen, doch hngt
weder die Extension der Gesamtuerung (0
oder 1) noch die einer ihrer Teile vom Ziel
der Zeigegeste (Stirn? Hirn? Vogel?) ab. An-
dererseits kann eine die zweite Person beglei-
tende Zeigegeste durchaus zur Klrung der
Referenz beitragen, wie wir in Abschnitt 2.4
(im Zusammenhang mit der Tokenanalyse)
gesehen haben. Das legt den Verdacht nahe,
da der fr die zweite Person einschlgige
Aspekt des Angesprochenen unter Berck-
sichtigung eventueller, die jeweilige uerung
(das Token) begleitender Zeigegesten be-
stimmt werden mu. Noch strker scheint
hier vom Zeige-Parameter abzuhngen: so-
lange auf nichts gezeigt wird, verweist hier
offensichtlich immer auf den Ort der ue-
rung also auf irgendeine, von diversen
Situationsfaktoren abhngige Umgebung des
Sprechers. Tritt eine Zeigegeste hinzu, fun-
giert aber der Ort des Ziels derselben als Re-
ferent von hier. Ein besonders beachtenswer-
ter Fall liegt vor, wenn diese Zeigegeste auf
einen Stellvertreter des gemeinten Gegen-
stands (ein Symbol im weitestmglichen
Sinne) gerichtet ist wie etwa der berhmte
9. Kontextabhngigkeit 195
Auch wenn keine Zeigehandlung vorliegt,
mu die deiktische Verwendung einer Kenn-
zeichnung a nicht unbedingt auf dthat() hin-
auslaufen. Bemhen wir noch einmal das Bei-
spiel (37)! Selbstverstndlich kann bei ue-
rung dieses Satzes zu den genannten Umstn-
den noch die Voraussetzung treten, da die
Polizeibehrden dem organisierten Verbre-
chen mit einer ganzen Riege von Spitzeln
beizukommen versuchen. Nur einer von ihnen
so wollen wir auerdem annehmen ist
aber ganz neu, und ber ihn erstattet jetzt der
Inspektor Bericht. Es ist klar, da sich die
Kennzeichnung der von uns eingeschleuste
Mann auf den besagten Agenten bezieht, da
dieser aber kaum als dasjenige Individuum
bezeichnet werden kann, dem in der ue-
rungssituation die Eigenschaft, Agent zu sein,
zukommt; eher lt sich die Person, von der
die Rede ist, als einziger Agent, der in der
betreffenden Situation zur Debatte steht, cha-
rakterisieren, also als dasjenige einschlgige
Individuum, das die durch durch das Nomen
ausgedrckte Eigenschaft besitzt. Als Faust-
regel fr die Deutung deiktisch gebrauchter
Kennzeichnungen ergibt sich somit::
(R
)
Es sei a eine deiktisch gebrauchte Kenn-
zeichnung der Gestalt , wobei ein
definiter singularischer Artikel und die
kongruente Form eines Nomens ist.
Dann lt sich folgendermaen para-
phrasieren:
dthat (x (x ist einschlgig & x ist ein )).
Statt x ist einschlgig htte die Bedingung
ebensogut x ist relevant, x steht zur Debatte
oder hnlich lauten knnen. Auf die genaue
Wortwahl kommt es uns hier nicht an. Der
Inhalt der Bedingung ist allerdings wichtig;
um ihn geht es im folgenden.
Eine Schwachstelle der Regel (R
) ist der
Begriff der Einschlgigkeit, den wir hier als
kontextuellen Aspekt auffassen wollen. Da es
sich dabei um einen ausgesprochen vagen,
aber wie wir gleich noch sehen werden
vielseitig einsetzbaren Begriff handelt, sollte
sich eine Theorie der Kontextabhngigkeit
um Klrung oder Przisierung bemhen. Was
also macht in einer uerungssituation den
einen oder anderen Gegenstand einschlgig
und hebt ihn gegebenenfalls aus dem Meer
der anderen seiner Art hervor? In dem zuvor
diskutierten Beispiel war es der Umstand, da
von der betreffenden Person bereits seit ln-
gerem die Rede war. Doch kann es auch ganz
andere Ursachen geben. Wenn z. B. ein Ba-
bysitter mit seiner Freundin telefoniert und
zeichnung der von uns eingeschleuste Mann
nicht die Auswertungssituationen des Neben-
satzes einschlgig, sondern die uerungssi-
tuation selbst. Die Kennzeichnung wird also
deiktisch gebraucht.
Gegen diesen etwas flotten Nachweis des
deiktischen Gebrauchs von Kennzeichnungen
lt sich einwenden, da (37) mglicherweise
blo ein Beispiel fr flexibles Skopusverhalten
(und nicht deiktischen Gebrauch) ist und da
obendrein diese Art Rckbezug auf die ue-
rungssituation (in der einen oder anderen
Form) bei jeder Nominalphrase beobachtet
werden kann. Wir werden darauf in Abschnitt
4.3 zurckkommen.
Wenn nun der Referent einer wie in (37)
gebrauchten Kennzeichnung nicht das Ziel
einer Zeigehandlung ist, woher bekommt
dann die Nominalphrase ihre Extension?
Oder anders ausgedrckt: wie sieht der fr
die deiktisch, aber ohne Zeigehandlungen be-
nutzten Kennzeichnungen zustndige kontex-
tuelle Parameter aus? Eine Antwort besteht
darin, solche Kennzeichnungen auf die Form
dthat() zu bringen (siehe Abschnitt 1.3) und
dann jeweils die deskriptiven Gehalte a mit-
einander zu vergleichen: was ihnen gemein-
sam ist, beschreibt den gesuchten Parameter.
Bei der von uns betrachteten uerung von
(37) ist a schnell gefunden: der Inspektor
bezieht sich auf diejenige Person x, fr die in
der uerungssituation gilt: x wurde von der
Polizei in die Organisation eingeschleust. ist
somit die Kennzeichnung der von uns einge-
schleuste Mann selbst. Genauer gesagt: der
Charakter der in (37) deiktisch gebrauchten
Kennzeichnung lt sich mit der Intension
derselben bei normalem, nicht-deiktischem
Gebrauch umschreiben. Der Inspektor ver-
wendet (37) also so, als wre die besagte
Kennzeichnung in ein unsichtbares dthat ein-
gebettet.
Ist (37) in dieser Hinsicht ein Einzelfall?
Oder knnen deiktische Verwendungen von
Kennzeichnungen a stets mit dthat() para-
phrasiert werden? Diese einfache Analyse
kann zumindest dann nicht zutreffen, wenn
die Kennzeichnung von einer Zeigehandlung
begleitet wird; in diesem Falle mu nmlich
der Zeige-Aspekt bei der Extensionsbestim-
mung hinzugezogen werden. Nimmt man
etwa fr die Kennzeichnung der Wasser-
tropfen, so ergibt die bertragung von (R
)
als Paraphrase statt dthat() das komplizier-
tere dthat(x (x wird gezeigt & x ist ein Was-
sertropfen)).
196 IV. Kontexttheorie
das Adjektiv einschlgig dort im Skopus eines
dthat erscheint, wodurch seine Extension re-
lativ zur uerungssituation ermittelt wird.
(ii) und (iii) sind in (R
) nicht bercksichtigt.
Eine entsprechende nderung der Regel wre
zwar prinzipiell mglich, wrde aber in viele
technische Details fhren, die mit dem Stoff
dieses Kapitels nicht viel zu tun haben. Wir
belassen es also bei der obigen Formulierung
und behalten notfalls immer im Auge, da sie
noch einiger Korrekturen bedarf. Der Rest
des vorliegenden Abschnitts ist einer weiteren
Vertiefung und Erklrung des Einschlgig-
keits-Begriffs anhand einschlgiger Beispiele
gewidmet.
Besonders naheliegend und insofern ein-
schlgig sind natrlich die Dinge, auf die die
Sprecherin zeigt. Damit deckt die Regel (R
)
prinzipiell auch demonstrative Verwendungen
singularischer Kennzeichnungen ab. Dennoch
kann der Einschlgigkeits-Aspekt den Zeige-
Aspekt nicht immer ersetzen: rein demonstra-
tive Ausdrcke wie das da bedrfen im Nor-
malfall eines zeigenden Hinweises und kn-
nen nicht einfach auf irgendwelche nahelie-
genden Referenten bezogen werden. Rein de-
monstrative Ausdrcke sind deshalb auch in
der Schriftsprache in der Regel nicht zu fin-
den; Ausnahmen von dieser Regel sind allen-
falls Vorkommen in Bilderluterungen oder
in der direkten Rede.
Ebenfalls besonders naheliegend ist der
Ort, an dem sich die Sprecherin befindet. Das
lt vermuten, da der Orts-Aspekt zumin-
dest prinzipiell durch ein Zusammenspiel der
kontextuellen Einschlgigkeit mit der abso-
luten Eigenschaft, ein Ort zu sein, simuliert
werden kann. Was die Deutung des lokal
deiktischen Wortes par excellence, nmlich
hier, betrifft, so spricht einiges fr diese Ver-
mutung. Zunchst ist festzustellen, da sich
hier demonstrativ verwenden lt, also mit
Bezug auf das Ziel einer die uerung be-
gleitenden Zeigegeste. Interpretiert man hier
also im Sinne von dthat(x x ist einschlgig &
x ist ein Ort), so ergibt sich dieser Bedeu-
tungsaspekt ganz von selbst: solange kein an-
derer Ort im Mittelpunkt des Interesses steht,
kann man getrost den Ort der uerung als
den einzig einschlgigen ansehen; doch wenn
die Sprecherin auf einen bestimmmten Ort
(oder auf ein Symbol fr einen bestimmten
Ort) zeigt, so verdrngt dieser den Ort der
Sprechhandlung von seiner herausragenden
Position. Darberhinaus kann wie bei den
Kennzeichnungen neben dem Zeigen auch
das Erwhnen einen Ort nahelegen, wodurch
dabei (41) uert, so kann er sich mit dem
Subjekt des Nebensatzes auf die ihm anver-
trauten Kinder beziehen, ohne da von denen
vorher die Rede war:
(41) Brunners denken natrlich, da die G-
ren schon lngst schlafen.
Was die betreffenden Kinder hier besonders
einschlgig macht, knnte z. B. der Lrm sein,
den sie verursachen oder ganz einfach die
den beiden Gesprchspartnern wohlvertraute
und fr sie wichtige Tatsache, da der Spre-
cher sie htet. Etwaige andere, den beiden
bekannte Kinder knnen dagegen vernach-
lssigt werden: Brunners Kinder liegen den
Kommunikationsteilnehmern in der geschil-
derten Situation am nchsten. Einschlgig
kann also alles sein, was auffllig ist oder
sonstwie besonders naheliegt. Dazu gengt es
dann im allgemeinen nicht, da der betref-
fende Gegenstand (bzw. die betreffende Per-
son) jedem einzelnen Gesprchsteilnehmer
naheliegt. Wenn sich nmlich der besagte Ba-
bysitter etwa zu Anfang des Telefonats
unsicher ist, ob seine Freundin berhaupt
wei, was er gerade treibt, dann wird er so
etwas wie (41) gar nicht uern selbst wenn
die Freundin sehr wohl ber die von ihm
ausgebte Ttigkeit unterrichtet ist. Er wird
sich nur dann der Kennzeichnung die Gren
bedienen, wenn er wei, da auch die Freun-
din wei, von wem die Rede ist. Einschlgig-
keit basiert demnach auf einem Fundus den
Kommunikationspartnern gemeinsamer oder
gemeinsam zugnglicher Informationen.
Einschlgigkeit ist kein absoluter Begriff
und das im dreifachen Sinne. Neben (i)
seiner Relativitt zu einer betrachteten Situa-
tion hngt sein Umfang in der Regel auch
von (ii) einer Bezugs-Eigenschaft ab: in der
eben betrachteten Situation bildet vielleicht
der Brunner-Nachwuchs eine einschlgige
Gruppe G von Kindern doch ist G damit
nicht in jedem Sinne einschlgig: wenn etwa
unmittelbar vor dem Telefongesprch aber
ohne Wissen des Babysitters oder seiner
Freundin das Ehepaar Brunner an den
Folgen eines Unfalls gestorben ist, so wrde
sich die Kennzeichnung die Erben jedenfalls
nicht auf G beziehen. Schlielich ist Einschl-
gigkeit auch in dem Sinne relativ, als es sich
um eine (iii) graduelle Eigenschaft handelt:
vielleicht sind auch die Geschwister der
Freundin des Babysitters irgendwie einschl-
gig, aber eben nicht so einschlgig wie der
Nachwuchs der Familie Brunner. Der Rela-
tivitt (i) wird in (R
) Rechnung getragen, als
9. Kontextabhngigkeit 197
Sprecher und Hrer die in ihren Rollen als
Kommunikationspartner einschlgigsten Per-
sonen der uerungssituation? Wenn dem so
wre, mte allerdings die Referenz von ich
und du durch hnliche Ablenkungsmanver
wie in (42) und (43) manipuliert werden kn-
nen. Ein entsprechendes Beispiel scheint auch
schnell gefunden:
(44) Ich wei noch, wie der Arzt zu meinem
Schwager sagte: Das nchste Mal kann
ich Ihnen vielleicht nicht mehr helfen.
In der Tat verweisen die beiden Vorkommmen
des Personalpronomens der ersten Person
Singular bei einer uerung von (44) in der
Regel auf verschiedene Personen. Der da-
durch mglicherweise nahegelegte Verdacht,
da die Erwhnung einer anderen ue-
rungssituation einen noch einschlgigeren
Sprecher als den tatschlichen und somit
einen neuen Referenten von ich schafft, lt
sich jedoch rasch wieder zerstreuen: die Er-
setzung der direkten durch indirekte Rede
ndert offenbar so gut wie nichts an der Aus-
sage aber nur, wenn mit dem Modus auch
die Person gewechselt wird:
(44) Ich wei noch, wie der Arzt zu meinem
Schwager sagte, da er ihm das nchste
Mal vielleicht nicht mehr helfen knne.
(44) Ich wei noch, wie der Arzt zu meinem
Schwager sagte, da ich ihm das nch-
ste Mal vielleicht nicht mehr helfen
knne.
Anders als in (44) mu sich in (44) das zweite
ich wie das erste auf den Sprecher der Ge-
samt-uerung beziehen; und anders als (44)
ist also (44) auch keine ungefhre Paraphrase
von (44). Aus dieser banalen Beobachtung
werden wir gleich zwei wichtige Schlufolge-
rungen ziehen: erstens ist (44) kein Indiz fr
eine Einschlgigkeits-Analyse von ich; und
zweitens ist die direkte Rede ein weites Feld.
Die erste Folgerung ziehen wir indirekt:
wenn die Verschiedenheit der Extensionen der
ich-Vorkommen in (44) dadurch erklrt wer-
den soll, da hier durch die Erwhnung einer
anderen uerungssituation mit anderem
Sprecher letzterer einschlgiger wird als der
tatschliche Produzent der uerung, so wre
eine bertragung der Argumentation auf
(44) kaum zu verhindern; das ist aber
wegen unserer simplen Beobachtung un-
erwnscht. Wir werden ohne weitere Argu-
mentation die etwas khnere, in der Literatur
aber selten ernsthaft bezweifelte Folgerung
ziehen, da sich durch Themenwechsel, Ab-
lenkung und andere fr die nderung der
sich ebenfalls die Extension von hier ndert.
Solche Vernderungen knnen oft sehr
schnell und unvermittelt geschehen, wie der
folgende Typ von Beispiel zeigt:
(42) Im Alter von sechsundsechzig Jahren
reiste Karl erstmals nach Amerika: hier
fand er endlich jene Freiheit, der er hier
so sehr entbehrt hatte.
Das erste hier in (42) bezieht sich offensicht-
lich auf Amerika, whrend das zweite Vor-
kommen desselben Wortes im selben Satz auf
Europa, Deutschland oder jedenfalls eine
Umgebung des uerungs-Ortes verweist.
Man knnte diesen pltzlichen Wechsel der
Extension in einer pragmatischen Verlegung
des Ortes sehen in Analogie zu dem in
Abschnitt 3.1 angesprochenen historischen
Prsens. Ansonsten bleibt wollte man un-
bedingt das auf den uerungs-Ort bezogene
hier auf einen Orts-Aspekt zurckfhren
die Annahme einer echten Ambiguitt von
hier; allerdings mten selbst dann die bri-
gen Lesarten unter Rckgriff auf andere kon-
textuelle Aspekte (Gezeigtes, Vorerwhntes,
...) gedeutet werden. Die Einschlgigkeits-
Analyse hat gegenber diesen Alternativen
den Vorteil der Einfachheit. Hinzu kommt,
da die Referenten deiktischer Kennzeich-
nungen unter hnlichen Umstnden und hn-
lich schnell wechseln knnen wie die Exten-
sion von hier. Ein wegen der ungeschickten
(vom Sprecher aber vielleicht beabsichtigten)
Wiederholung stilistisch etwas miglcktes
Beispiel ist:
(43) Auf unser letzten Neuseeland-Rundreise
ist uns der Rolls-Royce nach zwei Tagen
verreckt, aber in Europa haben wir mit
dem Rolls-Royce bisher Glck gehabt.
Geht man davon aus, da es sich bei dem in
(43) ersterwhnten Luxus-Gefhrt um einen
Mietwagen handelt, whrend der zweite zum
Wagenpark des uerers gehrt, so verndert
sich in (43) die Extension der NP der Rolls-
Royce etwa so schnell wie der in (42) thema-
tisierte Ort. Da so etwas wie Einschlgigkeit
im Redekontext eine Rolle spielt, ist also
kaum zu bezweifeln; und diese Einschlgig-
keit ist es, die so rasant mit der Rede-Zeit
geht. Insgesamt sprechen diese Beobachtun-
gen fr eine Deutung des Hier als Ort der
Einschlgigkeit.
Wenn schon der scheinbar direkte Bezug
von hier durch Einschaltung des Einschlgig-
keits-Aspekts zerlegt werden kann, wie steht
es dann um die anderen, zunchst ebenso
irreduzibel anmutenden Parameter? Sind z. B.
198 IV. Kontexttheorie
Probleme aufwirft. Neben den notorischen
Schwierigkeiten des Verhltnisses zwischen
Sprache und Metasprache im allgemeinen ist
hier vor allem die in der natrlichen Sprache
oft nur mangelhaft durchgehaltene Trennung
der beiden Ebenen zu nennen.
Wenn auch nicht jede Kontextabhngigkeit
mit Einschlgigkeit in Beziehung gebracht
werden kann, so gilt dies doch fr die meisten
Arten der Bezugnahme auf die uerungssi-
tuation. Zum Abschlu dieses Abschnitts soll
dies anhand einer skizzierten Fallstudie, der
Deutung von Genitivattributen, gezeigt wer-
den.
Grundstzlich kann man im Deutschen
zwei Arten von Genitivattributen unterschei-
den: solche, die gemeinsam mit einem (mg-
licherweise syntaktisch komplexen) Nomen
wieder ein Nomen bilden, und solche, die sich
syntaktisch wie (definite) Artikel verhalten
und ein Nomen zu einer Nominalphrase ver-
vollstndigen. Wegen ihrer Stellung innerhalb
der NP wegen werden wir sie als rechte bzw.
linke Attribute bezeichnen. Zunchst zu den
rechten Attributen:
(46) Guinivere ist die Gemahlin Arthurs.
(47) Lancelot ist ein Getreuer Arthurs.
(48) Excalibur ist das Schwert Arthurs.
Von Details abgesehen ist die Deutung von
(46) unproblematisch: es handelt sich um die
Behauptung der Identitt zwischen der durch
das Subjekt bezeichneten Guinivere und der-
jenigen Person, die mit dem durch das Geni-
tivattribut Arthurs benannten Knig vermhlt
ist. Gemahlin lt sich in diesem Zusammen-
hang als Bezeichnung fr eine Funktion auf-
fassen, deren Argumente und Werte jeweils
Menschen sind. Substantive wie Gemahlin be-
zeichnen wir daher als funktionale Substan-
tive.
Nur die wenigsten Substantive sind funk-
tional. Flle wie in (47) sind weitaus hufiger:
was ein ordentlicher Knig ist, hat eine groe
Schar von Fans. Als Funktionswert braucht
man also eine Menge, was auf eine Deutung
von Getreuer als Relation zwischen Personen
hinausluft. Derartige Substantive heien
deshalb auch relationale Substantive. Natr-
lich lt sich Funktionalitt als Spezialfall
von Relationalitt auffassen, womit (46) und
(47) durch eine einzige Regel interpretiert wer-
den knnen: in beiden Fllen wird der Exten-
sion eines Substantivs a durch ein Genitivat-
tribut ein Argument zugefhrt. Genauer:
(G) Es sei ein relationales Nomen, ein
Eigenname im Genitiv, s
0
eine ue-
Einschlgigkeit einschlgige Methoden die
Extension von ich nicht verndern lt; der
Einschlgigkeits-Parameter ist also fr die
Deutung der ersten Person nicht einschlgig.
Insbesondere ist er damit auch nicht in dem
Sinne trivial, da sich jede deiktische Referenz
mit ihm erklren liee. Und was fr die erste
Person richtig ist, gilt ebenso fr die zweite.
Was Zeit und Welt der uerung angeht, so
wollen wir allerdings im folgenden offenlas-
sen, ob auch diese Parameter durch entspre-
chende Einschlgigkeits-Analysen ersetzt
werden knnen.
Da die direkte Rede ein Thema fr sich
ist, sieht man gerade daran, da sie die an-
sonsten unmgliche Verschiebung von ich zu-
lt oder sogar erzwingt. Doch ist dies kei-
neswegs die einzige oder auch nur die auffl-
ligste Eigentmlichkeit der direkten Rede. Im
Gegenteil: bei genauerem Hinsehen entpuppt
sich die vermeintliche Verschiebung der Ex-
tension in (44) als Nebeneffekt einer allge-
meinen Umdeutung aller in der direkten Rede
vorkommenden (= angefhrten) Ausdrcke.
Bei geeigneter Variation des Beispiels sieht
man nmlich, da sich ein angefhrtes ich
nicht nur auf einen anderen Sprecher, sondern
auch auf mehrere Sprecher oder auf nieman-
den beziehen kann:
(45) Schon oft hat ein Arzt zu meinem
Schwager gesagt: Das nchste Mal
kann ich Ihnen vielleicht nicht mehr hel-
fen.
(45) Es ist nicht auszudenken, was passiert,
wenn einmal ein Arzt zu meinem
Schwager sagt: Das nchste Mal kann
ich Ihnen vielleicht nicht mehr helfen.
Die einfachste Erklrung fr dieses auf den
ersten Blick etwas verwirrende Verhalten des
angefhrten ich ist, da es sich bei der direk-
ten Rede um eine metasprachliche Redeweise
handelt, da also die Extension des ange-
fhrten ich strenggenommen das Wort ich
selbst ist, und da der Eindruck einer ande-
ren, sekundren Extension nur von der im
jeweiligen Satz ber dieses Wort gemachten
Aussage herrhrt. Fr diese Erklrung spricht
unter anderem auch die Tatsache, da zumin-
dest unter gewissen Umstnden angefhrte
Ausdrcke einer anderen Sprache entstam-
men knnen. Wir werden jedoch diese Be-
trachtung hier nicht weiter vertiefen, weil sie
vom Thema abfhrt. Es sei nur angemerkt,
da die eigentlich sehr naheliegende meta-
sprachliche Aufassung der direkten Rede im
Detail zahlreiche, teilweise berraschende
9. Kontextabhngigkeit 199
nite Regel denkbar, die die entsprechende Ar-
gumentstelle existentiell abbindet.
Wir wenden uns nun der vermutlich hu-
figsten Art von rechten Attributen zu, die in
(48) exemplifiziert wird. Schwert hat so gar
nichts Relationales: offenbar drckt dieses
Substantiv einfach nur eine Eigenschaft aus.
Es gehrt somit zur groen Gruppe der ge-
sttigten Nomina, die ebenso wie relationale
Substantive mit rechten Attributen versehen
werden knnen. Sehr viele dieser Beispiele
legen ein Besitzverhltnis nahe. Schwert Ar-
thurs kann sich aber auch auf Schwerter be-
ziehen, die Arthur leihweise benutzt, oder sol-
che, die er im Auftrag des Britischen Muse-
ums prpariert. Die Relation, die zwischen
den Trgern der durch das gesttigte Sub-
stantiv ausgedrckten Eigenschaft und die
Extension der Nominalphrase hergestellt
wird, mu also nicht unbedingt ein Besitzver-
hltnis sein. Im Interesse des Sprechers sollte
jedoch stets klar sein, welche Relation R ge-
meint ist. R mu also einschlgig sein. Hier
ist eine entsprechende Deutung:
(G) Es sei ein gesttigtes Nomen, ein
Eigenname im Genitiv, s
0
eine ue-
rungs- und s eine Auswertungssituation.
Dann gilt:
(s
0
)(s) =
{x x
(s
0
)(s) & x R (s)
(s
0
)(s)},
wobei R (in ihrer Eigenschaft als Rela-
tion zwischen Elementen der Extension
von und der Extension von ) ein-
schlgig in s
0
ist.
Unter der Annahme, da Besitz solange ein-
schlgig ist, bis etwas dagegen spricht, deckt
(G
R
) auch die vielen Flle ab, bei denen der
Genitiv eine im engeren Sinne possessive
Funktion ausbt. Besitz ist dann der Default-
Wert fr Einschlgigkeit von Relationen.
Nach (G
R
) hngt das Bestehen der von der
uerungssituation beigesteuerten Relation
R von der Auswertungssituation ab. Warum
ist das so? Die Rechtfertigung ergibt sich wie-
der durch Einbettung in intensionale Umge-
bungen:
(50) Lancelot glaubt, da der Becher Arthurs
Gift enthlt.
Nach einer naheliegenden Interpretation be-
sagt (50), da zu den mit Lancelots Glauben
vereinbaren Situationen nur solche s gehren,
fr die gilt: der Becher, aus dem Arthur in s
trinkt, enthlt in s Gift. Besitz ist fr diese
Deutung offenbar nicht einschlgig, vielmehr
mu das gesuchte R die Relation zwischen
Zecher und Becher sein. Diese Relation ist
rungs- und s eine Auswertungssituation.
Dann gilt:
(s
0
)(s) = {x x
(s
0
)(s)
(s
0
)(s)}
Notation und Idee dieser Regel sind anhand
der Beispiele (46) und (47) leicht erlutert: fr
Getreuer Arthurs liefert (G
Q
) als Extension die
Menge der (Personen) x, fr die gilt: x G a,
wobei G die Extension von Getreuer ist und
a der Trger des Namens Arthur; ein Getreuer
Arthurs mu demnach jemand sein, der in
einem gewissen (Treue-) Verhltnis zu Arthur
steht. Fr die Deutung von Gemahlin Arthurs
mssen wir natrlich die Ehe als Relation
auffassen, die zwischen x und y genau dann
besteht, wenn x die Ehefrau von y ist. (G
Q
)
liefert dann die Menge der Ehefrauen von a;
Aufgabe des bestimmten Artikels mu es sein,
das einzige Element dieser Menge herauszu-
greifen und zur Extension der gesamten No-
minalphrase zu machen.
Was hat das nun mit Kontextabhngigkeit
im allgemeinen und Einschlgigkeit im beson-
deren zu tun? Nicht immer werden die Ar-
gumente relationaler Substantive so explizit
genannt wie in (46) und (47). Hufig findet
man sie auch in Stzen wie:
(49) Arthur fhlte sich einsam: die Gemahlin
war unplich, und die Getreuen hatten
ihn verlassen.
Keines der beiden relationalen Substantive ist
hier mit einer anderen Argumentangabe ver-
sehen. Das ist allerdings auch nicht ntig: aus
der Tatsache, da kein Argument genannt
wird, kann man in (49) schlieen, da es sich
bei dem Gesuchten in beiden Fllen um Ar-
thur handelt. Warum? Weil er gerade erwhnt
wurde und insofern naheliegt. Arthur ist also
einschlgig. Wir gelangen damit zu folgender
Ellipsenregel:
(G) Es sei ein relationales Nomen, eine
leere genitivische Nominalphrase, s
0
eine
uerungs- und s eine Auswertungssi-
tuation. Dann gilt:
(s
0
)(s) = {x x
(s
0
)(s)y},
wobei y (in seiner Eigenschaft als Ar-
gument von ) einschlgig in s
0
ist.
(G
) setzt eine syntaktische Analyse voraus,
nach der relationale Nomina eines Genitiv-
Attributs bedrfen, dessen Fehlen irgendwie
strukturell (hier durch eine leere NP) markiert
wird. Offen bleibt, ob jede Weglassung eines
Genitiv-Attributs bei einem relationalen No-
men im Sinne von (G
), also definit, gedeutet
werden mu. Immerhin ist wie schon in
Abschnitt 1.3 erwhnt eine weitere indefi-
200 IV. Kontexttheorie
die eine, einmal die andere Relation einschl-
gig sein?
Beispiele wie (51) sind durchaus im Geiste
der oben diskutierten Regeln erklrbar. Zu-
nchst kann man das relationale Substantiv
Ehefrauen mit Hilfe der Regel (G
Q
) kontex-
tuell sttigen; dafr bentigt man allerdings
eine pluralische Version von (G
Q
), die dann
eine Gruppe einschlgiger Ehemnner an die
Argumentstelle setzt. Bei akutem Mangel an
solchen Mnnern mte man auf die oben
nur angedeutete indefinite Sttigungsregel zu-
rckgreifen. Das Resultat dieser Umkatego-
risierung ist ein gesttigtes Nomen, womit
(G
R
) anwendbar wird und die einschlgige
Therapeut-Patient-Beziehung ins Spiel bringt.
Kommen wir nun noch kurz auf die linken
Genitivattribute zu sprechen. Zunchst wie-
der ein paar Beispiele:
(46) Queenie Vera ist Atzes Braut.
(47) Latzehos ist Atzes Kumpel.
(48) Exknallibus ist Atzes Knarre.
Offensichtlich fhrt das linke Attribut stets
ein definites Element in die Nominalphrase
ein: Atzes Braut heit soviel wie die Braut
Atzes, Atzes Kumpel bedeutet der Kumpel
Atzes etc. Im wesentlichen lt sich also das
linke Attribut als eine Kombination zwischen
rechtem Attribut und definiten Artikel auf-
fassen. Die Rolle des Einschlgigkeitspara-
meters ist damit von etwaigen Eingriffen
in die Deutung des Artikels abgesehen
dieselbe wie in den oben diskutierten Fllen.
Erwhnenswert ist die Konstruktion, weil sie
in unmittelbarem Zusammenhang zu der in
Abschnitt 1.3 genannten Deutung der Posses-
sivpronomina steht. Der Zusammenhang ist
folgender: die Position, die das linke Genitiv-
Attribut innerhalb der NP einnimmt, ist die
des Artikels. Man knnte diese Konstruktion
also als eine Umkategorisierung der Genitiv-
NP zum (genus- und kasusneutralen) Artikel
ansehen. Wir bezeichnen diese Umkategori-
sierung hier einmal als Possessivierung. Es
fllt dann auf, da dieselbe Konstruktion fr
Personalpronomina tabu ist: *seiner Getreuer.
An die Stelle der zu erwartenden Genitiv-
Form des Personalpronomens tritt hier das
Possessivpronomen. Damit ergibt sich das
Possessivpronomen als Resultat der Posses-
sivierungs-Regel (linkes Attribut) in Anwen-
dung auf das Personalpronomen; es liegt so-
mit nicht im Einflubereich der Hypothese
(L).
Wie sie beim Genitiv-Attribut fehlende Ar-
gumente und Relationen einfhrt, so kommt
aber nur insofern einschlgig, als sie in den
Glaubens-Welten von Lancelot besteht. Da-
her die in (G
R
) postulierte Abhngigkeit von
R von der Auswertungssituation.
Der Effekt von (G
R
) lt sich auch als eine
situationsabhngige Umdeutung des betref-
fenden Substantivs auffassen: das normaler-
weise gesttigte Becher wird in den einschl-
gigen uerungssituationen im Sinne eines
relationalen Becher
R
gedeutet. Man knnte
deshalb daran denken, die auf den Einschl-
gigkeits-Parameter zurckgreifende Regel
(G
R
) durch eine Mehrdeutigkeits-Analyse des
betreffenden Nomens zu ersetzen, wobei dann
die hufigste Lesart von der Besitz-Interpre-
tation geliefert wird. Gegen eine solche lexi-
kalische Ambiguitt spricht die Tatsache, da
die Zahl der potentiellen Lesarten im Prinzip
unbeschrnkt ist. Es handelt sich hier um eine
Art Polysemie, eine systematische Ambiguitt
im Lexikon, und (G
R
) dient zur Beschreibung
dieser Polysemie. Wir kommen hierauf in Ab-
schnitt 4.4 zurck.
Auch die Strategie einer ersatzlosen Strei-
chung von (G
Q
) zugunsten einer Verallgemei-
nerung von (G
R
) auf beliebige Substantive ist
denkbar: der problematischen Unterschei-
dung zwischen relationalen und nicht-relatio-
nalen Nomina knnte man aus dem Weg ge-
hen, indem man Wrter wie Gemahlin im
Sinne des gesttigten Gemahlin von jemanden
deutet und dem Einschlgigkeitsparameter
die Arbeit berlt, die richtige Relation
(Ehe) zu liefern. Dieses Vorgehen wrde auch
erklren, warum selbst in Verwendungen typi-
scher relationaler Substantive gelegentlich an-
dere, vom Kontext offenbar strker forcierte
Relationen ins Spiel kommen: in einem Ge-
sprch unter Psychotherapeuten kann sich
der uerer von (51) beispielsweise auf einen
Teil der weiblichen Patientenschaft seines ge-
schtzten Kollegen beziehen:
(51) Die Ehefrauen des Dr. Leid sind allesamt
hysterisch.
Doch die inhrente Relationalitt einiger
Substantive lt sich nicht so leicht wegerkl-
ren. Die angedeutete Strategie knnte etwa
den einfachen und offenkundigen Bedeu-
tungsunterschied zwischen Vorabend und
Abend gar nicht oder nur auf sehr gezwungene
Weise erklren: der Vorabend eines Tages ist
zugleich auch der Abend eines (freilich an-
deren) Tages. Die Sttigung der beiden Wr-
ter fhrt also jeweils zum gleichen Resultat.
Warum sollte dann fr dieses Resultat einmal
9. Kontextabhngigkeit 201
in einer Situation (hinsichtlich beliebiger Ei-
genschaften) einschlgigen Gegenstnde, Re-
lationen usw. ohne Bezugnahme auf die
aufgrund dieser ja erst zu ermittelnden
Extensionen der in ihr gemachten uerung
bestimmt werden sollen. Da dies vielleicht
nicht einmal immer mglich ist, belegt das
folgende Beispiel:
(52)
Beim berschreiten des Innenhofes hat
sich Martin das Bein gebrochen.
Selbst wenn man annimmt, da Martin die
fr die Relation des Bein-Besitzes beim u-
ern von (52) einschlgigste Person ist, bleibt
die Tatsache, da er ein ungefiederter Zwei-
beiner ist. Was aber das Interesse auf eine der
beiden Extremitten lenkt, scheint nun gerade
die in (52) selbst zur Sprache gebrachte Frak-
tur zu sein. Einschlgig so scheint es je-
denfalls wird das gebrochene Bein da-
durch, da von ihm geredet wird.
4. Probleme
Dieser Teil dient dazu, ein wenig an den Wur-
zeln der klassischen Theorie und ihrer Vari-
anten zu nagen. Die Probleme, um die es in
den folgenden vier Abschnitten geht, sind
recht unterschiedlicher Natur. Gemeinsam ist
ihnen, da sie dazu beitragen, das in den
ersten drei Teilen dieses Kapitels vermittelte
heile Weltbild etwas ins Schwanken zu brin-
gen. Nebenbei werden wir auch einige weitere
Anwendungen der klassischen Theorien ken-
nenlernen.
4.1Bindung
Wir beginnen mit der Frage, ob die Perso-
nalpronomina der dritten Person Singular der
Hypothese (L) aus Abschnitt 1.3 gengen.
Hier ist ein harmloses Beispiel:
(53) Er ist ein Genie.
Wir nehmen einmal an, (53) werde auf einem
Filmkritikertreffen in einer Diskussion ber
Wim Wenders geuert. In diesem Zusam-
menhang ist klar, da sich das Pronomen er
auf den Regisseur von Paris-Texas bezieht:
Wim Wenders ist das in dieser Diskussion
(hinsichtlich Genialitt) einschlgigste Indi-
viduum. Das legt die folgende einfache Inter-
pretationsregel fr er nahe:
(R)
Es sei s
0
eine uerungssituation und s
eine Auswertungssituation. Dann gilt:
er
(s
0
)(s) ist das in s
0
einschlgigste In-
dividuum.
die Einschlgigkeit oft dann zu Hilfe, wenn
es in der logischen Form irgendwelche Lcher
zu stopfen gilt. Damit lt sich vor allem die
Anzahl der ntigen kontextuellen Aspekte ra-
dikal reduzieren. Insbesondere lassen sich auf
diese Weise allerlei abstruse vorgebliche Kon-
textparameter ausmerzen wie beispielsweise
die in der Literatur gelegentlich erwhnte Pre-
vious Drink Coordinate (PDC), die dafr sor-
gen soll, da die an den Ober gerichtete Auf-
forderung Noch so eins! nicht nur von diesem,
sondern auch von der Theorie korrekt inter-
pretiert wird. Grob gesprochen bentigt man
anstelle der an den Haaren herbeigezogenen
PDC lediglich eine hnliche Strategie der El-
lipsendeutung wie im Falle des Genitivattri-
buts sowie eine vom Einschlgigkeitsaspekt
abhngige Deutung des Wortes so: erstere
fhrt die kontextuell einschlgige Eigen-
schaft, vom Gast gewnscht zu werden, ein,
whrend so auf die fr diese Eigenschaft ein-
schlgige Getrnkesorte verweist. Natrlich
steckt auch hier wieder der Teufel im Detail,
doch ist diese Art der Ausnutzung von Ein-
schlgigkeiten intuitiv und theoretisch befrie-
digender als eine Kollektion von Ad-Hoce-
reien wie der PDC.
Selbst bei optimaler Ausnutzung des Be-
schreibungs-Potentials des Einschlgigkeits-
Parameters bleiben noch einige zustzliche,
irreduzible Aspekte brig: zumindest der
Sprecher-Parameter scheint sich einer Zu-
rckfhrung auf Einschlgiges zu widerset-
zen. Ein weiterer, bisher nicht erwhnter
Aspekt des Kontexts, der in diesem Sinne
ebenso irreduzibel ist, ist der Przisionsgrad
der Aussage. Dabei handelt es sich um den-
jenigen Parameter, der fr eine grozgige
Deutung solcher Angaben wie zwei Millionen
Einwohner verantwortlich ist und der durch
gewisse Gradadverbien wie ungefhr oder
haargenau verschoben werden kann (und sich
damit als indexikalisch erweist). Die Nicht-
Reduzierbarkeit des Przisionsgrads auf in
der uerungssituation Einschlgiges macht
man sich analog zu den oben im Zusammen-
hang mit (44) angestellten berlegungen zur
Irreduzibilitt des Sprechers klar.
Wir wollen das Thema Einschlgigkeit
nicht verlassen, ohne auf eine der Schatten-
seiten dieses sehr ntzlichen Parameters auf-
merksam zu machen. Aus der Vielfalt der in
diesem Abschnitt diskutierten Beispiele sollte
bereits hervorgegangen sein, da sich eine
Przisierung des Begriffs der Einschlgigkeit
extrem schwierig gestalten drfte. Vor allem
aber gilt dies dann, wenn man um eine zir-
kelfreie Erklrung bemht ist, wenn also die
202 IV. Kontexttheorie
zu kommentieren, geben wir hier eine hin-
sichtlich der beiden eben genannten Unzu-
lnglichkeiten verbesserte Version von (R
er
):
(R) Es sei x ein Vorkommen des Personal-
pronomens er in dem in der Situation s
0
geuerten Satz und s eine Auswer-
tungssituation. Dann gilt:
er
(s
0
)(s) ist das in s
0
bezglich [
x
] ein-
schlgigste Individuum, auf das entwe-
der (a) in s
0
kurz vor der uerung von
x mit einer maskulinen Nominalphrase
referiert wurde oder das (b) (fr alle an
der Kommunikation in s
0
Beteiligten of-
fensichtlich) in der Extension eines gn-
gigen maskulinen Nomens liegt.
Dabei ist [
x
] diejenige Eigenschaft, die
ein Individuum y in einer Situation s
besitzt, falls die Ersetzung von x durch
einen Standardnamen von y zu einem
am Referenzpunkt s
0
,s wahren Satz
fhrt.
Die Rolle der Eigenschaft [
x
] in (R
2
) besteht
darin, potentielle Referenten von er hinsicht-
lich der durch a ausgedrckten Eigenschaft
miteinander zu vergleichen. Wie die Notation
andeuten soll, entspricht dieser Bestimmung
einer Eigenschaft durch hypothetische Sub-
stitution potentieller Alternativen zum Vor-
kommen eines Pronomens gerade die Ab-
straktion vom konkreten Wert einer Varia-
blen. Bei der Definition von [
x
] wird wie
in der sog. substitutionellen Deutung der Va-
riablenbindung blich vorausgesetzt, da
jedes berhaupt infrage kommende y einen
(Standard-) Namen besitzt; diese Vorausset-
zung liee sich auf verschiedene Weisen um-
gehen, wrde aber die Regel (R
2
) nur noch
umstndlicher machen, als sie ohnehin schon
ist. Auf die Rolle der Bindung von x in (R
2
)
kommen wir gleich wieder zurck. Zuvor
berzeugen wir uns aber noch davon, da
diese Bedeutungsregel tatschlich der Be-
schrnkung (L) gengt.
Natrlich besttigt (R
2
) die Hypothese (L).
Da nmlich im Definiens der Extension von
er die (metasprachliche) Variable s gar nicht
erscheint, fhrt die Anwendung von
er
(s
0
)
auf verschiedene Auswertungssituationen
stets zum selben Ergebnis. er ist demnach
direkt referentiell. Da sich weiterhin ue-
rungssituationen hinsichtlich der Einschlgig-
keit einzelner Individuen stark unterscheiden
knnen, ist die Gleichung
er
(s
0
) =
er
(s
1
)
nicht allgemeingltig. er ist nach (R
2
) also
deiktisch und erfllt damit insbesondere (L).
(R
er
) ist alles andere als perfekt. Schon fr
die Analyse von (53) reicht die Regel nicht
ganz aus, weil sie die Relativierung auf die
Genialitt vernachlssigt. Wenn nmlich ge-
rade vom jngsten Opus des Meisters die
Rede ist, so ist dieser Film ebenso einschlgig
wie sein Regisseur. Aber als Eigenschaft eines
Film ist Geniehaftigkeit gnzlich unpassend;
sie ist das Attribut des Knstlers. Deshalb ist
Wim Wenders in der genannten Situation hin-
sichtlich der ber den Subjekts-Referenten in
(53) gemachten Aussage einschlgiger als sein
Werk. Um diese berlegungen in eine Re-
formulierung von (R
er
) einzubeziehen, bedarf
es offenkundig einer sorgfltigen Tokenana-
lyse.
Eine hnliche, aber leichter zu behebende
Unzulnglichkeit betrifft das Genus des Pro-
nomens. Es ist denkbar, da Wim Wenders
nicht die einzige zur Debatte stehende schp-
ferisch ttige Person ist. Vielleicht war eben-
sosehr von Doris Drrie die Rede. Dennoch
ist klar, da man sich mit er in (53) oder
sonstwo kaum auf diese Regisseurin beziehen
kann und sei sie als Gesprchsthema und
Genie-Kandidatin noch so einschlgig: ihr na-
trliches Geschlecht gebietet es, mglichst mit
Pronomina femininen Generis auf sie zu ver-
weisen. Zur thematischen Einschlgigkeit in
der Situation tritt also beim deutschen Per-
sonalpronomen in der dritten Person Singular
noch eine sprachliche Nebenbedingung: das
Genus des Pronomens mu zum Referenten
passen. Im Falle von Personen heit dies in
der Regel, da mnnliches Geschlecht mit
Maskulinum, weibliches aber mit Femininum
korreliert. Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit. Denn erstens kann man bekanntlich auf
eine zuvor mit dem Attribut Mdchen oder
Frulein versehene Person unter Umstnden
mit neutralem es referieren; und auch der Fall,
da eine Person mnnlichen Geschlechts ist
und ein feminines Pronomen auf sie verweist,
ist gar nicht so selten. Zweitens gibt es viele
Lebewesen und Gegenstnde, die gar kein
natrliches Geschlecht besitzen oder deren
natrliches Geschlecht fr die Auswahl des
Pronomens oft unerheblich ist. Dies gilt z. B.
fr Kater, auf die man sich mit dem femininen
Substantiv Katze und in der Folge mit femi-
ninen Pronomina beziehen kann, oder auch
fr als Tasse bezeichnete Trinkgefe. Insge-
samt spielen damit fr die Entscheidung des
Genus natrliche Eigenschaften der Referen-
tin ebenso eine Rolle wie die blicherweise
oder unmittelbar vorher in der uerungssi-
tuation bereits auf sie bezogene Bezeichnun-
gen. Ohne alle Details zu rechtfertigen oder
9. Kontextabhngigkeit 203
durch Bindung unsichtbarer Variablen in
einer zugrundeliegenden Struktur dargestellt.
Fr die einschlgige Lesart von (54) mte
man den Satz in sein Subjekt jeder Kritiker
und eine sog. Matrix oder offene Formel der
Gestalt x lt gerne einflieen, da x ein Genie
ist zerlegen. Um nun aus Subjekt und Matrix
den erwnschten Satz (54) zu konstruieren,
bedarf es einer speziellen syntaktischen Ope-
ration Q namens Quantorenbindung, deren se-
mantisches Pendant
Q
denselben Effekt wie
ein (auf die Extension des Nomens relativier-
ter) die Variable x bindender Quantor hat.
Q
ist also eine zweistellige Operation ber Cha-
rakteren mit dem folgenden Effekt:
(Q
S
)
Q
(
jeder Kritiker
,
x lt gerne einflieen, da x ein Genie ist
)
(s
0
)(s) = 1, falls fr jede Einsetzung eines
(Standard-) Namens k fr ein Individuum
aus der Extension
Kritiker
(s
0
)(s) gilt:
k lt gerne einflieen, da k ein Genie ist
(s
0
)(s) = 1.
Q
ist in dieser Form nicht kompositionell
[vgl. dazu Artikel 7]. Eine sich an das Kom-
positionalittsprinzip haltende Reformulie-
rung mu statt der Einsetzungen von Stan-
dardnamen fr Kritiker unterschiedliche Be-
legungen, also Benennungen der Kritiker
durch Variablen, heranziehen, von denen die
Extension der Matrix dann jeweils abhngt.
Aus (Q
S
) wird damit:
(Q
B
)
Q
(
jeder Kritiker
,
x lt gerne einflieen, da x ein Genie ist
)
(s
0
)(s) = 1, falls fr alle Belegungen b von
x durch ein Individuum aus der Extension
Kritiker
(s
0
)(s) gilt:
k lt gerne einflieen, da k ein Genie ist
(s
0
)(s) = 1, bei
der Belegung b.
Auch diese Formulierung ist strenggenom-
men nicht kompositionell, weil sie (fr die
Relativierung) eine Zerlegung des Subjekts
vornimmt. Dieses Kompositionalittspro-
blem hat aber nichts mit den gegenwrtigen
Betrachtungen zu tun und lt sich auf leichte
und befriedigende Weise mit den blichen
Methoden der Quantorensemantik [s. Artikel
21] lsen. Uns interessiert an (Q
B
) vor allem
die Nebenbedingung bei der Belegung b. Da-
mit die vom Charakter zugewiesene Extension
berhaupt von einer Belegung abhngt, mu
diese im Definitionsbereich dieses Charakters
auftauchen. Das kann sie prinzipiell an drei
Stellen: (i) als Bestandteil der Auerungssi-
tuation, also kontextuell; (ii) als Bestandteil
der Auswertungssituation, also indexikalisch;
(iii) als weiteres Argument neben uerungs-
und Auswertungssituation, also eigenstndig.
Wenn nun er deiktisch ist, dann luft die
fr die Bestimmung der Eigenschaft [
x
] vor-
genommene Bindung auf eine Abstraktion
von der uerungssituation hinaus. Unter-
luft damit (R
2
) das Monsterverbot (M)?
Nein. Denn (R
2
) ist ja nicht fr die Bestim-
mung der Extension des metasprachlichen
Ausdrucks [
x
] zustndig. Diese wird zwar
am Rande auch definiert, was aber nur eine
Erluterung der Notation ist. Die Abstrak-
tion von der uerungssituation findet also
bei [
x
] in der Metasprache statt; und da
sie dort zulssig ja sogar unumgnglich
ist, steht auer Zweifel: jede in diesem Kapitel
diskutierte Bedeutungsregel nimmt auf ue-
rungssituationen im allgemeinen Bezug und
abstrahiert somit von ihnen.
Sicherlich knnte man (R
2
) noch in ver-
schiedener Hinsicht verfeinern. Wie auch im-
mer die Details dazu aussehen mgen: an der
Besttigung von (L) aufgrund der direkten
Referentialitt der Personalpronomina wird
sich wohl nichts ndern. Damit steht die Sze-
nerie fr das hier zu diskutierende Problem.
Nun heit es: Vorhang auf! Eintritt:
(54) Jeder Kritiker lt gerne einflieen, da
er ein Genie ist.
Zunchst ist festzustellen, da (54) die ein-
gebettete Nebensatz-Variante von (53) als Teil
enthlt. Was zu (53) gesagt wurde, sollte auch
fr (54) gelten. In einer Situation, in der von
Wim Wenders die Rede ist, wre (54) folgen-
dermaen zu paraphrasieren:
(55) Jeder Kritiker lt gerne einflieen, da
Wim Wenders ein Genie ist.
Natrlich ist diese Deutung mglich. Doch
besitzt (54) noch eine andere Lesart, nach der
sich das Pronomen er auf das Subjekt des
Gesamt-Satzes zurckbezieht. Dieser Rck-
bezug ist nicht so zu verstehen, da das Pro-
nomen als Abkrzung fr das Subjekt steht;
denn (55) unterscheidet sich deutlich von
dieser (und berhaupt jeder) Lesart von (54):
(55) Jeder Kritiker lt gerne einflieen, da
jeder Kritiker ein Genie ist.
(54) ist in der rckbeziehenden, anaphorischen
Lesart mglicherweise wahr, (55) mit Sicher-
heit falsch. Damit kommt eine auf quantifi-
zierende Nominalphrasen erweiterte Ein-
schlgigkeits-Analyse nach dem Vorbild von
(R
2
) fr diese Lesart nicht infrage. Was man
braucht, ist eher eine Technik der Variablen-
bindung, wie man sie aus der Logik kennt.
blicherweise werden anaphorische Bezge
204 IV. Kontexttheorie
hngt nach (R
2
) die Extension des Pronomens
nicht vom Index, sondern vom Kontext ab;
und andererseits ist von einer Belegung in
dieser Regel sowieso nicht die Rede. Letzteres
ist allerdings ein leicht zu behebender Makel:
die in (R
2
) beschriebene Abhngigkeit der Ex-
tension des Vorkommens eines Pronomens
von der uerungssituation kann ja als
Funktion von uerungen in (mgliche) Ex-
tensionen umgedeutet werden. Die so aufge-
fate Belegung mte dann allerdings noch
in den Index geschoben werden sonst w-
ren wir ja ber die monstrse Lsung (i) des
Problems nicht hinausgekommen. Gegen
diese indexikalische Auffassung der variieren-
den Extension von Pronomina spricht nun
aber eine Grundannahme der klassischen
Theorie, nmlich das den Zusammenhang
zwischen Intension und Information postulie-
rende Prinzip (F) oder eine seiner Differen-
zierungen (siehe Abschnitt 2.5). Es ist auf
jeden Fall so, da die in einer uerungssi-
tuation s
0
von einem Satz bermittelte Infor-
mation also das, was der Satz in der Situa-
tion besagt mit seiner Intension (in s
0
)
bereinstimmt. Diese Identifizierung ist un-
vereinbar mit der Annahme (ii-b), die impli-
ziert, da Pronomina absolut gedeutet wer-
den. Um dies einzusehen, kann man einen
beliebigen Satz mit freiem Personalprono-
men betrachten:
(56) Sie hat einen Holzkopf.
Nehmen wir an, (56) werde in einer Situation
geuert, in der sich das Subjekt auf eine sich
in der erhobenen Hand der Sprecherin be-
findliche Handpuppe bezieht. Die so ber-
mittelte Information ist dann dieselbe wie die
durch (57) ausgedrckte:
(57) Diese Puppe hat einen Holzkopf.
Die Intensionen wren aber wenn das Pro-
nomen als absolut gedeutet wird verschie-
den: (56) wrde das Verfahren zur Feststel-
lung des Referenten des Subjekts in die Inten-
sion miteinbeziehen, whrend die durch (57)
ausgedrckte Proposition direkt von der ge-
zeigten Puppe als Gegenstand handelt.
An dieser Stelle wird die Tiefe des Problems
der Quantorenbindung wohl am deutlichsten:
es weist auf eine in der klassischen Theorie
bestehende Spannung zwischen der Charak-
terisierung der Intension als absoluter Infor-
mation einerseits und der Unverschiebbarkeit
der uerungssituation andererseits hin. Die
Rolle der Pronomina als direkt referentielle,
die Intensionsebene berspringende Aus-
drcke steht in einem klassisch nicht befrie-
Alle drei Lsungen haben jedoch ihre Tcken.
Das werden wir jetzt der Reihe nach zeigen.
Ad (i): Fat man Belegungen als kontex-
tuelle Parameter auf, gelangt man zu einer
Aufweichung des Monsterverbots (M). Wie
man an (Q
B
) sieht, ist es gerade der Sinn (der
kompositionellen Deutung) der Quantoren-
bindung, da man von irgendeiner festen Be-
nennung abstrahiert und somit bei der Exten-
sionsbestimmung auch andere Benennungs-
mglichkeiten untersucht als etwa eine ein-
zige, zufllig vom Kontext gegebene (in der
uerungssituation akute?) Belegung. (Q
B
)
wrde somit zu einer Verschiebung der ue-
rungssituation fhren, womit
Q
ein Monster
wre.
Ad (ii): Die Indexikalisierung der Belegun-
gen lt zwei Varianten zu, die sich in der
Beschreibung des Zusammenhangs zwischen
gebundener Variable in der Matrix und Per-
sonalpronomen an der sprachlichen Oberfl-
che unterscheiden.
(ii-a) Die den gebundenen Variablen ent-
sprechenden Pronomina werden als Reflexe
der Quantorenbindung aufgefat, die in Laut-
form und syntaktisch-morphologischem Ver-
halten zufllig mit den echten Personalpro-
nomina in Sinne der Analyse (R
2
) berein-
stimmen. Whrend letztere als deiktische Aus-
drcke analysiert werden, ist das gebundene
Pronomen im wesentlichen ein anderes Wort
(oder syntaktisches Phnomen), das nichts
mit direkter Refererenz zu tun hat, sondern
mit Intensionalitt denn nichts anderes
wre die durch Quantorenbindung verur-
sachte Index-Verschiebung. Es handelt sich
um eine Mehrdeutigkeits-Analyse der Prono-
mina der dritten Person. Gegen eine solche
Auffassung spricht die durch sie hervorgeru-
fene Redundanz oder Umstndlichkeit in der
Sprachbeschreibung: jedes in Funktion einer
gebundenen Variablen auftretende Pronomen
mte entweder im Lexikon doppelt klassi-
fiziert und beschrieben werden; oder die Ope-
ration F fhrt diese Pronomina synkategore-
matisch (d. h. ohne Lexikonzugriff) ein, wo-
mit die fr die Kongruenz zur Bezugs-NP
bentigten morphologischen Informationen
bei der Formulierung dieser Regel reprodu-
ziert werden mten. Zudem bedrfte es einer
Erklrung, warum diese Art von Mehrdeutig-
keit in sehr vielen Sprachen auftritt.
(ii-b) Man fat die gebundenen Vorkom-
men von Variablen in der Matrix als gewhn-
liche Pronomina auf. Allerdings kann dann
die korrekte Semantik der Pronomina un-
mglich wie in (R
2
) aussehen. Denn einerseits
9. Kontextabhngigkeit 205
handelt; sie scheint auch mit dem Monster-
verbot (M) unvereinbar zu sein. Wir wollen
deshalb nher untersuchen, welche Rolle cha-
rakterielle Einstellungen in der logischen
Sprachanalyse spielen.
Zunchst mu betont werden, da die er-
kenntnistheoretische Deutung der klassischen
Theorie eine Interpretation satzeinbettender
Verben als propositionale Einstellungen nicht
ausschliet; denn selbst wenn die Funktion
eines Einstellungsverbs darin besteht, einem
Individuum einen Bewutseinsinhalt eines be-
stimmten, im Komplementsatz nher charak-
terisierten Typs zu unterstellen, so knnte
diese Charakterisierung immer noch durch
eine Proposition erfolgen. Konkreter lt sich
diese Mglichkeit an der folgenden aus Sicht
der erkenntnistheoretischen Deutung nicht
ganz unplausiblen Bedeutungsregel verdeut-
lichen:
(R
meinen
) Es sei eine Verbalphrase der Ge-
stalt meint da , wobei ein
(Neben-) Satz ist; s
0
und s seien
Auerungs- bzw. Auswertungssitua-
tionen. Dann ist
(s
0
)(s) die Menge
derjenigen Individuen x, fr die gilt:
die durch ausgedrckte Proposi-
tion
(s
0
) folgt aus dem Bewut-
seinsinhalt
x,s
von x in s.
Das Meinen wird hier als emotionslose, den
Bewutseinsinhalt charakterisierende Einstel-
lung aufgefat. Man beachte nebenbei, da
(R
meinen
) der Hypothese (L) gengt: meinen
referiert danach absolut.
Die in (R
meinen
) aufgestellte Bedingung soll
in dem Sinne verstanden werden, da nach
ihr der (als Charakter aufgefate) Bewut-
seinsinhalt
x,s
von x (in der Welt und zur
Zeit der Auswertungssituation s) so beschaf-
fen ist, da die ihm entsprechende (als Pro-
position aufgefate) perspektivelose Infor-
mation
x,s
(s
x
) also (in der Terminologie
von Abschnitt 2.5) der objektivierte Bewut-
seinsinhalt nur Situationen umfat, in de-
nen auch p gilt; s
x
ist dabei der kognitive
Zustand von x, also die von x aus gesehene
Situation s: s
x
und s stimmen weitestmglich
berein, aber x ist das Ego, das erkennende
Subjekt, in s
x
. Um Motivation und Arbeits-
weise dieser Regel zu verstehen, kann man
(R
meinen
) auf ein einfaches Beispiel ansetzen:
(58) Martin meint, da ich lisple.
uert Maria in einer Situation s
0
diesen
Satz, bestimmt sich der Wahrheitswert mit
(R
meinen
) wie folgt:
digend zu lsenden Konflikt mit ihrer Funk-
tion als quantifizierte, also durch Abstraktion
oder Verschiebung gedeutete Variablen. So-
lange dieser Konflikt auf einen eng begrenzten
Bereich wie den des Einflubereichs der
Quantorenbindung beschrnkt ist, mag man
geneigt sein, Ad-hoc-Lsungen wie (ii-a) fr
den besten Ausweg zu halten. In Abschnitt
4.3 werden wir jedoch sehen, da sich Bin-
dungen einer erheblich weiteren Verbreitung
erfreuen, als man es aufgrund des bisherigen
Diskussionsstandes erhoffen knnte.
Ad (iii): Dem soeben beschriebenen Kon-
flikt kann man durch Einfhrung einer drit-
ten Komponente des Referenzpunktes aus
dem Wege gehen: neben Kontext und Index
beherbergt dieser dann gleichberechtigt noch
eine Belegung der Pronomina, die auf diese
Weise wie schon in der Variante (ii-b)
als eindeutige Wrter aufgefat werden kn-
nen. Gegen diese Vermeidungsstrategie lt
sich zweierlei einwenden. Erstens liefert sie
keine Garantie dafr, da nicht irgendwann
einmal weitere, der Quantorenbindung ver-
gleichbare Phnomene entdeckt werden, die
dann analog zu einer Vier-, Fnf- oder Sechs-
teilung des Referenzpunktes fhren wrden.
Auerdem sollte man ein ber das bloe Auf-
zeigen hinausgehendes Identifikationskrite-
rium fr das Phnomen der Quantorenbin-
dung haben, das es von der blichen, als
Index-Verschiebung aufgefaten Intensiona-
litt unterscheidet; da die Angabe eines sol-
chen Kriteriums keine Trivialitt ist, ersieht
man schon aus der Tatsache, da sich nach
dem in Abschnitt 2.2 beschriebenen Verfahren
auch letztere prinzipiell als Variablenbindung
darstellen lt.
4.2Perspektivische Verschiebungen
In Abschnitt 2.5 haben wir gesehen, da im
Rahmen der erkenntnistheoretischen Umdeu-
tung der klassischen Theorie Charakteren
momentane Bewutseinsinhalte entsprechen.
Da man sich sprachlich auf die Gedanken
und Wahrnehmungen von Personen mit satz-
einbettenden Verben wie glauben, befrchten,
hoffen, ahnen etc. beziehen kann, liegt der
Verdacht nahe, da eine adquate Semantik
diese Verben als charakterielle Einstellungen,
also als (indexabhngige) Relationen zwi-
schen Individuen und Charakteren analysie-
ren sollte. Eine solche Klassifikation satzein-
bettender Verben widerspricht nun allerdings
nicht nur der in Abschnitt 1.2 (und andern-
orts) gemachten gngigen Annahme, da es
sich hier um propositionale Einstellungen
206 IV. Kontexttheorie
zweier perspektiveloser Propositionen hinaus-
luft: die erste ist die Intension v des einge-
betteten Nebensatzes in der uerungssitua-
tion, die zweite der seiner ihm eigenen Per-
spektive beraubte, objektivierte Bewutseins-
inhalt des Subjekts, und verglichen werden
die beiden hinsichtlich der Frage, ob der erste
den zweiten (im Sinne einer Mengeninklu-
sion) umfat. Sowohl die dem Charakter des
eingebetteten Nebensatzes innewohnende
Perspektive als auch insbesondere der episte-
mische Blickwinkel des Subjekts werden in
(R
meinen
) bergangen.
Wir haben bereits in Abschnitt 2.5 festge-
stellt, da der Verlust der epistemischen Per-
spektive durch Objektivierung einen Infor-
mationsverlust nach sich ziehen kann: ver-
schiedene Individuen knnen dem Subjekt auf
verschiedene Arten gegeben sein. Dieser In-
formationsverlust spiegelt sich in konkreten
semantischen Effekten der Regel (R
meinen
)
wider. Der erste, harmlose Effekt macht
sich dann bemerkbar, wenn sich etwa Martin
und Maria in s
0
gegenber sitzen, Martins
Bewutseinsinhalt
Martin,s
0 den Charakter
Du lispelst
umfat, Martin aber nicht nur sein
Gegenber, sondern auch seine Vermieterin
fr eine Lisplerin hlt, die beiden allerdings
nicht miteinander in Beziehung bringt, ob-
wohl es sich in beiden Fllen um Maria han-
delt. Unter diesen Annahmen macht (R
meinen
)
Marias uerung von (58) sozusagen aus
zwei unabhngigen Grnden wahr: die Inten-
sion des eingebetteten Nebensatzes ist die-
selbe singulre Proposition p wie die in Mar-
tins epistemischen Zustand durch Du lispelst
bzw. Meine Vermieterin lispelt ausgedrckte.
Der erste Effekt von (R
meinen
) besteht also ganz
einfach darin, da zwei voneinander unab-
hngige Meinungen Martins durch ein und
dieselbe Beschreibung Marias abgedeckt wer-
den, da also Marias Aussage (58) eine ge-
wisse Unbestimmtheit unterstellt wird.
Ein umgekehrter Effekt ergibt sich, wenn
Martin vielleicht aufgrund einer neuen Fri-
sur oder einer Wahrnehmungsstrung sein
Gegenber nicht als seine Lebensgefhrtin er-
kennt, von der er gerade annimmt, da sie
nicht lispelt. Ein in etwa dem Satz Meine
Lebensgefhrtin lispelt nicht entsprechender
Charakter gehrt demnach ebenfalls zu Mar-
tins aktuellem Bewutseinsinhalt. Da Maria
Martins tatschliche Lebensgefhrtin ist,
folgt nun, da der objektivierte Bewutseins-
inhalt
Martin,s
0(s
0
Martin
) auch das Gegenteil von
p impliziert.
Martin,s
0 (s
0
Martin
) ist damit wider-
sprchlich und impliziert wie man sich
leicht berlegt berhaupt jede Proposition.
Nach der so reduzierten Wahrheitsbedingung
besagt Marias uerung von (58) also, da
Maria in jeder mit Martins Bewutseinsinhalt
(zur Zeit der uerungssituation) vereinba-
ren Situation lispelt. Das ist sicherlich kein
unerwnschtes Ergebnis. Uns interessiert hier
vor allem, wie es zustande kommt. Denn ei-
nerseits deutet (R
meinen
) das satzeinbettende
Verb als propositionale Einstellung, doch an-
dererseits fat diese Regel den Bewutseinsin-
halt des erkennenden Subjekts als Charakter
auf. Der Trick besteht lediglich in der per-
spektivischen Verschiebung: der Charakter des
Nebensatzes wird zunchst den Grund-
prinzipien der klassischen Theorie gem
an der uerungssituation ausgewertet; das
Resultat ist eine gewisse (in diesem Falle sin-
gulre) Proposition. Dann wird die Auswer-
tungssituation leicht verschoben, zur entspre-
chenden epistemischen Perspektive des Sub-
jekts hin, aus der heraus die (singulre) Pro-
position betrachtet wird. Die der uerungs-
situation eigene Perspektive wird also zur Er-
mittlung der durch den Nebensatz ausge-
drckten Propositon benutzt; doch fr die
Feststellung der Einstellung des Subjekts wird
sie ignoriert. Dieses Vorgehen entspricht na-
trlich genau der bereits in Abschnitt 1.2 skiz-
zierten Deutung von Einstellungsverben. Neu
ist hier lediglich, da dem Subjekt der Ein-
stellung eine epistemische Perspektive unter-
stellt wird.
Mit der epistemischen Perspektive ist es in
(R
meinen
) nicht allzu weit her. Ein zweiter Blick
zeigt nmlich, da diese prinzipiell nicht in
die Deutung von Einstellungsstzen einbezo-
gen wird. Intuitiv gesehen liegt das daran,
da die Regel ohnehin nur auf einen Vergleich
9. Kontextabhngigkeit 207
derspruch lt sich vllig unabhngig von der
hier betrachteten Regel einfach aufgrund
des Propositionsbegriffs und des Monsterver-
bots vorfhren. Eine Kritik an (R
meinen
)
unter Hinweis auf die offensichtlich inad-
quate Erfassung solcher Beispiele wie (59)
und (59) knnte damit im gegenwrtigen Zu-
sammenhang als thematisch verfehlt empfun-
den werden. Wir werden zwar noch sehen,
da der Zusammenhang zwischen der Fein-
heit des Propositions-Begriffs und der Ein-
beziehung epistemischer Perspektiven in die
Deutung von Einstellungsberichten enger ist
(oder jedenfalls enger konstruiert werden
kann), als es hier den Anschein haben mag.
Im Interesse einer skeptischen Leserschaft tun
wir jedoch vorerst einmal so, als handele es
sich hier um zwei vollkommen unabhngige
Phnomene.
Von solchen Problemen einmal abgesehen,
lassen sich also Einstellungsberichte vermit-
tels satzeinbettender Verben einigermaen be-
friedigend mit Hilfe der bezglich epistemi-
scher Arten des Gegebenseins unspezifischen
Regel (R
meinen
) beschreiben. Das unspezifische
Element ist aber nicht bei allen Typen von
Einstellungsberichten erwnscht:
(60) Bettina meint, mit Eddy Merckx verhei-
ratet zu sein.
Im Unterschied zu den bisher betrachteten
Beispielen liegt hier (oberflchlich) keine
Satz-Einbettung vor. Da hier eine gegenber
den bisherigen Beispielen neue Dimension er-
ffnet wird, sieht man, wenn man versucht,
(60) mit Hilfe von (R
meinen
) zu deuten und den
Infinitiv als Ausdruck einer unvollstndigen,
um das Matrix-Subjekt zu ergnzenden Pro-
position aufzufassen:
(60) Bettina meint, da sie mit Eddy Merckx
verheiratet ist.
Das im eingebetteten Satz ergnzte Personal-
pronomen mte dann natrlich als durch
das Matrix-Subjekt (im Sinne des vorherge-
henden Abschnitts) gebunden gedeutet wer-
den. (Da hier eine bloe, auf kontextuelle
Einschlgigkeit zurckgehende extensionale
bereinstimmung nicht ausreicht, sieht man
an analogen Beispielen mit quantifizierendem
Subjekt; es liegt also syntaktisch gespro-
chen Kontrolle durch das Matrix-Subjekt
vor.) Aber ansonsten knnte ja die Deutung
im Stil von (R
meinen
) vonstatten gehen. Da im
Falle von (Standard-) Namen Bindung und
Ersetzung auf intensionaler Ebene keinen Un-
terschied machen in beiden Fllen kommt
eine singulre Proposition ber den Referen-
Maria htte also auch behaupten knnen, da
es nach Martins Meinung in Kreuzlingen Ze-
bras gibt und damit nach (R
meinen
) auf
jeden Fall recht gehabt. Dieser Defekt von
(R
meinen
) lt sich nun relativ leicht ausmerzen,
ohne da sich an der Idee der Regel Wesent-
liches ndert: anstatt Bewutseinsinhalte als
Charaktere aufzufassen, knnte man in-
tuitiv etwa entsprechend den vom Subjekt fr
wahr befundenen Stzen dieselben ad-
quater durch Mengen von Charakteren re-
prsentieren. Die absurde Konsequenz um
(59) wrde auf diese Weise vermieden; aller-
dings wre dann immer noch Marias ue-
rung von (58) wahr, was angesichts der Um-
stnde insbesondere Martins unerschtter-
lichen Glaubens an die reine Artikulation sei-
ner Lebensgefhrtin Maria jedoch gar
nicht einmal unerwnscht ist:
(58) Martin meint, da ich nicht lisple.
Diese Technik der Widerspruchs-Vermeidung
im wesentlichen eine Adaption der sog.
Umgebungs-Semantik fr propositionale Ein-
stellungen hat ihre Grenzen, die sich be-
sonders deutlich zeigen, wenn der eingebettete
Satz oder seine Negation notwendig wahr ist,
ohne zugleich a priorisch zu sein. Ein typi-
scher Fall liegt etwa vor, wenn Maria unter
Anspielung auf ihre perfekte Verkleidung die
folgende zutreffende Behauptung aufstellt:
(59) Martin meint, da ich Maja bin.
Zumindest unter der Annahme, da es sich
bei Maja um einen Standard-Namen (von
Marias Freundin) handelt, drckt der in (59)
eingebettete da-Satz eine widersprchliche
Proposition aus. Damit folgt sofort, da nach
(R
meinen
) unter den gegebenen Umstnden jede
uerung wahr ist, die Martin eine wider-
sprchliche Meinung unterstellt also auch
etwa:
(59) Martin meint, da ich Ruth Rendell bin.
Der Schlu von (59) auf (59) ist nun aller-
dings sehr gewagt, zumal zwischen Marias
Freundin und der groen britischen Krimi-
nalschriftstellerin keinerlei uerliche hn-
lichkeit besteht.
Die Grenzen, an die die Regel (R
meinen
) hier
stt, sind natrlich auch die Grenzen des der
klassischen Theorie zugrundeliegenden und
bereits in Abschnitt 1.1 als bekanntermaen
zu grobmaschig eingeschtzten Propositions-
begriffs. Der Schlu von einem Widerspruch
auf einen beliebigen anderen (klassisch: den-
selben!) bzw. von einer Einstellung zu einem
Widerspruch auf die Einstellung zu jedem Wi-
208 IV. Kontexttheorie
bersehen; die Schuld daran trgt natrlich
die weiter oben beobachtete Unbestimmtheit
von (R
meinen
).
Mehreres lt sich gegen diese Betrachtun-
gen einwenden. Zum einen ist es gar nicht so
klar, ob (60) oder auch (60) unter den
genannten Umstnden wirklich in irgendei-
nem Sinne wahr wre. Dies wrde nun aller-
dings auf eine Kritik der Regel (R
meinen
) hin-
auslaufen, die bei dieser bereits die Sensitivitt
gegenber der epistemischen Perspektive des
Subjekts vermit. In diesem Falle htten wir
also gar nicht erst die infinitivische Variante
zu bemhen brauchen. Diese Kritik wollen
wir dahingestellt sein lassen, weil einerseits
die Frage des Wahrheitswerts der genannten
Stze mglicherweise nicht ganz theorieunab-
hngig beantwortet werden kann und ande-
rerseits eine Ablehnung von (R
meinen
) aufgrund
mangelnder Rcksichtnahme auf epistemi-
sche Perspektiven unserem Argumentations-
gang ohnehin entgegenkommt. Ein zweiter
Einwand knnte natrlich genau dem umge-
kehrten Weg folgen und schlichtweg die
Falschheit von (60) infrage stellen. Die Infi-
nitiveinbettung wre dann mit (R
meinen
) kor-
rekt gedeutet. Immerhin mte man unter
dieser Annahme zunchst (etwa pragmatisch)
erklren, warum denn (60) in der beschrie-
benen Situation zumindest falsch wirkt. Die
prinzipielle Mglichkeit einer solchen Erkl-
rung knnen wir hier nicht bezweifeln; wir
gehen jedoch davon aus, da die Falschheit
von (60) ein semantisches, die wrtliche Be-
deutung dieses Satzes betreffendes Phnomen
ist. Weitere Einwnde knnten die spezielle
Art des Gegebenseins Bettinas durch Ver-
mittlung einer Fotographie betreffen. In so
einem Falle ist der Leser angehalten, sich ein
besseres Beispiel auszudenken.
An dieser Stelle erhebt sich natrlich die
Frage, ob man nicht den subtilen Bedeutungs-
unterschied zwischen (60) und (60) durch eine
genauere Paraphrase beschreiben kann. Also
etwa durch:
(60) Bettina meint
de se
, da sie mit Eddy
Merckx verheiratet ist.
Wir wollen einmal dahingestellt sein las-
sen, was wohl der genaue Zusammenhang
zwischen den beiden Verben meinen und
meinen
de se
sein knnte. Stattdessen zeigen wir,
da eine kompositionelle Deutung der Para-
phrase (60
s
) keineswegs eine triviale Angele-
genheit ist. Betrachten wir zunchst die inten-
dierte Deutung von meinen
de se
:
ten heraus und nur die Intension fr
(R
meinen
) von Belang ist, knnten wir die Pro-
bleme aus Abschnitt 4.1 verdrngen und (60)
einfach durch (60) ersetzen:
(60) Bettina meint, da Bettina mit Eddy
Merckx verheiratet ist.
Dabei gehen wir natrlich davon aus, da die
beiden Vorkommen des Namens Bettina in
(60) auf ein und dieselbe Person, Bettina,
verweisen.) Nach (R
meinen
) besagen also (60)
und (60) genau dasselbe. Doch ist das kor-
rekt? Unter den meisten Umstnden werden
wohl die beiden Stze in der Tat auf dasselbe
hinauslaufen, doch mglicherweise nicht in
allen. Eine Situation, in der (60) falsch, aber
(60) wahr ist, knnte sich etwa so abspielen:
Bettina findet auf dem Speicher ein altes
Hochzeitsfoto von sich und ihrem Gatten
Wendelin. Das Foto zeigt Wendelin halb ver-
deckt in seiner Sportausrstung; sie selbst ist
nur von hinten zu sehen, aber unschwer als
seine Braut zu identifizieren. Den Rest kann
man sich denken: Bettina glaubt, da es sich
bei dem abgebildeten Athleten um den groen
belgischen Radfahrer handelt und dement-
sprechend bei der nicht zu erkennenden Braut
um dessen Gattin. Nach (R
meinen
) ist der Fall
dann klar: die (in einer beliebigen uerungs-
situation) durch den in (60) eingebetteten
Nebensatz ausgedrckte singulre Proposi-
tion folgt in der beschriebenen Situation aus
Bettinas objektivierten Bewutseinsinhalt: die
von Bettina auf dem Foto betrachtete Frau
ist ihrer Meinung nach mit Eddy Merckx
verheiratet, und in Wirklichkeit ist die so be-
schriebene Frau Bettina selbst. Die Falschheit
von (60) scheint jedoch durch diese Ge-
schichte unberhrt: von sich selbst glaubt Bet-
tina nichts dermaen Falsches, wie ihr in (60)
unterstellt wird. Es scheint, als msse Bettina
im Falle der Wahrheit von (60) das Subjekt
der Einstellung als Subjekt gegeben sein; die
durch den eingebetteten Satz (in einer ent-
sprechenden uerungssituation) ausge-
drckte Proposition mu sich also nicht
wie in (R
meinen
) gefordert irgendwie durch
Objektivierung einer Meinung von Bettina er-
geben, sondern auf eine ganz bestimmte Art
und Weise, nmlich durch Auswertung des
Sprecher- oder Subjekt-Parameters (in einem
gewissen epistemischen Zustand Bettinas).
Die in (60) von Bettina behauptete Einstel-
lung mu eben in einer gngigen Termi-
nologie eine Meinung de se sein. Und genau
diese Nebenbedingung wird durch die Zu-
rckfhrung von (60) auf die Paraphrase (60)
9. Kontextabhngigkeit 209
von Bettina, wobei allerdings den beiden ganz
verschiedene Eigenschaften zugesprochen
werden. Nach (R
meinen de se
) mte also (60
s
)
noch eine Lesart besitzen, nach der Bettina
meint, mit Bettina verheiratet zu sein. Doch
das ist offenkundig absurd.
Die Situation ist nicht hoffnungslos. Denn
(R
meinen de se
)lt sich dann retten, wenn es nur
gelingt, den Gegenstand der durch den Ne-
bensatz ausgedrckten Proposition eindeutig
als die Stelle zu bestimmen, an der das auf
das Einstellungssubjekt zurckbezogene Pro-
nomen steht. Neben einer Markierung der
Einstellung als Meinung de se bentigt die
Paraphrase also auch noch eine Markierung
des Pronomens als an die Sprecher-Perspek-
tive gebundenes Pronomen:
(60) Bettina meint
de se
, da sie* mit Eddy
Merckx verheiratet ist.
Der Stern deutet dabei gerade an, da das
Pronomen das Thema der durch den Satz
ausgedrckten Proposition ist. Dabei mu
natrlich der Themenbegriff irgendwie pr-
zisiert werden. Das kann z. B. dadurch ge-
schehen, da man die gesamte Proposition p
in Thema und Rest (= Rhema) strukturiert,
indem man sie etwa als Paar x
p
,E
p
auffat.
Die Details einer solchen Verfeinerung des
Propositionsbegriffs sind uerst trickreich
und knnen an dieser Stelle unmglich vor-
gefhrt werden. [Siehe dazu Artikel 34.] Wir
erwhnen hier lediglich die prinzipielle Mg-
lichkeit einer Przisierung von (R
meinen de se
) mit
Hilfe thematisch strukturierter Propositionen.
Die Version (60
C
) weist den Weg zu einer
ganz anderen Mglichkeit der Deutung von
(60) im Rahmen der klassischen Theorie, aber
ohne Verfeinerung des Propositionsbegriffs.
Denn wenn die gesternten Pronomina in je-
dem Falle als Ausdruck der Subjekts-Per-
spektive gedeutet werden, sind sie selbst
solange nur irgendwie die Stellen markiert
werden, an die sie gehren vollkommen
redundant. Statt auf (60
C
) knnte man (60)
also genausogut auf (60
*
) zurckfhren:
(60.) Bettina meint, da * mit Eddy Merckx
verheiratet ist.
Der Unterschied zwischen (60
C
) und (60
*
) ist
nun, da bei letzterem ein unvollstndiger,
lckenhafter Satz eingebettet ist; dem einge-
betteten Satz fehlt das Subjekt, womit er (zu-
mindest semantisch gesehen) eine Art VP ist.
Statt wie in (R*
meinen
) knnte man also die
Extension der Konstruktion meinen + Infi-
nitiv auf den Charakter dieser VP zurck-
fhren. In der Tat: nichts liegt oberflchlich
(R
meinen de se
) Es sei eine Verbalphrase der
Gestalt meint
de se
da , wobei
ein (Neben-) Satz ist; s
0
und s
seien uerungs- bzw. Auswer-
tungssituationen. Dann ist
(s
0
)(s) die Menge derjenigen
Individuen x, fr die gilt: der
Bewutseinsinhalt
x, s
von x in
s impliziert denjenigen Charak-
ter x, der an einem Referenz-
punkt s
1
,s den Wahrheitswert
1 liefert, falls der Sprecher von
s
1
die durch ausgedrckte Pro-
position
(s
0
) in s erfllt.
Den bislang undefinierten Implikationsbe-
griff fr Charaktere kann man entweder
in Analogie zu dem in Abschnitt 2.5 einge-
fhrten A Priori als Folgerung an allen
diagonalen Referenzpunkten oder wenn
man Bewutseinsinhalte durch Mengen von
Charakteren rekonstruiert als Element-
schaftsbeziehung auffassen.
Wie (R
meinen de se
) gemeint ist, macht man
sich am besten anhand des Beispiels (60
s
) klar.
In diesem Falle verlangt die Regel (von einer
Auswertungssituation), da Bettinas Bewut-
seinsinhalt (in dieser Situation) den Charakter
des Satzes Ich bin mit Eddy Merckx verhei-
ratet impliziert; denn dieser ist gerade an
einem Punkt s
1
,s wahr, falls die Spreche-
rin in s
1
die durch sie mit Eddy Merckx verhei-
ratet ist ausgedrckte Proposition erfllt.
(R
meinen de se
) scheint uns also in der Tat die
intendierte Deutung de se fr (60) zu geben.
Bei der Formulierung von (R
meinen de se
)
haben wir an entscheidender Stelle gemogelt.
Wir haben nmlich vergessen zu sagen, was
es fr ein Individuum x bedeutet, eine Pro-
position zu erfllen. Auf den ersten Blick
scheint es sich hier um ein harmloses Versehen
zu handeln. Denn wir sind ja in diesem Falle
nur an singulren Propositionen p interessiert,
die jeweils aus genau den Situationen beste-
hen, in denen ein bestimmtes, festes Indivi-
duum xp eine bestimmte, feste Eigenschaft Ep
hat; und in (R
meinen de se
) ist natrlich in diesem
Falle mit der Erfllung von p durch x (in s)
gemeint, da x (in s) die Eigenschaft E
p
be-
sitzt. Diese Definition macht nun allerdings
offensichtlich nur dann Sinn, wenn sich aus
dem singulren p die Eigenschaft E
p
eindeutig
ermitteln lt. Das kann man im allgemeinen
jedoch nicht erwarten: schon in unserem Bei-
spiel schlgt nmlich diese Bestimmung fehl,
handelt doch die zur Debatte stehende Pro-
position genausogut von Eddy Merckxs wie
210 IV. Kontexttheorie
Einstellung zum Widerspruch lsen.
Die Deutung des Meinens de se als Selbst-
zuschreibung einer gewissen Eigenschaft lt
sich mit der in Abschnitt 2.5 angesprochenen
Version (E) der Unterscheidung von perspek-
tiveloser und lokalisierender Information in
Verbindung bringen. Den Zusammenhang er-
kennt man am klarsten im Rahmen einer Pa-
rametrisierung von uerungs- und Auswer-
tungssituationen (im Sinne von Abschnitt
2.1). Um ihn herzustellen, bedarf es allerdings
der Annahme, da es genau einen rein kon-
textuellen Parameter gibt, und zwar den des
Sprechers. Dann lt sich mit (E) die Regel
(R
meinen + INF
) folgendermaen quivalent um-
formulieren:
(R
meinen + INF
) Es sei eine Verbalphrase der
Gestalt meint , wobei ein
Infinitiv (mit zu) ist; c sei ein
Kontext, i ein Index. Dann ist
(c)(i) die Menge derjenigen
Individuen x, fr die gilt: der
Sprecher jedes Kontexts c aus
!
x,i
ist in
(c)(i(c)).
Unter den gegebenen Annahmen lt sich die
quivalenz dieser Formulierung mit der Aus-
gangsregel leicht nachweisen. (E) lag ja die
Idee zugrunde, da die lokalisierende Infor-
mation eines Charakters bereits in der als
Menge von Kontexten aufgefaten waage-
rechten Diagonalisierung ! derselben steckt.
Insbesondere mssen also Folgerungen aus
Bewusteinsinhalten
x,s
als Folgerungen aus
!
x,i
darstellbar sein (wobei i die Parametrisie-
rung von s als Auswertungssituation ist). Was
soll es aber heien, da ein Charakter aus
der Menge !
x,i
von Kontexten folgt? Hier
hilft ein beliebig gewhltes Beispiel weiter:
offenbar impliziert Alains Bewutseinsinhalt
etwa den Charakter
mir ist kalt
, falls sich Alain
in einer Situation zu befinden meint, deren
Ego zu deren Zeit an deren Ort in deren Welt
etc. friert, falls also
mir ist jetzt hier tatschlich kalt
an
allen Kontexten in !
x,i
im Sinne des De-
fault-Prinzips (D) wahr ist. Letzteres heit
aber gerade, da !
x,i
eine Teilmenge von
mir ist kalt
ist. In dem uns interessierenden Fall wird
so aus der in (R
meinen + INF
) geforderten Im-
plikation zwischen
x,s
und eine Teilmen-
genbeziehung zwischen !
x,i
und der Menge
der Kontexte c, fr die
ich
(c)(i(c)) in
(c)(i(c)) liegt. Damit ist klar, da
(R
meinen + INF
) in der Tat nur eine Reformulie-
rung von (R
meinen + INF
) auf der Basis von (E)
ist.
nher; diese VP ist ja von der Finitheit
des Verbs abgesehen der eingebettete In-
finitiv! Die entsprechende Regel kann dann
(R
meinen de se
) ersetzen. Und so sieht sie aus:
(R
meinen + INF
) Es sei eine Verbalphrase der
Gestalt meint , wobei ein
Infinitiv (mit zu) ist; s
0
und s
seien uerungs- bzw. Auswer-
tungssituationen. Dann ist
(s
0
)(s) die Menge derjenigen
Individuen x, fr die gilt: der
Bewutseinsinhalt
x, s
von x in
s impliziert denjenigen Charak-
ter , der an einem Referenz-
punkt s
1
,s den Wahrheits-
wert 1 liefert, falls der Sprecher
von s
1
in s die durch ausge-
drckte Eigenschaft
(s
0
) be-
sitzt, falls also gilt:
ich
(s
1
)(s)
(s
0
)(s).
Die berprfung von (R
meinen + INF
) am Bei-
spiel (60) berlassen wir diesmal der Leserin.
Wir weisen zudem darauf hin, da nach dieser
Regel die Infinitiveinbettung unter meinen
kein Monster ist. Das wiederum ersieht man
unmittelbar aus dem Umstand, da in der
obigen Bedingung zur Festlegung der Exten-
sion der Verbalphrase vom Charakter des ein-
gebetteten Infinitivs nur insofern die Rede ist,
als seine Intension in der uerungssituation
betrachtet wird. Fr zwei intensionsgleiche
Infinitive kommt also jeweils dieselbe Menge
meinender Individuen heraus. Die geneigte
Leserin mge auch diese Behauptung am Bei-
spiel (60) und unter Heranziehung etwa des
durch Eddy Merckx geuerten Satze (61)
berprfen:
(61) Bettina meint, mit mir verheiratet zu
sein.
Meinungen de se sind nach (R
meinen + INF
)
Selbstzuschreibungen von Eigenschaften. Da
im Falle von (60) die zugeschriebene Eigen-
schaft gerade die Intension des eingebetteten
Infinitvs ist, ist die Deutung nach (R
meinen + INF
)
sehr direkt und elegant. So besehen ist sie der
nur um den Preis einer Verfeinerung des Pro-
positions-Begriffs przisierbaren Zurckfh-
rung (R
meinen de se
) der Infinitiveinbettung auf
eine Satzeinbettung berlegen. Andererseits
ist die Deutung der perspektivischen Bindung
mit Hilfe strukturierter Propositionen eine
universeller einsetzbare Strategie als die ober-
flchennahe Deutung der Infinitiveinbettung
als Selbstzuschreibung, lt sich doch auf
diese Weise auch das im Zusammenhang mit
(59) und (59) angesprochene Problem der
9. Kontextabhngigkeit 211
gesichts eventueller Lesarten de se noch ver-
blieben sein knnte. Da die Details sehr
kompliziert sind, wird der geduldige Leser
sptestens dann merken, wenn er selbst ein-
mal versucht, den subtilen Bedeutungsunter-
schied zwischen (63) und (63) den einschl-
gigen Regeln gem zu beschreiben:
(63) Lakoff trumte, da er Brigitte Bardot
war und ihn selbst kte.
(63) Lakoff trumte, da er Brigitte Bardot
war und sich selbst kte.
In (63) soll dabei das akkusativische Perso-
nalpronomen auf das Matrix-Subjekt Lakoff
zurckbezogen sein, whrend das Reflexivum
in (63) an das Subjekt er des eingebeteten
Satzes gebunden werden soll. Selbst wer (wie
der Verfasser dieser Zeilen an allen Tagen mit
ungeradem Datum) fr (63) die Lesart, nach
der Lakoff in seinem Traum die Welt aus BBs
Augen sieht und aus dieser Perspektive einen
bedeutenden Linguisten kt, nicht so recht
nachempfinden kann, ist herzlich dazu ein-
geladen, diesem Satz einmal zu bungszwek-
ken ebendiese Interpretation zu unterstellen.
Den bisher in diesem Abschnitt betrachte-
ten Beispielen ist gemeinsam, da die in ihnen
enthaltenen deiktischen Elemente ganz im
Sinne der klassischen Theorie stets unmit-
telbar auf die uerungssituation bezogen
waren und da andere, dieser Situation
fremde Perspektiven niemals zur Ermittlung
der Intensionen irgendwelcher Teilausdrcke
herangezogen werden muten: in (R
meinen
)
wurden die fr das Einstellungs-Subjekt ein-
schlgigen Arten des Gegebenseins der Refe-
renten direkt referentieller Ausdrcke offen-
gelassen und somit insbesondere nicht von
den im Einstellungs-Bericht verwendeten
Ausdrcken determiniert; und in (R
meinen + INF
)
wird zwar fr das implizite Subjekt des Infi-
nitivs eine ganz bestimmte Perspektive gefor-
dert, doch wird dieses Subjekt synkategore-
matisch gedeutet und gerade nicht als sprach-
licher Ausdruck, dessen Charakter die betref-
fende Einstellung als de se kennzeichnet. Um
nun aber im Berich der Einstellungsberichte
die klassische Theorie aufs Glatteis zu fhren,
bedarf es offenbar mehr als nur solcher Bei-
spiele, fr deren Deutung andere uerungs-
situationen oder epistemische Zustnde her-
angezogen werden mssen. Wie ein potenti-
elles Gegenbeispiel zur klassischen Theorie
beschaffen sein knnte, macht man sich viel-
leicht an dieser Stelle anhand einer abwegigen
Deutung des eingebetteten Infinitivs klar,
nach der einfach das dem Infinitiv implizite
Die Formulierung (R
meinen + INF
) ist dann
besonders aufschlureich, wenn der eingebet-
tete Infinitiv keinerlei deiktische Elemente
enthlt. In diesem Falle besagt die Regel, da
alle indexikalischen Parameter durch die
durch einen Kontext c reprsentierte episte-
mische Situation des Subjekts besetzt werden.
Unserer Annahme gem ist der einzige zu-
stzliche kontextuelle Parameter der des Spre-
chers; und dieser wird nach (R
meinen + INF
)
ebenfalls von c determiniert. Die durch einen
Satz wie (62) berichtete Einstellung luft also
auf eine Lokalisierung der epistemischen Si-
tuation des Subjekts hinaus: der Satz ist wahr,
falls Alain seine eigene Situation als eine sol-
che begreift, zu deren Zeit, an deren Ort, in
deren Welt etc. das Subjekt friert:
(62) Alain meint zu frieren.
Der Beitrag des in (62) eingebetteten Infinitivs
zur Extensionsbestimmung reduziert sich so-
mit auf die Menge der Kontexte c, deren
Sprecher die durch das Verb ausgedrckte
Eigenschaft besitzen. Das dem Infinitiv feh-
lende Subjekt wird also nach (R
meinen + INF
)
implizit als Aspekt eines Kontexts aus dem
Bewutseinsinhalt des Einstellungssubjekts
aufgefat. Der eingebettete Infinitiv erscheint
so als unmittelbarer Ausdruck einer gewissen
lokalisierenden Information im Sinne der Un-
terscheidung (E). Dabei ist freilich zu beach-
ten, da diese Lokalisierung nicht durch den
!-Operator aus dem infinitivischen Charakter,
sondern lediglich durch eine (in der meta-
sprachlichen Erluterung gegebene) Deutung
der unbesetzten Subjekts-Stelle gewonnen
werden kann. Aber immerhin: (R
meinen + INF
)
liefert in der Anwendung auf Beispiele wie
(62) eine gute Illustration fr (E): lokalisie-
rende Informationen kann man sich als die
durch absolut referierende Infinitive ausge-
drckten Eigenschaften vergegenwrtigen.
Bevor wir das Thema Einstellungsverben
endgltig verlassen, sei noch darauf hinge-
wiesen, da sich die anhand infinitiveinbet-
tender Verben dargestellte Deutung von Ein-
stellungen de se durch Selbstzuschreibung
prinzipiell auch auf satzeinbettende Verben
bertragen lt. Die fr diese bertragung
erforderliche semantische Technik ist die aus
der Kategorialgrammatik entlehnte Lcken-
vererbung, deren Darstellung hier allerdings
zu weit fhren wrde. (Eine ausfhrliche
Wrdigung enthlt Artikel 7.) Dieser Hinweis
mag jenen Rest von Skepsis gegenber der
weiter oben vorgefhrten Deutung (R
meinen
)
satzeinbettender Verben zerstreuen, der an-
212 IV. Kontexttheorie
um ein absolutes Wort zur Kennzeichnung
des auf die Auswertungssituation folgenden
Tages handelt. Wenn wir dann noch anneh-
men, da der Satz morgen war Heiligabend in
(64) unter ein unsichtbares Einstellungspr-
dikat (mit unsichtbarem Subjekt Tom) einge-
bettet ist, kmen wir der intendierten Deu-
tung von (64) offenbar recht nahe. Gegen
diese bequeme Lsung spricht der Umstand,
da Beispiele wie (64) sehr selten sind und in
der berwltigenden Mehrzahl der Flle das
Wort morgen eben doch auf die uerungs-
situation bezug nimmt, was zumindest ir-
gendwie erklrt werden mte. Fr eine ab-
solute Deutung spricht wiederum die Tatsa-
che, da eine analoge Verschiebung der ue-
rungssituation fr die Bestimmung der Exten-
sion eines so klar deiktischen Wortes wie ich
unmglich zu sein scheint: (64) besagt etwas
ganz anderes als (64).
(64) Schweigebadet wachte Tom mitten in
der Nacht auf: morgen war Heilig-
abend, und ich hatte vllig vergessen,
dem Weihnachtsmann meinen Wunsch-
zettel zu schicken.
Es ist natrlich fraglich, ob sich aus der Exi-
stenz solcher isolierter Beispiele irgendein ent-
scheidender Einwand gegen die klassische
Theorie konstruieren lt. Stze wie (64) mu-
ten ohnehin irgendwie metasprachlich an oder
sind jedenfalls sonstwie markiert. Die Ge-
suchtheit solcher vermeintlicher Gegenbei-
spiele ist vielleicht gerade ein Hinweis darauf,
da die klassische Theorie mit ihrer Analyse
des Normalfalls nicht so ganz schief liegt.
4.3Skopismus, Holismus und quantifizierte
Kontexte
In diesem Abschnitt dreht es sich weniger um
einen Phnomenbereich, der sich im Rahmen
der klassischen Theorie nicht oder nur auf
unbefriedigende Weise beschreiben liee, als
vielmehr um einen weiteren Ansatz zur Se-
mantik deiktischer Ausdrcke: den Skopis-
mus. Aus zweierlei Grnden handeln wir diese
Alternative erst hier und nicht schon im zwei-
ten Teil ab: einerseits hat nmlich offenbar
niemand jemals eine ernstgemeinte skopisti-
sche Analyse des Phnomens der Deixis ge-
liefert; die Mglichkeit geistert lediglich als
Schreckgespenst durch die klassisch geprgte
Literatur. Andererseits ergeben sich aus der
Kritik des Skopismus aus klassischer Sicht
wiederum tiefe Einsichten in und mglicher-
weise schwerwiegende Einwnde gegen die
klassische Theorie selbst.
Subjekt durch ich besetzt wird, wobei gleich-
zeitig gefordert wird, da die Extension dieses
nicht realisierten ich am epistemischen Zu-
stand des Einstellungs-Subjekts bestimmt
wird. Eine solche systematisch verschobene
Deutung des ich hat offenbar denselben
Effekt wie die oben angegebene Interpreta-
tion der Infinitiv-Einbettung; doch diese der
klassischen Theorie fremde Ersetzung der
uerungssituation ist natrlich einigerma-
en ad hoc und wie die quivalente Regel
(R
meinen + INF
) beweist vermeidbar. (Sie
fhrt obendrein zu syntaktischen Komplika-
tionen.) Die Frage aber bleibt, ob es nicht
Beispiele gibt, bei denen eine solche Ersetzung
der uerungssituation durch eine andere
epistemische Perspektive die einzige Mglich-
keit ist. Dies wre natrlich insbesondere
dann der Fall, wenn das entsprechende deik-
tische Element an der sprachlichen Oberfl-
che erscheint und nicht wie das vorgebliche
ich des Infinitivs durch grammatische Ana-
lyse hin- oder wegerklrt werden kann. Hier
ist so ein Fall:
(64) Schweigebadet wachte Tom mitten in
der Nacht auf: morgen war Heiligabend,
und er hatte vllig vergessen, dem Weih-
nachtsmann seinen Wunschzettel zu
schicken.
Das Problem ist das Temporaladverb morgen,
das sich fr gewhnlich auf den Tag nach der
uerungssituation bezieht (und somit deik-
tisch ist). Im vorliegenden Fall ist zunchst
nicht hundertprozentig klar, worauf morgen
berhaupt verweist: ist es der auf die be-
schriebene (Auswertungs-) Situation folgende
Tag, oder handelt es sich um den nchsten
Tag aus Toms Sicht? Wie dem auch sei: die
uerungssituation spielt zumindest in der
nchstliegenden Lesart von (64) fr die
Bestimmung der Extension von morgen gar
keine Rolle. Es scheint, als msse sie fr den
kurzen Moment der uerung von morgen
durch eine andere Situation ersetzt werden.
Wir haben also unser Gegenbeispiel gefun-
den.
Oder etwa nicht? Immerhin basierte die
Argumentation des vorhergehenden Absatzes
auf der Voraussetzung, da morgen deiktisch
ist und also seine Extension aus der ue-
rungssituation bezieht. Nun zeigt aber doch
(64) gerade, da das nicht der Fall sein kann.
Statt der gesamten klassischen Theorie sollten
wir vielleicht einfach nur die Annahme auf-
geben, da morgen deiktisch ist, und (64) im
Gegenteil als Indiz dafr werten, da es sich
9. Kontextabhngigkeit 213
stellt, es werfe dem Reichskanzler Adolf Hit-
ler Vaterlandsverrat vor. Es ist nicht zu be-
streiten, da (65) in der Tat diese beiden
offenkundig falschen Lesarten besitzt.
Das Problem ist natrlich, da (65) in ge-
wisser Weise stimmt. Doch hatte es die rechts-
radikale Presse zum genannten Zeitpunkt na-
trlich weder auf den pflzischen Konserva-
tiven noch auf den Braunauer Rassisten ab-
gesehen. Zielscheibe der Angriffe war viel-
mehr der damals amtierende Bundeskanzler
Willy Brandt. Neben p
d
und p
a
scheint also
der eingebettete Satz auch noch die Proposi-
tion p
m
ausdrcken zu knnen, die gerade in
den Situationen zutrifft, in denen derjenige,
der zum einschlgigen Erscheinungsdatum z
der National-Zeitung Kanzler war, im Dritten
Reich das Vaterland im Stich gelassen hat.
Diese dritte (oder mittlere) Lesart, die man
mit der Auflsung der Kennzeichnung der
Kanzler in zwei Lesarten offensichtlich nicht
bekommen kann, ergibt sich nun auf natr-
liche Weise mit einer Skopus-Analyse.
Wir fhren das Verfahren hier nur sehr
grob vor; die Details knnen an anderer Stelle
nachgelesen werden. Wir verweisen auf die
Artikel 22 und 7. In der Tat haben wir die
Technik schon in Abschnitt 4.1 kennenge-
lernt, wo wir fr den Zweck der Quantoren-
bindung Stze in Nominalphrasen und offene
Formeln zerlegt haben. Entsprechende Zer-
legungen knnen wir nun auch bei (65) und
seinen Teilstzen vornehmen, obwohl dort na-
trlich gar kein Pronomen gebunden werden
mu. Drei dieser Zerlegungen interessieren
uns hier besonders, da sie wie wir sogleich
sehen werden den drei beobachteten Les-
arten entsprechen. Zunchst einmal kann
man (65) in die (absolut zu deutende) No-
minalphrase der Kanzler und die verbleibende
Matrix m
d
(Anfang der siebziger Jahre war in
der National-Zeitung zu lesen, in schwerer Zeit
habe x das Vaterland im Stich gelassen) zer-
legen; diese Zerlegung lt sich dann so deu-
ten, da die Extension von m
d
die Menge M
d
der Individuen ist, die die Matrix (anstelle
von x) erfllen und da der ganze Satz wahr
ist, wenn die Extension der Kennzeichnung
ein Element von M
d
ist. Eine zweite Mglich-
keit ergibt sich, wenn wir lediglich den ein-
gebetteten Satz in der Kanzler und die Matrix
m
m
(in schwerer Zeit habe x das Vaterland im
Stich gelassen) zerlegen und das Ganze analog
deuten. Drittens und letztens knnen wir den
eingebetteten Satz unterhalb des Tempora-
ladverbs in der Kanzler und eine Matrix m
a
(x habe das Vaterland im Stich gelassen) se-
Um berhaupt zu sehen, da und wie der
Skopismus ursprnglich motiviert ist, fhren
wir zunchst ein Beispiel vor, bei dem man
die fr den Skopismus zentrale Skopus-Ana-
lyse auf gewisse absolut referierende Aus-
drcke anwendet:
(65) Anfang der siebziger Jahre war in der
National-Zeitung zu lesen, in schwerer
Zeit habe der Kanzler das Vaterland im
Stich gelassen.
Uns interessiert an (65) nur ein ganz spezieller
semantischer Aspekt, nmlich der Beitrag,
den die Kennzeichnung der Kanzler zur Ex-
tensionsbestimmung leistet; und bei dieser
Nominalphrase ist es vor allem die Zeitab-
hngigkeit ihrer Extension, der unsere Auf-
merksamkeit gilt. Zunchst einmal mssen
wir aber die Grobstruktur von (65) irgendwie
in den Griff bekommen. Wir gehen davon
aus, da es sich bei war in der National-Zei-
tung zu lesen um ein subjektloses Einstellungs-
Prdikat handelt, dessen Extension (in einer
Auswertungssituation) die Propositionen um-
fat, die durch die in der National-Zeitung
(in derselben Situation) behaupteten Stze
ausgedrckt werden. Die adverbialen Bestim-
mungen Anfang der siebziger Jahre und in
schwerer Zeit dagegen quantifizieren (existen-
tiell) ber die Auswertungs-Zeiten jeweils
ganz bestimmter Zeitrume. Der gesamte Satz
besagt damit, da es einen Zeitpunkt z am
Anfang der 70er Jahre gibt, so da in der zu
z erschienenen Ausgabe der National-Zeitung
eine Behauptung aufgestellt wurde, die dann
zutrifft, falls es eine Zeit z zwischen 1933 und
1945 gibt, zu dem die durch den Satz der
Kanzler hat das Vaterland im Stich gelassen
ausgedrckte Proposition p wahr ist. Nach
der in Abschnitt 3.3 skizzierten Semantik der
Kennzeichnungen hngt nun die Identitt von
p davon ab, ob die Kennzeichnung der Kanz-
ler deiktisch oder absolut verstanden werden
soll; der eingebettete Satz ist gerade in dieser
Hinsicht mehrdeutig. Nach der ersten Lesart
wrde zur Zeit der Abfassung dieses Kapitels
die Intension des eingebetteten Satzes p
d
ge-
rade die (fiktiven und realen) Situationen um-
fassen, in denen Helmut Kohl das Vaterland
im Stich lt; die zweite Lesart p
a
dagegen
besteht aus den Situationen s, in denen der
Kanzler in s das Vaterland im Stich lt. Im
einen Falle wrde also (65) auf die Behaup-
tung hinauslaufen, da die National-Zeitung
zu Beginn der 70er Jahre Helmut Kohls Ver-
gangenheit unter die Lupe genommen htte;
im zweiten Falle wrde dem Blttchen unter-
214 IV. Kontexttheorie
denen diese nicht in Abhngigkeit von der
uerungssituation gedeutet wrden. Da
die Durchfhrung einer solchen Blockade
kein triviales Unternehmen sein kann, sieht
man vielleicht schon daran, da eine einfache
Regelung, nach der jedes deiktische Element
a zu einer Zerlegung des Gesamtsatzes ()
in a plus Rest-Matrix (x) Anla geben soll,
schon deshalb nicht funktionieren kann, weil
der Gesamtsatz mehr als ein deiktisches Ele-
ment enthalten knnte. Von diesem techni-
schen Detail abgesehen, wrde eine Zurck-
fhrung der Deixis auf Skopus-Verhalten in
einen ernsthaften Konflikt mit jeder Art von
Kompositionalittsprinzip fhren. Ein Satz,
der Deiktisches enhlt, knnte nmlich nach
dieser Analyse so gut wie nie in einen anderen
Satz eingebettet werden, ohne da sich durch
diese Einbettung nicht auch seine Bedeutung
ndern wrde: durch die Einbettung ergibt
sich ein neuer Gesamtsatz und somit auch
eine neue Zerlegung, die im allgemeinen nicht
zur ursprnglichen Zerlegung quivalent ist.
In gewisser Weise liegt genau hier der An-
griffspunkt der klassischen Theorie gegen den
Skopismus; doch davon spter mehr. Schauen
wir uns zunchst einmal an, was durch die
Beschreibung der Deixis mit Hilfe der Sko-
pus-Analyse gegenber der klassischen Theo-
rie gewonnen sein knnte.
Was den Skopismus gegenber der klassi-
schen Theorie so attratkiv macht, ist leicht
gesagt: er kommt ohne eine Unterscheidung
von uerungs- und Auswertungssituation
und somit ohne den Charakter als zu Exten-
sion und Intension zustzlicher semantischer
Ebene aus. Da die Unterscheidung von Cha-
rakter und Intension ja gerade durch die klas-
sische Analyse deiktischer Ausdrcke in in-
tensionalen Umgebungen motiviert war, ist
das nicht weiter verwunderlich. Dennoch
lohnt es sich, einmal genau nachzuschauen,
was eigentlich im Rahmen einer skopistischen
Analyse aus dem ursprnglichen Situationen-
paar wird. Dazu ziehen wir eine Variante eines
Beispiels zurate, das uns einmal (in Abschnitt
1.2) zur Motivation der Dualitt von ue-
rungs- und Auswertungssituation gedient hat:
(66) Monika vermutet, da ich nicht spreche.
Der klassischen Theorie gem sieht die lo-
gische Form von (66) in der extensionali-
sierten Notation von Abschnitt 2.2 in etwa
folgendermaen aus:
(66) VERMUTEN(s, Monika,
{s SPRECHEN(s, ICH(s
0
))})
zieren. Wie man nun leicht nachweist (und
die Notation schon andeutet), entsprechen
diesen drei Zerlegungen gerade die drei vorher
ausgemachten Lesarten. Das war die Skopus-
Analyse von (65).
Es ist bemerkenswert, da die Skopus-
Analyse ohne die Annahme einer Ambiguitt
in der Kennzeichnung der Kanzler auskommt.
Daraus knnte man an dieser Stelle die (frei-
lich voreilige) Konsequenz ziehen, genau diese
Annahme sei berflssig. Wir lassen diesen
Punkt vorerst offen und wenden uns zunchst
einer weit radikaleren Spekulation zu, die sich
an dieser Stelle ebenso aufzudrngen scheint.
Dazu schauen wir uns noch einmal genauer
an, wie die direkt referentielle Lesart der
Kennzeichnung der Kanzler durch die Sko-
pus-Analyse von (65) abgedeckt wird. Wir
haben bereits erwhnt, da der gewnschte
Effekt dadurch erreicht wird, da der gesamte
Satz (65) in die betreffende Nominalphrase
plus Rest-Matrix zerlegt wird: die Extension
der NP wird dann an der fr die Auswertung
dieses Gesamtsatzes einschlgigen Situation
vorgenommen, und das ist aufgrund des
Prinzips (D) gerade die uerungssitua-
tion. Dieser Effekt ist natrlich von Einzel-
heiten des Beispiel (65) unabhngig: sobald
ein Satz in eine NP plus Rest-Matrix zerlegt
und im angedeuteten Sinne interpretiert wird,
hngt die Extension der NP eben wegen
(D) nur von der uerungssituation ab.
In diesem Sinne lt sich direkte Referentia-
litt durch Skopus simulieren. Da man den
komplexen Apparat der Skopus-Analyse
wie (65) zeigt ohnehin zu bentigen
scheint, ist es nur billig zu fragen, warum man
ihn dann nicht auch auf dem Terrain der
klassischen Theorie, der Semantik deiktischer
Ausdrcke, zum Einsatz bringen sollte. Ge-
nau diese bertragung der soeben beschrie-
benen skopusanalytischen Techniken auf
deiktische Ausdrcke bezeichnen wir hier als
Skopismus. Schauen wir uns genauer an, wo-
hin diese Spekulation fhrt.
Zunchst einmal mu klargestellt werden,
da eine Skopus-Analyse fr deiktische Aus-
drcke nicht genau nach dem Muster des eben
diskutierten Beispiels vorgenommen werden
darf. Denn der Witz an solchen Ausdrcken
wie ich und jetzt ist es ja gerade, da sie sich
immer auf die uerungssituation beziehen
und nicht wie der Kanzler in (65) je
nach Lesart (Zerlegung) auf sie bezogen wer-
den knnen oder nicht. Eine bertragung der
Skopus-Analyse auf deiktische Ausdrcke
mte also smtliche Lesarten blockieren, bei
9. Kontextabhngigkeit 215
rungs- und Auswertungssituation in der Sko-
pus-Analyse (66
s
) durch den entsprechenden
waagerechten Diagonalpunkt ersetzt wurde:
die Skopus-Analyse ist damit zur waagerech-
ten Diagonalisierung der klassischen Analyse
quivalent. Zwischen den beiden besteht so-
mit durchaus ein kleiner Unterschied. Ist da-
mit unsere Vermutung, der Skopismus knne
die klassische Theorie ohne Charaktere si-
mulieren, widerlegt? Nicht ganz.
Der Schlssel zur Klrung des Verhltnis-
ses der beiden Anstze zueinander liegt in dem
der klassischen Theorie eigentmlichen De-
fault-Prinzip. Denn das Prinzip (D) besagt,
da ein Satz genau in den (uerungs-)Si-
tuationen wahr ist, in denen auch seine waa-
gerechte Diagonalisierung wahr ist. Der von
Haus aus zweidimensionale Wahrheitsbegriff
der klassischen Theorie wird auf diese Weise
eindimensional. Mit Hilfe der soeben an (66)
gemachten Beobachtungen die sich bei
einer geeigneten Przisierung auf beliebige
Stze verallgemeinern lieen schlieen wir,
da der Skopismus auf denselben eindimen-
sionalen Wahrheitsbegriff fhrt wie die klas-
sische Theorie. Soweit sich die zentralen se-
mantischen Begriffsbildungen auf den (auf
uerungssituationen relativierten) Wahr-
heitsbegriff zurckfhren lassen, ist also der
Skopismus seine Machbarkeit einmal vor-
ausgesetzt zumindest in deskriptiver Hin-
sicht der klassischen Theorie ebenbrtig. Eine
klassische Kritik der Gleichsetzung von di-
rekter Referenz und weitem Skopus mu da-
mit entweder (a) ber die deskriptive Ad-
quatheit hinausgehende externe Kriterien fr
die Bevorzugung semantischer Theorien an-
geben oder aber (b) wenigstens einen nur klas-
sisch (im Gegensatz zu: skopistisch) definier-
baren Begriff nennen, der nicht nur innerhalb
der klassischen Theorie selbst von Interesse
ist.
Vertreter der klassischen Theorie versuchen
in der Regel, den Forderungen (a) und (b)
auf einen Schlag nachzukommen. Wir haben
ja schon gesehen, da der Skopismus mit dem
Makel einer inhrenten Nicht-Kompositio-
nalitt behaftet ist. Kompositionalitt ist
dann auch das klassischerweise angefhrte ex-
terne Kriterium. Der Skopismus erfllt es
nicht; die klassische Theorie hingegen
Durchfhrbarkeit des Programms wieder ein-
mal auen vor erfllt das Monsterverbot
(M) und damit eine relativ strenge Kompo-
sitionalitats-Anforderung: Kompositionalitt
gilt nicht nur auf Charakter-, sondern sogar
auf Intensions-Ebene. Die Intension ist zu-
In (66) haben wir die in der Metasprache
bliche Notation fr Mengenabstraktion
durch geschweifte Klammern benutzt. Man
beachte, da die zwischen { und stehende
Variable s im Mengenterm gebunden ist und
sich in dieser Hinsicht von dem ersten, freien
Vorkommen von s in (66) unterscheidet; wir
haben dieselbe Variable gewhlt, um hervor-
zuheben, da es sich um dieselbe Art der
Bezugnahme auf Auswertungssituationen
handelt. Weniger verwirrend ist jedoch diese
vollkommen quivalente -Notation:
(66) VERMUTEN(s, Monika,
{s SPRECHEN(s, ICH(s
0
))})
Vergleichen wir nun diese Formel mit dem
Ergebnis der entsprechenden Skopus-Ana-
lyse! Dafr mssen wir (66) zunchst in das
deiktische ich und die Restmatrix vermutet,
da x nicht spricht zerlegen. (Morphologische
Feinheiten bergehen wir wieder einmal.)
Letztere enthlt keine deiktischen Elemente
zumindest wenn wir die Finitheit ignorie-
ren und besitzt demnach die folgende ab-
solut referierende Form:
(67) VERMUTEN(s, Monika,
{s SPRECHEN(s,x)})
Die Skopus-Analyse bildet jetzt aus (67) eine
Menge und weist (66) die Aussage zu, da die
Extension von ich ein Element derselben ist.
Wir erhalten damit:
(66) ICH(s
0
) {x VERMUTEN(s, Monika,
{s SPRECHEN(s, x)})
Wir haben wie in der klassischen Theorie die
Extension von zwei Situationen abhngig ge-
macht, obwohl wir ja zeigen wollen, da nach
skopistischer Auffassung eine einfache Situa-
tionsabhngigkeit vollkommen ausreicht.
Das in (66) freie Vorkommen von s (das die
Auswertungssituation fr das Prdikat VER-
MUTEN andeutet) und das (fr die Exten-
sionsbestimmung von ICH zustndige) s
0
mten also durch dieselbe Variable ersetzt
werden knnen, wenn unsere Vermutung rich-
tig ist; und da der Sprecher-Parameter ICH
nur in Bezug auf uerungssituationen Sinn
macht, sollte diese eine Variable gerade s
0
sein.
Wir erhalten somit aus (66) eine Formel, die
sich wieder unter Rckgriff auf eine ge-
bundene Umbenennung auf die folgende
kompaktere Form bringen lt:
(66) VERMUTEN (s
0
, Monika,
{s SPRECHEN (s, ICH(s
0
))})
Wir sehen also, da das bei der klassischen
Analyse (66
k
) herangezogene Paar aus ue-
216 IV. Kontexttheorie
sen, da der ihm entsprechende vortheoreti-
sche Begriff des Besagten ein wenig vage ist.
Machen wir uns das an einem Beispiel klar:
(68) Ich bin jetzt in Grasse.
Was (68) besagt, hngt offensichtlich davon
ab, unter welchen Umstnden der Satz ge-
uert wird. Gnter Grass htte mit einer
uerung von (68) anno 1959 etwas anderes
gesagt, als es Patrick Sskind mit demselben
Satz im Jahre 1989 vermag: im ersten Fall
luft die uerung auf die Behauptung hin-
aus, da sich der bekannte Sozialdemokrat
zu einem gewissen Zeitpunkt der fnfziger
Jahre in der Parfmstadt befindet, whrend
die zweite uerung von einem gewissen Ge-
genwartsautoren besagt, er weile zu einer be-
stimmten spteren Zeit in der Provencestadt.
So jedenfalls lehrt es uns die klassische Theo-
rie. Doch stimmt das auch? Stellen wir uns
einmal vor, die beiden uerungen von (68)
wren Texte auf Ansichtskarten, die die Auto-
ren jeweils an ihre Verleger geschickt htten.
Auf der Buchmesse treffen sich nun diese bei-
den Verleger, wobei der eine die Karte des
anderen sieht und dieselbe mit folgenden
Worten kommentiert:
(69) Das hat Grass damals auch geschrieben;
in Wirklichkeit hat er sich dann in Go-
desberg herumgetrieben.
Uns interessieren die ersten drei Buchstaben
von (69), mit denen sich der Sprecher auf die
in Sskinds Ansichtskarte aufgestellte Be-
hauptung bezieht. Da er nach unserer Ge-
schichte zumindest mit dem ersten Teilsatz
von (69) recht hat, kann die Extension des
das in dieser Lesart (A) unmglich die (nach
der klassischen Theorie) auf Sskinds An-
sichtskarte ausgedrckte Proposition sein;
denn ber seines zuknftigen Kollegen zu-
knftigen Aufenthaltsort hat sich Gnter
Grass zur Zeit des Parteitags sicherlich keine
Gedanken gemacht. In einem gewissen Sinne
ist also das, was mit der von uns betrachteten
uerung von (68) gesagt wird, nicht dasselbe
wie die Intension dieses Satzes. Natrlich
kann man den Begriff auch in dieser Situation
im Sinne der klassischen Theorie verstehen:
wenn Sskinds Verleger ein Witzbold ist,
kann er vielleicht auf die uerung seines
Kollegen mit seiner Bewunderung der Weit-
sicht des Autoren der Blechtrommel kontern
oder seiner Verwunderung darber Aus-
druck geben, da sich der von ihm selbst
verlegte Erfolgsautor schon in so jungen Jah-
ren fr Politik interessierte. Im ersten Falle
(B) htte er dann das das im Sinne von da
gleich auch der wichtigste gegen vermeintliche
Skopisten als Beleg zu (b) ins Felde gefhrte
klassische Begriff: in der Skopus-Analyse ver-
wischt sich der Unterschied zwischen Charak-
ter und Intension. Wir knnen uns diese klas-
sische Kritik leicht anhand des obigen Ana-
lyse-Beispiels klarmachen. Der kleine Unter-
schied zwischen (66
k
) und (66
s
) besteht ja ge-
rade darin, da nur in der klassischen Vari-
ante (durch die Wahl unterschiedlicher Varia-
blen) zwischen uerungs- und Auswertungs-
situation differenziert wird. Bei der Defintion
der Intension aus der Charakterformel (66
k
)
macht man sich diesen Unterschied zunutze,
indem man erstere, nicht aber letztere mit
einem konkreten Wert belegt. Eine solche dif-
ferenzierte Belegung ist aber in (66
s
) unmg-
lich, da es hier nur eine freie Variable gibt,
deren Vorkommen alle (zu)gleich belegt wer-
den mssen. Die Nicht-Definierbarkeit der
Intension erklrt das Scheitern der Kompo-
sitionalitt: die Intension wird gerade fr eine
Einbettung in intensionale Umgebungen be-
ntigt. Da Intensionen ber ihre Rolle fr
eine kompositionelle Deutung hinaus irgend-
ein Interesse haben knnen, mu freilich erst
noch gezeigt werden. Dazu gengt es, sich auf
einen speziellen Typ von Intensionen, die Pro-
positionen, zu konzentrieren.
Bereits bei ihrer intuitiven Motivierung (in
Abschnitt 1.1) sind Propositionen als Satzin-
halte, als das, was Stze besagen, eingefhrt
worden. Sie haben somit eine wenn auch
etwas vage auertheoretische Charakteri-
sierung erfahren. Genauer: der klassische Pro-
positionsbegriff beansprucht, ein vortheore-
tisch gegebenes Phnomen zu erfassen. Dieser
Anspruch der klassischen Theorie, die mit
Stzen (in uerungssituationen) gemachten
Aussagen durch die von ihnen ausgedrckten
Propositionen zu erfassen, manifestiert sich in
der Aufspaltung (E) des Informationsgehalts
in zwei Komponenten. Und hier versagt der
Skopismus: da mit ihm der Propositionsbe-
griff nicht definierbar ist, ist er auch nicht in
der Lage, ein Analogon zu (E) zu liefern.
Damit ist er insbesondere auch als Ausgangs-
punkt fr die in Abschnitt 2.5 angedeuteten
erkennntistheoretischen Betrachtungen un-
geeignet.
Die die Kompositionalitt betreffende
klassische Kritik (a) des Skopismus wollen
wir hier nicht weiter diskutieren, weil sie of-
fenkundig gerechtfertigt ist. Uns interessiert
hier mehr der Einwand (b), der klassische
Propositions-Begriff sei von unabhngigem
Interesse. Wir haben bereits darauf hingewie-
9. Kontextabhngigkeit 217
wurf der Nicht-Kompositionalitt hinausge-
hender Einwand gegen den Skopismus kon-
struieren allenfalls der, da der Begriff des
(kompositionellen) Beitrags zur Extension
von unabhngigem (empirischen?) Interesse
sei. Versucht die klassische Theorie, mit ihrem
Intensions-Begriff irgendeinen weitergehen-
den Anspruch zu stellen, bleibt ihr nur die
Flucht in eine zweifelhafte Normativitt.
Wie die Intension in der klassischen Theo-
rie aufgefat wird, gert sie nicht nur hufig
mit dem vortheoretischen Begriff vom Gesag-
ten in Konflikt, sondern ebensooft auch mit
einem sich durch einfache Plausibilitts-ber-
legungen aufdrngenden umgebungsrelativen
Begriff des Beitrags zur Extension. Das gilt
zumindest im Rahmen einer Parametrisie-
rung. Wie wir schon in Abschnitt 2.3 gesehen
haben, luft eine Parametrisierung (immer
unter der Annahme, da jeder kontextuelle
Parameter zugleich auch indexikalisch ist) auf
eine Aufspaltung i,i,c jedes Referenz-
punkts in die Aspekte i der Auswertungs-
situation, die indexikalischen Aspekte i der
uerungssituation und die rein kontextuel-
len Aspekte c der uerungssituation hinaus.
In welcher Aspektliste sich ein Parameter P
niederschlgt, hngt von seiner Verschiebbar-
keit ab: wenn es eine (intensionale) Konstruk-
tion gibt, die die Extension eines Gesamtaus-
drucks von den Extensionen seiner Teile an
solchen Situationen abhngig macht, die sich
von der uerungssituation in P unterschei-
den, dann ist P indexikalisch; sonst ist P rein
kontextuell. Man beachte, da die Einord-
nung von P ein fr allemale und insbesondere
unabhngig von der fr die Verschiebbarkeit
verantwortlichen Konstruktion geschieht:
wenn es auch nur eine einzige solche den
Parameter P betreffende Verschiebung gibt,
dann ist P grundstzlich indexikalisch; die
Abhngigkeit der Extension von Ps Wert mu
in diesem Falle bei jeder intensionalen Kon-
struktion und sei es auch nur pro forma
bercksichtigt werden. In dieser Unflexi-
bilitt in der Aufspaltung der Referenzpunkte
lt sich die Ursache einiger Unplausibilit-
ten der klassischen Theorie erkennen.
Ein paar Beispiele zeigen hoffentlich, was
gemeint ist. Bei ihrer Analyse werden wir uns
noch weiter von jeglichen Standards der de-
skriptiven Semantik entfernen, als wir es
ohnehin schon in diesem Kapitel getan haben.
Mge der didaktische Zweck, einen allge-
mein-theoretischen Punkt aufzuhellen, die
Skrupellosigkeit gegenber den Daten und
ihrer Beschreibung rechtfertigen!
Sskind zur Zeit der Abfassung seiner Karte
in Grasse sei, also der Intenison der betreffen-
den uerung von (68), verstanden; im zwei-
ten Falle (C) htte er offenbar das Demon-
strativum auf die durch Sskind befindet sich
1959 in Grasse ausgedrckte Proposition be-
zogen. Wohlgemerkt: alle drei Mglichkeiten
des Verstndnisses von das sind in dieser Si-
tuation legitim wenn auch zwei von ihnen
aus inhaltlichen Grnden abwegig erscheinen;
und alle drei Mglichkeiten ergeben sich aus
der waagerechten Diagonalisierung des Cha-
rakters von (68) durch Bezug jeweils verschie-
dener situationeller Parameter auf die ue-
rungssituation aber es ist keineswegs klar,
da eine dieser drei Mglichkeiten in einem
besonderen, von den anderen beiden verfehl-
ten Sinne das mit dem Satz (in der Situation)
Gemeinte trifft. In der schon weiter oben be-
nutzten Notation der Extensionalisierung
kann man die drei Verstndnisse des in der
betreffenden Situation durch (68) Besagten so
darstellen:
(68) LOKALISIERUNG(Welt(s
0
), Zeit(s
0
),
ICH(s
0
), Grasse)
(68) LOKALISIERUNG(Welt(s
0
),1989,
Sskind, Grasse)
(68) LOKALISIERUNG(Welt(s
0
), Zeit(s
0
),
Sskind, Grasse)
Die von der klassischen Theorie beanspruchte
Rekonstruktion eines vortheoretischen Be-
griffs ist also alles andere als offenkundig: das
Beispiel legt eher den Verdacht nahe, da das
vage alltagssprachliche Verstndnis vom Ge-
sagten zwischen der Intension (68
B
) im klas-
sischen Sinne und anderen Mglichkeiten der
Abstraktion von Aspekten der uerungssi-
tuation changiert. Bei der vermeintlichen Re-
konstruktion handelt es sich also allenfalls
um einen normativen Eingriff in die Alltags-
sprache: verwende den Begriff des Gesagten
stets im Sinne des klassischen Propositions-
Begriffs. Die uerung (69) des Verlegers von
Grass zeugt dann von laxem Sprachgebrauch.
Natrlich waren Intensionen und speziell
Propositionen in der klassischen Theorie und
ihren Vorlufern in erster Linie herangezogen
worden, um den Beitrag zu bestimmen, den
ein sprachlicher Teilausdruck in einer nicht-
extensionalen Umgebung zur Bestimmung
der Extension des Gesamtausdrucks leistet.
Diese Bestimmung des Propositions-Begriffs
ist gegen die soeben vorgebrachten kritischen
Betrachtungen immun. Doch mit ihr allein
lt sich auch kein wesentlich ber den Vor-
218 IV. Kontexttheorie
Fllen die Abhngigkeit von der Welt, vom
Ort und von weiteren, in anderen Umgebun-
gen beobacheten Aspekten sein. Was der Bei-
trag eines Teils zur Extension des Ganzen ist,
hngt also nach der klassischen Theorie
strenggenommen von allen nicht-extensiona-
len Konstruktionen der jeweiligen Sprache
bzw. von deren Beschreibung ab. In diesem
Sinne haftet der klassischen Theorie (bei einer
Parametrisierung der Auswertungssituatio-
nen) ein holistisches Element an. Eine Alter-
native zu diesem Holismus knnte sich durch
eine etwas flexiblere Auffassung von Refe-
renzpunkten ergeben. Wir skizzieren hier nur
ein denkbares Vorgehen; ob es wirklich zu
intuitiveren Resultaten fhrt als die klassische
Theorie, steht in den Sternen am Ideenhim-
mel.
Fr die Skizze setzen wir eine feste Para-
metrisierung voraus. Fr eine beliebige
Menge M von indexikalischen Parametern ist
dann ein M-Referenzpunkt ein Paar, beste-
hend aus einem Kontext sowie einem M-In-
dex, d. h. einer Liste von indexikalischen
Aspekten, die nur fr jedes Element von M
einen Wert enthlt. Ein M-Index m lt sich
in der Weise in einen gewhnlichen Index i
einarbeiten, da alle M-Aspekte in i durch
die entsprechenden Aspekte von m ersetzt
werden; das Resultat notieren wir als
i
/
m
. Jeder
gewhnliche Charakter determiniert dann
in natrlicher Weise an jedem parametri-
sierten, ungespaltenen und mglicherweise
unstimmigen Referenzpunkt c,i eine M-
Intension namens (c)(i-M), also eine Funk-
tion von M-Indizes in Extensionen: (c)(i-M)
liefert fr einen beliebigen M-Index m als
Wert (c)(
i
/
m
). Ganz analog zu den in Ab-
schnitt 1.4 eingefhrten Begriffsbildungen
kann man nun eine n-stellige syntaktische
Operation F als M-intensional bezeichnen,
falls jeweils M-intensionsgleiche Teilaus-
drcke stets zu extensionsgleichen Gesamt-
ausdrcken fhren, falls also fr alle Charak-
tere
1
,
1
,...,
n
,
n
und alle Referenzpunkte
c,i gilt:
1
(c)(i-M) =
1
(c)(i-M), ...,
n
(c)(i-M) =
n
(c)(i-M) impliziert
F
(
1
, ...,
n
)(c)(i) =
F
(
1
, ...,
n
)(c)(i).
Und ganz analog ist eine solche syntaktische
Konstruktion F genau dann M-intensional,
wenn sich die entsprechende semantische
Operation
F
jeweils, also an jedem Kontext
c, in dem Sinne auf eine Operation
F
c
ber
M-Intensionen zurckfhren lt, da fr be-
liebige Charaktere
1
, ...,
n
und Indizes i gilt:
Ein Modaladverb wie mglicherweise be-
zieht sich jedenfalls nach einer naheliegen-
den semantischen Analyse auf den Welt-
parameter und auf keinen anderen:
(70) Mglicherweise war alles umsonst.
Wenn Fritz nach Verspeisen eines opulenten
Mahls in einem Restaurant mehrere Male ver-
geblich nach der Rechnung verlangt und dann
seiner Gemahlin gegenber die Hoffnung (70)
uert, so bringt er damit zum Ausdruck, da
es zumindest in gewissen, wohl eher irrealen
Situationen s so ist, da der unter das Mo-
daladverb eingebettete Satz es war alles um-
sonst in s wahr ist. Nicht von jedem berhaupt
denkbaren s ist jedoch dabei die Rede, son-
dern lediglich von solchen, die sich zur selben
Zeit am selben Ort, aber nicht unbedingt in
der Wirklichkeit abspielen. Verschoben wird
also nur der Weltaspekt. Als Beitrag des ein-
gebetteten Satzes zur Extension des Gesamt-
satzes bietet sich somit diese Abhngigkeit
vom Weltaspekt an.
Ein Lokaladverb wie nirgends bezieht sich
ebenfalls nach einer naheliegenden seman-
tischen Analyse auf den Ortsparameter
und auf keinen anderen:
(71) Nirgends gibt es einen fr diese Zwecke
geeigneteren Ort.
Wenn ein Schler auf die Anordnung seiner
Lehrerin, schleunigst den auf ihrem Stuhl be-
findlichen Reibrettstift zu entfernen, (71) er-
widert, so bringt er damit zum Ausdruck, da
keine Situation s so ist, da der unter das
Lokaladverb eingebettete Satz es gibt einen
fr diese Zwecke geeigneteren Ort in s wahr
ist. Nicht von jedem berhaupt denkbaren s
ist jedoch dabei die Rede, sondern lediglich
von solchen, die sich zur selben Zeit in der-
selben Welt, aber nicht unbedingt am Ort der
uerung abspielen. Verschoben wird also
nur der Ortsaspekt. Als Beitrag des eingebet-
teten Satzes zur Extension des Gesamtsatzes
bietet sich somit diese Abhngigkeit vom
Ortsaspekt an.
Die im Zusammenhang mit (70) und (71)
angestellten Betrachtungen sind mit der klas-
sischen Theorie nicht hundertprozentig ver-
einbar. Wenn nmlich die Analyse von (70)
zeigt, da der Weltparameter verschiebbar ist
und die Analyse von (71) auf die Verschieb-
barkeit des Ortsparameters hinweist, dann
mu in jedem der beiden Flle die im jeweils
anderen Fall beobachtete Verschiebbarkeit in
den globalen, von der einzelnen Konstruktion
unabhngigen Intensions-Begriff eingehen.
Beitrag des eingebetteten Satzes zur Exten-
sion des Gesamtsatzes mu also in beiden
9. Kontextabhngigkeit 219
darin, da gestandene kontextuelle Parameter
urpltzlich dabei erwischt werden, wie sie
durch sprachliche Operatoren gebunden, also
verschoben, werden. Hier zunchst ein harm-
loses, weil klassisch erklrbares Beispiel, das
wir bereits in Abschnitt 1.3 angesprochen
haben:
(72) Vater werden ist nicht schwer, Vater sein
dagegen sehr.
Immer unter der Annahme, da es sich bei
Vater um ein funktionales Substantiv handelt
und da weiterhin ein fehlendes Argument
stets durch den Kontext beigesteuert wird,
gibt es hier ein ernsthaftes Problem. Offen-
sichtlich besagt ja (72) in seiner nchstliegen-
den Lesart nicht, da die Vaterschaft eines
ganz bestimmten, vielleicht unmittelbar vor
uerung des Satzes erwhnten Kindes eine
Brde ist; gemeint ist offenbar vielmehr eine
Aussage ber die Vaterschaft im allgemeinen.
Je nach Skopus der Negation ist also die
Argumentposition existentiell oder universell
abquantifiziert. In jedem Falle mte man
dann aber von der fr kontextuelle Auffl-
lung vorgesehenen Stelle abstrahieren, was
nach den Regeln der klassischen Theorie nicht
mglich ist.
Das Problem mit (72) kann man auf ver-
schiedene Weisen lsen. Zunchst sei darauf
hingewiesen, da die betreffende deiktische
Position unsichtbar ist und insofern hn-
lich wie das fehlende Subjekt des Infinitivs im
vorhergehenden Abschnitt relativ beliebig
manipuliert werden kann: vielleicht handelt
es sich bei der fr die quantifizierte Lesart
verantwortlichen Konstruktion um eine an-
dere, nicht deiktische Possessivierung als die
in Abschnitt 3.3 diskutierte. Eine andere
Mglichkeit der Erklrung ist rein pragma-
tischer Natur: (72) hat so etwas Sprichwrt-
liches. Und bei allgemeinen Lebensweisheiten
abstrahiert man schon einmal vom Kontext.
So z. B. auch in:
(73) Ich kann doch nicht einerseits andau-
ernd Nchstenliebe predigen und ande-
rerseits smtliche Nachbarn verklagen.
Das ich wird in (73) weniger als Bezeichnung
des Sprechers, sondern eher als Stellvertreter
fr dessen Perspektive oder Rolle (morali-
sches Subjekt) verstanden, ber die durch den
Einleitungssatz quantifiziert wird. Es gibt
gute Grnde fr die Annahme, da man der-
artige Quantifikationen in die Art des Sprech-
akts und somit in die Pragmatik abschieben
kann. Und was bei (73) geht, knnte auch bei
(72) funktionieren.
F
(
1
,...,
n
)(c) =
F
c
(
1
(c)(i-M),...,
n
(c)(i-
M)). Wren die fr (70) und (71) skizzierten
Beispielsanalysen korrekt, so wre die Hin-
zufgung eines Modal- bzw. Lokaladverbs
{Welt}- bzw. {Zeit}-intensional. Die Angabe
der entsprechenden M-intensionalen Opera-
tionen berlassen wir wieder in Analogie
zu Abschnitt 1.4 der Leserin. Auf die sinn-
geme bertragung der dort im Zusammen-
hang mit intensionalen und gemischten Kon-
struktionen angestellten berlegungen zur
Kanonizitt verzichten wir hier.
Ziel der ganzen Sophisterei ist es, einen
begrifflichen Rahmen fr eine Aufweichung
der klassischen Theorie bereitzustellen. Die
Idee dabei ist zunchst, fr jede syntaktische
Operation F eine (im Sinne der Inklusion)
mglichst kleine Menge M indexikalischer
Parameter zu finden, so da F M-intensional
ist. Sind solche minimalen Parameter-Mengen
erst einmal gefunden in der Regel drfte
dies keine allzu groen Schwierigkeiten be-
reiten so kann man die klassische Dicho-
tomie von Intensionalitt und Extensionalitt
in der Grammatik durch ein ganzes Spektrum
von M-Intensionalitten wie Temporalitt (M
= {Zeit}), Modalitt (M = {Welt}), Proposi-
tionalitt (M = {Zeit, Welt}) etc. ersetzen.
Das ist zunchst nur eine Verfeinerung der
klassischen Theorie. Die Situation ndert sich
aber dann, wenn die M-Intensionen nicht nur
zur Klassifikation syntaktischer Konstruktio-
nen herangezogen werden, sondern auch in
andere Bereiche der Theorie vordringen, wie
es etwa der Fall wre, wenn man in dem
Prinzip (E) als perspektivelose Information
jeweils das ganze Spektrum der M-Intensio-
nen bercksichtigte, die sich in einer ue-
rungssituation durch Abstraktion von einigen
indexikalischen Aspekten bei gleichzeitiger
Besetzung der anderen durch den Kontext
ergeben. Sieht man einmal von der zumeist
angenommenen reinen Kontextualitt des
Sprecher-Parameters ab, so htte man hier
einen Ausgangspunkt zur Erfassung des im
Zusammenhang mit (68) beobachteten Chan-
gierens des Besagten; die angesprochene
Lcke lt sich dann entweder durch Qua-
dratur oder durch Erweiterung des Begriffs
der M-Intensionaltitten schlieen.
Die obigen Andeutungen sind zugegebe-
nermaen sehr vage und unfertig, knnen
aber als Anregung fr eine weitere Beschf-
tigung mit dem neuerlich im klassischen Rah-
men aufgetauchten, leicht beunruhigenden
Phnomen der quantifizierten Kontexte ver-
standen werden. Das Phnomen besteht
220 IV. Kontexttheorie
Nazi lediglich in der Zeit vor den im zweiten
Satz berichteten Aktivitten Brgermeister
war:
(76) Nach dem Krieg blieben viele der Par-
teimitglieder ohne Gesinnungswechsel
im Amt. Der Brgermeister, der freilich
inzwischen hatte zurcktreten mssen,
wurde noch Jahre spter auf NPD-
Kundgebungen gesehen.
Als Ersatz fr die Skopus-Analyse werden
deshalb oft Strategien zur Verteilung von Re-
ferenzpunkten (genauer: Variablen fr solche)
fr die Extensionsbestimmung von absoluten
Teilausdrcken vorgeschlagen. Diese Strate-
gien lassen sich dann wieder zur Analyse der
Deixis heranziehen. Ob sich damit die in die-
sem Abschnitt genannten Probleme der klas-
sischen Theorie lsen lassen und welche neuen
Probleme sich aus einer solchen Vorgehens-
weise ergeben, steht natrlich auf einem an-
deren Blatt. Aber eine neue Perspektive ergibt
sich allemale.
4.4Mibrauch
Zum Abschlu des Artikels stellen wir zwei
Erweiterungen der klassischen Theorie vor,
die sich zwar teilweise nach dem Buchstaben
derselben richten, ihrem Geist jedoch fremd
sind. Die erste dieser Erweiterungen ergibt
sich aus der schon zu Beginn von Teil 3 an-
gesprochenen und von der Theorie nur schwer
auszuschlieenden Mglichkeit abwegiger
Parametrisierungen; die zweite ist eine Revi-
sion, die die in Abschnitt 2.5 betrachteten
Konsequenzen der erkenntnistheoretischen
Umdeutung noch einmal neu interpretiert.
Die Tatsache, da die klassische Theorie nicht
in der Lage ist, sich vor diesen keineswegs
fiktiven Mibruchen zu schtzen, mu
natrlich besonders heutzutage jeden verant-
wortungsbewuten Wissenschaftler nach-
denklich stimmen.
Fr den ersten Mibrauch gengt es, sich
eine auffllige Eigentmlichkeit deiktischer
Wrter vor Augen zu halten. Ein Charakte-
ristikum von ich ist es beispielsweise, da es
in verschiedenen Situationen verschiedene Ex-
tensionen annehmen kann. Darin unterschei-
det sich das deiktische Wort nicht von den
meisten absoluten Wrtern. Der Unterschied
besteht wenn die klassische Theorie recht
hat darin, da die Situationsabhngigkeit
beim absoluten, nicht aber beim deiktischen
Wort einen Beitrag zur Extensionsbestim-
mung leisten kann. Unterschiedliche Exten-
sionen in verschiedenen Situationen trifft man
Die nchsten beiden Beispiele zeigen, da
die Flucht in die Pragmatik keine Erlsung
vom bel der quantifizierten Kontexte bringt:
(74) Die meisten Unternehmen sprechen die
Preisgestaltung mit der Konkurrenz ab.
(75) Jeder Gast ist mir willkommen und
sei es nur, damit wir ber den Rest der
Welt lstern knnen.
Es sollte klar sein, da eine Deutung von (74)
als Spruch ber die Konkurrenten im allge-
meinen zu einer abwegigen Lesart fhrt. Al-
lerdings besteht natrlich hier wieder die
Mglichkeit einer Wegerklrung der Kontext-
Verschiebung durch eine weitere Possessivie-
rungs-Konstruktion, bei der weder durch den
Kontext aufgefllt noch existentiell (oder
sonstwie) quantifiziert wird, sondern eine un-
sichtbare Variable fr sptere Bindungen (im
Sinne von Abschnitt 4.1) eingefhrt wird.
(75) ist hrter. Das Problem ist, da das
Wort wir nicht auf eine bestimmte, in der
uerungssituation besonders wichtige, den
Sprecher umfassende Gruppe verweist, wie
wir das von den Betrachtungen zu Beginn des
Abschnitts 3.1 her erwarten wrden. Vielmehr
scheint sich das Wort wie eine durch das Sub-
jekt des Hauptsatzes gebundene Variable fr
relevante, den tatschlichen Sprecher umfas-
sende Gruppen zu handeln: wir heit so viel
wie ich und der jeweilige Gast. Damit wird
aber der fr die Bestimmung der richtigen
Gruppe zustndige Einschlgigkeits-Aspekt
gebunden; nach der klassischen Theorie er-
weist er sich damit als indexikalisch. Doch
damit widerspricht das Pronomen ich der
Hypothese (L); denn der Sprecher-Aspekt
wird fr die Bestimmung der Extension von
wir in (75) nach wie vor vom Kontext beige-
steuert.
Alle diese Beispiele weisen offenbar darauf
hin, da die Unterscheidung von indexikali-
schen (verschiebbaren) und kontextuellen
Aspekten nicht in der von der klassischen
Theorie postulierten Weise funktioniert. Ob
eine Aufweichung der Theorie hier wirklich
weiterhilft, ist allerdings unklar. In jngster
Zeit werden stattdessen auch Mglichkeiten
einer radikalen Revision oder sogar Ersetzung
der klassischen Theorie der Deixis untersucht.
Ausgangspunkt einiger dieser Untersuchun-
gen sind gewisse Inadquatheiten der Skopus-
Analyse von Kennzeichnungen und quantifi-
zierenden Nominalphrasen. So kann man mit
der Skopus-Analyse beispielsweise nicht so
recht erkren, warum (76) (auch) in dem
Sinne zu verstehen ist, da der besagte Alt-
9. Kontextabhngigkeit 221
rungssituation ausgedrckte Lesart bzw.
im Rahmen einer Parametrisierung einen
(rein kontextuellen) Disambiguierungspara-
meter. Die Einfhrung eines solchen Para-
meters stellt den ersten von uns angekndig-
ten Mibrauch der klassischen Referenztheo-
rie dar. Machen wir uns einige Konsequenzen
dieses strflichen Vorgehens klar.
Ein erster Grund fr Skepsis gegenber
einem Disambiguierungsparameter ist, da
mit ihm das Prinzip (L) von der Zweiteilung
des Lexikons zerstrt wird. Das knnen wir
uns wieder anhand des Beispiels (77) klar
machen. Carolines Vorhaben richtet sich bei
der von uns ins Auge gefaten Lesart ja nicht
auf die Objekte, die zum Zeitpunkt der ue-
rung Schlsser sind: was heute ein Schlo ist,
kann in unserer schnellebigen Zeit schon mor-
gen eine Ruine sein. Die Extension von Schlo
wird also fr die Auswertungssituation ermit-
telt. Damit besitzt aber das Lexem Schlo eine
gemischte Referenzweise: die Extension hngt
wegen der Disambiguierung sowohl von
der uerungs- als auch von der Auswer-
tungssituation ab.
Mehr Unbehagen gegen eine Disambiguie-
rung durch die uerungssituation stellt sich
ein, wenn man bedenkt, da diese zu einer
Erweiterung des Einflubereichs der Token-
analyse fhrt:
(78) In Carolines Schlo mu das Schlo am
Hauptportal erneuert werden.
Eine einzige uerungssituation fr (78)
wrde fr die beiden Vorkommen von Schlo
ein und dieselbe Lesart determinieren. Um
das zu verhindern, mte man also die Situa-
tion im Sinne einer Tokenanalyse aufspalten.
Ohne Disambiguierungsparameter wre das
nicht ntig.
Damit nicht genug. Wenn man dem Kon-
text schon die Arbeit aufbrdet, (78) zu dis-
ambiguieren, sollte man eigentlich (79) gleich
dazutun:
(79) Ein Wechsel der Bank bewirkt keinen
Unterschied im Gehalt.
(79) besitzt (mindestens) acht Lesarten, von
denen die meisten freilich aus inhaltlichen
Grnden recht eigenartig sind. Der Unter-
schied zu (78) ist, da die Mehrdeutigkeiten
in (79) nicht auf Mehrdeutigkeiten der betei-
ligten Wrter, sondern auf das Zusammen-
fallen von Wortformen zurckzufhren sind.
Wechsel kann ein Austausch oder ein Zah-
lungsmittel bezeichnen, aber nur im zweiten
Fall kann man auch einen Plural bilden. (Bei
der Bewertung dieses Beispiels mag es dialek-
aber auch aus offensichtlich ganz anderen
Grnden an. Vom schwierigen Sonderfall der
Eigennamen [die Gegenstand von Artikel 16
sind] einmal abgesehen, begegnen wir wech-
selnden Extensionen insbesondere dort, wo
auch die Intensionen wechseln, nmlich bei
Ambiguitten. Und ganz wie beim deiktischen
Ausdruck leistet der Intensionswechsel als sol-
cher keinen Beitrag zur Extensionsbestim-
mung. So wie sich ich stets auf den Sprecher
der Auerungssituation bezieht, bezieht sich
auch ein mehrdeutiges Wort wie Schlo stets
auf das, was in der uerungssituation mit
Schlo gemeint ist. Machen wir uns diese ele-
mentare Tatsache anhand eines einigermaen
beliebigen Beispiels klar:
(77) Caroline hat vor, sich morgen ein Schlo
zu kaufen.
(77) hat (mindestens) vier Lesarten, die sich
durch Ausmultiplikation einer uns hier nicht
weiter interessierenden strukturellen (Sko-
pus-) Mehrdeutigkeit beliebiges versus be-
stimmtes Schlo mit der lexikalisch be-
dingten Ambiguitt von Schlo ergeben.
Nach einer dieser vier Lesarten plant etwa
Caroline (im Sinne einer in Abschnitt 4.2 dar-
gestellten Analyse), die Eigenschaft zu besit-
zen, die ein Individuum x in einer Welt w
genau dann hat, wenn es in w ein Herrschafts-
gebude gibt, welches x (in w) am Tag nach
der uerung von (77) kuflich erwirbt. Eine
Lesart, die (77) nicht besitzt, ist die, nach der
sich Carolines Trachten auf einen beliebigen
Zeitpunkt richtet, an dessen darauffolgenden
Tag sie sich dann das Schlo kauft: morgen
rechnet vom Tag der uerung an. Ebenso
gibt es keine Lesart, nach der Caroline am
Tag nach der uerung etwas kaufen will,
das entweder eine Schlievorrichtung oder ein
Gebude ist je nachdem, wie in der Kauf-
situation Schlo verstanden wrde: die Dis-
ambiguierung findet also in der uerungs-
situation statt.
Die Tatsache, da lexikalische Disambi-
guierungen in der uerungssituation statt-
finden, knnte man nun als Indiz fr einen
Bezug mehrdeutiger Lexeme auf die ue-
rungssituation werten. Lexikalische Ambigui-
tt wre demnach ein Spezialfall von direkter
Referenz. Damit lieen sich die Begriffsbil-
dungen der klassischen Theorie von der Re-
ferenzbestimmung auf die fr gewhnlich
als davorgeschaltet aufgefate Disambi-
guierung bertragen. Alles, was man dazu
bentigt, ist offenbar ein Bezug auf die durch
ein (mehrdeutiges) Lexem in einer ue-
222 IV. Kontexttheorie
also Mehrdeutigkeiten auf der Wortebene mit
erkennbarem, systematischen Zusammen-
hang zwischen den Lesarten. Ein typisches
Beispiel ist die Mglichkeit, mit Bezeichnun-
gen fr Institutionen, die in einem Gebude
untergebracht sind, zugleich auch auf die Ge-
bude zu verweisen:
(80) Die Universitt ist vollkommen uninter-
essant.
Wenn ein Baumeister (80) in einem Vortrag
ber die Bodenseestadt Konstanz uert,
kann er damit (a) ein fachlich-sthetisches
Urteil ber ein gewisses Bauwerk ausdrcken
oder aber zu verstehen geben, da (b) Archi-
tektur nicht zu den an der dortigen Univer-
sitt gelehrten Fchern gehrt. Wollte man
diese Mehrdeutigkeit unter Rckgriff auf
einen Disambiguierungsparameter auflsen,
so lieen sich dagegen dieselben Bedenken
vorbringen wie in den anderen bisher betrach-
teten Fllen. Das Systematische an dieser
Zweideutigkeit erffnet aber zugleich eine
ganz andere Mglichkeit, die klassische Ana-
lyse der Kontextabhngigkeit zum Einsatz zu
bringen. So knnte man etwa der Lesart (a)
eine komplexere logische Form unterlegen, in
der dem Subjekt von (80) eine Beschreibung
wie das der Universitt entsprechende Ge-
bude oder (falls die Polysemie Ausdruck
eines allgemeineren Phnomens sein sollte)
das der Universitt entsprechende konkrete
Ding entspricht. Die einschlgige Entspre-
chungs-Relation beizusteuern wre dann Auf-
gabe eines Kontext-Parameters. Wenn dieses
Vorgehen hier auch etwas gezwungen wirken
mag, so wollen wir zumindest auf die prinzi-
pielle Mglichkeit einer solchen semantischen
Auflsung von Polysemien und den prinzipi-
ellen Unterschied zur Annahme eines Dis-
ambiguierungsparameters hinweisen: die hier
skizzierte und schon in Abschnitt 3.3 an-
gesprochene Zurckfhrung von Polyse-
mien auf unsichtbare Kontextvariablen setzt
einen hohen Grad von systematischer Vor-
hersagbarkeit der Lesarten voraus. Insbeson-
dere ist also keineswegs gesagt, da man alle
in der Literatur als Polysemien abgehandelten
Phnomene in dieser Weise behandeln knnte
oder sollte.
Da die klassische Theorie nicht zur Auf-
lsung lexikalischer Ambiguitten herange-
zogen werden sollte, heit natrlich nicht, da
jegliche Beschreibung oder Erklrung dieses
alltglichen Vorgangs mit der klassischen
Theorie unvereinbar ist. Die Bestimmung der
korrekten Lesart ist nur nicht Gegenstand der
tale Unterschiede geben!) Die Pluralbildung
entlarvt auch die beiden Lesarten der Wort-
form Bank als zu verschiedenen Wrtern ge-
hrig. Bei Gehalt ist es noch einfacher: hier
gibt es (neben anderen morphologischen Un-
terschieden) zwei Genera. Wollte man nun
(79) mit Hilfe der Charaktere der betreffenden
Wrter disambiguieren und etwa ein einziges
Wort Bank mit kontextabhngiger Intension
unterstellen, so knnte man schlecht erklren,
warum dann der Plural einmal Banken, ein
anderes Mal Bnke lautet und wieso oben-
drein die Intension von der Wahl der Plural-
form abhngt. Wenn man andererseits den
Formen selbst Charaktere zuweist, gibt man
damit den Wortbegriff fr semantische
Zwecke auf und knnte nicht mehr erklren,
warum beispielsweise in der berragenden
Zahl der Flle morphologisch eng verwandte
Formen auch die gleichen Charaktere besit-
zen. Will man derartig absurde Konsequenen
vemeiden, mu man den Aktionsradius des
Disambiguierungsparameters auf echte lexi-
kalische Ambiguitten unsystematische
Mehrdeutigkeiten auf der Wortebene wie
in (78) einschrnken. Da aber auch fr Mehr-
deutigkeiten auf der Formebene in aller Regel
Disambiguierungen vorgenommen werden,
mu man diese auf andere Mechanismen
etwa auf pragmatisch erklrbare Verstehens-
strategien zurckfhren. Die Annahme
solcher zustzlichen, ber den Disambiguie-
rungsparameter hinausgehenden Strategien
macht aber ebendiesen berflssig: die Auf-
lsung einer Ambiguitt wie (79) scheint kein
prinzipiell anderes Unternehmen zu sein als
die Disambiguierung von (78) und so werden
sich Strategien zur Lsung des ersten Pro-
blems auch auf das zweite bertragen lassen.
Auch bei strukturellen Ambiguitten
drfte die Annahme eines Disambiguierungs-
parameters zu Schwierigkeiten fhren. Denn
die Bestimmung der Extension komplexer
Ausdrcke geschieht zumindest nach landlu-
figer Meinung anhand der syntaktischen
Struktur, die also fr diese Zwecke bereits
vorausgesetzt wird. Nach einer ebenso ver-
breiteten Ansicht werden strukturelle Ambi-
guitten aber durch die syntaktische Struktur
aufgelst, weswegen die Identifikation der
korrekten Lesart ber einen kontextuellen Pa-
rameter wie auch immer diese vonstatten
gehen mag wieder berflssig zu sein
scheint.
Wenig einwenden gegen eine Disambiguie-
rung durch Kontextabhngigkeit lt sich da-
gegen bei einer Beschrnkung auf Polysemien,
9. Kontextabhngigkeit 223
(81) Alain geht zur Schule.
(81) Alain geht jetzt zur Schule.
Der intensionale Unterschied zwischen diesen
beiden Stzen erklrt dann auch ebenfalls
nach klassischer Auffassung warum sie
sich z. B. bei Einbettung unter die temporale
Prpositionalphrase nchstes Jahr verschie-
den verhalten. Knnte man da nicht einen
ebenso feinen Unterschied zwischen (81) und
dem logisch quivalenten (81) annehmen, der
sich dann ganz analog erst bei Einbettung
unter, sagen wir einmal, Einstellungsverben
bemerkbar macht?
(81) Wenn Alain nicht zur Schule geht oder
Tom den Kindergarten besucht, dann
geht Alain zur Schule.
(Wir nehmen selbstverstndlich an, da in
(81) wenn dann, nicht und oder im Sinne
der klassischen Aussagenlogik zu verstehen
sind; wer Skrupel hat, mge das Beispiel aus-
tauschen.) Die Annahme mglicher intensio-
naler Unterschiede zwischen logisch quiva-
lenten Stzen stellt den zweiten hier betrach-
teten Mibrauch der klassischen Referenz-
theorie dar. Machen wir uns einige Voraus-
setzungen fr dieses strfliche Vorgehen klar.
Wir wollen hier nicht infrage stellen, da
logische quivalenz auch quivalenz a priori
nach sich zieht. Demnach mssen Satzpaare
wie (81) und (81) in allen uerungssituatio-
nen denselben Wahrheitswert zugewiesen be-
kommen. Die nchstliegende (und hier einzig
betrachtete) Methode, um das zu garantieren,
besteht ganz einfach darin, dem in solchen
Stzen auftretenden logischen Material (in
unserem Falle: den Junktoren) eben an allen
entsprechenden Referenzpunkten die von der
Logik her zu erwartende Extension zuzuwei-
sen: nicht denotiert danach an beliebigen
Punkten der Gestalt s
0
,s
0
die Umkehrung
der Wahrheitswerte etc. Die a priorische
quivalenz von (81) und (81) ist dann im
wesentlichen das Werk der Kompositionali-
tt. Natrlich drfen wir jetzt nicht wie
sonst in der klassischen Theorie blich
diese Annahme des Standardverhaltens des lo-
gischen Materials auf beliebige Referenz-
punkte bertragen; denn auf diese Weise wr-
den wie man leicht nachprft die ent-
sprechenden Stze auch stets intensional
gleich, was wir ja verhindern wollen. Also
bentigen wir Punkte s
0
,s, an denen bei-
pielsweise nicht nicht die Wahrheitswertum-
kehrfunktion denotiert. Wir nennen solche
s
0
,s einmal Nonstandard-Punkte. Mit der
Annahme von Nonstandard-Punkten sind
Semantik, sondern der Pragmatik. Die Frage,
welche Lesart eines Ausdrucks in einer be-
stimmten uerung gemeint ist, hat fr die
klassische Theorie also weniger mit der Ex-
tensionsbestimmung zu tun als etwa mit der
Frage, was der Sprecher mit seiner uerung
wohl bezwecken will, welcher Sprache diese
uerung entstammt und ob er berhaupt
etwas aussagt oder nicht vielmehr nur hustet
oder nachplappert.
ber das Verhltnis von Kontextabhngig-
keit und Mehrdeutigkeit liee sich noch eini-
ges mehr sagen, doch interessiert uns hier
eigentlich nur der Aspekt der Pervertierung
der klassischen Theorie durch Hinzunahme
eines Disambiguierungsparamters. Wir wei-
sen noch einmal darauf hin, da es abge-
sehen von der Hypothese (L) keine theo-
rieinternen Grnde fr den Ausschlu eines
solchen Parameters zu geben scheint und se-
hen darin zumindest eine unerfreuliche Lcke
der klassischen Theorie.
Der Ausgangspunkt des zweiten Theorie-
Mibrauchs ist die gegen Ende von Abschnitt
2.5 notierte und dort philosophisch gewendete
Beobachtung, da die klassische Theorie zwei
voneinander unabhngige Trivialittsbegriffe
bereitstellt: das auf Charaktere bezogene A
Priori und die Notwendigkeit als Eigenschaft
von Propositionen. Der erste Begriff spielt
dabei eine der Gltigkeit aus der Logik ana-
loge Rolle: eine gltige Formel ist eine solche,
die als alleinstehende Formel und nicht als
Teilformel betrachtet stets (in allen Mo-
dellen) wahr ist; ebenso ist ein Satz a priori
wahr, wenn er in Isolation also nicht ein-
gebettet geuert stets (in allen ue-
rungssituationen) wahr ist. Da es einen Un-
terschied macht, ob ein Satz in diesem Sinne
logisch trivialerweise wahr ist oder ob er eine
notwendige Proposition ausdrckt, knnte
man hier einen neuen Ansatzpunkt fr das
Problem der mangelnden Feinheit des Pro-
positions-Begriffs suchen, das sich ja wie
wir in Abschnitt 4.2 gesehen haben vor
allem darin uert, da quivalente Stze im
Rahmen der klassischen Theorie allzu leicht
freinander ersetzbar erscheinen. Doch a
priorische quivalenz also Extensions-
gleichheit in allen uerungssituationen
impliziert ja nicht unbedingt intensionale
quivalenz, d. h. (im Falle von Stzen)
Gleichheit der ausgedrckten Proposition. So
sind zwar (81) und (81) a priori quivalent,
drcken aber nach klassischer Auffassung
niemals dieselbe Proposition aus:
224 IV. Kontexttheorie
ten knnte; aber man mu sie eben irgendwie
beantworten.
Die gemeinsame Ursache dieser Probleme
ist offensichtlich, da man sich unter einem
Referenzpunkt, an dem die Logik versagt,
nichts Rechtes vorstellen kann. Lediglich die
Idee, eine spezielle Eigenschaft der klassischen
Theorie zur Verfeinerung des Propositions-
Begriffs heranzuziehen, hat berhaupt erst
zur Annahme der Existenz dieser Punkte ge-
fhrt. Oder waren sie vielleicht schon vorher
da, ohne da sie jemand bemerkt hat? War
vielleicht die in Abschnitt 1.3 erwhnte, fr
gewhnlich als Selbstverstndlichkeit hinge-
nommene Annahme, logische Wrter seien
sowohl deiktisch wie auch referentiell und
htten mithin stets dieselbe Extension,
schlichtweg falsch? In der Tat: ist denn nicht
schon eine fiktive Situation, in der eine andere
Sprache gesprochen wird, die sich vom Deut-
schen lediglich in der Semantik einiger (bei
uns) logischer Wrter unterscheidet, ein ge-
eigneter Ausgangspunkt zur Konstruktion
eines Nonstandard-Punkts? Nein. Denn die
Extensionsbestimmung mit Hilfe klassischer
Charaktere erfolgt ja nicht nach den Regeln
der Sprache, die in einer betrachteten Situa-
tion gesprochen wird. Wre dies so, knnten
wir mit klassischen Mitteln nicht einmal Stze
deuten, in denen von der Frhzeit der Erde
die Rede ist; und Stze ber fremde Lnder
und Kulturen bekmen haufenweise falsche
Lesarten zugewiesen. Auerdem htte die
Hinzunahme und entsprechende Deutung sol-
cher uerungssituationen unmittelbar zur
Folge, da A Priori und Notwendigkeit leere
Begriffe wrden. Die Tatsache, da wir auch
an exotischen Referenzpunkten die Exten-
sionsbestimmung nach den tatschlichen Re-
geln des Deutschen vornehmen mssen, zeigt
also gerade, da es im Rahmen der klassi-
schen Theorie keine Nonstandard-Punkte ge-
ben kann.
Aus der Not der Unbekanntheit von Non-
standard-Punkten knnte man natrlich eine
Tugend der Unterdeterminiertheit machen.
Wie das geht, zeigt eine Analogie zu einem in
der logischen Semantik durchaus blichen (in
Abschnitt 1.2 als abstrakt und formal bezeich-
neten) Vorgehen bei der Deutung sprachlicher
Ausdrcke. Anstatt ihnen nmlich einfach
bei lexikalischen Ausdrcken durch Auf-
listung und ansonsten ber Regeln Cha-
raktere zuzuordnen, wird normalerweise nur
gesagt, wie so eine Zuordnung im allgemeinen
auszusehen hat. Das lt dann allerhand, fr
semantische Zwecke in der Regel uninteres-
nun zwei Probleme verbunden, die sich beide
nicht auf befriedigende Weise lsen zu lassen
scheinen. Diese Tatsache und der Umstand,
da zwischen dem Kontrast (81) versus (81)
einerseits und dem Unterschied zwischen (81)
und (81) andererseits keine intuitive Parallele
besteht, lt uns die hier angedeutete Mg-
lichkeit zur Verfeinerung des Propositions-
Begriffs als Irrweg erscheinen.
Die beiden Probleme deuten darauf hin,
da der Begriff des Nonstandard-Punkts
recht dunkel ist; die Annahme eines intensio-
nalen Unterschieds zwischen (81) und (81)
impliziert also die Existenz von hchst zwei-
felhaften Objekten. Problem Nummer Eins
ist schlicht: wie soll ein Nonstandard-Punkt
s
0
,s berhaupt aussehen, was ist seine in-
terne Struktur? Wir knnen lediglich sagen,
da es sich bei s
0
und s nicht um dieselbe
Situation handeln kann. Unklar aber ist, ob
die beiden berhaupt etwas gemeinsam haben
oder haben knnen (die Welt oder die Zeit
etwa), ob s eine uerungssituation sein
kann, ob s unstimmig sein kann oder gar mu
etc. Das Problem ist nicht, da diese Fragen
nicht so zu beantworten wren, da schlie-
lich irgendeine Verfeinerung des Propositions-
begriffs herauskme. Das Problem ist, da
offenbar jede Beantwortung dieser Fragen
willkrlich zu sein scheint. Ein Nonstandard-
Punkt ist einfach ein Referenzpunkt, an dem
die Logik nicht mehr stimmt. Warum das so
ist und wie der Referenzpunkt ansonsten aus-
sieht, ist egal solange er nur nicht auf der
Diagonalen liegt. Und diese letzte, einzig von
dem Bestreben, die A Priorizitt der logischen
Wahrheit zu garantieren, geleitete Einschrn-
kung erscheint noch besonders willkrlich.
Problem Nummer Zwei betrifft das Nonstan-
dardverhalten der logischen Ausdrcke: wenn
die bliche, von der Logik her zu erwartende
Extension tabu ist, was ist dann die Extension
eines logischen Ausdrucks an einem Nonstan-
dard-Punkt? Bezeichnet also etwa das Wort
nicht stets entweder die Umkehrfunktion oder
eine ganz bestimmte, andere Funktion
oder variiert die Extension der Negations-
Partikel von einem Nonstandard-Punkt zum
nchsten? Kann die Extension eines anson-
sten extensionalen Junktors an einem Non-
standard-Punkt intensional sein? Wieviele lo-
gische Ausdrcke knnen an einem Nonstan-
dard-Punkt von ihrem Standardverhalten ab-
weichen: alle, fnf oder nur einer zur Zeit?
Auch bei diesen Fragen besteht nicht das Pro-
blem, da man sie nicht irgendwie beantwor-
9. Kontextabhngigkeit 225
(R*) gehren ausgehend von Hintikka
(1969b) zum logisch-semantischen Allge-
meingut; der Begriff der singulren Proposi-
tion geht auf Kaplan (1975) zurck, wo er
mit der Russellschen Ontologie in Zusam-
menhang gebracht wird. Da deiktische Aus-
drcke sich nicht nahtlos in das durch die
Unterscheidung von Extension und Intension
gewonnene Bild fgen, ist schon in Frege
(1918) gesehen worden. Die im Text gegebene
Darstellung schliet sich im Geiste Kaplan
(1977) an, dem Urtext der hier als klassisch
bezeichneten Referenztheorie. Die Ursprnge
dieser Theorie sind nicht ganz eindeutig zu
ermitteln, scheinen aber in Kalifornien zu lie-
gen: Kamp (1971) und Vlach (1973) gelten als
erste Vorlufer; Montague (1968: Abschnitt
3) und Montague (1970: Abschnitt 4) sind
weitere frhe (freilich wenig explizite) Zeug-
nisse. Einen guten und ausfhrlichen Einstieg
bietet das erste Kapitel von Kratzer (1978).
Die Unterscheidung verschiedener Refe-
renzweisen liegt im Rahmen der klassischen
Theorie zu nahe, um irgendjemandem zuge-
schrieben werden zu knnen. Die Hypothese
(L) ist wahrscheinlich neu (aber ebenfalls
nicht besonders originell). Auf den Zusam-
menhang zwischen (L) und die in der gene-
rativen Syntax bliche Abspaltung der Finit-
heit vom lexikalischen Verb hat Arnim von
Stechow (in einem Kommentar zu einem Vor-
lufer dieses Kapitels) hingewiesen. Die Auf-
fllung unterdeterminierter Dimensionen
durch die uerungssituation ist in Bartsch
(1986) vorgeschlagen worden; eine entspre-
chende Einbeziehung von Standards findet
man in E. Klein (1980). Der Operator dthat
ist pr-klassisch und stammt aus Kaplan
(1978); vgl. auch Kaplan (1977: Kapitel XII).
Das Allgemeine Kompositionalittsprinzip
findet man in Montague (1970: Abschnitte 3
und 4), wo Monster explizit zugelassen wer-
den. Fr das Monsterverbot (M) wird erst-
malig in Kaplan (1977: VIII) pldiert; hier
kommt auch die Bezeichnung Monster her.
Die monstrse Analyse der Dimensions-Ad-
verbien folgt von der Idee her wieder Bartsch
(1986). Auf weitere im Bereich der Modifi-
katoren-Semantik heimische Monster macht
Pinkal (1977: Kapitel 6) aufmerksam.
5.2Zu den Varianten und Alternativen
Situationelle Parameter und Aspekte tauchen
schon in den frhesten Formulierungen der
klassischen Theorie und davor auf: vgl. z. B.
Scott (1970) (pr-klassisch) und Kaplan
santen Spielraum fr die konkrete Ausfh-
rung. Diesen Spielraum knnte man durch
definitorische Setzung einfach auf die Hin-
zunahme beliebiger Nonstandard-Punkte er-
weitern. Die Konsequenz wre, da jede Be-
antwortung der Fragen des vorletzten Absat-
zes zu einer theoretisch mglichen Interpre-
tation fhrt. Auf diese Weise knnte man
zwar peinlichen Fragen nach der Natur der
Sache geschickt aus dem Weg gehen, htte
aber keine Einsicht in das tatschliche Funk-
tionieren der Sprache gewonnen, sondern nur
ein Wohlverhalten des zur Modellierung her-
angezogenen formalen Apparats erzwungen.
Und soll das der Zweck des ganzen Unter-
nehmens sein?
5. Historisch-bibliographische
Anmerkungen
Die Literatur zum Thema Kontextabhngig-
keit ist ausgesprochen umfangreich und dem
Verfasser dieser Zeilen nur zu einem Bruchteil
bekannt. Die folgenden Hinweise erheben da-
her keinen Anspruch auf Vollstndigkeit,
nicht einmal auf Reprsentativitt. Genannt
werden lediglich die wichtigsten Quellen, auf
denen der Text basiert, ein paar Klassiker
sowie ausgewhlte Werke, die tiefer ins Detail
gehen. Die Bemerkungen schlieen sich in
Aufbau und Reihenfolge in etwa an den
Haupttext an; Abschnitte entsprechen Teilen
(14), Abstze Abschnitten (1.1 etc.).
5.1Zur klassischen Theorie
Die Beobachtung, da sich sprachliche Aus-
drcke gelegentlich auf die Welt beziehen und
insofern Extensionen haben, ist zu offensicht-
lich, um historisch belegt zu werden. Ein fr-
her Versuch, auf systematische Weise Exten-
sionen (Bedeutungen) fr beliebige sprach-
liche Ausdrcke zu finden, ist Frege (1892).
Aus demselben Werk stammt auch die Idee
des Wahrheitswertes als Satzextension sowie
die Einfhrung von Ersatzextensionen (Sin-
nen) zur Rettung eines (impliziten) Kompo-
sitionalittsprinzips. Die mengentheoretische
Bestimmung der Wahrheitswerte und ihre
prdikatenlogische Motivation findet man al-
lerdings erst in Tarski (1936). Die Charakte-
risierung von Intensionen als extensionsbe-
stimmende Funktionen geht letztlich auf Car-
nap (1947) zurck, wo jedoch (in 29) aus-
drcklich auf die Unterschiede zum Frege-
schen Sinn-Begriff hingewiesen wird.
Deutungen von Satzeinbettungen wie in
226 IV. Kontexttheorie
ternative zur klassischen Theorie ist sie in
Cresswell (1973: Kapitel 8) propagiert und
przisiert worden. Die fr die klassische
Theorie wichtige Rolle von Zeigehandlungen
wurde schon in Kaplan (1977: Kapitel II)
gesehen. Eine detaillierte klassische Behand-
lung inhomogener uerungssituationen fin-
det man in von Stechow (1979b).
Die Analogie zwischen der Semantik deik-
tischer Ausdrcke und der Analyse epistemi-
scher Situationen hat eine mindestens auf
Russell (1940) zurckreichende Vorge-
schichte; der moderne Klassiker ist Castaeda
(1966). Eine ausfhrlichere Diskussion der
philosophischen Aspekte (und weitere Lite-
raturhinweise) bietet Forbes (1989). Die Iden-
tifikation (F) von Informationsgehalt und In-
tension stammt aus Frege (1892). Der Begriff
des Standard-Namens geht auf Kaplan (1969:
VIII) zurck. Die Version (S) der Gewin-
nung der epistemischen Perspektive enspricht
dem Vorgehen in Stalnaker (1978); die For-
mulierung folgt einem Vorschlag aus Lewis
(1980a: 94). (E) findet man in Kaplan (1977:
Kapitel XVII). Das Resultat der Reduktion
(E) ist gerade die (dort unabhngig moti-
vierte) Charakterisierung der Selbstlokalisie-
rung in Lewis (1979b) abzglich der (nur
in der dort propagierten Ontologie mgli-
chen) Identifikation von Individuen und Kon-
texten (einer bestimmten Parametrisierung).
Identittskrisen werden vor allem seit Perry
(1977), einem weiteren modernen Klassiker,
gerne diskutiert. Die im Text gegebene Ge-
genberstellung von (einem Typ von) A Prio-
rizitt und (metaphysischer) Notwendigkeit
gibt die auf Kaplan (1977: Kapitel XVII) zu-
rckgehende Rekonstruktion einer geistesver-
wandten Unterscheidung aus Kripke (1972)
wieder. Der Beweis fr die Existenz jedes den-
kenden Subjekts findet sich in Descartes
(1641: Meditatio II,3). Das Beispiel (27) zur
Illustration der Unvertrglichkeit der Token-
analyse mit der erkenntnistheoretischen Deu-
tung der klassischen Theorie hat Jean Yves
Lerner (in einer Diskussion mit dem Autoren)
vorgeschlagen. Da die erkenntnistheoreti-
sche Umdeutung zunchst nur eine Analogie
ist, wird schon in Kaplan (1977: Kapitel XX)
angedeutet. Ein von deiktischen Bezgen
freies Beispiel fr ein kontingentes A Priori
liefert Williamson (1986).
5.3Zu den Aspekten des Kontexts
Ausfhrlichere berlegungen zur Bestim-
mung des Sprechers in einer gegebenen ue-
rungssituation sowie weitere Beispiele im Stil
(1979) (klassisch). In der Tat: einiges spricht
dafr, da die offizielle Version der klassi-
schen Theorie in Kaplan (1977) die Parame-
trisierung ist und da das, was wir hier als
klassisch bezeichnen, allenfalls heuristischen
und illustrativen Charakter hat. (Daneben
gibt es noch eine weitere terminologische
Falle in unserer Darstellung: das englische
Adjektiv indexical entspricht nicht unserem
indexikalisch; letzteres leitet sich von Index
im Englischen auch meist index her, wh-
rend ersteres dem deutschen Wort deiktisch
entspricht und somit so ziemlich das Gegen-
teil bedeutet!) Fr unstimmige indexikalische
Aspektlisten wird in Lewis (1980a: Abschnitt
6) argumentiert; dort wird auch fr die Bei-
behaltung der uerungssituationen pldiert,
um dem in Cresswell (1972: Abschnitt 4) be-
klagten Wildwuchs der kontextuellen Para-
meter Einhalt zu gebieten. In Kaplan (1977)
wird diese Frage nur am Rande (in Funote
16) berhrt (und offengelassen).
Ein frher Verfechter extensionalisierter lo-
gischer Formen ist Tich (1971). Neuere Ar-
beiten haben sich allerdings eher von Gallin
(1975: 8) inspirieren lassen. Die Reformulie-
rung (EM) des Monsterverbots gehrt zur
logisch-semantischen Folklore. Die klassische
Theorie ist bereits in ihren frhesten Darstel-
lungen als abstrakte Referenztheorie aufge-
fat worden: vgl. z. B. Kaplan (1979). Eine
Version, in der sich nicht einmal (D) ohne
axiomatische Zusatzannahmen formulieren
lt, ist Montague (1970: Abschnitt 4); die
Diagonale tritt dort in Gestalt der Menge der
ausgezeichneten Referenzpunkte logisch
mglicher Modelle [designated points of re-
ference of logically possible models] (ebd.,
382) auf.
Der Urtext der zweidimensionalen Modal-
logik ist Segerberg (1973); der Zusammen-
hang zur Kontextabhngigkeit wird dort be-
reits erwhnt. Die aufgrund der Asymmetrie
der Dimensionen bestehenden Unterschiede
zwischen zweidimensionaler Modallogik und
klassischer Referenztheorie sind vor allem in
Kapitel VIII von Kaplan (1977) herausgestellt
worden. Die Idee zur Quadratur der Charak-
tere, um die Umschreibbarkeit beliebiger
deiktischer Ausdrcke zu garantieren, kann
man in Stalnaker (1981: Abschnitt IV) hin-
einlesen, wo die Kontexte und Indizes ver-
wirrenderweise als Welten (worlds) bezeich-
net werden.
Die Analyse der Deixis als Tokenreflexivi-
tt ist lter als die klassische Theorie und geht
auf Reichenbach (1947: 50) zurck. Als eine
dem Wesen der Sprache nherkommende Al-
9. Kontextabhngigkeit 227
8). Den Przisionsgrad als kontextuellen Pa-
rameter findet man in Lewis (1980a: Ab-
schnitt 5). Irene Heim hat (vor einigen Jahren,
beim Kaffeetrinken) den Autor dieses Kapi-
tels erstmals mit Beispielen wie (52) bekannt-
gemacht; sie gehren inzwischen zu den alten
Bekannten jedes Semantikers.
5.4Zu den Problemen
Eine Przisierung der Deutung von Personal-
pronomina mit Hilfe einer Einschlgigkeits-
hierarchie findet man in Smaby (1979: Ab-
schnitt 2). Die Darstellung der Quantorenbin-
dung gibt die Idee hinter der gngigsten, auf
Montague (1973) zurckgehenden Behand-
lung der Quantifikation wieder. Weitere De-
tails entnimmt man dem Artikel 21. Die Mon-
ster in Kauf nehmende Lsung (i) des Status-
Problems von Belegungen wird in Montague
(1970: Abschnitte 6 und 7) vertreten. Die
Mehrdeutigkeits-Analyse (ii-a) wird bei Ben-
nett (1978) und Janssen (1980) vorgeschlagen;
bei der Abschiebung (ii-b) der Belegung in
den Index handelt es sich um einen Buhmann,
der wohl von keinem Anhnger der klassi-
schen Referenztheorie ernsthaft vertreten
wird und dessen Widerlegung durch die ent-
sprechenden Passagen in Kaplan (1977: Ka-
pitel II) inspiriert wurde. Belegungen mit Ei-
genstatus (iii) sind der ratlose Ausweg von
Kaplan (1979).
Die Diskussion um die korrekte Semantik
der Einstellungsberichte wird in der sprach-
analytischen Literatur naturgem nicht im-
mer klar getrennt von der Diskussion um die
richtige Theorie der kognitiven, epistemischen
etc. Einstellungen; die meisten der zu Ab-
schnitt 2.5 gegebenen Literaturhinweise las-
sen sich somit ohne weiteres auch auf Ab-
schnitt 4.2 bertragen. Die Regel (R
meinen
) ist
die offenkundige bersetzung der in Ab-
schnitt 1.2 gegebenen blichen Semantik der
Einstellungsverben im Rahmen der klassi-
schen Theorie (und ihrer erkenntnistheoreti-
schen Deutung); eine hnliche Regel (fr say)
findet man z. B. in Kaplan (1977: Kapitel
XX). Die mangelhafte Behandlung der Ein-
stellung zum Widerspruch wird in von Ste-
chow (1984c: Abschnitt 2) zum Hauptan-
griffspunkt gegen (R
meinen
) gemacht. Die (auch
dort implizite) Umgebungs-Semantik geht
letztlich auf Montague (1968: Abschnitt 1)
zurck. Genaueres erfhrt man in Artikel 34.
Die Bezeichung Einstellung de se stammt
aus Lewis (1979b); einen Stern am Pronomen
zur Andeutung derselben findet man bereits
in Castaeda (1966). Das Phnomen als sol-
von (29) findet man in Kratzer (1978: 17
27). Die Idee, solche Phnomene teilweise mit
pragmatischen Akkomodationsregeln (rules
of accomodation) zu beschreiben, stammt
aus Lewis (1979a) und ist eine Verallgemei-
nerung des Vorgehens in Stalnaker (1973).
(Mehr dazu bringt Artikel 10.) Ein Versuch,
der notorischen Vagheit der Personalprono-
mina der ersten und zweiten Person Plural
durch Disambiguierung Herr zu werden, ist
etwa Gardies (1985: 127134); eine einheit-
liche Deutung von wir findet man dagegen in
Kratzer/von Stechow (1977: 109115). Mehr
ber den im Text reichlich vernachlssigten
Ortsparameter erfhrt man etwa bei Fillmore
(1975a), W. Klein (1978) oder von Stechow
(1982b). (Vgl. auch Artikel 37.) Die Literatur
zum Zeitparameter ist dermaen umfang-
reich, da eine Nennung einzelner Titel nur
irrefhrend sein kann; die obige Diskussion
wurde von Buerle (1979b) inspiriert, wo man
eine genaue Darstellung der Interaktion von
Tempus und Temporaladverb findet. (Zum
Tempus vgl. auch Artikel 35.) Wichtige Bei-
trge zum Wesen mglicher Welten sind
Kripke (1972: Lecture 1), Kaplan (1975) und
Lewis (1986).
Der Zeige-Parameter spielt in Kaplan
(1977: Kapitel II) die Rolle des typischen kon-
textuellen Parameters und dient sogar zur
Motivation der Unterscheidung von Inten-
sion und Charakter. Etwaige subjektive Zge
des Zeige-Parameters werden in Kaplan
(1978: 239 f.) als fr die objektive Referenz
irrelevant zurckgewiesen; Kaplans Argu-
mentation wird in Bach (1987: 182186)
berzeugend widerlegt. Die Unterscheidung
zwischen subjektiver und objektiver Referenz
wird in Castaeda (1977) und Kripke (1977)
vertieft. Der Begriff Deixis am Phantasma
geht auf Bhler (1934: 8) zurck, ist dort
aber weiter gefat.
Einer der ersten und einflureichsten Bei-
trge zum deiktischen Gebrauch von Kenn-
zeichnungen ist Donnellan (1966); mindestens
ebenso wichtig ist die Kritik in Kripke (1977).
Der Einschlgigkeitsbegriff wird von Lewis
(1979a: Example 3) ins Spiel gebracht. Bei
Satz (42) hat ein Beispiel aus W. Klein (1978:
26) Pate gestanden. Das schwierige Verhltnis
zwischen direkter Rede und Kontextabhn-
gigkeit wird in Grabski (1981) unter die Lupe
genommen. Die Darstellung der Possessivie-
rung gibt wohl die gngige (und sicherlich
auch irgendwo anders beschriebene) Sicht-
weise dieses Phnomenbereichs wieder. Die
PDC ist ein Buhmann aus Cresswell (1972:
228 IV. Kontexttheorie
Die prominenteste Stelle, an der ein Dis-
ambiguierungsparameter vorgeschlagen wur-
de, ist wohl Bennett (1978: 9 f.), wo auch mit
einem hnlichen Beispiel wie (78) auf die Not-
wendigkeit einer Tokenanalyse hingewiesen
wird. Die Bemerkungen zum pragmatischen
(vor-semantischen) Status der Disambiguie-
rung schlieen sich an Kaplan (1977: Kapitel
XXII) an. Den Vorschlag zur Ausnutzung der
klassischen Theorie zur Verfeinerung des Pro-
positions-Begriffs findet man in Montague
(1970: Abschnitt 4). Die Kritik ist von Cress-
well (1975: Abschnitt 1) inspiriert. Auf die
Tatsache, da die Sprachregeln nicht mit der
Auswertungssituation wechseln, wird z. B. in
Kripke (1972: Lecture 2) hingewiesen. Die
abstrakte, formale Modellierung ist charak-
teristisch fr fast die gesamte Montaguesche
Tradition; wir sind in diesem Kapitel vor
allem aus darstellungstechnischen Grnden
hnlich wie Cresswell (1973) naiv und di-
rekt vorgegangen.
5.5Zu den historisch-bibliographischen
Anmerkungen
Jahreszahlen hinter den Autorennamen bezie-
hen sich nach Mglichkeit auf das jeweilige
Datum der Erstverffentlichung. In einigen
Fllen sind die Texte etwas lter. So wurde
der pr-klassische Text Kaplan (1978) bereits
im Herbst 1970 verfat. Der Klassiker Kaplan
(1977) ist inzwischen in dem Band Almog et
al. (eds.) (1989) mit aktuellen Kommentaren
Kaplans und anderer erschienen.
Danksagung
Im Verlaufe der erstaunlich langwierigen Arbeiten
an diesem Handbuch-Artikelhabe ich mit zahlrei-
chen Freunden und Kollegen ber das eine oder
andere oben angeschnittene Thema diskutiert. Na-
mentlich erwhnen mchte ich an dieser Stelle Rai-
ner Buerle, Manfred Krifka, Jean-Yves Lerner,
Kjell Johan Sb, Arnim von Stechow, Dieter
Wunderlich und Sandro Zucchi, denen ich entschei-
dende Hinweise, Anregungen und Einwnde ver-
danke. Mein Dank gilt aber auch vielen Unge-
nannten sowie Astrid Wahlert fr Korrekturen an
der letzten Version des Manuskripts.
6. Literatur (in Kurzform)
Almog et al. (eds.) 1989 Bach 1987 Bartsch
1986 Barwise (ed.) 1977 Buerle 1979b Buerle
1983 Bennett 1978 Bhler 1934 Castaeda
1966 Castaeda 1977 Carnap 1947 Cresswell
1972 Cresswell 1973 Cresswell 1975 Cresswell/
von Stechow 1982 Dalrymple 1988 Descartes
ches hat schon Geach (1957) problematisiert.
Die Aufspaltung der Proposition in Thema
und Rhema wird im Rahmen der Mgli-
che-Welten-Semantik in Cresswell/von Ste-
chow (1982) przisiert und in von Stechow
(1984c) erstmals zur Beschreibung von Ein-
stellungen de se ausgenutzt. Der Satz (63) ist
eine bertragung eines (im Deutschen so
nicht wiederzugebenden) noch raffinierteren
Beispiels aus Lakoff (1970c: 245), wo das
Problem allerdings wohl zu Unrecht als
ontologisches dargestellt wird. Passagen wie
(64) werden gerne von Feinden der systema-
tischen Grammatik (am Biertisch) als Belege
fr die Naturwchsigkeit der Sprache ange-
fhrt nicht ganz zu Unrecht, wie man aus
Sicht der klassischen Theorie wohl sagen
mu!
Die Erklrung gewisser durch Kennzeich-
nungen hervorgerufener Ambiguitten ver-
mittels Skopus-Analyse wird blicherweise
Bertrand Russell zugeschrieben; ein Locus
classicus ist Whitehead/Russell (1910: 69
71). Da eine an der Nominalphrase selbst
ansetzende Disambiguierung fr solche Flle
wie (65) nicht ausreicht, kann man an vielen
Stellen nachlesen so z. B. bei Kripke (1977:
Abschnitt 2). Der klassische, auf die ausge-
drckte Proposition bezugnehmende Ein-
wand gegen eine Skopus-Analyse der Deixis
findet sich (in seiner Anwendung auf Demon-
strativa) in Kaplan (1977: Kapitel IX); hier
besteht wieder eine enge Analogie zu der Ar-
gumentationsweise in Kripke (1972: Lecture
1). Die feste Rolle, die dem in Wirklichkeit
eher vagen vortheoretischen Propositions-
Begriff dabei zugeschrieben wird, wird in Le-
wis (1980a: Abschnitt 11) klar gesehen; in
Evans (1979: 164) findet man eine hnliche
Betrachtung zur Kripkeschen Namens-Theo-
rie. Fr einen situationsabhngigen Proposi-
tions-Begriff wird dagegen in Stalnaker (1981:
Abschnitt IV) pldiert. Die Unterscheidung
verschiedener Typen von Intensionalitt ist
gngige, aber fr gewhnlich nicht eigens the-
matisierte Praxis in der logischen Semantik.
Ein Beispiel im Stil von (72) und (73) wird in
Kaplan (1977: Funote 13.2) angesprochen
und Richmond Thomason zugeschrieben;
Kaplan kommentiert: What shall one say
about this? Von quantifizierten Kontexten
und Beispielen wie (74) und (75) ist in Partee
(1989) die Rede. Kritiken an der Skopus-
Analyse und Spekulationen zu ihrer ber-
windung enthalten Buerle (1983), En (1986)
und Dalrymple (1988).
10. Kontextvernderung 229
tague 1973 Partee 1989 Perry 1977 Pinkal
1977 Reichenbach 1947 Russell 1940 Scott
1970 Segerberg 1973 Smaby 1979 Stalnaker
1973 Stalnaker 1978 Stalnaker 1981 von Ste-
chow 1979b von Stechow 1982b von Stechow
1984c Tarski 1936 Tich 1971 Vlach 1973
Whitehead/Russell 1905 Williamson 1986
Thomas Ede Zimmermann, Stuttgart,
(Bundesrepublik Deutschland)
1641 Donnellan 1966 En 1986 Evans 1979
Fillmore 1975a Forbes 1989 Frege 1882 Frege
1918 Gallin 1975 Gardies 1985 Geach 1957
Grabski 1981 Hintikka 1969b Janssen 1980
Kamp 1971 Kaplan 1969 Kaplan 1975 Kaplan
1977 Kaplan 1978 Kaplan 1979 Klein 1978
Klein 1980 Kratzer 1978 Kratzer/von Stechow
1977 Kripke 1972 Kripke 1977 Lakoff 1970c
Lewis 1979a Lewis 1979b Lewis 1980a Lewis
1986 Montague 1968 Montague 1970b Mon-
10. Kontextvernderung
solcher aussagt etwa dann, wenn er sich
ber die Umstnde der uerung tuscht. Sie
kann ihm auch mehr sagen als das, was der
Satz tatschlich aussagt weil er das, was
der Satz sagt, zu anderem, was er glaubt, in
Beziehung setzt, und seine Schlsse daraus
zieht. Oder sie kann ihm gar nichts sagen,
ihm berhaupt keine Information liefern
dann nmlich, wenn der Inhalt des Satzes dem
Hrer bereits bekannt ist.
Beschrnkt man sich auf die Betrachtung
von Gesprchssituationen, in denen die Ver-
mittlung von Information im Vordergrund
steht, so ist es eine sinnvolle Idealisierung
vorauszusetzen, da die berzeugungen der
Gesprchsteilnehmer in den fr die Zwecke
des Gesprchs relevanten Hinsichten berein-
stimmen. Solche gemeinsamen Annahmen
von Gesprchsteilnehmern die Prmissen
sozusagen, unter denen neue uerungen in-
terpretiert werden werden wir einen Re-
dehintergrund oder Redekontext nennen.
Es ist wichtig, diese beiden Kontextbegriffe
Kontext als uerungssituation und Kon-
text als Redehintergrund auseinanderzu-
halten. Denn wenn wir uns im folgenden mit
Theorien der Kontextvernderung beschfti-
gen, so wird es zunchst immer nur um Kon-
texte im zweiten Sinn gehen. nderungen von
Kontexten im ersten Sinn, d. h. von ue-
rungssituationen, werden wesentlich von Fak-
toren bestimmt, deren Beschreibung auer-
halb der Zustndigkeit der Linguistik liegt.
Die nderung eines Redekontextes sollte hin-
gegen linguistisch beschreibbar sein; denn
schon allein dadurch, da auf einem gewissen
Redehintergrund eine uerung fllt und von
den Hrern interpretiert wird, ndert sich die-
ser Redehintergrund geeignete Aufrichtig-
keits- und Vertrauensannahmen vorausge-
setzt. So sollte sich auch die Information, die
1. Einleitung
2. Pragmatische Folgerungen
3. Redekontext und uerungssituation
4. Anaphora
5. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
Was ein Satz aussagt, welchen Inhalt oder
welche Proposition er ausdrckt, hngt davon
ab, unter welchen Umstnden, in welcher Si-
tuation er geuert wird jedenfalls dann,
wenn der Satz indexikalische Elemente ent-
hlt. Die Bedeutung indexikalischer Aus-
drcke und damit die Abhngigkeit der
Wahrheitsbedingung eines Satzes von mgli-
chen Kontexten seiner uerung wird von
der indexikalischen Semantik oder der Theo-
rie der Kontextabhngigkeit, wie sie im vor-
angehenden Artikel dargestellt wurde, unter-
sucht. Ihr zentraler Begriff ist der des Cha-
rakters. Der Charakter eines Satzes ist eine
semantische Regel, die fr jeden Kontext an-
gibt, welchen Inhalt der Satz in diesem Kon-
text ausdrckt. Kontexte hat man sich in die-
sem Zusammenhang als mgliche uerungs-
situationen vorzustellen, als begrenzte Welt-
ausschnitte, die fr die Zwecke der Semantik
jedenfalls so weit spezifiziert sein mssen, da
sie den Bezug der indexikalischen Ausdrcke
festlegen.
Was jedoch die uerung eines Satzes
einem Hrer sagt, welche Information sie ihm
vermittelt, hngt nicht nur von der Bedeutung
des geuerten Satzes, von seinem Charakter
ab, sondern auch vom Hrer selbst, von sei-
nen berzeugungen ber die Umstnde
der uerung und ber vieles andere mehr.
Die uerung eines Satzes kann dem Hrer
etwas ganz anderes sagen, als der Satz als
230 IV. Kontexttheorie
schnitt 3 fr indexikalische und im Abschnitt
4 fr anaphorische Ausdrcke untersuchen.
Im Abschnitt 3 werden wir zugleich die beiden
eben so sorgfltig getrennten Kontextbegriffe
wieder zueinander in Beziehung setzen kn-
nen.
Letztendlich dreht es sich im gesamten Ar-
tikel immer wieder um das Verhltnis von
Semantik und Pragmatik: wie die theoreti-
schen Zusammenhnge zwischen ihnen zu
konstruieren sind, wo sich zwischen ihnen
eine Trennlinie ziehen lt, und ob es ber-
haupt eine autonome, aus der Pragmatik aus-
grenzbare Semantik gibt. Da es bei einer
Kontextvernderungstheorie auch um solche
Fragen geht, wird immer im Auge zu behalten
sein.
2. Pragmatische Folgerungen
Logische von nicht-logischen Folgerungen zu
unterscheiden, das heit, Bedeutungsaspekte,
die einen Einflu auf die Wahrheitsbedingun-
gen von Stzen haben, von solchen zu tren-
nen, die dafr irrelevant sind, ist bezglich
der Umgangssprache keine eindeutig und un-
strittig zu lsende Aufgabe. Es gibt allerdings
einige klare Flle. Betrachten wir dazu die
nachstehenden Beispielstze:
(1) Alle Gste haben abgesagt.
(2) Einige Gste haben abgesagt.
(3) Nicht alle Gste haben abgesagt.
Es ist klar, da (2) eine logische Folgerung
aus (1) ist; andererseits wird man bei einer
uerung von (2) in der Regel darauf schlie-
en, da auch Satz (3) gilt. Der Schlu von
(2) auf (3) kann also offenkundig kein logi-
scher Schlu sein, denn sonst wrde (1) ber
(2) seine eigene Negation, nmlich (3) logisch
implizieren und mte damit als widersprch-
lich betrachtet werden. Der Schlu von (2)
auf (3) ist vielmehr ein Standardfall dessen,
was man in Abgrenzung zur logischen Im-
plikation als (konversationelle) Implikatur
bezeichnet: eine Folgerung, die nicht zur Satz-
bedeutung gehrt, sondern aufgrund allge-
meiner Prinzipien der rationalen Gesprchs-
fhrung aus der uerung von Stzen gezo-
gen werden kann.
Implikaturen werden im Rahmen der Gri-
ceschen Theorie der Konversationsmaximen
eingefhrt; wir verweisen fr eine Darstellung
dieser Theorie und eine Klassifikation der
verschiedenen Arten von Implikaturen auf
Artikel 14 dieses Handbuchs. Unser obiges
Beipiel ist eine Implikatur, die sich aus der
durch eine uerung vermittelt wird, ber die
Beschreibung des Einflusses der uerung
auf den Redehintergrund erfassen lassen.
Man findet im wesentlichen zwei Arten der
formalen Modellierung von Redekontexten:
Zum einen stellt man sie als eine Menge von
Propositionen dar, die als die Menge der ge-
meinsamen Annahmen der Gesprchsteilneh-
mer zu verstehen ist. Zum anderen beschreibt
man sie als eine Menge von mglichen Wel-
ten, nmlich als die Menge derjenigen Welten,
die mit den gemeinsamen Annahmen der Ge-
sprchsteilnehmer vertrglich, also gem
diesen Annahmen mglich sind. Das erste
Modell fllt inhaltlich dann mit dem zweiten
zusammen, wenn man nur solche Mengen von
Propositionen zult, die unter logischer Fol-
gerung abgeschlossen sind. In den Abschnit-
ten 3 und 4 werden Grnde auftauchen, beide
Modelle in der einen und anderen Hinsicht
zu modifizieren.
Eine Theorie der Vernderung von Rede-
kontexten dient zunchst einem prinzipiellen
Zweck: der Anbindung der abstrakten Wahr-
heitsbedingungssemantik an eine pragmati-
sche Theorie, die die Bedeutung von ue-
rungen betrachtet. So lt sich die illokutio-
nre Kraft einer erfolgreichen Behauptung,
wenngleich unvollstndig, dadurch charakte-
risieren, da die vom behaupteten Satz aus-
gedrckte Proposition dem Redekontext hin-
zugefgt wird, das heit, von den Gesprchs-
teilnehmern als weitere Prmisse akzeptiert
wird.
Dies ist allerdings nur das einfachste Mo-
dell der Kontextvernderung. Es wird sich in
mehrerlei Hinsicht als zu simpel erweisen:
Zum einen mssen wir an einem Satz ver-
schiedene Bedeutungsaspekte unterscheiden,
die alle zu seinem Informationswert beitra-
gen. Neben den Wahrheitsbedingungen eines
Satzes, das heit, der von ihm ausgedrckten
Proposition, sind dafr ja auch seine Prsup-
positionen und seine konversationellen Im-
plikaturen relevant. Diese verschiedenen Be-
deutungsaspekte zu integrieren, ist eine wei-
tere Aufgabe einer Kontextvernderungstheo-
rie, der wir uns im Abschnitt 2 zuwenden.
Ihre Lsung wird uns schlielich zu einer
Explikation des Begriffs der pragmatischen
Folgerung fhren.
Zum anderen hngt die von einem Satz
ausgedrckte Proposition von dem Redekon-
text ab, in dem der Satz geuert wird. Wie
diese Abhngigkeit aussieht und welche Kon-
sequenzen sie fr die Beschreibung von Kon-
textvernderungen hat, werden wir im Ab-
10. Kontextvernderung 231
Verben aufhren und bedauern, die die ent-
sprechenden Prsuppositionen induzieren.
Man kann sich nun fragen, wann die Pr-
suppositionen einfacher Stze bei deren Ein-
bettung in komplexere Konstruktionen erhal-
ten bleiben und wann sie verloren gehen; diese
Fragestellung ist als das sogenannte Projek-
tionsproblem fr Prsuppositionen bekannt.
Die nachstehenden Stze etwa sind Beispiele
fr Einbettungen von (4a), bei denen die Pr-
supposition (4b) bewahrt bleibt:
(4)
c. Vielleicht ist der Knig von Frank-
reich kahlkpfig.
d. Der Knig von Frankreich ist nicht
kahlkpfig.
e. Wenn der Knig von Frankreich kahl-
kpfig ist, dann braucht er eine Pe-
rcke.
f. Entweder ist der Knig von Frank-
reich nicht kahlkpfig oder er trgt
eine Percke.
(4g)(4k) hingegen prsupponieren intuitiv
nicht mehr, da Frankreich einen Knig hat:
(4)
g. Frankreich hat einen Knig, und der
Knig von Frankreich ist kahlkpfig.
h. Vielleicht hat Frankreich einen Knig
und vielleicht ist der Knig von Frank-
reich kahlkpfig.
i. Wenn Frankreich einen Knig hat, so
ist der Knig von Frankreich kahlkp-
fig.
j. Entweder hat Frankreich keinen K-
nig oder der Knig von Frankreich ist
kahlkpfig.
k. Der Knig von Frankreich ist nicht
kahlkpfig, denn Frankreich hat kei-
nen Knig.
Einige pragmatische Prsuppositionstheorien
versuchen das Projektionsproblem nun ber
einen Mechanismus der Kontextvernderung
zu lsen. (Semantische Prsuppositionstheo-
rien geben auf das Projektionsproblem bereits
ber die oben genannte Prsuppositionsdefi-
nition eine Antwort, da diese ja fr Stze
beliebiger Komplexitt formuliert ist. Jedoch
sind semantische Prsuppositionstheorien ge-
rade dahingehend kritisiert worden, da sie
damit intuitiv inadquate Vorhersagen ber
die Prsuppositionen komplexer Stze ma-
chen. Die einschlgigen Argumente lassen
sich etwa in Gazdar (1979) oder in Van der
Sandt (1987) nachlesen; da alle diese Argu-
mente aber nicht gnzlich zwingend sind, wird
in Link (1986) gezeigt.)
Fr die pragmatische Behandlung des Pro-
jektionsproblems gibt es im wesentlichen zwei
Maxime der Quantitt ableiten lt. Diese
besagt, da uerungen so informativ wie
mglich und fr den jeweiligen Gesprchs-
zweck ntig zu gestalten sind. Da nun eine
uerung von (1) informativer wre als eine
uerung von (2), man aber davon auszu-
gehen hat, da die Maxime der Quantitt
beachtet wird, lt sich einer uerung von
(2) entnehmen, da der Sprecher (1) nicht
guten Gewissens htte behaupten knnen und
demnach seine Negation, nmlich (3) fr
wahr hlt. In einer feineren Klassifikation ist
der Schlu von (2) auf (3) eine sogenannte
skalare Implikatur; eine przise Definition
dieses Begriffs findet sich in Gazdar (1979,
Kap. 3).
Eine andere Klasse von Bedeutungsaspek-
ten, bei denen man sich besonders heftig dar-
ber gestritten hat, ob sie als logisch-seman-
tische Folgerungen aus Stzen oder als prag-
matische Eigenschaften der uerung von
Stzen aufzufassen sind, bilden die sogenann-
ten Prsuppositionen. Einige Standardbei-
spiele sind nachstehend angefhrt:
(4)
a. Der Knig von Frankreich ist kahl-
kpfig.
b. Frankreich hat einen Knig.
(5)
a. Gregor bedauert, da Renate gekn-
digt hat.
b. Renate hat gekndigt.
(6)
a. Anna hat aufgehrt zu rauchen.
b. Anna hat frher geraucht.
Vertreter eines semantischen Prsuppositions-
begriffs gehen davon aus, da Stze, deren
Prsuppositionen nicht erfllt sind, weder
wahr noch falsch, sondern wahrheitswertlos
oder unbestimmt sind; im Rahmen einer drei-
wertigen Semantik lassen sich die Prsuppo-
sitionen eines Satzes dann als diejenigen lo-
gischen Folgerungen definieren, die sich so-
wohl aus dem Satz selbst als auch aus seiner
Negation ergeben. Der pragmatische Prsup-
positionsbegriff hingegen besagt, da Prsup-
positionen Bedingungen fr die angemessene
und erfolgreiche uerung von Stzen dar-
stellen. Diese beiden Konzeptionen sind na-
trlich nicht von vorneherein unvertrglich,
wenngleich viele Vertreter eines pragmati-
schen Prsuppositionsbegriffs ein semanti-
sches Pendant desselben ablehnen.
Prsuppositionen sind im Gegensatz zu
konversationellen Implikaturen nicht aus all-
gemeinen Prinzipien der Konversation abzu-
leiten, sondern werden als lexikalische Eigen-
schaften betrachtet; in den obigen Beispielen
sind es der bestimmte Artikel der bzw. die
232 IV. Kontexttheorie
turen, die aus der Griceschen Maxime der
Quantitt abgeleitet werden: skalare Impli-
katuren fr die wir schon zu Anfang dieses
Abschnitts ein Beispiel gegeben haben und
auf die wir auch hier nicht weiter eingehen
werden, da sie fr die Prsuppositionsprojek-
tion irrelevant sind und sogenannte Klau-
salimplikaturen.
Eine Klausalimplikatur entsteht, wenn ein
Satz A als Teil einer uerung in einer Weise
vorkommt, in der er weder behauptet noch
verneint wird; man kann dann davon ausge-
hen, da der Sprecher bezglich der Gltig-
keit von A eine neutrale Haltung hat, das
heit, sowohl A als auch die Negation von A
fr mglich hlt. Dementsprechend werden
einem Satz A, der einen Teilsatz B enthlt,
dann die potentiellen Klausalimplikaturen
Der Sprecher hlt fr mglich, da B und Der
Sprecher hlt fr mglich, da nicht B zuge-
ordnet, wenn aus A weder B noch die Nega-
tion von B logisch folgt. (Auerdem darf die
betreffende Einbettung von B nicht Anla zur
Erzeugung potentieller Prsuppositionen der
Form Der Sprecher wei, da B oder Der
Sprecher wei, da nicht B Anla geben; fr
eine genaue Definition vgl. Gazdar 1979: 59.)
So erhalten beispielsweise die Stze (4h)(4j)
alle die nachstehenden potentiellen Klausal-
implikaturen:
(4.1) Der Sprecher hlt fr mglich, da
Frankreich einen Knig hat.
(4.2) Der Sprecher hlt fr mglich, da
Frankreich keinen Knig hat.
(4.3) Der Sprecher hlt fr mglich, da der
Knig von Frankreich kahlkpfig ist.
(4.4) Der Sprecher hlt fr mglich, da es
nicht der Fall ist, da der Knig von
Frankreich kahlkpfig ist.
Die von den potentiellen Implikaturen und
Prsuppositionen eines Satzes ausgedrckten
Propositionen werden nun gleichfalls durch
die uerung des Satzes zum Redekontext
hinzugefgt, allerdings nur dann, wenn ihre
Hinzufgung diesen Redekontext nicht in-
konsistent machen wrde. Auerdem ist es
wichtig, da die Hinzufgung geordnet von-
statten geht: Bei einer uerung von S, wurde
der Kontext ja zunchst um die Qualittsim-
plikatur Der Sprecher wei, da S erweitert
diese ist nie nur potentielle, sondern stets
auch aktuale Implikatur einer uerung
(woraus sich ergibt, da die uerung eines
Satzes, der mit dem Kontext inkonsistent ist,
den Proze der Kontextvernderung von vor-
neherein zum Abbruch bringen wrde). Als
Strategien. Die erste Strategie findet sich in
Gazdar (1979). Gazdar setzt eine strikte Tren-
nung der semantischen von der pragmati-
schen Komponente voraus. Die Semantik
ordnet Stzen die von ihnen ausgedrckten
Propositionen zu; darauf aufbauend hat die
Pragmatik zu beschreiben, wie sich durch die
uerung von Stzen der Redekontext ver-
ndert. Dabei sind drei verschiedene Arten
von Informationen auseinanderzuhalten, die
durch die uerung eines Satzes zum Kontext
hinzugefgt werden knnen: sein semanti-
scher Gehalt, seine Implikaturen und seine
Prsuppositionen.
Gazdar fat Redekontexte als konsistente,
aber nicht unbedingt deduktiv abgeschlossene
Mengen von Propositionen auf. Allerdings
weicht sein Verstndnis davon von dem ein-
gangs skizzierten etwas ab; bei ihm enthalten
Redekontexte diejenigen Propositionen, auf
die sich der Sprecher mit der uerung eines
Satzes festlegt, die der Hrer ihm also ge-
rechtfertigterweise unterstellen kann.
Die Anbindung des pragmatischen Effekts
einer Behauptung an den semantischen Ge-
halt des behaupteten Satzes wird von Gazdar
nun ber seine Formulierung der Griceschen
Maxime der Qualitt bewerkstelligt. Diese
lautet: Sage nur, was Du weit! Daraus
ergibt sich, da durch die uerung eines
Satzes S der Redekontext (des Hrers) um
die von dem Satz Der Sprecher wei, da S
ausgedrckte Proposition erweitert wird
der semantische Inhalt des geuerten Satzes
kommt also ber dessen epistemische Impli-
katur, aus der er logisch folgt, zum alten
Kontext hinzu.
Gazdar unterscheidet nun ferner zwischen
potentiellen und aktualen Prsuppositionen
und Implikaturen. Potentielle Prsuppositio-
nen oder Implikaturen sind Eigenschaften
von Stzen. Potentielle Prsuppositionen wer-
den aufgrund lexikalischer Information ein-
fachen Stzen zugeordnet, in denen die ent-
sprechenden prsuppositionsauslsenden Le-
xeme vorkommen; sie vererben sich dann un-
beschrnkt auf beliebig komplexe Stze, die
solche einfachen Stze als Teile enthalten.
Auch potentielle Prsuppositionen haben bei
Gazdar immer die Form Der Sprecher wei,
da .... Demnach haben zum Beispiel nicht
nur (4a) und (4c) bis (4 f), sondern auch (4g)
bis (4k) die potentielle Prsupposition Der
Sprecher wei, da Frankreich einen Knig hat.
Potentielle Implikaturen werden Stzen
aufgrund allgemeiner Regeln zugeordnet.
Gazdar betrachtet zwei Typen von Implika-
10. Kontextvernderung 233
(4.6) Der Sprecher wei, da Frankreich
keinen Knig hat.
In den Beipielen (4a), (4c)(4f) hingegen gibt
es keine Klausalimplikaturen, die zur poten-
tiellen Prsupposition im Widerspruch ste-
hen. Sie knnte daher hchstens kontextuell
gelscht werden, bleibt in der Regel jedoch
als aktuale Prsupposition der uerung er-
halten. Fr (4g) allerdings macht Gazdars
Mechanismus eine intuitiv inadquate Vor-
hersage:
(4)
g. Frankreich hat einen Knig, und der
Knig von Frankreich ist kahlkpfig.
Dieser Satz hat berhaupt keine Klausalim-
plikaturen und auch keine semantischen Fol-
gerungen, die mit seiner potentiellen Prsup-
position (4.5) inkonsistent wren. Dement-
sprechend ist (4.5) Element des neuen Kon-
texts einer uerung von (4g) und somit ak-
tuale Prsupposition. Intuitiv wird (4.5) in
(4g) jedoch keineswegs prsupponiert, son-
dern vielmehr im ersten Konjunktionsglied
behauptet.
Diese Inadquatheit hat ihren Ursprung in
der Tatsache, da Gazdar Prsupposition und
Behauptung nicht als komplementre Begriffe
behandelt, sondern Prsuppositionen und Im-
plikaturen gleichfalls als Behauptungen auf-
fat als implizite Behauptungen allerdings,
die sich von expliziten Behauptungen eben
gerade dadurch unterschieden, da sie igno-
riert werden knnen, wenn Widersprchlich-
keit droht. Weitere Gegenbeispiele zu Gaz-
dars Theorie finden sich etwa in Soames
(1982) und Van der Sandt (1987); vgl. eben-
falls Artikel 13 dieses Handbuchs.
Die zweite Strategie zur Behandlung des
Projektionsproblems geht in ihrem Grundge-
danken bereits auf Stalnaker (1973), (1974)
und Karttunen (1974) zurck. Ihre explizite-
ste Version findet sich in Heim (1983b). (Auch
Soames (1982) und van der Sandt (1987) las-
sen sich, zumindest teilweise, der zweiten Stra-
tegie zurechnen.)
Im Unterschied zur ersten, betrachtet die
zweite Strategie Prsuppositionen nicht als
implizite Behauptungen, sondern vielmehr als
Voraussetzungen fr Behauptungen: die Pr-
suppositionen eines Satzes sind Propositio-
nen, die ein Redekontext enthalten mu,
wenn die uerung des Satzes in diesem Kon-
text angemessen oder zulssig sein soll. Fr
uerungen elementarer Stze sind solche
Zulssigkeitsbedingungen aufgrund lexikali-
scher Information zu spezifizieren. Das Pro-
jektionsproblem stellt sich dann als die Frage,
nchstes kommen nun die potentiellen Impli-
katuren des Satzes zum Kontext hinzu und
abschlieend seine potentiellen Prsupposi-
tionen allerdings jeweils nur insoweit, als
durch ihre Hinzufgung im Redekontext
keine Inkonsistenzen entstehen. (Fr die ge-
naue Definition dieser geordneten konsisten-
ten Erweiterung vgl. Gazdar 1979: 131 f.)
Es ist nun gerade diese so geordnete und
durch die Konsistenzforderung beschrnkte
Kontexterweiterung, die es ermglicht zu-
mindest in den meisten Fllen , die Prsup-
positionen komplexer Stze korrekt vorher-
zusagen. Potentielle Prsuppositionen kn-
nen nun nmlich durch Elemente des alten
Kontexts, durch Folgerungen aus dem se-
mantischen Gehalt ihres Trgersatzes, und
insbesondere durch Klausalimplikaturen der
uerung gelscht werden und sind dann
nicht mehr als Bestandteile der uerungs-
bedeutung aufzufassen. Wir wollen dies fr
unsere Beipiele unter (4) kurz vorfhren. Be-
trachten wir zunchst (4h)(4j), die der
bersichtlichkeit halber hier noch einmal wie-
derholt seien:
(4)
h. Vielleicht hat Frankreich einen Knig,
und vielleicht ist der Knig von Frank-
reich kahlkpfig.
i. Wenn Frankreich einen Knig hat, so
ist der Knig von Frankreich kahlkp-
fig.
j. Entweder hat Frankreich keinen K-
nig oder der Knig von Frankreich ist
kahlkpfig.
Diese Stze haben alle die potentielle Prsup-
position (4.5); sie haben jedoch gleichzeitig
die potentielle Klausalimplikatur (4.2):
(4.5) Der Sprecher wei, da es einen Knig
von Frankreich gibt.
(4.2) Der Sprecher hlt fr mglich, da
Frankreich keinen Knig hat.
Da diese Implikatur bei einer uerung von
(4h), (4i) oder (4j) dem Kontext hinzugefgt
wird, ist die potentielle Prsupposition (4.5)
mit dem daraus resultierenden Kontext nicht
mehr konsistent und wird dementsprechend
gelscht.
(4k) ist ein Beispiel dafr, da eine Folge-
rung aus dem semantischen Gehalt des ge-
uerten Satzes die Prsupposition lscht;
Der Sprecher wei, da (4k) impliziert (4.6),
und dieses steht im Widerspruch zu (4.5):
(4)
k. Der Knig von Frankreich ist nicht
kahlkpfig, denn Frankreich hat kei-
nen Knig.
234 IV. Kontexttheorie
gleich (k + A) + B, das heit sofern A und
B elementar sind , gleich k A B.
Daraus ergeben sich unmittelbar die Zuls-
sigkeitsbedingungen von Konjunktionen:
Eine uerung von A und B ist im Kontext
k dann zulssig, wenn A in k und B in k + A
zulssig ist. Dies bedeutet, da im ursprng-
lichen Kontext k nur solche Prsuppositionen
von B enthalten sein mssen, die nicht durch
die uerung von A eingefhrt werden. Be-
trachten wir dazu das nachstehende Beispiel:
(7)
Der Knig von Frankreich hat einen
Sohn und der Sohn des Knigs von
Frankreich ist kahlkpfig.
(7)
a. Der Knig von Frankreich hat einen
Sohn.
b. Der Sohn des Knigs von Frankreich
ist kahlkpfig.
Wenn (7) in einem Kontext k geuert wird,
so ist diese uerung zunchst nur angemes-
sen, wenn k die Prsupposition von (7a), das
heit die Proposition Frankreich hat einen
Knig enthlt. Ist dies der Fall, so darf man
k um (7a) zu k (7a) erweitern. Ferner
mu nun k (7a) die Prsuppositionen
von (7b) enthalten, also Frankreich hat
einen Knig und Der Knig von Frank-
reich hat einen Sohn = (7a). Dies ist er-
fllt, und so hat die Konjunktion (7) nur die
Prsupposition Frankreich hat einen K-
nig.
Betrachten wir noch zwei weitere Flle,
nmlich Negationen und Konditionale. Hier
werden, im Gegensatz zur Konjunktion, die
Teilstze nicht behauptet; und so haben die
Kontexte, die durch die Behauptung der Teil-
stze erzeugt wrden, nur eine Hilfsfunktion
bei der Festlegung des von der komplexen
uerung erzeugten Kontexts.
Fr negierte Stze der Form nicht A sieht
dies folgendermaen aus: Die uerung von
A im Kontext k wrde den Kontext k + A
erzeugen. Mit der uerung von nicht A will
man nun aber gerade diejenigen Welten als
mglich beibehalten, die im bergang von k
zu k + A ausgeschlossen werden. Demnach ist
k + nicht A gerade als k\(k + A) zu definieren.
Und damit ist eine uerung von nicht A nur
in Kontexten zulssig, in denen die Prsup-
positionen von A enthalten sind dies ent-
spricht natrlich genau der Beobachtung, da
Prsuppositionen (in der Regel) unter Nega-
tion erhalten bleiben.
Bei der Interpretation von Konditionalst-
zen der Form wenn A, dann B mssen zwei
provisorische Kontexte betrachtet werden: er-
wie sich die Zulssigkeitsbedingungen fr die
uerung eines komplexen Satzes auf die Zu-
lssigkeitsbedingungen seiner elementaren
Teile zurckspielen lassen.
Es zeigt sich nun, da sich auf diese Frage
eine ganz einfache Antwort geben lt, wenn
man den Prozess der Kontextvernderung
schrittweise, rekursiv ber den Aufbau des
geuerten Satzes, beschreibt wenn man
also die von einer komplexen uerung be-
wirkte Kontextvernderung aus den Kontext-
vernderungen, die ihre elementaren Teile
nach sich ziehen, zusammensetzt. Denn dar-
aus lt sich dann ablesen, wie sich die Zu-
lssigkeitsbedingung der komplexen ue-
rung aus den schon bekannten Zulssigkeits-
bedingungen ihrer elementaren Teile ergibt.
Und es wird gleichzeitig der Tatsache Rech-
nung getragen, da Teile einer uerung Pr-
suppositionen einfhren knnen, die fr die
Interpretation anderer Teile vorausgesetzt
werden mssen.
Etwas technischer ausgedrckt, sieht das
Programm also folgendermaen aus: Zu-
nchst werden Redekontexte als Mengen von
mglichen Welten aufgefat; da eine Pro-
position in einem Kontext gilt oder er sie
enthlt, heit dann einfach, da er eine Teil-
menge von ihr ist. Den zentralen Begriff bildet
nun die Kontextvernderungsfunktion +, die
einem Kontext k und einem Satz S den Kon-
text k + S zuordnet, der aus der uerung
von S in k entsteht. Wesentlich ist, da diese
Funktion nur partiell ist; k + S ist nur dann
definiert, wenn die uerung von S in k zu-
lssig ist und insbesondere also die Prsup-
positionen von S in k enthalten sind.
Ist S ein elementarer Satz und die ue-
rung von S in k zulssig, so ist k + S gleich
k S wir verwenden hier und im wei-
teren S, um die von einem Satz S gem
der vorgegebenen Semantik ausgedrckte
Proposition zu bezeichnen. Was zu tun bleibt,
ist, k + S auch fr komplexe Stze rekursiv zu
definieren, und dazu gehrt auch die An-
gabe der Zulssigkeitsbedingungen komple-
xer uerungen.
Wie das geschieht, wollen wir anhand eini-
ger Beispiele veranschaulichen. Beginnen wir
mit dem einfachsten Fall, den Konjunktionen.
Die Vernderung des Redekontexts k durch
eine uerung der Form A und B lt sich
offenkundig so beschreiben, da zunchst
zum Kontext k die von A ausgedrckte Pro-
position hinzugefgt wird, und zum daraus
resultierenden Kontext dann die von B aus-
gedrckte Proposition; k + (A und B) ist also
10. Kontextvernderung 235
samen Kontext zulssig zu machen. Die Ak-
kommodationsregel kann also, genau genom-
men, nur dann zur Anwendung kommen,
wenn kein gemeinsamer Redekontext besteht:
Die uerung eines Sprechers mu in seinem
Redehintergrund auf jeden Fall zulssig sein,
und so knnen die Hrer nur dann zur Ak-
kommodation gentigt sein, wenn ihr Rede-
hintergrund nicht der des Sprechers ist.
Die rekursive Definition der Kontextvern-
derungsfunktion macht es nun zudem mg-
lich, die Akkommodationsregel nicht auf den
Ausgangskontext, sondern stattdessen auf die
provisorisch eingefhrten Kontexte anzuwen-
den. Dadurch lt sich der Fall behandeln,
da ein Satz bei der Einbettung in die Ne-
gation seine Prsuppositionen verlieren kann.
Betrachten wir dazu noch einmal das Beispiel
(4k) und seine mgliche Prsupposition (4b):
(4)
k. Der Knig von Frankreich ist nicht
kahlkpfig, denn Frankreich hat kei-
nen Knig.
b. Frankreich hat einen Knig.
Wenn (4k) in einem Kontext k geuert wird,
der die Proposition 4b nicht enthlt und
demnach die Zulssigkeitsbedingungen des
ersten Teilsatzes nicht erfllt, so gibt es prin-
zipiell zwei Mglichkeiten der Akkommoda-
tion: Man kann zum einen den ursprng-
lichen Kontext k zu k + 4b akkommodie-
ljren und dazu dann den ersten Teilsatz von
(4k) gem obiger Regel fr die Negation
hinzufgen; damit entsteht der Kontext
k + (4b)\k + (4b) + der Knig von Frankreich
ist kahlkpfig. Dazu lt sich der zweite Teil-
satz von (4k) nicht mehr konsistent hinzuf-
gen.
Man sollte daher zur zweiten Mglichkeit
bergehen: Man akkommodiert nur den pro-
visorisch eingefhrten Kontext zu k + (4b),
fgt dazu der Knig von Frankreich ist kahl-
kpfig hinzu und bildet dann die Differenz
zum ursprnglichen Kontext k. Danach er-
zeugt der erste Teilsatz von (4k) den Kontext
k\k + (4b) + der Knig von Frankreich ist kahl-
kpfig. In ihm gilt lediglich, da entweder
Frankreich keinen Knig hat oder da er
nicht kahlkpfig ist; und so lt sich zu ihm
der zweite Teilsatz konsistent hinzufgen.
Auf die Prsuppositionstheorie sind wir
deswegen so ausfhrlich eingegangen, weil
sich an ihr die verschiedenen Funktionsweisen
der zwei Anstze zu einer Kontextvernde-
rungstheorie, Gazdars und Stalnakers, beson-
ders augenfllig vergleichen lassen. Nun ist
aber zu betonen, da in Stalnakers Ansatz
stens die Menge derjenigen Welten aus dem
alten Kontext k, in denen A der Fall ist, also
k + A, und zweitens die Menge der Welten
aus k + A, in denen B der Fall ist, also
(k + A) + B. Mit dem Konditionalsatz wer-
den dann gerade diejenigen Welten aus k aus-
geschlossen, in denen A der Fall ist und unter
dieser Annahme B nicht der Fall ist.
Demnach ist k + (wenn A, dann B) als
k\(k + A\k + A + B) zu definieren. Fr Kon-
ditionalstze haben wir damit dieselben Zu-
lssigkeitsbedingungen wie fr Konjunktio-
nen: wenn A, dann B ist in k zulssig, wenn
A in k und B in k + A zulssig ist. Dement-
sprechend prsupponiert etwa unser Beispiel
(4e), da Frankreich einen Knig hat, das
Beispiel (4i) hingegen nicht:
(4)
e. Wenn der Knig von Frankreich kahl-
kpfig ist, dann braucht er eine Pe-
rcke.
i. Wenn Frankreich einen Knig hat, so
ist der Knig von Frankreich kahlkp-
fig.
Die Prsuppositionen eines beliebig komple-
xen Satzes S lassen sich also ganz allgemein
so definieren: S prsupponiert die Proposition
p, wenn jeder Kontext, in dem eine uerung
von S zulssig ist, p impliziert.
Die soweit skizzierte Kontextvernde-
rungstheorie birgt allerdings noch eine ent-
scheidende Schwierigkeit in sich. Wir waren
ja davon ausgegangen, da der Redekontext
die gemeinsamen Annahmen der Gesprchs-
teilnehmer enthlt, also diejenigen Propositio-
nen, die sowohl Sprecher als auch Hrer vor-
aussetzen. Daraus ergibt sich jedoch, da
Stze, deren Prsuppositionen weder explizit
eingefhrt wurden, noch als Allgemeinwissen
zu den berzeugungen der Hrer gerechnet
werden knnen, als unzulssig und damit als
uninterpretierbar betrachtet werden mssen.
Nun ist es aber allgemein zugestanden, da
ein Sprecher auch indirekt ber die Prsup-
positionen eines Satzes Informationen ver-
mitteln kann beim Gazdarschen System
stand dies gerade im Vordergrund. Die zweite
Strategie versucht dem ber die Einfhrung
der sogenannten Akkommodationsregel Rech-
nung zu tragen: Wenn ein Sprecher einen Satz
S in einem Kontext k uert und S in k nur
dann zulssig ist, wenn die Proposition p in
k glte, p aber in k nicht enthalten ist, so
werden die Hrer ihre Prmissen stillschwei-
gend so verndern, da sie die Proposition p
hinzunehmen, um damit S in ihrem gemein-
236 IV. Kontexttheorie
eine generelle Zulssigkeitsbedingung, die
man die Wahrheitsdefinitheitsbedingung nen-
nen knnte. Sie besagt, da eine uerung
von S im Kontext k nur dann zulssig ist,
wenn S in allen Welten aus k wahrheitsdefinit
ist, wenn also S was nun als eine partielle
Funktion aus der Menge der mglichen Wel-
ten in {wahr, falsch} aufzufassen wre fr
alle Welten in k definiert ist (vgl. Stalnaker
1973, 452; 1978, 326).
Auf dem Hintergrund des bisher Gesagten
lt sich schlielich eine allgemeine Definition
des Begriffs der pragmatischen Folgerung ge-
ben. Eine solche Definition findet sich bereits
in Stalnaker (1976a), wo er von reasonable
inference spricht und diese folgendermaen
charakterisiert:
... an inference from a sequence of assertions or
suppositions (the premisses) to an assertion or hy-
pothetical assertion (the conclusion) is reasonable
just in case, in every context in which the premisses
could appropriately be asserted or supposed, it is
impossible for anyone to accept the premisses wi-
thout committing himself to the conclusion. (Stal-
naker 1976a, 180/181)
Im Rahmen der oben geschilderten Kontext-
vernderungstheorie knnen wir das so pr-
zisieren:
Eine Behauptung B ist genau dann eine
pragmatische Folgerung aus den Behauptun-
gen A
1
,...A
n
, wenn fr jeden Redekontext k,
in dem A
1
und ... und A
n
zulssig ist, gilt, da
(...(k + A
1
) + ...) + A
n
B, das heit er-
steres letzteres impliziert.
Damit knnen wir nun Prsuppositionen
und, wenn wir sie behandelt htten, auch Im-
plikaturen in einem przisen Sinn als prag-
matische Folgerungen beschreiben. Stalnaker
setzt in dem erwhnten Aufsatz brigens ge-
rade Klausalimplikaturen von Disjunktionen
und Konditionalen dazu ein, gewisse Schlu-
schemata Kontraposition, hypothetischer
Syllogismus, direktes Argument , die unter
einer konditionallogischen Interpretation des
umgangsprachlichen wenn-dann nicht logisch
gltig sind, als pragmatische Folgerungen zu
erklren und damit ihrer intuitiven Gltigkeit
Rechnung zu tragen.
3. Redekontext und
uerungssituation
Im vorangehenden Abschnitt haben wir skiz-
ziert, wie sich ber eine Theorie der Kontext-
vernderung verschiedene Bedeutungskom-
ponenten von uerungen integrieren lassen.
mit dem Begriff der pragmatischen Zulssig-
keitsbedingung ein Instrument zur Verfgung
steht, dessen Anwendungs- und Erklrungs-
mglichkeiten viel weiter reichen.
Wie in der Einleitung erwhnt, ist es ja ein
Ziel einer Kontextvernderungstheorie, den
Sprechakt des Behauptens zu charakterisie-
ren. Eine natrliche Bedingung an geglckte
Behauptungen besteht nun darin, da sie den
Redehintergrund bereichern, das heit, die
Menge der gemeinsam fr mglich gehaltenen
Welten verkleinern, aber nicht auf die leere
Menge reduzieren sollen. Daraus ergibt sich
erstens, da in einem Kontext k nur solche
uerungen A zulssig sind, die keine Inkon-
sistenzen erzeugen, fr die also k + A
diese Konsistenzbedingung hatten wir ja schon
oben stillschweigend verwendet. Und zwei-
tens ergibt sich daraus die Informativittsbe-
dingung, da in k eine uerung A unzulssig
ist, wenn A in k schon bekannt ist, wenn also
k + A = k. (vgl. hierzu auch Stalnaker 1978,
325 f.).
Damit lt sich die sogenannte Gerichtet-
heit der Konjunktion erklren, das heit, da
zum Beipiel der nachstehende Satz (4g) zu-
mindest in einigen Kontexten zulssig, (41)
hingegen nie akzeptabel ist:
(4)
g. Frankreich hat einen Knig und der
Knig von Frankreich ist kahlkpfig.
l. Der Knig von Frankreich ist kahl-
kpfig und Frankreich hat einen K-
nig.
Denn der erste Teilsatz von (41) ist in einem
Kontext k nur zulssig, wenn k die Prsup-
position Frankreich hat einen Knig ent-
hlt; und auf diesem Hintergrund kann der
zweite Teilsatz von (41) nicht mehr informativ
geuert werden (vgl. Stalnaker 1973, 454).
Die Gerichtetheit der Konjunktion zu erkl-
ren, macht Gazdar brigens deswegen
Schwierigkeiten, weil seine pragmatische
Theorie Stze als ganze behandelt und sich
nicht in ihren rekursiven Aufbau vertieft.
Eine andere Zulssigkeitsbedingung liefert
uns die folgende Beobachtung: Whrend Gaz-
dar seine Prsuppositionstheorie in der expli-
ziten Absicht entwickelt hat, ohne einen se-
mantischen Prsuppositionsbegriff und so mit
der klassischen zweiwertigen Semantik aus-
zukommen, will Stalnaker durchaus fr eine
semantische Prsuppositionstheorie Raum
lassen welche er sich im Rahmen einer
Semantik mit Wahrheitswertlcken vorstellt.
Dafr, da aus semantischen Prsuppositio-
nen auch pragmatische werden, sorgt dann
10. Kontextvernderung 237
nannten Charakter definieren: eine Funktion
von uerungssituationen in Intensionen,
also eine systematische Beschreibung der Ab-
hngigkeit des Inhalts eines Ausdrucks von
der Situation, in der er geuert wird. Wir
werden dementsprechend jetzt mit A den
Charakter eines Ausdrucks A bezeichnen. Ist
A ein Satz, so bezeichnet A,c die uerung
von A in einer Situation c und A
c
die von
A in c ausgedrckte Proposition, das heit,
die Auswertung des Charakters von A in der
Situation c. Ist A ein indexikalischer Aus-
druck, so ist A
c
immer eine konstante In-
tensionfunktion. Bei indexikalischen Aus-
drcken ist es also allein die uerungssitua-
tion und nicht die Auswertungswelt, welche
ihren auersprachlichen Bezug festlegt. Man
spricht hier auch davon, da indexikalische
Ausdrcke direkt referentiell sind.
uerungssituationen sind nun offensicht-
lich Objekte ganz anderer Art als die bislang
betrachteten Redekontexte; formal werden sie
in der Regel als Tripel c = w
c
, t
c
, p
c
reprsentiert, wobei w
c
fr die Welt, t
c
fr den
Zeitpunkt und p
c
fr den Ort der Situation c
steht. Diese drei Merkmale reichen hin, eine
potentielle uerung eines Satzes eindeutig
zu lokalisieren. Daher sind alle anderen Ei-
genschaften von c, die man fr die Interpre-
tation indexikalischer Ausdrcke bentigt,
ber Welt, Zeit und Ort festgelegt. Zum Bei-
spiel ist der Sprecher in c dasjenige Indivi-
duum aus w
c
, welches zu t
c
am Ort p
c
spricht,
der Adressat in c dasjenige Individuum aus
w
c
, das vom Sprecher in c zu t
c
angesprochen
wird. Fr weitere Details der indexikalischen
Semantik verweisen wir auf Artikel 9 dieses
Handbuchs. Fr unsere Zwecke, das heit fr
eine Theorie der Vernderung von Redekon-
texten, sind nur die folgenden allgemeinen
berlegungen wesentlich:
Wenn nicht Stze, sondern erst ue-
rungen, also lokalisierte Stze, Propositionen
ausdrcken, so wird es notwendig, auch Re-
dekontexte explizit zu lokalisieren denn
wir wollen ja nicht den Inhalt einer uerung
vor einem beliebigen Redekontext betrachten,
sondern vor dem, auf dem die uerung fllt.
Wir hatten zwar schon immer davon gespro-
chen, da Redekontexte durch die uerung
von Stzen in bestimmter Weise verndert
werden, aber da wir uns fr die Indexikalitt
von Stzen nicht interesssiert hatten, brauch-
ten wir diese Redeweise nicht weiter zu pr-
zisieren.
Allerdings ist die Lokalisierung von Re-
dekontexten offenkundig unproblematisch:
In diesem Abschnitt soll es nun um den Zu-
sammenhang zwischen dem Redehintergrund,
vor dem ein Satz geuert wird, und seinem
semantischen Inhalt im engeren Sinn, das
heit, der vom Satz ausgedrckten Proposi-
tion gehen.
Bisher stand hinter unseren berlegungen
ja die Vorstellung, da eine Kontextvernde-
rungstheorie auf der Grundlage einer vorge-
gebenen Semantik operiert: die Semantik spe-
zifiziert fr jeden Ausdruck der betrachteten
Sprache, welche Proposition er ausdrckt,
und es ist diese Proposition, die bei einer
zulssigen uerung des Satzes dem jeweili-
gen Redekontext hinzugefgt wird. Diese
Vorstellung gilt es nun in verschiedenerlei
Hinsicht zu verfeinern.
Zunchst ist natrlich zu beachten, da die
semantische Komponente nicht Stzen
schlechthin, sondern erst den auf eine ue-
rungssituation relativierten Stzen Proposi-
tionen zuordnen kann. Das liegt daran, da
in einem Satz sogenannte indexikalische oder
deiktische Ausdrcke vorkommen knnen,
Ausdrcke, deren Bedeutung sich nur unter
Bezugnahme auf den Kontext ihrer uerung
bestimmen lt; klassische Beispiele fr Deik-
tika sind ich, hier, jetzt, morgen, dies, der da,
dort. So mu man, um festzulegen, welche
Proposition etwa der Satz Ich bin jetzt mde
ausdrckt, darauf Bezug nehmen, wann und
von wem er geuert wird; uert ihn eine
Person a zu einem Zeitpunkt t, so besagt er,
da a zu t mde ist, uert ihn eine Person b
zu einem Zeitpunkt t, so drckt er aus, da
b zu t mde ist.
Weniger offenkundige Beispiele fr Indexi-
kalitt liefern Kennzeichnungen; bei ihnen
lt sich eine attributive und eine referentielle
Lesart unterscheiden: ein Ausdruck wie der
Erfinder des Blitzableiters bezeichnet im at-
tributiven Sinn, ganz unabhngig davon, un-
ter welchen Umstnden er geuert wird, in
jeder Welt w dasjenige Individuum, welches
in w den Blitzableiter erfunden hat; in der
referentiellen Lesart hingegen bezeichnet er in
jeder Welt w dasjenige Individuum, welches
in der uerungswelt den Blitzableiter erfun-
den hat, in diesem Sinne ist er dann kontext-
abhngig. Da selbst Eigennamen Indexika-
litt anhaftet, wird spter noch deutlich wer-
den. (Vgl. dazu auch Artikel 16 dieses Hand-
buchs.)
Wir werden jedenfalls von nun an voraus-
setzen, da die semantischen Interpretations-
regeln fr jeden Ausdruck der Sprache nicht
einfach eine Intension, sondern seinen soge-
238 IV. Kontexttheorie
Fall korrekt, in dem diesen die relevanten
Merkmale der uerungssituation bekannt
sind. Betrachten wir dazu ein Beispiel:
(8) Morgen wird es eine Sonnenfinsternis ge-
ben.
Wir wollen annehmen, da Satz (8) am 5.
November 1987, um 15 Uhr geuert wird;
der Inhalt dieser uerung ist dann die
Menge all derjenigen Welten, in denen es am
Freitag, den 6. November, (irgendwo) eine
Sonnenfinsternis gibt. Findet die uerung
jedoch gegenber einem Hrer statt, der irr-
tmlicherweise davon ausgeht, da es Mitt-
woch, der 4., und nicht Donnerstag, der 5.
November ist, so wird dieser Hrer den Satz
so verstehen, da es am Donnerstag, den 5.
November, eine Sonnenfinsternis gibt. Sein
Redekontext wird also nach der Interpreta-
tion des Satzes nur noch solche Welten ent-
halten, in denen es am 5. November 1987 eine
Sonnenfinsternis gibt und, aufgrund all-
gemeinen Wissens ber die Hufigkeit von
Sonnenfinsternissen, keine Welten, in denen
sich am 6. November die Sonne verfinstert.
Schauen wir uns noch ein weiteres, weniger
banales Beispiel an:
(9) Am Tag nach Madeleines vierundvierzig-
stem Geburtstag wird es in Deutschland
eine totale Sonnenfinsternis geben.
Hier interessiert uns die referentielle Lesart
der Kennzeichnung Madeleines vierundvier-
zigster Geburtstag. Wird (9) unter dieser Les-
art irgendwann und irgendwo in der wirkli-
chen Welt geuert, so ist die damit ausge-
drckte Proposition die Menge der Welten,
in denen es am 11. 8. 1999 in Deutschland
eine totale Sonnenfinsternis gibt. Wrde (9)
mir gegenber geuert, so wre es genau
diese Proposition, die dadurch zu meinen
berzeugungen hinzukme, denn mir ist be-
kannt, worauf sich die Kennzeichnung Ma-
deleines vierundvierzigster Geburtstag in der
wirklichen Welt bezieht. Jemandem, der le-
diglich wei, da Madeleine im Jahre 1955
geboren wurde, wird (9) hingegen nur die
Information geben, da es irgendwann im
Jahre 1999 oder am 1. 1. 2000 eine Son-
nenfinsternis gibt. Und jemand, der von Ma-
deleine gar nichts wei auer, da sie derzeit
lebt, wird (9) nur entnehmen knnen, da es
irgendwann in den nchsten vierundvierzig
Jahren eine Sonnnenfinsternis gibt, und da
diese Sonnenfinsternis einen Tag und vierund-
vierzig Jahre nach dem Geburtstag einer Per-
son namens Madeleine liegt.
Da der semantische Gehalt, den die ue-
rung eines indexikalischen Satzes fr einen
Mit jeder uerung A,c sind uns ja durch
die uerungssituation c die einschlgigen
Annahmen der Gesprchsteilnehmer gegeben
ganz einfach deshalb, weil uns ber w
c
alles, also auch die Einstellungen von Spre-
chern und Hrern gegeben sind. Daher kn-
nen wir immer als eines der Merkmale von c
einen Redekontext k
c
annehmen. Die im vor-
hergehenden Abschnitt eingefhrte Kontext-
vernderungsfunktion ist dann so umzudeu-
ten, da sie nicht mehr einfach einen Satz und
einen Redekontext als Argument nimmt, son-
dern einen in einer bestimmten Situation lo-
kalisierten Satz und den in dieser Situation
gegebenen Redehintergrund; das heit statt k
+ A mssen wir jetzt k
c
+ A,c schreiben.
Es fragt sich nun, wie groe Rckwirkun-
gen diese vorderhand triviale nderung auf
die Definition der Kontextvernderungsfunk-
tion hat. Eine Mglichkeit wre ja, die bis-
herigen Definitionen sinngem beizubehal-
ten, also einfach in den entsprechenden Re-
kursionsklauseln die Relativierung auf die
uerungssituation hinzuzufgen. Damit
wre dann, wenn A ein atomarer Satz ist, k
c
+ A,c gleich k
c
A
c
, wenn A eine Kon-
junktion der Form B und C ist, gleich (k
c
B
c
) C
c
, und so weiter. Intuitiv wrde
dies, grob gesagt, bedeuten, da eine ue-
rung A,c ihren Redekontext k
c
so vern-
dert, da die von A in c ausgedrckte Pro-
position zu k
c
hinzugenommen wird. (Wir
gehen hier zunchst davon aus, da in die
Definition des Charakters eines indexikali-
schen Ausdrucks der Redekontext einer Si-
tuation c nie wesentlich eingeht, das heit,
da es nur die objektiven Merkmale einer
uerungssituation und nicht subjektive H-
rer/Sprechereinstellungen sind, die den Bezug
der Deiktika festlegen. Zumindest fr inde-
xikalische Ausdrcke wie ich, hier, jetzt ist
diese Annahme sicherlich unumstritten.)
Doch leider trifft dieses einfache und
scheinbar naheliegende Vorgehen nicht wirk-
lich die Zielsetzungen einer Kontextvernde-
rungstheorie. Denn diese sollte beschreiben,
welche Information ein Satz, der in einer be-
stimmten Situation geuert wird, den H-
rern vermittelt, oder, allgemeiner formuliert,
wie die Hrer den Satz auf der Grundlage
ihrer bisherigen berzeugungen verstehen.
Der oben skizzierte Weg, der besagt, da es
die tatschlich oder objektiv in einer Situation
ausgedrckte Proposition ist, die dem Rede-
kontext hinzugefgt wird, erfat das subjek-
tive Verstndnis der Hrer jedoch nur in dem
10. Kontextvernderung 239
interpretiert werden kann.- wie unser zweites
Beispiel oben zeigen sollte. Wenn hinsichtlich
des Bezugs eines indexikalischen Ausdrucks
keine Festlegung besteht, gehen die Hrer
nmlich zu so etwas wie einer attributiven
Lesart ber: der Ausdruck wird in diesem Fall
nicht mehr als direkt referentiell, sondern als
(attributiv zu lesende) Deskription (um)ge-
deutet, also etwa ich als der Sprecher, jetzt als
der uerungszeitpunkt, Madeleine als die
Person, die mit Madeleine bezeichnet wird,
usw. Es ist dann die unter einer solchen Um-
interpretation von einem Satz ausgedrckte,
nunmehr kontextunabhngige Proposition,
die zum Redekontext hinzukommt.
Was wir in diesem Abschnitt geschildert
haben, entspricht weitgehend berlegungen
von Stalnaker in dem bereits erwhnten Auf-
satz Assertion. Stalnaker macht dort aller-
dings die vereinfachende Annahme, da
uerungssituationen sich mit mglichen
Welten identifizieren lassen. Unter dieser An-
nahme kann er seine berlegungen dann in
den folgenden Bestimmungen zusammenfas-
sen:
Kontextvernderung durch indexikalische
Stze:
k
c
+ A,c = k
c
A
c
, fr ein c k
c
Hier stehen c, c nicht mehr fr Tripel aus
einer Welt, einem Zeitpunkt und einem Ort,
sondern nur noch fr mgliche Welten; das
heit, c = c
w
. A steht fr einen elementaren
Satz. (Die Definition gilt natrlich trivialer-
weise auch fr nicht indexikalische Stze.)
Damit obiges aber berhaupt wohldefiniert
ist, bentigen wir eine Zulssigkeitsbedingung
fr uerungen indexikalischer Stze:
Zulssigkeitsbedingung fr indexikalische
Stze:
Die uerung eines Satzes A vor einem
Redehintergrund k ist nur dann zulssig,
wenn gilt:
A
c
= A
c
, fr alle c, c k
c
.
Stalnakers Zulssigkeitsbedingung fr inde-
xikalische Stze im folgenden mit ZBI
abgekrzt kann nun auf zwei verschiedene
Weisen erfllt werden, die der zuvor getrof-
fenen Fallunterscheidung entsprechen. Zum
einen gilt ZBI nmlich dann, wenn der Re-
dekontext die Annahmen der Hrer
den Bezug der indexikalischen Ausdrcke in
A eindeutig festlegt. So ist gem ZBI etwa
die uerung des Satzes (10)
(10) An Madeleines dreiigstem Geburtstag
regnet es.
Hrer hat, ganz stark mit den Informationen
des Hrers hinsichtlich der uerungssitua-
tion und des Bezugs der deiktischen Aus-
drcke variiert, heit natrlich keineswegs,
da sprachliche Bedeutung eine hoffnungslos
subjektive und systematischer Beschreibung
unzugngliche Angelegenheit wre. Die Be-
deutung indexikalischer Stze ist ja mit ihrem
Charakter zu identifizieren und dieser ist je-
dem Mitglied der Sprachgemeinschaft allein
aufgrund seines semantischen Wissens gege-
ben. Erst um die von einem Satz ausgedrckte
Proposition seinen semantischen Gehalt im
engeren Sinn zu kennen, ist mehr als nur
sprachliches Wissen erforderlich, bentigt
man zustzlich Tatsachenwissen ber die
uerungssituation und die uerungswelt
im allgemeinen. Erst an dieser Stelle kommt
die subjektive Komponente in Form von sub-
jektiven berzeugungen ins Spiel.
Es drfte nun klar geworden sein, da die
Behandlung indexikalischer Stze innerhalb
einer Kontextvernderungstheorie nicht in
der oben skizzierten Weise erfolgen kann.
Wenn wir so etwas wie den subjektiven In-
formationsgehalt der uerung eines Satzes
A im Kontext c erfassen wollen, mssen wir
nicht A
c
zum Redekontext k
c
hinzufgen,
sondern vielmehr eine Proposition A
c
: die-
jenige Proposition, die A in einer mglichen
uerungssituation c ausdrcken wrde, die
den vielleicht falschen Annahmen der
Hrer ber die tatschliche uerungssitua-
tion entspricht. Solche Annahmen knnen
natrlich nie so spezifisch sein, da sie genau
eine Situation c festlegen. So, wie wir ue-
rungssituationen oben eingefhrt hatten,
wrde dies ja darauf hinauslaufen, da die
berzeugungen der Hrer genau eine mgli-
che Welt w
c
auszeichnen, und das ist schlech-
terdings nicht mglich. Doch ist fr die In-
terpretation einzelner uerungen ja auch
nur eine begrenzte Festlegung ntig: die An-
nahmen der Hrer sollten eine Menge von
mglichen uerungssituationen c ausson-
dern, die hinsichtlich des Bezugs der in A
vorkommenden Deiktika bereinstimmen
also etwa darber, wer der Sprecher, wann
der uerungszeitpunkt, wer die mit Ma-
deleine bezeichnete Person ist. Jedes solche
c wrde dann als Argument des Charakters
von A ein und dieselbe, passende Proposition
liefern.
Aber auch wenn diese Bedingung an die
Hrerannahmen also an den Redekontext
verletzt ist, hat das nicht zur Folge, da
ein indexikalischer Satz berhaupt nicht mehr
240 IV. Kontexttheorie
(10)
w
=
{w in w regnet es dreiig Jahre
nach dem Tag, an dem in w die
Person, auf die sich Made-
leine in w bezieht, geboren
wurde.}
Der Diagonaloperator erfat zwar formal alle
in einem Satz vorkommenden Deiktika, doch
heit dies nicht, da wir nur solche Stze
diagonalisieren drften, die lauter indexika-
lische Ausdrcke mit unbekanntem Bezug
enthalten. Denn hinsichtlich indexikalischer
Ausdrcke, deren Bezug innerhalb eines Re-
dekontexts bekannt ist, ist der Diagonalope-
rator, jedenfalls innerhalb dieses Redekontex-
tes, einfach redundant: Wenn etwa fr unser
Beispiel (10) der Bezug von Madeleine ein-
deutig festgelegt ist, so liefert die in den Wahr-
heitsbedingungen von (10) vorkommende
Kennzeichnung die Person, auf die sich Ma-
deleine in w bezieht fr alle Welten w in k
immer das gleiche Individuum, ist also ein-
geschrnkt auf k direkt referentiell.
Stalnakers Theorie ermglicht unter an-
derem eine einfache Lsung des Fregeschen
Problems: Wie knnen Identittsstze infor-
mativ sein? Betrachten wir dazu ein Beispiel
mit Eigennamen:
(11) Hesperus ist Phosphorus.
Wie wir bisher schon stillschweigend voraus-
gesetzt hatten, werden Eigennamen als inde-
xikalische Ausdrcke betrachtet, deren Se-
mantik sich ganz grob so formulieren lt:
Wenn N ein Eigenname ist, so gilt fr alle
w und alle w:
N
w,w
= dasjenige Individuum, auf das
sich N in w bezieht.
Demgem hat aber ein Satz wie (10) nie
einen kontingenten Inhalt, sondern drckt in
jeder uerungssituation entweder die tau-
tologische oder die kontradiktorische Pro-
position aus je nachdem, ob Hesperus
und Phosphorus sich in der fraglichen
uerungswelt auf den gleichen Gegenstand
beziehen oder nicht.
Doch reprsentieren uerungssituationen
sozusagen totales Wissen; fr eine Kommu-
nikations- oder Informationstheorie mu der
Gehalt eines Satzes hingegen vor dem Hin-
tergrund partiellen Wissens, wie es durch Re-
dekontexte modelliert wird, betrachtet wer-
den. Und in einem Redekontext kann natr-
lich der Bezug eines oder beider Eigennamen
in (11) unbekannt sein;. Das wiederum be-
deutet, da (11) nicht wrtlich, sondern dia-
gonalisiert zu interpretieren ist. Die diago-
in einem Redekontext k zulssig, der nur sol-
che Welten w enthlt, in denen sich Made-
leine jeweils auf dasselbe Individuum a, und
nur auf dieses, bezieht und a in jedem w am
selben Tag t geboren wurde. Denn dann ist
der Charakter von (10) innerhalb von k kon-
stant; das heit, fr jede mgliche uerungs-
welt w k ist die von (10) in w ausgedrckte
Proposition dieselbe, nmlich die Menge der
Welten w, in denen es dreiig Jahre nach t,
dem Geburtstag von a in w, regnet.
Wird nun aber ein Satz vor einem Rede-
hintergrund geuert, der ZBI nicht gengt,
so findet, wie wir oben gesagt hatten, eine
Uminterpretation statt. Diese Uminterpreta-
tion wird bei Stalnaker auf eine ganz syste-
matische Weise erzeugt, nmlich durch die
Verwendung des sogenannten Diagonal-
operators (vgl. dazu auch Artikel 9) und
das Diagonalisierungsprinzip:
Diagonalisierung:
Wenn die uerung eines Satzes A in
einem Redekontext k gem ZBI nicht zu-
lssig ist, so wird nicht k + A, sondern k
+ A berechnet.
Der Diagonaloperator ist semantisch folgen-
dermaen erklrt:
A
w,w
= A
w,w
, fr alle mglichen Welten
w,w.
Der Diagonaloperator identifiziert im Cha-
rakter eines Ausdrucks A die uerungswelt
w mit der jeweiligen Auswertungswelt w. Er
hat also den Effekt, da die Extension von A
in einer Welt w unter der Annahme betrachtet
wird, da A in dieser Welt w geuert wrde.
Es ist offenkundig, da der Charakter eines
diagonalisierten Satzes fr jede mgliche
uerungssituation w die gleiche Proposi-
tion liefert, denn w geht in die semantische
Regel fr die Bestimmung dieser Proposition
nicht mehr ein. ZBI ist durch Diagonalisie-
rung also auf jeden Fall Genge getan. Doch
ist der Diagonaloperator nicht nur ein tech-
nischer Kniff, sondern erzeugt vielmehr ge-
rade solche Lesarten, wie wir sie oben als
intuitiv wnschenswert beschrieben haben: er
bewirkt, da alle direkt referentiellen Aus-
drcke attributiv gelesen werden. Das wird
deutlich, wenn wir zum Beispiel die Wahr-
heitsbedingungen von (10) ausformulieren
und mit denen von (10) vergleichen:
(10)
w
=
{w in w regnet es dreiig Jahre
nach dem Tag, an dem in w die
Person, auf die sich Madeleine
in w bezieht, geboren wurde}
10. Kontextvernderung 241
wie in eine Theorie der Kontextvernderung
deiktische Ausdrcke und die durch sie er-
zeugte Abhngigkeit des Satzinhalts von der
uerungssituation einzupassen sind. Ab-
schlieend hatten wir angedeutet, da es fr
eine allgemeine Behandlung von Indexikalitt
erforderlich sein drfte, Redekontexte und
auch Propositionen nicht mehr einfach als
Mengen von Welten aufzufassen, sondern zu-
stzliche Raum- und Zeitkoordinaten einzu-
fhren. In diesem Abschnitt werden wir uns
den anaphorischen Ausdrcken, insbesondere
den anaphorischen Personalpronomina zu-
wenden. Auch diese, so wird sich zeigen, lie-
fern Grnde dafr, Redekontexte mit mehr
Struktur zu versehen. Die Betrachtung der
Anaphora fhrt uns in das Zentrum der ak-
tuellen Kontextvernderungsdiskussion, denn
hier haben Kamp (1981 a) und Heim (1982)
eine ausgearbeitete und wohlmotivierte Theo-
rie vorgelegt, die auf breiter Front aufgegrif-
fen wurde und weiterentwickelt wird.
Deiktika sind, so hatten wir gesagt, Aus-
drcke, deren Interpretation von Merkmalen
der uerungssituation bestimmt wird. Die
Interpretation anaphorischer Ausdrcke hin-
gegen hngt von einem anderen Ausdruck im
gleichen oder in einem vorangehenden Satz
ab, von ihrem Bezugselement oder Anteze-
dens. (Eine ausfhrliche Darstellung der gn-
gigen Theorien zur Semantik anaphorischer
Pronomina findet sich in den Artikeln 23, 24
dieses Handbuchs.)
Die erste und nchstliegende Hypothese
zur Deutung anaphorischer Ausdrcke ver-
sucht nun, Anaphora wie Deiktika zu behan-
deln und ihre Bedeutung durch eine spezielle
Form von Situationsabhngigkeit zu erkl-
ren: was ein anaphorischer Ausdruck bezeich-
net, hngt davon ab, welcher Ausdruck sein
Antezedens ist und was dieses bezeichnet
eine Information, die in jeder uerungssi-
tuation im Redekontext enthalten sein sollte.
Um ein Beispiel zu geben: Wenn der Satz (13)
in einer Situation geuert wird, in der zuvor
(12) geuert wurde, so ist klar, da das Pro-
nomen er sich auf das gleiche Individuum
bezieht wie sein Antezedens Oskar ge-
nauso, wie klar ist, da er sich auf Oskar
bezieht, wenn Oskar tot auf einer Bahre liegt
und der Gerichtsmediziner, auf ihn deutend,
(13) uert:
(12) Oskar ist tot.
(13) Er wurde vergiftet.
Doch scheint die Parallele zwischen Deixis
und Anaphorik nicht weit zu tragen. Deikti-
sche Pronomina sind immer referentiell, sie
beziehen sich stets auf einen Gegenstand der
nalisierte Lesart von (11) besagt ungefhr:
Das, worauf sich Hesperus bezieht, ist
identisch mit dem, worauf sich Phosphorus
bezieht ein Satz, der dann durchaus eine
informative Lesart hat, das heit, eine kon-
tingente Proposition ausdrckt. (Es ist sogar
so, da wegen der im letzten Abschnitt ein-
gefhrten Konsistenz- und Informativitts-
bedingung eine uerung von (11) nur in
Kontexten zulssig ist, in denen der Bezug
zumindest eines der beiden Eigennamen nicht
bekannt ist.)
Abschlieend sei jedoch noch betont, da
Stalnakers Gleichsetzung von uerungssi-
tuationen mit uerungswelten zwar angehen
mag, solange man nur Eigennamen und
Kennzeichnungen im Auge hat, sich aber mit
Sicherheit dann nicht mehr beibehalten lt,
wenn auch andere Deiktika, etwa die Stan-
dardbeispiele ich, hier, jetzt zu bercksichtigen
sind. Denn betrachtet man Stze, in denen
diese Ausdrcke vorkommen, so wird es wich-
tig, uerungen solcher Stze nicht mehr nur
in einer mglichen Welt, sondern auch in
Raum und Zeit zu lokalisieren: Eine ue-
rung von Ich bin mde zum Beispiel drckt
ja nur als konkretes Ereignis betrachtet eine
Proposition aus und nicht unabhngig davon,
wann und von wem sie produziert wird.
Fat man aber uerungssituationen wie-
der, wie eingangs geschildert, als Tripel aus
einer Welt, einer Zeit und einem Ort auf, so
sind natrlich weitere Abnderungen vonn-
ten. wenn die Stalnakersche Theorie nach wie
vor anwendbar sein soll: Auch Redekontexte
knnen nicht mehr einfach als Mengen von
mglichen Welten, sondern mssen als Men-
gen von mglichen uerungssituationen
verstanden werden. Und wenn das Prinzip der
Diagonalisierung auch fr lokale und tem-
porale Deiktika (und solche, die sich ber
diese definieren lassen) verallgemeinert wer-
den soll, so mssen auch uerungsbedeu-
tungen, also Propositionen, als Mengen von
solchen Situationen und nicht mehr nur als
Mengen von Welten definiert werden.
Die Details dieser Erweiterungen werden
wir hier nicht entwickeln, aber es drfte klar
sein, da damit die Kontextvernderungsregel
und die Zulssigkeitsbedingung in der obigen
Form unverndert bernommen werden
knnten; der Diagonaloperator wre dann als
A
w,t,p,w,t,p
= A
w,t,p,w,t,p
zu definie-
ren.
4. Anaphora
Im vorangehenden Abschnitt ging es darum,
242 IV. Kontexttheorie
daher von diesen nicht gebunden sein knnen.
Fr Stze wie (17) liee sich die zweite Hypo-
these noch durch die Annahme retten, da
indefinite Nominalphrasen ungewhnlich
weiten, ber die Grenzen des jeweiligen Teil-
satzes hinausreichenden Skopus haben. Doch
fr Stze wie (18) und (19) ntzt auch das
nicht viel. (18) und (19) sind sogenannte Esel-
stze: Stze, in denen innerhalb eines Wenn-
oder Relativsatzes eine indefinite Nominal-
phrase steht und auerhalb dieses Teilsatzes
ein auf diese NP anaphorisch bezogenes Pro-
nomen. In solchen Konstruktionen hat der
unbestimmte Artikel intuitiv nicht mehr die
Bedeutung eines Existenz-, sondern vielmehr
die eines Allquantors. (18) und (19) sind so
zu paraphrasieren:
(18)
a. Fr jeden Esel x gilt: wenn Hans den
x besitzt, dann schlgt Hans den x.
(19)
a. Fr jeden Bauern y und jeden Esel x
gilt: wenn y den x besitzt, dann
schlgt y den x.
Natrlich darf man aus diesen Paraphrasen
nun nicht den Schlu ziehen, da der unbe-
stimmte Artikel sich eben sowohl als Existenz-
als auch als Allquantor deuten lt und da
die problematischen Pronomina so doch als
Variablen erklrt werden knnen, die durch
NPs mit ungewhnlich weitem Skopus ge-
bunden sind. Denn der unbestimmte Artikel
ist ja nicht schlechthin mehrdeutig zwischen
einer existenz- und einer allquantifizierenden
Lesart. Letztere erhlt er nur in ganz be-
stimmten Konstruktionen, und wie dies zu-
stande kommt, sollte eine adquate Theorie
erklren knnen.
Eine solche Erklrung findet sich nun in
Kamp (1981a) und Heim (1982). (Eine kriti-
sche Darstellung anderer Versuche, das Pro-
blem der Eselstze zu lsen, gibt Heim 1982:
Kap. I, 1.2.) Kamp und Heim haben ihre
Theorien voneinander unabhngig entwickelt
und im wesentlichen stimmen sie sowohl in
ihrer bedeutungstheoretischen Grundkonzep-
tion, als auch in ihrer Lsung des Problems
der Eselstze berein. Ihre Auffassung soll
hier in drei Schritten dargelegt werden: Im
ersten Schritt geht es nur um eine neue Kon-
zeption der Semantik definiter und indefiniter
NPs und damit auch des anaphorischen Be-
zugs. Erst im zweiten Schritt kehren wir zu
unserem eigentlichen Thema zurck und zie-
hen die Konsequenzen dieser neuen Semantik
fr eine Kontextvernderungstheorie. Im drit-
ten Schritt soll dann schlielich der theoreti-
uerungssituation. Anaphorische Prono-
mina sind hingegen hchstens dann referen-
tiell, wenn sie ein definites Antezedens haben.
Bezieht sich ein Pronomen jedoch anapho-
risch auf eine quantifizierende Nominal-
phrase, so bezeichnet es natrlich genauso-
wenig einen Gegenstand wie sein Antezedens.
Die Beispiele (14) bis (16) verdeutlichen dies:
(14) Jeder bekommt das, was er sich ge-
wnscht hat.
(15) Niemand ist verpflichtet mehr zu tun, als
er tun kann.
(16) Jemand hat gedroht, er werde Oskar ver-
giften.
In solchen Fllen scheint die zweite Hypo-
these angebracht zu sein, da anaphorische
Pronomina als Variablen zu deuten sind, die
von ihrem Bezugswort, dem Quantor gebun-
den sind. Danach ist ihre Interpretation ge-
rade nicht mehr von der uerungssituation
abhngig.
Nun gibt es jedoch Beispiele, die sich vor-
derhand weder der einen noch der anderen
Hypothese fgen:
(17) Maria hat einen Esel. Er wird gut be-
handelt.
(18) Wenn Hans einen Esel hat, schlgt er
ihn.
(19) Jeder Bauer, der einen Esel hat schlgt
ihn.
Im Sinne der ersten Hypothese lassen sich die
hervorgehobenen Pronomina in den obigen
Stzen deshalb nicht analysieren, weil ihre
Bezugswrter indefinite Nominalphrasen
sind, die gemeinhin als Existenzquantoren ge-
deutet werden und insofern keinen Gegen-
stand bezeichnen. Es gibt allerdings Versuche,
die erste Hypothese so umzuinterpretieren,
da sie Beispiele wie (17) noch erfassen kann.
Man sagt dann, da indefinite NPs zwar se-
mantisch gesehen keinen Gegenstand bezeich-
nen, da aber derjenige, der einen Satz mit
einem Indefinitum uert, einen bestimmten
Gegenstand im Sinn haben kann, und da es
dann dieser Gegenstand ist, der von dem ana-
phorischen Pronomen bezeichnet wird. Eine
solche Analyse findet sich etwa in Kripke
(1977); auch in Lewis (1979a) wird etwas hn-
liches vorgeschlagen. Vgl. dazu ebenfalls
Heim (1982, Kap. I, 1.3.). Beispiele wie (18)
und (19) lassen sich auf diese Weise allerdings
nach wie vor nicht behandeln.
Die zweite Hypothese ist insofern nicht an-
wendbar, als diese Pronomina, gem allen
gngigen syntaktischen Analysen, auerhalb
des Skopus ihrer Antezedentia stehen und
10. Kontextvernderung 243
toren aus den Quantorenphrasen herausge-
zogen. Eine genauere Fomulierung dieser
Konstruktionsregeln findet sich in Heim
(1982, Kap.II, 5.2, Kap.III, 3.1, 4.2, 4.3). Wir
sind hier jedoch insofern von Heims Regeln
abgewichen, als wir davon ausgehen, da Ei-
gennamen immer weitesten Skopus erhalten.
Diese Annahme, die sich auch in Kamp
(1981 a) findet, ist fr die Angemessenheit der
unten formulierten Interpretationsregeln not-
wendig. Sie wird dann berflssig, wenn wir
im dritten Schritt zur endgltigen Formulie-
rung der Heimschen Theorie bergehen.
Die so erzeugten Strukturen werden dann
fr die Zwecke der semantischen Interpreta-
tion reanalysiert. Das ist ntig, weil sich syn-
taktische und semantische Kategorien nicht
decken. So sind pronominale und leere NPs,
semantisch gesehen, Variablen, also Terme,
NPs, die aus einem Nomen und einem Artikel
bzw. einer leeren Quantorenposition beste-
hen, sind hingegen atomare Formeln. Kom-
plexe Formeln sind Konstituenten, die eine
oder mehrere atomare Formeln als unmittel-
bare Konstituenten enthalten. Es gibt zwei
Typen von komplexen Formeln: solche, die
aus einem Quantor oder Operator und seinen
Schwesterkonstituenten bestehen, und solche,
die einfach nur andere Formeln als unmittel-
bare Konstituenten haben; letztere nennt
Heim (1982, Kap.II, 3.1) kumulative kom-
plexe Formeln. Nach Anwendung der Kon-
struktionsregeln kommt dann als logische
Form eines Satzes so etwas heraus, wie wir
es oben fr unsere Beispiele (17)(19) hin-
geschrieben haben, von den oberen Indizes
i und d an den Variablen abgesehen.
(Wenn-dann-Stze behandelt Heim nicht ganz
so, wie wir es hier und im folgenden schildern
werden, sondern als intensionale Konstruk-
tionen. Sie geht davon aus, da Konditional-
stze, in denen kein expliziter adverbialer
Quantor vorkommt wie zum Beispiel das
meistens in wenn Hans einen Esel besitzt,
schlgt er ihn meistens , dennoch einen un-
sichtbaren Modaloperator enthalten, der in
der logischen Form am Satzanfang sichtbar
gemacht wird. Das wenn-dann selbst ist dann
semantisch irrelevant, vgl. Heim 1982, Kap.II,
4.2; s. auch Artikel 30. Wir werden hier die
Intensionalitt des Konditionals nicht be-
rcksichtigen und uns an die vereinfachende
Analyse in Kamp 1981 a halten.)
Die Rolle dieser oberen Indizes ist klar: sie
zeigen an, welche Variablen in der logischen
Form definit (= d) und welche indefinit (= i)
sind. Diese Information, die wir fr die se-
sche Nutzen klar gemacht werden, der im
bergang zu einer Kontextvernderungs-
theorie liegt, denn dadurch lassen sich einige
Fragen beantworten, die in der Semantik
noch offen bleiben muten. Unsere Darstel-
lung wird sich weitgehend an Heim (1982)
orientieren. (Fr eine Darstellung der Version
Kamps siehe Artikel 41.)
Heim und Kamp lehnen zunchst die tra-
ditionelle Analyse des unbestimmten Artikels
als Existenzquantor ab. Dies lt sich anhand
der Eselstze plausibel machen. Denn wenn
der unbestimmte Artikel mal als Existenz-
und mal als Allquantor zu lesen ist, so liegt
es nahe ihn allein als keins von beidem zu
lesen und den quantifizierenden Effekt an-
deren Elementen von Stzen zuzuschreiben.
Im Kern beruht darauf die Strategie von
Heim und Kamp. Die semantische Funktion
indefiniter Nominalphrasen liegt demgem
nur darin, Argumentpositionen mit freien Va-
riablen zu besetzen und die Belegung der Va-
riablen zu beschrnken. Diese Strategie deh-
nen Kamp und Heim auch auf definite No-
minalphrasen aus; deren semantische Funk-
tion ist genau die gleiche. Letztlich bedeutet
dies, da der bestimmte und der unbestimmte
Artikel semantisch leer sind. Der offenkundig
vorhandene Bedeutungsunterschied zwischen
ihnen wird sich so erst im dritten Schritt auf
der pragmatischen Ebene erklren lassen. Zu-
nchst ist allerdings zu betrachten, wie sich
die semantische Strategie konkret zum Tragen
bringen lt.
Unsere obigen Stze (17)(19) erhalten
bei Heim die nachstehenden logischen For-
men. Wie man zu ihnen gelangt und wie sie
semantisch zu interpretieren sind, wird gleich
erlutert werden:
(17) b. (Maria , Esel , besitzt )
( wird gut behandelt)
(18) b. (Hans , (wenn (Esel , besitzt
) dann ( schlgt )))
(19) b. jeder (Bauer , Esel , besitzt )
( schlgt )
Die logische Form eines Satzes wird von
Heim aus seiner syntaktischen Struktur durch
eine Reihe von Konstruktionsregeln erzeugt.
Diese Regeln versehen zuerst jede Nomi-
nalphrase mit irgendeinem Index. Wenn wir
dabei einem Pronomen und einer anderen NP
denselben Index geben, so heit das, da wir
ersteres auf zweiteres anaphorisch beziehen.
Danach werden alle nichtpronominalen NPs
unter Hinterlassung einer koindizierten leeren
NP an den Satzanfang bewegt und die Quan-
244 IV. Kontexttheorie
in w zutrifft. Eine zu M gehrige Varia-
blenbelegung ist eine Funktion von der
Menge der Variablen in die Menge D. Es
gilt dann:
1. Ist F ein atomarer Satz der Form
, ...,
so ist
EM(F) =
{j,w j(x
r
1
),...,j(x
r
n
)
w
}
und
QV(F) = {x
r
k
a
k
= i},
d. h. die Menge der in F indefinit vor-
kommenden Variablen.
2. Ist F eine komplexe Formel der Form
(A
1
, ..., A
n
), so ist
3. Ist F eine komplexe Formel der Form
jeder (A,B) oder (wenn A, dann B),
so ist
EM(F) = {j,w zu jedem j =
QV(A)
j
mit j,w EM(A) gibt es ein j =
QV(B)
j mit j,w EM(B)}
und
QV(F) = hierbei heit j =
QV(A)
j,
da j mit j bis auf die Belegung der
Variablen aus QV(A) bereinstimmt.
Schlielich heit eine Formel F in einer
Welt w wahr gdw. es ein j gibt, so da j,w
EM(F).
Zusammen mit den Regeln zur Erzeugung der
logischen Formen ergeben sich damit fr um-
gangssprachliche Stze die erwnschten
Wahrheitsbedingungen. Dies sei wiederum
anhand unserer Beispiele (17)(19) veran-
schaulicht. Wir werden dabei die vereinfa-
chende Annahme machen, da, wenn N ein
Eigenname ist, eine atomare Formel der
Form Nx
r
als x
r
heit N zu verstehen ist.
Damit vernachlssigen wir die in Abschnitt 3
angesprochene Indexikalitt von Eigenna-
men, wir werden aber spter darauf zurck-
kommen.
Betrachten wir als erstes unser Beispiel
(17). Die logische Form von (17) ist eine ku-
mulative komplexe Formel; sie ist wahr in
einer Welt w genau dann, wenn es eine Varia-
blenbelegung j gibt, so da j(x
1
) ein Indivi-
duum ist, welches in w Maria heit, und
j(x
2
) ein Individuum, welches sowohl zu den
Eseln in w, als auch zu den in w gut behan-
mantische Interpretation der logischen For-
men bentigen werden, ist ja in der syntak-
tischen Struktur von Stzen enthalten. Das
Vorkommen einer Variablen in der logischen
Form eines Satzes heit definit bzw. indefinit,
wenn der kleinste NP-Knoten, der dieses Vor-
kommen enthlt, definit bzw. indefinit ist. Als
indefinit in diesem erweiterten Sinn gelten
nicht nur NPs mit dem unbestimmten Artikel,
sondern auch NPs mit einer leeren Quanto-
renposition; definit sind leere NPs, NPs, die
aus einem definiten Pronomen bestehen, und
NPs mit dem bestimmten Artikel.
Es kommt nun natrlich entscheidend auf
die Interpretation der so gegebenen logischen
Formen an. Wie dies in der Theorie von Heim
aussieht, wird uns als nchstes beschftigen,
allerdings nur so weit, da wir die in unseren
Beispielstzen auftauchenden Elemente be-
handeln knnen.
Die logischen Formen umgangssprachli-
cher Stze lassen sich als Ausdrcke einer
Reprsentationssprache betrachten, die wir
fr unsere begrenzten Zwecke so definieren
knnen: Grundausdrcke sind n-stellige Pr-
dikate , , ... (n = 1,2,...) und Indivi-
duenvariablen x
1
, x
2
, ...; atomare Formeln
sind Ausdrcke der Form
, ...,
wobei a
k
{i,d} (k = 1,...,n). Wenn A, B,
B
1
,...B
n
Formeln sind, so sind auch
(B
1
,...,B
n
), jeder (A,B) und (wenn A, dann B)
Formeln.
Die semantischen Regeln fr diese Sprache
sollen nun jeder Formel F ihre Erfllungs-
bedingungen zuordnen, das heit, fr jede
Variablenbelegung j und jede mgliche Welt
w festlegen, ob F bei j in w wahr oder falsch
ist. Dazu ist zweierlei rekursiv zu bestimmen:
die Menge aller Paare j,w, bei denen eine
Formel F wahr ist und welche die Erfllungs-
menge von F EM(F) heie; und auer-
dem die Menge der quantifizierbaren
Variablen
einer Formel F QV(F) , die durch die
Quantoren jeder und wenn-dann quantifiziert
werden knnen. Dies ist folgendermaen de-
finiert:
Definition 1:
Sei M = W, D, ein intensionales
Modell fr unsere Reprsentationssprache,
worin W eine Menge von mglichen Wel-
ten, D ein nicht-leerer Individuenbereich
und eine Interpretation der Prdikate
ist. Da wir indexikalische Ausdrcke vor-
lufig auer acht lassen, ist keine
Charakter-, sondern eine Intensionsfunk-
tion, die jeder Welt w die Menge derjenigen
n-tupel von Individuen zuordnet, auf die
10. Kontextvernderung 245
zuwenden, den Konsequenzen dieser vern-
derten Semantik fr eine Kontextvernde-
rungstheorie. Diese kommen schon im ein-
fachsten Fall zum Vorschein, dem Fall eines
anaphorischen Pronomens mit einem indefi-
niten Antezedens im vorausgehenden Satz,
also z. B.:
(20)
a. Ein Mann liegt auf dem Sofa.
b. Er schlft.
Gem den obigen Regeln ist die von (20) als
ganzem ausgedrckte Proposition die Menge
aller Welten, in denen es einen Mann gibt,
der auf dem Sofa sitzt und schlft; und wenn
(20) in einem als Proposition reprsentierten
Redekontext k geuert wird, so wird diese
Proposition zu k hinzugefgt. Nun besteht
(20) aber aus zwei Einzelstzen, und wir soll-
ten daher versuchen, k + (20) auf ((k +
(20a)) + (20b) zurckzuspielen. Dazu k erst
mit der von (20a) und dann mit der von (20b)
ausgedrckten Proposition zu schneiden,
wre allerdings intuitiv vllig inadquat: Die
von (20a) ausgedrckte Proposition ist die
Menge aller Welten, in denen es einen Mann
gibt, der auf dem Sofa sitzt; und die Wahr-
heitsbedingung von (20b) ist, gem den obi-
gen Regeln, die Menge aller Welten, in denen
es ein schlafendes mnnliches Individuum
gibt. Betrachtete man den Satz (20b) losgelst
von jeglichem Kontext, so wre das keines-
wegs unerwnscht; denn wenn gnzlich un-
bekannt ist, worauf sich das er in (20b) be-
zieht, so ist es nicht unplausibel, er als ir-
gendjemand zu verstehen und (20b) diese
Wahrheitsbedingung zuzuordnen. (Das ent-
spricht dem, was wir in Abschnitt 3 als Dia-
gonalisierung beschrieben haben.) Doch wol-
len wir (20b) in einem Kontext betrachten, in
dem zuvor (20a) geuert wurde; und dann
entspricht diese Wahrheitsbedingung natr-
lich gar nicht dem Informationsgehalt, den
(20b) in diesem Kontext hat. (20b) besagt
dann ja nicht, da irgendein Mann schlft,
sondern, da derselbe Mann, von dem in
(20a) schon die Rede war, schlft.
In der Tat scheint sich dieser Informations-
gehalt von (20b) berhaupt nicht propositio-
nal als eine bestimmte Menge von Welten
beschreiben zu lassen. Man knnte meinen,
da sich die von (20b) vermittelte Informa-
tion als die Proposition beschreiben liee, die
von dem Satz Der Mann, der auf dem Sofa
liegt, schlft ausgedrckt wird. Dies steht zum
einen in Widerspruch zu der gerade geschil-
derten Theorie anaphorischer Pronomina, die
diese ja als mit ihrem Antezedens koindizierte
Variablen und nicht als verkleidete Kenn-
zeichnungen analysierte. Zum anderen wrde
delten Individuen zhlt und auerdem in w
Eigentum von j(x
1
) ist. (17) hat also die glei-
chen Wahrheitsbedingungen wie die nachste-
hende prdikatenlogische Formel (17c):
(17)
c. x
1
x
2
(Maria x
1
Esel x
2
Besit-
zen x
1
,x
2
Gut-behandelt-werden x
2
)
Die Beispiele (18) und (19) illustrieren die
dritte semantische Regel. (18) ist genau dann
in einer Welt w wahr, wenn es eine Variablen-
belegung j gibt, derart, da j in w die Formel
Hans x
3
erfllt und jede x
4
-Variante von j, die
in w die Formel (Esel x
4
, x
3
besitzt x
4
) erfllt,
auch die Formel (x
3
schlgt x
4
) in w erfllt.
[Eine x
4
-Variante einer Variablenbelegung j ist
eine Variablenbelegung, die alle Variablen
auer x
4
wie j belegt.] (18) ist also in w genau
dann wahr, wenn es eine Person namens Hans
in w gibt und jedes Individuum, welches in w
ein Esel ist und Hans gehrt, von Hans in w
geschlagen wird. Analog sind die Wahrheits-
bedingungen von (19) zu berechnen. Mithin
ergeben sich fr (18) und (19) genau die Wahr-
heitsbedingungen, die wir in (18a) und (19a)
schon umgangssprachlich ausgedrckt haben
und die sich prdikatenlogisch so darstellen:
(18)
c. x
3
(Hans x
3
x
4
((Esel x
4
Be-
sitzen x
3
x
4
) Schlagen x
3
,x
4
))
(19)
c. x
1
x
2
((Bauer x
1
Esel x
2
Besit-
zen x
1
,x
2
) Schlagen x
1
,x
2
)
Das Problem der Eselstze lt sich also da-
durch lsen, da man den unbestimmten Ar-
tikel nicht mehr als Quantor, sondern als freie
Variable analysiert. Ob eine NP mit dem un-
bestimmten Artikel eine existentielle oder eine
universelle Lesart hat, hngt dann davon ab,
in welcher Kontruktion sie vorkommt. Auf
diese Weise bleibt eine einheitliche Analyse
des unbestimmten Artikels gewahrt.
Da der bestimmte Artikel ebenso, das
heit nicht als Quantor, sondern als freie Va-
riable zu analysieren ist, ist vollends leicht
einzusehen. Denn offenbar knnen wir in den
Stzen (17)(19) das sich auf einen Esel
beziehende Pronomen er bzw. ihn ohne Be-
deutungsunterschied durch der bzw. den Esel
ersetzen; es gibt eben auch anaphorische Ver-
wendungen von NPs mit dem bestimmten Ar-
tikel. Folglich ist dieses anaphorische der Esel
ebenso zu analysieren wie er, d. h. als freie
Variable, und diese Feststellung ist dann um
der Einheitlichkeit der Analyse willen, auf
weitere Verwendungen des bestimmten Arti-
kels auszudehnen.
Wir knnen uns nun dem zweiten Schritt
246 IV. Kontexttheorie
erklrt nun nmlich den Unterschied zwi-
schen definiten und indefiniten Nominal-
phrasen mittels eines einzigen pragmatischen
Prinzips, der sogenannten Neu/Alt-Bedin-
gung. Hinter diesem Prinzip steht eine Ein-
sicht, die schon aus der traditionellen Gram-
matik stammt: Indefinite Nominalphrasen
haben die Funktion, neue, noch nicht er-
whnte Gesprchsgegenstnde einzufhren;
definite Nominalphrasen dienen dazu, auf be-
reits bekannte Gesprchsgegenstnde zurck-
zuverweisen (vgl. dazu etwa die Duden-
Grammatik, 360). Dieser noch sehr vage
Gedanke lt sich mit Hilfe der oben entwik-
kelten Begrifflichkeit angemessen przisieren.
Dazu gilt es zunchst die Rede von relativ
zu einem Kontext neuen und alten Variablen
zu erklren: Eine Variable x heit genau dann
bezglich eines Redekontexts k neu, wenn
mit jedem j,w k auch fr jedes d D
j
x
/d,w k ist wobei j
x
/d die Belegung
ist, die x mit d und alle anderen Variablen
wie j belegt. Eine Variable, die bezglich k
nicht neu ist, heit bezglich k alt; und die
Menge der bezglich k alten Variablen nennen
wir auch den Bereich von k.
Neu sind in einem Kontext mithin die Va-
riablen, deren Belegung durch den Kontext
in keiner Weise beschrnkt ist, ber die der
Kontext also keinerlei Information enthlt;
alt sind hingegen die Variablen, die in frhe-
ren, im Kontext schon aufgenommenen St-
zen unquantifiziert vorkommen und so durch
den Kontext in ihrer Belegung beschrnkt
sind.
Wir knnen damit nun Heims Neu/Alt-
Bedingung, im folgenden mit NAB abge-
krzt, formulieren:
Neu-/Alt-Bedingung fr Variablen:
Eine atomare logische Form F ist in einem
Redekontext k nur dann zulssig, wenn
jede indefinite Variable von F neu und jede
definite Variable von F alt bezglich k ist.
NAB bezieht sich nur auf atomare logische
Formen. In NAB von den definiten und in-
definiten Variablen und nicht Variablen-
vorkommen in F zu reden, ist dabei des-
wegen erlaubt, weil in atomaren logischen
Formen, insoweit sie von umgangssprachli-
chen Stzen herrhren, eine Variable nicht
sowohl definit als auch indefinit vorkommen
kann.
Es stellt sich nun natrlich sofort die Frage,
wie die Neu/Alt-Bedingung auf komplexe
Formeln ausgedehnt werden kann. Die Ant-
wort ist nicht schwer, denn das Problem der
der obige Satz aber auch insofern nicht die
richtige Proposition liefern, da er bei der
gngigen Analyse von Kennzeichnungen
eine Einzigkeitsbehauptung enthielte, die in-
tuitiv in (20) nicht vorhanden ist: (20) kann
durchaus auch in Situationen wahr werden,
in denen zwei Mnner auf dem Sofa liegen
und einer davon schlft. Eine ausfhrlichere
Begrndung dafr, da es nicht angemessen
ist, anaphorische Pronomina der obigen Art
als Kennzeichnungen zu analysieren, findet
sich in Heim (1982, Kap. I, 1.4 und 2.3).
Was (20b) zum Redekontext beitrgt, ist
vielmehr eine zustzliche Beschrnkung fr
die Belegung der Variablen, die dem indefi-
niten Antezedens entspricht; und so verhlt
es sich mit allen Stzen, die eine indefinite
NP pronominal wieder aufnehmen.
Dieser Gedanke lt sich in einer Kon-
textvernderungstheorie nur dann angemes-
sen przisieren, wenn man Redekontexte
nicht mehr als Mengen von mglichen Wel-
ten, sondern als etwas von der gleichen Art
wie die oben fr offene Stze eingefhrten
Erfllungsmengen auffat. Ein Redekontext
ist demnach eine Menge von Paaren aus einer
Variablenbelegung und einer mglichen Welt
oder, anders gesagt, eine Eigenschaft von
einer Folge von Individuuen. Da Gesprchs-
teilnehmer einen so aufgefaten Redekontext
k haben, heit dann intuitiv, da sie glauben,
da die durch k gegebene Eigenschaft in der
wirklichen Welt instantiiert ist, da es also
eine Belegung j gibt, so da das Paar aus j
und der wirklichen Welt in k enthalten ist.
Diese vernderte Auffassung von Rede-
kontexten erlaubt es zudem, an unserer ein-
fachen Beschreibung einer Kontextvernde-
rung als einem mengentheoretischen Durch-
schnitt festzuhalten. Der durch einen Satz er-
zeugte neue Kontext ist nun eben der Durch-
schnitt des alten Kontexts mit der Erfllungs-
menge des Satzes. Das Beispiel (20) ist damit
vllig angemessen zu erfassen.
In einem dritten Schritt knnen wir nun
diese Darstellung von Redekontexten, die von
unserer Analyse definiter und indefiniter NPs
erzwungen wurde, nutzbringend auf diese
Analyse rckbeziehen.
Bisher haben wir ja den bestimmten und
den unbestimmten Artikel semantisch weit-
gehend gleichbehandelt; der einzige Unter-
schied, der sich so weit ergab, war, da nur
indefinite Variablen im obigen Sinn quantifi-
zierbare Variablen sind und definite nicht.
Auf der pragmatischen Ebene der Kontext-
vernderung lt sich mehr dazu sagen. Heim
10. Kontextvernderung 247
Natrlich kann die Neu/Alt-Bedingung zu-
sammen mit ihrer rekursiven Ausdehnung auf
komplexe logische Formen nicht alle uner-
wnschten Koindizierungen ausschlieen.
(Einige werden, so drfen wir annehmen, be-
reits durch rein syntaktische Bedingungen
ausgeschlossen vgl. Art. 23 dieses Hand-
buchs.) Aber sie erklrt wenigstens, wieso in-
definite NPs nie anaphorisch gebraucht wer-
den knnen und wieso Definita sich auf In-
definita beziehen knnen gem NAB
mssen sich Definita sogar auf Indefinita be-
ziehen, sofern der Kontext nur ber frhere
uerungen zu seinem Inhalt kommen kann.
Machen wir uns das an einigen Beispielen
klar:
(21) Ein Mann hatte einen Schwamm. Er
war na.
(21) Mann , Schwamm , hatte ,
war na.
(22) Er war na. Ein Mann hatte einen
Schwamm.
(22) war na, Mann , Schwamm ,
hatte
Hier sagt unsere Theorie, da man zwar in
(21), aber nicht in (22) er und ein Schwamm
anaphorisch aufeinander beziehen kann,
d. h., in (21), aber nicht in (22) t = s sein
kann. Auf genau die gleiche Weise knnen
wir den Kontrast zwischen (23) und (24) er-
klren:
(23) Wenn ein Mann einen Esel besitzt,
schlgt er ihn.
(23) wenn (Mann , Esel , besitzt )
dann ( schlgt )
(24) Wenn ein Mann ihn besitzt, schlgt er
einen Esel
(24) wenn (Mann , besitzt ) dann (Esel
, schlgt ))
Hier wird zunchst der alte Kontext k durch
den Wenn-Satz zu einem hypothetischen Kon-
text k erweitert; in (23) mu x
t
bezglich k
alt sein, weswegen hier s = t gelten darf; in
(24) dagegen mu x
t
bezglich k neu sein,
und deswegen mu dort t s gelten.
Um nicht-pronominale definite NPn an-
gemessen zu behandeln, ist schlielich der
Neu/Alt-Bedingung noch eine weitere Zuls-
sigkeitsbedingung zur Seite zu stellen, die so-
genannte Inhaltsbedingung, mit IB abge-
krzt. Sie verlangt, da der deskriptive Gehalt
einer definiten NP keine neue Information
enthalten darf; z. B. ist die Verwendung von
der Esel nur dann zulssig, wenn der Ge-
sprchsgegenstand, auf den sich der Esel be-
Projektion von Zulssigkeitsbedingungen
hatten wir ja schon im Abschnitt 2 fr die
dort betrachteten Flle gelst: wir muten nur
den Prozess der Kontextvernderung rekursiv
ber den Aufbau der Stze beschreiben und
konnten dann die Zulssigkeitsbedingungen
als Bedingungen fr die Definiertheit der
Kontextvernderungsfunktion auffassen. Da-
durch wurde der Tatsache Rechnung getra-
gen, da durch einen (Teil)Satz Annahmen
eingefhrt werden knnen, von denen die Zu-
lssigkeit eines darauffolgenden (Teil)Satzes
abhngt. Genau die gleiche Strategie wird uns
auch hier zum Erfolg verhelfen. Wir definie-
ren:
Definition 2:
1. k + F = k EM(F), wenn F atomar
ist.
2. k + (A
1
,...,A
n
) = (...(k + A
1
) ...
+ A
n
).
3. k + (wenn A, dann B) = k + jeder
(A,B) = {j,w k fr jedes j, das
mit j bezglich des Bereichs von k ber-
einstimmt und fr das gilt: j,w k
+ A, gibt es ein j, das mit j im Bereich
von k + A bereinstimmt, so da gilt:
j,w (k + A) + B }
Im Verbund mit dieser Definition liefert NAB
eine Zulssigkeitsbedingung fr alle logischen
Formen unserer einfachen Reprsentations-
sprache. Wir knnen dies auch als eine Be-
schrnkung fr die mglichen Lesarten um-
gangssprachlicher Stze auffassen. Denn
wenn wir uns die obigen Regeln zur Erzeu-
gung logischer Formen anschauen, so ist es
klar, da sie keineswegs jedem Satz genau
eine logische Form zuordnen. Gem der In-
dizierungsregel, um die es uns hier geht, lassen
sich ja NPs mit beliebigen Indizes versehen.
Zwar sind viele Indizierungen dabei einander
gleichwertig, da sie durch Umbenennung der
Variablen auseinander hervorgehen, doch
fhren verschiedene Koindizierungen auch zu
wesentlich verschiedenen logischen Formen.
NAB ist nun gerade dazu da, Koindizierun-
gen, die zu intuitiv unerwnschten Interpre-
tationen fhren, auszuschlieen. Um ein be-
sonders krasses Beispiel zu geben: Ordnete
man dem obigen Satz (19) die nachfolgende
logische Form (19d) zu so hiee das, (19) als
(19) zu verstehen was sichtlich absurd ist:
(19)
d. Jeder (Bauer , Esel , besitzt )
( schlgt )
(19) Jeder Bauer, der ein Esel ist und sich
selbst besitzt, schlgt sich.
248 IV. Kontexttheorie
besondere die Prsuppositionen quantifizier-
ter Stze aus den Prsuppositionen ihrer of-
fenen Teilformeln abzuleiten. (Vgl. dazu Heim
1983b, 3.2 und 3.3.).
Eine letzte Wendung fhrt uns nun zur
endgltigen Fassung der von Heim (1982)
und (1983) vertretenen Theorie. Betrachten
wir dazu noch einmal die Definition der Kon-
textvernderungsfunktion. Die semantischen
Regeln, das heit die Definition der Erfl-
lungsbedingungen geht in Definition 2 offen-
bar nur an einer Stelle ein, nmlich in 2.1,
der Rekursionsbasis. Setzen wir aber dort fr
EM(F) das Definiens von EM(F) aus Defi-
nition 1.1 ein, so ist es uns mglich, ganz
ohne die semantischen Regeln auszukommen.
Auch die Definition von QV(F) erweist sich
als berflssig. Ihre Funktion wird von der
Definition des Bereichs eines Kontexts erfllt,
zusammen mit der in NAB formulierten For-
derung, da indefinite Variablen immer neu
sein mssen. Denn daraus ergibt sich, da in
Definition 2.2 gerade die noch nicht quanti-
fizierten Variablen in der gewnschten Weise
quantifiziert werden.
Mit diesen Reformulierungen gelangen wir
also zu einer Bedeutungstheorie, die lediglich
aus einer rekursiven Definition des Kontext-
vernderungspotentials von Stzen und einer
Reihe von pragmatischen Zulssigkeitsbedin-
gungen besteht. Unsere Theorie sagt mithin
fr jede Formel F und jeden Redekontext k
nur, wann und wie dann k + F definiert ist.
Doch lassen sich daraus die Wahrheitsbedin-
gungen von Stzen zurckgewinnen, aller-
dings nur partiell und kontextrelativ: Zu-
nchst ist ein Kontext k genau dann in einer
Welt w wahr, wenn es ein j gibt, so da j,w
k. Und falls k in w wahr ist, so ist ein Satz
S unter einer Lesart F genau dann in w und
relativ zu k wahr, wenn k + F in w wahr ist.
Die Kontextrelativitt dieser Wahrheits-
definition ist offenkundig; sie ist unumgng-
lich, wenn man Stzen mit anaphorischen
Ausdrcken wie z. B. (20b) gerecht werden
will. Eine Wahrheitsbedingung im klassischen
Sinn hat ein Satz S unter einer Lesart F nur
dann, wenn F im tautologischen Kontext k
o
zulssig ist; seine Wahrheitsbedingung ist
dann gerade {w es gibt j mit j,w k
o
+ F}.
Die Wahrheitsdefinition ist partiell, da sie
die Wahrheit von Stzen nur relativ zu wah-
ren Kontexten erklrt. Darin kommt einfach
zum Ausdruck, da ein Satz, dessen Prsup-
positionen nicht erfllt sind, gar keinen Wahr-
heitswert erhlt. Allerdings rechnet die obige
Definition alle Prmissen eines Gesprchs,
zieht, als Esel bekannt ist. Dies ist so zu
explizieren:
Inhaltsbedingung fr definite NPn
Wenn F eine Formel ist, die gem obiger
Regeln zur Erzeugung der logischen Form
von dem (einfachen oder komplexen) No-
men N einer NP der Form der N herrhrt,
so ist F nur in einem Kontext k zulssig,
der F impliziert.
Da ein Kontext k eine logische Form F
impliziert, ist dabei folgendermaen definiert:
k impliziert F genau dann, wenn es zu jeder
Variablenbelegung j und jeder Welt w mit
j,w k eine Variablenbelegung j gibt
derart, da j hinsichtlich des Bereichs von
k mit j bereinstimmt und j,w k + F.
Diese Definition findet sich erst in Heim
(1987). In Heim (1982) wird k impliziert F
einfach als k + F = k bestimmt. Diese
schlichtere Definition wre jedoch nicht ganz
korrekt, wie ein einfaches Beispiel zeigt. Wenn
wir in einem Kontext k bereits den Satz Ein
Mann kauft ein Buch unter der logischen
Form F = (Mann x
r
, Buch x
s
, x
r
kauft x
s
)
ausgewertet haben, so wollen wir, da die NP
der Mann, der ein Buch kauft bzw. ihre logi-
sche Form F = (Mann x
r
, Buch x
t
, x
r
kauft
x
t
) von k impliziert wird. Der NP ein Buch,
die in der definiten NP enthalten ist, mu
jedoch in F eine bezglich k neue Variable
entsprechen; also ist t s und damit auch
auch k + F k. Die verfeinerte Definition
der Implikation kann hingegen diesen Fall
adquat erfassen: wenn es eine Variablenbe-
legung j gibt, die in einer Welt w den Kontext
k und damit auch F erfllt, dann gibt es
natrlich auch eine Variablenbelegung j, die
den Bereich von k wie j belegt und k + F in
w erfllt; j braucht dazu lediglich x
t
mit j(x
r
)
und alle anderen Variablen wie j zu belegen.
Worin besteht nun der Bedeutungsunter-
schied zwischen dem bestimmten und dem
unbestimmten Artikel? Mit IB wird ganz
deutlich, da er nur in den unterschiedlichen
Prsuppositionen besteht, die die Artikel mit
sich fhren. Das ist natrlich kein neuer Ge-
danke. Etwas Neues entsteht daraus nur da-
durch, da wir diesen Gedanken mit der in
Abschnitt 2 entwickelten Prsuppositions-
theorie und mit der Einsicht, da definite und
indefinite NPs selbst keine Quantoren sind,
kombinieren. Mit der neuen Auffassung von
definiten und indefiniten NPs und demgem
von Redekontexten wird es im brigen auch
mglich, Prsuppositionsprojektion unter-
halb der Satzebene zu behandeln, d. h. ins-
10. Kontextvernderung 249
ist. Diese beiden Verwendungen unterschei-
den sich nur darin, wie die Variable x
r
in den
Bereich des Kontexts k, vor dem der Satz Er
schlft betrachtet wird, eingefhrt worden ist.
Ist das er anaphorisch, so ist dafr ein zuvor
geuerter Satz verantwortlich. Ist das er
deiktisch, so ist dagegen davon auszugehen,
da die entsprechende Prmisse, die die Va-
riable x
r
in k eingefhrt hat, situationell er-
zeugt wurde, z. B. durch eine Zeigegeste und
die entsprechenden Wahrnehmungen der Ge-
sprchsteilnehmer. In diesem Fall knnen wir
also annehmen, da k eine Formel P er-
fllt, in der P diejenige Eigenschaft bezeich-
net, durch die der mit er bezeichnete Gegen-
stand den Gesprchsteilnehmern gegeben ist
z. B. kann P so viel heien wie ist ein Mann,
den wir vor uns auf dem Sofa sitzen sehen, und
auf den der Sprecher deutet.
Diese Behandlung bedeutet allerdings, da
Deiktika als Deskriptionen und nicht mehr
als direkt referentielle Ausdrcke angesehen
werden. Betrachten wir dazu noch einmal den
Satz (11):
(11) Hesperus ist Phosphorus.
(11) (Hesperus , Phosphorus , = )
Da Hesperus und Phosphorus als Eigenna-
men indexikalische Ausdrcke sind, hatten
wir ja schon im Abschnitt 3 festgestellt. Neh-
men wir nun an, da Hesperus in einem Kon-
text k unter der Beschreibung P = ist ein
Stern, der Hesperus heit und abends an der-
und-der Stelle am Himmel zu sehen ist und
Phosphorus unter der Beschreibung Q = ist
ein Stern, der Phoshorus heit und morgens
an der-und-der Stelle am Himmel zu sehen ist
eingefhrt ist. Danach erfllt k die Formel
( , Q ). Wenn wir zudem annehmen, da
k sonst nichts enthlt, so gilt, gem obiger
Wahrheitsdefinition, da k + (11) und damit
(11) selbst genau dann in einer Welt w wahr
ist, wenn es in w ein P und ein Q gibt, die
identisch sind. Die Menge aller Welten, in
denen k + (11) wahr ist, ist dann die von
(11) in k ausgedrckte Proposition. Diese
Proposition ist kontingent, und sie entspricht
in etwa dem, was wir im Abschnitt 3 als die
Diagonalproposition von (11) bezeichnet
haben. So gesehen, liefert unsere Theorie fr
die Beschreibung der kontextverndernden
Wirkung von (11) das richtige Ergebnis.
Doch bleibt als Problem, da eine solche
Theorie uns vorderhand keinerlei Mglichkeit
bietet, die von (11) in einer uerungssitua-
tion objektiv ausgedrckte Proposition zu be-
schreiben. Selbst wenn wir nur an einer Theo-
eben den gesamten Kontext zu den Prsup-
positionen eines Satzes, und das ist offenbar
eine zu starke Annahme. In Heim (1982,
Kap.III, 3.3) finden sich berlegungen, wie
diesem Problem zu begegnen wre.
Schlielich ist zu beachten, da eine Be-
deutungstheorie von der gerade skizzierten
Form das bliche Verhltnis von Pragmatik
und Semantik umkehrt. Gewhnlich verwen-
det eine pragmatische Theorie eine unabhn-
gige semantische Komponente. Hier aber
steht die pragmatische Komponente fr sich,
aus ihr kann man, wenn man will, eine Teil-
komponente aussondern, die dem entspricht,
was sonst Semantik heit. Wir haben keine
Begrndung angegeben, die diese Umkehrung
erzwingt. Aber wir haben immerhin vorge-
fhrt, da Heim diese Umkehrung auf ele-
gante Weise mglich macht.
Wir wollen uns abschlieend noch kurz der
Frage zuwenden, wie sich die berlegungen
dieses Abschnitts mit denen des vorangegan-
genen Abschnitts vereinbaren lassen. Eine
einheitliche Behandlung von Deiktika und
Anaphora ist ja ein offenkundiges Desiderat,
handelt es sich doch weitgehend um die glei-
chen Wrter und Phrasen, die eben sowohl
deiktisch als auch anaphorisch verwendet
werden knnen.
Allerdings fllt ein Gegensatz gleich ins
Auge. Fr indexikalische Stze hatte es sich
als ntzlich herausgestellt, zwischen der von
der uerungssituation bestimmten objekti-
ven und der auf den Redehintergrund bezo-
genen subjektiven Bedeutung zu unterschei-
den. Bei Stzen mit Anaphora ergibt diese
Unterscheidung hingegen keinen Sinn je-
denfalls solange wir keine anaphorischen
Ausdrcke mit deiktischem Antezedens be-
rcksichtigen. Denn zu wissen, worauf sich
ein anaphorischer Ausdruck bezieht, erfor-
dert ja gerade rein sprachliche Kenntnisse und
keine Kenntnisse ber die Welt. Bei anapho-
rischen Stzen fallen also subjektive und ob-
jektive Bedeutung zusammen; beide sind nur
vom Redekontext abhngig.
Dieser Gegensatz mag eine Vereinheitli-
chung unwahrscheinlich machen. Aber nach-
dem wir schon zu Beginn dieses Abschnitts
gesehen haben, da sich Anaphora nicht ein-
fach wie Deiktika behandeln lassen, wollen
wir nun zumindest versuchen, Deiktika in die
hier entwickelte Theorie der Anaphora ein-
zupassen. Bei diesem Versuch erhlt z. B. der
Satz Er schlft zunchst einfach die logische
Form schlft ganz unabhngig davon, ob
er nun anaphorisch oder deiktisch verwendet
250 IV. Kontexttheorie
che externen Anker fr die Variablen im Be-
reich des Kontexts zulassen, so hat dies zur
Folge, da diese berzeugungen nicht mehr
als de-dicto-, sondern als de-re-berzeugun-
gen zu verstehen sind. Was diese Begriffe be-
trifft, so sei nur auf den Artikel 34 verwiesen.
Um die Behandlung propositionaler Einstel-
lungen im Rahmen einer Kontextvernde-
rungstheorie geht es auch in Stalnaker (1987,
1988), Kamp (1985), Asher (1986) und Asher
(1989). Fr uns ist aber offenkundig, da die
Theoriebildung hinsichtlich all der angespro-
chenen Phnomene noch sehr im Flu ist.
5. Literatur (in Kurzform)
Asher 1986 Asher 1989 Gazdar 1979 Heim
1982 Heim 1983b Heim 1987 Kamp 1981a
Kamp 1985 Kamp 1986 Kartunnen 1974
Kripke 1977 Lewis 1979a Link 1986 Soames
1982 Stalnaker 1973 Stalnaker 1974 Stalnaker
1976a Stalnaker 1978 Stalnaker 1987 Stalnaker
1988 van der Sandt 1987
Ulrike Haas-Spohn, Mnchen
(Bundesrepublik Deutschland)
rie subjektiver Bedeutung interessiert wren,
wrde dieses Problem sprbar, sobald wir
modale Stze betrachten wollten. Denn dann
wrden sich gerade wieder die Schwierigkei-
ten auftun, die ursprnglich den Ansto dazu
gaben, indexikalische Ausdrcke als direkt
referentielle Ausdrcke zu analysieren. (Vgl.
dazu Artikel 9.) Der oben festgestellte Gegen-
satz verhindert also in der Tat, Deiktika ein-
fach wie Anaphora zu behandeln.
Es bedarf demnach noch weiterer theore-
tischer Modifikationen. Eine naheliegende
nderung besteht in der Forderung, da eine
deiktische Variable nur mit dem Gegenstand
belegt werden darf, der von dem deiktischen
Ausdruck in einer uerungssituation tat-
schlich bezeichnet wird; die womglich irrige
Art und Weise des Gegebenseins dieses Ge-
genstandes tut es dann nicht mehr. Solche
Bedingungen nennt man auch externe Anker
fr Variablen; dieser Begriff wird zum Beispiel
in Kamp (1986) eingefhrt. Allerdings ist
dann der Kontextbegriff erneut umzuinter-
pretieren. Wenn wir sagten, da ein Kontext
die gemeinsamen berzeugungen der Ge-
sprchsteilnehmer reprsentiere, nun aber sol-
11. Vagheit und Ambiguitt
vor. Dabei handelt es sich nicht um zufllige
und korrekturbedrftige Mngel, wie dies von
der sprachanalytischen Philosophie angenom-
men wurde. Vagheit und Ambiguitt sind
konstitutive Eigenschaften natrlicher Spra-
chen, die mageblich zu deren Eigenschaft als
effizientem und universellem Kommunika-
tionsmittel beitragen. Die Ausnutzung von
systematischen Bedeutungsvarianten und
Vagheitsspielrumen macht den flexiblen Ein-
satz von Sprache mglich: Ein Ausdruck ist
in verschiedenen Situationen in einer Vielzahl
unterschiedlicher Lesarten bzw. Przisierun-
gen verwendbar, und zwar mit dem Grad an
Przision, der den jeweiligen Erfordernissen
angemessen ist. Grundlegende Ausfhrungen
und schlagende Beispiele fr den Status von
Vagheit und Ambiguitt in natrlichen Spra-
chen finden sich auer in den einschlgigen
Passagen von Wittgenstein (1953: 66133)
in Erdmann (1910) und Naess (1975).
Fr die Semantiktheorie sind Vagheit und
Ambiguitt Problemflle: Sie verstoen gegen
die Prinzipien der eindeutigen Bedeutungs-
zuweisung, der Bivalenz, anscheinend sogar
1. Einleitung
2. Die Reprsentation semantischer Unbe-
stimmtheit
2.1 Dreiwertige Logiken
2.2 Supervaluationssemantik
2.3 Kommentare und Vergleich
3. Metrische Vagheitstheorien
3.1 Fuzzy Logic
3.2 Probabilistische Vagheitssemantik
3.3 Kommentare und Vergleich
4. Zur Typologie der Unbestimmtheitsphno-
mene
4.1 Vagheitstypen
4.2 Ambiguitt
4.3 Zur Abgrenzung von Vagheit und Ambiguitt
5. Das Grenzziehungsproblem und topologische
Vagheitstheorien
5.1 Vagheit und Toleranz
5.2 Topologisch basierte Vagheitstheorien
6. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
Vagheit und Ambiguitt kommen in Aus-
drcken natrlicher Sprache fast durchgngig
11. Vagheit und Ambiguitt 251
Verwendung des Ausdrucks vage zielt jedoch
auf eine pragmatische Eigenschaft von Satz
(2) bzw. seiner uerung: Er ist unangemes-
sen allgemein und unspezifisch, und daher zu
wenig informativ. Semantisch vage ist Satz
(2) nicht.
Ein dritter Gesichtspunkt, der die Defini-
tion von Peirce ergnzt, ist der enge Zusam-
menhang von semantischer Unbestimmtheit
und Kontextabhngigkeit. Die Existenz un-
klarer Anwendungsflle als Vagheitskriterium
hat eine positive Entsprechung: die Mglich-
keit unterschiedlicher Verwendungen in ver-
schiedenen Situationen.
(3) Hans hat einen teuren Wagen.
Je nach den finanziellen Verhltnissen von
Hans und den Standards der Kommunika-
tionsteilnehmer wird das unbestimmte teuer
recht przise unterschiedliche Lesarten an-
nehmen. Der Indefinitbereich eines unbe-
stimmten Ausdrucks ist gleichzeitig sein Pr-
zisierungspotential.
Die bisher genannten Eigenschaften se-
mantischer Vagheit gelten fr Ambiguitt in
gleicher Weise. Ich komme nun zu einer ersten
Bestimmung des Unterschiedes zwischen Vag-
heit und Ambiguitt, und greife dazu wieder
auf die Definition von Peirce zurck. Dort
wird Vagheit als Unbestimmtheit von Pro-
positionen, nicht von Stzen, bestimmt. Ein
Satz kann einerseits unbestimmt sein, weil er
eine unbestimmte vage Proposition aus-
drckt; er kann andererseits auch deswegen
unbestimmt sein, weil er zwei unterschiedliche
Propositionen alternativ ausdrcken kann
(Beispielsatz (4)), und dem Hrer die zur Des-
ambiguierung ntige Information fehlt.
(4) Fritz hat einen neuen Wagen.
Im ersten Fall liegt Vagheit vor, im zweiten
Ambiguitt (wobei Satz (4) gleichzeitig de-
monstriert, da Vagheit und Ambiguitt ein-
ander nicht ausschlieen).
Im Abschnitt 4 wird sich zeigen, da es
tatschlich nicht ein klares Kriterium fr die
Unterscheidung von Vagheit und Ambiguitt
gibt, sondern eine Reihe von Unterschieden,
und dementsprechend eine Palette von ber-
gangsformen zwischen reiner Vagheit und
prototypischer Mehrdeutigkeit. Im Abschnitt
5 wird eine zentrale Eigenschaft vager Aus-
drcke behandelt, die ber das bisher Gesagte
hinausgeht und in der formalen Beschreibung
zu besonderen Problemen fhrt: ihre prinzi-
pielle Unschrfe, die Unmglichkeit, in einer
kontinuierlichen Realitt przise Denotat-
grenzen zu ziehen.
gegen die elementare Forderung der Konsi-
stenz. Dieser Artikel wird verschiedene Vor-
schlge behandeln, Vagheit und Ambiguitt
in einen formal-semantischen Beschreibungs-
rahmen zu integrieren. Dabei geht es in einem
ersten Durchgang (Abschnitt 23) um Theo-
rien fr semantische Unbestimmtheit im all-
gemeinen (unter diesem Terminus werden im
folgenden Vagheit und Mehrdeutigkeit zu-
sammengefat). Daran anschlieend werden
spezielle Fragen im Zusammenhang mit Am-
biguitt (Abschnitt 4) und Vagheit (Abschnitt
5) diskutiert. Vor der Vorstellung formaler
Theorien sollen in diesem Abschnitt die we-
sentlichen Eigenschaften semantischer Unbe-
stimmtheit informell herausgearbeitet wer-
den. Den Ausgangspunkt dafr bildet die
klassische Definition des Vagheitsbegriffs, die
Charles Peirce 1902 in einem Wrterbuchar-
tikel formuliert hat:
A proposition is vague when there are possible
states of things concerning which it is intrinsically
uncertain whether, had they been contemplated by
the speaker, he would have regarded them as ex-
cluded or allowed by the proposition. By intrinsi-
cally uncertain we mean not uncertain in conse-
quence of any ignorance of the interpreter, but
because the speakers habits of language were in-
determinate.
In dieser Formulierung sind verschiedene
Aussagen ber semantische Vagheit enthal-
ten. Erstens ist Vagheit intrinsische, der Aus-
sage inhrente Unbestimmtheit. Sie hat nichts
mit mangelndem Wissen ber die Weltum-
stnde, mit Ungewiheit oder epistemischer
Unbestimmtheit zu tun.
Zweitens ist fr semantische Vagheit die
Mglichkeit von Grenzfllen entscheidend,
von Sachverhalten, bei denen unklar ist, ob
sie unter die Aussage fallen oder nicht.
It is indeterminancy of the usage, not its extension,
which is important (...). The finite area of the field
of application of the word is a sign of its generality,
while vagueness is indicated by the finite area and
lack of specification of its boundary. (Black 1937:
432).
(1) Hans hat einen roten Wagen.
(2) Hans hat irgendeinen Wagen.
Satz (1) ist semantisch vage: dunkelrosa oder
rotorange Fahrzeuge im Besitz von Hans sind
Anwendungsgrenzflle, die auf der intrinsi-
schen Unbestimmtheit von rot beruhen. Satz
(2) wrde man umgangssprachlich wohl noch
eher als vage bezeichnen als (1), jedenfalls
wenn (2) als Antwort auf die Frage Was fr
einen Wagen hat Hans? geuert wurde. Diese
252 IV. Kontexttheorie
das reelle Interval (0, 1) zur Reprsentation
des Indefinitbereiches benutzen. Die Theo-
rien, die partielle Wahrheitswertzuweisungen
zugrundezulegen, gehren in der groen
Mehrheit zur Familie der Supervaluationsse-
mantiken. Analog zur dreiwertigen Logik ar-
beitet man hier mit den drei Wahrheitszu-
stnden wahr, falsch und undefiniert. Ge-
legentlich sind Erweiterungen des Superva-
luationsansatzes durch Wahrscheinlichkeits-
mae vorgeschlagen worden, die in etwa eine
Entsprechung zu den numerischen Wahrheits-
werten der fuzzy logic ergeben. Quer zur Ein-
teilung in mehrwertige und Lckentheorien
laufen schlielich einige neuere Vorschlge,
bei der Beschreibung vager Ausdrcke auf
Denotate im blichen Sinne zu verzichten und
als Basisreprsentation fr ihre Bedeutung
relationale, topologische Strukturen anzuneh-
men.
Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes wer-
den dreiwertige Vagheitstheorien und Super-
valuationstheorien vorgestellt. Im dritten Ab-
schnitt sollen die beiden grundlegenden Zu-
gnge zum Unbestimmtheitsphnomen ver-
glichen und anhand des Vergleichs einige
grundlegende strukturelle Eigenschaften von
Vagheit und Ambiguitt herausgearbeitet
werden. Abschnitt 3 befat sich mit den un-
endlichwertigen Varianten: fuzzy logic und
probabilistische Vagheitssemantik. Topologi-
sche Anstze werden in Abschnitt 5 betrach-
tet.
2.1Dreiwertige Logiken
Verschiedene Varianten dreiwertiger Logik
sind seit den zwanziger Jahren vorgeschlagen
und untersucht worden, meist allerdings nicht
zur Modellierung semantischer Unbestimmt-
heit, sondern aus den verschiedensten Moti-
vationen: zur Durchfhrung von Unabhn-
gigkeitsbeweisen (Post 1941), zur Reprsen-
tation von Ungewiheit (Lukasiewicz 1930),
und, in den siebziger Jahren, zur Behandlung
von Prsuppositionen (Peters 1979, Blau
1978a; letzterer bezieht allerdings den Vag-
heitsaspekt mit ein). Eine ausfhrliche Dar-
stellung der lteren Systeme findet sich in
Rescher (1969).
Die Einfhrung eines dritten Wahrheits-
wertes fhrt zu betrchtlichen Freiheiten bei
der Interpretation der logischen Konstanten.
Die Wahrheitstafeln fr die zweistelligen
Junktoren der Aussagenlogik haben neun Po-
sitionen; nur fr vier davon sind die Werte
durch die klassische Logik vorgegeben.
Hier sollen zunchst, wie angekndigt,
Theorien behandelt werden, die das Phno-
men semantischer Unbestimmtheit im allge-
meinen betreffen (wenngleich sie meist als
Vagheitstheorien formuliert wurden). Dabei
wird, entsprechend den Ausfhrungen dieses
Abschnitts, die folgende Charakterisierung
von semantischer Unbestimmtheit zugrunde-
gelegt:
(5)
a. Ein Satz ist semantisch unbestimmt ge-
nau dann, wenn ihm trotz hinreichend
genauer Kenntnis der relevanten Welt-
umstnde in bestimmten Kontexten
weder wahr noch falsch eindeutig als
Wahrheitswert zugeordnet werden
kann.
b. Ein Ausdruck ist semantisch unbe-
stimmt, wenn er in Stzen so vorkom-
men kann, da er fr deren semanti-
sche Unbestimmtheit verantwortlich
ist.
2. Die Reprsentation semantischer
Unbestimmtheit
Vage und mehrdeutige Ausdrcke verstoen
gegen das Bivalenzprinzip der klassischen Lo-
gik, das die Zuordnung genau eines der bei-
den Wahrheitswerte wahr oder falsch zu
jedem Satz verlangt. Dies kann man sich
grundstzlich auf zwei Arten vorstellen: Ent-
weder ist neben wahr und falsch (minde-
stens) ein dritter Wahrheitswert vorhanden;
oder es liegen Lcken in der Wahrheitswert-
zuweisung vor. Je nachdem welche Variante
man im Falle semantischer Unbestimmtheit
als gegeben ansieht, wird man entweder mehr-
wertige Logiken als Reprsentationsformat
verwenden, oder zweiwertige semantische
Theorien, die mit partiellen Wertzuweisungen
arbeiten. Es handelt sich bei der Entscheidung
darber nicht um eine Frage der Notation:
Die resultierenden Theorien des Indefiniten
unterscheiden sich in inhaltlich wichtigen
Punkten und sind grundstzlich unvereinbar.
Beide Zweige, mehrwertige und Lcken-
theorien, sind in der Literatur in verschie-
denen Varianten vorgeschlagen worden. Von
den mehrwertigen Logiken haben die mini-
male und die maximale Variante Beachtung
gefunden: dreiwertige Logiken, die Indefinit-
heit mit einem zustzlichen Wahrheitswert
unbestimmt oder indefinit reprsentieren,
und unendlichwertige Logiken, unter der Be-
zeichnung fuzzy logic gekannt geworden, die
11. Vagheit und Ambiguitt 253
Eine Sonderstellung unter den dreiwertigen
Anstzen nimmt in zweifacher Hinsicht das
System von Ulrich Blau ein (Blau 1978a).
Erstens ist es in einer gewissen Hinsicht eine
konservative Erweiterung der klassischen Lo-
gik; zweitens stellt es mit Abstand die am
sorgfltigsten ausgearbeitete und von den na-
trlich-sprachlichen Daten her am besten be-
grndete mehrwertige Theorie der semanti-
schen Unbestimmtheit dar. Unter den Begriff
der semantischen Unbestimmtheit fat Blau
auer Vagheit auch Flle von Prsupposi-
tionsverletzungen. Tatschlich ist die seman-
tische Analyse der Prsupposition sogar sein
primres Anliegen; seine Theorie des Indefi-
niten ist von daher motiviert. Blau betrachtet
I und F als sekundre Ausdifferenzierungen
des klassischen falsch: F steht fr normale
unmarkierte Falschheit, I im Prsuppositions-
fall fr Falschheit aufgrund einer verletzten
Prsupposition. Entsprechend fordert Blau
fr die dreiwertige Interpretation der klas-
sisch-logischen Konstanten, da sie in die
klassisch-zweiwertige bergeht, wenn man I
und F zu klassisch falsch zusammenfallen
lt (Regularitt). Die unter (7) angefhrten
Wahrheitswertetafeln fr und sind re-
gulr (im Sinne Blaus); fr die Implikation
ergibt Blaus Regularittsbedingung dagegen
in Abweichung sowohl von Kleenes wie von
Lukasiewicz System die folgende Wahrheits-
tafel.
(8)
W
I
F
W
W
W
W
I
I
W
W
F
F
W
W
Die wichtigste Konsequenz dieser Interpre-
tationsvariante ist, da in beschrnkten All-
stzen ( x(Fx Gx)) nurmehr die eindeutig
wahren Anwendungsflle des Prdikats F
zhlen: Indefinite F-Instantiierungen bleiben
ebenso wie falsche auer Betracht.
Die Regularittsbedingung garantiert Kon-
servativitt: Da die Verteilung des Wertes W
durch die Einfhrung von I unberhrt bleibt,
sind Gltigkeit und Folgerung in Blaus Sy-
stem extensionsgleich mit den klasssichen Be-
griffen. Der explizite Bezug auf die differen-
zierte Werteskala wird durch die Einfhrung
eines zweiten, nicht-klassischen Negations-
operators zustzlich zum regulren
ermglicht.
(6) W I F
U W F
I
F F F
Die Wertzuweisung an die brigen fnf Po-
sitionen, bei denen jeweils mindestens ein Teil-
ausdruck indefinit ist, ist im Prinzip beliebig.
Durch intuitive Erwgungen lt sich der
Spielraum jedoch schnell und wirkungsvoll
einschrnken. Kleene (1952) schlgt ein drei-
wertiges Symbol vor, das sich aus der folgen-
den Regularittsbedingung ergibt: Ein kom-
plexer Ausdruck erhlt W (bzw. F) als Wert,
wenn die definiten Werte der Teilausdrcke
in der klassischen Logik bereits ausreichen
wrden, um W (bzw. F) zuzuweisen; sonst ist
er indefinit (I). Die resultierenden Wahrheits-
tafeln fr die aussagenlogischen Junktoren
sind in (7) aufgefhrt:
Die Interpretationen fr und sind so
plausibel, da es in der Literatur keine nen-
nenswerten Alternativvorschlge gibt. Insge-
samt hat Kleenes System jedoch Eigenschaf-
ten, die es als formal uninteressant und fr
die Modellierung semantischer Unbestimmt-
heit ungeeignet erscheinen lassen: Die Folge-
rungsbeziehung ist gegenber der klassischen
Logik stark reduziert, vor allem aber gibt es
in Kleenes System keine gltigen Stze: Bei
durchgngig indefiniten Teilausdrcken
nimmt jeder Ausdruck den Wert I an. Neuere
Arbeiten zur Vagheitssemantik knpfen des-
halb eher beim dreiwertigen System von
ukasiewicz an, das etwas strker ist, indem
es der Implikation A B bei indefiniten A
und B den Wert W zuweist. Damit bleiben
eine Reihe von wichtigen Tautologien der
klassischen Logik erhalten (z. B. A A,
A A, (A B) ((B C)
(A C))). Andere klassisch gltige Stze,
z. B. das Tertium Non Datur (A A) und
der Satz vom Widerspruch ( (A A)) ge-
hen verloren. Ob dies als Nachteil oder als
wnschenswerte Konsequenz des aufgehobe-
nen Bivalenzprinzips betrachtet werden sollte,
wird in 2.2 zu diskutieren sein. Als allgemei-
nes Resultat ist festzuhalten, da die bisher
betrachteten dreiwertigen Systeme nicht kon-
servativ sind: Sie geben einen Teil des klas-
sisch-logischen Folgerungs- und Gltigkeits-
begriffs auf.
254 IV. Kontexttheorie
Satzkonstanten, sondern fr alle prdikaten-
logischen Stze (und, mit entsprechenden
Modifikationen, fr Ausdrcke beliebiger
Kategorie): V(A) fr einen komplexen Aus-
druck A ergibt sich also nicht unmittelbar aus
den V-Werten seiner Teilausdrcke; die Bezie-
hung ist immer ber die Menge klassischer
Komplettierungen vermittelt. Dies soll am
Beispiel der Disjunktion illustriert werden.
Wenn V(A), V(B) {W, F}, so ergibt das Su-
pervaluationsverfahren fr A v B trivialer-
weise die klassischen Resultate: alle klassi-
schen Komplettierungen von V stimmen fr
A und B, und damit auch fr A v B, im
Wahrheitswert berein. (11a) zeigt die Be-
wertung der Disjunktion fr ein wahres und
ein indefinites Disjunktionsglied, (11b) den
entsprechenden Fall fr einen falschen und
einen indefiniten Teilsatz. Die untere Zeile
enthlt die Werte fr die Basisinterpretation
V, die beiden oberen Zeilen die alternativen
Mglichkeiten der Wertzuweisung an A, B,
A v B in den mit V vertrglichen klassischen
Interpretationen. Die Pfeile deuten die Rich-
tung an, in der sich der Wert des komplexen
Ausdrucks aus den Werten der Teilausdrcke
berechnet. Wahrheitswertlcken sind durch I
markiert.
Im Beispiel (a) erhlt der Gesamtausdruck
den definiten Wert W, da die klassische De-
finition der Disjunktion fr alle Komplettie-
rungsalternativen bereinstimmend W ergibt.
Im Beispiel (b) erhlt man fr die alternativen
Komplettierungen abweichende Resultate;
entsprechend bleibt die Basisinterpretation
fr A v B hier undefiniert. So weit decken
sich die Resultate des Supervaluationsverfah-
rens mit denen der dreiwertigen Logik. Das
kritische Beispiel, das den Unterschied zwi-
schen beiden Anstzen demonstriert, ist der
Fall mit zwei unbestimmten Disjunktionsglie-
dern, der in (12) dargestellt ist.
Es handelt sich um die aus der Prsupposi-
tionssemantik bekannte Unterscheidung zwi-
schen starker (innerer) und schwacher (u-
erer) Negation. Das Tertium Non Datur
kommt entsprechend in einer gltigen
(A A) und in einer kontingenten Version
vor (A A), letzteres in bereinstimmung
mit den anderen genannten dreiwertigen Sy-
stemen. Im Abschnitt 3 wird die Frage dis-
kutiert, wie weit Blaus System eine adquate
Theorie fr den Vagheitsfall darstellt.
2.2Supervaluationssemantik
Im Gegensatz zu mehrwertigen Logiken in-
terpretieren supervaluationsbasierte Theorien
semantische Unbestimmtheit als das Vorlie-
gen einer Wahrheitswertlcke. Vagheit wird
nicht durch Erweiterung des Wertespektrums,
sondern duch das Zulassen partieller Wert-
zuweisungen modelliert. Die konsistente In-
tegration partieller Funktionen in die prdi-
katenlogische Semantik leistet das Prinzip der
Supervaluation. Supervaluationen sind erst-
malig in van Fraassen (1968, 1969) zur Be-
schreibung des Prsuppositionsphnomens
eingesetzt worden, und dort mit bezug auf
eine Nezessitationsrelation definiert. Fr
vagheitssemantische Zwecke ist die einfachere
Version hinreichend, die in Fine (1975) aus-
fhrlich beschrieben und diskutiert und in
hnlicher Form in Kamp (1975) vorgeschla-
gen wird. Die Grundidee ist die folgende: Da
die Denotate vager und mehrdeutiger Aus-
drcke durch deren Bedeutung nicht vollstn-
dig determiniert sind, gibt es nicht nur eine
scharfe Begrenzung / eine klassisch-logische
Interpretation, sondern eine Menge von mg-
lichen Grenzziehungen / klassischen Interpre-
tationen, die mit der Bedeutung dieser Aus-
drcke vertrglich sind. Die Semantik einer
Sprache mit unbestimmten Ausdrcken kann
durch eine solche Menge klassischer Kom-
plettierungen () reprsentiert werden, die
ihrerseits eine Supervaluation oder Basis-
interpretation (V) determiniert. Ein Satz ist
wahr in V, wenn er wahr in allen V ,
falsch, wenn er falsch in allen V ist; er ist
indefinit, wenn er Komplettierungen zult,
die zu unterschiedlichen klassischen Wahr-
heitswerten fhren.
Die Beziehung unter (10) gilt nicht nur fr
11. Vagheit und Ambiguitt 255
Am eben vorgestellten Standardansatz der
Supervaluationstheorie strt, da er mit fik-
tiven, in natrlichen Sprachen mglicherweise
gar nicht realisierbaren vollstndig przisen
Interpretationen als Elementen von arbei-
tet. Dies ist jedoch keine notwendige Eigen-
schaft supervaluationsbasierter Theorien. Im
folgenden wird eine Variante vorgestellt,
die ohne klassische Komplettierungen aus-
kommt. Sie ist in Pinkal (1983, 1985) be-
schrieben und der dort entwickelten Przisie-
rungssemantik zugrundegelegt. Ein przisie-
rungssemantisches Modell ist ein geordnetes
Paar V, ), wobei V eine partielle Interpre-
tation und eine Menge partieller Interpre-
tationen ist. Die partiellen Definitionen ms-
sen in ihren definiten Teilen konsistent sein
(drfen keinen klassischen Widerspruch ent-
halten); auerdem mu das Paar V, ) den
folgenden Bedingungen gengen:
(14)
(i) V
(ii) V V fr jedes V
(iii) fr alle V und Stze A:
wenn V(A) undefiniert, so gibt es
V, V mit V V, V V,
V(A) = W und V(A) = F
V ist gem (14) ein Mengenverband, der
durch die - Relation partiell geordnet ist,
ein Infimum besitzt (nmlich V), aber nicht
notwendig ein Supremum. Inhaltlich kann
man sich als ein System von mehr oder
weniger przisen Interpretationen vorstellen,
die durch unterschiedliche uerungskon-
texte induziert werden, und durch bzw. die
Umkehrung als Przisierungsrelation
(mindestens so przise wie) geordnet sind.
Die przisierungssemantische Variante er-
gibt fr die Basisinterpretation exakt die glei-
chen Eigenschaften wie die Standardversion
der Supervaluationstheorie. Sie unterscheidet
sich in mehreren Punkten in bezug auf Status
und Eigenschaften von : Erstens fordert die
Bedingung (14) (iii) nur die punktuelle Pr-
zisierbarkeit jedes unbestimmten Ausdrucks;
global przise Interpretationen brauchen
nicht vorzukommen. Zweitens ist es mglich,
intermedire Przisierungszustnde darzu-
stellen, und damit den Proze der sukzessiven
Przisierung unbestimmter Ausdrcke im
Diskurs als Ketten in darzustellen. Drittens
ist nicht durch die Basisinterpretation de-
terminiert: Es knnen bestimmte Przisie-
rungsalternativen (partielle Komplettierun-
gen der Basisinterpretation) bercksichtigt,
andere ausgeschlossen werden. Damit kann
in gewissem Ausma dazu verwendet wer-
(12a) als die nchstliegende Lsung geht von
vier mglichen Komplettierungen aus. Was
eine mgliche klassische Komplettierung ist,
hngt jedoch nicht nur vom Wahrheitszu-
stand der unmittelbaren Teilausdrcke der
Disjunktion ab, sondern auch von deren
Struktur (allgemeiner: von ihrer wechselseiti-
gen semantischen Beziehung, die sich im ein-
fachen Fall aus ihrer Struktur ergibt). Ist B
von der Form A, fallen V1 und V4 als mg-
liche Przisierungen aus (s. (12b)): Der Satz
vom Ausgeschlossenen Dritten erhlt in
bereinstimmung mit der klassischen Logik,
aber in Abweichung vom allgemeinen Fall der
Disjunktion mit indefiniten Teilstzen W als
Wert.
Das Beispiel illustriert zwei wichtige Eigen-
schaften des Supervaluationsansatzes. Erstens
ist er konservativ: Da die Bewertung komple-
xer Ausdrcke ber klassische Komplettie-
rungen erfolgt, und da alle Tautologien in den
klassischen Komplettierungen durchgngig
wahr sind, mssen sie unabhngig vom Wert
der Konstituenten in der Supervaluation wahr
sein (Entsprechendes gilt fr den Folgerungs-
begriff). Zweitens ist er in bezug auf den drit-
ten Wahrheitszustand nicht wahrheitsfunk-
tional: Wie (12) zeigt, lt sich der Wahr-
heitszustand der Disjunktion (W oder I) nicht
aus der Tatsache vorhersagen, da beide Teil-
stze indefinit sind. Information ber die
Struktur der Teilausdrcke sowie lexikalische
Bedeutungsrelationen ist zustzlich erforder-
lich. Fehlende Wahrheitsfunktionalitt gilt
potentiell fr genau diejenigen komplexen
Ausdrcke, die mehr als einen indefiniten
Teilausdruck enthalten. V(A B) variiert fr
V(A) = V(B) = I zwischen I und F, V(A B)
zwischen W und I, die quivalenz A B
sogar zwischen W (fr A = B), F (fr
A = B) und I. Alle brigen Wahrheits-
wertverteilungen (d. h. die Flle mit maximal
einem I) fhren fr die aussagenlogischen
Junktoren zu Resultaten, die mit Kleenes
Wahrheitstafeln bereinstimmen (s. o. (7)).
Die Negation ist als einstelliger Operator un-
problematisch; sie entspricht der dreiwertigen
starken Negation. Definitheit und Indefinit-
heit knnen durch einen Definitheitsoperator
explizit ausgedrckt werden (D bei Fine 1975,
bei Pinkal 1983, 1985), der mit eindeutig
oder in jeder Hinsicht paraphrasierbar ist
und wie folgt interpretiert wird:
256 IV. Kontexttheorie
Supervaluation Kleene u. a. Blau
Wenn man den I-Wert benutzt, um Prsup-
positionsverletzungen semantisch zu repr-
sentieren, ist die Asymetrie plausibel, im Ge-
gensatz zur supervaluationsbasierten Prsup-
positionstheorie von Fraassens: Satz (16)
kann im Falle, da Karl keinen Wagen besitzt,
als falsch, nie jedoch als wahr betrachtet wer-
den:
(16) Karls Wagen ist rot.
Fr die Modellierung des Vagheitsfalles ist
die asymmetrische Lsung jedoch problema-
tisch. Vagheitsbedingte Unbestimmtheit ist
nicht ein markierter Fall von Falschheit, son-
dern semantisch bedingte Unklarheit
darber, ob eine Aussage den wahren oder
den falschen Fllen zuzurechnen ist: Wenn
die Farbe von Karls Wagen einen Grenzfall
von rot darstellt, so ist Satz (16) gerade des-
halb unbestimmt, weil man ihn mit gleichem
Recht unter die wahren und unter die falschen
Flle einordnen knnte, bzw. weil man ihn
mit gleichem Recht von den wahren und den
falschen Fllen ausschlieen knnte.
Die beiden parallelen Formulierungen im
letzten Satz markieren den Unterschied zwi-
schen supervaluationsbasierten Theorien des
Unbestimmten (I ist einerseits W, anderer-
seits F) und den symmetrischen mehrwerti-
gen Systemen (I ist weder W noch F). In
Pinkal (1985) wird ausfhrlich dafr argu-
mentiert, da es Indefinitheit an sich gar
nicht gibt; das Resultat der Argumentation
ist in einem Przisierungsprinzip zusammen-
gefat, das in vereinfachter Form in (17) wie-
dergegeben ist.
Je nach dem, ob man Prsuppositionsver-
letzungen als semantisches Phnomen oder
blo als eine Angelegenheit der Pragmatik
betrachtet, ist (17) als abgrenzende Definition
der vagheits- und ambiguittsbedingten Un-
bestimmtheit oder als generelle Aussage ber
Indefinitheit zu interpretieren.
(17) Semantische Unbestimmtheit ist alter-
native Przisierbarkeit zu wahr und
falsch.
Dieses Przisierungsprinzip und damit eine
Entscheidung fr den Supervaluationsansatz
lt sich auf verschiedene Weise motivieren.
Ein Indiz liefert die Betrachtung, wie Unbe-
stimmtheit umgangssprachlich thematisiert
wird, nmlich typischerweise mit einerseits
ja, andererseits nein-Formulierungen. Dazu
kommt die Beobachtung, da sich Unbe-
stimmtheit durch einen geeigneten Kontext-
wechsel immer zu einem eindeutigen Fall (W
oder F) auflsen lt, eine Mglichkeit, die
den, konkrete Przisierungsgefge im Lexi-
kon natrlicher Sprachen zu modellieren. Bei-
spiele dazu folgen in 4.
2.3Kommentare und Vergleich
Dreiwertige und supervaluationsbasierte An-
stze interpretieren unbestimmte natrlich-
sprachliche Prdikate in der Weise, da der
Individuenbereich in drei Teilmengen (Posi-
tiv-, Negativ- und Indefinitbereich) zerlegt
wird. Die przisierungssemantische Variante
des Supervaluationsansatzes ist jedoch, wie
soeben ausgefhrt wurde, strukturell in signi-
fikanter Weise reicher als die mehrwertigen
Logiken. Sie ermglicht es, die interne Struk-
turierung des Indefinitbereiches zu modellie-
ren, wie sie z. B. von K. O. Erdmann be-
schrieben wurde:
..., auf dem Grenzgebiet, das als Hauptgrenze den
Kern einschliet, verlaufen mehr oder minder zahl-
reiche Untergrenzen, die zum Teil ebenfalls Grenz-
gebiete aufweisen, auf denen wieder Untergrenzen
zweiter Ordnung sich befinden. Hufig setzt sich
dieser Gliederungsvorgang noch weiter fort, so da
sich Untergrenzen dritter und hherer Ordnung
nachweisen lassen. Indem aber alle diese Grenzen
Sonderbedeutungen einschlieen, entsteht jene
Vieldeutigkeit ... (Erdmann 1910: 8).
Dies ist ein Argument fr den Supervalua-
tionsansatz: In Abschnitt 4 wird sich zeigen,
da sich in seinem Rahmen verschiedene in-
teressante Struktureigenschaften unbestimm-
ter Prdikate przise festmachen lassen. Zu-
nchst mu jedoch die Frage gestellt werden,
welche Erklrung des Indefiniten grundstz-
lich adquat ist: die mehrwertige, die zur Auf-
gabe des klassischen Theorembestandes ten-
diert, oder die Lckentheorie, die auf die
elementare Eigenschaft der Wahrheitsfunk-
tionalitt verzichtet.
Das dreiwertige System Ulrich Blaus ist das
einzige, das gleichzeitig die Eigenschaften der
Konservativitt und der Wahrheitsfunktio-
nalitt fr sich reklamiert. Der Grund fr
diese Sonderstellung ist das Regularittsprin-
zip, dem Blaus dreiwertige Logik gehorcht: I
und F stehen als zwei Varianten von Falsch-
heit dem Wert W gegenber. Blaus System ist
von der Konzeption her asymetrisch, im Un-
terschied sowohl zu den anderen dreiwertigen
Systemen, bei denen I unabhngig neben W
und F steht, als auch zu den Supervaluations-
systemen, in denen Unbestimmtheit zu W und
F in der gleichen (Przisierungs-)Beziehung
steht.
11. Vagheit und Ambiguitt 257
indefiniten Teilstzen I als Wahrheitswert
mglich. Mehrwertige Logiken haben keine
Erklrung fr das Verhalten von (20), und
der Unterschied zwischen (20) und (21) steht
in direktem Widerspruch zur Annahme der
Wahrheitsfunktionalitt. Die nicht-wahr-
heitsfunktionale Supervaluationssemantik
wird diesen Beispielen offenbar besser ge-
recht.
Das erste und das zweite Satzpaar (18)/(19)
bzw. (20)/(21) liefern also entgegengesetzte
Evidenz. Sie mu jedoch unterschiedlich ge-
wichtet werden. (18) und (19) sind logisch
determinierte Stze, die keine direkte infor-
mative Lesart besitzen. Sie sind deshalb, im
Gegensatz zu den unmarkierten Beispielst-
zen (20) und (21), von vornherein zweifelhafte
Quellen fr semantische Intuitionen. Tatsch-
lich bietet sich als sekundre Interpretation
fr (18) an, da der Sprecher auf einer ein-
deutigen Wertzuweisung besteht, fr (19) die
Interpretation als implizite einerseits-ande-
rerseits-Formulierung. Beides lt sich gut
mit dem Supervaluationsansatz in Einklang
bringen. Die Evidenz spricht demnach eher
fr eine konservative, aber nicht-wahrheits-
funktionale Semantik des Unbestimmten, und
damit fr die Supervaluationsalternative. Die
Argumentation dieses Abschnitts folgt im
wesentlichen den Ausfhrungen in Pinkal
(1985). Die Gegenposition ist ausfhrlich in
Blau (1982) dargestellt.
3. Metrische Vagheitstheorien
Im Abschnitt 2 sind dreiwertige Logiken und
ihr supervaluationstheoretisches Korrelat be-
sprochen worden. In diesem Abschnitt geht
es um unendlichwertige Varianten bzw. Er-
weiterungen dieser Systeme, die als Wahr-
heitswerte reelle Zahlen aus dem Intervall
[0, 1] verwenden. Der bergang von drei
Wahrheitswerten zu einem Wertespektrum ist
verschieden motiviert worden. Ein grundstz-
liches Argument besteht darin, da der kon-
tinuierliche bergang vom Positiv- zum Ne-
gativbereich bei vagen Prdikaten durch ein
dreiwertiges System nicht dargestellt wird
(vgl. z. B. Zadeh 1975). Weitere Argumente
ergeben sich aus der Anwendung auf den
Komparativ von Adjektiven (Kamp 1975)
und auf die Beschreibung bestimmter sprach-
licher Hecken (Gradmodifikatoren wie sehr
und relativ; Lakoff 1973). Die Stichhaltigkeit
dieser Argumente wird im einzelnen in 3.3,
im Anschlu an die Vorstellung der Forma-
lismen, kommentiert. Es wird sich zeigen, da
im Diskurs auch durchgngig genutzt wird.
Das wesentliche Argument fr die Entschei-
dung zwischen den alternativen Theorien des
Unbestimmten ergibt sich jedoch aus der Be-
trachtung ihrer grundlegenden nicht-klassi-
schen Struktureigenschaften: der Nicht-Kon-
servativitt im einen und der fehlenden Wahr-
heitsfunktionalitt im anderen Fall. Im fol-
genden soll die Angemessenheit dieser Eigen-
schaften diskutiert werden, ausgehend vom
Standardbeispiel der Vagheitsliteratur, dem
Tertium Non Datur.
Wie im Abschnitt 2 ausgefhrt, erhlt man
in den symmetrischen dreiwertigen Systemen
V(A A) = I fr V(A) = I, in der Super-
valuationssemantik ist in jedem Fall
V(A A) = W. Entsprechendes gilt fr
den Satz vom Widerspruch: A A ist kon-
tingent in den mehrwertigen Logiken, kontra-
diktorisch in Supervaluationssystemen. Da
diese den Gltigkeitsbegriff der klassischen
Logik bewahren, hngt unmittelbar damit zu-
sammen, da die logischen Konstanten (auf
der Ebene der Supervaluation) nicht wahr-
heitsfunktional sind. Vertreter der mehrwer-
tigen Logik knnen die Tatsache anfhren,
da in bereinstimmung mit der nicht-kon-
servativen dreiwertigen Analyse natrlich-
sprachliche Stze wie (18) und (19) keines-
wegs eindeutig als wahr bzw. falsch empfun-
den werden.
(18) Dies Buch ist rot, oder es ist nicht rot.
(19) Dies Buch ist rot, und es ist nicht rot.
Wenn es sich bei dem bezeichneten Gegen-
stand um einen Grenzfall von rot handelt,
kann (18) sogar als falsch und (19) als zu-
treffende Charakterisierung betrachtet wer-
den. Zusammen mit dem strukturellen Vorteil
der Wahrheitsfunktionalitt spricht dies fr
die mehrwertige Lsung. Zu einem anderen
Resultat kommt man, wenn man die Stze
(20) und (21) betrachtet.
(20) Dies Buch ist rot, und jenes ist nicht rot.
(21) Dies Buch ist rot, und jenes ist nicht
grn.
Sie sind parallel zu (19) gebaut; dabei ist (20)
ein kontingentes Gegenstck zu (19). Unter
der Voraussetzung, da die beiden Bcher
gleichfarbig sind, mu Satz (20) als falsch
beurteilt werden. Im Supervaluationsrahmen
folgt dies direkt aus der Tatsache, da die
Prdikate beider Teilstze identisch sind, die
Wahrheitsbewertungen also strikt korrelieren:
wie immer man przisiert, kann (20) nicht
wahr werden. In (21) dagegen sind die Pr-
dikate unabhngig, und entsprechend ist bei
258 IV. Kontexttheorie
Tatschlich ist das Konzept der unendlich-
wertigen Logik lter als der Terminus fuzzy
logic. Es geht auf Lukasiewicz (1930) zurck,
dessen Interpretation fr die aussagenlogi-
schen Standardoperatoren in (23) wiederge-
geben ist.
(23) V( A) = 1 V(A)
V(A B) = min (V(A), V(B))
V(A B) = max (V(A), V(B))
V(A B) = min (1, 1 V(A) + V(B))
Die Definitionen unter (23) liefern auch die
Wahrheitstafeln des dreiwertigen Systems von
ukasiewicz, wenn man W = 1, I = und
F = 0 setzt; sie sind als generelle Definitionen
der Junktoren in n-wertigen Systemen inten-
diert. Wie das dreiwertige System ist das
unendlichwertige nicht konservativ. Fr
V(A) = 0.3 erhlt man z. B.:
(24) V(p p) = max (0.3,10.3) = 0.7
V( (p p)) = 1 min (0.3,10.3)
= 0.7
Goguen (1969) argumentiert im Blick auf die
natrlich-sprachliche Anwendung fr ein
alternatives unendlichwertiges System, dessen
elementare Definitionen in (25) aufgefhrt
sind.
(25) V( A) = 1 V(A)
V(a B) = V(A) V(B)
V(A B) = V(A) + V(B)
V(A) V(B)
Von der Negation abgesehen, ordnen (23) und
(25) den aussagenlogischen Junktoren jeweils
unterschiedliche Wahrheitsfunktionen zu. Fr
und sind damit die gngigen Interpre-
tationsvarianten bereits erschpft. Fr die
Implikation ist eine grere Anzahl von De-
finitionsalternativen vorgeschlagen worden,
die in ihren Resultaten fr spezifische Aus-
gangswerte z. T. erheblich voneinander ab-
weichen (vgl. Todt 1983).
Die Anwendung im fuzzy reasoning, dem
Schlieen auf der Basis indefiniter, partiell
zutreffender Information, soll den kurzen
berblick ber die fuzzy logic abschlieen.
die Notwendigkeit von Wahrheitsmetriken
unter theoretischem Gesichtspunkt nicht
zwingend ist; dies gilt in besonderem Mae,
wenn man in einem supervaluationsbasierten
Rahmen arbeitet, in dem ja ber die Drei-
wertigkeit hinaus bereits zustzliche Struktur
vorhanden ist.
Allerdings gibt es ein praktisches Argu-
ment, das fr beide Anstze dreiwertige
Logik und Supervaluation in gleicher
Weise gltig ist. Unter den Grenzfllen eines
vagen Prdikates kommen bessere und
schlechtere Anwendungsflle vor (man ver-
gleiche ein fast-rotes Rotorange und ein blas-
ses Rosa als Anwendungsflle fr rot). Zur
Information, die mit der uerung eines va-
gen Prdikates vermittelt wird, trgt nicht nur
das Wissen um die Verteilung des I-Wertes
und um die relative Position der Anwen-
dungsflle zu den extremen Werten W und F
bei (die sich im Supervaluationsrahmen dar-
stellen lt), sondern auch das Wissen ber
die unterschiedlichen Grade, mit denen ver-
schiedene Objekte das Prdikat verifizieren.
Ein konkretes Beispiel dafr, da man dies
Wissen fr die Bewertung von uerungen
bentigt, ist die Funktion vager Prdikate in
definiten Deskriptionen (Pinkal 1979). Da
Wissen ber Wahrheitsgrade seinerseits vage
ist, soll vorerst unbercksichtigt bleiben. Die
Frage wird, zusammen mit einer Reihe wei-
terer inhaltlicher Probleme, nach der Vorstel-
lung der fuzzy logic (in 3.1) und der proba-
bilistischen Erweiterung des Supervaluations-
ansatzes (in 3.2) in 3.3 diskutiert.
3.1Fuzzy Logic
Unendlichwertige Logiken sind seit den Sech-
ziger Jahren durch Lofti Zadehs Arbeiten
(z. B. 1965, 1975) unter dem Etikett fuzzy
logic bekannt geworden; mit Lakoff (1973)
wurden sie in die linguistische Diskussion ein-
gebracht. Zur Popularitt der fuzzy logic hat
ihr Anwendungsbezug beigetragen, die Tat-
sache, da semantische Operationen sich als
arithmetische Funktionen problemlos imple-
mentieren lassen. Stze erhalten Werte aus
dem reellen Intervall [0, 1] direkt zugewiesen.
Die Denotate von Prdikaten sind fuzzy
sets, Abbildungen vom Individuenbereich in
die Menge [0, 1], in den Standardbeispielen
als Funktionen bestimmter mebarer Eigen-
schaften der Individuen definiert. (22) zeigt
einen mglichen Funktionsverlauf fr das
Adjektiv gro (tall), bei dem die Wahrheits-
grade der Prdikation von der Krpergre
abhngen.
11. Vagheit und Ambiguitt 259
(28) V(A) = P(C
A
)
Die probabilistische Erweiterung der Super-
valuationssemantik ist konservativ; eine klas-
sische Tautologie hat nur verifizierende Kom-
plettierungen; es gilt also C
A
= C und damit
V(A) = P(C) = 1. Entsprechend ist C
A
fr
einen klassischen Widerspruch , und deshalb
V(A) = P() = 0. Als Wahrscheinlichkeits-
metrik ist die Erweiterung jedoch nicht wahr-
heitsfunktional: Die kompositionelle Bestim-
mung semantischer Werte erfolgt nicht durch
den Bezug auf P-Werte, sondern ber men-
gentheoretische Operationen auf der Kon-
textmenge. So erhlt man als Wert fr die
Konjunktion:
(28) V(A B) = P(C
A B
) = P(C
A
C
B
).
Dies Resultat lt sich in Form von
Wahrheitswertzuweisungen bestenfalls als
V(A) V
A
(B) reformulieren, wobei V
A
(B)
eine bedingte Wahrscheinlichkeit ausdrckt:
den P-Wert von B unter der Voraussetzung,
da A wahr ist. Welchen Wert A A B zuge-
wiesen erhlt, hngt davon ab, wie stark die
Teilausdrcke miteinander korrelieren: Der
Wert wird um so hher, je einheitlicher sich
A und B in verschiedenen przisierenden
Kontexten verhalten. Entsprechendes gilt fr
v und :
(29) V(A B) = V(A) + V(B) P(C
A
C
B
)
V(A B) = 1 V(A) + P(C
A
C
B
)
3.3Kommentare
Beim Vergleich von fuzzy logic und probabi-
listischer Vagheitstheorie zeigt sich ein hnli-
ches Bild wie auf der Ebene der dreiwertigen
Entsprechungen, nur da die Unterschiede
hier krasser heraustreten. Im einen Fall wer-
den einzelne Wahrheitsfunktionen aus einem
Kontinuum alternativer Mglichkeiten in
schwer motivierbarer Weise herausgegriffen.
Im anderen Fall liegt der Bewertungsmodus
fest; die Werte variieren jedoch in Abhngig-
keit vom zugrundegelegten Wahrscheinlich-
keitsma in schwer vorhersagbarer Weise.
Um die Zusammenhnge deutlicher zu ma-
chen, soll fr das Beispiel der Konjunktion
betrachtet werden, wie der Spielraum aus-
sieht, den die probabilistische Semantik fr
die Wertzuweisung berhaupt zult. Erstens
kann wegen C
A
C
B
C
A
, C
B
der P-Wert
von A B nicht grer sein als der P-Wert
eines seiner Konjunkte. Zweitens mssen
auch bei ungnstigster Korrelation C
A
und
C
B
im Fall von P(C
A
) + P(C
B
) > 1 berlap-
pen. Man erhlt demnach:
Folgerungsbeziehungen zwischen indefiniten
Stzen kann man in dreiwertigen oder Super-
valuationssystemen formulieren, indem man
Indefinitheit durch die Einfhrung eines
nicht-klassischen Operators ausdrckbar
macht. Dies leistet z. B. der Definitheitsope-
rator D oder Blaus starke Negation
( DA D A bzw. A A fr
A indefinit). Dieser Weg ist fr die fuzzy
logic verschlossen: Um sie expressiv vollstn-
dig zu machen, bentigt man unendlich viele
Operatoren (nmlich je einen fr jedes
x (0, 1)), und Systeme mit unendlich vielen
Operatoren sind wiederum nicht vollstndig
axiomatisierbar (Morgan/Pelletier 1977).
Stattdessen kann man in der fuzzy logic mit
Varianten der konventionellen Schluregeln
arbeiten, die fr jedes klassische Schlu-
schema zustzlich eine arithmetische Opera-
tion ber [0, 1] spezifizieren. Parallel zur
Durchfhrung der klassischen Schlsse wird
so der Wahrheitsgrad fr jede neue Konklu-
sion berechnet. Die allgemeine Form fr den
fuzzy Modus Ponens sieht z. B. folgender-
maen aus:
(26) A i
A B j
B k = f(i,j)
Die Spezifikation von f in den einzelnen Sy-
stemen der fuzzy logic hngt mit der Defini-
tion der Implikation zusammen. In (27a, b)
sind die Operationen fr die Systeme von
Lukasiewicz und Goguen angegeben:
(27)
a. f(i,j) = max (0, i + j l)
b. f(i,j) = i j
3.2Probabilistische Vagheitssemantik
Supervaluationsbasierte Wahrheitsmetriken
sind in Kamp (1975) und Pinkal (1977, 1979)
vorgeschlagen worden. Man erhlt sie, indem
man ein Wahrscheinlichkeitsma P ber der
Komplettierungs-/Przisierungsmenge eta-
bliert, bzw. ber einer Kontextmenge C, deren
Elemente die Interpretationen in induzie-
ren. Als Wahrheitsgrad eines Satzes A erhlt
man den P-Wert, die Wahrscheinlichkeit der
Menge von Kontexten, die verifizierende In-
terpretationen fr A induzieren (im folgenden
kurz: C
A
). Wahrscheinlichkeit ist hier ein
technischer Begriff, der fr bestimmte formale
Eigenschaften der zugrundegelegten Metrik
steht; er darf nicht inhaltlich im Sinne von
Zutreffenswahrscheinlichkeit miverstanden
werden. Die V-Funktion ordnet Wahrheits-
grade zu, nicht epistemische Wahrscheinlich-
keiten.
260 IV. Kontexttheorie
Beim fuzzy reasoning hat man ein zustz-
liches Problem: Korrelationen von fuzzy-
Schlssen sind, wie in 3.1 ausgefhrt, Paare
bestehend aus einem Satz und einem Wahr-
heitsgrad, den der Satz aufgrund des Wahr-
heitsgrades der Prmissen zugewiesen erhlt.
Diese Konklusionen haben jedoch einen an-
deren Status als die aus klassisch-logischen
Schlssen: Sie sind nicht endgltig, sondern
geben in ihrem numerischen Bestandteil nur
eine Untergrenze an. Der Wahrheitsgrad der
erschlossenen Aussage kann tatschlich viel
hher sein, als er sich aufgrund der jeweils in
den Prmissen verwendeten Evidenz ergibt.
(34) Ottos Wagen ist rot.
(35) Wenn Ottos Wagen rot ist, ist er nicht
grn.
(36) Ottos Wagen ist orange.
(37) Wenn Ottos Wagen orange ist, ist er
nicht grn.
(38) Ottos Wagen ist nicht grn.
Angenommen, die Farbe von Ottos Wagen
liegt so zwischen rot und orange, da (34) 0.4
und (36) 0.6 als Wahrheitswert erhlt. (35)
und (37) sollen eindeutig wahr sein. Die Mo-
dus-Ponens-Regel weist (in beiden oben spe-
zifizierten Versionen) dem Satz (38) auf der
Grundlage von (34)/(35) den Wert 0.4, auf der
Grundlage von (36)/(37) den Wert 0.6 zu,
obwohl (38) tatschlich 1 erhalten msste.
Fuzzy-logische Schlusysteme mssen Evi-
denzverstrkung durch Mehrfachableitung
erlauben. Dabei mu allerdings verhindert
werden, da voneinander abhngige Prmis-
sen in mehreren Schlssen gleichzeitig ver-
wendet werden. In der Knstliche-Intelligenz-
Forschung sind komplexe Evidenzverstr-
kungssysteme sowohl fr die Behandlung von
Vagheit (Wahlster 1981) wie von unsicherem
Wissen (Shortliffe 1976) entwickelt werden.
Das letztere System versteht sich explizit als
Approximation an ein wahrscheinlichkeits-
theoretisches Schluverfahren. Es ist wohl
korrekt, wenn auch nicht im Sinne ihrer In-
itiatoren, die fuzzy logic insgesamt in dieser
Weise zu interpretieren.
Eine wichtige Motivation fr die Einfh-
rung von Wahrheitsmetriken war die Mg-
lichkeit der einheitlichen Behandlung unter-
schiedlicher Adjektivkonstruktionen (Zadeh
1975, Kamp 1975): Der Komparativ lt sich
in naheliegender Weise als Relation zwischen
Wahrheitsgraden interpretieren (s. (39)),
Gradmodifikatoren wie sehr und relativ durch
arithmetische Operationen auf Wahrheitsgra-
den wie in (40):
(30)
a. V(A B) min (V(A), V(B))
b. V(A B) max (0, V(A) + V(B) 1)
Im Extremfall maximaler Korrelation geht
das in (30a) in Identitt ber, und ent-
sprechend das in (30b) bei minimaler Kor-
relation. Ein Sonderfall in dem von den Ex-
tremfllen aufgespannten Spektrum mgli-
cher Werte ist der, bei dem die Konjunkte
voneinander unabhngig sind (P ist Gleich-
verteilung, und A und B enthalten durchgn-
gig unterschiedliche lexikalische Ausdrcke).
Fr diesen Fall ergibt sich:
(31) V(A B) = V(A) V(B)
Ein Blick auf die unendlichwertigen Systeme
in 3.1 zeigt, da ukasiewicz den Sonderfall
maximaler Korrelation, Goguen den Gleich-
verteilungsfall zugrundelegt. Welche der bei-
den Varianten gibt die natrlich-sprachlichen
Verhltnisse angemessen wieder? Es scheint,
da die Beantwortung der Frage vom jewei-
ligen Einzelfall abhngt. Die berlegungen in
2.3 hatten anhand von (quasi-)tautologischen
und widersprchlichen Stzen gezeigt, da
unbestimmte Stze natrlicher Sprache nicht
wahrheitsfunktional sind. Die Argumentation
gilt natrlich ebenso fr die unendlichwerti-
gen Erweiterungen der in Abschnitt 2 bespro-
chenen dreiwertigen Anstze. Hier soll ein
Beispiel angefhrt werden, das auch fr nor-
male Stze mit Werten aus dem Zwischenbe-
reich die Relevanz von Korrelationen unter-
halb der Wahrheitswertebene nahelegt.
(32) Hans und Otto sind gro.
(33) Hans ist gro und intelligent.
Wenn Hans und Otto gleich gro sind, sollte
man (32) mit demselben Resultat als wahr
bezeichnen knnen wie jedes seiner Kon-
junkte, und daran ndert sich auch nichts,
wenn beliebig viele gleichwahre Konjunk-
tionsglieder hinzugefgt werden. Anders ver-
hlt es sich mit (33): Der Satz ist, wenn Hans
ein echter Grenzfall von gro und intelligent
ist, problematischer als seine Konjunkte, und
er wird durch Hinzufgen weiterer partiell
zutreffender Eigenschaften immer fragwr-
diger. Im Falle (32), bei dem die Teilstze ber
das gemeinsame Prdikat gro korrelieren,
scheint die eine, im Fall (33), wegen der wenig
ausgeprgten Korrelation von Gre und In-
telligenz, die andere fuzzy-logische Variante
angemessener. Beide zusammen legen die pro-
babilistische Version nahe: sie erlaubt es im
Gegensatz zur fuzzy logic, den Einflu von
Korrelationen zu reprsentieren.
11. Vagheit und Ambiguitt 261
schlagene fuzzy-logische Behandlung ohnehin
nur fr sehr, relativ und einige przisierende
und deprzisierende Modifikatoren wie exakt
und ungefhr. Andere Heckenausdrcke, z. B.
adadjektivische fr-Phrasen (gro fr einen
Baskettballspieler) erfordern eine Supervalua-
tion bzw. przisierungssemantische Interpre-
tation (vgl. Pinkal 1977). Wieder andere Hek-
ken wie eigentlich, echt, typisch lassen sich in
einem reinen vagheitssemantischen Rahmen
gar nicht beschreiben.
Wahrheitsmetriken leisten zur Semantik-
theorie natrlicher Sprachen nur einen be-
grenzten Beitrag. Auf der anderen Seite fh-
ren sie in methodologische Probleme, die Ul-
rich Blau als Vagheitsdilemma folgenderma-
en charakterisiert:
Wollen wir die klassische Logik anwenden, so sind
wir zu einem scharfen Schnitt gezwungen; fhren
wir zwischen wahr und falsch eine unbestimmte
(neutrale) Zone ein, so kommen wir den Phno-
menen vielleicht etwas nher, aber die beiden nun
erforderlichen Schnitte sind ebenfalls willkrlich;
fhren wir weitere Wahrheitswerte ein, so werden
sie zunehmend nichtssagend und ziehen immer
noch willkrliche Grenzen; lassen wir schlielich
unendlich viele Wahrheitswerte zu, so ist die Klas-
sifikation scharf genug, aber auch schon zu scharf,
also wieder willkrlich, und berdies ist der Zusam-
menhang mit den ursprnglichen Begriffen wahr,
falsch so ziemlich verlorengegangen, wir wissen
nicht, was diese Wahrheitswerte noch bedeuten
sollen. (Blau 1978a: 28)
Wie Todt (1980) ausgefhrt, fhrt der Aus-
weg, die Wahrheitsbewertungen selbst zu fuz-
zifizieren, nicht zu einer echten Lsung.
Gleich, ob man mit Werten aus [0, 1], mit
Verteilungen ber [0, 1] arbeitet (linguistische
Variablen Zadeh (1975 a)), oder ob man im
Supervaluationsrahmen Grenzziehungen
durch die Einfhrung von Vagheit hherer
Ordnung aufweicht (Fine 1975): Man ver-
schiebt das Problem nur auf die nchste
Ebene, und mu dort wieder przise und
noch schwerer motivierbare Werte bzw.
Grenzen ansetzen. Der Grenzziehungskon-
flikt ergibt sich grundstzlich, sobald man
przise Theorien auf eine kontinuierliche Do-
mne anwendet. Es handelt sich dabei nicht
nur um ein methodologisches Problem, das
die Beziehung zwischen Theorie und natr-
lich-sprachlicher Vorgabe betrifft. Der Kon-
flikt ist in der natrlich-sprachlichen Bedeu-
tung selbst angelegt, und fr eine Eigenschaft
verantwortlich, um die es im Abschnitt 5 ge-
hen wird: die latente Inkonsistenz genuin va-
ger Ausdrcke.
(39) V (a ist grer als b) = 1
gdw. V (a ist gro) > V (b ist gro)
(40)
V (a ist sehr gro) = [V (a ist gro)]
2
Tatschlich mu man die Situationen diffe-
renzierter sehen: Komparative lassen sich
schon in der nichtmetrischen Supervalua-
tionssemantik definieren, ber die Inklusions-
beziehung zwischen verifizierenden Interpre-
tationen/Kontexten:
(41) V (a ist grer als b) = 1
gdw. C
a ist gro
C
b ist gro
Allerdings erfat die Definition nur die Flle,
in denen unmittelbarer Vergleich mglich ist.
(42) Hans ist begabter als Karl.
(43) Hans ist grer als intelligent (mehr
gro als intelligent).
Vergleiche zwischen unterschiedlichen Di-
mensionen eines Adjektivs (wie in (42), wenn
Hans ein sehr begabter Klavierspieler und
Karl ein relativ begabter Schachspieler ist)
und Vergleiche, die verschiedene inkommen-
surable Adjektive einbeziehen (Metakompa-
rative wie in (43)) sind im Supervaluations-
rahmen nur in der metrischen Erweiterung
interpretierbar. Dies deckt sich gut mit der
Intuition, da (42) in der beschriebenen Si-
tuation sowie (43) markierte, sekundre Ver-
wendungen des Komparativs sind. Die fuzzy
logic macht keinen Unterschied zwischen or-
dinren und Metakomparativen. Auch dies
Resultat wrde also fr die Supervaluations-
variante sprechen. Allerdings lt sich gegen
beide Anstze einwenden, da eine generelle
Theorie des Komparativs auf der Basis von
Wahrheitsgraden nicht mglich ist. Eines von
mehreren Gegenargumenten illustriert das
folgende Beispiel:
(44) Der Tisch ist lnger als breit.
(44) kann auch dann wahr sein, wenn der
Tisch relativ kurz, aber ziemlich breit ist: Ver-
glichen werden hier die Skalenwerte von
Lnge und Breite, nicht Wahrheitsgrade.
Wahrheitsmetriken liefern demnach keine
vollstndige Semantik fr Adjektivkonstruk-
tionen. Und auch in den Bereichen, wo sie
anwendbar sind, sind sie nicht unumgnglich:
Metakomparative werden in Klein (1980),
Hoepelman (1986) ohne Rekurs auf Wahr-
heitsgrade beschrieben, und die gleichen
Autoren liefern eine nicht-metrische Interpre-
tation fr die Gradmodifikatoren sehr und
relativ.
Was sprachliche Hecken im allgemeinen be-
trifft, so eignet sich die von Lakoff vorge-
262 IV. Kontexttheorie
zisierungsstruktur: Wenn in einer Przisierung
ein bestimmter Gegenstand unter das Prdi-
kat schwer fllt und ein anderes nicht, kann
es keine andere Przisierung geben, die das
Verhltnis umkehrt. Das vieldimensionale be-
gabt verhlt sich entgegengesetzt: Hier lassen
sich tendenziell immer Kriterien finden, die
die Begabungshierarchie fr zwei beliebige
Personen umkehren. Zwischen den Extremen
liegen die beschrnkt-dimensionalen Aus-
drcke (Pinkal 1985). Hier gibt es im Indefi-
nitbereich sowohl Objekte, deren Verhltnis
przisierungsunabhngig festliegt, als auch
Paare von Objekten, die an der Basis unver-
gleichbar sind und deren Verhltnis sich in
unterschiedlichen Przisierungen umkehrt.
Ein Beispiel ist gro in der Anwendung auf
nicht-menschliche Objekte: Ist ein Fahrrad
grer als ein Khlschrank? Die Mehrzahl
der relativen Prdikate gehrt in diese
Gruppe, auerdem die meisten Gattungssub-
stantive.
Die letzteren bilden wegen ihrer Vielfalt
und Komplexitt im Lexikon natrlicher
Sprachen einen Sonderfall. Entsprechend in-
tensiv sind sie in der Vagheitsliteratur errtert
worden. Eine ihrer eher harmlosen Eigen-
schaften wird in Quine (1960) beschrieben.
Quine fhrt aus, da nicht nur der Umfang
eines Gattungsbegriffs, sondern auch die Aus-
dehnung der unter ihn fallenden Objekte zur
Unbestimmtheit fhren kann: Einerseits ist
zwischen den Prdikaten Berg und Hgel
keine eindeutige Grenzziehung mglich; an-
dererseits lassen sich Berg und Tal, Tag und
Nacht als Individuen nicht scharf gegenein-
ander abgrenzen. Beide Vagheitsarten fhren
in jeweils verschiedenen syntaktischen Um-
gebungen Unbestimmtheit herbei: die erste in
Prdikationen (vagueness of predication),
die zweite in lokalen bzw. temporalen Bestim-
mungen (vagueness of individuation).
Susan Haack unterscheidet in ihrer Vag-
heitsbersicht (1974: 111) drei Arten von Vag-
heit in bezug auf die Anwendungsbedingun-
gen der betroffenen Ausdrcke (qualifica-
tions):
(a) The qualifications are complex ... and it is
indeterminate how many of the qualifications
must be satisfied ...
(b) The qualifications are complex and in certain
cases conflicting ...
(c) The qualifications are simple ..., but in certain
cases it is indeterminate whether the condi-
tions, or one of the conditions, is satisfied.
Der Unterschied zwischen den ersten beiden
Fllen und dem Fall (c) kann unter Mehrdi-
4. Zur Typologie der
Unbestimmtheitsphnomene
Nach der Charakterisierung semantischer
Unbestimmtheit in Abschnitt 1 fllt unter die-
sen Begriff das vage Prdikat rot ebenso wie
Homonyme und syntaktische Skopusambi-
guitten. In diesem Abschnitt soll die interne
Strukturierung des heterogenen Gegenstands-
bereichs betrachtet werden; verschiedene in
der Literatur zu Vagheit und Ambiguitt gn-
gige Unterscheidungen, die sich primr auf
vage Ausdrcke beziehen, werden vorgestellt
und kommentiert. Anschlieend wird der Be-
reich der Ambiguittsphnomene gesichtet
und verschiedene Kriterien fr die Abgren-
zung von Vagheit und Mehrdeutigkeit dis-
kutiert.
4.1Vagheitstypen
Eine erste Klassifikation unbestimmter Aus-
drcke betrifft das Verhltnis von Definit-
und Indefinitbereichen in der Basisinterpre-
tation. Bei relativen Ausdrcken ist der In-
definitbereich umfassend. Jeder mgliche An-
wendungsfall ist (tendenziell) durch alter-
native Przisierung relativierbar. Die auffl-
ligste und geschlossenste Gruppe relativer
Ausdrcke bilden die Gradadjektive; weiter
gehren dazu relative Adverbien und Quan-
toren (oft und viel). Der zweite Typ ist unter
dem Terminus Randbereichsunschrfe be-
kannt. Randbereichsunscharfe Ausdrcke be-
sitzen ausgedehnte Bereiche definitiver An-
wendbarkeit, die durch eine mehr oder we-
niger ausgeprgte bergangszone getrennt
sind. Neben Adjektiven wie rot, Orts- und
Zeitadverbien wie hier und bald gehrt in
diese Gruppe vor allem die Hauptmasse der
Verben und Gattungssubstantive. Einen drit-
ten Typ bilden schlielich die punktuellen
Prdikate, die durch einen punktfrmigen po-
sitiven Definitbereich gekennzeichnet sind,
der ber eine Toleranzzone in den beinahe
umfassenden Negativbereich bergeht. Seine
wichtigsten Vertreter sind die Ausdrcke, die
gemeinhin als Prototypen fr Przision gel-
ten: geometrische Prdikate (rechteckig) und
Maangaben (2 700 m hoch). Von ihnen wird
im nchsten Abschnitt noch die Rede sein.
Eine andere Unterscheidungsmglichkeit
ergibt sich aufgrund der Beobachtung, da
vage Prdikate unterschiedliche Przisie-
rungseigenschaften besitzen und deshalb dem
Individuenbereich verschiedene Ordnungs-
strukturen aufprgen (vgl. Kamp 1975). Das
Adjektiv schwer ist von eindimensionaler Pr-
11. Vagheit und Ambiguitt 263
ergiebig. Stattdessen ist ein realistischer Be-
griff von Unbestimmtheit ntig, der mgliche
Grenzflle gerade so weit einbezieht, wie sie
plausibel vorstellbar sind. Die theoretische
Bestimmung der realistischen Ebene ist ein
offenes Problem mit starken philosophischen
Implikationen. Praktisch wird ein vagheits-
semantischer Realismus jedoch in allen de-
skriptiven Analysen vorausgesetzt. Natrli-
che Gattungen, wie sie z. B. durch die Klas-
sifikation der chemischen Elemente gegeben
sind, sind nach Waismann pors, in realisti-
scher Sicht jedoch przise. Der Bereich der
Artefakte und sozialen Institutionen mag in
einem bestimmten Weltzustand und vor einem
bestimmten soziokulturellen Hintergrund ex-
tensional przise gegliedert sein. Die realisti-
sche Vorstellung von Alternativen weist die
begriffliche Gliederung dieser Bereiche als
vage aus. Das bekannteste Beispiel ist das
Stuhlmuseum aus Black (1937), in dem ein-
deutige Sthle und Nicht-Sthle durch eine
Kette gedachter Grenzflle verbunden sind.
4.2Ambiguitt
Ambiguitt oder Mehrdeutigkeit tritt in ver-
schiedenen Formen und in den verschieden-
sten Sprachbereichen auf. Lexikalische Am-
biguitt wird traditionell mit dem Begriffs-
paar Homonymie/Polysemie weiter unter-
schieden. Homonyme sind unterschiedliche
lexikalische Einheiten, die zufllig (oder auf-
grund einer dem Sprecher nicht mehr gegen-
wrtigen etymologischen Beziehung) identi-
sche phonetische (Homophone) oder ortho-
graphische (Homographen) Reprsentatio-
nen haben. Beispiele sind Schlo und Bank.
Polyseme sind dagegen Wrter mit mehreren
verwandten Lesarten, die typischerweise
durch metaphorische oder metonymische
Prozesse aufeinander bezogen sind. Polyse-
mien knnen idiosynkratisch sein (grn fr
Farbe und Reifezustand, Birne fr die Frucht
und die Glhbirne, etc.). Es gibt jedoch wich-
tige Formen systematischer Polysemie, die
das Lexikon durchziehen. Nach Bierwisch
(1979) ergeben sie sich dadurch, da ein Kon-
zept in verschiedenen Domnen oder auf
verschiedenen Abstraktionsstufen realisiert
wird. Beispiele fr systematische Polysemien
sind die aktual/dispositionell-Unterscheidung
(etwa bei schnell und Klavier spielen) und die
Gebude/Institution-Ambiguitt (z. B. Uni-
versitt, Amtsgericht). Die Frage nach kon-
kreten Abgrenzungskriterien zwischen Ho-
monymie und Polysemie wird weiter unten
noch einmal zur Sprache kommen. Die
mensionalitt vs. Eindimensionalitt (bzw.
Vagheit in einer Bewertungsdimension) ver-
bucht werden. Interessant ist die Unterschei-
dung zwischen (a) und (b), die wiederum Gat-
tungssubstantive betrifft. Mit (a) charakteri-
siert Haack das in Wittgenstein (1953) am
Beispiel des Ausdrucks Spiel beschriebene
Phnomenen der Familienhnlichkeit. (b) be-
schreibt die Situation bei Termini wie dem
Quineschen tributary (Nebenflu), wo alter-
native Definitionskriterien zu leicht unter-
schiedlichen Begriffsextensionen fhren (vgl.
Quine 1960: 128). Der Fall (a) betrifft den
alltagssprachlich-kognitiven Zugriff ber ste-
reotypische Merkmale, die fr eine bestimmte
Gattung charakteristisch, aber weder notwen-
dig noch hinreichend sind. Fall (b) betrifft
Probleme, die sich beim Versuch fachsprach-
lich-verbindlicher Referenzbestimmung erge-
ben. Die beiden Vagheitsarten lassen sich
demnach den beiden Komponenten des Put-
namschen Bedeutungsbegriffs zuordnen (Put-
nam 1975b). Bei Spiel ist die psychologische,
bei Nebenflu die referentielle Ebene domi-
nierend. Zustzliche Unbestimmtheit ergibt
sich bei Ausdrcken, bei denen umgangs-
sprachliche Verwendung und fachsprachliche
Przisierung(en) konkurrieren, durch die
berlagerung der beiden Ebenen.
Schlielich wird im Zusammenhang mit
Gattungssubstantiven gelegentlich die Unter-
scheidung zwischen extensionaler und inten-
sionaler Vagheit errtert. Semantische Unbe-
stimmtheit ist in diesem Artikel bisher nur auf
der Ebene der Extensionen behandelt worden.
Da semantische Eigenschaften streng exten-
sional von der zuflligen Existenz bestimmter
Grenzflle und ihrem Verhalten abhngig ge-
macht werden, ist offenbar inakzeptabel.
Aber auch die intensionale Definition der
Vagheit ber mgliche Grenzflle ist nicht
problemlos mglich. Waismann (1951) fhrt
aus, da bei gengender Abweichung von den
Gegebenheiten der realen Welt die Anwen-
dung aller Gattungsbegriffe hoch problema-
tisch wird; sie sind typischerweise ostensiv,
nicht durch Definition eingefhrt, und behal-
ten Stabilitt und Przision nur unter den
natrlichen Bedingungen unserer Welt.
Diese von Waismann als open texture oder
Porositt bezeichnete intensionale Eigen-
schaft natrlich-sprachlicher Begriffe ist
sprachphilosophisch und wissenschaftstheo-
retisch bedeutsam. Fr die Semantik natr-
licher Sprachen ist jedoch die Unterscheidung
zwischen extensionaler und intensionaler Vag-
heit ber das Grundstzliche hinaus nicht sehr
264 IV. Kontexttheorie
vorgeschlagenen Abgrenzungskriterien fh-
ren dabei zu einer zustzlichen, domnenab-
hngigen internen Differenzierung des Am-
biguittsbegriffs.
4.3Zur Abgrenzung von Vagheit und
Ambiguitt
Im Abschnitt 1 ist eine Unterscheidung zwi-
schen Vagheit und Ambiguitt fr die Satz-
ebene grob umrissen worden, die sich folgen-
dermaen verallgemeinern lt: Vage Aus-
drcke haben ein unbestimmtes Denotat; am-
bige Ausdrcke besitzen mehrere alternative
Denotate. Kit Fine charakterisiert die Bezie-
hung zwischen den beiden Phnomenen fol-
gendermaen:
Vague and ambiguos sentences are subject to si-
milar truth-conditions; a vague sentence is true if
true for all complete precisifications; an ambigous
sentence is true if true for all disambiguations. (...)
However, how we grasp the precisifications and
disambiguations, respectively, is very different. (...)
disambiguations are distinguished; to assert an am-
bigous sentence is to assert, severally, each of its
disambiguations. (...) precisifications are extended
from a common basis and according to common
constraints; to assert a vague sentence is to assert,
generally, is precisifications. Ambiguity is like the
super-imposition of several pictures, vagueness like
an unfinished picture, with marginal notes for com-
pletion. (Fine 1975: 282 f)
Entsprechend besitzen Vagheit und Ambigui-
tt unterschiedlichen kommunikativen Sta-
tus: Im Falle von randbereichsunscharfen
Substantiven, Verben, Farbadjektiven ist die
Unbestimmtheit ein von Sprecher und Hrer
akzeptierter weitgehend unbemerkter Be-
standteil des jeweiligen Wortsinnes. Bei Ho-
monymen und referentiell mehrdeutigen
Kennzeichnungen dagegen legt der Sprecher
immer einen bestimmten semantischen Wert
zugrunde. Unbestimmtheit tritt nur unter der
Hrerperspektive auf, und zwar in dem Fall,
da das Kontextwissen des Hrers nicht die
zur Desambiguierung erforderlichen relevan-
ten Kontextdaten umfat. Es gibt keine un-
bestimmte Lesart des ambigen Ausdrucks.
Unbestimmtheit als Wahrheitszustand ist
zwar mglich, aber nur als kommunikativer
Unglcksfall, der umgehend behoben werden
mu: Ambige Ausdrcke sind, im Gegensatz
zu vagen, desambiguierungs- bzw. przisie-
rungsbedrftig.
Dies Przisierungsgebot als Eigenschaft
ambiger Ausdrcke ist einleuchtend und auf
die genannten Beispiele offenbar zutreffend.
In weniger prototypischen Fllen knnen In-
Schwierigkeit, przise Kriterien, die ber den
vagen Begriff der Worteinheit hinausgehen,
mit konventionellen Mitteln zu formulieren,
wird ausfhrlich in Lyons (1977) kommen-
tiert.
Ambiguitt kommt in verschiedenen For-
men auch in der Syntax (im weiteren Sinne)
vor. Hier sollen zwei wichtige Ausprgungen
syntaktischer Ambiguitt genannt werden. Bei
Prpositionalphrasen ist oft die Stelle nicht
eindeutig vorgegeben, an der sie in die Kon-
stituentenstruktur des Satzes eingehngt wer-
den mssen (attachment ambiguity).
(46) Hans traf den Mann mit dem Akten-
koffer.
Whrend hier die Ambiguitt darauf beruht,
da fr einen Satz unterschiedliche syntakti-
sche Strukturen im engeren Sinne mglich
sind, betrifft der umfangreichere Komplex der
Skopusambiguitten Alternativen in der lo-
gischen Form.
(47) Alle Linguisten lieben eine Theorie.
Wie in (47) kann Skopusambiguitt durch das
gemeinsame Vorkommen mehrerer Quanto-
ren entstehen; es knnen aber auch Terme,
Modal- und Temporaloperatoren und Ein-
stellungsverben interagieren, wobei es zum
Teil zu recht subtilen, vagheitsartigen Unter-
scheidungen kommt.
Ein dritter prominenter Typ von Ambigui-
tt ist die referentielle Mehrdeutigkeit von
Pronomina und definiten Nominalphrasen,
die hier stellvertretend fr eine grere
Gruppe steht: Alle indexikalischen Ausdrcke
sind potentiell ambig; ihre Unbestimmtheit ist
einfach das Gegenstck ihrer Kontextabhn-
gigkeit. Weiterhin kommt Ambiguitt als
funktionale Mehrdeutigkeit bei Komposita
und Genitivattributen vor, als elliptische
Mehrdeutigkeit bei mehrstelligen Prdikaten
(Verben, relationale Substantive, Kompara-
tiv), bei denen einzelne obligatorische Argu-
mente nicht realisiert sind. Quantoren und
quantifizierende Adverbien sind schlielich
oft im Hinblick auf ihren Bezugsbereich
mehrdeutig.
Die in dieser keineswegs vollstndigen
Aufzhlung genannten Ambiguittsph-
nomene stellen die Sprachtheorie vor unter-
schiedliche Probleme. Fr deren Behandlung
ist jedoch nicht die Semantik zustndig, son-
dern die linguistischen Teildisziplinen, in de-
ren Gegenstandsbereich die Ambiguitten je-
weils auftreten. Hier soll im folgenden nur die
generelle Frage betrachtet werden, wie sich
Ambiguitt insgesamt gegen Vagheit abgren-
zen lt. Die verschiedenen in der Literatur
11. Vagheit und Ambiguitt 265
gestellten Ferrari und einen 2 CV, der mit 80
km/h durch ein Wohngebiet rast, kann man
schlecht unter der Bezeichnung zwei schnelle
Wagen zusammenfassen.
Die Sichtung der beiden Ambiguittskri-
terien ergibt also im Resultat eine Untertei-
lung der Ambiguittsphnomene: Bei einer
starken Form der Ambiguitt stehen die Les-
arten isoliert nebeneinander; bei einer schwa-
chen Form existiert eine einheitliche unbe-
stimmte Basislesart. Diese Unterscheidung
deckt sich zumindest in der Tendenz mit dem
Wahrscheinlichkeitskriterium, das die tradi-
tionelle Philosophie fr die Homonymie/
Polysemie-Distinktion bei lexikalisch mehr-
deutigen Ausdrcken verwendet. Beide Arten
von Ambiguitt grenzen sich gegen den Rest
der Unbestimmtheitsphnomene dadurch ab,
da man ihre Lesarten nicht zu einer umfas-
senden Lesart erweitern kann.
Dieser Rest der Unbestimmtheitsphno-
mene wrde, der bisher eingefhrten Termi-
nologie entsprechend, insgesamt unter den
Begriff Vagheit fallen. Auch hier mu jedoch
eine zustzliche Unterscheidung getroffen
werden. Randbereichsunscharfe Substantive,
bei denen bestimmte Standardprzisierungen
ausgeprgt sind, fallen nicht unter das Un-
vereinbarkeitskriterium. Trotzdem kann man
sie mit gleichem Recht als mehrdeutig wie als
vage bezeichnen. Das Farbprdikat rot fllt
dagegen eindeutig unter die vagen Ausdrcke.
Hier scheint ein Kriterium zu greifen, das im
Abschnitt 3 schon angesprochen wurde: Ein
Ausdruck ist mehrdeutig, wenn er ber eine
begrenzte Zahl diskreter Lesarten verfgt,
vage, wenn ein Kontinuum mglicher Przi-
sierungen vorliegt. Man darf dieses Anzahl-
kriterium nicht schematisch anwenden: Ein-
faches Abzhlen von Lesarten ist wegen flie-
ender bergnge und berlagerungen
schlecht mglich; man wird denselben Aus-
druck als mehrdeutig und als vage bezeich-
nen, je nachdem man auf die grundstzliche
Unbestimmtheit des Zwischenbereiches oder
auf faktisch ausgeprgte Konturen in diesem
Bereich abhebt. Allerdings verweist die Kon-
tinuittsbedingung auf eine wesentliche Ei-
genschaft vager Ausdrcke: Wegen des kon-
tinuierlichen bergangs von positiven zu ne-
gativen Anwendungsfllen stellt bei ihnen
jede przise Grenzziehung einen ungerecht-
fertigt scharfen Schnitt dar. In erster Nhe-
rung kann man diese Feststellung zu einem
Przisierungsverbot fr vage Ausdrcke um-
mnzen, das dem Przisierungsgebot bei am-
bigen Ausdrcken entspricht. Tatschlich
tuitionen ber die Notwendigkeit von Des-
ambiguierungen jedoch problematisch wer-
den. In Lakoff (1970a) wird ein Test vorge-
schlagen, der die Unterscheidung zwischen
Ambiguitt und Vagheit auf die Wahrheits-
beurteilung von Stzen reduziert. Lakoffs
Beispiel ist (48). Der Test kann auerdem mit
allen Konstruktionen durchgefhrt werden,
in denen mit einem syntaktischen Vorkom-
men des fraglichen Prdikats gleichzeitig zwei
oder mehrere Prdikationen vorgenommen
werden (z. B. Satzteilkoordination, universelle
Quantifikation).
(48) John hit the wall, and so did Bill.
(49) John schlug gegen die Wand, und Bill
auch.
Unter der Voraussetzung, da John gegen die
Wand prallt und Bill dagegen hmmert, be-
sitzt Satz (48) (wie seine deutsche Entspre-
chung (49)) keine verifizierende Lesart. Es
gibt nmlich (nach Lakoff wenigstens) keine
umfassende Przisierung des Verbs hit, die die
Lesarten Ereignis und Aktion einschliet:
hit ist ambig im Gegensatz zu den vagen
Prdikaten gro, begabt und Spiel: Sie besit-
zen zu zwei unterschiedlichen Przisierungen
immer eine allgemeinere Lesart, die beide ein-
bezieht, und es ist deshalb nicht mglich, mit
ihnen unerfllbare Stze nach dem Muster
(48)/(49) zu konstruieren.
Das Kriterium fr Ambiguitt, das dem
Text zugrundeliegt, lt sich folgendermaen
formulieren: Ein Ausdruck ist ambig, wenn
er unvereinbare Przisierungen besitzt. Dies
Unvereinbarkeitskriterium und das zuvor for-
mulierte Przisierungsverbot scheinen auf
dasselbe hinauszulaufen. Tatschlich zieht das
letztere die Grenzen jedoch etwas enger als
das erste: Unvereinbarkeit der Lesarten be-
sagt, da keine umfassende Lesart mit maxi-
malem Umfang vorhanden ist. Das Przisie-
rungsgebot hngt darber hinaus mit dem
Fehlen einer maximal unbestimmten Basis-
interpretation zusammen. Tatschlich scheint
es, vor allem im Bereich systematischer Poly-
semien, Beispiele fr unbestimmte Ausdrcke
zu geben, die zwischen die beiden Grenzen
fallen: Ein Kind, das zur Schule geht,
braucht sich im Normalfall nicht zu entschei-
den, ob es die Institution oder das Gebude
meint; mit dem Satz Das war ein schneller
Wagen, mit dem man auf der Autobahn einen
rasant berholenden Ferrari kommentiert,
legt man sich nicht unbedingt auf eine der
Lesarten aktual oder dipositionell fest. Der
Ambiguittstest ist jedoch positiv: Einen ab-
266 IV. Kontexttheorie
tere Krnchen. Was vorher kein Sandhaufen
war, kann nicht durch Hinzufgen eines ein-
zelnen Krnchens ein Sandhaufen werden. Es
gilt also: Wieviel Krnchen Sand man auch
immer zusammenlegt, sie bilden keinen Sand-
haufen.
Plausible Prmissen ergeben hier ein offen-
bar falsches, mit der Realitt unvereinbares
Resultat. Die Inkonsistenz basiert auf der
Vagheit des Prdikates Sandhaufen (andere
bekannte Versionen verwenden kahlkpfig
und rot). Die Plausibilitt der Prmissen be-
ruht darauf, da sie in kleinen Schritten von
einem Anwendungsfall zum nchsten, nur un-
wesentlich davon verschiedenen Anwen-
dungsfall bergehen. Wegen der Irrelevanz
des Unterschiedes kann man keinen einzelnen
der bergnge zurckweisen; zusammenge-
nommen ergeben sie das offenkundig falsche
Resultat.
Das Argumentationsschema des Sorites
lt sich auf zwei Arten formal reprsentie-
ren, die unter (51) und (52) wiedergegeben
sind.
(mit Fx x ist kein Sandhaufen)
geht sie viel weiter: Sie luft auf die Unmg-
lichkeit hinaus, fr vage Ausdrcke ber-
haupt Denotatgrenzen festzulegen, und damit
auf deren inhrente Inkonsistenz. Von dieser
wird im folgenden Abschnitt die Rede sein.
Fr den Zwischenbereich zwischen genui-
ner Vagheit und echter Ambiguitt bietet sich
der Terminus Verwendungsvielfalt an. Da-
mit erhlt man fr den Gesamtbereich inde-
finiter Ausdrcke das Klassifikationsschema
(50).
5. Das Grenzziehungsproblem und
topologische Vagheitstheorien
5.1Unbegrenztheit und Inkonsistenz
Vagheit im engeren Sinne liegt bei Ausdrk-
ken vor, bei denen der bergang zwischen
Positiv- und Negativbereich kontinuierlich
ist. Mit der Kontinuitt des bergangs ist
eine Eigenschaft verknpft, die fr die Se-
mantiktheorie problematischer ist, als alle bis-
her behandelten Aspekte von Unbestimmt-
heit: Kontinuierliche bergnge lassen es
nicht zu, da sinnvolle Denotatgrenzen ge-
zogen werden. Dieser Sachverhalt wird in
einem Argumentationsschema explizit ge-
macht, das in einer Version als Sorites oder
Haufenparadox bekannt ist. Sie wird im fol-
genden in umgangssprachlicher Form wieder-
gegeben:
Ein Krnchen Sand bildet keinen Sand-
haufen. Legt man ein zweites Krnchen dazu,
erhlt man auch noch keinen Sandhaufen.
Das gleiche gilt fr das dritte und jedes wei-
11. Vagheit und Ambiguitt 267
semantische Irrelevanz geringfgiger Unter-
schiede ist als semantische Toleranz konsti-
tutiver Bestandteil vager Begriffe. Theoretisch
kann man fr einen vagen Ausdruck przise
Denotatgrenzen festlegen. Damit gibt man
jedoch wesentliche Aspekte seiner natrlichen
Bedeutung und seine unproblematische Ver-
wendbarkeit im normalsprachlichen Diskurs
auf.
Dummett (1975) und, mit Bezug darauf,
Kamp (1981c) fhren das Farbprdikat rot
als Beispiel an. Sein Denotat lt sich in Form
eines Frequenzintervalls przise festlegen.
Wenn man dies tut, befinden sich aber auf
beiden Seiten der Denotatsgrenze Farbtne,
die wahrnehmungsmig nicht unterscheid-
bar sind. Rot ist nicht lnger ein Beobach-
tungsprdikat; die Grundlage fr die unpro-
blematische Verwendung der Farbwrter
gleichaussehende Objekte fallen unter das
gleiche Prdikat entfllt. Wright (1975)
fhrt zu den Prdikaten child und adult fol-
gendes aus:
Without tolerance these predicates (...) could no
longer substain the explanatory role which they
now have for us (...) That predicates of degree of
maturity possess tolerance is a direct consequence
of their social role; very small differences cannot
be permitted to generate doubt about their appli-
cation without correspondingly coming to be as-
sociated with a burden of moral and explanatory
distinctions which they are too slight to convey.
(Wright 1975: 337)
Pinkal (1985) zeigt in Anlehnung an Quine
(1960), da auch umgangssprachliche Ma-
angaben mit Toleranzen verwendet werden
mssen. Interpretiert man Maangaben wie
1,80 m gro (fr Personen) und 687 km lang
(fr Flsse) als vllig przise, werden sie prak-
tisch unanwendbar. Das liegt in erster Linie
nicht daran, da es Grenzen fr die Mege-
nauigkeit gibt, sondern an der Tatsache, da
unterhalb gewisser Toleranzgrenzen die Me-
vorschriften vage werden, und mit groem
Aufwand in unnatrlicher Weise fixiert wer-
den mten.
Die Konsequenz dieser Beispiele besteht
darin, da man eine Relation des irrelevanten
Unterschiedes oder Toleranzrelation als to-
pologische Bedeutungskomponente explizit in
die semantische Beschreibung vager Aus-
drcke aufnimmt. Die Toleranzrelation ist
symmetrisch und reflexiv, aber nicht transitiv.
Sie wird im folgenden als notiert (mit F-
Superskript fr das jeweilige Prdikat). Die
Sorites-Problematik ergibt sich, kurz gesagt,
daraus, da die nicht-transitive F-Relation
(mit F* (n) = n Krnchen Sand bilden keinen
Sandhaufen)
Auf die beiden Versionen wird im folgen-
den mit Modus-Ponens-Variante bzw. All-
satzvariante referiert. In (51) ergibt sich das
falsche Resultat aus einer beliebig langen
Folge von Modus-Ponens-Schlssen. In (52)
wird das Schluverfahren der mathemati-
schen Induktion angewandt.
Metrische Vagheitstheorien legen eine ein-
fache Lsung des Problems nahe. Entspre-
chende Vorschlge sind sowohl fr die fuzzy
logic (Goguen 1969) als auch fr die Super-
valuationssemantik (Thomason 1973) ge-
macht worden. Der Wahrheitsgrad der Fa
k
-
Prdikationen bzw. die Menge der verifizie-
renden Komplettierungen nimmt beim ber-
gang vom Positiv- zum Negativbereich kon-
tinuierlich ab; die Prmissen Fa
k
Fa
k + 1
er-
halten deshalb nicht 1, sondern einen etwas
niedrigeren Wahrheitswert zugewiesen. Die
wiederholte Anwendung der fast-wahren Pr-
missen in der Modus-Ponens-Regel ergibt fr
die Resultate in bereinstimmung mit den
Voraussetzungen immer schwchere Wahr-
heitsgrade. Dies gilt fr die Modus-Ponens-
Variante. Fr die Allsatzvariante ergibt sich
im Supervaluationsrahmen ebenfalls eine
berraschend einfache Lsung: In jeder klas-
sischen Komplettierung der Prmisse B ist
genau eine Instantiierung falsch, und damit
der gesamte Allsatz. In der Supervaluation ist
die Prmisse B also eindeutig falsch, obwohl
jede Instantiierung fast wahr ist.
Ein anderer Weg, das Konsistenzproblem
der Sorites-Argumentation zu lsen, besteht
darin, da man den Wahrheitswert der Pr-
missen nicht generell zurcknimmt, sondern
ihre Bewertung vom Kontext abhngig
macht. Dies wird in Kindt (1983) und hnlich
in Veltman (1986) vorgeschlagen: Im Nor-
malfall erlaubt die Semantik vager Ausdrcke
Schlsse von einem Anwendungsfall auf einen
nahe verwandten. Falls erforderlich, kann sie
so weit verfeinert werden, da die Implikatio-
nen ungltig werden und damit die Ableitung
falscher Resultate blockiert wird.
Diesen Vorschlgen steht die Auffassung
gegenber, da die Inkonsistenz, die im So-
rites zutage tritt, eine inhrente Eigenschaft
der Bedeutung vager Ausdrcke ist, die nicht
wegerklrt werden darf, sondern von der Se-
mantiktheorie modelliert werden mu. Die
268 IV. Kontexttheorie
ranzprinzip zur Geltung. Es verbietet grob
gesagt, Fa und Fa gleichzeitig in einen
Kontext zu integrieren, wenn fr die deno-
tierten Individuen und gilt.
Der Formalismus sieht in groben Zgen
folgendermaen aus: Kamp definiert einen
Kontext C als eine ber (Ableitbarkeit)
abgeschlossene Satzmenge. Der Ableitbar-
keitsbegriff soll schwcher sein als der klas-
sische; er wird zunchst undefiniert voraus-
gesetzt. Wird im Kontext C ein neuer Satz A
akzeptiert, erhlt man als resultierenden Kon-
text C die -Hlle ber C {A}. Stze er-
halten ihren Wahrheitswert relativ zu Kon-
texten. Alle Stze aus C sind wahr (relativ zu
C), aber nicht alle wahren Stze (relativ zu
C) sind in der Regel Elemente von C. Insbe-
sondere ist mit Fa C und immer auch
Fb wahr, ohne da Fb damit automatisch
zum Kontext gehrt. In dem Fall, da die
Integration eines Satzes den Kontext inkon-
sistent machen wrde, darf er nicht in den
Kontext integriert werden, auch wenn er re-
lativ zum Kontext wahr ist. In einer Impli-
kation setzt der Vordersatz schlielich analog
zur Anaphernbehandlung in der Diskursre-
prsentationstheorie den Kontext, der fr die
Interpretation des Hintersatzes magebend
ist.
Vage Prdikate lassen sich im Diskurs kon-
sistent verwenden, solange zwischen positiven
und negativen Prdikationen ausreichender
Abstand (in bezug auf F) besteht. Fr die
Modens-Ponens-Variante des Sorites ergibt
Kamps Theorie die folgende Analyse: Die Im-
plikationen Fa
k
Fa
k + 1
sind wahr, da der
Vordersatz jeweils einen Kontext setzt, in dem
wegen
k
k+1
die Wahrheit des Hintersat-
zes garantiert ist. Durch das Toleranzprinzip
wird jedoch die Integration der Prmissen in
den Kontext verhindert, wenn sie zu F-Pr-
dikationen ber Individuen fhren, die in der
unmittelbaren Umgebung des negativen De-
finitbereiches liegen. Fr die Allsatzva-
riante des Sorites nimmt Kamp an, da die
universelle Prmisse (B in 52) falsch ist, ob-
wohl alle Instantiierungen wahr sind.
Diese Annahmen sind offenbar mit der
klassischen Logik unvereinbar. Kamp spezi-
fiziert keine alternative Logik, sondern stellt
nur die folgende allgemeine Betrachtung an:
Der Begriff der Folgerung ist sinnvollerweise
auf die Menge konsistenter Kontexte zu de-
finieren. Was ein konsistenter Kontext ist,
hngt von der Spezifikation des nur partiell
festgelegten Ableitungsbegriffs ab. Damit
ist der Folgerungsbegriff eine Funktion des
die transitiven Implikations- (bzw. quiva-
lenz-) Beziehungen begrndet, die zusammen-
genommen das inkonsistente Resultat erge-
ben.
Die wahrheitsmetrischen Anstze lsen das
Problem, indem sie die Begrndungsbezie-
hung () relativieren und die -Relation
damit fr die Semantik unbercksichtigt las-
sen. Kindt und Veltman lassen zu, da die
-Relation kontextuell variiert (was sicher
angemessen ist) und im Sorites-Fall beliebig
verfeinert wird, was zu bedenklichen Konse-
quenzen fr die Semantik vager Ausdrcke
fhrt, wie die oben angefhrten Beispiele zei-
gen. Kamp (1981c) und Pinkal (1985) entwik-
keln dagegen Vorschlge fr eine Vagheits-
semantik, die die Beziehung unter (53) be-
rcksichtigt, und damit die latente Inkonsi-
stenz vager Ausdrcke akzeptiert. Indem die
Theorien partielle Diskursmodelle und ein dy-
namisches Interpretationskonzept zugrunde-
legen werden, erhalten normale Verwendun-
gen vager Ausdrcke jedoch konsistente In-
terpretationen.
5.2Topologisch basierte Vagheitstheorien
Hier sollen die Anstze von Kamp (1981c)
und Pinkal (1985) (erweitert in Pinkal 1990)
skizziert werden. Ein topologisch basierter
vagheitstheoretischer Formalismus wird
auerdem in Kindt (1983) vorgeschlagen;
Kindts Theorie bezieht die -Topologie auf
eine fuzzy-logische Wahrheitsmetrik und be-
trachtet sie, wie bereits erwhnt, als beliebig
verfeinerbar.
Ausgangspunkt von Kamps Vagheitstheo-
rie (und in Anlehnung daran derjenigen von
Pinkal (1985), (1990)) ist das Konzept der
dynamischen Interpretation, das Kamp als
Diskursreprsentationstheorie fr die Bewer-
tung anaphorischer Ausdrcke in Kamp
(1981 a) entwickelt hat. Im Diskursverlauf
wird eine endliche Reprsentation ein Dis-
kursuniversum zusammen mit einer Menge
von Bedingungen ber dessen Elementen
sukzessive aufgebaut. Semantische Invarian-
ten sind die Mengen definiter (positiver und
negativer) Anwendungsflle sowie eine Tole-
ranzrelation fr jedes Prdikat F. Die de-
finiten Flle sind automatisch in jedem Kon-
text (jeder Diskursreprsentation) enthalten.
Die Toleranzrelation kommt ber ein Tole-
11. Vagheit und Ambiguitt 269
weiterung wesentliche formale Eigenschaften
aufgegeben, als wichtigste die Transitivitt des
Folgerungsbegriffs. Der praktische Folge-
rungsbegriff spiegelt damit die strukturellen
Eigenschaften der ~ -Relation.
Die Zulssigkeitsbeschrnkungen im An-
satz von Pinkal (1985) werden nur im Falle
expliziter Referenz auf ein Individuum akti-
viert. Die Interpretation der universellen Pr-
misse in der Allsatz-Variante fllt deshalb mit
der Standard-Supervaluation zusammen. Sie
ist einfach falsch. In Kamp (1981c) wird ihr
der Wert F trotz Wahrheit aller Instantiierun-
gen zugewiesen, mit der einzigen Begrndung,
da sonst unmittelbare Inkonsistenz die Folge
wre. Beide Vorschlge sind in diesem Punkt
nicht zufriedenstellend. In Pinkal (1990) wer-
den berlegungen zur Allsatz-Variante an-
gestellt, die auch die Beziehung von Vagheit
und Quantifikation im allgemeinen betreffen.
Die Beschreibung der Interaktion von All-
quantor und lokalen Konsistenzregeln wird
mithilfe von Tableau-Verfahren und ihrer
Technik der selektiven Instantiierung vorge-
nommen: Der Allsatz ist wahr, die Konklu-
sion aufgrund der restriktiven Instantiie-
rungsregel jedoch nicht ableitbar.
6. Literatur (in Kurzform)
Ballmer/Pinkal 1983 Bierwisch 1979 Black
1937 Blau 1978a Blau 1982 Dummett 1975
Eikmeyer/Rieser 1983 Erdmann 1910 Fine
1975 van Fraassen 1969 Goguen 1969 Haack
1974 Hoepelman 1986 Kamp 1975 Kamp
1981a Kamp 1981c Kindt 1983 Kleene 1952
Klein 1980 Lakoff 1970a Lakoff 1973 Lewis
1970 ukasiewicz 1930 Lyons 1977 Morgan/
Pelletier 1977 Naess 1975 Peirce 1902 Peters
1979 Pinkal 1977 Pinkal 1979 Pinkal 1980/81
Pinkal 1983 Pinkal 1984 Pinkal 1985 Pinkal
1990 Post 1941 Putnam 1975b Quine 1960
Rescher 1969 Russell 1923 Shortliffe 1976 Tho-
mason 1973 Todt 1980 Ullmann 1957 Veltmann
1986 Wahlster 1981 Waismann 1951 Wittgen-
stein 1953 Wright 1975 Zadeh 1965 Zadeh 1975
Manfred Pinkal, Saarbrcken
(Bundesrepublik Deutschland)
Ableitungsbegriffs: Es gibt eine Abbildung,
die unterschiedlichen Ableitungsrelationen
unterschiedliche Folgerungsrelationen zuord-
net. Diese Abbildung ist, wie sich zeigen lt,
monoton, besitzt also Fixpunkte. Die Fix-
punkte (an denen sich Ableitungs- und Fol-
gerungsbegriff decken) wren Kandidaten fr
eine alternative Vagheitslogik.
Pinkal (1985) bernimmt Kamps Konzept
der kontextuellen Dynamik, entwirft aber
eine Vagheitstheorie, deren Gltigkeits- und
Folgerungsbegriff die klassischen Begriffe
einschlieen. Der Ansatz verbindet topologi-
sche und supervaluationssemantische Ele-
mente in der folgenden Weise: Die Semantik
vager Ausdrcke wird einerseits durch ein
Przisierungsmodell V, (s. o. 2.2), ande-
rerseits mittels der -Relationen in einer to-
pologischen Modellstruktur reprsentiert,
wobei die quivalenzrelation fr F in V,
mindestens so fein sein mu wie . Zulssig-
keitsbeschrnkungen mit der allgemeinen
Form (54) verlangen als lokale Konsistenzre-
geln, da in der unmittelbaren Umgebung von
explizit in den Diskurs eingebrachten Indivi-
duen keine Denotatgrenzen verlaufen drfen.
(54)
V(Fa) = V(Fb)
Sie etablieren einen automatischen Kontext-
wechselmechanismus, der unter Ausnutzung
des Przisierungsspielraums vager Ausdrcke
jeweils fr ein semantisch homogenes Umfeld
bei den Individuen des Diskursuniversums
sorgt. In der Modus-Ponens-Variante des So-
rites sind die Implikationen jeweils wahr, weil
der Vordersatz eine Przisierung erzwingt, die
den Hintersatz wahr macht. hnlich wie bei
Kamp wird dabei die Grenze des Definitbe-
reiches immer wieder vorverlegt, bis schlie-
lich die lokalen Konsistenzregeln mit der glo-
balen Semantik in Konflikt geraten. Anders
als in Kamps Vorschlag wird die klassische
Logik nicht ersetzt, sondern fr bestimmte
topologische Strukturen jeweils erweitert. Der
entstehende praktische Gltigkeitsbegriff ist
eine Erweiterung des klassischen, da er auf
der Menge aller zulssigen Valuationen (also
einer Teilmenge der Supervaluationen) defi-
niert ist. Entsprechendes gilt fr den Folge-
rungsbegriff. Allerdings werden bei dieser Er-
270
V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Semantic Foundations of Speech Acts
12. Theorien der Satzmodi
Unterschiede zurck, nmlich in der Reihen-
folge der Konstituenten, in der Interpunktion
bzw. Intonation und im Vorkommen einer
weiteren Konstituente. Die von solchen Un-
terschieden konstituierten Formtypen nennt
man Satzmodi (in der traditionellen Gram-
matik meist Satzarten) oder syntaktische
Modi, die damit korrelierten Funktionstypen
(Arten der Bezugnahme auf den jeweiligen
Sachverhalt) illokutionre Rollen, Illokutions-
typen oder semantische Modi.
Von den Satzmodi streng zu unterscheiden
sind die Modi des Verbs (Indikativ, Konjunk-
tiv, Imperativ etc.), obwohl oder gerade weil
hier zum Teil, z. B. beim Imperativ (Verb- und
Satzmodus) enge Zusammenhnge bestehen.
Ferner ist es beraus hilfreich, die Namen
der Satzmodi von denen der damit typischer-
weise verbundenen Illokutionstypen strikt zu
unterscheiden, z. B. fr die Stze (1)(4) wie
folgt:
Satzmodus Illokutionstyp
1 deklarativ
(Aussagesatz)
assertiv
(Aussage)
2 interrogativ
(Fragesatz)
erotetisch
(Frage)
3 imperativ
(Aufforderungssatz)
direktiv
(Aufforderung)
4 exklamativ
(Ausrufesatz)
exklamatorisch
(Ausruf)
Vor einer genaueren Diskussion des Satzmo-
dusbegriffs, der damit verknpften Probleme
und der einschlgigen Theorien soll jedoch
zunchst der sprachphilosophische Hinter-
grund der modernen Satzmodusforschung
umrissen werden.
2. Der sprachphilosophische
Hintergrund
2.1Freges Urteilsstrich
Ausgehend von der Unterscheidung zwischen
dem Ausdrcken eines Urteils und dem be-
grifflichen Inhalt, der mit einem Urteil aus-
1. Einleitung
2. Der sprachphilosophische Hintergrund
2.1 Freges Urteilsstrich
2.2 Wittgensteins Grundlegung semantischer und
pragmatischer Modustheorien
2.3 Die Theorie der Sprechakte Modus als
Illokutionstyp
3. Der Satzmodusbegriff
4. Satzmodusprobleme
5. Satzmodustheorien
5.1 Ein-Ebenen-Theorien
5.2 Zwei-Ebenen-Theorien
5.3 Drei-Ebenen-Theorien
6. Offene Fragen
7. Literaturempfehlungen
8. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
(1) Sie lesen dieses Buch.
(2) Lesen Sie dieses Buch?
(3) Lesen Sie dieses Buch!
(4) Da Sie dieses Buch lesen!
Wer unter normalen Umstnden einen der
Stze (1)(4) uert, nimmt damit in jedem
Fall auf den Sachverhalt Bezug, da sein
Adressat ein situationell nher bestimmtes
Buch liest, aber die Art, in der er darauf Bezug
nimmt, ist von Fall zu Fall in charakteristi-
scher Weise verschieden: Eine uerung von
(1) ist typischerweise eine Feststellung, da
dieser Sachverhalt Tatsache ist, eine ue-
rung von (2) gilt im allgemeinen als Frage
nach der Tatschlichkeit dieses Sachverhalts,
uerungen von (3) als Versuche, den Adres-
saten zur Realisierung dieses Sachverhalts zu
bewegen, und uerungen von (4) als Aus-
druck des Erstaunens ber das Bestehen die-
ses Sachverhalts. Woher die Gemeinsamkeit,
woher die Unterschiede?
Die inhaltliche Gemeinsamkeit, der Sach-
verhaltsbezug, basiert offenbar auf einer for-
malen Gemeinsamkeit, dem Vorkommen der
Konstituenten lesen, Sie und dieses Buch in
allen vier Stzen. Die inhaltlichen Unter-
schiede gehen offenbar ebenfalls auf formale
12. Theorien der Satzmodi 271
sprochenen Satz (cf. Gedankengefge 1923/
25).
Worin besteht nun die distinktive Funktion
des Urteilsstrichs, wenn diese weder zur Ab-
grenzung grammatischer noch handlungsbe-
zogener Modi gedacht ist? Frege zufolge ist
er Mittel zur Kundgebung des Urteils, dient
also zum Vollzug der Behauptung, da ein
ausgedrckter, beurteilbarer und als wahr an-
erkannter Inhalt das Wahre ist. Dennoch
fungiert er nicht so wie etwa der Ausdruck
Es ist wahr, da .... Wird letzterer einem
Satz ohne Urteilsstrich vorangestellt, so
kommt dadurch keine Behauptung zustande,
sondern lediglich ein anderer Satz mit dem-
selben Inhalt. Dieser Satz kann als Konsti-
tuent eines komplexen Satzes vorkommen.
Der Urteilsstrich dagegen kann niemals vor
einem Konstituentensatz innerhalb eines
komplexen Satzes stehen.
Dies ist auch der Grund, warum er nicht
im Sinne von Ich behaupte, da ... gedeutet
werden kann. Allerdings gibt es Parallelen mit
Austins Auffassung explizit performativer
uerungen (s. 2.3): Nur der Satz, dem der
Urteilsstrich vorangestellt worden ist, kann
als wahr oder falsch beurteilt werden; der
gesamte Ausdruck mit dem Urteilsstrich
drckt weder etwas (einen Inhalt) aus, noch
bezeichnet er etwas: Er behauptet etwas, nm-
lich, da der ihm folgende Inhalt wahr ist.
Der Urteilsstrich kann daher auch nicht als
deskriptiver Behauptungsoperator gedeutet
werden: Seine Funktion besteht darin, den
Akt der Behauptung zu konstituieren, nicht
darin, ihn zu beschreiben.
Freges Urteilsstrich kann somit als erste
logische Reprsentation explizit performati-
ver uerungen aufgefat werden, allerdings
mit folgenden Unterschieden zu Austins dies-
bezglicher Theorie: Er soll stets den erfolg-
reichen Vollzug des Behauptungsaktes garan-
tieren, und als wahr nur behaupten, was auch
wahr ist, also nie vor falschen Stzen stehen.
Mit dieser auf Freges System ausgerichteten
Funktion des Urteilsstrichs erwies sich dieser
allerdings als berfordert, wie durch Russells
Paradoxie offenkundig wurde.
2.2Wittgensteins Grundlegung
semantischer und pragmatischer
Modustheorien
Freges Urteilsstrich ist von zwei sprachphi-
losophischen Traditionen her kritisiert wor-
den, die als grundlegend fr alle spteren
Theorien des semantischen bzw. pragmati-
schen Modus angesehen werden knnen. Die
gedrckt wird, reprsentiert Frege in seiner
Begriffsschrift (1879) Urteile wie folgt: Ein
senkrechter Strich (der sog. Urteilsstrich) vor
einer Zeichenverbindung, die fr einen beur-
teilbaren Gehalt steht, gibt an, da dieser
Inhalt, der ansonsten eine blosse Vorstel-
lungsverbindung darstellt, als Urteil ausge-
drckt wird.
Freges Urteilsstrich wird bisweilen als eine
erste formale Reprsentation eines Modus
aufgefat: als Zeichen dafr, da ein be-
stimmter Inhalt behauptet wird. Vor einer
genaueren Deutung dieses Zeichens ist jedoch
darauf hinzuweisen, da Freges Urteilsstrich
nicht an der traditionellen Unterscheidung
grammatischer Modi orientiert war: Frege
war nicht der Meinung, da deklarative Stze,
Imperative und Interrogative wie (1)(3)
denselben Inhalt ausdrcken und sich ledig-
lich im Modus (in dem jeweils vollzogenen
sprachlichen Akt) unterscheiden.
In ber Sinn und Bedeutung (1892) for-
muliert Frege den Unterschied zwischen de-
klarativen, interrogativen und imperativen
Stzen als Unterschied in ihrem Sinn (= In-
halt) und nicht als Unterschied in dem voll-
zogenen sprachlichen Akt: Deklarative Stze
drcken einen Gedanken aus, interrogative
eine Frage und imperative einen Befehl; bei
interrogativen Stzen sind allerdings nur die
Wortfragen gemeint, Satzfragen drcken den-
selben Gedanken aus wie Behauptungsstze
(cf. Der Gedanke 1918/19).
Wie etwa aus Funktion und Begriff (1891)
hervorgeht, hat Freges Trennung des Urtei-
lens von dem, worber geurteilt wird, darin
ihren Grund, da sonst eine bloe Annahme,
das Setzen eines Falles, ohne gleich ber sein
Eintreten zu urteilen, nicht ausdrckbar
wre. Freges Annahme kann allerdings im
Sinne einer bloen Vorstellungsverbindung
nur psychologisch gedeutet werden.
Mit der spter von Gentzen fr seine Theo-
rie des natrlichen Schlieens entwickelten
Idee, neben dem Behauptungsakt einen exter-
nen Akt des eine-Annahme-Machens einzu-
beziehen, ist eine solche Auffassung unver-
trglich.
In spteren Arbeiten (z. B. Grundgesetze
der Arithmetik, Der Gedanke, Gedankenge-
fge) formuliert Frege eine spezifischere und
entpsychologisierte Version der Urteilslehre.
Urteilen ist danach die Tat der Aner-
kennung der Wahrheit eines Gedankens und
das Behaupten ist die Kundgebung dieses
Urteils: Das Urteil wird kundgemacht
durch einen mit behauptender Kraft ausge-
272 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Anla gewesen, den Urteilsstrich einzufhren.
Wittgenstein illustriert seine Version wie folgt:
Denken wir uns ein Bild, einen Boxer in bestimm-
ter Kampfstellung darstellend. Dieses Bild kann
nun dazu gebraucht werden, um jemand mitzutei-
len, wie er stehen, sich halten soll; oder, wie er sich
nicht halten soll; oder, wie ein bestimmter Mann
dort und dort gestanden hat; oder etc. etc. Man
knnte dieses Bild (chemisch gesprochen) ein Satz-
radikal nennen. hnlich dachte sich wohl Frege
die Annahme. (PU, S. 299).
Will man unter Satzradikal Freges begriffli-
chen Inhalt verstehen, so enthlt das Satz-
radikal keinerlei modale (Modus-)Kompo-
nente. Will man das, was der Tractatus-Theo-
rie zufolge ein Satz darstellt (abbildet), als
Satzradikal bezeichnen, so enthlt das Satz-
radikal eine Modus-Komponente, da der Sinn
eines Satzes der Tractatus-Theorie zufolge im
Sinne eines assertorischen Anspruchs (cf.
4.022) auf wahr/falsch-Pole hin gerichtet
ist.
Vor dem Hintergrund dieses Unterschieds
und unter Bercksichtigung obiger Passage
aus den Philosophischen Untersuchungen mu
der fr sptere semantische Modustheorien
einflureiche Versuch von Stenius gedeutet
werden, der Tractatus-Theorie eine Frege-
Version zu geben und sie dadurch mit Witt-
gensteins Sptphilosophie vereinbar zu ma-
chen.
Stenius zufolge lt sich die Bildtheorie des
Satzsinnes nur auf das Satzradikal anwenden.
Jener Teil des Satzsinnes, der durch das Satz-
radikal gegeben ist, ist sein deskriptiver In-
halt, also das, was ein Satz zeigt und als
Bild darstellt.
Nun akzeptiert Stenius aber einerseits
Wittgensteins Auffassung, da das Satzradi-
kal gerichtet ist, und ist andererseits der
Meinung, da es mit einer modalen Kompo-
nente (etwa im Sinne von Freges Urteilsstrich)
verbunden werden mu, um einen Satz zu
bilden, und da es mit verschiedenen Modi
kombinierbar ist.
Der Trick, mit dem Stenius hier Unver-
trgliches zu vereinbaren sucht, besteht in der
Unterscheidung zwischen zwei Arten von
Wahrheit: der deskriptiven Wahrheit eines
Satzradikals und der modalen Wahrheit eines
Satzes. Dieser Trick ist nun aber der Kritik
sowohl des frhen, als auch des spten Witt-
genstein ausgesetzt. Wenn nmlich das Satz-
radikal in bereinstimmung mit 4.022 bereits
eine modale Komponente enthlt, dann ist
nicht einzusehen, wieso es darberhinaus noch
mit einem Modus (etwa i. S. von Freges Ur-
Kernpunkte dieser Kritik finden sich in der
Fregekritik von Wittgensteins Tractatus und
in der Fregekritik von Wittgensteins Philo-
sophischen Untersuchungen. Erstere geht aus
von einer Bildtheorie des Satzes und kritisiert
den nicht-deskriptiven (performativen) Cha-
rakter von Freges Moduszeichen; letztere geht
aus von einer Gebrauchstheorie des Satzes
und kritisiert den deskriptiven (nicht-perfor-
mativen) Charakter von Freges Annahme
sowie seiner anderen Modusbedeutungen.
Peano hatte Freges Urteilsstrich als ber-
flssig zurckgewiesen, da er jedem Theorem
vorangehe. Auch Wittgenstein bezeichnet im
Tractatus Freges Urteilsstrich als logisch be-
deutungslos, allerdings aus einem anderen
Grund: Ein Satz knne nicht von sich selbst
aussagen, da er wahr ist.
Diese Begrndung hat Freges Urteilsstrich
aber bereits im Sinne der Wittgensteinschen
Bildtheorie des Satzes uminterpretiert: Der
Satz zeigt, wie es sich verhlt, wenn er wahr
ist. Und er sagt, da es sich so verhlt.
(4.022)
Da Wittgenstein den Modus hier dem de-
skriptiven Inhalt eines Satzes zurechnet, kann
er Frege die genannte Selbstreferenz eines Sat-
zes unterstellen. Eine solche Identifikation
nimmt Wittgenstein jedoch nur im Fall de-
skriptiver Stze (Stze der Naturwissen-
schaften) vor. Da nur diese Stze fr ihn
Sinn haben, und da zu ihrem Sinn nicht nur
gehrt, was sie darstellen, sondern auch, da
sie dies darstellen, besteht ihr Modus gerade
in ihrer Darstellungsfunktion/Abbildungs-
funktion (cf. 4.031). Dieser Auffassung zu-
folge gibt es also gar keine sinnvollen Stze
mit anderem Modus, ein Verdikt, das auch
Freges Urteilsstrich in seinem intendierten,
nicht-deskriptiven Sinne trifft.
Die linguistisch absurde Konsequenz der
Bildtheorie fr Stze mit anderen Modi wurde
von den logischen Empiristen dadurch zu ver-
meiden versucht, da man fr alle Stze einen
verkappten deklarativen Modus annahm,
eine Auffassung, die in den performativen
Analysen der logischen Semantik weiterlebt,
obwohl ihre berwindung eigentlich schon
bei Frege zu sehen sein mte.
Die Kritik, die Wittgensteins Sptphiloso-
phie an der Bildtheorie des Tractatus vor-
bringt, steht daher trotz der Fregekritik
auch des spten Wittgenstein partiell
durchaus im Einklang mit berlegungen Fre-
ges. Dies betrifft vor allem die Auffassung,
da ein Bild als solches keinen Modus besitzt.
Eine berlegung dieser Art war fr Frege der
12. Theorien der Satzmodi 273
worden. Ebenso hat erst Austin in seiner
Theorie der Sprechakte das Instrumentarium
bereitgestellt, mit dem sich die Wittgenstein-
sche Vorstellung vom Modus als Art der Ver-
wendung von Stzen und d. h. als Typ sprach-
licher Handlungen przisieren lt.
2.3Die Theorie der Sprechakte Modus
als Illokutionstyp
Wie Wittgenstein kritisiert Austin den de-
skriptiven Fehlschlu der philosophischen
Tradition: da die primre Funktion der
Sprache darin bestnde, ber die Welt zu
reden. Die vielfltigen Gebrauchsweisen der
Sprache, die Wittgensteins Sprachspiele die-
sem Fehlschlu entgegenhalten, hat Austin in
seiner Theorie der Sprechakte zu systematisie-
ren versucht.
Ausgehend von der Frage, in welcher Hin-
sicht man sagen kann, da mit uerungen
Handlungen vollzogen werden, unterscheidet
er drei Aspekte solchen Handlungsvollzugs:
(a) den lokutionren Akt als den Akt des
Etwas-Sagens. Bei diesem Akt des Etwas-Sa-
gens lassen sich die folgenden Aspekte unter-
scheiden: Der phonetische Akt besteht darin,
da Laute der Art geuert werden, wie sie
von der Phonetik beschrieben werden; der
phatische Akt besteht darin, da Wrter nach
den grammatischen Konstruktionsregeln
einer Sprache, mit einer bestimmten Intona-
tion etc. geuert werden; der rhetische Akt
besteht darin, da ber etwas gesprochen
wird (reference) und darber etwas gesagt
(sense) wird.
(b) den illokutionren Akt als jene Hand-
lungen, zu deren Vollzug das im lokutionren
Sinne Gesagte gebraucht wird, also z. B. um
eine Behauptung aufzustellen, ein Verspre-
chen zu geben, eine Frage zu stellen, einen
Befehl zu geben, zu warnen etc. Der illoku-
tionre Akt reprsentiert jenen Aspekt
sprachlicher Handlung, auf den sich Wittgen-
stein primr bezog, wenn er ber die Ge-
brauchsweise von Stzen redete.
(c) den perlokutionren Akt als einen Akt,
der dadurch zustandekommt, da mit einer
uerung bestimmte kausale Wirkungen auf
die Gefhle, Gedanken oder Handlungen der
Adressaten erzielt werden. Beispiele sind: je-
manden berzeugen, jemanden berreden, je-
manden krnken, jemanden von etwas ab-
halten etc.
Wittgensteins pragmatische Auffassung
der Modi lt sich in Austins Theorie wie
folgt wiedergeben: Ein Modus ist ein illoku-
tionrer Typ. Diese Charakterisierung setzt
teilsstrich) kombiniert werden mu; auf der
Basis von 4.022 wrde dies geradezu in einen
Regre fhren. Da andererseits fr das Satz-
radikal unabhngig von dem Modus, mit
dem es kombiniert ist kein gerichteter
Sinn im Sinne von deskriptiven wahr/falsch-
Polen angenommen werden kann, soll Witt-
gensteins Bild des Boxers gerade demonstrie-
ren. Danach knnen fr ein Satzradikal erst
dann Wahrheitsbedingungen identifiziert wer-
den, wenn vorausgesetzt wurde, da es in
einem assertorischen Illokutionstyp ge-
braucht wird.
Dem spten Wittgenstein zufolge luft die
Auffassung, die Bedeutung eines Satzes sei
durch Angabe seiner Wahrheitsbedingungen
zu spezifizieren, darauf hinaus, fr jeden Satz
einen assertorischen Typ anzunehmen. Aber
genau diese Auffassung von der primr de-
skriptiven Funktion der Sprache, die nicht
nur die Tractatus-Theorie, sondern auch die
Theorie Freges kennzeichnet, hat er entschie-
den bekmpft. Seiner eigenen Auffassung
nach mu man, um Stze in der wahr/falsch-
Dimension bewerten zu knnen, die Bedeu-
tung dieser Stze schon kennen, und nicht
jeder Satz hat eine Bedeutung, die es zult,
ihn in dieser Dimension zu bewerten. Der
assertorische Modus (Typ) ist einer unter vie-
len, und wieviele Modi es gibt, bestimmt sich
danach, wie Stze gebraucht werden knnen.
Damit wird der Modus von Stzen von deren
Form vllig abgelst: Die (modale) Art eines
Satzes bestimmt sich nach der Art seiner Ver-
wendung (cf. PU 2124).
Eine Theorie der Modi als Gebrauchswei-
sen von Stzen impliziert, da die Auffassung,
jeder Satz liee sich formal in einen Modusteil
und einen Satzradikalteil mit korrespondie-
renden sprachlichen Handlungen analysieren,
nicht aufrechtzuerhalten ist. Wittgensteins
diesbezgliche Kritik an Frege, sein Urteils-
strich fungiere wie ein Zeichen des Satzes,
nach dem der Behauptungsakt vollzogen
werde, etwa so, wie man nach Noten singt
(PU 22), beruht allerdings auf einer Fehl-
deutung, die damit zusammenhngt, da
Wittgenstein noch nicht ber eine Theorie der
explizit performativen uerungen im Sinne
Austins verfgte.
Freges Urteilsstrich ist gerade nicht als ein
Satzzeichen zu verstehen, das als Reprsen-
tation des deskriptiven Es wird behauptet,
da ... gedeutet werden kann. Eine Analyse
jener Art von Ausdrcken, als deren formale
Reprsentation Freges Urteilsstrich gelten
kann, ist erst von J. L. Austin vorgenommen
274 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
geschaffen; nicht nur, indem sich nun auf den
explizit performativen Charakter dieses Mo-
duszeichens verweisen lt, sondern auch da-
durch, da die Art der Bewertung von ue-
rungen von deren Illokutionstyp und damit
ihrem Modus abhngig gemacht wird. In sei-
ner Zwei-Dimensionen-Theorie ist dies wie
folgt zusammengefat: Zuerst ist zu fragen,
welchen Illokutionstyp eine uerung reali-
siert, und erst dann lt sich die Frage be-
antworten, auf welche Weise sie bezglich der
Korrespondenz mit den Tatsachen zu be-
werten ist.
3. Der Satzmodusbegriff
Die Namen der Satzmodi in der traditionellen
Grammatik Aussagesatz, Fragesatz, Auf-
forderungssatz, Ausrufesatz verweisen
deutlich darauf, da die intuitive Idee hinter
dem Satzmodusbegriff die einer Korrelation
von Formtyp (syntaktischer Modus: Subka-
tegorie der Kategorie Satz) und Funktionstyp
(semantischer Modus: Teilmenge der Menge
mglicher Funktionen von Ausdrcken) ist.
Einer Explikation dieser scheinbar klaren In-
tuition stehen aber mehrere erhebliche Hin-
dernisse im Weg.
(a) Die Vermischung von Form und Funktion
ist die Hauptsnde der Modusbehandlung in
den traditionellen Grammatiken, aber leider
nicht nur in diesen. Es steht aber wohl auer
Zweifel, da die zu explizierende Form-Funk-
tions-Korrelation nicht zu leisten ist, ohne
da die Relate, Formtyp und Funktionstyp,
klar voneinander unterschieden werden.
(b) Die unscharfen Grenzen des Formtyp-
begriffs bilden die nchste Schwierigkeit.
Zwar herrscht Einigkeit darber, da zur De-
finition eines Formtyps nur strukturell-gram-
matische Eigenschaften wie Stellung der Kon-
stituenten, ihre syntaktischen Kategorien und
Funktionen sowie ihre morphosyntaktischen
Eigenschaften, das Vorkommen von Struk-
turwrtern und schlielich die Intonation her-
angezogen werden drfen (Altmann 1983,
Zaefferer 1983a: 474), oder negativ und kr-
zer, da lexikalische Information (im Sinne
der Stammbedeutung von Wrtern der
Hauptkategorien) ausgeschlossen bleiben
mu. Auf der anderen Seite wei man aber,
da die Grenze zwischen Funktions- und In-
haltswort und damit zwischen grammatischer
und lexikalischer Bedeutung flieend ist. Eine
Grammatik mu also fr eine gegebene
Sprachausprgung eine Entscheidung bezg-
lich lexikalischer vs. grammatischer Eigen-
voraus, da sich illokutionre Akte in einer
systematischen Weise in Typen klassifizieren
lassen. Entsprechende Klassifikationen sind
etwa von Austin oder Searle vorgeschlagen
worden.
Illokutionre Akte und damit pragmati-
sche Modi (diese lassen sich als Spezialisie-
rungen der semantischen Modi auffassen)
knnen auf unterschiedliche Art realisiert
werden. Man kann sie auf explizite Weise
vollziehen mit sog. explizit performativen
uerungen, bei denen durch eine bestimmte
Verwendung (meist 1.Pers. Sing. Ind. Prs.
Akt.) von Verben, die illokutionre Akte be-
zeichnen, der betreffende illokutionre Akt
vollzogen werden kann. So kann z. B. mit
Ich verspreche dir, morgen zu kommen auf
explizite Weise ein Versprechen gegeben wer-
den. Man kann sie aber auch auf implizite
Weise vollziehen mit uerungen, bei denen
dem Kontext entnommen werden mu, wel-
cher illokutionre Akt vollzogen wird. So
kann man etwa auch mit Ich komme mor-
gen ein Versprechen geben.
Ein wesentliches Merkmal explizit perfor-
mativer uerungen wie etwa Ich vermache
dir meine Uhr sah Austin darin, da sie nicht
wie etwa bestimmte deskriptive implizit per-
formative uerungen, etwa Ich zeige dir
meine Uhr, als wahr oder falsch beurteilt
werden knnen.
Im Gegensatz zur letzteren uerung, mit
der man in bestimmten Umstnden etwas
feststellt, behauptet oder beschreibt, heit die
erste uerung machen, normalerweise, eine
Uhr vermachen, und nicht behaupten, fest-
stellen oder beschreiben, da man eine Uhr
vermacht.
Austin wendet sich also nicht nur wie Witt-
genstein gegen die Auffassung der logischen
Empiristen, da alle sinnvollen uerungen
einen Assertionsmodus besitzen, er bestreitet
auch speziell fr den Typ explizit performa-
tiver uerungen die traditionelle Annahme,
diese uerungen htten wie gewhnliche de-
klarative uerungen in der 1.Person generell
einen assertorischen Modus (Typ). Er bestrei-
tet insbesondere eine notwendige Vorausset-
zung dieser Annahme, nmlich da ue-
rungen wie Ich verspreche dir, morgen zu
kommen ein Satzradikal bzw. einen deskrip-
tiven Inhalt der Art da ich dir verspreche,
morgen zu kommen ausdrckten.
Mit seiner Theorie der explizit performa-
tiven uerungen hat Austin die Vorausset-
zungen fr eine sprachtheoretisch adquate
Interpretation des Fregeschen Urteilsstrichs
12. Theorien der Satzmodi 275
xikalischen Semantik wohlbekanntes Pro-
blem, das der
(d) Mehrdeutigkeit in beiden Richtungen.
Zum einen knnen demselben Satz (und da-
mit natrlich auch Satzmodus) verschiedene
Illokutionstypen entsprechen, z. B. dem Satz
Sie knnen gehen der Illokutionstyp der Er-
laubnis bzw. des Mitteilens einer Erlaubnis
(nur in letzterem Fall wre z. B. eine Rck-
frage Woher wissen Sie das? angebracht).
Zum anderen knnen ein und demselben Il-
lokutionstyp verschiedene Satzmodi entspre-
chen, z. B. dem Illokutionstyp der Bitte der
interrogative und der imperative Satzmodus
(Stellst du bitte das Radio etwas leiser?, Stell
bitte das Radio etwas leiser!). Wie in anderen
Bereichen der Ausdrucks- und Inhalts-Zuord-
nung mssen wir uns fragen: Liegt echte Am-
biguitt bzw. Synonymie vor? Oder nur Vag-
heit mit verschiedenen Przisierungsmglich-
keiten? Und im Falle echter Mehrdeutigkeit:
Sind die beiden Lesarten unabhngig vonein-
ander? Oder ist eine Zuordnung primr und
die andere abgeleitet?
4. Satzmodusprobleme
Die meisten Theorien der Satzmodi befassen
sich nicht mit der Frage, wie denn Satzmodus
zu definieren sei, sondern nehmen die tradi-
tionellen Satzmodi als gegeben. Sie sind daher
mit der angefhrten Begriffsexplikation ver-
trglich. Sie sind sich darberhinaus darin
einig, da es zur strukturellen Bedeutung der
deklarativen Stze gehrt, da sie im allge-
meinen wahrheitswertfhig sind, und da dar-
berhinaus ein wesentlicher Teil der Bedeu-
tung solcher Stze in Termini von Wahrheits-
bedingungen (im folgenden kurz WB) expli-
ziert werden kann.
Das Hauptproblem fr jede WB-seman-
tisch fundierte Satzmodustheorie sind also
Stze, auf die der Wahrheitsbegriff nicht so
recht zu passen scheint: Nicht-deklarative
Stze vor allem, aber auch nicht-assertierend
gebrauchte Deklarativstze.
Als der wichtigste Schlssel zur Semantik
der Nicht-Deklarative hat sich die Tatsache
erwiesen, da einige von ihnen eingebettete
Entsprechungen haben (z. B. die Interroga-
tive die sogenannten indirekten Fragestze).
Deren Semantik, soweit WB-relevant, lt
sich nmlich dadurch ermitteln, da sie in
wahrheitswertfhige Matrixstze eingebettet
werden.
Schlielich kommen manche Theorien auf
dem Umweg ber die Nicht-Deklarative auch
schaften von Stzen treffen. Dann lassen sich
in der Menge mglicher Stze einer Sprache
durch Abstraktion von lexikalischer Infor-
mation quivalenzklassen strukturgleicher
Stze bilden und davon wieder nach gewis-
sen Struktureigenschaften quivalenzklassen.
Solche Formtypen wollen wir Konstruktions-
typen nennen. Davon erfllen aber lngst
nicht alle die Bedingungen des intuitiven Satz-
modusbegriffs. Eine parataktische Reihung
ist z. B. ein Konstruktionstyp, aber kein Satz-
modus, denn ihr entspricht kein bestimmter
Funktionstyp. Oder doch? Vielleicht der
Funktionstyp der Verknpfung von Sachver-
halten? Das bringt uns zum nchsten Pro-
blem.
(c) Die Unklarheit des Funktionstypbegriffs.
Die Funktionen des Sprachgebrauchs sind
derart vielfltig, da hier eine Eingrenzung
dringend notwendig erscheint. Die Einschrn-
kung auf kommunikative Funktionen ist kri-
tisiert worden, da sie den kalkulativen
Sprachgebrauch vernachlssige (Harman
1977:418). Sie erscheint aber gerechtfertigt,
wenn man annimmt, da dieser als verinner-
lichtes selbstadressiertes Sprechen vom kom-
munikativen Sprachgebrauch abgeleitet ist
(vgl. Wygotski 1964). Kommunikative Funk-
tionstypen haben wiederum verschiedene
Aspekte, die den Aspekten sprachlichen Han-
delns und somit zum Teil den linguistischen
Beschreibungsebenen entsprechen. Der im
Zusammenhang mit den Satzmodi relevante
Funktionstypaspekt ist derjenige, der die Art
der Handlung nher charakterisiert, die man
vollzieht, indem man etwas sagt, oder, in
Austinschen Termini, der Aspekt des illoku-
tionren Aktes oder kurz der Illokution (vgl.
oben 2.3). Illokutionstypen erhalten wir,
wenn wir einerseits vom propositionalen Ge-
halt (dem rhetischen Aspekt des lokutionren
Aktes) abstrahieren und andererseits von den-
jenigen beim Adressaten erzielten Effekten,
die ber das bloe Verstehen hinausgehen
(dem perlokutionren Akt). Standardbei-
spiele fr Illokutionstypen sind Behauptun-
gen, Fragen, Bitten (das wrde gut zu den
Satzmodi passen), aber auch Versprechen,
Drohungen, Warnungen. Eine Definition des
Begriffs mglicher Illokutionstyp ist u. W.
zum erstenmal von Vanderveken vorgeschla-
gen worden (Vanderveken 1985b). Doch
selbst wenn die Begriffe Satzmodus und Il-
lokutionstyp und damit Vor- und Nachbe-
reich der von einer Theorie der Satzmodi zu
definierenden Relation klar bestimmt sind,
bleibt noch ein groes, allerdings aus der le-
276 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
bestimmt, in die sie eingebettet sind;
(AK 2.5) den satzmodusspezifischen Fokus-
sierungsimplikaturen (vgl. unten
5.2.4).
Abstrahiert man von der Relativierung auf
eine bestimmte Sprache L, so kann man mit
Zuber (1983:3) weiterhin fordern:
(AK 3) Eine universelle Theorie der Satz-
modi sollte Aussagen ber die Anzahl
und Identitt der mglichen Satz-
modi machen.
5. Satzmodustheorien
Der folgende berblick ber eine Auswahl
von Satzmodustheorien teilt diese nach den
folgenden beiden Hauptkriterien in Gruppen
ein: (a) die Anzahl der angenommenen Be-
schreibungsebenen fr die Bedeutung von
Stzen einschlielich ihrer Modi (eine, zwei
oder drei), (b) die Art der jeweils angenom-
menen Semantik (Modelltheorie, Spieltheo-
rie, Merkmalstheorie etc.).
5.1Ein-Ebenen-Theorien
Die ersten sechs Gruppen von Theorien sie-
deln Satzmodusbedeutung und Restbedeu-
tung auf einer Ebene an.
5.1.1Die Methode der abstrakten
Modusmorpheme
In ihrem einflureichen Buch An Integrated
Theory of Linguistic Description stellen J.
Katz und P. Postal die Behauptung auf, da
spezielle Frage- und Imperativmorpheme in
den zugrundeliegenden Phrasenstrukturen
von Frage- bzw. Imperativstzen vorkommen
mssen (Katz/Postal 1964:74; bers. G./Z.).
Fr das Imperativmorphem I wird ein Lexi-
koneintrag mit etwa folgender Bedeutung an-
gesetzt: Der Sprecher bittet darum (verlangt,
besteht darauf etc.), da; fr das Fragemor-
phem Q wird eine Bedeutung angenommen,
die auf etwa folgende Paraphrase hinausluft:
Sprecher verlangt eine Antwort, d. h. die ue-
rung eines wahren Satzes, der entweder aus der
positiven bzw. negativen Form des Fragesatzes mi-
nus Q besteht, oder aber bedeutungsmig mit dem
Fragesatz bereinstimmt unter Abzug der Bedeu-
tung von Q und nach Ergnzung der semantischen
Bestimmung der W-markierten Konstituenten.
Syntaktisch wird zunchst ein Deklarativsatz
erzeugt, aus dem bei Anwesenheit von I oder
Q obligatorische Transformationen dann
einen Imperativ- bzw. Fragesatz machen.
zu einer Neubewertung des deklarativen Satz-
modus.
Die Probleme, die eine Theorie der Satz-
modi zu lsen htte, lassen sich in Form von
Adquatheitskriterien formulieren (vgl. z. B.
Zaefferer 1983a:467 f.), etwa wie folgt:
Eine adquate Theorie der Satzmodi einer
natrlichen Sprache L sollte
(AK 1) die selbstndigen L-Stze nach den
L-Satzmodi subkategorisieren, d. h.
den Begriff des L-Satzmodus als
Teilklasse der Klasse der L-Stze
extensional definieren, und dabei
folgenden Phnomenen Rechnung
tragen:
(AK 1.1) den strukturellen Beziehungen zwi-
schen L-Stzen verschiedener Modi
(Transformationen);
(AK 1.2) den strukturellen Beziehungen zwi-
schen L-Stzen der verschiedenen
Modi und ihren eingebetteten Ent-
sprechungen (so vorhanden);
(AK 1.3) den syntaktischen Beziehungen
zwischen solchen eingebetteten
Entsprechungen (so vorhanden)
und den einbettenden Strukturen;
(AK 1.4) den satzmodus- oder illokutions-
typspezifischen Vorkommensbe-
schrnkungen fr bestimmte Aus-
drcke wie Negationspartikel, po-
larity items, Satzadverbien, Modal-
partikeln etc.
(AK 1.5) den spezifischen Beschrnkungen
der Verknpfbarkeit von L-Stzen
verschiedener Modi mit Hilfe von
Konjunktionen.
Eine solche Theorie sollte ferner
(AK 2) fr jeden L-Satzmodus M die struk-
turelle Bedeutung von M auf eine
Weise definieren, die es gestattet,
beliebigen L-M-Stzen eine intuitiv
adquate Bedeutung zuzuordnen,
die folgenden Phnomenen Rech-
nung trgt:
(AK 2.1) eventuellen Ambiguitten von L-
M-Stzen;
(AK 2.2) den logischen Eigenschaften von L-
M-Stzen sowie den logischen Be-
ziehungen sowohl zwischen L-M-
Stzen, als auch zwischen L-M-St-
zen und L-M-Stzen;
(AK 2.3) der Bedeutungsrelation zwischen L-
M-Stzen und ihren eingebetteten
Entsprechungen (falls vorhanden);
(AK 2.4) der Tatsache, da die Bedeutung
solcher eingebetteter Entsprechun-
gen die Bedeutung von Stzen mit-
12. Theorien der Satzmodi 277
durch zu erklren, da man annimmt, da
auch erstere im Grunde eingebettet sind, nur
da hier eben die einbettende Struktur getilgt
wurde. So scheint z. B. die Anomalie in (10)
die gleiche zu sein, wie die in (13):
(13) ?
Ich fordere Sie auf, dieses Buch zu
verstehen!
Nach diesem Muster erklrt R. Lakoff (1968)
Bedeutungsparallelen von selbstndigen und
eingebetteten Konjunktivstzen im Lateini-
schen.
Sowohl die Methode der abstrakten Mo-
dusmorpheme, als auch die Performative
Analyse waren ursprnglich zur Behandlung
nichtdeklarativer Satzmodi gedacht. Ganz
analog hatte Austin vor der Entwicklung sei-
ner Theorie der Sprechakte eine grundlegende
Dichotomie von konstativen und performa-
tiven uerungen angenommen, die jeweils
auch verschieden zu analysieren seien, bis er
entdeckte, da ja auch konstative ue-
rungen ihren performativen Anteil haben, der
z. B. in Stzen wie (14) explizit gemacht wer-
den kann:
(14) Ich behaupte, da niemand dieses Buch
lesen wird.
Es lag nahe, die Performative Analyse ent-
sprechend auf Deklarativstze auszuweiten,
und genau dies ist die Hauptidee von Ross
Aufsatz On Declarative Sentences:
Alle Deklarativstze, die in Kontexten vorkom-
men, in denen Pronomina der ersten Person mg-
lich sind (damit sollen Hinweisschilder und der-
gleichen ausgeschlossen werden, G./Z.), sind von
Tiefenstrukturen abzuleiten, die genau einen ber-
geordneten performativen Teilsatz enthalten, des-
sen Hauptverb ein verbum dicendi ist. (Ross
1970a:252; bers. G./Z.).
Da die Performative Analyse in diesem fr-
hen, naiven Stadium, das wir Performative
Analyse I nennen, noch keine spezifizierte
Semantik besa, waren ihre Argumente im
wesentlichen syntaktischer Art. Die grte
Sammlung an einschlgigen Daten stellt wohl
Sadock (1974) dar.
Unglcklicherweise erwiesen sich gerade
die syntaktischen Argumente fr die Perfor-
mative Analyse als sehr angreifbar (vgl. Gre-
wendorf 1972 und Gazdar 1979: Kap. 2). Es
stellte sich nmlich heraus, da die angebli-
chen Effekte des abstrakten Matrixsatzes
nicht nur ebensogut, sondern sogar besser
erklrbar sind, wenn man sie als Kontext-
Effekte auffat.
Dies ist auch der Tenor der Argumentation
von Downes (1977), und es lt sich leicht
Die Argumente, die Katz und Postal fr
ihre Analyse anfhren, sind syntaktischer und
semantischer Natur und tauchen seither in
der Literatur immer wieder auf. Die syntak-
tischen Argumente betreffen vor allem unser
Kriterium (AK 1.4), also Kookkurrenzbe-
schrnkungen, wie sie durch (5) vs. (6) und
(7) vs. (8) illustriert werden:
(5) Mglicherweise lesen Sie dieses Buch.
(6) * Lesen sie dieses Buch mglicherweise!
(7) Sie lesen dieses Buch wohl kaum.
(8) * Lesen Sie dieses Buch wohl kaum?
Die semantischen Argumente betreffen das
Kriterium (AK 2.2), nmlich Paraphrasebe-
ziehungen wie die zwischen (3) und (9) und
semantische Anomalien wie die in (10):
(3) Lesen Sie dieses Buch!
(9) Ich bitte Sie, dieses Buch zu lesen.
(10) ?
Verstehen Sie dieses Buch!
Der Einflu des Buches von Katz und Postal
war, wie erwhnt, gro, was sich auch daraus
ablesen lt, da aus einer seiner Anmerkun-
gen (Nr. 9, S. 149) eine alternative Satzmo-
dustheorie entwickelt wurde, die sogenannte
Performative Analyse.
5.1.2Die Performative Analyse I
Die Performative Analyse der Satzmodi ver-
dankt ihren Namen den von J. Austin (1962)
so genannten performativen Verben, einer
Klasse von Handlungsverben, die nicht nur
dazu benutzt werden knnen, ber die von
ihnen bezeichnete Handlung zu sprechen,
sondern in bestimmten Formen (im allgemei-
nen 1. Person Singular Indikativ Prsens Ak-
tiv) auch dazu, sie zu vollziehen (vgl. oben,
2.3; z. B. bitten in (11)):
(11) Ich bitte Sie, das Rauchen einzustellen.
Die von Katz und Postal in der oben erwhn-
ten Funote angedeutete Mglichkeit, statt
z. B. eines abstrakten Imperativmorphems I
einen abstrakten Matrixsatz I request that you
will, also mit einem performativen Haupt-
verb, anzunehmen, wurde von Ross (1967)
aufgegriffen und weiterverfolgt. Er schlgt
vor, Fragestze aus zugrundeliegenden Struk-
turen mit einem abstrakten Verb des Fragens
abzuleiten, also z. B. (2) aus einer Struktur,
wie sie etwa (12) zugrundeliegt:
(2) Lesen Sie dieses Buch?
(12) Ich frage Sie, ob Sie dieses Buch lesen.
Die Grundidee der Performativen Analyse be-
steht darin, gewisse Parallelitten zwischen
selbstndigen und eingebetteten Stzen da-
278 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
betreffende Buch liest oder nicht, was eindeu-
tig inadquat wre:
(20) Ich behaupte, da Sie dieses Buch lesen.
Ein Vorteil von Lewis Methode ist es, da
sie die WB-semantische Interpretation auch
nicht-satzfrmiger uerungen wie (21) er-
laubt, vorausgesetzt, man ist bereit, etwa (22)
als Paraphrase anzusehen:
(21) Ein Prosit der Gemtlichkeit!
(22) Ich bringe hiermit einen Toast auf die
Gemtlichkeit aus.
Mglichen Einwnden gegen seine Annahme
einer quivalenzbeziehung zwischen nicht-
deklarativen Stzen und ihren performativen
Entsprechungen begegnet Lewis mit dem
Hinweis, da WB-semantisch quivalente
Stze durchaus verschiedene Gebrauchsbe-
dingungen haben und deswegen intuitiv als
bedeutungsverschieden empfunden werden
knnen. Dies ist ein hufiges Argument bei
Ein-Ebenen-Theoretikern; es spricht die
grundstzliche Modularittsfrage an (Wel-
che Phnomene sollen von der Sprachbe-
schreibung welchen Subsystemen oder Mo-
dulen zugeordnet werden?), auf die wir unter
5.1.6. kurz zurckkommen werden.
Lewis Gegeneinwand hat der ernsthaften
Kritik an seinem Ansatz aber nicht den Wind
aus den Segeln genommen (vgl. z. B. Grewen-
dorf 1979). Sie wendet sich erstens gegen Le-
wis Vorschlag, gewhnliche performative
Verben in den Paraphrasen zu verwenden. Da
man z. B. (3) auer durch (18) ebensogut
durch (23) paraphrasieren knnte,
(23) Ich bitte Sie, dieses Buch zu lesen.
fhrt dies dazu, da Lewis entweder bitten
und auffordern als Synonyme annehmen
mte, was sicher inadquat wre, oder da
er fr jeden nicht-deklarativen Satzmodus n
Lesarten ansetzen mu, wenn n die Zahl der
paarweise bedeutungsverschiedenen passen-
den performativen Verben ist, was ebenfalls
sehr unattraktiv ist. Selbst wenn Lewis, dem
Beispiel von Katz/Postal und den Vertretern
der Performativen Analyse folgend, statt kon-
kreter Verben in den Paraphrasen abstrakte
Verben verwenden wrde, deren Bedeutung
als der gemeinsame Nenner der Bedeutungen
der einschlgigen Verben zu definieren wre,
bliebe der zweite Einwand.
Dieser besagt, da Lewis durch die uni-
forme Behandlung der WB von Deklarativ-
stzen und dessen, was er WB von Nicht-
Deklarativen nennt, heterogene Dinge in
einen Topf wirft, nmlich (a) die Charakteri-
zeigen, da die Annahme abstrakter Matrix-
stze die Annahme strukturierter Kontexte
mit Sprecher- und Adressatenreprsentation
nicht ersetzen kann, sondern nur um eine
Ebene verschiebt und unntig verdoppelt. So
lt sich zwar der Plural in Lest! durch Nu-
meruskongruenz mit einem Objekt euch im
abstrakten Matrixsatz erklren, aber es stellt
sich natrlich gleich die Frage, woher dieses
seinen Numerus erhlt.
Was durch die heftige Kritik an der Per-
formativen Analyse freilich nicht aus der Welt
geschafft wurde, ist ihre Attraktivitt fr die
WB-Semantiker, gestattet sie es doch, Stzen
beliebiger Modi Wahrheitsbedingungen zu-
zuordnen, da sie ja alle aus zugrundeliegenden
Deklarativstzen abgeleitet werden. Einen et-
was anderen, WB-semantisch motivierten An-
satz behandelt der folgende Abschnitt.
5.1.3Die Methode der paraphrasierten
Performative
Dies ist die Bezeichnung, die Lewis selbst
seiner Variante der Performativen Analyse
(Lewis 1970) gegeben hat; die recht gewalt-
same Streckung des WB-Begriffs, die ihr zu
eigen ist, hat ihr auch den Namen Prokru-
stes-Methode eingetragen (Zaefferer 1983a).
Zwei Ideen charakterisieren diesen Ansatz,
nicht-deklarative Stze WB-semantisch in den
Griff zu bekommen. Die erste besteht darin,
solche Stze genau dann wahr zu nennen,
wenn ihre performative Paraphrase wahr ist.
So werden fr (2)(4) etwa die WB von
(17)(19) angenommen:
(7) Ich frage Sie, ob Sie dieses Buch lesen.
(18) Ich fordere Sie auf, dieses Buch zu lesen.
(19) Ich uere mein Erstaunen darber, da
Sie dieses Buch lesen.
Die Tatsache, da es merkwrdig erscheint,
Stzen wie (2)(4) berhaupt WB zuzuord-
nen, versucht Lewis damit zu erklren, da
sie unter normalen Umstnden immer wahr
sind. (Wre diese Erklrung stichhaltig, so
mte auch die Zuordnung von WB zu St-
zen wie Eine Frau ist eine Frau merkwrdig
erscheinen, was aber wohl nicht zutrifft.)
Die zweite Grundidee von Lewis besteht
darin, die Austin-Rosssche Parallelisierung
von deklarativen und nichtdeklarativen Satz-
modi nicht mitzumachen und dem deklarati-
ven Satzmodus einen Sonderstatus einzuru-
men. Der Grund hierfr ist leicht zu sehen:
Erhielte (1) die WB von (20), so wre (1)
unter allen normalen uerungssituationen
wahr, unabhngig davon, ob der Adressat das
12. Theorien der Satzmodi 279
da nmlich jedem SM genau eine Bewertung
angemessen ist. Anstze, beiden Mngeln ab-
zuhelfen, werden erst weiter unten (v. a. in
5.2.4) zur Sprache kommen.
5.1.5Modusspezifische Denotattypen
Einen originellen Vorschlag zur Behandlung
der Satzarten in einer Montague-Grammatik
hat Hausser (1980) gemacht. Er geht davon
aus, da in einer Montague-Grammatik die
Menge mglicher Denotate fr die Ausdrcke
einer Sprache nach Typen eingeteilt ist und
da Ausdrcken verschiedener Kategorien im
allgemeinen (wenn auch nicht immer) mgli-
che Denotate verschiedener Typen zugeordnet
werden. Nachdem nun Stze verschiedener
Modi offenbar Ausdrcke verschiedener Ka-
tegorien sind, ist es natrlich denkbar, ihnen
Denotate verschiedener Typen zuzuordnen,
und genau dies ist es, was Hausser vorschlgt:
(1) wrde bei ihm eine Proposition denotie-
ren, (2) eine Eigenschaft von Propositions-
mengen (das liegt daran, da (2) ein Ja/Nein-
Fragesatz ist; anderen Interrogativen werden
andere Denotattypen zugeordnet) und (3)
eine Individuenkonzepteigenschaft.
Eine partielle Vorwegnahme dieser Me-
thode findet sich bereits bei Cresswell (1973),
der vorschlgt, einfachen W-Fragen wie (24)
(24) Wer liest?
entweder einstellige Prdikate (also hier: le-
sen) oder NP-Denotate (also hier: der Le-
ser) zuzuordnen. Cresswell lt die Frage
offen, welche der Alternativen vorzuziehen
sei; dem Einwand, da (24) doch nicht mit
lesen oder der Leser synonym sei, begeg-
net er mit dem Hinweis, da der Unterschied
nicht in der Bedeutung, also im Beitrag zur
WB, sondern in den Gebrauchsbedingungen
liege. Im Gegensatz zu Hausser ordnet Cress-
well Imperativen WB zu, wobei er aber offen-
lt, ob ein Imperativ dann wahr sein soll,
wenn der Adressat die Proposition wahr
macht (das entsprche Montagues Erfl-
lungsbedingung), oder dann, wenn der Spre-
cher mit der uerung tatschlich eine Auf-
forderung oder dergleichen vollzieht (das ent-
sprche einer verbesserten Version der Pro-
krustes-Methode).
Im Gegensatz zu Cresswell und unter Be-
rufung auf Hausser lt Wunderlich (1983a)
Imperative Adressateneigenschaften denotie-
ren und setzt sich damit ebenfalls Bierwischs
Kritik an diesem Ansatz aus, da nmlich
eine uerung eines Imperativsatzes nicht
nur eine bestimmte Eigenschaft spezifiziere,
sierung des modusunabhngigen Inhalts einer
uerung und (b) die der damit vollzogenen
Handlung. Bei Deklarativen vernachlssigt er
(b), bei den anderen Satzmodi (a). Anders der
folgende Ansatz, der konsequent bei allen
Satzmodi (im folgenden kurz SM) (a) ver-
folgt.
5.1.4Modusspezifische Bewertungen
R. Montagues Beitrag zur Entwicklung der
formalen Semantik natrlicher Sprachen ist
zweifellos von grter Bedeutung (vgl. Mon-
tague 1974, Partee 1976, Link 1979). Sein
Beitrag zur Semantik der Satzmodi be-
schrnkt sich freilich auf eine programmati-
sche Bemerkung des Inhalts, da es die zen-
trale Rolle von Syntax und Semantik sei,
Wahrheits- und Folgerungsbedingungen zu
konstruieren, solange man ausschlielich De-
klarativstze betrachtet, sowie eine Funote
dazu (die direkt gegen Lewis gewendet werden
kann), da solche Bedingungen bei Impera-
tiv- und Interrogativstzen selbstverstndlich
unangemessen seien und durch Erfllungs-
bedingungen und eine Charakterisierung des
semantischen Inhalts einer korrekten Ant-
wort ersetzt werden mten (Montague
1974:248). Der Satzmodus wird hier als eine
Art Weiche aufgefat, die die semantische
Bewertung in das jeweils passende Gleis lenkt,
deswegen kann man hier von einer Methode
der modusspezifischen Bewertungen spre-
chen.
Die Idee ist leicht zu illustrieren. Nennen
wir fr einen gegebenen Referenzpunkt i
U und U die Sachverhalte, da der i-
Adressat das in i spezifizierte Buch liest bzw.
nicht liest. Dann ist nach dieser Auffassung
der semantische Gehalt von (1)(3) dadurch
charakterisiert,
da (1) genau dann wahr ist in i, wenn U;
da der semantische Inhalt einer i-Ant-
wort A auf (2) dadurch bestimmt ist, da
A entweder genau dann wahr ist in i, wenn
U, oder wenn U;
da (3) genau dann erfllt ist in i, wenn
U.
Die Methode der modusspezifischen Bewer-
tungen ist bestimmt intuitiv attraktiver als die
Prokrustes-Methode, aber sie hat zumindest
zwei wesentliche Mngel: Erstens wird sie
unserem Kriterium (AK 2.2) nicht gerecht,
weil sie es nicht gestattet, logische Beziehun-
gen zwischen Stzen verschiedener Modi ad-
quat zu explizieren, und zweitens setzt sie
voraus, was erst nachgewiesen werden mte,
280 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
auch diese differenzierteren Anstze trifft,
lt sich an Lappins Erfllungsbedingungen
fr Befehle und Bitten ablesen, die identisch
sind. Dies ist zwar intuitiv adquat (ue-
rungen von Du gibst mir mal das Buch? als
Bitte und Gib mir das Buch! als Befehl sind
gleichermaen genau dann erfllt, wenn der
Adressat mit der bergabe des fraglichen Bu-
ches reagiert); es zeigt aber zugleich, da Er-
fllungsbedingungen den semantischen Ge-
halt von uerungen mit verschiedenen syn-
taktischen und semantischen Modi untercha-
rakterisieren. Dem spezifischen Unterschied
zwischen Befehlen und Bitten haben laut Lap-
pin die Sprechaktregeln Rechnung zu tragen,
d. h. die Unzulnglichkeit der Erfllungsbe-
dingungen als Bedeutungscharakterisierung
soll wiederum pragmatisch wettgemacht wer-
den.
An dieser Stelle ist der Hinweis angebracht,
da die meisten Vertreter der hier als Ein-
Ebenen-Methoden bezeichneten Anstze die
Notwendigkeit einer Ergnzung andeuten,
nur sagen sie eben nichts darber oder sie
verweisen vage auf die Gebrauchsbedingun-
gen. Dies bedeutet aber noch keine klare Stel-
lungnahme in der Modularittsfrage, in unse-
rem Fall also der Frage, ob die Unterschiede
zwischen den Satzmodi als Bedeutungsunter-
schiede, also semantisch, oder als reine Ge-
brauchsunterschiede, also pragmatisch zu be-
handeln seien, denn Gebrauchsbedingungen
sind im allgemeinen wesentlich bedeutungs-
abhngig. Natrlich haben Stze verschiede-
ner Modi verschiedene Gebrauchsbedingun-
gen. Die Frage ist, ob diese Gebrauchsunter-
schiede bedeutungsunabhngig sind, m. a. W.
ob Lewis Vergleich mit den bedeutungsglei-
chen Ausdrcken, die sich nur im Versfu
unterscheiden, hier trifft. Wer an einer Bedeu-
tungsebene und der Gleichung Bedeutung =
(Beitrag zur) Wahrheitsbedingung strikt fest-
hlt, sieht sich fast zu einer positiven Antwort
gezwungen und wird mit Levinson (1979:30)
und Gazdar (1981:75) annehmen, da illo-
kutionre Rollen nichts mit Semantik zu tun
haben und vielmehr zur Gnze in der Prag-
matik behandelt werden sollten.
Anders diejenigen Autoren, die fr die L-
sung der Problematik der Satzmodi von vorn-
herein zwei Ebenen fr ntig erachten.
5.2Zwei-Ebenen-Theorien
Ausgehend von der Beobachtung, da Stze
verschiedener Modi die gleiche Restbedeu-
tung haben knnen (vgl. (1)(4) oben),
gehen die Vertreter dieser Theorien davon
sondern auch eine bestimmte Einstellung
dazu (Bierwisch 1980:19).
Hier tut sich wieder die Modularittsfrage
auf: Fr Bierwisch haben Lies! und du
sein und lesen verschiedene Bedeutungen,
sind semantisch nicht quivalent, whrend sie
sich fr Hausser und Wunderlich nur prag-
matisch, in den Gebrauchsbedingungen un-
terscheiden.
5.1.6Illokutionstypspezifische Bewertungen
Dem Vorwurf einer zu armen semantischen
Charakterisierung entgehen auch diejenigen
Anstze nicht, die sich insofern als Verfeine-
rung von Montagues Methode der satzmo-
dusspezifischen Bewertungen auffassen las-
sen, als sie illokutionre Mehrdeutigkeit (vgl.
AK 2.1) zulassen und somit nicht jedem Satz-
modus, sondern jedem realisierten Illoku-
tionstyp eine Bewertung zuordnen. Auf diese
Weise kann vor allem der Eigenschaft gewis-
ser Deklarativstze Rechnung getragen wer-
den, da sie sowohl assertive wie explizit per-
formative Lesarten haben, wie z. B. (25), was
als Erteilen einer Erlaubnis fungieren kann,
aber auch als bloes Mitteilen einer solchen.
(25) Sie drfen dieses Buch lesen.
Im Gegensatz zu Lewis kann dieser Ansatz
solche Unterschiede direkt erfassen und
braucht sie nicht auf irgendwelche unspezifi-
zierten Gebrauchsbedingungen abzuschieben.
H. Kamp, der das Problem der illokutionren
Mehrdeutigkeiten am Beispiel der Erlaubnis-
stze ausfhrlich diskutiert, zeigt auf, da es
jeden Theoretiker in ein Trilemma fhrt, der
sowohl (a) die relevanten Generalisierungen
erfassen, als auch (b) den rekursiven Teil sei-
ner Theorie von pragmatischen Begriffen frei-
halten, und schlielich (c) eine streng formale
Theorie haben will (Kamp 1978). Nur zwei
der drei Ziele, so Kamp, sind simultan erreich-
bar, ob man eher das zweite oder das dritte
aufgeben soll, mchte er nicht entscheiden
(vgl. Grewendorf 1984b).
Eine konsequente Anwendung der Me-
thode der illokutionstypspezifischen Bewer-
tungen ist der Vorschlag von Lappin (1982),
jeder illokutionren Lesart eines Satzes pas-
sende Erfllungsbedingungen zuzuordnen.
Die Relativierung der Bewertung auf Lesarten
lt sich bereits an der Form seiner Regeln
ablesen: Eine uerung von S als X zur Zeit
t ist erfllt gdw. ..., wobei S ein Satz und X
ein Illokutionstyp ist.
Da der eingangs erwhnte Vorwurf der
zu armen semantischen Charakterisierung
12. Theorien der Satzmodi 281
Verhltnisse bei natrlichen Sprachen wieder-
zugeben scheint: Diese haben syntaktische In-
dikatoren fr den semantischen Modus, die
aber fr die eindeutige Bestimmung des letz-
teren nicht immer hinreichend sind.
Die Annahme zweier vllig verschiedener
Arten von Semantik ist einer doppelten Kritik
ausgesetzt: Erstens ist auch die Einhaltung
von Modus-Regeln in gewisser Weise konsti-
tutiv und nicht nur funktionserhaltend (oder
wrde man sagen, jemand spricht Deutsch,
der mit Imperativstzen das Berichtsspiel und
mit Deklarativstzen das Befehlsspiel spielt?);
deswegen formuliert Searle seine Regeln fr
das modale Element auch ausdrcklich als
konstitutive Regeln (Searle 1969).
Zweitens fhrt diese Konzeption zu unn-
tigen Schwierigkeiten, wenn es um Bedeu-
tungsrelationen wie die zwischen (3) und (26)
geht, weil dazu Regeln der einen Art erst
einmal in Regeln der anderen Art berfhrt
werden mssen.
(3) Lesen Sie dieses Buch!
(26) Ich empfehle Ihnen, dieses Buch zu le-
sen.
Eine einheitliche Bedeutungsbeschreibung
scheint also vorzuziehen zu sein, falls sie, und
das ist natrlich wesentlich, die ntige Ebe-
nenunterscheidung aufrechterhlt.
5.2.2Zweimal Handlungstheorie
Einen mglichen Ansatz der skizzierten Art
stellt die Searlesche Ausarbeitung von Austins
Theorie der Sprechakte dar (Searle 1969).
Searle charakterisiert sowohl propositionale
wie auch modale Bedeutung in Termini von
sprachlichen Handlungen, indem er Regeln
fr den Gebrauch der referierenden und pr-
dizierenden Ausdrcke und der Illokutions-
typindikatoren angibt (letztere nennt er illo-
cutionary force indicating devices), zu denen
er auch die Satzmodi zhlt.
Eine Charakterisierung der Bedeutung von
(3) wrde bei ihm unter anderem folgende
Aussagen enthalten: (a) Propositionaler Ge-
halt: Es gibt Objekte x und y, die der Sprecher
von (3) seinem Adressaten mit Hilfe der
uerung von Sie bzw. dieses Buch identifi-
zierbar machen will, und der Sprecher beab-
sichtigt, mit der uerung von (3) die Frage
des Bestehens oder Nicht-Bestehens der Re-
lation lesen zwischen x und y aufzuwerfen;
(b) Illokutionstyp: Die uerung von (3) gilt
als ein Versuch, den Adressaten dazu zu be-
wegen, das Bestehen der Relation lesen zwi-
schen x und y herbeizufhren.
aus, da es zur vollstndigen Beschreibung
der Bedeutung natrlichsprachlicher Stze
notwendig ist, zwei Ebenen zu unterscheiden:
die der Gesamtbedeutung einschlielich Mo-
dus, und die des nach Abzug der Modusbe-
deutung verbleibenden Restes, wobei letztere
meist unter der Bezeichnung propositionaler
Gehalt behandelt wird. Da man den Trger
des propositionalen Gehalts seit Wittgenstein
(vgl. 2.2 oben) das Satzradikal nennt, lassen
sich diese Theorien alle als Varianten der Me-
thode der Satzradikale charakterisieren. Die
Untergliederung des Abschnitts erfolgt nach
der Art der fr die beiden Ebenen angenom-
men Semantik.
5.2.1Zwei Arten von Semantik
Der sprachphilosophische Hintergrund von
Stenius einflureichem Versuch, WB-Seman-
tik und Wittgensteins Sprachspiel-Konzep-
tion auf einen Nenner zu bringen, ist bereits
oben (Abschnitt 2.2) umrissen worden. Die
Grundannahme seiner Variante der Methode
der Satzradikale ist die, da die Regeln, die
die Bedeutung des Satzradikals bestimmen,
ganz anderer Art sein mssen, als die, die die
Bedeutung des modalen Elements ausmachen
(Stenius 1967:259).
Regeln der ersten Art, die als Denotations-
regeln aufgefat werden knnen, bestimmen
das, was Stenius deskriptive Wahrheit nennt,
Fllesdal (1967:279) nennt sie konstitutive
Regeln; Regeln der zweiten Art bestimmen im
Falle von Deklarativstzen das, was Stenius
modale Wahrheit nennt, Fllesdal spricht hier
von funktionserhaltenden (preservative) Re-
geln, denn obwohl sie nicht konstitutiv sind
fr das Sprechen einer Sprache, ist ihre Ein-
haltung dennoch wesentlich dafr, da die
kommunikative Funktion dieser Sprache auf-
rechterhalten bleibt.
Stenius stellt die Regeln eines Berichts- und
eines Befehlsspiels zu einem kombinierten
Spiel zusammen, das er in zwei Varianten
prsentiert: Die erste enthlt keine syntakti-
schen modalen Elemente, so da die korrekte
Moduswahl vllig dem Kontext berlassen
bleibt. (Das entspricht dem, was Ross (1970a)
die pragmatische Analyse nennt, bei der alles,
was bei der Performativen Analyse im per-
formativen Matrixsatz kodiert ist, dem Kon-
text zu entnehmen ist.) Die zweite enthlt
modale Elemente, und der syntaktische Mo-
dus bestimmt eindeutig den semantischen.
Diese beiden Varianten sind insofern interes-
sant, als keine von beiden die tatschlichen
282 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Zu den verwandelten Bedingungen, die Katz
vorschlgt, gehren neben WB fr Assertive
Erfllungsbedingungen fr Direktive mit den
Spezialfllen der Antwortsbedingungen fr
Fragen und der Annahmebedingungen fr
Herausforderungen, Kompensierungsbedin-
gungen fr Expressive, Einhaltungsbedingun-
gen fr Obligative, Anerkennungsbedingun-
gen fr deklarierende Sprechakte, Erlaubnis-
bedingungen fr permissive Sprechakte und
Befolgungsbedingungen fr Ratschlge.
Obwohl die meisten dieser Propositions-
typen im Englischen und im Deutschen nicht
durch Satzmodi indiziert werden, drfte es
klar sein, da solche Begriffe fr eine univer-
sale Theorie der Satzmodi insofern interessant
sind, als die Mglichkeit besteht, da die ent-
sprechenden Typen in irgendeiner natrlichen
Sprache via Satzmodus ausgedrckt werden.
Kritisch anzumerken ist, (a) da Katz
Analysen auer beim assertiven und beim di-
rektiven Typ noch sehr vorlufig und ad hoc
sind, (b) da nirgends Grenzen abzusehen
sind, die einer beliebigen Inflation des Typen-
inventars Einhalt gebieten knnten, vor allem
aber, (c) da eine przise modelltheoretische
Interpretation des ganzen merkmalssemanti-
schen Apparates fehlt und wegen seiner Un-
bersichtlichkeit und Schlechtdefiniertheit
wohl auch schwer zu leisten sein drfte.
5.2.4Zweimal Modelltheorie
So verschieden alle in diesem Abschnitt zu
behandelnden Theorien auch sein mgen, ih-
nen gemeinsam ist, da sie auf zwei Beschrei-
bungsebenen, der des propositionalen Gehalts
und der der Illokution, modelltheoretisch in-
terpretierte Reprsentationsebenen ansetzen.
Der erste Schritt in dieser Richtung war wohl
der Vorschlag von G. Lakoff (1975), die naive
Performative Analyse I durch eine ausgear-
beitetere Version zu ersetzen, in der (a) der
performative Matrixsatz samt Komplement
und (b) der Komplementsatz allein (das Satz-
radikal) getrennte modelltheoretische Inter-
pretationen erhalten.
Cresswell (1973) hat, wie oben (5.1.5) er-
whnt, bei den Imperativstzen bereits die
beiden Optionen (a) und (b) gesehen, aber da
er jedem nicht-ambigen Satz genau eine se-
mantische Charakterisierung, seine WB, zu-
ordnen zu mssen glaubt, sieht er die Mg-
lichkeit einer Mehrfachcharakterisierung
nicht, die ihm aus seinem Dilemma helfen
wrde.
Es wird wohl deutlich, da solche hand-
lungstheoretischen Charakterisierungen pro-
positionaler Gehalte sehr schwerfllig sind,
und es liegt daher nahe, sich mehr an das zu
halten, was die linguistische Semantik bereits
entwickelt hat.
5.2.3Zweimal Merkmalssemantik
Anders als Searle behandelt Katz (1977) die
Illokutionstypdetermination nicht handlungs-
theoretisch, also pragmatisch, anders als Ross
aber auch nicht syntaktisch: fr ihn ist der
richtige Ort dafr zunchst einmal, nmlich
unter den idealisierten Bedingungen, die er
Null-Kontext nennt, die Semantik. Syntak-
tisch scheint sich, was die Behandlung der
Satzarten betrifft, seit Katz/Postal (1964) we-
nig gendert zu haben Satzmodi scheinen
weiterhin durch abstrakte Modusmorpheme
reprsentiert zu werden , aber semantisch
wird jetzt zwischen dem propositionalen Ge-
halt und dem Propositionstyp eines Satzes
unterschieden, wobei letzterer als diejenige In-
formation charakterisiert wird, die bestimmt,
welcher Sprechakttyp mit einer uerung die-
ses Satzes im Null-Kontext (also ohne Zusatz-
information) vollzogen wird.
Was den Katzschen Ansatz bei allen Be-
denken (fr eine Kritik an der Merkmalsse-
mantik vgl. Lewis 1970; Gazdar 1979a zeigt
auf, da der Begriff Null-Kontext nicht das
leistet, was er leisten soll) interessant macht,
ist, da er einerseits dem WB-Begriff fr As-
sertive eine ganze Reihe von Analoga fr
nichtassertive Sprechakte an die Seite stellt
(wie spter Lappin, vgl. oben 5.1.6), und da
er andererseits eine Unterscheidung zwischen
der Erfllung dieser Bedingungen, die er ver-
wandelte Bedingungen nennt, und den illo-
kutionren Erfolgsbedingungen nicht nur
vorsieht (das tut Lappin auch), sondern auf
der Ebene der Semantik ansiedelt. Da eine
solche Unterscheidung notwendig ist, ist evi-
dent (die Bedingungen dafr, da eine Frage
als beantwortet gilt das WB-Analogon fr
Fragen sind verschieden von den Bedin-
gungen dafr, da sie als gestellt gilt), dafr,
da sie in die Semantik gehrt, argumentiert
Katz aufgrund der Tatsache, da die Erfolgs-
bedingungen fr einen Sprechakt in die WB
fr einen anderen eingehen knnen, man ver-
gleiche etwa (2) und (27):
(2) Lesen Sie dieses Buch?
(27) Er hat mich gefragt, ob ich dieses Buch
lese.
12. Theorien der Satzmodi 283
Quasi-Wahrheit bei rhetorischen Fragen,
Wahrheit und Gerechtfertigtheit bei Exkla-
mativen, (c) die Bewertungen auf der illoku-
tionren Ebene erfolgen in der Dimension des
Erfolgs bzw. der Wirksamkeit (fr Einzelhei-
ten siehe Zaefferer 1983a, 1984). So werden
Bedeutungsbeziehungen zwischen Stzen ver-
schiedener Modi explizierbar (AK 2.2); es lt
sich z. B. zeigen, da (33) wahr ist (in seiner
assertierenden Lesart), wenn (32) wirksam ist:
(32) Sag mir, wer du bist!
(33) Ich frage dich, wer du bist.
Die ernsthaften Probleme werden dadurch
vermieden, da zur Charakterisierung des lo-
kutionren Gehalts auf Davidsons Konzept
der deklarativen Umformung verzichtet wird.
Die W-Stellen in W-Interrogativen werden
nicht durch Existenzquantifizierung gebun-
den (wie in (28)), sondern durch Allquantifi-
zierung mit Skopus ber den Illokutionstyp-
operator. So wird es mglich, sowohl die Am-
biguitt des Karttunen-Hirschbhler-Pro-
blemsatzes (34) zu explizieren (Karttunen
1977, Hirschbhler 1978), wie auch seine par-
tielle Synonymie mit (35):
(34) Welche Note verdient jeder Student?
(35) Welcher Student verdient welche Note?
Ein anderer, ebenfalls in vielen Bereichen
schon recht detailliert ausgearbeiteter Ansatz
ist die von D. Vanderveken, teilweise in Zu-
sammenarbeit mit J. Searle, entwickelte Illo-
kutionslogik (Vanderveken 1980, 1983,
Searle/Vanderveken 1985). Vandervekens L-
sung des ersten, mehr terminologischen Pro-
blems gleicht der von Zaefferer (s. o.), nur da
er die verschiedenen Bewertungen auf der lo-
kutionren Ebene unter den Erfllungsbegriff
(satisfaction) zusammenfat und auf der il-
lokutionren Ebene zwischen dem Vollzug
und dem makellosen Vollzug (non-defective
performance) eines Sprechakts unterscheidet.
So gehrt z. B. zur Erfllung eines mit (36)
gegebenen Versprechens,
(36) Ich verspreche Ihnen, da ich dieses
Buch lesen werde.
da sein Sprecher das betreffende Buch lesen
wird, zum Vollzug, da er dieses Versprechen
gibt, und zum makellosen Vollzug, da er
beabsichtigt, es zu halten. Der Begriff des
makellosen Vollzugs ist notwendig fr Van-
dervekens Rekonstruktion von Grices (1975)
konversationellen Implikaturen (Vanderve-
ken 1985a), da in deren Bestimmung hufig
die Annahme eines makellosen Vollzugs ein-
geht. Eine Lsung des zweiten Problems fin-
Ganz hnlich wie Lakoff, aber ohne auf
diesen Bezug zu nehmen, hat Davidson (1979)
vorgeschlagen, die volle Bedeutung einer
uerung durch zwei WB zu charakterisie-
ren, z. B. die eines Imperativs durch die WB
der uerung einer indikativischen Umfor-
mung des betreffenden Satzes und die WB des
Modusindikators, wobei letztere genau dann
erfllt ist, wenn die betreffende uerung tat-
schlich dem imperativen (oder direktiven)
Illokutionstyp zugehrt. Im Unterschied zu
Lakoff (und in bereinstimmung mit Lewis)
nimmt er allerdings Deklarativstze von die-
ser Behandlung aus, denn diese zeichnen sich
seiner Ansicht nach durch die Abwesenheit
eines Modusindikators aus.
Die Vorteile eines solchen Vorgehens liegen
auf der Hand: Es erlaubt eine Ausweitung des
bewhrten WB-semantischen Vorgehens auf
diejenigen Satzarten, denen man schlecht
einen Wahrheitswert zusprechen kann. Die
Davidsonsche Erklrung fr diese Unmg-
lichkeit klingt freilich wenig berzeugend:
Das liege daran, da sie eben zwei Wahrheits-
werte haben. Das ist aber wohl vor allem ein
terminologisches Problem.
Ernsthaftere Probleme fr den Davidson-
schen Ansatz ergeben sich bei den Interro-
gativen (diese Mglichkeit rumt er selbst in
einer Funote ein). Wie schon Katz und
Postal bemerkt haben, lassen sich zwar mit
Hilfe von Indefinitformen deklarative Ent-
sprechungen zu W-Interrogativen bilden,
aber es bleibt offen, ob (28) eine Davidson-
Umformung von (29), (30) oder (31) ist:
(28)
Meine nchste uerung ist eine Frage.
Jemand liest etwas.
(29) Wer liest etwas?
(30) Was liest jemand?
(31) Wer liest was?
Die in den Arbeiten Zaefferer (1981)(1984)
entwickelte Illokutionssemantik versucht, die-
sen Problemen mit zunehmender Differen-
ziertheit und Adquatheit Rechnung zu tra-
gen. Die berwindung der ersten Schwierig-
keit mit Davidsons Ansatz ist der Idee nach
den Vorschlgen von Katz (1977) und Lappin
(1982) verwandt: (a) uerungen werden auf
zwei Ebenen bewertet (semantisch charakte-
risiert): der lokutionren und der illokutio-
nren, (b) die Bewertung auf der lokutionren
Ebene erfolgt in derjenigen Dimension, die
fr den jeweils realisierten Illokutionstyp spe-
zifisch ist: Wahrheit bei Assertiven, Beantwor-
tetheit bei Fragen, Erflltheit bei Direktiven,
284 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
sondern sie auf einer ohnehin notwendigen,
die Kernbedeutung ergnzenden Ebene an-
zusiedeln, der Ebene der Implikaturen oder
Prsuppositionen.
Der erste Vorschlag in dieser Richtung
drfte wohl der von Kasher sein, der annahm
(1974:25), da mit jedem Satz eine Klasse
schwacher Kontextimplikaturen verbunden
sei, die seinen semantischen Modus (also Il-
lokutionstyp) bestimmt, und da zu jedem
Modus eine charakteristische Klasse von Pr-
ferenzrelationen gehrt, an denen das ent-
sprechende Satzradikal teilhat. So impliziere
z. B. der fragende Modus bezglich einer Pro-
position p, da der Sprecher das Wissen, ob
p, dem Nichtwissen, ob p, vorzieht, und der
assertierende, da der Sprecher eine Situa-
tion, in der der Adressat wei, da er, der
Sprecher, p glaubt, einer Situation vorzieht,
in der dies nicht der Fall ist.
Anders als Kasher expliziert Lee (1983) die
Modusbedeutung nicht als Kontextimplika-
tur, sondern als konventionelle Implikatur im
Sinne von Karttunen/Peters (1979). Es erhebt
sich allerdings die Frage, ob hier nicht allzu
Heterogenes zusammengeworfen wird, denn
z. B. das fr die normalen konventionellen
Implikaturen typische Projektionsproblem
tritt bei den Modusimplikaturen nicht auf.
Whrend bei Lee Imperative die Bedeutung
ihres Radikals zum Inhalt haben und die Mo-
dusbedeutung als Implikatur mit sich fhren,
sind die Verhltnisse bei R. Zuber, von dem
der jngste Vorschlag in dieser Gruppe
stammt (Zuber 1983), gerade umgekehrt: Die
Modusbedeutung lst die Implikatur (in Zu-
bers Terminologie: Prsupposition) nur aus,
und was prsupponiert wird, ist das Satzra-
dikal (bei Zuber: die Satzbasis) oder etwas
daraus Abgeleitetes. Zuber vertritt die These,
da es genau drei nichtdeklarative Satzarten
gibt: die exklamative, die imperative und die
interrogative. Ein nicht-deklarativer Satz ist
nach Zuber exklamativ genau dann, wenn er
seine Basis maximal prsupponiert, er ist im-
perativ genau dann, wenn er die Negation
seiner Basis maximal prsupponiert, und in-
terrogativ genau dann, wenn er entweder das
eine oder das andere tut. Zubers Buch ist voll
von originellen und interessanten Vorschl-
gen, von denen allerdings viele der wichtigsten
leider wohl unmodifiziert nicht haltbar sind.
So wren z. B. nach den oben genannten De-
finitionen die Interrogative entweder Exkla-
mative oder Imperative. Richtig an diesem
Ansatz ist sicher die Intuition, da Nicht-
det sich bei Vanderveken nicht, da er sich
nicht nher mit W-Fragen befat.
Zaefferers Illokutionssemantik und Van-
dervekens Illokutionslogik sind in der Ziel-
setzung ganz hnlich, aber im Vorgehen ver-
schieden. Das Ziel ist die Vervollstndigung
des modelltheoretischen Ansatzes, so da
auch nicht-deklarative SM und andere illo-
kutionstypbezogene Phnomene behandelt
werden knnen. Die Illokutionssemantik ist
mehr sprachbezogen und rekonstruiert spe-
zifische Bedeutungsrelationen wie die zwi-
schen (32) und (33) mit Hilfe von Bedeutungs-
postulaten, die Illokutionslogik ist apriorisch
aufgebaut, definiert mgliche Illokutionsty-
pen auf der Basis von Searles Klassifikation
(Searle 1975b) und rekonstruiert die gleichen
Relationen aufgrund der Definitionen der be-
treffenden Illokutionstypen. In Zaefferer
(1983b) wurde auf Punkte hingewiesen, in
denen sich das illokutionslogische System we-
gen der Problematik der ihm zugrundeliegen-
den Searleschen Klassifikation als empirisch
inadquat erweisen knnte.
Der in Zaefferer (1984) festgehaltene Stand
der Illokutionssemantik weist noch zwei deut-
liche Unzulnglichkeiten auf: Die von der zu-
grundegelegten Mgliche-Welten-Semantik
ererbten Probleme des Propositionsbegriffs
und die Tatsache, da sie noch mit unstruk-
turierten Propositionen arbeitet. Wie man
letzterem Mangel abhelfen kann, hat Jacobs
(1984a) gezeigt, und er hat weiterhin nach-
gewiesen, da eine Illokutionssemantik mit in
Fokus und Hintergrund strukturierten Pro-
positionen (a) eine einheitliche Behandlung
von Fokussierung sowohl in An- wie in Ab-
wesenheit fokussierender Elemente (wie z. B.
auch) erlaubt und (b) ganz zwanglos der Tat-
sache Rechnung trgt, da Fokusimplikatu-
ren illokutionstypspezifisch sind. Vgl. (37)
und (38), denen man als Implikaturen etwa
(37) und (38) zuordnen knnte (Majuskeln
indizieren die Satzakzentsilbe):
(37) Lesen Sie DIEses Buch!
(37) Sprecher nimmt an, da Adressat be-
absichtigt, ein Buch zu lesen.
(38) Lesen Sie DIEses Buch?
(38) Sprecher nimmt an, da Adressat ein
Buch liest.
5.2.5Modusbedeutung als
Implikatur(-auslser)
Mehrere Autoren haben vorgeschlagen, fr
die Satzmodusbedeutung nicht eine eigene,
spezifische Bedeutungsebene anzunehmen,
12. Theorien der Satzmodi 285
nalen Gehalt und dem damit in einem Inter-
aktionsrahmen bermittelten kommunikati-
ven Sinn, wobei die Bestimmung der ersteren
eine linguistische, die des letzteren (und damit
des vollzogenen Sprechakts) hingegen eine
kommunikationstheoretische Aufgabe sei.
Die Sprechakttheorie sei keine Theorie der
sprachlichen Bedeutung, sondern des kom-
munikativen Sinns, und sprachliche Illoku-
tionstypindikatoren im strengen Sinn gebe es
nicht (Bierwisch 1980:24). Satzmodi bezeich-
nen propositionale Sprechereinstellungen wie
Annehmen, Wollen und wissen Wollen, und
haben nur sehr vermittelt mit Sprechhandlun-
gen zu tun.
Bei genauerer Betrachtung stellt sich aller-
dings die Frage, ob wirklich ein Unterschied
zu der gngigen Auffassung besteht, wonach
Satzmodi Illokutionstypindikatoren sind,
denn es ist ja durchaus denkbar, den assertie-
renden, direktiven und erotetischen Illoku-
tionstyp zu definieren als diejenigen Handlun-
gen, die im Ausdrcken der genannten Ein-
stellungen bestehen.
6. Offene Fragen
Obwohl sich eine gewisse berlegenheit der
modelltheoretisch orientierten Zwei-Ebenen-
Theorien ber die anderen Anstze abzu-
zeichnen scheint, sind damit noch lngst nicht
alle Probleme im Bereich der Satzmodi gelst.
Zu den noch anstehenden Aufgaben fr die
knftige Satzmodusforschung gehren unter
anderem:
(a) die przise Bestimmung der Bedeutung
der Satzmodi in den verschiedenen natrli-
chen Sprachen (und damit die Beantwortung
der Frage, inwieweit z. B. der Imperativ im
Deutschen mit dem Imperativ im Englischen
quivalent ist);
(b) die Beschreibung und Erklrung der
Verknpfbarkeitsbeschrnkungen fr Teil-
stze verschiedener Modi im Rahmen ein und
desselben Satzes, vgl. z. B. (39) (Imp + Dekl)
mit (40) (* Dekl + Imp) und (41) (Dekl +
Int) mit (42) (* Int + Dekl);
(39) Lesen Sie dieses Buch und Sie sind im
Bilde!
(40) * Sie lesen dieses Buch und seien Sie im
Bilde!
(41) Sie lesen dieses Buch, aber strt Sie nicht
dieser Lrm?
(42) * Lesen Sie dieses Buch, aber dieser
Lrm strt Sie nicht.
(c) die Bestimmung des Grades der Kom-
positionalitt der Satzmodusbedeutung
Deklarative ihren propositionalen Gehalt
nicht behaupten, sondern eine andere Rela-
tion dazu ausdrcken.
5.3Drei-Ebenen-Theorien
Wie die Zwei-Ebenen-Theorien gehen auch
diese Anstze von der Annahme einer Ebene
des propositionalen Gehalts (oder eines Ana-
logons dazu) aus, allerdings pldieren sie da-
fr, fr die Explikation des semantischen Mo-
dus zwei zustzliche Analyse- und damit Re-
prsentationsebenen anzusetzen, wobei frei-
lich die Vorstellungen davon, welches diese
beiden Ebenen sein sollen, sehr unterschied-
lich sind.
5.3.1Drei Ebenen sprachlicher Bedeutung
Einen Ansatz zu einer Zwei-Ebenen-Behand-
lung der Modusbedeutung stellt Wunderlich
in seinen Studien zur Sprechakttheorie vor, wo
er unterscheidet zwischen illokutiven Typen
(Sprechakttypen) und Positionstypen (Typen
propositionaler Einstellungen) und die Mg-
lichkeit andeutet, propositionale Einstellun-
gen mit bestimmten Sprechakttypen zu asso-
ziieren (Wunderlich 1976:44), was er aller-
dings nicht weiter ausfhrt.
Etwas anders Lyons (1977), der ausgeht
von der Hareschen Trichotomie Phrastik
(propositionaler Gehalt) Tropik (Modus-
anzeichen) Neustik (Anzeichen fr die Ver-
pflichtung, die der Sprecher eingeht), und den
Illokutionstyp als Produkt von Tropik und
Neustik ansieht (Lyons 1977:750). Die Ar-
gumente fr die Unterscheidung von Tropik
und Neustik vermgen allerdings nicht recht
zu berzeugen (vgl. die Besprechungen von
Lyons Buch durch Cresswell 1979 und von
Stechow 1982).
5.3.2Zwei sprachliche Ebenen und eine
kommunikative
Eine ganz andere Auffassung von der mo-
dularen Organisation sprachlicher Kommu-
nikation kommt in einem Ansatz zum Aus-
druck, zu dessen Vertretern Bierwisch (1980),
Doherty (1985), Lang (1983), Motsch (1979)
und in neueren Schriften wohl auch Altmann
(1983) und Wunderlich (1983a) zu rechnen
sind. Zur Vermeidung dessen, was Bierwisch
(1980:2) die Erbsnde der Sprechakttheorie
nennt, nmlich der Vermischung von Sprache
und Kommunikation, unterscheidet dieser
Ansatz zwischen der mit der uerung eines
Satzes in einem bestimmten Modus ausge-
drckten Einstellung zu dessen propositio-
286 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
lich moderne Arbeit von K. Brugmann
(1918) empfohlen.
Fr wertvolle Hinweise sei Andreas Kemmerling
und Dieter Wunderlich gedankt.
8. Literatur (in Kurzform)
Altmann 1983 Anscombe 1967 Austin 1962
Bierwisch 1980 Brugmann 1918 Cresswell 1973
Davidson 1979 Doherty 1985 Downes 1977
Dummett 1973 Fodor 1977 Fllesdal 1967
Frege 1879 Frege 1891 Frege 1892 Frege 1893/
1903 Frege 1918/19 Frege 1923/25 Gazdar
1979 Gazdar 1979a Gazdar 1981 Grewendorf
1972 Grewendorf 1979 Grewendorf 1980 Gre-
wendorf 1984b Grice 1975 Harmann 1977
Hausser 1980 Hirschbhler 1978 Jacobs 1984a
Kamp 1978 Karttunen 1977 Karttunen/Peters
1979 Kasher 1974 Katz 1977 Katz/Postal
1964 Lakoff, G. 1975 Lakoff, R. 1968 Lang
1983 Lappin 1982 Lee 1983 Lewis 1970 Link
1979 Lyons 1977 Montague 1974 Motsch
1979 Partee (ed.) 1976 Ross 1967 Ross 1970a
Sadock 1974 Sadock/Zwicky 1985 Searle 1969
Searle 1975b Searle/Vanderveken 1984 von Ste-
chow 1982 Stenius 1967 Stenius 1969 Vander-
veken 1980 Vanderveken 1983 Vanderveken
1985a Vanderveken 1985b Wittgenstein 1921
Wittgenstein 1969 Wunderlich 1976 Wunderlich
1983a Wygotzky 1964 Zaefferer 1981 Zaefferer
1982 Zaefferer 1983a Zaefferer 1983b Zaefferer
1984 Zuber 1983
Gnther Grewendorf, Frankfurt a. M./
Dietmar Zaefferer, Mnchen
(Bundesrepublik Deutschland)
(haben z. B. im Deutschen die Merkmale
Verberststellung und terminale Intonation Ei-
genbedeutungen, aus deren Kombination die
Imperativbedeutung entsteht, oder tragen die
Merkmale erst in Kombination Bedeutung?);
(d) die Beschreibung anderer Modi als der
Standardflle Deklarativ, Imperativ und In-
terrogativ, z. B. des Exklamativs (Zaefferer
1983a ist nur ein erster Schritt hierzu);
(e) die Frage der Modifizierbarkeit der
Satzmodusbedeutung durch Satzadverbien
und Modalpartikeln;
(f) die Ermittlung des Inventars an Satz-
modi, ber das natrliche Sprachen verfgen
(erste Hypothesen hierzu finden sich in Zaef-
ferer 1983a, reichhaltiges Material in Sadock/
Zwicky 1985).
7. Literaturempfehlungen
Eine knappe Einfhrung in die Sprechakt-
theorie gibt Grewendorf (1980), einen guten
berblick ber die linguistischen Probleme
Fodor (1977). Mehr wegen der angefhrten
Daten als wegen der vorgeschlagenen Lsun-
gen interessant ist Sadock (1974). Trotz aller
Einwnde lesenswert ist Kapitel 16 von Lyons
(1977), wenn man von Stechow (1982) als
Korrektivlektre hinzunimmt. Als interessan-
ter Versuch, den zentralen Begriff des Illo-
kutionstyps (illocutionary force) przise zu de-
finieren, ist Vanderveken (1985b) eine Ausein-
andersetzung wert. Fr historisch interessierte
Leser, die auch mehr spekulative Ausfhrun-
gen zu schtzen wissen, sei schlielich die
in den grundstzlichen Bemerkungen erstaun-
13. Prsuppositionen
6.1 Allgemeines
6.2 Die diskurssemantische Lsung des Projek-
tionsproblems
6.3 Prdikatbedingungen, Dreiwertigkeit und die
Ambiguitt von nicht
7. Offene Fragen
8. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
Die meisten Stze haben eine oder mehrere
Prsuppositionen. Es ist nicht schwierig,
einen Blick fr sie zu entwickeln: wenn man
das Phnomen einmal aufgezeigt und ein paar
Beispiele gegeben hat, so sind sie leicht wie-
1. Einleitung
2. Empirische Kriterien
3. Klassifikation und strukturelle Basis von Pr-
suppositionen
4. Der logische Prsuppositionsbegriff und wie
er pragmatisch wurde
5. Das Projektionsproblem
5.1 Einleitung
5.2 Karttunen, Karttunen & Peters
5.3 Gazdar
5.4 Heim
5.5 Van der Sandt
6. Der diskurstheoretische Prsuppositionsbe-
griff
13. Prsuppositionen 287
Prsuppositionen dem geuerten Trgersatz.
Prsuppositionen sind also sozusagen in ihren
Trgerstzen enthalten, und es ist eine der
Aufgaben einer Prsuppositionstheorie, Stze
so zu analysieren, da deutlich wird, auf wel-
che Weise genau Prsuppositionen in ihnen
implizit enthalten sind. Um dieses Problem
wird es in Abschnitt 3 gehen.
Wir haben Prsuppositionen als struktu-
relle Eigenschaften von Stzen eingefhrt: sie
sind aus einem Bestandteil des Trgersatzes
oder aus seiner Struktur ableitbar. Nicht alle
Autoren folgen diesem Sprachgebrauch; man-
che haben einen umfassenderen Prsupposi-
tionsbegriff. So sagt z. B. Stalnaker (1978:
321) Prsuppositionen sind das, was vom
Sprecher als gemeinsamer Hintergrund der
Gesprchsteilnehmer, als ihr gemeinsames
oder wechselseitiges Wissen betrachtet wird.
Soames (1982:485 f.) vertritt eine ganz hnli-
che Meinung, doch versucht er, die strukturell
impliziten Prsuppositionen durch die Bedin-
gung auszusondern, da ein Satz S dann die
Prsupposition P hat, wenn bei normalen
uerungen von S P als gemeinsames Wissen
vorhanden ist. Wir werden hier nicht mit
diesem pragmatischen Prsuppositionsbegriff
operieren, sondern uns an den linguistischen
oder semantischen Prsuppositionsbegriff hal-
ten, gem dem Prsuppositionen in der
Struktur ihrer Trgerstze enthalten sind.
Auch werden wir nicht versuchen, den lin-
guistischen Begriff aus dem pragmatischen
herzuleiten, wie Soames das mit Hilfe des
Begriffs der normalen uerung tut. Soa-
mes Prsuppositionsbegriff wrde vorhersa-
gen, da der Satz Das Auto hielt an z. B. Autos
haben Motoren prsupponiert, denn dies ist
gemeinsames Wissen, das bei normalen
uerungen dieses Satzes vorhanden ist (ak-
tiviert wird). Eine solche Verwendung des Ter-
minus Prsupposition macht den Prsup-
positionsbegriff unbrauchbar. Prsuppositio-
nen sollten von Hintergrundwissen getrennt
gehalten werden.
Der Grund fr diese Beschrnkung liegt
darin, da nur der linguistische (oder seman-
tische oder strukturelle) Prsuppositionsbe-
griff zu einer klaren Formulierung von Pro-
blemen und Lsungsvorschlgen gefhrt hat,
nicht aber der pragmatische, der Prsuppo-
sitionen mit uerungssituationen und Ge-
sprchsteilnehmern variieren lt. Laut Stal-
naker wrde man, wenn eine Ziege in den
Raum kme, normalerweise von diesem Zeit-
punkt an prsupponieren, da eine Ziege im
Raum ist (1978:323), und auf diese Tatsache
derzuerkennen, zumindest in klaren Fllen.
Was sich als schwierig erwiesen hat, ist viel-
mehr, dem Prsuppositionsbegriff den rechten
Platz innerhalb der Sprachtheorie zuzuwei-
sen. In diesem Artikel werde ich versuchen,
einen berblick darber zu geben, wie dieses
Problem in neuerer Zeit angegangen wurde,
welche Schwierigkeiten dabei hauptschlich
aufgetaucht sind und welche Perspektiven
man entwickelt hat.
Prsuppositionen waren in der Philosophie des
Mittelalters bekannt. Nuchelmans (1973:174) be-
richtet, da z. B. in der Ars Meliduna, einer Logi-
kabhandlung aus dem spten 12. Jahrhundert, Tr-
gerstze propositiones implicatae genannt werden,
die ein enuntiabile (= Behauptung) enthalten und
eine weitere Aussage (die Prsupposition), die wahr
sein mute, wenn die Behauptung nicht nichtig
werden sollte. Walter Burleigh (frhes 14. Jh.) be-
zeichnet das, was wir Prsupposition nennen, als
praeiacens (was vorliegt).
Beginnen wir mit einigen Beispielen. Wir sa-
gen, da die Stze (1 ag) unter anderem so
etwas wie die Stze (1 ag), die rechts neben
ihnen stehen, prsupponieren; das Symbol
dient hier zur Bezeichnung der Prsup-
positionsrelation:
(1) a. Frank hat auf-
gehrt zu rau-
chen.
a. Frank hat fr-
her geraucht.
b. Norma lebt
noch in Paris.
b. Norma hat in
Paris gelebt.
c. David hat Ehe-
bruch begangen.
c. David ist ver-
heiratet.
d. Hans wei, da
er sich geirrt hat
d. Hans hat sich
geirrt..
e. Haralds Kinder
schlafen.
e. Harald hat
Kinder.
f. Nur Karl hat
Whisky ge-
schmuggelt.
f. Karl hat
Whisky ge-
schmuggelt.
g. Es war Karl,
der Whisky ge-
schmuggelt hat.
g. Jemand hat
Whisky ge-
schmuggelt.
Die Stze (1ag) nennen wir die Trgerstze
und (1ag) Prsuppositionen dieser Trger-
stze. Der Unterschied besteht in der Regel
darin, da, wer einen Trgersatz uert, des-
sen Prsuppositionen als gegeben anzuneh-
men scheint. Ein Sprecher kann dies explizit
machen und zuerst eine oder mehrere der
Prsuppositionen uern und dann den Tr-
gersatz (man erhlt dann immer ein wohlge-
formtes Textstck); oder er kann die Prsup-
position(en) implizit lassen in diesem Fall
entnimmt ein kompetenter Hrer (das heit,
ein Hrer, der die Sprache beherrscht) die
288 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Satz A
B
nur in Kontexten interpretiert werden
kann, die zulassen, da B vor A geuert
wird.
Wie mittlerweile klar geworden ist, knnen
nicht nur Behauptungen, sondern auch alle
anderen Arten von Sprechakten Prsupposi-
tionen haben. Eine Frage zum Beispiel kann
sicherlich eine Prsupposition haben, wie
Shakespeares Der Widerspenstigen Zhmung
(V,1) zeigt, wo Vincentio ausruft: Komm
hierher, Spitzbube! Was, hast du mich verges-
sen? Diese Frage prsupponiert, da der
Adressat, Biondello, den Sprecher einmal ge-
kannt hat. Doch da Biondello das abstreitet,
erbrigt sich die Frage (wird sie nichtig):
Euch vergessen? Nein Herr, ich konnte Euch
nicht vergessen, denn ich habe Euch in mei-
nem Leben nicht gesehen. Beispiele dieser
Art lieen sich beliebig vermehren.
Die formalen semantischen Theorien, die
in diesem Jahrhundert entwickelt wurden,
haben Prsuppositionen als problematisch
empfunden. Zum einen kommt man nicht
umhin, Prsuppositionen der betrachteten
Art als etwas Semantisches anzusehen: sie
sind ein Teil des Sprachsystems und leisten
einen Beitrag zur Bedeutung ihrer Trger-
stze. Dann mu man ihnen aber auch in
einer semantischen Theorie, soll sie adquat
sein, einen geeigneten Platz zuweisen. Doch
haben die semantischen Theorien, die auf
dem Markt sind, Schwierigkeiten, einen ge-
eigneten Platz fr Prsuppositionen zu finden.
Es gibt dafr eine Reihe von Grnden. Er-
stens haben die existierenden Standard-Se-
mantiken wenig oder gar nichts ber Sprech-
akte zu sagen, die keine Behauptungen sind;
doch kommen Prsuppositionen solchen
Sprechakten ebenso zu wie den Behauptun-
gen. Ferner hat die moderne Semantik, die
sich aus der Logik entwickelt hat und immer
noch eng mit ihr verbunden ist, keine Erkl-
rung des Begriffs der Nichtigkeit; in der Pr-
suppositionsanalyse sagt man jedoch traditio-
nellerweise, da ein Satz, dessen Prsupposi-
tionen nicht alle erfllt sind, nichtig ist. Ein
weiterer Grund liegt darin, da die blichen
Formalisierungen von (Behauptungs-)Stzen,
die die syntaktische Herleitung logischer Fol-
gerungen ermglichen, fr die Ableitung von
Prsuppositionen ungeeignet sind. Es gibt
noch andere Grnde, zum Beispiel, da mo-
derne Semantik und Logik keinen Raum fr
Unterscheidungen lassen, die mit der Reihen-
folge von Behauptungen zusammenhngen,
wohingegen Prsuppositionen deutlich etwas
mit linearer Abfolge zu tun haben: man erhlt
knnte man zurckgreifen, wenn beispiels-
weise jemand sagt: Schau dir die an! Doch
linguistische Prsuppositionen liefern nicht
den auersprachlichen Bezug deiktischer Aus-
drcke. Linguistische Prsuppositionen sind
systematische Eigenschaften von Satztypen,
keine zuflligen Eigenschaften von ue-
rungen. Sie sind in der Sprache festgelegt. Nur
um diese Art von Prsuppositionen wird es
uns hier gehen.
Zudem mu sich eine Prsupposition durch
einen Satz ausdrcken lassen. Anders gesagt,
eine Prsupposition ist selbst ein sprachlicher
Gegenstand. So kann man zwar sagen, der
Satz Schau dir die an! verlange systematisch,
da die uerungssituation klar mache, wor-
auf sich das Wort die bezieht, doch ist das
keine Prsupposition im gewnschten Sinn.
Wir wollen in der Semantik nur das als Pr-
supposition betrachten, was eine Tatsache
ausdrckt, die fr den geglckten Gebrauch
des Trgersatzes als gegeben akzeptiert sein
mu. Die jeweilige Tatsache wird sich von
Situation zu Situation ndern, aber der Aus-
druck mu immer derselbe oder ein quiva-
lenter sein. Wenn ich also die Behauptung A
B
uere (das heit, den Satz A, der B prsup-
poniert) und die Behauptung, da A wahr ist,
glcken soll, dann mu B als wahr anerkannt
worden sein. (Wir werden uns hier nicht wei-
ter darber auslassen, was es genau heit,
Propositionen als wahr anzuerkennen oder
als gegeben zu akzeptieren. Man findet prak-
tisch in der gesamten aktuellen Literatur zur
Analyse von verbalen Kommunikationssitua-
tionen keine befriedigende Behandlung von
Sprecher-Verpflichtungen und der Annahme
von Propositionen fr die Zwecke eines Ge-
sprchs. Es kann hier nicht unsere Absicht
sein, eine grundstzliche Klrung solcher Be-
griffe zu liefern.)
Oder wenn ich frage, ob A
B
(wobei A eine
Ja-NeinFrage ist), so mu B als wahr akzep-
tiert sein, damit die Frage nach der Wahrheit
von A glcken kann. Ebenso kann eine ue-
rung des Imperativs A
B
nur dann glcken,
wenn B als wahr betrachtet wird. Der Ter-
minus glcken verweist auf ein ziemlich kom-
plexes Gefge von Bedingungen, aber im ge-
genwrtigen Zusammenhang ist nur eine Be-
dingung relevant, nmlich da das Gesprch
ohne Korrekturen fortgesetzt werden knnen
mu. Von einem streng logischen Standpunkt
aus bedeutet das, wie wir sehen werden, da
fr jede Aussage (oder Behauptung) A
B
gilt,
da B aus A logisch folgt. Von einem seman-
tischen Standpunkt aus bedeutet es, da ein
13. Prsuppositionen 289
Worten eine Default-Annahme, wenn (2) fr
wahr gehalten wird. Wir sagen daher, da B
eine Default-Annahme (DA) von (2) ist. Pr-
suppositionen unterscheiden sich prinzipiell
dadurch von anderen, normalen Folgerun-
gen, da letztere, im Gegensatz zu ersteren,
nie Anla zu DAs geben. Fr die herkmm-
liche formale Semantik liegt darin insofern
ein Problem, als sie ber kein Instrumenta-
rium verfgt, welches Default-Annahmen er-
fassen knnte. Solche nicht logischen Ph-
nomene werden, falls man sie berhaupt zur
Kenntnis nimmt, gewhnlich an eine (schlecht
definierte) Pragmatik abgeschoben. Doch
kann man schwer leugnen, da Prsupposi-
tionen etwas Semantisches sind.
Auerhalb der formalen Semantik im en-
gen Sinn findet man jedoch in gewissem Um-
fang theoretische berlegungen zu dem Pro-
blem, was mit den Prsuppositionen einge-
betteter Stze geschieht, d. h. dem sogenann-
ten Projektionsproblem fr Prsuppositionen.
Diese Literatur lt sich weder eindeutig der
Semantik noch eindeutig der Pragmatik zu-
ordnen; sie bildet einen eigenstndigen Be-
reich im Rahmen der Prsuppositionslitera-
tur. Das Projektionsproblem werden wir in
Abschnitt 5 besprechen. Hier sei nur darauf
hingewiesen, da in dieser Literatur oft nicht
oder nicht sehr klar zwischen Prsuppositio-
nen, die im strikten Sinn Folgerungen sind,
und abgeschwchten Prsuppositionen oder
DAs unterschieden wird. Das trifft nicht auf
die ganze Literatur zu, wie in Abschnitt 5 klar
wird, aber auf einiges davon. Und es ergibt
sich daraus ein bedauerlicher Mangel an
Klarheit in der gngigen Terminologie. Oft
wird der Begriff der Prsupposition ohne Un-
terschied sowohl fr Prsuppositionen, die
Folgerungen sind, als auch fr abgeschwchte
Prsuppositionen verwendet, und das ist ver-
wirrend. Und es gibt keinen allgemein aner-
kannten Terminus fr Prsuppositionen, die
bei der Einbettung des Trgersatzes zu blo
plausiblen Folgerungen abgeschwcht wer-
den. Wie oben bereits erwhnt, werden wir
hier den Begriff der Default-Annahme oder
DA verwenden.
2. Empirische Kriterien
Bevor wir zu einer genaueren Analyse von
Prsuppositionsphnomenen bergehen kn-
nen, gilt es, hinreichende Kriterien fr Pr-
suppositionen und Default-Annahmen zu
entwickeln. berlegen wir uns dazu zunchst
einmal, welche empirischen Kriterien es fr
einen guten Text, wenn die Prsupposition
zuerst kommt und danach der Trgersatz,
aber die umgekehrte Anordnung fhrt immer
zu kontextuellem Kauderwelsch oder jeden-
falls dazu, da man die Prsupposition als
nachtrgliche Information betrachten mu,
die den Trgersatz erst interpretierbar macht.
Der wichtigste Grund fr das Unbehagen
der formalen Semantiker an den Prsuppo-
sitionsphnomenen rhrt jedoch daher, da
Prsuppositionen manchmal zu blo plausi-
blen Folgerungen abgeschwcht werden. Dies
ist in der Regel dann der Fall, wenn ein Tr-
gersatz in einen greren, komplexeren Satz
eingebettet wird. Bei Einbettungen fallen Fol-
gerungen oft weg, wie man von der elemen-
taren Logik her wei. Ein komplexer Satz C,
der einen Satz A enthlt, erbt nicht notwen-
digerweise die Folgerungen von A. Wenn A
zum Beispiel das Antezedens eines Konditio-
nalsatzes ist, so gehen alle seine Folgerungen
verloren; ebenso, wenn A unter einem Glau-
bensoperator eingebettet ist. Dasselbe gilt fr
Prsuppositionen, die Folgerungen aus ihrem
Trgersatz sind: sie fallen bei Einbettungen
immer dann weg, wenn andere, normale Fol-
gerungen auch wegfallen. (Allerdings ist die
Negation, wie wir unten sehen werden, ein
Sonderfall.) Das Problem ist jedoch, da Pr-
suppositionen, anders als normale Folgerun-
gen, oft in abgeschwchter Form berleben,
nicht als strikte logische Folgerungen, aber
als naheliegende Schlufolgerungen, die man
zieht, solange nichts dagegen spricht. Man
betrachte etwa den Satz (2):
(2) Viktor glaubt, da sein Sohn in Kentucky
lebt.
Dies ist ein komplexer Satz, in dem der Satz
Viktors Sohn lebt in Kentucky (A) unter
einen Glaubensoperator eingebettet ist. A
prsupponiert Viktor hat einen Sohn (B),
und wenn A alleine vorkommt, so folgt der
Satz B auch aus A (A B). Aber aus (2), dem
ganzen komplexen Satz, folgt B nicht; das
zeigt sich daran, da aus (3):
(3) Viktor glaubt, da er einen Sohn hat, und
er glaubt, da sein Sohn in Kentucky lebt.
B nicht folgt. (Wenn B aus (2) folgen wrde,
dann sollte B auch aus (3) folgen, denn (3)
ist eine Konjunktion, die (2) als Konjunk-
tionsglied hat. Aber B folgt nicht aus (3), wie
jedermann zugeben wird. Also folgt B auch
nicht aus (2)). Dennoch legt (2) B immer noch
nahe: solange nichts dagegen spricht, wird
man, wenn man (2) fr wahr hlt, annehmen,
da Viktor einen Sohn hat. B ist mit anderen
290 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
(5)
a. Harald hat keine Tulpen gekauft
Harald hat Blumen gekauft.
Vielleicht hat Harald berhaupt
keine Blumen gekauft, jedenfalls hat er
keine Tulpen gekauft.
Harald hat keine Blumen gekauft
und erst recht keine Tulpen.
b. Sie denkt, der Gefangene sei entflohen
Jemand ist entflohen.
Vielleicht ist niemand entflohen,
aber sie denkt, der Gefangene sei ent-
flohen.
Niemand ist entflohen, aber sie
denkt, der Gefangene sei entflohen.
c. Vielleicht hat David Ehebruch began-
gen David ist verheiratet.
Vielleicht ist David nicht verheiratet,
aber vielleicht ist er verheiratet und
dann hat er mglicherweise Ehebruch
begangen.
! David ist nicht verheiratet, aber viel-
leicht hat er Ehebruch begangen.
d. Falls Hans wei, da er sich geirrt hat,
wird er es sagen.
Hans hat sich geirrt.
Vielleicht hat Hans sich nicht geirrt,
vielleicht aber doch, und falls er das
dann wei, wird er es sagen.
! Hans hat sich nicht geirrt, aber wenn
er wei, da er sich geirrt hat, wird er
es sagen.
Es ist darauf hinzuweisen, da es auch Flle
gibt, wo zwar der Test mit dem Mglichkeits-
operator Widersprchlichkeiten aufweist, der
Test ohne diesen Operator aber nicht:
(6) Die Wand ist schwarz
Die Wand ist wei
! Vielleicht ist die Wand nicht wei, aber
sie ist schwarz.
Die Wand ist nicht wei, aber/sondern
sie ist schwarz.
Beide Tests sind also notwendig. Fr die
Zwecke der Prsuppositionstheorie gengt
aber anscheinend der Test mit dem Mg-
lichkeitsoperator. Dieser liefert ein hinrei-
chend zuverlssiges Kriterium fr die Flle,
die uns hier beschftigen. Da Prsuppositio-
nen Folgerungen sind, mssen sie diesen Test
bestehen, doch braucht man ein weiteres Kri-
terium, um sie von gewhnlichen Folgerun-
gen abzugrenzen. Stalnaker (1973, 1974) und
insbesondere Van der Sandt (1982) haben ge-
zeigt, da die Akzeptabilitt von Texten ein
solches weiteres Kriterium bildet. Wenn A
B, dann gilt nicht nur A B, sondern auch,
da die Verknpfung B und A ein natrli-
den Begriff der Folgerung gibt. Der Folge-
rungsbegriff ist der zentrale Begriff der Logik,
denn die Logik ist ein Kalkl zur Bestimmung
von Folgerungen; die logische Definition der
Folgerung lautet: Aus A folgt B (A B) genau
dann, wenn es analytisch unmglich ist, da
A wahr ist und zugleich B falsch. Praktisch
heit dies: wenn A B, so kann ein Sprecher
nicht A behaupten und zugleich explizit auch
nur die Mglichkeit offen lassen, da nicht-B
gilt. Jede Folge von uerungen, in der eine
Behauptung, die die Mglichkeit von nicht-B
beinhaltet, und eine Behauptung, da A, ge-
meinsam vorkommen, mu intuitiv wider-
sprchlich anmuten. Es handelt sich jetzt
darum, dies in empirischen Kriterien auszu-
drcken, die sich auf gewhnliche wie auf
prsuppositionale Folgerungen gleicherma-
en anwenden lassen mssen.
In empirischer Hinsicht sagen wir also, da
eine analytisch notwendige Folgerung A B
genau dann vorliegt, wenn sowohl nicht-B
und/aber A als auch mglicherweise nicht-B
und/aber A widersprchlich anmuten. So geht
aus Beispiel (4) hervor, da es sich hier um
richtige Folgerungen handelt um nicht-
prsuppositionale oder gewhnliche in (a)
und (b) und um prsuppositionale Folgerun-
gen in (c) und (d) (die Ausrufezeichen stehen
fr intuitive Widersprchlichkeit):
(4)
a. Harald hat Tulpen gekauft
Harald hat Blumen gekauft.
! Vielleicht hat Harald keine Blumen
gekauft, aber er hat Tulpen gekauft.
! Harald hat keine Blumen gekauft,
aber er hat Tulpen gekauft.
b. Der Gefangene ist entflohen
Jemand ist entflohen.
! Vielleicht ist niemand entflohen, aber
der Gefangene ist entflohen.
! Niemand ist entflohen, aber der Ge-
fangene ist entflohen.
c. Alle Seejungfrauen sind blond
Es gibt Seejungfrauen.
! Vielleicht gibt es keine Seejungfrauen,
aber alle Seejungfrauen sind blond.
! Es gibt keine Seejungfrauen, aber alle
Seejungfrauen sind blond.
d. David hat Ehebruch begangen
David ist verheiratet.
! Vielleicht ist David nicht verheiratet,
aber er hat Ehebruch begangen.
! David ist nicht verheiratet, aber er hat
Ehebruch begangen.
Dagegen gibt es in (5) keine Folgerungsbezie-
hungen ( steht fr in Ordnung):
13. Prsuppositionen 291
Hier ist eine Katze, welche zu einer DA des
Glaubenssatzes wird, und daher sollte es un-
problematisch sein, den Satz Vielleicht ist hier
keine Katze vorangehen zu lassen. Da es
nicht unproblematisch ist, hat offenkundig
damit zu tun, da das Pronomen ich das
Subjekt von glauben ist. Mit einem anderen
Subjekt ist der Satz akzeptabel:
(8)
f. Vielleicht ist hier keine Katze, aber er
glaubt, da die Katze auf der Matratze
ist.
Wir knnen nun auch einen empirischen Test
fr DAs angeben: Wenn A B, aber B und
A einen akzeptablen Text bilden, und A
einen Teilsatz C
B
enthlt (d.h, einen Teilsatz
C, der B prsupponiert), dann ist B eine DA
von A (im folgenden mit A B abgekrzt).
Es ist zu beachten, da es viele Flle gibt, in
denen A B gilt und B und A akzeptabel
ist, es aber kein eingebettetes C
B
gibt, wie zum
Beispiel in:
(9)
a. Lady Fortune wiehert.
Lady Fortune ist ein Pferd.
b.
Lady Fortune ist vielleicht kein
Pferd, aber sie wiehert.
c. Lady Fortune ist ein Pferd, und sie
wiehert.
Da kein C
B
vorhanden ist, betrachten wir den
Satz Lady Fortune ist ein Pferd nicht als DA
von Lady Fortune wiehert. Da er gleichfalls
keine Folgerung ist wie (9b) zeigt , ist
er auch keine Prsupposition. Er mag eine
Default-Annahme in einem umfassenderen
Sinn sein, aber nicht in dem hier eingefhrten
technischen Sinn.
Die Kombination der beiden Tests Fol-
gerung und Textakzeptabilitt weicht von
dem ab, was man hufig in der Literatur
findet, dem sogenannten Negationstest. Die-
ser Test geht auf Strawson (1950a) zurck
(siehe unten). Strawson hat vorgeschlagen,
da, wenn A B, so auch nicht-A B (und
wenn nicht-B wahr ist, so hat A keinen Wahr-
heitswert). Wenn dieser Vorschlag korrekt
wre, wre A B genau dann der Fall, wenn
(a) B sowohl aus A als auch aus nicht-A folgt
und (b) B keine notwendige Wahrheit ist.
Doch wrde dies zum einen bedeuten, da
notwendige Wahrheiten nie Prsuppositionen
sein knnten (eine offenbar allzu drakonische
Manahme). Zum anderen wre damit (wor-
auf u. a. Russell (1905), Wilson (1975), Bor
& Lycan (1976) hingewiesen haben) nicht be-
rcksichtigt, da A B (zumindest in der
Regel vgl. Abschnitt 6) nicht nicht-A B
nach sich zieht: die Negation kann radikal
ches und wohlgeformtes (d. h. akzeptables)
Textstck bildet. Wenn wir diesen Test bei-
spielsweise auf (1ag) anwenden und ge-
eignete Pronominalisierungen zulassen , so
ist das Ergebnis positiv:
(7)
a. Frank hat frher geraucht, und er hat
aufgehrt zu rauchen.
b. Norma hat in Paris gelebt, und sie lebt
noch in Paris.
c. David ist verheiratet, und er hat Ehe-
bruch begangen.
Stze, die unbetonte Teile enthalten, die aus
ihnen folgen, knnen demnach so analysiert
werden, da diese Teile prsupponiert sind:
(7)
d. (Harry wird abreisen, und) er wird mor-
gen abreisen.
e. (Die Geldbrse wurde gefunden, und)
sie wurde von der Polizei gefunden.
Solche Flle hneln Spalt- und Sperrkon-
struktionen, die in Abschnitt 3 behandelt wer-
den. Sie zeigen da Prsuppositionen mit
Thema-Rhema-Phnomenen verwandt sind.
Bei gewhnlichen Folgerungen fhrt je-
doch die Verbindung B und A zu einem
unnatrlichen und inakzeptablen Textstck
(D* soll die Inakzeptabilitt von Texten be-
zeichnen):
(8)
a. D* Harald hat Blumen gekauft, und
er hat Tulpen gekauft.
b. D* Jemand ist entflohen, und der Ge-
fangene ist entflohen.
Dies sind also unsere beiden empirischen Kri-
terien fr Prsuppositionen: Folgerung und
Textakzeptabilitt. Sie haben sich, zumindest
fr Trgerstze, die Behauptungen sind, fr
den derzeitigen Stand der Prsuppositions-
theorie als hinreichend erwiesen. Systemati-
sche empirische Tests fr andere Sprechakte
wurden nicht entwickelt. Doch ist es mglich,
da eine Prsupposition im Skopus eines
nicht-behauptenden Sprechaktoperators steht
und damit ihren DA-Status verliert:
(8)
c. Wurde Hans von seiner Frau verlassen,
oder hat er keine Frau?
d. Geh in den Laden und kaufe nur eine
Sddeutsche!
Auch ist zu beachten, da der Test, so wie
wir ihn formuliert haben, bei einer Variante
von Moores Paradox scheitert:
e. ! Vielleicht ist hier keine Katze, aber
ich glaube, da die Katze auf der Ma-
tratze ist.
Der eingebettete Satz hat die Prsupposition
292 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
suppositionen durch das Prdikat eines Satzes
erzeugt werden, und zwar genau dann, wenn
dieses Prdikat bezglich der betrachteten
Termposition extensional ist und der betrach-
tete Term definit oder allquantifiziert.
Eine zweite wohlbekannte Klasse sind die
faktiven Prsuppositionen. Manche Prdikate
(zu denen auch einige Adjektive gehren) sind
bezglich eines Satzterms faktiv. Das heit,
die Wahrheit des eingebetteten faktiven Satzes
wird prsupponiert. Der faktive Satz kann
ein Subjekt- oder ein Objektsatz sein. Bei
manchen Verben kann sowohl an Subjekt- als
auch an Objektposition ein Satz stehen (be-
deuten, nahelegen, beweisen). Solche Zwei-
Satz-Verben sind immer bezglich des Sub-
jektsatzes faktiv. Der Grund fr diese eigen-
tmliche Tatsache ist nicht bekannt. Aber
man kann sagen, da ein faktives Verb stets
bezglich des Satzterms mit dem hchsten
Rang faktiv ist unter der Annahme, da
es eine universelle Rangfolge von Termposi-
tionen gibt, gem der Subjekte vor Objekten
kommen, Objekte vor indirekten Objekten
usw. (vgl. Keenan & Comrie 1977, Comrie &
Keenan 1979). Dementsprechend ist in (13)
der Subjektsatz faktiv:
(13) Da an Haralds Schuhen Schlamm ist,
bedeutet/ legt nahe/ beweist/ lt einen
vermuten, da er der Mrder ist.
Neben den normalen faktiven Verben gibt es
auch Verben, die die Falschheit eines einge-
betteten Satzterms prsupponieren (z. B. sich
einbilden, da oder whnen vgl. Frege
1892:47). Diese knnte man antifaktive Ver-
ben nennen.
Normale faktive Prdikate sind z. B. wis-
sen, einsehen, vergessen haben, schade sein,
bedauerlich, schrecklich, wunderbar, nichts/et-
was ausmachen, entzckt sein. Es ist mglich,
eine Klasse von schwachen faktiven Verben
auszugrenzen: Verben, die zwar gewhnlich
die Wahrheit des eingebetteten Satzterms pr-
supponieren, aber auch so verwendet werden
knnen, da dies nicht der Fall ist. Beispiele
sind traurig sein, herausfinden:
(14)
a. Lindas Kaninchen ist nicht gestorben,
aber sie glaubt, es sei gestorben und
ist traurig darber.
b. Du Dummkopf, ich bin sicher, du hast
jetzt herausgefunden, da die Erde ein
Wrfel ist.
Man mu aufpassen, da man faktive Pr-
dikate (Verben) nicht mit sogenannten impli-
kativen Verben verwechselt (Karttunen 1971).
Stze mit einem implikativen Verb als Haupt-
verwendet werden, so da auch die Prsup-
position verneint wird:
(10) David hat NICHT Ehebruch begangen:
er ist nicht einmal verheiratet!
Auch wenn solche Verwendungen der Nega-
tion markiert sind, zeigen sie, da der Straw-
sonsche Test zwar einen heuristischen Wert
haben mag, aber nicht wirklich zuverlssig
ist.
3. Klassifikation und strukturelle
Basis von Prsuppositionen
Wir knnen vier Klassen von Prsuppositio-
nen unterscheiden (wobei die vierte eine Rest-
kategorie ist). Wir haben zunchst die Klasse
der Existenzprsuppositionen. Sie wurden als
erste entdeckt und haben die besondere Auf-
merksamkeit der Philosophen auf sich gezo-
gen. Es handelt sich bei ihnen um Behaup-
tungen, da etwas tatschlich existiert, wie in:
(11)
a. Der Knig von Frankreich ist kahl-
kpfig.
Es gibt einen Knig von Frank-
reich.
b. Alle Tren waren verschlossen.
Es gab Tren.
Man sagt gewhnlich, da Existenzprsup-
positionen durch den bestimmten Artikel
(der) oder den Allquantor (alle) ausgelst
werden. Doch das ist nicht richtig, denn
manchmal ist es mglich, eine wahre Behaup-
tung zu machen, die der oder alle enthlt (und
zwar nicht in einem eingebetteten Satz) und
dennoch nicht die tatschliche Existenz des-
sen prsupponiert, auf das mittels der oder
alle Bezug genommen wird:
(12)
a. Die gesamte Polizei sucht den York-
shire-Mrder
Es gibt einen Yorkshire-Mrder.
b. Alle Gtter werden von jemandem
verehrt. Es gibt Gtter.
Existenzprsuppositionen hngen zwar in der
Regel davon ab, ob die fragliche Nominal-
phrase definit oder allquantifiziert ist, aber
eben auch davon, ob das betreffende Prdikat
an der Position, an der die Nominalphrase
steht, extensional ist. Manche Prdikate sind
bezglich bestimmter Termpositionen nicht
extensional: suchen und verehren zum Beispiel
sind bezglich ihres Objekts nicht extensional,
denn man kann nach etwas suchen oder etwas
verehren, ohne da dieses Etwas tatschlich
existiert. Wir sagen deshalb, da Existenzpr-
13. Prsuppositionen 293
ist und da der Objektterm eine Person von
hohem sozialen Status bezeichnet, die in Ver-
bindung mit diesem Status ermordet wird.
Neben Vorbedingungen stellen Prdikate
auch Erfllungsbedingungen (im engeren Sinn)
an die Denotate ihrer Argumentterme: diese
Bedingungen mssen erfllt sein, wenn ein
Satz mit dem fraglichen Prdikat wahr sein
soll und sie erzeugen gewhnliche Folgerun-
gen. Ihre Verletzung fhrt zu (klassischer)
Falschheit. Die empirischen Kriterien, die wir
in Abschnitt 2 besprochen haben, entscheiden
darber, ob eine Bedingung eine Vorbedin-
gung oder eine Erfllungsbedingung ist. Das
Verb ermorden zum Beispiel hat als Vorbedin-
gung, da das Denotat seines Subjektterms
menschlich und das Denotat des Objektterms
zumindest ein Tier mit Rechten ist. Zu seinen
Erfllungsbedingungen gehrt, da das Tten
ungesetzlich und vorstzlich erfolgen mu.
Diese Forderung ist keine Vorbedingung, wie
der empirische Test sofort zeigt. Vorbedin-
gungen knnen einen Groteil des semanti-
schen Gehalts eines Prdikats ausmachen und
so seine Erfllungsbedingungen trivialisieren.
So besteht zum Beispiel bei steigerbaren
Adjektiven wie gro, alt, hlich, leicht die
Vorbedingung darin, da das Denotat des
Subjektterms die Eigenschaft haben mu, die
der von dem Adjektiv ausgedrckten Dimen-
sion entspricht (Gre, Alter, Nicht-
Schnheit, Leichtigkeit); die diesen Adjek-
tiven gemeinsame Erfllungsbedingung be-
sagt, da das Denotat des Subjekts die be-
treffende Eigenschaft in einem bestimmten
(implizit festgelegten) Grad besitzt.
Wenn eine kategorielle Vorbedingung ver-
letzt ist, so erhalten wir in der Regel das, was
in der Sprachphilosophie als Kategorienfehler
bekannt ist. Es ist zum Beispiel ein Katego-
rienfehler zu sagen Diese Kugel hat den Butler
ermordet. Manchmal werden Kategorienfeh-
ler absichtlich gemacht, um den Hrer dazu
zu zwingen, den Satz so zu deuten, als ob er
keinen Kategorienfehler enthalte. Wenn zum
Beispiel E. M. Forster (Engel und Narren)
schreibt:
(17) Und der Zug tanzte im Sonnenunter-
gang einen Walzer um die Mauern von
Verona.
so werden Sie als Leser das so deuten, als ob
der Zug ein lebendiges menschliches Wesen
sei. Dies ist ein wichtiges Element in der Me-
tapher, die dann weiterhin den kreisfrmigen
Weg des Zuges um die Stadtmauern von Ve-
rona mit den Drehungen eines Walzers ver-
gleicht (und damit das Bild eines Festes am
prdikat prsupponieren nicht die Wahrheit
des eingebetteten Satzes, sondern dieser Teil-
satz folgt aus ihnen, und wenn sie negiert
werden, folgt aus ihnen der negierte Teilsatz
(und wenn man sie in Frageform setzt, so
wird nach der Wahrheit des Teilsatzes ge-
fragt). Ein solcher Fall ist gelingen:
(15)
a. Es gelang ihnen, die Grenze vor Ein-
bruch der Dunkelheit zu erreichen.
Sie erreichten die Grenze vor Ein-
bruch der Dunkelheit.
b. Es gelang ihnen nicht, die Grenze vor
Einbruch der Dunkelheit zu erreichen.
Sie erreichten die Grenze nicht vor
Einbruch der Dunkelheit
Der Textakzeptabilittstest (Abschnitt 2) zeigt
deutlich, da wir es hier nicht mit Prsup-
positionen zu tun haben:
(16)
D* Sie erreichten die Grenze vor Ein-
bruch der Dunkelheit und das gelang
ihnen.
Faktive Prsuppositionen sind in neuerer Zeit
von Linguisten (wieder) entdeckt worden (Ki-
parsky & Kiparsky, 1970). Der Begriff der
Faktivitt war schon in der Philosophie des
Mittelalters bekannt. Er kommt aber in der
philosophischen Prsuppositionsliteratur
kaum vor und wird auch in der formalen
Semantik selten erwhnt.
Eine dritte Klasse von Prsuppositionen
knnte man kategorielle Prsuppositionen
nennen. Sie entstehen aufgrund spezifischer
semantischer Eigenschaften von Prdikaten
(d. h. von einzelnen Lexemen oder auch von
komplexen Konstruktionen wie Ehebruch be-
gehen). Solche prsuppositionsauslsenden
lexikalisch-semantischen Eigenschaften fin-
den sich im Lexikon aller natrlichen Spra-
chen. Allerdings haben die Semantiker erst
krzlich einen Blick fr dieses Phnomen ent-
wickelt (vgl. Fillmores Untersuchung von
1971 ber accuse und criticise). Wir werden
hier von Vorbedingungen sprechen, die von
Termdenotaten erfllt werden mssen, wenn
die uerung des Satzes mit dem betreffen-
den Prdikat als Hauptprdikat glcken soll.
Es lassen sich beliebig Beispiele fr lexikali-
sche Vorbedingungen im Lexikon finden. So
stellt etwa das Verb schmuggeln an seinen
Objektterm die Vorbedingung, da er etwas
bezeichne, dessen Transport illegal ist. Zu-
rckkommen hat als Vorbedingung, da der
Subjektterm etwas bezeichnet, das weg war
oder ist. Das englische assassinate erfordert,
da das Denotat seines Subjekts menschlich
294 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
prsupponiert, da Karl Whisky geschmuggelt
hat und da er behauptet, da niemand an-
deres Whisky geschmuggelt hat. Wir weisen
hier darauf hin, da die regulre Negation
dieses Satzes:
(21) Nicht nur Karl hat Whisky geschmug-
gelt.
die Prsupposition bewahrt und nur die Be-
hauptung verneint. Wir werden dazu weiter
unten mehr sagen.
Ein hnlicher, aber komplexerer Prsup-
positionstyp ist mit sogar [even] verknpft:
(22) Sogar Karl hat Whisky geschmuggelt.
[Even Carl smuggled whisky.]
Dieser Satz prsupponiert, da niemand von
Karl erwarten wrde, da er Whisky schmug-
gelt, und behauptet, da Karl es dennoch
getan hat. Fr den negierten Satz:
(23) Nicht einmal Karl hat Whisky ge-
schmuggelt.
[Not even Carl smuggled whisky.]
gilt jedoch nicht (wie bei nur), da er die
Prsupposition bewahrt und blo die Be-
hauptung verneint. (23) prsupponiert viel-
mehr, da niemand von Karl erwarten wrde,
da er keinen Whisky schmuggelt, und be-
hauptet, da Karl es dennoch nicht getan hat.
Logisch und semantisch gesehen ist (23) also
nicht die Negation von (22). Will man (20)
und (21) als den regulren Fall behalten, so
kann man annehmen, da (23), obwohl es so
tut, als sei es die Negation von (22), in Wirk-
lichkeit eher (24) entspricht:
(24) Sogar Karl hat keinen Whisky ge-
schmuggelt.
[Even Carl did not smuggle whisky.]
(Man beachte, da viele Sprachen eine Satz
(24) entsprechende Form verwenden, um den
Inhalt von (23) auszudrcken.) sogar [even]
wird dann so analysiert, da es die Prsup-
position erzeugt, da man von dem Gegen-
stand, den der von sogar [even] modifizierte
Term bezeichnet, nicht erwarten wrde, da
er die Proposition, in der er vorkommt, er-
fllt; und die Behauptung ist dann, da er
dies doch tut. Eine solche Lsung ist natrlich
nur dann gangbar, wenn man bereit ist, in der
Grammatik einen Unterschied zwischen der
Oberflchenform eines Satzes und seiner se-
mantisch relevanten Form zu machen. Nicht
alle semantischen Theorien lassen eine solche
Unterscheidung zu und stehen dann unver-
meidlich vor dem Problem, eine systematische
Erklrung fr Flle wie (22) und (23) zu ge-
ben.
frhen Abend auftauchen lt). Absichtliche
Kategorienfehler knnen also zum Aufbau
einer Metapher beitragen.
Schlielich gibt es noch einige weitere Pr-
suppositionstypen, die in der Literatur wohl-
bekannt sind, sich aber nicht ohne weiteres
einer der drei bisherigen Kategorien zuordnen
lassen. Wir fassen sie hier in Ermangelung
einer grundstzlicheren Behandlung zu einer
vierten Kategorie zusammen. Ein typischer
Fall sind die Prsuppositionen, die mit Spalt-
und Sperrstzen assoziiert sind fr die wir
in (18a) und (18b) jeweils ein Beispiel geben
(vgl. auch 7d,e):
(18)
a. Es war Karl, der Whisky geschmug-
gelt hat.
b. Wer Whisky geschmuggelt hat, war
Karl
Beide Stze prsupponieren, da jemand
Whisky geschmuggelt hat, und diese Prsup-
position ist regelmig und vermutlich struk-
turell mit der Spalt- bzw. Sperrkonstruktion
gekoppelt. Man beachte, da die reale Exi-
stenz eines Whiskyschmugglers nur aus der
Tatsache folgt, da schmuggeln bezglich der
Subjektposition extensional ist. Bei Spalt-
oder Sperrkonstruktionen mit nichtextensio-
nalen Termen haben wir eine solche Folge-
rung nicht:
(19)
a. Es war das Ungeheuer von Loch
Nesss, von dem sie trumte.
b. Wovon sie trumte, war das Unge-
heuer von Loch Ness.
Offenkundig knnen diese Stze wahr sein,
ohne da es tatschlich ein Ungeheuer von
Loch Ness gibt. Aber die Prsupposition, da
sie von etwas trumte, ist immer noch vorhan-
den. Dies hat zur Folge, da es Dinge gibt,
die nicht existieren, wie das Haus, das ge-
plant, aber nie gebaut wurde oder die Person,
von der wir uns einbilden, sie stehe in der
Tr, usw. (vgl. Seuren 1985: 472476),
eine Folgerung, die fr einige Philosophen
unerwnscht ist, aber in der Semantik natr-
licher Sprachen unvermeidlich. Man mu da-
her zwischen es gibt und es existiert unter-
scheiden, und der Existenzquantor ist am be-
sten so zu deuten, da er ersteres und nicht
letzteres impliziert.
Ein anderer Prsuppositionstyp in dieser
Klasse sind die von dem Operator nur er-
zeugten Prsuppositionen:
(20) Nur Karl hat Whisky geschmuggelt.
Der empirische Test zeigt, da dieser Satz
13. Prsuppositionen 295
suppositionen erzeugen und da diese Pr-
suppositionen als Teil ihrer lexikalischen Be-
deutung beschrieben werden mssen. Das
macht sie zu lexikalischen Prsuppositionen,
wenngleich nicht unbedingt zu solchen, die an
ein Prdikat gebunden sind: Man mte ei-
gens begrnden, da nur, sogar, auch am be-
sten als Prdikate zu analysieren sind. Fr
die Prsuppositionen von Spalt- und Sperr-
konstruktionen lt sich jedoch kein nahelie-
gender lexikalischer Ursprung finden. Hier
werden die meisten lieber davon sprechen,
da die Prsuppositionen von einer gram-
matischen Konstruktion erzeugt werden.
Man wrde ein neues und berzeugendes Ar-
gument bentigen, um zu zeigen, da sich
auch hier eine lexikalische Quelle ausmachen
lt (z. B. die Kopula sein, s. Abschnitt 6.2).
In der Literatur wurde brigens der Frage
nach der strukturellen Basis von Prsuppo-
sitionen nicht die Aufmerksamkeit geschenkt,
die ihr angesichts der Relevanz gebhrt, die
sie fr das umfassendere Problem der Kom-
positionalitt hat, d. h. fr das Problem, wie
sich die Gesamtbedeutung von Stzen aus der
Bedeutung ihrer Teile aufbaut. Fr den kom-
positionalen Aspekt hat man sich hauptsch-
lich im Zusammenhang mit Projektionsph-
nomenen interessiert (vgl. Abschnitt 5), aber
viel weniger hinsichtlich des Ursprungs ele-
mentarer Prsuppositionen. Manche Autoren
(Sadock 1978; 282, Karttunen & Peters 1979)
ziehen es vor, Prsuppositionen als konven-
tionale Implikaturen (im Sinne von Grice
1975) zu betrachten, d. h. als etwas, das kon-
ventional an Lexeme und grammatische Kon-
struktionen gebunden ist. Das steht nicht un-
bedingt im Widerspruch zu dem, was wir
oben gesagt haben, vorausgesetzt, da man
die Folgerungsbeziehungen przise be-
schreibt. Doch scheint der Versuch, den ohne-
hin undurchsichtigen Begriff der Prsuppo-
sition ber den noch undurchsichtigeren Be-
griff der konventionalen Implikatur zu expli-
zieren, kontraproduktiv (vgl. Van der Sandt
1982:73). Es drfte produktiver sein, Prsup-
positionen als systematische und konven-
tionale Bedeutungsbestandteile als seman-
tische Eigenschaften der Lexeme und Kon-
struktionen zu betrachten, von denen sie aus-
gelst werden.
4. Der logische Prsuppositionsbegriff
und wie er pragmatisch wurde
Den Ausgangspunkt der modernen Prsup-
positionsforschung bildet Gottlob Freges
klassische Untersuchung ber Sinn und Be-
Schlielich haben wir die Prsuppositionen
die mit auch, ebenso, gleichfalls und hnlichen
Wrtern verbunden sind. Man betrachte die
nachstehenden beiden Flle:
(25)
a. Karl hat auch Whisky geschmuggelt
Karl hat etwas anderes (als
Whisky) geschmuggelt.
b. Auch Karl hat Whisky geschmuggelt
Jemand anderer (als Karl) hat
Whisky geschmuggelt.
Diese Flle zeigen, da Wrter wie auch je-
weils an eine Konstituente des Satzes gekop-
pelt sind (ganz hnlich wie nur und sogar).
Die erzeugte Prsupposition ist dann der
ganze Satz, aber mit einer Existenzabschw-
chung bezglich der Konstituente, zu der auch
gehrt. Wir werden hier auf die grammati-
schen Regeln, die festlegen, mit welcher Kon-
stituente auch jeweils verbunden ist, nicht wei-
ter eingehen. (Fr frhere Analysen von nur,
sogar, auch siehe Horn (1969), Keenan
(1971b), vgl. auch Artikel 38).
Die obige Klassifikation wirft unmittelbar
die Frage nach der strukturellen Basis von
Prsuppositionen auf, und insbesondere die
Frage, ob es eine gemeinsame strukturelle Ba-
sis fr alle Prsuppositionen gibt. Fr die
erste Kategorie (Existenzprsuppositionen)
haben wir die strukturelle Basis angegeben:
sie werden dadurch erzeugt, da das Haupt-
prdikat bezglich einer Position extensional
ist, in der ein definiter oder allquantifizierter
Term steht. Das bedeutet, da das Lexikon
fr jedes Prdikat angeben mu, an welchen
Positionen es extensional ist und an welchen
nicht. (In der Praxis betrachtet man Extensio-
nalitt am besten als den Normalfall, so da
man nur Nichtextensionalitt besonders
kennzeichnen mu.)
Die Kategorien der faktiven und der ka-
tegorialen Prsuppositionen sind gleichfalls
lexikalisch bestimmt: Man mu im Lexikon
fr jedes Prdikat angeben, welche faktiven
und kategorialen Prsuppositionen es auslst.
Solange man keine allgemeinen Prinzipien
entdeckt hat, die das Vorkommen solcher le-
xikalischen Prsuppositionen regeln und da-
mit in einem gewissen Ma vorhersagen, mu
man die Prsuppositionseigenschaften jedes
einzelnen Prdikats gesondert auffhren.
Wir sehen also, da die strukturelle Basis
fr die ersten drei Typen von Prsuppositio-
nen in der semantischen Beschreibung einzel-
ner lexikalischer Prdikate gegeben ist. Dies
gilt nicht fr die Flle, die wir unter der
vierten Kategorie diskutiert haben. Bei nur,
sogar und auch kann man sagen, da sie Pr-
296 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
rator im logischen System formuliert wer-
den konnte.
Man sieht, da Frege irgendwo in der
Mitte zwischen traditioneller und moderner
Analyse steht. Er lt noch Stze ohne Wahr-
heitswert zu, aber nur in der Literatur und
nicht, wenn es um Wahrheit geht, also in
Wissenschaft und Logik. Diese mchte er von
jeglichem aristotelischen Makel frei halten.
Aber er mu dafr einen Preis zahlen: wenn
die Extension definiter Terme, die nichts in
der Welt bezeichnen, die leere Menge ist, dann
mu aufgrund des Prinzips der Substitution
koreferentieller Terme salva veritate (SSV)
(27b), genauso wie (27a), wahr sein:
(27)
a. Die leere Menge ist Teilmenge von
jeder Menge.
b. Der gegenwrtige Knig von Frank-
reich ist Teilmenge von jeder Menge.
Das luft unseren Intuitionen ernstlich zu-
wider. Es war Frege klar, da Prsuppositio-
nen eine Herausforderung, wenn nicht gar
eine Bedrohung fr jede logische Analyse na-
trlicher Sprache im klassischen Rahmen dar-
stellen.
Das war auch Russell klar. Und Russells
Lsung (seine Kennzeichnungstheorie, 1905)
war viel radikaler: Man eliminiere alle defi-
niten Terme (auer den Eigennamen) und rea-
nalysiere sie als Erscheinungsformen des Exi-
stenzquantors; man lese (26) als es gibt ein
x, so da gilt: x ist Knig von Frankreich
und x ist kahlkpfig. Da die natrliche Spra-
che zudem offenbar verlangt, da es nur einen
solchen Knig geben darf, wird die Einzig-
keitsklausel hinzugefgt: und fr jedes y
gilt: wenn y Knig von Frankreich ist, dann
ist y identisch mit x. Die Formel lautet also:
(28)
a. x(KF(x) Kahl(x) y(KF(y)
x = y))
So, wie die Welt derzeit beschaffen ist, ist
(28a) falsch, und seine logische Negation
wahr:
(28)
b. x(KF(x) Kahl(x) y(KF(y)
x = y))
Aber aus dem einen oder anderen Grund nei-
gen Sprecher natrlicher Sprachen dazu, die
natursprachliche Negation von (26):
(29) Der gegenwrtige Knig von Frankreich
ist nicht kahlkpfig.
nicht als (28b) sondern als (30) zu verstehen:
(30) x(KF(x) Kahl(x) y(KF(y)
x = y))
deutung (1892). Dort setzt Frege ein exten-
sionales Kompositionalittsprinzip voraus: die
Extension eines Satzes ist eine Funktion der
Extensionen seiner Teile (S. 33). Die Exten-
sion eines Satzes ist fr Frege sein Wahrheits-
wert (S. 34). Die Extension eines definiten
Terms (Kennzeichnung, Eigenname, definites
Pronomen) ist ein Gegenstand in der Welt,
der Bezug oder die Bedeutung dieses Terms.
Die Frage lautet nun: Was geschieht, wenn
ein definiter Term in einem Satz nichts be-
zeichnet, wie in dem berhmten Beispiel von
Russell (1905):
(26) Der gegenwrtige Knig von Frankreich
ist kahlkpfig.
wenn Frankreich keinen Knig hat? In sol-
chen Fllen, so sagt Frege, darf man, wie bei
der Lektre eines Romans, den Satz so inter-
pretieren, als habe er nur einen Sinn, aber
keinen Wahrheitswert. Oder aber man sagt,
da der Term die leere Menge bezeichnet
(S. 41); dann ergibt sich in der Regel, da der
Satz falsch wird (z. B. ist Kahlkpfigkeit
keine Eigenschaft der leeren Menge). Doch
fr Frege ist ein solcher Gebrauch definiter
Terme ein Mibrauch, der in der Umgangs-
sprache vermieden werden sollte und der in
der Logik und der Mathematik eindeutig ge-
fhrlich ist. Seiner Meinung nach ist es eine
Unvollkommenheit der natrlichen und eini-
ger logischen Sprachen, da sie solche Ver-
wendungen berhaupt zulassen. Es ist eine
Voraussetzung also eine Prsupposition
fr jeden Behauptungssatz und ebenso fr
seine Negation, da die definiten Terme in
ihm einen Bezug in der Welt haben.
Man mu die ganze Angelegenheit vor dem
Hintergund des klassischen metalogischen
Prinzips vom Ausgeschlossenen Dritten (PAD)
sehen, das auch als striktes Bivalenzprinzip
bekannt ist. Es besagt:
Im logischen System gilt:
(a) jeder Satz hat einen Wahrheitswert und
(b) es gibt genau zwei Wahrheitswerte, nm-
lich wahr und falsch.
Aristoteles Prdikatkalkl, das logische
Quadrat, war explizit durch PAD be-
schrnkt (Strawson 1952:157171; Kneale &
Kneale 1962:55 f.). Dieses alte System hatte
jedoch den Nachteil, da es nicht alle Stze
erfassen kann: Stze, die ber leere Klassen
quantifizieren, mssen ausgeschlossen wer-
den, da sonst Paradoxien entstehen. Es war
eine der wichtigsten Motivationen fr die Ent-
wicklung der modernen Quantifikationstheo-
rie, diese Beschrnkung aufheben zu wollen,
so da PAD ohne den einschrnkenden Ope-
13. Prsuppositionen 297
b. Es gab einen Mann, und der Mann
gewann das Rennen, und es gab einen
Mann, und der Mann gewann das
Rennen nicht.
Russells Analyse kann nicht erklren, warum
(33a) widersprchlich ist und (33b) nicht.
Und schlielich gibt es in Russells Theorie
keine Erklrung dafr, da normale Sprecher
dazu neigen, (29) als (30) und nicht als (28b)
zu verstehen, obwohl, grammatisch gesehen,
(29) nichts anderes ist als die Negation von
(26). Es ist wahr, da Russell nicht den An-
spruch erhoben hat, eine semantische Analyse
zu liefern, sondern nur eine logische Analyse
geben wollte. Aber die Semantiker haben die-
sen Unterschied immer vernachlssigt, und
die Russellsche Kennzeichnungstheorie hat in
der Semantik und nicht in der Logik Karriere
gemacht. Doch als semantische Theorie ist sie
falsch.
Es ist kein Zufall, da die erste ernstzu-
nehmende Kritik an Russells Analyse aus der
Philosophie der normalen Sprache kam, die
in den Jahrzehnten nach dem zweiten Welt-
krieg in Oxford ihren Hhepunkt hatte. Diese
einflureiche philosophische Bewegung be-
trachtete Sprache als etwas auf natrliche
Weise Entstandenes, das man als solches ak-
zeptieren und ernst nehmen msse. Die Ver-
treter dieser Richtung wurden zu scharfen
Beobachtern der Sprache und waren natrlich
nicht damit einverstanden, wie Russell sich
rcksichtslos ber sprachliche Tatsachen und
Regelmigkeiten hinwegsetzte. 1950 und
1952 verffentlichte Strawson seinen bekann-
ten Angriff auf Russell (1905). Er macht zu-
nchst die zweifellos richtige Beobachtung,
da in der natrlichen Sprache nicht Satzty-
pen, sondern uerungsvorkommnisse Wahr-
heitswerte haben. Dann bernimmt er Freges
Analyse, zieht jedoch die weitere Konsequenz,
da ein Satz (oder besser eine uerung), in
der ein definiter Term vorkommt, der nichts
bezeichnet, berhaupt keinen Wahrheitswert
hat. Das heit, er weicht insofern von Frege
ab, als er Termen, die nichts bezeichnen, nicht
als knstliches Denotat die leere Menge zu-
ordnet und damit das merkwrdige Ergebnis
vermeidet, da (27a) und (27b) notwendiger-
weise den gleichen Wahrheitswert haben, so-
lange Frankreich keinen Knig hat. Strawson
wendet einfach das extensionale Kompositio-
nalittsprinzip an: wenn ein Teil einer ue-
rung keine Extension hat, dann hat auch die
ganze uerung keine Extension. In einem
solchen Fall hat die uerung dann keinen
Wahrheitswert.
Wenn diese logische Analyse auch linguistisch
und insbesondere semantisch korrekt ist, so
kann man offenkundig zumindest auf Exi-
stenzprsuppositionen verzichten und davon
ausgehen, da die natrliche Sprache PAD in
seiner unbeschrnkten Version gengt und
damit von einem logischen Standpunkt aus
einwandfrei ist. Diese saubere und logische
Sichtweise der Sprache war daher den Logi-
kern, die sich fr Linguistik interessierten, viel
lieber. Sie wird immer noch in gewissen Krei-
sen fr korrekt erachtet. (Vgl. jedoch Geach
(1950), der eine ernstzunehmende Kritik an
Russells Analyse vorbringt, die teilweise auf
der Unterscheidung von Prsupposition und
Behauptung grndet.)
Man mu jedoch sehen, da diese Kenn-
zeichnungstheorie der natrlichen Sprache
nicht gerecht wird. Erstens kann sie Prsup-
positionen, die keine Existenzprsuppositio-
nen sind (vgl. Abschnitt 3), berhaupt nicht
erklren. Und zweitens kann sie auch Exi-
stenzprsuppositionen nicht wirklich erkl-
ren. Man nehme den Satz:
(31) Hans dachte, ich htte ein Auto, und er
hoffte, da mein Auto in gutem Zustand
sei.
Versucht man nun, die Russellsche Analyse
auf mein Auto anzuwenden, so wird man fest-
stellen, da der Existenzquantor, der dabei
eingefhrt wird, eine grob falsche Deutung
erzeugt, ganz egal, welche Position man ihm
in der Formel zuweist:
(32)
a. x (Hans dachte, x sei mein Auto &
Hans hoffte, da x in gutem Zustand
sei)
b. Hans dachte, da x (x ist mein Auto
& Hans hoffte, da x in gutem Zu-
stand sei)
c. Hans dachte, da ich ein Auto htte
& x (x ist mein Auto & Hans hoffte,
da x in gutem Zustand sei)
d. Hans dachte, da ich ein Auto htte
& Hans hoffte, da x (x ist mein
Auto & x ist in gutem Zustand)
Wenn der Bezug von mein Auto das Auto sein
soll, von dessen Existenz im ersten Konjunk-
tionsglied die Rede ist, so entstehen Skopus-
probleme. Und wenn man Skopusprobleme
vermeidet, dann gibt es keine Mglichkeit
auszudrcken, da es sich um dasselbe Auto
handelt. hnliche Probleme ergeben sich bei
Stzen wie:
(33)
a. Es gab einen Mann, und der Mann
gewann das Rennen, und der Mann
gewann das Rennen nicht.
298 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
traposition nannte Van Fraassen (1968, 1969)
necessitations.
Von Van Fraassen (insbesondere 1971)
stammt auch ein bekannter Versuch, Prsup-
positionen als logische Beziehungen zu expli-
zieren. In seinem Supervaluationssystem er-
zeugt er Prsuppositionssprachen aus zwei-
wertigen Sprachen mit vollstndiger Bewer-
tung und schafft damit Raum fr eine logi-
sche und dennoch nicht triviale Prsupposi-
tionsrelation. Wir werden auf das Superva-
luationssystem hier nicht im einzelnen
eingehen, denn es ist technisch ziemlich kom-
plex, aber linguistisch vllig unplausibel
(siehe aber Artikel 11). Es wurde von Logi-
kern als elegant und geistreich gepriesen, aber
es hat die Prsuppositionsforschung nicht be-
einflut.
Das wesentliche Fazit von Strawsons Pr-
suppositionstheorie ist, da mit A B, auch
nicht-A B gilt. Wenn B falsch ist, dann hat
A keinen Wahrheitswert und fllt dement-
sprechend unter keinen logischen Kalkl. Die
Frage, ob A oder nicht-A wahr ist, taucht
dann gar nicht auf, da die Bedingungen dafr,
diese Frage zu stellen, nicht erfllt sind
(Strawson 1952:18). Es gibt jedoch Probleme.
Wenn A B, dann, so mchte man meinen,
gilt auch A B und nicht-A B; denn in
allen Fllen, in denen A (oder nicht-A) wahr
ist, ist auch B wahr. Doch ist es andererseits
irrefhrend, so zu reden, denn der Begriff der
Folgerung ist ein logischer Begriff, der Pr-
suppositionsbegriff unter dieser Analyse je-
doch nicht. Vom logischen Standpunkt aus
ist die Situation unbefriedigend.
Sie ist auch in empirischer Hinsicht unbe-
friedigend. Sellars (1954) wendet ein, da der
Satz:
(34) Der Knig von Frankreich hat mich
zum Mittagessen eingeladen.
wenn er von einem Spinner und Angeber ge-
uert wird, eindeutig falsch und eben nicht
wahrheitswertlos ist, und es ist schwer, ihm
hier nicht zuzustimmen. Auerdem mte,
wie von verschiedenen Autoren beobachtet
wurde, die Negation einer Existenzbehaup-
tung zu einem Widerspruch fhren und dem-
nach paradox sein:
(35) Das Ungeheuer von Loch Ness existiert
nicht.
knnte dann nie wahr sein, denn aus seiner
Wahrheit wrde die Existenz des Ungeheuers
von Loch Ness als Prsupposition folgen.
Schlielich wre, wenn Hans keine Kinder
hat, ein Satz wie (36a) unter Strawsons Ana-
Die Analyse von Strawson fhrt allerdings
wieder zu einer eingeschrnkten Formulie-
rung von PAD und pat insofern nicht zum
Trend in der modernen Logik. Sie lt zu,
da es uerungen gibt (wir mssen nun
diesen Terminus verwenden und drfen nicht
mehr von Stzen reden), die keinen Wahr-
heitswert haben, und schiebt damit der Logik
und nicht der Sprache den schwarzen Peter
zu. Das erklrt wohl, warum Strawsons Ana-
lyse in der philosophischen Literatur auf un-
gewhnlich scharfen Widerstand stie. Fr
Strawson hat eine uerung mit einem defi-
niten Term, der nichts bezeichnet, oder mit
einer Allquantifikation ber eine leere Klasse
keinen Wahrheitswert; sie fllt damit nicht
unter den Kalkl, der aber ansonsten strikt
zweiwertig bleibt. Diese Position ist mit der
des Aristoteles verwandt (wenngleich nicht
identisch); sie bedeutet, da die Anwendbar-
keit der Logik teilweise von kontingenten Tat-
sachen und nicht allein von der Struktur der
logischen Analyse abhngt. Das Dilemma
wurde spter in der modelltheoretischen Se-
mantik aufgelst. Dort betrachtet man Stze
unter einer Interpretation, die den Bezug der
definiten Terme vorgibt; erst dann wird der
Kalkl auf sie angewendet. Aber diese Lsung
hat das Prsuppositionsproblem nicht voll-
stndig ausgerumt.
Fr Strawson folgt aus der Tatsache, da
eine uerung A
B
einen Wahrheitswert hat,
bereits die Wahrheit von B: A prsupponiert
dann B. Wenn der Prsuppositionsbegriff so
definiert wird und zudem eine logische Bezie-
hung in einem strikt zweiwertigen System dar-
stellen soll, so mu B offenkundig eine not-
wendige Wahrheit (logisch gltig) sein, da
nicht-B zu einem Widerspruch fhren wrde.
Damit wrde die Prsuppositionsrelation vl-
lig trivialisiert, was sicherlich nicht in Straw-
sons Sinn ist. Sie mu deshalb eine Beziehung
auerhalb des logischen Systems sein, eine
Vorbedingung fr die Anwendung der Logik,
dafr, da die uerung nicht nichtig ist.
Man kann auf B deshalb schlieen, weil A
berhaupt in den Anwendungsbereich der
Logik fllt. Strawson selbst hat sich zu diesem
Punkt nicht wirklich explizit geuert, seine
Kritiker im brigen auch nicht was daran
lag, da die Theorie nichtzweiwertiger Spra-
chen kaum entwickelt war. (Van Fraassen
1971:154). Es ist aber klar, da, wenn A
B, der Schlu von A auf B keine Kontrapo-
sition erlaubt: nicht-B liefert nicht nicht-A
(obwohl es A ist nicht wahr liefert). Diese
Klasse von logischen Folgerungen ohne Kon-
13. Prsuppositionen 299
Dieser pragmatische Prsuppositionsbe-
griff fand breite Anerkennung, und das lag
mit Sicherheit auch daran, da er die logische
Orthodoxie unangetastet lie. Fr viele Se-
mantiker (und Pragmatiker) ist das auch
heute noch die Standardtheorie. Es ist je-
doch zu beachten, da die Folgerungsanalyse,
wenngleich sie deutliche Vorteile gegenber
der Analyse von Strawson bringt, auch ihre
Schwchen hat. Erstens braucht man, wenn
Prsuppositionen, logisch gesehen, nichts an-
deres als Folgerungen sind, eine Analyse, die
es gestattet, einen Kalkl fr diese Folgerun-
gen zu entwickeln. Fr die sogenannten klas-
sischen Folgerungen gibt es im Prinzip eine
solche Analyse, aber man braucht auch fr
Folgerungen, die Prsuppositionen sind, eine
wohlbegrndete und systematische Behand-
lung. Viele Prsuppositionen lassen sich auf
semantische Bedingungen an Prdikate (Be-
deutungspostulate) zurckfhren, doch gibt
es, wie wir gezeigt haben, Flle, die eindeutig
wahrheitskonditional sind (Spaltkonstruktio-
nen, nur, auch), bei denen aber die strukturelle
Basis noch unklar ist.
Eine zweite Schwche findet sich auf der
pragmatischen Seite. Es gibt bislang noch kei-
nen theoretischen Ansatz, der Prsuppositio-
nen ber Merkmale des Sprachgebrauchs von
anderen Folgerungen abgrenzt und dabei er-
klrt, wieso Prsuppositionen in Umgebun-
gen, in denen gewhnliche Folgerungen ver-
loren gehen, hufig als Default-Annahmen
erhalten bleiben. Man hat Formalismen ent-
wickelt, die beschreiben, wie die Prsupposi-
tionen eingebetteter Stze auf DAs komplexer
Stze projiziert werden (vgl. den folgenden
Abschnitt). Doch es gibt keine adquate prag-
matische Theorie.
Zum Beispiel folgt sowohl aus dem Ante-
zedens von (37a), als auch aus dem von (37b),
da Hans gearbeitet hat. Aber in (37a) ist das
eine gewhnliche Folgerung, in (37b) hinge-
gen eine Prsupposition:
(37)
a. Wenn Hans um vier Uhr angefangen
hat zu arbeiten, dann ist er jetzt noch
nicht fertig.
b. Wenn Hans um vier Uhr aufgehrt
hat zu arbeiten, dann ist er jetzt noch
nicht fertig.
Der Unterschied in der Art der Folgerung
zeigt sich darin, da (37b) als Ganzes immer
noch die DA, da Hans gearbeitet hat, besitzt,
(37a) hingegen nicht. Wenn dieser Unter-
schied in der Art der Folgerung aus Merk-
malen des normalen Sprachgebrauchs her-
lyse wahrheitswertlos, der gleichbedeutende
Satz (36b) jedoch wre dann falsch:
(36)
a. Nicht alle Kinder von Hans schlafen.
b. Einige Kinder von Hans schlafen
nicht.
Zweifellos entsprechen diese Ergebnisse ber-
haupt nicht den sprachlichen Intuitionen.
Strawson hat versucht, derartigen Einwnden
zu begegnen (1954a, 1964), doch ohne Erfolg.
Einige Jahre spter (als man auch andere
als die traditionellen Existenzprsuppositio-
nen untersuchte) wurde dann beobachtet, da
Prsuppositionen nicht (ausnahmslos) unter
Negation erhalten bleiben (Wilson 1975;
Kempson 1975; Bor & Lycan 1976, Atlas
1977). Diese Autoren behaupten, da Straw-
sons Analyse zusammenbricht, weil sie em-
pirisch nicht haltbar ist. Wenn es z. B. in
Frankreich keinen Knig gibt, dann ist (26)
nicht ohne Wahrheitswert, sondern schlicht-
weg falsch, denn man kann wahrheitsgem
sagen: Der gegenwrtige Knig von Frank-
reich ist NICHT kahlkpfig: es GIBT keinen
Knig von Frankreich!. Deshalb, so sagen
sie, ist, wenn eine Prsupposition B von A
falsch ist, A falsch und nicht-A wahr. Prsup-
positionen sind also von einem rein logischen
Standpunkt aus nichts anderes als Folge-
rungen. Was sie von anderen, vielleicht ge-
whnlicheren Folgerungen unterscheidet, hat
nichts mit Logik, sondern nur mit Pragmatik
zu tun: aus pragmatischen Grnden, die mit
guter und zweckdienlicher Kommunikation
zu tun haben, legt nicht-A die Wahrheit von
B nahe (doch sie folgt nicht mehr daraus).
Diese Analyse ist als Folgerungsanalyse der
Prsuppositionen bekannt. Wenn sie richtig
ist, kann die Logik so bleiben, wie sie ist, und
das uneingeschrnkte PAD lt sich aufrecht-
erhalten. Man kann alle Schwierigkeiten mit
dem Prsuppositionsbegriff aus der Logik
und der formalen Semantik heraushalten.
Unter dieser Analyse gehrt alles, was mit
Prsuppositionen zu tun hat, in die Pragma-
tik, nicht in die Semantik, geschweige denn
in die Logik. Dieser Ansatz verschaffte den
Sprachlogikern und formalen Semantikern
wieder die Sicherheit, da man das uneinge-
schrnkte PAD fr die natrliche Sprache
beibehalten knne. Man brauchte keine
Angst vor den Prsuppositionen zu haben.
Man konnte sie als Epiphnomene betrach-
ten, die sich aus Bedingungen des praktischen
Sprachgebrauchs ableiten und daher einer
hinreichend weit verstandenen Pragmatik
berlassen werden knnen.
300 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
nicht Karl war. Bei normaler, nicht-kontra-
stiver Intonation (die wir die ganze Zeit un-
terstellt haben) ist eine solche konversatio-
nelle Implikatur jedoch nicht vorhanden. Der
Unterschied ist natrlich, da (39a) eine ge-
whnliche Folgerung aus (38) ist und keine
Prsupposition.
Der anaphorische Bezug, der bei der vor-
geschlagenen Analyse im zweiten Konjunk-
tionsglied vorkommt, erzeugt fernerhin ein
Problem, das ihre logische Adquatheit be-
trifft (vgl. Geach 1969, 1972). Wenn z. B. (42)
die konversationell bevorzugte Analyse von
(43) ist:
(42) Es gibt einen Knig, und er ist nicht
kahlkpfig.
(43) Der Knig ist nicht kahlkpfig.
dann haben wir das Problem, da (42) mit
(44) vertrglich ist, welches die Analyse von
(45) wre:
(44) Es gibt einen Knig, und er ist kahlkp-
fig.
(45) Der Knig ist kahlkpfig.
Aber (43) und (45) widersprechen einander,
ganz gleich, welche Analyse der Negation
man whlt.
Es hilft nichts, die logische Analyse von
(43) wie nachstehend zu verfeinern (vgl. Grice
1981:197):
(46) !x (Knig(x)) y (Knig(y)
kahlkpfig(y))
Denn obwohl dieses in der Tat unvertrglich
ist mit (47), was fr Der Knig ist kahlkpfig
steht:
(47) !x (Knig(x)) y (Knig(y)
kahlkpfig(y)),
gibt es immer noch ein Adquatheitsproblem:
man sieht nun, da die folgenden beiden Stze
(wenngleich geschraubt) voll miteinander ver-
trglich sind:
(48)
a. Es gibt einen Knig, und der Knig
ist kahlkpfig.
b. Es gibt einen Knig, und der Knig
ist nicht kahlkpfig.
was sie unter obiger Analyse nicht sein soll-
ten. Andererseits haben wir einen Wider-
spruch in:
(48)
c. Es gibt einen Knig, und der Knig
ist kahlkpfig, und der Knig ist nicht
kahlkpfig.
Das zeigt einfach, da jeder Ansatz, der la
Russell definite Terme in einen oder mehrere
quantifizierte Terme zerlegt, zum Scheitern
geleitet werden soll, dann ist diese Herleitung
anzugeben. Die Vertreter der Folgerungs-
analyse haben das zwar versucht, jedoch ohne
Erfolg. Ihr Vorlufer war Grice (1981), dem
ein Vortrag von Grice aus dem Jahre 1970
zugrundeliegt (S.183). Ihre Argumentation ist
im Kern die folgende: Man betrachte einen
Satz AB (z. B. Der Knig ist kahlkpfig). A
B
kann nur wahr sein, wenn B und A
B
(z. B.
Es gibt einen Knig und er ist kahlkpfig) wahr
ist, da A B. A
B
wird dann als B und A
B
analysiert. Nicht-A
B
wird dementsprechend
als nicht (B und A
B
) analysiert (z. B. nicht
(es gibt einen Knig und er ist kahlkpfig)).
Da nicht-B nicht-A
B
, ist es berflssig
nicht(B und A
B
) zu sagen, wenn B nicht
wahr ist: nicht-B wrde gengen (Maxime
der Quantitt). Daher liegt es nahe anzuneh-
men, da B wahr ist, aber A
B
falsch, wenn
A
B
negiert wird. So liegt es etwa nahe anzu-
nehmen, da es einen Knig gibt, wenn Der
Knig ist kahlkpfig verneint wird, wie in Der
Knig ist nicht kahlkpfig.
Van der Sandt (1982, 1988) vermerkt, da
diese Argumentation nur fr die Negation
gilt, und es nicht klar ist, wie sie sich auf
andere Arten der Einbettung bertragen liee.
Er sagt ferner, da unter dieser Analyse ein
Satz nicht-A
B
semantisch vage wre und man
daher gem der Maxime Sei informativ
eher den Satz B und nicht-A uern mte.
Auerdem fragt er, woher es kommt, da ein
Satz der Form es ist nicht der Fall, da B
und AB nicht nahelegt, da B gilt. Und
schlielich gibt er zu bedenken, da sich leicht
Beispiele angeben lassen, die genau der Struk-
tur der pragmatischen Argumentation ent-
sprechen und dennoch nicht das gleiche Er-
gebnis liefern. Man betrachte den Satz:
(38) Karl ist entflohen.
Das kann nur wahr sein, wenn die nachste-
henden zwei Stze wahr sind:
(39)
a. Jemand ist entflohen.
b. Es ist Karl.
Wir wollen (38) als die Konjunktion von (39a)
und (39b) analysieren. Die Negation von (38):
(40) Karl ist nicht entflohen.
mu dann als (41) gelesen werden:
(41) nicht (jemand ist entflohen und es ist
Karl.)
Da (41) schon dann wahr ist, wenn das erste
Konjunktionsglied falsch ist, mu jeder, der
(40) uert, konversationell implizieren, da
jemand entflohen ist, und behaupten, da es
13. Prsuppositionen 301
Bedingungen zu formulieren und zu erklren,
unter denen elementare Prsuppositionen zu
Prsuppositionen oder zu DAs werden oder
ganz wegfallen. Dieses Problem hat den
Groteil der Aufmerksamkeit, die man den
Prsuppositionsphnomenen gewidmet hat,
auf sich gezogen auf Kosten anderer,
ebenso wichtiger Probleme.
Alle Versuche, das Projektionsproblem zu
lsen, sind in dem Sinn kompositional oder
als kompositional zu deuten , da es die
Struktur des komplexen Satzes ist, die den
endgltigen Status der Prsupposition fest-
legt. Innerhalb dieses Rahmens lassen sich
zwei Haupttrends unterscheiden. Es gibt er-
stens den Projektionsansatz, bei dem man ein-
bettenden Operatoren sprachlich festgelegte
semantische Eigenschaften zuordnet, welche
das Schicksal der Prsuppositionen der unter
ihnen eingebetteten Stze bestimmen. Die
Hauptvertreter dieser Richtung sind Karttu-
nen, Karttunen & Peters und Heim. Zweitens
haben wir den Tilgungsansatz, bei dem die
einbettenden Operatoren nur die klassischen
Eigenschaften haben, die die Bewahrung oder
Tilgung von Folgerungen regeln, und das
berleben der elementaren Prsuppositionen
(die keine Folgerungen sind) davon abhngt,
ob sie miteinander vertrglich sind und auch
den pragmatischen Implikaturen des Satzes
nicht widersprechen, welche entweder von der
Position eines Operators auf einer semanti-
schen Skala abgeleitet sind oder davon, da
ein eingebetteter Satz gewisse Folgerungen
nicht zult. Vorlufer des Tilgungsansatzes
sind Langendoen & Savin (1971), die die
simple Theorie vertraten, da alle elemen-
taren Prsuppositionen ungefiltert erhalten
bleiben (die kumulative Hypothese). Gazdar
(1976, 1979a, 1979b) nahm dies zum Aus-
gangspunkt und schlug einen Filtermechanis-
mus vor. Ihm folgte Soames (1979). Soames
(1982) strebt eine Synthese der beiden An-
stze an. Van der Sandt nimmt eine geson-
derte Position ein.
Beide Richtungen haben zu einem Prsup-
positionsbegriff gefhrt, der ber Kontextab-
hngigkeit und Kontexterweiterung bestimmt
ist: jeder neue Satz in einem Text oder einem
Gesprch wird dem gegebenen Kontext hin-
zugefgt, und Prsuppositionen sind als Be-
dingungen an den vorangehenden Text oder
Kontext zu betrachten (vgl. auch Artikel 10).
Van der Sandt (1988) weist darauf hin, da
sich die beiden Anstze mit verschiedenen
Arten von Gegenbeispielen angreifen lassen.
Gegenbeispiele zum Projektionsansatz sind
verurteilt ist. Die Definitheit ist nun einmal
da, und sie dient dazu, auf etwas zurckzu-
verweisen, was vorher eingefhrt wurde.
Wir mssen daher abschlieend feststellen,
da die pragmatische Analyse der Prsup-
positionen falsch ist. (Sie scheint letztlich die
Formulierung der Wahrheitsbedingungen
eines Satzes mit seiner strukturellen semanti-
schen Analyse zu verwechseln). Auerdem
gibt es genug Hinweise darauf, da die typi-
schen Merkmale von Prsuppositionen auf
ein autonomes, axiomatisches System, welches
ihr Verhalten regelt, zurckzufhren sind. Wir
werden unten, in Abschnitt 6, sehen, da diese
Sichtweise durch eine Reihe von semantischen
und linguistischen Beobachtungen gesttzt
wird, die alle darauf hindeuten, da Prsup-
positionen ber ihre Funktion im Text be-
stimmt sind. Aber bevor wir diesen Prsup-
positionsbegriff entwickeln knnen, mssen
wir einen berblick ber das Projektionspro-
blem geben und ber das, was hierzu an L-
sungen vorgeschlagen wurde.
5. Das Projektionsproblem
5.1Einleitung
Die Prsuppositionsforscher haben nicht nur
die logischen und kontextuellen Besonderhei-
ten der Prsuppositionen einfacher Stze und
ihrer Negation erkundet, sondern auch die
Eigenheiten, die entstehen, wenn Trgerstze
tiefer eingebettet werden. Wir wollen, im An-
schlu an Van der Sandt (1982), Prsupposi-
tionen unnegierter einfacher Stze als elemen-
tare Prsuppositionen bezeichnen. Wie wir ge-
sehen haben, knnen elementare Prsuppo-
sitionen als abgeleitete Prsuppositionen eines
komplexen Satzes auftauchen oder zu DAs
abgeschwcht werden oder ganz verloren ge-
hen. Prsuppositionen unterscheiden sich in-
sofern von gewhnlichen Folgerungen, als
diese bei der Einbettung ihres Trgersatzes
entweder zu abgeleiteten Folgerungen des
komplexen Satzes werden oder verloren ge-
hen; sie werden nie zu Default-Annahmen
abgeschwcht. Prsuppositionen hneln ge-
whnlichen Folgerungen insofern, als sie,
wenn ihr Trgersatz eingebettet wird, unter
den gleichen Bedingungen zu abgeleiteten
Prsuppositionen bzw. zu gewhnlichen Fol-
gerungen werden: jede Einbettung, unter der
Folgerungen erhalten bleiben, bewahrt auch
die Prsuppositionen die Negation ist hier,
wie wir sehen werden, die einzige Ausnahme.
Das Projektionsproblem besteht darin, die
302 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
tik). Das andere ist sein Implikaturausdruck
(X)
i
: er steht, wenn X ein Satz ist, fr die
konventionale Implikatur von X (im Grice-
schen Sinn), andernfalls fr das, was X zu
den konventionalen Implikaturen des Satzes,
in dem es vorkommt, beitrgt. Die meisten
Prsuppositionen werden als (Gricesche) kon-
ventionale Implikaturen behandelt, und auf
diese konzentriert sich KPs Analyse. KP un-
terscheiden zwischen dem, was logisch folgt
und dem, worauf sich ein Sprecher festlegt
(die konventionalen Implikaturen). Es wer-
den allerdings keine empirischen Kriterien da-
fr angegeben, und dementsprechend bleibt
die Beziehung zwischen Propositionen, die lo-
gisch folgen, und solchen, die konventional
impliziert sind, unklar.
Wir werden nicht darauf eingehen, wie KP
die e- und i-Ausdrcke von Stzen aus den
Teilen unterhalb der Satzebene zusammenset-
zen (es wird angenommen, da das Lexikon
fr jeden Eintrag beide Arten von Ausdrk-
ken liefert). Uns geht es hier vielmehr darum,
was mit elementaren konventionalen Impli-
katuren in komplexen Stzen geschieht, also
um das Projektionsproblem. Fr Lcher,
Stpsel und nicht-faktive Verben der propo-
sitionalen Einstellung (wir wollen sie Glau-
bensverben nennen) ist KPs Lsung trivial.
Sie fhren fr diese Flle eine Vererbungs-
funktion h ein, deren Argumente Paare aus
den e-Ausdrcken und i-Ausdrcken der be-
treffenden Lcher, Stpsel und Glaubensver-
ben sind, und die als Werte die jeweiligen i-
Ausdrcke der Stze liefert, in denen der be-
treffende Operator als hchstes Prdikat vor-
kommt. Fr faktive Verben (bzw. fr die
Paare aus e- und i-Ausdrcken, die ihnen
zugeordnet sind) liefert h also genau die fak-
tiven Teilstze. Fr gelingen liefert h den i-
Ausdruck des Objekt-Satzes. Fr hoffen, wn-
schen, wollen, glauben usw. (also fr Glau-
bensverben) liefert h einen Satz, der dem Sub-
jekt des betreffenden Verbs einen Glauben
zuschreibt, dessen Inhalt der i-Ausdruck des
Objekt-Satzes ist. Fr Verben wie sagen liefert
h eine Tautologie, die keine Verpflichtung
mit sich bringt (S.21). Diese Vererbungs-
funktion bleibt im Text unklar, doch gibt es
in einem Anhang eine formale Beschreibung.
Das Hauptinteresse richtet sich offensichtlich
auf die Klasse der Filter.
Es ist anzumerken, da ein Satz, dessen i-
Ausdruck nicht mit dem e-Ausdruck vertrg-
lich ist, in jedem Kontext uninterpretierbar
oder inakzeptabel ist. Wenn sich andererseits
als i-Ausdruck eine Tautologie ergibt, dann
Flle, in denen die Theorie eine abgeleitete
Prsupposition oder DA vorhersagt, die nicht
vorhanden ist. Fr den Tilgungsansatz gilt
das Umgekehrte: hier sind solche Flle stich-
haltige Gegenbeispiele, in denen die Theorie
vorhersagt, da eine elementare Prsupposi-
tion ausgefiltert wird, die in Wirklichkeit als
abgeleitete Prsupposition oder DA auf-
taucht.
5.2Karttunen, Karttunen & Peters
Karttunens Name ist mit dem System der
Stpsel, Lcher und Filter assoziiert. Das sind
Bezeichnungen fr verschiedene Klassen von
Operatoren. Die Bezeichnung Stpsel wird fr
Operatoren verwendet, die elementare Pr-
suppositionen daran hindern, abgeleitete Pr-
suppositionen oder DAs zu werden. Lcher
sind Operatoren, die elementare Prsupposi-
tionen als Prsuppositionen oder DAs durch-
lassen. Filter sind Operatoren, die Prsuppo-
sitionen manchmal durchlassen, manchmal
aber auch nicht. Dieses Dreigespann kommt
mit kleinen Variationen in Karttunen (1973,
1974) und in Karttunen & Peters (1979) vor.
Wir werden hier die letzte Verffentlichung
besprechen, denn sie gibt die endgltige Po-
sition ihrer Verfasser zu diesem Thema wie-
der.
Die Klasse der Stpsel enthlt z. B. Verben
des Sagens. In Karttunen (1973, 1974) um-
fate sie auch nicht-faktive Verben der pro-
positionalen Einstellung (glauben, hoffen
usw.), aber in dem Aufsatz von 1979 gehren
diese in eine gesonderte Kategorie. Zu den
Lchern gehren z. B. faktive Verben, impli-
kative Verben (z. B. gelingen), aspektuelle
Verben (z. B. anfangen, aufhren, weiterma-
chen) und alle Modalausdrcke. Die Negation
wird als ambig betrachtet, sie kann eine innere
Negation sein, welche ein Loch ist, oder eine
uere Negation, die ein Stpsel ist. Diese
Unterscheidung entspricht dem Unterschied
zwischen einer Verwendung der Negation, bei
der Prsuppositionen erhalten bleiben, und
einer Verwendung, bei der sie getilgt werden.
Die Filter sind nur eine kleine Klasse, die aus
den natursprachlichen Entsprechungen der
logischen, wahrheitsfunktionalen Operatoren
und, oder, wenn ... dann besteht (d. h. Kon-
junktion, Disjunktion, Implikation).
Karttunen & Peters (im folgenden KP) ord-
nen jedem sprachlichen Ausdruck X eine
zweifache bersetzung in die intensionale Lo-
gik zu (seine Bedeutung) Das eine ist sein
Extensionsausdruck (X)
e
: das Denotat von X
(wie in der herkmmlichen formalen Seman-
13. Prsuppositionen 303
b. Widersprechende Negation:
(NICHT-A
P
)
e
= (A P);
(NICHT-A
P
)
i
= P P
Dem gewhnlichen nicht sind als i-Ausdruck
gerade die Prsuppositionen des Satzes zu-
geordnet, der verneint wird, doch der i-Aus-
druck der klassischen, widersprechenden Ne-
gation NICHT ist eine Tautologie: da die
Prsuppositionen des verneinten Satzes wahr
oder nicht wahr sind sie sind damit also
aufgehoben.
Auf diesen Vorschlag zur Lsung des Pro-
jektionsproblems prasselte ein Hagel von Ge-
genbeispielen hernieder. Ebenso trafen ihn
ernste methodologische Einwnde. Es gibt
auerdem einige logische Probleme, die wir
als erstes besprechen wollen.
In der Theorie von KP gilt, da einige
Prsuppositionen logische Folgerungen sind,
wohingegen andere nur etwas sind, worauf
der Sprecher sich verpflichtet. Diejenigen, die
keine Folgerungen sind, bringen KPs Mecha-
nismus in Schwierigkeiten; er kann auf sie
nicht angewendet werden. Wenn elementare
Prsuppositionen, wie gemeinhin angenom-
men wird, Folgerungen aus ihrem Trgersatz
sind, wohingegen Prsuppositionen, die nicht
aufgehoben wurden (also projizierte Prsup-
positionen), nicht immer Folgerungen sind
(z. B. wenn es sich um DAs handelt), dann
gibt es rger mit der widersprechenden Ne-
gation. Dieser Operator nimmt einen i-Aus-
druck als Teil eines e-Ausdrucks (vgl. (51b)).
Aber die Logik soll nur auf e-Ausdrcken
operieren. Solange Prsuppositionen (i-Aus-
drcke) Folgerungen sind, gibt es keine Pro-
bleme. Dann hat z. B. ein Ausdruck der Form
(NICHT (A
P
oder B
Q
)) den e-Ausdruck ((A
B) (P B) (A Q)), und der ist
mit dem einfachen Satz (A B) quiva-
lent, da A P und B Q. Aber wenn A
P und B Q oder B Q, dann ist (NICHT
(Ap oder B
Q
)
e
wiederum ((A B) (P
B) (A Q)). Nun seien A wahr und B,
P, Q falsch. Dann ist (A
P
oder B
Q
) wahr, da
A wahr ist. Aber (NICHT (A
P
oder B
Q
)) ist
auch wahr, denn ((A B) (P B) (A
Q)) ist wegen der Falschheit des zweiten
Konjunktionsglieds falsch.
Daraus ergibt sich also bedauerlicherweise,
da die von KP definierte widersprechende
Negation nicht wahrheitsfunktional ist. Das
liegt eindeutig nicht in KPs Absicht. Dennoch
lt sich dieses Ergebnis nur dann vermeiden,
wenn man alle i-Ausdrcke (elementare Pr-
suppositionen und DAs) als Folgerungen aus
werden die elementaren Prsuppositionen, die
in diese Tautologie eingehen, als Prsupposi-
tionen oder DAs des komplexen Satzes auf-
gehoben.
Was die Filter anbelangt, so geben KP
eigene Definitionen fr die i-Ausdrcke an,
die von ihnen erzeugt werden (die e-Aus-
drcke sind mit den blichen logischen Ana-
lysen der fraglichen Stze identisch). Es wre
einfach gewesen, die Funktion h so zu erwei-
tern, da sie die Filter gleichfalls abdeckt,
aber KP (1979:34) wollten das nicht. Die De-
finitionen fr die wahrheitsfunktionalen Ope-
ratoren und, oder und wenn ... dann sind in (49)
aufgefhrt. Dabei steht A immer fr (A)
e
.
A
P
wird fr A, mit P als Implikaturaus-
druck verwendet. Die Variablen P, Q, ...
stehen fr die i-Ausdrcke des jeweiligen
Basissatzes. K ist Hintikkas epistemischer
Notwendigkeitsoperator.
(49)
a.
(A
P
und B
Q
)
i
= P (A Q)
b.
(A
P
oder B
Q
)
i
= (P B) (A Q)
c.
(wenn A
P
dann B
Q
)
i
= K A P
(A Q)
KP unterscheiden zwei natursprachliche Ne-
gationen, die gewhnliche oder innere Ne-
gation, die Prsuppositionen bewahrt, und die
widersprechende oder uere Negation, die
Prsuppositionen aufhebt. Letztere entspricht
der klassischen zweiwertigen Negation. KP
(1979:47) merken an, da die klassische,
uere, prsuppositionslschende Negation
die Verteilung von Polarittsausdrcken
nicht berhrt, und sie bringen dafr als Be-
leg:
(50)
a. Baldur hat nicht schon vergessen, da
heute Freitag ist, denn heute ist Don-
nerstag.
mit dem positiven Polarittsausdruck schon.
Es ist ihnen aber offenkundig nicht aufgefal-
len, da die prsuppositionslschende Nega-
tion nicht bei negativen Polarittsausdrcken
stehen kann, wie sich an der Inakzeptabilitt
des Satzes (50b) zeigt:
b. *Es macht Baldur nichts aus, da heute
Freitag ist, denn heute ist Donnerstag.
der das (faktive) negative Polarittsverb etwas
ausmachen enthlt. (Vgl. Abschnitt 6.2 und
Seuren 1985:228236 fr weitere Einzelhei-
ten.)
Die beiden Negationen sind folgenderma-
en definiert (1979:47):
(51)
a. Gewhnliche Negation:
(nicht-A
P
)
e
= A;
(nicht-A
P
)
i
= P
304 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Und doch ist klar, da (52a) (in diesem Sinne)
prsupponiert, da Hans Kinder hat, wohin-
gegen (52b) noch nicht einmal andeutet, was
es gem KPs Theorie prsupponieren
mte.
Auerdem gibt es wie Soames (1979),
Gazdar (1979a), Wilson (1975) und Van der
Sandt (1982) festgestellt haben unmittel-
bare Gegenbeispiele in Hlle und Flle. Wir
werden einige davon betrachten. Eine Gruppe
von Gegenbeispielen ist von der Form wenn
Ap, dann P (Wilson, 1975):
(53) Wenn Andreas darber traurig ist, da
seine Katze gestorben ist, dann ist seine
Katze gestorben
Dies soll prsupponieren, da die Katze von
Andreas gestorben ist, da (wenn A
P
, dann P)
i
= P. Aber (53) hat offenkundig keine solche
Prsupposition.
Zu einer anderen Klasse von Gegenbei-
spielen gehren die folgenden Stze:
(54)
a. Es ist mglich, da Susanne keine
Kinder hat, aber es ist auch mglich,
da sie weggefahren sind.
b. Es ist mglich, da Susanne Kinder
hat, und es ist mglich, da sie weg-
gefahren sind.
c. Es ist mglich, da Susanne Kinder
hat und da sie weggefahren sind.
Diese Stze sind von der Form (55ac):
(55)
a. Mglicherweise nicht-A und mgli-
cherweise B
A
.
b. Mglicherweise A und mglicher-
weise B
A
.
c. Mglicherweise (A und B
A
).
Gazdar (1979a) hat darauf hingewiesen, da
der i-Ausdruck von (55a), also mglicherweise
A A, in Verbindung mit seinem e-Aus-
druck ber den modus ponens A ergibt. (54a)
sollte also prsupponieren, da Susanne Kin-
der hat. Das gleiche gilt fr (54b). Beide Vor-
hersagen sind eindeutig falsch. Van der Sandt
fgt hier die Beobachtung hinzu, da die
Theorie zwar flschlicherweise behauptet, da
(55b) A prsupponiert, aber die richtige Vor-
hersage macht, da (55c) A nicht prsuppo-
niert: (A und B
A
)
i
= A A, und das ist eine
Tautologie, so da es nichts gibt, was der
Mglichkeitsoperator erben knnte. Doch in-
tuitiv gibt es keinen solchen Unterschied zwi-
schen (54b) und (54c). Entsprechend sagt KPs
Theorie voraus, da (56a) prsupponiert, da
Hans Kinder hat, (56b) hingegen nur, da
Hans Kinder hat, wenn heute Montag ist:
ihrem Trgersatz betrachtet. Doch das ist em-
pirisch nicht haltbar. Das Ergebnis ist nicht
berraschend, denn in einer streng zweiwer-
tigen Logik ist nur fr eine einzige wahrheits-
funktionale Negation Platz. (Es sei denn, man
lt logisch leere Operatoren zu. Angenom-
men N sei ein von der klassischen Negation
verschiedener wahrheitsfunktionaler Ne-
gationsoperator in einer strikt zweiwertigen
Logik. N darf nicht Wahres auf Wahres ab-
bilden, denn das wrde das Prinzip vom aus-
geschlossenen Widerspruch verletzen: ein Satz
und seine Negation knnen nicht zugleich
wahr sein. Also bildet N Wahres auf Falsches
ab. Aber N darf nicht Falsches auf Wahres
abbilden, denn sonst wre es mit identisch.
Also bildet N Falsches auf Falsches ab. D. h.,
N bildet jede Proposition auf Falsches ab: fr
jeden Satz a ist Na notwendigerweise falsch,
und fr jeden beliebigen Satz b gilt Na b,
der Operator N ist also logisch leer.)
Die Lsung ist offenkundig: Beide Nega-
tionen msssen den e-Ausdruck A fr ne-
giertes A
P
haben. Damit ist die Logik (die
nur mit e-Ausdrcken zu tun hat) wieder in
Ordnung. Aber man hat sich nun den zwei-
felhaften Begriff der Prsuppositionsambi-
guitt eingehandelt oder mu wenn man
ihn vermeiden will in Kauf nehmen, da
der Projektionsmechanismus nicht mehr
kompositional ist, da er teilweise von der wei-
teren Umgebung abhngt. Die Auswirkungen
dieses Punktes sind also nicht trivial.
Da zwischen Folgerungen und DAs nicht
unterschieden wird, hat eine weitere uner-
wnschte Konsequenz. Abgeleitete i-Aus-
drcke knnen unterschiedliche logische Ei-
genschaften haben, je nachdem, ob die Pr-
suppositionen, die in ihre bersetzungen ein-
gehen, elementar sind oder nicht. So ist
(nicht-A
P
oder nichtB
P
)
i
= (P B) ( A
P). Das ist nur dann eine Tautologie, wenn
A P und B P. Das bedeutet, da (52a)
nicht prsupponieren (konventional implizie-
ren) sollte, da Hans Kinder hat, und (52b)
(in diesem Sinne) prsupponieren sollte, da
Hans Kinder hat, wenn die Kinder von Hans
ehelich oder amtlich gemeldet sein knnen,
denn
(P B) ( A P) (B A) P:
(52)
a. Entweder sind die Kinder von Hans
nicht ehelich, oder sie sind nicht amt-
lich gemeldet.
b. Entweder knnen die Kinder von
Hans nicht ehelich sein, oder sie kn-
nen nicht amtlich gemeldet sein.
13. Prsuppositionen 305
Klausalimplikaturen. Skalarimplikaturen wer-
den von Ausdrcken erzeugt, die eine Position
auf einer semantischen Skala einnehmen
(Horn 1972). Ein Ausdruck e, der eine Posi-
tion auf einer semantischen Skala s einnimmt
und in einem Satz A vorkommt, erzeugt lau-
ter Skalarimplikaturen der Form K( )
wobei a aus A dadurch entsteht, da e durch
einen analogen Ausdruck e, der auf s eine
strkere Position als e einnimmt, ersetzt wird.
So hat ein Satz wie Einige Menschen starben
die Skalarimplikatur K(nicht alle Menschen
starben). Der K-Operator drckt epistemi-
sche Notwendigkeit aus (Hintikka 1962) und
ist als soweit der Sprecher wei, ... zu lesen.
(Sein Gegenstck ist der Operator P, der fr
epistemische Mglichkeit steht.) Klausalim-
plikaturen sind Eigenschaften von Stzen a,
die als Teil einen Satz so enthalten, da aus
a weder noch folgt. Die Implikatur hat
dann die Form P() P( ). (Fr formale
Einzelheiten siehe Gazdar 1979: 5859).
Zum Beispiel hat der Satz Hans denkt, da er
gro ist die Klausalimplikatur P(Hans ist
gro) und P(Hans ist nicht gro).
Beide Arten von Implikaturen sind fr
minimale Satzstrukturen definiert (Gazdar
verwendet hier den verwirrenden Terminus
Im-Plikatur). Skalare Implikaturen vererben
sich auf grere Strukturen B, die A als Teil
enthalten, wenn B A, es sei denn, sie werden
durch den Filtermechanismus gelscht. Klau-
salimplikaturen vererben sich, wenn der Me-
chanismus sie nicht tilgt.
Elementare Prsuppositionen (fr Gazdar
Pr-Suppositionen) werden von Prsuppo-
sitionsauslsern erzeugt, also etwa vom be-
stimmten Artikel, von einem lexikalischen
Ausdruck, von einer grammatischen Kon-
struktion. (Die Funktion, die sie erzeugt, wird
von Gazdar nicht im einzelnen ausgefhrt).
Sie sind fr jeden Satz A
Q
von der Form
K(Q). Sie werden vererbt und damit zu
abgeleiteten Prsuppositionen, wenn sie nicht
vom Filtermechanismus getilgt werden. Ele-
mentare Prsuppositionen sind Folgerungen
aus ihrem Trgersatz und damit auch aus
jeder greren Struktur, die Folgerungen be-
wahrt. Prsupposition und Folgerung werden
also als zwei verschiedene Eigenschaften be-
trachtet, die bei Basisstzen zufllig zusam-
menfallen.
Der Filtermechanismus funktioniert folgen-
dermaen. Wenn man einen Satz A hat, so
listet man zunchst seine Folgerungen (E),
seine Implikaturen (I) und seine elementaren
Prsuppositionen (PR) auf. Wenn E einander
widersprechende Folgerungen enthlt, dann
(56)
a. Wenn die Kinder von Hans in der
Schule sind, dann knnen wir bei ihm
einbrechen.
b. Wenn heute Montag ist und die Kin-
der von Hans in der Schule sind, dann
knnen wir bei ihm einbrechen.
Es ist klar, da dieser Unterschied nicht vor-
handen ist.
Soames (1979) hat beobachtet, da (A
nicht-P
oder B
P
)
i
= ( P B) (A P), und da
dies genau dann zu A B quivalent ist,
wenn A P und B P, d. h. wenn A und
B bezglich der Projektion atomar sind. Aber
in diesem Fall prsupponiert die Disjunktion
sich selbst, und das gilt gemeinhin als etwas,
was jede Prsuppositionstheorie vermeiden
mu. Van der Sandt (1982: 116) bemerkt, da
dadurch jede Theorie auch die von Kart-
tunen (1974) , dergem Prsuppositionen
ihren Trgerstzen kontextuell vorgeordnet
sind, disqualifiziert wrde.
Neben solchen direkten Gegenbeispielen
lassen sich Flle anfhren, in denen tatsch-
liche Prsuppositionen oder DAs flschlicher-
weise ausgefiltert werden (Gazdar 1979a:114),
oder Flle, in denen e- und i-Ausdrcke lo-
gisch unvertrglich sind und der fragliche Satz
dennoch vllig verstndlich ist (Van der
Sandt, 1982:118). Gazdar (1979a) fgt noch
den methodologischen Einwand an, da KPs
Lcher, Stpsel, Filter und Glaubensverben
keine natrlichen Klassen bilden und da vor
allem das Filtersystem durch keinerlei unab-
hngige Prinzipien motiviert zu sein scheint.
5.3Gazdar
In Gazdars System (1976, 1979a, 1979b) wer-
den Prsuppositionen anders als bei KP
nicht projiziert, sondern gezielt gelscht.
Es gibt keine Klassen von Operatoren mit
Stpsel-, Lcher-, Filter- oder sonstigen Ei-
genschaften: ein allgemeiner Mechanismus
soll genau diejenigen Prsuppositionen tilgen,
die in den natursprachlichen Stzen intuitiv
nicht auftauchen. Dieser Mechanismus arbei-
tet mit drei verschiedenen semantischen Ei-
genschaften: Folgerungen, Implikaturen und
Prsuppositionen.
Der Folgerungsbegriff ist klassisch, und
klassisch ist auch die Logik, die ihn regelt.
Folgerungen leiten sich aus lexikalischen Ei-
genschaften her und bleiben bei logischen Ver-
knpfungen unter den klassischen folgerungs-
bewahrenden Operatoren erhalten. Es gibt
zwei Arten von Implikaturen: Skalar- und
306 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
supponieren, so da sie zu keinem k etwas
Neues hinzufgen knnten, da die Hinzuf-
gung des Satzes (oder seiner Proposition)
nach der Prsupposition immer berflssig
wre. Ganz hnlich verhlt es sich mit Stzen
der Form A und B
A
: hier ist A notwendi-
gerweise eine Prsupposition und eine Fol-
gerung, so da das erste Konjunktionsglied
notwendigerweise berflssig wre. Er fhrt
auch einige direkte Gegenbeispiele an, bei de-
nen Prsuppositionen flschlicherweise aus-
gefiltert werden. So sagt Gazdars Theorie
etwa voraus, da in (57) die elementare Pr-
supposition K (der Teufel existiert nicht)
ausgefiltert wird. Doch es ist klar, da sie als
Default-Annahme erhalten bleibt:
(57) Ronald ist nicht traurig darber, da der
Teufel nicht existiert.
Die Menge PR der elementaren Prsupposi-
tionen mu K (der Teufel existiert) enthal-
ten (wegen des bestimmten Artikels) und
gleichfalls K (der Teufel existiert nicht) (we-
gen der faktiven Konstruktion ber etwas
traurig sein). Da aus (57) keine der beiden
Prsuppositionen folgt, heben sie sich wegen
ihrer Widersprchlichkeit gegenseitig auf.
Auch in dem folgenden Fall wird nicht richtig
ausgefiltert:
(58) Wenn Ronald denkt, da ich aufgehrt
habe zu rauchen, dann wei er nicht,
da ich nie geraucht habe.
Die Menge PR von (58) enthlt K (ich habe
frher geraucht), wegen aufhren, aber auch
K (ich habe nie geraucht), aufgrund des
faktiven Verbs wissen. Da keine von beiden
eine Folgerung ist, heben sie sich gegenseitig
auf. Doch (58) hat ganz klar die Default-
Annahme, da die Person, auf die mit ich
Bezug genommen wird, in Wirklichkeit nie
geraucht hat.
Es sei ferner vermerkt, da Gazdars Theo-
rie zwar die korrekte Vorhersage macht, da
(59a) ein interpretierbarer Satz ist, bei dem
das erste Konjunktionsglied die elementare
Prsupposition, da Harald einen Sohn hat,
aufhebt, aber da sie nicht erklren kann,
warum (59b) inakzeptabel ist und als wider-
sprchlich empfunden wird, obwohl der Fil-
termechanismus das gleiche Ergebnis liefert:
(59)
a. Harald hat keinen Sohn, aber er
glaubt, da sein Sohn in Kentucky
lebt.
b. ! Harald hat keinen Sohn, aber wenn
sein Sohn in Kentucky lebt, werden
wir ihn finden.
ist A uninterpretierbar, d. h. A kann in kei-
nem Kontext verwendet werden (hchstens
als Zitat). Wenn ein Element e aus E mit
einem Element p aus PR oder i aus I unver-
trglich ist, dann wird p bzw. i gelscht, und
A bleibt in allen Kontexten interpretierbar.
Wenn ein i aus I mit einem p aus PR unver-
trglich ist, dann wird p ausgefiltert. Impli-
katuren, die miteinander unvertrglich sind,
heben sich gegenseitig auf, und das gleiche
gilt fr einander widersprechende Prsuppo-
sitionen. Es gibt also eine Rangfolge, derge-
m Folgerungen Implikaturen und Impli-
katuren Prsuppositionen vorgeordnet sind.
Diese Theorie nimmt auch auf Kontexter-
weiterungen Bezug: Ein Satz A wird in einem
gegebenen Kontext k betrachtet, k wird dann
um A erweitert, und so wird der Kontext fr
den nchsten Satz erzeugt. Auch abgeleitete
Implikaturen und Prsuppositionen werden k
hinzugefgt (1979:132). k ist als eine Menge
von Propositionen zu betrachten. Kontexter-
weiterung ist dann als Konjunktion, d. h. als
mengentheoretischer Durchschnitt aufzufas-
sen. Jede interpretierbare Menge von Propo-
sitionen mu unter logischer Folgerung ab-
geschlossen sein, d. h. sie mu konsistent sein.
Wenn k mit A unvertrglich ist, ist A in k
nicht interpretierbar. Wenn k mit einem i I
oder einem p PR unvertrglich ist (A p),
dann wird i bzw. p ausgefiltert, und A verliert
in k diese Implikatur oder Prsupposition.
Offenkundig ist dieser Aspekt der Kontexter-
weiterung in Wirklichkeit nichts anderes als
eine Anwendung des Filtermechanismus auf
k. Man erhlt die gleichen Ergebnisse, wenn
man A mit den Propositionen in k bzw. den
Stzen, die diese ausdrcken, konjunktiv ver-
knpft. Wenn Kontexterweiterung so defi-
niert wird, lt sie die Kompositionalitt des
Filtermechanismus unangetastet.
Der Hauptkritiker von Gazdars System ist
Van der Sandt. Er weist darauf hin
(1982:132), da Gazdars Verwendung des K-
Operators nicht richtig sein kann. Ein Satz
wie Der Weihnachtsmann macht viele Kinder
glcklich prsupponiert K (Der Weihnachts-
mann existiert), und es folgt aus ihm Der
Weihnachtsmann existiert. Die Prsupposi-
tion kann daher nicht getilgt werden. Das
bedeutet, da der Satz in allen Kontexten, in
denen der Sprecher wei, da der Weih-
nachtsmann nicht existiert, nicht interpretier-
bar ist. Doch das stimmt nicht, wie sich daran
zeigt, da man ihn sinnvoll bestreiten kann.
Van der Sandt weist auch darauf hin, da
Stze wie Der Teufel existiert sich selbst pr-
13. Prsuppositionen 307
die Bestimmung von Prsuppositionen geben
mu.
Ein Kontext wird, wie in Stalnaker (1970,
1973, 1978), als eine Menge von mglichen
Welten aufgefat, und Kontexterweiterung ist
als mengentheoretischer Durchschnitt defi-
niert. Die Notation k + A wird verwendet,
um das Resultat der Anwendung des KVP
von A auf den Kontext k zu bezeichnen.
Heim gibt konkret nur die KVPs fr die Im-
plikation und fr die Negation an:
(60) KVP(wenn): k + (wenn A, dann B) =
k \ (k+A \ k+A + B)
(61) KVP(nicht): k + nicht-A = k \ (k + A)
wobei \ wie blich fr die mengentheore-
tische Differenzbildung steht.
Dies bestimmt laut Heim die Wahrheits-
bedingungen: mengentheoretisch errechnet
sich (60) zu k \ (A \ B) und (61) zu k \ A
was den klassischen Wahrheitsbedingungen
fr die Implikation bzw. Negation entspricht.
Es liefert auch, sagt Heim, die Projektionsei-
genschaften der betreffenden Operatoren: fr
wenn wird verlangt, da k + A und
k + A + B definiert sind, d. h., da die Pr-
suppositionen von A Teil von k sind und die
von B Teil von k + A; fr nicht wird verlangt,
da k + A definiert ist, d. h., da die Pr-
suppositionen von A Teil von k sind. Dies, so
sagt Heim, legt fest, da die Negation ein
Loch im Sinne von Karttunen ist.
Es kommt hufig vor, da ein Satz A in
einem Kontext k nicht zulssig ist, weil die
Prsuppositionen von A kein Teil von k sind.
In solchen Fllen werden diese Prsuppositio-
nen, falls sie in k zulssig sind, nachtrglich
hineingeschmuggelt: k wird zu einem etwas
reicheren Kontext k abgendert, in dem A
zulssig ist. Ganz im Sinne Heims kann man
also das folgende allgemeine Prinzip postulie-
ren:
(62) Fr jeden Satz A, der P prsupponiert,
ist k + Ap = (k + P) + A, wobei k + P
leer luft, wenn k P.
Wenn k + P nicht leer luft, wenn also zum
Zeitpunkt der uerung von A k P gilt,
dann wird die Operation k + P Akkommoda-
tion des Kontexts k genannt.
Laut Heim, enthlt diese informelle Cha-
rakterisierung der Akkommodation eine ver-
steckte Ambiguitt, die zum Vorschein
kommt, wenn wir uns ein Beispiel an-
schauen. Ihr Beispiel ist nicht-A
P
in einem
Kontext k, aus dem P nicht folgt. Hier mu
man akkommodieren, und man kann sich
dann zwei ganz verschiedene Weisen vorstel-
Wenn Harald hat einen Sohn A ist, dann
haben beide Stze K(A) als Element von PR
(wegen sein Sohn lebt in Kentucky), und aus
keinem Satz folgt A. Jedoch folgt aus beiden
A, so da K(A) getilgt wird. Beide Stze
sollten also interpretierbar sein (erfllbar in
Gazdars Terminologie). Doch ist nur (59a)
interpetierbar, nicht aber (59b). Das gleiche
Problem entsteht, wenn das erste Konjunk-
tionsglied (Harald hat keinen Sohn) Teil des
Kontexts ist, zu dem das zweite Konjunk-
tionsglied hinzugefgt werden soll. Es fehlt
eine Erklrung dafr, da das zweite Kon-
junktionsglied von (59a) eine akzeptable Er-
weiterung darstellt, das von (59b) jedoch
nicht.
5.4Heim
Im Jahre 1983 hat Irene Heim einen kurzen
Aufsatz verffentlicht, der ein hohes Ma an
Inspiration mit einem geringen Ma an for-
maler Przision vereint. In diesem Aufsatz
versucht sie die deskriptive Adquatheit der
Theorie von Karttunen und Peters mit der
von Gazdar geforderten Erklrungsadquat-
heit zu verbinden. Es geht ihr insbesondere
darum zu zeigen, da der richtige Weg zur
Lsung des Projektionsproblems eine Klas-
sifikation von Operatoren wie in Karttunens
Projektionssystem mit einer expliziten Theo-
rie der Kontexterweiterung verbinden mu.
(Sie verfolgt damit den Ansatz von Karttunen
1974.) Sie nimmt an, da jeder Operator ein
Kontextvernderungspotential (KVP) besitzt,
und sie postuliert, da das KVP eines Ope-
rators sowohl seine wahrheitskonditionalen
Eigenschaften festlegt, als auch diejenigen Ei-
genschaften, die die Projektion von Prsup-
positionen betreffen. Dieser allgemeine Ge-
danke mag richtig sein, doch um das zu zei-
gen, bedarf es einer formalen Przision, die
in Heim (1983b) nicht vorhanden ist.
Heim fhrt den Begriff der Zulssigkeit ein.
Ein Satz A ist in einem Kontext k genau dann
zulssig, wenn k + A definiert ist. Auerdem
ist p genau dann eine Prsupposition von A,
wenn aus jedem Kontext, in dem A zulssig
ist, p folgt. Die Begriffe Zulsssigkeit,
k + A und Prsupposition werden also
bereinander definiert, aber es wird kein em-
pirisches Kriterium angegeben, mittels dessen
man entscheiden knnte, wann die Begriffe
zutreffen und wann nicht. Man kann erahnen,
da Heim meint, da ein Satz A genau dann
in einem Kontext k zulssig ist, wenn die
Prsuppositionen von A Teil von k sind, und
da es unabhngige empirische Kriterien fr
308 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Akkommodation von Prsuppositionen kann
dann so formuliert werden (vgl. (62) oben):
(64)
a. k + A
P
= (k + P) + A
b. k\\A
P
= (k + P)\\A
Das macht es uns mglich, zwei wahrheits-
funktional verschiedene Negationen zu unter-
scheiden:
(65)
a. KVP(nicht): k + nicht-A
P
= k\\A
P
= (k + P)\\A (k P) \ A
b. KVP(NICHT): k + NICHT-A
P
= k\\A k \ A
Die erste ist die prsuppositionserhaltende
Negation, whrend die zweite einfach die
klassische zweiwertige Negation ist, bei der
Prsuppositionen keine Rolle spielen. Es ist
zu beachten, da eine solche Analyse nicht
im Rahmen einer zweiwertigen Logik erfolgen
kann, sondern mehr als zwei Werte voraus-
setzen mu. Das ist so, weil die minimale
prsuppositionserhaltende Negation die Fol-
gerungen aus den Prsuppositionen des ne-
gierten Satzes bewahrt, denn (k P) \ A be-
zeichnet eine Teilmenge der durch P gegebe-
nen Menge von mglichen Welten.
Dasselbe knnte man fr die Implikation
machen: man knnte eine minimale Impli-
kation definieren, die die Prsuppositionen
des Antezedens bewahrt, und daneben eine
klassische Implikation, bei der Prsuppositio-
nen keine Rolle spielen. Dasselbe gilt fr die
Disjunktion, fr nicht-implikative Modal-
operatoren, fr Einstellungsverben usw. Wir
wrden uns damit eine Unmenge von syste-
matisch mehrdeutigen Operatoren aufhalsen,
blo weil ein solcher klassischer mengentheo-
retischer Ansatz nicht dazu in der Lage ist,
das Phnomen der Default-Annahmen, wie
es sich aus der Abschwchung von Prsup-
positionen ergibt, in allgemeiner Weise zu in-
tegrieren.
Wir mssen daher abschlieend festhalten,
da KVPs vielleicht Wahrheitsbedingungen
festlegen knnen, aber grundstzlich nicht
dazu geeignet sind, die Projektionseigenschaf-
ten von Stzen zu bestimmen, solange der
Begriff der Kontextvernderung ber die
klassischen mengentheoretischen Operatio-
nen fr Mengen von mglichen Welten (oder
hnlichem) definiert ist. Das Beste, was man
erreichen kann, ist eine Analyse, die mit ganz
vielen systematisch mehrdeutigen Operatoren
beladen ist, die systematisch verschiedene
Wahrheitsbedingungen haben. Jede derartige
Lsung des Projektionsproblems braucht eine
ceteris-paribus-Prferenz, die aus unabhn-
gigen Grnden postuliert werden mu. Das
len, auf die das geschehen knnte. Die glo-
bale Weise besteht darin, da man zunchst
k zu k + P erweitert und dann nicht-A hin-
zufgt; man erhlt so k + P\((k+P)+A). Die
lokale Mglichkeit sieht so aus, da man
wieder k zu k + P erweitert und dann k + A
in (61) durch (k + P) + A ersetzt; das ergibt
k\((k + P) + A). Man sollte dann eine ceteris-
paribus-Prferenz postulieren, um sicher zu
stellen, da Prsuppositionen nur dann ge-
tilgt werden, wenn sonst Widersprche dro-
hen wrden.
Obwohl der Gedanke, da KVPs sowohl
Wahrheitsbedingungen als auch die Projek-
tion von Prsuppositionen bestimmen, ver-
mutlich richtig und gewilich anregend ist,
sind Heims Formalisierungsvorschlge ernst-
zunehmender Kritik ausgesetzt. Als erstes ist
darauf hinzuweisen, da Heim entweder mit
zwei verschiedenen wahrheitsfunktionalen
Negationen arbeitet (und in diesem Fall
wrde man gerne die zugehrige Logik sehen)
oder eine nicht wahrheitsfunktionale Nega-
tion hat (und in diesem Fall wrde man
gerne die semantische Beschreibung sehen).
Ihre globale und lokale Negation entspre-
chen den mengentheoretischen Produkten
(kP)\A bzw. k\A. Letzteres ist die klassi-
sche zweiwertige Negation, ersteres entspricht
der prsuppositionserhaltenden Negation von
Strawson (und anderen). Wenn die Negation
in dieser Weise gespalten sein sollte, so wre
aber nicht einzusehen, warum sich z. B. nicht
auch die Implikation in eine prsuppositions-
erhaltende globale und eine klassische lo-
kale Implikation aufspalten sollte.
Auerdem weist der Formalismus eine ver-
hngnisvolle Ambiguitt auf. Wenn k + A
einfach das Resultat der Anwendung des
KVP von A auf den Kontext k bezeichnet,
dann ist das KVP von wenn, d. h.
k\(k + A\k+A + B), nichts anderes als
k\(A\B) und das KVP von nicht einfach k\A.
Hier wird in keiner Weise verlangt, da
k + A oder k + A + B definiert sein ms-
sen, und es folgt auch nichts hinsichtlich der
Projektionseigenschaften von Implikation
oder Negation. Um entscheiden zu knnen,
ob KVPs Projektionseigenschaften festlegen,
braucht man eine klare Unterscheidung von
KVP-Regeln einerseits und mengentheoreti-
schen Ergebnissen andererseits, wie z. B. in
(63)(65), wo + und \\ Kontextver-
nderungsregeln sind und die Klammern die
Reihenfolge der Anwendung anzeigen:
(63)
a. k + A k A
b. k\ \A k \ A (oder: k )
13. Prsuppositionen 309
derlegen die Theorie nicht gnzlich, zeigen
aber, da man sie verstrken mu.
Die beiden Grundbegriffe in dieser Theorie
sind elementare Prsupposition und Text-
akzeptabilitt. Hinsichtlich der elementaren
Prsuppositionen unterscheidet sich Van der
Sandts Auffassung nicht wesentlich z. B. von
der Auffassung Gazdars. Sein Akzeptabili-
ttsbegriff, wie er in, (67) und (68) festgelegt
ist, leitet sich von einem allgemeinen prag-
matischen Informativittsprinzip her. Das
zentrale Prinzip, welches die Projektionsph-
nomene erklrt, besteht aus diesem pragma-
tisch motivierten Begriff der Akzeptabilitt
im Kontext, dessen grundlegende Bestim-
mung (67) auf abgeleitete Bestimmungen wie
in (68) bertragen wird.
Diese Theorie gibt sich nicht-kompositio-
nal: der Prsuppositionsbegriff wird unter Be-
zugnahme auf einen gegebenen Kontext de-
finiert. Es ist jedoch auch mglich, den ge-
wohnten Begriff der Prsupposition an sich,
d. h. einen kontextunabhngigen Begriff zu
definieren. Man mu sich dazu berlegen,
unter welchen Bedingungen eine elementare
Prsupposition in keinem Kontext erhalten
bleibt, also in jedem Kontext getilgt wird.
Eine elementare Prsupposition B eines Sat-
zes A wird getilgt, wenn es keinen Kontext k
gibt, so da AKZ(A,k) gilt, wobei k = k + B.
Da es kein solches k gibt, ist nur dann si-
chergestellt, wenn die Abfolge B und A
selbst gem (67) inakzeptabel ist. Man be-
trachte z. B. die folgenden Stze:
(69)
a. Hans hat Kinder, und seine Kinder
sind in der Schule.
b. Entweder hat Hans keine Kinder,
oder seine Kinder sind in der Schule.
Diese Stze sind von der Form P und Q
P
bzw. nicht-P oder Q
P
(wobei P fr Hans
hat Kinder steht und Q fr Die Kinder
von Hans sind in der Schule). In beiden
Fllen wird die elementare Prsupposition P
von Q getilgt, und zwar aufgrund der internen
Inakzeptabilitt von:
(70)
a. D* Hans hat Kinder, und Hans hat
Kinder und seine Kinder sind in der
Schule.
b. D* Hans hat Kinder, und entweder
hat er keine Kinder oder seine Kinder
sind in der Schule.
Dies wird durch (67) erklrt, wenn man davon
ausgeht, da der prsupponierte Satz P den
Kontext k darstellt und das zweite Vorkom-
men von P in (70a), bzw. das Vorkommen
von nicht-P im ersten Disjunktionsglied von
veranschaulicht noch einmal, da sich Pr-
suppositionsphnomene nicht so leicht in den
Rahmen der herkmmlichen modelltheoreti-
schen Semantik einpassen lassen.
5.5Van der Sandt
In Van der Sandts Prsuppositionstheorie
(1982, 1988) wird ber den Begriff der Text-
akzeptabilitt in Verbindung mit dem Begriff
der elementaren Prsupposition festgelegt, was
die Prsuppositionen oder DAs komplexer
Stze sind. AKZ(A,k) stehe fr der Satz
A ist im Kontext k akzeptabel und +
bezeichne die Kontexterweiterung. Dann sind
Prsupposition und Akzeptabilitt folgender-
maen definiert:
(66) A prsupponiert B im Kontext k genau
dann, wenn B eine elementare Prsup-
position von A ist und AKZ(A,k), wo-
bei k = k + B
(67) AKZ(A,k) nur, wenn k A und k
A.
Fr bestimmte, eingeschrnkte Klassen von
komplexen Stzen werden die folgenden zu-
stzlichen Akzeptabilittsbedingungen unter
Bezug auf die Grundbedingung (67) formu-
liert:
(68)
a. Wenn A nicht von der Form B und
C, B oder C, wenn B, dann C
ist, und wenn A einen eingebetteten
Satz D enthlt, der weder das Objekt
eines nicht-faktiven Einstellungsverbs
noch eine elementare Prsupposition
von A ist, dann gilt AKZ(A,k) nur,
wenn AKZ(D,k).
b. Wenn A von der Form B und C ist,
dann gilt AKZ(A,k) nur, wenn
AKZ(B,k) und AKZ(C,k), wobei k
= k + B.
c. Wenn A von der Form B oder C
oder wenn B, dann C ist, dann gilt
AKZ(A,k) nur, wenn AKZ(B,k) und
AKZ(C,k).
Die Bedingungen in (67) und (68) sind als
notwendige Bedingungen formuliert; man
mu sie mglicherweise verfeinern, um hin-
reichende Bedingungen zu erhalten (allerdings
wird behauptet, da sie jedenfalls fr das Pro-
jektionsproblem hinreichend sind). Auerdem
knnte man fr andere Satztypen spezielle
Definitionen bentigen. Also bilden Flle, in
denen eine Akzeptabilittsbedingung verletzt
ist, aber die Prsupposition erhalten bleibt,
Gegenbeispiele. Wir werden unten sehen, da
es eine Klasse von Fllen gibt, die zeigen, da
die Bedingungen zu schwach sind. Diese wi-
310 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
gen (68a) und (68c) problematisch sind. Ge-
m (68a) sollten (72a) und (72b) beide ak-
zeptabel (oder inakzeptabel) sein, aber nur
ersteres ist intuitiv akzeptabel, letzteres nicht.
Das heit, whrend AKZ(mglicherweise
A,k) gilt, gilt nicht AKZ(A,k):
(72)
a.
Vielleicht hat Harald keine Kinder,
aber vielleicht schlafen seine Kinder.
b. D* Vielleicht hat Harald keine Kin-
der, aber seine Kinder schlafen.
hnlichen rger macht (68c), denn (73a) ist
intuitiv akzeptabel, obwohl (73b) und (73c)
nicht akzeptabel sind, wohingegen (68c) ver-
langt, da alle drei Stze den gleichen Akzep-
tabilttsgrad haben. Das heit, whrend
AKZ((wenn A, dann B),k) gilt, gilt weder
AKZ(B,k), noch AKZ(C,k):
(73)
a.
Vielleicht hat Harald keine Kinder,
aber wenn er welche hat, werden wir
sie finden.
b. D* Vielleicht hat Harald keine Kin-
der, aber er hat Kinder. (= (71))
c. D* Vielleicht hat Harald keine Kin-
der, aber wir werden sie finden.
Diese Flle zeigen, da die Bedingung (67)
noch genauer formuliert werden mu. Es sieht
so aus, als ob (67) dann adquat funktionie-
ren wrde, wenn man den Parameter k etwa
in der folgenden Weise verstrkt. Dafr, da
ein Satz A in einem Kontext k akzeptabel ist,
scheint es, neben der Bedingung, da aus k
weder A noch nicht-A folgen darf, eine wei-
tere Bedingung zu geben. Diese weitere Be-
dingung verlangt, da keine Kontexterweite-
rung von k dazu fhren darf, da eine be-
nachbarte Erweiterung inakzeptabel wird
(wobei es eine Aufgabe der empirischen For-
schung ist, herauszufinden, wie strikt diese
Nachbarschaftsbedingung gilt.) Diese zustz-
liche Bedingung erklrt die Inakzeptabilitt
von (71), (72b), (73b,c): in all diesen Fllen
fgt das zweite Konjunktionsglied dem Kon-
text eine Folgerung hinzu, die das erste Kon-
junktionsglied inakzeptabel macht. Bezeich-
nenderweise erzeugen (72a) oder (73a) keine
solchen Folgerungen. Es ist eine interesssante
Feststellung, da diese Nachbarschaftsbedin-
gung ihre offenkundige intuitive Anziehungs-
kraft nicht von der Logik, sondern von dem
psychologischen Faktor der Nhe herleitet.
Der wesentliche Beitrag von Van der
Sandts Theorie ist die Behauptung, da die
Antwort auf das Projektionsproblem in einer
adquaten Definition des Begriffs der Text-
akzeptabilitt zu suchen ist. Diese Behaup-
tung grndet auf der allgemeinen Regel (zu
(70b), fr das A in (67) steht unter Be-
rcksichtigung der Regeln fr die Konjunk-
tion und die Disjunktion in (68b) bzw. (68c).
Das erlaubt uns, (in Van der Sandts Sinn) zu
sagen, da ein Satz (oder seine Proposition)
P genau dann eine Prsupposition an sich
eines Satzes Q ist, wenn P eine elementare
Prsupposition von Q und P und Q akzep-
tabel ist (d. h. es mindestens einen Kontext k
gibt, in dem AKZ(P,k) und AKZ(Q,(k + P))
gilt.)
Aus dieser Theorie folgt, da ein Satz Q
P
,
aus dem P logisch folgt, in Kontexten, die
nicht-P enthalten, inakzeptabel ist, denn aus
solchen Kontexten folgt nicht-Q. Aber abge-
sehen von den Fllen, die von (68ac) abge-
deckt sind und vielleicht noch einigen an-
deren wird ein Satz Q
P
, wo P keine Fol-
gerung, sondern nur eine DA ist, in einem
Kontext, der nicht-P enthlt, nicht inakzep-
tabel. In solchen Kontexten wird die DA ein-
fach getilgt, wie in (59a) oben. Man beachte,
da Stze der Form nicht-Q
P
von (68a)
abgedeckt werden: nicht-Q
P
ist in genau den
Kontexten akzeptabel, in denen Q
P
akzepta-
bel ist. Diese Negation ist also prsupposi-
tionserhaltend.
Es ist darauf hinzuweisen, da Van der
Sandts Prsuppositionstheorie eine grund-
stzliche Erklrung dafr hat, da Stze der
Form P und Q
P
(z. B. (69a)) P nicht pr-
supponieren. Die Tilgung dieser Prsupposi-
tion ist fr alle vorherigen Theorien mit
Ausnahme der von Stalnaker ein Problem.
In Stalnakers Theorie wird die Tilgung da-
durch erreicht, da man den Prsuppositions-
begriff auf Flle einschrnkt, in denen der
vorangehende Kontext (und speziell das vor-
angehende Konjunktionsglied) die Prsup-
position nicht bereits enthlt. In Van der
Sandts Theorie wird die Prsupposition ge-
tilgt, sobald ein Satz Q
P
als P und Q aus-
buchstabiert wird.
Wie wir bereits erwhnt haben, hat diese
Theorie mit gewissen, in systematischer Weise
problematischen Fllen zu kmpfen. Die Be-
dingung (67) scheint zu schwach zu sein, denn
es gibt inakzeptable Satzfolgen, die davon
nicht erfat werden. Es stehe k fr das erste
Konjunktionsglied von (71) und A fr das
zweite:
(71)
D* Vielleicht hat Harald keine Kinder,
aber er hat Kinder.
Gem (67) gilt dann AKZ(A,k), aber unsere
Intuition sagt das Gegenteil. Es zeigt sich,
da mit k wie oben auch die Bedingun-
13. Prsuppositionen 311
ein neues Bild ersetzt. Dessen Hauptbestand-
teil ist ein System mentaler (d. h. psychisch
realer) Diskursreprsentationen, in denen der
semantische Beitrag vorangehender ue-
rungen gespeichert ist (und die auf Sprecher
relativiert sind, falls es mehr als einen gibt).
(Man mu davon ausgehen, s. Seuren 1985:
322; Reichgelt 1985, da Diskursreprsenta-
tionen, genau wie das gewhnliche Gedcht-
nis, zeitlichen Einwirkungen unterliegen.
Nach einer Weile werden einzelne Beitrge
nicht mehr getrennt gehalten, und es kommt
zu einer allgemeinen Durchorganisierung
oder Integration, bei der der ursprngliche
Input auf ein dauerhafteres Speicherformat
gebracht wird. Die Fragen, die mit solchen
Umwandlungen verbunden sind, werden wir
hier nicht ansprechen.) Zentral ist die Be-
hauptung, da Diskursreprsentationen oder
Diskursbereiche (D) eine entscheidende Rolle
im Interpretationsprozess spielen.
Diese Behauptung gewinnt Substanz durch
das Postulat, da jeder D die Einfhrung von
Unterbereichen (oder, wie Fauconnier sagt,
von Unterrumen) erlaubt, in denen die durch
den Diskurs gegebene Information gespei-
chert ist, die speziell diese Unterbereiche be-
trifft. Wenn also z. B. von einer Person na-
mens Hans im Diskurs gesagt wird, sie glaube
bestimmte Dinge, dann wird ein eigener Un-
terbereich oder Unterraum in D eingefhrt,
der das wiedergibt, was Hans laut Diskurs
glaubt. Oder wenn von einer Proposition A
gesagt wird, sie sei mglich, dann wird ein
Unterraum erffnet, der das reprsentiert,
was als mglich bezeichnet wurde. Und wenn
gesagt wird, da sowohl A als auch nicht-A
mglich ist, dann werden zwei Unterbereiche
eingefhrt, einer fr A und einer fr nicht-A.
Der entscheidende Punkt liegt darin, da
dieser Mechanismus von Bereichen und Un-
terbereichen den ganzen Komplex intensio-
naler Phnomene abdecken soll, derentwegen
mgliche Welten zusammen mit der bli-
chen intensionalen Modelltheorie in die Se-
mantik eingefhrt wurden. Es wird, mit an-
deren Worten, behauptet, da man in der
Semantik natrlicher Sprachen einfach eine
extensionale Modelltheorie verwenden sollte
und die Behandlung von Intensionalittsph-
nomenen der Theorie der Bereiche und Un-
terbereiche berlassen kann. Man braucht
dann in der Semantik natrlicher Sprachen
keine mglichen Welten mehr, denn ihre Rolle
wird von Unterbereichen oder Unterrumen
bernommen. Wir werden dieses neue seman-
tische Paradigma als Diskurssemantik be-
zeichnen.
der es bislang keine Ausnahmen gibt), da
jeder Satz Q mit der elementaren Prsuppo-
sition P diese Prsupposition behlt sei es
als Folgerung, d. h. als abgeleitete Prsup-
position, sei es als Default-Annahme , wenn
die Abfolge P und Q intuitiv akzeptabel ist.
Die Frage ist also: Wie soll man Akzepta-
bilitt formal definieren? Und Van der
Sandts Theorie liefert zumindest teilweise eine
Antwort auf diese Frage.
Van der Sandt vertritt eine konservative
Position bezglich der herkmmlichen mo-
delltheoretischen Semantik und ihrer Bezie-
hung zur Pragmatik. Da er eine nicht-kom-
positionale Formulierung seiner Theorie vor-
zieht, ist vor diesem Hintergrund zu sehen:
die bliche formale Semantik sollte hinrei-
chen, wenn man sie um (eine nicht-komposi-
tionale) Pragmatik erweitert. Gleichzeitig
kommt jedoch, wie wir gesehen haben, der
psychologische Aspekt zu kurz. Und es
scheint, da das theoretische Potential von
Kontextphnomenen fr die Semantik natr-
licher Sprachen nicht gengend genutzt wird,
wenn man die Aufmerksamkeit hauptschlich
auf das Projektionsproblem richtet.
Im folgenden Abschnitt wird es um einige
neuere Arbeiten gehen, die sich darum be-
mhen, einen kontext- oder, wie wir auch
sagen werden, diskursrelativen Prsupposi-
tionsbegriff auszuarbeiten und ihn zu einer
substantiellen, neuen Komponente einer voll-
stndigen semantischen Theorie der Sprache
zu machen, einer Komponente, die weder zur
Modelltheorie noch zur Pragmatik gehrt,
aber beide entlastet.
6. Der diskurstheoretische
Prsuppositionsbegriff
6.1Allgemeines
Fauconnier (1984, 1985) und Seuren (1985)
stellen innerhalb der Prsuppositionsfor-
schung eine neue Entwicklung dar, die die
Vorgaben von Autoren wie Morgan, Stalna-
ker, Gazdar, Heim und Van der Sandt in der
gleichen Richtung weiterfhrt. Fauconnier
und Seuren betrachten die Kontextrelativitt
von Prsuppositionen als nur einen Aspekt
der Rolle, die der Kontext bei der Interpre-
tation von uerungen spielt. Ihrer Meinung
nach gelangt man zu einer viel besseren ber-
einstimmung von Theorie und Tatsachen,
wenn man die bliche Aufspaltung in formale
Semantik und Pragmatik aufgibt und durch
312 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
und nicht im Unterbereich von B
P
. Diese Flle
sind fr alle Theorien, die es gibt, problema-
tisch, auch fr die Diskurssemantik. Man be-
achte allerdings, da nicht alle Prsuppositio-
nen eine solche Behandlung zulassen. Ein Satz
wie:
(74)
d. Hans hat gesagt, da nur Harald be-
trunken war.
erfordert, da Hans unter anderem gesagt
hat, da Harald betrunken ist. Es gibt keine
mgliche Interpretation im Sinne von Ha-
rald war betrunken, wir wissen das, und Hans
sagte, da niemand betrunken war. Wir be-
finden uns hier in einem noch unausgeloteten
Bereich von Prsuppositionsphnomenen,
und es gibt dort so viele Komplikationen, da
weitere Untersuchungen vonnten sind.
Theorien, die mit nur einem Bereich und
nicht mit Unterbereichen arbeiten, sind
grundstzlich nicht in der Lage, Beobachtun-
gen wie zu (74a) zu erklren. In dieser Hin-
sicht hat die Diskurssemantik gegenber an-
deren nicht-intensionalen Kontexterweite-
rungssemantiken einen empirischen Vor-
sprung.
Sowohl Fauconnier als auch Seuren postu-
lieren ein funktionales Prinzip der maximalen
Einheit von Diskursreprsentationen. Daraus
folgen hauptschlich zwei Dinge. Erstens
kann man auf Referenzpunkte (Adressen),
die in einen (Unter)bereich D
n
eingefhrt wur-
den, mit definiten Termen Bezug nehmen, die
zu einem von D
n
verschiedenen Bereich D
m
gehren, mit m n. (n, m (n 0) kennzeich-
nen die Tiefe des (Unter)bereichs; D
0
ist der
Wahrheitsbereich, d. h. der Bereich, der all
das enthlt, worauf sich der Sprecher durch
seine uerungen festgelegt hat.) Fauconnier
bringt viele Beispiele dieses Typs:
(75) Der kluge Junge ist dumm.
Ein solcher Satz mu nicht widersprchlich
sein. Nehmen wir an, es geht um eine Er-
zhlung. (75) kann dann so verstanden wer-
den, da der Junge, der in Wirklichkeit klug
ist, in der Erzhlung als dumm beschrieben
wird, oder, da der Junge, der in der Er-
zhlung als klug beschrieben wird, in Wirk-
lichkeit dumm ist. Laut Seuren (1985: 429
430) hat der Gebrauch des Verbs existieren
mit einem definiten Subjektterm zur Bedin-
gung, da der Term eine Adresse bezeichnet,
die in einem intensionalen Unterbereich ein-
gefhrt wurde; der Satz mit existieren als
Hauptprdikat erzeugt dann eine entspre-
chende Adresse in dem Bereich, zu dem der
Satz hinzugefgt wird (oder die Einfhrung
Wenn ein Diskursbereich D durch die
uerung eines Satzes A
P
erweitert wird,
dann mu D auerdem entweder bereits den
Beitrag von P, b(P), enthalten, oder b(P) wird
nachtrglich hinzugefgt. (Dies ist nichts an-
deres als das, was Lewis, Heim und andere
Akkommodation genannt haben, und es ist
ganz im Sinn von Karttunen 1974, Gazdar,
Van der Sandt und anderen.) In allen Fllen,
in denen A P und damit auch A P gilt,
zieht die Inakzeptabilitt von P in D die von
A nach sich. Wenn jedoch P nur eine DA von
A ist (A P), dann gilt A P und es gibt
einen eingebetteten Satz B, so da B P gilt.
Nun kann D P zurckweisen, aber D mu
deshalb nicht auch A zurckweisen. A wird
in D solange akzeptabel bleiben, wie P (nach-
trglich) in den Unterbereich, zu dem B
P
hin-
zukommt, eingefgt werden kann. Im allge-
meinen mu P im (Unter)bereich seines Tr-
gersatzes akzeptabel sein. In allen Fllen, in
denen A P, aber nicht A P gilt, also P
eine DA von A ist, gehrt der eingebettete
Satz B
P
zu einem intensionalen Unterbereich,
und der komplexe Satz A bleibt solange in D
akzeptabel, wie P im zu B
P
gehrigen Unter-
bereich akkommodiert werden kann. Wenn P
in dem geeigneten Unterbereich keinen Platz
findet, dann ist A tatschlich inakzeptabel in
D. So ist, um ein einfaches Beispiel zu geben,
(74)
a. D* Robert hat den Preis gewonnen,
aber er denkt, er habe ihn nicht ge-
wonnen, und er denkt, da es mich
rgert, da er ihn gewonnen hat.
inkohrent oder inakzeptabel, weil die faktive
Prsupposition von mich rgern da nicht in
den Unterbereich dessen, was Robert glaubt,
hineinpat.
Fauconnier (1985: 105108) stellt fest,
da es Flle gibt, in denen P tatschlich nicht
in den Unterbereich von B
P
kommt, sondern
zum (Unter)bereich von A:
(74)
b. Auf diesem Gemlde ist Gundula wie-
der hbsch.
c. Hans hat gesagt, da Harald auch be-
trunken war.
Satz (74b) ist wahr, wenn Gundula frher
hbsch war, aber es jetzt nicht mehr ist, und
das Gemlde sie dennoch als hbsch darstellt.
Satz (74c) ist wahr, wenn Hans nur gesagt
hat, da Harald betrunken war, Sprecher und
Hrer aber wissen oder fr wahr halten
, da ein anderer oder mehrere andere
ebenfalls betrunken waren. Hier ist also die
Prsupposition des eingebetteten Satzes nur
im Bereich des bergeordneten Satzes erfllt
13. Prsuppositionen 313
d.
AKZ
u
(A
P
oder B
Q
,D
n
) gdw.
AKZ
m
(A
P
,D
n
) und
AKZ
u
(B
Q
,D
n
+nicht-A
P
), oder
AKZ
m
(B
Q
,D
n
) und
AKZ
u
(A
P
,D
n
+nicht-B
Q
)
e.
AKZ
u
(A
P
und B
Q
,D
n
) gdw.
AKZ
u
(A
P
,D
n
) und
AKZ
u
(B
Q
,D
n
+ A
P
)
f.
AKZ
u
(nicht-A
P
,D
n
) gdw.
AKZ
u
(A
P
,D
n
)
(76c) stimmt mit der blichen Analyse von
Konditionalstzen wenn A, dann B berein,
gem der die Abfolge A und B hinzufgbar
sein mu. Manche Vorkommen von wenn A,
dann B verlangen jedoch die Hinzufgbarkeit
von B und A, wie in:
(77)
a. Wenn die Kinder von Hans schlafen,
dann hat Hans Kinder.
b. Wenn er sich in die Hand geschnitten
hat, dann hat er das Glas zerbrochen.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Ty-
pen von Konditionalstzen wurde bislang
noch nicht systematisch erforscht. Auf den
ersten Blick sieht es so aus, als ob in den B
und A-Fllen der Konditionalsatz ein Echo
hat, d. h. als Wenn es stimmt, da A, dann
B paraphrasiert werden kann.
Der Notwendigkeitsoperator und die Kon-
junktion, deren Argumentstze Folgerungen
sind, erfordern unmittelbare Akzeptabilitt
fr Einfgungen in D
n
, wohingegen die Ope-
ratoren, deren Argumentstze keine Folge-
rungen sind, nur mittelbare Akzeptabilitt
verlangen; nicht bildet hier die einzige Aus-
nahme und verlangt gleichfalls unmittelbare
Akzeptabilitt. (Wir werden spter Argu-
mente dafr betrachten, da bei der Negation
in (76f) die Prsuppositionen des negierten
Satzes Folgerungen sind.) Dieser Unterschied
ist zweifellos darauf zurckzufhren, da
Folgerungen unmittelbare Akzeptabilitt ver-
langen, wohingegen Operatoren, deren Ar-
gumente keine Folgerungen sind, das nicht
fordern.
Neben den obigen Operatoren gibt es sol-
che, deren Semantik nicht die Akzeptabilitt
der eingebetteten Stze im bergeordneten
Bereich D
n
, sondern nur im intensionalen Un-
terbereich D
m
(m n) verlangt. Dazu gehren,
wie man wei, die Operatoren glauben, hoffen,
erwarten, wnschen, sagen, erzhlen, behaup-
ten usw. Diese bauen einfach ihre intensio-
nalen Unterbereiche auf, die betrchtlich von
D
n
abweichen knnen.
Andererseits verlangen faktive oder anti-
faktive Prdikate, einschlielich der Perzep-
tionsverben, die unmittelbare Akzeptabilitt
einer solchen Adresse wird blockiert, nmlich
dann, wenn es sich um einen negierten Satz
handelt). Adressen (Referenzpunkte) werden
so weit wie mglich auf intensionale Unter-
bereiche weitergegeben. Das heit, sie haben
die Tendenz, nach unten durchzusickern.
Zweitens haben die Prsuppositionen ein-
gebetteter intensionaler Stze die Tendenz,
sich von den Unterbereichen dieser Stze aus
nach oben in die von hheren Stzen und
selbst bis hin zum Wahrheitsbereich D
0
aus-
zubreiten. Wenn die Prsupposition keine
Folgerung aus dem ganzen komplexen Satz
ist, aber von D
0
zugelassen wird, ohne den
Gesamtsatz inakzeptabel zu machen, dann
wird diese Prsupposition zu einer DA. Dieser
Aspekt der Diskurssemantik liefert die
Grundlage fr ihre Lsung des Projektions-
problems.
6.2Die diskurssemantische Lsung des
Projektionsproblems
Kontextuelle Akzeptabilitt wird wie oben in
(67) bestimmt, doch in Verbindung mit dem
Nachbarschaftsprinzip. Damit wird also zwi-
schen unmittelbarer und mittelbarer Akzep-
tabilitt unterschieden; letztere ist wie in (67)
charakterisiert, erstere durch (67) und das
Nachbarschaftsprinzip. Wir werden die Nota-
tionen AKZ
u
(A,D
n
) und AKZ
m
(A,D
n
)
fr unmittelbare bzw. mittelbare Akzeptabi-
litt verwenden.
Einige Satzoperatoren stellen Bedingungen
an die Einfgbarkeit ihrer Argumentstze in
den bergeordneten Bereich D
n
. Diese Argu-
mentstze mssen daher in D
n
wenigstens mit-
telbar akzeptabel sein. So ist ein Satz der
Form mglicherweise (A
P
) in D
n
genau
dann unmittelbar akzeptabel, wenn A
P
in D
n
mittelbar akzeptabel ist. Fr den Notwendig-
keitsoperator hingegen mu man aufgrund
intuitiver Akzeptabilittsurteile fordern, da
notwendigerweise (A
P
) in D
n
genau dann
(unmittelbar) akzeptabel ist, wenn A
P
in D
n
unmittelbar akzeptabel ist. Auf hnliche
Weise kann man Akzeptabilittsbedingungen
fr wenn, oder, und und nicht formulieren:
(76)
a.
AKZ
u
(mglicherweise(A
P
),D
n
) gdw.
AKZ
m
(A
P
,D
n
)
b.
AKZ
u
(notwendigerweise(A
P
),D
n
) gdw.
AKZ
u
(A
P
,D
n
)
c.
AKZ
u
(wenn A
P
, dann B
Q
,D
n
) gdw.
AKZ
m
(A
P
,D
n
) und
AKZ
u
(B
Q
,D
n
+ A
P
)
314 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Der Unterschied zu (78a,b) besteht hier darin,
da die Semantik des satzeinbettenden Ope-
rators glauben keine Bedingungen an die Ein-
fgbarkeit des Argumentsatzes in den Bereich
D
0
stellt.
6.3Prdikatbedingungen, Dreiwertigkeit
und die Ambiguitt von nicht
Seuren (1985, Kap.3) gibt eine ausfhrliche
Begrndung dafr, da Prsuppositionen sich
ganz allgemein aus Vorbedingungen herleiten,
die semantisch an das hchste Prdikat des
Trgersatzes geknpft sind (vgl. Abschnitt 3
oben). Er behauptet, da dies die strukturelle
Grundlage aller Prsuppositionen ist, ein-
schlielich der, die sich bei Spalt- und Sperr-
konstruktionen oder bei nur, sogar und auch
ergeben. Man braucht fr diese Behauptung
die grammatische Annahme, da alle logi-
schen und sonstigen nichtverbalen Operato-
ren in der semantischen Analyse Prdikate
sind. Die Einzelheiten dieser grammatischen
Theorie knnen wir hier jedoch nicht bespre-
chen.
Ebenso behauptet Seuren aus Grnden,
auf die wir gleich zu sprechen kommen ,
da die natrliche Sprache mit einer dreiwer-
tigen Logik arbeitet, die zwei Negationen ent-
hlt. Die drei Wahrheitswerte sind wahr, mi-
nimal falsch und radikal falsch. Radikale
Falschheit ergibt sich, wenn eine Vorbedin-
gung des Hauptprdikats nicht erfllt ist. Mi-
nimale Falschheit ergibt sich, wenn alle Vor-
bedingungen erfllt sind, aber nicht alle Er-
fllungsbedingungen (im strikten Sinn). Wenn
alle Bedingungen erfllt sind, ist der Satz
wahr. Minimale Falschheit bewahrt demnach
Prsuppositionen. Minimale Falschheit wird
mittels der minimalen Negation zu Wahrheit;
diese Negation ist also gleichfalls prsuppo-
sitionserhaltend. Radikale Falschheit ist nicht
prsuppositionserhaltend und wird mittels
der radikalen Negation zu Wahrheit. Radikale
Falschheit ist nicht dasselbe wie die klassische
Negation, wie aus der Tafel (79) ersichtlich
wird. Seuren behauptet, da in der natrli-
chen Sprache nicht die klassische, sondern
nur die minimale und die radikale Negation
vorkommt. In (79) sind die Wahrheitstafeln
fr minimale Falschheit (~), fr radikale
Falschheit (), fr die Konjunktion und fr
die Disjunktion gegeben und obendrein
auch fr die klassische Negation , die nichts
anderes als die Disjunktion (Vereinigung) von
minimaler und radikaler Negation ist (1 steht
fr Wahrheit, 2 fr minimale, 3 fr radikale
Falschheit):
der eingebetteten Stze in D
n
, weil diese Stze
(bzw. ihre Negationen) Folgerungen sind.
Das Phnomen der Default-Annahmen
lt sich nun folgendermaen erklren. Die
Akzeptabilittsbedingungen derjenigen Ope-
ratoren in (76), deren Argumentstze keine
Folgerungen sind, fordern (mittelbare) Ak-
zeptabilitt in D
n
. D
n
darf also nicht die Ne-
gationen der Prsuppositionen dieser Argu-
mentstze enthalten, und deswegen liegt die
Annahme sehr nahe, da diese Prsuppositio-
nen wahr sind, wenn D
n
und der hinzugefgte
Satz wahr sind. Verben der propositionalen
Einstellung oder des Sagens, die unabhngige
Unterbereiche aufbauen, erzeugen nicht sol-
che starken DAs. Dennoch stellt das oben
erwhnte Prinzip der maximalen Einheit von
Diskursreprsentationen auch hier sicher, da
sich die Prsuppositionen der eingebetteten
Stze, wenn keine Widersprche entstehen
knnen, nach oben hin bis zu D
n
ausbreiten
wo sie gegebenenfalls nachtrglich einge-
fgt werden und damit eine schwchere Art
von DAs erzeugen. Alle DAs, die starken wie
die schwachen, werden getilgt, sobald unver-
trgliche DAs oder Folgerungen von anderen
Quellen her in das gleiche D
n
gelangen. Man
beachte, da eine aus einer anderen Quelle
stammende unvertrgliche Folgerung in D
n
dazu fhrt, da die Operatoren in (76) nicht
verwendet werden knnen, da ihre Argu-
mentstze dann in D
n
inakzeptabel sind. Aber
inkompatible DAs aus anderen Quellen er-
zwingen nur, da die Prsuppositionen inner-
halb ihres eigenen intensionalen Unterbe-
reichs bleiben. So ist (78a) ein inakzeptables
Textstck, aber (78b) nicht; hier geht nur die
DA, da Hans Kinder hat, verloren, und der
Mglichkeitsbereich im zweiten Konjunk-
tionsglied enthlt vielleicht hat er Kinder
und vielleicht sind sie in der Schule:
(78)
a. D* Hans hat keine Kinder, aber viel-
leicht sind seine Kinder in der Schule.
b. Vielleicht hat Hans keine Kinder, aber
vielleicht sind seine Kinder in der
Schule.
Andererseits sind sowohl (78c) als auch (78d)
akzeptabel, obwohl keine DA erhalten bleibt
(vgl. (59a,b) oben):
(78)
c. Hans hat keine Kinder, aber er glaubt,
da seine Kinder in der Schule sind.
d. Vielleicht hat Hans keine Kinder, aber
er glaubt, da seine Kinder in der
Schule sind.
13. Prsuppositionen 315
Man vergleiche das widersprchliche (83a), in
dem der faktive Subjektsatz nicht extrapo-
niert ist, mit dem konsistenten (83b):
(83)
a. ! Da sie schuldig war, berraschte
ihn nicht.
Sie war gar nicht schuldig.
b. Es berraschte ihn NICHT, da sie
schuldig war.
Sie war gar nicht schuldig.
D. Spalt- und Sperrkonstruktionen. Sie be-
wahren Prsuppositionen unter Negation.
Man vergleiche den grammatisch negierten
Sperrsatz (84a) mit dem logisch negierten
(84b):
(84)
a. ! Was er gesagt hat, war nicht Hallo.
Er hat berhaupt nichts gesagt.
b. Es stimmt nicht, da, was er gesagt
hat, Hallo war. Er hat berhaupt
nichts gesagt.
E. Kontrastakzent:
(85)
a. ! Die NONNE hat keine Waffen ge-
schmuggelt. Niemand hat Waffen ge-
schmuggelt.
b. Es stimmt nicht, da die NONNE
Waffen geschmuggelt hat. Niemand
hat Waffen geschmuggelt.
F.
Negationen in nicht-behauptender Funktion.
Wenn eine Negation in nicht-behauptender
Funktion vorkommt, mu sie Prsuppositio-
nen bewahren:
(86)
a. ! Der Knig von Frankreich scheint
NICHT kahlkpfig zu sein. Es gibt
gar keinen Knig von Frankreich.
b. ! Ede hofft, da seine Kinder NICHT
schlafen. Er hat gar keine Kinder.
c. ! Die meisten Geldschrnke wurden
NICHT aufgebrochen: es gab gar
keine Geldschrnke
(Im letzten Beispiel befindet sich die
Negation im Skopus des Quantors
meistens.)
G. Negationen mit negativen Polarittsaus-
drcken (NPAs). NPAs sind lexikalische Aus-
drcke, idiomatische Wendungen oder Kon-
struktionen, die in einfachen Deklarativstzen
nur zusammen mit einer Negation oder einem
negativen Adverb (kaum, nur) grammatisch
sind. Beispiele im Deutschen sind brauchen,
mehr (er kann nicht mehr), einmal (er hat
nicht einmal abgesagt), etwas dafr knnen,
etwas ausmachen usw. Bei einigen NPAs kann
man die Negation durch die emphatische Par-
tikel doch ersetzen. (Es macht mir DOCH
(79) B B
A A ~ A A 1 2 3 1 2 3
2 2 2 1 1 2 3 1 1 1
1 2 1 2 2 2 3 1 2 2
1 1 3 3 3 3 3 1 2 3
Wie A. Weijters im Anhang zu Seuren (1985)
zeigt, weicht diese Logik in keiner Weise von
der klassischen zweiwertigen Logik ab, so-
lange man nur die klassischen Operatoren (,
, ) verwendet.
Seurens Begrndung fr die Dreiwertigkeit
der natrlichen Sprache sieht folgendermaen
aus. Er macht zunchst eine Reihe von Be-
obachtungen, die zeigen, da die Negation
unter bestimmten grammatischen Bedingun-
gen Prsuppositionen bewahrt (d. h. per se
minimal ist), whrend sie in anderen gram-
matischen Umgebungen perse radikal ist (vgl.
Seuren 1985:228238). Die nachstehenden
Klassen enthalten Beispiele fr Negationen,
bei denen die Prsuppositionen erhalten blei-
ben:
A. Morphologisch inkorporierte Negationen
(z. B. un-, oder -los, wie in unmglich oder
erfolglos) bewahren prsuppositionale Fol-
gerungen. Man vergleiche dazu (80a) mit
(80b) (das Ausrufezeichen markiert wiederum
Widersprchlichkeit):
(80)
a. ! Stefans ltester Sohn war unhflich.
Er existiert gar nicht.
b. Stefans ltester Sohn war NICHT
hflich. Er existiert gar nicht.
Nur morphologische Negationen, die in einen
Existenzquantor inkorporiert sind, wie nie-
mand oder niemals, fallen, wie (81a) und (81b)
belegen, nicht unter dieses Prinzip:
(81)
a. Niemand hat hier zu rauchen aufge-
hrt. Niemand hat hier je geraucht.
b. Hans hat niemals seine Frau beleidigt.
Er ist gar nicht verheiratet.
B. Negationen in nicht-kanonischen Positio-
nen. Unter der kanonischen Position der Ne-
gation verstehen wir im Deutschen die Posi-
tion, bei der die Negation das Prdikat mo-
difiziert. Negationen in anderen Positionen
sind notwendigerweise prsuppositionserhal-
tend:
(82)
a. ! Nicht alle Geldschrnke wurden auf-
gebrochen. Es gab gar keine Geld-
schrnke.
b. Tim hat NICHT alle Geldschrnke
aufgebrochen. Es gab gar keine Geld-
schrnke.
C. Nicht-extraponierte faktive Subjektstze.
316 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
inkonsistent ist, (88b) aber konsistent bleibt:
(88)
a. ! Sie wohnt nicht mehr in Paris. Sie
hat dort berhaupt nie gewohnt.
b. Sie wohnt NICHT noch in Paris. Sie
hat dort berhaupt nie gewohnt.
Es wird nun begrndet, da es (mindestens)
drei Wahrheitswerte geben mu, wenn man
die Negation als wahrheitsfunktional betrach-
ten will. Da es, wie wir gesehen haben, (a)
viele Flle gibt, in denen sowohl A
P
P als
auch nicht-A
P
P gilt, ohne da P eine not-
wendige Wahrheit ist, und (b) Falschheit von
P nicht zu einer Wahrheitswertlcke fr A
P
und nicht-A
P
, sondern zu deren Falschheit
fhrt, ergibt sich, da es mehr als zwei Wahr-
heitswerte geben mu: Neben dem Wert
wahr mu es (mindestens) zwei Werte
falsch geben, wenn man das Prinzip vom
ausgeschlossenen Widerspruch retten will.
Wenn es so ist, da man Wahrheitswerte
so wie Gegenstnde nicht mehr als ntig
vervielfltigen sollte, dann mu die Logik der
natrlichen Sprache dreiwertig sein, oder die
natursprachliche Negation ist nicht wahr-
heitsfunktional. Seuren behauptet, da die
Negation wahrheitsfunktional und zweideutig
ist, nmlich fr die minimale und fr die
radikale Negation stehen kann.
Man knnte diese Schlufolgerung ver-
meiden, wenn sich eine Analyse finden liee,
bei der der klasssischen Negation verschie-
dene Positionen zugewiesen und damit die
beobachteten logischen Unterschiede erfat
werden. Bislang hat aber noch niemand eine
solche Analyse geliefert (vgl. Seuren 1985:
235238; 260266, wo einige Vorschlge
dazu diskutiert werden). Seuren geht aller-
dings nicht auf Horn (1985) ein. Horn be-
hauptet eine pragmatische Ambiguitt und
unterscheidet zwischen einer gewhnlichen
(Seurens minimaler) Negation und einer
metasprachlichen Negation, welche nicht nur
alle Flle von Seurens radikaler Negation ab-
decken wrde, sondern auch Flle wie:
(89) Gromutter ist nicht abgekratzt, du un-
gezogenes Ding, sie ist gestorben.
Horns Aufsatz ist ein wichtiger Beitrag zur
Erforschung der Negation, und es sieht so
aus, als ob metasprachliche Verwendungen
der Negation in der Tat eine abgrenzbare
Kategorie bilden wrden. Zum Beispiel
scheint die metasprachliche Negation auf ka-
nonische Positionen beschrnkt zu sein, so
wie die radikale Negation (siehe oben, unter
B). Dennoch ist es wohl nicht richtig, die
etwas aus, Er kann DOCH etwas dafr)
Einige dieser NPAs sind faktive Verben und
bieten sich daher fr den Prsuppositionstest
an:
(87)
a. Frieda kann DOCH etwas dafr, da
ihr Mann Alkoholiker ist.
Friedas Mann ist Alkoholiker.
b. ! Frieda kann nicht etwas dafr, da
ihr Mann Alkoholiker ist.
Er ist kein Alkoholiker.
Es gibt mglicherweise weitere Verwendungs-
weisen der Negation, bei denen Prsupposi-
tionen erhalten bleiben: bisher hat hier noch
niemand einen vollstndigen berblick ge-
geben. Man wei auch nicht, warum die Ne-
gation in den genannten Fllen per se Pr-
suppositionen bewahren sollte. Man kann
also bislang nur die Tatsachen festhalten.
Zum Ausgleich gibt es aber auch Verwen-
dungen der Negation, bei denen Prsupposi-
tionen eindeutig nicht bewahrt bleiben, nicht
einmal als DAs. Alle Sprachen haben neben
NPAs auch positive Polarittsausdrcke
(PPAs); im Deutschen gehren dazu z. B.
ziemlich, kaum, mindestens, noch, schon, sogar
usw. Genau wie bei den NPAs wei man auch
hier nicht, wie sich ihre syntaktischen und
semantischen Eigenschaften erklren lassen;
einige Beobachtungen sind bekannt, aber die
ganze Wahrheit mu erst noch herausgefun-
den werden. (Vgl. Ladusaw 1980 und Zwarts
1986, die versuchen, das Verhalten von Po-
larittsausdrcken ber Folgerungsbeziehun-
gen in Booleschen Algebren zu erklren. Aber
in Anbetracht der vielen Gegenbeispiele, die
es dazu immer noch gibt, vgl. Seuren 1985:
241, mu man diese Versuche, so interessant
sie auch sind, als vorlufig betrachten.) PPAs
haben die Eigenschaft, einen sogenannten
Echo-Effekt hervorzurufen, wenn sie unter
einer Negation stehen so, als ob der un-
negierte Satz gerade von jemand anderem ge-
uert worden wre. Auerdem sind Negatio-
nen ber PPAs prsuppositionslschend, also
radikal. Man betrachte dazu etwa das Satz-
paar (88a,b). In (88a) erzeugt der NPA mehr
die Prsupposition, da das, was gesagt wird,
frher so war, und behauptet, da es jetzt
nicht der Fall ist. In (88b) kommt die PPA
noch vor, die die gleiche Prsupposition er-
zeugt, aber behauptet, da sich nichts gen-
dert hat. (88a) verlangt die Negation, weil
mehr ein NPA ist. In (88b) ist die Negation
mglich, aber nur die radikale. In beiden St-
zen wird die Prsupposition geleugnet, und
das fhrt, wie vorhergesagt, dazu, da (88a)
13. Prsuppositionen 317
welche der beiden Analysen wenn ber-
haupt eine die richtige ist.)
Bei diesem Ansatz sollten die Akzeptabili-
ttsbedingungen fr Stze mit Satzoperatoren
(so wie sie oben in (76) definiert sind) als
etwas betrachtet werden, das sich aus dem
Diskursbeitrag (d. h. dem KVP) der einzelnen
Operatoren ergibt. Und idealerweise sollte
sich der Diskursbeitrag aus der wahrheits-
konditionalen Beschreibung der Operatoren
herleiten. Hier ist die Reihenfolge der Ablei-
tung also umgekehrt wie in Heim (1983b).
Ein Satz der Form NICHT-A
P
(d. h. mit
radikaler Negation) hat jetzt in D
n
die Ak-
zeptabilittsbedingung, da b(A
P
) in D
n
oder
in einem Unterbereich von D
n
vorkommen
mu:
(76)
g.
AKZ
u
(NICHT-A
P
,D
n
) gdw. D
m
A
P
(m n).
7. Offene Fragen
Es bleibt immer noch eine erschreckende Liste
von offenen Fragen brig, von denen wir
einige bereits angesprochen haben (vgl. die
Bemerkungen zu den Beispielen (7d,e),
(8cf), (74bd), (77a,b), (8990))). Dane-
ben ist noch das folgende zu erwhnen.
Da gibt es als erstes das Problem der Ne-
gation. Man kann in Anbetracht der geschil-
derten Beobachtungen nicht vernnftiger-
weise daran zweifeln, da die natursprachli-
che Negation ber die klassische zweiwertige
Negation der Logik nicht erschpfend abge-
handelt ist. Es scheint auch nicht wahrschein-
lich, da eine pragmatische Ergnzung aus-
reichen wird. Man braucht eindeutig eine
neue Bewertung der logischen und pragma-
tischen Merkmale der Negation und eine Un-
tersuchung ihrer metasprachlichen Eigen-
schaften, denn sie ist, wie auf den vorange-
henden Seiten klar wurde, offenbar aller
Theorien Schreckgespenst.
Dann haben wir das noch weitgehend un-
gelste Problem, wie sich Prsuppositionen
unter Quantoren verhalten. Um es in einfa-
chen Worten zu sagen: whrend wir mittler-
weile wohl eine Antwort auf die Frage haben,
warum ein Satz wie:
(91) Das Gespenst von Neuschwanstein hat
ein Konto in Fssen.
die Existenzprsupposition verletzt, die von
dem Prdikat ein Bankkonto haben erzeugt
wird, gibt es keine grundstzliche Antwort
auf die Frage, warum ein Satz wie:
beiden zu identifizieren, denn man kann (me-
tasprachlich) sagen:
(90)
a.
Da sie schuldig war, BER-
RASCHTE ihn nicht, es BRACHTE
ihn GANZ AUSSER FASSUNG.
b. Was er hat, sind nicht fette Rinder,
sondern nette Kinder.
In Anbetracht von C und D oben mssen
diese Negationen als minimal und nicht als
radikal betrachtet werden. Man beachte
auerdem, da der metasprachliche Ge-
brauch der Negation per se einen Kontrast-
akzent nach sich zieht; wenn es sich um die
radikale Negation handeln wrde, htten wir
daher einen Konflikt mit D. Es drfte das
beste sein, die metasprachliche Negation als
gewhnliche minimale Negation zu behan-
deln, die allerdings nicht den Inhalt des ne-
gierten Satzes bestreitet, sondern die sprach-
liche Angemessenheit eines verwendeten Aus-
drucks. Um einer solchen Analyse Substanz
zu geben, mu man allerdings eine Theorie
der Anfhrung entwickeln.
Prsuppositionen werden allerdings nicht
von den logischen Eigenschaften von Stzen
bestimmt. Sonst htte man nmlich, selbst mit
einer dreiwertigen Logik, das absurde Ergeb-
nis, da jeder Satz alle Tautologien und ein
Widerspruch alle Stze prsupponiert. Pr-
suppositionen sind in Seurens Theorie keine
logischen, sondern semantische Eigenschaf-
ten, deren Ursprung in den semantischen Ein-
trgen lexikalischer Prdikate liegt. Die Logik
wird als ein Epihnomen der Semantik be-
trachtet; diese definiert sowohl die Wahrheits-
bedingungen als auch den Diskursbeitrag der
Prdikate (ihr KVP in Heims Sinn). Der Dis-
kursbeitrag der minimalen Negation ist eine
Anweisung, die besagt, da der negierte Satz
aus D
n
herauszuhalten ist. Fr die radikale
Negation erhalten wir gleichfalls eine Anwei-
sung; sie besagt, da das jeweilige D
n
in Ord-
nung zu bringen ist und sicher gestellt werden
mu, da D
n
nicht-P (wobei P eine Prsup-
positionen des negierten Satzes A ist). Die
radikale Negation kann also nur dann ange-
messen verwendet werden, wenn die Prsup-
position, die eliminiert werden soll, explizit
angegeben ist, so wie oben in (80b), (81a,b),
(82b), (83b) und (88b). Der negierte Satz A
P
ist dann a fortiori aus D
n
ausgeschlossen.
(Fauconnier schlgt eine andere Behandlung
der Negation vor. Er behandelt sie als einen
intensionalen Operator, der fr das, was ne-
giert ist, einen Unterbereich (Unterraum) ein-
fhrt (oder fortfhrt). Es bleibt abzuwarten,
318 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
knnte. Es wird z. B. hufig die Meinung
vertreten, da ein Wort wie sogar keine Pr-
suppositionen erzeugt, sondern nur konven-
tionale Implikaturen (Stalnaker 1974; Kart-
tunen & Peters 1979). (95a) gilt dementspre-
chend als wahr, wenn der fragliche Minister
korrupt ist, ganz gleich, was man von ihm
erwarten wrde; man betrachtet den seman-
tischen Beitrag von sogar nicht als Teil der
Wahrheitsbedingungen. Doch sind die Mei-
nungen zu diesem Punkt gespalten, und auch
ber die Frage, ob man noch andere Flle
auf diese Weise behandeln sollte, herrscht
keine Einigkeit. In jedem Fall liegt hier die
Beweislast bei denen, die wie Karttunen und
Peters neue Unterscheidungen einfhren.
Diese mten durch gute empirische Tests
und eine solide formale Basis abgesttzt wer-
den.
Eine ntzliche Bibliographie zum Thema
Prsuppositionen findet sich in Sag & Prince
1979.
Ich bin Rob van der Sandt, Arnim von Stechow
und einem anonymen Gutachter fr ntzliche kri-
tische Bemerkungen, Anregungen und Vorschlge
zu Dank verpflichtet.
8. Literatur (in Kurzform)
Atlas 1977 Barlow/Flickinger/Wescoat (eds.)
1983 Bierwisch/Heidolph (eds.) 1970 Bor/Ly-
can 1976 Cole (ed.) 1978 Cole (ed.) 1981 Cole/
Morgan (eds.) 1975 Comrie/Keenan 1979 Da-
vidson/Hintikka (eds.) 1969 Fauconnier 1984
Fauconnier 1985 Fillmore 1971 Fillmore/Lan-
gendoen (eds.) 1971 Van Fraassen 1968 Van
Fraassen 1969 Van Fraassen 1971 Frege 1892
Gazdar 1976 Gazdar 1979a Gazdar 1979b
Geach 1950 Geach 1969 Geach 1972 Grice
1975 Grice 1981 Heim 1983b Hintikka 1962
Horn 1969 Horn 1972 Horn 1985 Kartunnen
1971 Kartunnen 1973 Kartunnen 1974 Kartun-
nen/Peters 1979 Keenan 1971b Keenan/Comrie
1977 Kempson 1975 Kiparsky/Kiparsky 1970
Kneale/Kneale 1962 Ladusaw 1980 Lambert
(ed.) 1969 Langendoen/Savin 1971 McCawley
1981 Morgan 1969 Munitz/Unger (eds) 1974
Nuchelmans 1973 Oh/Dinneen (eds.) 1979 Pat-
zig (ed.) 1969 Reichgelt 1985 Russell 1905 Sa-
dock 1978 Sag/Prince 1979 Van der Sandt 1982
Sellars 1954 Seuren 1985 Soames 1979 Soames
1982 Stalnaker 1970 Stalnaker 1973 Stalnaker
1974 Stalnaker 1978 Steinberg/Jakobovits (eds.)
1971 Strawson 1950a Strawson 1952 Strawson
1954a Strawson 1964 Wilson 1975 Zwarts 1986
Pieter A. M. Seuren, Nijmegen (Niederlande)
(bersetzt aus dem Englischen
von Ulrike Haas-Spohn)
(92) Einige Gespenster aus verschiedenen
Schlssern haben ein Konto in Fssen.
gleichfalls diese Prsupposition verletzt. Die
zweite Hlfte von Heim (1983b) ist ein Ver-
such, dieses Problem zu lsen, aber man mu
gerechterweise sagen, da eine Lsung noch
weit entfernt ist.
Der nchste Problembereich betrifft die
Syntax, die man fr eine angemessene Be-
handlung der Prsuppositionsphnomene
braucht. Wir haben es hier mit einer komple-
xen Problemstellung zu tun, die keineswegs
trivial ist. Wie oben schon vermerkt wurde,
brauchen wir eine Syntaxtheorie, die eine
Trennung von Oberflchenform und seman-
tischer Form ermglicht. Der oben anhand
der Stze (20)(24) besprochene Fall ist klar
und aufschlureich. Whrend die logische Ne-
gation von Stzen wie (93a) oder (94a) durch
(93b) bzw. (94b) gegeben ist, ist (95b) nicht
die logische Negation von (95a):
(93)
a. Alle Minister waren korrupt.
b. Nicht alle Minister waren korrupt.
(94)
a. Nur der Innenminister war korrupt.
b. Nicht nur der Innenminister war kor-
rupt.
(95)
a. Sogar der Kultusminister war kor-
rupt.
[Even the Minister of Culture was cor-
rupt.]
b. Nicht einmal der Kultusminister war
korrupt.
[Not even the Minister of Culture was
corrupt.]
(95a,b) ist insofern interessant, als der zweite
Satz nicht die logische Negation des ersten
ist, wie das bei (93) und (94) der Fall ist. Man
kann (95) so paraphrasieren: Der Kultus-
minister war korrupt, obwohl er der letzte ist,
von dem man das erwarten wrde. Doch
(95b) entspricht Der Kultusminister war
nicht korrupt, obwohl er der erste ist, von
dem man das erwarten wrde. Aber trotz
dieses semantischen Unterschieds zwischen
(95) auf der einen und (93) und (94) auf der
anderen Seite sind die Stze syntaktisch vllig
analog konstruiert. Es ist klar, da darin ein
Problem liegt, und zwar ein Problem fr die
Syntax. (Das obige Beispiel ist nur eines von
vielen; man knnte leicht weitere Beispiele
anfhren.)
Schlielich bleibt noch die berechtigte
Frage, welche anderen semantischen Eigen-
schaften es neben Folgerungen, Prsup-
positionen und DAs (im obigen Sinn von
abgeschwchten Prsuppositionen) geben
319
14. Implikatur
1. Einleitung
2. Grices Theorie der Implikatur
2.1 Meinen
2.2 Sagen und Implikieren
2.3 Konventionale Implikatur
2.4 Konversationale Implikatur
2.5 Implikaturen, die weder konventional noch
konversational sind
2.6 Schematische bersicht
2.7 Unterscheidungsmerkmale
3. Anwendungen der Theorie der Implikatur
3.1 Die Semantik logischer Konstanten in der na-
trlichen Sprache
3.2 Indirekte Sprechakte
3.3 Prsupposition und die Grenze zwischen Se-
mantik und Pragmatik
4. Kritik an der Theorie der Implikatur
4.1 Die Konversationsmaximen
4.2 Die Konventional/konversational Unter-
scheidung
4.3 Gesagtes versus konventional Implikiertes
5. Literaturempfehlungen
6. Literatur (in Kurzform)
320
14. Implikatur 321
Kernstck seiner Theorie rationaler Verstn-
digung. Mit einer Handlung (insbesondere
auch einer sprachlichen uerung) etwas mei-
nen, das umfat bei Grice: mit der Handlung
versuchen, dem Adressaten Grnde fr eine
Annahme oder Handlung seinerseits zu ge-
ben. (Im folgenden wird es nur um solche
Flle gehen, wo mit der Handlung Grnde
fr Annahmen gegeben werden.) Der fr das
2. Grices Theorie der Implikatur
2.1Meinen
Grices Theorie der Implikatur ist Teil seiner
Theorie des Meinens. Diese wiederum ist das
322 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
scheid. Nehmen wir weiterhin an, da A
glaubt, da S ihn nicht was das Wetter
angeht hinters Licht fhren will. Und neh-
men wir schlielich an, da S all dies wei.
Wenn S unter solchen Umstnden A zu der
berzeugung bringen will, da es regnet [Be-
dingung (i)], so mag er zu diesem Zweck den
Satz Es regnet uern (dieser uerung ent-
spricht x in den obigen Erluterungen).
Diese uerung hat, fr sich genommen,
nichts Regnerisches an sich; S macht diese
uerung also nicht deshalb, weil er glaubt,
da A aus ihr unmittelbar entnehmen wrde,
da es regnet (wie A dies etwa dann tun
wrde, wenn er Gerusche wahrnhme, die
er fr typische Regengerusche hlt). S macht
diese uerung vielmehr deshalb, weil er
glaubt, da A aus ihr entnehmen wird, da S
ihn damit zu der berzeugung bringen
mchte, da es regnet [Bedingung (ii)]. Und
dies mchte S, weil er darauf vertraut, da A
ihn (zumindest in Hinsicht aufs Wetter) fr
informiert und aufrichtig hlt, so da A also
weil er merkt, da S ihn glauben machen
will, da es regnet einen guten Grund hat
anzunehmen, da es regnet [Bedingung (iii)].
Und genau deshalb wird A schlielich glau-
ben, da es regnet, wie S es will [Bedingung
(i)]. Der Kreis schliet sich, und eine ber-
zeugung entsteht hier also aufgrund indirek-
ter oder sekundrer Anhaltspunkte: A glaubt
schlielich (wenn alles klappt), da es regnet,
aber nicht weil er irgendwie wahrgenommen
htte, da es regnet, sondern weil er eine (hier
eine sprachliche) Handlung von S wahrge-
nommen hat, in der nichts auf Regen hin-
weist, auer Ss Geisteszustand, der in der
Handlung deutlich wird.
Beim Griceschen Meinen wird also darauf
abgezielt, eine berzeugung (z. B. da es reg-
net) rational hervorzurufen, obwohl das dazu
benutzte Mittel (z. B. die uerung von Es
regnet) kein unmittelbarer natrlicher An-
haltspunkt dafr ist, da die betreffende
berzeugung inhaltlich zutrifft. Im einfach-
sten Falle treten beim Adressaten Annahmen
ber die Absichten, den Informationsstand
und die Gutwilligkeit des Sprechers an die
Stelle von Annahmen ber rein naturgesetz-
liche Zusammenhnge, die auch ohne alles
menschliche Dazutun bestehen.
Dieser Mechanismus rationaler Beeinflus-
sung kann auch auersprachlich und all-
gemeiner gesagt ohne die Zuhilfenahme
konventional bedeutungsvoller Mittel in
Gang gesetzt werden und ablaufen. Fr das
Gricesche Meinen bedarf es keiner vorab kon-
Meinen springende Punkt ist dabei, da die
Handlung, mit der etwas gemeint wird, diese
Grnde nicht allein dank ihren natrlichen
Eigenschaften bereitstellt, sondern nur dank
des Umstands, da sie solche Grnde bereit-
stellen soll (gleichgltig, welches ihre natr-
lichen Eigenschaften sind). Der Handlung fr
sich selbst, als natrliches Ereignis genom-
men, lt sich nicht entnehmen, was der
Adressat aus ihr entnehmen soll. Der Gedan-
kengang, der den Adressaten zu dem vom
Handelnden gewnschten Ergebnis fhren
soll, hat als eine unerlliche Prmisse, da
der Handelnde mit der Handlung gerade die-
ses Ergebnis anstrebt.
In einem einfachen Fall haben wir einen
Handelnden (den Sprecher) S, einen Adres-
saten A, eine Handlung x, eine Proposition
p, wobei x (oder Ss Vollzug von x) kein
natrliches Zeichen fr p ist: (1) S will mit x
erreichen, da A zu der Annahme gelangt,
da p; (2) S unterstellt, da A angesichts von
x (bzw. angesichts von Ss Vollzug von x)
bemerkt, da (1); und (3) S unterstellt, da
wenn A bemerkt, da (1), er damit Grund hat
zu glauben, da p. Das Grundschema des Ge-
dankengangs von A lt sich dann so be-
schreiben:
(0) S tut x.
(1) Wenn S x tut, dann will er mich damit zu
der Annahme bringen, da p.
(2) Wenn S mich zu der Annahme, da p,
bringen will, dann p.
(3) p
Baut S darauf, da A auf so einem Weg von
der Wahrnehmung der Handlung zur ge-
wnschten Annahme (da p) gelangt, dann
vollzieht S x mit der Absicht, da
(i) A zu der Annahme gelangt, da p;
(ii) A zu der Annahme gelangt, da S x mit
der Absicht vollzieht, da (i);
(iii) die in (ii) bezeichnete Annahme A Grund
fr die in (i) bezeichnete Annahme gibt.
Hat S diese drei Absichten, so meint er im
Sinne der Theorie von Grice mit x, da p.
Dabei ist die fr unsere Zwecke irrelevante
weitere Voraussetzung beiseite gelassen, da
S mit seiner uerung gegenber A gewisse
arglistige Absichten nicht hegt.
Es ist leicht zu sehen, da mit sprachlichen
uerungen bei ihrer Verwendung zu nor-
malen Zwecken der Verstndigung etwas im
Griceschen Sinne gemeint wird. Nehmen wir
an, da A nicht wei, wie das Wetter ist, und
da er glaubt, S wisse ber das Wetter Be-
14. Implikatur 323
drcke (einschlielich der kontextabhngi-
gen) bestimmt, so liegt fest, was der Sprecher
mit der uerung gesagt hat. (Dem Gesagten
entspricht in Austins Zerlegung des Sprech-
aktes das sog. Rhem und bei Frege der mit
dem Satz ausgedrckte Gedanke.) Alles, was
ber das Gesagte hinaus mit der uerung
gemeint wird, ist das Implikat der uerung.
Entscheidend fr den Unterschied zwi-
schen Gesagtem und Implikiertem ist, wie der
Adressat aufgrund der uerung zu der be-
treffenden Annahme gelangen soll. Und zwar
kommt es dabei darauf an, wie er jeweils
Prmisse (1) des Grundschemas sttzen soll.
Wenn mit der uerung eines Satzes s gesagt
wird, da p, dann baut der Sprecher darauf,
da der Adressat etwa so folgert:
sagen, da p
s hat die Bedeutungen b, b
1
..., b
n
S benutzt s in einer der Bedeutungen von s
S benutzt s nicht in den Bedeutungen
b
1
, ..., b
n
S benutzt s in der Bedeutung b
b bestimmt in der gegebenen Situation den
Sachverhalt, da p
(1) Wenn S (in der gegebenen Situation) s
uert, dann will er mich damit zu der
Annahme bringen, da p.
Wenn der Adressat so schliet (und im Rah-
men des Grundschemas bis zu p weiterfol-
gert), dann sttzt er Prmisse (1) des Grund-
schemas durch Annahmen ber die Bedeu-
tung des geuerten Satzes; und weil er
schlielich, auf diesem Weg, zu der Annahme
gelangt, da p, und p im Einklang mit der
Bedeutung des geuerten Satzes steht, hat
der Sprecher mit seiner uerung gesagt, da
p vorausgesetzt natrlich (und das ist we-
sentlich fr Grice), der Sprecher baut bei sei-
ner uerung auf all dies.
Es ist hier eine Bemerkung zwischendurch
am Platze. Diese Schlsse, die der Adressat
ziehen soll und die der Sprecher also antizi-
piert, wirken ein bichen kompliziert und
wrden erst recht so wirken, wenn sie eini-
germaen vollstndig entfaltet wrden. Es
sieht so aus, als msse ein Sprecher eine Phase
intrikater Planung durchlaufen, bis er schlie-
lich etwas im Griceschen Sinne sagen
kann. Der naheliegende Einwand da
kaum jemand so rsonniert, bevor er den
Mund aufmacht, um etwas zu sagen ver-
mag der Theorie von Grice allerdings nichts
anzuhaben. Sie soll keine psychologische Re-
konstruktion sprachlicher Verstndigung ab-
ventional etablierten semantischen Beziehung
zwischen dem, womit gemeint wird, und dem,
was gemeint wird. Ein schnes Beispiel dafr
finden wir in einer Erzhlung von J. L. Borges
(sie trgt den Titel Der Garten der Pfade,
die sich verzweigen). Da meint jemand mit
einem Revolverschu, den er in England ab-
gibt, da der britische Artilleriepark sich in
einer bestimmten nordfranzsichen Stadt be-
findet; zwischen ihm und seinem Adressaten,
der in Berlin sitzt, besteht keine Abmachung,
dank der Revolverschsse berhaupt etwas
bedeuten, geschweige denn gerade diesen spe-
ziellen Inhalt haben. Dennoch gelingt die Ver-
stndigung, ohne nachgeschobenes Glossar
oder dergleichen. Gemeinsame Interessen von
Meinendem und Adressat, hnlicher Sinn fr
das, was auffllig ist, beiderseitige Intelligenz
und noch unberschaubar viel anderes mehr
kurz, bereinstimmungen der kognitiven
Gestimmtheit reichen aus, um Verstndi-
gung mit nicht-natrlichen Zeichen gelingen
zu lassen. Auch sprachliche Verstndigung be-
ruht auf dieser Grundlage das ist ein
Grundgedanke von Grices Sprachphiloso-
phie. Sprachliche Verstndigung ist zwar in-
sofern konventional, als ihr Medium es ist.
(Zu einer Sprache gehren per definitionem
Ausdrcke mit wrtlicher Bedeutung; und
wrtliche Bedeutung ist eine konventional
verfestigte Beziehung zwischen dem, womit
gemeint wird, und dem, was gemeint wird.)
Aber sprachliche Verstndigung ist insofern
nicht wesentlich konventional, als solcherlei
Verstndigung auch ohne Konventionen ge-
lingen kann. Zudem wird bei sprachlicher
Verstndigung systematisch von der Mglich-
keit Gebrauch gemacht, mit den konventio-
nalen Mitteln auch auerkonventionale Ver-
stehenseffekte zu erreichen. Darum wird es
im Folgenden gehen; die Theorie der Impli-
katur ist ein Teil der Theorie des Meinens,
und zwar solcher Flle, in denen etwas mit
sprachlichen uerungen gemeint wird.
2.2Sagen und Implikieren
Die Gesamtheit dessen, was ein Sprecher mit
einer sprachlichen uerung meint, zerfllt
nach Grice in das, was mit ihr gesagt wird,
und das, was mit ihr implikiert wird. Was mit
ihr gesagt wird, ergibt sich aus der wrtlichen
(bei Grice: der konventionalen) Bedeutung
des geuerten Satzes durch Desambiguie-
rung und Bezugsbestimmung; ist aus den Les-
arten eines mehrdeutigen Satzes die in der
uerung gemeinte Lesart ausgesondert, und
ist der Bezug aller bezugnehmenden Aus-
324 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
hat.
Die meisten von Grice und in der sonstigen
Literatur behandelten Flle sind von der Art
(b). Ein typisches Beispiel geben die starken
Untertreibungen ab: Jemand uert den Satz
Die Eintracht Frankfurt wird heuer wohl nicht
deutscher Meister und implikiert damit, da
diese sympathische Mannschaft Glck hat,
wenn sie nicht absteigt. Der Sprecher meint,
was der Satz bedeutet; also sagt er es aber
angesichts des allgemein bekannten Tabellen-
standes (zwei Spieltage vor Saisonende) meint
er noch etwas mehr, und das implikiert er
demzufolge. Alle indirekten Sprechakte im
Sinne Searles (1975a) gehren in die Rubrik
(b) des Implikierens.
2.3Konventionale Implikatur
Grice unterscheidet nun darberhinaus ver-
schiedene Formen der Implikatur. Konventio-
nale Implikaturen rhren von der wrtlichen
Bedeutung des geuerten Satzes her, gehren
aber nicht zu dem, was mit der uerung
gesagt wird. Der Standardtest fr die Unter-
scheidung zwischen Gesagtem und Implikier-
tem ist die Anwendbarkeit des modus tollens:
zum Gesagten gehren nach Grice nur solche
Inhalte, aus deren Falschheit sich ergibt, da
etwas Falsches gesagt worden ist. Das Impli-
kat hingegen mu immer falsch sein knnen,
ohne da das Gesagte falsch ist. In derselben
Weise hat bereits Frege (1918) zwischen dem
vom Satz ausgedrckten Gedanken und den
blo angedeuteten Bestandteilen des Satzin-
haltes unterschieden. Es gilt also: Nur das,
was wahr sein mu, damit nicht falsch ist,
was gesagt wird (vorausgesetzt, es wird etwas
gesagt), gehrt zum Gesagten; was sonst noch
allein von der wrtlichen Bedeutung des ge-
uerten Satzes her in den gemeinten ue-
rungsinhalt hineingebracht wird, ist konven-
tional implikiert. Mit der uerung von (4a)
bzw. (4b) wird nach Grice jeweils dasselbe
gesagt:
(4)
a. Edie war schn, und sie war reich
b. Edie war schn, aber sie war reich
denn was nach Grice (und auch nach Frege)
damit gesagt wird, ist hchstens dann falsch,
wenn Edie nicht schn oder nicht reich war.
Wer den zweiten Satz uert, gibt damit al-
lerdings unweigerlich auch zu verstehen, (da
er glaubt,) da irgendetwas Edies vormalige
Schnheit in einen Kontrast dazu setzt, da
sie reich war. (Dieser Kontrast mag darin
bestehen, da zuvor gesagt wurde, sie sei
geben, sondern eine rationale. Einer solchen
Rekonstruktion ist es nicht darum zu tun,
was im Bewutsein von Sprecher und Adres-
saten bei sprachlicher Verstndigung nun ge-
nau vor sich geht, sondern darum, wie sich
das, was auch immer da vor sich geht, als ein
rationaler Proze (nach Magabe der uns ver-
fgbaren Modelle von Rationalitt) darstellen
lt. Natrlich darf so eine Rekonstruktion
mit den psychologischen Daten nicht unver-
einbar sein es darf beispielsweise nichts
psychologisch Unmgliches oder berflssi-
ges in ihr postuliert werden , aber sie steht
auch nicht unter dem Diktat einer introspek-
tiven Datenerhebung, in der es Annahmen,
Wnsche und Folgerungsschritte nur gibt, wo
sie erlebt werden. Grice entwickelt eine
Theorie der sprachlichen Verstndigung, so-
weit sprachliche Verstndigung eine Form ra-
tionaler Beeinflussung ist und zwar bei-
derseits: auf seiten des Sprechers ist dies ein
rational gesteuerter Beeinflussungsversuch
und auf seiten des Adressaten ein rational
berwachtes Beeinflutwerden. Da es solch
ein (rationaler) Aspekt unseres gewhnlichen
Redens ist, dem sich der uerungsinhalt ver-
dankt, diese Auffassung liegt der Theorie von
Grice zugrunde. Nur wenn der Anspruch auf
Rationalitt preisgegeben oder eine Theorie
der Rationalitt entwickelt wird, die nicht auf
Annahmen, Wnsche und Folgerungen zu-
rckgreift, lt sich der von Grice entwickelte
Ansatz verwerfen.
Wird mit der uerung eines Satzes s im-
plikiert, da p, dann baut der Sprecher dar-
auf, da der Adressat Prmisse (1) des Grund-
schemas sttzen kann, ohne dabei anzuneh-
men, da p (in der gegebenen Situation) durch
einen wahrheitskonditionalen Bestandteil der
Bedeutung von s bestimmt wird. Dabei sind
erst einmal zwei Flle zu unterscheiden:
(a) S sagt mit s gar nichts (sondern implikiert
nur, da p);
(b) S sagt mit s irgendetwas (aber etwas an-
deres als p).
Ein Beispiel fr den ersten Fall: A ist herein-
gelegt worden, wei aber nicht, von wem. Er
fragt S, ob S an der Sache beteiligt war. S
skandiert in kindlicher Intonation den Satz
Ich bin klein (obwohl er auch fr A un-
bersehbar recht gro ist), weil er an-
nimmt, da A daraufhin die zweite Zeile des
Kindergebetreims (Ich bin klein) Mein Herz
ist rein einfllt. S meint mit seiner uerung
dann nicht, da er klein ist; also sagt er mit
seiner uerung nichts. Vielmehr implikiert
er blo, da er mit der Sache nichts zu tun
14. Implikatur 325
nen einigermaen klar ist, was der Zweck und
welches die Umstnde ihres Gesprches sind
(ob sie beispielsweise blo eilig einen unver-
meidlichen Plausch bei einer zuflligen Be-
gegnung absolvieren oder unter Zeitdruck ein
gemeinsames Abendessen planen oder mit
Mue ihre Einschtzung eines Films verglei-
chen oder eine heftige Diskussion ber die
Beurteilung einer bestimmten Verhaltensweise
haben). Darber hinaus sei jeder der Beteilig-
ten, zumindest was das Gesprch angeht, auf
Kooperation bedacht, jedenfalls in dem
Sinne, da er das Prinzip beachtet: Rede so,
wie es dem Gesprch, an dem du teilnimmst,
gerade angemessen ist! Dies alles wiederum
sei gemeinsames Wissen unter den Gesprchs-
teilnehmern: Jeder nimmt an, da es sich so
verhlt; jeder nimmt an, da auch die andern
dies annehmen; keiner nimmt an, da einer
der andern irgendetwas von alledem in Zwei-
fel zieht, und so weiter. Was sich aufgrund
dieser Gegebenheiten (ber das Gesagte und
das konventional Implikierte hinaus) an mit
einer uerung Gemeintem erfassen lt, ist
eine konversationale Implikatur der ue-
rung.
Das Kooperationsprinzip so zu reden,
wie es angesichts des Gesprchszwecks und
Gesprchsstandes angemessen ist wird von
Grice (1975) in vier Hinsichten nher spezi-
fiziert. In lockerer Anlehnung an Kants Ka-
tegorien nennt er diese Hinsichten Quantitt,
Qualitt, Relation und Modalitt und ordnet
ihnen folgende Konversationsmaximen zu:
Quantitt:
1. Mache deinen Beitrag so informativ wie
(fr die gegebenen Gesprchszwecke) n-
tig.
2. Mache deinen Beitrag nicht informativer
als ntig.
Qualitt:
Versuche deinen Beitrag so zu machen, da
er wahr ist.
1. Sage nichts, was du fr falsch hltst.
2. Sage nichts, wofr dir angemessene
Grnde fehlen.
Relation:
Sei relevant.
Modalitt:
Sei klar.
1. Vermeide Dunkelheit des Ausdrucks.
2. Vermeide Mehrdeutigkeit.
3. Sei kurz (vermeide unntige Weitschwei-
figkeit).
4. Der Reihe nach!
schn und arm gewesen.) Wer den ersten Satz
uert, tut das nicht. Das Fehlen solch eines
Kontrasts widerlegt nach Grice nicht, was mit
der uerung des zweiten Satzes gesagt
wurde: Die uerung ist vielleicht irgendwie
unangemessen oder schrg, aber es wurde mit
ihr etwas gesagt, was dennoch deswegen nicht
falsch ist.
Die Bezeichnung konventionale Implika-
tur rhrt daher, da das Implikat durch die
konventionale (d. h. wrtliche) Bedeutung des
Wortes aber hervorgerufen wird. Es bedarf
nichts weiter als einer Kenntnis der Sprach-
konventionen, um zu erkennen, da mit der
uerung des zweiten Satzes gemeint wird,
da ein Kontrast zwischen Edies Schnheit
und ihrem Reichtum besteht, obwohl mit der
uerung laut Grice nicht gesagt wird,
da ein solcher Kontrast besteht.
Was eine konventionale Implikatur von
einer semantischen Prsupposition (falls es so
etwas gibt) unterscheidet, ist folgendes: wenn
das konventionale Implikat falsch ist, kann
das Gesagte dennoch ganz klar falsch sein;
hingegen wre nichts gesagt worden oder
das Gesagte wre wahrheitswertlos , wenn
das semantisch Prsupponierte falsch ist.
2.4Konversationale Implikatur
Konventionale Implikaturen sind die Be-
standteile des uerungsinhaltes, die sich
zwar aus der wrtlichen Bedeutung des ge-
uerten Satzes ergeben, die aber nicht zum
Gesagten zu rechnen sind. Sie zu erfassen,
bedarf es nur der Sprachbeherrschung. Nicht-
konventionale Implikaturen ergeben sich
nicht allein aus der Satzbedeutung; sie zu
erfassen, verlangt vom Adressaten auer-
sprachliche Erwgungen. Solche Erwgungen
knnen von ganz verschiedenen Merkmalen
der uerung und des Rahmens, in dem sie
getan wird, ausgelst werden. Grices Theorie
der konversationalen Implikatur beschrnkt
sich auf die Behandlung solcher Flle, in de-
nen die Annahme, da der Sprecher mit seiner
uerung kooperiert (d. h., grob gesagt, da
er einen sinnvollen Gesprchsbeitrag machen
will), den Schlssel dafr liefert, was er mit
seiner uerung implikiert. Es gibt Implika-
turen, die anders funktionieren die sich
nicht allein aus dieser Annahme erschlieen
lassen , sie sind weder konventionale noch
konversationale Implikaturen und werden
kurz im nchsten Abschnitt behandelt.
Konversationale Implikaturen sind in Si-
tuationen angesiedelt, in denen wenigstens
zwei Personen miteinander reden, wobei ih-
326 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Maxime der Quantitt vor.)
2.5Implikaturen, die weder konventional
noch konversational sind
In diese Kategorie fallen Implikaturen, die
sich von den konversationalen darin unter-
scheiden, da andere Maximen (als die Kon-
versationsmaximen) bei dem Schlu auf das
Gemeinte eine Rolle spielen. Maximen der
Moral, einer Religion, der Hflichkeit, der
Feierlichkeit usw. knnen natrlich in der
gleichen Weise wie die der Konversation fr
die Interpretation einer uerung relevant
werden. Wer z. B. bei einem feierlichen Anla
unfeierlich spricht, kann damit vielerlei im-
plikieren.
Grice behandelt diese Implikaturen nicht,
sondern bercksichtigt sie in seiner Theorie
nur durch Erwhnung. Es findet sich in seinen
Arbeiten auch kein Kriterium zur Unterschei-
dung zwischen Konversationsmaximen und
andern Maximen. Doch der Leitgedanke bei
der Unterscheidung ist ziemlich klar: zu den
Konversationsmaximen gehren nur die Prin-
zipien, die jede vernnftige Verstndigungs-
praxis leiten, jedenfalls soweit es in ihr um
die charakteristischen Zwecke sprachlicher
Verstndigung (wie z. B. mglichst effektiven
Informationsaustausch) geht.
2.6
Schematische bersicht
Abb. 14.1:Einteilung der Implikate
2.7Unterscheidungsmerkmale
Linguistisch relevant ist insbesondere die Un-
terscheidung zwischen Satzinhalt (also den
konventionalen Bestandteilen des uerungs-
inhaltes) und nicht-konventionalen Impli-
kata. Angenommen, die Proposition p gehrt
normalerweise zum uerungsinhalt des Sat-
zes s; wie lt sich nun entscheiden, ob p zur
wrtlichen Bedeutung von s zu rechnen ist
der Zusammenhang von s und p also, prima
Grice beansprucht fr diese Sammlung von
Konversationsmaximen weder Vollstndig-
keit noch wechselseitige Unabhngigkeit.
Grice gibt keine Definition fr konversa-
tionale Implikaturen, und auch die folgende
Erluterung soll blo eine abschlieende Zu-
sammenfassung einiger wichtiger Merkmale
sein, wobei ein normaler Gesprchskontext
vorausgesetzt wird. Da ein Inhalt p mit einer
uerung x konversational implikiert wird,
besagt in etwa, da (i) der Sprecher mit x
weder sagt noch konventional implikiert, da
p; (ii) x sich aber nur dann (oder: am besten
dann) als in Einklang mit den Konversations-
maximen auffassen lt, falls der Sprecher mit
x auch meint, da p; und (iii) der Sprecher
mit x meint, da p, wobei er u. a. gerade
darauf spekuliert, da der Adressat bemerkt,
da (ii).
Die Paradeflle konversationaler Implika-
tur ergeben sich da, wo die uerung auf-
grund ihrer konventionalen Beschaffenheit al-
lein kontextuell unangemessen wre (d. h. ge-
gen wenigstens eine der Maximen verstiee).
Der Sprecher baut darauf, da der Adressat
jetzt versucht, die uerung nun doch so zu
verstehen, da sie kein Versto gegen die
Konversationsmaximen ist, und da er da-
durch das Implikat erfat. Grice nennt dieses
Verfahren Ausbeutung der Maximen, gegen
die scheinbar verstoen wird. Mit der Aus-
beutung lassen sich nach Grice eine Menge
gelufiger Phnomene sprachlicher Verstn-
digung erklren, die von einem rein semanti-
schen Blickpunkt aus Schwierigkeiten berei-
ten: die uerung von Tautologien, von
Mehrdeutigkeiten und von offenkundig fal-
schen Stzen (Ironie, Metapher, Litotes, Hy-
perbel); hierher gehrt auch unser obiges Bei-
spiel mit Ich bin klein und vieles andere mehr.
All diese Flle gehren in den Bereich dessen,
was Grice spezialisierte konversationale Impli-
katuren nennt: Es bedarf spezieller Merkmale
der uerungssituation, um das jeweilige Im-
plikat zu erschlieen.
Generalisierte konversationale Implikaturen
liegen im Gegensatz zu den spezialisierten
da vor, wo die Implikatur normalerweise
mit der uerung einhergeht, wo kein Ver-
sto gegen die Konversationsmaximen wahr-
genommen wird, weil das Implikat mitver-
standen wird, sich aber ein solcher Versto
ergbe, wenn das Implikat nicht auch gemeint
wre. (Die uerung von Im letzten Jahr habe
ich zwei silberne Feuerzeuge verloren hat als
generalisierte konversationale Implikatur,
da es eigene Feuerzeuge waren; wrde dies
nicht gemeint, lge unter gewhnlichen
Umstnden ein Versto gegen die erste
14. Implikatur 327
auch diese Maxime aufgrund der ihr inne-
wohnenden Vagheit noch viel Spielraum fr
Zweifelsflle.
3. Anwendungen der Theorie der
Implikatur
Ursprnglich hat Grice (1961) seine Theorie
der Implikatur auf ein philosophisches Pro-
blem der Wahrnehmungstheorie angewandt;
ich werde mich hier aber auf Anwendungs-
flle in der Linguistik und Sprachphilosophie
beschrnken und auch die in Abschnitt 2.2
bereits erwhnten Phnomene nicht-wrtli-
cher Sprachverwendung beiseite lassen.
3.1Die Semantik logischer Konstanten in
der natrlichen Sprache
(a) Grice (1975) hat zu zeigen versucht, da
natursprachliche Ausdrcke wie nicht, oder
und falls sich semantisch nicht von der Ne-
gation, der Adjunktion bzw. dem Konditional
(in ihrer logischen Standardinterpretation)
unterscheiden. Laut Grice sind diese Aus-
drcke auch in der natrlichen Sprache rein
wahrheitsfunktionale Junktoren; alles, was
man sonst noch zu ihrer Bedeutung hinzu-
rechnen mag, seien in Wirklichkeit genera-
lisierte konversationale Implikaturen. Beim
umgangssprachlichen falls sind Grices Argu-
mente sehr kompliziert und wenig berzeu-
gend; Grice selbst (1967: Vorl.5) rumt ein,
da er keine befriedigende Lsung fr ein
Problem hat, das sich fr seinen Ansatz bei
negierten Konditionalen ergibt. Es gab wei-
tere gewichtige Einwnde gegen die semanti-
sche Gleichsetzung von und falls (zu
einem knappen berblick vgl. Gazdar 1979:
83 ff.). Es ist deshalb nicht verwunderlich, da
diese Gleichsetzung auch von Philosophen
und Linguisten verworfen wird, die die Grice-
sche Theorie der Implikatur und ihre Anwen-
dung auf und und oder akzeptieren. (Siehe
dazu beispielsweise auch Strawson (1986).)
Die These von der semantischen Wahr-
heitsfunktionalitt von nicht, und und oder
wurde insbesondere von Cohen (1971, 1977)
angegriffen; Walker (1975) und Gazdar (1979)
haben die Argumente von Cohen entkrftet:
Im Falle der Negation bercksichtigt Cohen
nicht, da eine oberflchensyntaktisch gese-
hen doppelte Verneinung (Ich will kein
Streit nich) semantisch gesehen blo eine dia-
lektale Variante der einfachen Verneinung
(Ich will keinen Streit) sein mag; Cohens Bei-
spiele gegen die Wahrheitsfunktionalitt von
facie, von einer Semantik zu beschreiben und
zu erklren ist oder nicht? Grice (1961,
1975, 1978, 1981) erwhnt und diskutiert meh-
rere Anhaltspunkte, von denen die drei wich-
tigsten erwhnt seien.
1. Ein nicht-konventionales Implikat ist
hufig nicht abtrennbar; d. h. ein nicht-kon-
ventionales Implikat hat die Tendenz, erhal-
ten zu bleiben, wenn man mit andern Worten
dasselbe sagt. Falls sich also das Gesagte mit
ganz verschiedenen Worten sagen lt, in al-
len Formulierungen aber dieselbe Implikatur
vorliegt, dann ist dies ein Indiz dafr, da es
sich um eine nicht-konventionale Implikatur
handelt (denn offenbar rhrt sie nicht von der
konventionalen Bedeutung einzelner Wrter
her).
2. Ein nicht-konventionales Implikat ist
stornierbar, d. h. der fragliche Satz kann ge-
uert werden, ohne da die betreffende Pro-
position implikiert wird. So kann man bei-
spielsweise sagen Im letzten Jahr habe ich zwei
silberne Feuerzeuge verloren, ohne damit zu
implikieren, da es eigene Feuerzeuge waren.
Beispielsweise kann man der uerung die
Bemerkung hinzufgen Allerdings waren es
nicht meine eigenen (explizite Stornierung). Es
kann auch uerungsgelegenheiten geben,
wo die Implikatur einfach aufgrund gewisser
Kontextmerkmale nicht entsteht (kontex-
tuelle Stornierung); z. B. mag es in dem Ge-
sprch gerade darum gehen, wie peinlich es
ist, Dinge zu verlieren, die einem nicht ge-
hren.
3. Ein konversationales Implikat ist her-
leitbar, d. h. es lt sich jeweils mit Hilfe der
Konversationsmaximen und andern Merk-
malen der uerungssituation erklren, wie
die Implikatur im einzelnen zustandekommt,
wie also der Sprecher plausiblerweise darauf
bauen kann, in der gewnschten Weise ver-
standen zu werden.
Keiner dieser Anhaltspunkte ist ein end-
gltiger Test, wie Grice selbst wiederholt be-
tont. Es findet sich im Rahmen von Grices
Theorie mithin kein scharfes Kriterium fr
die Unterscheidung zwischen konventionalen
und nicht-konventionalen Bestandteilen des
uerungsinhaltes. Die Unterscheidung zwi-
schen Gesagtem, konventionalem Implikat
und generalisiertem konventionalen Implikat
lt unbersehbar viele Zweifelsflle offen.
Grice (1978) selbst empfiehlt in Zweifelsfllen
die Anwendung der methodologischen Ma-
xime, nicht mehr konventionale Bedeutungen
anzunehmen als ntig. Doch natrlich lt
328 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
mit der Annahme einer zustzlichen Prsup-
positionsbeziehung zwischen Propositionen
vermeiden lieen. Viele Linguisten waren
Strawson darin, mit allerdings unterschied-
lichen Erluterungen der Prsuppositionsbe-
ziehung, gefolgt. Gem Grice (1981) erweist
sich die ursprngliche Russsellsche Theorie
als semantisch wenigstens so befriedigend wie
Strawsons Theorie, wenn man Russells An-
satz in geeigneter Weise durch die Theorie der
Implikaturen ergnzt (die Argumentation
Grices erstreckt sich brigens auch auf die
Verwendung des Kennzeichnungsoperators in
nichtindikativischen Kontexten). Eine Schw-
che von Grices Vorschlag zur Modifikation
von Russells Kennzeichnungstheorie liegt al-
lerdings darin, da neuartige syntaktische
Hilfsmittel ins Spiel gebracht werden, deren
Extravaganz ihre Durchsichtigkeit weit ber-
ragt. Ein wichtiges Argument Grices gegen
Strawson ist, da mit einer Feststellung wie
Der Knig von Frankreich ist nicht kahl nicht
immer vorausgesetzt wird, da es einen Knig
von Frankreich gibt; diese angeblich voraus-
gesetzte Proposition sei sowohl explizit, als
auch kontextuell stornierbar und sie sei auch
nicht leicht abtrennbar; mithin sei sie nicht
zur konventionalen Satzbedeutung zu rech-
nen.
(d) hnlich argumentieren Karttunen &
Peters (1979) gegen das Bestehen einer se-
mantischen Beziehung zwischen subjunktiven
Konditionalen (Wenn das-und-das der Fall
wre, dann wre auch dies-und-dies der Fall)
und der Falschheit ihrer Antecedens-Stze.
Vielmehr werde, so Karttunen & Peters, mit
solchen Konditionalen nur zumeist konver-
sational implikiert, da der Antecedens Satz
falsch ist.
(e) Als letztes Beispiel sei die These von
Horn (1973) und Gazdar (1979) ber die se-
mantische Eindeutigkeit von mglich ge-
nannt. Fr eine Mehrdeutigkeit dieses Wortes
scheint zu sprechen, da aus (5) sowohl (6)
wie auch (7) folgt.
(5) Es ist notwendig, da p
(6) Es ist mglich, da p
(7) Es ist nicht mglich, da nicht p
Nun wird aber mit der uerung eines Satzes
vom Typ (5) hufig auch (8) gemeint:
(8) Es ist mglich, da nicht p.
Wegen der Unvertrglichkeit von (7) mit (8)
und der Vertrglichkeit von (6) mit (7) und
von (6) mit (8) liegt es nahe, zwei verschiedene
Bedeutungen fr mglich anzunehmen: in
dem einen Sinn von mglich wird (8) von (6)
und und oder kranken daran, da es sich um
Einbettungen von und- und oder-Stzen in
Konditionale handelt, so da sich der An-
schein des Gegenbeispielcharakters mit guten
Grnden durch das Vorkommen des nicht
wahrheitsfunktionalen Wortes falls in diesen
Stzen erklren lt.
(b) Umgangssprachliche Existenzquanto-
ren wie einige, manche und es gibt ..., die
haben hufig die Funktion, den Schlu auf
die Negation der Allquantifikation zuzulas-
sen. Mit einem Satz wie Einige Studenten nick-
ten in der Vorlesung ein ist hufig auch ge-
meint, da nicht alle Studenten einnickten.
Gehrte die Zulssigkeit des Schlusses von
einige auf nicht alle zur Bedeutung dieser um-
gangssprachlichen Quantoren, dann bestnde
eine tiefgreifende semantische Diskrepanz
zwischen ihnen und den Quantoren der Stan-
dardlogik. Im Lichte der Griceschen Theorie
betrachtet, erweist sich die Folgerung, da
nicht alle Studenten einnickten, jedoch als ein
konversationales Implikat der uerung von
Einige Studenten nickten in der Vorlesung ein:
es ist, erstens, nicht abtrennbar (denn es ergibt
sich auch bei Stzen wie Es gab Studenten,
die in der Vorlesung einnickten u. .); es ist,
zweitens, stornierbar (man kann der ue-
rung anfgen: Ja, keinem einzigen Studenten
gelang es wach zu bleiben); und es ist, drittens,
mit Hilfe der ersten Maxime der Quantitt
herleitbar (denn wenn dem Sprecher bekannt
wre, da tatschlich alle Studenten vom
Schlaf bermannt worden sind, dann wre
seine uerung nicht so informativ, wie sie
leicht htte sein knnen).
Umgangssprachliche Quantoren bilden
eine sog. quantitative Skala, die von alle ber
die meisten, viele, einige, usw. bis zu kein
reicht. (Ein, weiteres Beispiel fr solch eine
Skala liefern die Ausdrcke gewi, wahr-
scheinlich, mglich, usw.). Eine allgemeine
Theorie der Implikaturbeziehungen zwischen
solchen skalaren Ausdrcken haben Horn
(1972) und daran anknpfend Gazdar (1979)
entwickelt. (Siehe dazu auch weiter unten Ab-
schnitt (e).)
(c) Grice (1981) hat die Theorie der Impli-
katur auch auf die umgangssprachlichen
Kennzeichnungsoperatoren (der/die/das so-
und-so) angewandt. Die Storichtung ist da-
bei, fr diese Flle die Einfhrung einer be-
sonderen logischen Beziehung der Prsuppo-
sition in die Semantik zu vermeiden. Strawson
(1950a) hatte gegen Russells (1905) Kenn-
zeichnungstheorie eingewandt, sie fhre zu
unplausiblen Resultaten, die sich am besten
14. Implikatur 329
Unter diesen Vorbehalten, was die Klarheit
der involvierten Begriffe angeht, lassen sich
nun die folgenden Tendenzen unterscheiden:
Erstens gibt es die Tendenz, die Unterschei-
dung zwischen Semantik und Pragmatik
berhaupt als hinfllig oder verfehlt zu be-
trachten. Grob gesagt behaupten (a) Gene-
rative Semantiker, die Pragmatik werde sich
in recht verstandene Semantik auflsen
(so findet sich z. B. bei Gordon & Lakoff
(1975) ein Versuch, konversationale Implika-
turen zu semantisieren), und (b) Anhnger
der sog. Gebrauchstheorie der Bedeutung be-
haupten gerade das Umgekehrte. Diese bei-
den Extrempositionen spielen in der Diskus-
sion keine wesentliche Rolle; gegen (a) sind
schwerwiegende Einwnde siehe dazu ins-
besondere Morgan (1977) und Gazdar (1979)
vorgebracht worden, die nicht entkrftet
worden sind; Position (b) ist bislang nicht zu
einem fr Linguisten diskussionswrdigen
Stand der Ausarbeitung gediehen.
Zweitens gibt es die Tendenz, der Semantik
eine in erweitertem Sinne wahrheitskonditio-
nale Komponente zuzurechnen, die den sog.
semantischen Prsuppositionen Rechnung
tragen sollen. Normalerweise ergeben sich
daraus Anstze, die zum einen fr logische
oder quasi-logische Wrter (nicht / mglich)
lexikalische Mehrdeutigkeiten postulieren
und zum andern fr natrliche Sprachen
nicht-klassische Logiken zugrunde legen.
(Nheres dazu in Artikel 13).
Drittens gibt es die Tendenz, die Unter-
scheidung zwischen Semantik und Pragmatik
zu przisieren als die zwischen den klassisch
wahrheitskonditionalen Bestandteilen der
Satzbedeutung (Semantik) und dem Rest
(Pragmatik). Diese Auffassung wird bei-
spielsweise von Kempson (1975) und Gazdar
(1978, 1979) vertreten, mit dem Unterschied
allerdings, da Kempson offenbar der An-
sicht ist, alle unter dem Etikett Prsupposi-
tion angesammelten Phnomene lieen sich
im Rahmen einer pragmatischen Theorie der
Implikatur erfassen, whrend gem Gazdars
Konzeption in der Pragmatik zwischen Pr-
suppositionen und Implikaturen unterschie-
den wird.
Viertens gibt es die Tendenz, der Semantik
die klassisch wahrheitskonditionalen Be-
standteile der uerungsbedeutung zuzuord-
nen und noch Platz in ihr fr etwas nicht
Wahrheitskonditionales zu lassen der Rest
ist Pragmatik. So mchte Wilson (1975) den
Begriff der Prsupposition aus der Semantik
heraushalten, aber mehr als blo Wahrheits-
beinhaltet; in dem andern Sinn nicht. Die von
den genannten Autoren vorgeschlagene Ge-
genlsung besteht darin, da mglich einen
einzigen Sinn hat, so da zwischen (6) und
(8) kein Bedeutungszusammenhang besteht,
sondern nur einer der konversationalen Im-
plikatur. Zu einer Kritik dieses Lsungsvor-
schlages siehe Burton-Roberts (1984).
3.2Indirekte Sprechakte
John Searle (1975a) erklrt im Rahmen seiner
Sprechakttheorie das Zustandekommen in-
direkter Sprechakte u. a. auch mit Hilfe der
Annahme, da bei sprachlicher Verstndi-
gung Konversationsmaximen beachtet wer-
den. Mit einer uerung wie Kommst du an
das Salz ran? stellt man normalerweise nicht
nur eine Frage nach einer Fhigkeit des
Adressaten, sondern bittet ihn auch darum,
das Salz herberzureichen. Diese Bitte ist
dann ein indirekter Sprechakt, der mit der
uerung vollzogen wird; er ergibt sich nach
Searle nicht aus der Bedeutung der benutzten
Wrter allein (wie dies bei der Frage nach der
Fhigkeit der Fall ist), sondern auch aus an-
dern Merkmalen der uerungssituation,
u. a. aus der Geltung gewisser Konversations-
maximen.
3.3Prsupposition und die Grenze
zwischen Semantik und Pragmatik
Vielerseits wurde in der Theorie der Impli-
katur ein Ansatz erblickt, mit dem man den
schillernden Begriff der Prsupposition schr-
fer konturieren oder sogar als berflssig er-
weisen knnte. Eine der in diesem Zusam-
menhang am heftigsten diskutierten Fragen
betrifft die Zuordnung von Prsuppositionen
in die Bereiche Semantik und Pragmatik. Die
begrifflichen Unklarheiten, die bei diesen Fra-
gen im Spiel sind, lassen sich kaum bertrei-
ben: Erstens wird die Unterscheidung zwi-
schen Semantik und Pragmatik von verschie-
denen Autoren mit sehr unterschiedlichen
Schlsselbegriffen charakterisiert; zweitens
bilden die unter dem Etikett Prsupposition
erfaten Phnomene einen schwer berschau-
baren und auf den ersten Blick recht dispa-
raten Haufen; und drittens bringt Grices
Theorie der Implikatur eine von den Begriffen
Semantik, Pragmatik und Prsupposi-
tion unabhngige Terminologie ins Spiel, die
von sich aus wenig Aussichten darauf birgt,
sog. Prsuppositionen nun mit erfreulicher
Eindeutigkeit auf die Semantik und die
Pragmatik zu verteilen.
330 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
normalen Umstnden) unweigerlich pragma-
tisch prsupponiert, wenn der Satz geuert
wird; aber nicht jede pragmatische Prsup-
position ist eine semantische. Der pragmati-
sche Begriff der Prsupposition ist also jeden-
falls weit genug, um alle sprachlichen Ph-
nomene zu erfassen, fr die Linguisten eine
semantische Prsuppositionsbeziehung postu-
lieren. Allerdings ist der pragmatische Pr-
suppositionsbegriff unabhngig motiviert und
knnte im Verbund mit allgemeinen Konver-
sationsmaximen zu einer Erklrung dieser
Phnomene ausreichen; dann wre ein se-
mantischer Prsuppositionsbegriff berfls-
sig.
Der in der Linguistik gelufige Terminus
Prsupposition deckt ein mehr oder weni-
ger homogenes Korpus von Beispielen ab.
Stalnaker empfiehlt, zunchst einmal zu ver-
suchen, die im Korpus erfaten Erscheinun-
gen mit einem ohnehin bentigten Begriff im
Rahmen einer pragmatischen Theorie in den
Griff zu bekommen. Es wre voreilig, an das
Korpus mit dem Postulat einer semantischen
Beziehung heranzugehen, die einschneidende
Komplikationen in der Semantik nach sich
zge und von vornherein ber einen Kamm
scherte, was sich bei nherer Betrachtung als
verschiedenartig erweisen mag. Ob sich
schlielich alle sog. Prsuppositionsphno-
mene auf pragmatischem Wege befriedigend
behandeln lassen, hlt Stalnaker (vgl. z. B.
1974: 212) fr eine offene Frage, die knftige
linguistische Forschung zu beantworten hat.
(Deshalb rechne ich Stalnaker der vierten
Tendenz zu, obwohl seine Arbeiten vom Geist
der dritten Zeugnis geben.)
Es sei noch einmal hervorgehoben, da
weder die Gleichsetzung von Semantik mit
einer Theorie der rein wahrheitskonditionalen
Bedeutungsaspekte, noch die vollstndige
Zuordnung von Implikaturen zur Pragmatik
sich auf die Arbeiten von Grice berufen kann.
Gazdar (1978: 10) gibt ein Beispiel fr dieses
wohl verbreitete Miverstndnis ab. Die Di-
chotomien Semantik/Pragmatik und Gesag-
tes/Implikat bilden eine Kreuzklassifikation.
In Grices Sprachphilosophie ist eher eine
duale Semantik-Konzeption angelegt: sowohl
das Gesagte (etwas Wahrheitskonditionales),
als auch das konventionale Implikat (etwas
nicht Wahrheitskonditionales) fallen in den
Aufgabenbereich der Semantik. Entsprechend
fallen nicht alle Implikaturen der Pragmatik
zu (sondern zumindest die konventionalen
darunter der Semantik). Natrlich mchte
auch Grice keine semantischen Prsuppositio-
konditionales in ihr enthalten sehen; was dies
genau ist, lt sie allerdings offen nichts
weist darauf hin, da sie gerade konventio-
nale Implikaturen fr das fehlende Stck Se-
mantik hlt. Genau dies hingegen tun Kart-
tunen & Peters (1979), und sie fhren aus,
wie sich das im Rahmen der Montague-Se-
mantik darstellen lt.
Zu dieser vierten Tendenz sind auch die
einschlgigen Arbeiten von Stalnaker (1970,
1973, 1974, 1978) zu rechnen, der in lockerer
Anlehnung an Grices oben dargestellte Auf-
fassungen eine interessante Skizze einer prag-
matischen Theorie entworfen hat. Stalnaker
greift Grices (1967, 1981) Begriff der gemein-
samen Grundlage (common ground) auf, um
damit u. a. einen umfassenden Begriff der
pragmatischen Prsupposition zu umreien.
Eine Proposition gehrt in diesem Sinne dann
zur gemeinsamen Grundlage eines Gespr-
ches, wenn jeder am Gesprch Beteiligte sie
glaubt (oder gesprchsweise unterstellt), sie
fr von allen andern Beteiligten geglaubt
(bzw. unterstellt) hlt, usw; und grob ge-
sagt prsupponiert ein Sprecher eine Pro-
position im Gesprch, wenn er die Disposi-
tion hat, sich im Gesprch so zu verhalten,
als gehre die Proposition zur gemeinsamen
Grundlage. (Der sprechakttheoretisch gehal-
tene Versuch einer genaueren Bestimmung
dieses Begriffs der pragmatischen Prsuppo-
sition findet sich bei Caton (1981); eine de-
taillierte linguistische Przisierung und An-
wendung von Stalnakers Ansatz findet sich
bei Heim (1982).) Stalnaker fhrt berzeu-
gend aus, da ein solcher Begriff der prag-
matischen Prsupposition in einer Theorie ra-
tionaler Verstndigung eine zentrale Rolle
spielt; mit seiner Hilfe lasse sich der wesent-
liche kommunikative Witz von Sprechakten,
wie z. B. dem des Behauptens, in einer fr
eine Mgliche-Welten-Semantik anknpfba-
ren Form beschreiben. Der springende Punkt
einer Behauptung besteht nach Stalnaker bei-
spielsweise darin, da mit ihr angestrebt wird,
den behaupteten Inhalt zu den pragmatischen
Prsuppositionen des Gesprchs hinzuzuneh-
men was auch geschieht, solange die Be-
hauptung unwidersprochen bleibt.
In einem derartigen gewissermaen un-
abhngig motivierten Begriff der prag-
matischen Prsupposition sieht Stalnaker zu-
mindest den Ausgangspunkt, von dem aus
eine linguistische Theorie sich mit dem Ph-
nomen der sog. Prsupposition beschftigen
solle. Jede semantische Prsupposition eines
Satzes, falls es so etwas gibt, wrde (unter
14. Implikatur 331
tatschlich zu den Konversationsmaximen zu
rechnen ist oder nicht (Vermeide Ausdrucks-
formen, die den Adressaten unntigerweise
daran hindern knnten, sich um den sachli-
chen Gehalt deines Beitrages zu kmmern).
Diese offensichtlichen Kritikpunkte weisen
darauf hin, da es fr eine Theorie der Im-
plikatur noch vieles zu tun gibt, und nichts
an ihnen spricht gegen die Mglichkeit, diese
bei Grice nur in Umrissen entworfene Theorie
durch Przisierung und Formalisierung lin-
guistisch fruchtbar zu machen. Dies ist z. B.
in Arbeiten von Stalnaker, Karttunen & Pe-
ters (1979), Gazdar (1979) und Heim (1982)
teilweise geschehen.
4.2Die Konventional/Konversational-
Unterscheidung
Eine weitere Schwche der Theorie der Im-
plikatur liegt in der unscharfen Trennung zwi-
schen konventionalen und konversationalen
Implikaturen. Dieser Mangel ist hufig kon-
statiert worden, doch nicht immer scheint be-
merkt worden zu sein, wie grundstzlich er
ist und wie gravierend er sich gerade fr die
Belange des Linguisten auswirkt. Der Her-
leitbarkeitstest auf den Grice (1981: 188)
letztlich noch den grten Wert zu legen
scheint ist bestenfalls eine notwendige Be-
dingung fr konversationale Implikaturen;
zudem ist er wie Sadock (1978) darlegt
angesichts der Erklrungsstrke der Konver-
sationsmaximen trivial: Es lt sich mit ihnen
einfach zu viel herleiten. Der Test mit der
Abtrennbarkeit setzt voraus, da sich vorab
beurteilen lt, ob mit verschiedenen Stzen
dasselbe gesagt wird, und er gibt vgl. Grice
(1978: 115) weder eine hinreichende, noch
eine notwendige Bedingung fr konversatio-
nale Implikaturen ab. Es ist um ihn allerdings
nicht ganz so schlimm bestellt, wie Sadock
(1978: 289) meint, der an dieser Stelle ber-
sieht, da es in dem Test um Gleichheit des
Gesagten und und nicht um Synonymie geht.
Der Test mit der Stornierbarkeit versagt sp-
testens bei den Zweifelsfllen, fr die Lingu-
isten sich gerade eine Entscheidung erhoffen.
Dasselbe gilt fr den von Sadock (1978: 294)
vorgeschlagenen Test mit der Verstrkbar-
keit (reinforceability): die Idee dabei ist, da
sich ein konversationales Implikat explizit in
die uerung hinzunehmen lt, ohne da
die entstehende uerung in angreifbarer
Weise redundant wre whrend dies bei
konventionalen Implikaten gerade nicht geht.
Die Unterscheidung zwischen konventio-
nalen und konversationalen Implikaturen ist
nen zulassen: das ist geradezu die linguistische
Pointe seiner Theorie der Implikatur. Am
deutlichsten stemmt er sich gegen derlei Pr-
suppositionen bei seiner implikaturalen Be-
handlung des Prsuppositionslochs bedauern
(vgl. Grice 1981: 195 ff.). Dennoch sind in der
Theorie der Implikatur semantische Prsup-
positionen nicht von vornherein in Abrede
gestellt. Jedem Aspiranten auf den Titel se-
mantische Prsupposition einen Ort auer-
halb der Wahrheitskonditionalitt zuzuwei-
sen: das ist der Leitgedanke von Grices Theo-
rie. Ob dieser Ort der Semantik oder der
Pragmatik zuzurechnen ist, ist seine besten-
falls zweite Sorge.
4. Kritik an der Theorie der
Implikatur
Im Folgenden werden nur Kritikpunkte er-
whnt, die es mit der Theorie der Implika-
turen im besonderen zu tun haben. Mannig-
fache allgemeinere Einwnde gegen Grices be-
deutungstheoretische Konzeption bleiben un-
bercksichtigt.
4.1Die Konversationsmaximen
Da die von Grice aufgefhrten Maximen
sehr vage sind, ist offensichtlich: informa-
tiv, Gesprchszweck, ntig, angemes-
sener Grund, relevant usw. all diese
Ausdrcke sind vage. Das ist theoretisch be-
dauerlich, aber von sich aus kein Einwand
gegen eine Theorie im Stadium ihres Ent-
wurfs. Vielfache Przisierungs- und Forma-
lisierungsvorschlge einzelner Maximen ent-
krften, was erst ein Einwand wre: da diese
Vagheit unbeseitigbar in der Natur der Theo-
rie liege.
Mit der Vagheit hngt zusammen, da die
Maximen nicht (zumindest nicht deutlich) un-
abhngig voneinander sind. Wie kann man
informativ sein, ohne die Wahrheit zu sagen
und sich klar auszudrcken? Hngt die beste
Reihenfolge eines Berichtes nicht davon ab,
was relevant ist? Ergeben sich nicht auch die
Maximen der Quantitt aus der Maxime, re-
levant zu sein? Zudem ist die Liste der
Maximen sicherlich unvollstndig; Grice
(1981: 189) erwhnt en passant einen weiteren
Kandidaten fr die Kategorie der Modalitt:
Whle fr das, was du sagst, die Form, die
die Formulierung passender Erwiderungen
maximal erleichtert. Wichtiger ist vielleicht,
da ein klares Kriterium fehlt, mit dem sich
entscheiden lt, ob eine gegebene Maxime
332 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
c. Edie war schn, mithin reich, aber
dennoch war sie unglcklich
d. Edie war unglcklich, mithin reich,
aber dennoch war sie schn
Grice hat sich auf diese intuitiv wenig befrie-
digenden Konsequenzen nicht explizit fest-
gelegt, doch werden sie durch seine Ausfh-
rungen (in Grice 1975) zumindest nahegelegt.
Die Kategorie der konventionalen Impli-
katur steht also auch da, wo es um ihre Ab-
grenzung gegen das Gesagte geht, auf keinen
sichereren Fen als denen unserer sprachli-
chen Intuitionen. Und diese scheinen nicht
einmal bei den von Grice angegebenen Bei-
spielen eindeutig auf die vorgenommene Ka-
tegorisierung zu deuten.
Die Theorie der konversationalen Implika-
tur ist sicherlich ein verheiungsvoller, wenn
nicht sogar unverzichtbarer Ausgangspunkt
fr jede Bemhung, systematische Verbindun-
gen zwischen einer wahrheitskonditional aus-
gerichteten Semantik und einer sprechakt-
theoretisch ausgerichteten Verstndigungs-
theorie herzustellen. Das theoretische Deside-
rat fr die linguistische Anwendung ist hier
die Przisierung. Die Lehre von den konven-
tionalen Implikaturen hingegen bedarf zuvr-
derst der Erhellung. Selbst im Griceschen Sy-
stem ist sie unklar. Und hufig versagt die
Lehre gerade da, wo man linguistisch etwas
mit ihr anfangen mchte: an den heiklen
Grenzen zwischen Semantik und Pragmatik,
zwischen wahrheitskonditionalen und andern
Bestandteilen wrtlicher Bedeutung, oder
zwischen Prsupposition und Inhalt des voll-
zogenen Sprechaktes. Klarer als diese Unter-
scheidungen ist auch die zwischen konventio-
nalen und konversationalen Implikaturen
nicht. Keine dieser Unterscheidungen sollte
vorab als theoretisch bessergestellt (oder gar
sakrosankt) betrachtet werden; erst vom
Standpunkt einer umfassenden Theorie wird
sich wohl beurteilen lassen, wieviel jede ein-
zelne von ihnen tatschlich taugt.
5. Literaturempfehlungen
Der in Abschnitt 1.1 dargestellte Meinensbe-
griff wird von Grice (1957) entwickelt. Bei
Grice (1968, 1969, 1982, 1989) und Schiffer
(1972, 1982) finden sich eine Reihe von Mo-
difikationen und Verfeinerungen; in diesen
Arbeiten wird auch ausfhrlich errtert, in
welcher Weise dieser Begriff eine zentrale
Rolle bei der Explikation des Begriffs der
sprachlichen Bedeutung spielen soll. Einen
guten und auch bibliographisch sorgfltigen
berhaupt noch nicht klar getroffen. Mithin
ist eine Berufung auf die Theorie der Impli-
katur in ihrem derzeitigen Zustand zumal
in den subtilen Zweifelsfllen an einer fr sich
selbst unklaren Semantik/Pragmatik-Trenn-
linie nicht besser als die auf vortheoretische
Intuition.
4.3Gesagtes versus konventional
Implikiertes
Schlielich ist auch die Unterscheidung zwi-
schen konventionaler Implikatur und Gesag-
tem nicht unanfechtbar. Laut Grice wird mit
Stzen des Typs p, aber q und p, mithin q
dasselbe gesagt, aber verschiedenes konven-
tional implikiert: ein Gegensatz bzw. ein Fol-
gerungszusammenhang zwischen p und q. Es
ist sicherlich unbestreitbar, da bei der ue-
rung solcher Stze von keinem bestimmten
Gegensatz (bzw. von keinem bestimmten Fol-
gerungszusammenhang) gesagt wird, er be-
stehe zwischen p und q. Dennoch lt sich
die Auffassung vertreten, da mit solchen
uerungen gesagt wird, zwischen p und q
bestehe ein Gegensatz (bzw. Folgerungszu-
sammenhang). Nach dieser konkurrierenden
Auffassung wrde mit einem Satz des Typs
(*) p, aber q also gesagt, (i) da p, (ii) da q,
und (iii) da zwischen p und q ein Gegensatz
besteht wobei allerdings offen bleibt, wel-
cher Gegensatz genau gemeint ist. Zumindest
die Intuition scheint nicht vllig abwegig, da
jemand, der einen Satz vom Typ (*) uert,
strenggenommen etwas Falsches sagt, wenn
(iii) falsch ist. Zu zeigen, da (iii) falsch ist,
mag allerdings in den meisten Fllen eine
schier unlsbare Aufgabe sein. So liee sich
denn auch erklren, weshalb eine unqualifi-
zierte Zurckweisung von (*) etwa mit
Nein oder Das stimmt nicht vernnftiger-
weise erst einmal als ein Angriff auf (i) oder
(ii) aufzufassen ist.
Auch leuchtet es nicht unbedingt ein, da
mit (9a) und (9b) dasselbe gesagt wird:
(9)
a. Er ist Englnder, er ist mithin tapfer
b. Er ist tapfer, mithin ist er Englnder
Zumal bei komplexeren Stzen wie (10ad) ist
es wohl nicht sehr plausibel anzunehmen, es
werde mit ihnen allen genau dasselbe gesagt,
und zwar etwas, das allein dann schon
stimmt, wenn Edie schn, reich und unglck-
lich war.
(10)
a. Edie war schn und reich, und mithin
unglcklich
b. Edie war schn, mithin reich und un-
glcklich
15. Fragestze 333
6. Literatur (in Kurzform)
Austin 1962/1975 Bertolet 1983 Burton-Roberts
1984 Caton 1981 Cohen 1971 Cohen 1977
Frege 1892 Frege 1918 Gazdar 1978 Gazdar
1979 Gordon/Lakoff 1975 Grandy/Warner
(eds.) 1986 Grice 1957 Grice 1961 Grice 1967
Grice 1968 Grice 1969 Grice 1975 Grice 1978
Grice 1981 Grice 1982 Grice 1989 Harnish
1977 Heim 1982 Horn 1972 Horn 1973 Kart-
tunen/Peters 1979 Kasher 1974 Kasher 1975
Kempson 1975 Lewis 1969 Meggle (ed.) 1979
Morgan 1977 Posner 1979 Recanati 1989
Rogers/Wall/Murphy (eds.) 1977 Russell 1905
Sadock 1978 Schiffer 1972 Schiffer 1982
Searle 1975a Smith (ed.) 1982 Sperber/Wilson
1982 Sperber/Wilson 1986 Stalnaker 1970 Stal-
naker 1973 Stalnaker 1974 Stalnaker 1978
Strawson 1950a Strawson 1986 Walker 1975
Wilson 1975
Andreas Kemmerling, Mnchen
(Bundesrepublik Deutschland)
berblick ber die Diskussion zur Bedeu-
tungstheorie von Grice liefert die Anthologie
von Meggle (1979). Der in Abschnitt 2.3 er-
whnte Begriff der gemeinsamen Grundlage
ist von Lewis (1969) und Schiffer (1972) ge-
nauer untersucht worden; neuere Diskussio-
nen, insbesondere auch zu seiner linguisti-
schen Fruchtbarkeit, finden sich in der An-
thologie von Smith (1982) und in der Grice-
Festschrift von Grandy & Warner (1986). Er-
weiterungen, Vereinfachungen, neue Syste-
matisierungen, Przisierungen oder Formali-
sierungen der Griceschen Konversationsma-
ximen finden sich in beinahe jeder Arbeit zum
Thema. Es sind zu viele, um sie alle zu nen-
nen, und keine darunter sticht gengend her-
vor, um sie besonders herauszuheben. Eine
Extremposition sei ausgenommen: Sperber &
Wilson (1982, 1986) lehnen nicht nur den
Begriff der gemeinsamen Grundlage als prag-
matisch irrelevant ab, sondern lassen auch
den Rest von Grices Ansatz zu einer Verstn-
digungstheorie auf ein einziges Prinzip grt-
mglicher Relevanz zusammenschrumpfen.
15. Fragestze
Verhalten der Interrogative hinsichtlich Kants
logischer Tafel der Urteile (Prolegomena):
zwar lassen sich auch Interrogative der Re-
lation nach in kategorische, hypothetische
und disjunktive einteilen, die Aspekte der
Quantitt, der Qualitt und der Modalitt
aber lassen sich nur auf die Beziehung von
Frage und Antwort anwenden. Es stellt sich
also die Frage nach einer Behandlung der
Interrogative mit Hilfe des fr wahrheits-
wertfhige Deklarative entwickelten seman-
tischen Apparats.
Nun zeigt schon die Bezeichnung der bei-
den grammatischen Modi, da eine promi-
nente Art ihrer Verwendung darin besteht,
da einerseits Behauptungen/Aussagen ge-
macht und andererseits Fragen gestellt wer-
den. Die Parallele zwischen diesen illokutio-
nren Modi und der entsprechenden gram-
matischen Form ist kein Zufall. Die zweite
Frage ist also die nach dem spezifischen In-
halt deklarativer bzw. interrogativer Stze,
der sie fr bestimmte illokutionre Verwen-
dungen geeignet erscheinen lt.
Die sprachlichen Handlungen, die mit der
uerung (1) von Mary in einer gegebenen
1. Fragemodus und Frageinhalt
2. Reduktionstheorien der direkten Frage
3. Frage-Antwort-Paare
4. Fragen als Mengen von Deklarativen
5. Deklarative und Interrogative in einer logi-
schen Kategorie
6. Literatur (in Kurzform)
1. Fragemodus und Frageinhalt
Nach formalen Kriterien (wie z. B. Wortstel-
lung, Intonation, Prsenz eines Fragewortes)
unterscheidet man die grammatischen Modi
des deklarativen bzw. interrogativen Satzes
(Aussagesatz vs. Fragesatz), wobei unter den
Interrogativen seit Aristoteles (De Int. 20b
2731) die dialektischen (Entscheidungsfra-
gen, Ja/Nein-Fragen) von den nicht-dialekti-
schen Bestimmungs- bzw. Ergnzungsfragen
getrennt werden. Aber abgesehen von ver-
streuten Bemerkungen konzentrierten sich
Logik und Semantik nahezu ausschlielich
auf die Aussagestze, so da erst Prior &
Prior (1955) den Ansto zu einer mehr syste-
matischen Beschftigung mit den Interroga-
tiven gaben. Sie diskutierten das ambivalente
334 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
berlegt, wer als Tter in Frage kommt, wei
sein Assistent es schon, und seinem Chef ist
es ganz egal. Wichtig ist dabei, da die mg-
lichen Einstellungen zu den Inhalten von De-
klarativen teilweise disjunkt sind von den bei
Interrogativen mglichen. Zwar lt wissen
beides zu, aber bei glauben ist nur der Dekla-
rativ mglich, whrend berlegen nur Inter-
rogative zult:
(3)
a. Ich wei, da/ob Peter kommt,
b. Ich glaube, da/*ob Peter kommt,
c. Ich berlege, *da/ob Peter kommt.
Damit lassen sich nun folgende Konsequen-
zen fr die Ausgangsfragen plausibel machen
(wenngleich nicht in einem strengen Sinn ab-
leiten):
(a) Der Unterschied zwischen Deklarativ
und Interrogativ liegt nicht darin, da ein
bestimmter mentaler oder verbaler Akt, ein
bestimmter illokutionrer Aspekt, signalisiert
wird. Jedoch umfat umgekehrt jede Theorie
solcher Akte (z. B. die Untersuchung der
Frage als Fragehandlung) eine Beschreibung
des Inhalts oder Objekts dieses Aktes als Teil-
komponente.
(b) Theorien der Frage mssen demgem
unterschieden werden von Theorien des Fra-
geinhalts, mssen aber auch mit solchen kom-
patibel sein. Der eigentliche Gegenstand der
Semantik als theory of meaning (im Gegensatz
zu einer theory of use) ist aber der Inhalt,
denn, so Cohen (1929:352),
...our desire to receive an answer when we ask a
question is, like our desire to be relieved when we
assert a proposition, neither universally present nor
in any way constitutive of the meaning or content
of what we ask or assert.
Demgem wird im folgenden nicht auf ver-
schiedene Verwendungsweisen (Informations-
frage, Examensfrage u. a. m.) eingegangen,
und Theorien der Frage wie z. B. qvist
(1965) werden nur hinsichtlich ihrer Behand-
lung des Frageinhalts diskutiert.
(c) Es gibt offensichtlich Affinitten von
bestimmten (Gruppen von) Verben oder Ein-
stellungen zu Deklarativ-Inhalten einerseits
bzw. zu Interrogativ-Inhalten andererseits.
Der grammatische Modus steht also fr einen
semantisch-propositionalen Unterschied, und
hchstens sekundr dadurch auch fr einen
illokutionren, indem der semantische Inhalt
eines Deklarativs oder Interrogativs nicht mit
allen illokutionren Rollen vertrglich ist.
(d) Eine Theorie des Frageinhalts sollte die
quivalenz direkter und indirekter Fragen
nachvollziehen knnen.
Situation vollzogen werden, lassen sich durch
einen deklarativen Satz wie (2) beschreiben:
(1) Beryl wird kommen. Wird George auch
kommen?
(2) Mary behauptet, da Beryl kommen
wird, und fragt, ob George auch kommen
wird.
In dieser von Egli (1976) Vollbeschreibung ge-
nannten Analyse sind die in (1) vollzogenen
Sprechhandlungen zerlegt in einen illokutio-
nren Teil, der sich in den Verben der Haupt-
stze manifestiert, und einen propositionalen
Teil, der durch die dazugehrigen Nebenstze
reprsentiert wird. Fr die Frage entspricht
dem die Unterscheidung von ultimate concern
und ultimate topic of concern in Leonard
(1959) und die Trennung von request und
subject in Belnap & Steel (1976).
An einer Handlungsbeschreibung wie (2)
fllt zweierlei auf: erstens wird bei der Um-
wandlung von (1) in (2) der grammatische
Modus keineswegs neutralisiert, obwohl der
illokutionre Modus abgetrennt wird (es wird
lediglich die direkte Frage/Aussage in eine
indirekte umgewandelt); und zweitens sind die
indirekten Fragen/Aussagen mit einer ganzen
Reihe verschiedenartiger Matrixverben kom-
binierbar. Die Abtrennung des illokutionren
Aspekts lst also nicht die Frage nach dem
semantischen Gehalt von Interrogativen,
macht aber den Zusammenhang von direkter
und indirekter Frage deutlich und damit das
Problem der interrogativen Einstellungen
(s. Artikel 12).
Auf das Problem der Einstellungen sttzt
sich nun die Postulierung einer unterhalb der
Ebene der Vollbeschreibung angesiedelten
Analyseebene der kognitiv-semantischen
(Egli 1976) Beschreibung des propositionalen
Gehalts. Der in (2) beschriebene Behaup-
tungsakt hat ja einen spezifischen Inhalt, ist
auf ein spezifisches Objekt bezogen. Die ver-
schiedensten sprachlichen oder mentalen
Akte knnen aber denselben Inhalt, dasselbe
Objekt haben: das, was Peter behauptet, wird
von Franz gewnscht und von Fritz befrch-
tet. Hinsichtlich dieses Objekts, der ausge-
drckten Proposition, sind direkte und indi-
rekte Deklarative quivalent.
Es liegt also nahe, das Problem der dekla-
rativen d. h. propositionalen Einstellun-
gen auf Interrogative zu bertragen und auch
direkte und indirekte Interrogative als hin-
sichtlich ihres Inhalts quivalent anzusehen
(fr eine explizite Argumentation siehe Bel-
nap 1983): whrend der Kommissar noch
15. Fragestze 335
Hier entstehen zwei erkennbar verschiedene
Ebenen. Beim Deklarativ sagt man, er sei
wahr oder falsch, je nachdem, ob der ausge-
sagte Sachverhalt existiert oder nicht. Und
das heit, da der Wahrheitswert direkter De-
klarative auf den Inhalt bezogen ist und nicht
mit dem Wahrheitswert der performativen Pa-
raphrase
(6)
d. Ich behaupte (hiermit), da Sie Brahms
lieben.
bereinstimmen mu. Bei der Reduktion der
direkten Frage auf eine explizit performative
Struktur bleibt also der Frageinhalt zunchst
ungeklrt.
Da Lewis (1970) es aber im Unterschied
zur Satzradikalmethode vermeidet, das Ra-
dikal und damit den Frageinhalt als Trger
des Wahrheitswertes anzusehen, ist er aller-
dings nicht mehr gezwungen, Deklarativ-In-
halte mit Interrogativ-Inhalten zu identifizie-
ren. Dies erlaubt es ihm, mit der Paraphrasen-
Methode auch Ergnzungsfragen zu behan-
deln. Versucht man nmlich allerdings ent-
gegen den Intentionen von Lewis aus sei-
nen Analysen eine Trennung von illokutio-
nrem und propositionalem Aspekt heraus-
zufiltern, so ist die Beschreibung der Ent-
scheidungsfrage zumindest oberflchlich der
Satzradikalmethode nicht unhnlich:
whrend Ergnzungsfragen der Art (7a) auf
die Struktur (7b) zurckgefhrt werden:
2. Reduktionstheorien der direkten
Frage
Angesichts der Unterscheidung von illokutio-
nrem und propositionalem Aspekt und von
Satzpaaren wie
(4)
a. Rosen sind rot.
b. Sind Rosen rot?
liegt es nahe, hinter Interrogativen und De-
klarativen denselben propositionalen Gehalt
zu vermuten und den Unterschied allein im
illokutionren Aspekt zu suchen. Eine solche
Auffassung findet sich z. B. in Leonard (1959)
und in der Satzradikalmethode von Stenius
(1967), wo Stze wie (5ac) ein gemeinsames
Inhalts-Radikal (5d) erhalten:
(5)
a. You are late:
b. Are you late?
c. Be late!
d.
Ganz hnlich ist auch die Q-Morphem-Ana-
lyse von Katz & Postal (1964). Intuitiv plau-
sibel erscheint der Ansatz jedoch nur bei der
Entscheidungsfrage, das Radikal einer Ergn-
zungsfrage kann keine Proposition sein. Und
selbst bei Entscheidungsfragen stellt sich das
Problem, wann der propositionale Inhalt, der
ja mit dem eines deklarativen Satzes identisch
ist, im Falle einer Einbettung als da-Satz
auftaucht und wann als ob-Satz.
Lehnt man andererseits eine Trennung von
illokutionrem und propositionalem Aspekt
ab, nimmt man also mit anderen Worten die
Vollbeschreibung als einzige Analyseebene an,
so kann man, mit Lewis (1970), eine direkte
Frage wie (6a) als quivalent zu der explizit
performativen Paraphrase (6b) ansehen. Diese
performative Paraphrase hat als deklarativer
Satz natrlich einen Wahrheitswert, wenn-
gleich (saying so makes it so) einen trivia-
len, der von der Wahrheit oder Falschheit des
Satzes (6c) vllig unabhngig ist.
(6)
a. Lieben Sie Brahms?
b. Ich frage Sie (hiermit), ob Sie Brahms
lieben.
c. Sie lieben Brahms.
336 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Die Fragen unterscheiden sich dann aber
nicht in der Art der vom Verb geforderten
Ergnzung, sondern der Unterschied ist eine
Frage der Semantik des einbettenden Verbs
geworden. Da das Lexikon endlich ist, scheint
eine solche Auffassung jedoch nicht haltbar
zu sein (Groenendijk und Stokhof, persnl.
Mitteilung) angesichts von im Prinzip endlos
erweiterbaren Fragesequenzen (und damit
einer entsprechenden Anzahl immer komple-
xer werdender Fragewrter) wie (8e):
(8)
e. In welchem Ort verbringt Franz seine
Ferien?
In welchem deutschen Ort verbringt
Franz seine Ferien?
In welchem deutschen Ort mit weniger
als 1 000 Einwohnern verbringt Franz
seine Ferien?
Darberhinaus ist aber auch klar, da die
Lewissche Analyse der direkten Frage nur
dann erfolgreich ist, wenn es neben der Voll-
beschreibung keine isolierbare Ebene des pro-
positionalen Gehaltes gibt. Eine solche wre
aber erforderlich, wenn man an der parallelen
Kategorie der indirekten Frage festhalten will,
was insofern plausibel zu sein scheint, als
dann der Satz (9a) getreu seiner syntaktischen
Form als eine interrogative Einstellung zu
einer Konjunktion zweier Fragen gedeutet
werden kann, whrend Lewis zwei Einstellun-
gen (egal-wann, egal-wohin) zu nur einer Pro-
position unterstellen mte, was eigentlich
nur auf die syntaktische Struktur (9b) zu pro-
jizieren ist, also auf die Konjunktion zweier
Deklarative.
(9)
a. Es ist mir egal, wann er geht und wohin
er geht.
b. Es ist mir egal, wann er geht, und es
ist mir egal, wohin er geht.
Noch schwieriger wird eine solche Para-
phrase, wenn man mir durch das quantifizie-
rende jemand ersetzt. Und whrend das kon-
junktive Beispiel (9a,b) immerhin noch mg-
lich erscheint, zeigt ein analoges disjunktives
Beispiel (9c,d) einen deutlichen Bedeu-
tungsunterschied:
(9)
c. Ich frage mich, wann er geht oder ob
er schlielich doch bleibt.
d. Ich frage mich, wann er geht, oder ich
frage mich, ob er bleibt.
Versucht man jedoch, einen propositionalen
Gehalt zu isolieren, so kann dieser nicht mit
dem identifiziert werden, was an deklarativer
Struktur brig bleibt, wenn man das Frage-
wort, soweit vorhanden, einfach ignoriert.
Unterstellt man nun, da die jeweilige Ergn-
zung des performativen Verbs den propositio-
nalen Gehalt reprsentiert, so vermit man
eine Kategorie indirekter Fragesatz mit ent-
sprechendem sematischen Typ. Im Fall der
Ob-Frage hat die Ergnzung die Kategorie S
(semantischer Typ:Proposition), im Fall der
Wer-Frage ist die Kategorie S/N (seman-
tisch:Eigenschaft). Insgesamt gibt es also
keine speziellen interrogativen Inhalte: die
Entscheidungsfrage entspricht im Typ dem
Deklarativsatz, die Ergnzungsfrage dem,
was an deklarativer Struktur brig bleibt,
wenn man das Fragewort einfach ignoriert.
Die Konsequenz daraus, da verschiedene
Fragestze verschiedene semantische Typen
reprsentieren, ist eine entsprechende Typen-
vermehrung beim einbettenden Verb:
FRAGEN-OB mit propositionaler Ergn-
zung,
FRAGEN-WER mit Eigenschaftsergnzung,
usw.
Zwar behandelt Lewis nur die ob- und die
wer-Frage (also die Frage nach einer obliga-
torischen Verbergnzung), und dafr reicht es
aus, die Unterscheidung von FRAGEN-OB
und FRAGEN-WER lediglich als Problem
der Valenz des Frageverbs zu behandeln. Aber
dennoch ist es fraglich, ob man Lewis (1970)
gerecht wird, wenn man diese Valenzen als
propositionalen Gehalt isoliert. Denn in der
Typeninflationierung beim einbettenden Verb
ist die wenngleich wenig intuitive Mg-
lichkeit angelegt, den eigentlich interessanten
Teil der Semantik des Interrogativsatzes als
ein Problem der lexikalischen Semantik des
performativen Verbs anzusehen. Lewis
knnte nmlich auch inhaltlich so verschie-
dene Stze wie (8a,b) dadurch analysieren,
da er eine gemeinsame Ergnzung (8c) zu
den Frageverben FRAGEN-WANN und
FRAGEN-WOHIN postuliert:
(8)
a. Wann bringt Arnim die Schlittschuhe?
b. Wohin bringt Arnim die Schlittschuhe?
c. Arnim bringt die Schlittschuhe.
d.
15. Fragestze 337
Ein weiterer Versuch, Fragen vermittels de-
klarativer Strukturen zu paraphrasieren,
grndet sich auf die Beobachtung, da Fra-
gen ebenso wie Deklarative Prsuppositionen,
nmlich Fragevoraussetzungen haben. Dieser
Ansatz wird zuerst von Harrah (1961, 1963)
verfolgt. Versteht man unter der logischen
Prsupposition eines Satzes S einen Satz, der
sowohl aus S als auch aus dessen Negation
logisch folgt, so ist zunchst nicht klar, wie
man analog die Prsupposition einer Frage
definieren soll. Deshalb ist ein solcher Ansatz
nicht ganz unabhngig vom Verhltnis der
Frage zu ihren Antworten.
Eine disjunktive Frage wie (11a) lt sich
beantworten mit (11b) oder (11c); daher
scheint der Fragesteller die Disjunktion (11d)
vorauszusetzen und um eine Verringerung der
Alternativen zu bitten. Die Erwiderung (11e)
ist dann eine Zurckweisung der Fragevor-
aussetzung, d. h. die Frage stellt sich nicht.
(11)
a. Kommt Urs oder Renate?
b. Urs kommt.
c. Renate kommt.
d. Urs kommt oder Renate kommt.
e. Weder Urs noch Renate kommt.
Ja/Nein-Fragen sind dann eine spezielle Va-
riante der disjunktiven Fragen, weil auf (12a)
die Antworten (12b) bzw. (12c) mglich sind,
was ebenfalls zu einer vorausgesetzten Dis-
junktion (12d) fhrt, die allerdings vllig tau-
tologisch ist.
(12)
a. Kommt Urs?
b. Er kommt.
c. Er kommt nicht.
d. Er kommt oder er kommt nicht.
Bei einer Ergnzungsfrage wie (13a) werden
die Antwortalternativen Urs kommt, Renate
kommt, ... usw. fr alle in Frage kommenden
Individuen nicht explizit aufgefhrt, so da
anstelle einer Disjunktion Urs kommt oder
Renate kommt oder Philipp ... das quivalente
(13b) als Fragevoraussetzung angenommen
wird.
(13)
a. Wer kommt?
b. x (x kommt)
Harrah hat nun die Idee, den propositionalen
Gehalt der direkten Frage mit der Fragevor-
aussetzung zu identifizieren. Dazu Harrah
(1963: 28):
Our basic idea is that particular types of question
can be identified with particular types of statement.
Whether questions can be identified with statements
which behave like exclusive disjunctions that is,
statements of the form F or else G; the disjuncts
Dies knnte der Grund sein, warum Lewis
bei einer Vollbeschreibung stehen bleibt, aber
explizit wird die Theorie von Interrogativsatz-
minus-Fragewort von Cresswell (1973) und Ti-
ch (1978) vertreten, die signifikanterweise
ebenfalls nur ob- und wer- Fragen diskutieren.
Cresswell (1973: 236 f.) nimmt nmlich fol-
gendes an:
1. ...in the case of yes/no questions at least, the
most straightforward analysis seems to be to regard
them ... as ordinary sentences.
2. In
(a) WHO RUNS
V (who runs) is not a proposition ... Rather V((a))
is the same as V(runs) ... I. e. what is being que-
stioned is a one-place property ...
Das Symbol WHO in WHO RUNS steht fr
Cresswell nur als syntaktische Markierung,
die anzeigt, da ein einstelliges Prdikat allein
eine komplette uerung bildet. Semantisch
gesehen hat WHO keine Wirkung, sondern
ist eine Identittsfunktion von Eigenschaften
in Eigenschaften.
Tich (1978) bemerkt zu den Stzen
(10a,b): the difference ... boils down to the
difference in meaning between the verbs as-
serts and asks. Und zu (10c) sagt er, da
dem Prfix Who is und dem Fragezeichen
keinerlei logische Signifikanz zukommt.
(10)
a. Tom asserts that Bill walks.
b. Tom asks whether Bill walks.
c. Who is the president of the U. S.?
Nur lt sich aus den schon bei Lewis be-
sprochenen Grnden der propositionale In-
halt nicht ganz so einfach isolieren, weil sonst
alle Fragen nach nicht-obligatorischen Ergn-
zungen (wann, wohin, warum) denselben In-
halt htten den einer vollstndigen asser-
torischen Struktur. Und da kann es wohl
nicht Aufgabe des Frageworts sein, eine sonst
nicht vorhandene syntaktische Komplettie-
rung herzustellen. Die triviale Deutung als
Identittsfunktion bzw. die vllige Ignorie-
rung helfen nicht weiter, da dann nicht gesagt
werden kann, was eigentlich erfragt ist. Tichs
Kommentar zu (10a/b) wird von Groenendijk
& Stokhof (1984: 393) durch (10d/e) wider-
legt:
(10)
d. Tom wei, da Bill schlft.
e. Tom wei, ob Bill schlft.
Nimmt man nmlich an, da wissen in beiden
Verwendungen dieselbe Bedeutung hat, dann
mten nach Tich (10d) und (10e) bedeu-
tungsgleich sein. Dies ist jedoch nicht der Fall,
denn wenn Bill nicht schlft und Tom dies
wei, so ist (10e) wahr, (10d) aber falsch.
338 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
eine performative deklarative Struktur redu-
ziert, sondern auf einen Imperativ. Und im
Gegensatz zu Harrah ist der propositionale
Gehalt wenn man einen solchen aus einer
Vollbeschreibung herausbrechen kann
nicht die Fragevoraussetzung, sondern das
Frageziel. Wenn ich frage, ob Hans kommt,
dann will ich wissen, ob Hans kommt (zu-
mindest wenn es sich um eine Informations-
frage handelt), so da ich meinen Zweck er-
reicht habe, wenn ich wei, ob Hans kommt.
Das Ziel der Frage Hintikka (1976) nennt
es Desideratum ist also (18a) im Fall der
Entscheidungsfrage und (18b) im Fall der Er-
gnzungsfrage.
(18)
a. Ich wei, ob Hans kommt.
b. Ich wei, wer kommt.
Jeder Imperativ hat ein Desideratum man
beschreibt die Situation, deren Herstellung
man wnscht/befiehlt/anordnet. Das Deside-
ratum ist eine Proposition. Der Imperativ
(19a), an Ede und Rainer gerichtet, beschreibt
die Situation (19b) und fordert dazu auf, diese
Situation herzustellen.
(19)
a. Schreibt einen Artikel ber Fragen!
b. Ede und Rainer schreiben einen Ar-
tikel ber Fragen.
Die Besonderheit von Frage-Imperativen ist
nun, da sie ein epistemisches Desiderat
haben: ich wei + eingebettete Frage. Im
Gegensatz zu Lewis (1970) kann man hier
also annehmen, da das Desideratum als pro-
positionaler Gehalt abtrennbar ist.
(20) BRING IT
ABOUT THAT
(I know who lives here)
BRING IT
ABOUT THAT
(I know whether John
lives here)
Imperativ Desideratum
In der Analyse (20) ist aber die Frage nicht
hinwegparaphrasiert worden, sondern erst
einmal etwas tiefer versteckt. Die Proposition,
die den propositionalen Gehalt des Impera-
tivs ausmacht, ist somit nicht der propositio-
nale Gehalt der Frage. Der Angelpunkt der
qvist-Hintikka-Analyse ist also nicht die
Imperativ-Reduktion, sondern die nicht-in-
terrogativische Paraphrasierung des Deside-
ratums.
Dies entspricht in etwa dem Vorgehen von
Harrah d. h. es werden dieselben Prsup-
positionen angenommen plus der Addition
des epistemischen Elements bei der Umfor-
mung der Prsupposition zum Ziel der Frage.
Fragewrter werden als Quantorenphrasen
expliziert, die weiten Skopus ber das episte-
F and G can be taken to be the answers. Which
ones questions can be identified with existential
generalizations that is, statements of the form
Some things are F; ...
Und zum illokutionren Aspekt bemerkt er:
... questions are regarded as tools for reducing
states of rational doubt. The questioner expresses
what he knows concerning the given subject matter
by saying This or that is the case or Some things
are so and so; and the respondent then, if he
chooses, matches this with a counterstatement
which provides more information and thereby les-
sens the questioners doubt.
Hinsichtlich des propositionalen Gehaltes
sind also die Frage (14a) und die Feststellung
(14b) identisch; ebenso die Frage (15a) und
die Feststellung (15b).
(14)
a. Kommt Hans oder Fritz?
b. Hans kommt oder Fritz kommt.
(15)
a. Wer kommt?
b. Es kommt jemand.
Whrend aber die deklarative Struktur nur
die Feststellung signalisiert, verbindet sich mit
dem Interrogativ darber hinaus noch die
Obligation fr den Adressaten, wenn mglich
die Alternativen zu reduzieren oder die Werte
der vom partikulren Quantor gebundenen
Variablen zu spezifizieren oder zumindest ein-
zuschrnken.
Dieser Ansatz transzendiert die Satzradi-
kalmethode, indem er nicht auf eine Analyse
der Entscheidungsfrage beschrnkt ist. Er teilt
aber mit der Satzradikalmethode die Proble-
matik der bertragung der Analyse auf die
indirekte Frage. Dort entfllt der Aspekt der
Adressaten-Obligation, so da zwischen (16a)
und (16b) ebensowenig ein Unterschied ge-
macht werden kann wie zwischen (17a) und
(17b).
(16)
a. Max wei, da entweder Dale oder
David kommt.
b. Max wei, ob Dale oder David
kommt.
(17)
a. Ismay wei, wer kommt.
b. Ismay wei, da jemand kommt.
Und es bleibt unerfindlich, warum der Inhalt
von jemand kommt = wer kommt bei man-
chen Verben als Deklarativform, bei anderen
nur als Interrogativform auftritt.
Ein letzter Versuch, Fragen mit deklarati-
ven Strukturen hinwegzuparaphrasieren,
stammt von qvist (1965) und Hintikka
(1976). hnlich wie bei Lewis (1970) handelt
es sich um den Versuch einer Vollbeschrei-
bung. Nur wird diesmal die Frage nicht auf
15. Fragestze 339
technique must be adopted for sentences like (a)
which feature two indirect questions with only one
verb.
Insgesamt sind also die verschiedenen Metho-
den der deklarativen Paraphrasierung von
Fragen bei den direkten Fragen relativ er-
folgreich, lassen sich aber allesamt nicht auf
das Problem der indirekten Frage anwenden.
3. Frage-Antwort-Paare
Direkte Fragen sind initiative Sprechakte,
d. h. sie leiten einen minimalen Dialog ein,
der durch eine Antwort komplettiert wird.
Und knowing what counts as an answer,
so bemerkt Hamblin (1958), is equivalent to
knowing the question. Die Konsequenzen,
die sich daraus fr eine Fragetheorie ergeben
knnen, hngen nunmehr vom Antwortbe-
griff ab, insbesondere auch vom Antwortfor-
mat. Hamblin nimmt an, da alle Antworten
Deklarative sind und daher schon fr sich
allein eine Proposition ausdrcken. Antwor-
ten, die nicht als vollstndige Stze formuliert
sind, mssen dann als Ellipsen erklrt werden.
Nimmt man dagegen die Satzteil-Antwort als
grundlegend an, so ergibt sich ganz natrlich
die Auffassung, da Frage + Antwort mit
einem Deklarativsatz quivalent sind, z. B.
Wer kommt? Urs. Urs kommt.
Mit dieser Auffassung knnten nun auch die
bereits besprochenen Theorien von Cresswell
(1973) und Tichy (1978) in Verbindung ge-
bracht werden. Denn selbst wenn man den
Fragewrtern keinerlei logische Signifikanz
zuspricht und daher wohl so verschiedenen
Fragen wie (24ac) allesamt den propositio-
nalen Gehalt von (24d) zuschreiben mu, so
sind doch die Paare (24ac) jeweils wieder
einer Proposition quivalent.
(24)
a. Wann bringt Arnim die Schlittschuhe?
b. Wohin bringt Arnim die Schlitt-
schuhe?
c. Warum bringt Arnim die Schlitt-
schuhe?
d. Arnim bringt die Schlittschuhe
(24)
a. Arnim bringt die Schlittschuhe.
Morgen
b. Arnim bringt die Schlittschuhe. Auf
die Reichenau
c. Arnim bringt die Schlittschuhe. Weil
er aufs Eis will.
Zur Bedingung der quivalenz mu also
noch das hinzukommen, was Hamblin ange-
sprochen hat: es mu aus der Frage ersichtlich
sein, was jeweils als Antwort zhlt. Alle obi-
mische Element haben, so da aus den
Harrahschen Prsuppositionen (21a) jeweils
das qvist-Hintikkasche Desideratum (21b)
wird.
(21)
a. Hans kommt oder Hans kommt nicht.
x (x kommt)
b. Ich wei, da Hans kommt, oder ich
wei, da Hans nicht kommt.
x (Ich wei, da x kommt)
Mit diesem Vorgehen wird aber nicht der pro-
positionale Gehalt der Frage isoliert, sondern
es handelt sich um die Reduktion einer inter-
rogativen Einstellung (wissen-wer und wissen-
ob) auf eine deklarative Einstellung (wissen-
da). Die Mglichkeit einer solchen Reduk-
tion ist aber nicht durch den Fragesatz be-
dingt, sondern durch die semantischen Eigen-
schaften des Einstellungsverbs. Das hat zur
Folge, da der Ansatz von qvist und Hin-
tikka nicht auf den allgemeinen Fall einer
interrogativen Einstellung anwendbar ist.
Zwar kann aus (22a) der Satz (22b) gefolgert
werden, oder sogar, in einer von Hintikka
ebenfalls behandelten Lesart, der Satz (22c):
(22)
a. Ich wei, wer kommt.
b. Es gibt jemanden, von dem ich wei,
da er kommt.
c. Von jedem, der kommt, wei ich, da
er kommt.
Aber bei Verben, die ausschlielich interro-
gative Einstellungen ausdrcken, ist eine sol-
che Reduktion gar nicht erst mglich, denn
(23a) ist sicher nicht durch (23b) paraphra-
sierbar, da ein da-Satz hier nicht akzeptabel
ist.
(23)
a. Ich berlege, welcher Berg der hchste
ist.
b. Es gibt einen Berg, von dem ich ber-
lege, da er der hchste ist.
Vielleicht knnte man dem mit einer ingeni-
sen lexikalischen Dekompositionsanalyse be-
gegnen, aber auch dann bleibt immer noch
das Argument von Karttunen (1979):
I cannot conceive of any lexical decomposition of
depend on which would enable us to account for
the meaning of (a) along the lines Hintikka sug-
gests.
(a) Whether Mary comes to the party depends on
who invites her.
The crucial point here is that Hintikka does not
assign any meaning to indirect questions as such.
Instead, they are interpreted contextually, that
is, as a part of a larger construction which in
addition contains a verb. Some radically different
340 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
nan & Hull (1973). Dort wird das Fragewort
als eine Art restringierter Quantor behandelt,
nach dem Vorbild von Carnap (1934,
1968:223) und Reichenbach (1947), die fr
(28a) eine Form wie (28b) annehmen.
(28)
a. Wann war Karl in Berlin?
b. (?t) (Karl war zu t in Berlin)
Der Vorteil eines solchen Ansatzes knnte
sein, da Fragestze eine einheitliche Kate-
gorie reprsentieren, whrend die Funktio-
nalabstraktion zu einer Vielfalt von Typen
fhrt. Der Vorteil der Funktionalabstraktion
liegt aber darin, diese Typen auch angeben zu
knnen, whrend eine direkte Semantik des
?-Operators bei Keenan & Hull nicht gegeben
wird, so da letztlich der propositionale Ge-
halt der Frage aus der deklarativquivalenten
Struktur Frage, Antwort gar nicht isolier-
bar ist. Womit die Frage der Anwendbarkeit
dieses Ansatzes auf eingebettete Fragen gar
nicht mehr gestellt zu werden braucht. Auch
scheint eine solche unlsbare Verquickung
nicht der Tatsache Rechnung zu tragen, da
Frage und Antwort letztlich verschiedene
Sprechakte mit angebbaren verschiedenen In-
halten sind.
Die Funktionalabstraktionsanalyse hat als
Paradefall natrlich die Ergnzungsfrage, die
schon in Jespersen (1940) x-question genannt
wird. Aber je nachdem, ob es sich um eine
Frage nach wer (NP-Frage: x
NP
(X
NP
kommt)), wann (ADV
t
-Frage: t
ADV
(t
ADV
(er
kommt))), welche (Quantorenfragen) usw.
handelt, entsteht jedesmal ein anderer seman-
tischer Typ fr etwas, was syntaktisch zu einer
Kategorie Fragesatz zusammengefat ist.
Dies ist problematisch, wenn man einerseits
an dem Prinzip festhalten will, da Ausdrcke
derselben syntaktischen Kategorie auch den-
selben semantischen Typ haben, und anderer-
seits nicht behaupten will, die syntaktische
Kategorie der Fragestze habe einen hnli-
chen Status wie die Kategorie VERB in der
Kategorialgrammatik, wo der Verbbegriff
selbst gar nicht existiert, sondern nur in Form
der verschiedenen Kategorien Transitivum,
Intransitivum etc. auftritt. Was aber bei Lewis
ein Problem der infiniten Anzahl potentieller
Frageverben war, ist hier ein Problem der
Zugehrigkeit eines Verbs zu einer infiniten
Menge semantischer Typen. Es mte mg-
lich sein, die Bedeutung des Verbs in all seinen
Typen mit einer Meta-Regel zu beschreiben.
Denn ohne sie fiele eine Generalisierung weg:
wie erklrt sich, da praktisch jedes Verb, das
eine indirekte Frage irgendeines Typs zult,
auch alle anderen Fragetypen zult? Man
gen Paare mgen Propositionsquivalente
sein, aber nur jeweils eines davon zhlt als
Antwort auf jeweils eine der drei Fragen. Das
Fragewort hat also zumindest die Aufgabe,
die Art der erwarteten Komplettierung zu spe-
zifizieren.
Die Auffassung von der Frage als Struktur
mit einer wohldefinierten Lcke, die durch
die Antwort gefllt wird, tritt erstmals bei
Cohen (1929) auf, der den logischen Inhalt
der Frage (25a) mit der propositionalen Form
(25b) angibt, so da Fragewrter einfach als
Variablen eines bestimmten Typs aufgefat
werden.
(25)
a. Was ist die Summe von 3 und 5?
b. x = 3 + 5
Eine solche offene Satzform ist z. B. auch Teil
der Analyse von qvist (1965) und Hintikka
(1976: 29 f.), der sie als Matrix der Frage
bezeichnet:
... we also define the matrix of a wh-question to
be its presupposition minus the quantifier. ... an
answer (potential answer) to a given question is a
substitution instance of its matrix ...
Von einer solchen propositionalen Form lt
sich sagen, sie sei wahr oder falsch relativ zu
einer Substitutionsinstanz, zu einem ange-
nommenen Wert der Variablen. Unabhngig
von einer bestimmten Substitutionsinstanz
lt sich daher dies ist die Grundannahme
in Egli (1974, 1976) die mit der proposi-
tionalen Form assoziierte propositionale
Funktion als propositionaler Gehalt der
Frage isolieren:
(26) x (x = 3 + 5).
Die Verwendung der Funktionalabstraktion
hat ihren Vorteil darin, da auch Satzformen
mit mehr als einer assoziierten propositiona-
len Funktion adquat reprsentiert werden
knnen. Die Fragen (27a,b) fallen in einer
Cohen-Satzform (27c) zusammen.
(27)
a. Wer sieht wen?
b. Wen sieht wer?
c. x sieht y.
Dagegen werden sie in den mit dieser Form
assoziierten Funktionen wohl unterschieden:
(27)
d. x y (x sieht y)
e. y x (x sieht y).
Einen vergleichbaren Ansatz verfolgen auch
Hausser (1978) und Hausser & Zaefferer
(1979). Die wohl frheste Formulierung der
quivalenz des Frage-Antwort-Paares zu
einem Deklarativ stammt allerdings von Kee-
15. Fragestze 341
der Fragetheorie in Egli (1976) der Ansicht
von Hamblin (1958) anschliet, da Antwor-
ten Satzantworten sind. Dies ist nmlich nicht
nur eine Frage der Natrlichkeit des Antwort-
formats, sondern eine Konsequenz aus dem
Postulat
(A) Knowing what counts as an answer is
equivalent to knowing the question.
Die Fragen (31a,b) sind nmlich verschieden,
obwohl sie dieselben kategorialen Antworten
(31c) haben. Die gewnschte Verschiedenheit
drckt sich erst wieder in den Satzantworten
(31d,e) aus.
(31)
a. In welchem Erdteil liegt Luxemburg?
b. In welchem Erdteil liegt Liechten-
stein?
c. In Asien (Afrika, usw.)
d. Luxemburg liegt in Asien (Afrika ...)
e. Liechtenstein liegt in Asien (Afrika ...)
Nur hinsichtlich der Satzantwort gilt also die
quivalenzthese. Die kategorialen Antworten
lassen hchstens eine Implikation zu:
(B) Die Frage zu kennen, impliziert, die mg-
lichen Antworten zu kennen.
4. Fragen als Mengen von
Deklarativen
Mit Hamblin (1958) beginnt die Tradition der
von Harrah (1984) so genannten set-of-an-
swers-methodology (hier: Antwortmengen-
bzw. AM-Methode), in der Antworten Pro-
positionen sind und Fragen Mengen von Ant-
worten. Diese Antworten knnen was die
disjunktive Frage nahelegt als explizite
Auflistung reprsentiert oder aber im Fall
der Ergnzungsfragen als Eigenschaften
von Propositionen angebbar sein.
Mit Belnap & Steel (1976:2)
The meaning of a question addressed to a query
system ...is to be identified with the range of an-
swers that the question permits.
setzt die AM-Methode die von Harrah
(1961, 1963) begonnene Bemhung um ein
Fragesystem fort, und Titel wie Questions
in Montague English (Hamblin 1973), Que-
stions in Montague Grammar (Bennett
1979b), Questions and Answers in Monta-
gue Grammar (Belnap 1982), hinter denen
sich durchweg AM-Anstze verbergen, zeigen
die Affinitt der Methode zu einer formalen
Semantik, die auf mengentheoretischen Ope-
rationen beruht und dem Prinzip eine syn-
taktische Kategorie bedingt einen semanti-
schen Typ huldigt. Erstmals taucht jetzt
braucht nicht einmal die eingebettete Frage
zu bemhen; auch direkte Fragen lassen sich
durch eine Konjunktion verknpfen, die ei-
gentlich immer zwei typengleiche Objekte ver-
knpft:
(29) Wann kommt er und wie lange bleibt er?
Fr eine Behandlung der Entscheidungsfrage
fhrt Egli (1974) die Kategorie des Modus
ein, die nur die beiden Elemente es ist so, da
und es ist nicht so, da enthlt, auf Deutsch:
ja und nein. Aber dies ist eine Achillesferse
aller Theorien mit diesem Antwortformat: die
Semantik ist korrekt fr (30a,b), versagt aber
bei negierter Frage (30c).
(30)
a. Kommt Urs? Ja Es ist so, da Urs
kommt.
b. Kommt Urs? Nein Es ist nicht so,
da Urs kommt.
c. Kommt Urs nicht? Nein Es ist nicht
so, da Urs nicht kommt.
Das unterschiedliche Verhalten von nein und
die Existenz eines dritten Elements dieser Ka-
tegorie im Deutschen nmlich doch wei-
sen darauf hin, da in einer adquaten Be-
handlung auch Kontexteigenschaften zu be-
rcksichtigen wren.
Unterschiedliche Auffassungen finden sich
zur disjunktiven Frage, die von Hausser
geleitet von den mglichen Antworten als
Ergnzungsfrage, von Egli inspiriert von
der Form der disjunktiven Fragen als Kon-
junktion (!) zweier Entscheidungsfragen in-
terpretiert wird. Eine Darstellung der Pro-
bleme mit disjunktiven und Ja/Nein-Fragen
findet sich in Buerle (1979a).
Als Schwchen dieses Ansatzes erwhnt
Egli (1976) selbst die Extensionalitt der Se-
mantik und die Verletzung des Natrlichkeits-
prinzips dadurch, da keine Bedeutungsan-
gaben fr Fragewrter angegeben werden,
diese also lediglich hinwegparaphrasiert wer-
den. Eine Intensionalisierung ist erforderlich,
wenn man berhaupt eine Theorie der indi-
rekten Frage anschlieen will. Und das Na-
trlichkeitsprinzip erfordert die Angabe einer
Kategorie, die sowohl deklarative wie auch
interrogative Werte hat, in der sowohl z. B.
deklarative Nominalphrasen (jeder Mann,
ein Mann) wie auch interrogative Nomi-
nalphrasen (welcher Mann) untergebracht
werden knnen. Erforderlich ist also die L-
sung des schon bei Keenan & Hull (1973)
angesprochenen Frageoperator-Problems.
Nur lt sich dieses Problem im Rahmen des
Antwortformats Satzteilantwort nicht l-
sen, weswegen sich die intensionale Version
342 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
Da das Komplement in (33a) nach der Kart-
tunenschen Analyse einem anderen logischen
Typ angehrt als das in (33b), mte es sich
streng genommen um zwei verschiedene,
gleichlautende Verben, wissen
d
und wissen
w
,
handeln. Wie man allerdings unschwer er-
kennt, besteht ein enger Zusammenhang zwi-
schen den beiden; denn beispielsweise folgt
aus (33b) und (33c) der wissen
d
-Satz (33a):
(33)
c. Die Tagesschau beginnt pnktlich.
Im Rahmen der Karttunenschen Analyse ist
man gezwungen, diese Folgerungsbeziehun-
gen durch ein Bedeutungspostulat wie (33d)
zu beschreiben, das einen Zusammenhang
zwischen wissen
d
und wissen
w
herstellt:
(33)
d. A wei
w
eine nicht-leere Menge von
Propositionen gdw. gilt: A wei
d
jedes
Element dieser Menge.
(Im gerade betrachteten Fall ist das Attribut
nicht-leere redundant, im allgemeinen aber
nicht. (33d) ist eine Folgerung aus dem von
Karttunen (1977: 18, fn. 11) angegebenen
Postulat, das auerdem noch etwas ber das
Wissen der leeren Propositionen-Menge aus-
sagt.)
Whrend man also den Zusammenhang
zwischen (33a) und (33b) mit einem Bedeu-
tungspostulat noch einigermaen in den Griff
bekommen kann, erweisen sich Beispiele wie
(34) als erheblich schwieriger fr eine Auf-
spaltung des Wissens in propositionales und
frageeinbettendes:
(34) Monika wei, da im Ersten ein Krimi
luft und ob der Western im Zweiten in
Farbe ist.
Die Koordinierbarkeit von da-Stzen mit
(brigens: beliebigen) indirekten Fragen in
der Komplementposition einiger Verben
macht offenbar die Angabe eines gemeinsa-
men logischen Typs (zumindest fr koordi-
nierte Strukturen) erforderlich. Karttunens
Theorie weist an dieser Stelle eine Lcke auf.
Bevor wir allerdings auf alternative Mg-
lichkeiten der Klassifikation indirekter Fra-
gen eingehen, sei noch erwhnt, wie sich an-
dere Fragetypen im Rahmen von Karttunen
(1977) ausnehmen. Bei Alternativfragen der
Gestalt ob
1
oder [ob]
2
... oder [ob]
n
zhlen nach Karttunen als wahre Antworten
alle wahren Propositionen aus der Menge
{
1
, ...,
n
}. Das Denotat von ob es reg-
net oder die Sonne scheint enthielte somit bei
Regenbogenwetter zwei Elemente, whrend es
Fragesatz als Kategorie ernsthaft auf, auch
wenn man gleich vorwegnehmen kann, da
dahinter nunmehr die Frage nach der ge-
meinsamen Kategorie Satz stehen wird.
Immerhin ist hier die durch Funktionalab-
straktion entstandene Typenvielfalt auf die
Dichotomie Deklarativ-Interrogativ reduziert
(die in Hamblin (1973) bereits dahingehend
aufgelst wird, da auch Deklarative fr Pro-
positionsmengen stehen mit genau einem
Element), so da erstmals Arbeiten sowohl
zur direkten wie auch zur indirekten Frage
im Rahmen derselben Methode durchgefhrt
werden. Whrend dies in Wunderlich (1976a)
und Bennett (1979b) explizit festgestellt wird,
beschrnkt sich Karttunen (1977) allein auf
die indirekte Frage, weil ihm fr die direkte
Frage eine Art Vollbeschreibung vorschwebt.
Varianten der AM-Beschreibung ergeben sich
aus unterschiedlichen Auffassungen darber,
ob man
(a) die Menge der mglichen (Hamblin 1973)
oder die Menge der wahren (Wunderlich
1976a, Karttunen 1977) Antworten zu-
grundelegen soll, und ob man
(b) die Menge der wahren Antworten exhau-
stiv als die Antwort versteht (Karttunen
1977) oder als Menge, aus der ausgewhlt
werden kann (Bennett 1979b).
Neuere im Rahmen der Montague-Gram-
matik oder verwandter Systeme angestellte
Untersuchungen zur Frage-Semantik nehmen
fr gewhnlich Karttunens (1977) Analyse
der indirekten Frage als Ausgangspunkt, de-
ren Grundidee, wie erwhnt, darin besteht,
jede Frage die Menge ihrer wahren Satz-Ant-
worten (genauer: der entsprechenden Propo-
sitionen) denotieren zu lassen. Wenn also
ein Satz ist und die durch ihn ausge-
drckte Proposition, so wird nach Karttunen
die indirekte Entscheidungsfrage ob die
Einermenge {} oder die der Negation, also
{}, denotieren je nachdem, ob wahr
ist oder nicht. Tritt eine indirekte Frage nun
als Komplement eines Verbs wie in
(32) Monika fragt Erwin, ob es schon 8 Uhr
ist.
auf, so mu dieses Verb eine Argumentstelle
fr Propositionen-Mengen besitzen. Daraus
ergibt sich unmittelbar eine Doppelt-Klassi-
fizierung solcher Verben wie wissen, die neben
indirekten Fragen auch da-Stze, also Pro-
positionen denotierende Ausdrcke, einbet-
ten:
(32)
a. Erwin wei, da die Tagessschau
pnktlich beginnt.
b. Erwin wei, ob die Tagesschau pnkt-
lich beginnt.
15. Fragestze 343
alle Elemente des Redeuniversums hinsicht-
lich der Frage, ob sie im Fernsehen kommen,
zu beurteilen (starke Exhaustivitt von wissen
+ Ergnzungsfrage). Um also den Wider-
spruch zwischen (37a) und (37b) zu beschrei-
ben, mte man insbesondere von (37a) auf:
(37)
c. Monika wei, was heute nicht im
Fernsehen kommt.
schlieen drfen, was im Karttunenschen Sy-
stem jedoch ausgeschlossen ist. Dabei ist zu
beachten, da dieser Defekt nicht etwa durch
ein weiteres Postulat fr das Wort wissen
w
behoben werden kann. Mit dem schon vor-
ausgesetzten Prinzip (33d) wrde ein solches
Postulat ja im wesentlichen auf eine Festle-
gung ber das propositionale wissen
d
hinaus-
laufen, fr das die Exhaustivittsannahme
aber natrlich nicht gilt: (37d) ist nmlich
durchaus mit (37b) vertrglich.
(37)
d. Von jeder Sendung, die kommt, wei
Monika, da sie kommt.
Es gibt allerdings eine andere Mglichkeit, im
Rahmen der Karttunenschen Analyse die
starke Exhaustivitt zu erzwingen. Man kann
dieselbe nmlich einfach in die Fragebedeu-
tung selbst einbauen. Dazu mte man ledig-
lich auch wahre Propositionen der Form es
ist nicht der Fall, da x die durch V ausge-
drckte Eigenschaft besitzt als Antworten
auf Ergnzungsfragen zulassen. Obwohl ein
solches Vorgehen etwas gegen den Geist der
Karttunenschen Analyse geht intuitiv han-
delt es sich bei diesen Propositionen ja nicht
um adquate Antworten bekommt man
auf diese Weise ebenfalls keine Schwierigkei-
ten mehr mit Stzen wie (37ad). Der Einbau
der starken Exhaustivitt in die Analyse der
indirekten Frage selbst bringt jedoch gewisse
(mglicherweise allerdings berwindbare)
Schwierigkeiten mit sich. Starke Exhaustivitt
tritt nmlich nicht immer oder zumindest
nicht immer auf dieselbe Weise wie in wissen
+ w(h)-Konstruktionen auf. Man betrachte
dazu den folgenden Satz:
(38) Monika fragt Erwin, wo man sonntags
eine Programmzeitschrift kaufen kann.
Dieser Satz ist typischerweise in Situationen
wahr, in denen Monika bereits zufrieden ist,
wenn Erwin ihr auch nur eine sonntglich
geffnete Verkaufsstelle von Programmzeit-
schriften nennen kann. Mit der Exhaustivitt
wrde man aber als einzig mgliche Lesart
von (38) diejenige bekommen, wonach Mo-
nika nach einer vollstndigen Liste aller sol-
cher Lden verlangt. Man beachte, da sich
in einer lauen Sommernacht meistens leer
wre. Mit dem oben erwhnten Postulat (33d)
ergibt sich bei dieser Analyse der Schlu von
(35a) auf (35b), eine Tatsache, die an der
Karttunenschen Theorie gelegentlich bemn-
gelt wurde (z. B. von Bor 1978b: 310):
(35)
a. Monika wei, da die Tagesschau
nicht luft.
b. Monika wei, ob die Tagesschau nicht
luft oder ob sie verlegt wurde.
Fr Ergnzungsfragen fhrt die Karttunen-
sche Strategie, Frageinhalte mit Eigenschaf-
ten von Propositionen zu identifizieren, zu
einer Analyse, in der ein Fragewort mit einem
Existenzquantor identifiziert wird (im folgen-
den w(h) = -Analyse): wenn etwa wer
schwimmt durch die Menge der wahren Pro-
positionen der Form x schwimmt gedeutet
werden soll, so lt sich im allgemeinen das
Denotat einer Frage der Form was V mit der
Menge der Propositionen p identifizieren, fr
die (36) gilt.
(36) p ist wahr, und es gibt ein x, so da p
besagt, da x die durch V ausgedrckte
Eigenschaft besitzt.
(V ist dabei der durch Abstraktion gedeutete
Rest des Satzes.) Diese Analyse lt sich in
naheliegender Weise auf mehrfache Ergn-
zungsfragen bertragen. Dabei entspricht
dann jedem Fragewort ein Existenzquantor.
Mit dieser w(h) = -Analyse sind zahl-
reiche Probleme verbunden, von denen zwei
hier genannt seien. Das erste betrifft das Ph-
nomen der Exhaustivitt. Man betrachte:
(37)
a. Monika wei, was heute im Fernsehen
kommt.
b. Monika wei nicht, ob das Wort zum
Sonntag heute im Fernsehen kommt.
Nach der Karttunenschen Analyse sind (37a)
und (37b) miteinander vertrglich: damit
(37a) als wahr herauskommt, gengt es, da
Monika von jeder Sendung, die tatschlich
kommt, auch wei, da sie kommt; von Sen-
dungen, die nicht laufen, ist in Karttunens
Wahrheitsbedingungen nicht die Rede, so da
Monika also insbesondere ber diese nichts
wissen mu. Intuitiv ist jedoch schwerlich ein-
zusehen, wie (37a) und (37b) gemeinsam wahr
sein knnen: wenn Monika wei, was im
Fernsehen luft, und vielleicht auerdem
noch ber minimale deduktive Fhigkeiten
verfgt, so sollte sie auch darber informiert
sein, was mit dem Wort zum Sonntag los ist.
Man ist also geneigt, (37a) so zu verstehen,
da Monika die Fhigkeit zugesprochen wird,
344 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
204 f und Zimmermann 1985: 433 f).
Trotz aller Schwchen der Karttunenschen
Analyse indirekter Fragen sei hier jedoch an
einen ihrer wesentlichen Vorzge erinnert: alle
indirekten Fragen sind nach Karttunen vom
selben logischen Typ, denn sie denotieren al-
lesamt Mengen von Propositionen. Insbeson-
dere gibt es also kein Problem, verschieden-
artige Fragen miteinander zu koordinieren.
Insofern kann man Karttunens Theorie als
echten Fortschritt gegenber frheren Dar-
stellungen der Frage ansehen.
Seit dem Erscheinen von Karttunens Arbeit
(1977) zur Syntax und Semantik indirekter
Fragen hat es eine ganze Reihe von Verbes-
serungsvorschlgen und alternativen Anst-
zen zur Darstellung dieser Phnomene gege-
ben. Auf zwei davon wollen wir hier etwas
ausfhrlicher eingehen. Bor (1978b) ber-
nimmt zunchst im wesentlichen die Karttu-
nensche Analyse der Entscheidungsfrage, ge-
langt aber aufgrund der weiter oben (im Zu-
sammenhang mit 35a,b) erwhnten Kritik zu
einer anderen Deutung von Alternativfragen
der Form:
(40)
a. ob
1
oder [ob]
2
... oder [ob]
n
.
Wie der einfachen Entscheidungsfrage wird
auch der Alternativfrage nach Bor als De-
notat eine Einermenge zugewiesen, die jetzt
als Element die tatschliche Wahrheitswert-
verteilung der durch
1
, ...,
n
ausgedrckten
Propositionen besitzt. Falls also alle Teilglie-
der wahr sind, so enthlt das Denotat der
gesamten Alternativfrage als einziges Element
den durch die Konjunktion
1
und
2
...und
n
ausgedrckten Satzinhalt, also den Schnitt
der einzelnen Propositionen miteinander:
1
2
...
n
; wenn hingegen
z. B. die Elemente
2
und
n
falsch sind, ist
das Denotat der Alternativfrage die Menge
{
1
2
...
n
} etc. Im allgemei-
nen lautet dann die Formel zur Bestimmung
der Proposition im Denotat von (40a):
Es ist klar, da auf diese Weise der oben
kritisierte Schlu von (35a) auf (35b) nur
noch dann funktioniert, wenn Monikas Wis-
sen unter logischen Folgerungen (Abschw-
diese Konsequenz auch nicht dadurch ver-
meiden lt, da man etwa die Auswahl der
in Frage kommenden Orte irgendwie kontex-
tuell (z. B. auf solche, die im Umkreis von 2,5
km liegen) einschrnkt: vielleicht gibt es ja 5
solcher Orte, von denen Erwin blo einen
kennt und nennt; Monika wre aber trotz der
mangelnden Exhaustivitt der Erwinschen
Antwort (in der nchstliegenden Lesart des
Satzes) zufrieden.
Bevor wir auf die zweite Schwierigkeit der
Karttunenschen Analyse indirekter Ergn-
zungsfragen eingehen, sei noch kurz eine An-
merkung zu der soeben eingefhrten Termi-
nologie gemacht: die Exhaustivitt, von der
soeben die Rede war, war die sog. starke
Exhaustivitt. Das Gegenstck dazu, die
schwache Exhaustivitt, liegt dann vor, wenn
man von der Einstellung (z. B. wissen
w
) zu
einer Frage (was
v
) auf eine entsprechende Ein-
stellung zu allen positiven Instanzen, also al-
len wahren Propositionen der Form x hat die
Eigenschaft V schlieen kann. Diese schwa-
che Exhaustivitt ist bei der Karttunenschen
Analyse bereits in die Bedeutung der Frage
eingebaut. (Eine ausfhrliche Darstellung
verschiedener Exhaustivitts-Grade findet
man bei Groenendijk & Stokhof 1982:
179181.)
Die zweite Unzulnglichkeit der w(h) =
-Analyse betrifft Fragen mit welcher/e/es
(engl.: which):
(39) Monika wei, welche Programmzeit-
schrift Erwin abonniert hat.
Ohne auf Details einzugehen, wollen wir hier
nur erwhnen, da Karttunen fr (39) nur
eine Lesart bekommt, und zwar eine de re-
Lesart, nach der Monika von jeder Pro-
grammzeitschrift, die Erwin abonniert hat,
wei, da er sie abonniert hat, ohne unbe-
dingt zu wissen, da es sich bei diesen Blttern
um Programmzeitschriften handelt. So
knnte (39) nach Karttunen wahr sein, falls
Erwin den Gong abonniert hat, Monika dies
wei, aber zugleich irrtmlich annimmt, es
handle sich dabei um eine Fachzeitschrift fr
den Boxsport. Mglicherweise besitzt (39)
auch tatschlich eine solche Lesart. Das Pro-
blem ist jedoch, da der Satz offensichtlich
auch so verstanden werden kann (de dicto),
da durch ihn Monikas Wissen um den Status
der von Erwin abonnierten Zeitschriften mit-
behauptet wird. Eine solche Lesart ist aber
nach der Karttunenschen Analyse nicht vor-
gesehen, ja nicht einmal mit dieser vereinbar.
(Vgl. Groenendijk & Stokhof 1982: 181183,
15. Fragestze 345
Man braucht nmlich nur anzunehmen, da
(42a) wiederum auf (42b) zurckzufhren ist:
(42)
a. Monika erzhlt Erwin, was sie heute
gemacht hat und da sie bereits meh-
rere Lexika verkauft hat.
b. Monika erzhlt Erwin, was sie heute
gemacht hat, und Monika erzhlt Er-
win, da sie bereits mehrere Lexika
verkauft hat.
Da Karttunen fr die beiden Vorkommen von
erzhlt in (42b) zwei (sogar kategoriell) ver-
schiedene Relationen ansetzt, htte er im
Gegensatz zu Bor Probleme, (42a) in die-
ser Weise als Ellipse zu erklren.
Man beachte, da die in den Frageinhalt
eingeschleuste Faktivitt noch keine starke
Exhaustivitt nach sich zieht: (41b) ist nm-
lich durchaus mit der Annahme vertrglich,
da Monika Erwin gegenber den falschen
Eindruck erweckt hat, sie habe noch mehr
verkauft als die Gegenstnde, von denen sie
ihm erzhlt hat. Doch wie bei Karttunen, so
lt sich auch hier bei Bor die starke Exhau-
stivitt nachtrglich einbauen, worauf wir
hier allerdings aus Platzgrnden verzichten.
(Vgl. dazu Zimmermann (1985: 439)).
Es gibt brigens viele Flle von Frageein-
bettungen, bei denen keine Faktivitt vorliegt,
so z. B. in:
(43) Monika berlegt, was sie lesen soll.
(43) besagt ja nicht, da sich Monika zu je-
dem Buch, das sie lesen soll, berlegt, da sie
es lesen soll: vielleicht kommen ihr ja immer
nur die falschen Schriften in den Sinn. Als
Ausweg schlgt Bor in diesen Fllen vor, das
einbettende Verb (hier: berlegen) mit einem
an der Oberflche mglicherweise unsichtba-
ren Operator (namens about) auszustatten,
der die Frageinhalte ihrer Faktivitt beraubt.
Auf eine genauere Diskussion mssen wir hier
allerdings verzichten. Ebensowenig gehen wir
auf die bei Bor ohnehin nur andeutungsweise
behandelten which-Fragen ein. Es sei jedoch
erwhnt, da sich die bei Karttunen nicht
darstellbare de re/de dicto Ambiguitt der-
selben im Rahmen der Borschen Theorie zu-
mindest prinzipiell erfassen lt.
5. Deklarative und Interrogative in
einer logischen Kategorie
Die von Groenendijk & Stokhof (1982) vor-
gelegte Analyse indirekter Fragen besitzt ge-
genber ihren Vorgngern den groen Vor-
zug, auf einer einheitlichen logischen Kate-
chungen) abgeschlossen ist, was nicht unbe-
dingt der Fall ist.
Indirekte Ergnzungsfragen wie (41a) sind
nach Bor wie (41b) zu paraphrasieren:
(41)
a. Monika erzhlt Erwin, was sie heute
verkauft hat.
b. x V(m,x) x [V(m,x)
E(m,e,
V(m,x))]
(V = hat (heute) verkauft, E = erzhlt,
m = Monika, e = Erwin,
= da.)
Das erste Konjunkt gibt dabei eine Art
Existenzprsupposition (genauer: -implika-
tion) wieder, die bei Karttunen und den mei-
sten anderen Theorien vernachlssigt wird;
auch wir werden sie im folgenden unterschla-
gen. Ersetzt man das Bikonditional () im
zweiten Konjunkt durch eine einfache (ma-
teriale) Implikation (), so erhlt man die
Karttunensche Analyse von (41a), wenn man
einmal fr erzhlen eine hnliche Aufspaltung
(samt Postulat) annimmt wie weiter oben fr
wissen. Die -Richtung bringt ein zustzli-
ches faktives Element in die Analyse von
(41a): die Gegenstnde, von denen Monika
Erwin gegenber behauptet, da sie sie ver-
kauft habe, mu sie auch wirklich verkauft
haben, wenn (41a) unter der Analyse (41b)
wahr sein soll. Interessanterweise ist die in
(41b) zugrundegelegte propositionale Einstel-
lung des Erzhlens an sich nicht faktiv; der
genannte Effekt ergibt sich erst bei einer Fra-
geeinbettung wie in (41a). Fr Verben wie
wissen, die schon von Haus aus faktiv sind,
luft natrlich die Borsche Analyse im we-
sentlichen auf die Karttunensche hinaus.
Neben der zustzlichen Existenzimplikation
ist ein gegenber Karttunen neues Merkmal
allerdings die Tatsache, da Bor ohne eine
Aufspaltung der Verben wie wissen, erzhlen
etc. in frageeinbettende und propositionale
Vorkommen auskommt: die indirekte Frage
wird bei Bor nmlich als Funktor aufgefat,
der propositionale Operatoren (Einstellungen
mit Subjekt) als Argumente nimmt. So erhlt
man die Borsche Interpretation der in (41a)
eingebetteten Frage im wesentlichen durch
Abstraktion von den Parametern e (Objekt),
m (Subjekt) und E (Hauptverb) in (41b); fr
die Details dieser geschickten logischen Ka-
tegorisierung mssen wir auf Bors Original-
arbeit verweisen. Ein Effekt dieses Vorgehens
sei hier allerdings noch erwhnt: wenn man
bei Verben wie wissen und erzhlen eine ein-
heitliche semantische Form zugrundelegt, ist
es prinzipiell mglich, auch die gemischten
Koordinationen wie (42a) zu beschreiben:
346 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
plemente von wissen als intensional bezeich-
net werden. Der Unterschied ist aber, da es
in der Konstruktion wissen, da (oder auch:
wissen, ob ) der Satz ist, dessen Intension
beachtet werden mu; nicht der Wahrheits-
wert von , sondern die durch ausgedrckte
Proposition ist es, die zu den Wahrheitsbedin-
gungen beitrgt und als Extension (Denotat)
sowohl des da-Satzes als auch des ob- Satzes
dient. Davon zu unterscheiden sind jedoch
die Intensionen von da und ob , die jedem
Index die entsprechende Proposition zuord-
nen. Wie bereits angedeutet wurde, handelt
es sich bei der Intension von da um eine
konstante Funktion mit Wert , whrend
sich die Intension f von ob nach der Formel
(45) bestimmt:
Die Schlsse (44a) und (44b) funktionieren
gerade deshalb, weil es fr die Einstellung des
Wissens nur darauf ankommt, welche Pro-
position durch das Komplement da bzw.
ob denotiert wird, was also die Extension
des jeweiligen Komplements ist. Wenn man
nun annimmt, da dies bei Verben wie ber-
legen nicht der Fall ist, sondern da vielmehr
die Intension des Komplements also der
jeweilige propositionale Begriff (= die Art
des Gegebenseins der Proposition) in die
Wahrheitsbedingungen eingeht, so ist der
bergang von (i) und (ii) nach (iii) in (44c)
tatschlich nicht mehr mglich: selbst wenn
(ii) gilt und somit da und ob dieselbe
Proposition denotieren, sind sie dennoch (im
allgemeinen) sinnverschieden.
Die durch gewisse Verben eingeschleuste
Faktivitt indirekter Fragen stellt sich also
nach Groenendijk und Stokhof als Extensio-
nalitt bezglich der Komplementposition
dar. Bisher war allerdings nur von indirekten
Entscheidungsfragen die Rede. Alternativfra-
gen werden wie bei Bor, also nach der For-
mel (40b), behandelt freilich mit dem Un-
terschied, da man jetzt die dort angegebene
Proposition selbst (und nicht die entspre-
chende Einermenge) als Denotat nimmt.
Es stellt sich aber die Frage, ob sich die
Strategie, indirekten Fragen Propositionen
als Denotate zuzuordnen, auch auf Ergn-
zungsfragen bertragen lt. Welche Propo-
sition soll in diesem Fall bezeichnet werden?
Um die von Groenendijk & Stokhof vorge-
schlagene Lsung dieses Problems besser
nachvollziehen zu knnen, sei zunchst ein-
gorisierung der Frage- und Satzeinbettungen
zu basieren. Die Grundidee, die brigens auch
in Lewis (1982) zu finden ist, ist zunchst sehr
einfach: anstatt Einermengen von Propositio-
nen als Denotate von Entscheidungsfragen
oder (wie bei Bor) Alternativfragen zu neh-
men, kann man gleich die Elemente derselben
dafr benutzen. Auf diese Weise erhlt man
automatisch eine einheitliche logische Kate-
gorie fr da- und ob-Ergnzungen. Der Un-
terschied ist, da ein Ausdruck der Form da
immer, d. h. an jedem Index (in jeder Welt),
dieselbe Proposition bezeichnet, whrend
die indirekte Entscheidungsfrage ob ent-
weder oder bezeichnet, je nach dem,
welche der beiden Propositionen am Index
wahr ist. Nimmt man nun (wie allgemein b-
lich) an, da Verben wie wissen Relationen
zwischen Individuen und Propositionen aus-
drcken, so ergeben sich unmittelbar die fol-
genden Schluschemata:
(44) a. (i) A wei, ob .
(ii)
(iii) A wei, da .
b.(i) A wei, ob .
(ii) Es ist nicht so, da .
(iii)A wei, da nicht der Fall ist.
Wegen der Prmisse (ii) bezeichnet nmlich
da in (44a) dieselbe Proposition wie ob ,
also ; mit (i) wiederum folgt, da diese
Proposition zu As Wissen gehrt. hnlich
argumentiert man fr (44b). Man beachte,
da diese Schlsse lediglich auf der logischen
Kategorisierung des Wissens als propositio-
naler Einstellung und auf der Analyse von
ob-Komplementen als Bezeichnungen fr
Propositionen beruhen. Insbesondere wurde
also von keinem Bedeutungspostulat (etwa:
Faktivitt von wissen) oder gar einer Doppelt-
Klassifizierung des einbettenden Verbs Ge-
brauch gemacht.
Whrend die obigen Schlsse bei Verben
wie wissen und erzhlen willkommen sind,
mchte man sie doch nicht berall haben:
Groenendijk und Stokhof haben eine ver-
blffend einfache Methode gefunden, um
Schlsse wie den in (44c) zu blockieren: man
mu nmlich einfach nur annehmen, da es
sich bei dem Komplement zu berlegen um
eine intensionale (opake, ungerade) Position
handelt! Diese Idee bedarf der Erluterung,
da ja in blicher Redeweise auch die Kom-
15. Fragestze 347
schwchungen abgeschlossen ist, knnen
(47a) und (47b) nicht gleichzeitig wahr sein,
was zu zeigen war.
Auch die schon erwhnte de re/de dicto-
Ambiguitt von Ergnzungsfragen mit wel-
cher/e/es + N wird bei Groenendijk und
Stokhof behandelt, eine ausfhrliche Darstel-
lung der Methode wrde jedoch hier zu weit
fhren. Die beiden Lesarten, die eine indirekte
Frage wie (48a) erhlt, sind (48b,c).
(48)
a. welches Schulbuch rot ist
b. {w Schulbuch (w
0
) rot (w) =
Schulbuch (w
0
) rot (w
0
)}
c. {w Schulbuch (w) rot (w) =
Schulbuch (w
0
) rot (w
0
)}
((w) ist die Extension des Ausdrucks in
der Welt w; aus Einfachheitsgrnden haben
wir angenommen, da rot als durchschnitts-
bildend gedeutet wird.) (48b) ist dasselbe wie:
(48)
b. {w x Schulbuch (w
0
): x rot
(w) x rot (w
0
)}
Ohne die -Richtung wre (48b) die Kon-
junktion (der Schnitt) ber die Karttunensche
Interpretation von (48a); bei Groenendijk und
Stokhof kommt aber noch die starke Exhau-
stivitt der Frage hinzu. (48c) ist die de dicto-
Lesart von (48a). Der Unterschied zwischen
den beiden ist der folgende: um (48a) in der
de re-Lesart (48b) zu wissen, mte Erwin
von jedem Schulbuch bekannt sein, ob es rot
ist oder nicht; um die de dicto Lesart (48c)
zu wissen, mte er von jedem Gegenstand
wissen, ob er ein rotes Schulbuch ist oder
nicht. Diese beiden Lesarten sind natrlich
(streng genommen) logisch unabhngig von-
einander. Ob sie auch die sicherlich vor-
handene Ambiguitt von welcher-Fragen
richtig wiedergeben, ist jedoch zweifelhaft. So
hat uns ein anonymer Gutachter darauf hin-
gewiesen, da nach Groenendijk und Stokhof
der indirekte Fragesatz
(48)
d. welches rote Schulbuch ein Schulbuch
ist
in der de dicto-Lesart genauso behandelt wird
wie (48a), d. h. er wird durch (48c) gedeutet.
Das ist aber offensichtlich nicht korrekt. (Vgl.
Zafferer 1984 fr eine mglicherweise ad-
quatere Behandlung von welcher-Fragen.)
Einer der wesentlichen Vorzge der hier
nur skizzenhaft dargestellten Theorie von
Groenendijk & Stokhof ist die einheitliche
logische Kategorisierung aller indirekten Fra-
gen sowie der da -Stze: sie alle denotieren
Propositionen (Weltenmengen) und knnen
deshalb beliebig miteinander koordiniert wer-
den. Stze wie:
mal daran erinnert, da sich die durch eine
Entscheidungsfrage ob bezeichnete Propo-
sition als die Menge aller Welten (Indizes)
auffassen lt, in denen dieselbe Extension
(denselben Wahrheitswert) hat wie in Wirk-
lichkeit:
(46)
a. {w (w) = (w
o
)},
wobei w
o
auf die wirkliche Welt referiert.
Die in (46a) definierte Proposition ist nmlich
gerade dann , falls (in w
o
) wahr ist und
sonst. Diese Charakterisierung der De-
notation von Entscheidungsfragen lt sich
nun in naheliegender Weise auf Ergnzungs-
fragen wie wer am Samstag Erwin vertritt
bertragen. Der Unterschied ist lediglich, da
letzteren statt eines Satzes ein Prdikat ent-
spricht. In unserem Beispiel bietet sich somit
die Menge derjenigen Welten als Denotat an,
in denen das Prdikat am Samstag Erwin ver-
treten dieselbe Extension hat wie in Wirklich-
keit. Im allgemeinen wrde man dann fr eine
Frage der Form wer Q (bzw. wen Q, was Q
etc.) das folgende Denotat bekommen:
(46)
b. {w Q (w) = Q (w
o
)},
wobei wieder w
o
die Wirklichkeit ist und Q
die Intension des Prdikates Q, also der durch
Abstraktion vom Fragewort gedeutete Rest
des Satzes. Bei Mehrfachfragen (wer wen un-
terrichtet etc.) mu man dementsprechend f-
ter abstrahieren, um ein mehrstelliges Prdi-
kat Q zu erhalten; an der Formel (46b) ndert
das aber nichts.
Ein wichtiges Merkmal dieser von Groe-
nendijk & Stokhof vorgeschlagenen Deutung
von Ergnzungsfragen ist, da man mit ihr
die starke Exhaustivitt geschenkt bekommt.
Man betrachte etwa:
(47)
a. [Monika wei,] wer wen unterrichtet
b. [Monika wei nicht,] ob Erwin Maya
unterrichtet.
Das Denotat der in (47a) eingebetteten Frage
ist (47c), das quivalent ist zu (47d):
(47)
c. {w unterrichtet (w) = unterrich-
tet (w
o
) }
d. {w x y: x,y unterrichtet (w)
x,y unterrichtet (w
o
)}
Andererseits denotiert die eingebettete Frage
in (47b) die folgende Menge:
(47)
e. {w Erwin, Maya unterrichtet
(w) Erwin, Maya unterrichtet
(w
o
)},
also eine Abschwchung von (47d). Wenn nun
Monikas Wissen aber unter solchen Ab-
348 V. Semantische Grundlagen der Sprechakte
einer solchen Wegerklrung im Rahmen sei-
ner Theorie.)
6. Literatur (in Kurzform)
quist 1965 Buerle 1979a Belnap 1982 Bel-
nap/Steel 1976 Bennett 1977 Bennett 1979b
Bor 1978b Carnap 1934 Cohen 1929 Cresswell
1973 Egli 1974 Egli 1976 Engdahl 1980 Groe-
nendijk/Stokhof 1982 Groenendijk/Stokhof
1984 Hamblin 1958 Hamblin 1967 Hamblin
1973 Harrah 1961 Harrah 1963 Harrah 1984
Hausser 1978 Hausser/Zaefferer 1979 Hintikka
1974 Hintikka 1976 Hiz (ed.) 1978 Jespersen
1940 Karttunen 1977 Katz/Postal 1964 Kee-
nan/Hull 1973 Kiefer (ed.) 1983 Leonard 1959
Lewis 1970 Lewis 1982 Manor 1982 Prior/Prior
1955 Reichenbach 1947 Scha 1983 von Ste-
chow/Zimmermann 1984 Stenius 1967 Tich
1978 Wunderlich 1976a Zaefferer 1983 Zaef-
ferer 1984 Zimmerman 1985
Bibliographien zum Thema:
Egli, Urs und Hubert Schleichert (1976) Bibliogra-
phy of the Theory of Questions and Answers. In:
Belnap & Steel (1976), 155200. Vorlufige Ver-
sion in: Linguistische Berichte 41, 1976, 105128.
Ficht, Heribert (1978) Supplement to a bibliogra-
phy of the theory of questions and answers. In:
Linguistische Berichte 55, 92114.
Rainer Buerle, Stuttgart/Thomas Ede
Zimmermann, Stuttgart,
(Bundesrepublik Deutschland)/
(49) Erwin wei, welches Schulbuch rot ist
und da rote Schulbcher nicht zulssig
sind.
knnen deshalb ganz direkt, ohne Tilgungs-
transformation o. ., als Einbettungen von
Konjunktionen (p q) gedeutet werden.
Doch diese elegante Lsung des Koordina-
tionsproblems gibt ein Rtsel auf, welches
sich brigens auch schon bei der Borschen
Analyse ergibt. Es erscheint nmlich aus der
Sicht dieser Theorien einigermaen schleier-
haft, warum Stze wie (50a) und (50b) ab-
weichend sind:
(50)
a. *Erwin glaubt, welches Schulbuch rot
ist.
b. *Erwin fragt Monika, da rote Schul-
bcher nicht zulssig sind.
Weiterhin gilt natrlich, da es solche ge-
mischten Koordinationen wie in (49) nur
dann gibt, wenn das einbettende Verb sowohl
da -Stze als auch indirekte Fragen nimmt.
Natrlich knnte man (50a) und (50b) rein
syntaktisch ausschlieen, was allerdings im
Rahmen der beiden zuletzt angesprochenen
Theorien ganz unnatrlich erscheint. (Kart-
tunen bereiten diese Fakten dagegen kein Pro-
blem, aber er hat ja dafr auch mit (49) r-
ger!) Von einem rein deskriptiven Standpunkt
aus handelt es sich hier lediglich um einen
Schnheitsfehler, der sich vielleicht sogar
eines Tages irgendwie wegerklren lt. (Vgl.
Bor 1978b: 332 f., fr einen ersten Versuch
349
VI. Nominalsemantik
Nominal Semantics
16. Eigennamen
eignis wollen wir als Namenstoken bezeich-
nen. Diesem Token entspricht ein Typ, den
wir die Lautform des Namens nennen. Unter
einem Wort verstehen wir ein Paar aus einer
Lautform und einer ihr per Sprachkonvention
zugewiesenen Bedeutung. Der Bedeutungs-
begriff ist dabei theorieabhngig und kann
unterschiedlicher Natur sein (vgl. Artikel 1).
Wenn wir nun Namen den Status von Wr-
tern (eventuell) absprechen, so soll dies hei-
en, da ihnen (mglicherweise) keine kon-
ventionell gefestigten Paare aus Lautformen
und Bedeutungen entsprechen. Versuchen wir
nun, die Anforderungen, die wir an den Be-
deutungsbegriff stellen mssen, etwas enger
zu fassen.
Viele Namen besitzen gewisse deskriptive
Zge. So sind beispielsweise die meisten Vor-
namen geschlechtsspezifisch. Es gibt typische
Hundenamen und auch mehr oder weniger
vornehme Familiennamen, die die Herkunft
ihrer Trger verraten. Schlielich haben viele
Namen (wie unser Beispiel Ursula) eine ety-
mologische Bedeutung. All diese Arten von
Bedeutungen interessieren uns hier nicht: in
einem Satz wie (1) knnen sie nmlich den
Beitrag (vorausgesetzt es gibt ihn) nicht be-
schreiben, den die Lautform Ursula zur Be-
deutung des Satzes beisteuert, nmlich die
Festlegung eines Individuums, des Namens-
trgers.
(1) Ursula ist abgereist.
Wer (1) uert, wird voraussetzen, da die
Gesprchspartner Ursula irgendwie kennen.
Es wird dagegen im allgemeinen nicht ver-
langt, da die Hrer die ursprngliche Be-
deutung des Namens kennen, und die Hrer
erwarten auch nicht, da die Sprecher dies
von ihnen erwarten. Diese Bedeutung trgt
also nicht zum Verstndnis des Satzes bei und
gehrt demnach nicht zu dem, was wir die
systematische Bedeutung eines Namens nen-
nen.
Ein Sprecher knnte hingegen vom Hrer
erwarten, da er wei, da es sich um eine
1. Einleitung
2. Namenstrger als Bedeutungen
3. Namen als verkleidete Kennzeichnungen
4. Eigennamen in modalen Kontexten
4.1 Ein Problem fr die Deskriptionstheorie
4.2 Namen als starre Designatoren
5. Was Eigennamen bedeuten
5.1 Die Festlegung der Referenz
5.2 Bedeutung und Inhalt
5.3 Mgliche Verfeinerungen
6. Eigennamen und Einstellungen
6.1 Diagonalisierungen als Nebensinne
6.2 Waterloo
6.3 Zwei Dimensionen oder reine Benennung? Ein
Fazit
7. Vermischte Bemerkungen
7.1 Logische Kategorie der Eigennamen
7.2 Fiktion
8. Historisch-bibliographische Notizen
8.1 Zum Terminus Eigenname
8.2 Zur Benennungstheorie
8.3 Zur Kennzeichnungstheorie und zur logischen
Kategorisierung
8.4 Zu den verkleideten Kennzeichnungen
8.5 Zur Kritik an den sogenannten Deskriptions-
theorien
8.6 Zur Festlegung des Namens-Prdikats
8.7 Zum Begriff der Tradition
8.8 Zur Namensbedeutung
8.9 Zu den propositionalen Einstellungen
8.10 Zur Fiktion
9. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
Einige Wrterbcher wollen konsequent sein
und fhren deshalb keine Eigennamen auf. In
anderen findet man die Hauptstdte der Welt
und die groen Feldherren der Geschichte.
Unsere gute Erde fehlt in keinem. Sind Ei-
gennamen vielleicht gar keine richtigen Wr-
ter?
Um diese Vermutung genauer ausdrcken
zu knnen, fhren wir zunchst einige ter-
minologische Unterscheidungen ein. Jemand
ruft in den Wald: Ursula! Das akustische Er-
350 VI. Nominalsemantik
(2) jedoch informativ.
Zustzliche Probleme bringen Stze wie (7)
und (8):
(7) Romulus hat nicht existiert.
(8) Remus hat nicht existiert.
Wenn sie wahr sind, haben Romulus und Re-
mus keinen Trger, also auch (laut Hypothese)
keine Bedeutung. Dann enthalten die beiden
offenbar doch sinnvollen Stze als Subjekte
Ausdrcke, die keine Bedeutung haben, was
mit dem Kompositionalittsprinzip wiederum
nicht in Einklang zu bringen ist.
Mit diesen und hnlichen berlegungen
und Beispielen hat man vor allem in der ein-
schlgigen sprachphilosophischen Literatur
zu zeigen versucht, da die Semantik der Ei-
gennamen komplizierter ist, als es die reine
Benennungstheorie wahrhaben will.
Eine Antwort auf die Frage der Informa-
tivitt von Identittsaussagen geben wir in
Abschnitt 5.2. Das Problem der Namen in
intensionalen Kontexten wird in Abschnitt
6.2.2 gelst. Wie man Stze wie (7) oder (8)
in einer Theorie der Eigennamen behandeln
kann, errtern wir in 7.2. Doch bevor wir
unsere eigenen Lsungsvorschlge bringen,
schauen wir, wie die sog. Deskriptionstheorie
mit den Schwierigkeiten fertig wird, mit der
die Bennennungstheorie zu kmpfen hat.
3. Namen als verkleidete
Kennzeichnungen
Probleme, wie sie die Stze (2)(8) fr eine
Auffassung der Namen als reine Benennun-
gen stellen, treten in hnlicher Form bei einer
allzu einfachen Interpretation von Kennzeich-
nungen auf. Eine Lsung die Russellsche
Kennzeichnungstheorie (s. Artikel 22), nach
der Kennzeichnungen Quantoren sind lt
sich auch direkt auf die logische Analyse der
Eigennamen bertragen. Danach entspricht
jedem natrlichsprachlichen Namen N ein
Prdikat P
N
(N-sch zu sein). Der Name N
wird dann durch die Kennzeichnung der/die/
das P
N
wegparaphrasiert, wobei letztere als
Quantor (es gibt genau ein P
N
, und fr dieses
gilt:) aufgefat wird. Eine prdikatenlogi-
sche Paraphrase von z. B. (2) she nach dieser
Methode dann so aus:
(9) x y x y ([P
Konfuzius
(x) x = x]
[P
Kung-tse
(y) y = y] x = y)
Diese Analyse von Eigennamen als Quanto-
ren liefert nur dann eine adquate Beschrei-
Frau handelt. In einem gewissen Sinne sind
wir also berechtigt, das Merkmal weiblich
als ein Element der systematischen Bedeutung
von Ursula anzusehen. Doch der Hrer iden-
tifiziert nicht (oder nicht allein) aufgrund die-
ser Information ber das Geschlecht das In-
dividuum, von dem die Rede ist. Ein solches
Merkmal bildet also auf keinen Fall den Kern
der gesuchten Bedeutung.
2. Namenstrger als Bedeutungen
Als eine erste Hypothese bietet sich an, die
Bedeutung von Ursula dem Individuum, das
diesen Namen trgt, gleichzusetzen. Wir wer-
den diese Hypothese als (reine) Benennungs-
theorie bezeichnen. In die durch (1) ausge-
drckte Proposition geht das Individuum Ur-
sula ein, und der Beitrag, den ein Name zur
Bedeutung eines Satzes, in dem er vorkommt,
leistet, besteht darin, fr dieses Individuum
zu stehen. Gegen eine solche Sichtweise schei-
nen eine Reihe von Beobachtungen zu spre-
chen, die im wesentlichen auf Frege zurck-
gehen. Da die Diskussion der Methode, die
man zur Lsung der Fregeschen Probleme fr
gewhnlich benutzt, schon fast zum traditio-
nellen Einstieg in die Semantik der Eigenna-
men geworden ist, beginnen auch wir unsere
Darstellung mit der Errterung dieser Pro-
bleme.
Betrachten wir zunchst einige Beispiele.
(2) Konfuzius ist niemand anders als Kung-
tse.
(3) Zhangsan glaubt, da Konfuzius ein r-
mischer Redner war.
(4) Zhangsan glaubt, da Kung-tse ein r-
mischer Redner war.
(5) Zhangsan glaubt nicht, da Konfuzius
mit Kung-tse identisch ist.
(6) Zhangsan glaubt nicht, da Konfuzius
mit Konfuzius identisch ist.
Wenn (2) gilt, so haben Konfuzius und Kung-
tse denselben Referenten (denselben Namens-
trger). Nach unserer Annahme mten sie
also auch bedeutungsgleich sein. Mit Hilfe des
Kompositionalittsprinzips kann man dann
schlieen, da auch (3) und (4) sowie (5) und
(6) dieselben Wahrheitsbedingungen besitzen,
was zumindest auf den ersten Blick nicht kor-
rekt zu sein scheint.
Wenn Konfuzius und Kung-tse denselben
Referenten haben, ist es auerdem nicht auf
den ersten Blick zu sehen, wie (2) selbst etwas
anderes ausdrcken knnte als die Identitt
eines Individuums mit sich selbst. Intuitiv ist
16. Eigennamen 351
von (13)) nicht immer zu funktionieren schei-
nen, lt sich dann leicht erklren. Neben den
de-re-Lesarten (12) und (15) besitzen (10) und
(11) nmlich noch jeweils eine de-dicto-Lesart,
und zwar (16) bzw. (17).
(16) Zhangsan glaubt: x x ([P
Konfuzius
(x)
x = x]
x war ein rmischer Redner)
(17) Zhangsan glaubt: x x ([P
Kung-tse
(x)
x = x]
x war ein rmischer Redner)
Der Schlu von (10) auf (11) wird im allge-
meinen schon dann blockiert, wenn nur einer
der beiden Stze de dicto interpretiert wird.
Deutet man Eigennamen durch Indivi-
dualbegriffe, so lt sich diese Art der Ana-
lyse des Zusammenhangs zwischen (10) und
(11) nur unter Zuhilfenahme einer Relation
Erf wiedergeben, welche besagt, das ein In-
dividuum unter einen Individualbegriff fllt,
ihn also erfllt. Die entsprechenden Analysen
von (10) wren dann:
(18) xErf(x, K) Zhangsan glaubt: x war
ein rmischer Redner)
(19) Zhangsan glaubt: K war ein rmischer
Redner.
Dabei steht K fr den Individualbegriff, der
dem Namen Konfuzius entspricht. In (18) ist
dann (wie in (12)) eine offene Proposition
Gegenstand von Zhangsans Glauben; in (19)
hingegen ist es die Proposition, die aus der
Kombination des Sinnes (der Intension) K
von Konfuzius mit dem (der) von war ein
rmischer Redner entsteht.
Ein weiterer Vorteil der Auffassung von
Namen als Quantoren ist die relativ nahelie-
gende Paraphrase (21) von negativen Exi-
stenzaussagen wie (20); das Tempus haben wir
dabei allerdings vernachlssigt.
(20) Sherlock Holmes hat es nicht gegeben.
(21) xP
Sherlock Holmes
(x)
Bei einer Interpretation von Namen durch
Individualbegriffe mte man so etwas wie
partielle Konzepte zulassen, also solche, die
nicht fr alle Situationen definiert sind. Zu-
dem sollte dann noch garantiert werden, da
die nchstliegende Formalisierung von (20),
nmlich (22), auch wirklich wahr wird, wenn
das Konzept H (fr Sherlock Holmes) leer-
luft.
(22) x Erf (x, H)
Es sollte erwhnt werden, da sich die soeben
dargestellten Schwierigkeiten allesamt aus der
Frege-Carnapschen Kennzeichnungstheorie
direkt ergeben und nicht aus den speziellen
bung der mit (2)(8) verbundenen Probleme,
wenn eine extensionale Gleichheit zweier Pr-
dikate P
N
und P
N
also Identitt oder
Nicht-Existenz der Namenstrger nicht die
Bedeutungsgleichheit der (z. B. intensional in-
terpretierten) Prdikate P
N
und P
N
impliziert.
Erst dann ist nmlich garantiert, da z. B. die
in (3) und (4) eingebetteten Stze trotz der
Wahrheit von (2) wirklich etwas verschiedenes
bedeuten knnen.
Im Prinzip knnte man die einem Namen
N entsprechende Kennzeichnung der/die/das
P
N
statt wie in (9) als Quantor auch im
Sinne der Frege-Carnapschen Kennzeich-
nungstheorie (s. Artikel 22) als Individualbe-
griff (Individuenkonzept, Art des Gegeben-
seins) interpretieren, also durch eine Funk-
tion, die je nach Situation (Index, mglicher
Welt) ein Objekt, nmlich den (eindeutig be-
stimmten) Besitzer der Eigenschaft P
N
spezi-
fiziert. Auch hier mte man dann eine inten-
sionale Verschiedenheit von z. B. P
Kung-tse
und
P
Konfuzius
annehmen.
Ein Vorteil der Auffassung von Namen als
Quantoren gegenber dieser zweiten ist der,
da sie eine einfache Erklrung der Tatsache
erlaubt, da Schlsse wie der von (10) auf
(11) gelegentlich zulssig sind. Unter Rck-
griff auf die Russell-Paraphrase der Kenn-
zeichnung P
Konfuzius
kann man nmlich (10)
eine sog. de-re-Lesart (12) unterlegen, nach
der Zhangsan etwas ber Konfuzius, also
Kung-tse, glaubt.
(10) Zhangsan glaubt, da Konfuzius ein r-
mischer Redner war.
(11) Zhangsan glaubt, da Kung-tse ein r-
mischer Redner war.
(12) x x ([P
Konfuzius
(x) x = x]
[Zhangsan glaubt: x war ein rmischer
Redner])
Da nun die Identittsbehauptung (13) nach
der Russellschen Kennzeichnungstheorie auf
so etwas wie (9), hier wiederholt als (14) hin-
ausluft, folgt in der Tat (11) aus prdikaten-
logischen Grnden vorausgesetzt, man
analysiert es im Sinne von (15).
(13) Konfuzius und Kung-tse sind ein und
derselbe.
(14) x y x y ([P
Konfuzius
(x) x = x]
[P
Kung-tse
(y) y = y] x = y)
(15) x x ([P
Kung-tse
(x) x = x]
[Zhangsan glaubt: x war ein rmischer
Redner])
Auch die Tatsache, da solche Schlsse wie
der von (10) auf (11) (unter Voraussetzung
352 VI. Nominalsemantik
Namen Aristoteles definiert ist (dessen Refe-
renz es ja erst festlegen soll) und da es den
Namenstrger eindeutig identifiziert (was wir
zumindest einmal voraussetzen wollen). Als
nchstes bringen wir Aristoteles in den Be-
reich eines Modaloperators, und zwar so:
(23) Es verhlt sich notwendigerweise so, da
Aristoteles der Lehrer Alexanders war.
Die in (23) ausgedrckte Modalitt wollen
wir dabei als metaphysische Notwendigkeit,
also als Wahrheit in allen mglichen Welten,
auffassen. (ber das eingebettete Prteritum
sehen wir aus Einfachheitsgrnden still-
schweigend hinweg.) Gem der Analyse, die
wir in Teil 3 fr das Verhalten der Namen in
Glaubenskontexten gegeben haben, besitzt
(23) mindestens zwei Lesarten. Die der de-
dicto Lesart entsprechende Interpretation be-
sagt, da es sich in jeder mglichen Welt so
verhlt, da es genau ein Individuum gibt,
das Alexander unterrichtet hat, und da die-
ses Individuum Alexander unterrichtet hat.
Die andere Lesart (de re) sagt, da es genau
ein Individuum gibt, das Alexander unter-
richtet hat, und da dieses Individuum in
allen mglichen Welten Alexander unterrich-
tet hat; diese Lesart besagt also, da Aristo-
teles die Eigenschaft, Alexanders Lehrer zu
sein, mit metaphysischer Notwendigkeit zu-
kommt. Whrend nun diese zweite Lesart
dem blichen Verstndnis von (23) recht nahe
kommt, scheint die erste nicht belegt zu sein.
Um die unerwnschten Lesarten auszu-
schalten, knnte man eine Skopuskonvention
vorschlagen, nach welcher die (als Quantoren
aufgefaten) Kennzeichnungen, die den Ei-
gennamen entsprechen, den Modaloperato-
ren gegenber, die von den epistemischen
Operatoren scharf zu trennen wren, immer
weiten Skopus htten. Da es jedoch um
mehr als nur Quantorenskopus geht, zeigt
eine Betrachtung des modalen Status nicht
modalisierter Aussagen.
(24) Alexanders Lehrer war Aristoteles.
Laut Deskriptionstheorie hat (24) die Lesart
(25):
(25) x x [[Alexanders-Lehrer(x) x
= x] Alexanders-Lehrer(x)]
Demnach wre (24) unter der Voraussetzung,
da Aristoteles existiert hat, tautologisch.
Dies kann aber nicht sein, denn Aristoteles
htte sicher auch zurckgezogen leben kn-
nen und dann nie den Auftrag erhalten, einen
Knigssohn zu erziehen.
Hier kann keine Skopuskonvention helfen,
da der Skopus der Aristoteles entsprechenden
Anwendungen derselben auf Paraphrasen
(der/die/das P
N
) von Eigennamen (N). Wei-
terhin soll nicht verschwiegen werden, da
sich diese Probleme zwar alle lsen lassen,
aber eben nur um den Preis einer Theorie, die
komplizierter ist, als sie sich auf den ersten
Blick darstellt.
Wie immer man nun die kennzeichnenden
Paraphrasen der/die/das P
N
im einzelnen in-
terpretiert, so scheint doch schon jetzt eines
klar zu sein: die Auffassung von Namen als
verkleideten Kennzeichnungen, die sog. De-
skriptionstheorie der Eigennamen, ist offenbar
in der Lage, die in Abschnitt 2 angesproche-
nen Probleme, auf die eine naive Benennungs-
theorie sofort stt, auf befriedigende Weise
zu lsen. Ein weiterer Vorteil der Deskrip-
tionstheorie liegt zudem darin, da man mit
ihr auch leicht erklren kann, wie ein Name
referiert, d. h. auf welche Weise die Bedeutung
eines Namens N Aufschlu darber gibt, wer
Ns Namenstrger ist: nach der Deskriptions-
theorie ist nmlich der Referent von N das-
jenige (aufgrund von P
N
) eindeutig bestimm-
bare Individuum, welches die durch P
N
aus-
gedrckte Eigenschaft besitzt. Dennoch hat
auch diese Theorie ihre Schattenseiten, denen
wir uns jetzt zuwenden werden. Einerseits
kann man mit der Deskriptionstheorie das
Verhalten der Eigennamen in bestimmten
opaken Kontexten, namentlich in modalen
Umgebungen (Mglichkeit, Notwendigkeit
etc.), erstaunlicherweise nicht ohne weiteres
erklren. Zum anderen gibt es eine Vagheit in
der Deskriptionstheorie, die zu beseitigen er-
hebliche Schwierigkeiten bereitet; gemeint ist
die Bestimmung des einem Namen N entspre-
chenden, den Namenstrger identifizierenden
Prdikates P
N
. In den beiden nun folgenden
Teilen 4 und 5 werden eben diese Probleme
nacheinander abgehandelt.
4. Eigennamen in modalen Kontexten
4.1Ein Problem fr die
Deskriptionstheorie
Wir betrachten zunchst einen beliebigen Ei-
gennamen, z. B. Aristoteles, und ein (gem
Deskriptionstheorie) dazugehriges Prdikat
P
Aristoteles
. Obwohl es fr das darauffolgende
Argument unerheblich ist, nehmen wir der
Anschaulichkeit halber einmal an, P
Aristoteles
wre das Prdikat Lehrer Alexanders zu sein;
wichtig ist eigentlich nur, da es sich um ein
Prdikat handelt, welches unabhngig vom
16. Eigennamen 353
Bndeltheorie. Im nchsten Abschnitt wollen
wir untersuchen, wie die Deskriptionstheorie
modifiziert werden kann, damit wenigstens
ihre Grundidee gerettet werden kann.
4.2Namen als starre Designatoren
Die Schwierigkeiten, die die Modalitten fr
die Deskriptionstheorie bereiten, lassen sich
auf einen einfachen Nenner bringen; nicht der
Inhalt der Kennzeichnung der/die/das P
N
ist
es, welcher fr die Bestimmung des modalen
Status von Stzen, in denen ein Name N
vorkommt, eine Rolle spielt, sondern das
durch diese Kennzeichnung jeweils festgelegte
Individuum. Es scheint also, als habe die reine
Benennungstheorie zumindest einen wahren
Kern, da sie den rger mit den Modalitten
vermeidet. Eine Art Kompromi zwischen
den beiden Anstzen knnte sich demnach als
Ausweg erweisen. Ein solcher Kompromi ist
die zweidimensionale Namenstheorie oder
kurz: die 2D-Theorie. (Das D soll dabei zu-
gleich an Deskription erinnern, da es sich um
eine, wenn auch erhebliche Modifikation der
Deskriptionstheorie handelt.) Die 2D-Theorie
besagt, da die einem Namen entsprechende
Kennzeichnung (zumindest in gewissen Um-
gebungen) rein benennend oder starr inter-
pretiert werden soll. Um klarzustellen, was
das heit, sei zunchst der Begriff der Starr-
heit eingefhrt. Der Einfachheit halber und
der Tradition gem fhren wir diesen Begriff
im Rahmen der Frege-Carnapschen Kenn-
zeichnungstheorie ein und berlassen den Le-
sern die (etwas umstndliche) bertragung
auf die Russellsche Quantoren-Paraphrase
von Kennzeichnungen.
Ein Individualbegriff, also eine Funktion
f, die Situationen (oder Welten) Individuen
zuordnet, heit starr (engl. rigid), falls fr jede
Situation, fr die f definiert ist, dasselbe In-
dividuum als Wert geliefert wird, falls also fr
beliebige Welten w und w im Definitionsbe-
reich von f gilt: f(w) = f(w). Ein sprachlicher
Ausdruck, der einen starren Individualbegriff
zum Inhalt hat, heit dann ein starrer Des-
ignator (engl. rigid designator). Nach der
Frege-Carnapschen Kennzeichnungstheorie
wre also z. B. die kleinste natrliche Zahl ein
die Null bezeichnender starrer Designator; die
Eigennamen laut Deskriptionstheorie ent-
sprechenden Kennzeichnungen sind hingegen
im allgemeinen keine starren Designatoren.
Man kann nun aber einen Diagonalisierungs-
Operator (s. Artikel 9) namens dthat definie-
ren, der aus beliebigen Kennzeichnungen
starre Designatoren macht. Sei nmlich eine
Kennzeichnung sozusagen maximal ist. Fol-
gendes Ergebnis knnen wir also vorerst fest-
halten: Ohne Skopuskonvention weist die De-
skriptionstheorie Stzen, in denen Eigenna-
men in modalen Kontexten auftreten, gewisse
tautologische bzw. widersprchliche Lesarten
zu, die diese offensichtlich nicht besitzen.
Doch auch nach Einfhrung einer auf Mo-
daloperatoren beschrnkten Skopuskonven-
tion bleiben Stze, in denen dem Namens-
trger eine dem Namen entsprechende Kenn-
zeichnung zugeschrieben wird, problematisch.
In der vorigen Argumentation wurde an-
genommen, da sich alle Sprecher ber eine
Deskription geeinigt htten, eine Annahme,
die sicherlich nicht realistisch ist. Ein echter
Fregianer wrde sagen, da der Sinn eines
Namens von Sprecher zu Sprecher variiert.
Er vertritt demnach eine Art von Theorie, die
in der Literatur unter dem Namen Bndel-
theorie bekannt ist. Nach dieser Theorie
knnte (24) nun durchaus falsch sein, weil ja
ein uerer den Namen Aristoteles vielleicht
im Sinne von der vielseitigste griechische Phi-
losoph versteht. Abgesehen davon, da diese
semantische Relativitt gewisse Probleme mit
sich bringt, lt sie sich durch folgendes Ar-
gument widerlegen: man bilde einen Satz, der
als Prdikat statt z. B. Alexanders Lehrer die
Disjunktion ber alle bei den Sprechern gn-
gigen Kennzeichnungen enthlt; dieser Satz
ist nun fr jeden Sprecher notwendig wahr.
Da diese Disjunktion offensichtlich vom Zu-
fall abhngt (nicht jede Sprachgemeinschaft
wird ber dieselben Kennzeichnungen verf-
gen), scheint dieses Ergebnis zumindest ber-
raschend. Es ist sogar vllig unakzeptabel,
wenn man bedenkt, da es in der Standard-
Mgliche-Welten-Semantik genau eine not-
wendig wahre Proposition gibt. Wenn man
jedoch diese Annahme (die sowieso an an-
deren Stellen rger macht) fallen lassen
knnte, so wrde die Argumentation fr den
Fregianer besser aussehen. Man knnte dann
nmlich fr den disjunktiven Satz bei jedem
Sprecher eine eigene Lesart voraussetzen, bei
der sichtbar wre, da der jeweilige Sprecher
den Satz nur deshalb fr logisch wahr hlt,
weil er in der Disjunktion seine eigene Kenn-
zeichnung wiedererkennt. Der Satz wre dann
fr den Sprecher, der fr Aristoteles die Kenn-
zeichnung Alexanders Lehrer benutzt, nur
deshalb notwendig wahr, weil (24) fr ihn
notwendig wahr ist. Dies wre nun ein Er-
gebnis, mit dem man leben knnte.
In der Standard-Mgliche-Welten-Seman-
tik gibt es aber hier kein Entrinnen fr die
354 VI. Nominalsemantik
eine kennzeichnungstheoretische Notations-
Variante der reinen Benennungstheorie hin-
aus. Insbesondere htte man also keine Er-
klrung fr die Referenz von Eigennamen.
Die gesuchten P
N
mssen eben nicht nur den
jeweiligen Namenstrger eindeutig identifizie-
ren; die Entsprechung N : P
N
mu auch in
dem Sinne im Regelsystem der Sprache ver-
ankert sein, da die Verwendung von N bei
allen Sprechern unter Rckgriff auf P
N
erklrt
werden kann. Fr N = Konfuzius sind damit
z. B. auch solche speziellen Eigenschaften P
N
ausgeschlossen wie chinesischer Religionsstif-
ter aus dem 6.5. Jahrhundert v. Chr.
Besser geeignete Kandidaten scheinen dann
schon eher solche P
N
zu sein, die mit dem
Gebrauch von N als Namen wesentlich zu-
sammenhngen. Die Namenstrger-Relation
selbst ist natrlich ausgeschlossen sie soll
ja gerade erst definiert werden und auch
der direkte Rckgriff auf die Namensgebung
(Person, die auf den Namen Konfuzius getauft
wurde) verbietet sich in vielen Fllen: Konfu-
zius ist ein lateinischer Name, auf den sein
Trger nie getauft wurde. Allerdings lt sich
jede Verwendung eines Eigennamens insofern
auf die Namensgebung zurckfhren, als je-
der einzelne Sprecher den von ihm benutzten
Namen irgendwann einmal gelernt, also von
einem anderen Sprecher bernommen hat.
Auf diese Weise ergibt sich eine Kette von
bernahmesituationen, an deren Anfang der
Taufakt, die Namensgebung, steht. Diese
Kette, die wir von nun an als Tradition (fr
den betreffenden Namen) bezeichnen wollen,
stellt also eine Verbindung zwischen Sprecher
in einer uerungssituation und Namenstr-
ger her. Aus dieser berlegung ergibt sich die
folgende Bestimmung von P
N
.
(27) Ein Individuum x erfllt das Prdikat
P
N
definitionsgem genau dann, wenn
gilt: x steht am Anfang der einschlgigen
Tradition fr N.
Diese Festlegung bedarf einiger Erluterung.
Zunchst einmal sollte klar sein, da P
N
nach
ihr nicht nur den Namenstrger eindeutig
identifiziert, sondern auch als konventionell
verankert gelten kann: P
N
lt sich schema-
tisch auf beliebige Eigennamen N beziehen
und stellt somit keine speziellen Anforderun-
gen an die einzelnen Sprecher. Andererseits
handelt es sich auch nicht um eine triviale
Relation, die lediglich zu einer starren Kenn-
zeichnung des Namenstrgers fhrte: welches
die einschlgige Tradition eines Namens ist
und wer an ihrem Anfang steht, hngt von
den Umstnden ab. Da der entsprechende
Kennzeichnung, die in einem Kontext c den
Individualbegriff f zum Inhalt hat, und sei w
c
die Welt, in der c realisierbar ist (die Kon-
textwelt von c). Dann ist der Inhalt von
dthat() in c derjenige (starre) Individualbe-
griff g, der jeder Welt w als Wert f(w
c
) zu-
weist:
(25)
dthat()
c
(w) = g(w) = f(w
c
) =
c
(w
c
)
Man beachte, da nach dieser Theorie die
Inhalte
c
von Ausdrcken kontextab-
hngig sind; das wird normalerweise unab-
hngig motiviert (s. Artikel 9) und macht das
Zweidimensionale an der 2D-Theorie aus, die
wir jetzt wie folgt formulieren knnen: ein
Eigenname N lt sich paraphrasieren durch
(26) dthat(der/die/das P
N
),
wobei P
N
(wie in der ursprnglichen Deskrip-
tionstheorie) ein N entsprechendes Prdikat
ist, das den Namenstrger eindeutig festlegt.
Wie man leicht sieht, sind Namen nach der
2D-Theorie starre Designatoren, die auf den
Namenstrger verweisen. Die Probleme mit
den Modalitten sind damit offenbar gelst.
Gleichzeitig erhlt die 2D-Theorie einen we-
sentlichen Aspekt der Deskriptionstheorie:
die Frage, worauf Eigennamen referieren,
wird unter Verweis auf die den Namen ent-
sprechenden Kennzeichnungen beantwortet.
Es drngt sich allerdings der durchaus be-
rechtigte Verdacht auf, da man sich durch
die postulierte Starrheit der Eigennamen die
Fregeschen Probleme (aus Teil 2) wieder ein-
gehandelt hat, die zur Verwerfung der reinen
Bennenungstheorie gefhrt haben. Bevor wir
jedoch diesem Verdacht nachgehen, widmen
wir uns dem anderen offenen Problem der
Deskriptionstheorie, das sich fr die 2D-
Theorie natrlich genauso stellt: was ist der
Zusammenhang zwischen einem Namen und
dem ihm entsprechenden, den Namenstrger
eindeutig identifizierenden Prdikat?
5. Was Eigennamen bedeuten
5.1Die Festlegung der Referenz
Gesucht sind jetzt die Prdikate P
N
, die man
in die Paraphrasen (26) von Eigennamen N
einsetzen kann. Es htte dabei wenig Sinn, als
P
N
jeweils die Eigenschaft zu nehmen, mit
dem Namenstrger identisch zu sein. Wenn
nmlich n ein starrer Designator des Namens-
trgers von N ist, so luft die Paraphrase
dthat (das mit n identische Individuum) auf
16. Eigennamen 355
zwischen einer Analyse, die fr alle Eigenna-
men dieselbe, rein schematische Bedeutung
ansetzt (das, was am Anfang der einschlgi-
gen Tradition fr den gerade geuerten Ei-
gennamen steht) und einer der Disambiguie-
rung echter Homonyme analogen tiefenstruk-
turellen Aufspaltung referenzambiger Namen
in mehrere Wrter mit jeweils eigenem Cha-
rakter. Die eine, abstraktere Alternative hat
gegenber (27) den Nachteil, da sie in der
Praxis eine recht unhandliche Zerstckelung
des Kontextes in einzelne Teiluerungen vor-
aussetzt. (Vgl. dazu den Artikel 9.) Die zweite
Mglichkeit ist im wesentlichen die Benen-
nungstheorie: wenn zum disambiguierten Na-
men bereits seine Verwendungstradition ge-
hrt, dann ist nur diese fr ihn einschlgig.
5.2Bedeutung und Inhalt
Nach der 2D-Theorie sind Eigennamen starre
Designatoren. Darin besteht die groe Ge-
meinsamkeit zwischen der 2D-Theorie und
der reinen Benennungstheorie. Wo liegt nun
der Unterschied zwischen den beiden Theo-
rien? Vielleicht mag es scheinen, als seien die
beiden Theorien gleich, denn beiden zufolge
besteht der Beitrag eines Eigennamens zum
Satzinhalt (= Proposition) in seiner (direk-
ten) Bezugnahme auf den Namenstrger.
Diese Gemeinsamkeit der beiden Theorien
lt sich etwas salopp durch die Glei-
chung
(28) Inhalt = Referenz
charakterisieren: sowohl nach der reinen Be-
nennungstheorie als auch nach der 2D-Theo-
rie ist (28), wenn man es auf Eigennamen
einschrnkt, korrekt. (Man mu dazu freilich
die starren Namensinhalte der 2D-Theorie
mit ihren konstanten Werten identifizieren;
diese Subtilitt wollen wir aus Einfachheits-
grnden ignorieren.) In gewisser Weise besagt
die reine Benennungstheorie nicht mehr als
(28), d. h. sie erschpft sich in einer Inhalts-
angabe fr Eigennamen, und diese Inhalts-
angabe besteht in einem Verweis auf den Re-
ferenten. Fat man die Benennungstheorie
jedoch als semantische Theorie auf, also als
Theorie darber, was Eigennamen bedeuten,
so mu man zu (28) wie wir es getan haben
stillschweigend eine weitere, weitaus ge-
wagtere Behauptung hinzufgen. Es ist dies
die Gleichung:
(29) Bedeutung = Inhalt
(Auch (29) soll natrlich nur in bezug auf
Eigennamen betrachtet werden.) Das Pro-
Eigenname N dennoch starr auf den Namens-
trger referiert, ist einzig und allein das Werk
des in ihm (nach der gegenwrtigen Theorie)
impliziten dthat-Operators.
Diese semantische Beschreibung der Eigen-
namen behandelt dieselben analog zu Perso-
nalpronomina wie ich (s. Artikel 9), wo man
auch zwei Ebenen der Bedeutung unterschei-
det: zum deskriptiven Gehalt, der im Falle von
ich in etwa auf die Beschreibung der/die Spre-
cher/in hinausluft, tritt noch eine Kompo-
nente der direkten Referentialitt, die durch
einen dthat-Operator beigetragen wird und
zur Folge hat, da ich nicht so etwas wie der
jeweilige Sprecher heit, sondern eher durch
die gegenwrtige, tatschliche Sprecherin pa-
raphrasiert werden sollte. Der deskriptive Ge-
halt liefert also das Kriterium, nach dem der
Referent von ich bestimmt wird, whrend die
direkte Referentialitt sichert, da nicht die-
ses Kriterium, sondern der Referent selbst die
Rolle der Intension spielt. Anstatt nun diese
beiden Bedeutungskomponenten getrennt
voneinander zu betrachten, ist es blicher und
zweckmiger, beide durch die einzige Funk-
tion (im mathematischen Sinn des Wortes)
darzustellen, welche uerungssituationen
(oder Kontexten) und Welten (oder auch
Welt-Zeit-Paaren) Extensionen zuordnet.
Dem Wort ich entspricht dann die Funktion
ich
, die einem Kontext c und einer Welt w
den Sprecher in c zuordnet. Die direkte Re-
ferentialitt offenbart sich dabei in der Un-
abhngigkeit dieser Funktion von w; der de-
skriptive Gehalt macht den Rest der Defini-
tion von
ich
aus.
ich
heit auch der Charakter
des Ausdrucks ich.
Bei Eigennamen N kann also die Kenn-
zeichnung der/die/das P
N
als deskriptiver Ge-
halt fungieren, da mit ihr der Namenstrger
bestimmt wird; wegen des dthat-Operators
bleibt die fr modale Kontexte bentigte di-
rekte Referentialitt der Eigennamen davon
unberhrt.
Es ist zu beachten, da es sich bei (27) um
eine schematische Bestimmung der Eigen-
schaft P
N
handelt: fr verschiedene Laut-
bzw. Schriftformen N liefert diese Definition
entsprechend verschiedene Eigenschaften und
somit auch verschiedene Namensbedeutun-
gen (Charaktere). Dies hat unter anderem die
Konsequenz, da nach der 2D-Theorie der
Ortsname Frankfurt semantisch eindeutig ist,
auch wenn er auf mehrere Stdte referiert,
da sich aber andererseits diese Bedeutung
von der von Frankfort [frkft] unterschei-
det. Damit whlt (27) den goldenen Mittelweg
356 VI. Nominalsemantik
bernahmesituation) wissen, was die gerade
relevante Tradition genau ist geschweige
denn, wer am Anfang derselben steht; die
allgemeine Regel kennt er jedoch, und inso-
fern kennt er auch die Bedeutung des Na-
mens.
Die Unterscheidung zwischen Bedeutung
(= Charakter) und Referenz gibt uns auch
eine Handhabe fr die Erklrung der Infor-
mativitt von Identittsaussagen. Die durch
eine Identittsaussage wie (2) in Abschnitt 2
ausgedrckte Proposition ist zwar notwendig
wahr. Es gibt aber Kontexte, in denen die
Identitt nicht gilt, nmlich diejenigen, in de-
nen die Individuen am Anfang der einschl-
gigen Tradition der entsprechenden Namen
verschieden sind.
Die der Semantik deiktischer Pronomina
nachgebildete Unterscheidung zwischen den
Bedeutungen und den (starren) Inhalten von
Eigennamen lt sich auch auf gewisse Gat-
tungsnamen anwenden. Es gibt gute Argu-
mente dafr, da sich der Beitrag eines Wor-
tes wie Tiger zum Satzinhalt in der reinen
Benennung einer bestimmten Art von Tieren
erschpft, whrend der Zugang zu diesem
Referenten ber kontingente Eigenschaften
(Gestreiftheit o. .) der typischen Vertreter
dieser Gattung erfolgt. Ein anderer Zugang
ist zumindest dem durchschnittlichen kom-
petenten Sprecher auch gar nicht gegeben, da
die wesentlichen Eigenschaften, die die An-
gehrigkeit zur Gattung determinieren, zu-
meist nicht angebbar sind. Von gewissen Ei-
gennamen, insbesondere von Personenna-
men, liee sich dasselbe behaupten. Es
scheint, als knne man auf bestimmte Gegen-
stnde wie Personen oder natrliche Arten
nur dann direkt, d. h. mit Hilfe starrer Desi-
gnatoren, Bezug nehmen, wenn diese Desi-
gnatoren ihrerseits wieder von nicht-essen-
tiellen Eigenschaften der Referenten abhn-
gen.
Der Mangel an essentiellen Kriterien zur
Festlegung eines Referenten ist jedoch keine
notwendige Bedingung dafr, da ein Wort
modo nominis proprii gebraucht wird. So wer-
den z. B. neue industrielle Produkte oft durch
(in dieser Verwendung zumeist kurzlebige) Ei-
gennamen bezeichnet, obwohl sich fr sie
prinzipiell auch begriffliche Umschreibungen
angeben lieen. (Ein Beispiel ist die in
Deutschland bliche Bezeichnung Aspirin fr
Acetylsalicylsuretabletten.) Der Grund der
Bevorzugung von Namen liegt hier sicherlich
in der groen semantischen Flexibilitt der-
selben: man kann immer eine neue Namens-
blem ist dann, da aus (28) und (29) aufgrund
gewisser identittslogischer Gesetze (30) folgt:
(30) Bedeutung = Referenz
Die Bedeutung eines (disambiguierten) Ei-
gennamens wre danach sein Namenstrger.
Dies allerdings steht im Konflikt mit einem
allgemeinen Anspruch, der fr gewhnlich an
einen Bedeutungsbegriff im Rahmen einer lin-
guistischen Theorie gestellt wird, da nmlich
die Beziehung zwischen den Ausdrcken ent-
sprechenden Bedeutungen im konventionel-
len Regelsystem der Einzelsprache verankert
ist. Insbesondere sollte bei jedem Ausdruck
der Sprache zumindest ein groer Teil der
kompetenten Sprecher wissen, was dieser
Ausdruck bedeutet. Doch obwohl bei Eigen-
namen stets klar ist, auf welche Weise sie
referieren (wenn sie referieren!), sind doch
dem einzelnen Sprecher nur relativ wenige
Referenten als Namenstrger bekannt. Eine
grere berschneidung ergibt sich dann nur
bei berhmten Persnlichkeiten, Orten oder
Produkten, so da die Gleichung (30) zwar
bei gewissen Verwendungen von Namen wie
Nixon funktioniert, im allgemeinen aber ver-
sagt.
Die 2D-Theorie hingegen lt (30) auch im
Falle von Eigennamen nicht durchgehen: Be-
deutungen sind Charaktere, also Extensionen
in Abhngigkeit von Kontexten und Welten
(= Indizes), und genauso, wie man die Be-
deutung des Wortes ich nicht mit dem (vor-
bergehenden) Referenten etwa Herrn Dr.
Lauben gleichsetzen darf, so darf man
Herrn Dr. Lauben auch nicht als Bedeutung
des Namens Dr. Lauben auffassen, selbst
wenn es Herr Dr. Lauben ist, der zum Satzin-
halt beitrgt, sobald jemand Dr. Lauben sagt
(und sich damit auf Herrn Dr. Lauben be-
zieht) oder Herr Dr. Lauben selbst das Wort
ich (in einer nicht-generischen, normalen
Verwendung) uert. Die Bedeutung von ich
ist nmlich immer dieselbe, egal wer das Wort
uert: sie ist eine Funktion, die in jedem
Kontext den Sprecher in diesem Kontext her-
ausgreift. Ebenso ist die Bedeutung eines Ei-
gennamens stets dieselbe, egal in welchem Zu-
sammenhang der Name gebraucht wird: es
handelt sich lediglich um eine allgemeine Re-
gel zur Auffindung des Referenten unter Vor-
gabe gewisser kontextueller Informationen.
Diese Regel kann man kennen, ohne etwa in
einer konkreten uerungs-Situation ber
diese Informationen zu verfgen. Insbeson-
dere mu also nicht jeder Sprecher des Deut-
schen beim Hren eines Namens (z. B. in einer
16. Eigennamen 357
verschiedenen Zeiten gelten. Solche Details
werden offenbar von der 2D-Theorie, wie wir
sie eingefhrt haben, nicht bercksichtigt; sie
stellen aber auch keine prinzipiellen Schwie-
rigkeiten dar.
hnlich unproblematisch, in der Praxis
aber unbersichtlicher, liegt der Fall bei den-
jenigen deskriptiven Zgen der Bedeutungen
von Eigennamen, die konventionell mit der
Lautform verknpft sind, aber ber unser P
N
-
Schema (27) hinausgehen. Hierzu gehrt die
schon in Teil 1 angefhrte Geschlechtsspezi-
fitt einiger Vornamen. Es ist klar, da man
die der Namensbedeutung zugrundeliegende
Deskription in solchen Fllen einfach um wei-
tere Bedingungen (wie x ist weiblichen Ge-
schlechts) anreichern kann. Dennoch ist na-
trlich bei vielen Namens-Lautformen frag-
lich, welche deskriptiven Zge ihnen speziell
zukommen: viele geschlechtsspezifische Na-
men knnen auch als Namen fr geschlechts-
lose Gegenstnde fungieren (z. B. Georgia), so
da man das Geschlechts-Prdikat hchstens
bedingt (wenn x Mensch ist, so ist x weiblichen
Geschlechts) zur Bedeutungs-Festlegung hin-
zunehmen darf. Obwohl es hier sicherlich
noch viele Unklarheiten in den Details gibt,
scheint uns die 2D-Theorie doch fr die Be-
schreibung dieser Phnomene einen guten
Rahmen abzugeben.
Schlielich gibt es noch eine (marginale)
Gruppe von Eigennamen, die zwar auch als
Abkrzung fr eine fixierte Kennzeichnung
der Form dthat der/die/das P stehen, bei de-
nen P aber nicht die von uns angegebene P
N
-
Gestalt hat. So scheint das fr den Namen
Jack the Ripper einschlgige P so etwas wie
Mann, der 1888 in Whitechapel mindestens
sieben Prostituierte ermordet hat zu sein. Die
Hauptgrnde, die dafr sprechen, diesen
Namen so und nicht mit Hilfe unseres
P
Jack-the-Ripper
zu analysieren, knnen wir hier
nur andeuten. Einmal denotiert der Name
genau dann, wenn P von genau einem Indi-
viduum erfllt wird (was keineswegs sicher
ist). Zweitens wird man nur dann von einer
korrekten Verwendung dieses Namens spre-
chen, wenn die Zuschreibung der Eigenschaft
P nicht zu einem Informations-Gewinn fhrt:
Jack the Ripper ist P wird sofort als wahr
erkannt, wenn nur der Name Jack the Ripper
bekannt ist; der Satz ist in gewisser Weise a
priori wahr. Obwohl derartige Namen offen-
bar sehr selten sind und wohl auch nur dann
auftreten, wenn das benannte Individuum we-
der bei der Taufe noch spter als Tufling
identifiziert werden kann, mu man doch zu-
tradition begrnden, ohne wirklich eine neue
Wortbedeutung in die Sprache einzufhren.
(Die Lautform ist allerdings in der Regel neu.)
In unserer schnellebigen Zeit ist dies oft von
Vorteil.
5.3Mgliche Verfeinerungen
Die 2D-Theorie kann in der von uns darge-
stellten Form leider nicht alle mit Eigennamen
zusammenhngenden Phnomene erfassen.
In diesem Abschnitt greifen wir drei der ver-
nachlssigten Bereiche heraus, die in der vor-
hergehenden Darstellung zum Teil bereits an-
getippt wurden. In allen drei Fllen lt sich
leicht einsehen, da die Theorie prinzipiell so
modifiziert werden kann, da auch diese Bei-
spiele von ihr abgedeckt werden. Ein schwie-
rigeres Problem werden fr den Abschnitt 6.2
aufheben.
Problem Nummer Eins sind die Vernde-
rungen der Lautformen (bzw. Schriftformen)
von Eigennamen. In der Definition (27) von
P
N
haben wir so getan, als seien die Lautfor-
men N ewig und unvernderlich, von der
Taufe bis zu beliebigen spteren Verwendun-
gen des Namens. Da dem nicht immer so
ist, sieht man schon anhand eines in Teil 3
vorgebrachten Beispiels: die Form Konfuzius
ist eine (berdies an die phonetischen bzw.
orthographischen Verhltnisse des gegenwr-
tigen Deutschen angepate) Latinisierung
eines chinesischen Namens. Die relevante Tra-
dition von berlieferungssituationen dieser
Lautform fhrt also gar nicht auf die Taufe
von Kung-tse zurck, sondern nur auf eine
Einbrgerung, in der die ursprngliche chi-
nesische Form ins Lateinische bertragen
wurde. Von dieser Einbrgerungs-Situation
fhrt aber der Weg ber die Quelle der ber-
tragung zu einer chinesischen Tradition, die
bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. zurckreicht.
Um eine Namens-Tradition zu erfassen, ge-
ngen also nicht immer die bernahmesitua-
tionen derselben Lautform (im relevanten Ge-
brauch). Gelegentlich kann sich diese Form
abrupt ndern, so da man Einbrgerungen
und die damit verbundenen bernahmesitua-
tionen anderer, quivalenter Lautformen be-
rcksichtigen mu. Da berdies nicht alle
Form-Vernderungen abrupt geschehen, son-
dern die meisten mehr oder weniger schlei-
chend, z. B. aufgrund von Lautverschiebun-
gen, vor sich gehen, mte man eigentlich
sogar die Laut- und Schriftformen selbst von
den Entwicklungsstadien der Einzelsprachen
abhngig machen, so da z. B. Leibnitz und
Leibniz als Vertreter derselben Schriftform zu
358 VI. Nominalsemantik
Man beachte nun, da (33) und (34) schon
deswegen einander auszuschlieen scheinen,
weil der eine die Negation dessen ausdrckt,
was der andere besagt:
(34) Zhangsan glaubt, da Kung-tse ein r-
mischer Redner war.
Wenn nun aber wie es nicht nur die reine
Benennungstheorie, sondern auch die 2D-
Theorie behauptet der Beitrag eines Na-
mens zum Satzinhalt sich in der (starren) Be-
zugnahme auf den Namenstrger erschpft,
scheint der Schlu von (31) und (32) auf (34)
unvermeidlich. Nach unserer Voraussetzung
wren dann aber (33) und (34) gemeinsam
wahr, was nicht sein kann.
Um die 2D-Theorie vor diesem Argument
zu schtzen, kann man den kritischen Schlu
von (31) und (32) auf (34) dadurch blockieren,
da man bei Einbettung unter Einstellungs-
verben (allgemeiner: Einstellungsprdikaten)
den deskriptiven Gehalt des Namens berck-
sichtigt. Man knnte die 2D-Theorie dahin-
gehend einschrnken, da die logische Form
eines Namens N von dessen syntaktischer
Umgebung abhngig gemacht wird: kommt
N im Komplement eines Einstellungsprdi-
kats vor, so wird es im Sinne von
(35) der/die/das/P
N
interpretiert; sonst, d. h. in extensionalen, mo-
dalen etc. Umgebungen, bleibt es bei der Pa-
raphrase:
(36) dthat(der/die/das/P
N
)
Dies wrde fr (31) folgende Interpretation
ergeben:
(37) Zhangsan glaubt, da der folgende
Sachverhalt besteht: es gibt genau ein
Individuum x, so da gilt: x steht am
Anfang der einschlgigen Tradition fr
Konfuzius, und x war ein rmischer Red-
ner.
Interpretiert man nun (33) als Negation
von (34), so ergibt sich in der Tat kein Wi-
derspruch aus der von uns angenommenen
Wahrheit von (31) bis (33): da die Namen
Konfuzius und Kung-tse voneinander verschie-
den sind, unterscheiden sich auch die ein-
schlgigen Traditionen, und somit die Pro-
positionen, an die Zhangsan glaubt. Leider
ist (37) nicht immer adquat, insbesondere
dann nicht, wenn Zhangsan die Namensform
Konfuzius gnzlich unbekannt ist. Zhangsan
wre dann wohl schwerlich irgendein Glau-
ben ber die einschlgige Namenstradition zu
unterstellen. In einem solchen Fall mchte
geben, da es sich um eine Art von Eigen-
namen handelt, die wir in der 2D-Theorie
bisher nicht beschrieben haben. Es ist jedoch
klar, da sich alle diese Flle nach dem Jack-
the-Ripper-Muster durch dthat(der/die/das P)
mit P P
N
beschreiben lassen, wodurch al-
lerdings die Theorie ein wenig an Homoge-
nitt einbt: was bisher ber die Semantik
der Eigennamen gesagt wurde, trifft streng
genommen nur auf echte Eigennamen und
nicht auf die seltenen Fllen von uneigentli-
chen Namen wie Jack the Ripper zu. Da diese
Unterteilung der Namen in echte und unei-
gentliche nicht rein theorieintern ist, sieht
man brigens daran, da in den meisten Kon-
versationslexika unter einem echten Eigen-
namen steht, wer oder was der Referent ist
(Nixon: Politiker; Rom: Stadt etc.), whrend
bei einem uneigentlichen Namen erklrt wird,
worauf dieser (wahrscheinlich) referiert (Jack
the Ripper: Bezeichnung fr einen Mrder).
Ein hrterer Brocken als die soeben dis-
kutierten Phnomene ist das semantische Ver-
halten von Eigennamen in Komplementen zu
Verben der propositionalen Einstellung (s. Ar-
tikel 34). Dies gab ja auch den Anla, von
der reinen Benennungstheorie zur Deskrip-
tionstheorie berzugehen. In der 2D-Theorie
aber sind die alten Geister wieder da. Wie
man mit ihnen fertigwerden kann, soll im
nchsten Abschnitt erlutert werden.
6. Eigennamen und Einstellungen
6.1Diagonalisierungen als Nebensinne
Wir kommen jetzt auf die Beispiele zurck,
die ausschlaggebend fr die Verwerfung der
reinen Benennungstheorie waren. Sie hatten
alle mit Verben der propositionalen Einstel-
lung zu tun. Ein Fall war:
(31) Zhangsan glaubt, da Konfuzius ein r-
mischer Redner war.
Wir werden die durch diesen Satz beschreib-
baren Situationen gleich etwas genauer unter
die Lupe nehmen. Dazu nehmen wir zunchst
an, (31) wre wahr, wobei Zhangsan der
Name einer bestimmten Person sei. Weiterhin
sei die Wahrheit von (32) vorausgesetzt.
(32) Konfuzius und Kung-tse sind ein und
derselbe.
Intuitiv scheint nichts dagegen zu sprechen,
da auch (33) gilt, wobei Zhangsan wie in
(31) verwendet wird.
(33) Zhangsan glaubt nicht, da Kung-tse ein
rmischer Redner war.
16. Eigennamen 359
den Eigennamen einen hchst eigentmlichen
Status im semantischen Regelwerk ein. Ob-
wohl sich nmlich das Phnomen der Dia-
gonalisierung bei deiktischen Ausdrcken ge-
legentlich beobachten lt (oder vorsichtiger
ausgedrckt: unterstellt werden kann), ist dies
nur dann der Fall, wenn eine normale, wrt-
liche, starre Interpretation in einen Konflikt
mit irgendwelchen konversationellen Prinzi-
pien gert. Man diagonalisiert sozusagen nor-
malerweise nicht ohne irgendeinen erkenn-
baren Grund. Obwohl sich zwar ein solcher
pragmatischer Konflikt in den obigen Bei-
spielen vielleicht noch nachweisen liee, ist
dies aber nicht immer der Fall, wenn die wrt-
liche Interpretation der Namen zu einem un-
angemessenen Ergebnis fhrt; ein einschlgi-
ges Beispiel wird im folgenden Abschnitt dis-
kutiert. Wir haben daher (41) in einer allge-
meinen, ungesteuerten Form formuliert, als
Postulat einer Ambiguitt von Eigennamen
in einer ganz bestimmten syntaktischen Um-
gebung, ohne Prferenz einer der beiden Les-
arten. Insbesondere braucht also bei einer An-
wendung von (41) nicht geprft zu werden,
ob diese berhaupt angemessen ist. Auf diese
Weise liefert die Diagonalisierung in manchen
Fllen mglicherweise zu viele Lesarten.
Doch ist das nicht ihr eigentlicher Nachteil:
der folgende Abschnitt wird ein Gegenbeispiel
(und damit die Widerlegung der Hypothese
(41)) bringen, welches zeigt, da man gewisse
Lesarten von Stzen mit Namen in Einstel-
lungskontexten auch durch Diagonalisierung
nicht bekommt. Selbst wenn dieses Verfahren
also gelegentlich zu viele Lesarten vorhersagt,
so sind die richtigen nicht immer dabei.
6.2Waterloo
6.2.1Das Rtsel
Wir beginnen mit einer Geschichte, fr deren
Falschheit wir uns verbrgen: Stellen wir uns
vor, da Gereon auf einer Autofahrt durch
Belgien an einem Hinweisschild mit der Auf-
schrift Waterloo 3 km vorbeikommt. Der
Ortsname kommt ihm irgendwie bekannt vor,
und Gereon beginnt zu grbeln. In Brssel
hat er es dann geschafft: er kennt den Namen
(genauer: die Schriftform) aus seiner feier-
abendlichen Lektre geschichtswissenschaft-
licher Fachliteratur, wo er im Zusammenhang
mit einer napoleonischen Schlacht erwhnt
wurde. An eine Schlacht Napoleons gegen die
Belgier vermag sich Gereon allerdings (zu
recht) nicht erinnern, so da er (flschlicher-
weise) schliet, es msse sich um ein anderes
man eher die Lesart (40) haben, d. h. genau
die Lesart, die die 2D-Theorie in ihrer bis-
herigen Form voraussagte.
(40) Zhangsan glaubt, da der folgende
Sachverhalt besteht: dthat (derjenige, der
am Anfang der einschlgigen Tradition
fr Konfuzius steht) war ein rmischer
Redner.
Was jetzt geboten scheint, ist eine Aufwei-
chung der obigen obligatorischen Fallunter-
scheidung, also etwa folgendes: taucht ein
Name N im Komplement eines Einstellungs-
prdikats auf, so kann es normal oder de-
skriptiv, d. h. als starrer Designator (36) oder
als deskriptiver Gehalt (35), interpretiert wer-
den. Etwas salopper ausgedrckt heit dies,
da man das dthat in der logischen Praphrase
von Eigennamen wegstreichen darf, wenn
diese in Einstellungskomplementen vorkom-
men. Diesen bergang vom rein referentiellen
Inhalt eines starren Designators zu seinem
deskriptiven Gehalt bezeichnet man auch als
Diagonalisierung, weil er sich statt als Strei-
chung des dthat in den meisten Fllen auch
als Ergebnis der Anwendung eines sog. senk-
rechten Diagonaloperators (s. Artikel 9) auf-
fassen lt. Wir knnen also folgende Hypo-
these ber den Zusammenhang zwischen Ei-
gennamen und propositionalen Einstellungen
formulieren:
(41) Taucht ein Eigenname im Komplement
eines Einstellungsprdikats auf, so darf
er diagonal, d. h. durch seinen deskrip-
tiven Gehalt, gedeutet werden.
Man beachte, da der ursprnglich uner-
wnschte Schlu von (31) und (32) auf (34)
durch (41) nun zwar doch wieder legitimiert
wird, dies allerdings nur unter einer gewissen
Lesart von (31) (bzw. (34)), welche mit (33)
nicht kompatibel ist, falls dieses als Negation
von (34) (als Konklusion) aufgefat wird. Da
es aber noch eine andere, nmlich die diago-
nale Lesart gibt, nach der (31) und (33) ver-
trglich ist und der fragliche Schlu blockiert
wird, braucht uns die normale Interpretation
in diesem Zusammenhang nicht weiter zu st-
ren. Man sieht, da auch die inhaltliche Auf-
fllung der Eigennamen um die Annahme
einer Ambiguitt oder Unbestimmtheit in
mindestens einem der oben betrachteten Stze
wohl nicht umhinkommt.
Obwohl man wie hoffentlich aus der
bisherigen Diskussion klar geworden ist
mit (41) relativ weit kommt, weist dieses Prin-
zip bei nherer Betrachtung doch gewisse
Schwchen auf. Zunchst einmal rumt es
360 VI. Nominalsemantik
Lesarten zuordnen, nach denen die eingebet-
teten Teilstze einander nicht widersprechen;
sie mu gleichzeitig dafr sorgen, da beide
Stze unter den geschilderten Umstnden in
jeweils einer Lesart als wahr herauskommen.
Schauen wir nun, ob die Hypothese (41) aus
dem vorhergehenden Abschnitt all dieses lei-
sten kann.
Zunchst gilt es, bei (42) die beiden Les-
arten (42r) und (42d) zu unterscheiden, von
denen die erste (de re) besagt, da Gereon zu
einer gewissen singulren Proposition p im
Glaubensverhltnis steht, da er nmlich von
dem Ort Waterloo glaubt, er sei eine histori-
sche Sttte. Die (diagonale) Lesart (42d) hin-
gegen besagt, da Gereon an die Wahrheit
der Proposition glaubt, da es nmlich in
der Welt w, in der er sich befindet, genau
einen einschlgigen Trger fr den Namen
Waterloo gibt. (42d) ist offensichtlich mit Ge-
reons Ansichten unvereinbar und kann auf-
grund der Widerspruchsfreiheit dessen, was
Gereon glaubt, also nicht wahr sein. Wie steht
es nun mit (42r)? Wenn man fr seine Wahr-
heit argumentieren wollte, dann wohl so, da
man zeigt, da Gereon vom Gegenstand von
p, also von Waterloo, gelernt habe und daher
nach wie vor annehmen, da dieser der
Schauplatz einer Schlacht Napoleons war.
Dieses Wissen habe er nmlich durch Lektre
eines Geschichtsbuches erworben, in welchem
die Schriftform Waterloo benutzt wurde, wo-
bei man sich auf Waterloo, also den Gegen-
stand von p, bezog etc. Hlt man diese Ar-
gumentation fr korrekt, so scheint es jedoch
unumgnglich, auch der folgenden zuzustim-
men: durch Lektre des weiter oben erwhn-
ten Hinweisschildes habe Gereon vom Gegen-
stand von p gelernt, da selbiger in Belgien
liege, woraus er geschlossen habe und daher
auch nach wie vor annehme, da es sich nicht
um einen Ort von historischem Interesse han-
dele. Da Gereons Glaubensinhalt frei von lo-
gischen Widersprchen ist, hiee dies, da er
von Waterloo nicht glauben kann, es handele
sich um eine historische Sttte. Gereon knne
demnach p nicht glauben, und (42r) ist somit
falsch. Die Annahme der Wahrheit der Lesart
(42r) hat uns somit mit derselben Art von
Argument auf ihre Falschheit gefhrt, die
wir damit als nachgewiesen ansehen drfen.
An dieser Stelle sind wir schon fertig. Eine
Betrachtung von (43) erbrigt sich nmlich:
da (42d) und (42r) die einzigen Lesarten sind,
die (42) nach der Hypothese (41) besitzt, kn-
nen wir letztere in der von uns betrachteten
Fassung als widerlegt ansehen. Eine ad-
Waterloo handeln, nmlich eines, das in der
abendlndichen Geschichte nie eine Rolle ge-
spielt hat. Ende der Vorstellung! Wir fragen
uns jetzt, ob unter den oben genannten Um-
stnden der folgende Satz wahr ist:
(42) Gereon ist der Meinung, da Waterloo
eine historische Sttte ist.
Intuitiv spricht nichts gegen die Wahrheit von
(42): eingedenkt seines historischen Wissens
glaubt Gereon mit Sicherheit, da Waterloo
eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt
hat, und dieser Glaube ist ihm auf seiner
Autofahrt durch Belgien wohl kaum abhan-
den gekommen. Wie steht es nun aber mit
dem folgenden Satz?
(43) Gereon ist der Meinung, da Waterloo
keine historische Sttte ist.
Ganz analog lt sich jetzt natrlich dafr
argumentieren, da (43) ebenfalls wahr ist:
Gereons Glauben, da der Ort (namens Wa-
terloo), an dem er gerade vorbeigekommen
ist, historisch unbedeutend ist, lt sich auf
seine berzeugung zurckfhren, da kein
belgischer Ort dieses Namens in den Stan-
dardwerken der abendlndischen Geschichts-
schreibung auftaucht; diese berzeugung und
das Wissen, da Waterloo ein Ort in Belgien
ist, sind fr die Wahrheit von (43) verant-
wortlich. Sowohl (42) als auch (43) scheinen
also in der von uns geschilderten Situation
wahr zu sein.
Das Problem fr eine semantische Theorie
des Verhaltens von Namen in Einstellungs-
kontexten besteht nun darin, zu erklren, wie
(42) und (43) gemeinsam wahr sein knnen,
ohne da sich Gereons Glaubensinhalte lo-
gisch widersprechen. Es ist nmlich klar, da
sich diese Annahme unserer Geschichte leicht
hinzufgen liee, ohne da die Konsistenz
derselben zerstrt wrde: Gereon glaubt ja
lediglich, es gbe einen Ort (namens Water-
loo), welcher Schauplatz einer napoleonischen
Schlacht war etc. sowie einen Ort (namens
Waterloo), der keine historische Sttte ist, bei
Brssel liegt usw. Insbesondere knnte also
Gereons Glauben frei von Widersprchen
sein (was wir von jetzt an auch annehmen
wollen). Andererseits sieht es so aus, als im-
pliziere die Wahrheit von (42) und (43), da
Gereon an das Bestehen und an das Nicht-
Bestehen ein und desselben Sachverhaltes
glaube, da also seine Glaubensinhalte mit-
einander unvertrglich wren. Eine semanti-
sche Theorie, die die Wahrheitsbedingungen
von (42) und (43) korrekt beschreiben will,
mu also diesen Stzen zumindest gewisse
16. Eigennamen 361
langt sein, es gbe neben dem Schlachten-
schauplatz und dem Brsseler Vorort keine
andere Stadt dieses Namens. Offenbar ist
dann Gereons Ansicht, von der (43) wahr-
heitsgem berichtet, ein Irrglaube. Was bei
(43d) verlorengeht, scheint also ein gewisser
singulrer Aspekt der wahren Lesart von (43)
zu sein: Gereon liegt ja deswegen schief, weil
das Waterloo, von dem er glaubt, es sei so
unbedeutend, in Wirklichkeit der ehemalige
Schlachtenschauplatz ist. Auch diese letzte
Anstrengung, die Diagonalisierungs-Hypo-
these zu retten, scheint uns somit gescheitert
zu sein, und wir haben uns nach etwas Neuem
umzuschauen.
6.2.2Des Rtsels Lsung
Bevor wir (wie Napoleon) endgltig an Wa-
terloo scheitern, wollen wir als letzte Strategie
eine Disambiguierung des Eigennamens Wa-
terloo nach seinen Gebrauchsweisen aufbie-
ten: immerhin ist es nicht abwegig anzuneh-
men, da der ganze rger mit (42) nur da-
durch entsteht, da Gereon den Namen an-
ders gebraucht als wir. Ein genauerer Blick
auf diese Taktik entlarvt sie jedoch als Schein-
lsung. Denn entweder handelt es sich bei
Gebrauchsweisen von Eigennamen um auf
eine gemeinsame Namensgebung zurckge-
hende und sich im wesentlichen durch die
Namenstrger unterscheidende globale Ver-
wendungsweisen wie sie etwa in einem
Konversationslexikon unterschieden werden;
oder die Gebrauchsweisen sind lokaler ge-
meint, etwa im Sinne von Traditionsketten,
auf denen der Namen von Sprecher zu Spre-
cher berreicht wird. Nach der ersten Inter-
pretation findet keine Disambiguierung statt,
denn es gibt nur ein (fr das Beispiel einschl-
giges) Waterloo; und im zweiten Sinne wrde
Gereon eine Einstellung zum Gebrauch des
Namens Waterloo durch den uerer von
(42) zugewiesen, ber den er jedoch gar nichts
zu wissen braucht. Natrlich hilft auch die
soeben angesprochene Diagnonalisierung
nicht weiter, weil bei einer Mehrdeutigkeits-
Auffassung die Eigennamen nicht mehr kon-
textabhngig sind und die Diagonalisierung
somit leerluft.
Aus der ausfhrlichen Diskussion des Wa-
terloo-Beispiels haben wir gesehen, da die
Analyse von Einstellungs-Prdikaten als Re-
lationen zwischen dem Subjekt und der durch
den Komplementsatz ausgedrckten Pro-
position zumindest dann zu Schwierigkeiten
fhren kann, wenn cp einen Eigennamen N
enthlt. Insbesondere hat sich die radikale de-
quate Semantik der Namen in Einstellungs-
kontexten sollte ja unter den geschilderten
Umstnden mindestens eine Lesart von (42)
als wahr einstufen.
Man knnte hier vielleicht einwenden, da
(42d) nicht das wiedergibt, was Gereon
glaubt. Statt dessen glaubt Gereon an die
Wahrheit der Proposition , da es nmlich
am Anfang der Traditionskette, an die er sich
bei seinen berlegungen anschliet, genau
einen Ort gibt, der historisch bedeutend ist.
Dies setzt aber voraus, da wir uerungs-
token (hier sogar eine Art Denktoken) ein-
fhren. Da eine solche Theorie uns nicht zur
Verfgung steht und ihre Entwicklung alles
andere als trivial ist, werden wir einer Lsung
den Vorzug geben, bei der wir im Rahmen
der hier vorgestellten Kontexttheorie bleiben
knnen.
Bevor wir nun aber die Diagonalisierung
endgltig aufgeben, sei noch ein letzter Ret-
tungsversuch unternommen. Die Falschheit
von (42d) beruhte blo auf der von impli-
zierten Einzigkeit der relevanten Tradition.
Vielleicht sollte man es statt mit also mit
einer etwas schwcheren Proposition ver-
suchen, die dann zwar nicht durch Diagona-
lisierung, aber eventuell durch ein hnliches
Verfahren gewonnen werden knnte.
wrde dann einfach besagen, da es zumin-
dest eine (relevante) Tradition gibt, an dessen
Anfang ein Ort steht, welcher historisch be-
deutsam ist. Gegen eine solche Lesart von
(42) wre in der Tat nicht viel einzuwenden;
sie wre vor allem auch unter den geschilder-
ten Umstnden wahr. Der rger fngt aber
bei (43) an. Zunchst mu nmlich sicherge-
stellt sein, da auch (43) neben der blichen
de-re-Lesart (43r) die aus hnlichen Grn-
den wie (42r) falsch sein mu eine Lesart
(43d) besitzt, bei der der eingebettete Teilsatz
nun aber nicht als (logische) Negation von
interpretiert werden darf: sonst wre nmlich
auch (43) in allen Lesarten falsch. Doch selbst
wenn man (43) so deutet, da Gereon der
Glaube an die Existenz eines historisch un-
bedeutenden (einschlgigen) Trgers des Na-
mens Waterloo zugeschrieben wird, erfat
man damit nicht das, was der Satz in seiner
wahren Lesart besagt: nach (43d) wrde nm-
lich Gereon dann etwas Wahres glauben, da
ja beispielsweise das Waterloo im US-Bun-
desstaat Iowa tatschlich nie eine grere
Rolle in der Weltgeschichte gespielt hat. Doch
Gereon hat vielleicht noch nie von diesem
und anderen amerikanischen Waterloos ge-
hrt und mag sogar zu der berzeugung ge-
362 VI. Nominalsemantik
ist also eine Relation R, fr die gilt: R ist eine
Bekanntschaftsrelation, x R y und x R z,
sobald z y. (Da R intensional bestimmt ist,
hngt die Wahrheit von x R y und somit die
Frage, ob R fr x ein Zugang zu y ist, in der
Regel von der jeweils betrachteten Situation
ab!)
Mit Hilfe des Zugangs-Begriffs lt sich
nun der Glaube de re wie folgt definieren:
(44) Es seien x und y Individuen, Z sei eine
Bekanntschaftsrelation und P eine Ei-
genschaft. Dann gilt:
x glaubt von y qua Z, es habe P, genau
dann, wenn:
(i) Z ein Zugang fr x zu y ist, und
(ii) x in der Glaubensrelation zu der
Proposition steht, die in den Welten
w wahr ist, in denen gilt:
v [Z ist in w ein Zugang fr x zu
v & v hat in w die Eigenschaft P]
Natrlich setzt diese Definition ein Verstnd-
nis des Glaubens de dicto als Einstellung zu
einer Proposition voraus. Es mag sein, da
(44) auch noch etwas zu ungenau ist und wir
den Glauben de dicto eher als Selbstzuschrei-
bung einer Eigenschaft analysieren sollten.
Eine entsprechende Angleichung von (44)
wre dann leicht gemacht; doch fhren diese
Erwgungen zu weit von unserem eigentlichen
Thema ab (s. Artikel 34 oder Artikel 9). Man
beachte, da y in der obigen Definition nicht
in die Bestimmung des Gegenstandes des
Glaubens de re direkt eingeht, sondern da
stattdessen der Zugang Z als Scharnier zwi-
schen y selbst und der geglaubten Eigenschaft
fungiert.
Natrlich kann man (44) noch zu einer
Definition des Glaubens de rebus verallge-
meinern, indem man mehrere Gegenstnde
y
1
, ..., y
n
mit Zugngen Z
1
, ..., Z
n
als Para-
meter zult. Und das Ganze lt sich natr-
lich auch auf andere Einstellungen bertra-
gen. Wir berlassen dies dem Leser und zeigen
stattdessen, wie (44) fr eine Bestimmung der
Wahrheitsbedingungen von Stzen wie (45)
und (46) herangezogen werden kann.
(45) Gereon glaubt, da Waterloo ein ehe-
maliger Schlachtenschauplatz ist.
(46) Gereon glaubt, da Waterloo kein ehe-
maliger Schlachtenschauplatz ist.
Fat man (45) als Zuschreibung eines Glau-
bens ber Waterloo auf, so liegt es im Rah-
men der bisherigen Betrachtungen nahe, den
im Satz nicht weiter spezifizierten Zugang
auch tatschlich unspezifisch, d. h. existentiell
dicto-Deutung, nach der in unserem Beispiel
Waterloo als Beschreibung eines Ursprungs
irgendeiner relevanten berlieferungs-Tradi-
tion interpretiert wird, als zu schwach erwie-
sen, weil eben diese Beschreibung auch auf
ganz andere Waterloos zutrifft, von denen
Gereon gar nichts wei oder glaubt. Um zu
einer adquaten Interpretation des Komple-
mentsatzes zu gelangen, mu man also auf
jeden Fall das Individuum, von dem er han-
delt, also den Namenstrger, bercksichtigen.
Doch die Deutung von durch eine singulre
Proposition ber den Namenstrger von N
hat sich als zu pauschal erwiesen: in unserem
Beispiel hat Gereon von Waterloo nur inso-
fern geglaubt, es habe dort eine napoleonische
Schlacht stattgefunden, als ihm der Ort durch
seine geschichtswissenschaftliche Lektre ge-
geben war. Er hat von Waterloo als dem Ort,
den er aus dem-und-dem Buch kannte, ge-
glaubt, es sei ein Schlachtenschauplatz, wh-
rend er von demselben Waterloo als belgischer
Kleinstadt, an der er dann-und-dann vorbei-
gefahren ist, das Gegenteil annahm. Fr eine
Glaubenseinstellung zur entsprechenden sin-
gulren Proposition hat das aber nicht aus-
gereicht.
Diese Beobachtungen legen nun nahe, bei
Einstellungen zu singulren Propositionen
zwischen verschiedenen Zugngen zu diffe-
renzieren, die das Subjekt (der Einstellung)
zum Objekt (der Proposition) hat. Bevor man
sich also fragt, ob Gereon in der Glaubens-
relation zu p steht, sollte man erst einmal
klren, ob er von Waterloo, also dem Gegen-
stand von p, glaubt, da es die in p postulierte
Eigenschaft (eine historische Sttte zu sein)
besitzt, wenn ihm Waterloo einerseits durch
ein Geschichtsbuch, andererseits durch einen
Wegweiser etc. zugnglich wird. Im ersten
Fall gilt dies, im zweiten nicht. Eine solche
Deutung der Einstellungen de re wollen wir
im vorliegenden Abschnitt skizzieren, weil wir
von ihr als der von uns favorisierten Theorie
glauben, da sie alle bisher diskutierten Pro-
bleme (und andere) auf befriedigende Weise
lsen kann. Als erstes mu dafr geklrt wer-
den, was ein Zugang zu einem Gegenstand
ist.
Wir gehen davon aus, da einem poten-
tiellen Einstellungs-Subjekt x ein Gegenstand
y dann zugnglich ist, wenn x y in irgend-
einem Sinne kennt was etwa der Fall ist,
wenn x y beobachtet oder eben auch, wenn x
einen Text liest, in dem y namentlich erwhnt
wird und wenn y zugleich das einzige Ob-
jekt ist, das x auf diese Weise kennt. Ein
Zugang zu einem Objekt y fr ein Subjekt x
16. Eigennamen 363
einer Lsung des klassischen Problems der
Deutung von Eigennamen in Einstellungs-
kontexten recht nahe kam: mit ihr waren re-
ferenzgleiche Namen in Einstellungskontex-
ten im allgemeinen nicht miteinander aus-
tauschbar. Wie steht es nun mit der differen-
zierten de-re-Deutung der Einstellungsprdi-
kate? Kann sie die Vertrglichkeit von Stzen
wie (47) bis (49) erklren?
(47) Monika glaubt, da sich Werner den
Fu gebrochen hat.
(48) Werner ist mit Erwin identisch.
(49) Monika glaubt nicht, da sich Erwin den
Fu gebrochen hat.
Wenn wir annehmen, da die Identitt (48)
gilt, und wir auerdem die Einstellungen in
(47) und (49) beide (bezglich des gemeinsa-
men Trgers der Namen Erwin und Werner)
de re interpretieren, so knnen wir einen Wi-
derspruch offenbar nur dadurch vermeiden,
da wir (49) nicht als Negation von (47) auf-
fassen. Wir mssen also fr (49) zumindest
eine Lesart finden, die mit (47) (de re) und
(48) vertrglich ist. Eine solche bietet sich
natrlicherweise an, wenn man den Skopus
des durch die de-re-Lesart gegebenen Exi-
stenzquantors (es gibt einen Zugang Z) er-
weitert: die so erhaltene Lesart von (49) be-
sagt, da Monika einen Zugang Z zu Werner
(= Erwin) besitzt, ohne zu glauben, da sich
der ihr so Gegebene eine Fraktur am Fue
zugezogen habe. Wenn wir annehmen, da
(49) auf diese Weise mehrdeutig ist, knnen
wir offenbar den vermeintlichen Widerspruch
zwischen den drei letztzitierten Stzen weg-
erklren: vielleicht glaubt ja Monika von Er-
win qua einem Z
2
, er habe sich den Fu
gebrochen, aber sie glaubt es eben nicht qua
Z
3
(was immer Z
2
und Z
3
sein mgen). Ob-
wohl diese Darstellung schon in die richtige
Richtung geht, scheint sie doch noch einen
Punkt ungeklrt zu lassen: werden nmlich
(47) und (49) in einem Kontext, in dem die
Wahrheit von (48) klar ist, kurz hintereinan-
der geuert, so drngt sich den Hrern der
Eindruck auf, die Zugnge Z
2
und Z
3
, die
jeweils fr die Wahrheit der beiden Stze ga-
rantieren, htten etwas mit den Namen Wer-
ner bzw. Erwin zu tun. Insbesondere knnte
man meinen, es werde behauptet, da Monika
zwar dem Satz (50), nicht aber (51) zustimmen
wrde.
(50) Werner hat sich den Fu gebrochen.
(51) Erwin hat sich den Fu gebrochen.
Wir halten diesen Eindruck letztlich fr eine
pragmatisch bedingte Implikatur, die nur zu-
abquantifiziert, zu interpretieren. (45) ist
dann wahr, falls es fr Gereon einen Zugang
Z zu Waterloo gibt, so da Gereon die Pro-
position glaubt, da er, Gereon, zu genau
einem Ding, welches auerdem ein ehemaliger
Schlachtenschauplatz ist, in der Bekannt-
schaftsrelation Z steht. Setzt man fr Z nun
etwa die Relation Z
0
des Kennens als Ort des
Wellingtonschen Lagers o. . ein, so kme (45)
in dieser de-re-Lesart im Rahmen der zu An-
fang des Abschnitts 6.2.1 erzhlten Ge-
schichte als wahr heraus: Gereon hat ber Z
0
Kenntnis von Waterloo erlangt und glaubt
auch, da der Gegenstand, von dem er gelesen
hat, er sei Ort des Wellingtonschen Lagers
gewesen, ein Schlachtenschauplatz war.
Ebenso problemlos stellt sich bei dieser Be-
trachtungsweise (46) dar: Z
0
tut es hier zwar
nicht, dafr kann man aber Z, nehmen, die
Relation, die zwischen u und v genau dann
besteht, wenn u auf einem Schild bei Brssel
liest, da v 10 km entfernt ist. (Die genauen
Definitionen von Z
0
und Z
1
sind natrlich
unwichtig; die Hauptsache ist, man findet eine
fr Gereon eindeutige Bekanntschaftsrela-
tion, also einen Zugang.) Das Hauptproblem
des vorhergehenden Abschnittes wre also
mit dieser de-re-Analyse aus der Welt geschaf-
fen.
Sptestens an dieser Stelle stellt sich nun
die Kompositionalittsfrage: wenn (45) und
(46) die eben skizzierten Lesarten besitzen,
wie kann man dies aufgrund des syntakti-
schen Aufbaus dieser Stze und mit Hilfe der
Bedeutungen der in ihnen vorkommenden
Wrter erklren? Insbesondere interessiert
uns hier natrlich der Beitrag, den die Vor-
kommen des Namens Waterloo zu den Ge-
samtbedeutungen leisten. Zunchst ist dabei
klar, da die Referenz des Namens, also der
Namenstrger, ein wesentlicher Bestandteil
der de-re-Lesarten von (45) und (46) sein
mu. Auerdem enthalten die beiden frag-
lichen Propositionen auch keinen anderen, fr
den Namen Waterloo spezifischen Bestand-
teil: wrde man Waterloo durch Washington
ersetzen, vernderte sich nur das Gereon zu-
gngliche Objekt, also der Namenstrger.
Doch selbst wenn klar ist, was die Namens-
vorkommen in (45) und (46) zur Gesamt-
Proposition beitragen, so bleibt zunchst of-
fen, wie sie diesen Beitrag leisten. Aus Platz-
grnden knnen wir hier leider nicht nher
auf dieses Problem eingehen und mssen wie-
der auf die Artikel 9 und 34 verweisen.
Die Diagonalisierung scheiterte an Water-
loo, doch wir sollten nicht vergessen, da sie
364 VI. Nominalsemantik
sind, auch zu einer Lsung tendieren (oder
mindestens eine solche nicht ausschlieen),
die die Semantik von Eigennamen unange-
tastet lt, dafr aber fiktive Gegenstnde
einfhrt. Gerade der Gebrauch von fiktio-
nalen Namen galt aber traditionell als Be-
reich, in dem nur eine Deskriptionstheorie
den Fakten gerecht werden konnte.
Dem Leser dagegen, der die berlegungen
aus Abschnitt 5.2 ernst nimmt, bietet die 2D-
Theorie eine Mglichkeit, Namen in einem
traditionelleren Sinn eine Bedeutung zu ge-
ben. Die im vierten Satz dieses Aufsatzes ge-
stellte Frage findet eine eindeutige Antwort.
Auerdem knnen wir in einer 2D-Theorie
ohne weiteres erklren, warum Identittsaus-
sagen zwischen den Namen informativ sind:
es gibt eben Kontexte, in denen die Identitt
nicht gilt. (Vgl. Abschnitt 5.2.) Eine Benen-
nungstheorie hat auf diese Frage keine przise
Antwort.
Mit dieser Gegenberstellung beider Theo-
rien schlieen wir unsere Darstellung ab. Was
folgt, sind Nachtrge und Ergnzungen zu
Themen, die unseres Erachtens am Rande der
Thematik des vorliegenden Artikels liegen.
7. Vermischte Bemerkungen
7.1Logische Kategorie der Eigennamen
Bei den in unserem Artikel angestellten Be-
trachtungen zur Semantik von Eigennamen
haben wir wesentlichen Gebrauch von der
Methode der logischen Sprachanalyse ge-
macht. Wir haben nmlich immer dann, wenn
es auf Klarheit und Genauigkeit ankam, die
zur Debatte stehenden natursprachlichen
Ausdrcke in logische Formeln, also Aus-
drcke einer Logiksprache, bersetzt, oder
wir haben zumindest angedeutet, wie eine sol-
che bersetzung auszusehen hat. Dabei
haben wir allerdings eine Fragestellung aus-
geklammert, die traditionellerweise zum
Kernbereich der logischen Sprachanalyse ge-
hrt, die Frage nach den logischen Kategorien
der zu analysierenden natursprachlichen Aus-
drcke. In diesem Abschnitt wollen wir dazu
das nachtragen, was uns in diesem Zusam-
menhang interessant erscheint. Wir stellen
uns also die folgende Frage:
(F) Was ist die den Eigennamen entspre-
chende logische Kategorie vorausge-
setzt es gibt eine solche?
(F) ist nicht ganz eindeutig zu beantworten:
Namen werden nach der in Teil 5 dargestellten
2D-Theorie als (kontextuell fixierte) Kenn-
stande kommt, wenn wirklich beide Stze,
also (47) und (49), innerhalb desselben Kon-
textes geuert werden: ohne (49) wre es ja
abwegig anzunehmen, (47) enthielte irgend-
welche Informationen ber Monikas Einstel-
lung zum Namen Werner. Doch selbst wenn
es sich hier um eine Implikatur handelt, die
nur unter gewissen speziellen Umstnden zu-
standekommt, sollte klar sein, welches die
genauen Ursachen fr dieses Phnomen sind.
Wir wollen deshalb versuchen, eine pragma-
tische Erklrung zu liefern.
Wenn ein Sprecher mehrere Aussagen ber
dasselbe Ding macht, so wrde er nur Ver-
wirrung stiften, wenn er dies kurz hinterein-
ander verschieden nennt (vorausgesetzt es be-
sitzt berhaupt mehrere, den Hrern ver-
traute Namen). Im allgemeinen folgt der typi-
sche kooperative Sprecher also der folgenden
Maxime:
(M) Benenne dasselbe Ding im selben Kon-
text nicht auf unterschiedliche Weise!
Verstt nun der Sprecher gegen (M), so
wahrscheinlich deshalb, weil er den Hrern
zustzliche Informationen zukommen lassen
will, in unserem Falle nmlich Informationen
darber, wie die in (47) und (49) unspezifisch
angedeuteten Zugnge des Einstellungs-Sub-
jekts zum Objekt geartet sind. Daher die Im-
plikatur.
6.3Zwei Dimensionen oder reine
Benennung? Ein Fazit
Der letzte Abschnitt hat ein berraschendes
Ergebnis gebracht: der nach der 2D-Theorie
jedem Namen zugeschriebene Charakter
spielt bei der Lsung der Probleme, die beim
Gebrauch von Namen in intensionalen Kon-
texten entstehen, keine Rolle. Hiermit wre
wieder der Weg frei fr eine reine Benen-
nungstheorie.
Demjenigen, der dieser Theorie anhngt
und schon ihre bestechende Einfachheit
spricht fr sie bringt dieser Aufsatz neue
Argumente gegen jeden Versuch, deskriptive
Zge in die Bedeutung von Namen einzufh-
ren. So gelesen reiht sich unser Aufsatz in eine
Reihe von Schriften, die die Deskriptions-
theorien anfechten. Unsere Arbeit zeigt aber
auch, da viele Probleme, die traditionell im
Zusammenhang mit Namen diskutiert wer-
den, nicht unbedingt Probleme der Namens-
semantik sind, sondern in anderen Bereichen
der Semantik zu lsen sind. Wir weisen schon
an dieser Stelle darauf hin, da wir bei der
Frage, wie fiktionale Eigennamen zu deuten
16. Eigennamen 365
napsche Theorie whlt, um die Namens-Pa-
raphrase der 2D-Theorie auszufllen. Nach
der Frege-Carnapschen Kennzeichnungstheo-
rie bezeichnen Kennzeichnungen Individuen,
d. h. sie sind Individualterme. Wir erhalten
somit:
(A3) Die logische Kategorie der Eigennamen
ist die Kategorie Individualterm.
(A3) besitzt wie (A1) gegenber (A2) den
Vorteil der Erststufigkeit, also der ontologi-
schen Sparsamkeit; doch lt sich auch mit
dieser Methode keine einheitliche Behandlung
aller Nominalphrasen erzielen. Im Falle der
logischen Kategorisierung von Eigennamen
kann wohl der Unterschied zwischen (A1)
und (A3) nur noch mit sthetischen Kriterien
beurteilt werden.
Es sei noch erwhnt, da sich die Frege-
Carnapsche Kennzeichnungstheorie im Rah-
men einer hherstufigen Logik so uminter-
pretieren lt, da eine einheitliche logische
Kategorisierung der Nominalphrase (im Sin-
gular) herauskommt. Das Ergebnis dieser sog.
Hherstufung ist jedoch gerade (A2); wir fh-
ren diese Variante deshalb nicht getrennt auf.
Damit haben wir alle wesentlichen Mg-
lichkeiten der Przisierung der 2D-Theorie
der Eigennamen auf ihre Aussage zur logi-
schen Kategorisierung der Namen hin ber-
prft, ohne uns fr eine von ihnen besonders
stark zu machen. Es sei abschlieend noch
darauf hingewiesen, da wir dabei einen rein
extensionalen Standpunkt eingenommen und
die Antworten (A1)(A3) nicht weiter da-
nach differenziert haben, welche Art von In-
halten den Namen jeweils zugewiesen werden.
In unserem Fall war dies deshalb mglich und
sinnvoll, weil ja die 2D-Theorie gerade besagt,
da fr Eigennamen die Gleichung Inhalt =
Referenz gilt.
7.2Fiktion
Namen ohne Referenten, wie etwa diejenigen
fiktiver Romanhelden, haben wir bisher igno-
riert. Im folgenden werden wir etwas nher
auf sie eingehen und dabei feststellen, da mit
ihnen Probleme verbunden sind, die weit ber
das Thema dieses Artikels hinausreichen. Dies
mge als Rechtfertigung dafr dienen, da
wir das (vor allem innerhalb der Sprachphi-
losophie) wichtige Problem der fiktionalen Ei-
gennamen hier ausgeklammert haben; fiktio-
nal heien dabei solche (Verwendungen von)
Eigennamen, die sich nicht auf die Taufe eines
Individuums zurckfhren lassen, sondern le-
diglich auf eine Einfhrung innerhalb eines
zeichnungen aufgefat. Die Frage mu somit
an die Kennzeichnungstheorie weitergegeben
werden, und genau hier waren wir vorher
etwas vage oder liberal, indem wir alternativ
verschiedene Kennzeichnungstheorien zur
Przisierung der von uns vorgeschlagenen
Namensparaphrase zugelassen haben. Bei der
Beantwortung von (F) kommt es aber nun
darauf an, fr welche dieser Mglichkeiten
man sich entscheidet. Wir haben also eine Art
Fallunterscheidung zu machen.
Nach der Russellschen Kennzeichnungs-
theorie sind Kennzeichnungen eigentlich
komplexe Quantoren. Whlt man nun (wie in
der logisch-philosophischen Literatur blich)
die erststufige Prdikatenlogik als Zielsprache
der bersetzung, so sind Quantoren fr sich
genommen keine wohlgeformten Ausdrcke,
sondern (wie bereits angedeutet) Formel-
Schemata. Im Rahmen der Prdikatenlogik
erster Stufe luft also die durch die Russell-
sche Kennzeichnungstheorie przisierte Na-
mens-Paraphrase der 2D-Theorie auf fol-
gende Beantwortung von (F) hinaus:
(A1) Eigennamen werden synkategorema-
tisch bersetzt; ihnen entspricht somit
keine logische Kategorie.
Doch die Russellsche Kennzeichnungstheorie
lt sich auch fr solche Logiksprachen ver-
werten, in denen Quantoren eine eigene syn-
taktische Kategorie besitzen. Dies gilt insbe-
sondere fr die (in der linguistischen Satz-
Semantik beliebten) hheren typenlogischen
Sprachen, in denen Quantoren als Mengen
von Individuen oder Begriffe zweiter Stufe
gedeutet werden. Die Antwort auf (F) lautet
dann:
(A2) Die logische Kategorie der Eigennamen
ist die Kategorie Quantor, der ontolo-
gisch die Kategorie der Menge von
Mengen von Individuen entspricht.
Die Entscheidung zwischen (A1) und (A2)
liegt also in erster Linie bei der Entscheidung
fr oder gegen gewisse Logiksprachen zum
Zwecke der Bedeutungsanalyse. Bei den Be-
frwortern von (A1) spielen in der Regel on-
tologische Skrupel gegenber abstrakten Re-
ferenzobjekten (wie sie hherstufige Logiken
voraussetzen) eine Rolle; die Anhnger von
(A2) berufen sich dagegen auf die grere
Eleganz ihrer Theorie, die u. a. allen Nomi-
nalphrasen (im Singular) eine einheitliche lo-
gische Kategorie, die des Quantors, zuweist.
Eine dritte Mglichkeit, (F) zu beantwor-
ten, ergibt sich, wenn man statt der Russell-
schen Kennzeichnungstheorie die Frege-Car-
366 VI. Nominalsemantik
arten berhaupt einen guten Sinn machen.
Die Frage, welche Beschreibung dabei einen
vorgegebenen Namen ersetzen soll, ist im all-
gemeinen gar nicht so einfach zu beantwor-
ten. Aus Platzgrnden gehen wir darauf auch
nicht nher ein, sondern vermerken lediglich,
da es eine einfache Diagonalisierung hier
nicht tut, weil nmlich sonst herauskme, da
z. B. Conan Doyle Geschichten ber die Per-
son verfat hat, die am Anfang der tatsch-
lichen berlieferungs-Tradition des (fiktio-
nalen) Namens Sherlock Holmes steht. Die
fr die kontrafaktischen Lesarten bentigten
Deskriptionen mssen also offenbar etwas
mehr mit dem Inhalt der relevanten Fiktion
zu tun haben.
Man sieht, da die 2D-Theorie hier sehr
uneinheitlich zu werden droht, indem sie ge-
wissen Verwendungen fiktionaler Namen
ganz andere Arten von Bedeutungen zuweist
als gewhnlichen Eigennamen. Doch damit
nicht genug. Es gibt nmlich noch mehr Pro-
bleme, die mit fiktionalen Namen zusammen-
hngen und auch mit Hilfe von Fiktions-
Operatoren nicht zu lsen sind. Ein beliebtes
Beispiel dafr ist das folgende:
(54) Der fiktive Detektiv Sherlock Holmes ist
ironischerweise viel berhmter als jeder
echte Detektiv.
(54) ist offensichtlich zumindest in einer
sehr naheliegenden Lesart wahr. In seiner
wrtlichen wie in seiner kontrafaktischen In-
terpretation wre er aber falsch: im ersten
Fall luft die Kennzeichnung des Meisterde-
tektivs wieder leer; aber die Einbettung unter
einen Fiktions-Operator ist auch falsch, denn
laut Conan Doyle ist Holmes kein fiktiver,
sondern eben ein echter Detektiv. In welchem
Sinn versteht man (54) dann?
Das Problem mit Stzen wie (54) ist um so
dringlicher, als sie durchaus wrtlich zu deu-
tenden Stze wie (54) zu gleichen scheinen:
(54) Der antike Philosoph Plato ist ironi-
scherweise viel berhmter als jeder mo-
derne Philosoph.
Wollte man aber (54) parallel zu (54) deuten,
so mte man wohl Sherlock Holmes als Na-
men fr etwas z. B. eine fiktive Entitt
auffassen. Fr diese Auffassung spricht u. a.,
da (54) wie (54) die blichen Extensionali-
tts-Tests glnzend besteht; so kann man bei-
spielsweise den Namen Sherlock Holmes
durch die Kennzeichnung der Heldder Conan-
Doyle-Geschichten ersetzen, ohne an der
Wahrheit von (54) etwas zu ndern. Gegen
die Deutung von Sherlock Holmes als Namen
literarischen Werkes, Mrchens, Films etc.
Ein Standardbeispiel ist Sherlock Holmes, ein
Name, auf den man in vielerlei Zusammen-
hngen trifft, so auch hier:
(52) Sherlock Holmes lebte in Dublin.
Es ist klar, da (52) falsch ist, und zwar aus
mehreren Grnden: einmal hat es Sherlock
Holmes nie gegeben, also hat er auch nirgends
gewohnt; zum anderen htte er, wenn es ihn
gegeben htte, nicht in Dublin, sondern in
London (und zwar in der Baker Street) ge-
wohnt. (52) kann man also auf zweierlei Wei-
sen verstehen: wrtlich, also als Aussage, an
deren Subjektstelle eine leere, nicht referie-
rende Kennzeichnung steht, und kontrafak-
tisch, also ungefhr in folgendem Sinne:
(52) Wenn sich alles so verhielte, wie es bei
Conan Doyle steht, dann htte Sherlock
Holmes in Dublin gelebt.
Wegen ihrer Bezugnahme auf einen bestimm-
ten Autor ist die Paraphrase (52) der kontra-
faktischen Lesart von (52) nicht allgemein
einsetzbar. Wir schlagen deshalb eine neutra-
lere Formulierung fr das Antezedens vor:
(52) Wenn alles so wre, wie es im relevanten
literarischen Werk steht, dann htte
Sherlock Holmes in Dublin gelebt.
Die Kennzeichnung das relevante literarische
Werk soll dabei diejenigen Geschichten, Ro-
mane etc. herausgreifen, auf die die im Suk-
zedens stehenden fiktionalen Eigennamen zu-
rckfhrbar sind. Das Antezedens von (52)
kann man als eine Art intensionaler Satz-
operator (Fiktions-Operator) auffassen, der
bei Stzen mit fiktionalen Eigennamen oft
implizit mitverstanden wird.
Stze wie (52) versteht man wohl eher kon-
trafaktisch. Doch ist das keineswegs immer
der Fall, wenn von Romanhelden die Rede
ist. In (53) dominiert offensichtlich die wrt-
liche, wahre Lesart ber die falsche kontra-
faktische:
(53) Sherlock Holmes hat es nicht gegeben.
Leider ist die soeben skizzierte Wegerklrung
einiger Schwierigkeiten mit fiktionalen Na-
men mit der 2D-Theorie nicht vereinbar. Der
Grund dafr ist, da die den Namen entspre-
chenden Kennzeichnungen in den kontrafak-
tischen Lesarten obiger Stze nicht als starr
aufgefat werden drfen, weil sie ja sonst
auch in den einschlgigen Fiktionswelten leer-
laufen mten. Die fiktionalen Eigennamen
mten also durch echte Beschreibungen er-
setzt werden, damit die kontrafaktischen Les-
16. Eigennamen 367
nen, selbst wenn der Flu seinen Lauf n-
derte. Auch ein Wort wie (das) Wei (engl.
whiteness) ist nach Mill ein nicht-konnotativer
Name, aber kein echter Eigenname, weil nicht
konkret. The Sun und God sind dagegen kon-
notativ, weil sie ihren Namenstrgern Eigen-
schaften (Sonne bzw. Gott zu sein) zuschrei-
ben; auch sie sind in diesem Sinne keine Ei-
gennamen.
8.3Zur Kennzeichnungstheorie und zur
logischen Kategorisierung
Die im Text mehrfach erwhnte Frege-Car-
napsche Kennzeichnungstheorie ist die von
Carnap in Anlehnung an Frege vorgeschla-
gene Deutung von Kennzeichnungstermen,
nach der diesen jeweils zwei semantische
Werte, Extension und Intension, entsprechen.
Die Extension ist dabei das Individuum, das
die Bedingung der Kennzeichnung als einziges
erfllt, falls es ein solches Ding berhaupt
gibt. Andernfalls tritt irgendeine willkrliche
Konvention z. B. der Verweis auf ein Er-
satzobjekt in Kraft. Die Intension einer
Kennzeichnung ist die Extension derselben in
Abhngigkeit von beliebigen Tatsachenkon-
stellationen ( mglichen Welten), d. h. (in
Carnaps Theorie) eine Funktion, welche Tat-
sachenkonstellationen Individuen zuordnet.
Die Idee, neben dem Denotat, also der Ex-
tension (bei Frege: der Bedeutung), einen wei-
teren semantischen Wert, nmlich die Inten-
sion (bei Frege: den Sinn) anzusetzen, welcher
den ersten vollstndig determiniert, stammt
dabei von Frege (1892) und dient vornehm-
lich dem Zweck, den Informationsgehalt von
Kennzeichnungstermen von ihrer referentiel-
len Funktion zu trennen; daneben soll auf
diese Weise auch eine allgemeine, auf Kenn-
zeichnungen wie Eigennamen gleichermaen
bezogene Version des oben (in Abschnitt 6.1)
dargestellten klassischen Problems der pro-
positionalen Einstellungen gelst werden. Die
Idee, das Verhltnis Extension vs. Intension
als das einer funktionalen Abstraktion bezg-
lich mglicher Tatsachenkonstellationen auf-
zufassen, ist der von Carnap (1947: I.79.)
geleistete Beitrag zur Frege-Carnapschen
Kennzeichnungstheorie.
Die Russellsche Kennzeichnungstheorie,
die im Text als ebenbrtige Alternative zur
Frege-Canapschen betrachtet wird, geht auf
Russell (1905) zurck. Dort werden Kenn-
zeichnungen als gewisse Quantoren mit varia-
blem Skopus aufgefat. Der dabei eingehende
Begriff des variablen Skopus wird in White-
head & Russell (1910: I. B 14.) przisiert, be-
einer fiktiven Person spricht vor allem der
zweifelhafte ontologische Status nicht-exi-
stenter Gegenstnde. Auch auf diese Frage
gehen wir hier nicht weiter ein, wollen aber
erwhnen, da sich die 2D-Theorie dann ret-
ten lt, wenn man fiktive Entitten als Na-
menstrger zult.
Neben diesen ontologischen Schwierigkei-
ten gibt es noch eine ganze Reihe weiterer
interessanter Fragestellungen zum Thema fik-
tionale Namen, von denen viele noch nicht
befriedigend behandelt werden knnen. Es ist
jedoch unklar, inwieweit die bisher ungelsten
Probleme wirklich in den Bereich der Eigen-
namen-Semantik gehren. Es spricht vielmehr
einiges dafr, da es dabei nicht um fiktionale
Namen, sondern um fiktive Gegenstnde
geht.
8. Historisch-bibliographische Notizen
8.1Zum Terminus Eigenname
Das deutsche Wort Eigenname ist eine Lehn-
bersetzung von lat. nomen proprium, welche
laut Kluge (1975) erstmals 1642 belegt
ist. Die lateinische Bezeichnung selbst lt
sich wiederum auf griech. vo ov zu-
rckverfolgen, das man beispielsweise bei
Dionysios Thrax (Uhlig 1883: 33) findet, der
eine Unterscheidung der stoischen Sprach-
lehre bernimmt, wonach der Name (vo)
ein Wort ist, das eine spezifische Eigenschaft
bedeutet, whrend ein Appellativum (o-
o) ein Wort ist, welches eine allgemeine
Eigenschaft bedeutet (vgl. Egli 1981: 28). Mit
dem Beiwort ov grenzt Dionysios die
wahre (gelehrte) Bedeutung von der allge-
meinen (umgangssprachlichen) Bedeutung
des Wortes vo ab. vo ov bedeutet
also so etwas wie Name im eigentlichen
Sinne.
8.2Zur Benennungstheorie
Als klassischer Vertreter einer reinen Benen-
nungstheorie wird blicherweise John Stuart
Mill (1843: Kap. I.2) angefhrt. Mill unterteilt
die Namen in individuelle und allgemeine,
konkrete und abstrakte, konnotative und
nicht-konnotative. Nicht-konnotative Namen
schreiben dem Gegenstand, den sie bezeich-
nen, keine Eigenschaft zu; sie besitzen also
eine reine Benennungsfunktion: auch wenn
die Stadt Travemnde ihren Namen ur-
sprnglich aufgrund ihrer Lage an der Mn-
dung der Trave erhalten hat, so knnte Tra-
vemnde immer noch dieselbe Stadt bezeich-
368 VI. Nominalsemantik
namen fungieren. Ein Beispiel ist die Verwen-
dung des Namens Bismarck durch den Na-
menstrger selbst (und mit Bezug auf sich
selbst). Wird jedoch dieser Name von jemand
anders benutzt, mu er (in der Regel) durch
eine Kennzeichnung paraphrasiert werden,
weil die uerung einer singulren Proposi-
tion (die bei Verwendung eines logischen
Eigennamens entsteht) vom Sprecher einen zu
hohen Grad an Bekanntschaft mit dem
Gegenstand derselben voraussetzt. Welche
Kennzeichnung im Einzelfall fr einen Na-
men eingesetzt werden mu, hngt nach Rus-
sell hnlich wie der Fregesche Namens-
Sinn unter anderem vom jeweiligen Spre-
cher ab.
Eine Ersetzung smtlicher benennender
Ausdrcke durch Kennzeichnungen hat
Quine (1960) vorgeschlagen, allerdings aus
Grnden der ontologischen Durchsichtigkeit
logischer Notationen.
Kennzeichnungen spielen auch in der sog.
Bndeltheorie von Searle (1958) eine Rolle.
Allerdings werden sie dort nur dazu benutzt,
die pragmatische Voraussetzung zu sichern,
da die Verwendung eines Namens Kennt-
nisse voraussetzt, die es erlauben, den Na-
menstrger eindeutig zu identifizieren. Einen
hnlichen Gebrauch von Kennzeichnungen
machen auch Wittgenstein (1953: 79), Evans
(1973), Strawson (1959, 1974), Dummett
(1973: 110 ff.) und Linsky (1977).
8.5Zur Kritik an den sogenannten
Deskriptionstheorien
Der Begriff der Deskriptionstheorie subsu-
miert allgemein alle Theorien, die die Kom-
petenz des Sprechers, mit einem Namen auf
ein Individuum zu referieren, von Informatio-
nen abhngig machen, die der Sprecher ber
dieses Individuum besitzen mu. Insbeson-
dere gehren dazu die Theorien, die Namen
Kennzeichnungen gleichsetzen. Kritik an die-
sen Theorien findet man auer bei Kripke
(1980) auch bei Donnellan (1966, 1972, 1974).
Die speziellen Probleme, die sich fr verklei-
dete Kennzeichnungen in modalen Kontexten
ergeben, stellt vor allem Kripke (1980) aus-
fhrlich dar, von dem auch der Begriff starrer
Designator (rigid designator) stammt. Der von
uns in 4.2 benutzte dthat-Operator geht auf
Kaplan (1978) zurck.
8.6Zur Festlegung des Namens-Prdikats
Quine (1960, 1961a) setzt P
N
gleich der Ei-
genschaft, mit dem Trger des Namens N
identisch zu sein, falls N einen Referenten
sitzt allerdings (intuitiv wie formal betrachtet)
Tcken und Schattenseiten, wie z. B. Kaplan
(1970) zeigt. Eine neuere Version der Russell-
schen Kennzeichnungstheorie, bei der die
eigentliche Deutung der Quantoren unabhn-
gig von ihrem (variablen) Skopus vorgenom-
men wird, stammt von Montague (1973).
Die logische Kategorisierung der Eigen-
namen hngt, wie weiter oben (in Abschnitt
7.1) bemerkt wurde, im Rahmen der von uns
favorisierten 2D-Theorie von der zugrunde-
gelegten Kennzeichnungstheorie ab; die in 7.1
betrachtete Kategorisierung (A1) entspricht
dabei einem strikt an Russell (1905) orien-
tierten Vorgehen, (A2) ist die Montaguesche
Version der Russellschen Kennzeichnungs-
theorie und (A3) ist natrlich Frege-Carnap.
Diese Entsprechungen gelten aber nur im
Falle einer Zurckfhrung der Eigennamen
auf Kennzeichnungen.
8.4Zu den verkleideten Kennzeichnungen
Es ist zu unterscheiden zwischen solchen ge-
migten Theorien, die Eigennamen auf die
gleiche Art interpretieren wie Kennzeichnun-
gen und den radikaleren Versuchen, Eigen-
namen durch Kennzeichnungen zu ersetzen.
Als Hauptvertreter einer gemigten Position
kann Frege (1892) gelten, der die Unterschei-
dung von Intension und Extension (genauer:
Sinn und Bedeutung) ebenso auf Eigennamen
wie auf Kennzeichnungen anwendet. Ein we-
sentlicher Unterschied besteht aber darin, da
die Intension eines Eigennamens im allgemei-
nen nicht durch die sprachlichen Konventio-
nen festgelegt ist, sondern lediglich der Bedin-
gung gengen mu, den (tatschlichen) Re-
ferenten, den Namenstrger, zu identifizieren,
whrend sich die Intension einer Kennzeich-
nung aus der Deutung des kennzeichnenden
Prdikates ergibt. Auf diese Weise kann es
nach Frege bei Eigennamen z. B. zu Sinn-
schwankungen (= unterschiedlichen Inten-
sions-Auffassungen) bei verschiedenen Spre-
chern kommen. Diese Idee einer gewissen
Vagheit von Eigennamen findet man auch bei
Wittgenstein (1953: 79).
Eine radikalere Position vertritt Russell
(1905), der Eigennamen der natrlichen Spra-
che im allgemeinen durch (Russellsche) Kenn-
zeichnungen paraphrasiert und ihnen insofern
(vgl. oben: 8.3) keine eigenstndige Bedeu-
tung zugesteht. Allerdings besitzt nach Rus-
sell (1910) auch die natrliche Sprache rein
benennende Ausdrcke (wie etwa engl. this),
die dann als logische Eigennamen bezeichnet
werden. Auch echte Eigennamen knnen
nach Russell gelegentlich als logische Eigen-
16. Eigennamen 369
rien gelangen von linguistischer Seite Gardi-
ner (1940) und von sprachphilosophischer
Seite Castaeda (1979) zu dem Schlu, da
Eigennamen berhaupt keine Bedeutungen
haben, sondern nur denotieren. Gardiner
sieht hier ein Dilemma, weil Namen doch
Wrter seien und Wrter stets etwas bedeu-
teten. Die 2D-Theorie gibt Gardiner insofern
recht, als sich auch nach ihr der inhaltliche
Aspekt eines Eigennamens in seiner Benen-
nungsfunktion erschpft; dennoch haben Na-
men Bedeutungen (wenn auch sehr ab-
strakte), wodurch sich Gardiners Dilemma
(so es ein solches berhaupt gibt) lst. Casta-
eda wiederum sieht sich gezwungen, Eigen-
namen zumindest in indirekter Rede deskrip-
tiv zu deuten, wodurch seine Hauptthese un-
terlaufen wird, da (in unserer Terminologie)
die Verwendung eines Namens keine Rck-
schlsse auf den Zugang des Sprechers bzw.
des Einstellungs-Subjekts zum Referenten zu-
liee. Unsere Version der 2D-Theorie ist
aufgrund der von uns vorgenommenen exi-
stentiellen Abquantifizierung des Zugangs-
Parameters (vgl. oben: 6.2.2) insofern eine
konsequentere Anwendung der Castaeda-
schen These, als die Namen auch in beliebigen
Einstellungskontexten ihre rein referentielle
Funktion beibehalten.
Der moderne sprachphilosophische Klas-
siker der Eigennamen-Interpretation, Kripke
(1980), bezieht interessanterweise zur Frage,
was ein Name bedeutet, offenbar keine Stel-
lung. Kripke geht es in erster Linie um In-
halte.
Die von uns (oben 4.2) angestellten Be-
trachtungen zu kontextueller Vagheit und
Ambiguitt gehen auf Kaplan (1977: XXII)
zurck. Die Parallelitt zwischen der Seman-
tik der Eigennamen und der Deutung einiger
Gattungsbegriffe (vgl. oben: 4.3) heben vor
allem Kripke (1980) und Putnam (1973, 1975)
hervor. Uneigentliche Namen wie Jack the
Ripper werden von Bor (1978a) untersucht,
der von attributiven Verwendungen von Namen
spricht.
8.9Zu den propositionalen Einstellungen
Das klassische Problem aus 6.1 kann man
ber Quine (1961 b) bis auf Frege (1892) zu-
rckverfolgen. Eine Diagonalisierungs-L-
sung hat Stalnaker (1978) vorgeschlagen, der
auch andere Anwendungen dieses Verfahrens
diskutiert. Die Diagonalisierung selbst
stammt ursprnglich aus der zweidimensio-
nalen Modallogik (vgl. Segerberg (1973)), wo
auch Kaplans dthat als eine Art Diagonal-
Operator dargestellt werden kann.
besitzt. In diesem Falle luft die Quinesche
Kennzeichnungsparaphrase auf eine Spielart
der reinen Benennungstheorie hinaus. Die
Konsequenz des Quineschen Vorgehens fr
nicht-denotierende Namen untersucht Hoch-
berg (1957).
Plantinga (1978) benutzt unter Verweis auf
die von Boethius und Scotus vertretene These,
da Eigennamen wesentliche Eigenschaften
ihrer Referenten ausdrcken, fixierte (= starr
gemachte) P
N
-Kennzeichnungen als Para-
phrasen. Das entspricht unserem Vorgehen in
4.2; Plantinga lt allerdings weitgehend of-
fen, wie man dabei das P
N
selbst bestimmt.
8.7.Zum Begriff der Tradition
Ein Begriff der berlieferungskette findet sich
andeutungsweise schon bei Strawson (1959:
181, Fn.). Kripke (1980) gibt nur einige Hin-
weise darauf, wie eine Namens-Tradition un-
gefhr auszusehen habe. Kritiken an der
Kripkeschen Sichtweise findet man z. B. bei
Dummett (1973: 110 ff), der Kripke Zirkula-
ritt vorwirft, und Evans (1973), der einige
verzwickte Flle von berlieferungs-Ketten
diskutiert und daraufhin fr eine pragmati-
sche Deskriptionstheorie pldiert (vgl. oben:
8.4).
Przisierungen der Kripkeschen Ideen ber
Namens-Traditionen findet man bei Devitt
(1974, 1981) und Lerner (1979). Wir haben in
diesem Artikel die Frage, wie eine wohlge-
formte Tradition aussehen soll, ausgeklam-
mert. In der Literatur spricht man gewhnlich
von der Kripkeschen Kausal-Theorie der Ei-
gennamen. Es wird angenommen, da die
Glieder der berlieferungskette durch kau-
sale Beziehungen miteinander verbunden
sind. Unsere Theorie macht darber keine
Annahme, wie der von uns neutrale Terminus
Tradition andeutet. Zur Frage der Kausali-
tt in berlieferungsketten vgl. Schwarz
(1979).
8.8Zur Namensbedeutung
Der allgemeine bedeutungstheoretische Rah-
men der 2D-Theorie ist die klassische Theorie
der Kontextabhngigkeit von Kaplan (1977).
Die Indexikalitt von Eigennamen betont
Burge (1973), der Aristoteles durch dieser Ari-
stoteles paraphrasiert, wobei dem Namen Ari-
stoteles in der logischen Paraphrase das Pr-
dikat, Aristoteles zu heien, zugrundegelegt
wird und verlangt wird, da auf den Referen-
ten dieses Prdikat zutrifft.
Ausgehend von reinen Benennungstheo-
370 VI. Nominalsemantik
(1974) und Lewis (1978) vorgeschlagen. Die
einschlgigen Gegenbeispiele stammen von
Parsons (1980a), der eine an Meinong (1971)
orientierte ontologische Lsung propagiert
und fiktionale Namen auf fiktive Gegen-
stnde referieren lt.
9. Literatur (in Kurzform)
Bor 1978a Carnap 1947 Castaeda 1977
Cresswell/von Stechow 1982 Devitt 1974 Devitt
1981 Donellan 1966 Donnellan 1972 Donnel-
lan 1974 Dummett 1973 Egli 1981 Evans 1973
Frege 1892 Hochberg 1957 Kaplan 1970 Ka-
plan 1975 Kaplan 1977 Kaplan 1978 Kluge
1975 Kripke 1979 Kripke 1980 Lerner 1979
Lewis 1978 Lewis 1979b Linsky 1977 Meinong
1971 Mill 1843 Montague 1973 Parsons 1980a
Plantinga 1978 Putnam 1973 Putnam 1975
Quine 1960 Quine 1961a Quine 1961b Russell
1905 Russell 1910 Schwarz 1979 Searle 1958
Segerberg 1973 Stalnaker 1978 Strawson 1959
Strawson 1974 Uhlig 1883 Whitehead/Russell
1905 Wittgenstein 1958 Woods 1974
Jean-Yves Lerner, Saarbrcken/ Thomas Ede
Zimmermann, Stuttgart,
(Bundesrepublik Deutschland)
Der im Zusammenhang mit de-re-Lesarten
in 5.2 eingefhrte Begriff der singulren Pro-
position geht auf Kaplans (1975) Betrachtun-
gen zur Russellschen Ontologie zurck.
Unsere Redeweise vom Gegenstand einer
singulren Proposition ist insofern etwas hei-
kel, als sich nach der gngigen Auffassung
von Propositionen als Weltenmengen dieser
Gegenstand durch die infrage kommende
Proposition nicht eindeutig bestimmen lt;
auf diese Schwierigkeit weist z. B. auch Ka-
plan (1977: IV) hin. Bei einer prziseren Dar-
stellung mte man also einen feinkrnigen
Propositions-Begriff wie etwa den aus
Cresswell & von Stechow (1982) zugrun-
delegen.
Das Waterloo-Problem aus 5.3 stammt von
Kripke (1979), der es allerdings nicht lst,
sondern nur darstellt. Die in 5.4 skizzierte
Theorie der propositionalen Einstellungen ist
die von Cresswell & von Stechow (1982). Der
Begriff des Zugangs wird dabei im Geiste von
Lewis (1979b) definiert.
8.10Zur Fiktion
Eine kontrafaktische Analyse von Stzen mit
fiktionalen Namen wird z. B. von Woods
17. Natural Kinds and Common Nouns
such as the measles and polio and perhaps
phemomena like heat and pain. In general,
natural kinds are the sorts of things that are
naturally amenable to scientific investigation.
There is, for example, no science of big things,
because big things do not seem to form a
natural kind. In human languages, natural
kinds can be referred to with the use of noun
phrases (also called terms). These noun
phrases are typically built up around a central
common noun which itself appears to be spe-
cially connected to the natural kind referred
to (or denoted) by the phrase. For example,
if we analyze the reference of a use of the
noun phrase the tiger (as in The tiger is a
striped beast) as referring to the species itself,
the central common noun is the count noun
tiger.
2. Kind-Denoting Terms
As the term natural kinds implies, natural
kinds are a subclass of kinds more generally.
Noun phrases referring to or denoting natural
1. Introduction
2. Kind-Denoting Terms
3. Kind-Level Versus Individual-Level Predi-
cates
4. Semantic Analysis
5. Stages
6. Common Nouns in the Historical Perspective
7. Proper Names, Kinds and the Theory of Ref-
erence
8. Reaction to Kripke and Putnam
9. Sortal Concepts
10. Conclusion
11. Short Bibliography
1. Introduction
Natural kinds are real causal powers that
order the world in which we live. The central
cases of natural kinds are generally taken to
include species of plants and animals such as
lemon-trees and tigers, chemical substances
such as gold or helium, elements of physical
theory such as electrons or quarks, diseases
17. Natural Kinds and Common Nouns 371
The other form of the definite article is used
where the speaker and hearer share general
knowledge, and is non-anaphoric in usage.
This is the form that appears with proper
names, as in the following example.
(3) Da Karel is kema.
Charles has arrived
Substituting the form da for dea in (2), or
substituting dea for da in (3) results in unac-
ceptable sentences. Kind-denoting phrases
employing the definite article in Bavarian em-
ploy only the form that goes with proper
names. An example is (4).
(4) Da Schnaps (*Dea Schnaps) is daia.
Schnapps is expensive
Thus, the definite article is another means of
constructing a term that may refer to a kind.
In some languages, the determinerless form
of the noun phrase may still function as if
there were a definite article present. Porter-
field and Srivastav (1988) have recently ar-
gued that determinerless Hindi count noun
phrases function as definites, displaying the
same sort of ambiguity we find in example
(1) in spite of the absence of a definite article.
They argue that not all languages pattern
likewise. Their analysis of determinerless
noun phrases in Indonesian reveals that they
display only a generic reading, and no indi-
vidual non-generic reading at all.
Finally, a more artificial means of con-
structing a noun phrase referring to a certain
kind, often employed in Western science, is
to contruct a Latinate name, as with homo
sapiens for mankind, or felis tigris for the
tiger. This method, though employed almost
exclusively in conjunction with scientific in-
vestigation, nevertheless represents a linguis-
tic resource for the creation of new kind-
denoting terms.
The indefinite article likewise can give rise
to a generic reading with singular count
nouns, as in the English samples:
(5)
a. A Tiger has stripes.
b. An electron consists of two up quarks
and one down quark.
c. An elm tree is classified as a gymno-
sperm.
Languages with indefinite articles very com-
monly (and possibly always) may employ
them in this same way. While these noun
phrases result in generic sentences with truth-
conditions typically indistinguishable from
kinds come in a variety of forms and differ
somewhat from language to language. Carl-
son (1978) and Krifka (1988) discuss several
such constructions. The chief criteria in de-
ciding whether a noun phrase denotes a kind
are whether the sentence it appears in (typi-
cally as subject) has a generic reading, and
whether the noun phrase can have predicated
of it kind-level predicates such as (be) wide-
spread, common, rare, increasing in population,
or comes in a range of sizes, has xs up to y
long, and so forth (see Carlson 1978). These
predicates, as has long been recognized, can-
not be satisfactorily attributed to individuals
(e. g. Socrates is widespread). The most com-
mon form of a kind-denoting noun phrase is
a determinerless expression either identical to
the basic common noun itself (as in the case
of English heat, gold, and man), or else a
pluralized form of the basic common noun in
the case of count nouns (as in the case of
English cats, lemons or tigers). In some lan-
guages, such as Thai, the singular form of the
count noun may be employed generically at
least in combination with a classifier (see
Stein 1981). Another equally common means
of referring to natural kinds is with the defi-
nite article in conjunction with the basic com-
mon noun. This may accompany both count
and mass nouns, as in German, or it may
accompany just the count version and exclude
the mass version (as in English). Examples
include the tiger, the elm tree, or das Gold,
and lor (French). Such noun phrases are gen-
erally ambiguous between a generic reading
(where it refers to the kind) and a non-generic
or individual reading, where the referent is
some particular individual. So, a sentence like
(1) is generally taken to be ambiguous:
(1) The tiger eats about 80 kilograms of meat
a day.
This sentence could be about the tiger before
you, or the kind itself. Krifka (1988) notes
that languages such as Bavarian German and
Frisian have two different definite articles
with distinct uses, only one of which may be
used in a noun phrase with generic reference.
One form of the definite article has a directly
anaphoric use, where it is used to pick out
something that is in the immediate environ-
ment, or has just been mentioned, as in the
following Bavarian example taken from
Krifka (1988).
(2) I hab a Bia und an Schnaps bschdait. Dea
Schnaps war daia.
I ordered a beer and a schnapps. The
schnapps was expensive.
372 VI. Nominalsemantik
With mass common nouns, conversion to
count noun status is a sign that it has become
taxonomic. Examples such as those in (9) are
commonly noted.
(9)
a. Two wines are grown in this region.
b. Every ore in this region is valuable.
Taxonomic noun phrases make use of the full
range of determiners available in a given lan-
guage, although the articles may preclude a
taxonomic interpretation. For example, the
following seem difficult to interpret as mean-
ing a type of bird and the kind of mammal
(e. g. that we were just discussing).
(10) A bird is quite common. (cf: One bird
is quite common)
(11) The mammal is widely known. (cf: This
mammal is widely known)
Natural languages also may employ an
overtly taxonomic noun in conjunction with
a superordinate common noun to denote a
kind. In English such words as type, kind,
sort, etc. are routinely used to create unam-
biguously kind-denoting noun phrases, as in
(12).
(12)
a. Every kind of metal is solid at room
temperature, save on.
b. One type of bird migrates from the
Arctic to the Antarctic annually.
As with the taxonomic noun phrases, the
choice of determiners is not restricted (so long
is it is a count determiner), except again for
some similar problems with the articles.
Finally, anaphoric devices may also be
used to refer to kinds, as in:
(13)
a. They (meaning lions) are not very
common around here.
b. This (meaning iron) is a very useful
metal.
Of this entire range of constructions, we can
distinguish those that make crucial use of a
particular common noun in their construction
in order for the noun phrase to have its in-
tended denotation (the first examples em-
ploying articles and no determiner at all) from
the remainder, in which a wide range of dif-
ferent subordinate common nouns may be
employed. So, while the noun phrase this an-
imal, this carnivore and this Asian mammal,
this striped beast, etc. may all be used to refer
to the tiger on a given occasion of use, the
denotations of carnivores, Asian mammals,
striped beast, animals, etc. all differ solely
according to the meaning of the noun.
those same sentences with noun phrases of
the sorts discussed above, they lack the ability
to take kind-level predicates. The following
examples appear to be unacceptable (though
they have an acceptable reading to be dis-
cussed shortly).
(6)
a. ??A tiger is common (vs. Tigers are
common)
b. ??A lemon tree is rare (cf: The lemon
tree is rare)
Hence their status as noun phrases referring
to kinds is somewhat in doubt. However, they
do give rise to generic readings and are for-
mally based on the appropriate common
nouns, forming a paradigm with the definite
article. Similar to the definite article, the in-
definite is often times ambiguous between a
generic reading and a singular non-generic
reading. (7) has two distinct readings.
(7) A dog pleases its master every day.
On one reading this refers to some particular
dog, but there is also another generic reading
where this is about dogs in general.
It is of some interest that the definite and
indefinite articles are both commonly em-
ployed in the creation of generic noun
phrases, to the exclusion of the other deter-
miners one finds in natural language. In fact,
it has been suggested (Kramsky 1972) that
one criterion for whether a given word is
functioning as an article at a given stage in
the development of a language is whether they
give rise to generic noun phrases. Very com-
monly, definite articles develop from weak-
ened demonstratives (as has occurred in Ro-
mance languages), and indefinite articles com-
monly develop from the numeral one (Ger-
manic and Romance languages follow this
pattern). Why becoming an article would cre-
ate the possibility of a generic NP remains an
open topic for future research.
Natural languages also employ various
means of creating kind-denoting NPs
through descriptive maans. One type of con-
struction is the use of a determiner with a
taxonomic common noun a common noun
understood as a predicate applied to subor-
dinate kinds. So, the examples of (8) have
sensible readings because the common nouns
can be understood as applying to kinds, and
not to individuals.
(8)
a. One mammal lays eggs to reproduce
itself.
b. Every dinosaur is extinct.
c. This metal is widespread.
17. Natural Kinds and Common Nouns 373
However, these observations do not in and
of themselves require that kinds be treated as
entities in order to assimilate their analysis to
that of individual-denoting phrases. One
could equally well, in Montague-grammar
style, treat both as generalized quantifiers of
a common semantic type, yet retain the claim
that kind-phrases are non-denoting NPs, just
like everyone or no animal. This is tantamount
ot the claim that kind-phrases are quantified
NPs. There is substnatial cause to think, in
the absence of any overt quantification, they
are not. Instead, kind-phrases like this kind
of animal are best analyzed as denoting
phrases, much as proper names or definite
descriptions, in the absence of overt indica-
tions of quantification.
Perhaps the most controversial case study
is that of the semantics of the English bare
plural construction, which has been proposed
in Carlson (1977, 1978) and elsewhere to func-
tion as a proper name of an entity which is a
kind. It remains controversial whether all in-
stances of bare plural NPs should be so an-
alyzed in English, or whether most or all
corresponding determinerless constructions in
other languages demand a similar treatment.
Evidence for a denoting analysis takes a va-
riety of forms. One important form of argu-
ment, which will not be discussed here in any
detail, is to consider concrete non-denoting
analyses one by one, and examine the ade-
quacy each. So, to take a simple case, if a NP
such as dogs were treated as universally quan-
tified, thereby meaning something much like
all dogs, one can easily show that incorrect
truth-conditions would thereby be assigned
many sentences; true sentences like dogs bark
or dogs have four legs would be predicted on
this analysis to be false. Hence, this analysis,
as it stands, is inadequate. One may then
proceed to the consideration of other non-
denoting analyses, and examine them in a
similar light.
The most compelling arguments, however,
are those that apply to non-denoting analyses
as a class. One of the chief characteristics of
quantified phrases is that they exhibit scope
ambiguities relative to one another, negation,
and a variety of other constituents of the
sentence in which they may appear. In a sen-
tence like (17), a scope ambiguity arises, the
quantified phrase several horses interacting
with the verb look for:
(17) Mary is looking for several horses.
Mary could have several particular ones in
mind, or else she might be satisfied with find-
3. Kind-Level Versus Individual-Level
Predicates
With this background in mind, we will now
turn to some of the motivating features of a
theory incorporating kind terms. In a series
of works (chiefly, Carlson 1978), a view of
noun phrase denotations is developed in
which kinds play a central role. Kinds in this
framework are taken to be elements of the
domain of entities of the model, rather than
being themselves constructed out of more
primitive elements of the model, such as sets
or functions from points of reference to sets
(one analysis of properties). The primary mo-
tivation for treating kinds thus is two-fold.
The first is that it enables a uniform syntactic
and semantic treatment for predicates that
seem to be equally applicable to kinds and
individuals. Consider, for instance, the pred-
icate eat meat. One can equally predicate this
of a kind (14b) or of an individual, such as
John (14a):
(14)
a. This person (said pointing at John)
eats meat.
b. This kind of animal (said pointing at
a dog) eats meat.
Note that one can even conjoin these NPs
and predicate a common property of them:
(15) This person and this kind of animal both
eat meat.
One may even from meaningful comparative
constructions which contrast properties of
kind-denoting and individual-denoting NPs:
(16)
a. This person (said pointing at Harold)
runs faster than this kind of animal
(said, pointing at a turtle) (runs).
b. This kind of animal runs faster than
this person (runs).
Such comparisons on anyones analysis of
comparatives requires a predication common
to both. If the predicates of the matrix and
subordinate are of different semantic types, it
is not clear how one could form a common
grounds for comparison, nor how one could
sensibly conjoin these NPs and predicate a
single property of both, as in (15). On the
other hand, if kinds and individuals are
treated as being of the same semantic type,
standard analyses of comparison and con-
junction, and other constructions, will apply
without difficulty. Observations of this sort
motivate the need to treat kinds and individ-
uals as at least belonging to a common se-
mantic type.
374 VI. Nominalsemantik
What serves as the denotation of bare plurals
may also provide one of the values that quan-
tified sentences are evaluated with respect to.
For instance, if someone claims that at least
one type of animal eats meat, the sentence
Wolves eat meat shows that the open sentence
x eats meat is true with wolves assigned as
the value of x, and hence that At least one
type of animal eats meat is true. Or, if someone
claims that every breed of cat has a tail, the
falsity of Manx cats have a tail provides a
value (manx cats) which falsifies the universal
closure of x has a tail with values of x re-
stricted to kinds.
A variety of semantic phenomena, some
long-noted in the philosophical literature, dis-
tinguish phrases denoting or quantifying over
kinds from those denoting or quantifying
over individuals (NPs I will henceforth call
kind-level and individual-level). There are a
variety of predicates, simple and complex,
which select kind-phrase subject, being infel-
icitious with subjects denoting at the individ-
ual-level. Probably most widely-known and
transparent are predicates employing kind-
words themselves. Sentences of the following
sort were an important ingredient in medieval
theories of supposition, for instance:
(22)
a. The lion is a kind of mammal.
b. ??Leo (an individual lion) is a kind
of lion.
(23)
a. Killer bees are a variety of honeybee.
b. ??These six bees are a variety of hon-
eybee.
(24)
a. Man is a species.
b. ??John is a species.
(The question marks intend that the (b) ex-
amples have a different status from the (a)
examples; whether the (b) examples are sor-
tally incorrect or necessarily false remains an
open question.) There are also a number of
adjectives that select for kind-phrases as sub-
jects which, too have been often noted. These
adjectives include widespread, common, rare,
heterogeneous, indigenous (to)
(25)
a. Dogs are common/rare/widespread/
heterogeneous (e. g. in size)
b. ??Those five dogs are common/rare/
widespread/heterogeneous (e. g. in
size)
Such predicates as these are to be clearly
distinguished from those which typically se-
ing any colleagues so long as she finds several
of them. On the other hand, in a sentence like
(18), no similar ambiguity may be found:
(18) Mary is looking for horses.
The only reading of (18), according to the
semantic interpretation, is one where there
are no particular horses which Mary is look-
ing for.
A similar result emerges when other quan-
tified NPs appear in the sentence. Under
most circumstances, quantified NPs may in-
teract to produce scope ambiguities (though
typically one reading is more salient). With
bare plural NPs, however, there is little evi-
dence of scope interaction. The following ex-
amples do not readily yield judgments of
scope ambiguities involving bare plurals:
(19)
a. Dogs like everyone.
b. Most people in this room own cars.
c. Each customer bought gifts at four
different drug stores.
Nor do the bare plurals of English participate
convincingly in scope ambiguities produced
by placing them subordinate clauses, as ex-
emplified below:
(20)
a. Three of our students believe that
professors (cf: each professor) are in-
credibly good at critiquing articles.
b. Jerry wanted to ask poets (cf: some
poet) to come to his birthday party.
c. Mary hoped her husband would meet
celebrities (cf. a celebrity) in Las Ve-
gas.
In none of these cases is there a convincing
and consistently-judged wide-scope reading
for the bare plural NP, in contrast to other
quantified noun phrases. There is a de dicto/
de re distinction in examples such as (20a),
but such an ambiguity is also associated with
proper names in such contexts as well, and
hence does not require that the bare plural
be treated as a quantified, non-denoting
phrase.
The argument thus far is that at least some
instances of bare plural NPs function as de-
noting terms, taken as denoting a kind of
thing. As a result, a term such as dogs may
have the same denotation as a number of
other denoting phrases used in a given con-
text, such as:
(21) that kind of animal (said, pointing at a
dog, for example)
the dog (generic reading)
the type of animal which is the worlds
most common domestic pet
Jeromes favorite sort of pet
this mammal over here (taxonomic read-
ing)
17. Natural Kinds and Common Nouns 375
able where there need be no particular, indi-
vidual small Japanese car that is itself popular
(this is a pragmatically implausible state of
affairs). However, (28b), with an individual-
level subject, has only the implausible reading,
unless of course the subject is taken as quan-
tifying over types of automobile on a taxo-
nomic reading.
Other semantic phenomena related to
kinds have been somewhat more widely dis-
cussed. One such is the adverbs of quantifi-
cation first introduced in Lewis (1975a).
Many frequency adverbs allow for two dis-
tinct readings in the presence of a kind-level
subject, but only one in the presence of an
individual-level subject. Contrast the follow-
ing:
(29)
a. Female birds usually care for their
young.
b. All female birds usually care for their
young.
Again, setting aside the taxonomic reading of
(29b), there is a reading of (29a) which (29b)
does not have; it is the one equivalent to most
female birds care for their young. (29b) has
only a reading which describes how much of
her time a female birds spends on caring for
its babies; (29a) shares that as a possible read-
ing, but has the quantificational reading as
well.
In some cases the nature of the predicate
rules out the plausibility of a temporal read-
ing; in such cases only one reading plausibly
appears with the kind-level subject, and no
plausible reading appears in the case of the
individual-level subject. The examples below,
taken from Lewis (1975a) and Carlson (1978)
illustrate this point.
(30)
a. Quadratic equations usually have
two solutions.
b. ??Many quadratic equations usually
have two solutions.
(31)
a. Texans are often tall.
b. ??All Texans are often tall.
The (b) examples probably do have readings,
but the readings require an unusual state of
affairs. Most frequency adverbs function as
adverbs of quantification, with clear corre-
spondences to the set of determiner meanings:
usually/most, always/all, sometimes/some,
never/no, often/many, hardly ever/few, and so
forth. One does not find such correspon-
dences in the case of cardinal specifications.
Lions like Fred twice does not mean the same
things as Two lions like Fred.
lect plural NPs, such as (be) similar, (be) a
couple, etc., which are entirely felicitious with
individual-level plural phrases as subjects.
A very few verbs have been noted also to
select for kind-phrases as subjects. The verb
come in (e. g. Coke cans come in three different
sizes) is one such example. In more complex
verb phrases, elements in combination with
the verb may select kind-level subjects. For
example, the verb gain or increase by them-
selves do not particularly select for kinds.
However, a complex phrase like is increasing
in numbers or is gaining in population do.
However, in far more cases, we can detect a
certain reading of a predicate which is only
possible when there is a kind-level subject,
though there is a felicitious interpretation
with an individual-level subject. A good ex-
ample of this is noted in Carlson (1978). Com-
pare the readings available for the following:
(26)
a. Wolves get larger and more vicious
as you drive north from here.
b. My three dogs get larger and more
vicious as you drive north from here.
(26b) has only a pragmatically implausible
reading where there is an implied causal con-
nection between my dogs sizes and vicious-
ness, and someones driving north. While
(26a) also has this unusual reading associated
with it, there is in addition another much
more natural reading in which size and dis-
position of northerly wolves are compared to
their southerly neighbors. Such a reading,
with such examples as Scientists are becoming
more sophisticated these days having a reading
where no individual scientist need himself or
herself be getting more sophisticated, in con-
trast to All scientists are becoming more so-
phisticated, which demands increased dophis-
tication in individual scientists. Quite a few
other parallel distinctions may be noted. For
instance, the adverb continuously allows for
two readings in (27a) but only one (the much
less plausible one) in (27b):
(27)
a. Guests continuously arrived at our
party until 11:30.
b ??Several guests continuously arrived
at our party until 11:30.
A somewhat different type of example is il-
lustrated in (28).
(28)
a. Small Japanese cars are very popular
this year.
b. Most small Japanese cars are very
popular this year.
In (28a), unlike (28b), there is a reading avail-
376 VI. Nominalsemantik
a reading which states which wolves are likely
to be (generally) dangerous, and a reading
which states the conditions under which a
given wolf might be most dangerous. (34b)
has only the latter reading.
4. Semantic Analysis
We have just examined a series of semantic
phenomena related to the distinction between
kind-level and individual-level phrases. In this
section we will sketch the rudiments of a
semantics designed to address many of the
issues raised. The basic ingredients of the
analysis will involve making a sub-typed dis-
tinction between kinds and individuals, relat-
ing the two domains to one another, and a
corresponding distinction among predicates.
The analysis of predicates will require posit-
ing a generalization operator, which derives
predicates from other predicates, as well as
the introduction of a class of predicates that
apply to neither kinds nor individuals, but
instead to stages (see section 5). In light of
this semantic machinery, we can better un-
derstand the organization of the semantic
phemonena just discussed.
As a point of reference, we here assume a
modified version of a Montague grammar
(Dowty, Wall, and Peters 1981); chiefly, we
replace the role of individual concepts (of type
s, e) with individuals (of type e, following
Bennett, 1975). The domain of entities A of
type e is further subdivided into (at least)
two disjoint domains: those of individuals I
type e
i
and those of kinds K type e
k
. The
two domains I and K are related to one
another in intension by a relation R of rela-
tion (or instantiation); R is an irreflexive,
asymmetric, (and transitive) relation defined
over IxK. We leave open a more precise spec-
ification of its character, as the types of issues
this would raise (e. g. essentialism) will be
discussed in subsequent sections. We shall,
however, assume for the sake of simplicity the
following identity condition for kinds:
x
k
y
k
[[z
i
[R(z
i
, x
k
) R(z
i
, y
k
)] x
k
= y
k
]
Just as members of I serve as the denotations
of individual-level denoting phrases (such as
proper names), so the members of K serve as
the denotations of kind-level phrases (such as
bare plural phrases). We will assume also that
common nouns are predicates which corre-
spond to kinds; that is, for every common
noun phrase CN with translation CN there
is some member a of K such the following
holds:
Another construction that appears very
much akin to these adverbs of quantification
are modals used quantificationally. This is
probably most easily seen in the case of can,
which functions as an existential quantifica-
tion over instances of a kind. Contrast (32a)
and (32b), the latter without a kind-level sub-
ject.
(32)
a. Cats can weigh 25 pounds.
b. ??Each cat can weigh 25 pounds.
The interpretation of (32a) does not require
that a given cat may fluctuate in weight,
which is the only possible reading for (32b)
(again, taxonomic readings aside). This quan-
tificational use of the modals (limited to can,
may, and should) selects kind-terms for its
subject. In the absence of a kind-term as
subject, the interpretation attributes ability to
individuals, which is strange with predications
of weight and other generic properties that
do not readily fluctuate.
A final phenomenon, which has been more
widely discussed and criticized, is the appear-
ance of an atemporal interpretation for when
under the following circumstances: (a) a kind-
term appears in the main clause (b) a pronoun
bound by the kind-term appears in the when-
clause (in the case where the when-clause fol-
lows the main clause). So, for instance,
(33a, b), which do not fulfill these conditions,
have only a (difficult) temporal reading. (33c),
on the other hand, has a restrictive, or atem-
poral reading. Note that one can substitute
if for when in (33c) but not (33a, b) and
retain its sense.
(33)
a. Each dog is intelligent when it has
intelligent parents.
b. Dogs are intelligent when cats have
intelligent parents.
c. Dogs are intelligent when they have
intelligent parents.
This constructions is discussed in Carlson
(1979), Farkas & Sugioka (1982), and De-
clerck (1988). With a change of the type of
predicate in the sentence, an ambiguity can
result with a kind-term in the main clause,
while with an individual-term in the main
clause, only the temporal reading is possible.
Contrast the following:
(34)
a. Wolves are dangerous when they are
mean.
b. Most wolves are dangerous when
they are mean.
In (34a), the sentence is ambiguous between
17. Natural Kinds and Common Nouns 377
low only individual-level subjects. However,
none are to be found, at least if one quite
reasonably discounts predicate nominals such
as is an individual dog and the like. How might
we account for this pattern?
A persistent intuition about examples such
as those above is that the predicate is one
that basically applies to individuals, and only
derivatively to kinds. Having four legs, for
instance, is a property of individual thinking
entities, rather than a basic property of spe-
cies. If we take this intuition seriously, we
take have four legs to be an individual-level
predicate that applies basically to the domain
of I, and then seek to account for how it
might (apparently) apply to a kind. In Carl-
son (1978, 1982) the following solution is
proposed, making use of this intuition.
There is a semantic operation applying to
all individual-level predicates which maps
their intensions into predicates applying to
kind-level entities; this generalization opera-
tion is abbreviated Gn. Thus, in predicating
has four legs of a kind, one is not doing so
directly, but rather through the mediating the
generalization operation; the resulting anal-
ysis directly represents in the intensional logic
that a component of the interpretation is an
individual-level predicate. Below are reduced
and abbreviated IL translations of the two
corresponding examples of (35).
(35)
a. Gn( [have (four legs)]) (d)
b. have (four legs) (those two dogs)
(Here, d abbreviates x
k
y
i
[R(y
i
, x
k
) dog
(y
i
)]). Provided we understand that Gn applies
to any individual-level predicate, we expect
to find no individual level predicates in the
object language which cannot also be equally
applied (or so it appears) to kinds. However,
this is not the only motivation for having
such a semantic operation. Another reason
can be found in examining such examples as
those in (37).
(37)
a. The lion protects its young from pred-
ators.
b. Paranoids fervently believe that they
are under constant scrutiny by the
authorities.
c. Timid people do not like to talk about
themselves in public.
The issue at hand is the interpretation of the
pronouns in each case. One finds that there
is in each case an interpretation for the pro-
nouns in each case. One finds that there is in
each case an interpretation for the pronoun
[x
i
R(x,
i
, a)] CN(x
i
)]]
With these restrictions, we are able to provide
an analysis of the meaning of a bare plural
noun phrase, based on a common noun of
arbitrary syntactic complexity. The bare plu-
ral NP derived from CN will have the follow-
ing denotation:
x
k
[y
i
[R(y
i
, x
k
) CN(y
i
)]
(While this treats the bare plural as a type of
definite description, nothing about the gram-
matical property of definiteness necessarily
follows; rather, this analysis treats bare plu-
rals as denoting phrases, a property logically
distinct from definiteness; see Kamp 1981a
and Heim 1982.)
Once one has a distinction between kinds
and individuals in the domain of entities, we
are then able to distinguish predicate subtypes
as well according to the sortal range. Proba-
bly the most obvious group of predicates that
form under such an analysis are those which
are restricted only to kinds. These are such
examples as widespread, common, etc. If such
predicates are defined only for members of
K, a sentence such as John is widespread (we
assume John to be a member of I, not K) will
be strange because the predicate applies only
to kinds (entities of type e
k
), and is unde-
fined for entities outside the sortal range (i. e.
the typing of the predicates is also sensitive
to subtypes); however, various alternative ac-
counts may well be preferable in which the
type (e. g. predication of widespread to an
individual is sortally but not type-wise incor-
rect, or that it is merely necessarily false).
Various other more complex predicates de-
fined as applying only to kinds may also be
built up (such as increased in population last
year, etc.).
However, the vast majority of predicates
would, at least on the surface of things, apply
equally to kinds and to individuals. That is,
most predicates, simple and complex, pattern
like the examples below:
(35)
a. Dogs have four legs.
b. Those two dogs (e. g. the individuals
before us) have four legs.
(36)
a. This type of mineral absorbs water.
b. This lump of mineral absorbs water.
Given we are assuming a sub-typing differ-
ence between kind-phrases and individual-
level phrases, the ability of nearly all predi-
cates to apply equally to both would appear
unexpected; in particular one would antici-
pate finding individual-level predicates cor-
responding to the widespread class, which al-
378 VI. Nominalsemantik
satisfying the property in extension. Taking
the translation of this instance of often to be:
Px
k
[many y
i
[R(y
i
, x
k
) & P (y
i
)]], in reduced
and abbreviated form Texans are often tall
would come out as follows:
(38)
many y
i
[R(y
i
, t) & tall(y
i
)]
What is wrong, then, with a sentence like Few
Texans are often tall is that the quantification
of the subject NP is at the individual-level,
but the adverb of quantification takes some-
thing at the kind-level. In schematic form, the
difficulty with this example can be isolated
thus:
(39)
few (Texan) z
i
[x
k
[many y
i
[R(y
i
, x
k
)
& tall (y
i
)] (z
i
)]
The x
i
bound by the quantifier few Texan(s)
has a predicate applied to it in this formula
which applies only to kinds; thus, it is unac-
ceptable, and has no interpretation assigned
(or, a necessarly false one).
Thus far, we have focused on examples in
which individual-level predicates are deriva-
tively predicated of kinds. There appear, how-
ever, to be some basic predicates which allow
for two analyses at the kind-level. The adjec-
tive popular is a good example. Contrast the
more salient readings of the following exam-
ples:
(40)
a. Brass buttons are popular in the U. S.
b. Film stars are popular in the U. S.
On the one hand, it is unlikely that the truth
of (40a) will be supported by any popular
individual brass buttons; on the other, the
more salient reading of (40b) does seem to
implicitly popularity to individual film stars
(e. g. Maryl Streep, William Hurt, etc.). That
is, in (40a) the predicate popular is being ap-
plied directly to the kind thus, the kind
itself is the object of popularity, whereas in
(40b) the predicate is applied derivatively,
thus implying that the predicate basically ap-
plies to individuals instantiating that kind.
(40)
a. popular (bb)
b.
Gn[ x
k
(popular(x
k
))] (fs)
Thus, there is a further category of predicates
applying to kinds, which may apply either
directly or derivatively; they then basically
apply to I K. This is typical of psycholog-
ical predicates, including complex derived
predicates such as be talked about or worry
everyone. As the Gn operation applies to any
individual-level predicate, a dual analysis of
such predicates is predicted when predicated
of a kind.
in which its value is not at the kind-level, but
rather at the individual level. The message
imparted by, say, (37a), is (roughly) that a
given lion with young, will protect its own
from predators, and not necessarily the young
of other lions. If the pronoun were bound by
the kind, the sentence should be synonymous
with The lion protects the lions young from
predators (with both instances of the lion ge-
neric in interpretation). Similarly, if the re-
flexive pronoun in (37c) were to take on the
value of its apparent kind-level antecedent, it
ought to mean the same as Timid people do
not like to talk about timid people in public.
However, in each case there is an interpreta-
tion of the pronoun which is at the individual-
level. The Gn operation provides an account
of this by taking the intension of a predicate
that binds an individual-level pronoun and
converting the predicate into one that applies
to kinds. Schematic IL representations for
this reading of (37) are provided in (37).
(37)
a.
Gn( x
i
[x
i
protects x
i
s young from
predators]) (l)
b.
Gn( x
i
[x
i
fervently believes x
i
is
under scrutiny]) (p)
c.
Gn( x
i
[ x
i
likes to talk about x
i
in public]) (tp)
(p abbreviates the translation of paranoids,
tp, timid people, and 1, the lion). Thus, the
Gn operation allows for the binding of an
individual-level pronoun in a predicate that
is applied to a kind. It is noteworthy that, in
the latter two cases, there is an additional
reading of the pronoun in which the value of
the pronoun is at the kind-level; thus, there
is a reading of (37c) in which timid people
dont like to talk about timid people in gen-
eral in public. Its schematic IL representation
would then be as follows:
(37)
c.
y
k
[Gn ( like to talk about y
k
in public) (y
k
)] (tp)
Thus, the Gn analysis allows for pronouns to
be interpreted at either level. ((37a) does not
seem to allow such a kind-level reading; this
correlates with the fact that protect is a basic
stage-level relation see below). In certain
instances noted above, a lexical item in the
syntactic structure of the sentence functions
as an elevating operator. The adverbs of
quantification and the instances of the modals
noted may be viewed as expressions that re-
late predicates to kind terms. To provide an
example, the adverb of quantification often
would predicate an individual-level property
truly of kinds which have many instances
17. Natural Kinds and Common Nouns 379
tial: that, for instance, some breed of mam-
mals arrived iff there was at least one animal
of the breed that arrived, and if no animals
of the breed arrived, then the breed cannot
have arrived. This set of existential truth-
conditions stands in marked contrast to the
truth-conditions of generic and habitual sen-
tences, where matters are much more com-
plicated, and cannot be reduced to simple
existentials. For instance, Texans are tall is
not true iff some Texan is tall, but height
must somehow be distributed among Texans
in a way not fully understood at present (see
Carlson 1991, for discussion of this point).
To account for the existential import of
kind-level NPs in episodic sentences, as well
as their extensional character, Carlson (1978)
introduces into the semantics the philosoph-
ically common notion of a stage, which is
taken to be a spatio-temporally bounded por-
tion of the extension of an individual in a
world at a given interval. The episodic pred-
icates, then, are analyzed as predicates apply-
ing basically to stages of individuals. Let us
elaborate briefly on how the analysis works,
and then comment on its wider significance.
Let us take stages to be entities of a different
subtype from I and K; let us subtype them as
e
s
. We assume stages to have a semilattice
structure, in that the join of any two stages
of an individual forms another stage of that
individual, up to a unique maximal stage (the
full spatiotemporal extension of an individual
in a possible world), and that any given stage
can be analyzed into at least two non-over-
lapping stages (we assume no minima). Un-
like the higher-order entities, stages are purely
extensional, having no extensions themselves
or counterparts in other possible worlds, ap-
pearing at a unique time and place. It is
convenient to think stages continuous in time,
without gaps, but whether this further re-
striction is necessary remains an open ques-
tion.
All entities in I K are related to the set
of stages by another realization relation M
(mnemonic, manifestation), with appropri-
ate relationships built into the M relation.
For instance, if an individual a stands in the
R relation to a kind k at some set of points
of evaluation, then all stages standing in the
M relation to a also stand in the M relation
to k (but not necessarily vice-versa); the tax-
onomic relations among the kinds will also
be expressed accordingly. There are no (or
perhaps only a very few) expressions in the
object language that denote stages directly;
NP-meanings denote or quantify only at the
This, then, exhausts the categories of basic
predicates for generic and habitual sentences.
There are other dimensions to examine. For
example, it appears that there is a need on
occasion for a notion of kinds of kinds (it is,
quite possibly, interpretable to say some thing
like: Mammals are often usually intelligent
and not encounter anomaly). However, in the
next section we will examine a notion of
stages, as they stand in contrast to both
individuals and kinds.
5. Stages
Heretofore, we have been dealing exclusively
with stative sentences which predicate some
property in generality to individuals or kinds.
However, an equally common type of sen-
tence in everyday discourse is non-stative (i. e.
an event or process) and attributes ephemeral
properties to individuals and kinds. I will
refer to this class of sentences as episodic
sentences. When episodic predicates are pred-
icated of individuals, there seems little to note;
however, when attributed to a kind-term,
there is a clear existential interpretation of
the subject NP. Consider the following ex-
amples:
(41)
a. John Smith was spotted twice in Ver-
mont last week.
b. The California condor was spotted
twice in Vermont last week.
(42)
a. Several dogs attacked my neighbors
cat last night.
b. Dogs attacked my neighbors cat last
night.
(43)
a. One famous explorer (i. e. Columbus)
arrived in the New World in 1492.
b. One famous breed of mammal (i. e.
horses) arrived in the New World in
1492.
Examples like (42b) have long been a source
of controversy regarding whether the subject
NP should be analyzed as kind-denoting, or
as an existentially quantified indefinite. How-
ever, there can be little question about the
kind level status of the subject NPs in (41b)
and (43b), and once we have an analysis for
them, it would be naturally extendable to the
example (42b) as well (see Carlson 1977 for
arguments that the subject of examples like
(42b) are kind-denoting, and Gillon (1990)
for some arguments against the analysis). The
main thing to note about the truth-conditions
of (4143b) is that they are simply existen-
380 VI. Nominalsemantik
tion fo the sentence (41b) would be as follows:
(41)
b.
x [twice (y
s
[M(y
s
, x) & in Vermont
(were-spotted (y
s
))]) (cc)
If the predicate were spotted twice in Vermont
were taken as basically applying only to in-
dividuals, it would have to be false under
circumstances where no single individual con-
dor was seen more than once. However, if we
allow direct application to kinds, as pre-
sented in (41b), there is no such requirement
placed on any particular California condors,
only on the kind itself.
The set of stage-level expressions of the
language encompasses almost all the episodic
verbal predicates (though see Schubert & Pel-
letier 1987 for some examples where this does
not seem quite true). A particularly interest-
ing distinction appears when we turn to ad-
jectives, which turn out to be very much of a
mixed class. A good many adjectives are ba-
sically stage-level (e. g. available, drunk,
(physically ill, alive, asleep, (physically) hun-
gry etc.). A large number of others apply
basically to the individual-level as noted
above (e. g. intelligent fat, four-legged, red,
(mentally) ill, sickly). There is also a group
of adjectives that function in both categories,
typically according to whether the state is
manifested (stage-level) or idspositional (in-
dividual-level). Thus, mean as a stage-level
adjective requires that the subject be acting
mean, whereas at the individual-level is de-
notes a typical characteristic of the individual,
independently of present behavior. Included
in this mixed class are such cases as dangerous,
cooperative, noisy, muddle-headed, and so
forth. In general, predicative PPs are stage-
level, and predicate nominals individual-level,
though one can easily find exceptions in both
directions.
There are various test constructions which,
on the whole, isolate the same class of epi-
sodic predicates. Milsark (1974) notes that
the range of adjectives found in the post-NP
position of English existential sentences is re-
stricted. For instance, while one can saw
There were several men drunk, one cannot
equally well say There were several men intel-
ligent. The set of post-NP predicates is the
set of stage-level predicates. Likewise, Carl-
son (1978) notes that this same class of pred-
icates may appear in the bare infinitival com-
plements of perception verbs (e. g. John saw
several men drunk, but not, John saw several
men intelligent). Stump (1985) introduces an-
higher levels. That stages of individuals of a
kind also are stages of the kinds is important
in that it means that, while a given individual
has a unique maximal extension with respect
to a time and world, kinds may have many.
Turning to the proposed analysis of epi-
sodic predicates, we see that they cannot ap-
ply to stages directly since NP-meanings in-
troduce entities from I K and not from the
set of stages S. As a result, stage-level predi-
cates are introduced in the semantics with
existential quantification over stages in its
translation. Suppose run is a stage-level pred-
icate; its translation is going to apply to a
kind or individual such that the resulting
proposition is true iff there is a stage of the
kind or individual in the extension of a stage-
level predicate corresponding to run. The
analysis of John ran (setting aside tense) will
be:
(44)
x [y
s
[M(y
s
, x) & run*(y
s
)] (j)
Here, all but the (j) part are the IL translation
of the verb run; x is a variable taking values
in I K, and run* is a stage-level predicate
picking out, at a given time and world, all
stages of running individuals and kinds.
If the same predicate is applied to a kind
(such as dogs), its reduced translation (omit-
ting tense) would be as follows:
(45)
y
s
[M(y
s
, d) & run*(y
s
)]
Thus, dogs ran is true at a given past time iff
ther is some stage of the kind in the extension
of run*; it is further reasonable to assume, in
this case, that any running stage of the kind
dogs is also a running stage of some individ-
ual dog realizing the kind dog; thus, (45) will
be true iff (46) also holds:
(46)
x
i
y
s
[R(x
i
, d) & M(y
s
, x
i
) & run*(y
s
)]
That is, dogs ran is true iff there is some dog
(or dogs) that ran. The existential quantifi-
cation over stages, combined with restrictions
on the R and M relations, gives the effect of
an existentially quantified subject in cases
such as these, even though the subject is a
phrase denoting a kind.
On some occasions, though, this equiva-
lence does not hold. Consider sentence (41b)
above again. Note that introduction of a
wide-scope existential over individual condors
will not give a logically equivalent result, be-
cause a wide-scope existential will require that
it be the same condor that was spotted twice,
whereas in the actual sentence, it could well
be two different condors spotted, though each
only once. An informal abbreviated transla-
17. Natural Kinds and Common Nouns 381
volved in such cases which maps basic stage-
level verbal predicates into individual and
kind-level; we shall call this G. This opera-
tion, like Gn, is a generalization operation as
well. Unlike Gn, which is is an elevating
operation taking predicates of type s,e
i
, t
into predicates of type e
k
, t, this other op-
eration maps stage-level predicates of type
s,e
ik
, t to expressions of type e
ik
, t.
In the process, the extensional stage-level
predicate operated on is intensionalized. Ben-
nett (1975) notes this characteristic of generic/
habitual sentences, observing that a sentence
like Procedure P picks out the largest state
has a reading different from Procedure P picks
out Alaska. If Alaska were no longer the
largest state, the procedure would pick out
whatever was, though the current extension
of the expression the largest state (in the
U. S.) is Alaska.
The addition of G results in a sentence
whose truth-conditions are no longer simply
existential, but have all the usual difficulties
associated with defining truth-conditions for
generic/habitual sentences. The intuition is
that a generalization has been formed over
events/processes of the sort expressed by the
basic stage-level predicate generalized over.
Thus, if we take a sentence like (49a), its
abbreviated IL representation would be (49b)
(keep in mind that bark is the translation of
the lexical item bark, and that this is further
decomposible into an expression containing
bark and existential quantification over
stages).
(49)
a. Dogs bark loudly.
b. G( loudly ( bark) (d)
This forms a generalization over stages of the
type described by bark loudly and attributes
the generalization to the kind dogs.
This concludes a sketch of a semantics
based on an ontology of kinds, individuals,
and stages. The most difficult issue this per-
spective raises is how to express the content
of the generalization operators Gn and G. It
is very natural to think of these as quantifier-
expressions, especially as they appear to al-
ternate with adverbs of frequency and ad-
verbs of quantification, which are transpar-
ently quantificational. Farkas and Sugioka
(1983), Krifka et al. (1991), and Schubert &
Pelletier (1987) have explicitly made propos-
als to this effect. However, in none of the
cases is there an explicit analysis of the se-
mantics of the proposed quantifier, and there
is some reason to think Gn and G are not
quantificational in content. For instance, they
other means of isolating the same set of stage-
level predicates, noting that that free adjuncts
have differing potentials for interpretation de-
pending on this distinction, and that certain
constructions take stage-level but not individ-
ual-level predicates (e. g. With John drunk,
Mary was worried, but not With John stupid,
Mary was worried). (See also Stump 1981 for
more on stages.)
Once the distinction between stage-level
and individual-level predicates is recognized,
we can see that the availability of stage-level
readings can effect interpretations. Consider
once again the ambiguity inherent in a sen-
tence like Dogs are often mean. Since mean is
either a stage-level or an individual-level pred-
icate, we find that the sentence is likewise
ambiguous (i. e. whether it is an adverb of
quantification saying that many dogs are
(characteristically) mean, or whether it is
stage-level, saying that typically, a given dog
is mean a lot of the time). A similar ambiguity
is not available for an example like Dogs are
often intelligent, since intelligent applies only
to individuals.
To conclude this section, another class of
generic/habitual sentences has yet to be dis-
cussed: those based upon episodic predicates.
It turns out, in most cases, that any verbal
predicate applying to stages can also be used
to express a general characteristic. So, for
instance, the predicate ran fast or wrote with
the left hand can be used to express what
happened on a given occasion (the episodic
interpretation), or else a general characteristic
(the generic/habitual interpretation). This was
noted and argued for in Dahl (1975). Sen-
tences like the following are ambiguous:
(47)
a. Maxwell ran fast.
b. Hermans cousin wrote with the left
hand.
Similar ambiguities appear with kind-level
subjects as well.
(48)
a. Dinosaurs attacked one another.
b. Two kinds of fish ate the shellfish.
Either sentence could attribute a (past) gen-
eral characteristic, or describe a past scene.
Insertion of used to in (47) and (48) disam-
biguates. The appropriate generalization
would appear to be that any verbal stage-
level predicate may also function as a predi-
cate applying to individuals and kinds, giving
rise to a generic/habitual reading. There is a
certain amount of evidence (see Carlson 1978,
1991) that another semantic operation is in-
382 VI. Nominalsemantik
limited in membership, closed, and semanti-
cally less contentful. These are generally felt
to be more grammatical and logic in na-
ture. Included here would be conjunctions,
determiners, subordinators (e. g. if), comple-
mentizers, and so forth. Coppleston (1972)
notes that the Stoics characterized syncate-
corematic words as (i) unable to function
alone (in Greek) as subject or predicate, (ii)
having no referential function, and (iii) able
to signify only in virtue of their logical func-
tion in propositions. This last point might be
best thought of as the notion that syncate-
goremata are functions without real world
significance which, when applied to some-
thing capable of signification (a categore-
matic word), yields an expression which has
altered signification. So, for instance, as Wil-
liam of Ockham noted later. ... syncatego-
remata signify not things, but rather added
to another term causes it to signify some-
thing (Boehner 1957: 42 f). So, for instance,
the word every taken alone has no definite
reference to anything, but the phrase every
man does (Boehner 1952).
From the perspective of current logical
analysis, this broad distinction is well en-
coded. First-order predicate calculus, insofar
as it can be construed as a semantic analysis
of natural language, treats the major syntactic
categories (nouns, verbs, and adjectives) as n-
place predicates, while representing in a very
different way the few syncategorematic ele-
ments it chooses to represent at all directly
(i. e. negation, coordination, subordination
with if ... then, and universal and existential
determiners). Extensions of the system, such
as tense logic or modal logic, tend to preserve
this distinction, again to the extent they can
be construed as semantic analyses of natural
languages. Yet, mainstream semantic analysis
has not sought very diligently to differentiate
the syntactic classes within the categoremata.
For example, in the influential Montague
(1973) paper, adjectives, common nouns, and
intransitive verbs are all treated identically as
one-place predicates (though differentiated
syntactically). However, there exists a long-
standing tradition of attempts to differentiate
nouns, adjectives, and verbs semantically,
which is continued by insightful current work
as well.
Aristotle (in Categories and De interpreta-
tione) was interested in the semantic content
of nouns. According to Aristotle, their con-
tent depended on the notion of substance,
substance being the underlying real strata of
are both intensional, whereas quantification
itself is not; furthermore, there is a default
portion of the meaning, and it remains un-
clear whether the notion of default quanti-
fication really qualifies as a possible quan-
tifier meaning. In other words, at present a
number of fundamental issues surrounding
the analysis of generics and habituals remain
unresolved.
We now will turn away from a discussion
of sentences in which kind-terms appear, and
focus more closely on common noun mean-
ings and the character of natural kinds.
6. Common Nouns in the Historical
Perspective
It is a compelling and long-noted fact that
there is a strong association between natural
kinds and the syntactic category of common
nouns in that nouns and no other syntactic
categories play the role in the way natural
languages express thoughts about kinds of
things (though adjectives may play a much
more limited role). While it is almost univer-
sally assumed that not all nouns express nat-
ural kinds (see below), it is quite clear that
the category of nouns alone has the logical
properties necessary for the linguistic expres-
sion of natural kinds. Thus, the study of the
semantics of natural kind terms leads imme-
diately to the question of the semantic content
of the syntactic categories of natural lan-
guage. Here I take a traditional perspective,
setting aside very serious questions about the
cross-linguistic significance of syntactic cate-
gories derived largely from the analysis of
Indo-European languages (see, for instance,
Kinkade 1983).
Traditionally, syntactic categories are dif-
ferentiated into two broad categories com-
monly referred to as categorematic and syn-
categorematic. The categorematic categories
include nouns, adjectives, verbs, participles,
and possibly more. These are the meaningful
words of a language, corresponding most
closely to the major lexical categories of mod-
ern linguistic theory commonly characterized
by large, open-ended membership and a guid-
ing intuition that these words have content
in a way other words do not. In X-Bar syn-
tactic theory, (for example Jackendoff 1977;
Chomsky 1981; Gazdar et al. 1985), the ca-
tegorematic words form the heads of phrases.
Syncategorematic categories, on the other
hand, are characterized by being generally
17. Natural Kinds and Common Nouns 383
phasizes not so much what is signified by the
use of a part of speech, as the way it signifies.
But the tradition of Aristotle and of the gram-
marians differed in crucial ways. Most im-
portant was a basic assumption of how many
parts of speech there are. Aristotle and the
logically-oriented followers held that there
was basically two categories nominal and
verbal, corresponding roughly to the present-
day stative-nonstative distinction with the
remaining parts of speech playing subordi-
nate roles as completions of, or connections
between, the two (Kretzman 1982: 134). The
Priscianic tradition, though, held that there
were eight parts of speech with equal status.
The Middle Ages, especially the late Mid-
dle Ages, saw the rise of a tradition of gram-
matical study firmly rooted in logic, with an
aim and purpose quite different from that of
the traditional grammarians that the study
of language should be a science, or at least
theoretically oriented, whose primary goal
was to give causal explanation for the nature
of language (which, in this context, meant
Latin and maybe Greeek). A good deal of
this work focused on the content of the syn-
tactic categories, and quite sophisticated anal-
yses were offered, building on the approach
of Aristotle.
Abelard, for instance, disputed Aristotles
notion that the time was the distinguishing
feature of verbs as opposed to the nominals;
there seemed little reason to deny that time
was of relevance to the nominals since their
true application was, in fact, dependent on
time fully as much as the verb. Recently, En
(1981) has argued a similar point in a more
sophisticated manner, concluding that time is
implicit in the meaning of all nouns, as well
as verbs.
Abelard instead suggests that verbs (the
copula among them) had a completeness of
sense (Coppleston 1972: 144 f) characteristic
of whole sentences that is lacking in the other
categories (a notion akin to thinking of sen-
tences as verb-headed endocentric construc-
tions). This completeness of sense character-
istic of verbs derives from a verbs signifying
things which inhere in the subject of the
sentence. For example, the NP a running man,
lacking a verb (it has a participle instead),
fails to have a completeness of sense found
in a man runs because the latter signifies that
which inheres in the subject, while the former
signifies a man with certain properties. In an
insightful analysis, Abelard notes that adjec-
tives and nouns are really very much like
existence which persist in the face of change
(for Aristotle, substance was the same as the
essence of the individual). These substances
have a variety of characteristics: (1) They
have no contrary; thus, while the contrary of
black is white, the substance named by horse
has no contrary. (2) The same substance can
have contrary qualities at different times, and
remain the same substance; a horse can be
black one day and white the next and remain
a horse. (3) Substances are not accidental. If
an individual ceases to participate in a sub-
stance that it currently participates in, then
that individual is destroyed; if my dog Fido
ceases to be a dog, the individual Fido has
ceased to exist. (4) Substances signify that
which is individual that is, they provide a
way of individuating things. McKeon (1941)
explains that the substance is the concept
under which a thing is to be identified, if it is
to be identified at all. Two sorts of sub-
stances were distinguished, the primary sub-
stances (corresponding to individuals) being
what all else may be predicated of; the sec-
ondary substances (species, and so forth) do
not exhibit this characteristic on this analysis.
Nouns were taken to designate these sub-
stances, though with reference to a given qual-
ity: signify substance qualitatively differen-
tiated.
In contrast, and more weakly, Aristotle
proposed that verbs denote accidental quali-
ties by virtue of time (hence the tense endings
on the verbs), and did not fulfill the four
criteria above. Like verbs, adjectives denoted
accidental qualities and nothing more sub-
stance is not involved but unlike verbs and
like nouns (which, in Greek, shared case in-
flections with adjectives), adjectives had a no-
tion of permanence as a part of their meaning,
and did not signify by virtue of time.
Traditionally, Greek and Roman gram-
marians also offered similar accounts of syn-
tactic category. Diomedes says of nouns: A
noun is a complete expression with case and
without tense, signifying a material thing
(rem) properly or commonly (Irvine 1982).
Donatus gives a similar definition. The influ-
ential Roman grammarian Priscian explicitly
claimed that the parts of speech cannot be
distinguished from one another an any way,
except by taking into account their properties
of signification. The property of signification
of the noun was to signify substance and
quality (following Aristotle), while the adjec-
tive signify quality alone (and pronouns sub-
stance without quality). Priscians notion em-
384 VI. Nominalsemantik
Modistic analysis proceeds very much
along these lines, unconcerned for the most
part with what was subject to interlanguage
variation and hence of little interest for re-
vealing the universal generalizations under-
lying language (phonology, for instance, was
not included as an element of linguistic
study). The Modistic system was to a large
extent an attempt to converge the categories
of the tradition grammarians (chiefly Pris-
cian) and the metaphysical categories of the
Aristotelean/logical tradition.
An important notion inherited by this tra-
dition, connected with common noun mean-
ings, is the idea that there is an essential
ingredient inherent in an individual that
makes reference by use of a common noun
possible. This is called the quiddity of the
thing that without which the thing no
longer exists so-called because it consti-
tutes the answer to the question Quid sit?
(What (kind of thing) is it?). In giving the
answer to such a question (and the notion of
quiddity implies that there is but one answer,
so Aristotle is a man in answer to this question
but not a philosopher) one also gives the es-
sential nature of the thing; an implicit mode
of individuation is implied by the use of a
noun in answer. We do not identify objects
solely on the basis of pronouns, or ostention,
or demonstratives.
This gives rise to the question of whether
this essential property of a thing is determined
only relative to a given mode of reference, or
whether there is an absolute sense in which a
given object, however referred to, has a single
essence. This latter position is referred to as
Aristotelean essentialism by Gupta (1980). It
would not appear that the medieval gram-
marians were committed to this strong form
of essentialism, as not all nouns give essential
properties to things (e. g. runner). However, if
each noun carriers with it an implicit mode
of individuation, each noun carriers with it
some designation of an essential property
something must have to fall under that con-
cept (however ill-defined or abstract the prop-
erty). Thus, to use Kretzmans example, des-
ignating this as a coat is different from des-
ignation it as a piece of cloth. Asking
whether this is the same coat as the one I saw
yesterday is quite different from asking
whether it is the same piece of cloth as I say
yesterday. Coats and pieces of cloth have
different quiddities, for one could destroy the
coat without destroying the piece of cloth (by
making it into a pair of trousers, for instance).
verbs except that they cannot link with a
subject of a sentence as a verb can. Adjectives
and nouns, though, can be linked if supple-
mented with a copula. Thus, be a man or be
white are, on his analysis, complex verbs,
sharing the same type of signification.
But by far the most intensive effort so far
among grammarians and philosophers to at-
tribute meanings to syntactic categories is to
be found in the work of the Modistae, whose
main body to work was accomplished in the
late 13th and early 14th centuries (see Bursill-
Hall 1971, 1975; Pinborg 1976 for basic re-
views of the work of this group of speculative
grammarians). Their work was based to a
large extent on the work of Priscian, as well
as the Aristotelean framework as passed
down through the translations and commen-
taries of Boethius on Aristotle. They sought
to explain the universal form of language (of
which Latin was assumed the best known
example of a language where the universals
showed so plainly), by appeal to the nature
of reality itself. For furhter discussion, see
Kretzmann, Pinborg and Kenny (1982), Bur-
sill-Hall (1971, 1972, 1975, 1976), Coppleston
(1972), Pinborg (1976) and Moody (1975).
Though himself not one of the Modistae,
the basic perspective is expressed explicitly in
John of Salisburys Metalogicon Book 1
(McGarry, 1955). The argument in Chapter
14 (pp. 3841) proceeds as follows: Gram-
mar, though arbitrary and an invention of
man, bears the stamp of its origins, where
man named all the things that lay before him.
This gives us a stock of nouns, or names
denoting entities. These entities have quali-
ties, which differentiate the entities from one
another (some qualities accidental, other
more permanent) the name of these differ-
entia are adjectives, which depict the force
and nature of nouns in the same way that
properties of substances indicate their differ-
ences. He notes, for example, that nouns do
not admit of comparison since the substances
are themselves not subject to degrees of in-
tensity. Finally, verbs indicate that aspect of
substances with regard to change, either spa-
tial (motion) or temporal. And since there is
no motion independent of time, verbs (in
Latin) obligatorily bear tense. And since
movement is subject to change and variation,
verbs are used for expressing these aspects of
substances. Is this not a clear footprint of
nature impressed on (the devices of) human
reason?
17. Natural Kinds and Common Nouns 385
whether these other proposals care to coun-
tenance such things is more a matter of on-
tology than of semantics).
7. Proper Names, Kinds and the
Theory of Reference
Frege (1892) presented influential arguments
that a semantics needs to be constructed along
less conceptualist lines. Frege proposed that
there be a separation between the sense of an
expression and its reference in order to ac-
count for the possibilities of intersubstitution
of terms for one another in some contexts,
but not in others. The reference of a term is
its (actual) extension. If it is the meaning of
the term then extensionally equivalent terms
ought to be intersubstitutable for one another
throughout, salva veritate. As is well-known,
however, such extensionally equivalent terms
as animal with a heart and animal with a
kidney cannot be so intersubstituted. Thus,
Frege argues, each term has also associated
with it a different sense, in which the terms
mode of presentation is contained. Frege
also extended this analysis to the domain of
proper names, claiming that they had besides
a reference, a sense as well (thus differenti-
ating Hesperus from Phosphorus and Cicero
from Tully). Finally, and crucially, Frege ar-
gues that senses cannot be construed as ideas,
but instead need to be treated as public en-
tities representing the objective content of our
thoughts. Thus, while two people might have
different ideas about the meaning of a term,
they can still be said to share the same sense,
which is only possible if senses are not ideas.
The notion of granting proper names
meaning in the same way that other common
nouns may be said to have meaning, whether
as a Fregean sense, or as a Russellian definite
description, has the merit of solving the in-
tersubstitutibility dificulties with coreferential
proper names, but it strikes many people as
counterintuitive (see article 16 on Proper
names for a much fuller and more qualified
discussion). If reference to an object can only
be achieved as the result of that object satis-
fying certain predicates or having particular
properties, then these predicates or properties
must be associated with any word or words
that successfully refer. Hence, either names
must be so analyzed, or a new theory of
reference needs to be proposed.
Kripke and Putnam chose to argue that
the traditional analysis of names is incorrect,
The converse case is also possible, as with the
ship of Theseus which maintains its identity
through changes in material composition car-
ried out bit-by-bit in time; it is the same ship
but not the same quantity of wood.
In early modern times, Locke (as discussed
in Schwartz 1977 and Bolton 1976) held a
view that there are in fact two types of essen-
tial properties. On the one hand there was a
real essence, this essence being that which
determined all other qualities an individual
would have, forming the causal basis of the
phenomenal world (qualitites are those prop-
erties with the powers to produce ideas in the
mind see Bealer (1981)for one recent dis-
cussion of qualities). The real essence was
viewed as something that is unknown and
unknowable, beyond our epistemological
abilities to identify (Locke cites the difficulties
chemists of his time had in these attempts).
What was of most interest to Locke, though,
was the nominal essence, since the nominal
essence was essentially known and knowable.
These are the concepts of the mind by which
things are grouped together into kinds that a
common name (noun) might be applied to
all. Nominal essences are thus complex ideas
which serve as criteria for whether a given
individual is of that kind, and at the same
time provide a meaning for the associated
linguistic expression. Unlike real essences,
which subsist by themselves, nominal essences
are purely products of the mind; nominal
essences do not determine the qualities a given
thing actually has, for they play no real causal
role.
On Lockes view, then, the semantic con-
tent of any kind term is to be found in the
mind, resulting in a conceptualist view of
meaning. The most straightforward proposal
based on Lockes analysis is to treat the com-
plex ideas that constitute the nominal essences
as sets of properties which, if all apply to a
given individual, then that individual is sub-
sumed under that kind. However, other sorts
of analyses still consistent with the concep-
tualist view have also been proposed. Witt-
gensteins (1953) notion of family resem-
blance in his discussion of the category of
names is a more complex proposal, but one
still within the conceptualist framework. Sim-
ilarly, proposals which involve the notion of
prototypes or central exemplars, possibly
along with corresponding foils to mark cate-
gory boundaries, are typically conceptualist
proposals of meaning (since real essences do
not play a role in meaning in Lockes system,
386 VI. Nominalsemantik
In contrast, consider finding out that bache-
lors are not unmarried after all; under these
circumstances one could well be said not to
have understood the meaning of the word in
the first place. Hence, Putnam argues, natural
kind terms cannot be analyzed as any com-
plex of necessary and sufficient properties,
and that a different analysis of their meaning
is required. In particular, he argues that the
extension of the term is a part of the meaning
because the extension fixes the reference at
the essence of that extension as a represen-
tative of the natural kind.
Putnams most famous and most contro-
versial argument about the nature of the
meaning of natural kind terms is the Twin
Earth argument presented in Putnam (1975 b).
Putnam considers two auxiliary hypotheses
arising from the conceptualist hypothesis that
the meaning of a term is just a way of rec-
ognizing if a given thing falls under its exten-
sion or not; (1) that knowing the meaning of
a term is just a matter of being in a certain
psychological state, and (2) that the meaning
of a term determines its extension. Putnam
wishes to argue that these two hypotheses are
not mutually tenable, and that the first is the
one we should give up. Hence, meaning is not
entirely conceptual.
We are asked to imagine a place called
Twin Earth which is an exact double of the
present planet in all respects save one: that
all the clear liquid on Twin Earth that one
drinks, finds in lakes and rivers, bathes in,
and so forth, is not H
2
O, but instead a dif-
ferent liquid with a long and complicated
chemical composition abbreviated as XYZ.
On Earth and Twin Earth alike, the word
water is applied, and a Twin Earthian visiting
Earth would call our stuff water just as we
call XYZ water upon visiting Twin Earth.
No one can tell the difference between XYZ
and H
2
O, and we are asked to roll back to
the time to about 1750, before chemistry was
developed on Earth and Twin Earth, so even
expert chemists of the time could not distin-
guish the two. Putnams conclusion is that
the term water on Earth means something
different from the term water on Twin Earth,
even though an Earthian and his Twin-Ear-
thian exact counterpart may be in exactly the
same psychological states. Hence, the exten-
sion is a part of the meaning, accounting for
this difference in meaning, since the meaning
difference cannot be accounted for psycho-
logically.
and that a new theory of reference is indeed
the appropriate course to take. While
Kripkes arguments focused on proper names,
and while Putnams paid close attention to
the meanings of natural kind terms, the con-
clusion of both is that a semantics for these
terms requires incorporating non-psycholog-
ical constructs into the theory that are very
similar to Lockes real essences, or Aristotles
substances.
Kripke (1972) attacks the idea that the
referent of a proper name is determined via
reference to a cluster of properties given by
the meaning of the noun. I n a series of influ-
ential arguments, he shows that if one fixes
the meaning of a name as being a given cluster
of properties, it is still possible to use that
same name to refer to that same person even
if the person lacks one or more of those
properties. Kripke proposes instead that di-
rect reference is possible, and that proper
names refer directly to individuals, unme-
diated by any other reference-determining
properties. (See article 16, for extensive dis-
cussion of this point.)
Putnam (chiefly 1970 and 1975 b) focuses
on natural kind terms instead of proper
names (terms like lemon, tiger, and magnet-
ism) and develops similar conclusions about
the nature of reference. Putnam attacks the
traditional theory of reference, arguing that
for natural kind terms, at any rate, there is
no set of properties P such that any sentence
of the form K is P is analytic for any natural
kind term K (for terms like bachelor, however,
such properties can be specified; it is analytic
that bachelors are unmarried and male). So,
for example, suppose one specifies that lem-
ons must be yellow, or have a tart taste. One
can always imagine objects which do not have
these properties, but are lemons nonetheless.
For example, green lemons are still lemons,
and if a change in the suns rays caused all
lemons to turn blue (so that they were never
yellow again), then they would still be lemons.
Putnam argues that even such central classi-
ficatory properties as mammal-hood are not
analytic. It was, after all, a discovery that
dolphins are mammals, even if at one time
they were thought to be fish, but they re-
mained dolphins. Or, Putnam argues in a
more far-fetched example, suppose we dis-
cover that cats are really very cleverly-con-
structed robots from Mars (and not organ-
isms of any type at all). They would still be
cats, though their nature would be quite dif-
ferent from what we had thought at one time.
17. Natural Kinds and Common Nouns 387
nity. English speakers are required by their
communities to be able to distinguish tigers
and leopards, but not beeches and elms. This
minimum level of competence is contained
within a stereotype associated with a term.
Stereotypes represent what are taken to be
the central, paradigmatic feature of a class,
for instance the stripedness of tigers or the
yellowisch color of gold. However, these are
not necessary properties (unstriped tigers are
tigers, white gold is still gold), nor is it nec-
essary that the stereotypes be accurate only
that they be conventionally agreed-upon.
However, there appear to be a few properties
associated with kinds that are especially re-
sistant to revision and particularly central to
the associated concept, and Putnam wishes to
single these out for special consideration since
these properties involve a system of classifi-
cation, as when we consider tigers to be ani-
mals or gold to be a metal. He calls properties
with this character semantic markers. In the
end, then, a words meaning consists of a
complex of properties which collectively de-
termine the reference of the term indexically
and specify the minimum level of knowledge
required of the linguistic community for ap-
propriate usage. These include (i) the syntac-
tic characteristics of the word (e. g. mass
noun, etc.), (ii) semantic markers, (iii) the
stereotype, and (iv) the extension, the first
three characterizing the speakers compe-
tence.
8. Reaction to Kripke and Putnam
The arguments of Kripke, and Putnam in
particular, have generated a large amount of
commentary on a wide range of issues; most
revolve around the question of the viability
of the essentialism underlying their conclu-
sions, even if Kripkes arguments repeat the
basic argument of Aristotle. It is crucial to
the story that there be some real elements of
the world that are not products of the ability
of humans to classify phenomena on the basis
of some psychological notion of similarity,
which serve to ground the reference of names
and natural kind terms. It is conceded very
much from the beginning that there are terms
expressing kinds for which there is no such
natural grounding, non-natural kinds like
bachelors or big things, which do call for an
account based on human classificatory pro-
pensities. Thus, one of the main tasks of the
Kripke-Putnam view is to provide a means of
distinguishing natural kinds from the others;
A slightly different point may be made
using more realistic examples, which points
to a difference in meaning not traceable to a
difference in mental states in the individual
user. Putnam claims not to be able to tell the
difference between beach trees and elm trees
that his concept of both are identical.
Nevertheless, in using the term elm he means
by that elm trees and not beech trees, and in
using the term beech he means beeches, and
not elms. In differentiating the terms Putnam
proposes that he is relying on other people
who are in a position to distinguish the two
(such as botanists), and that his legitimate
and accurate uses of these terms relies not on
any concepts he has in his head, but instead
on the uses of the terms by other people,
whose uses are in turn fixed by the extensions.
Thus, Putnam proposes that meaning in-
volves a social component as well as an ex-
tensional component. Traditional theories of
meaning thus leave out two important ingre-
dients of meaning the social and the real.
The central point so far, then, is that nat-
ural kind terms have an indexical character
in that when the reference of a term is fixed,
it is fixed indexically. The Twin-Earthians
water is the water there, and the Earthian
water is the water here, and like the indexical
(or token-reflexive) terms such as I or now
or here, the psychological state of the user is
not what determines reference. If, for in-
stance, I sincerely believe that the time is three
in the afternoon and it is in fact only one in
the afternoon, my uses of the term now will
mean one oclock in the afternoon, and not
three. And someone else who uses the term
now at the same time as I do who is in a very
different psychological state (the person may
think it is ten in the morning), nevertheless
successfully refers to the same time as I do,
namely, one in the afternoon, in spite of our
differing mental states. So natural kind terms
include an indexical component as well which
is sensitive to more than a persons mental
state.
Still, even in the case of natural kind terms,
it seems that speakers of the language need
to have some idea of what they are talking
about in order to use the term successfully.
As Putnam points out, if someone points at
a snowball and asks if it is a tiger, there is
not much point in talking with him. Speech
communities have their own minimum stan-
dards which dictate a certain level of knowl-
edge, and these standards are social standards
that may vary from community to commu-
388 VI. Nominalsemantik
plausibility and promises to distinguish nat-
ural kind from other kinds. So, suppose in
this world that Rex is also a pet. It is difficult
to imagine another world where Rex is not a
dog and, say, a fly instead, but it is quite
reasonable to consider a world in which Rex
is not a pet. Hence, being a pet is not an
essential property and thus not a natural
kind, whereas dog is on this criterion much
more plausibly a natural kind.
However, this criterion, too, is open to
objection. On the one hand, it is not all that
clear that the basic intuition is all that sound.
Can we not really imagine a world in which
my dog Rex has been turned into a cat, for
instance? After all, we have stories in which
princes turn into frogs (see Price, 1980 for
such arguments). There appear to be real
examples of such metamorpheses in the real
world, as Schwartz (1980) has noted, as
wehen one element turns into another as the
result of radioactive decay.
Schwartz also cites the cases of the cater-
pillar and butterfly, and tadpole and frog.
Something like butterfly or frog would appear
to be a natural kind term, even on the as-
sumption that frogs and tadpoles, and but-
terflies and caterpillars, are disjoint types of
things. Still, it is quite easy to imagine a
possible world in which a given frog exists
but is not a frog (as, for instance, when the
same frog, let us call it Mel, is young and
hence a tadpole). It is also quite easy to imag-
ine a world in which Mel is never a frog, as
when Mel is eaten by a large fish while still a
tadpole. These are quite clearly possible
worlds, yet would appear to violate our as-
sumptions. Still other criticisms (such as that
of Norton 1982) involve the argument that
there is an element of circularity involved in
reasoning about generic essences. One is
prone to actually use the generic property as
a means of identifying an individual across
possible worlds, and hence it would appear
to be essential to that individual. The thrust
of these arguments casts doubt on the initial
hope that essentialism will serve as the key.
Unfortunately, the arguments often trade on
nuclear intuitions about what a possible
world may be like, and firm conclusions are
difficult to come by (see Plantinga 1974, for
example, on whether Socrates could have
been an alligator).
Another line of counterargument questions
whether Kripke and Putnam place too much
reliance on science to deliver the real essences;
perhaps their trust is misplaced. As Zemach
the other is to defend some notion of natural
kind as viable.
One natural suggestion following from the
Kripkean view of reference is to regard nat-
ural kind terms, like proper names, as rigid
designators, having the same extension in all
possible worlds in which an extension of the
term exists. However, as pointed out by Don-
nellan (1983), Schwartz (1977, 1980) and
Mondadori (1978) among others, this would
appear not so. The extension of the term tiger
may consist of one set of individuals in one
world and an entirely distinct set of individ-
uals in another (or, for that matter, at a later
time in the same world). This is precisely the
characteristic of descriptive, non-rigid terms.
Nevertheless, the evidence does militate in
favor of taking natural kind terms in fact to
be rigid designators (Mondadori 1978; Carl-
son 1978; Cook 1972). For example, in con-
trafactual contexts the extension of the term
would appear to be constant. The solution is
to then take natural kind terms as denoting
the same kind of things in each possible world;
thus the extension of the term is no longer a
set of individuals, but the kind itself (Mon-
dadori 1978; Donnellan 1983). Unfortu-
nately, though, rigid designation does not dif-
ferentiate natural kinds from non-natural
kinds at all, since such phrases as bachelor,
lawyer, or even yellow thing with a rounded
end all function as rigid designators in pre-
cisely the same way, by all the same tests, and
hence rigid designation fails to differentiate
the two types of kind-denoting terms. While
it is of interest that all such phrases function
as Kripkean rigid designators, this test fails
to isolate a set of terms which would intui-
tively be called natural kinds.
Another non-semantic criterion that has
been proposed to distinguish the two classes
of terms harkens to the original Aristotelean
conception of essence: that which survives
change and by which a thing is identified if
it is to exist at all. The claim is that natural
kinds are properties which, if an individual
has that property in one possible world, it
must have the same property in all worlds in
which it exists. A wide variety of authors have
discussed this possibility, including Marcus
(1971), Cocchiarella (1976), Chandler (1975),
Mondadori (1978), Wiggins (1980), Plantinga
(1974), Copi (1954). For example, if Rex is a
dog in one possible world, then Rex must be
a dog in all worlds in which Rex is to be
found (assuming dog to be a natural kind
term). This metaphysical criterion has initial
17. Natural Kinds and Common Nouns 389
ally submicroscopic, which contains a core of
either DNA or RNA covered by a protein or
lipoprotein capsid which reproduces exclu-
sively within living cells. The point is that if
such a definition of virus is accepted, it
guides investigation into what is to count as
an instance of the kind in a way that is con-
tingent upon what happens to have been dis-
covered at the time, or what is taken as im-
portant at the time (for example, the disease-
inducing characteristics of many viruses in
humans seems to persist in their study even
if the range of things causing disease in people
is generally regarded not to be a natural kind),
Donnellan (1983) similarly cites the example
of whether elements are to be individuated
solely by reference to their atomic number,
rather than by their isotope number (i. e. by
the combined total of protons and neutrons
in the nucleus). Some isotopes of an element
behave quite differently from other isotopes
(e. g. by being radioactive), and it is quite
plausible to consider a classification of ele-
ments based on isotope number rather than
atomic number. Donnellans point is that
there is no way of showing that one of these
schemes is right, and the other wrong, in spite
of the fact that they divide the world into
very different natural kinds. Thus, science is
not only involved in discovery, but in stipu-
lation of meaning as well.
A similar point has been made about the
status of species in scientific investigation.
One hypothesis about species consonant with
the natural kind arguments of Putnam is that
they are individuals (Ghiselin 1974; Hull
1976), thus lending species a metaphysical
priority. This point of view has been subject
to question, however (see, for an overview of
issues Kitcher 1984 and Sober 1984). Lakoff
(1987) attacks the notion that species should
enjoy such priority. He points out that biol-
goists have varying criteria for individuating
species. One group examines the overall sim-
ilarity of the structures of organisms to de-
termine which should count as conspecifics;
another wishes to take into account the his-
torical origins of the kind in question. Still
another employs both criteria. Lakoff points
to some interesting cases in which the varying
approaches give different results, making the
point that there is no reasonable way to de-
termine which way of doing things is right.
Lakoff also points out that many of the cat-
egories commonly assumed to name natural
kinds (e. g. zebra, fish, and moth) are badly
gerrymandered categories which do not form
(1976) notes, science has a way of changing,
and showing its previous assumptions untrue.
For instance, of the four primary elements of
Greek physics earth, wind, fire and water,
quite possibly only the last may be a natural
kind. But Kripke-Putnam appear to hold that
the meaning of a term is established by point-
ing to an original set of examples of what are
taken to be instances of the same kind,
thereby establishing the kind as the reference
of the term. The rest is up to science to
enlighten us as to the nature of this grounding
kind. Thus, Kripke says, One might discover
essence empirically. Science can discover
empirically that certain properties are neces-
sary of cows, or of tigers ... (pp. 318, 322 f).
Canfield (1983) finds this view of things
most unsatisfactory, as does Cassam (1986).
One of the first difficulties is that in almost
all cases the original samples that served to
ground the original use of a term (if any such
samples could be isolated in the first place)
can no longer be examined by scientists.
Hence, what scientists actually examine are
items that are assumed to be of the same kind
as the original sample. It may even have been
that the original samples were in fact of an-
other kind which through subsequent usage
became connected to quite a different kind.
(Canfield cites a questionable fabricated ex-
ample about a ruler of England who was
duped into calling a sample of iron pyrite
gold, which is subsequently used by the king-
doms inhabitants to refer to gold and not
iron pyrite; still, the point remains a valid
one).
The Kripkean view also meets with the
objection that scientists are not themselves
making purely stipulative decisions about
what is to count as a member of a given kind.
That is, perhaps scientists themselves are in-
troducing an intermediate step in their inves-
tigations of natural kinds in which they take
certain discovered properties to be essential
to the kind, thereby redefining the kind. Can-
field cites Hughes (1971) discusion of how
viruses were first isolated and later defined.
First, viruses were taken to be causal agents
of certain diseases that passed through filters
that barred other microbes. So at first, viruses
were effectively defined by size (it is not at
all clear that any size specification at all ever
intuitively distinguishes a natural kind). Sub-
sequent microscopic analysis revealed a dis-
junctive defintion. Hughes writes: Modern
definitions abound, but most characterize the
virus as an infectious ... entity which is usu-
390 VI. Nominalsemantik
sulting from two terms that, on Putnams
account, mean the same thing.
Additional criticisms of Putnam have fo-
cused on the character of the Twin-Earth ar-
gument and the other arguments he presents
(Mellor 1977; Unger 1984). Zemach (1976)
asserts that the basic intuitions of the Twin-
Earth argument are simply wrong: that for
both the Earthian and the Twin-Earthian
counterpart, the term water mean the same
thing, namely, H
2
O or XYZ. These intuitions,
however, do not appear to be very widely
shared, and most counterarguments have ac-
cepted the intuition but focused on other
parts of the argument. Fodor (1982, 1987)
adapts the intuitions but disputes the conclu-
sion. It is not entirely clear that Putnam can
legitimately claim that the Earthian and the
Twin-Earthian doppelganger can be mole-
cule-for-molecule the same. Both, Zemach
points out, can be said to have different in-
tentions precisely because they are different
individuals living in different worlds with dif-
ferent scientists living in them and this results
in different mental contents. (However, see
Parret 1982 for an argument that the differing
indexicality values of the first-person I do not
have this consequence). In spite of the objec-
tions, the Twin-earth story appears to tap into
strong and widely-held intuitions which have
led to various efforts to further investigate
the basic theory set forth.
Welsh (1988) takes issue with some of the
basic claims that Putnam and Kripke make
about natural kind terms. She argues, first of
all, that artifact terms and natural kind terms
should not be conflated. Artifact terms are
not to be defined analytically (contra
Schwartz 1978), nor are they to be defined
like natural kind terms (contra Putnam 1975).
Rather, artifact terms are those terms whose
reference determining properties are func-
tional properties, which themselves may not
be directly observable. (p. 104). She goes on
to argue that the relevant notions concerning
artifacts and natural kinds are the notion of
structure and function, and that by and large,
natural kind terms are structure terms, and
that artifacts terms are (again, by and large)
functions terms. Both of these categories are
opposed to purely descriptive terms, whose
extensions are determined by satisfaction of
some set of predicates.
Another point Welsh makes is that proper
names and structure terms (i. e. most natural
kind terms) should receive separate analyses,
and that it is a mistake to empty natural kind
kinds even under any scientific account. As
Lakoff is primarily interested in defending a
conceptualist view of semantics, he concludes
that the notion of natural kind should not be
countenanced. However, other writers equally
skeptical about the nature of species do not
draw precisely this same conclusion. Dupr
(1986) articulates a point of view in which it
is still possible to say that there are natural
kinds, yet not in making the claim he is not
committed to any form of essentialism, which,
he argues, is a separate issue. Dupr thus
argues that in discovering kinds (which can
be done) one is not thereby discovering es-
sences, as Kripke and Putnam would seem to
have it. Fales (1982) argues for a weaker form
of essentialism in determining natural kinds,
arguing that there are fundamental natural
kinds (which govern the basic physical con-
stituents of the world) but that the disconti-
nuities found in nature which form the basis
of speciation and so forth are derivative, and
not themselves fundamental. Thus, there are
natural kinds, but tigers and gold would not
be among them.
Some of these criticisms may be blunted
by a reformulation of Putnams analysis of
meaning of natural kind terms which reflects
scientists reformulations of the extension of
a term. McKay and Stern (1979) argue that
the four-part analysis of natural kind terms
needs to be supplemented by a notion of
standards of membership. The argument is
that Putnams proposal as it stands allows
that two terms might have the same extension,
markers, stereotype, and syntactic markers,
yet still mean different things. They suggest
the case of theoretical terms drawn from dif-
ferent disciplines, such as chemists bionic
compound and biologists vitalic compound.
These have the same extension, plausibly the
same semantic markers, and apparently the
same stereotype (such as carbon compound
occurring in organisms). Still, chemists and
biologists might apply different standards of
membership, and hence would mean different
things by their terms; biologists might insist
that the compound be produced in an organ-
ism, but the chemists might only pay attention
to the chemical properties alone. As it is these
standards of membership happen to yield the
same results, yet it is easy to imagine a world
in which a vitalic compound might not be
produced in an organism, and hence it would
not be called a bionic compound. Including
a set of standards of membership would
avoid this difference in possible extension re-
17. Natural Kinds and Common Nouns 391
we can imagine being that that badly mis-
taken about things, the conclusion appears
correct that pencils (i. e. those things) turn
out to have quite a different nature from what
we first thought; we would not deny that they
are pencils. However, it is not clear that this
criterion will work in all cases. Sloops are
boats would appear to be a stable generali-
zation, or arguably so, yet according to
Schwartz sloops would not be a natural kind.
In such cases as these, the reply is that boat
is a part of the meaning of the word sloop,
and hence we are dealing with an analytic
truth and not an exotic one. It is easy to see
how one might go back and forth on this for
some time in the absence of clear criteria for
analycity.
In investigating the question of which noun
phrases denote natural kinds, it becomes dif-
ficult occasionally to draw clear boundaries.
One point of debate is whether artifacts (pen-
cils, sloops, shoelaces, etc.) should be consid-
ered natural kinds. If we mean by natural
kind that the kind is simply not man-made,
then pencils and so forth would be excluded,
but then so would substances such as plastic,
which quite reasonably should be classified
as a natural kind (Bolton 1976). Schwartzs
arguments are directed towards trying to dif-
ferentiate artifacts from other naturally-oc-
curring kinds (his definition would count
plastic as a natural kind). However, some
believe that the Twin-earth arguments, when
applied to artifact terms, show them to be
natural kinds as well. Abbott (1989), in a
review of major issues surrounding Putnams
arguments, expresses doubt that terms like
pencil should be excluded from the list of
natural kinds. She finds it odd that ... Put-
nam only considers internal structure prop-
erties as possible denotation-determinants for
artifact terms. On the face of it, we might
imagine that exostructure, general appear-
ance, and/or function would be a greater im-
portance in the case of an artifact. Unfor-
tunately, in constructing the Twin-earth type
arguments, the intuitions become weakened.
So, for instance, consider another world in
which there are thin wooden things with
graphite cores, erasers at one end, but the
people in that world never write with them
(they write with something else) and in fact
eat these things for breakfast; additionally,
they are made in factories for their nutrional
content and bear the form they do for the
sake of ease of digestion. Now, are these
things pencils? The answer ist most unclear.
terms of all descriptive content. Proper names
are, as Kripke claims, fully non-descriptional.
But structure terms include a description
(akin to Putnams stereotype) which plays a
role in determining the content of a term.
However, Welsh argues, the stereotypical de-
scriptions do not provide an analytic defini-
tion; they are, rather, partial specifications
which require a context in order to specify
contents. To collapse proper names with func-
tion terms fails to represent the difference
between contentless terms, on the one hand,
and incomplete knowledge on the other.
Schwartz (1980) discusses one proposal
which he sets forth to distinguish natural kind
terms from the rest. One of the striking char-
acteristics of certain types of sentences in-
volving natural kinds is that they can be nec-
essary truths, yet synthetic and known only
after empirical investigation (a posteriori).
Whales are mammals falls into this category.
It is a necessary truth, yet it is one that had
to be discovered by examining whales. It is
also clear that the meaning of the word whale
does not include the meaning mammal in
the same analytic way that unmarried is re-
lated to the meaning bachelor. Donnellan
calls these truths exotic truths. One of their
chief characteristics is that if the truth holds
for any one member of a natural kind, it must
hold for all. If one whale is discovered to be
a mammal, then they all must be; it is not
possible for some to be mammals, others fish,
and perhaps others amphibians. Generaliza-
tions with this character Schwartz refers to
as stable generalizations. He goes on to hy-
pothesize, ... a term is a natural kind term
if and only if it occurs as the subject term of
some stable generlization. A term is a nominal
kind term if and only if it does not occur in
any stable generalization (p. 187). Thus the
claim is that a nominal kind, such as barbed
wire cannot occur as the subject of any such
generalizations. Consider, for instance, the
claim that barbed wire is made of metal. This
is not a stable generalization, since it is easy
enough to imagine some barbed wire not
made of metal (e. g. a special plastic com-
pound) without it following that all barbed
wires must be made of the same material.
Consider as a possible counterexample the
statement that pencils are artifacts. This
would appear to be stable generalization, at
least at first sight. However, Schwartz points
out that we might be mistaken about the
nature of pencils suppose they grow in
bushes (and thus are not artifacts). Now, if
392 VI. Nominalsemantik
not the impurities. By regrounding a term,
however, the stable part of the reference will
be H
2
O, and the impurities will be unstable,
varying from sample to sample.
This emphasis on grounding the meaning
of a term in extensions has also been discussed
by Kripke (1972) and Bennett (1979). Con-
sider the non-existent kind unicorns. This
kind has no extension in the real world, and
hence there is no grounding for the term
(nothing for the indexicality of the term to
connect to). It is quite tempting to think of
unicorns as a species of horse-like animals
which, instead of inhabiting some place across
the ocean, inhabit another possible world.
The point Kripke makes is that the story does
not tell us enough about unicorns: we have
no idea what their internal structure would
be. Thus, in a world inhabited by a variety
of species, all having the relevant character-
istics of unicorns (white, one horn, large,
horse-like, etc.), we could not tell which one
of those was the unicorn species, and which
were similar but other species. And in the
absence of being able to do this note that
we cannot say, Choose the ones that are like
these here the term unicorn has no definite
natural-kind reference. A similar story might
be told for fictional substances as well (e. g.
kryptonite, of the Superman stories).
Here we might draw an analogy to names
of fictional characters. Lycan and Shapiro
(1986) consider the problem of essence of
non-actuals, such as the fictional Perry White,
the editor of the newspaper the (fictional)
Superman/Clark Kent works for. Now, Lycan
and Shapiro ask us to consider the following
question: Might he have gone into bricklay-
ing, philosophy, or nursing, instead of jour-
nalism? (p. 359). We feel pulled two ways.
On the one hand, the answer appears to be
no. If the author of the original Superman
story had eliminated the editor character, and
put in a janitor named Perry White instead,
there would be no real sense in which we
could say that the janitor is the same Perry
White as the editor. In stark contrast are real
individuals, for whom we feel no such ambiv-
alence. Kripke could have gone into bricklay-
ing instead of philosophy. Thus, it appears
that fictional characters must have the stip-
ulated properties associated with them in or-
der to remain the same character. On the
other hand, if we take the point of view of
someone else who is already in the story (e. g.
Clark Kent), there is a clear sense in which
Perry White might have not gone into jour-
Somewhat surprisingly, Putnam would ap-
pear to agree that artifacts might be natural
kinds. In a reply to Schwartz, Putnam (1982)
concludes that things like sloops and jokes
could well be natural kinds, depending on
ones perspective. From a given perspective,
any kind could be regarded as a nominal kind
or as a natural kind. De Sousa (1984) likewise
comes to the conclusion after examining pro-
posed distinguished features of natural kinds,
that virtually any kind, including artifacts,
can be viewed as a natural kind relative to
some set of interests or epistemic priorities.
If you shift these, a nominal kind may take
on the character of a natural kind. One could
draw the conclusion from these arguments
that natural kinds should not be distinguished
from nominal kinds. However, this conclu-
sion need not follow. It may only shed light
on why certain Twin-earth type stories yield
unclear results, whereas others do not (e. g.
the case of H
2
O and XYZ). The basic argu-
ments assume a background set of epistemic
priorities and/or interests, and in the case of
artifact terms or similar terms, the epistemic
priorities are easily adjusted to obtain oppos-
ing intuitions. If one is unclear about the
precise character of these background as-
sumptions, one cannot account for the source
of this variation.
There is one line of argument, however,
which lends substance to the notion that nat-
ural kinds are essentially indexical in the way
Putnam suggests. This line of argument em-
phasizes the necessity of grounding the uses
of the term in an (actual) extension. In a
reanalysis of the causal theory of names, fo-
cusing on natural kind terms, Sterelny (1983)
discusses two modifications of the theory:
first, that the theory must be able to account
for kind terms adduced in the absence of
sample, and second, that the theory must
include subsequent uses of a term in fixing its
reference above and beyond an original dub-
bing event. In the first modification, it is
necessary to provide a role for (referential)
definite descriptions in originally fixing the
extension of a term, as when samples are
inaccessible (e. g. black hole). The second
modification allows for the constant re-
grounding of a term through subsequent use.
The term may in fact undergo change as the
result of this regrounding. Or, it may serve
also to stabilize the meaning of a term. For
example, Putnam and Zemach both note the
problem of impurities in samples (say, of wa-
ter), yet the term water refers to H
2
O, and
17. Natural Kinds and Common Nouns 393
as well, by reference to causal, scientific the-
ory.
This emphasis on causation may also be
the key to an outstanding difficulty with the
Kripke/Putnam story how the meanings of
natural kind terms are fixed, namely, which
kind is one pointing at in applying a term to
an instance if a given instance may exemplify
a large number of distinct kinds? One sug-
gestion, found in Wiggins (1980) and else-
where, is that the instance is to be classified
under the highest kind (or sortal) available.
However, as Strawson (1981) has pointed out,
the idea of a highest sortal carries substantial
difficulties which are not easily circumvented.
An alternative proposed in Sterelny (1983)
appears more promising. In identifying an
instances as an instance of a certain kind, one
is not simply pairing a noise with an instance,
but there are other prerequisites which must
be fulfilled in order for a term to be applied
felicitously as a grounding instance of the term.
The speaker must have (a) recognitional ca-
pacities, and (b) knowledge of causal powers.
The recognitional capacities require that one
has the ability to discriminate with some de-
gree of reliability between instances and non-
instances of the kind. On the other hand, one
needs to also have some knowledge of the
causal powers of the kind this need not be
couched in terms of a scientific theory the
causal powers governing the role the instance
plays in its interactions with the world. If
these two requirements are fulfilled, one can
isolate kinds from their superordinates and
their subordinates. (If the first requirement of
recognitional capacity is sufficient, one has a
nominal kind). Note that the crucial distinc-
tion is that these requirements only apply to
grounding instances of the use of the term.
One may use the term felicitously as a non-
grounding instance even in the absence of
these two types of knowledge.
We close this section with an emphasis on
the causal powers of natural kinds. However,
it is also clear that a semantic analysis of
natural kind terms needs to be embedded in
a more general theory of common noun
meanings. In the following section we will
examine some formal treatments of common
noun meanings. The central focus in each will
be that common noun meanings carry with
them powers of individuation; that in the
absence of common noun meanings we find
no preclassified set of individuals. This per-
spective draws on traditions that have been
mentioned above, but in more recent years
nalism. However, notice too that Clark Kent
is, in the story, able to ground his uses of
the name Perry White by reference to an
individual with extension in that world.
Similar things might be said about fictional
natural kinds. There is a clear sense in which
unicorns must be single-horned and white,
etc., and that this cannot be a mistaken de-
scription of a species seen from afar. So, in
this sense there is no way we can agree that
unicorns might have two horns. But of a real
species, we might have some doubts; many
horned animals if viewed from the appropri-
ate angle appear to have one horn. So, we
could agree that oryxes might have two horns
instead of one, even if our community believes
(mistakenly) they have just one. But we can
also take the within-the-story perspective as
well, noting that from the perspective of peo-
ple in the story, modal properties of unicorns
may well exist (for those in the legend, it
would be possibly true that unicorns might
have two horns). This change in perspective
also conforms to a change in the availability
to ground ones uses of a term in extensions.
Thus, once again extensions appear critical to
meaning, for in their absence natural kind
terms behave like attributive descriptions.
A related theme also permeates the discus-
sion surrounding natural kinds, that of kinds
exhibiting real causal powers. The notion that
natural kinds have an inner structure that
science may discover may not be quite to the
point, for the inner structures are posited in
a science to account for the causal powers the
kind exhibits, not merely to classify tokens as
being of this kind or that. The connection
between causal powers and natural kinds has
a long tradition in Western philosophy ac-
cording to Cassam (1986), who describes this
idea as the Lockean/Leibnizian/Kantian in-
sight. He goes on to describe the insight thus:
The point here is that there is no question
of first of all identifying things and then at-
tempting to discover laws governing their be-
havior; for part of what it is to recognize an
object is to recognize its characteristic pattern
of behavior, its (causal) powers and disposi-
tions. (p. 101). Thus, as Fodor (1987) argues,
it is not correct to identify a kind with its
observed perceptually basic properties (to in-
clude its observable internal structure); rather,
the kind is to be identified with the causal
role played by the kind in determining what
our perceptions will be like under appropriate
circumstances. Copi (1954) wishes to distin-
guish real essence from accidents on this basis
394 VI. Nominalsemantik
mixed materials like mud, and so forth); nor
is there any necessary connection between
natural kinds and sortal concepts. It could be
that natural kinds themselves would not pro-
vide sortal concepts; but it seems to be a fact
that at least some do. Cocchiarella offers a
definition by which we can tell if a sort S is
in fact a natural kind (NK).
NK(S) =
df
k
F
c
(x) (Fx Sx)
i. e. for S to be a natural kind there must be
some sortal predicate F such that in all pos-
sible worlds where the same natural laws ap-
ply as this one (this is the import of the c
superscript), everything in each world is F iff
it falls under the sort S. Natural kinds, on
this account, are not the sorts themselves, but
are (contingently) associated with them. The
result appears to be a Lockean position where
all nouns in the language actually denote
something of the same class as non-natural
kind terms (though they are not mental con-
structs for Cocchiarella), and only a certain
subset of these sorts are associated with some-
thing else out there; but in no sense does a
noun in this system actually denote a natural
kind. Indeed, he allows for the possibility that
there are natural kinds for which we may well
be unable to have any corresponding terms
in the language, or for that matter where
natural kinds correspond to the meanings of
words belonging to other syntactic categories.
Gupta (1980) attacks the problem of com-
mon noun meaning from the standpoint of a
possible worlds view of semantics. All predi-
cates (nouns, verbs, adjectives, and perhaps
some adverbs) have associated with them a
principle of application, a means by which the
extension of the term is determined (for
Gupta this is a semantic and not a psycho-
logical matter). But nouns also contain as
parts of their meanings another type of prin-
ciple, a principle of identity by which objects
are traced and identified from one time to the
next (persistence), and from one possible
world to the next (trans-world identity). Thus,
a principle of persistence for a common noun
K traces a K through time (i. e. it determines
when a K at time t is the same as or different
from a K at another time t). A principle of
trans-world identity for a common noun K
through possible worlds determines if a K in
one possible world is the same K as in a K
in another possible world. A major conse-
quence of this view is that trans-world identity
of individuals is not an element of the model
structure itself (what Gupta calls the standard
view), but instead these identities are deter-
the perspective has been articulated variously
by Strawson (1959), Geach (1962, 1973), Wig-
gins (1980), and Wallace (1965), among oth-
ers. In light of these discussions we will then
return to the question of the status of natural
kinds in a semantic theory.
9. Sortal Concepts
N. Cocchiarella (1977) presents a perspective
crediting Geach, Strawson, Sellars, and Wal-
lace as examples of philosophers who have
taken the view that common nouns are not
simply predicates like adjectives or intransi-
tive verbs. Strawson (1959) says that a sortal
concept (provided by a noun) ... supplies a
principle for distinguishing and counting par-
ticulars which it collects. (p. 168). Cocchi-
arella, following a suggestion he finds implicit
in Wallace, associates sorts with the notion
of restricted quantification. He argues that
even standard systems of unrestricted quan-
tification implicitly presuppose some sortal
concept like object or entity determining
the range of values for the variables, and
about which identity statements can be as-
serted. Like Gupta (to be discussed shortly),
Cocchiarella holds that sorts, as denotations
of count nouns, provide us with criteria for
identity, where each thing is identifiable and
can be referred to at all only through criteria
provided by some sortal concept under which
it falls. He excludes mass nouns and very
general count nouns like thing and object,
though providing no defence of the exclusion
of mass nouns apart from their apparent fail-
ure to describe a set of packaged individuals.
He takes great care to assert that this is a
semantic principle which need not have any
direct epistemological counterpart. This
claim should in no way be confused with the
different (and false!) claim that each thing is
individuated in accordance with some (or
any) sortal concept by means of which it can
be identified (p. 444).
Cocchiarella regards the natural kinds as a
particular subset of these sorts. They are es-
sential to an object (as identified under that
kind), and represent the natural power or
capacities which things have to act, behave,
function etc., in certain specific and determi-
native ways: to be in fact the causal basis for
the natural laws upon which our scientific
theories are constructed. (p. 456). He does
not hold that all things fall under some nat-
ural kind or other (exceptions being artifacts,
17. Natural Kinds and Common Nouns 395
constant (has the same extension everywhere)
and (b) K is separated (the individual con-
cepts in Ks extension never overlap). A con-
cept like number or planets is not modally
constant, because it picks out different num-
bers in different possible worlds, whereas the
concept number is modally constant. Mo-
dal separation is the other requirement; an
intensional property I is separated (with re-
spect to a model) iff any two individual con-
cepts (functions from worlds to individuals)
falling under I are such that if their extensions
are identical at a given world, then the indi-
vidual concepts must be identical as well. For
instance, person expresses a separated prop-
erty because the individual concepts falling
under that sort are such that if any two (e. g.
Cicero and Tully) pick out the same individual
at world
1
, they must pick out the same indi-
vidual at any other world.
Thus, while Guptas full analysis presents
a compelling view of common noun mean-
ings, his system goes only part way towards
identifying a class of natural kind meanings
(a subclass of his substance sorts). Natural
kinds, it appears, would be the subclass of
substance sorts which have a particular ori-
gin, a matter above and beyond his semantic
analysis.
If we consider the way that natural kinds
are to be isolated in the analyses reviewed (of
which Cocchiarella has the most to say di-
rectly), we see that natural kind terms must
come with principles of individuation and ap-
plication as a part of their meaning (which is
consistent with the traditional views). How-
ever, the analyses do not force us into the
position of including natural kind terms as a
class of common nouns meanings semanti-
cally distinguished from the rest. Instead, the
class of natural kinds may be isolated by
reference to some property of the denotation
that is not part of the meaning of the common
noun itself (as Cocchiarella and, it appears,
Gupta would appear to have it). For instance,
the notion of natural kind may be constituted
in a belief we hold about the reference of the
term. In the final section, we will consider the
status of natural kinds more fully.
10. Conclusion
The discussion above points to an array of
insights and arguments which appear to point
towards some notion of natural kind, but no
definitive analysis can be presented which
mined and given by the interpretation of the
common nouns of the language. For each
world, a common noun establishes a set of
certain types of intentional properties called
individual concepts (which, in spite of the
name, are not mental constructs). So, for ex-
ample, the word ship determines a set of in-
dividual concepts of particular ships which
are used to trace each ship from world to
world and time to time. The collection of such
concepts represents the principle of identity
of the word ship. Common nouns, then, pack-
age the objects of the world according to the
principles of application and identity. The
principle of identity as reflected in language
provides us a means of counting things. De-
pending on which noun we use to describe
what we are counting, the same objects may
be counted differently. Thus, Gupta notes
that passengers and people are counted dif-
ferently (one person traveling twice counts as
two passengers), though at some level they
seem to be the same things (all passengers are
in some sense people).
A related natural language phenomenon
affected by principles of individuation, as
noted above, is the use of the term the same
N, where the N chosen will give rise to dif-
ferent judgments regarding whether or not x
is the same as y a matter that cannot be
determined absolutely, but only with refer-
ence to a sort, the meaning of a common
noun. Other predicates, like adjectives and
intransitive verbs, play no role in individua-
tion and reidentification, and even in com-
bination with common nouns should thereby
play no role in building up of complex ex-
pressions denoting a sort distinct from the
sort already determined by the head common
noun. So, we count and reidentify fat man by
counting and identifying men that the predi-
cate fat applies to. This would appear to be
correct.
Gupta distinguishes a subclass of common
nouns which he calls substance sorts. These
are common nouns which, he hypothesizes,
are essential properties of individuals. The
sort expressed by the common noun man
would on his analysis be a substance sort,
whereas the one expressed by the common
noun man born in Jerusalem would not, since
a man may fall within its extension in one
world yet not in another, and still remain the
same individual. The common noun man sat-
isfies the definition of substance sort (p. 45)
which expresses basic essentialism:
K is a substance sort if (a) K is modally
396 VI. Nominalsemantik
vice-versa. For example, Burge (1982) in-
forms us that arthritis is not a physiological
kind, but instead is applied to any inflam-
mation of the joints whatever source. Putnam
discusses the case of jade which in fact applies
to two quite distinct substances; vitamins,
once thought to form a natural class, do not.
Were dinosaurs a natural kind? Are wallabies
kangaroos or a separate species? There is the
intuition that reversing conceptions of this
sort, which appear to cross the natural-kind/
nominal-kind boundary, call for major revi-
sions in our concepts in a way that is not
called for if we learn that dinosaurs lived
longer ago than we had thought, or that jade
is an igneous and not a sedimentary creation.
Other less anecdotal observations also ar-
gue for a separation of vocabulary type. F.
Keil (1986, 1988) has shown that children
come to distinguish natural kinds and nomi-
nal kinds at a certain stage of development.
Keil asked children to judge whether various
objects could undergo transformations and
remain the same sort of object. Keil tells a
couple of contrasting stories. One is about
raccoon-like creatures that turn out to have
all the relevant microstructure of skunks (in-
cluding having skunks for descendents and
ancestors). By about second grade, the ma-
jority of children assert that these creatures
were in fact skunks, though they looked just
like raccoons. On the other hand, Keil tells a
story about artifacts which have been trans-
formed into other artifacts (e. g. things that
look like and function like coffee pots, but
turn out to have beem made out of bird
feeders). Children at no point come to the
conclusion that these coffee pots were really
bird-feeders in any great numbers. Thus, the
(tentative) conclusion of this line of research
is that there is a separation of vocabulary
type which emerges with age in which out-
ward appearance of an object either plays or
does not play an important role. Further-
more, at an early age, children seem to treat
all terms alike, making no such distinction
(i. e. natural kind terms at an early age are
treated about the same as nominal kind
terms).
Keil also remarks anecdotally that it is not
simply an exposure to science which, as a
matter of formal education, forces these dis-
tinctions on children. Based on work he at-
tributes to Sheila Jeyifous in Nigeria, he re-
ports that among traditional non-literate Yo-
ruba people, the same kinds of developmental
shifts in vocabulary are evidenced. What is
most would regard as reasonably satisfactory.
In fact, the objections may appear strong
enough to some to demand abandonment of
the whole notion.
Yet, there are a number of quite compelling
phenomena which still require attention, and
which bring one back to consideration of
natural kinds. There is, for instance, the basic
intuition that natural kind terms are in some
way non-accidental, perhaps essential or at
least central properties in a way that other
terms are not. Natural kind terms appear
much better than others to delimit domains
for doing science, the results of which have
in many cases yielded rewarding results. It is
hard to imagine a biology based on size dis-
tinctions alone, for example, yielding the
same sort of insight that our basic notion of
species and genera appear to yield, even if
some of these notions (or, perhaps many of
them) do not match up with nature in the end
(for example, many people might regard
beetle as a species when in fact it is a very
general term that includes about 290,000 or
so species (Dupr 1981)).
The Twin-earth argument and others pre-
sented by Putnam also yield, for many, strong
and striking intuitions which distinguish
terms like water from more descriptive terms
like bug. While there have been many critics
of the arguments, most have accepted the
basic intuitions and argued instead that the
consequences of the intuitions are not what
Putnam and Kripke take them to be. The
arguments which revolve around the necessity
of an extension to ground the meanings of
the term have been discussed less (though see
Salmon 1981), but again point to a contrast
which needs account. The basic idea that nat-
ural kinds are associated with causal roles,
and hence serve as the locus of powerful gen-
eralizations, also is a compelling intuition
lending prima facie credence to such a dis-
tinction.
Many people can attest anecdotally to the
observations that natural kind terms are
among the most difficult to learn of a new
language being acquired (despite the fact that
most have very precise definitions and are not
subject to vagaries of usage); this would ap-
pear to point in the direction of an analysis
which did not grant natural kind terms much
descriptive content, like proper names. We
also have the strong intuition that a signifi-
cant readjustment in our conceptions follow
learning that what we once assumed to be a
natural kind is a nominal kind instead, or
17. Natural Kinds and Common Nouns 397
(50)
a. The wooly mammoth is extinct.
b. Dinosaurs are extinct.
But it is quite strange if extinct is applied to
what does not seem to be a natural kind:
(51)
a. ?People who try to make gold from
lead are now extinct.
b. ?Big lazy dogs are extinct.
Unless these kinds are thought of (somehow)
as being species or similar natural kinds, the
examples are strange. The predicates of this
class may be few and far between, but may
also include the objects of such verbx as dis-
cover or invent (or possibly technical vocab-
ulary such as isolate in chemistry).
What one will generally find, though, is
that phenomena which semantically appear
to single out natural kind terms also include
artifacts and other products of human inven-
tion. Consider the distinction in English be-
tween bare plural forms and their correspond-
ing definite generic forms. Under many cir-
cumstances, these are felt to be synonymous
(e. g. lions vs. the lion). However, various writ-
ers (e. g. Vendler 1967b; Lawler 1973) have
noted a subtle semantic difference between
the two, with the range of application of the
definite generics limited. There are perfectly
acceptable bare plural generics for which the
corresponding definite form is judged unnat-
ural. For example, alongside the term circles,
one can comfortably speak of the circle.
However, as Vendler (1971) notes, the form
curves has no corresponding natural form the
curve his explanation is that curve is too
general. However, definite singular generic
forms cannot be convincingly applied to even
some very specific common nouns. For ex-
ample, while one might speak of dusty blue
refrigerators, there is something very strange
about the form the dusty blue refrigerator
(though the form the refrigerator is quite ac-
ceptable). Clearly, this is not simply a syntac-
tic or morphological matter (although there
are some such restrictions, as for instance, in
English mass terms have no corresponding
definite form, whereas in other related lan-
guages (e. g. German and French) they do).
Many proposed cases of non-natural kinds
do not accept the definite article well. Thus,
phrases like the bug, the varmint, the short
bush are difficult to use. If one makes an
inventory of the sorts of generic phrases in
which the definite article is used most natu-
rally, one finds alongside species and other
lower biological taxa: artifacts (just those that
can be invented) such as the mechanical pencil
particularly interesting, though, is that the
mode of explanation differs. Thus, when a
Yoruba subject judges that a sheep which has
acquired all the characteristic features of a
goat is still a sheep, she may justify her re-
sponse not by referring to evolution of bio-
logical laws, but by referring instead to what
is loosely called Yoruba metaphysical logic,
wherein she might discuss how the two ani-
mals were created by different gods in certain
ways, and how such origins override simple
changes in characteristic features (p. 146).
These cross-cultural remarks are consistent
with the findings reported in Berlin (1973),
who reports that among Amerindian cultures,
strong phenomenal differences of e. g. male
and female of bird species are overlooked in
favor of vocabulary which divide animals ap-
proximately according to species lines
(though Lakoff notes that it is more often the
genus level that bears the common name, e. g.
maple). Berlin states, There is a growing
body of evidence that suggests that the fun-
damental taxa recognized in folk systematics
correspond fairly closely with scientifically
known species (p. 210).
In sum, an account is due to a series of
arguments and phenomena that all point at
least in the general direction of the natural-
kind/nominal-kind distinction. No competing
point of view on these phenomena has
emerged which expresses the distinction as
generally or as distinctly.
Finally, let us consider natural language a
bit more closely. At this time, I know of no
human language which grammatically marks
a distinction between nominal and natural
kinds (via e. g. gender marking of nouns, se-
lection of determiners, etc.). However, many
other major semantic distinctions do not nec-
essarily become encoded in the syntax or mor-
phology of natural language, either. This for-
mal absence can only count in favor of those
who do not find the direction compelling.
However, as a semantic phenomenon, it may
have significance for natural language in ways
that have not been yet discussed, and which
will be presented briefly in closing.
I will illustrate with English examples, and
while it is not clear how widely the phenom-
ena are shared, they are shared by some other
languages as well. In the analysis of the mean-
ing of certain predicates, in determining their
range of application, a notion of natural kind
may well come into play. Take, for instance,
the predicate extinct. One can reasonably say
the examples in (50):
398 VI. Nominalsemantik
11. Short Bibliography
Abbott 1989 Ashworth 1974 Bealer 1981 Ben-
nett 1975 Bennett 1979 Berlin 1973 Boehner
1952 Bolton 1976 Brge 1982 Bursill-Hall
1971 Bursill-Hall (ed. and translator) 1972 Bur-
sill-Hall 1975 Bursill-Hall 1976 Canfield 1983
Carlson 1977 Carlson 1978 Carlson 1979 Carl-
son 1982 Carlson 1991 Cassam 1986 Chandler
1975 Chandler 1986 Chomsky 1981 Cocchi-
arella 1976 Cocchiarella 1977 Cook 1980 Copi
1954 Copleston 1972 Dahl 1975 Declerck
1988 De Sousa 1984 Donnellan 1966 Donnel-
lan 1983 Dowty/Wall/Peters 1981 Dupr 1981
Dupr 1986 En 1981 Fales 1982 Farkas/Su-
gioka 1983 Fodor 1982 Fodor 1987 Frege
1982 Gazdar/Klein/Pullum/Sag 1985 Geach
1962 Geach 1973 Ghiselin 1974 Gillon 1990
Ginet/Shoemaker (eds.) 1983 Goodwin 1965
Gupta 1980 Harris 1959 Heim 1982 Hughes
1971 Hull 1976 Irvine 1982 Jackendoff 1977
Kamp 1981a Keil 1986 Keil 1988 Kenny 1980
Kinkade 1983 Kitcher 1984 Kramsky 1972
Kretzman/Kenny/Pinborg (eds.) 1982 Krifka
1988 Krifka/Carlson/Chierchia/Link/Pelletier/ter
Meulen (1991) Kripke 1972 Lakoff 1987 Law-
ler 1973 Lewis 1975a Lycan/Shapiro 1986
Mondadori 1978 Marcus 1971 McGarry (ed.)
1955 McKay/Stern 1979 McKeon 1941 Mellor
1977 Milsark 1974 Montague 1974 Moody
1953 Moody 1975 Norton 1982 Parret 1982
Pinborg 1976 Plantinga 1974 Plantinga 1978
Porterfield/Srivastav 1988 Price 1977 Putnam
1970 Putnam 1975b Putnam 1975 Putnam
1982 Schubert/Pelletier 1987 Schwartz 1977
Schwartz 1978 Schwartz 1980 Searle 1969
Searle 1983 Sober 1984 Sterelny 1983 Stein
1981 Strawson 1959 Stump 1981 Stump 1985
Thomason (ed.) 1974 Unger 1984 Vendler
1967b Wallace 1965 Welsh 1988 Wiggins 1980
Wittgenstein 1953 Wolter (ed. and translator)
1962 Zemach 1976
Greg N. Carlson, Rochester,
New York (USA)
or the automobile, artistic forms like the
novel, or the symphony, other cultural forms
activities in games, such as the jump shot
in basketball or the slap-shot in ice hockey;
mathematical objects such as the hyperbola
or the triangle. Thus, the possibility of ac-
cepting a definite generic form in English
isolates a class which includes natural kinds,
but a variety of other kinds as well.
However, given a different perspective,
many people feel that any phrase at all can
accept a definite generic form. Consider the
phrase the philosopher, for instance. In many
contexts, this sounds a bit odd (e. g. ? The
philosopher is in demand these days, cf: Phi-
losophers are in demand). However, the phrase
the philosopher does have an acceptable read-
ing as long as one thinks of philosophers as
being something like a natural kind. This may
result in ajocular air, as if the philosopher is
to be found in the cage alongside the Siberian
tiber at the zoo, but it need not. This may be
the same sort of phenomena Putnam and De
Sousa (1984) are considering in noting that
kind-terms seem to be able to change uses.
Whatever the appropriate analysis of this or
other like natural language phenomena, a the-
ory of natural kinds or of the type of phe-
nomena motivating their study should shed
light on such questions as these.
I wish to thank Barbara Abbott, Rod Bertolet,
David Fowler, Gerhard Heyer, Martin Irvine, Nor-
man Kretzmann, Manfred Krifka, Michael Mc-
Kinsey, and Armin von Stechow for their com-
ments and criticisms in the preparation of this
work; none are responsible for any errors nor do
any necessarily agree with any of my conclusions.
My appreciation to Yves Fuchs for typing the final
manuscript. Preparation of this work was also
aided by support from the Merrill-Palmer Institute
of Wayne State University, and the Max-Planck-
Institut fr Psycholinguistik in Nijmegen.
18. Massennomina 399
18. Massennomina
kategorien identifizieren, nmlich diejenige
der Individualnomina (count nouns, im fol-
genden IN) und diejenige der Massennomina
(mass nouns, im folgenden MN, auch
Kontinuativa genannt). Ein morphologi-
sches Unterscheidungskriterium ist, da MN
im Gegensatz zu IN transnumeral sind, d. h.
keine Numerusdistinktion aufweisen; ein syn-
taktisches Unterscheidungskriterium, da
MN im Gegensatz zu IN nicht mit Numeralia
wie drei kombinierbar sind. Typische Beispiele
fr IN sind Ring oder Sonate. Unter den
Massennomina knnen zwei weitere Spielar-
ten unterschieden werden, nmlich Stoffno-
mina (mass nouns im engeren Sinne, im
folgenden SN) wie Wein, Gold, Musik und
Kollektivnomina (auch Genuskollektive, im
folgenden KN) wie Vieh, Schmuck, Polizei.
Ein semantisches Unterscheidungskriterium
dieser beiden MN-Arten ist, da SN im Ge-
gensatz zu KN auf homogene, nicht natrlich
voneinander abgegrenzte und damit nicht un-
mittelbar zhlbare Entitten zutreffen. Die
IN/MN-Distinktion tritt auch bei Abstrakta
auf; vgl. etwa Zahl, Tugend als IN und Glck,
Trauer als MN. MN wurden als syntaktisch
und semantisch auffllige Klasse von Noreen
(1903) und Jespersen (1924) identifiziert; auf
KN als eigene Klasse hat z. B. Leisi (1953)
hingewiesen.
Einige syntaktische Eigentmlichkeiten
von MN im Vergleich zu IN im Deutschen
fhrt folgende Gegenberstellung vor. Da es
sich hierbei durchweg um Terme (NPn) han-
delt, seien weitere Bezeichnungen und geeig-
nete Abkrzungen eingefhrt: Unter einem
Massenterm (MT) und einem Individualterm
(IT) sei eine NP auf der Basis eines MN bzw
IN verstanden, und unter einem Pluralterm
(PT) ein pluralischer IT.
1. Einleitung
1.1 Massennomina und Individualnomina
1.2 Variable Verwendungsweisen
1.3 Typologie der IN/MN-Distinktion
2. Die Syntax von Massentermen
2.1 Bloe Massen- und Pluralterme
2.2 Die Syntax von Numerativ- und Numeral-
konstruktionen
3. Grundpositionen in der Semantik von MN
3.1 Drei Anstze zur logischen Analyse von blo-
en MT
3.2 Generische und objektbezogene Verwendung
von bloen MT
3.3 Die Referenzweise objektbezogener Massen-
terme
3.4 Mereologische Rekonstruktionen
3.5 Dinge und Stoffquanta
3.6 Mae und Grade
4. Die Semantik objektbezogener Massenterme
4.1 Eine verbandstheoretische Modellstruktur
4.2 Die Semantik nominaler Konstruktionstypen
4.3 Definite, quantifizierende und partitive NPn
5. Die Semantik generischer Massenterme
5.1 Die Interpretation generischer Terme
5.2 Die Bedeutung generischer Stze
5.3 Sorten
6. Kumulativitt bei anderen syntaktischen Ka-
tegorien
6.1 Kumulative und gequantelte, kollektive und
distributive Prdikation
6.2 Zeitkonstitution und die MN/IN-Distinktion
7. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
1.1Massennomina und Individualnomina
Unter den Nomina vieler natrlicher Spra-
chen kann man zwei einigermaen klar un-
terscheidbare, wenn auch nicht disjunkte Sub-
Individualnomina Massennomina
Singular Plural Stoffnomina Kollektivnomina
(1)a. der Ring ist ... die Ringe sind ... der Honig ist ... der Schmuck ist ...
b. ein Ring ist ... Ringe sind ... Honig ist ... Schmuck ist ...
c. ein Ring zwei Ringe *ein/*zwei Honig *ein/*zwei Schmuck
d. *viel Ring viele Ringe viel Honig viel Schmuck
e. *etwas Ring *etwas Ringe etwas Honig etwas Schmuck
f. jeder Ring *jede Ringe jeder Honig jeder Schmuck
g. *aller Ring alle Ringe aller Honig aller Schmuck
h. *drei Kstchen Ring drei Kstchen Ringe drei Gramm Honig drei Kstchen Schmuck
i. *mehr Ring mehr Ringe mehr Honig mehr Schmuck
j. *lauter Ring lauter Ringe lauter Honig lauter Schmuck
400 VI. Nominalsemantik
auf die sich das Nomen bezieht; in MN-Kon-
struktionen werden hingegen die Entitten als
homogen und hinsichtlich der Zhlbarkeit
neutral dargestellt. Hufig ist dann die ma-
teriale Substanz eines Gegenstands gemeint,
z. B. in ein Kilogramm Huhn.
Aufgrund der Variabilitt der syntakti-
schen Verwendungsweisen wird hufig die
Annahme einer lexikalischen Distinktion zwi-
schen IN und MN aufgegeben zugunsten der
Auffassung, da jedes Nomen sowohl als MN
wie als IN verwendet werden kann (vgl. z. B.
Ware 1975, Allan 1980). Es gibt ferner ein
ganzes Spektrum von Mglichkeiten, die eine
oder andere Verwendungsweise fr den ge-
samten Nominalwortschatz oder einen Teil
davon zugrundezulegen und andere Verwen-
dungweisen davon abzuleiten, wobei diese
Ableitungen auf verschiedenen linguistischen
Ebenen beschrieben werden knnen (syntak-
tisch, semantisch oder pragmatisch vgl.
Pelletier & Schubert 1989).
1.3Typologie der IN/MN-Distinktion
An dieser Stelle mchte ich einige Hinweise
dazu geben, in welcher Form die IN/MN-
Distinktion in den Sprachen der Welt auftritt.
In sogenannten Klassifikatorsprachen gibt
es keine IN; alle Nomina sind als MN anzu-
sehen (vgl. Leisi 1953, Sharvy 1978): sie sind
transnumeral, und ein Numerale kann nicht
unmittelbar mit einem Nomen kombiniert
werden, sondern es mu ein Numerativ, ein
sogenannter Klassifikator, eingesetzt werden.
Ein Beispiel ist das Chinesische. Einem No-
men, dem im Deutschen ein IN entspricht, ist
hier ein spezifischer Klassifikator zugeordnet,
z. B. zhng fr Bezeichnungen flacher, aus-
gedehnter Gegenstnde (z. B. sn zhng
zhuzi, drei KL Tisch, drei Tische), b fr
Bezeichnungen von zu greifenden Gerten
(z. B. haj b jinzi viele Scheren), chng fr
Wettkmpfe und Unwetter (z. B. zhi chng
xu dieser Schneefall). In europischen Spra-
chen treten Klassifikatoren nur ganz marginal
auf, zum Beispiel in drei Stck Vieh oder three
heads of cattle. Die Individuierbarkeit spielt
auch in Klassifikatorsprachen eine Rolle (vgl.
Drossard 1982), allerdings nicht fr die IN/
MN-Distinktion, sondern fr die SN:KN-
Distinktion: Nomina, die homogene Stoffe
bezeichnen, im Chinesischen z. B. ch Tee,
haben in der Regel keine speziellen Klassifi-
katoren, sondern werden mit neutralen Ma-
angaben wie bng Pfund konstruiert (z. B.
sn bng (de) ch drei Pfund (von) Tee); die
Einfgbarkeit der subordinierenden Partikel
(l a) zeigt die Aufhebung der Numerusdistink-
tion bei MT. Im Deutschen tritt hier meist
der Singular ein (Singularetantum), seltener
der Plural (Pluraletantum, z. B. bei Ma-
sern); in anderen Sprachen ist der Plural hu-
figer, z. B. im Swahili. (b) zeigt, da MN ohne
Artikel als Terme verwendet werden knnen,
eine Eigenschaft, die sie mit pluralischen IN
teilen. Man spricht hier von bloen Massen-
oder Pluraltermen (bare mass terms, bare plu-
rals). (c) zeigt, da MN nicht mit Numeralen
kombinierbar sind. (d) bis (g) fhren die
Kombinierbarkeit mit einigen Determinato-
ren vor. (h) zeigt, da MN und Plural-IN in
Konstruktionen verwendet werden knnen, in
denen eine Maangabe, eine Behlterbezeich-
nung o. . auftritt (Ausdrcke wie Kstchen
und Glas werden hinfort Numerative ge-
nannt). (i) und (j) zeigen, da MN und Plural-
IN mit lauter und der Komparativpartikel
mehr verbindbar sind.
1.2Variable Verwendungsweisen
Es gibt eine nicht unerhebliche Anzahl von
Nomina, die sich einer eindeutigen Zuord-
nung zu MN oder IN entzieht (z. B. Kuchen).
Weiterhin gibt es Beispiele, in denen ein ver-
meintliches MN in IN-Konstruktionen auf-
tritt (z. B. drei Mehle im Sinne von drei
Sorten Mehl, eine Liebe im Sinne von ein
Fall von Liebe), und umgekehrt Beispiele,
in denen ein vermeintliches IN in MN-Kon-
struktionen vorkommt (z. B. etwas Apfel).
Da diese letztere Verwendungsweise nicht
auf kulinarische Kontexte beschrnkt ist, zei-
gen die Beispiele (2). Zuweilen knnen auch
Eigennamen in MN-Verwendung auftreten;
sie bezeichnen dann knstlerische oder andere
Hervorbringungen (vgl. 3).
(2)
a. Und das ZDF ist natrlich heute ein
Routinebetrieb zur Erstellung und Ver-
breitung von Programm.
b. Noch mehr U-Bahn ab 28. Mai.
c. Schden wurden auch an Ahorn, Esche
und Eiche beobachtet.
d. ... Bielefeld, dieses groe Stck Uni-
versitt, ...
(3)
a. 1000 Seiten Arno Schmidt fr 49 Mark.
b. Die Welt ist voller Degussa.
Die Verwendung eines Nomens in MN- oder
IN-Konstruktionen hat Einflu auf dessen
semantische Interpretation. In IN-Konstruk-
tionen wird die Individuierbarkeit und damit
die Zhlbarkeit der Entitten vorausgesetzt,
18. Massennomina 401
pragmatischen Status: objektbezogene sind
indefinit und hufig rhematisch, generische
definit und hufig thematisch. Dies zeigt sich
darin, da objektbezogene bloe Terme im
Gegensatz zu generischen eine Tendenz zur
Akzentuierung und zur Nachstellung besitzen
(GOLD lag im Safe, Im Safe lag GOLD). In
vielen Sprachen werden diese beiden Formen
deutlicher unterschieden, z. B. im Finnischen
durch Kasus (Nominativ/Akkusativ vs. Par-
titiv) und im Franzsischen und Bairischen
durch Artikel (definiter vs. partitiver/indefi-
niter Artikel). Die bersetzung von (4a,b) ins
Bairische lautet beispielsweise:
(5)
a. As Goid schmuizd bei 1063 Grad.
b. A Goid is im Safe glegn.
2.2Die Syntax von Numerativ- und
Numeralkonstruktionen
Fr MN besonders charakteristisch sind
Konstruktionen wie fnf Glas Wein, die im
folgenden als Numerativkonstruktionen be-
zeichnet seien. Sie bestehen aus einem Nu-
merale wie fnf, einem Numerativ wie Glas
(auch Zhlwort, Mensurativ, Quant
genannt), und einem Nomen wie Wein (dieses
kann ein MN oder ein Plural-IN sein).
Numerativkonstruktionen sind zu unter-
scheiden von den bedeutungshnlichen attri-
butiven Konstruktionen der Art fnf Barren
von Gold, fnf Glser mit Wein oder fnf Glas
guten Weines, in denen das Nomen durch eine
Prposition oder den Genitivkasus unterge-
ordnet ist. Im Englischen und Franzsischen
gibt es nur diese formal unterordnende Kon-
struktion, z. B. five glasses of wine, cinq verres
de vin; in einer Reihe von Arbeiten wird je-
doch argumentiert, die Prpositionen of bzw.
de hier nicht unbedingt als unterordnend zu
analysieren (vgl. z. B. Akmajian & Lehrer
1976, Selkirk 1977).
Es gibt zwei plausible syntaktische Struk-
turierungen der Numerativkonstruktion, (6a)
und (6b):
(6)
a. [[drei Barren][Gold]]
b. [[drei][Barren Gold]]
Man beachte, da sowohl drei Barren als auch
Barren Gold in einer Austauschklasse mit ein-
fachen Wrtern vorkommen: (drei Barren)/
(viel) Gold, drei (Barren Gold)/(Ringe). Fr
die Annahme von (6a) mindestens fr Klas-
sifikatorkonstruktionen spricht, da von den
sechs Stellungsmglichkeiten von Numerale,
Numerativ und Nomen universal nur die vier
auftreten, in denen Numerale und Numerativ
benachbart sind (vgl. Greenberg 1975). Die
de stellt einen weiteren Unterschied zu Klas-
sifikatorkonstruktionen dar. (Vgl. zu Klassi-
fikatorsprachen Greenberg 1972, Allan 1977,
Serzisko 1980, Klver 1982).
Weniger gut belegt sind Sprachen, deren
Nominalwortschatz strker den IN zuneigt;
Greenberg (1972) erwhnt Papua-Sprachen
und nordamerikanische Sprachen wie das
Hopi. In diesen Sprachen soll jedes Nomen
unmittelbar mit einem Numerale kombinier-
bar sein.
Ein weiterer Sprachtyp, der in unserem Zu-
sammenhang von Interesse ist, sind Sprachen
mit Kollektiv-Singulativ-Distinktion wie Bre-
tonisch, Arabisch oder Oromo (Galla, vgl.
hierzu Andrzejewski 1960), in denen von
einem KN eine Form abgeleitet werden kann,
die eine einzelne Entitt bezeichnet (z. B.
arab. ammu Taube(n), ammatun eine
Taube), von welcher dann wiederum eine Plu-
ralform gebildet werden kann (ammatun
Tauben). Die Singulativmarkierung hat hier
die Funktion eines Klassifikators mit dem
Numerale EINS (vgl. Greenberg 1972). Sin-
gulativmarkierungen knnen zuweilen auch
mit Nomina verwendet werden, die homogene
Entitten bezeichnen (z. B. addun Eisen,
addatun ein Stck Eisen).
2. Die Syntax von Massentermen
2.1Bloe Massen- und Plural-Terme
Bloe MT und PT treten in zwei wesentlich
verschiedenen Verwendungsweisen auf, die
durch folgende Beispiele illustriert werden:
(4)
a. Gold schmilzt bei 1063 Grad.
b. Gold lag im Safe.
(4a) ist eine Aussage ber die Gattung Gold;
(4b) eine Aussage ber ein Exemplar dieser
Gattung. Ter Meulen (1981) bezeichnet Terme
der ersten Art als nominal, Terme der zweiten
Art als prdikativ und folgt damit den logi-
schen Untersuchungen von Quine (1960) zur
Semantik von MN in Kopulastzen wie Gold
ist ein Element und dieses Pulver ist Gold (vgl.
Abschnitt 3.1). Da aber auch prdikative
Terme an NP-Position vorkommen (z. B. in
Eva hat Gold gekauft) ist eine andere Bezeich-
nungsweise angebracht: ich spreche hinfort in
Fllen wie (4a) von generischen und in Fllen
wie (4b) von objektbezogenen bloen MT. Es
ist zu beachten, da die beiden Lesarten auch
bei bloen PT auftreten (vgl. pfel sind ge-
sund vs. pfel lagen im Korb).
Generische und objektbezogene bloe
Terme unterscheiden sich in ihrem diskurs-
402 VI. Nominalsemantik
tiv, sondern das Nomen gengen. Damit er-
gibt sich eine Diskrepanz zwischen der syn-
taktischen und der semantischen Strukturie-
rung (vgl. zu dieser Problematik Akmajian &
Lehrer 1976, Selkirk 1977, Lbel 1986).
Betrachten wir nun die syntaktische Struk-
tur von Numerativkonstruktionen wie drei
Barren Gold im Verhltnis zu IN-Konstruk-
tionen mit Numeralen wie drei Ringe (im fol-
genden Numeralkonstruktionen genannt).
Hier ist zu bercksichtigen, da IN und MN
verschiedenen, Numeralkonstruktionen, Nu-
merativkonstruktionen und MN aber glei-
chen syntaktischen Kategorien angehren
(vgl. (*Ring)/ (ein Ring)/ (ein Barren Gold)/
(Gold) lag im Safe). Mit den Kategorienbe-
zeichnungen IN (Individualnomina), N (No-
mina), NL (Numerale), NM (Numerativ),
NMP (Numerativphrase) ergeben sich fol-
gende Strukturierungen:
(9)
a. [
N
[
NL
ein][
IN
Ring]]
b. [
N
[
NL
drei][
N
Ringe]]
c. [
N
[
NMP
[
NL
drei][
NM
Barren]][
N
Gold]]
Plural-IN knnen sowohl in Numeral- als
auch in Numerativkonstruktionen und
schlielich auch als bloe PT vorkommen. Sie
mssen also sowohl als IN wie auch als N
kategorisiert werden. Ich nehme an, da die
Pluralmarkierung in (9b) ein rein syntakti-
sches Kongruenzphnomen ist, whrend es
sich in Fllen wie (10) um inhrent semanti-
schen Plural handelt. Dafr spricht das Feh-
len der Pluralmarkierung bei Konstruktionen
wie (9b) in vielen Sprachen, z. B. im Trki-
schen (siehe Artikel 19). Da die Pluralmar-
kierung rein syntaktischen Status haben
kann, wird auch daraus deutlich, da Dezi-
malbruchzahlen unabhngig von der Anzahl
stets Pluralmarkierung erfordern (vgl. eins
komma null Ellen/ *Elle).
(10)
[
N
[
NMP
zehn Kilogramm][
N
pfel]]
Nominalphrasen entstehen durch Kombina-
tion eines Determinators mit Ausdrcken der
Kategorie N oder IN. Demnach kann man
zwei Kategorien, DETI und DETN, unter-
scheiden.
(11)
a. [
NP
[
DETI
der][
IN
Ring]]
b. [
NP
[
DETN
die][
N
drei Ringe]]
c. [
NP
[
DETN
die][
N
drei Barren Gold]]
Fr indefinite Determinatoren mu ein leerer
Determinator angenommen werden:
(12) [
NP
[
DETN
][
N
Gold]]
Quantifizierende Determinatoren sind meist
vom Typ Det, z. B. jeder, die meisten (vgl. die
blichen Konstitutententests liefern ein wenig
klares Bild. Im Konjunktionstest mu bei-
spielsweise sowohl (6a) als auch, allerdings
etwas weniger gut, (6b) zugelassen werden;
relevante Daten sind [drei Barren und zwei
Sckchen] Gold und drei [Barren Gold und
Sckchen Silber]. Ich lege im folgenden die
Struktur (6a) als die elementarere zugrunde.
Es gibt einige Unterarten von Numerativ-
konstruktionen (vgl. Jansen 1980, Lbel
1986), z. B. Mekonstruktionen wie zwei Liter
Wein oder zwei Schluck Wasser, Behlterkon-
struktionen wie zwei Becher Milch, Zhlkon-
struktionen wie zwei Scheiben Brot, Klassifi-
katorkonstruktionen wie zwei Stck Vieh, Kol-
lektivkonstruktionen wie zwei Rudel Wlfe und
Sortenkonstruktionen wie zwei Sorten Bier.
Diese Konstruktionen weisen einige syntak-
tische und semantische Besonderheiten auf.
Nicht alle kommen mit jedem beliebigen No-
mentyp vor; Kollektivkonstruktionen sind
beispielsweise nicht mit SN mglich, und
Zhl- und Klassifikatorkonstruktionen nicht
mit Plural-IN. Me-, Behlter- und Klassifi-
katorkonstruktionen zeichnen sich ferner da-
durch aus, da sie keine Kompositabildungen
unter Bedeutungserhaltung zulassen (z. B.
drei Scheiben Brot = drei Brotscheiben; drei
Glser Bier drei Bierglser). Eine interes-
sante stilistische Restriktion ist, da Nume-
rativkonstruktionen bei Bezug auf Menschen
eher gemieden werden (vgl. ?eine Schar junge
Mdchen vs. eine Schar junger Mdchen).
Ein besonderes Problem stellt die Bestim-
mung des Kopfes einer Numerativkonstruk-
tion dar. Sehen wir uns die Vererbung syn-
taktischer und semantischer Merkmale im
Deutschen an. Die syntaktischen Merkmale
(wir betrachten hier lediglich den Numerus)
werden im allgemeinen durch das Numerativ
bestimmt, das damit als syntaktischer Kopf
anzusehen ist (vgl. 7a). Bei Mekonstruktio-
nen kann jedoch auch das Numerativ Kopf-
Funktion einnehmen (vgl. 7b).
(7)
a. Ein Strau Blumen stand/ *standen in
der Vase.
b. Drei Ellen Stoff lagen/ lag im Schrank.
Nach der Vererbung semantischer Merkmale
mte das Nomen als Kopf zhlen, wie fol-
gende Beispiele zeigen:
(8)
a. Eva hat drei Steigen Obst gepflckt.
b. Hans hat drei Glser Wein getrunken.
Das Verb pflcken selektiert an Objektposi-
tion Blumen oder Obst, und das Verb trinken
Flssigkeiten. Diesen semantischen Merk-
malen mu offensichtlich nicht das Numera-
18. Massennomina 403
Exemplare einer Gattung distribuieren, ms-
sen als Prdikate hheren Typs eingefhrt
werden:
(16) Gold ist selten. (G)
Der Individuen-Ansatz geht auf Parsons
(1970) zurck und wird unter anderem auch
von Moravcsik (1973) und Carlson (1977,
1978) vertreten. Dabei wird (14a) mithilfe
einer eigenen Relation R ist ein Exemplar/
eine Realisation/ein Quantum von formali-
siert. Schlsse wie (15) knnen damit nicht
unmittelbar nachgebildet werden; vielmehr
mu man eigens postulieren, da ein Prdi-
kat, das auf eine Gattung zutrifft, berhaupt
auf deren Exemplare distribuiert. Das Schlu-
Schema sieht damit wie folgt aus:
(17) Dieses Pulver ist
Gold.
R(p,g)
Gold ist wertvoll. W(g)
Wenn eine Gattung x [W(x) y
wertvoll ist, so sind
es auch deren Rea-
lisationen.
[R(y,x) W(y)]
Dieses Pulver ist
wertvoll.
W(p)
Zwischen den Typen der Prdikate wertvoll
und selten mu nicht unterschieden werden,
da in diesem Ansatz beide auf Entitten vom
Individuentyp zutreffen.
Den dualen Ansatz vertritt ter Meulen
(1980, 1981). Hierbei kommt es darauf an,
zwischen den beiden Interpretationen Bezie-
hungen zu stiften. Ter Meulen analysiert Gold
in (15a) als Prdikat und Gold in (15b) als
Namen der Intension dieses Prdikats; andere
Rekonstruktionen sind mglich. Auch in den
dualen Anstzen lassen sich Schlsse wie (15)
nur durch Annahme weiterer Stze beweisen.
Individuen-Ansatz und dualer Ansatz sind
dem Prdikat-Ansatz in einem Punkte ber-
legen: Die Formalisierung von generischen
Aussagen wie (15b) als Allquantifikationen
ist nach Lyons (1977: 194 f.) nmlich sowohl
zu stark als auch zu schwach. Betrachten wir
den Satz Schnee ist wei: das Vorkommen von
nichtweiem, z. B. schmutzigem Schnee
macht diesen Satz nicht falsch, und umge-
kehrt bliebe der Satz sogar wahr in einer Welt,
in der zufllig aller Schnee schmutzig-grau ist.
Aus diesem Grund ist die Annahme von zu-
stzlichen Bedingungen zum Beweis des
Schlusses (17), zu welcher der duale Ansatz
und der Individuen-Ansatz greifen mssen,
durchaus gerechtfertigt.
meisten (*drei) Ringe; eine Ausnahme ist alle,
vgl. alle (Ringe)/ (drei Ringe). Konstruktio-
nen der Art der Barren Gold, jeder Barren
Gold schlielich knnen analysiert werden,
wenn man nach (10b) Barren Gold die Kate-
gorie N zuweist:
(13) [
NP
[
Det
der] [
N
[
Nm
Barren] [
NP
Gold]]]
3. Grundpositionen in der Semantik
von MN
3.1Drei Anstze zur logischen Analyse von
bloen MT
Vor allem das Auftreten von MT als Subjekte
und als Prdikate in Kopulastzen hat
Sprachphilosophen und Linguisten zu seman-
tischen Analysen gereizt. Drei Grundanstze
sind nach Bealer (1975) zu unterscheiden. Auf
die Doppelrolle der bloen MT hat Quine
(1960) hingewiesen; nach der Kopula analy-
siert er sie als Prdikate, vor der Kopula
hingegen als Individuenbezeichnungen, die
auf eine Gattung referieren. Ein Beispiel:
(14)
a. Dieses Pulver ist Gold. G(p)
b. Gold ist wertvoll. W(g)
Im folgenden wurde an diesem dualen Ansatz
(dual approach) vor allem kritisiert, da
zwischen dem Prdikat G und dem Indivi-
duum g keinerlei logischer Zusammenhang
bestehe. Aus diesem Grunde ist es nicht un-
mittelbar mglich, den Schlu von (14a) und
(14b) auf dieses Pulver ist wertvoll zu forma-
lisieren. Es wurde daher versucht, beide MT-
Interpretationen auf eine einzige zurckzu-
fhren: auf die Interpretation als Prdikat
(Prdikat-Ansatz, general term approach)
oder auf die Interpretation als Individuenbe-
zeichnung (Individuen-Ansatz, singular term
approach).
Den Prdikat-Ansatz verfolgen Clarke
(1970), Burge (1972), Grandy (1973) und, in
intensionaler Variante, Montague (1973a),
Pelletier (1974) und Bennett (1979a). Dabei
wird (14a) als allquantifizierter Satz interpre-
tiert. So knnen Schlsse wie (15) formalisiert
werden:
(15) Dieses Pulver ist
Gold.
G(p)
Gold ist wertvoll. x [G(x) W(x)]
Dieses Pulver ist
wertvoll.
W(p)
Prdikate wie ist selten, die nicht ber einzelne
404 VI. Nominalsemantik
Zucker verwechselte, sondern da sie von
einem bestimmten Quantum Strychnin
dachte, es wre Zucker; dies erfordert jedoch
eine weitskopige Analyse von Strychnin.
(22) Anna wollte Strychnin in den Kaffee
tun, weil sie es mit Zucker verwechselte.
Zum zweiten ist Carlsons Analyse gerade we-
gen Anaphora-Phnomenen auch problema-
tisch. So kann die anaphorische Beziehung in
(23a) nicht adquat beschrieben werden, da
es auf dasselbe Gold-Exemplar und nicht auf
die Gattung Gold referiert. Ferner sollten
nach Carlsons Analyse anaphorische Bezie-
hungen auch in (23b) mit dem definiten Pro-
nomen es mglich sein; tatschlich sind sie es
nur mit dem indefiniten Pronomen welches:
(23)
a. Anna hat Gold
i
verloren, und Otto
hat es
i
gefunden.
b. Weil Anna Gold
i
liebt, hat sie *es
i
/
welches
i
gekauft.
Ein weiteres Argument gegen Carlsons Ana-
lyse ist, da in vielen Sprachen die beiden
Interpretationen von Gold auch syntaktisch
unterschieden werden (vgl. Abschnitt 2.1).
Ich nehme im folgenden deshalb zwei In-
terpretationen von bloen MT an, eine ge-
nerische, die durch Individuenbezeichnungen
reprsentiert werden kann, und eine objekt-
bezogene, die wie andere indefinite NPn re-
prsentiert werden sollte. Da indefinite
bloe MT in der Regel mit engem Skopus,
d. h. nonspezifisch, interpretiert werden, er-
klrt sich aus der Beobachtung von Partee
(1972), nach der deskriptiv arme indefinite
NPn hufiger nonspezifisch interpretiert wer-
den als deskriptiv reiche; bloe MT/PT kn-
nen dabei als deskriptiv besonders arm gelten,
da ihnen die Anzahl- oder Quantittsangabe
fehlt. Die Korrelation zwischen Verbbedeu-
tung und Interpretation des bloen MT lt
sich auf ein allgemeineres Phnomen zurck-
spielen, nmlich da nonspezifische NPn nur
fr bestimmte Verben (genauer: bestimmte
Verb-Argumentstellen) zulssig sind. Insbe-
sondere knnen stative Verben keine nonspe-
zifischen Subjekte haben; dies zeigt Beispiel
(24a), das im Gegensatz zu (24b) nur eine
spezifische (weitskopige) Interpretation von
ein Gemlde zult. Betrachtet man ein hn-
liches Beispiel mit dem Subjekt Gold, so zeigt
sich, da bei nichtstativen Verbausdrcken
nur die nonspezifische (engskopige) Interpre-
tation vorkommt (vgl. 25b), und da Stze
mit stativen Verbausdrcken ungrammatisch
sind, wenn eine generische Interpretation aus
unabhngigen Grnden ausgeschlossen ist
(vgl. 25a):
3.2Generische und objektbezogene
Verwendung von bloen Massentermen
In (14a) tritt Gold in generischer Verwendung
auf. Diese kommt nicht allein in Kopulast-
zen vor, sondern kontrastiert allgemein mit
der objektbezogenen Verwendung:
(18)
a. Gold hat die Ordnungszahl 79.
b. Gold lag im Safe.
c. Anna liebt Gold.
d. Anna hat Gold gekauft.
In (18a,c) bezieht sich Gold auf die Gattung
Gold und in (18b,d) auf ein bestimmtes Quan-
tum dieser Gattung. Eine explizite Analyse
solcher Stze (mit Schwerpunkt auf bloen
PT, die dasselbe Verhalten aufweisen) liegt in
Carlson (1977, 1978) vor. Carlson nimmt eine
einheitliche Interpretation von Gold an, nm-
lich wie im Individuen-Ansatz als Namen der
Gattung. Da in (18b,d) eigentlich Aussagen
ber Exemplare der Gattung gemacht wer-
den, liegt nach ihm an den Verben im Safe
liegen und kaufen, in deren Interpretation der
Bezug auf die Exemplare erfolgt (eine hnli-
che Auffassung vertritt Chafe 1970: 188 ff.).
Als Analyse von (18a,b) sind demnach (19a,b)
anzusetzen, wobei R fr die Realisierungsre-
lation (s. o.) steht.
(19)
a. Gold hat die Ordnungszahl 79:
O-79 (g)
b. Gold lag im Safe:
x y [R(y,x) & L-i-S(y)] (g)
= y [R(y,g) & L-i-S(y)])
Fr Carlsons Analyse spricht, da es tatsch-
lich eine enge Korrelation zwischen Verb-
bedeutung und Interpretation einer NP als
generisch oder objektbezogen gibt. Carlson
fhrt ferner ins Feld, da objektbezogene
bloe MT und PT im Gegensatz zu indefini-
ten NPn mit Numerale stets engsten Skopus
besitzen (vgl. 20), und da anaphorische Be-
zge zwischen beiden Lesarten mglich sind
(vgl. 21):
(20)
a. Anna mchte einen Schweden heira-
ten.
(enger/weiter Skopus)
b. Anna mchte Gold kaufen.
(nur enger Skopus)
(21) Anna kaufte Gold
i
, weil es
i
wertvoll ist.
Kratzer (1980) hat jedoch darauf hingewiesen,
da die Annahme, bloe PT htten stets en-
gen Skopus, nicht aufrechterhalten werden
kann; ihr Argument gilt auch fr bloe MT.
So ist die natrliche Interpretation von (22)
nicht, da Anna die Gattungen Strychnin und
18. Massennomina 405
griffe kommt keine endliche Zahl zu (S. 66).
Frege hat die Teilbarkeit als Unterscheidungs-
kriterium zwischen den beiden Prdikatarten
herangezogen. Dieses wurde spter Kriterium
der distributiven, partitiven oder divisiven Re-
ferenz (Goodman 1951) genannt, und u. a.
von Cheng (1973), Bunt (1979) und ter Meu-
len (1980, 1981) zur Beschreibung der Seman-
tik von MT verwendet. Auf Quine (1960) geht
das Kriterium der kollektiven oder kumula-
tiven Referenz zurck:
So called mass terms like water, footwear, and
red have the semantic property of referring cu-
mulatively: any sum of parts which are water is
water (S. 91).
Sowohl das Kriterium der divisiven wie das
der kumulativen Referenz vermag die Refe-
renzweise eines bloen MT wie Gold von der
eines IT wie ein Ring zu scheiden. Doch wel-
ches Kriterium ist angebracht? Divisive Pr-
dikate unterscheiden sich von kumulativen in
zweierlei Weise: (a) sie knnen auf Entitten
zutreffen, ohne auf deren Zusammenfassung
zuzutreffen; (b) wenn sie auf eine Entitt zu-
treffen, so treffen sie auf jeden noch so kleinen
Teil dieser Entitt zu. Fr MT gilt (a) offen-
sichtlich nicht; daher mu das Kriterium der
Divisivitt auf jeden Fall durch das der Ku-
mulativitt ergnzt werden. (b) hat als das
Problem der kleinsten Teile in der Diskussion
eine wichtige Rolle gespielt. Vertreter des Kri-
teriums der divisiven Referenz nehmen an,
da der natrlichsprachlichen Semantik ein
nicht-atomares Weltbild zugrundeliegt, vgl.
etwa Bunt (1979: 255): mass nouns provide
a way of talking about things as homoge-
neous entities, as if they do not consist of
certain smallest parts. Dies fhrt jedoch zu
Problemen bei MT wie Vieh, die ganz offen-
sichtlich kleinste Teile besitzen. Andere Se-
mantiker gehen umgekehrt von der Existenz
kleinster Teile aus, z. B. Quine (1960: 97): In
general a mass term in predicative position
may be viewed as a general term which is true
of each portion of the stuff in question, ex-
cluding only the parts too small to count.
hnliche Auffassungen vertreten Laycock
(1972) und Moravcsik (1973).
Beide Annahmen scheinen mir unangemes-
sen zu sein. In der Semantik der natrlichen
Sprache ist wohl weder ein atomares noch ein
nicht-atomares Weltbild eingebaut; sie lt
die Frage der Atomaritt vielmehr offen. Dies
ist wiederum mit dem Kriterium der kumu-
lativen Referenz vertrglich, das nichts ber
die Existenz oder Nicht-Existenz von klein-
sten Teile postuliert.
(24)
a. Ein Gemlde stammt wahrscheinlich
aus dem Louvre. (spez.)
b. Ein Gemlde wurde wahrscheinlich
aus dem Louvre gestohlen. (spez./
nonspez. mit Akzent auf ein Gemlde)
(25)
a. *Gold stammt wahrscheinlich aus der
Bank von England.
b. Gold wurde wahrscheinlich aus der
Bank von England gestohlen. (non-
spez. mit Akzent auf Gold)
Die Koreferenzphnomene in (21) und
(23a,b) schlielich knnen unter der An-
nahme erklrt werden, da mit einem objekt-
bezogenen bloen MT wie Gold zugleich auch
die Gattung Gold in den Diskurs eingefhrt
wird und als mgliches Antezedens fr Pro-
nomina zur Verfgung steht, da aber um-
gekehrt mit einem generischen bloen MT
selbstverstndlich noch kein Exemplar der
Gattung eingefhrt wurde, soda hierfr ein
spezielles indefinites Pronomen verwendet
werden mu.
Die Betrachtungen in den Abschnitten 3.1
und 3.2 haben ergeben, da sich die Anstze,
die bloen MT und PT eine einheitliche In-
terpretation zuweisen wollen Prdikat-An-
satz und Individuen-Ansatz nicht halten
lassen (vgl. auch ter Meulen 1980, 1981, Pel-
letier & Schubert 1987b). Die plausibelste
Theorie scheint somit eine Version des dualen
Ansatzes zu sein.
3.3Die Referenzweise objektbezogener
Massenterme
Die Extension eines Prdikats wie Gold un-
terscheidet sich in charakteristischer Weise
von der Extension von Prdikaten wie ein
Barren Gold oder ein Ring: letztere sind so-
genannte sortale Prdikate, erstere nicht.
Diese Unterscheidung geht (in ontologischem
Gewand) auf Aristoteles zurck (Metaphysik
Buch D, 1014a); seine Beispiele sind Wasser
und Silbe. Frege (1884) entwickelt das Kon-
zept des sortalen Prdikats als das eines Be-
griffs, der das unter ihn Fallende bestimmt
abgrenzt und keine beliebige Zertheilung ge-
stattet. Ein Beispiel ist der Begriff Buch-
stabe des Wortes Zahl, der das Z gegen das
a, dieses gegen das h usw. abgrenze. Frege
bemerkt:
Nicht alle Begriffe sind so beschaffen. Wir knnen
z. B. das unter den Begriff des Rothen Fallende in
mannigfacher Weise zertheilen, ohne da die Theile
aufhrten, unter ihn zu fallen. Einem solchen Be-
406 VI. Nominalsemantik
mantik fr Logiksprachen herangezogen (vgl.
Goodman 1951). Die verschiedenen Spielar-
ten des Individuenkalkls wurden von Eberle
(1970) dargestellt und axiomatisiert, insbe-
sondere auch solche, die nicht die Existenz
von atomaren Teilen implizieren. Ver-
wandte Modelle setzt Burge (1977) mit seinen
aggregates, Bunt (1979) mit seinen ensem-
bles und Blau (1981a) mit seinen collec-
tions ein. Gewisse Mereologien sind ferner
strukturgleich mit Booleschen Algebren ohne
Nullelement (vgl. Clay 1974); explizit werden
Boolesche Algebren von Wald (1977),
Lnning (1982) und Roeper (1983) zur Be-
schreibung von MT verwendet. Ein mengen-
theoretisches Modell mereologischer Struk-
turen sind Teilmengensysteme, z. B. die Po-
tenzmenge einer Menge (ohne die leere
Menge), wobei die Zusammenfassung durch
die Mengenvereinigung reprsentiert wird;
dieses Modell legen z. B. Gabbay & Moravc-
sik (1973) und Hoepelman (1981) zugrunde.
Link (1983a) arbeitet schlielich mit ebenfalls
strukturhnlichen Verbnden (vgl. dazu nher
Abschnitt 4, ebenfalls Artikel 19 Plural).
Wichtigstes Kennzeichen mereologischer
Modelle ist, da sie eine Operation der Zu-
sammenfassung (Fusion) von Elementen be-
sitzen, die im Gegensatz zur Mengenvereini-
gung nicht zu einer Typanhebung fhrt. Wei-
tere wichtige Begriffe, die auf der Basis der
Zusammenfassungsoperation definiert wer-
den knnen, sind die Relationen der berlap-
pung und der Teilbeziehung zweier Elemente
(vgl. Abschnitt 4.1).
Mereologische Modellbildungen wurden
zur semantischen Beschreibung sowohl ob-
jektbezogener als auch generischer MT ver-
wendet. Ich beginne die Darstellung mit den
letzteren. Relevante Arbeiten hierzu sind
Quine (1960), Stewart (1971), Burge (1972),
Moravcsik (1973), Wald (1977). Ihre Grund-
vorstellung ist, da ein MT wie Gold in ge-
nerischer Interpretation die Fusion aller
Goldquanta, d. h. das gesamte Gold der Welt,
denotiert.
Diese Auffassung hat sich jedoch einer gan-
zen Reihe von Schwierigkeiten zu erwehren
(vgl. Parsons 1970, Pelletier 1974, ter Meulen
1980, Pelletier & Schubert 1989). Vor allem
sind Stze ber das Fusionsobjekt keine Aus-
sagen ber die Gattung, und umgekehrt. Bei-
spielsweise ist der Satz das Gold der Welt wiegt
mehr als eine Tonne in unserer Welt sicher
wahr, doch die Umformung in einen generi-
schen Satz ist nicht mglich: Gold wiegt mehr
als eine Tonne ist falsch. Umgekehrt ist der
Das Kriterium der Kumulativitt schliet
auch bloe PT mit ein: die Zusammenfassung
zweier Entitten, die unter Ringe fallen, fllt
wieder unter Ringe. Beide Termtypen knnen
deshalb im folgenden als kumulative Terme
zusammengefat werden. Terme der Art ein
Ring oder ein Barren Gold seien hingegen
gequantelt genannt.
Die Zhlbarkeit hngt, wie Frege be-
merkte, von der Atomaritt des Prdikats ab.
Doch nicht von ihr allein: darber hinaus gilt,
da zhlbare Entitten sich nicht berlappen
drfen, d. h. diskret sein mssen (vgl. Carlson
1981). Zum einen hat dies die Folge, da bei
der Zhlung von Dingen, die unter ein ato-
mares kumulatives Prdikat wie Ringe fallen,
nur die atomaren Elemente als Zhleinheiten
gelten und nicht auch die verschiedenen Zu-
sammenfassungen (es gilt allgemein, da ein
kumulatives Prdikat bei n atomaren Enti-
tten auf 2
n
-1 Entitten insgesamt zutrifft).
Zum anderen bedingt dies, da nicht jedes
gequantelte Prdikat zhlbar ist. Ein Beispiel
ist ein Liter Wasser: die Entitten, die dar-
unter fallen, knnen einander berlappen,
und deshalb ist die Frage, wie viele einzelne
Liter Wasser in einer Wanne sind, nicht sinn-
voll. Jespersen (1924) spielt auf das Kriterium
der Diskretheit an; MN sind nach ihm words
which do not call up the idea of some definite
thing with a certain shape or precise limits,
die deshalb auf Entitten aus der world of
uncountables zutrfen (S. 198).
Zu kumulativen Prdikaten ist noch eine
Besonderheit zu vermerken (vgl. Roeper
1983). Wenn mit zwei Entitten a,b stets auch
die Zusammenfassung von a und b eine En-
titt ist, so hat dies Auswirkungen auf die
Interpretation von Prdikaten. Angenom-
men, a sei rot und b sei nicht rot, ist dann
die Zusammenfassung von a und b rot oder
nicht rot? Drei Mglichkeiten bieten sich an:
entweder schlgt man sie der Extension von
rot zu, oder der von nicht rot, oder man legt
eine dreiwertige Logik zugrunde und schlgt
sie dem Neutralbereich von rot zu.
3.4Mereologische Rekonstruktionen
Zur Rekonstruktion der Semantik von MT
wurden hufig mereologische Modelle ver-
wendet. Dazu gehren die Mereologie im en-
geren Sinne, um 1916 von Lesniewski als eine
antinomiefreie Alternative zur Mengenlehre
entwickelt (vgl. Luschei 1962), und der Indi-
viduenkalkl, 1940 von Leonard und Good-
man vorgestellt und zur Fundierung einer
streng nominalistischen, d. h. eintypigen Se-
18. Massennomina 407
mu dem betreffenden Wasserquantum ein
zustzliches Identifikationskriterium durch
eine dinghafte Entitt aufgeprgt werden
z. B. durch einen Eimer, durch eine Pftzen-
Gestalt usw. Im Gegensatz dazu sind solche
zustzlichen Identifikationskriterien nicht n-
tig, wenn man zu recht sagen will, da x
derselbe Apfel ist wie der, den Anna gestern
gepflckt hat.
Es gibt eine Reihe von Anstzen zur Ent-
wicklung einer eigenen Stoff-Ontologie ohne
dinghafte Identittskriterien; Beispiele sind
Strawson (1959), Quine (1960, 1974) und Ze-
mach (1970). Fr die Semantik von MT wer-
den derartige Anstze von Wald (1977), Bunt
(1979) und Lnning (1982, 1987) herangezo-
gen. Ein Kennzeichen dieser Arbeiten ist, da
sie es berhaupt vermeiden, fr Stoffquanta
Variablen einzusetzen, da Variablen nur fr
Entitten mit Identittskriterien stehen kn-
nen. Ein Satz wie (Etwas) Wasser verdampft
wird beispielsweise von Lnning wie folgt be-
handelt: Wasser und verdampft werden als
Individuen in einem mereologischen Modell
interpretiert, die jeweils fr die Gesamtheit
des Wassers bzw. die Gesamtheit des Ver-
dampfenden stehen, und der Satz Wasser ver-
dampft wird als Behauptung interpretiert, da
diese beiden Individuen sich berlappen.
Es ist allerdings zu bezweifeln, da die Se-
mantik von MT auf diese Weise angemessen
beschrieben werden kann. Ein Grund hierfr
ist, da auf bloe MT anaphorisch bezugge-
nommen werden kann; in (26) bezieht sich es
auf dasselbe Wasser, das Anna aus der Quelle
geschpft hat, ohne da es durch einen Trger
eines Identittskriteriums wie Eimer modifi-
ziert zu werden brauchte:
(26) Anna hat gestern Wasser
i
aus der Quelle
geschpft und es
i
heute weggeschttet.
Wir mssen deshalb annehmen, da auch
Stoffquanta ihre Identittskriterien haben;
diese Annahme hat vor allem Cartwright
(1965, 1970) vertreten. Vielfach wurde auch
davon ausgegangen, da ein objektbezogener
MT wie Wasser stets paraphrasiert werden
knne durch Ausdrcke wie ein Quantum
Wasser oder eine Portion Wasser (vgl. Mon-
tague 1973a, Cook 1975, Bennett 1979a).
Ein weiteres Problem der mereologischen
Rekonstruktion objektbezogener MT besteht
darin, da sich die Atomaritt in ihr nicht
befriedigend behandeln lt. Beispielsweise
mchte Moravcsik (1973) den Satz x ist Was-
ser als x ist ein mereologischer Teil des In-
dividuums Wasser analysieren, was ihm aber
Satz Gold ist schwerer als Wasser in unserer
Welt sicher wahr, obwohl das Gold unserer
Welt zusammengenommen wesentlich leichter
ist als das Wasser unserer Welt.
Ein weiteres Problem des mereologischen
Ansatzes besteht darin, da ko-extensive Gat-
tungen ihm zufolge identisch sind. Wre bei-
spielsweise alles Gold zu Goldschmuck ver-
arbeitet, so wre die Fusion des Goldes gleich
der Fusion des Goldschmucks, und damit
nach mereologischer Interpretation die Gat-
tung Gold gleich der Gattung Goldschmuck.
Gleiches gilt fr Gattungen, die gar nicht
realisiert sind, wie z. B. Ambrosia und Phlo-
giston.
Diese Konsequenz wurde zu umgehen ver-
sucht durch die Einbeziehung mglicher Wel-
ten (Moravcsik 1973): wenn beispielsweise
Gold und Goldschmuck in nur einer mgli-
chen Welt nicht ko-extensiv sind, so wren sie
bereits mereologisch differenzierbar. Dies ge-
ngt allerdings nicht; es lassen sich nmlich
Gattungen vorstellen, die notwendig koexten-
siv sind, jedoch unterschiedliche atomare
Teile haben und deshalb nicht identisch sind;
z. B. knnte man Goldschmuck und Schmuck-
gold ber ein Bedeutungspostulat auf diese
Weise interpretieren.
Die mereologische Interpretation generi-
scher MT mu aus diesen Grnden verworfen
werden. Wie steht es mit der mereologischen
Analyse objektbezogener MT? Hier sind zwei
Analysen zu unterscheiden: (a) Die Extension
objektbezogener MT sind Mengen, deren Ele-
mente einer mereologischen Struktur unterlie-
gen; (b) sie sind Individuen, die einer mereo-
logischen Struktur unterliegen.
Die erste Auffassung stellt die notwendige
Voraussetzung fr die Interpretation kumu-
lativer Prdikate bereit: der Zusammenfas-
sung von Entitten mu ein formales Pendant
gegeben werden, wozu eben die Fusion dient.
Dies wird in Abschnitt 4 nher ausgefhrt.
Die zweite Auffassung geht davon aus, da
die Ontologie von Stoffquanta sich funda-
mental von der Ontologie von Dingen unter-
scheidet und daher einer neuartigen, nicht-
mengentheoretischen modellhaften Rekon-
struktion bedarf; ein Vertreter dieser Theorie
ist Laycock (1975) mit Rckgriff auf Straw-
son (1954b, 1959).
Laycock zufolge besitzen Stoffquanta wie
etwas Wasser im Gegensatz zu Dingen wie
einem Apfel keine inhrenten Identifikations-
kriterien. Wenn man zu Recht sagen will, da
x dasselbe Wasser ist wie jenes, das Anna
gestern aus der Quelle geschpft hat, dann
408 VI. Nominalsemantik
unterschiedliche Strategien eingeschlagen. Es
gibt Theorien, die eine Stoff-Ontologie fr SN
mit einer Ding-Ontologie fr IN verknpfen
(vgl. Wald 1977, Bunt 1979, Lnning 1982,
1987). Als problematisch erweist sich hier die
Integration der beiden Ontologien, vor allem,
weil viele Nomina sowohl als SN wie als IN
verwendet werden knnen. Andere Theorien
rekonstruieren Dinge und Quanta als Indivi-
duen, jedoch als Individuen unterschiedlicher
Art (ter Meulen 1980, Link 1983a). Um zwi-
schen Dingen und Stoffquanta Beziehungen
herzustellen, mu eine eigene Funktion an-
genommen werden, die einem Ding das Stoff-
quantum zuweist, aus dem es zum Referenz-
punkt besteht.
Ein anderer Weg, Dinge und Stoffquanta
in einem einheitlichen Modell zu reprsentie-
ren, fhrt ber die Annahme von elementa-
reren Entitten, nmlich von raumzeitlichen
Manifestationen. Diese wurden unter ver-
schiedenen Bezeichnungen diskutiert, z. B. als
Schichten (Carnap 1954), features und
incidences (Strawson 1954b, 1959), sta-
ges (Quine 1960, Carlson 1977, 1978, Hin-
richs 1985), types (Zemach 1970), tem-
poral parts (Gabbay & Moravcsik 1973) und
Homaams (heaps of molecules at a mo-
ment, Montague 1973a). Man kann sie sich
als Raumzeitgebiete vorstellen, die ganz von
einem Ding oder einer Substanz erfllt sind.
Die Koinzidenz eines Dings mit einem Stoff-
quantum kann dann als Identitt ihrer raum-
zeitlichen Manifestationen zu einem Refe-
renzzeitpunkt rekonstruiert werden.
3.6Mae und Grade
Zur Beschreibung von Numerativkonstruk-
tionen wie zwei Gramm Gold mu auch ber
die Semantik von zwei Gramm nachgedacht
werden. Ausdrcke dieser Art werden amount
terms genannt; Anstze zu ihrer Beschreibung
finden sich bei Parsons (1970), Bennett
(1974), Cartwright (1975), Wald (1977), Bunt
(1979), ter Meulen (1980), Eikmeyer & Jansen
(1980), Lnning (1982, 1987) und Krifka
(1989). Ferner mu auch das damit zusam-
menhngende Problem der Vergleichsstze
der Art (27) behandelt werden; Anstze zu
deren Beschreibung finden sich bei Cresswell
(1976), Hellan (1981) und v. Stechow (1984a).
(27) Dies (x) ist mehr Gold als das (y).
Fr die Analyse von Maangaben wie zwei
Gramm erweisen sich die Konzepte der Ma-
theorie als geeignet (vgl. z. B. Krantz et al.
1971). Eine Maeinheits-Bezeichnung wie
nicht mglich erscheint, da faktisch nicht je-
der Teil des Wassers Wasser ist. Er mu des-
halb zu jedem Massenterm eine zustzliche
strukturelle Eigenschaft annehmen, so da
nur diejenigen Teile als Wasser gelten, die
auch die entsprechende strukturelle Eigen-
schaft haben. Damit wird aber die mereolo-
gische Rekonstruktion selbst berflssig, da
alle Information, ob eine Entitt x Wasser ist,
bereits aus der Kenntnis dessen gewonnen
werden kann, ob sie der fr Wasser spezifi-
schen strukturellen Eigenschaft gengt (vgl.
zu anderen Kritikpunkten Pelletier & Schu-
bert 1989).
3.5Dinge und Stoffquanta
Obgleich in der natrlichen Sprache Stoff-
quanta behandelt werden, als wre die Re-
Identifizierung kein Problem, weisen sie eine
Reihe von Unterschieden zu Dingen auf, die
ihre Reflexe auch in der sprachlichen Be-
handlung zeigen. Die drei wichtigsten will ich
hier anfhren:
Stoffquanta und Dinge knnen mitein-
ander koinzidieren, z. B. ein Quantum
Gold x mit einem Ring y. Das Verhltnis
von x und y wird sprachlich nicht sym-
metrisch behandelt; man sagt, y besteht
aus x (vgl. Parsons 1970).
Stoffquanta und Dingen knnen unter-
schiedliche Eigenschaften zugeschrieben
werden, auch wenn sie miteinander koin-
zidieren. Zum Beispiel kann das Gold, aus
dem ein Ring besteht, aus Brasilien kom-
men, der Ring selbst aber aus Holland.
Auch wird man nicht sagen, da das Gold
des Ringes einen Diamanten hat der
Ring ist es, der ihn hat (Parsons 1970, ter
Meulen 1980). Es gibt jedoch Prdikate
Link (1983a) nennt sie invariant ,
die stets sowohl auf Dinge als auch auf
die sie konstituierenden Stoffquanta zu-
treffen (z. B. befindet sich im Safe).
Eine Bedingung fr die Identitt von
Stoffquanta ist die Identitt ihrer Teile.
Zum Beispiel sind x und y derselbe Liter
Wasser, wenn x und y aus denselben Was-
serteilen bestehen. Dies gilt nicht fr
Dinge; hier knnen Teile ausgetauscht
werden, ohne da dies die Identitt des
Dinges berhren mte man denke
etwa an den Stoffwechsel eines Lebewe-
sens oder die Reparatur eines Autos (Wald
1977).
Zur Beschreibung des unterschiedlichen Ver-
haltens von Dingen und Stoffquanta wurden
18. Massennomina 409
des Komparativmorphems -er analysieren
knnte vor allem natrlich, wenn man das
Englische zugrundelegt, wo more tatschlich
in beiden Funktionen auftritt. Ferner dr-
fen auch (28a) und (28b) keineswegs parallel
analysiert werden. Sowohl in ihrer Akzent-
struktur als auch in ihrer Syntax weichen sie
voneinander ab: es heit zwei GRAMM
schwer vs. zwei Gramm GOLD, und Topika-
lisierungen wie zwei Gramm ist dies schwer
sind mglich, *zwei Gramm ist dies Gold hin-
gegen nicht.
Da Mafunktionen auch zur Rekonstruk-
tion von MT-Quantoren wie das meiste Gold
ntig sind, hat Parsons (1970) gezeigt. Der
Satz Das meiste Gold ist ungeschrft kann
nach ihm nicht analysiert werden als: die mei-
sten Goldquanta sind ungeschrft, sondern
als: das Ma des ungeschrften Goldes ist
grer als das Ma des geschrften Goldes.
4. Die Semantik objektbezogener
Massenterme
Im folgenden sollen einige der in Abschnitt 3
eingefhrten Begriffe etwas przisiert werden.
Eine ausfhrliche Darstellung findet sich in
Krifka (1989).
4.1Eine verbandstheoretische
Modellstruktur
Will man die Semantik von kumulativen Pr-
dikaten modelltheoretisch rekonstruieren, so
mu vor allem der Zusammenfassung von
Entitten ein formales Pendant gegeben wer-
den. Die wesentlichen Eigenschaften der
hierzu ntigen Modellstruktur werden durch
einen vollstndigen Summen-Halbverband
dar-
gestellt (vgl. Link 1983a). Hierunter versteht
man eine Struktur A,u, wobei A eine
Menge und u eine zweistellige Operation auf
A, die Summenoperation, ist und fr alle
x,y,z A gilt:
(30)
a. x y = y x,
d. h. ist kommutativ;
b. x [y z] = [x y] z,
d. h. ist assoziativ;
c. x x = x, d. h. ist idempotent;
d. d A [x y = d & d A [x y
= d d = d]],
d. h. ist eine innere Verknpfung
auf A, und A ist bezglich abge-
schlossen.
ber die Summenoperation kann die Teilre-
lation definiert werden (vgl. 31); sie kon-
stituiert eine Halbordnung A, , deren
Gramm ist demnach semantisch als (partielle)
Funktion aufzufassen, die einem Individuum
eine Zahl zuordnet, hier einem massebehaf-
teten Individuum dessen Gewichtsschwere in
Gramm. Eine solche Funktion heit allge-
mein eine Mafunktion. (Siehe auch Artikel
32.)
Unter den mebaren Eigenschaften inter-
essieren in unserem Zusammenhang vor allem
diejenigen, fr die sich eine Brcke zur Zu-
sammenfassung von Elementen schlagen lt.
Fr eine Mafunktion m einer solchen Eigen-
schaft lt sich auf natrliche Weise eine Ad-
dition definieren (vgl. auch Cartwright 1975):
Wenn zwei Entitten sich nicht berlappen,
so sei die Summe der Mae der beiden Enti-
tten gleich dem Ma der Zusammenfassung
der beiden Entitten. Mithilfe von Mafunk-
tionen dieser Art kann ein Ausdruck wie zwei
Gramm Gold interpretiert werden als Prdi-
kat, das auf Gold-Quantitten des Gewichts
2 Gramm zutrifft.
Cresswell (1976) und v. Stechow (1984a)
behandeln Numerativkonstruktionen etwas
anders. Nach ihnen denotiert ein MN wie
Gold genauso wie ein graduierbares Adjektiv
wie schwer eine Relation zwischen Individuen
x und Graden d, wobei x und d in der Relation
Gold stehen, wenn x Gold und d der Quan-
tittsgrad von x ist. Dies erleichtert die Dar-
stellung von komparativen Stzen, da stets
eine einschlgige Dimension vorgegeben ist;
(27) drckt beispielsweise aus, da x bezglich
des Goldmaes einen hheren Grad besitzt
als y. Fr eine parallele Behandlung von Gold
und schwer scheint auch die Parallelitt der
folgenden Beispiele zu sprechen:
(28)
a. Dies ist zwei Gramm schwer.
b. Dies ist zwei Gramm Gold.
Es gibt jedoch wichtige syntaktische Unter-
schiede zwischen graduierbaren Massenno-
mina und MN. Sie verhalten sich nicht un-
mittelbar parallel zueinander, wie folgende
Beispiele (quativ, Positiv, Komparativ) zei-
gen:
(29)
a. Dies ist so schwer wie das.
b. Dies ist schwer.
c. Dies ist schwerer als das.
a. Dies ist so viel Gold wie das.
b. Dies ist viel Gold.
c. Dies ist mehr Gold als das.
Offensichtlich wird das MN Gold erst durch
viel in einen Ausdruck vom semantischen Typ
eines graduierbaren Adjektivs berfhrt. Im
Falle von (29c) ist dies lediglich etwas ver-
unklart, da man mehr auch als Entsprechung
410 VI. Nominalsemantik
(38)
a. ATOM(x,M) : x M &
y [y x & y M]
b. P ist atomar : x [x P
y [y x & ATOM(y, P )]]
4.2Die Semantik nominaler
Konstruktionstypen
Wenden wir uns nun der Beschreibung der
Semantik nominaler Konstruktionen zu, wo-
bei wir mit Numerativkonstruktionen begin-
nen. Maeinheits-Bezeichnungen wie Gramm
werden mithilfe von Mafunktionen rekon-
struiert, die bezglich der Summenoperation
u additiv sind und die sogenannte archi-
medische Eigenschaft besitzen, die besagt,
da Entitten in Teilbeziehung kommensu-
rabel sein mssen. Fr alle derartigen Funk-
tionen m soll gelten:
(39)
a. x y m(x) + m(y) = m(x y)
b. m(x) > 0 & y x n [n m(y) >
m(x)]]
Im folgenden seien Mengen mit ihren charak-
teristischen Funktionen identifiziert, so da
neben x M auch die Schreibweise M(x) und
neben {x..x..} die Schreibweise x [..x..] zu-
gelassen ist. Ein Numerativausdruck wie zwei
Gramm Gold kann dann als Anwendung eines
Operators zwei Gramm auf ein Prdikat Gold
analysiert werden:
(40) zwei Gramm Gold
= n X x [X(x) & g(x) = n](2)
( Gold )
= x [ Gold (x) & g(x) = 2]
Hier steht g fr die Gramm-Mafunktion,
und der semantische Aufbau verluft wie von
der syntaktischen Analyse (6a) vorgezeichnet.
Zwei wichtige semantische Einschrnkun-
gen lassen sich fr Numerativkonstruktionen
formulieren: Erstens mu die zugrundelie-
gende Mafunktion additiv und archimedisch
bezglich u sein; dies erklrt, weshalb Aus-
drcke wie *achtzehn Karat Gold nicht akzep-
tabel sind (im Gegensatz zu Wortbildungen
wie achtzehn-KaRAT-Gold). Unter dieser Be-
dingung kann man nachweisen, da Nume-
rativkonstruktionen stets gequantelte Prdi-
kate sind.
Zweitens darf das Bezugsnomen nicht ge-
quantelt sein. Dies erklrt, weshalb Aus-
drcke wie *hundert Meter fnfhundert
Gramm Wolle ungrammatisch sind, obwohl
sie semantisch durchaus interpretierbar wren
(z. B. Wolle, die 100 Meter lang und 500
Gramm schwer ist). Man knnte zwar diese
Bildungen auch syntaktisch ausschlieen;
doch es gibt durchaus syntaktisch korrekte
wichtigste Struktureigenschaften in (32) auf-
gefhrt werden. Fr alle x,y,z A gilt:
(31)
a. x y : x y = y
b. x y : x y & x y
(32)
a. x x, d. h. ist reflexiv;
b. x y & y z x z,
d. h. ist transitiv;
c. x y & y x x = y,
d. h. ist antisymmetrisch;
Mithilfe der Teilrelation kann die Relation
der berlappung zweier Entitten, , definiert
werden:
(33) x y : z [z x & z y]
Damit kann eine weitere Einschrnkung der
zulssigen Modelle definiert werden, die in
bestimmten Zusammenhngen von Bedeu-
tung ist, nmlich die der Komplementaritt
des Summen-Halbverbandes:
(34) y x !z [y z & y z = x]
Die Operation der Summenbildung findet
ihre ordnungstheoretische Entsprechung in
der Fusion. Unter der Fusion (dem Supre-
mum) einer Teilmenge M von A relativ zu
einer Halbordnung in A, kurz FU(M),
versteht man die kleinste obere Schranke von
M.
(35)
a. O. Schr(x,M) : y [y M y x]
b. FU(M) = x : O.Schr(x,M) &
y [O.Schr(y,M) x y]
FU ist eine Verallgemeinerung von u; es gilt
FU({x, y}) = x y. Wegen der Vollstndig-
keit von A, besitzt jede Teilmenge von
A (auch eine infinite) eine Fusion.
Zu unterscheiden von der Fusion einer
Menge M, die nicht Element von M zu sein
braucht, ist das maximale Element von M
bezglich einer Halbordnung , genannt
MAX(M). Es ist wie folgt definiert:
(36) MAX(M) = x x = FU(M) & x M.
Auf der Grundlage eines kumulativen Sum-
men-Halbverbands knnen nun kumulative,
gequantelte und divisive Prdikate durch ihre
Extensionen charakterisiert werden. Es sei
eine Interpretationsfunktion; dann gilt
(37)
a. P ist kumulativ : x,y [x P &
y P x y P ]
b. P ist
gequantelt : x,y [x P &
y P & x y]
c. P ist divisiv : x,y [x P &
y x y P ]
Die Begriffe des Atoms einer Menge und des
atomaren Prdikats knnen wie folgt defi-
niert werden:
18. Massennomina 411
Kann der hier entwickelte Ansatz auch auf
die Behandlung von Klassifikatorkonstruk-
tionen wie zwei Stck Vieh ausgedehnt wer-
den? Das Problem liegt bei der Mafunktion
von Stck. Offensichtlich ist diese nicht un-
abhngig von dem jeweiligen Nomen, hier
Vieh. Setzen wir daher eine zweistellige Funk-
tion NE an, die, angewendet auf ein Prdikat,
eine Mafunktion liefert (NE steht fr Na-
trliche Einheit). Wir erhalten damit:
(42) zwei Stck Vieh
= n,X,x [X(x) & NE(X)(x) = n] (2)
(Vieh )
= x [ Vieh (x) & NE( Vieh )(x) = 2]
Unter zwei Stck Vieh fallen demnach alle
Entitten, die unter Vieh fallen und die zwei
Natrliche Einheiten Vieh zhlen. Das zwei-
malige Auftreten von Vieh mag redundant
erscheinen; wenn man den NE-Operator je-
doch gengend allgemein versteht (bei Lebe-
wesen z. B. als ein Organismus), dann ist
es sinnvoll, qualitative und quantitative Kom-
ponente eines Prdikats in der angegebenen
Weise zu trennen. Es ist schlielich zu be-
rcksichtigen, da NE eigentlich auf die In-
tension von Prdikaten angewendet werden
soll; anderenfalls ist die Mafunktion bei
koextensiven Prdikaten, z. B. bei Prdikaten
mit leerer Exension, gleich.
Die vorgeschlagene Methode zur Darstel-
lung von Klassifikatorkonstruktionen kann
auch zur Darstellung von Numeralkonstruk-
tionen wie zwei Rinder herangezogen werden.
Ausgehend davon, da ein IN wie Rind sich
von einem KN wie Vieh durch ein eingebau-
tes Stckma unterscheidet, ist hierfr die
Analyse (43) mglich. Dabei steht Rd fr ein
kollektives Prdikat (hnlich Vieh); bei der
Pluralform Rinder handelt es sich um ein rei-
nes Kongruenzphnomen (vgl. Abschnitt 2.2).
(43) Rind = r,x [NE( Rd )(x) = r]
zwei Rinder
= Z [Z(2)] (r,x [NE
( Rd ) (x) = r])
= x [NE( Rd )(x) = 2]
Die Extensionsgleichheit von Rind und Vieh
vorausgesetzt, besitzen damit zwei Stck Vieh
und zwei Rinder die gleiche Extension. Nach
(43) sind IN als relational zu analysieren: sie
bilden Zahlen auf Prdikate ab.
Bloe PT wie Rinder treffen auf Entitten
zu, die sich aus zwei oder mehr Einzelentit-
ten, z. B. Rindern, zusammensetzen. Ihre Ex-
tension kann kompositional aus der Exten-
sion von IN mithilfe eines Plural-Operators
gewonnen werden.
Ausdrcke derselben Struktur, z. B. zwei Mal
fnfhundert Gramm Wolle, so da besser nach
semantischen Grnden gesucht werden sollte.
Informell gesprochen, liegt der Grund fr die
beiden semantischen Einschrnkungen wohl
darin, da es Aufgabe von Numerativkon-
struktionen ist, aus einem Kontinuum von
Entitten (wie es durch kumulative Extensio-
nen dargestellt wird) Entitten bestimmter
Gre auszusondern; deshalb darf das Be-
zugsprdikat nicht bereits gequantelt sein,
whrend das resultierende Prdikat gequan-
telt sein mu.
Wenn dieser Ansatz allgemein zur Rekon-
struktion der Semantik von Numerativkon-
struktionen dienen soll, mssen auch Nume-
rative wie Glas oder Barren mithilfe von Ma-
funktionen interpretiert werden. Dies ist
durchaus mglich; Barren basiert dann bei-
spielsweise auf einer Funktion b, die einer
Entitt die Anzahl der Barren zuordnet, aus
denen sie besteht. Ein Ausdruck wie zwei Bar-
ren Gold trifft dann auf alle Entitten zu, die
Gold sind und das Ma zwei Barren besitzen.
Allerdings mu dabei bercksichtigt werden,
da zwei Barren und das Gold, aus dem die
Barren bestehen, nicht miteinander identifi-
ziert werden sollten (vgl. 3.5). Wenn wir mit
Link (1983a) eine Funktion h annehmen, die
Dinge auf die Stoffquanta abbildet, aus denen
sie bestehen, ergibt sich folgende Reprsen-
tation:
(41) zwei Barren Gold = x [ Gold (h(x))
& b(x) = 2]
Die Formalisierung von zwei Glas Wein be-
darf statt h einer primitiven Relation des Ent-
haltenseins.
Ein Einwand gegen diese Analyse ist, da
man Barren als normales IN analysieren
knnte, das auf Atome der Modellstruktur
zutrifft. Dann bentigte man eine allgemeine
Mafunktion, die angibt, aus wievielen Ato-
men ein Individuum besteht, und knnte zwei
Barren Gold reprsentieren als: Gold, das mit
zwei Modell-Atomen koinzidiert, die unter
Barren fallen. Diese Analyse ist jedoch ab-
zulehnen, da sie beispielsweise keine Mglich-
keit bereitstellt, auf Ausdrcke wie anderthalb
Barren Gold ausgeweitet zu werden: andert-
halb Barren Gold sind zwei Dinge, ein ganzer
und ein halber Goldbarren, und sollten daher
durch zwei Atome in der Modellstruktur re-
prsentiert werden. Zweitens sollte nach ihr
jedes IN auch als Numerativ verwendbar sein;
Ausdrcke wie *zwei Ringe Gold sind jedoch
ungrammatisch.
412 VI. Nominalsemantik
im allgemeinen auch weitere Elemente, z. B.
Teile von a, unter dieses Prdikat. Dies gilt
jedoch nicht fr gequantelte Bezugsprdikate:
die drei Barren Gold im Safe referiert nur,
wenn es im Safe genau drei Barren Gold gibt.
Es ist dennoch eine einheitliche Analyse dieser
Flle mglich, nmlich ber den MAX-Ope-
rator (vgl. Montague 1973a, Link 1983a):
(45)
a. das Gold = X MAX(X)( Gold )
= MAX( Gold )
b. die drei Barren Gold = MAX( drei
Barren Gold )
Es lt sich nmlich zeigen: Wenn das Be-
zugsprdikat (hier: Gold) kumulativ ist, dann
liefert MAX wegen der Vollstndigkeit des
zugrundeliegenden Summen-Halbverbands
immer einen Wert. Wenn das Bezugsprdikat
jedoch gequantelt ist, dann liefert MAX nur
dann einen Wert, wenn es zugleich singulr
ist, d. h. nur auf eine einzige Entitt zutrifft;
andernfalls ist MAX nicht definiert.
Nach Abschnitt 2.2 sind zwei unterschied-
liche Verwendungsweisen des definiten Arti-
kels zu unterscheiden; in der einen sollte er
eine Anzahl-Argumentstelle abbinden, in der
zweiten nicht. Dies legt folgende Analyse im
letzteren Fall nahe:
(46) der Ring = Z [MAX(Z(1))] (n,x
( Rg (x) & NE( Rg )(x)
= n])
= MAX(x [ Rg (x) & NE
( Rg )(x) = 1])
Hier bindet der definite Artikel zugleich die
Anzahl-Argumentstelle des IN mit ab. hn-
lich sind auch Ausdrcke wie der Barren Gold
zu behandeln; allerdings mu durch geeignete
Typ-Kombinationsregeln dafr gesorgt wer-
den, da Barren unmittelbar mit Gold zu
einem Ausdruck des IN-Typs kombiniert wer-
den kann.
5. Die Semantik generischer
Massenterme
In diesem Abschnitt sollen um einige
Grade weniger formal wichtige Beobach-
tungen zur Semantik generischer Massen-
terme dargestellt werden.
5.1Die Interpretation generischer Terme
Die generische Interpretation von Termen ist
nicht auf bloe MT oder PT beschrnkt. Drei
Arten generischer Terme sind zu unterschei-
den (vgl. z. B. Lawler 1973), nmlich definit-
(44) Rinder = Zx r [Z(r)(x) & r 2]
(r,x [NE( Rd )(x) = r])
= x r [NE( Rd )(x) = r &
r 2]
Bei Dualformen wre die Anzahl mit 2 und
bei Singulativformen mit 1 zu spezifizieren.
Konstruktionen wie zwei Herden Rinder sind
parallel zu zwei Barren Gold zu analysieren:
auf das Prdikat Rinder wird eine Numera-
tivphrase zwei Herden angewendet.
Das Konzept der NE-Mafunktion kann
ferner zur Klrung der Verwendung von MN
in IN-Funktion wie in zwei Bier(e) dienen.
Man mu hierzu annehmen, da NE nicht
nur natrliche Einheiten einer Gattung, son-
dern auch konventionelle Einheiten zhlen
kann. Allerdings knnen konventionelle Ein-
heiten durchaus unterschiedlich sein; zwei
Bier kann sich je nach Kontext auf zwei Gl-
ser, zwei Flaschen, zwei Ksten, zwei Fsser
Bier usw. beziehen; NE ist daher nicht als
Funktion, sondern als Relation zu analysie-
ren. Da sich zu sehr vielen MN in bestimmten
Situationen geeignete konventionelle Einhei-
ten denken lassen, verwundert es nicht, da
viele MN auch in IN-Verwendung auftreten
knnen.
Nach der hier vorgeschlagenen Analyse
liegt jedem IN ein MN zugrunde, Rind bei-
spielsweise ein Prdikat Rd. Ist dies der ge-
eignete Kandidat fr die MN-Verwendung
eines IN ? In manchen Fllen wohl, oft aber
liefert dies jedoch nicht die intendierte Bedeu-
tung: viel Rind heit in der Regel etwas an-
deres als viel Vieh, nmlich viel Rindfleisch.
Hier sind zwei Lexikoneintrge fr Rind an-
zunehmen, einmal als IN und einmal als MN
in der Bedeutung Rindfleisch.
Die MN/IN-Distinktion ist dieser Analyse
zufolge eine syntaktische. Zwar gehren MN
und IN semantisch unterschiedlichen Kate-
gorien an, aber jedem IN liegt ein MN (ge-
nauer: KN) zugrunde, in unserem Beispiel
etwa dem IN Rind ein Prdikat Rd. Da
einerseits ein Nomen wie Vieh nicht als IN
verwendet werden und andererseits Rd nicht
unmittelbar als MN dienen kann, lt sich
aber semantisch nicht weiter begrnden; bei
Rd wie bei Vieh handelt es sich um diskrete
kumulative Prdikate. Wir haben mithin ein
syntaktisches Phnomen vor uns.
Wenden wir uns nun definiten Deskriptio-
nen wie das Gold im Safe zu. Die Einzigkeits-
bedingung, die blicherweise an definite De-
skriptionen gestellt wird, ist bei kumulativen
Bezugsprdikaten in der Regel nicht erfllt
wenn a unter Gold im Safe fllt, dann fallen
18. Massennomina 413
(54)
a. Pandabren sind am Aussterben.
b. Styropor wurde 1950 erfunden.
Allerdings scheinen die fr Stze der Art (54)
zulssigen bloen MT/PT stets auf etablierte
Gattungen beschrnkt zu sein. Dies zeigt sich
an Beispielen wie *Zottelige Bren sind am
Aussterben oder *Blaugefrbtes Styropor
wurde 1950 erfunden.
Wie sind nun generische Terme semantisch
zu analysieren? Definit-generische Terme
plausiblerweise als Individuenbezeichnungen
von Gattungen, also von abstrakten Indivi-
duen. Da sie auf etablierte Gattungen be-
schrnkt sind, ist hierfr eine beschrnkte
Menge von Individuen zur Reprsentation
der Gattungen erforderlich. Indefinit-generi-
sche Terme hingegen sind nicht auf etablierte
Gattungen beschrnkt, sondern jeder belie-
bige indefinite Term (jedes nominale Prdi-
kat) kann generisch interpretiert werden. Sol-
len sie ebenfalls Individuenbezeichnungen
sein, so mu die Modellstruktur fr jedes
nominale Prdikat ein korrespondierendes In-
dividuum bereitstellen. Dies ist durchaus
mglich, allerdings nicht im Rahmen der b-
lichen Typentheorie. Modellstrukturen, die
dies erlauben, wurden in verschiedenen Theo-
rien zu nominalisierten Prdikaten ausgear-
beitet (vgl. Chierchia 1982, auf der Basis von
Arbeiten von Cocchiarella, und Turner 1983,
der Modellstrukturen annimmt, die auf Scott-
schen Bereichen basieren).
Wenn sowohl definit-generische als auch
indefinit-generische NPn als Individuenbe-
zeichnungen analysiert werden, so werden al-
lerdings die eben dargestellten Unterschiede
zwischen ihnen unterschlagen. Natrlich
knnte man dem Nomen Pandabr zwei Gat-
tungsindividuen entsprechen lassen, wobei
dann nur auf eines zutrfe, am Aussterben zu
sein. Diese Auffassung halte ich jedoch fr
wenig plausibel. Alternativ dazu knnte man
Stze mit indefinit-generischen Termen als
Aussagen ber die Denotate der nominalen
Prdikate selbst ansehen (hnlich ter Meulen
fr generische MT allgemein). Ein Satz wie
(48a) wre dann zu verstehen als: die Eigen-
schaft, ungesellig zu sein (wobei diese durch
den typischerweise-Modus modifiziert ist)
trifft auf das Denotat von ein Pandabr zu
(wobei dieses als Menge oder besser intensio-
nal als Eigenschaft zu verstehen ist). Diese
Analyse bedingt allerdings, da ist ungesellig
hier ein Prdikat hheren Typs ist als etwa in
(47a) oder in Otto ist ungesellig, die beide als
Aussagen ber einfache Individuen zu ana-
lysieren wren. Diese Typanhebung kann auf
den typischerweise-Operator zurckgefhrt
werden.
generische (47), indefinit-generische (48) und
artikellose, d. h. bloe MT/PT (49):
(47)
a. Der Pandabr ist ungesellig.
b. Die Pandabren sind ungesellig.
c. Das Schiepulver wurde in China er-
funden.
(48)
a. Ein Pandabr ist ungesellig.
b. Eine Herde Vieh ist der Stolz jedes
Hirten.
(49)
a. Gold ist ein Metall.
b.
pfel sind gesund.
Betrachten wir zunchst definit-generische
und indefinit-generische Terme. Sie unter-
scheiden sich in mehrfacher Hinsicht, was hier
an zwei Beispielen gezeigt wird. Erstens treten
definit-generische Terme nur als Bezeichnun-
gen von etablierten, bekannten Gattungen
auf; (50a) hat, im Gegensatz zu (50b) und
(47a), nur eine nicht-generische Lesart (s. Ar-
tikel 17).
(50)
a. Der zottelige Br ist ungesellig.
b. Ein zotteliger Br ist ungesellig.
Zweitens: Verbausdrcke in Stzen mit inde-
finit-generischen Subjekten sind stets stativ,
was bei Stzen mit definit-generischen Sub-
jekten nicht der Fall zu sein braucht. (67b)
ist nur in nicht-generischer Lesart mglich,
und (68b) nicht einmal in dieser, da das Verb
aussterben nur auf Gattungen anwendbar ist.
(51)
a. Der Mensch betrat 1969 den Mond.
b. Ein Mensch betrat 1969 den Mond.
(52)
a. Der Pandabr ist am Aussterben.
b. *Ein Pandabr ist am Aussterben.
Der Grund hierfr liegt darin, da Stze mit
indefinit-generischen Stzen in einem be-
stimmten Modus stehen, der annhernd mit
typischerweise markiert werden kann und Sta-
tivitt impliziert. Er kann bei definit-generi-
schen Stzen fehlen (vgl. 51a).
Konstituieren bloe MT/PT eine eigene
Art generischer Terme, oder sind sie den bei-
den bisher beobachteten Arten zuzurechnen?
Sie teilen zum einen das Verhalten von inde-
finit-generischen Termen, insofern sie nicht
auf etablierte Gattungen beschrnkt sind (vgl.
53). Zum anderen zeigen sie jedoch auch Ei-
genschaften definit-generischer Terme, inso-
fern die mit ihnen kombinierten Verbaus-
drcke nicht stativ zu sein brauchen (vgl. 54):
(53)
a. Zottelige Bren sind ungesellig.
b. In Sdafrika geschrftes Gold wird in
die USA exportiert.
414 VI. Nominalsemantik
diskutiert. Es handelt sich hierbei um gene-
rische Stze, die (in der indefinit-generischen
Rekonstruktion von Gold) wie folgt beschrie-
ben werden knnen.
(56)
a. Gold ist Gold = TYP ( Gold )
( Gold )
b. Gold ist Metall = TYP ( Metall )
( Gold )
Beide Stze sollten bei einer angemessenen
Rekonstruktion von TYP wahr sein: jedes
Quantum Gold fallt typischerweise (und so-
gar notwendig) unter die Prdikate Gold und
Metall.
5.3Sorten
Etablierte Gattungen, auf die mit definit-ge-
nerischen Termen bezuggenommen werden
kann, stehen hufig in Sorten-Beziehung zu
bergeordneten Gattungen; z. B. gelten Gold
und Eisen als Metallsorten oder als Metalle.
Durch diese Sortenbeziehungen entstehen ta-
xonomische Klassifikationshierarchien, deren
Struktureigenschaften von Kay (1971) und
Cocchiarella (1976) beschrieben wurden. Als
Beispiel sei ein Ausschnitt aus einer solchen
Hierarchie in einem Diagramm dargestellt:
Fr die Bedeutungsbeschreibung dieser Aus-
drcke ist von Interesse, da Stze wie Gold
ist ein Metall und Gold ist ein Edelmetall wahr
sind, Edelmetall ist ein Metall oder Weigold
ist ein Metall hingegen falsch. Dies korrelliert
damit, da mit Gold, Silber usw. ohne weiteres
definit-generische Terme gebildet werden
knnen, was mit Metall, Edelmetall oder
Weigold eher problematisch ist. Dieser Be-
fund steht in engem Zusammenhang mit der
Beobachtung von Berlin, Bredlove und Raven
(1973), da es in taxonomischen Hierarchien
eine ausgezeichnete Ebene gibt, von ihnen
generics und hier im folgenden Spezies ge-
nannt, deren Taxa eine zentrale Rolle bei der
Erfassung der Welt spielen und fr die ein
besonders reicher und morphologisch einfa-
cher Wortschatz zur Verfgung steht; in unse-
rem Beispiel ist dies die Gold-Silber-Eisen-
Blei-Ebene.
Bloe PT oder MT knnen auf zweierlei
Weise interpretiert werden: entweder, wie alle
nominalen Prdikate, als indefinit-generische
Terme, oder als definit-generische Terme. Im
letzteren Falle handelt es sich um Namen von
etablierten Arten eine Interpretation, die
Carlson (1977, 1978) fr generische bloe
MT/PT allgemein vorgeschlagen hat.
5.2Die Bedeutung generischer Stze
Der Wahrheitswert eines generischen Satzes
wird letztlich durch die Eigenschaften der Ex-
emplare der Gattung bestimmt. Die Bezie-
hung zwischen Aussagen ber Exemplare und
Aussagen ber die Gattung selbst stellt jedoch
ein notorisches Problem dar (vgl. Abschnitt
3.1 zu Stzen der Art Schnee ist wei).
Drei Arten von generischen Stzen kann
man nach diesem Kriterium unterscheiden:
solche, deren Prdikat typischerweise auch
auf die einzelnen Exemplare der Gattung zu-
trifft (z. B. Schnee ist wei); solche, deren Pr-
dikat nicht auf Exemplare zutrifft (z. B. Gold
ist selten), und schlielich bei definit-generi-
schen Stzen solche, die auf einige wenige
Exemplare mit Vorreiter-Rolle fr die ge-
samte Gattung zutreffen (z. B. Aids erreichte
1979 Europa). Wir wollen hier nur Stze der
ersten Art betrachten.
Wie erwhnt erhalten diese Stze stets
einen typischerweise-Operator. Der Opera-
tor TYP fr Stze mit indefinit-generischen
Subjekten hebe dabei das Prdikat um eine
Stufe an. Daneben gibt es aber auch einen
zweiten Operator TYP, der das Prdikat
nicht anhebt (fr Stze der Art (47a) oder fr
habituelle objektbezogene Stze wie Otto
raucht; vgl. zu einer einheitlichen Theorie
Chafe 1970, Dahl 1975 und Carlson 1977,
1979). Ich nehme im folgenden ein Prdikat
Schnee und eine Individuenbezeichnung d-
Schnee an, deren semantische Relation zuein-
ander hier von der Betrachtung ausgeklam-
mert bleibt.
(55)
a. Schnee ist wei = TYP ( wei )
( Schnee )
b. (Der) Schnee ist wei = TYP
( wei ) ( d-Schnee )
(55a) wre nher zu beschreiben als: unter
normalen Umstnden fllt jede Entitt, die
unter das Prdikat Schnee fllt, unter das
Prdikat wei, und (55b) als: unter normalen
Umstnden fllt jedes Exemplar der Gattung
Schnee auch unter das Prdikat wei.
In der Literatur zu MN werden hufig
Stze wie Gold ist Gold oder Gold ist Metall
18. Massennomina 415
enthlt Kupfer kumulativ, wiegt 2 Kilogramm
gequantelt und befindet sich im Safe sowohl
kumulativ als auch divisiv. Eine Diskussion
solcher nichtnominalen Prdikate und ihrer
Kombinierbarkeit mit MN bzw. MT findet
sich in Bunt (1979, 1981a) und Lnning
(1982).
Der Unterschied zwischen kumulativen/di-
visiven und gequantelten Prdikaten ist ins-
besondere im Zusammenhang mit der Di-
stinktion zwischen kollektiver und distributi-
ver Prdikation von Interesse (s. Artikel 19).
Bei gequantelten Prdikaten haben die bei-
den Interpretationen stets unterschiedlichen
Wahrheitswert (vgl. 60a); bei kumulativen
oder divisiven Prdikaten (vgl. 60b,c) knnen
die Wahrheitswerte beider Interpretationen
jedoch zusammenfallen, und sie tun dies bei
Prdikaten, die kumulativ und divisiv sind,
zwingend (vgl. 60d):
(60)
a. Die drei Barren Gold wiegen zwei
Kilogramm.
b. Die drei Barren Gold sind schwer.
c. Die drei Barren Gold sind leicht.
d. Die drei Barren Gold befinden sich im
Safe.
Die Grnde hierfr liegen auf der Hand. Be-
trachten wir (60a). Wenn dieser Satz in der
distributiven Lesart wahr ist, d. h. wenn die
einzelnen Goldbarren unter wiegen zwei Ki-
logramm fallen, so kann wegen der Nicht-
Kumulativitt des Prdikats nicht auch die
Zusammenfassung der drei Barren Gold dar-
unter fallen. Den mglichen Zusammenfall
von Lesarten bei (60b, c und d) erklrt man
hnlich, indem man die Kumulativitt, die
Divisivitt oder beides der jeweiligen Prdi-
kate zugrundelegt.
6.2Zeitkonstitution und die MN/IN-
Distinktion
Das Kriterium der Kumulativitt kann noch
in einem anderen Sinne auf verbale Prdikate
angewendet werden. Die MN/IN-Distinktion
zeigt dann berraschende Parallelen zu
Aspektklassen oder Zeitkonstitutions-Ty-
pen (vgl. Franois 1985), worauf unter an-
derem in Leisi (1953), Allen (1966), Stewart
(1971), Taylor (1977) und ter Meulen (1980,
1984) hingewiesen haben.
Betrachten wir atelische und telische Verb-
ausdrcke (vgl. Garey 1957; nach Vendler
1957 Activities und Accomplishments).
Zu ersteren zhlen schlafen, Wein trinken; zu
letzteren einschlafen, ein Glas Wein trinken.
Die wichtigsten syntaktischen Tests fr diese
Taxonomische Beziehungen werden durch
Wrter wie Art, Sorte ausgedrckt, die wie
Numerative verwendet werden oder in Kom-
posita auftreten knnen (vgl. zwei Sorten Me-
tall, zwei Metallsorten). Daneben gibt es auch
den sogenannten Artenplural (zwei Metalle);
wenn ein MN in pluralischer Verwendung
auftritt, ist sehr hufig gerade diese Bedeu-
tung gemeint, die aber auch bei IN nicht
ausgeschlossen ist (vgl. In unserem Garten
haben wir Kartoffeln, Kohl und zwei pfel). In
semantischer Hinsicht ist interessant, da die
Sortenbeziehung nur zwischen Spezies und
bergeordneten Gattungen besteht; Stze wie
Gold ist ein Metall und Gold ist ein Edelmetall
sind wahr, Stze wie Edelmetall ist ein Metall
hingegen falsch.
Zur formalen Behandlung von Sortenpr-
dikaten wie zwei Metalle gehe ich davon aus,
da die Summenoperation u auch auf Gat-
tungsindividuen, d. h. auf abstrakte Entit-
ten, anwendbar ist. SR sei ein Sorten-Opera-
tor, der angewendet auf ein Gattungsindivi-
duum eine Mafunktion fr die Anzahl der
Sorten dieser Gattungen liefert:
(58) a. zwei Sorten Metall
= n,y,x[SR(y)(x) = n](2)
( d-Metall )
= = x [SR( d-Metall )(x) = 2]
b. zwei Metalle
= n,x [SR( d-Metall )(x) = n])(2)
= x [SR( d-Metall )(x) = 2]
Damit ist auch gewhrleistet, da die beiden
Stze Gold ist Metall (s.o) und Gold ist ein
Metall unterschiedliche semantische Repr-
sentationen erhalten (vgl. 56, 59). Dies ist
ntig, um unterschiedliche Wahrheitswerte
bei Stzen wie Mit Kupfer legiertes Gold ist
Metall (wahr) und Mit Kupfer legiertes Gold
ist ein Metall (falsch) zu erhalten.
(59) Gold ist ein Metall = SR( d-Metall )
( Gold ) = 1
6. Kumulativitt bei anderen
syntaktischen Kategorien
6.1Kumulative und gequantelte, kollektive
und distributive Prdikation
Mit dem Kriterium der Kumulativitt knnen
nicht nur Nomina erfat werden. Bereits
Quine (1960) bezieht es auch auf Adjektive;
er hlt rot fr kumulativ, kugelfrmig fr ge-
quantelt. Es gibt auch divisive Adjektive wie
leicht. Verbausdrcke knnen nach diesem
Kriterium ebenfalls eingeteilt werden; so ist
416 VI. Nominalsemantik
der Divisivitt ist wiederum nicht streng an-
wendbar, da es durchaus Teile von Schlafens-
Ereignissen geben kann, die nicht unter schla-
fen fallen (z. B. ein nchtliches Auf-die-Uhr-
Schauen); das Kriterium der Kumulativitt
ist daher auch hier angemessener. Atelische
Verbausdrcke knnen somit als kumulative,
telische Verbausdrcke als gequantelte Ereig-
nisprdikate angesehen werden (vgl. auch L.
Carlson 1981).
Diese Unterscheidung wird etwas verun-
klart, weil zugrundeliegend telische Verbaus-
drcke auch in iterativer und imperfektiver
Lesart auftreten (im Sinne von wiederholt ein-
schlafen, am Einschlafen sein) und dann ku-
mulativ interpretiert werden. Dies hat seine
Entsprechung im nominalen Bereich in der
kumulativen Interpretation von Pluraltermen
(Iterativformen sind verbale Pluralia) und
Partitivkonstruktionen (ein Ereignis, das un-
ter am Einschlafen sein fllt, ist echter Teil
eines Ereignisses, das unter einschlafen fllt).
Die Analogie zu Nomina geht noch weiter: es
gibt Entsprechungen zum Singulativ (Semel-
faktiva wie ungar. zrren einmal klopfen vs.
zrg klopfen); es gibt Numerativkonstruk-
tionen (eine Stunde (lang) trinken), Klassifi-
katorkonstruktionen (ein Mal trinken) und
Vergleichskonstruktionen (mehr schlafen als)
(vgl. zu diesen Parallelitten Leisi 1953,
Dressler 1968). Lediglich das Pendant zu Nu-
meralkonstruktionen scheint bei Verben zu
fehlen; Sprachen, mit Konstruktionen wie
*zwei schlafen sind mir unbekannt.
Die Tests in (61) und (62) erhalten in die-
sem Licht eine einfache Erklrung. (62a) ist
ausgeschlossen, weil durative Adverbiale wie
Numerativphrasen fordern, da der Bezugs-
ausdruck nicht bereits gequantelt sein darf.
(vgl. Abschnitt 4.2). (61b) ist aus einem prag-
matischen Grund ausgeschlossen. In einer
Stunde drckt aus, da Anfang und Ende des
Ereignisses nicht weiter als eine Stunde aus-
einanderliegen, egal wie lang es tatschlich
dauert. Es kann hier eine aus der Konversa-
tionsmaxime der Quantitt (vgl. Grice 1975)
abzuleitende pragmatische Regel angenom-
men werden, die Zeitrahmen-Angabe so eng
wie mglich zu whlen. Nun fallen unter einen
kumulativen Verbausdruck mit einem Ereig-
nis e im allgemeinen auch Teile von e; und
wenn e in einem Zeitrahmen von einer Stunde
plaziert ist, so natrlich auch die zeitlichen
Teile von e. Die pragmatische Regel zwingt
nun dazu, das Intervall so klein wie mglich
zu whlen. Bei kumulativen Ereignisprdi-
katen darf es dann nur mehr die Atome des
Ereignisprdikats umfassen, und tatschlich
Aktionsarten sind: atelische Verbausdrcke
knnen nicht durch durative Adverbiale wie
in einer Stunde (nicht-futurisch), telische
Verbausdrcke nicht durch Zeitspannen-Ad-
verbiale wie eine Stunde (lang) spezifiziert
werden.
(61)
... da Eva
a. eine Stunde (lang) schlief
b. *in einer Stunde Wein trank
(62)
... da Eva
a. *eine Stunde (lang) einschlief
b. in einer Stunde ein Glas Wein trank
Der Einflu der Kumulativitt auf die Ak-
tionsart liegt in den (b)-Fllen offen zutage:
ein kumulatives Verbargument wie Wein lst
bei einem Verb wie trinken die atelische In-
terpretation aus (vgl. 61b), ein gequanteltes
Argument wie ein Glas Wein hingegen die
telische (vgl. 62b). Notiert wurde dieses Ph-
nomen von Verkuyl (1972); semantische Er-
klrungsversuche geben Hoepelman (1976,
1981), Hoepelman & Rohrer (1980), Dowty
(1979), L. Carlson (1981) und Hinrichs
(1985).
Diese Versuche weisen jedoch Schwchen
auf. Um nur ein Beispiel herauszugreifen:
Hoepelman will die Nicht-Akzeptabilitt von
(61b) damit erklren, da in diesem Satz aus-
gedrckt wrde: (1) ein Quantum Wein wurde
von Eva in einer Stunde getrunken, und (2)
(da Wein als divisiv rekonstruiert wird) jeder
Teil dieses Quantums wurde in einer Stunde
getrunken, was intuitiv nicht richtig sei. Ein-
wand: das von in einer Stunde bezeichnete
Intervall kann durchaus grer sein als die
Gesamtdauer des Vorgangs, was Stze wie
Eva trank 10 Glas Wein in einer Stunde, tat-
schlich sogar in nur 54 Minuten nahelegen.
In diesem Sinne wurde aber jedes Teilquan-
tum des Weins ebenfalls in einer Stunde ge-
trunken.
Ich mchte abschlieend kurz die Analyse
in Krifka (1989) skizzieren, in der die Kor-
relation zur MN/IN-Distinktion unmittelbar
deutlich wird (vgl. auch ter Meulen 1984,
Bach 1986). Voraussetzung ist eine Analyse
von Verbausdrcken als Ereignisprdikate
(vgl. hierzu Davidson 1967a). Prdikate wie
schlafen und einschlafen unterscheiden sich
dann auf mittlerweile vertraute Weise: wenn
ein Ereignis unter schlafen fllt, so fllt in der
Regel auch ein echter (zeitlicher) Teil davon
darunter; wenn hingegen ein Ereignis unter
einschlafen fllt, so fllt ein echter Teil davon
in der Regel nicht darunter. Das Kriterium
18. Massennomina 417
1975 Cook 1975 Cresswell 1976 Culicover/Wa-
sov/Akmajian (eds.) 1977 Dahl 1975 Davidson
1967a Davis/Mithun (eds.) 1979 Dowty 1979
Dressler 1968 Drossard 1982 Eberle 1970 Eik-
meyer/Jansen (eds.) 1980 Franois 1985 Frege
1884 Gabbay/Guenthner (eds.) 1983-1989 Gab-
bay/Moravcsik 1973 Garey 1957 Goodman
1951 Grandy 1973 Greenberg 1972 Greenberg
1975 Grice 1975 Groenendijk/Jansen/Stokhof
(eds.) 1981 Heilmann (ed.) 1975 Hellan 1981
Hinrichs 1985 Hintikka/Moravcsik/Suppes (eds.)
1973 Hoepelman 1981 Hoepelman/Rohrer
1980 Jensen 1980 Jespersen 1924 Kay 1971
Keenan 1975 Klver 1982 Krantz et al. 1971
Kratzer 1980 Krifka 1989 Lawler 1973 Lay-
cock 1972 Laycock 1975 Lehrer 1986 Leisi
1953 Leonard/Goodman 1940 Li (ed.) 1975
Link 1983a Lnning 1982 Lnning 1987 Lbel
1986 Luschei 1962 Lyons 1977 Mayer 1981
Montague 1973a Moravcsik 1973 Noreen 1903
Parsons 1970 Partee 1972 Partee (ed.) 1976
Pelletier 1974 Pelletier (ed.) 1979 Pelletier/Schu-
bert 1987b Pelletier/Schubert 1989 Quine 1960
Rescher (ed.) 1967 Roeper 1983 Rohrer (ed.)
1980 Russell 1905 Seiler/Lehmann (eds.) 1982
Selkirk 1977 Serzisko 1980 Sharvy 1978
Schwarze/Wunderlich (eds.) 1985 von Stechow
1984a Stewart 1971 Strawson 1954b Strawson
1959 Strawson 1971 Taylor 1977 Tedeschi/Zae-
nen (eds.) 1981 ter Meulen 1980 ter Meulen
1981 ter Meulen 1984 Turner 1983 Vendler
1957 Vendler 1967 Verkuyl 1972 Wald 1977
Ware 1975 Zemach 1970
Manfred Krifka, Austin, Texas (USA)
ist ein Satz wie Eva hat in 0,4 Sekunden Wein
getrunken (etwa als Bericht von einem
Schnellschluckspecht-Wettbewerb) durchaus
akzeptabel.
Wenn telische Verben als gequantelt, ate-
lische als kumulativ rekonstruiert werden,
sind auch die Unterschiede von Wein trinken
und ein Glas Wein trinken erklrbar. Offenbar
bertrgt sich hier die Referenzweise des Ob-
jekts auf die Referenzweise des Gesamtaus-
drucks. Diese bertragung wird ausgelst
durch die spezifische semantische Relation
zwischen Verbdenotat und Termdenotat. Ent-
scheidend ist hierbei, da das Termdenotat
Teil fr Teil einem Ereignis in der Extension
des Verbs unterzogen wird. Dabei entsprechen
sich jeweils ein Teil des Objekts und ein Teil
des Ereignisses.
Ich danke Thomas Becker, Godehard Link, Arnim
v. Stechow, Dieter Wunderlich und den beiden Gut-
achtern fr wertvolle Hinweise zu diesem Artikel.
7. Literatur (in Kurzform)
Akmajian/Lehrer 1976 Allan 1977 Allan 1980
Allen 1966 Andrzejewski 1960 Bach 1986 Bu-
erle/Schwarze/von Stechow (eds.) 1983 Bealer
1975 Bennett 1975 Bennett 1979a Berlin/Breed-
love/Raven 1973 Blau 1981a Bunt 1979 Bunt
1981a Bunt 1985 Burge 1972 Burge 1977
Carlson; G. M. 1977 Carlson, G. M. 1978 Carl-
son, L. 1981 Carnap 1954 Cartwright 1965
Cartwright 1970 Cartwright 1975 Chafe 1970
Cheng 1973 Chierchia 1982 Clarke 1970 Clay
1974 Cocchiarella 1976 Cole/Morgan (eds.)
418 VI. Nominalsemantik
19. Plural
Massenomina dagegen stehen fr nicht-dis-
krete Objekte, so da die Numerus-Unter-
scheidung neutralisiert wird: Pluralitt als dis-
krete Gesamtheit ergibt hier keinen Sinn (vgl.
*drei Atommlle, *many furnitures). Masse-
nomina knnen daher Transnumeralia ge-
nannt werden; in den westlichen Sprachen ist
ihre morphologische Nische nicht immer der
Singular: neben Singulariatantum (Gold) fin-
den sich auch Pluraliatantum wie Mbel und
engl. entrails. Die letzteren nennt Dougherty
(1970: 853) syntaktische Pluralia. Solche rein
syntaktischen Pluralformen knnen auch se-
mantische Einzahlen bezeichnen (z. B. engl.
scissors) oder durch Kongruenz erzeugt wer-
den (im Deutschen und Englischen erzwingen
etwa Dezimalzahlen Pluralisierung; vgl. 1,0
pfel, 1.0 apples). Transnumeralia im Singu-
lar pluralisieren gelegentlich ebenfalls; dieser
Proze ist jedoch mit einer ziemlich lexem-
spezifischen Bedeutungsvernderung verbun-
den, die z. B. Abundanz (die Wasser des Nil)
oder Mannigfaltigkeit bzw. Sortigkeit (die
brigen drei Weine auf der Liste; wertvolle
exotische Hlzer) ausdrckt. In einigen Spra-
chen schlielich ist die Pluralform mit Zahl-
wrtern unvertrglich: im Ungarischen haben
wir hajkat lttam (Schiffe sah ich) vs. t hajt
lttam (fnf Schiffe sah ich). Das Plural-Mor-
phem -k- dient im Ungarischen also dazu,
lediglich numerisch unspezifizierte Gesamt-
heiten zu markieren; in Verbindung mit Zahl-
wrtern ist die zustzliche Pluralmarkierung
des Nomens offensichtlich redundant. Es lt
sich hier aber auch die Tendenz ablesen, da
der reine Plural ohne Determinator so etwas
wie eine transnumeralisierende Funktion
hat: die individuierende semantische Rolle des
Singulars wird aufgehoben, und brig bleibt
eine eher strukturlose Vielzahl.
Der umgekehrte Proze jedenfalls ist in
vielen Sprachen direkt manifest: ausgehend
von einem transnumeralen Nomen, das einen
unspezifischen, nicht-diskreten Begriff be-
zeichnet, gelangt man mit einem geeigneten
Affix zu einer Singulativ-Form, die auf nun-
mehr individuierte Exemplare des Begriffs zu-
trifft (vgl. das arabische dabban: unspezifisch
Fliege; vs. dabbane: eine Fliege). Das deutsche
Kollektiv-Affix ge- erzeugt einen hnlichen
Effekt, indem es ein zhlbares Nomen in
ein + zhlbares umwandelt (vgl. Holz vs. Ge-
hlz); aber dieser Fall ist semantisch anders
gelagert. Man kann jedoch die beteiligten Un-
terscheidungen sehr schn anhand des deut-
schen Wortes Polizei illustrieren: dieses No-
1. Einleitung
2. Typen von Plural-Konstruktionen
2.1 Indefinite Plural-NPn; bloe Pluralia (BP)
2.2 Definite Plural-NPn
2.3 Universell quantifizierte Plural-NPn; Quan-
toren-Floating
2.4 Numeralia und andere Plural-Quantoren
2.5 Partitiv-Konstruktionen
2.6 Koordinierte konjunktive NP-Strukturen
2.7 Kollektive Nomina, Prdikate und Adverbien
2.8 Distributive vs. kollektive Prdikation
2.9 Relationale Plural-Stze
2.10 Reziproke Konstruktionen und das englische
respectively
3. Ontologie
3.1 Das Potenzmengen-Modell; Kollektionen;
Mereologie
3.2 Das algebraisch strukturierte Universum der
Individuensummen und Gruppen
4. Analyse der linguistischen Daten im Rahmen
der Plural-Logik LP
4.1 Indefinite Plural-NPn
4.2 Bloe Pluralia
4.3 Definite Plural-NPn
4.4 alle
4.5 Partitiv
4.6 Konjungierte NPn
4.7 RP-Stze
4.8 Reziproke Konstruktionen
4.9 respectively
5. Spezielle Probleme und Ausblick
6. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
In den bekannten indogermanischen Spra-
chen wie Deutsch, Englisch, Franzsisch un-
terliegen die meisten Nomina der Unterschei-
dung zhlbar (engl. count). Beispiele von
+ zhlbaren Nomina sind Pferd, Apfel, Auf-
gabe, Menge; sie seien im folgenden indivi-
duierende Nomina(IN) genannt (engl. count
nouns). Diese Nomina treffen auf diskrete,
zhlbare Objekte zu und treten daher mit
Zahlwrtern wie ein, acht, viele auf. Zhl-
bare Nomina oder Massenomina(MN) da-
gegen bezeichnen typischerweise Stoffe (Gold,
Wasser); es finden sich hier aber auch Kollek-
tiva wie Atommll, engl. furniture und Ab-
strakta wie Solidaritt. Die Numerus-Unter-
scheidung Singular/Plural lt sich vom se-
mantischen Standpunkt nur auf die Klasse
IN anwenden. IN im Plural bezeichnen dis-
krete Gesamtheiten von Objekten derselben
Art (z. B. Pferde, pfel, Aufgaben, Mengen).
19. Plural 419
sei als Plural-NP oder einfach PNP ab-
gekrzt.
2.1Indefinite Plural-NPn; bloe Pluralia
(BP)
Betrachten wir die folgenden Beispiele.
(1)
a. Einige Freunde kamen vorbei.
b. Ein paar Tage spter kam Hans zu-
rck.
c. Kinder haben das Flo gebaut.
d. Ich hab mpa Freunde getroffen.
e. Mindestens einige der Huser waren
vollkommen zerstrt.
f. There are only a few tickets left.
Die indefiniten PNPn in (1) beziehen sich
intuitiv auf eine nicht spezifizierte, jedoch
konkrete Gesamtheit von Objekten mittels
Existenz-Quantifikation. Die existentielle
Kraft rhrt von Determinatoren wie einige,
ein paar, verschiedene, engl. a few her. Die-
selbe Funktion wird traditionellerweise dem
Null-Determinator zugesprochen, der in (1c)
anzusetzen wre (Chomsky 1965); er wird als
pluralisches Gegenstck zum indefiniten Ar-
tikel ein angesehen. Stockwell et al. (1973a)
ziehen fr das Englische die unbetonte Ver-
sion von some, mitgeteilt sm, als das eigent-
liche Gegenstck des unbestimmten Artikels
a vor; sm knnte im Deutschen etwa wie in
(1d) durch mpa (unbetontes ein paar) wieder-
gegeben werden. Beispiel (1e) enthlt eine
Partitivkonstruktion: es gibt eine kontextuell
spezifizierte Gesamtheit von Husern, von de-
nen mindestens einige gem der Aussage des
Satzes vollkommen zerstrt waren; in Ab-
schnitt 2.5 wird auf diese Konstruktion ein-
gegangen. Im Englischen lt die existentielle
Lesart brigens ebenso wie im Singular there-
insertion zu; vgl. (1 f).
Indefinite PNPn knnen auch als Prdi-
katsnomen auftreten; in dieser Position lassen
sie keinen Determinator zu, sind also bloe
Pluralia.
(2) Die Tiere auf dieser Wiese sind (*einige)
Pferde.
(3) Einige Jakobiner waren (*verschiedene)
Advokaten.
(4) Kohl und Strau waren (*mpa) Freunde.
In (2) und (3) scheint der Plural im Prdi-
katsnomen lediglich ein Fall von Kongruenz
zu sein; genau genommen treffen die Eigen-
schaften Pferd und Advokat nur auf einzelne
Individuen zu. Der Satz (4) ist jedoch anders
gelagert: die PNP Freunde ist elliptisch auf-
zufassen und setzt in ausformulierter Gestalt
men selbst ist transnumeral mit der Bedeu-
tung eines Massenausdrucks (vgl. die Polizei
umstellte das Gebude). Es besitzt als Sin-
gulativ das IN Polizist, das auf einzelne Po-
lizeibeamte zutrifft und regulr pluralisiert
(Polizisten); von dem Ausgangsnomen gibt es
jedoch auch einen Sortenplural Polizeien
(z. B. der Lnder Bayern und Baden-Wrttem-
berg), der fr verschiedene Polizei-Organisa-
tionen steht. Fr weitere Beispiele aus einer
Anzahl verschiedener Sprachen siehe Bier-
mann (1981).
Die Untersuchung einer breiten Palette von
Sprachen hat ergeben, da es eine universell
ziemlich stabile Hierarchie von Klassen von
Nomina gibt, die sich mit abnehmender
Leichtigkeit pluralisieren lassen. Diese Klas-
sen knnen durch Merkmale charakterisiert
werden, die auf einer Skala des semantischen
Individuierungsprozesses in der Sprache an-
gesiedelt sind. Nach Smith-Stark (1974) lautet
die Hierarchie SPRECHER > ADRESSAT
> VERWANDTSCHAFTSNAME > VER-
NUNFTBEGABTES WESEN > MENSCH
> LEBEWESEN. In Sprachen ohne Plural-
Morphem (z. B. im Chinesischen) bernimmt
ein mehr oder weniger ausgefeiltes System
von Klassifikatoren die Rolle der Bildung von
diskreten Einheiten, die dann durch Hinzu-
fgung von Zahlwrtern gezhlt werden kn-
nen (syntaktisch gesehen scheinen jedoch die
Klassifikatoren die Numeralia zu parametri-
sieren; die Verbindung Numerale + Klassifi-
kator operiert dann auf dem Nomen). Klas-
sifikatoren finden sich auch im Deutschen
und Englischen (30 Stck Vieh, 30 head of
cattle; man beachte, da der Klassifikator
typischerweise nicht pluralisiert wird). Siehe
auch M. Krifkas Beitrag ber Massenomina,
Artikel 18.
Zusammenfassend lt sich sagen, da die
meisten, wenn nicht sogar alle Sprachen
grammatische Mittel zur Bildung pluralischer
Terme besitzen, die semantisch gesehen Viel-
heiten bezeichnen. Die Pluralisierung ge-
schieht entweder mit Hilfe eines eigenen Plu-
ralmorphems oder ber ein System von Klas-
sifikatoren, oder mit Hilfe einer Kombination
von beidem.
2. Typen von Plural-Konstruktionen
Zur detaillierteren Beschreibung der seman-
tischen Eigenschaften der Pluralisierung be-
schrnke ich mich im folgenden auf das Deut-
sche und nahe verwandte Sprachen wie Eng-
lisch. Der Ausdruck Plural-Nominalphrase
420 VI. Nominalsemantik
hier gewissermaen als Eigennamen dieser
Gesamtheiten. Carlson (1977, 1978) zieht es
vor, von einer Referenz auf Arten von Gegen-
stnden anstelle ihrer Gesamtheiten oder
Klassen zu sprechen (siehe auch Artikel 17).
Carlson geht sogar noch einen Schritt weiter
und schlgt eine semantische Analyse vor, in
der alle BP einheitlich Arten denotieren. Die-
ser Vorschlag soll hier keiner abschlieenden
Wrdigung unterzogen werden; stattdessen
werde ich anhand ausgewhlter Beispiele aus
der Flle der Daten, die Carlson liefert, einige
wichtige Aspekte von BP-Konstruktionen
vorstellen. Eine weitere Klasse generischer
Stze etwa enthlt relationale BP wie die fol-
genden unter (9) (siehe auch Abschnitt 2.9).
(9)
a. Einhrner haben Hrner.
b. Biber bauen Dmme.
Andere generische Konstruktionen mit BP
sind
(10)
a. Hans repariert alte Autos.
b. Laubbume werden selten, wenn man
hher in die Berge kommt.
Carlson kontrastiert das Verhalten der BP mit
dem des singularischen indefiniten Artikels im
Zusammenhang mit anderen grammatischen
Phnomenen wie Skopus, Opakheit und
Aspekt. So weisen BP in Gegenwart anderer
skopus-sensitiver NPn eine Tendenz zu engem
Skopus auf, whrend eine singularische in-
definite NP die bliche Skopus-Ambiguitt
zeigt. Vergleichen wir die a)- und b)-Stze
unter (12) und (13); die mglichen Lesarten
sind durch Quantorenfolgen wie etwa in
Klammern angegeben, wobei > fr ist na-
heliegender als steht.
(12) a. Jedes Mdchen las ein Buch ber
Pferde. ( > )
b. Jedes Mdchen las Bcher ber
Pferde. (; *)
(13) a. ?Ein Hund war berall. ( > )
b. Hunde waren berall. (; *)
Carlson behauptet fr das Englische, da die
-Lesart in (13a) (a dog was everywhere)
nicht mglich sei, so da die pragmatisch
abweichende -Lesart erzwungen werde.
Das wrde bedeuten, da (13a) und (13b) gar
keine gemeinsame Lesart besen, was Carl-
son als Beweis dafr ansieht, da BP nicht
das Gegenstck zu singularischen indefiniten
NPn sein knnen. Wenn wir das Beispiel (13a)
ein wenig variieren, scheinen beide Lesarten
jedoch mglich, wie in (14a):
(14) a. Eine seltsame Stimme lie sich ber-
all vernehmen. (, )
Freunde voneinander ein pluralisches Subjekt
voraus. Dieses Prdikatsnomen ist also ein
irreduzibler Plural.
Es gibt eine wichtige Parallele zwischen
Stzen der Art (2) und dem Gebrauch von
Massenausdrcken in prdikativer Position.
Man vergleiche
(5)
a. Wenn die Tiere auf dieser Wiese Pferde
sind und die Tiere auf jener Wiese auch
Pferde sind, dann sind die Tiere auf
den beiden Wiesen (zusammengenom-
men) ebenfalls Pferde.
b. Wenn dies hier Wasser ist und das da
Wasser ist, dann ist dies hier und das
da (zusammengenommen) ebenfalls
Wasser.
Dies zeigt, da Plural-Prdikate und Massen-
ausdrcke gemeinsam die Eigenschaft der ku-
mulativen Referenz besitzen (siehe dazu das
Ende des Abschnitts 3.2).
Der Rest dieses Abschnitts ist dem wich-
tigen Problem der bloen Pluralia (BP) gewid-
met. Zwar knnen BP in Stzen wie (1c) exi-
stentiell interpretiert werden, doch treten sie
hufig als Subjekt von generischen Stzen auf
und haben dort eine ganz andere Bedeutung.
Betrachten wir die folgenden Beispiele.
(6)
a. Pferde sind Sugetiere.
b. Tiger sind gestreift.
(7)
a. Im revolutionren Frankreich waren
hohe Staatsposten von Mitgliedern po-
litischer Clubs besetzt.
b. Im revolutionren Frankreich gab es
hohe Staatsposten, die von Mitglie-
dern politischer Clubs besetzt waren.
(8)
a. Wale werden bald ausgestorben sein.
b. Tranquillizer sind weit verbreitet.
Satz (6a) hat eine strikte universelle Bedeu-
tung: jedes Pferd ist ein Sugetier. (6b) da-
gegen hat bestenfalls so etwas wie eine quasi-
universelle Bedeutung: die meisten (oder alle
typischen) Tiger sind gestreift. (7a) hat eben-
falls eine quasi-universelle Lesart: ein hoher
Posten im Staat war blicherweise von einem
Mitglied irgendeines politischen Clubs be-
setzt. Die existentielle Lesart wird dagegen,
analog zur englischen Regel der there-inser-
tion, durch die Wendung es gab explizit ge-
macht; vgl. (7b). Fr einen hnlichen gram-
matischen Effekt im Hollndischen siehe de
Mey (1984). Wie aber sind die Stze unter (8)
zu behandeln? Ihre BP scheinen weder eine
(quasi-)universelle noch eine eigentlich exi-
stentielle Lesart zu haben; sie beziehen sich
vielmehr kollektiv auf die Gesamtheit der
Wale bzw. Tranquillizer. Die BP fungieren
19. Plural 421
Ich wende mich nun Opakheitsphnomenen
zu. Betrachten wir das Satzpaar unter (17).
(17)
a. Der Reporter will mit einem Augen-
zeugen sprechen.
b. Der Reporter will mit Augenzeugen
sprechen.
Carlson behauptet im Zusammenhang mit
hnlichen Beispielen, da (17a) sowohl eine
opake wie eine transparente Lesart besitzt,
whrend (17b) nur eine opake Bedeutung hat.
Seine Beobachtung entspricht zweifellos der
Intuition ber die dominante Interpretation
dieser Stze. Wie jedoch Kratzer (1980) be-
merkt, kann der Kontext auch bei den BP die
transparente Lesart in den Vordergrund rk-
ken; ihr Beispiel ist
(18) Hans wollte Tollkirschen in den Obst-
salat tun, da er sie mit richtigen Kirschen
verwechselte.
Schlielich seien zwei Beispiele erwhnt, in
denen es um den Einflu der Objekt-NP auf
den Aspekt-Typ der Verbalphrase geht (zu
diesem Themenkomplex siehe Verkuyl 1972,
Hinrichs 1985, und besonders Krifka 1986,
1987). Achievement-Verben wie entdecken
werden in Verbindung mit Objekt-BP zu Ak-
tivitten (activities), wie die Vertrglichkeit
mit der durativen Adverbialphrase zwei Stun-
den lang zeigt:
(19) Hans entdeckte zwei Stunden lang
(schne Beispiele/*ein schnes Beispiel).
Bei spezifischer Objekt-NP ist jedoch trotz
des Plurals das Zeitspannen-Adverbial inner-
halb von zwei Stunden mglich.
(20) Hans entdeckte innerhalb von zwei
Stunden einige besonders interessante
Beispiele.
Zusammenfassend kann festgestellt werden,
da PNPn mit einem indefiniten Determina-
tor existentielle Kraft besitzen. Sie stehen fr
spezifische Kollektionen von Objekten mit
einer deutlichen Mehrzahl-Prsupposition.
Bloe Pluralia sind ambig; sie knnen exi-
stentielle Kraft besitzen und sogar weiten
Skopus ber einen anderen Operator anneh-
men, aber das kann abhngen von dem kon-
textuell gegebenen Grad der Individuierung
der bezeichneten Pluralitt. Ansonsten steht
ein BP fr eine mehr oder weniger homogene
Vielheit, die in keiner mensurativen Dimen-
sion (numerisch, raum-zeitlich, klassifizie-
rend) spezifiziert ist. In generischen Kontex-
ten und dort vornehmlich in Subjektposition
verhalten sich BP wie Eigennamen von Arten
b. Seltsame Stimmen lieen sich berall
vernehmen. ()
Die BP-Version (14b) des Satzes lt aber die
-Lesart immer noch nicht zu. Bei genauerer
Betrachtung scheint es allerdings, als ob selbst
dieser Befund gradueller Natur ist: die Mg-
lichkeit der -Lesart scheint von dem Grad
abzuhngen, in dem der durch den BP mit-
geteilte Begriff sich zu zhlbaren Einheiten
oder einer wohlumrissenen Gruppe individui-
eren lt. Vergleichen wir die Stze (15a) und
(15b).
(15) a. CIA-Agenten verminten alle Hfen
Nicaraguas. ( > )
b. Fanatische Ayatollahs gewannen die
Kontrolle ber alle Bereiche des f-
fentlichen Lebens. ( > )
Bereits in (15a) ist die -Lesart mglich (d. h.
ein spezielles CIA-Kommando bernahm die
Aufgabe), whrend sie in (15b) sogar vor-
herrschend zu sein scheint. Letzteres ist auf
die einigermaen kontingente historische Tat-
sache zurckzufhren, da das Stereotyp,
welches die meisten von uns seit einiger Zeit
mit dem Begriff Ayatollah verbinden, so et-
was wie eine wohlumrissene Clique religiser
Anfhrer mit politischem Einflu bedeutet,
die dazu tendiert, als Gruppe zu agieren. Wir
brauchen in (15b) jedoch nur Ayatollahs
durch Mullahs zu ersetzen, um mit groer
Wahrscheinlichkeit einen Skopus-Wechsel zu
erzeugen: jetzt bedeutet der Satz eher, da
jeder Bereich des ffentlichen Lebens der Auf-
sicht eines wachsamen Mullahs unterworfen
ist. Wir haben es hier also mit einer in hohem
Mae pragmatischen und kulturabhngigen
Skala von bergngen von der - zur -
Lesart zu tun, die einhergeht mit der wach-
senden Spezifizitt der Subjekt-NP. Diese bei-
nahe kontinuierlichen bergnge sind in der
folgenden Liste von Stzen illustriert.
(16) a.
berallhin war Blut verspritzt.
()
b. Sand fand sich in jedem Teil der Ka-
mera. ()
c. Ameisen krabbelten in jeder Zimmer-
ecke herum. ()
d. Wander-Arbeiter schliefen unter allen
Brcken der Stadt. ( )
e. Rechtsradikale randalierten in allen
Wiesn-Zelten. ( > )
f. GSG9-Beamte riegelten alle Haupt-
straen ab. (, )
g. Putschende Generle besetzten alle
Zentren der Macht. ()
h. Eine Militr-Junta kontrollierte alle
Regierungspositionen. ()
422 VI. Nominalsemantik
hingerichtet.
b. Die Indulgents wurden verbannt oder
hingerichtet (ich habe vergessen,
was).
(27) a. ?Weil sie
i
die terreur stoppen wollten,
wurden alle Cordeliers
i
hingerichtet.
b. Weil sie
i
die terreur stoppen wollten,
wurden die Cordeliers
i
hingerichtet.
Die Stze in (24), die Robespierres Alptraum
beschreiben, zeigen die Interaktion mit einer
indefiniten NP. (24a) besitzt die blichen zwei
Lesarten: in der einen jubelten einige Sans-
culotten z. B. Danton zu, andere Desmoulins,
usw.; in der anderen jubelten alle Sansculotten
ein und demselben Mitglied des Clubs der
Cordeliers, etwa Danton, zu. (24b) dagegen
hat nur die Danton-Lesart, da die definite
PNP nicht skopus-sensitiv ist. (25) zeigt den-
selben Effekt im Zusammenhang mit der Ne-
gation. Die Version (25b) mit der definiten
PNP heit in ihrer natrlichsten Interpreta-
tion, da die Cordeliers als Gruppe in Luciles
Augen nicht korrupt sind; die Negation ist
hier also nicht imstande, den Gruppen-Term
die Cordeliers aufzuspalten. (26) betrifft Dis-
junktionen. Obwohl die Intuitionen hier we-
niger stabil sind, scheint die intendierte Lesart
fr (26b) natrlich zu sein: entweder wurden
die Indulgents verbannt, oder sie wurden hin-
gerichtet. In (26a) dagegen nimmt der All-
quantor weiten Skopus ber die Disjunktion,
d. h. die Indulgents wurden nach der Aussage
des Satzes einer verschiedenen Behandlung
unterzogen. (27) schlielich gibt zu erkennen,
da die definite PNP mhelos rckwrts pro-
nominalisiert (vgl. (27b)), whrend dies im
Fall des Allquantors zumindest fraglich er-
scheint.
Wenn definite PNPn mit kollektiven Pr-
dikaten kombiniert werden, so ist die univer-
selle Paraphrase nicht mehr mglich, wie (28)
zeigt; das Prdikat sich versammeln trifft viel-
mehr auf eine gewisse kontextuell vorgege-
bene Gruppe von Schlern zu:
(28) Die Schler versammelten sich um ihren
Lehrer.
All dies deutet darauf hin, da definite PNPn
sich wie pluralische Kennzeichnungen verhal-
ten; eine solche Auffassung wrde auch der
sprachlichen Tatsache Rechnung tragen, da
bis auf morphologische Varianz der be-
stimmte Artikel im Singular und Plural der-
selbe ist (im Englischen gibt es sogar nur das
eine the). Damit diese Idee der auf den Plural
verallgemeinerten Kennzeichnung auch for-
mal sinnvoll wird, mssen wir eine Art Grup-
penobjekt in die Semantik einfhren, so da
die blichen Bedingungen der Existenz und
(Carlsons kind denoting terms) oder besitzen
quasi-universelle Kraft nach Art der sog. be-
liebigen Objekte (Fine 1985). Die indefiniten
PNPn besitzen somit in ihren Eigenschaften
eine groe hnlichkeit zu den indefiniten
Massenausdrcken.
2.2Definite Plural-NPn
Auf den ersten Blick induzieren definite PNPn
der Gestalt die PNP eine universelle Lesart,
wie etwa in den Stzen
(21)
a. Die Soldaten starben.
b. Die reellen Zahlen lassen sich durch
nicht-abbrechende Dezimalbrche
darstellen.
Das bedeutet einfach, da jeder Soldat starb
bzw. da jede reelle Zahl eine Darstellung als
nicht-abbrechender Dezimalbruch besitzt.
Aber ebenso wie bei den indefiniten PNPn
sind Ausnahmen mglich, ohne da der Satz
falsch wird:
(22)
a. Julia hat die Montagues (und liebt
gleichwohl den Romeo).
b. Die Deutschen leiden unter einer Sau-
berkeitsfixierung (dennoch gibt es in
diesem unserem Land einige ganz
schn dreckige Winkel).
c. Die Tiger sind gestreift (bis auf Al-
binos).
Auch wenn hier ein gewisser Spielraum bleibt,
so behalten die Stze doch im Prinzip ihre
universelle Bedeutung. Im folgenden Satz
wrde eine universelle Paraphrase allerdings
bizarr klingen:
(23) Die Rmer haben die Brcke erbaut.
Die definite PNP die Rmer steht hier viel-
mehr fr eine Gruppe, das Volk der Rmer,
welcher irgendwie kollektiv der Brckenbau
zugeschrieben wird. Skopus-berlegungen
zeigen noch klarer, da die PNP in der Tat
als denotierender Ausdruck behandelt werden
sollte, ebenso wie die klassische Kennzeich-
nung im Singular (siehe Scha 1981). Die fol-
genden Beispiele kontrastieren definite PNPn
mit ihren universellen Paraphrasen.
(24) a. Alle Sansculotten jubelten einem
Cordelier zu. ( > )
b. Die Sansculotten jubelten einem Cor-
delier zu. ()
(25) a. Lucile glaubt nicht, da alle Corde-
liers korrupt sind.
b. Lucile glaubt nicht, da die Corde-
liers korrupt sind.
(26) a. Alle Indulgents wurden verbannt oder
19. Plural 423
(31)
a. Die Dinosaurier sind ausgestorben.
b. ?Dinosaurier sind ausgestorben.
c. *Ein Dinosaurier ist ausgestorben.
In (31 a) steht die definite PNP fr eine Art
(die Spezies der Dinosaurier); der Satz macht
eine historische und insofern nicht-generi-
sche Aussage ber diese Spezies. Er hat damit
eine andere Qualitt als (32a), wo das Pr-
dikat ist ein Wiederkuer eigentlich auf die
Exemplare der Spezies Kuh und nicht auf die
Art selbst zutrifft. In diesem Fall spricht man
von abgeleiteter Objekt-Prdikation (derived
object predication). Sie ist natrlicher mit dem
BP oder einer indefiniten NP im Singular (cf.
(32b, c)); der bestimmte Artikel in (32a)
scheint eher marginal und nur aufgrund eines
gewissen Vertrautheitseffekts zugelassen (im
Englischen klingt er nicht gut, im Franzsi-
schen wiederum ist er wegen des Verbots von
BP notwendig).
(32)
a. Die Khe sind Wiederkuer.
b. Khe sind Wiederkuer.
c. Eine Kuh ist ein Wiederkuer.
Zum Problemkreis generischer Aussagen
siehe Carlson (1982), Pelletier & Schubert
(1987 a, 1987 b), Heyer (1987), Gerstner &
Krifka (1987), Gerstner (1988) sowie Carlson
& Pelletier (1991); dieser Sammelband enthlt
einen ausfhrlichen Forschungsbericht zum
Thema.
2.3Universell quantifizierte PNP;
Quantoren-Floating
Wie wir oben gesehen haben, knnen bereits
definite PNP universell-quantifizierende
Kraft besitzen. Worin liegt dann der Unter-
schied zwischen (21 a) und Stzen wie in (33)?
(33)
a. Alle Soldaten starben.
b. All die Soldaten starben.
Bei distributiven Prdikaten wie sterben schei-
nen (21 a) und (33a) auf dasselbe hinauszulau-
fen. Bei kollektiver Prdikation wie in (34),
(34) Die Soldaten widerstanden dem feindli-
chen Angriff.
sind der Allsatz und sein Gegenstck mit der
definiten PNP nicht mehr synonym (dies
wurde bereits weiter oben festgestellt): hier ist
nicht gesagt, da alle Soldaten dem feindli-
chen Angriff widerstanden haben; einige m-
gen gefallen sein. Ein Unterschied besteht also
darin, wie leicht der Satz eine kollektive In-
terpretation zult. In (33b) wird durch die
Anwesenheit von all der Aspekt der Totalitt
betont: die Mitglieder einer kontextuell ge-
gebenen Gruppe von Soldaten starben ohne
Eindeutigkeit fr Kennzeichnungen erfllt
sind. Betrachten wir die PNP
(29) die Ns
wobei Ns fr irgendein pluralisiertes No-
men N steht. Dann sollte die Extension von
N mindestens zwei Elemente enthalten, damit
der Term (29) denotieren kann. Im Gegensatz
zu dieser Existenzbedingung sind die Identi-
ttskriterien von (29) nicht ganz so einfach
zu formulieren; dieser Punkt wird in Ab-
schnitt 3 behandelt.
Wir nehmen hier also erst einmal an, da
der Term (29) in seiner blichen Bedeutung
eine konkrete Kollektion von Objekten be-
zeichnet, wie auch immer diese Kollektion
formal spezifiziert sein mag. Trotzdem bleibt
uns der etwas unklare Status der generischen
Verwendung von (29), der in den Beispielen
immer wieder auftaucht. Im Rest dieses Ab-
schnitts mchte ich einige Bemerkungen zu
dieser Verwendung machen, indem ich sie mit
dem indefiniten Fall vergleiche. Betrachten
wir den Satz (30),
(30)
a. Ein Mitglied dieses Clubs trinkt kei-
nen Alkohol.
b. Mitglieder dieses Clubs trinken kei-
nen Alkohol.
c. Die Mitglieder dieses Clubs trinken
keinen Alkohol.
Wie Dahl (1975) zu Recht beobachtet, for-
muliert (30a) einen notwendigen Zusammen-
hang bezglich eines gewissen modalen Stan-
dards (hier Club-Regeln) zwischen der Mit-
gliedschaft im Club und der Alkoholfreiheit.
(30b) kann als synonym mit (30a) angesehen
werden. Der Satz (30c) macht zwar dieselbe
universelle Aussage, aber hier knnte es reiner
Zufall sein, da kein Clubmitglied Alkohol
trinkt. Dieser Satz bezieht sich vorrangig auf
die realen Clubmitglieder, whrend (30a, b)
auch potentielle Mitglieder betreffen. In die-
ser Lesart ist der Satz keine generische Aus-
sage ber die Clubmitgliedschaft, auch wenn
er immer noch etwas Generisches an sich hat,
jedoch bezglich einer anderen, der tempo-
ralen Dimension: er kann eine Gewohnheit
ausdrcken, die kontingenterweise allen
Clubmitgliedern zukommt; dieser Effekt ist
aber unabhngig von der definiten PNP.
Der deutlichste Unterschied zum indefini-
ten Fall zeigt sich bei sog. Artenprdikaten
wie aussterben. Definite NPn im Singular wie
im Plural lassen eigentliche Artenprdikation
(proper kind predication) zu, whrend dies zu-
mindest fr indefinite NPn im Singular nicht
gilt:
424 VI. Nominalsemantik
2.4Numeralia und andere Plural-
Quantoren
Es gibt eine groe Anzahl weiterer plurali-
scher Quantoren, die alle auf die eine oder
die andere Art dazu dienen, eine PNP quan-
titativ zu messen. Wir haben exakte Quanto-
ren wie Zahlwrter (genau) zwei, drei, vier,
..., mindestens n, hchstens n; mathematische
Quantoren wie endlich viele, unendlich viele;
vage Quantoren wie ungefhr n, wenige, viele,
eine Menge, die meisten.
Die exakten Quantoren haben eine przise
Bedeutung, die in naheliegender Weise se-
mantisch erfat werden kann (Blau 1980, Bar-
wise & Cooper 1981). Whrend ihre Semantik
also klar ist, scheinen quantifizierte PNP nicht
vllig in ihrer syntaktischen Struktur be-
stimmt zu sein. Zum Beispiel haben Nume-
ralia auf der einen Seite einen quantifizieren-
den Effekt (cf. drei Mnner trafen sich im
Park); auf der anderen Seite scheinen sie sich
wie Adjektive zu verhalten, also NP-Modifi-
katoren, die immer noch Raum fr einen wei-
teren Determinator lassen (vgl. alle drei pfel
vs alle roten pfel). Echte Quantoren lassen
sich aber nicht hufen (vgl. *alle einige P);
gleichwohl nehmen die Zahlwrter syntak-
tisch eine Sonderstellung ein, da sie vor den
gewhnlichen Adjektiven stehen mssen
(vgl. drei rote pfel vs *rote drei pfel).
Ich schlage hier die folgende Lsung vor
(Link 1987 d). Numeralia spielen im prno-
minalen Bereich eine doppelte Rolle. Zu-
nchst gibt es eindeutige Hinweise darauf,
da sie als akjektivische Modifikatoren mit
einer intersektiven Bedeutung auftreten. Be-
trachten wir das Satzpaar drei Mnner stemm-
ten das Klavier vs je drei Mnner knnen das
Klavier stemmen; wenn das Zahlwort drei wie
ein Quantor mit eingebauter existentieller
Kraft behandelt wird, so pat das zwar auf
den ersten Satz, aber die universelle (generi-
sche) Lesart des zweiten Satzes steht dem
entgegen. Es gibt jedoch eine ziemlich natr-
liche Adjektiv-Analyse dieses Satzpaares: mit
dem ersten wird ausgesagt, da eine Gruppe
von Mnnern, die aus drei Individuen besteht,
das Klavier stemmte, mit dem zweiten dage-
gen, da jede beliebige Gruppe von Mnnern,
die aus drei Individuen besteht, in der Lage
sein wird, das Klavier zu stemmen. Die inter-
sektive Bedeutung von drei besteht also darin,
da die zugelassenen Mnnergruppen mit sol-
chen Gruppen von Objekten (mengentheore-
tisch) geschnitten werden, die aus drei Indi-
viduen bestehen. Das syntaktische Problem,
Ausnahme. Dieser Totalittsaspekt enthlt
auch ein Skalen-Moment, wie durch das fol-
gende literarische Beispiel deutlich wird:
(35) All the kings horses and all the kings
men cannot put Humpty Dumpty to-
gether again.
Dieser Satz ist auch dadurch interessant, da
er ein Prdikat (put together) enthlt, welches
bezglich der Unterscheidung kollektiv vs.
distributiv nicht markiert ist. Derartige Pr-
dikate sind gut geeignet, die hier in Frage
kommenden Lesarten auseinanderzusortie-
ren. Betrachten wir die Stze in (36) (in Klam-
mern ist eine Bewertung der Dominanz der
Lesarten angegeben).
(36) a. Alle Mnner hoben den Tisch.
(distr > koll)
b. Die Mnner hoben den Tisch.
(koll > distr)
c. Die Mnner hoben alle den Tisch.
(distr > koll)
d. Die Mnner hoben jeder den Tisch.
(distr)
In (36c) und (36d) haben wir es mit einem
gefloateten Quantor zu tun. Quantoren-Floa-
ting ist ein weitverbreitetes Phnomen in
Sprachen wie Englisch (vgl. Postal 1972) und
Deutsch (vgl. Link 1974) und dient haupt-
schlich der Akzentuierung der Skopus-Be-
ziehungen in einem Satz. Wir sehen hier, da
es auch bei der kollektiv/distributiv-Unter-
scheidung eine Rolle spielt. Ich gebe zwei
weitere Beispiele. Aus (37) ist zu ersehen, da
der gefloatete Quantor alle im Unterschied zu
jeder mit der kollektiven Lesart jedenfalls ver-
trglich ist, wenn diese durch ein Adjektiv wie
gemeinsam erzwungen wird. In (38) schlie-
lich haben wir Quantoren-Floating von einer
Nicht-Subjekt NP, mit demselben Effekt der
Betonung der distributiven Lesart.
(37) a. Die Mieter strengten alle einen Pro-
ze gegen ihre Hausherren an.
(distr > koll)
b. Die Mieter strengten (alle/*jeder)
einen gemeinsamen Proze gegen ihre
Hausherren an. (koll)
(38) a. Der Vater verpate seinen ungezo-
genen Kindern eine gehrige Straf-
predigt. (koll)
b. Der Vater verpate seinen ungezo-
genen Kindern allen eine gehrige
Strafpredigt. (distr > koll)
19. Plural 425
Standard kann zum Beispiel sein: (i) die reine
Gre der durch das zugehrige Pluralnomen
bezeichneten Gruppe (hier: die Studenten an
diesem Seminar; wenn es etwa hundert sind,
dann sind 80 Studenten viele); (ii) der Cha-
rakter des Pluralnomens oder des Prdikats
(wei man etwa, da es sich um ein Seminar
fr moderne Logik handelt, oder aber, da
Hegels Logik unter den heutigen Studenten
wenig populr ist, dann sind 10 von 100 Stu-
denten viele); (iii) externe Information wie die
Anzahl der Hegel-Studenten im letzten Jahr,
in anderen Universitten oder Lndern, etc.
Whrend die Bedeutung dieser Quantoren
also vage und in hohem Mae kontextabhn-
gig ist, gibt es gewisse feste Bedeutungsbezie-
hungen zwischen ihnen. Altham (1971) gibt
die folgenden quivalenzen an:
(42)
a. viele = nicht wenige = nicht fast alle
nicht
b. nicht viele = wenige = fast alle nicht
c. nicht viele nicht = wenige nicht =
fast alle
Aber selbst diese Beziehungen bedrfen n-
herer Erluterungen. Die erste Gleichheit in
jeder Zeile setzt eine klassische (schwache)
Auffassung der Negation voraus; und die
zweite Gleichheit stimmt nur in der rein quan-
titativen Lesart von wenige.
Die wichtigste formale Konsequenz, die
aus einer adquaten Behandlung der vagen
Quantoren zu ziehen ist, ist die Einsicht, da
der Quantor und sein Nomen als Einheit zu
behandeln sind. Dies ist der Grund, warum
Barwise & Cooper (1981) die gesamte quan-
tifizierte NP Quantor nennen. Dieser ein-
flureiche Aufsatz ist eine der Hauptquellen
fr vage Quantoren, eine andere ist Blau
(1980); siehe auch Verkuyl (1981) und Hr-
mann (1983). Fr den gesamten Abschnitt 2.4
ist ferner die Literatur zur Theorie der Ge-
neralisierten Quantoren einschlgig, die in der
Linguistik von Barwise & Cooper (1981) ih-
ren Ausgang nahm; siehe Grdenfors (1987)
und die dortige Bibliographie (darin vor allem
die Arbeiten von J. van Benthem und von D.
Westersthl) sowie Westersthl (1989).
2.5Partitiv-Konstruktionen
Im Deutschen haben Partitiv-Konstruktionen
entweder die Gestalt Determinator + von +
NP oder Determinator + NP
Genetiv
(einer von
den Anwesenden, einer der Anwesenden); im
Englischen lautet die Konstruktion Determi-
nator + of + NP, z. B. some of the men. Der
semantische Unterschied zu den rein quanti-
fizierenden NP wie einige Mnner kann wie
da Zahlwrter und normale Adjektive nicht
beliebig angeordnet werden knnen, lt sich
durch die Einfhrung eines extra Knotens
NUM fr Numeralia lsen. Damit bleibt uns
allerdings der folgende problematische Fall.
(39)
a. Alle drei Mnner verlieen den
Raum.
b. Die drei Mnner verlieen den
Raum.
Wenn drei ausschlielich ein Adjektiv wre,
semantisch gesprochen also auf Nomina (hier
Mnner) operieren wrde, um eine Menge
von Mnner-Gruppen zu erzeugen, die alle
aus drei Individuen bestehen, dann sollte
(39a) eine universelle Quantifikation ber
diese Dreiergruppen beinhalten. Aber der
Satz bedeutet natrlich, da alle Mnner den
Raum verlieen, wobei auerdem mitgeteilt
wird, da es drei waren. Dasselbe kann fr
(39b) gesagt werden: es gibt eine eindeutig
bestimmte Gruppe von Mnnern, die den
Raum verlieen; dieser Bedeutungsanteil, den
der bestimmte Artikel beisteuert, wird durch
das Zahlwort in nicht-restriktiver Weise nu-
merisch spezifiziert. Dies legt eine doppelte
Behandlung der Numeralia nahe, einmal als
adjektivische Modifikatoren mit einem eige-
nen NUM-Knoten, das andere Mal als nu-
merische Spezifizierungen des Quantors oder
Artikels. Diese Doppelrolle wird in Stzen wie
(40a) und (40b) deutlich, die bis auf ihre Re-
dundanz akzeptabel sind. Die numerische
Spezifikation des Quantors, die den Charak-
ter einer Nebeninformation oder Prsuppo-
sition besitzt, mu sich natrlich mit der In-
formation aus dem Nomen vertragen, sonst
wird der Satz ungrammatisch; siehe (40c, d).
(40)
a. Alle sieben der sieben Astronauten
gaben ihre Zustimmung.
b. Alle fnf von den Fnflingen ber-
lebten.
c. *Alle drei der sieben Astronauten ga-
ben ihre Zustimmung.
d. *Alle drei von den Fnflingen ber-
lebten.
Die semantische Analyse von vagen Quanto-
ren ist weniger offensichtlich. Betrachten wir
den Satz (41 a),
(41)
a. Viele Studenten an diesem Seminar
studieren Hegels Logik.
Der vage Quantor viele verlangt nach einer
Bezugsgruppe oder einem relevanten Stan-
dard, in Bezug auf den seine Bedeutung (eine
groe Anzahl) zu interpretieren ist. Dieser
426 VI. Nominalsemantik
Plural-Strukturen ergeben sich auch bei der
Konjunktion von Nominalphrasen. Betrach-
ten wir die folgenden Stze.
(45)
a. Georg und Martha schlafen.
b. Georg und Martha treffen sich.
c. Georg und Martha haben geheiratet.
d. Georg und Martha sind Mann und
Frau.
e. Ein Junge und ein Mdchen spielten
im Hof.
f. Die Meiers und die Mllers trafen
sich.
g. Drei Mnner und vier Frauen kamen
zusammen.
h. Eine Reihe Mnner und einige wenige
Frauen versammelten sich.
(45a) ist gleichbedeutend mit dem Satz Georg
schlft und Martha schlft. Das kollektive
Verb sich treffen erlaubt eine solche Para-
phrase jedoch nicht, ebensowenig wie heira-
ten, wenn dies in (45c) im Sinne von einander
heiraten verstanden wird. (45d) ist noch ein
wenig komplizierter; whrend in (45ac) die
NP Georg und Martha ohne Einflu auf den
Wahrheitswert durch Martha und Georg er-
setzt werden kann, spielt hier sogar die Rei-
henfolge der Konjunkte eine Rolle. Der Rest
der Beispiele zeigt, da die Konjunktion von
Satzkonstituenten nicht nur auf Namen in der
Rolle von NPn angewendet werden kann,
sondern auch auf volle NPn. Dies ist jedoch
gewissen Einschrnkungen unterworfen; so
bekommt man etwa nicht *Hans und keine
Frau, *wenige Frauen und einige Mnner (kn-
nen [kollektiv] das Klavier heben), *zwei Brat-
schen und wenige Geigen (spielten im Takt).
Barwise & Cooper (1981: 194 ff) geben eine
Erklrung fr dieses Verhalten. Wenn NPn
als generalisierte Quantoren interpretiert wer-
den, dann stellt sich heraus, da nur solche
NPn in einer Konjunktion verbunden werden
knnen, die sich monoton in derselben
Richtung verhalten, entweder beide monoton
steigend oder monoton fallend (fr den tech-
nischen Begriff der Monotonizitt siehe Bar-
wise & Cooper).
2.7Kollektive Nomina, Prdikate und
Adverbien
Es gibt eine Anzahl von Individualnomina in
der Einzahl, die eine pluralische Bedeutung
besitzen; wie PNPn stehen sie fr identifizier-
bare Gruppen-Objekte. Beispiele im Deut-
schen sind Paar, Duo, Trio, Gruppe, Menge,
folgt beschrieben werden: (i) eine spezifische
Gesamtheit von Objekten, die in der in Rede
stehenden Situation vorhanden ist, wird von
der Genetiv-NP oder der NP hinter dem von
herausgegriffen (diese NP mge Kern-NP und
die Gesamtheit selbst Kern heien); (ii) der
Determinator sondert daraufhin einen geeig-
neten Teil dieser Gesamtheit aus. Daraus er-
gibt sich, da die Kern-NP definit zu sein hat
(vgl. *einige aller Mnner, *alle weniger B-
cher); dies ist der sog. partitive constraint (La-
dusaw 1982). Ferner sei angemerkt, da auch
bei pluralischen (d. h. mit Individualnomina
gebildeten) Kern-NPn nicht-diskrete Partitiv-
Determinatoren auftreten knnen (vgl. die
Hlfte, ein groer Teil, das meiste von diesen
Bchern ist Ausschu). Daher sollte eine se-
mantische Reprsentation des Partitivs ein
passendes Kern-Objekt sowie eine auf dem
Kern operierende Teil-Ganzes-Relation zur
Verfgung stellen. Diese beiden Stcke wer-
den brigens auch in solchen Konstruktionen
gebraucht, in denen der Determinator (oder
Quantor) gefloatet ist; so ist die hnlichkeit
zwischen den folgenden beiden Stzen auffal-
lend.
(43)
a. (Alle / viele / die Mehrzahl) von den
Studenten schlossen sich der Frie-
densbewegung an. (Partitiv)
b. Die Studenten schlossen sich (alle /
in groen Zahlen / mehrheitlich) der
Friedensbewegung an. (Quantoren-
Floating)
Im Deutschen ist in manchen Floating-Kon-
struktionen der Partitiv noch sichtbar, wie die
folgenden Beispiele zeigen.
(44)
a. Die Mieter strengten (alle / jeder)
einen Proze an.
b. Von den Mietern (strengten alle /
strengte jeder) einen Proze an.
Mit der hier vorgestellten Konzeption des
Partitivs lt sich brigens auch ein sonst
nicht erklrbarer Unterschied zwischen dem
englischen both und the two behandeln, wie
Ladusaw (1982) festgestellt hat. So kann man
sagen one of the two, aber nicht *one of both.
Der Grund liegt darin, da der streng distri-
butive Quantor both nicht fr ein Kern-Ob-
jekt stehen kann, von dem man geeignete Teile
nehmen knnte. Mit anderen Worten, im Ge-
gensatz zu both individuiert der Anzahlquan-
tor the two eine Gruppe.
2.6Koordinierte konjunktive NP-
Strukturen
19. Plural 427
lektiven Prdikaten zu nennen ist. Danach
steht die NP die Soldaten stets fr die Gruppe
der Soldaten, von der im gegebenen Kontext
die Rede ist. Die Ambiguitt ist damit in die
VP verlagert, was unter anderem den Vorteil
hat, da Stze mit einer einzigen PNP und
einer aus einem kollektiven und einem distri-
butiven Prdikat kombinierten VP (wie die
Beatles trennten sich und starteten (jeder) eine
Solo-Karriere) kein Problem darstellen: se-
mantisch ist von ein und demselben Objekt
(der Gruppe der Beatles) die Rede, die erst
lokal bei den zwei verschiedenen Prdikat-
Konjunkten differenziert zu behandeln ist.
Wie das zu geschehen hat, ist im Fall der
kollektiven Prdikate wie in (47b) klar: sich
versammeln ist einfach eine Eigenschaft dieses
Gruppenobjekts. Weniger offensichtlich ist
eine Antwort auf die Frage, ob auch distri-
butive Prdikate wie schlafen auf eine ganze
Gruppe von Objekten zutreffen knnen. Zu-
mindest in einem abgeleiteten Sinn scheint
nichts dagegen zu sprechen; die formale Se-
mantik fordert hier jedoch eine przise Ent-
scheidung. Nehmen wir an, die vorliegende
Gruppe bestehe aus drei Soldaten a, b und c;
was soll dann alles zur Extension von schlafen
in (47a) zhlen? Neben den einzelnen Objek-
ten a, b und c knnte man ja redundanter-
weise auch die ganze Gruppe zur Exten-
sion hinzunehmen. Eine solche Entscheidung
wrde jedoch zu unhaltbaren Konsequenzen
fhren, wie das folgende Beispiel zeigt.
(48) Die Soldaten erhielten hundert Mark.
Wre in unserem Modell neben den einzelnen
Soldaten auch die Gruppe in der Extension
von erhielten hundert Mark, so mte die
Zahlstelle nicht 300 Mark, sondern 400 Mark,
und wenn man die mglichen Zweiergruppen
noch dazutut, sogar 700 Mark auszahlen! Wir
kommen daher nicht umhin, den unwesentli-
chen Gebrauch von PNPn mit distributiven
Prdikaten formal explizit zu machen. Neben
dem distributiven Prdikat schlafen sei ein
abgeleitetes Prdikat *schlafen eingefhrt,
welches auch auf Gruppenobjekte zutrifft,
und zwar (i) auf alle Personen, die (im gege-
benen Kontext) schlafen, sowie (ii) auf alle
Gruppen von Objekten, die aus diesen schla-
fenden Personen gebildet werden knnen; im
obigen Modell besteht damit die Extension
von *schlafen aus a, b, c, {a, b}, {a, c}, {b, c},
{a, b, c}(hier wurden die Gruppenobjekte der
Einfachkeit halber durch Mengen reprsen-
tiert, was aber keine systematische Bedeutung
hat; zum Problem der Reprsentation oder
Modellierung dieser Objekte siehe Abschnitt
Volk, Mannschaft, Vieh, Gremium, Kommis-
sion, Versammlung, Aufsichtsrat. Entspre-
chend dazu gibt es viele kollektive Prdikate,
die nur solche NPn zulassen, die entweder
eine Pluralitt ausdrcken (wie PNPn, kollek-
tive Nomina, koordinierte konjunktive NPn)
oder eine homogene Vielheit (Massenaus-
drcke): zahlreich vertreten sein, zahlreich er-
scheinen, (sich) hnlich sein, sich gleichen, par-
allel sein, Klassenkameraden sein, gut gemischt
sein, sich treffen, sich versammeln, sich verei-
nigen, paarweise antreten, sich trennen, ausein-
andergehen, auseinanderstieben, ausschwr-
men, sich zerstreuen, umgeben, umzingeln, sich
teilen, aneinandergeraten, und viele mehr. Die
verschiedenen Kategorien des semantischen
Plurals passen jedoch nicht in gleichem Mae
zu allen hier aufgefhrten Prdikaten:
(46)
a. Die Gste waren zahlreich erschie-
nen.
b. *Hans, Max und Peter waren zahl-
reich erschienen.
c. Hans, Max und Peter gerieten anein-
ander.
d. ?Das Ganstertrio geriet aneinander.
Normale distributive Verben werden durch
Hinzufgung kollektiver Adverbien zu kol-
lektiven Prdikaten; Beispiele fr solche Ad-
verbien sind zusammen, gleichzeitig, einstim-
mig, massenhaft, im Chor. Man beachte den
Bedeutungsunterschied zwischen zusammen
und insgesamt: das erste Adverb erzeugt, wie
gesagt, echte kollektive Prdikate, whrend
das zweite zu einer weiteren, der sog. kumu-
lativen Lesart fhrt (siehe Abschnitt 2.9). Das
Adverb einander schlielich erzeugt reziproke
Konstruktionen, die ebenfalls zu den kollek-
tiven Prdikaten gerechnet werden knnen
(siehe Abschnitt 2.10).
2.8Distributive vs. kollektive Prdikation
Betrachten wir noch einmal die Stze
(47)
a. Die Soldaten schliefen.
b. Die Soldaten versammelten sich.
c. Jeder Soldat schlief.
Im Gegensatz zu (47b) enthlt der Satz (47a)
eine unwesentliche Verwendung der PNP, da
er ohne weiteres durch den singularischen All-
satz (47c) paraphrasierbar ist. Eine Mglich-
keit, diesen Fall zu behandeln, wre die An-
nahme einer systematischen Ambiguitt in
der NP die Soldaten. Der Unterschied zwi-
schen (47a) und (47b) ist jedoch besser im
Prdikat zu suchen, wobei als Auslser gerade
der Gegensatz zwischen distributiven und kol-
428 VI. Nominalsemantik
werden, wie dies zuweilen vorgeschlagen
wurde. Dieses Vorgehen ist auch aus syste-
matischen Grnden inadquat: eine numeri-
sche Aussage kann bestenfalls aus einer Be-
hauptung wie (49b) gefolgert werden, ist je-
doch schwerlich mit dieser synonym zu nen-
nen.
Eine formale Darstellung von (49) mu
erkennen lassen, ob das Prdikat distributiv
zu verstehen ist oder nicht. Zu diesem Zweck
sei ein Distributivittsoperator D auf Pr-
dikaten eingefhrt, der neue Prdikate er-
zeugt, welche unterschiedslos auf Gruppen
und normale Individuen anwendbar ist. Eine
Gruppe von Objekten ist dann in der Exten-
sion von
D
heben, wenn alle Individuen in der
Extension von heben sind, d. h. wenn jedes
einzelne Mitglied der Gruppe den Akt des
Hebens ausfhrt. Fehlt dagegen der Operator
vor dem Prdikat heben, so ist die kollektive
Lesart gemeint.
Sobald wir es mit Gruppen zu tun haben,
stellt sich das Problem einer mglichen Stu-
fung der Gruppenbildung. Betrachten wir
noch einmal den Satz (45 f), der hier als (50)
wiederholt sei.
(50) Die Meiers und die Mllers trafen sich.
In einer Lesart zumindest bedeutet dieser
Satz, da sich die beiden Familien trafen, was
nicht notwendig dasselbe ist wie wenn sich
alle Mitglieder der beiden Familien versam-
meln. Stellen wir uns ferner ein rotes und ein
blaues Kartenspiel vor, die auf dem Tisch
liegen. Wenn wir sagen,
(51) Die roten Karten und die blauen Karten
sind gemischt,
dann bedeutet das nicht, da die roten und
die blauen Karten alle untereinander ver-
mischt wurden. In jedem Fall sind jedoch die
folgenden beiden Stze wahr:
(52)
a. Die Kartenspiele liegen auf dem
Tisch.
b. Die Karten der beiden Kartenspiele
liegen auf dem Tisch.
Man sieht also, da kollektive Prdikate auf
die Bildung einer mittleren Ebene der Grup-
penbildung ansprechen knnen (wie bei trafen
sich, sind gemischt) oder auch nicht (wie bei
auf dem Tisch liegen). In Link (1983) werden
die letzteren Prdikate invariant genannt. Das
Ebenenproblem wird hier wie folgt behandelt:
eine eigene Zwischenebene wird in die formale
Semantik als gesondertes formales Objekt ein-
gefhrt, und ein Bedeutungspostulat fr in-
variante Prdikate besagt, da diese gerade
3). Der Satz (47a) ist damit so zu interpretie-
ren, da die Gruppe der Soldaten in der Ex-
tension von *schlafen liegt, d. h. aus Elemen-
ten aufgebaut ist, die in der Extension von
schlafen liegen. Das heit aber soviel wie da
jeder Soldat schlft, woraus sich die Wahrheit
von (47c) ergibt. Der kritische Fall (48) kann
nun ganz analog behandelt werden: die
Gruppe der Soldaten liegt in der Extension
von *(erhielten hundert Mark), d. h. ist auf-
gebaut aus Elementen, die in der Extension
von erhielten hundert Mark liegen. Also erhlt
jeder Soldat gerade hundert Mark, und die
Zahlstelle zahlt insgesamt 300 Mark und
nicht mehr, wie es sein mu.
Es gibt nun eine groe offene Klasse von
Prdikaten (zu der auch schon erhielten hun-
dert Mark zu rechnen ist), die nicht nach ihrer
Zugehrigkeit zu den distributiven bzw. kol-
lektiven Prdikaten markiert sind, sondern
vielmehr beide Interpretationen zulassen. Be-
trachten wir
(49)
a. Drei Mnner hoben das Klavier.
b. Drei Mnner hoben ein Klavier.
Der erste Satz hat zwei Lesarten: er bezieht
sich entweder auf einen einzigen Akt des Kla-
vierhebens (kollektive Lesart) oder auf drei
getrennte Handlungen, von denen jede ein
Klavierheben darstellt (distributive Lesart).
Wieviele Lesarten besitzt (49b)? Man stellt
fest, da der Satz skopussensitiv ist, was
prima facie seltsam ist, da bei der Kombina-
tion zweier indefiniter NPn keine Skopus-
Unterschiede auftreten sollten (vgl. ein Mann
sah eine Frau, was nur eine Lesart hat). Es ist
bemerkenswert, da indefinite Plural-NPn in
der Tat Skopus-Unterschiede erzeugen. Wir
erhalten damit fr (49b) vier Lesarten (enger
und weiter Skopus zustzlich zu der kollektiv/
distributiv-Unterscheidung), von denen aller-
dings zwei zusammenfallen; die verbleibenden
drei Lesarten lauten: (i) es gibt eine Gruppe
x von drei Mnnern und ein Klavier y so da
x hob y (ein Heben, ein gehobenes Klavier);
(ii) es gibt eine Gruppe x von drei Mnnern,
von denen jeder ein Klavier hob (drei Akte
des Hebens, 3 gehobene Klaviere); (iii) es
gibt ein Klavier y und eine Gruppe x von drei
Mnnern, von denen jeder y hob (drei Akte
des Hebens, ein gehobenes Klavier). Hieraus
ergibt sich nebenbei, da es nicht ausreicht,
zum Auffinden der verschiedenen Lesarten
einfach die Anzahl der gehobenen Klaviere
zu zhlen; a fortiori kann eine Aussage ber
die Gesamtzahl der gehobenen Klaviere nicht
als logische Form fr (49b) hergenommen
19. Plural 429
dene Treffen ergeben?):
(55) Eine halbe Million Leute trafen sich in
Deutschland / in Bayern / in Mnchen /
auf der Oktoberwiese / im Olympiasta-
dion (?) / auf dem Marienplatz (??) / in
der bayerischen Staatskanzlei (pragma-
tischer Stern).
2.9Relationale Plural-Stze
Bisher haben wir lediglich Stze mit einer
PNP betrachtet. Zu den interessantesten Fl-
len von Pluralitt zhlen jedoch zweistellige
Prdikate mit PNPn an beiden Argument-
stellen. Solche Konstruktionen wurden in der
Literatur Elementary Plural (Relational) Sen-
tences (EPRS; Langendoen 1978, de Mey
1984) oder Dependent Plurals genannt. Ich
schlage den Ausdruck relationaler Plural (RP)
vor. Wir wollen uns dazu die folgenden Bei-
spiele ansehen.
(57)
a. Einhrner haben Hrner.
b. Biber bauen Dmme.
c. Pferde haben vier Beine.
d. Antilopen versammeln sich an Was-
serstellen.
(58)
a. Die Quadrate enthalten die Kreise.
b. Die Seiten des Rechtecks 1 verlaufen
parallel zu den Seiten des Rechtecks
2.
c. Die Seiten des Rechtecks 1 kreuzen
die Seiten des Rechtecks 2.
die Zwischenebene ignorieren. Eine Iteration
von Gruppenbildungsebenen scheint in der
Sprache nicht realisiert zu sein, d. h. es gibt
keine Prdikate, die Gruppen von Gruppen,
Gruppen von Gruppen von Gruppen, usw.
auseinanderhalten.
Es gibt noch eine andere Lesart von (50),
in der die Meiers sich an einem Ort und die
Mllers sich an einem anderen Ort trafen. In
diesem Fall mssen wir die beiden Familien
als gesonderte Objekte auf der Zwischenebene
abschlieen und von der Kollektion (oder
der Summe, wie wir das weiter unten nen-
nen werden) dieser zwei Familien sagen, da
sie in der Extension von *sich-treffen liege;
das fhrt dann dazu, da jede Familie fr
sich genommen in der Extension von sich-
treffen liegt, d. h. da die Familien sich ge-
trennt trafen.
In (50) sind die relevanten Untergruppen
syntaktisch klar markiert. Scha (1981) be-
hauptet, da es auch in Stzen wie
(53) Six boys gather
eine weitere, bisher nicht erfate Lesart gebe,
die etwa von einem Modell erfllt werde, in
dem es drei Gruppen mit je zwei Jungen gebe,
die sich an verschiedenen Orten treffen, oder
auch von einem Modell, in dem sich vier
Jungen an einer Stelle und der Rest woanders
trifft. Scha will damit sagen, da die Ge-
samtgruppe in eine Partition von Untergrup-
pen zu zerlegen ist, die sich alle an (mgli-
cherweise) verschiedenen Orten treffen, eine
Vorstellung, die im folgenden Satz sogar na-
trlich erscheint:
(54) Eine halbe Million Leute versammelten
sich im ganzen Land.
Man beachte, da die bisherige kollektive
Lesart einen Spezialfall der jetzt betrachteten
darstellt (wenn nmlich die Partition nur aus
einem einzigen Element, der ganzen Gruppe,
besteht). Man knnte somit eine Dreiteilung
einfhren und neben der distributiven und
kollektiven noch eine partitionelle Lesart un-
terscheiden. Es scheint jedoch aus methodo-
logischen Grnden vernnftiger zu sein, die
letztgenannten Lesarten nicht wirklich zu dif-
ferenzieren, sondern sie als pragmatische Va-
rianten (Modelle) ein und derselben Lesart
anzusehen. Nehmen wir das Verb sich versam-
meln: mit diesem Prdikat lt sich in wech-
selnden Kontexten ein kontinuierlicher ber-
gang von der einen zur anderen Lesart voll-
ziehen (wie weit voneinander mssen die
Treffpunkte entfernt sein, damit sich verschie-
430 VI. Nominalsemantik
Formen geben genau die hier dargestellten
Verhltnisse wieder. Dazu war es ntig, den
D-Operator nicht nur auf elementare Prdi-
kate wie heben anzuwenden, sondern auf
ganze VPn bzw. Lambda-Ausdrcke als ihre
logischen Gegenstcke.
Eine Besonderheit im Zusammenhang mit
(56a) sei noch erwhnt. Wenn die Zahlwrter
in den beiden PNPn zufllig bereinstimmen,
ergibt sich eine bijektive Lesart, die sich von
allen anderen unterscheidet. Der Satz
(59) Vier Mnner hoben vier Tische
bedeutet vorrangig, da wir es mit vier Mn-
nern und mit vier Tischen zu tun haben der-
art, da jeder Mann gerade einen Tisch hob
(bijektive Beziehung). Dieses Beispiel scheint
seinerseits ein Spezialfall von einer weiteren
Lesart zu sein, die in (56b) realisiert ist und
auf die Scha (1981) aufmerksam gemacht hat.
In dieser kumulativen Lesart geht es nur um
die Gesamtzahl der Individuen auf beiden
Seiten der Relation; wieviele Beziehungen im
einzelnen vorliegen, das spielt keine Rolle. Im
Fall von (56b) bedeutet das etwa, da die
Gesamtzahl der hollndischen Firmen mit
einem amerikanischen Computer 300 ist, und
da diese Firmen insgesamt 5000 amerikani-
sche Computer besitzen. Die Besitzverhlt-
nisse mgen dabei im einzelnen aussehen wie
sie wollen, solange die Kardinalitt des Vor-
bereichs 300 und die des Nachbereichs 5000
ist (man sieht, da (59) der Spezialfall der
kumulativen Lesart darstellt, in dem zwischen
Vor- und Nachbereich eine bijektive Bezie-
hung besteht).
Erneut stellt sich die Frage, ob die kumu-
lative Lesart nicht besser auch unter die (dop-
pelt) kollektive CC zu subsumieren sei. Das
liefe jedoch auf eine systematische Unge-
nauigkeit in bezug auf die gegebene Relation
hinaus. Eine genuin kollektive Interpretation
von (56b) etwa wrde bedeuten, da die 5000
amerikanischen Computer gemeinschaftlicher
Besitz der 300 hollndischen Firmen wren;
dies ist aber natrlich nicht intendiert. Die
kumulative Lesart relationaler Pluralia stellt
insofern in der Tat eine unabhngige Kon-
struktion dar, als Subjekt- wie Objektphrase
gewissermaen beide thematisch sind: sie stel-
len autonom referierende Ausdrcke (Keenan)
dar, was man daran sehen kann, da die in
ihnen auftretenden Zahlwrter absolut zu
nehmende Grenangaben machen (die Ob-
jektphrase einen Tisch in drei Mnner hoben
einen Tisch referiert im Gegensatz dazu nicht
(56)
a. Vier Mnner hoben drei Tische.
b. 300 hollndische Firmen besitzen
5000 amerikanische Computer.
c. Die Frauen kochten fr die Gefan-
genen.
d. Die Mieter hassen die Hausherren.
Im letzten Abschnitt sahen wir, da eine
indefinite PNP im Prinzip bereits vier Les-
arten erzeugen kann; eine zweite PNP wie in
(56a, b) erhht damit die Anzahl auf acht.
Zwei davon fallen wieder zusammen, wie sich
herausstellt; die verbleibenden sieben Les-
arten fr (56a) sind in Abb. 19.3 auf anschau-
liche Weise zusammengestellt. CC steht da-
bei fr die doppelt kollektive, DD fr die
doppelt distributive Lesart, CD fr die im
Subjekt kollektive und im Objekt distributive
sowie DC fr die im Subjekt distributive und
im Objekt kollektive Lesart.
Abb. 19.3:Die 7 Lesarten von (56a): Vier Mnner
hoben drei Tische
Die in Abschnitt 4.7 angegebenen logischen
19. Plural 431
kann nicht ohne Modifikationen aufrechter-
halten werden. Scha selbst nimmt Zuflucht
zu geeigneten Bedeutungspostulaten fr die
drei beteiligten Verben; vgl. Scha (1981: 497).
Das ist ein Hinweis darauf, da die definiten
PNPn fr sich genommen doch nicht fr die
erratischen Quantorenstrukturen verant-
wortlich gemacht werden knnen; deren
Quelle liegt vielmehr in den auftretenden Pr-
dikaten. In der Tat sind alle drei Beispiele
einem ziemlich mathematischen Kontext ent-
nommen. Je technischer aber der verwendete
Relationsausdruck, desto prziser ist die da-
mit verbundene Quantorenstruktur. Das Pr-
dikat parallel verlaufen ist der klarste Fall: es
bezeichnet eine zweistellige Relation, die so-
wohl links- als auch rechtstotal ist, daher die
Struktur [xy & yx]. Im Prinzip verhlt
es sich mit enthalten genauso; hier ist aber
bereits der Kontext gengend unscharf, da
eine Vagheit in der Subjektposition zugelassen
wird. Die Betonung liegt lediglich auf keine
Gegenbeispiele im Nachbereich der Rela-
tion; das heit aber soviel wie yx
oder yx, was einfach Rechtstotalitt bedeu-
tet. Wird das Beispiel variiert, ist noch nicht
einmal das notwendig: der Satz
(60) Die Montagues hassen die Capulets
ist wahr, so wie die Geschichte erzhlt wird,
auch wenn wir annehmen, da Romeo und
Julia beschlossen haben, ihrem Ha auf die
jeweils andere Familie zu entsagen. hnliche
berlegungen lassen sich zu Schas drittem
Beispiel anstellen: das Bedeutungspostulat
xy fr kreuzen scheint beinahe nur auf den
vorliegenden Fall mit den Rechtecken zu pas-
sen; man wrde nmlich wohl kaum den fol-
genden Satz ber Amerika fr wahr halten,
nur weil sich irgendwo im Mittelwesten ein
Highway mit einem Bahnstrang kreuzt.
(61) In Amerika kreuzen die Highways die
Eisenbahnschienen.
Welche Schlufolgerung soll man aus derlei
Betrachtungen ziehen? Die Diskussion drfte
wohl gezeigt haben, da die hergebrachte se-
mantische Technik der Bedeutungspostulate
ein viel zu rigides Mittel sind, um all die
pragmatischen und situationsbedingten Be-
deutungsnuancen erfassen zu knnen. Der Se-
mantiker sollte sich an die invarianten Bedeu-
tungskomponenten halten. Dazu zhlt etwa
die distributiv/kollektiv-Unterscheidung, die
bei zwei PNPn zu den vier Lesarten CC, CD,
DC, DD fhrt. Einige davon werden mgli-
cherweise durch den Kontext oder die vorlie-
gende Relation ausgeschlossen; wenn wir in
autonom, da die Zahlangabe (= ein) nicht
ausreicht, um etwas ber die Anzahl der be-
teiligten Tische zu sagen).
Betrachten wir als nchstes den Satz (56c);
er enthlt zwei definite PNPn, so da keine
Skopusambiguitt entsteht. Wir bekommen
daher die vier Lesarten CC, CD, DC und
DD. Der Satz (56d) ist ein wenig komplexer.
In der naheliegenden Interpretation hat je-
der Mieter (nur) seinen eigenen Hausherrn
(kein allgemeiner Klassenkampf). Diese Les-
art kann leicht formalisiert werden; Schwie-
rigkeiten bereitet dagegen die Angabe eines
genauen bersetzungsalgorithmus, der die
gruppen-denotierenden PNPn geeignet aus-
einandernimmt, so da die funktionale Bezie-
hung zwischen den einzelnen Mietern und
ihren Hausherren zum Vorschein kommt. Ich
werde hier keinen Vorschlag fr eine derartige
bersetzung machen; zuviele Annahmen ber
die Gesamtgestalt einer logisch fundierten
Grammatik kmen ins Spiel, die derzeit kaum
endgltig geklrt sind.
Unter (57) wurden einige wichtige relatio-
nale Pluralkonstruktionen angefhrt, die ge-
nerische Stze darstellen. Generizitt ist ein
eigenes Thema fr sich, zu dem eine wach-
sende Literatur existiert, auf die im Abschnitt
2.1 schon verwiesen wurde. Hier mge es
gengen, die Beobachtung festzuhalten,
da in generischen Kontexten die Numerus-
Distinktion semantisch neutralisiert wird, so
da es sich bei der pluralischen Form gene-
rischer Stze nicht wirklich um ein Pluralph-
nomen handelt. Wir verzichten daher auch
auf eine Formalisierung der Stze in (57).
Wir kommen nun zu den interessanten Bei-
spielen unter (58), welche von Scha (1981)
entdeckt und zuerst analysiert wurden. Sie
scheinen zunchst jeden formalen Ansatz zu
ruinieren, nach dem im wesentlichen die Ge-
stalt der NPn die quantifikationelle Struktur
eines Satzes bestimmen. Bezeichnen wir die
Variable fr die Subjekt-Individuen mit x, die
fr die Objekt-Individuen mit y. Dann hat
(58a) die Quantoren-Struktur yx; (58b):
[xy & yx]; (58c): xy. Das Verb wird in
allen drei Fllen gleichwohl von zwei definiten
PNPn flankiert. Damit stellen diese Stze
prima facie Gegenbeispiele zu der Behaup-
tung dar, da die Quantorenstruktur durch
die Grupen/-Ambiguitt bei definiten PNPn
festgelegt wird (Hausser 1974, Bennett 1975);
diese Analyse sagt im vorliegenden Fall
gleichfrmig eine xy-Struktur voraus.
Auch Langendoens Vorschlag, der die Struk-
tur in (58b) favorisiert (Langendoen 1978),
432 VI. Nominalsemantik
definierbar ist. Doch schon in (63b) stellt sich
Vagheit ein: der Satz kann wahr sein, ohne
da alle Paare von zwei Professoren in der
gegebenen Relation stehen. In (63c) ist dies
sogar vom Weltwissen her ausgeschlossen
(hier zeigt sich also wieder die Begrenztheit
von Bedeutungspostulaten). Disjunkte Refe-
renz mit gruppen-denotierenden Nomina wie
Ausschu scheint im Deutschen kaum mglich
(63d), whrend sich im Englischen die Se-
mantik gegenber der Syntax leichter durch-
setzt, insbesondere bei Plural-agreement im
Verb (63e). Der nchste Satz (63 f) ist wie (60)
in der Lesart Ha zwischen den Familien;
analysieren wir einander-hassen als einstelliges
kollektives Prdikat wie oben angedeutet, so
sind die beiden Familien als Untergruppen
abzuschlieen, bevor das Bedeutungspostu-
lat fr einander zum Tragen kommt; andern-
falls wrde sich auch eine Habeziehung in-
nerhalb der Familien ergeben. Eine mittlere
Gruppenbildungsebene wird auch in (63g) be-
ntigt, wenn der Satz die geschichtlichen Fak-
ten wiedergeben soll (d. h. Blcher und Wel-
lington gegen Napoleon); es ist allerdings
zweifelhaft, ob der Satz diese Bedeutung an-
nehmen kann. Der letzte Satz (63h) schlie-
lich soll nur darauf verweisen, da die dis-
junkte Referenz im Englischen eine viel fle-
xiblere syntaktische Konstruktion darstellt als
im Deutschen; zu den each-other-Konstruk-
tionen siehe z. B. Dougherty (1974), Fiengo
& Lasnik (1973) und Higginbotham (1980)
mit den jeweils dort angegebenen Literatur-
hinweisen. Langendoen (1978) schlielich gibt
einen ausfhrlichen berblick ber die Lite-
ratur der reziproken Konstruktionen und dis-
kutiert ihre Reduzierbarkeit auf RP-Stze.
Ein letztes, wenn auch ziemlich spezielles
Phnomen sei angefhrt, das im Zusammen-
hang mit Pluralitt diskutiert werden kann:
mit der englischen respectively-Konstruktion
lassen sich gleichzeitig mehrere paarweise Be-
ziehungen derselben Art ausdrcken, die
sonst nur nacheinander aufgelistet werden
knnen. Hier sind einige Beispiele.
(64)
a. George and Nick hate Martha and
Honey, respectively.
b. George and Martha are drinking and
dancing, respectively.
c. Charley Brown, Linus, and Schroe-
der won the first, second, and third
prize, respectively / in this order.
Hier wird die semantische Bedeutung, wenn
auch auf Kosten einer schwerflligen Syntax,
explizit gemacht: die intendierten Einszueins-
Beziehungen zwischen den sich entsprechen-
(56c) etwa das Verb kochen-fr durch das
achievement-Verb freilassen ersetzen, so ist die
Interpretation DD schwerlich zu realisieren:
(62) Die Frauen lieen die Gefangenen frei.
Was nun Schas Beispiele angeht, so sind sie
am besten unter die doppelt kollektive Lesart
CC zu subsumieren. Es verhlt sich nicht so,
da die relationalen PNP-Konstruktionen
stndig ihre Bedeutung verndern; die In-
terpretation CC lt vielmehr gengend
Raum fr die verschiedenen Quantorenstruk-
turen, die sich aufgrund des speziellen Pr-
dikats und des speziellen Kontexts ergeben
mgen. Wie auch in anderen Bereichen wird
hier deutlich, da die Interpretation eines Sat-
zes durch die reine Bedeutung (die kontext-
unabhngige Semantik) unterbestimmt ist.
Auf diese Weise lassen sich die scheinbaren
Gegenbeispiele in eine geeignete Perspektive
bringen.
2.10Reziproke Konstruktionen und das
englische respectively
Es gibt eine ausgedehnte Literatur, vor allem
in der generativen Syntax, zu den reziproken
Konstruktionen. Weil sie eine systematische
Beziehung zu den Pluralia haben, seien sie
hier kurz diskutiert. Die folgenden Stze sind
typische Beispiele.
(63)
a. Georg und Martha hassen einander.
b. Die Professoren hassen einander.
c. Die See-Elefanten lagen aufeinander.
d. ?Der Ausschu hat einander/sich.
e. The committee ?hates/hate each
other.
f. Die Meiers und die Mllers hassen
einander.
g. ?Blcher und Wellington und Napo-
leon kmpften in Waterloo gegenein-
ander.
h. George und Martha expect each
other to win.
(63a) und (63b) bedeuten, da innerhalb der
durch die Subjektphrase bezeichneten Gruppe
eine wechselseitige Habeziehung besteht,
wobei auf jeden Fall Selbstha ausgeschlos-
sen ist (disjunkte Referenz, engl. disjoint refe-
rence). Also hat nach (63a) Georg Martha
und umgekehrt, und in (63b) gehren alle
Paare von Professoren zu der Relation hassen,
mit Ausnahme der Diagonalpaare. Es liegt
also nahe, einander als einen VP-Operator
aufzufassen, der kollektive Prdikate erzeugt,
und der ber die Quantorenstruktur xy
[x y mit Hilfe des Ausgangsprdikats
19. Plural 433
stenz gemischter Prdikate wie ein Klavier
heben ist eine solche Trennlinie offensichtlich
inadquat. Man kann nun auch die normalen
Individuen um eine Mengenstufe anheben
(d. h. sie mit ihren Einermengen identifizieren)
und damit die Einheitlichkeit der Prdikatex-
tensionen wiederherstellen (siehe z. B. Scha
1981). Damit besteht ein Modell fr eine
Sprache mit Pluralitten aus einer Potenz-
mengen-Struktur 2
E
, zusammen mit einer De-
notationsfunktion f derart da f(t) {{d}
d E} fr einfache Individuenterme t, f(g) 2
E
fr Gruppenterme g, und f(P) 2
E
fr ein-
stellige Prdikate P. Die Teilgruppenrelation
ist dann als Mengeninklusion auf 2
E
realisiert,
wie das oben ins Auge gefat wurde.
Wir knnten es damit bewenden lassen und
auf der Grundlage dieser einfachen Idee eine
Logik der Pluralia entwickeln. Aber besitzen
Mengen von Mengen die passenden Existenz-
und Identittsbedingungen, um als formale
Gegenstcke des intuitiven Begriffs von einem
Pluralobjekt zu dienen? Blau (1981 a) widmet
sich dieser Frage. Die Existenzbedingungen
fr Pluralobjekte, bei Blau Kollektionen
genannt, stellen kein Problem dar; ist P ein
einstelliges Prdikat, so existiert die Kollek-
tion der P genau dann, wenn P auf minde-
stens ein Individuum zutrifft. Zwar scheint
die definite PNP die P die Existenz von min-
destens zwei Objekten, die P sind, vorauszu-
setzen; Blau zieht es jedoch vor, die Einer-
kollektionen als Grenzflle miteinzuschlieen.
Was die Identittsbedingungen betrifft, so ist
Blau der Auffassung, Kollektionen seien
hyperextensional im folgenden Sinn: die
Gleichheit der Extensionen zweier Prdikate
P und Q ist eine hinreichende, aber nicht
notwendige Bedingung fr die Gleichheit der
Kollektionen. Wenn z. B. P fr Karte (eines
Kartenspiels) und Q fr Kartenspiel steht,
dann knnen wir sagen, da die Kollektion
der drei Q genau dann auf dem Tisch liegt,
wenn die Kollektion der P, die zu den Q
gehren, auf dem Tisch liegt. Nun ist auf dem
Tisch liegen ein invariantes Prdikat, wie das
oben genannt wurde, und stellt damit nicht
den allgemeinsten Kontext dar, in dem eine
Kollektion auftreten kann. Gegen die auf-
kommende Vermutung, da die Gleichheit
der Extensionen vielleicht doch eine notwen-
dige Bedingung sei, argumentiert Blau in
(1981 a: 129, Funote).
Verfolgt man die Blauschen berlegungen
weiter, so kommt man zurck zu dem Po-
tenzmengen-Modell, das zumindest struktu-
rell angemessen zu sein scheint. Warum iden-
den Termen sind leicht zu identifizieren. Da
es auf die Reihenfolge der Terme ankommt,
mu eine mengentheoretische Darstellung auf
sog. n-tupel, d. h. geordnete Paare, Tripel usw.
rekurrieren. Im Gegensatz dazu lassen sich
die Terme in einer normalen konjunktiven
NP, die Gruppen denotiert, vertauschen. Ein
nicht-symmetrisches Verhalten gibt es aber
auch bei konjunktiven PNPn in Stzen wie
(45d), der hier als (65) wiederholt sei.
(65) Georg und Martha sind Mann und
Frau.
3. Ontologie
3.1Das Potenzmengen-Modell;
Kollektionen; Mereologie
Was fr Entitten sind Plural-Objekte? In der
informellen Diskussion des Abschnitts 2 wur-
den Ausdrcke wie Gesamtheit, Gruppe,
Kollektion verwendet, wenn von diesen
Objekten die Rede war. Nehmen wir einmal
in unserer mengentheoretischen Metasprache
diese Gruppenobjekte als gegeben an und fra-
gen uns, in welcher Weise sie in die semanti-
schen Relationen eingehen. Zum Beispiel
kann eine Gruppe ein Element der Extension
eines kollektiven Prdikats wie sich treffen
sein; wenn Extensionen einstelliger Prdikate
Teilmengen des Individuenbereichs sind, dann
mu eine Gruppe ein Individuum sein. Ein
solches Gruppen-Individuum hat aber offen-
sichtlich eine innere Struktur. Betrachten wir
etwa zum einen die Gruppe b von Personen,
die aus Marat, Danton und Robespierre be-
steht, und zum anderen die Gruppe a, die nur
aus Marat und Danton besteht. a ist eine
Untergruppe von b. Wenn wir die Relation
ist eine Untergruppe von mit mitteilen,
so knnen wir a b schreiben. Nun ist
eine Halbordnung, wie man leicht feststellen
kann; und da das Standardmodell fr die
Halbordnungen die Mengeninklusion ist, liegt
es nahe, Gruppenobjekte als Mengen von In-
dividuen aufzufassen (Bartsch 1973, Hausser
1974, Bennett 1975, u. a.). Diese Entschei-
dung erzwingt allerdings eine Anpassung in
der Struktur der Prdikat-Extensionen: so
mu sich treffen etwa nunmehr eine Menge
von Mengen von Individuen bezeichnen,
wenn die elementare Prdikation weiterhin
durch die Elementschaftrelation reprsentiert
werden soll. Damit entsteht eine starre Trenn-
linie zwischen kollektiven und distributiven
Prdikaten, wenn diese nach wie vor Mengen
von Individuen denotieren. Wegen der Exi-
434 VI. Nominalsemantik
Abb. 19.4a: Teilermenge fr 30
Abb. 19.4b: Potenzmenge von {2, 3, 5}
Abb. 19.4c: Summenmenge fr a, b, c
c durch die nach oben gerichteten Linien und
deren Kombinationen halbgeordnet sind, und
zwar in der gleichen Weise wie die Strukturen
in den Abb. 19.4a und 19.4b. Diese Halbord-
nung ist die Teilgruppen-Relation, die wir
jetzt als ist ein (Individuen-) Teil von lesen
werden (symbolisch:
i
); ihr objektsprachli-
ches Gegenstck ist das zweistellige Prdikat
. Die Menge dieser Summen mit der Rela-
tion
i
ist aber isomorph zur Potenzmengen-
Algebra ber der Menge {a,b,c} minus der
tifizieren wir dann nicht einfach die Pluralob-
jekte mit Mengen von Individuen, wie dieses
Modell angibt? In Link (1983, 1984) wurden
linguistische wie philosophische Argumente
gegen eine solche Identifizierung angefhrt,
die in der Folgezeit fr eine gewisse Verwir-
rung gesorgt haben (siehe etwa Landman
1987). Das Argument mit den gemischten
Prdikaten, das bereits erwhnt wurde, ist
weiterhin gltig, ebenso das der strukturellen
Analogie zu dem nicht-atomaren Verband der
Massenausdrcke. Was nun die rein philoso-
phische Frage der Identifizierung angeht, so
scho das dort Gesagte womglich ber das
Ziel hinaus. Der Sinn der Polemik war, be-
wut zu machen, da mengentheoretische
Konstrukte niemals die Objekte selbst sind,
die es zu reprsentieren gilt, sondern lediglich
Modellierungen (siehe zu diesem Begriff z. B.
Link 1987 b: 244). Die Situation sei durch ein
mathematisches Beispiel illustriert. Man be-
trachte die Menge der Teiler der Zahl 30,
T
30
:= {1,2,3,5,6,10,15,30}. Man wrde wohl
kaum sagen, da diese Menge nichts anderes
ist als die Potenzmenge der Menge {2,3,5},
und noch weniger, da 1 die leere Menge ist,
die Zahlen 2,3,5 Einermengen sind, und da
30 identisch mit der Menge {2,3,5} ist (in der
Tat macht die bliche mengentheoretische
Definition der natrlichen Zahlen diese Aus-
sagen im strikten Sinn falsch). Und doch sind
all diese Aussagen wahr unter einer ganz
przisen Interpretation: die Menge T
30
, zu-
sammen mit der Teilerrelation, ist ordnungs-
isomorph zur Potenzmente 2
{2,3,5}
mit der
Mengeninklusion als Ordnungsrelation. Abb.
19.4a und 19.4b zeigen diese strikte Parallele
zwischen T
30
und der Potenzmenge von
{2,3,5}. T
30
stellt eine atomare Boolesche Al-
gebra ber den drei Atomen 2, 3 und 5 dar,
von der die Potenzmenge in Abb. 19.4b das
Standardmodell bildet. Die Potenzmenge
modelliert oder reprsentiert den Teilerver-
band T
30
, ist aber deshalb noch nicht mit ihm
identisch.
Betrachten wir nun drei Individuen,
a = Marat, b =Danton, c = Robespierre,
und das Prdikat P = sich treffen. Wir wollen
nun annehmen, da, wenn Marat und Dan-
ton sich treffen, das Prdikat P auf die Indi-
viduensumme (kurz: i-Summe) von a und b
zutrifft, die durch a b mitgeteilt sei (analog
mit a c und b c). Wenn alle drei Revo-
lutionshelden zusammenkommen, trifft P auf
die Dreiersumme a b c zu. Diese Sum-
men-Individuen knnen wie in Abb. 19.4c an-
geordnet werden; man sieht dann, da die
Summen unter Einschlu der Atome a, b und
19. Plural 435
3.2Das algebraisch strukturierte
Universum der Individuensummen
und Gruppen
Die formale Sprache einer Logik der Plura-
litten, die hier vorgestellt wird, mge LP
heien. Sie ist der Plural-Teil des Systems
in Link (1983, 1984). LP ist eine Prdikaten-
logik der ersten Stufe mit den blichen logi-
schen Konstanten, einem Kennzeichnungs-
operator und einer simultanen Lambda-
Abstraktion (zur letzteren siehe z. B. Link
1979: 100). Mitteilungszeichen fr Formeln in
LP sind , , ; fr Individuenvariablen,
die gleichermaen ber Atome wie Indivi-
duen-Summen laufen, u, v, w, x, y, z;
fr Individuenterme a, b, c; fr Prdikate
P, Q, R, S. Diese Symbole knnen auch
mit Strichen und Indizes versehen werden.
Als spezielle Grundsymbole der Sprache
seien eingefhrt: die einstelligen Prdikatkon-
stanten E fr existiert und RA fr ist
ein reines Atom; die 2-stellige Prdikatkon-
stante fr ist ein Individuenteil (i-Teil)
von; das einstellige Funktionssymbol
fr die Gruppe von und der Plural-Ope-
rator auf einstelligen Prdikaten, *.
Als nchstes bentigen wir einige definierte
Ausdrcke; unter jeder Definition ist eine um-
gangssprachliche Paraphrase angegeben.
(D.1) a = b a b b a
a ist identisch mit b genau dann wenn (i. f.
gdw) a ein i-Teil von b und b ein i-Teil von a
ist.
(D.2) Ata x[x a x = a]
a ist ein Atom gdw alle i-Teile von a schon
mit a bereinstimmen (wegen der semanti-
schen Regel (TD.3) unten sind alle i-Teile
schon ungleich dem Nullelement; damit sagt
die Bedingung, da die Atome unmittelbar
ber dem Nullelement liegen).
(D.3) a b ab At a
a ist ein atomarer i-Teil von b gdw a ist ein i-
Teil und a ist ein Atom.
(D.4) ROa x[x a RAx]
a ist ein reines Objekt gdw alle atomaren Teile
von a sind reine Atome.
(D.5)
P a *P a Ata
a ist ein echt pluralisches P gdw a ist eine
Summe von Elementen, die P sind, und ist
kein Atom.
(D.6) Distr(P) x [Px Atx]
Das Prdikat P ist distributiv gdw alle Ob-
jekte, auf die P zutrifft, sind atomar.
leeren Menge. Nach der hier vertretenen Auf-
fassung beinhaltet eine Struktur der Art 4c
alle Intuitionen ber das Verhalten von Plu-
ral-Objekten, und es kann daher auch kein
Argument geben, das zeigen wrde, da diese
Objekte in Wirklichkeit Mengen seien. Aus
rein praktischen Grnden knnen Mengen als
Modelle von Plural-Objekten dienen, solange
man den Modellierungsaspekt nicht vergit.
Methodisch ist jedoch der axiomatische Zu-
gang vorzuziehen, der die Objekte, ber die
die Sprache spricht, als gegeben annimmt und
stattdessen die strukturellen Beziehungen zwi-
schen den verschiedenartigen Individuen zu
charakterisieren versucht (dies ist der Kern
einer algebraischen Semantik; vgl. Link
1987 b).
Die atomaren Booleschen Algebren ohne
Nullelement sind brigens die Modelle fr die
Teil-Ganzes-Strukturen der Mereologie (Les-
niewski 192731, Leonard & Goodman
1940, Eberle 1970). Aber der logische und
philosophische Kontext, in dem mereologi-
sche Theorien erforscht wurden, waren von
dem vorliegenden Problemfall vollkommen
verschieden. Massey (1976) scheint der erste
gewesen zu sein, der mereologische Summen
in Verbindung mit Pluralia gebracht hat. Mit
der Mereologie verwandt sind auch die Theo-
rien von Bunt (1981b) und Lnning (1982).
Was diese Anstze ber technische Unter-
schiede hinweg mit dem hier vorgestellten ge-
mein haben, ist der strukturelle oder alge-
braische Geist, in dem sie abgefat sind. In
Link (1983, 1984) ist der Individuenbereich
in einem Modell nicht mehr eine bloe nicht-
leere Menge, sondern mit einer algebraischen
Struktur versehen, die die intuitive Logik von
Pluralstzen in der Sprache wiedergibt. Im
folgenden Abschnitt wird dieser verbandstheo-
retische Ansatz soweit beschrieben, da einer
reprsentativen Auswahl aus den obigen Bei-
spielen eine passende logische Interpretation
gegeben werden kann.
Es sei abschlieend noch auf andere wich-
tige algebraische Anstze verwiesen, die in
den letzten Jahren einflureich geworden
sind: die Boolesche Semantik (siehe z. B. Kee-
nan 1981, Keenan & Faltz 1985, Keenan &
Stavi 1986) sowie die Theorie der Generalisier-
ten Quantoren (siehe Barwise & Cooper 1981,
van Benthem 1983b und Grdenfors 1987 mit
der dort enthaltenen Bibliographie). Aller-
dings war keiner der beiden Anstze entwik-
kelt worden, um auch Pluralphnomene be-
handeln zu knnen. Fr eine Plural-Diskus-
sion im Rahmen der Generalisierten Quan-
toren siehe jedoch Link (1987d).
436 VI. Nominalsemantik
(D. 11) Eine Boolesche Modellstruktur mit
Gruppen ist ein Tripel E, A, , so
da gilt:
1. E ist eine vollstndige atomare
Boolesche Algebra, mit der Menge
A der Atome, mit der Summen-
operation und der Halbord-
nung
i
;
2. A, die Menge der reinen Atome,
ist eine Teilmenge von A;
3. y ist eine injektive Abbildung von
der Menge aller echten i-Summen
ber A in die Komplementmenge
A\A.
Ist E, A, eine Boolesche Modellstruktur
mit Gruppen, so heie d E ein reines Objekt,
wenn d nur aus reinen Atomen aufgebaut ist;
sonst heie d unrein. Ein reines Objekt ist
etwa Blcher Wellington, ein unreines Bl-
cher Wellington Napoleon. ist die
Gruppenbildungsoperation fr die mittlere
Gruppenebene.
(D.12) Ein Modell fr LP ist ein geordnetes
Paar M = B, ., so da gilt:
1. B = E, A, y ist eine Boolesche
Modellstruktur mit Gruppen;
E\{0}, wobei 0 das Nullelement in
E ist, heie der Individuenbereich
von M.
2. . ist eine prdikatenlogische Mo-
dellfunktion auf den Grundaus-
drcken von LP, so da gilt:
(i) a E fr eine Individuen-
konstante a;
(ii)
P
n
(E\{0})
n
, wenn P
n
eine
n-stellige Prdikatkonstante
ist.
Sei M = B, . ein Modell fr LP. Ich
gebe nun die Wahrheits- und Denotations-
bedingungen fr die theoriespezifischen Sym-
bole in LP an (auf eine komplette rekursive
Definition sei hier verzichtet). Das Nullele-
ment 0 dient als Dummy-Objekt fr nicht-
denotierende Terme (siehe z. B. Link 1979:
102 f), und die Quantifikation luft nur ber
Individuen, die von 0 verschieden sind. Man
beachte, da das formale Gegenstck zur Plu-
ralbildung in der Sprache, der Pluraloperator
*, mengentheoretisch przise charakterisiert
wird.
(TD.1) Ea = 1 gdw a 0;
(TD.2) RAa = 1 gdw a A;
(TD.3) a b = 1 gdw a 0 und
a
i
b;
(TD.4) a = (a) falls a D
1
, und
0 sonst;
(TD.5) *P = die Menge aller i-Summen
von Elementen aus P, d. h. der von
(D.7) D
P := xu[u x Px]
Die distributive Version
D
P von P ist die
Menge aller Individuensummen x, so da je-
der atomare i-Teil von x die Eigenschaft P
hat.
(D.8) xPx := x[*P x y [*P y y x]]
Die Individuensumme der P ist diejenige i-
Summe x so da x ein *P ist (d. h. eine Summe
von Atomen, die die Eigenschaft P haben)
und alle sonstigen y, die *P sind, i-Teil von x
sind; xPx ist damit das Supremum aller i-
Summen, die aus Atomen mit der Eigenschaft
P aufgebaut sind.
(D.9)
*xPx := x
Px
Die gesternte Individuensumme der P ist die i-
Summe der P mit der Prsupposition, da
diese Summe aus mindestens zwei Atomen
besteht und damit echt pluralisch ist.
(D. 10) a b := xI
a,b
x
mit I
a,b
:= x[x = a x = b]
Die Individuensumme aus a und b ist das Su-
premum der Individuen a und b (die selbst
keine Atome zu sein brauchen).
Die Semantik fr LP gibt die Idee eines
algebraisch-strukturierten Individuenbereichs
formal wieder. Der Individuenbereich E eines
Modells ist mit der Halbordnung
i
verse-
hen, die die i-Teil-Beziehung zwischen Indi-
viduen(summen) darstellt. Auerdem fhren
wir eine zweistellige Supremumsoperation auf
E ein, die mit bezeichnet sei, und die aus
zwei Individuen die Individuensumme bildet.
Fr die hier behandelten Daten wrde es aus-
reichen, mit der dadurch gegebenen sog.
Halbverbandsstruktur zu operieren, von der
lediglich weiter zu fordern ist, da sie atomar,
in einem gewissen Sinne frei sowie vollstndig
ist (d. h. alle Individuen knnen aus Atomen
aufgebaut werden, und zu jeder beliebigen,
nicht nur endlichen, Menge von Individuen
existiert ein Supremum). Der Einfachheit hal-
ber sei jedoch die zunchst reicher erschei-
nende, in Wahrheit aber durch die genannten
Forderungen bereits garantierte Struktur
einer atomaren Booleschen Algebra (Schtze
1989, Link 1991 b) angenommen, die in der
Potenzmengen-Algebra ein anschauliches
Modell besitzt. Schlielich mu noch die mitt-
lere Gruppenbildungsebene reprsentiert wer-
den, um den oben diskutierten Beispielen
Rechnung zu tragen. Diese Bemerkungen fh-
ren zu der folgenden Definition.
19. Plural 437
Die LPM-Theoreme in Link (1983: 315 f),
welche nur Symbole aus LP enthalten, sind
in der hier gegebenen Semantik LP-logisch
wahr. Speziell sei das Prinzip der kumulativen
Referenz fr Pluralia erwhnt; vgl. den Bei-
spielsatz (5a) oben. Es besagt, da, wenn x
und y Summen aus P-Individuen sind, so ist
auch die Summe von x und y eine Summe
aus P-Individuen:
(66) x y [*P x *P y *P [x y]]
4. Analyse der linguistischen Daten
im Rahmen der Plural-Logik LP
Ich werde nun fr die wichtigsten Flle von
Plural-Konstruktionen, die oben diskutiert
wurden, logische Reprsentationen in LP an-
geben. Eine aus der Montague-Grammatik
entlehnte Strichnotation berfhrt die de-
skriptiven Ausdrcke des Deutschen in kate-
goriengerechte Konstanten von LP.
der Extension Pvon P erzeugte
Summen-Unterverband.
Mit Hilfe von (TD.1)(TD.5) knnen die
folgenden semantischen Regeln abgeleitet
werden:
(TD.6) a = b = 1 gdw a 0 b
und a = b;
(TD.7) Ata = 1 gdw a A;
(TD.8) ab = 1 gdw a A und
a
i
b;
(TD.9) RO a = 1 gdw a [A], d. h.
a ist eine Summe von reinen Ato-
men;
(TD.10)
P a = *P\A;
(TD.11) xPx = sup
i
P,
mit sup
i
= 0;
(TD.12) *xPx = xPx, falls P 2
Elemente hat, und sonst = 0;
(TD.13) a b = a b;
(TD.14) xPx = xPx, falls P nicht
mehr als ein Element enthlt.
4.1Indefinite PNPn
(1) a. Einige Freunde kamen vorbei.
LF1:
x [
Freund(x) kam-vorbei(x)]
(kollektiv)
LF2:
x [
Freund(x)
D
kam-vorbei(x)]
(distributiv)
x [
Freund(x) u [u x kam-vorbei(u)]]
(3) Einige Jakobiner waren Advokaten.
LF:
x [
Jakobiner(x) *Advokat(x)]
x [
Jakobiner(x) u [u x Advokat(u)]]
Wegen der Distributivitt von Advokat folgt die zweite Zeile (vgl. Link 1983: 309); man beachte
ferner, da die Pluralittsprsupposition in der formalen Darstellung durch
erhalten bleibt.
(49) a. Drei Mnner hoben das Klavier.
LF1: x [(3*Mann)(x) hob(x, y Klavier(y))] (kollektiv)
LF2:
x [(3*Mann)(x)
D
u hob(u, y Klavier(y))(x)]
x [(3*Mann)(x) u [u x hob(u, y Klavier(y))]]
(distributiv)
Die Numeralia 2, 3, 4, ... sind adjektiv-hnliche Modifikatoren, die alle diejenigen Summen
in einer NP-Extension herausgreifen, die die angegebene Anzahl von Atomen besitzen. Somit ist
LF1 etwa zu lesen; es gibt eine Summe von Mnnern, die aus drei Atomen besteht und kollektiv
das Klavier hob. Zur Diskussion siehe Abschnitt 2.4.
(49) b. Drei Mnner hoben ein Klavier.
LF1: x y [(3*Mann)(x) Klavier/(y) hob(x, y)] (kollektiv)
LF2:
x [(3*Mann)(x)
D
u y [Klavier(y) hob(u, y)](x)]
(distributiv)
x [(3*Mann)(x) u [u x y [Klavier(y) hob(u, y)]]
LF3:
y [Klavier(y) x [(3*Mann)(x)
D
u hob(u, y) (x)]]
(Klavier weiter Skopus)
y [Klavier(y) x [(3*Mann)(x) u [u x hob(u, y)]]
Die kollektive Lesart mit weitem Skopus fr Klavier stimmt mit LF1 berein.
4.2Bloe Pluralia
LF: x [
Kind( x ) baute-das-Flo( x )]
(kollektiv) (1)c.Kinder haben das Flo gebaut.
Dies ist die existentielle und unproblematische Lesart eines bloen Plurals. Fr die Reprsentation
bloer Pluralia in generischen Stzen siehe die Literaturhinweise in Abschnitt 2.1.
438 VI. Nominalsemantik
4.3Definite PNPn
(28) Die Schler versammelten sich (um ihren Lehrer).
LF: sich-versammeln (*x Schler (x))
(24) b. Die Sansculotten jubelten einem Cordelier zu.
LF1: y [Cordelier (y) zujubeln (*x Sansculotte (x), y))]
LF2:
y [Cordelier (y)
D
u zujubeln (u, y)(*x Sansculotte (x))]
y [Cordelier (y) u [u*x Sansculotte (x) zujubeln (u, y)]]
y [Cordelier (y) u [Sansculotte (u) zujubeln (u, y)]]
(39) b. Die drei Mnner gingen / verlieen den Raum.
LF1: ging (x [3*Mann](x))
Diese logische Form entspricht der Option, das Zahlwort in die drei Mnner als Adjektiv zu
behandeln. Wie oben angedeutet, ist es jedoch mglicherweise angemessener, das Zahlwort als
prsupponierenden numerischen Spezifikator des definiten Artikels aufzufassen. Dann htte die
Formalisierung etwa die folgende Gestalt:
LF2: ging([/3]x *Mann(x))
[/3]xPx ist hier eine Abkrzung fr xPx / x [Px drei(x)], wobei der zweite Schrgstrich
Blaus prsupponierender Prjunktor ist (siehe Blau 1985, Link 1986: Appendix). Der Term ist
zu lesen als das eindeutige x so da Px, wobei prsupponiert ist, da alle i-Summen, die P sind,
genau drei Atome enthalten (der Prsuppositionsbegriff ist natrlich nur sinnvoll in einer Logik
mit Wahrheitswertlcken; fr eine Diskussion verschiedener Systeme siehe Link 1986).
4.4alle
(33) a. Alle Soldaten starben.
LF: *starb(*x Soldat(x))
u [Soldat(u) starb(u)] [wegen Distr(starb)]
(24) a. Alle Sansculotten jubelten einem Cordelier zu.
LF1: D
x y [Cordelier(y) zujubeln (x, y)] (*x Sansculotte (x))
u [u *x Sansc(x) xy [Cord(y) zujubeln (x,y)](u)]
u [Sansculotte(u) y [Cordelier(y) zujubeln (u, y)]]
LF2:
y [Cordelier(y)
D
u zujubeln (u, y)(*x Sansculotte (x))]
y [Cordelier(y) u [Sansculotte(u) zujubeln(u, y)]] (Wie 24b)
4.5Partitiv
einige der Studenten
LF: x [x *y Student (y) ...]
(43)
a. alle (von den) Studenten
LF: u [u *x Student(x) ...]
4.6Konjungierte NPn
(45) a. Georg und Martha schlafen.
LF:
D
schlafen(g m) u [u g m schlafen(u)]
schlafen(g) schlafen(m)
(45) b. Georg und Martha treffen sich.
LF: sich-treffen(g m)
(45) c. Georg und Martha haben geheiratet.
LF: x u v [x = u v heirateten(u, v)] (g m)
heirateten(g, m)
(45) d. Georg und Martha sind Mann und Frau.
LF: xy [Mann-von(x, y) Frau-von(y, x)] (g,m)
Mann-von(g, m) Frau-von(m, g)
(45) e. Ein Junge und ein Mdchen spielten im Hof.
LF1: x y [Junge(x) Mdchen(y spielte(x y)]
LF2: x y [Junge(x) Mdchen(y)
D
spielte(x y)]
x y [Junge(x) Mdchen(y) spielte(x) spielte(y)]
19. Plural 439
(45) f. Die Meiers und die Mllers trafen sich.
LF1: sich-treffen(*x Meier(x) *x Mller(x))
LF2: D
sich-treffen(*x Meier(x) *x Mller(x))
sich-treffen(*x Meier(x)) sich-treffen(*x Mller(x))
(45) g. Drei Mnner und vier Frauen kamen zusammen.
LF: x y [(3*Mann)(x) (4*Frau)(y) A kam-zusammen (x y)]
4.7RP-Stze
Sei
D1
hob(x, y) :=
D
u hob(u, y)(x) und
D2
hob(x, y) :=
D
v hob(x, v)(y). MT (bzw. TM) steht
fr Mann (bzw. Tisch) hat weiten Skopus; MT-CD etwa bedeutet damit: M hat Skopus
ber T, wobei die M-Position kollektiv und die T-Position distributiv aufgefat wird.
(56)
a. Vier Mnner hoben drei Tische.
Sei
D1
hob(x, y) :=
D
u hob(u, y)(x) und
D2
hob(x, y) :=
D
v hob(x, v)(y). MT (bzw. TM) steht
fr Mann (bzw. Tisch) hat weiten Skopus; MT-CD etwa bedeutet damit: M hat Skopus
ber T, wobei die M-Position kollektiv und die T-Position distributiv aufgefat wird.
LF1: x [(4*Mann)(x) z y [(3*Tisch)(y) hob(z,y)](x)] (MT-CC)
x y [(4*Mann)(x) (3*Tisch)(y) hob(x, y)]
LF2:
x [(4*Mann)(x) z y [(3*Tisch)(y)
D2
hob(z, y)](x)]
(MT-CD)
x y [(4*Mann)(x) (3*Tisch)(y) v [vy hob(x,v)]]
LF3:
x [(4*Mann)(x)
D
u y [(3*Tisch)(y) hob(u,y)](x)]
(MT-DC)
x [(4*Mann)(x) u [ux y [(3*Tisch)(y) hob(u,y)]]]
LF4:
x [(4*Mann)(x)
D
u y [(3*Tisch)(y)
D2
hob(u, y)](x)]
(MT-DD)
x [(4*Mann)(x) u [ux y [(3*Tisch)(y) v [vy hob(u, v)]]]]
LF5: y [(3*Tisch)(y) z x [(4*Mann)(x) hob(x, z)](y)] (TM-CC)
x y [(4*Mann)(x) (3*Tisch)(y) hob(x,y)] = LF1
LF6:
y [(3*Tisch)(y) z x [(4*Mann)(x)
D1
hob(x,z)](y)]
(TM-CD)
x y [(4*Mann)(x) (3*Tisch)(y) u [ux hob(u, y)]]
LF7:
y [(3*Tisch)(y)
D
v x [(4*Mann)(x) hob(x, v)](y)]
(TM-DC)
y [(3*Tisch)(y) v [vy x [(4*Mann)(x) hob(x, v)]]]
LF8:
y [(3*Tisch)(y)
D
v x [(4*Mann)(x)
D1
hob(x, v)](y)]
(TM-DD)
y [(3*Tisch)(y) v [vy x [(4*Mann)(x) u [ux hob(u, v)]]]]
(56) d. DieMieter hassen die (= ihre) Hausherren.
LF:*u [Atu hassen(u, y Hausherr-von(y, u))](*x Mieter(x))
u [u (*x Mieter(x)) hassen(u, y Hausherr-von(y, u))]
u [Mieter(u) hassen(u, y Hausherr-von(y, u))]
4.8Reziproke Konstruktionen
(63) a. Georg und Martha hassen einander.
LF: [EINANDER(hassen)] (g m)
hassen(g, m) A hassen(m, g);
dabei wurde das folgende Bedeutungspostulat benutzt (zur Diskussion siehe oben):
(BP)
EINANDER(
2
) x u v [ux vx u v P
2
(u, v)]
(63) h. George und Martha expect each other to win.
LF: [EINANDER(xy expect(x, win(y)))] (g m)
expect(g, win(m)) expect(m, win(g))
4.9respectively
(64) a. George und Nick hate Martha and Honey, respectively.
LF: x
1
x
2
[y
1
, y
2
[hate(x
1
, y
1
) hate(x
2
, y
2
)](m, h)] (g, n)
hate(g, m) hate(n, h)
(64) b. George and Martha are drinking and dancing, respectively.
LF: xy [drink(x) dance(y)] (g, m)
drink(g) dance(m)
440 VI. Nominalsemantik
6. Literatur (in Kurzform)
Allan 1977 Allan 1980 Allgayer (ed.) 1991 All-
gayer/Reddig-Siekmann 1990 Altham 1971 Bach
1986 Ballmer/Pinkal (eds.) 1983 Bartsch 1973
Barwise 1979 Barwise/Cooper 1981 Buerle/
Schwarze/von Stechow 1983 Bennett 1975 van
Benthem 1983b Biermann 1982 Blsius/Hedt-
stck/Rollinger (eds.) 1990 Blau 1978 Blau
1980 Blau 1981a Blau 1981b Blau 1985
Brady/Berwick (eds.) 1984 Bunt 1979 Bunt
1981b Brge 1977 Carlson 1977 Carlson 1978
Carlson 1982 Carlson/Pelletier (eds.) 1991
Cartwright 1979a Cartwright 1979b Chierchia
1982 Choe 1987 Chomsky 1965 Clarke, B. L.
1981 Clarke, D. S. 1970 Cocchiarella 1976
Dahl 1975 Dougherty 1970 Dougherty 1971
Dougherty 1974 Dowty 1985b Dowty 1986
Dowty/Brodie 1984 Eberle 1970 Eberle 1989
Fiengo/Lasnik 1973 Fine 1985 Gabbay/Guenth-
ner (eds.) 1989 Grdenfors (ed.) 1987 Gerstner
1988 Gerstner/Krifka 1987 Gil 1987 Groenen-
dijk/Janssen/Stokhof (eds.) 1981 Groenendijk/de
Jongh/Stokhof (eds.) 1986a Groenendijk/Stok-
hof/Veltman (eds.) 1987 Gupta 1980 Hausser
1974 Heim 1983a Heim/Lasnik/May 1991
Heyer 1987 Hinrichs 1985 Hoeksema 1983b
Hoepelman/Rohrer 1980 Hrmann 1983 Kee-
nan (ed.) 1975 Keenan 1981 Keenan/Faltz 1985
Keenan/Stavi 1986 Kiefer/Perlmutter (eds.) 1974
Kimball (ed.) 1973 Klver 1982 Kratzer 1978
Kratzer 1980 Krifka 1987 Krifka 1988 Krifka
1989 Ladusaw 1982 Landman 1987 Landman/
Veltman (eds.) 1984 Langendoen 1978 van Lan-
gendonck 1972 Lasersohn 1988 Leonard/Good-
man 1940 Lsniewski 1927-31 Lewis 1975a
Link 1974 Link 1979 Link 1983a Link 1983b
Link 1984 Link 1986 Link 1987b Link 1987c
Link 1987d Link 1991a Link 1991b Lnning
1982 Lnning 1987 Lnning 1986 Lnning
1989 Massey 1976 de Mey 1984 Ojeda 1990
Pelletier (ed.) 1979 Pelletier/Schubert 1987a Pel-
letier/Schubert 1987b Reyle 1986 Roberts 1987
Roeper 1983 Rohrer (ed.) 1980 Rooth 1987
Scha 1981 Scha/Stallard 1988 Schtze 1989
Seiler/Lehmann (eds.) 1982 Serzisko 1980
Sharvy 1978 Sharvy 1980 Smith-Stark 1974
von Stechow 1980 von Stechow/Zimmermann
1984 Stockwell/Schachter/Partee 1973a ter Meu-
len (ed.) 1983 Verkuyl 1972 Verkuyl 1981 Web-
ber 1984 Westersthl 1989 Zaefferer 1984 Zaef-
ferer (ed.) 1991
Godehard Link, Mnchen
(Bundesrepublik Deutschland)
5. Spezielle Probleme und Ausblick
Viele Probleme konnten hier nicht behandelt
werden, in denen Pluralia eine Rolle spielen.
Generische Konstruktionen wurden schon er-
whnt. Zum eng verwandten Thema der Mas-
senausdrcke siehe Krifkas Beitrag, Art. 18.
Fr eine geschlossenen Theorie einfacher und
mehrfacher Fragen ist eine Behandlung von
Pluralia ebenfalls unumgnglich (zu diesem
Themenkomplex siehe Zaefferer 1984, de Mey
1984, v. Stechow & Zimmermann 1984, und
Artikel 15 in diesem Handbuch). Kompara-
tiv-Konstruktionen wie etwa mehr Plutonium-
Fsser wurden angeliefert als Frachtbriefe vor-
handen waren verdienen ebenfalls eine einge-
hende Analyse. Es gibt ferner ein interessantes
Problem fr eine Pluraltheorie, das im Zu-
sammenhang mit Relativsatz-Konstruktionen
mit mehreren Kopfnomina auftritt (sog. Hy-
dren nach Link 1984); siehe v. Stechow (1980)
und Link (1984).
Es gibt sicherlich sehr viel mehr ber re-
lationale Pluralkonstruktionen zu sagen. Ein
enger Zusammenhang besteht auerdem zu
dem groen Fragenkomplex der Plural-Ana-
phora; siehe Rooth (1987) und Arbeiten im
Rahmen der Diskursreprsentationstheorie
(siehe z. B. Reyle 1986).
Das Thema der Distributivitt ist in jn-
geren Arbeiten weiterbehandelt worden; ge-
nannt seien Roberts (1987), Gil (1987), Choe
(1987). In der letztgenannten Schrift wird eine
koreanische Partikel diskutiert, die Choe
Antiquantor nennt. Sie hat ein Gegenstck in
dem deutschen je, das in Link (1987 c, 1987 d)
diskutiert und dort als Distributivittsopera-
tor auf der VP gedeutet wird.
Semantische Theorien, die den Begriff des
Ereignisses zu ihrem Gegenstand machen,
rcken immer mehr in den Vordergrund der
Diskussion. Auch hier spielen Pluralia eine
prominente Rolle. Ein Beispiel ist der Einflu
von Plural-Objektphrasen auf die Aspekt-
klasse der VP. Wie in Abschnitt 2.1 bereits
erwhnt, wird dieses Phnomen der Zeitkon-
stitution (Krifka) diskutiert in Hinrichs (1985)
und Krifka (1986, 1987). Fr eine bertra-
gung des algebraischen Ansatzes von LP auf
die Ereignistheorie siehe Bach (1986), Krifka
(1987, 1989) und Link (1987 b).
In jngster Zeit werden Pluralia schlielich
auch in der knstlichen Intelligenz im Rah-
men natrlichsprachlicher Wissensverarbei-
tungssysteme untersucht; siehe dazu Schtze
1989, Eberle 1989, Allgayer & Reddig-Siek-
mann 1990 sowie Allgayer 1991.
20. Nominalisierungen 441
20. Nominalisierungen
wurde u. a. durch Diskussionen um den theo-
retischen Status von Nominalisierungen aus-
gelst (Lakoff 1965, McCawley 1968, Bach
1968, Pusch 1972). Diese Auseinandersetzun-
gen drehten sich im wesentlichen um die
Frage, ob Nominalisierungen lexikalistisch,
also als Einheiten des Lexikons, oder trans-
formationalistisch, also als das Ergebnis von
syntaktischen Transformationen, zu behan-
deln seien. Der Theaterdonner ist verklungen,
die Transformationalisten haben mit der Ge-
nerativen Semantik die Szene verlassen. b-
riggeblieben ist die von Chomsky (1970) ent-
worfene X-bar-Theorie, die heute zum Stan-
dardinventar (beinahe) jeder Syntaxtheorie
gehrt. Der theoretische Status der Wortbil-
dung ist aber weiterhin in der Diskussion.
Neben strikt lexikalistischen Positionen (Jak-
kendoff 1975, Aronoff 1976, Williams 1981,
Selkirk 1982, di Sciullo & Williams 1987,
Bierwisch 1989), denen zufolge Wortbildungs-
prozesse sich zwar in den Begriffen der X-
bar-Syntax formulieren lassen, aber eigenen,
genuin lexikalischen Prinzipien unterliegen,
stehen neuerdings wieder syntaktische Rekon-
struktionsversuche gegenber, in denen die
Ebene der Wortsyntax nicht von der der Satz-
syntax abgetrennt wird (Pesetsky 1985, Le-
beaux 1986, Roeper 1987).
Den zahlreichen Untersuchungen zu Wort-
bildungssyntax, in denen die Nominalisie-
rungsproblematik allerdings zumeist nur
einen Anwendungsfall unter anderen abgibt,
stehen nur wenige Studien zur Semantik von
Nominalisierungen gegenber. Auch in diesen
Arbeiten ist das Nominalisierungsproblem
zumeist nicht zentral, sondern bildet einen
Anwendungsfall fr das allgemeine Problem
der Semantik von Ereignisausdrcken. ber
den theoretischen Status von Ereignissen be-
steht dabei weithin Uneinigkeit. Sind Ereig-
nisse Individuen, hnlich wie Personen oder
Gegenstnde, oder sind Ereignisse Eigen-
schaften von Raum-/Zeitregionen? Von der
Beantwortung dieser Frage hngt es ab, wie
eine semantische Theorie aufgebaut wird.
Sieht man Ereignisse als Individuen an, so
wird man, um sie von Personen oder Sachen
semantisch unterscheiden zu knnen, ver-
schiedene Sorten von Individuen einfhren,
der Bedeutungsanalyse also eine mehrsortige
Logik zugrundelegen. Sieht man Ereignisse
als Eigenschaften und die Eigenschaften von
Ereignissen mithin als Eigenschaften von Ei-
genschaften an, so wird man diese, um sie
1. Vorbemerkung
2. Die Syntax von Nominalisierungen
2.1 Formklassenunterschiede
2.2 X-bar-Theorie und Nominalisierungen
3. Die Bedeutungen von Nominalisierungen
3.1 Tatsachen und Ereignisse
3.2 Ereignisse und Ereignisbegriffe. Realistische
oder intensionalistische Ereignissemantik
3.3 Nominalisierung und Aspekt
4. Die formale Semantik von Nominalisierungen
4.1 Typenlogik und Nominalisierungen
4.2 Ereignissemantik ohne Ereignisindividuen
(Cresswell)
4.3 Realistische Ereignisontologie im -Format
(Bierwisch)
5. Zusammenfassung
6. Literatur (in Kurzform)
1. Vorbemerkung
Nominalisierungen sind in der Geschichte der
Sprachwissenschaft immer ein heies oder,
besser gesagt, ein heikles Thema gewesen. In
der deskriptiven Wortbildungslehre (Henzen
1947, Marchand 1960, Fleischer 1969) spielen
Nominalisierungen als Belege fr die Produk-
tivitt/Nichtproduktivitt morphologischer
Prozesse eine wesentliche Rolle. So wird die
Nominalisierung auf -ung als Paradebeispiel
fr ein produktives Wortbildungsmuster gern
zitiert. Zugleich sind in der traditionellen
deutschen Grammatik Nominalisierungen
Gegenstand sprachkritischer Reflexion: die
Substantivierungstendenzen im heutigen
Deutsch wurden und werden als Auswchse
brokratischer Sprachverkrustung beklagt
(Daniels 1963).
In der Ur- und Frhgeschichte der Trans-
formationsgrammatik (Version Syntactic
Structures) wurden Nominalisierungen als
ein besonders gelungenes, weil morphologisch
produktives, Beispiel fr die durch syntakti-
sche Transformationen zu explizierende ober-
flchensyntaktische hnlichkeit verschiede-
ner Konstruktionen (Peters Kommen ist be-
dauerlich; Da Peter kommt, ist bedauerlich;
Peter kommt. Das ist bedauerlich) herange-
zogen. Ein dieser frhen TG-Tradition ver-
pflichtetes Standardwerk ist das Buch von
Lees (1960), das viele wesentliche Einsichten
zur Syntax und Semantik von Nominalisie-
rungen enthlt.
Die midlife crisis der sog. Standardtheorie
(Version Aspects of the Theory of Syntax)
442 VI. Nominalsemantik
und den theoretischen Status der Morpholo-
gie thematisiert worden (Oh 1985, 1988, Bier-
wisch 1989, Lenerz 1990). In der Semantik-
Diskussion stehen aber nach wie vor die Er-
eignisnominalisierungen im Vordergrund.
Deshalb wird sich die nachfolgende bersicht
weitgehend auf diesen Nominalisierungstyp
beschrnken.
2. Die Syntax von Nominalisierungen
2.1Formklassenunterschiede
Im Deutschen lassen sich morphologisch zwei
Klassen von Nominalisierungen unterschei-
den: Infinitivnominalisierungen auf -en und
Derivativnominalisierungen z. B. auf -ung, -t,
-e, - bzw. auf Ge...e und -erei. Letztere be-
ziehen sich auf Ereigniswiederholungen, drk-
ken also eine Art iterativen Aspekt aus, und
haben eine leicht pejorative Konnotation.
Infinitivnominalisierung (N-INF)
Derivativnominalisierung (N-DER)
Infinitivnominalisierungen sind grundstzlich
nicht pluralisierbar und infolgedessen nur ein-
geschrnkt determinierbar; alle Plural-Deter-
minantien sind ausgeschlossen.
Derivativnominalisierungen lassen die Plural-
bildung in der Regel zu (4) und unterliegen
daher hinsichtlich der Determinierbarkeit kei-
nen grundstzlichen Beschrnkungen (5).
Eine Ausnahme bilden aber die Bildungen auf
Ge...e, die schon im Singular eine pluralische
Bedeutung haben:
von den Eigenschaften von Personen oder
Gegenstnden absetzen zu knnen, einem h-
heren logischen Typ zuordnen und die Bedeu-
tungsanalyse dementsprechend typenlogisch
organisieren.
Die nachfolgende bersicht beginnt mit
einer Darstellung der Nominalisierungssyn-
tax. Diese umfat eine Subklassifizierung
formal verschiedener Nominalisierungsarten
(Abschnitt 2.1) sowie eine kurze Errterung
der X-bar-Theorie (Abschnitt 2.2). Die Dar-
stellung der Nominalisierungssemantik hat
zwei Teile. Der erste Teil umfat den Versuch
einer Phnomenologie der Bedeutungen von
Nominalisierungen unterschiedlicher Form-
klassenzugehrigkeit (Abschnitte 3.1, 3.2). In
diesem Zusammenhang werden einige fr die
Nominalisierungssemantik grundlegende Be-
griffe der analytischen Sprachphilosophie wie
Ereignis, Tatsache, Ereignisbegriff erlutert
und anhand linguistischer Kriterien proble-
matisiert. Im Zentrum der Errterung steht
dabei die Auseinandersetzung um Davidsons
realistischen und Montagues intensionalisti-
schen Ereignisbegriff. Das Kapitel enthlt fer-
ner eine (intuitive) Darstellung der Aspekt-
eigenschaften von Nominalisierungen (Ab-
schnitt 3.3). Im zweiten Teil der Semantik-
darstellung werden unterschiedliche formale
Modelle zur semantischen Reprsentation
und Interpretation von Nominalisierungen
besprochen: die typenlogische Reprsentation
von Nominalisierungen in der Montague-
Grammatik (des PTQ-Formats) und formale
Versuche zur Umgehung des Typenproblems
(Abschnitt 4.1) sowie die Darstellung des No-
minalisierungsproblems in der -kategorialen
Sprache Cresswells (Abschnitt 4.2). Ferner
wird der Ansatz von Bierwisch (1989) vor-
gestellt (Abschnitt 4.3), der den Versuch
macht, Davidsons realistische Ontologie in
einer -kategorialen Sprache zu rekonstruie-
ren.
In der traditionellen Wortbildungslehre ste-
hen neben den Ereignisnominalisierungen die
Agensnominalisierung (Sprecher, Sieger, Trin-
ker, Teilnehmer, Bedienung, Leitung, Vermitt-
lung), die Objektnominalisierung (Erfindung,
Sammlung, Bedachung), die Instrumentnomi-
nalisierung (Kocher, Rechner, Kopierer, Kh-
lung, Lftung, Verkleidung) und die Eigen-
schaftsnominalisierung (Schnheit, Klugheit,
Magerkeit, Munterkeit) an zentraler Stelle. In
der theoretischen Linguistik spielten Nomi-
nalisierungen dieser Art lange eine eher un-
tergeordnete Rolle (vgl. aber Motsch 1963,
Vendler 1968), erst in jngster Zeit sind sie in
der Diskussion um die Theorie des Lexikons
20. Nominalisierungen 443
chen auch gegen die These von Grimshaw
(1988b), derzufolge nur Resultatnominalisie-
rungen pluralisierbar sind. Ein Beispiel, das
diese These zu untersttzen scheint, ist (8):
(8)
a. Edisons inventions are ingenious
b. *Edisons inventions of the phono-
graph are ingenious
Der Vergleich von (8a,b) zeigt, da die Ar-
gumentstruktur der Resultatnominalisierung
(8a) von der der Ereignisnominalisierung (8b)
verschieden ist: Bei der Resultatnominalisie-
rung fehlt das interne Themaargument.
Schublin (1972) hat versucht, Pluralisie-
rungsverhalten und Argumentstruktur von
Nominalisierungen in einen systematischen
Zusammenhang zu bringen. Seinen Beobach-
tungen zufolge sind Ereignisnominalisierun-
gen nur dann pluralisierbar, wenn das Geni-
tivkomplement als genitivus subjectivus gedeu-
tet werden kann, d. h. wenn es ein Agens-
Argument reprsentiert:
(9)
a. Die Ausgrabungen Schliemanns
b. *Die Ausgrabungen des Tempels
Beispiele, bei denen das Genitivkomplement
zwischen einer Agens-Lesart und einer
Thema-Lesart ambig ist, werden so Schu-
blin stets agentiv gedeutet:
(10)
a. Die Begrungen des Vorstands
b. Die Verdchtigungen des Zeugen
c. Die Ermahnungen des Abgeordneten
Beispiele wie die in (7) zeigen allerdings, da
die Pluralisierbarkeit von Derivativnominali-
sierungen nicht auf Bildungen mit Agens-
Komplement beschrnkt ist.
Infinitivnominalisierungen des Typs N-
INF verhalten sich (wenn man von Plurali-
sierbarkeit und Determinierbarkeit absieht)
wie gewhnliche Nomen: Sie werden durch
Adjektive oder durch rechtsadjungierte Ge-
nitiv- bzw. Prpositionalphrasen modifiziert
(11, 12):
(11)
a. Das hufige Beobachten des Kindes
b. Das schnelle Fahren im Auto
c. Das bequeme Reisen ohne Gepck
d. Das regelmige Verkaufen von Bil-
dern
(12)
a. Das Beobachten des Kindes
b. Das Fahren des Chauffeurs
c. Das Verkaufen von Bildern durch den
Museumsleiter
Den nominalen Infinitiven des Typs N-INF
stehen verbale Infinitivkonstruktionen (V-
INF) der Art (13, 14) gegenber:
Von der grundstzlichen Pluralisierbarkeit
der Derivativnominalisierungen gibt es wei-
tere Ausnahmen:
Esau (1973) betrachtet die Nicht-Pluralisier-
barkeit bestimmter Derivativnominalisierun-
gen als eine idiosynkratische Eigenschaft der
jeweiligen Bildung und wertet dies als ein
Argument fr die lexikalistische Position.
Ehrich gibt in Ullmer-Ehrich (1977) eine ak-
tionsartenspezifische Erklrung: Nicht plu-
ralisierbar sind Nominalisierungen von ter-
minativen Verben (accomplishments und achie-
vements in der Terminologie von Vendler
1957), welche sich auf einmalige und unwie-
derholbare Ereignisse beziehen. Vendler
(1967a) nennt diese Bildungen perfective no-
minals. Der aktionsartenspezifischen Erkl-
rung des Pluralisierungsverhaltens von Deri-
vativnominalisierungen stehen aber Beispiele
wie (7) entgegen:
(7)
a. Die Besteigungen des K1
b. Die Leerungen des Briefkastens
c. Die Reinigungen des Hallenbades
d. Die Suberungen der Partei
Die Verben in (7) sind ebenso wie die in (6)
terminativ. Ihre Nominalisierungen beziehen
sich auf abgeschlossene Ereignisse, also sol-
che, die zu einem bestimmten Ergebnis ge-
fhrt haben. Der Unterschied zwischen (6)
und (7) hat damit zu tun, ob wir dieses Er-
gebnis fr permanent und den Vorgang selbst
damit als unwiederholbar ansehen oder nicht.
Einen bestimmten Vorrat kann man nur ein-
mal verzehren, die Pluralnominalisierung (6a),
welche Wiederholung ausdrcken wrde,
macht daher keinen Sinn. Dagegen ist es b-
lich, da ein Briefkasten immer wieder geleert
wird und die Pluralnominalisierung (7b) ist
dementsprechend sinnvoll. Es sind also nicht
wie bei Infinitivnominalisierungen die Kon-
struktionseigenschaften des formalen Bil-
dungstyps, die Pluralisierungen der Art (6)
verbieten; ob eine Derivativnominalisierung
pluralisierbar ist, gehrt vielmehr zu den Ei-
genschaften, die sich auf die Wortbedeutung
beziehen und nicht ber morphologische Re-
geln festzulegen sind. Beispiele wie (7) spre-
444 VI. Nominalsemantik
unterschiedliche Distributionseigenschaften:
(17)
a. Die Beobachtung des Kindes wurde
angeordnet
b. Das Beobachten des Kindes wurde
angeordnet
c. *Das Kind beobachten wurde ange-
ordnet
Die unterschiedlichen Distributionseigen-
schaften weisen auf mgliche semantische
Unterschiede hin. Das Verhltnis von V-INF-
und N-INF-Konstruktionen ist fr die No-
minalisierungssemantik also problematisch
und bedarf der Klrung. Ich werde deshalb
im folgenden V-INF-Konstruktionen in die
Errterung miteinbeziehen, obwohl es sich bei
diesen Konstruktionen nicht um Nominalisie-
rungen im strengen Sinne handelt.
Im Englischen gibt es wie im Deutschen
zwei Typen von nomenbildenden Operatio-
nen, also Nominalisierungen im engeren
Sinne: Derivativnominalisierungen (18) und
Nominale Gerundien (19). Den Nominalen
Gerundien stehen die Verbalen Gerundien ge-
genber (20).
(18) Derivativnominalisierungen (N-DER)
a. The refusal of the offer was a pleasure
b. The introduction of the guests was a
pleasure
(19) Nominale Gerundien (N-GER)
a. The refusing of the offer was a plea-
sure
b. The introducing of the guests was a
pleasure
(20) Verbale Gerundien (V-GER)
a. Refusing the offer was a pleasure
b. Introducing the guests was a pleasure
Die Opposition zwischen nominalen und ver-
balen Gerundien stimmt in mancher Hinsicht
mit der zwischen nominalen und verbalen In-
finitiven berein: nominale Gerundien haben
prpositionale Attribute, verbale Gerundien
haben strukturellen Kasus; nominale Gerun-
dien werden durch den Artikel determiniert,
verbale Gerundien nicht. Anders als die no-
minalen Infinitive des Deutschen lassen sich
die nominalen Gerundien des Englischen plu-
ralisieren:
(21)
a. The refusings of the offers were a plea-
sure
b. The introducings of the guests were a
pleasure
Anders als die verbalen Infinitive des Deut-
schen lassen die verbalen Gerundien links-
adjungierte Agens-NPn im Genitiv zu:
Verbale Infinitive kommen wie die entspre-
chenden N-INFe in Subjekt- oder Objekt-
funktion vor. In ihrer internen Grammatik
unterscheiden sie sich aber von den nomina-
len Infinitiven: Verben in V-INF-Konstruk-
tionen werden nicht wie die entsprechenden
Nomen in N-INF-Konstruktionen durch Ge-
nitiv- oder Agentiv-NPn modifiziert. Sie re-
gieren vielmehr den Akkusativ (13a, d) oder
den Dativ (13e). Sie werden nicht durch Ad-
jektive, sondern durch Adverbien modifiziert
(14). Sie nehmen linksadjungierte PPn als At-
tribute (13b,c) und stehen gemeinhin ohne
Artikel.
V-INFe sind insofern nicht ohne weiteres
den Nominalisierungen zuzurechnen. Es gibt
aber Mischkonstruktionen, in denen sich ver-
bale und nominale Elemente verbinden:
(15) Hufiges den Beruf wechseln schadet der
Gesundheit
(16) Das Aufstze schnell Hinschreiben ist
sein grter Ehrgeiz
In (15) weist das Adjektiv die Konstruktion
als nominal aus, die linksadjungierte Akku-
sativ-NP hingegen kennzeichnet die Kon-
struktion als verbal. In (16) spricht die De-
termination durch den Artikel fr eine no-
minale, die Modifikation durch ein Adverb
fr eine verbale Konstruktion. Zu beiden Bei-
spielen gibt es rein verbale Infinitive (15,16)
und rein nominale (15,16):
(15) Hufig den Beruf wechseln schadet der
Gesundheit
(15) Hufiges Wechseln des Berufs schadet
der Gesundheit
(16) Aufstze schnell hinschreiben ist sein
grter Ehrgeiz
(16) Das schnelle Hinschreiben von Aufst-
zen ist sein grter Ehrgeiz
Semantisch erscheinen die verschiedenen Va-
rianten quivalent, jedenfalls ist es bezogen
auf die bisher diskutierten Beispiele nicht
leicht, Bedeutungsunterschiede zwischen V-
INFen, N-INFen und Mischkonstruktionen
anzugeben. Bezglich anderer Kontexte als
-macht Spa haben V-INFe und N-INFe aber
20. Nominalisierungen 445
(X
max
) die Phrase gesttigt ist.
Die hauptschliche Leistung der X-bar-
Theorie fr eine Nominalisierungsgramma-
tik besteht darin, syntaktisch wohlgeformte
Bildungen wie (2426) korrekt zu erzeugen
und ungrammatische wie (27,28) auszuschlie-
en.
(27) The destruction by the enemy *of the
city
(28) The enemys destruction of the city *by
Caesar
Interessant fr die Theorie sind diese Beispiele
deshalb, weil nur das Hinzutreten des jeweils
letzten Komplements die Konstruktionen un-
grammatisch macht. (Fr (27) gilt das natr-
lich nur unter der Voraussetzung, da the city
als Objekt von destruction und nicht als At-
tribut zu enemy aufgefat wird).
In der ursprnglichen Version der Theorie
(Chomsky 1970) werden (25) und (26) trans-
formationell abgeleitet, (25) ergibt sich aus
der Tiefenstruktur von (24a) durch AGENT-
POSTPOSING, NP-PREPOSING rckt
dann die Objekt-NP an die Spitze und erzeugt
so (26a). Da AGENT-POSTPOSING die
Agens-NP immer ans Ende bewegt, ist (27)
transformationell nicht ableitbar. (28) kann
durch die Festlegung der Projektionsstufe
verhindert werden, wenn man davon ausgeht,
da NPGEN und of NP auf derselben
Projektionsstufe N
max-1
wirksam werden und
diese zu N
max
erhhen.
In der um Theta-Rollen erweiterten lexi-
kalistischen Theorie haben nominalisierte
Nomen ebenso wie Verben eine bestimmte
Anzahl von Argumenten, denen im Lexikon
bestimmte Theta-Rollen zugewiesen sind. Die
Argumentstruktur des Verbs bleibt dabei in
der Nominalisierung erhalten (Prinzip der Ar-
gumentvererbung) bzw. darf nur nach zwei
Grundregeln der Argumentverschiebung (Wil-
liams 1981) verschoben werden:
In dieser Eintragung unterscheiden sich de-
stroy und destruction nur durch die Katego-
rienzuweisung (v. Stechow & Sternefeld, 1988,
Kap. 2). Williams (op.cit.) weist darauf hin,
da Nominalisierungen ein zustzliches Er-
eignisargument haben. In
(30) I consider that [destruction of the city
by evil forces]
steht that fr ein Ereignisargument R, zu wel-
chem das in Parenthese gesetzte komplexe
Nomen mit seinen zwei Argumenten (Agens
(22)
a. Bills refusing the offer was a pleasure
b. Janets introducing the guests was a
pleasure
Gerundien mit nur einem linksadjungiertem
Genitiv (23) lassen sich daher nicht ohne wei-
teres der Nominal- oder der Verbalklasse zu-
ordnen:
(23)
a. Bills refusing was a pleasure
b. Janets introducing was a pleasure
In der Diskussion um die Standardtheorie hat
fr die Unterscheidung zwischen nominalen
und verbalen Gerundien auch das Problem
der syntaktischen Kontrolle eine Rolle gespielt.
Nach Wasow & Roeper (1972) werden verbale
Gerundien von der Subjekt-NP des Matrix-
satzes kontrolliert, nominale Gerundien un-
terliegen keiner syntaktischen Kontrolle.
Thompson (1973) hat in ihrer Kritik an Wa-
sow & Roeper jedoch gezeigt, da die Kon-
trolleigenschaften von der jeweiligen Bedeu-
tung des Matrixverbs abhngen, z. B. kon-
trolliert avoid das verbale ebenso wie das no-
minale Gerundium (Bill avoids singing arias
vs. Bill avoids the singing of arias). Fr die
Unterscheidung der verschiedenen Gerun-
dialkonstruktionen ist das Kontrollproblem
mithin irrelevant. Fr die Nominalisierungs-
semantik kommt es vielmehr darauf an, die
Bedeutungsunterschiede zwischen den im ei-
gentlichen Sinne nomenbildenden Konstruk-
tionen N-DER und N-GER einerseits sowie
dem verbalen Konstruktionstyp V-GER an-
dererseits zu kennzeichnen.
2.2X-bar-Theorie und Nominalisierungen
Chomsky hat die X-bar-Theorie in Remarks
on Nominalizations (1970) entwickelt, um
strukturelle Parallelen zwischen Nominalisie-
rungen und Stzen syntaktisch zu rekonstru-
ieren.
(24)
a. The enemys destruction of the city
b. The enemy destroys the city
(25) The destruction of the city by the enemy
(26)
a. The citys destruction by the enemy
b. The city is destroyed by the enemy
Der Grundgedanke der X-bar-Theorie ist die
Einfhrung von Phrasen unterschiedlicher
Projektionsstufen, die den Grad der Komple-
xitt einer Phrase angeben. Lexikonelemente
der Kategorien N, V, Prp, A haben den
Komplexittsgrad Null (Schreibweise X bzw.
X). Mit jeder Erweiterung kann die Projek-
tionsstufe um Eins erhht werden (X
1
, X
2
...
X
n
), bis auf der maximalen Projektionsstufe
446 VI. Nominalsemantik
wort lautet: Ereignisnominalisierungen kom-
men in der Umgebung von Wahrnehmungs-
verben, Zeitadverbien und temporalen Pr-
positionen vor.
(33) I heard Peters singing of the Marseil-
laise
(34) Peters singing of the Marseillaise occur-
red at midnight
(35) Everything was quiet until Peters sin-
ging of the Marseillaise
Was sind Tatsachen? Strawsons ontologische
Antwort lautet: Tatsachen werden in wahren
Aussagen behauptet. Tatsachen sind nicht in
der Welt, sondern Aussagen ber die Welt.
Tatsachen haben keine raum/zeitlichen Attri-
bute, und man kann sich zu ihnen nicht in
Raum-/Zeitbezgen verhalten, sie nicht sehen
oder hren. Tatsachennominalisierungen sind
dementsprechend mit Wahrnehmungsprdi-
katen oder Temporalausdrcken nicht kom-
binierbar:
(36) *I heard Peters singing the Marseillaise
(37) *Peters singing the Marseillaise occur-
red at midnight
(38) *Everything was quiet until Peters sin-
ging the Marseillaise
Zu Tatsachen kann man bestimmte Einstel-
lungen haben, sich darber freuen oder sie
bedauern; man kann den Tatsachencharakter
von Sachverhalten auch bezweifeln oder be-
streiten. Tatsachenausdrcke (39) und Sach-
verhaltsausdrcke (40) sind dementsprechend
als Komplemente zu Verben der propositio-
nalen Einstellung verwendbar.
(39) Peters singing the Marseillaise was de-
nied
(40) Peters singing the Marseillaise is unli-
kely
Cresswell (1979) fragt, wie es mit Nominali-
sierungen der Art (41) steht:
(41)
a. The non-arrival of the train annoyed
us
b. The non-arriving of the train annoyed
us
Wenn wir mit Vendler davon ausgehen, da
nominale Konstruktionen (N-DER und N-
GER) Ereignisse denotieren, mssen wir dann
nicht auch die Nicht-Ankunft eines Zuges als
Ereignis auffassen? Der Auffassung, da auch
das Nicht-Stattfinden von etwas ein Ereignis
sei, stehen zwei Einwnde entgegen (vgl. dazu
Cresswell 1979): Man kann keinen Zeitpunkt
oder Ort finden, an dem sich das Nicht-
Stattfinden eines Ereignisses festmachen lt
(*The non-arrival of the train occurred at mid-
und Thema) prdiziert ist. Damit ergeben sich
fr destroy und destruction die folgenden Le-
xikoneintrge:
In beiden Eintrgen (29,31) ist die Thema-NP
auf die Position unmittelbar rechts neben dem
Kopf-Nomen destruction festgelegt, (27)
scheidet damit durch lexikalische Festlegung
aus. (28) wird durch das Theta-Prinzip aus-
geschlossen, wonach dieselbe thematische
Rolle nur einmal vergeben wird.
3. Die Bedeutung von
Nominalisierungen
3.1Tatsachen und Ereignisse
Im Hinblick auf die Bedeutung von Nomi-
nalisierungen stellt sich zunchst die Frage,
ob und inwieweit die oben betrachteten
Formklassenunterschiede eine semantische
Entsprechung haben. Denotieren z. B. deri-
vative Nominalisierungen andere Arten oder,
um es technisch auszudrcken, Sorten von
Entitten als nominale oder verbale Infinitive
bzw. nominale oder verbale Gerundien? Die
Errterung von Sortenunterschieden wurde in
die semantische Diskussion von Strawson
(1950b) und Vendler (1967a) eingebracht.
Beide diskutieren vor allem die Unterschei-
dung zwischen Tatsachen und Ereignissen,
Strawson unter primr logischen und onto-
logischen, Vendler unter primr linguistischen
Gesichtspunkten. Vendler bezieht die Form-
klassenunterscheidung zwischen verbalen und
nominalen Gerundien auf Sortenunter-
schiede: Verbale Gerundien denotieren Tat-
sachen (32a), nominale Gerundien denotieren
Ereignisse (32b).
(32)
a. Peters singing the Marseillaise was
surprising
b. Peters singing of the Marseillaise was
slow
Was sind Ereignisse? Strawsons ontologische
Antwort lautet: Ereignisse sind raum/zeitliche
Entitten, sie finden an bestimmten Orten, zu
bestimmten Zeiten statt, man kann sie sehen,
hren, daran teilnehmen. Was charakterisiert
die Ausdrcke einer Sprache, mit denen man
sich auf Ereignisse bezieht, oder anders aus-
gedrckt, was kennzeichnet Ereignisnomina-
lisierungen? Vendlers linguistische Ant-
20. Nominalisierungen 447
und inkorporierte Negationen verbieten.
Eine wichtige Rolle in der Diskussion um
verschiedene semantische Sorten von Nomi-
nalisierungen spielte in der Tradition der Ge-
nerativen Semantik die Unterscheidung zwi-
schen faktiven und nicht-faktiven Prdikaten
(Kiparsky & Kiparsky 1970, McCawley 1968,
Peterson 1979, Peterson & Wali 1985). Diese
Unterscheidung bezieht sich zunchst auf die
Wahrheitsprsuppositionen, die mit dem Ge-
brauch bestimmter Verben der propositiona-
len Einstellung verbunden sind. Komple-
mentstze im Kontext faktiver Verben gelten
als wahr prsupponiert (46,47), mit dem Ge-
brauch nicht-faktiver Verben verbindet sich
keine Wahrheitsprsupposition (48).
Aus der Prsuppositionsanalyse wurden zwei
Schlufolgerungen hinsichtlich der Denotate
von Komplementstzen und Nominalisierun-
gen gezogen:
1. Komplemente von faktiven Verben deno-
tieren Tatsachen, Komplemente von nicht-
faktiven Verben denotieren Sachverhalte.
2. Derivativnominalisierungen denotieren
Tatsachen, denn sie sind nur im Kontext fak-
tiver Verben mglich (McCawley 1968).
Die Faktivittsanalyse ist jedoch in drei
Punkten kurzschlssig:
1. Es gibt faktive Verben, die sich eindeutig
nicht auf Tatsachen, sondern auf Handlungen
beziehen, z. B. bereuen und kritisieren, und
die dennoch Derivativnominalisierungen als
Komplemente zulassen:
(51)
a. Hans bereut seine Absage
b. *Hans bereut die Tatsache, da er ab-
gesagt hat
night, *The non-arrival of the train occurred
at Florence); und es gibt keine Identittskri-
terien, aufgrund derer sich das Nicht-Ankom-
men des Zuges von der Nicht-Verheiratung
des Papstes unterscheiden lt. Cresswells L-
sung: Nominalisierungen der Art (3941)
sind Namen nicht von Ereignissen, sondern
von Propositionen (= Tatsachen oder Sach-
verhalten). Diese Feststellung kann allerdings
kein Argument dafr sein, Ereignisse ber-
haupt aus der Semantik zu verbannen. Be-
stimmte Verben und Prpositionen, die No-
minalisierungen als Komplemente nehmen,
verbieten nmlich Komplemente der Art (41),
also solche, die nur als Namen von Proposi-
tionen analysiert werden knnen (vgl. Vater
1976, Bayer 1986). Wir mssen daher davon
ausgehen, da die nominalisierten Komple-
mente dieser Verben etwas anderes bezeichnen
als Propositionen, nmlich Ereignisse.
(42)
a. Hans wartet auf die Ankunft des Zu-
ges
b. *Hans wartet auf die Nicht-Ankunft
des Zuges
c. Hans wartete darauf, da der Zug an-
kam (ankme)
d. *Hans wartete darauf, da der Zug
nicht ankme
(43)
a. Seit der Ankunft des Zuges sind fnf
Stunden vergangen
b. *Seit der Nicht-Ankunft des Zuges
sind fnf Stunden vergangen
c. Seit der Zug angekommen ist, sind
fnf Stunden vergangen
d. *Seit der Zug nicht angekommen ist,
sind fnf Stunden vergangen
(44)
a. Hans hat die Ankunft des Zuges ver-
pat
b. *Hans hat die Nicht-Ankunft des Zu-
ges verpat
(45)
a. Hans hat die Ankunft des Zuges ge-
filmt
b. *Hans hat die Nicht-Ankunft des Zu-
ges gefilmt
c. Hans hat gefilmt, wie der Zug ange-
kommen ist
d. *Hans hat gefilmt, wie der Zug nicht
angekommen ist
Wir unterscheiden deshalb als zwei grundle-
gende semantische Kategorien: (i) Nominali-
sierungen von Propositionen, die als solche die
Inkorporierung der Negation zulassen, und
(ii) Ereignisnominalisierungen, die als Nomi-
nalisierungen von Prdikaten zu gelten haben
448 VI. Nominalsemantik
4. Derivativnominalisierungen sind im Deut-
schen nicht erlaubt in der Umgebung von
Verben, die ausschlielich Propositionen als
Komplemente zulassen, und zwar auch dann
nicht, wenn die fraglichen Verben faktiv sind.
Im Deutschen, so lt sich aus diesen Beob-
achtungen ableiten, denotieren derivative No-
minalisierungen niemals Propositionen (Tat-
sachen oder Sachverhalte), sondern Ereig-
nisse oder Resultate von Ereignissen. Fakti-
vitt spielt fr die Zulssigkeit und die Sor-
tenzuweisung von Nominalisierungen im
Deutschen keine Rolle.
Im Japanischen ist wie im Deutschen die
Unterscheidung nach Propositionen und Er-
eignissen primr. Darber hinaus ist aber
Faktivitt ein auch morphologisch markiertes
Unterscheidungsmerkmal (vgl. Kuno 1973).
Das Japanische hat die Komplementierungs-
partikel no fr Ereigniskomplemente, koto
und to fr Propositionskomplemente, wobei
koto wahre (bzw. vom Sprecher fr wahr ge-
haltene) Propositionen (= Tatsachen) kenn-
zeichnet, whrend to Propositionen ohne
Wahrheitsanspruch (= Sachverhalte) charak-
terisiert:
(52)
a. Hans kritisiert Pauls Absage
b. *Hans kritisiert die Tatsache, da
Paul abgesagt hat
2. Derivativnominalisierungen stehen hufig
im Kontext von (nicht-propositionalen) Ge-
genstandsprdikaten, fr die die faktiv/non-
faktiv- Unterscheidung keine Rolle spielt. In
diesen Kontexten beziehen sie sich nicht auf
Ereignisse, sondern auf Gegenstnde, die aus
diesen Ereignissen resultieren (Resultatnomi-
nalisierungen):
(53)
a. Die Bebauung des Gebiets wurde ein-
geebnet
b.
Die bersetzung des Textes ist fehler-
haft
c. Edisons Erfindung ist praktisch
In Nominalisierungsgrammatiken des
Aspects-Formats ist deshalb vorgeschlagen
worden (Fraser 1970, Stockwell, Schachter &
Partee 1973b, Esau 1973), Nominalisierungen
auf Komplementsatzkonstruktionen zu be-
stimmten Trgernomen zurckzufhren, z. B.
das Ereignis, da ..., die Handlung, da ...,
der Inhalt dessen, was..., das Resultat davon,
da ... etc. Eine Kritik an diesen Vorschlgen
enthlt Ullmer-Ehrich 1977.
3. Derivativnominalisierungen sind, jedenfalls
im Deutschen, auch als Komplemente zu
nicht-faktiven Verben mglich, sie mssen
dann aber als Namen von Handlungen oder
Ereignissen interpretierbar sein.
(54) Hans kndigt seine Ablehnung an
Hans hat Pauls Rcktritt befohlen
des vorigen Abschnitts gehren zu unter-
schiedlichen Sorten von Entitten. Aber was
fr eine Sorte von Entitten sind Ereignisse?
Wir haben oben Strawsons Position zitiert,
wonach Ereignisse in der Welt sind. Die
Frage ist: Als was sind Ereignisse in der Welt
3.2Ereignisse und Ereignisbegriffe
Realistische oder intensionalistische
Ereignissemantik
Ereignisse und Tatsachen dies ist das Fazit
20. Nominalisierungen 449
len Zeitmessung beziehen kann. Freilich sind
diese Einheiten der Zeitmessung nicht in dem-
selben Sinn real wie Personen, Gegenstnde
oder Ereignisse, da sie auf konventioneller
Festlegung beruhen. Insofern mu auch eine
realistische Ontologie wie die Davidsons letzt-
lich auf konventionalisierte Festlegungen re-
kurrieren.
Montague (1960) diskutiert verschiedene
Explikationen des Ereignisbegriffs:
1. Die nominalistische Auffassung, wonach
Ereignisse Beschreibungen von dem sind,
was zu bestimmten Zeitpunkten geschieht.
2. Die extensionalistische Auffassung, der-
zufolge Ereignisse als Mengen von Zeit-
punkten anzusehen sind.
3. Die intensionalistische Auffassung, wo-
nach Ereignisse Eigenschaften von Zeit-
punkten sind.
Gegen die erste Auffassung spricht nach
Montague, da durch sie der Begriff des Er-
eignisses auf beschreibbare Ereignisse einge-
schrnkt wird. Inexpressible events wrde es
nach dieser Auffassung nicht geben knnen.
Die extensionalistische Auffassung schliet
aus, da zwei Ereignisse, die stets zur selben
Zeit vorkommen, also koextensiv sind, den-
noch als verschiedene Ereignisse gelten kn-
nen. Beispiel: Jemand knipst das Licht an (e)
und Das Licht geht an (e). Wann immer e
geschieht, geschieht auch e. Dennoch knnen
e und e unterschiedliche Eigenschaften und
Folgen haben, weshalb sie als verschieden an-
zusehen sind.
Die intensionalistische Auffassung, die
Montague selbst favorisiert, fhrt striktere
Identittsbedingungen ein. Zwei Eigenschaf-
ten F und F sind identisch, wenn in jeder
mglichen Welt, in der F ein Individuum a
charakterisiert, auch F auf a zutrifft. Bezo-
gen auf Ereignisse als Eigenschaften von Zeit-
punkten heit dies: zwei Ereignisse e und e
sind identisch, wenn in jeder mglichen Welt,
in der e eine gegebene Zeit t charakterisiert,
auch e auf t zutrifft.
Beide, Montague und Davidson, betrach-
ten die Identitt von Ereignissen ausschlie-
lich im Hinblick auf das Kriterium der Zeit-
gleichheit. Gegen eine solche Beschrnkung
ist kritisch eingewendet worden (z. B. von
Lemmon 1967), da Ereignisse zeitlich und
rumlich determiniert sind. Der Tod des So-
krates und Das Witwe-werden der Xanthippe
ereignen sich in jeder Welt, in der Xanthippe
die Frau des Sokrates ist, zur selben Zeit,
aber mglicherweise an verschiedenen Orten,
als Individuen, als Eigenschaften? David-
sons (1967a) inzwischen klassische Antwort
auf diese Frage lautet: Ereignisse sind Indivi-
duen, sie bevlkern unsere Erde hnlich wie
Personen und Gegenstnde, sie haben be-
stimmte Eigenschaften und stehen in be-
stimmten Relationen zu anderen Individuen.
Auf der Ebene der logischen Form macht
Davidson keinen Unterschied zwischen ereig-
nis- oder handlungsdenotierenden Verben ei-
nerseits und Nominalisierungen, die auf Er-
eignisse oder Handlungen referieren, anderer-
seits. Stze, die adverbial modifizierte Hand-
lungsverben enthalten, werden wie folgt re-
prsentiert:
(59) John buttered the toast with a knife in
the bathroom
(60) (e) (Butter (John, the toast,e) & With a
knife (e) & In the bathroom (e))
In dieser Darstellung reprsentiert e das Er-
eignisargument. Jedes n-stellig scheinende
Prdikat wie z. B. butter wird als n+1-stellig
aufgefat.
Davidsons realistische Ontologie setzt vor-
aus, da man Identittskriterien angeben
kann, die es ermglichen, ein Ereignis eindeu-
tig von anderen zu unterscheiden. Davidson
diskutiert das Identittsproblem an einem
Beispiel von Austin: Wenn A den Abzugshahn
einer geladenen Schuwaffe gezogen und auf
B gezielt hat, ist dieses Ereignis e identisch
mit dem Ereignis e (= Schieen von A auf
B)? Davidson bejaht die Frage, e und e sind
identisch, weil sie zeitlich nicht voneinander
zu trennen sind. Wann immer e geschieht,
geschieht zugleich e. As denkbare Entschul-
digung, er habe zwar e beabsichtigt, nicht
aber e, ndert nach Davidson nichts an der
Identittsfestlegung, sondern besagt lediglich,
A habe nicht gewut, da e = e. Wenn je-
mand mit einer geladenen Schuwaffe auf
jemanden schiet (e), wird das Opfer von
einer Kugel getroffen (e). Gilt deshalb auch
hier e = e? Davidsons Antwort ist negativ, e
und e sind in diesem Fall verschieden, denn
e geschieht kurz vor e. Die Identitt von
Ereignissen ist damit auf die Identitt von
Zeitpunkten oder -intervallen zurckgefhrt.
Doch wie begrndet man die Identitt von
Zeitpunkten? Eine denkbare Antwort ist: Die
Zeitpunkte t und t sind identisch, wenn zur
Zeit t und t genau dasselbe geschieht. Diese
Antwort scheidet fr Davidson natrlich aus.
Sein Identittskriterium setzt voraus, da
man sich auf die Einheiten der konventionel-
450 VI. Nominalsemantik
verschiedenen Bedeutungen bleiben unbe-
rcksichtigt. Fr das Englische geht Monta-
gue dementsprechend davon aus, da Nomi-
nalausdrcke wie rising, denen man den Kon-
struktionstyp V-GER vs. N-GER so nicht
ansieht, ambig sind zwischen einer generi-
schen und einer partikularen Lesart. Im Deut-
schen lt sich zwischen beiden Lesarten, der
generischen und der partikularen, bis zu
einem gewissen Grad morphologisch differen-
zieren. Verbale Infinitive (V-INF) denotieren
stets generische Ereignisse, sie sind mit defi-
niten Temporalausdrcken daher nicht kom-
binierbar:
(66) *Die Mlltonne gestern leeren war mh-
sam
Nominale Infinitive (N-INF) und Derivativ-
nominalisierungen (N-DER) sind dagegen im
Kontext definiter Temporalausdrcke mg-
lich. Sie denotieren Partikularereignisse.
(67)
a. Das gestrige Leeren der Mlltonne
war mhsam
b. Die gestrige Leerung der Mlltonne
war mhsam
Barwise & Perry (1983) sehen fr das Engli-
sche den Unterschied in hnlicher Weise: Ge-
rundive nominals are used to refer not only
to events, but also to general types of events.
By contrast, derived nominals refer to specific
situations or events (S. 77). Barwise & Perry
geben zum Beleg ihrer These die folgenden
Beispiele:
(68)
a. Cat hair being in the butter always
means a cat is in the house
b. Jackies biting Molly always upsets
the Perrys
(69)
a. *That hair in the butter always means
a cat is in the house
b. *The situation, when Jack bit Molly,
always upsets the Perrys
Bei den Beispielen in (69) handelt es sich
freilich nicht wie von Barwise & Perry
nahegelegt um Derivativnominalisierun-
gen, sondern um gewhnliche Basisnomen.
Worauf es in ihrer Argumentation aber an-
kommt, ist die semantische Differenzierung
zwischen nominalem Bildungstyp (69) und
verbalem Bildungstyp (68).
Thomason (1985) kritisiert diese Auffas-
sung von Barwise & Perry und vertritt als
Gegenposition die These, da Derivativno-
minalisierungen sich auf Ereignisse beziehen,
whrend Gerundien Namen von Propositio-
nen sind. Diese Position entspricht der oben
weshalb sie als verschiedene Ereignisse anzu-
sehen sind.
Die erweiterte intensionalistische Auffas-
sung, wonach Ereignisse Eigenschaften von
Raum-/Zeitregionen sind, fhrt zu strikteren
Identittskriterien, sie hat aber auch ihren
Preis: Namen von Eigenschaften sind Allge-
meinbegriffe und Ereignisse als Eigenschaften
zu analysieren, heit, die Rede von Ereignis-
sen auf generische Ereignisse einzuschrnken.
Montague spricht von instantaneous generic
events. In
(61) Das Aufgehen der Sonne ist (immer) ein
groartiges Schauspiel
wird die Eigenschaft, ein groartiges Schau-
spiel zu sein, nicht einem bestimmten Son-
nenaufgang zugeschrieben, sondern einem Er-
eignistyp. (61) kann dementsprechend durch
(62) formal reprsentiert werden (vgl. Mon-
tague 1960):
(62) Q = t (Aufgehen (die Sonne,t)) &
Groartiges Schauspiel(Q)
Wie aber steht es mit besonderen Sonnenauf-
gangsereignissen (in Montagues Redeweise in-
stantaneous particular events)?
(63) Hans hat diesen Sonnenaufgang ver-
schlafen
(63) drckt nicht aus, da Hans ein generi-
sches Ereignis verschlafen hat, sondern da
ihm ein bestimmtes Partikularereignis entgan-
gen ist. Montague schlgt vor, auch Parti-
kularereignisse als Eigenschaften von Zeit-
punkten aufzufassen, allerdings als Eigen-
schaften von solcher Besonderheit, da sie in
der Regel nur einem einzigen Zeitpunkt (-in-
tervall) zukommen. Zur formalen Darstellung
dieser Intuition fhrt Montague eine Prdi-
katskonstante P ein mit der Bedeutung Ist
ein Individualereignis. Aufgehen wird dann
als Prdikat interpretiert, das Individuen,
aber eben auch Prdikatskonstanten vom Typ
P, als Argumente nimmt.
(64) Aufgehen (P, die Sonne)
ist dann zu lesen als P ist ein bestimmtes
individuelles Aufgehen der Sonne. Die For-
mel (65) besagt dann, da Hans genau das-
jenige Aufgehen der Sonne verschlafen hat,
welches durch die Eigenschaft P unik charak-
terisiert ist.
(65) Aufgehen (P, die Sonne) & Verschlafen
(Hans, P)
Montagues berlegungen sind nicht primr
linguistisch motiviert, sondern sprachphilo-
sophisch. Verschiedene Formklassen von Er-
eignisausdrcken mit ihren (mglicherweise)
20. Nominalisierungen 451
lauf als zeitlich geschlossen (mit Anfang und
Ende) betrachtet wird. Bartsch (1972) spricht
in diesem Zusammenhang davon, da die In-
finitivnominalisierung imperfektive (zeitlich
offene) Vorgnge bezeichnet, whrend die De-
rivativnominalisierung perfektive (zeitlich ge-
schlossene) Ereignisse denotiert. Damit stellt
sich die Frage, worin Vorgnge und Ereig-
nisse sich semantisch unterscheiden. Zwei Ge-
sichtspunkte sind fr die Klrung dieser
Frage relevant: (i) im Bereich der Nominal-
Semantik die strukturelle Gegenberstellung
von Individualnomen und Massennomen sowie
(ii) im Bereich der Verb-Semantik die Ak-
tionsartenunterscheidung zwischen termina-
tiven und nicht-terminativen Verben.
(i) Massennomen teilen mit Infinitivnomi-
nalisierungen nicht nur strukturelle Eigen-
schaften (hinsichtlich Determinierbarkeit und
Pluralisierbarkeit s. o.), sondern auch seman-
tische: So wie jede Teilportion eines gegebe-
nen Quantums Wasser selbst ein Quantum
Wasser ist, so ist jeder Ausschnitt aus einem
Vorgang Reisen auch eine Instantiierung des
Vorgangs Reisen. Derivativnominalisierun-
gen verhalten sich in dieser Hinsicht anders,
sie teilen die referentiellen Eigenschaften von
Individualnomen: So wie nicht jeder Teil von
einem Stuhl ein Stuhl ist, so instantiiert nicht
jeder Ausschnitt einer Reise selbst eine Reise,
sondern bezeichnet nur einen Teil davon: eine
Reiseetappe. M. a. W. Infinitivnominalisierun-
gen haben wie Massennomen kumulative Re-
ferenz (diese Ausdrucksweise stammt von
Quine 1960). Derivativnominalisierungen tei-
len mit anderen Individualnomen das Merk-
mal der holistischen Referenz.
(ii) Terminative Verben (accomplishments
und achievements in der Terminologie von
Vendler 1957), also solche, die sich auf Zu-
standsvernderungen beziehen, sind hinsicht-
lich ihrer zeitlichen Eigenschaften ebenfalls
holistisch zu deuten. Nicht-resultative Zu-
stands- und Vorgangsverben (activities und
sta-
tes bei Vendler) haben dagegen zeitlich ku-
mulative Bedeutung (vgl. auch Galton 1984,
Lbner 1988, Bach 1986).
(71) Terminativ
Hans lst das Problem
(72) Nicht-Terminativ
Hans denkt ber das Problem nach
Whrend (72), wenn es fr eine bestimmte
Zeitspanne T gilt, auch auf beliebige Teilin-
tervalle von T zutrifft, kann (71) nur auf T
in seiner Gesamtheit, aber nicht auf jedes
beliebige Teilintervall von T zutreffen.
fr den Vergleich von verbalen und nominalen
Gerundien vertretenen Auffassung. Der hier
relevante Formklassenunterschied zwischen
V-GER und N-GER wird jedoch von Tho-
mason ebensowenig diskutiert wie von Bar-
wise & Perry oder von Montague. Das Bei-
spiel (68b) macht im brigen deutlich, da
verbale Gerundien nicht, wie oben angenom-
men, allein Propositionen denotieren, son-
dern auch fr den Bezug auf Ereignisse ver-
wendbar sind. Der Satz drckt nicht aus: Die
Perrys sind immer emprt ber (ein und)
die(selbe) Tatsache, (nmlich) da Jack Molly
beit, sondern Wann immer Jack Molly
beit, sind die Perrys emprt darber. Die
verbalen Gerundien des Englischen sind also
sortenambig zwischen dem Bezug auf Tatsa-
chen und Sachverhalte (= Propositionen) ei-
nerseits und dem Bezug auf generische Ereig-
nisse andererseits. Die V-INFe des Deutschen
lassen hingegen nur den Bezug auf generische
Ereignisse zu. N-INFe wiederum beziehen
sich ebenso wie Derivativnominalisierungen
auf partikulare Ereignisse, niemals auf Pro-
positionen. Damit stellt sich die Frage, ob
nominale Infinitive und Derivativnominalisie-
rungen Konstruktionsvarianten mit gleicher
Bedeutung sind oder ob es einen semantischen
Unterschied zwischen ihnen gibt.
3.3Nominalisierungen und Aspekt
Man kann ein Ereignis quasi von innen in
seinem kontinuierlichem Zeitablauf oder von
auen als ein zeitlich abgeschlossenes Ganzes
betrachten. In Sprachen mit Aspektsystem
wird die interne Perspektive durch den imper-
fektiven, die externe durch den perfektiven
Aspekt ausgedrckt (Comrie 1976). Das
Deutsche zhlt nicht zu den Aspektsprachen;
Bedeutungsunterschiede, die den Aspektop-
positionen entsprechen, lassen sich im Deut-
schen aber durch die Verwendung verschie-
dener Typen von Nominalisierungen zum
Ausdruck bringen.
(70)
a. Das Reisen ohne Gepck hat Spa
gemacht
b. Die Reise ohne Gepck hat Spa ge-
macht
Die Infinitivnominalisierung in (70a) ist im-
perfektiv, sie bezieht sich auf den Verlauf einer
Reise in ihren verschiedenen Stadien unter
Absehung von ihrem Anfang und/oder Ende.
Die Derivativnominalisierung in (70b) ist per-
fektiv, sie bezieht sich auf das Gesamtereignis
Reise, das unter Absehung von seinem Ver-
452 VI. Nominalsemantik
(76) [ DUR, + TERM]
a. *Hans kam seit zwei Stunden an
b. Hans kndigte den Besuch seit zwei
Tagen an
c. Hans kam in zwei Stunden an
d. *Hans kndigte den Besuch in zwei
Stunden an
(77) [ DUR, TERM]
a. Hans hustete seit zwei Wochen
b. *Hans hustete in zwei Wochen
Terminative Verben (74,76) verbieten in der
Regel die Kombination mit Durativadverbia-
len oder durativen Begrenzungsadverbialen
seit + Zeitangabe. Wo solche Kombinatio-
nen zulssig sind wie in (76b) ist das
Verb nicht wie in (75b) kontinuativ, sondern
iterativ zu deuten. Durative Terminative (74)
lassen die Kombination mit dem durativen
Begrenzungsadverbial in + Zeitangabe zu,
bei nicht-durativen Terminativen ist in +
Zeitangabe nicht als Durativadverbial, son-
dern als Temporaladverbial mit nachzeitiger
Bedeutung aufzufassen (76c). Nicht-termina-
tive Verben (75,77) verbieten die Kombina-
tion mit in + Zeitangabe. Die Kombination
mit seit + Zeitangabe ist zulssig, hat aber
unterschiedliche Lesarten: kontinuativ bei du-
rativen und iterativ bei nicht-durativen Ter-
minativen (vgl. 75a vs. 77a).
Die obige Feststellung ber die Aspekt-
funktion von Nominalisierungen lt sich
nun dahingehend przisieren, da imper-
fektivierende Infinitivnominalisierungen
stets, also auch als Nominalisierungen von
terminativen Verben, vom zeitlichen Ab-
schlu der Denotatsituation absehen, wh-
rend umgekehrt ung-Nominalisierungen sich
grundstzlich, also auch als Nominalisierun-
gen von nicht-terminativen Verben auf Situa-
tionen mit zeitlichem Abschlu beziehen.
Testkriterium dafr ist die Kombinierbarkeit
mit terminativen Prdikaten:
Nominalisierungen teilen einerseits mit ge-
whnlichen Basisnomen (wie Maus (N
1
INDIV
),
Mutter (N
2
INDIV
) oder Mehl (N
1
MASS
)) Eigen-
schaften der kategorialen oder typenlogischen
Bedeutung. Mit den Basisverben (wie genesen,
schwimmen, ankommen, nicken (V
1
) oder zer-
stren, belagern, finden, ablehnen (V
2
)) verbin-
det sie andererseits die lexikalische Bedeu-
tung, z. B. die Argumentstruktur (s. o.) und
die Aktionsart. Fr die semantische Charak-
terisierung von deverbativen Nominalisierun-
gen spielt daher das Zusammenwirken der
Aktionsartenbedeutung des nominalisierten
Verbs mit der Aspektbedeutung der Nomi-
nalisierungsoperation eine wichtige Rolle.
Nach den Merkmalen der Terminativitt
und der Durativitt lassen sich fr das Deut-
sche vier Verbaktionsarten unterscheiden (vgl.
Andersson 1972).
(73)
a. [+ DUR, + TERM]: genesen, heilen,
leeren, zerstren, rumen, vertreiben
b. [+ DUR, TERM]: schwimmen,
wandern, tanzen, belagern, verfolgen,
beobachten
c. [ DUR, + TERM]: ankommen, ein-
treten, erreichen, versagen, ablehnen
d. [ DUR, TERM]: springen, husten,
nicken
Terminativa sind Verben der Zustandsvern-
derung, sie beziehen sich auf zeitlich geschlos-
sene Handlungen, Prozesse und Vorkomm-
nisse mit inhrentem Abschlu. Nicht-termi-
native Aktivitts- und Zustandsverben bezie-
hen sich auf zeitlich offene Vorgnge, die aber
einen kontigenten Abschlu haben knnen.
Kanonische Kontexte fr die Klassifizierung
von Verben und Verbphrasen nach Aktions-
arten sind bestimmte Zeitadverbien und Ad-
verbien der Dauer.
(74) [+ DUR, + TERM]
a. *Die Wunde heilte zwei Monate lang
b. *Die Polizei rumte das Haus zwei
Stunden lang
c. Die Wunde heilte in zwei Monaten
d. Die Polizei rumte das Haus in zwei
Stunden
(75) [+ DUR, TERM]
a. Hans schwamm seit zwei Stunden im
See
b. Galileo beobachtete den Stern seit
zwei Jahren
c. * Hans schwamm in zwei Stunden im
See
d. *Galileo beobachtete den Stern in
zwei Jahren
20. Nominalisierungen 453
semantischem Typ festhlt, dann korrespon-
diert der erhhte Typ einer anderen (komple-
xeren) syntaktischen Kategorie als der einfa-
che Typ. Es gibt verschiedene Auswege aus
dieser Zwickmhle:
1. Man gibt die Forderung nach Struktur-
identitt von syntaktischer Kategorie und se-
mantischem Typ auf. Hans und Schlafen oder
da Hans schlft sind dann von derselben
syntaktischen Kategorie, aber nicht vom sel-
ben semantischen Typ. Thomason (1976) hat
fr die Analyse von that-Komplementen die-
sen Weg eingeschlagen.
2. Man subkategorisiert die syntaktischen Ka-
tegorien nach Typenunterscheidungen und
lt auch variable Typenindizes (floating
types) zu. Dies ist ein Vorschlag von Parsons
(1977). Hans, Schlafen und da Hans schlft
haben dann jeweils einen festen Typenindex,
nmlich NP
e
, NP
e,t
bzw. NP
s,t
, wobei s,t
der Typ eines Komplementsatzes ist. Ein in-
transitives Verbal wie langweilig sein hat einen
variablen Typenindex IV
*,t
mit * als einer
Variablen fr e, e,t oder s,t, ein intran-
sitives Verb wie froh sein hat dagegen einen
festen Index IV
e
. Zustzlich wird festgelegt,
da Ausdrcke, die miteinander kombiniert
werden, kompatible Typenindizes haben ms-
sen. Damit leitet das System Hans ist lang-
weilig, Hans ist froh, Schlafen ist langweilig
und Da Hans schlft, ist langweilig in ein-
heitlicher Weise her und schliet zugleich
Kombinationen wie *Schlafen ist froh und
*Da Hans schlft, ist froh aus.
3. Man kann auf Typen verschiedener Stufung
verzichten, wenn man verschiedene Sorten
von Individuen zult: Objektindividuen, Er-
eignisindividuen, Eigenschaftsindividuen etc.
Diesen Weg schlagen Reichenbach (1947)
und, im Anschlu an Davidson (1967a),
Bartsch (1972), Ullmer-Ehrich (1977) und
Bierwisch (1989) ein.
Reichenbach (1947, 48) reprsentiert No-
minalisierungen durch event splitting als kom-
plexe Prdikate, die aus Stzen gebildet und
zu Ereignisvariablen v prdiziert sind. Wenn
F(a) die allgemeine Form der prdikatlogi-
schen Darstellung eines elementaren Satzes
ist, so hat die korrespondierende Nominali-
sierung die Form [F(a)]*(v):
(84) George VI is crowned
Be crowned (George VI)
(85) The coronation of George VI
(v) ([Be crowned (George VI)]*(v))
Hier ist v der Name des Ereignisses, welches
die Eigenschaft [F(a)]* hat.
Ehrich inkorporiert in Ullmer-Ehrich
(1977) eine modifizierte Version des Rei-
Die Aspektbedeutung von Nominalisierungen
spielt in den Analysen von Esau (1973), Ull-
mer-Ehrich (1977) und Bartsch (1981, 1983)
eine zentrale Rolle. Eine Einbeziehung dieses
Gesichtspunkts der Nominalisierungsseman-
tik in neuere Theorieformate steht noch aus.
4. Die formale Semantik von
Nominalisierungen
4.1Typenlogik und Nominalisierungen
In der Montague-Grammatik wird jeder syn-
taktischen Kategorie ein strukturidentischer
(homomorpher) semantischer Typ zugeord-
net. Ausgehend von den elementaren Grund-
typen e (fr Individuennamen) und t (fr
Satznamen) lassen sich komplexe Typen be-
liebiger Stufung bilden. Intransitive Verben
etwa haben den Typ e,t. Ein Ausdruck die-
ses Typs ist ein Funktor, der, angewendet auf
einen Ausdruck vom Typ e, einen Ausdruck
vom Typ t ergibt. Wie steht es nun mit Infi-
nitivnominalisierungen in Stzen wie
(82)
a. Schlafen ist langweilig
b. Tanzen macht Spa
Langweilig sein und Spa machen haben den
Typ e,t. Die Nominalisierungen Schlafen
und Tanzen mten demnach vom Typ e sein,
also auf Individuen referieren. Das ist jedoch
nicht der Fall, die Eigenschaft langweilig zu
sein wird in (82) nicht einem besonderen
Schlafereignis zugeschrieben, sondern dem
generischen Ereignis Schlafen (vgl. Ab-
schnitt 3.2). Ist langweilig denotiert demnach
die Eigenschaft einer Eigenschaft und der se-
mantische Typ mu um eine Stufe zu
e,t,t erhht werden:
(83) Schlafen ist langweilig
e,t e,t,t
Diese Analyse ist jedoch problematisch fr
einfache Stze wie Hans ist langweilig, bei
denen wir das intransitive Verb nicht als
e,t,t, sondern als e,t analysieren wol-
len. Ist langweilig hat dann zwei verschiedene
Typen, den einfachen und den um eine Stufe
erhhten, was zu einer unbefriedigenden
Komplizierung der Grammatik fhrt. Wenn
man nmlich an der Forderung nach Struk-
turidentitt von syntaktischer Kategorie und
454 VI. Nominalsemantik
erhhte Stelligkeit. Dies, ebenso wie die Auf-
fassung, da Eigenschaften Individuen sind,
erinnert an die Davidson-Lsung, die in allen
neueren Anstzen zur Analyse von Nomina-
lisierungen eine deutliche Renaissance erfhrt.
4.2Ereignissemantik ohne
Ereignisindividuen (Cresswell)
In Cresswells Ansatz werden die Ausdrcke
einer natrlichen Sprache in einer -katego-
rialen Sprache syntaktisch analysiert. Diese
baut auf zwei Grundkategorien auf, der Ka-
tegorie der Stze (0) und der Kategorie der
Individuenausdrcke (1). Die brigen Kate-
gorien werden durch funktionale Ableitung
gewonnen. So ist 0,1 die Kategorie der
intransitiven Verben, die aus Individuen-
ausdrcken (Kategorie 1) Stze (Kategorie 0)
machen. Fr die semantische Deutung der
syntaktischen Strukturen ist allein der Funk-
tor-/Argumentzusammenhang wesentlich; die
Reihenfolge, in der die semantischen Korre-
late der natrlichsprachlichen Ausdrcke auf-
gereiht sind, spielt fr die Interpretation keine
Rolle und unterliegt auf der Ebene der syn-
taktischen Tiefenstrukturen auch keiner Be-
schrnkung. Ein Subjekt-Term etwa kann am
Anfang oder am Ende eines syntaktisch ana-
lysierten Satzes stehen, er mu als Funktor
der Kategorie 0,0,1 aber stets ber einem
Ausdruck der Kategorie 0,1 als seinem Ar-
gument operieren.
Cresswell (1973) behandelt Nominalisie-
rungen als das Ergebnis von tiefensyntakti-
schen Operationen. Er unterscheidet drei No-
minalisierungsoperatoren: nom
1
macht aus
Stzen Terme, nom
2
macht Nomen aus in-
transitiven Verben, nom
3
macht Nomen aus
transitiven Verben. Damit ergeben sich die
folgenden Kategorienzuweisungen:
nom
1
: 0, 0,1, 0
nom
2
: 0,1, 0,1
nom
3
: 0,1, 0,1,1
Die Nominalisierung I hate Bills leaving litter
wird von Cresswell (1973) als Ergebnis einer
nom
2
-Operation behandelt und (im Gegensatz
zu den in Abschnitt 2.1 angenommenen Kri-
terien) als nominales Gerundium aufgefat.
Der nominale Charakter ergibt sich fr Cress-
well aus der Tatsache, da das Gerundium
durch einen possessiven Genitiv determiniert
ist. Das Possesiv-Morphem s ist als ein Aus-
druck der Kategorie 0,0,1, 0,1, 1
analysiert und macht aus Individuenausdrk-
ken der Kategorie 1 Determinatoren, welche
ihrerseits Nomen der Kategorie 0,1 als Ar-
gumente nehmen und daraus Terme der Ka-
chenbach-Vorschlags in eine Kategorialgram-
matik des PTQ-Formats. Nominalisierungen
gehen dabei aus morphologischen Operatio-
nen ber Verbstmmen hervor. In die Seman-
tiksprache werden sie als unanalysierte Ereig-
nisprdikate F* bersetzt und durch Korres-
pondenzregeln zu Stzen in Beziehung ge-
setzt. (85) hat dann die semantische Darstel-
lung (86a), woraus sich durch -Konversion
(86b) ergibt:
(86)
a. P (v) [P(v) & VON (v, George VI)]
(coronate*)
b. (v) [coronate* (v) & VON (v, George
VI)]
Die Korrespondenzregeln beziehen Formen
vom Typ (86b) auf Nominalisierungsopera-
tionen ber temporalisierten Stzen und ord-
nen so das Argument im Nachbereich der
VON-Relation dem Agens- oder dem Patiens-
argument des Verbs zu:
(87)
(v) [(coronate* (v) VON (v, George VI))
(t
i
)]
(v) [((Nom (coronate (x, George VI)) (v))
(t
i
)]
Einen sortenlogischen Ansatz vertreten in
neueren Arbeiten Chierchia (1982) und Tur-
ner (1983). Chierchia entwickelte im An-
schlu an Vorschlge von Cocchiarella (1976,
1978) eine (um Intensionen erweiterte) mehr-
sortige Logik IL*, in der Prdikate als Indi-
viduenausdrcke analysiert werden. Prdi-
kation ist als Relation H zwischen Individuen
verschiedener Sorten (gewhnlichen Indivi-
duen und Eigenschaftsindividuen) aufge-
fat:
(88) H(Dancing, John)
John hat die Tanz-Eigenschaft
John is dancing
Mit der Relation H ist eine Funktion H*
systematisch assoziiert, welche elementare
Prdikatausdrcke zu ihren Nominalisierun-
gen in Beziehung setzt:
(89) H*(u) = {u: H (u,u)}
Die Nominalisierung Dancing bezieht sich da-
nach auf die Menge der u, die die Eigenschaft
haben, ein Tanzen zu sein:
(90) H*(Dancing) = {u: H(Dancing, u)}
Johns dancing is fun hat dann die H-Repr-
sentation:
(91) (u) [H (Dancing, John, u) & Fun(u)]
Wie man sieht, hat die Nominalisierung ge-
genber dem elementaren Prdikat eine um 1
20. Nominalisierungen 455
(96) Johns walk to the station occurs
Cresswell schliet sich im Prinzip der oben
diskutierten Auffassung Montagues an, da
Ereignisse Eigenschaften von Zeitpunkten
sind bzw. (in einem um mgliche Welten und
Zeitintervalle erweiterten Rahmen) Eigen-
schaften von Paaren von Welten und Zeitin-
tervallen (w,t). Wie lt sich diese Sichtweise
mit unserer naiven Ontologie vereinbaren,
wonach Ereignisse (bestimmte Sorten von)
Individuen sind? Cresswell knpft hier an die
schon in dem Buch von 1973 (S. 93 ff.) dar-
gelegte Auffassung an, da ein Individuum p
als Funktion von einer gegebenen Welt w auf
bestimmte Raum/Zeit-Ausschnitte aus w ver-
standen werden kann, nmlich genau diejeni-
gen Ausschnitte, in denen sich p manifestiert:
A basic individual p is a function from a
world w to a part of that world [...]. p(w),
the value of the function p in the world w, is
called the manifestation of p in w (Cresswell
1973: 94). (Siehe auch Artikel 36).
Der Bedeutungszusammenhang zwischen
Nominalisierungen und Verben kann nun als
ein indirekter Zusammenhang reprsentiert
werden. Als syntaktische Analysen fr (95,96)
ergeben sich die Strukturen (95,96):
(95) ((,x (John, (walks
v
, (to,x)))) (the, sta-
tion))
(96) (((John, s), (,x ((,y ((walk
N
, (to,y)), x)),
(the, station)))), occurs)
Die semantischen Deutungen fr das Verb
walk
v
und das Nomen walk
N
werden in den
folgenden Regeln angegeben:
(97) walk
v
: V(walk) ist die Funktion f in
D
0,1
, fr die gilt:
(i) a ist im Argumentbereich von f gdw.
a ein physikalisches Objekt ist.
(ii) Fr jedes a im Argumentbereich von
f und fr jedes Welt-Zeitpaar (w,t) W
gilt: (w,t) f(a) gdw. t in w ein Intervall
ist, in dem a luft.
(98) V(walk
N
) ist eine Funktion fin D
0,1
,fr
die gilt: a D, ist im Argumentbereich
von f gdw. a((w,t)) fr jedes Paar (w,t)
W ein Ausschnitt aus der Manifestation
eines Individuums im Argumentbereich
von V(walk
v
) ist und wenn fr jedes (w,t)
W und jedes a im Argumentbereich
von f gilt: (w,t) f (a) gdw. es ein b gibt
mit a((w,t)) = b((w,t)) und b luft in w
zur Zeit t.
Vereinfacht formuliert besagt diese Regel: a
ist ein Laufereignis in w, wenn es sich in einem
Zeitintervall manifestiert, das mit einem Aus-
tegorie 0,0,1 machen. Damit ergibt sich
(93) als syntaktische Analyse fr (92).
(92) Bills leaving litter
(93) , x
0,1
, Bill, , x
1
, s,x
1
, nom
2
,
, z
1
, , y
1
leaving, z
1
, y
1
, litter
x
0,1
Die Interpretation fr diesen Ausdruck be-
sagt in umgangssprachlicher Formulierung:
There is exactly one thing, which is both, an
action of leaving litter and is performed by
Bill (S. 207). Dieser Deutung unterliegt die
folgende semantische Regel:
(94) V(nom
2
) ist eine Funktion
f D
0,1, 0,1
, und fr
jede Eigenschaft P D
0,1
gilt:
f (P) = P
Die Bedeutung der Nominalisierung wird in
dieser Regel mit der Bedeutung der nicht-
nominalisierten Verben gleichgesetzt. (On
this view the only function performed by nom
2
is the changing of a verb phrase into a com-
plex common noun expression, a. a. O.
S. 207). Die Nominalisierungsoperation hat
allein syntaktische Bedeutung und verhindert
z. B., da (92) als vollstndiger Satz fehlana-
lysiert wird. (94) bercksichtigt nicht, da
Verben und Nominalisierungen extensional
zumeist verschieden sind: Die Extension von
leave litter ist die Menge aller Individuen, die
Abfall herumliegen lassen; die Extension von
leaving litter ist die Menge aller Handlungen,
die als Liegenlassen von Abfall charakteri-
sierbar sind.
In Cresswell (1979) wird diese rein syntax-
orientierte Position verlassen. Nominalisie-
rungen gelten nicht mehr als das Ergebnis
von Nominalisierungsoperationen, sondern
werden direkt aus dem Lexikon in die syn-
taktische Struktur eingefhrt. Mit transitiven
Verben teilen sie die syntaktische Kategorie
0,1, semantisch mssen sie aber unter-
schiedlich analysiert werden, denn The walk
is represented by the predicate is a walk,
while the verb is x walks, and the problem
is that the x which is the walk is clearly not
the same as the x which walks (Cresswell
1979: 96). Es gibt aber systematische Bedeu-
tungszusammenhnge zwischen Verben und
Nominalisierungen, die die semantische Ana-
lyse zu bercksichtigen hat: Zum einen trifft
in einer gegebenen Welt w (96) auf denselben
Zeitraum zu, fr den (95) gilt. Zum anderen
hat die PP to the station in beiden Stzen
dieselbe Bedeutung.
(95) John walks to the station
456 VI. Nominalsemantik
gen keinen Unterschied. Bierwischs Lsung
unterscheidet sich in diesem Punkt von Wil-
liams (1981, s. o.), der das zustzliche Ereig-
nisargument nur fr Nominalisierungen und
nicht auch fr das zugrundeliegende Basis-
verb einfhrt. Die semantische Form fr ret-
ten bzw. Rettung ist dementsprechend
(102) x
1
INST (RESCUE (x
2
, x
3
))
Dabei sind INST und RESCUE als elemen-
tare Prdikate einer abstrakten Semantik-
sprache aufgefat. (103) ist der um -Opera-
toren als Indikatoren auf Thetarollen erwei-
terte Lexikoneintrag fr retten/Rettung:
(103) x
3
x
2
x
1
[x
1
INST (RESCUE (x
2
,
x
3
))]
Die Differenzierung zwischen Basisverben
und Nominalisierungen ergibt sich aus zu-
stzlichen Konventionen ber die funktionale
Applikation der -Operatoren und die Zu-
weisung von Thetarollen. Die -Operatoren
werden grundstzlich in der Reihenfolge
n < n 1 ... 2 < 1 abgearbeitet, d. h. es
wird zunchst das interne Argument der am
tiefsten eingebetteten Propositionalstruktur
abgebunden. Dies gilt fr Verben und No-
mina bereinstimmend. Die Unterscheidung
kommt durch die Zuweisung der Thetarollen
zustande: Die durch das zustzliche Ereignis-
argument gegebene referentielle Thetarolle x
1
ist bei Nominalisierungen (wie bei Nomina
schlechthin) identisch mit der externen oder
ausgezeichneten Thetarolle. Bei Verben spezi-
fiziert x
2
die ausgezeichnete Thetarolle (die
als Satzsubjekt realisiert wird), die referen-
tielle Thetarolle fllt also nicht mit der aus-
gezeichneten Thetarolle zusammen. Bleibt
noch der theoretische Status der Affixmor-
pheme (z. B. -ung) zu klren. Die Bedeutung
von Affixmorphemen wird ebenfalls -kate-
gorial dargestellt. Jedoch wird die kategoriale
Bedeutung des Resultats der Affigierung nicht
durch funktionale Applikation (nach den Re-
geln der -Konversion) abgeleitet, sondern
durch funktionale Komposition. Whrend ein
Ausdruck x
(...)
gem den Regeln fr
funktionale Applikation der Kategorie (, )
zuzurechnen ist, kann das Resultat der funk-
tionalen Komposition F
kom
(x
(...)
) eine an-
dere Kategorie als (, ) realisieren. (Genaue-
res siehe Artikel 7.) Die Tatsache, da Affixe
zwar -kategorial dargestellt, aber nicht funk-
tional appliziert werden, reflektiert so Bier-
wisch den besonderen Status der Affigie-
rung. Das Nominalisierungssuffix -ung hat
die Reprsentation z [z] wobei z eine Pro-
positionsvariable der Kategorie O reprsen-
tiert.
schnitt aus der Manifestation von b in w
identisch ist, und zwar mit dem Ausschnitt,
in dem b zur Zeit t in w luft. Identisch sind
hier nicht mehr die Extensionen des Basis-
verbs und der Nominalisierung, identisch ist
das Zeitintervall, auf das die Nominalisierung
zutrifft, mit dem Zeitintervall, in dem das
Basisverb auf ein bestimmtes Individuum zu-
trifft. Ein hnlicher Ansatz findet sich un-
ter Einbeziehung der Aspektfunktion von No-
minalisierungen in Bartsch (1981,1983).
4.3Realistische Ereignisontologie im -
Format (Bierwisch 1989)
Bierwischs Vorschlag zur Behandlung des No-
minalisierungsproblems rekonstruiert David-
sons realistische Ontologie im Rahmen einer
-kategorialen Sprache. Wortableitungen ge-
hren dieser Theorie zufolge ins Lexikon und
gehen auf regulre lexikalische Prozesse zu-
rck. Das Lexikon selbst wird anders als in
frheren generativen Theorien nicht einfach
als Liste von Worteintrgen mit idiosynkra-
tischer Bedeutungszuweisung aufgefat, son-
dern als ein Prozemodul, welches semanti-
sche Information (z. B. ber die Zerlegung
von Lexemen in atomare Prdikate und ihre
Argumente) mit syntaktischer Information
ber die Zuweisung von Thetarollen im Satz
verkoppelt. Ein Lexikoneintrag spezifiziert
diesem Ansatz zufolge die semantische Form
SF eines Lexems als eine (komplexe) Prdi-
kat-/Argumentstruktur und reprsentiert das
Thetaraster fr dieses Lexem durch -Ope-
ratoren, die ber der gegebenen Prdikat-/
Argumentstruktur operieren.
Fr die Darstellung der semantischen Form
von Ereignisprdikaten bernimmt Bierwisch
die Davidson-Lsung: Jedem Ereignisprdi-
kat F
n
wird ein zustzliches Ereignisargument
zugewiesen:
(100)
F
n
(x
1
, ... x
n
, x
n+1
)
Das Ereignisargument x
1
instantiiert den
Sachverhalt, da F(x
2
...x
n
, x
n+1
). Statt (100)
kann daher auch (101) geschrieben werden:
(101)
x
1
INST (F
n
(x
2
...x
n
x
n+1
))
Wie bei Davidson ist das zustzliche Ereig-
nisargument Bestandteil der semantischen
Form von Ereignisverben ebenso wie von Er-
eignisnominalisierungen. In dieser Hinsicht
gibt es zwischen Verben und Nominalisierun-
20. Nominalisierungen 457
tik, Phonologie) gab und Lexikonelemente
(wie z. B. Nominalisierungen oder kausative
Verben) als Ergebnis von prlexikalischen
syntaktischen Transformationen behandelt
wurden, ist Bierwischs Auffassung vom Auf-
bau der Grammatik strikt modular. Syntax,
Semantik und Phonologie sind autonome
Komponenten der Grammatik, die durch das
Lexikon als Schnittstelle aneinander ange-
schlossen werden. Nominalisierungsoperatio-
nen (wie Wortbildungsprozesse berhaupt)
gehren ins Lexikon, nicht in die Syntax, und
gehorchen genuin lexikalischen Prinzipien.
5. Zusammenfassung
Die Bilanz der hier gegebenen bersicht ist
nicht eindeutig. Einerseits hat es im Rahmen
neuerer Theorieanstze in den letzten Jahren
deutliche Fortschritte vor allem hinsichtlich
der syntaktischen Behandlung des Nomina-
lisierungsproblems gegeben. Andererseits
steht eine umfassende semantische Analyse
noch aus, in der die kategoriale Bedeutung
der verschiedenen Nominalisierungsarten (In-
finitiv- vs. Derivativnominalisierung, verbale
vs. nominale Infinitive) ebenso bercksichtigt
ist wie die Aspektfunktion von Nominalisie-
rungen und der wortsemantische Beitrag, den
die Verbaktionsarten zur Interpretation von
Nominalisierungen leisten. Auch der Bedeu-
tungszusammenhang zwischen Nominalisie-
rungen und Komplementstzen, der in fr-
heren transformationsgrammatischen Analy-
sen des Nominalisierungsproblems eine zen-
trale Rolle gespielt hat, ist im Rahmen jn-
gerer Theorieanstze neu zu berdenken.
Eine berzeugende Analyse wird ferner die
ontologische Grundfrage nach dem Status
von Ereignissen (Individuen vs. Eigenschaf-
ten) eindeutig und im Hinblick auf die ver-
schiedenen Nominalisierungsarten zu beant-
worten haben. Allgemeinphilosophische Be-
trachtungen mgen Skepsis gegenber einer
realistischen Ontologie angezeigt sein lassen.
Der sprachliche Formenreichtum rechtfertigt
diese Skepsis nicht und legt es nahe, Modelle,
die semantischen Deutungen unterlegt wer-
den, sortenreich zu strukturieren.
6. Literatur (in Kurzform)
Andersson 1972 Aronoff 1976 Bach 1968 Bach
1981 Bach 1986 Bartsch 1972 Bartsch 1981
Bartsch 1983 Barwise/Perry 1983 Bayer 1986
Bierwisch 1989 Chierchia 1982 Chomsky 1970
Cocchiarella 1976 Cocchiarella 1978 Comrie
Resultatnominalisierungen fat Bierwisch
als Sonderflle der Ereignisnominalisierung
auf. Jedes Ereignis hat einen Verlauf und mit
dem Herbeifhren einer Zustandsvernde-
rung ein Resultat. Die Ereignisnominalisie-
rung umfat im Prinzip beide, in bestimmten
Kontexten kann aber der Bezug auf den Ver-
lauf oder der auf das Ergebnis primr sein
(vgl. 104 a,b).
(104)
a. Die Ordnung der Bcher kostete ihn
drei Tage (Verlauf)
b. Die Ordnung der Bcher war schwer
wiederherzustellen (Resultat)
Da die diesbezgliche Deutung vom Kontext
(vor allem von dem der Nominalisierung zu-
geschriebenen Prdikat) abhngt, ist die Un-
terscheidung zwischen Verlauf und Resultat
nicht auf der Ebene der semantischen Form
SF zu reprsentieren, sondern ergibt sich auf
der Ebene der konzeptuellen Interpretation,
wenn man eine entsprechende Deutungsscha-
blone (template) an die semantische Form
SF anlegt. Die Schablone fr die Resultat-
nominalisierung hat die Form:
(105) v z [[z RES e] : [v e]]
Hier ist e das Ereignisargument, dem v als
Prdikatsvariable zugeschrieben ist. Fr v ist
der Lexikoneintrag der Ereignisnominalisie-
rung einzusetzen, bei Ordnung ist dies
(106) x y z [z INST [y ARRANGE x]]
(106) wird in (105) eingesetzt. Dabei wird z
durch die Ereignisvariable e abgebunden, und
es ergibt sich (107) als Interpretation fr die
Nominalisierung in (104b):
(107)
a. z [[z RES e] : [x y [e INST [AR-
RANGE (y,x)]]]]
b. z x y [[z RES e : [e INST [AR-
RANGE (y,x)]]]]
Andere Schablonen erzeugen in analoger
Weise die instrumentelle Deutung (z. B. fr
Khlung) oder die lokale Deutung (z. B. fr
Umgebung).
Auf den ersten Blick hat diese Analyse
hnlichkeit mit dem Verfahren der lexikali-
schen Dekomposition wie es in der Genera-
tiven Semantik blich war. Der Unterschied
steckt nicht nur in der Verwendung der aus
der Kategorialgrammatik bernommenen
Verwendung von -Operatoren, sondern vor
allem in der allgemeinen Konzeption vom
modularen Aufbau der Grammatik. Whrend
es in der Generativen Semantik keine prinzi-
pielle Trennung zwischen verschiedenen Ana-
lyseebenen der Grammatik (Syntax, Seman-
458 VI. Nominalsemantik
1979 Peterson/Wali 1985 Pusch 1972 Quine,
van Orman 1960 Reichenbach 1947 Roeper
1987 Schublin 1972 Schwartz 1969 Selkirk
1982 von Stechow/Sternefeld 1988 Stowell
1981 Strawson 1950b Stockwell/Schachter/Par-
tee 1973b Thomason 1976 Thomason 1985
Thompson 1973 Toman 1983 Turner 1983 Ull-
mer-Ehrich 1977 Vater 1976 Vendler 1957
Vendler 1967a Vendler 1968 Wagner 1971 Wa-
sow/Roeper 1972 Williams 1981 Wunderlich
1971
Veronika Ehrich, Nijmegen (Niederlande)
1976 Cresswell 1973 Cresswell 1979 Daniels
1963 Davidson 1967a Delacruz 1976 DiSciullo
/Williams 1987 Dowty 1979 Eisenberg 1986
Esau 1973 Fabb 1984 Fleischer 1969 Fraser
1970 Galton 1984 Grimshaw 1988b Henzen
1947 (3. Aufl. 1965) Higginbotham 1983 Jacken-
doff 1975 Kiparsky/Kiparsky 1970 Kuno 1973
Lakoff 1965 Lakoff 1972 Lebeaux 1986 Lees
1960 Lemmon 1967 Lenerz 1990 Lbner 1988
Marchand 1960 McCawley 1968 Montague
1960 Montague 1973 Moortgat 1985 Motsch
1963 Neale 1988 Oh 1985 Oh 1988 Olsen
1989 Parsons 1979 Pesetzky 1985 Peterson
459
VII. Semantik der Funktionswrter
Semantics of Functional Words
21. Quantification
for the description of branching quantifica-
tion, Donkey quantification, and Bach-Pe-
ters quantification.
Finally, the treatment of quantifiers in the
mapping of syntactic form to logical form is
discussed. The two main techniques here are
quantifier raising (as used in transformational
theories of Logical Form) and Quantifying in
(as used in Montague grammar). Both tech-
niques are described and their limitations dis-
cussed. The conclusion lists two open prob-
lems areas for theories of quantification and
syntax.
1. Introduction
As Aristotle demonstrated twenty-three cen-
turies ago, quantity words play a crucial role
in any normative theory of reasoning in nat-
ural language. Aristotles logic concentrates
on the inferential behaviour of words like all,
some, and no, words that can be classified as
noun phrase specifiers (or: determiners). The
study of the logical properties of these quan-
tifiers led him to a theory of reasoning on
which Immanual Kant commented that never
since its conception has it needed to retrace
a single step. But Kant also wrote:
Merkwrdig ist noch an ihr, da sie auch bis jetzt
keinen Schritt vorwrts hat tun knnen, und also
allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu
sein scheint. [Furthermore it is remarkable that
until now [Aristotles logic] has also not been able
to advance a step, so that to all appearances it is
closed and complete.] (Kritik der reinen Vernunft,
Vorrede zur zweiten Auflage, 1787).
Indeed, the theory of the syllogism remained
unchallenged as the standard theory of rea-
soning until the nineteenth century. Aristo-
tles theory of reasoning is syntactic in the
sense that the justification for drawing a con-
clusion from given premisses is stated in terms
of the forms of the natural language sentences
constituting the premisses and the conclusion.
1. Introduction
2. History
2.1 Aristotle on Quantification
2.2 The Fregean Leap
3. The Semantics of Quantification
3.1 Determiners and Quantifiers
3.2 Quantifiers, Number Trees, Relational Prop-
erties
3.3 Quantifiers of Higher Types
3.4 Reducibility of Higher-Type Quantifiers
3.5 Branching Quantifiers, Donkey Quantifiers,
Bach-Peters Quantifiers
3.6 Resumptive Quantification and Branching
4. Quantification and Syntax
4.1 Syntactic Form and Logical Form
4.2 Quantifier Raising
4.3 Quantifying In
5. Conclusion
6. Short Bibliography
The paper discusses quantification in natural
language from the perspective of the theory
of generalized quantifiers. Attention is re-
stricted to explicit quantification, with a focus
on quantified Noun Phrases.
In a brief historical sketch, the quantifi-
cation theories of Aristotle and Frege are
summarized. It is shown how the Fregean
theory improves on the Aristotelean account
by introducing the notion of variable binding,
which allows for an arbitrary number of
quantifiers in a single expression.
Next, a systematic account of the use of
generalized quantifiers in the semantics of
natural language is given. Numerical trees for
quantifiers are introduced, examples of rela-
tional properties of quantifiers with cor-
responding number tree properties are
given, and their use in semantic descriptions
is illustrated. It is then argued that generalized
quantifiers of higher types, as defined by
Lindstrm, play an irreducible role in the
semantics of natural language, and it is shown
how these higher type quantifiers can be used
460 VII. Semantik der Funktionswrter
(1) Most sailors are adventurers.
All adventurers are brave.
Most sailors are brave.
depends just as much on the properties of
most as on those of all, while the invalidity
of the following argument shows that the
logical properties of all and most must be
different:
(2) Most sailors are adventurers.
Most adventurers are brave.
Most sailors are brave.
Quantification in natural language covers the
standard logical quantifiers but it is not con-
fined to them; neither is the phenomenon
confined to quantifiers that can be expressed
by means of determiners. For convenience,
examples of quantifiers from English, Ger-
man and Dutch will be used, but there is no
reason to believe that similar expressions can-
not be found in other natural languages.
Many languages have dedicated adverbs
for expressing quantification over locations:
English has everywhere, somewhere, nowhere,
German has berall, manchenorts, nirgends,
Dutch has overal, ergens, nergens. Also wide-
spread are adverbs that quantify over tem-
poral objects. In an example like
(3) Manchmal sind sich die Verliebten hier
begegnet.
(The lovers have often met here.)
it is the sentential adverb that expresses quan-
tity. In this example the domain of quantifi-
cation presumably is intervals of time. Other
sentential adverbials that quantify over this
domain are only once, sometimes, always,
never. Note that always, sometimes, never and
not always form an Aristotelian quadruple.
And again there are non-standard adverbial
quantifiers to be added to the list, e. g. at least
four times, more than once, exactly twice, sel-
dom. Sometimes it is difficult to tell what is
the domain of discourse that these adverbial
quantifiers range over: the adverbial quanti-
fier in this sentence is a case in point (see
Lewis 1975a for discussion).
Quantification over intervals of time may
also be implicit in sentences in which no overt
quantifiers occur. If one is willing to look
beyond surface structure, an X-ray picture of
the logical structure of a sentence like
(4) Penelope will be at the banquet.
will reveal an existential quantifier over in-
stants or intervals of time, witness the natural
paraphrase of this sentence in predicate logic
Thus we see that in Aristotles days logic was
still quite close to linguistics.
Quantification phenomena are of concern
to logicians and linguists alike. Logicians are
primarily interested in the role of quantifi-
cation in inference. In order to study the
inferential properties of quantifiers they have
developed theories about the nature of quan-
tification, theories that lie at the heart of
logic. Aristotles theory is the first of these.
Twenty-two centuries later Gottlob Frege
made a giant improvement by linking the
theory of quantification with a theory of var-
iable binding: thus predicate logic was born.
A neat account of the semantics of predicate
logic was added later by Alfred Tarski. Later
still, in the fifties of the present century, An-
drzej Mostowski has fitted the quantifiers all
and some of first order predicate logic into a
larger framework of generalized quantifiers.
Linguists have only recently become inter-
ested in semantics; it is not surprising that
they have turned first to the fields where
logicians have toiled for centuries, in order to
see if they could share in the harvesting. But
the linguists quickly started to ask questions
of their own, questions about the meaning
and behaviour of non-standard quantifiers,
about the relation between quantification,
definite and indefinite reference and naming,
about appropriate mechanisms for represent-
ing quantifier scope distinctions, about quan-
tification and the singular-plural distinction,
about the interaction between quantification
and the natural language counterpart to var-
iable binding, and so on. This fertilizing in-
fluence has caused a new discipline of logical
semantics for natural language to emerge, a
discipline with a research program of its own.
Most notably, Mostowskis generalized quan-
tifiers theory has been partly rediscovered and
partly reconstructed by natural language re-
searchers and logicians with an interest in
natural language, and has provided a stimulus
for inspired and inspiring new research.
Emphasis was brought to the fact that the
class of quantified noun phrase specifiers is
much larger than the quadruple all, some, no,
and not all that Aristotle studied. Quantified
determiners like most, more than five, exactly
three, etc., have not until recently attracted
much attention, despite the fact that in rea-
soning they play a role almost as important
as that of all and its three close relatives. The
validity of the argument
21. Quantification 461
tions between two terms, or, as we will say,
between a first and a second argument, where
the two arguments denote sets of entities. The
validity of the syllogism BARBARA,
(10) All B are C
All A are B
All A are C
rests on the transitivity property of the rela-
tion all. Another way of putting this is by
saying that BARBARA expresses the fact
that all is transitive. Basically, all the rest of
syllogistic theory follows from this fact plus
the logical relations that hold between the
quantifiers in the square and some general
properties of quantifiers. That this is so was
largely proven by Aristotle himself, by means
of a reduction of all syllogisms to BARBARA
and CELARENT. Here is the syllogism CE-
LARENT:
(11) No B are C
All A are B
No A are C
The Scholastic names BARBARA and CE-
LARENT are mnemonic names based on the
words affirmo and nego, for the universal
affirmative quantifier all and the universal
negative quantifier no, respectively. Existen-
tial affirmation by some is indicated by I
(affirmo); existential negation by means of
some not by O (nego). Syllogism (11) can be
reduced to (10) by replacing C in (10) by not-
C and observing that All B are not-C is equiv-
alent to No B are C.
According to the Stagirite, the following
logical relations hold in the square of oppo-
sition:
(a) the assertions in opposite corners of the
square are contradictories;
(b) the assertions of the top row of the square
cannot both be true; these assertions are
called contraries;
(c) the assertions of the bottom row of the
square cannot both be false; they are
called subcontraries.
(d) Finally, Aristotle takes it that the asser-
tion in the top left corner implies that in
the bottom left corner, and that in the
top right corner implies that in the bot-
tom right corner (subalternant implies
subalternate).
Two extra assumptions are needed to war-
rant the relations (b), (c) and (d). (b) and (c)
are true only on the assumption that the do-
main of discourse E is non-empty. (d) is true
only on the considerably stronger assumption
that no argument has an empty extension.
(suppose t
0
is a dedicated variable interpreted
as now):
(5) t(t > t
0
AtBanquet(p, t))
In spite of the fact that in logical paraphrases
of natural language tense in usually expressed
by means of quantification over instants or
intervals of time, tense is not discussed in this
article. The article does not cover implicit
quantification, as in the modal expression in
the following example:
(6) Odysseus cannot swim.
Example (6) has a logical paraphrase:
(7) There is no situation in which Odysseus
has the abilities he actually has and in
which he swims.
The trouble with implicit quantification is
that it is difficult to draw a line at all. The
following example exhibits implicit quantifi-
cation:
(8) Achilles is a murderer.
Example (8) means:
(9) There was a person whom Achilles has
murdered.
Attention will be restricted to explicit quan-
tification because explicitness of the quanti-
fying phrase is a clear cut criterion for delim-
iting the field of investigation. Also, we will
focus on quantification in NPs. For a discus-
sion of quantification in a non-NP context
see Lbner (1986).
We will first give a short historical survey
that of necessity emphasizes the logical per-
spective on quantification, the special interest
linguists have shown for quantified expres-
sions being relatively recent. Next we will take
a systematic look at the semantics of quan-
tification. Finally, we will turn to matters of
quantification and syntax.
2. History
2.1Aristotle on Quantification
Aristotles theory of quantification focusses
on the following Square of Opposition:
The quantifiers in this square express rela-
462 VII. Semantik der Funktionswrter
theory, although subtle, were completely ad
hoc. Frege had the striking insight that all
that is needed is a general description of the
way in which the combination of a universal
quantifier that acts as binder for a variable
, with an expression , affects the meaning
of .
As Frege noted, natural language sentences
can be regarded as containing symbols that
are replaceable by other symbols at one or
more of their occurrences. In such cases the
part of the original expression that is invari-
ant under the replacement can be said to
denote a function, the replaceable part an
argument to this function. One might think
of the word Calypso in
(13) Calypso is more beautiful than Circe.
as replaceable by the word Artemis: the result
of the replacement is an expression of the
same kind as the first. If one makes such a
replacement, one considers the word Calypso
as an argument-symbol that fits in the slot
marked in the functional expression
(14) is more beautiful than Circe.
Alternatively, one might look at the original
sentence in a different way, by considering
Circe as an argument that combines with
(15) Calypso is more beautiful than ...
Or one might consider Calypso and Circe as
occupying the two argument places indicated
respectively by and ... in
(16) is more beautiful than ...
Examination of other examples leads to the
recognition of functions with more than two
arguments. The two argument slots in (16)
must be kept apart. If one compares (17) and
(18),
(17) Calypso admires herself.
(18) Calypso admires Artemis.
the difference between these expressions can
be phrased by saying that the former has been
construed by combining the proper name Ca-
lypso with the functional expression (19),
whereas the latter is the result of combining
Calypso and (20). Expression (20) in turn
results from combining (21) and Artemis. This
shows that the two expressions (19) and (21)
are different.
(19) admires
(20) admires Artemis.
(21) admires ...
Marking open slots in expressions typo-
graphically is cumbersome. Instead, Frege
proposes to use variables: expressions that
What this means is that the Aristotelean
quantifiers are taken to have existential im-
port.
One might say that Aristotle took the
quantifiers all, no, some and not all, and fig-
ured out what inferential patterns with two
premisses and a conclusion were validated by
these. As is observed in van Benthem (1986 b),
one might also pose the converse question:
what are the quantifiers that are related as in
the square of opposition and satisfy the in-
ferential patterns of syllogistic theory? If the
two assumptions of the previous paragraph
are accepted, then the quantifiers that Aris-
totle put in the square are the only ones that
fit (cf. van Eijck 1985 a); if not, it turns out
that the syllogistic theory of all and some is
also satisfied by other candidates: the com-
plete syllogistic theory of all and some is sat-
isfied by precisely all couples:
(12) There are at most n 1 A or all A are
B / At least n A are B
See van Benthem 1986 b and Westersthl
1989. Thus, the following generalized Square
of Opposition emerges:
Aristotles square is a special case, where n
= 1.
Aristotles theory has two considerable lim-
itations: only one quantifier per sentence is
allowed, and the theory is limited to standard
quantifiers.
2.2The Fregean Leap
In his Begriffsschrift (1879), Gottlob Frege
presented a systematic theory in which quan-
tification and variable binding are combined.
Quantifiers are introduced as variable-bind-
ing operators, and a general theory of rela-
tions is presented. The inferences covered by
Aristotelean logic use sentences with at most
one expression of generality. In medieval
logic, attempts had been made to extend the
theory to make it cover sentences containing
several expression of generality. These at-
tempts at formulating a so-called suppositio-
21. Quantification 463
an expression in which both x and y are free,
namely (35), first an expression is formed in
which y gets bound but x remains free,
namely (36), and next the variable x gets
bound by a universal quantifier, in (37).
(35) x admires y
(36) y(x admires y)
(37) xy(x admires y)
The stronger reading of (33), according to
which there is someone who is admired by
everyone, can be formed by reversing the or-
der of the construction steps by which the
quantifiers are introduced; the result is:
(38) yx(x admires y)
In this formula the existential quantifier has
scope over the universal quantifier, while in
the formula that expresses the weaker reading
the existential quantifier is within the scope
of the universal quantifier.
In order to illustrate more clearly that
Freges theory of quantification is in fact a
combined theory of quantification and bind-
ing, it is convenient to use -operators
(lambda-operators) to express the binding of
variables, and let the quantifiers and com-
bine with expressions in which a -operator
has maximal scope. The notation using -
operators is not Freges; the -calculus was
introduced in Church (1940). The notation is
adopted here because it illustrates the essence
of the Fregean combination of quantifiers
and variable-binding remarkably well.
Using -abstraction, a one-place predicate
(i. e., an expression denoting a property) can
be formed out of a sentence. Consider again
the sentence
(39) Calypso admires Artemis.
By abstracting from the name Calypso, a
predicate can be formed, namely the predicate
to admire Artemis, to be translated as
(40) x(x admires Artemis)
The predicate to be admired by Calypso is the
result of abstracting from the object in the
same sentence, the name Artemis; this predi-
cate is translated as (41). The translation of
the predicate to admire oneself is (42).
(41) y(Calypso admires y)
(42) x(x admires x)
Let us suppose now that a one-place predicate
can only be combined with a universal or
existential quantifier V or 3, and that the
result is again a sentence. (43) is rendered as
(44):
(43) Everyone admires Artemis.
serve the purpose of open slots in other ex-
pressions. Instead of (19) one can write (22)
and instead of (21) one writes (23).
(22) x admires x
(23) x admires y
Sentences can now be formed by uniformly
substituting proper names for variables in
expressions containing these variables. Uni-
formly substituting Calypso for x in (22) re-
sults in:
(24) Calypso admires Calypso.
This is equivalent to (17). Next, Frege com-
bines quantification and variable binding, as
follows.
(25) Everyone admires Calypso.
can be paraphrased as: no matter how one
interprets x, (26) will be true:
(26) x admires Calypso.
The logical form of this universal statement
becomes evident from the translation:
(27) x(x admires Calypso)
In this translation the universal quantifier V
binds the variable x in (26). In the logical
translation of (28) two occurrences of the
same variable get bound by the universal
quantifier in (29):
(28) Everyone admires himself.
(29) x(x admires x)
We say that the quantifier x ranges over the
variable x. Replacing all occurrences of x by
occurrences of a different variable does not
change the meaning of an expression: (30) has
the same meaning as (29).
(30) y(y admires y)
We say that (29) and (30) are alphabetic var-
iants.
Frege defines the existential quantifier in
terms of the universal quantifier and the
negation operator : if v is a variable, then
v is an abbreviation for v . (31) can be
rendered as (32):
(31) Someone admires Calypso.
(32) x(x admires Calypso)
The treatment of several expressions of gen-
erality in one sentence poses no problem: the
logical translation of (33) is built by univer-
sally quantifying over x in (34),
(33) Everyone admires someone.
(34) x admires someone.
and (34) is built by existentially quantifying
over a different variable, say y. Thus, from
464 VII. Semantik der Funktionswrter
object that is both P and Q, which is rendered
as (52):
(51) Some P are Q
(52) x(Px Qx)
Thus, restricted universal and existential
quantification are reducible to unrestricted
universal and existential quantification. To
capture the existential import of the Aris-
totelian all, a slightly more involved transla-
tion is needed:
(53) x(Px) y(Py Qy)
The first conjunct ensures that the extension
of P is non-empty.
If one considers the logical translations of
natural language sentences with quantified
expressions, it should be noted that these
quantified expressions do not figure as such
in the translations any more. The logical
translation of (54) is (55):
(54) Odysseus killed every gallant.
(55) x(gallant(x) Odysseus killed x)
In this translation the constituent every gal-
lant has disappeared: it is contextually elimi-
nated. Frege remarks that a quantified ex-
pression like every gallant does not by itself
give rise to einer selbstndigen Vorstellung
(a concept by itself), but can only be inter-
preted in the context of the translation of the
whole sentence. Applied to this particular ex-
ample: the literal paraphrase of (55) is:
(56) All objects in the domain of discourse
have the property of either not being
gallants or being objects killed by Odys-
seus.
In this restatement of sentence (54) the phrase
every gallant does not occur.
Summing up, we can say that two princi-
ples are central to Freges account of quan-
tification: the principle of compositionality
and the closely connected principle of contex-
tuality. The former says that the meaning of
a complex expression like the logical trans-
lation of Everyone admires someone de-
pends in a systematic way on the meanings
of the components from which the expression
is construed in a step by step process. Frege
does not often refer to this principle explicitly,
but nevertheless it always looms large in the
background of his writings; see Janssen
(1983). According to the principle of contex-
tuality the meaning of a phrase cannot be
studied in isolation, but must always be
viewed as related to the context in which the
phrase appears. Quantified expressions are
prominent examples to which this applies.
(44) x(x admires Artemis)
Here the quantifier V expresses a property of
properties, namely being a property that all
objects in the domain of discourse have. Us-
ing for the interpretations of logical ex-
pressions we can say that (i. e., the inter-
pretation of ) equals {E}, where E is the
domain of discourse. Applied to the example,
this gives that (44) is true iff x(x admires
Artemis)is an element of . In other words,
(44) is true iff x(x admires Artemis) = E.
To put it yet another way, (44) expresses the
following:
(45) The property of admiring Artemis is a
property that all objects in the domain
of discourse have.
From (44) a new predicate can be formed by
abstracting from the name Artemis:
(46) y(x(x admires y))
This is the predicate to be admired by every-
one. By combining this predicate with the
existential quantifier one gets the formula
that expresses that everyone admires some-
one, in the strong reading:
(47) y(x(x admires y))
Like the universal quantifier, the existential
quantifier 3 expresses a property of proper-
ties: being a property that at least one object
in the domain of discourse has, or: being a
property with a non-empty extension. In
other words, if E is the domain then is
{A E A }. A formula of the form ()
is true just in case is an element of .
Thus, (47) can be paraphrased as:
(48) The property of being admired by every-
one is a property of at least one object
in the domain of discourse.
Note that the Fregean and differ from
the binary relations all and some of the pre-
vious section. Unlike the quantifiers in section
2.1, the Fregean quantifiers range over the
whole domain of discourse. Expression in
which the Aristotelean quantifiers occur can
easily be reformulated in terms of Fregean
quantifiers. (49) becomes (50):
(49) All P are Q
(50) x(Px Qx)
Here the universal quantifier combines with
a predicate that expresses the property of
being Q if one is P (the property of either
being Q or not being P). To say that this is a
property that all objects have is nothing other
than saying that all P are Q. Similarly, (51)
can be paraphrased as there is at least one
21. Quantification 465
{A E gallants A 3}. This provides a
uniform treatment of the semantics of subject-
predicate combinations. Equivalently, deter-
miners in natural language may be interpreted
as two-place relations D between sets of in-
dividuals. Instead of B DA we now write
DAB. All men walk is true in a given model
iff the relation of inclusion holds between men
and walk. Thus, the determiner all is inter-
preted as the inclusion relation. Abstracting
from the domain of discourse, we can say
that determiner interpretations pick out a bi-
nary relation on sets of individuals, on arbi-
trary universes E. Notation: D
E
AB. Pictori-
ally:
Above, we have used DAB for a determiner
relation on sets A and B. It is convenient to
use d, a and b to refer to the linguistic ex-
pressions that have, respectively, the deter-
miner relation D and the sets A and B as their
interpretations.
This view on determiners might be thought
to be linguistically naive because of the focus
on subject noun phrases that combine with
simple verb phrases. How, for instance, is one
to deal with the determiner every in the fol-
lowing example?
(62) A servant of Penelope hated every gal-
lant.
At first sight it seems that every relates the
set gallants to a two-place relation hate. How-
ever, underneath the surface the familiar re-
lation of inclusion can be found, between the
set gallants and the set {x yhatesx}, where
y is some fixed object.
Many of the determiners occurring in nat-
ural language satisfy some interesting global
constraints. A first intuition about determin-
ers is extension (EXT):
Definition 1 (EXT)
A determiner D satisfies the condition of
extension if the following holds: for all
A, B E E: D
E
AB D
E
AB.
Determines observing EXT are stable under
growth of the universe. So, given sets A and
B, only the objects in the minimal universe
A B matter. Pictorially:
Freges theory of quantification and vari-
able binding removes the first of the two
limitations on the theory of Aristotle, the
limitation to one expression of generality per
sentence. The limitation to standard quanti-
fiers still exists.
The first crystal-clear discussion of the dis-
cipline of semantics conceived as the study of
the relations between the expressions of a
logical language and the objects that are de-
noted by these expressions was given in Tarski
(1933) (English translation in Tarski 1956).
Tarski first defines the concept of a model for
a first order predicate logical language (a
language that allows quantification over en-
tities of the first order, i. e., individual ob-
jects). He then uses this definition to define a
function that yields either true or false for
any formula of the language, provided that
the interpretations of the free variables in
are fixed. This definition or a variation on
it can be found in any textbook on first
order predicate logic; see for instance van
Dalen (1983).
3. The Semantics of Quantification
3.1Determiners and Quantifiers
Basically, noun phrases like
(57) [
NP
[
DET
all][
CN
men]]
(58) [
NP
[
DET
no][
CN
nymphs]]
(59) [
NP
[
DET
at least three][
CN
gallants]]
can be interpreted as sets of sets of individuals
(sets of VP-denotations), namely the deno-
tations of those VPs for which DET CN VP
holds. Let E be a domain of discourse. Then
we have:
(57) is interpreted as {A E men A};
(58) is interpreted as {A E nymphs
A = };
(59) is interpreted as {A E
gallants A 3}
Here men is the extension of men
in the model,
nymphs is the extension of nymphs in the
model, and gallants A is the cardinality of
the intersection of A and the extension of
gallants is the model. Now we can say that
(60) All men walk.
is true in a model iff the set of walkers is in
{A E men A}. Similarly,
(61) At least three gallants sing.
is true iff the set of singers is a member of
466 VII. Semantik der Funktionswrter
than like an NP-constituent. Another excep-
tion to CONS is the determiner many in the
proportional sense that was mentioned above.
But even here one can make a syntactic es-
cape: it has been argued that many is an
adjective rather than a determiner. Conser-
vativity is extensively discussed in Barwise &
Cooper (1981), where it is called the live-on
property.
CONS plus EXT permit one to suppress
the parameter E. The two conditions taken
together ensure that the truth of DAB de-
pends only on A and A B. Expressed as a
diagram:
Next, the relational perspective on determin-
ers suggests a very natural way of distinguish-
ing, inside of the set of determiners, between
determiners that are expressions of quantity
(like every, all, some, most), and determiners
that are not (like my, the, Johns). Determin-
ers that form logical quantifiers satisfy the
following condition of isomorphy (ISOM):
Definition 3 (ISOM)
A determiner D satisfies the condition
of isomorphy if the following holds:
if f is a bijection from E to E, then
D
E
AB D
E
f[A]f[B].
This intuition expresses that only the cardi-
nalities of the sets A and B matter.
The first mention of ISOM is in Mostowski
(1957), an article that laid the logical foun-
dations of the generalized quantifier perspec-
tive. Any relation between sets of individuals
A and B that fulfils the requirements of EXT,
CONS and ISOM is called a generalized
quantifier. Also, if a natural language deter-
miner is interpreted as a relation that fulfils
the requirements of EXT, CONS and ISOM,
it is called a logical determiner. The interpre-
tation of every satisfies ISOM, the interpre-
tation of
(65) every ... except Odysseus
does not, for in some state of affairs (67)
might be true and (66) false, even though
there is an isomorphic mapping of sailors to
peasants and perished ones to survivors.
(66) Every sailor except Odysseus has per-
ished.
(67) Every peasant except Odysseus has sur-
vived.
One example of a determiner that does not
satisfy the constraint EXT is many in the sense
of relatively many, the sense in which Many
adventurers survived can be false while Many
adventurers were surviving adventurers is true.
Many A are B is true in this sense if the
proportion of objects that are B inside the set
A is larger than the proportion of Bs in the
whole universe; these proportions may change
with growth of the universe. Formally:
However, this is not the only sense of many.
Many in the sense of exceeding some contex-
tually given norm number does satisfy EXT.
Another intuition that is satisfied by many
determiners is conservativity (CONS):
Definition 2 (CONS)
A determiner D satisfies the condition of
conservativity if the following holds: for all
A, B E: D
E
AB D
E
A(A B).
Conservativity says that the part of the second
argument B that is outside the first argument
A is irrelevant for evaluating the determiner;
it is the first argument of the determiner that
sets the stage. Although this property holds
for all ordinary determiners, there are some
exceptions.
(63) Only fishermen survived.
(64) Odysseus encountered mainly syrens and
nymphs.
Under its most plausible reading, (63) means
that the set of survivors consisted exclusively
of fishermen. In other words, it is an assertion
about the full set of survivors, not just about
the set of surviving fishermen. Similarly, (64)
means that the majority of the set of beings
encountered by Odysseus consisted of syrens
and nymphs. Again, it is an assertion about
the full set of beings that Odysseus encoun-
tered, and not just about the syrens and
nymphs that he came across. We can get
around these exceptions by denying that only
and mainly are syntactically in the same class
as determiners like all, some, no and so on.
Only seems to combine with NPs to form new
NPs, and mainly behaves more like an adverb
21. Quantification 467
AB, the second one A B. As an ex-
ample of how the positions in the tree should
be read, consider the third row. This row
treats the case where there are 2 As: either
both of them are non-Bs, or one of them is
non-B and the other is B, or both of them
are Bs. Here are some examples of tree pat-
terns for logical determiners:
Once the principle behind the construction of
these trees is grasped, many interesting prop-
erties of logical determiners can be visualized
quite easily, and results for these properties
obtained through reasoning about tree pat-
terns. Consider e. g. the following monoton-
icity property (right-monotonicity in the up-
ward direction).
Definition 4 (MON )
A Logical determiner D is right upward
monotone if the following holds: if DAB
and B B, then DAB.
Examples of determiners with this property
are all and some, as can be seen from the fact
that (68) implies (69) and the fact that (70)
implies (71):
(68) All warriors are aggressive.
(69) All warriors are aggressive or arrogant.
(70) Some peasants are rude.
(71) Some peasants are rude or stubborn.
In cases where a determiner D has the prop-
erty MON, we also say that a noun phrase
denotation DA formed with that determiner
has property MON. Here is the numerical
Every sailor except one does fulfil ISOM,
precisely because it does not matter which
one is the exception. If D satisfies EXT,
CONS and ISOM, it turns out that the truth
of DAB depends only on the cardinal numbers
A and A B, or equivalently, on AB
and A B.
The proper treatment of quantification in
Montague (1973) implicitly uses generalized
quantifiers. According to Montague the
proper way to treat noun phrases in natural
language is a uniform way. Ignoring the tech-
nicalities of Montagues intensional treat-
ment, an NP is interpreted as a set of sets of
entities. The NP every man is interpreted as
the set of all sets that include the set of men;
the interpretation of the NP a man is the set
of all sets that contain at least one man; the
interpretation of the man is the set of all sets
that contain the one and only man in the
domain in case there is a unique man in the
domain, the empty set otherwise. For reasons
of structural uniformity this treatment is ex-
tended to cover proper names as well: the
interpretation of the NP John is the set of all
sets having the individual John as a member.
The interpretation of John is not a generalized
quantifier, for it is not invariant under iso-
morphic mappings of the universe.
In Barwise & Cooper (1981) the systematic
study of the semantics of noun phrases in
natural language from a generalized quanti-
fiers perspective is started. This article, in
which the historical link with Mostowski
(1957) is mentioned, has given rise to new
research on generalized quantifiers and their
application in natural languages. See van
Benthem (1986 a) for an overview and for
further references.
3.2Quantifiers, Number Trees, Relational
Properties
Suppose a determiner D satisfying EXT,
CONS, and ISOM has A as a first and B as
a second argument. D can then be character-
ized as a subset of the following tree of num-
bers:
The first number in each number pair is
468 VII. Semantik der Funktionswrter
phenomena:
(72) Hoogstens honderd strijders hoeven de
wacht te houden.
(At most a hundred warriors need to be
on guard.)
(73) *Minstens honderd strijders hoeven de
wacht te houden.
(At least a hundred warriors need to be
on guard.)
(74) Es interessierte keinen einen Deut.
(No-one was at all interested.)
(75) *Es interessierte einen einen Deut.
(Someone was slightly interested.)
(76) Few people lifted a finger to help the
wounded soldiers.
(77) *Many people lifted a finger to help the
wounded soldiers.
In the Dutch examples, the verb hoeven is a
so-called negative polarity item: the verb
phrase in which it occurs must be a negative
context. Likewise, the German ein Deut and
the English to lift a fnger are negative polarity
items. The following English examples illus-
trate the fact that any, in one of its readings,
is a negative polarity item:
(78) No sailor refused any of the gifts.
(79) *Every gallant refused any of the gifts.
When these phenomena were first discussed,
negative polarity items were defined as items
that demand a negative context, where neg-
ative context was paraphrased as: context that
is somehow in the scope of a negation oper-
ator. The examples make clear that noun
phrases also qualify as negative contexts. The
noun phrases no sailor and hoogstens honderd
strijders (at most a hundred warriors) are neg-
ative, every gallant and minstens honderd
strijders (at least a hundred warriors) are not.
The noun phrases that allow negative polarity
items in their scopes turn out to be precisely
the downward monotone noun phrases.
Negative polarity items have positive coun-
terparts. Positive polarity items occur in the
following Dutch sentences:
(80) Alle mannen waren allerminst tevreden.
(All men were not-in-the-least satisfied.)
(81) Precies vijf mannen waren allerminst
tevreden.
(Exactly five men where not-in-the-least
satisfied.)
(82) *Niemand was allerminst tevreden.
(Nobody was not-in-the-least satisfied.)
The positive polarity item allerminst (not-in-
the-least) is allowed in the scope of a MON
tree pattern for logical determiners that are
MON:
Definition 5 (MON tree property)
If a node has a +, then all nodes to the
right on the same row have +-s.
To see that this is the correct tree property,
consider a node with a + in the pattern of a
MON determiner. What the MON prop-
erty expresses is that if we add extra elements
to the Bs the determiner relation will still
hold. If these extra elements are non-As then
this does not affect the node position we are
in (the conservativity of D tells us that the
determiner relation still holds). If the extra
elements are As, then one or more of the As
change from non-Bs into Bs, and we shift to
a new + position one or more places to the
right in the same row.
Definition 6 (MON )
A logical determiner D is right downward
monotone if the following holds: if DAB
and B B then DAB.
Again, a noun phrase interpretation DA of
which the determiner has property MON
will be called MON. We will also call a noun
phrase with an MON (MON) interpreta-
tion upward (downward) monotone. Exam-
ples of downward monotone noun phrases
are not all and no. The corresponding tree
pattern property:
Definition 7 (MON tree property)
If a node has a +, then all nodes to the
left on the same row have +-s.
Inspection of the above example tree patterns
shows that at least three is MON, less than
half is MON, and an even number of is nei-
ther MON nor MON. Barwise & Cooper
(1981) observe that the choice between and
and but for noun phrase conjunction depends
on the monotonicity properties of the con-
juncts. Noun phrases that are monotone in
the same direction are conjoined with and,
monotonicity in opposite directions triggers
conjunction by means of but: all sailors and
some peasants versus many gallants but no
bridegroom. It is easy to come up with excep-
tions, but with some qualifications the rule
seems to hold.
Monotonicity properties of logical deter-
miners also turn out to play an important
role in the description of negative and positive
polarity phenomena in natural languages (see
for instance Ladusaw 1979, Zwarts 1986).
The following sentences, taken from Dutch,
English and German, exhibit negative polarity
21. Quantification 469
and anti-persistence for this kind of mono-
tonicity.
Definition 8 (MON)
A determiner D is left upward monotone if
the following holds: if DAB and A A
then DAB.
Definition 9 (MON)
A determiner D is left downward monotone
if the following holds: if DAB and A A
then DAB.
Examples of MON determiners are some and
not all, as can be seen from the fact that (86)
entails (87) and (88) entails (89):
(86) Some seductive nymphs smiled.
(87) Some nymphs smiled.
(88) Not all boastful gallants sang.
(89) Not all gallants sang.
All and no are examples of MON determin-
ers, witness the entailment relations between
(90) and (91), and those between (92) and
(93):
(90) All sailors perished.
(91) All adventurous sailors perished.
(92) No storytellers talked.
(93) No entertaining storytellers talked.
One might say that MON and MON refer
to monotonicity properties of the determiner,
MON and MON to monotonicity proper-
ties of the whole noun phrase. Therefore, a
determiner that is MON (MON) is some-
times simply called upward (downward) mon-
otone.
Again, these monotonicity properties are
borne out by linguistic facts. In English, neg-
ative polarity any must occur in a negative
context, and the first argument of a MON
provides such a context (every and no are
MON, some is MON):
(94) Every sailor who accepted any of the
gifts perished.
(95) No sailor who accepted any of the gifts
perished.
(96) *Some sailor who accepted any of the
gifts perished.
Because of CONS, the first argument of a
determiner relation is more important than
the second one. Thus, left monotonicity im-
poses a more severe constraint on a deter-
miner relation than right monotonicity. The
tree pattern property that corresponds to
MON is:
Definition 10 (MON tree property)
If a node has a +, then all nodes in the
or a non-monotone noun phrase, but it is
ruld out in a context where a MON, noun
phrase is present.
The tree pattern characterizations of the
properties MON and MON make it easy
to establish useful facts about these proper-
ties. The conjunction of MON (MON,)
noun phrases is MON (MON). The dis-
junction of MON (MON) noun phrases is
MON (MON). The conjunction of a
MON noun phrase and a MON noun
phrase is in general not monotone, and nei-
ther is their disjunction. Negating a monotone
noun phrase reverses the monotonicity direc-
tion. These observations follow immediately
from the fact that the tree pattern of a con-
joined noun phrase has + in exactly those
places where all the conjuncts have +, and
the tree pattern of a disjunction of noun
phrases has + in all places where at least one
of the disjuncts has +. The negation of a
noun phrase changes all +-s into -s and
vice versa. The observed regularities can be
used to explain the following data.
(83) No sailor and few peasants refused any
of the gifts.
(84) *Every sailor but no peasant accepted
any of the gifts.
(85) *Geen man of geen vrouw was aller-
minst tevreden.
(No men or no woman was not-in-the-
least satisfied.)
In (83) the conjoined NP is MON, so that
a suitable negative context for any is estab-
lished, and the example is acceptable. In (84)
the disjunction every sailor but no peasant is
not monotone, which rules out a sentence
with negative polarity any. From this example
we see that the mere presence of the MON
noun phrase no peasant in the sentence is not
enough to make the use of a negative polarity
item felicitous: the negative polarity item any
is not in the scope of no peasant but in that
of the noun phrase in which no peasant occurs
as a disjunct. In (85), finally, the noun phrase
geen man of geen vrouw is a disjunction of
two MON noun phrases, which means that
it is itself MON, and this rules out the oc-
currence of a verb phrase with the positive
polarity item allerminst.
The properties MON and MON refer to
monotonicity in the second argument of a
determiner. We may also look at monoton-
icity properties in the first argument. Barwise
& Cooper (1981) use the terms persistence
470 VII. Semantik der Funktionswrter
miners D satisfying the natural requirement
that for every A there are B, B such that
DAB and DAB, then, as Zwarts (1986) has
shown, there are no anti-euclidic determiners.
Observe that Zwarts requirement merely
states that the second argument of the quan-
tifier should make a difference.
As an example of a non-existence result,
here is a proof of the fact that there are no
interesting asymmetric quantifiers.
Theorem 1 (Van Benthem)
There are no asymmetric quantifiers except
the empty one.
Proof: Because D is non-empty, there are
A, B such that DAB. It follows from CONS
that DA(A B). Suppose ABequals
n. Add n new individuals to A B and call
the result A*. Now A* A = A B, and
DA(A B) implies DAA* by CONS. Also
DA(A B) implies DA*(A B) by ISOM,
which implies DA*A by CONS. We have
found a pair A, A* with DAA* and DA*A,
contradicting asymmetry.
For the use of relational properties of
quantifiers to describe linguistic constraints,
consider sentences of the following pattern:
(97) There is/are NP.
Barwise & Cooper (1981) propose as a lin-
guistic universal that the NPs that can occur
in this position are precisely the quantifiers
that are neither reflexive nor irreflexive. This
rule explains the following contrasts:
(98) There are five gallants.
(99) There are many sailors.
(100) There are not many women.
(101) There are no women.
(102) *There are all soldiers.
(103) *There are not all men.
Unfortunately there are counterexamples: the
determiner most is neither reflexive nor irre-
downward triangle with this node as its
root have +-s.
To see that this is correct, observe that MON
says that if the determiner relation holds for
some sets A and B, and we add one or more
extra elements to the set of As, then the re-
lation will still hold, no matter whether the
extra elements are Bs or non-Bs. Adding an
extra A will bring us in the next lower row,
at the nearest position in the direction if
the extra element is a non-B, or at the nearest
position in the direction if the extra ele-
ment is a B; in both places we will find +-s.
Similarly, we can establish that the corre-
sponding tree pattern property for MON
determiners is the same, but in the upward
direction. Looking again at the example trees
from the beginning of the section, we see
immediately that at least three is MON, and
less than half of and an even number of are
not monotone in their left arguments.
For another illustration of the relevance of
logico-semantic analysis to empirical linguis-
tics, look at the table below, which shows the
relational properties of quantifiers.
A natural question suggests itself: why is
it that certain relational properties do not
seem to be realized in natural language?
Prima facie it might be an accidental fact that
the natural languages we have studied do not
exhibit asymmetric, circular, euclidic or anti-
euclidic quantifiers. Or it might be a general
empirical constraint on natural languages: a
linguistic universal in the true sense. The log-
ical study of quantifiers has revealed, how-
ever, that the constraints are a matter of logic
rather than empirical fact. Van Benthem has
shown that there are no asymmetric, euclidic,
or circular quantifiers. Also, it has turned out
that anti-euclidic determiners depend only on
their first argument. If one focusses on deter-
property definition examples
symmetry DAB DBA some, no, at least k,
exactly k, an even number of
antisymmetry DAB&DBA A = B all
asymmetry DAB DBA
reflexivity DAA all, at least half
irreflexivity DAA not all, all but k
transitivity DAB&DBC DAC all
circularity DAB&DBC DCA
euclidity DAB&DAC DBC
anti-euclidity DAB&DCB DAC
21. Quantification 471
then A is called the generator of F.
Definition 16
A principal filter F is nontrivial F has
a non-empty generator.
Note that the principal filter on E generated
by the empty set is equal to E; this principal
filter is trivial just because it does not exclude
anything at all. We now have a precise se-
mantic characterization of definiteness:
Definition 17
Definite NPs are NPs that are interpreted
as non-trivial principal filters.
Furthermore, singular definites are generated
by singleton sets, plural definites by non-sin-
gletons.
If a definite NP has the structure deter-
miner + common noun, then the determiner
must be MON. This is because principal
filters satisfy the following constraint: F(B)
and B B implies F(B). However, the char-
acterization is not only applicable to noun
phrases that have this structure, but also to
proper names interpreted as sets of sets, in
the Montagovian style. Proper names inter-
preted thus are non-trivial principal filters.
Similarly for noun phrases like the king, the
gallants, both princesses, these five sailors,
Odysseus and the king of the Achaians. None
of these satisfies ISOM. Plural definites are
the NPs that occur most naturally in the
position following of in partitive construc-
tions like one of these five sailors, so again the
generalized quantifier perspective provides a
semantic characterization of a linguistic con-
straint. The partitive construction presup-
poses the existence of a set of which some
part is singled out: this set is precisely the
non-empty generator of the principal filter.
3.3Quantifiers of Higher Types
The concept of a generalized quantifier that
was introduced in Mostowski (1957) has been
generalized further in Lindstrm (1966), and,
as it turns out, this further generalization is
useful for the semantic analysis of natural
language. Consider the following example.
(105) More nymphs than goddesses are
happy.
This sentence is true iff the number of happy
individuals that are nymphs is larger than the
number of happy individuals that are god-
desses. Thus, the truth conditions for the sen-
tence involve the three sets nymphs, goddesses
and {x happy(x)}.
flexive. It is obvious that it is not irreflexive;
it is not reflexive either, because most gallants
are gallants is not true in case there are no
gallants. Still, we have:
(104) *There are most gallants.
Similarly for determiners like more than half,
more than two thirds, and so on.
A proposal that seems to work better than
Barwise & Coopers is the following:
There-universal
The items that satisfy the There is/are A
context are precisely the symmetric quan-
tifiers.
The symmetric quantifiers turn out to be
those quantifiers that can be characterized by
a condition on the intersection of their first
and second arguments. To see this, assume
that D is symmetric. If there are A, B such
that DAB then by CONS, DA(A B), and by
symmetry, D(A B)A, and again by CONS,
D(A B)(A B).
To see that the symmetric quantifiers are a
proper subclass of the quantifiers that were
singled out by Barwise & Cooper, look at the
corresponding properties in the tree of num-
bers. Symmetry is reflected in the number tree
as follows:
Definition 11 (SYM tree property)
If a node has a +, then all nodes on the
diagonal through this node have +.
The tree properties corresponding to reflex-
ivity and irreflexivity are, respectively:
Definition 12 (REFL tree property)
Every node on the diagonal through 0,0
has +.
Definition 13 (IRREFL tree property)
Every node on the diagonal through 0,0
has .
It follows immediately that if a quantifier is
symmetric, either the quantifier is trivial
(every node in its tree has a +, or every node
in its tree has a ), or it is neither reflexive
nor irreflexive.
As a final example of a linguistic descrip-
tion in terms of semantic properties, we con-
sider the concept of a definite NP. In order
to get at a semantic characterization, we drop
ISOM, and we look at NP interpretations as
sets of sets of individuals.
Definition 14
An NP interpretation F is a principal filter
there exists an A such that F(B) iff
A B.
Definition 15
If F = {B A B} is a principal filter,
472 VII. Semantik der Funktionswrter
a 1, 1 determiner every that combines with
a conjoined common noun, but this is not so.
Conjoining the two common nouns results in
a common noun interpreted as the set of
individuals that are both ploughmen and yeo-
men, and thus gives a reading for the whole
sentence that is not intended. The same ap-
plies to the determiners the thousand and
... and at least one hundred and ... in
examples (107) and (108), respectively.
Note the syntactic difference between (110)
and (111). The italics in the examples indicate
that fewer Achaian kings than princes can be
analysed in two non-equivalent ways. If one
takes the adjective Achaian as part of the
determiner, the property of being Achaian is
asserted of both the first and the second com-
mon noun that the determiner combines with.
In other words: if one takes the syntax to be
(112) [fewer Achaian [kings] than [princes]]
then the things being compared are Achaian
kings on one hand and Achaian princes on
the other. Alternatively, the syntactic analysis
can be
(113) [fewer [Achaian kings] than [princes]]
This produces the reading in which Achaian
kings are compared with princes in general.
The examples show that there are deter-
miners in natural language that can be ana-
lysed as 1, 1, 1 quantifiers. Of course, the
examples by themselves do not prove that
there is no way of constructing these deter-
miners out of simpler building blocks. We will
return to this issue below.
The following examples seem to indicate
that natural languages employ quantifiers of
still higher types:
(114) Every Boeotian, Phocian, Locrian, Ai-
tolean and Cretan took part in the
fighting.
(115) Equal numbers of Boeotians, Phocians,
Locrians, Aitoleans and Cretans came
to Ilios.
The quantifier involved in example (114)
would be of type 1, 1 if one could explain
away the and, for then one could assume that
every combines with -or-. In the absence of
such an and/or swap theory one has to as-
sume that both sentences involve determiners
of type 1, 1, 1, 1, 1, 1. It is clear that the
number of common nouns can be arbitrarily
extended (Homers famous list of men and
ships sent to Troy is much longer), so the
examples suggest that quantifiers of type
1, ..., 1 occur in natural language.
Following Lindstrm, we consider rela-
tions between relations on universes E. If Q
is a relation between n relations on E, of
arities r
1
, ..., r
n
respectively, then we say that
Q is a relation of type r
1
, ..., r
n
. Note that
one-place predicates are taken to be rela-
tions of arity 1. To clarify this perspective,
here are some examples (take E to be the
universe):
Q is a relation of type 1 iff Q E.
Q is a relation of type 1, 1 iff
Q ( E E).
Qis a relation of type 1, 1, 2 iff
Q ( E E E
2
).
Q is a relation of type 2, 2 iff
Q ( E
2
E
2
).
In the general case:
Q is a relation of type r
1
, ..., r
n
iff
Q ( E
r
1 ... E
r
n).
Of course, in order to ensure that these rela-
tions Q are really quantificational we have to
impose the proper constraints, most notably
a suitably extended version of ISOM.
The Fregean quantifiers V and 3 have type
1, for they are subsets of the set of one-
place predicates on some universe E, i. e., they
are relations of arity 1 on the set of all subsets
of E.
The Aristotelean quantifiers and the gen-
eralized quantifiers that we have discussed in
sections 3.1 and 3.2 have type 1, 1; they
denote relations between pairs of subsets of
the universe E, i. e., relations between pairs
of one-place predicates on E.
The complex determiner that occurs in ex-
ample (105) can be interpreted as a quantifier
of type 1, 1, 1, for the truth conditions of
the sentence are stated in terms of three one-
place predicates on the universe of discourse.
Some further examples of 1, 1, 1 quantifi-
ers occur in the following sentences.
(106) Every ploughman and yeoman was
happy.
(107) The thousand foot soldiers and chario-
teers cheered.
(108) At least one hundred Trojans and Achai-
ans were killed.
(109) More than twice as many warriors as
charioteers attacked.
(110) Fewer Achaian kings than princes sur-
vived.
(111) Fewer Achaian kings than princes sur-
vived.
One might think that the determiner every
and ... in (106) can be discarded in favour of
21. Quantification 473
(120) Three kings awarded a total of thirty
prizes to a total of twelve champions.
Here a quantifier of type 1, 1, 1, 3 seems
to be present, for the three sets kings, prizes,
champions and the three place relation award
are involved.
Again, EXT, CONS and ISOM must be
amended to separate the real quantifying re-
lations of these higher types from the rest.
Again, the generalizations of EXT and ISOM
to quantifiers Q of type
are straightforward (ISOM must now be
stated in terms of bijections with domain E
n
that are induced by bijections with domain
E). The version of CONS for quantifiers of
these types reads as follows.
Definition 19 (CONS for 1, ..., 1, n
quantifiers)
A quantifier Q of type 1, ..., 1, n satisfies
conservativity if the following holds:
A
1
, ..., A
n
E, R E
n
:
Q
E
A
1
... A
n
R Q
E
A
1
... A
n
(R (A
1
... A
n
)).
This new version of conservativity says that if
n CNs are combined with an n-place VP, it is
the Cartesian product of the CN denotations
that sets the stage. Schas examples of cu-
mulative quantification observe EXT, CONS
and ISOM.
We have shown by example that general-
ized quantifiers of higher types than 1, 1
may be employed in the analysis of natural
language. The obvious sequel question is: do
we really need them? Let us consider some
examples of quantifiers of type 1, 1, 2:
(121) (A, B, R) iff dom(R (A B)) = A.
(122) (A, B, R) iff for some b B: A {b}
R.
For convenience we introduce some simple
abbreviations:
Definition 20
For a E and R E
2
: R
a
{x Rax} and
{x Rxa}.
The following definition is from Keenan
(1987b).
Definition 21
A quantifier of type 1, 1, 2 is a com-
pound of two 1, 1 quantifiers Q
1
and Q
2
iff we have either
(A, B, R) Q
1
(A, {a Q
2
(B, R
a
)})
Again we can separate the logical deter-
miners from the rest by imposing the con-
straints of EXT, CONS and ISOM. The re-
formulations of EXT and ISOM are straight-
forward. The reformulation of CONS may
come as a surprise.
Definition 18 (CONS for 1, ..., 1 quan-
tifiers)
A quantifier Q of type 1, ..., 1 satisfies
conservativity if the following holds:
A
1
, ..., A
n
, P E:
Q
E
A
1
... A
n
P Q
E
A
1
... A
n
(P
( A
i
)).
This new version of CONS says that the last
argument of the quantifier the one that
corresponds to the VP denotation plays a
special role. The set to which the VP deno-
tation can be restricted is the union of the
denotations of the n other arguments. In
other words: the union of the denotations of
the n other arguments sets the stage. Note
that the version of CONS for 1, 1 quanti-
fiers is covered as a special case (set n = 1).
The following equivalences illustrate that the
above generalization is indeed the correct one.
(116) Every ploughman and yeoman was
happy.
Every ploughman and yeoman was a
happy ploughman or yeoman.
(117) More Achaians than Trojans survived.
More Achaians than Trojans were sur-
viving Achaians or Trojans.
Notice that all determiners mentioned so far
in this section satisfy EXT and CONS. They
also satisfy ISOM, except for the determiner
(118) fewer Achaian than ...
which is sensitive to the property of individ-
uals of being Achaian, surely part of their
individuality.
We can generalize still further. Sentences
of the following type were first discussed in
Scha (1981):
(119) Twenty Achaians slaughtered one hun-
dred Trojans.
Scha considered the reading expressing that
a total of twenty Achaians were involved in
the slaughtering of Trojans, and that a total
of one hundred Trojans were killed in the
event. He branded this cumulative quantifi-
cation. The truth conditions for this sentence
involve two sets achaian and trojan, and, with
disregard of tense, the two-place relation
slaughter. This means that a quantifier of type
1, 1, 2 is involved. Nor is this the end:
474 VII. Semantik der Funktionswrter
3.4Reducibility of Higher-Type Quantifiers
In section 2.2 it was mentioned that the 1, 1
type Aristotelean quantifiers are reducible to
1 type Fregean quantifers. Such a reduc-
tion of 1, 1 quantifiers to 1 quantifiers
is not always readily available, however.
Theorem 2 (Barwise & Cooper)
More than half of the A are B is not defin-
able in terms of More than half of all things
in a language with only the two one-place
predicates A and B.
A fortiori we know that more than half of the
A is not first-order definable (in a language
with only the two one-place predicates A and
B and identity). In other words: there is no
formula of first order predicate logic that
only contains the predicates A, B and =, and
that has the same truth conditions as more
than half of the A are B. This shows that the
addition of the 1, 1 quantifier most to first
order predicate logic genuinely strengthens
the language. Freges limitation to and
turns out to be a genuine restriction.
In van Benthem (1984b) logical definability
of type 1, 1 quantifiers is discussed. Which
generalized quantifiers can be considered as
abbreviations of expressions of first order
logic, and which cannot? This question is
important for the logico-semantic analysis of
natural language because the answer will af-
fect the choice of logical translation language
for the semantic enterprise. A precise char-
acterization of the class of first order defin-
able 1, 1 quantifiers has been given in Wes-
tersthl (1984). The characterization is in
terms of the quantifier property of being con-
tinuous in the left argument.
Definition 22 (L-CONT)
A quantifier Q is called continuous in the
left argument if the following property
holds: A A A: QAB QAB
QAB.
It is not difficult to see that a quantifier Q is
L-CONT iff Q is the intersection of a MON
quantifier Q
1
and a MON quantifier Q
2
. An
example of a L-CONT quantifier is between
five and ten, which is the intersection of at
least five (MON) and at most ten (MON).
Exactly four is L-CONT; this quantifier is the
intersection of at least four (MON) and at
most four (MON). Also, as is easy to see
from the definitions, MON or MON quan-
tifiers are L-CONT. Note that MON and
MON quantifiers satisfy the intersection
condition: every quantifier Q has the property
or
(A, B, R) Q
2
(B, {b Q
1
(A, )})
In the first case we call the quantifier a
linear compound, in the second case an
inverted compound.
(A, B, R) is a compound iff it can be viewed
as the interpretation of an expression
(123) quant
1
a is r-related to quant
2
b
where quant
1
is interpreted as Q
1
and quant
2
as Q
2
, and where the two quantifiers can have
both possible scope orderings.
The quantifier in example (121) is a
1, 1 compound, because for this case we
have:
(124) (A, B, R) ALL(A, {a SOME
(B, R
a
)})
This reduction shows that in example (121)
is merely a 1, 1, 2 type formulation of the
pattern in Every man loves some woman.
Similarly, the quantifier in example (122)
is a compound, for it can be defined as fol-
lows:
(125) (A, B, R) SOME(B, {b ALL(A,
)})
The higher type quantifier in example (122)
turns out to be a 1, 1, 2 type formulation
of the reading of Every man loves some
woman.
Incidentally, the cases of compound
1, 1, 2 quantifiers provide a nice check of
the generalization of CONS in definition 19:
if a 1, 1, 2 quantifier is a compound of
two 1, 1 quantifiers Q
1
and Q
2
that both
satisfy CONS (in the original version for
1, 1 quantifiers), then it is not very difficult
to show that satisfies the extended version
of CONS.
Obviously, in cases where higher type
quantifiers are 1, 1 compounds, the anal-
ysis in terms of 1, 1 quantifiers is to be
preferred to the higher type analysis. The fact
that a quantifier is a compound means that
it is reducible and points the way to a com-
positional treatment. If it turns out that ir-
reducibly higher type quantifiers occur in nat-
ural language, then a compositional account
of the meaning of sentences in which they
occur might turn out to be a problem. The
issue of reducibility, which will be discussed
in the next section, is therefore of paramount
importance for the semantics of natural lan-
guage.
21. Quantification 475
closed under boolean operations.
Note that the theorem assumes that
MORE-THAN has the same VP argument as
the 1, 1 quantifier that one tries to reduce
it to. If this requirement is dropped, then
as one of the referees of this article pointed
out a reduction turns out to be possible
after all, witness the following equivalence:
(126) MORE-THAN(A, B, C)
MORE-THAN-HALF(((C (A B))
(C (B A))), (C (A B)))
To see why (126) does not contradict Keenan
& Moss result, note that theorem 4 assumes
that MORE-THAN observes the usual quan-
tifier constraints. In particular, the relations
is supposed to satisfy CONS, i. e. in MORE-
THAN(A, B, C) the stage is set by A B. In
the 1, 1 quantifier of (126) it is not A B
but (C (AB)) (C (BA)) that sets
the stage.
Next, let us consider the class of 1, 1, 2
quantifiers. We have seen some examples in
section 3.3; here are some more:
(127) (A, B, R) iff R (A B) is a
constant function.
(128) (A, B, R) iff f: A
B, f R
(A B).
(129) (A, B, R) iff dom(R (A B)) =
20 and rng(R (A B)) = 100.
These examples observe EXT, CONS and
ISOM.
We will show that the 1, 1, 2 quantifier
in example (127) is not a 1, 1 compound
by proving that the compound 1, 1, 2 quan-
tifiers have a property that (127) lacks. The
account, based on van Benthem 1989, uses
some definitions.
Definition 24
If R, S E
2
, then R ~
r
S iff R
a
= S
a
for all a E.
Definition 25
If R, S E
2
, then R ~
1
S iff =
for all a E.
Definition 26
A 1, 1, 2 A quantifier is right-oriented
(left-oriented) if the following holds: for
all R, S with R ~
r
S (R ~
1
S): (A, B, R)
(A, B, S).
Thus, a right-oriented 1, 1, 2 quantifier
does not distinguish between relations R and
S with the property that for all a E the R-
range and the S-range of a have the same
number of elements. Similarly, a left-oriented
Q = Q Q
T
, where Q
T
is the trivial quantifier
Q
T
that is always true (Q
T
is both MON and
MON). Again, there is a corresponding
property for L-CONT in the tree of numbers:
Definition 23 (L-CONT tree property)
If two nodes m, n and m, n have +-s,
then the parallelogram in between consists
of +-s.
In a picture:
Here is Westersthls result:
Theorem 3 (Westersthl)
On finite universes, the first-order defina-
ble 1, 1 quantifiers are precisely the dis-
junctions of L-CONT quantifiers.
Reformulation in terms of numerical tree pat-
terns: a quantifier Q is first order definable
iff Q has a tree pattern that can be analysed
as a set of superimposed parallelograms.
Next, it can be shown that not all 1, 1, 1
quantifiers are reducible to 1, 1 quantifiers
(see Keenan & Moss 1985).
Theorem 4 (Keenan & Moss)
More than ... is not definable in terms
of any 1, 1 quantifier.
Sketch of proof: The basic idea of the proof
is the following. Instead of viewing 1, 1
quantifier Q on universe E as a relation
( E E), we can consider Q as a func-
tion in E E, defined as
Q(A) {B QAB}
for all A E. Here, Q(A) is the interpretation
of the whole noun phrase.
Thus, every quantifier Q of type 1, 1,
maps sets to sets of sets, and if n is the number
of elements in E, then E has 2
2
n
elements,
but the range of the function Q has at most
2
n
elements. The quantifier MORE-THAN of
type 1, 1, 1 can be viewed as a function in
( E
2
E, defined as
MORE-THAN(A, B) {C MORE A
THAN B C}
for all pairs A, B E. Keenan & Moss show
that this function has a range larger than 2
n
,
and it follows that MORE-THAN cannot be
reduced to any 1, 1 quantifier. Nor is it
possible to define MORE-THAN by means
of boolean combinations of 1, 1 quanti-
fiers, for the class of 1, 1 quantifiers is
476 VII. Semantik der Funktionswrter
(130) Every man loves (one and) the same
woman.
Although the of this example is not a
compound, it is equivalent to a conjunction
of two compounds:
(131) Every man loves exactly one woman
and exactly one woman is loved by
every man.
By similar applications of theorem 5 it can
be shown that the 1, 1, 2 quantifiers in ex-
amples (128) and (129) are not compounds.
The quantifier in example (128) can be used
to paraphrase sentence (132):
(132) Every man loves a different woman.
It is proved in van Benthem (1989) that this
quantifier is not definable in terms of 1, 1
quantifiers at all.
The irreducibility argument applies equally
well to quantifiers of still higher types:
(133) Two nasty old men told the same dirty
story in the same ugly manner to the
same young girl on the same day in
different pubs.
Example (133), freely adapted from Keenan
(1987b), involves a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 quan-
tifier that is irreducible to a compound of six
1, 1 quantifiers.
3.5Branching Quantifiers, Donkey
Quantifiers, Bach-Peters Quantifiers
Once it is accepted that quantifiers of type
1, 1, 2 and higher play an irreducible role
in the semantics of natural language, such
quantifiers can profitably be employed for the
treatment of so-called branching quantifica-
tion phenomena. Examples like the following
are discussed in Barwise (1979):
(134) Most men and most women like each
other.
As Barwise convincingly argued, the most
plausible reading for (134) can be para-
phrased as follows: it is possible to select a
group containing a majority of the men, and
then independently of the selection of this
first group to select a group containing a
majority of the women, and to do this in such
a way that all the members in the first group
and all the members in the second group like
each other. This reading can be represented
by the following branching formula:
To make sense of this notation, an interpre-
tation for the branching prefix must be agreed
1, 1, 2 quantifier does not disinguish be-
tween relations R and S such that for all a E
that R
1
range and the S
1
range of a have
the same number of elements.
Incidentally, the right-oriented 1, 1, 2
quantifiers are precisely the quantifiers that
are closed under right-permutations in the
sense of the following definition in Higgin-
botham & May (1981):
Definition 27
F is a right-permutation of E
2
if F is defined
by F(a, b) = f(a), f
a
(b), where f is a
permutation of E and {f
a
a E} a set of
permutations of E.
Left-permutations of E
2
are defined similarly.
Theorem 5 (Van Benthem)
1, 1, 2 quantifiers that are 1, 1 com-
pounds are either right-oriented or left-
oriented.
Proof: Suppose (A, B, R) is a linear 1, 1
compound. Then there are Q
1
Q
2
such that
Q
1
(A, {a Q
2
(B, R
a
)})
Because Q
2
observes ISOM: if Q
2
(B, R
a
)and
R
a
= S
a
then Q
2
(B, S
a
). This holds for
every a E. So if R
a
= S
a
for every a E
then (A, B, R) iff (A, B, S), i. e., is right-
oriented. Similarly, it can be shown that in-
verted 1, 1 compounds are left-oriented.
To see that the quantifier of example
(127) above is not a linear 1, 1 compound
one need only observe that R ~
r
S in the
picture below:
The quantifier holds for R, but not for S, so
is not right-oriented. To see that it is also
not left-oriented, observe that R and S in the
picture below have R ~
l
S, while the quanti-
fier relation holds for R, not for S:
Note that the quantifier in (127) fulfils the
weaker requirement of being AB-left-oriented:
it is invariant under all R, S A B such
that R ~
l
S.
Of course, the of example (127) is ex-
pressible in natural language:
21. Quantification 477
The relations in the following picture show
that is not right-oriented:
In fact, these pictures show that does not
even fulfil the weaker requirements of being
AB-left-oriented or AB-right oriented.
Here are some more examples of quanti-
fication that can be analyzed both as branch-
ing 1, 1 quantifiers and as 1, 1, 2 quan-
tifiers.
(139) No Achaian and no Trojan trust each
other.
(140) Exactly five Achaians and exactly six
Trojans fight each other.
(141) If nobody helps nobody, everybody will
suffer in the end.
A branching analysis for (141) was first pro-
posed in van Benthem (1983b). The corre-
sponding higher type analysis employs a
1, 1, 2 quantifier defined as follows:
(142) (person, person, help) (person
person) help =
Here a reduction to two 1, 1 determiners
is unproblematic, for this quantifier can also
be expressed in logical formula with just
1, 1 quantifiers, as follows:
(143) no x: (person(x), some y: (person(y),
help(x, y)))
But the point is that such an analysis has no
syntactic motivation at all, for why should
the second occurrence of nobody in the sen-
tence be interpreted as an occurrence of some-
body? Provided that a plausible syntactic
story can be told about it see section 3.6
the higher type analysis seems preferable.
In all these cases the reanalysis of branch-
ing quantification in terms of 1, 1, 2 quan-
upon. Barwise has proposed such an inter-
pretation for n-tuples of MON or MON
quantifiers. A proposal for numerical quan-
tifiers (quantifiers of the form exactly m ...)
was added by Van Benthem (1983 b). Restrict-
ing attention to binary branching, we can
picture the format like this:
Assuming that quant
1
is interpreted as Q
1
and
quant
2
as Q
2
, the following definitions give
the interpretation instructions for the three
cases in which we can assign a plausible mean-
ing to (136):
Definition 28 (Branching of MON quan-
tifiers)
X A, Y B such that Q
1
AX and
Q
2
BY and X Y R.
Definition 29 (Branching of MON quan-
tifiers)
X A, Y B such that Q
1
AX and
Q
2
BY and R X Y.
Definition 30 (Branching of numerical quan-
tifiers)
X A, Y B such that Q
1
AX and
Q
2
BY and R = X Y.
Note that these definitions depend on CONS
and on the monotonicity properties of the
quantifiers (in the case of the numerical quan-
tifiers: on the fact that exactly n can be
defined as a conjunction of a MON and a
MON quantifier). See Westersthl (1987) for
discussion and for a generalisation of the
account.
It is clear that the branching readings can
also be expressed by means of higher type
quantification. An interpretation for (134) in
terms of a 1, 1, 2 quantifier looks like this:
(137) (men, women, like-each-other)
where is the 1, 1, 2 quantifier such that
(138) (A, B, R) U A, V B,
U V R, and
This quantifier is not a 1, 1 compound, for
it is neither left-oriented nor right-oriented,
as the following pictures make clear. The re-
lations in the first picture are equivalent under
~
l
. Still the quantifier relation holds for R
but not for S:
478 VII. Semantik der Funktionswrter
2, 2 quantifier defined as:
According to this paraphrase, the donkey-
owning farmers that beat all of their donkeys
are the farmers that matter. This condition
may of course be weakened by changing the
definition of the 2, 2 quantifier; see Rooth
(1987) for discussion.
Once we are at it, higher type quantifiers
can also be used to analyze Bach-Peters sen-
tences with crossed anaphoric links:
(152) Every pilot who shot at it hit some Mig
that chased him.
This might mean the same as:
(153) Every pilot who shot at some Mig that
chased him hit it.
For this paraphrase the donkey analysis
works. In this reading all chasing Migs that
were shot at were hit. But maybe (152) should
rather be paraphrased as:
(154) For every pilot who shot at some Mig
that chased him it was the case that he
hit at least one of the chasing Migs that
he shot at.
This reading can also be analyzed by means
of a type 2, 2 quantifier
(155) ({x, y x pilot & x, y shot-at
& y mig & y, x chased}, hit)
where is defined by:
(156) (R, S) x dom(R) y rng(R) :
x, y R S
It should be noted, though, that the real prob-
lem with donkey sentences and Bach-Peters
sentences is not to state their truth conditions,
either in terms of higher type quantification
or by some other means, but rather to relate
their semantics to their syntax in some plau-
sible way.
3.3Resumptive Quantification and
Branching
It is claimed in May (1985) and May (1989)
that in examples like the following a pair
reading is present:
(157) Nobody helps nobody.
(158) Everyone likes everyone.
(159) Exactly one man loves exactly one
woman.
(160) Few men admire few women.
(161) Many Trojans loathe many Achaians.
tifiers is not the only possibility. One might
contend that quantifiers of still higher types
are involved, and analyze (134) as:
(144) (men women, like-each-other)
where , of type 2, 2, is defined as:
In a case such as this we can say that the
2, 2 quantifier is reducible to a 1, 1, 2
quantifier. Not every 2, 2 quantifier is re-
ducible in this sense; such a reduction is only
possible for 2, 2 quantifiers that always
have a Cartesian product as their first argu-
ment.
The quantifier relation in the famous don-
key sentence
(146) Every farmer who owns a donkey beats
it.
can be viewed as a 2, 2 type quantifier:
(147) ({x, y x farmer y donkey
& x, y own}, beat)
where is defined by:
(148) (R, S) R S
Note that this 2, 2 quantifier is not reduc-
ible to a 1, 1, 2 quantifier: if one takes the
set of farmers who own donkeys as the first
argument, the set of donkeys owned by farm-
ers as the second argument, and the beat-
relation as the third, then the relation between
the donkeys and their owners is lost. Note
also that the 2, 2 quantifier employed here
is a direct generalization of the 1, 1 every.
Using a type 2, 2 quantifier, we can also
state acceptable truth conditions for a related
and reputedly troublesome sentence:
(149) More than half of the farmers who own
a donkey beat it.
This sentence certainly does not mean that
more than half of the pairs consisting of a
farmer and a donkey owned by that farmer
are members of the beat-relation. Consider a
situation where there is one rich and cruel
farmer, who beats all of his fifty donkeys, and
there are nine poor farmers, who all own just
one donkey that they treat well; in such a
situation the sentence should turn out false.
Presumably, the sentence should mean some-
thing like:
(150) More than half of the donkey-owning
farmers are donkey-beating farmers.
Reasonable truth conditions are given by the
21. Quantification 479
of types 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, and so on. In
many instances, they are also reducible to
pairs, triples, ... of 1, 1 quantifiers, but not
to pairs, triples, ... of identical 1, 1 quan-
tifiers. This can be taken as semantic moti-
vation for the syntactic move of quantifier
resumption, provided of course that the re-
sumptive readings of identical quantifier pairs
really obtain. Note that the resumptive read-
ings of (157), (158) and (159) are equivalent
to the branching readings of these examples.
However, such is certainly not true for (162),
(163), (164) or for the following example:
(165) At most two men and at most two
women love each other.
On the branching reading, (165) means that
there are no sets X, Y such that X Y love,
and X does contain more than two men or Y
more than two women (see section 3.5). On
the resumptive reading it means that the in-
tersection of love and men women contains
at most two pairs. It is doubtful whether (165)
really has the resumptive reading.
Note that the picture given as a counter-
example to the resumptive reading of (164)
makes the branching reading of this sentence
true. The paradigm examples where resump-
tion works well turn out to be precisely the
cases where the resumptive reading is equiv-
alent to a branching reading. This suggests
linking the syntax of quantifier-resumption
and a branching semantics, where the branch-
ing readings may of course turn out to be
equivalent to linear arrangements of quanti-
fiers, as e. g. in the case of (157) and (158).
4. Quantification and Syntax
4.1Syntactic Form and Logical Form
In a well-known metaphor in the introduction
to the Begriffsschrift, Frege compared the re-
lation between natural language and formal
language to that between the naked eye and
a microscope. Freges attitude is characteristic
for the way in which logicians used to look
at natural language. The standpoint that nat-
ural language is not a suitable tool for rea-
soning because it does scant justice to the
formal structure of thought came to be called
the Misleading Form Thesis for Natural Lan-
guage.
An adherent to the Misleading Form The-
sis might discard the idea of a logico-semant-
ical analysis of natural language as altogether
hopeless this was the attitude of Alfred
These examples are taken to have the follow-
ing readings, possibly among other ones.
(157): there is no pair of persons such that
the first member of the pair helps the second
member. (158): for every pair of persons it
holds that the first member loves the second.
(159): exactly one pair consisting of a man
and a woman exists such that the man loves
the woman. (160): few pairs consisting of a
man and a woman are such that the man
admires the woman. (161): many pairs con-
sisting of a Trojan and an Achaian have the
property that the first member killed the sec-
ond. May accounts for these readings by as-
suming a syntactic mechanism that takes the
second quantified specifier of an identical pair
to be a resumption of the first (and the ac-
count can be extended to arbitrary n-tuples).
There are some semantic difficulties with
resumptive quantification. According to the
theory,
(162) Exactly two dots are connected to ex-
actly two stars.
should have a resumptive reading that is true
in the following situation:
In the same situation, the resumptive reading
of
(163) Half of the dots are connected to half
of the stars.
if there is one, should be true. The sentence
(164) Most of the dots are connected to most
of the stars.
is predicted to have a resumptive reading that
is false in the following situation:
These predictions are questionable. The prob-
lems are related to the difficulty noted in
section 3.5 in connection with example (149).
Resumptive quantifiers are taken to be of
types 2, 2, 3, 3, etc., according to the
number of identical specifiers that is taken
together. As has been noted in section 3.5,
these quantifiers are reducible to quantifiers
480 VII. Semantik der Funktionswrter
tures, plus the record of the way in which
they have been construed, contain enough
information about meaning and inferential
behaviour to enable direct interpretation in
an appropriate model. The fact that the in-
termediate level of translation in a logical
language is not essential has led to the stan-
dard but mistaken view that the concept of
Logical Form is alien to Montague gram-
mar. Montagovian analysis trees trees re-
cording the history of the building of syntactic
structures may fruitfully be regarded as
logical forms: because of their close connec-
tion with semantic rules they fulfil the five
requirements just mentioned to a sufficient
degree.
Montague Grammar has set rigorous stan-
dards for a non ad hoc semantic analysis of
natural language. Proponents of Transfor-
mational Generative Grammar and Govern-
ment Binding theory and other more syntac-
tically oriented theorists also saw the impor-
tance of a systematic relation between syn-
tactic structure and logico-semantic structure.
GB theorists have postulated a separate com-
ponent of the grammatical framework which
they call the Logical Form or LF component
of the grammar. This component is derived
from structures of surface syntax by a series
of applications of structure-transforming
rules.
Historically, the use of quantifier raising
for mapping syntactic structures into logical
forms that has been proposed in TGG and
GB theory was preceded by a quantifier low-
ering (or more generally: operator lowering)
analysis. See Seuren (1984) for a historical
synopsis and an account of this earlier Gen-
erative Semantics theory. As the generative
semantics account is only of historical interest
we will concentrate on GB theory and Mon-
tague grammar, with a focus on quantifier
scope and variable binding.
4.2Quantifier Raising
The theory of the scope behaviour of quan-
tified NPs that represents the main direction
for treating semantic phenomena in the TGG
and GB tradition is developed in May (1977,
1985). In this account, semantic structure is
covered in a separate Logical Form compo-
nent. Of central importance to the theory of
Logical Form is the effect of a single rule QR
(Quantification Rule), a transformation rule
for mapping surface-structures to LF struc-
tures. QR moves a component and leaves a
trace. The rule itself does not specify where
Tarski but a more positive reaction is also
possible. If the superficial form of natural
language sentences is indeed misleading, one
might still try to analyze natural language
sentences by translating them into a more
transparent medium. This would replace the
Misleading Form of a sentence with a repre-
sentation of its true Logical Form. To qualify
as representations of Logical Form, the
translations must satisfy several require-
ments:
1. They must be expressions of a disambig-
uated language.
2. They must be suitable for representing the
meanings of the original sentences, by spec-
ifying their truth conditions in sufficient
detail.
3. They must be suitable for reasoning, i. e.
they must be in a language for which
sound, manageable and preferably com-
plete inference systems exist.
4. They must be in a language that is rich
enough to deal with natural language frag-
ments of reasonable complexity.
Requirement (1) entails that the Logical
Forms cannot be natural language expres-
sions themselves. Requirements (2) and (3)
are interconnected but must nevertheless be
kept apart. It is conceivable that some me-
dium of representation copes successfully
with (2) but not nearly as well with (3), e. g.
because the Logical Form structures are too
cumbersome for use in systems of inference.
The language of predicate logic satisfies (1)
and is rather good for both (2) and (3). Un-
fortunately predicate logic does not satisfy
requirement (4).
Even if we substitute a language with gen-
eralized quantifiers for predicate logic, the
question of the connection between the mis-
leading natural language forms and the logi-
cal forms remains. If one supports the Mis-
leading Form Thesis one may take the trans-
lation process to be ad hoc. Otherwise, one
has to impose the following additional con-
dition on Logical Forms:
5. Logical Forms must be such that they can
be arrived at from syntactic forms in a non
ad hoc, compositional way.
The first logician to take requirement (5)
seriously has been Richard Montague. Mon-
tague proposed a close connection between
rules for the syntactic construction of natural
language expressions and rules for the inter-
pretation of these expressions. His syntactic
structures are not misleading: these struc-
21. Quantification 481
from Reinhart (1976).
Definition 32
A node A in a structure tree T c-commands
node B in T the first branching node
dominating A also dominates B.
Definition 33
The c-command domain of node A in T
the set of all nodes X in T that A c-
commands.
Definition 34
NP A
i
binds its trace e
i
in T e
i
is in
the c-command domain of A
i
in T.
Definition 35
A variable e
i
is properly bound in T
some NP A
i
binds e
i
in T.
Applications of QR must be forced in cer-
tain circumstances; the next definition is
needed to describe these:
Definition 36
The argument-positions of a predicate are
the NP-positions for which the predicate is
subcategorized (subject, object, etc.), ex-
cept for the positions where the dummy-
subject it can occur (e. g. the subject po-
sition in it is certain that ).
In more recent GB-jargon, argument posi-
tions are the positions in which -roles can
be assigned. The Predication Condition (PC)
ensures that every NP is related to a -po-
sition:
Definition 37 (PC)
A logical form structure satisfies the
predication condition if every quantified
phrase in properly binds one and only
one occurrence of a trace in argument po-
sition.
The requirement that logical forms satisfy PC
makes application of QR obligatory if quan-
tified NPs occur in the surface structure of a
sentence; also, it compels movement in up-
ward direction. Note that CA ensures that the
moved element will be a (possible complex)
NP.
As an example of the way in which QR
works, consider the following sentence with
two quantified NPs:
(167) Every satyr frightened some nymph.
QR must apply twice in order to comply with
PC; the two possible orders of application
yield the following LF-structures:
the moved element has to go, except in very
general terms. Extra information about the
target position is encoded in conditions on
transformations that apply to all possible
transformations. The rule is defined as fol-
lows:
(166) (QR) Adjoin Q to S.
Like every movement transformation, QR
leaves a trace at the source position when it
moves a constituent. Traces are interpreted as
variables bound by the moved elements in
their new positions. The (repeated) applica-
tion of QR on surface structures of sentences
results in structures that closely resemble for-
mulas of a logic with generalized quantifiers
of type 1, 1.
In connection with QR the most important
condition on transformations is the Condition
on Analyzability:
Definition 31 (CA)
A set of grammar rules satisfies the condi-
tion on analyzability if the following holds:
if a rule mentions SPEC, then applies
to the minimal [+ N]-phrase dominating
SPEC which is not immediately dominated
by another [+ N]-phrase.
CA makes use of some simple version of -
theory: [+ N]-phrase is used to generalize
over NPs and APs; SPEC generalizes over
NP-specifiers.
Among NP-specifiers the categories Q,
DET, and are distinguished; all these are
sisters of the -node. The category Q ranges
over (standard and non-standard) quantifier-
specifiers, including the indefinite article a
and indefinite some. The category DET
ranges over definite articles, demonstratives,
reflexives and processives. The empty speci-
fier is the specifier of a proper name, a
personal pronoun, a bare mass noun or a
bare plural. The distinction between three
kinds of specifiers induces a distinction be-
tween Quantified Phrases (NPs with Q as spe-
cifier) and Referring Phrases (NPs with DET
or as specifier). NPs with several specifiers
like the many victims are quantified
phrases: QR is triggered by the presence of a
specifier Q, regardless of whether a specifier
DET is also present.
To make QR work as intended the notion
NP A
i
binds its trace i must be defined and
it must be verified that the traces left after
application of QR are indeed bound in the
desired way. The definition of binding uses
the structural notion of c-command taken
482 VII. Semantik der Funktionswrter
amples differ in their possible scope readings.
(175) Everybody cursed Ephialtes in some
Greek city.
(176) Ephialtes betrayed everybody in some
Greek city.
Example (175) will get two readings: after two
applications of QR, either everybody or some
Greek city can end up in the higher position.
Example (176) is syntactically ambiguous be-
tween a structure where the PP belongs to the
direct object and a structure where the PP
and the direct object are sisters. Under the
first syntactic analysis (176) is semantically
unambiguous, under the other analysis the
sentence gives rise to two non-equivalent LF-
structures; this gives three readings in all. The
predictions fit in reasonably well with ones
intuitions about scope ambiguity. Note that
the predictions depend crucially on the asym-
metry of the c-command relation. If asym-
metric c-command is replaced by a symmetric
version, PC will permit any scope ordering.
We may take it that QR as applied to
sentences containing an embedded sentence is
subject to the Subjacency Conditionfor LF,
although May (1985) is equivocal about this.
Subjacency for LF implies that quantified
NPs in embedded sentences can only take
scope over operators in the embedded clause,
i. e. it predicts that quantification is clause-
bounded. Thus, in example (177), QR can
either adjoin the subject of the embedded
sentence to the matrix S or to the embedded
S, but only the second option results in a LF-
structure that complies with the Subjacency
Condition.
(177) Odysseus regretted that one of his
friends had been killed.
According to the theory, in the only accept-
able LF-structure for (177) the existential
quantifier representing the subject of the em-
bedded sentence will have narrow scope with
respect to regretted that. This prediction is
clearly wrong. Subjacency also predicts that
in relative clauses the relativized element has
scope over all operators in the relative clause.
There are many exceptions to the rule that
quantification is clause-bounded. In May
(1977) the following other shortcomings are
admitted, but the relevant facts are pro-
claimed to be outside the scope of the theory:
Direct objects of transitive verbs are pre-
dicted to exhibit only a transparent read-
ing; the reading of Odysseus seeks a prin-
cess, where a princess has narrow scope
with respect to seeks is unaccounted for.
In a logical language with 1, 1 quantifiers,
where the format of quantification is given
by
(170) quant x: ((x), (x))
with as the restriction of the quantifier and
as its body, (168) and (169) can respectively
be translated as follows (tense is disregarded):
(171) every x: (satyr(x), some y: (nymph(y),
frighten(x, y)))
(172) some y: (nymph(y), every x: (satyr(x),
frighten(x, y)))
The quantifiers here are the standard re-
stricted quantifiers, but non-standard gener-
alized quantifiers may occur as well. Of
course the logical translations can be dis-
pensed with: because the LF structures (168)
and (169) are unambiguous they can be in-
terpreted directly in suitable models.
The example illustrates how logical forms
fix scope relations between quantifiers; in
fact, the scope relations in LF structures are
determined by the syntactic c-command re-
lations. Recently it has been proposed to re-
gard LF structures as ambiguous between
several scope readings (cf May 1989). In this
proposal the asymmetric notion of c-com-
mand is replaced by a symmetric notion. With
this amendation, both LF structures for (167)
are ambiguous between the and the
reading. The replacement of asymmetric c-
command by symmetric c-command is moti-
vated by examples with crossed bindings, e. g.
in Bach-Peters sentences.
Here, we stick to the older version and
discuss some further examples of applications
of QR. If an NP has the form
(173) [
NP
[
NP
Q
1
N] [
PP
PREP [
NP
Q
2
N]]]
then as a consequence of CA and ap-
plication of QR to Q
1
will move the whole
NP; an application of QR to Q
2
will move
only the NP dominated by PP and extract it
from the whole NP. This predicts a scope
order Q
2
Q
1
for NPs with the above structure:
if Q
1
did c-command Q
2
in LF, then PC would
not be met.
(174) Everybody in some Greek city cursed
Ephialtes.
Example (174) will get an interpretation
where some x which is a Greek city has scope
over every y which is a person present in x.
The other scope order is ruled out because it
would leave the variable x in every y which is
a person present in x unbound.
The theory predicts that the following ex-
21. Quantification 483
index number n, and the rule application
QI
n
(A, ) inserts the NP A into the expression
in the position of the leftmost pronoun with
index n occurring in . If the NP A is not a
pronoun then the indices of all other occur-
rences of pronouns with index n in are
deleted. If A is a pronoun, then it has some
index, say k; application of QI
n
now replaces
all indices n on pronouns in by k.
Quantifiying-in is used to establish the an-
aphoric link that is indicated by the italics in
the following example.
(178) Every sailor believed that he would per-
ish.
This sentence, with the intended anaphoric-
link, is formed in two steps. First a sentence
is formed in which two pronouns with the
same index occur.
(179) He
3
believed that he
3
would perish.
Next, the subject every sailor is quantified in
at S-level for index 3. The first occurrence of
he
3
is replaced by every sailor, and the index
of the second occurrence of he
3
is erased.
The semantic effect of quantifying-in is
given by the translation instruction that goes
with syntactic function QI
n
. Let be a syn-
tactic expression of category S, let stand
for translates as, and let A be the translation
of A, and the translation of . Then we
have (disregarding intensions, here and
henceforth):
(180) Quantifying-in at S-level
QI
n
(A, ) A(x
n
.)
The variable x
n
in this instruction is of type
e. If is an expression of category CN or VP
the following rule applies:
(181) Quantifying-in at CN/VP level
QI
n
(A, ) y.A(x
n
.(y))
Again, this is an extensional version; the var-
iables x
n
and y are of type e. As can be seen
from these rules, quantifying-in of pronouns
serves no semantic purpose. Montague allows
it because he wants quantifying-in to apply
uniformly to all NPs.
The quantifying-in rules are context sensi-
tive; they regulate the process of substituting
an NP in a certain expression, with very dras-
tic effects on the interpretation of that ex-
pression. These rules serve not only to remove
ambiguities resulting from the mutual scope
behaviour of quantifiers; they are also used
to establish anaphoric links between an an-
tecedent NP and a bound pronoun, and they
account for ambiguities resulting from the
The asymmetries in scope behaviour be-
tween the various quantified NPs (ambi-
guity of Every satyr frightened some
nymph versus non-ambiguity of Some
nymph frightened every satyr) are unac-
counted for. Kroch (1974) gives an ac-
count in terms of lexical differences of the
specifiers involved.
Definite descriptions do not have scope in
this theory, or, more precisely, they are
taken to have narrow scope with respect
to every other operator. This yields fre-
quent wrong predictions for descriptions
with an embedded quantified NP, like the
lord of every creature.
QPs containing a preposition plus a quan-
tified NP are predicted to unambiguously
exhibit an inversely linked reading, which
means that the most natural reading of
examples like every patient with a non-
contagious disease is missed.
For reasons unknown to the present au-
thor, recent work on LF has not concentrated
on removing these shortcomings, but rather
on extending the theory in new directions:
quantification with crossed anaphoric link-
ing, as in Bach-Peters sentences, has been
studied, and a mechanism of absorption,
which essentially combines two 1, 1 quan-
tifiers into one 2, 2 quantifier is proposed
to handle it (cf Higginbotham & May 1981,
May 1985, May 1989). See section 3.6 above
for a discussion of the semantics.
The proposal to make absorption a general
mechanism that applies to examples like (167)
just as well as to Bach-Peters sentences is
disturbing. Analysing (167) by considering
as a 2, 2 quantifier that is true of the two
relations satyr nymph and frighten just in
case there is a y nymph with man {y}
frighten (or as a 1, 1, 2 quantifier with the
obvious modification to the truth conditions)
may be semantically unobjectionable but it
mocks the Fregean insight that these cases
can be treated by a compositional use of
quantifiers of type 1 or 1, 1.
4.3Quantifying In
In the so-called PTQ fragment of Montague
(1973), quantifying-in rules are used to effect
scope reversals of logical operators and to
provide anaphoric links. A quantifying-in rule
combines an NP A with an expression of
category S, CN or VP by substituting A for
the occurrences of some indexed pronoun in
. There is a syntactic function QI
n
for every
484 VII. Semantik der Funktionswrter
istential one, and her is anaphorically linked
to some nymph. To get this reading, some
nymph must be quantified-in at VP level; the
matrix for the application of the rule being
frightened him
2
and embraced him
2
.
Quantifying-in at CN level can be neces-
sary in examples where a relative clause A
modifies a CN already containing a modifier
B, with B itself containing an NP that is
anaphorically related to a pronoun in A. Sen-
tence (185) provides an example:
(185) Odysseus disliked every suitor of a girl
in Ithaca who had tried to marry her.
In the syntactic analysis of (185) that interests
us the relative clause who had tried to marry
her modifies suitor of a girl in Ithaca. Under
this analysis, example (185) has a reading
where every suitor has scope over a girl in
Ithaca, while a girl in Ithaca is anaphorically
linked to her. To get this anaphoric link one
has to quantify in a girl in Ithaca in a con-
stituent that already contains the relative
clause. To also get the quantifier scopes right,
the only suitable phrase is the common noun
suitor of him
3
who had tried to marry him
3
.
In example (182) the process of quantify-
ing-in, applied to the NP some nymph and the
sentence every satyr frightened him
4
, yields the
following translation (tense is disregarded):
(186) P.x(nymph(x) P(x)) (x
4
.y (sa-
tyr(y) P.P(x
4
) (z. frighten (y, z))))
After some applications of -conversion this
reduces to:
(187) x(nymph(x) y(satyr(y)
frighten(y, x)))
This is indeed the inverse scope reading of
(182). Here satyr translates as satyr, nymph
as nymph. The translation instruction for
frighten is:
(188) frighten Py.P(z.frighten(y, z)))
In (188), P is a variable of type e, t, t, y
and z are variables of type e and frighten is
a constant of type e, e, t. The notation
frighten(y, z) is used as shorthand for
frighten(z)(y). Incidentally, translation in-
struction (188) eliminates the need for a
meaning postulate to relate a constant of type
e, t, t, e, t to one of type e, e, t.
The example makes clear that the device
of quantifying-in necessitates a distinction be-
tween syntactic structure and derivational his-
tory. The following structure can be derived
in a number of ways, and not all of these
derivations result in the same interpretation:
interaction of NPs and the negation operator,
or from the interaction of NPs and inten-
sional operators.
The transparent/opaque distinction be-
tween the two readings of Odysseus seeks a
princess can be accounted for without using
the quantifying-in mechanism, by distinguish-
ing two versions of seek, one opaque and one
transparent in object position. Similarly for
the functional-nonfunctional distinction for
the subject position of IVs like change. The
transparent/opaque ambiguities out of the
way, we are left with scope ambiguities and
anaphoric linking as tasks for the quantify-
ing-in mechanism. Quantifying-in is primarily
intended to resolve scope ambiguities; the ac-
count of anaphoric links that it also provides
is more or less a side effect. It is clear that
quantifying-in can only account for bound
anaphora, never for other kinds of anaphoric
links (cf article 23).
The quantifying-in rules in PTQ and in
many extensions of the PTQ fragment allow
virtually anything in the way of scope inver-
sions: even the most scope-sensitive Mon-
tague-grammarian will be able to account for
all of the readings he or she feels. In many
cases, indeed, too many readings are pre-
dicted. Montague keeps the boom of pre-
dicted ambiguities within certain limits by
imposing meaning postulates to establish log-
ical equivalences between the translations of
different derivations of the same sentence. In
Montagues terminology two formulas are
logically equivalent iff they are true in the
same models satisfying a given set of meaning
postulates.
One way to build sentence (182) in PTQ is
by directly combining the NP every satyr with
the VP frightened some nymph.
(182) Every satyr frightened some nymph.
The translation rule that goes with this syn-
tactic rule ensures that every satyr has wide
scope over some nymph. A scope reversal can
be effected by first producing the sentence
(183) Every satyr frightened him
3
.
and then use the rule for quantifying-in at S-
level to substitute some nymph for the pro-
noun him
3
.
Example (184) illustrates why it is neces-
sary to allow quantifying-in at VP level.
(184) Every satyr frightened some nymph
and embraced her.
Sentence (184) has a reading where the uni-
versal quantifier has wide scope over the ex-
21. Quantification 485
calls them), not by syntactic structure trees or
structure bracketings like (189). Here is a
derivational history tree for the inverse scope
reading of (189):
(189) [
S
[
NP
every satyr] [
VP
[
TV
frightened]
[
NP
a nymph]]]
Sentences are disambiguated by derivational
history trees (or analysis trees, as Montague
Example (191) indicates that it is necessary
to restrict QI
n
. In appears to depend on the
nature of the antecedent whether an ana-
phoric link is permitted or not in sentences
like this. Example (193), with anaphoric links
as indicated by the italics, is perfectly all right.
(193) Every gallant who admired Penelope
courted her.
The problem appears to be that QI applies
indiscriminately to all NPs. Although a char-
acterization of NPs permitting an anaphoric
link between an antecedent in a relative clause
and a pronoun in the main clause as in
the intended readings of (191) and (193)
in terms of properties of NP-denotations may
be feasible (one could rule out MON NPs),
the quantifying-in mechanism will often en-
gender the wrong readings:
(194) Every satyr who loved a nymph kissed
her.
As is well-known, the reading of (194) with
an anaphoric link as indicated by the italics
but with narrow scope for a nymph with re-
spect to the subject of the sentence is impos-
sible in PTQ. The problem is that the pronoun
in (194) is an example of a donkey pronoun.
As an alternative for the PTQ-method of
quantifying-in, a technique of NP storage has
been worked out in Cooper (1975, 1983).
Practical applications of this technique are
demonstrated in Hobbs & Shieber (1987). NP
storage is very similar to quantifying-in. In
order to give an NP wide scope its translation
is put in store, with a variable annexed to
it. The variable serves as a temporary place
holder in the LF expression under construc-
tion. Quantifying-in now boils down to bind-
ing the placeholder variable by lambda ab-
straction and applying the NP translation
pulled from store to the abstract. Of course
some care must be taken with complex NPs:
an NP
1
in store may contain an embedded
The numbers following the expressions iden-
tify the syntactic operations (PTQ-number-
ing) that have been used. The nodes of the
tree are occupied by well-formed strings. Der-
ivational history trees or analysis trees in PTQ
are entirely comparable to LF structures in
TGG/GB.
The quantifying-in rules in PTQ do not
refer to syntactic structure; no syntactic rules
in PTQ do. It is easy to modify PTQ so that
it generates structured descriptions instead of
strings; in this modified version call it
structured PTQ a syntactic rule has struc-
tured descriptions as input and output. Con-
sequently, in structured PTQ derivational his-
tory trees are adorned trees: their nodes con-
sist of labelled bracketings instead of strings.
Each labelled bracketing represents a struc-
ture tree, so a derivational history tree is a
tree with structure trees at its nodes. See Par-
tee (1973b) and Janssen (1983) for further
discussion.
In the original PTQ-fragment QI
n
simply
refers to the leftmost pronoun with index n.
This disregard of syntactic structure creates
serious problems in connection with quanti-
fying-in. To demonstrate this, a provisional
extension of the PTQ-fragment with the de-
terminer no is useful. The translation of no is:
(190) QP.x(Q(x) P(x))
Now consider this example:
(191) Every satyr who frightened no nymph
embraced her.
Clearly, an anaphoric link between no nymph
and her is impossible. Still, the PTQ rules
permit quantifying-in of no nymph in the S-
expression every satyr who frightened her
3
em-
braced her
3
;this establishes an anaphoric link
between no nymph and her, and gives the
following translation:
(192) x(nymph(x) y((satyr(y)
frighten(y, x)) embrace(y, x)))
486 VII. Semantik der Funktionswrter
introduced in it, and has the rest of the sen-
tence as its body. The body is x kissed her,
which means that the pronoun her can be
anaphorically linked to y because her is in the
scope of a quantifier with y in its block. The
universal quantification over x and y gives
(194) the reading that was discussed in section
3.5. A very neat account of the semantics of
a theory along these lines can be given in
terms of the state change semantics employed
in dynamic logic: see Barwise (1987a), Groe-
nendijk & Stokhof (1987) and Rooth (1987)
for more information. In van Eijck (1985 b)
it is argued that the representation structures
of the Kamp/Heim theory fulfil the require-
ments for Logical Forms from section 4.1.
Advantages of the Kamp/Heim theory are
that it provides a neat account of donkey
pronouns in examples like (194) and that text
anaphora are dealt with elegantly: pronouns
can be linked to variables that always remain
accessible because they are introduced in the
top block. Problems for the theory are ex-
amples like (149) from section 3.5. The inter-
esting question remains whether the new
quantification and anaphoric link mechanism
can fully replace the Montagovian approach.
The answer to this depends of course on the
kinds of extensions one is prepared to graft
on the original theory. It is fairly clear that
the account of the distinction between the
strict and the sloppy reading of
(197) Agamemnon loved his wife and Orestes
did so too.
will necessitate the introduction of some no-
tion of bound anaphora in addition to the
notion of link anaphora that is the basis of
the Kamp/Heim theory.
5. Conclusion
By way of general conclusion we can say that
the theory of generalized quantifiers provides
the toolbox for defining adequate truth con-
ditions for a wide variety of quantification
phenomena in natural language expressions.
Of course there are difficult remaining prob-
lems evaded in the present contribution
most notably concerning the nature of the
domain of quantification. Is it, for instance,
fruitful or maybe even necessary to quantify
over events in the sense of Davidson (1967)?
If so, what is the nature of these events, and
what is their principle of individuation, i. e.
how do we go about to distinguish one event
from another? Fortunately, progress in nat-
NP
2
which may or may not be stored itself.
One only gets a well-formed LF expression if
the NPs are pulled from store in the correct
order. This imposes the same constraint on
the quantifier scopes in examples like (174)
as the predication condition in GB theory.
Another alternative to quantifying-in is
lexicalisation of scoping, as proposed in Hen-
driks (1987). To get the inversed scopes read-
ing of (182), one adds the following new
translation instruction for frighten to the lex-
icon:
(195) frighten PQ.P (y.Q (z. frighten
(z, y)))
Note that whereas the old translation instruc-
tion (188) maps frighten to an expression of
type f(NP), e, t (f(NP) is the type
e, t, t of NPs), the new instruction (195)
maps to an expression of type f(NP),
f(NP), t. This means that for this ap-
proach to scoping to work a switch to flexible
Montague grammar is necessary, where given
categories can map to a variety of types. In-
dependent reasons for making this move are
given in Partee & Rooth (1983).
Of course, the constraints that are needed
on quantifying-in will have to be imposed on
the alternative techniques as well. Both NP
storage and lexicalisation of scoping remain
very close to quantifying-in in that they em-
ploy a mechanism of binding of the variables
introduced by quantifiers; neither of the two
alternatives can solve the anaphora problems
in connection with (191) and (194). The link-
ing anaphora mechanism proposed in Kamp
(1981a) and Heim (1982) tackles these issues.
This theory draws a sharp distinction between
quantified expressions on one hand and def-
inite or indefinite expressions on the other.
Definite and indefinite expressions add new
variables to a current block of variables;
quantified expressions start a new variable
block, introduce a variable in this block and
bind the whole block of variables after it has
been completed. The proposal for the treat-
ment of (194) now runs like this: every satyr
who loved a nymph introduces a variable x for
satyr who loved a nymph. This variable is
constrained to satyr(x) and x loved a nymph.
When x loved a nymph is further analysed, a
nymph gives rise to a new variable y con-
strained to nymph(y). This gives the follow-
ing block:
(196) satyr(x), nymph(y), x loved y
The universal quantifier takes the whole block
as its restriction, binds the variables x and y
487
say that this is no accident. This should not
disturb natural language semanticists, howe-
ver. Rather than admitting defeat they should
carry on looking for the missing links.
This paper has benefited from comments by Johan
van Benthem, David Carter, Hans Peter Kolb,
Fernando Pereira, Elias Thijsse, Dieter Wunder-
lich, and two anonymous Handbook referees. Jane
Gardiner gave valuable advice on English prose
style. Thank you all.
6. Short Bibliography
Barwise 1979 Barwise 1987a Barwise/Cooper
1981 van Benthem 1983b van Benthem 1983c
van Benthem 1984b van Benthem 1986a van
Benthem 1986b van Benthem 1989 Church
1940 Cooper 1975 Cooper 1983 van Dalen
1983
2
Davidson 1967 van Eijck 1985a van Eijck
1985b Evans 1980 Frege 1879 Frege 1891
Frege 1892 Geach 1962 Geach 1970 Geach
1972 Groenendijk/Stokhof 1987 Heim 1982
Hendriks 1987 Higginbotham/May 1981 Hobbs/
Shieber 1987 Janssen 1983 Kamp 1981a Kee-
nan 1987b Keenan/Moss 1985 Kroch 1974 La-
dusaw 1979 Landman/Moerdijk 1983 Lewis
1970 Lewis 1975a Lindstrm 1966 Lbner
1986 May 1977 May 1985 May 1989 Mon-
tague 1973 Mostowski 1957 Partee 1973b Par-
tee 1979 Partee/Rooth 1983 Reinhart 1976
Reinhart 1987 Rooth 1987 Russell 1905 Scha
1981 Seuren 1984 Tarski 1933 Tarski 1956
Westersthl 1984 Westersthl 1985 Westersthl
1987 Westersthl 1989 Zwarts 1983 Zwarts
1986
Jan van Eijck, Amsterdam
(The Netherlands)
ural language semantics does not seem to
depend on a solution of these issues.
The semantic theory of quantification is
reasonably well developed, but the area of
quantification and syntax is another matter.
The main open questions are:
1. How is the variable binding paradigm
from first order logic employed both in
the GB theory of LF and in Montague
grammar related to the state change
semantics paradigm from dynamic logic
that is employed in the Kamp/Heim theory
of Logical Form?
2. How are LFs for natural language expres-
sions involving higher type quantification
connected to surface syntactic forms?
As to the second question, it seems clear that
a combination of paradigms is called for. Gi-
ven that the two paradigms treat indefinite
descriptions in a different way one para-
digm assimilates them to quantifiers, the
other one does not this raises the question
how indefinites are to be treated in a combi-
ned theory. Also, the line between anaphora
resolution by binding and anaphora resolu-
tion by linking needs to be drawn.
Although the theories discussed in section
4 provide a partial answer to the first que-
stion, for most of the irreducibly higher type
quantifiers that we have encountered in sec-
tion 3 we have no systematic way of deriving
them from syntactic surface structures. The
compositional connection between syntactic
structures and the higher type generalized
quantifiers that are needed to state their truth
conditions has not yet been found. Of course,
adherents to the Misleading Form Thesis will
22. Artikel und Definitheit
3. Definitheit in NP-Klassifikationen
3.1 Definita im engeren Sinne
3.2 Starke und schwache NPs
4. Quellenangaben und Literaturempfehlungen
5. Literatur (in Kurzform)
Artikel und Definitheit bezeichnet keinen
natrlich begrenzten Themenkomplex in der
logischen Semantik. Entsprechend zerfllt
dieser Artikel in mehrere nur lose zusammen-
hngende Teile, und viele berlegungen en-
den in Fragen, fr die andere Artikel zustn-
dig sind.
1. Der bestimmte Artikel
1.1 Die Russellsche Deutung und ihre Rechtfer-
tigung
1.2 Existenz- und Einzigkeitsbedingung als Pr-
supposition, Fregesche Deutung
1.3 Referentieller und attributiver Gebrauch
1.4 Bereichswahl: Kontextabhngigkeit und Ana-
phorizitt
1.5 Sonstiges
2. Der unbestimmte Artikel
2.1 Ein als Existenzquantor
2.2 Spezifische und unspezifische Lesart
2.3 Sonstiges
488 VII. Semantik der Funktionswrter
grenzen lt. (Grob gesagt ist der Artikel vl-
lig unbetont und verschmilzt im Kontext ge-
wisser Prpositionen obligatorisch zum Por-
temanteau, z. B. von + dem = vom, whrend
der Demonstrativdeterminator einen wenn
auch schwachen Akzent trgt und neben Pr-
positionen selbstndig bleibt.) Diesen Artikel
nennen wir hier das, wobei die Singular-Neu-
trum-Nominativ-Form zugleich fr alle an-
deren Numeri, Genera und Kasus stehen soll.
Das tritt, grob gesagt, auer mit Eigennamen
mit allen Substantiven auf, ungeachtet Nu-
merus und Zhlbarkeit. Bis Abschnitt 1.4 be-
schrnken wir uns allerdings auf Vorkomm-
nisse vor zhlbaren Singularappellativa. Wir
nehmen weiterhin an, da das oder ein in
relevanter Hinsicht quivalentes abstraktes
Morphem versteckt in NPs mit prnomina-
lem Genitiv oder Possessivpronomen vorhan-
den ist (des Knigs Tochter = die Tochter des
Knigs, sein Haus = das Haus von ihm).
1.1Die Russellsche Deutung und ihre
Rechtfertigung
1.1.1Russellsche Deutung
Die berhmteste Deutung des bestimmten Ar-
tikels stammt von Russell (1905) und besagt
folgendes:
(1) Ein Satz der Form [das ] drckt die-
jenige Proposition aus, die wahr ist, wenn
es genau ein gibt und dieses ist, und
die andernfalls falsch ist.
Daraus ergibt sich also, da (2) wahr ist, wenn
es genau eine Katze gibt und diese schlft.
(2) Die Katze schlft.
Falls es hingegen keine Katze gibt, oder falls
es zwei oder mehr Katzen gibt, oder schlie-
lich falls es genau eine gibt, diese aber nicht
schlft, so ist (2) falsch.
Man kann diese Analyse auf allerhand Ar-
ten implementieren, von deren Unterschieden
wir hier abstrahieren (s. Artikel 7 und 21).
Wenn man semantische Interpretation auf
dem Umweg der bersetzung in eine gngige
Logiksprache betreibt, kann man z. B. so ver-
fahren, da man Stze wie (2) in prdikaten-
logische Formeln wie (3) berfhrt.
(3) x [y [Katze(y) x = y] & schlft(x)]
Arbeitet man mit sogenannten Generalisier-
ten Quantoren, so kann man sagen, das
drcke diejenige Relation zwischen zwei Men-
gen aus, die genau dann besteht, wenn die
erste Menge genau ein Element hat und dar-
berhinaus Teilmenge der zweiten ist. Uns
Der erste und mit Abstand lngste Haupt-
abschnitt widmet sich der Deutung des be-
stimmten Artikels, ein zweiter der des unbe-
stimmten. In beiden Fllen beginnen wir mit
Vorschlgen, die seit Beginn des Jahrhunderts
zum Kanon der logischen Sprachanalyse ge-
hren, und konfrontieren diese dann mit einer
Reihe von Einwnden und Verbesserungsvor-
schlgen. In erster Linie referieren wir dabei
Literatur aus der Tradition der Wahrheits-
bedingungensemantik, verweisen aber hie und
da auch auf Berhrungspunkte mit Frage-
stellungen und Begriffsbildungen philolo-
gisch-linguistischer Herkunft. Manche Le-
ser(innen) wird es enttuschen, da wir so
ausgiebig bei den alten Hten verweilen
und vielbeachtete neueste Arbeiten noch nicht
einmal erwhnen. Damit soll nicht impliziert
sein, da diese Arbeiten ohne Wert sind; ge-
rade sie knnen aber nur im Vergleich mit
den klassischen Theorien angemessen beur-
teilt werden. Aus Platzgrnden muten hier
Prioritten gesetzt werden, und die Autorin
dieses Kapitels hielt ein relativ genaues und
vollstndiges Bild von Leistungsfhigkeit und
Grenzen der klassischen Analysen fr lehr-
reicher als einen notgedrungen oberflchli-
chen Querschnitt durch die aktuelle Literatur.
Der dritte Hauptabschnitt beschftigt sich
mit Definitheit als einer semantischen Eigen-
schaft, die neben dem bestimmten Artikel und
damit gebildeten NPs auch auf gewisse andere
Determinatoren und NPs zutrifft. Wir be-
trachten dort kurz einen engeren und einen
weiteren Definitsbegriff aus der neueren Syn-
tax- und Semantikliteratur, knnen aber nicht
ernsthaft auf empirische Anwendungen und
theoretischen Nutzen solcher Begriffsbildun-
gen eingehen.
Mit Ausnahme des dritten Abschnittes ist
die Darstellung nicht sehr technisch. Forma-
lisierungen werden nur wo unbedingt ntig
erwhnt, und auch dann mehr oder weniger
vereinfacht wiedergegeben. So gewinnen hof-
fentlich auch technisch unerfahrene Le-
ser(innen) wenigstens einen ersten Einblick in
die Problematik, whrend es versierteren im
allgemeinen leicht fallen drfte, die unter-
schlagenen Feinheiten zu ergnzen.
1. Der bestimmte Artikel
Wir schlieen uns hier ohne Diskussion der
traditionellen Lehrmeinung an, da das Deut-
sche einen bestimmten Artikel besitzt, der sich
mittels prosodischer und morphophonemi-
scher Kriterien vom sonst identischen De-
monstrativpronomen und -determinator ab-
22. Artikel und Definitheit 489
rungskontext knnen wir uns ein Welt-Zeit-
Paar vorstellen, d. h. uerungswelt und
uerungszeit. Ein Auswertungsindex ist
gleichfalls ein Welt-Zeit-Paar, jedenfalls ge-
ngt das fr unsere Zwecke hier.)
(7) Russellsch: direkt refe-
rentiell:
Wann drckt immer nur wenn es
eine Propo- an k
genau
sition aus? ein gibt
Wann ist die wenn es an wenn an i
ausgedrckte i genau ein auf das ein-
Proposition gibt, und zige an k
zu einem an i auf zutrifft
Auswertungs- das einzige
index i wahr? an i zu-
trifft
1.1.3Standardargumente fr die Russellsche
Analyse
Da die referentielle Deutung dem naiven Ver-
stndnis nher liegt, fragt sich sofort, was
wohl Russell und seine Nachfolger zu einer
Gegentheorie bewogen hat. Dafr gibt es eine
Reihe Standardargumente. Kurz gesagt wer-
den der referentiellen Analyse Schwierigkei-
ten mit folgenden vier (teilweise berlappen-
den) Typen von Beispielen vorgeworfen: Iden-
tittsaussagen; wahre Stze mit leeren Kenn-
zeichnungen; Existenzaussagen; und Skopus-
phnomene. Die Russellsche Alternative wird
jeweils mit den Problemen fertig.
1.1.3.1Identittsstze
(8) bedeutet nicht dasselbe wie (9).
(8) Der Vater von Vreneli bin ich.
(9) Ich bin ich.
Whrend (9) trivial ist, ist (8) informativ,
kann also je nach Sachlage wahr oder falsch
sein. Eine korrekte Semantik des bestimmten
Artikels mu das mglich machen.
Setzen wir voraus, da das Wort ich in
jeder uerungssituation dasjenige Indivi-
duum bezeichnet, das dort spricht. Stze mit
ich sind also unter beiden zur Diskussion ste-
henden Analysen kontextabhngig, d. h. sie
drcken in der Regel je nach uerungssitua-
tion verschiedene Propositionen aus. Fr (9)
allerdings ergibt sich, da damit immer die
notwendig wahre Proposition behauptet wird,
denn egal wer (9) uert, der Betreffende ist
garantiert mit sich selber identisch. Daher
unser Urteil, da dieser Satz trivial ist.
Bei Satz (8) jedoch scheiden sich die Ana-
lysen. Betrachten wir eine uerung von (8),
interessieren hier nur die Wahrheitsbedingun-
gen, die im Endeffekt herauskommen, und so
sprechen wir bei diesen und vielen anderen
Analysen allemal von der Russellschen Deu-
tung des bestimmten Artikels.
1.1.2Direkt referentielle Deutung
Die Alternative, die wir der Russellschen
Deutung hier gegenberstellen, ist in ihrem
intuitiven Kern wohl naheliegender und des-
halb auch historisch lter; allerdings prsen-
tieren wir sie in einer modernen Variante, zu
der sie sich erst unlngst gemausert hat. Die
Grundidee dieser Deutung ist, da mit der
uerung einer NP der Form das ein In-
dividuum benannt wird. Z. B. kann man sich
eine uerung des Satzes (2) vorstellen, bei
der sich die Sprecherin mit die Katze auf die
Katze Meimei bezieht und somit mit dem Satz
als ganzem eine Proposition ber Meimei aus-
drckt, nmlich die Proposition, da Meimei
schlft. Das ist also dieselbe Proposition, die
sich auch mit dem Satz (4) oder (bei geeig-
neter begleitender Geste) mit dem Satz (5)
ausdrcken liee.
(4) Meimei schlft.
(5) Sie schlft.
Natrlich kann man sich mit derselben NP
die Katze auch auf andere Katzen als Meimei
beziehen. In dieser Hinsicht hnelt diese NP
weniger dem Eigennamen Meimei als dem
Pronomen sie, das ja auch je nach uerung
mal dieses, mal jenes Individuum bezeichnet.
Die Katze hat bezglich mglicher Referenten
allerdings nicht ganz soviel Spielraum wie sie;
es gilt vielmehr die folgende Regel:
(6) das , geuert in der Welt w zum Zeit-
punkt t, bezeichnet nur dann etwas, wenn
es in w zu t genau ein gibt. Ist diese
Bedingung erfllt, so bezeichnet die be-
treffende uerung von das dieses In-
dividuum.
Es kann also bei unpassendem uerungs-
kontext passieren, da mit die Katze garnichts
benannt wird, in welchem Falle dann auch
mit dem Satz, in dessen Verlauf diese NP
geuert wird, nichts behauptet wird.
Die Deutung in (6) nennen wir fortan die
referentielle oder genauer die direkt refe-
rentielle Deutung des bestimmten Artikels
(s. Artikel 9). Da wir im folgenden diese Deu-
tung mit der Russellschen vergleichen wollen,
stellen wir die beiden noch einmal in einer
Tabelle gegenber. Sei eine uerung eines
Satzes der Form [das ] , die im uerungs-
kontext k
stattfindet. (Unter einem ue-
490 VII. Semantik der Funktionswrter
sprachliche Wort falsch verwendet werden
kann, entscheidet als solches nicht zugunsten
der Russellschen Deutung. Dem Vertreter der
referentiellen Analyse zeigt das allenfalls, da
seine Theorie hier eine feinere Unterscheidung
zwischen zwei Arten von Unangemessenheit
trifft, zwischen denen das vortheoretische
falsch nicht differenziert.
Interessanter sind deshalb Flle, wo die
referentielle Analyse keine Proposition, die
Russellsche dagegen eine wahre liefert, denn
bei diesem Unterschied kann man sich nicht
einfach durch terminologische Toleranz neu-
tral halten. Betrachten wir etwa das negierte
Gegenstck zu (10).
(11) Der deutsche Kaiser ist nicht krank.
Unter der referentiellen Deutung drckt die-
ser Satz, 1988 geuert, ebensowenig eine
Proposition aus wie (10). Das kommt heraus,
egal auf welche der folgenden beiden Weisen
man ihn logisch gliedert.
(12) Der deutsche Kaiser hat die Eigenschaft,
nicht krank zu sein.
(13) Es ist nicht der Fall, da der deutsche
Kaiser krank ist.
Whlt man (12), so ist von vorneherein klar,
da keine Proposition zustandekommt, da ja
das Subjekt keinen Referenten hat und folg-
lich die vom Prdikat ausgedrckte Eigen-
schaft auf nichts angewandt werden kann.
Whlt man (13), so steht man vor der un-
mglichen Aufgabe, von einer nicht zustan-
degekommenen Proposition die Negation zu
ermitteln.
Nun ist es tatschlich so, da wir das iso-
lierte Beispiel (11) als unangemessen empfin-
den, und zwar in der gleichen Weise unange-
messen wie sein unnegiertes Gegenstck (10).
Insofern knnen wir mit der Voraussage der
referentiellen Deutung zufrieden sein. Unter
passenden Umstnden ist es aber auch mg-
lich, Satz (11) in einem Sinne zu gebrauchen,
in dem er intuitiv nicht nur angemessen, son-
dern sogar wahr ist. Z. B. kann man sich fol-
genden Dialog vorstellen.
(14)
a. Der deutsche Kaiser ist krank.
b. Unsinn, der deutsche Kaiser ist be-
stimmt nicht krank, denn Deutsch-
land hat doch schon lngst keinen
Kaiser mehr.
Whrend die referentielle Deutung hier also
anscheinend der neutralen Lesart genge tut,
erlaubt sie uns nicht, auch die alternative Les-
art zu erfassen, die unter solchen besonderen
Umstnden entsteht.
deren Sprecher Hagelhans ist. Russellsch ge-
deutet drckt sie die Proposition aus, da
Hagelhans und niemand sonst Vrenelis Vater
ist. Dies ist ganz klar eine kontingente Pro-
position. Sie ist z. B. falsch, wenn Vreneli die
Tochter von Joggeli ist. Unter der referentiel-
len Analyse dagegen liegt die Proposition, die
dieses Beispiel ausdrckt, nicht schon da-
durch fest, da der Sprecher Hagelhans ist,
sondern hngt zustzlich noch davon ab, was
in der uerungssituation der Referent der
NP der Vater von Vreneli ist. Dafr ist Regel
(6) zustndig: Diese NP benennt, wenn ber-
haupt etwas, das einzige Individuum, das in
der uerungswelt Vrenelis Vater ist. Da gibt
es nun drei Mglichkeiten: Entweder in der
uerungswelt hat niemand oder mehr als
einer Vreneli gezeugt; dann kommt gar keine
Behauptung zustande, also erst recht keine
informative. Oder in der uerungswelt hat
Hagelhans Vreneli gezeugt; dann wird die
Proposition, da Hagelhans mit sich selbst
identisch ist, behauptet, also dieselbe Trivia-
litt, die (9) ausdrckt. Oder schlielich in der
uerungswelt hat jemand von Hagelhans
verschiedener Vreneli gezeugt; dann ist die
behauptete Proposition, da dieser andere mit
Hagelhans identisch ist, also notwendig
falsch. In keinem der drei Flle lt die re-
ferentielle Analyse also fr (8) eine kontin-
gente Behauptung zustandekommen.
1.1.3.2Leere Kennzeichnungen in wahren
Stzen
uerungen, die eine leere Kennzeichnung
enthalten, drcken nach der referentiellen
Analyse nie eine Proposition aus, whrend sie
nach der Russellschen teils wahr, teils falsch
sind. Mit leerer Kennzeichnung meinen wir
hier eine uerung von das in einer Welt
und zu einer Zeit, wo es kein gibt. Ein
einfaches Beispiel ist (10), geuert in unserer
Welt im Jahre 1988.
(10) Der deutsche Kaiser ist krank.
Diese uerung ist unter der Russellschen
Deutung falsch, unter der referentiellen Deu-
tung dagegen weder wahr noch falsch, da
berhaupt keine Behauptung mit ihr zustan-
dekommt. Leider lt sich dieser Unterschied
nicht ohne weiteres dazu ausnutzen, zwischen
den beiden Analysen zu unterscheiden. Beide
stimmen insofern mit unserem intuitiven Ur-
teil berein, als sie die uerung von (10) als
irgendwie unangemessen und irrefhrend ein-
stufen. Da fr dieses Urteil das umgangs-
22. Artikel und Definitheit 491
Aber auch hier finden sich Beispiele, mit
denen nur die Russellsche Analyse fertig wird,
nmlich uerungen, die eine NP das ent-
halten und dabei wahr sind, obwohl es meh-
rere s gibt. Beispiele analog zu (14) oben sind
hier zwar wesentlich schwerer zu forcieren
und glcken, wenn berhaupt, nur mit starker
Betonung auf dem bestimmten Artikel:
(17) ? Ich habe noch nie DIE Blume vor
meinem Fenster gegossen, denn es sind
zwei Blumen vor meinem Fenster.
Aber parallel zu (15) lassen sich natrliche
Beispiele finden. Stellen wir uns etwa vor,
Hans hat drei Shne und nur eine Tochter.
(18) ist in dieser Situation durchaus geglckt
und kann wahr sein.
(18) Wenn Hans drei Tchter und nur einen
Sohn htte, dann wrde die Brauerei
natrlich der Sohn erben.
Bei diesem Satz versagt wiederum die referen-
tielle Analyse, whrend die Russellsche keine
Probleme hat.
1.1.3.3Existenzstze
Als nchstes versuchen wir die referentielle
Analyse auf die folgenden beiden Stze an-
zuwenden.
(19) Den Knig von Frankreich gibt es.
(20) Den Knig von Frankreich gibt es nicht.
Bei (19) kommt folgendes heraus: Entweder
uerungswelt und -zeit sind so, da Frank-
reich darin genau einen Knig hat. Dann ist
dieser der Referent der NP und die ausge-
drckte Proposition ist, da er existiert. Dies
ist zwar keine notwendig wahre Proposition,
aber in der uerungssituation ist sie jeden-
falls wahr. Oder aber Frankreich hat in der
uerungswelt und -zeit keinen oder mehrere
Knige. Dann wird mit (19) gar keine Pro-
position ausgedrckt. So oder so scheint es
nicht mglich zu sein, mit (19) etwas in der
uerungssituation Falsches zu behaupten,
wie man es doch intuitiv durchaus kann.
Immerhin sagt die referentielle Deutung
voraus, da mit einer uerung von (19) in
einer Situation, wo Frankreich keinen Knig
hat, irgendetwas nicht in Ordnung ist, und
man knnte sich vielleicht auf den Stand-
punkt stellen, da das unserem intuitiven Ur-
teil, so eine uerung sei falsch, nahe ge-
nug kommt. Aber mit (20) kommt man auch
dann nicht zurecht: Wenn Frankreich in der
uerungszeit und -welt genau einen Knig
hat, dann drckt (20) die Proposition aus,
da dieser nicht existiert, also eine Proposi-
Die Russellsche Deutung ist hier besser
dran. Mit ihr entsprechen nmlich die beiden
logischen Gliederungen (12) und (13) zwei
echt verschiedenen Lesarten. Nimmt man
(12), so kommt die uerung genauso falsch
heraus, wie ihr unnegiertes Gegenstck. Dies
ergibt also die neutrale Lesart, unter der (11)
und (10) tatschlich den gleichen unangemes-
senen Status haben. Whlt man hingegen (13),
so erhlt man die Negation von etwas Fal-
schem, also insgesamt eine wahre uerung.
Das erfat plausiblerweise die spezielle Les-
art, die in (14) hervortritt.
Da eine leere Kennzeichnung den Satz als
ganzen nicht immer am Wahrsein hindert,
zeigen auch Beispiele des folgenden Typs.
(15) Wenn Hans Shne hat, dann erbt sein
ltester Sohn die Brauerei.
Intuitiv kann (15) wahr sein, wenn Hans keine
Kinder hat. In diesem Fall gibt es aber gewi
keinen ltesten Sohn von Hans, und die NP
sein ltester Sohn (= der lteste Sohn von
Hans) hat daher unter der referentiellen Deu-
tung keinen Referenten. Demzufolge drckt
der dann-Satzkeine Proposition aus und so-
mit kommt auch fr das Konditional als gan-
zes keine zustande. Wiederum funktioniert
die Russellsche Deutung besser: Der dann-
Satz drckt die Proposition aus, da Hans
genau einen ltesten Sohn hat und dieser die
Brauerei erbt. Diese ist zwar per Vorausset-
zung in der uerungssituation falsch, aber
das hindert sie natrlich nicht daran, zusam-
men mit der (ebenfalls falschen) Antezeden-
sproposition ein wahres Konditional zu er-
geben.
Nebenbei bemerkt ergeben sich analoge
Fragen, wenn wir statt leerer Kennzeichnun-
gen solche betrachten, die an mangelnder Ein-
deutigkeit leiden, also uerungen von das ,
wo es zwei oder mehr s gibt. Stellen wir uns
etwa folgenden Dialog vor.
(16)
a. Warum bst du nicht Geige?
b. Mir ist die Saite gerissen.
Wir nehmen hier an, da sonst nichts zwi-
schen A und B gesprochen wurde oder sonst-
wie zu ihrem gemeinsamen Erfahrungsschatz
gehrt, das eine gegenber den anderen drei
Saiten von Bs Geige auszeichnen wrde (siehe
dazu 1.4 unten). Dann ist Bs uerung in-
tuitiv unangemessen. Aber falsch wrden
wir sie nicht nennen. In diesem Fall weicht
die Russellsche Analyse eindeutig vom vor-
theoretischen Gebrauch des Wortes falsch
ab, whrend die referentielle Analyse ihn re-
spektiert.
492 VII. Semantik der Funktionswrter
zu t gdw. fr jede Zeit t nach t gilt, da der,
der zu t Prsident der USA ist, zu t Weier
ist. Unter der referentiellen Analyse kommt
immer dasselbe heraus, egal ob der Prsident
der USA im Skopus des Zeitoperators steht
oder nicht, denn laut Regel (6) bezeichnet
diese NP denjenigen, der zur uerungszeit
Prsident der USA ist. Wird Satz (23) also
1988 geuert, so drckt er ungeachtet seiner
logischen Gliederung die Proposition aus, da
Reagan immer Weier sein wird. Die inter-
essantere Lesart bleibt dabei unbehandelt.
Die Analyse von (24) ist wegen der seman-
tischen Flexibilitt modaler Ausdrcke etwas
komplizierter (s. Artikel 29). Hier kommt es
uns aber nur darauf an, da (24) eine Lesart
besitzt, die sich etwa folgendermaen para-
phrasieren lt: Die Spielregeln implizieren,
da man mit der zweiten verlorenen Runde
automatisch das ganze Spiel verloren hat.
Wenn (24) in diesem Sinne geuert wird,
kommt es offenbar fr die Wahrheit der
uerung nicht auf Eigenschaften des tat-
schlichen gegenwrtigen Gewinners an, ja es
mu nicht einmal einen solchen geben. Das
zeigt schon, da die referentielle Deutung hier
nicht angemessen ist. Mit der Russellschen
Analyse ergibt sich die gewnschte Lesart da-
gegen unter der Annahme, da der Gewinner
im Skopus von kann nicht steht, und da kann
nicht hier in etwa bedeutet: es gibt keine
mit den Spielregeln vertrgliche Welt, wo
wahr ist.
Das Verhalten von das-NPs im Skopus von
Zeit- und Modaloperatoren widerlegt ein fr
alle mal die These, da das sich auf das
einzige in der uerungswelt zur ue-
rungszeit bezieht. Das wird noch klarer, wenn
wir zum Vergleich NPs heranziehen, deren
Deutung wirklich nur von den uerungs-
umstnden abhngt, etwa das Pronomen ich
oder ein von einer Zeigehandlung begleitetes
Demonstrativum. Im Gegensatz zu (23) oben
sind (25) und (26) nicht mehrdeutig.
(25) Ich werde immer ein Weier sein.
(26) Dieser Prsident [Sprecher zeigt auf Rea-
gan] wird immer ein Weier sein.
1.1.3.5Bemerkungen
Keines dieser vier Argumente mu man beim
heutigen Forschungsstand einfach so hinneh-
men. Das Problem der informativen Identi-
ttsaussagen z. B. tritt auch bei solchen NPs
auf, bei denen es starke unabhngige Grnde
fr eine direkt referentielle Deutung gibt
jedenfalls nach Meinung vieler zeitgenssi-
scher Forscher.
tion, die in der uerungssituation garantiert
falsch ist. Oder aber Frankreich hat keinen
oder mehrere Knige, und es wird somit gar
nichts behauptet. Mit Satz (20) sollte man
also nie etwas in der uerungssituation
Wahres behaupten knnen, whrend man das
doch intuitiv mit jeder uerung dieses Satzes
im 20. Jahrhundert tut.
Wieder hat es die Russellsche Deutung
leichter. (19) besagt ihrzufolge, da es genau
einen Knig von Frankreich gibt und dieser
existiert. Was immer das ganz genau bedeutet,
es ist jedenfalls in unserer Welt und unserem
Jahrhundert falsch. Satz (20) ist unter der
Russellschen Analyse prinzipiell skopusmehr-
deutig, nmlich kann er entweder als (21) oder
als (22) gelesen werden.
(21) Es gibt genau einen Knig von Frank-
reich und dieser existiert nicht.
(22) Es ist nicht der Fall, da es genau einen
Knig von Frankreich gibt und dieser
existiert.
(22) ist die Negation von (19) und deshalb
hier und heute wahr; dies ist offensichtlich
die intuitiv verfgbare Lesart.
1.1.3.4Skopus
Wir haben schon an den Beispielen (11) und
(20) gesehen, da unter der Russellschen Ana-
lyse der Skopus eines Definitums semantisch
relevant ist, whrend er unter der referentiel-
len Analyse keinen Einflu auf die Bedeutung
hat. Die beiden Analysen machen daher un-
terschiedliche Voraussagen ber Stze, die
neben dem Definitum z. B. einen Zeit- oder
Modaloperator enthalten.
(23) Der Prsident der USA wird immer ein
Weier sein.
(24) Der Gewinner kann nicht mehr als eine
Runde verlieren.
(23) ist intuitiv zweideutig. Wer diesen Satz
1988 uert, hat unter einer Lesart offensicht-
lich recht, denn Reagan wird gewi immer
wei bleiben. Unter einer anderen Lesart sagt
er dagegen etwas Kontroverseres, nmlich
da auch in Zukunft immer nur Weie an die
Macht kommen werden. Bei der Russellschen
Deutung kommt das zwanglos als Skopus-
mehrdeutigkeit heraus. Gibt man dem Defi-
nitum weitesten Skopus, erhlt man die ba-
nale Lesart: (23) ist wahr zu einer Zeit t gdw.
der Prsident der USA zu t die Eigenschaft
hat, zu jeder Zeit nach t Weier zu sein. Hat
dagegen wird immer weiteren Skopus, so er-
gibt sich die interessante Lesart: (23) ist wahr
22. Artikel und Definitheit 493
(11) Der deutsche Kaiser ist nicht krank.
Wir haben oben festgestellt, da dieser Satz
zweierlei Lesarten hat, nebenbei allerdings
auch bemerkt, da nicht beide Lesarten gleich
neutral sind. Man versteht (11) lieber so, da
es die Existenz eines deutschen Kaisers impli-
ziert, und weicht auf die andere Lesart nur
aus, wenn aus dem Kontext hervorgeht, da
dies nicht gemeint ist. Nun rechtfertigt die
Markiertheit dieser zweiten Lesart natrlich
nicht, sie ganz zu vernachlssigen, wie das
unter der referentiellen Analyse geschah. Bes-
ser ist da sicher eine Analyse wie die Russell-
sche, die eine Mehrdeutigkeit voraussagt.
Aber noch besser wre es, nicht nur beide
Lesarten zu erfassen, sondern darber hinaus
auch noch zu erklren, warum die eine zwang-
loser hervortritt als die andere. Ist das unter
der Russellschen Analyse mglich?
Auf den ersten Blick bietet sich eine syn-
taktische Erklrung an. Die neutrale Lesart
ist bei (11) nmlich diejenige, wo das Defini-
tum weiteren Skopus als die Negation hat,
was die syntaktischen Hierarchieverhltnisse
zwischen Subjekt und Negation widerspiegelt.
Tatschlich ist es in Stzen dieser Form ganz
allgemein schwieriger, der im Mittelfeld ste-
henden Negation Skopus ber das vorange-
stellte Subjekt zu geben als umgekehrt. An-
dere Beispiele zeigen aber, da diese Erkl-
rung nicht allgemein genug ist. Denn auch in
(29) mu die Lesart mit weiter Negation
durch einen passenden Kontext erzwungen
werden, obwohl hier die syntaktischen Bedin-
gungen fr diese Skopuskonstellation gewi
gnstig sind.
(29) Ich frhstcke nicht mit dem deutschen
Kaiser.
Sehen wir uns ein paar weitere Beispiele an.
(30) Hans mchte seinen Kontraba verstek-
ken.
(31) Hans fragt sich, ob sein Kontraba 1000
Mark wert ist.
(32) Wenn mein Mann kme, wrde ich Kn-
del kochen.
Nach der Russellschen Analyse sollten diese
Stze unter anderem folgende Lesarten
haben:
(33) Hans mchte genau einen Kontraba
haben und diesen verstecken.
(34) Hans fragt sich, ob er genau einen Kon-
traba hat und dieser 1000 Mark wert
ist.
(35) Wenn ich (genau) einen Mann htte und
dieser kme, wrde ich Kndel kochen.
(27) Der da [Sprecher zeigt auf eine Figur auf
einem Foto] bin ich.
Auch Satz (27) kann nichttriviale Information
vermitteln, obwohl hier rechts und links des
Identittsprdikats ein demonstrativ ge-
brauchtes Pronomen und das Pronomen ich
stehen, also Paradebeispiele fr Ausdrcke,
deren Referenz ausschlielich von der ue-
rungssituation abhngt. In der neueren phi-
losophischen Literatur finden sich einige Vor-
schlge, wie man der Informativitt solcher
Stze Rechnung tragen kann, ohne deswegen
die direkt referentielle Deutung der betroffe-
nen NPs zu widerrufen. Die Diskussion dieser
Vorschlge wrde hier zu weit fhren, zumal
da auf diesem Gebiet noch manches ungeklrt
oder kontrovers ist (s. Artikel 9). Wir mssen
deshalb an dieser Stelle offenlassen, ob und
inwiefern das Problem der Identittsaussagen
fr die Wahl der richtigen Deutung des be-
stimmten Artikels relevant ist.
hnliches gilt fr das Problem der Exi-
stenzaussagen. Auch dieses Problem betrifft
neben NPs mit dem bestimmten Artikel ge-
wisse andere NPs, die (zumindest nach einer
verbreiteten Lehrmeinung) direkt referentiell
zu deuten sind, insbesondere Eigennamen.
(28) Homer hat es (nicht) wirklich gegeben.
Hier knnen wir ebenfalls nicht auf die ein-
schlgigen Argumente und Kontroversen ein-
gehen. Stattdessen belassen wir es wiederum
bei dem Hinweis, da erst nach einer umfas-
senden Behandlung von Existenzaussagen,
die neben (19) auch (28) und andere Beispiele
bercksichtigt, verlliche Rckschlsse fr
die Semantik des bestimmten Artikels gezo-
gen werden knnten.
Auf das Problem der wahren Stze mit
leeren Kennzeichnungen kommen wir gleich
in Abschnitt 1.2 noch zurck, mit dem Er-
gebnis, da hier die beste Lsung eine Art
Mittelweg zwischen Russellscher und referen-
tieller Analyse ist. Und selbst die angeblichen
Skopusmehrdeutigkeiten in (23) und (24) wer-
den wir noch einmal genauer unter die Lupe
nehmen mssen, nmlich in 1.3.3.
1.2Existenz- und Einzigkeitsbedingung
als Prsupposition, Fregesche
Deutung
1.2.1Schwer erhltliche Lesarten
Denken wir noch einmal etwas genauer ber
das Beispiel (11) nach.
494 VII. Semantik der Funktionswrter
Prsupposition ist nun so definiert:
(38) Seien p und q (mglicherweise partielle)
Propositionen. Dann ist q eine semanti-
sche Prsupposition von p gdw. q bei
allen Welt-Zeit-Paaren wahr ist, bei de-
nen p wahr oder falsch ist.
p prsupponiert also z. B., da es unmittelbar
vorher geregnet hat; genauer gesagt, p pr-
supponiert die folgende Proposition q:
(39) q ist in w zu t
wahr, wenn es in w unmittelbar vor t
regnet;
falsch, wenn es in w unmittelbar vor t
nicht regnet.
Was ergeben sich nun fr empirische Voraus-
sagen aus der Annahme, da ein Satz eine
partielle Proposition ausdrckt, also eine
nicht-triviale Prsupposition hat? Zunchst
einmal gar keine; dazu mu erst einmal fest-
gelegt werden, welchen semantischen und
pragmatischen Gesetzmigkeiten partielle
Propositionen unterliegen.
Allgemein angenommen wird, da man,
um einen Satz aufrichtig zu behaupten, dessen
Prsupposition fr wahr halten mu. Daraus
folgt also, da man mit einer uerung von
(36) der Meinung Ausdruck gibt, es habe un-
mittelbar zuvor geregnet, und da der Hrer
dieser uerung berechtigt ist, daraus u. a.
diese Information zu entnehmen. Diese Vor-
aussage erlaubt uns freilich nicht, empirisch
zu berprfen, ob der Satz (36) wirklich eine
Proposition ausdrckt, die q prsupponiert.
Dasselbe wrde nmlich vorausgesagt, wenn
(36) statt p die Proposition p ausdrckte, von
der q zwar eine logische Folge, aber keine
Prsupposition ist.
(40) p ist in w zu t
wahr, wenn es in w unmittelbar vor t
regnet und zu t nicht regnet;
falsch andernfalls.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Hy-
pothesen kommt erst zum Vorschein, wenn
wir Stze mit eingebetteten Vorkommnissen
von (36) betrachten.
(41) Es hrt nicht zu regnen auf.
(42) Hans mchte, da es zu regnen aufhrt.
(43) Hans fragt sich, ob es zu regnen aufhrt.
(44) Wenn es zu regnen aufhrte, wrde es
wrmer.
Drckte (36) die Proposition p aus, so sollte
(41) die Negation von p ausdrcken, also,
Solche Lesarten sagen wir voraus, wenn wir
dem Definitum Skopus ber den minimalen
Satz geben, in dem es enthalten ist; sie sollten
also nicht nur mgliche, sondern sogar be-
sonders leicht erhltliche Lesarten sein, da die
logische Gliederung hier nahe an der syntak-
tischen Struktur bleibt. Das stimmt aber
nicht. (30) und (31) knnen, wenn berhaupt,
nur mit groer Mhe im Sinne von (33) und
(34) gelesen werden. Spontan lesen wir (30)
so, da es nichts darber aussagt, wie wn-
schenswert der Besitz eines Kontrabasses fr
Hans ist. (31) verstehen wir dahingehend, da
Hans sich durchaus sicher ist, einen Kontra-
ba zu haben. Und wenn wir (32) etwa von
einer Unbekannten hren, schlieen wir spon-
tan, da die betreffende verheiratet ist. (35)
ist zwar auch eine mgliche Lesart, aber wir
denken an sie erst, wenn wir wissen, da die
Sprecherin keinen Mann hat. Alle diese Bei-
spiele geben dem Russellianer dasselbe Rtsel
auf: Warum ist die Lesart, in der das Defi-
nitum den durch die syntaktische Struktur
nahegelegten engen Skopus erhlt, nicht
zwanglos verfgbar?
1.2.2Prsuppositionstheorie
In der Literatur gelten solche Beispiele in der
Regel als Indiz dafr, da die mit dem be-
stimmten Artikel verbundene Existenz- und
Einzigkeitsbedingung eine Prsupposition ist.
Um zu verstehen, was damit gemeint ist, und
was es zur Erklrung unserer Beobachtungen
beitrgt, mssen wir kurz in die Prsupposi-
tionstheorie abschweifen (vgl. Artikel 13).
Prsuppositionsforscher sind sich keineswegs
einig darber, was Prsuppositionen sind. Der
Konkretheit halber whlen wir hier einen so-
genannten semantischen Prsuppositionsbe-
griff (weisen aber weiter unten noch kurz auf
eine Alternative hin). Der Grundgedanke hier
ist, da manche Stze partielle Propositionen
ausdrcken, d. h. Propositionen, die nicht je-
der mglichen Welt und Zeit einen Wahrheits-
wert zuordnen, sondern nur fr eine Teil-
menge aller Welt-Zeit-Paare definiert sind.
Ein Beispiel wre die in (37) definierte par-
tielle Proposition p, die nach Meinung vieler
Forscher der Satz (36) ausdrckt.
(36) Es hrt zu regnen auf.
(37) p ist in w zu t
wahr, wenn es in w unmittelbar vor t
regnet und zu t nicht regnet;
falsch, wenn es in w sowohl unmittelbar
vor t als auch zu t regnet;
undefiniert (= wahrheitswertlos), wenn
es in w unmittelbar vor t nicht regnet.
22. Artikel und Definitheit 495
von p berall falsch. Dann stipulieren wir,
da ein Satz, der eine Proposition p aus-
drckt, stets eine sekundre Lesart besitzt,
unter der er stattdessen die Proposition T(p)
ausdrckt. Schlielich setzen wir fest, da se-
kundre Lesarten nur in solchen uerungs-
situationen verfgbar werden, wo die primre
Lesart den offensichtlichen Absichten des
Sprechers widerspricht. So ein Fall liegt z. B.
vor, wenn (41) im Zusammenhang von (46)
geuert wird.
(46) Es hrt nicht zu regnen auf, denn es hat
noch gar nicht angefangen.
Unter der Annahme, da (36) p ausdrckt,
ist dieser Text widersprchlich. Deswegen
darf man hier auf eine sekundre Lesart aus-
weichen, unter der (36) T(p) und (41) folglich
die Negation von T(p) ausdrckt. T(p) ist
natrlich p. Alles dieses ist skizzenhaft, ad
hoc, und vielleicht ganz falsch. Die Le-
ser(innen) mssen sich hierber durch Aus-
einandersetzung mit der Prsuppositionslite-
ratur ihr eigenes Urteil bilden.
1.2.3Prsupposition des bestimmten
Artikels
Kehren wir jetzt zum bestimmten Artikel zu-
rck. Die Analogie zwischen den Beispielen
(41)(44) einerseits und (29)(32) ande-
rerseits drfte bereits aufgefallen sein. Bei (41)
(44) bekommen wir Schwierigkeiten unter
der Annahme, da (36) es hrt zu regnen auf
die totale Proposition p ausdrckt, und diese
Schwierigkeiten scheinen im wesentlichen die
gleichen zu sein, die wir mit (29)(32) unter
der Russellschen Deutung des bestimmten Ar-
tikels haben: Beidesmal sagen wir eine mar-
kierte Lesart statt der intuitiv naheliegendsten
voraus. Fr den Fall der aufhr-Stze haben
wir eben angedeutet, wie im Rahmen einer
Prsuppositionstheorie gegen diese Schwie-
rigkeiten angegangen wird. Nun verfahren
wir genauso mit den das-Stzen. Statt der
totalen Propositionen, die sie unter der Rus-
sellschen Deutung ausdrcken, lassen wir
Stze der Form [das ] nun partielle Pro-
positionen ausdrcken.
(47) Fregesche Deutung
Unabhngig vom uerungskontext
drckt [das ] diejenige Proposition
aus, die an einem Index i
wahr ist, wenn es an i genau ein gibt
und dieses an i ist,
falsch ist, wenn es an i genau ein gibt
und dieses an i nicht ist,
da es entweder unmittelbar zuvor nicht ge-
regnet hat oder jetzt immer noch regnet. Tat-
schlich ist dies zwar eine mgliche Lesart,
aber nicht die neutralste. Spontan lesen wir
(41) nmlich im Sinne von es regnet weiter,
was aus der Negation von p nicht folgt. Ana-
loge Probleme ergeben sich bei (42)(44):
Unter der Annahme, da (36) p ausdrckt,
erhalten wir zwar mgliche, aber nicht die
unmarkierten Lesarten dieser drei Stze.
Drckt (36) dagegen die partielle Proposition
p aus, so knnen wir mit geeigneten Zusatz-
annahmen die neutralen Lesarten herleiten.
Es kommt nun darauf an, diese Zusatzan-
nahmen auszuarbeiten und zu motivieren,
was in der hier skizzierten Version der Pr-
suppositionstheorie darauf hinausluft, eine
kompositionale Semantik fr partielle Pro-
positionen zu entwickeln. Um die Stze
(41)(44) zu interpretieren, mssen wir z. B.
festlegen, was die Negation einer partiellen
Proposition ist, was es bedeutet, zu einer par-
tiellen Proposition in der Wnschensrelation
zu stehen, und was ein Konditional mit par-
tiellem Antezedens bedeutet. Dies ist keine
leichte Aufgabe, und sie ist in der gegenwr-
tigen Prsuppositionsforschung erst teilweise
gelst. Betrachten wir etwa das negierte Bei-
spiel (41). Eine sehr naheliegende Verallge-
meinerung des klassischen Negationsopera-
tors auf partielle Propositionen ist folgende:
Die Negation von p hat denselben Defini-
tionsbereich wie p und liefert fr jedes Welt-
Zeit-Paar in diesem Definitionsbereich den
entgegengesetzten Wahrheitswert wie p. Wen-
den wir das auf (41) an und nehmen an, da
(36) p ausdrckt, so ergibt sich, da (41) die
folgende Proposition p ausdrckt.
(45) p ist in w zu t
wahr, wenn es in w sowohl unmittelbar
vor t als auch zu t regnet;
falsch, wenn es in w unmittelbar vor t
regnet und zu t nicht regnet;
undefiniert, wenn es in w unmittelbar
vor t nicht regnet.
Dies entspricht in der Tat der neutralen Les-
art, denn p hat ebenso wie p die Prsup-
position q.
Damit sind wir freilich noch nicht am
Ende, denn nun mssen wir uns auch noch
um die markierte Lesart kmmern. Das kn-
nen wir z. B. so angehen: Wir definieren zu-
nchst einen Operator T, der partielle Pro-
positionen in totale verwandelt: T(p) stimmt
auf dem Definitionsbereich von p mit p ber-
ein und ist auerhalb des Definitionsbereichs
496 VII. Semantik der Funktionswrter
(32) knnen wir ohne greren Aufwand hier
leider nicht eingehen. Wir wollen nicht ver-
schweigen, da da selbst fr grndliche Ken-
ner(innen) der neuesten Prsuppositionslite-
ratur noch manches mysteris bleibt. Soweit
die Semantik solcher Stze innerhalb einer
Theorie der semantischen Prsupposition ein-
sichtsvoll beschrieben werden kann, haben
wir eine Motivation fr die Fregesche gegen-
ber der Russellschen Deutung. Bevor dies
aber vollstndig gelungen ist, ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen.
Im folgenden werden wir oft ber den Un-
terschied zwischen Russellscher und Frege-
scher Deutung hinwegsehen und beide als die
klassischen Deutungen in einen Topf wer-
fen. Dies ist insofern gerechtfertigt, als die
beiden viel wesentliches gemeinsam haben.
Zwar sticht auf den ersten Blick eine ber-
stimmung zwischen Fregescher und referen-
tieller Deutung ins Auge: beide sagen voraus,
da eine uerung von [das ] in der ue-
rungswelt weder wahr noch falsch ist, wenn
es dort nicht genau ein gibt. Aber in Bezug
auf die klassischen Argumente gegen die di-
rekt referentielle Analyse verhlt sich die Fre-
gesche Deutung grtenteils wie die Russell-
sche. Insbesondere sagt (47) voraus, da die
uerung eines Identittssatzes wie (8) eine
kontingente Proposition ausdrckt. (Es ist so-
gar fast dieselbe Proposition wie unter der
Russellschen Deutung, nur da sie fr Welten,
wo Vreneli keinen oder mehrere Vter hat,
statt Falsch berhaupt keinen Wahrheitswert
liefert.) Weiterhin ergibt sich aus der Frege-
schen Deutung, da der Skopus einer das-NP
relativ zu Modal- und Zeitoperatoren bedeu-
tungsrelevant ist, und damit erfat sie die
Skopusmehrdeutigkeiten in Stzen wie (23).
Abschlieend weisen wir noch darauf hin,
da viele Autoren einen anderen Prsuppo-
sitionsbegriff verwenden (prominente Bei-
spiele sind Karttunen & Peters 1979 und Gaz-
dar 1979). Sie nehmen an, da jeder Satz zwei
Propositionen ausdrckt, einen Inhalt und
eine Prsupposition, die beide totale Propo-
sitionen sind. (Falschheit der Prsupposition
impliziert also nicht Wahrheitswertlosigkeit
des Inhalts.) Im Rahmen solcher Theorien
wird die Russellsche Deutung des bestimmten
Artikels intakt bernommen: sie liefert dort
den Inhalt von Stzen der Form [das ] , und
mu blo noch durch eine separate Regel fr
die Prsupposition ergnzt werden:
(52)
a. [das ] hat als Inhalt diejenige Pro-
position, die an einem Index i wahr
und wahrheitswertlos ist, wenn es an i
nicht genau ein gibt.
Nach dieser Deutung prsupponiert [das ]
also, da es genau ein gibt (siehe Definition
(38)), whrend dies unter der Russellschen
Deutung lediglich eine logische Folge der aus-
gedrckten Proposition war.
Wenden wir diese Fregesche Deutung nun
auf den negierten Satz (29) an.
(29) Ich frhstcke nicht mit dem deutschen
Kaiser.
Wir nehmen an, da (29) die Negation von
(48) ist.
(48) Ich frhstcke mit dem deutschen Kai-
ser.
(48) drckt nach (47) die partielle Proposition
r aus.
(49) r ist an i
wahr, wenn es an i genau einen deut-
schen Kaiser gibt und ich an i mit diesem
frhstcke;
falsch, wenn es an i genau einen deut-
schen Kaiser gibt und ich an i nicht mit
diesem frhstcke;
wahrheitswertlos, wenn es an i nicht ge-
nau einen deutschen Kaiser gibt.
Wir haben oben festgelegt, was die Negation
einer partiellen Proposition ist. Demnach
drckt (29) die folgende ebenfalls partielle
Proposition r aus.
(50) r ist an i
wahr, wenn es an i genau einen deut-
schen Kaiser gibt und ich an i nicht mit
diesem frhstcke;
falsch, wenn es an i genau einen deut-
schen Kaiser gibt und ich an i mit diesem
frhstcke;
wahrheitswertlos, wenn es an i nicht ge-
nau einen deutschen Kaiser gibt.
(29) prsupponiert also ebenso wie (48), da
es genau einen deutschen Kaiser gibt, womit
erklrt ist, da wir dies spontan aus (29)
schlieen. Soweit die unmarkierte Lesart. Die
markierte Lesart, die etwa im Zusammenhang
von (51) erzwungen wird, erhalten wir mit-
hilfe der obigen Stipulationen, indem wir (48)
von r auf T(r) uminterpretieren.
(51) Ich frhstcke nicht mit dem deutschen
Kaiser, denn Deutschland hat gar keinen
Kaiser.
T(r) ist brigens genau die Proposition, die
uns die Russellsche Deutung fr (48) geliefert
htte.
Auf die Behandlung der Beispiele (30)
22. Artikel und Definitheit 497
B. Situationstyp 2: Dem Gastgeber G einer
Versammlung der Blaukreuzler ist soeben zu-
geflstert worden, es trinke jemand auf der
Versammlung Obstler, und daraufhin uert
er (53) zu B.
Die erste Situation soll den referentiellen
Gebrauch exemplifizieren. Laut Donnellan
dient hier die Kennzeichnung den Mann mit
dem Obstler dazu, eine bestimmte Person zu
benennen; der Inhalt des geuerten Befehls
selbst ist aber von der Wahl dieser Kennzeich-
nung unabhngig, d. h. G htte genau das-
selbe befehlen knnen, indem er E auf eine
andere Weise benannt htte. In der zweiten
Situation dagegen geht die Kennzeichnung
der Mann mit dem Obstler irgendwie wesent-
lich in den Inhalt des Befehls ein; hinausge-
schmissen werden soll hier nicht eine be-
stimmte Person, sondern, wer immer es sein
mag, der da Obstler trinkt. Dies kennzeichnet
den attributiven Gebrauch. Donnellan weist
darauf hin, da der Unterschied besonders
deutlich wird, wenn in Wirklichkeit ber-
haupt niemand Obstler trinkt. Stellen wir uns
etwa vor, E trinkt Wasser aus einem Schnaps-
glas und niemand trinkt Obstler. In der ersten
Situation macht das fr Zustandekommen
und Ausfhrbarkeit des Befehls nichts weiter
aus. Solange B versteht, da G E gemeint hat,
wei er, was er zu tun hat, auch wenn ihm
klar ist, da E blo Wasser im Glas hat. In
der zweiten Situation ist das anders. Sobald
hier B bemerkt, da gar niemand Obstler
trinkt, hat er keinen ausfhrbaren Befehl
mehr vor sich.
Donnellan fhrt seine Unterscheidung
durch solche und andere Beispiele ein und
schliet, da eine Russellsche oder Fregesche
Analyse die Eigenschaften des attributiven
Gebrauchs korrekt voraussage, nicht aber die
des referentiellen. Er legt sich aber auf keine
konkrete Analyse fr letzteren fest, und seine
Interpreten in der Fachliteratur sind, wie sich
gezeigt hat, durchaus verschiedener Meinung
darber, wie so eine Analyse auszusehen
htte. Wir wollen hier kurz auf dreierlei Pr-
zisierungen eingehen, die sich u. a. bei Kripke
(1977), Stalnaker (1970) und Kaplan (1978)
finden. In der linguistischen Literatur gibt es
daneben noch diverse andere Auslegungen
von Donnellans Terminologie (insbesondere
eine, nach der mit attributiv eine gewisse
Art von generischen Definita gemeint sind
siehe dazu 1.5.3 unten), die hier unberck-
sichtigt bleiben.
Kripke vertritt die These, alle Verwendun-
gen des bestimmten Artikels seien klassisch
zu deuten, einschlielich der von Donnellan
ist, wenn es an i genau ein gibt und
dieses an i ist, und andernfalls
falsch.
b. [das ] hat als Prsupposition die-
jenige Proposition, die an einem Index
i wahr ist, wenn es an genau ein gibt,
und andernfalls falsch.
Wiederum kommt es nun darauf an, geeignete
Prinzipien zu entwickeln, die etwa Prsup-
position und Inhalt eines negierten oder
sonstwie komplexen Satzes festlegen, und
zwar dergestalt, da neben den neutralen
auch die markierten Lesarten herauskommen.
Wir verweisen dazu auf die einschlgige Lite-
ratur. Unser Ziel in diesem Abschnitt war
nicht, fr eine bestimmte Behandlung der Exi-
stenz- und Einzigkeitsprsupposition des be-
stimmten Artikels zu argumentieren. Wir
wollten lediglich zeigen, wozu es gut sein
knnte, die Existenz- und Einzigkeitsbedin-
gung irgendwie vom Rest der Russellschen
Wahrheitsbedingung abzuheben. Der Kon-
kretheit halber haben wir hier mit partiellen
Propositionen und der Fregeschen Deutung
gearbeitet, aber nichts in unseren Ausfhrun-
gen spricht dagegen, diese Differenzierung in
einer anderen Prsuppositionstheorie vorzu-
nehmen.
1.3Referentieller und attributiver
Gebrauch
1.3.1Donnellan und seine Exegeten
In einem berhmten Aufsatz vertrat Donnel-
lan (1966) die These, da der bestimmte Ar-
tikel auf zweierlei verschiedene Weisen ge-
braucht werden knne, nmlich referentiell
oder attributiv. Vom attributiven Gebrauch
meint Donnellan, da er einigermaen befrie-
digend durch die klassischen semantischen
Analysen erfat sei. (Aus dem Streit zwischen
Russellscher und Fregescher Deutung hlt
sich Donnellan heraus.) Der referentielle Ge-
brauch sei jedoch bisher bersehen worden
und besitze Eigenschaften, die den klassischen
Analysen widersprechen.
Donnellan fhrt seine Unterscheidung mit
einer Reihe von Beispielen ein. Er betrachtet
etwa einen Satz wie (53) in zweierlei Typen
von uerungssituationen.
(53) Schmeien Sie den Mann mit dem Obst-
ler bitte sofort hinaus!
Situationstyp 1: Der Gastgeber G einer gro-
en Party hat gerade am anderen Ende des
Gartens seinen Erzfeind E erspht und wen-
det sich mit dem Befehl (53) an seinen Butler
498 VII. Semantik der Funktionswrter
einen indirekteren Zusammenhang zwischen
den beiden:
Wenn E der einzige Mann ist, der Obstler
trinkt, dann ist mit der Ausfhrung des Be-
fehls (54) zugleich auch der Wunsch (55) er-
fllt. Unter der genannten Voraussetzung ist
daher dieser Befehl ein passendes Mittel zur
Erfllung dieses Wunsches. Da der Sprecher
G erstens den Wunsch (55) hegt und zweitens
voraussetzt, da E der einzige Mann ist, der
Obstler trinkt, handelt er also rational, indem
er den Befehl (54) produziert. Der Hrer B
seinerseits sieht sich mit dem Befehl (54) kon-
frontiert, errt die eben genannte Motivation
fr diesen Befehl seitens des Sprechers G, und
erschliet so, da G den Wunsch (55) hegt.
Damit dieses Ratespiel klappt, braucht B
natrlich einen gewissen Einblick sowohl in
die ueren Unstnde der uerung als auch
in das Innere Gs. Er mu z. B. sehen, da die
Annahme, da E Obstler trinkt, fr G nahe-
liegt. Es ist aber nicht notwendig, da er diese
Annahme teilt. B kann Gs Beweggrnde auch
erraten, wenn er zufllig wei, da der ver-
meintliche Obstler blo Wasser ist. Der Befehl
(54) ist dann zwar entweder unausfhrbar
oder seine Ausfhrung wrde nichts zur Er-
fllung des Wunsches (55) beitragen. Aber
daraus folgt natrlich keineswegs, da B nicht
wte, wie er als gehorsamer Butler auf Gs
uerung zu reagieren hat. Fr praktische
Zwecke ist es irrelevant, da ein unausfhr-
barer Befehl geuert wurde; solange B er-
raten konnte, was G mit seiner uerung
wollte, mu er ihn ganz so behandeln, als
htte er befohlen, E zu entfernen. Kein Wun-
der also, da es so aussieht, als habe G (55)
und nicht (54) befohlen.
Wir sehen also, wie es dem Kripkeaner
gelingt, das Phnomen des referentiellen Ge-
brauchs vorherzusagen, ohne die einheitliche
Semantik des bestimmten Artikels aufzuge-
ben. (Wir konnten das hier freilich nicht fr
die Gesamtheit der Donnellanschen Beispiele
belegen, sondern nur eine Kostprobe geben.)
Dies ist natrlich ceteris paribus die attraktiv-
ste Position, und wir schlieen deshalb bis auf
weiteres, da die klassische Analyse korrekt
ist, und zwar nicht nur als Analyse einer Les-
art unter anderen, sondern als Analyse der
einzigen Lesart des bestimmten Artikels.
Kaplan (1978) und Stalnaker (1970) ver-
treten eine andere Auffassung. Fr diese bei-
den Autoren ist der referentielle Gebrauch
kein pragmatisches Epiphnomen, sondern
beruht auf einer eigenstndigen nicht-klassi-
schen Lesart des bestimmten Artikels, nm-
beschriebenen sogenannten referentiellen. Die
scheinbar unklassischen Eigenschaften der
letzteren ergben sich aus dem Zusammen-
spiel dieser Deutung mit pragmatischen Ge-
setzmigkeiten. Illustrieren wir diese These
kurz an der uerung von (53) in Situations-
typ 1, Donnellans Beispiel fr einen referen-
tiellen Gebrauch.
Der Befehl, den G mit (53) in Situation 1
zustandebringt, hat nach Kripkescher Auffas-
sung einen Inhalt, den wir etwa so charakte-
risieren knnen:
(54) unausfhrbar in w, wenn in w nicht ge-
nau ein Mann Obstler trinkt;
ausgefhrt in w, wenn B in w den ein-
zigen in w Obstler trinkenden Mann hin-
auswirft;
unausgefhrt in w, wenn B in w den
einzigen in w Obstler trinkenden Mann
nicht hinauswirft.
Dies ist also (entgegen Donnellans Ansicht)
kein Befehl, der direkt das Individuum E be-
trifft, sondern vielmehr einer, in dessen Inhalt
das Prdikat Mann mit dem Obstler wesent-
lich eingeht. Mit anderen Worten, es ist der
Befehlsinhalt, den Donnellan fr die Analyse
des attributiven Gebrauchs annimmt und den
uns eine klassische (genauer hier: Fregesche)
Deutung des bestimmten Artikels liefert.
Wenn E in der uerungswelt blo Wasser
trinkt, so impliziert (54) klar, da der Befehl
in dieser Welt entweder berhaupt nicht oder
allenfalls durch Herauswerfen einer von E
verschiedenen Person ausgefhrt werden
kann.
Woher kommt dann die Donnellansche In-
tuition, da sich der Befehl auf eine be-
stimmte Person, nmlich E, bezieht? Kripkea-
ner fhren das darauf zurck, da diesem
Befehl seitens des Sprechers ein auf E bezo-
gener Wunsch zugrundeliegt, und da dieser
Wunsch fr den Hrer und andere Zeugen
der uerung erschliebar ist. Den Inhalt
dieses Wunsches knnen wir so beschreiben:
(55) erfllt in w, wenn B in w E hinauswirft;
unerfllt in w, wenn B in w E nicht
hinauswirft;
(und vielleicht: unerfllbar in w, wenn
es E oder B in w nicht gibt.)
Kripkeaner sind sich mit Donnellan darber
einig, da Zweck und Wirkung des Befehls in
unserem Beispiel darin bestehen, einen
Wunsch mit dem Inhalt (55) mitzuteilen. Aber
whrend Donnellan den Inhalt des geuer-
ten Befehls einfach mit dem Inhalt des mit-
geteilten Wunsches gleichsetzt, sieht Kripke
22. Artikel und Definitheit 499
leicht Umstnde vorstellen, in denen diese
Bedingung nicht erfllt ist und eine Stalnaker-
referentielle Deutung deswegen ausscheidet.
Unser obiges Beispiel der uerung von Satz
(53) auf der Blaukreuzler-Versammlung (wie
auch andere Paradebeispiele fr den soge-
nannten attributiven Gebrauch) ist von dieser
Art. Hier setzt G zwar voraus, da es genau
einen Obstler trinkenden Mann gibt, aber es
gibt niemanden, von dem er voraussetzt, da
dieser Obstler trinkt. In dieser uerung
kann die definite NP daher nicht referentiell
gedeutet werden, jedenfalls nicht unter Stal-
nakers Definition der referentiellen Lesart.
Kaplans Deutung beinhaltet keine solche Be-
schrnkung. Dort ist nur verlangt, da es in
der uerungswelt tatschlich genau ein
gibt; wenn dies gilt, so kann sich der Sprecher
mit einem Definitum auf dieses beziehen,
auch wenn er es in keiner Weise kennt. Don-
nellans Ausfhrungen deuten darauf hin, da
Stalnakers Version seinen Intentionen hier n-
her kommt als Kaplans.
1.3.2Indirekte Argumente fr eine
referentielle Lesart
Halten wir uns aber nicht mit Donnellan-
Exegese auf, sondern fragen wir uns lieber,
ob die von Kaplan oder Stalnaker definierten
direkt referentiellen Lesarten wirklich eigen-
stndige Lesarten des bestimmten Artikels
sind. Wenn wir nach Kripkescher Manier alle
empirischen Merkmale des referentiellen Ge-
brauchs auch bei einer einheitlich klassischen
Semantik erklren knnen, dann werden wir
uns natrlich keine zweite Lesart aufbrden.
(Da nicht alle Vorkommnisse des bestimm-
ten Artikels direkt referentiell sein knnen,
haben wir ja schon in Abschnitt 1.1.3 gesehen,
und diese Ansicht vertritt heute auch nie-
mand.) Vertreter einer Kaplanschen oder Stal-
nakerschen Deutung fr das schulden uns
also den Nachweis, da es doch Verwendun-
gen dieses Wortes gibt, denen eine klassische
Deutung nicht gerecht wird. Donnellans Be-
obachtungen alleine reichen, wie Kripke ge-
zeigt hat, hier nicht aus. Verfechter einer ei-
genstndigen direkt referentiellen Lesart (ins-
besondere Stalnaker) haben sich deshalb sub-
tilere Argumente einfallen lassen, von denen
wir nun eine kleine Kostprobe geben.
Fr das folgende gelte als etabliert, da das
eine klassische Lesart hat. Wie knnen wir
nun empirisch berprfen, ob dies seine ein-
zige Lesart ist oder ob es ambig ist und neben
der klassischem noch eine direkt referentielle
Lesart besitzt? Durch bloe Inspektion der
lich einer Lesart, unter der das-NPs direkt
referentiell sind. Nach Kaplanscher Auffas-
sung ist dies genau die direkt referentielle
Deutung (6), die wir oben definiert haben.
Stalnaker nimmt dagegen eine Variante an,
die wir grob wie folgt wiedergeben.
(56) das , geuert am Kontext k, bezeichnet
nur dann etwas, wenn der Sprecher von
k von genau einem Individuum voraus-
setzt, da es ist. Ist diese Bedingung
erfllt, so bezeichnet die betreffende
uerung von das dieses Individuum.
Beide Vorschlge machen ernst mit Donnel-
lans Intuition, da bei gewissen Gebruchen
von das uerungsinhalte zustandekom-
men, in die nicht die Eigenschaft , sondern
vielmehr der Referent der NP eingeht.
Die beiden Deutungen unterscheiden sich
allerdings darin, welche Eigenschaft der
uerungssituation fr die Bestimmung des
Referenten verantwortlich ist. In der Kaplan-
schen Version ist es dasjenige Individuum, das
in der uerungswelt und zur uerungszeit
tatschlich als einziges ist. In der Stalna-
kerschen Version kommt es dagegen nicht auf
die objektiven Tatsachen an, sondern darauf,
wen der Sprecher fr ein hlt (bzw. so tut,
als ob er ihn fr ein halte). Im Normalfall
wird das auf dasselbe herauskommen. Don-
nellan hebt aber gerade die Flle hervor, wo
der Unterschied sichtbar wird, etwa das Bei-
spiel vom Wasser im Schnapsglas. Stalnakers
Version ist hier direkt nach Donnellans An-
weisungen geschneidert: Wenn G mit der
Mann, der den Obstler trinkt E meint und E
Wasser trinkt, dann ist der Referent dieser
NP trotzdem E; denn E ist es, von dem G
voraussetzt, da er ein Obstler trinkender
Mann ist. Kaplans Version hingegen liefert in
diesem Fall entweder gar keinen Referenten
oder einen anderen als E. Kaplanianer kn-
nen allerdings argumentieren, da dieser Un-
terschied keine empirischen Folgen hat (das
Argument ist den Kripkeanern abgeschaut):
Fr praktische Zwecke macht es letztenendes
nichts aus, welchen Inhalt eine uerung tat-
schlich besitzt, solange nur durch die ue-
rungsumstnde gesichert ist, da der Hrer
erschlieen kann, was gemeint war.
Die beiden Versionen unterscheiden sich
noch in einem weiteren Punkt. Bei Stalnaker
ist verlangt, da der Sprecher vom Referenten
voraussetzt, da dieser ist, d. h. er mu eine
de re Einstellung zu ihm haben, was wiederum
erfordert, da er mit ihm in gewissem Mae
vertraut ist (s. Artikel 34). Man kann sich
500 VII. Semantik der Funktionswrter
so hat er vorausgesehen, da Fortuna gewin-
nen wrde, aber nicht, da ich auf das sieg-
reiche Pferd setzen wrde. Hat er dagegen
z. B. gesagt: Du gewinnst bestimmt wieder
deine Wette, dann hat er vorausgesehen, da
ich auf das siegreiche Pferd setzen wrde, aber
nicht, da Fortuna gewinnen wrde.)
Welche Deutung des bestimmten Artikels
stimmt nun also? Anscheinend beide. Der
zweite Satz in Text (58) lt sich nmlich
intuitiv sowohl auf die eine wie auf die andere
der genannten Weisen auslegen. Dies ergibt
sich zwanglos, wenn wir den bestimmten Ar-
tikel als zweideutig auffassen. Wir bekommen
es aber nicht heraus und das ist der Witz
dieser Beobachtung , wenn wir ihm nur eine
Deutung zugestehen.
Nun ein zweites Argument fr die Zwei-
deutigkeitshypothese: Wie wir schon bemerkt
haben, rhrt die Schwierigkeit, die Existenz
einer eigenstndigen referentiellen Lesart
nachzuweisen, daher, da ein referentielles
Definitum hinsichtlich der Bedingungen fr
die Wahrheit der uerung sich nicht von
einem klassischen mit weitestem Skopus un-
terscheiden lt. Jedesmal, wenn wir ein re-
ferentielles Definitum vor uns zu haben mei-
nen, kann also der Skeptiker einwenden, es
handle sich in Wirklichkeit um ein klassisches
mit weitestem Skopus. Mssen wir ihm damit
das letzte Wort lassen? Nicht immer, wie die
folgende berlegung zeigt:
Linguisten nehmen allgemein an, da die
syntaktische Struktur eines Satzes weitge-
hend, wenn auch nicht vollstndig, seine lo-
gische Gliederung determiniert. (Demnach
entspricht gerade in komplexeren Stzen
durchaus nicht jeder logisch mglichen Sko-
puskonstellation der darin vorkommenden
Quantoren und Operatoren auch eine intuitiv
mgliche Lesart; s. Artikel 7.) Dieser Tatsache
verdankt es sich, da sich skopusmehrdeutige
Stze in der Regel durch Paraphrase disam-
biguieren lassen. In (59) z. B. kann entweder
ein oder zwei Leute oder immer weiteren Sko-
pus haben. Aber in (60) und (61) berlebt nur
jeweils eine dieser zwei Lesarten.
(59) Ein oder zwei Leute kommen immer zu
spt.
(60) Es gibt ein oder zwei Leute, die immer
zu spt kommen.
(61) Es ist immer so, da ein oder zwei Leute
zu spt kommen.
Anscheinend liegt das an einem allgemeinen
Prinzip, das Relativ- und da-Stzezu Sko-
pusinseln macht. Was immer hier genau die
richtige Generalisierung sein mag, wir halten
Wahrheitsbedingungen einzelner uerungen
lt sich das leider nicht entscheiden. Direkt
referentielle und klassische Deutungen ma-
chen nmlich empirisch quivalente Voraus-
sagen ber den Wahrheitswert, den eine ue-
rung der Form [das ] in der uerungssi-
tuation hat. Erst wenn wir die von der ue-
rung ausgedrckte Proposition betrachten, ge-
hen die Voraussagen auseinander. Aber
woran sollen wir erkennen, welche von zwei
Propositionen eine gegebene uerung aus-
drckt, wenn diese Propositionen in der
uerungswelt denselben Wahrheitswert
haben? Theoriefreie Kriterien gibt es dafr
leider nicht. Mit etwas Phantasie kann man
aber indirekte Tests erfinden.
Einer dieser Tests basiert auf folgender Be-
obachtung: Die Pronomina das, dasselbe usw.
in Stzen wie Hans glaubt dasselbe, Hans be-
dauert das scheinen sich auf Propositionen zu
beziehen. (Denn Propositionen sind ja nach
gngiger Auffassung die Gegenstnde des
Glaubens und Bedauerns.) In Texten wie (57)
greift das offenbar die Proposition auf, die
der vorangegangene Satz ausdrckt.
(57) Fortuna hat gewonnen. Hans hat das
vorausgesehen.
Der zweite Satz bedeutet hier nmlich, da
Hans vorausgesehen hat, da Fortuna gewin-
nen wrde.
Betrachten wir nun eine Variante von (57),
bei der es prima facie kontrovers ist, welche
Proposition der erste Satz ausdrckt.
(58) Das Pferd, auf das ich gesetzt habe, hat
gewonnen. Hans hat das vorausgesehen.
Unter der Annahme, da das anaphorische
das im zweiten Satz auch hier die Proposition
aufgreift, die mit der uerung des voran-
gehenden Satzes ausgedrckt wurde, machen
unsere beiden Deutungen des bestimmten Ar-
tikels in das Pferd, auf das ich gesetzt habe
nun deutlich verschiedene Voraussagen ber
die Wahrheitsbedingungen des zweiten Satzes.
Nehmen wir an, in der uerungswelt habe
ich auf genau ein Pferd gesetzt, und zwar auf
Fortuna. Wenn die referentielle Deutung
stimmt, bedeutet der zweite Satz dann, Hans
habe vorausgesehen, da Fortuna gewinnen
wrde. Stimmt dagegen die klassische Deu-
tung, so sagt der zweite Satz, Hans habe vor-
ausgesehen, da ich auf das siegreiche Pferd
setzen wrde. (Der Unterschied kommt am
klarsten heraus, wenn Hans nicht gewut hat,
auf welches Pferd ich setzen wrde. Hat er
dann etwa gesagt: Fortuna wird gewinnen,
22. Artikel und Definitheit 501
mancherlei einwenden. Das Argument mit der
Propositionsanapher das in (58) beruht in er-
ster Linie auf Annahmen ber Anaphora, und
diese lassen sich infragestellen. Das Prono-
men das, mit dem im zweiten Satz angeblich
auf die vom ersten ausgedrckte Proposition
Bezug genommen wird, ist ja lngst dafr
bekannt, da es sich auf alle mglichen, oft
nur indirekt vorher angesprochenen Ab-
strakta beziehen kann. Man denke etwa an
das notorische Beispiel (66).
(66) Goldwater gewann im Westen, aber das
wre hier unmglich gewesen.
Hier verdankt das das zwar seine Interpreta-
tion auch irgendwie dem vorangehenden Satz,
aber es greift doch weder die Proposition, die
dieser als ganzer ausdrckt, noch anscheinend
die Bedeutung irgendeiner seiner Konstituen-
ten auf. Dies lt vermuten, da sich ana-
phorisches das auf alle mglichen Abstrakta
beziehen kann, die nur irgendwie lose vom
Antezedenssatz nahegelegt sein zu brau-
chen.
Wenn wir das aber zugestehen, knnen wir
nicht mehr arg viel aus der beobachteten
Zweideutigkeit von Hans hat das vorausgese-
hen in (58) schlieen: Diese beweist dann al-
lenfalls, da eine uerung des Satzes Das
Pferd, auf das ich gesetzt habe, hat gewonnen
unter gewissen Umstnden u. a. auch die Pro-
position, da Fortuna gewonnen hat, nahe-
legen kann. Dem widerspricht nun aber nicht,
da dieser Satz allemal nur die von der klas-
sischen Analyse vorausgesagte Proposition
ausdrckt. Man kann sich den Zusammen-
hang zwischen ausgedrckter und nahegeleg-
ter Proposition etwa so vorstellen (wir denken
hier wieder Kripkeanisch): Wenn ich be-
haupte, da das Pferd, auf das ich gesetzt
habe, gewonnen hat, so darf man mir unter-
stellen, da ich fr diese Behauptung gute
Grnde habe. Solche Grnde knnen im Prin-
zip von verschiedenster Art sein, aber eine
typische Mglichkeit ist, da es ein bestimm-
tes Pferd gibt, von dem ich erstens wei, da
es gewonnen hat, und zweitens, da ich auf
es (und kein anderes) gesetzt habe; denn zu-
sammengenommen impliziert dieses Wissen
den Inhalt meiner Behauptung. Nehmen wir
an, der Hrer meiner Behauptung errt, da
meine Grnde von solcher Art sind, errt also
u. a., da ich von einem bestimmten Pferd
wei, da es gewonnen hat. Dann hat meine
uerung fr diesen Hrer in gewisser Weise
die Proposition, da das betreffende Pferd
gewonnen hat, nahegelegt. Und das gengt
fest, da sich Skopusmehrdeutigkeiten typi-
scherweise wegparaphrasieren lassen. Diese
Beobachtung sollte sich nun ausntzen lassen,
um zu entscheiden, ob eine gegebene Mehr-
deutigkeit skopusbedingt ist oder nicht.
Betrachten wir ein Beispiel. Vertreter und
Gegner der Hypothese von der Zweideutig-
keit des bestimmten Artikels sind sich einig,
da (62) und (63) auf zweierlei Weisen ver-
standen werden knnen.
(62) Der Spieler auf der linken Seite gewinnt
immer.
(63) Der Spieler auf der linken Seite kann
nicht verlieren.
Mit (62) kann einerseits gemeint sein, da
der, der jetzt gerade links steht, immer ge-
winnt (auch wenn er rechts steht). Anderer-
seits kann gemeint sein, da immer gewinnt,
wer jeweils links steht. Analoges gilt fr (63).
Die Zweideutigkeitshypothese sagt voraus,
da die erstgenannte Lesart im Prinzip auf
zweierlei Weise zustandekommen kann: ent-
weder indem das Definitum weitesten Skopus
erhlt, oder aber indem es direkt referentiell
gedeutet wird. Dagegen impliziert eine un-
zweideutig klassische Analyse, da diese Les-
art nur von weitem Skopus des Definitums
herrhren kann.
Wenn letztere recht hat, steht nun zu er-
warten, da sich die Ambiguitt irgendwie
wegparaphrasieren lt. Versuchen wir das
einmal:
(64) Es ist immer so, da der Spieler auf der
linken Seite gewinnt.
(65) Es ist unmglich, da der Spieler auf der
linken Seite verliert.
Diese Paraphrasen tendieren wohl ein bi-
chen mehr zur Lesart mit engem Skopus fr
das Definitum, aber sie haben doch immer
noch beide Lesarten (jedenfalls scheint dies
das Konsensusurteil in der Literatur zu sein).
Dies spricht prima facie fr die Zweideutig-
keitshypothese. Denn wenn die fragliche Les-
art von einer referentiellen Deutung des be-
stimmten Artikels und nicht von weitem Sko-
pus herrhrt, dann gibt es natrlich keinen
Grund, weshalb sie in gewissen syntaktischen
Strukturen weniger verfgbar sein sollte als
in anderen. Andersherum gesagt: Wer sich auf
die klassische Analyse beschrnken will,
schuldet uns hier eine Erklrung, warum die
Skopusmglichkeiten fr das-NPs im Gegen-
satz zu denen anderer NPs keiner strukturel-
len Beschrnkung zu unterliegen scheinen.
Gegen beide dieser Argumente lt sich
502 VII. Semantik der Funktionswrter
der Vertreter der Zweideutigkeitshypothese
nicht darum herum, das anaphorische das
Propositionen aufnehmen zu lassen, die kein
vorangehendes Textstck ausdrckt. Ist das
aber erst einmal zugestanden, dann kann sich
der Vertreter einer rein klassischen Analyse
auch bei (58) darauf hinausreden.
Mir derselben Strategie knnen wir das
zweite Argument abschieen. Diesmal be-
trachten wir (68), wiederum eine um einen
zustzlichen Operator bereicherte Variante
unseres ursprnglichen Beispiels (64).
(68) Es htte immer ebensogut sein knnen,
da der Spieler auf der linken Seite
rechts gestanden wre.
Hier interessiert uns eine Lesart, wo der Spie-
ler auf der linken Seite weder referentiell ist,
noch Skopus innerhalb des da-Satzeshat.
Genauer gesagt, wir haben folgende Lesart
im Auge: Fr jede Zeit t gilt: der Spieler, der
zu t tatschlich links stand, htte ebensogut
rechts stehen knnen. Das Definitum mu
hier klassisch gedeutet werden, damit es sich
fr verschiedene Zeiten t auf verschiedene
Spieler beziehen kann. Andererseits mu es
aber weiteren Skopus als der Modaloperator
htte ebensogut bekommen, denn wir spre-
chen ja nicht von mglichen Welten, in denen
der dortige linke Spieler zugleich rechts steht.
Damit sind wir gezwungen, anzuerkennen,
da der Skopus eines klassischen Definitums
keine Schwierigkeiten hat, aus dem eingebet-
teten da-Satzzu entkommen. Sobald wir das
zugeben, wird aber die Berufung auf eine re-
ferentielle Deutung fr (64) berflssig, d. h.
erspart uns keine ad hoc Annahmen mehr in
der Theorie der strukturellen Skopusbe-
schrnkungen.
Diese Gegenargumente demonstrieren, da
die Zweideutigkeitshypothese nichts bringt,
jedenfalls nichts fr die Lsung der Probleme,
mit denen wir sie hier zu motivieren versucht
haben. Sie lassen aber Rtsel zurck: wir wis-
sen jetzt genausowenig wie zuvor, wie das
anaphorische das zu seiner Deutung kommt
oder wieso die Skopusmglichkeiten des De-
finitums sich nicht syntaktisch einengen las-
sen. Wir knnen diese Rtsel hier nicht lsen,
wollen aber doch wenigstens fr die Skopus-
beispiele kurz eine alternative Behandlung an-
deuten.
1.3.3Noch einmal Skopus
Eine wichtige Rolle spielte oben das Faktum,
da Stze wie (64) und (65) zwei Lesarten
haben, darunter eine, die unter einer rein klas-
vielleicht schon, damit sie von einem das auf-
gegriffen werden kann.
Diese alternative Erklrung ist zugestan-
denermaen etwas zu vage, um die Zweideu-
tigkeitshypothese klar aus dem Feld zu schla-
gen. Leider sind aber beide oben angefhrten
Argumente noch einem vernichtenderen Ein-
wand ausgesetzt. Betrachten wir eine Variante
des Beispiels (58).
(67) Jedesmal, wenn das Pferd, auf das ich
setze, gewinnt, sieht Hans das voraus.
Dieser Satz hat diverse Lesarten, aber von
Interesse ist hier diejenige, die in der folgen-
den Situation wahr ist: Ich setze insgesamt
dreimal auf ein Pferd, das gewinnt; davon das
erste Mal auf Fortuna, das zweite Mal auf
Silver Blaze, und das dritte Mal auf Eldorado.
Nun sagt Hans das erste Mal voraus, da
Fortuna gewinnt, das zweite Mal, da Silver
Blaze gewinnt, und das dritte Mal, da El-
dorado gewinnt, ohne da er jeweils etwas
ber meine Wette wte. Offenbar eignet sich
Satz (67) zur wahrheitsgemen Beschreibung
dieses Sachverhalts. berlegen wir uns nun
aber, was das fr die Deutung des Definitums
und des anaphorischen das impliziert. Refe-
rentiell kann das Definitum das Pferd, auf das
ich setze, hier nicht sein, denn es hat ja keinen
von der uerungssituation fixierten Refe-
renten, sondern ist klar im Skopus von jedes-
mal. Also mu es klassisch gedeutet werden.
Weiterhin mu es Skopus innerhalb des wenn-
Satzes haben, denn sonst kme ja eine Lesart
heraus, nach der fr ein bestimmtes Pferd gilt,
da jedesmal, wenn dieses gewinnt, Hans das
voraussieht. Jetzt folgt aber nach unseren obi-
gen Annahmen, da der wenn-Satzdiejenige
Proposition ausdrckt, die an i wahr ist, wenn
an i das Pferd gewinnt, auf das ich an i setze.
Ist dies die Proposition, die das aufnimmt?
Offenbar nicht, denn Hans hat ja in keinem
Fall vorausgesehen, da ich meine Wette ge-
winnen wrde. Tatschlich drckt Hans sieht
das voraus hier anscheinend diejenige Propo-
sition aus, die an i wahr ist, wenn Hans an i
von dem Pferd, auf das ich an i setze, voraus-
sieht, da dieses gewinnt. Es scheint aber
nicht mglich zu sein, dies vorherzusagen,
indem man das die Intension irgendeiner
Konstituente in der logischen Form des vor-
ausgegangenen Textes wiederaufnehmen lt.
Dieses Beispiel macht klar, da der Schlu
von den mglichen Deutungen des einfache-
ren Satzes (58) auf die Existenz einer referen-
tiellen Lesart des bestimmten Artikels auf
Sand gebaut war. Denn bei (67) kommt auch
22. Artikel und Definitheit 503
entspricht Vt in (71).
Das Bemerkenswerte an der Formalisie-
rung (71) ist, da die das-NP dort engen Sko-
pus relativ zum Zeitoperator hat und trotz-
dem insgesamt eine Lesart herauskommt, die
wir bisher nur durch entweder weiten Skopus
oder eine referentielle Deutung erzeugen zu
knnen glaubten. Wir sehen daran, da es
theoretisch eine dritte Mglichkeit gibt: Viel-
leicht ist das Deutsche auf der relevanten
Analyseebene eine Sprache, deren Substantive
und Verben Argumentstellen fr Welt und
Zeit besitzen. Wenn das stimmt, gibt es offen-
bar Prinzipien, die erzwingen, da das Welt-
und Zeitargument des Verbums stets lokal
gebunden ist (d. h. durch den Propositions-
abstraktor bzw. Zeit- oder Modaloperator an
der unmittelbar darberliegenden Satz-
grenze). Die Welt- und Zeitargumente eines
Substantivs hingegen scheinen prinzipiell frei
whlbar zu sein. Sie knnen von der nchst-
liegenden oder auch von einer weiter entfern-
ten Satzgrenze aus gebunden sein; und viel-
leicht knnen sie sogar frei bleiben und deik-
tisch gedeutet werden, d. h. sich auf kontex-
tuell gegebene Welten und Zeiten beziehen.
Prinzipiell lt sich ein Satz wie (23)
(23) Der Prsident der USA wird immer ein
Weier sein.
dann auf unendlich viele Weisen disambigu-
ieren: Nicht nur kann das Definitum weiten
Skopus wie in (73) oder engen wie in (74)
erhalten, es gibt in jedem dieser beiden Flle
auch noch beliebig viele Mglichkeiten fr
die Wahl der Argumente von Prsident der
USA.
(73) w,t [[der Prsident-der-USA(_, _)]
x
[wird-immer(w,t)
t
, [x ein-Weier-sein
(w,t)]]]
(74) w,t [wird-immer(w,t)
t
[[der Prsident-der-USA(_, _)] ein-
Weier-sein(w,t)]]
Wenn wir fr (_, _) in (74) (w,t) whlen,
erhalten wir die echte enge-Skopus-Lesart
fr das Definitum der Prsident der USA,
d. h. das, was wir uns bisher unter einer en-
gen-Skopus-Lesart vorgestellt haben. Wenn
wir aber ebenfalls in (74) ! stattdessen
(w,t) einsetzen, dann ergibt sich haargenau
dieselbe Bedeutung, als htten wir (w,t) in
(73) eingesetzt. Mit anderen Worten, es
kommt dann das heraus, was wir vormals als
weite-Skopus-Lesart des Definitums diagno-
stiziert haben. Allgemein gilt: das Disambi-
guierungsschema (73) bringt uns berhaupt
sischen Analyse nur dann erzeugt wird, wenn
das Definitum weitesten Skopus erhlt. Dazu
muten diese Stze folgendermaen logisch
gegliedert werden. (Wir beschrnken uns hier
auf (64); analoges gilt fr (65).)
(69) [der [linke Spieler]]
x
[es ist immer so, da
[x gewinnt]]
Wir haben dem Definitum hier weiten Skopus
gegeben, damit das Prdikat linke Spieler zur
selben Zeit ausgewertet wird wie der ganze
Satz. (69) drckt die folgende Proposition p
aus:
(70) p ist in w zu t
wahr, wenn es in w zu t genau einen
linken Spieler a gibt und fr alle t gilt,
da a in w zu t gewinnt;
falsch, wenn es in w zu t genau einen
linken Spieler a gibt und fr mindestens
ein t gilt, da a in w zu t nicht gewinnt;
wahrheitswertlos sonst.
Bemerkenswerterweise lt sich nun dieselbe
Proposition p in einer extensionalen Sprache,
wo explizit ber Welten und Zeiten quantifi-
ziert wird, auch folgendermaen formalisie-
ren:
(71) w,t t [[der linke-Spieler(w,t)] ge-
winnt(w,t)]
Wir meinen hier eine Sprache, in der gewinnt
und linke-Spieler nicht einstellige Prdikate
sind, sondern vielmehr Funktoren, die auf ein
Welt-Zeit-Paar angewandt werden mssen,
um erst mit diesem zusammen ein einstelliges
Prdikat zu ergeben. Gewinnt etwa drckt die
Funktion aus, die fr jedes Welt-Zeit-Paar w,t
die Menge derer liefert, die in w zu t gewin-
nen; analog fr linke-Spieler. Die Deutung des
bestimmten Artikels ist das extensionale Ana-
logon der oben eingefhrten klassischen In-
terpretation, also (wenn wir die Fregesche
Variante whlen):
(72) Extensionalisierte Fregesche Deutung:
[das ] ist
wahr, wenn eine einelementige Menge
ausdrckt, deren einziges Element auch
in der von ausgedrckten Menge ist;
falsch, wenn eine einelementige Menge
ausdrckt, deren einziges Element nicht
auch in der von ausgedrckten Menge
ist;
wahrheitswertlos, wenn keine einele-
mentige Menge ausdrckt.
Zeit- bzw. Modaloperatoren sind in so einer
Sprache natrlich einfach Quantoren, die
Zeit- bzw. Weltvariablen binden; immer z. B.
504 VII. Semantik der Funktionswrter
(78) w,t [ist-einmal(w,t)
t
,
[kein Verstorbener(w,_)
hier-gewesen(w,t)]]
Fllen wir die Zeitargumentstelle von Ver-
storbener nun mit t, so bedeutet (78), da zu
einem Zeitpunkt in der Vergangenheit keiner
der jetzt Verstorbenen hier war. Dies ist eine
Lesart, die wir vormals prinzipiell nicht er-
zeugen konnten, egal welchen Skopus wir der
NP gegeben htten. Wenn (77) tatschlich so
gelesen werden kann, spricht das prima facie
fr den hier skizzierten Ansatz. Grndlichere
berlegungen zu solchen Beispielen finden
sich in der Literatur, insbesondere in den Ar-
beiten von En (1982, 1986).
Bevor wir unsere berlegungen an dieser
Stelle abbrechen, werfen wir einen Blick zu-
rck auf unsere Argumentation in Abschnitt
1.1.3.4. Dort haben wir die direkt referentielle
Analyse mit der ursprnglichen Russellschen
Version der klassischen Analyse verglichen
und sind zu dem Ergebnis gekommen, da sie
dieser unterlegen ist. Mittlerweile haben wir
aber zwei Revisionen der klassischen Analyse
vorgenommen, die beide die Distanz zur re-
ferentiellen Analyse vermindert haben. In Ab-
schnitt 1.2.3 sind wir zur Fregeschen Version
bergegangen und haben damit zugestanden,
da die Existenz- und Einzigkeitsbedingung
einen anderen Status hat als der Rest der
Wahrheitsbedingung. Hier in 1.3.3 sind wir
nun sogar bei einer Version gelandet, die in
gewisser Weise die direkt referentielle Deu-
tung als Spezialfall einschliet. Dies wird
deutlich, wenn wir uns berlegen, wie wir
unter der neuen Version (72) eine gegebene
(Oberflchen-)NP das soundso disambiguie-
ren knnen. Alle Disambiguierungen sind von
der Form [das soundso(u,v)], wobei u eine
Welt- und v eine Zeitvariable ist. Hinsichtlich
der Wahl von u und v knnen wir drei Flle
unterscheiden: (i) u,v werden deiktisch gedeu-
tet und referieren direkt auf uerungswelt
und uerungszeit; (ii) u,v werden so lokal
wie mglich gebunden, d. h. es bindet sie der
hierarchisch niedrigste Operator, in dessen
Skopus sie sich befinden; (iii) sonstige Mg-
lichkeiten. (i) liefert uns die Lesarten, die wir
vormals durch direkt referentielle Deutung
des betreffenden Definitums bekamen. (ii) lie-
fert uns die Lesarten, die wir mit der alten
Fregeschen Deutung (47) bekamen. (iii)
schlielich liefert uns Lesarten, die im allge-
meinen unter den vormaligen Deutungen
berhaupt nicht zu erzeugen waren (jedenfalls
nicht unter der gegebenen Skopuskonstella-
keine neuen Lesarten gegenber (74), d. h.
jede Instantiierung von (73) besitzt eine qui-
valente von (74). Und noch allgemeiner gilt:
unter der extensionalisierten Fregeschen Deu-
tung von das in (72) ist der Skopus einer das-
NP nicht bedeutungsrelevant.
Kehren wir im Lichte dieser berlegungen
zu den Beispielen zurck, die ursprnglich fr
eine klassisch/referentiell-Ambiguitt des be-
stimmten Artikels zu sprechen schienen.
(64) Es ist immer so, da der linke Spieler
gewinnt.
Wir waren oben mit dem Dilemma konfron-
tiert, dem Definitum in diesem Satz entweder
eine referentielle Lesart zuzugestehen oder
ihm zu erlauben, sich ber syntaktische Sko-
pusbarrieren hinwegzusetzen. Jetzt haben wir
einen Ausweg: Selbst wenn die Skopusver-
hltnisse in (64) durch die Syntax fest vor-
gegeben sind, also nur Disambiguierungen
der Form (75) gestattet sind, bekommen wir
alle gewnschten Lesarten.
(75) w,t [es ist-immer(w,t)
t
, so, da
[[der linke-Spieler(_, _)]
gewinnt(w,t)]]
Insbesondere erhalten wir die vermeintlich re-
ferentielle Lesart, indem wir die Argument-
stellen des Substantivs linke-Spieler mit den
Variablen w,t fllen. Ein Vorteil dieser Lsung
ist, da sie auch bei (68) nicht passen mu.
Die kritische Lesart, die wir oben fr dieses
Beispiel betrachtet haben, erhalten wir so:
(76) w,t [immer(w,t)
t
[es htte-sein-kn-
nen(w,t)
w
, da
[[der Spieler-auf-der-linken-Seite(w,t)]
rechts-gestanden-wre(w,t)]]]
Wenn dieser Ansatz weiterverfolgt wird, er-
geben sich eine Reihe neuer Fragen, die wir
hier nicht behandeln knnen und die auch in
der Literatur noch wenig geklrt sind. Vor
allem mssen wir die empirischen Voraussa-
gen berprfen, die dieser Ansatz fr NPs mit
anderen Determinatoren als dem bestimmen
Artikel impliziert. Sehen wir uns dazu kurz
(77) an.
(77) Einmal ist kein Verstorbener hier gewe-
sen.
Dieser Satz enthlt den Zeitoperator ist-ein-
mal (d. h. einmal in der Vergangenheit) und
die quantifizierte NP kein Verstorbener. Wenn
wir ersterem weiten und letzterer engen Sko-
pus geben, erhalten wir eine Reprsentation
der folgenden Form.
22. Artikel und Definitheit 505
nahe, da wir hier ein allgemeineres Phno-
men vor uns haben, das nichts speziell mit
der Semantik des bestimmten Artikels zu tun
hat. Der Individuenbereich, den wir der In-
terpretation einer quantifizierenden NP zu-
grundelegen, hngt grundstzlich von der
uerungssituation ab und bildet mitunter
nur eine kleine Teilmenge der tatschlich exi-
stierenden Individuen. Was jeweils in dieser
Menge enthalten ist und was nicht, hngt
grob gesagt davon ab, worauf die Gesprchs-
partner gerade ihre Aufmerksamkeit richten,
und dies ist wiederum bedingt durch schwer
zu przisierende Faktoren wie Relevanz fr
das Gesprchsinteresse und sinnliche Auffl-
ligkeit. Z. B. ist der Individuenbereich in unse-
rer Abendessensszene offenbar auf Mobiliar,
Geschirr und Nahrungsmittel beschrnkt, die
der Sprecher unmittelbar vor sich hat oder
die sich jedenfalls in derselben Wohnung be-
finden. Die Existenz unversehrter Glser und
scharfer Messer auerhalb dieses Bereiches
tut der intuitiven Wahrheit der uerungen
(80) und (81) keinen Abbruch, und so braucht
den Vertreter der klassischen Analyse des be-
stimmten Artikels auch nicht zu verwundern,
da die Existenz beliebig vieler Tische auer-
halb desselben Bereiches ebenso unschdlich
fr die Wahrheit von (79) ist.
Bei der genaueren Ausarbeitung dieser
Antwort ergeben sich allerdings Komplikatio-
nen. In der oben vorgestellten Abendessens-
szene knnte die Sprecherin ihre uerung
von (79) z. B. ohne weiteres wie in (82) fort-
setzen.
(82) Der Tisch wackelt. Wir htten doch lie-
ber den Eichentisch von Tante Lida be-
halten sollen.
Hier geraten wir in ein Dilemma. Nach dem
bisher Gesagten sagt oder prsupponiert die
Sprecherin mit (82) unter anderem, da es im
kontextuell relevanten Individuenbereich ge-
nau einen Tisch und genau einen Eichentisch
von Tante Lida gibt. Das kann aber nur stim-
men, wenn der Eichentisch von Tante Lida
der einzige Tisch berhaupt im betreffenden
Individuenbereich ist, und damit folgt aus
(82), da der Eichentisch von Tante Lida
wackelt. Intuitiv folgt das natrlich keines-
wegs.
Dem Dilemma entkommen wir, wenn wir
annehmen, da fr die Deutung der beiden
NPs in (82) aus irgendeinem Grunde nicht
derselbe Individuenbereich relevant ist. ue-
rungssituationen wandeln sich bekanntlich
stndig, und selbst im Verlauf der uerung
kurzer Texte verschiebt sich die Aufmerksam-
tion, und manchmal sogar unter keiner mg-
lichen logischen Gliederung des betreffenden
deutschen Satzes). (Fall (iii) ist etwa durch
(76) illustriert.)
Wir wollen keineswegs behaupten, da die
von den Vertretern der Zweideutigkeitshypo-
these aufgebrachten Probleme jetzt gelst
sind. Was wir soeben skizziert haben, mu
erst einmal sauber ausgearbeitet und empi-
risch berprft werden, ganz zu schweigen
davon, da wir die Beispiele mit anaphori-
schem das auf die lange Bank geschoben
haben. Es ist aber wohl fair, zu schlieen, da
die Zweideutigkeitshypothese in der Form,
wie wir sie in 1.3.2 betrachtet haben, beim
gegenwrtigen Forschungsstand wenig fr
sich hat. Bis die hier angedeutete Alternative
oder noch etwas Besseres konkurrenzfhig ge-
worden ist, bleiben wir da lieber gleich bei
der klassischen Analyse in einer der blichen
Varianten, z. B. der in 1.2.3. So halten wir es
jedenfalls fr den Rest dieses Artikels, zumal
da wir uns nun Themen zuwenden, die von
den hier betrachteten Kontroversen unabhn-
gig sind.
1.4Bereichswahl: Kontextabhngigkeit
und Anaphorizitt
1.4.1Situationsbedingte Beschrnkung des
Individuenbereichs
Nichts an Russells Deutung hat wohl hufiger
Ansto erregt als die darin eingebaute Ein-
zigkeitsbedingung. Offensichtlich gebrauchen
wir doch tagtglich Stze wie (79), ohne des-
wegen der abwegigen Meinung Ausdruck zu
geben, da es auf der ganzen Welt nicht mehr
als einen Tisch gibt.
(79) Der Tisch wackelt.
Man stelle sich etwa vor, (79) wird whrend
eines huslichen Abendessens geuert. Der-
selbe Einwand trifft selbstverstndlich die
Fregesche Deutung; da die Einzigkeitsbedin-
gung dort prsupponiert ist, macht es nicht
besser.
Der Einwand ist richtig, aber betrifft er
speziell den bestimmten Artikel? hnlich las-
sen sich ja auch die blichen Deutungen an-
derer Determinatoren angreifen: Wenn etwa
im Verlaufe desselben Abendessens (80) oder
(81) geuert werden, geht es auch nicht um
alle Glser und alle Messer auf der Welt.
(80) Jedes Glas hat einen Sprung.
(81) Kein Messer ist scharf.
Die Parallele zwischen (79), (80) und (81) legt
506 VII. Semantik der Funktionswrter
meine Theorie, nach der Quantifikationsbe-
reiche von psychologischen Gegebenheiten
der uerungssituation abhngen, und vor
deren Hintergrund sie richtige Voraussagen
macht.
1.4.2Anaphora und Variablenbindung
Nun wird in der traditionellen Literatur oft
gesagt, da NPs mit bestimmtem Artikel
neben ihrem situationsbezogenen (deikti-
schen) Gebrauch auch einen anaphori-
schen haben. Unser Beispiel (79), geuert
in der huslichen Kche in Anwesenheit ge-
nau eines Tisches, war ein typischer Fall von
deiktischem Gebrauch. Den anaphori-
schen Gebrauch illustriert hingegen etwa
(84).
(84) Hanno hat einen Hund und eine Katze.
Die Katze hat Flhe.
Unter den oben eingefhrten Annahmen lt
sich auch dieses Beispiel im Rahmen klassi-
scher Analysen des bestimmten Artikels be-
schreiben. Plausiblerweise wird nmlich auch
hier das Definitum die Katze in einer ue-
rungssituation gebraucht, in der von allen in
der uerungswelt existierenden Katzen nur
eine im Individuenbereich ist. Die Ursache
dafr ist diesmal eine vorangehende ue-
rung, nmlich die des Satzes Hanno hat einen
Hund und eine Katze. Diese uerung hat
nmlich die Aufmerksamkeit des Hrers auf
Hannos Haustiere gelenkt und damit diese
bis auf weiteres in den Individuenbereich ge-
bracht und andere Tiere ausgeschlossen. Be-
zogen auf den so umgrenzten Bereich ist die
Einzigkeitsprsupposition von die Katze hat
Flhe unproblematisch erfllt, solange Hanno
nicht mehr als eine Katze hat, und der Wahr-
heitswert des Satzes richtet sich ausschlielich
nach dem Flohbefall von Hannos einziger
Katze.
hnlich kann man die sogenannten as-
soziativ-anaphorischen Gebruche des be-
stimmten Artikels verstehen:
(85) Ich habe eine Uhr gefunden. Nur die
Batterie ist leer.
Die Batterie verstehen wir hier spontan im
Sinne von die Batterie in der eben erwhnten
Uhr. Die NP die Batterie ist hier nicht ei-
gentlich anaphorisch, denn es wurde ja im
vorausgehenden Text noch keine Batterie er-
whnt. Aber sie ist doch in einem gewissen
weiteren Sinne anaphorisch, denn ihre Inter-
pretation hngt wesentlich von einer NP im
vorangehenden Text ab. Hawkins spricht hier
keit der Gesprchspartner oft auf neue Dinge
(s. Artikel 10). Um unser Dilemma mit (82)
aufzulsen, mssen wir plausibel machen, da
der Individuenbereich hier von einer NP-
uerung zur nchsten anschwillt: Whrend
bei der Tisch nur eine kleine Menge in un-
mittelbarer Nhe befindlicher Dinge berck-
sichtigt wird, ist fr die Interpretation von
den Eichentisch von Tante Lida auf einmal eine
grere Menge relevant, die mindestens noch
einen zweiten Tisch einschliet. Wodurch ist
diese Erweiterung bewirkt? Offensichtlich
durch nichts, was sich in der Zeit zwischen
den beiden NP-uerungen ereignet, denn
was der Sprecher vor der uerung von den
Eichentisch von Tante Lida gesagt hat, ist al-
lenfalls dazu angetan, den einzigen physisch
prsenten Tisch noch mehr ins Rampenlicht
zu rcken, und kaum dazu, an die Existenz
anderer Tische zu erinnern. Ausschlaggebend
fr die Bereichserweiterung scheint hier viel-
mehr erst die uerung des Prdikats Ei-
chentisch von Tante Lida zu sein. Dieses ver-
anlat den Hrer, an Trger dieser Eigen-
schaft zu denken, und damit, seinen Auf-
merksamkeitshorizont so weit auszudehnen,
bis er wenigstens die naheliegendsten davon
mit einschliet. Erst dieser erweiterte Bereich
wird dann der Deutung der NP, die dieses
Prdikat enthlt, zugrundegelegt. Der gleiche
Mechanismus scheint brigens in (83) am
Werk zu sein.
(83) Jedes Glas hat einen Sprung. Aber die
meisten Glser von Tante Lida waren
auch nicht besser.
Auch hier knnen wir die intuitiv natrliche
Deutung darauf zurckfhren, da beim H-
ren des Prdikats Glser von Tante Lida das
geistige Auge so weit schweift, bis es die (oder
wenigstens die aufflligsten) Glser der Tante
in den Blick bekommt, und da die meisten
dann auf den daraus resultierenden Aufmerk-
samkeitsbereich bezogen wird.
Hier gibt es noch vieles zu przisieren. Es
bleibt abzuwarten, ob psychologische Begriffe
wie Aufflligkeit, Aufmerksamkeit sich
geeignet explizieren lassen, um die Verwen-
dung des bestimmten Artikels vorauszusagen,
und ob wirklich genau dieselbe Explikation
dieser Begriffe der Interpretation anderer De-
terminatoren zugrundeliegt. Immerhin haben
wir hier eine Forschungsstrategie angedeutet,
die prima facie vernnftig aussieht: Statt we-
gen Daten wie den obigen die klassische Deu-
tung des bestimmten Artikels wegzuwerfen
oder an ihr herumzudoktern, versuchen wir
erst einmal, sie zu ergnzen durch eine allge-
22. Artikel und Definitheit 507
verspricht. Wir zeigen nun, da unsere bis-
herige Analyse mit diesen Beispielen nicht
fertig wird.
Natrliche uerungssituationen fr (86)
sind intuitiv so beschaffen, da der Bereich
der zur Diskussion stehenden Individuen
mehrere Kinder einschliet. In solchen ue-
rungssituationen hat aber nach unseren bis-
herigen Annahmen das Prdikat macht ihm
selbst mehr Spa als dem Kind entweder gar
keine Extension (Fregesch) oder eine leere
(Russellsch). Also sollte der Satz (86) als gan-
zer in solchen uerungssituation nie wahr
werden knnen. Fr (87) und (88) gilt
analoges: In uerungssituationen, die intui-
tiv fr (87) und (88) passen, ist typischerweise
nicht ein einziger Schlafsack bzw. Umschlag-
text als relevant ausgezeichnet. Vielmehr sind
die Schlafscke aller Personen im Quantifi-
kationsbereich der viele-NP (bzw. die Um-
schlagtexte aller zur Rede stehenden Bcher)
gleichermaen auffllig. Damit haben wir
aber Individuenbereiche, bezglich derer un-
ter klassischen Deutungen des bestimmten
Artikels die Prdikate nehmen nur den Schlaf-
sack mit in den Canyon bzw. hlt, was der
Umschlagtext verspricht keine wohldefinier-
ten, nichtleeren Extensionen erhalten. Infol-
gedessen bekommen wir keine intuitiv ad-
quaten Wahrheitsbedingungen fr diese
Stze heraus.
Versuchen wir das Problem genauer zu dia-
gnostizieren, indem wir uns Schritt fr Schritt
durch die Interpretation eines unserer Bei-
spiele arbeiten. (88) z. B. hat die logische
Grobstruktur (89).
(89) [keines dieser Bcher]
x
[x hlt, was der
Umschlagtext verspricht]
Nehmen wir an, die uerungssituation lie-
fert uns einen Individuenbereich U, wobei sich
in U u. a. zwei oder mehr Bcher befinden.
Gem der Semantik von kein ist (89) genau
dann wahr, wenn es keine Variablenbelegung
gibt, die erstens x eines der Bcher in U zu-
ordnet, und die zweitens den Teilsatz (90)
wahr macht.
(90) x hlt, was der Umschlagtext verspricht
Aber halt! Das war schlampig ausgedrckt,
denn wir haben nicht gesagt, welchen Indi-
viduenbereich wir bei der Deutung von (90)
zugrundelegen sollen, wenn wir prfen, wel-
che Belegungen diesen Teilsatz wahrmachen.
Ist es U? Wenn wir dies annehmen, kriegen
wir auf jeden Fall Schwierigkeiten, egal wie
wir uns den Inhalt von U im einzelnen vor-
stellen. Nehmen wir an, da U genau einen
vom assoziativ-anaphorischen Gebrauch.
Von unserer Warte lt sich dieses Beispiel
etwa wie folgt beschreiben: Der vorausge-
hende Text in (85) rckt eine Uhr ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. Ceteris paribus sind
deshalb Teile und Zubehr dieses Objekts auf-
flliger als andere Gegenstnde von der glei-
chen Sorte. Der kontextuell gegebene Indivi-
duenbereich enthlt an Batterien also nur sol-
che, die zur betreffenden Uhr gehren. Deu-
ten wir den zweiten Satz von (85) mit Bezug
auf diesen Bereich, so prsupponiert er nicht,
da es nur eine Batterie in der uerungswelt
gibt, sondern blo, da nur eine Batterie zur
eben erwhnten Uhr gehrt. Dies ist intuitiv
richtig, und die Wahrheitsbedingungen kom-
men so auch richtig heraus.
Was wir in den letzten zwei Abstzen an-
gedeutet haben, luft darauf hinaus, den
anaphorischen Gebrauch (im weitesten
Sinne) sozusagen als Spezialfall des deikti-
schen Gebrauchs zu behandeln. In beiden
Fllen ist der zentrale Punkt, da das Defi-
nitum bezglich eines Bereichs gedeutet wird,
der von der uerungssituation bestimmt ist.
Der anaphorische Fall zeichnet sich nur
dadurch aus, da an der Hervorbringung die-
ser uerungssituation wesentlich eine un-
mittelbar vorausgegangene sprachliche Hand-
lung beteiligt war. Dieser Gedanke ist wohl-
bekannt aus der Pronominalsemantik, wo er
allerdings in jngster Zeit ziemlich unter Be-
schu geraten ist (s. Artikel 23 und 10). Wir
knnen hier in diesem Artikel leider nicht
allgemein auf die Frage eingehen, wieweit sich
Anaphora auf Kontextabhngigkeit reduzie-
ren lt. Wir wollen aber kurz eine Verwen-
dungsweise von das-NPs betrachten, fr die
eine solche Reduktion, wenn nicht unmglich,
so doch mit einer nicht-trivialen Schwierigkeit
behaftet ist.
(86) Der Hemul gab jedem Kind ein Ge-
schenk, das ihm selbst mehr Spa
machte als dem Kind.
(87) Viele, die ein Zelt und einen Schlafsack
haben, nehmen nur den Schlafsack mit
in den Canyon.
(88) Keines dieser Bcher hlt, was der Um-
schlagtext verspricht.
Fr (86) und (87) haben wir Lesarten im
Auge, unter denen die hervorgehobenen De-
finita anaphorisch auf die Antezedentien je-
dem Kind bzw. einen Schlafsack bezogen sind.
Bei (88) geht es uns um die assoziativ-ana-
phorische Lesart, derzufolge kein Buch hlt,
was der Text auf dem Umschlag dieses Buches
508 VII. Semantik der Funktionswrter
zu tun, welche Aspekte der uerungssitua-
tion jeweils fr die Abgrenzung des Indivi-
duenbereichs verantwortlich sind.) Wir haben
in diesem Abschnitt in gewisser Weise den
Standpunkt gerechtfertigt, da die Mechanis-
men der Bereichswahl nicht speziell zur Se-
mantik des bestimmten Artikels gehren, son-
dern eine allgemeinere Rolle spielen. Ande-
rerseits ist aber hoffentlich auch klar gewor-
den, da die empirische Adquatheit einer
semantischen Analyse des bestimmten Arti-
kels erst vor dem Hintergrund einigermaen
konkreter Annahmen ber diese Mechanis-
men berprft werden kann, und da es sich
hier keineswegs um ein triviales Forschungs-
thema handelt.
1.5Sonstiges
Bis jetzt haben wir viele Verwendungen des
bestimmten Artikels vllig ignoriert, beispiels-
weise Vorkommnisse im Plural und vor Ei-
gennamen, und diverse sogenannte generi-
sche Lesarten. Wir wollen abschlieend kurz
einige Probleme anreien, die sich ergeben,
wenn wir diese vernachlssigten Beispiele ein-
zubeziehen versuchen. In einigen Fllen sind
diese Probleme weitgehend gelst, in anderen
noch nicht einmal klar formuliert.
1.5.1Verallgemeinerung auf Pluralia und
Stoffnamen
Russells Deutung war von ihrem Urheber
nicht fr alle NPs mit bestimmten Artikeln
gedacht, sondern nur fr solche im Singular
und mit zhlbarem Appellativ, und in der
philosophischen Literatur wird diese Ein-
schrnkung meistens stillschweigend ber-
nommen. Linguisten haben das oft bemngelt
und darauf hingewiesen, da der bestimmte
Artikel nicht nur in die Katze, sondern auch
in die Katzen und das Wasser vorkommt und
intuitiv in allen drei Umgebungen eine ein-
heitliche Bedeutung hat. Um diese zu erfas-
sen, braucht man augenscheinlich eine allge-
meinere Deutung als die klassische.
In diesem Zusammenhang wurde mitunter
vorgeschlagen, da der bestimmte Artikel als
solcher nur die Bedeutung eines Universal-
quantors hat. Damit besagt sowohl (2) als
auch (92) unter anderem, da jede Katze
schlft.
(2) Die Katze schlft.
(92) Die Katzen schlafen.
Man beachte, da dies der Russellschen Deu-
tung fr (2) nicht widerspricht, da ja (93) aus
(3) logisch folgt.
Umschlagtext enthlt, so erhalten wir eine
wohldefinierte Extension fr die NP der Um-
schlagtext, aber leider immer dieselbe, egal
was unser jeweiliges g ist. Nehmen wir ande-
rerseits an, da U keinen oder mehrere Um-
schlagtexte enthlt, dann hat der Umschlag-
text berhaupt keine Extension. U ist also
nicht der richtige Bereich fr die Deutung von
(90). Was dann? Anscheinend mssen wir hier
je nach g einen anderen Bereich U
g
whlen,
der jeweils die Dinge enthlt, die irgendwie
zu g(x) gehren und andere Dinge der glei-
chen Art ausschliet. Z. B. enthlt U
g
an Um-
schlagtexten nur solche, die sich auf dem Um-
schlag von g(x) befinden, und keine, die auf
den Umschlgen anderer Bcher (innerhalb
oder auerhalb von U) stehen.
Mit anderen Worten, der Schlssel zu einer
erfolgreichen Behandlung von (88) und
gleichfalls von (86) und (87) ist die Er-
kenntnis, da wir im Skopus eines Quantors
bei der Deutung eines Definitums einen In-
dividuenbereich zugrundelegen mssen, der
nicht schon allein durch die uerungssitua-
tion festliegt, sondern auch noch von der Va-
riablenbelegung abhngt. Dies gilt nebenbei
bemerkt nicht blo fr Definita; die nahelie-
gendste Interpretation der kein-NP in (91)
illustriert genau dasselbe Phnomen:
(91) Nur eine Klasse war so schlecht, da
kein einziger Schler die Prfung be-
stand.
(Kein einziger Schler bedeutet hier kein ein-
ziger Schler der jeweiligen Klasse, und
nicht: kein einziger Schler im fr die Aus-
wertung von (91) einschlgigen Gesamtbe-
reich.) Von dieser Erkenntnis ist es freilich
noch ein weiter Weg zu einer sauber ausfor-
mulierten Lsung. Unser Ziel in diesem Ab-
schnitt war bescheidener: Wir wollten ledig-
lich plausibel machen, da Flle wie
(86)(88) nicht unbedingt als Gegenbeispiele
zur klassischen Analyse des bestimmten Ar-
tikels aufzufassen sind, sondern mit ebenso
guter Berechtigung fr die Entwicklung einer
Theorie der Bereichswahl fruchtbar gemacht
werden knnen.
Das Problem der Bereichswahl wird in der
logisch-philosophischen Literatur zum be-
stimmten Artikel oft nur am Rande erwhnt
bzw. als geklrt vorausgesetzt. In der philo-
logisch-linguistischen Tradition hingegen
steht es im Mittelpunkt des Interesses. (Wenn
dort z. B. verschiedene Gebrauchsweisen des
bestimmten Artikels unterschieden werden,
haben die Klassifikationskriterien oft damit
22. Artikel und Definitheit 509
(96) [das ] ist wahr genau dann wenn die
Extension von ein maximales Element
enthlt und dieses in der Extension von
ist.
Um (96) anzuwenden, brauchen wir noch eine
Definition: ein maximales Element einer
Menge M ist ein Element von M, das alle
anderen Elemente von M als Teile einschliet.
Es ergibt sich also z. B., da a + b + c ein
maximales Element der Menge {a + b, b + c,
a + c, a + b + c} ist, da sowohl a + b als auch
b + c und a + c Teilgruppen davon sind. In der
Menge {a, b, c} gibt es dagegen kein maxi-
males Element; man beachte, da hier kein
Element Teil eines anderen ist. Allgemein be-
sitzt die Extension eines Singularsubstantivs
nur in dem Spezialfall ein maximales Element,
wo es sich um eine Menge mit nur einem
Element handelt; das einzige Element erfllt
dann trivial die Definition der Maximalitt.
Fr unsere Stze (2) und (92) ergibt sich
mithin folgendes: Der Singularsatz (2) ist
wahr genau dann, wenn es genau eine Katze
gibt und diese schlft. Der Pluralsatz (92) ist
wahr genau dann, wenn die Gruppe, in der
alle Katzen enthalten sind, schlft. Auch hier
kommt fr den Singular also wieder genau
die Russellsche Deutung heraus. Die neue
Deutung des Artikels verbleibt dabei sehr
nahe am Russellschen Original; wir haben
blo einzig durch maximal ersetzt. Diese
Deutung funktioniert brigens auch gut fr
Stoffnamen. Dabei nehmen wir an, da etwa
die Extension von Wasser die Menge aller
Portionen Wasser ist. Unter diesen ist die
maximale Portion die Gesamtheit allen Was-
sers. Nach (96) mu diese Gesamtheit kalt
sein, damit (97) wahr ist.
(97) Das Wasser ist kalt.
Wir knnen (96) die verallgemeinerte Russell-
sche Deutung nennen. Ganz analog knnen
wir die brigen oben diskutierten Deutungen
verallgemeinern. Die verallgemeinerte Frege-
schen Deutung z. B. geht wie (96), auer da
sie besagt, da [das ] wahrheitswertlos ist,
wenn die Extension von kein maximales
Element hat. Fr = Hund passiert das,
wenn es keinen oder mehrere Hunde gibt, fr
= Luft, wenn es keine Luft gibt, und fr
= Hunde, wenn es keinen oder nur einen
Hund gibt.
Alles, was wir in 1.2, 1.3 und 1.4 im Zu-
sammenhang mit den spezielleren Versionen
diskutiert haben, bertrgt sich auf diese Ver-
allgemeinerungen. Z. B. was wir in 1.4 zur
Kontextrelativitt der Einzigkeitsbedingung
gesagt haben, gilt mutatis mutandis fr die
Maximalittsbedingung in der verallgemei-
(3) x [y [Katze(y) x = y] & schlft(x)]
(93) x [Katze(x) schlft(x)]
Dieser Allsatz ist nun aber noch nicht die
ganze Bedeutung dieser Stze, sondern es
kommt noch der Beitrag des Numerus hinzu.
Angenommen das Merkmal Singular an
einem Substantiv bedeutet, da dieses Sub-
stantiv auf genau ein Ding zutrifft, whrend
Plural bedeutet, da es auf mindestens zwei
zutrifft. Die Gesamtbedeutung unserer beiden
Stze ergbe sich dann durch Konjunktion
der Beitrge von Artikel und Numerus, so
da fr (2) (94) herauskommt und fr (92)
(95).
(94) Jede Katze schlft und es gibt genau eine
Katze.
(95) Jede Katze schlft und es gibt minde-
stens zwei Katzen.
(94) ist der Russellschen Deutung quivalent,
und (95) scheint einigermaen richtig die in-
tuitive Bedeutung von (92) wiederzugeben.
Wir haben diesen Vorschlag hier etwas
vage dargestellt und werden es auch dabei
bewenden lassen. Bei nherer Betrachtung er-
heben sich nmlich ernste Zweifel, ob er auf
dem richtigen Wege ist. Erstens scheint er
flschlich zu implizieren, da Jede Katze
schlft die gleiche Einzigkeitsbedingung wie
(2) enthalten sollte, da der Numerus hier ja
auch Singular ist. Zweitens knnen damit
prinzipiell nur distributive Lesarten fr Plu-
raldefinita erfat werden. Wir wenden uns
daher einer anderen Methode zu, die seman-
tischen Funktionen von Numerus und Artikel
voneinander zu trennen, die sich in der jn-
geren semantischen Forschung besser be-
whrt hat. (Fr Einzelheiten und Diskussion
verweisen wir auf die Artikel 18 und 19.)
Angenommen, die Extension des Singular-
substantivs Katze ist die Menge aller Katzen,
whrend die Extension des Pluralsubstantivs
Katzen die Menge aller Katzengruppen ist.
Wenn es z. B. insgesamt drei Katzen gibt, a,
b und c, dann ist die Extension von Katze die
Menge {a, b, c}, und die Extension von Katzen
ist die Menge {a+b, b+c, a+c, a+b+c}.
(Mit dem Pluszeichen bilden wir Gruppen,
z. B. ist a + b die Gruppe, die sich aus a und
b zusammensetzt.) Als Deutung des bestimm-
ten Artikels schlagen wir nun (96) vor, wobei
das wie bisher fr beliebige Formen des be-
stimmten Artikels steht (auch pluralische!)
und nun entweder ein Singular- oder ein
Pluralsubstantiv sein kann.
510 VII. Semantik der Funktionswrter
Z. B. sagt man auch in einem Deutsch, wo
*der Horaz (jedenfalls als Name fr die Per-
son) nicht vorkommt, die Oden des Horaz.
Wer Hans kommt sagt, sagt trotzdem Der
arme Hans kommt, und nicht *Armer Hans
kommt. Mit generischen NPs lassen sich zahl-
reiche minimale Paare wie die folgenden fin-
den: (Ewige) Treue wird belohnt; der Lohn
ewiger Treue; aber nicht *der Lohn Treue,
sondern stattdessen der Lohn der Treue. Viele
ziehen Bier billigem Sekt vor, aber nicht so
gut? Viele ziehen Bier Sekt vor, sondern schon
eher Viele ziehen Bier dem Sekt vor.
Die Gesetzmigkeiten hier sind wenig er-
forscht und drfen uns auch in diesem Hand-
buch nicht beschftigen. Wir mssen uns je-
doch fragen, was aus solchen Fakten fr die
semantische Beschreibung des bestimmten
Artikels folgt. Sollen wir uns einfach auf den
Standpunkt stellen, da wir es vor Eigenna-
men blo mit einem semantisch leeren Dop-
pelgnger des echten bestimmten Artikels
zu tun haben? Dann knnten wir es fr letz-
teren getrost bei der bisherigen Deutung be-
lassen, und ersterer ginge uns als Semantiker
natrlich nichts an. An dieser Auffassung ist
jedoch unbefriedigend, da sie es als reinen
Zufall erscheinen lt, da ausgerechnet ein
Homonym des bestimmten Artikels und nicht
irgendein anderes Morphem in diesen Bei-
spielen erscheint. Dies luft der Intuition (und
traditionellen Lehrmeinung) zuwider, da der
bestimmte Artikel doch mit einer gewissen
semantischen Berechtigung bei Eigennamen
steht, nmlich weil sie selber ihrer Bedeutung
nach definit sind und er deshalb mit ihnen
semantisch kompatibel ist. (Inwiefern Eigen-
namen definit sind, werden wir in Abschnitt
3.1 unten przisieren.) Wenn man dies kon-
sequent weiterverfolgt, fhrt es unter Um-
stnden zu einer Theorie, nach der der be-
stimmte Artikel selbst berhaupt nie etwas
bedeutet. Seine Distribution ist auf seman-
tisch definite NPs beschrnkt, aber im bri-
gen durch (teilweise sprachspezifische) syn-
taktische Bedingungen gesteuert. Auch in den
normalen Fllen, die wir bisher ausschlie-
lich betrachtet haben, ist vielleicht etwas an-
deres, nicht oberflchlich Manifestes fr die
definite Deutung verantwortlich, wovon der
bestimmte Artikel nur ein oberflchliches
Symptom ist. Eine andere Mglichkeit wre,
zu leugnen, da es in der natrlichen Sprache
berhaupt Eigennamen im semantischen
Sinne gibt. Die sogenannten Eigennamen sind
einfach Prdikate, deren Extension (notwen-
digerweise?) eine Einermenge ist. Z. B. be-
nerten Deutung: Wenn wir beim huslichen
Abendessen Stze wie (98) oder (99) gebrau-
chen, meinen wir nicht, da es auf der ganzen
Welt kein kaltes Bier und keine frischen Bre-
zen gibt.
(98) Das Bier ist warm.
(99) Die Brezen sind von gestern.
Auch hier wird der Interpretation der Sub-
stantive jeweils ein vom Aufmerksamkeitsra-
dius der Gesprchsteilnehmer umschriebener
Individuenbereich zugrundegelegt.
1.5.2Bestimmter Artikel vor Eigennamen
Selbst unter den verallgemeinerten Deutun-
gen des letzten Abschnitts kann das wie ja
unter blichen Annahmen alle Determinato-
ren nur mit Gemeinnamen kombiniert wer-
den. Die Deutungsregel setzt allemal voraus,
da die Schwesterkonstituente von das eine
Menge zur Extension hat, also ein Prdikat
ist. Dies wird nun auch gelegentlich als will-
kommen erwhnt, da ja in der Tat vor Eigen-
namen kein Artikel steht. Aber in diesem
Punkt finden wir viel Variabilitt von Sprache
zu Sprache und sogar von Fall zu Fall inner-
halb desselben Dialektes. Diese Tatsache
macht es etwas fragwrdig, ob es richtig ist,
die Unvertrglichkeit des bestimmten Artikels
mit Eigennamen aus grundlegenden Eigen-
schaften seiner Bedeutung herzuleiten.
Bei oberflchlichem Vergleich verschiede-
ner Sprachen mit Artikeln stechen besonders
zwei Typen von Umgebungen ins Auge, wo
bestimmte Artikel in der einen Sprache arti-
kellosen Formen in der anderen entsprechen:
erstens vor Eigennamen und zweitens vor ge-
nerischen Plural- und Stoff-NPs. In sddeut-
schen Dialekten stehen z. B. Personennamen
grundstzlich mit bestimmtem Artikel. Auf
Spanisch heit der generische Satz Hunde bei-
en: Los perros muerden; ebenso bersetzt
sich Blut ist rot zu La sangre es roja. Seman-
tische Forschungen zur Generizitt lassen es
plausibel erscheinen, da Hunde und Blut in
den genannten Beispielen auch als Eigenna-
men fungieren, nmlich Namen fr Arten (s.
Artikel 17). Wenn wir uns dieser Auffassung
hier einmal anschlieen, knnen wir also alle
diese Beispiele zusammenfassen als Belege da-
fr, da die Distribution des bestimmten Ar-
tikels vor Eigennamen von Sprache zu Spra-
che variiert. Man findet auch gerade in dieser
Hinsicht sehr viele Flle, wo innerhalb der-
selben Sprache die Setzung des Artikels von
stilistischen oder schlecht durchschauten syn-
taktischen Faktoren gesteuert zu sein scheint.
22. Artikel und Definitheit 511
der Satz unter der hier intendierten Lesart ist
so gemeint, da er auch ber die Kanzler und
Nationalversammlungen vergangener und zu-
knftiger Zeiten spricht. (104) lt durchaus
zu, da es in der uerungssituation unzh-
lige gleich-auffllige Busse gibt (und darber
hinaus sogar, da wir auf unserer Reise nach
Feuerland fters umsteigen muten und somit
mehr als einen Bus benutzt haben.) Auch
(105) kann geglckt und wahr sein, wenn es
viele gleich relevante Schulen gibt; die Frage
Welche Schule? mu der Sprecher bei der in-
tendierten Lesart nicht beantworten knnen.
Es liegt also erst einmal der Schlu nahe,
da wir es in diesen Beispielen mit einer
neuen, von den bisher besprochenen Analysen
nicht berhrten Lesart des bestimmten Arti-
kels zu tun haben. Das ist aber ein bichen
vorschnell gedacht, was man sptestens be-
merkt, wenn man diese neue Lesart etwas
prziser zu charakterisieren versucht. Dabei
drngt sich schnell der Verdacht auf, da in
der Liste oben recht Heterogenes zusammen-
geworfen wurde.
Bei manchen Beispielen ist es plausibel, die
generische Kraft einem impliziten Quantifi-
kationsadverb zur Last zu legen. Z. B. lt sich
(103) recht zwanglos durch (106) paraphra-
sieren.
(106) Der Kanzler wird immer von der Na-
tionalversammlung gewhlt.
Vielleicht steckt also in (103) ein unsichtbares
immer, das ebenso wie das sichtbare in (106)
die beiden Definita in seinem Skopus hat.
Damit ergbe sich als Bedeutung so etwas wie
zu jeder Zeit t wird der Kanzler zu t von der
Nationalversammlung zu t gewhlt. Dies
mu noch verfeinert werden, denn genauge-
nommen geht es in (103) nicht um alle Zeiten
schlechthin, sondern nur um solche, wo ein
Kanzler gewhlt wird wenn es berhaupt
um Zeiten geht, und nicht vielmehr um Ge-
legenheiten oder so etwas. Aber diese Fragen
stellen sich auch beim expliziten immer in
(106), treten also in der Semantik der Quan-
tifikationsadverbien sowieso auf. hnlich
lt sich vielleicht (102) angehen, obwohl hier
eine Paraphrase mit explizitem immer nicht
ganz so natrlich wirkt. Dieser Satz scheint
so ungefhr zu bedeuten: in jeder hypothe-
tischen Situation, wo es eine Frau mit dir
aushlt, verdient diese Frau die Heiligspre-
chung. Wie wir beim Verstndnis allerdings
gerade diesen Universalquantor und seine Be-
schrnkung rekonstruieren, wre noch zu kl-
ren. Immerhin, die Attraktivitt eines Ansat-
zeichnet Hans die Eigenschaft, Hans zu sein.
So wird gewhrleistet, da die fr Gemein-
namen entworfene Deutung von das auch mit
Eigennamen kombinierbar ist, und es kommt
die richtige Gesamtbedeutung fr der Hans
heraus. Fr die oberflchlich artikellose Va-
riante nhme man hier wohl am zweckmig-
sten an, da dort auf der semantisch relevan-
ten Reprsentationebene ebenfalls ein be-
stimmter Artikel vorhanden ist, der nur eben
nicht phonetisch realisiert ist.
Beim gegenwrtigen Forschungsstand ist
unklar, wie man sich hier entscheiden soll und
ob berhaupt etwas Interessantes daran
hngt. Der bestimmte Artikel vor Eigenna-
men und sein semantisches und syntaktisches
Verhltnis zum bestimmten Artikel vor Ge-
meinnamen scheinen bisher berhaupt nicht
in theoretischem Rahmen thematisiert wor-
den zu sein.
1.5.3Generische Lesarten
Manchmal knnen NPs der Form das so
gelesen werden, da sie sich nicht auf ein
bestimmtes beziehen, sondern irgendwie auf
s im allgemeinen. In solchen Fllen ist oft
von einer generischen Lesart die Rede. Die
hervorgehobenen NPs in den folgenden Bei-
spielen sind eine reprsentative Auswahl des-
sen, was in der Literatur unter diesen Termi-
nus gefat worden ist.
(100) Der Walkman bewirkt die Vereinsa-
mung des modernen Menschen.
(101) Der Geisterkrebs ist an der ganzen
Golfkste verbreitet.
(102) Die Frau, die es mit dir aushlt, ver-
dient, heiliggesprochen zu werden.
(103) Der Kanzler wird von der Nationalver-
sammlung gewhlt.
(104) Wir fuhren mit dem Bus nach Feuer-
land.
(105) Philipp kommt bald in die Schule.
Auf keines dieser Definita scheinen die bisher
referierten berlegungen zu passen. Z. B. feh-
len hier trotz des Singulars die Einzigkeits-
und gelegentlich auch die Existenzprsuppo-
sitionen. Ganz klar ist das bei (100) und (101),
wo selbstverstndlich an Situationen mit zahl-
reichen Walkmans, modernen Menschen und
Geisterkrebsen gedacht ist. Bei (102) fllt auf,
da der Sprecher ohne weiteres glauben kann,
da es keine Frau mit dir aushlt, und er mu
wohl auch nicht ausschlieen, da es mehrere
gibt. Bei (103) mag es zwar zur uerungszeit
nur einen Kanzler und eine Nationalver-
sammlung (im relevanten Staat) geben, aber
512 VII. Semantik der Funktionswrter
Wieweit sich so eine Analyse dann auch auf
andere der obigen Beispiele bertrgt, hngt
davon ab, was man von Arten alles prdizie-
ren kann und was solche Prdikationen be-
deuten. Carlson z. B. schlgt vor, da selbst
so gewhnliche Prdikate wie liebt Ruhe
und Ordnung nicht nur auf einzelne Menschen
sondern auch auf Arten von Menschen (z. B.
Nationen) anwendbar sind. Damit erhlt
(107) eine ganz analoge Analyse wie (101):
das Definitum bezieht sich auf die Art der
Deutschen, und von dieser wird prdiziert,
da sie Ruhe und Ordnung liebt. Es ist dann
natrlich zu explizieren, wie die Eigenschaften
von Arten mit denen ihrer Realisierungen zu-
sammenhngen, z. B. was man aus der Ord-
nungliebe der deutschen Nation ber die Ord-
nungsliebe einzelner Deutscher schlieen
kann und umgekehrt. Wir verweisen zu dieser
und anderen sich bei diesem Ansatz ergeben-
den Fragen auf die Arbeiten von Carlson (s.
auch Artikel 17).
Gesetzt einmal den Fall, da eine Deutung
generischer Definita als Namen fr Arten sich
fr einige oder gar alle der obigen Beispiele
motivieren lt dann wre noch zu klren,
wie diese Art-Lesart kompositional zustan-
dekommt, d. h. welchen Beitrag dabei jeweils
das Substantiv und der Artikel leisten. Carl-
son macht in dieser Hinsicht einen Vorschlag,
demzufolge der bestimmte Artikel rein klas-
sisch bleibt, und die Verantwortung fr die
Art-Referenz allein beim Substantiv liegt. Er
ntzt dabei eine systematische Mehrdeutig-
keit in Substantiven aus, die sich z. B. auch
in der Mehrdeutigkeit von Dieses Auto habe
ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen uert
(Auto als konkreter Gegenstand oder als
Typ). Der Geisterkrebs in (101) bedeutet fr
ihn so etwas wie die einzige (kontextuell
relevante) Art, deren Realisierungen notwen-
dig Geisterkrebse sind. Es ist aber wohl et-
was verfrht, sich eingehend mit der Frage
zu befassen, inwieweit der bestimmte Artikel
innerhalb so eines Ansatzes seine klassische
Bedeutung behalten kann.
Der generische Gebrauchs definiter NPs ist
von vielerlei Geheimnissen umwittert, auf die
bis jetzt weder der eine noch der andere der
oben skizzierten Anstze irgendwelches Licht
geworfen hat. Warum z. B. kann (108) nicht
mit einer generischen Lesart fr das hervor-
gehobene Definitum gelesen werden, whrend
doch z. B. in (109) die intendierte generische
Bedeutung zwanglos zum Vorschein kommt?
(108) Der versptete Bus macht mich nervs.
zes, der in generische Stzen stets einen im-
pliziten Allgemeinheitsoperator hineinanaly-
siert, liegt auf der Hand: Er gestattet es nm-
lich, die angeblich generischen Definita
ganz in der blichen (klassischen) Manier zu
deuten. Sie sind als solche genausowenig ge-
nerisch wie etwa der Prsident der USA in
unserem alten Beispiel (23). Es sah nur zu-
nchst so aus, da wir den wirklichen Trger
der generischen Kraft an der Oberflche nicht
sehen konnten. Ist er aber erstmal dingfest
gemacht, dann lst sich der Bedarf nach einer
generischen Lesart des bestimmten Artikels
von selbst auf.
Auf wieviele Beispiele sich so ein Ansatz
ausweiten lt, ist nicht auf Anhieb klar. Aus
der Forschung ber Quantifikationsadver-
bien ist bekannt, da diese nicht blo ber
Zeiten, sondern auch ber allerhand anderes
quantifizieren knnen, im allgemeinsten Fall
vielleicht ber so etwas Abstraktes wie Situa-
tionen oder Flle. Wenn man das konsequent
ausntzt, kann man vielleicht sogar Beispiele
wie (107) ber den gleichen Kamm wie (103)
und (102) scheren.
(107) Der Deutsche liebt Ruhe und Ordnung.
Vielleicht ist hier so etwas zu ergnzen wie
in jedem Fall, der genau einen (typischen)
Deutschen einschliet: ... Damit blieben
aber noch viele Fragen offen, nicht zuletzt die
Frage, wonach sich unter dieser Analyse die
Wahl zwischen definiten und indefiniten ge-
nerischen NPs (vgl. 2.3.2 unten) richtet.
Wie dem auch sei, allen der eingangs ge-
nannten Beispiele ist auf diesem Weg ohnehin
nicht beizukommen. Ein klares Hindernis bil-
det das Prdikat verbreitet in (101). Was im-
mer wir hier fr ein Quantifikationsadverb
hineingeheimnissen, es kme Unsinn heraus,
denn an der ganzen Golfkste verbreitet zu
sein, ist eben keine Eigenschaft, die jeweils
einzelnen Geisterkrebsen zukommen kann.
Beispiel (100) ist nicht so eklatant proble-
matisch, aber auch hier ist wohl nicht ge-
meint, da zu allen Zeiten oder in allen Fllen
einer bestimmten Sorte der jeweilige Walk-
man zur Vereinsamung des jeweiligen moder-
nen Menschen beitrgt. (100) kann wahr sein,
ohne da je ein einzelner Walkman einen ein-
zelnen Menschen vereinsamt hat.
Beispiele wie (101) motivieren eine ganz
andere Theorie, nmlich die von Carlson
(1978), gem der die NP der Geisterkrebs in
(101) sich auf eine Art, nmlich auf die Spe-
zies Geisterkrebs, bezieht. Von dieser kann
dann verbreitet sinnvoll prdiziert werden.
22. Artikel und Definitheit 513
Die Wahrheitsbedingungen des Satzes (110)
werden beispielsweise mit denen der prdi-
katenlogischen Formel (111) idenfiziert.
(110) Eine Katze ist anwesend.
(111) x [Katze(x) & anwesend(x)]
Man kann diese Analyse auf verschiedene
Weise implementieren. Z. B. wrde man im
Rahmen der generalisierten Quantoren-Theo-
rie (s. Artikel 21) sagen, da ein die Relation
der Nicht-Disjunktheit zweier Mengen aus-
drckt. (Satz (110) z. B. bedeutet, da die
Menge der Katzen und die Menge der An-
wesenden einen nicht-leeren Durchschnitt
haben.) Auf die konkrete Realisierung kommt
es uns hier aber nicht an. Wir bezeichnen als
-Deutung jede Interpretation des unbe-
stimmten Artikels, die irgendwie die folgende
Voraussage macht:
(112) Ein Satz der Form [ein ] drckt die-
jenige Proposition aus, die wahr ist,
wenn es mindestens ein Individuum
gibt, das sowohl als auch ist, und
falsch sonst.
Wir erinnern nun kurz an die blichen Ar-
gumente fr diese Deutung. Danach betrach-
ten und verwerfen wir zwei Mglichkeiten,
die relativ liberalen Wahrheitsbedingungen in
(112) in gewissen Richtungen zu verschrfen.
2.1.1Vorteile der -Deutung
In der philologisch-linguistischen Tradition
ist es blich, so zu reden, als beziehe man sich
mit der uerung eines Indefinitums auf ein
Individuum. Demnach bezieht sich die Spre-
cherin z. B., wenn sie (110) uert und dabei
die Wahrheit sagt, mit eine Katze auf die
anwesende Katze. Diese Auffassung fhrt
aber zu bekannten Schwierigkeiten. Was,
wenn die Sprecherin lgt, d. h. wenn in Wirk-
lichkeit gar keine Katze anwesend ist oder es
vielleicht noch nicht einmal Katzen gibt? Es
ist unklar, auf welches Individuum sich das
Indefinitum dann bezieht. Anscheinend auf
keines; aber welchen Beitrag macht es dann
sonst zur Bedeutung dieser uerung, die wir
ja offenbar ohne Schwierigkeiten verstehen?
Die -Deutung rumt mit solchen Rtseln
grndlich auf.
Mysteris ist aus dem traditionellen Blick-
winkel auch, welchen Beitrag ein Indefinitum
zur Bedeutung von Stzen macht, in denen es
unter Negation, Quantoren oder anderen
Operatoren eingebettet ist.
(113) Es stimmt nicht, da Hagit eine Katze
mitbringt.
(109) Versptete Busse machen mich nervs.
Bisher ist leider kein konkreter Vorschlag zur
Deutung generischer Definita gemacht wor-
den, der sich nicht sofort dem Vorwurf aus-
setzt, viel zu viel zuzulassen und insbesondere
weitgehende Austauschbarkeit mit anderen
generischen Ausdrcken (etwa artikellosen
Pluralia) vorherzusagen. Genaueres Eingehen
auf diese Problematik wrde den Rahmen
dieses Artikels sprengen.
Nehmen wir noch kurz zu den Beispielen
(104) und (105) Stellung. Unser erstgenannter
Ansatz scheint diese Beispiele nicht zu erfas-
sen, denn bei (104) und (105) ist offenbar kein
verallgemeinerndes Quantifikationsadverb
versteckt: Es ist hier nicht von einer Mehrzahl
von Fllen die Rede, in denen wir mit dem
jeweiligen Bus nach Feuerland fuhren, bzw.
in denen Philipp in die jeweilige Schule
kommt. Carlsons Theorie hat wohl bessere
Chancen. Jedenfalls ist nicht so leicht zu wi-
derlegen, da der Bus und die Schule hier
Arten bezeichnen, und man kann wohl auch
explizieren, wie sich die Eigenschaften mit
dem Bus fahren und in die Schule gehen (bzw.
kommen) kompositional aus der Verbindung
der Verbbedeutungen mit diesen Arten erge-
ben.
Wir konnten hier kaum mehr tun, als die
Existenz generischer Definita zu erwhnen.
Was sie genau bedeuten und ob sie berhaupt
eine einheitliche Deutung zulassen, bleibt of-
fen. Ob der bestimmte Artikel hier eine spe-
zielle generische Bedeutung hat und wie sich
diese gegebenfalls zu seiner normalen Be-
deutung verhlt, darber knnen wir noch
nicht einmal intelligent spekulieren.
2. Der unbestimmte Artikel
Der unbestimmte Artikel im Deutschen ist
ein. (Wiederum lassen wir die Neutrum-No-
minativ-Singular-Form alle anderen Formen
mitvertreten.) Er wird in der Regel vom Nu-
merale unterschieden, mit dem er bis auf pho-
nologische Eigenschaften fehlenden Ak-
zent, Reduzierbarkeit (je nach Dialekt) zu n
identisch ist. Allerdings ist nicht klar, da
diese Unterscheidung semantisch relevant ist;
jedenfalls trifft die Standardinterpretation,
die wir gleich vorstellen werden, ebensogut
auf das Numerale zu.
2.1Ein als Existenzquantor
Seit Frege und Russell ist es blich, den un-
bestimmten Artikels ein mithilfe des Existenz-
quantors der Prdikatenlogik zu analysieren.
514 VII. Semantik der Funktionswrter
(117) Ein Gewicht unseres Zelts ist unter
2 kg.
(118) Ein Kopf des Ermordeten war kahlge-
schoren.
Unter der -Deutung des unbestimmten Ar-
tikels sind diese Stze wahr, wenn das Ge-
wicht unseres Zelts unter 2 kg ist bzw. der
Kopf des Ermordeten kahlgeschoren war. Es
ist also nicht ohne weiteres einzusehen,
warum wir sie in diesem Falle nicht uern
drfen. Dieses Problem gibt zu der Vermu-
tung Anla, da die -Deutung zu liberal ist
und durch eine zustzliche Nicht-Einzig-
keitsbedingung verstrkt werden sollte:
(119) [ein ] drckt diejenige Proposition
aus, die wahr ist, wenn es mindestens
zwei s gibt, darunter mindestens eines,
das sowohl als auch ist; andernfalls
falsch.
(119) verhindert, da (117) und (118) in den
beschriebenen Situationen wahr sind. Aller-
dings sagt es voraus, da sie stattdessen falsch
sind, was auch nicht ganz stimmt. Intuitiv
sind (117) und (118) nicht falsch, sondern
miglckt. Wir tten also besser daran, die
Nicht-Einzigkeitsbedingung als Prsupposi-
tion zu behandeln, etwa so:
(120) [ein ] drckt diejenige Proposition
aus, die
wahr ist, wenn es mindestens zwei s
gibt, darunter mindestens eines, das so-
wohl als auch ist;
falsch ist, wenn es mindestens zwei s
gibt, darunter keines, das sowohl als
auch ist;
wahrheitswertlos ist, wenn es nicht
mindestens zwei s gibt.
Dieser Vorschlag ist durch die Ausfhrungen
von Hawkins (1978) inspiriert.
Mit (120) lassen sich zwar nun die Urteile
ber (117) und (118) herleiten, aber dafr gibt
es anderswo Schwierigkeiten. Betrachten wir
etwa (121) und (122).
(121) Robert hat einen sechs Meter langen
Wels gefangen.
(122) Ein krankhaft neugieriger Nachbar von
mir ist in den Speicher eingebrochen.
Gem (120) sollten diese Stze prsupponie-
ren, da es mindestens zwei sechs Meter lange
Welse gibt bzw. da ich mindestens zwei
krankhaft neugierige Nachbarn habe. Das
tun sie aber intuitiv nicht. Wer (121) behaup-
tet oder hrt, kann durchaus meinen, da
Robert das Glck hatte, den mit Abstand
lngsten Wels auf der Welt zu erwischen. (122)
(114) In jedem Geigenkasten sitzt eine Katze.
Die Frage, auf welche Katze (oder sonstiges
Individuum) sich eine Katze hier bezieht, ist
offenbar unangebracht. Unter der -Deutung
dagegen sind diese Beispiele vollkommen
durchsichtig, wie aus elementaren Einfhrun-
gen in die Logik oder formale Semantik ge-
lufig sein drfte.
2.1.2Implikatur der Einzigkeit
Gem der -Deutung ist (110) nicht nur
dann wahr, wenn genau eine Katze anwesend
ist, sondern auch dann, wenn es zwei oder
mehr sind. Wie vertrgt sich das mit dem
Urteil, da (110) irgendwie unpassend oder
irrefhrend ist, wenn der Sprecher damit ber
eine Szene mit mehreren Katzen berichtet?
Wie vertrgt es sich auch damit, da wir (110)
und (115) nicht als synomym empfinden?
(115) Eine oder mehrere Katzen sind anwe-
send.
Solchen Intuitionen wre vielleicht besser ent-
sprochen, wenn ein als genau ein gedeutet
wrde. Aber das geriete dafr wieder mit an-
deren Urteilen in Konflikt, etwa dem Urteil,
da die Antwort in (116) durchaus nicht wi-
dersprchlich ist.
(116) War eine Katze anwesend? Ja, sogar
zwei.
Auch wrde es so eine Deutung unmglich
machen, kein schlicht als die Negation von
ein zu deuten.
Das Dilemma lst sich zum Glck leicht
auf, wenn wir zwischen ausgedrckter Pro-
position im engeren Sinne und skalarer Im-
plikatur unterscheiden. Wir knnen dann
daran festhalten, da die -Deutung adquat
den Beitrag des unbestimmten Artikels zur
ausgedrckten Proposition beschreibt. Die oft
zustzlich vermittelte Information, da es
hchstens ein Individuum im Durchschnitt der
beiden Prdikate gibt, ist dagegen eine skalare
Implikatur. (Ein analoges Dilemma, mit auch
analoger Auflsung, stellt sich brigens bei
der Interpretation aller Numeralia.) Auf diese
Weise erklren sich die oben angedeuteten
Intuitionen ohne gegenseitigen Widerspruch
(s. Artikel 14).
2.1.3Nicht-Einzigkeitsbedingung
Offenbar darf ein nicht verwendet werden,
wenn bereits bekannt ist, da es nicht mehr
als ein gibt. Die folgenden Stze sind nicht,
bzw. nur unter abwegigen Bedingungen, ak-
zeptabel.
22. Artikel und Definitheit 515
kann, da es genau ein gibt, mit der ge-
meinsamen Voraussetzung der Gesprchsteil-
nehmer, da es genau ein gibt, in Konflikt
gert, resultiert plausiblerweise Unangemes-
senheit. Dies scheint bei (117) und (118) der
Fall zu sein.
Nun werden die blichen Beispiele von ska-
larer Implikatur in der Regel aus der Grice-
schen Konversationsmaxime der Quantitt
(Mach deinen Beitrag so informativ wie fr
die gegebenen Gesprchszwecke ntig!) her-
geleitet. An dieser Stelle bricht leider die Ana-
logie zusammen, denn fr die Nicht-Einzig-
keitsimplikatur des unbestimmten Artikels
scheint so eine Herleitung nicht mglich zu
sein. Wenn schon bekannt ist, da jeder
Mensch nur einen Kopf hat, vermittelt (118)
nmlich haargenau so viel neue Information
wie der betreffende Satz mit bestimmtem Ar-
tikel. Mangelnde Informativitt kann hier
also nicht der Grund fr die Unangemessen-
heit sein. Soweit wir sehen knnen, lt sich
(123) auch auf keine andere der bekannten
Griceschen Maximen zurckfhren. Vielleicht
sollten wir eine neue Maxime postulieren:
Prsupponiere in deinem Beitrag so viel wie
mglich! Aus so etwas, passend przisiert,
knnte man (123) wohl als Spezialfall gewin-
nen. Damit befinden wir uns aber ganz auf
Neuland und wollen weitere Spekulationen in
dieser Richtung erst einmal der zuknftigen
Forschung berlassen.
Wie immer (123) zu erklren ist, als de-
skriptive Generalisierung hat es einiges fr
sich. Neben der Unangemessenheit von (117)
und (118) erklrt es auch den (von Hawkins
im selben Zusammenhang diskutierten) se-
mantischen Kontrast in minimalen Paaren
wie dem folgenden.
(124) Richard hat sich gestern abend das
Beaux-Arts-Trio angehrt und hinter-
her ein Bier mit dem Pianisten getrun-
ken.
(125) Richard hat sich gestern abend das
Beaux-Arts-Trio angehrt und hinter-
her ein Bier mit einem Pianisten getrun-
ken.
Angenommen, Richard hrt sich das Beaux-
Arts-Trio an und trinkt nachher mit Pressler,
dem Pianisten dieses Trios. ber diesen Sach-
verhalt kann mit (124) angemessen und wahr-
heitsgem berichtet werden. (125) dagegen
wre irrefhrend und wrde den Hrer zu
dem Schlu berechtigen, da Richard mit
einem anderen Pianisten als Pressler getrun-
ken hat. Wir versuchen nun zu zeigen, wie
lt ebenfalls ganz offen, wieviele krankhaft
neugierige Nachbarn ich habe, und spricht
insbesondere keineswegs gegen die Hoffnung,
da es nur einer ist.
Um solche Komplikationen zu vermeiden,
bleiben wir lieber bei der ursprnglichen -
Deutung anstelle von (120). Dann mssen wir
freilich nach einer alternativen Erklrung fr
(117) und (118) suchen. Ganz grob gesagt
scheint hier die Regel zu gelten: Vermeide
den unbestimmten Artikel, wenn du den be-
stimmten verwenden kannst. Ein bichen ge-
nauer gesagt:
(123)
In uerungssituationen, wo bereits
bekannt ist, da die Prsupposition fr
[das ] erfllt ist, ist es verboten, [ein
] zu uern.
Da z. B. bekannt ist, da jeder Gegenstand
genau ein Gewicht und jeder Mensch genau
einen Kopf hat, ist es in potentiellen ue-
rungssituationen fr (117) oder (118) gemein-
sames Wissen der Gesprchsteilnehmer, da
die Einzigkeitsprsupposition von das Ge-
wicht unseres Zelts bzw. der Kopf des Ermor-
deten erfllt ist. Deshalb mssen hier diese
Definita anstelle der entsprechenden Indefi-
nita verwendet werden.
Es wre wnschenswert, (123) aus irgend-
welchen allgemeineren Prinzipien herzuleiten.
Es ist allerdings unklar, wie das gehen soll.
Auf den ersten Blick erinnert (123) an das
Phnomen der skalaren Implikatur (s. Artikel
14): Wenn zwischen zwei Ausdrcken eine
asymmetrische Folgerungsbeziehung vorliegt,
geht die Wahl des schwcheren Ausdrucks
allgemein mit der konversationalen Implika-
tur einher, da das Wissen des Sprechers fr
den strkeren nicht ausreicht. Z. B. folgt [es
ist mglich, da p] asymmetrisch aus [es ist
notwendig, da p], und deshalb implikiert [es
ist mglich, da p], da der Sprecher nicht in
der Lage ist, [es ist notwendig, da p] zu be-
haupten (typischerweise, weil er [es ist mg-
lich, da nicht p] ebenfalls fr wahr hlt). Da
zwischen bestimmtem und unbestimmtem Ar-
tikel ebenfalls eine asymmetrische Folge-
rungsbeziehung besteht aus [das ] (unter
der klassischen Deutung) folgt [ein ] (unter
der -Deutung) erwartet man hier einen
analogen Effekt: Der Gebrauch von [ein ]
sollte konversational implikieren, da der
Sprecher nicht in der Lage ist, [das ] zu
uern, m. a. W. da er nicht voraussetzen
kann, da es genau ein gibt. Daraus liee
sich in der Tat (123) ableiten: Wenn die Im-
plikatur, da der Sprecher nicht voraussetzen
516 VII. Semantik der Funktionswrter
hat, darf man also schlieen, da er die str-
kere entweder fr falsch hlt oder nicht wei,
ob sie wahr ist. M. a. W., man darf ihm unter-
stellen, da er entweder wei, da es nicht
Pressler war, oder nicht wei, wer es war. Dies
stimmt in der Tat mit dem intuitiven Ver-
stndnis von (125) berein. Ceteris paribus
nehmen wir wohl eher an, da der Sprecher
wei, mit wem Richard getrunken hat; daher
unser spontaner Schlu, da es nicht Pressler
war. Die andere Mglichkeit ist aber auch
vorhanden, wie (126) deutlich macht.
(126) Richard hat sich gestern abend das
Beaux-Arts-Trio angehrt und hinter-
her ein Bier mit einem Pianisten getrun-
ken. Er verrt mir aber nicht, wer dieser
Pianist gewesen ist.
Die Fortfhrung hier impliziert nicht blo,
da es unter den Pianisten auerhalb von B
einer so gut wie jeder andere gewesen sein;
vielmehr nimmt sie uns auch das Vertrauen,
da es nicht Pressler war.
Zusammenfassend mssen wir zugestehen,
da noch nicht restlos geklrt ist, woher es
kommt, da der Gebrauch des unbestimmten
Artikels oft Nicht-Einzigkeit nahelegt. Wir
haben aber hoffentlich klargemacht, da es
kurzsichtig wre, die Nicht-Einzigkeit direkt
mit in die ausgedrckte Proposition oder als
Prsupposition in die Semantik einzubauen.
Vielversprechender scheint einstweilen eine
konservativere Strategie: die -Deutung bei-
zubehalten und durch eine pragmatische Re-
gel wie (123) zu ergnzen.
2.2Spezifische und unspezifische Lesart
In der linguistischen Literatur wird hufig
zwischen einer spezifischen und einer un-
spezifischen Lesart des unbestimmten Arti-
kels unterschieden. Ganz grob gesagt soll der
Unterschied darin bestehen, da der Sprecher
bei der spezifischen Lesart von eine Katze eine
bestimmte Katze meint, whrend das bei der
unspezifischen nicht der Fall ist. Aber das
mu natrlich erst einmal przisiert werden,
bevor man darber diskutieren kann, ob eine
solche Mehrdeutigkeit tatschlich existiert,
und wenn ja, wie sie sich mit der -Analyse
vertrgt.
2.1.1Spezifitt als weiter Skopus?
In der Frhzeit der Generativen Grammatik
ist die Unterscheidung zwischen spezifisch
und unspezifisch oft mit Beispielen illustriert
worden, bei denen der Logiker sofort an Sko-
pusmehrdeutigkeiten denkt. Z. B. werden dort
sich dieses intuitive Urteil aus dem Zusam-
menspiel von (123) mit Mechanismen der Be-
reichswahl erklrt (siehe Abschnitt 1.4 oben).
Sehen wir uns zunchst (124) an. Mit dem
ersten Konjunkt wird hier durch die Erwh-
nung des Beaux-Arts-Trios ein Individuen-
bereich B geschaffen, der die Musiker dieses
Trios enthlt und andere ausschliet. In B
gibt es bekanntermaen genau einen Piani-
sten, also ist die Prsupposition des zweiten
Konjunkts von (124) erfllt, und es resultiert,
wie gewnscht, eine Lesart, nach der Richard
mit dem einzigen Pianisten in B trinkt. Nun
zu (125). Da das erste Konjunkt und (nehmen
wir an) der extralinguistische Kontext genau
wie bei (124) sind, wird auch hier erst einmal
der Bereich B etabliert. Da es in B aber be-
kanntermaen genau einen Pianisten gibt, fin-
det nun (123) Anwendung und verbietet den
Gebrauch des unbestimmten Artikels. Um die
uerung vor dem Miglcken zu retten,
mte nun entweder die Annahme revidiert
werden, da das Beaux-Arts-Trio nur einen
Pianisten hat, oder aber der Individuenbe-
reich erweitert werden. Leichter ist hier offen-
bar das zweitere: der Bereich wird spontan so
weit ausgedehnt, bis alle nchst-aufflligsten
Pianisten mit eingeschlossen sind (bzw., wenn
es auerhalb des Beaux-Arts-Trios keine Auf-
flligkeitsunterschiede mehr gibt, alle Piani-
sten berhaupt); nennen wir diesen neuen Be-
reich B+. (Diese Bereichsrevision ist ein Fall
von Akkommodation im Sinne von Lewis
1979a; siehe Artikel 10.) Bezglich B+ ist
nun die Einzigkeitsprsupposition von der
Pianist nicht mehr erfllt, und der Gebrauch
von ein Pianist folglich erlaubt. Bezglich B+
bedeutet das zweite Konjunkt von (125), da
Richard mit irgendeinem Pianisten in B+
getrunken hat.
Soweit haben wir vorausgesagt, da (125)
nicht ausschliet, da der Pianist, mit dem
Richard trinkt, ein anderer als Pressler ist.
Bleibt zu erklren, warum es dies nicht nur
zult, sondern geradezu erzwingt. Dafr
scheint die Gricesche Quantittsmaxime ver-
antwortlich zu sein. Da Richard mit einem
Mitglied von B getrunken hat, ist (wegen
B B+) informativer, als da er mit einem
Mitglied von B+ getrunken hat. Wenn der
Sprecher genug wte, um erstere Proposition
zu behaupten, htte er dies also tun sollen,
zumal da es ohne zustzlichen Aufwand
nmlich durch die uerung von (124) an-
stelle von (125) mglich gewesen wre. Aus
der Tatsache, da der Sprecher statt dessen
die schwchere zweite Proposition behauptet
22. Artikel und Definitheit 517
Es kann bedeuten, da (i) es einen Schweden
gibt, den Maria und niemand sonst heiraten
wollte; oder da (ii) Maria und niemand sonst
darauf aus ist, eine Schwedenfrau zu werden;
oder schlielich, da (iii) es fr Maria, aber
fr niemand sonst, einen Schweden gibt, auf
den sie es abgesehen hat. Da die NP nur Maria
aus unabhngigen Grnden weiteren Skopus
als das intensionale Verb wollen bekommen
mu, sind dies genau die drei Lesarten, die
man erwartet, wenn einen Schweden gegen-
ber diesen beiden Satzteilen (i) weitesten, (ii)
engsten oder (iii) mittleren Skopus einnehmen
kann.
Soweit sieht es also so aus, als knnten wir
das Merkmal [ spezifisch] getrost aus der
Semantik des unbestimmten Artikels verban-
nen. Die Mehrdeutigkeiten, zu deren Be-
schreibung es gut sein sollte, ergeben sich
ganz von selbst aus der -Analyse und der
logischen Syntax natrlicher Sprachen. Aber
damit htten wir es uns leider ein bichen zu
einfach gemacht. Auch in der jngsten und
von logischer Bildung gewi nicht unbeleck-
ten Literatur taucht immer wieder die Ver-
mutung auf, da der unbestimmte Artikel
noch in einem anderen Sinne spezifisch sein
kann als es ein Existenzquantor mit weitestem
Skopus ist.
2.2.2Spezifische Indefinita als referentielle
Ausdrcke
Um uns an diesen anderen Sinn von spezi-
fisch heranzutasten, betrachten wir den fol-
genden Text.
(132) Ein Student von mir hat promoviert.
Das htte ich nie fr mglich gehalten.
Wenn Barbara das sagt, kann man sie auf
zweierlei Weisen verstehen: Entweder sie
meint, da sie nie erwartet htte, einmal einen
promovierten Studenten zu haben. Oder sie
meint vielmehr, da sie es speziell dem, von
dessen Promotion da berichtet wird, nicht
zugetraut htte. Wie erklren sich diese bei-
den Lesarten? Ein attraktiver Vorschlag wre
der folgende: Das Wort das bezieht sich in
jedem Falle auf die mit dem vorangehenden
Satz behauptete Proposition. Welche Propo-
sition das ist, hngt nun aber davon ab, wel-
che Lesart im ersten Satz fr das Indefinitum
ein Student von mir gewhlt wurde. War es
die spezifische Lesart, so hat sich Barbara
damit auf einen bestimmten Studenten bezo-
gen, sagen wir einmal auf Franz, und die
behauptete Proposition war somit, da Franz
promoviert hat. Das das nimmt also diese
die zweierlei Lesarten von (127) oder (128)
darauf zurckgefhrt, da der Artikel ein ent-
weder positiv oder negativ fr das Merkmal
[spezifisch] spezifiert sein kann.
(127) Ein Arzt war nicht anwesend.
(128) Maria mchte einen Schweden heira-
ten.
Trgt ein in (127) das Merkmal [+ spezifisch],
so ergibt sich fr den Satz als ganzen die
Aussage, da es einen Arzt gab, der abwesend
war; fr ein [-spezifisch] dagegen kommt her-
aus, da kein Arzt anwesend war. In (128)
ergibt die spezifische Deutung fr einen die
Lesart, nach der Maria es auf einen bestimm-
ten Schweden abgesehen hat, die unspezifi-
sche Deutung hingegen die Lesart, nach der
es ihr Ziel ist, eine Schwedenfrau zu werden,
ein Ziel also, das sich durch die Heirat belie-
biger verschiedener Schweden erreichen liee.
Solche Beispiele erregen, wie gesagt, den
Verdacht, da bei den sogenannten [ spezi-
fisch]-Mehrdeutigkeiten einfach der durch ein
ausgedrckte Existenzquantor gegenber an-
deren Satzteilen mal engen, mal weiten Sko-
pus hat. Diese Erklrung liegt insbesondere
fr (127) auf der Hand. Die genannten zwei
Lesarten ergeben sich zwanglos, wenn man
eine einheitliche -Deutung von ein mit der
Annahme verbindet, da dieser Satz zweierlei
logische Gliederungen zult, nmlich eine
analog der logischen Formel in (129) und eine
andere analog der in (130).
(129) x [Arzt(x) & anwesend(x)]
(130) x [Arzt(x) & anwesend(x)]
(129) erfat offenbar die Lesart, die mit dem
Merkmal [+ spezifisch] des Artikels ein ein-
hergehen sollte, (130) dagegen diejenige, in
der ein als [-spezifisch] beschrieben wurde. Bei
(128) ist es weniger offensichtlich, wie Spezi-
fitt und Nichtspezifitt sich einfach mit wei-
tem bzw. engem Skopus gleichsetzen lassen
sollen. In diesem Beispiel ist das mit blo
elementarlogischen Mitteln auch nicht zu be-
werkstelligen; doch hat die Entwicklung in-
tensionaler Logiken auch hier eine plausible
Rckfhrung auf Skopusmehrdeutigkeit be-
reitgestellt.
Allgemein hat die Hypothese, da der un-
bestimmte Artikel variablen Skopus haben
kann, den Vorteil, in komplexeren Stzen drei
oder mehr Lesarten vorauszusagen, whrend
mit dem binren Merkmal [ spezifisch]
grundstzlich nur zwei unterschieden werden
knnen. Tatschlich ist z. B. (131) dreideutig.
(131) Einen Schweden wollte nur Maria hei-
raten.
518 VII. Semantik der Funktionswrter
Kontextabhngigkeit: Die von (134) ausge-
drckte Existenzproposition hngt nur inso-
fern vom uerungskontext ab, als dieser die
Referenz des Pronomens mir bestimmt; der
Artikel ein
q
trgt von sich aus keine Kontext-
abhngigkeit bei.
(134) Ein
q
Student von mir hat promoviert.
Dagegen drckt (135) gem (133) (selbst bei
festem Sprecher) verschiedene Propositionen
aus, je nachdem welchen Studenten der Spre-
cher meint.
(135) Ein
r
Student von mir hat promoviert.
Zweitens ist zu beachten: Aus der Proposi-
tion, die [ein
r
] ausdrckt, folgt nicht, da
es ein gibt; das Prdikat findet in diese
Proposition berhaupt keinen Eingang.
Trotzdem entnimmt man natrlich aus einer
uerung z. B. des Satzes (135) mit Recht,
da die Sprecherin glaubt, (mindestens) einen
Studenten zu haben. Der Grund dafr ist,
da der Satz berhaupt keine Proposition
ausdrckt, wenn das von der Sprecherin ge-
meinte Individuum nicht ihr Student ist. Drit-
tens impliziert (133), da der Skopus eines
spezifischen Indefinitums nicht bedeutungs-
relevant ist. Z. B. drckt (bei gleichbleibender
uerungssituation) nicht [[ein
r
] ] genau
dieselbe Proposition aus wie [ein
r
] nicht-,
nmlich da der vom Sprecher beabsichtigte
Referent nicht die Eigenschaft hat.
Wie stellen wir es nun an, eine spezifische
Lesart intuitiv von einer unspezifischen zu
unterscheiden? Dies ist nicht in allen Fllen
leicht. Zwar sind Lesarten, die durch ein un-
spezifisches Indefinitum mit engem Skopus
zustandekommen, im allgemeinen unschwer
von spezifischen Lesarten zu unterscheiden.
(Z. B. manifestiert sich der Bedeutungsunter-
schied zwischen nicht [[ein
q
] ] und nicht
[[ein
r
] ] in solchen uerungskontexten, wo
einige, aber nicht alle s sind; dort kann
man nmlich mit ersterem nichts Wahres be-
haupten, mit letzterem aber durchaus.) Aber
eine unspezifische Lesart mit weitestem Sko-
pus sieht einer spezifischen oft zum Verwech-
seln hnlich. Dies kommt daher, da gem
(133) in jeder uerungsituation, wo mit [ein
r
] eine wahre Proposition behauptet wird,
notwendigerweise auch die mit [ein
q
] aus-
gedrckte Proposition wahr ist.
Die Umkehrung gilt freilich nicht wenn
[ein
q
] wahr ist, kann [ein
r
] in derselben
uerungssituation trotzdem falsch sein
und das sollte uns dabei helfen, die beiden
empirisch auseinanderzuhalten. Angenom-
Proposition wieder auf, und wir erhalten die
oben als zweite genannte Lesart fr den Text
als ganzen. Hatte ein Student von mir hingegen
die unspezifische Lesart, so wurde im ersten
Satz nur die Existenzproposition behauptet,
da sich unter Barbaras Studenten (minde-
stens) ein promovierter findet. Bezieht sich
das nun auf diese Proposition, so entsteht die
oben erstgenannte Lesart fr (132).
Diese berlegung ist natrlich unmittelbar
von Stalnaker (1970) und seinem Pldoyer
fr eine direkt referentielle Deutung des be-
stimmten Artikels inspiriert (vgl. Abschnitt
1.3.2). Tatschlich luft die bis heute explizi-
teste und bestmotivierte Version der spezi-
fisch-Ambiguitt des unbestimmten Artikels
darauf hinaus, da spezifische Indefinita di-
rekt referentiell sind. Wir sprechen hier von
der Arbeit von Fodor & Sag (1982), der wir
folgenden Vorschlag entlehnen:
Die -Deutung des unbestimmten Artikels
ist korrekt, aber eben nur als Analyse einer
seiner beiden Lesarten, nmlich der unspezi-
fischen. (Dies haben wir natrlich schon im-
plizit in unserer Betrachtung des Beispiels
(132) vorausgesetzt.) Fortan fgen wir dem
Artikel das Subskript q (fr quantifizie-
rend) zu, wenn wir diese Lesart meinen.
Ebenfalls korrekt ist, da der unbestimmte
Artikel, sofern er unspezifisch gedeutet wird
und in passender syntaktischer Umgebung
steht, zu Skopusmehrdeutigkeiten Anla ge-
ben kann. Bei einem hinreichend komplexen
Satz wie (131) rechnen wir also mit mehr als
einer unspezifischen Lesart. Darber hin-
aus aber postulieren wir nun eine spezifische
Lesart (fortan ein
r
, fr referentiell). Unter
dieser ist das Indefinitum kein Quantor, son-
dern ein referentieller Ausdruck, und welches
Individuum sein Referent ist, variiert je nach
uerungssituation, genauer: je nachdem,
auf wen oder was sich der Sprecher zu bezie-
hen beabsichtigt.
(133) Ein Satz der Form [ein
r
] , drckt nur
in solchen uerungskontexten k eine
Proposition aus, wo sich der Sprecher
auf genau ein Individuum a zu beziehen
beabsichtigt und a an k ist.
Ist diese Bedingung erfllt, so drckt
[ein
r
] diejenige Proposition aus, die
an einem Index i wahr ist, wenn a an i
ist, und sonst falsch.
Ein
r
unter der Deutung (133) und ein
q
unter
der -Deutung (112) unterscheiden sich durch
mehrere semantische Eigenschaften, ber die
wir uns fr die Diskussion weiter unten klar
sein sollten. Ein Unterscheidungsmerkmal ist
22. Artikel und Definitheit 519
verbirgt, hier die Katze, die anwesend war.
Gegen den ersten Weg sprechen beim heutigen
Forschungsstand eine Reihe semantischer
und syntaktischer Grnde, aber der zweite ist,
jedenfalls fr dieses Beispiel, gut vertretbar
(s. Artikel 23).
Andererseits kann man das Argument von
der Prmisse (ii) her untergraben, indem man
nmlich zugesteht, da das Pronomen ein re-
ferentieller Ausdruck ist, aber zeigt, wie es
auch unter der Annahme einer -Lesart fr
den vorangehenden Satz zu seinem Referen-
ten kommen kann. Dabei rsonniert man
hnlich (Kripkeanisch), wie wir es weiter oben
in Bezug auf das propositionsaufnehmende
das skizziert haben. Angenommen, die Spre-
cherin macht eine bloe Existenzaussage,
nmlich da die Menge der anwesenden Kat-
zen nicht leer war. Es trifft sich nun aber
und der Hrer errt es auch richtig , da
sie zu dieser Aussage speziellere Information
ber eine bestimmte Katze veranlat hat. Das
allein mag gengen, um diese verantwortli-
che Katze in den Brennpunkt der Aufmerk-
samkeit zu rcken und damit fr pronominale
Referenz verfgbar zu machen. Und so
kommt das sie zu seinem Referenten, ohne
ihn von einem vorangehenden referentiellen
Ausdruck geerbt zu haben. Dieser Angriff auf
Prmisse (ii) hat gegenber den obengenann-
ten Strategien zur Umgehung von (i) den Vor-
teil, auch auf Beispiele wie den folgenden
Dialog anwendbar zu sein.
(137) A: Ein Junge ist vom Gelnder ge-
sprungen und hat sich das Genick ge-
brochen. B: Nein, er ist nicht ge-
sprungen, sondern er wurde herunter-
gestoen.
(Man beachte, da hier nicht mit einer E-
Type-Analyse gedient ist, da er ja nicht mit
der Junge, der vom Gelnder gesprungen ist
und sich das Genick gebrochen hat zu um-
schreiben ist.) Es ist natrlich auch gut mg-
lich, da man je nach Beispiel mal die eine,
mal die andere Prmisse entkrften kann.
2.2.4Skopusargumente
In 1.3.2 haben wir Stalnakers Versuch vor-
gestellt, mithilfe des Kriteriums der Disam-
biguierbarkeit zwischen einem referentiellen
Definitum und einem klassischen mit weite-
stem Skopus zu unterscheiden. Dieselbe Stra-
tegie ist in der Debatte um die spezifische
Lesart des Indefinitums benutzt worden, in
diesem Falle von Fodor & Sag (1982), deren
diesbezgliche Ausfhrungen allerdings we-
men Barbara glaubt flschlich, Franz habe
promoviert, und uert (135) aufgrund dieser
irrigen Annahme. Ohne ihr Wissen ist es nun
aber zufllig so, da ein anderer Student von
ihr, Fritz, wirklich promoviert hat. Wenn wir
hier ein gem (133) als ein
r
deuten und un-
terstellen, da sich Barbara mit ein Student
von mir auf Franz beziehen wollte, dann war
ihre uerung falsch. Deuten wir ein hinge-
gen als ein
q
, dann war ihre uerung wahr.
Das Urteil naiver Sprecher besttigt hier wohl
eher die letztere Deutung: Barbara hat sich
zwar geirrt, aber die Wahrheit gesprochen hat
sie trotzdem, auch wenn das reine Glckssa-
che war. Ceteris paribus ist dies ein Argument
gegen die Existenz der spezifischen Lesart.
Dem entgegen stehen aber Argumente fr
eine solche Lesart, insbesondere gewisse in-
direkte Argumente (hnlich denen, die wir bei
der Diskussion um die referentielle Lesart des
bestimmten Artikels kennengelernt haben),
und mit diesen mssen wir uns nun ausein-
andersetzen.
2.2.3Anaphora-Argumente
Wir haben schon oben (Abschnitt 1.3.2) dar-
auf hingewiesen, da das Argument mit dem
anaphorischen das in (132) auf etwas wack-
ligen Beinen steht, und wollen das hier nicht
noch einmal ausfhren. Betrachten wir statt
dessen kurz einen anderen Versuch, die Exi-
stenz der spezifischen Lesart aus Anaphora-
daten herzuleiten. Dies ist wohl das schlich-
teste und lteste Argument dieser Art, und es
bedient sich einfach der Tatsache, da ein
Indefinitum als Antezedens fr ein anapho-
risches Pronomen fungieren kann:
(136) Eine Katze war anwesend. Sie hielt eine
Ansprache.
Wenn hier das Antezedens eine Katze keinen
Referenten htte so argumentiert man
wie kme dann das Pronomen sie zum dem
seinigen? Also bentigt man eine Analyse wie
die spezifische, die im Gegensatz zur -Ana-
lyse dem Indefinitum einen Referenten zuer-
kennt.
Dieses Argument setzt voraus, da (i) das
Pronomen in (136) referentiell ist, und (ii) ein
referentielles anaphorisches Pronomen immer
den Referenten seines Antezedens bernimmt.
Prmisse (i) knnte man angreifen, indem
man dem Pronomen eine nicht-referentielle
Behandlung gibt: Entweder man analysiert es
als gebundene Variable, oder man erklrt es
als sogenanntes E-Type-Pronomen, hinter
dem sich ein komplexes klassisches Definitum
520 VII. Semantik der Funktionswrter
allgemeines Prinzip zu postulieren, etwa, da
eine in einem adverbialen Nebensatz enthal-
tene NP hchstens Skopus ber diesen Ne-
bensatz haben kann. (Oder vielleicht ein all-
gemeineres oder auch ein spezielleres Prinzip
dieser Art; darauf kommt es hier nicht so an.)
Aus einem solchen Prinzip ergibt sich nun
auch fr Satz (139), der ja im wesentlich die-
selbe Struktur wie (138) aufweist, eine Vor-
aussage, nmlich, da die indefinite NP einen
unscheinbaren Mann, der auf der Strae Flug-
bltter verteilte in ihrem Skopus auf den wenn-
Satz beschrnkt ist. Angenommen nun, wir
vertreten eine unzweideutige -Analyse aller
Indefinita. Dann luft diese Voraussage dar-
auf hinaus, da (139) in der Bedeutung von
(142) gelesen werden kann, aber nicht in der
von (143). (F = unscheinbarer Mann, der auf
der Strae Flugbltter verteilt, G(x) = wir
hren auf x, p = es kommt alles anders.)
(142) [x[F(x) & G(x)]] p
(143) x[F(x) & [G(x) p]]
Nun reprsentiert (142) in der Tat eine mg-
liche Lesart von (139), wenn auch nicht die,
an die man zuerst denkt. (142) wrde wohl
eher nahegelegt, wenn man das ein durch ir-
gendein ersetzte oder die Formulierung in
(144) whlte.
(144) Wenn damals ein unscheinbarer Mann
auf der Strae Flugbltter verteilt htte
und wir auf ihn gehrt htten, ...
So weit so gut. Interessant wird es nun aber
bei (143). Diese Formel besagt, da es da
einen unscheinbaren, flugbltterverteilenden
Mann gab, auf den zu hren dramatische
Folgen gehabt htte whrend es aber wo-
mglich neben diesem einen noch viele andere
ebenfalls unscheinbare, flugbltterverteilende
Mnner gab oder htte geben knnen, bei
denen es keine besonderen Auswirkungen ge-
habt htte, ob wir auf sie gehrt htten oder
nicht. Tatschlich sind wir spontan geneigt,
(139) in eben diesem zweiten Sinne zu verste-
hen, whrend dies doch gerade die Lesart ist,
die unser Prinzip verbietet.
Was schlieen wir an dieser Stelle? Ent-
weder das Prinzip ist falsch und mu durch
ein anderes ersetzt werden, das (138) und
(139) nicht mehr ber einen Kamm schert.
Vielleicht verhlt sich jeder anders als ein,
oder eine kurze NP anders als eine lange, oder
es liegt am Relativsatz? Oder aber die
Lesart, die wir an (139) wahrnehmen, ist eben
gar nicht die in (143) symbolisierte mit weitem
Existenzquantor, sondern vielmehr eine spe-
zifische Lesart. Mit dem gerade skizzierten
sentlich expliziter und detaillierter als die von
Stalnaker sind.
Wir erinnern zunchst noch einmal an zwei
Tatsachen: erstens, da der Skopus eines spe-
zifischen Indefinitums nicht bedeutungsrele-
vant ist; und zweitens, da eine unspezifische
Lesart mit weitestem Skopus oft nicht von
einer spezifischen zu unterscheiden ist. Folg-
lich mssen Vertreter der Hypothese, da der
unbestimmte Artikel eine spezifische Lesart
hat, irgendwie die Gegenthese entkrften, da
alle angeblich spezifischen Vorkommnisse von
ein in Wirklichkeit unspezifische mit weite-
stem Skopus sind. Dabei hilft die Existenz
syntaktischer Skopusbarrieren: Weitester
Skopus sollte in gewissen syntaktischen Kon-
struktionen unmglich oder stark markiert
sein, whrend eine spezifische Lesart unab-
hngig von der strukturellen Umgebung stets
verfgbar sein sollte.
Fodor & Sag betrachten unter diesem Ge-
sichtspunkt u. a. Beispielpaare wie das fol-
gende:
(138) Wenn ich auf jeden Einwand einginge,
wrde ich niemals fertig.
(139) Wenn wir damals auf einen unschein-
baren Mann, der auf der Strae Flug-
bltter verteilte, gehrt htten, wre al-
les anders gekommen.
(138) enthlt an skopustragenden Elementen
mindestens den Universalquantor jeden Ein-
wand und die kontrafaktische Konditional-
verknpfung. Man mte also a priori mit
mindestens zwei Lesarten rechnen, je nach-
dem welches der beiden im Skopus des an-
deren steht. (In den folgenden Formalisierun-
gen symbolisieren wir das kontrafaktische
wenn-dann mit und krzen Prdikate und
Stze ab: E = Einwand, G(x) = ich gehe auf
x ein, p = ich werde niemals fertig.)
(140) [x[E(x) G(x)]] p
(141) x[E(x) [G(x) p]]
Aus (141) lt sich fr jeden einzelnen Ein-
wand schlieen, da ich, wenn ich auf diesen
eingehe, nicht fertigwerde; es luft also darauf
hinaus, da ich auf gar keinen Einwand ein-
gehen darf, wenn ich fertigwerden will. Dies
scheint aber keine Lesart des deutschen Satzes
(138) zu sein. Vielmehr besagt dieser, was
(140) symbolisiert, nmlich, da ausnahms-
loses Eingehen auf alle Einwnde mein Fer-
tigwerden verhindern wrde, wobei es durch-
aus keinen einzelnen Einwand geben mu,
dessen Bercksichtigung allein diese Folge
htte. Nach Betrachtung weiterer hnlicher
Beispiele mag man nun dazu kommen, ein
22. Artikel und Definitheit 521
Meier gehrt htte, und die andere, wenn sie
auf Huber gehrt htte. Eine solche Lesart
ist jedoch fr den deutschen Satz (145), wenn
berhaupt, nur mit groer Mhe erhltlich.
Der Witz dieser Beobachtung ist folgender:
Wenn man nur -Lesarten anerkennt, nimmt
sich die Abwesenheit von Lesart (147) myste-
ris aus. Man mu sich da eine recht seltsame
Sorte von skopusbeschrnkenden Prinzipien
vorstellen, die dem Indefinitum zwar erlau-
ben, aus dem wenn-Satzauszubrechen, aber
nur unter der Auflage, da es dann auch
gleich ganz nach oben springt. Auch dies ist
zwar beim heutigen Forschungsstand nicht
mit Gewiheit auszuschlieen, aber es ver-
trgt sich prima facie schlecht mit vernnfti-
gen Arbeitshypothesen (s. Artikel 7). Ande-
rerseits pat Verfechtern der spezifischen Les-
art das Fehlen der mittleren Skopuskonstel-
lation (147) ganz hervorragend ins Konzept.
Fr diese gibt es ja auch die Lesart in (148)
nicht, so da das Fehlen von (147) nur wieder
das ursprngliche einfache Prinzip besttigt,
nach dem der wenn-Satzder maximale Sko-
pus aller darin enthaltenen NPs ist. Die ein-
zige zulssige unspezifische Lesart ist somit
(146), und daneben gibt es dann noch eine
spezifische aber natrlich nur eine, und
nicht zwei, denn spezifische Lesarten lassen
sich ja aus prinzipiellen Grnden nicht durch
Skopusvariation vermehren. Die eine, die es
gibt, ist wie blich leicht mit einem Existenz-
satz zu verwechseln, also mit (148).
Auch dieses Argument ist aber nicht un-
widersprochen geblieben. Die Daten, auf die
sich Fodor & Sag hier sttzen, sind subtil und
wenn gewisse Kritiker recht haben viel-
leicht gar nicht reprsentativ; zu diesem
Punkt verweisen wir auf die einschlgige Lite-
ratur. Gesetzt den Fall, da sich solche Be-
denken ausrumen lassen, dann bleibt immer
noch vieles an der spezifischen Lesart sehr
geheimnisvoll. Warum z. B. bedarf es eines so
wort- und inhaltsreichen Indefinitums wie in
(139) und (145), um der spezifischen Lesart
auf die Sprnge zu helfen? Das folgt gewi
nicht sofort aus der direkt referentiellen Ana-
lyse, die Fodor & Sag vorgeschlagen haben.
Diese Sorge hat wiederum der Vertreter einer
reinen -Analyse nicht. Dafr plagt ihn wie
gesagt die Aufgabe, eine Theorie der Skopus-
beschrnkungen zu erfinden, die mit dem
Fehlen der mittleren Lesart in (147) ver-
trglich ist. Was am Ende schwieriger ist, wird
sich erst noch herausstellen. Einstweilen ist
jedenfalls nicht verwunderlich, da das se-
mantische Lager geteilt bleibt: Die einen glau-
intuitiven Verstndnis von (139) ist diese Ana-
lyse genauso vertrglich, und darber hinaus
erlaubt sie uns, das skopusbeschrnkende
Prinzip fr NPs aller Art ohne Qualifikatio-
nen aufrechtzuerhalten. Denn wie oben be-
merkt macht der Skopus eines spezifischen
Indefinitums ja sowieso keinen Unterschied,
mu also insbesondere nicht weiter als der
wenn-Satzsein, um die in Rede stehende Les-
art hervorzubringen. Kurzum, hier haben wir
ein Argument fr die Existenz einer eigen-
stndigen spezifischen Lesart.
Dieses Argument ist natrlich nicht unan-
greifbar: ber skopusbeschrnkende Prinzi-
pien wie das oben verwendete ist beim heu-
tigen Forschungsstand nicht viel bekannt,
und wir drfen uns nicht allzu sicher sein,
da man nicht vielleicht aus unabhngigen
Grnden bei der Skopuszuweisung auf syn-
taktische, lexikalische oder stilistische Fak-
toren Rcksicht nehmen mu, in denen sich
etwa (138) und (139) unterscheiden. Wer hier
skeptisch verbleibt, den hoffen Fodor & Sag
aber doch noch durch die folgende raffinier-
tere Variante des Beispiels zu bekehren.
(145) Wenn er damals auf einen unschein-
baren Mann, der auf der Strae Flug-
bltter verteilte, gehrt htte, wre je-
der heute dankbar.
Wir beschrnken uns auf Lesarten, wo das er
durch das jeder gebunden ist, wodurch schon
einmal festliegt, da letzteres weiteren Skopus
als erhlt. Welche Lesarten sind nun unter
einer reinen -Analyse des Indefinitums zu
erwarten? Abgesehen von eventuellen skopus-
beschrnkenden Prinzipien, die folgenden
drei. (G(x,y) = x hrt auf y, D(x) = x ist
heute dankbar.)
(146) x[y[F(y) & G(x,y)] D(x)]
(147) xy[F(y) & [G(x,y) D(x)]]
(148) y[F(y) & x[G(x,y) D(x)]]
Wiederum ist es (148), mit weitestem 3, das
unter diesen Alternativen am besten dem na-
trliche Verstndnis von (145) entspricht.
(146), mit engstem 3, ergibt wie oben eine
sekundre aber mgliche Lesart, nach der
heute jeder dankbar wre, wenn er damals
auf irgendeinen unscheinbaren Flugblattver-
teiler gehrt htte. Aber wie steht es mit (147),
wo 3 mittleren Skopus innerhalb von V aber
auerhalb von hat? Diese Formel besagt
in etwa, da es fr jeden einen unscheinbaren
Flugblattverteiler gibt, auf den er htte hren
sollen. Das knnte also zum Beispiel eine
Sachlage beschreiben, wo die Hlfte der Be-
vlkerung heute dankbar wre, wenn sie auf
522 VII. Semantik der Funktionswrter
sie erscheint nun in einem anderen Lichte,
nmlich als Generalisierung ber die Kom-
binierbarkeit von Numeralia und Substanti-
ven. Hier gelten offenbar zwei Beschrnkun-
gen: erstens ist kein Numerale mit Stoffap-
pellativa vereinbar, und zweitens mu der Nu-
merus des Substantiv mit dem Numerale
kompatibel sein. Nheres zu diesen Beschrn-
kungen und ihrer Erklrung ist im Artikel 18
und der einschlgigen Literatur nachzulesen.
Wenn der eben skizzierte Ansatz richtig ist,
haben wir also in den ganzen vorausgegan-
genen Abschnitten nicht wirklich von ein ge-
handelt, sondern vielmehr von einem leeren
oder abwesenden Determinator, mit dem wir
es in Eine Katze schlft zu tun haben aber
nicht nur dort, sondern auch in Zwei Katzen
schlafen, (151), (152), usw. (Die Substanz des
dort Referierten bertrgt sich natrlich ohne
Schwierigkeiten.) Wie weit man mit der Ana-
lyse des ein als Numerale kommt, ist aber erst
noch zu prfen. Zu bedenken ist dabei auch,
da die oben vorausgesetzten Distributions-
daten sprachspezifisch sind. Im Bairischen
z. B. steht der unbestimmte Artikel auch vor
Stoffnamen; im Spanischen andererseits ist er
pluralisierbar. Und im Englischen erscheint er
unter gewissen Bedingungen zustzlich zu
Numerale und Plural (a ridiculous ten bottles).
Wo in der Grammatik derlei Variation zu
lokalisieren ist, bleibt vorderhand unklar, und
um so mehr, was daraus fr die Semantik
folgt.
2.3.2Generische Lesart
Die -Analyse reicht offenkundig nicht hin,
die augenflligste Lesart eines Beispiels wie
(153) vorauszusagen.
(153) Eine Katze ist gengsam.
(153) lt sich als Aussage ber Katzen im
allgemeinen verstehen und hat als solche deut-
lich andere Wahrheitsbedingungen als die von
(112) erfaten. Grob gesagt, erfordert die
Wahrheit von (153) unter dieser Lesart, da
nicht nur irgendeine, sondern vielmehr jede
normale Katze gengsam ist. Was aus der
Existenz solcher generischen Lesarten fr die
Semantik des unbestimmten Artikels folgt, ist
nicht ohne weiteres klar.
Manchmal wird geschlossen (oft ohne viel
berlegung), da hier eine Mehrdeutigkeit
eben dieses Wortes vorliegt, da es also neben
dem in (112) erfaten existenziellen ein noch
ein homophones, eben das generisene ein gibt.
Dieses wre dann durch eine separate Bedeu-
tungsregel zu deuten. Ein konkreter Vor-
schlag dazu findet sich z. B. bei Carlson
ben an eine eigenstndige spezifische Lesart,
die anderen halten es nach wie vor mit einer
reinen -Analyse.
2.3Sonstiges
2.3.1Zur Distribution
Im Gegensatz zum bestimmten Artikel
kommt der unbestimmte nur vor zhlbaren
Singularappellativa vor, d. h. nicht vor Plu-
ralia oder Stoffnamen. Dabei scheint fr diese
Beschrnkung aber eigentlich kein semanti-
scher Grund zu bestehen. Setzen wir die in
1.5.1 angenommenen Deutungen fr Plural-
und Stoffappellativa voraus und kombinieren
damit die -Deutung fr ein in (112), so er-
geben sich fr (149) und (150) ganz vernnf-
tige Bedeutungen, nmlich die, die man in
grammatischem Hochdeutsch mit (151) bzw.
(152) ausdrckt.
(149) *Hier wohnen eine Vgel.
(150) *Uli hat ein Geld.
(151) Hier wohnen Vgel.
(152) Uli hat Geld.
Was folgt daraus fr die semantische Analyse
des unbestimmten Artikels? Das kommt dar-
auf an. Eine Mglichkeit ist, da wir hier ein
semantisch irrelevantes Faktum der morpho-
logischen Realisierung vor uns haben: Das
zugrundeliegende Morphem /ein/, dessen
Deutung durch (112) definiert ist, wird eben
je nach Umgebung durch die Allomorphe ein
und realisiert. Es gibt aber noch eine andere,
semantisch interessantere Mglichkeit:
Vielleicht geht die existenzquantifizierende
Kraft in Eine Katze schlft berhaupt nicht
zu Lasten des ein, sondern wird genau wie in
(151) und (152) durch den Nulldeterminator
bzw. das Fehlen eines Determinators ausge-
drckt. Das ein hingegen ist ein Numerale
und also solches vom semantischen Typ eines
Adjektivs, d. h. ein Funktor, der auf eine Ei-
genschaft angewandt wiederum eine Eigen-
schaft ergibt (s. Artikel 19). Zusammen mit
dem Substantiv Katze bildet dieses also das
Prdikat eine Katze, welches die Eigenschaft
ausdrckt, eine einzige Katze zu sein. (Analog
drckt etwa das Prdikat zwei Katzen die
Eigenschaft aus, ein Paar von Katzen zu sein.)
Wenn dieses Prdikat nun eine NP mit leerem
Determinator bildet, kommt die Existenz-
quantifikation hinzu und wir erhalten die ge-
wnschte bliche -Deutung fr die NP als
ganze. Unsere anfngliche Beobachtung ber
die Distribution des unbestimmten Artikels
ist damit zwar immer noch nicht erklrt, aber
22. Artikel und Definitheit 523
Die intendierte Interpretation fr das Quan-
tifikationsadverb ist dabei immer noch (158),
aber das linke Argument von mitunter
x
, d. h.
eine [wissenschaftliche Diskussion]
x
, ist nun
offenbar nicht mehr in blicher Manier zu
deuten. Vielmehr soll es, obwohl seiner syn-
taktischen Form nach eine NP, semantisch
ein Satz sein, und zwar quivalent zu dem,
was man blicherweise in der Prdikatenlogik
so notieren wrde: wissenschaftliche-Diskus-
sion(x). Heim erreicht dies mithilfe der Inter-
pretationsregel (160) und der Annahme, da
der unbestimmte Artikel eine hier semantisch
leer ist, also bei der Deutung von (159)
schlicht bergangen wird.
(160) Sei eine Appellativphrase, u eine Va-
riable. Dann ist
u
bei einer Belegung g
wahr gdw. g(u) in der Extension von
ist.
Diese Analyse erzwingt vorderhand die
Schlufolgerung, da der unbestimmte Arti-
kel in generischen Indefinita eine spezielle und
von seiner blichen -Lesart verschiedene In-
terpretation hat, nmlich als semantisch leeres
Element. Will man diese Ambiguitt vermei-
den, so gibt es zwei Mglichkeiten: Entweder
man verfolgt die Hypothese, da der unbe-
stimmte Artikel auch in den normalen exi-
stenziellen Lesarten nicht selbst fr die Exi-
stenzquantifikation verantwortlich ist, also
letztendes immer die Deutung hat, die wir fr
(159) gebraucht haben. Diesen Weg geht
Heim, und wir knnen ihn hier aus Platz-
grnden nicht weiterverfolgen (s. Artikel 10).
(Vgl. auch die aus anderen Grnden in die-
selbe Richtung zielenden Bemerkungen in
2.3.1.) Oder aber man versucht, den Indefi-
nita, die wie in (153), (155) und (156) den
Quantifikationsbereich von expliziten oder
impliziten Quantifikationsadverben be-
schrnken, doch noch eine existenzielle Be-
deutung zu verleihen. Ein erster Schritt dazu
wre vielleicht, die Adverbien ber etwas Ab-
strakteres wie etwa Flle oder Situationen
quantifizieren zu lassen. M. a. W., man knnte
(156) ungefhr so lesen: In manchen Situa-
tionen, in denen es eine wissenschaftliche Dis-
kussion gibt, endet diese in Trnen. In dieser
Paraphrase hat das Indefinitum wieder die
alte -Deutung. So eine Analyse ist aber bis
jetzt nicht ausgefhrt. Wir drfen also zusam-
menfassend schlieen, da generische Indefi-
nita den Rahmen der klassischen -Analyse
sprengen wobei abzuwarten bleibt, ob sie
damit alleinstehen, oder ob sie womglich nur
ein besonders transparentes Indiz dafr sind,
(1978); grob gesagt schafft das generische ein
dort einen Artnamen. D. h. eine Katze in (153)
bezeichnet die Spezies Katze, und von dieser
wird Gengsamkeit prdiziert, was wiederum
bedeutet, da typische Vertreter dieser Spezies
gengsam sind (vgl. 1.5.3 oben). Carlson
kann dann allerdings nur ad hoc verhindern,
da die so gebildeten Artnamen mit typischen
Artprdikaten wie verbreitet auftreten.
(154) *Ein Geisterkrebs ist an der ganzen
Golfkste verbreitet.
berzeugender ist deshalb die Auffassung,
da der generische Sinn in Stzen wie (153)
nicht vom Artikel beigesteuert wird, sondern
von einem oberflchlich unrealisierten Quan-
tifikationsadverb, analog zu im allgemeinen in
(155) oder mitunter in (156).
(155) Eine Katze ist im allgemeinen geng-
sam.
(156) Eine wissenschaftliche Diskussion en-
det mitunter in Trnen.
Bei der Przisierung dieses Ansatzes stellen
sich zwei Fragen: erstens, worber das Quan-
tifikationsadverb quantifiziert, und zweitens,
was die indefinite NP zur Gesamtbedeutung
beitrgt. Hinsichtlich der ersten Frage schlgt
Lewis (1975) vor, da im allgemeinen in (155)
ber Katzen und mitunter in (156) ber wis-
senschaftliche Diskussionen quantifizieren.
Seine logische Form fr (156) sieht z. B. fol-
gendermaen aus, wobei die Interpretation
gem (158) erfolgt.
(157) mitunter
x
(x ist eine wissenschaftliche
Diskussion) (x endet in Trnen)
(158) mitunter
u
()() ist wahr bei einer Be-
legung g gdw. fr manche a, fr die
bei g
a
/
u
wahr ist, auch bei g
a
/
u
wahr
ist.
In (157) wre eine wissenschaftliche Diskus-
sion offenbar ganz normal im Sinne der klas-
sischen -Analyse zu deuten (jedenfalls wenn
man die Kopula als Identitt und das Prdi-
katsnomen als normale NP deutet, vgl. etwa
Montague 1974). Bei Lewis wird allerdings
nicht ganz klar, wie logische Formen wie (157)
systematisch zur syntaktischen Struktur von
Stzen wie (156) in Beziehung zu setzen w-
ren. Wo kommt z. B. die Kopula ist in (157)
her? Diesen Punkt problematisiert Heim
(1982) und schlgt anstelle von (157) eine
etwas einfachere und syntaxnhere logische
Form vor:
(159) mitunter
x
(eine [wissenschaftliche Dis-
kussion]
x
) (x endet in Trnen)
524 VII. Semantik der Funktionswrter
tisch. (Allerdings kann man hier vielleicht ar-
gumentieren, da es sich um eine andere Kon-
struktion handelt, was insofern plausibel ist,
als von hier ins Englische mit out of bersetzt
wird, statt mit of wie in den echten Partitiven.)
Zweitens ist die Definitheitsbeschrnkung of-
fenbar nicht die einzige Beschrnkung, der
Partitivkonstruktionen unterliegen. Vielmehr
gilt zustzlich, da die innere NP eine Gruppe
bezeichnen mu. Dies ist z. B. in *einer des
Hundes verletzt. Definitheit der inneren NP
ist also bestenfalls eine notwendige, doch
keine hinreichende Bedingung fr einen ak-
zeptablen Partitiv.
Wie dem auch sei, wir nehmen hier einmal
an, da ein Definitheitsbegriff, der gerade die
eingangs aufgelisteten NPs zusammenfat
also Personal- und Demonstrativpronomina,
Eigennamen und NPs mit bestimmtem Arti-
kel oder Demonstrativdeterminator , zur
Beschreibung und Erklrung der Partitivbe-
schrnkung oder anderer linguistischer Ge-
neralisierungen von Nutzen ist. In diesem
Falle stellt sich die Frage, ob die NPs in dieser
Gruppe eine natrliche semantische Klasse
bilden, und wenn ja, was ihren Bedeutungen
gemeinsam ist und sie gegenber den Bedeu-
tungen anderer NPs auszeichnet. Wenn wir
die Liste durchgehen, finden wir darin (i) di-
rekt referentielle Ausdrcke (Eigennamen,
Demonstrativ-NPs, gewisse Personalprono-
mina, mglicherweise gewisse das-NPs), (ii)
gebundene Variablen (Personalpronomina,
gewisse Demonstrativ-NPs) und (iii) NPs mit
der klassischen Russell- oder Fregesemantik
(das-NPs). Was verbindet diese drei Gruppen?
Ganz schlampig ausgedrckt, da ihre Exten-
sionen Individuen sind, und nicht, wie bei den
brigen NPs, Mengen von Mengen. Dies wol-
len wir nun przisieren.
Dazu brauchen wir erst ein bichen for-
males Rstzeug, das wir uns aus den Artikeln
9, 19 und 21 zusammenklauben. Gegeben
seien die Menge W aller mglichen Welten,
die Menge T aller Zeiten und die Menge E
aller mglichen Individuen. Letztere enthalte
neben Einzeldingen auch Gruppen. Unter
einer Interpretation fr eine Sprache verstehen
wir eine Funktion , die jedem Ausdruck a
dieser Sprache einen Charakter zuordnet.
ist induktiv ber den syntaktischen Auf-
bau der Ausdrcke definiert: Ein Lexikon be-
stimmt fr alle Wrter a, und Komposi-
tionsregeln bestimmen fr Phrasen a in
Abhngigkeit von deren Struktur und den
Charakteren ihrer Teilausdrcke. Ein Cha-
rakter ist eine Funktion, deren Argumente
Paare k, g aus einem uierungskontext k
da der Zusammenhang zwischen unbe-
stimmtem Artikel und Existenzquantifikation
grundstzlich nicht so eng ist, wie wir uns das
seit Russell vorzustellen gewohnt sind.
3. Definitheit in NP-Klassifikationen
3.1Definita im engeren Sinne
Personal- und Demonstrativpronomina, Ei-
gennamen und NPs mit bestimmtem Artikel
oder Demonstrativdeterminator werden oft
als definite NPs zusammengefat. Dies ge-
schieht zuweilen einfach aufgrund einer in-
tuitiv empfundenen semantischen Verwandt-
schaft zwischen diesen NP-Typen, oft aber
auch, um syntaktische Generalisierungen zu
formulieren, bezglich derer sich alle diese
NPs gleich verhalten.
In der generativen Grammatik ist das be-
kannteste Beispiel dieser Art die sogenannte
Partitivbeschrnkung. Diese ist durch die fol-
genden Daten motiviert und besagt, da die
innere NP in partitiven NPs definit sein mu.
(161)
drei von uns ?drei von vielen Lffeln
viele dieser Katzen *viele junger Katzen
wenige von euch
Deppen
?wenige von hundert
Bohnen
jedes von den elf
Kindern
?jedes von einigen Kin-
dern
die meisten der
Huser
?die meisten von weni-
gen Erfolgen
keiner der Bud-
denbrooks
*keiner von lauter Lf-
feln
*eines von fast allen
Schafen
*drei der meisten Vor-
schlge
Partitive NPs setzen sich aus einem Quantor
und einer Genitiv-NP oder von-PP zusam-
men. Mit innerer NP meinen wir die NP
im Genitiv oder nach von, in den obigen Bei-
spielen jeweils hervorgehoben. In der linken
Spalte handelt es sich hier durchweg um Ver-
treter der definiten Gruppe, rechts dagegen
sind es NPs auerhalb dieser Gruppe. (Der
bestimmte Artikel in die meisten zhlt nicht;
er ist offenbar idiomatisch und keine seman-
tische Einheit.) Wir wollen uns aber davor
hten, diesen Distributionstest als definieren-
des Kriterium fr Definitheit zu nehmen. Er-
stens ist nmlich gar nicht so klar, ob das
Verbot nicht-definiter innerer NPs wirklich
ausnahmslos gilt, denn sieben von zehn Fa-
milien und dergleichen sind vllig gramma-
22. Artikel und Definitheit 525
Zum Beispiel ergibt sich also:
(165) Fr beliebige k, g und i:
[
NP
[
DET
kein] [
CNP
]]
k,g,i
ist genau dann
definiert, wenn [
CNP
]
k,g,i
definiert ist.
In diesem Falle gilt:
[
NP
[
DET
kein] [
CNP
]]
k,g,i
=
{X (E): [
CNP
]
k,g,i
X = }.
Was wir bis hierher gesagt haben, wider-
spricht erst einmal der oben angekndigten
Idee: Wir haben uns soeben entschieden, allen
NPs Mengen von Mengen zuzuordnen, und
nicht etwa nur denen, die nicht definit sind.
Selbst Eigennamen oder Pronomina unter-
scheiden sich in dieser Hinsicht also nicht von
den Paradefllen quantifizierender NPs. Man
vergleiche (165) mit (166)(168).
(166) Fr beliebige k, g und i:
[
NP
Afrika]
k,g,i
=
{X (E): Afrika X}.
(167) Fr beliebige k, g und i:
[
NP
er
7
]
k,g,i
= {X (E): g(7) X}.
(168) Fr beliebige w,t,s WxTxE, g und i:
[
NP
dieses]
w,t,s,g,i
ist genau dann de-
finiert, wenn s in w zu t auf genau ein
Individuum a zeigt. In diesem Falle gilt:
[
NP
dieses]
w,t,s,g,i
=
{X (E): a X}.
Dennoch steckt hinter der Behauptung, da
definite NPs Individuuen bezeichnen, eine
richtige Intuition: die definiten NPs htten
wir nmlich genausogut als echte Individuen-
terme deuten knnen, whrend das bei nicht-
definiten NPs prinzipiell nicht gegangen wre.
Wir erklren gleich, was damit gemeint ist.
Mit Individuenterm (IT) meinen wir einen
Ausdruck a, dessen Extension
k,g,i
(fr be-
liebige k, g und i) stets ein Individuum, also
ein Element von E ist. Individuenterme lassen
sich mit VPs zu Stzen verbinden, die nach
folgender Kompositionsregel gedeutet wer-
den:
(169) Fr beliebige Kontexte k, Belegungen
g und Auswertungsindizes i:
[s [
IT
] [
VP
]]
k,g,i
ist definiert gdw.
sowohl [
IT
]
k,g,i
als auch [
VP
]
k,g,i
definiert sind. In diesem Falle gilt:
[
S
[
IT
] [
VP
]]
k,g,i
= 1 gdw.
[
IT
]
k,g,i
[
VP
]
k,g,i
Nun knnen wir przisieren, was es heit,
da eine NP genausogut als IT gedeutet
werden knnte:
und einer Variablenbelegung g, und deren
Werte Intensionen sind. Unter einem ue-
rungskontext stellen wir uns konkretheitshal-
ber ein Tripel in WxTxE vor (intuitiv ue-
rungswelt, uerungszeit und Sprecher). Eine
Intension schlielich ist eine Funktion, die
Auswertungsindizes i auf Extensionen abbil-
det, wobei wir uns unter einem Auswertungs-
index wie bisher ein Paar in WxT (Auswer-
tungswelt und -zeit) vorstellen wollen. Was
eine Extension ist, hngt von der syntakti-
schen Kategorie des zu interpretierenden Aus-
drucks ab, dazu gleich Nheres. Sowohl Cha-
raktere als auch Intensionen sind im allge-
meinen partielle Funktionen. Die Intension
(k, g) mu also nicht fr beliebige k und
g definiert sein, und selbst fr solche k, g, wo
sie es ist, mu nicht fr beliebige i auch eine
Extension (k, g) (i) definiert sein. (Statt
(k, g) (i) bedienen wir uns fortan der
einfacheren Schreibweise
k,g,i
.)
Wenn a von der syntaktischen Kategorie
Satz ist, ist seine Extension
k,g,i
ein Wahr-
heitswert, d. h. 1 oder 0; ist dagegen eine
VP oder CNP (Appellativphrase), so ist
k,g,i
eine Teilmenge von E. Was die Inter-
pretation von NPs anbelangt, so nehmen wir
an, da ihre Extensionen Mengen von Men-
gen von Individuen sind, also Elemente von
((E)). Damit einher geht die folgende
Kompositionsregel fr Stze der Form [NP
VP].
(162) Fr beliebige Kontexte k, Belegungen
g und Auswertungsindizes i:
[
S
[
NP
] [
VP
]]
k,g,i
ist definiert gdw.
sowohl [
NP
]
k,g,i
als auch [
VP
]
k,g,i
definiert sind. In diesem Falle gilt:
[
S
[
NP
] [
VP
]]
k,g,i
= 1 gdw.
[
VP
]
k,g,i
[
NP
]
k,g,i
Komplexe NPs haben die Struktur [DET
CNP]. Extensionen fr Determinatoren sind
Funktionen mit Argumenten in (E) und
Werten in ((E)). Zum Beispiel:
(163) Fr beliebige k, g und i, beliebige X
(E):
[
DET
kein]
k,g,i
(X) =
{Y (E): X Y = }.
Die zugehrige Kompositionsregel ist (164).
(164) Fr beliebige Kontexte k, Belegungen
g und Auswertungsindizes i:
[
NP
[
DET
] [
CNP
]]
k,g,i
ist definiert gdw.
sowohl [
DET
]
k,g,i
als auch [
CNP
]
k,g,i
definiert sind und letzteres im Argu-
mentbereich des ersteren ist. In diesem
Falle gilt:
[
NP
[
DET
] [
CNP
]]
k,g,i
=
[
DET
]
k,g,i
([
CNP
]
k,g,i
).
526 VII. Semantik der Funktionswrter
raldefinita Link (1987d) folgen (siehe 1.5.1
oben) und uns deshalb eine etwas striktere
Version der Definitheitsdefinition erlauben
knnen. Aus Platzgrnden knnen wir nun
nicht zeigen, da diese Definition tatschlich
die intuitiv gewnschte Einteilung vornimmt.
Die entsprechenden Theoreme und (durchweg
elementaren) Beweise sind in der Fachlitera-
tur nachzuschlagen. Wir beschrnken uns hier
auf Bemerkungen speziell zu den bestimmten
und unbestimmten Artikeln.
Ein Narr unter der -Deutung von ein ist
nicht definit. Wir unterstellen dabei, da die
-Deutung im hier gewhlten formalen Rah-
men folgende Form annimmt:
(174) Fr beliebige k, g und i, beliebige X
(E):
ein
k,g,i
(X) = {Y (E): X Y }.
(Beweisidee: Nimm an, ein Narr wre definit,
und betrachte einen Auswertungsindex, an
dem es zwei Narren gibt.) Bemerkenswert ist,
da dagegen das referentielle ein
r
von Fodor
& Sag (siehe (133), Abschnitt 2.2.2) im Sinne
der Definition (173) definite NPs bildet.
Nun zum bestimmten Artikel. Hier stellt
sich heraus, da es auf die genaue Deutung
ankommt. Unter einer direkt referentiellen
Deutung wie (6) (Abschnitt 1.1.2) sind das-
NPs natrlich definit. Interessanter wird es
bei den klassischen Deutungen. Es stellt sich
heraus, da das-NPs unter der Fregeschen
Deutung definit sind, nicht aber unter der
Russellschen. Wir gehen hier von folgenden
Versionen der beiden Deutungen aus:
(175) Russellschesdas:
Fr beliebige k, g und i, beliebige X
(E):
das
k,g,i
(X) =
{Y (E) : X Y und X = 1}.
(176) Fregesches das:
Fr beliebige k, g und i, beliebige X
(E):
X ist genau dann im Bereich von
das
k,g,i
, wenn X = 1. Ist dies der
Fall, so gilt:
das
k,g,i
(X) = {Y (E) : X Y }.
Beim Beweis der Definitheit von Fregeschen
das-NPs wird ausgentzt, da immer wenn
das
k,g,i
definiert ist,
k,g,i
ein einziges Ele-
ment hat. Dieses ist dann das gesuchte a
k,g,i
.
Russellsche das-NPs scheitern dagegen an
unserer Definitheitsdefinition. (Beweisidee:
Nimm an, der Narr wre definit und betrachte
einen Auswertungsindex, an dem es keine
Narren gibt.) Dieses Resultat ist unter Um-
stnden problematisch. Dann nmlich, wenn
(170) Definition:
Die NP ist unter der Interpretation
reduzierbar auf den IT gdw. fr
beliebige Kontexte k, Belegungen g,
Auswertungsindizes i und VPs gilt:
Entweder sind sowohl
[
S
[
NP
] [
VP
]]
k,g,i
als auch
[
S
[
IT
] [
VP
]]
k,g,i
undefiniert, oder
[
S
[
NP
] [
VP
]] = [
S
[
IT
] [
VP
]]
k,g,i
.
Z. B. ist die in (166) oben gedeutete NP Afrika
reduzierbar auf den folgendermaen definier-
ten IT Afrika
*
:
(171) Fr beliebige k, g und i:
[
IT
Afrika
*
]
k,g,i
= Afrika
Dies lt sich unter Zuhilfenahme von (162)
und (169) leicht beweisen. Dagegen ist es nicht
mglich, einen IT einzufhren, auf den etwa
die NP kein Narr reduzierbar wre.
Beweis: Angenommen, wre ein solcher
IT. Whlen wir nun k und g beliebig, und w
und t so, da in w zu t nichts lacht. Hiermit
gilt lacht
k,gw,t
= . Wegen (162) und (165)
impliziert das, da kein Narr lacht
k,g,w,t
=
1. Gem Annahme und Definition (170) ist
also auch lacht
k,g,w,t
= 1. Daraus folgt
wegen (169), da
k,g,w,t
, eine mengen-
theoretische Unmglichkeit. QED.
Entsprechende berlegungen fr andere
Beispiel-NPs legen nahe, da sich mit dem
Kriterium der Reduzierbarkeit auf einen In-
dividuenterm genau die oben durch Aufzh-
lung umrissene Klasse der definiten NPs aus-
sondern lt. Wir gelangen also zu folgender
Definition.
(172) Eine NP ist definit unter der Inter-
pretation gdw. sich ein IT
*
defi-
nieren lt, auf den unter redu-
zierbar ist.
Denselben Gedanken knnen wir ohne Um-
weg ber Definition (170) auch so formulie-
ren:
(173) Eine NP ist definit unter der Inter-
pretation gdw. die folgende Bedin-
gung erfllt ist:
Fr jeden uerungskontext k, jede
Belegung g und jeden Auswertungsin-
dex i: Wenn
k,g,i
berhaupt definiert
ist, dann gibt es ein Individuum a
k,g,i
E, so da fr alle Mengen X (E)
gilt: X
k,g,i
gdw. a
k,g,i
X.
Verwandte Vorschlge finden sich in der Lite-
ratur, z. B. bei Barwise & Cooper (1981), wo-
bei wir allerdings in der Behandlung der Plu-
22. Artikel und Definitheit 527
nun komplizierter. Es ist nicht auf Anhieb
klar, ob wir alle Narren wie die Narren oder
wie jeder Narr deuten sollen oder noch ein
bichen anders, z. B. so, da es weder die
Existenz von Narren prsupponiert noch in-
hrent distributiv ist. Die verschiedenen Mg-
lichkeiten fhren zu unterschiedlichen Vor-
aussagen hinsichtlich der Definitheit von alle
Narren. Wenn wir uns nach der Distribution
in Partitiven richten z. B. nur einer von
allen Narren scheint okay zu sein , sind wir
gezwungen, eine Existenzprsupposition ein-
zubauen. Der Vergleich mit dem Englischen
legt nahe, da das deutsche alle Narren even-
tuell ambig zwischen den Englischen ber-
setzungen all fools and all the fools ist. Hier
verbirgt sich ein komplexes Thema, das wir
nicht klren knnen, ohne tief in die Plural-
problematik einzudringen (s. Artikel 19).
Zuletzt noch ein Hinweis auf ein techni-
sches Problem. In gewissen pathologischen
Fllen macht die Definition (173) intuitiv ver-
kehrte Voraussagen. Betrachten wir z. B. die
NP ein Punkt im runden Viereck. Die CNP
Punkt im runden Viereck ist hier so gewhlt,
da sie niemals eine Extension hat, egal wie
k, g und i gewhlt sind. Daran schuld ist
natrlich die darin als Konstituente vorkom-
mende NP das runde Viereck, die niemals eine
Extension hat, weil die CNP runde Viereck
bei allen k, g, i die leere Menge bezeichnet
und diese laut (176) nicht im Argumentbe-
reich von das
k,g,i
ist. (Wir setzen hier die
Fregesche Deutung voraus.) Da nun aber die
CNP Punkt im runden Viereck nie eine Exten-
sion hat, geht es laut Regel (164) auch der
NP ein Punkt im runden Viereck so. Dies fhrt
aber leider dazu, da diese NP trivial die
Bedingung in der Definition (173) erfllt und
damit als definit eingestuft wird. Dieses Pro-
blem wird blicherweise dadurch umgangen,
da man Definitheit primr als Eigenschaft
von Determinatoren statt von NPs definiert.
Man mu dann allerdings fr NPs, die prima
facie nicht von der Form [DET CNP] sind,
entweder eine separate Definition machen
oder ihnen doch irgendwie diese Form geben.
Nheres entnehme man bitte der einschlgi-
gen Literatur.
3.2Starke und schwache NPs
In der Syntaxliteratur wird Definitheit oft in
einem weiteren Sinne verstanden, in dem
neben den im letzten Abschnitt charakteri-
sierten NPs auch z. B. allquantifizierte NPs
und solche mit die meisten als definit zhlen.
Das Paradebeispiel hierfr ist die sogenannte
sich einerseits doch noch die Russellsche Deu-
tung des bestimmten Artikels als die richtige
herausstellt, andererseits aber in der seman-
tischen Theorie natrlicher Sprachen ein De-
finitheitsbegriff bentigt wird, der das-NPs
mit den unter (173) fallenden NPs zusam-
mengruppiert. In diesem Falle mte man
sich eine passend abgeschwchte Definition
einfallen lassen. Wir verfolgen dies hier nicht
weiter.
Eine knappe Bemerkung wert ist der Un-
terschied zwischen die Narren, alle Narren
und jeder Narr. Die Narren ist unter der ver-
allgemeinerten Fregeschen Deutung definit
(vgl. 1.5.1).
(177) Verallgemeinertes Fregesches das:
Fr beliebige k, g und i, beliebige X
(E):
X ist genau dann im Bereich von
das
k,g,i
, wenn X ein maximales Ele-
ment x hat. Ist dies der Fall, so gilt:
das
k,g,i
(X) = {Y (E) : x Y}.
Beim Beweis der Definitheit von die Narren
ist das gesuchte a
k,g,i
jeweils die Gruppe, die
alle Narren am Index i einschliet; wo die
Narren
k,g,i
berhaupt definiert ist, ist dies
immer mindestens ein Paar von zwei Narren.
Fr jedes geht die Standarddeutung so:
(178) Fr beliebige k, g und i, beliebige X
(E):
jedes
k,g,i
(X) = {Y (E): X Y}.
Diese Deutung verhindert sozusagen doppelt,
da jeder Narr definit ist. Einerseits knnen
wir den Beweis dadurch fhren, da wir einen
Index betrachten, wo es keine Narren gibt.
Andererseits knnen wir ausntzen, da es
an gewissen Indizes zwei oder mehr Narren
gibt. Es ist zu beachten (im Gegensatz etwa
zur Definitheitsdefinition von Barwise &
Cooper 1981), da uns die zweite Beweisstra-
tegie auch dann noch zu Gebote stnde, wenn
wir wie gelegentlich vorgeschlagen eine
Prsupposition in die Deutung von jedes ein-
bauten:
(179) Fr beliebige k, g und i, beliebige X
(E):
X ist genau dann im Bereich von
jedes
k,g,i
, wenn X 2.
Ist dies der Fall, so gilt:
jedes
k,g,i
(X) = {Y (E): X Y}.
Auch auf der Grundlage von (179) lt sich
noch zeigen, da jeder Narr nicht definit ist.
Der springende Punkt ist intuitiv, da jeder
Narr im Gegensatz zu die Narren inhrent
distributiv ist. Der Fall von alle Narren ist
528 VII. Semantik der Funktionswrter
(182) bzw. (185) heien stark, die in (181)
und (184) dagegen schwach. Definite NPs
sind in dieser Terminologie also eine echte
Teilmenge der starken NPs.
3.2.1Zwei Definitionen
Was haben nun die Bedeutungen aller schwa-
chen NPs im Gegensatz zu denen der starken
gemeinsam? Innerhalb eines technischen Rah-
mens wie dem im letzten Abschnitt einge-
fhrten haben diese Frage erstmals Barwise
& Cooper (1981) behandelt. Dort werden
gleich mehrere mgliche Charakterisierungen
der stark/schwach-Unterscheidung erwhnt,
insbesondere die folgenden beiden (hier leicht
abgewandelt):
(186) Ein Determinator ist schwach
1
unter
der Interpretation gdw. fr alle k,
g und i, wo
k,g,i
definiert ist, gilt:
Es gibt Mengen X, Y (E), so da
E
k,g,i
(X) und E
k,g,i
(Y).
(187) Ein Determinator ist schwach
2
unter
der Interpretation gdw. fr alle k,
g, i, X (E) und Y (E):
Entweder
k,g,i
(X) und
k,g,i
(E) sind
beide undefiniert, oder es gilt:
Y
k,g,i
(X) gdw. X Y
k,g,i
(E).
Beide Definitionen sind fr Determinatoren
statt fr NPs formuliert, lassen sich aber ein-
fach ergnzen:
(188) Eine NP ist unter der Interpretation
schwach
i
gdw. die Form
[
NP
[
DET
] [
CNP
]] hat und unter
schwach
i
ist. Andernfalls ist unter
stark
i
.
Diese Definitionen von Fall zu Fall auf Bei-
spiele anzuwenden, ist wiederum Routine-
sache und wird hier den Leser(inne)n ber-
lassen. Etwas weniger trivial ist es, die allge-
meinen mathematischen Beziehungen zwi-
schen den beiden Schwachheitsbegriffen und
anderen zentralen Begriffen der Quantoren-
theorie aufzuzeigen, insbesondere z. B. zu be-
weisen, da DETs, die definite NPs im Sinne
des letzten Abschnitts bilden, nicht schwach
sind. Dazu verweisen wir auf die Literatur (s.
Artikel 21). Wir begngen uns hier mit ein
paar Worten zu den intuitiven Ideen, die hin-
ter diesen Definitionen stecken.
(186) beruht auf der Beobachtung, da der
Informationswert eines Satzes der Form (189)
systematisch davon abhngt, ob man in die
Lcke eine schwache oder eine starke NP
einsetzt.
Definitheitsbeschrnkung fr Stze mit exple-
tivem there im Englischen. Grob gesagt sind
in der Umgebung (180) NPs aus der Liste
(181) zulssig, aber solche aus der Liste (182)
nicht.
(180) There will be ______ in the garden.
(181) a man, men, some men, no men, few
men, many men, three men, ...
(182) John, you, the man, the men, that man,
all men, every man, most men, ...
Die Generalisierung wird oft so formuliert,
da das postverbale Subjekt solcher Stze
nicht definit sein drfe. Dieses Beispiel hat
kein direktes Gegenstck im Deutschen (je-
denfalls scheint eine analoge Beschrnkung
weder fr deutsche Stze mit expletivem es
und satzinternem logischen Subjekt zu gelten,
noch fr es-gibt-Stze). Dieselbe oder doch
eine sehr hnliche Restriktion ist aber in Kon-
texten wie (183) wirksam (nach De Jong
1987).
(183) _____spter war er hier.
(184) eine Woche, Jahre, drei Monate, viele
Jahre, keinen Monat, wenige Tage, ...
(185) das ganze Jahr, 1987, die meisten Tage,
jedes Jahr, die nchsten zwei Minuten,
...
Die NPs in (184) knnen in (183) als Dauer-
angaben eingesetzt werden, die in (185) pas-
sen dagegen nicht. Die verbotene Liste (185)
scheint genau dieselben definiten NPs zu
enthalten wie (182) oben.
Es ist uns hier wiederum nicht mglich,
diese distributionellen Fakten genauer zu un-
tersuchen oder gar zu erklren. Wir beschrn-
ken uns auf die viel bescheidenere Frage, ob
die Mitglieder der obigen Listen jeweils eine
semantische Eigenschaft gemeinsam haben
und welche Eigenschaft dies gegebenenfalls
ist. Zu dieser Frage gibt es einige formalse-
mantische Arbeiten, deren Hauptresultate wir
gleich referieren. Welche Rolle diese Resultate
aber bei der Erklrung der angedeuteten Fak-
ten spielen zweifellos letztlich die interes-
santere Frage , das wird dabei ganz offen-
bleiben.
Wie schon erwhnt, betrifft das Definit-
heitsverbot in (180) und (183) eine umfas-
sendere Gruppe von NPs als unter die Defi-
nitheitsdefinition (173) des vorigen Abschnitts
fallen. (Jedes Jahr und die meisten Tage z. B.
erfllen (173) nicht.) Um Verwechslungen zu
vermeiden, hat Milsark (1977) deshalb eine
neue Terminologie eingefhrt, die wir hier
bernehmen wollen: Die NPs auf der Liste
22. Artikel und Definitheit 529
(192) Eine NP ist schwach
i
unter der Inter-
pretation gdw. fr alle k, g, wo
(k,g) definiert ist, gilt: Es gibt In-
dizes i
1
und i
2
, so da E
k,g,i
1 und
E
k,g,i
2.
Diese Definition hat allerdings den Nachteil,
da die Einstufung einer NP als schwach hier
auch von der Wahl der Appellativphrase be-
einflut ist. Z. B. ist es notwendig falsch, da
sich im Individuenbereich zwei runde Vier-
ecke befinden, und deshalb wre zwei runde
Vierecke nach (192) nicht schwach. Da diese
Voraussage fr die vorgesehenen deskriptiven
Anwendungen des Schwachheitsbegriffs (z. B.
bei der Beschreibung der there-be- Konstruk-
tion) aber unerwnscht ist, empfiehlt sich
statt dessen die Definition (186), nach der es
nur auf den Determinator ankommt.
Nebenbei bemerkt haben Barwise & Coo-
per bei der Entwicklung dieser Definition ein
ehrgeizigeres Ziel verfolgt, nmlich die Dis-
tributionsverhltnisse in der there-be-Kon-
struktion nicht nur przise beschreibbar zu
machen, sondern sie darberhinaus zu erkl-
ren. Die Idee dabei ist folgende: Angenom-
men there be _ bedeutet dasselbe wie der
Satzrahmen (189), m. a. W., there be
k,g,i
=
1 gdw. E
k,g,i
. Dann folgt mithilfe der
Definition (192), da genau die there-be-
Stze mit schwachen NPs informativ sind,
whrend die mit starken trivial wahr oder
trivial falsch sind. Barwise & Cooper meinen,
da dies erklrt, weshalb letztere nicht akzep-
tabel sind. Diese Erklrung leuchtet aber aus
verschiedenen Grnden nicht ein. Schon die
Tatsache, da es zur korrekten Beschreibung
der distributionellen Regularitt ntig war,
von (192) zur Definition (186) berzugehen,
beweist, da Trivialitt in dem in (192) pr-
zisierten Sinne eben keine hinreichende Be-
dingung fr das zu erklrende Ungrammati-
kalittsurteil ist. berhaupt ist es offensicht-
lich falsch, da tautologische und kontradik-
torische Stze generell als ungrammatisch
empfunden werden. Wir betrachten diesen Er-
klrungsversuch also als milungen. Bis jetzt
ist schlicht nicht bekannt, ob und wie die
von formalen Semantikern bereitgestellten
Schwachheitsdefinitionen fr die Erklrung
der mit ihrer Hilfe beschreibbaren Distribu-
tionsdaten fruchtbar gemacht werden kn-
nen.
Von einer ganz anderen Intuition inspiriert
ist der alternative Definitionsvorschlag (187).
Betrachtet man die blichen Deutungsregeln
fr die Determinatoren, die auf der schwa-
chen Liste erscheinen, so fllt einem auf, da
sie alle nach demselben Schema gebaut sind:
(189) Unter den Individuen, die es insgesamt
gibt, befindet (bzw. befinden) sich __.
Whlt man eine Einsetzung aus der Liste der
schwachen NPs, so erhlt man durchweg kon-
tingente Aussagen, z. B.:
(190) Unter den Individuen, die es insgesamt
gibt,
(a) befindet sich kein Huhn.
(b) befinden sich sieben Gabeln.
(c) befinden sich nur wenige Hte.
Dies sind gestelzte Paraphrasen von es gibt
kein Huhn, es gibt sieben Gabeln und es
gibt nur wenige Hte, alles Aussagen, die
offenbar je nach Sachlage wahr oder falsch
sein knnen. Vergleichen wir damit die star-
ken Einsetzungen in (191).
(191) Unter den Individuen, die es insgesamt
gibt,
(a) befindet sich jedes Huhn.
(b) befinden sich die meisten Affen.
(c) befinden sich weder du noch ich.
(d) befindet sich der Baum vor meinem
Fenster.
Diese Stze vermitteln in gewissem Sinne
keine neue Information. Gemeint ist damit:
wenn wir wissen, da wir in einer Welt sind,
wo diese NPs geglckt verwendet werden
knnen und wo gegebenenfalls ihre Prsup-
positionen wahr sind, dann wissen wir auch
ohne Ansehung der Tatsachen schon, ob diese
Stze wahr oder falsch sind. Egal wie die
Tatsachen sind, ist es z. B. unvermeidlich, da
(191c) falsch ist (in dem technischen Sinn von
Individuum jedenfalls, den wir hier voraus-
setzen). Unter der Voraussetzung, da die
(Fregesche) Prsupposition von der Baum vor
meinem Fenster erfllt ist, es also vor meinem
Fenster genau einen Baum gibt, kann dagegen
(191d) unmglich falsch sein. Auch (191a)
und (191b) sind garantiert wahr. Hat jedes
die Standarddeutung, so gilt insbesondere,
da (191a) wahr ist, ob es nun kein, ein, oder
mehrere Hhner gibt. Bevorzugt man eine
prsuppositionstragende Deutung fr jedes
wie (179), so kann (191a) gleichfalls nicht
falsch werden, solange die Prsupposition als
wahr unterstellt ist.
Przisiert man die intendierte Lesart des
Satzrahmens (189) und den passenden Sinn
von informativ, in dem sich (190ac) von
(191ad) unterscheiden, so gelangt man zu
einem Vorlufer der Definition (186).
530 VII. Semantik der Funktionswrter
Zusammenhang einfach: M
,k,g,i
=
k,g,i
(E).
Illustrieren wir das kurz am Beispiel ein. Fr
ein haben wir oben in das Regelschema (193)
bei ... die Eigenschaft, nicht leer zu sein,
eingesetzt. Ein Kandidat fr M
ein
,k,g,i, der
der Bedingung in (195) gengt, ist hier also
die Menge aller nicht-leeren Teilmengen von
E, d. h. {Y (E): Y }. Dies ist aber
gleich {Y (E): E Y }, und laut (174)
weiter gleich ein
k,g,i
(E). Analoges lt sich
fr alle andern schwachen DETs zeigen. Statt
(195) knnen wir daher spezieller formulieren:
(196)
Ist
k,g,i
die Extension eines schwa-
chen Determinators, so gilt fr die
Menge
k,g,i
(E):
Fr alle X, Y (E): Y
k,g,i
(X)
gdw. X Y
k,g,i
(E).
Ist
k,g,i
dagegen die Extension eines
starken Determinators, so gibt es keine
Menge, fr die dies gilt (d. h. es gibt
keine Menge Z, fr die fr alle
X, Y (E): Y
k,g,i
(X) gdw.
X Y Z).
Daraus folgt nun direkt das Bikonditional im
Definitionsvorschlag (187).
3.2.2Unterschiede
Sowohl zu (186) als auch insbesondere zu
(187) gibt es in der Literatur eine Reihe von
Varianten, die jedoch unter Voraussetzung des
Konservativittsuniversales (s. Artikel 21) mit
(186) bzw. (187) extensional quivalent sind;
insofern bringen sie nichts substanziell Neues
und wir knnen sie hier ignorieren. Dagegen
sind die beiden Definitionsvorschlge (186)
und (187) nicht nur hinsichtlich ihrer intuiti-
ven Herkunft verschieden, sondern auch ex-
tensional keineswegs quivalent selbst
dann nicht, wenn man nur solche hypotheti-
schen Determinatoren bercksichtigt, die al-
len bekannten Determinatoruniversalien ge-
ngen. Ein Unterschied zeigt sich z. B. hin-
sichtlich gewisser pathologischer komplexer
DETs: Null oder mehr ist schwach
2
, aber nicht
schwach
1
, was einen dazu bewegen knnte,
sich zugunsten von (187) zu entscheiden, da
ja nach den blichen Tests null oder mehr auf
derselben Liste wie nicht-triviale Numeralia
landet. Dabei ist aber zu bedenken, da auch
jedes oder nicht jedes schwach
2
ist; fr triviale
komplexe DETs taugen also beide Definitio-
nen gleich wenig. Ein weiterer Unterschied
betrifft die Einstufung des Russellschen be-
stimmten Artikels. Dieser ist schwach
1
(weil
fr beliebige k, g, i und a E gilt: E
(193)
k,g,i
(X) = {Y (E): X Y hat
die Eigenschaft ...}.
Setzen wir fr z. B. nicht leer zu sein, so
erhalten wir die Regel fr ein (174). Setzen
wir leer zu sein, bekommen wir kein (163).
Setzen wir eine Kardinalitt von (minde-
stens?) 3 zu haben, so haben wir drei. Setzen
wir schlielich etwas Vages wie klein zu
sein, so haben wir wenig (zu diesem Beispiel
vgl. jedoch weiter unten). Dabei gilt durch-
weg, da die betreffende Eigenschaft unab-
hngig von X und Y definiert ist. Wir betonen
das, denn in einem gewissen Sinne knnten
wir natrlich auch die Regeln fr starke De-
terminatoren in die Form von (193) zwngen,
z. B. so:
(194)
jedes
k,g,i
(X)
= {Y (E): X Y hat die Eigen-
schaft, gleich X zu sein}.
(Beachte, da X Y gdw. X Y = X.)
Hier steht fr ... aber eine Eigenschaft, die
in Abhngigkeit vom jeweiligen X definiert
ist, und es lt sich zeigen, da das bei der
Definition von jedes prinzipiell nicht ver-
mieden werden kann. Allgemeiner stellt sich
heraus, wenn man die Listen der schwachen
und starken Determinatoren durchgeht, da
die Bedeutungen aller schwachen DETs, und
nur dieser, vermittels einer von X und Y un-
abhngigen Eigenschaft des Durchschnitts
X Y beschrieben werden knnen. Drcken
wir das etwas prziser aus, so gelangen wir
zu folgender Generalisierung:
(195)
Ist
k,g,i
die Extension eines schwa-
chen Determinators, so gibt es eine
Menge M
,k,g,i
((E)), fr die gilt:
Fr alle X (E) und Y (E):
Y
k,g,i
(X) gdw. X Y M
,k,g,i
.
Ist
k,g,i
dagegen die Extension eines
starken Determinators, so gibt es keine
Menge, fr die dies gilt.
(Wir haben hier stillschweigend zugelassen,
da bei festem Determinator und fester
Interpretation die Wahl von M
,k,g,i
mit der
von k, g und i variiert. Was k und g betrifft,
so tritt dieser Fall in der Semantik von so
viele und wieviele ein; ob M
,k,g,i
jemals von i
abhngt, ist weniger klar, spielt aber hier
keine Rolle.)
Um von (195) die Brcke zum Definitions-
vorschlag (187) zu schlagen, mssen wir uns
noch vergegenwrtigen, wie das von (195) ge-
forderte M
,k,g,i
(sofern es existiert) jeweils mit
k,g,i
zusammenhngt. Tatschlich ist der
22. Artikel und Definitheit 531
mung beitragen. Insbesondere ist nicht un-
plausibel, da einer dieser Faktoren der Um-
fang von in der unmittelbaren linguistischen
Umgebung von viele erwhnten Mengen ist:
ceteris paribus treibt die Erwhnung groen
Mengen n
k
in die Hhe, whrend die Erwh-
nung kleiner Mengen n
k
herunterdrckt. Es
wre dann also nicht verwunderlich, da n
k
bei einer uerung des Satzes (197) desto
hher zu liegen tendiert, je grer die Menge
der Studenten ist. Der proportionale Effekt
schliche sich da sozusagen durch die Hinter-
tr der Kontextabhngigkeit ein. Dieses
Thema ist offenbar eng verwandt mit einem
aus der Adjektivsemantik gelufigen, nmlich
mit der Frage, ob Adjektive wie gro durch-
schnittsbildend sind (s. Artikel 31), und ist
sinnvoll wohl nur in diesem allgemeineren
Zusammenhang weiterzudiskutieren.
3.2.3Gemeinsamkeiten
Sowohl (186) als auch (187) implizieren, da
bei der Explikation der stark-schwach-Unter-
scheidung nicht ganz von Fragen des inneren
Aufbaus von NPs abstrahiert werden kann.
Gbe es eine Eigenschaft, die den Bedeutun-
gen aller schwachen NPs, und nur diesen,
gemeinsam wre, so wre das mglich gewe-
sen. Die Begriffe schwache NP und starke
NP knnten dann direkt mit Bezug auf diese
Eigenschaft definiert werden, und ob eine ge-
gebene NP diese Definitionen erfllt, bliebe
unberhrt davon, wie ihre Bedeutung kom-
positional aufgebaut wird. Nun haben wir
aber bereits gesehen, da Schwachheit keine
Eigenschaft der NP-Bedeutung als ganzer sein
kann (jedenfalls nicht, wenn man einen Be-
griff definieren will, der sich zur Beschreibung
der eingangs genannten distributionellen
Regularitten eignet). Vielmehr lt sich
schwache NP offenbar nur auf dem Umweg
ber schwacher DET definieren; erst indem
man den Determinator fr sich betrachtet,
kann man ein semantisches Kriterium fr
Schwachheit angeben. Deshalb ist es poten-
ziell ausschlaggebend, wie man eine gegebene
NP in DET und Prdikat aufspaltet. Bei die
meisten Amerikaner ist es z. B. blich, die
meisten als den Determinator zu identifizie-
ren, und so stufen die gngigen Definitionen
diese NP als stark ein. Die Existenz der (so-
weit auf Anhieb ersichtlich) bedeutungsglei-
chen NP eine Mehrheit von Amerikanern je-
doch bringt ans Licht, da es zumindest theo-
retisch auch denkbar wre, die meisten Ame-
rikaner mit einer anderen logischen Struktur
zu versehen, in der der Determinator schwach
wre.
das
k,g,i
({a}) und E das
k,g,i
().) Er ist aber
nicht schwach
2
(da {a} das
k,g,i
({a}) nicht
{a} das
k,g,i
(E) garantiert). Ob dies fr die
Bewertung der Definitionsvorschlge relevant
ist, hngt natrlich davon ab, wie man zur
Russellschen Analyse steht (und umgekehrt).
Auf einen dritten Unterschied schlielich wei-
sen Barwise & Cooper selbst hin. Sie entschei-
den sich nmlich fr die Definition (186) und
gegen (187) und liefern dafr folgende Be-
grndung:
Die Determinatoren viele und wenige
haben intuitive Anwendungsbedingungen, in
denen sowohl der absolute Umfang des
Durchschnitts X n Y als auch der relative
Umfang von X n Y im Vergleich zu X eine
Rolle spielen zu scheinen. Konkret gesagt, zu
den Wahrheitsbedingungen von (197) gehrt
zweierlei.
(197) Viele Studenten bekamen eine Eins.
Erstens mu die Anzahl der Studenten, die
Einsen bekamen, gro sein. Wie gro ge-
nau, hngt dabei vom uerungskontext k
ab; nehmen wir einmal an, der Schwellenwert
in unserem k ist n
k
. Zweitens mu der Pro-
zentsatz der Einserstudenten in der Gesamt-
heit der Studenten gro sein. Auch hier
bestimmt wieder k, wie gro, sagen wir einmal
m
k
%. Die Deutung von viele ist also (198).
(198)
viele
k,g,i
(X) =
{Y (E): X Y n
k
und
X Y m
k
% X}.
Wenn diese semantische Analyse korrekt ist,
ist viele nicht schwach
2
. (Beweisidee: Whle
X und Y so, da X Y fast so gro wie X,
aber winzig im Vergleich zu E ist.) Dabei ist
viele aber schwach
1
, da z. B. E viele
k,g,
(E),
whrend E viele
k,g,i
() (angenommen, da
n
k
> 0 und E > n
k
). Analog lt sich bei
wenige argumentieren. Insofern als diese
DETs nach distributionellen Kriterien
schwach zu sein scheinen, spricht das fr die
Definition (186) und gegen (187). Dieses Ar-
gument ist freilich nicht unangreifbar. Man
kann anzweifeln, da die Proportionsbedin-
gung X Y m
k
% X wirklich in dieser
Form zur Deutung von viele gehrt. Was
spricht letztlich gegen die einfachere Deu-
tungsregel (199)?
(199)
viele
k,g,i
(X) =
{Y (E): X Y n
k
}.
n
k
ist eine vom uerungskontext gelieferte
Richtzahl, und es ist nicht von vorneherein
klar, was alles fr Faktoren zu ihrer Bestim-
532 VII. Semantik der Funktionswrter
wobei a dasselbe wie viel bedeutet. Wie dem
auch sei, nehmen wir einmal an, eine solche
Aufspaltung in echten Determinator und
Quantittsadjektiv ist fr mindestens einige
(und vielleicht sogar alle) Mitglieder der
schwachen Liste angezeigt. Was fr Konse-
quenzen htte das fr das Forschungsunter-
nehmen, ber das wir in diesem Abschnitt
berichtet haben?
Hinsichtlich der empirischen Voraussagen
der vorliegenden Definitionen htte es an-
scheinend keine Folgen. Ob man nun etwa
wenig als unanalysierten DET nimmt oder
daraus den echten DET abspaltet und
den Rest zum Prdikat schlgt man hat es
so oder so mit einem schwachen DET zu tun.
Es ergibt sich aber eventuell ein forschungs-
praktischer Unterschied: Wenn sich Dekom-
positionen der Form () + Quantittspr-
dikat tatschlich fr alle NPs der schwachen
Liste als korrekt bewhren, dann wird die
Aufgabe, den Schwachheitsbegriff zu definie-
ren, ziemlich trivial. Es gibt dann nmlich in
der natrlichen Sprache genau zwei schwache
DETs, nmlich und (wobei man letz-
teren unter der Annahme geringfgig abstrak-
terer logischer Formen vielleicht auch noch
eliminieren kann). Doch bis es soweit kommt,
mu noch viel linguistische Arbeit geleistet
werden, denn die Forschungen zur internen
semantischen Struktur der NP stecken wohl
erst in den Kinderschuhen.
Zum Abschlu wollen wir noch kurz dar-
auf eingehen, inwieweit in (186) und (187)
eigentlich dieselbe Unterscheidung definiert
wird, die Milsark bei seinem ursprnglichen
Gebrauch der Terminologie stark/schwach
im Sinn zu haben schien. Auf den ersten Blick
besteht hier eine Diskrepanz: Wesentlich bei
Milsark ist nmlich, da die Determinatoren
ein, kein, viele, wenige (und mglicherweise
smtliche Mitglieder der schwachen Liste) sei-
ner Meinung nach zweideutig sind und neben
einer schwachen auch eine starke Lesart be-
sitzen. Die Unterscheidung zwischen diesen
zwei Lesarten wird durch Beispiele und ein
paar heuristische Tests eingefhrt. Grob ge-
sagt soll eine starke Lesart genau dann vor-
liegen, wenn eine partitive oder generische
Paraphrase natrlich ist:
(200) Ich habe diesmal eine gute Klasse. Drei
Studenten haben schon etwas verf-
fentlicht.
Paraphrase: Drei von den Studenten ...
(201) Viele Amerikaner sind aberglubisch.
Paraphrase: Amerikaner sind vielfach
aberglubisch.
Eine Gruppe von Beispielen, die in diesem
Zusammenhang von Interesse ist, bilden die
partitiven NPs mit schwachen DETs, also
z. B. zwei von euch. Es ist gelegentlich be-
hauptet worden (z. B. von Milsark 1977), da
diese NPs unter distributionellen Gesichts-
punkten stark sind. (Dies ist im Fall der there-
be-Konstruktion bestritten worden, aber se-
hen wir davon im Moment einmal ab.) Unter
einer naheliegenden syntaktisch-semantischen
Analyse besteht zwei von euch aus dem DET
zwei und der Appellativphrase von euch.
Wenn das stimmt, ist zwei von euch aber ge-
m unseren Definitionen schwach. Will man
es als stark eingestuft haben, so mu man
eine andere Analyse whlen, etwa eine, wo
euch in einen abstrakten bestimmten Artikel
DEN und ein Prdikat aufgespalten ist, und
wo zwei von DEN als der DET der NP zwei
von euch zhlt. (ber die genaue Deutung
von zwei von den und den Nachweis, da es
unter dieser Deutung weder schwach
1
noch
schwach
2
ist, gehen wir hier aus Platzgrnden
hinweg.) Die Suche nach der besten Defini-
tion fr den Schwachheitsbegriff kann also
nicht unabhngig von der Erforschung der
inneren Struktur von NPs vorangetrieben
werden.
Die Definitionsvorschlge (186) und (187)
machen beide eine stillschweigende Voraus-
setzung, die im Lichte der zeitgenssischen
Pluralforschung recht fragwrdig ist, nm-
lich, da es sich bei ein, kein, den Numeralia,
wenig, viel usw. tatschlich um Determinato-
ren handelt, d. h. um Ausdrcke des logischen
Typs, der Mengen auf Mengen von Mengen
abbildet (siehe 3.1). Wie wir schon in 2.3.1
angedeutet haben, gibt es eine alternative
Sichtweise, unter der z. B. die NP zwei Hunde
wie folgt interpretiert wird: Zunchst wird das
Prdikat zwei Hunde gebildet, dessen Exten-
sion eine Teilmenge von E ist, nmlich die
Menge aller Paare von Hunden. Auf dieses
wird dann der morphologisch unrealisierte
Existenzquantor angewandt, und so ergibt
sich die bliche Extension in ((E)) fr die
DET-NP zwei Hunde. Analog lt sich auch
mit vagen Quantittswrtern wie einige und
viele verfahren. Bei den monoton fallenden
Quantittswrtern wie kein, wenig und hch-
stens zwei ist die Sache allerdings ein bichen
komplizierter. Will man hier einen Quantor
abspalten, so mu dies ein negierter Existenz-
quantor sein. M. a. W., es gibt z. B. kein Quan-
tittsadjektiv a, fr das wenig mit [ ]
quivalent wre. Man mte hier vielmehr
eine Analyse der Form [ ] ansetzen,
22. Artikel und Definitheit 533
gig von dieser berlegung und durch unsere
Bemerkungen hier nicht prjudiziert ist dabei
natrlich die Frage, ob es solche Lesarten
wirklich gibt, und wenn ja, ob es wnschens-
wert ist, sie als stark zu klassifizieren. Um
dies zu klren, mten wir wiederum ernst-
haft in die Beschreibung und Erklrung der
Daten eindringen, derentwegen eine Przisie-
rung der stark/schwach-Unterscheidung
berhaupt fr Linguisten interessant ist.
4. Quellenangaben und
Literaturempfehlungen
Die Russellsche Deutung des bestimmten Ar-
tikels stammt aus Russell (1905), wo sich auch
Versionen der Argumente in 1.1.3 finden.
Strawson (1950) vertritt etwas hnliches wie
die direkt referentielle Deutung in 1.1.2; wo
die hnlichkeiten und Unterschiede liegen,
arbeitet Soames (1988) genauer heraus.
Unsere Formulierung in (6) setzt die Unter-
scheidung zwischen uerungs- und Auswer-
tungssituation voraus, fr die z. B. Stalnaker
(1970) und Kaplan (1977) argumentieren (s.
Artikel 9). Zu den in 1.1.3 angesprochenen
Problemen mit Identitts- und Existenzstzen
gibt es eine umfangreiche philosophische Lite-
ratur, z. B. Donnellan (1974), Stalnaker
(1978), Salmon (1986) (s. Artikel 9).
Die Fregesche Deutung (47) in 1.2.3 haben
wir nach Frege (1892) benannt. Dabei mssen
wir hier offenlassen, was bei der bertragung
in unseren moderneren Begriffsapparat von
Freges Einsichten eventuell verlorengegangen
oder zu ihnen hinzugekommen ist. Die Quel-
len fr die Ausfhrungen zur Prsupposi-
tionstheorie in 1.2 sind zu zahlreich, um sie
hier vollstndig aufzufhren (s. Artikel 13);
stellvertretend genannt seien Gazdar (1979),
Karttunen & Peters (1979), Soames (1988),
Stechow (1981) und Link (1986). Es gibt auch
kritische Stimmen, die hier nicht zu Wort
gekommen sind. Bor & Lycan (1976) bei-
spielsweise glauben nicht an die Existenz se-
mantischer Prsuppositionen und argumen-
tieren insbesondere, da die Daten, mit denen
wir die Fregesche Deutung des bestimmten
Artikels motiviert haben, mit Hilfe allgemei-
ner pragmatischer Prinzipien auch unter der
Russellschen Deutung erfabar sind.
In 1.3.1 sttzen wir uns auf Donnellan
(1966), Kripke (1977), Stalnaker (1970) und
Kaplan (1978). Letzterer beschrnkt sich al-
lerdings darauf, eine mgliche Przisierung
von Donnellans Unterscheidung bereitzustel-
Milsarks schwache Lesart ist dagegen nicht
so paraphrasierbar:
(202) Unter dem Balkon hngen einige Wes-
pennester.
... einige von den Wespennestern.
Wespennester hngen mitunter un-
ter dem Balkon. (mit neutraler End-
betonung und nicht-temporaler
Lesart fr mitunter)
Soweit die (oben so genannten) starken De-
terminatoren betroffen sind, stimmt Milsarks
Terminologie mit der oben verwendeten ber-
ein: Diese DETs sind fr ihn unzweideutig
stark. Seine Terminologie ist dabei insofern
natrlich, als starke DETs wie jedes, die mei-
sten stets die partitiven oder generischen Pa-
raphrasen erlauben, die fr die starken Les-
arten sonst schwacher DETs charakteristisch
sind. (Diese Behauptung scheint oberflchlich
nicht ganz zu stimmen, was das deutsche die
meisten anbelangt. Dieses besitzt im Gegen-
satz etwa zum englischen most eine zustzli-
che Lesart, die wir bisher vernachlssigt
haben. Wir meinen hier die Lesart, in der
Hans kennt die meisten Linguisten bedeutet,
da Hans mehr Linguisten kennt als jeder
andere. Dies kann wahr sein, ohne da er eine
Mehrheit der Linguisten kennt. In dieser Les-
art ist die meisten schwach aber nicht nur
nach Milsarks Kriterien, sondern auch nach
den gngigen formalen Definitionen. Unsere
allgemeinen Bemerkungen zum Verhltnis
zwischen Milsarks Begriffen und den oben
definierten sind deshalb von dieser Beobach-
tung nicht tangiert.)
Milsarks Schwachheitsbegriff scheint also
enger zu sein als der, von dem hier bisher die
Rede war. Ob das wirklich so ist, kann man
jedoch erst entscheiden, wenn eine przise
Analyse der starken Lesart sonst schwacher
DETs vorliegt. Im Moment ist aber ziemlich
unklar, wie so eine Analyse auszusehen htte.
Das Hauptproblem liegt darin, die Flle in
den Griff zu bekommen, bei denen generische
Paraphrasen natrlich sind. Wenn wir uns auf
die Beispiele mit partitiven Paraphrasen be-
schrnken, haben wir es etwas einfacher. Eine
simple Auslegung von Milsark wre hier, da
zwei, viele usw. in jeweils einer Lesart qui-
valent mit zwei von den, viele von den usw. zu
deuten sind. Wie wir schon oben (ohne Nach-
weis) bemerkt haben, sind diese Paraphrasen
unter den vorliegenden formalen Definitionen
nicht schwach. Bei nherem Hinsehen knn-
ten diese Definitionen hier also doch mit Mil-
sarks Intentionen bereinstimmen. Unabhn-
534 VII. Semantik der Funktionswrter
Die Argumente in 2.1.1 fr die -Deutung
des unbestimmten Artikels finden sich in Rus-
sell (1919); vgl. auch Kaplan (1970). Zu 2.1.2
vgl. Artikel 14 bzw. die dort zitierten Arbeiten
von Horn und Gazdar, aber auch Lbner
(1985b). 2.1.3 ist im wesentlichen eine Aus-
einandersetzung mit der These von Hawkins
(1978), da der unbestimmte Artikel sich vom
bestimmten in erster Linie durch eine ex-
clusiveness-Bedingung unterscheide.
Ein reprsentatives Beispiel fr die Ver-
wendung des Merkmals [ spezifisch] in der
generativen Grammatik der 60er Jahre (Ab-
schnitt 2.2.1) ist Stockwell, Schachter & Par-
tee (1973a). Karttunen (1976) (geschrieben
1969) pldiert als einer der ersten dafr, dieses
Merkmal zugunsten einer Skopusanalyse ab-
zuschaffen. Schon Partee (1970) sieht die spe-
zifische Lesart von Indefinita als analog zu
Donnellans referentieller Lesart von Definita,
aber explizit gemacht ist diese Analogie erst
bei Fodor & Sag (1982). Dort finden sich die
Deutung (133) in 2.2.2 und die Argumenta-
tion, die wir in 2.2.4 auf ein deutsches Beispiel
bertragen haben. Anaphoraargumente wie
in 2.2.3 bringen u. a. Strawson (1952) und
Chastain (1975), kritische Entgegnungen da-
zu Evans (1977), Kripke (1977) und Lewis
(1979a). Auch die Skopusargumente von Fo-
dor & Sag sind angegriffen worden, besonders
von Rooth & Partee (1982) und Ludlow &
Neale (1987).
Zur Deutung von Numeralia und der Mg-
lichkeit, ein als Numerale zu behandeln, wre
neben den in Artikel 19 genannten Arbeiten
insbesondere Artikel 18 zu konsultieren. Zur
Problematik der generischen Lesarten siehe
wiederum Carlson (1978) und Krifka &
Gerstner (1987); daneben hier Lewis (1975a),
Heim (1982) und Kamp (1981a).
Die wichtigste Quelle fr Abschnitt 3 ist
Barwise & Cooper (1981), Artikel 21 ist un-
mittelbar relevant. Zur in 3.1 erwhnten Par-
titivbeschrnkung vgl. Jackendoff (1977) und
Ladusaw (1982). Zum Vergleich zwischen der
Definitheitsdefinition (173) mit Barwise &
Coopers Vorschlag, insbesondere hinsichtlich
der Behandlung des Plurals, siehe auch Link
(1987d) und Lbner (1987b). Die stark/
schwach-Unterscheidung in 3.2 stammt von
Milsark (1977); siehe auch Safir (1985) und
diverse Kapitel in Reuland & ter Meulen
(1987) fr einen berblick des deskriptiven
Anwendungsbereichs dieser Unterscheidung.
Kritik und Alternativen zur formalen Defi-
nition von Barwise & Cooper finden sich z. B.
bei Doron (1986) und Keenan (1987a). Im
len. Er behauptet nicht, da die von ihm
przisierte Unterscheidung tatschlich fr die
korrekte Analyse von Donnellans Beispielen
angemessen ist, noch geht er darauf ein, ob
sie berhaupt in der Semantik natrlich-
sprachlicher NPs mit bestimmtem Artikel ge-
braucht wird. Stalnaker dagegen lt sich auf
solche empirischen Fragen ein und argumen-
tiert explizit fr eine referentiell/attributiv-
Mehrdeutigkeit in englischen Stzen mit the-
NPs. In diesem Zusammenhang skizziert er
(wenn auch sehr knapp) die in 1.3.2 referier-
ten Argumente. Zu 1.3.3 vergleiche En (1982,
1986), wo allerdings keineswegs die hier an-
gedeutete Analyse vertreten wird.
Die deiktischen und anaphorischen
Aspekte des bestimmten Artikels (Abschnitt
1.4) fanden lange Zeit vorwiegend in Arbeiten
auerhalb der Wahrheitsbedingungenseman-
tik Beachtung; siehe z. B. Hawkins (1978).
Dies gilt aber nicht mehr fr die neuere Lite-
ratur (z. B. Heim 1982, Kadmon 1987, Lb-
ner 1985a, Hintikka & Kulas 1985). Unsere
Diskussion in 1.4.1 bewegt sich im Rahmen
sprachphilosophischer Arbeiten zur Kontext-
theorie; vgl. besonders Kratzer (1978) und
Lewis (1979d). Letzterer uert sich auch spe-
ziell zur Kontextabhngigkeit des bestimmten
Artikels und vertritt eine Behandlung, die von
der hier empfohlenen abweicht. Mit dem Pro-
blem, das Stze wie (86)(88) in 1.4.2 auf-
werfen, befassen sich u. a. Kempson (1984)
und Partee (1984a). Insgesamt berhrt sich
die Thematik von Abschnitt 1.4 eng mit der
in den Artikeln 10, 23 und 24.
1.5.1 sttzt sich im wesentlichen auf Artikel
19 und dort genannte Arbeiten. Siehe auch
Hawkins (1978) (nicht-formalen) Vorschlag,
die klassische Einzigkeitsbedingung zu einer
inclusiveness-Bedingung zu verallgemei-
nern. Die hier verworfene Idee, den bestimm-
ten Artikel als Universalquantor zu deuten,
findet sich z. B. bei Chomsky (1975). Die
Beispiele in 1.5.2 zur Distribution des be-
stimmten Artikels bei Eigennamen und ge-
nerischen NPs stammen hauptschlich aus
der Duden-Grammatik (1965). Zu den ge-
nerischen Lesarten (1.5.3) siehe u. a Carlson
(1978) und Krifka & Gerstner (1987).
Viele interessante Fragen zum bestimmten
Artikel haben wir in diesem Handbuch-Arti-
kel ausgespart. Besonders zu erwhnen sind
hier Studien ber Sprachen mit mehr als
einem bestimmten Artikel (Ebert 1971) und
Vergleiche zwischen bestimmtem Artikel und
Demonstrativdeterminator (Hawkins 1978,
Maclaran 1982).
23. Pronouns 535
1986 Duden Grammatik 1965 Ebert 1971 En
1982 En 1986 Evans 1977 Fodor/Sag 1982
Frege 1892 Gazdar 1979 Hawkins 1978 Heim
1982 Hintikka/Kulas 1985 Jackendoff 1977
Kadmon 1987 Kamp 1975 Kamp 1981a Kaplan
1970 Kaplan 1977 Kaplan 1978 Karttunen
1976 Karttunen/Peters 1979 Keenan 1987a
Kempson 1984 Kratzer 1978 Krifka/Gerstner
1987 Kripke 1977 Ladusaw 1982 Lewis 1975a
Lewis 1979a Link 1986 Link 1987d Lbner
1985a Lbner 1985b Lbner 1987b Ludlow/
Neale 1987 Maclaran 1982 Milsark 1977 Partee
1970 Partee 1984a Partee 1988 Reuland/ter
Meulen (eds.) 1987 Rooth/Partee 1982 Russell
1905 Russell 1919 Safir 1985 Salmon 1986
Soames 1988 Stalnaker 1970 Stalnaker 1978
von Stechow 1980 von Stechow 1981a Stock-
well/Schachter/Partee 1973a Strawson 1950
Strawson 1952 Szabolcsi 1986
Irene Heim, M. I. T., Cambridge,
Massachusetts (USA)
Zusammenhang mit der Vagheit von viele ist
insbesondere Kamp (1975) relevant. Einer
grndlichen Diskussion des Verhaltens von
viele und wenige hinsichtlich der stark/
schwach-Unterscheidung ist Partee (1988)
gewidmet. Motivation fr die Behandlung
schwacher Determinatoren als Quantittspr-
dikate findet sich in Artikel 19 und dort zi-
tierter Literatur; Stechow (1981a) weist dar-
auf hin, da dies das Inventar an echten quan-
tifizierenden Determinatoren drastisch verk-
leinert. Die schwache Lesart von die meisten
analysiert Szabolcsi (1986). Zu Milsarks
These, da viele Determinatoren eine stark/
schwach-Ambiguitt aufweisen, siehe auch
Lbner (1987b).
5. Literatur (in Kurzform)
Barwise/Cooper 1981 Bor/Lycan 1976 Carlson
1978 Chastain 1975 Chomsky 1975 de Jong
1987 Donnellan 1966 Donnellan 1974 Doron
23. Pronouns
reference can be construed either from the
situation (e. g., by pointing at someone while
uttering (1a)), or from the linguistic context.
If the latter option is chosen, e. g. in (1b), the
pronoun is coreferential with some other NP
(Felix). Nevertheless, its interpretation is es-
sentially the same as in the case of (1a) a
fixed referential value is assigned to the pro-
noun, and we will refer to this assignment as
the referential interpretation of pronouns.
Anaphora, under the referential interpreta-
tion will be labelled pragmatic, or referential
coreference.
The interpretation of the pronoun in (2) is
quite different: Here it does not have a fixed
value, but its value depends on the choice of
value for the antecedent. (2) is interpreted as
in (3), where the pronoun is bound by the
quantifier every, and we will refer to this as
the bound-variable interpretation of pronouns.
In section 3.2 we will see that this interpre-
tation is not restricted to the case of quanti-
fied antecedents. Unlike pragmatic corefer-
ence, bound-variable anaphora is strictly a
sentence-level phenomena; it is impossible
across sentences, as illustrated in (4), and its
distribution intra-sententially is severely re-
stricted, as we shall see.
(4) *Lucy invited each officer
1
to the party
and Felix kissed him
1
.
1. Types of Pronouns and Anaphoric Relations
2. Structural Relations and Restrictions
2.1 The General Structural Restriction
2.2 Restrictions on the Different Anaphoric Types
3. Bound-Variable Interpretation
3.1 Quantified-NP Anaphora
3.2 Bound-Variable Anaphora With Definite An-
tecedents
3.3 The Interpretative Procedures
4. Pragmatic Coreference With Pronouns
5. Semantic Approaches to Anaphora
6. Short Bibliography
1. Types of Pronouns and Anaphoric
Relations
Third person pronouns have two basic uses,
or interpretations, which are illustrated in (1)
and (2):
(1)
a. He is very original.
b. Felix
1
is convinced that he
1
is very
original.
(2) Every writer
1
is convinced that he
1
is very
original.
(3) Every x (writer (x)) (x is convinced that x
is very original).
In the first case the pronoun is used to refer
to some person or object in the world. Its
536 VII. Semantik der Funktionswrter
This was also the central issue in latter works
such as Lasnik (1976) and Reinhart (1976),
and has been incorporated, as such, into the
binding theory of the government and bind-
ing (GB) framework of Chomsky (1981),
(1982). However, it is easy to observe that, in
fact, pragmatic coreference is the exceptional
case of anaphora: while all anaphoric ele-
ments allow the bound-variable interpreta-
tion, only pronouns allow, in addition, for
pragmatic coreference. I will therefore focus,
first, on the conditions for the bound-variable
interpretation, returning to pragmatic core-
ference in section 4. Before that, however, we
shall view the surface structure (SS) condi-
tions which restrict all types of anaphoric
elements.
2. Structural Relations and
Restrictions
As is well known, the anaphoric interpreta-
tion of pronouns and other anaphoric ele-
ments, intrasententially, is not free, but it is
restricted by syntactic properties of the sen-
tence. While semantic analyses of the ana-
phora restrictions have been proposed, such
analyses are stated, as we shall see in section
5., at a level of logical syntax, i. e. the func-
tion-argument representations to which they
apply reflect the structural properties of sur-
face structure. The semantic and the syntactic
approaches are, therefore, essentially equiv-
alent, and it is crucial to identify the structural
conditions which underlie, in effect, both ap-
proaches.
These structural conditions fall into two
types: First, there is a general structural re-
lation that all anaphoric elements must bear
to their antecedent; next, the different types
of anaphoric elements have different distri-
butions, i. e. they select different sub-domains
of the general syntactic domains allowing
anaphora.
2.1The General Structural Restriction
Much of the study of anaphora, and semantic
interpretation of SS in general, has concen-
trated on identifying the general structural
relation restricting it. This is a central issue
in linguistic theory, since more generally, it
determines the domains in which linguistic
rules can apply. The syntactic relations pro-
posed in the earlier generative work as rele-
vant for the operation of interpretative rules
(or transformations like pronominalization
in early stages) include command, in con-
Evans (1980) argues for the existence of a
third type of pronoun interpretation labelled
E-type, under which the pronoun is taken to
refer to the object(s) which satisfy the clause
containing a quantified NP, as e. g. in (5):
(5) Lucy owns some cats
1
and they
1
are so
cute.
Anaphora of this type is possible across sen-
tences, as in this example. Although we will
not discuss such cases here, we should note
that E-type pronouns are best analyzed as
set-pronouns, i. e. as pronouns referring to
sets (or to each of their members, in the
distributive interpretation). In (5), the pro-
noun, then, refers to (each member of) a set
of more than one cat which Lucy owns. As
such, this pronoun interpretation is a subcase
of the referential interpretation, since the
value of the set is established in the discourse.
In other instances, set-pronouns can also be
bound intra-sententially. (The details of this
analysis are given in Reinhart 1986.)
We should note that (non-reflexive) pro-
nouns are the only anaphoric elements in
English, German and many other languages,
which allow for referential interpretation.
Other anaphoric elements include reflexive
and reciprocal pronouns (hereafter R-pro-
nouns), as in (6), and empty nodes, such as
the wh-trace of (7) or the PRO of (8).
(6)
a. Lucy bores herself.
b. Diplomats seek each others com-
pany.
(7) Which dragon
1
did you encounter e
1
?
(8) Felix
1
promised Lucy PRO
1
to be on
time.
(9)
a. *Felix bores herself.
b. *Each other vanished.
(10) *Did you encounter e?
Such anaphoric elements must have an ante-
cedent within the sentence, and in none of the
cases of (6)(8) can they select a discourse-
value as reference. This is witnessed by the
fact that when they occur with no antecedent,
as in (9)(10), the sentences are uninterpret-
able, in contrast, e. g. to (1a). As we shall see
in section 3.3, the obligatory anaphors of this
type are interpreted as bound variables, re-
gardless of the semantic interpretation of the
antecedent.
Historically, anaphora studies were moti-
vated by the problems of pragmatic corefer-
ence. Thus, the earliest attempt to define
structural restrictions on anaphora, that of
Langacker (1966), considered only this type.
23. Pronouns 537
mand the topmost PP
3
, which is dominated
by S, rather than by VP.
The relation c-command is incorporated
into the anaphora theory of the GB frame-
work (Chomsky 1981, 1982) via the definition
of syntactic binding in (13).
(13) An NP is bound if it is coindexed with
a c-commanding NP.
I will assume in the discussion the general GB
approach, although obviously, the same gen-
eralizations can be captured also in different
approaches. In this framework, all NPs are
base generated with an index, which is then
left on the trace if an NP is moved. Since the
indexing is free, NPs may also be generated
coindexed. However, only the coindexing un-
der c-command is defined as binding by (13).
E. g. in tree (12b) the pronouns with the index
1 (her
1
) are bound by every actress. As we
shall see in more detail in section 3, the con-
dition on all bound-variable anaphora is that
the antecedent must bind the pronoun syn-
tactically at SS. Although this is not explicitly
stated in the current GB theory, this means
that the syntactic relation of binding has a
unique interpretation as semantic variable-
binding.
2.2Restrictions on the Different Anaphoric
Types
Although in all kinds of bound-variable
anaphora the anaphoric element must be
bound, this is not yet a sufficient condition
for binding, since different anaphoric ele-
ments impose different restrictions. E. g. in
(14), the R-pronoun is bound, given (13), but
anaphora is not permitted.
struction with, superiority, clause mate
and the linear relation precede. The relation
found most useful at this stage was precede
and command which was introduced in
Langacker (1966) to handle pronominaliza-
tion and was later applied to the analysis of
the scope of negation in Ross (1967) and to
quantifier scope, in Jackendoff (1972). (For a
survey of these relations, see Reinhart 1983.)
However, in recent years the prevailing as-
sumption has been that the relevant structural
relation is c-command, of Reinhart (1976),
which is similar to Klimas (1964) in con-
struction with. We will assume here the more
recent definition of this relation in (11), which
was proposed by Aoun and Sportiche (1981):
(11) A node c-commands iff the first
maximal projection dominating also
dominates .
(12)
a. The mayor thanked every actress
1
on
her
1
birthday for her
1
wonderful per-
formance, according to her
5
.
The crucial node defining a domain here is
the maximal projection, which is the node
with maximal bars of a given category type.
E. g. the maximal projection of the V category
is V. To illustrate the definition, consider
tree (12b). The subject c-commands all other
nodes in the sentence: The first category dom-
inating it is S, which dominates also all other
nodes. The domain of the object every actress
is the whole topmost VP (i. e. V), which is
the maximal projection of the category (V)
dominating it. Thus, every actress c-com-
mands both the pronoun in PP
1
and in PP
2
.
The pronoun in the PPs, on the other hand,
c-commands nothing outside the PP, which is
its first dominating maximal projection. Note
that the object every actress does not c-com-
538 VII. Semantik der Funktionswrter
categories are assumed, including, e. g. NP
traces (in passive constructions) which have
the same distribution as R-pronouns. How-
ever, empty nodes bound by wh-constituents
deserve special attention. While, as all ana-
phors, they must be c-commanded by their
wh-antecedent, as witnessed by the inappro-
priateness of (19c), they can only be bound
by a node in COMP (i. e. in an (non-A)
position), as in (19b), but not, e. g. in (20).
(19)
a. Felix realized [
s
he is a failure] after
whose remark.
b. After whose remark
1
did Felix realize
[
s
he is a failure] e
1
.
c. *Felix realized [
s
[after whose re-
mark]
1
he is a failure] e
1
.
(20) *Which man told which woman
1
that
Felix loves e
1
?
(21) *Which diplomat
1
do you despise him
1
?
This distribution is guaranteed, within GB by
independent considerations which we shall
not view here. However, it is important to
notice that in many languages, the environ-
ments which allow empty anaphors to be wh-
bound do not allow pronouns, as in (21),
(though other languages exist which allow
resumptive pronouns).
We may conclude, then, that the various
anaphoric elements vary with respect to the
position allowed for their binding antecedent:
The obligatory anaphors R-pronouns and
empty nodes have their antecedent either
in their GC or in COMP. The optional ana-
phors, i. e. pronouns, are in complementary
distribution: they cannot be bound in their
GC or by a node in COMP. This, in fact,
does not seem arbitrary. The generalization
which emerges is that if a language has the
means to express anaphora with obligatory
anaphors, it does not use, in the same envi-
ronment, the less committal optional-form to
express anaphora.
3. Bound-Variable Interpretation
3.1Quantified-NP Anaphora
Let us illustrate, first, the claim of the previ-
ous section; that the bound-variable interpre-
tation of pronouns is possible only if the
antecedent syntactically binds (i. e. c-com-
mands) the pronoun at SS.
(22)
a. No boy
i
brought his
i
dog to the party.
b. Who
i
t
i
brought his
i
dog to the party?
c. Each of the southern planets
i
was de-
serted by its
i
residents.
(14) *Lucy
1
believes that herself
1
is quite
amusing.
(15) *Max adores herself.
(16)
a. Lucy
1
believes herself
1
to be amusing.
b. Lucy adores herself.
(17)
a. *Lucy
1
believes her
1
to be amusing.
b. *Lucy
1
adores her
1
.
This is so because R-pronouns have narrower
distribution than pronouns, which was cap-
tured in the early work by the requirement
that it be clause-mate with its antecedent. In
fact the distribution of pronouns and R-pro-
noun is complementary (as observed in
Chomsky 1973): In the environments allow-
ing R-pronouns, such as (16) pronouns can-
not be anaphoric, as witnessed by (17). To
specify the sub-domain of binding which al-
lows R-pronouns, we will follow Chomskys
(1981) analysis: In this framework, the gov-
ernor of a given node is, intuitively, the
node which assigns case to a, and it can be,
e. g., N, V, INFL or P. (This is a broader
notion which is defined independently of case,
but the details are not crucial for our pur-
pose.) The governing category of (GC) is
any S or NP node containing both and the
governor of a. The distribution of the two
types of pronouns is then restricted by the
two conditions stated in (18). (In this frame-
work, R-pronouns are viewed as included in
the set labelled anaphors, which include also
NP traces.)
(18) Chomskys (1981) binding conditions:
A. Anaphors (R-pronouns) must be
bound in their GC.
B. Pronominals must be free (i. e. un-
bound) in their GC.
In (14) the governor of herself is the INFL
of the embedded S, so this S is the GC, and,
though herself is bound, its antecedent is not
in its GC. In (16a), on the other hand, the
governor is the verb believes, so the GC is the
higher S which contains, properly, the binder
of the R-pronoun. Condition A filters out as
ungrammatical both (14) and (15), where the
R-pronoun has no antecedent at all. It cap-
tures, thus, the fact that R-pronouns, unlike
pronouns, are obligatory anaphors that can-
not be interpreted referentially, if they lack
an antecedent. Condition B captures the com-
plementary distribution of the two types of
pronouns.
The distribution of empty anaphoric ele-
ments is also distinct from that of pronouns.
At least in English and German, the distri-
bution of the two is, again, complementary.
In the GB framework several types of empty
23. Pronouns 539
stricted in quite a different way all the
environments that blocked bound-variable in-
terpretation in (23) allow pragmatic corefer-
ence, as illustrated in (24). On the other hand,
it is also not the case that pragmatic corefer-
ence is completely free. It is not possible,
generally, when the pronoun c-commands the
antecedent, as in (25).
(24)
a. His
i
dog accompanies Christopher
i
everywhere.
b. A party without Felix
i
is inconceiva-
ble to him
i
.
c. The rebellion against Java the Hut
i
destroyed him
i
.
d. According to Winnie
i
he
i
is the
smartest kid in the world.
(25)
a. *He
i
adores Christopher
i
s dog.
b. *He
i
was destroyed by the rebellion
against Java the Hut
i
.
c. *I informed him
i
that Winnie
i
is not
so smart.
This, combined with the fact that, historically,
it was the problem of the restrictions on prag-
matic coreference with which the studies of
anaphora were preoccupied, has led to the
assumption that a major goal of the grammar
is to allow the coindexing in (24) and to block
it in (25), and the SS binding-conditions of
the GB framework have been stated accord-
ingly. (We return to the condition blocking
anaphora in (25) in section 4.) However, if
coindexing is permitted at SS in (24), it must
be permitted also in (23), since at this level
there are no syntactic differences between the
two cases. Consequently, such cases of coin-
dexing must be filtered out later by a different
mechanism. It is a reasonable move, then, to
assume that this filtering mechanism must
apply at LF, since at this level quantified
antecedents are structurally distinct from the
others. This framework assumes the LF for-
mation rule Quantifier Raising (QR), of May
(1977), which adjoins a quantified NP to S,
yielding for (26a) the representation (26b). At
this level, quantified sentences then have the
same structure as cases of wh-movement, like
(27), and it is possible to state an anaphora
restriction applying equally to both.
(26)
a. Every guest
i
brought his
i
dog.
b. Every guest
i
[
s
e
i
brought his
i
dog].
(27) Which guest
i
[
s
e
i
brought his
i
dog]?
(28)
a. *His
i
dog accompanied every guest
i
.
b. *Every guest
i
[his
i
dog accompanied
e
i
].
d. In front of him
i
each participant
i
held
a candle.
(23)
a. *His
i
dog accompanied no boy
i
to the
party.
b. *Who
i
did his
i
dog accompany t
i
to
the party?
c. *A party without every student
i
is in-
conceivable to him
i
.
d. *The rebellion against every tyrant
i
destroyed him
i
.
e. *According to everyone
i
he
i
is an un-
appreciated genius.
f. *Which of his
i
students did you per-
mit every teacher
i
to praise t?
In (22) a quantified NP may be interpreted
as an operator binding the pronoun. In all
these cases the quantified NP (QNP) c-com-
mands the pronoun at SS. As long as this
requirement is met, the linear order of pro-
noun and antecedent is irrevelant, and in
(22d) the QNP binds a pronoun to its left,
(assuming that the preposed PP adjoins to S,
in which case it is still c-commanded by the
subject). Note that in the case of wh-antece-
dent in (22b), the pronoun is bound, syntac-
tically, by the trace, which, in turn, is bound
by the wh-operator.
In (23), by contrast, the QNP does not c-
command the pronoun, and bound-variable
interpretation is, indeed excluded. Note that
the crucial factor in determining anaphora
options is c-command relations at SS, rather
than at deep structure (DS), as can be wit-
nessed by a comparison of (22e) and (23f).
While in DS the QNP c-commands the pro-
noun in both cases, only in (22e), where this
relation is preserved at SS, anaphora is per-
mitted.
Although the facts seem relatively clear, an
issue which generated much theoretical de-
bate is at which level of linguistic represen-
tation these facts are to be captured. One
stand is that the anaphora restrictions apply
only at SS (Reinhart 1976, 1983, Haik 1984).
The other assumes it must apply at LF
Logical Form (Chomsky 1976, Higgin-
botham 1980, Koopman & Sportiche 1981,
Safir 1984). The major motivation for the
second approach is that it is believed that in
the case of pronouns, whether they are inter-
preted as bound variables or not, depends on
the semantic interpretation of their antece-
dent: Only if it is interpreted as an operator,
as in the case of QNP and wh-antecedents,
can it bind a pronoun semantically. In all
other cases pronouns are interpreted under
the pragmatic-coreference interpretation. It
turns out, furthermore, that the latter is re-
540 VII. Semantik der Funktionswrter
approach, as well as many other anaphora
studies, has been that the interpretation of
the pronoun as a bound-variable depends on
the semantics of its antecedent. This assump-
tion is, in fact, mistaken. The relevant facts
indicating that bound variable interpretation
of anaphora is not restricted to quantified
antecedents have been around, in fact, for
quite a while, and they are usually labelled
sloppy identity phenomena following Ross
(1969b). To see what is at issue here, let us
consider the interpretation of (31).
(31) Charlie Brown
i
talks to his
i
dog and my
neighbor Max does too.
(32)
a. Pragmatic coreference interpretation:
Max talks to Charlies dog.
b. Bound variable interpretation:
Max talks to Maxs dog.
The interpretation of conjunctions like (31)
requires the copying of the missing predicate
from the first conjunct into the second. The
coindexing in the first conjunct indicates that
we are considering, at the moment, only the
case where the pronoun is intended to corefer
with Charlie Brown. Under this assumption
we still arrive at the two interpretations in
(32) for the second conjunct. The question is,
then, what is the source of the ambiguity in
the second conjunct, given the fact that the
first conjunct seems unambiguous. The an-
swer (given, e. g. by Keenan 1971a, Sag 1976,
Williams 1977 and Partee 1978b) is that the
first conjunct is, in fact, ambiguous. One in-
terpretation is that of pragmatic coreference,
under which a reference (Charlie Brown) is
fixed for the pronoun in the first conjunct.
Talking to Charlies dog is, then, the property
which is copied into the second conjunct,
yielding the interpretation (32a). The second
interpretation, however, requires treating the
pronoun as a bound variable. We need to
assume that the first conjunct contains some
open formula, x talks to xs dog, which is
satisfied by Charlie Brown in the first con-
junct and by Max in the second. This inter-
pretation is commonly obtained by deriving
a predicate x(x talks to xs dog) (Sag 1976,
Williams 1977). The predicate being copied,
then, is that of talking to ones own dog rather
than of talking to Charlies dog. This inter-
pretation (32b) is the one labelled sloppy
identity. A more successful name for it is, of
course, bound-variable interpretation, which
indicates that the identity at issue is not of
reference (or value) but, rather, of variables.
Arguments why this ambiguity cannot be
captured by copying or deleting at SS are
given in Bach & Partee (1980). They rest on
(29) *Who
i
(did his
i
dog accompany e
i
]?
(30)
a. *Who
1
did your criticizing him
1
de-
stroy e
1
?
b. Who
1
did your criticizing e
1
destroy
e
1
?
As for the actual mechanism allowing the
translation of the pronoun as a bound vari-
able in (26)(27), while filtering out the coin-
dexing in (28)(29) as uninterpretable, there
exist several proposals. The bijection principle
of Koopman & Sportiche (1981) states that
an operator can locally bind only one varia-
ble. Binding is used here in its syntactic sense,
of the definition in (13), and locally binds
iff there is no intervening node bound by a
and binding . In (26)(27) the operator
binds locally only its trace, since the coin-
dexed pronoun is bound by the trace. In
(28)(29) neither the trace nor the pronoun
bind the other, hence they are both locally
bound by the operator in violation of the
bijection principle. An alternative formula-
tion of the restriction is Safirs (1984) paral-
lelism constraint which states that all nodes
locally bound by an operator must be of the
same anaphoric type. This formulation has
the advantage of distinguishing the cases of
(30). While in both cases the operator locally
binds two anaphors, the parasitic-gap case
in (30b) is permitted. This is because both
anaphors are empty nodes, while in (30a) one
is a pronoun.
In any case, we should note that in the
case of QNPs, both LF constraints are equiv-
alent, empirically, to a constraint requiring
that the antecedent binds the pronoun syn-
tactically at SS, since precisely in these cases
the pronoun will not be locally bound by the
operator at LF (though they are not precisely
equivalent in the case of wh-antecedents as
we shall see directly). However, the fact that
in the SS of (26) the pronoun is syntactically
bound, while in (28) it is not, plays no role
in this approach because of the theoretical
assumptions we surveyed above. I will
procede to present the alternative approach,
arguing that the interpretation of anaphoric
elements as bound variables is dependent
solely on their surface-structure relation to
their antecedent, i. e. that within the frame-
work assumed here the relation of syntactic
binding at SS is all we need to capture this
interpretation.
3.2Bound-Variable Anaphora With
Definite Antecedents
As we saw, the basic assumption of the LF
23. Pronouns 541
(37) Even Linda is fed up with her husband.
(38)
a. Most people are fed up with Lindas
husband.
b. Most women are fed up with their
(own) husbands.
Sentence (37) presupposes either (38a) or
(38b). The presupposition in (38a) is derived
from the pragmatic interpretation of the
anaphora in (37), and (38b) is derived from
its bound variable interpretation.
Such examples show that the ambiguity of
definite NP anaphora is independent of dis-
course deletion. Although this ambiguity may
not be noted in isolation, once the appropri-
ate context is supplied it becomes clear, and
in section 4 we will observe a few more ex-
amples. However, the ellipsis context is the
clearest case where the ambiguity always sur-
faces. Therefore, it is convenient to use such
contexts as tests for whether a given anaphora
case has the bound variable interpretation or
not.
Our next step will be to observe that the
bound interpretation is possible precisely un-
der the same structural conditions assumed
for bound variable anaphora with quantified
antecedents, namely, when the antecedent
syntactically binds the pronoun at SS. The
studies of sloppy identity concentrated only
on one type of discourse context that of
VP ellipsis as in (31). To see the full range of
this interpretation, we need to look at other
types of discourse ellipsis, as in (39). (Such
constructions usually allow several construals
of the deleted part, and the one intended here
is indicated in brackets.)
(39)
a. We asked Linda
i
to read her
i
paper
and Lucy too (i. e. and we asked Lucy
... too).
b. Christopher brought Winni
i
a nice jar
of honey on his
i
birthday and Felix
too (i. e. and he brought one to Felix
too).
c. You could probably find Charlie
i
in
his
i
room right now, but not Snoopy
(i. e. but you could not find Snoopy
...).
d. In his
i
spaceship Solo
i
found a sus-
picious object and Skywalker (did)
too.
In all the sentences of (39) the bound variable
interpretation is possible, e. g. the second con-
junct in (39a) can mean that we asked Lucy
to read Lucys paper and in (39b) that Chris-
topher bought Felix honey on Felixs birth-
day. It will be recalled that this interpretation
the fact that the pronoun-interpretation in
ellipsis structures is more restricted than in
their non-elliptic counterparts. E. g. the non-
elliptic version in (34) allows all anaphora
construals in (a)(c). However, the elliptic
(33) allows only the construals (a) and (b).
(33) After Max insulted his wife Ben did too.
(34) After Max insulted his wife Ben insulted
his wife (too).
a.Max Max
b.Max Ben
c.Ben Max
If (33) was analyzed either as a SS deletion
on (34), or as a SS copy of the predicate,
prior to coindexing of the pronoun, there
would be no way to exclude the interpretation
(c). A surface-structure analysis will fail also
to account for the cases we turn to directly
in (40), where coreference is permitted but the
sloppy interpretation, is nevertheless impos-
sible.
What we have seen, then, is that definite
NPs may enter bound anaphora relations
and that this interpretation of pronouns is,
therefore, independent of the semantic status
of the antecedent. The ambiguity of the first
conjunct in (31) is not noticeable if the sen-
tence occurs alone, since the two interpreta-
tions happen to be equivalent, under normal
conditions. Possibly, this would explain why
the bound anaphora interpretation of definite
NP anaphora has been overlooked by the
mainstream of anaphora studies or perhaps
dismissed as strictly a discourse phenomenon.
It would be interesting, therefore, to observe
that it is possible to find cases where the two
interpretations are distinguishable indepen-
dently of discourse deletion.
When the quantifier only is involved, as in
(35), the two interpretations differ in their
truth conditions.
(35) Only Winnie
i
thinks he
i
is smart.
(36)
a. Nobody but Winnie thinks Winnie is
smart.
b. Nobody but Winnie thinks himself
smart.
Under the pragmatic interpretation, (35) en-
tails (36a). Under the bound variable inter-
pretation, it is thinking oneself to be smart
(x(x thinks x is smart)) which is attributed
to Winnie only, i. e. (36b) is entailed. It is
clearly possible for one interpretation to be
false while the other is true.
In other cases, the two interpretations yield
different (pragmatic) presuppositions for the
sentence:
542 VII. Semantik der Funktionswrter
bound anaphora, there is no difference be-
tween quantified and definite antecedents
both can bind a pronoun (in the sense of
binding a variable) and in precisely the same
syntactic environments. The difference be-
tween them is only that definite NPs allow
pragmatic coreference in addition. This, how-
ever, follows from the fact that pragmatic
coreference involves a direct assignment of
reference to a pronoun. If there is a definite
NP around, its reference can be assigned to
a given pronoun even if it is not bound by
that NP. Since quantified NPs do not have
a reference, they cannot provide a reference
to an unbound pronoun.
What this means, then, is that, contrary to
the common assumption, the general or ba-
sic anaphora interpretation shared by all
types of NPs is the bound variable interpre-
tation, and the grammar must specify, first,
the conditions for this type of interpretation.
The exceptional case which is affected by se-
mantic properties of the antecedent is the case
of pragmatic coreference, and not, as previ-
ously believed, bound variable anaphora.
3.3The Interpretative Procedures
We have seen, then, that the question when
can a pronoun be interpreted as a bound
variable is a syntactic issue, independent of
the interpretation of the antecedent: whenever
a pronoun is syntactically bound, it is inter-
pretable as a bound variable. What this
means, is that the syntactic relation of binding
has a unified semantic interpretation as var-
iable-binding, i. e. under the appropriate syn-
tactic conditions all anaphoric elements are
interpreted in the same way (with the excep-
tion of pronouns which allow, in addition,
also for referential interpretation). Let us see
this in more detail.
As we saw in section 2, in the case of
obligatory anaphors the sentences are inter-
pretable only if the anaphor is syntactically
bound (under the appropriate further condi-
tions). It is easy to observe now that in all
these cases the different anaphors have the
same interpretation as bound variables. In the
case of wh-traces this is necessary, indepen-
dently, since the antecedent is interpreted as
an operator. That the coindexing of R-pro-
nouns has only the bound variable interpre-
tation can be witnesses by the following con-
texts:
(42)
a. I talked to Lucy about herself and to
Nora too.
requires an open formula, or predicate, in the
first conjunct (e. g. Christophers buying x
honey on xs birthday), which is later satisfied
by the argument in the second conjunct. In
all cases, the antecedent in the first conjunct
c-commands the pronoun, just as it does in
the VP-deletion cases like (31), where the an-
tecedent is the subject.
Now let us consider some cases where the
bound variable interpretation is not possible.
(40)
a. Her
i
dog talks to Lucy
i
, when he is
in a good mood, and to Linda too.
b. The rebellion against Java the Hut
i
bothered him
i
and the rebellion
against the other tyrant (did) too.
c. People from the southern planet
i
de-
serted it
i
, and people from the western
planet (did) too.
d. According to Winnie
i
, he
i
is the
smartest creature on earth, and ac-
cording to Charlie too.
In all these cases anaphora is permitted in the
first conjunct. However, placing them in the
ellipsis context shows clearly that the anaph-
ora relation here is only of the pragmatic type,
since the second conjunct cannot have the
bound interpretation. (The second conjunct
does not have the meaning that Lindas dog
talks to Linda in (40a). Likewise, (40b) does
not entail that the other tyrant was bothered
by the rebellion against him and (40d) does
not mean that according to Charlie, Charlie
is smart.) These are precisely the structures
of the type we have been discussing in (23)
where the antecedent does not c-command
the pronoun. We saw there that although
pragmatic coreference is permitted with defi-
nite NPs, as in (24), when the antecedent is
quantified bound anaphora is not possible.
Returning to the cases like (33)(35)
which show the ambiguity independently of
context, we may observe that here too, this
ambiguity will not show up when the ante-
cedent does not c-command the pronoun.
(41)
a. Only the most devoted groupies of
Winnie
i
think he
i
is smart.
b. Even the jokes about Nora
i
do not
discourage her
i
.
The anaphora in these sentences is only prag-
matic. (41a) cannot entail that for no person
x, except for Winnie, the groupies of x think
that x is smart, and (41b) does not presuppose
that for most people jokes about them do not
discourage them.
We may conclude that, with respect to
23. Pronouns 543
should be stated as optional in the case of
pronouns.)
The next LF procedures must introduce
the operator binding the variables. How this
is done depends on our general theoretical
assumptions concerning semantic interpreta-
tion. It is possible, e. g. to introduce a -
operator equally in all the cases of variable
binding and interpret quantified and unquan-
tified NPs alike. In a framework assuming
QR as an LF formation rule, it would be
argued that, first, all NPs are raised and
adjoined to S. When the NP is quantified, its
quantifier is interpreted as the operator, as in
(47). In other cases, where no operator is
available, a -operator is introduced to bind
the variables, as in (48). I follow here the LF
analysis assumed in GB for quantified NPs.
This, however, is only for convenience. Ob-
viously a unified analysis can be given to
(47)(48).
(47) Every x (man x) (x considers x smart).
(48) Lucy (x (x worships xs car))
(= x(x worships xs car) (Lucy).)
In any case, the index translation procedure
applies prior to the other LF formation rules.
For this reason, although after QR the quan-
tifier in (46a) will both c-command the pro-
noun and have it in its scope, the pronoun
can no longer be translated as a variable
bound by it.
This means, then, that we do not need any
special LF mechanism to block anaphora in
(46) and in the similar cases of quantified NP
anaphora discussed in section 3.1. These cases
just obey the general restriction on bound-
variable interpretation. However, the cases of
wh-movement deserve more attention. Look-
ing again at (30a), repeated in (49a), we may
note that while the LF mechanism discussed
in section 3.1 blocks this sentence, it is not,
in fact, excluded by our SS analysis, since the
wh antecedent binds both e and the pronoun
at SS.
(49)
a. *Who
i
did your criticizing him
i
de-
stroy e
i
?
b. Who
i
did your criticizing e
i
destroy
e
i
?
(50) Which paper
i
did you reject e
i
without
reading e
i
?
(51) *Who
i
did you criticize him
i
?
However, the inappropriateness of (49a) is
explained on different grounds. As we noted
in section 2.2, pronouns in English cannot be
locally COMP-bound, since English does not
allow resumptive pronouns. In (49a) the wh
b. Only Churchill remembers himself
giving the speech about blood, sweat,
toil and tears. (Fodor 1975: 134)
The second conjunct of (42a) has only the
bound-variable interpretation (I talked to
Nora about Nora) which means that the R-
pronoun in the first conjunct does not have
a referential interpretation. (42b) will not be
false if many people remember Churchill giv-
ing the speech, since Churchill is the only one
remembering that about himself. So the only
interpretation of the sentence is that xs re-
membering x giving the speech is true only of
Churchill, i. e. the bound-variable interpreta-
tion. It is easy to reconstruct identical ex-
amples with bound PROs, and as for NP-
traces, although they are not interpreted at
the present as bound variables, there is no
principled reason for why not.
In the framework we assumed so far, then,
all we need to capture the facts of bound-
variable anaphora is a translation procedure
for bound coindexing. The first step can be
trivially stated as in (43), whose operation is
illustrated in (44)(46).
(43) Index translation (IT):
For any given NP a, replace the index
of and every anaphoric element bound
syntactically by (given definition (13)),
with identical variables.
(44)
a. SS: Every man
i
considers himself
i
smart.
b. IT: Every man
x
considers x smart.
(45)
a. SS: Lucy
i
worships her
i
car.
b. IT: Lucy
x
worships xs car.
(46)
a. SS: His
i
dog accompanied each boy
i
.
b. IT: inapplicable.
(43) applies to all and only bound anaphoric
elements (pronouns, R-pronouns, empty
nodes). Since anaphoric elements lack lexical
content, their only content is their index, i. e.
the variable left after (43) applies. In the case
of lexical NPs the variable is written as an
NP index, at this stage. Recall that we are
assuming free base-indexing, so the unbound
coindexing in (46) can be generated. But since
the pronoun is not bound, it cannot be trans-
lated by (43). Hence, the coindexing in (46a)
has no interpretation. Similarly, if a full NP
happens to be bound, (43) is inapplicable. (In
the next section I argue that the pragmatic
interpretation of pronouns requires no coin-
dexing, i. e. that pronouns can be coreferential
precisely when they happen not to be bound.
However, if one wants to capture pragmatic
coreference also by means of coindexing, (43)
544 VII. Semantik der Funktionswrter
the first is not appropriately bound syntacti-
cally, it has no interpretation at all, while the
optional type (pronouns) can still be inter-
preted referentially in this case, and, as such,
it may still corefer with other referential NPs.
It is this exceptional case that we turn to now.
4. Pragmatic Coreference With
Pronouns
As we saw in the discussion of sentences (24)
and (25), some of which are repeated below,
pragmatic coreference is permitted also in en-
vironments which do not allow bound-vari-
able anaphora, as in (52), but, on the other
hand, it is also not free. As illustrated in (53),
it is impossible when the pronoun c-com-
mands its antecedent.
(52)
a. His
i
dog accompanies Christopher
i
everywhere.
b. The rebellion against Java the Hut
i
destroyed him
i
.
(53)
a. *He
i
adores Christopher
i
s dog.
b. *I informed him
i
that Winnie
i
is not
so smart.
(54) ?Christopher
i
hates Christopher
i
s dog.
To capture these facts, the GB framework of
Chomsky (1981) assumes that the pragmatic
interpretation of coreference is also governed
by coindexing mechanism, and the grammar
should guarantee that coindexing be allowed
in (52) and blocked in (53). For this purpose,
a further binding condition is formulated,
which follows the analysis proposed in Rein-
hart (1976).
(55) Binding-Condition C.
Non-anaphoric NPs must be free.
It would be recalled that free means un-
bound (and not uncoindexed). Given the def-
inition of binding in (13), (55) blocks coin-
dexing only when the full NP is c-commanded
by the NP it is coindexed with. I. e. it blocks
coindexing in both (53) and (54), but allows
it in (52). If this approach is taken, this means
that syntactic coindexing has two interpreta-
tions: The one we assumed so far applies to
all anaphoric elements, if the coindexing is
defined as bound, and translates them as
bound variables. (In the case of pronouns,
this procedure is optional.) The other applies
only to coindexed pronouns, whether their
coindexing is bound or not, and assigns the
pronoun a fixed referential value identical to
that of the coindexed NP. Though things may
antecedent in COMP is the only possible
binder for the pronoun, so this sentence is
excluded in precisely the same way as (51).
(This contrasts with a sentence like Who
i
e
i
kissed his
i
dog, where the pronoun has e as a
non-COMP binder.) If another e node occurs
in the pronouns position of (49a), as in (49b)
and (50), anaphora is permitted. This indi-
cates that the position of the anaphor is in-
deed a position which allows its translation
as a variable, provided that the appropriate
form of anaphor is selected. In languages
which allow resumptive pronouns in wh-ques-
tions, structures with the properties of (49a)
were found to be acceptable (Engdahl 1983).
A similar account for the inappropriateness
of cases like (49a) in English was proposed in
Chao & Sells (1983).
We may conclude, then, that the various
typological distinctions of anaphoric elements
play a role only in the syntax. Their type
determines in what environments they are
allowed to be coindexed, or syntactically
bound. In the system I assumed here, this
syntactic distribution is regulated by the in-
dexing mechanism, the binding conditions A
and B in (18), and the other language-specific
restrictions on the distribution of anaphors.
But, obviously, other means to capture the
same distribution-facts are conceivable. How-
ever, once the syntax allows their bound coin-
dexing, the different anaphores are indistin-
guishable semantically and they are all inter-
preted as bound variables. Obviously, in a
formal (logical) language, we would not need
various types of expressions to denote the
same type of bound variable in different con-
texts. This is so, however, since such lan-
guages are free of considerations of process-
ing and communication. In natural language,
the different ways available to mark bound
variables help the processing of the sentence,
since it eases the search for an antecedent.
E. g., when encountering an R-pronoun, we
know that its antecedent should be searched
in its GC, while a pronoun instructs us to
search elsewhere, but not in COMP, since a
COMP antecedent (in English) is signalled by
an empty node. However, there is no reason
to expect that these syntactic distinctions, nec-
essary for processing, should be reflected in
the semantics, where all anaphoric elements
function alike as bound variables.
The one interpretative choice effected by
the type of anaphor, though, is that of prag-
matic coreference which is possible only with
pronouns. As we saw, the difference between
obligatory and optional anaphors is that if
23. Pronouns 545
(57)
a. Winnie
i
ate his
i
honey.
b. # He ate Winnies honey.
c. # Winnie ate Winnies honey.
(58)
a. The doctor told Felix
i
that he
i
was
sick.
b. # The doctor told him that Felix was
sick.
(59)
a. Felix
i
pities himself
i
.
b. # Felix
i
pities Felix
i
.
(60)
a. A party without Winnie is inconceiv-
able for him.
b. A party without him is inconceivable
for Winnie.
c. A party without Winnie is inconceiv-
able for Winnie.
(61)
a. Those who know Lucy adore her.
b. Those who know her adore Lucy.
In the structures of (57)(59), the (a) sen-
tences allow bound anaphora, since one NP
c-commands the other and the second is an
anaphoric element. In the (b) sentences the
same structures are used, but the bound
anaphora option is avoided by choosing a
different placement of the NPs. In this case
the hearer will infer that the reason for avoid-
ing this option is that the speaker did not
intend coreference. In the structures of (60)
(61), on the other hand, the grammar does
not allow for bound anaphora, regardless of
the possible placements of pronouns and an-
tecedents, since neither of the relevant NPs
c-commands the other. In this case, then, the
hearer can infer nothing about the referential
intentions of the speaker from the structure
and placement of the NPs, and whether the
NPs are intended as coreferential or not can
be determined on the basis of discourse in-
formation alone. Pragmatic coreference, then,
is an available option.
The pragmatic strategy (56), then, can do
the work of principle C, so this principle need
not be incorporated in the grammar. This
would mean that the only interpretable coin-
dexing in the grammar would be in the cases
of bound anaphora, as described in Section
3. If we continue to assume a free indexing
system, as assumed before, the NPs of the
(b) sentences in (57)(59) may still end up
accidentally coindexed, as well as the NPs in
(60)(61). However, this coindexing will
have no interpretation, the way the transla-
tion procedure (43) is stated. Intended core-
ference, then, is not controlled by coindexing,
but rather, two free NPs can be pragmatically
coreferential, subject to the strategy (56).
So far, we saw that a pragmatic analysis
of coreference is equivalent to the syntactic
be simply left at that, I believe that there are
several theoretical problems with this ap-
proach to pragmatic coreference, some of
which pointed out by Evans (1980). However,
rather than listing them here, I would like to
present the alternative view proposed in var-
ying versions in Dowty (1980), Engdahl
(1980) and Reinhart (1983), arguing that the
distribution of pragmatic coreference is not
governed at all by the grammar.
As a starting point, we may note that non-
coreference arises precisely in the same syn-
tactic environments that bound anaphora is
possible in: when a given NP c-commands the
other than, if the c-commanded NP is an
anaphoric element it can be bound by the
first and if it is not an anaphoric element,
condition C (55) prevents its coindexing, i. e.
prevents a coreference interpretation. There
is no reason, however, why this complemen-
tary distribution should be captured by the
grammar, since it follows from Gricean re-
quirements on rational use of the language
for communication. The relevant maxim here
is manner: be as explicit as the conditions
permit. In a rational discourse we would ex-
pect that if a speaker has the means to express
a certain idea clearly and directly he would
not choose, arbitrarily, a less clear way to
express it. When syntactically permitted,
bound anaphora is the most explicit way
available in the language to express corefer-
ence, as it involves direct dependency of the
pronoun upon its antecedent for interpreta-
tion. So, if this option is avoided, we may
conclude that the speaker did not intend co-
reference. An approximation of the pragmatic
strategy governing decisions about intended
coreference is stated in (56).
(56)
a. Speakers strategy: When a syntactic
structure you are using allows bound-
anaphora interpretation, then use it
if you intend your expressions to co-
refer, unless you have some reasons
to avoid bound-anaphora.
b. Hearers strategy: If the speaker
avoids the bound anaphora options
provided by the structure he is using,
then, unless he has reasons to avoid
bound-anaphora, he did not intend
his expressions to corefer.
The way this strategy works is illustrated in
(57)(61). Coindexing is used here for bound
anaphora; italics indicate intended corefer-
ence, and the symbol # indicates pragmatic
inappropriateness.
546 VII. Semantik der Funktionswrter
larity between the two cases, which was in-
corporated into the non-coreference rules has
been often challanged (see Evans 1980; Bach
& Partee 1980). The strategy (56) also does
not explicitly distinguish these two cases.
However, since what is involved here is the
ease of identifying coreference when the
bound-anaphora option needs to be avoided,
it is generally the case that the reference of a
full NP is more easily recoverable than the
reference of a pronoun, so, independently of
(56), it should be easier to identify intended
coreference of two indentical full NPs than
of a pair of a pronoun and a full NP which
do not allow bound-anaphora interpretation.
A possible objection that might be raised
against the pragmatic approach is that the
intuitions in the core cases of non-corefer-
ence, such as (53) or (57b), are as substantial
as intuitions about ungrammaticality in the
standard cases, so they should be considered
ungrammatical. However, such arguments
should be taken with due caution. However
clear our intuitions are here, what we cannot
have intuition about is whether our judge-
ment of such sentences is due to our grammar
or to our pragmatic strategies. On such issues,
only the theory can decide. To take a familiar
example, our intuitions tell us that the sen-
tences in (63) are problematic.
(63)
a. The dog that the man that the woman
invited liked disappeared.
b. *Here is the dog that the man who
owns t disappeared.
They may be judged as ill-formed or unpro-
cessable. However, our intuitions could not
tell us that in (63a) the difficulty is due to
processing problems, while in (63b) it is be-
cause the sentence violates a condition on
movement, i. e. that (63a) is grammatical
while (63b) is not. We are used to viewing
(53) and (57b) as ungrammatical. Possibly, if
twenty years ago the questions of anaphora
had been stated differently, our feelings con-
cerning their theoretical status would have
been quite different.
5. Semantic Approaches to Anaphora
While in the approach I assumed here the
distribution of anaphora is restricted by SS
properties, there are alternative approaches
which derive it from semantic considerations.
The most developed proposal is Bach & Par-
tee (1980), but Boschs (1983) analysis is along
the same lines.
analysis in yielding the same results. Next, we
should look at some advantages of the first
over the second.
A crucial difference between the syntactic
and the pragmatic analysis of intended core-
ference is that the latter predicts that the cases
violating principle C should be possible if
there are good pragmatic reasons to avoid
bound anaphora while still intending corefer-
ence. As we saw in Section 3.2, such cases
may not be easy to find, since the two inter-
pretations are normally equivalent. However,
in (39)(40) we observed environments
where the two interpretations can easily be
distinguished. Precisely in these environ-
ments, serious counter-examples for the syn-
tactic analysis have been pointed out by
Evans (1980).
(62)
a. Everyone has finally realized that Os-
car is incompetent. Even he has fi-
nally realized that Oscar is incompe-
tent. (Evans 1980: 52)
b. Only Winnie thinks Winnie is smart.
c. Only Churchill remembers Churchill
giving the speech about blood, sweat,
toil, and tears (see (42)).
d. I know what Ann and Bill have in
common. She thinks that Bill is ter-
rific and he thinks that Bill is terrific.
(Adopted from Evans 1980: 49)
Although the structures used in these exam-
ples allow bound anaphora, it is not the in-
terpretation which is intended. E. g. in (62a)
it is realizing Oscars incompetence which is
at issue. The pragmatic entailment is not that
every one else considers himself incompetent,
but that they consider Oscar to be so. As we
saw, when only is involved, the pragmatic and
the bound interpretations differ in truth con-
ditions, therefore no special context is needed
to justify the avoiding of bound anaphora in
(62b) and (62c). In (62d) it is the property of
finding Bill terrific which is taken to be shared
by Ann and Bill, while it is possible that xs
finding x terrific is true of Bill but not of
Ann. The strategy (56) has, then, a principled
way to account for cases like (62): pragmatic
coreference is permitted since the speaker has
a reason to avoid bound anaphora.
Another problem that can be resolved if
non-coreference is pragmatically determined
is that, in general, violations of condition C
which involve two full NPs are much easier
to process than violations involving a pro-
noun and a full NP. (See, e. g. (54) above.)
Lasnik (1976)s observation about the simi-
23. Pronouns 547
of the order of the pronoun and the antece-
dent. E. g. coreference is permitted in the cases
of (67): Although the pronoun in these sen-
tences is part of the argument expression and
the antecedent is in the function expression,
the pronoun is not itself the argument, and
(65) prohibits coreference only if the pronoun
is the direct argument.
Condition (65) is largely equivalent, em-
pirically, to condition C, but it is believed to
follow from the general restriction on inter-
pretation (64), rather than from syntactic con-
siderations. We should note, however, that
given the specific formulation of (65) this is,
in fact, not true (as observed also by Dowty
1980): Although condition (65) yields the cor-
rect coreference results for (67), the results
themselves do not conform to condition (64),
since in, e. g. (67a), the reference of the ar-
gument expression the teacher she liked can-
not be identified without identifying the ref-
erence of the pronoun it contains, and this
pronoun depends on the antecedent (Lucie)
occuring in the function expression. Identi-
fying the argument expression, then, is de-
pendent on the function expression, in vio-
lation of (64). It turns out, therefore, that
(65), as formulated, is just an alternative syn-
tactic rule required specifically for corefer-
ence. Although it applies at the level of logical
syntax, it does not follow from any inde-
pendent semantic considerations. Further-
more, if (65) is correct, (64) cannot be as-
sumed as a condition on interpretation, al-
though it seems to be intuitively correct.
However, it appears that this problem with
(65) is just a reflection of the problems we
observed already for any theory attempting
to account for pragmatic coreference within
the grammar. A functional semantic account
will fare better with capturing the distribution
of bound pronouns. Suppose that, as I argued
above, the only type of referential dependency
assumed in the grammar is that of variable
binding. Then it is indeed true that no case
of bound-anaphora violates the functional
principle (64), since if the pronoun is embed-
ded in the argument expression, as in (67), it
cannot be syntactically bound (c-com-
manded) by its antecedent. The anaphora
condition on this type of dependency is, how-
ever, stricter than predicted by (64), and it
should be stated as in (68).
(68) An anaphoric element can depend for
its interpretation on another NP, a, only
if it occurs in a function expression,
which takes as argument.
This approach attempts to explain the
anaphora restrictions on the basis of the func-
tional principle in (64) proposed by Keenan
(1974), for a wider range of cases.
(64) The reference of the argument expres-
sion (in a function-argument expression)
must be determinable independently of
the meaning or reference of the function
expression.
Bach and Partee follow the then prevailing
theoretical assumption that the major issue
in the theory of anaphora is that of explaining
coreference rather than bound anaphora.
Consequently, their condition (65) is formu-
lated to capture this phenomenon, and they
too, assume that some special mechanism is
needed for quantified NP anaphora. (An ad-
ditional condition is assumed for R-pro-
nouns.)
(65) A pronoun cannot be stipulated corefer-
ent to an NP that occurs in a constituent
interpreted as a function with the pro-
noun as argument (Bach & Partee 1980,
principle B).
Since in this framework anaphora condi-
tions such as (65) operate on semantic rep-
resentations, i. e. at the level of logical syntax,
their application depends crucially upon the
precise assignment of function-argument rep-
resentation to sentences of natural language.
The framework assumes, crucially, that the
logical representations of sentences are iso-
morphic with their syntactic structures. E. g.
in a basic SVO sentence like Lucie kissed Max
the full VP (kissed Max) is translated as a
function taking the subject as argument. I. e.
only one of the possible logical representa-
tions of this sentence is viewed as its logical
structure (see Keenan & Faltz 1978 for details
of the isomorphism-hypothesis). Given this
analysis, condition (65) will allow coreference
in (66a), but not in (66b), where the argument
is the pronoun and the antecedent occurs in
the function expression.
(66)
a. (Lucie) (kissed her husband)
b. *(She) (kissed Lucies husband)
(67)
a. (The teacher she liked) (gave Lucie
an A)
b. (Jokes about him) (upset Max)
c. (Her parents) (are convinced that Lu-
cie is a genius)
Similar to condition C of the binding theory
of GB, (65) determines only when referential
dependency is impossible, and in all cases not
blocked by it, coreference is free, regardless
548 VII. Semantik der Funktionswrter
where they are not equivalent are those which
are, independently, problematic for both ap-
proaches the cases where the semantic rep-
resentations seem not to be isomorphic to
surface structure, such as some PP structures
discussed in Bach (1979).
The choice beteen these two approaches to
anaphora cannot, therefore, be based on em-
pirical grounds (except for the area of un-
solved problems just mentioned), and it de-
pends on the overall theoretical picture of
natural-languages, and specifically on the no-
tion of explanation. While the SS approach
explains the conditions on anaphora by re-
strictions on the mental processing of syntac-
tic trees, the semantic approach seeks to de-
rive them from universal logical considera-
tions, though the logical representations as-
sumed are, themselves, probably to be ex-
plained by the same account of the mental
processing of syntactic trees.
6. Short Bibliography
Aoun/Sportiche 1981 Bach 1979 Bach/Partee
1980 Bosch 1983 Chao/Sells 1983 Chomsky
1973 Chomsky 1976 Chomsky 1981 Chomsky
1982 Dowty 1980 Engdahl 1980 Engdahl
1983 Evans 1980 Fodor 1979 Haik 1984 Hig-
ginbotham 1980 Jackendoff 1972 Keenan
1971a Keenan 1974 Klima 1964 Koopman/
Sportiche 1981 Langacker 1966 Lasnik 1976
May 1977 Partee 1978b Reinhart 1976 Rein-
hart 1983 Reinhart 1986 Ross 1967 Ross
1969b Safir 1984 Sag 1976 Williams 1977
Tanya Reinhart, Tel Aviv (Israel)
This condition will alow dependency, or bind-
ing in (66a), but not in (66b) or (67) (and the
difference between the last two should be
captured by pragmatic inference along the
lines of Section 4). While (68) does not follow,
logically from (64), it does not violate it.
Given the logical syntax assumed by this
semantic approach, (68) is equivalent to the
surface-structure condition (requiring that the
antecedent c-commands the pronoun), in all
structures examined in the previous sections.
This is so, because the isomorphism require-
ment yields the result that an NP is always
interpreted as an argument of a function con-
sisting of the interpretation of all and only
the nodes it c-commands. Crucially, condition
(68) (just like (65)), can operate only if we
assume such isomorphic representations. E. g.
to capture the binding in (69), it must apply
to the function-argument analysis (70a), but
not to the logically equivalent representation
(70b). If the condition was changed so as to
allow dependency also in (70b), it could not
be prevented from applying to (72b) as well,
which would, incorrectly, allow anaphora in
(71).
(69) Every man
i
brought his
i
dog
(70)
a. (bring his dog) (every man)
b. (Bring) (every man, his dog)
(71) *His
i
dog bit every man
i
(72)
a. (bit every man) (his dog)
b. (bit) (his dog, every man)
Obviously, a restriction stated on function-
argument structures of this type should be
equivalent to a restriction stated directly on
SS in terms of c-command. The few cases
24. Anaphern im Text
d. h. ihre Referenz hngt stets von einem an-
deren Ausdruck im Text, dem Antezedens, ab,
wobei dieses der Anapher nicht unbedingt
vorausgehen mu. Diese Beziehung der Ana-
pher zu ihrem Antezedens wird im Folgenden
einfach anaphorische Beziehung genannt,
der Redegegenstand, auf den das Antezedens
referiert, Antezedensreferent.
Anaphorische Ausdrcke werden bis heute
in der Sprachphilosophie und Sprachwissen-
schaft fast ausschlielich satzorientiert behan-
delt. Untersuchungsgegenstand ist dabei ein-
mal die Art der anaphorischen Beziehung
(vgl. Cooper 1979, Partee 1978b). Sie kann
1. Die Probleme
2. Diskursreprsentation und Diskursreferenten
3. Prinzipien der Anapherninterpretation
3.1 Personalpronomen
3.2 Possessivpronomen
3.3 Kennzeichnungen
3.4 Demonstrativa
4. Literatur (in Kurzform)
1. Die Probleme
Anaphern sind, das ist ihre charakteristische
Eigenschaft, relativ referierende Ausdrcke,
24. Anaphern im Text 549
ihre quantifikationelle Kraft erst durch den
Kontext zugewiesen bekommen (in Abhn-
gigkeit z. B. von einem Allquantor oder Kon-
ditionalsatz all-, sonst existenzquantifizie-
rend). Aktuelle Anstze zeigen allerdings, da
die Einfhrung von Diskursreprsentationen
allein zur Behandlung dieser speziellen Pro-
bleme nicht zwingend ist (vgl. z. B. Reinhart
1987, Rooth 1987, aber auch schon Heim
1982).
Eine zentrale charakteristische Eigenschaft
textueller Anaphern hat in der Linguistik bis-
her kaum Beachtung gefunden (mit Aus-
nahme z. B. von Smaby 1978, vgl. Abschnitt
3): Eine Anapher in einem gegebenen Text
bezieht sich in der Regel auf ein ganz be-
stimmtes (im Normalfall das vom Autor in-
tendierte) Antezedens. Es stellt sich die Frage,
wie sich dieses Phnomen erklren lt und
ob bzw. welche Eigenschaften der Textstruk-
tur und der Textbedeutung dabei eine Rolle
spielen.
Meist wird in diesem Zusammenhang auf
das allgemeine Problem der Mehrdeutigkeit
sprachlicher Ausdrcke verwiesen. Die Auf-
lsung (Desambiguierung) anaphorischer
Ausdrcke im Text wird auf die Plausibilitt
des jeweiligen inhaltlichen Zusammenhangs
der uerungen im Kontext zurckgefhrt.
Als Beleg dafr werden oft Beispiele der fol-
genden Art angegeben:
(4)
a. Die Stadtrte verweigerten den De-
monstranten die Erlaubnis, weil sie
Gewalt befrchteten.
b. Die Stadtrte verweigerten den De-
monstranten die Erlaubnis, weil sie
Gewalt befrworteten.
In der Kognitionspsychologie, besonders aber
in der Knstlichen-Intelligenz-Forschung
(KI) ist daher u. a. die These vertreten wor-
den, da der Sprecher/Hrer hauptschlich
aufgrund spezifischer Inferenzen gesttzt auf
Textinhalt und Hintergrundwissen (insbeson-
dere das Alltagswissen) den Bezug anaphori-
scher Ausdrcke bestimmt (z. B. Charniak
1972).
Von Linguisten wird diese Ansicht oft ge-
teilt und damit begrndet, da die Auflsung
anaphorischer Ausdrcke nicht auf der
sprachlichen, sondern primr kognitiv deter-
minierten Ebene der uerungsbedeutung zu
beschreiben ist, bei der die abstrakte gram-
matische Struktur relativ zu einem gegebenen
Kontext ihre aktuelle, konzeptuell ausge-
prgte Interpretation erhlt. So kommt etwa
Kamp 1983 zu der Schlufolgerung:
auf Referenzidentitt, der Koreferenz von
Anapher und Antezedens, beruhen, wobei die
Anapher die Referenz des Antezedens wieder
aufgreift. Diese Auffassung hat wohl im Hin-
blick auf pronominale Ausdrcke zu deren
Namen gefhrt. Die anaphorische Beziehung
kann auf paralleler lexikalischer Belegung
und damit auf der Identitt von Eigenschaf-
ten beruhen wie etwa bei den sogenannten
Faulheitspronomen (pronoun of laziness):
(1) Paul, der seinen Gewinn der Kirche
schenkte, war glcklicher als Peter, der
ihn wieder verspielte.
Hier ergibt sich die intendierte Interpretation
nicht durch Einsetzung des gleichen Referen-
ten, sondern durch Substitution des gleichen
Prdikats in der semantischen Reprsenta-
tion der Anapher (y (das x:Gewinn(x) und
R(x,y)); zu den Possessivpronomen vgl. 3.2).
Eine dritte Mglichkeit besteht in der Inter-
pretation der Anapher als gebundene Varia-
ble.
Ein anderer wichtiger Untersuchungsge-
genstand betrifft die Bestimmung prinzipieller
Einschrnkungen syntaktischer und semanti-
scher Art fr die Mglichkeit anaphorischer
Beziehungen im Satz. Hierzu gehrt auch die
Annahme, da Pronomen, die sich auf quan-
tifizierte Nominalphrasen beziehen und als
gebundene Variable zu interpretieren sind, in
deren Bereich auftreten mssen. Der Bereich
des Quantors kann prinzipiell nicht ber die
jeweilige Satzgrenze hinausgehen. Da eine
solche Einschrnkung zu grundstzlichen
Schwierigkeiten fhrt, zeigen die folgenden
Beispiele, deren Problematik letztlich schon
in der Antike diskutiert wurde (vgl. Egli
1981):
(2) Irgendwann kommt ein Auto
1
, und es
1
wird dich mitnehmen.
(3) Wenn jemand
1
einen Esel
2
besitzt, dann
schlgt er
1
ihn
2
.
Die indefiniten Nominalphrasen lassen sich
weder als Existenzquantoren im blichen Sinn
mit den Pronomen als gebundene Variable
deuten, denn sie binden diese ber die Satz-
grenze hinaus, noch lt sich die anaphori-
sche Beziehung ber Koreferenz erklren,
denn diese Nominalphrasen haben berhaupt
keine bestimmte Referenz (schon gar nicht,
wenn man die spezifische Lesart ausschliet).
In der neueren Semantik-Forschung werden
zur Behandlung dieser Probleme sogenannte
Diskursreprsentationen eingefhrt (vgl.
Abschnitt 2). Dort werden u. a. indefinite No-
minalphrasen als freie Variable gedeutet, die
550 VII. Semantik der Funktionswrter
(7) Max hatte sich mit Gnter auf dem
Marktplatz vor der Eisbude verabredet.
Als er
1
am Fischstand vorbeikam, sah er
2
Egon, einen alten Schulkameraden, mit
seinem Vater. Er
3
stand vor der Eisbude
und kaufte gerade ein Eis.
In diesem Text ist es kaum mglich fr den
Leser, er
1
nicht auf Max zu beziehen, oder er
1
und er
2
verschiedene Antezedentien etwa
Max und Gnter zuzuordnen. Fr das Pro-
nomen er
3
ist Gnter als Antezedens kaum
zugnglich, obwohl eine solche Beziehung
vom Inhalt des Textes aus gesehen erwartbar
wre.
Diese Flle fr Beschrnkungen anapho-
rischer Beziehungen deuten darauf hin, da
die Interpretation von Anaphern im Text in
hohem Mae von satzbergreifenden struk-
turellen Faktoren abhngig ist. Fr die Deu-
tung von Textanaphern stellt sich daher die
zentrale Frage, ob sich diese Faktoren auf
einheitliche Prinzipien zurckfhren lassen
und von welcher Art diese sind. Von einer an-
deren Perspektive aus gesehen ist dies die
Frage, ob sich die Bedeutung von Anaphern
ohne Rekurs auf Texte vollstndig verstehen
und beschreiben lt.
2. Diskursreprsentation und
Diskursreferenten
Eine beraus interessante Entwicklung neue-
rer semantischer Untersuchungen zu dem mit
den Beispielen (2) und (3) angesprochenen
Problem des anaphorischen Bezugs im Zu-
sammenhang mit der Deutung indefiniter No-
minalphrasen (insbesondere Kamp 1981a,
Heim 1982) besteht darin, da sie letztlich
alle ber das traditionelle statische Kompe-
tenzmodell der Wahrheitsbedingungen-Se-
mantik hinausgehen hin zu dynamischen pro-
zeorientierten Interpretationsmodellen.
Die Lsungsvorschlge gehen nicht mehr
primr von der in der Semantik immer be-
tonten prinzipiellen Unterschiedlichkeit von
referentiellen Termen und Quantorenphrasen
(bzw. gebundenen Variablen) aus, sondern be-
tonen umgekehrt deren gemeinsame Eigen-
schaften: Quantorenphrasen referieren auf
dieselbe Art von Gegenstnden wie referen-
tielle Terme, sie kommen in denselben syntak-
tischen Umgebungen vor wie diese, und man
kann sich anaphorisch auf diese Gegenstnde
beziehen; nur sind es eben keine bestimmten
Individuen, auf die referiert wird. Referen-
tielle Terme, Quantorenphrasen, allgemein
alle Nominalphrasen bezeichnen zunchst
This is typical of the various cues that help us
select the intended antecedent for an anaphoric
pronoun from among a set of possible candidates.
Trying to give an explicit and comprehensive ac-
count of the spectrum of such cues would be tan-
tamount to axiomatizing all that language users
know, or assume, about the topics they discuss,
and in particular, about one of these topics, viz.
the world in which they live. To demand this of a
linguistic theory would not be reasonable.
(S. 89)
Diese Schlufolgerung erscheint einleuch-
tend, kann aber (wie man an der Analyse der
Pronomina in Kamp 1983 sieht, vgl. die Kritik
in Pinkal 1986a) zu inadquaten Beschrn-
kungen und Ergebnissen der linguistischen
Theorie fhren. Sprachlich strukturelle Fak-
toren, die fr die Anapherninterpretation re-
levant sind, finden sich nicht nur auf der
satzgrammatischen, sondern auch auf der
textuellen Ebene und sind von grerem Ge-
wicht als Beispiele wie (4) zunchst erwarten
lassen wrden. Einen ersten Eindruck fr die
Relevanz textstruktureller Eigenschaften
kann man sich anhand von Texten verschaf-
fen, in denen inhaltliche mit strukturellen
Faktoren konkurrieren:
(5) An den Chef der 3. Kompanie! Ich habe
mich drei Jahre zu den Soldaten verpflich-
tet. Jetzt werde ich Vater. Kann ich das
noch rckgngig machen?
(6) If an incendiary bomb drops near you,
dont lose your head. Put it in a bucket
and cover it with sand.
Das Demonstrativpronomen das hat, wenn es
anaphorisch auf Sachverhalte referiert, als
Antezedens einen vorausgehenden Teil des
Textes, der insbesondere den direkt vorange-
henden Satz miteinschlieen mu. Vom Inhalt
her gesehen erscheint uns jedoch in (5) allein
mit der Wahl des zweiten Satzes als Anteze-
dens eine plausible Interpretation herstellbar
zu sein. Ganz hnlich verhlt es sich in Bei-
spiel (6): das Pronomen it bezieht sich struk-
turell auf die Nominalphrase your head, deren
Referent besonders im Vordergrund steht (s. u.
Abschnitt 3.1). Vom Inhalt her betrachtet, ist
jedoch an incendiary bomb als Antezedens
plausibler.
Strukturelle Eigenschaften von Texten
scheinen als Einschrnkungen mglicher ana-
phorischer Bezge ebenso streng zu gelten wie
etwa syntaktisch-konfigurationelle auf der
Satzebene (vgl. Reinhart 1983), man betrachte
dafr das folgende Beispiel:
24. Anaphern im Text 551
phorische Beziehungen, in denen sie eine
Rolle spielen, verallgemeinern; eine notwen-
dige Bedingung fr den anaphorischen Bezug
besteht dann darin, da die Anapher inner-
halb der Lebensspanne des Diskursreferenten
liegen mu, den das Antezedens bezeichnet.
Diese Bedingung beruht letztlich doch, wie
man sieht, auf den jetzt allerdings verall-
gemeinerten Begriffen der Bindung (einer
Variablen durch einen Operator) und des Sko-
pus, wie sie uns aus der klassischen logischen
Semantik vertraut sind.
Der oben betonte dynamische Aspekt in
der Etablierung von Diskursreferenten be-
steht nun darin, da etwa Nominalphrasen
bei der Textinterpretation zentral in ihrer
Funktion, neue Redegegenstnde einzufhren
(z. B. durch eine indefinite NP) oder sich auf
schon bekannte zu beziehen (z. B. durch ein
Pronomen), betrachtet werden. Einem gege-
benen Text wird zunchst eine (semantische)
Text- oder Diskursreprsentation zugeordnet,
die alle Diskursreferenten enthlt, ber die
der Text redet, mit all den Aussagen, die der
Text ber sie macht. Die Diskursreprsenta-
tion enthlt somit das anaphorische Potential
eines Textes. Die Lebensspanne von Diskurs-
referenten wird dann bei Kamp beispielsweise
ber Bedingungen der Zugnglichkeit zwi-
schen Teilreprsentationen eingeschrnkt.
Damit knnen nichtakzeptable anaphorische
Beziehungen wie in (8) ausgefiltert werden.
(8) *Wenn jemand jeden Esel
1
besitzt, dann
schlgt er ihn
1
.
Bei diesem Ansatz werden syntaktische Struk-
turen nicht mehr direkt, sondern unter Zwi-
schenschaltung der Diskursreprsentation
modelltheoretisch gedeutet. Diese soll genau
die Information enthalten, die die Vernde-
rung des Adressatenwissens ausmacht. Se-
mantische Interpretation geht hier in eine
pragmatisch orientierte Theorie der Kontext-
vernderung ein (fr eine weitere Motivation
des Ansatzes vgl. Heim 1982: 396 ff.).
Mit diesen Vorstellungen werden die satz-
semantisch und modelltheoretisch ausgerich-
teten Anstze mit textorientierten Modellen
aus der KI (die z. B. Kamp explizit als Aus-
gangspunkt seiner berlegungen mitanfhrt)
verknpft. Fr die letzteren steht die Kon-
struktion von Diskursmodellen (d. s. Dis-
kursreprsentationen), die von vornherein als
sehr reich strukturiert angesehen werden, im
Mittelpunkt. Sie bilden die Grundlage fr die
Beschreibung und Erklrung anaphorischer
Beziehungen im Text:
einfach Redegegenstnde, sogenannte Dis-
kursreferenten.
Eine indefinite Nominalphrase etwa fhrt
einen Diskursreferenten in einen Text ein,
ber den dann weitergeredet, auf den also
anaphorisch Bezug genommen werden kann,
eventuell in kontextuell eingeschrnkter
Weise, wenn etwa die betreffende Nominal-
phrase im Bereich eines anderen Quantors
oder Operators vorkommt. So kann man sich
sogar, wie das folgende Beispiel zeigt (aus
Heim 1982: 69), auf hypothetische Gegen-
stnde, die durch universell quantifizierte
Ausdrcke wie every copy bezeichnet wer-
den, ber einen lngeren Textabschnitt hin-
weg anaphorisch beziehen, solange der spe-
zifische (hier: modale) Kontext der Rede nicht
verlassen wird:
(8) Every copy, must meet the specifications
in the handbook. It
1
must be on 50% rag
bond paper, and it
1
has to include the title
page and the vita.
Was sind nun Diskursreferenten (auch Dis-
kursentitten genannt)? In Karttunens rich-
tungsweisendem Aufsatz Discourse refe-
rents von 1976 (vgl. dazu auch die Errte-
rung und Verallgemeinerung von Heim 1982)
werden sie als diejenigen Redegegenstnde in
einem Text charakterisiert, auf die mit geeig-
neten Anaphern Bezug genommen werden
kann. Die unterschiedlichen Formen der sie
bezeichnenden Ausdrcke und der jeweilige
Kontext beeinflussen dabei die Lebens-
spanne eines Diskursreferenten. So bezeich-
net etwa ein Eigenname einen permanenten
Diskursreferenten in einem Text, d. h. einen
Redegegenstand, auf den man sich whrend
des gesamten Textes anaphorisch beziehen
kann. Allquantifizierte Nominalphrasen be-
zeichnen hingegen in der Regel Redegegen-
stnde, die auerhalb des Skopus des Quan-
tors aufhren zu existieren, es sei denn, dieser
ist von einem hheren Quantor bzw. Operator
wie etwa in (8) abhngig; dann legt dessen
Skopus ihre Lebensspanne fest.
Diskursreferenten sind nicht mit Referen-
ten in der wirklichen Welt zu verwechseln. Es
sind zunchst einfach Redegegenstnde, Ge-
genstnde der Textwelt, d. h. wirkliche oder
hypothetische Entitten, ber die ein Text
Aussagen macht (erst in zweiter Linie, etwa
in einer modelltheoretischen Interpretation
(s. u.), werden sie als Gegenstnde in der wirk-
lichen Welt interessant). Der Begriff der Ko-
referenz lt sich dann in diesem Sinn auf
Diskursreferenten und entsprechende ana-
552 VII. Semantik der Funktionswrter
Hauptsatz vor Nebensatz und in den Ele-
mentarstzen aufgrund der Rangfolge Sub-
jekt vor Objekt.
Der erste Kandidat, fr den sich nach die-
ser Prferenzordnung eine relevante Interpre-
tation ergibt, wird als Antezedens gewhlt
(wobei die Unterscheidung von relevanten
und nicht-relevanten Informationen als ge-
geben vorausgesetzt wird). Smaby gibt dazu
folgendes Beispiel:
(9) John tickled Bill. He squirmed.
Nach den strukturellen Prferenzfaktoren fr
diesen Text wrde das Subjekt des ersten Sat-
zes John als Antezedens von he gewhlt wer-
den mssen. Der Faktor der Relevanz hat
jedoch ein greres Gewicht, deshalb wird in
diesem Fall der nchste in Frage kommende
Kandidat Bill als Antezedens gewhlt.
Da dieser Ansatz nicht adquat ist und
nur in ganz eingeschrnkten Fllen zu akzep-
tablen Ergebnissen fhrt, mag das folgende
Beispiel illustrieren:
(10)
a. Hans spielte mit seinem kleinen Bru-
der. Er kitzelte ihn unter den Fu-
sohlen.
b. Er lachte wie verrckt.
c. Dann lachte er wie verrckt.
In (10a,b) ist auch wenn das Prdikat
lachen normalerweise fr Personen relevant
ist, die gekitzelt werden, und nicht fr die-
jenigen, die kitzeln eine Prferenz fr das
Subjekt des Vorsatzes (und dessen Anteze-
dens) Hans als Antezedens von er in (10b)
ausgedrckt. Der Faktor der Parallelitt von
morphologischer Form und syntaktischer
Funktion steht hier in Konkurrenz zum Fak-
tor der Relevanz (und deswegen erscheint uns
der Text auch als nicht besonders akzeptabel).
Ersetzt man (9b) durch (9c), dann wirkt sich
in (9a,c) die durch dann markierte Struktur
des Textes als Abfolge von Ereignissen
zentriert um einen besonders thematischen
Diskursreferenten (vgl. Abschnitt 3.1) zu-
stzlich aus und erzwingt durch die Hufung
struktureller Faktoren in Bezug auf eine be-
stimmte Interpretation die Wahl von Hans als
Antezedens des Pronomens.
In Smabys Ansatz spielen satzbergrei-
fende, textuelle Faktoren, wie man sieht,
kaum eine Rolle. Es lt sich nicht ausma-
chen, ob und wie die betrachtete Menge der
Einzelfaktoren abgesehen vom ausschlag-
gebenden Gewicht des Relevanzkriteriums
aufgrund eines einheitlichen Prinzips zusam-
menwirken. Im Folgenden werden textorien-
One objective of discourse is to enable the speaker
to communicate to a listener a model s/he has of
some situation. Thus the ensuing discourse is, on
one level, an attempt by the speaker to direct the
listener in synthesizing a similar model.
Such a discourse model can be viewed as a struc-
tured collection of entities, organized by the roles
they fill with one another, the relations they par-
ticipate in, and so on.
A speaker uses a definite anaphor to refer to an
entity already in his or her discourse model ... In
doing so, the speaker assumes (a) that on the basis
of the discourse so far, a similar entity will be in
the listeners model ..., and (b) that the listener will
be able to access and identify that entity via the
given definite anaphor, where different types of
anaphor will provide different clues.
Discourse entities may have the properties of in-
dividuals, sets, events, actions, states, facts, beliefs,
hypotheses, properties, generic classes, typical set
members, stuff, specific quantities of stuff, and so
on. (Webber 1981: 283)
3. Prinzipien der
Anapherninterpretation
Zahlreiche Untersuchungen von Psycholo-
gen, KI-Forschern und Linguisten belegen die
Bedeutsamkeit verschiedenartiger Einzelfak-
toren fr die Interpretation bzw. Auflsung
(Desambiguierung) anaphorischer Ausdrcke
im Text, wie z. B. die Prferenz fr ein An-
tezedens in Subjektfunktion oder in gleicher
syntaktischer Funktion wie die Anapher, fr
den zuletzt genannten in Frage kommenden
Antezedenskandidaten (recency) oder fr
den Kandidaten, der aufgrund des inhaltli-
chen Zusammenhangs aufgrund des All-
tagswissens besonders plausibel ist wie
z. B. in (4) (vgl. Caramazza et al. 1977, 1979,
Hirst 1981, Karmiloff-Smith 1980, Smaby
1978).
Smaby 1978 etwa kombiniert fr die Inter-
pretation von Personalpronomen einige dieser
Faktoren in einer semantics of informing,
die sich vor allem durch Einbeziehung der
Desambiguierung anaphorischer Ausdrcke
im Kontext von herkmmlichen Satzseman-
tiken unterscheidet. Hauptkriterien sind der
syntaktische Kontext des Pronomens im Text
und die Relevanz (vergleichbar dem Faktor
der Plausibilitt) der jeweiligen Interpreta-
tion. Der syntaktische Kontext liefert eine
Wohlordnung der in Frage kommenden An-
tezedenskandidaten allgemein aufgrund des
Faktors der Letzterwhntheit und speziell in-
nerhalb von Stzen aufgrund der Anordnung
24. Anaphern im Text 553
die in Spaltstzen extraponierten Einheiten
oder in bezug auf die erwarteten Foki das
Subjekt von there-insertion-Stzen, gefolgt
von Diskursreferenten in der Rolle des
theme.
Bei der Analyse des ersten Satzes eines
gegebenen Textes wird der (nach der Rang-
folge) erste Kandidat aus der Menge der er-
warteten Foki als aktueller Diskursfokus und,
wenn vorhanden, das Agens des Satzes als
aktueller Aktorfokus gewhlt. Mit jedem
neuen analysierten Satz werden in Abhn-
gigkeit vom Bezug der im Satz vorkommen-
den Anaphern die aktuellen Foki entweder
besttigt oder durch andere Foki aus den
jeweils vorhandenen mglichen oder vergan-
genen Foki ersetzt.
Die Regeln fr die Interpretation von Per-
sonalpronomen (der 3. Person) beziehen sich
dabei nicht nur auf die verschiedenen Fokus-
mengen, sondern enthalten darber hinaus
morphologische und syntaktische (konfigu-
rationelle) Beschrnkungen, semantische Be-
schrnkungen (Selektionsrestriktionen bezg-
lich semantischer Rollen), textstrukturelle Be-
schrnkungen (Beschrnkungen des Zugriffs
auf alte und mgliche Foki) und pragmati-
sche Beschrnkungen (Kompatibilitt mit
dem vorhandenen und vorausgesetzten Wis-
sen).
Die beiden Zugriffsbeschrnkungen sollen
kurz charakterisiert werden. Die erste betrifft
die vergangenen Foki: Ein vergangener Fokus
kann Antezedens einer Anapher werden,
wenn zwischen seiner Spezifizierung im Text
und der Anapher kein passender anderer An-
tezedenskandidat vorkommt. Die zweite Be-
schrnkung gilt fr die mglichen Foki: Po-
tential foci have a short lifetime. If a potential
focus does not become the focus as the result
of interpreting the sentence following the one
in which the potential is seen, it is dropped
as a potential focus. (Sidner 1979: 96).
Die Hauptregeln von Sidner fr Personal-
pronomen (es gibt einige Regeln fr Sonder-
flle) lassen sich folgendermaen wiederge-
ben: Kommt ein Pronomen nicht in der
Agensrolle vor, whle, wenn die Beschrn-
kungen dies erlauben, den Diskursfokus als
Antezedens; anderenfalls prfe nacheinander
in der gleichen Weise die mglichen Foki, den
Aktorfokus und schlielich die Elemente des
Fokusstacks. Kommt ein Pronomen in der
Agensrolle vor, prfe analog zunchst den
Aktorfokus, dann die mglichen Aktorfoki
(belebte mgliche Foki), den Diskursfokus,
die restlichen mglichen Foki und schlielich
tierte Anstze vorgestellt, wobei wiederum die
definiten Anaphern, insbesondere die Prono-
men (der 3. Person) im Vordergrund stehen.
3.1Personalpronomen
Der bisher umfassendste Ansatz zur Aufl-
sung von Anaphern im Text stammt von Sid-
ner 1979 aus dem Bereich der KI-Forschung.
Er ist analyseorientiert und versucht, die re-
ferentielle Progression in einem gegebenen
Text, letztlich das Verstehen eines Textes zu
rekonstruieren. Fokussieren und Anapho-
risieren werden dabei als zwei verwandte zen-
trale Prozesse der Textorganisation angese-
hen. Einheiten im Fokus (nicht zu ver-
wechseln mit dem blichen Begriff des Satz-
fokus, vgl. etwa Jacobs 1984a) sind Diskurs-
referenten, die je nach Textverlauf gerade im
Vordergrund stehen, d. h.: Diese Foki stellen
relativ zum jeweils betrachteten Satz zum
Diskursstand die gerade aktuellen Dis-
kursthemen (oder Diskurstopiks) dar. Dies
sind im allgemeinen die durch anaphorische
Wiederaufnahme im Vorsatz besonders the-
matisierten Redegegenstnde. Auf der ande-
ren Seite werden Anaphern, z. B. Personal-
pronomen, interpretiert, indem die gerade ak-
tuellen Foki als Antezedenskandidaten pr-
feriert werden.
Sidner unterscheidet in der Menge der in
einem Text vorkommenden Diskursreferenten
relativ zum Diskursstand die Mengen
der aktuellen Foki, der vergangenen Foki und
der mglichen Foki. Die Menge der aktuellen
Foki besteht aus dem Aktor-Fokus ein
Diskursreferent in der Agens-Rolle und
dem primren Fokus, dem Diskursfokus, ein
Diskursreferent, der normalerweise die Rolle
des theme (des affizierten Objekts) ein-
nimmt. Die vergangenen Foki sind Diskurs-
themen, die nicht mehr aktuell sind (anapho-
risch nicht mehr aufgenommen werden) und
in der Reihenfolge ihres Vergehens fr eine
eventuelle sptere Wiederaufnahme in einem
Fokusstack gespeichert werden. Die mgli-
chen Foki sind die neben den aktuellen Foki
im Satz vorkommenden restlichen Diskurs-
referenten; eine besondere Rolle spielen dabei
die erwarteten Foki als die mglichen Foki
des ersten Satzes in einem Text, aus denen die
Anfangsbelegungen fr die aktuellen Foki als
Default-Werte gewhlt werden.
Die mglichen Foki sind nach Prferenzen
geordnet, die sich aufgrund von syntaktischen
Konstruktionen, semantischen Rollen und
der Oberflchenreihenfolge der Konstituen-
ten ergeben. Besonders bevorzugt sind z. B.
554 VII. Semantik der Funktionswrter
Restriktionen, nicht einmal die pragmatische,
greift: da Lena zu Franz gegangen ist, fhrt
zu keiner Inkonsistenz hinsichtlich des vor-
ausgesetzten Wissens.
Diese Inadquatheiten des Sidnerschen
Modells lassen sich darauf zurckfhren, da
das Antezedens eines Pronomens letztlich nur
durch ein einziges positives Kriterium charak-
terisiert ist, nmlich Textfokus zu sein. Des-
halb lt sich in Fllen wie (12) eine Wahl
zwischen verschiedenen in Frage kommenden
Antezedenskandidaten, die den Beschrnkun-
gen gengen, nicht treffen.
Was die Lokalittsbeschrnkung fr mg-
liche Foki angeht, die von Pinkal 1986 fr
Personalpronomen (im Deutschen), die sich
auf unbelebte Gegenstnde beziehen, ber-
nommen und auf die alten Foki ausgedehnt
wird, so ist sie in dieser Allgemeinheit mit den
empirischen Daten nicht vereinbar; die Sach-
lage ist komplizierter: Ein Pronomen kann
sich auch ber mehrere Stze hinweg auf
einen mglichen Fokus als Antezedens bezie-
hen, wie man an folgendem Beispiel sehen
kann:
(13) Achim wollte seiner Mutter etwas ganz
Besonderes schenken. Er hatte einen
kostbaren Ring aus Platin mit einem
groen Rubin gekauft. Rund um den
Edelstein waren in mehreren Ringen
kleine glitzernde Diamanten angeordnet.
Sie sollte sehen, wie dankbar er ihr war.
Auch die Einschrnkung Pinkals ist nicht un-
bedingt zwingend, wie (14) illustriert:
(14) Maria hatte endlich den Alfa bekom-
men, den sie sich so lange gewnscht
hatte. Er war mit roten Ledersitzen und
Stereoanlage ausgestattet. Sie hatte
lange sparen mssen. Ihre Tante hatte
ihr heimlich einen betrchtlichen Zu-
schu gegeben. Jetzt aber stand er glit-
zernd vor der Tr, und alle bewunderten
ihn.
Die mglichen Foki verhalten sich also zu-
nchst einmal hnlich wie die alten Foki. Es
bleibt zu untersuchen, ob nicht beide Restrik-
tionen im Hinblick auf spezifische Eigen-
schaften der Diskursorganisation weiter be-
stimmt werden mssen. So spielt beispiels-
weise wie man an (15) im Gegensatz zu
(13) sehen kann der Faktor, wann Dis-
kursthemen weiterbestehen, gewechselt, ab-
geschlossen oder begonnen werden, eine nicht
unwesentliche Rolle fr die Mglichkeit des
Zurckgreifens auf nicht mehr aktuelle Dis-
kurstopiks (man vergleiche dazu den Begriff
die Elemente im Fokusstack. Das erste Fo-
kuselement, das auf diese Weise den Filter der
Beschrnkungen passiert, wird Antezedens
des Pronomens.
Die anaphorische Bezugnahme in Texten
erfolgt also nach Sidner wesentlich durch das
Zusammenspiel von Satz- und Textinforma-
tion, wobei der Satz durch anaphorische Wie-
der- bzw. Neuaufnahme von Redegegenstn-
den das dynamische Element im Fokussieren
von Diskursreferenten darstellt. Neben den
als Filter wirkenden negativen Beschrnkun-
gen gibt es ein zentrales positives Kriterium
dafr, Antezedens eines Pronomens zu sein:
Der bezeichnete Diskursreferent mu re-
lativ zum Diskursstand im Fokus sein, er
mu ein mglichst salientes Diskursthema
darstellen (allgemeine Formulierungen dieser
Hypothese findet man beispielsweise auch bei
Grosz 1977 und Kantor 1977).
Bei nherer Betrachtung weist Sidners An-
satz allerdings mehrere Mngel auf (vgl.
Pause 1986). Zunchst erscheint die Betonung
der Rollen Agens und Thema (abgesehen
von der fehlenden expliziten Rollendefinition)
bei der Fokusbildung im Text und die ent-
sprechende Aufteilung der aktuellen Foki in
Aktor- und Diskursfokus ad hoc. In einem
Text knnen prinzipiell mehr als zwei Dis-
kursreferenten gleichzeitig in einem Satz ana-
phorisch oder sogar pronominal wiederauf-
genommen werden, und welcher im nchsten
Satz besonders thematisiert und etwa als Sub-
jekt genannt wird man vergleiche Beispiel
(11) , kann von ganz unterschiedlichen
Faktoren abhngen.
(11) Er hat es ihm fr sie gegeben. Sie freute
sich sehr darber.
Aufgrund dieser Einschrnkung versagt das
Sidnersche Verfahren immer dann, wenn im
Text ein Fokuswechsel (von einem aktuellen
auf einen neuen Fokus) erfolgen mte, die
Beschrnkungen aber diesen Wechsel nicht
erzwingen:
(12) Als die Mutter sah, da Franz nicht
mehr vom Rauchen loskam, schickte sie
ihn zum Therapeuten in die Hauptstadt.
Lena war zu ihm gegangen, als sie Lie-
beskummer hatte.
Nach Abarbeitung des ersten Satzes von (12)
ist die Mutter Aktorfokus, Franz Diskursfo-
kus und Therapeut potentieller Fokus. Die
Anapher ihm im zweiten Satz mu nach den
Regeln auf den aktuellen Diskursfokus Franz
bezogen werden und das eigentliche Anteze-
dens bleibt unbercksichtigt, weil keine der
24. Anaphern im Text 555
UF: fr die Diskursreferenten aus UA, die
in SL anaphorisch wiederaufgenom-
men sind; dies sind die jeweils aktuellen
Diskursthemen, die Diskursfoki relativ
zu SA;
UP: fr die vergangenen und mglichen
Diskursfoki aus UA (relativ zu SA), die
aus allen SA vorausgehenden Stzen
stammen und nicht aus UF sind;
UE: fr die mglichen Diskursfoki aus UP,
die (anders als bei Sidner) von SL an-
gefangen bis zum Auftreten der Ana-
pher vorkommen; dies sind die erwar-
teten Diskursfoki relativ zu SA, d. h.
diejenigen Diskursreferenten, die typi-
scherweise an einem Fokuswechsel be-
teiligt sind.
Ein anaphorisches Personalpronomen wird
normalerweise bezglich derjenigen Diskurs-
referenten interpretiert, die bis zum Vorkom-
men des Pronomens im Text aktiviert worden
sind.
Prototypisch fr die anaphorische Bezie-
hung eines Personalpronomens sind folgende
Eigenschaften: Das Antezedens bezeichnet
den gerade salientesten Diskursfokus aus UF,
das Pronomen ein (salientes) Topik des Sat-
zes, in dem es vorkommt (d. h. es gehrt zum
Satzhintergrund und nicht zum Satzfokus,
vgl. Lambrecht 1986). Dies ist der unmar-
kierte Fall der pronominalen Anapher (vgl.
dazu den Begriff der topic continuity in
Givn 1983, S. 55 und allgemein Hauenschild
1985).
Im markierten Fall, z. B. beim Fokuswech-
sel im Text, oder bei Ambiguitt (wenn z. B.
der Unterschied in der Salienz der in Frage
kommenden Diskursreferenten aus UF nicht
signifikant genug ist) werden zunchst die
Elemente aus UF u UE fr die Antezedens-
bestimmung in Betracht gezogen und, wenn
dies ergebnislos ist, schlielich die brigen
Elemente aus UP. Dabei fallen, neben der
Salienz der Diskursreferenten, zustzliche
Kriterien ins Gewicht (vgl. Pause 1988a).
Dazu zhlen besonders die hnlichkeit und
Parallelitt von Eigenschaften von Anteze-
dens und Pronomen wie z. B. Ausdrucksiden-
titt, gleiche syntaktische Funktion, gleiche
semantische Rolle, Argument eines Prdikats
mit gleicher oder hnlicher Bedeutung zu sein,
oder die hnlichkeit der lokalen thematischen
Kontexte (die konzeptuelle Nhe der invol-
vierten Szenen) usw. (vgl. dazu auch Weber
1986). Man erkennt leicht, da bei Hinzu-
nahme dieser Faktoren die Schwierigkeiten,
des focus space bzw. context space bei
Grosz 1977 bzw. Reichmann 1986)
(15) Achim hatte sich vorgenommen, seiner
Mutter etwas Besonderes zu schenken.
Heute wollte er mit Stefan in die Stadt,
um Geld von seinem Sparbuch abzuhe-
ben. Stefan aber hatte keine Lust. Bei
der Hitze ging er lieber zum Baden. ?Sie
wrde sehen, wie dankbar Achim ihr
war.
Was den Charakter der textstrukturellen Be-
schrnkungen angeht, so sind sie sicher nicht
mit den oben (in Kap. 2) erwhnten eher text-
semantischen Zugnglichkeitsbeschrnkun-
gen vergleichbar, sondern lassen sich, da es
um die Reihenfolge der zu prfenden Ante-
zedenskandidaten einer Anapher geht, wahr-
scheinlich ber die Salienz der entsprechenden
Diskursreferenten ausdrcken. Dies knnte
z. B. durch Angabe eines Schwellenwerts ge-
schehen, dessen Unterschreitung dazu fhrt,
da bestimmte Redegegenstnde relativ zu ih-
rem Vorkommen im Text zu deaktiviert, d. h.,
fr eine nachfolgende pronominale Wieder-
aufnahme von vornherein nicht salient genug
sind.
Eine Lokalittsbeschrnkung fr mgliche
Diskurstopiks in bezug auf die Interpretation
von Personalpronomen ist (im Gegensatz zu
den definiten Beschreibungen) sicher in vielen
Fllen adquat, nur kann sie nicht absolut
gelten (vgl. unten den Begriff des erwarteten
Diskursthemas).
Bevor wir abschlieend das bisher ber die
Interpretation anaphorischer Personalprono-
men Gesagte verallgemeinern und ergnzen,
fhren wir folgende Abkrzungen ein:
SA: zur Bezeichnung des Satzes (clause), in
dem die Anapher vorkommt;
SL: fr den Satz, der SA vorausgeht;
UA: fr die Diskursreferenten, die bis zum
Vorkommen der Anapher im Text er-
whnt worden sind und die relativ
zu ihrem jeweils betrachteten Vorkom-
men im Text zugnglich und gege-
benenfalls bei Pronomen mor-
phologisch kongruent sind (der akti-
vierte Teil des Diskursuniversums U).
Sie bilden untereinander eine partielle
Rangfolge entsprechend ihrer Salienz,
die sich aufgrund der Art und Weise
ihres Vorkommens im Text (syntakti-
sche Funktion, semantische Rolle,
Hufigkeit, etc.) ergibt (vgl. Pause
1988b, 1990, Asher/Wada 1988);
556 VII. Semantik der Funktionswrter
phrasen im Matrixsatz (etwa auf das Subjekt
in (17)).
3.2Possessivpronomen
Einschlgige Untersuchungen zu den anapho-
risch verwendeten Possessivpronomen gibt es
kaum. Sie werden meist im Zusammenhang
mit Personalpronomen abgehandelt, wiewohl
sie sich als in Nominalphrasen eingebettete
Konstituenten schon syntaktisch z. B. bezg-
lich konfigurationeller Beschrnkungen ganz
anders verhalten, man vergleiche (18a) und
(18b) im Gegensatz zu (18c) und (18d); nur
als gebundene Anaphern, mit quantifizierten
Nominalphrasen als Antezedentien, verhalten
sie sich analog, wie die Beispiele (18e) und
(18 f) zeigen (vgl. dazu Reinhart 1983,
S. 177 ff).
(18)
a. *Peter
1
hat ihn
1
verraten.
b. *Er
1
glaubt, da Peter
1
einfach faul
war.
c. Sein
1
bester Freund hat Peter
1
ver-
raten.
d. Sein
1
Vater glaubt, da Peter
1
einfach
faul war.
e. *Seine
1
Frau liebt jeden Mann
1
.
f. *Wenn eine Frau jeden Mann
1
liebt,
dann kennt sie seinen
1
Charakter
nicht.
Possessivpronomen sind definite Pronomen,
die sowohl die Funktion des Artikels als auch
die Funktion des attributiven Genitivs ein-
nehmen. Eine Nominalphrase wie sein Haus
wird also als das Haus von ihm (oder: das
Haus, das ihm zugehrt) allgemein wie in
(19) interpretiert, wobei P das Possessivum
(im Beispiel: Haus), y den Possessor, d. h.,
den Referenten des jeweiligen Antezedens,
und R die Zugehrigkeitsrelation bezeichnet,
die durch die Eigenschaft P charakterisiert
ist.
(19) das x: P(x) und R(x,y)
Sidners Bemerkungen zu den Possessivpro-
nomen sind uerst knapp. Beschrnkungen
werden nicht explizit genannt; man kann aber
annehmen, da die fr die Personalpronomen
angegebenen textstrukturellen Beschrnkun-
gen und Konsistenzbedingungen auch fr die
Possessivpronomen gelten. Die Hauptregel
lautet folgendermaen:
The general rule for possessives can be formulated
as: if the discourse focus and actor focus were not
established in the same sentence of the discourse,
then the discourse focus is the co-specifier (if ac-
ceptable on the usual grounds); if the discourse
die anhand von Beispiel (12) diskutiert wur-
den, nicht mehr auftreten.
Parallelitt als strukturelles Merkmal spielt
u. a. auch bei der Interpretation von koordi-
nierten Ausdrcken, von Faulheitspronomen
und z. B. von Kontrastfoki im Satz eine wich-
tige Rolle (vgl. Lang 1987, allgemein auch
Hobbs 1979):
(16)
a. Peter
1
schlug Paul
2
und dann BE-
SIEGTE er
1
ihn
2
.
b. Peter
1
schlug Paul
2
und dann besiegte
ER
2
IHN
1
.
Im Falle der Gegenberstellung der Bedeu-
tungen von schlagen und besiegen wie in (16a)
ergibt sich eine parallele, im Falle der Paral-
lelitt wie in (16b) eine kontrastive Interpre-
tation der Pronomen.
Ein Modell fr die Resolution pronomi-
naler Anaphern mu also auf Vergleich und
Bewertung verschiedener spezifischer Eigen-
schaften von Antezedens und Pronomen be-
ruhen, unter Beachtung der grammatischen
und pragmatischen Beschrnkungen (vgl.
Hauenschild 1985, Pause 1986, Asher/Wada
1988). Die Bestimmung des Antezedens er-
folgt im allgemeinen nicht aufgrund deter-
ministischer Regeln, sondern mit Hilfe von
Prinzipien und Strategien (Heuristiken), die
zu einer mehr oder weniger groen Prferenz
eines Kandidaten unter mglichen Alternati-
ven fhren.
Ein vollstndiges Bild der Funktionsweise
pronominaler Anaphern wird sich erst auf-
grund weiterer linguistischer Untersuchungen
ergeben. So ist z. B. der Stellenwert textueller
Strukturen, wie sie sich bei temporalen, kau-
salen, etc. Relationen zwischen Stzen oder
Teiltexten zeigen vgl. die Beispiele (4) und
(10) bisher ungeklrt (zu Problemen des
Tempus im Diskurs vgl. z. B. Dowty 1986,
Partee 1984b und Buerle 1987 sowie Artikel
35).
Bestimmte lexikalisch bedingte Einschrn-
kungen mten ebenfalls in Betracht gezogen
werden: So thematisiert beispielsweise die fa-
kultative von-Ergnzung von Einstellungsver-
ben und verba dicendi den entsprechenden
Diskursreferenten. Damit ergeben sich starke
Einschrnkungen fr den Bezug anaphori-
scher Pronomen im Komplementsatz:
(17) Peter glaubt von Paul, da er unschlag-
bar ist.
Ein solches Pronomen kann sich, wenn es
z. B. wie in (17) die einzige passende Anapher
ist, nur auf diese Ergnzung als Antezedens
beziehen, nicht aber auf andere Nominal-
24. Anaphern im Text 557
3.3Kennzeichnungen
Nach der Analyse Lbners 1985a gehen wir
davon aus, da alle definiten Beschreibungen
hier wird nur die Komposition aus be-
stimmtem Artikel und (komplexem) Nomen
betrachtet funktional zu interpretieren sind
(vgl. zur Problematik besonders Hawkins
1978, Heim 1982, Kamp 1983, Lewis 1979a).
Der bestimmte Artikel drckt nach Lbner
Existenz und Nicht-Ambiguitt aus und ist
als Hinweis zu verstehen, da das folgende
Nomen als funktionales Konzept zu interpre-
tieren ist. Die Nomina werden nach ihrer Be-
deutung eingeteilt in solche, die sortale ob-
jektklassifizierende Konzepte (wie Mensch,
Buch, etc.) und solche, die relationale Kon-
zepte (wie Vater, Nachbar) bezeichnen und
Objekte zu anderen in Beziehung setzen.
Funktionale Konzepte sind dann solche, die
relationalen Konzepten genau einen Wert zu-
ordnen. Kennzeichungen sind nach Lbner
semantisch definit, wenn sie, unabhngig von
der Verwendungssituation, aufgrund ihrer Be-
deutung ein funktionales Konzept reprsen-
tieren, pragmatisch definit, wenn ihre Funk-
tionalitt wesentlich vom spezifischen Kon-
text abhngt.
Anaphorisch verwendete Kennzeichnun-
gen gehren demnach zu den pragmatischen
Definitiva. Sie beinhalten oft nur sortale In-
formationen, bestehen z. B. nur aus dem
Kopfnomen selbst; sie knnen aber auch sehr
komplex sein und mithilfe von Attributen
funktionale desambiguierende Verknpfun-
gen zu bereits gegebener Information eines
Textes enthalten (wobei eine Schwierigkeit
darin besteht, da z. B. Relativstze nicht im-
mer restriktiv, also distinktiv zu verstehen
sind, sondern oft zustzliche neue Informa-
tion ber den betreffenden Diskursreferenten
einfhren). Die Informativitt der Beschrei-
bung korreliert mit der Salienz des jeweiligen
Antezedensreferenten, d. h., je grer die in-
hrente Ambiguitt des anaphorischen Aus-
drucks (je inhaltsrmer die Beschreibung)
ist, um so grer mu die Salienz des Ante-
zedenzreferenten im Kontext sein.
Die Mglichkeit, durch anaphorische
Kennzeichnungen vorerwhnte Diskursrefe-
renten je nach Kontext beliebig exakt identi-
fizieren zu knnen, stellt schlielich auch die
charakteristische Eigenschaft dar, die Kenn-
zeichnungen von Personalpronomen unter-
scheidet. Deshalb drften Lokalittsbe-
schrnkungen oder andere (positive) Fakto-
ren, wie wir sie neben der Salienz fr Perso-
focus was unacceptable, the actor focus is checked
for acceptability and that failing, the potentiel dis-
course foci are considered; if both were established
in the same sentence, the use will be ambiguous.
(Sidner 1983: 308)
Die Bedingungen bezglich der nicht gleich-
zeitigen bzw. gleichzeitigen Etablierung von
Diskurs- und Aktorfocus im Text lassen sich
in der angegebenen Allgemeinheit empirisch
kaum halten:
(20)
a. Peter freute sich auf den Samstag.
Paul hatte ihn zum Essen eingeladen.
Er hatte ihm ein exotisches Mahl ver-
sprochen. Seine Knste in der asia-
tischen Kche waren bekannt.
b. Paul hatte Peter zum Essen eingela-
den. Er hatte ihm ein exotisches Mahl
versprochen. Seine Knste in der
asiatischen Kche waren bekannt.
Weder wrden wir in (20a) das Possessivpro-
nomen auf den Diskursfokus Peter beziehen,
noch erscheint uns der Bezug des Pronomens
in (20b) echt mehrdeutig, d. h. gleichgewichtig
sowohl mit Paul wie mit Peter als Antezedens
mglich zu sein.
Das Beispiel macht deutlich, da ein an-
deres wesentliches Kriterium fr die Interpre-
tation von Possessivpronomen in der Salienz
der jeweiligen im Text genannten, spezifischen
Zugehrigkeitsrelation liegt. Diese Relation
kann von verschiedener Art sein (vgl. Bond-
zio 1973): Eine Teil-Ganzes-Relation (seine
Augen), Besitzen-Relation (sein Geld), Pro-
duzieren-Relation (seine Schriften), Prdika-
tiv-Relation (ihre Klugheit), Verbalrelation
(ihre Abreise) oder eine assoziative Relation
(er verreist sein Zug) etc. (Es wre inter-
essant zu untersuchen, ob bei Vorliegen der
Verbalrelation die Parallelitt bzw. hnlich-
keit von Eigenschaften in bezug auf die je-
weiligen Argumentkasus von Antezedens und
Pronomen bei der Interpretation eine Rolle
spielen knnen).
Die anaphorische Beziehung von Posses-
sivpronomen beruht also im wesentlichen auf
zwei charakteristischen Eigenschaften des
Antezedens: Der entsprechende Diskursrefe-
rent ist das salienteste Element aus UF UE
bzw. aus UP (im unmarkierten Fall aus UF),
das den Beschrnkungen gengt und fr das
die Zugehrigkeitsrelation am relevantesten
ist (wobei der Begriff der Relevanz dem oben
angefhrten Begriff der konzeptuellen Nhe
von Kontexten entspricht).
558 VII. Semantik der Funktionswrter
zepts wird die betreffende Rolle, d. h. die Exi-
stenz des anderen Arguments als gegeben vor-
ausgesetzt. Das Antezedens einer Kontigui-
ttsanapher ist der Angabe fr Possessiv-
pronomen entsprechend der salienteste
Diskursreferent aus UF UE bzw. UP (im
prototypischen Fall aus UF), der zu dem von
der Anapher bezeichneten Diskursreferenten
in der jeweils ausgedrckten stereotypen Re-
lation steht.
Schwierigkeiten bieten assoziative Ana-
phern wie der Mrder in (22) (vgl. Sidner
1979):
(22) Die alte Dame lebte zurckgezogen. Sie
starb unter mysterisen Umstnden. Der
Mrder wurde nie gefunden.
Hier ergibt sich aus der konzeptuellen Nhe
der betreffenden Konzepte eine naheliegende
Annahme (nmlich, da die alte Dame von
jemandem ermordet wurde) und damit der
Angelpunkt fr eine funktionale Interpreta-
tion.
3.4Demonstrativa
Was die anaphorisch verwendeten Demon-
strativa (Demonstrativpronomen oder De-
monstrativpronomen plus Deskription) an-
geht, so sollen hier abschlieend einige cha-
rakteristische Eigenschaften genannt werden,
die ihren Unterschied zu Pronomen und
Kennzeichnungen deutlich machen (man ver-
gleiche dazu Kamp 1983, Lbner 1985a, Sid-
ner 1979).
Es gibt verschiedene und sehr komplexe
Gebrauchsweisen fr Demonstrativa. Fr alle
scheint zu gelten, da stets a) im Gegensatz
zu den Kennzeichnungen (implizit oder
explizit) eine Auswahl zwischen Alternativen
zugrundeliegt und b) eine Hervorhebung,
z. B. eine Fokussierung, Kontrastierung oder
hnliches zum Ausdruck gebracht wird.
Punkt a) bedingt, da die betreffenden De-
skriptionen stets als sortale oder relationale
Konzepte zu verstehen sind.
Fr komplexe Demonstrativa der Form
this + Deskription stellt Sidner fest, da
sie normalerweise einen Fokuswechsel bein-
halten, wobei ein mglicher Fokus, das An-
tezedens, zu einem aktuellen Diskursfokus
wird. Dies gilt auch fr das Deutsche:
(23) Wir knnen diesen Zusammenhang aus-
nutzen, indem wir annehmen, da es
einen Ligationsmodus gibt, der besagt,
da das Prdikat des Kommunikations-
modus in der Kommunikationsstruktur
nalpronomen angefhrt haben, fr Kenn-
zeichnungen kaum eine Rolle spielen. Im Bei-
spiel (21) kann man sich mit dem Pronomen
auf den zuletzt genannten Gastwirt beziehen,
weil er als Diskursreferent salienter und als
Folgethema erwartbarer ist, als der zuerst ge-
nannte:
(21) Maria kennt einen Gastwirt, der sieben
Biersorten ausschenkt. Susanne dagegen
kennt einen Gastwirt, der nur Obstsfte
anbietet. Er war Alkoholiker und kann
das Zeug nicht mehr riechen.
Eine Kennzeichnung wie der Gastwirt oder
eine vollstndige Wiederholung des Anteze-
dens sind anstelle des Pronomens kaum ak-
zeptabel; angemessen wre eine desambiguie-
rende Kennzeichnung wie der letztere, oder
das Demonstrativpronomen dieser,das hier
den gleichen Bezug wie das Personalprono-
men herstellt, allerdings aufgrund anderer
Faktoren (vgl. 3.4 unten).
Anaphorische Kennzeichnungen knnen
z. B. a) direkt, b) indirekt und c) assoziativ
als Kontiguittsanaphern gebraucht werden:
direkter Gebrauch liegt vor, wenn Antezedenz
und Anapher das gleiche Kopfnomen enthal-
ten, indirekter Gebrauch, wenn dies nicht der
Fall ist (z. B. ein Fremder ... der Mann). Eine
Kontiguittsanapher dagegen beruht nicht
auf Koreferenz, sondern liegt vor, wenn die
Kennzeichnung selbst nicht vorerwhnt ist,
sondern ein implizites Argument (Attribut)
beinhaltet, das im Text erwhnt ist und das
die funktionale Interpretation bestimmt (z. B.
das Buch ... der Autor).
Fr die Flle a) und b) lt sich die ana-
phorische Beziehung folgendermaen charak-
terisieren: das Antezedens ist der salienteste
Diskursreferent aus UA, der zugnglich ist
und auf den die Kennzeichnung zutrifft.
Als textuelle Anaphern besonders hufig
und interessant sind die Kontiguittsana-
phern. Da ihnen letztlich Possessivkonstruk-
tionen zugrundeliegen, haben sie systemati-
sche Beziehungen zu den Possessivpronomen.
Da in ihrem Fall das explizite Argument
oder Possessivpronomen wegfallen kann,
weist darauf hin, da die zugrundeliegenden
Zugehrigkeitsrelationen besonders salient
sein mssen: Es handelt sich um stereotype
Relationen, durch die die betreffenden Kon-
zepte miteinander verbunden sind. Dabei lt
sich das eine Argument einer solchen Relation
stets als ein Konzept verstehen, das eine be-
stimmte Rolle (Funktion) in dem von dem
anderen Argument beinhalteten Konzept-
schema spielt. Bei Instantiierung dieses Kon-
24. Anaphern im Text 559
Demonstrativa, die nur aus dem Pronomen
diese (r/s) bestehen. Das Antezedens bezieht
sich hier jeweils auf das letzte Element einer
Auswahlfolge FU von Diskursreferenten aus
UE, die im Kontext relevant ist. Die Reihen-
folge der Elemente in FU entspricht der Rei-
henfolge ihres Vorkommens im Text, die Re-
levanz ergibt sich aus dem jeweils spezifischen
lokalen Kontext der Anapher, man vergleiche
(25 a, b) im Gegensatz zu (25 a, c):
(25)
a. Peter hatte Paul einen Fller und
einen Kalender mitgebracht.
b. Dieser aber wollte von Geschenken
nichts wissen.
c. Dieser eignete sich gut als Notizbuch
fr seinen Schreibtisch.
Da diese Analyse nicht inadquat ist, zeigt
sich, wenn wir das Verhalten des Ferne
signalisierenden Gegenstcks dieser Prono-
men, jene(r/s), in diesen Kontexten betrach-
ten. Ersetzen wir dieser in (25 b) durch jener,
so knnen wir uns wiewohl die Intuition
hier etwas schwach ist damit gleichfalls auf
Paul beziehen. Der Grund dafr ist einfach:
bezglich der Auswahlfolge (Peter, Paul) ist
die Nominalphrase Paul der Anapher am
nchsten, d. h., die Verwendung von dieser ist
angemessen. Bezglich der Folge (Peter, Paul,
Fller, Kalender) ist diese Nominalphrase re-
lativ weit von der Anapher entfernt, die Ver-
wendung von jener ist mglich. Eine analoge
Ersetzung in (25 c) mit konstantem Bezug auf
Kalender ist nicht akzeptabel.
4. Literatur (in Kurzform)
Asher/Wada 1988 Buerle 1987 Buerle/Egli
1985 Bondzio 1973 Caramazza/Grober/Garwey/
Yates 1977 Caramazza/Gupta 1979 Charniak
1972 Cooper 1979 Cornish 1986 Dowty 1986
Egli 1979 Fillmore 1975a Givn 1983 Grosz
1977 Hauenschild 1985 Hawkins 1978 Heim
1982 Hirst 1981 Hobbs 1979 Jacobs 1984a
Kamp 1981a Kamp 1983 Kantor 1977 Kar-
miloff-Smith 1980 Karttunen 1976 Lambrecht
1986 Lang 1986 Lewis 1979a Lbner 1985a
Lyons 1977 Pause 1986 Pause 1988a Pause
1988b Pause 1990 Partee 1978b Partee 1984b
Pinkal 1986a Reichman 1985 Reinhart 1983
Reinhart 1987 Rooth 1987 Sidner 1979 Sidner
1983 Smaby 1978 Webber 1981 Weber 1986
Peter E. Pause, Konstanz
(Bundesrepublik Deutschland)
anwesend sein mu. Wir wollen diesen
Ligationsmodus Performieren nen-
nen. Die Grammatik mu dann so auf-
gebaut werden, da alle mit dem Liga-
tionsmodus Performieren verbunde-
nen Konsequenzen garantiert werden.
Eine weitere Verwendungsweise besteht darin,
da ein Diskursreferent in einer anderen Per-
spektive, in einem anderen thematischen Zu-
sammenhang gesehen wird. Dabei ist der An-
tezedensreferent in der Regel ein aktueller
Diskursfokus:
(24) Doch als der Herd endlich an Ort und
Stelle stand, war er das Kernstck des
Palace, sein Goldzahn! Vorne strahlte
ein blankes Blattwerk nebst Tulpenbeet
in seligem Licht. In seiner Bratrhre
konnte man sogar Eier kochen. Mit die-
sem Ofen kam Stolz und mit dem Stolz
das Gefhl, heimisch zu sein, ins Palace
Union und Grillroom.
Der Antezedensreferent anaphorisch ge-
brauchter Demonstrativa der Form dies +
Deskription lt sich fr diese beiden Flle
folgendermaen charakterisieren: Es ist nor-
malerweise der salienteste Diskursreferent aus
UE bzw. aus UF, auf den die Beschreibung
zutrifft.
Schwierigkeiten bei der Analyse bereiten
Demonstrativa wie dieses Problem, dieser
Sachverhalt, diese Feststellung, diese Defini-
tion, etc., die meist einfache sortale Beschrei-
bungen enthalten und hufig in wissenschaft-
lichen Texten vorkommen (die Pronomen dies
und das werden teilweise analog verwendet,
vgl. Buerle 1987). Ihre Antezedentien sind
oft keine Nominalphrasen, sondern Stze,
d. h., sie beziehen sich auf Sachverhalte, Er-
eignisse oder Propositionen, die die jeweils
beschriebenen relevanten Eigenschaften oder
Funktionen haben. Die Abgrenzung dieser
Anaphern von ihrem diskursdeiktischen Ge-
brauch ist oft schwierig (vgl. Fillmore 1975a).
Auf jeden Fall gilt fr sie ein striktes Nhe-
prinzip: Die der Anapher direkt vorausge-
hende Folge von Stzen gilt als das Anteze-
dens, wobei die Identifizierung des komplexen
Antezedensreferenten in bezug auf die Lnge
dieser Folge von der jeweils spezifischen Text-
struktur abhngt.
Ein solches Nheprinzip das vermutlich
im deiktischen Gebrauch dieser Anaphern sei-
nen Ursprung hat (vgl. Lyons 1977) gilt
auch fr die (kaum untersuchten) einfachen
560 VII. Semantik der Funktionswrter
25. Negation
Adjektivinhalte in Adjektivinhalte (vgl. (3),
(4)) usw. Danach ist Negation fr jeden in
Frage kommenden Inhaltstyp a eine Opera-
tion auf der Menge der Inhalte des Typs a.
Worin aber besteht die Entgegengesetzt-
heit der durch Negation zugeordneten In-
halte? Eine erste Bedingung ist offensichtlich,
da fr jeden in Frage kommenden Inhalt i
und seine Negation n(i) gilt: i n(i). Doch
das ist nicht hinreichend. Nehmen wir an, wir
fassen Inhalte als Intensionen im Sinne der
blichen an Carnap (1947) anknpfenden Ex-
plikationen auf, also als Funktionen von
mglichen Welten in Extensionen. Dann ord-
net die Negation in (3) dem Inhalt von ver-
heiratet also einer Funktion, die jeder mg-
lichen Welt die Menge der jeweils verheirate-
ten Individuen zuordnet nicht einen belie-
bigen anderen Inhalt gleichen Typs zu, son-
dern einen, der in jeder Welt als Wert eine
Menge ergibt, die mit der Menge, die der
Inhalt von verheiratet dieser Welt zuordnet,
einen leeren Durchschnitt bildet (weil ja kein
Individuum gleichzeitig verheiratet und un-
verheiratet sein kann). Dies kann man verall-
gemeinern: Fr alle Inhalte i mu n(i) nicht
nur verschieden von i sein, sondern darf sich
darberhinaus mit i auch nicht berlappen
(im Sinne des eben gegebenen Beispiels).
Wenn man nur (1) und (3) betrachtet,
knnte man zu der Ansicht kommen, da ein
weiteres wesentliches Merkmal der Negation
die Komplementaritt der durch sie zugeord-
neten Inhalte ist. Letztere scheinen ja in diesen
Beispielen alles zu umfassen, was nicht zum
jeweils negierten Inhalt gehrt. So scheint der
Inhalt von (3) jeder Welt w genau die Menge
zuzuordnen, die das Komplement des w-
Werts des Inhalts von verheiratet in der
Menge der Individuen bildet. Auch ein belie-
big gewhlter Wert des Inhalts von (1), also
der Funktion, die mglichen Welten den je-
weiligen Wahrheitswert von (1) zuordnet,
scheint immer das Komplement des Werts des
jeweils negierten Inhalts zu sein, nmlich der
jeweils andere Wahrheitswert (wenn man von
der Standardannahme ausgeht, da es genau
zwei Wahrheitswerte gibt). Wenn das nicht-
negierte Pendant von (1) wahr ist, ist (1)
falsch, und umgekehrt.
Diese Darstellung ist natrlich zu einfach.
Zunchst bercksichtigt sie bei (3) nicht, da
es ja Individuen gibt, von denen man gar nicht
sinnvoll sagen kann, sie seien unverheiratet,
nmlich genau die, von denen man auch nicht
1. Einige grundlegende Begriffe
2. Erscheinungsformen der natrlichsprachli-
chen Negation
2.1 Die Vielfalt der Negationstrger
2.2 Die Markiertheit der Negation
2.3 Negationssensitive Phnomene
3. Dimensionen des Negationsbezugs
3.1 Natrlichsprachliche und logische Negation
3.2 Semantischer und syntaktischer Negations-
bereich
3.3 Pragmatischer Negationsbereich
3.4 Der Fokus der Negation
4. Wieviele Negationsarten gibt es?
4.1 Zwei Ebenen der Negationsartdifferenzierung
4.2 Starke und schwache Negation
4.3 Sachverhalts- und Begriffsnegation
4.4 Replazive und nicht-replazive Negation
5. Zur Distribution von Polarittselementen
6. Kompositionalittsprobleme
7. Literatur (in Kurzform)
1. Einige grundlegende Begriffe
So, wie der Begriff Negation blicherweise
verwendet wird, beinhaltet jedes der folgen-
den deutschen Beispiele Negation (wobei die
fr diesen Inhaltsbestandteil verantwortlichen
Elemente hervorgehoben sind):
(1) Es regnete gestern nicht.
(2) Nicht Gerda ist mit Peter verheiratet.
(3) unverheiratet
(4) ungebildet
Eine vorlufige Bestimmung des Begriffs Ne-
gation auf der Basis solcher Beispiele kann
von der Beobachtung ausgehen, da die her-
vorgehobenen Elemente bewirken, da der
Inhalt des jeweiligen Rests in einen intuitiv
entgegengesetzten berfhrt wird. Dies, so
scheint es, ist der gemeinsame Nenner aller
typischen Flle von Negation: Negation
formt Inhalte in jeweils entgegengesetzte In-
halte um.
Was dies genau bedeutet, hngt davon ab,
was man unter Inhalt, entgegengesetzt
und umformen versteht. In mengentheore-
tischer Sprechweise gibt es die folgende Ex-
plikationsmglichkeit: Eine Umformung von
Inhalten in andere Inhalte kann man als eine
Operation auf der Menge der Inhalte, d. h.
eine Funktion von der Menge der Inhalte in
sich selbst, betrachten. Auerdem deuten die
Beispiele darauf hin, da Negation Inhalte
jeweils in Inhalte desselben Typs berfhrt,
also Satzinhalte in Satzinhalte (vgl. (1), (2)),
25. Negation 561
Negation ist, wie wir sahen, eine Operation
auf Sprachinhalten. Das Verneinen ist eine
Handlung, die man vollziehen kann, indem
man Ausdrcke einer Sprache uert, also
eine mgliche sprachliche Handlung. Neben
diesem kategorialen Unterschied ist zu beach-
ten, da nicht alle Stze, die Negation bein-
halten (s. u.), zum Verneinen geeignet sind:
(5) Wenn Kapitn Nemo nicht eingreift, wird
Dr. No die Insel in die Luft sprengen.
Dieser Satz beinhaltet die Negation des Sach-
verhalts, da Kapitn Nemo eingreift, ohne
da man mit seiner uerung diesen Sach-
verhalt verneinen knnte.
Solche Beispiele (und Beispiele von Ver-
neinung ohne Negation, vgl. Falkenberg
1987) lassen es als aussichtslos erscheinen, die
Negation irgendwie auf das Verneinen oder
andere negative Sprechakte zurckfhren zu
wollen. Es hat dennoch des fteren Versuche
einer entsprechenden pragmatischen Fundie-
rung der Negation gegeben, z. B. in Heine-
mann 1983. (Zur Kritik an diesem Ansatz vgl.
Falkenberg 1985, 1987.)
Alle natrlichen Sprachen haben Mittel,
um Negation zum Ausdruck zu bringen.
Diese sollen hier als Negationstrger bezeich-
net werden. Ein Negationstrger ist irgendeine
Formeinheit (z. B. ein Affix, ein Wort, ein
Konstruktionstyp), deren normaler Beitrag
zur Bedeutung der komplexen Ausdrcke, in
denen sie vorkommt, von einer adquaten
Theorie der Bedeutungskomposition in der
jeweiligen Sprache als Hinzufgung von Ne-
gation eventuell in Verbindung mit ande-
ren Inhalten gedeutet werden mu. In die-
sem Sinn sind etwa im Deutschen die Partikel
nicht und das Prfix un- Negationstrger. Sie
sind darberhinaus semantisch einfache Ne-
gationstrger, indem sie nur Negation bein-
halten.
Daneben gibt es semantisch komplexe Ne-
gationstrger, hufig solche, die die Negation
mit einer Quantifikation verbinden, wie nie
(Negation + temporale Existenzquantifika-
tion), vgl. 2.1. Bei semantisch komplexen Ne-
gationstrgern kann es zudem vorkommen,
da die Negation implizit ist, im Gegensatz
zur expliziten Negation bei einfachen Nega-
tionstrgern oder beim eben genannten kom-
plexen Negationstrger. Implizit ist Negation
dann, wenn sie in der Hierarchie der durch
das Formelement zum Ausdruck kommenden
Inhalte nicht an oberster Stelle steht, was sich
darin manifestieren kann, da sie sich nur im
Bereich der Prsuppositionen (oder konven-
sinnvoll sagen kann, sie seien verheiratet (z. B.
Drillbohrer). Also umfat der Wert des In-
halts von (3) nicht in jeder Welt das Komple-
ment der Extension von verheiratet in der
Gesamtmenge der Individuen, sondern im all-
gemeinen nur eine echte Teilmenge dieses
Komplements. Allgemeiner: In Fllen wie (3)
sind die durch Negation zugeordneten Inhalte
deswegen nicht komplementr zu den jeweils
negierten Inhalten, weil die ersteren genau wie
die letzteren nur auf eine bestimmte Sorte von
Entitten zutreffen knnen.
Doch selbst wenn man das Phnomen der
sortalen Beschrnkungen ausklammert, lt
sich die Komplementarittshypothese (s. o.)
nicht halten. Dies sieht man an (4). Auch
wenn man nur Individuen in Betracht zieht,
von denen man sinnvoll sagen kann, sie seien
(un)gebildet, bezeichnet ungebildet im allge-
meinen nicht das ganze Komplement der Ge-
bildeten in der Menge dieser Individuen, son-
dern nur eine echte Teilmenge dieses Komple-
ments. Nicht jeden, der nicht zur Menge der
Gebildeten gehrt, kann man als ungebildet
bezeichnen. (Es gibt ja auch Halbgebildete.)
hnlich scheint es sich bei (2) zu verhalten.
Nicht in allen Situationen, in denen der Satz
ohne nicht sinnvoll geuert und als wahr
oder falsch beurteilt werden kann, hat (2)
einfach den jeweils anderen Wahrheitswert.
So wrde man (2) wohl kaum als wahr be-
trachten, wenn Peter ledig ist.
Da die durch Negation zugeordneten In-
halte nicht in allen Fllen komplementr im
angedeuteten Sinne sind, weist darauf hin,
da es verschiedene Arten von Negation gibt.
Es wird sich allerdings erweisen (s. 4.), da
die durch die bisherigen berlegungen nahe-
gelegte Unterscheidung zwischen komple-
mentrer ((1), (3)) und nicht-komplementrer
Negation ((2), (4)) die man in Bezug setzen
kann zur Aristotelischen (de interpreta-
tione) Unterscheidung zwischen kontradik-
torischen und kontrren Gegenstzen noch
zu grob ist, weswegen letztlich mehr und an-
dere Negationsartunterscheidungen anzuneh-
men sein werden.
Negation, wie sie eben diskutiert wurde,
darf nicht mit dem Verneinen verwechselt wer-
den. Man verneint einen Sachverhalt p genau
dann, wenn man zum Ausdruck bringt, da
man annimmt, da p nicht der Fall ist. Dies
wiederum tut man nur dann, wenn man zum
Ausdruck bringt, da man die Negation von
p annimmt. Damit wird eine Beziehung zwi-
schen Negation und Verneinen, aber auch der
Unterschied zwischen beiden deutlich. Die
562 VII. Semantik der Funktionswrter
Ausdrcke damit nicht als solche bestimmt,
deren Bedeutung Negation enthlt. Damit
vermeidet man das wohlbekannte Problem,
da man, falls man die Bedeutung von Stzen
mit ihren Wahrheitsbedingungen identifiziert,
keinen Unterschied zwischen negationshalti-
gen und nicht negationshaltigen Satzbedeu-
tungen machen kann. Stze wie (8) und (9)
(8) Alle lieben Dr. No.
(9) Niemand liebt Dr. No nicht.
haben dann ja dieselbe Bedeutung. Nach dem
oben vorgeschlagenen Kriterium kann man
dagegen (9) als negativen und (8) als affir-
mativen Satz identifizieren.
Auch dieses Negativittskriterium ist na-
trlich nicht unproblematisch. Das kann es
schon wegen der erwhnten Theorieabhngig-
keit der Bestimmung von Negationstrgern
nicht sein, die selbst in scheinbar so klaren
Fllen wie nicht wirksam ist, etwa in Stzen
wie (10):
(10) Habe ich dich nicht tausendmal gewarnt
vor ihr?
Erst eine ausgebaute Theorie der Fragestze
(vgl. Art. 15) kann entscheiden, ob in solchen
rhetorischen Fragen der Negationstrger
nicht oder eine gleichlautende Modalpartikel
vorliegt.
Noch gravierender ist auf den ersten Blick
das Problem, da das obige Negativittskri-
terium nicht geeignet ist, diejenigen Kontexte
zu bestimmen, in denen negationssensitive
Phnomene vorkommen knnen (vgl. 2.3). In
5. wird sich jedoch zeigen, da Negativitt
in irgendeinem vernnftigen Sinn ohnehin
weder eine hinreichende noch eine notwen-
dige Bedingung fr das Vorkommen solcher
Phnomene ist. Die Qualitt einer Explika-
tion der Negativitt sollte deswegen auch
nicht an diesem Problem gemessen werden.
2. Erscheinungsformen der
natrlichsprachlichen Negation
2.1Die Vielfalt der Negationstrger
Schon der flchtigste Blick auf die Daten
zeigt, da die natrlichsprachliche Negation
syntaktisch-morphologisch kein einheitliches
Phnomen ist. Vielmehr gibt es eine Flle von
Methoden, Negation zum Ausdruck zu brin-
gen. Nach den typologischen Untersuchun-
gen von Osten Dahl (1979) und John R.
Payne (1985) sind es mindestens die folgen-
den, jeweils mit Beispielen illustrierten:
tionellen Implikaturen, vgl. Art. 13 und 14)
auswirkt. Nur prsupponiert und damit im-
plizit ist Negation z. B., wenn sie durch ein
kontrafaktisches Konditional zum Ausdruck
gebracht wird:
(6) Wenn Luise Kapitn Nemo geheiratet
htte, wre sie heute Witwe.
Sowohl da Luise Kapitn Nemo nicht ge-
heiratet hat, als auch da sie heute keine
Witwe ist, ist nach Aufweis der blichen Tests
eine Prsupposition von (6).
Der Bezug auf die Theorie der Bedeutungs-
komposition in der obigen Bestimmung des
Begriffs Negationstrger soll von vornehe-
rein klar machen, da die Entscheidung Ne-
gationstrger oder nicht letztlich theorieab-
hngig ist. Dies betrifft z. B. die Mittel zum
Ausdruck des Komparativs. Auf die Nega-
tivitt dieses Phnomens ist immer wieder
hingewiesen worden, und tatschlich lassen
sich Komparative als Negation beinhaltend
paraphrasieren:
(7) Kapitn Nemo ist gtiger als Dr. No.
a. Es gibt einen Grad g, so da gilt: Ka-
pitn Nemo ist gtig mindestens im
Grad g, und es ist nicht der Fall, da
Dr. No gtig mindestens im Grad g
ist.
b. Das Ma der Gte von Kapitn Nemo
bertrifft das Ma der Gte von Dr.
No.
Wer, wie P. Seuren (1973), die Bedeutungs-
komposition in Komparativstzen im Stil von
(7 a) analysiert, der expliziert damit auch die
sprachlichen Mittel zum Ausdruck des Kom-
parativs als Negationstrger, weil letztere
nach dieser Analyse ja unter anderem Nega-
tion induzieren. Wer dagegen eine Analyse
whlt, die (7 b) entspricht, wie R. Bartsch und
T. Vennemann (1972), fr den ist eine Kom-
parativkonstruktion kein Negationstrger im
obigen Sinn. Die Entscheidung Negations-
trger oder nicht hngt hier also von der
Abwgung zweier Theorien des Komparativs
ab (die selbst ein komplexes Problem ist, vgl.
von Stechow 1984 a).
Wenn hier von Ausdrcken (z. B. von St-
zen gesprochen wird, die Negation beinhalten
(kurz: von negativen Ausdrcken, im Gegen-
satz zu affirmativen), so ist damit nur ge-
meint, da diese Ausdrcke einen Negations-
trger im eben skizzierten Sinn enthalten. Da-
mit wird Negativitt an der syntaktischen
Struktur und an der lexikalischen Besetzung
festgemacht. Insbesondere werden negative
25. Negation 563
der Negation that can apply to the most
minimal and basic sentences (Payne 1985:
198). Deshalb fehlt z. B. ein Hinweis auf die
in vielen Sprachen vorhandenen negativen
Quantoren, wie niemand, never, nihil. Auer-
dem fehlen die Ausdrucksmittel der Begriffs-
negation (vgl. 4.3), nmlich Wortstammbil-
dungsmittel wie un-, in- usw. Schlielich mu
man die Liste durch den Hinweis darauf er-
gnzen, da den meisten Sprachen mehrere
Negationstrger zur Verfgung stehen. So
gibt es im Deutschen mindestens die folgen-
den Mittel des Ausdrucks der Negation (vgl.
Jacobs 1982, 1983; es ist jeweils nur die wich-
tigste syntaktische Funktion bercksichtigt;
Trger von Begriffsnegation und impliziter
Negation sind nicht aufgefhrt):
Ausdruck syntaktische Funktion
nicht Adverbial
keineswegs Adverbial
keinesfalls Adverbial
nie(mals) Adverbial
nirgends Adverbial
nichts NP-Funktionen
keinerlei Artikel
nicht einmal Adverbial
kein Artikel
niemand NP-Funktionen
weder noch diskontinuierliche Kon-
junktion
nein Satzquivalent
Versuche, Einheitlichkeit in das syntaktische
Verhalten dieser Elemente hineinzuinterpre-
tieren, indem man sie transformationell auf
eine gemeinsame tiefenstrukturelle Quelle (ein
abstraktes Negationsadsentential) zurck-
fhrt (Stickel 1970, im Anschlu an Klima
1964), knnen als berholt gelten (vgl. Jacobs
1982).
In all dieser Vielfalt sind doch gewisse Ten-
denzen erkennbar. So ist unbersehbar, da
das Verb eine starke Anziehungskraft auf die
Negation ausbt (vgl. dazu auch Dahl 1979).
Dies manifestiert sich teilweise darin, da die
Negation durch morphologische oder kliti-
sche Verbbestandteile realisiert wird (die unter
(i) genannten Mglichkeiten betreffen aus-
schlielich Verbmorphologie, bei (v) ist die
Negation klitisch mit dem hinzugefgten
Hilfsverb verbunden), teilweise darin, da der
Negationstrger selbst verbal ist, vgl. (iii)
(iv). Darberhinaus sind die unter (ii) ge-
nannten Partikelrealisierungen der Negation
ausnahmslos Flle von Verbalphrasenmodi-
fikation. Die syntaktische Affinitt zum Verb
manifestiert sich auch in der Stellung der Ne-
(i) Morphologischer Ausdruck der Negation
durch Affigierung, Reduplikation oder Ton-
variation
(11) Swahili:
watampenda hawatampenda
Sie werden ihn lie- Sie werden ihn
ben nicht lieben
(12) Japanisch:
samu-katta samu-na-katta
Es war kalt Es war nicht kalt
(13) Arabisch:
fiih biira hina mafiish biira hina
Es gibt hier Bier Es gibt hier kein
Bier
(14) Mano (Niger-Kongo, aus Dahl 1979):
yd yd
Ich wei Ich wei nicht
(ii) Syntaktischer Ausdruck der Negation
durch eine Partikel (eventuell im Zusammen-
wirken mit anderen Negationstrgern)
(15) Deutsch:
Ich komme. Ich komme nicht.
(16) Franzsisch:
Pierre quitte lho- Pierre ne quitte
tel. pas lhotel.
(iii) Syntaktischer Ausdruck der Negation
durch ein hheres Verb (d. h. eines, das den
Restsatz als Komplement nimmt)
(17) Tonga (aus Payne 1985, Nae und ke sind
Aspektmarkierer)
Nae alu a Siale Nae ikai ke alua
Siale
Charlie went Charlie didnt go
(iv) Syntaktischer Ausdruck der Negation
durch ein Hilfsverb
(18) Finnisch:
laulan en laula
Ich singe Ich singe nicht
(19) Maung (Australisch, aus Dahl 1979,
ngiudbaji Potentialisform):
ngiudba marig ngiudbaji
I put I do not put
(v) Syntaktischer Ausdruck der Negation
durch eine Partikel bei gleichzeitiger Hinzu-
fgung eines Hilfsverbs
(20) Englisch:
John met Mary John did not meet
Mary.
Diese Liste ist noch unvollstndig. Sie ver-
zeichnet nur das, was Payne (1985) Standard-
negation nennt, also Formen des Ausdrucks
564 VII. Semantik der Funktionswrter
Existenzquantoren, vgl. niemand, nichts, none,
never usw., whrend negierte Allquantifika-
tion wohl syntaktisch (nicht alle, not always),
aber so gut wie nie lexikalisiert vorkommt
(*nalles, *nalways). Dieser Trend dehnt sich
ber die bekannten logischen Entsprechungen
auch auf die Lexikalisierung der Verbindung
der Negation mit anderen Elementen aus, vgl.
z. B. nor (Negation + oder), aber *nand
(Negation + und), und er hinterlt seine
Spuren auch im Feld der Begriffsnegation. Im
Lexikon vieler Sprachen findet sich eine be-
griffsnegierende Entsprechung zu nicht mg-
lich aber keine zu nicht notwendig, etwa im
Franzsischen impossible, *innecessaire (vgl.
auch *unnotwendig). Horns Erklrung fr die-
sen Trend basiert auf den mit den involvierten
Lexemen verbundenen skalaren Implikaturen
(vgl. Art. 14). Sie lassen die Lexikalisierung
der Negation einer Allquantifikation (Kon-
junktion, Notwendigkeit etc.) als berflssig
erscheinen, weil diese eine generalisierte ska-
lare Implikatur des in jedem Fall im Lexikon
bereits vorhandenen Ausdrucks unnegierter
Existenzquantifikation (Disjunktion, Mg-
lichkeit etc.) ist. Mglich implikatiert nicht
notwendig, oder implikatiert nicht und,
einige nicht alle usw.
Das bekannteste Muster der historischen
Entwicklung von Negationstrgersystemen ist
jenes, das man nach dem Sprachwissenschaft-
ler, der es am prgnantesten beschrieben hat,
Jespersens Zyklus nennt. (Vgl. Jespersen
1917.) Es setzt an bei der weitverbreiteten
emphatischen Verstrkung eines Negations-
trgers durch ein anderes Element, oft eines,
das als Maangabe fungiert, wie etwa beim
bergang von altfranzsisch (22) zu neufran-
zsisch (23):
(22) jeo ne di
(23) je ne dis pas
Da pas in (23) heute nicht mehr als em-
phatischer Zusatz interpretiert wird was
sich insbesondere darin manifestiert, da es
in der Standardsprache nicht weglabar ist
erklrt sich durch eine Abschleifung der
ursprnglich verstrkenden Funktion. Dies
wiederum begnstigt eine Reanalyse, nach der
der Zusatz der eigentliche Negationstrger,
der ursprngliche Negationstrger dagegen
berflssig ist. Damit hat die Sprache einen
neuen Negationstrger gewonnen und befin-
det sich gleichzeitig auf dem Weg, einen an-
deren zu verlieren, wie im Neu-Umgangsfran-
zsischen:
(24) je dis pas
gationstrger im Satz. Nach Dahl besteht bei
Negationspartikeln ein universeller Trend zu
einer unmittelbar prverbalen Position (vgl.
Dahl 1979: 91 ff), der unabhngig von der
jeweiligen Grundwortstellung ist. Dies deckt
sich weitgehend mit den Ergebnissen einer
von M. Dryer (1988) anhand von 345 Spra-
chen durchgefhrten Untersuchung der Kor-
relationen zwischen Grundwortstellung und
Negationstrgerposition. Nach Dryer ist in
SVO- und VSO-Sprachen die bei weitem pr-
ferierte Negationstrgerposition die unmittel-
bar prverbale; in SOV-Sprachen dagegen ist
die prferierte Position die unmittelbar post-
verbale, die unmittelbar prverbale Position
ist jedoch auch hier hufig. Die Unterschiede
zwischen Dahls und Dryers Ergebnissen er-
klren sich z. T. aus der Tatsache, da Dryer
nicht zwischen verschiedenen Arten von Ne-
gationstrgern unterschieden hat, vgl. Dryer
1988: 113 ff. Eine diesbezgliche Differenzie-
rung ist auf jeden Fall unumgnglich, wenn
man versuchen will, die eben beschriebenen
Muster zu erklren, vgl. 3.2.
Der syntaktischen Affinitt von Negation
und Verb gewissermaen gegenlufig ist die
Tendenz zur lexikalisierten Verschmelzung der
Negation mit der Quantifikation (oder mit an-
deren logischen Operationen) mit dem Re-
sultat der Bildung negativer Quantoren (s. o.).
Dafr, da eine solche Verschmelzung zu-
stande kommt, spielt die Wortart des Trgers
der Quantifikation kaum eine Rolle. Insbe-
sondere mu er nicht verbal sein, sondern ist
sehr oft nominal. Dieses Muster ist aber ge-
genber dem Trend zum Einbau des Nega-
tionstrgers in den Prdikatskomplex nicht
nur deswegen sekundr, weil es keine Stan-
dardnegation im obigen Sinn ist. Es gibt auch
viele Sprachen, in denen die Quantifikations-
negation kein wirklich autonomes Negations-
mittel ist, sondern in der Regel nur in pleo-
nastischer Verbindung mit einer ans verbale
Prdikat gebundenen Negation auftaucht
(vgl. Dahl 1979: 105, Payne 1985: 236 f), z. B.
russisch nikto (niemand):
(21) Nikto ne priel
Niemand kam (wrtlich: Niemand
nicht kam)
Die lexikalische Verbindung von Negation
und Quantifikation unterliegt universell be-
stimmten Restriktionen. Insbesondere scheint
sie nur uerst selten bei Allquantoren vor-
zukommen, vgl. z. B. Horn 1978, Lbner
1987. Die allermeisten der fraglichen Lexeme
sind semantisch und etymologisch negierte
25. Negation 565
tribution negativer Ausdrcke, wiederum im
Vergleich mit entsprechenden Ausdrcken
ohne Negation:
(25)
a. Sobald sie anfing zu rauchen, verlie
er das Zimmer.
b. ?Sobald sie nicht anfing zu rauchen,
verlie er das Zimmer.
(26)
a. Er wei mehr, als sie ahnt.
b. *Er wei mehr, als sie nicht ahnt.
(27)
a. auf den Dchern vieler Huser
b. ??auf den Dchern keiner Huser
Die Akzeptabilittsunterschiede sind offen-
bar durch spezielle inhaltliche Eigenschaften
der Negation bedingt. Nach sobald in (25)
mu ein bestimmter Zeitpunkt spezifiziert
werden, der den Zeitverlauf in der Situation,
ber die gesprochen wird, in zwei Teile
davor und danach zerlegt. Zeitpunkte,
zu denen eine Person nicht anfngt zu rau-
chen, sind hierfr anscheinend nicht geeignet
allerdings nur, wenn man von normalen
Situationen ausgeht (s. u.). Die Inakzeptabi-
litt von (26 b) und (27 b) ist dagegen wohl
nicht situationsabhngig.
Negation schrnkt nicht nur die Distribu-
tion der Syntagmen, in denen sie vorkommt,
ein, sondern stellt oft auch besondere Anfor-
derungen an die Form dieser Syntagmen. So
macht Negation zuweilen spezielle Tempus-
oder Aspektmarkierungen erforderlich, vgl.
Givn 1978 und Payne 1985. Insbesondere
wirkt die Negation hufig als Barriere fr
diesbezgliche Markierungsinnovation. Gi-
vn weist auf das Beispiel der erst vor kurzem
ins Bemba eingefhrten Markierung der Un-
terscheidung von morgen und spter als
morgen durch -k- bzw. -k- hin, die nur in
affirmativen Stzen verwendet werden kann,
whrend in negativen Stzen nur das alte -k-
zur Verfgung steht, das ein undifferenziertes
Futur ausdrckt (vgl. Givn 1978: 97):
(28)
a. N-k-boomba
Ich werde morgen arbeiten
b. N-k-boomba
Ich werde nach morgen arbeiten
c. Nshi-k-boomba
Ich werde nicht arbeiten (weder mor-
gen noch danach)
d. *Nshi-k-boomba
In Givn 1978 findet sich auch ein Versuch,
die Markiertheit der Negation zu erklren.
Givn geht von dem Faktum aus, da nega-
tive Stze im allgemeinen weniger Informa-
tion beinhalten als die entsprechenden affir-
Viele Negationstrger natrlicher Sprachen
sind so entstanden, z. B. nicht und kein
(< deh-ein), wobei das erstere, anders als pas,
auf einen Negationsverstrker mit einem in-
korporierten Vorkommnis des ursprnglichen
Negationstrgers zurckgeht, nmlich auf ni-
wiht. Andererseits ist auch das weitgehende
Verschwinden des alten indoeuropischen ne
als selbstndiger Negationstrger ein Ergeb-
nis dieses Prozesses. Da es sich dabei wirk-
lich um einen Zyklus handelt, sieht man im
brigen z. B. daran, da ne in (22) ebenfalls
auf einen lteren Negationsverstrker zurck-
geht, nmlich auf lateinisch non (< ne-oe-
num). (Die Vermutung, da bei Jespersens
Zyklus areale Zusammenhnge eine Rolle
spielen, wird in Bernini & Molinelli & Ramat
1987 diskutiert.)
2.2Die Markiertheit der Negation
Negation ist nicht in dem Sinn markiert, in
dem z. B. Silben mit der Struktur VCCC es
sind. Alle natrlichen Sprachen haben gram-
matische Mittel zum Ausdruck der Negation,
und es sind auch keine diachronischen Pro-
zesse bekannt, die Negation abbauen. Mar-
kiert ist die Negation jedoch in dem Sinn, da
negative Stze im Vergleich mit den entspre-
chenden affirmativen Stzen besonderen
grammatischen und Verwendungsbedingun-
gen unterliegen. Dies beginnt damit, da in
allen natrlichen Sprachen die Anwesenheit
von Negation in der semantischen Struktur
eines Satzes durch die Anwesenheit spezieller
Ausdrcke oder Konstruktionen (vgl. 2.1) im
Satz angezeigt werden mu und nicht etwa
dadurch indiziert werden kann, da be-
stimmte ansonsten ntige Elemente weggelas-
sen werden. Dies fhrt dazu, da negative
Stze syntaktisch oder morphologisch kom-
plexer sind als ihre affirmativen Pendants. (Es
wurde zuweilen behauptet, da im Telugu die
Negation systematisch durch Weglassung be-
stimmter Elemente des affirmativen Satzes
ausgedrckt wird. Tatschlich verwendet das
Telugu in speziellen syntaktisch-semantischen
Umgebungen ein negatives Suffix -a, das un-
ter bestimmten morphologischen Bedingun-
gen getilgt wird, was bei gleichzeitiger Stamm-
alternation den Eindruck einer Weglassung
von Teilen des affirmativen Satzes erwecken
kann. Das wichtigste Mittel zum Ausdruck
der Negation ist jedoch die Hinzufgung des
Hilfsverbs lee-, die jeweils zu einem deutlichen
Komplexittszuwachs gegenber dem affir-
mativen Satz fhrt.)
Eine weitere Manifestation der Markiert-
heit der Negation ist die eingeschrnkte Dis-
566 VII. Semantik der Funktionswrter
Schmidt 1973 und Zifonun 1976.) Doch kn-
nen nach dem Givnschen Muster auch
(25)(28) erklrt werden? Bei (25) scheint
dies mglich zu sein. Einerseits ist es plausi-
bel, da es gerade die in normalen Situationen
anzunehmende Nicht-Gestalthaftigkeit des in
die Sobald-Phrase eingebetteten negativen
Satzes ist, die in Konflikt steht mit der Zeit-
punktkennzeichnung, die hier gefordert ist
(s. o.). Andererseits scheint auch die Voraus-
sage richtig zu sein, da (25 b) bei nderung
der Gestalt-Grund-Verhltnisse akzeptabel
werden kann. Wenn von einer Frau die Rede
ist, die sich ber einen bestimmten Zeitraum
hinweg stndig Zigaretten anzndet und sie
dann sofort wieder lscht, wre eine ue-
rung von (25 b) zumindest problemlos inter-
pretierbar (wenn man dann auch eher nicht
mehr statt nicht erwarten wrde). In den an-
deren Fllen scheitert eine Erklrung der an-
gedeuteten Art an der Situationsunabhngig-
keit ihrer Inakzeptabilitt. Nach dieser Erkl-
rung sollten ja die inakzeptablen Varianten
von (26)(28) in Sprechsituationen, in denen
die normalen Gestalt-Grund-Verhltnisse ver-
kehrt sind, akzeptabler sein. Dies ist aber
nicht der Fall. Ein Ausweg wre hier die An-
nahme einer Grammatikalisierung der nor-
malen Gestalt-Grund-Verhltnisse, aber auch
damit wre hchstens (26) zu erklren. In (27)
und (28) ist einfach kein inhaltlicher Zusam-
menhang zwischen der Informationsarmut
negativer Syntagmen und den sichtbar wer-
denden Beschrnkungen zu erkennen. (Auch
Givn selbst versucht fr (28) nicht, einen
solchen Zusammenhang herzustellen. Zu (27)
vgl. 6.)
Schlielich ist auch nicht klar, in welchem
Zusammenhang die psychischen Manifestatio-
nen der Markiertheit der Negation mit der
relativen Informationsarmut stehen. In zahl-
reichen Untersuchungen, von denen hier nur
Clark 1974 genannt sei, wurde nachgewiesen,
da negative Syntagmen langsamer verar-
beitet werden als entsprechende affirmative
Syntagmen. Verf. kennt jedoch keine Unter-
suchungen, bei denen die Verarbeitungszeit
negativer Syntagmen in Korrelation mit Va-
riationen der Gestalt-Grund-Verhltnisse ge-
bracht wurde. Ein solches Vorgehen wre n-
tig, um einen mglichen Zusammenhang zwi-
schen Informativitt und psychologischer
Markiertheit der Negation aufzudecken.
2.3Negationssensitive Phnomene
In vielen Sprachen gibt es Elemente, die eine
Affinitt zur Negation zeigen, indem sie ent-
weder nur in der Umgebung von Negations-
mativen Stze was sich unter anderem in
der Menge der jeweils zulssigen Folgerungen
manifestiert, vgl. 3.3. Er beschreibt dieses
Faktum aus der Sicht der Gestaltpsychologie.
Danach stellt der durch einen negativen Satz
wie (29 b) beschriebene Sachverhalt in aller
Regel nach Magabe unseres Weltwissens den
Grund (ground) dar, vor dem sich der Inhalt
des entsprechenden affirmativen Satzes als
Gestalt (figure) abhebt, also als das Nicht-
Erwartbare, Bemerkenswerte (vgl. Givn
1978: 105 ff):
(29)
a. Meine Frau ist schwanger.
b. Meine Frau ist nicht schwanger.
Wenn nun negationsfeindliche Kontexte
(s. o.) gerade solche sind, in die nur Syntag-
men eingebettet werden knnen, deren Inhalt
Gestalt im eben angedeuteten Sinne ist, htte
man eine Erklrung fr die entsprechenden
Distributionsrestriktionen. Sehr plausibel ist
dieses Erklrungsmuster fr die einge-
schrnkte Distribution negativer Stze in Dis-
kursen. Z. B. kann man negative Stze wie
(29 b) normalerweise nicht sinnvoll diskurs-
initial uern. Dafr ergibt sich mit dem oben
Gesagten eine Erklrung, wenn fr jede Dis-
kursposition d das folgende Relevanzprinzip
gilt: In d drfen nur die noch nicht als ge-
meinsames Wissen der Diskurspartner eta-
blierten Inhalte behauptet (erfragt usw.) wer-
den also nur Gestalten, nicht Teile des
Grundes. (Vgl. Grices Maxime der Relevanz,
Artikel 14.) Daraus folgt, da uerungen
negativer Stze normalerweise nicht diskurs-
initial sein knnen, denn das bei Diskursbe-
ginn als gemeinsam etablierte Wissen besteht
ja in der Regel aus dem normalen Weltwissen,
das wiederum in der Regel den Inhalt des
negativen Satzes umfat (s. o.). uerungen
negativer Stze beinhalten also diskursinitial
normalerweise keine Gestalt, die sich vom
Grund der gemeinsamen Vorannahmen ab-
heben knnte, und verstoen damit gegen das
obige Relevanzprinzip.
Damit ist auch erklrt, warum negative
Stze manchmal eben doch diskursinitial ge-
uert werden knnen, nmlich dann, wenn
sich das normale Verhltnis von Gestalt und
Grund verkehrt, indem das, was negiert wird,
zur diskursinitialen Wissensbasis der Kom-
munikationspartner gehrt. Darberhinaus
wird erklrt, warum uerungen negativer
Stze generell nur dann sinnvoll sind, wenn
der Sprecher davon ausgehen kann, da der
Adressat den negierten Sachverhalt fr wahr
oder wahrscheinlich hlt. (Dies ist hufig fest-
gestellt worden, auer in Givn 1978 z. B. in
25. Negation 567
?Luise wies jeden, der sogar darber lachte,
aus dem Zimmer.
Englisch already:
Peter has already talked to me.
*Peter hasnt already talked to me.
Die unter (iii) und (iv) genannten Elemente
meint man zumeist, wenn man von negativen
bzw. affirmativen Polarittselementen spricht.
(Vgl. Horn 1978, speziell zum Deutschen
Krschner 1983, zum Hollndischen Zwarts
1981, allgemein fr germanische Sprachen
schon Jespersen 1917, zum Franzsischen
Gaatone 1971, zum Japanischen McGloin
1976, zum Englischen Welte 1978 sowie die
in 5. angegebene Literatur.)
Eines der vielen linguistischen Probleme,
die mit negationssensitiven Phnomenen ver-
bunden sind, ist das der genaueren Klassifi-
zierung dieser Phnomene. Jede einzelne der
genannten Gruppen umfat, was die Bezie-
hung zur Negation angeht, recht verschieden-
artige Elemente. (Genaueres z. B. bei Krsch-
ner 1983.) Ein weiteres Problem bildet die
Diachronie der Negationssensitivitt. Durch
welche Vernderungsprozesse kommen Ele-
mente in die genannten Gruppen? Bekannt
ist, da Jespersens Zyklus (s. 2.1) auch hier
eine wichtige Rolle spielt. Pas und point ge-
hren (in einer Lesart) zur Gruppe (i) im
Standardfranzsischen, durch Jespersens Zy-
klus zu Satelliten von ne geworden. Elemente,
die ursprnglich Negationsverstrker waren,
gibt es auch in (iii), offensichtlich als Ergebnis
einer generalisierenden bertragung dieser
Funktion auf negationshnliche Kontexte,
z. B. je(mals). (Vgl. Coombs 1976: 87 f.) Da-
gegen ist weitgehend unbekannt, welche dia-
chronischen Prozesse affirmative Polaritts-
elemente erzeugen.
Die semantisch interessanteste Frage ist je-
doch, was Ausdrcke oder Kontexte nega-
tionshnlich und damit fr Elemente von
(i)(iii) und (iv) zugnglich bzw. unzugng-
lich macht. Dieser Frage wird ein eigenes Ka-
pitel gewidmet sein (5.). Sie wird deshalb vor-
erst zurckgestellt.
Negationssensitivitt manifestiert sich
nicht ausschlielich in Vorkommensbeschrn-
kungen. Manchmal ist es auch nur eine hu-
fige Kookkurrenz mit der Negation, die ein
Phnomen als negationssensitiv ausweist. In
diesem Sinne ist der Partitiv (oder der Geni-
tiv) negationssensitiv. So findet er sich in l-
teren indoeuropischen Sprachen hufig in
negativen Stzen an Stellen, wo er in den
affirmativen Pendants nicht zu erwarten
trgem oder auerdem nur in wenigen an-
deren, in gewisser Weise negationshnlichen
Kontexten vorkommen. Man kann minde-
stens drei Gruppen unterscheiden (vgl.
Krschner 1983):
(i) Elemente, die die Anwesenheit von Nega-
tionstrgern oder hnlichen Ausdrcken (wie
kaum oder nur) im selben Teilsatz erfordern.
Z. B.:
Deutsch mehr:
Er hat kein Geld mehr.
*Er hat Geld mehr.
*Es stimmt nicht, da er Geld mehr hat.
(ii) Elemente, die die Anwesenheit von Ne-
gationstrgern oder hnlichen Ausdrcken in
einer Konstituente erfordern, die mit der
Konstituente, in der sie selbst vorkommen,
koordinativ verknft ist. Z. B.:
Englisch neither:
Bill didnt find a solution, and neither did
John.
*Bill found a solution, and neither did
John.
(iii) Elemente, die negationshnliche Kontexte
erfordern, ohne zu (i) oder (ii) zu gehren.
Zu diesen Kontexten gehren neben eigentlich
negativen also solchen mit Negationstr-
gern auch Fragestze sowie bestimmte Ab-
schnitte von Konditionalstzen, Stzen mit
Allquantoren, Komparativstzen u. a. m.
Z. B.:
Deutsch jemals:
Niemand glaubt, da er jemals kommen
wird.
*Jemand glaubt, da er jemals kommen
wird.
Hast du ihm jemals vertraut?
Englisch any:
John didnt manage to solve any of the
problems.
*John managed to solve any of the pro-
blems.
If he had solved any of these problems, he
would have told us.
Andererseits gibt es in natrlichen Sprachen
auch eine Negationssensitivitt mit umge-
kehrten Vorzeichen:
(iv) Elemente, die in bestimmten negativen
oder negationshnlichen Kontexten nicht vor-
kommen knnen. Z. B.:
Deutsch sogar:
*Peter lachte sogar darber.
*Niemand lachte sogar darber.
568 VII. Semantik der Funktionswrter
(32) Je crains quil ne vienne. (Ich frchte,
da er kommt).
Auch in frheren Ausprgungen germani-
scher Sprachen waren solche Formulierungen
gang und gbe. (Vgl. Jespersen 1917: 7580.)
Und noch im heutigen Standarddeutschen
gibt es negationshnliche Umgebungen, in de-
nen pleonastische Negationstrgervorkom-
men ganz normgerecht sind (vgl. Krschner
1983: 4.4.3.2.):
(33) Ich verweigere dir den Eintritt, bevor du
nicht deine Schuhe ausziehst.
Solche pleonastischen Negationstrgervor-
kommen stellen ein erhebliches Problem fr
eine kompositionale Semantik dar. Darauf
kommen wir in Abschnitt 6 zurck.
3. Dimensionen des Negationsbezugs
3.1Natrlichsprachliche und logische
Negation
In Abschnitt 1 wurde festgestellt, da Nega-
tion eine semantische Operation ist, die Be-
deutungen bestimmter Typen auf gegenteilige
Bedeutungen desselben Typs abbildet. Es
wurde auch schon diskutiert, was gegentei-
lig hier heien knnte. Gnzlich offen ist
dagegen noch, auf welchen bestimmten Ty-
pen von Bedeutungen Negation operiert. Die
einfachste Hypothese hierzu wre: nur auf
einem Typ von Bedeutungen. Dies ist die Ant-
wort, die die in den meisten Systemen der
Logik enthaltene Negationsanalyse gibt. In
ihnen ist Negation ausschlielich eine Ope-
ration auf den semantischen Korrelaten von
Stzen, im allgemeinen nmlich auf einer
Menge von Wahrheitswerten. Die populrste
Analyse dieser Art ist die in der folgenden
Wahrheitstafel festgehaltene, wobei wir die
fragliche Operation durch den Operator
NEG1 ausdrcken (sie wird blicherweise
durch oder ~ symbolisiert; im folgen-
den wird, wo dies unschdlich ist, der Unter-
schied zwischen Operatoren und den von ih-
nen bezeichneten Operationen ignoriert; p
ist eine Metavariable fr logische Formeln):
Wahrheitstafel fr NEG1
p NEG1(p)
w f
f w
Der ganze Rest dieses Artikels wird um die
Frage zentriert sein, ob sich auf dem Fun-
dament der theoretischen Identifikation der
natrlichsprachlichen Negation mit der logi-
wre. Manchmal lt er sich als verdeckter
Adnominal-Partitiv (bzw. Genitiv) interpre-
tieren, wie in mittelhochdeutsch (30):
(30) S brich ich mner triuwe niht.
Hier knnte man miner triuwe
als Spezifikator
des in niht etymologisch enthaltenen Substan-
tivs wiht auffassen. In anderen Fllen ist eine
solche Rckfhrung auf eine auch in affir-
mativen Stzen beobachtbare Partitiv- bzw.
Genitivfunktion kaum mglich, so in gotisch
(31):
(31) Ni was im barn. (wrtlich Nicht war
ihnen der Kinder)
ber den Ursprung des indoeuropischen
Negationsgenitivs spekulierte H. Hirt (1937:
75), da das indoeuropische Negationsele-
ment ne ursprnglich den Wert eines No-
mens hatte, von dem regelrecht der Genitiv
abhngig war. Eine befriedigendere Erkl-
rung fr die Negationssensitivitt des Parti-
tivs mte im Auge behalten, da in vielen
Sprachen, in denen Akkusative mit Partitiven
alternieren (ltere germanische Sprachen, sla-
wische, finno-ugrische und baltische Spra-
chen, Baskisch u. a. m.), dies nicht nur unter
dem Einflu der Negation geschieht, sondern
auch unter dem anderer aspektueller Ab-
schwchungen des Geltungsgrades der jewei-
ligen Aussage, so etwa, wenn das beschriebene
Ereignis als nicht beendet oder das jeweilige
Objekt als nicht vollstndig vom Ereignis be-
troffen dargestellt wird, vgl. Moravcsik 1978.
Krifka 1989 vermutet deshalb, da der Par-
titiv/Genitiv in den fraglichen Sprachen ein
negatives Polarittselement ist, vgl. auch
Abschnitt 5.
Negationssensitiv im eben angedeuteten
schwachen Sinn sind schlielich die Nega-
tionstrger selbst. Vor allem in Nicht-Stan-
dardsprache gilt das Prinzip: Ein Negations-
trger kommt selten allein. Oft dienen die
dadurch entstehenden pleonastischen Nega-
tionstrgerhufungen einer emphatischen
Strkung der Negation, oft fhren sie aber
auch nur zu einer redundanten Negations-
markierung, vor allem dann, wenn sie durch
Jespersens Zyklus konventionalisiert sind.
Und genauso wie die oben genannten Ph-
nomene dehnt sich auch dieses auf negations-
hnliche Kontexte aus, so da man z. B. in
vielen Sprachen auch im Komplement von
Verben des Zweifelns, Frchtens, Hinderns,
Verbieten, Leugnens usw. pleonastische Ne-
gationstrger findet. (Vgl. Horn 1978: 3.3.2.)
Ein bekanntes Beispiel ist das franzsische ne
expltif:
25. Negation 569
dem der Satzintensionen; symbolisiert den
Extensor. Die propositionale Bedeutung
nur von dieser soll hier die Rede sein des
Beispiels (34)
(34) Peter kommt nicht.
knnte dann mit (34 a) reprsentiert werden,
also mit einer Formel, in der die Negation
tatschlich als auf einer Satzintension operie-
rend dargestellt wird (Teile von semantischen
Reprsentationen, deren genaue Struktur
nicht spezifiert werden soll, werden durch
Groschreibung des entsprechenden natr-
lichsprachlichen Materials wiedergegeben):
(34)
a. q(NEG(q) ( PETER KOMMT)
Dies ist aber nach Lambda-Konversion (und
nach = ) quivalent mit (34 b):
(34)
b. NEG(PETER KOMMT)
Der vermutete Widerspruch besteht also gar
nicht: Ob man die logische Negation als
Wahrheitswert- oder als Satzintensionsnega-
tion formuliert, hat keine Konsequenzen fr
die Diskussion von HNEG. Da man Satz-
intensionen als (grobe) Entsprechung der von
den Stzen jeweils zum Ausdruck gebrachten
Sachverhalte betrachten kann, werde ich im
folgenden NEG auch oft als Sachverhalts-
negation bezeichnen.
Bevor man berprft, ob in allen Fllen
eine theoretische Identifikation der natrlich-
sprachlichen Negation mit NEG mglich ist,
sollte man fragen, ob es Beispiele gibt, in
denen diese Identifikation ntig ist. Diese
Frage kann man bejahen. In (35)
(35) Es regnet nicht.
kann man die Negation wohl kaum anders
auffassen als als Operation, die den Wahr-
heitswert, den die Aussage, da es regnet, in
einer gegebenen Situation hat, umdreht.
M. a. W.: Die propositionale Bedeutung von
(35) kann man kaum anders als durch (35 a)
reprsentieren:
(35)
a. NEG(REGNEN)
Insbesondere liee sich hier, anders als in (34),
die Negation nicht als Operation auf der Be-
deutung eines einstelligen Prdikats auffassen
es gibt ja kein solches Prdikat in (35).
Darberhinaus ist fr (34) die Annahme einer
solchen Prdikatsnegation anscheinend un-
ntig. NEG scheint also fr die Analyse man-
cher Beispiele notwendig, fr die anderer zu-
mindest brauchbar ein fr den Vertreter
von HNEG ermutigendes Ergebnis.
schen Negation eine adquate Semantik fr
die negativen Ausdrcke natrlicher Spra-
chen aufbauen lt. Dabei wird zunchst dis-
kutiert, ob auf dieser Basis den vielfltigen
Schattierungen des Negationsbezugs Rech-
nung getragen werden kann.
Manche Semantiker halten es fr selbst-
verstndlich, da diese Fragen zu bejahen
sind. Ihnen sollte man entgegenhalten, da
die Logiksysteme, in die Operationen wie
NEG1 eingebettet sind, nicht ausschlielich
zum Zweck der semantischen Analyse natr-
licher Sprachen entworfen wurden. Zudem
spielte oft auch dann, wenn die Logik als
Instrument der Sprachanalyse angewandt
wurde, die fr Linguisten zentrale Frage nur
eine untergeordnete Rolle, nmlich die nach
der Bedeutungskomposition. Man kann also
nicht von vorneherein ausschlieen, da die
logische Negation die Verhltnisse in den na-
trlichen Sprachen zumindest simplifiziert.
Andererseits ist die Rekonstruktion der na-
trlichsprachlichen durch die logische Nega-
tion sicher ein theoretisch attraktives Unter-
fangen, beinhaltet sie doch den Versuch einer
Zurckfhrung einer Vielfalt von Phnome-
nen (vgl. 2.) auf ein einfaches Prinzip.
Da vorerst nicht von einer bestimmten der
in der Literatur vorgeschlagenen Varianten
der logischen Negation die Rede sein soll,
symbolisieren wir die logische Negation im
folgenden mit NEG, als Sammelbegriff fr
logische Operationen, die (wie NEG1) Wahr-
heitswerte umdrehen. Die Hypothese
(HNEG) przisiert die oben angedeutete Fra-
gestellung:
(HNEG) Fr jede natrliche Sprache L gilt:
In einer adquaten semantischen
Theorie fr L lt sich jedes Vor-
kommen von Negation mit NEG
reprsentieren.
Zunchst soll der nahliegende Einwand gegen
HNEG ausgerumt werden, da NEG auf
Wahrheitswerten operiere, stehe im Wider-
spruch zu der in 1. gegebenen Bestimmung
der natrlichsprachlichen Negation als einer
Operation auf Bedeutungen. Es ist leicht,
NEG ohne nderung des Inhalts kategorial
so anzuheben, da daraus eine Operation
auf Objekten wird, die man eher mit Satzbe-
deutungen identifizieren kann als Wahrheits-
werte, nmlich eine Operation auf Satzinten-
sionen. In der Notation von Montagues in-
tensionaler Logik (vgl. Art. 7) wre diese Ope-
ration als q(NEG (q) darzustellen, wobei
q eine Variable vom Typ s, t ist, also von
570 VII. Semantik der Funktionswrter
darstellt, da dem Prdikat in der semanti-
schen Reprsentation ein ganzer logischer
Satz entspricht, kann man auf diesen NEG
anwenden. Das ist leicht mglich. Der klas-
sischen Quantorenlogik folgend knnte man
(37) als eine logische Verknpfung zweier
Formeln unter einer Quantifikation darstellen
(x ist eine Individuenvariable, Montague-
Typ e):
(37)
b.
FR MANCHE x: x IST LIN-
GUIST & NEG(x MAG NOAM
CHOMSKY)
Oder man knnte (37) im Stil der Theorie der
Generalisierten Quantoren (vgl. Artikel 21)
so reprsentieren, da das Subjekt Funktor
auf dem Prdikat ist, und dieses dabei mit
Hilfe des Lambda-Operators ins erforderliche
Format bringen:
(37)
c. MANCHE LINGUISTEN
(x (NEG(x MAG NOAM
CHOMSKY)))
Diese Reprsentationen stellen die Einschrn-
kung der Wirkung der Negation auf das Pr-
dikat dar und stehen dennoch im Einklang
mit HNEG. Allgemein kann man sagen, da
sich auch Nicht-Satznegation (s. o.) durch
NEG reprsentieren lt, wenn sich der Satz-
teil, auf den sich die Negation bezieht, in der
Semantik als eine Formel im Skopus von
NEG, also innerhalb des NEG folgenden
Klammerpaars, darstellen lt. HNEG bein-
haltet also nicht, da Negation immer Satz-
negation ist, sondern da dem Material im
semantischen Bereich des Negationstrgers
immer ein ganz logischer Satz bzw. ein ganzer
Sachverhalt entspricht. Semantischer Bereich
ist dabei folgendermaen zu verstehen:
In einem Satz S ist ein Abschnitt X seman-
tischer Bereich einer Konstituente Y, wenn
in der semantischen Reprsentation von S
die Entsprechung zu X den Skopus der
Entsprechung von Y bildet.
(Hier wie berall im folgenden steht S fr
einen Satz mit fixierter Lesart, also eigentlich
ein Paar aus einem Satz und einer Interpre-
tation.)
Eine Sttzung der eben erwhnten Kon-
sequenz von HNEG mag man darin sehen,
da sich auf ihrer Basis fr manche Sprachen
sehr einfache Regularitten des Zusammen-
hangs zwischen der syntaktischen Rolle von
Negationstrgern und ihrem semantischen
Bereich konstatieren lassen. So wurde, aus-
gehend von HNEG, in Jacobs 1982 gezeigt,
da im Gegenwartsdeutschen der semantische
Bereich der Negationstrger und vieler an-
3.2Semantischer und syntaktischer
Negationsbereich
Die vorangehenden Beispielanalysen knnten
die Annahme nahelegen, aus HNEG folge,
da Negation sich jeweils auf den ganzen
Restsatz beziehe, in diesem Sinne also immer
Satznegation sei. Dann wre HNEG aber
nicht zu halten. Zwar ist der Bezug auf den
ganzen Restsatz sicher eine der Optionen fr
natrlichsprachliche Negation (sofern sie
keine Begriffsnegation ist, vgl. 4.3), doch in-
tuitiv bezieht sich die Negation sehr hufig
nur auf bestimmte Teile des Restsatzes:
(36) Regnet es nicht, so gehen wir spazieren.
(37) Manche Linguisten mgen Noam
Chomsky nicht.
(38) Kein Linguist mag Stalin.
(39) Nicht ich habe dich verpfiffen.
Intuition und grammatische Tradition sagen
uns, da hier die Negation nur das jeweils
hervorgehobene Material betrifft. Lt sich
das mit HNEG in Einklang bringen? Bei (36)
ist das leicht mglich. Hier liegt eine kondi-
tionale Verbindung zweier Stze vor, und
nichts spricht dagegen, NEG nur auf den
ersten anzuwenden, (36) also so wie in (36 a)
zu reprsentieren (wobei fr eine geeig-
nete Explikation des Konditionals steht, vgl.
Artikel 30):
(36)
a. NEG(REGNEN) WIR GEHEN
SPAZIEREN
(36 a) zeigt, da HNEG die Identifikation von
Negation mit Satznegation nicht in jedem Fall
erzwingt. Aber was geschieht bei nicht-kom-
plexen Stzen wie (37)? Diesen Satz mit (37 a)
zu reprsentieren,
(37)
a. NEG(MANCHE LINGUISTEN
MGEN NOAM CHOMSKY)
wre inkorrekt: (37) beinhaltet ja nicht die
Negation des Sachverhalts, da manche Lin-
guisten Noam Chomsky mgen. Das erkennt
man daran, da (37) wahr sein kann, wenn
dieser Sachverhalt zutrifft. In (37) wird viel-
mehr ber manche Linguisten eine negative
Prdikation gemacht, nmlich da sie Noam
Chomsky nicht mgen. Das Prdikat, nicht
aber das Subjekt, liegt hier im Wirkungsbe-
reich der Negation der Normalfall in na-
trlichen Sprachen (vgl. z. B. Givn 1984).
Wenn man Negation als Operation auf Pr-
dikatsbedeutungen explizieren wrde, knnte
man das leicht reprsentieren. Doch auch
HNEG erlaubt eine entsprechende Reprsen-
tation. Wenn man die Bedeutung von (37) so
25. Negation 571
reichs wird nach der Beschreibung von Alice
Davison (1978) manchmal rein kontextuell
beseitigt (vgl. Davison 1978: 35), fter jedoch
durch den Einsatz von grammatischen Mit-
teln, die eigentlich nicht der Markierung des
semantischen Bereichs dienen, aber durch
Vermittlung pragmatischer Interpretations-
mechanismen bereichsdisambiguierend wir-
ken. So wird in negativen Stzen die Anwe-
senheit von Numerus-, Genus- oder anderen
Spezifizierungen an einem existenzquantifizie-
renden Pronomen als Hinweis darauf gewer-
tet, da dieses auerhalb des Bereichs der
Negation liegt, whrend die Abwesenheit sol-
cher Spezifizierungen die Einbeziehung des
Pronomens in den Bereich der Negation na-
helegt:
(44) Kisii nee kuch nah deekhaa.
Jemand-erg. etwas nicht sah
Prferierte Lesart: NEG(JEMAND
SAH ETWAS)
(45) Kuch vyaktiy nee kuch nah deek-
haa.
Etwas Leute (= einige Leute)
Prferierte Lesart: EINIGE LEUTE (x
(NEG (x SAHEN ETWAS)))
Davison fhrt diese Lesartenverteilung dar-
auf zurck, da die Markierung der Pluralitt
(vyaktiy) in (45) gegen das Gricesche Re-
levanzprinzip verstiee, wenn die Subjekt-NP
im Bereich der Negation und damit ohne Re-
ferenten sein soll. Andererseits verstiee nach
Davison der Mangel an nherer Spezifizie-
rung in (44) gegen das Gricesche Quantitts-
prinzip, wenn die Subjekts-NP referieren, also
auerhalb des Bereichs der Negation liegen
soll. (Vgl. Davison 1978: 30 f.)
Ein weiterer Faktor, der in natrlichen
Sprachen mgliche Bereichsambiguitten ein-
schrnkt, sind inhrente Bereichsprferenzen.
So gilt universell, da beim Zusammentreffen
eines Negationstrgers mit einem Existenz-
oder Allquantor im selben einfachen Satz der
letztere als im semantischen Bereich des er-
steren liegend interpretiert wird, es sei denn,
es wird (wie in (45)) deutlich das Gegenteil
angezeigt, was dann oft zu markierten Struk-
turen fhrt, vgl. Givn 1978. Deswegen sind
z. B. deutsche Stze wie (46),
(46) Er mag jeden Diktator nicht.
in denen durch die Reihenfolge ausdrcklich
der Quantor aus dem Bereich der Negation
herausgerckt wird, ziemlich ungewhnlich,
fr manche Sprecher sogar inakzeptabel (vgl.
Jacobs 1982). Eine berzeugende Erklrung
fr diese inhrenten Bereichsprferenzen steht
bisher noch aus.
derer Ausdrcke (z. B. quantifizierender NPn)
stark mit der Oberflchenreihenfolge korre-
liert (wobei dies allerdings nur fr bestimmte
topologische Felder gilt, insbesondere fr das
sogenannte Mittelfeld, vgl. Jacobs 1982:
3.3.2):
(40) da nicht viele Linguisten freiwillig jeden
zweiten Tag duschen
(41) da viele Linguisten nicht freiwillig jeden
zweiten Tag duschen
(42) da viele Linguisten freiwillig nicht jeden
zweiten Tag duschen
(43) da viele Linguisten freiwillig jeden
zweiten Tag nicht duschen
Wenn man die propositionale Bedeutung die-
ser Stze im Sinne von HNEG mit (40 a)
(43 a) reprsentiert (wir bentzen weiter die
Reprsentationsform der Theorie der Gene-
ralisierten Quantoren, s. o.), ergibt sich, da
fr alle involvierten Konstituenten X und Y
gilt: wenn X im semantischen Bereich von Y
ist, folgt X linear auf Y. (Weiter unten wird
deutlich werden, da dieser Zusammenhang
aus strukturellen Eigenschaften der Stze ab-
geleitet werden kann.)
(40)
a. NEG (VIELE LING. (FREIW.
(JED. ZW. T. (DUSCH.))))
(41)
a. VIELE LING. (x (NEG (FREIW.
(JED. ZW. T. (x DUSCH.)))))
(42)
a. VIELE LING. (Xx (FREIW. (NEG
(JED. ZW. T. (x DUSCH)))))
(43)
a. VIELE LING. (x (FREIW. (JED.
ZW. T. (NEG (x DUSCH.)))))
Nicht immer lt sich jedoch auf der Basis
solcher Bedeutungsreprsentationen ein so
einfacher Zusammenhang zwischen Syntax
und semantischem Bereich konstatieren. Dies
gilt insbesondere fr Sprachen, bei denen die
Position des Negationstrgers innerhalb des
Verbalkomplexes fixiert ist (also wohl fr die
Mehrzahl aller Sprachen, vgl. 2.1). Viele die-
ser Sprachen scheinen berhaupt keine for-
male Markierung des semantischen Bereichs
vorzusehen und die dadurch entstehenden
Ambiguitten rein kontextuell aufzulsen.
Andere verwenden daneben indirekte formale
Hinweise, wie Hindi-Urdu, eine OV-Sprache,
in der das Negationselement immer unmittel-
bar vor dem Verb steht und das zudem keine
lexikalisch-morphologischen Mittel hat, um
anzuzeigen, ob Ausdrcke im semantischen
Bereich der Negation liegen (wie engl. some
vs. any). Die dadurch verursachte potentielle
Ambiguitt des semantischen Negationsbe-
572 VII. Semantik der Funktionswrter
giert? Man mu nicht, wenn man, anders als
die traditionelle Grammatik, das Konzept des
Negationsbezugs als ein mehrdimensionales
verstehen. Da sich ein Negationstrgervor-
kommnis X auf ein Element Y bezieht, kann
danach vier Dinge bedeuten:
(i) Y ist semantischer Bereich von X
(ii) Y ist syntaktischer Bereich von X
(iii) Y ist pragmatischer Bereich von X
(iv) Y ist Fokus von X
Auf der Basis dieser Auffassung kann man
HNEG in Einklang mit den auf der gram-
matischen Intuition beruhenden Ansichten
der traditionellen Grammatik ber den Ne-
gationsbezug bringen, diesen aber gleichzeitig
viel genauer analysieren. So kann man sagen,
da sich (38) kein tatschlich auf das nach-
folgende Nomen bezieht, allerdings nur in
dem Sinne, da das letztere der syntaktische
Bereich des Negationstrgers ist. Der syntak-
tische Bereich entspricht der K-Kommando-
Relation der Generativen Grammatik:
Immerhin ergibt sich aus den eben disku-
tierten Zusammenhngen kein offensichtli-
ches Argument gegen die Hypothese HNEG.
Wie aber wird HNEG mit den noch nicht
diskutierten Beispielen (38)(39) fertig?
Kann man der Einschtzung der traditionel-
len Grammatik, da in ihnen Satzteilnegation
vorliegt, genauso wie bei (36) und (37) durch
die Annahme einer Einschrnkung des se-
mantischen Bereichs der Negation Rechnung
tragen? Schon bei (38) ist dies problematisch.
Dieser Satz beinhaltet die Negation des Sach-
verhalts, da es einen Linguisten gibt, der
Stalin mag, mu also nach den oben einge-
fhrten Annahmen so reprsentiert werden:
(38)
a. NEG(EIN LINGUIST MAG STA-
LIN)
Danach ist die Negation in (38) aber Satz-
negation. Mu man also die traditionelle An-
sicht zurckweisen, in Stzen wie (38) werde
das dem Negationstrger folgende Nomen ne-
ist, eine semantische Reprsentation wie (38 a)
zuordnen, in der der Skopus von NEG das
dem ganzen Restsatz entsprechende Material
ist? Im Rahmen der Montague-Grammatik
(vgl. Art. 7) kann diese Aufgabe etwa so ge-
lst werden wie in der Ableitung (38 b), die
(unter Ignorierung vieler hier unwichtiger
syntaktischer Probleme) angibt, wie eine
Strukturierung und eine bersetzung von
(38) aus Strukturierungen bzw. bersetzun-
gen von Teilen dieses Satzes aufgebaut werden
(P und Q sind Variablen des Montague-
Typs e, t).
Die im letzten Schritt abgeleitete bersetzung
kann durch Lambda-Konversion zu (38 a) re-
duziert werden. (In Abschnitt 6 wird sich zei-
gen, da sich Unterschiede zwischen dem syn-
taktischen und dem semantischen Bereich
nicht immer so einfach berbrcken lassen
und da auch die hier angenommene seman-
tische Analyse des Wortes kein zu berdenken
ist.)
Der syntaktische Bereich einer Konsti-
tuente X in einem Satz S ist das Material,
das nach Aufweis der Konstituentenstruk-
tur von S vom ersten verzweigenden Kno-
ten dominiert wird, der X dominiert, und
weder von X dominiert wird noch X do-
miniert
Im Sinne des semantischen Bereichs bezieht
sich die Negation in (38) dagegen auf den
ganzen Satz, s. (38 a). (Zu (iii) und (iv) s. u.)
Die mehrdimensionale Analyse des Nega-
tionsbezugs ist nicht nur flexibler als die tra-
ditionelle eindimensionale, sondern sie erff-
net auch interessante neue Fragestellungen,
so die nach dem Verhltnis zwischen den Be-
zugsdimensionen. Diese beinhaltet zunchst
das technische Problem, wie man in einer
expliziten Grammatik die verschiedenen Di-
mensionen miteinander in Beziehung setzen
kann. Wie kann man z. B. einer syntaktischen
Analyse von (38), nach der der syntaktische
Bereich von kein das nachfolgende Nomen
25. Negation 573
da Gesetz (A) nicht gilt, wenn Y gegenber
X in einer Kopfposition ist. In diesem Fall
gilt ein anderes Prinzip (vgl. Jacobs 1990):
(B) X kann im semantischen Bereich von Y
liegen, wenn X auf der Linie liegt, auf
der Merkmale von Y nach oben weiter-
gereicht werden.
Die Wirksamkeit von (B) erkennt man z. B.
an Stzen wie (48):
(48) da viele Linguisten Stalin nicht zu m-
gen scheinen
Eine naheliegende Lesart von (48) ist (48 a),
die syntaktische Struktur in etwa (48 b):
(48)
a. SCHEINEN (VIELE LINGUI-
STEN (x (NEG (x MGEN STA-
LIN))))
b. (
S
viele Linguisten (
VP
(
VP
Stalin (nicht
zu mgen)) scheinen))
Weil scheinen
nach (48 b) die Kopfposition des
ganzen Satzes innehat, kann SCHEINEN
nach (47) auf die bersetzung jeder Konsti-
tuente angewandt werden, die auf der Per-
kolationslinie des Finitums liegt, also, wie in
(48 a), auch auf die des gesamten Restsatzes.
(Es wird angenommen, da Merkmale des
Finitums bis zum S-Knoten weitergereicht
werden.) Eine Beschrnkung des semanti-
schen Bereichs von scheinen durch den syn-
taktischen Bereich im Sinne von (A) besteht
offensichtlich nicht. Deswegen kann dieses
Verb hier auch mhelos den adverbalen Ne-
gationstrger in seinen semantischen Bereich
nehmen.
Wenn wir annehmen, da (A) und (B) die
Interaktion von syntaktischer Struktur und
semantischem Bereich exhaustiv beschreiben,
lassen sich daraus bestimmte Voraussetzungen
fr normale Negationstrgerpositionen ablei-
ten. Wenn nmlich, wie wir oben bei der Dis-
kussion von (37) schon festgestellt haben, der
semantische Bereich von Negationstrgern im
unmarkierten Fall das jeweilige Prdikat ist,
d. h. der Komplex aus dem Verb und (gege-
benenfalls) seinen Objekten, dann gibt es nach
(A)/(B) zwei Normalpositionen fr Nega-
tionstrger:
(a) wenn Negationstrger als Nicht-Kpfe
realisiert werden (etwa als Adjunkte),
sollten sie eine Position haben, von der
aus das Prdikat in ihrem syntaktischem
Bereich liegt;
(b) wenn Negationstrger in einer Kopfpo-
sition sitzen, sollte dies die Kopfposition
des Prdikats (und damit des ganzen Sat-
Mit der Unterscheidung verschiedener Be-
zugsdimensionen stellt sich auch die Frage
nach mglichen Gesetzmigkeiten ihres Zu-
sammenwirkens. So liegt es angesichts von
Beispielen wie (47)
(47) Da dieses Problem nicht gelst ist,
wundert viele Linguisten.
nahe, das folgende Gesetz anzunehmen:
(A) Nur dann, wenn X im syntaktischen Be-
reich von Y ist, ist X auch im semanti-
schen Bereich von Y.
Dieses Gesetz erklrt, warum in (47) der
Quantor viele nicht im semantischen Bereich
des Negationstrgers liegt, obwohl er auf ihn
folgt. (Dieses Gesetz geht auf Reinhart 1983
zurck, wo allerdings nicht bemerkt wurde,
da ein anderes Prinzip gilt, wenn Y in der
Kopfposition gegenber X ist, s. u.)
Doch wie steht es mit Stzen wie (38), wo
wir ja gerade gezeigt haben, da der syntak-
tische Bereich des Negationstrgers kleiner ist
als sein semantischer Bereich? Wenn man an-
gesichts solcher Flle (A) nicht einfach als
falsifiziert betrachten will, mu man anneh-
men, da Y in (A) nur fr ganze NPn, PPn
etc., also jedenfalls nicht fr echte Teile von
Satzgliedern steht. Dann gibt es keinen Kon-
flikt mit (38) mehr: kein allein bleibt auer
Betracht, und die NP kein Linguist erfllt (A).
(Die VP, die nach Aufweis von (38 b) im se-
mantischen Bereich von kein Linguist und da-
mit im Einflubereich der darin enthaltenen
Negation liegt, befindet sich ja auch im syn-
taktischen Bereich dieser NP. Die in 6. zu
diskutierende Analyse von kein wrde es al-
lerdings erlauben, (A) ohne die genannte Ein-
schrnkung auf (38) anzuwenden.)
Darberhinaus legt es die Beschrnkung
des semantischen durch den syntaktischen Be-
reich nahe, da hinter der oben fr das Deut-
sche aufgezeigten Korrelation zwischen se-
mantischem Bereich und Reihenfolge ein
struktureller Zusammenhang steht. Wenn
man syntaktische Strukturen wie (43 b)
(43)
b. (viele Linguisten (freiwillig(jed. zw.
Tag (nicht duschen))))
annimmt (vgl. Jacobs 1982, 1983), folgen tat-
schlich bei Annahme von (A) die semanti-
schen aus den syntaktischen Bereichsverhlt-
nissen, und die Reihenfolge wre gegenber
letzteren ein sekundrer Faktor.
Auch in anderen Sprachen lassen sich zahl-
reiche Stellungseigenschaften von Negations-
trgern auf die Interaktion von syntaktischer
Struktur und semantischem Bereich zurck-
fhren. Hierbei mu man allerdings beachten,
574 VII. Semantik der Funktionswrter
korporationsanalyse ergibt sich daraus, da
sie erwarten lt, da Prinzip (B) den seman-
tischen Negationsbereich in SONegV-Spra-
chen steuert, was sich in massiven Bereichs-
ambiguitten sowie den Einsatz anderer als
struktureller oder topologischer Mittel zu de-
ren Abbau manifestieren mte. Diese Vor-
aussage sollte relativ leicht zu berprfen
sein. (Da Hindi-Urdu die fraglichen Eigen-
schaften hat, wurde ja schon oben deutlich.)
3.3Pragmatischer Negationsbereich
Die dritte der in 3.2 genannten Dimensionen
des Negationsbezugs wird in den verschiede-
nen Versionen des folgenden Dialogs sichtbar:
(49)
S1: Wohnt Peters Schwester bei ihrem
Freund?
S2: Nein, Peters Schwester wohnt nicht
bei ihrem Freund,
(a) denn sie hat eine eigene Woh-
nung.
(b) denn sie hat berhaupt keinen
festen Wohnsitz.
(c) denn er hat gar keine Schwester.
Intuitiv wird im ersten Satz der S2-uerung
in der a)-Version negiert, da Peters Schwe-
ster in der Wohnung einer anderen Person
wohnt, in b), da sie berhaupt irgendwo
wohnt, und in c), da sie existiert. In der
mehrdimensionalen Theorie des Negations-
bezugs sind diese Inhalte jeweils der prag-
matische Bereich der Negation im ersten Teil-
satz der S2-uerung:
Der pragmatische Bereich einer Negation
in einem Satz S bei einer uerung A von
S sind diejenigen Implikate (d. h. Inhalts-
bestandteile) des in S negierten Inhalts i,
deren Nicht-Erfllung fr den Sprecher
von die Negation von i rechtfertigen.
Dabei ist der folgende Zusammenhang zu be-
achten: Fr alle Implikate i eines Inhalts i
gilt: Wenn i nicht erfllt ist, ist die Negation
von i erfllt. (Dies gilt allerdings nicht fr
starke Negation, s. u.) Die Behauptung der
Negation von i kann also mit der Nicht-Er-
fllung eines beliebigen Implikats von i be-
grndet werden, das dann als pragmatischer
Bereich der Negation fungiert. Pragmatisch
ist dieses Phnomen einerseits wegen seines
essentiellen Bezugs auf uerungen, anderer-
seits, weil nicht gilt: wenn die Negation von i
erfllt ist, ist jedes Implikat i von i nicht
erfllt. Aus der Negation von i lt sich also
nicht auf die Nicht-Erfllung bestimmter ein-
zelner Implikate von i schlieen, sondern, falls
zes) sein, d. h. die Position des finiten
Verbs.
Diese Voraussetzungen passen gut zu den in
2.1 referierten Ergebnissen Dahls und Paynes
ber die Realisierungsformen der Standard-
negation und zur dabei deutlich gewordenen
Affinitt zum Verb: (a) beschreibt die Reali-
sierung der Negation als Adverbial (vgl. 2.1,
(ii)), (b) die Realisierung als morphologischer
Teil des Verbs, als Hilfsverb oder hheres Verb
bzw. als klitischer Bestandteil eines Hilfsverbs
(vgl. 2.1, (i), (iii)(v)). In all diesen Fllen
sitzt die Negation ja in der Kopfposition des
Prdikats.
Auch Dryers (1988) Beobachtungen der
Universalien der Negationstrgerstellung ste-
hen im Einklang mit (a) und (b) (vgl. ebenfalls
2.1). Dryer hat auch selbst schon einige dieser
Beobachtungen auf die Forderung, da im
unmarkierten Fall das Prdikat im semanti-
schen Negationsbereich liegen mu, zurck-
gefhrt, so z. B. die Tatsache, da in SVO-
Sprachen die prferierte Negationstrgerpo-
sition SNegVO ist, wobei er das Wirken des
Prinzips (A) voraussetzt und auerdem, da
semantische Einheiten dazu tendieren, syn-
taktisch kontingent realisiert zu werden, wes-
wegen das Objekt im Normalfall verbadjazent
ist. (Die nach dieser Erklrung ebenso gut
mgliche, aber faktisch sehr seltene Variante
SVONeg verstt nach Dryer gegen das
Branching Direction Principle, nach dem ein
universeller Trend zu entweder konsistent
linksverzweigendem oder konsistent rechts-
verzweigendem Strukturbau besteht. Vgl.
Dryer 1988: 98 ff. Im brigen wre auch bei
Einschlgigkeit von (B) wenn Neg also
z. B. ein negatives Hilfsverb ist SNegVO
eine gute Position fr Neg.)
Dryer hat andererseits groe Mhe, zu er-
klren, wieso in SOV-Sprachen neben SOV-
Neg auch SONegV sehr weit verbreitet ist,
verstt die letztere Anordnung doch bei
Annahme von Prdikatsnegation gegen
(A) und die prferierte Adjazenz von V und
O. (Vgl. Dryer 1988: 101 ff.) Wenn man jedoch
annimmt, da in solchen Fllen Neg ins Verb
inkorporiert ist, also syntaktisch als Teil des
Verbs fungiert, wren O und V genauer O
und (
V
Neg V) adjazent. Ein unabhngiges
Argument fr diese Inkorporationsanalyse
ist, da die unmittelbar prverbale Position
des Negationstrgers in den fraglichen Spra-
chen in der Regel obligatorisch zu sein scheint
(weswegen z. B. keine Adverbiale zwischen
Neg und V intervenieren drfen). Eine indi-
rekte Mglichkeit zur berprfung der In-
25. Negation 575
Version semantisch abweichend. In den an-
deren Versionen kann dagegen sowohl starke
als auch schwache Negation vorliegen, sie
sind also ambig. Ob es fr diese Analyse
plausible linguistische Argumente gibt, wird
in 4.2 diskutiert.
Zurck zu HNEG (vgl. 3.2). Beinhaltet der
pragmatische Bereich Schwierigkeiten fr
diese Hypothese? Zunchst ist festzustellen,
da das erwhnte Verhltnis zwischen der Ne-
gation eines Inhalts i und den Implikaten von
i mit NEG1 (s. 3.1) genau rekonstruiert wer-
den kann (wobei dann i natrlich ein Sach-
verhalt sein mu). Fr alle Formeln p gilt ja:
NEG1(p) (s. o.) ist wahr, wenn irgendeine
Folgerung q aus p falsch ist. Auerdem gilt
nicht: Wenn NEG1(p) wahr ist, dann sind alle
Folgerungen aus p falsch. Welche Folgerun-
gen aus dem negierten Sachverhalt in einem
gegebenen uerungskontext nach Meinung
des Sprechers nicht erfllt sind also der
pragmatische Bereich der Negation geht
natrlich nicht aus einer ansonsten adquaten
Formalisierung des geuerten Satzes mit
NEG1 hervor, aber das soll es ja auch nicht,
wenn diese Formalisierung als semantische
Reprsentation, also als eine der kontext-
unabhngigen Inhaltsaspekte, dienen soll.
Auch die Annahme einer Negationsart, die
in ihrem pragmatischen Bereich keine Prsup-
positionen zult (s. o.), bringt HNEG nicht
in Schwierigkeiten. Es gibt verschiedene Ver-
suche, die starke Negation logisch zu rekon-
struieren, vgl. 4.2.
3.4Der Fokus der Negation
Auch bei dem hier wiederholten Beispiel (39)
(in dem nun der Hauptakzent durch Gro-
schreibung angezeigt wird):
(39) Nicht ICH habe dich verpfiffen.
wrden traditionelle Grammatiker Satzteil-
negation konstatieren, weil nicht sich hier in
gewissem Sinn nur auf ich bezieht. Die mehr-
dimensionale Theorie des Negationsbezugs
kann das przisieren: Das Subjekt ist der Fo-
kus von nicht, whrend der Restsatz den Hin-
tergrund des Negationstrgers bildet. Dabei
gilt:
In einem Satz S ist ein Abschnitt X Fokus
und ein Abschnitt Y Hintergrund eines Ne-
gationstrgervorkommens Z genau dann,
wenn X gegenber Y hervorgehoben ist
und diese Hervorhebung anzeigt, da die
Ersetzung von X durch ein inhaltlich alter-
natives X bei gleichzeitiger Beibehaltung
nicht weitere Informationen hinzukommen,
nur darauf, da irgendwelche Implikate nicht
erfllt sind. Welche dies nach Meinung des
Sprechers sind, wechselt von Kontext zu Kon-
text, ist also pragmatisch bedingt.
Negative Stze erweisen sich aufgrund die-
ser Zusammenhnge als relativ uninformativ.
Infolge allgemeiner Konversationsprinzipien
(vgl. Atlas & Levinson 1981) besteht jedoch
die Tendenz, dieses Informativittsdefizit in
konkreten uerungskontexten zu beheben,
also den pragmatischen Bereich der Negation
mglichst klar zu machen. Dies kann man
durch explizite Zustze tun, wie in (a)(c)
von (49). Man kann sich aber oft auch auf
das gemeinsame Vorwissen der Diskursteil-
nehmer verlassen, wenn dieses eine Nicht-
Erfllung der Mehrzahl der Implikate des ne-
gierten Inhalts ausschliet und damit den
mglichen pragmatischen Bereich der Nega-
tion zumindest stark eingrenzt. Wenn bei (49)
das als gemeinsam vorausgesetzte Vorwissen
von S1 und S2 beinhaltet, da Peter eine
Schwester hat, die in der Wohnung einer an-
deren Person haust, ist auch ohne Zusatz klar,
da der pragmatische Bereich der Negation
nur sein kann, da diese andere Person ihr
Freund ist. Schlielich wird die Identifizie-
rung des pragmatischen Negationsbereichs
auch dadurch erleichtert, da es Implikate
gibt, die in aller Regel nicht in diesem Bereich
liegen. Wenn sie es doch tun sollen, mu es
hierfr deutliche Hinweise geben. Zu diesen
Implikaten gehrt die mit der Verwendung
einer definiten NP verbundene Existenzaus-
sage. Deswegen wirkt die Erluterung (c) in
(49) berraschend und der ganze Dialog in
dieser Variante etwas unnatrlich. Die Exi-
stenz von Peters Schwester liegt im ersten von
S2 in (49) geuerten Satz eben normaler-
weise nicht im pragmatischen Negationsbe-
reich.
Wir berhren hier das Problem der Pr-
suppositionen. Das sind Implikate, die von der
Negation und anderen semantischen Opera-
tionen (wie der In-Frage-Stellung) normaler-
weise nicht betroffen werden (vgl. Art. 13).
In der Debatte ber dieses Phnomen ist des
fteren die Existenz zweier Negationsarten po-
stuliert worden: einer starken Negation, die
Prsuppositionen grundstzlich aus ihrem
pragmatischen Bereich ausschliet, und einer
schwachen Negation, die das nicht tut. Da-
nach htten wir es also in der (c)-Version von
(49) im ersten von S2 geuerten Satz mit
schwacher Negation zu tun; bei Annahme
starker Negation wre der Dialog in dieser
576 VII. Semantik der Funktionswrter
Ein Indikator dafr, da eine Hervorhebung
einen Negationsfokus anzeigt, ist die An-
schliebarkeit einer entsprechenden Sondern-
Phrase, hier z. B. sondern das Wohnzimmer.
Dieser Zusatz ist in (50 a) mglich, kaum aber
in (50 b). Ein Indikator fr den Assertionsfo-
kus ist die Mglichkeit, den fraglichen Satz
als natrliche Antwort auf eine Ergnzungs-
frage zu uern, in der der hervorgehobene
Abschnitt durch eine W-Phrase ersetzt ist,
hier also Welchen Raum hat er nicht tapeziert?
Darauf kann man mit (50 b), aber nicht mit
(50 a) antworten.
Der klarste Hinweis darauf, da der Ne-
gationsfokus etwas anderes ist als das Rhema,
ist jedoch, da in typischen Verwendungskon-
texten fr Stze wie (39) oder (50 a) das her-
vorgehobene Material vorerwhnte Informa-
tion beinhaltet. Die natrlichste Position fr
(39) oder (50 a) im Gesprch ist die unmittel-
bar nach einer Behauptung des entsprechen-
den affirmativen Satzes.
All dies ist einerseits problematisch fr die
traditionelle Annahme, da die Hervorhe-
bung eine bestimmte feste (d. h. von ihrer
syntaktischen Umgebung unabhngige) Be-
deutung hat (etwa die, das Rhema anzuzei-
gen, vgl. z. B. Hajiov 1973, Szabolcsi
1981 a, Lieb 1984), und sttzt andererseits den
Vorschlag, den Fokus als eine autonome Be-
zugsdimension der Negation zu betrachten.
Zur weiteren Etablierung dieser Autono-
mie mu man den Fokus der Negation auch
von den in 3.23.3 diskutierten Bezugsdi-
mensionen abgrenzen. Das Verhltnis zum se-
mantischen Bereich lt sich leicht bestimmen:
Fokus und Hintergrund eines Negationstr-
gers bilden zusammen den semantischen Be-
reich desselben. Das erklrt die Akzeptabili-
ttsverteilung im folgenden Beispielpaar:
(51)
a. Ich bezweifle nicht, da er das WILL,
sondern ich bezweifle, da er das
KANN.
b. ??Ich bezweifle, da er das nicht
WILL, sondern ich bezweifle, da er
das KANN.
Nicht-elliptische Sondern-Phrasen bestehen
aus sondern, dem Hintergrund des jeweiligen
Negationstrgers und einer Konstituente, die
den Fokus des Negationstrgers ersetzt. In
(51 b) wird gegen diese Regel verstoen, weil
ich bezweifle nicht im semantischen Bereich
und damit weder im Fokus noch im Hinter-
von Y die in Z enthaltene Negation un-
angebracht machen wrde.
In (39) z. B. zeigt die durch die Akzentuierung
geleistete Hervorhebung an, da die Erset-
zung von ich durch einen inhaltlichen alter-
nativen Ausdruck (etwa Rudi) bei Beibehal-
tung der Verbalphrase die Negation unange-
bracht machen wrde (da also z. B. Rudi hat
dich verpfiffen eine zutreffende Aussage wre).
Dies steht im Einklang mit der allgemeinen
Bestimmung der Funktion der Fokus-Hinter-
grund-Gliederung aus Jacobs 1988 (wobei
dort allerdings noch eine semantische und
eine syntaktische Ebene dieses Phnomens
unterschieden wird):
In einem Satz S ist ein Abschnitt X Fokus
und ein Abschnitt Y Hintergrund eines Ele-
ments Z genau dann, wenn X gegenber Y
hervorgehoben ist und diese Hervorhebung
eine fr das Wirken von Z relevante Bezie-
hung zwischen X und inhaltlichen Alter-
nativen zu X anzeigt, die unter Vorausset-
zung der Beibehaltung von Y gilt.
Nicht nur Hervorhebungen in der Umgebung
von Gradpartikeln, Negationstrgern oder
Satzadverbien lassen sich als Foki im Sinne
dieser Definition auffassen, sondern auch sol-
che, fr die es kein fokussierendes Element
(das Z der Definition) in der Oberflchen-
struktur gibt. Eine solche Hervorhebung
kann nmlich als Fokus des in der semanti-
schen Struktur vorhandenen Illokutionstyp-
operators (Assertion, Frage, Aufforderung
etc.) aufgefat werden. Diese Theorie der Fo-
kussierung macht es zu einer empirischen
Frage, ob eine Hervorhebung in einem ne-
gativen Satz das Rhema des Satzes ist, also
der neue Information beinhaltende Teil.
Wenn man letzteren nmlich mit dem Fokus
des jeweiligen Illokutionstypoperators iden-
tifiziert (was durchaus sinnvoll ist, vgl. Jacobs
1984 a: 35), wird es theoretisch mglich, da
Hervorhebungen in negativen Stzen Nega-
tionsfokus sind, ohne Rhema zu sein (und
umgekehrt), weil ja der Fokus eines Elements
Z (hier: eines Negationstrgers) nicht iden-
tisch mit dem eines anderen Elements Z im
selben Satz (hier: des Illokationstypoperators)
sein mu. Und tatschlich ist das Rhema ne-
gativer Stze im allgemeinen verschieden vom
Negationsfokus. So lt sich die Hervorhe-
bung in (50 a) nur als Negationsfokus, die in
(50 b) nur als Assertionsfokus interpretieren:
(50)
a. Er hat nicht das SCHLAFzimmer ta-
peziert.
b. Er hat das SCHLAFzimmer nicht ta-
peziert.
25. Negation 577
nativen kommen hier in Frage dein, Gerdas
etc.) Bei einer Variante mit nicht-fokussieren-
der Negation
(53)
b. Es STIMMT nicht, da mein Hund
krzlich den Hausmeister gebissen
hat.
bestehen dagegen alle diese pragmatischen
Bereichsmglichkeiten. Dies macht deutlich,
da der Negationsfokus ein effektives Mittel
zur Eingrenzung des pragmatischen Bereichs
und damit zur Steigerung der Informativitt
von uerungen negativer Stze ist (s. 3.3).
Darberhinaus zeigt (53 a), da aufgrund der
geschilderten Zusammenhnge die Plazierung
des Negationsfokus eine starke Negations-
interpretation (s. 3.2) erzwingen kann, nm-
lich dann, wenn ein Prsuppositionsauslser
im Hintergrund liegt, wie in (53 a) den Haus-
meister. Tatschlich kann eine Behauptung
von (53 a) kaum damit begrndet werden, da
das Haus gar keinen Hausmeister hat (wohl
aber eine von (53 b)).
Wie kann man all dem im Rahmen von
HNEG (s. 3.1) Rechnung tragen? In Jacobs
1983 wurde vorgeschlagen, die Bedeutung
eines Beispiels wie (54)
(54) Nicht PEter kommt.
etwa so wie in (54 a) darzustellen (X eine
Variable vom NP-Typ):
(54)
a. NEG1(PETER KOMMT) & INKL
(X(X KOMMT), PETER)
Dabei ist INKL so definiert, da INKL(, )
genau dann wahr ist, wenn in der Menge der
bezglich a am Kontext in Frage kommenden
Alternativen ein von verschiedenes ist, so
da () wahr ist (vgl. Jacobs 1983: 146 f).
Damit wre (54 a) genau dann wahr, wenn
Peter nicht kommt und es in der Menge der
bezglich X(X KOMMT) im Kontext in
Frage kommenden Alternativen zu PETER
ein Y gibt, so da X(X KOMMT) (Y) (= Y
KOMMT) wahr ist. (Man beachte, da da-
nach aus (54 a) nicht folgt, da berhaupt
jemand kommt! Falls als Alternative zu PE-
TER auch NIEMAND in Frage kommt
eine Mglichkeit, mit der man durchaus rech-
nen mu, vgl. Jacobs 1982: 306 und falls
tatschlich niemand kommt, wird (54 a)
wahr.)
Eine Konsequenz dieser Formalisierung
der fokussierenden Negation ist, da der Sko-
pus des negierenden Anteils (NEG1) und der
des quantifizierenden Anteils (INKL) immer
gleich sind. Dies widerspricht dem an Gab-
bay/Moravcsik 1978 anschlieenden Vor-
grund von nicht liegt. (Nheres zu Sondern-
Phrasen in Lang 1984: Kap. 4.)
Die Beziehung zwischen dem Negations-
fokus und dem syntaktischen Negationsbe-
reich ist im Deutschen durch ein Geflecht von
Beschrnkungen geregelt (vgl. Jacobs 1986).
Zentral ist, da der Fokus einer Konstituente
Z (oder eine Spur dieses Fokus) innerhalb
des syntaktischen Bereichs von Z liegen mu.
Dies erzwingt eine groe Beweglichkeit der
Negationstrger, da im Deutschen fokussierte
Ausdrcke in den verschiedensten syntakti-
schen Positionen stehen knnen. In anderen
Sprachen gibt es jedoch feste Fokuspositionen
oder -konstruktionen, erstere zumeist verbad-
jazent, letztere oft cleft-artig, vgl. Harries-
Deslisle 1978. Ein Beispiel wre nach Kiss
1981 das Ungarische (der Beispielsatz ist aus
Szabolcsi 1981 a):
(52)
a. Nem Pter aludt a padln.
Nicht Peter schlief auf dem Fubo-
den.
(+fok)
b. Nem aludt Pter a padln.
Peter schlief nicht auf dem Fubo-
den.
(fok)
Eine enge Beziehung besteht zwischen dem
Fokus und dem pragmatischen Bereich der
Negation. Ein Implikat, das durch einen Aus-
druck im Hintergrund eines Negationstrgers
in einem Satz S induziert wird, kann bei einer
uerung von S nicht im pragmatischen Be-
reich der Negation liegen. Dies ergibt sich
unmittelbar aus der inhaltlichen Funktion des
Negationshintergrundes: Er bildet ja die kon-
stante Schablone fr die Einsetzung von Al-
ternativen zum Negationsfokus, wobei bei
mindestens einer solchen Einsetzung die Ne-
gation unangebracht und die dadurch entste-
hende Kombination aus Hintergrund und Fo-
kusalternative zutreffend wird (s. o.). Damit
letzteres mglich ist, mssen aber alle Hinter-
grundimplikate im jeweiligen Kontext erfllt
sein. Bei (53 a) z. B.,
(53)
a. Nicht MEIN Hund hat krzlich den
Hausmeister gebissen.
wo mein Negationsfokus und der darauf fol-
gende Abschnitt Negationshintergrund ist,
wird man als pragmatischen Negationsbe-
reich weder in Betracht ziehen, da ein Hund
jemand gebissen hat, noch da er krzlich
jemand gebissen hat, noch da er den Haus-
meister gebissen hat, sondern nur, da es der
Hund des Sprechers war, der krzlich den
Hausmeister gebissen hat. (Als Fokusalter-
578 VII. Semantik der Funktionswrter
Analyse im semantischen Bereich der Nega-
tion ist (hier da Peter kommt), den Tatsa-
chen entspricht. Damit werden Paare aus Be-
hauptung und Gegenbehauptung wie (58 a)
(mit Gesamtsatzfokus) und (58 b)
(58)
a. PEter kommt.
b. Nicht PEter kommt, sondern GERD.
als nicht in einem Widerspruchsverhltnis ste-
hend analysiert, was klar kontraintuitiv ist.
Auerdem ist diese Analyse sogar angesichts
von Beispielen wie (59) dubios,
(59) Nicht PEter kommt, sondern Peters
ganze FaMIlie (einschlielich seiner
selbst).
in denen die fokussierende Negation anschei-
nend mit der Wahrheit der negierten Aussage
kompatibel ist. Da Peter kommt, wird ja
auch in (59) in gewissem Sinne als nicht den
Tatsachen entsprechend gekennzeichnet. An-
dererseits macht auch unser (54 a) eine falsche
Voraussage, nmlich da (59) kontradikto-
risch ist. In 4.4 wird sich zeigen, da man es
hier mit einem ganz generellen Problem der
fokussierenden (genauer: replaziven) Nega-
tion zu tun haben, nmlich ihrer Nicht-Wahr-
heitsfunktionalitt.
Die skizzierte Analyse siedelt den Quanti-
fikationsanteil der fokussierenden Negation
in derselben Bedeutungsdimension an wie den
Negationsanteil. Da letzterer eindeutig ein
Bestandteil der Implikationen (entailments)
entsprechender Stze ist, sollte also auch er-
sterer zu den Implikationen gehren, also ins-
besondere keine Prsupposition oder Impli-
katur sein. Da dies im Gegensatz zu einer
weit verbreiteten Ansicht bei Stzen wie
(54) tatschlich der Fall ist, wurde in Jacobs
1982 gezeigt. Insbesondere das Annullie-
rungs- und Projektionsverhalten der entspre-
chenden Folgerungen ist eindeutig das von
Implikationen: Die Folgerungen sind weder
kontextuell aufhebbar noch berleben sie
semantische Modifikationen. So lt sich aus
(60) Wahrscheinlich kommt nicht PEter.
nicht folgern, da es ein X gibt, so da X
kommt, sondern nur, da es wahrscheinlich
ist, da es so ein X gibt. Das ist typisch fr
Implikationen.
4. Wieviele Negationsarten gibt es?
4.1Zwei Ebenen der
Negationsartdifferenzierung
In 3. wurde deutlich, da die theoretische
Gleichsetzung von natrlichsprachlicher und
logischer Negation einer differenzierten Ana-
schlag von J. Hoepelman (1979), nach dem
sich in bestimmten Fllen die beiden Skopi
nicht decken. Hoepelman wrde (55) (mit en-
gem Fokus auf Hund) mit einem quivalent
von (55 a) reprsentieren, whrend aus unse-
rer Formalisierung (55 b) die Formel (55 c)
folgt, in der die Existenzquantifikation wei-
teren Skopus hat als die Allquantifikation:
(55) Peter liebt nicht jeden HUND.
a. NEG1(x(HUND(x) PETER
LIEBT x)) & x(P(P(x) PETER
LIEBT x))
b. NEG1(x(HUND(x) PETER
LIEBT x)) & INKL(P(x(P(x)
PETER LIEBT x)),HUND)
c. NEG1(x(HUND(x) PETER
LIEBT x)) & P(x (P(x) PETER
LIEBT x))
(55a) kann im Gegensatz zu (55 c) wahr sein,
wenn es keine Spezies gibt, von der Peter alle
Exemplare liebt. (Tatschlich ist das zweite
Konjunkt von (55 a) eine Tautologie.) Da
dies nicht der intuitiven Bedeutung entspricht,
zeigen u. a. die an (55) anschliebaren Son-
dern-Phrasen, z. B. sondern jede Katze.
Eine weitere Eigenheit der vorgeschlagenen
Analyse ist, da nach ihr eine Negation, deren
Fokus ihren ganzen semantischen Bereich
umfat, nicht quivalent mit der entsprechen-
den nicht-fokussierenden Negation ist. Z. B.
ist (56) (mit es regnet als Negationsfokus)
nicht quivalent mit (57) (ohne Negations-
fokus):
(56) Es REGnet nicht.
(57) Es regnet NICHT.
Nach obigem Vorschlag wird (56) nmlich
anders als (57) schon dann falsch, wenn keine
der in Frage kommenden Alternativen zum
Regnen (etwa Schneien oder Hageln) zutrifft.
(Natrlich hat auch (56) eine Lesart mit nicht-
fokussierender Negation, nmlich mit regnet
als Rhema.)
Anders als oben wird das Verhltnis des
Negations- und des Quantifikationsanteils
der fokussierenden Negation von R. Posner
(1972) und A. Szabolcsi (1981 a, b) bestimmt.
(Szabolcsi analysiert allerdings ausdrcklich
nur das Ungarische.) Nach ihren Vorschlgen
wre (54) mit einem quivalent von (54 c)
(Posner) bzw. (54 d) (Szabolcsi) zu formalisie-
ren:
(54)
c. x (NEG1(PETER = x) & x
KOMMT)
d. NEG 1(X(X KOMMT
(X = PETER)))
Das Hauptproblem dabei ist, da offen ge-
lassen wird, ob die Aussage, die nach unserer
25. Negation 579
pus eines direktiven Operators steht, im nicht-
prohibitiven dagegen in dem eines anderen
Illokutionsoperators. Wenn man dies tut, ex-
pliziert man einen objektsprachlichen Nega-
tionsartunterschied in der semantischen Re-
prsentation als Bezugsunterschied.
Im allgemeinen wird man aber versuchen,
funktionale Unterschiede auf beiden Ebenen
gleich zu behandeln, also gleichermaen als
Bezugsunterschiede oder gleichermaen als
Negationsartunterschiede. Andernfalls be-
stnde die Gefahr, da einschlgige Regula-
ritten nicht verfat werden. Da in (61) der
entsprechende affirmative Satz komplemen-
tr negiert wird (vgl. 1.), in (62) dagegen
nicht-komplementr (in einer anderen Ter-
minologie: kontradiktorisch bzw. kontrr),
(61) Es wird hier nicht stndig gearbeitet.
(62) Es wird hier stndig nicht gearbeitet.
wird man in der semantischen Reprsentation
kaum durch verschiedene Negationsoperato-
ren explizieren wollen. Durch ein solches Vor-
gehen wrde man eine Ad-hoc-Ausnahme
von den ansonsten im Deutschen geltenden
Zusammenhngen zwischen der syntakti-
schen Position und dem semantischen Bereich
von Negationstrgern konstruieren (nach de-
nen hier nur in (61) stndig im semantischen
Bereich von nicht sein kann, vgl. 3.2), und
dies ganz unntigerweise, weil eine Reprsen-
tation, die in bereinstimmung mit diesen
Zusammenhngen hier einen reinen Bereichs-
unterschied konstatiert, den Unterschied in
der Wirkung der Negation genauso gut er-
fassen kann:
(61)
a.
HIER(NEG1(STNDIG(WIRD
GEARBEITET)))
(62)
a.
HIER(STNDIG(NEG1(WIRD
GEARBEITET)))
Hierin kommt zum Ausdruck, da in (62) die
Negation strker ist als in (61). (Aus (62 a)
folgt (61 a), aber nicht umgekehrt.)
4.2Starke und schwache Negation
Eine viel diskutierte Negationsartunterschei-
dung ist die von starker und schwacher Ne-
gation. Wie schon in 3.2 gesagt, ist erstere
dadurch gekennzeichnet, da Prsuppositio-
nen immer auerhalb ihres pragmatischen Be-
reichs liegen, whrend dies fr letztere nicht
gilt. Nach 4.1 ist die Frage nach dem Wert
dieser Unterscheidung in zwei Teilfragen zu
zerlegen: Einerseits mu man fragen, ob
Sprachsysteme eine dieser Unterscheidung
entsprechende Differenzierung ihrer Aus-
lyse der Bezugsvariation natrlichsprachli-
cher Negationstrger nicht im Wege steht.
Eine andere Frage ist jedoch, ob durch An-
nahme von Bezugsvariationen alle funktio-
nalen Differenzierungen der natrlichsprach-
lichen Negation erklrt werden knnen. Mu
man hierzu nicht auch Variationen in der Art
der jeweils involvierten Negation annehmen?
Es gibt zwei Ebenen, auf denen theoretische
Negationsartdifferenzierungen mglich sind.
Zum einen kann man solche Differenzierun-
gen auf der Ebene der Beschreibung der Aus-
drucksmittel der Negation einfhren. Wenn in
einer natrlichen Sprache eine funktionale
Differenzierung im Bereich der Negation mit
zwei unterschiedlichen Arten, die Negation
zum Ausdruck zu bringen, verbunden ist und
wenn sich darberhinaus dieser Unterschied
in den Ausdrucksmitteln nicht auf gngige
Muster, Bezugsunterschiede anzuzeigen, zu-
rckfhren lt, dann kann man sagen, da
die fragliche funktionale Differenzierung im
jeweiligen Sprachsystem als Negationsart-
unterschied kodiert wird.
Andererseits knnte sich die Annahme ver-
schiedener Negationsarten auf der Ebene der
semantischen Reprsentation als ntig erwei-
sen, dann nmlich, wenn man einen funktio-
nalen Unterschied nicht ausschielich da-
durch erfassen kann, da man ein und dem-
selben Negationsoperator verschiedene Posi-
tionen in der semantischen Reprsentation
zuweist (z. B. verschiedenen Skopus), sondern
dazu zwei semantisch verschiedene Nega-
tionsoperatoren annehmen mu. Damit htte
man eine Negationsdifferenzierung in die se-
mantische Beschreibungssprache eingefhrt.
Diese beiden Ebenen der Negationsartdif-
ferenzierung die objektsprachliche und die
reprsentationssprachliche sind prinzipiell
voneinander unabhngig. So kann es sein,
da einer Differenzierung auf der ersten
Ebene keine auf der zweiten entspricht. Ein
Beispiel wre die in vielen Sprachsystemen
enthaltene lexikalische Unterscheidung zwi-
schen normaler und prohibitiver Negation.
(Vgl. Dhmann 1974: 34 f.) Z. B. verwendet
das Neugriechische in Verboten, Ratschlgen,
etwas zu unterlassen, etc. den Negationstrger
, wo in anderen Satztypen die Partikel
steht. In der semantischen Reprsentation je-
doch knnte man prohibitive und nicht-pro-
hibitive Negation durch denselben Negations-
operator darstellen und den funktionalen Un-
terschied dadurch explizieren, da auf der
Ebene der Reprsentation der illokutionren
Bedeutung (vgl. Zaefferer 1979) dieser Ne-
gationsoperator im prohibitiven Fall im Sko-
580 VII. Semantik der Funktionswrter
Negationstrgers liegt. Tatschlich ist dies oft
nicht nur technisch machbar, sondern stimmt
auch vllig mit den Regularitten der syntak-
tischen Markierung des semantischen Be-
reichs berein:
(63) Der Erzbischof hat zwei Mtressen des
Knigs von Frankreich nicht gegrt.
(64) Es war der Knig von Frankreich selbst,
der seine Mtressen nicht gegrt hat.
(65) Auch Elsa, die der Knig von Frank-
reich sehr verehrt, hat er nicht gegrt.
Da in diesen Stzen die Prsupposition, da
es einen Knig von Frankreich gibt, niemals
im pragmatischen Bereich der Negation liegt,
kann man mhelos darauf zurckfhren, da
hier berall der Prsuppositionsauslser der
Knig von Frankreich auerhalb des seman-
tischen Bereichs des mit NEG1 reprsentier-
ten Negationstrgers liegt. Dabei wre z. B.
(63) durch (63 a) zu reprsentieren (wir folgen
weiterhin dem Reprsentationsstil der Theo-
rie der Generalisierten Quantoren, nach dem
NPn Operatoren auf Verbalphrasen sind):
(63)
a.
DER ERZBISCHOF(x(ZWEI M-
TRESSEN DES KNIGS VON
FRANKREICH(y(NEG1(x HAT y
GEGRT)))))
Solche Reprsentationen sind kompatibel so-
wohl mit den intuitiven Wahrheitsbedingun-
gen der Stze als auch mit den Regularitten
der Markierung des semantischen Bereichs im
Deutschen (vgl. 3.2). Dagegen stnden se-
mantische Reprsentationen, in denen die
Strke der Negation dadurch expliziert wird,
da die Entsprechung des Prsuppositions-
auslsers im Skopus von NEG2 liegt, nicht
nur in Konflikt mit den Bereichsregularitten,
sondern auch mit den intuitiven Wahrheits-
bedingungen, vgl. (63 b):
(63)
b. NEG2(DER ERZBISCHOF HAT
ZWEI MTRESSEN DES K. V. F.
GEGRT)
(63 b) kann im Gegensatz zu (63 a) wahr sein,
wenn der Knig von Frankreich nur genau
eine Mtresse hat. (Wenn es keine zwei M-
tressen gibt, wird der in (63 b) negierten Sach-
verhalt nicht unbestimmt, sondern falsch,
(63 b) damit wahr.) Das widerspricht den In-
tuitionen ber (63).
Bei anderen Stzen kann die Skopusver-
schiebungsanalyse den intuitiven Wahrheits-
bedingungen wenigstens genauso gut Rech-
nung tragen wie die NEG1/NEG2-Theorie:
drucksmittel erkennen lassen, andererseits, ob
es sinnvoll ist, in der semantischen Reprsen-
tation eine entsprechende Differenzierung
von Negationsoperatoren vorzunehmen. Be-
ginnen wir mit der zweiten Frage.
Es gibt verschiedene Versuche, einen der
starken Negation entsprechenden logischen
Operator zu definieren. Recht bekannt ist der
folgende Vorschlag im Rahmen der dreiwer-
tigen Logik (vgl. Blau 1978):
Wahrheitstafel fr NEG2
p NEG2(p)
w f
f w
u u
Hier ist vorausgesetzt, da das Scheitern einer
Prsupposition von p dazu fhrt, da p den
dritten Wahrheitswert u (unbestimmt) er-
hlt. Damit ist NEG2(p) nur dann wahr,
wenn alle Prsuppositionen von p erfllt sind,
was ja genau die wesentliche Eigenschaft der
starken Negation ist. Die schwache Negation
htte im selben Logiksystem die folgende De-
finition:
Wahrheitstafel fr NEG1
p NEG1(p)
w f
f w
u w
Die Notation NEG1 soll deutlich machen,
da dies eigentlich der vertraute Operator
NEG1 ist, nur da falsch jetzt differenziert
wird in falsch im engeren Sinne und unbe-
stimmt. Der wichtige Punkt ist, da NEG1
im Gegensatz zu NEG2 wahr sein kann, wenn
eine Prsupposition verletzt ist. (Vgl. auch
Art. 13.) NEG2 kann auch durch NEG1
definiert werden, wenn man ein Wahrheits-
prdikat einfhrt, vgl. Horn 1985.)
Die Unterscheidung von NEG1 und
NEG2 in der semantischen Reprsentation
wre nun z. B. dann uerst fragwrdig, wenn
man alle einschlgigen funktionalen Differen-
zierungen genauso durch Skopusverschiebun-
gen von NEG1 erfassen knnte. (Vgl. die Be-
merkungen zu (61), (62).) Im pragmatischen
Bereich einer Negation knnen ja nur Impli-
kate sein, die von Ausdrcken in ihrem se-
mantischen Bereich induziert werden (vgl.
3.2). Also knnte ein Gegner der NEG1/
NEG2-Theorie versuchen, jeden Fall von ver-
meintlich starker Negation als einen zu re-
konstruieren, in dem der Prsuppositionsaus-
lser auerhalb des semantischen Bereichs des
jeweiligen mit NEG1 reprsentierten
25. Negation 581
ben. So wre (63 c) eine korrekte Wiedergabe
der intuitiven Wahrheitsbedingungen von
(63), die zudem in bereinstimmung mit den
Bereichsregularitten wre:
(63)
c. DER ERZBISCHOF(x(ZWEI
MTR. DES KNIGS VON
FRANKREICH(y(NEG2(x HAT y
GEGRt)))))
Knnte man also vielleicht durch eine ge-
schickte Synthese der NEG1/NEG2-Theorie
mit der Skopusverschiebungstheorie zu einer
adquaten Analyse des Unterschieds zwi-
schen starker und schwacher Negation kom-
men? Man mu dies wohl verneinen. Auch
eine solche Mischtheorie wre schwerwiegen-
den Einwnden ausgesetzt. Auch sie mu ja
in Fllen wie (67) eine durch die Wahl ver-
schiedener reprsentationssprachlicher Ne-
gationsoperatoren zu explizierende Ambigui-
tt annehmen. Und fr diese Ambiguittsan-
nahme gibt es keinerlei unabhngige Stt-
zung. (Vgl. Kempson 1975, Bor & Lycan
1976, Atlas 1977, Gazdar 1979, Atlas & Le-
vinson 1981, Horn 1985. Die meisten dieser
Autoren schtten allerdings das Kinde mit
dem Bade aus, indem sie auch fr Flle wie
(66) eine Skopusambiguitt verneinen.) Er-
stens gibt es keine Sttzung durch Ambigui-
ttstests, weil diese in Fllen, wo zwei Inter-
pretationen in einer Implikationsbeziehung
stehen (aus (67 b) folgt (67 a)), grundstzlich
nicht zu klaren Ergebnissen fhren. (Vgl.
Horn 1985: 126 f. Dies gilt zwar auch fr die
Skopusambiguitt in (66), doch fr diese gibt
es, wie oben angedeutet, eine Sttzung durch
die strukturelle bereinstimmung mit Fllen
wie Viele Knige sind nicht kahlkpfig, die
durch Tests eindeutig als ambig erwiesen wer-
den knnen.)
Zweitens und das wiegt schwerer gibt
es anscheinend universell keine objektsprach-
liche Entsprechung zu der in der fraglichen
Analyse enthaltenen reprsentationssprachli-
chen Negationsdifferenzierung. Unter all den
z. T. hchst subtilen Negationsartunterschei-
dungen, die natrliche Sprachen machen,
scheint in keiner Sprache eine zu sein, die
genau der von NEG1 und NEG2 entspricht.
(Vgl. Horn 1985: 127 f.) Eine solche krasse
Divergenz zwischen den beiden Ebenen der
Negationsartdifferenzierung (s. 3.1) weist
darauf hin, da die NEG1/NEG2-Unter-
scheidung und damit auch die Ambiguitt
von Stzen wie (67) rein theoretische Arte-
fakte sind.
Doch wie erfat man dann die ja auch in
Fllen wie (67) (in denen keine Skopusambi-
(66) Der Knig von Frankreich ist nicht
kahlkpfig.
Schon B. Russell hat vorgeschlagen (1905),
die Mglichkeit, die Negation hier stark oder
schwach zu interpretieren, dadurch zu erkl-
ren, da in der semantischen Reprsentation
NEG1 verschiedener Skopus zugewiesen
wird, etwa so wie in (66 a, b):
(66)
a.
DER KNIG VON FRANK-
REICH(x(NEG1(x IST KAHL-
KPFIG)))
b.
NEG1(DER KNIG VON
FRANKREICH IST KAHLKP-
FIG)
Dies entspricht nicht nur den intuitiven Wahr-
heitsbedingungen von (66), sondern auch den
Bereichsregularitten des Deutschen und des
Englischen. In beiden Sprachen ist nmlich
die Position vor dem Finitum bei Verbzweit-
stellungsstzen prinzipiell ambig bezglich
des Enthaltenseins im semantischen Bereich
von nachfolgenden Operatoren. Fr eine
Analyse, die die Ambiguitt an der Wahl des
Negationsoperators festmacht (NEG1 oder
NEG2 beide mit weitestem Skopus), gibt
es dagegen keinerlei Deckung durch objekt-
sprachliche Daten (s. u.).
Es gibt jedoch auch Flle, in denen die
Skopusverschiebungsanalyse nicht anwend-
bar ist:
(67) Ludwig hat nicht aufgehrt, seine M-
tressen zu verprgeln.
Auch in (67) kann die Negation stark oder
schwach sein: Die Prsupposition, da Lud-
wig in der Vergangenheit seine Mtressen ver-
prgelt hat, kann innerhalb oder auerhalb
ihres pragmatischen Bereichs liegen. Mit den
intuitiven Wahrheitsbedingungen von (67) ist
jedoch nur eine NEG1-Formalisierung ver-
einbar, in der die Entsprechung des Prsup-
positionsauslsers aufhren innerhalb des
Skopus des Negationsoperators liegt. Dage-
gen entspricht sowohl (67 a) als auch (67 b)
einer intuitiv mglichen Interpretation:
(67)
a. NEG1(LUDWIG HAT AUFGE-
HRT, SEINE MTRESSEN ZU
VERPRGELN)
b. NEG2(LUDWIG HAT AUFGE-
HRT, SEINE MTRESSEN ZU
VERPRGELN)
Hier scheint also die NEG1/NEG2-Analyse
im Vorteil zu sein. Sie mu zudem auch bei
Fllen wie (63) nicht passen. Man kann ja
auch NEG1 bzw. NEG2 engen Skopus ge-
582 VII. Semantik der Funktionswrter
ferenzierung nicht mit NEG1/NEG2 repr-
sentieren kann. Damit erweist sich dann die
Unterscheidung von starker und schwacher
Negation endgltig als auf beiden Ebenen der
Negationsdifferenzierung unbrauchbar.
Man beachte aber, da die Annahme, da
Prsuppositionen manchmal nicht in den
pragmatischen Bereich der Negation geraten
knnen, weil der Prsuppositionsauslser sich
nicht im semantischen Bereich des jeweiligen
Negationstrgers befindet (und da es auch
entsprechende Ambiguitten gibt), davon un-
berhrt bleibt, vgl. (63)(66). Es ist zudem
nicht gezeigt worden, da die NEG1/NEG2-
Unterscheidung fr jeden Zweck unbrauchbar
ist, etwa auch fr die Explikation des Ver-
haltens der Negation in Stzen mit vagen
Prdikaten, vgl. Blau 1978 und Artikel 11.
4.3Sachverhalts- und Begriffsnegation
Auf den ersten Blick spricht einiges dafr,
da, wie in Blau 1978 und Seuren 1980 vor-
geschlagen wurde, der semantische Unter-
schied zwischen Stzen wie (68) und (69) mit
dem zwischen einer notwendigen NEG2- und
einer mglichen NEG1-Interpretation (s. 4.2)
koinzidiert:
(68) Der Knig von Frankreich ist unfreund-
lich.
(69) Der Knig von Frankreich ist nicht
freundlich.
In (68) kann, anders als in (69), die vom
Subjekt induzierte Existenzprsupposition
nicht im pragmatischen Negationsbereich lie-
gen:
(70) *Der Knig von Frankreich ist un-
freundlich, denn Frankreich hat schon
lange keinen Knig mehr.
(71) Der Knig von Frankreich ist nicht
freundlich, denn Frankreich hat schon
lange keinen Knig mehr.
Auerdem folgt (69) aus (68) intuitiv, nicht
aber (68) aus (69): Ein Unfreundlicher ist
nicht freundlich, aber nicht jeder, der nicht
freundlich ist, mu unfreundlich sein.
Beiden Beobachtungen wird Rechnung ge-
tragen, wenn man (68) in jeder mglichen
Interpretation mit (68 a) und (69) in einer
mglichen Interpretation mit (69 a) reprsen-
tiert:
(68)
a. NEG2(DER K. V. F. IST FREUND-
LICH)
(69)
a. NEG1(DER K. V. F. IST FREUND-
LICH)
guitt in Frage kommt) tatschlich beste-
hende Alternative, Prsuppositionen in den
pragmatischen Bereich der Negation zu brin-
gen oder sie intakt zu lassen? Dies ist eigent-
lich gar kein Problem. Eine NEG1-Reprsen-
tation wie (67 c)
(67)
c. NEG1(LUDWIG HAT AUFGE-
HRT, SEINE MTRESSEN ZU
VERPRGELN)
lt ja durchaus beide Mglichkeiten zu,
wenn wir davon ausgehen, da die hier ne-
gierte Proposition den Wert f erhlt, falls
Ludwig nicht frher seine Mtressen verpr-
gelt hat. Das eigentliche und durch (67 c) vl-
lig offengelassene Problem ist, zu erklren,
warum die eine pragmatische Bereichsmg-
lichkeit weniger naheliegend ist als die andere.
Warum wird im Normalfall die Prsupposi-
tion intakt gelassen (vgl. 3.2)? Da diese Ei-
genschaft Prsuppositionen per definitionem
zukommt, mte man weiter fragen: Warum
gibt es berhaupt Prsuppositionen, also Im-
plikate, die im Normalfall von der Negation
und anderen semantischen Modifikationen
ausgespart werden? Eine Diskussion dieser
Frage ginge weit ber den Rahmen dieses
Artikels hinaus, und so kann hier nur auf
einige einschlgige Arbeiten hingewiesen wer-
den: Wilson & Sperber 1979, Atlas & Levin-
son 1981, Levinson 1983: 216225, und Art.
13 in diesem Band.
Diese letzten berlegungen bedeuten nun
den endgltigen Bankrott der NEG1/NEG2-
Theorie der Prsuppositionen negativer Stze
(auch in der durch Skopusvariationen verbes-
serten Version, s. o.). Nicht nur wird die An-
nahme einer Negationsartambiguitt in Fl-
len wie (67) nicht durch die objektsprachli-
chen Daten gesttzt, sondern sie ist auch noch
vollkommen berflssig! Die alternativen Fl-
lungen des pragmatischen Negationsbereichs
sind auch durch eine einfache NEG1-Repr-
sentation wie (67 c) zu erfassen, und das
eigentliche Problem, nmlich die Asymmetrie
in der Erwartbarkeit dieser Fllungen, wird
weder durch die eine noch durch die andere
Reprsentationsmethode gelst.
Dagegen knnte man einwenden, da es
doch eine weitverbreitete objektsprachliche
Negationsartdifferenzierung gibt, die der
NEG1/NEG2-Distinktion entspricht, nm-
lich jene, der im Deutschen die Unterschei-
dung von syntaktischen und morphologi-
schen Negationstrgern (nicht vs. un-) ent-
spricht. Im nchsten Abschnitt wird jedoch
gezeigt, da man diese objektsprachliche Dif-
25. Negation 583
(76) *Der grte deutsche Dichter war ein
Nicht-Christ/Unchrist, weil es ja ber-
haupt keinen grten deutschen Dichter
gibt.
Das Hauptproblem ist jedoch, da entge-
gen dem ersten Anschein die NEG1/
NEG2-Theorie die propositionale Bedeutung
von Stzen wie (68) nicht korrekt wiedergibt.
In allen Situationen, in denen die jeweils ne-
gierte Proposition nicht unbestimmt ist, hat
nmlich die NEG2-Reprsentation dieser
Stze denselben Wahrheitswert wie die
NEG1-Reprsentation der entsprechenden
Stze mit nicht oder nicht- (vgl. (68 a), (69 a)).
Das ist ein kontraintuitives Ergebnis, denn
auch, wenn alle Prsuppositionen erfllt sind,
ist (68) strker als (69)! Weder die prsup-
positionserhaltende Wirkung von Negations-
affixen noch das Strkegeflle zwischen man-
chen Negationsaffixen und anderen Nega-
tionstrgern kann also durch die NEG1/
NEG2-Theorie auf generelle Weise erfat
werden.
Doch was ist die richtige Analyse? Zu-
nchst sollte man die auffallendste syntakti-
schen Eigenschaft von un-, nicht- usw. ernst
nehmen, nmlich, da sie Teile von komple-
xen Wortstmmen sind. Dies weist darauf hin,
da es sich hier semantisch um Operationen
auf Wortstammbedeutungen handelt, und
zwar, den Kategorien der jeweiligen Stmme
entsprechend (im wesentlichen Adjektive und
Nomina, bei manchen Affixen auch Verben)
um Operationen auf Begriffen, genauer: um
Funktionen, die Entitten des Montague-
Typs e, t (oder deren Intensionen) auf En-
titten des gleichen Typs abbilden. Damit
htte Satz (68) die logische Form (68 b):
(68)
b. DER K. V. F. (UN(FREUNDLICH))
Schon vor einer genauen Deutung einer sol-
chen Begriffsnegation erkennt man nun,
warum die Negation hier prsuppositionser-
haltend ist: Ihr logischer Typ macht es un-
mglich, da der Prsuppositionsauslser in
ihren semantischen Bereich gert! Eine Re-
prsentation wie (68 c) wre nicht wohlge-
formt:
(68)
c. *UN(DER K. V. F. (FREUND-
LICH))
Man mag vermuten, da dieses Resultat ent-
scheidend von der Reprsentation definiter
NPn als Quantoren (Typ e, t, t) abhngt.
Dem ist jedoch nicht so. Auch wenn wir sol-
che NPn als Individuenausdrcke (Typ e)
deuten, bleiben sie auerhalb des semanti-
schen Bereichs des Affixes:
Aus (68 a), aber nicht aus (69 a), folgen die
Prsuppositionen der negierten Proposition,
und auerdem folgt (69 a) einseitig aus (68 a).
Bei diesem Beispielpaar knnte man ver-
suchen, dasselbe Ergebnis durch Verschie-
bung des Skopus von NEG1 zu erreichen. Bei
anderen Beispielen ist dies jedoch ausge-
schlossen:
(72) Der Knig von Frankreich erwies sich
als unfreundlich.
(73) Der Knig von Frankreich erwies sich
als nicht freundlich.
Die Bereichsregularitten des Deutschen er-
zwingen hier engsten Skopus fr den Nega-
tionsoperator (wegen der Bereichsabsorption
durch die Als-Phrase, vgl. Jacobs 1982). Des-
wegen kann in keinem der Stze die Existenz-
prsupposition im pragmatischen Negations-
bereich sein. Damit mu man aber mit der
NEG1-Methode die beiden Stze gleich re-
prsentieren und kann nicht mehr zum Aus-
druck bringen, da hier genauso wie in (68)/
(69) die erste Negation strker ist als die
zweite. Mit (72 a) und (73 a)
(72)
a. DER K. V. F. (ERWIES SICH ALS
(x(NEG2(FREUNDLICH x))))
(73)
a. DER K. V. F. (ERWIES SICH ALS
(x(NEG1(FREUNDLICH x))))
wird dem dagegen Rechnung getragen.
Hier scheint also die NEG1/NEG2-Ana-
lyse der NEG1-Analyse technisch berlegen
und zudem nicht dem Einwand des Fehlens
einer entsprechenden objektsprachlichen Dif-
ferenzierung ausgesetzt zu sein. Die Unter-
schiede zwischen nicht und un- sind schlielich
unbersehbar.
Man kann jedoch zeigen, da sich auch auf
der NEG1/NEG2-Analyse keine generelle
Theorie des Unterschieds zwischen Nega-
tionstrgern wie un- und solchen wie nicht
aufbauen lt. Das erste Problem illustriert
das folgende Beispielpaar:
(74) Der grte deutsche Dichter war ein
Nicht-Christ.
(75) Der grte deutsche Dichter war ein Un-
christ.
Um auszudrcken, da die Negation in (75)
strker ist als die in (74), mte man im
Rahmen der NEG1/NEG2-Theorie (75) mit
NEG2, (74) jedoch mit NEG1 reprsentie-
ren. Dies zeigt aber, da die prsuppositions-
erhaltende Wirkung der fraglichen Nega-
tionstrger gar nichts mit starker Negation
im Sinne von NEG2 zu tun hat. Sie ist dem
Prfix nicht- nmlich genauso zueigen wie un-:
584 VII. Semantik der Funktionswrter
die Reprsentation von nicht-. Fr NICHT
gilt einfach, da fr alle P vom Typ e, t
NICHT(P) (ebenfalls e, t) in jeder mgli-
chen Welt genau die Menge der Individuen
charakterisiert, auf die P nicht zutrifft, aber
zutreffen knnte (in dem Sinn, da sie zu der
Sorte von Entitten gehren, auf die P an-
wendbar ist). Das letztere trgt einem wich-
tigen, hier noch nicht diskutierten Unter-
schied zwischen nicht und nicht- Rechnung:
(82) Fido ist nicht-berufsttig, denn er ist ja
ein Hund.
(83) ?Fido ist nicht berufsttig, denn er ist ja
ein Hund.
Sehr viel komplexer ist die Semantik der an-
tonymenbildenden Operatoren wie UN. Sie
knnte eigentlich nur auf der Basis einer ge-
nerellen Theorie der Antonymie entwickelt
werden, die bisher nur in Anstzen existiert.
(Vgl. Lyons 1977, 9.1, Lehrer/Lehrer 1982.)
Insbesondere setzt sie eine Explikation der
Skalaritt von Begriffen voraus. Ein skalarer
(oder gradueller) Begriff ist, grob gesagt,
einer, der einen bestimmten Abschnitt auf
einer Skala markiert, die wiederum einer be-
stimmten Beurteilungsdimension entspricht,
etwa Freundlichkeit oder Intelligenz. Wenn
nun P ein skalarer Begriff ist, ist UN(P) ein
Begriff auf der entgegengesetzten Seite der
jeweiligen Skala, eben ein Antonym von P,
was insbesondere bedeutet, da es jeden-
falls bei bestimmten Skalen Entitten ge-
ben kann, auf die weder P noch UN(P), son-
dern ein Begriff zwischen den beiden zutrifft.
Damit hat man ein grobes Schema zur Ana-
lyse der Bedeutung von Adjektiven wie unin-
telligent, unschn oder unwahrscheinlich und
eine Erklrung fr die semantischen Relatio-
nen zwischen Stzen wie den folgenden:
(84) Er ist freundlich.
(85) Er ist unfreundlich.
(86) Er ist nicht freudlich.
(87) Er ist nicht unfreundlich.
(84) und (85) sind inkompatibel, (86) und (87)
jedoch nicht, und auch nicht (84) und (87).
Auerdem folgt (86) aus (85) und (87) aus
(84). Dagegen folgt weder (85) aus (86) noch
(84) aus (87). (Insbesondere ist also (87) nicht
quivalent mit (84). Da man (87) im Sinne
von (84) verwenden kann, ist ein rein prag-
matisches Phnomen.)
Schlielich mu man hinzufgen, da UN
anscheinend nur auf den unmarkierten Be-
griff der jeweiligen Skala angewandt werden
kann, also weder auf Begriffe, die auf der
negativen Seite der Skala liegen, noch auf
(68) d. UN(FREUNDLICH)(DER K. V. F.)
Daraus folgt die Existenz eines Knigs von
Frankreich, weil aus P(a) die Existenz von a
folgt, falls P und a die Typen e, t bzw. e
haben.
Da im semantischen Bereich dieser Ne-
gationstrger grundstzlich nur der Wort-
stamm ist, an den sie affigiert wurden, erklrt
auch andere Daten, die fr eine Formalisie-
rung mit NEG1, NEG2 oder NEG1 irritie-
rend wren. So wird verstndlich, da (77),
anders als (78), in keiner mglichen Interpre-
tation mit der Existenz von freundlichen Erz-
bischfen kompatibel ist (denn dazu mte
die Allquantifikation ja im Bereich der Ne-
gation liegen knnen):
(77) Alle Erzbischfe sind unfreundlich.
(78) Alle Erzbischfe sind nicht freundlich.
Auerdem wird erklrt, warum solche Ne-
gationstrger niemals einen Fokus haben:
(79) Er ist nicht freundlich, sondern hflich.
(80) *Er ist unfreundlich, sondern hflich.
Wenn fokussierende Negation grundstzlich
auf Sachverhalten operiert, wie es die
NEG1&INKL-Analyse aus 3.3 impliziert,
dann kann eine Negation, deren Argumente
Begriffe sind, keinen Fokus haben.
Gegen diese Analyse mag man Beispiele
wie das folgende (aus Blau 1978) ins Feld
fhren:
(81) Der Verfasser dieses Liedes ist unbe-
kannt.
Daraus folgt natrlich nicht die Existenz eines
Verfassers (es knnte ja ein Volkslied sein).
Das Subjekt mu jedoch hier nicht im seman-
tischen Bereich von un- liegen (was obige
Analyse falsifizieren wrde). Man kann, ist
unbekannt ja als ein Prdikat mit einer inten-
sionalen Subjektargumentstelle analysieren,
hnlich wie ist eine Erfindung der Bild-Zei-
tung. (Man beachte, da auch die Subjekt-
stelle von ist bekannt intensional ist.)
Die prsuppositionserhaltende Wirkung
und andere Eigenschaften der fraglichen Ne-
gationstrger werden also durch ihre Typisie-
rung als Operatoren auf Begriffen erklrt.
Doch wie steht es mit dem oben diskutierten
Strkegeflle? Das leitet ber zu der Frage,
wie die Interpretation der negierenden Be-
griffsoperatoren festgelegt werden soll. Man
wird mindestens zwei Gruppen von Opera-
toren unterscheiden mssen: Solche, die kom-
plementre (oder kontradiktorische) und sol-
che, die antonyme (oder kontrre) Begriffe
bilden. Zu ersteren Gruppe gehrt NICHT,
25. Negation 585
negation ist (genauer: eine Negation, die auf
den inhaltlichen Korrelaten von Stzen ope-
riert, vgl. 3.1). Der zentrale Punkt der vor-
angehenden Errterungen ist jedoch, da
man den Verhltnissen in natrlichen Spra-
chen nur dann gerecht wird, wenn man in der
semantischen Reprsentation auer Sachver-
haltsnegation auch (mehrere Arten von) Be-
griffsnegation annimmt, eine Differenzierung,
der auf der objektsprachlichen Ebene in Spra-
chen wie dem Deutschen oder dem Englischen
die Unterscheidung zwischen (satz)syntak-
tischen und morphologischen Negationstr-
gern entspricht, die wiederum mit vielen an-
deren grammatischen Unterschieden ver-
knpft ist, s. Welte 1978 oder Tottie 1980.
(Allerdings lt sich diese semantische Dif-
ferenzierung nicht universell an der Grenzzie-
hung zwischen Satzsyntax und Morphologie
festmachen, denn viele Sprachen markieren
auch die Sachverhaltsnegation morpholo-
gisch, vgl. 2.1.)
Andererseits ist das Experiment der logi-
schen Rekonstruktion der natrlichsprachli-
chen Negation bisher nicht in dem Sinne ge-
scheitert, da sich eine Negationsart grund-
stzlich einer von logischen Mitteln Gebrauch
machenden semantischen Analyse entzogen
htte. In die Nhe eines solchen Resultats
wird jedoch der nchste Abschnitt fhren.
4.4Replazive und nicht-replazive Negation
Eine sehr wichtige Negationsartunterschei-
dung ist die von replaziver und nicht-repla-
ziver Negation (RN und NRN). Erstere wird
durch (88)(90) exemplifiziert, letztere durch
(91)(93):
(88) Nicht ICH habe dich verpfiffen, sondern
RUdi.
(89) Viele Pfeile trafen nicht die ZIELscheibe,
sondern den SCHIEDSrichter.
(90) Nicht ICH habe dich verpfiffen.
(91) Sie hat mich mit ABsicht nicht infor-
miert.
(92) Emil wute auf nicht EIne der Fragen
eine Antwort.
(93) Hast Du meinen BRIEF nicht bekom-
men?
In Jacobs 1982 wurde als Kriterium fr diese
Unterscheidung (die dort als kontrastierende
vs. nicht-kontrastierende Negation bezeich-
net wurde) folgendes vorgeschlagen: Im Deut-
schen mu RN mit einer durch sondern ein-
geleiteten Phrase (S-Phrase) oder dem qui-
valent einer S-Phrase verbunden sein. Bei
NRN darf dagegen keine S-Phrase ange-
solche, die einen Extremwert auf der positi-
ven Seite markieren, vgl. *undumm, *unher-
vorragend.
Vieles an dieser Analyse ist noch unbefrie-
digend. Neben der mangelnden Explizitheit
(Was ist eine Skala? Was sind entgegenge-
setzte, positive und negative Seiten einer
Skala?) strt, da anscheinend nicht allen
Verwendungen von un- Rechnung getragen
wird. Dabei kann man Flle wie unwirsch
oder unheimlich noch leicht durch Idiomati-
sierung erklren. Bei unnahbar oder unaus-
stehlich, deren wortsyntaktische Struktur
nicht der logischen Form UN(P) entspricht
(*nahbar, *ausstehlich), knnte man obige
Analyse wohl durch einen etwas komplizier-
teren bersetzungsmechanismus zwischen
wortsyntaktischer und wortsemantischer
Struktur retten. Doch wie steht es mit unver-
heiratet und unehelich? Die negierten Begriffe
scheinen hier nicht skalar zu sein, un- hat hier
dieselbe Wirkung wie nicht-. Vielleicht kann
man jedoch verheiratet und ehelich als Grenz-
flle skalarer Begriffe explizieren, bei denen
eine Skala mit nur zwei mglichen Zustnden
involviert ist. Dies wrde zusammen mit der
oben skizzierten Semantik fr un- die frag-
lichen Flle erklren. Die Alternative, eine
antonyme und eine komplementre Variante
von un- anzunehmen, wre nicht nur prinzi-
piell unattraktiv, sondern wrde auch Mini-
malpaare wie Nicht-Christ vs. Unchrist rt-
selhaft erscheinen lassen, bei denen un- offen-
sichtlich die skalare Interpretation des Argu-
mentbegriffs erzwingt. (Detaillierter wird die
Skalaritt von un- z. B. in Wunderlich 1983 b
diskutiert. Die klassische Arbeit hierzu ist
Zimmer 1964.)
Weitere Probleme werden sichtbar, wenn
man sich die Bedeutungsunterschiede zwi-
schen den verschiedenen Wortstammbil-
dungsmitteln vor Augen hlt, die traditionell
als Negationstrger klassifiziert wurden, im
Deutschen neben nicht-, un-, a-, in- die se-
mantisch deutlich verschiedenen -los, -frei,
pseudo-, schein- und mi-. Man mu hier wohl
eine ganze Serie von Begriffsoperationen de-
finieren, wofr aber die Aufgabe der An-
nahme, es handle sich hier um starke (oder
um irgendeine andere) Sachverhaltsnegation,
immerhin den Weg geebnet hat.
Es ist nun ein Punkt erreicht, wo der Ver-
such, die natrlichsprachliche Negation voll-
stndig durch die logische Negation zu expli-
zieren (die Hypothese HNEG, vgl. 3.1), als
gescheitert zu betrachten ist. Das Wesen der
logischen Negation ist, da sie Sachverhalts-
586 VII. Semantik der Funktionswrter
Damit sind wir schon bei den zahlreichen
Unterschieden, die diese Negationsartdiffe-
renzierung rechtfertigen. Es gibt zunchst of-
fensichtliche oberflchenstrukturelle Unter-
schiede. In manchen Sprachen verndern Ne-
gationstrger ihre Form, je nachdem welche
der beiden Negationsarten vorliegt (z. B. per-
sisch na, vgl. Payne 1985: 232), oder sind auf
eine der Negationsarten spezialisiert, wie das
franzsische non auf RN in Stzen wie dem
folgenden (vgl. Gross 1977 und Horn 1985:
158 f):
(97) Max a bu non pas du vin, mais de leau.
Dieses Beispiel verweist auerdem darauf,
da es einen Zusammenhang zwischen den
beiden Negationsarten und bestimmten syn-
taktischen Positionen gibt. Generell gilt, da
RN-Trger dazu neigen, sich ihrem Fokus
(zum Verhltnis von RN und Fokussierung
s. u.) anzunhern und sich gegebenenfalls
dazu aus dem engeren Verbkomplex der
typischen Umgebung fr Standard-Nega-
tionstrger, vgl. 2.1 zu lsen:
(98) Peter was born not in New York, but in
L. A.
(Das but in (36) kann nur mit sondern, nicht
mit aber bersetzt werden!)
Im Deutschen mu allerdings nicht jedes
nicht unmittelbar verbadjazente Vorkommen
von nicht als RN gedeutet werden. Zudem
gibt es Flle von Satzgliednegation, die ber-
haupt keine RN-Lesart haben, z. B. (92). (Die
komplizierten Zusammenhnge zwischen der
Syntax negativer deutscher Stze und der
Wahl einer RN oder NRN-Interpretation
werden ausfhrlich in Jacobs 1982 diskutiert.)
Zahlreich sind auch die semantischen Un-
terschiede zwischen RN und NRN und deren
Reflexe in der Syntax der beiden Negations-
arten. Zentral ist, da RN, im Gegensatz zu
NRN, immer fokussierend ist. Dies ist auf-
grund der eben gegebenen Definition von RN
und der Definition des Negationsfokus in 3.3
zu erwarten. Bei RN wird gewissermaen das
mit der Fokussierung gegebene Versprechen,
bei Ersetzung des Fokus durch eine Alterna-
tive knnte die Negation berflssig werden,
durch die Durchfhrung einer entsprechen-
den Ersetzungsoperation eingelst. Das er-
klrt u. a., warum man keine S-Phrasen an-
schlieen oder einklagen kann, wenn man
z. B. durch ausschlieliche Akzentuierung
eines Elements auerhalb des semantischen
Bereichs des Negationstrgers die Zuwei-
sung eines Fokus zur Negation verhindert:
schlossen werden. Mit quivalent einer S-
Phrase sind asyndetisch angeschlossene
Phrasen gemeint, die die Rolle einer S-Phrase
bernehmen:
(94) Nicht ICH habe dich verpfiffen, RUdi
hat dich verpfiffen.
Fr andere Sprachen mu das Kriterium auf
die dortigen Entsprechungen zu S-Phrasen
bzw. ihre quivalente bezogen werden, so da
man dann z. B. auch im spanischen Satz (95)
RN konstatieren kann:
(95) No es probable, sino cierto/es cierto.
(Dabei mu man allerdings beachten, da
manche Sprachen sondern und aber lexika-
lisch nicht unterscheiden, vgl. Engl. but und
Franz. mais. Dadurch mgliche Ambiguitten
werden jedoch durch ausgeprgte syntakti-
sche und semantische Differenzierungen ein-
geschrnkt, die im Englischen und Franzsi-
schen ganz analog den syntaktisch-semanti-
schen Unterschieden zwischen deutschen Son-
dern- und Aber-Konstruktionen sind, vgl. An-
scombre & Ducrot 1977, Horn 1985.)
Ein Problem des obigen Kriteriums ist, da
bei RN der Anschlu von S-Phrasen oder
deren quivalenten (zusammengefat: S-
Phrasen) als notwendig bezeichnet wird. Dies
bedeutet nicht, da das Fehlen einer S-
Phrase zur Inakzeptabilitt von Stzen mit
RN fhrt, vgl. (90). Es bedeutet vielmehr, da
bei solchen Stzen eine S-Phrase kommu-
nikativ einklagbar ist, wenn ihr Inhalt nicht
schon aus dem Kontext bekannt ist. Auf eine
uerung von (90) kann man genau dann mit
Sondern? reagieren, wenn es nicht zum ge-
meinsamen Wissen der Kommunikations-
partner gehrt, wer den Adressaten verpfiffen
hat.
Problematisch an der obigen Bestimmung
der RN/NRN-Dichotomie ist auerdem, da
sie an einem Symptom fr das Vorliegen der
einen oder der anderen Negationsart orien-
tiert ist und damit das, was man als den
wesentlichen Unterschied empfindet, nicht er-
fat. In dieser Hinsicht ist das Folgende bes-
ser: Replaziv ist eine Negation genau dann,
wenn sie notwendig mit der Ersetzung min-
destens eines Teiles des negierten Inhalts ver-
knpft ist. Auf der Basis dieser Definition
kann man es dann als empirisches Faktum
konstatieren, da die fragliche Ersetzung
durch S-Phrasen erfolgen mu. Insbeson-
dere knnen dazu keine mit aber gebildeten
Anschlsse verwendet werden:
(96) ?Nicht ICH habe dich verpfiffen, aber
RUdi.
25. Negation 587
von Alle Pfeile trafen das Ziel oder etwas
hnlichem voraussetzt. Es ist vielmehr nur
eine nicht notwendigerweise zum Aus-
druck gebrachte Annahme des Adressaten,
die hier richtiggestellt wird. Bei (101) wird die
Interpretation als Richtigstellung einer nicht
zum Ausdruck gebrachten Einstellung wohl
gerade deswegen vermieden, weil der Satz in
dieser Interpretation inakzeptabel ist. Das
Material im Bereich der Negation ist ja keine
adquate Formulierung einer solchen Ein-
stellung.
Ob man darberhinaus annehmen kann,
da RN immer als Richtigstellung von Ein-
stellungen oder uerungen des Adressaten
fungiert, ist unklar. Es wre dann zu erwarten,
da RN nicht in Umgebungen vorkommen
kann, die grammatisch nicht mit dieser Funk-
tion vertrglich sind. Tatschlich kann RN,
im Gegensatz zu NRN, nur schlecht in Fra-
gestzen vorkommen:
(105)
?Wer hat sich nicht GRne, sondern
ROte Strmpfe gekauft?
Andererseits kommt RN in restriktiven Re-
lativstzen vor, die kein grammatikalisiertes
Mittel zur Beeinflussung von Adressateinstel-
lungen sind:
(106) Der Mieter, der gestern den Abfall
nicht in die Mlltonne, sondern vor die
Haustr gekippt hat, soll sich melden.
Diesen Relativsatz kann man aber vielleicht
so interpretieren, da er eine Adressatenan-
nahme quasi prsupponiert. (106) ist ja nur
dann sinnvoll, wenn zu erwarten war, da der
Abfall in die Mlltonne gekippt wird.
Eine ausgebaute Theorie der Verwendungs-
bedingungen der Negation mte jedenfalls
die diesbezglichen Unterschiede zwischen
RN und NRN erklren, die sich nicht nur in
der Interaktion mit Polarittselementen und
in Fragestzen manifestieren, sondern auch
z. B. in diskursinitialer Position, wo (107 a)
deutlich besser wre als (107 b):
(107)
a. Du hast ja keine Brille mehr:
b. Du hast ja keine BRILle mehr, son-
dern HAFTschalen!
Diesen Unterschied zu erklren, drfte ins-
besondere angesichts der Feststellung in 2.2
schwierig sein, da Negation im Diskurs ganz
allgemein voraussetzt, da der Adressat den
negierten Sachverhalt fr wahr oder wahr-
scheinlich hlt.
Noch problematischer als die unterschied-
lichen Verwendungsbedingungen von RN und
NRN sind die Unterschiede in den Wahrheits-
(99)
S1: Sie hat mich mit ABsicht nicht in-
formiert.
S2: *Sondern?
Ein weiterer semantischer Unterschied zwi-
schen RN und NRN ist, da im semantischen
Bereich von RN normalerweise (s. u.) keine
negativen Polarittselemente vorkommen
knnen:
(100) *Nicht ICH habe dich jemals verpfif-
fen, sondern RUdi.
(101) ?Ich habe dich nicht JEmals verpfiffen,
sondern NIEmals.
Eine Erklrung fr die Inakzeptabilitt von
(100) ist leicht zu finden: Die bei RN anzu-
schlieenden S-Phrasen bestehen auf den
Beschreibungsebenen, die vor elliptischen Til-
gungen anzunehmen sind (etwa der S-Struk-
tur in der Transformationsgrammatik), aus
dem Hintergrund der Negation sowie aus der
jeweils gewhlten Alternative zum Fokus
(wobei die Tilgung dann nur Hintergrund-
material betreffen darf). Auf diesen Beschrei-
bungsebenen hat (100) also eine (102) ent-
sprechende Reprsentation:
(102) *Nicht ICH habe dich jemals verpfif-
fen, sondern RUdi hat dich jemals ver-
pfiffen.
Die S-Phrase in (102) verstt aber gegen die
in 5. zu diskutierenden Vorkommensrestrik-
tionen fr negative Polarittselemente. Diese
Erklrung ist auch kompatibel mit der weit-
gehend (z. B. in Horn 1985) unbemerkt ge-
bliebenen Tatsache, da manchmal eben doch
negative Polarittselemente im Hintergrund-
teil des semantischen Bereichs von RN liegen
knnen:
(103) Nicht PEter hat sichs mit allen Frauen
verscherzt, die ihn jemals geliebt haben,
sondern GERD (hat sichs mit allen
Frauen verscherzt, die ihn jemals ge-
liebt haben).
Hier bildet die ausbuchstabierte S-Phrase
einen geeigneten Kontext fr jemals, und ent-
sprechend ist (103) akzeptabel.
Komplizierter ist (101), wo das Polaritts-
element Negationsfokus ist. (101) ist als Kor-
rektur einer (unwahrscheinlichen) uerung
von (104) durchaus akzeptabel:
(104) *Du hast mich jemals verpfiffen.
Die Frage der Inakzeptabilitt von (101) stellt
sich also nur, wenn eine Nicht-Korrektur-
Interpretation von RN-Stzen mglich ist.
Dies scheint tatschlich so zu sein, deutlich
z. B. bei (89), der keine vorherige uerung
588 VII. Semantik der Funktionswrter
heitsbedingungen gar keine Rolle spielt. Da
diese Stze tatschlich nicht als widersprch-
lich bzw. inakzeptabel empfunden werden,
knnte eine solche Analyse dann auf Grice-
sche Rettungsmechanismen (vgl. Art. 14) zu-
rckzufhren versuchen. Wenn aber bei
(109)(112) solche pragmatischen Repara-
turen wirksam wren, mten sie es auch bei
(113)(114) sein. Da dies nicht der Fall ist,
macht den pragmatischen Erklrungsansatz
ziemlich unplausibel.
Damit sind wir bei der Frage der seman-
tischen Reprsentation der RN/NRN-Unter-
scheidung. Als Ausgangspunkt kann obige
Feststellung dienen, da RN immer fokussie-
rend ist. In 3.3 wurde schon eine Methode
zur Reprsentation fokussierender Negation
eingefhrt. Mit ihr wre (108) (unter Weglas-
sung der S-Phrase) so darzustellen:
(108)
a. NEG1(HANSI LIEBT KON-
STANZE) & INKL(X(HANSI
LIEBT X),KONSTANZE)
Das ist genau dann wahr, wenn es falsch ist,
da Hansi Konstanze liebt und wenn es
auerdem unter den in Frage kommenden
NP-Alternativen ein X gibt, so da Hansi X
liebt. Der (108) entsprechende NRN-Satz
(115) Hansi liebt Konstanze NICHT.
wre dann einfach mit NEG1 zu reprsentie-
ren.
Mit dieser Analyse htten wir die objekt-
sprachliche RN/NRN-Differenzierung repr-
sentationssprachlich auf die Unterscheidung
von fokussierender und nicht-fokussierender
Negation zurckgefhrt. Die Tatsache, da in
(108 a) nicht zum Ausdruck kommt, da eine
S-Phrase angeschlossen werden mu, strt
dabei nicht, wenn man diese Formel aus-
schlielich als eine Darstellung der Wahrheits-
bedingungen betrachtet. Auerdem kann man
in einer Reprsentation wie (108 a) durchaus
eine Aussage ber anschliebare S-Phrasen
erkennen, denn solche Phrasen mssen den
INKL-Anteil der Formel wahr machen. (Die-
ser ist ja gewissermaen eine Antizipation des
wahrheitskonditionalen Resultats des An-
schlusses einer S-Phrase). Damit knnen
z. B. (116)(117) ausgeschlossen werden:
(116) ?Hansi liebt nicht KonSTANze, son-
dern mglicherweise ANnamirl.
(117) ??Hansi liebt nicht KonSTANze, son-
dern JEmand.
(116) verstt gegen die angedeutete Restrik-
tion, weil aus der S-Phrase nicht folgt, da es
ein X gibt, so da Hansi X liebt. (117) ver-
bedingungen. Man betrachte die folgenden
Beispiele:
(108) Hansi liebt nicht KonSTANze, sondern
ANnamirl.
(109) Sie hatten keinen GeSCHLECHTS-
verkehr, sondern sie haben geVgelt.
(110) Er kam nicht LEIder zu spt, sondern
glcklicherWEIse.
(111) Goethe wurde nicht Mitte des 18.
JahrHUNderts geboren, sondern am
28. 8. 1749.
(112) Das ist nicht eiNE AdverbiaLE, son-
dern EIN AdverBIAL.
Wie die angeschlossenen S-Phrasen deutlich
machen, liegen in diesen Beispielen Inhalte im
pragmatischen Bereich der Negation, die zu-
nehmend weniger vom Typ der Implikationen
(entailments) sind. In (109) ist es eine Kon-
notation (also eine Art konventioneller Im-
plikatur), die von der Negation getroffen
wird, in (110) eine durch das Satzadverb aus-
gedrckte Sprechereinstellung (vgl. Doherty
1985), in (111) eine Art konversationeller Im-
plikatur (nmlich da die Angabe ber das
Geburtsdatum in der gegebenen Situation
przis genug ist man denke an eine Pr-
fungssituation) und in (112) etwas, das man
auch im weitesten Sinne nicht mehr zum In-
halt des entsprechenden affirmativen Satzes
rechnen wrden, nmlich ein Aspekt der For-
mulierung desselben. Da in dieser groen
Breite des mglichen pragmatischen Bereichs
tatschlich ein Unterschied zwischen RN und
NRN liegt, sieht man leicht, wenn man durch
formale nderungen eine NRN-Interpreta-
tion der Beispiele erzwingt. Sie werden dann
mit Ausnahme von (108), wo eine Impli-
kation im pragmatischen Bereich liegt alle
inakzeptabel, z. B.:
(113) ??Sie HATten keinen Geschlechtsver-
kehr. Sie haben geVgelt.
(114) *Er kam NICHT leider zu spt.
Die Inakzeptabilitt von Beispielen wie diesen
ist auch ein Argument gegen den Versuch, die
Akzeptabilitt von solchen wie (109)(112)
pragmatisch wegzuerklren. Dieser Versuch
liegt nahe, wenn man RN durch eine Variante
der logischen Negation semantisch reprsen-
tieren will. Eine solche Analyse wrde (s. u.)
zu dem Ergebnis kommen, da (109) und
(111) semantisch widersprchlich sind, indem
in der S-Phrase etwas ausgesagt wird, was
die Falschheit des vorangehenden negativen
Satzes impliziert, und da (110) und (112)
semantisch inakzeptabel sind, indem etwas
negiert wird, was auf der Ebene der Wahr-
25. Negation 589
Das ist nun keine Kontradiktion, da aus dem
ersten Konjunkt nicht folgt, da es nicht zu-
trifft, da Goethe Mitte des 18. Jahrhunderts
geboren wurde. Darberhinaus expliziert
(111 b) die Intuition, da (111) im Wider-
spruch zu dem entsprechenden affirmativen
Satz steht, vorausgesetzt, man nimmt an, da
dieser auf einer bestimmten Ebene mit
KORR(G. WURDE MITTE DES 18.
JHRH. GEBOREN) zu reprsentieren ist
(wogegen Atlas 1980 argumentiert hat; vgl.
dagegen wiederum Jacobs 1982: 317).
Natrlich ist auch diese Lsung hchst
problematisch. Zunchst ist sie Larry Horns
Einwand gegen Linebarger 1980 ausgesetzt,
die Verwendung abstrakter Bewertungspr-
dikate (wie KORR) sei eine Ad-hoc-Ma-
nahme, die keine oberflchenstrukturellen
Korrelate habe (Horn 1985: 128). Dieser Ein-
wand wiegt aber wohl nicht schwer, denn man
kann ja genau die formalen Charakteristika
von RN (s. o.) als Reflexe der Anwesenheit
einer NEG(... KORR ...)-Konstellation in der
semantischen Reprsentation betrachten. Das
Hauptproblem ist vielmehr, in welchem Sinne
die Formeln im Skopus von KORR seman-
tische Reprsentationen sind (s. o.). Offen-
sichtlich mssen sie alle Informationen bein-
halten, die ntig sind, um jede der verschie-
denen Folgerungsmengen zu berechnen. Sie
mssen also weit informationsreicher sein als
die heute blichen Reprsentationen der pro-
positionalen Bedeutung.
hnliche Probleme htte man, wenn man
einen Vorschlag aus Karttunen & Peters 1979
verallgemeinern und fr RN-Stze eine se-
mantische Struktur der Form (118) annehmen
wollte:
(118) NEG1(p
1
& ... p
n
)
Die Aussagen p
i
charakterisieren dabei jeweils
eine der fraglichen Folgerungsmengen, also
etwa p1 die Implikationen, p2 die konventio-
nellen Implikaturen, usw. Es ist aber beim
heutigen Stand der semantischen Forschung
nicht zu sehen, wie alle hier einschlgigen p
i
durch kompositionale Mechanismen zu ge-
winnen sind. Darberhinaus lt (118), im
Gegensatz zur KORR-Analyse, die Frage, wie
die mit RN verbundene Fokussierung zu re-
prsentieren sei, unbeantwortet. (Da sie
nicht wissen, wie die prosodische Charakte-
ristik also die Fokussierung der kon-
tradiktorischen Negation zu behandeln ist,
fhren Karttunen und Peters ausdrcklich als
Grund dafr an, ihre Analyse nicht weiter
auszuarbeiten.)
stt dagegen, weil jemand in keinem denk-
baren Kontext eine Alternative zu Konstanze
ist.
Aber natrlich gibt es Probleme mit Fllen
wie (109)(112), und zwar wegen der Repr-
sentation des Negationsanteils von RN durch
NEG1. Damit ldt man sich genau die oben
angedeuteten Schwierigkeiten auf:
(111)
a. NEG1(G. WURDE MITTE DES
18. JHRH. GEBOREN) &
INKL(X(G. WURDE X GEBO-
REN), MITTE DES 18. JHRH.) &
G. WURDE AM 28. 8. 1749 GE-
BOREN
(111 a) ist eine Kontradiktion: Daraus, da
jemand am 28. 8. 1749 geboren wurde, folgt
ja, da er Mitte des 18. Jahrhunderts geboren
wurde. Damit knnen das erste und das dritte
Konjunkt von (111 a) niemals gleichzeitig
wahr sein.
Als Lsung fr dieses Problem ist in Jacobs
1982 das Folgende vorgeschlagen worden.
Angenommen, man kann den verschiedenen
Typen von Folgerungen, die Stze in fixierten
Kontexten haben also ihren Implikationen,
ihren konventionellen Implikaturen, ihren
konversationellen Implikaturen, den ausge-
drckten Sprechereinstellungen etc. jeweils
ein Bewertungsprdikat zuordnen, das genau
dann auf die semantische Reprsentation des
jeweiligen Satzes zutrifft, wenn die entspre-
chende Folgerungsmenge erfllt ist. Also:
Wenn S die semantische Reprsentation eines
Satzes S ist, dann ist in einem Kontext k S
imp-erfllt gdw. die Implikationen von S in
k erfllt sind, konventimp-erfllt gdw. die
konventionellen Implikaturen von S in K
erfllt sind, konversimp-erfllt gdw. die kon-
versationellen Implikaturen von S in k erfllt
sind, sprein-erfllt gdw. die in S zum Aus-
druck kommenden Sprechereinstellungen von
den Kommunikationspartner in k geteilt wer-
den usw. Nehmen wir weiter an, wir htten
ein Prdikat KORR (fr korrekt), das genau
dann auf S in k zutrifft, wenn fr alle Be-
wertungsprdikate x-erfllt gilt: S ist in k
x-erfllt. Dann knnte man z. B. (111) so
reprsentieren:
(111)
b. NEG1(KORR(G. WURDE GE-
BOREN)) &
INKL(X(KORR(G. WURDE X
GEBOREN)), MITTE DES 18.
JHRH.) &
KORR(G. WURDE AM 28. 8. 1749
GEBOREN)
590 VII. Semantik der Funktionswrter
Fr die fragliche Alternative gilt a) eindeutig
nicht, wenn man sie mit der RN/NRN-Alter-
native gleichsetzt (zu den formalen Unter-
schieden s. o.). Da b) gilt, hat Horn zumin-
dest nicht gezeigt. Vielmehr expliziert er den
Unterschied dadurch, da er Negation einer-
seits als einen deskriptiven wahrheitsfunktio-
nalen Operator auf Propositionen, anderer-
seits als einen metasprachlichen Operator
sieht, dessen Wirkung mit Ich wende mich
gegen die uerung u paraphrasiert werden
kann (vgl. Horn 1985: 136). Pragmatische
Mechanismen, die diese beiden Operatoren in
einen Zusammenhang bringen knnten, wer-
den von Horn nicht diskutiert. Ein weiteres
Problem der Hornschen Vorschlge ist, da
er die Unterscheidung zwischen starker und
schwacher Negation (vgl. 4.2) auf die von
wahrheitsfunktionaler und nicht-wahrheits-
funktionaler Negation zurckfhren mchte.
Es stimmt natrlich, da man mit RN alle
Arten von Prsuppositionen verschwinden
lassen kann, z. B. die faktive Prsupposition
in (119):
(119) Ich WEISS nicht, da sie Egon liebt,
sondern ich verMUte es.
Man kann jedoch auch mit NRN, also mit
wahrheitsfunktionaler Negation, Prsuppo-
sitionen attackieren:
(120) Da im Hotel Barbarossa der bayeri-
sche Hygieneminister abgestiegen ist,
STIMMT nicht. Es gibt nmlich gar
keinen Hygieneminister in Bayern.
Dies besttigt die Vermutung aus 4.2, da die
Strke der Negation tatschlich rein prag-
matisch gesteuert ist, whrend ihre (Nicht)-
Wahrheitsfunktionalitt nach den Beobach-
tungen in diesem Abschnitt mit einer in
Sprachsystemen verankerten Negationsart-
differenzierung korreliert.
5. Zur Distribution von
Polarittselementen
In 2.3 wurde der Begriff negatives Polaritts-
element (NPE) eingefhrt. NPEe sind Aus-
drcke, die nur in der Umgebung von Ne-
gationstrgern und negationshnlicher Ele-
mente vorkommen. Beispiele sind jemals, any
und ever. Seit langem wird diskutiert, wie man
die Distributionseigenschaften von NPEen
przise beschreiben und auf ein einheitliches
Prinzip zurckfhren kann. Dabei sind meh-
rere Teilfragen zu klren. In der Feststellung,
da NPEe nur in der Umgebung von Ele-
Andere Vorschlge sind noch weniger at-
traktiv. Die bereits in 3.3 erwhnte Analyse
von A. Szabolcsi, nach der fokussierenden
Negation (zumindest im Ungarischen) die Ne-
gation einer Einzigkeitsaussage ist, die den
propositionalen Gehalt des Restsatzes dar-
stellt, lt sich offensichtlich auf viele der
fraglichen RN-Flle nicht bertragen, weil die
Negation in ihnen auf den propositionalen
Gehalt des Rests gar keinen Bezug nimmt.
Dazu kommt noch das schon erwhnte Pro-
blem, da bei Anwendung von Szabolcsis
Theorie viele Paare von Behauptung und RN-
Gegenbehauptung nicht in einem logischen
Widerspruchsverhltnis stehen wrden.
Nicht besser fhrt man mit einem Vor-
schlag aus Kempson & Cormack 1981, nach
dem es Prozeduren gibt, die Aussagen ver-
strken, bevor auf sie die Negation ange-
wandt wird. Abgesehen davon, da diese Pro-
zeduren ohnehin problematisch sind (vgl.
Tennant 1981), versagt dieser Ansatz aus dem
gleichen Grund wie der Szabolcsis bei Fllen
wie (110) und (112), aber auch bei solchen
wie (111). (Es ist hchst unplausibel, anzu-
nehmen, da es pragmatische Mechanismen
gibt, die ungenaue, aber richtige Aussagen zu
genauen, aber falschen verstrken.) Man mu
also wohl konstatieren, da es bis heute keine
befriedigende Lsung fr das Problem der
nicht-wahrheitsfunktionalen Verwendungen
von RN gibt.
Die umfangreichste deskriptive Arbeit zu
solchen Negationsverwendungen ist Horn
1985. (Horn spricht dabei, in Anlehnung an
Ducrot 1972, von metasprachlicher Negation,
was allenfalls fr Flle wie (112) angemessen
zu sein scheint.) Neben einer Flle von inter-
essanten Beispielen und Beobachtungen fin-
den sich auch dort Anstze zu einer Theorie.
So schlgt Horn vor, die Alternative, Nega-
tion wahrheitsfunktional oder nicht-wahr-
heitsfunktional einzusetzen, als eine prag-
matische Ambiguitt zu betrachten. Dem ist
entgegenzuhalten, da eine funktionale Alter-
native nur dann als pragmatisch gesteuert gel-
ten kann, wenn sie mindestens eine der fol-
genden Eigenschaften hat:
a) Es drften ihr keine klaren systematischen
Unterschiede in der Form der jeweiligen
Stze entsprechen.
b) Es mte pragmatische Mechanismen ge-
ben, die die alternativen Interpretationen
miteinander oder mit einer gemeinsam zu-
grundeliegenden Interpretation in Bezie-
hung setzen.
25. Negation 591
(126) Every (linguist who has ever read any-
thing by Chomsky) admires him.
Jeder der hervorgehobenen Ausdrcke kann
semantisch als ein Funktor reprsentiert wer-
den, dessen Argument die Entsprechung der
Phrase ist, die jeweils das NPE enthlt (durch
Umklammerung verdeutlicht). Da diese
Funktoren zudem alle AbI-Funktoren sein
mssen, wenn den intuitiven Wahrheitsbedin-
gungen Rechnung getragen werden soll, er-
kennt man leicht. Da niemand und alle an-
deren Negationstrger abwrts implizierend
sind (vgl. (121), (122)), sieht man z. B. an der
Gltigkeit des folgenden Schlusses:
(127) Niemand liebt mehr als eine Person.
Niemand liebt mehr als drei Personen.
Diese Eigenschaft von niemand kann man lo-
gisch leicht rekonstruieren, wenn man den
Funktor NIEMAND als P (NEG1 (x
(PERSON (x) & P(x)))) deutet. Analoges
kann man fr die anderen Beispiele zeigen,
vgl. etwa zu (125):
(125) Jeder, der Gerda singen gehrt hat,
wird von ihr begeistert sein.
Jeder, der Gerda singen gehrt hat und
etwas vom Gesang versteht, wird von
ihr begeistert sein.
Auch fr die folgenden Daten ergeben sich
zutreffende Voraussagen:
(129) *Jemand (hat Gerda jemals geliebt).
(130) *Most Americans (believe that there
will be any nuclear wars in the near
future).
(131) *Wenn (Peter einen Haupttreffer im
Lotto hat), wird er sich jemals einen
Porsche kaufen.
(132) *Every (linguist who admires
Chomsky) has ever read anything by
him.
(133) *Peter war jemals un(gehorsam).
In (129)(130) ist der Funktor, in dessen
Skopus das NPE liegt, kein AbI-Funktor, in
(131)(133) liegt das NPE nicht im Skopus
des AbI-Funktors. (Zu (133) vgl. 4.3.)
Ladusaws Theorie expliziert die Negations-
hnlichkeit der NPE-Kontexte also rein se-
mantisch, und zwar ohne die Annahme einer
irgendwie zugrundeliegenden Negation. Die
Negation ist bei Ladusaw nur eine unter vie-
len semantischen Operationen mit der fr
NPEe entscheidenden Eigenschaft und der
Terminus negatives Polarittselement des-
wegen eigentlich eine Fehlbenennung.
menten des Typs X vorkommen knnen, sind
zwei Unklarheiten enthalten:
(a) Was heit in der Umgebung von ..?
(b) Was heit Typ X?
(a) fragt nach einer syntagmatischen Relation,
in der NPEe zu anderen Elementen stehen
mssen, (b) fragt nach einer gemeinsamen
Charakteristik dieser anderen Elemente.
Hier kann nicht auf die lteren Versuche,
diese Fragen zu beantworten (Klima 1964,
Jackendoff 1969, Baker 1970), eingegangen
werden, zumal sie heute als widerlegt gelten
knnen. (Darstellungen von Problemen dieser
Anstze finden sich in Horn 1978, Welte 1978,
Ladusaw 1979, Linebarger 1980.) Es soll viel-
mehr nur der Vorschlag diskutiert werden, der
in jngerer Zeit das strkste Echo fand. Wil-
liam Ladusaw hat vorgeschlagen (in Ladusaw
1979, vgl. auch Ladusaw 1980, 1983, Krifka
1989), die obigen Fragen wie folgt zu beant-
worten:
(a) Die Relation, in der NPEe zu den frag-
lichen anderen Elementen stehen mssen,
ist die Skopusrelation.
(b) Die Elemente, in deren Umgebung NPEe
vorkommen mssen, sind abwrts impli-
zierende Funktoren (AbI-Funktoren).
Beide Antworten sind auf die Ebene einer
intensionallogischen Reprsentation der
Funktor-Argument-Struktur der jeweiligen
Stze bezogen. Ladusaws Theorie besagt also,
da NPEe auf der Ebene der intensionallo-
gischen Funktor-Argument-Struktur im Sko-
pus von AbI-Funktoren stehen mssen. Da-
bei ist X im Skopus von Y gdw. X Bestandteil
der Formulierung des Arguments von Y ist.
Ein Funktor f ist ein AbI-Funktor gdw. fr
alle mglichen Argumente und gilt: Falls
, dann f()f(). Das Symbol
bezeichnet die Folgerungsrelation, wenn es
Aussagen verknpft, die Teilmengenrelation,
wenn es Bezeichnungen von Mengen ver-
knpft. (Genaueres bei Ladusaw 1979:
145 ff.) AbI-Funktoren sind also solche, die
in ihrem Skopus semantische Inklusionsbezie-
hungen umdrehen.
Diese Theorie macht in vielen Fllen rich-
tige Voraussagen:
(121) Niemand (hat Gerda jemals geliebt).
(122) I didnt (see anyone).
(123) Wenige Menschen (haben jemals einen
Yeti gesehen).
(124) Few Americans (believe that there will
be any nuclear wars in the near future).
(125) Jeder, (der Gerda jemals singen gehrt
hat), wird von ihr begeistert sein.
592 VII. Semantik der Funktionswrter
NPEen eine Rolle spielen knnten, eine Idee,
die (im Anschlu an Baker 1970) von M.
Linebarger (1981, 1987) przisiert wurde. Ein
weiteres Problem ist, da bei manchen Funk-
toren unklar ist, ob sie wirklich abwrts im-
plizierend sind, z. B. bei Komparativen, in
deren Vergleichsphrasen NPEe gut gedeihen,
vgl.:
(140) Gerda ist schner als Petra es jemals
war.
Manche mglichen Schlufolgerungen lassen
die Annahme zu, da als ein AbI-Funktor ist:
(141) Gerda ist schner als Petra oder Kon-
stanze es ist.
Gerda ist schner als Petra es ist.
In vielen anderen Fllen fhrt die Ersetzung
einer Vergleichsphrase durch eine logisch str-
kere jedoch zu ungltigen Schlssen (vgl. zu
diesen Problemen v. Stechow 1984 a: VI
VII):
(142) Gerda ist schner als zwei ihrer Kolle-
ginnen.
*
Gerda ist schner als vier ihrer Kolle-
ginnen.
All diese Probleme zeigen, da Ladusaws
Antwort auf die obige Frage (b) zumindest
noch weiter przisiert werden mu. Es gibt
jedoch auch Hinweise darauf, da seine Ant-
wort auf Frage (a) unzureichend ist, da also
die relevante syntagmatische Relation nicht
der Funktorenskopus in der semantischen Re-
prsentation ist:
(143) Da er jemals promovieren wird, ist
unwahrscheinlich.
In der semantischen Reprsentation dieses
Satzes ist die Entsprechung des Prdikativs
im Skopus der Entsprechung des Subjekts
(auch nach Ladusaws eigener Skopustheorie):
(143)
a. P(P(DA ER JEMALS PROMOV.
WIRD)) (UN (WAHRSCHEIN-
LICH))
Damit bleibt aber unerklrt, wieso der AbI-
Funktor UN(WAHRSCHEINLICH) das
Vorkommen von NPEen im Subjekt ermg-
licht. Eine andere Antwort auf Frage (a)
wrde dies jedoch bei Beibehaltung der
Antwort auf (b) erfassen knnen. Sie
wrde fordern, da NPEe in der Funktor-
Argument-Struktur in abwrts implizierenden
Positionen liegen mssen. Dabei ist (unter
Vernachlssigung gewisser technischer Fein-
heiten) eine Konstituente einer Formel
Leider hat auch diese schne Theorie ihre
Probleme. Sie trgt z. B. der Tatsache nicht
Rechnung, da es erhebliche Distributions-
unterschiede zwischen einzelnen NPEen gibt.
So kann engl. until im Gegensatz zu anderen
NPEen nicht bei allen AbI-Funktoren vor-
kommen, sondern nur bei solchen, die Horn
(1978) strongly negative-implying nennt, vgl.
die folgenden Beispiele aus Horn 1978:
(134) Id be surprised if he ever hires you.
(135) ?Id be surprised if he hires you until
you get your hair cut.
(136) Im damned if Ill hire you until you
get your hair cut.
Whrend es vielleicht mglich wre, Ladu-
saws Theorie mit solchen lexikalischen Un-
terschieden kompatibel zu machen, lt das
nchste Problem grundstzliche Zweifel auf-
kommen. Es gibt typische Kontexte fr
NPEe, in denen sich kein AbI-Funktor aus-
machen lt! So sind Fragestze eine voll-
kommen natrliche Umgebung fr NPEe:
(137) Hat Peter dir jemals geholfen?
(138) Did anyone ever lift a finger to help
you?
Der in der semantischen Reprsentation sol-
cher Stze anzunehmende Frageoperator ist
kein AbI-Funktor. (Aus Hat Peter dir zweimal
geholfen? kann man intuitiv nicht folgern Hat
Peter dir fnfmal geholfen?.) Deshalb skizziert
Ladusaw auch eine ganz andere Erklrung
fr NPEe in Fragen. Er postuliert ein Prinzip,
nach dem die Formulierung von Fragen so
sein soll, da sie in den gewhlten Antworten
weitgehend unverndert bernommen werden
kann. (Vgl. Ladusaw 1979: 189.) Wer sich an
dieses Prinzip hlt, kann nach Ladusaw ein
NPE in seine Frageformulierung nur dann
aufnehmen, wenn er eine Antwort antizipiert,
in der das NPE oder ein nah verwandter
Ausdruck vorkommt. Im allgemeinen bedeu-
tet das, da NPEe in Fragen vorkommen, die
eine negative Antwort antizipieren, und das
ist bei (137)(138) tatschlich der Fall. (Eine
andere, aber ebenfalls auf pragmatische Stra-
tegien verweisende Erklrung findet sich in
Krifka 1989.)
Die semantische Charakteristik von Funk-
toren scheint also nicht der einzig relevante
Faktor zu sein. Das zeigt auch das folgende
Beispiel aus Horn 1978:
(139) Im anything but happy with that anal-
ysis, either.
Solche Beispiele lassen vermuten, da nega-
tive Implikaturen fr die Distribution von
25. Negation 593
das Gebot, da sich die engere Umgebung
des APE als Nicht-AbI-Position interpretie-
ren lt. Eine solche Erklrung ich ber-
gehe viele Details wrde (144)(145) dar-
auf zurckfhren, da sich hier die abwrts
implizierende Wirkung der beiden Funktoren
aufhebt und damit der das APE enthaltende
Satzteil eine Nicht-AbI-Position wird:
(144)
a. NIEMAND(x(x BEZWEIFELT
DA SOGAR PETER DIESE
PRFUNG BESTEHEN WIRD))
In mindestens einer der hier zu betrachtenden
quivalenten Umformungen, nmlich in
(144 b),
(144)
b. X(NIEMAND(y(y BEZWEI-
FELT X)))
(DA SOGAR PETER DIESE
PRFUNG BESTEHEN WIRD)
ist der Funktor, dessen Argument der das
APE enthaltende Nebensatz ist, nicht abwrts
implizierend.
Fr das Vorkommen von Polarittselemen-
ten ist also wohl die inhaltliche Wirkung der
syntaktischen Gesamtumgebung und nicht
nur der (in der Regel weniger ausgedehnte)
Funktorenskopus mageblich).
Trotz dieser Probleme kann Ladusaws An-
satz als ein entscheidender Beitrag zur Lsung
des Rtsels der Distribution von Polaritts-
elementen gelten. Eine wirkliche adquate
Lsung wird wohl zumindest seine Antwort
auf Frage (b) als Teil enthalten, wenn auch
vielleicht nur fr einen Kernbereich der ein-
schlgigen Flle. (Dies trifft z. B. auf die Pr-
zisierung von Ladusaws Ideen in Krifka 1989
zu, die einige der Probleme dieser Theorie
einer Lsung nher bringen kann.)
6. Kompositionalittsprobleme
Abschlieend sollen zwei Probleme diskutiert
werden, die sich bei der Analyse der Kom-
position der Bedeutung negativer Stze aus
den Bedeutungen ihrer Teile ergeben, wenn
man die verbreitetste und am besten ausge-
arbeitete Konzeption von Bedeutungskom-
position voraussetzt, nmlich die in der Mon-
tague-Grammatik entwickelte (vgl. Art. 7).
Nach dieser Konzeption erhlt man die Be-
deutung eines komplexen Ausdrucks, indem
man die Bedeutungen der Teile, aus denen er
nach Aufweis einer syntaktischen Analyse be-
steht, mit denen ihrer jeweiligen Kokonsti-
tuenten durch bestimmte Operationen (zu-
meist Funktionalapplikation) verbindet, und
eine AbI-Position (mit Bezug auf ) gdw. es
eine mit quivalente Formel der Form ()
gibt, so da y ein abwrts implizierender
Funktor ist. Nach dieser Definition liegt JE-
MALS in (143 a) in einer AbI-Position, denn
(143 a) ist mit (143 b) quivalent
(143)
b. UN(WAHRSCHEINLICH)(DA
ER JEMALS PROMOVIEREN
WIRD)
und UN(WAHRSCHEINLICH) ist ein AbI-
Funktor. (Man beachte, da die umklammer-
ten Phrasen in (121)(126) ebenfalls abwrts
implizierende Positionen sind.)
Fr diese Hypothese ber die fr das Vor-
kommen von Polarittselementen ausschlag-
gebende syntagmatische Relation sprechen
zudem Daten aus dem Bereich der affirmati-
ven Polarittselemente (APEe), wie already
oder sogar. (Zu sogar vgl. Jacobs 1983: 4.3.3.)
Es ist bekannt, da sich APEe im Kontext
von doppelten Vorkommen von AbI-Funk-
toren aufhalten knnen:
(144) Niemand bezweifelt, da sogar Peter
diese Prfung bestehen wird.
(145) Im surprised that someone else hasnt
already talked to you.
In der Funktor-Argument-Struktur sind die
hier enthaltenen APEe im Skopus von je zwei
AbI-Funktoren (z. B. SOGAR in (144) im
Skopus von NIEMAND und BEZWEI-
FELT). Das wre nicht strend, wenn die
Inklusion von APEen in einen einfachen AbI-
Skopus mglich wre. Da dies nicht mglich
ist, ist jedoch gerade typisch fr APEe:
(146) ??Jemand bezweifelt, da sogar Peter
diese Prfung besteht.
(147) ?Someone else hasnt already talked to
you.
Da (147) dennoch als Konstituente des ak-
zeptablen Satzes (145) fungieren kann, ver-
sucht Ladusaw damit zu begrnden, da
(147) akzeptabel ist, wenn man die Negation
als Zurckweisung einer Behauptung oder
Annahme anderer Kommunikationsteilneh-
mer interpretiert, und da (147) in dieser In-
terpretation in (145) eingebettet ist. (Vgl. La-
dusaw 1979: VII.) Zumindest fr das deutsche
Beispiel ist diese Erklrung jedoch nicht ber-
zeugend, denn (144) ist zur Zurckweisung
der Behauptung, da sogar Peter die Prfung
bestehen wird, vllig ungeeignet. Viel plau-
sibler wre hier eine Erklrung, die die Vor-
kommensbeschrnkung fr APEen nicht als
ein Verbot des Enthaltenseins im Skopus von
AbI-Funktoren ausbuchstabiert, sondern als
594 VII. Semantik der Funktionswrter
Strukturen zu erzeugen. In jeder solchen
Struktur wird der Negationstrger kein als
eine Konstituente fungieren. Der Mechanis-
mus, der die Bedeutungskomposition expli-
ziert, wird versuchen, die Bedeutung dieser
Konstituente mit der der anderen Konstituen-
ten zur Gesamtbedeutung zusammenzufgen.
Man wird dabei davon ausgehen, da die
Bedeutung von kein die Negation der Bedeu-
tung von ein ist, also in etwa:
(147) Q(P(NEG1(EIN Q(P))))
Wenn man (147) mit der Bedeutungsreprsen-
tation des in (145) als Kokonstituente fungie-
renden Nomens verbindet, erhlt man als Re-
prsentation der Objekt-NP (nach Lambda-
Konversion):
(148) P(NEG1(EINE PUTZFRAU(P)))
Das lt sich nun mit den anzunehmenden
Reprsentationen der anderen Konstituenten
von (145) zu (145 b) oder (145 c), aber nicht
zu (145 a) verbinden. Fr die in (145 a) zwi-
schen NEG1 und EINE intervenierenden
Teile ist in (148) einfach kein Platz vorgese-
hen. Analoges gilt fr keinen Pa in Beispiel
(146).
Der Kern des Problems ist, da (147) die
Bedeutung von kein in Umgebungen wie
(145)(146) nicht richtig wiedergibt. Kein
trgt hier zwar Negation und die Bedeutung
von ein zur Satzbedeutung bei, aber es tut
dies, ohne als Negation von ein gedeutet wer-
den zu knnen. Man kann dem nun nicht
einfach dadurch Rechnung tragen, da man
die semantische Reprsentation von kein an
Umgebungen wie (145) und (146) anpat. Wie
in Jacobs (1980) gezeigt wurde, mte man
bei einem solchen Vorgehen eine Vielzahl ver-
schiedener Reprsentationen fr kein anneh-
men, um zu erfassen, da zwischen NEG1
und EIN Operatoren der verschiedensten Ty-
pen intervenieren knnen. (Schon fr (145)
und (146) bentigte man zwei verschiedene
Reprsentationen.) Die Annahme einer viel-
fachen Ambiguitt des Negationstrgers ist
aber nicht durch unabhngige Argumente zu
sttzen.
Die Postulierung von Ambiguitten kann
man vermeiden, wenn man davon ausgeht,
da kein und andere semantische komplexe
Negationstrger, die sich hnlich verhalten
(wie nichts, vgl. Jacobs 1980, 1982), auf der
Ebene der syntaktischen Struktur, auf der der
Mechanismus der Bedeutungskomposition
ansetzt, keine Konstituenten sind, sondern je-
weils Sequenzen aus dem entsprechenden
nicht-negativen Indefinitum und einem un-
mittelbar vorangehenden abstrakten Nega-
tionselement, das dieselben syntaktischen Ei-
zwar beginnend bei den kleinsten Teilen auf-
steigend zu den jeweils nchstgreren. Hier-
bei ergeben sich fr negative Stze spezifische
Probleme. Eines davon wird in den folgenden
Beispielen sichtbar:
(145) Peter sucht keine Putzfrau.
(146) An diesem Grenzbergang mu man
keinen Pa vorzeigen.
In einer naheliegenden Lesart sind diese Stze
so zu reprsentieren, da der mit dem Fini-
tum verbundene intensionale Operator im
Skopus der Negation und die Entsprechung
der Indefinitheit des Negationstrgers im
Skopus dieses Operators liegt:
(145)
a. PETER(x(NEG1(x SUCHT
(EINE PUTZFRAU))))
(146)
a.
AN DIESEM GRENZBER-
GANG (NEG1 (NOTWENDIG
(MAN ZEIGT EINEN PA
VOR)))
Hier schiebt sich also zwischen den Nega-
tionsanteil und den Indefinitheitsanteil des
Negationstrgers ein weiterer semantischer
Operator. Diese Trennung der Bedeutungs-
bestandteile des Negationstrgers kann nicht
durch eine andere Form der semantischen
Reprsentation vermieden werden. Man
knnte damit allenfalls andere Lesarten dar-
stellen:
(145)
b. NEG1(EINE PUTZFRAU (x
(PETER (SUCHT(P(P(x)))))))
(146)
b.
AN DIESEM GRENZBER-
GANG (NEG1 (EINEN PA (x
(NOTWENDIG (MAN ZEIGT x
VOR)))))
(145)
c. PETER SUCHT(P(NEG1(EINE
PUTZFRAU(P))))
(146)
c.
AN DIESEM GRENZBER-
GANG (NOTWENDIG
(NEG1(EINEN PA(x(MAN
ZEIGT x VOR)))))
In den (b)-Varianten ist das Objekt gegenber
dem intensionalen Operator spezifisch, in
den (c)-Varianten wrde sich dieser Operator
auf ein negatives Objekt bzw. eine negierte
Aussage beziehen. Alle diese Lesarten, vor
allem die (c)-Versionen, sind unwahrschein-
lich.
Das Problem besteht nun darin, da es bei
einer Kompositionalittsauffassung, wie sie
oben angedeutet wurde, kaum mglich ist,
Reprsentationen wie die obigen (a)-Versio-
nen aus oberflchennahen syntaktischen
25. Negation 595
eine nominale Phrase modifiziert (vgl. *Auf
den Dchern nicht einiger Huser ...).
Unbefriedigend an dieser Analyse ist vor
allem ihre mangelnde Oberflchenorientiert-
heit. Dafr, da kein oder nichts zugrundelie-
gend Sequenzen aus zwei Wrtern sind, gibt
es keine Evidenz im Bereich der Wortstruktur.
Insbesondere lassen sich diese Formen syn-
chronisch weder als morphologisch komplex
noch als das Ergebnis einer Proklise interpre-
tieren. Dies wird besonders deutlich in Fllen
wie (160):
(160) Peter wartet auf keinen Polizisten.
Um der Lesart Rechnung zu tragen, in der
negiert wird, da Peter auf einen unspezifi-
schen Polizisten wartet, mu man (160) so
wie in (160 a) strukturieren und damit bei der
Amalgamierung von neg und ein eine Pr-
position berspringen, was wohl keinem na-
trlichen morphologischen oder Klitisie-
rungsproze entspricht:
(160)
a. Peter(neg(auf einen Polizisten war-
tet))
Wie es scheint, ist also die Annahme, die
fraglichen Negationstrger seien syntaktisch
zugrundeliegend komplex, recht knstlich.
Eine andere halbwegs plausible und alle ein-
schlgigen Daten bercksichtigende Lsung
ist jedoch zur Zeit nicht in Sicht. (Im Kern
wurde die Dekompositionsanalyse bereits in
Bech (1955/1957) vorgeschlagen. In Dahl
(1991) werden schwedische Daten diskutiert,
die eine entsprechende Negationstrgerde-
komposition nahelegen. In Jacobs (1989) wird
versucht, das fragliche Phnomen als einen
synchronischen Nachklang von Jespersens
Zyklus zu deuten.)
Eine kaum jemals in der Literatur disku-
tierte Herausforderung fr eine kompositio-
nale Semantik ist das weit verbreitete Ph-
nomen der pleonastischen Negationstrger. Es
liegt dann vor, wenn mehrere Negationstr-
gervorkommen zum Ausdruck einer einzigen
Negation dienen, wie z. B. in dem folgenden
bairischen Satz:
(161) I hab koan Huad ned.
Ich habe keinen Hut nicht (= Ich habe
keinen Hut)
Wenn man bei solchen Stzen in der ange-
deuteten Weise die Konstituentenbedeutun-
gen von unten nach oben zur Reprsenta-
tion der Gesamtbedeutung zusammenfgt,
wird letztere so viele Vorkommen des Nega-
tionsoperators enthalten, wie es Vorkommen
von Negationstrgern gibt. Bei (161) wrde
genschaften wie nicht hat und als Modifikator
der Verbalphrase fungiert, deren erstes Wort
des Indefinitum ist. Die entsprechende syn-
taktische Struktur von (145) wre in etwa
(145 d):
(145)
d. (Peter(neg(eine Putzfrau sucht)))
Diese Struktur kann man nun leicht mit der
Ableitung einer mit (145 a) quivalenten se-
mantischen Reprsentation koppeln (wovon
der Leser sich selbst berzeugen mge).
Die Oberflchengestalt des Negationstr-
gers wird bei einer solchen Analyse durch eine
Verschmelzungstransformation erzeugt, die
neg und adjazentes ein zu kein amalgamiert.
Ganz entsprechend wre (146) zu behandeln.
(Genaueres in Jacobs 1990.)
Die Dekomponierung von Negationstr-
gern wie kein in ein abstraktes Negationsad-
verbial und ein nachfolgendes Indefinitum er-
weist sich nicht nur bei der Analyse des Zu-
sammenspiels der Negation mit verbal reali-
sierten intensionalen Operatoren als ntzlich.
Auch der Fokus solcher Negationstrger ver-
hlt sich so, als seien diese syntaktisch kom-
plex:
(149) Luise KAUFte kein Haus, sondern
MIEtete eines.
(149) zeigt, da der Fokus von kein auerhalb
des Nomens liegen kann, das als Kokonsti-
tuente dieses Numerales fungiert. Dies wider-
spricht aber der ansonsten gut besttigten
Hypothese, da der Fokus eines Negations-
trgers immer in dessen syntaktischem Be-
reich liegt (s. 3.3). Man braucht diese Hypo-
these jedoch nicht aufzugeben, wenn man an-
nimmt, da der erste Teilsatz von (149) die
zugrundeliegende Struktur (149 a) hat:
(149)
a. (Luise(neg(ein Haus kaufte)))
Weitere Phnomene, die fr eine Dekompo-
nierung semantisch komplexer Negationstr-
ger sprechen, werden in Jacobs 1980, 1982,
1990 diskutiert. Zu ihnen gehrt z. B. die In-
akzeptabilitt bestimmter attributiver Ver-
wendungen von kein-NPn:
(159) *Auf den Dchern keiner Huser waren
Vgel.
Wenn kein in der angedeuteten Weise dekom-
poniert werden mu und wenn das dabei an-
zunehmende Element neg dieselbe Syntax hat
wie nicht, also insbesondere nur Phrasen mit
dem Merkmal [+verbal] modifizieren kann
(vgl. Jacobs 1990), dann mte man fr (159)
eine nicht-wohlgeformte zugrundeliegende
Struktur annehmen, nmlich eine, bei der neg
596 VII. Semantik der Funktionswrter
tungsbeitrags der einzelnen Konstituenten je-
weils Informationen ber die Struktur des
ganzen Restsatzes verwerten kann, der also
z. B. bei der Analyse der semantischen Rolle
von ned in (161) die Information bercksich-
tigen kann, da in einer nicht-verschwisterten
Position der Gesamtstruktur koan auftaucht.
Genau wie bei den in 4.4 diskutierten Proble-
men fhren uns jedenfalls auch hier Nega-
tionsphnomene gewisse Grenzen der heute
gngigen Vorstellungen von einer kompositio-
nalen, wahrheitskonditionalen Semantik vor
Augen.
7. Literatur (in Kurzform)
Anscombre/Ducrot 1977 Atlas 1977 Atlas 1980
Atlas/Levinson 1981 Baker 1970 Bech 1955/57
Blau 1978 Carnap 1947 Clark 1974 Dahl 1979
Dahl 1991 Davison 1978 Dhmann 1974 Do-
herty 1985 Dryer 1988 Falkenberg 1985 Fal-
kenberg 1987 Gabbay/Moravcsik 1978 Gazdar
1979 Givn 1973 Givn 1984 Gross 1977
Hajicov 1973 Harries-Delisle 1978 Heim 1982
Heinemann 1983 Hoepelman 1979 Horn 1972
Horn 1978 Horn 1985 Jackendoff 1969 Jacobs
1980 Jacobs 1982 Jacobs 1983 Jacobs 1984 a
Jacobs 1986 Jacobs 1988 Jacobs 1989 Jacobs
1990 Jespersen 1917 Karttunen/Peters 1979
Kempson 1975 Kempson/Cormack 1981 Kiss
1981 Klima 1964 Krifka 1989 Ladusaw 1979
Ladusaw 1980 Ladusaw 1983 Lang 1984 Leh-
rer/Lehrer 1982 Levinson 1983 Lieb 1983 Li-
nebarger 1980 Linebarger 1987 Lyons 1977
McGloin 1976 Moravcsik 1978 Payne 1985
Reinhart 1983 Russell 1905 Schmidt 1973 Seu-
ren 1973 Seuren 1979 von Stechow 1984 a Stik-
kel 1970 Szabolcsi 1981 a Szabolcsi 1981 b Ten-
nant 1981 Tottie 1980 Welte 1978 Wilson/Sper-
ber 1979 Wunderlich 1983 b Zaefferer 1979 Zi-
fonun 1976 Zimmer 1964 Zwarts 1981
Joachim Jacobs, Wuppertal
(Bundesrepublik Deutschland)
man also zu einem quivalent von (161 a)
gelangen:
(161)
a. NEG1(NEG1(ICH HABE EINEN
HUT))
(161) bedeutet aber nicht (161 a), sondern
(161 b):
(161)
b. NEG1(ICH HABE EINEN HUT)
Was ist hier zu tun? Der naheliegende Vor-
schlag, koan ... ned als diskontinuierliches
Morphem zu behandeln, dem nur ein Nega-
tionsoperator in der semantischen Struktur
entspricht, widerspricht der Tatsache, da die
beiden Negationstrger syntaktisch selbstn-
dig sind und in anderen Umgebungen jeweils
alleine Negation ausdrcken:
(162) Ea war ned da. (Er war nicht da)
(163) Des is koa unguada Mo. (Das ist kein
unguter Mann)
Realistischer ist vielleicht die Auffassung, bei
pleonastischen Negationstrgern handle es
sich um ein Kongruenzphnomen. Nach ihr
enthielten Stze wie (161) zugrundeliegend
nur einen Negationstrger, der das Merkmal
[+ negativ] in einem Proze, der nach dem
Aufbau der semantischen Reprsentation er-
folgt, an geeignete Konstituenten in seiner
Umgebung weitergibt. Allerdings pat dies
nicht so recht zu Fllen wie (164):
(164) I hab di no nia ned gseng.
Ich habe dich noch nie nicht gesehen
(= Ich habe dich noch nie gesehen)
Kongruenz zwischen einem Temporaladver-
bial und einer Verbalphrase wre ein univer-
sell gesehen uerst exotisches Phnomen.
Diese Probleme sind, wie gesagt, mit der
oben skizzierten atomistischen Kompositio-
nalittsauffassung verbunden. Es ist denkbar,
da sie verschwinden, wenn man Bedeutungs-
komposition als einen holistischen Proze
expliziert, der bei der Analyse des Bedeu-
26. Koordinierende Konjunktionen 597
26. Koordinierende Konjunktionen
Wahrheitsfunktionen sind darstellbar durch
sog. Wahrheitstabellen wie (i)
(i) a. p q p q b. p q p q
1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
c. p q p q
1 1 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1 etc.
Die Tabellen sind von links nach rechts lesbar
wie in (ii) als Aufzhlung der hinreichenden
Bedingungen
(ii)a.Wenn p = 1 und q = 1,
dann p q = 1,
wenn p = 1 und q = 0,
dann p q = 0,
wenn p = 0 und q = 1,
dann p q = 0,
wenn p = 0 und q = 0,
dann p q = 0 etc.
oder krzer von rechts nach links wie in (iii)
als Spezifikation der notwendigen Bedingun-
gen
(iii)a.p q = 1 gdw.
p = 1 und q = 1;
p q = 0 sonst
b.p q = 0 gdw.
p = 0 und q = 0;
p q = 1 sonst
c.p q = 1 gdw.
p = 0 und q = 0;
p q = 0 sonst
etc.
Wir benutzen forthin die abgekrzte Notation
in (iv), in der ein Funktor o durch die geord-
nete Menge der Wahrheitswertpaare fr p o
q = 1 charakterisiert wird, also
(iv)a.p q : 1,1
b.p q : 1,1; 1,0; 0,1
c.p q : 0,0 etc.
Dieses Verfahren ist fr die Gegenberstel-
lung von logischen Funktoren und sprachli-
chen Konjunktionen besonders geeignet. In
der Bezeichnung der Funktoren halte ich
mich an die sog. Mnchener Terminologie.
Der folgende berblick versucht demge-
genber deutlich zu machen, da fr die se-
mantische Beschreibung der koordinierenden
1. Einfhrung: Ausgliederung, Grundbegriffe,
Strukturaspekte
1.1 Einleitung
1.2 Subordination vs. Koordination
1.3 Koordination als Strukturbildung
1.4 Gleichartigkeitsbedingungen der Konjunkte
1.5 Parallelisierungseffekt der Koordination
2. Semantik der koordinativen Verknpfung
2.1 Common Integrator
2.2 Semantische Relationen zwischen Konjunkten
2.3 Logisches Gerst fr die Interpretation von
KV
3. Semantik der koordinierenden Konjunktio-
nen
3.1 Logische Funktoren vs. sprachliche Konjunk-
tionen
3.2 Operative Bedeutung der Konjunktionen
3.3 Systematik der koordinierenden Konnektive
4. Probleme und Ausblick
5. Literatur (in Kurzform)
1. Einfhrung: Ausgliederung,
Grundbegriffe, Strukturaspekte
1.1Einleitung
Theoretische Auffassungen ber die Semantik
der Konjunktionen sind traditionell wie ak-
tuell geprgt durch den jeweiligen Stand der
Wechselwirkung von Grammatik und Logik
als Wissenschaften. Diese historisch belegte,
aber hier nicht nachzuzeichnende Einsicht
verweist einerseits auf einen damit grundstz-
lich vorgegebenen Variationsbereich, anderer-
seits auf bestimmte bisher als unstrittig gel-
tende Grundannahmen. Letztere beinhalten,
(A) da die Konjunktionen insgesamt (neben
den Determinierern, Modalwrtern, Partikeln
u. a.) zu den als synsemantisch charakteri-
sierten sog. Funktionswrtern gehren, und
(B) da die koordinierenden Konjunktionen
speziell (also und, oder, weder noch etc.)
semantisch mehr oder minder als sprachliche
Gegenstcke zu den standardlogischen Funk-
toren , , , etc. fr wahrheitsbewertete
Propositionen p, q zu behandeln sind.
Die standardlogischen Funktoren (oder
Konnektoren) sind semantisch definiert als
Funktionen von Paaren von Wahrheitswerten
fr p und q in Wahrheitswerte fr p o q,
wobei 1 fr wahr und 0 fr falsch steht.
Da die Wahrheitswerte fr p und q unabhn-
gig voneinander sind, gibt es 2
4
= 16 ver-
schiedene Belegungen des Funktors o. Die
598 VII. Semantik der Funktionswrter
1.2Subordination vs. Koordination
Die Grammatik jeder Sprache enthlt Verfah-
ren der Erweiterung von einfachen Stzen zu
komplexen Stzen. Komplexe Stze beruhen
grob gesprochen auf Fgung und/oder
auf Verknpfung. Ein Simplex-Satz S, d. h.
eine durch Sttigung aller obligatorischen Ar-
gumentstellen des Verbs definierte Struktur,
wird zu einem komplexeren Satz S, indem
man S weitere, und zwar fakultative oder
freie, Konstituenten an- oder einfgt (Ad-
jungierung) oder indem man S mit weiteren
(normalerweise satzwertigen) Konstituenten
zu einem S
+
verknpft (Konjungierung).
Die Konjunktionen nun stellen ein in jeder
Sprache vorhandenes, unterschiedlich be-
stcktes, aber eng begrenztes Inventar von
Funktionswrtern CONJ dar, die, wie der
Name sagt, der Verknpfung von zwei oder
mehr Stzen (bzw. auf SATZ projizierbaren
Strukturen) S
1
conj S
2
zu einem komplexen
Satz S
+
dienen. Die Komplexbildung durch
Verknpfung beruht ihrerseits auf zwei sehr
allgemeinen, die gesamte Grammatik durch-
ziehenden, grundstzlich zu unterscheidenden
Strukturierungsprinzipien: Einbettung vs.
Koordination. Die darauf zurckfhrbaren
Arten der Verknpfung teilen auch die jeweils
involvierten Verknpfungselemente, nmlich
die Verknpfer oder Konjunktionen, in die
syntaktisch und semantisch zu differenzieren-
den Gruppen conj
s
und conj
k
.
Die Bildung komplexer Stze durch Ein-
bettung lt sich durch das in (1) angegebene
Schema der syntaktischen Grundstruktur an-
deuten.
(1) Einbettung: S
+
= [S
1
[conj
s
[S
2
]]]
Auf Einbettung beruht u. a. das als Subordi-
nation bezeichnete, d. h. mithilfe subordinie-
render Konjunktionen realisierte, Verknp-
fungsverfahren. Seine wichtigsten Merkmale
sind:
(11)S
2
ist abhngig, deshalb kann die Kon-
junktion conj
s
weder weggegelassen
noch mit weiteren S
2
, S
2
iteriert wer-
den.
(2)a.Vater schenkt uns ein Haus, weil/ob-
wohl Mutter uns ein Auto schenkt.
b.Vater schenkt uns ein Haus, *() Mut-
ter uns ein Auto schenkt.
c.Vater schenkt uns ein Haus, ?? [weil
Mutter uns ein Auto schenkt, [weil
Oma uns einen Garten vererbt, [weil
Opa krank ist]]].
Konjunktionen als lexikalische Einheiten ein
passender Rekurs auf die logischen Funkto-
ren als Reprsentationsmittel im Sinne von
(B) zwar notwendig, aber keinesfalls hinrei-
chend ist. Das Hauptgewicht liegt auf der
Darlegung der komplex ineinandergreifenden
Bedingungen, die den Bedeutungsbeitrag der
koordinierenden Konjunktionen zur seman-
tischen Interpretation der durch sie gebildeten
komplexen Ausdrcke determinieren. Dabei
sind die oben genannten Annahmen so aus-
zubuchstabieren, da deutlich wird:
(a) die Rolle der koordinierenden Konjunk-
tionen als Verknpfer ist gekoppelt mit ihrer
Rolle als Gruppierungsmittel, Gliederungs-
faktoren und Kohrenztrger im Rahmen der
Koordination, eines generellen Strukturbil-
dungsverfahrens, das durch eine Grammatik
zweiter Stufe determiniert ist.
(b) die semantische Interpretation eines kom-
plexen Ausdrucks mit koordinativer Ver-
knpfung ergibt sich aus (i) den Bedeutungen
seiner strukturierten Teile, (ii) der zwischen
diesen Bedeutungen gegebenen Beziehung,
(iii) der durch die Konjunktion zwischen ih-
nen induzierten Beziehung;
(c) die Interpretation und Bewertung eines
Ausdrucks mit koordinativer Verknpfung ist
abhngig (i) von der grammatisch determi-
nierten Integrierbarkeit seiner syntaktischen,
lexikalisch-semantischen und prosodischen
Struktur und (ii) von seiner darauf beruhen-
den kommunikativ-pragmatisch determinier-
ten Informativitt in Normalkontexten.
Damit ist vorgezeichnet, da eine lingui-
stische Analyse die semantischen Eigenschaf-
ten koordinierender Konjunktionen aus ihren
Interpretationsbedingungen in Ausdrcken
mit koordinativer Verknpfung abdestillieren
mu, und das heit, im Kontext koordinativer
Strukturbildung (die letztlich die gesamte
Grammatik involviert) und in Interaktion mit
grundlegenden Bedingungen der kommuni-
kativen Akzeptanz wie Informativitt, Kon-
tingenz und Kohrenz. Was seinerseits die
Schwierigkeiten verdeutlicht, die semantische
Analyse der koordinierenden Konjunktionen
angemessen zu lokalisieren, nmlich im ber-
gangsbereich von Satzbildung und Textstruk-
tur, im Interaktionsbereich von Grammatik
und Pragmatik und an der Schnittstelle zwi-
schen der sprachgebundenen semantischen
Struktur und der kontextuell determinierten
konzeptuellen Interpretation eines Ausdrucks
mit koordinativer Verknpfung.
26. Koordinierende Konjunktionen 599
listet.
(3) Koordination:
S
+
= [(Y) [X
1
conj
k
X
2
(conj
k
X
n
)*] (Z)]
wobei:
Konstituenten in (...) sind bedingt fakul-
tativ;
* bedeutet beliebige Iteration.
Die Distribution der Belegungen fr conj
k
auf
Positionen vor, hinter oder zwischen X
1
, X
2
,
..., X
n
unterliegt typologisch (nach SOV vs.
SVO) determinierten und kategoriell gesteu-
erten Beschrnkungen (so sind lat. X
1
, X
2
-
que, chin. X
1
, X
2
dou auf NP-Konjunkte be-
schrnkt). Die fakultative Auslassung von
und bzw. oder zwischen X
1
, ... . X
n-1
, n 3,
ist hingegen als stilistische Reduktion zu be-
trachten.
(31) Die verknpften Teilstrukturen X
1
,
X
2
, ..., X
n
, sind nicht auf Belegungen
vom Format SATZ beschrnkt, wohl
aber mssen sie (grosso modo) von
gleichem kategorialem Format sein (s.
Abschnitt 1.3 unten).
Wir nennen forthin einen nach (3) gebildeten
Komplex S
+
koordinierte Struktur, die durch
die Konjunktion conj
k
verknpften Teilstruk-
turen X
1
, X
2
, ... Konjunkte, die aus Konjunk-
tion(en) und Konjunkten gebildete Struktur
koordinative Verknpfung (KV), die durch Y,
Z angedeuteten Konstituenten Rahmenstruk-
tur (cf. Abb. 26.1, S. 600). Syntax und Se-
mantik der koordinativen Verknpfung sind
korrelativ bestimmt durch (a) das variierende
Verhltnis von Konjunkt- und Rahmenstruk-
tur und (b) durch die innerhalb dieses Spiel-
raums zulssigen Konjunktionen. Die Kon-
junkte einer koordinierten Struktur umfassen
alle parallel kontrastierenden Konstituenten,
die Rahmenstruktur entsprechend den Rest.
Die Rahmenstruktur umfat minimal die fr
den Satzmodus zustndige (abstrakte) Satz-
typspezifikation (s. Abschnitt 1.4-I), und ma-
ximal alle Konstituenten von S
+
bis auf die
KV.
(32) In koordinierten Strukturen knnen
identisch wiederholte Segmente in den
Konjunkten bedingt wegfallen, d. h.
Konjunkte knnen in Formaten un-
terhalb von SATZ, und zwar als Kon-
stituenten oder auch als Nicht-Kon-
stituenten, auftreten (s. Abschnitt 1.3).
Einschrnkungen betreffen das Format der in
X
i
weglabaren Teilstrukturen bzw. der fr Y
und/oder Z beizubehaltenden Rahmenstruk-
turen sowie die innerhalb dessen whlbare
Konjunktion.
(12)S
2
ist auf eine komplette Belegung
vom Format SATZ festgelegt, d. h. es
gibt keine Reduktionen in S
2
.
(2)d.*Vater schenkt uns ein Haus, weil
Mutter uns ein Auto.
e.*Vater schenkt uns ein Haus, weil
Mutter ein Auto.
f. *Weil Mutter uns ein Auto, schenkt
Vater uns ein Haus.
(13)Die Bedeutung von S
2
wird als Relat
direkt in die Bedeutung von S
+
inte-
griert, wobei die Konjunktion der in
S
2
ausgedrckten Proposition eine le-
xikalisch in conj
s
verankerte semanti-
sche Rolle zuweist.
Dies wird am deutlichsten bei subordinieren-
den Konjunktionen, zu denen es ein prpo-
sitionales Pendant gibt, vgl. die Quasi-qui-
valenz von (2a) und (2g):
(2)
a. Vater schenkt uns ein Haus, weil/ob-
wohl Mutter uns ein Auto schenkt.
g. Vater schenkt uns ein Haus wegen/
trotz Mutters Autogeschenk an uns.
(14) S
2
und S
1
sind nicht ohne Bedeutungs-
bzw. Akzeptabilittsnderung ver-
tauschbar vgl. die Nicht-quiva-
lenz von (2a) und (2h). Jedoch ist
meist [conj
s
[S
2
]] nach links in oder vor
S
1
verschiebbar.
(2)
h. Mutter schenkt uns ein Auto, weil/
obwohl Vater uns ein Haus schenkt.
i. Weil/obwohl Vater uns ein Haus
schenkt, schenkt Mutter uns ein Auto.
j. Mutter schenkt uns, weil/obwohl Vater
uns ein Haus schenkt, ein Auto.
Zusammengefat: Einbettungsstrukturen tra-
gen alle wesentlichen Merkmale einer inh-
rent asymmetrischen Strukturbildung. Das
gilt auch fr Satzkomplemente, die statt
durch conj
s
durch Complementizer (da, ob
etc.) eingeleitet sind, aber es gibt gute Grnde,
die Complementizer nicht der Kategorie der
Konjunktionen zuzurechnen. Einige der zwei-
fellos subordinierenden Konjunktionen wer-
den in den Artikeln 27 und 28 dieses Hand-
buchs behandelt.
Das Strukturierungsprinzip Koordination
lt sich analog durch das Schema in (3)
andeuten. Die damit korrelierenden Merk-
male fr koordinierte Strukturen und die
daran beteiligten Konjunktionen sind in (3)
(15) in Gegenberstellung zu den Merk-
malen der Subordination in (1)(14) aufge-
600 VII. Semantik der Funktionswrter
Abb. 26.1: Koordinierte Struktur
Im Beispielfall von Abb. 26.1 ist der entspre-
chende CI offensichtlich die Eltern, das fi-
nite Verb zeigen als Teil der Rahmenstruktur
weist den eine KV bildenden Konstituenten
in der Subjektposition eine thematische Rolle
(als externes Argument) und eine semantische
Rolle (Agens) zu, die innerhalb der KV von
der Konjunktion und an die Konjunkte Vater,
Mutter weitergereicht werden. Da dies so
ist, belegt die Unakzeptabilitt einer KV wie
??Vielleicht zeigen uns Vater und die Fotos
den Zoo, wo an die Fotos entsprechend auch
die Agens-Rolle zugewiesen wird (statt der
eher zutreffenden Rolle Thema). Mehr zur
Gleichartigkeit der Konjunkte in Abschnitt
1.4.
Das in (35) Genannte ist wesentlich fr
die Bedeutungskomposition: die semantische
Interpretation einer koordinierten Struktur
resultiert aus der Bedeutung der Rahmen-
struktur und der Bedeutung der in sie einzu-
setzenden KV; die wiederum ergibt sich aus
der (innerhalb eines Common Integrators)
durch die Konjunktbedeutungen vorgegebe-
nen und der durch die Konjunktionsbedeu-
tung induzierten Relation zwischen den Kon-
junkten (s. Abschnitt 2.3).
Zusammengefat: Koordinierte Strukturen
tragen alle wesentlichen Merkmale einer auf
Parallelitt der Konjunkte (in allen relevanten
Dimensionen) beruhenden genuin symmetri-
schen Strukturbildung (Details s. Lang
1987b).
1.3Koordination als Strukturbildung
Koordination ist grammatisch betrachtet se-
quentielle Ausdrucksverknpfung auf der
Basis parallel strukturierter Ausdrcke mit
(33) Die Konjunkte einer koordinierten
Struktur hngen syntaktisch und se-
mantisch nicht voneinander ab wie S
2
von S
1
in (11), sie sind daher (im
Prinzip) umstellbar und in der Anzahl
beliebig erweiterbar.
Mgliche Einschrnkungen ergeben sich aus
der internen Struktur der Konjunkte (etwa
bei Anaphorik) und aus der gewhlten Kon-
junktion. So lassen dt. denn oder engl. for, die
ohnehin eine Sonderstellung unter den koor-
dinierenden Konjunktionen einnehmen (s.
Lang 1976), weder Nicht-Satz-Konjunkte
noch eine Konjunktvertauschung zu. Diese
in der Bedeutung von denn verankerte Asym-
metrie ist klar zu trennen von Implikaturen,
die mit der Konjunktvertauschung bei und,
oder, aber einhergehen knnen. So etwa setzt
bei Konjunkten mit finiten tempuskongruen-
ten Verben ein Prinzip wie im Defaultfall ist
Erwhnungsfolge gleich Ereignisfolge be-
stimmte Interpretationsprferenzen (Details
s. Schmerling 1975, Posner 1980).
(34) Die Konjunktionen in einer koordi-
nierten Struktur sind (bedingt) weg-
labar und/oder (nach Anzahl der
Konjunkte) iterierbar und/oder in ih-
rer lexikalischen Belegung variierbar.
(35) Die Bedeutungen der Konjunkte wer-
den in die Bedeutung von S
+
indirekt
integriert, nmlich als durch eine Kon-
junktion verknpfte gleichartige Ex-
emplifizierungsinstanzen eines berge-
ordneten Gesichtspunkts (= Common
Integrator (CI) s. Abschnitt 2.1).
Die den Konjunkten zugewiesene
semantische Rolle ist durch die Rah-
menstruktur determiniert und wird
durch Konjunktionen wie und, oder
etc. nur weitergereicht.
26. Koordinierende Konjunktionen 601
(7) Koordination gem (3) ist kein lokal,
sondern ein generell wirksames Struktur-
bildungsprinzip, das alle Einheiten und
Reprsentationsebenen der Grammatik
erster Stufe involviert, d. h. die Regeln
und Prinzipien, die die Struktur von Sim-
plex-Stzen S und von durch Einbettung
gebildeten komplexen Stzen S
+
gem
(1) determinieren.
Der mitunter als transgrammatisch be-
zeichnete Charakter der Koordination und
die damit zusammenhngenden Probleme der
Grammatikalittsbewertung koordinierter
Ausdrcke beruhen genau darauf, da die
Bildung einer koordinativen Verknpfung wie
in Abb. 26.1 ber Einheiten, die durch Gram-
matik erster Stufe determiniert sind (kon-
junktfhige Konstituenten), eine Beziehung
etabliert, die nicht durch die Grammatik er-
ster Stufe begrndet ist, sondern durch sie
nur in ihrer Ausprgung beschrnkt wird.
Man kann sich das so klar machen:
(8) Eine koordinative Verknpfung unter-
scheidet sich hinsichtlich der Beziehung
zwischen conj
k
und den Konjunkten von
allen anderen grammatischen Beziehun-
gen zwischen Konstituenten (Rektion,
Bindung, Attribution, Apposition, Kon-
gruenz, Anaphora etc.), hat zugleich aber
hinsichtlich der Konjunktformate und der
Beziehungen der Konjunkte zur Rahmen-
struktur einen jeweils spezifischen Anteil
an ihnen.
Daraus ergibt sich das fr Koordination und
koordinative Verknpfung konstitutive Ver-
hltnis zur Grammatik erster Stufe, das man
als These so zusammenfassen kann:
(9) Koordination ist grammatische (morpho-
syntaktische, semantische und prosodi-
sche) Strukturbildung zweiter Stufe, weil
sie ber Einheiten operiert, die in Termen
der Grammatik erster Stufe (Simplex-
strukturen) vollstndig spezifiziert sind.
ber diesen grammatischen Eigenschaf-
ten erster Stufe sind die Gleichartigkeits-
bedingungen der Konjunkte definiert und
damit die Akzeptabilitts- und Inter-
pretationsbedingungen fr koordinierte
Strukturen berhaupt.
Der so anvisierte Zugang zu koordinativen
Verknpfungen bietet auch einen Erklrungs-
ansatz fr die in Abschnitt 1.1 erwhnte no-
torische Kontextdeterminiertheit der Inter-
pretation und Bewertung von Ausdrcken mit
partiell identischer und partiell variierender
Konstituentenbelegung. Partiell identisch
umfat dabei alle nicht-kontrastierenden
Konstituenten (= Rahmenstruktur), partiell
variierend alle paarweise kontrastieren-
den Konstituenten (= Konjunktstruktur).
Kurzum: Koordination ist ein Prinzip sprach-
licher Strukturbildung, bei dem innerhalb der
Domne SATZ aus Paaren, Tripeln, etc. von
Teilstrukturen K
1
, K
2
, ... der syntaktischen
Kategorie a und des semantischen Typs
komplexere Strukturen KV gebildet werden,
die wiederum der Kategorie und dem Typ
zuzuordnen sind, so da Rahmenstruktur
und KV zusammen einen Ausdruck S
+
der
syntaktischen Kategorie SATZ und des seman-
tischen Typs PROPOSITION ergeben. Die koor-
dinative Ausdrucksverknpfung im engeren
Sinne unterliegt auerdem den beiden folgen-
den Bedingungen:
(4) Die koordinative Komplexbildung ist ge-
bunden an das (aktuelle oder virtuelle)
Vorhandensein einer Konjunktion (und,
aber, denn, weder-noch etc.), die die be-
treffenden Teilstrukturen K
1
, K
2
, ... als
Konjunkte einer KV kennzeichnet.
Diese Bedingung grenzt koordinativ ver-
knpfte Strukturen von asyndetischer Anrei-
hung, Juxtaposition und Apposition sowie
von den (ebenfalls bestimmten Gleichartig-
keitsbedingungen unterliegenden) Kompara-
tivkonstruktionen ab.
(5) Bezglich der Spezifikation Zugehrig-
keit zur Kategorie a und zum Typ T
unterliegen die Konjunkte und die resul-
tierenden KV einer Menge von ineinan-
dergreifenden Gleichartigkeitsbedingun-
gen, die fr jede Ebene der Grammatik
(morphosyntaktisch, semantisch, lexika-
lisch, prosodisch) spezifisch zu formulie-
ren sind (s. Abschnitt 1.4).
Diese Bedingung ermglicht es, bestimmte
Konstruktionen, die zwar und, aber, oder ent-
halten, aber ungleichartige Konjunkte, als
pseudo-koordinative Strukturen mit speziel-
ler Interpretation von den regulr interpre-
tierbaren koordinierten Strukturen abzugren-
zen (s. (1418) und (3233)).
(6) Die Konjunkte einer koordinierten Ver-
knpfung bilden eine spezielle Art von
Kontext freinander und stehen in Selek-
tionsbeziehungen zu den die Rahmen-
struktur bildenden Konstituenten (s. Ab-
schnitte 1.4 und 3.3).
602 VII. Semantik der Funktionswrter
dardlogischen Funktoren nur einige ein mehr
oder minder direktes lexikalisches Pendant
haben und warum die meisten nicht. Dies ist
der Ort, wo kognitive Elementaroperationen
mit kommunikativen Prinzipien (Kontingenz,
Kohrenz etc.) in der Weise in Bezug zu setzen
sind, da die selektive Lexikalisierung von
Konjunktionen als Ergebnis von Beschrn-
kungen erklrbar wird (s. Abschnitt 3.1).
1.4Gleichartigkeitsbedingungen fr
Konjunkte
Wir illustrieren die fr wohlgeformte koor-
dinierte Strukturen gltigen Gleichartigkeits-
bedingungen in der Auswahl (IIII), die zei-
gen soll, (a) welche Konstituentenmerkmale
der Grammatik erster Stufe dabei involviert
sind, (b) wie die Interpretation des gesamten
Ausdrucks und damit die der jeweiligen Kon-
junktion vom Grad der Gleichartigkeit der
Konjunkte abhngt.
Die Gleichartigkeitsbedingungen manife-
stieren sich in Konjunktformaten vom kom-
pletten SATZ ber phrasale Konstituenten und
Folgen von Nicht-Konstituenten bis zu Kom-
positagliedern (Kinder- und Hausmrchen,
Kinderschuhe und -kleider) und gewissen Pr-
fixen (Be- und Entladen von Laub gestattet,
aber: *Ab- oder Verbrennen von Laub verbo-
ten) und betreffen alle Ebenen der gramma-
tischen Strukturbildung.
I.Gleicher Satztyp:
Wenn K
1
und K
2
komplette (oder regulr
elliptische) Stze sind, mssen sie die gleiche
Satztypspezifikation aufweisen. Gleich
heit dabei nicht unbedingt identisch, son-
dern wie (13a) zeigt kompatibel unter
einer Art Archityp. Die Beispiele (13b-e) be-
legen, da gewisse satztypverschiedene Kom-
binationen grundstzlich zu inkohrenten
und damit inakzeptablen Strukturen fhren.
(13)
a. Wie spt ist es und sind wir heute mit
dem Referat dran?
(W- und J/N-Frage)
b. *Wie spt ist es und/oder/aber ich
komme nicht pnktlich?
c. *Wie spt ist es, aber nimm doch den
Bus!
d. *Heute ist Dienstag oder sei pnkt-
lich!
e. *Sei weder pnktlich noch wie spt
ist es denn?
Akzeptable Konstruktionen, wo K
1
, K
2
ver-
schiedenen Satztypen zugehren, also die
koordinativen Verknpfungen und zugleich
auch fr die Universalitt der Koordination:
(10) Wenn die wesentlichen Bedingungen der
koordinativen Strukturbildung aus der
Grammatik zweiter Stufe stammen,
dann ist es nur natrlich, da ihre sub-
stantielle Fundierung nicht in der Gram-
matik erster Stufe zu suchen ist, sondern
in letztlich sprachunabhngigen Prinzi-
pien der kognitiven Reprsentation und
Verarbeitung von Kenntnissen und ihrer
kommunikativen Vermittlung. Daher die
schwierige Grenzziehung zwischen Se-
mantik und Pragmatik der Koordina-
tion.
(11) Wenn man die koordinative Strukturbil-
dung aus der Grammatik zweiter
Stufe ableitet, dann lassen sich ihre we-
sentlichen Bedingungen als Universalien
formulieren, die nur in ihrer Realisie-
rung bezglich bestimmter syntakti-
scher, morphologischer oder lexikali-
scher Parameter einzelsprachlicher Va-
riation unterliegen.
Korrelativ zu (10) und (11) ergibt sich dann
fr die eigentliche Bedeutungsbeschreibung
der koordinierenden Konjunktionen als me-
thodischer Hinweis fr das eingangs unter (B)
erwhnte Verhltnis von linguistischer vs. lo-
gischer Semantik:
(12) Die semantische Beschreibung der Kon-
junktionen und, aber etc. mu
(i) einerseits so abstrakt sein, da sie
den jeweiligen Spielraum kontext-
determinierter Interpretationen
ohne berzogene Polysemieannah-
men abdeckt genau dies wird er-
reicht, wenn man die lexikalische Be-
deutung der koordinierenden Kon-
junktionen auf kognitive Elementar-
operationen bezieht (s. Abschnitt
3.2), die letztlich auch die Basis fr
die standardlogischen Funktoren
bilden;
(ii) andererseits so spezifisch sein, da
sie eine Systematik fr die lexikali-
schen Feldeigenschaften der koor-
dinierenden Konjunktionen liefert
und eine Erklrung, warum be-
stimmte (Kombinationen von) sol-
chen Grundoperationen lexikalisiert
sind, andere nicht.
Der letzte Punkt betrifft die fr das Verhltnis
von Logik und Linguistik entscheidende
Frage, warum z. B. von den 2
4
= 16 stan-
26. Koordinierende Konjunktionen 603
oder PP-Prdikativ zur Kopula in (20).
(19) Ich wnsche dir ein langes Leben und
da es dir gut geht.
(20) Peter ist (ein) Vegetarier und gesund und
von krftiger Gestalt/vom Land.
Unter diese Bedingung fallen auch koordi-
nierte Strukturen mit Konjunkten, die durch
weggelassene Teile (___) Nicht-Konstituen-
ten sind, wie Gapping-, Right-Node-Raising-,
After-thought- und eine Reihe weiterer Kon-
struktionen. Die Konjunkte mssen in jedem
Falle so strukturiert sein, da sie unter Ein-
beziehung des finiten Verbs konstituenten-
weise auf S projizierbar sind. Dafr gibt es
einzelsprachliche syntaktische Bedingungen
fr das lineare Verhltnis von nichtkontra-
stierenden Konstituenten (Rahmenstruktur)
und kontrastierenden Konstituenten (Kon-
junktstruktur) s. Wunderlich 1988a,b. Die
durch Indizes angedeutete Koreferenz bzw.
Referenzverschiedenheit der betreffenden
Paare in (21, 22) korreliert mit entsprechen-
den Akzentmustern. Zu Nicht-Konstituenten-
Konjunkten und Ellipse s. Lundy 1980, Klein
1981.
a. Opa vererbt den Enkeln
i
das Haus
k
und/aber/oder/*denn
Oma __ uns
j/*i
die Htte
l/*k
b. Opa vererbt das Haus
k
den Enkeln
i
und/aber/oder/denn
*Oma es
k
uns
j/i
c. Opa vererbt das Haus
k
den Enkeln
i
und/aber/oder/denn
Oma schenkt es
k
uns
j/i
(22)
a. Ein Auto hat mir Opa __
und/aber/oder/*denn
ein Rad __ dir Oma geschenkt
b. Ein Auto hat mir Opa __
und/aber/oder/denn
*Oma __ dir ein Rad geschenkt.
(23)
a. John both/neither sang and/or/nor
danced
b. *Hans sowohl/weder sang als auch/
noch tanzte
c. ..., weil Hans sowohl/weder sang als
auch/noch tanzte
d. Hans sang weder/*sowohl noch /*als
auch tanzte er
e. Weder/*Sowohl sang noch/*als auch
tanzte jemand
Wir fhren die Beispiele an, weil sie (i) bele-
gen, da nicht alle Konjunktionen Nicht-
Konstituenten-Konjunkte zulassen (z. B.
denn); (ii) belegen, da zweigliedrige Kon-
junktionen Konstituenten-Konjunkte nur po-
sitionsabhngig zulassen (s. 23be);
Gleichartigkeitsbedingung verletzt wird, sind
wie (15) zeigt keine regulren KV, son-
dern Konstruktionen mit spezieller Uminter-
pretation, die bei (17) als quasi-phraseologi-
sierte Einkleidung der standardlogischen
quivalenz p v q = p q erscheinen
knnte (es aber wegen (1416) nicht ist) und
die bei (18) auf eine Infinitivkonstruktion be-
zogen wird.
(14)
a. Zeige mir deinen Ring und ich zeige
dir meine Kette.
b. = Wenn du mir deinen Ring zeigst,
zeige ich dir meine Kette.
(15) *Zeige mir deinen Ring und ich __
dir meine Kette.
(16)
Sei pnktlich und du mut nicht
drauen bleiben.
b. = Wenn du pnktlich bist, dann
mut du nicht drauen bleiben.
a. Sei pnktlich oder du mut drauen
bleiben.
b. = Wenn du nicht pnktlich bist,
dann mut du drauen bleiben.
a. Sei so gut und gib mir den Ring.
b. = Sei so gut mir den Ring zu geben.
Die Uminterpretation solcher Konstruktio-
nen, die natrlich auch den Bedeutungsanteil
von und und oder affiziert, wird durch die
Ungleichartigkeit der Konjunkte ausgelst.
Fr die Analyse von und und oder heit das
nur, da ihre semantische Beschreibung mit
den Uminterpretationen vertrglich sein mu,
nicht aber, da man ein spezielles finales
oder konditionales und bzw. oder zu postu-
lieren htte. Die Beispiele belegen auch, da
die Satztypspezifikation zur Rahmenstruktur
gehrt.
II.Gleiche Konstituentenkonfiguration
Die Konjunkte K
1
, K
2
mssen syntaktisch in
KV die gleiche Konstituentenkonfiguration K
belegen. Diese Bedingung ist in der Literatur
unter Bezeichnungen wie same-type-hypo-
thesis (Chomsky 1957, Lang 1984), Law of
the Coordination of Likes (George 1980,
Williams 1981c) ausfhrlich diskutiert und
modellspezifisch rekonstruiert worden (s.
dazu vor allem Sag/Gazdar/Wasow/Weisler
1985; Renz 1989). Wiederum besagt gleich
hier nicht, da die Konjunkte von identischer
Kategorie sein mssen, wohl aber gleichwer-
tig als Belegungen einer durch die Rahmen-
struktur determinierten syntaktischen Posi-
tion, also etwa als NP- oder Satz-Komple-
ment zu wnschen in (19) oder als NP-, AP-
604 VII. Semantik der Funktionswrter
junkte eine phraseologisierte Uminterpreta-
tion aus (3233). Details zu intensivie-
render und- Verknpfung und All-Quantifi-
kation cf. Knig 1971, Lang 1984.
(29) Opa
i
vererbte den Kindern
j
das Haus
k
*und/oder er
i
vererbte es
k
ihnen
j
.
(30) *Er ging zur Bank und zur Bank, um
Geld zu holen bzw. sich hinzusetzen.
(31)
a. Wer ist hier mit wem verwandt?
b. *Wer und wer ist hier verwandt?
c. Der und der hier sind verwandt.
(32)
a. Opa schlft lnger und lnger/mehr
und mehr/tiefer *oder tiefer.
b. = Opa schlft immer lnger/ immer
mehr.
(33)
a. Die Leute warten und warten. Der
Zug kommt und kommt nicht.
b. = Die Leute warten immer noch. Der
Zug kommt immer noch nicht.
Die Auswahl zeigt, da die standardlogischen
Gesetze der Idempotenz (p p) p und
(p p) p kein natrlichsprachliches Pen-
dant als Interpretationsvorschrift fr koor-
dinierte Strukturen haben. Die Grammatik
erster Stufe enthlt keine Bedingung, nach der
Strukturen wie (29, 30, 31b) als inakzeptabel
zu bewerten wren. Im Sinne der in 1.2 skiz-
zierten Grammatik zweiter Stufe jedoch sind
nichtdistinkte Konjunkte wegen Redundanz
als inakzeptabel markiert. Auf analoge Weise
sind kontradiktorische bzw. tautologische
Verknpfungen bewertbar (s. Abschnitt 2.3).
1.5Parallelisierungseffekt der Koordination
Bisher haben wir die Koordination als we-
sentlich auf Symmetrie beruhendes Komplex-
bildungsverfahren anhand von Gleichartig-
keitsbedingungen fr Konjunkte illustriert.
Die Symmetrie zeigt sich jedoch ebenso bei
der semantischen Interpretation. Der in (6)
erwhnte Umstand, da die Konjunkte eine
spezielle Art von Kontext freinander bilden,
zeitigt deutliche Parallelisierungseffekte. In
koordinierten Strukturen werden die Inter-
pretationsmglichkeiten der Konjunkte in sy-
stematischer und fr alle Konjunkte gleich-
artiger Weise eingeschrnkt. Dabei ergibt sich
eine Interpretationsfestlegung, die fr die
Konjunkte isoliert nicht gilt. Zu unterschei-
den sind zwei Untereffekte:
I.Selektionseffekt
Bei fr sich genommen mehrdeutigen Kon-
junkten entsteht durch Koordination keine
Multiplikation der Mehrdeutigkeit, sondern
(iii) einen Ausschnitt reiner Syntax zweiter
Stufe zeigen nmlich die Parallelittsbe-
dingung bezglich der Konstituentenanord-
nung in den Konjunkten (s. 22b). Konjunkte
mssen ferner gleich sein bezglich der Topik-
Fokus-Gliederung der Gesamtstruktur von
S
+
. Das zeigt (24), wo nur a oder b als ko-
hrente Fortsetzungen mglich sind, aber
nicht das semantisch quivalente c (KAPITL-
CHEN = Hauptakzenttrger).
(24) (Dort drben sitzt Peter! Ja, und?)
a. Er schmust mit einer BLONDEN.
b. Eine BLONDE schmust mit ihm.
c. *Er und eine BLONDE schmusen mit-
einander.
Kriterial fr die Akzeptabilitt einer koordi-
nierten Struktur innerhalb der Bedingung
gleiche Konstituentenkonfiguration ist die
Kontrastfhigkeit der Konjunkt-Belegungen.
(25) zeigt, da primr ungleichartige und da-
her unakzeptable Konjunkte durch Kontra-
stierung sekundr gleichartig und damit ak-
zeptabel werden knnen. (2627) sind Bei-
spiele fr Belegungen, die aufgrund lexika-
lisch verankerter Eigenschaften prinzipiell
nicht kontrastfhig (nicht fokussierbar etc.)
sind und daher als Konjunkte nicht in Frage
kommen.
(25)
a. Opa arbeitet heute (*oder) im Garten.
b. Opa arbeitet weder heute noch im
Garten, sondern morgen und im
Haus.
(26)
a. Opa springt auf und ber das Bett.
b. *Opa freut sich auf und ber das Bett.
(27) *Man oder/und er arbeiten heute nicht.
(28) *Opa rgert/erinnert sich und uns gerne.
Die hier angesprochene lexikalisch verankerte
Fokusfhigkeit der Konjunkte leitet ber zu
einer Bedingung der Semantik zweiter Stufe
bezglich der Konjunktbedeutungen.
III.Semantische Minimaldifferenz
Die Konjunkte K
1
, K
2
mssen sich semantisch
in wenigstens einem kontrastfhigen Merk-
mal unterscheiden, andernfalls sind die be-
treffenden koordinierten Strukturen inakzep-
tabel. Referentiell und/oder konzeptuell iden-
tische Konjunkte sind grundstzlich ausge-
schlossen (29). Das schliet entsprechend ho-
mophone Konjunkte aus (30), sofern sie nicht
zu einer lexikalischen Kategorie gehren, die
Referenzdistinktion allein schon durch into-
natorisch indizierten Kontrastfokus ermg-
licht wie deiktische Pronomina (31c). In ge-
wissen Fllen lsen identisch belegte Kon-
26. Koordinierende Konjunktionen 605
Unterschied die Bedeutungskomposition
bei (42) umfat nicht nur die disjunktive Ver-
knpfung von zwei eigenstndigen und un-
abhngig voneinander in die Gesamtbedeu-
tung eingehenden Konjunktbedeutungen,
sondern und darauf beruht der Defekt
die Interpretation von (42) ist sensitiv fr die
interne Struktur der Konjunkte und fr die
zwischen den Konjunktbedeutungen beste-
henden Relationen.
Diese Sensitivitt ist ein weiterer auf die
Gleichartigkeit der Konjunkte bezogener
Aspekt der Koordination. Die einschlgigen
Kriterien fr die semantische Ausgewogenheit
der Konjunkte lassen sich letztlich alle auf die
folgende bei der Interpretation koordinierter
Strukturen unweigerlich wirksam werdende
Bedingung zurckfhren.
2.1Common Integrator
Bei der Interpretation einer koordinierten
Struktur wird nach Magabe der Gleichartig-
keitsbedingungen fr Konjunkte in 1.3 und
1.4 durch Vergleichs- und Ausgliederungs-
operationen aus den Konjunktbedeutungen
eine sie subsumierende begriffliche Einord-
nungsinstanz abstrahiert ein Common In-
tegrator (CI). Fr die Determination eines
geeigneten CI gilt:
(43)
a. Die in den Konjunktbedeutungen re-
prsentierten Eigenschaften, Indivi-
duen und Sachverhalte sind Exempli-
fizierungsinstanzen des CI.
b. Je strikter die Konjunkte den syntak-
tischen und semantischen Gleichartig-
keitsbedingungen gengen, desto di-
rekter und natrlicher ist ihr CI ab-
zuleiten, desto weniger Sach- oder
Kontextinformation wird bentigt,
um einen geigneten CI zu etablieren.
Abb. 26.2 zeigt etwas vereinfacht die
sich ber mehrere Ebenen erstreckende Pro-
zedur der Etablierung eines CI. Dabei beruht
die Konjunktdetermination auf der morpho-
syntaktischen + prosodischen Strukur des
Gesamtausdrucks, die semantische Differen-
zierung auf der lexikalisch-semantischen
Struktur der Konjunkte. Die Integration von
Kontextinformation hingegen involviert die
konzeptuelle Interpretation des betreffenden
Ausdrucks (im Sinne der in Bierwisch/Lang
1989 vorgeschlagenen Ebenenunterschei-
dung). Die Prozedur liefert im Default-Fall
fr zwei oder mehr gegebene Konjunkte K1,
K2 der syntaktischen Kategorie a und des
semantischen Typs T ein Konzept E, das die
es gilt fr alle Konjunkte einer KV derselbe
Lesungstyp. Mischungen sind ausgeschlossen.
So behlt (35) die Mehrdeutigkeit von Ver-
wandtenbesuch in (34) bei, nmlich entweder
beidemale Besuch bei Verwandten oder bei-
demale Besuch durch Verwandte, und (36)
ist kontradiktorisch in jeder Lesart.
(34) Peter liebt Verwandtenbesuche.
(35) Peter liebt Verwandtenbesuche, aber Ina
hat Verwandtenbesuche.
(36) *Peter liebt Verwandtenbesuche, aber er
hat Verwandtenbesuche.
II.
bertragungseffekt
Der Lesungstyp eines eindeutigen Konjunkts
legt den Lesungstyp der jeweils anderen mehr-
deutigen oder unspezifizierten Konjunkte in-
nerhalb der KV fest. (Weitere Beispiele in
Lang 1984).
(37) Peter liebt Verwandtenbesuche, aber er
hat Besuche bei Verwandten.
(38) Peter hat einen Vogel und Fritz auch.
(wrtlich vs. metaphorisch)
(39) Peter hat einen Vogel und Fritz einen
Goldhamster.
(nur wrtlich)
(40) Peter hat einen Vogel und Fritz hat auch
eine Meise.
(nur metaphorisch)
(41)
a. Dort sind Lwen oder Nashrner.
(sexus-unspezifiziert)
b. Dort sind Lwen oder Lwinnen.
(sexus-spezifiziert)
Diese Beispiele sind zwingend, es gibt auch
Flle, wo der Parallelisierungseffekt nur Pr-
ferenzen setzt. Jedenfalls aber ist sein Ein-
treten ein klares Indiz fr die in Abschnitt 1.2
aufgezhlten Eigenschaften der Koordina-
tion.
2. Semantik der koordinativen
Verknpfung
Wenden wir uns nun etwas detaillierter den
im Anschlu an (35) genannten Bestand-
teilen zu, aus denen sich die semantische In-
terpretation einer KV zusammensetzt. Gewi
ist wie fr p v q in der Standardlogik
die Bedeutung eines natrlichsprachlichen
Ausdrucks wie
(42) Waldi ist ein Dackel oder (Waldi ist) ein
Hund.
eine Funktion der Bedeutung seiner Bestand-
teile, aber und das macht den triftigen
606 VII. Semantik der Funktionswrter
Abb. 26.2: Ableitung eines Common Integrators
(46)
a. Die Sonne scheint und die Vgel sin-
gen
b. ?? Die Sonne und die Vgel scheint
bzw. singen.
c. CI:?? WER TUT WAS?
Die Eigenartigkeit von (46b) gegenber (46a)
beruht genau auf der syntaktisch determi-
nierten, jedoch semantisch kaum legitimierten
Ableitung des in (46c) angedeuteten CI. Der
Defekt von (42) beruht auf der Automatik
der Konjunktdifferenzierung, die in diesem
Falle eine (der semantischen und faktischen
Beziehung widersprechende) Umkategorisie-
rung von Dackeln zu Nicht-Hunden erzwingt.
Aber selbst semantisch korrekte und im Sinne
von (43) ausbalancierte Konjunkte knnen zu
inakzeptablen Interpretationen fhren, weil
sich die Etablierung eines CI unweigerlich
auch in der pragmatischen Interpretation
einer KV durchsetzt. Darauf beruht die iro-
nische oder diffamierende Wirkung von zeug-
matischen KV wie:
(47)
a. Gttingen ist bekannt fr Professo-
ren, Philister und Vieh. [H. Heine]
kontrastierenden Merkmale von K1, K2 so
umfat, da E in einer Konzepthierarchie der
Knoten ist, der die durch K
1
, K
2
reprsen-
tierten Konzepte direkt dominiert. In einem
Trivialfall wie Morgen wollen uns Opa und
Oma ein Haus vererben ist der CI entspre-
chend Groeltern. Der CI mu jedoch kei-
neswegs immer auch direkt lexikalisierbar
sein (Details bei Lang 1984).
Die Rolle der syntaktischen und prosodi-
schen Strukturierung der Konjunkte fr die
Deduktion des CI kann man sich leicht an-
hand von multiplen Fragen verdeutlichen.
Kontrastierende bzw. nicht-kontrastierende
Konstituenten kennzeichnen wir durch Indi-
zierung wie bisher, die CIs durch KAPITL-
CHEN.
(44)
a. Opa vererbt den Enkeln
i
das Haus
k
und Oma uns
j
die Htte
l
.
b. Opa und Oma vererben den Enkeln
i
und uns
j
das Haus
k
bzw. die Htte
l
.
c. CI: WER vererbt WEM WAS?
(45)
a. Opa vererbt den Enkeln
i
das Haus
k
,
aber Oma schenkt uns
i
die Htte
k
.
b. Opa vererbt, aber Oma schenkt [uns
Enkeln]
i
das Haus
k
.
c.
CI: WER BEREIGNET WIE
uns Enkeln
das Haus?
26. Koordinierende Konjunktionen 607
d. Kontradiktorischer Gegensatz K
1
, K
2
(K
1
, K
2
knnen nicht beide wahr oder
falsch sein: 1,0; 0,1)
Hans ist grer als Fritz; Hans ist
nicht grer als Fritz
die Zahl z ist ungerade; z ist gerade
e. Kontrrer Gegensatz K
1
, K
2
(K
1
, K
2
knnen nicht beide wahr, aber
beide knnen falsch sein: 1,0; 0,1;
0,0)
Hans ist grer als Fritz; Fritz ist
grer als Hans
die Zahl z ist gerade; z ist 17
f. Subkontrrer Gegensatz K
1
, K
2
(K
1
, K
2
knnen nicht beide falsch,
aber beide knnen wahr sein: 1,1;
1,0; 0,1)
Hans ist nicht grer als Fritz; Fritz
ist nicht grer als Hans
die Zahl z ist teilbar; z ist ungerade
g. Unabhngigkeit K
1
, K
2
(K
1
, K
2
knnen unabhngig wahr oder
falsch sein: 1,1; 1,0; 0,1; 0,0)
Hans ist grer als Fritz; Hans ist
lter als Fritz
die Zahl z ist gerade; z ist eine Qua-
dratzahl
Wenn man davon ausgeht, da begriffliches
Wissen strukturell durch hierarchische Sub-
sumptionsbeziehungen determiniert ist, dann
sind die in (48) aufgefhrten Relationen alle
unmittelbar in der Struktur unseres Kennt-
nissystems verankert. Daraus folgt, da jedes
Paar von Konjunkten K
1
, K
2
einer KV
zwangslufig auch wenn die Konjunkte
satztypgleiche Nicht-Aussagestze (z. B. Fra-
gestze) sind unter eine der in (48) aufge-
fhrten Relationen fllt. Diese ist dann die
zwischen den Konjunkten vorgegebene Rela-
tion, in Bezug auf die durch die koordinie-
renden Konjunktionen eine weitere Relation
induziert wird. Die semantische Interpreta-
tion einer KV und damit einer koordinierten
Struktur insgesamt ist durch das Verhltnis
dieser beiden Relationen bestimmt.
Die Relationen (48de) beruhen auf der
Unvertrglichkeit (Inkompatibilitt) ihre in
... dargestellten Belegungsspielrume ent-
halten kein Paar 1,1; die restlichen auf der
Vertrglichkeit (Kompatibilitt) der Kon-
junktbedeutungen ihre Belegungsspiel-
rume enthalten ein Paar 1,1. Die Konjunkte
sind nicht-distinkt bei (48a), distinkt sonst; sie
sind voneinander unabhngig bei (48g), ab-
hngig sonst. Fr die semantischen Relatio-
nen in (48) gelten die folgenden Axiome:
b. No entry for dogs and Chinese.
[Am Parktor in Shanghai vor 1949]
Fazit: Die Akzeptabilitt einer koordinativen
Verknpfung ist unmittelbar abhngig davon,
ob sich, wie sich und was fr ein CI sich ber
den Konjunktbedeutungen etablieren lt.
Genau daran bemessen sich auch Normalin-
terpretation, phraseologisierte Sonderinter-
pretation oder kontextuelle Uminterpretation
einer koordinierten Struktur.
2.2Semantische Relationen zwischen den
Konjunkten
Wie aus (42) ersichtlich, spielen die durch die
Konjunktbedeutungen vorgegebenen Relatio-
nen fr die Akzeptabilitt einer KV eine ent-
scheidende Rolle. Es sind, wie in Lang (1984)
begrndet, genau die sieben semantischen Re-
lationen in (48), die als mgliche Beziehungen
zwischen Konjunkten K
1
, K
2
(Indizes fr Ab-
folge) relevant sind.
Diese Relationen sind standardlogisch for-
mulierbar als Funktionen von Paaren von
Wahrheitswerten in Wahrheitswerte. Wir wer-
den sie jeweils verbal umschreiben und nach
dem eingangs erluterten Verfahren durch die
geordnete Menge der Wahrheitswertpaare
darstellen, die fr sie den Wert 1 ergeben. Im
gegebenen Zusammenhang deuten wir die je-
weilige Menge der Wahrheitswertpaare als
den durch die betreffende semantische Rela-
tion zwischen den Konjunkten vorgegebenen
Belegungsspielraum. Wir illustrieren die be-
treffenden Relationen durch simple, aber se-
mantisch eindeutige Beispiele mit Konjunkten
im Satzformat.
(48)
a. Nicht-Distinktheit K
1
, K
2
(K
1
, K
2
knnen nur beide wahr oder
falsch sein: 1,1; 0,0)
Hans ist Junggeselle; Hans ist unver-
heiratet
die Zahl z ist nicht teilbar; z ist eine
Primzahl (sei z 3)
b. Inklusion K
1
, K
2
(Wenn K
1
wahr ist, ist auch K
2
wahr:
1,1; 0,1; 0,0)
Hans malt Elefanten; Hans malt Tiere
die Zahl z ist eine Primzahl; z ist un-
gerade
c. Inklusion K
2
, K
1
(Wenn K
2
wahr ist, ist auch K
1
wahr:
1,1; 1,0; 0,0)
Hans malt Tiere; Hans malt Elefanten
die Zahl z ist ungerade; z ist eine Prim-
zahl
608 VII. Semantik der Funktionswrter
f. *Hans malt entweder/nicht Tiere
oder/sondern Elefanten.
g. *Hans malt entweder/nicht Elefanten
oder/sondern Tiere.
Die Beispiele in (51e) zeigen, da, um der
Inkompatibilittsforderung von entweder
oder, nicht sondern zu gengen, semantisch
kompatible, aber voneinander unabhngige
Konjunkte kontextuell auf wechselseitigen
Ausschlu festgelegt werden knnen. Wenn
indes semantisch abhngige Konjunkte eine
konjunktionale Selektionsforderung nicht er-
fllen, resultieren daraus stets kontradiktori-
sche Verknpfungen (51a,f,g).
Hier zeigt sich eine Asymmetrie: Ein-
schrnkung von semantisch vertrglich auf
kontextuell alternativ ist auch bei wrtlicher
Interpretation immer mglich, die Lockerung
von semantisch unvertrglich zu kontextuell
kompatibel hingegen nicht. Kontradiktori-
sche Verknpfungen sind unakzeptabel wegen
Unverstndlichkeit, d. h. solche Ausdrcke
sind nach den Prinzipien des Auf- und Um-
baus von Kenntnissen nicht regulr verar-
beitbar (s. Lang 1974, 1984). Kontradiktori-
sche Ausdrcke wie (51a) knnen nur ber
Ausweichstrategien (z. B. in einer Hinsicht ...,
in anderer Hinsicht ..., s. Lang 1978) aufgelst
und interpretiert werden.
Auf dem Hintergrund der angefhrten
kognitiven und kommunikativer Kriterien der
Kenntnisverarbeitung lassen sich nun smtli-
che Selektionsbeziehungen zwischen den ko-
ordinierenden Konjunktionen und den se-
mantischen Relationen zwischen Konjunkten
in der folgenden Generalisierung zusammen-
fassen:
(III) Koordinative Verknpfungen mssen
kontingent und informativ sein!
Da die durch (I) und (II) ausgeschlossenen
Strukturen hierdurch miterfat sind, liegt auf
der Hand, weil sie nicht kontingent (51 a,fg)
oder nicht informativ (21 b, 50ab) sind. Als
Verfeinerung kommt nur noch hinzu, da KV
sowohl kontingent als auch informativ sein
mssen. Zur Illustration:
(52)
a. ? Hans ist entweder grer als Fritz
oder nicht grer als Fritz.
b. ? Die Zahl z ist entweder gerade oder
ungerade.
c. Die Zahl z ist ungerade und/aber/oder
teilbar.
d. Hans ist weder grer noch lter als
Fritz.
(49)
a. inkompatibel (K
1
, K
2
)
abhngig (K
1
, K
2
)
b. inkompatibel (K
1
, K
2
)
distinkt (K
1
, K
2
)
Die koordinierenden Konjunktionen und,
aber, oder etc. sind nun ihrerseits sensitiv fr
die (Un-)Vertrglichkeit, (Un-)Abhngigkeit
und Distinktheit der Konjunktbedeutungen.
Es gibt, bezogen auf die in Termen von Ver-
stehbarkeit und Informativitt auszubuchsta-
bierende Akzeptabilitt einer koordinierten
Struktur, klare Selektionsbeziehungen zwi-
schen den durch die koordinierenden Kon-
junktionen induzierten und den durch die
Konjunkte vorgegebenen semantischen Rela-
tionen. Sie sind formulierbar als sukzessive
Einschrnkungen. So gilt, den speziellen Fall
mit denn in (50c) ausgenommen, zunchst fr
alle regulr (d. h. nicht phraseologisiert) in-
terpretierbaren koordinierten Strukturen:
(I) Keine semantische Inklusion zwischen den
Konjunkten!
(50)
a. ?Hans malt gerne Elefanten und/oder/
aber/denn er malt gerne Tiere.
b. ?Hans malt gerne Tiere und/oder/
aber/ er malt gerne Elefanten.
c. Hans malt gerne Tiere, denn er malt
gerne Elefanten.
In Bezug auf den CI heit das: Es darf nicht
ein Konjunkt der mgliche CI fr das andere
sein. Die Bewertung in (50ab) beruht auf
der anhand von (42) schon diskutierten er-
zwungenen Umkategorisierung von Elefanten
zu Nicht-Tieren. Mit der Bedingung (I) sind
natrlich auch alle nicht-distinkten Kon-
junkte wie in (21b, 29, 30, 31b) ausgeschlos-
sen. Bezogen auf die einzelnen Konjunktionen
gilt sodann:
(II) Die Konjunktionen und, aber, denn u. a.
erfordern kompatible Konjunkte, die
Konjunktionen entweder oder, nicht
sondern u. a. inkompatible. Jede koordi-
nierende Konjunktion ist sensitiv bezg-
lich der Vertrglichkeit bzw. der Unver-
trglichkeit ihrer Konjunkte.
(51)
a. *Hans ist grer als Fritz und/aber/
denn Fritz ist grer als Hans.
b. Entweder ist Hans grer als Fritz
oder Fritz ist grer als Hans.
c. Nicht Hans ist grer als Fritz, son-
dern Fritz ist grer als Hans.
d. Hans ist grer als Fritz und/aber/
denn Hans ist lter als Fritz.
e. Hans ist entweder/nicht grer als
Fritz oder/sondern lter als Fritz.
26. Koordinierende Konjunktionen 609
guistische Bedeutungsbeschreibung der ko-
ordinierenden Konjunktionen.
(53)a. und, aber: 1,1
b. oder: 1,1; 1,0; 0,1
c. entweder oder
:
1,0; 0,1
d. weder noch: 0,0
e. nicht
sondern:
0,1
f. und nicht: 1,0 (mit speziel-
ler Emphase auf
nicht)
Unter Bezug auf die in (51) illustrierten Se-
lektionsbedingungen deuten wir die in ...
angegebenen Wahrheitswertpaare nun als den
von der betreffenden Konjunktion bezglich
der Konjunkte geforderten Belegungsspiel-
raum (Bel-Sp), kurz: als den Selektionsrah-
men der Konjunktion. So rekonstruieren wir
die in 2.1 genannte Selektionsbedingung, da
und, aber vertrgliche Konjunkte (mit ... 1,1
... gem (48)) und entweder oder unver-
trgliche Konjunkte (mit ... 1,0 ..., aber
ohne ... 1,1 ... gem (48)) etc. verlangen.
Auf dieser Basis knnen nun Konjunktions-
bedeutungen und Konjunktbedeutungen nach
gefordertem vs. vorgegebenem Belegungs-
spielraum in Beziehung gesetzt und bezglich
der Akzeptabilitt der resultierenden KV be-
rechnet werden. Zu unterscheiden sind drei
relevante Flle:
I.
Komplette bereinstimmung
Wenn der vorgegebene und der geforderte
Belegungsspielraum komplett bereinstim-
men, ist die resultierende KV tautologisch und
somit redundant. Die durch die Konjunktion
induzierte Relation wird durch die zwischen
den Konjunkten ohnehin bestehende schon
erfllt, somit wird durch die KV keine Kennt-
nisumstrukturierung bewirkt. Beispiel:
(54)?Die Zahl z ist entweder teilbar oder eine
Primzahl.
vorgegebener Bel-Sp: 1,0; 0,1
geforderter Bel-Sp: 1,0; 0,1
II.Komplette Divergenz
Wenn der vorgegebene und der geforderte
Belegungsspielraum in keinem Wahrheits-
wertpaar bereinstimmen, ist die resultie-
rende KV kontradiktorisch und somit unver-
stndlich. Die durch die Konjunktion indu-
zierte Relation und die zwischen den Kon-
junkten vorgegebene bewirken, da eine In-
tegration der KV ins Kenntnissystem blok-
kiert wird. Beispiele:
Die Beispiele (52ab) sind tautologisch, d. h.
sie sind zwar regulr interpretierbar im Sinne
der Kenntnisverarbeitung, aber nicht infor-
mativ, sondern redundant, weil sie gewisser-
maen nur vorgebene Kenntnisstrukturen
verbalisieren. Genauer gesagt: die durch die
Konjunktion entweder oder induzierte Re-
lation zwischen den Konjunkten wird exakt
erfllt durch die Relation, die zwischen den
Konjunkten semantisch schon vorgeben ist.
Redundante KV erhalten daher, um wenig-
stens im gegebenen Kontext informativ zu
sein, eine pragmatische Zusatzinterpretation,
etwa als erinnernder Hinweis auf die sortale
Domne eines gegebenen Individuums (Ter-
tium non datur), oder als kaschierte Infor-
mationsverweigerung (z. B. wenn der Mathe-
Lehrer ber die Lsung einer Aufgabe nur
(52b) mitteilt). Redundante Verknpfungen
sind wegen hheren Interpretationsaufwan-
des als minder akzeptabel zu werten. Dem-
gegenber sind die Beispiele (52cd) kontin-
gent und auch in wrtlicher Interpretation
informativ, sie bedrfen keiner pragmatischen
Zusatzinterpretation und sind daher voll ak-
zeptabel im Sinne des hier zugrunde gelegten
(in Lang 1984 detailliert begrndeten) Bewer-
tungsrasters.
Die in (III) zusammengefate Bedingung
ist in Termen einer Semantik zweiter Stufe
zu rekonstruieren. Den dabei auf die Relatio-
nen zwischen den Konjunkten entfallenden
Anteil haben wir in (48) und (49) in wahr-
heitsfunktionaler Formulierung bzw. als de-
finierende Belegungsspielrume fr Wahr-
heitswertpaare dargestellt. Nun fehlt noch die
entsprechende Ausformulierung fr die Kon-
junktionen.
2.3Logisches Gerst fr die Interpretation
von KV
Zunchst knnen wir einen wichtigen Bedeu-
tungsaspekt der koordinierenden Konjunk-
tionen im gegebenen Zusammenhang be-
schreiben, indem wir sie auf das reduzieren,
was in den logischen Funktoren enthalten ist,
d. h. wir charakterisieren sie in (53) durch ihre
definierenden Belegungsspielrume wie die se-
mantischen Relationen in (48). Das ist natr-
lich nur eine Approximation, bei der und und
aber zusammenfallen, fr denn kein rechtes
Pendant zu finden ist und die fr entweder
oder und nicht sondern angegebene Cha-
rakteristik durch weitere Bedingungen zu er-
gnzen ist. Die prinzipiellen Unterschiede von
logischen Funktoren und sprachlichen Kon-
junktionen diskutiert Abschnitt 3.1. Aber im-
merhin gibt (53) eine Art Gerst fr die lin-
610 VII. Semantik der Funktionswrter
Lang 1984).
Aus der so entwickelten Charakterisierung
von koordinativen Verknpfungen insgesamt
werden im nchsten Abschnitt einige Konse-
quenzen fr die linguistische Analyse des auf
die koordinierenden Konjunktionen entfal-
lenden Bedeutungsbeitrags abgeleitet.
3. Semantik der koordinierenden
Konjunktionen
3.1Logische Funktoren vs. sprachliche
Konjunktionen
Die in (53) vorgenommene Reduktion einiger
koordinierender Konjunktionen auf die ent-
sprechenden standardlogischen Funktoren
hatte den heuristischen Zweck, die Kompo-
sitionsbedingungen, nach denen einem natr-
lich-sprachlichen Ausdruck mit KV eine se-
mantische Interpretation zugewiesen wird,
transparent zu machen und die resultierenden
Interpretationen nach kognitiven und kom-
munikativen Kriterien der Kenntnisverarbei-
tung zu bewerten.
Das Vorgehen beeinhaltet jedoch keine
pauschale Identifizierung, was auch unzuls-
sig wre, denn logische Funktoren und
sprachliche Konjunktionen gehren verschie-
denen semiotischen Systemen an. Erstere sind
eine Abstraktion ber letzteren. Wir zhlen
in IIII unten die grundstzlichen Unter-
schiede als Gegenberstellung von (a) logi-
schen Ausdrucksverknpfungen und (b) na-
trlich-sprachlichen koordinierten Strukturen
auf und fgen dann einige Erluterungen be-
zglich der linguistischen Analyse der Kon-
junktionen an.
a. Die Konjunkte standardlogischer Aus-
drucksverknpfungen sind Propositionen,
die ausschlielich als voneinander unab-
hngige Trger von Wahrheitswerten eine
Rolle spielen. Ein standardlogischer Funk-
tor operiert ber propositionalen Kon-
junkten ohne Rekurs auf deren interne
Struktur.
b. Die Konjunkte koordinierter Strukturen
sind weder auf den semantischen Typ PRO-
POSITION beschrnkt noch bloe Trger
von Wahrheitswerten. Vielmehr sind sie
primr Trger sprachlich kommunizier-
barer begrifflich reprsentierter Sachver-
halte, Individuen oder Prdikate und erst
vermittelt dadurch und bezogen auf ihre
(Un-)Vertrglichkeit gem (48) sind Kon-
junkte bzw. koordinierte Strukturen ins-
gesamt auch Trger von mglichen Wahr-
(55)
a. *Die Zahl z ist teilbar und eine Prim-
zahl.
vorgegebener Bel-Sp: 1,0; 0,1
geforderter Bel-Sp: 1,1
b. *Die Zahl z ist weder gerade noch
ungerade.
vorgegebener Bel-Sp: 1,0; 0,1
geforderter Bel-Sp: 0,0
III.
Partielle bereinstimmung
Wenn der geforderte und der vorgegebene
Belegungsspielraum in wenigstens einem
Wahrheitswertpaar bereinstimmen, ist die
resultierende KV kontingent, aber noch nicht
voll akzeptabel s. (56). Nur wenn auer-
dem unter Beachtung des Inklusionsverbots
fr Konjunkte der geforderte Belegungsspiel-
raum im vorgegebenen echt enthalten ist, sind
die resultierenden KV maximal informativ
und somit voll akzeptabel s. (57).
(56)
a. ?? Die Zahl z ist unteilbar oder eine
Primzahl.
vorgegebener Bel-Sp: 1,1; 0,0
geforderter Bel-Sp: 1,1; 1,0; 0,1
b. ? Die Zahl z ist eine Primzahl oder
ungerade.
vorgegebener Bel-Sp: 1,1; 0,1; 0,0
geforderter Bel-Sp: 1,1; 1,0; 0,1
(57)
a. Die Zahl z ist weder gerade noch eine
Primzahl.
vorgegebener Bel-Sp: 1,0; 0,1; 0,0
geforderter Bel-Sp: 0,0
b. Die Zahl z ist ungerade und eine Qua-
dratzahl.
vorgeg. Bel-Sp: 1,1; 1,0; 0,1; 0,0
geforderter Bel-Sp: 1,1
Wir erhalten auf diese Weise ein logisches
Gerst, das in einem wesentlichen Aspekt die
Bedeutung von koordinierenden Konjunktio-
nen und die Bedeutungsbeziehungen zwischen
Konjunkten in Konnex bringt und eine mo-
tivierte Akzeptabilittsbewertung der KV ge-
stattet. Die angefhrten Flle IIII dienen
zunchst der Rekonstruktion von kontradik-
torischen, tautologischen und kontingenten
KV, diese werden dann nach Kriterien der
Kenntnisverarbeitung und der erfolgreichen
Kommunikation interpretiert (i) als unver-
stehbar, wenn ihre Integration ins Kenntnis-
system blockiert ist; (ii) als redundant, wenn
sie keine Umstrukturierung des Kenntnissy-
stems bewirken; (iii) als informativ, wenn die
Konjunktion zwischen den Konjunkten eine
Beziehung etabliert, die nicht als solche im
Kenntnissystem schon fixiert ist (Details in
26. Koordinierende Konjunktionen 611
(58)
a. Wir suchen einen Anwalt und Bank-
fachmann.
b. Charles und Diana sind ein telegenes
Paar.
c. Prag liegt zwischen Wien und Berlin.
d. Nur Schler und/oder Studenten er-
halten Ermigung.
Einzelne Analysevorschlge fr solche (in der
Literatur als phrasal conjunction oder
non-boolean and diskutierte) Vorkommen
von und finden sich in Gazdar 1980a, Partee
& Rooth 1983. Eine Gesamtanalyse, die alle
Verwendungen von und motiviert zusammen-
bringt, steht noch aus.
Aus der Tatsache, da die Konjunktionen
sensitiv fr die interne syntaktische und se-
mantische Struktur ihrer Konjunkte sind, er-
klrt sich im Zusammenhang mit den in
IIII genannten Differenzen auch, warum
standardlogische Gesetze nur auswahlweise
natrlich-sprachliche Gegenstcke haben. So
hat in der Grammatik des Deutschen, Engli-
schen, Russischen etc. nur die 1. De Morgan-
sche Regel in (59), nicht aber die 2. in (60)
ein Pendant in dem Sinne, da sie eine ent-
sprechende Menge von quivalenten Kon-
struktionen definiert:
(59) p q (p q)
a. Die Zahl z ist nicht gerade und (die
Zahl z ist) nicht teilbar. =
b. Die Zahl z ist nicht gerade oder teil-
bar. =
c. Die Zahl z ist weder gerade noch teil-
bar.
(60) p q (p q)
a. Die Zahl z ist nicht gerade oder (die
Zahl z ist) nicht teilbar.
b. Die Zahl z ist nicht gerade und teilbar.
c. Die Zahl z ist nicht gerade oder teil-
bar.
d. Die Zahl z ist weder gerade noch teil-
bar.
e. Die Zahl z ist *noder gerade *noder
teilbar.
Whrend (59bc) quivalente sind zu (59a),
sind (60bd) weder mit (60a) noch unterein-
ander gleichbedeutend. Diese Asymmetrie
weist daraufhin (i) da und und oder eigen-
stndige lexikalische Bedeutungen haben, (ii)
da diese Bedeutungen mit dem Skopus der
Negation unterschiedlich interagieren, (iii)
da daraus auch die Existenz von weder
noch und die Nicht-Existenz einer analogen
Konjunktion *noder zu erklren sein sollten.
heitswerten. Eine sprachliche Konjunktion
operiert ber Konjunkten mit Rekurs auf
deren interne syntaktische und semanti-
sche Struktur (s. die in (13)(46) illustrier-
ten Bedingungen).
a. Auerhalb der Operationsdomne eines
logischen Funktors stehen zwei Proposi-
tionen p, q in keinerlei Beziehung hinsicht-
lich ihrer Belegung mit Wahrheitswerten.
b. Auerhalb einer koordinierten Struktur
stehen zwei natrlich-sprachliche (satztyp-
gleiche) Ausdrcke S
1
, S
2
in jedem Falle in
einer der in (48) aufgefhrten semanti-
schen Relationen.
III.Bedeutung der Verknpfer
a. Logische Funktoren haben keine eigen-
stndige Bedeutung, sondern sind definiert
als Funktion der Wahrheitswerte ihrer
Konjunkte.
b. Sprachliche Konjunktionen haben eine ei-
genstndige Bedeutung, die definiert ist
durch eine bestimmte Menge von Opera-
tionen ber den Konjunkten, die ihrerseits
eine eigenstndige Bedeutung haben (mehr
dazu in 3.2).
Aus IIII erhellt, da und in welcher Weise
die standardlogischen Funktoren bezglich
der natrlich-sprachlichen Konjunktionen
eine Abstraktion darstellen. Das in 2.2 und
2.3 herausgearbeitete logische Gerst ist
vor allem was geforderte bzw. vorgegebene
(Un-)Vertrglichkeit von Konjunkten betrifft
fr die semantische Analyse der Konjunk-
tionen ein notwendiger Bestandteil, aber
keine hinreichende Beschreibung. An Ib
IIIb wird deutlich, in welchen Hinsichten das
Instrumentarium fr die Semantik der Kon-
junktionen differenzierter sein mu.
So zeigen die Beispiele in (58), da es KV
gibt, die keinesfalls als Verknpfung von Pro-
positionen analysiert werden knnen, so da
die entsprechende Konjunktion auch nicht als
Aussagenverknpfer, sondern z. B. als Ope-
rator zur Bildung komplexer Prdikate (58a),
zur Bildung komplexer pluraler Individuen
per Mengenkonstitution durch Aufzhlung
(58bc) bzw. durch Vereinigung (58d) zu
analysieren ist. Kennzeichnend fr den letzten
Fall ist die Austauschbarkeit von und und
oder (s. Legrand 1975, Oetke 1981 und 3.3.3
unten) und fr alle in (58) angefhrten Bei-
spiele, da und hier nicht durch andere sog.
kopulative Konjunktionen wie sowohl als
auch, nicht nur sondern auch ersetzbar ist.
612 VII. Semantik der Funktionswrter
ordinierenden Konjunktionen eine eigenstn-
dige Bedeutung haben, sondern auch, da
diese nach verschiedenen Kontrasten dekom-
ponierbar, also zusammengesetzt ist. (Wir
kommen in 3.3 darauf zurck.)
Lexikalisierungsbeschrnkungen fr Kon-
junktionen werden anhand von (62b) und
(63b) sichtbar: die der Wahrheitswertumkehr
entsprechende Negation von (62a) mu mit
nicht ... oder nicht ... ausbuchstabiert werden,
weil es eine dem Sheffer-Strich (p q) ent-
sprechende Konjunktion *noder nicht gibt;
die von (63a) mit dem fachsprachlichen sub-
ordinierenden Ausdruck genau dann wenn
(gdw.; iff), weil es eine der quivalenz (p
q) entsprechende koordinierende Konjunk-
tion nicht gibt. Zu erklren ist nun: Warum?
Die Frage, welche logischen Funktoren ein
mehr oder minder direktes Pendant als
sprachliche Konjunktion besitzen, ist in der
Literatur verschiedentlich behandelt worden.
Dhmann (1966) bringt viele etymologische
Belege, aber keine Theorie. Gazdar & Pullum
(1976) versuchen aus den 16 standardlogi-
schen Funktoren nach drei pragmatischen
Prinzipien primre Lexikalisierungskandida-
ten auszusondern, aber ihre Resultate sind
empirisch ungedeckt (weil sie z. B. die Nicht-
Existenz von *noder, aber nicht die Existenz
von weder noch, neither nor, ni ... ni
ableiten knnen).
Auf dem Hintergrund des in 2.2 und 2.3
mithilfe von (48) und (53) entwickelten logi-
schen Gersts und seiner Auslegung nach
kognitiven und kommunikativen Prinzipien
der Kenntnisverarbeitung ergibt sich (Details
in Lang 1984) fr die Lexikalisierung von
logischen Funktoren als koordinierende Kon-
junktionen die folgende These:
(64) In natrlichen Sprachen sind die primr
lexikalisierten koordinierenden Kon-
junktionen diejenigen, deren Selektions-
rahmen nach (53) nicht mit einem durch
semantische Relationen zwischen Kon-
junkten nach (48) vorgegebenen Bele-
gungsspielraum koinzidiert. Einfacher
gesagt:
Koordinierende Konjunktionen induzie-
ren Relationen, die nicht bereits in der
Struktur des Kenntnissystems und somit
als Beziehung zwischen Konjunkten vor-
gegeben sind.
Dies entspricht genau der in 2.2 formulierten
Bedingung, da koordinative Verknpfungen
kontingent und informativ sein mssen, und
ist im Einklang mit dem auch in 2.2 konsta-
tierten Befund, da jede koordinierende Kon-
In dieselbe Richtung weist eine weitere
signifikante Differenz. Die Negation einer
standardlogischen Aussagenverknpfung ist
einfach die Umkehrung ihrer definierenden
Wahrheitswerte, die wiederum einen Funktor
definiert (61ab). Die Negation einer koor-
dinativen Verknpfung in der natrlichen
Sprache lt Entsprechendes nur als markier-
ten Fall (62b, 63b) neben differenzierteren
Ausfhrungsvarianten zu (62cf, 63cd).
Vor allem aber unterliegt die Lexikalisierung
von negierten Verknpfern klaren Einschrn-
kungen.
(61) a. p q: 1,1;
(p q): 1,0; 0,1; 0,0,
quivalent zu p q
b. p >< q: 1,0; 0,1;
(p >< q): 1,1; 0,0,
quivalent zu p q
(62)
a. (Die Zahl z ist gerade und eine Qua-
dratzahl.)
1,1
b. Nein, die Zahl z ist nicht gerade oder
nicht eine Quadratzahl oder beides
nicht.
1,0; 0,1; 0,0
c. Nein, die Zahl z ist weder gerade noch
eine Quadratzahl.
0,0
d. Nein, die Zahl z ist entweder gerade
oder eine Quadratzahl.
1,0; 0,1
e. Nein, die Zahl z ist gerade, aber keine
Quadratzahl.
1,0
f. Nein, die Zahl z ist nicht gerade, aber
eine Quadratzahl.
0,1
(63)
a. (Die Zahl z ist entweder gerade oder
eine Quadratzahl.)
1,0; 0,1
b. Nein, die Zahl z ist gerade gdw. sie
eine Quadratzahl ist.
1,1; 0,0
c. Nein, die Zahl z ist gerade und eine
Quadratzahl.
1,1
d. Nein, die Zahl z ist weder gerade noch
eine Quadratzahl.
0,0
Der Spielraum der Mglichkeiten, einen Aus-
druck zu negieren, macht dessen interne
semantische Struktur sichtbar. So zeigen
(62cf) und (63cd) nicht nur, da die ko-
26. Koordinierende Konjunktionen 613
xikalisch verankerten Eigenschaften der Kon-
junktionen, von denen die logischen Funk-
toren abstrahieren. Wir betrachten nun, was
die eigenstndigen Bedeutungen der koordi-
nierenden Konjunktionen ausmacht und wie
sie zu systematisieren sind.
3.2Operative Bedeutung der
Konjunktionen
Die lexikalische Bedeutung eines Wortes ist
eine sprachlich kodierte, als semantische Re-
prsentation zu beschreibende Vorschrift zur
Identifizierung eines Konzepts und vermittelt
darber eventuell zur Bezeichnung (Denotie-
rung) von Individuen und Sachverhalten der
sog. auersprachlichen Wirklichkeit. Im Rah-
men der hier vertretenen Auffassung wird
dem synsemantischen Charakter der Kon-
junktionen als Funktionswrter so Rechnung
getragen, da den koordinierenden Konjunk-
tionen eine vollwertige lexikalische Bedeutung
zugesprochen wird (mit allen Konsequenzen
fr den sprachinternen Systembezug wie
Feldbildung, Dekomponierbarkeit etc.). Al-
lerdings ist diese Bedeutung, anders als bei
den sog. Autosemantica, nicht denotativ, d. h.
nicht begriffsidentifizierend (Konjunktionen
identifizieren nicht Konzepte mit mglichen
Denotaten in der Welt), vielmehr ist sie
operativ, d. h. begriffsverarbeitend, in folgen-
dem Sinn:
(66) Konjunktionen beziehen sich auf Ope-
rationen der Kenntnisverarbeitung. Die
lexikalische Bedeutung einer Konjunk-
tion ist keine Vorschrift zur Identifizie-
rung eines (gedchtnisfixierten oder ak-
tual generierten) Konzepts, sondern eine
Instruktion zur mentalen Verarbeitung
solcher Konzepte.
Die genannte Unterscheidung von operativer
vs. denotativer Bedeutung wird durch ent-
sprechende Evidenzen auerhalb der Seman-
tik besttigt.
(a) Strukturell. Die typischen Eigenschaften
der Konjunktionen als lexikalische Kategorie
wie geringes Inventar, kaum produktiv, mor-
phologisch unvernderlich, syntaktisch varia-
bel kombinierbar, skopusbildend, fokusdeter-
minierend etc. entsprechen genau ihrem Sta-
tus als Trger operativer Bedeutung. (Das gilt
natrlich auch fr die ebenfalls operativ zu
beschreibenden Negationslexeme s. Artikel
25.)
(b) Genetisch. Whrend begriffsidentifizie-
rende Bedeutung in hohem Mae perzeptiv
verankert ist und ber verhaltensrelevante
junktion sensitiv ist bezglich der (Un-)Ver-
trglichkeit ihrer Konjunkte. Damit sind die
zwei entscheidenden Faktoren fr mgliche
koordinierende Konjunktionen im Verhltnis
zu logischen Funktoren genannt:
(65)
(i) der als Selektionsrahmen dienende
Bezug auf die Vertrglichkeit bzw. die
Unvertrglichkeit der Konjunkte,
(ii) innerhalb dessen die Etablierung
einer Beziehung zwischen den Kon-
junkten, die nicht im Sinne von (48)
bereits vorgegeben ist.
Aus (65i) folgt, da ein Funktor, dessen de-
finierende Wahrheitswertmenge wertgleiche
Paare (1,1 oder 0,0) und wertverschie-
dene Paare (1,0 oder 0,1) zugleich auf-
weist, kein guter Kandidat fr direkte Lexi-
kalisierung ist, wegen Indifferenz bezglich
der (Un-)Vertrglichkeit der Konjunkte; aus
(65ii) folgt, da die in (48) als semantische
Relationen gedeuteten Funktoren ebenfalls
keine guten Kandidaten fr direkte Lexikali-
sierung sind. Unter diesen Prmissen wird die
Menge der primren Lexikalisierungskandi-
daten aus den 16 logischen Funktoren wie
folgt eingeschrnkt:
Wegen (65i) scheiden die vier Minimal-
funktoren (1,1; 1,0, 1,1; 0,1, 0,1; 0,0,
1,0; 0,0) aus, bei denen es nur auf jeweils
einen Wahrheitswert ankommt, nicht auf ein
Paar, so da sie nicht sensitiv sind fr die
(Un-)Vertrglichkeit der Konjunkte. Sie kn-
nen nur mit auf jeden Fall K
1
, unbeschadet ob
oder nicht K
2
etc. umschrieben werden.
Wegen (65i-ii) sind sodann die in (48) an-
gegebenen Funktoren keine Kandidaten fr
direkte Lexikalisierung, darunter eben qui-
valenz (gdw.) und Exklusion (*noder), aber
auch Kontravalenz und Disjunktion, weil sie
zwar den Selektionsrahmen fr (entweder-)
oder, aber nicht dessen Bedeutung ergeben.
(Wir kommen in 3.3 3 unten darauf zurck.)
brigbleiben die vier durch 1,1, 0,0,
0,1 und 1,0 definierten Funktoren, die
(65i und ii) erfllen und somit aussichtsreiche
Kandidaten fr primre Lexikalisierung sind,
wie (53) zeigt.
Dies sind die durch (64) und (65) vorge-
zeichneten Prferenzen fr potentielle koor-
dinierende Konjunktionen. Tatschlich defi-
nieren die letztgenannten Funktoren das
Grundinventar, das der Konjunktionsvorrat
einer natrlichen Sprache in verschiedenen
Dimensionen lexikalisch ausspezifiziert. Da-
mit sind wir bei der Bedeutung der Konjunk-
tionen im eigentlichen Sinn, d. h. bei den le-
614 VII. Semantik der Funktionswrter
Formalsemantisch orientierte Arbeiten wie
Gazdar (1980a), Partee & Rooth (1983) haben
sich mit der wortintern verankerten Feld-
struktur der Konjunktionen nicht befat, auf
Systematik der Konjunktionen abzielende
Untersuchungen wie Martin (1983) benutzen
klassifikatorische Merkmale. Im Rahmen des
in Bierwisch & Lang (1989) vorgestellten
Zwei-Stufen-Modells sind die genannten
Komponenten reprsentierbar als kategori-
sierte Funktorkonstanten der Semantischen
Form der koordinierenden Konjunktionen,
gekoppelt mit entsprechenden Regeln fr ihre
kontextuell spezifizierte Interpretation auf der
Ebene der Konzeptuellen Struktur. Wir be-
gngen uns hier mit einer notwendig skizzen-
haften Ausformulierung der Reprsentation
und legen der Schwerpunkt auf die zu expli-
zierenden Feld- oder Gruppeneigenschaften
der Konjunktionen.
3.3Systematik der koordinierenden
Konnektive
Die einzelnen koordinierende Konjunktionen
(und auch die einschlgigen anderen Konnek-
tive) unterscheiden sich semantisch danach,
welche spezifische Beziehung oder Verknp-
fung sie zwischen den nach (Un-)Vertrglich-
keit selektierten Konjunkten etablieren. Sie
haben, wie aus (5963) hervorgeht, struk-
turierte lexikalische Bedeutungen und lassen
sich entsprechend gruppieren hier ist u. a.
zu rekonstruieren, was traditionell mit ko-
pulativ, adversativ, alternativ etc. (s.
Buscha 1989) bezeichnet wird.
Grundlegend fr die Art der zu explizie-
renden koordinativen Verknpfung ist die
Einteilung in Konjunktionen, die vertrgliche,
und solche, die unvertrgliche Konjunkte se-
lektieren. Im Konnex damit legt (65) die An-
nahme nahe, da die Bedeutung einer koor-
dinierenden Konjunktion umso komplexer
ist, je spezieller die Etablierungsbedingungen
der betreffenden Verknpfung sind. Wir be-
trachten im folgenden einige Konjunktionen
mit dem Ziel, ihren Platz in der Systematik
und damit diese selbst nher zu bestimmen.
3.3.1und
Jede Konjunktionsanalyse mu der folgenden
Tatsache Rechnung tragen:
(68) Und ist die koordinierende Konjunktion
par excellence. Es hat von allen ko-
ordinierenden Konjunktionen die wenig-
sten syntaktischen und semantischen Be-
schrnkungen, den weitesten Verwen-
konzeptuelle Kategorisierungsschritte empi-
risch erworben wird, ist begriffsverarbeitende
Bedeutung durch die Struktur des kognitiven
Systems determiniert und wird durch konzep-
tuelle Differenzierung stufenweise getrig-
gert.
(c) Typologisch. Es entspricht der operativen
Bedeutung der koordinierenden Konjunktio-
nen, da sie in den Einzelsprachen ein weithin
universales Funktionsspektrum aufweisen,
da sie wenig vernderlich sind in diachro-
nischer Hinsicht, ziemlich konstant bezglich
synchronischer Variation etc.
Angesichts der hochgradigen Kontextde-
terminiertheit der Interpretation koordinati-
ver Verknpfungen ist davon auszugehen, da
die operative Bedeutung der koordinierenden
Konjunktionen sehr allgemein ist, d. h. sich
aus elementaren kognitiven Operationen zu-
sammensetzt. So sind die Bedeutungen der
koordinierenden Konjunktionen als lexika-
lisch kodierte Programme zu deuten, deren
einzelne Bestandteile auch sprachunabhngig
in der Kenntnisverarbeitung vorhanden und
aktiv sind. Zu diesen intermodal wirksamen
Operationen gehren offenbar:
(67)
a. Vergleichsoperationen (scanning,
balancing etc.)
b. Reihung und Bndelung (Gruppieren,
Zhlen)
c. Auswhlen unter bzw. Entscheiden
ber Alternativen
Um von solchen zwar plausiblen, aber noch
sehr intuitiven berlegungen zu semantischen
Reprsentationen fr und, oder, aber etc. zu
kommen, bedarf es der Systematisierung
und der Rechtfertigung von entsprechenden
Bedeutungskomponenten. Ebenenspezifische
Vergleichsoperationen sind (wie in den Ab-
schnitten 1.22.1 gezeigt) konstitutiv fr die
der Koordination zugrunde liegende Gram-
matik zweiter Stufe insgesamt, sie sind daher
nicht als spezieller Bestandteil der lexikali-
schen Bedeutung der koordinierenden Kon-
junktionen vorzusehen.
Damit beschrnkt sich das Inventar se-
mantischer Bestandteile fr die koordinieren-
den Konjunktionen (und andere Konnektive
s. Abb. 26.3) auf konzeptuell fundierte und
lexikalisch motivierte Komponenten fr die
in (67bc) genannten Operationen und deren
kombinatorisch und/oder kontextuell kondi-
tionierte Ausfhrung.
Der reprsentationelle Status solcher Kom-
ponenten ist natrlich nur modellabhngig
festzulegen und bislang wenig ausgearbeitet.
26. Koordinierende Konjunktionen 615
tieren, enthalten ist. Somit bildet die Bedeu-
tung von und die Basis fr die Bedeutung der
komplexeren Konjunktionen, die spezifiziert
sind nach Dimensionen wie Negationsinkor-
poration (weder noch, neither nor, nor),
Kontrastinvolvierung (aber, allein, nur; hin-
gegen, indes etc.). Dem entspricht der einzel-
sprachlich verschieden starke, aber insgesamt
gltige Befund, da die genannten komple-
xeren Konjunktionen (bzw. Konjunktionalad-
verbien) mehr syntaktischen und semanti-
schen Beschrnkungen unterliegen als und
(bzw. dessen jeweiliges Pendant). Zugleich
aber ist damit festgehalten, da alle auf der
Basis vertrglicher Konjunkte operierenden
Konjunktionen gemeinsam haben, da sie
Konjunkte verknpfen, indem sie die durch
sie reprsentierten Entitten im angegebenen
Sinne zusammenfassen.
3.3.2aber
Unter den adversativen Konnektiven ist aber
zweifellos die am wenigsten spezifische, in der
Verwendung allgemeinste und in der Literatur
seit Lakoff (1971) und Anscombre & Ducrot
(1977) umstrittenste lexikalische Einheit. Im
Unterschied zu den zahlreichen Arbeiten, die
gesttzt auf zunehmend differenzierte Fallun-
terscheidungen die vielfache Polysemie von
aber ins Zentrum stellen, ergibt sich im Rah-
men der hier vertretenen Vorstellungen die
folgende Annahme (69), die anschlieend er-
lutert und ausschnittweise belegt wird.
(69)
a. aber hat nur eine lexikalische Bedeu-
tung, deren Interpretation im Rahmen
einer KV durch den strukturellen
Kontext der Konjunkte und/oder den
situativen Kontext ihrer uerung de-
terminiert und auf der konzeptuellen
Ebene spezifiziert wird.
b. Die Bedeutung von aber umfat die
Instruktion, da die Konjunkte unter
Einbeziehung eines Kontrasts zusam-
mengefat werden. Die Abkrzung
dafr sei:
[SIMUL X, Y: [CONTRAST X, Y]],
wobei : (zu lesen so da) die Ver-
bindung der Komponenten ausweist.
Der unstrittige Aspekt bei aber-Konstruktio-
nen ist, da ihre Konjunkte (wie bei und)
nicht unvertrglich sein drfen etc. (70a), hin-
zukommt jedoch, da eine aber-Konstruk-
tion, um kontingent und informativ zu sein,
nicht nur eine semantische Minimaldifferenz
aufweisen darf (70c).
dungsspielraum, die am wenigsten spe-
zifische Bedeutung und die hchste Kon-
textabhngigkeit bezglich seiner Inter-
pretation.
Zur Illustration sei daran erinnert, da und
beliebig viele, im Format beliebig komplexe
und syntaktisch verschiebbare Konjunkte hat;
da und die grte Auswahl an semantischen
Typen als Konjunkte hat (inklusive solcher,
die Uminterpretationen auslsen); da und
fr die meisten anderen koordinierenden
Konjunktionen, die vertrgliche Konjunkte
selektieren (weder noch, aber, sowohl als
auch etc.) austauschbar ist, aber nicht umge-
kehrt; da und am ehesten weglabar und
somit am leichtesten kontextuell rekonstruier-
bar ist. (Dennoch bleibt zwischen und-Ver-
knpfung und asyndetischer Reihung ein
prinzipieller Unterschied, der sich z. B. in
Skopusverhltnissen zeigt: Die Sonne scheint.
Die Vgel singen nicht.vs. Die Sonne scheint
und die Vgel singen nicht.)
Die lexikalische Bedeutung von und mu
also sehr elementar sein. Aber wegen der ge-
rade angefhrten Aspekte ist sie anderes und
mehr als die durch 1,1 definierte Wahr-
heitswertfunktion. Die operative Bedeutung
von und besteht nicht darin, da sie Wahr-
heitswerte auf die Konjunkte verteilt oder von
den Konjunkten aufsammelt, sondern da sie
die durch die Konjunkte denotierten Sach-
verhalte, Individuen oder Prdikate als kom-
patible Instanzen eines CI zusammenfat
oder bndelt. (Angesichts der Abstraktheit
der in (67b) genannten Operation ist es kein
Zufall, da kein passendes hinreichend ge-
nerelles Verb oder Adjektiv zur Verfgung
steht. Zur Erluterung sei aber darauf ver-
wiesen, da Bndelung z. B. auch das um-
fat, was der additiven Zahlwortbildung zu-
grunde liegt, die sich ja in vielen Sprachen als
phraseologisierte KV mit und manifestiert:
dreiundzwanzig; zweitausendundeins; vingt-et-
un).
Wir nehmen nun zu Illustrationszwecken
an, da es fr die Ausfhrung dieser elemen-
taren kognitiven Operation in der lexikali-
schen Bedeutung von und ein Minimalpro-
gramm mit dem Namen SIMUL gibt. (Natr-
lich mit dem Vorbehalt, da formaler Status
und substantielle Interpretation im jeweiligen
theoretischen Gesamtrahmen auszubuchsta-
bieren sind).
Fr die Systematik heit das, da die fr
und zustndige Bedeutungskomponente SI-
MUL in der Bedeutung aller anderen Kon-
junktionen, die vertrgliche Konjunkte selek-
616 VII. Semantik der Funktionswrter
gilt :
(71) Die Interpretation einer aber-Konstruk-
tion bemit sich an Art und Ausma der
Parallelitt der Konjunkte S
1
, S
2
und
somit deren Zerlegbarkeit nach dem
Schema AB, AC.
Die Belegung dieser Variablen erfolgt strikt
nach dem in Abb. 26.2 gezeigten Schema der
Ableitung eines CI. Dabei sind A, A die
gemeinsame Fundierung des CI exemplifiziert
nach S
1
bzw. S
2
; B und C hingegen umfassen
die darberhinaus bestehenden Differenzen.
Natrlich sind A und B aus K
1
, A und C aus
K
2
ableitbar, aber je nach Parallelitt der
Konjunkte verluft die Ableitung auf seman-
tisch vorgegebenen oder kontextuell induzier-
ten Prmissen (vgl. die Typen IIII unten).
Wir nehmen also an, da CONTRAST X, Y
eine Instruktion ist, die Konjunkte der gege-
benen aber-Konstruktion syntaktisch und se-
mantisch nach dem Schema AB, AC zu
parsen, um in der konzeptuellen Interpreta-
tion des Gesamtausdruck einen Kontrast zu
etablieren, fr den gilt:
(72)
Int(S
+
) = [Int(S
1
,A) & Int(S
2
,A) :
[B q, C q]]
Dabei ist Int die Funktion, die semantische
auf konzeptuelle Reprsentationen abbildet
(s. Bierwisch & Lang 1989), ... & ... ist
Vertreter fr die Interpretamente der SIMUL-
Komponente (des und-Anteils von aber), die
hier die Ausgliederung von A, A aus den
Konjunkten S
1
, S
2
in der Weise umfassen, da
B und C aus S
1
, S
2
als Trger eines durch q,
q reprsentierten Kontrasts spezifiziert wer-
den. Dabei stehen q und q fr kontrre Pro-
positionen, die aus B und C ableitbar sind.
Da die Ableitung auch Informationen invol-
viert, die nicht aus den Konjunktbedeutungen
allein, sondern nur durch Einschaltung von
Situations- oder Allgemeinwissen zu gewin-
nen sind, figurieren q und q auf der Ebene
der intermodal zugnglichen konzeptuellen
Struktur.
Wichtig ist, da q determiniert ist durch
B q aus S
1
und da somit die Struktur von
S
1
die Interpretationsvorgabe fr S
2
darstellt.
Dies ist die fr aber (und alle brigen Adver-
sativkonnektive) gruppentypische Asymme-
trie in der Ausfhrung der in (6) notierten
Bedingung, da die Konjunkte einer KV eine
spezielle Art von Kontext freinander bilden.
Hieraus erklrt sich auch die weitere grup-
pentypische Eigenschaft, da aber nicht ite-
rierbar ist.
(70)
a. *Hans ist gro und/aber (Hans ist)
klein.
b. Hans ist gro und/aber Fritz ist klein.
c. Hans ist gro und/* aber Fritz ist
gro.
d. Hans ist gro und/aber Fritz ist auch
gro.
Die morphosyntaktische Entsprechung zu
den in (69b) angegebenen Bedeutungskom-
ponenten ist die Bedingung, da bei aber-
Konstruktionen die Konjunkte K
1
, K
2
so in
Bestandteile AB, A C zu parsen sind, da
auf der Basis von A, A (das ist der und-
Anteil) die Differenz von B zu C als Kontrast
zwischen K
1
und K
2
realisiert werden kann.
Der Grund, weshalb (70c) mit aber schlicht
ungrammatisch ist, liegt darin, da hier K
2
=
AB, also ein struktureller Trger fr C
fehlt. Die Differenz von C und D mu nicht
in der semantischen Struktur der Konjunkte
selbst verankert sein, sie kann auch kontex-
tuell induziert sein, aber sie mu einen struk-
turell identifizierbaren (d. h. fokusfhigen)
Trger haben wie die Partikel in (70d).
Der heikle Punkt an der Semantik von aber
ist die Natur und die Auswertung dessen, was
wir vorlufig mit Kontrast umschrieben
haben. Der in aber-Konstruktionen invol-
vierte Kontrast ist stets Ausdruck von Be-
wertungen, denen die in den Konjunkten de-
notierten Sachverhalte unterzogen werden.
Da die in aber-Konstruktionen involvierten
Kontraste ontologisch in die Domne der
Einstellungen einzuordnen sind, wird in den
meisten Analysen der mit CONTRAST X, Y um-
schriebene Bedeutungsanteil nicht der Seman-
tik, sondern dem Zustndigkeitsbereich der
Pragmatik zugerechnet. (Im linguistischen
Volksmund : aber = und + Weltanschau-
ung.) Jenseits dieser (hier nicht auszudisku-
tierenden) Frage bleibt als Aufgabe, den zwei-
felsfrei vorhandenen Beitrag dieser in aber
lexikalisch kodierten Komponente fr die In-
terpretation einer KV gem (69) auszubuch-
stabieren.
Klar ist, da der in aber-Konstruktionen
involvierte Kontrast letztlich in der konzep-
tuellen Interpretation des Gesamtausdrucks
Int(S
+
) realisiert wird, d. h. auf der Ebene,
wo strukturelle und kontextuelle Information
verrechnet wird, da aber die Realisierungs-
bedingungen wesentlich von der grammati-
schen Struktur der Konjunkte determiniert
sind. Wir behandeln der Einfachheit halber
die Konjunkte K
1
, K
2
als Stze. Als Leitlinie
617
(iii) Fritz ist krank, trotzdem (*aber) er geht
arbeiten.)
Der bersicht halber geben wir jedem
Konstruktionstyp einen Namen, bieten ein
Sample und notieren seine Kennzeichen nach
einem festen Muster.
Typ I: Kontrast durch semantisch kontra-
stible Abschnitte in den Konjunkten
(73)
a. Hans ist gro, aber Fritz ist klein.
b. Hans ist gro, aber Fritz ist nicht
gro.
c. ?? Hans ist gro, aber Fritz ist blond/
verheiratet.
d. Hans ist gro, aber Fritz ist stark/
zh/schlau.
In (73ab) ist die Konjunktstruktur exakt
parallel, die Zerlegung nach AB, AC ist
vorgezeichnet und die Ableitung von q, q
lexikalisch vorgegeben.
A, A:h hat fr Gre einen Wert w,
f hat fr Gre einen Wert w;
B, C: w([h,G]) ber Norm,
w([f,G]) unter/nicht ber Norm;
q, q: w([h,G], Norm) w([f,G], Norm).
Es ist dann eine Sache des situativen Kon-
texts, ob und wie die so ermittelte Verteilung
der Differenzen weiter aus- oder umgewertet
wird (etwa im Sinne von Vorteil Nach-
teil). Anders bei den restlichen Beispielen.
Als Extrakt einer lngeren Studie (Lang
1988) werden nun die wichtigsten Typen von
aber-Konstruktionen kurz vorgestellt, um zu
zeigen:
(a) wie bei der Interpretation einer Adversa-
tivkonstruktion q und q als Trger des durch
aber induzierten Kontrasts identifiziert wer-
den, und zwar abhngig von der in (71) ge-
nannten Parallelstrukturiertheit der Kon-
junkte;
(b) da die jeweiligen aber-Konstruktionen
als Typen der Korrelation von Konjunkt-
struktur und q, q-Identifizierung zu betrach-
ten sind belegt durch die selektive Aus-
tauschbarkeit von aber gegen andere Adver-
sativkonnektive. Abb. 26.3 bietet eine syntak-
tisch basierte bersicht, zu der wir nur an-
merken, da Konjunktionaladverbien, die in
S
+
an Stelle von oder zusammen mit koor-
dinierenden Konjunktionen vorkommen kn-
nen, in S
2
entweder Spitzenstellung mit In-
version haben oder floaten das ist das
Adverbiale an ihnen. (Als Idiosynkrasie ist in
diesem Zusammenhang anzumerken, da
aber auch entsprechend viele Positionsmg-
lichkeiten in S
2
hat:
(i) Fritz ist krank, aber er geht arbeiten/
er geht aber arbeiten/arbeiten geht er
aber;
(ii) Fritz ist krank, (aber) trotzdem geht er
(aber) arbeiten;
Abb. 26.3: Taxonomie der Adversativkonnektive
618 VII. Semantik der Funktionswrter
Wie gleich deutlich wird, ist das Konjunktio-
naladverb hingegen genau auf Konjunktstruk-
turen zugeschneidert, die den Typ I, jedoch
auf solche, die Typ II, dennoch auf solche, die
Typ III ausmachen.
Typ II: Kontrast durch implizierten Gegen-
satz zwischen Koprdikaten
(75)
a. Anna ist klug, aber hlich.
b. Anna ist hlich, aber klug.
c. Anna ist nicht dumm, aber auch nicht
hbsch.
d. Hans ist nicht dumm, aber faul.
Da die Konjunkte fr die Zerlegung nach
AB, AC zuwenig Unterschiede aufwei-
sen, mu eine Differenzierungsbasis kontex-
tuell induziert werden. Das Verfahren ist wie
bei (73c d), nur entsprechend eingeschrnk-
ter: D ist eine Vergleichsdimension, die nur
positive und negative Werte {} = { +, }
umfat (keine Gradskala), und q, q rangieren
ber der Polaritt der Werte. Wir erhalten:
A, A:a hat eine Eigenschaft p mit einem
Wert w bezglich D,
a hat eine Eigenschaft p mit einem
Wert w bezglich D;
B, C: p([a,D]) = B, p([a,D]) = C;
q, q: w(B) = gdw. w(C) = .
Die Verteilung von + und auf q, q richtet
sich nach zwei Bedingungen: die lexikalisch
verankerte Polaritt legt fr (75a) als Default-
Belegung [+, -], fr (75b) [-, +] fest. Die aber
kann situativ umgepolt werden, etwa wenn
die Besetzung einer unattraktiven und dmm-
lichen Frauenrolle gesucht wird. Danach rich-
tet sich dann auch die Abfolge der Konjunkte.
Das obligate auch in (75c) zeigt, da innerhalb
von B und C nicht einfach Antonyme substi-
tuiert werden knnen wie bei Typ I-Konstruk-
tionen.
Die Austauschbarkeit mit anderen Kon-
nektiven ergibt:
(76)
a. *Anna ist klug, hingegen (ist sie) h-
lich.
b. *Anna ist klug, hingegen ist Anna
hlich.
c. Anna ist klug, jedoch (ist sie) hlich.
d. ??Anna ist klug, dennoch/trotzdem (ist
sie) hlich.
Die Ungrammatikalitt von (76ab) zeigt,
da auch hier die Typisierung der aber Kon-
struktion und das dafr zustndige Interpre-
In (73cd) ist die Konjunktstruktur se-
mantisch nicht ganz parallel, so da die Zer-
legung nach AB, AC auf kontextuelle
Ausgleichsfaktoren zurckgreifen mu. Das
prferente Verfahren dafr ist, da der se-
mantische Gehalt von B und C relativ zu einer
kontextuell determinierten Dimension D be-
wertet wird (etwa nach dem Schema Vorteil
Nachteil). Das findet hier statt, aber
immer noch lexikalisch gesteuert. Da Kr-
pergre sich mit Haarfarbe oder Personen-
stand nur schwer unter einen passenden CI
bringen lt, ist (73c) eben markiert d. h.
die Kontextanforderungen sind sehr spezi-
fisch. Bei (73d) indes legt die inhrent positive
Wertung der genannten Eigenschaften eine
entsprechende Zerlegung nahe. Wir erhalten
folgendes Interpretationsmuster fr Flle wie
(73c-d):
A, A:h hat eine Eigenschaft p mit einem
Wert w bezglich D,
f hat eine Eigenschaft p mit einem
Wert w bezglich D;
B, C: p([h,D]) = B, p([f,D]) = C;
q, q: w(B) w(C).
Die Differenz zwischen (73c) und (73d) drfte
darin liegen, da bei (73d) die inhrente po-
sitive Wertung zu D gehrt, so da sich q, q
als graduierte Wertedifferenz ergibt, bei (73c)
indes ist D ausschlielich kontextuell be-
stimmt und q, q rangieren ber dadurch de-
finierte -Werte.
Das gezeigte Interpretationsverfahren de-
finiert den Defaultfall: wenn in einer Kon-
struktion der durch aber induzierte Kontrast
nicht auf der Ebene der Konjunktbedeutun-
gen etabliert werden kann, dann ist die dafr
nchstliegende Ebene die der kontextuellen
Bewertung der Konjunktbedeutungen.
Typ I ist der Typ von aber-Konstruktion,
der das determiniert, was seit Lakoff 1971 als
semantic-opposition-but diskutiert, aber
einer separaten Lesart der Konjunktion zu-
geschrieben wird. Wir hingegen haben gem
(69) und (71) fr die Konjunktion Bedeu-
tungskonstanz postuliert und ihre Lesarten
am strukturellen Kontext ihrer Konjunkte
festgemacht. Die damit gewonnene Systema-
tik wird besttigt durch die selektive Aus-
tauschbarkeit von aber in Typ I gegen be-
schrnktere Konnektive aus Abb. 26.3:
(74)
a. Hans ist gro, Fritz hingegen ist klein.
b. Hans ist gro, hingegen ist Fritz klein.
c. *Hans ist gro, jedoch/ indessen ist
Fritz klein.
d. *Hans ist gro, dennoch/ trotzdem ist
Fritz klein.
26. Koordinierende Konjunktionen 619
oder aber eine Interpretation nach Typ III,
die eine (auf Pflegeanspruch bei Krankheit
fuende) Conclusio blockiert.
Typ III hat die Sorte von Konjunktstruk-
tur, die nicht nur eine Ersetzung von aber
durch dennoch, trotzdem gestattet, sondern
die auch den von Knig in Artikel 28 disku-
tierten Kausal- und Konzessivkonstruktionen
zugrunde liegt. Das gemeinsame Kennzeichen
ist die Einordnung der Konjunkte als Pr-
missen in wissensbasierte Schluschemata
(weitere Typen und Details in Lang 1988).
3.3.3nicht sondern und oder
Wir betrachten noch kurz, was die Selektion
unvertrglicher Konjunkte fr die Systematik
der Konjunktionen einbringt. Grundstzlich
gilt:
(78) Die auf unvertrglichen Konjunkten ope-
rierenden Konjunktionen haben gemein-
sam, da sie alle ein Auswhlen unter
den Konjunkten involvieren, dessen Aus-
fhrung unterschiedlich spezifiziert ist.
So ist die Bedeutung von nicht sondern und
und nicht als eine Korrekturoperation ber
unvertrglichen Konjunkten zu analysieren,
durch die das eine Konjunkt durch replazive
Negation im Sinne von Jacobs (siehe Artikel
25) als Corrigendum spezifiziert wird, das an-
dere als Corrigens. Wir setzen dafr die Kom-
ponenten WRONG bzw. CORRECT an, wobei
dies nur provisorische Etiketten sind fr kom-
plexere Operationen (s. Lang 1984), die durch
die Interaktion lexikalischer, syntaktischer
und prosodischer Bedingungen determiniert
sind.
Nur ein typologischer Aspekt sei ange-
merkt. Die hier diskutierte Unterscheidung
von Kontrast und Korrektur ist nicht in allen
Sprachen auch distinkt lexikalisiert wie dt.
aber vs. sondern, schwed. men vs. utan, span.
pero vs. sino etc., sondern in vielen ist fr
beides nur eine Konjunktion vorhanden. Aber
auch dies ist noch kein Grund fr Polysemie-
annahmen, weil der betreffende Unterschied
in (79a-b) dann in der syntaktischen Struktur
der Konjunkte in (79c-f) erkennbar sein mu:
(79)
a. Hans ist nicht dumm, aber faul.
[Kontrast]
b. Hans ist nicht dumm, sondern faul.
[Korrektur]
c. Hans isnt stupid, but he is lazy /
*but lazy.
[Kontrast]
tationsverfahren strukturell im Sinne von (69)
definiert sind. Der Kalauer in (76d) zeigt, da
es einen weiteren Typ von Adversativkon-
struktionen geben mu, bei dem die Etablie-
rung von Kontrasten auf Kenntniszusammen-
hngen beruht. Hier ist er:
Typ III: Kontrast durch Annullierung von
Schlssen aus dem Alltagswissen
(77)
a. Hans ist krank, aber er geht arbeiten.
b. Hans geht arbeiten, aber er ist krank.
c. Hans ist krank, aber seine Frau geht
arbeiten.
Der springende Punkt hier ist, da bei (77a
b), indiziert durch wenig parallele Konjunkt-
struktur und schwer herzuleitenden CI, eben-
falls eine Differenzierungsbasis kontextuell
induziert werden mu, hier also die durch
krank und arbeiten angesprochenen Verhal-
tensbereiche und ihr in unserem Alltagswissen
als normal unterstellter Zusammenhang. Die
Dimension D ist hier zu belegen durch die
gegebene Situation s, diese wird bewertet auf
dem Hintergrund von Normalittsbedingun-
gen fr derartige Situationen. Wir erhalten
unter Einbeziehung einer Schlufigur fol-
gende Ableitungsschritte:
A, A: h hat eine Eigenschaft p in s,
h zeigt ein Verhalten v in s;
B, C: h ist krank in s,
h geht arbeiten in s
Fr Situationen wie s gilt:
Norm: WER KRANK IST, GEHT NICHT
ARBEITEN [1. Prmisse]
B: h ist krank [2. Prmisse]
B q:
Norm: .. h GEHT NICHT ARBEITEN
[Conclusio = q]
C: h geht arbeiten
[blockierte Conclusio = q]
Der Kontrast wird etabliert, indem das erste
und das zweite Konjunkt in der angegebenen
Weise auf ein Schluschema bezogen werden,
in dem 1. Prmisse und Conclusio durch Nor-
malittsoperatoren gebundene Aussagen
sind. Die Konjunktabfolge legt fest, was als
2. Prmisse ins Schema kommt entspre-
chend ist bei (77b) die Ableitung komplexer,
weil sie die Kontraponierung der 1. Prmisse
als Schritt einschliet. Fr (77c) schlielich
gibt es entweder eine Interpretation nach Typ
I, die frs erste Konjunkt B q h geht nicht
arbeiten und damit den Kontrast zu C f(h)
geht arbeiten liefert (testbar durch hingegen)
620 VII. Semantik der Funktionswrter
(80)
a. Hans ist entweder grer als Fritz
oder als Rudi.
b. Hans ist entweder grer als Fritz
oder als Rudi oder als beide.
Offenheit der Liste, grammatisch durch
Hochtonigkeit () des letzten Konjunkts in-
diziert, heit: die Konjunkte exemplifizieren
im gegebenen Kontext mgliche Optionen,
deren Anzahl erweiterbar ist, was wiederum
semantisch vertrgliche Konjunkte voraus-
setzt.
Dies erklrt die Daten in (81) und (82). Im
ersten Fall sind die Konjunkte semantisch
unabhngig, was es erlaubt, da sie intona-
torisch gekennzeichnet als abgeschlossene
oder offene Liste figurieren knnen s.
(81ab). Nicht so bei semantisch unvertrg-
lichen (hier: kontradiktorischen) Konjunkten
wie in (82), die nur als (hier mit zwei bereits)
abgeschlossene (82a), nicht als offene Li-
ste (82b) figurieren knnen. Daran wird deut-
lich, wie grammatisch als Alternativenaufzh-
lung bzw. als Optionenexemplifizierung indi-
zierte Wahlmglichkeiten mit der semantisch
vorgebenenen (Un-)Vertrglichkeit von Kon-
junkten bei der Interpretation von oder-Ver-
knpfungen interagieren.
(81)
a. Es ist klar, da/unklar, ob Hans gr-
er als Fritz oder Rudi, ist.
b. Es ist klar, da/unklar, ob Hans gr-
er als Fritz oder Rudi ist.
c. Es ist klar, da/unklar, ob Hans gr-
er als Fritz und Rudi ist.
(82)
a. Es ist klar, da/unklar, ob die Zahl z
gerade oder ungerade ist.
b. *Es ist klar, da/unklar, ob die Zahl
z gerade oder ungerade ist.
c. *Es ist klar, da/unklar, ob die Zahl
z gerade und ungerade ist.
Fr diese Behandlung von oder spricht ferner,
da sie eine Erklrung bietet fr die qui-
valenz von und (81b) und (81c), bzw. generell
fr Austauschbarkeit von und und oder in sog.
De Morgan-Kontexten (Oetke 1981) wie:
(83)
a. Hans ist grer als Fritz und Rudi.
b. Hans ist grer als Fritz oder Rudi.
c. Die Zahl z ist nicht gerade und/oder
teilbar.
d. Er darf nach Belieben schlafen und/
oder wachen etc.
Dabei sind mit und und oder verschiedene
Operationen verbunden, die jedoch unter ge-
eigneten Bedingungen zu quivalenten Ergeb-
nissen fhren. Die quivalenz beruht zu-
d. Hans isnt stupid, but lazy/hes lazy/
*but he is lazy.
[Korrektur]
e. Hans nest pas bte, mais il est fai-
nant/*mais fainant.
[Kontrast]
f. Hans nest pas bte, mais fainant/
il est fainant/*mais il est fainant.
[Korrektur]
Dies nur als Hinweis, da die in (69) formu-
lierte Annahme auch eine typologische An-
wendungsdomne hat, wobei Teil a frs Eng-
lische, Franzsische usw. nur beibehalten wer-
den kann, wenn man Teil b entsprechend auf-
splittet.
Die Annahme einer semantischen Kom-
ponente CHOICE fr die in (67c) erwhnte kog-
nitive Elementaroperation des Auswhlens
oder Entscheidens macht es mglich, die Be-
deutung von oder als Wahl unter vertrgli-
chen, die von entweder oder als Wahl unter
unvertrglichen Konjunkten zu beschreiben.
Dies weicht ab von bisherigen Analysen, die
das erste als inklusives oder (lat. vel) be-
trachten und mehr oder minder direkt mit
dem logischen Funktor der Disjunktion (1,1;
1,0; 0,1) identifizieren, das zweite als exklu-
sives oder (lat. aut) und mit dem Funktor
der Kontravalenz (1,0; 0,1) gleichsetzen,
was seinerseits die Zahl der Konjunkte von
entweder oder auf exakt zwei beschrnkt.
Das stimmt nicht mit den sprachlichen Fak-
ten berein, weil die grammatisch (intonato-
risch wie in (8182) und/oder lexikalisch
durch entweder -) indizierte Unterscheidung
nicht die von inklusiv vs. exklusiv ist,
sondern von abgeschlossene vs. offene Li-
ste von (beliebig vielen) Alternativen s.
(80ab).
Dabei ist die grammatisch gekennzeichnete
Abgeschlossenheit der Liste ein Indiz dafr,
da die Konjunkte im gegebenen Kontext als
einander ausschlieende Alternativen gelten
sollen ein Belegfall fr den im Anschlu
an (51) vermerkten Umstand, da Unvertrg-
lichkeit kontextuell induziert sein kann. Des-
halb ist (80b), dessen Konjunkte semantisch
unabhngig, also vertrglich sind, eine kon-
tingente und informative KV, die nach der
o. g. Deutung von entweder oder als 1,0;
0,1 nicht angemessen behandelt werden
kann. Natrlich haben (80a) und (80b) auch
verschiedene Bedeutungen im Sinne von kon-
textrelativen Wahrheits- und Gebrauchsbe-
dingungen.
26. Koordinierende Konjunktionen 621
rechnet, dann sind die darin involvierten Me-
chanismen auch legitimer Gegenstand der Se-
mantik, einschlielich des Anteils, der dabei
auf die lexikalische Kategorie der koordinie-
renden Konjunktionen entfllt.
Dies war der Angelpunkt, von dem aus
fr die substantielle und instrumentelle Un-
terscheidung von logischen Funktoren und
sprachlichen Konjunktionen, fr die Di-
stinktion von Selektionsbeziehung bezglich
(un-) vertrglicher Konjunkte und semanti-
schen Beziehungen zwischen Konjunkten so-
wie fr die Annahme von semantischen Kom-
ponenten mit operativer Bedeutung und kon-
textueller Interpretation auf der konzeptuel-
len Ebene pldiert wurde. Es seien als Aus-
blick drei Problembereiche benannt, an denen
verdeutlicht werden kann, wie in der Ausar-
beitung einer Konjunktionssemantik vorhan-
dene Analysevorschlge mit verbliebenen
Desideraten zu verbinden sind.
4.2Syntax und Semantik der Konjunkte
Die Forschung der letzten Jahre hat schlssig
bewiesen, da eine Beschreibung der Kon-
junktformate unterhalb von SATZ durch Til-
gung von syntaktisch kompletten Satz-
Konjunkten aus semantischen Grnden (s.
(58, 60)) unangemessen ist. Demzufolge wer-
den Konjunkte aller relevanten Konjunktfor-
mate ausgenommen sog. stilistische Re-
duktionen als basisgeneriert angenommen.
(Ergnzend dazu ist der Vorschlag von Munn
(1988) zu sehen, der innerhalb des X-bar-
Schemas eine eigene Kategorie BP = Boo-
lean Phrase fordert, in der und bzw. oder
Kpfe sind, die Konjunkte als Komplemente
nehmen.)
Den so determinierten Konjunkten kann
dann semantisch mithilfe von -Abstraktion
und Type-Raising (Gazdar 1980a, Partee &
Rooth 1983) ein ihrer syntaktischen Katego-
rie a entsprechender und die Gleichartigkeits-
bedingungen in 1.3 erfllender semantischer
Typ zugewiesen werden. Kurzum: fr simple
KV mit und oder oder gibt es eine Prinzip-
lsung fr die typengerechte Verknpfung
von Propositionen/Sachverhalten, Individuen
oder Prdikaten.
Als Desiderate im Rahmen dieser Analyse
stehen an: (a) die konjunktionsabhngige
Spezifikation der conjoinables; (b) eine ent-
sprechende Behandlung von komplexeren
Konjunktionen wie aber, weder noch, denn.
Mit dem Aufgreifen dieser Fragen wird dann
auch deutlich, an welchen Stellen der auf Ge-
neralisierung der mengentheoretischen Ope-
nchst darauf, da etwa eine als CI determi-
nierte Menge {x/Hans ist grer als x} auf
verschiedene, aber im Ergebnis quivalente
Weise bestimmt wird, nmlich per Aufzh-
lung in (83a), per Vereinigung in (83b):
(84)
a. {f, r} {x/Hans ist grer als x}
b. {{f} {r}} {x/Hans ist grer als x}
In der Umschreibung: Die Menge der Leute,
fr die gilt, da Hans grer ist als sie, umfat
Fritz und Rudi bzw. Wen immer du nimmst,
Fritz oder Rudi, er gehrt zur Menge der
Leute, fr die gilt, da Hans grer ist als
sie letzteres entspricht genau der oben
gegebenen Deutung von oder-Verknpfung
als Optionenexemplifizierung. Analog bei
(83cd).
Das definierende Kriterium fr koordinie-
rende Strukturen als De Morgan-Kontexte
besteht darin, da sie, nach Rahmen- und
Konjunktstruktur, als CI eine Menge deter-
minieren, die durch Aufzhlung ihrer Ele-
mente oder durch Vereinigung von Teilmen-
gen quivalent darstellbar ist. (Daher bilden
z. B. (82a, 62a, 63a) keine De Morganschen
Kontexte). Diese quivalenz von und- und
oder-Verknpfungen ist seitens der Konjunk-
tionen daran gebunden, da sie beide auf
vertrglichen Konjunkten operieren, was so-
mit fr die Annahme einer Komponente
CHOICE fr oder spricht, die als solche indif-
ferent ist bezglich der (Un-)Vertrglichkeit
der Konjunkte.
4. Probleme und Ausblick
4.1 Die koordinierenden Konjunktionen sind
hinsichtlich ihrer semantischen Beschreibung
wie ihrer Reprsentation im Lexikon ein nach
wie vor wenig durchschauter Gegenstand.
Dies unter dem Leitmotiv Grammatik zwei-
ter Stufe zu verdeutlichen, war ein Ziel dieses
berblicks. Nun knnte aus einem bestimm-
ten Blickwinkel der Eindruck entstehen, da
hier etwas aufwendig reverbalisiert wurde,
was andernorts lngst in formalisierten Ein-
sichten abgelegt ist. Das trifft aber nicht zu.
Gewi hngt es von den jeweiligen Grund-
annahmen ab, was man zum Gegenstands-
bereich der Semantik rechnet und welche Re-
prsentationsmittel dafr einschlgig sind.
Wenn man, wie hier vertreten, z. B. die F-
higkeit, koordinierte Strukturen nach ihrer
Kontingenz und Informativitt zu bewerten,
zu interpretieren und ggf. umzuinterpretieren,
zur semantischen Kompetenz des Sprechers
622 VII. Semantik der Funktionswrter
sichts so groer Variabilitt?
4.4Semantische vs. kontextuelle Aspekte
ber den Status des Common Integrators
(Lang 1984) hat es einige Debatten gegeben
derart, da die durch die Deduktion eines CI
bewirkten Restriktionen bzw. Prferenzen fr
die Interpretation einer koordinierten Struk-
tur zwar faktisch nicht zu bestreiten, aber
theoretisch in die Domne der Pragmatik zu
verweisen seien, d. h. in den Interaktionsbe-
reich von Sprach- und Sachwissen, in dem die
grammatische Struktur einer uerung rela-
tiv zum situativen Kontext ihrer Anwendung
evaluiert wird.
Richtig ist an solchen Vorbehalten, da die
fr die Etablierung eines CI in 2.1 formulier-
ten Bedingungen sich auch und gerade im
Bereich konzeptueller Strukturen durchsetzen
(vgl. die an (42) und (47) illustrierten Effekte)
und daher auch als Filter fr die Einbezie-
hung kontextueller Information in die Inter-
pretation einer KV wirken. Aber es gibt auch
hinreichende Evidenz dafr, da die Etablie-
rung eines CI direkt durch den semantischen
Gehalt der Konjunkte determiniert ist (s.
(2141, 4446) und die Typen von aber-
Konstruktionen). Ferner gilt, da die Bewer-
tung einer koordinierten Struktur als nicht-
kontingent, z. B. als kontradiktorisch oder
tautologisch, was doch unstrittig semantische
Eigenschaften sind, und die Bedingungen ih-
rer eventuellen Uminterpretation, so direkt
mit der Deduktion eines CI verbunden sind,
da dessen Verankerung in der Semantik
nicht zu bezweifeln ist.
Als Problem bleibt freilich, da der CI wie
das hier vertretene Konzept der Grammatik
zweiter Stufe insgesamt noch der klrenden
Einordnung in den Gegenstandsbereich der
Grammatik bedrfen. Dabei liegt die Beweis-
last natrlich bei dem, der einen solchen
Aufstockungs- oder Erweiterungsvorschlag
macht. Die in Abschnitt 1 aufgefhrten Kenn-
zeichen der Koordination und die in 3.2 und
3.3 skizzierten berlegungen zur operativen
Bedeutung liefern fr die weitere Argumen-
tation zumindest Anhaltspunkte.
Dieter Wunderlich danke ich fr seine hilfreichen
Hinweise und seine beraus groe Langmut.
5. Literatur (in Kurzform)
Anscombre/Ducrot 1977 Bierwisch/Lang (eds.)
1989 Buscha 1989 Chomsky 1957 Dhmann
1966 Gazdar 1980a Gazdar/Pullum 1976
rationen Joint und Meet beruhende An-
satz ergnzt oder in seinen Grundannahmen
modifiziert werden mte. Die Rekonstruk-
tion von Eigenschaften koordinativer Ver-
knpfungen wie Nicht-Kontingenz etc. oder
die Formulierung von Lexikoneintrgen fr
Konjunktionen ist in diesem Rahmen nicht
vorgesehen.
4.3Lexikonreprsentation fr
Konjunktionen
Wir sind von der Formulierung auch nur
halbwegs kompletter Lexikoneintrge fr ko-
ordinierende Konjunktionen noch weit ent-
fernt (Fragmente finden sich in Lang 1984,
ihre lexikographische Darstellung wird in
Lang 1982, 1989b diskutiert). Immerhin legen
die hier berblicksweise ausgebreiteten kate-
gorialen und gruppenbildenden Merkmale
der Konjunktionen einige Fragen nahe, die
ber das weitere Vorgehen entscheiden.
Wenn man, gesttzt auf die in 3.1 und 3.3
angefhrten Fakten, davon ausgeht, da die
koordinierenden Konjunktionen eigenstn-
dige und wortintern strukturierte Bedeutun-
gen haben, dann mssen diese im Lexikon
auch komponentiell reprsentiert sein. Dabei
ist das Problem, die betreffenden semanti-
schen Komponenten als Instruktionen fr
Operationen der Kenntnisverarbeitung zu
rechtfertigen, im Rahmen des hier vertretenen
kognitiven Ansatzes zwar prinzipiell, aber in
hinreichender Detaillierung nur langfristig
lsbar. Nherliegend sind Entscheidungen
ber die folgenden Fragen:
(a) Wie ist die fr die koordinierenden Kon-
nektive grundlegende Eigenschaft, vertrgli-
che bzw. unvertrgliche Konjunkte zu selek-
tieren, im Lexikon zu verankern? Offensicht-
lich handelt es sich dabei um einen gegenber
bisher behandelten Selektionsbeschrnkun-
gen neuen Typ. Man knnte die semantischen
Komponenten so axiomatisieren, da z. B.
Eintrge mit SIMUL stets vertrgliche, solche
mit WRONG CORRECT unvertrgliche Kon-
junkte selektieren. Das aber wrde die fr
(entweder) oder anvisierte Analyse als CHOICE
unter unvertrglichen bzw. vertrglichen
Konjunkten beintrchtigen.
(b) Wie soll man mit den Restriktionen be-
zglich des syntaktischen Formats der Kon-
junkte verfahren? Da sie (zumindest zum Teil)
idiosynkratischer Natur sind (so bei aber,
denn, weder noch, sowie), gehren sie in
den Lexikoneintrag. Aber sind sie zu behan-
deln wie Subkategorisierungsinformation bei
Verben? Und mit welchen Merkmalen ange-
27. Causal and Purposive Clauses 623
1980 Renz 1989 Sag/Gazdar/Wasow/Weisler
1985 Schachter 1977 Schmerling 1975 Williams
1981c Wunderlich 1988a Wunderlich 1988b
Ewald Lang, Wuppertal
(Bundesrepublik Deutschland)
George 1980 Grice 1975 Knig 1971 R. Lakoff
1971 Lang 1974 Lang 1976 Lang 1978 Lang
1982 Lang 1984 Lang 1985 Lang 1987b Lang
1988 Lang 1989b Legrand 1975 Lundy 1980
Martin 1983 McCawley 1981 Munn 1987 Oetke
1981 Partee/Rooth 1983 Pelletier 1977 Posner
27. Causal and Purposive Clauses
from another in at least five respects.
1. Mood. As often as not, and notably in
Romance languages, the purposive clause is
systematically construed with the subjunctive:
(1) Legati ad Caesarem venerunt, ut auxilium
rogarent.
(envoys came to Caesar to ask for help)
2. Infinitive. Normally there is one purpo-
sive conjunction that may (e. g. Russian
toby) or must (e. g. German um (zu)) be
combined with an infinitival. So in the latter
case, it is not a conjunction in the strict sense;
it is a preposition, and the same one can often
be combined with that (e. g. French pour
que) to form the conjunction in the strict
sense.
The empty subject of purposive infinitivals
is normally controlled by the subject of the
matrix sentence, as in (2a). Reference of PRO
may be arbitrary as in (2b), though its a
question how arbitrary; whether (2c) isnt a
correct representation. There may be prob-
lematic cases, like (3) and (4).
(a)
a. I sold the books [PRO to help the
refugees]
b. The books were sold [PRO to help the
refugees]
c. The books were sold (by someone
i
)
[PRO
i
to help the refugees]
(3) Were not shooting [PRO to kill], but they
are (shooting [PRO to kill])
(4) Some people take pills (PRO to go to
sleep], others use alcohol ([PRO to go to
sleep])
Preposition + infinitive can serve as causal
clause too, such as door ... te ... -en in Dutch:
(5) Door te vroeg buiten te komen, begon
Jantje weer opnieuw te hoesten.
(through-too-early-out-to-go, Jantje be-
gan coughing again)
3. Topology. Clauses introduced by certain
conjunctions (e. g. Russian potomu to,
1. Phenomenology
2. The Standard Case
3. The Residue
4. Short Bibliography
1. Phenomenology
A language will contain a number of con-
junctions which are termed causal because
they have the essentials of their semantics in
common, and a couple of words being clas-
sified as purposive conjunctions in order to
signal a semantic kinship, or identity, of a
certain kind. The implication is that they con-
vey the modal categories of cause and pur-
pose, respectively, and relate their conjuncts
to each other as cause, or reason, to effect,
or consequence, and means to end. Purposes
are sometimes thought of as a special kind of
cause, and so both classes of conjunctions
would appear to have some part of their se-
mantics in common.
Morphologically these conjunctions form
a heterogeneous group. They present a variety
of phenomena, ranging from atomic elements
(e. g. German weil) to concatenations of in-
dependent morphemes (e. g. Spanish para
que). Preposition plus that (Spanish porque)
and adverb plus that (Swedish drfr att)
are typical patterns among complex conjunc-
tions.
Standard modal (causal/purposive) con-
junctions combine with a sentence to form a
sentence adverb and so belong to the syntactic
category ((s/s)/s) corresponding to the logical
type t, t, t, though with a view to inter-
pretation they are more appropriately treated
as two-place sentence operators, on a par with
coordination.
It is not unusual for a language to have
several causal and purposive conjunctions
that are not syntactically interchangeable.
There are at least five distinctive features, that
is to say, one conjunction can be different
624 VII. Semantik der Funktionswrter
Or by means of Korrelat:
(11)
a. Sie ist deshalb wichtiger als ihr alle,
weil sie es ist, die ich begossen habe.
b. *Sie ist deshalb wichtiger als ihr alle,
da sie es ist, die ich begossen habe.
It seems that only elements from this class
allow the main clause to be topical (Pasch
1982: 63); this will be reflected in intonation.
Features 1 and 5 are probably of special
relevance to the semantics of causals and pur-
posives, reflecting some aspect of truth con-
ditions. So are two further facts, concerning
the propositions expressed by the conjuncts
in purposives and causals:
First, matrix sentences of purposive con-
structions do not allow of every type of prop-
osition; they must be conceivable as repre-
senting conscious actions, or at least intended
results of such actions. Passives are okay, as
in (2b), as are states deliberately brought
about; (Norwegian) (12) and (Swedish) (13).
(12) Brua er s hy for at store bter skal
kunne passere under.
(the bridge is so high in order that big
ships may pass beneath it)
(13) Norska anoraker r rda fr att vara
synliga p lngt avstnd.
(Norwegian anoraks are red in order to
be visible at a distance)
Agents need not be human, cf. (Danish) (14),
suggesting God or Nature, and (Spanish)
(15).
(14) Mange dyr og fugle bliver hvide nr
vinteren kommer, for at deres fjender
ikke skal se dem.
(many animals and birds turn white
when winter comes in order that their
enemies shall not be able to see them)
(15) Nunca viene sola una desgracia, y parece
que el Hado las enva en quadrilla para
que no se pierdan por el camino.
(a calamity never comes alone, and it
seems that fate sends them in bands in
order that they do not lose each other
on the way)
But (2d) is excluded (Manzini 1980), as well
as (Norwegian) (16) because the action is non-
agentive.
(2)
d. *The price decreased [to help the
poor]
(16) *Vi kom til knuse et vindu for
komme oss inn.
(we happened to break a window (in
order) to get in)
Swedish fr, French car) cannot precede the
main clause.
(6)
a. Rien nest perdu pour la France, car
la France nest pas seule.
b. *Car la France nest pas seule, rien
nest perdu pour la France.
4. Subordination. Causal clauses are not
always subordinate causal conjunctions
can be conjunctions in the very strict sense of
coordination. For example, Norwegian for
clauses exhibit main clause word order
whereas fordi clauses do not.
(7)
a. Hun la ham i ei krybbe, for det var
ikke plass til dem i herberget.
(she-laid-him-in-a-manger, for-there-
was-not-room-for-them-in-the-inn)
b. Hun la ham i ei krybbe, fordi det ikke
var plass til dem i herberget.
(she-laid-him-in-a-manger, because-
there-not-was-room-for-them-in-the-
inn)
5. Commentability (focusability would be
an interchangeable term). One causal con-
junction seems to occupy a special position
in many languages, like because, correspond-
ing to German weil, Norwegian fordi, French
parce que, etc. Only elements from this class
can be commented upon, e. g. negated, or
focused on by scalar particles (8a and 8b from
Lang 1976: 171):
(8)
a. Die Heizungsrhren sind geplatzt,
nicht weil es Frost gegeben hat, sondern
weil sie einen Materialfehler haben.
b. *Die Heizungsrhren sind geplatzt,
nicht denn es hat Frost gegeben, son-
dern denn sie haben einen Materialfeh-
ler.
c. Ty eto govori, tolko potomu cto ty
menja ljubi.
(youre saying that only because you
love me)
c. *Ty eto govori, tolko tak kak ty
menja ljubi.
(youre saying that only since you love
me)
Or questioned (the example is Norwegian):
(9)
a. Gikk hun fordi hun kjeda seg?
(Did she leave because she was
bored?)
b. *Gikk hun siden hun kjeda seg?
(Did she leave since she was bored?)
Or emphasized by means of clefting:
(10)
a. Cest (seulement) parce que ..., que ...
b. *Cest (seulement) puisque ..., que ...
27. Causal and Purposive Clauses 625
(23)
a. Hann fr til Vesturheims, af v a
honum lei svo illa heima.
(he went to America because he was
doing so badly at home)
(Icelandic)
b. Hann fr ekki til Vesturheims, af v
a honum lii svo illa heima.
(he didnt go to America because he
were (!) doing so badly at home)
Because and af v a are commentable (fo-
cusable) causal conjunctions (cf. fact 5 under
Chapter 1). Whenever it is possible to com-
ment upon the conjunction in a causal con-
struction, we may be confident that the causal
connection conveyed is actually asserted.
A standard purposive construction carries
the assertion of some connection too; it can
be false just because that connection fails to
hold. (24a) is false if (24b) in the wide
negation reading is true. And (25a) is false
if (25b) is true. (The former example is Ice-
landic and the latter is Norwegian.)
(24)
a. Hann fr til Vesturheims, til ess a
litast um verldinni.
(he went to America in order to look
about in the world)
b. Hann fr ekki til Vesturheims, til ess
a litast um verldinni.
(he didnt go to America in order to
look about in the world)
(25)
a. Det var ikke for bli rik at han gjorde
det heller.
(it-was-not-to-get-rich-that-he-did-
it-either)
b. Det var for bli rik at han gjorde
det.
(it-was-to-get-rich-that-he-did-it)
A causal construction can be untrue for the
simple reason that one of its conjuncts is false.
Assertion or presupposition? Probably the
former; because does not seem inherently fac-
tive with respect to either one of its connects.
So p because q entails both p and q and
so is paraphrasable by p & q & ... (e. g. Rei-
chenbach 1947: 329 f because as and
& ... and Reis 1977: 60 f). It may be that
depending on topic and focus and topology,
p and q can be alternately presupposed, ac-
cording to some presupposition concept.
Purposive constructions p in order that
q seem to be semantically structured in the
same way, with the one exception of entailing
that the agent wants q to be the case instead
of simply q. (Needless to say, this neutrality-
to-fact of purposives as regards the end as
such is what justifies the use of the subjunctive
in the q clause.) Thus even syntactically com-
plete sentential purpose clauses are incom-
Second, in the typical case, time reference of
the causal proposition is prior to or simulta-
neous with that of the main proposition; this
will be reflected in tenses and time adverbials.
As of purposives, the opposite is the case, the
content of the subordinate clause being tem-
porally posterior to or simultaneous with that
of the main clause. (18) and (20) are Lappian
examples of simultaneity.
(17) Parce quil na pas tu ces deux-l, des
milliers denfants mourront pendant des
annes encore.
(18) Bivan dainna go viegan.
(I am keeping warm because I am run-
ning)
(19) Je plante cette arbre maintenant, pour
pouvoir rcolter des pommes dans cinq
ans.
(20) Viegan vai bivan.
(I am running to keep warm)
Still one more potential distinctive feature
deserves attention. Whereas purposive con-
junctions in general permit only intentional
acts as main clause propositions, there may
be causal conjunctions which on the contrary
do not tolerate that sort of thing. Dutch door-
dat, for example, differs from the more fre-
quent omdat in that it cannot give a reason
for an agentive action. Jantje stopte in (21a)
describes an involuntary event, while Jantje
stopte in (21b) expresses a deliberate act of
the will.
(21)
a. Jantje stopte omdat/doordat zijn rem-
men zich vastgezet hadden.
(Jantje stopped because his brakes
had jammed)
b. Jantje stopte omdat/*doordat de stop-
lichten op rood stonden.
(Jantje stopped because the traffic
lights were red)
2. The Standard Case
A standard causal construction carries the
assertion of a causal connection, i. e. it can
be false even if both conjuncts are true. (22a)
is false if (22b) in the reading where the
link is denied is true. (23a) is false if (23b)
is true.
(22)
a. She got the job because shes a
woman.
b. She didnt get the job because shes
a woman.
626 VII. Semantik der Funktionswrter
Causal conjunctions mostly treat of singular,
particular things in quite specific situations,
and there can be no unambiguous way of
identifying the associated general statement
(cf. Weber 1981: 160). Strictly speaking, there
is no need to specify it in stating truth con-
ditions, like: p because q is true only if
there is a law and there are facts such that
the law, the facts and q jointly imply p
and this is at the same time a possible analysis
of p if q (to be compared, for instance, with
the one in Kratzer 1978: 241248).
But there is another way of using condi-
tionals. p because q can be fairly convinc-
ingly paraphrased by (p, q, and) a coun-
terfactual: if it werent for q, p wouldnt be
the case either. Lewis (1973) is the classic of
counterfactual analysis of causation. Dowty
(1972) made the abstract predicate CAUSE
of generative semantics take two sentential
arguments in logical structure and interpreted
CAUSE(A,B) as (A & B & ) not-A >
not-B (p. 125). Wierzbicka (1972: 199)
defined: S
1
is P
1
because S
2
is P
2
= If S
2
were not P
2
, then S
1
would not be P
1
.
One good thing about this conception is
that it can always be put to the test; it is
immediately accessible to intuition. More-
over, intuition seems to license paraphrases
like (22c) and (28b).
(22)
a. She got the job because shes a
woman.
c. She got the job and shes a woman
and she wouldnt have got it if she
werent a woman.
(28)
a. He shot himself because gasoline
wasnt obtainable.
b. He shot himself and gasoline wasnt
obtainable and if it had been, he
wouldnt have shot himself.
Closer investigation reinforces the equiva-
lence in question. Denial of the causal con-
nection may take forms like (22d) and (28c).
(22)
d. She didnt get the job because shes
a woman she would have got it
otherwise too.
(28)
c. He shot himself, but not because gas-
oline wasnt obtainable he might
have done so even if gasoline had
been obtainable.
When used in the analysis of causation, coun-
terfactuals are given a ceteris-paribus inter-
pretation in terms of possible-world similar-
ity, the classics of which, in turn, are Stal-
naker (1968) (using the sign >) and Lewis
plete as second arguments of a purposive
conjunction as a truth-conditional operator,
the conjunct involved on the level of logical
form resulting from the application of the
agents intention attitude on the apparent
conjunct. We shall see below that p because
the agent wants that q explicates p in order
that q reasonably well. The agent being that
of p, the completed expanded conjunct
really refers across the conjunction (this re-
ducing in effect to because), depending on
the matrix sentence for determination of the
subject of intending, just as surface purposive
infinitivals derive their subject proper from
the main clause.
How should the causal connection con-
veyed by because and its approximate equiv-
alents be analyzed? As with causation proper
and in general, philosophers and linguists
have taken two basic approaches. Both of
these take as their starting point that causals
are in some way closely related to condition-
als, and the mainstream of because analysis
has been based on the idea of sufficient con-
ditionship.
Many people have assumed that p be-
cause q somehow involves p if q (e. g.
Ramsey 1965: 248 and, somewhat differently,
Ryle 1950: 310) or some regularity connection
along the same lines something like al-
ways if q, p (cf. van Dijk 1977b: 48) or
(counterfactually) always(if q, p) (nomic
tie; cf. v. Wright 1971: 71); q may not be
sufficient by itself, but together with implicit
circumstances (cf. Ballweg 1981a: 151):
whenever q-and-unspecified-conditions, p.
Regularity analysis may seem too narrow
in scope to encompass very many causal con-
structions. (26a) can be viewed as an instan-
tiation of a universal statement (26b), and if
(26b) is felt too strong, one can recur to (26c).
But (27) looks like a counterexample. One
has to make a considerable amount of ab-
straction to obtain a law-like paraphrase and
in that process, the gain would be lost in the
getting.
(26)
a. Because inflation has now been
curbed, unemployment will decrease
too.
b. Whenever inflation is curbed, unem-
ployment decreases.
c. Whenever inflation is curbed and the
situation resembles this one, unem-
ployment decreases.
(27) Japan has surrendered because an
atomic bomb has been dropped on
Hiroshima.
27. Causal and Purposive Clauses 627
... there may be causes of each other (for example,
exercise is a cause of good physical condition, and
good physical condition is a cause of exercise, al-
though not in the same manner, but good physical
condition as an end, and exercise as a moving
principle); ...
So purposive and causal clauses would seem
to meet on a double basis:
1. Both types of clause can be used for an-
swering why questions, so purposive clauses
are causal clauses in a wider, general sense.
Purpose clauses somehow give reasons for
action.
2. Purposive constructions can be taken to
represent reversals of causal constructions;
because as a reverse of in order that.
Main clause actions are supposed to bring
about the ends. (30a) is much more similar
to (30b) than to (30c).
(30)
a. Aristotle works in order to feel good.
b. Aristotle feels good because he
works.
c. Aristotle works because he feels good.
Both of these aspects are since traceable in
philosophy and linguistics. Georg Henrik von
Wright gives a ripe version of the second
aspect in Explanation and Understanding
(1971):
If ... I say that he ran in order to catch the train,
I intimate that he thought it (under the circum-
stances) necessary, and maybe sufficient, to run, if
he was going to reach the station before the de-
parture of the train. (p. 84)
We ask Why? The answer often is simply: In
order to bring about p. It is then taken for granted
that the agent considers the behavior which we are
trying to explain causally relevant to the bringing
about of p ... (p. 96 f)
But at the same time he admits that teleo-
logical explanations might turn out to be
transformable into causal ones so that He
ran in order to catch the train would depend
on the truth of a nomic connection between
his anxiety to catch the train ... and his
running. (p. 192)
We are left with two alternative analyses
of purposive constructions, based on these
two paraphrases:
a does m in order to attain e =
(A) a does m because a wants to attain e,
(B) a does m and a wants to attain e and a
believes that doing m is the best way to
achieve e.
(30)
d. Aristotle works because he wants to
feel good.
(1973 b) (using the sign , which has
since become general).
Conjunctions accentuate one traditional
problem: that of causal selection, pointed
out e. g. by John Stuart Mill in A System of
Logic (Book 3, Ch. 5, 3). A given proposi-
tion depends counterfactually on many dif-
ferent propositions, i. e. there are many nec-
essary conditions, yet causation statements as
a rule require us to select one of them. Con-
junctions may assign several causes to one
effect; we may have, for instance, p because
q and because r, and there are countless
possible variations on this theme (cf. Hen-
schelmann 1977: 145 f). Causes can even be
graded, as is seen in (22e) and (28d):
(22)
e. She got the job not so much because
shes a woman, mostly because
shes acknowledged as a very able
person.
(28)
d. He shot himself mainly because gas-
oline wasnt obtainable, but also to a
certain degree because it was so hot.
So conjunctions enable us not only to single
out one causal factor as the cause, but also
to make subtle distinctions among such fac-
tors. A hierarchy of causes can be named,
and this phenomenon may be matched by the
solution to the selection problem proposed in
Abbott (1974) and Dowty (1979: 107109),
using the scalar notion of distance from ac-
tuality (important causes would be absent
in worlds relatively close to this one).
Backward causation seems impossible in
standard because cases and corresponding
counterfactuals seem contradictory too.
(29)
a. The settlements perished around 1390
because supply ships ceased to arrive
in 1403.
b. If supply ships hadnt ceased to arrive
in 1403, the settlements wouldnt
have perished around 1390.
On counterfactual analysis, this absurdity is
explicable in terms of trees (where worlds split
at moments of time; cf. Sb 1980).
Aristotle related purpose to cause in two
ways. Purposes, or ends, figure as his fourth
type of cause, and at the same time, they may
be caused (Metaphysics, Book 5, Chapter 2):
A cause means ... the end, and this is the final
cause (that for the sake of which); for example,
walking is for the sake of health. Why does he
walk? We answer, In order to be healthy; and
having spoken thus, we think that we have given
the cause.
628 VII. Semantik der Funktionswrter
On the other hand, paraphrase (A) does not
preserve the restriction that the main clause
represent an agentive action. (2e) and (33), as
opposed to (2d) and (16), are acceptable.
(2)
e. The price decreased because the au-
thorities wanted to help the poor.
(33) Vi kom til knuse et vindu fordi vi ville
komme oss inn.
(we happened to break a window be-
cause we wanted to get in)
How are purposives lacking agent subjects to
be paraphrased on the model because ...
want ...? Most matrix sentences are overt or
hidden passives, like (2b) and (12), represent-
ing intended events or states of affairs delib-
erately brought about, and it is reasonable to
treat the one who brings them about as agent,
i. e. to have the unexpressed indefinite insti-
gator be the one to want.
(2)
f. The books were sold because those
who sold them wanted to help the
refugees.
(34) The bridge is so high because those re-
sponsible for it being so high intended
to enable big ships to pass beneath it.
A causal or purposive construction is struc-
tured logically as a tripartite conjunction, and
so there are a variety of possibilities for the
whole to be false. A comprehensive not has
three places to go, plus combinations, provid-
ing theoretically seven different ways of ne-
gating. (Of course, this is not to say that
sentences displaying wide-scope negation are
ambiguous, however, focus and topic may
serve to allocate denial and assent within a
sentence, so that what is meant actually var-
ies.) Specifically, a construction p because
q or p in order that q can be false for the
simple reason that one of its two simple con-
juncts is. But note that on counterfactual
analysis
p & q & q p or
p & Wq & Wq p
(W symbolizing the agent wants that),
this is only half true, since the alternative of
(W)q and only (W)q being negative is contra-
dictory; either p or the counterfactual (not
both, which would again yield a contradic-
tion) must follow along.
The opposite option, on the other hand
p and only p is negative will sometimes
materialize. (35a) and (36a) suggest this read-
ing of not (p because/in order that q), aptly
e. Aristotle works and he wants to feel
good and he thinks that unless he
works, he wont feel good.
(a does m because a wants to attain e would
only be an intermediate stage in that analysis,
preparing the purposive e. g. for the ultimate
paraphrase a does m and a wants to attain
e and a wouldnt do m if a didnt want to
attain e.
(30)
f. Aristotle works and he wants to feel
good and if he didnt want to feel
good, he wouldnt work.)
On the surface these two possibilities are very
different from each other. Paraphrase (A)
rests on the proposition that the agent enter-
tains certain preferences; this proposition re-
mains opaque. Paraphrase (B) dissects that
proposition and introduces a cognitive ele-
ment, viz. the agents propositional attitude
of belief towards the proposition that the act
in question is in some (strong or weak) sense
a necessary condition for the fulfilment of his
intention. (One should note that the agent
thus regards her action as a potential cause
of the end-attainment; if she is right and her
intention comes true, we may say that she
wouldnt have attained e if she hadnt done
m, and so (30b) would be justified.) (Both
viewpoints are again represented in linguistic
literature; e. g. the former in Rudolph (1982:
218), the latter in Rudolph (1973: 59).)
Differences shrink to a minimum, however,
when it comes to deciding which one is the
more adequate analysis: (A) seems a bit
stronger, and therefore more adequate, than
(B).
Suppose youd stop doing m the moment
you were to lose interest in e, then surely you
think of m as the (or one) best way to produce
e, due to a principle of rationality, we may
assume. But the supposition that you think
of m as the best, perhaps even the only, way
to produce a appears to be compatible with
the contention that youd do m even if you
didnt care about e e could be only a
pleasant side-effect, a gratuitous by-product;
m could be enjoyable, for instance, and then
it would be untruthful to say that you do m
to achieve e. We may reject purpose P
1
and
accept purpose P
2
(see e. g. 31, 32) and yet
agree to paraphrase (B) for both of them
(then wed say that the one necessary inten-
tion was stronger than the other intention).
(31) We used aluminium to save money / to
ensure safety.
(32) (32) Brecht wrote an advertisement to re-
deem a bet / to acquire an automobile.
27. Causal and Purposive Clauses 629
plication that ctait dimanche and the con-
nection carried by puisque are apparently un-
touched by ne ... pas in (38). Martin (1973),
Heinmki (1975), and Dal (1952: 215) (e. g.)
contend that puisque-, since-, and da sen-
tences, respectively, are presupposed.
Conjunctions belonging to the coordinat-
ing paradigm for, denn, car etc. are
comparable with adversative conjunctions
but, aber, mais etc.; they thus probably in-
clude and, und, et etc. (see e. g. Reis 1977:
59), i. e. both connects are asserted (e. g. Pasch
1982: 197), whereas the relation they establish
is probably best represented as a presuppo-
sition or conventional implicature (see Grice
(1967: lecture 2, p. 6) who makes the point
regarding an occurrence of therefore).
(39) Und sie verwunderten sich seiner
Lehre, denn seine Rede war gewaltig.
(6)
a. Rien nest perdu pour la France, car
la France nest pas seule.
What do the connections conveyed/relations
established by since and for and their ap-
proximate equivalents consist in? One answer
to this question could be simply: the same as
in the Standard Case. (37), (38), (39), and (6a)
are not yet obvious counterexamples: they
could contain because, parce que and weil and
be analyzed in terms of counterfactual de-
pendence. But this conception is too narrow.
Causation is too restricted to capture e. g.
(40)(43). (40) is taken from Boettcher/Sitta
(1972), (41) from Lang (1976), (42) from Ross
(1970a), and (43) from Aijmer (1978).
(40) Da die Lampe nicht brennt, ist der Mo-
tor kaputt.
(41) Es hat Frost gegeben, denn die Hei-
zungsrhren sind geplatzt.
(42) Jenny isnt here, for I dont see her.
(43) Bill has gone to Spain, for he told me
he would.
Members of the because paradigm are not
restricted to the Standard Case either, though
conjunctions which, like because, can anytime
be substituted for the coordinating one seem
more versatile than those subordinating
through word order. (44) is taken from Quirk
et al. (1974: 752), and (45) is taken from
Rutherford (1970: 100), who drew attention
to its second, non-restrictive sense, or read-
ing:
(44) Theyve lit a fire, because I can see the
smoke rising.
(45) He beats his wife because I talked to her.
(40), (41), and maybe (42) and (44), belong
to what has been termed the symptomatic, or
evidential, use of causal conjunctions. One can
rephrasable by saying that (W)q fails to bring
about p. (35b, 36b) are paraphrases adhering
to the pattern p & (W)q & (W)q
p.
(35)
a. I dont close my eyes to the conse-
quences because theyre unpleasant.
(36)
a. The rescue party arent risking their
lives to recover survivors.
(35)
b. I dont close my eyes to the conse-
quences, which are unpleasant, as I
certainly wouldnt were they not un-
pleasant.
(36)
b. The rescue party are trying to recover
survivors, if they werent, they would
certainly not be risking their lives,
and they arent either.
The normal locution for this content, how-
ever, is a concessive conjunction conjoining
p and q, where negation is confined to
the main clause. (35c) and (36c) are fair par-
aphrases of the above sentences. This would
mean the following analysis of p although
q: p & q & q p. (Quite possibly,
the two latter conjuncts are best considered
presuppositions; cf. article 28.)
(35)
c. I dont close my eyes to the conse-
quences even though theyre unpleas-
ant.
(36)
c. The rescue party, though eager to re-
cover survivors, arent risking their
lives.
3. The Residue
Conjunctions that cannot be commented, or
focused, upon (cf. fact 5 under 1), such as
since and for, German da and denn, and Nor-
wegian siden and for, pose anew the question
of how truth conditions are structured. We
have good reason to doubt that the connec-
tions they convey are asserted. Moreover, we
cannot be sure that sentences subordinated
by since, da, siden etc. do not merely repre-
sent presuppositions.
(37) My opinion is (not) that since weve lost
more than two thousand subscribers, we
cannot go on publishing.
(38) Je (ne) pris (pas) la rsolution den
prendre mon aise puisque ctait di-
manche.
Comprehensive negation seems unable to sus-
pend the implication that weve lost more
than two thousand subscribers. Both the im-
630 VII. Semantik der Funktionswrter
1979, i. a.). By embedding p under hyper
sentences in semantic structure, (40)(50)
would be made to conform to, thus restoring,
the Standard Case:
(44)
a. I claim/know that theyve lit a fire
because I can see the smoke rising.
(46)
c. Ill bet that Louie has (definitely)
come into some money, because hes
driving around town in a new Rolls-
Royce.
(47)
a. I ask you whether youre going to the
post-office because I have some let-
ters to send.
(48)
a. Ich fordere dich auf, mir ein Bier zu
bringen, denn ich habe Durst.
Now the performative method has met with
heavy criticism (Kac 1972, Grewendorf 1972,
Gazdar 1979, i. a.). (44a) evinces an ambigu-
ity, or a vagueness: Does explaining a speech
act mean giving a reason for the performance
or some other aspect of it? Choosing the latter
alternative, one can deepen the analysis (Val-
gard 1979, Kper 1983), as the rules consti-
tuting the act its felicity conditions can
provide a bridge between the performance
and q. The causal clauses in (44), (47), (48)
go to explain the sincerity rule of the respec-
tive acts: the speaker justifies his/her belief in
p, his/her desire to know if p, and his/her
desire for the hearer to bring about p, re-
spectively. With the causal clause of (49) the
speaker justifies his/her conviction that the
hearer knows if p, and in (51) he/she explains
why he/she doesnt.
(51) Lebt er noch? denn in meiner Einsamkeit
hre ich nichts von ihm.
(quoted by Adelung 1782: 485)
Some people have suggested that denn (Reis
1977: 60) and puisque and car (LE GROUPE
-1 1975: 245 f) should be described as illo-
cutionary indicators, indicating a speech act
of explanation.
There is a speech act use of purposive
clauses too. A purposive clause can serve to
explicate indirect speech acts, cf. (52), like a
performative phrase, or an indicator. It can
serve to clarify the point of the utterance
where there may be doubt because the indi-
cator is ambiguous: (53). It can be used for
defining the act more accurately, making the
point of the utterance more precise, i. e. spe-
cializing the essential rule of e. g. questions
(54) or representatives/answers (55).
(52) Just to warn you: theres a bull on the
meadow.
note two things in this connection: this use
favours epistemic modals, and reverses the
causation use, so that (46a) and (46b),
brought by Morreall (1979: 234), seem near-
equivalent:
(46)
a. Louie has definitely come into some
money, because hes driving around
town in a new Rolls-Royce.
b. Louie is driving around town in a
new Rolls-Royce because he has
come into some money.
One could conclude that one connection can
give rise to two constructions. Lang (1976:
166 f) paraphrases (41) as (41c) and (41a) as
(41b).
(41)
a. Die Heizungsrhren sind geplatzt,
denn es hat Frost gegeben.
b. Wenn es Frost gegeben hat, dann sind
die Heizungsrhren geplatzt, nun, es
hat Frost gegeben, also sind die Hei-
zungsrhren geplatzt.
c. Wenn es Frost gegeben hat, dann sind
die Heizungsrhren geplatzt, nun sind
die Heizungsrhren tatschlich ge-
platzt, also darf man annehmen, da
es Frost gegeben hat.
Such occurrences of (p) because/since/for
(q) as (40)(46a) may be considered to cen-
ter on another aspect of p p in another
rle: the causal clause appears to explain the
main clause not as an event or a state of
affairs, but as an object of belief, or a judg-
ment, or an assertion, as a proposition
complete with attitude; an act including
(representative) illocution (cp. e. g. Pasch
1982: 106 f).
But (40)(46a) exemplify only the tip of
the iceberg: main clauses need not be de-
clarative sentences; corresponding speech acts
need not be representatives. (47) is taken from
Quirk et al. (1972: 752), (48) from Kper
(1983: 16), and (49) from Aijmer (1978: 46).
(47) Are you going to the post-office? be-
cause I have some letters to send.
(48) Bring mir ein Bier, denn ich habe Durst.
(49) Since youre a linguist, what is the cur-
rent status of transformational gram-
mar?
(50) Brother, can you spare a dime, cause
my children are starving.
Here p unmistakably appears as questions
and requests, and there is no evident cognitive
connection between q and the propositional
content p. At the latest, this is where the
performative hypothesis comes in (Ross 1970a,
Rutherford 1970, Sadock 1974, Morreall
28. Konzessive Konjunktionen 631
(60) The government needs an economic
boom to get reelected.
(61) To get to Harlem, you must take the A
train.
(62) Because the government has accom-
plished so little, it wont get reelected.
(63) Without an economic boom, the govern-
ment wont get reelected.
(64) You wont get to Harlem unless you take
the A train.
4. Short Bibliography
Abbott 1974 Adelung 1782 Aijmer 1979 Aris-
totle (transl. by Apostle 1966) Arndt 1960 Ball-
weg 1981a Bech 1957 Boettcher/Sitta 1972
Chomsky 1981 Dakin 1970 Dal 1952 van Dijk
1977b Dowty 1972 Dowty 1979 Gazdar 1979
Grewendorf 1972 Grice 1967 Hartung 1961
Heinmki 1975 Henschelmann 1977 Heuer
1929 Kac 1972 Kratzer 1978 Kper 1983
Lang 1976 Laun 1956 LE GROUPE -1 1975
Lewis 1973a Lewis 1973b Manzini 1980 Martin
1973 Mill 1961 Mittwoch 1977 Morreall 1979
Pasch 1982 Posch (ed.) 1981 Quirk/Greenbaum/
Leech/Svartvik 1972 Ramsey 1965 Reichenbach
1947 Reis 1977 Ross 1970a Rudolph 1973
Rudolph 1982a Rudolph 1982b Rutherford
1970 Ryle 1950 Sadock 1974 Seb 1980
Spohn 1983 Stalnaker 1968 Teleman 1976 Val-
gard 1979 Weber 1981 Wierzbicka 1972 Wood
1956 Wright 1971
Kjell Johan Seb, Oslo (Norway)
(53) To give you a good piece of advice, Doc:
Get married!
(54) Just to make quite sure you didnt
notice anything unusual?
(55) Well, to be quite exact, I imagine she did
seem a bit suspicious.
Besides, a purposive clause can give a reason
for a speech act via a rule too. (56): Stating
the purpose of the point of the utterance (i. e.
(attempt) to get H to do A essential rule),
the purposive clause states the end purpose
of the directive. (57): Relating something
good for H, the purposive clause explains S
premiss that doing A will benefit H (prepar-
atory or sincerity rule of advice): p is in your
best interest because q is so too.
(56) Die Geisslein riefen, zeig uns erst deine
Pfote, damit wir wissen, dass du unser
liebes Mtterchen bist. (quoted by Ru-
dolph 1982b: 277)
(57) Bitte senden Sie den Informations-Cou-
pon mglichst umgehend ein, damit
Ihnen rechtzeitig Ihre individuelle
Computer-Analyse kostenlos vorliegt
(quoted by Rudolph 1982b: 277)
Purposives have one more secondary use.
Bech (1957: 102 ff) employed the term deter-
mination to describe the way the purpose
phrase appears to modify some certain part
of the main clause in sentences like (58)
(61): here the to phrase would determine the
verb do, the adverb enough, the verb need,
and the auxiliary must, respectively. (59)
(61) appear to permit the paraphrases (62)
(64). Here the items in question are necessity
words in a wide sense, and such sentences
seem to convey exactly a notion of necessary
condition (Bech 1957: 104 and Rudolph
1973a: 103, 114 f, 141).
(58) The government hasnt done enough to
reduce unemployment.
(59) The government hasnt accomplished
enough to get reelected.
28. Konzessive Konjunktionen
1. Einleitende Bemerkungen
Ebenso wie die Begriffe konditional, kausal,
final, modal oder temporal gehrt der Begriff
konzessiv zu dem begrifflichen Inventar, das
die traditionelle Grammatik zur Klassifizie-
rung und Charakterisierung von Adverbial-
stzen allgemein zur Verfgung stellt. Wie
auch die brigen der durch diese Begriffe cha-
1. Einleitende Bemerkungen
2. Zur Bedeutung der konzessiven Konjunktio-
nen
3. Beziehung zu Konditionalstzen
4. Beziehung zu Kausalstzen
5. Pragmatische Aspekte
6. Affinitt zu anderen semantischen Bereichen
7. Offene Probleme
8. Literatur (in Kurzform)
632 VII. Semantik der Funktionswrter
Die weitgehende quivalenz dieser beiden
Stze ist somit das Ergebnis unterschiedlicher
Komposition:
not (q because p) vs. (not q) although p.
Konzessive Beziehungen knnen nur von
einer fokussierenden, metasprachlichen Ne-
gation betroffen werden, von einer Negation
also, die nicht nur anzeigt, da ein Satz falsch
ist, sondern auch die Stelle markiert, an der
eine Korrektur vorzunehmen ist.
(2) Die Hutterer sind glcklich nicht ob-
WOHL, sondern gerade WEIL sie auf
irdische Gter verzichten.
Im Gegensatz zu anderen Adverbialsatz-
typen knnen Konzessivstze zudem nicht
Fokus einer Gradpartikel wie nur, gerade, so-
gar sein oder in einer anderen fokussierenden
Konstruktion vorkommen:
(3)
a. Nur/gerade wenn du dich anstrengst,
wirst du Erfolg haben.
b. *Nur/gerade/sogar obwohl er wenig
gearbeitet hat, hat er viel Geld ver-
dient.
Einige der genannten besonderen Eigenschaf-
ten von konzessiven Nebenstzen, insbeson-
dere die Tatsache, da sie nicht im Skopus
anderer Operatoren sein knnen, hngen ver-
mutlich mit der Tatsache zusammen, da
Konzessivstze im Gegensatz zu anderen Ad-
verbialstzen ein eigenes, mit dem des Haupt-
satzes nicht identisches Sprechaktpotential
haben. Nach einer weitverbreiteten Auffas-
sung haben illokutive Operatoren stets wei-
testmglichen Skopus.
Zu den spezifischen Eigenschaften von
Konzessivstzen gehrt schlielich noch, da
sie nicht wie andere Adverbialstze interpre-
tativ ergnzt werden knnen, sondern gleich-
sam eine Endstation fr jede Interpretations-
erweiterung darstellen: whrend sowohl Tem-
poral- als auch Kausal- oder Konditionalstze
unter bestimmten Bedingungen konzessiv in-
terpretiert werden, knnen Konzessivstze,
die explizit als solche gekennzeichnet sind,
nicht analog reinterpretiert werden (cf. Knig
1985 a).
2. Zur Bedeutung von konzessiven
Konjunktionen
Die Wahrheitsbedingungen von Konzessiv-
stzen sind einfach zu beschreiben. Wie all-
gemein blich wird hier die Bezeichnung Kon-
zessivsatz nicht nur fr einen bestimmten Typ
rakterisierten Beziehungen werden konzessive
Beziehungen entweder durch Prpositionen
(trotz, wider), durch Konjunktionen (obwohl,
obgleich, obschon, wenngleich etc.) oder durch
Konjunktionaladverbien (doch, dennoch, je-
doch, trotzdem, gleichwohl, nichtdestoweniger
etc.) zum Ausdruck gebracht. Unter dem
Oberbegriff Konnektiva knnen alle Mitglie-
der der genannten Wortklassen subsumiert
werden. Zu den konzessiven Konnektiva wird
auch die in vielen Grammatiken als adver-
sativ bezeichnete, nebengeordnete Konjunk-
tion aber gerechnet. Eine Entsprechung zu
dieser Konjunktion scheint es in allen Spra-
chen zu geben, whrend spezielle konzessive
Prpositionen, unterordnende Konjunktio-
nen oder Konjunktionaladverbien (engl. con-
juncts) nicht zur Ausstattung jeder Sprache
gehren.
Die folgenden Ausfhrungen beziehen sich
in erster Linie auf konzessive Konjunktionen,
gelten aber mutatis mutandis auch fr die
brigen Konnektiva.
Unter den Adverbialstzen nehmen Kon-
zessivstze in jeder Beziehung eine Sonder-
stellung ein. Das wird bereits an der Termi-
nologie deutlich: whrend Ausdrcke wie
kausal, final, instrumental oder konditional
eine zweistellige Relation bezeichnen, kenn-
zeichnet der Ausdruck konzessiv eine mgli-
che Verwendung der entsprechenden Stze.
Konzessive Konnektiva scheinen sich relativ
spt in der Geschichte einer Sprache zu ent-
wickeln und werden auch relativ spt erwor-
ben (cf. Knig 1985 b). Im Gegensatz zu an-
deren Adverbialstzen knnen Konzessiv-
stze weder im Skopus einer Negation noch
im Skopus einer Frage sein. Stze wie die
folgenden knnen nur so verstanden werden,
da ausschlielich der Hauptsatz negiert bzw.
erfragt ist:
(1)
a. Ich werde Paul das Auto nicht verkau-
fen, obwohl wir befreundet sind.
b. Geht Fritz spazieren, obwohl es reg-
net?
Da Konzessivstze im Gegensatz zu Kau-
salstzen nicht im Skopus einer vorausgehen-
den Negation sein knnen, wird auch durch
die beiden folgenden Stze verdeutlicht:
(1)
c. This house is no less comfortable be-
cause it dispenses with air condition-
ing.
d. This house is no less comfortable, al-
though it dispenses with air condition-
ing.
28. Konzessive Konjunktionen 633
allgemeine Form eines Konzessivsatzes
etwa folgendermaen wiedergegeben werden:
(7) p normalerweise q
Dabei soll der Pfeil in etwa der im Deutschen
durch wenn ... dann ausgedrckten Konditio-
nalbeziehung entsprechen. p und q stehen
fr Verallgemeinerungen der entsprechenden
Stze p und q. Durch den Operator norma-
lerweise kann auf Normen der unterschied-
lichsten Art Bezug genommen werden. Fr
Satz (4) wre die in (7) beschriebene Impli-
kation von konzessiven Konjunktionen etwa
als (8a) oder (8b) auszuformulieren:
(8)
a. Normalerweise geht Fritz nicht spazie-
ren, wenn es regnet.
b. Normalerweise geht man nicht spazie-
ren, wenn es regnet.
Die in (7) durch einen Pfeil gekennzeichnete
Relation als Kausalbeziehung aufzufassen,
wie es in einigen der o. g. Analysen geschieht,
ist nicht sinnvoll, da dies nur fr bestimmte
Verwendungen von konzessiven Konjunktio-
nen angemessen wre. Wie spter noch deut-
lich werden wird, knnen konzessive ebenso
wie konditionale Konnektiva sowohl auf kau-
sale wie auch auf epistemische Zusammen-
hnge Bezug nehmen.
Bei Beispielen wie (9) ist die prinzipielle
Unvereinbarkeit zwischen p und q natrlich
nur dann gegeben, wenn angenommen wird:
Sokrates wute, da p.
(9) Obwohl der Wein vergiftet war, hat So-
krates ihn getrunken.
Aus (7) folgt, da diese Annahme hier zu dem
fr (9) relevanten Redehintergrund gehrt.
Wie schon vorher bei der Beschreibung der
Wahrheitsbedingungen von Konzessivstzen
angedeutet, drckt (7) keine logische Folge-
rung dieser Stze aus (cf. Reichenbach 1947:
329). Ein abnormales Projektionsverhalten
ebenso wie die Lschbarkeit in bestimmten
Kontexten weist (7) als konzessive Prsuppo-
sition aus. Die folgenden Beispiele zeigen, da
die in (7) formulierte Implikation bei Ein-
bettung von Konzessivstzen in konditionale,
interrogative oder andere Kontexte unvern-
dert bleibt:
(10)
a. Wenn Fritz spazieren geht obwohl es
regnet, so sage mir bitte Bescheid.
b. Ich habe eben festgestellt, da Fritz
spazieren geht, obwohl es regnet.
Jemand, der den in (10a) formulierten Auftrag
erhlt, hat lediglich zu berprfen, ob Fritz
spazieren geht und ob es regnet. Die konzes-
von adverbialen Nebenstzen verwendet, son-
dern auch fr das Satzgefge, das einen sol-
chen Nebensatz als Konstituente enthlt.
Stze wie (4) oder (5) sind dann wahr, wenn
auch die jeweiligen Teilstze wahr sind (cf.
Reichenbach 1947: 329):
(4) Obwohl es regnet, geht Fritz spazieren.
(5) Obwohl die Mannschaft nicht gut gespielt
hat, hat sie auch nicht ausgesprochen
schlecht gespielt.
M. a. W. ein Satz der allgemeinen Form (6)
impliziert logisch sowohl p als auch q:
(6) Obwohl p, (dennoch) q.
Wesentlich schwieriger ist jedoch die Ana-
lyse des Beitrags von konzessiven Konnektiva
zur Bedeutung eines Satzes, der ber diese
eben beobachtete Gemeinsamkeit mit der ne-
benordnenden Konjunktion und hinausgeht.
Vorschlge, die dazu in den letzten zwanzig
Jahren gemacht wurden, gehen kaum ber die
informellen Analysen hinaus, die in der ersten
Hlfte dieses Jahrhunderts (cf. Lerch 1925)
oder auch schon in frheren Jahrhunderten
gemacht wurden (cf. Weydt 1983). Die we-
sentlichen Punkte dieser Analysen lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
Konzessive Konjunktionen geben den
durch sie verbundenen Stzen p und q nicht
nur einen faktischen Charakter, sondern brin-
gen darberhinaus zum Ausdruck, da zwi-
schen den durch diese Teilstze bezeichneten
Sachverhalten ein Konflikt, ein Gegensatz
oder Dissonanz besteht. Die durch p und q
in Stzen der allgemeinen Form (6) bezeich-
neten Sachverhalte sind normalerweise nicht
miteinander vereinbar (cf. Quirk 1954: 4 ff;
Curme 1931: 332, Heidolph et al. 1981:
806 ff). Angesichts dieser prinzipiellen Unver-
einbarkeit ist der zweite Sachverhalt fr Spre-
cher und Hrer unerwartet und somit ber-
raschend (cf. Bellert 1972; Halliday & Hasan
1976: 250 ff). In die gleiche Richtung gehen
all die Analysen, die den Gegensatz zwischen
Kausal- und Konzessivstzen zum Ausgangs-
punkt ihrer Beschreibung machen: sowohl
kausale als auch konzessive Satzgefge im-
plizieren logisch beide Teilstze. Ein wesent-
licher Unterschied zwischen diesen beiden Ty-
pen von adverbialen Satzgefgen besteht je-
doch darin, da in Konzessivstzen eine nor-
male und somit erwartete Grund-Folge Be-
ziehung nicht verwirklicht wird (cf. Burnham
1911: 2 f; Hartung 1964: 125; Hermodsson
1978: 59 ff; Moeschler & de Spengler 1981:
99). Der gemeinsame Nenner dieser Aussage
knnte bezogen auf die in (6) angegebene
634 VII. Semantik der Funktionswrter
junktionen verbundenen Stze in dem rele-
vanten Kontext K zu einander widerspre-
chenden Schlssen (r und r) berechtigen,
wobei das zweite Konjunkt und die darauf
basierende Folgerung greres argumentati-
ves Gewicht hat:
(13)
a. p aber q
b. p r (bzw. K & p r)
c. q r (bzw. K & q r)
d. q ist ein strkeres Argument fr r
als p fr r.
Durch K soll hier gekennzeichnet werden, da
diese Schlsse auf einen bestimmten Kontext
beschrnkt sind.
Diese Analyse kommt ohne die Annahme
von Polysemie fr aber aus und subsumiert
alle anderen Analysen der entsprechenden
Konjunktionen (z. B. Lakoff 1971; Abraham
1975; Lang 1977; Pusch 1975; Wunderlich
1980: 48 ff) als Spezialflle. Zu den hufig
diskutierten Spezialfllen gehren Beispiele,
bei denen aus p und q Bewertungen abgeleitet
werden (cf. 14) sowie Beispiele, bei denen die
auf p basierende Folgerung direkt durch q
verneint wird (q = r):
(14) Das Haus ist klein, aber es ist hbsch
gelegen.
(15) Ich wrde Fritz zwar gern einmal ein-
laden, aber ich werde es aus bestimmten
Grnden nicht tun.
Im Falle von (14) knnte als r etwa die
Bewertung Wir sollten das Haus nicht kau-
fen angenommen werden. In (15) wird eine
plausible Folgerung aus dem ersten Teilsatz
(Ich werde Fritz einladen) durch den zweiten
Teilsatz unmittelbar negiert.
Die eben fr aber gegebene Analyse ist
sicherlich auch fr subordinierende Konjunk-
tionen in Stzen des Typs (5) angemessen.
Zwei verschiedene Bedeutungen wie (7) und
(13) fr konzessive Konjunktionen, oder
Konnektiva allgemein, zu unterscheiden,
wrde einer hufig vertretenen Auffassung
voll und ganz entsprechen, nach der minde-
stens zwei verschiedene konzessive oder ad-
versative Beziehungen zu unterscheiden sind.
Halliday und Hasan (1976: 250 ff) unterschei-
den z. B. zwischen externen und internen
adversativen Relationen. An die Stelle dieser
Unterscheidung knnte man auch die zwi-
schen adversativen Umstandsbestimmungen
(z. B. 1, 4) und konzessiven Beziehungen im
engeren Sinne des Wortes (5, 14, 15) setzen.
Konzessive Beziehungen wren dann als rein
diskursive Beziehungen aufzufassen, in denen
sive Prsupposition des Antezedens in (10a)
ist auch eine Prsupposition des gesamten
Satzes. Ebenso ist in Satz (11) die prinzipielle
Unvereinbarkeit von Regen und Spazieren-
gehen nicht Gegenstand der Feststellung des
Sprechers. Auch hier vererbt sich die Prsup-
position des Objektsatzes auf den gesamten
komplexen Satz. Reduktions-Argumente wie
das folgende zeigen zudem, da die in (7)
beschriebene Implikation lschbar ist:
(11) Obwohl ich dieses Pulver in das Wasser
schtte, erfolgt keine Frbung des Was-
sers. Das zeigt, da dieses Pulver keine
Farbnderung hervorruft.
Die in (7) formulierte konzessive Prsuppo-
sition mag zwar fr Stze des Typs (4) einen
Schritt in die richtige Richtung darstellen,
aber kaum fr Stze des Typs (5). Im zuletzt
genannten Fall besteht keinerlei Unverein-
barkeit oder Konflikt zwischen den durch die
beiden Teilstze ausgedrckten Sachverhal-
ten. In (5) schliet der zweite Teilsatz lediglich
eine mit dem Wortlaut des ersten vereinbare
Interpretation dieses Satzes aus und verndert
die Perspektive oder argumentative Orientie-
rung (Ducrot), die durch den ersten Teilsatz
zum Ausdruck kommt. Damit hnelt die
durch (5) illustrierte Verwendung von obwohl
sehr stark typischen Verwendungsweisen von
aber, wie sie in einschlgigen Arbeiten fr
diese deutsche Konjunktion und ihre Ent-
sprechungen in anderen Sprachen beschrieben
worden sind. Im Unterschied zu der konzes-
siven Prposition trotz kann aber auch in
Fllen verwendet werden, wo keinerlei Kon-
flikt oder Unvereinbarkeit zwischen zwei Pro-
positionen besteht. Ein Mann, der von seiner
Frau den Auftrag erhlt, fr seine zwei Kin-
der Eis zu kaufen und der nur 1 DM in der
Tasche hat, knnte auf die Frage, ob das Geld
gereicht htte, folgendermaen antworten:
(12) (Tja) Fritz wollte ein Eis, aber Paul
wollte auch eins.
In dem angegebenen Kontext legt der erste
Teil der Antwort den Schlu nahe Das Geld
hat gereicht, whrend der zweite Teil einen
genau entgegengesetzten Schlu suggeriert.
Die generellste Analyse, die fr aber oder
eine Entsprechung dieser Konjunktion in
einer anderen Sprache vorgeschlagen worden
ist, ist m. E. in Ducrot (1976; 1980b) sowie in
Anscombre und Ducrot (1973; 1977) zu fin-
den (cf. auch Moeschler und de Spengler
1981: 100; Braue 1983a: 6 ff). Nach dieser
Analyse ist frz. mais, dt. aber oder engl. but
ein Indikator dafr, da die durch diese Kon-
28. Konzessive Konjunktionen 635
Ebenso wie (5) oder (12) knnen auch Stze
wie (16b) oder (17) dazu verwendet werden,
vor naheliegenden aber in diesem Fall fal-
schen Folgerungen zu warnen. (Einige kon-
zessive Konnektiva, wie z. B. allerdings im
Deutschen oder das Konjunktionaladverb
though im Englischen sind im wesentlichen
auf die Funktion, vor naheliegenden, aber
falschen Schlssen zu warnen und die Trag-
weite des vorher Gesagten einzuschrnken,
festgelegt.)
3. Beziehung zu Konditionalstzen
Die Tatsache, da wir nur sehr wenig ber
Konzessivitt wissen, lt es ratsam erschei-
nen, die Bedeutung von Konzessivstzen
nicht nur direkt, sondern auch indirekt, d. h.
durch Kontrastierung mit verwandten Er-
scheinungen zu beschreiben. Die im letzten
Abschnitt skizzierte Analyse von konzessiven
Konjunktionen erlaubt es uns, Konzessivstze
von Konditionalstzen, aber auch von Kon-
struktionen zu unterscheiden, die hufig als
konzessiv bezeichnet werden, aber gleichsam
zwischen Konditionalstzen und Konzessiv-
stzen anzusiedeln sind und sinnvollerweise
als Irrelevanzkonditionale oder konzessive
Konditionale zu bezeichnen wren (cf. Knig
1985 a). Eine Unterscheidung zwischen Kon-
ditionalstzen, Konzessivstzen und Irrele-
vanzkonditionalen ist am besten auf der
Grundlage der semantischen Beziehungen
mglich, die zwischen dem jeweiligen kom-
plexen Satz und den Teilstzen bestehen.
Konditionalstze implizieren logisch weder
ihr Antezedens noch ihr Konsequens. Kon-
zessivstze implizieren, wie schon erwhnt,
beide Teilstze. Irrelevanzkonditionale unter-
scheiden sich von Konditionalen dadurch,
da sie einen konditionalen Zusammenhang
zwischen einem Konsequens und einer ganzen
Reihe von Antezedensbedingungen herstellen,
die durch die Alternative p oder p, durch
einen Allquantor oder durch einen skalaren
Ausdruck beschrieben sein kann:
(18)
a. (Ganz gleich) ob ich eingeladen werde
oder nicht, ich werde nicht zu dieser
Feier gehen.
b. Wieviel er mir auch immer bieten
mag, ich werde es nicht tun.
c. Selbst/auch wenn mir keiner hilft, ich
werde es schaffen.
Ebenso wie Konzessivstze implizieren auch
Irrelevanzkonditionale ihr Konsequens. (Fr
Stze des Typs (18b) und (18c) gilt dies nur
ein potentielles Gegenargument dem eigent-
lichen Argument gegenbergestellt wird.
Nun ist allerdings die hnlichkeit zwischen
(7) und (13) so gro, da der Versuch nahe-
liegt, beide auf eine Grundbedeutung zurck-
zufhren oder (7) unter (13) zu subsumieren.
Der prinzipiellen Unvereinbarkeit von Sach-
verhalten in (7) entspricht in (13) eine Unver-
einbarkeit von Schlssen, die auf den durch
eine konzessive Konjunktion verknpften
Teilstzen basieren. In Beispielen des Typs (4)
wird die Gltigkeit des in (7) formulierten
generellen Zusammenhangs fr eine konkrete
Situation aufgehoben. In Beispielen des Typs
(5) und (12) wird die Berechtigung eines
Schlusses von p auf r fr einen speziellen
Kontext aufgehoben. Eine dritte Gemeinsam-
keit liegt in der Kontextabhngigkeit der in
(7) und (13) beschriebenen Aspekte konzes-
siver Bedeutung. Da die Schlsse von p auf
r und von q auf r nur fr einen spe-
ziellen Kontext K gltig sind, wurde bereits
erwhnt. Der Operator normalerweise in (7)
markiert im Grunde ebenso eine kontextuelle
Beschrnkung: der in (7) formulierte Zusam-
menhang gilt fr Standardkontexte, fr Kon-
texte also, in denen Dinge einen normalen
Verlauf nehmen. Als vierte Gemeinsamkeit sei
schlielich noch die Asymmetrie konzessiver
Beziehungen angefhrt. Wie bereits erwhnt,
knnen durch aber verbundene Konjunkte,
ebenso wie die beiden Teilstze in Beispielen
des Typs (5), nicht vertauscht werden, ohne
die generelle argumentative Orientierung
(Ducrot) der Stze und damit vollziehbarer
Sprechakte zu verndern.
Auch in Beispielen des Typs (4) sind die
Teilstze ohne Vernderung der Bedeutung
nicht vertauschbar. Wenn einer der beiden
Sachverhalte, die in eine konzessive Bezie-
hung gesetzt werden, als primr angenommen
werden kann, wenn er also dem anderen zeit-
lich vorausgeht wie in (16a), oder wenn er im
Gegensatz zum zweiten Sachverhalt nicht
menschlicher Kontrolle unterworfen ist (cf.
4), dann wird durch eine Vertauschung der
Teilstze der kausale Charakter der Bezie-
hung in einen epistemischen verndert:
(16)
a. Obwohl Fritz schlechte Erfahrungen
mit Gebrauchtwagen gemacht hat,
hat er sich wieder einen gekauft.
b. Obwohl sich Paul wieder einen Ge-
brauchtwagen gekauft hat, hat er
schlechte Erfahrungen damit ge-
macht.
(17) Es regnet, obwohl Paul spazieren
geht.
(cf. 4)
636 VII. Semantik der Funktionswrter
(20)
a. Ich mu mir das alles anhren, ob-
wohl ich deshalb mein Examen ver-
passe.
b. p, obwohl (weil p, q)
Bemerkenswert ist angesichts der vorausge-
gangenen Beobachtungen jedoch, da ein ein-
facher Satz sowohl ein kausales als auch ein
konzessives Konjunktionaladverb enthalten
kann und somit in eine kausale als auch in
eine konzessive Beziehung zum vorausgehen-
den Ko-text gesetzt wird:
(21)
(A. (zu Kindern) Warum darf Ali bei
euch nicht mitspielen?
B. Er ist Trke.)
C. Deswegen kann er doch trotzdem
mitspielen.
Durch eine solche uerung wird die An-
nahme, auf der die von B gegebene Antwort
basiert, d. h. eine Annahme der Form (7) zu-
rckgewiesen. Beispiele wie diese suggerieren,
da zwischen Konzessivstzen und Kausal-
stzen die semantische Beziehung der Duali-
tt besteht. Diese Beziehung kann immer
dann auftreten, wenn zwei Verneinungsmg-
lichkeiten in einem Satz bestehen, wie z. B.
bei Stzen mit Quantoren oder Operatoren
(Adverbialen). In diesen Fllen kann sowohl
der Gesamtsatz als auch der Teilsatz bzw. das
Prdikat ohne Operator und Quantor negiert
sein (uere vs. innere Negation). Das klarste
Beispiel fr eine solche Analyse ist Hermods-
son (1978). Hermodsson pldiert sogar dafr,
die traditionelle Bezeichnung konzessiv durch
inkausal zu ersetzen. Darstellen lt sich dies
in dem Dualittsdiagramm (22) fr Kausal-
und Konzessivstze (vgl. Lbner 1986).
Diagonal gegenberliegende Elemente ste-
hen in einem dualen Verhltnis zueinander.
Die folgenden Beispiele verdeutlichen diese
Beziehung zwischen Kausal- und Konzessiv-
stzen:
unter bestimmten Bedingungen, cf. Knig
1985 a; Stze des Typs (18a), implizieren (tri-
vialerweise) auch ihr Antezedens.) Eine wei-
tere Gemeinsamkeit zwischen den beiden
Konstruktionstypen besteht darin, da auch
bei Irrelevanzkonditionalen eine der genann-
ten Bedingungen in einem prinzipiellen Kon-
flikt zu dem im Konsequens genannten Sach-
verhalt steht.
4. Beziehung zu Kausalstzen
Weitere Einsichten in die Bedeutung von
Konzessivstzen vermittelt auch ein Vergleich
mit Kausalstzen. Da Konzessivstze wie
Kausalstze beide Teilstze logisch implizie-
ren, wurde schon erwhnt. Beispiele wie (2)
zeigen jedoch, da Konzessivstze einen Ge-
gensatz zu Kausalstzen ausdrcken knnen.
Durch die kontrastierende metasprachliche
Negation wird in (2) die von dem Konzessiv-
satz prsupponierte und in (7) beschriebene
prinzipielle Beziehung zwischen den durch die
Teilstze ausgedrckten Sachverhalte verwor-
fen. Die Korrektur durch eine kausale Kon-
junktion bringt zum Ausdruck, da diese
Sachverhalte generellen Zusammenhngen
nicht zuwider, sondern mit ihnen konform
verlaufen. Dieser Gegensatz zwischen Kau-
salstzen und Konzessivstzen ist auch in Bei-
spielen des folgenden Typs deutlich:
(19) Er ist weggefahren, obwohl seine
Schwiegermutter kommt oder weil seine
Schwiegermutter kommt.
Eine uerung wie (19) verrt mangelndes
Wissen ber den grundstzlichen Zusammen-
hang zwischen den genannten Tatbestnden.
Der eben beschriebene Kontrast zwischen
Kausal- und Konzessivstzen schliet natr-
lich nicht aus, da ein Kausalsatz als Argu-
ment in einer konzessiven Beziehung fungiert
oder umgekehrt:
28. Konzessive Konjunktionen 637
Klein 1980):
(26)
a. Harry ist auf den Bermudas geboren.
Also ist er britischer Staatsbrger.
b. Obwohl Harry auf den Bermudas ge-
boren ist, ist er nicht britischer
Staatsbrger.
Indem ein Sprecher (26b) verwendet, um die
Folgerung in (26a) zurckzuweisen, akzep-
tiert und konzediert er damit nicht nur die
Prmisse von (26a), sondern auch die An-
nahme ber einen generellen Zusammenhang
einer Geburt auf den Bahamas und der bri-
tischen Staatsangehrigkeit, die in (26a) zum
Ausdruck kommt. Nach den vorangegange-
nen Ausfhrungen drfte deutlich sein, da
diese Verwendungsweise letztlich ein Reflex
der dualen Beziehung zwischen Kausalitt
und Konzessivitt ist.
Nicht immer wird in dem konzessiv mar-
kierten Teilsatz einer konzessiven Verbindung
eine Aussage des Gesprchspartners aufge-
griffen. Der Sprecher kann auch einen Ein-
wand gegen das im anderen Teilsatz behaup-
tete Faktum konzedieren. Wie in der vorher
beschriebenen Situation, so besteht auch in
dieser Situation nur eine partielle berein-
stimmung zwischen den Gesprchspartnern.
Der Sprecher sieht sich auch gezwungen, sei-
nem Gesprchspartner zu widersprechen. Auf
Grund dessen, was wir aus der Konversa-
tionsanalyse ber Hflichkeitsmaximen, face
work und preference ordering wissen (cf.
Levinson 1983: 332 ff), ist in einer solchen
Situation zu erwarten, da ein Sprecher seine
bereinstimmung besonders betont und sei-
nen Widerspruch herunterspielt. Viele empha-
tische Ausdrucksmittel, die fr den als kon-
zessiv markierten Teilsatz in vielen Sprachen
charakteristisch sind (z. B. zwar, durchaus,
trotz allem, allerdings, wohl, etc.) finden in
dieser Konfliktsituation eine natrliche Er-
klrung. Einige dieser emphatischen Aus-
drucksmittel lassen stets einen Einwand oder
eine argumentative Umorientierung als Fol-
gebeitrag erwarten. So sind z. B. Stze mit dt.
zwar, engl. true oder frz. certes elliptisch und
verlangen eine Fortfhrung durch einen Satz
mit aber bzw. but und mais:
(26)
a. Er ist zwar noch sehr jung, (aber ...)
b. True, he is still very young (but ...)
6. Affinitt zu anderen semantischen
Bereichen
Gewisse Einsichten in die Bedeutung von
konzessiven Konnektiva vermittelt uns auch
ihre etymologische Analyse. Konzessive Kon-
(23)
a. Es ist nicht der Fall, da Paul weil er
krank ist zu Hause bleibt.
b. Obwohl Paul krank ist, bleibt er nicht
zu Hause.
(24)
a. Paul ist krank. Deswegen bleibt er
aber nicht zu Hause.
b. Paul ist krank, ohne deswegen zu
Hause zu bleiben.
c. Paul ist krank. Trotzdem bleibt er
nicht zu Hause.
d. Paul ist krank. Deswegen bleibt er
trotzdem nicht zu Hause.
In all diesen Fllen ist ein Kausalsatz mit
weitem Skopus der Negation einem Konzes-
sivsatz quivalent, dessen Hauptsatz negiert
ist. Zu beachten ist hier allerdings, da es sich
bei der Negation nicht um die fokussierende
nicht ... sondern Negation handelt. Weitere
Evidenz fr die These, da Konzessivstze in
einer dualen Beziehung zu Kausalstzen ste-
hen, bietet die Tatsache, da ehemalige kau-
sale oder korrelative Konjunktionen sich in
negativen Kontexten zu konzessiven Kon-
junktionen entwickelt haben. Eine solche Ent-
wicklung hat z. B. die Konjunktion pour au-
tant im Franzsischen durchgemacht, die
noch im 16. Jahrhundert eine rein kausale
Beziehung ausdrckte:
(25) Il est riche. Il nest pas pour autant heu-
reux.
5. Pragmatische Aspekte
Eine Analyse, die sich mit der Formulierung
von Wahrheitsbedingungen begngt, blendet
wesentliche Aspekte der Bedeutung von Kon-
zessivstzen aus (cf. Knig und Eisenberg
1984). Die vorausgegangene Diskussion hat
bereits mehrfach deutlich gemacht, da wich-
tige Aspekte dieser Bedeutung etwas mit der
Verwendung dieser Stze in Argumentationen
und Sprechakten zu tun haben und somit in
einen Bereich fallen, der als Pragmatik von
Semantik im engeren Sinn abgegrenzt wird
(cf. Levinson 1983). Schon allein die traditio-
nelle Bezeichnung konzessiv macht dies deut-
lich. Konzessivstze werden hufig dann ver-
wendet, wenn man mit der Prmisse eines
Arguments bereinstimmt, aber den daraus
gezogenen Schlu zurckweist. Indem man
Konzessivstze in dieser Weise verwendet, ak-
zeptiert man neben der Prmisse auch das
was Toulmin (1958) warrant eines Arguments
nennt, d. h. den Zusammenhang zwischen den
genannten Fakten, auf Grund dessen die Pr-
misse fr die Schlufolgerung herangezogen
werden kann. An Toulmins berhmtem Bei-
spiel (26a) lt sich dies gut verdeutlichen (cf.
638 VII. Semantik der Funktionswrter
(iv) Fr die folgenden Beispiele gilt schlie-
lich, da sie alle von Begriffen abgeleitet sind
(z. B. Trotz, Gedankenlosigkeit, Verach-
tung), die ursprnglich nur von menschlichen
Subjekten prdiziert werden konnten:
(30) dt. trotz; engl. in spite of; frz. au mpris
de, mal-gr; span. a pesar de; ndl. on-
danks, in weerwil van; serb. kroat. upr-
kos, etc.
Die eben beschriebenen Zusammenhnge, die
sich aus einem synchronen Vergleich einer
Vielzahl von Sprachen ergeben, sowie detail-
lierte historische Betrachtungen in einzelnen
Sprachen (cf. Knig 1985 c) zeigen bestimmte
Grundlinien der Entwicklung auf: Konzessiv-
stze haben sich in vielen Fllen aus Kondi-
tionalstzen, insbesondere aus Irrelevanzkon-
ditionalen des Typs (18), entwickelt, wobei
das Antezedens dieser Konditionale durch
den vorausgehenden Ko-text oder durch eine
emphatische Partikel einen faktischen Cha-
rakter erhielt. Fr die Mitglieder der Gruppe
(iii) ist die Annahme plausibel, da sich die
konzessive Bedeutung aus einer Konventio-
nalisierung konversationeller Implikaturen
ergeben kann, die durch die Assertion von
bemerkenswerter Koexistenz oder Ko-okku-
renz generell ausgelst werden. Die Elemente
der vierten Gruppe knnen schlielich als Er-
gebnis eines Prozesses des Ausbleichens von
Begriffen angesehen werden, die ursprnglich
nur von menschlichen Subjekten prdiziert
werden konnten.
7. Offene Probleme
Die vorausgegangene Zusammenfassung un-
seres Wissens ber die Bedeutung von kon-
zessiven Konjunktionen hat viele Fragen un-
beantwortet gelassen oder gar nicht erst ge-
stellt. Zu den interessanten offenen Proble-
men in diesem Bereich gehrt u. a. die Frage
nach dem Einflu verschiedener formaler Va-
riationsmglichkeiten auf die Bedeutung von
Konzessivstzen: der Einflu der Stellung des
als konzessiv markierten Nebensatzes vor
oder hinter dem Hauptsatz, der Einflu einer
unterschiedlichen Einteilung in Tongruppen,
oder der Einflu der durch die Beispiele (16)
und (18) illustrierten Variation in der Wort-
stellung, die z. B. im Deutschen oder Nieder-
lndischen zu beobachten ist. Unberhrt ist
auch die Frage nach den Bedeutungsunter-
nektiva sind in der Regel morphologisch
komplex. Die Grundbedeutung der am Auf-
bau dieser Konnektiva beteiligten Morpheme
liefert wichtige Aufschlsse ber Affinitten
zwischen Konzessivitt und anderen seman-
tischen Bereichen sowie ber die historische
Entwicklung dieser Konnektiva. Auf der
Grundlage ihres morphologischen Aufbaus
und der semantischen Affinitt, die aus die-
sem Aufbau deutlich wird, lassen sich kon-
zessive Konnektiva in vier (oder fnf) groe
Gruppen einteilen (cf. Knig 1985 b; 1985 c):
(i) In vielen Sprachen enthalten diese Kon-
nektiva eine Komponente, die auch als All-
quantor verwendet wird, oder genauer gesagt,
als Quantor, der freie Wahl signalisiert. Zu
dieser Gruppe knnen wir auch all jene Aus-
drcke zhlen, die Begriffe des Wollens oder
der Wahl unmittelbar zum Ausdruck brin-
gen (cf. Haiman, 1974):
(27) dt. bei all ... allerdings; engl. although,
all the same, albeit, however;lat. quam-
quam; frz. toutefois; finn. vaikka ob-
wohl (cf. vaikka kuka wer auch im-
mer); ungar. habr obwohl (cf. ha
wenn, brki wer auch immer); russ.
vs-taki, chotja; chin. swi rn ... du/ y
obwohl ... dennoch (cf. du alles, y
auch); Margi kw, k, etc.
(ii) Konzessive Konnektiva sind hufig als
Ergebnis einer Kombination von (ursprng-
lich) konditionalen oder temporalen Kon-
junktionen wie dt. wenn, ob und additiven
oder emphatischen Partikeln wie dt. auch,
gleich, schon, wohl analysierbar:
(28) dt. ob-gleich, ob-wohl, ob-schon, wenn-
gleich, wenn ... auch; engl. even though,
even so; lat. et-si; frz. quand mme; finn.
jos-kin wenn-auch; Malayalam -enkil-
um (wenn auch); Ewe ne-ha (wenn-
und/auch); Sesotho le ha obwohl
(auch/selbst wenn); Bengali jodi-o (jodi
wenn, o auch); Lahu th, k auch,
sogar, obwohl.
(iii) Eine weitere Gruppe von konzessiven
Konnektiva lt sich auf Grund der Tatsache
von anderen Gruppen unterscheiden, da die
betreffenden Konnektiva bemerkenswerte
Ko-existenz oder Ko-okkurenz (z. B. Gleich-
zeitigkeit etc.) in ihrer ursprnglichen Bedeu-
tung ausdrcken bzw. implizieren:
(29) dt. dennoch, unbeschadet; engl. neverthe-
less, just the same, still, yet; lat. nihilo-
minus; frz. nempche que, cependant;
span. aunque; japan. nagara whrend/
obwohl; chin. hi noch, dennoch; in-
dones. sekali-pun (zugleich sogar);
tibet. yan auch, noch, obwohl.
29. Modality 639
Abraham 1975 Anscombre 1976 Anscombre/
Ducrot 1976 Bartori 1975 Borkin 1982 Braue
1983a Burnham 1911 Curme 1931 van Dijk
1977a Ducrot 1973 Ducrot 1980b Haiman
1974 Halliday/Hasan 1976 Hartung 1964 Hei-
dolph et al. 1981 Hermodsson 1978 Klein 1980
Knig 1985a Knig 1985b Knig 1985c Knig
1988 Knig 1989 Lakoff 1971 Lang 1977
Lerch 1929 Levinson 1983 Lbner 1986 Maz-
zoleni 1988 Moeschler/de Spengler 1981 Morel
1980 Pusch 1975 Quirk 1954 Quirk et al. 1972
Reichenbach 1947 Toulmin 1958 Valentin (ed.)
1983 Wunderlich 1980
Ekkehard Knig, Berlin
(Bundesrepublik Deutschland)
schieden geblieben, die durch verschiedene
konzessive Konnektiva in einer Sprache aus-
drckbar ist. In den Untersuchungen von
Braue (1983a) fr das Deutsche, Borkin
(1980) fr das Englische und Morel (1980)
fr das Franzsische liegen hier interessante
Anstze vor. Zu den offenen Problemen ge-
hrt aber letztlich auch noch die Frage, die
im Mittelpunkt der vorausgegangenen Aus-
fhrungen stand: eine przise Beschreibung
des Beitrages von konzessiven Konjunktio-
nen, die ber die genannten Wahrheitsbedin-
gungen hinausgeht und als konzessive Pr-
supposition bezeichnet wurde.
Der vorliegende Beitrag wurde whrend eines Auf-
enthaltes am Netherlands Institute for Advanced
Study geschrieben. Fr die Untersttzung, die ich
dort erhalten habe, mchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken. Auerdem danke ich S. Lbner
fr wertvolle Anregungen bezglich des Verhltnis-
ses von Kausalitt und Konzessivitt.
8. Literatur (in Kurzform)
29. Modality
1. Relative Modality
Modality has to do with necessity and pos-
sibility. In a language like English, modality
can be expressed by auxiliaries as in (1),
(1) New structures must be generated.
New structures can be generated.
by adjectives, adverbs and nouns as in (2),
(2) This is not absolutely impossible.
This is a remote possibility.
Possibly, we will return soon.
by suffixes as in (3),
(3) Such thoughts are not expressible in any
human language.
or else modality may be inherent in the verb
as in (4):
(4) (4) This car goes twenty miles an hour.
Modal words have usually been thought to
be ambiguous. (5) illustrates the epistemic
reading of must
(5) Jockl must have been the murderer.
(in view of the available evidence, Jockl
must have been the murderer)
(6) is an example for the deontic reading of
must:
1. Relative Modality
2. The Semantics of Modal Words: A First At-
tempt
3. Some Shortcomings of the Standard Analysis
3.1 Inconsistencies
3.2 Conditionals
3.3 Graded Notions of Modality
4. Graded Modality in the Epistemic Domain
5. Two Basic Kinds of Modal Reasoning
6. Ordering Sources for Circumstantial Modal
Bases
7. Overcoming Inconsistencies
8. Conditional Modality
9. The Semantic Field of Modal Expressions
10. Short Bibliography
... while it is not absolutely impossible, it is none-
theless quite difficult for Nature to construct an
angel from an extant phylogeny. In addition to the
arms and the legs of a human, an angel has a set
of wings along its back, and wings are complex
structures sculpted of muscles, bones, and nerves
(an angels wings are covered with feathers). ...
the back of a mammal has no preexisting structures
that can be stretched or shrunk, folded or bent into
a wing. To make an angel, the fundamental ground
plan of the existing elements must be tampered
with and new structures must be generated without
precedent. This Nature cannot easily do ...
Michael J. Katz (1987)
640 VII. Semantik der Funktionswrter
know. Then the informationally possible is that
which in a given information is not perfectly known
not to be true. The informationally necessary is
that which is perfectly known to be true ... The
information considered may be our actual infor-
mation. In that case, we may speak of what is
possible, necessary or contingent, for the present.
Or it may be some hypothetical state of knowledge.
Imagining ourselves to be thoroughly acquainted
with all the laws of nature and their consequences,
but be ignorant of all particular facts, what we
should then not know not to be true is said to be
physically possible; and the phrase physically nec-
essary has an analogous meaning. If we imagine
ourselves to know what the resources of men are,
but not what their dispositions and their desires
are, what we do not know will not be done is said
practically possible; and the phrase practically nec-
essary bears an analogous signification. Thus the
possible varies its meaning continually. We speak
of things mathematically and metaphysically possi-
ble, meaning states of things which the most perfect
mathematician or metaphysician does not qua
mathematician or metaphysician know not to be
true.
(Peirce 1933: 42 f.)
2. The Semantics of Modal Words: A
First Attempt
We have seen that modal words require for
their interpretation a specification of the kind
of modality involved. This specification can
be given by linguistic or non-linguistic means.
Linguistic means for specifying the necessary
piece of information are phrases like in view
of what we know, given the regulations, in view
of what the law provides and what have you.
In what follows, let us confine our attention
to those cases of modals where the kind of
modality is specified by the context of use.
We will consider sentences like (5) to (9)
above. Such sentences express a proposition
only if a context parameter specifying the
kind of modality has been fixed. To make our
ensuing discussion a little bit more precise,
we have to review a few notions of possible
worlds semantics.
Propositions
Utterances of sentences express propositions.
In possible worlds semantics, a proposition is
identified with the set of possible worlds in
which it is true. Suppose we are given a set
W of possible worlds. A proposition is then
a subset of W.
Truth of a proposition
A proposition p is true in a world w W iff
w p. Otherwise, p is false in w.
(6) Jockl must go to jail.
(in view of what the law provides, Jockl
must go to jail)
(7), (8), and (9) contain modals which have a
circumstantial interpretation:
(7) Jockl must sneeze.
(in view of the present state of his nose
etc., Jockl must sneeze)
(8) Jockl can lift the rock.
(given the weight of the rock and the
condition of Jockls muscles etc., Jockl
can lift this rock)
(9) Jockl couldnt see the train arrive.
(given that Jockl is short sighted and the
train was far away, Jockl couldnt see the
train arrive)
Sentences (5) to (9) are accompanied by a
paraphrase spelling out how the modal in
each sentence is to be understood. The modal
in (5) means necessary in view of the avail-
able evidence. The must in (6) means nec-
essary in view of the law. The different oc-
currences of can in (7) to (9) mean possible
given the relevant circumstances.
You will have noted that each of the par-
aphrases given contains itself a modal. What
do those modals mean? Take the paraphrase
for sentence (5). In this paraphrase, must
doesnt mean necessary in view of the avail-
able evidence. If it did, the phrase in view of
the available evidence would be redundant.
The modal in the paraphrase for sentence (5),
then, is a neutral sort of modal, and so are
the modals in the other paraphrases. Neutral
modals are not ambiguous. They come with
a phrase like in view of ... or given that ...
specifying the kind of modality involved.
Non-neutral modals lack such an in view of
... or given that ... phrase. Hence one and the
same expression is open to a variety of inter-
pretations. The existence of neutral modals
suggests that non-neutral modals are not truly
ambiguous. They just need a piece of infor-
mation to be provided by the context of use.
The only difference between neutral and non-
neutral modals, then, is that the kind of mo-
dality is linguistically specified in the former,
but provided by the non-linguistic context in
the latter. Modality is always relative modal-
ity. This was clearly seen by C. S. Peirce:
... first let me say that I use the word information
to mean a state of knowledge, which may range
from total ignorance of everything except the
meanings of words up to omniscience; and by in-
formational I mean relative to such a state of
knowledge. Thus by informationally possible, I
mean possible so far as we, or the person considered
29. Modality 641
Definition 1
must
f
= {w W:
f
follows from f(w)}
can
f
= {w W:
f
is compatibel with
f(w)}
According to these definitions, the proposi-
tion expressed by my utterance of sentence
(10)
(10) Jockl must have been the murderer
(in view of what we know).
is true in a world w if and only if it follows
from what we know in w that Jockl is the
murderer. And the proposition expressed by
my utterance of sentence (11)
(11) Jockl might have been the murderer
(in view of what we know).
is true in a world w if and only if it is com-
patible with what is known in w that Jockl is
the murderer.
The analysis correctly predicts that modal
statements of the sort we have considered so
far are contingent, they are neither necessarily
true nor necessarily false. That Jockl must
have been the murderer (in view of what we
know) is a fact of our world, but it is not a
necessary truth. Had our knowledge been dif-
ferent, it might not have implied anymore
that Jockl is the murderer.
The analysis also tells us that the meaning
of must is related to the meaning of can in a
certain way. Must and can are duals of each
other (and so are must and might, necessarily
and possibly). This means that the proposi-
tions expressed by the following two sentences
are logically equivalent (for a given conver-
sational background):
(12)
a. We must rehearse for the play.
b. We cannot not rehearse for the play.
If it is necessary to rehearse for the play, then
it is not possible not to rehearse for the play.
Likewise, the propositions expressed by the
following two sentences are logically equiva-
lent (for a given conversational background):
(13)
a. We can rehearse for the play.
b. Its not the case that we must not
rehearse for the play.
If it is possible to rehearse for the play, then
it is not necessary not to rehearse for the play.
So far, our analysis isnt really any different
from the customary analysis of modals in
terms of accessibility relations. (See Hughes
& Cresswell 1968 or Bull & Segerberg 1984
for good introductions and further refer-
Logical consequence
A proposition p follows from a set of prop-
ositions A iff p is true in all worlds of W in
which all propositions of A are true.
Consistency
A set of propositions A is consistent iff there
is a world in W where all propositions of A
are true.
Logical Compatibility
A proposition p is compatible with a set of
propositions A iff A {p} is consistent.
Conversational backgrounds
A conversational background is the sort of
entity denoted by phrases like what the law
provides, what we know etc. Take the phrase
what the law provides. What the law provides
is different from one possible world to an-
other. And what the law provides in a partic-
ular world is a set of propositions. Likewise,
what we know differs from world to world.
And what we know in a particular world is a
set of propositions. The denotation of what
the law provides will then be that function
which assigns to every possible world the set
of propositions p such that the law provides
that p in that world. And the denotation of
what we know is that function which assigns
to every possible world the set of propositions
we know in that world. Quite generally, con-
versational backgrounds are functions which
assign to every member of W a subset of the
power set of W.
We are now in the position to make a first
attempt at writing down what the meaning of
modals like must, or can might be (parallel
analyses would be given to other modal words
like might, necessarily or possibly). Syntacti-
cally, modal words are sentence operators at
some level of logical form. If you prefix a
sentence with a modal you get another sen-
tence. The result expresses a proposition once
a conversational background has been pro-
vided by the context of use. Where is any
sentence and f is any conversational back-
ground, let us write
f
for the proposition
expressed by with respect to f. If contains
a modal, the proposition expressed by will
crucially depend on the parameter f. If
doesnt contain a modal, f does not have any
work to do. That is, The roof is falling down
f
is the set of possible worlds in which the roof
is falling down. For reasons of simplicity, we
will not deal with cases where a sentence may
contain several modals each requiring a dif-
ferent conversational background. (See
Kratzer 1978 for a more dynamic interpre-
tation.) For any sentence a and any conver-
sational background f we have:
642 VII. Semantik der Funktionswrter
roughly goes as follows:
Judgments
Let us imagine a country where the only
source of law is the judgments which are
handed down. There are no hierarchies of
judges, and all judgments have equal weight.
There are no majorities to be considered.
There is one judgment which provides that
murder is a crime. Never in the whole history
of the country has anyone dared to attack
this judgment. There are other judgments,
however. Sometimes, judges have not agreed.
Here is an example of such a disagreement:
Judge A decided that owners of goats are
liable for damage their animals inflict on
flowers and vegetables. Judge B handed down
a judgment providing that owners of goats
are not liable for damage caused by their
animals. Owners of gardens have to construct
adequate fencing. This means that the set of
propositions corresponding to the judgments
handed down in the country we are consid-
ering is an inconsistent set of propositions.
The standard analysis cannot cope with
such a situation. It would predict that (given
our scenario) the propositions expressed by
the following two sentences should both be
true:
(14) in view of what the judgments provide
a. Murder is necessarily a crime.
b. Murder is necessarily not a crime.
On the other hand, the propositions expressed
by the following two sentences should both
be false:
(15) in view of what the judgments provide
a. Owners of goats are possibly liable
for damage caused by their animals.
b. Owners of goats are possibly not li-
able for damage caused by their an-
imals.
Since the set of propositions which form the
content of the law in the world under consid-
eration is inconsistent, every proposition fol-
lows from it, and no proposition is compati-
ble with it. These consequences are all the
more annoying since we have clear intuitions
as to what should and should not come out
true in our case: Murder must be a crime,
and goat owners might or might not be liable
for damage caused by their animals.
3.2Conditionals
Conditionals are another area where the flaws
of the standard analysis make their presence
unpleasantly felt. A good example is the so
called Samaritan Paradox of deontic logic.
(There is an extensive literature on the inter-
action of deontic modal operators and con-
ences.) Let us see why. An accessibility rela-
tion is a binary relation on the set of all
possible worlds. Intuitively, accessibility re-
lations correspond to notions like is episte-
mically accessible from, is deontically acces-
sible from etc. A world w is epistemically
accessible from a world w if and only if w is
compatible with everything we know in w. A
world w is deontically accessible from a
world w if and only if w is compatible with
everything the law provides in w. For any
sentence a and any accessibility relation R,
we have:
Definition 2
must
R
=
{w W: w
R
, for all w such
that wRw}
can
R
={w W: w
R
, for some w
such that wRw}
Note now that every conversational back-
ground f uniquely determines an accessibility
relation R
f
as follows:
Definition 3
For all w,w W: wR
f
w iff w f(w)
This means that we could just as well specify
the meaning of must and can in terms of the
accessibility relation determined by the con-
versational background under consideration.
For any sentence a and any conversational
background f, we might have the following
two definitions which are equivalent to the
ones given above (definition 1):
Definition 4
must
f
=
{w W: w
f
, for all w such
that wR
f
w}
can
f
= {w W: w
f
, for some w such
that wR
f
w}
Let us briefly stop here, and summarize what
we have accomplished so far. We have been
looking at a semantic analysis of modals
which ultimately boils down to the analysis
of modality familiar from modal logic (let us
call this analysis the standard analysis). The
standard analysis correctly accounts for the
relativity of modality, the contingency of mo-
dal statements, and the duality of must and
can (and similar pairs). In the remainder of
this contribution, I am going to point out
some shortcomings of the standard analysis
and make a different proposal (originally
made in Kratzer 1981).
3. Some Shortcomings of the
Standard Analysis
3.1Inconsistencies
In Kratzer (1977), I consider a case which
29. Modality 643
On the standard analysis of modality, the
notion of, say, possibility is captured through
the notion of logical compatibility. Now a
proposition is or isnt compatible with a set
of propositions. It cannot be more or less
compatible. Or barely compatible, or easily
compatible. The standard analysis, then, can-
not cope with graded notions of possibility.
4. Graded Modality in the Epistemic
Domain
To get a better understanding of what is in-
volved in graded modality, let us take a closer
look at modal notions in one selected domain,
the domain of epistemic modality. The ex-
ample we are going to examine is from
Kratzer (1981).
The murder
Girgl has been murdered on his way home.
The police begin an investigation. Certain
conclusions may be drawn from what is
known about the circumstances of the crime.
Utterances of the following sort might have
occurred in such a situation:
(19)
a. Michl must be the murderer.
b. Michl is probably the murderer.
c. There is a good possibility that Michl
is the murderer.
d. Michl might be the murderer.
e. There is a slight possibility that Michl
is the murderer.
f. There is a slight possibility that Michl
is not the murderer.
g Michl is more likely to be the mur-
derer than Jakl.
The police inspector does not know what the
real world looks like in every detail. Yet he
can draw conclusions from the evidence avail-
able to him. At any time, this evidence is
compatible with a set of worlds which, for all
he knows, could be the real world. These
worlds are the epistemically accessible worlds.
Some worlds among the epistemically acces-
sible worlds are more far-fetched than others.
A world where Jakl is the murderer is much
more far-fetched than a world where Michl
has killed Girgl. Michl has never really liked
Girgl, but Jakl got along very well with him.
Even more far-fetched are worlds where
someone from another town, from another
country, from another continent, or another
planet has murdered Girgl. Far-fetched in
which respect? With respect to what is actu-
ally the case in the real world? This doesnt
seem right since, sometimes, things which are
almost impossible turn out to be true. This is
ditionals. See e. g. qvist 1984 for an over-
view and detailed references. See also Feld-
man 1986.)
Here is a version of the paradox: Suppose
that the law provides that nobody be mur-
dered. Suppose furthermore that the law pro-
vides that if a murder occurs, the murderer
will go to jail. The following two sentences
give the relevant content of the law:
(16)
a. No murder occurs.
b. If a murder occurs, the murderer will
go to jail.
Given the standard analysis of modality and
the standard analysis of conditionals (in terms
of a two-place connective interpreted as ma-
terial implication), we predict that (for a con-
versational background like in view of what
the law provides) the propositions expressed
by the following sentences should all be true:
(17) It is necessary that
a. if a murder occurs, the murderer will
go to jail.
b. if a murder occurs, the murderer will
be knighted.
c. if a murder occurs, the murderer will
be given $ 100.
d. if a murder occurs, the murderer will
be fined $ 100.
...
While the set of propositions which constitute
the content of what the law provides in our
scenario is consistent, it has nevertheless
strange implications. It implies any old con-
ditional whose antecedent is the proposition
a murder occurs. At this point, we dont yet
know which of our assumptions has to be
blamed for this ugly consequence. Is it the
standard analysis of modals, or is it the stan-
dard analysis for conditionals? We will see
shortly that an adequate analysis for modality
will naturally lead to a very different analysis
of conditionals.
3.3Graded Notions of Modality
Modal words are gradable in many ways.
Here are a few examples.
(18)
a. It is barely possible to climb Mount
Everest without oxygen.
b. It is easily possible to climb Mount
Toby.
c. They are more likely to climb the
West Ridge than the Southeast Face.
d. It would be more desirable to climb
the West Ridge by the Direct Route.
644 VII. Semantik der Funktionswrter
The definition is in the spirit of Lewis (1981).
Roughly, it says that a proposition is a ne-
cessity if and only if it is true in all accessible
worlds which come closest to the ideal estab-
lished by the ordering source. The definition
would be less complicated if we could quite
generally assume the existence of such clos-
est worlds.
Definition 7
A proposition p is a good possibility
in a world
w with respect to a modal base f and an
ordering source g iff there is a world
u f(w) such that for all v f(w): if
v
g(w)
u, then v p.
Definition 8
A proposition p is a possibility in a world w
with respect to a modal base fand an ordering
source g iff -p is not a necessity in w with
respect to f and g.
Definition 9
A proposition p is
at least as good a possibility
as a proposition q in a world w with respect
to a modal base f and an ordering source g
iff for all u such that u f(w) and u q there
is a v f(w) such that v
g(w)
u and v p.
Definition 9 requires that for every acces-
sible q-world there is an accessible p-world
which is as least as close to the ideal.
Definition 10
A proposition p is a better possibility than a
proposition q in a world w with respect to a
modal base f and an ordering source g iff p
is at least as good a possibility as q but q is
not at least as good a possibility as p in w
with respect to f and g.
Definition 11
A proposition p is a weak necessity in a world
w with respect to a modal base f and an
ordering source g iff p is a better possibility
than -p in w with respect to f and g.
Definition 12
A proposition p is a slight possibility in a
world w with respect to a modal base f and
an ordering source g iff p is a possibility and
-p is a weak necessity in w with respect to f
and g.
Let us relate these modal notions to the
modal expressions we encountered in the sen-
tences (19a) to (19g):
necessity must
weak necessity probably
good possibility there is a good possi-
bility that
possibility might
what usually happens in good detective sto-
ries. The most unlikely candidate turns out
to be the murderer. If it is pretty far-fetched
that someone from another continent or an-
other planet has killed Girgl, then it is because
such events dont correspond to the normal
course of events. Normally you need a motive
for murdering someone. A man from another
planet is likely to lack such a motive. It
couldnt have been for money. There is no
evidence that Girgl was robbed. All his money
was found on him. In view of the normal
course of events, it is far-fetched that some-
body from another planet murdered Girgl.
In this example, the epistemic conversa-
tional background (in view of the available
evidence) determines for every world the set
of worlds which are epistemically accessible
from it. It forms the modal base. There is a
second conversational background involved
in the above pieces of modal reasoning. We
may want to call it a stereotypical conversa-
tional background (in view of the normal
course of events). For each world, the second
conversational background induces an order-
ing on the set of worlds accessible from that
world. It functions as the ordering source.
Quite generally, a set of propositions A
induces a partial ordering
A
on W in the
following way (Lewis 1981):
Definition 5
For all w, w W, for any A (W):
w
A
w iff {p: p A and w p} {p: p A
and w p}
A world w is at least as close to the ideal
represented by A as a world w iff all prop-
ositions of A which are true in w are true in
w as well.
We can now define an interesting set of
modal notions which correspond to the modal
expressions occurring in the sentences (19a)
to (19g). These modal notions are doubly rel-
ative. They depend on two conversational
backgrounds. (The definition of modal no-
tions given here differ from the ones presented
in Kratzer 1981. Id like to thank Fred Land-
man for pointing out a mistake in Kratzer
1981 which is corrected here.)
Definition 6
A proposition p is a necessity in a world w
with respect to a modal base f and an ordering
source g iff the following condition is satis-
fied:
For all u f(w) there is a v f(w) such
that v
g(w)
u and
for all z f(w): if z
g(w)
v, then z p.
29. Modality 645
Stokhof 1975, Lyons 1977, Kratzer 1981):
(20)
a. She climbed Mount Toby.
b. She must have climbed Mount Toby.
These utterances present a problem if we as-
sume that must receives a purely epistemic
interpretation, the usual approach within the
confines of the standard analysis. On our
approach, a purely epistemic interpretation
would be one where the modal base is episte-
mic (a function which assigns to every pos-
sible world a set of propositions which con-
stitute a body of knowledge in that world),
while the ordering source is the empty con-
versational background (the function which
assigns the empty set to every possible world).
If (20b) had a purely epistemic interpretation,
the proposition expressed by (20b) would im-
ply the proposition expressed by (20a) but
not vice versa. That is, (20b) would make a
stronger claim than (20a). Since this is con-
trary to our intuitions, we have good reasons
to assume that must in (20b) shouldnt be
interpreted as a pure epistemic modal. In our
framework this amounts to saying that the
ordering source is not empty. In uttering (20b)
rather than (20a), I convey that I dont rely
on known facts alone. I use other sources of
information which are more or less reliable.
These other sources may include facts con-
cerning the normal course of events, a map,
a tourist guide or hearsay. If the ordering
source for the modal in (20b) is, say, a con-
versational background assigning to every
world the set of propositions which represent
the normal course of events in that world,
then the proposition expressed by (20b) will
not imply the proposition expressed by (20a)
anymore. There are worlds w such that
among all the worlds which are compatible
with what we know in w, those which come
closest to the normal course of events in w
dont include w itself (never mind that there
may not be any closest worlds of the re-
quired kind). (The phenomenon illustrated by
(20a) and (20b) has been used to argue for a
treatment of modality as proposed in data
semantics (Veltman 1984, Landman 1986). In
data semantics, (20b) doesnt imply (20a). But
unfortunately, (20a) is predicted to imply
(20b).)
5. Two Basic Kinds of Modal
Reasoning
In modal reasoning, a conversational back-
ground may function as a modal base or as
an ordering source. The modal base deter-
slight possibility there is a slight possi-
bility that
better possibility is more likely than
This list is a short way of giving meaning
rules of the following sort:
probably
f,g
=
{w W:
f,g
is a weak ne-
cessity in w with respect to
f and g}
Sentences are now quite generally interpreted
with respect to two parameters. One fixing
the modal base, the other one fixing the or-
dering source.
Given meaning rules of this sort, we obtain
a number of predictions concerning relations
between the propositions expressed by utter-
ances of sentences (19a) to (19g) (repeated
here for convenience):
(19)
a. Michl must be the murderer.
b. Michl is probably the murderer.
c. There is a good possibility that Michl
is the murderer.
d. Michl might be the murderer.
e. There is a slight possibility that Michl
is the murderer.
f. There is a slight possibility that Michl
is not the murderer.
g. Michl is more likely to be the mur-
derer than Jakl.
Keeping modal base and ordering source con-
stant, the proposition expressed by (19a) im-
plies the proposition expressed by (19b). If a
proposition is necessary, it is also probable
(though not merely probable). The propo-
sition expressed by (19b) implies the propo-
sition expressed by (19c). If a proposition is
probable it is also a good possibility. The
proposition expressed by (19c) implies the
proposition expressed by (19d). If a propo-
sition is a good possibility, then it is a possi-
bility. The proposition expressed by (19e) im-
plies the proposition expressed by (19d). If a
proposition is a slight possibility, it is never-
theless a possibility. The propositions ex-
pressed by (19a) and (19f) are incompatible
with each other. If a proposition is a necessity
its negation cannot be a possibility, not even
a slight one. The proposition expressed by
(19f) is compatible with the propositions ex-
pressed by (19b, c, d, e). Furthermore, we
predict that if Michl is more likely to be the
murderer than Jakl, and Jakl is more likely
to be the murderer than Jockl, then Michl is
more likely to be the murderer than Jockl.
It has often been observed that I make a
stronger claim in uttering (20a) than in utter-
ing (20b) (Karttunen 1972, Groenendijk &
646 VII. Semantik der Funktionswrter
facts. Epistemic modality is the modality of
curious people like historians, detectives, and
futurologists. Circumstantial modality is the
modality of rational agents like gardeners,
architects and engineers. A historian asks
what might have been the case, given all the
available facts. An engineer asks what can be
done given certain relevant facts.
We have seen in the preceding section how
epistemic modal bases may interact with non-
empty ordering sources. In the following sec-
tion we will investigate the interplay between
circumstantial modal bases and different sorts
of normative ordering sources.
6. Ordering Sources for
Circumstantial Modal Bases
Like all conversational backgrounds func-
tioning as modal bases, circumstantial con-
versational backgrounds are realistic conver-
sational backgrounds. They assign to every
possible world a set of facts of that world.
Formally, a realistic conversational back-
ground is a function f such that for all w W,
w f(w). The empty conversational back-
ground will now come out as a limiting case
of a realistic one.
Circumstances create possibilities: the set
of possible worlds compatible with them.
These worlds may be closer or further away
from
what the law provides
what is good for you
what is moral
what we aim at
what we hope
what is rational
what is normal
what you recommended
what we want
...
To all of those ideals correspond normative
conversational backgrounds. Those conver-
sational backgrounds can function as order-
ing sources for a circumstantial modal base.
As a result, we get graded notions of modality
as manifested in the following sentence:
(22) Given your state of health youd be bet-
ter off going to Davos than to Amster-
dam.
A typical utterance context for (22) would be
a situation where I talk to someone with
tuberculosis. The persons state of health is
not very good and the climate in Amsterdam
would be detrimental to her. On the other
mines the set of accessible worlds (for a given
world). The ordering source imposes an or-
dering on this set.
In English, as in other languages, we have
to distinguish two kinds of modal bases. The
difference can be illustrated by the following
example. Consider sentences (21a, b):
(21)
a. Hydrangeas can grow here.
b. There might be hydrangeas growing
here.
The two sentences differ in meaning in a way
which is illustrated by the following scenario.
Hydrangeas
Suppose I acquire a piece of land in a far
away country and discover that soil and cli-
mate are very much like at home, where hy-
drangeas prosper everywhere. Since hydran-
geas are my favorite plants, I wonder whether
they would grow in this place and inquire
about it. The answer is (21a). In such a situ-
ation, the proposition expressed by (21a) is
true. It is true regardless of whether it is or
isnt likely that there are already hydrangeas
in the country we are considering. All that
matters is climate, soil, the special properties
of hydrangeas, and the like. Suppose now that
the country we are in has never had any
contacts whatsoever with Asia or America,
and the vegetation is altogether different from
ours. Given this evidence, my utterance of
(21b) would express a false proposition. What
counts here is the complete evidence available.
And this evidence is not compatible with the
existence of hydrangeas.
(21a) together with our scenario illustrates
the pure circumstantial reading of the modal
can. The pure circumstantial reading of mod-
als is characterized by a circumstantial modal
base and an empty ordering source. (21b)
together with our scenario illustrates the ep-
istemic reading of modals. The epistemic read-
ing of modals is characterized by an epistemic
modal base (the ordering source may or may
not be empty here). Epistemic and circum-
stantial modal bases are both realistic modal
bases. That is, both kinds of conversational
backgrounds assign to every possible world a
set of propositions which are true in that
world. Yet circumstantial and epistemic con-
versational backgrounds involve different
kinds of facts. In using an epistemic modal,
we are interested in what else may or must
be the case in our world given all the evidence
available. Using a circumstantial modal, we
are interested in the necessities implied by or
the possibilities opened up by certain sorts of
29. Modality 647
Type 2 worlds in which murder is a crime and
goat owners are liable for damage
caused by their animals
Type 3 worlds in which murder is a crime and
goat owners are not liable for damage
caused by their animals
Type 1 worlds are further away from the ideal
(set by the ordering source for the worlds we
are considering) than type 2 or type 3 worlds.
Type 2 worlds and type 3 worlds are those
worlds which come closest to the ideal. Take
their union. In all the worlds in the resulting
set murder is a crime. There are some worlds
in which goat owners are liable, and there are
others in which they are not. If must is inter-
preted as necessity and can as possibility in
the sense of definitions 6 and 8, it follows
that the propositions expressed by (14a),
(15a), and (15b) are true, given our scenario,
but the proposition expressed by (14b) comes
out false (the sentences are repeated below
from section 3). These predictions square well
with our intuitions.
(14) in view of what the judgments provide:
a. Murder is necessarily a crime.
b. Murder is necessarily not a crime.
(15) in view of what the judgments provide:
a. Owners of goats are possibly liable
for damage caused by their animals.
b. Owners of goats are possibly not li-
able for damage caused by their an-
imals.
Let us now look at another example. The
example involves what has been called prac-
tical inferences. (See e. g. Anscombe 1957, von
Wright 1963, Kenny 1966, Feldman 1986.)
Suppose that the whole content of my de-
sires consists of exactly three propositions. I
want to become popular, I dont want to go
to the pub (more precisely: I want not to go
to the pub), and I want to hike in the moun-
tains. All three of my desires have equal
weight. As a matter of fact, I live in a world
where it is an unalterable fact that I will
become popular if and only if I go to the pub.
I ask you: Given the unalterable facts and my
desires, what should I do? (Note that I am
not asking for a recommendation. I am asking
for an inference. All that matters are the
relevant facts and my desires.) You might give
me any of the following answers, for example.
(23) In view of the relevant facts and your
desires:
a. You should go to the pub.
b. You should not go to the pub.
hand, the climate in Davos is well-known for
its soothing effect on the lungs. Given the
relevant facts (modal base) and what is good
for the person (ordering source), going to
Davos is a better option than going to Am-
sterdam. The modal notion on which my
statement is based is the notion of a better
possibility, which we discussed in connection
with epistemic modality. What is different are
the conversational backgrounds involved. In
particular, we always have a circumstantial
modal base when we speak about options.
A circumstantial modal base is also re-
quired by any sort of inherent modality as
illustrated by sentence (4) above. And any
modality expressed by the suffixes -ible or
-able will likewise have a circumstantial mo-
dal base.
7. Overcoming Inconsistencies
We have seen that letting the interpretation
of sentences with modals depend on two pa-
rameters rather than only one gives us suit-
able graded modal notions, thereby overcom-
ing one of the shortcomings of the standard
analysis. We will now see that the very same
device avoids all problems with inconsisten-
cies, thereby overcoming another drawback
of the standard analysis.
Recall the example we discussed above. We
are in a country practicing something like
English Common Law. We have one judg-
ment concerning murder, which has never
been called into question. And we have two
judgments concerning the liability of goat
owners, which happen to contradict each
other. We had clear intuitions as to what is
necessary or possible in view of what the law
provides in the country under consideration.
Yet the standard analysis could not account
for the case. On the new analysis, what the
law provides would function as ordering
source, being a normative conversational
background. Lets assume that the modal
base is empty (not a necessary assumption).
If the modal base is empty, it follows that for
each world, the set of accessible worlds is the
set of all possible worlds. For each world
compatible with our scenario, all possible
worlds will now be ordered as to how close
they come to what the law provides in that
world. There is no world in which all three
judgments are true, of course. The set of all
worlds can be partitioned into three mutually
disjoint subsets:
Type 1 worlds in which murder is not a crime
648 VII. Semantik der Funktionswrter
sets and you have the set of those accessible
worlds which come closest to what I want. In
all of those worlds, I hike in the mountains.
In some of them I go to the pub and become
popular. In others I dont become popular
and dont go to the pub. The right predictions
for sentences (23ae) follow once we estab-
lish the right correspondences. Should corre-
sponds to necessity, could corresponds to pos-
sibility (in the sense of definitions (6) and (8)).
It seems, then, that the new analysis is indeed
capable of successfully dealing with inconsis-
tencies. Our next step will now consist in
showing that it offers a solution to the Sa-
maritan Paradox and similar problems.
8. Conditional Modality
Consider the following sentence:
(24) If a murder occurs, the jurors must con-
vene
(in view of what the law provides).
Given the standard analysis of modals and
the standard analysis of conditionals in terms
of a two place connective, we have two op-
tions for formalizing this sentence.
Option 1
[A murder occurs] must [the jurors con-
vene]
Option 2
Must [a murder occurs the jurors convene]
Neither options is viable. We know already
that option 2 leads to the Samaritan Paradox.
So option 2 must be discarded. Option 1 is
just as bad. On this analysis, the proposition
expressed by (24) is automatically true if no
murder occurs in the world under consider-
ation. And if a murder does indeed occur, the
sentence is predicted to be true just in case it
follows from what the law provides that the
jurors convene. But the whole conditional and
its antecedent could very well be true without
the law implying any such thing. The example
suggests that we should think about condi-
tionals in a very different way. Suppose we
interpret conditional sentences like (24) as
follows:
Definition 13
if , must
f,g
= must
f,g
, where for all
w W, f(w) = f(w) {
f,g
}
The analysis implies that there is a very close
relationship between if-clauses and operators
like must. They are interpreted together. For
each world, the if-clause is added to the set
of propositions the modal base assigns to that
c. You could refrain from going to the
pub and still become popular.
d. You could go to the pub.
e. You could also not go to the pub.
f. You should hike in the mountains.
In a world of the sort described above, the
propositions expressed by (23a, b, c) are false.
The propositions expressed by (23d, e, f) are
true. The modal base we are dealing with here
is a circumstantial one (in view of the rele-
vant facts). The ordering source is bouletic
(in view of what I want). Such combinations
of conversational backgrounds are typical for
practical inferences. In our case, both con-
versational backgrounds assign consistent
sets to the worlds compatible with our sce-
nario. The facts are consistent, facts always
are. And what I want is consistent, too. Yet
there is a conflict between the relevant facts
and what I want. Not everything I want can
be realized.
The standard analysis cannot account for
cases of this sort. Lacking the distinction be-
tween ordering source and modal base, it
would have to lump together facts and de-
sires. This would simply result in an inconsis-
tent set. All necessity statements would come
out true. All possibility statements would
come out false. On the new analysis, the rel-
evant facts form the modal base. What I want
constitutes the ordering source. For the
worlds we are considering, all the accessible
worlds are worlds in which I become popular
if and only if I go to the pub. These worlds
are now ordered as to their closeness to what
I want. The set of accessible worlds can be
partitioned into four pairwise disjoint subsets:
Type 1worlds in which I dont hike in the
mountains, dont go to the pub, and
dont become popular
Type 2worlds in which I dont hike in the
mountains, do go to the pub, and
become popular
Type 3worlds in which I do hike in the
mountains, dont go to the pub, and
dont become popular
Type 4worlds in which I do hike in the
mountains, do go to the pub, and do
become popular
Type 1 worlds and type 2 worlds are worlds
in which only one of my wishes is realized.
They are thus further away from what I want
than type 3 or type 4 worlds. Type 3 worlds
and type 4 worlds are as close to what I want
as we can ever get. Take the union of the two
29. Modality 649
then contain a non-overt necessity operator.
Their logical form would be as specified in
definition 13. We would obtain different kinds
of conditionals in specifying the parameters f
and g in different ways. Material implication
would be the result of an empty ordering
source and a totally realistic modal base. A
conversational background is totally realistic
if it assigns to every world a set of facts which
characterize it completely (a function f such
that for every w W, f(w) = {w}). Strict im-
plication would arise under the impact of an
empty modal base and an empty ordering
source. In Kratzer (1981), I show that we can
even consider counterfactual conditionals as
special cases of conditionals of the sort that
fall under definition 13. They would be char-
acterized by an empty modal base and a to-
tally realistic ordering source.
9. The Semantic Field of Modal
Expressions
In our preceding discussion, we showed that
an interpretation of modals which is relativ-
ized to two parameters is able to avoid three
shortcomings of the standard analysis. The
improved analysis makes us expect that dif-
ferences between modal expressions in differ-
ent languages can be captured in terms of
three dimensions:
Dimension 1modal force: necessity, weak ne-
cessity, good possibility, possi-
bility, slight possibility, at least
as good a possibility, better pos-
sibility, maybe others
Dimension 2modal base: circumstantial ver-
sus epistemic (possibly further
differentiations within these
groups, like knowledge coming
from certain sources, facts of a
special kind)
Dimension 3ordering source: deontic, bou-
letic, stereotypical etc.
Not every kind of modal base can combine
with every kind of ordering source. Epistemic
modal bases take ordering sources related to
information: What the normal course of
events is like, reports, beliefs. Circumstantial
modal bases take ordering sources related to
laws, aims, plans, wishes. Within these con-
straints, there are many possibilities. As an
illustration, let us look at some German mod-
als. The following list gives an overview of
their idiosyncratic restrictions.
world. This means that for each world, the
if-clause has the function of restricting the set
of worlds which are accessible from that
world.
Let us now return to example (24). The
example involves a deontic conversational
background. Being normative, this conver-
sational background constitutes the ordering
source. The modal base is initially empty, no
factual premises have to be considered. The
effect of the if-clause is to change the modal
base in a systematic way. For every world,
the new set of accessible worlds is the set of
all worlds in which a murder occurs. The
proposition expressed by (24) is then true in
a world w just in case the jurors convene in
all accessible worlds which come closest to
what the law provides in w. (Roughly. We
cannot always assume that there are such
closest worlds.) Given such an analysis, it is
easy to see that the Samaritan Paradox can-
not arise. Recall the structure of the paradox.
In our case, we would assume that in some
world w, the whole content of what the law
provides in w can be given by the following
two sentences (where the conditional in (25b)
is to be interpreted as material implication):
(25)
a. No murder occurs.
b. If a murder occurs, the jurors con-
vene.
We have just seen that the proposition ex-
pressed by (24) is predicted to be true in w
just in case the jurors convene in all those
worlds in which a murder occurs and which
come closest to what the law provides in w.
We are only allowed to consider worlds in
which a murder occurs. Hence we have to
drop the part of the law requiring that no
murder occur. There are worlds in which a
murder occurs and in which the proposition
expressed by (25b) is true. In all of those
worlds, the jurors convene. But these worlds
are precisely the worlds in which a murder
occurs and which come closest to what the
law provides in w. But then the proposition
expressed by (24) is correctly predicted to be
true in w.
The analysis given in definition 13 can be
extended to other kinds of conditionals. Con-
ditionals with other modals in the consequent,
for example (like probability conditionals). In
Kratzer (1978), I argue that we should treat
bare conditional sentences like
(26) If she has seen the place, she loves it.
as implicitly modalized. These sentences would
650 VII. Semantik der Funktionswrter
ing sentences from Chomsky (1981):
(28)
a. *The books were sold without PRO
reading them.
b. The books can be sold without PRO
reading them.
Williams suggests that the reason why PRO
can be controlled in (28b), but not in (28a) is
partly due to the fact that the root modal can
has an implicit argument which can act as a
controller. In this case, the implicit argument
would be the one for whom it is possible to
sell the books. It is interesting to note that
the same sentence with an epistemic modal is
as bad as (28a):
(28)
c. *The books might have been sold
without reading them.
The examples discussed above suggest that
the distinction between modals with circum-
stantial and modals with epistemic modal ba-
ses which is at the heart of our proposal may
correlate with a difference in argument struc-
ture.
There is an enormous literature concerning
the expression of modality in different lan-
guages (see Palmer 1986 for an overview and
references). Since there is no consensus as to
the categorization of different types of mo-
dalities, the data offered dont always con-
tribute to a coherent picture of the semantics
of modal words.
10. Short Bibliography
Anscombe 1957 qvist 1984 Bull/Segerberg
1984 Chomsky 1981 Feldman 1986 Groenen-
dijk/Stokhof 1975 Hughes/Cresswell 1968
Jackendoff 1972 Kenny 1966 Katz 1987
Kratzer 1977 Kratzer 1978 Kratzer 1981 Land-
man 1986 Lewis 1981 Lyons 1977 Palmer
1986 Peirce 1933 Perlmutter 1971 Ross 1969a
Veltman 1984 Williams 1985 von Wright 1963
Angelika Kratzer, Amherst,
Massachusetts (USA)
modal force modal base ordering
source
muss necessity no restric-
tions
no restric-
tions
kann possibility no restric-
tions
no restric-
tions
darf possibility circumstan-
tial
deontic, tele-
ological (in
view of cer-
tain aims)
soll
1
necessity circumstan-
tial
bouletic (in
view of cer-
tain wishes)
soll
2
necessity empty hearsay
wird weak neces-
sity
epistemic doxastic (in
view of cer-
tain beliefs)
drfte weak neces-
sity
epistemic stereotypical
In the earlier transformational literature,
we often find a distinction between root and
epistemic modality (Perlmutter 1971, Ross
1969a, Jackendoff 1972). On our proposal,
this distinction has a direct counterpart. Root
modality comprises all occurrences of modals
with a circumstantial modal base. Epistemic
modality comprises all occurrences of modals
with an epistemic modal base. Ross and Perl-
mutter both assumed that modals are verbs
embedding a sentence. Epistemic modals were
claimed to be intransitive, root modals were
claimed to be transitive. Evidence of the fol-
lowing kind was given for the transitivity of
root modals:
(27)
a. Die Kinder drfen gerne drauen
schlafen.
b. Die Kinder drften gerne drauen
schlafen.
Drfen is a root modal. (27a) says that the
person who gives permission for the children
to sleep outside is happy to do so. Drften is
an epistemic modal. (27b) says that it is likely
that the children will enjoy sleeping outside.
On Perlmutters and Ross analysis, root may
has an implicit argument referring to the one
who gives permission. Williams (1985) arrives
at a similar conclusion discussing the follow-
30. Conditionals 651
30. Conditionals
(2) My hen hasnt laid any eggs today.
(3) The Cologne Cathedral will collapse to-
morrow.
If you believe that I wont lead you astray
and that for all I know, I told you the truth,
you conclude that I must believe that there is
some non-truth functional connection be-
tween the antecedent and the consequent of
(1).
A Gricean analysis of indicative condition-
als is appealing in that unlike so many
other accounts replacing material implication
it is able to explain why it is that material
implication has cropped up again and again
in the history of logic and mathematics. The
material implication interpretation would be
the interpretation of conditionals as soon as
we abstract away from certain principles reg-
ulating everyday conversation. It would be
an interpretation that is accessible to all of
us, not some arbitrary invention created for
the purposes of an excentric group of scien-
tists. Learning logic would consist in drop-
ping a few rules for cooperative interaction.
2. Gibbard
In Two Recent Theories of Conditionals
(1981), Allan Gibbard proves that any con-
ditional operator satisfying (4) and the
additional rather obvious principles (5) and
(6) is in fact material implication:
(4) p (q r) and (p & q) r are logically
equivalent.
(5) p q entails the corresponding material
implication, that is p q is false in all
worlds in which p is true and q is false.
(6) If q follows from p, then p q is a
logical truth.
(4) is a principle that holds for if ... then-
clauses in English. (7) and (8) are logically
equivalent:
(7) If you are back before eight, then if the
roast is ready, we will have dinner to-
gether.
(8) If you are back before eight and the roast
is ready, we will have dinner together.
Gibbards proof, then, seems to exclude any
sort of stricter implication as a candidate for
the interpretation of indicative conditionals
in English. It gives further support to a ma-
terial implication analysis in the spirit of
Grice.
1. Grice
2. Gibbard
3. The Gradual Decline of Material Implication
4. Indicative Conditionals as Modalized Con-
ditionals
5. Gibbards Proof Reconsidered
6. Grice Reconsidered
7. Conclusion
8. Short Bibliography
1. Grice
In his William James Lectures (1967), Paul
Grice defends an analysis of indicative con-
ditionals in terms of material implication. (If
p, then q is false if p is true and q is false.
Otherwise, if p, then q is true.) The observa-
tion that sometimes, there seem to be non-
truth functional reasons for accepting these
conditionals is explained by invoking conver-
sational implicatures adding to the meaning
proper of this construction. Consider a sen-
tence like (1) (see also Frege 1923):
(1) If my hen has laid eggs today, then the
Cologne cathedral will collapse tomorrow
morning.
On a Gricean account, (1) is interpreted as
material implication. My utterance of it, how-
ever, implicates that there is some connection
between my hen laying eggs and a possible
collapsing of the Cologne Cathedral. That is,
what I ultimately convey to my audience is
some stricter form of implication. Very
roughly, this implicature arises in the follow-
ing way: Suppose I just happen to know that
my hen laid eggs today as well as that the
Cologne cathedral will collapse tomorrow,
and these are my only grounds for uttering
(1). Given a material implication analysis,
what I said would be true. Although being
true, my utterance would be misleading. I
could have said:
(2) My hen has laid eggs today and the Co-
logne Cathedral will collapse tomorrow.
If I say (1) to you, you dont expect me to be
in the position of uttering (2). Hence you will
assume that I have other reasons for asserting
(1). What could these other reasons be? It
couldnt just be that I know that my hen
hasnt laid any eggs today. Or just that I am
convinced that the Cologne Cathedral will
collapse tomorrow. If this were so, I should
have uttered (2) or (3) respectively:
652 VII. Semantik der Funktionswrter
(18) Always, if a man buys a horse, he pays
cash for it.
(19) Most of the time, if a man buys a horse,
he pays cash for it.
There is some discussion in Lewis article as
to what the type of entity is that adverbs like
sometimes, always and most of the time quan-
tify over. For ease of exposition, let us assume
that these entities are events (this is not Lewis
view, but nothing hinges on that; arguments
in Partee 1984b and in Buerle & Egli 1985
suggest that some such assumption might be
more than just a convenient simplification).
If adverbs of quantification are sentence ad-
verbs and if indicative conditionals are for-
malized in the traditional way, we are led to
the following logical representations of (17)
to (19):
(20) There is an event e [if e is an event that
involves a man buying a horse, then e is
part of an event in which this man pays
cash for it]
(21) For all events e [if ... (e) ..., then ... (e)
...]
(22) For most events e [if ... (e) ..., then ...
(e) ...]
If some such analysis is the right analysis for
adverbs of quantification, then the very same
arguments that showed that material condi-
tionals cannot be part of a formalization of
sentences with nominal quantifiers will now
show that material conditionals cannot be
part of a formalization of sentences with ad-
verbial quantifiers. And this is indeed the
conclusion David Lewis draws. To see why,
take sentence (19). If its logical form were as
in (22) (with the conditional being interpreted
als material implication), we would predict,
for example, that it would be true in a world
with the following properties: There are al-
together a million events. Out of these, 2000
events involve a man buying a horse, and all
of these 2000 events involve payment by
check. Since all the events that are not horse
buyings by a man at all, satisfy the condi-
tional in (22), (22) and hence (19) are pre-
dicted to be true in this world.
Following Lewis (with the modifications
mentioned above), we might propose the fol-
lowing improved logical form for (22):
(23) [Most events e: e involves a man buying
a horse] e is part of an event in which
this man pays cash for the horse
(For Lewis, adverbs of quantification are un-
selective binders. Unselective binders are op-
3. The Gradual Decline of Material
Implication
The two preceding sections built a strong case
in favor of a material implication interpreta-
tion of indicative conditionals. This glorious
picture cannot withstand closer scrutiny,
however. The recent history of semantics can
be seen as a history of the gradual decline of
the material conditional. There was a time,
for example, when even sentences like (9) were
formalized with the help of an if ... then-
clause interpreted in the material mode:
(9) All porches have screens.
(10) For all x [if x is a porch, then x has
screens]
These times are gone. Formalizations like (10)
disappeared for reasons of generality. Real-
izing that (11) couldnt be formalized as (12)
(11) Some porches have screens
(12) There is an x [if x is a porch, then x has
screens]
was not yet deadly. But attempts to formalize
sentences like
(13) Most porches have screens.
(14) Many porches have screens.
(15) Few porches have screens.
made it very clear that material conditionals
had no role to play in the formalization of
sentences with quantifiers. Another two-place
connective, conjunction, was successful in the
case of (11), but then again was an absolute
failure with (13), (14) and (15). Paying close
attention to quantifiers like most, many and
few led to the theory of generalized quantifiers
within interpretational frameworks and to
the theory of restrictive quantification in the
representational tradition (see for example
Barwise and Cooper 1981, Cushing 1976,
McCawley 1981). On the latter account, we
have logical representations of the following
sort:
(16) [Most x: x is a porch] x has screens
Representations like (16) are interpreted in
such a way, that the clause x is a porch has
the function of restricting the domain of the
quantifier most. (16) is true in a world w, if
and only if most values for x that satisfy x is
a porch in w also satisfy x has screens in w.
For our material conditionals, worse was
yet to come. In Adverbs of Quantification
(1975a), David Lewis examines sentences like:
(17) Sometimes, if a man buys a horse, he
pays cash for it.
30. Conditionals 653
terpretation of the conditional, both formal-
izations are absurd. A sentence of the form
(26) is true whenever A is false. But Yogs
having black would not be sufficient for mak-
ing (24) true. Likewise, if Yog did indeed win,
this wouldnt mean that for that reason alone,
(25) would be true.
Taking (27) to be the formalization of (24)
and (25) would give us the following:
(28) 8/9-probably [if Yog had white, then Yog
won]
(29) 1/2-probably [if Yog lost, Yog had black]
And here is Grices paradox: Given that in
chess, not having black is having white, and
that if there are no draws, not losing is win-
ning, the two conditional sentences in (28)
and (29) are contrapositions of each other.
But then (assuming a material implication
interpretation), they are equivalent. How
come, two equivalent sentences can have dif-
ferent probabilities? I think we have to ex-
amine very carefully how we arrived at our
assignments of probabilities in the first place.
Reasoning for establishing the truth of (24):
There was a total of 100 games. This is our
universe of discourse. For the case at hand,
we only have to consider the games in which
Yog had white. This is what the if-clause tells
us to do. We are now left with 90 games. Out
of these, Yog won 80. These 80 games are 8/9
of the 90 games. Hence (24) is true.
Reasoning for establishing the truth of (25):
Our universe of discourse is as above. This
time, the if-clause of the conditional tells us
to consider only those games which Yog lost.
There are 20 such games. Out of these, Yog
had black in 10 cases. These 10 games are
half of the 20 games considered. Hence (25)
is true.
(Dont say: Thats just how we calculate
conditional probatilities. So what?. We have
to explain why conditionals and probability
operators interact in such an exceptional
way.
Lewis (1976) shows that there is no general
way of interpreting a two-place conditional
connective so that the probabilities of the
resulting conditionals equal the correspond-
ing conditional probabilities.)
What was the function of the if-clause in
these two pieces of reasoning? The answer
must sound familiar by now: The role of the
if-clause was to restrict the domain contex-
tually provided for the operator x-probably.
We expect then, that the logical form of (24)
and (25) should resemble those of the quan-
erators that bind every free variable in their
scope. A Lewis type logical form for (23)
would look as follows:
(23) Mostly, x is a man and y is a horse and
x buys y, x pays cash for y
Syntactically, (23) is a tripartite construction,
consisting of an unselective quantifier, a re-
strictive clause and a matrix clause. (23) is
true in a world w, iff every pair of individuals
that satisfies the restrictive clause in w also
satisfies the matrix clause in w.)
(23) has the same form as (16) above. And
it is interpreted in the same way. (23) is true
in a world w if and only if most events of w
that involve a man who is buying a horse are
part of events that involve cash payment.
What originated as an if-clause in surface
structure ended up as a restrictive clause in
the corresponding logical form. On this pro-
posal, there is no such thing as a two place
if ... then operator in any logical representa-
tion corresponding to English sentences like
(17) to (19). The function of the if-clause is
to restrict the domain of quantification of the
adverb. If this is true, then we have to concede
that there are indicative conditionals that can-
not possibly be given a Gricean analysis.
Consider next an example due to Grice
himself: Grices paradox (William James Lec-
tures 1967, lecture IV): Yog and Zog play
chess according to normal rules, but with the
special conditions that Yog has white 9 out
of 10 times and that there are no draws. Up
to now, there have been a hundred games.
When Yog had white, he won 80 out of 90.
And when he had black, he lost 10 out of 10.
Suppose Yog and Zog played one of the hun-
dred games last night and we dont yet know
what its outcome was. In such a situation we
might utter (24) or (25):
(24) If Yog had white, there is probability of
8/9 that he won.
(25) If Yog lost, there is a probability of 1/2
that he had black.
Both utterances would be true in the situation
described above. Let us now examine what
the logical form of sentences like (24) and
(25) may be. If we stick to a traditional anal-
ysis of conditionals, two candidates that come
to mind are (26) and (27):
(26) If A, then x-probably B
(27) x-probably [if A, then B]
In (26), x-probably stays in its surface posi-
tion, in (27), it has been raised out of its
clause. Assuming a material implication in-
654 VII. Semantik der Funktionswrter
and related work (Kratzer 1979 and 1981)
that we should consider simple indicative con-
ditionals as implicitly modalized. On a slightly
simplified view, we might think of modal op-
erators as of quantifiers over possible worlds.
This set of possible worlds is then the domain
that an if-clause can restrict. On this account,
the logical form of sentence (1) above might
look as follows:
(32) [must: my hen has laid eggs today] the
Cologne Cathedral will collapse tomor-
row
(32) is true in a world w if and only if the
Cologne Cathedral will collapse tomorrow in
all those worlds w that are accessible from
w and in which my hen has laid eggs. Which
worlds are accessible depends on the modality
expressed by the modal must (see Kratzer
1977). In different utterance situations, an
utterance of must might express different sorts
of relative necessities: Necessity in view of the
evidence available in the utterance situation
(epistemic necessity), necessity in view of what
the law provides (deontic necessity), necessity
in view of what we desire (bouletic necessity),
and so on. The hidden modal in the logical
representation of sentences like (1) (and of
many other indicative conditionals without
overt operators) seems to favor an epistemic
interpretation. (This interpretation is the
backbone of data semantics, see Veltman
1984, 1985 and Landman 1986. Data seman-
tics captures one special use of conditional
sentences. It emphasizes the important con-
nection between epistemic modality and bare
indicative conditionals.)
If epistemic interpretations of modals are
relativized to the evidence available in the
utterance situation, different utterances of
one and the same sentence involving such a
modal might express different propositions.
Let us look at an example:
Suppose a man is approaching both of us.
You are standing over there. I am further
away. I can only see the bare outlines of this
man. In view of my evidence, the person ap-
proaching may be Fred. You know better. In
view of your evidence, it cannot possibly be
Fred, it must be Martin. If this is so, my
utterance of (33) and your utterance of (34)
are both true.
(33) The person approaching might be Fred.
(34) The person approaching cannot be Fred.
Had I uttered (34) and you (33), both our
utterances would have been false. Certain
bare indicative conditionals show strikingly
tified sentences we considered before. For the
purposes at hand, we might think of repre-
sentations like (30) and (31):
(30) [8/9-probably: g is a game and Yog had
white in g] Yog won g
(31) [1/2-probably: g is a game and Yog lost
g] Yog had black in g
Sentence (30) is true in a world w if and only
if the proportion of things (in a general sense
including events) satisfying Yog won g in w
among all the things satisfying g is a game
and Yog had white in g in w is 8/9. Quite
generally, a sentence of the form (30) or (31)
is true in a world w if and only if the pro-
portion of events satisfying the matrix clause
in w relative to all the events satisfying the
restrictive clause in w is as required by the
probability operator. I am not saying that
this is the correct interpretation of probability
sentences. In previous work (Kratzer 1981), I
proposed a different account for (compara-
tive) probability sentences not involving var-
iable. In the present context, I dont want to
choose between the two proposals. I rather
want to stress what they have in common:
On both accounts, we dont have a two-place
conditional operator, and the only role of the
if-clause is to restrict the universe of discourse
necessary for the interpretation of some sort
of quantifier. Grices paradox, then, is not
only a counterexample to the material impli-
cation interpretation of conditionals. It is also
an example that once more points to the role
if-clauses seem to play quite generally: They
are devices for restricting the domain of
quantifiers. As soon as this semantic func-
tion is reflected in the logical forms for (24)
and (25), the paradox disappears. Formali-
zations of these two sentences in terms of
restrictive quantification does not contain
logically equivalent constituents anymore. In
fact, they dont have if ... then-clauses as con-
stituents at all.
4. Indicative Conditionals as
Modalized Conditionals
The picture that emerged in the previous sec-
tion was that if-clauses might quite generally
serve as restrictive devices for certain opera-
tors, for adverbs of quantification or proba-
bility operators, for example. But what about
cases where there is no operator the if-clause
could restrict? What about bare condition-
als, the type of sentences we started out with?
I argued in my dissertation (Kratzer 1978)
30. Conditionals 655
(36) [Must: you are back before eight and the
roast is ready] we will have dinner to-
gether.
(36) is obviously identical with the logical
form of sentence (8) (here repeated as (37)):
(37) If you are back before eight and the
roast is ready, we will have dinner to-
gether.
6. Grice Reconsidered
On the present account, the reason that some-
times, there are non-truth conditional
grounds for accepting a bare indicative con-
ditional sentence is its implicit modalization.
In connection with Gibbards riverboat ex-
ample, we have seen that this implicit mod-
alization might be an epistemic one that de-
pends on the evidence available in the utter-
ance situation. Suppose now that mathema-
ticians and logicians behave like omniscient
gods. For them, then, the modal appearing
in a conditional is relativized to a total state
of information (see Peirce 1933). This state
of omniscience comprises everything that is
the case in the world under consideration.
Their conditionals now reduce to material
implication. As on Grices account, material
implication comes out as a special case. The
difference is that mathematicians and logi-
cians are not uncooperative anymore, they
are just megalomanic. Sometimes, however,
they go for the other extreme: The state of
total ignorance. This will give them strict im-
plication. Most of us prefer something in be-
tween.
Material implication and strict implication,
then, can be seen as involving extreme cases
of epistemic modality. In Kratzer (1981), I
show that these two types of implication fall
out as special cases from a more general ac-
count of conditional modality that provides
a unified analysis for a wide range of condi-
tionals including deontic conditionals and
counterfactuals. Giving a common analysis
to e. g. indicative conditionals and counter-
factuals is not trivial: Such an analysis has to
predict that the two types of constructions
differ with respect to their inference proper-
ties, and also that counterfactuals are vague
to an extent that by far exceeds the degree of
vagueness found with indicative conditionals
(see Lewis 1973).
similar properties as shown by a famous ex-
ample invented by Allan Gibbard (1981: 231):
Sly Pete and Mr. Stone are playing poker
on a Mississippi riverboat. It is now up to
Pete to call or fold. My henchman Zack sees
Stones hand, which is quite good, and signals
its content to Pete. My henchman Jack sees
both hands, and sees that Petes hand is rather
low, so that Stones is the winning hand. At
this point, the room is cleared. A few minutes
later, Zack slips me a note which says If Pete
called, he won, and Jack slips me a note which
says If Pete called, he lost.
Zacks and Jacks utterances are both true.
But again: If Zack had uttered If Pete called,
he lost (given his evidence) and if Jack had
uttered If Pete called, he won (given the sit-
uation he was in) the two mens claims would
have been both false. Like the epistemic mod-
als above, these particular indicative condi-
tionals are interpreted with respect to the
evidence available to their utterers. But this
means that they are implicitly modalized.
5. Gibbards Proof Reconsidered
I have now argued that certain bare indicative
conditionals are implicitly modalized. But
doesnt Gibbards proof mentioned in section
2 show that that couldnt be the case in any
interesting sense? This proof seems to dem-
onstrate that conditional sentences endowed
with obvious properties could not receive any
other interpretation but material implication.
Note however, that one property slipped in
that by now is not obvious any longer: Gib-
bards arrow is a two-place operator. We have
seen above that in the logical forms for nat-
ural languages, conditional sentences have a
very different structure: there simply is no
two-place conditional connective, and con-
ditional sentences as a whole dont even form
constituents. Now what about stacked if-
clauses? If one if-clause alone appears in the
restrictive term of the quantifier, then two if-
clauses in a row might very well both appear
there. That is, they may successively restrict
the domain of one and the same quantifier
like two adjectives or two relative clauses
might successively restrict the extension of
one and the same noun. That is, a sentence
like (7) above (here repeated as (35)) would
have the logical form (36):
(35) If you are back before eight, then if the
roast is ready, we will have dinner to-
gether.
656 VII. Semantik der Funktionswrter
makes a similar point with respect to when-
clauses. Obviously, all of these results impose
certain requirements on the syntactic prop-
erties of that level of representation where
semantic interpretation takes place. This level
has to allow for the creation of restricted
operator structures of various kinds. How
precisely these structures are related to the
corresponding surface structures of natural
language sentences is largely unknown. (See,
however, Geis 1985.)
(This paper originally appeared in: A. M. Farley,
P. Farley and K.-E. McCullough (eds): Papers from
the Parasession on Pragmatics and Grammatical
Theory, Chicago Linguistic Society, 1986.)
8. Short Bibliography
Barwise/Cooper 1981 Buerle/Egli 1985 Cush-
ing 1976 Farkas/Sugioka 1983 Frege 1923 Geis
1985 Gibbard 1981 Grice 1967 Heim 1982
Kratzer 1977 Kratzer 1978 Kratzer 1979
Kratzer 1981 Landman 1986 Lewis 1973b
Lewis 1975a Lewis 1976 McCawley 1981 Par-
tee 1984b Peirce 1933 Stump 1981 Stump
1985 Veltman 1984 Veltman 1985 Wilkinson
1986
Angelika Kratzer, Amherst,
Massachusetts (USA)
7. Conclusion
The history of the conditional is the story of
a syntactic mistake. There is no two-place
if...then connective in the logical forms for
natural languages. If-clauses are devices for
restricting the domains of various operators.
Whenever there is no explicit operator, we
have to posit one. As shown above, epistemic
modals are candidates for such hidden oper-
ators. Work by Farkas and Sugioka (1983)
and by Wilkinson (1986) suggests that invis-
ible generic operators may play a similar role.
Relying on Lewis work on adverbs of
quantification and on my work on condi-
tional modality, Irene Heim argues in her
dissertation (1982) that the operators that
have to be posited in order to obtain a unified
semantics for if-clauses might have an addi-
tional use: They might act as unselective bind-
ers for variables. This assumption enabled
Heim to develop a new solution for an old
puzzle regarding the so-called donkey-sen-
tences. Heims work, then, gives further sup-
port to the hidden operator approach to bare
indicative conditionals.
If-clauses are not the only clauses that
function as restrictive devices for operators.
Stump (1981, 1985) showed that free adjuncts
can play the same role. And Partee (1984b)
657
VIII. Adjektivsemantik
Adjectival Semantics
31. Adjectives
have or satisfy that property. In a formal
language with lambda-operator, we can there-
fore put:
(2) a. x(runs(x))
b. x(boy(x))
c. x(musical(x))
for the property of running, for the property
of being a boy, for the property of being
musical.
Given lambda-conversion, an individual
constant J for John, and a suitable choice of
predicate constants, we get the familiar for-
malizations for (1ac): r(J), b(J) and m(J).
Semantically, therefore, adjectives express
properties just like verbs and nouns.
In consequence, adjectives have to be
treated on a par with intransitive verbs and
nouns in a categorial syntax: they are of cat-
egory s/n, i. e. they take a noun phrase and
produce a sentence.
Government-and-binding (GB) theory also
treats adjectives as verblike and nounlike
at the same time. The similarities and distinc-
tions of the word classes can be seen in the
following feature table.
+ N N
+ V ADJ VERB
V NOUN PREP
That we need to distinguish the classes, fol-
lows easily from the fact that in languages
with an open class of adjectives the latter can
be identified by syntactic and morphological
criteria. Moreover, there seems to be little
interlanguage variation regarding semantic
content of the adjective classes provided
the languages under consideration have such
classes. A first indication for this is the fact
that an adjectival concept of a language with
an open class of adjectives will emerge as an
adjective when translated into another such
language. Languages with a productive class
of adjectives are (a. o.) English, French, Dyir-
bal (Australia), Tzotzil (Mexico).
1. The Word Class of Adjectives
1.1 Properties
1.2 Adjectives and Intransitive Verbs
1.3 Adjectives and Nouns
1.4 Argument Structure
1.5 Summary
2. Semantics and Adjective Classes
2.1 Formal Language, Formal Semantics
2.2 Adjectives
2.3 Summary
3. More About Adjective Classes
3.1 Absolute Adjectives
3.2 Relative Adjectives
3.3 Summary
4. The Literature
4.1 Word Classes
4.2 Semantics and Adjective Classes
4.3 More about Adjective Classes
5. Short Bibliography
1. The Word Class of Adjectives
Many languages do not only possess the
parts-of-speech classes of verbs and nouns,
but a third, large, open word class, that of
the adjectives. Elements of this class are char-
acteristically both predicative and attributive
and can be further distinguished from the
other classes in that they show morphological
marking for comparison.
The following discussion compares and
distinguishes the three above classes in more
detail.
1.1Properties
(1) a. John runs
b. John is a boy
c. John is musical.
In the sentences (1ac) runs, is a boy, and is
musical function as predicates, so that clas-
sical predicate logics and also generative se-
mantics interpret these three expressions as
one-place properties. Properties, however, can
be considered as the set of individuals which
658 VIII. Adjektivsemantik
as designating the characteristics of an indi-
vidual, but as volitional, controllable behav-
iour. Therefore only properties which admit
such a reinterpretation can be used in these
constructions which excludes a large num-
ber of typical adjectives:
(3) a. Shes being the loving wife again
b. Shes being silly again
c. ??? Shes being tall again.
We conclude: Adjectives are characteristi-
cally stative. (Quirk 1972:265).
In languages which assign verbs to the ad-
jectival concepts, these verbs normally form
a subclass which is either inflectionally
marked (Japanese) or can be distinguished
from ordinary verbs by their potential to ap-
pear not only predicatively but attributively
as well. Often attributive position is specially
marked: Mojave uses a prefix, other lan-
guages employ obligatory relative construc-
tions. Some languages contrast states which
are expressed by adjectives with states which
are the results of actions, and thus use an
adjective-participle opposition. English and
German have whole/ganz and broken/zer-
brochen or split/gespalten. Dyirbal, a strongly
adjectival language requires that the opposite
of an adjective also be an adjective: muguba
and yagi, where the verbs are rulban/split and
gayn
y
d
y
an/break.
1.3Adjectives and Nouns
That adjectives can stand attributively, i. e.
can modify a noun, appears to be an impor-
tant characteristic of this class:
(4)
a. The ball is red/ Der Ball ist rot
b. The red ball rolls off/ Der rote Ball
rollt weg.
The relation of modifier and modified can
give rise to agreement marking of the adjec-
tive for gender, case and number (Latin, Ger-
man) and/or rules of positioning. In some
languages adjectives lose this marking in
predicative position, either completely as in
German (ein roter Ball, ein rotes Haus, eine
rote Rose, but der Ball, das Haus, die Rose ist
rot) or partly, as in the Russian long- and
short-forms. Nouns, on the other hand, never
lose it. In Dyirbal adjectives have the same
inflectional and derivational potential as
nouns and are distinguished only by an ad-
ditional marking.
Now, predicative adjectives were of cate-
gory s/n, their interpretation being properties.
Attributive adjectives, on the other hand, are
Languages with small, closed adjective
classes as Japanese (Asian), Hausa, Bantu
(African), Samoan (Melanesian), and Yurok
(Californian variant of Algonquian) assign
verbs or nouns to properties which in other
languages are expressed by adjectives: Man-
darin (with no adjectives at all), Yurok, and
Samoan have stative verbs for all adjectival
concepts; Hausa has partly verbs, partly
nouns, while adjectives in Alamblak (New
Guinea) seem to be more or less a subclass
of nouns. It holds, however, that certain prop-
erties are coded as adjectives, even in lan-
guages with only a very small class of adjec-
tives. These properties concern colour, di-
mension, age and value. Exceptions are
Bemba (African), which codes colours by
verbs, and Kirivinian (Austronesian), which
puts colour expressions among the nouns.
Twenty well investigated languages with small
adjective classes show the following statistics
(cf. Dixon 1977).
big was found in
all 20 languages
small in 19
good in 13 bad in 14
long in 14 short in 15
black in 13 white in 14
new in 15 old in 14
red in 14
additionally raw, green, unripe was found in
7 languages.
As these observations seem to point to se-
mantic universals, the question which imme-
diately arises is: Why are these properties
adjectival properties? In other words: Can
we identify different types of properties which
correspond to the different parts-of-speech?
As (1ac) show clearly, we are dealing with
one-place predicates. Therefore, we have a
trivial distinction between transitive verbs and
adjectival predicates. Accordingly, we will dis-
cuss only the differences of adjectives and
intransitive verbs.
1.2Adjectives and Intransitive Verbs
Verbs typically describe movements, proc-
esses, actions, i. e. properties which develop in
time, describe temporal change, have tempo-
ral limits and can be temporally structured.
Nouns and adjectives on the other hand, de-
scribe properties which are stative and dura-
tive, often co-existent with the individual of
which they hold. Adjectives and nouns there-
fore are not morphologically marked for
tense, aspect or mood. Languages which show
traces of such marking mostly via the
copula do not interpret these constructions
31. Adjectives 659
We are dealing with identification of a species,
on the one hand, and qualifying characteris-
tics of a specimen, on the other.
We can say that horses are a natural kind,
the things which are white or red are not (cf.
article 17). Being red can be subsummized
under a canonical concept of property,
which we will henceforth call quality, while
being a horse presupposes a cluster of prop-
erties and does not correspond to this canon-
ical concept of quality. We can say that nouns
express natural kinds, while adjectives express
qualities (cf. Carlson 1977).
This semantic differentiation can be chal-
lenged if one takes into account Kripke
(1972), who treats hot on a par with horse,
i. e. as a rigid designator (cf. article 16). Then
both are names. What remains is that they
are names of different things. Another draw-
back is the fact that adjectives like good have
to be considered multi-dimensional, i. e. as
clusters of properties, and even items like big
have been given a decompositional feature
analysis (cf. Bierwisch 1967), which turns
them into another cluster.
We will take the distinction of natural kind
and natural quality at face value and will
try to motivate it in the following.
1.3.2Gradability
Arguments for the existence of the above dis-
tinction are modifiers and the possibility of
comparison or measuring (cf. article 32). Ad-
jectives take modifiers like very, rather,
enough, too, and measure phrases. Individuals
can be compared with respect to the quality
in question or can be said to possess the
quality to a certain, measurable degree:
(7)
a. Paul is very/ rather/ too tall tall
enough
b. Paul is as tall as Peter
c. Paul is taller than Peter
d. Paul is six feet tall.
Roughly speaking, this syntactic potential is
semantically based, namely on the fact that
qualities, i. e. natural properties, apply to a
certain degree more for one individual, less
for another. This does not hold for verb- or
noun- properties. If we find in Sapir
(1949:123): ... every quantifiable, whether
existent (say house) or occurrent (say run) or
quality of existent (say red) or quality of
occurrent (say gracefully) is intrinsically grad-
able, we realize that this holds in a canonical
and systematic fashion only for qualities. For
this reason adjectives the natural encoders
traditionally viewed as modifiers. In catego-
rial grammar, modifiers are seen as taking an
element of a category C and producing an-
other element of the same category C. In the
case of adjectives this means that they take a
noun and produce a more complex, a modi-
fied noun. Nouns, however, are of category
s/n, therefore attributive adjectives are of cat-
egory (s/n)/(s/n). Semantically, we arrive at a
mapping of one property onto another. In
particular: in the syntagma white horse the
adjective white maps the property of being a
horse onto the property of being a white
horse.
But as we have seen, adjectives are char-
acteristically both predicative and attributive,
so that any serious account of the semantics
of adjectives will have to say something on
the relation of these two adjectival roles.
Their modifier function was, as we have
seen, a useful tool in distinguishing adjectives
from verbs, or in identifying special verbs
functioning as adjectives. Unfortunately,
however, nouns can also function as modifi-
ers, as seen in the compound constructions
found in many languages: silken scarf, silk
scarf or hlzernes Pferd, Holzpferd. On the
semantic level we therefore cannot use the
modifier label in order to distinguish nouns
and adjectives. We must look elsewhere.
1.3.1Natural Kinds and Qualities
Let us go back to some predicative examples:
a. The animal is a horse
b. The animal is big
c. The animal is white
d. Das Tier ist ein Schimmel (the animal
is a white horse)
(6)
a. ??? The animal is horsy, horsish
b. ??? The animal is a big
c. ??? The animal is a white
d. The animal is a black.
The fact that properties which are normally
coded by adjectives cannot be expressed by
nouns on the surface level and vice versa
points to their conceptual difference. The
problematic cases, (5d) and (6d), turn out to
be idiosyncratic lexicalizations, as (6c) and
the lack of systematic interlanguage corre-
spondence show. Trying to pin down the con-
ceptual difference emerging from the above
examples, Bloomfield defines as class mean-
ing for nouns: object of such and such a
species (Bloomfield 1933:202), while for de-
scriptive adjectives he has: qualitative char-
acter of specimens (Bloomfield 1933:203).
660 VIII. Adjektivsemantik
in a way, kind of, strictly speaking. This leads
to a rough simplification which disregards
cases like good for the time being: If those
languages with closed classes of adjectives,
which always contain red, and big-small but
perhaps no other colour adjectives and cer-
tainly no value adjectives, are the proof for
the existence of the properties we have called
qualities, i. e. if the above adjectives give the
prototype of qualities, then a quality is one-
dimensional.
1.3.4Vague and Sharp Predicates
The fact that an individual or object can
possess a quality to a greater or lesser degree,
makes adjectives vague expressions (cf. article
11). Pinkal (1979) calls the scalar or degree
adjectives (tall-short, hot-cold) the paradig-
matic case of vagueness. This vagueness
arises because the common speaker/hearer
knowledge is never made quite explicit, and
therefore comparison classes and (culture-de-
pendent) norms are mostly implicit and vary
often:
(10)
a. John is tall
b. John is tall for a ten-year-old boy/
American/Japanese.
Among other things, this context dependence
implies that an adjective like tall cannot be
used in order to classify: tall does not divide
the set of all individuals into the set of tall
individuals and the set of the non-tall indi-
viduals. Typical adjectives therefore occur
in antonym pairs. Languages with closed ad-
jective classes contain mostly antonym pairs.
Igbo, for example, has only eight adjectives,
and these make up four pairs. Studies of
language acquisition make the same point:
the child first learns some antonym pairs like
hot-cold, and only later it acquires colour
terms. Both adjectives of an antonym pair
share or describe a basic quality. One of them,
called positive pole (+pole), asserts that the
quality holds, while the other, the negative
pole (pole), asserts that the quality does
not hold. Some of these pairs (married-single)
show the following relations:
(11)
a. not (+pole) (pole)
b. not (pole) (+pole).
For others (tall-short) we have
(12)
a. (+pole) not (pole)
b. (pole) not (+pole)
but no equivalence of the expressions. Adjec-
tives of this type delimit two areas on a shared
of qualities are marked for gradability.
Most languages have morphological marking
only for comparative and superlative, some
(e. g.Irish) mark the equative as well. Nouns
and verbs, on the other hand, are not inher-
ently gradable.
(8)
a. The house is very large
b. The house is very white
c. This house is larger than the neigh-
bouring house
d. ? This plaster is whiter than that on
the back wall
(9)
a. ??? This building is very a house
b. ??? This building is housier than the
other one
c. ?? This building is more a house than
the other one
d. ? This building is more of a house!
e. This building is much more like a
house!
1.3.3One-Dimensional Qualities and
Clusters of Criteria
Sentences (9ac) are unacceptable because a
whole cluster of criteria is needed to define a
house, and language does not systematically
mark which of these are to be considered in
such comparisons. Lakoff (1973), however,
speaks of degrees of birdiness and says:
... category membership is not simply a yes-
or-no matter, but rather a matter of degree
(Lakoff 1973:460). An individual can be said
to be a member of such a category if certain
criterial properties hold: all, some important
ones, or only one which is crucial for classi-
fication. Therefore Lakoff (1973) distin-
guishes definitional, primary, secondary and
characteristic though incidental criteria.
In Andreas ball is red, the adjective says
nothing about being a ball balls are not
characteristically red it merely describes an
additional, important property of a specified
object. Adjectival properties are therefore ad-
ditional and not criterial: semantically an
adjective describes some important but non-
criterial property of an object (Dixon
1977:63).
In comparison with the clusters of criteria
which define natural kinds, we can delineate
another characteristic of qualities. Noun con-
cepts become more easily gradable if we find
contextual or explicit information saying in
just what respect, i. e. according to which of
the criteria, they are to be compared. We find
with respect to, concerning ... (form/ density/
rigidity). Sometimes it suffices to give a hint
that we do not have to consider all criteria:
31. Adjectives 661
compared to that of a passive surface subject.
This means that the class of intransitive verbs
consists of two subclasses. Class a) contains
verbs like dance, sleep, speak. Class b) has
verbs like arrive, fall, leave. Diagnostic criteria
show interlanguage variation. For German
the verbs of class b) pattern as follows (cf.
Toman 1986):
1) they take sein as past tense auxiliary;
2) they do not form an impersonal passive;
3) their second participle may appear preno-
minally;
4) they do not form er-nominalizations
(nomina agentis);
5) they allow a topicalization in which a
nominative subject seems to form a single
constituent together with a participle: Feh-
ler unterlaufen sind ihm nie.
This subclass of the intransitive verbs has
recently received much attention in GB-the-
ory. It was called ergative by Burzio (1981),
while Perlmutter (1978) uses the term unac-
cusative. According to Chomsky (1981) or
Stechow & Sternefeld (1988:302) they have
the property that they do not assign a -role
to their subject and are of the neutralized
category [+V]. This means in particular, that
they do not assign case to the object and
therefore require raising in order not to be
blocked by the case filter. In this respect they
resemble the adjective, which has been called
the ergative predicate par excellence
(Haider 1984:17).
Discussions in this area have not yet
brought any definite results, so that ergative
verbs and adjectives are either taken to be
predicates without a designated argument,
which has to appear in the nominative be-
cause of the realization principle (Haider
1984:7f), or are viewed as predicates which
have only an internal argument and therefore
a direct object in deep structure. This, of
course, cannot be an agent because agent
arguments appear as deep subjects. These
analyses are meant to capture the intuition
that arrive/ankommen and tired/mde have no
agent. Recent work shows, however, that in
this area one should not only take into ac-
count the thematic dimension (agent, theme
...) but the causal dimension as well. Accord-
ing to Grimshaw (1988a) external arguments
are only those which are prominent in both
dimensions, i. e. thematically and causally.
Now, ergative verbs and especially adjectives,
are normally not causative, so that this idea
explains very nicely why they can have only
internal arguments.
dimension or scale, one area where the quality
holds and one where it does not. But they are
vague as we often have a sort of no-mans
land in between these two areas, a so-called
extension gap. This contains the individuals
for which it is impossible to decide whether
they are in the extension of the (+pole) ad-
jective or in the (pole) extension, unless the
standard and class of comparison are further
specified:
(12)
c. John is neither tall nor short.
Naturally, different classes of adjectives show
different degrees of vagueness. Red is cer-
tainly less vague than tall, while tall is less
vague than good (cf. Pinkal 1985). But as the
extension gap on the scale of antonyms is
characteristic and predictable in location, we
can say that adjectives display a sort of vague-
ness different from that of nouns with fuzzy
edges.
Nouns do not have this systematic and
predictable extension gap. They behave more
like sharp predicates because it seems to be a
fact of life that their criteria hold all at once
and to the same degree or not at all. We
follow Kamp (1975) and assume that typical
nouns are sharp predicates; typical adjectives,
however, are inherently vague. This means
that we neglect artificial situations in which
objects are lined up according to certain cri-
terial noun properties. In particular, we ig-
nore situations as created by Black (1937) in
his museum of chairs. We hold that adjectives
are inherently vague precisely because such
line-up situations are not artificial, but nor-
mal in their case.
1.4Argument Structure
Adjectives are one-place predicates, so are
intransitive verbs. This single place is nor-
mally held by the grammatical subject. If we
now leave the purely logical considerations
and take into account older grammatico-se-
mantic concepts which have come into fash-
ion again through GB, then differences
emerge in the roles of these subjects in differ-
ent constructions:
(13)
a. The child dances
b. The train arrives
c. The child is tired.
In (13a) one would call the subject an agent,
for (13c) one has difficulties in identifying
such a role for the subject. The same holds
for (13b), here the role of the subject has been
662 VIII. Adjektivsemantik
the fact that not all adjectives are unaccusa-
tive. But then (17a) has to be explained. We
could require that derived forms conform to
the unmarked prototype of the category,
which implies in particular that adjectives are
stative in the sense that they do not have a
causative subject. We will not go into the
question whether predicates which are stative
in the above sense are also ergative and vice
versa. Decisions in this area have wide rang-
ing ramifications concerning the status of the
copula, cf. Toman (1986).
Another point which should be mentioned
but cannot be pursued here, is that in Cinque
(1988) and Cinque (1989) we find two classes
of adjectives: ergative and unergative adjec-
tives! Cinque (1989) investigates which Ger-
man predicates allow the embedding of verb-
second-clauses of the form ...er wird kommen/
he will come. Because of the contrast of es ist
klar, er wird kommen and *es ist peinlich, er
wird kommen (it is clear, he will come and it
is awkward, he will come) he distinguishes two
classes of adjectives. Cinque calls bekannt/
known, klar/clear, sicher/certain ergative ad-
jectives, because the embeddability of V2-sub-
ject clauses is a criterion for ergativity. An-
genehm/agreeable, peinlich/awkward, gefhr-
lich/dangerous, wichtig/important qualify as
unergative. The diagnostic criteria, among
which the above embeddability is only one,
go back to Helbig & Kempter (1981), Helbig
& Buscha (1984), Ptz (1986), Fanselow
(1987), and Cardinaletti (1988).
These GB-considerations have been given
some scope here because the syntactic dis-
tinctions certainly effect LF (the link to se-
mantics in GB) and could perhaps be con-
sidered to be of a more semantic than syn-
tactic nature anyway. Attempts to wed the
syntactic level (including -roles) via LF to
a truth-conditional semantics can be found in
Bierwisch (1986).
1.5Summary
The comparison of adjectives with nouns and
verbs shows that semantically adjectives ex-
press qualities. These are a) no criteria for a
species, b) stative, c) one-dimensional, d)
gradable, e) vague, and show f) the argument
structure of ergative predicates. Typical such
qualities are concerned with colour, dimen-
sion, age, value. Deviations from the proto-
type are only to be expected and give rise to
subclasses: dead-alive are not gradable, good-
bad are not one-dimensional, red is less vague
than tall and can be graded only in certain
contexts, and dead is less vague than red.
The following judgments of acceptability
are due to the argument structure of the verbs
involved and the fact that adjectives
(A-nodes) are ergative in the unmarked case:
(14)a.der gehate Hausmeister (transitive)
the hated building-super
b.der gefallene Engel (ergative)
the fallen angel
c.???das geschlafene Krokodil
(not ergative)
the slept crocodile
d.der verlorene Schlssel
the lost key
e.??? der einen Schlssel verlorene Pro-
fessor
the a key lost professor
As explanations we have the following alter-
natives: a) the ergative environment, i. e. the
prenominal adjectival phrase, where the par-
ticiple is inserted, determines -inheritance
and thus, by the specification [+ unaccusa-
tive] for A-nodes, would permit internal ar-
guments only (Toman 1986); b) the external
index is blocked by properties of the past
participle (Haider 1984).
There are more phenomena requiring
closer consideration of the predicates argu-
ment structure:
(15)
a. Der Engel ist gefallen
the angel is fallen
b.
??? Das Krokodil ist geschlafen
the crocodile is slept.
We observe that past participles of unergative
verbs do not occur predicatively. Further-
more we find a difference in German -end
adjectives and -end participles:
(16)
a.
??? Die Katze ist miauend
the cat is mewing
b. Der Film ist enttuschend
the film is disappointing.
That we have a pure adjective in (16b) be-
comes evident if we consider that enttu-
schend cannot assign accusative case in pred-
icative position. Compare:
(17)a.??? Der Film ist mich enttuschend
(adjective)
the film is me disappointing
b.der mich enttuschende Film
(participle)
the me disappointing film
The existence of adjectives which are derived
from transitive verbs, German enttuschend
or the English -ive adjectives, may point to
31. Adjectives 663
the categories s/n and (s/n)/(s/n). If we more-
over accept that the fundamental content of
most adjectives is the same in both construc-
tions, then we have two basic possibilities of
analysing the relation of a predicative adjec-
tive to its attributive counterpart.
2.2.1The Predicative Approach
Assuming that adjectives function primarily
as predicates, Reichenbach (1947) analyses
the sentence
(18) Rice Hall is a red building
in the notation of classical predicate logic as
(18) b(R) and r(R).
Given the canonical model (interpretation)
for such an expression, this means that the
individual called Rice Hall is to be found in
the intersection of the set of objects which are
buildings and the set of objects which are red.
The second half of the conjunction, Rice Hall
is red, shows that Reichenbach takes the pred-
icative use of adjectives as primary and as-
sumes that the adjective red qualifies the ref-
erent of the noun directly.
Generative Grammar takes the same ap-
proach when attributive use is derived from
the predicative construction via a transfor-
mation called Adjective-Fronting:
(19) Rice Hall is a building, which is red
Rice Hall is a building, red
Rice Hall is a red building.
This transformation operates on the short
form of a relative clause which is non-restric-
tive in (19) but can be restrictive:
(2o) A ball which is green
a ball green
a green ball.
This analysis is supported by the following
facts:
it keeps the lexical content of the adjective
constant in predicative and attributive
use;
investigations of language acquisition by
children and of language re-acquisition in
the case of aphasia- and dysphasia- pa-
tients seem to indicate that predicative use
is basic;
most predicative adjectives can be found
attributively;
it captures the similarity of relative-clause
modification and attributive modifiers.
If adjectives are basically of category s/n, we
first have to distinguish this category from
that of nouns and intransitive verbs on syn-
tactic grounds. We use Montagues slashes:
In addition to accounting for the relation
of predicative and attributive adjectivals, a
semantic theory of adjectives has to deal with
these phenomena.
2. Semantics and Adjective Classes
2.1Formal Language, Formal Semantics
For the following discussion we presuppose
a lambda-categorial syntax, where we call the
basic categories s and n for sentence and noun
phrase (cf. article 8). We build up the complex
categories according to the well-known prin-
ciples, i. e. we have the basic rule that for c of
category A/B and b of category B the syn-
tactic expression formed by c and b is of
category A.
For our semantics we need: the set of truth
values {0,1}, a set of individuals I, a set of
possible worlds W, an interpretation V, and
a function D that assigns those things to each
category which are to be the values of the
expressions of that category.
We define in the usual fashion:
D
S
is the set of propositions, i. e. the set of
mappings g: W {0,1}. D
n
is the set of
individuals I. An element of D
A/B
is a function
f from D
B
to D
A
.
For a of category A we have V(a) D
A
,
and for c of A/B and b of category B, we
have V(c,b) = V(c)(V(b)) D
A
.
We do not treat variables and the interpre-
tation of quantifiers here.
The introduction of a level with lambda-
categorial syntax is justified even if one has
assumed a level of LF in a Chomskian type
of model. Arguments for the existence and
independence of both levels can be found in
Bierwisch (1986). Following Bierwisch we call
the categorial level SF. We then have to ex-
plain how SF is mapped onto LF, in partic-
ular we have to show how -roles can be
recognized in SF. This is done by interpreting
-roles as lambda-operators. Indexing and
assignment of roles then proceeds according
to rules which, however, take not a lambda-
operator but an existential quantor for an
optional complement. In the following we will
only deal with LF and -roles, when dis-
cussing Bierwisch.
2.2Adjectives
According to section 1 adjectives are qualities
and/or modifiers, i. e. we have to deal with
664 VIII. Adjektivsemantik
is interpreted by another operator which he
paraphrases as an x with .... Whether this
exchange explains ergativity and the exter-
nally realized internal role of adjectives, is
beyond this paper.
In the Bierwisch approach the rule about
absorption of -roles achieves about the
same as the application of the operator attr.
Why Bierwisch (1986) chooses the old pred-
icative-first analysis, will be discussed in 2.2.4.
2.2.2Problems of the Predicative Approach
1)Syntactic classes
Aside from the adjectives which can occur in
both positions, languages with large adjective
classes usually have some items which occur
only attributively (A) or only predicatively
(P). English main, former, alleged, fake, recent
belong to (A), flush, asleep, alone, ill to (P).
Adjectives of class (A) cannot be derived
via attr from predicative adjectives because
they do not have a predicative counterpart.
Partees wellformedness constraint (Partee
1976, 1978) would therefore block the relative
clause involved in the transformational deri-
vation corresponding to attr:
(recent
CN/CN
immigrant
CN
) = recent immi-
grant
(*immigrant who is recent) = recent immi-
grant.
Moreover, an analysis involving a conjunc-
tion is simply false: A former pupil is not a
pupil any more. Accordingly, adjectives of
class (A) have to be categorized as CN/CN
from the start.
2) Functional differences
The sentences
(21)
a. Andreas ball is small
b. The small ball rolls
show that adjectives in predicative and attrib-
utive position are functionally different. In
(21a) a quality is merely attributed to an
object, in (21b) this attribution helps to dif-
ferentiate and identify that object. Evidence
for this difference comes from psychological
experiments as described in Osgood (1971),
which showed that attributive adjectives were
mostly used in situations where reference had
to be narrowed down in order to allow iden-
tification of the referent.
This difference can, however, be considered
as truth-conditionally irrelevant and should
better be treated in a theory of conditions of
use and processing as for example in the fe-
licity conditions for the use of the definite
B
n
= {John, Mary ...}
B
CN
= B
s/n
= {horse, house, building, cat...}
B
IV
= B
s//n
= {run, walk, sleep, arrive ...}
B
ADJ
= B
s///n
= {red, dead, square, tall, short,
fake ...}.
This categorization implies that an B
ADJ
takes a noun phrase or name and that a
suitable combination F of and then forms
a sentence. A suitable combination can be the
following:
For B
ADJ
and B
n
, F(): = be .
In the usual way we interpret F() se-
mantically as V()(V()), where V() is a sub-
set of the set of individuals and V() is an
individual.
In the following we will mostly write ADJ
for B
ADJ
and use other simplified notations as
well; we will, for example, not distinguish
general properties and qualities in the logical
context.
The movement which forces the category
change of the adjective is effected by an op-
erator called attr. Attr changes an a s///n
into a noun modifier of category (s/n)/(s/n)
or CN/CN. Attr therefore is of category (CN/
CN)/ADJ. This operator can be realized on
the surface, as in German or Russian in the
inflectional suffix of the attributive adjective.
Therefore V(attr) is a function which
maps properties on functions which map
properties on properties.
If
1
is a property,
2
some other property,
b is some individual and w a world, then
((
1
)(
2
)(b)(w) = 1 iff
1
(b)(w) = 1 and
2
(b)(w) = 1. Of course,
1
and
2
have to be
suitably restricted.
Bierwisch (1986) also suggests an analysis
which considers the predicative adjective to
be primary. He has a general modifier rule in
which the external -role, x, of the head of
the modifier is absorbed by the external -
role, x, of the head of the modified quantity,
thus giving an extensional conjunction anal-
ysis of modifier and modified:
(x(Px))(x(Qx))(x((Px) (Q(x)))
iff x absorbs x according to the modifier
rule.
Bierwisch (1986:98) speaks of an adjectives
external -role. As mentioned before, this
role must not be an agent wherefore other
authors refrain from calling it external. The
same considerations lead Bierwisch to distin-
guish this role from the external roles of other
predicates. To achieve this distinction, Bier-
wisch interprets normal -roles by the
lambda-operator, while the role of adjectives
31. Adjectives 665
Bolingers not very well-known distinction
of referent versus reference modification,
seems to be an early, linguistically motivated
step in the right direction: the first corre-
sponds to a conjunction analysis, the latter
to a categorization as CN/CN. Some lan-
guages mark this distinction not only through
the positioning but morphologically. Accord-
ing to Siegel (1976), the so-called Russian
long-form, which can appear predicatively
and attributively, has the interpretation Ad-
jective qua Noun, while the short-form di-
rectly qualifies the individual.
3) Entailments
The problem of reference modification is mir-
rored in the question of which are the entail-
ments of these expressions. This, of course,
has to be dealt with in a truth-conditional
semantics.
Bartsch & Vennemann (1972:73) suggest a
classification according to admissable entail-
ments. They distinguish absolute, relative, and
non-standard adjectives:
(23)
a. absolute A
X is an A N X is an N
X is an A N X is A
b. relative A
X is an A N X is an N
X is an A N X is A
c. non-standard A
X is an A N X is an N
X is an A N X is A.
These criteria allow a conjunction analysis
only for absolute adjectives like dead, finished,
Greek, differentiable and perhaps some colour
adjectives. All dimension adjectives (tall-
short, heavy-light) qualify as relative adjec-
tives. So do all value adjectives (good-bad,
beautiful-ugly), but also Bolingers reference
modifiers. Non-standard adjectives are for-
mer, fake, alleged.
2.2.3The Attributive Approach
Because the conjunction analysis turns out to
be correct only for a small class of expres-
sions, and for most other expressions it works
only with further specifications of context,
most recent work opts for the other possibility
of categorization: adjectives, as modifiers, are
of category CN/CN, i. e. mappings from prop-
erties to properties. As we know nothing
about the resulting property, all entailments
are a priori blocked! The entailments which
intuitively hold and define the above classes
are then added to the theory like axioms
article (cf. articles 10 and 22). Semantics,
however, can and should make explicit that
(21a) can be uttered when the comparison
class comprises other toys as well, Andreas
tricycle and her big teddy, for example, while
we can only have balls in the comparison
class of (21b). Such a model must take ac-
count of contextual factors, and attr then
must not only combine two properties to form
a complex one, but must introduce the rele-
vant context coordinate, the comparison
class. As this normally is the class given by
the noun, attributive adjectives can be said to
be reference modifying (they are accompanied
by the noun), while predicative adjectives are
not and thus directly apply to the referent.
Pinkal (1979) has compared the relation of
complex NPs (with prenominal adjectives)
and predicative adjectives to the relation of
definite descriptions and pronouns: ... in
both cases, the more complex phrases are
interpreted as context-specifying versions of
the simpler ones. (Pinkal 1979:45).
Similar considerations lead Bolinger (1967)
to repudiate the derivation of attributive ad-
jectives via the corresponding relative clause.
He claims that attributive adjectives tend to
characterize, while predicative adjectives can
also describe a circumstance, a difference
which involves the distinction of durative ver-
sus temporal properties.
(22)
a. the stars which are visible
b. the stars visible
c. the visible stars
(22a) has both interpretations: a) the stars
which are at this moment visible, and b) the
stars which can principally be seen from the
earth; (22b) only has the first interpretation,
and (22c) only the latter.
A further difference appears with the in-
troduction of Bolingers kind of-slot: Some
adjectives occur attributively and predica-
tively. In attributive position they can occur,
however, only with certain nouns to whose
referential system they belong. The question
what kind of lawyer, policeman, student,
cousin, ball is he/it? can only be answered by
a criminal lawyer, a rural policeman, a lazy
student, a distant cousin, a football, but never
by a very criminal lawyer or a green ball. The
modifier very can only occur in the case of
direct modification of the referent, not in the
case of reference modification, i. e. not in the
case where the function determining reference
is itself further modified.
666 VIII. Adjektivsemantik
secting adjectives (i. e. those which allow the
conjunction analysis) are transparent, and all
transparent adjectives are restrictive. It re-
mains to be explained why dimension adjec-
tives are classified as transparent, i. e. as ex-
tensional, though usually the norm varies to-
gether with the comparison class, and cer-
tainly a tall man need not be a tall basketball
player. However, dimension adjectives are
treated as taking the average of the compar-
ison-class extension for the norm. This im-
plies that if the extensions are the same (i. e.
if all men are basketball players and vice
versa) then the norms are the same and tall
is transparent. This shows the importance of
how the adjectives form their norms. If it is
not an average norm, then the adjective is
most likely not transparent. More than this
is involved for value adjectives. In that case
we usually not only have a change of norm
but of criteria as well. For the reference mod-
ifier beautiful
2
we cannot deduce that a beau-
tiful dancer is a beautiful singer, even if all
dancers were singers and vice versa.
Non-transparency of many adjectives
seems to be the best argument for preferring
the CN/CN approach to the conjunction
analysis. Critical points will be discussed later.
What remains to be done is the transition
to predicative use. This is achieved by dele-
tion, triggered by the operator pred:
(24)
a. The tower is a red tower
b. The tower is red.
Keenan & Faltz (1978) solve the problem
somewhat more elegantly in the semantics of
the copula be. Thus they avoid the error of
Montague (1970a) and Bennett (1976), who
always delete entity. Keenan & Faltz define:
John(be(tiny)) is true iff there is a property
q, which makes John is a tiny q true.
2.2.4Problems of the Attributive Approach
Problematic for the CN/CN approach is the
decision of what exactly has to be deleted or
supplied. Entity, as is easily verified, works
only for absolute adjectives. For relative ad-
jectives, i. e. dimension and value adjectives,
it is particularly difficult to decide what has
been deleted. With a proper-name subject the
problems show up beautifully:
(25)
a. Fido is small
b. Fido is a small dog
c. Fido is a small boy
d. Fido is a small elephant
e. Fido is a small (entity) individual.
defining the individual language, either as
meaning postulates as in Montague (1970a)
and Bennett (1976), or directly in the seman-
tics of the adjectives as in Cresswell (1976).
Keenan & Faltz (1978) prefer to analyse all
adjectives as mappings, but distinguish the
mappings by the way they work. Again classes
are formed, and their union constitutes the
class of adjectives.
The features of these classes are: restricting,
intersecting, transparent, negatively-restrict-
ing. [+ restricting, + intersecting] are those ad-
jectives which are elsewhere called absolute,
[+ restricting, intersecting] are large, tiny,
beautiful, the relative adjectives. This is cor-
rect, however, only at first glance. Like Kamp
(1975), Keenan & Faltz stress that in an ex-
tensional semantics some adjectives cannot be
functions. The reason can be found in the
following argument: If all housewives were
mothers, then it still does not follow that all
good housewives are good mothers. There-
fore, some adjectives are not transparent in
their argument. This holds for many value
adjectives and for Bolingers reference modi-
fiers. Value adjectives like beautiful in beau-
tiful dancer or beautiful painter, are consid-
ered to be ambiguous (here Keenan & Faltz
follow Reichenbach (1947)) so that we have
a transparent beautiful
1
and a non-transpar-
ent beautiful
2
.
The problem is that adjectives should be
mappings, and yet can be non-transparent. It
can be solved, if one changes the extensional
into an intensional logic. In particular, it is
the option of possible worlds we need in the
semantics. We have already included them by
defining propositions as mappings from
worlds into truth values. Therefore, we al-
ways have a possible world as implicit argu-
ment.
We now define:
A mapping f: X Y is transparent iff
for all w W and a,b X: if a(w) = b(w),
then f(a)(w) = f(b)(w).
Keenan & Faltz (1978) and (in a somewhat
different terminology) Kamp (1975) arrive at
the following classes:
[+t, +r, nr, +i] Adj., these are the absolute
adjectives;
[+t, +r, nr,i] Adj., large, tiny, beautiful
1
;
[t,+r,nr,i] Adj., beautiful
2
, distant;
[t, r, +nr, i] Adj., fake;
[t, r, nr, i] Adj., alleged.
The label negatively-restricting
obviously fur-
ther divides the class of non-standard adjec-
tives. It furthermore follows that all inter-
31. Adjectives 667
been designed. The other point which the CN/
CN approach takes up is the unwanted en-
tailment X is A in the case of relative ad-
jectives. Now, the above quote from Bier-
wisch (1986) implies, that this entailment is
not blocked if X is an individual which is
designated through a definite description, i. e.
if the subject has a head noun which can
furnish the reference value. If this is not the
case as for proper names, then the entailment
is blocked for adjectives like small without
more context (cf. 25ae). These adjectives are
simply not amenable to a conjunction anal-
ysis. Moreover, a potential comparison class
given via the head of the subject, can be
overruled by context:
(28)
a. The tower is beautiful (as a tower)
b. The tower is beautiful (as a building)
c. The tower is beautiful (as a wall for
alpine excercise).
Of course, nobody is denying that a compar-
ison class can or must be present in the con-
text of interpretation as Bierwisch de-
mands. In such a contextual/pragmatic solu-
tion, the approaches could compromise.
2.3Summary
We arrive at the following picture: there are
adjectives which behave like independent
predicates and therefore can be given a con-
junction analysis and be categorized as s/n
even when occurring attributively; there are
adjectives which occur only as modifiers and
so are natural members of category CN/CN;
finally, there are adjectives which are prob-
lematic in any case no matter which basic
categorization is chosen. The problems al-
ways occur at the point of functional transi-
tion, or, in a double- categorization approach
the point of functional overlap. The problems
are caused by the inherent vagueness and
context dependence of especially the relative
adjectives, and the fact that the attributive
adjective is, of course, endowed with more
context. Models which account for these fac-
tors can deal with the problems quite easily.
In Kamp (1975) the entailment Fido is a big
flea Fido is big would go through in the
same model, i. e. with the same standard
(norm and comparison class), but not in the
super-valuation, because Fido is big would
not hold in all models in which Fido is a big
flea holds. In his semantics for attr, Pinkal
(1979) introduces a context parameter which
has to be filled so as to reduce vagueness.
Bierwisch (1986) solves the problem by spec-
Evidently, context information is required in
order to establish the comparison class for
(25a). Keenan & Faltz (1978) at least leave
the comparison class open so that context
could apply at this point and give the speci-
fications. If one does not allow this openess
and requires, as is often suggested (cf. (24a,b),
that the relevant comparison class is that in-
dicated by the subject, one arrives at absurd-
ities as soon as context is added:
(26) The cathedral tower is high in compar-
ison with the surrounding houses
would get the interpretation that the cathe-
dral tower is a high tower compared with
houses, which does not make sense because
we now have two comparison classes. If, how-
ever, one takes the contextually given class of
surrounding houses as the comparison class,
then it follows that the cathedral is a high
house, which is absurd. What has to be done
is to take the next higher class comprising
both towers and houses as the comparison
class, here it would be the class of buildings.
But how this can be achieved in every partic-
ular case, is not quite clear.
Bierwisch (1986), another critic of the CN/
CN approach, also takes up the problem of
comparison value or class. Bierwisch
(1986:1oo) introduces a new coindexing rule
for -roles, which specifies that the head of
the subject is the reference value of the pred-
icate just as the head of the modified unit is
the reference value of the modifier. More-
over, Bierwisch (1986:113) says about the ex-
amples:
(27)
a. The wine (doctor) is good
b. He knows a good wine (doctor)
the notoriously context dependent interpre-
tation of good is fixed by the reference value
in both cases. Therefore, the adnominal ad-
jective theory is discredited.
This rather summary judgment is problem-
atic in so far as Bierwisch equates the ad-
nominal, i. e CN/CN, approach with the in-
tensional theory and concludes that an exten-
sional semantics and the conjunction analysis
are fully adequate for adjectives. However,
the CN/CN approach is not motivated, as
Bierwisch claims, by the observation that the
reference value and so the comparison class
is missing in predicative constructions and has
to be supplied. It is, however, concerned with
the fact that the interpretation of good de-
pends crucially on the reference value no
matter whether predicative or attributive. To
capture this the intensional approach had
668 VIII. Adjektivsemantik
interpretations of the available material differ
widely (cf. section 4).
3.2Relative Adjectives
Relative adjectives, as we have seen in section
2, must be divided into two subclasses: 1)
dimension adjectives and 2) value adjectives.
These classes differ importantly in the areas
of grading and comparison. The main differ-
ence is that dimension adjectives inherently
carry the identification of their comparison
scale while it is context which identifies the
scale for value adjectives. This implies that
dimension adjectives always have the same
scale while scales vary for value adjectives.
The fact that value adjectives often occur in
clusters with related meanings and can choose
different opposites (dumb, stupid clever,
intelligent, wise) can either be explained by
their forming scales with not only two des-
ignated areas but four or more or by the
above possibility to form different scales with
different basic qualities: stupid-clever, stupid-
intelligent, stupid-wise.
The two subclasses also differ in the way
their norms are built up. Dimension adjectives
take the average as their norm, value adjec-
tives have a norm of expectation, dependent
on context.
The five phenomena to be captured are as
follows.
1) Measure phrases can accompany the
(+ pole) of a pair of dimension adjectives.
The (pole) of such a pair does not take
them and neither do value adjectives:
(29)
a. The board is two meters long
b. ??? The board is two meters short
c. ??? Belinda is hundred units beautiful
(ugly).
2) Together with a measure phrase, relative
adjectives become absolute because they cease
to be norm-dependent. Normally, the positive
of relative adjectives involves a norm which
it asserts to be exceeded.
(30)
a. Hans is tall (short)
b. Hans is good (bad).
3) The comparatives of dimension adjectives
do not involve a norm, while the compara-
tives of value adjectives are normdependent
at least for (-pole). This implies that the com-
paratives of an antonym pair of dimension
adjectives are inverse relations of each other.
This does not hold for value adjectives.
ifying the different parameters like reference
value, norm and comparison value according
to adjective class. In the other approach the
operator pred has to provide for greater free-
dom, a parameter is made free to be filled
anew by the comparison class given in the
head of the subject or other contextual infor-
mation (cf. examples (26) and (28)), always
provided that absurdities are not created.
3. More About Adjective Classes
Apart from the CN/CN s/n dichotomy,
other phenomena and problems have been
touched on in section 1. How these can be
treated becomes apparent in a detailed dis-
cussion of the semantic properties of the dif-
ferent adjective classes. The main distinctions
turn out to have to do with gradability. In
order to outline possible semantic solutions
it therefore seems necessary to mention at
least the relevant phenomena.
More about gradability can be found, of
course, in article 32.
3.1Absolute Adjectives
The class of absolute adjectives is formed by
those predicates which are extensional and
intersecting, so that the conjunction analysis
describes them properly. In this class we find
complementary adjectives like dead-alive or
single-married, nationality adjectives like
Greek or English, colour adjectives like red,
white or black and some predicates like
square, differentiable or continuous in mathe-
matical usage which are sharp by virtue of
their exact definition. We have seen that such
adjectives are not gradable because they are
lacking in extension gap. But in some contexts
red or Greek are gradable. Therefore the ques-
tion arises whether sharp, in particular ab-
solute adjectives really exist, or whether it is
vagueness as a property of the class in
general which overlays the special proper-
ties of an individual adjectives meaning.
Special properties of absolute adjectives are
that they do not occur in antonym pairs, the
paradigm case of gradability, and that they
occur in complementary pairs or have more
than one counterpart as illustrated by colour
and nationality adjectives.
Colour adjectives have been studied in
depth with respect to the question of linguistic
universals. The discussion turns about the
point whether colour expressions are arbi-
trary or code a universal inventory, and the
31. Adjectives 669
ranges.
Another important group of facts are the
possible answers to the questions how tall or
how beautiful. Dimension adjectives allow
(36)
a. Hans is six feet tall/ as tall as Eva/
two inches taller than Fritz/ three
times taller than his little brother
b. Hans is tall enough for the job/ too
tall for the bed.
Value adjectives allow only
c. Belinda is as beautiful as Miranda/
threetimes more beautiful than Mir-
anda/ beautiful enough for the part/
too beautiful to ...
The problems of comparison have been dealt
with in several approaches. The first decision
to make is whether to build up the semantics
of the comparative on the semantics of the
positive or vice versa. The second approach
runs into the problem that an inherently
vague predicate with an inherent extension
gap has to help define a predicate without
such an extension gap keeping comparison
class and standard of comparison constant,
of course. Wallace (1972) illustrates this prob-
lem with elephants: In the same circumstances
of evaluation it can remain debatable that
Jumbo is a big elephant, even though it is
quite clear, probably even decidable in the
mathematical sense, that Jumbo is a bigger
elephant than Dumbo.
Moreover, comparing things seems to be a
basic cognitive operation so that most au-
thors try the first alternative.
Authors agree that at least two arguments
are needed: x is tall becomes x is y-tall, where
y is a degree on the scale, the degree of tallness
of x.
(37)
a. Hans is tall
b. Hans is taller than Eva
c. Hans is as tall as Eva
are then given the following analyses:
Alternative 1 (Cresswell 1986):
(A) Hans is y-tall and y is located on top
of the scale, or
Hans is y-tall and y > N
(B) Hans is y-tall and Eva is z-tall and y > z
(C) Hans is y-tall and Eva is z-tall and y z
or y = z.
Alternative 2 (Seuren 1973, 1985):
(A) y((Hans is y-tall) and (not(N < y)))
(B) y((Hans is y-tall) and (not(Eva is y-
tall)))
(C) y((Eva is y-tall) (Hans is y-tall)).
(31)
a. Hans is shorter than Franz ( both
are short)
b. Franz is taller than Hans ( both
are tall)
c. Hans is better than Fritz (, ?)
d. Fritz is worse than Hans ( both are
bad).
4) Dimension adjectives can take measure
phrases in order to specify the difference in
the individuals qualities:
(32)
a. Hans is three centimeters shorter
than Fritz
b. ??? Belinda is two units more beau-
tiful than Miranda.
Sometimes units can be contextually fixed
for value adjectives:
(32)
c. In maths, Hans is two grades better
than Fritz.
5) There is a certain duality of comparative
and equative:
(33)
a. Hans is taller than Fritz
b. Fritz is not as tall as Hans
are equivalent. Some speakers, notably Bier-
wisch (1986:102), accept (34) as equivalent:
(34)
a. Hans is not taller than Fritz
b. Fritz is as tall as Hans
This seems to be a consequence of Bierwischs
discussion of
(35) Applicants must be six feet tall,
which means must be at least six feet tall.
Therefore, Bierwisch interprets x-tall as at
least x-tall and claims that (34a) and (34b)
are equivalent. The canonical interpretation
of x-tall as exactly x-tall implies, of
course, that the sentences are not equivalent.
The interpretation of (35) is most probably
due to some condition on the use of the
modality.
What emerges is that antonym pairs of
dimension adjectives share a basic quality.
Dimension adjectives then build up a scale on
this quality. On this scale the comparatives
of the antonyms are inverse relations of each
other and the norm is the average, dependent
on comparison class. Value adjectives also
build up a scale, but the comparatives are
inverse relations if at all then only in a very
small area. In general, the positives of an
antonym pair of value adjectives occupy dif-
ferent ranges of the scale. Therefore it is de-
batable whether they really share a quality,
especially as their norm seperates the two
670 VIII. Adjektivsemantik
the scale remains constant and only the norm
varies with the comparison class; b) short gets
a scale of its own, the degrees of which are
defined in such a way as not to take measure
phrases.
What is lost is the intuition that antonym
pairs share a basic quality, and their compar-
atives are inverse relations on a common
scale.
Alternative 3 runs into the same problem
about this property of the comparatives.
To capture it, the scales have to be altered
substantially. One can keep the construction
of equivalence classes of objects of the same
tallness, and then order them with the relation
. But one should consider the field of this
relation as the set of degrees, because only
then the same degrees can constitute the field
of the inverse relation. Scales of dimension
adjectives should, moreover, have an origin
(a zero-point) and thus be isomorphic to an
order with a smallest element, as Hamann
(1982) suggests. Due to vagueness, the norm
on these scales is probably not a sharp value,
but covers a certain range.
The scales of value adjectives have no ori-
gin, but show two areas seperated by the
norm and having different orientation. Here,
too, the norm covers a certain range, so that
we get the following picture:
Fig. 31.1: Scale of value adjectives
We build up the scales with a strong order
relation because that is intuitively simpler
than a weak order. Additionally, in a strong
order one can always define the distance be-
tween two elements, or, turning it around,
with the help of the addition operation and
the concept of the distance between two ele-
ments of a set one can always define a strong
order. Therefore, only strong orders can ad-
equately explain (32a). If one decides to base
the scale on a weak order relation, as Bier-
wisch (1986) does because of his interpreta-
Alternative 3 (Hellan 1981):
(A) x y z ((Hans is x-tall) and (N > y)
and (x = y+z))
(B) x y z ((Hans is x-tall) and (Eva is y-
tall) and (x = y + z))
(C) x y ((Hans is x-tall) and (Eva is y-tall)
and (x y)).
All three alternatives base the positive on the
comparative, such that the norm becomes the
comparison value for the positive. All of the
above expressions have been simplyfied by
leaving out the lambda-operator. This oper-
ator has the effect that in a fully fledged
theory not the degrees (the points on the
scale) are compared, but properties, in par-
ticular the properties of having Hanss or
Evas degree of tallness. Then, of course, the
norm has to be treated as a property, too. It
becomes the property of having the average
degree of tallness. Strictly speaking, N addi-
tionally needs an index which specifies the
comparison class. Measure phrases can be
treated either as names or as properties of
degrees.
Though all these niceties have been left out
from the above formalizations, it is nonethe-
less worthwhile to examine how categoriza-
tion is effected. Consider a CN/CN approach
and an analysis like Alternative 1. Then tall
is of category (s/n/n)/(s/n). Let man be a noun
of category (s/n), then tall man is of category
(s/n/n). This is so, because tallman stands for
x-much tall man and thus takes a degree and
an individual as arguments to form a sen-
tence.
All three alternatives can treat most of the
above examples. However, only Alternative 3
can treat examples where the difference is
specified in a measure phrase.
Alternative 2, which ingeniously intro-
duced negation into the semantics in order to
explain the occurrance of negative-polarity-
items in the than-complement, lost some of
its attractiveness when Ladusaw (1979)
pointed out that the occurrance of negative-
polarity items is not due to an underlying
negation but is triggered by downward-entail-
ing expressions. As it turns out, than-comple-
ments are downward entailing.
Alternative 1, which goes back to Cresswell
(1976), also has weaknesses: a) as is evident
from the above categorization, Cresswell
builds up a seperate scale for each adjective-
noun combination, so that the scales for tall
man, tall boy etc. are not the same. One ex-
pects, however, that for dimension adjectives
31. Adjectives 671
acquire gradability, however reluctant they
may be to accept the operator. According to
Bierwisch, only adjectives which satisfy (12)
and where (-pole) is not equivalent to
un(+ pole) can be inherently gradable, adjec-
tives satisfying (11) are never gradable. This
condition on gradability is much stronger
than the requirement that the adjective pos-
sess an extension gap. It excludes value ad-
jectives from the class of inherently gradable
expressions because they cannot be con-
sidered as truly fulfilling (12). The reason is
that they are not transparent. Together with
a noun (good mother bad mother) they
fulfill (12), and this leads back to the require-
ment that they need a comparison class in the
form of the noun before they can become
gradable. Some of these adjectives which no-
toriously occur in pairs are called canonically
gradable by Bierwisch, but their tendency to
occur in pairs is attributed not to any system-
atic, but an accidental relation of their se-
mantic content. We will not further discuss
how far this treatment captures intuitions.
We have said next to nothing about factor
phrases (examples (36a,b)) and the modifiers
too and enough. The latter obviously say
something about satisfying a norm and can
explicitly introduce this norm and the relevant
comparison class.
Neither will we deal with comparisons on
different scales, which are possible but vary
in acceptability:
(38)
a. Ophelia is much more beautiful than
intelligent
b. ? Hans is much taller than cautious.
Example (38a) seems to be more acceptable
than (38b) because there the mixed compari-
son at least compares adjectives of the same
type, while in (38b) a dimension and a value
adjective are involved. The apparatus capable
of treating such comparisons, has to relate
Hanss degree of tallness to his degree of
caution. This can be done only if degrees of
tallness and degrees of caution have been
mapped in suitable fashion onto an auxiliary
scale. The comparison is then effected on this
auxiliary scale. Hamann et al. (1980) dem-
onstrate how this can be done without vio-
lating the order relations of the original
scales.
3.3Summary
The characteristic of relative adjectives is their
dependence on a comparison class and a
norm, predicatively and attributively. A pre-
tion of (35) and the equative, then Grice (Be
relevant!) must explain why the normal inter-
pretation of (29a) is that the board is exactly
two meters long, and why Hans is taller than
Eva is hardly a satisfactory answer to How
tall is Hans?
Bierwisch (1986) arrives at scales like those
in Fig.1 in the following way. He introduces
a degree complement for dimension adjec-
tives, i. e. an internal -role, and one more
argument, the comparison value, which is a
variable.
long (syntactic frame)
(z(x(QUANT MAX x) = (y + z)));
short (syntactic frame)
(z(x(QUANT MAX x) = (y z))).
Here x is the -role which will eventually
become the grammatical subject or be ab-
sorbed by the modified quantity, z is the
difference value, and y the comparison value.
Actually, the formulas are much more com-
plicated as there is the weak order to be
considered and so the +/ operations have to
be employed. The important thing, however,
is the open variable for the comparison value.
Either the norm or the origin of the scale can
be assigned to this value according to certain
rules. These rules thus are the key of the
theory because they license norm dependence
or measure phrase modification.
Value adjectives, on the other hand, do not
have an inherent degree complement in Bier-
wischs theory. They become gradable only
relative to a class C. For value adjectives,
therefore, Bierwisch takes over Cresswells
scales, after an operator with a semantics
similar to much has applied and added the
degree complement to the adjectives syntactic
frame. Bierwisch further assumes that these
scales have a class dependent origin O
C
in-
stead of a norm. Therefore the above menti-
onend rules have no choice between a norm
and an origin, and the required distinctions
about norm dependence of dimension and
value adjectives and their comparatives follow
automatically. As in Cresswell (1976), how-
ever, each adjective of a pair now has a scale
of its own, so Bierwisch glues these two scales
together in their origins and thus also arrives
at Fig.1.
The approach is interesting because it clas-
sifies only dimension adjectives as inherently
gradable, all the others need the application
of an operator to become gradable. This is a
nice explanation of why colour adjectives like
red or even absolute adjectives like single can
672 VIII. Adjektivsemantik
Problems of attributive participles and er-
gative constructions are considered in Haider
(1984) and Toman (1986). Both argue in the
framework of GB, but take different ap-
proaches. Haider (1984) works with the
blocking and deblocking of internal and ex-
ternal arguments triggered or detriggered
by the properties of the participles or sein and
haben. Toman (1986), whose approach we
have delineated, uses the idea of inheritence
domain, argues that sein + participle and ha-
ben + participle is such a domain and so the
properties of these constructions can be de-
duced from the properties of sein (ergative)
and haben (transitive). Both give different ex-
planations for crucial examples, which we
take as justification for the detailed discus-
sion. It demonstrates very nicely, how much
interesting turmoil can be found in GB, es-
pecially concerning parameter setting for dif-
ferent languages.
Borer (1984) outlines yet another ap-
proach. She advocates the weak lexicalist hy-
pothesis, while Toman (1986) adheres to the
strong variant, compare Borer and Wexler
(1989).
More about ergative adjectives can be
found in Cinque (1989, 1990).
4.2Semantics and Adjective Classes
The predicative approach is presented in Rei-
chenbach (1947), Smith (1964), Chomsky
(1965) and, more recently, in the second the-
ory of Kamp (1975), in Siegel (1976) and
(1979), Kaiser (1978), Pinkal (1979), and in
Bierwisch (1986).
Double classification is favoured by Bol-
inger (1967), Parsons (1972), Emonds (1976),
and Hamann (1982).
The modifier approach is pursued by Clark
(1970), where we find a very detailed classi-
fication of adjectives, by Montague (1970a),
Bennett (1976), Ballmer & Brennenstuhl
(1982), Cresswell (1976), Keenan & Faltz
(1978) and Hausser (1984).
Discussions about the (missing) compari-
son classes or the problem of reference value
can be found in Katz (1967) and in most of
the above mentioned authors work. It gets
special scope in Pinkal (1979), Kaiser (1978),
Keenan & Faltz (1978), and Bierwisch (1986).
4.3More About Adjective Classes
In the discussion of colour adjectives and
their status as universals, especially Berlin &
Kay (1969) take a stand against the Sapir &
Whorf hyphothesis. McNeill (1971) and oth-
requisite for their gradability is certainly their
systematic extension gap and probably con-
dition (12). Comparisons can be made be-
cause the primitive operation of ordering al-
lows to construct a scale. The comparatives
of relative adjectives can be seen as order
relations, the fields of which become the
points of the scales. The scales differ for
dimension and value adjectives as shown in
Fig. 1. This difference in scales explains the
different behaviour of the comparatives with
regard to the respective norms. The positives
always involve a norm or a class dependent
origin. In order to capture the full breadth of
phenomena regarding the possibilities of
modification in the adjectival phrase one has
to introduce three arguments for relative ad-
jectives: one for the individual, one for the
individuals degree on the scale, and one
which can be filled by the distance value.
4. The Literature
4.1Word Classes
The problems of identification of word classes
and the possibilities of expressing adjectival
concepts via nouns or verbs are dealt with in
Dixon (1977), Schachter (1985) and Anderson
(1985). Keenan & Faltz (1978) take another
approach. They a priori distinguish the clas-
ses. Only nouns are interpreted as properties,
verbs are functions and adjectives are func-
tions from properties to properties. In Dixon
(1977) one can find the inventories of the
languages with small adjective classes.
The above authors also treat the various
possibilities of marking predicative and at-
tributive constructions. Siegel (1976) investi-
gates the Russian short- and long-forms.
A discussion of natural kinds, their clusters
of criteria and conceptual difference to adjec-
tives can be found in Lakoff (1973), in Miller
& Johnson-Laird (1976), and in Carlson
(1977). Kripke (1972) advocates another view
in which the terms for natural kinds and
adjectives like hot are treated on a par, namely
as rigid designators.
The concept of extension gap is discussed
in Kamp (1975). Kamp and Pinkal (1979) take
adjectival vagueness and its contextual reduc-
tion as the point of departure for their theory.
Vagueness and related concepts are discussed
in Pinkal (1985).
An early, but thorough treatment of most
of the above problems is Sapir (1944) (ed.
Mandelbaum (49)).
32. Comparatives 673
combines the methods of formal logic with
the concepts of GB (as found in Chomsky
1981), but treats many more phenomena than
could be listed and discussed here.
5. Short Bibliography
Anderson 1985 Ballmer/Brennenstuhl 1982
Bartsch/Vennemann 1972 Barwise 1973 Bennett
1976 Berlin/Kay 1969 Bierwisch 1967 Bier-
wisch 1986 Black 1937 Bloomfield 1933 Bol-
inger 1967 Borer 1984 Borer/Wexler 1989 Bur-
zio 1981 Cardinaletti 1988 Carlson 1977
Chomsky 1965 Chomsky 1981 Cinque 1989
Cinque 1990 Clark 1970 Cresswell 1976 Dixon
1977 Emonds 1976 Fanselow 1987 Grimshaw
1988a Haider 1984 Hamann 1982 Hamann/
Nerbonne/Pietsch 1980 Hausser 1984 Helbig/
Kempter 1981 Helbig/Buscha 1984 Hellan 1981
Kaiser 1978 Kamp 1975 Katz 1967 Keenan/
Faltz 1978 Kripke 1972 Ladusaw 1979 Lakoff
1973 McNeill 1972 Miller/Johnson-Laird 1976
Montague 1970a Osgood 1971 Parsons 1972
Perlmutter 1978 Partee 1976 Partee 1978 Pin-
kal 1979 Pinkal 1985 Ptz 1989 Quirk/Green-
baum/Leech/Svartvik 1972 Reichenbach 1947
Sapir 1944/1949 Schachter 1985 Seuren 1973
Seuren 1985 Siegel 1976 Siegel 1979 Smith
1964 von Stechow 1985 von Stechow/Sternefeld
1988 Toman 1986 Wallace 1972 Wunderlich
1973
Cornelia Hamann, Ferney-Voltaire (France)
ers take up the discussion and, in many
points, argue against Berlin & Kay.
Kamp (1975) and Wallace (1972) discuss
the question, whether the comparative should
be the semantic primitive for relative adjec-
tives or whether it should be the positive.
Bartsch & Vennemann (1972) provide a val-
uable overview over the problems of compar-
ison and the research of the sixties. Bierwisch
(1967) suggests a decomposition analysis for
dimension adjectives, and Wunderlich (1973)
discusses the problems of dependence on a
norm and comparison class.
Cresswell (1976) analyses the comparative
in the framework of a Montague Grammar
and introduces Alternative 1. Hamann et al.
(1980) take his approach a bit further in dem-
onstrating how the scales have to be altered
in order to accomodate the difference of di-
mension and value adjectives. They also treat
the minimal requirements on a mapping be-
tween scales for mixed comparisons. Ha-
mann (1982) makes it plausible to treat a scale
as a simple model of an order relation with
or without a smallest element without hav-
ing to accept the structure of the real numbers
lock stock and barrel.
Seuren (1973) and (1985) introduce and
comment on Alternative 2, Hellan (1981) in-
troduces Alternative 3. Von Stechow (1985)
compares those three approaches. Bierwisch
(1986) gives a recent and comprehensive treat-
ment of the whole subject, which not only
32. Comparatives
1. Linguistic Phenomenology
1.1A Comparative Look at Comparatives
It is usually fairly easy to recognize a com-
parative construction, but less easy to give a
satisfactory general definition. Central to our
discussion is the status of gradable adjectives
such as old, big, and generous (also known as
degree or relative adjectives). These have a
number of interesting characteristics. The
most important seems to be that they express
properties which are order inducing, in the
sense that we can impose an ordering (pos-
sibly incomplete) on objects according to
whether one object possesses the relevant
property to greater or less extent than an-
other. It is difficult to disagree with Cress-
wells (1976: 281) contention that our ability
1. Linguistic Phenomenology
1.1 A Comparative Look at Comparatives
1.2 Further Syntactic Considerations
2. Measurement
3. Degree Ontologies
3.1 The Degree Parameter
3.2 Degrees as Equivalence Classes
3.3 Numerical Degrees
3.4 Delineation Theories of Comparatives
3.5 Positive and Comparative
3.6 Commensurability
4. The Logical Form of Comparatives
4.1 The Comparative Complement
4.2 Connectives
4.3 Quantifiers
4.4 Modal Contexts
5. Concluding Remarks
6. Short Bibliography
674 VIII. Adjektivsemantik
attention in this article, comparatives will be
the main focus.
In order to establish some grammatical
terminology, let us briefly consider an English
adjectival comparative. (3) illustrates a rea-
sonably uncontroversial phrase structure
analysis.
(3) Sue is [
AP
[
AP
taller] [
PP
than
[
S
Tom is [
AP
e]]]]
The comparative construction itself is the
constituent dominated by the topmost AP
(Adjective Phrase) node. The head of this
construction is the AP taller. The comparative
complement of the head is the constituent
than Tom is; following Larson (1985), we have
classified this as a PP (Prepositional Phrase).
Syntacticians are generally agreed that there
is a grammatically controlled missing constit-
uent in the comparative clause, which has
here been indicated as a lexically empty AP
node. The affix -er in taller is a degree mod-
ifier. While the comparative degree marker in
English is realized as an inflection on mono-
syllabic and some disyllabic adjectives, it can
also be expressed analytically by the modifier
more; cf. also less and as.
It is useful to also give a notional analysis
of the comparative construction. Terminology
in this area is somewhat confused; I shall
largely follow that of Ultan (1972). The ad-
jective tall expresses the gradable property.
Sue is the item of comparison, while Tom is
the standard of comparison. The standard
marker, than, marks the degree relationship
between the item and standard of compari-
son, and according to Ultans analysis must
belong to the same syntactic constituent as
the standard of comparison. The degree
marker, -er, is notionally characterized as the
expression which marks the degree to which
the item of comparison possesses the gradable
property. (4) summarizes:
The typological characteristics of compara-
tive constructions have attracted a fair
amount of attention; cf. particularly Ander-
sen (1983), Stassen (1984), Ultan (1972). A
major distinction can be drawn between para-
tactic and hypotactic constructions. A para-
tactic construction consists of two coordinate
constituents, whereas a hypotactic construc-
tion consists of a complement embedded
within a main clause. A second major dis-
to draw comparisons has to be taken as basic
data, and that it is the business of linguistics
... to tell us how we put the comparisons we
do make into the linguistic forms into which
we put them. From a cognitive point of view,
it is highly plausible that the notion under-
lying a predicate such as old is a relational,
intrinsically comparative notion. What is less
clear is whether we should take this compar-
ative relation as fundamental to the natural
language semantics of gradable predicates.
This is a topic of considerable and continued
debate which we shall not attempt to resolve
in this article; for discussion, cf. Bartsch &
Vennemann (1972), van Benthem (1982,
1983 a, c), Bierwisch (1987/89), Cresswell
(1976), Hoepelman (1983), Kamp (1975),
Klein (1980), Sapir (1944), von Stechow
(1983), Wallace (1972) and Wheeler (1972).
The second important characteristic of
gradable predicates concerns the linguistic
manifestation of their comparative nature,
namely that they admit degree modification.
Degree modifiers in English consist of ex-
pressions like very, fairly, too, and so, measure
phrases such as twenty five years, two metres
and six kilograms, and the comparative con-
structions themselves.
The third property of gradable predicates
which we wish to draw attention to is that
they typically come in pairs, standing in polar
opposition; for example, old ~ young, big ~
small, and generous ~ mean. Following Hoe-
pelman (1983), let us symbolize the polar op-
posite of a gradable predicate as . For
Lyons (1977: 272), the distinguishing logical
characteristic of such pairs is that they vali-
date inferences of type (1a), but not the con-
verse (1b):
(1)
a. x is x is not
b. x is not x is
For further discussion of polarity, see also
Hoepelman (1983), Lehrer & Lehrer (1982),
Rusiecki (1985), Seuren (1978, 1984) and von
Stechow (1984d).
Traditionally, gradable predicates are said
to allow four degrees of comparison:
(2) a. positive: a is tall
b. equative: a is as tall as b
c. comparative: a is taller than b
d. superlative: a is the tallest of the
children
Types (b) and (c) are also sometimes classed
as comparatives of equality and inequality, re-
spectively. While equatives will receive a little
32. Comparatives 675
Hypotactic clausal constructions seem often
to be historically derived from paratactic
structures (Seuren 1984, Stassen 1984: 175),
and tend to involve a specialized comparative
particle, such as than in English, dan in Dutch,
or quam in Latin.
There has been some debate within generative
grammar as to whether such particles are
complementizers; the current weight of opin-
ion tends to the view that they are not (cf.
Chomsky & Lasnik 1977, den Besten 1978,
Larson 1985). It is interesting to note that
hypotactic comparative clauses frequently
pattern like wh-constructions. Thus, in the
case of English, Doherty & Schwarz (1967)
have pointed out the possibility of inversion
(though cf. Emonds 1976: 24):
(11) Politicians are friendlier than are states-
man.
Huddleston (1967) observed interesting simi-
larities in scopal interaction with negatives;
and Chomsky (1977) has drawn attention to
the overt wh-expression in the (non-standard)
construction (12):
(12) I am taller than what you are.
Languages such as Hungarian, Italian, Polish,
Maltese and German show an analogous
morphology; we illustrate from Hungarian:
tinction, crosscutting the first, can be drawn
between clausal and phrasal comparatives (cf.
Hankamer 1973), depending on whether the
comparative complement is a phrase consist-
ing of the standard of comparison, or whether
it is a clause which contains the standard of
comparison as a subconstituent. The exam-
ples in (5) (taken, like many others in this
section, from Stassen 1984) illustrate paratac-
tic clausal comparatives.
Typically in the paratactic clausal construc-
tion, each clause contains a gradable predi-
cate and there is some feature which marks a
contrast between the two clauses. The sub-
types illustrated above are: (a) a conjunction
of adversity (but), (b) polar opposition be-
tween the two predicates, and (c) negation of
one of the two predicates.
Finally, Malay possesses a number of com-
parative constructions, one of which is se-
mantically similar to the paratactic clausal
structure, though hard to classify syntacti-
cally:
Phrasal paratactic constructions have re-
ceived relatively little discussion from a cross-
linguistic perspective. Pinkham (1982) argues
persuasively that examples like (6) and (7) are
best analyzed as coordinate structures (cf.
also Napoli 1983):
676 VIII. Adjektivsemantik
subclasses: (17a) separative (from), (17b) al-
lative (to), and (17c) locative (at/on).
We briefly alluded earlier to a type of phrasal
construction which Stassen (1984: 149150)
calls derived case comparison. In such con-
structions, the case of the standard of com-
parison is parallel to, and thus determined
by, the case of the item of comparison. This
parallelism is neatly illustrated in the Latin
quam construction:
Notice that the English counterpart of (18),
I love Brutus no less than you, is ambiguous
between the two readings made explicit in
Latin. This factor provides some basis for the
view that on at least one derivation, the
phrase following the comparative particle is
related by ellipsis to a clausal complement
(Bresnan 1973, Hankamer 1973).
This brief overview of the major devices
for expressing comparison has of course ig-
nored much complicating detail. It has also
omitted any discussion of equative construc-
tions. According to Ultan (1972), the major
type of equative construction involves a de-
gree-like marker expressing similarity or iden-
tity, such as English like. He claims that of
the different kinds of standard markers found
in comparative, superlative and equative con-
structions, there is a marked similarity be-
It has also been noted, particularly by Seuren
(1973, 1984), that hypotactic comparative
clauses resemble paratactic ones in often con-
taining a negative particle:
However, Napoli and Nespor (1976) have ar-
gued that, at least in the case of Italian, the
(optional) presence of negation is not a reflex
of the underlying logical structure of com-
paratives (as supposed by Seuren), but instead
conveys a rhetorical overtone of denying an
existing assumption.
Phrasal hypotactic constructions are ex-
tremely widespread, and the major subtypes
divide into what Stassen (1984: 149) calls de-
rived case and fixed case constructions. We
will return to derived case constructions later;
the fixed case constructions are distinguished
by the standard of comparison being formally
marked by an invariable case assignment.
Within this class, a further subdivision into
direct object and adverbial comparatives can
be drawn. The direct object construction em-
ploys a verb meaning to surpass or to excel
whose subject is the item of comparison and
whose object is the standard. Typical exam-
ples are illustrated in (15) and (16).
In adverbial comparatives, the standard of
comparison is marked by an adposition or
oblique case inflection. Within this category,
we should probably place English examples
like (16a) (cf. Hankamer 1973), and (16b) (cf.
Huddleston 1967):
(16)
a. Sue is taller than Tom.
b. The car was travelling faster than 90
mph.
However, across languages, the semantic con-
tent of the adverbial is overwhelmingly loca-
tional, and as such can be divided into three
32. Comparatives 677
(20)
a. Hes not as successful as Mary claims
to believe that he is _.
b. *Hes not as successful as Mary be-
lieves the claims that he is _.
Comparative Subdeletion removed only part
of the compared constituent, namely the de-
gree modifier/quantifier:
(21)
a. Youve written more books than Ive
written articles.
b. Bill is as slim now as he was _ obese
before.
c. My sister drives as carelessly as I
drive __ carefully.
Finally, Comparative Ellipsis was regarded as
optionally removing part or all of a verb
phrase which had already undergone (CD):
(22) Youve written more books than Bill
(has) _.
Not surprisingly, subsequent work has called
into question many of the details of Bresnans
proposals. For example, Chomsky (1977) has
claimed that wh-Movement rather than an
unbounded deletion rule is responsible for
CD constructions; Bennis (1978) has argued
that the only grammatically-determined gap
in comparatives is caused by Subdeletion, and
that CD constructions arise from pragmati-
cally-determined ellipsis of the phrasal head;
and Napoli (1983 a) has denied the existence
of Comparative Ellipsis, arguing that the phe-
nomena in question can be accounted for
either by independently required mechanisms
such as VP Ellipsis, Null Complement
Anaphora and Gapping, or else by invoking
a distinct construction which we earlier
termed the Phrasal Comparative. (Additional
discussion of Comparative Ellipsis can be
found in Bach, Bresnan & Wasow (1974),
Higgins (1973), Napoli (1983 b), Plann (1982),
and Sag (1976).)
Despite the largely syntactic orientation of
the above-mentioned studies, some observa-
tions of semantic interest can be found. Thus,
Chomsky (1965: 180) remarks that (23a) en-
tails (23b), though not (23c) (cf. also Bresnan
1973, Doherty & Schwarz 1967, McCawley
1979):
(23)
a. John is a more clever man than Bill.
b. Bill is a man.
c. Bill is a clever man.
On the other hand, the entailment to (23b) is
not licensed by (24):
(24) John is a man more clever than Bill.
Some attention has also been paid to con-
structions like (25) (cf. Bresnan 1973: 324
tween comparative and superlative markers,
and generally dissimilarity between equative
markers and either of the other type. A fur-
ther interesting result of Ultans survey con-
cerned suppletive paradigms. Two thirds of
his sample consistently exhibited shared sup-
pletive bases for, on the one hand, compara-
tives and superlatives and, on the other hand,
positives and equatives. This is illustrated by
English better ~ best versus good ~ as good.
(Suppletion in the field of gradable adjectives
has also been studied by Wurzel 1985, 1987.)
Apart from the works already cited, the
literature contains a variety of reports on
comparative constructions in languages other
than English: for example, Chinese (Arlotto
1975), Dutch (Bennis 1978, Hoeksema 1983),
Eskimo (Mey 1976), French (Anscombre
1975, Milner 1973, 1978, Pinkham 1982),
German (Wunderlich 1973), Japanese (Haig
1976), Italian (Bracco 1979, Napoli & Nespor
1976), Polish (Borsley 1981), Proto-Indo-Eur-
opean (Andersen 1980), Spanish (Rivero
1981), Swedish (Andersson 1973), and Turk-
ish (Knecht 1976).
1.2Further Syntactic Considerations
The syntax of English comparative construc-
tions has been extensively studied within gen-
erative grammar; see, for example, Andrews
(1974, 1975), Bresnan (1971, 1973, 1975,
1976 a, b), Bowers (1975), Chomsky (1965,
1977), Dieterich & Napoli (1982), Doherty &
Schwarz (1967), Gazdar (1980), Hale (1970),
Hellan (1981), Hendrick (1978), Heny (1978),
Huddleston (1967), Jackendoff (1977), Kuno
(1981), Lees (1961), McCawley (1973a), Na-
poli (1983 a), Pilch (1965), Rivara (1979),
Smith (1961) and Williams (1976). Bresnans
(1975) analysis, according to which three rules
are centrally involved, has provided a useful
descriptive terminology which is widely ac-
cepted. Comparative Deletion (CD) was held
to be responsible for deleting the phrases in-
dicated in (19):
(19)
a. Youve written more articles than Ive
read _. (NP)
b. Bill is slimmer than he used to be _.
(AP)
c. They ate more quickly than they
drank _. (AdvP)
Bresnan points out that CD induces an un-
bounded dependency which respects familiar
island constraints:
678 VIII. Adjektivsemantik
as at least as long as. Ignoring concatenation
for the moment, consider the structure
A, consisting of a set A and the relation
on A. This is termed an (empirical) rela-
tional structure. It constitutes a weak order iff
for all a, b and c A, the following two axioms
are satisfied:
Weak Order:
(i) Connectedness: Either a b or b a.
(ii) Transitivity: If a b and b c, then
a c.
To arrive at a system of ordinal length meas-
urement, we must assign numbers to the rods
in a way that preserves the empirical ordering
induced by : the measure associated with a
is greater than or equal to the measure as-
sociated with b just in case a is at least as
long as b. That is, if is an assignment of
numbers to rods, then the following condition
must obtain:
(29) (a) (b) iff a b
This numerical assignment constitutes a ho-
momorphism of an empirical relational struc-
ture into a numerical relational structure. For
the latter, we take , , where is the set
of real numbers and is the usual greater
than or equal to relation. For to be a
homorphism, it must send A into and
into in a way which respects (i). The ex-
istence of the homorphism is guaranteed by
a representation theorem; that is, a theorem
which asserts that if a given relational struc-
ture satisfies certain axioms, then a homor-
phism into a certain relational structure can
be constructed. There are of course many
assignments of the required kind. A unique-
ness theorem states that, under a certain class
of permissible transformations, they are all
equivalent. In the case at hand, two assign-
ments and are equivalent iff there is a
monotone increasing function f such that for
any a A, (a) = f((a)). Thus the permis-
sible transformations for ordinal measure-
ment is the set of all monotone increasing
functions from onto .
The relation on the reals is a weak order
which is also anti-symmetric: if both x y
and y x, then x = y. We call this a simple
order to distinguish it from the case of a weak
order, where there can be distinct elements a
and b such that a b and b a.
Given the relation , we define two new
relations as follows:
(30) a ~ b iff a b and b a
(31) a b iff a b and (b a)
327, McCawley 1976, Napoli 1983 a, Thomp-
son 1972):
(25) Sue is more sad than angry.
This can be construed in two distinct ways.
The most salient reading, which Thompson
(1972) characterizes as denial of assumption,
arises when (25) is interpreted as a negative
answer to the question Is Sue angry? It also
has a more normal degree reading as an
answer to the question How sad is Sue?
On the denial reading, such constructions
have a number of distinctive properties. The
inflected form of the adjective is not allowed
(cf. also Andrews (1984), Huckin (1977), and
Ross (1974) on this interaction between mor-
phology and semantics):
(26) *Sue is sadder than angry.
They allow paraphrases of the form (27):
(27)
a. Sue is sad, more than angry.
b. Sue is sad rather than angry.
And third, the adjective cannot occur as a
prenominal modifier:
(28) *Sue is a more sad person than agry.
2. Measurement
Before considering proposals for the analysis
of comparative constructions, it will be useful
to review some of the basic mathematical
ideas involved in comparison and measure-
ment. For convenience, we adopt the frame-
work developed by Krantz et al. (1971, es-
pecially Ch. 1). Following their exposition, we
use the example of length measurement.
We take as given a set A of straight rods
whose length can be compared. If two rods a
and b are placed side by side so that they are
aligned at one end, then three situations may
obtain: either a is longer than b, or b is longer
than a, or a and b are equivalent in length.
These cases are symbolized, respectively, as
a b, b a, and a ~ b. As well as comparing
rods, we can concatenate them, that is place
two or more rods end to end in a straight
line. The concatenation of a and b is sym-
bolized a b. Naturally, it is possible to com-
pare the lengths of sets of concatenated rods,
so for example a b c d expresses the
proposition that the concatenation of a and
b is longer than the concatenation of c and d.
It is convenient (in order to state connect-
edness) to take as our basic empirical re-
lation. In the present context, we can gloss it
32. Comparatives 679
Suppose that a, a, a, ... are perfect cop-
ies of the rod a. Krantz et al. (1971: 4) call
the sequence a, 2a = a a, 3a = (2a) a, 4a,
5a, ... a standard sequence based on a. Clearly,
(na) = n(a), while the value of (a) will
depend on the particular rod chosen to have
unit length; if the unit rod is co-extensive with
ma, then (a) = 1/m. If a rod b falls within
an interval in the standard sequence, say
3a b 2a, then b will be assigned some
numerical value between 3(a) and 2(a).
The interval can be made arbitrarily small by
choosing finer and finer standard sequences.
For our purposes, the important property
of standard sequences is that the numbers
assigned are additive with respect to concat-
enation. That is, (b c) = (b) + (c). This
holds because if b approximates na and c
approximates na then (b c) approximates
(n + n)a. The additivity equation approaches
exactness as for finer and finer standard se-
quences.
We close this section with one possible ax-
iomatization of the conditions for extensive
measurement (Krantz et al. 1971: 73). Let A
be a nonempty set, a binary relation on A,
and a closed binary operation on A. Then
A, , is a positive closed extensive struc-
ture iff the following axioms are satisfied for
all a, b, c, d A:
(33)
i. Weak order: A, is a weak order.
ii. Weak associativity:
a (b c) ~ (a b) c.
iii. Monotonicity: a b iff a c b c
iff c a c b.
iv. Archimedean: If a
1
, ..., a
n
, ... is a
standard sequence, and there is some
b such that for all a
n
in the sequence,
b a
n
, then the sequence is finite.
v. Positivity: a b a.
It can be shown that A, , is a positive
closed extensive structure iff there is a func-
tion from A to the positive reals such that
for all a, b A,
(34)
i. a b iff (a) (b),
ii. (a b) = (a) + (b).
Another function satisfies (i) and (ii) iff
there is an > 0 such that = .
3. Degree Ontologies
3.1The Degree Parameter
Now that we have glanced at some founda-
tional concepts in measurement, we turn to
examine various proposals for analyzing nat-
If is a weak order on A, then ~ is an
equivalence relation on A, and is transitive
and asymmetric. The relation ~ partitions A
into a set of equivalence classes, where a =
{b b A b ~ a} is the equivalence class de-
termined by a. The set of equivalence classes
is denoted A/ ~. Suppose we define an order-
ing on A/ ~ by
(32) a biff a b.
Then A/~, is a simple order, since if
a b and b a, then a = b.
We note in passing that since a is the set
of objects which are exactly as long as a, by
analogy with the Frege-Russell treatment of
cardinal numbers, it might well be viewed as
a formal reconstruction of the length of a.
Indeed Cresswell (1976), amongst others, has
proposed a general analysis of degrees of just
this kind.
Consider a simple example. A = {a,b,c
1
,c
2
},
a b c
1
, c
2
, A/~ = {{a}, {b}, {c
1
, c
2
}} =
{a, b, c
1
}. The required representation theo-
rem states that if A / ~, is a simple order,
then there is an assignment such that (a)
(b) iff a b. We show this by providing
a method for constructing . For each a A /
~, (a) = card({b a b}). Thus, continuing
our example, we have (c
1
) = 1, (b) = 2, and
(a) = 3. The assignment to A/~ carries over
to A by setting (a) = (a).
Although this approach allows us to assign
numbers to the rods, it is important to note
that this induces an ordinal measure. The only
thing we can do with the numbers is compare
them under the relation; without more
information about the structure A/~, ,
and more constraints on the assignment ,
there is no guarantee that summing the values
of will make any sense. Consequently, al-
though we have constructed a formal notion
of length as an equivalence class, it does not
yet provide a basis for familiar systems of
length measurement. To be concrete, given
our example above, we cannot infer that the
measure (b) = (c
1
) + (c
1
). In fact, the
assignment is compatible with c
1
having a
length of 1 metre, and b having a length of 5
metres. In order to allow addition on the
range of , we must have the counterpart of
addition on s domain. This, of course, is
provided by the concatenation operation. As-
suming, for example, that we take c as the
unit measure, then we require that (b) =
(c) + (c) = 2(c) only if b ~ c
1
c
2
. Notice
that we assume that c
1
and c
2
are perfect
copies of each other, and in general we assume
that we can find indefinitely many such cop-
ies.
680 VIII. Adjektivsemantik
Siegel (1979), Beesley (1982) and von Stechow
(1983) for further discussion).
As we have to make some choices, we an-
swer (i) and (ii) in the manner that most
simplifies exposition, namely gradable adjec-
tives are predicates, parameterized for a de-
gree. Consequently, we propose (36) as the
object language representation of (35), where
tall denotes a binary relation between degrees
and individuals.
(36) tall(d, Sue)
We have little to say here about question (iii),
but will return briefly to it later.
What we wish to focus on now are the
issues raised in (iv) about the ontological
status of degrees. It could be argued that the
delineation approach makes weaker assump-
tions about the structure of the world than
either of the other two approaches. In addi-
tion, we have already seen that the degrees-
as-real-numbers approach presupposes the
degrees-as-equivalence-classes approach, to-
gether with some assumptions about the be-
haviour of concatenation. In the next three
subsections, we will try to find out whether
any substantial benefits accrue from making
these increasingly strong assumptions. We
shall also have occasion to reflect on (v), since
it has both formal and empirical conse-
quences. As a last introductory comment, we
note that because of our present concern with
ontology, questions about the logical struc-
ture of comparatives will be kept in the wings
for the time being, but will make their en-
trance on the stage in section 4.
3.2Degrees as Equivalence Classes
Anyone who has glanced at the linguistics
literature on comparatives will have encoun-
tered logical representations of (37) that re-
semble (38), (which we gloss as (39)).
(37) Sue is taller than Tom
(38) d[tall(d, Sue)] d[tall(d, Tom)]
(39) The degree to which Sue is tall exceeds
the degree to which Tom is tall.
The notation provides an answer to our ear-
lier question (v): it is assumed that each in-
dividual can be assigned a unique degree of
height. However, it is left open what kind of
thing the variable d ranges over. One pos-
sible answer is that a degree of height is a set
of objects that are all exactly as high as each
other. According to this view, proposed for
example by Cresswell (1976), comparatives
involve an ordering on degrees, where the
latter are construed as equivalence classes.
ural language comparatives. Every approach
to comparatives requires a means of express-
ing propositions like (35) (irrespective of the
particular treatment of positive adjectives):
(35) Sue is tall to degree d
However, there is a lot of room for disagree-
ment about what exactly is involved in the
reference to degrees. I t seems that we can ask
at least the following questions:
(i) Should degrees be explicit parameters in
the object language, or should they be
regarded as contextual coordinates (e. g.
Lewis 1970, Kamp 1975)?
(ii) Are gradable adjectives to be analysed as
basically being noun modifiers (e. g.
Cresswell 1976, Hoepelman 1983) or as
vague predicates (e. g. Kamp 1975, Klein
1980)?
(iii) Is the semantics of the compared adjec-
tive a compositional function of the se-
mantics of the positive adjective (e. g.
Kamp 1975, Klein 1980), or are they
both derived from some third, more ab-
stract semantic structure (e. g. Cresswell
1976)?
(iv) Are degrees (a) equivalence classes under
a relation of comparison (e. g. Cresswell
1976), (b) numbers closed under addition
(e. g. Hellan 1981), or (c) delineations (or
boundary specifications) for vague pred-
icates (e. g. Kamp 1975)?
(v) If (35) is satisfied by some degree d, is it
uniquely satisfied by d (e. g. Cresswell
1976), or is it also satisfied by each d
such that d' d (e. g. Kamp 1975)?
Although the issues addressed by questions
(i)(iii) are of great interest, and involve
some fairly knotty questions about the rela-
tion between context and content in natural
language semantics, they are largely periph-
eral to my present concerns. For example,
from our present perspective, the debate
around (ii) can be viewed as largely a matter
of notation; the noun modifier view has to
invoke contextual parameters to supply a
suitable property when adjectives are used
predicatively, as in Sue is tall, whereas the
one-place predicate view has to relativize the
interpretation of adjectives to a suitable com-
parison class, which can be explicitly ex-
pressed by a modified nominal when adjec-
tives are use attributively, as in Sue is a tall
woman. At any rate, since we are not specif-
ically concerned with the semantics of adjec-
tives, we will not attempt to provide princi-
pled answers to (i)(iii) here (though see also
32. Comparatives 681
a set DVar = {d
0
, d
1
, d
2
, ...} of variables over
degrees.
The set Form of well-formed formulae is
defined in the usual way, with the addition of
the following clauses:
(47) Every element of DVar belongs to
DTerm.
(48) If DPred, DTerm and Term,
then (, ) Form.
(49) If Form, and d
i
DVar,
then d
i
[] DTerm.
(50) If , DTerm, then , and
Form.
A model for L is a 4-tuple =
A, , F, where
(i) A is a nonempty set.
(ii) A is a nonempty set.
(iii) For each DPred, there is a partial
function f
from onto (A )/~
; f
is one-one on its domain; and
is the
image of (A )/~
under f
-1
.
(iv) F is a function on the nonlogical con-
stants of L.
(v) If Term, then F() A.
(vi) If d
i
DVar, then d
i
is assigned a value
in .
(vii) : DPred (A A) is a function
which assigns a weak order to each
DPred.
Elements of
(degrees of -ness) are a cer-
tain kind of abstract individual which possess
useful properties with respect to the ordering
. In particular, we have the following facts:
(51) If d, d
and d ~
d, then d = d.
(52) For all a A, and d
, a ~
d iff
a f
(d).
According to (51),
is an antisymmetric
relation on , while according to (52), an
ordinary individual a is -equivalent with a
degree d just in case a belongs to the -equi-
valence class to which d corresponds under f
.
The truth definition for the logical part of
L is standard, and we add the following
clauses to deal with degree expressions:
(53)
If (, ) Form, then (, )
= 1 iff
.
(54)
If Form, then
= 1 iff
and
;
similarly for and .
We pointed out earlier that the approach un-
der consideration imposes a uniqueness con-
dition on degrees, in the sense that (55) holds:
(55) xd
0
d
1
[(d
0
, x) (d
1
, x) d
0
= d
1
]
In order to make this a little more precise,
we will define a syntax and semantics for a
language containing definite degree terms. As
a simplifying assumption, the intended model
will associate a weak order
with each
degree predicate . We should not in general
require this association to be one-one. On the
one hand, two or more distinct predicates can
be scaled along the same dimension; for ex-
ample, we might allow that
tall
=
short
=
wide
=
narrow
. On the other hand, some
predicates are multi-dimensional, in the
sense that there may be several, possibly in-
compatible, criteria for their application. A
simple example is large: city X may be larger
than Y with respect to population, but less
large with respect to surface area. We will
ignore this kind of indeterminacy here (for
discussion, see e. g. Kamp 1975, Pinkal 1983).
As before, we define some additional re-
lations based on
:
(40)
a ~
b iff a
b and b
a.
(41) a
b iff a
b and (b
a).
(42) a
b iff b
a.
Since ~
is an equivalence relation on the
universe A of individuals, the degree to which
an individual a possesses the property ex-
pressed by can be spelled out as the equi-
valence class {b A b ~
a}. As a shorthand,
we also denote this class by [a]
. The set of
all equivalence classes on A induced by ~
is
the quotient algebra A/ ~
. So as to keep our
language first-order, we do not use equiva-
lence classes directly, but rather distinguish a
subset A, each element of which corre-
sponds to [a]
for some a and .
As suggested earlier, will be the object
language relation on degree terms which rep-
resents comparatives of inequality. Analo-
gous representations can be constructed for
comparatives of equality and less than com-
paratives:
(43)
a. Sue is (at least) as tall as Tom is.
b. Sue is less tall than Tom is.
(44)
a. d[tall(d, Sue)] d[tall(d, Tom)]
b. d(tall(d, Sue)] d[tall(d, Tom)]
Thus, let L be a first order language supple-
mented with the following nonlogical con-
stants:
(45) A set Term of singular terms Sue, Tom,
Rob, ...
(46) A set DPred of two-place degree predi-
cates tall, old, wise, ...
In addition, we assume the iota operator, and
682 VIII. Adjektivsemantik
(61)
(d[tall(d, Sue)])
(d[tall(d, Tom)])
= 1 iff
(d[tall(d, Sue)])
(d[tall(d, Tom)])
iff
([d[tall(d, Sue)]
)
(d[tall(d, Tom)]
) iff
d[tall(d, Sue)
d[tall(d, Sue)
(by HOM() iff
Sue
tall
Tom (by (56)).
Again it turns out that the truth conditions
of simple comparatives reduce to the primi-
tive grading relation. While the mapping into
real values has added an extra level of com-
plexity in the interpretation rules, has it
gained us any commensurate advantage? So
far, the answer is no. Although L(
) allows
us to represent numeric degrees, we cannot
legitimately add, subtract or multiply such
degrees, but only compare them. The numer-
ical models for L(
) induce an ordinal scale,
and nothing more. Thus, we still have no way
of representing sentences like (62), dubbed
differential comparatives by von Stechow
(1984 a):
(62)
a. Sue is twice as tall as Tom is.
b. Sue is 6cm taller than Tom is.
In order to deal with these, we need to sup-
plement L with something like arithmetic ad-
dition on degrees. Let us therefore introduce
a binary operator + on numerals, as follows:
(63) If v, v Num, then v + v Num.
A model for L(
, +) is a 4-tuple
= , , F, , where F and are as
before, and
(i) = A, , , .
(ii) = , , +.
(iii) : DPred (A A A) is a partial
function which associates a concatena-
tion with elements of DPred.
We assume that for each dimension
there
is a corresponding concatenation
, and that
each
is closed under
. The homomor-
phism from to also obeys the following
restriction:
HOM(): For all d, d
, (d) + (d) =
([d
d]
)
This says that the result of summing the num-
bers assigned to the degrees of d and d is the
same as the number assigned to the degree of
the concatenation of d and d.
Finally, it should be recalled that the re-
lation between dimensions and concatena-
tions is governed by certain axioms. In the
preceding section, the axioms proposed were
This condition is valid under the class of
intended models for L. For if the antecedent
is true under an assignment d
0
/d
0
, d
1
/d
1
and
a/x, then a ~
d
0
and a ~
d
1
; since ~
is an
equivalence relation, we have d
0
~
d
1
and
thus d
0
= d
1
.
It should be noticed that degrees do not
play an essential semantic role in the analysis
yet, since the comparatives in which they oc-
cur can always be reduced to comparisons
between ordinary individuals. That is,
(56)
d[tall(d, Sue)]
d[tall(d, Tom)]
iff d
d, where d ~
Sue and
d ~
Tom iff Sue
Tom.
3.3Numerical Degrees
If we confine our attention to those instances
where is defined, then is connected,
transitive and antisymmetric. Consequently,
by a representation theorem of the kind dis-
cussed in Section 2, we know that we can
assign real values to the degrees in
, yielding
an ordinal measurement. In order to imple-
ment this step, we augment L with an oper-
ator
which maps a member of DTerm into
an expression of category Num (or numeral):
(57)
If DTerm, then
Num.
(58) If v, v Num, then v v Form.
We shall assume that the representation of
Sue is as tall as Tom in L(
) is the following:
(59)
(d[tall(d, Sue)])
(d[tall(d, Tom)])
A numerical model for L(
) is a 4-tuple
= , , F, , where
(i) = A, , , with A, and as
before.
(ii) = , .
(iii) : .
(iv) is a simple order on .
(v)
For any d , F(
)(d) = (d).
As noted in the preceding section, the assign-
ment must also satisfy the appropriate ho-
momorphism condition:
HOM(): For all d, d
, (d) (d) iff
d
d.
Thus, the truth clause corresponding to (54)
is the following:
(60)
If v v Form, then v v
= 1 iff
v
.
Tracing the various conditions on the inter-
pretation of Sue is as tall as Tom yields the
following list of equivalences:
32. Comparatives 683
Notice that once this approach has been
adopted for differential comparatives, it sug-
gests a revision in the analysis of ordinary
comparatives such as Sue is taller than Tom
is. These can now be construed as the exis-
tential generalization of formulae like (68):
(69)
(v 0)[tall(
(d[tall(d, Tom)]) + v, Sue)]
3.4Delineation Theories of Comparatives
The family of approaches that we have ex-
amined so far all adopted a degree-based
analysis of comparatives. First, the item and
standard of comparison were associated with
degrees along some dimension, and this was
formalized with iota terms over degree vari-
ables in the object language. Second, a com-
parative sentence was represented as a rela-
tion between two degrees, and this was for-
malized using either the relation-symbol,
or else by means of +.
In this section, we will examine a somewhat
different approach, one which relies on what
Lewis (1970) calls delineations. A delinea-
tion is intended as a contextual parameter
that plays a role in the evaluation of degree
predicates. Just as the interpretation of That
is a sock requires a specification of the object
indexically invoked by that, so according
to this view the interpretation of Sue is
tall requires a specification of the standard
according to which something is judged as
tall. A delineation for tall determines where,
along the dimension of height, the cut-off
point between tall and not-tall is to be set,
and it is claimed that this point can vary with
context.
There are a number of ways in which con-
textual parameters can be formally captured.
For our current purposes, the simplest strat-
egy for dealing with delineations is to treat
them like degrees, via an extra argument to
the degree predicate. This argument will de-
note a standard, which in turn will determine
a delineation of the predicate. Thus, we trans-
late Sue is tall as (70), where s is a variable
over standards.
(70) tall(s, Sue)
Despite appearances, this step does not com-
pletely conflate the delineation approach with
the degree-based one. In order to be faithful
to the intuition underlying delineations, (70)
should not be interpreted to mean that Sue
belongs to an equivalence class associated
with s, but rather that the standard deter-
mines a delineation according to which Sue
is judged tall. In other words, (70) can be
Weak Associativity, Monotonicity, the Archi-
medean axiom and Positivity.
Lets return now to the sentences in (62).
The obvious way to deal with (62a) is to treat
twice as a modifier of the comparative rela-
tion as tall, as. However, since is intro-
duced syncategorematically in L, it is easier
to translate twice as though it applies directly
to a numeral expression, as follows:
(64) If v Num, then 2v, 3v, ... Num.
The numerals 2, 3, ... can of course be defined
in terms of the plus operator:
(65) v[2v = v + v]
Within this set of assumptions, the logical
counterpart of Sue is twice as tall as Tom is
will be (66):
(66)
(d[tall(d, Sue)]) 2
(d[tall(d, Tom)])
(This of course represents the reading on
which twice as tall means at least as twice as
tall. To get the exactly as twice as tall reading,
would be replaced by ~.)
Again, it may be useful to work through
the truth definition.
(67)
(d[tall(d, Sue)])
2
(d[tall(d, Tom)])
= 1 iff
(d[tall(d, Sue)])
(d[tall(d, Tom)])
iff
(d[tall(d, Sue)])
)
(d[tall(d, Tom)]
) +
(d[tall(d, Tom)]
) iff
d[tall(d, Sue)])
d[tall(d, Tom)]
tall
d[tall(d, Tom)]
Notice that the presence of degrees here al-
lows us to avoid the embarrassment of trying
to concatenate Tom with himself.
Let us turn now to sentences like (62b),
(62) b. Sue is 6 cm taller than Tom is.
These constitute more of a problem for the
apparatus developed so far, since it is not
immediately obvious how a measure phrase
such as 6cm should be integrated with the
comparative relation expressed by taller than.
One strategy, adopted by Hellan (1981) and
von Stechow (1984 a), is to express the com-
parative entirely in terms of the + operator.
That is, we take (62b) to mean something like
Sue is tall to [the degree to which Tom is tall
plus 6cm]. An analysis of this kind is readily
expressed in our current language, assuming
that we treat expressions like 6cm as elements
of Num.
(68)
tall(
(d[tall(d, Tom)]) + 6cm, Sue)
684 VIII. Adjektivsemantik
(72):
(72) s[tall(s, Sue) tall(s, Tom)]
Similarly, Sue is taller than Tom is holds if
there is some standard which satisfies tall(s,
Sue) but fails to satisfy tall(s, Tom):
(73) s[tall(s, Sue) tall(s, Tom)]
An attractive feature of this approach is that
(73) is logically equivalent to the negation of
(72), namely (74).
(74) s[tall(s, Sue) tall(s, Tom)]
In other words, we get for free the equiva-
lence between (75) and (76):
(75) Sue is taller than Tom is.
(76) Tom is not as tall as Sue is.
The approach just sketched is notationally
closest to the system presented in Klein
(1982). However, the essential idea is to be
found in several earlier studies, in particular
Lewis (1970) (where it is attributed to unpub-
lished work by David Kaplan), Kamp (1975),
McConnell-Ginet (1973), and Seuren (1973).
Related discussions can also be found in Klein
(1980, 1981 a, b) and van Benthem (1982,
1983 a, c).
At this point, let us briefly confront an
objection against the delineation approach
raised by von Stechow (1984 a). As we have
already seen, comparatives allow differential
forms such as (62), repeated here.
(77)
a. Sue is twice as tall as Tom is.
b. Sue is 6cm taller than Tom is.
How can these be captured? As a preliminary
step, let us ask another question, namely how
are sentences like (78) to be analyzed?
(78) Sue is 1m tall.
If we just focus attention on the measure
phrase 1m, a rather plausible step is to inter-
pret it as a degree of height: it denotes the
equivalence class of objects which are one
metre in length. Instead of taking our earlier
route of introducing a special category Num
for numeral expressions, we might just as well
assign 1m to the category DTerm of degree
terms. A second observation to be made
about (78) is that 1m appears to have the
function of making explicit the appropriate
standard for tall.
Let us return to the problem of how to
represent differential comparatives of ine-
quality. Recall that (75) was represented as
(73), repeated here:
(79) Sue is taller than Tom is.
(80) s[tall(s, Sue) tall(s, Tom)]
paraphrased as Sue is at least as tall as stan-
dard s. Notice that there is no unique stan-
dard of tallness possessed by an individual: if
Sue is at least 2 metres tall, then she is at
least 1.50 metres tall, and so on. Support for
this position lies in the fact that a question
like (71a) can be answered as (71b):
(71)
a. Is Sue 1.50 metres tall?
b. Yes. In fact shes 2 metres tall.
By Grices maxim of quantity, an utterance
of Sue is 1.50 metres tall will conversationally
implicate that Sue is at most 1.50 metres tall,
unless there is explicit cancellation of the im-
plicature as in (71b).
In order to formalize these notions, we
might define a new first order language L(s);
like L, it would contain a category DPred
whose members denote binary degree rela-
tions between standards and individuals. We
will not go into detail, but mention some of
the most important points.
Models for L(s) will contain
A, a set
of standards for . We assume, as with
,
that there is one-one correspondence between
and A/~
. Every standard s
generates
a possible positive extension for , namely the
set {a : a
s} of objects which are at least as
as s. We will call this set an s-extension. An
s-extension is the principal filter generated by
s, and we denote it by [s)
. We can now say
that tall(s, Sue) is true in a model for L(s)
just in case Sue belongs to [s)
tall
.
Despite the fact that ss value is allowed to
vary from context to context, the admissible
delineations must conform to the principle
GRAD of Consistent Gradience:
GRAD: For all DPred, a, b A, and s
if s, a F() and b
a,
then s, b F(), and
if s, a F() and a
b,
then s, b F().
That is, if Sue
tall
Tom, then any value of s
which satisfies tall(s, Tom) must also satisfy
tall(s, Sue). But once GRAD is imposed, then
the converse regularity gives us a straightfor-
ward means of expressing comparatives. That
is, if any value of s which satisfies tall(s, Tom)
also satisfies tall(s, Sue), then it follows that
Sue is at least as tall as Tom. As a result, the
representation of comparative constructions
in L(s) does not require the addition of a
further relation such as , but only involves
the quantification of s-variables. For exam-
ple, Tom is as tall as Sue is has the translation
32. Comparatives 685
ment by an operator pos, along the following
lines:
(84) pos()(x) d[(d) (d, x)]
where means roughly is higher than
average
On a delineation approach, much the same
effect can be gained by assuming that an
appropriately high standard is picked out on
the basis of contextual factors.
Another important consideration, so far
not discussed, is the fact that degree adjectives
are interpreted relative to a comparison (or
reference) class (see, for example, Hare 1952,
Ross 1970 b, Siegel 1979, von Stechow 1983,
Wallace 1972, Wescoat 1984, Wheeler 1972,
and Zwicky 1969). The comparison class can
either be implicit, as when we interpret Fergus
is big to mean that Fergus is big relative to
the class of fleas, or explicit, as in (85).
(85)
a. Fergus is a big flea.
b. Fergus is big for a flea.
A rather simple and attractive proposal is to
analyse the comparison class as setting the
domain of discourse relative to which the
adjective is evaluated. On such an approach,
we might interpret a degree adjective as a
function which, given a set X, acts very much
as a one-place predicate restricted to X. Thus,
the positive adjective big would denote a par-
tial characteristic function which, when ap-
plied to the set of fleas, induces a partition
into the set of big fleas and the set of small
fleas, with possibly some residue of fleas
which are neither definitely big nor small. We
might then derive the comparative as a quan-
tification over comparison classes:
(86) x is bigger than y is true iff there is some
comparison class X such that x is big is
true relative to X while y is big is false
relative to X.
Indeed, the truth of (86) can be resolved on
the basis of one particular comparison class,
namely the set {x, y}. Given a few plausible
axioms, it can be shown that the relation
induced in this way is transitive and irreflexive
and, on a quotient algebra, connected; cf. van
Benthem (1982, 1983 a), Hoepelman (1983)
and Klein (1980).
From a structural point of view, the analy-
sis sketched in (86) is a close variant of the
delineation approach: just take s in (81) to
range over comparison classes rather than
standards. This is to be expected if we assume
that every comparison class X for a predicate
is associated with a delineation; i. e. a divi-
There is an equivalent way of expressing (80)
which uses sets of standards; namely, that the
set of standards which satisfy tall(s, Sue) but
not tall(s, Tom) is non-empty. We can repre-
sent this in the object language by means of
and an existential generalized quantifier V :
(81) (s[tall(s, Sue) tall(s, Tom)])
, of course, is to be viewed as a second
order predicate, true of just those sets which
are non-empty. The set denoted by
(82) s[tall(s, Sue) tall(s, Tom)]
is the class of all those standards s such that
Sue is tall according to s but Tom is not.
Suppose for example that Sue is (exactly) 1.06
metres tall, Tom is 1 metre tall, and that
standards of height correspond to centime-
tres. It follows from what we said earlier that
Sue belongs not only to [106 cm)
tall
, but also
to [105 cm)
tall
, [104 cm)
tall
, ..., [1 cm)
tall
. Sim-
ilarly, Tom belongs to [100 cm)
tall
, [99 cm)
tall
,
..., [1 cm)
tall
; but, crucially, he does not belong
to [101 cm)
tall
nor to any higher s-extension.
Consequently, (82) will denote the following
set of standards in
tall
:
(83) {106 cm, 105 cm, 104 cm, 103 cm,
102 cm, 101 cm}
It is exactly these six standards which make
Sue is tall true but fail to make Tom is tall
true. Moreover, it is fairly obvious that we
can also associate a further standard with this
set of standards, namely 6 cm. We conclude,
therefore, that a differential comparative like
(77b) is a special case of (82), one where the
set of standards separating Sue from Tom is
claimed not just to be nonempty, but equal
to 6 cm. In order for this approach to succeed,
we need to show in detail how an appropriate
set of standards can form a standard se-
quence which provides the basis for a metric.
Roughly speaking, we have to say this: If P
is a predicate of standards, then the higher
order predicate 1 m* is true of P iff P is true
of 1 m and for any s > 1 m, P is false of s.
Thus, Sue is 1 m tall is analysed as 1 m*
(s[tall(s, Sue)]). However, there is not space
to develop this here in more detail.
3.5Positive and Comparative
As noted earlier, there is still much debate as
to the correct relation between positive and
comparative gradable adjectives. One ap-
proach, put forward by Cresswell (1976) and
supported by von Stechow (1984 a), involves
existential quantification of the degree argu-
686 VIII. Adjektivsemantik
richness.
It should be pointed out that one of the
inadequacies of the degree-as-numbers ontol-
ogy is that it will always fail to predict any
incommensurability. For example, when a de-
gree of thinness has been mapped into a nu-
merical value, it is qualitatively indistinguish-
able from a degree of richness, and thus the
two should be readily comparable, despite the
fact that we have seen this not to be so (cf.
Cresswell 1984).
We briefly alluded earlier to the denial
interpretation of comparatives, illustrated by
examples like the following ((b) and (c) are
cited by Doherty and Schwarz (1967: 904)):
(93)
a. Sue is more sad than angry.
b. This table is more decorative than it
is useful.
c. His manner was more elegant than
his matter was convincing.
On the denial reading, no condition of com-
mensurability is required. Unfortunately,
there is little discussion in the formal seman-
tics literature about the interpretation of this
type of comparative. As a first approximation
(cf. Dieterich and Napoli 1982), one might
say that
(94) x is more A than B
is true iff x is A is true and x is B is false.
Perhaps slightly better would be: (94) is true
iff x is A is true according to more criteria
than x is B is true. This is motivated by the
intuition that (94) involves a concession that
x meets at least some of the prototypical
criteria for being judged to be B; notice the
oddness of *x is more tall than short. How-
ever, the notion of true according to some
criteria remains to be explicated further.
4. The Logical Form of Comparatives
4.1The Comparative Complement
Despite the expenditure of much effort, there
is still little agreement about the appropriate
logical representation of comparative con-
structions. The interaction of comparatives
with quantifiers, logical connectives and
opaque contexts presents a wealth of intricate
puzzles. To date, the most detailed and com-
prehensive survey is von Stechow (1984 a),
and it is not possible to reproduce his discus-
sion in the space of this article. However, we
will take his proposed analysis as a basis for
surveying the main issues and compare it to
some of the main rival approaches.
sion of members of X into those objects which
have the property and those that lack it (or
possess its polar opposite).
It is not clear however whether the degree/
delineation parameter of gradable adjectives
should be replaced or supplemented by a
comparison class parameter. On the hypoth-
esis that the head noun in an adjective-noun
construction is taken to fill the comparison
class slot, then a sentence like (87a) might
argue for a representation like (87b):
(87)
a. Blackie is a three year old horse,
b. old(horse, 3yr, Blackie)
Yet the oddness of (88) suggests that this
hypothesis is inadequate, and that (87a) is
more different from (87b) than often as-
sumed:
(88) ?Blackie is three years old for a horse.
Further research is called for here.
3.6Commensurability
In section 1 we briefly encountered Subdele-
tion constructions, such as (89):
(89) This table is longer than the door is wide.
Comparisons of this sort seem relatively
straightforward inasmuch as the same dimen-
sion is common to the two predicates long
and wide. Much less acceptable are examples
where the properties in question appear to
involve different scales:
(90) ?This table is longer than it is heavy.
(91) ?Sue is thinner than Tom is rich.
The logical syntax of comparatives proposed
earlier in this section would allow us to rep-
resent (89)(91), but the semantics did not
distinguish between the different cases. One
approach, following Cresswell (1976), would
be to render a Subdeletion comparative un-
defined if the degree predicates are associated
with different scales, in the following manner:
(92)
If Form, then
(i)
= 1 if
, and
;
(ii)
= 0 if
, and
;
(iii)
is undefined otherwise.
Yet it might be felt that this excludes too
much. One way of making sense of a sentence
like (91) is to compare relative positions on
the respective scales; i. e. (91) could be para-
phrased as saying that Sue is higher on the
scale of thinness than Tom is on the scale of
32. Comparatives 687
4.2Connectives
Following Lakoff & Ross (1970) and Seuren
(1973), it has often been observed that clausal
complements of comparatives are negative
polarity environments; cf. also Hoeksema
(1983a), Klein (1982), Ladusaw (1979),
McCawley (1981), and von Stechow (1984 a).
(101) illustrates some representative cases,
where the polarity items are italicised:
(101)
a. Sue was poorer than I would ever
care to be.
b. John drives faster than he need do.
c. We bought more wine than we could
ever drink.
According to the theory developed by Fau-
connier (1975b) and Ladusaw (1979), the ar-
gument of an expression a is in a negative
polarity environment only if a is Downward
Entailing (DE). An informal characterization
of DE is the following.
(102) A function f is called downward entail-
ing iff for all X, Y in the domain of f,
if X is more informative than Y, then
f(Y) is more informative than f(X).
The expression more informative is deliber-
ately vague, but is meant to subsume relations
like logical consequence and set inclusion. So,
for example, (103) would be particular in-
stances of a DE function f.
(103)
a. If X Y, then f(Y) f(X).
b. If X Y, then f(Y) f(X).
Before examining the data, we need to briefly
comment on the rather controversial and fun-
damental question as to whether there is a
logical difference between the clausal form of
the comparative, such as (104), and the
phrasal form, such as (105).
(104) Sue is taller than Tom is.
(105) Sue is taller than Tom.
In particular, while it is generally thought that
the clausal construction is DE, Hoeksema
(1983, 1984) has argued that this is not the
case for phrasal comparatives. We will review
this question later, but in order not to pre-
judge the issue we will only use the clausal
construction in examples for the time being,
despite the sometimes un-idiomatic results.
Returning from our digression, let us now
examine evidence for the claim that compar-
ative clauses occur in a DE environment. An
obvious starting place is the behaviour of or
and and. Given the usual account of logical
connectives, we would expect the following
entailments to hold for a DE function f:
Von Stechow agrees with a number of au-
thors in interpreting gradable adjectives as
relations between degrees and individuals,
and interpreting comparative clauses as sets
(or properties) of degrees (op cit: 54, 56).
Thus, in the first instance, (95a) receives a
representation like (95b) (where is the ap-
propriate adjective von Stechow does not
state exactly how this is determined).
(95)
a. than Tom is
b. d (d, Tom)
He also argues that comparative clauses, like
other sentential complements, should be nom-
inalized. This is achieved by a special rule of
maximization which maps (95b) into (96):
(96) the(max(d (d, Tom)))
The the is essentially Russells -operator,
while max denotes a function on sets of de-
grees which yields as value the singleton set
of degrees containing the maximal element of
its argument; the definition is equivalent to
the following (ignoring intensionality) (op cit:
37, 55):
(97) If D is a set of degrees and d is a degree,
then d max (D) iff d D and there is
no d such that d d and d D.
Von Stechow justifies the presence of the max
operator by appealing to the context-depend-
ence of definite descriptions; a different line
of approach, which might be worth exploring
in the light of our earlier remarks about hy-
potactic constructions in Section 1, would be
to relate maximality to the exhaustiveness
constraint which is typically associated with
wh-questions.
Our sentence Sue is taller than Tom is is
now represented by (98).
(98) d
1
(d
2
0)[tall(d
2
+ d
1
, Sue)]
(the(max(d(d, Tom))))
By -conversion, this is equivalent to (99).
(99) (d
2
0)[tall(d
2
+ the(max(d(d,
Tom))), Sue)]
This can be paraphrased as saying that Sue
is tall to a degree which is greater by some
positive amount d
2
than the degree to which
Tom is tall.
Equatives are treated in an analogous man-
ner, with a quotient parameter instead of an
additive one. So Sue is as tall as Tom is looks
like (100):
(100) d
1
[tall(1.d
1
, Sue)] (the(max(d(d,
Tom))))
688 VIII. Adjektivsemantik
(108) involving or in comparative comple-
ments.
The situation is slightly more complex
when we turn to and. Since it is assumed that
everyone is tall to some unique degree, the
question arises as to whether the set denoted
by an expression like (115) is empty or not:
(115) d[tall(d, Tom) tall(d, Rob)]
That is,
the(max(d[tall(d, Tom) tall(d, Rob)])
denotes if Tom and Rob have the same height,
and is undefined otherwise. Correspondingly,
(116) von Stechows translation of (110)
also presupposes that Tom and Rob have
the same height.
(116)
d
1
(d
2
0)[tall(d
2
+ d
1
, Sue)]
(the (max (d[tall(d, Tom) tall(d, Rob)])))
This provides a rather persuasive explanation
for the apparent invalidity of the inference
(108) involving and. The reason why the con-
clusion fails to hold is that we do not know
whether the than clause succeeds in denoting
a degree; and this is because we do not know,
from the premiss alone, whether Tom and
Rob have the same height.
Let us briefly consider the presence of nega-
tion in comparative clauses.
(117) Sue is taller than Tom isnt.
Sentences such as (117) are usually felt to be
anomalous. (Potential counterexamples to
this claim noticed by Green (1970) should
probably be considered as denial compara-
tives.) The account supplied by von Stechows
framework again seems plausible. The than
clause will have a representation like the fol-
lowing:
(118) (the(max(d[ tall(d, Tom)])))
If Tom is in fact 2 metres tall, then he is not
3 metres tall, nor 4 metres, nor ...; i. e. there
is no maximum degree in the set denoted by
d[ tall (d, Tom)]. As a result, (118) will fail
to denote and the sentence as a whole will
fail to express a proposition, giving rise to the
perceived anomaly.
It has also been noted that the presence of
a DE factive in the comparative clause has a
similar effect, presumably for essentially the
same reason:
(119) Sue is taller than she realizes/*regrets.
For discussion, see Carden (1977) and Vlach
(1974).
(106) f(Tom is [tall] or Rob is [tall])
f(Tom is [tall])
(107) f(Tom is [tall])
f (Tom is [tall] and Rob is [tall])
Consider then the sentences in (108), where
the putative DE context is Sue is taller than:
(108) Sue is taller than Tom is or Rob is
Sue is taller than Tom is
Despite the rather stilted style of the example,
it seems clear that the inference is valid, and
hence the hypothesis that comparatives in-
duce a DE context gains support. On the
other hand, the behaviour of and tends in the
opposite direction; the following does not ap-
pear to be valid:
(109) Sue is taller than Tom is
Sue is taller than Tom is and Rob is
Nevertheless, the inference does seem legiti-
mate if we add the additional premiss that
Tom and Rob are the same height. Intuitions
here seem delicate; they can perhaps be ca-
joled in the relevant direction if the conclusion
of (109) is revised to (110).
(110) Sue is taller than Tom and Rob are.
The account of logical connectives and com-
paratives given by von Stechow (1984a)
hinges on his analysis of than complements
as definite NPs. We note first that the follow-
ing analogue to (103b) holds:
(111) If D, D are nonempty sets of
degrees, and D D, then
the(max(D)) the(max(D)).
For instance, we have (112).
(112)
d[tall(d, Tom)]
d[tall(d, Tom) tall(d, Rob)], so
the(max(d[tall(d, Tom) tall(d, Rob)]))
the(max(d[tall(d, Tom)]))
Second, we note the following obvious point:
(113) If , are degrees, and ,
then for any assignment g to x,
(d 0)[tall(d + , x)
g
,
(d 0)[tall(d + , x)
g
.
By transitivity, we obtain the result (114).
(114) If D, D are nonempty sets of de-
grees, and D D, then
(d 0)[tall(d + the(max(D)), x)
g
(d 0)[tall(d + the(max(D)), x)
g
.
This explains how von Stechows analysis cor-
rectly predicts the validity of entailments like
32. Comparatives 689
istential quantifiers, differing only in that
some boy is outside and any boy is inside the
DE context. Some support for this view can
be derived from the fact that further negative
polarity items can appear in relatives modi-
fying the second, but not the first NP:
(127)
a. *Sue is taller than some boy that I
ever met.
b. Sue is taller than any boy that I ever
met.
Hoeksema (1983:415) claims, contrary to
what we have proposed so far, that NP com-
paratives induce upward entailing contexts.
Part of his case rests on the observation that
the following entailments hold, at least on
one reading of the premisses.
(128) Sue is taller than Tom or Rob
Sue is taller than Tom or Sue is taller
than Rob
(129) Sue is taller than Tom and Rob
Sue is taller than Tom and Sue is taller
than Rob
Yet this data only shows that the readings in
question are ones where the conjoined NPs
have wider scope than the DE context. A
further consideration adduced by Hoeksema
involves the claim that the Dutch negative
polarity item ook maar canot occur in NP
comparatives; however, the data is disputed
by Seuren (1984, FN. 15).
4.4Modal Contexts
The interaction of comparatives with modal
contexts has been a topic of long-standing
interest in the semantics literature, apparently
stimulated by Russells (1905) famous exam-
ple (130).
(130) I thought your yacht was larger than it
was.
Russell adduced this in support of his pro-
posal for assigning scope to definite descrip-
tions. The logical structures in (131) indicate
a Russellian rendering of the two relevant
readings:
(131)
a. d[I thought(large(d, y))]
d [large (d, y)]
b. I thought(d[large(d, y)]
d [large (d, y)])
The first structure represents the sensible, or
external reading of (130), while the second
represents the contradictory, or internal read-
ing (cf. Larson 1985).
Since Russell, there have been a variety of
analyses which share the goal of locating the
than clause outside the scope of the proposi-
4.3Quantifiers
Given the well-known equivalence of existen-
tial and universal quantification with (infini-
tary) disjunction and conjunction, respec-
tively, we would expect the results of the
previous section to extend to NPs with some
and every. This is largely the case. However,
the overall picture is complicated by two fac-
tors. First, quantifiers induce extra scope pos-
sibilities, and second, some has a negative
polarity counterpart, namely any. The rele-
vance of these consideration is illustrated in
(120).
(120)
a. Sue is taller than some boy is.
b. Sue is taller than any boy is.
The truth conditions of (120a, b) are brought
out more clearly by the paraphrases in
(121 a, b), respectively.
(121)
a. There is some boy such that Sue is
taller than him.
b. Every boy is such that Sue is taller
than him.
This is exactly what we would expect if both
some boy and any boy corresponded to exis-
tential quantification in the logical represen-
tation, differing only with respect to scope:
some boy is outside the scope of the DE
context, while any boy is inside the scope.
That is, within von Stechows framework,
(120) would correspond to the following two
translations.
(122)
(x)[boy(x) (d
1
0)
[tall (d
1
+ (the (max (dtall(d, x)))), Sue)]]
(123) (d
1
0)[tall (d
1
+ (the (max (d
[(x) [boy(x) tall(d, x)]]))), Sue)]].
The translation of the than clause in (123)
will denote the maximum of the set containing
the degrees of height of each boy in the do-
main. Consequently, (123) is equivalent to
(124), which is the wide scope translation of
(125).
(124)
(x)[boy(x) (d
1
, 0)
[tall (d
1
+ (the (max (dtall(d, x)))), Sue)]]
(125) Sue is taller than every boy is.
If we turn now to NP comparatives, the se-
mantic facts appear to follow the same pat-
tern. For example, (126a, b) parallel (120a, b):
(126)
a. Sue is taller than some boy.
b. Sue is taller than any boy.
We surmise that both NPs correspond to ex-
690 VIII. Adjektivsemantik
belonging to the category of degree mod-
ifiers. It is this constituent which can take
wide or narrow scope with respect to the verb
of propositional attitude. We could incorpo-
rate Dreshers idea easily into von Stechows
analysis of differential comparatives, since the
phrase 10 metres ...-er...than it is can be
represented by the complex degree term
(10m + the(max(d[long(d, y)]))). This would
yield (134) in place of(133b).
(134) d
0
[I thought(long(d
0
, y)])]
(10m + the (max(d[long(d, y)])))
However, it is less clear how the existential
quantification in non-differential compara-
tives should be accommodated.
5. Concluding Remarks
Within the confines of this article, it has not
been possible to cover issues arising from
nominal comparatives like (135) or adverbial
comparatives like (136):
(135)
a. Sue ate more apples than Tom did.
b. Tom ate two fewer apples than Sue
did.
c. Sue found as much silver as gold.
(136)
a. Sue eats apples as often as Tom
does.
b. Sue likes Rob more than Tom.
To a large extent, the treatment of these con-
structions depends on a prior analysis of plu-
ral and mass determiners on the one hand,
and of adverbs on the other. For some dis-
cussion, see in particular Cresswell (1976),
Hellan (1981), Klein (1981 a), and von Ste-
chow (1984 a).
A related topic is the observation that tem-
poral prepositions such as before and after
appear to be syntactically and semantically
related to comparatives:
(137)
a. Sue arrived before Bill (did)
b. *Sue arrived before Bill didnt
c. *Sue arrived an hour before Bill
knows a man who did.
(138)
a. Sue arrived earlier than Bill (did)
b. *Sue arrived earlier than Bill didnt
c. *Sue arrived an hour earlier than
Bill knows a man who did.
For discussion, see Baker and Brame (1972),
Geis (1970, 1973), Jayaseelan (1983), and
Lakoff(1970b).
Let us turn now to briefly review the path
we have taken. In Section 1, we surveyed
various types of construction for expressing
tional attitude verb. An early contribution
within the Generative Semantics framework
by Ross and Perlmutter (1970) derived the
external reading of (130) by assigning it a
deep structure analogous to (131a), and then
transformationally lowering it into position;
see also Lakoff (1970) and Bresnan (1971) for
reactions. A non-transformational analysis
was proposed by Hasegawa (1972), provok-
ing a lengthy critique and counter-proposal
by Postal (1974). Postals paper was in turn
met by a flurry of comment, most of it highly
critical, including Abbott (1976), Dresher
(1977), Horn (1981), Liddell (1975), Reinhart
(1975), von Stechow (1984 a) and Williams
(1977).
Russells analysis is maintained, with mi-
nor modifications, by von Stechow (1984 a:
69), as illustrated in (132).
(132)
a. d
2
[I thought((d
1
0)
[large (d
1
+ d
2
, y)])]
(the (max (d[large(d, y)])))
b. I thought((d
1
0) [large (d
1
+ (the
(max (d[large (d, y)]))), y)])
One objection that might be levelled against
(132a) is that it attributes a comparative com-
ponent to the content of my thought: it claims
that the size of your yacht is some degree d
such that I thought your yacht was larger
than d (see Larson 1985 for a variation of
this point). To bring this out more clearly, let
us change the example slightly so as to include
an explicit differential measure:
(133)
a. I thought that your yacht was 10
metres longer than it was.
b. d
2
[I thought(long(10m + d
2
, y)])]
(the(max(d[long(d, y)])))
Presumably (133a) would be a true belief-
report if your yacht is in fact 20 metres long,
and I thought it was 30 metres long. But, so
the objection runs, it seems wrong in such a
situation to represent the content of my belief
as in (133b), namely by the proposition that
your yacht is 10 metres more than 20 metres
long. While this is logically equivalent to the
proposition that your yacht is 30 metres long,
yet on a sufficiently fine-grained view of prop-
ositions, we would presumably want to keep
the two distinct.
A plausible alternative analysis of the scope
ambiguity is suggested by Dresher (1977), in-
spired by Bresnans (1973) syntactic analysis
of comparatives (and earlier, Chomsky 1965,
Lees 1961). On Dreshers approach, the dis-
continuous string -er ... than it was in (130)
forms a syntactic and semantic constituent,
32. Comparatives 691
how both kinds of complexity are incremen-
tally built up from our basic ability to draw
comparisons.
6. Short Bibliography
Abbott 1977 Andersen 1980 Andersen 1983
Andrews 1974 Andrews 1975 Andrews 1984
Anscombre 1975 Bach/Bresnan/Wasow 1974
Baker/Brame 1972 Bartsch/Vennemann 1972
Beesley 1982 Bennis 1978 van Benthem 1982
van Benthem 1983a van Ben them 1983c den
Besten 1978 Bierwisch 1987/89 Borsley 1981
Bowers 1975 Bracco 1979 Bresnan 1971 Bres-
nan 1973 Bresnan 1975 Bresnan 1976a Bresnan
1976b Campbell/Wales 1969 Cantrall 1977
Carden 1977 Chomsky 1977 Chomsky/Lasnik
1977 Cresswell 1973 Cresswell 1976 Cresswell
1984 Dieterich/Napoli 1982 Doherty/Schwarz
1967 Dresher 1977 Emonds 1976 Fauconnier
1975b Gazdar 1980 Geis 1970 Geis 1973
Green 1970 Haig 1976 Hale 1970 Hankamer
1973 Hare 1952 Hasegawa 1972 Hellan 1981
Hellan 1984 Hendrick 1978 Heny 1978 Higgins
1973 Hoeksema 1983a Hoeksema 1984 Hoe-
pelman 1982 Horn 1981 Huckin 1977 Hud-
dleston 1967 Jackendoff 1977 Jayaseelan 1983
Khler 1965 Kamp 1975 Klein 1980 Klein
1981a Klein 1981b Klein 1982 Knecht 1976
Krantz/Luce/Suppes/Tversky 1971 Kuno 1981
Ladusaw 1980 Lakoff/Ross 1970 Lakoff 1970b
Larson 1988 Lees 1961 Lehrer/Lehrer 1982
Lewis 1970 Liddell 1975 Lyons 1977 Mc-
Cawley 1973a McCawley 1979 McCawley 1981
McConnell-Ginet 1973 Mey 1976 Milner 1973
Milner 1978 Napoli/Nespor 1976 Napoli 1983a
Napoli 1983b Pilch 1965 Pinkal 1983 Pinkham
1982 Pinkham 1983 Plann 1982 Postal 1974
Reinhart 1975 Rivara 1979 Rivero 1970 Rivero
1981 Ross 1967 Ross 1970b Ross 1974 Ross/
Perlmutter 1970 Rusiecki 1985 Russell 1905
Sag 1976 Sapir 1944 Seuren 1973 Seuren 1978
Seuren 1984 Siegel 1979 Smith 1961 Stanley
1969 Stassen 1984 von Stechow 1983 von Ste-
chow 1984a von Stechow 1984d Swinburn 1976
Thompson 1972 Ultan 1972 Vlach 1974 Wal-
lace 1972 Wescoat 1984 Wheeler 1972 Williams
1976 Williams 1977 Wunderlich 1973 Wurzel
1985 Wurzel 1987 Zwicky 1969
Ewan Klein, Edinburgh (Great Britain)
comparison. Many of these particularly
the paratactic forms and the exceed type
were semantically transparent, in the sense
of Seuren (1984: 120); that is, the languages
in question make use of existing means to
express what the comparative expresses in
languages that have a special category for it.
It also seems safe to say that the delineation
family of approaches provides a plausible ex-
planation of how the existing means of
gradable adjectives, conjunction and negation
give rise to a comparative ordering of the
appropriate kind. Seuren (1984: 121123)
goes on to argue that the European than-
comparatives derive historically from seman-
tically more transparent constructions, and
suggests that they involve a lexical encoding
of logical structures of the kind that we saw
in Section 3.3. In response, von Stechow
(1984b) has argued that whatever the merits
of such semantic archaeology, the empirical
predictions of the delineation approach are
simply incorrect when it comes to a detailed
analysis of the logical form of English. The
gist of Section 4 was an endorsement of von
Stechows conclusion.
Nevertheless, there are two, interlinked,
questions which should be addressed at this
stage in our research, before simply accepting
von Stechows theory as the right one. First,
is it really necessary to build so much math-
ematical structure into our models? As we
saw in Section 2, treating degrees as real num-
bers leads us to make some uncomfortably
strong assumptions about comparison and
concatenation over our universe of discourse;
and this holds not only with respect to grad-
able predicates like tall, but also skilful, wise
and generous. We noted that there is also an
empirical problem with this approach, in that
there seems to be no way of accommodating
incommensurability. Second, is it possible to
explain how the more highly grammaticised
constructions, replete with differential meas-
ure phrases, can be constructed out of the
transparent constructions? Presumably the
linguistic complexity of comparatives par-
tially reflects the complexity of measurement
devices, both conceptual and technological,
that the linguistic community has at its dis-
posal. A good theory should be able to show
692
IX. Verbalsemantik
Verbal Semantics
33. Verbklassifikation
grammatischen Kategorien nicht kennen oder
in den denen Verben und Nomina das gleiche
Flexionspotensial besitzen, wie z. B. im Grn-
lndischen und Kalispel. Und die semantische
Charakteristik ist in dieser Form noch zu
primitiv oder vage, um beispielsweise Verben
wie fliehen, wachsen oder act, run von den
entsprechenden abstrakten Substantiven
Flucht, Wachstum; action, run differenzieren
zu knnen. Erst die moderne (logische, mo-
delltheoretische) Semantik macht durch hin-
reichend przise Begriffsexplikationen die
berwindung dieser Schwierigkeiten mglich.
Als Ergnzung oder eventuell Ersatz
der morphologischen und semantischen Verb-
definition wird hufig als charakteristische
syntaktische Funktion des Verbs angefhrt,
da es allein oder als Kern einer Phrase (der
Verbalphrase, VP) mit einer nominalen
Phrase (NP) zusammen einen Satz bildet. Das
heit, das Verb dient als Prdikat oder zen-
traler Teil des Prdikats im Satz (vgl. Jesper-
sen a. a. O., Lyons 1977: 429) eine Defi-
nition, die allerdings nur auf sog. finite Verb-
formen zutrifft. Dem entsprechen die aristo-
telischen und stoischen Definitionen des
Verbs als Ausdruck des Prdikats bzw. als
Bezeichnung von an uncombined predicate
(Michael 1970: 56) sowie Freges Auffassung
vom Prdikat als einem unvollstndigen, er-
gnzungsbedrftigen Ausdruck einer
Funktion. Dies besagt modelltheoretisch
rekonstruiert , da Verben Eigenschaften
von oder n-stellige Relationen zwischen En-
titten bezeichnen, d. h. extensional verstan-
den Mengen von (n-Tupeln von) Entitten
unterschiedlichen Typs und intensional Funk-
tionen von mglichen Welten (s. Artikel 2)
o. . in solche Mengen. Und zwar handelt es
sich im typischen Fall wie bei essen, tten,
sterben, wachsen eat, kill, die, grow um
dynamische Relationen oder Eigenschaften
Handlungen, Aktivitten, Prozesse; solche
Verben bilden the distinguished subclass,
wenn man, wie es sinnvoll erscheint, davon
1. Verbcharakteristik. Arten von Verbklassifika-
tionen
2. Syntaktisch-semantische Valenzklassen
2.1 Die grammatische Tradition
2.2 Generative Grammatik
2.3 Valenztheorie
2.4 Zusammenfassendes ber Valenz und seman-
tische Rollen
3. Einzelne Klassifikationskriterien
3.1 Argument- bzw. Ergnzungstypen, fakultative
Valenz
3.2 Kontrolleigenschaften
3.3 Transparenz und Opakheit, Extensionalitt
und Intensionalitt
3.4 Faktivitt, Implikativitt und Verwandtes
3.5 Aktionsart, Agentivitt und Kausativitt
4. Literatur (in Kurzform)
1. Verbcharakteristik. Arten von
Verbklassifikationen
Verben werden auf formaler (morphologi-
scher) Ebene traditionell als Wrter (Lexeme)
definiert, die in sog. finiter Form Tempus,
Modus und eventuell Diathese ausdrcken,
sofern es diese grammatischen Kategorien in
der jeweiligen Sprache gibt, und im typischen
Fall Handlungen, Aktivitten, Vorgnge
u. dgl. bezeichnen (s. z. B Jespersen 1924: 86).
Wie andere traditionelle Wortartdefinitionen
hat auch diese eine lange Geschichte. Die
Anfnge des eher formalen Teils der Defini-
tion finden wir bei Dionysios Thrax (2. Jh.
vor Chr.), whrend der zweite, rein semanti-
sche Teil auf Plato zurckgeht (vgl. Michael
1970: 56 f.; s. auch Arens 1969: 16 ff., Pinborg
1975). Und wie andere traditionelle Wortart-
bestimmungen hat auch diese ihre einleuch-
tenden Schwchen, und zwar vor allem als
Versuch einer universalen, auereinzelsprach-
lich gltigen Definition. Das formale (mor-
phologische) Kriterium versagt fr Sprachen,
die im Unterschied etwa zu den indoeuropi-
schen und finno-ugrischen die betreffenden
33. Verbklassifikation 693
Einteilung in transitive und intransitive Ver-
ben, die als Teilaspekt einer allgemeineren
Valenzklassifikation (s. unten 2.3) gesehen
werden kann. Es besteht ein enger Zusam-
menhang wenn auch nicht unbedingt eine
Eins-zu-eins-Beziehung zwischen der Zahl
und Art von Komplementen (Ergnzungen),
mit denen sich ein Verb verbindet, und der
Zahl und dem semantischen Typ der Argu-
mente des Prdikats, als das der Verbinhalt
rekonstruiert wird. Diese Tatsache rechtfer-
tigt es, da solche in erster Linie syntakti-
schen Verbklassifikationen hier mitberck-
sichtigt werden.
Ausschlielich semantisch, und zwar z. T.
onomasiologisch basiert sind beispielsweise
Klassifikationen, die den Verbwortschatz in
verschiedene Wortfelder (s. Schumacher 1981)
unterteilen z. B. Verben der Nahrungsauf-
nahme, Verben des Besitzes und des Besitz-
wechsels, des Schlafens und Wachens (s. Pro-
jektgruppe Verbvalenz 1981), der Fortbewe-
gung (s. Gerling & Orthen 1979), der Sprech-
handlungen (s. Ballmer & Brennenstuhl
1981), wie auch weitgehend die Weitereintei-
lung solcher Wortfelder. Verbklassifikationen
dieser Art werden hier nicht besprochen.
Auch Versuche einer globalen Strukturcha-
rakterisierung (Schwarze & Wunderlich
1985: 18), wie sie bei Ballmer & Brennenstuhl
(1978, 1986) und Gerling & Orthen (1979:
Kap. 3) begegnen, mssen hier unbercksich-
tigt bleiben; siehe dazu auch die Kapitel ber
Verben in der hervorragenden Monographie
von Leisi (1971). Es wird vielmehr zuerst eine
knappe bersicht ber syntaktisch-semanti-
sche Klassifikationen oder Klassifikations-
strategien gegeben, die sich wenn auch auf
jeweils verschiedener theoretischer Grundlage
auf das beziehen, was man die syntaktisch-
semantischen Valenzeigenschaften der Verben
nennen kann. Danach werden einzelne Klas-
sifikationskriterien besprochen, mit denen
neuere Syntax- und Semantiktheorien sich be-
sonders intensiv abgegeben haben.
2. Syntaktisch-semantische
Valenzklassen
Die Bezeichnung Valenzklassifikation wird
hier zusammenfassend verwendet fr Verbein-
teilungen, denen syntaktische Kombinations-
mglichkeiten des Verbs (einschlielich seiner
Rektion) und/oder die Argumentstruktur des
vom Verb ausgedrckten Prdikats zugrun-
deliegen. Valenzklassifikationen in diesem
weiten Sinne hat es von alters her gegeben.
ausgeht, da the semantic, or ontological,
part of the traditional definitions of the parts-
of-speech define for each part-of-speech not
the whole class, but a distinguished subclass
of the total class (Lyons 1977: 44). Weniger
typisch verbal wren demnach stative Ver-
ben wie wissen, sein, abhngen know, be,
depend, die eher statische Eigenschaften oder
Relationen bezeichnen (s. dazu Abschnitt 3.5)
und ihren Verbstatus demnach anderen
morphologischen, syntaktischen Eigen-
schaften zu verdanken haben. Zur-
Nomen-Verb-Adjektiv-Distinktion aus
sprachtypologischer Sicht s. z. B. Walter
(1981), Dixon (1977).
Entsprechend der heterogenen Wortartde-
finition knnen bei Verbklassifikationen mor-
phologische, syntaktische oder semantische
Kriterien im Vordergrund stehen.
Morphologisch basiert ist beispielsweise
eine Einteilung in Verben, die sowohl das
Aktiv als auch das Passiv (bzw. Medium)
kennen, d. h. mit beiden Flexionsparadigmen
verbunden werden (vgl. lat. amare amari,
dn. elske elskes lieben geliebt werden),
Verben, die nur im Aktiv vorkommen (vgl.
besitzen), und Verben, die ausschlielich in
passiver (medialer) Form erscheinen (sog. De-
ponentia), vgl. lat. moriri sterben, dn. min-
nes gedenken, oder eventuell gemischt akti-
visch und passivisch (medial) flektieren (Se-
mideponentia). Ob die Verteilung der Verben
auf solche morphologisch definierten Sub-
klassen semantischen Prinzipien folgt, ist eine
andere Frage, die natrlich untersucht werden
mu, deren Antwort jedoch bei einer syn-
chronen Sprachbeschreibung keineswegs von
vorneherein gegeben ist. Die apriorische An-
nahme, da derartige morphologische oder
entsprechende syntaktische Unterschiede
semantisch begrndet sind, hat ein unent-
wirrbares Durcheinander formaler und se-
mantischer Klassifikationskriterien und eine
bedauerliche Unklarheit zentraler Termini wie
aktiv etc. zur Folge (s. dazu etwa Michael
1970: 92 ff.). Eine sprachtypologische mor-
phologische Verbklassifikation erfolgt ganz
allgemein nach den Kategorien, die jeweils am
Verb ausgedrckt werden: Tempus; Modus;
Satzmodus; Aspekt; Aktionsart; Diathese;
Negation; Inferentialitt; Kongruenz mit
Subjekt, direktem Objekt, indirektem Objekt
u. weiteres mehr.
Syntaktisch basierte Verbklassifikationen
beziehen sich auf die syntaktischen Kombi-
nationsmglichkeiten die Distribution
der Verben. Hierher gehrt die traditionelle
694 IX. Verbalsemantik
quem Objekt oder nur noch diejenigen mit
Akkusativobjekt transitiv zu nennen sind,
stellt sich natrlich nur fr Sprachen, die wie
z. B. Deutsch, Russisch, Latein, Griechisch
verschiedene Objektskasus besitzen; sie er-
brigt sich beispielsweise fr gleichfalls
indoeuropische Sprachen wie heutiges
Englisch, Franzsisch und Dnisch, wo folg-
lich alle Verben mit nominalem Objekt tran-
sitiv zu nennen wren. In einem weiteren
Schritt der Beschrnkung ist allerdings die
Eigenschaft der Transitivitt mitunter mit der
der Passivfhigkeit gekoppelt worden, so da
die Bezeichnung transitiv lediglich auf Ver-
ben verwendet wird, die ein Akkusativobjekt
zu sich nehmen und passivfhig sind, wobei
das Subjekt im Passiv dem Akkusativobjekt
im Aktiv entspricht. Unter diesem Aspekt
sind mithin etwa essen, lieben transitiv, wissen,
bekommen hingegen nicht. Fr den modernen
Transitivittsbegriff und die Korrelation der
Transitivitt mit anderen Verbeigenschaften
Kinesis, Aspekt, Punktualitt, Volitiona-
litt, Affirmation, Modus, Agentivitt, Affi-
ziertheit, Individuierung sei auf Hopper &
Thompson (1980) verwiesen.
Wenn nur noch akkusativregierende Ver-
ben als transitiv und Verben mit anderen Ka-
susobjekten dementsprechend als intranstiv
einzustufen sind, knnen Verben mit (Kasus-)
Objekt wie essen, lieben; begegnen; gedenken
als relativ den intransitiven absoluten Verben
wie sterben, ruhen gegenbergestellt werden,
wie es beispielsweise bei Behaghel (1924:
113 ff.) geschieht.
Wenden wir uns wieder dem Schema in
Abb. 33.1 zu, so wird deutlich, da die Un-
2.1Die grammatische Tradition
Schon die Stoiker (3. Jh. v. Chr.) teilten Ver-
ben (Prdikate) im Griechischen nach ihrer
Kombination mit Kasus, d. h. nach ihren
Rektionsmglichkeiten, ein; vgl. unten ste-
hendes, Pinborg (1975: 89) entnommenes
Schema (Abb. 33.1).
Fr Verben, die sich mit einem Nominativ
und einem obliquen Kasus verbinden, wurde
spter (Apollonius, Priscian) die Bezeichnung
transitiv eingefhrt, andere mit einem Nomi-
nativ verbundene Verben wurden intransitiv
(oder eventuell absolut) genannt. Diese Be-
zeichnungen sind als Versuche einer seman-
tischen Explikation der an sich syntaktischen
Erscheinungen zu verstehen: the action de-
noted by a verb in a sentence containing both
a subject and an object passes (transit) from
the person denoted by the subject to that
denoted by the object, whereas no such tran-
sition takes place in a sentence which lacks
an object (Percival 1977: 235; vgl. auch Mi-
chael 1970: 95). Die Unterscheidung transi-
tiver und intransitiver Verben ist heute noch
gang und gbe, hat allerdings im Laufe der
Zeit gewisse Wandlungen erfahren, die einen
Verlust der Eindeutigkeit zur Folge gehabt
haben. Als transitiv werden wohl jetzt kaum
Verben wie begegnen, gedenken und russ. gro-
zit drohen, bojatcja frchten bezeichnet,
die zwar einen obliquen Kasus (Dativ bzw.
Genitiv), aber einen anderen als den Akku-
sativ regieren; vgl. Michael (1987: 96), der
eine aus dem 16. Jh. stammende explizite Ein-
schrnkung auf Verben mit Akkusativobjekt
zitiert. Die Frage, ob alle Verben mit obli-
Abb. 33.1: Einteilung der Prdikate bei den Stoikern (nach Pinborg)
695
bzw. sie kommen nur noch in reflexiver Form
vor. Es handelt sich hier wieder einmal um
eine primr morphosyntaktische Unterschei-
dung, insofern als semantisch keine Reflexi-
vitt vorzuliegen braucht: es ist nicht unbe-
dingt so, da das Verb semantisch als zwei-
oder mehrstellig einzustufen ist, wobei die
Subjekt- und eine Objektstelle identisch be-
setzt werden. Dies kann hingegen dann zu-
treffen, wenn ein an sich nicht reflexives Verb
reflexiv verwendet wird, vgl. ich klage mich,
nicht dich an, franz. elle se regarde, in anderen
Fllen bei anderen Verben liegt eher
reziproke Bedeutung vor, vgl. Hans und Peter
schlagen sich tglich, franz. ils se battent. Oft
besteht jedoch zwischen einem Verb in refle-
xiver und nicht reflexiver Verwendung
einer reflexiven und der entsprechenden nicht
reflexiven Verbvariante eine semantische
Beziehung der gleichen Art wie zwischen
einem Intransitivum und einem entsprechen-
den (transitiven) Kausativum (s. 3.5), vgl. die
Tr ffnete sich jemand ffnete die Tr,
franz. tout se change on change tout und
engl. the door opened somebody opened the
door, I have changed something has changed
me. Eine ausfhrliche Darstellung von
mglichen semantischen Funktionen der Re-
flexivierung kann hier nicht vorgenommen
werden (vgl. Hopper & Thompson 1980:
277 ff.).
Sogenannte Hilfsverben sind rein formal
(morphologisch) echte Verben wenn auch
oft mit unregelmiger Flexion , dienen
jedoch zur Bildung sogenannter periphrasti-
terscheidung von Symbama und Parasym-
bama der z. B. fr die Beschreibung des Dt.
immer noch relevanten Einteilung in persn-
liche und unpersnliche, nur noch in der 3.
Pers. Sg. vorkommende Verben entspricht;
vgl. mich friert, mir graut davor. Beispiele aus
dem Lat. und Russ. sind pluit es regnet,
svetaet es dmmert, menja (Akk.) toschnit
mir ist unwohl. Zu den Impersonalia werden
heute auch Verben gerechnet, die wie u. a. die
Witterungsverben im Dt., Engl., Franz. und
in den skandinavischen Sprachen syntaktisch
nicht vllig subjektlos auftreten, aber als Sub-
jekt das Personalpronomen der 3. Person ver-
langen (es regnet, it is raining, il pleut, det
regner) und deren syntaktischem Subjekt kein
semantisches Argument zu entsprechen
scheint. Unpersnliche Verben sind Bei-
spiele fr semantisch motivierte Rektions-
klassen (s. Abschnitt 2.4).
In Abb. 33.2 werden die skizzierten syn-
taktisch-semantischen Einteilungen der tra-
ditionellen Grammatik schematisch zusam-
mengefat, wobei auch die verschiedenen
Auslegungen der Termini transitiv und in-
transitiv angedeutet werden.
Bevor wir die traditionelle Grammmatik
verlassen, sollen einige weitere typische Op-
positionen kurz erwhnt werden:
Reflexive Verben verlangen im Unterschied
zu den nicht reflexiven ein Reflexivpronomen
(oder reflexiv verwendetes Personalprono-
men) als Objekt, vgl. sich ereifern, dn.
skamme sig sich schmen, franz. se repentir,
Abb. 33.2: Einteilung der Verben in der traditionellen Grammatik
696 IX. Verbalsemantik
Rahmen _ NP spezifiziert, d. h. sie mssen
bzw. knnen in der syntaktischen Tiefen-
struktur unmittelbar vor einer als Schwester-
konstituente dienenden NP stehen, whrend
intransitive oder intransitiv verwendbare Ver-
ben wie elapse, grow den Rahmen _
verlangen bzw. zulassen, d. h. ohne Ko-Kon-
stituente vorkommen (knnen). Become und
seem verlangen ein nachfolgendes Adjektiv
(become/seem old) oder Prdikatsnomen (be-
come a painter) bzw. like + Prdikatsnomen
(seem like a lie). Look ist wie seem subkate-
gorisiert (look old/like a ghost), erlaubt aller-
dings als dritte Alternative eine Prpositio-
nalphrase (look at something). Und believe
lt sich statt einer NP auch mit einem that-
Satz verbinden, whrend persuade fr eine NP
und ein Satzkomplement spezifiziert ist (per-
suade someone (of the fact) that...).
Fr das Dt. und andere Kasussprachen
sind natrlich weitere Spezifizierungen der
NP-Kasus ntig (s. Bierwisch 1970). Von zen-
traler Bedeutung ist es, da die grammati-
schen Relationen Subjekt-von, Objekt-von
etc. in diesem theoretischen Rahmen konfi-
gurationell definiert werden, d. h. durch ihre
Positionen in der Phrasenstruktur. Das Sub-
jekt etwa ist als linksstehende Schwesterkon-
stituente der Verbalphrase, d. h. durch die
Konfiguration [NP, VP], und das (einzige)
Objekt als rechtsstehende Schwesterkonsti-
tuente des Verbs, d. h. durch die Konfigura-
tion [V, NP], bestimmt.
Fillmores Abhandlung The Case for
Case (Fillmore 1968) bedeutete einen Bruch
mit diesem Ansatz und markierte den Anfang
der sog. Kasustheorie (s. dazu z. B. Heger &
Petfi 1977, Abraham 1978). Fillmore ersetzte
die rein konfigurationalen syntaktischen Re-
lationen durch eine Reihe etikettierter Re-
lationen (sog. Tiefenkasus) wie Agentiv (A,
intentional handelnde Person, Urheber der
vom Verb bezeichneten Ttigkeit), Instrumen-
tal (I, unbelebtes Instrument einer Ttigkeit;
eventuell auch unbelebte Ursache eines Vor-
gangs spter Force genannt), Objektiv (O,
unbelebter, von einer Ttigkeit oder einem
Vorgang affizierter Gegenstand) etc. Ver-
ben lassen sich dann nach den Kasusrahmen
spezifizieren und einteilen, in die sie hinein-
passen. So erhlt man beispielsweise fr das
Verb open im Engl. die Kasusrahmen
[_ O]: the door opened,
[_ O + A]: John opened the door,
scher (zusammengesetzter, komplexer) Verb-
formen, wobei das Vollverb in einer bestimm-
ten, von dem jeweiligen Hilfsverb bedingten
infiniten Form erscheint; vgl. z. B. das Perfekt
und das Passiv im Engl., Dt., Franz. Eine
scharfe Abgrenzung von Hilfs- und Vollver-
ben scheint kaum zu erreichen oder zu be-
grnden. Die vom Hilfsverb regierte infinite
Verbform lt sich als eine besondere Art von
Komplement desselben auffassen; und den
angeblichen Hilfsverben stehen meistens auch
homonyme Vollverben zur Seite, vgl. haben,
sein, werden, engl. have, be, franz. avoir, tre
etc. (s. Artikel 35 fr periphrastische Tem-
pusformen).
Abschlieend sei betont, da ein guter Teil
der hier besprochenen Klassifikationskrite-
rien wegen ihrer Abhngigkeit von einzel-
sprachspezifischen morpho-syntaktischen Ka-
tegorien sich natrlich nicht ohne weiteres
bertragen lassen auf Sprachen, die ganz an-
ders strukturiert sind als diejenigen, fr deren
Beschreibung sie eingefhrt wurden.
2.2Generative Grammatik
In der tranformationsgrammatischen Stan-
dardtheorie, wie sie von Chomsky (1965) ent-
wickelt wurde, werden nicht-auxiliare Verben
subklassifiziert nach den kategorialen Rah-
men, in denen sie auftreten (sog. strikte Sub-
kategorisierung), und nach z. T etwas primi-
tiven syntaktisch-semantischen Merkmalen
(distinctive features) wie [Abstract], [Ani-
mate] im Subjekt und in den Komplementen
des Verbs (sog. Selektionsrestriktionen). Dar-
aus ergeben sich Lexikoneintrge (lexikalische
Charakterisierungen) wie die folgenden
(Chomsky 1965: 94):
eat, [+ V, + _ NP]
elapse, [+ V, + _ ]
grow, [+V, + _ NP, + __ , + _ Adjective]
become, [+V, +_ Adjective, + _ Predicate-
Nominal]
seem, [+ V, + _ Adjective, + _ likePredicate-
Nominal]
look, [+V, + _ (Prepositional-Phrase) , + _
Adjective, +_ likePredicate-Nominal]
believe, [+ V, + _ NP, + _ thatS]
persuade, [+ V, + _ NP (ofDetN) S]
Abb. 33.3: Verbeintrge bei Chomsky
Transitive oder transitiv verwendbare Verben
wie eat, grow, believe sind demnach fr den
33. Verbklassifikation 697
ten, Kontrollphnomene, Expletivkonstruk-
tionen mit there, es etc. , auf die hier nicht
eingegangen werden kann (s. Chomsky 1981:
34 ff., 170 ff., Czepluch & Janen 1984).
2.3Valenztheorie
Wie oben angedeutet, hat der Rollenbegriff
auch in die sog. Valenztheorie Eingang gefun-
den, die von Tesnire (1959) als Bestandteil
eines primr syntaktischen Beschreibungs-
modells konzipiert wurde und als Versuch
gelten kann, die traditionelle Einteilung nach
Transitivitt etc. (s. 2.1) in einen generelleren
und universell verwendbaren Rahmen zu in-
tegrieren. Nach der Zahl der Aktanten (ac-
tants, Mitspielern), mit denen sie sich in
einem Satz verbinden und zu denen auch
das Subjekt gerechnet wird lassen Verben
sich in a-, mono-, bi- und trivalente einteilen;
Satzglieder, deren Vorkommen nicht durch
die Valenz des Verbs bedingt ist, werden cir-
constants genannt. (In der deutschsprachi-
gen Fachliteratur haben sich fr Valenz, Ak-
tant und Circonstant auch die Termini
Wertigkeit, Ergnzung, (freie) Angabe
eingebrgert.) Zur Klasse der monovalenten
Verben gehren die absoluten Intransitiva der
traditionellen Grammatik und unpersnliche
Verben mit einer obliquen Kasusergnzung
(Beispiel: mich friert, s. oben 2.1); bivalent
sind transitive Verben mit einem (Akkusativ-)
Objekt (z. B. kennen, sehen, schlagen) und
andere Verben mit Subjekt und einem Objekt
(z. B. begegnen, gedenken) sowie unpersnli-
che Verben mit zwei Objektergnzungen, vgl.
altgr. (Dat.) (Gen.) es fehlt
mir an Geld; und trivalent sind Verben mit
Subjekt und zwei Objekten, egal in welchem
Kasus, wie geben, erzhlen, lat. dare (Dat. +
Akk.), lehren, lat. docere (Akk. + Akk.) und
verdchtigen (Akk. + Gen.); auch transitive
Verben mit prpositional eingeleitetem indi-
rektem Objekt engl. give, tell, franz. don-
ner, dire gehren hierher.
Zur Gruppe der avalenten Verben rechnet
Tesnire komplementlose unpersnliche Ver-
ben (Beispiel: meteorologische Verben, 2.2),
unabhngig davon, ob ein formales Subjekt
erscheinen mu oder nicht (il pleut vs. pluit).
Das formale Subjekt hat mithin keinen Ak-
tantenstatus, was damit erklrt wird, quil
sagit dune drame qui se joue indpendam-
ment de tout actant. Il neige exprime simple-
ment un procs qui se droule dans la nature
sans que nous puissions concevoir un actant
qui en soit lorigine [...]. [da es sich hier
[_ O + I]: the wind opened the door,
[_ O + I + A]: John opened the door with
a chisel
(vgl. Fillmore 1968: Kap. 3). Aus den Bei-
spielen wird ersichtlich, da zwischen Tiefen-
kasus und Oberflchenkasus bzw. grammati-
scher (Oberflchen-)Funktion keine Eins-zu-
eins-Beziehung besteht: Der mit der gram-
matischen Subjektfunktion verbundene Tie-
fenkasus variiert nach Verb (und Diathese),
und umgekehrt kann ein und derselbe Tiefen-
kasus z. B. Objektiv je nach den Um-
stnden als (Oberflchen-)Subjekt und Objekt
realisiert werden. Die Abbildung der Tiefen-
kasus auf Oberflchenkasus oder Prposi-
tion (+ Oberflchenkasus), einschlielich der
Subjektselektion, erfolgt transformationell.
Die Thesen der Kasustheorie, die fr ihre
Tiefenkasus starke zahlenmige Begrenzt-
heit, Universalitt und hchstens einmaliges
Vorkommen in jedem Kasusrahmen behaup-
tete, haben sich nicht alle besttigen lassen.
Dies hngt mit der kaum zu vermeidenden
Vagheit der Kasusdefinitionen zusammen, die
wie der Tiefenkasusbestand berhaupt
mehrmals gendert worden sind. Dennoch
hat die Kasusgrammatik als Versuch, rein
morphosyntaktisch definierte Oberflchen-
kasus wie Nominativ, Akkusativ etc. bzw.
grammatische Satzgliedfunktionen wie Sub-
jekt, Objekt etc. und rein semantische Begriffe
wie Tter, Instrument grundstzlich ausein-
anderzuhalten, die weitere Entwicklung der
generativen Grammatik wie auch die Va-
lenzgrammatik (s. unten) stark beeinflut.
Den Tiefenkasus entsprechen im neuesten
Zweig der generativen Transformationsgram-
matik, der nach Chomsky (1981) benannten
Rektions - Bindungs -Theorie (GB -Theorie),
thematische Rollen wie Agens, Patiens (mit
einem etwas unglcklichen Terminus auch
Thema genannt), sofern diese nicht einfach
als semantisch leere Etiketten zu verstehen
sind, die zur Differenzierung von Argumenten
eines Verbs (Prdikats) genau das gleiche lei-
sten wie eine Nummerierung der Argumente
(vgl. Stechow & Sternefeld 1985: 309 ff.). Die
Konzeption der thematischen Rollen geht vor
allem auf Gruber (1965, 1976) und Jackendoff
(1972) zurck. Zur semantischen Auslegung
und Spezifizierung der einzelnen themati-
schen Rollen hat die GB-Theorie bisher wenig
beigetragen. Die Teiltheorie der thematischen
Markierung (Theta-Theorie) dient vielmehr
in erster Linie der Erklrung anderer, ber-
wiegend syntaktischer Erscheinungen
Wortstellungs- und Passivierungsregularit-
698 IX. Verbalsemantik
Argumente klassifizierbar sein. Beispiele
fr null-, ein-, zwei- und dreistellige Verben
sind den obigen Abschnitten zu entnehmen;
als vierstellig wre etwa bersetzen einzustu-
fen: man bersetzt etwas aus einer Sprache in
eine andere Sprache. Vllig problemlos ist
eine solche Klassifizierung allerdings nicht,
was mit der schwierigen, in der Valenzliteratur
ausgiebig diskutierten Abgrenzung von Verb-
komplementen (verbbedingten Gliedern) und
anderen, freien Satzgliedern, vor allem im Be-
reich der Adverbiale, zusammenhngt (vgl.
Buerle 1985: 223). Es sei in dem Zusammen-
hang auch auf das Phnomen der Inkorporie-
rung von Argumenten verwiesen, das sich z. B.
durch hmmern, Auto fahren veranschauli-
chen lt.
Ein weiteres mgliches Einteilungskrite-
rium betrifft den Tiefenkasus oder die the-
matische Rolle, die mit dem jeweiligen Ar-
gument verknpft ist. Kasusrolle, semanti-
scher Kasus, semantische Rolle, Theta-Rolle
sind andere, jetzt gelufige Bezeichnungen fr
das, was mit diesen Begriffen eingefangen
werden sollte: semantische Charakteristika
von Argumenten von Verben (Prdikaten),
die einerseits die einzelnen Argumente des
Verbs semantisch voneinander differenzieren
und es andererseits erlauben, Argumente ver-
schiedener Verben semantisch miteinander zu
paaren und einer gemeinsamen Argument-
kategorie einer semantischen Rolle zu-
zuordnen. Unter den einstelligen Verben w-
ren dann u. a. Agens-/Agentiv- und Thema-/
Objektiv-Verben zu unterscheiden (vgl. tanzen
wachsen, dance grow) und bei Zweistel-
ligkeit Konstellationen wie Agens + Thema
(betrachten, look at), Experiencer + Thema
(sehen, see) und Thema + Experiencer (ge-
fallen, please); s. dazu z. B. Wunderlich 1985a.
Eine angemessene Klassifizierung des gesam-
ten Verbwortschatzes nach diesen Richtlinien
wrde jedoch eine Klrung des Rollenbegriffs
und przise Rollendefinitionen voraussetzen,
die bisher nicht geliefert worden sind. Es ist
auch noch eine offene Frage, wie weit dieser
Abstraktionsproze (s. Schwarze 1985) an-
gemessenerweise getrieben werden kann, d. h.
mit wie wenigen und welchen semantischen
Rollen man fr die Beschreibung des gesam-
ten Verbwortschatzes auskommt. Fraglich ist
berhaupt, ob man semantische oder the-
matische Rollen als theoretische Primitive
braucht. Eher ist vielleicht mit Dowty (1985a:
318) anzunehmen, da all phenomena refer-
red to under the heading thematic roles in
the literature are properly regarded as lexical
um ein Drama handelt, das unabhngig
von irgendeinem Aktanten abluft. Es schneit
bezeichnet einfach ein in der Natur sich ab-
spielendes Geschehen; wir knnen uns keinen
Aktanten als Urheber dieses Geschehens vor-
stellen] (Tesnire 1959: 239; dt. bersetzung
S. 162). Dies zeigt den z. T. semantischen Cha-
rakter des Tesnireschen Aktantenbebegriffs:
Aktanten knnen nicht semantisch leer sein,
sie mssen vielmehr wirkliche Akteure eines
Dramas bezeichnen. Jedem Aktanten mu
somit ein Argument entsprechen, wenn man
den Verbinhalt als n-stelliges Prdikat rekon-
struiert.
Es sei hinzugefgt, da es in manchen
Sprachen (z. B. Japanisch, Koreanisch) keine
obligatorischen Verbergnzungen gibt, so da
ein Verb fr sich allein und zwar ohne
Kongruenzmerkmal wie im Lat. einen Satz
konstituieren kann.
Der Valenzgedanke hat vor allem in der
deutschen (germanistischen) Linguistik in
verschiedenen Ausprgungen Fu gefat (s.
z. B. Engel & Schumacher 1978, Helbig 1982).
Er ist dabei z. T. so syntaktifiziert worden,
da auch semantisch leere Elemente wie for-
male Subjekte und obligatorische Reflexivob-
jekte als Aktanten zhlen oder aber es wird
zwischen syntaktischer Valenz und seman-
tischer Valenz unterschieden , so da zwi-
schen der (syntaktischen) Valenz eines Verbs
und dessen Stelligkeit keine Eins-zu-eins-Ent-
sprechung bestehen mu. Beispiele fr feh-
lende bereinstimmung von Valenz und Stel-
ligkeit finden sich etwa allerdings in einem
anderen theoretischen Rahmen bei Hhle
(1978: 221 ff.).
Die Valenztheorie(n) nahm(en) fast von
Anfang an Elemente der generativen Gram-
matik in sich auf: im Valenzwrterbuch von
Helbig & Schenkel (1969
1
) wurden die einzel-
nen Leerstellen der Verben zustzlich zur
morpho-syntaktischen Spezifizierung in An-
lehnung an Chomsky (1965) anhand seman-
tischer Merkmale wie [+ Anim], [Hum],
[Mod] charakterisiert; und bei Helbig (1982:
Kap. 3) wird eine Verknpfung von Valenz-
und Kasustheorie diskutiert dahingehend,
da fr jeden (semantisch nicht leeren) Ak-
tanten eines Verbs sein semantischer Kasus
zu bestimmen ist.
2.4Zusammenfassendes ber Valenz und
semantische Rollen
Verbinhalte lassen sich als n-stellige Prdikate
auffassen, und Verben mssen dementspre-
chend nach ihrer Stelligkeit der Zahl ihrer
33. Verbklassifikation 699
technische Frage, die uns hier nicht zu inter-
essieren braucht. Wesentlich ist, da die mor-
pho-syntaktischen Eigenschaften von Verben
in vielen Sprachen nicht aufgrund der Argu-
mentstruktur vollstndig vorhersagbar sind,
so da Informationen der einen wie der an-
deren Art zur vollstndigen Charakterisie-
rung eines Verblexems gehren. Andererseits
verluft die Zuordnung die Kodierung
der semantischen Rollen in der einzelnen
Sprache nicht vllig willkrlich, sondern weist
mehr oder wenig klar erkennbare Tendenzen
auf. Aus universalistischer Sicht sind nach
Plank (1983a) in dieser Hinsicht zwei ver-
schiedene Kodierungsprinzipien zu erkennen:
das Transparenzprinzip, nach dem die syntak-
tische Kodierung von Argumenten seman-
tisch motiviert ist in dem Sinne, da idealer-
weise jeder semantischen Rolle ein eigener
Ergnzungstyp entspricht, und das Funktio-
nalittsprinzip, nach dem die bei ein und dem-
selben Verb oder in ein und demselben Satz
realisierten semantischen Rollen eine eindeu-
tig verschiedene syntaktische Kodierung er-
fahren, without insisting on a consistent
identification of semantic roles [...] by the
coding devices (Plank 1983a: 1). Dem Funk-
tionalittsprinzip folgt z. B. das heutige Engl.
in hherem Ausma als das heutige Dt., da
beispielsweise nicht-agentive semantische
Rollen im Dt. bei weniger Verben als Subjekt-
ergnzung auftreten knnen als im Engl. (vgl.
*Dieses Zelt schlft zwei Leute vs. This tent
sleeps two persons, *Der Wagen platzte einen
Reifen vs. The car burst a tyre). Fr beide
Sprachen gilt allerdings, da, wenn eines der
Argumente eines mehrstelligen Verbs die
Agentiv/Agens-Rolle tragen kann, dieses Ar-
gument dann syntaktisch als Subjekt des
Verbs im Aktiv realisiert wird. Beispiele fr
das Transparenzprinzip geben sog. Aktivspra-
chen wie Guarani oder Bats ab, in denen u. a.
die Argumente einstelliger Verben in verschie-
denen Kasus stehen je nachdem, ob sie eine
aktive oder inaktive Rolle spielen. Eine
hnliche Erscheinung ist die in den lteren
germanischen Sprachen bliche oblique Ka-
susrealisierung der Experiencer-Rolle auch
bei einstelligen Verben, deren Reste sich noch
im heutigen Dt. beobachten lassen (mich hun-
gert, mir graut davor). Fr in diesen Zu-
sammenhang gehrende typologische Unter-
scheidungen wie Nominativ-Akkusativ vs.
Ergativ-Absolut-Sprachen sei z. B. auf Plank
(1979, 1983) verwiesen.
Im Zusammenhang mit der Argument-Er-
gnzung-Zuordnung sind auch die Diathesen
entailments, i. e., that a thematic role is a class
of lexical entailments (and/or presupposi-
tions) to the effect that (the referents of) cer-
tain of their arguments have certain proper-
ties z. B. da das Experiencer-Argument
ein Lebewesen ist, das eine bestimmte Art von
Wahnehmungs-, Gefhls- oder Erkenntnis-
erlebnis hat.
Semantische Rollen sind relational, inso-
fern sie mit der Art der Beteiligung der Ak-
tanten am verbalen Vorgang zu tun haben.
Es knnen aber auch spezifischere Bedeu-
tungskomponenten der Aktanten in die Be-
deutung des Verbs mit eingehen, d. h. es kn-
nen fr die Besetzung einer bestimmten Leer-
stelle mehr oder weniger spezifische sog. Se-
lektionsrestriktionen bestehen. Ein anschauli-
ches Beispiel im Deutschen sind die Selek-
tionsrestriktionen nach den Klassen mensch-
lich und tierisch, nach denen sich u. a. die
Verben gebren vs. werfen, stillen vs. sugen,
essen vs. fressen, sterben vs. verenden unter-
scheiden. Im Extremfall sind die Wahlmg-
lichkeiten so eingeschrnkt, da man es mit
sog. lexikalischen Solidaritten zu tun hat:
bellen kann im wrtlichen Sinne nur auf Be-
zeichnungen fr Hunde, miauen nur mit Be-
zug auf Katzen angewandt werden usw. Spra-
chen knnen sich in der Schrfe der Selek-
tionsrestriktionen betrchtlich voneinander
unterscheiden (vgl. Plank 1983a), wie Selek-
tionsrestriktionen auch eine fehlende gram-
matische Markierung der Aktanten teilweise
kompensieren knnen (Li/Thompson 1976).
In diesem Zusammenhang ist schlielich auch
das vor allem aus athapaskischen Sprachen
(z. B. Navaho) bekannte Phnomen der Ver-
balklassifikation zu erwhnen, das auf eine
andere Vorgangsanschauung hindeutet, inso-
fern in Verbklassifikator-Sprachen allein die
Klassenzugehrigkeit von Aktanten die Wahl
des Verbstamms bestimmt und der Verbvor-
gang selbst sich in morphologischen Abwand-
lungen des Verbstamms ausdrckt (Barron
1982).
Die (semantische) Stelligkeit ist grundstz-
lich von der Ergnzungsbedrftigkeit (Valenz)
und den Rektionseigenschaften der Verben
auf syntaktischer Ebene zu unterscheiden, ob-
wohl enge Beziehungen zwischen beiden be-
stehen. Wie die beiden Ebenen in der Sprach-
beschreibung einander zugeordnet werden
ob lexikalistisch wie in der Valenzgrammtik
und in der Lexical Functional Grammar (s.
z. B. Kaplan & Bresnan 1982) oder transfor-
mationalistisch wie in der generativen Trans-
formationsgrammatik (s. 2.2) , ist eine eher
700 IX. Verbalsemantik
3.1Argument- bzw. Ergnzungstypen,
fakultative Valenz
Verben sind nicht nur hinsichtlich der Zahl
ihrer Ergnzungen bzw. Argumente, sondern
auch im Hinblick auf die syntaktische Kate-
gorie und den semantischen (logischen) Typ
(s. Artikel 7) derselben zu spezifizieren. Syn-
taktisch unterscheiden wir Ergnzungen in
Form von Nominalphrasen (in einem be-
stimmten Kasus), (Neben-)Stzen und Infi-
nitkonstruktionen. Dementsprechend lassen
sich Verben nach dem semantischen Typ ihrer
Argumente subklassifizieren, so da man fr
einstellige Verben folgende Subklassen erhlt:
einstellige Verben, die als Argument ((Sub-
jekt-)Ergnzung) lediglich Individuen/ In-
dividuenkonzepte (Nominalphrasen) zu-
lassen wie frieren, stehen, schlafen, husten,
altern;
einstellige Verben, die als Argument eine
Proposition (Satzergnzung) fordert wie
sich herausstellen.
Bei Zweistelligkeit sind u. a. zu unterscheiden:
zweistellige Verben, die Relationen zwi-
schen Individuen/Individuenkonzepten
bezeichnen (nominales Subjekt und Ob-
jekt verlangen) wie begren, finden, se-
hen, helfen, gedenken;
zweistellige Verben, die Relationen zwi-
schen Propositionen oder Prdikaten ei-
nerseits und Individuen oder Individuen-
konzepten andererseits ausdrcken, sich
also mit Satz- oder Infinitsubjekt + no-
minalem Objekt oder umgekehrt mit no-
minalem Subjekt und Satz- oder Infini-
tobjekt verbinden wie wundern, gelingen
bzw. wissen, glauben, wnschen, wagen,
versuchen;
zweistellige Verben, die an beiden Argu-
mentstellen eine Proposition oder ein Pr-
dikat verlangen (Satz- oder Infinitsubjekt
+ Satz- oder Infinitobjekt) wie besagen,
veranlassen, heien (vgl. da..., besagt/ver-
anlat, da...).
Entsprechende Kombinationsmglichkeiten
gibt es bei hheren Stelligkeiten, wenn auch
wohl selten mit mehr als zwei Propositions-
argumenten zu rechnen sein drfte. Viele Ver-
ben werden dabei in mehreren Subklassen
vorkommen, da Satz- oder Infinitergnzun-
gen meistens mit Nominalergnzungen alter-
nieren. Prpositionale oder adverbiale Ergn-
zungen, wie sie z. B. bei wohnen und legen
vorkommen, und ihre semantische Beschrei-
bung stellen ein noch weitgehend ungelstes
(Passiv, Medium, Kausativ, Reflexiv, Stativ,
Applikativ etc.) zu sehen grammatische
Kategorien, die mit bestimmten valenzvern-
dernden morpho-syntaktischen Prozessen
(Konversionenen unterschiedlicher Art) kor-
reliert sind: Bei der Passivierung wird das
Argument, das im Aktiv als Subjektergn-
zung erscheint, grammatisch anders (im Engl.
und Dt. als Prpositionalphrase) realisiert,
oder es bleibt eventuell unrealisiert; die gram-
matische Subjektposition wird dabei von
einem Argument bernommen, das im Aktiv
als Objekt (meistens direktes, seltener indi-
rektes) kodiert ist (sog. persnliches Passiv),
oder sie bleibt eventuell leer, unbesetzt von
irgendwelchen semantischen Argumenten
(unpersnliches Passiv); vgl. unser Auto ist
(vom Nachbarn) repariert worden our car
has been repaired (by the neigbour), he was
sent a letter *er wurde einen Brief geschickt
ihm wurde ein Brief geschickt, heute wird
(von allen) gearbeitet! dn. idag skal der
arbejdes (af alle) today, there should be wor-
ked (by everybody). Bei der Kausativierung
tritt eine neue Subjektergnzung als Trger
der Verursacher-Rolle hinzu, wobei ein ur-
sprngliches Subjekt in ein Objekt konver-
tiert wird (vgl. die Tr war offen/ging auf
jemand ffnete die Tr, the door was open/
opened somebody opened the door); siehe
Abschnitt 3.5 fr den semantischen Aspekt
der Kausativierung. Dem gegenstzlichen
Zweck der Beseitigung eines Verursacher-
Arguments dient oft die Reflexivierung
(vgl. jemand ffnete die Tr die Tr ffnete
sich). Das Applikativ schlielich lt sich etwa
durch Swahili pika kochen vs. pikia fr je-
manden kochen, jemanden bekochen ver-
anschaulichen.
3. Einzelne Klassifikationskriterien
Wie oben (1.) erwhnt, soll in diesem Ab-
schnitt eine Reihe einzelner semantischer
Klassifikationskriterien besprochen werden,
fr die sich Linguisten im Rahmen moderner
Semantik- und Syntaxtheorien besonders in-
teressiert haben, und zwar weitgehend aus
theoretischen Grnden. Es handelt sich dabei
zum groen Teil um Eigenschaften von Verb-
argumenten oder Verb-Argument-Beziehun-
gen, die ber die rein quantitative Stelligkeit
und den semantischen Kasusrahmen der
Verben hinausgehen.
33. Verbklassifikation 701
syntaktischen Leerstelle hat in solchen Fllen
semantisch die Funktion eines anaphorischen
oder (seltener) deiktischen Elements, d. h.
einer freien Variablen, und mu dementspre-
chend kontextrelativ interpretiert werden
(zum Begriff der Kontextabhngigkeit s. Ar-
tikel 9). Ein Satz wie (4a) ist isoliert geuert
nicht voll interpretierbar, sondern verlangt
wie der entsprechende anapherhaltige Satz
(4b) einen Kontext, der spezifiziert, in was
eingewilligt wurde; vgl. (4c). Die logische
bersetzung von (4a) allein ist wie in (4d),
mit einer freien Variablen in der Objektposi-
tion. Weitere Beispiele bieten (5)-(6).
(4)
a. Lisa willigte ein.
b. Lisa willigte darin ein.
c. Ich bat Lisa, meine Frau zu werden.
Sie willigte ein.
d. einwilligen-in (x)(Lisa)
(5)
[brigens, wir veranstalten im Mrz ein
Presseseminar ber Frauenmihandlung.]
Ob du teilnehmen mchtest?
(6) [Er befahl mir, Mbius abzusetzen und
an seiner Stelle zu herrschen.]
Ich gehorchte.
Einige Verben z. B. teilnehmen, anfangen,
aufhren, fortfahren verlangen zur Erschlie-
ung des Unterdrckten keinen sprachlichen
Kontext, sondern knnen auch mit einem ge-
eigneten Situationskontext auskommen: Eine
Frage wie Mchtest du teilnehmen? ist voll
interpretierbar, wenn die Fragende(n) z. B.
gerade Karten spielt (spielen). Definitfakul-
tativitt (wenn nicht Obligatheit) scheint bei
Infinitiv- und Satzobjekten der Normalfall zu
sein.
Wahrscheinlich werden detailliertere se-
mantische Analysen deutlich machen, da es
von der Verbbedeutung abhngt, ob etwaige
Fakultativitt von der einen (indefiniten) oder
anderen (definiten) Art ist. Mglicherweise
wird Indefinitfakultativitt sich berhaupt als
semantisch vorhersagbar erweisen. Was De-
finitfakultativitt vs. Obligatheit betrifft, gibt
es jedoch bei Paaren anscheinend quivalen-
ter Verben zwischen Sprachen z. B. dem
Englischen und dem Deutschen Unter-
schiede, die sich kaum semantisch erklren
lassen (Sb 1984: 105 f.); vgl. z. B. die un-
terschiedliche Akzeptabilitt von We have to
find out! und *Wir mssen herausfinden! ge-
genber Wir mssens herausfinden!. Dies lt
darauf schlieen, da Obligatheit verstan-
den als definit-anaphorisches oder deikti-
sches Komplement statt nichts tatschlich
eine syntaktische, fr die einzelnen Verble-
xeme zu spezifizierende Eigenschaft ist.
Problem dar, das hier unbercksichtigt blei-
ben mu (s. dazu etwa Dowty 1979: 207 ff.).
Bei vielen Verben knnen Argumente
sprachlich unausgedrckt bleiben. Es handelt
sich dann auf syntaktischer Ebene um sog.
fakultative Ergnzungen, deren Abgrenzung
gegenber freien Angaben eines der Haupt-
themen der posttesnireschen Valenztheorie
darstellt. Wir wollen hier nicht in diese De-
batte einsteigen, und begngen uns deshalb
mit dem Hinweis, da semantisch nicht leere
Verbergnzungen sozusagen in der Bedeutung
des Verbs angelegt sind insofern, als entspre-
chende Argumente semantisch mitverstanden
werden mssen, wenn Ergnzungen der be-
treffenden Kategorie nicht dastehen.
Semantisch lassen sich zwei Typen der Fa-
kultativitt unterscheiden nach dem Effekt
der Nicht-Besetzung der jeweiligen syntakti-
schen Leerstelle (s. Sb 1984, dem die mei-
sten der unten angefhrten Beispiele entnom-
men sind; vgl. auch Fillmore 1971, Mittwoch
1971). Bei Indefinitfakultativitt wird ein in-
definites Argument etwa eine durch Exi-
stenzquantor gebundene Variable in der
syntaktisch leeren Position ergnzt: Ein Satz
wie (1a) ist im Sinne des (b)-Satzes zu verste-
hen und logisch-semantisch etwa wie in (c)
darzustellen.
(1)
a. Anna liebt wieder.
b. Es gibt wieder jemanden, den Anna
liebt.
c. x [lieben(x)(Anna)]
Vgl. auch Satz (2a), der wie (2b) verstanden
werden mu, und (3), wo an irgend jemanden
als implizites Prpositionalobekt von ver-
schenken mitverstanden wird.
(2)
a. Anna schreibt.
b. Anna schreibt (an) irgend etwas.
(3) [Was tun wir aber mit all diesen alten
Kleidern?]
Wir knnen sie ja verschenken. [- An
wen denn?]
Diese Art der Objektfakultativitt scheint
typisch u. a. fr effizierende Verben wie
schreiben, malen, nhen, bauen.
Stze mit unbesetzter indefinitfakultativer
Leerstelle sind grundstzlich nicht auf den
Kontext angewiesen, um das fehlende Ar-
gument zu ergnzen, d. h. sie lassen sich in
diesem Punkt kontextunabhngig interpretie-
ren. Bei Definitfakultativitt hingegen ist dem
Kontext und zwar meistens dem sprachli-
chen Kontext ein Argument passenden
Typs zu entnehmen. Die Nicht-Besetzung der
702 IX. Verbalsemantik
haben jedoch erst spter seit Rosenbaum
(1967) allgemeines Interesse erweckt; s.
etwa Chomsky (1981: 74 ff.), Bresnan (1982),
Koster (1984) und Dowty (1985a); vgl. auch
Stechow (1984b). Bei zweistelligen Verben
mit Infinitivkomplement wie versuchen, try,
manage ist das fehlende Infinitivsubjekt ko-
referent mit dem Subjekt des regierenden
Verbs, d. h. es liegt Subjektkontrolle vor; vgl.
(8b). Bei dreistelligen Verben mit Kasusobjekt
und Satzkomplement wie bitten, raten, ask,
persuade, force ist Objektkontrolle (Korefe-
renz mit dem Objekt des regierenden Verbs)
die Regel; vgl. (8c,d). Es gibt jedoch Ausnah-
meverben mit (Dativ-)Objekt wie verspre-
chen, zusagen, drohen, promise, die im Nor-
malfall Subjektkontrolle aufweisen; vgl. (9).
(9)
a. Anna
i
versprach ihrem Bruder, [x
i
ihn
zu beschtzen]
b. Anna
i
drohte ihrem Bruder, [x
i
ihn ein-
zusperren]
Bei Verben, die sich mit einer Infinitivkon-
struktion in Subjektfunktion verbinden, kann
das Subjektargument des Infinitivs wie in (8a)
und (10) eventuell ber ein Kasusobjekt kon-
trolliert werden. Es bleibt jedoch oft unkon-
trolliert und ist dann dem weiteren Kontext
zu entnehmen oder allgemein zu verstehen;
vgl. (11).
(10) [x
i
dich hier zu sehen], freut mich
i
sehr.
(11) Jahrelang zu studieren, hilft nichts.
Es ist diskutiert worden, ob Kontrollerschei-
nungen syntaktisch konfigurationell wie in
der GB-Theorie oder lexikalistisch wie in der
LFG (Lexical Functional Grammar)
oder im weiteren Sinne semantisch zu erklren
sind. Da semantische Faktoren wenigstens
teilweise verantwortlich sind fr die Kontrol-
leigenschaften von Verben, kann jedoch kaum
bezweifelt werden. Zum einen bilden die Aus-
nahmeverben mit (Dativ-)Objekt, aber Sub-
jektkontrolle (versprechen, drohen usw.) eine
semantisch einheitliche Gruppe: Sie bezeich-
nen Sprechhandlungen, bei denen die Ver-
antwortlichkeit fr oder Kontrolle ber die
mit der Infinitivkonstruktion angekndigten
Handlung beim Subjektargument liegt; hin-
gegen kommt diese semantische Rolle bei
dreistelligen Verben mit Objektkontrolle wie
bitten, auffordern etc. dem Objekt zu. Ferner
werden die angeblich normalen Kontrollver-
hltnisse bei den betreffenden Verben umge-
stlpt, wenn die Infinitivkonstruktion ihrem
Subjektargument semantisch keine Agens-/
Agentiv-Rolle zult; d. h. versprechen/dro-
hen-Verben knnen unter geeigneten seman-
tischen Umstnden Objektkontrolle und bit-
3.2Kontrolleigenschaften
Fr Verben mit Satzergnzung und Verben
mit Inifinitivergnzung, wie sie in (7) vorlie-
gen, mssen nach der syntaktischen Kategorie
der Ergnzung verschiedene (Valenz-)Klassen
angesetzt werden.
(7)
a. Den Weg zu finden, gelang uns nicht.
b. Anna versuchte, rechtzeitig zu kom-
men.
c. Anna bat ihren Bruder, rechtzeitig zu
kommen.
d. Anna riet ihrem Bruder, rechtzeitig zu
kommen.
e. Anna verlangte von ihrem Bruder,
rechtzeitig zu kommen.
Semantisch scheint die Infinitivergnzung je-
doch vom gleichen Typ wie die Satzergn-
zung: Sie wird im Kontext als eine vollstn-
dige Proposition aufgefat, deren syntak-
tisch nicht ausgedrcktes Subjektargument
nach bestimmten Richtlinien ergnzt wird.
Und zwar wird diese Subjektzuordnung mehr
oder weniger rigide vom bergeordneten Verb
gesteuert: Das ergnzte (logische, zugrun-
deliegende) Subjektargument ist meistens als
koreferent mit einem bestimmten Argument
dieses Verbs zu verstehen in (7a) mit dem
(Dativ-) Objekt (uns), in (7b) mit dem Subjekt
(Anna), in (7c,d) mit dem (Akkusativ- bzw.
Dativ-)Objekt (ihren bzw. ihrem Bruder) und
in (7e) mit dem prpositional angeschlosse-
nen Argument (... ihrem Bruder). Wir ver-
anschaulichen diese Subjektzuordnungen
durch Hinzufgung einer Variablen, die als
Subjektargument in der Infinitivkonstruktion
zu verstehen ist und mit der relevanten Er-
gnzung des regierenden Verbs koindiziert
(also gebunden) wird, wie in (8).
(8)
a. [x
i
den Weg zu finden] gelang uns
i
nicht
b. Anna
i
versuchte [x
i
rechtzeitig zu kom-
men]
c. Anna bat ihren Bruder
i
[x
i
rechtzeitig
zu kommen]
d. Anna riet ihrem Bruder
i
[x
i
rechtzeitig
zu kommen]
e. Anna verlangte von ihrem Bruder
i
[x
i
rechtzeitig zu kommen]
Verben mit Infinitivergnzung lassen sich nun
subklassifizieren nach der Art und Weise, wie
sie das Subjektargument der Infinitivkon-
struktion kontrollieren. Derartige Kon-
trollerscheinungen wurden erstmals von Bech
in einer 1955 und 1957 erschienenen Mono-
graphie (Bech 1983) systematisch erforscht,
33. Verbklassifikation 703
(Mary)) wahr zu machen; und im Fall per-
suade, da das Objekt (John) is an agent
capable of forming intentions to act (Dowty
1985a: 300) und durch Handlungen des Sub-
jekts (Mary) dazu gebracht wird, die Objekt-
Infinitiv-Proposition (leave(John)) wahr ma-
chen zu wollen. Nach dem fr Raising-Ver-
ben charakteristischen Bedeutungspostulat
wird hingegen lediglich ber die Proposition
etwas prdiziert, die das jeweilige Subjekt-
bzw. Objektargument mit dem untergeord-
neten Prdikat bildet im Fall seem, da es
Grnde gibt, anzunehmen, da die Subjekt-
Infinitiv-Proposition (have left(Mary)) wahr
ist; und im Fall believe, da die Objekt-Infi-
nitiv-Proposition (have left(John)) in der
Glaubenswelt des Subjekts (Mary) wahr
ist. Das heit, the meaning of a sentence NP
seems to VP cannot depend in any way on
the meaning of NP (or of VP) per se, but only
on the proposition they form together
(Dowty 1985a: 301). Das Raising-Verb ver-
gibt in der GB-Terminologie im Unter-
schied zum Kontroll-Verb keine eigene the-
matische Rolle an die Subjekt- bzw. Objekt-
position.
3.3Transparenz und Opakheit,
Extensionalitt und Intensionalitt
Zentral in der heutigen Semantikforschung
ist die Unterscheidung referentiell transparen-
ter (durchsichtiger) und opaker (undurch-
sichtiger) Verben oder Verbkonstruktionen
(s. hierzu beispielsweise Dowty et al. 1981:
143; Link 1976: 13 ff.) Eine transparente Kon-
struktion liegt vor, wenn Dominanz von in
den Komplementen enthaltenen Quantoren
ber das Verb zugelassen ist in dem Sinne,
da ein Quantor aus einer als (Teil der) Er-
gnzung dienenden Nominalphrase heraus-
gezogen werden und das Verb selber in seinen
Skopus nehmen kann, ohne da sich die Be-
deutung dabei ndert. Diese Mglichkeit der
Exportation von beispielsweise einem Exi-
stenzquantor aus dem Objekt bzw. einem pr-
positionalen Komplement ist bei sehr vielen
Verben gegeben; vgl. die folgenden Paare
quivalenter Stze mit finden, kaufen, einzie-
hen.
(16)
a. Monika hat einen schnen Stein ge-
funden.
b. Es gibt einen schnen Stein, den Mo-
nika gefunden hat.
(17)
a. Anna kaufte einige Bcher.
b. Es gab einige Bcher, die Anna
kaufte.
ten-Verben Subjektkontrolle aufweisen; vgl.
(12).
(12)
a. Anna versprach ihrem Bruder
i
, [x
i
mit
ins Kino gehen zu drfen]
b. Anna
i
bat ihren Bruder, [x
i
pnktlich
abgeholt zu werden]
Schlielich gibt es auch Verben z. B. vor-
schlagen , die neben Objektkontrolle auch
Subjektkontrolle sowie gemeinsame Kon-
trolle durch Objekt und Subjekt haben kn-
nen; vgl. (13).
(13) Der Gastwirt schlug Herrn Meier vor,
das Essen gegen 20 Uhr zu servieren.
Bei Siebert-Ott (1983) werden weitere Argu-
mente fr die Annahme vorgebracht, da es
die logisch-semantischen Eigenschaften des
Prdikats und nicht seine kategorialen sein
mssen, die den zentralen Faktor bei der Be-
stimmung von Kontrollbeziehungen darstel-
len (Siebert-Ott 1983: 113).
Dowty (1985a) veranschaulicht, wie man
Kontroll-Verben wie die obigen semantisch
als Prdikate ber Prdikate darstellen und
ihnen Bedeutungspostulate zuordnen kann,
aus denen sich ihre Kontrolleigenschaften
ableiten lassen. Dabei wird die in der trans-
formationsgrammatischen Tradition ge-
machte syntaktische Unterscheidung von
Kontroll- oder Equi-Verben wie den oben
besprochenen einerseits und sog. Raising-
Verben z. B. scheinen, seem und Verben mit
Akkusativ + Infinitiv wie sehen, believe
andererseits hinfllig (vgl. dazu von Stechow
1984b). Die intransitiven Verben try und
seem gehren genau wie die transitiven per-
suade und believe zur gleichen syntaktischen
Kategorie insofern, als sie sich mit einem In-
finitivkomplement verbinden; vgl. (14)(15).
(14)
a. Mary tried to leave.
b. Mary seems to have left.
(15)
a. Mary persuaded John to leave.
b. Mary believes John to have left.
Semantisch besteht jedoch folgender Unter-
schied: Den Kontroll-Verben try und per-
suade ist ein Bedeutungspostulat zugeordnet,
nach dem ihr jeweiliges Subjekt- bzw. Objekt-
argument und das untergeordnete Prdikat
(die Infinitivkonstruktion) miteinander zu
einer Proposition verknpft werden und zu-
gleich etwas anderes ber das betreffende Ar-
gument prdiziert wird im Fall try, da
das Subjekt (Mary) intentional handelt und
die Intention hat, durch seine Handlun-
gen die Subjekt-Infinitiv-Proposition (leave
704 IX. Verbalsemantik
(23)
a. Man verhaftete den Spion im Kanz-
leramt.
b. Man verhaftete Guillaume.
(24)
a. Nollau kennt den Spion im Kanzler-
amt.
b. Nollau kennt Guillaume.
In (25, 26) hingegen, wo das Verb eine opake
Konstruktion etabliert, ist die Wahrheit des
(a)-Satzes nicht automatisch mit der des (b)-
Satzes gegeben: Nollau kann den Spion im
Kanzleramt suchen oder erwarten, ohne (zum
gegebenen Referenzpunkt) zu wissen, da die
so gekennzeichnete Person mit Guillaume
identisch ist.
(25)
a. Nollau erwartete den Spion im Kanz-
leramt.
b. Nollau erwartete Guillaume.
(26)
a. Nollau sucht den Spion im Kanzler-
amt.
b. Nollau sucht Guillaume.
Die Opakheit ist hier an die Wissenssituation
die epistemische Perspektive der mit
dem Subjekt bezeichneten Person des epi-
stemischen Subjekts gebunden und wird
deshalb epistemische Opakheit genannt:
Die Opakheit entsteht also dadurch, da die epi-
stemische Perspektive sich der rein referentiellen
Funktion berlagert und die Art und Weise be-
deutsam werden lt, in der das Referenzobjekt
durch einen Term in dieser Position gekennzeichnet
wird. (Link 1976: 16).
Epistemische Opakheit mit Bezug auf die Ob-
jektposition ist besonders verbreitet bei Ver-
ben mit Satz- oder Inifinitivobjekt. Hierher
gehren u. a. Verben des Begehrens (z. B.
wnschen, verlangen), der Redewiedergabe
(sagen, erzhlen etc.) und der propositionalen
Einstellung (glauben, wissen usw.), bei denen
die Ungltigkeit des extensionalen Substitu-
tionsprinzips sehr deutlich zu Tage tritt; vgl.
die folgenden eindeutig nicht quivalenten
Satzpaare.
(27)
a. Brandt behauptete, seinen Sekretr
gut zu kennen.
b. Brandt behauptete, den Spion im
Kanzleramt gut zu kennen.
(28)
a. Brandt wute, da Guillaume sein
Sekretr war.
b. Brandt wute, da der Spion im
Kanzleramt sein Sekretr war.
Transparente Verben, die nach dem oben Ge-
sagten sowohl Quantorenexportation und
existentielle Abschwchung als auch extensio-
nale Substitution fr ihre Ergnzungen gltig
machen, werden in vielen Darstellungen auch
(18)
a. Otto zieht in eine groe Wohnung
ein.
b. Es gibt eine groe Wohnung, in die
Otto einzieht.
Bei einer bezglich einer bestimmten Position
opaken Konstruktion ist die Exportation von
Quantoren aus der betreffenden Position hin-
gegen nicht ohne Bedeutungsnderung mg-
lich: Die Satzpaare in (19)-(21) sind nicht
quivalent, der (b)-Satz gibt nur noch eine
referentielle (de re -Lesart) wieder und wird
der zweiten nicht-refentiellen (de dicto
Lesart) nicht gerecht (siehe Artikel 34 zu den
Begriffen referentiell, de re, de dicto). Der
(a)-Satz kann im Unterschied zum (b)-Satz
auch dann wahr sein, wenn die relevante No-
minalphrase im Komplement (zum aktuellen
Referenzpunkt) keine Extension hat, d. h. die
sog. existentielle Abschwchung P(T) x
P(x), wo T ein Term ist hat in diesem Fall
keine Gltigkeit.
(19)
a. Monika hat einen schnen Stein ge-
sucht.
b. Es gibt einen schnen Stein, den Mo-
nika gesucht hat.
(20)
a. Anna wnschte sich einige Bcher.
b. Es gab einige Bcher, die Anna sich
wnschte.
(21)
a. Otto redet von einer groen Woh-
nung.
b. Es gibt eine groe Wohnung, von der
Otto redet.
Transparenz ist der Normalfall fr Verben
ohne Satz- oder Infinitivergnzung. Opakheit
(bezglich der Objektposition) kennzeichnet
nebst suchen, erwarten, seek, expect Verben
mit einem modalen Inhalt wie brauchen, wn-
schen, verlangen, need, want. Als Beispiel fr
ein bezglich der Subjektposition opakes Verb
mge fehlen dienen; vgl. die Nicht-quivalenz
von (22a,b).
(22)
a. Mir fehlt ein geeigneter Partner.
b. Es gibt einen geeigneten Partner, der
mir fehlt.
Als Charakteristikum fr Transparenz vs.
Opakheit gilt auch die Substitutivitt exten-
sionsgleicher Terme. Wenn zwei Nominal-
phrasen extensionsgleich sind (dieselbe Enti-
tt bezeichnen), so lassen sie sich in transpa-
renten Konstruktionen ohne Einflu auf den
Wahrheitswert der jeweiligen Aussage fr ein-
ander substituieren. So sind die folgenden
Satzpaare quivalent, falls es sich bei dem
Spion im Kanzleramt und Guillaume um ein
und dieselbe Person handelt.
33. Verbklassifikation 705
nen an zwei verschieden Referenzpunkten
(Zeiten) ntig und knnten insofern als (sub-
jekt-)intensional klassifiziert werden, wie es
Lbner (1976: 225) tut. Der Wert (die Sub-
jekt-Extension) darf jedoch nur in einer ein-
zelnen Dimension Alter, Zustand, Loka-
lisierung, Krperhaltung etc. variieren, es
mu sich an den beiden Punkten um das
gleiche, konstante, in seiner zeitlichen Aus-
dehnung definierte Individuum handeln. Man
wird (30a) nicht als wahr oder angemessen
betrachten knnen, wenn die Person, die zu-
rckkommt eine andere ist als diejenige, die
wegging, und hnlich fr (30b).
(30)
a. Der Brgermeister ist zurckgekehrt.
b. Der Brgermeister ist gealtert.
Solche Verben, die fr die betreffende Er-
gnzung mehrere Werte einer einzelnen Di-
mension [des betroffenen Gegenstands] zu
verschiedenenen Welt/Zeit-Punkten themati-
sieren, werden von Lbner spter (Lbner
1979: 168 ff.) partialvariant genannt und nach
einiger Diskussion als extensional eingestuft.
Sie unterscheiden sich durch die Varianz in
einer Dimension des betroffenen Gegenstands
von den indiskutabel extensionalen (Typ lie-
gen, frieren, schlafen), die in der betreffen-
den Ergnzung nur den momentanen Wert
dieser Dimension thematisieren und deshalb
(a. a. O.) momentbezogen genannt werden.
Und sie unterscheiden sich durch die notwen-
dige Kernkonstanz (Individuenkonstanz)
von den eigentlich intensionalen, kernvarian-
ten Verben (Typ wechseln, variieren), die in
allen Verwendungen Wertnderungen inten-
sionaler Funktionen thematisieren (Lbner
1979: 109).
Subklassifizierungen, wie sie hier mit Bezug
auf die Subjektposition veranschaulicht wur-
den, sind bei mehrstelligen Verben im Hin-
blick auf jede Argumentposition vorzuneh-
men. Momentbezogen extensionale Verben
wren dann solche, die in allen Argument-
positionen durch momentbezogene Exten-
sionalitt gekennzeichnet sind (transitive Bei-
spiele: finden, sehen), whrend partialvariante
bzw. eigentlich intensionale Verben in min-
destens einer Position Partialvarianz bzw.
Kernvarianz aufweisen (transitive Beispiele:
wecken, legen bzw. wechseln, austauschen, ent-
lassen). Viele Verben kennen allerdings so-
wohl partialvariante als auch kernvariante
(intensionale) Verwendungen: Sie werden teils
auf mehrdimensionale, reale Begriffe an-
gewandt und greifen dabei unter Wahrung der
Kernkonstanz ine Varianzdimension heraus,
teils werden sie sozusagen metaphorisch auf
extensional genannt, whrend die im obigen
Sinne opaken Verben als intensional bezeich-
net werden (s. z. B. Link 1976: 17 ff. und
Dowty 1979: 244 ff.). Dies hngt damit zu-
sammen, da im einen Fall eher die Extensio-
nen und im anderen Fall eher die Intensionen
(der Sinn) der jeweiligen Ergnzungen als
Argumente des Verbinhalts thematisiert wer-
den oder zum Tragen kommen (zu den Be-
griffen Extension und Intension siehe Ar-
tikel 9). (Link 1976 versucht allerdings episte-
mische Opakheit extensional zu explizieren,
und zwar im Zusammenhang mit einer Dis-
kussion wertender Verben wie bewundern,
die auch als intensional eingestuft worden
sind; s. Link 1976: 144 ff. und Dowty et al.
1981: 219.) Werden Verbargumente grund-
stzlich als Intensionen aufgefat, d. h. als
Funktionen, die erst relativ zu Referenzpunk-
ten Extensionen zuweisen, so sind extensio-
nale Verben dadurch gekennzeichnet, da sie
den Wert ihrer Argumente (z. B. eines Indi-
viduenkonzepts) nur am aktuellen Referenz-
punkt betrachten; bei einem intensionalen
Verb hingegen mu der Wert (mindestens)
eines Arguments an mehr als einem Refe-
renzpunkt in Betracht gezogen werden. Dar-
aus folgt dann die Gltigkeit bzw. Ungltig-
keit der extensionalen Substitutivitt:
Wenn ein subjekt-extensionales Prdikat auf einen
Individualbegriff [i. e. ein Individuenkonzept] zu-
trifft, dann mu es damit gleichzeitig auf alle an-
deren e-Intensionen zutreffen, die dieselbe Exten-
sion haben: weil das Prdikat nur eine Aussage
ber die gegebene Extension macht, ist es nicht in
der Lage, zwischen verschiedenen, aber in dieser
Extension bereinstimmenden Individualbegriffen
zu unterscheiden. (Lbner 1976:224).
Nach diesem Verstndnis sind z. B. die in-
transitiven Verben frieren, husten, schlafen,
stehen, einziehen (in) subjekt-extensional,
whrend Vernderungsverben wie wechseln
und variieren (als Intransitiva) subjekt-inten-
sional zu nennen sind: Fr die Wahrheit von
Stzen wie (29) an einem gegebenen Refe-
renzpunkt ist der Wert der Subjekt-Intension
an verschiedenen Punkten (Zeiten) relevant,
und zwar mu er ein jeweils verschiedener
sein es mu sich um verschiedene Indivi-
duen (Personen bzw. Einkommensgren)
handeln.
(29)
a. Der Brgermeister hat gewechselt.
b. Mein Einkommen variiert.
Auch intransitive Vernderungsverben wie al-
tern, einschlafen, zurckkehren, aufstehen ma-
chen eine Bewertung ihrer Subjekt-Intensio-
706 IX. Verbalsemantik
b. Anna bedauert nicht, da sie bei der
Prfung durchgefallen ist.
Anna bedauert nicht, bei der Prfung
durchgefallen zu sein.
c. Anna ist bei der Prfung durchgefal-
len.
Faktiv sind vor allem emotive Verben, vgl.
wundern, rgern, freuen, erschrecken, berra-
schen. Durch ihre Forderung nach Wahrheit
der Argumentproposition erinnern sie an Ver-
ben mit NP-Ergnzung, die wie z. B. be-
obachten, kennen existentielle Prsupposi-
tionen an ihre Argumente knpfen.
Fr implikative Verben gilt, da die Argu-
mentproposition aus einer affirmativen Pro-
position mit dem betreffenden Verb und die
Negation der Argumentproposition aus der
entsprechenden negativen Proposition folgt.
Hierher gehren geschehen, gelingen; succeed,
manage, happen: aus (34a) folgt (34b), und
aus (35a) folgt (35b).
(34)
a. Es gelang Anna, rechtzeitig zu kom-
men.
b. Anna kam rechtzeitig.
(35)
a. Es gelang Anna nicht, rechtzeitig zu
kommen.
b. Anna kam nicht rechtzeitig.
Negativ implikative Verben verhalten sich um-
gekehrt: Die Argumentproposition mu
falsch sein, wenn die komplexe Proposition
affirmativ ist, und wahr, wenn diese negiert
ist. Beispiele sind unterlassen, vermeiden, ver-
gessen (mit Infinitivkomplement vergessen
mit da-Satzkomplement ist faktiv), fail,
avoid, forget (to), wie aus den Folgerungs-
beziehungen in den folgenden Satzpaaren er-
sichtlich wird.
(36) a. Anna verga, ihren Schirm mitzuneh-
men.
b. Anna nahm ihren Schirm nicht mit.
(37) a. Anna verga nicht, ihren Schirm mit-
zunehmen.
b. Anna nahm ihren Schirm mit.
Gemeinsam ist den hier besprochenen Verb-
gruppen, da affirmative wie negative Stze
mit einem solchen Verb Schlsse erlauben be-
zglich der Wahrheit oder Falschheit der Ar-
gumentproposition. In anderen Fllen kann
enweder nur aus einer affirmativen oder nur
aus einer negativen Proposition auf den
Wahrheitswert der Argumentproposition ge-
schlossen werden. Hierher gehren nach
Karttunen (1970) explizite Kausativa wie ver-
ursachen, veranlassen, zwingen; cause, bring
about, force (sog. wenn-Verben) und verhin-
eindimensionale, abstrakte, fiktive Be-
griffe angewandt und sind dann notgedrun-
gen kernvariant. Beispiele fr solche unei-
gentlich intensionalen Verben (Lbner 1979:
118 ff.) wren etwa zunehmen, fallen, senken,
erweitern; vgl. die Satzpaare in (31, 32).
(31)
a. Der Brgermeister nimmt zu.
b. Der Lrm nimmt zu.
(32)
a. Der Minister senkte die Arme.
b. Der Minister senkte die Steuern.
Die fr Intensionalitt charakteristische
Kernvarianz ist nicht notwendigerweise zeit-
abhngig wie in den oben besprochenen Bei-
spielen, sondern kann an andere Parameter
gebunden sein. Dies ist der Fall bei modal
opaken Konstruktionen (s. oben) einschlie-
lich epistemischer Opakheit (wenn diese nicht
extensional rekonstruiert wird): Bestimmend
fr die Wahrheit von beispielsweise (28b) ist
nicht oder nicht nur die Wahrheit der vom
Objektsatz ausgedrckten Proposition relativ
zur wirklichen Welt, sondern (auch) relativ
zur Brandts damaligen Wissenssituation
(Wissenswelt); vgl. dazu auch Lbners (1979:
129 ff.) Darstellung der Faktenvarianz.
3.4Faktivitt, Implikativitt und
Verwandtes
Verben (Prdikate) mit Satz- oder Infinitiv-
komplement unterscheiden sich im Hinblick
auf die logischen Beziehungen zwischen einer
Proposition mit dem betreffenden Prdikat
einerseits und der jeweiligen Argumentprop-
sition andererseits (Karttunen 1970). Bei sog.
faktiven Verben (Kiparsky & Kiparsky 1971)
bildet die Argumentproposition eine Prsup-
position (bzw. konventionelle Implikatur) der
komplexen Proposition. Das heit im Rah-
men einer dreiwertigen Logik, da die Wahr-
heit der eingebetteten Proposition (am jewei-
ligen Referenzpunkt) eine Voraussetzung ist
fr die Wahrheit wie fr die Falschheit der
komplexen Proposition; diese ist wahrheits-
wertig unbestimmt sinnlos , wenn jene
nicht wahr ist: (33a) und (33b) sind, isoliert
geuert, gleich unangemessen, falls (33c)
nicht zutrifft. Oder anders ausgedrckt: die
Argumentproposition folgt logisch aus der
komplexen Proposition wie aus deren (star-
ker) Negation. (Fr den Begriff der Prsup-
position und das damit verbundene sog. Pro-
jektionsproblem s. Artikel 13 und 10.)
(33)
a. Anna bedauert, da sie bei der Pr-
fung durchgefallen ist.
Anna bedauert, bei der Prfung
durchgefallen zu sein.
33. Verbklassifikation 707
sein knnen hinsichtlich des Gegensatzes te-
lisch atelisch, insofern als die Aktionsart
nach Eigenschaften der Verbergnzungen,
einschlielich des Subjekts, variieren kann: In
den (a)-Stzen von (38, 39) liegt Telizitt (de-
finite change of state), in den (b)-Stzen hin-
gegen Atelizitt (indefinite change of state)
vor (s. dazu Verkuyl 1972, Storch 1978, Plat-
zack 1979).
(38)
a. Das Wasser verdampfte.
b. Wasser verdampfte.
(39)
a. Anna baute ein Haus.
b. Anna baute Huser.
Aktionsarten kommen mithin Konstruktio-
nen aus Verb + Ergnzungen (einschlielich
des Subjekts) zu, und zwar so, da die Ak-
tionsart einer solchen Konstruktion eine
Funktion von semantischen Eigenschaften
des Verbs und seiner Ergnzungen ist, wobei
die einschlgigen Verbeigenschaften ihrerseits
lexikalische Aktionsarten genannt werden
knnten.
Auf die semantische Rolle des Subjekts be-
zogen ist die Unterscheidung agentiver und
non-agentiver Verben; vgl. z. B. laugh, kill,
build a house und notice, roll, sleep. Bei erste-
ren steht die jeweilige Aktivitt oder der je-
weilige Vorgang oder Zustand under the un-
mediated control (Dowty 1979: 118) des mit
dem Subjekt bezeichneten Individuums, bei
diesen liegt keine solche Kontrolle vor das
Subjekt ist hier kein Agens.
Auch hinsichtlich der Agentivitt liegt oft
kein Entweder-Oder vor, insofern als es Ver-
ben wie sitzen, stehen gibt, die in agentiven
und non-agentiven Konstruktionen erschei-
nen; vgl. (40).
(40)
a. Liege ruhig!
b. Das Buch liegt auf dem Tisch.
Im Zusammenhang mit Aktionsart (Aspekt)
ist meistens auch die Unterscheidung existen-
tieller und generischer Verben behandelt wor-
den (vgl. Chafe 1970, Carlson 1977), die sich
daraus ergibt, da bestimmte Argumentstel-
len bestimmter Verben eine nicht-generische
bzw. eine generische Interpretation bestimm-
ter Terme erzwingen (z. B. Elephanten kom-
men vs. Elephanten haben einen Rssel). Diese
Phnomene scheinen mit anderen, oft unab-
hngig behandelten (Existenzverben oder Exi-
stenz-Einfhrungsverben, Definiteness Effect
s. Milsark 1974, Safir 1982 , ergative
Verben) zusammenzuhngen, ohne da dieser
ganze Komplex noch gengend erforscht
wre.
dern, abhalten; prevent, dissuade, keep (from)
(negative wenn-Verben). Demgegenber
stehen dann Verben, die bei Affirmation und
Negation im gleichen Mae den Wahrheits-
wert der Argumentproposition offen lassen,
d. h. vor allem solche, die wie glauben, tru-
men, annehmen, behaupten propositionale
Einstellungen oder Redewiedergabe bezeich-
nen.
3.5Aktionsart, Agentivitt und
Kausativitt
Zentral in der Verbsemantik steht die Klas-
sifizierung von Verben (Prdikaten) nach
ihrer Aktionsart (in der englischsprachlichen
Fachliteratur u. U. auch aspect genannt), die
lange Traditionen hat (s. Franois 1985 fr
eine bersicht). Es handelt sich dabei mei-
stens und zwar vor allem in der neueren
Literatur um eine Einteilung in Sorten
von Prdikaten (Manzotti et al. 1975), die
sich im Wesentlichen auf die Struktur von
Wahrheits- oder Geschehensintervallen der
mit den Prdikaten gebildeten Propositionen
richtet, aber zugleich die semantische Rolle
des Subjekts allgemeiner: den semanti-
schen Kasusrahmen (s. 2.2) der Prdikate
bercksichtigt.
Auf die Wahrheitsintervallstruktur bezo-
gen ist Dowtys (1979: 184) Unterscheidung
von Prdikaten, die eine definite change of
state ausdrcken wie notice, kill, dissolve,
build a house, und solchen, die wie roll, rain,
walk, laugh eine indefinite change of state
(oderactivity) oder wie know, sleep, sit einen
Zustand state bezeichnen. Die Defi-
nition der definite change of state-Prdikate
(Dowty 1979: 166) scheint zur Explikation
des traditionellen Begriffs der Perfektivitt
geeignet; ein heute gelufigerer Terminus ist
Telizitt. Imperfektiv bzw. atelisch wren
dann die activity- und state-Prdikate; ihr
Kennzeichen ist, da unmittelbar nacheinan-
derfolgende oder berlappende Wahrheitsin-
tervalle einer entsprechenden Proposition
z. B. Anna schlafen ein zusammenhn-
gendes Wahrheitsintervall der betreffenden
Proposition bilden. Dies ist bei Telizitt aus-
geschlossen: zwei unmittelbar nacheinander-
folgende Geschehensintervalle der Proposi-
tion Anna ein Haus bauen machen zusam-
men kein Geschehensintervall dieser Propo-
sition aus, sondern ein Geschehensintervall
von Anna zwei Huser bauen und Anna
Huser bauen (vgl. Fabricius-Hansen 1986:
Kap. IV).
Zu beachten ist, da Verben an sich neutral
708 IX. Verbalsemantik
tungspostulat erklrt. Ein implizites Kausa-
tivum wie kill wird in Anlehnung an das Ver-
fahren der generativen Semantik etwa als
CAUSE TO BECOME DEAD dekomponiert
bzw. ihm wird ein Bedeutungspostulat zuge-
ordnet, das die quivalenz von kill(x,y) und
CAUSE(...x..., BECOME(DEAD(y))) fest-
legt. Der Kausaloperator selber wird wie
auch der bergangsoperator BECOME
o. . in der Logiksprache definiert, und
zwar meistens so, da er in beiden Argu-
mentbereichen nur noch Propositionen zult
(s. Ballweg 1977: 130, Dowty 1979: 109), d. h.
als semantische Entsprechung von verursa-
chen in Stzen wie (44).
(44) Da das Wetter so schlecht war, verur-
sachte, da wir zu Hause blieben.
Die Ursache-Wirkung-Relation ist als Rela-
tion zwischen Sachverhalten oder Ereignissen,
nicht zwischen Individuen und Sachverhalten
bzw. Ereignissen, aufzufassen: nicht einfach
die Person Kain, sondern etwas, was sie tat,
veranlate Abels Tod. Dies scheint allerdings
schlecht damit bereinzustimmen, da impli-
zite Kausativa wie tten oft gerade nicht Stze
oder Infinitivkonstruktionen, sondern No-
minalphrasen in der Subjektposition verlan-
gen. Das lt sich am zweckmigsten da-
durch erklren, da das Vorderglied von
CAUSE in der semantischen Reprsentation
ein nicht nher spezifizierter Vorgang ist, in
den das von dem in der Oberflchenstruktur
aufscheinenden Designator bezeichnete Indi-
viduum involviert ist. (Ballweg 1977: 133).
Die logische Struktur von (43a) wre dann
nicht wie in (45a), sondern eher wie in (45b);
vgl. Dowty (1979: 91).
(45)
a. CAUSE(Kain, BECOME(tot(Abel)))
b. CAUSE([Kain etwas tun], BE-
COME(tot(Abel)))
Um die semantische Beschreibung der ein-
schlgigen Verben zu vereinfachen, lohnt es
sich allerdings, wie es Ballweg (1977: 134) tut,
einen abgeleiten Kausaloperator BRING
ABOUT o. . anhand von CAUSE zu defi-
nieren, der im Unterschied zu CAUSE nicht
Propositionen, sondern Terme im Vorderglied
verlangt; vgl. (46) (in Anlehnung an Ballweg).
(46) BRING ABOUT(x, p) =
df
x(p
[CAUSE(E...x..., BECOME(p))])
wo E...x... ein Ereignis bezeichnet, an
dem x als Handelnde(r) beteiligt ist.
Die Bedeutung eines impliziten Kausativums
wie tten ist dann anhand dieses Operators
und des entsprechenden Rezessivums zu er-
klren, wie die folgenden Bedeutungspostu-
Intensiv erforscht worden ist die Eigen-
schaft der Kausativitt (s. z. B. Shibatani (ed.)
1976, Nedjalkov 1976, Ballweg 1977, Dowty
1979: 91 ff., Comrie 1981: 158 ff.), die viele
transitive Verben kennzeichnet und in ver-
schiedenen Varianten vorkommt. Explizit
kausativ sind Verben wie verursachen, veran-
lassen, dazu fhren, dazu bringen, machen, las-
sen oder cause, bring about, die ein Satz- oder
Infinitivkomplement nehmen und eine Ursa-
che-Wirkung-Relation bezeichnen zwischen
dem Subjektargument und dem propositio-
nalen Objektargument (genauer: der Propo-
sition, die aus einem affirmativen Satz mit
dem Kausativum folgt, s. oben 3.4); vgl. die
Satzpaare in (41).
(41)
a. Das schlechte Wetter verursachte,
da wir zu Hause blieben.
Das schlechte Wetter veranlate uns,
zu Hause zu bleiben.
b. Wir blieben zu Hause.
Ein implizites oder lexikalisches Kausativum
liegt vor, wenn das n(1)-stellige transitive
Verb eine Ursache-Wirkung-Relation be-
zeichnet zwischen dem Subjektargument und
einer Proposition, die folgende Bedingungen
erfllt: Sie ist mit einem n-1-stelligen, typisch
intransitiven Prdikat gebildet, enthlt das
Objektargument des Transitivums als Sub-
jektargument und folgt notwendig aus einem
affirmativen Satz mit dem Transitivum; vgl.
(42, 43), wo der jeweilige (b)-Satz die Wir-
kung beschreibt.
(42)
a. Die Sonne hat die Kleider getrocknet.
b. Die Kleider sind trocken geworden.
Die Kleider sind getrocknet.
(43)
a. Kain ttete seinen Bruder.
b. Kains Bruder starb.
Die beiden Verben (oder Verbkonstruktionen)
das n-stellige Kausativum und das n-1-
stellige Rezessivum knnen etymologisch
unverwandt sein wie im Fall tten sterben;
oder das eine kann von dem anderen abge-
leitet sein (vgl. legen liegen, trocknen -
trocken [werden]); oder es kann sich einfach
um verschiedene Valenzvarianten desselben
Verbs handeln (cf. trocknen und rollen als
transitive Kausativa und entsprechende in-
transitive Rezessiva).
In der logischen Semantik werden die
gemeinsamen Charakteristika kausativer
Verben meistens mit dem Vorhandensein
eines eigenen Operators CAUSE o. . unter
den Bedeutungskomponenten des jeweiligen
Verbs bzw. in dem ihm zugeordneten Bedeu-
34. Verben der propositionalen Einstellung 709
Heger/Petfi (eds.) 1977 Helbig (ed.) 1971 Hel-
big 1982 Helbig/Schenkel 1969 Heringer 1984
Hoepelman 1986 Hhle 1978 Hopper/Thomp-
son 1980 Jackendoff 1972 Jansen 1977 Janen
1984 Jespersen 1924 Kaplan/Bresnan 1982
Karttunen 1970 Kiparsky/Kiparsky 1971 Koster
1984 Lehrer 1974 Leisi 1971 Link 1976 Lb-
ner 1976 Lbner 1979 Lyons 1977 Manzotti/
Pusch/Schwarze 1975 Marantz 1982 Menzel
1975 Michael 1970 Milsark 1974 Mittwoch
1971 Nedjalkov 1976 Percival 1975 Pinborg
1975 Plank (ed.) 1979 Plank 1983a Plank
1983b Platzack 1979 Projektgruppe Verbvalenz
1981 Rosenbaum 1967 Safir 1982 Schumacher
(ed.) 1986 Schwarze 1979 Schwarze (ed.) 1985
Schwarze/Wunderlich (eds.) 1985 Shibatani (ed.)
1976 Shopen 1973 Siebert-Ott 1983 von Ste-
chow 1984b von Stechow/Sternefeld 1985 Storch
1978 Tesnire 1959 Walter 1981 Wilkins (ed.)
1988 Wunderlich 1985a
Cathrine Fabricius-Hansen,
Oslo (Norwegen)
late veranschaulichen mgen (vgl. dazu auch
Fabricius-Hansen 1975: 110 ff.).
(47)
a. x y [tten(x, y) BRING
ABOUT(x, sterben(y))]
b. y [sterben(y) BECOME(tot(y))]
4. Literatur (in Kurzform)
Abraham (ed.) 1978 Arens 1969 Buerle 1985
Ballmer/Brennenstuhl 1978 Ballmer/Brennenstuhl
1981 Ballmer/Brennenstuhl 1986 Ballweg 1977
Baron 1982 Bech 1983 Behaghel 1924 Bier-
wisch 1970 Bresnan 1982 Carlson 1977 Cattell
1984 Chafe 1970 Chomsky 1965 Chomsky
1981 Comrie 1981 Czepluch/Janen (eds.) 1984
Dixon 1977 Dowty 1979 Dowty 1985a Dowty/
Wall/Peters 1981 Dressler 1968 Engel/Schuma-
cher 1978 Fabricius-Hansen 1975 Fabricius-
Hansen 1986 Fillmore 1968 Fillmore 1971 Fill-
more 1977 Franois 1981 Franois 1985 Ger-
ling/Orthen 1979 Gruber 1965 Gruber 1976
34. Verben der propositionalen Einstellung
Dieses ebenso einfache wie einleuchtende Bild
erzeugt jedoch ein Dilemma, das die grund-
legenden Annahmen der Semantik in Frage
stellt. Dieses Dilemma ist als das Problem der
propositionalen Einstellungen bekannt und
darauf konzentriert sich der vorliegende Ar-
tikel.
Vernachlssigt wird darber vollkommen
die wortsemantische Beschreibung dieser Ver-
ben in dem Sinne, da z. B. die Art der Kom-
plemente untersucht wrde: welche Verben
haben warum ein deklaratives (1a) Komple-
ment, welche ein interrogatives (1b), welche
gar beides (1c,d) oder einen Infinitiv (1e).
(1)
a. Brigitte glaubt, da sie Mumps hat.
b. Brigitte berlegt, ob sie Mumps hat.
c. Brigitte wei, da sie Mumps hat.
d. Brigitte wei, ob sie Mumps hat.
e. Brigitte behauptet, Mumps zu haben.
Es werden vielmehr ausschlielich Verben mit
einem (deklarativen) da-Komplement be-
handelt, fr die sog. erotetischen Einstellun-
gen sei lediglich auf Artikel 15 verwiesen.
Auch werden Unterschiede zwischen den
Einstellungsverben wie z. B. die folgenden
nicht thematisiert. Bei manchen satzeinbet-
tenden Verben gelten die folgenden Schlsse:
1. Eingrenzung des Problems
2. Das semantische Problem
3. Diagonalisierung
4. Zur Individuierung von Bedeutungen
5. Reprsentationen: Sprachliche Form und pro-
positio mentalis
6. Strukturierte Bedeutungen
7. Einstellungen als Eigenschaftszuschreibung:
Glauben de se
8. Glauben de re
9. Technisches: Die Adaptation der strukturier-
ten Bedeutungen
10. Iterierte Einstellungen
11. Literatur (in Kurzform)
1. Eingrenzung des Problems
Einstellungsverben sind ganz allgemein gesagt
Verben, die ein Satzkomplement verlangen.
Intuitiv gesprochen sollte der eingebettete
Satz eine Proposition ausdrcken und das
Verb eine Einstellung zu dieser Proposition,
die dem Subjekt des Hauptsatzes zugeschrie-
ben wird. Die allgemeine Form solcher Stze
ist also:
EinstellungssubjektEinstellung Proposition
Peter behauptet da Paul zur
Schule geht bezweifelt
710 IX. Verbalsemantik
Es ist fr das zu behandelnde Problem un-
wichtig, ob und wie der ffentlichen Re-
prsentationsform der sprachlichen ue-
rung (Schallwellen/Schriftzeichen in einem
einmaligen uerungskontext) im Fall des
Glaubens oder Hoffens eine mentale Re-
prsentationsform etwa als uerung in einer
language of thought (Fodor 1975) entspricht.
Wichtig und interessant ist im gegenwrtigen
Kontext nicht die Identifizierung solcher Ein-
stellungsobjekte, sondern allein, da sie den-
selben Inhalt haben knnen: das, was Urs
behauptet, wird von Renate geglaubt (die Un-
terscheidung Objekt/Inhalt entstammt Cress-
well 1985b). Unser Problem ist also das einer
Spezifizierung des Inhalts von Einstellungen.
Auch hinsichtlich der Objekte und Inhalte
von Einstellungen gibt es eine Menge von
Fragen und Unterschieden, die hier nicht wei-
ter verfolgt werden. Welchen Arten von Ein-
stellungssubjekten drfen wir z. B. einen
Glauben oder eine Hoffnung zuschreiben?
Manche Einstellungen knnen einen kontra-
diktorischen Inhalt haben, andere wohl kaum
(man kann eine Kontradiktion behaupten,
aber nicht wissen).
Behandelt wird also ein kleiner Ausschnitt
aus einem weiten Bereich. Aber dieser Aus-
schnitt ist von fundamentaler Wichtigkeit fr
das Gebude der Semantik.
2. Das semantische Problem
Der Inhalt einer Einstellung, also das, was
erhofft, geglaubt oder gewnscht wird, sollte
eigentlich ganz unabhngig vom Einstellungs-
verb der Inhalt des Komplementsatzes sein.
Und der Inhalt des Komplementsatzes, das
legt die sprachliche Form nahe, sollte in einer
systematischen Beziehung zum Inhalt des ent-
sprechenden nichteingebetteten Satzes stehen,
vgl. (7a,b).
(7)
a. Kirsten hofft, da die Schule ausfllt.
b. Die Schule fllt aus.
Die Reifikation des Inhalts unter der Bezeich-
nung Proposition ergibt sich also sowohl aus
den Bedrfnissen der Bedeutungstheorie als
auch aus der Theorie der Intentionalitt des
Bewutseins, der mentalen Akte. Mit (7b)
wird eine Proposition ausgedrckt, und der
eingebettete Satz in (7a) verhlt sich zur aus-
gedrckten Proposition praktisch genauso
wie der nicht-eingebettete Satz (7b). Damit
drckt das Einstellungsverb hoffen eine Re-
(2) a. Gottfried wei, da die Arminia ab-
gestiegen ist
Die Arminia ist abgestiegen.
b. Gottfried wei nicht, da die Arminia
abgestiegen ist
Die Arminia ist abgestiegen.
Solche faktiven Verben prsupponieren also
die Gltigkeit des Komplements, implikative
Verben verhalten sich da etwas anders:
(3) a. Ede machte sich die Mhe, den Auf-
satz durchzulesen
Ede las den Aufsatz durch
b. Ede machte sich nicht die Mhe, den
Aufsatz durchzulesen
Ede las den Aufsatz NICHT durch.
Und aus wieder anderen Verben lt sich hin-
sichtlich der Gltigkeit des Komplements
berhaupt nichts folgern: aus (4a) oder (4b)
folgt weder (4c) noch (4d):
(4)
a. Arnim glaubt, da Dieter kommen
wird.
b. Arnim glaubt nicht, da Dieter kom-
men wird.
c. Dieter wird kommen.
d. Dieter wird nicht kommen.
Fr diese Probleme sei auf den Artikel 13
ber Prsuppositionen verwiesen.
Auch Bedeutungsbeziehungen zwischen
einzelnen Einstellungsverben werden hier aus-
gespart. Die alte philosophische Frage, was
einen Glauben von einem Wissen unterschei-
det, ob Wissen eine besondere Form von
Glauben ist, wird z. B. in Hintikka (1962),
Blau (1969) und Armstrong (1973) diskutiert.
Ein weiteres Problem ist die Unterschei-
dung zwischen Inhalt und Objekt einer
Einstellung. Die Handlungsbeschreibungen
(5a,b) beschreiben Sprechhandlungen und
nehmen damit auf ein eher unproblemati-
sches, weil ffentliches Objekt Bezug eine
uerung von Urs.
(5)
a. Urs sagte, die Veranstaltung werde
stattfinden.
b. Urs behauptete, die Veranstaltung
werde stattfinden.
In (6a,b) werden dagegen sehr private, weil
mentale Objekte ins Spiel gebracht, die dem-
gem auch eher problematisch sind: ein
Glaube und eine Hoffnung.
(6)
a. Urs glaubt, da die Veranstaltung
stattfinden wird.
b. Urs hofft, da die Veranstaltung statt-
finden wird.
34. Verben der propositionalen Einstellung 711
Satz.
(8)
a. 12 =12
b.
12 =
2
144
Bei den eingebetteten Stzen der propositio-
nalen Einstellung wird dieses Unbehagen je-
doch zum echten Problem, denn das zunchst
plausibel erscheinende Kriterium, da durch
(8a) und (8b) dann verschiedene Propositio-
nen ausgedrckt werden, wenn es mglich ist,
da jemand (8a) glaubt, nicht aber (8b), wird
durch die Annahme Proposition = Intension
eindeutig verletzt: (8a,b) drcken die logisch
wahre Proposition aus.
Und legt man das in der Bedeutungstheorie
ebenfalls geforderte Frege- oder Kompositio-
nalittsprinzip zugrunde (der Inhalt/die Be-
deutung eines komplexen Ausdrucks ist eine
Funktion der Bedeutung seiner Teile), dann
ist dies nicht nur ein Dilemma der Einstellun-
gen, sondern vor allem der Bedeutungstheorie
selbst. Denn wenn (8a,b) dieselbe Proposition
ausdrcken und in den anderweitig identi-
schen Stzen (9a,b) als Konstituente auftre-
ten, dann mten auch (9a,b) dieselbe Pro-
position ausdrcken.
(9)
a. Ede glaubt, da 12 = 12.
b.
Ede glaubt, da 12 =
2
144.
Es ist aber eine bedenkliche Annahme, da
mangels semantischer Unterschiede in den je-
weiligen Konstituenten Subjekt-Einstellungs-
verb-Proposition in (9a,b) beide Stze densel-
ben Wahrheitswert haben mssen. Dies wre
eine Semantik fr den Allwissenden. Bei
einem Normalsterblichen wie Ede ist es
durchaus mglich, da (9a) wahr ist, (9b) aber
falsch. Lassen wir es aber zu, da (9a,b) be-
deutungsverschieden sind, dann mu dies an
der Bedeutungsverschiedenheit der Konsti-
tuenten liegen. Die einzig unterschiedliche
und damit in Frage kommende Konstituente
ist aber der eingebettete Satz, so da eben
doch (8a,b) trotz Intensionsgleichheit eine un-
terschiedliche Bedeutung haben mssen. Eine
plausible Semantik fr satzeinbettende Ver-
ben macht es also erforderlich, die Grund-
annahmen der Bedeutungstheorie zu ber-
denken: mu entweder der Bedeutungsbegriff
oder das Kompositionalittsprinzip irgendwie
neu formuliert werden, um dem Dilemma zu
entrinnen?
Sicher ist vorerst nur, da Verben der pro-
positionalen Einstellung Kontexte darstellen,
in denen die Intension des Komplementsatzes
eine wahrheitswerterhaltende Substitution
lation aus zwischen einem hoffenden Subjekt
und einer Proposition als Hoffnungsinhalt,
eben eine propositionale Einstellung.
Freilich mu nun fr diese Objekte die
Propositionen ein Identittskriterium ge-
funden werden. Und hier erweist sich die ver-
fhrerisch elegante Unifizierung der Objekte
der Bedeutungstheorie mit denen der menta-
len Einstellungen doch als problematisch.
Plausibel erscheinen zwei Kriterien, die sich
zunchst nicht widersprechen:
(a) das Einstellungs-Kriterium:
die Stze P und Q drcken unterschied-
liche Propositionen aus, wenn es der Fall
ist, da jemand P glaubt und Q nicht
glaubt.
(b) das Bedeutungs-Kriterium:
was immer Bedeutungen sein mgen, als
most certain principle (Cresswell 1982)
steht fest, da Stze P und Q eine ver-
schiedene Bedeutung haben, wenn sie
nicht denselben Wahrheitswert haben,
d. h. wenn ihre Extension verschieden ist.
Das eigentliche Problem beginnt nun damit,
da die Bedeutungstheorie ber den Wahr-
heitswert eines Satzes nicht nur zu einem not-
wendigen, sondern auch zu einem hinreichen-
den Identittskriterium fr Propositionen ge-
langen will: wenn zwei Stze P und Q unter
allen Umstnden (in allen mglichen Welten)
denselben Wahrheitswert haben, wenn sie also
dieselbe Intension haben, dann haben sie die-
selbe Bedeutung bzw. drcken dieselbe Pro-
position aus. Der Propositionsbegriff der
Wahrheitswertsemantik rekonstruiert also
Propositionen als Funktionen von mglichen
Welten in Wahrheitswerte; oder auch, da es
sich bei der Annahme von nur zwei Wahr-
heitswerten um eine charakteristische Funk-
tion handelt, eben als eine Menge mglicher
Welten (derjenigen Welten, fr die die Funk-
tion den Wert wahr hat).
Zieht man auf diese Weise den Intensions-
begriff zur Explikation des Bedeutungsbegrif-
fes heran, so geht man auch davon aus, da
alle Tautologien und alle Kontradiktionen
dieselbe Bedeutung haben nmlich einmal
die Menge aller mglichen Welten und einmal
die leere Menge. Es gibt also jeweils nur eine
logisch wahre und eine logisch falsche Pro-
position. Schon bei nicht-eingebetteten Stzen
erzeugt diese Gleichsetzung Inhalt = Inten-
sion ein gewisses Unbehagen. Denn (8a,b)
sind als mathematische Wahrheiten zwar in
allen Welten wahr und somit intensionsgleich,
dennoch erscheint (8a) trivialer und umge-
kehrt (8b) informativer als der jeweils andere
712 IX. Verbalsemantik
aber er drckt in einer Situation A, in der ich
auf Arnim zeige, die logisch wahre Proposi-
tion (10b) aus, und in einer Situation E, in
der ich auf Ede zeige, die logisch falsche Pro-
position (10c).
(10)
a. Das ist Arnim.
b. Arnim ist Arnim.
c. Ede ist Arnim.
(10b) ist aber wahr, ob ich nun auf Arnim
oder Ede zeige, ebenso ist (10c) in beiden
Situationen falsch. Mit (10a) soll aber nun
offensichtlich etwas gesagt werden, was in A
wahr und in E falsch ist, daher die Informa-
tivitt dieses Satzes. Stalnaker (1978):
In each case, to construct a context...in which the
proposition expressed is neither trivial nor assumed
false...one must include possible worlds in which
the sentence, interpreted in the standard way, ex-
presses different propositions.
Nun haben wir zwei Situationen A und E, in
denen (10a) verschiedene Propositionen aus-
drckt in A die logisch wahre Proposition
(10b), in E die logisch falsche Proposition
(10c). Es entsteht folgende Wahrheitstafel fr
(10a):
Abb. 34.1: Wahrheitstafel fr (10a)
Stalnaker meint nun, da Stze wie (10a) oder
(11ac) berhaupt nur dann eine plausible
informativ-empirische Interpretation haben,
wenn sie in ihrem Gebrauchskontext fr die
diagonale Proposition stehen.
(11)
a. Es ist jetzt 15.00 Uhr.
b. Hesperus ist identisch mit Phospho-
rus.
c. Ophtalmologen sind Augenrzte.
Wir akkomodieren also eine scheinbar un-
informative Identittsaussage dahingehend,
da sich hinter der tatschlich ausgedrckten
logisch wahren oder falschen Proposition eine
nicht garantiert. Cresswell (1975) spricht des-
wegen von hyperintensionalen Kontexten.
Die obige Art der Prsentation des Pro-
blems hat freilich ihre Tcken. Es knnte der
Eindruck entstehen, da dies ein rein techni-
sches Problem der Wahrheitsbedingungense-
mantik ist. Da mithin eine Alternative zu
dieser Art, Semantik zu treiben, das Problem
gar nicht erst entstehen lassen wrde. Am
Ende des Artikels, nur soviel sei schon jetzt
gesagt, wird aber hoffentlich klar geworden
sein, da dies eine Fehleinschtzung der
Ernsthaftigkeit des Problems wre.
3. Diagonalisierung
Die ebenso einfache wie elegante Vorstellung,
da die Propositionen der Bedeutungstheorie
die Inhalte mentaler Einstellungen seien, fhrt
also zu einer Beschreibung eher dessen, was
man glauben oder hoffen sollte: sind P und
Q intensionsgleiche Stze, dann sollte man Q
glauben, wenn man P glaubt. Man beschreibt
also eine idealisierte Sprachgemeinschaft, in
der Beschrnkungen des logischen und em-
pirischen Wissens keine Rolle spielen. Aber
auch eine solche ideale Gemeinschaft mu,
wie Partee (1979b) bemerkt, die Probleme der
Hyperintensionalitt bercksichtigen, wenn
sie ber die Probleme der Normalsterblichen
reden knnen will.
Und vielleicht knnen wir Normalsterbli-
chen eben diese Beschrnkung unseres Wis-
sens als Argument anfhren, um zu erklren,
warum wir nicht mit einer gleich alle logischen
Wahrheiten glauben: vielleicht wissen wir ein-
fach nicht, welche Proposition ein Satz ei-
gentlich ausdrckt. Plausibel ist dies sicher,
z. B. bei noch nicht bewiesenen logischen oder
mathematischen Vermutungen. Sie sind ent-
weder wahr oder falsch, und als mathema-
tisch-logische Stze sogar logisch wahr oder
falsch. Es wird also, soviel wissen wir, ent-
weder die logisch wahre oder die logisch fal-
sche Proposition ausgedrckt. Aber welche
von beiden?
Stalnaker (1976b, 1978, 1987) sieht darin
den Ausgangspunkt fr eine Lsung des Pro-
blems. Er schreibt in Stalnaker (1976b:88):
...where a person fails to know some mathema-
tical truth, there is a non-actual possible world
compatible with his knowledge in which the ma-
thematical statement says something different from
what it says in the actual world.
Die intuitiv plausibelsten Beispiele fr Stal-
nakers Idee betreffen indexikalische Aus-
drcke. Der Satz (10a) ist sicher informativ,
34. Verben der propositionalen Einstellung 713
sition ausdrckt, eine andere finden, in der
die logisch falsche Proposition ausgedrckt
wird. Dies kann aber nur eine Welt sein, in
der eines der in (12a) vorkommenden Zeichen
eine andere als seine aktuelle Bedeutung hat,
in der z. B. 144 eine andere Zahl reprsen-
tiert, etwa 145.
(12)
a. 12 x 12 = 144
b. 12 x 12 = 145
Hlt man aber (12a) deswegen fr falsch, weil
es eine Art der Reprsentation ist, die fr die
aktuale Bedeutung von (12b) steht, dann
glaubt man in der aktualen Beschreibung
des Glaubens eben nicht, da nicht (12a),
sondern da nicht (12b). Da 144 mgli-
cherweise die Zahl 145 reprsentiert, ist ja ein
Problem dessen, der den Glauben zuschreibt,
fr den Inhalt des Glaubens allein wichtig ist
das, was reprsentiert wird eben (12b).
Wenn wir von jemandem behaupten, er
glaube (12b), dann unterstellen wir wohl, da
er einen mathematischen Fehler begangen
hat, nicht aber, da er andere Bezeichnungs-
konventionen befolgt, dabei aber korrekt kal-
kuliert.
Im Grunde pldiert Stalnaker fr ein ge-
genber dem hier bisher gezeichneten Bild
verfeinertes Verhltnis von Satzbedeutung
und Proposition. Stze sind kontextabhngig,
und ihre Bedeutung ist daher eine Funktion
von einem Kontext in die dort ausgedrckte
Proposition. Das erlaubt es zwar, bei einigen
als informativ empfundenen Aussagen wie
(10a,11a) den empirischen Charakter deutlich
zu machen, aber solange man davon ausgehen
kann, da es auch konstante Funktionen als
Satzbedeutungen gibt, also solche, die fr je-
den Kontext dieselbe Proposition als Wert
haben, solange kann dieser Ansatz das Pro-
blem der Einstellungen nicht beseitigen. Es sei
deshalb nur der Vollstndigkeit halber ange-
merkt, da in von Stechow (1984c) darber-
hinaus gezeigt wird, da der Ansatz von Stal-
naker nicht nur bei superstarren Designatoren
in Schwierigkeiten gert, sondern auch schon
mit starren Designatoren prinzipielle Pro-
bleme hat.
4. Zur Individuierung von
Bedeutungen
Das Frege-Prinzip, das die Bedeutung von
(14a) unter anderem aus der von (14b) ablei-
ten mu, wird dieselbe Bedeutung fr (14c)
aus (14d) ableiten. Trotzdem knnen (14a)
empirische verbirgt, die (in der Wahrheitstafel
diagonal) in manchen Situationen wahr und
in anderen falsch ist (vgl. dazu Artikel 9). Das
Problem wird also dahingehend aufgelst,
da unterstellt wird, da ein Satz, der de facto
eine logisch wahre oder falsche Proposition
ausdrckt, nicht der Ausdruck dessen sein
kann, was der Sprecher wirklich mitteilen will.
Der Sprecher will informativ sein, also mu
er etwas empirisches mitteilen, was die Zahl
der mglichen Alternativen reduziert.
Fr eine Identittsaussage mit Eigennamen
wie (11b) mu es nun ebenfalls neben der
aktualen Welt, in der sowohl Hesperus als
auch Phosphorus das Objekt Venus be-
zeichnen, Welten geben, in denen die beiden
Namen so benutzt werden, da sie auf ver-
schiedene Objekte referieren. Die ausge-
drckte diagonale Proposition lt sich also
als (11d) paraphrasieren:
(11)
d. Das, worauf sich Hesperus bezieht,
ist identisch mit dem, worauf sich
Phosphorus bezieht.
Damit liee sich erklren, warum (11b) ein
empirischer Satz ist, obwohl mit (11b) in einer
uerungswelt entweder die logisch wahre
oder die logisch falsche Proposition ausge-
drckt wird.
Stalnakers Lsung basiert also auf einer
suberlichen Unterscheidung von uerungs-
welt und Auswertungswelt. Eigennamen und
Pronomina sind sog. starre Designatoren, sie
referieren in jeder Auswertungswelt auf das-
selbe Objekt. Daher drcken Identittsaus-
sagen entweder die logisch wahre oder die
logisch falsche Proposition aus. Die Referenz
dieser starren Designatoren wird jedoch in
der uerungswelt fixiert und wird je nach
uerungswelt unterschiedlich fixiert. Eine
allgemeine Lsung fr das Problem der pro-
positionalen Einstellungen ist damit freilich
nur dann gefunden, wenn es neben den star-
ren nicht auch superstarre Designatoren gibt,
also solche, die nicht nur in obigem Sinne
starr sind, sondern auch noch an jeder ue-
rungswelt auf dasselbe Objekt referieren.
Und superstarr sind eben alle Ausdrcke,
die nicht von den empirischen Gegebenheiten
abhngen, sondern allein von den Bedeu-
tungsregeln der Sprache. Deswegen ist die
Diagonalisierungsmethode nicht auf mathe-
matische oder logische Aussagen anwendbar,
die Stalnaker (1978) selbst als the most dif-
ficult aspects of the problem bezeichnet und
nicht weiter behandelt. Man mte ja zu einer
Welt, in der (12a) die logisch wahre Propo-
714 IX. Verbalsemantik
andere Proposition als die tatschlich ausge-
drckte reprsentiert wird.
Und wenn die Negations- und Disjunk-
tionszeichen nicht fr ihre aktuale Bedeutung
stehen, dann ist ihre Bedeutung eventuell so-
gar gar nicht mehr determiniert welche
unter den mglichen Bedeutungen reprsen-
tieren sie denn nun? Und wenn die Bedeutung
nicht determiniert ist, dann entsteht doch ein
Problem fr das Frege-Prinzip.
Ohnehin garantiert auch nichts, da mit
einem Vorgehen dieser Art eine qualitative
Lsung fr das Problem der Hyperintensio-
nalitt einhergeht. Denn es ist nicht auszu-
schlieen, da es nun wiederum Stze gibt,
die in allen mglichen und unmglichen Wel-
ten denselben Wahrheitswert haben. Eine im-
mer feinere Differenzierung von Bedeutungen
hilft wenig, solange nicht gleichzeitig davon
ausgegangen werden kann, da es nicht mg-
lich ist, ein und dieselbe Bedeutung auf ver-
schiedene Arten auszudrcken. Was nunmehr
den Schlu nahelegt, da es die Art der Re-
prsentation eher ist als die Bedeutung selbst,
die das Dilemma verursacht. Das eigentliche
Problem, so formuliert Cresswell (1985b), ist
eben nicht, wie zwei bedeutungsverschiedene
Stze verschieden sein knnen, sondern wie
zwei bedeutungsgleiche Stze verschieden sein
knnen.
berhaupt luft die obige Diskussion ja
darauf hinaus, da eigentlich nicht ber un-
mgliche Welten, sondern ber nichtklassi-
sche Logiken zu reden ist. Und dazu bemerkt
Hintikka (1975):
Attempts have in fact been made to construct a
model theory of impossible worlds by adopting
some sort of nonstandard interpretation of logical
constants. However, this course i s very dubious.
The very problem was created by peoples failure
to perceive the logical consequences of what they
know far enough. Of course these logical conse-
quences must be based on the classical ... interpre-
tation of connectives and quantifiers. Thus an at-
tempted nonstandard interpretation is either bound
to be beside the point or else to destroy the problem
instead of solving it.
Genauso, wie wir die Konsequenzen unseres
Wissens in einem klassischen System nicht
weit genug bersehen, werden wir es letztlich
auch in einem nicht- klassischen System nicht
tun. Das Problem ist nicht die Wahl der Lo-
gik, sondern unsere mangelhafte logische
Kompetenz.
Betont werden sollte vielleicht noch, da
wir es wirklich mit einer Schwierigkeit der
feineren Differenzierung von Bedeutungen zu
und (14c) verschiedene Wahrheitswerte haben
und daher nicht dieselbe Bedeutung:
(14)
a. Josef glaubt, da 6 x 6 = 36.
b. 6 x 6 = 36
c. Josef glaubt, da 36 = 36.
d. 36 = 36
Wenn aber (14a) und (14c) verschiedene Be-
deutung haben, dann sind Bedeutungen viel-
leicht etwas feineres als Intensionen. Und
wenn (14b) und (14d) nun intensionsgleich,
aber bedeutungsverschieden sind, dann gibt
es wohl keine Probleme mit dem Frege-Prin-
zip.
Wenn also mgliche Welten nicht gengend
zwischen Bedeutungen differenzieren, knnte
man diese feineren Unterscheidungen ber die
Addition weiterer Welten der unmglichen
zu erzielen versuchen. Diese mchte man
ja auch unterscheiden knnen, so das Plau-
sibilittsargument, weil ja die physikalisch un-
mglichen Welten, in denen Wasser bergauf
fliet, nicht unbedingt identisch sein mssen
mit denjenigen der Alchemisten, in denen aus
Blei Gold gemacht werden kann.
Zwei logisch wahre Stze haben dann zwar
dieselbe Intension, aber dadurch verschiedene
Bedeutung, da sie in unmglichen Welten ver-
schiedene Wahrheitswerte annehmen. Nun ist
aber zum Beispiel die Tautologie (15) allein
durch die logischen Operationen der Disjunk-
tion und der Negation bestimmt der Inhalt
von P ist gleichgltig.
(15) P oder nicht-P
Die Bedeutung der logischen Operationen
Negation und Disjunktion ist aber unabhn-
gig von der Art der Welt determiniert: die
Negation bildet Weltmengen in ihre Komple-
mentmenge ab, die Disjunktion bildet die Ver-
einigungsmenge. Und die Vereinigung einer
Weltenmenge mit ihrer Komplementmenge ist
eben die Menge aller Welten, d. h. die logisch
wahre Proposition. Inwiefern also sollten
diese logischen Operationen in irgendeiner
unmglichen Welt anders funktionieren?
Wenn Disjunktion und Negation in irgend-
einer Welt den Satz (15) als nicht-tautologi-
schen erzeugen, dann eigentlich hchstens
deswegen, weil sie in dieser Welt nicht unsere
Negation und unsere Disjunktion ausdrk-
ken. Dafr aber, da die Zeichen fr Nega-
tion und Disjunktion etwas anderes bedeuten,
bedrfte es keiner unmglichen Welten, denn
kein Sprachzeichen hat seine Bedeutung not-
wendigerweise. Dies wrde, ganz hnlich wie
bei Stalnaker, ja nur fordern, da einfach eine
34. Verben der propositionalen Einstellung 715
Wahrheitswert, nicht aber (17a,b):
(16)
a. Danzig liegt an der Ostsee.
b. Gdansk liegt an der Ostsee.
(17)
a. Danzig enthlt zwei Vokale.
b. Gdansk enthlt zwei Vokale.
In (16a,b) wird der Name gebraucht und steht
fr einen Ort, in (17a,b) wird der Name er-
whnt und steht fr einen Ausdruck, verdeut-
licht durch die Konvention der Anfhrungs-
zeichen als nur zitiert. Wenn man nun (16a)
glauben kann und gleichzeitig (16b) nicht
glauben heit das, da man in Einstel-
lungskontexten eher eine Analyse wie bei
(17a,b) unterstellen mu?
Sicher ist, da Einstellungskontexte nicht
ausschlielich als Zitatkontexte angesehen
werden knnen. Denn der eingebettete Satz
ist nicht immer an sich ein geeignetes Objekt
fr eine Einstellung.
(18) Brigitte glaubt, da ich jetzt hier bin.
In (18) wird Brigitte kein Glauben an den
Satz Ich bin jetzt hier zugeschrieben. Viel-
mehr verdeutlichen gerade indexikalische
Ausdrcke, da es vom jeweiligen Referenten
von ich, jetzt, hier abhngt, ob und was ge-
glaubt wird.
Darber hinaus zeigt das bersetzungsar-
gument von Church (1950), da eine Einstel-
lung schon insofern bedeutungsabhngig sein
mu, als einerseits der besondere Ausdruck
des Glaubens, die Art seiner Zuschreibung,
in andere Ausdrcke anderer Sprachen ber-
setzt werden kann, da aber andererseits der
Wahrheitswert sich ndert, wenn man dem-
selben Ausdruck eine andere Bedeutung zu-
schreibt. Man kann also denselben Glaubens-
inhalt mit verschiedenen Ausdrcken ver-
schiedener Sprachen ausdrcken (19a,b),
nicht aber mit demselben Ausdruck in (be-
deutungs)verschiedenen Sprachen denselben
Inhalt.
(19)
a. Wolfgang glaubt, da Einstein in
Princeton starb.
b. Wolfgang believes that Einstein died
in Princeton.
Bei der Annahme aber, da zwischen zwei
Sprachen Deutsch und Teutsch ein Unter-
schied dahingehend besteht, da die Bedeu-
tungen von sterben und geboren werden in den
beiden Sprachen genau vertauscht sind, kann
(19a) in den beiden Sprachen unterschiedliche
Wahrheitswerte haben.
Die Form des Ausdrucks spielt zwar
manchmal auch eine Rolle, z. B. bei den
tun haben, nicht mit einem Problem, das ein-
fach aus den ohnehin problematischen un-
mglichen Welten erwchst. Man kann sie
ganz weglassen und z. B. mit Thomason
(1980a) Propositionen als primitive Entitten
annehmen. Man schliet einfach aus der
Mglichkeit verschiedener Einstellungen zu
zwei Stzen, da sie nicht dieselbe Proposition
ausdrcken, so da p und p zwei ver-
schiedene primitive Propositionen ausdrk-
ken. Das wirft natrlich die Frage nach den
logischen Beziehungen zwischen den Propo-
sitionen auf, aber darauf sei hier nicht ein-
gegangen. Es sei nur gezeigt, da die schon
oben diskutierten Probleme genauso auftre-
ten wie im Rahmen der Erklrung ber un-
mgliche Welten.
Erstens: akzeptieren wir (for the sake of
the argument), da die Negation eine Ope-
ration ist, die, auf eine Proposition zweimal
angewendet, zu einer anderen Proposition
fhrt. Das besagt nicht, da eine Operation,
die so funktioniert wie unsere Negation, die
also bei doppelter Anwendung wieder zum
Ausgangspunkt fhrt, in diesem anderen Sy-
stem nicht definierbar ist. Kann eine solche
Operation aber wieder vorkommen (m. a. W.:
gibt es wieder mehrere Ausdrcke fr ein und
dieselbe Proposition), dann bleibt das Ein-
stellungsproblem erhalten. Und zweitens: eine
ber das Wahrheitsfunktionale hinausge-
hende Bedeutung fr unsere Negation wird
zwar angenommen, aber nicht eingelst in
dem Sinne, da das mehr an Bedeutung
angebbar wre. Insofern werden die Bedeu-
tungen eigentlich nicht feiner analysiert, es
wird nur hypostasiert, da sie feiner seien.
Sind sie also nur partiell bekannt, diese Be-
deutungen? Auch das ist kein Ausweg: zu
verschiedenen Einstellungen kommt man
doch wohl ber den bekannten Teil der Be-
deutung, nicht ber den unbekannten Rest.
5. Reprsentationen: Sprachliche
Form und propositio mentalis
Diese Modifikation des Frege-Prinzips geht
davon aus, da die Art des Gegebenseins der
Bedeutungen ebenfalls eine Rolle spielt. Da
p und p sich in Einstellungskontexten
unterscheiden, knnte einfach daran liegen,
da die Reprsentation der Bedeutung eine
jeweils andere ist. Und das Phnomen, da
intensionsgleiche Ausdrcke in Einstellungs-
kontexten nicht intersubstituierbar sind,
kennt man auch bei anderen Konstruktionen,
z. B. Zitatkontexten. (16a,b) haben denselben
716 IX. Verbalsemantik
wenn es hier in einem Rahmen abgehandelt
wird, der von den semantischen Entitten
ausgeht.
Machen wir also andererseits den Versuch,
verschiedene mentale Reprsentationen einer
Proposition zuzulassen. Ein solcher Ansatz
kommt nicht gnzlich ohne semantische An-
nahmen aus. Denn wenn eine Bedeutung for-
mal verschiedene Reprsentationen haben
kann, dann mu daran erinnert werden, da
die Zuschreibung einer propositionalen Ein-
stellung hchstens etwas ber die Reprsen-
tation dessen sagen kann, der die Einstellung
zuschreibt, nicht aber ber die Reprsentatio-
nen dessen, der die Einstellung hat. Sei nun
(16a) meine Reprsentation und (16b) die von
Xaver. Ist dann meine Glaubenszuschreibung
(20) korrekt?
(20) Xaver glaubt, da Danzig an der Ostsee
liegt.
Die Reprsentation, auf die sich Xavers Ein-
stellung bezieht, ist formal nicht identisch mit
der, die meiner Beschreibung zugrunde liegt.
Dennoch wird man zunchst eine Lesart von
(20) als korrekte Zuschreibung akzeptieren.
Hier ist nun der Inhalt insofern notwendig,
als man darber reden knnen mu, da zwei
Reprsentationen R und R fr denselben In-
halt stehen knnen.
Aber, so scheint es, in diesem Fall ist auch
die sprachliche Form nicht ganz unwichtig.
War eines der Probleme bei dem Versuch,
Bedeutungen feiner zu differenzieren, da das
Feinere ein letztlich nicht recht fabares
Element blieb, so ist hier ganz analog die
Frage, wie und wann man von verschiedenen
mentalen Reprsentationen ausgehen mu
oder darf (und was genau die Verschiedenheit
ausmacht). Eigentlich doch immer dann und
nur dann, wenn auch die betrachteten Stze
verschieden sind. Ist dies aber die Evidenz fr
Verschiedenheit der mentalen Reprsentation,
dann ist die strukturelle Funktion der men-
talen Reprsentationen im Erklrungsmodell
diesmal von einer Art, die auch durch die
ffentliche Reprsentationsform der natr-
lichen Sprache ausgefllt werden knnte.
Dies soll kein Pldoyer gegen mentale Re-
prsentationen sein, sondern nur dafr, da
sie in unsere Fragestellung nicht essentiell ein-
gehen. Wie immer man sich hinsichtlich der
Ausdeutung der Idee der propositio mentalis
zu den beiden oben skizzierten Mglichkeiten
verhlt: es bleibt der Verdacht, da die Re-
prsentation mentaler Art nichts beitrgt, was
nicht auch allein ber Bedeutungen einerseits
manner verbs of communication (Partee
1973c), aber das scheint eher wieder eine Ei-
genschaft spezifischer Einstellungen zu sein
und nicht das allgemeine Problem zu berh-
ren.
Dem Problem der Inessentialitt der u-
eren Form kann man zunchst durch die
Wiederbelebung einer alten Idee begegnen,
die vor allem im Kontext von psychologischen
Fragen und solchen der knstlichen Intelli-
genz auftritt. Die Idee ist die einer propositio
mentalis in einer allen Menschen gemeinen
lingua universalis, der language of thought
(Fodor 1975, 1978a).
Was ein Satz auf Deutsch und Teutsch aus-
drckt, ist trotz Gleichheit der ueren Form
ein jeweils verschiedener Ausdruck der lingua
mentalis. Und einem Unterschied in der u-
eren Form zwischen Ausdrcken zweier
Sprachen entspricht nicht unbedingt ein Un-
terschied auf der Ebene der language of
thought. Wie die uere Form der natrlichen
Sprachen ist aber die propositio mentalis eine
Reprsentation, ein Satz der Universalspra-
che.
Da es auf der mentalen Ebene nur eine, die
Universalsprache, geben soll, ist zwar das
Problem einer irrelevanten Abhngigkeit von
der Ausdrucksverschiedenheit verschiedener
Sprachen dadurch gelst, da sozusagen von
einer kanonischen Form ausgegangen wird.
Dennoch wird dabei das Problem der pro-
positionalen Einstellungen wohl nur auf eine
neue Ebene verlagert. Denn nimmt man ei-
nerseits an, die propositio mentalis sei die
kanonische Reprsentation einer Satzbedeu-
tung bzw. Proposition; jede mentale Form
habe genau einen Inhalt, und jeder Inhalt
habe wenn berhaupt eine genau eine
mentale Form. Dann lt sich hinsichtlich der
propositionalen Einstellungen mit mentalen
Reprsentationen nicht mehr und nicht we-
niger anfangen als mit den von ihnen repr-
sentierten Propositionen. Das Problem, da
man von zwei Stzen gleicher Bedeutung
einen glauben kann und den anderen nicht,
wird abgelst durch das Problem, da man
von zwei Stzen mit identischer mentaler Re-
prsentation den einen glauben kann und den
anderen nicht. Die mentale Reprsentation
wre insofern nicht essentiell, als sie nichts
beitrgt, was die Bedeutung allein nicht schon
eingebracht hat. Oder anders herum: wem die
Entitten der Semantik suspekt sind, dem m-
gen Reprsentationen weniger suspekt sein,
er hat aber strukturell dasselbe Problem, auch
34. Verben der propositionalen Einstellung 717
der Reprsentation einen anderen Inhalt un-
terschiebt. Insofern kann sich die Art des
Gegebenseins der Bedeutungen nicht auf die
Form der Reprsentation beziehen, sondern
mu hnlich der Form ein strukturiertes Ob-
jekt sein, das jedoch andererseits nicht ein
Reprsentationsobjekt, sondern ein Inhalts-
Objekt ist. Mit anderen Worten: nicht nur
Formen, auch Bedeutungen knnen mehr
oder weniger komplex sein.
6. Strukturierte Bedeutungen
An einem Rechenexempel erlutert Cresswell
(1985b) seine Haltung zu den eben beschrie-
benen Anstzen, die entweder versuchen, Be-
deutungen feiner zu differenzieren, oder aber
andere Parameter fr das Kompositionalitts-
prinzip fordern (Bercksichtigung der ue-
ren Form). Wer die Operation der Addition
mit zwei Zahlen durchfhrt, der kann zu
einem falschen Ergebnis kommen. Das Er-
gebnis wird aber nicht deswegen falsch, weil
ihm eine besondere Reprsentation der Zah-
len zugundeliegt (also z. B. V und III statt
5 und 3). Es liegt auch nicht daran, da
den Zahlen eine andere Bedeutung gegeben
wird als die, die sie tatschlich haben. Es liegt
einfach in der Natur einer kompositionellen
Theorie, da man bei der Komposition, beim
Ausrechnen, Fehler machen bzw. zu keinem
Ergebnis gelangen kann. Wenn jemand also
glaubt, da 5 + 3 = 9, dann hat er einfach
die fehlerhafte Vorstellung, da die Operation
der Addition, angewandt auf die Zahlen 5
und 3, ihn zu der Zahl 9 fhren wrde. Er
hat also nicht einen widersprchlichen Glau-
ben ber die Zahl 8 (da sie nmlich mit 9
identisch sei), sondern einen Glauben ber
die Zahlen 3 und 5, sowie ber die Addition.
Das ist aber keine propositionale Einstellung,
sondern eine Einstellung zu mehreren Dingen:
zu der Additions-Operation, der Zahl 5 und
der Zahl 3. In die Einstellung geht also nicht
einfach das kompositionelle Resultat 8 ein,
sondern das Tripel der an der Rechenopera-
tion beteiligten Bestandteile: 5,3, +. D. h.
natrlich nicht die uere Form (das Zeichen
+ und die Ziffern), sondern die dadurch
reprsentierten Objekte, die Zahlen 3 und 5,
sowie die Additions-Operation. Eine ganz
hnliche Ansicht wurde schon von Russell
(1912) erwogen.
Mit dieser Auffassung von der Ursache des
Problems der Einstellungen ist eine Bedeu-
tungstheorie vertrglich, die unter dem Be-
griff des intensionalen Isomorphismus zu-
und sprachliche Form andererseits geklrt
werden kann oder sogar mu.
Als Konsequenz daraus, da die Reprsen-
tation des Einstellungsobjekts in der Zu-
schreibung einer Einstellung eben die Repr-
sentation R dessen ist, der die Einstellung
zuschreibt, und nicht die Reprsentation R
dessen, der die Einstellung hat, knnte man
den Ansatz von Davidson (1969) betrachten,
der wieder zur ffentlichen uerung als Ob-
jekt zurckkehrt, aber gleichzeitig vermeidet,
das Einstellungsobjekt mit dieser uerung
zu identifizieren. Sein Ansatz ist also nicht
einfach eine Fortentwicklung der Reprsen-
tations-Anstze, sondern eigentlich eine Ab-
kehr von ihnen. Davidson (1969) wrde eine
uerung (21a) von mir als Folge separater
uerungen (21b,c) analysieren:
(21)
a. Galileo said that the earth moves.
b. The earth moves.
c. There is an utterance x by Galileo,
such that x and my last utterance
make us samesayers.
Es wird also zwischen der uerung (21b)
von mir und einer uerung von Galilei
wie immer deren uere Form auch gewesen
sein mag die Relation des samesaying po-
stuliert. Diese Relation ist aber eine Bedeu-
tungsrelation, nur da die Reifizierung der
Bedeutung vermieden wird. Sie ist aber auch
eine primitive Relation, so da nicht explizit
wird, wann zwei uerungen in dieser Rela-
tion stehen besteht die Relation zwischen
(16a) und (16b) oder nicht? Wenn p und
p samesayings sind, dann gibt es auch
das Problem der propositionalen Einstellun-
gen, wenn sie es nicht sind, gibt es ein Problem
mit der Bedeutung der Negation das wurde
im Abschnitt ber Bedeutungsdifferenzierung
besprochen. Allerdings trifft diese Kritik wohl
nur dann, wenn man erwartet, da samesay-
ing, da es eine Bedeutungsrelation ist, zu-
mindest teilweise explizierbar sein sollte. Und
wenn schlielich dieses Explikationsmuster
auch auf andere Einstellungen bertragen
werden soll, wie z. B. glauben, dann kann
man nur vermuten, welche Gegenstnde
durch die Variable x in Davidsons Analyse
vertreten werden interne mentale Repr-
sentationen?
Insgesamt sind Reprsentationen interner
oder externer Art deswegen problematische
Einstellungsobjekte, weil sie als Reprsenta-
tionen ihren Inhalt eben nur konventionell,
nicht aber notwendigerweise reprsentieren.
Die Einstellung ndert sich aber, wenn man
718 IX. Verbalsemantik
1b) Der Vorteil strukturierter Bedeutungen
ist, da sie mit den ohnehin vorhandenen
Mitteln der Bedeutungstheorie auskom-
men. Dafr wird aber das einheitliche
Bedeutungsobjekt Proposition als Ein-
stellungsobjekt aufgegeben zugunsten
einer Vielfalt von Strukturen. Das schafft
zunchst einmal das technische Problem
der Behandlung der Typenvielfalt.
2a) Strukturierte Bedeutungen unterscheiden
zwischen Ausdrcken wie 6x6 = 36 und
36 = 36, so da z. B. (14a,c) durchaus
verschiedene Glaubensinhalte haben.
Aber es bleibt das Restproblem, da
quivalente Stze gleicher Struktur, die
sich nur an einer Stelle durch Verschie-
denheit der lexikalischen Fllung unter-
scheiden, nicht differenziert werden, so-
fern man nicht auch lexikalische Dekom-
position annimmt. Denn da /Danzig/ =
/Gdansk/ ist, haben (17a,b) auch dieselbe
strukturierte Bedeutung.
2b) Und es taucht das Problem auf, da bei
Iteration der Einstellungsverben inner-
halb eines Satzes das erste Verb ein Funk-
tor sein knnte, der eine Struktur zum
Argument hat, deren einer Bestandteil
eben wieder das Einstellungsverb ist, also
Funktor und Argument zugleich.
Strukturierte Bedeutungen im Sinne von Le-
wis (1970) mssen also an die obigen Pro-
bleme adaptiert werden, um zu einer Lsung
des Einstellungsproblems zu gelangen. Aber
es lohnt sich an dieser Stelle auch, noch ein-
mal ber die Motivation nachzudenken; zu
zeigen, da diese Lsung nicht als rein tech-
nisch abgetan werden kann.
7. Einstellungen als Eigenschafts-
zuschreibung: Glauben de se
Die Einfhrung von Propositionen als Glau-
bensobjekte fhrt in ein Dilemma. Dennoch
zgerte man, davon abzukommen, weil sie
eine verfhrerisch einfache Mglichkeit der
semantischen Analyse von Einstellungen bie-
ten. Diese Analyse beruht auf der von Hin-
tikka (1962) eingefhrten Relation der doxa-
stischen Alternativen: w R
a
w wenn das, was
a in w glaubt, nicht ausschliet, da er sich
in einer Welt von der Art w zu befinden
glaubt. Glaubt a eine Proposition, so heit
das, da sie in allen seinen doxastischen Al-
ternativen wahr ist. Oder: die Menge der Wel-
nchst von Carnap (1947) und dann von Le-
wis (1970) als structured meanings entwickelt
wurde. Die Satzbedeutung ist nicht mit der
Satzintension zu identifizieren, sondern be-
steht essentiell aus den Bedeutungen der Teile
des Satzes, also den Intensionen der Bestand-
teile, aus denen durch funktionale Komposi-
tion die Satzintension errechnet wird. 5 +
3 ist eben nicht dasselbe wie 8. Um zu
einem Resultat zu kommen, bedarf es kal-
kulatorischer Fhigkeiten, die man haben
kann oder auch nicht, so da die Mglichkeit
des Irrtums immer gegeben ist. Sei nun /a/
der semantische Wert eines Ausdrucks a, also
eine Intension, so ergibt sich aus der syntak-
tischen Struktur (22b) des Satzes (22a) seine
strukturierte Bedeutung (22c):
Das, wofr Einstellungskontexte ber die
Satzintension (= Proposition) hinaus sensibel
sind, knnte also die sich an der ueren
Form orientierende intensionale Struktur
eines Satzes sein, die sog. strukturierte Pro-
position. Cresswell (1985b) unterscheidet hier
zwischen der Referenz (mit dem Ergebnis der
Funktionalapplikation) und dem Sinn (der
Bedeutungsstruktur).
Will man das Problem der Einstellungen
auf der Grundlage strukturierter Bedeutun-
gen einer Lsung zufhren, so ergeben sich
vor allem zwei Problemkreise, wovon der er-
ste die eher rein technischen Adaptationspro-
bleme umfat, der zweite aber grundstzlicher
Natur ist:
1a) Strukturierte Bedeutungen folgen skla-
visch der Hierarchie der syntaktischen
Analyse. Damit kann ein Satz zunchst
nur jeweils ein Glaubensobjekt ausdrk-
ken. Die strukturierten Bedeutungen soll-
ten hier in zweierlei Hinsicht flexibel sein:
erstens folgt aus der Sensibilitt der Ein-
stellungskontexte fr die Bedeutungs-
struktur nicht unbedingt Sensibilitt fr
alle Details dieser Struktur, und zweitens
sollte sich, wo einer syntaktischen Struk-
tur mehr als eine logische Form ent-
spricht, dies auch in der strukturierten
Bedeutung niederschlagen.
34. Verben der propositionalen Einstellung 719
Ralph schreibt also in (23c) die Eigenschaft,
Spion zu sein, der res Ortcutt zu.
Nun ist Quines Geschichte die: bei zwei
verschiedenen Gelegenheiten sieht Ralph ein-
mal einen Mann im braunen Mantel, dann
einen Mann im grauen Mantel. Es ist jedoch
immer, und das entgeht Ralph, derselbe
Mann: Bernhard J. Ortcutt. Ralph glaubt je-
doch, da der eine von ihm gesehene Mann
ein Spion ist, der andere nicht. Unsere bis-
herigen Rekonstruktionsversuche machen
nun aus Ralph ein irrationales Wesen: er
glaubt von Ortcutt, da er ein Spion ist und
da er kein Spion ist. Nach der Hintikka-
Theorie glaubt Ralph nmlich zwei inkom-
patible Propositionen. Und wegen der Abge-
schlossenheit der Glaubensinhalte gegenber
der Folgerungsbeziehung in dieser Theorie
glaubt er damit einfach alles. Aber auch
nach der Eigenschafts-Zuschreibungs-Theo-
rie schreibt er einem Gegenstand zwei inkom-
patible Eigenschaften zu. Prima facie ist also
die eine Theorie so schlecht wie die andere.
Aber die Aufspaltung in einen Gegenstand
und eine Eigenschaft bietet den folgenden
Ausweg: Ralph glaubt in unserem Beispiel
sicher zwei miteinander durchaus vertrgliche
Dinge, aber er ist sich des Gegenstandes, dem
er jeweils die Eigenschaft zuschreibt, nicht
bewut. Der Gegenstand ist ihm unter ver-
schiedenen kognitiven Eigenschaften gege-
ben, die wir genau genommen nicht kennen.
Wir haben nicht seine Perspektive, so da wir
im Prinzip gar nicht in der Lage sind, seinen
Glaubensinhalt przise zu beschreiben. Sein
Glaube knnte sich nicht widersprchlich
zum Beispiel als (24a,b) reprsentieren.
(24)
a. Der Mann im braunen Mantel ist ein
Spion.
b. Der Mann im grauen Mantel ist kein
Spion.
Das Problem ist, wie dies aus unseren Glau-
benszuschreibungen (25a,b) zu gewinnen ist:
(25)
a. Ralph glaubt, da Ortcutt ein Spion
ist.
b. Ralph glaubt, da Ortcutt kein Spion
ist.
Fr eine de re-Analyse mu man dazu eine
geeignete Eigenschaft (vgl. Lewis 1979b)
einfhren, durch die Ralph in kognitivem Kon-
takt mit genau und nur der involvierten res
steht, so da man zu (26a,b) kommt:
(26)
a. Es gibt eine Relation
1
, durch die
Ralph in kognitivem Kontakt mit
Ortcutt und nur mit ihm steht, und
ten, die as doxastische Alternativen sind, ist
in der Menge der Welten, die die Proposition
ausmachen, enthalten. Wenn aber nun bei
intensionsgleichen Stzen einer geglaubt wird
und der andere nicht, dann heit das, da die
doxastischen Alternativen gleichzeitig Teil-
menge und nicht Teilmenge ein und derselben
Proposition sein mten.
In Lewis (1979b) wird nun gezeigt, da
Einstellungen nicht ausschlielich propositio-
nal (de dicto) sein knnen:
Consider the case of the two gods. They inhabit
a certain possible world, and they know exactly
which world it is. Therefore they know every pro-
position that is true at their world. In so far as
knowledge is a propositional attitude, they are om-
niscient. Still I can imagine them to suffer igno-
rance: neither one knows which of the two he is.
They are not exactly alike. One lives on top of the
tallest mountain and throws down manna, the
other lives on top of the coldest mountain and
throws down thunderbolts. Neither one knows
whether he lives on the tallest mountain or on the
coldest mountain; nor whether he throws manna
or thunderbolts.
...
If the gods came to know which was which, they
would know more than they do. But they wouldnt
know more propositions. There are no more to
know. Rather, they would self-ascribe more of the
properties they possess.
Die Zuschreibung von Eigenschaften verlangt
zwei Dinge: eine Eigenschaft und ein Objekt,
dem sie zugeschrieben wird. Und dies eben
sind wiederum die Dinge, die in der struktu-
rierten Proposition explizit gemacht werden.
Selbst-Zuschreibung ist sicher ein Spezialfall.
Man kann auch anderen Gegenstnden Ei-
genschaften zuschreiben. Das wre dann der
Glauben de re. Die Verbindung einer de re-
Analyse mit den strukturierten Propositionen
wird in von Stechow & Cresswell (1982) und
Cresswell (1985b) ausgearbeitet.
8. Glauben de re
Die Unterscheidung von Glauben de dicto
wie in (23a) und de re (23b) wird in Quine
(1956) diskutiert.
(23)
a. Ralph glaubt, da x (x ist ein Spion).
b. x (Ralph glaubt, da x ein Spion
ist).
Quines Abneigung gegen das Hineinquanti-
fizieren in opake Kontexte fhrt ihn aber
zu Analysen wie (23c) anstelle von (23b):
(23)
c. Ralph glaubt x (x ist ein Spion) von
Ortcutt.
720 IX. Verbalsemantik
(27)
a. Ede glaubt, da Jrgen sich selbst
berlistet hat.
b. Ede glaubt, da Jrgen Jrgen ber-
listet hat.
c. Es gibt eine Eigenschaft
1
, durch die
Ede in kognitivem Kontakt mit der
Proposition Jrgen hat Jrgen ber-
listet steht, und Ede glaubt, da,
welche Proposition auch immer von
1
spezifiziert wird, diese Proposition
wahr ist.
Dies wre die einzige Lesart, da Jrgen ber-
listet sich selbst genau dieselbe Proposition
bezeichnet. Dagegen ist die Eigenschaft, sich
selbst zu berlisten, eine ganz andere Eigen-
schaft als die, Jrgen zu berlisten: die beiden
Stze bezeichnen verschiedene Glaubensge-
genstnde.
9. Technisches: Die Adaptation der
strukturierten Bedeutungen
Sei 0 die Kategorie der Propositionen und 1
die Kategorie der Namen. Dann ergibt sich
aus (28a,b), da Einstellungsverben einer
Funktorkategorie 0/1,1 angehren, die aus
zwei Namen einem fr das Einstellungs-
subjekt und einem fr das Einstellungsobjekt
wiederum eine Proposition machen.
(28)
a. Brigitte glaubt etwas.
b. Brigitte sagt etwas.
c. Brigitte glaubt, da p v p eine Tau-
tologie ist.
d. Brigitte sagt, da p v p eine Tau-
tologie ist.
Das lt den Komplementierer da in (28c,d)
als einen Funktor erscheinen, der aus dem
eingebetteten Satz einen Namen erzeugt (ei-
gentlich eine Nominalphrase, aber das sei hier
bergangen). Im einfachsten Fall wre der
Komplementierer also in der Funktorkate-
gorie 1/0 anzusiedeln, mit der recht simplen
semantischen Interpretation als Identitts-
funktion aber genau das erzeugt ja das
Problem der propositionalen Einstellungen,
denn wenn zwei Stze dieselbe Proposition
ausdrcken, sind sie an der Argumentstelle
nicht zu unterscheiden.
Das Einstellungsverb mu also nicht nur
Propositionen, sondern auch komplexe struk-
turierte Bedeutungen als Argumente akzep-
tieren knnen. Daher mu der Komplemen-
tierer ein Funktor sein, der ber Teilen des
Komplementsatzes operiert und eine struk-
turierte Bedeutung als Wert hat. In den bis-
Ralph schreibt sich die Eigenschaft
zu, die Relation
1
einzig zu einem
Objekt zu haben, das ein Spion ist.
b. Es gibt eine Relation
2
, durch die
Ralph in kognitivem Kontakt mit
Ortcutt und nur mit ihm steht, und
Ralph schreibt sich die Eigenschaft
zu, die Relation
2
einzig zu einem
Objekt zu haben, das kein Spion ist.
In jeder von Ralphs doxastischen Alternativ-
welten gibt es also einen Gegenstand, der
1
erfllt und ein Spion ist, und einen Gegen-
stand, der
2
erfllt und kein Spion ist. In der
aktualen Welt allerdings ist der Gegenstand,
der
1
erfllt, identisch mit dem, der
2
erfllt.
Die Parallelen dieser de re-Lsung zu den
zu Anfang besprochenen Versuchen von Stal-
naker sind offensichtlich, und wie bei Stal-
naker gibt es eine Schwierigkeit mit mathe-
matischen Beispielen: 59 ist eine Primzahl,
was man nicht glauben mu. Glaubt man
aber, da 59 = 59, in dem Sinne, da man von
59 glaubt (res), da es die Eigenschaft hat,
59 zu sein, dann gibt es eine geeignete Eigen-
schaft , die in dieser Welt nur und genau von
59 instantiiert wird, und die in allen Glau-
benswelten ein Objekt herauspickt, das die
Eigenschaft hat, 59 zu sein. Alle Objekte, die
sind, sind dann aber auch Primzahlen, so
da man doch von 59 glauben mu, es sei
eine Primzahl.
Cresswell & v. Stechow (1982) lsen dieses
Problem dadurch, da sie auch das Prdikat
de re auffassen: der kognitive Kontakt zur res
59 wird ber eine Eigenschaft
1
hergestellt,
der zur Eigenschaft, 59 zu sein, ber eine
Eigenschaft von Eigenschaften
2
. In allen
doxastischen Alternativwelten gilt dann, da
die res, die
1
erfllt, die Eigenschaft hat, die
2
erfllt. Hingegen mu es kein
3
geben, das
den kognitiven Kontakt zur Eigenschaft, eine
Primzahl zu sein, herstellt und in allen Glau-
benswelten durch eine Eigenschaft instantiiert
wird, die auf die res zutrifft, die jeweils von
1
spezifiziert wird.
Der Unterschied zwischen einem proposi-
tionalen Ansatz, wie ihn Stalnaker vertritt,
und einem Eigenschafts-ZuschreibungsAn-
satz, wie ihn Cresswell und v. Stechow vertre-
ten, lt sich nun leicht zeigen. In der de re-
Analyse ist die res durch beliebige logisch
quivalente Ausdrcke benennbar, sie ist
transparent. Wre die res eine Proposition, so
wrden (27a,b) zu (27c) zusammenfallen,
obwohl (27a,b) durchaus unterschiedliche
Wahrheitswerte haben knnen. (Die hervor-
gehobene Position sei de re verstanden.)
34. Verben der propositionalen Einstellung 721
Ausdrcken operiert, den Ausdrcken der
Kategorien
i
und 0/
1
, ...,
n
, die fr sich
genommen einen Satz formen knnten. Das
Resultat der Applikation eines Komplemen-
tierers auf eine kategorial passende Sequenz
von Ausdrcken ist dann der Name einer
Sequenz, die aus den Bedeutungen der ein-
zelnen Teile besteht. Wenn also
1
, ...,
n
syntaktische Kategorien sind und a
1
, ..., a
n
Elemente der korrespondierenden Denotats-
bereiche D
1
, ... , D
n
, sowie weiterhin ein
Element des Denotatsbereichs D
0/1, ..., n
,
dann ist das Resultat der Anwendung von
THAT
1/0/1, ..., n,1, ..., n
auf (, a
1
, ..., a
n
)
gleich , a
1
, ..., a
n
. Der aus der Anwendung
des Operators resultierende Name ist also
nicht der Name eines einfachen Bedeu-
tungsobjekts, sondern der Name eines n-Tu-
pels solcher Objekte.
10. Iterierte Einstellungen
Die Ambiguitt des Komplementierers er-
laubt es nun, der Einbettung eines Satzes wie
(22a) verschiedene logische Strukturen zuzu-
schreiben, je nach Typ des verwendeten Kom-
plementierers, vgl. (31a-c)
(31)
a. da
1,0
(Arnim kommt nicht)
b. da
1,(0,0),0
(Nicht) (Arnim kommt)
c. da
1,(0,0),1,(0,1)
(Nicht) (Arnim)
(kommt)
In (31a) ist die Intension des da-Komple-
mentes identisch mit der Intension des ein-
gebetteten Satzes, d. h. da
1,0
ist semantisch
gesehen einfach die Identittsfunktion. In die-
sem Fall ergeben sich keine Iterationspro-
bleme, denn in (32) operiert der durch das
Einstellungsverb reprsentierte Funktor je-
weils auf Objekten derselben Art, der Inten-
sion eines Namens und eines Satzes.
(32) Ede glaubt, da
1,0
(Wolfgang glaubt,
da
1,0
(Arnim nicht kommt)).
Problematisch wird es, wenn der Komple-
mentierer struktursensitiv ist und ein Einstel-
lungsverb iteriert wird, wie in (33)
(33) Ede glaubt, da
1,(0,1)1,1
(glaubt) (Wolf-
gang) (da
1,0
(Arnim nicht kommt)).
Die Intension des ersten da-Komplementes
ist jetzt eine Struktur aus den folgenden In-
tensionen:
I(glauben), I(Wolfgang), I(Arnim kommt
nicht)
Damit wre aber die Intension I(glauben) des
ueren Einstellungsverbs eine Funktion, die
herigen de re-Beispielen wren die Argumente
des Komplementierers z. B. ein Individuum
und ein einstelliges Prdikat, d. h. da gehrt
dabei in die Funktorkategorie 1/0,1,1,
die einen Namen fr eine Sequenz aus einem
Namen und einer Eigenschaft erzeugt. Das
macht den Komplementierer zu einem syste-
matisch mehrdeutigen Funktor, der ber Tei-
len operiert, die zu einem Satz zusammenge-
fgt werden knnen. Allgemein gesagt gibt es
eine Familie von Komplementierern, deren
Kategorienzugehrigkeit fr syntaktische Ka-
tegorien
1
...
n
als (29) festgehalten werden
kann, fr n 0.
(29) 1/0/
1
,...,
n
,
1
,....,
n
Jetzt ist freilich der vom Komplementierer
eingebettete Satz nur noch fr n = 0 eine Kon-
stituente, nicht im allgemeinen Fall. Und die
systematische Ambiguitt des Komplementie-
rers lt zu, da manchmal (n = 0) die Struk-
tur keine Rolle spielt, da ein andermal jedes
einzelne Wort eines Satzes in die Struktur
eingeht, da aber auch eine zwischen diesen
beiden Mglichkeiten liegende Strukturebene
gewhlt werden kann. Dieses Auseinander-
klaffen von syntaktischer und logischer Form
vertrgt sich mit der Autonomiehypothese,
nach der die syntaktische Form die logische
Form unterdeterminiert und daher zu Am-
biguitten fhrt. Gegenber den stur an der
syntaktischen Form ausgerichteten struktu-
rierten Bedeutungen von Lewis (1970) ist
diese Adaptation von Cresswell/v. Stechow
(1982) und Cresswell (1985b) also flexibler.
Sie trgt der Tatsache Rechnung, da ein Satz
verschieden strukturiert werden kann, je
nachdem, welche Frage er beantwortet bzw.
was sein Thema ist, vgl. (30ad).
(30)
a. Wer hat den Pudding gegessen?
b. Was hat Ede gegessen?
c. Was war mit Ede und dem Pudding?
d. Ede hat den Pudding gegessen.
Als Antwort auf (30a) behaupte ich mit (30d)
von Ede, da er den Pudding gegessen hat;
die Antwort auf (30b) ist die Behauptung ber
den Pudding, da Ede ihn gegessen hat; und
(30c) wird dadurch beantwortet, da man von
der Relation des Essens behauptet, sie bestehe
zwischen Ede und dem Pudding. Alle Ant-
worten knnen aber dieselbe syntaktische
Form (30d) haben (in der allerdings verschie-
dene Intonationsmuster nicht reprsentiert
sind).
Semantisch gesehen ist die Idee die, da
die aus dem kategorialen Schema 1/0/
1
...
n
,
1
, ...,
n
entstehende Familie von
Komplementierern auf einer Sequenz von
722 IX. Verbalsemantik
deutungen in diesem Bereich weist in aller
Schrfe Thomason (1977, 1980b) hin. Er weist
nach, da unter gewissen Bedingungen Pr-
dikate wie ist wahr oder a wei, da nicht
ber allen Bedeutungen operieren knnen,
ohne zur Inkonsistenz zu fhren. Aber dieses
Problem stellt sich wohl jeder Semantik, die
mit Sprachen konfrontiert ist, in denen man
Dinge wie (35) sagen kann:
(35) Rainer glaubt, da alles, was er glaubt,
falsch ist.
11. Literatur (in Kurzform)
Armstrong 1973 Blau 1969 Carnap 1947
Church 1950 Cresswell 1975 Cresswell 1980
Cresswell 1982 Cresswell 1983 Cresswell 1985b
Cresswell/von Stechow 1982 Davidson 1969 Fo-
dor 1975 Fodor 1978a Hintikka 1962 Hintikka
1975 Lewis 1970 Lewis 1979b Partee 1973c
Partee 1979b Quine, van Orman 1956 Russell
1912 Stalnaker 1976b Stalnaker 1978 Stalnaker
1987 von Stechow 1984c Thomason 1977 Tho-
mason 1980a Thomason 1980b
Rainer Buerle, Stuttgart
(Bundesrepublik Deutschland)
als Argument eine Struktur htte, in der
I(glauben) selbst wieder als Argument vor-
kommt. Und eine solche Mglichkeit mu
natrlich ausgeschlossen werden.
Die erste Mglichkeit ist, den Satz (33) nur
in seinen harmlosen Lesarten zu akzeptieren.
Also in der Lesart (32) oder auch (34).
(34) Ede glaubt, da
1,(0,1),1
(glaubt, da
1,0
(Arnim nicht kommt)) (Wolfgang)
Die Mglichkeit, unterschiedlich viel von der
Struktur zu akzeptieren, kann also die
Schwierigkeit, die sich bei Lewis-Bedeutungen
in voller Schrfe stellen wrde, etwas umge-
hen.
Will man aber auf (33) als einer mglichen
Lesart beharren, so mu eine Hierarchie von
Einstellungsoperatoren angenommen werden.
Ein Operator erster Stufe, der auf Strukturen
angewandt wird, in denen er selbst nicht vor-
kommt, ein Operator zweiter Stufe, der auf
Strukturen angewandt wird, in denen der erst-
stufige Operator vorkommt, usw. ad infini-
tum. Eine solche Hierarchie wird in Cresswell
(1982) exploriert und bringt gewisse Schwie-
rigkeiten der Quantifikation mit sich.
Auf die Probleme der strukturierten Be-
35. Tempus
kurs
5.4 Tempora in komplexen Stzen
5.5 Abschlieendes
6. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitendes
Tempus lt sich zunchst mit Comrie
(1985: 9) als grammaticalized expression of
location in time definieren, d. h. als eine
im allgemeinen verbale grammatische Ka-
tegorie, die dazu dient, den im (tempuslosen
Rest-)Satz bezeichneten Zustand oder Vor-
gang (nach Comrie: die im Restsatz bezeich-
nete Situation) zeitlich zu lokalisieren. An-
ders gesagt: Das Tempus des Satzes (Verbs)
hilft eventuell zusammen mit anderen Mit-
teln (s. unten) eine Zeit einzugrenzen oder
festzulegen, zu der die im Restsatz ausge-
drckte Proposition wahr sein mu (eine Zeit,
die ein Wahrheitsintervall der Proposition dar-
stellt), um den tempushaltigen Satz als ue-
rung, relativ zu dem Kontext, in dem er ver-
wendet wird, wahr zu machen. Stellen wir uns
1. Einleitendes
2. Tempussysteme im traditionellen Sinne
2.1 Finite und infinite Verbformen
2.2 Einfache und zusammengesetzte Tempusfor-
men
2.3 Erweiterte Tempussysteme
3. Formal definierte vs. semantische Tempora
3.1 Temporalitt vs. Aspekt/Aktionsart und Mo-
dalitt
3.2 Relationen zwischen semantischen und for-
malen Tempora
3.3 Kompositionelle Analyse zusammengesetzter
Tempora
4. Stationen der Tempussemantik
4.1 Die klassische grammatische Tradition
4.2 Auereinzelsprachliche Zeitsysteme
4.3 Einflu der Zeitlogik
4.4 Thesen und Themen der heutigen linguisti-
schen Tempussemantik
5. Konkretisierung: Tempora in verschiedenen
Kontexttypen
5.1 Tempora in einfachen Stzen
5.2 Einfache Stze mit Referenzzeitadverbial
5.3 Einfache Stze im temporal verbundenen Dis-
35. Tempus 723
heit nicht aufweist.) Eine systematische
Behandlung von Temporaladverbialen oder
temporalen Nebenstzen kommt deshalb hier
nicht in Frage. Andererseits kann eine se-
mantische Tempusbeschreibung das Problem
des Zusammenspiels von Tempora und an-
deren nicht grammatikalisierten Aus-
drcken zeitlicher Lokalisierung nicht gnz-
lich ausklammern.
2. Tempussysteme im traditionellen
Sinne
2.1Finite und infinite Verbformen
Wie erwhnt ist Tempus normalerweise eine
grammatische Kategorie des Verbs, wie etwa
in den indoeuropischen und finno-ugrischen
Sprachen; und ich werde mich hier auf solche
Sprachen beschrnken. Verbale Wortformen,
die nach Tempus (und evtl. Modus) sowie
nach Person und Numerus flektiert sind, wer-
den traditionell finit genannt; Beispiele bilden
Prsens- und Prteritumformen im Dt., Engl.
und in den skandinavischen Sprachen (vgl.
ich liebe/liebte, engl. I love/loved, dn. jeg els-
ker/elskede), prsent, imparfait, pass simple,
futur simple und futur du pass im Franz.
(jaime/ jaimais/ jaimai/ jaimerai/ jaime-
rais), Prsens, Imperfektum, Futurum, Per-
fektum, Plusquamperfektum und Futurum
exactum im Latein (amo/ amabam/ amabo/
amavi/ amaveram/ amavero).
Den finiten Verbformen stehen infinite
Infinitive und Partizipien unterschiedlicher
Art gegenber, die nicht satzkonstituierend
sind im oben erwhnten Sinne und im allge-
meinen auch kaum als eigene Tempusformen
bezeichnet werden. Whrend finite Verbfor-
men oft wie im Beispiel (1) oben das
Geschehen direkt auf die Zeit der uerung
beziehen, d. h. deiktischen oder, wie es tra-
ditionell hie, absoluten Zeitbezug ausdrk-
ken, erfolgt ein solcher Zeitbezug bei den
infiniten Verbformen nur noch indirekt, ber
eine oder im Zusammenspiel mit einer fi-
nite(n) Verbform, wie u. a. in den sog. pe-
riphrastischen Tempusformen (s. 2.2). (Ich
sehe hier und im folgenden vom adjektivi-
schen attributiven Gebrauch der Par-
tizipien ab.) Das heit, infinite Verbformen
haben (wenn berhaupt) in erster Linie rela-
tiven Zeitbezug; sie leisten einen Zeitbezug
relativ zu anderen Elementen innerhalb des-
selben Satzes; vgl. dazu die lateinischen Stze
in (3), die jeweils einen (hervorgehobenen)
Infinitiv Prsens und Infinitiv Perfekt enthal-
beispielsweise vor, da (1)(2) von N. N. zur
Zeit t ohne einen weiteren relevanten sprach-
lichen Kontext geuert werden.
(1) Ich bin oft in Italien.
(2) Ich bin nie in Italien gewesen.
Dann wird mit dem Prsens in (1) ausge-
drckt, da es eine t umgebende Zeitspanne
gibt, fr die die Proposition N. N. oft in
Italien sein zutrifft (die also ein Wahrheits-
intervall derselben ausmacht). Um den Wahr-
heitswert von (1)-im-Kontext, d. h. von (1) als
uerung von N. N. zur Zeit t zu berprfen,
mu man mithin eine passend groe Umge-
bung von t im Hinblick darauf untersuchen,
ob sie die fr ein Wahrheitsintervall der Pro-
position N. N. oft in Italien sein geltenden
Bedingungen erfllt ob es also innerhalb
dieser Zeitspanne relativ viele disjunkte Zeit-
spannen gibt, die N. N. in Italien verbringt.
Und fr (2) legt das Perfekt fest, da die der
uerungszeit t vorausliegende Zeitspanne
ein Wahrheitsintervall der Proposition N. N.
nie in Italien sein darstellt. Das heit, (2) ist
als uerung von N. N. zur Zeit t dann und
nur dann wahr, wenn es vor t keine Zeit mit
der Eigenschaft gibt (gab), da N. N. sie in
Italien verbringt (verbrachte). Insofern die
Lokalisierung (direkt oder indirekt) relativ
zur uerungssituation(-zeit) erfolgt, ist Tem-
pus seiner semantischen Natur nach eine deik-
tische Kategorie; vgl. Lyons (1977: 636), Com-
rie (1985: 13 ff.)
Es gibt andere sprachliche Mittel zur
zeitlichen Lokalisierung von Situationen/
Sachverhalten/Geschehen: Temporaladver-
bien bzw. -adverbiale wie gestern, bald, letztes
Jahr sowie Zeitrelationen ausdrckende Pr-
positionen wie vor, nach, in und sog. Kon-
junktionen wie bevor, nachdem, als, whrend,
mit denen adverbiale Prpositionalphrasen
bzw. Nebenstze gebildet werden. Solche
Ausdrcke verdienen jedoch im Deutschen
und in verwandten Sprachen nicht die Be-
zeichnung grammatical expressions von
Temporalitt. Die betreffenden Zeitbezge
werden nicht mit typisch grammatischen
Mitteln, sondern im wesentlichen lexikalisch
ausgedrckt; und das Vorhandensein eines
Temporaladverbials ist im Unterschied zu
dem eines Tempus nicht konstituierend fr
das, was man einen typischen Satz der be-
treffenden Sprachen nennen kann. (Siehe
Comrie 1985: 11 f. fr Sprachen, in denen die
Tempuskategorie entweder das eine oder das
andere dieser beiden Charakteristika mor-
phosyntaktische Regelmigkeit und Obligat-
724 IX. Verbalsemantik
aus regierendem und infinitem regiertem Verb
dementsprechend unterschiedliche Grade der
Grammatikalisierung aufweisen. Hinzu
kommt die etwas problematische Unterschei-
dung modaler und zukunftsbezogener tem-
poraler Hilfsverben (s. Abschnitt 3.1).
Aus diesen Grnden knnen erweiterte
Tempussysteme in den einzelnen Sprachen je
nach Gesichtspunkt unterschiedlich weit ge-
fat werden. So kommt man fr das Dt. auf
ein vier- oder sechsgliedriges erweitertes (in-
dikativisches) Tempussystem, je nachdem, ob
man nur noch das Prsens, Prteritum, Per-
fekt und Plusquamperfekt als eigentliche
Tempora einstuft oder auch sog. Futur I und
Futur II (ich werde lieben/ werde geliebt
haben) dazurechnet; und achtgliedrig wird das
System, wenn entsprechende Umschreibun-
gen mit wrde (sog. Konditional I und II) in
gewissen Verwendungen als indikativische
Tempusformen (Fut. prteriti I und II) auf-
zufassen sind. hnliche Abgrenzungspro-
bleme begegnen bei der Etablierung erweiter-
ter Tempussysteme in anderen Sprachen. Fr
das Franz. lt sich etwa neben den klassi-
schen zusammengesetzten Tempusformen
mit avoir und tre eine Reihe temporaler Pe-
riphrasen mit Halbauxiliaren vgl. aller +
Infinitiv als unmittelbares Futur (elle va
mourir sie wird sterben), venir de + Infinitiv
zum Ausdruck der unmittelbaren Vergan-
genheit (je vient de mang ich habe soeben
gegessen) auflisten; im Dn./Norw. steht
die in (4) veranschaulichte Konstruktion mit
komme til + at/-Infinitiv als Futurumschrei-
bung den Konstruktionen mit Modalverb
(ville/skulle) zur Seite; usw.
(4) Det kommer til at gre ondt.
es kommt (da)zu zu tun weh (Es wird
wehtun.)
2.3Erweiterte Tempussysteme
Wie aus den Beispielen hervorgeht, besteht
eine zusammengesetzte Verbform aus (min-
destens) einem temporalen Hilfsverb und
einer infiniten Form des Vollverbs. Neben
Umschreibungen mit finitem Hilfsverb, wie
sie bisher besprochen wurden, sind nun auch
solche mit infinitem Hilfsverb (bzw. infiniten
Hilfsverben) zu verzeichnen. Ein Beispiel bil-
det der sog. Infinitiv II (Infinitiv Perfekt) im
Dt. und in anderen Sprachen, der semantisch
dem (synthetischen, einfachen) Infinitiv Per-
fekt im Lat. entspricht; vgl. (3) oben und (5).
(5)
a. N. N. glaubt/glaubte recht zu tun.
ten; hier wird ein Wahrheitsintervall der Pro-
position ich recht tun in erster Linie relativ
zu einem Wahrheitsintervall der bergeord-
neten Proposition ich finden, da ... loka-
lisiert, und zwar als (teilweise) zusammenfal-
lend bzw. vorausliegend im Verhltnis zu die-
sem.
(3)
a. Puto/putavi me recte facere.
finde/fand-ich mich recht tun
(Ich finde/fand, da ich recht tue/tat.)
b. Puto/putavi me recte fecisse.
finde/fand-ich mich recht getan-
haben
(Ich finde/fand, da ich recht getan
habe/hatte.)
2.2Einfache und zusammengesetzte
Tempusformen
Infinite Verbformen knnen hnlich wie
Kasusformen von Verben regiert werden:
Sog. Modalverben regieren u. a. im Dt. und
Engl. den reinen Infinitiv, werden verbindet
sich in jeweils verschiedener Bedeutung (Pas-
siv und Futur) mit dem Part.Perf. und
dem reinen Infinitiv, usw. Fr viele Sprachen
lt sich nun eine ziemlich begrenzte
Anzahl infinitregierender Verben als sog. tem-
porale Hilfsverben identifizieren oder heraus-
sondern, die sich mit allen oder den meisten
anderen Verben sog. Vollverben verbin-
den, wobei die Kombination aus regierendem
(finitem) und regiertem infinitem Verb eine
finiten Formen des Vollverbs entsprechende
semantische Funktion der zeitlichen Lokali-
sierung zu haben scheint. Solche Kombinatio-
nen Ketten von Verbformen werden
deshalb oft als zusammengesetzte (periphra-
stische, umschriebene, komplexe, analytische)
Tempusformen der Vollverben mit den einfa-
chen finiten (synthetischen) Tempusformen in
ein sog. erweitertes Tempussystem eingeord-
net.
Zum traditionellen Kernbereich der zusam-
mengesetzten Tempora gehren das sog. Per-
fekt und Plusquamperfekt im Dt. (ich habe/
hatte geliebt) und deren Entsprechungen in
den anderen germanischen Sprachen (engl.
present perfect und past perfect I have/
had loved) und im Franz. (pass compos/
indfini, plus-que-parfait und pass anterieur
jai aim/ javait aim/ jeus aim). Eine
genaue Abgrenzung von temporalen Hilfsver-
ben und anderen Verben ist jedoch mit
Schwierigkeiten verbunden, da infinitregie-
rende Verben unterschiedliche Grade des se-
mantischen Eigenwerts und Kombinationen
35. Tempus 725
Kennzeichnend fr das Perfektsystem ist
die von haben/sein regierte Partizip-II-
(PartizipPerfekt-)Form des Vollverbs. Und
das Futursystem zeichnet sich schlielich
durch die finite Form des Hilfsverbs werden
und eine einfache oder umschriebene Infini-
tivform (Infinitiv I bzw. II) des Vollverbs aus.
Die traditionellen Bezeichnungen der ver-
schiedenen Formen sind im Schema hervor-
gehoben. Der zu-Infinitiv und das nur noch
attributiv vorkommende sog. Gerundiv (zu
+ Part.Prs.) wurden nicht bercksichtigt.
Sprachen und zwar auch verwandte
Sprachen variieren erheblich im Hinblick
auf die Zahl und Art ihrer Tempuskategorien
wie auch im Hinblick auf den Grad der Gram-
matikalisierung und Systematizitt zusam-
mengesetzter Tempusformen. So unterschei-
det sich das Englische vom Dt. und den an-
b. N. N. glaubt/glaubte recht getan zu
haben.
Das erweiterte Tempussystem des Dt. lt
sich demnach zunchst rein formal ana-
lysiert wie in Abb. 35.1 darstellen.
Das erweiterte Finitsystem umfat (ein-
fache und zusammengesetzte) Tempusformen
mit finitem (Voll- bzw. Hilfs-)Verb, whrend
Formen ohne Finitum das Infinitsystem
konstituieren. Prsens und Prteritum sind
insofern Grundtempora zu nennen, als jede
finite Verbform sich morphologisch als eine
Prsens- oder eine Prteritumform identifizie-
ren lt. Zum Prsenssystem gehren dem-
nach alle Tempusformen mit prsentischem
Finitum, whrend das einfache Prt. und die
zusammengesetzten Formen mit prteritalem
Hilfsverb ein Prteritumsystem bilden.
Abb. 35.1: Erweitertes Tempussystem des Deutschen
726 IX. Verbalsemantik
3.1Temporalitt vs. Aspekt/Aktionsart und
Modalitt
Ein guter Teil der traditionell als Tempora
bezeichneten Formkategorien sind z. B. nach
Comrie (1985: 6 f.) semantisch nicht als Tem-
pus-, sondern als Aspektkategorien einzustu-
fen, weil sie nicht in erster Linie der zeitlichen
Lokalisierung dienen, sondern sich auf the
internal temporal contour of a situation be-
ziehen. Es gibt in der Tat gute Grnde fr die
Ausklammerung des engl. progressive aus der
Tempussemantik; die Verlaufsformen des
engl. Finitsystems lassen sich nicht nur
morphologisch, sondern auch semantisch als
normale Tempusformen der infiniten (infi-
nitivischen) Verlaufsform be + V-ing (be slee-
ping) analysieren, wobei der Unterschied zwi-
schen dieser und dem einfachen Verb seiner-
seits als einer des Aspekts oder der Aktionsart
(s. zu diesen Begriffen Artikel 36) zu klassi-
fizieren wre; vgl. Quirk et al. (1985: 188 ff.).
Eine saubere Trennung von Aspekt/Aktions-
art und Tempus lt sich auch etwa fr das
Russ. durchfhren. In anderen Sprachen
z. B im Franz. und Altgr. sind aspektuelle
und rein zeitlokalisierende Bedeutungskom-
pomenten jedoch insofern miteinander ver-
quickt, als die beiden Aspekte oder Aktions-
arten Perfektivitt und Imperfektivitt le-
diglich im Bereich der sog. Vergangenheits-
tempora Tempora, die bei deiktischem/
absolutem Gebrauch das Geschehen inner-
halb des vor der uerungszeit liegenden
Zeitraums lokalisieren formal differenziert
werden; vgl. limparfait und pass simple im
Franz., Imperfekt und Aorist im Altgr. In
solchen Fllen mu die Tempussemantik auch
mit den aspektuellen Seiten der jeweiligen
Tempora fertig werden.
Tempusformen knnen auer Temporalitt
nicht nur Aspekt-, sondern auch Modalitts-
bedeutung aufweisen. So knnen Tempora
des Prteritumsystems in vielen Sprachen,
die kein voll ausgebautes Konjunktivsystem
besitzen, neben zeitlicher Vergangenheit auch
sog. Irrealitt (Kontrafaktivitt) ausdrcken,
und zwar mit dem gleichen Zeitbezug wie
jeweils entsprechende Formen des Prsens-
systems (vgl. dn. Hvis vi var get en halv
time fr, var vi ikke kommet for sent entspre-
chend engl. If we had left an hour before, we
hadnt been late; vgl. Jespersen 1924: 266 ff.,
Lyons 1977: 818 ff). Eine Erklrung dieser
scheinbaren Doppelfunktion soll hier nicht
versucht werden (s. dazu etwa Lyons 1977).
Auf etwas anderer Ebene liegt die Schwie-
rigkeit, Modalitt und Temporalitt bei den
deren germanischen Sprachen im wesent-
lichen durch das progressive, die Umschrei-
bung mit be + Part. Prs., die jeder der
anderen Tempusformen eine entsprechende
Verlaufsform zur Seite stellt (vgl. sleeps is
sleeping, slept was sleeping usw.); rein se-
mantisch handelt es sich allerdings kaum um
eine temporale Kategorie (s. unten). Das
Franz. wiederum zeichnet sich vor allem
durch seine zwei Vergangenheitstempora
imparfait und pass simple und eine ent-
sprechende Vervielfachung der zusammenge-
setzten Tempusformen aus; und noch kom-
pliziertere Systeme finden sich etwa im Lat.
und Altgr. Sehr einfach ist demgegenber das
Russ., das keine Parallele des dt. Perfekts und
Plusquamperfekts kennt, sondern mit den bei-
den einfachen Tempora Prsens und Prteri-
tum und einer Futurumschreibung (imperfek-
tiver Verben) auskommt.
3. Formal definierte vs. semantische
Tempora
Bisher haben wir uns berwiegend mit Tem-
pusformen mit der Beschreibung formaler
morphosyntaktischer Systeme abgegeben,
ohne auf die im vorliegenden Zusammenhang
essentielle Frage einzugehen, was die verschie-
denen Formen jeweils bedeuten und in-
wieweit sie berhaupt etwas Verschiedenes be-
deuten. Es stellen sich dabei vor allem die
folgenden drei Fragen:
1. Bilden sog. Tempussysteme tatschlich
auch semantisch einheitliche Systeme in dem
Sinne, da die angeblichen Tempusformen
alle und ausschlielich Temporalitt Lo-
kalisierung in Zeit ausdrcken? Oder an-
ders gesagt: Ist jedes formal definierte Tempus
nun auch semantisch als ein Tempus im ein-
gangs definierten Sinne anzusehen?
2. Ist zwischen semantischen und formal
bestimmten Tempora eine Eins-zu-eins-Ent-
sprechung anzusetzen, oder mssen u. U. etwa
verschiedene formal definierte Tempora als
Ausdrucksvarianten eines einzelnen semanti-
schen Tempus bzw. umgekehrt in formales
Tempus als Ausdruck verschiedener semanti-
scher Tempora betrachtet werden?
3. Inwieweit sind zusammengesetzte, syn-
taktisch komplexe Tempora wie das Perfekt
und Futur im Dt. auch semantisch als kom-
plex, d. h. semantisch kompositionell zu ana-
lysieren?
35. Tempus 727
bung s. dazu Vater (1975) anhand einer
verzweigenden Zeitlogik zu lsen, findet sich
bei Ballweg (1988).
3.2Relationen zwischen semantischen und
formalen Tempora
Die zweite der oben gestellten Fragen ist vor
allem durch die (meistens kontextbedingte)
Austauschbarkeit von Tempusformen veran-
lat. Wenn zwei verschiedene Tempusformen
unter Umstnden ohne erkennbaren kogniti-
ven Bedeutungsunterschied einander ersetzen
knnen, wie es fr Prt. und Perf. im Dt. und
pass simple und pass compos im Franz.
weitgehend der Fall ist, liegt es zunchst nahe,
ihre Bedeutungen teilweise miteinander zu
identifizieren. So kommt man etwa fr das
Dt. mit Wunderlich (1970: 144 f.) und Buerle
(1979b: 77 f.) zur Ansetzung eines echten
und eines mit dem Prt. bedeutungsgleichen
Perfekts. Demnach htte das semantische
Tempus Prteritum verschiedene morpho-
syntaktische Realisierungen einmal als ein-
fache, einmal als zusammengesetzte Tempus-
form. Besteht jedoch, wie im vorliegenden
Fall, keine generelle Substituierbarkeit, so
drfte es allerdings methodisch angemessener
sein, die scheinbare Bedeutungsberschnei-
dung wenigstens versuchweise als einen Fall
kontextbedingter Synonymie zu erklren. Man
wird dann den Tempusformen je eine eigene
Bedeutung an sich zuschreiben mssen, und
zwar so, da ihre jeweils variierenden und
teilweise zusammenfallenden semantischen
Leistungen im Kontext (ihre Bedeutungen-
im-Kontext) als eine Funktion der Bedeu-
tung-an-sich und des Kontextes erklrbar
werden. Durch dieses Verfahren, das von Fa-
bricius-Hansen (1986) und Ballweg (1988)
u. a. auf das Perfekt des Dt. angewandt wird,
ist auch das Problem der angeblichen Viel-
deutigkeit anderer Tempora vor allem des
Prsens in Angriff zu nehmen.
3.3Kompositionelle Analyse
zusammengesetzter Tempora
Um das semantische Problem der zusammen-
gesetzten Tempusformen zu veranschauli-
chen, sei vorerst mit den meisten neueren tem-
pussemantischen Anstzen angenommen, da
Tempora, obwohl morphologisch am Verb
ausgedrckt, semantisch als Operatoren auf
(infinite) Satzbedeutungen Propositionen
darstellbar sind. (Es spielt fr die Argu-
mentation keine Rolle, ob sie letzten Endes
doch angemessener als Verbalphrase- oder so-
gar Verb-Operatoren zu beschreiben sind; s.
zukunftsbezogenen Tempusformen ausein-
anderzuhalten. Zum einen werden fr sog.
Futurumschreibungen oft keine eigenen Hilfs-
verben, sondern deontische oder bouletische
Modalverben (s. Artikel 29) verwendet (vgl.
engl. shall, will, dn. ville), so da eine rein
temporale (futurische) Bedeutung sich nur
dann einstellen kann, wenn die modale so-
zusagen auer Kraft gesetzt wird, z. B. wegen
der Semantik des Infinitums nicht zum Tra-
gen kommen kann (vgl. dn. det vil snart vre
for sent es wird bald zu spt sein). Zum
anderen kann man sich fragen, ob es Zu-
kunftsbezug ohne Modalitt berhaupt geben
kann. Der objektive oder faktische Wahr-
heitswert einer uerung, in der von nach der
uerungszeit liegenden Geschehen die Rede
ist, lt sich zur uerungszeit selber fr den
Sprecher grundstzlich nicht entscheiden; die
Verifikation oder Falsifikation der (Vor-)
Aussage kann erst spter erfolgen. Insofern
mssen Aussagen ber die Zukunft subjektiv,
pragmatisch vom Standpunkt des indivi-
duellen Sprechers aus einen in gewissem
Sinne unsicheren, modalen Charakter haben
(vgl. Lyons 1977: 815 f. und auch Jespersen
1924: 265). Von daher wird es verstndlich,
da Futurformen oft wie im Dt. auch ohne
Zukunftsbezug verwendet werden knnen,
um zu signalisieren, da der Sprecher das mit
der uerung Behauptete nicht selber verifi-
ziert hat (s. dazu Fabricius-Hansen 1986:
135 ff.); vgl. die Satzpaare in (6)(7).
(6)
a. Anna wird morgen wieder da sein.
b. Anna wird jetzt wieder da sein.
(7)
a. Anna wird nchste Woche ihre Staats-
examensarbeit beendet haben.
b. Anna wird vor einer Woche ihre
Staatsexamensarbeit beendet haben.
hnlich erklrt Jespersen (1924: 265) die mo-
dale Verwendung des Futurs in Fllen wie
franz. il dormira dj = he will already be
asleep = er wird schon schlafen (I suppose
that he is asleep):
It is true that we can assert nothing with regard
to a future time but mere suppositions and surmi-
ses, and this truth is here linguistically reversed as
if futurity and supposition were identical. Or it
may be that the idea is this: it will (some time in
the future) appear that he is already (at the present
moment) asleep [...].
Ein interessanter Versuch, die vieldiskutierte
und hier nicht im einzelnen aufzugreifende
Frage nach dem modalen oder temporalen
Charakter der deutschen werden-Umschrei-
728 IX. Verbalsemantik
PERF (im Dt. ausgedrckt durch haben/sein
+ Part.Perf.), auf die ein weiterer Tempus-
operator angewandt werden kann, und finite
wie PRS und PRT (ausgedrckt durch
Flexionsmittel), die das nicht erlauben und
sich deshalb gegenseitig ausschlieen. Als ge-
lungen darf die kompositionelle Analyse ge-
nau dann gelten, wenn sich der Bedeutungs-
beitrag der komplexen Tempora aus den se-
paraten Bedeutungsbeschreibungen der ein-
zelnen Tempusoperatoren und den allgemei-
nen Interpretationsprinzipien ableiten lt.
Kompositionelle Beschreibungen des Perfekts
und Plusquamperfekts im Dt. haben Buerle
(1979b) (allerdings nur fr das echte Perfekt,
s. oben), Fabricius-Hansen (1986) und Ball-
weg (1988) vorgelegt. Einen wichtigen Grund
fr die kompositionelle Analyse der Perfekt-
tempora bieten adverbiale Ambiguittser-
scheinungen, die sich unter dieser Analyse
damit erklren lassen, da bestimmte Tem-
poraladverbiale teils innerhalb, teils auer-
halb vom Skopus des infiniten PERF-Ope-
rators stehen knnen. So kann mit (12) ge-
meint sein, da mein Zeitungslesen immer
sptestens um zwei Uhr beendet ist, oder da
zwei Uhr immer die Zeit gewesen ist, zu der
ich die Zeitung lese/las. Diese Doppeldeutig-
keit, die dem entsprechenden Prteritumsatz
(13) abgeht, wre gegebenenfalls als eine Sko-
pusambiguitt darstellbar, wie in (12b, c) ver-
anschaulicht wird; s. fr eine ausfhrlichere
Argumentation Fabricius-Hansen (1986:
109 ff.) und Ballweg (1988).
(12)
a. Ich habe immer um zwei Uhr die
Zeitung gelesen.
b.
PRS (immer (um zwei Uhr (PERF
(ich die Zeitung lesen))))
c.
PRS (PERF (immer (um zwei Uhr
(ich die Zeitung lesen))))
(13)
a. Ich las immer um zwei Uhr die Zei-
tung.
b.
PRT (immer (um zwei Uhr (ich die
Zeitung lesen)))
Im Unterschied zu den Perfekttempora wird
die Futurumschreibung mit werden + Infi-
nitiv von den gleichen Autoren semantisch
nicht kompositionell analysiert, d. h. das
Hilfsverb wird semantisch als ein einfacher
finiter Tempusoperator FUT aufgefat, der
im sog. Futur I auf einen tempusfreien Infi-
nitiv(satz) und im Futur II auf einen PERF-
Infinitiv(satz) operiert; vgl. (14c, 15c) als se-
mantische Reprsentationen von (14a, 15a).
Die Nicht-Kompositionalitt der dt. Futur-
umschreibung lt sich zwar u. a. mit dem
Fehlen eines eigenen, dem Infinitiv Perfekt
Comrie 1985.) Weiter wollen wir gem dem
oben Gesagten zumindest fr jede formal ein-
fache Tempuskategorie ein semantisches Tem-
pus ansetzen und dieses durch Groschrei-
bung PRS als Bedeutung der Prsens-
formen, PRT als Bedeutung der Prteritum-
formen usw. symbolisieren. Dann knnen
wir die Bedeutung von (8a) (= (1)) und (9a)
vereinfacht wie in (8b), (9b) darstellen.
(8)
a. Ich bin oft in Italien.
b.
PRS (ich oft in Italien sein)
(9)
a. Ich war nie in Italien.
b.
PRT (ich nie in Italien sein)
Wrde man nun den Darstellungen traditio-
neller Grammatiken wie auch vielen neue-
ren Analysen, z. B. Wunderlich (1970), Stei-
nitz (1980), Nerbonne (1985), Comrie (1985)
folgen, so wre die Bedeutung der ent-
sprechenden Perfekt- und Plusquamperfekt-
stze (10a) (= (2)) und (11a) jeweils als (10b)
und (11b) wiederzugeben; d. h. die betreffen-
den Tempora wren trotz ihrer syntaktisch
komplexen Struktur als semantisch nicht wei-
ter analysierbare Tempusoperatoren PER-
FEKT und PLUSQPF darzustellen.
(10)
a. Ich bin nie in Italien gewesen.
b. PERFEKT (ich nie in Italien sein)
(11)
a. Ich war nie in Italien gewesen.
b. PLUSQPF (ich nie in Italien sein)
Geht man jedoch als theoretisch-methodische
Grundannahme von einer mglichst weitge-
henden Parallelitt syntaktischer und seman-
tischer Komplexitt aus, so ist allerdings vor-
erst die Tragfhigkeit einer semantisch kom-
positionellen Analyse der zusammengesetzten
Tempora zu prfen. Danach wre der Infini-
tiv Perfekt (Infinitiv II) semantisch als ein
Operator PERF zu analysieren und das Per-
fekt und Plusquamperfekt, die jeweils Pr-
sens- und Prteritumformen des perfektbil-
denden Hilfsverbs aufweisen, dementspre-
chend als PRS ... PERF bzw. PRT ...
PERF als present perfect (Prsensper-
fekt) und past perfect (Prteritumperfekt),
wie die englischen Bezeichnungen denn auch
oft lauten; das heit, (10a) und (11a) wren
stattdessen als (10c) und (11c) zu reprsentie-
ren.
(10)
c.
PRS (PERF (ich nie in Italien sein))
(11)
c.
PRT (PERF (ich nie in Italien sein))
Eine solche Analyse fhrt zur Unterscheidung
zweier Kategorien von Tempusoperatoren
(und Propositionen): infinite Operatoren wie
35. Tempus 729
und zugleich der natrlichsprachlichen Viel-
falt gerecht werden sollen; hierher gehren
etwa Beauze (1767), Jespersen (1924), Bull
(1960) und Reichenbach (1947) (4.2). Drittens
ist die vor allem von Prior (1967) und Rescher
& Urquhart (1971) entwickelte Zeitlogik zu
erwhnen, die trotz ihrer weitgehenden em-
pirischen Unangemessenheit zusammen mit
Reichenbach (1947) die theorienbewute lin-
guistische Tempussemantik der letzten 1015
Jahre entscheidend beeinflut hat (4.3). Diese
wird, ihrer Heterogenitt zum Trotz, in die-
sem Zusammenhang als eine (vierte) Gruppe
aufgefat und im Abschnitt 4.4 besprochen.
Auerhalb dieser Kategorisierung fallen
Anstze wie Weinrich (1971), der die Haupt-
funktion der Grundtempora Prsens und
Prteritum nicht in der zeitlichen Einordnung
von Geschehen, sondern in der Signalisierung
bestimmter Erzhlperspektiven sieht und hier
nicht weiter bercksichtigt werden soll.
4.1Die klassische grammatische Tradition
Typisch fr traditionelle einzelsprachliche
Tempusbeschreibungen sind die mehr oder
weniger starke Anlehnung an die Tempus-
lehre der griechischen und lateinischen Gram-
matiker und eine terminologische vielleicht
auch z. T. begriffliche Unklarheit: die feh-
lende Unterscheidung von Tempus (tense)
als einer formalen grammatischen Kategorie
und Zeit (time) als einer begrifflich-referen-
tiellen Kategorie. Dionysios Thrax (2. Jh.
v. Chr.) unterscheidet die gegenwrtige
(, instans/praesens), vergangene
(, praeteritum) und die kom-
mende (, futurum) Zeit (,
tempus) und unterteilt die Vergangenheit wei-
ter in vier verschiedene Arten: die ausge-
dehnte (, imperfectum), die fer-
tige (, perfectum), die ber-
vollendete (, plusquamper-
fectum) und die unbestimmte (),
entsprechend den vier verschiedenen Vergan-
genheitsformen des Altgriechischen; vgl.
Schwyzer (1966: 248 ff.). Dabei hebt die No-
menklatur der Untergliederung eher Aspekt-
unterschiede als Unterschiede der zeitlichen
Lokalisierung hervor, wie es dem griechischen
Tempussystem angemessen erscheint. Priscian
(5. Jh. n. Chr.) stellt fr das Latein ein hn-
liches System auf, kommt jedoch, da Latein
keine Entsprechung des gr. Aorist aufweist,
mit drei Vergangenheitstempora und insge-
samt mit fnf verschiedenen Tempora oder
Zeiten aus. Erst spter wurde auch das
sog. Futurum exactum als eigenes indikati-
visches Tempus anerkannt (Michael 1970:
entsprechenden Infinitiv Futur (*beenden wer-
den) s. Fabricius-Hansen (1986: 141 ff.),
Ballweg (1988) begrnden, die Mglichkeit
einer kompositionellen Analyse vgl. (14d,
15d) wre aber vielleicht doch etwas ein-
gehender zu untersuchen (vgl. Fabricius-Han-
sen 1986: 352). Gnzlich nicht-kompositionell
wre eine eher traditionelle Analyse,
wie sie in (14b, 15b) angedeutet wird.
(14)
a. Anna wird ihre Arbeit beenden.
b. FUT-I (Anna ihre Arbeit beenden)
c. FUT (Anna ihre Arbeit beenden)
d.
PRS (WERD (Anna ihre Arbeit be-
enden))
(15)
a. Anna wird ihre Arbeit beendet haben.
b. FUT-II (Anna ihre Arbeit beenden)
c. FUT (PERF(Anna ihre Arbeit be-
enden))
d.
PRS (WERD (PERF (Anna ihre
Arbeit beenden)))
Es sei der Vollstndigkeit halber erwhnt, da
auch finite (synthetische) Tempusformen
morphologisch komplex oder durchsichtig
sein knnen in dem Sinne, da sie aus zwei
oder mehr Flexionsmorphemen bestehen, die
je eine eigene temporale Bedeutungskompo-
nente beitragen. Dies trifft beispielsweise auf
das franz. futur du pass zu, das den Tem-
pusstamm des futur simple mit den Endungen
des imparfait kombiniert (vgl. 3.Sg. imparfait
aim-ait, futur simple aim-er-a, futur du pass
aim-er-ait). Semantische Kompositionalitt
der gleichen Art wie fr bestimmte Umschrei-
bungen mit Hilfsverb anzunehmen, wird je-
doch hier kaum ntig sein; denn Skopusam-
biguitten wie die fr (12) veranschaulichten
scheinen syntaktische und nicht einfach mor-
phologische Komplexitt vorauszusetzen.
4. Stationen der Tempussemantik
Betrachtet man die Geschichte der Tempus-
semantik, so lt sich das Gros der verschie-
denen Anstze zum Zwecke eines begriffli-
chen eher als chronologischen berblicks in
vier Gruppen einteilen: Eine Gruppe bilden
in der europischen grammatischen Tradition
stehende, theoretisch wenig reflektierte ein-
zelsprachliche Darstellungen, wie man sie in
vielen Standardgrammatiken und Handb-
chern vorfindet (4.1). Eine zweite Gruppe
konstituiert sich aus linguistischen oder lin-
guistisch orientierten Versuchen, auereinzel-
sprachliche Beschreibungssysteme zu entwik-
keln, die mglichst universell verwendbar sein
730 IX. Verbalsemantik
schon in den (griechisch-)lateinischen Be-
zeichnungen imperfectum, perfectum etc.
(s. oben) mitklingen, und die vor allem zur
Unterscheidung von Vergangenheitstempora
wie imparfait und pass simple im Franz. und
progressive vs. non-progressive im Engl. her-
angezogen werden. Die Einbeziehung des
Aspekts in die Tempuslehre wird unter Ein-
flu slawistischer Sprachbeschreibungen noch
verstrkt; s. Schwyzer (1966: 249).
In der (lateinisch-)klassischen Tradition
steht auch die Unterscheidung sog. absoluter
(oder selbstndiger) und relativer Zeiten (bzw.
Tempora); vgl. dazu Blatz (1896: 495 f.):
1. Nach dem Ausgangspunkte, von dem aus die
Zeit einer Handlung bemessen wird, unterscheidet
man absolute und relative Tempora.
2. Absolute Tempora sind diejenigen, bei denen die
Zeit der Handlung von dem Zeitpunkt aus bemes-
sen wird, in welchem der Redende sich befindet (=
von der Gegenwart des Sprechenden aus), z. B.
Gott hat die Welt erschaffen [...].
3. Relative Tempora nennt man solche, bei denen
die Zeit einer erwhnten Handlung den Ausgangs-
punkt der Zeitbemessung bildet, z. B. Nachdem
man die Dielen des Saals aufgebrochen hatte, ent-
deckte man ein gerumiges Gewlbe. [...]
Zum Ausdruck dieser relativen Zeitverhltnisse
sind jedoch nur zwei verschiedene Tempora vor-
handen: Das Plusquamperfektum und das Futu-
rum exactum. [...]
Die brigen relativen Zeitverhltnisse mssen
durch dieselben Tempora bezeichnet werden, wie
die absoluten.
Daraus wird ersichtlich, da Tempusverwen-
dungen eher als Tempora (oder Zeiten) ab-
solut oder relativ sind; absolut oder relativ ist
ein Tempus nur dann zu nennen, wenn es in
allen Verwendungen ein absolutes bzw. rela-
tives Zeitverhltnis ausdrckt, wie im allge-
meinen fr das Plusquamperfekt und Futur
II (Fut. ex.) im Latein (im Unterschied zum
Altgr.) und ihre Entsprechungen im Dt. an-
genommen wird; vgl. (17).
(17)
a. Tertio die postquam a te discesseram
(Plusqpf.) litteras scripsi (Perf.).
Am dritten Tag nachdem ich mich
von dir getrennt hatte, schrieb ich
den/einen Brief.
b. Si id feceris (Fut. ex.), gratiam ha-
bebo (Fut.).
Wenn du das tust (eigentlich: getan
haben wirst), werde ich dankbar sein.
Nach Comrie (1985: 56 ff.) sind relative Tem-
pora in absolute-relative und pure relative
zu unterteilen, je nachdem, ob das Verhltnis
zwischen der sekundren Bezugszeit und der
117 ff.). Das Ergebnis war die Unterscheidung
sechs verschiedener Zeitstufen Prsens,
Imperfektum (auch Prteritum genannt), Per-
fektum, Plusquamperfektum, Futurum und
Futurum exactum , die die Beschreibung
der Tempora in den einzelnen europischen
Sprachen in hohem Mae bestimmt hat, ob-
wohl auch andere Kategorisierungsversuche
und andere Nomenklaturen in der gramma-
tischen Geschichte zu verzeichnen sind (s.
zum Engl. Michael 1970: 395 ff.).
Die grundlegende Trichotomie Gegenwart
vs. Vergangenheit und Zukunft mag eine na-
trliche, auereinzelsprachlich gltige und in-
sofern begrifflich-referentielle sein (vgl. je-
doch Comrie 1985: 48 ff. zur Dichotomie
Vergangenheit vs. Nicht-Vergangenheit). Die
weitere Gliederung der Vergangenheit und
Zukunft hat jedoch nicht den gleichen uni-
versellen Status, sondern ist weitgehend durch
das System der jeweiligen klassischen Sprache
bestimmt. Und so stehen die Bezeichnungen
Prsens, Prteritum, Perfekt etc. letzten
Endes lediglich fr einzelsprachzpezifische
Tempora (als Formkategorien), nicht fr uni-
versell definierbare Zeiten oder Zeitstufen.
Dementsprechend wird fr das einzelne Tem-
pus meistens auch eine ganze Reihe verschie-
dener Gebrauchsvarianten, Verwendungen
oder Bedeutungen aufgelistet, ohne da ver-
sucht wird, diese aus einer allgemeinen
Grundbedeutung abzuleiten (ernsthafte Ver-
suche in dieser Richtung s. frs Deutsche
z. B. Ballweg (1984) sind verhltnismig
jung). So unterscheidet beispielsweise Blatz
(1896: 503 ff.) ein finitives, ein prsenti-
sches oder logisches, ein unbestimmtes/
aoristisches (d. h. generelles oder habituel-
les), ein futurisches und ein relatives Per-
fekt, und viele neuere Deutschgrammatiken
gehen besonders fr das Prsens im
Prinzip genauso vor; bei Quirk et al. (1985:
179 f.) finden wir die folgenden Prsensva-
rianten des Engl.: state present, habitual
present, instantaneous present, simple pre-
sent referring to the past (sog. historisches
Prsens), simple present referring to the fu-
ture; vgl. (16).
(16)
a. Peru shares a border with Chile.
b. She makes her own dresses.
c. Here comes the winner!
d. The plane leaves for Ankara at eight
oclock tonight.
In der Beschreibung der Tempusbedeutungen
werden meistens nicht nur Begriffe der zeit-
lichen Lokalisierung, sondern auch schwer
definierbare Aspektbegriffe verwendet, wie sie
35. Tempus 731
Zeitlinie abbildbaren Zeitstufen operiert Je-
spersen (1924: 256 f.), wobei er allerdings
Tempora in indirekter oder erlebter Rede zu-
nchst ausklammert; vgl. Abb. 35.2.
Abb. 35.2: Zeitstufen bei Jespersen (1924)
In anderen, vergleichbaren, siebenstelligen
Systemen ist zwischen Nachvergangenheit
und Gegenwart/Zukunft wie zwischen
Vergangenheit/Gegenwart und Vorzu-
kunft keine Nachfolgerelation festgelegt; vgl.
Abb. 35.3. Die Nachvergangenheit, belegt
etwa durch das futur du pass im Franz.,
kann vielmehr in die Gegenwart oder Zukunft
hineinreichen; und die Vorzukunft, belegt
etwa durch das futur antrieur im Franz. und
Fut. II im Dt., kann in die Gegenwart oder
Vergangenheit zurckreichen. Vgl. dazu (18),
wo die Kommen-Handlung nach der Sprech-
Sprechzeit relevant ist (wie beim Plusqpf.: jene
mu dieser vorausgehen) oder nicht.
Besondere Aufmerksamkeit wird in vielen
traditionellen Darstellungen wiederum un-
ter lateinischem Einflu der sog. consecutio
temporum (Zeitenfolge) geschenkt, d. h. dem
relativen oder absoluten Gebrauch der Tem-
pora in Nebenstzen (in den lat. Beispielen
oben liegt relativer Gebrauch vor, da der
Hauptsatz die Bezugszeit des Nebensatzes lie-
fert); vgl. Blatz (1986: 517 f.) und Comrie
(1985: 104 ff.).
4.2Auereinzelsprachliche Zeitsysteme
4.2.1Jespersen, Bull
Parallel zu den semantischen Beschreibungen
einzelsprachlicher Tempussysteme, bei denen
meistens von den formalen Tempora ausge-
gangen wird, haben Sprachwissenschaftler
auereinzelsprachliche, begriffliche Zeitsy-
steme, Systeme von Zeitstufen o. dgl., auf-
gestellt, die mglichst universell verwendbar
sein sollen in dem Sinne, da im Idealfall jede
formale Tempuskategorie einer beliebigen na-
trlichen Sprache sich als Ausdruck oder Be-
legung (mindestens) einer Systemstelle be-
schreiben lt; vgl. dazu Wunderlich (1970:
313 ff.), Rohrer (1977a).
Die bekanntesten Zeitsysteme sind sieben-,
neun- oder zwlfstellig. Mit sieben, auf einer
Abb. 35.3: Zeitstufen (nach Bull 1960)
732 IX. Verbalsemantik
[lassen], wie Rohrer (a. a. O.) im Anschlu
an Jespersen (1924) meint, oder ob die Bezie-
hung zwischen der (relativen) Nachvergan-
genheit bzw. Vorzukunft und der absoluten
Vergangenheit bzw. Zukunft auch sonst un-
spezifiziert bleiben kann, wie etwa Fabricius-
Hansen (1986:112 ff.) und Ballweg (1988) fr
die Vorzukunft annehmen; vgl. auch Comrie
(1985: 70 f.).
4.2.2Reichenbach
Von besonderer Bedeutung fr die weitere
Geschichte der linguistischen Tempusseman-
tik ist das von dem Logiker Reichenbach
(1947:251) vorgeschlagene Beschreibungssy-
stem gewesen. Nach Reichenbach lokalisieren
natrlichsprachliche Tempora nicht einfach
eine Ereigniszeit (point of event, kurz E:
Wahrheitsintervall/Aktzeit des tempuslosen
Satzes, s. Abschnitt 1 oben) im Verhltnis zur
Sprechzeit (point of speech, kurz S), sondern
sie spezifizieren Relationen zwischen drei Zei-
ten: der Ereigniszeit, der Sprechzeit und einer
durch den Kontext bestimmten sog. Refe-
renzzeit (point of reference, kurz R). Die
Referenzzeit kann mit der Sprechzeit zusam-
menfallen, ihr nachfolgen oder ihr vorausge-
hen, und die gleichen Relationen knnen zwi-
schen Referenzzeit und Ereigniszeit bestehen
nur wre hier eher von berlappung als
von Zusammenfall zu reden, da die Ereignis-
zeit ein echtes Intervall darstellen kann, wie
Reichenbach (1947: 290) fr die engl. Ver-
laufsformen und das franz. imparfait (im Un-
terschied zu pass simple) annimmt. Werden
Sprechzeit und Ereigniszeit nicht direkt auf-
einander bezogen, so ergeben sich insgesamt
3
2
= 9 mgliche Konstellationen; werden hin-
gegen die Relationen zwischen E und S mit
expliziert, so wird das System dreizehnstellig.
Vgl. dazu Abb. 35.5; hier werden fr jede
Systemstelle (Rubrik) die zugelassenen Rela-
tionen zwischen E und S in Reichenbachs
zeit lokalisiert ist, und (19), wo eine in der
Gegenwart abgeschlossene Handlung von
einem Zeitpunkt in der Zukunft aus beurteilt
wird (Rohrer 1977a: 42). Entsprechendes gilt
fr posterior past und anterior future in
Reichenbachs (neunstelligem) Zeitsystem (s.
unten und Abb. 35.5).
(18) Il a dit quil viendrait demain.
Er sagte, da er morgen kommen
wrde
(19) Si la guerre sarrte, jaurai fait des frais
pour rien.
Wenn der Krieg aufhrt, werde ich um-
sonst Ausgaben gemacht haben
Ein zwlfstelliges System von Zeitstufen liegt
bei Bull (1960) vor. Er setzt neben der um die
faktische uerungszeit als Achse (Null-
stufe) zentrierten realen Zeitebene drei wei-
tere Zeitebenen an, die sich jeweils um eine
anticipated, eine recalled und eine antici-
pated recalled Nullstufe zentrieren, und un-
terscheidet auf jeder Zeitebene auer der
Nullstufe eine Vergangenheits- und eine Zu-
kunftstufe (als Vektor bzw. + Vektor be-
zeichnet); vgl. Abb. 35.3. Dieses System ist
u. a. im Unterschied zu Reichenbachs inso-
fern asymmetrisch, als die Nachvergangenheit
(die Zukunftstufe auf der recalled Ebene)
ber die Nullstufe der realen Zeitebene hin-
ausgeht, whrend die Vorzukunft (die Ver-
gangenheit der Antizipationsebene(n)) nicht
hinter die reale oder recalled Sprech-
zeit zurckreicht. Ein noch komplizierte-
res, aber in dieser Hinsicht symmetrisches Sy-
stem mit n Zeitebenen entwickelt Heger
(1963) s. Abb. 35.4; vgl. Rohrer (1977a).
Wie man sieht, gehen die Ansichten aus-
einander in bezug darauf, ob die Zeitstufen
natrlicher Sprachen (Rohrer a. a. O.)
auerhalb des Bereichs der indirekten oder
der erlebten Rede tatschlich sich ohne
berlappungen auf eine Zeitachse abbilden
Abb. 35.4: Zeitebenen bei Heger (1963)
35. Tempus 733
begriff mit dem Begriff Zeitpunkt oder
Ausgangspunkt, von dem aus die Zeit einer
Handlung bemessen wird (Blatz 1896: 495)
identifizieren, der traditionell zur Unterschei-
dung absoluter und relativer Zeitverhlt-
nisse herangezogen wird (s. oben 4.1). Die
absoluten Zeiten der traditionellen Tempus-
lehre Gegenwart, Vergangenheit und Zu-
kunft entsprechen demnach bei Rei-
chenbach den drei verschiedenen E-R-Rela-
tionen bei Zusammenfall von R und S, d. h.
der ersten Spalte in Abb. 35.5; alle anderen
Kombinationen von Relationen zwischen R
und S und zwischen E und R sind im Prinzip
den traditionellen relativen Tempora gleich-
zustellen, da die Zeit (R), von der aus die
Zeit einer Handlung (E) bemessen wird,
dort nicht mit der Sprechzeit, sondern mit
einer anders identifizierten Zeit zusammen-
fllt. (In dem Zusammenhang sei erwhnt,
da Curme (1922: 211 f.) das sonst normaler-
weise als absolut behandelte Prt. als relatives
Tempus einstuft: [it] has for its leading idea
that of simultaneity of two or more related
past acts or conditions.)
Notation (, bezeichnet Zusammenfall/ber-
lappung und Nachfolgerelation) mit an-
gegeben; auerdem wird fr jede durch ein
englisches Tempus belegte Konstellation ein
entsprechendes Beispiel und die von Rei-
chenbach vorgeschlagene Bezeichnung des
betreffenden Tempus angefhrt. Man sieht,
da Reichenbach wie Bull (1960) und im Un-
terschied etwa zu Jespersen (1924) das Pr-
teritum und Perfekt als Vergangenheitstem-
pora unterscheiden kann (kritisch dazu Bu-
erle 1979b: 45 ff.); im Unterschied zu Bull hat
er jedoch keinen Platz fr ein Fut.Prt. II
(would have loved), cf. futur antrieur du pass
im Franz.
Der sptere (s. 4.4 unten) Erfolg der Rei-
chenbachschen Tempussemantik s. zu ihrer
Anwendung aufs Deutsche vor allem Baum-
grtner & Wunderlich (1969) und Vater (1983)
ist in erster Linie an die Einfhrung einer
Referenzzeit neben der Sprech- und der Er-
eigniszeit geknpft und wird erst als Beitrag
eines Logikers vor dem Hintergrund der rei-
nen Zeitlogik (s. 4.3) voll verstndlich. Denn
dem Sinne nach lt sich sein Referenzzeit-
Rel (R, S) [Verhltnis eines
bestimmten Bezugs-
zeitpunktes zum
Augenblick des
Sprechaktes]
Rel (E, R)
[Verhltnis
zwischen Existenz
und Bezugszeitpunkt
allgemeine Arten von Zeiten]
R S
[(definit)
gegenwrtig]
R < S
[(definit)
vorzeitig]
R > S
[(definit)
nachzeitig]
E R Simple Present
E, R, S
Simple Past
E, R S
Simple Future
S E, R
[Praesentia] loves loved
E < R Anterior Present
E R, S
Anterior Past
E R S
Anterior Future
S E R
S, E R
E S R
[Praeterita] has loved had loved will have loved
E > R Posterior Present
R, S E
Posterior Past
R E S
R E, S
R S E
Posterior Future
S R E
[Futura] shall love would love
Abb. 35.5:Zeitsysteme bei Reichenbach (1947) und Beauze (1767)
Rel (R, S): Relation zwischen Referenzzeit (R) und Sprechzeit (S)
Rel (E, S): Relation zwischen Ereigniszeit (E) und Referenzzeit
:
Zusammenfall/berlappung
<, >: vor bzw. nach
[...]: Beauzes Bezeichnungen
734 IX. Verbalsemantik
d. Chacun rcoltera (futur simple) ce
quil aura sem (futur antrieur).
Ein jeder wird ernten, was er gest
haben wird.
4.3Einflu der Zeitlogik
Die Zeitlogik wurde als Zweig oder Parallele
der Modallogik entwickelt, um eine logische
Behandlung von Stzen mit zeitlich be-
schrnkter Gltigkeit zu ermglichen, d. h.
Stze wie Es regnet., Gestern regnete es nicht.,
deren Wahrheitswert nach der Zeit variiert,
zu der sie geuert werden was fr die
meisten natrlichsprachlichen Stze zutreffen
drfte. Klassische zeitlogische Werke sind
Prior (1967) und Rescher & Urquhart (1971),
ein neueres van Benthem (1983a).
Als Explikation natrlichsprachlicher Da-
ten war die frhe Zeitlogik zwar in wichtigen
Punkten inadquat, sie hat jedoch im Zuge
der Entstehung der modelltheoretischen Se-
mantik die heutige linguistische Tempus-
semantik entscheidend beeinflut. Deshalb
sollen hier summarisch diejenigen Aspekte der
Zeitlogik besprochen werden, die fr die lin-
guistische Tempussemantik von besonderer
Bedeutung gewesen sind (s. dazu auch Bu-
erle 1979b: 3 ff.).
Dem Einflu zeitlogischer Kalkle, die als
Weiterfhrung der Satz- oder Propositions-
logik konzipiert wurden, ist es zum einen zu
verdanken, da Tempora semantisch jetzt
weitgehend als Satzoperatoren aufgefat wer-
den (vgl. Abschnitt 1 oben). Dies erlaubt es,
eine Mehrdeutigkeit wie in (21) auf Skopus-
ambiguitt zurckzufhren: je nachdem, ob
die quantifizierte Subjekt-NP innerhalb oder
auerhalb des Tempusoperator-Skopus steht,
wird von knftigen oder jetzigen Mitarbeitern
die Rede sein; vgl. Buerle (1979b), der selber
jedoch hnlich wie Bach (1980) Tem-
pora als Operatoren auf Verbalphrasen be-
schreibt.
(21) Alle Mitarbeiter werden anwesend sein.
Weiter haben Zeitlogiker den Linguisten ver-
schiedene Zeitmodelle lineare, verzwei-
gende, diskrete, dichte etc. zur Verfgung
gestellt; s. z. B. van Benthem (1983a). Eine
weite Verbreitung unter Linguisten hat vor
allem die Auffassung von der Zeit als linear
geordnet und dicht erlangt vgl. Wunderlich
(1970: 298), Dowty (1979: 139) , obwohl
auch andere, u. a. verzweigende, Modelle in
Erwgung gezogen worden sind; vgl. Dowty
Sehr klar vorweggenommen ist die Rei-
chenbachsche Systematik auch bei Beauze
(1767: 426 ff., zit. nach Arens 1969: 117 ff.).
Er fat in seinem metaphysischen System
der Zeiten des Verbums Zeiten (i. e. Tem-
pora) als Formen auf, die dem Grundbe-
griff der Bedeutung des Verbums den zustz-
lichen Begriff eines Bezugs der Existenz auf
einen Zeitpunkt hinzufgen, und unterschei-
det nach den mglichen Beziehungen
Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit
zwischen Existenz (i. e. Ereigniszeit) und
Bezugszeitpunkt drei allgemeine Arten von
Zeiten: Praesentia, Praeterita, Futura. In
einem zweiten Schritt wird jede dieser Zeiten
in eine indefinite und eine definite unter-
teilt, je nachdem ob sie einen Bezug der
Existenz auf irgendeinen unbestimmten Zeit-
punkt oder auf einen genauen und be-
stimmten Zeitpunkt ausdrckt, d. h. je nach-
dem, ob Gleich-/Vor-/Nachzeitigkeit von Er-
eigniszeit und einem allgemeinen, unbe-
stimmten oder einem speziellen, be-
stimmten, auf der Zeitlinie lokalisierten
Bezugszeitpunkt (Referenzzeit) ausgedrckt
wird. Die Positionen des genauen Bezugs-
zeitpunktes zu einem festen Punkt des Zeit-
verlaufs, nmlich zum Augenblick des
Sprechaktes, bilden dann die Grundlage der
dritten Einteilung: der Unterscheidung der
drei definiten Zeitarten in drei Unterarten,
die man wohl am besten charakterisieren
kann mit den Bezeichnungen gegenwrtig,
vorzeitig, nachzeitig, entsprechend der Posi-
tion des bestimmten Bezugszeitpunkts, nach
der sie unterschieden werden (a. a. O.).
Das neungliedrige System der definiten
Zeiten entspricht genau dem Reichenbach-
schen Zeitsystem; vgl. wieder Abb. 35.5, wo
Beauzes Bezeichnungen in eckigen Klam-
mern eingetragen sind. Die indefiniten Zei-
ten, die durch Gleich-, Vor- bzw. Nachzei-
tigkeit der Ereigniszeit im Verhltnis zu einem
beliebigen, unbestimmten Bezugszeitpunkt
gekennzeichnet sind, haben keine Parallele bei
Reichenbach; sie sind als Explikation der sog.
generellen oder generischen (aoristischen,
unbestimmten, gnomischen) Tempusver-
wendungen gemeint, vgl. (20).
(20)
a. Lavarice perd (Prs.) tout en voulant
tout gagner.
Der Geiz verliert alles, indem er alles
haben will.
b. Jeder Akademiker hat studiert.
c. Qui ne sait (Prs.) se borner ne sut
(pass simple) jamais crire.
Wer sich nicht zu beschrnken wei,
hat nie zu schreiben gewut.
35. Tempus 735
t bewertet):
(25)
PRT(p)(t
o
) = 1 (0) genau dann,
wenn
p(t) = 1 fr irgendein (kein) t < t
o
Eine solche Interpretation widerspricht je-
doch ganz eindeutig jeder natrlichen intui-
tiven Deutung: Wer (23) hrt oder liest, wird
annehmen, da von einer bestimmten, der
Sprechzeit (t
o
) vorausliegenden Zeit t
i
die
Rede ist, an der (24b) wahr sein mu, um (23)
als uerung zu t
o
wahr zu machen. (23) ist
eben nur dann eine angemessene uerung,
wenn der Sprech- oder Situationskontext eine
solche definite vergangene Zeit liefert. Dies
wird besonders deutlich in negierten Stzen
wie (26): Nach der indefiniten Tempusdeu-
tung wrde man mit (26) behaupten, da
Peter bis zur Sprechzeit nie den Ofen zu-
geschraubt htte, was dem tatschlichen
Sprachgebrauch vllig zuwiderluft. Dieser
Einwand gegen eine indefinite Interpretation
scheint von linguistischer Seite zuerst von
Partee (1973a) ausgesprochen worden zu sein.
(26) Peter didnt turn the stove off.
Die indefinite Tempusdeutung kann auch
dem Zusammenspiel von Tempora und Tem-
poraladverbialen wie in (27) nicht gerecht
werden.
(27) Prsident Sadat wurde am 5. Oktober
1981 ermordet.
(28)
a. am 5. Oktober 1981 (PRT (Prsi-
dent Sadat ermordet werden))
b. PRT (am 5. Oktober 1981 (Prsi-
dent Sadat ermordet werden))
Nehmen wir an, da der PRT-Operator in-
definit (wie oben) und Temporadverbiale die-
ser Art nach dem Muster in (29) interpretiert
werden (A: Temporaladverbialbedeutung):
(29) A(p)(t) = 1 gdw.
p(t
A
) = 1, wo t
A
die vom Adverbial
A bezeichnete Zeit ist.
Dann soll (27) unter der Analyse (28a), wo
das Tempus im Skopus des Adverbials steht,
genau dann wahr sein, wenn Sadat irgend-
wann vor dem 5. Oktober 1981 ermordet
wurde. Und unter der Analyse (28b), wo das
Adverbial im Skopus des Tempus steht, wird
dieses vllig redundant, es sagt dann nichts
aus ber die Position des betreffenden Tages
im Verhltnis zur Sprechzeit. Beide Alterna-
tiven sind natrlich gleich unangemessen; s.
fr eine ausfhrlichere Darlegung Buerle
(1979b: 3 ff.).
(1979: 151), Ballweg (1988). Da die Zeit li-
near geordnet ist, heit: fr jedes Paar nicht-
identischer Zeitpunkte gilt, da einer dem an-
deren nachfolgt; und wenn Zeitpunkt t nach
t folgt und t nach t, dann folgt auch t nach
t (Transitivitt der Nachfolgerelation). Nach
dem Dichtigkeitsaxiom gilt fr jedes beliebige
Paar nicht-identischer Zeitpunkte, da zwi-
schen ihnen wieder ein Zeitpunkt liegt.
Die in linguistischer Perspektive wesent-
lichen Unzulnglichkeiten der ersten zeitlo-
gischen Explikationen natrlichsprachlicher
Tempora, die auch den ersten Tempusbe-
schreibungen im Rahmen der Montague-
Grammatik eignen (Sb 1978), waren die
folgenden:
1. Es wurde was z. T. mit der Auffassung
von Tempora als Satzoperatoren zusammen-
hngt zunchst angenommen, da Tem-
pora auf (der Bedeutung von) Prsensstzen
operieren und nicht auf infiniten Stzen, wie
jetzt allgemein akzeptiert zu sein scheint; das
heit, ein Satz wie (21) wurde in der Lesart
mit weitem Tempusskopus wie (22a) statt
(22b) dargestellt.
(22)
a. FUT (alle Mitarbeiter sind anwe-
send)
b. FUT (alle Mitarbeiter anwesend sein)
Eine solche Beschreibung macht den Prsens-
operator redundant PRS (alle Mitar-
beiter sind anwesend) und alle Mitarbeiter
sind anwesend mssen quivalent sein ,
wird der morphologischen Struktur finiter
Verformen nicht gerecht und verhindert eine
adquate kompositionelle Analyse des (zu-
sammengesetzten) Perfekts; vgl. Buerle
(1979b).
2. Die (nicht-prsentischen) Tempora wer-
den indefinit gedeutet. Dies heit, da ein
Prteritumsatz wie (23) an der Sprechzeit t
o
bewertet als wahr (falsch) zu betrachten ist
genau dann, wenn es irgendeine (keine) Zeit
t vor t
o
gibt, an der die Argumentproposition
wahr (falsch) ist sei diese nun ihrerseits als
prsentisch (vgl. oben) oder als infinit wie in
(24a) aufgefat, wie hier des weiteren ange-
nommen wird.
(23) Peter turned the stove off.
(24)
a.
PRT (Peter turn the stove off)
b. Peter turn the stove off
Symbolisch ausgedrckt (p steht fr einen
beliebigen tempuslosen Satzinhalt, z. B. (24b);
< bezeichnet die Relation vor; ...(t) =
1(0) ist zu lesen als: ... ist wahr (falsch) an
736 IX. Verbalsemantik
mit identischem Anfangs- und Endpunkt re-
konstruieren lassen). Erst dadurch scheint
auch eine angemessene Explikation des Ak-
tionsartenbegriffs ermglicht worden zu sein;
(s. Fabricius-Hansen 1986: Kap. IV). Dies
besagt, da Tempora im Prinzip Relationen
zwischen Zeitintervallen wenn nicht gar
Mengen von Zeitintervallen, s. Tich (1980),
Fabricius-Hansen (1986) spezifizieren
(oder bezeichnen, wie bei Tich). Die Sprech-
zeit selber wird teils als Punkt, teils aber auch
als eigentliches Intervall (s. vor allem Krat-
zer 1978) aufgefat.
4.4.2Definite Tempusdeutung
Die indefinite Tempusanalyse der Zeitlogik ist
zugunsten einer in irgendeiner Weise definiten
Deutung aufgegeben worden. Partee (1973a)
schlug im Rahmen der generativen Transfor-
mationsgrammatik vor, Tempora oder zu-
mindest Prsens und Prteritum als eine
Art Zeitpronomina (vom Typ jetzt, da-
mals) darzustellen, die wie die Personalpro-
nomina ihre jeweils wechselnde Referenz vom
Kontext zugewiesen bekommen. Das Prsens,
das als Gegenwartstempus seine Referenz
direkt von der uerungssituation (bzw.
-zeit) beziehe, sei dann deiktisch im gleichem
Sinne wie das Personalpronomen der 1. Per-
son, das Prt. hingegen anaphorisch, weil es
immer auf eine von der uerungszeit ver-
schiedene (ihr vorausliegende) Zeit verweise,
die durch den weiteren meistens sprachli-
chen Kontext bereitgestellt wird, hnlich
wie die Referenzzuweisung fr anaphorische
Pronomina der 3. Person (er, sie etc.) erfolgt.
Diesem Verfahren entspricht etwa im Rahmen
einer Montague-Grammatik, da Tempora
semantisch als freie Zeitvariable dargestellt
werden, deren Bereich relativ zur jeweiligen
Sprechzeit eingeschrnkt werden kann (im
Fall des Prt. auf Zeiten, die der Sprechzeit
vorausliegen); vgl. Sb (1978). Die Di-
chotomie deiktische und anaphorische Tem-
pora kehrt in mehreren neueren Arbeiten
wieder, wenn auch anscheinend nicht immer
mit dem gleichen Inhalt; vgl. Cascio (1986),
Houweling (1986), Hinrichs (1986) und kri-
tisch zu dem Begriffspaar Grewendorf
(1982b).
In der modelltheoretischen Semantik
wurde eine definite Tempusdeutung sonst
meistens durch Doppel- oder Mehrfachindizie-
rung (multidimensionale Modelle) erreicht,
d. h. durch Vermehrung der kontextuell be-
legten Zeitindizes, mit Bezug auf die tempus-
haltige Propositionen bewertet werden; s.
4.4Thesen und Themen der heutigen
linguistischen Tempussemantik
Die heutige linguistische Tempussemantik ist
im groen und ganzen durch Bemhungen
gekennzeichnet, ein mglichst hohes Ma an
theoretischer Explizitheit und begrifflicher
Przision, wie sie in der Zeitlogik vorzufinden
sind, mit empirischen Einsichten, wie sie z. T.
in der lteren Tempusliteratur verborgen lie-
gen, zu verbinden. In theoretischer Hinsicht
decken die verschiedenen Anstze ein breites
Spektrum: mehr oder weniger stark formali-
sierte logische oder modelltheoretische Seman-
tik (bzw. Kontexttheorie) cf. z. B. Arbeiten
von Dowty (1979), Buerle (1979b), Guenth-
ner (1979), quist (1965), Rohrer (1977a,
1977b), Ballweg (1988), Fabricius-Hansen
(1986) , sog. Diskursreprsentationsseman-
tik vgl. Kamp & Rohrer (1983), Hinrichs
(1986), Partee (1984b) und Situationsse-
mantik cf. Cooper (1986) sind vertreten
neben etwas mehr idiosynkratischen Forma-
lisierungen und weniger anspruchsvollen,
strker pragmatisch orientierten Darstellun-
gen wie Smith (1980). Eine reiche Auswahl
verschiedener Beschreibungssysteme bieten
die Tempus- (und Aspekt-)Anthologien Roh-
rer (1977, 1978, 1980), Tedeschi & Zaenen
(1981), Linguistics & Philosophy 5 (1982),
Cascio & Vet (1986), Dowty (1986) und die
Monographien Dowty (1972), Vet (1980),
Buerle (1979b), Steube (1980), Nerbonne
(1985), Fabricius-Hansen (1986), Ballweg
(1988).
Wegen der theoretischen Vielfalt und der
z. T. sehr starken Komplexitt und Abstrakt-
heit der Darstellungen kann hier keine zusam-
menhngende bersicht gegeben werden. Es
sollen nur noch verhltnismig knapp und
informell die wichtigsten Errungenschaften,
Themen und Kontroversen der heutigen Tem-
pussemantik vorgestellt werden. Eine Kon-
kretisierung einiger Punkte folgt im nchsten
Abschnitt.
4.4.1Zeitintervalle
Im Unterschied zur klassischen Zeitlogik
wird mit Zeitintervallen statt Zeitpunkten ge-
arbeitet (s. fr die Anfnge der Intervallse-
mantik Cresswell 1977b, fr Details van Ben-
them 1983a). Das heit, die Ereigniszeiten
atomarer Propositionen und das, was jeweils
der Reichenbachschen Referenzzeit ent-
spricht, werden grundstzlich nicht als Zeit-
punkte, sondern als Intervalle dargestellt (wo-
bei Punkte sich als abgeschlossene Intervalle
35. Tempus 737
anzusetzen (s. 4.2.2). Dabei mssen allerdings
Przisierungen gegenber Reichenbach vor-
genommen werden, da neben Zusammenfall
von E und R, E vor R und E nach R
(verstanden als ganz vor bzw. nach) ber-
lappungen verschiedener Art in Frage kom-
men knnen (desgleichen fr die Relationen
zwischen S und R); vgl. Abb. 35.6. So knnen
E und R in (32) wie in (27) nicht vollstndig
zusammenfallen, falls das Zeitadverbial, wie
Reichenbach annimmt, die Referenzzeit spe-
zifiziert; vielmehr mu die Ereigniszeit ein
echtes Teilintervall der betreffenden Referenz-
zeit darstellen. Das heit, die sog. Referenz-
zeit bildet hier einen zeitlichen Bezugsrahmen,
innerhalb dessen eine Ereigniszeit (unbe-
stimmt) lokalisiert ist.
Abb. 35.6: Relationen zwischen Ereignis- und
Referenzzeitintervall
In (33) hingegen dient die nach Rei-
chenbach gleichfalls adverbial festgelegte Re-
ferenzzeit nicht als zeitlicher Rahmen, son-
dern spezifiziert eher die rechte Grenze eines
solchen Rahmens, insofern das infrageste-
hende Ereignis hier vor (dem Ende von) ye-
sterday lokalisiert sein mu.
(32) John left yesterday.
(33) John had left yesterday.
Nach Buerle (1979b: 43 ff.) ist nun das, was
man als zweiten Zeitparameter braucht, eine
Referenzzeit im ersten Sinne, d. h. ein zeitli-
cher Rahmen; sie wird bei ihm Betrachtzeit
genannt. Eine Referenzzeit des zweiten Typs
habe man nur noch fr die Interpretation von
Perfekttempora, wie in (33), ntig; eine solche
Zeit, von der aus gezhlt wird und von der
die Sprechzeit einen Sonderfall bilde, nennt
Buerle Evaluationszeit. Da eine Buerlesche
Betrachtzeit den Platz von t
r
in (31) einnimmt,
dazu etwa Guenthner (1979), Dowty (1982).
Grob gesagt werden Wahrheitsbedingungen
dann nicht nach dem Muster von (25) bzw.
(30), sondern in Anlehnung an Reichenbach
nach dem Muster von (31) formuliert (T =
beliebiger Tempusoperator):
(30) T(p) ist wahr zur Sprechzeit t
o
genau
dann, wenn es irgendeine Zeit t gibt, die
in der Relation X zu t
o
steht und eine
Ereigniszeit von p ist.
(31) T(p) ist wahr zur Sprechzeit t
o
mit
Bezug auf eine bestimmte andere Zeit t
r
(Referenzzeit), d. h. T(p)(t
o
)(t
r
) = 1,
genau dann, wenn
(a) zwischen Sprech- und Referenzzeit
die Relation X besteht und
(b) zwischen Referenzzeit und einer/ der
Ereigniszeit von p die Relation Y
besteht.
Bedingung (a) in (31), die fr PRT Refe-
renzzeit vor Sprechzeit festlegt, ist wohl am
besten als Prsupposition o.dgl. (s. Artikel 13)
darzustellen, d. h. als notwendige Bedingung
dafr, da PRT(p) im gegebenen Kontext
berhaupt eine Proposition ausdrckt bzw.
einen bestimmten Wahrheitswert haben kann.
Einen Satz wie (27) (Prsident Sadat wurde
am 5. Oktober 1981 ermordet.), geuert etwa
im Jahre 1978, wird man intuitiv nicht als
falsch, sondern als sinnlos, unangemessen ein-
stufen.
Die Bedingung (a) kann eventuell fehlen.
Beispielsweise erlaubt das Prsens des Dt. in
der Analyse Ballwegs (1984, 1988) jede belie-
bige Relation zwischen Sprech- und Refe-
renzzeit (dort Betrachtzeit genannt, s. unten);
vgl. auch Fabricius-Hansen (1986: 74 f.). An-
dere z. B. Kratzer 1978, Buerle 1979b
fassen das Prsens als Gegenwarts- oder zu-
mindest Nicht-Vergangenheitstempus auf,
mssen aber dann zur Erklrung des histo-
rischen Prsens annehmen, da eine von der
faktischen Sprechzeit verschiedene, vergan-
gene Zeit als uerungszeit zhlt, d. h. da
eine andere, kontextuell bestimmte Zeit auch
bei der Bewertung finiter Tempora den Platz
von t
o
in (31) einnehmen kann.
Wie Bedingung (b), der Assertionsteil in
(31), im einzelnen formuliert wird, ist durch
die Auslegung des Referenzzeitbegriffs be-
dingt. Handelt es sich um eine echte Rei-
chenbachsche Referenzzeit wie etwa bei Ner-
bonne (1985) und in vielen anderen Arbeiten,
so ist tatschlich im Prinzip fr jedes Tempus
eine eigene Relation zwischen Referenz- und
Ereigniszeit eine spezifische Relation Y
738 IX. Verbalsemantik
Als Ergebnis halten wir fest, da das, was
Referenzzeit genannt wird, teils als ein zeitli-
cher Bezugsrahmen (eine Buerlesche Be-
trachtzeit) aufgefat worden ist, der eine Er-
eigniszeit, ein Wahrheitsintervall der tempus-
losen Proposition als Teilintervall umfat,
teils aber auch als eine Orientierungszeit, von
der aus die Lokalisierung der Ereigniszeit in
anderer Weise berechnet wird. Anscheinend
braucht man fr eine adquate Beschreibung
von Tempora in komplexen Stzen und in
Texten letzten Endes beide Referenzzeittypen,
wenn nicht gar mehr; s. Bertinetto 1986, Roh-
rer 1986. Die Referenzzeit wird so oder so
verstanden als bestimmt, kontextuell vor-
gegeben aufgefat. Fraglich oder ungeklrt
bleibt jedoch, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Sinne auch die Ereigniszeit Definitheit
beanspruchen kann (vgl. etwa Buerle 1979b
und Nerbonne 1985).
4.4.3Tempus und Zeitadverbiale
Das oben (4.3) angedeutete Dilemma des Zu-
sammenspiels von Tempora und Temporalad-
verbialen der zeitlichen Lokalisierung (Be-
trachtzeitadverbiale, frame adverbials, im
folgenden Referenzzeitadverbiale genannt),
dem Wunderlich (1970) durch eine Art Kon-
gruenzregel beizukommen versucht, stellt bei
einer definiten Tempusdeutung kein so groes
Problem mehr dar: Solche Adverbiale lassen
sich jetzt semantisch als satzinterne Lieferan-
ten der Referenzzeit (im einen oder dem an-
deren Sinne) rekonstruieren, wie schon bei
Reichenbach (1947) angelegt war. Das Ad-
verbial am 5. Oktober 1981 im Satz Prsident
Sadat wurde am 5. Oktober 1981 ermordet
spezifiziert die Referenzzeit (Betrachtzeit),
und da das Prteritum verlangt, da diese der
Sprechzeit wenigstens teilweise vorausliegt, ist
eine notwendige Bedingung fr die Wahrheit
(eher: Sinnvollheit) des Satzes als uerung
etwa im Jahre 1978 nicht erfllt (vgl. oben).
Die Kombination des Prteritums mit einem
Referenzzeitadverbial, das ein nicht ganz vor
der Sprechzeit liegendes Intervall bezeichnet
wie im Satz Heute wurde Prsident Sadat er-
mordet, lt sich dabei in unterschiedlicher
Weise erklren: Entweder die Referenzzeit ist
in Wirklichkeit kontextuell weiter einge-
schrnkt auf einen bestimmten, der Sprechzeit
ganz vorausliegenden Teil des betreffenden
Intervalls (vgl. Nerbonne 1985); oder aber das
Prteritum selbst schrnkt den adverbial ge-
setzten Bezugsrahmen auf den vergangenen
Teil desselben ein (vgl. Buerle 1979b, Ballweg
1988 und die Diskussion bei Fabricius-Han-
hat zur Folge, da die Relation Y im (b)-Teil
nicht mehr nach dem Tempus variiert: t
r
mu
vielmehr unweigerlich eine Ereigniszeit, ein
Wahrheitsintervall der tempuslosen Proposi-
tion als (eventuell unechtes) Teilintervall um-
fassen; dazu etwas ausfhrlicher Fabricius-
Hansen (1986: 334 ff.). Und das heit wie-
derum, da Tempora dann ausschlielich die
Relation zwischen Sprechzeit (bzw. Evalua-
tionszeit) und Betrachtzeit spezifizieren; die
Ereigniszeit (dort Aktzeit genannt) selber ist
unbestimmt, indefinit innerhalb des Bezugs-
rahmens. Auch Ballweg (1988) bewertet tem-
pushaltige Stze relativ zu einer Buerleschen
Betrachtzeit und einer Sprech- bzw. Orientie-
rungszeit (d. h. Evaluationszeit im obigen
Sinne). Nerbonne (1985) arbeitet seiner
Terminologie zum Trotz mit einem hnli-
chen Modell, da seine event time als die
Zeit definiert wird, at (subintervals of) which
temporally atomic sentences must hold und
somit keine Ereigniszeit im eigentlichen Sinne,
sondern eher eine Buerlesche Betrachtzeit ist
(vgl. Nerbonne 1985: 64); seine reference
time entspricht anscheinend teils Ballwegs
Orientierungszeit, teils einer zweiten, gre-
ren Betrachtzeit. Auch die location und re-
ference time bei Bertinetto (1986), Rohrer
(1986) u. a. sind jeweils als zeitlicher Bezugs-
rahmen und Orientierungszeit im erwhnten
Sinne zu verstehen; vgl. dazu auch Fabricius-
Hansen (1986: 51 ff.).
In den auf der Diskursreprsentationsse-
mantik basierenden Tempusarbeiten (s. oben)
wird hingegen ein Referenzzeitbegriff verwen-
det, der sich eher mit dem Reichenbachschen
deckt, insofern als die Referenzzeit hier nicht
unbedingt den Rahmen einer Ereigniszeit ab-
gibt und die Beziehung zwischen Ereignis-
und Referenzzeit Y in (31b) deshalb
u. a. nach dem Tempus variiert. Interessant
sind in diesen Arbeiten nicht zuletzt die ber-
legungen zum Einflu der Aktionsart oder
des Aspekts (z. B. pass simple vs. imparfait)
auf diese Relation (s. unten).
In den situationssemantischen Tempus-
analysen entsprechen utterance location (1
d
)
und die durch speakers connection gege-
bene location (1
c
) der Sprechzeit (t
o
) bzw. der
Referenzzeit (t
r
) in (31), nur da locations
nicht einfach Zeitintervalle, sondern zweidi-
mensionale raum-zeitliche Entitten (Regio-
nen) sind; dabei ist l
c
bei Cooper (1986) eher
einer Reichenbachschen Referenzzeit als einer
Buerleschen Betrachtzeit hnlich, da die lo-
cation der beschriebenen Situation (d. h. im
Prinzip die Ereigniszeit) l
c
umgeben kann.
35. Tempus 739
durch das Vorkommen bestimmter Tempo-
raladverbiale mitbedingt sind, in drei Typen
ein. Differenziertere Darstellungen tempora-
ler Verankerung (temporal-anaphorischer
Ketten) in Texten und komplexen Stzen fin-
den sich z. B. bei Hinrichs (1986) und in Cas-
cio & Vet (1986).
Eine Folge von Stzen, die nicht durch
zeitliche Verankerung, d. h. temporal-ana-
phorischen Bezug, miteinander verknpft
sind, ist nach Nerbonne (1985) ein temporal
freier Diskurs; s. (35) im Unterschied zu (34).
(35) Al went to New York. The others were
there once, too.
Komplizierte zeitliche Zusammenhnge in
Texten werden in den obengenannten Arbei-
ten von Cascio und Rohrer beschrieben.
4.4.5Tempussemantik vs. -pragmatik
In mehreren neueren Tempusbeschreibungen
z. B. Heringer (1983), Nerbonne (1985),
Comrie (1985), Ballweg (1984, 1988), Gre-
wendorf (1984a), Fabricius-Hansen (1986)
wird zwischen Tempussemantik und -prag-
matik unterschieden; das heit, Tempusge-
brauch wird nicht ausschlielich semantisch
(wahrheitsfunktional) beschrieben, sondern
es werden in variierendem Ausma auch
pragmatische Interpretationsprinzipien (Gri-
cesche Konversationsmaximen etc., s. Artikel
14) herangezogen, um Tempusverwendungen
oder kontextuelle Tempusbedeutungen zu er-
klren, die sich nicht unmittelbar aus der se-
mantischen Beschreibung des jeweiligen Tem-
pus ableiten lassen.
Beispielsweise betrachtet Ballweg (1984,
1988) das Prsens im Dt. als semantisch neu-
tral in dem Sinne, da es alle mglichen
Relationen zwischen Sprechzeit und Betracht-
zeit (und damit auch zwischen Sprech- und
Ereigniszeit) erlaube. Das historische Prsens
bildet dann semantisch keinen Sonderfall; an-
dererseits mssen dann Gricesche Konver-
sationsmaximen eingesetzt werden, um den
blichen Gegenwartsbezug zu erklren in den
Fllen, wo keine andere Betrachtzeit explizit
festgelegt ist. Umgekehrt bietet Grewendorf
(1984a) eine enge semantische Definition des
Prsens (als Nicht-Vergangenheitstempus),
um anschlieend alle Abweichungen ein-
schlielich des historischen Prsens pragma-
tisch wegzuerklren. Es kann vor dem Hin-
tergrund nicht wundernehmen, da Lenerz
(1986) eine gewisse Willkr der Arbeitsteilung
von Semantik und Pragmatik beanstandet,
die eine Begriffsklrung ntig erscheinen
lasse.
sen 1986: 68 ff.). Meistens wird angenom-
men, da das Referenzzeitadverbial im Ver-
hltnis zum Tempus den weiteren Skopus hat;
mit einer geeigneten Semantik kann aber auch
umgekehrt dem Tempus der weitere Skopus
zugeschrieben werden (vgl. Fabricius-Hansen
1986, Ballweg 1988), oder die Skopusproble-
matik kann wegfallen wie in den Darstellun-
gen der Diskursreprsentationstheorie und
der Situationssemantik.
4.4.4Tempus in Texten
Whrend die klassische Zeitlogik sich auf
die Beschreibung einfacher isolierter Stze be-
schrnkte, ist eine stattliche Reihe linguisti-
scher Tempusarbeiten der Untersuchung von
tense in discourse, Tempus in Texten, gewid-
met; s. u. a. Smith (1980), Cascio & Vet
(1986), Dowty (1986). Es handelt sich dabei
oft um Sequenzen einfacher Stze, whrend
Tempusgebrauch in komplexen Stzen s.
vor allem Brecht (1974), Rohrer (1977b,
1985), Gabbay & Rohrer (1978), Smith (1978)
keineswegs so grndlich behandelt worden
ist, wie man erwarten knnte was z. T. auf
Unzulnglichkeiten des Beschreibungsappa-
rats beruhen drfte. Arbeiten wie Kamp &
Rohrer (1983), Cascio (1986), Cascio & Roh-
rer (1986) zeigen nmlich mit aller Deutlich-
keit, da ein Beschreibungsmodell mit zwei
Zeitparametern la Reichenbach oder Bu-
erle den uerst komplizierten Zeitstrukturen
in (Texten mit) komplexen Stzen nicht ge-
recht werden kann.
Wichtig fr die Beschreibung von Tempora
in Texten sind die Begriffe temporal verbun-
dener Diskurs (temporally connected discourse,
Nerbonne 1985: 9, bzw. extended temporal
structure, Smith 1980) und Verankerung.
Eine Folge von zwei oder mehr Stzen bildet
einen temporal verbundenen Text, wenn der
zweite (bzw. jeder nicht-erste) Satz Elemente
aus dem (bzw. einem) Vorgngersatz fr seine
temporale Interpretation verwertet. Beispiele
sind (34a,b) aus Nerbonne (1985) , wo
die Ereigniszeit des ersten Satzes als Refe-
renzzeit des/der nachfolgenden dient.
(34)
a. Al went to New York. The others
were there, too.
b. Al went to New York. Bo had found
him a room. He went directly to it.
Smith (1980: 358 f.) bezeichnet den nachfol-
genden Satz als zeitlich verankert (anchored)
im betreffenden Vorgngersatz und teilt Stze
nach ihren Verankerungsmglichkeiten, die
nicht nur durch das Tempus, sondern auch
740 IX. Verbalsemantik
eben nicht betrachtet; in einem Fall wie (27)
ist dies ausgeschlossen, der Endmoment einer
Ereigniszeit, d. h. eine abgeschlossenene Er-
eigniszeit mu hier innerhalb der vorgegebe-
nen Betrachtzeit liegen (s. auch Fabricius-
Hansen 1986: Kap. IV und V).
(27) Prsident Sadat wurde am 5. Oktober
1981 ermordet.
(36) Anna war am 5. Oktober 1981 zu Hause.
5.1Tempora in einfachen Stzen
In Prsensstzen ohne Referenzzeitadverbial,
die isoliert verwendet werden oder fr deren
temporale Deutung der etwaige sprachliche
Kontext nicht relevant ist, dient die Sprechzeit
selber im Reichenbachschen Sinne als Refe-
renzzeit, um die herum eine Ereigniszeit des
tempuslosen Satzes lokalisiert sein mu (wenn
man von der Mglichkeit sogenannten Zu-
kunftbezugs absieht; s. dazu Fabricius-Han-
sen 1986: 80 ff.). Angebliche Bedeutungsva-
rianten des Prsens aktuelles, habituel-
les, atemporales Prsens etc. (vgl. Die Tr
geht auf. Friederike raucht zu viel. Ele-
fanten werden alt.) haben nicht mit dem
Tempus, sondern mit der Bedeutung des Rest-
satzes zu tun mit typischen Eigenschaften
von Ereigniszeiten der jeweiligen tempuslosen
Proposition; vgl. Kratzer (1978), Fabricius-
Hansen (1986: 77 ff.) und auch Jespersen
(1924: 259).
Der Buerlesche Betrachtzeitbegriff findet
hier nicht so leicht Anwendung: es ist fraglich,
in welchem Sinne hier von einer spezifischen
kontextuell vorgegebenen (von der Sprechzeit
verschiedenen) betrachteten Zeit, die eine
Ereigniszeit als Teilintervall umfat, die Rede
sein kann. Wenn in solchen Fllen ein zeitli-
cher Bezugsrahmen vorliegt, dann wohl eben
die Gegenwart, verstanden als ein passend
groes sprechzeitinkludierendes Intervall
(bzw. als die Menge aller sprechzeitinkludie-
render Intervalle, vgl. Fabricius-Hansen 1986:
81); aber dieser Rahmen ist nicht mit dem
weiteren Kontext gegeben, sondern wird
durch das Tempus selber gesetzt.
Was das Prteritum betrifft das ja die
ganze Diskussion um die definite Tempus-
analyse ausgelst hat , so gilt nach Quirk
et al. (1985: 184):
It is not necessary, however, for the past tense to
be accompanied by an overt indication of time. [...]
Just as with the definite article [...], so with the
verb phrase, an element of definite meaning may
be recoverable from knowledge of
(a) the immediate or local situation;
5. Konkretisierung: Tempora in
verschiedenen Kontexttypen
Eine Grundannahme der modernen Tempus-
semantik ist, wie oben dargelegt, da Tem-
pora grundstzlich definit gedeutet werden
mssen und da man deshalb neben Sprech-
und Ereigniszeit mindestens einen weiteren
Zeitparameter eine Referenzzeit im einen
oder dem anderen Sinne braucht. Zweck
dieses Abschnitts ist es, diese These zu kon-
kretisieren und zu problematisieren, indem
fr Tempora in verschiedenen Kontexttypen
die Frage gestellt wird, inwiefern und in wel-
chem Sinne tatschlich eine Referenzzeit vor-
liegt und welchen Beitrag zur Gesamtbedeu-
tung des Satzes das Tempus jeweils leistet.
Dabei soll der Begriff Ereigniszeit im
Sinne von Wahrheitsintervall (s. Abschnitt 1)
verstanden werden; d. h. eine Ereigniszeit
einer untemporalisierten Proposition p (in
einer bestimmten Welt) ist ein Zeitintervall,
an dem der beschriebene Zustand/Vorgang/
die Handlung/das Geschehen vorliegt/ab-
luft/ausgefhrt wird/sich abspielt, ganz egal
ob dieses Intervall als Wahrheitsintervall des
Satzes (in der betreffenden Welt) abgeschlos-
sen oder Teilintervall eines greren Wahr-
heitsintervalls ist. Ob die zweite Mglichkeit
berhaupt vorliegt, ist eine Frage der Ak-
tionsart (des Aspekts): Bei imperfektiven bzw.
atelischen Propositionen wie Anna zu Hause
sein bilden nacheinanderfolgende Teilinter-
valle eines Wahrheitsintervalls selber Wahr-
heitsintervalle der Proposition: Wenn es wahr
ist, da Anna an einem bestimmten Tag von
zwlf bis achtzehn Uhr zu Hause ist, dann
sind auch z. B. die Intervalle von zwlf bis
vierzehn und von vierzehn bis achtzehn Uhr
beide Wahrheitsintervalle der Proposition.
Entsprechendes kommt bei perfektiven bzw.
telischen (oder perfektiv bzw. telisch verstan-
denen) Propositionen wie Prsident Sadat
ermordet werden nicht in Frage, da ein
Wahrheitsintervall hier den charakteristischen
Abschlumoment den Augenblick des
Sterbens mit umfassen mu.
Wenn gesagt wird, da eine Ereigniszeit der
(atelischen) Proposition Anna zu Hause
sein Teilintervall der adverbial vorgegebenen
Betrachtzeit (der 5. Oktober 1981) sein mu,
um (36) als uerung wahr zu machen, so
schliet das mithin nicht aus, da die Be-
trachtzeit innerhalb eines greren zusam-
menhngenden Wahrheitsintervalls der Pro-
position liegt was ber die Betrachtzeit
hinausgeht, ist jedoch nicht relevant, wird
35. Tempus 741
heit, so von einem spezifischen Teil der Ver-
gangenheit die Rede sein, deren Identitt
allerdings extensional unbestimmt bleiben
kann. Gerade darin liegt nun ein wesentlicher
Unterschied zwischen einem typischen Pr-
teritum und einem typischen oder echten
(Prsens-)Perfekt, wie er durch das Satzpaar
(38a,b) veranschaulicht wird (das Prteritum
und das Perfekt im Deutschen sind bekannt-
lich beide nicht mehr so typisch).
(38)
a. Did you beat your wife?
b. Have you beaten your wife?
In (38a) mu von einer bestimmten Gelegen-
heit in der Vergangenheit oder eventuell von
einer ganzen (abgeschlossenen) Ehezeit die
Rede sein. (38b) wird der Befragte hingegen
bejahen mssen, wenn er blo irgendwann
mal vor der Sprechzeit seine Frau geschlagen
hat (es sei denn, da die Situation das
Aussehen seiner Frau z. B. den relevanten
Zeitrahmen nicht noch links einschrnkt).
Das (Prsens-)Perfekt scheint hier in der Tat
die Funktion des indefiniten PAST-Opera-
tors der Zeitlogik zu haben (4.3); und so reden
denn auch z. B. Quirk et al. (1985: 193) von
einer indefinite past meaning des Perfekts.
Von einer kontextuell vorgegebenen begrenz-
ten Zeit in der Vergangenheit ist hier keine
Rede. Das (Prsens-)Perfekt etabliert viel-
mehr selber von der Sprechzeit als Evalua-
tions- oder Orientierungszeit aus einen zeitli-
chen Bezugsrahmen, der rechts mit der
Sprechzeit endet und dessen Anfang mg-
lichst weit zurckliegt; innerhalb dieses Rah-
mens mu dann mindestens eine Ereigniszeit
der tempuslosen Proposition lokalisiert sein;
vgl. auch das folgende, bei Latzel (1977: 215)
angefhrte Zitat aus Handkes Selbstbezich-
tigung:
(39) Ich habe gegessen. Ich habe ber den
Hunger gegessen. Ich habe ber den
Durst getrunken. Ich habe mir Speise
und Trank einverleibt. Ich habe die vier
Elemente zu mir genommen. [...]
In Fllen wie (40a-d) hilft der Kontext im
weitesten Sinne, dem vom Perfekt etablierten
Rahmen eine linke Grenze zu setzen, so da
es lediglich um das Vorhandensein einer ein-
zigen Ereigniszeit innerhalb des Rahmens
geht; dabei wird (zumindest als konversatio-
nelle Implikatur, s. Artikel 14) impliziert, da
etwaige Wirkungen des vergangenen Ereig-
nisses zur Sprechzeit noch bestehen das
Merkmal des sog. Zustands- oder Resultativ-
perfekts; vgl. Quirk et al. (1985) und auch
Fabricius-Hansen (1986: 106 ff.).
(b) the larger situation of general knowledge;
[...].
Der Satz (26) war ein Beispiel fr (a). Bei-
spiele fr (b) wren etwa die in (37):
(26) Peter didnt turn off the stove.
(37)
a. Byron died in Greece.
b. This picture was painted by the ow-
ners grandfather.
c. Goethe hatte mehrere Geliebte.
It is a matter of general knowledge that Byron is
a historical personage (and therefore that he must
have died at some time or another). The past time
in [Byron died in Greece] presupposes such common
ground between speaker and hearer: it is as if the
speaker had said: We all know that Byron died at
some time or the other. Well, when he died, he died
in Greece. (Quirk et al. 1985: 184)
Es ist also in solchen Fllen im Grunde ge-
nommen keine extensional bestimmte Zeit
kein bestimmtes begrenztes Zeitintervall in
der Vergangenheit als Referenzzeit vorgege-
ben; man mchte vielleicht eher sagen, da
die ganze Vergangenheit vom Tempus selber
als zeitlicher Bezugsrahmen gesetzt wird:
Der Byron-Satz ist wahr als uerung genau
dann, wenn die maximale ganz vor der
Sprechzeit liegende Zeit die Ereigniszeit der
Proposition Byron in Griechenland sterben
enthlt, wobei allerdings vorausgesetzt wird,
da Byron vor der Sprechzeit gelebt hat und
deshalb auch vor der Sprechzeit gestorben ist.
Mit anderen Worten: Wenn ein bestimmter,
begrenzter Teil der Vergangenheit als Refe-
renzzeit zu verstehen ist, dann ist dieser Teil
nicht extensional, sondern durch eine Art de-
finite description bestimmt etwa als die
(einzige) Zeit, die sich mit dem (Leben und)
Tod von Byron, mit der Entstehung des be-
treffenden Gemldes, mit dem (erwachsenen)
Leben Goethes deckt. Dieser Gebrauch des
Prteritums setzt mithin die Unikalitt des im
Restsatz beschriebenen Geschehens voraus: es
mu sich um eine Proposition handeln, fr
die es (in der betreffenden Welt) genau ine
abgeschlossene Ereigniszeit gibt. Deshalb
wird ein Satz wie Mein Vater rasierte sich
langsam ohne weiteren Kontext habituell, als
Beschreibung einer permanenten Eigenschaft
der Rasiergewohnheiten meines Vaters
verstanden, die natrlich einmalig ist, und
nicht als Beschreibung einer einzelnen Ra-
sierhandlung; denn dazu bruchte es einer
zeitlich nher bestimmten Referenzzeit.
Die zeitliche Definitheit des Prteritums
erweist sich somit als zeitliche Spezifizitt: Es
mu, wenn nicht von der ganzen Vergangen-
742 IX. Verbalsemantik
Bezugsrahmen hergibt, die fr die tempo-
rale Deutung des Satzes relevant wre. Eine
spezifische Referenzzeit kann dann eventuell
situationell oder durch allgemeines Hinter-
grundwissen als definit beschreibbares Inter-
vall geliefert werden, wie es fr Prteritum-
stze der Fall zu sein scheint, oder sie mu
sozusagen automatisch vorgegeben sein. Fat
man die Referenzzeit als eine Orientierungs-
zeit auf, relativ zu der das Tempus dann eine
Ereigniszeit (als vorausliegend, nachfolgend
oder orientierungszeitinkludierend) lokali-
siert, so mu im zweiten Falle die Sprechzeit
selber als Referenzzeit aufgefat werden, d. h.
auch den zweiten Zeitindex in (31) (Abschnitt
4.4.2) belegen. Wird die Referenzzeit hingegen
als zeitlicher Bezugsrahmen (Buerlesche Be-
trachtzeit) verstanden, der eine Ereigniszeit
als Teilintervall umfat, so ist mangels eines
spezifischeren Bezugsrahmens die ganze Zeit-
linie (bzw. die Menge aller Teilintervalle der-
selben) als kontextuell vorgegebener Bezugs-
rahmen anzusetzen, der dann durch das je-
weilige Tempus eingeschrnkt wird (auf Ge-
genwart, Vergangenheit etc.); ansonsten
verfllt man in Zirkularitt, indem man als
vorgegebenen Bezugsrahmen gerade das an-
setzt, was das Tempus selber intuitiv be-
trachtet abhngig von der Sprechzeit als
Bezugsrahmen ausweist.
5.2Einfache Stze mit
Referenzzeitadverbial
Einfache Stze mit Referenzzeitadverbial er-
scheinen im Prinzip nur dann diskurseinlei-
tend oder im temporal freien Diskurs, wenn
es sich um ein absolutes oder sprechzeitrelativ
(deiktisch) verwendbares Adverbial handelt
(z. B. am 1. Oktober 1985, im Jahre 1767 vs.
heute, jetzt, gestern, am Mittwoch). Das Ad-
verbial spezifiziert dabei in Kombination mit
dem Prsens, Prteritum oder Futur I nor-
malerweise einen zeitlichen Bezugsrahmen
(vgl. Abschnitt 4.4.2 oben); vgl. auer (27, 36)
die folgenden Beispiele:
(41)
a. I came to town last Monday.
b. Diese Woche ist nicht viel los.
c. Pierre partira dans deux jours.
Dabei ist festzustellen, da das Prsens im
Deutschen (und vielen anderen Sprachen) im
Unterschied zum Prteritum und Futur an-
scheinend keine besonderen Bedingungen
stellt an die Relation zwischen der adverbial
festgelegten Betrachtzeit und der Sprechzeit:
jene darf diese berlappen wie in (41b) oder
ihr nachfolgen (futurisches Prsens) oder
(40)
a.
ber Bismarck und seine Zeit haben
sich viele Fehler und Vorurteile ge-
bildet.
b. Der Lebensindex ist gestiegen.
c. Es hat aufgehrt zu regnen.
d. Ich habe das Chaos in Deutschland
berwunden, die Ordnung wiederher-
gestellt, die Produktion auf allen Ge-
bieten unserer nationalen Wirtschaft
ungeheuer gehoben. [...]
(Aus einer Rede Hitlers am 28. 4.
1939)
Der Kontext liefert mithin beim (Prsens-)
Perfekt wie beim Prsens keine eigene von der
Sprechzeit verschiedene Referenzzeit, sondern
hchstens eine linke Grenze des zeitlichen Be-
zugsrahmens, als dessen rechte Grenze das
Perfekt selber die Sprechzeit ausweist. Wir
sehen hier die Kompositionalitt des (Pr-
sens-)Perfekt: das finite Prsens ist fr die
Wahl der Sprechzeit als Orientierungszeit, das
infinite Perfekt fr die Etablierung eines mit
der Orientierungszeit endenden Bezugsrah-
mens, d. h. fr das Element der Vorzeitigkeit
verantwortlich.
Auch in generellen/generischen Perfektst-
zen wie Ein Akademiker hat studiert. (s. 4.1)
lassen sich die jeweiligen Beitrge des finiten
und des infiniten Tempus unschwer identifi-
zieren: Das Prsens legt fest, da von einem
sprechzeitinkludierenden, nicht nher be-
grenzten Zeitraum (der Gegenwart) die Rede
ist; und mit dem (infiniten) Perfekt wird aus-
gedrckt, da es fr eine beliebige Person x,
die zu einer beliebigen Zeit t innerhalb dieses
Zeitraums Akademiker ist, ein mit t endendes
Intervall gibt, das eine Ereigniszeit der Pro-
position x studieren umfat; vgl. Comrie
(1985: 41).
Wenn gesagt wird, da ein typisches Pr-
teritumtempus definit (spezifisch), ein typi-
sches (Prsens-)Perfekt hingegen indefinit
(unspezifizisch) zu deuten ist, so mu aller-
dings hinzugefgt werden, da der Unter-
schied in der Praxis nicht immer so scharf ist;
dies bezeugt die wiederholte mehr oder we-
niger vollstndige Vermischung beider Tem-
pustypen, cf. Prteritum und Perfekt im Deut-
schen, pass simple und pass compos im
Franz., Aorist und Perfekt im Griechischen
(s. Schwyzer 1966: 263 f.).
Als Fazit ergibt sich folgendes: Da ein
Satz temporal frei verwendet wird, heit,
da kein sprachlicher Kontext des Satzes eine
eigene Referenzzeit eine zweite Orientie-
rungszeit oder einen spezifischen zeitlichen
35. Tempus 743
andererseits (46).
(44)
a. In einem Jahr haben wir alles erledigt.
b. In einem Jahr werden wir alles erle-
digt haben.
(45)
a. Sptestens 1990 haben wir den Bau
beendigt.
b. Sptestens 1990 werden wir den Bau
beendigt haben.
(46)
a. Jetzt hast du smtliche Zeitungen ge-
lesen.
b. Jetzt wirst du smtliche Zeitungen ge-
lesen haben.
Die zweite Alternative, die auch mit modaler
Bedeutung des Futur II verbunden ist, liegt
vor, wenn das Adverbial eine der Sprechzeit
vorausgehende Zeit bezeichnet. Im Unter-
schied zum Dt., Franz. und Italienischen (s.
Bertinetto 1986: 72) scheint das Prsens-Per-
fekt im Englischen und den skandinavischen
Sprachen dabei ein sprechzeitrelatives Adver-
bial zu verlangen oder zumindest nur unter
bestimmten Bedingungen mit absoluten Ad-
verbialen vertrglich zu sein; auch ein Ge-
genwartsadverbial kann im Dt. die Betracht-
zeit eher als die Orientierungszeit spezifizie-
ren; vgl. (48, 49) und (45, 47), wenn nach
1990 bzw. 1981 geuert.
(47)
a. Prsident Sadat ist am 5. Oktober
1981 ermordet worden.
b. Prsident Sadat wird am 5. Oktober
1981 ermordet worden sein.
(48) Ive seen this movie a couple of years
ago.
(49)
a. Anna hat diese Woche sehr fleiig
gearbeitet.
b. Anna wird diese Woche sehr fleiig
gearbeitet haben.
Ballweg (1988) fhrt im Rahmen einer kom-
positionellen Analyse der Perfekttempora die
unterschiedliche semantische Funktion des
Referenzzeitadverbials darauf zurck, da
das Adverbial im einen Fall (als Orientie-
rungsadverbial) den infiniten Perfektopera-
tor im Skopus habe, im anderen Fall (als
Betrachtzeitadverbial) umgekehrt in dessen
Skopus stehe; vgl. auch Fabricius-Hansen
(1986: Kap. II.5.).
Es sei noch erwhnt, da ein Referenzzeit-
adverbial in einigen Sprachen z. B. im
Deutschen in Prsens- und Prteritum-
stzen mit bestimmten Typen durativen Ad-
verbialen statt der Betrachtzeit eine Orientie-
rungszeit abgeben kann, von der aus zurck-
berechnet wird: in anderen Sprachen wird
vorausliegen (sog. historisches Prsens) wie
in (42), je nachdem, ob der Satz vor oder
nach dem betreffenden Monat geuert wird.
Die Position der faktischen Sprechzeit ist
m. a. W. irrelevant fr die Bewertung des Pr-
sens, wenn erst eine eigene Referenzzeit vor-
gegeben ist.
(42) Im Juni dieses Jahres wird ein neues
Theater erffnet.
Nur scheinen historische Prsensstze eine
Fortsetzung zu verlangen, wenn ihnen kein
relevanter sprachlicher Kontext vorausgeht:
In vlliger Isolation geuert, mte (42) fu-
turisch verstanden werden, als historischen
Prsenssatz mu man sich ihn etwa als Teil
(eventuell Einleitung) eines Berichts vorstellen
(vgl. Fabricius-Hansen 1986: 84 ff.). Dies
wrde dann heien, da die Sprechzeit nur
noch im temporal verbundenen Diskurs ihre
Relevanz verliert; ansonsten wird beim Pr-
sens vorausgesetzt, da die vorgegebene Be-
trachtzeit der Sprechzeit nicht ganz voraus-
liegt.
In temporal freien Stzen mit Plusquam-
perfektum (Prteritum Perfekt) wie (43) spe-
zifiziert das Referenzzeitadverbial keine Bu-
erlesche Betrachtzeit, sondern die Orientie-
rungszeit, vor der gem der indefiniten
Vorzeitigkeitsbedeutung des (infiniten) Per-
fekts (s. oben) eine Ereigniszeit lokalisiert
sein mu; und zwar mu die Orientierungszeit
gem der Bedeutung des finiten Prteri-
tum der Sprechzeit vorausliegen.
(43)
a. Roger had (already) graduated last
week.
b. Gestern morgen hatte ich alles erle-
digt.
In temporal freien Stzen mit (Prsens-)Per-
fekt schlielich kann ein Referenzzeitadver-
bial grundstzlich entweder wie beim Plus-
quamperfekt die Orientierungszeit den ter-
minus ante quem der Ereigniszeit oder wie
beim Prteritum, Prsens und Futur die Be-
trachtzeit, den zeitlichen Rahmen um das Er-
eignis, spezifizieren. Die erste Alternative, wo
die adverbial bezeichnete Zeit die normale
Rolle der Sprechzeit in Perfektstzen ohne
Adverbial (s. oben 5.1) bernimmt, liegt im-
mer vor in Stzen mit zukunftbezogenem
Adverbial, in welchem Fall das Perfekt mit
dem Futur II quivaliert, und oft auch in
Stzen mit Gegenwartsadverbial wie jetzt,
heute, in welchem Fall das Futur II sog. mo-
dale Beutung hat, weil die Ereigniszeit dann
vor der Sprechzeit lokalisiert wird; vgl. einer-
seits (44, 45) (wenn vor 1990 geuert) und
744 IX. Verbalsemantik
ferenzzeit berlappen (eventuell inkludieren)
oder unmittelbar nachfolgen, je nach (u. a.)
Aktionsart/Aspekt des Satzes:
(52) Kollwitz wlzt sich mhselig von der
einen Seite auf die andere. Sein rechtes
Bein schmerzt entsetzlich. Mechanisch
greift die Hand unters Kissen und holt
Briefe hervor.
Hier tritt hier der Unterschied zwischen engl.
simple past und past progessive etc. wie
zwischen franz. pass simple und imparfait
besonders deutlich zu Tage: Progressive bzw.
imparfait lokalisiert eindeutig die S2-Ereig-
niszeit als Referenzzeitinkludierend und kann
selber keine neue Referenzzeit abgeben (fr
Einzelheiten s. Partee 1984b, Hinrichs 1986,
Kamp & Rohrer 1983).
(53)
a. He awoke to the sound of her
screeching. She was shaking him.
b. Jameson entered the room. He shut
the door carefully behind him.
(54)
a. Pierre entra. Marie tlphonait.
b. Pierre entra. Marie tlphona.
Enthlt S2 ein Plusquamperfekt bzw. (histo-
risches) Perfekt, so bildet die mit der Ereig-
niszeit von S1 gegebene Referenzzeit ent-
sprechend der Sprechzeit in isolierten Per-
fektstzen die Zeit, vor der eine Ereignis-
zeit von S2 lokalisiert sein mu; ein terminus
post quem kann dabei von dem Kontext ge-
liefert werden. (In Sprachen wie Deutsch und
Franzsisch, wo das (Prsens-)Perfekt ziem-
lich uneingeschrnkt auch definit verwend-
bar ist, kann das Perfekt im temporal ver-
bundenen Diskurs auch einem Prteritum
entsprechen.)
(55) Paul Tesman kndigte/kndigt. Er hatte/
hat sich einen Muskelschaden zugezo-
gen.
Wenn S1 ein Referenzzeitadverbial enthlt, so
braucht S2 (ohne Adverbial) nicht wie oben
in der Ereigniszeit von S1 verankert zu sein,
sondern er kann das adverbial spezifizierte
Zeitintervall von S1 als Referenzzeit verwer-
ten; und dies ist sogar die einzige Mglichkeit,
wenn S1 kein abgeschlossenes Ereignis be-
schreibt. (56) bietet ein Beispiel dafr, wie
beide Verankerungsprinzipien innerhalb eines
Textes verwendet werden knnen: S2 ist in
der Ereigniszeit von S1, S3 und S4 hingegen
in dessen adverbial spezifizierter Referenzzeit
(Betrachtzeit) verankert.
(56) In der Nacht gerieten im Holiday Inn
ein paar Zimmer in Brand (S1).
dafr das entsprechende Perfekttempus ver-
wendet; s. (50a) vs. (50b) und (51a) vs. (51b).
(50)
a. Heute arbeite ich seit fnf Jahren in
diesem Bro.
b. I dag har jeg arbejdet i fem r p
dette kontor.
Heute habe ich fnf Jahre lang in
diesem Bro gearbeitet
(51)
a. Ich lernte Anna im Sommer 1970
kennen.
Zu der Zeit studierte sie seit drei
Semestern Chemie
b. (...) P den tid havde hun studeret
kemi i tre semestre.
Zu der Zeit hatte sie drei Semester
lang Chemie studiert
5.3Einfache Stze im temporal
verbundenen Diskurs
Temporal connectedness von zwei unmittel-
bar oder mittelbar nacheinanderfolgenden
Stzen uert sich wie oben erwhnt darin,
da ein Temporalausdruck im zweiten Satz
auf ein Element im ersten Satz irgendwie ana-
phorisch bezogen, in diesem verankert ist.
Da eine Verankerung grundstzlich durch
Tempora und kontextrelative (anaphorische)
oder kontextrelativ verwendbare Temporal-
adverbiale zustande kommen kann, ergeben
sich verschiedene Mglichkeiten, je nachdem,
ob keiner der beiden Stze, nur der erste, nur
der zweite oder auch beide ein Referenzzeit-
adverbial enthlt bzw. enthalten.
Handelt es sich um zwei Stze ohne Refe-
renzzeitadverbial, so scheint zu gelten, da
der zweite Satz (S2) nur dann im ersten (S1)
verankert sein kann, wenn S1 ein (abgeschlos-
senes) Ereignis (accomplishment/achieve-
ment in der Terminologie von Vendler) be-
schreibt, d. h. perfektive(n) Aktionsart/
Aspekt aufweist. Die Ereigniszeit von S1 gibt
dann die Referenzzeit (Orientierungszeit) von
S2 ab, relativ zu der die Lokalisierung der
Ereigniszeit von S2 berechnet wird; sie ber-
nimmt somit bei der Bewertung von S2 die
Rolle der Sprechzeit in temporal freien St-
zen (s. 5.1). Angemessen ist es vielleicht
mit Hinrichs (1986), Partee (1984b) zu sagen,
da die Ereigniszeit von S1 eine neue, ihr
selber unmittelbar nachfolgende Referenzzeit
fr S2 etabliert, d. h. da sie the current
reference time im Text etwas nach vorne ver-
schiebt. Weist S2 Prteritum (bzw. ein an-
deres definites Vorzeitigkeitstempus) oder
(historisches) Prsens auf, so mu eine Er-
eigniszeit von S2 die durch S1 errichtete Re-
35. Tempus 745
der Orientierungszeit etabliert wird, sondern
adverbial vorgegeben ist.
Temporal verbundener Diskurs ist, wie
oben (5.2) angedeutet, das Gebiet des histo-
rischen Prsens und auch das der sog. erleb-
ten Rede. Das historische Prsens lt sich
am einfachsten dahingehend beschreiben, da
das Prsens in einfachen Stzen keine Bedin-
gungen stellt an die Relation zwischen
Sprechzeit und Referenzzeit, wenn eine eigene
Referenzzeit sprachlich vorgegeben ist; die
Sprechzeit ist irrelevant fr die Interpretation
von Prsensstzen, die ein eigenes Referenz-
zeitadverbial enthalten oder zeitlich im
sprachlichen Kontext verankert sind. Und die
Tatsache, da das gleiche fr das (Prsens-)
Perfekt gilt da auch das Perfekt histo-
risch verwendet werden kann, s. oben ,
whrend das Prteritum und Plusquamper-
fekt gleichermaen eine der Sprechzeit vor-
ausliegende Referenzzeit verlangen, spricht
natrlich wieder fr eine kompositionelle
Analyse der Perfekttempora (s. Abschnitt 1).
Der Trick der erlebten Rede (style indirecte
libre) besteht im temporalen Bereich nun sei-
nerseits vor allem darin, da Tempora des
Prteritumssystems, die eine vor der fakti-
schen Sprechzeit liegende Referenzzeit vor-
aussetzen, mit deiktischen Referenzzeitadver-
bialen verbunden werden, deren Extension
eigentlich relativ zur Sprechzeit berechnet
werden sollte; vgl. (59).
(59) Hans lehnte sich zufrieden zurck. Mor-
gen war Sonntag und in einem Augen-
blick lief sein Lieblingsfilm an (wrde
anlaufen).
Um einen zeitlichen Zusammenhang herzu-
stellen, mu dann dem ersten Satz eine Zeit
entnommen werden, der die vom S2-Tempus
verlangte Relation zur faktischen Sprechzeit
aufweist und zugleich dem Adverbial im zwei-
ten Satz als Evaluationszeit dienen kann; in
Abhngigkeit von der Evaluationszeit spezi-
fiziert das Adverbial dann die Referenzzeit
des zweiten Satzes. In dieser Art und Weise
wird eine Art sekundres deiktisches Zentrum
in der Vergangenheit geschaffen, eine beson-
dere temporale Perspektive (cf. Kamp &
Rohrer 1983, Rohrer 1986), die fr die Be-
wertung smtlicher Stze der erlebten Rede
die Rolle der Sprechzeit in direkter Rede
spielt. Der Bezug des Temporaladverbials
mu sich also hier gewissermaen dem des
Tempus unterwerfen, whrend beim histori-
schen Prsens das Gegenteil der Fall ist.
Der Brand wurde jedoch gelscht (S2).
Die Rue Danas lag streckenweise unter
Dauerbeschu (S3).
Die Front verlief anders als in der Nacht
vorher (S4).
Betrachten wir noch kurz den Fall, wo S2
(und eventuell auch S1) ein Referenzzeitad-
verbial enthlt. Fr das Adverbial in S2 kom-
men natrlich mit Bezug auf S2 selber grund-
stzlich die gleichen Funktionen in Frage wie
in temporal freien Stzen mit Referenzzeitad-
verbial (s. 5.2). Interessant ist jedoch die zeit-
liche Beziehung zwischen S1 und S2, die
durch das Zusammenspiel von Zeitadverbial
und Tempus zustandekommt. Es zeigen sich
nmlich hier besonders deutlich die beiden
verschiedenen Leistungen von Referenzzeit-
adverbialen in Kombination mit Perfekttem-
pora (s. oben); vgl. das folgende Textpaar.
(57) Winckelmann wurde/wird 1717 als Sohn
eines Schuhflickers in Stendal geboren
(S1).
1743 hatte/hat er es zum Konrektor in
Seehausen gebracht (S2).
(58) Im Mrz 1930 war/ist es soweit (S1).
Stresemann war/ist im Oktober 1929 ge-
storben (S2).
In S2 von (57) ist die adverbial spezifizierte
Referenzzeit (1743) eindeutig als Orientie-
rungszeit zu verstehen, d. h. als rechte Grenze
des mit dem Perfekttempus etablierten zeitli-
chen Bezugsrahmens, als dessen linke Grenze
die Referenzzeit (Betrachtzeit) (1717) von S1
dient: Innerhalb dieser Zeitspanne mu die
Ereigniszeit der untemporalisierten Proposi-
tion Winckelmann es zum Konrektor in See-
hausen bringen liegen, wobei pragmatische
berlegungen fr eine Lokalisierung relativ
nahe an der rechten Grenze sprechen. In (58)
hingegen dient die adverbiale Referenzzeit
(Oktober 1929) in S2 als endgltiger zeitlicher
Bezugsrahmen (Betrachtzeit), der die Ereig-
niszeit der untemporalisierten Proposition
Stresemann sterben umfat, und die Refe-
renzzeit (Betrachtzeit) von S1 (Mrz 1930)
liefert die Orientierungszeit von S2: das Per-
fekttempus in S2 signalisiert oder wird
dadurch ausgelst , da die Betrachtzeit
(Oktober 1929) und damit auch die Ereignis-
zeit von S2 der vorgegebenen Orientierungs-
zeit (Mrz 1930) vorangeht. Das Perfekt-
tempus ist wie in den oben (5.2) besprochenen
Fllen definit in dem Sinne, da der
endgltige zeitliche Bezugsrahmen nicht erst
durch das Perfekttempus in Abhngigkeit von
746 IX. Verbalsemantik
mehrmals tut, und relativ zu dieser unbe-
stimmten Ereigniszeit des Nebensatzes wird
dann eine Ereigniszeit des Obersatzes (evtl.
mehrere) in die Relation der berlappung
oder unmittelbaren Nachfolge gesetzt (s. dazu
Fabricius-Hansen/Sb 1983). A temporal
clause always has the same Zeitstufe (pa, pr
or fu) and the same temporal perspective as
its main clause. (Rohrer 1986: 92)
(60)
a. Der Fhrer wird die Nachrichten be-
kommen, wenn er frhstckt.
b. Der Fhrer bekommt die Nachrich-
ten, wenn er frhstckt.
c. Der Fhrer bekam gestern die Nach-
richten, als er frhstckte.
d. Der Fhrer bekam die Nachrichten,
wenn er frhstckte.
In Konditional- und Kausalgefgen hingegen
mu der Nebensatz selber zeitlich definit sein
im selben Sinne wie ein syntaktisch selbstn-
diger Satz, d. h. relativ zur Sprechzeit und/
oder zu einer spezifischen, kontextuell gesetz-
ten Referenzzeit bewertet werden. Die beiden
Teilstze brauchen keinen gemeinsamen zeit-
lichen Bezugsrahmen, sie knnen je ihre
eigene Referenzzeit haben, wie daraus ersicht-
lich wird, da in solchen Satzgefgen grund-
stzlich keine Restriktionen bezglich der
Tempuskombinationen bestehen; es kann also
hier die dritte der oben erwhnten Alternati-
ven vorliegen. Vgl. (61).
(61)
a. Wenn Hans nicht zu Hause ist, war
er gestern auch nicht da.
b. Weil der Wetterbericht so schlecht
war, werden wir nicht wegfahren.
c. Wenn der Fhrer gefrhstckt hat,
bekommt er jetzt gleich die Nachrich-
ten.
hnlich wie Kausalstze etc. sind auch Re-
lativstze temporal als selbstndige Stze zu
betrachten: das Tempus eines Relativsatzes
kann direkt auf die Sprechzeit bezogen (deik-
tisch, absolut verwendet) werden wie im
temporal freien Diskurs oder es kann ana-
phorisch im satzexternen sprachlichen Kon-
text verankert sein; handelt es sich dabei um
einen syntaktisch bergeordneten Teilsatz in-
nerhalb des gleichen Satzgefges, liegt sog.
relativer Gebrauch des Tempus vor. Vgl.:
(62)
a. Hier jai rencontr une jeune fille qui
tudie la linguistique.
Gestern traf ich ein junges Mdchen,
das Linguistik studiert.
b. Hier jai rencontr une jeune fille qui
tudiait la linguistique.
Es sei noch daran erinnert, da in diesem
Abschnitt im wesentlichen von Paaren nach-
einanderfolgender Stze die Rede gewesen ist.
Die zeitlichen Strukturen in Texten, die aus
vielen Stzen bestehen, knnen natrlich viel
komplizierter werden, weil ein Satz nicht im-
mer in seinem unmittelbaren Vorgngersatz
zeitlich verankert ist. Deswegen kann der Text
zeitlich mehrdimensional oder mehrstrngig
werden in dem Sinne, da er mehrere tem-
poralanaphorische Ketten enthlt und zwi-
schen Elementen verschiedener Ketten keine
Relationen spezifiziert sind (vgl. die Diskus-
sion ber die Nachvergangenheit und Vor-
zukunft im Abschnitt 4.2.1). Solche komple-
xen Strukturen bilden das Hauptanliegen von
Cascio (1986), Adelaar & Cascio (1986).
5.4Tempora in komplexen Stzen
Dieser Gegenstand ist zu kompliziert und
noch zu unerforscht (fr Literaturhinweise s.
Abschnitt 4.4.4), um hier anders als andeu-
tungsweise behandelt zu werden. Das Kern-
problem lt sich dabei wie folgt formulieren:
Welche Rolle kann oder mu der eine Teilsatz
eines aus Ober- und Untersatz (Haupt- und
Neben-, Matrix- und Konstituentensatz etc.)
bestehenden komplexen Satzes spielen fr die
temporale Interpretation des anderen Teilsat-
zes? Nach welchen Prinzipien wird das Tem-
pus im jeweiligen Teilsatz gewhlt? Wichtig
ist es vor allem, ob (i) der Untersatz temporal
im Obersatz verankert ist, ob (ii) der Neben-
satz umgekehrt dem Obersatz eine Referenz-
zeit (Orientierungszeit) liefert oder ob (iii) die
beiden Teilstze temporal voneinander un-
abhngig sind. Es bestehen in dieser Hinsicht
mehr oder weniger deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Nebensatztypen
Komplementstzen, Relativstzen, Tem-
poralstzen, Konditional- und Kausalstzen
etc. (s. vor allem Rohrer 1986).
In eine Kategorie fallen sog. temporale Ne-
benstze, die im Verhltnis zum Obersatz die
Funktion eines Temporaladverbials eines
Referenzzeitadverbials oder einer anderen Art
Zeitadverbial haben. Solche Stze sind,
wenn sie selber kein Referenzzeitadverbial
enthalten, an sich zeitlich unbestimmt, spielen
jedoch im Verhltnis zum jeweiligen Obersatz
die Rolle einer relativen Zeitbestimmung;
d. h. es liegt hier die oben angedeutete Alter-
native (ii) vor. In den folgenden Stzen z. B.
wird nichts darber ausgesagt, wann der Fh-
rer jeweils frhstckt; es wird aber voraus-
gesetzt, da er es innerhalb eines zeitlichen
Rahmens, der u. a. durch das Tempus im
Obersatz festgelegt wird, genau einmal bzw.
35. Tempus 747
d. Tonio erfuhr dort, da Kids aus
Washington hergekommen waren.
Zu beachten ist jedoch, da das Tempus des
abhngigen Satzes nicht immer wie in den
obigen Fllen in Abhngigkeit von der Ereig-
niszeit des bergeordneten Satzes (der sekun-
dren Sprechzeit) oder der Relation zwischen
sekundrer und primrer Sprechzeit gewhlt
wird, d. h. nicht unbedingt relativ oder in der
Terminologie Brechts (1974) endophorisch
verwendet wird. Es kann vielmehr unter Um-
stnden auch absolut oder exophorisch ge-
braucht werden, d. h. in Abhngigkeit von
der primren Sprechzeit und/oder einer dem
weiteren Kontext zu entnehmenden Referenz-
zeit wie in einem syntaktisch selbstndigen
Satz. Die russischen Stze in (63) erlauben
deshalb an sich auch die folgenden berset-
zungen, wo der Nebensatz temporal nicht
vom Obersatz abhngt.
(65)
a. Didnt you know that he is in
Europe?
b. Didnt you know that he was in
Europe?
c. Didnt you know that he will be in
Europe?
5.5Abschlieendes
Abschlieend sei zum Thema Tempus im Text
und Satzgefge Rohrer (1986: 93f.) zitiert:
We have seen that for a sentence to be fully
interpretable in a given discourse we have to find
a reference point and a temporal perspective point.
Usually these points are provided by the preceding
sentence (or by the immediately dominating clause
in the case of subordinated clauses). Sometimes
however, one has to pick up a reference point which
was introduced several sentences before. There
exists a set of possible temporal referents (maybe
ordered by a salience relation) among which a tense
form in a given sentence may find its reference
time. This is analogous to the way we find a suitable
referent for an anaphoric pronoun. We can define
some configurational conditions which restrict the
set of reference markers from which a pronoun
may choose its referent. However we cannot define
exactly which referent among the set of possible
referents the anaphoric pronoun must pick up.
6. Literatur (in Kurzform)
Adelaar/Cascio 1986 Arens 1969 qvist 1965
Bach 1980 Ballweg 1981b Ballweg 1984 Ball-
weg 1988 Ballweg/Frosch 1981 Buerle 1977a
Buerle 1977b Buerle 1979b Baumgrtner/
Wunderlich 1969 Beauze 1767 Bennett/Partee
Gestern traf ich ein junges Mdchen,
das Linguistik studierte.
Ein eigenes Kapitel bildet der Tempusge-
brauch in Nebenstzen und Nebensatzgef-
gen, die von uerungsverben o. . abhn-
gen, d. h. in sog. indirekter Rede. In der Regel
nimmt bekanntlich das Tempus des unterge-
ordneten Satzes die Ereigniszeit des berge-
ordneten uerungssatzes als Referenzzeit
(temporal perspective point bei Rohrer 1986).
Sprachen variieren jedoch im Hinblick dar-
auf, ob die Lokalisierung dieser sekundren
uerungszeit im Verhltnis zur primren fr
die Tempuswahl relevant bleibt oder ob die
sekundre Sprechzeit die primre sozusagen
ersetzt. Im Russischen ist letzteres der Fall:
es wird hier im indirekten Referat das gleiche
Tempus verwendet wie im entsprechenden di-
rekten, oder anders gesagt: der Tempusge-
brauch der direkten Rede wird auf die indi-
rekte bertragen (Brecht 1974):
(63)
a. Ne znali (Prt.) li vy, to on v Evrope
(Prs.)?
Didnt you know that he was in Eu-
rope?
b. Ne znali (Prt.) li vy, to on byl
(Prt.) v Evrope?
Didnt you know that he had been in
Europe?
c. Ne znali (Prt.) li vy, to on budet
(Fut.) v Evrope?
Didnt you know that he would be in
Europe?
In anderen Sprachen z. B. im Englischen
und in den skandinavischen Sprachen
bleibt die primre Sprechzeit relevant und
wird die sekundre Sprechzeit als zustzliche
eigene Referenzzeit (Orientierungszeit) mit
bercksichtigt (wie in der erlebten Rede), so
da ein passendes Vorzeitigkeitstempus im in-
direkten Referat gewhlt werden mu, wenn
der uerungssatz selber ein Vorzeitigkeits-
tempus aufweist; es findet von der direkten
Rede aus gesehen eine sog. Tempustransposi-
tion oder -verschiebung statt, wie in den eng-
lischen bersetzungen oben. Im Deutschen
kommen im Indikativ beide Prinzipien zur
Verwendung, wie aus den Solfjeld (1983) ent-
nommenen Beispielen (64) hervorgeht; auf
den konjunktivischen Tempusgebrauch soll
hier nicht eingegangen werden.
(64)
a. Und da dachte ich, da sie ihn doch
lieber hat als mich.
b. Und ich dachte, da mich da einer
verpetzt hat.
c. Man brauchte Brenda nicht erst zu
erklren, da etwas faul war.
748 IX. Verbalsemantik
chael 1970 Nerbonne 1985 Nerbonne 1986 Par-
tee 1973a Partee 1984b Prior 1967 Quirk et al.
1985 Rauh 1983 Reichenbach 1947 Rescher/
Urquhart 1971 Rivire 1980 Rohrer 1977a
Rohrer 1977b Rohrer (ed.) 1977 Rohrer (ed.)
1978 Rohrer (ed.) 1980 Rohrer 1986 Sb
1978 Schwyzer 1966 Smith 1978 Smith 1980
Solfjeld 1983 Steube 1980 Steube 1983 Taylor
1977 Tedeschi/Zaenen (eds.) 1981 Tich 1980
Vater 1975 Vater 1983 Vet 1980 Vlach 1981
Weinrich 1971 Wunderlich 1970
Cathrine Fabricius-Hansen,
Oslo (Norwegen)
1978 van Benthem 1983a Bertinetto 1986 Blatz
1896 Brecht 1974 Brons-Albert 1978 Bull
1960 Cascio 1986 Cascio/Rohrer 1986 Cascio/
Vet (ed.) 1986 Comrie 1985 Cooper 1986 Cress-
well 1977b Curme 1922 Dahl 1985 Dowty
1972 Dowty 1979 Dowty 1982 Dowty (ed.)
1986 Fabricius-Hansen 1986 Fabricius-Hansen/
Sb 1983 Franois 1984 Gabbay/Rohrer 1978
Grewendorf 1982a Grewendorf 1982b Grewen-
dorf 1984a Guenthner 1979 Heger 1963 Herin-
ger 1983 Hinrichs 1986 Houweling 1986 Jesper-
sen 1924 Kamp 1981 Kamp/Rohrer 1983 Kas-
her/Manor 1980 Koenig 1980 Kratzer 1978
Lenerz 1986 Lyons 1977 McCoard 1978 Mi-
36. Adverbial Modification in -Categorial Languages
cult. The idea is that in (1) the phrase winks
roguishly is a (complex) predicate in the same
syntactic category as winks. This means that
in the underlying -categorial language it
would be in E
(s/n)
. So it would seem that the
function of roguishly is to convert the one-
place predicate winks into the one-place pred-
icate winks roguishly. For this reason adverbs
like roguishly have been called predicate mod-
ifiers and the first task of this section will be
to examine the predicate-modifier view of ad-
verbial phrases. The -categorial sentence un-
derlying (1) would be
(2) Cecily, winks, roguishly
If we were to adhere strictly to the rule that
a functor precedes its arguments (2) would
have to be written as
(3) roguishly, winks, Cecily
It was explained in article 8 why (3) may be
regarded as equivalent to (2).
In (2) Cecily is in category n, winks is in
category (s/n) and roguishly is in category
((s/n)/(s/n)). This last reflects the fact that it
is a one-place predicate modifier.
Not all adverbs are one-place predicate
modifiers. Some are sentential modifers. For
instance
(4) Probably Jack dances
should be analysed as
(5) Probably, Jack, dances
Sentential operators include modal adverbs
like probably and possibly and also the logi-
cal words like not and and (this last being a
two-place functor and not usually thought of
as an adverb). Such words are discussed else-
1. Adverbials as Predicate Modifiers
2. Adverbials in Possible World Semantics
3. Prepositional Modifiers
4. Degree Adverbs
5. Causal Adverbs
6. Spatio-Temporal Manifestations
7. Short Bibliography
1. Adverbials as Predicate Modifiers
Adverbial modification, difficult enough for
syntactic theories, poses problems of extreme
difficulty for semantics. One problem is that
of classification. What kinds of adverbs and
adverbial phrases are there? How can you tell
whether a phrase is an adverbial one or not?
Perhaps this problem can be postponed if we
choose the study only examples which are
uncontroversially cases of adverbial modifi-
cation. But the treatment of even these cases
is obscure. This article will concentrate on
this latter problem. It will take certain central
cases of adverbial modification and examine
the difficulties in providing a semantics for
them. The solution of these difficulties will,
it is to be hoped, give insight into the nature
of the entities required in formal semantical
theories.
Consider the sentence
(1) Cecily winks roguishly
(Take winks here to be the episodic football
commentator present. Other tenses are dis-
cussed elsewhere in this handbook.)
How are we to represent (1) in a -cate-
gorial language? If we follow Thomason &
Stalnaker (1973) the answer is not too diffi-
36. Adverbial Modification in -Categorial Languages 749
reflect the corresponding English sentences.
And the reason is not hard to see. In (11) it
is Earnest who is willing (Gwendolen may be
very reluctant indeed), while in (12) it is
Gwendolen who is willing. If willingly is in
category ((s/n)/(s/n)) there is no problem. The
normal meaning of the English sentence (11)
is trying to represent would be captured by
(13) Earnest, , x, x, follows, Gwendo-
len, willingly
In (13) the formation rules for -categorial
languages ensure that
(14) , x, x, follows, Gwendolen
is in E
(s/n)
. (The functor follows is here put
between its arguments, it could have been put
in front of them.) (14) can then be modified
by willingly so get a more complex (s/n) which
will form a sentence when combined with
Earnest.
(12) can be represented by
(15) Gwendolen, , x, x, precedes, Ear-
nest, willingly
In (15) willingly modifies the predicate
(16) , x, x, precedes, Earnest
Obviously (14) and (16) have quite different
meanings, for they represent, respectively, the
predicates follows Gwendolen and precedes
Earnest. And this is quite compatible with the
assumed synonymy of (9) and (10).
In theory there can be adverbial expres-
sions for any k such that they are k-place
modifiers but cannot be used to form j-place
modifiers for any j < k. Whether there are
such expressions in natural language is a more
controversial question.
In the discussion of (9)(16) some intui-
tive informal semantics has been assumed, but
the real task of this section is to shew how a
formal semantic theory of adverbial modifi-
cation can be based on the idea that adverbial
phrases are predicate modifiers.
2. Adverbials in Possible World
Semantics
The semantic importance of adverbs lies in
this. When we try to represent many other
parts of speech in a categorial language, we
end up with semantic categories of the kind
which occur in ordinary first-order predicate
logic. Names are individual constants (or var-
iables), verbs, common nouns and predicative
adjectives all seem to be predicates, and noun
phrases can be represented by various quan-
where in the handbook, and all that is nec-
essary here is to shew how the use of -
abstraction can be used to convert every sen-
tential modifier, i. e. any expression in cate-
gory (s/s), into a predicate modifier, i. e. an
expression in category ((s/n)/(s/n)). In fact in
article 8 it was shewn how to use not and
smiles to make a predicate which represents
does not smile. It is
(6) , x, not, smiles, x
By the principles of -conversion (see article
8) (6) is equivalent to
(7) , y, , x, not, y, x, smiles
provided y is a variable in X
(s/n)
, i. e. a variable
for one-place predicates.
In (7) the expression
(8) , y, , x, not, y, x
is in category ((s/n)/(s/n)) provided x X
n
and
y X
(s/n)
.
A two-place predicate modifier will be of
category ((s/nn)/(s/nn)) and in general a k-
place predicate modifier would be of category
Call an expression a uniform predicate mod-
ifier (or perhaps just a predicate modifier) if
it is a k-place predicate modifier for some k.
Where k = 0 we have sentential modifiers,
which thus emerge as a special case of uni-
form predicate modifiers.
Where is a k-place predicate modifier
and k < j, then -abstraction can be used as
above to produce a j-place predicate modifier.
However for j < k the result is not always
possible. This can be seen by exhibiting a one-
place predicate modifier which cannot be
treated as a sentential modifier. For this pur-
pose suppose that precedes and follows are in
F
(s/nn)
and Gwendolen and Earnest are names.
Also suppose that (9) is synonymous with
(10):
(9) Gwendolen, precedes, Earnest
(10) Earnest, follows, Gwendolen
Now consider the adverb willingly. If willingly
were in category (s/s) then (11) would be
synonymous with (12):
(11) Earnest, follows, Gwendolen, will-
ingly
(12) Gwendolen, precedes, Earnest, will-
ingly
Obviously (11) and (12) do not adequately
750 IX. Verbalsemantik
a pretty high proportion of the reasonable
alternative worlds to w. At least on this se-
mantics it is no longer obvious that an ade-
quate semantics for probably as a sentential
functor cannot be given.
The same point can be made about one-
place predicate modifiers. In first-order pred-
icate logic the semantic value of a predicate
is just a set of objects from the domain of
discourse. So consider a language in which
winks and dances are both one-place predi-
cates. Suppose further that, as a matter of
fact, the set of those who wink and those who
dance is the same. So that the semantic value
of winks and dances are the same. Now sup-
pose that roguishly is a one-place predicate
modifier. This means that (18) and (19) are
both one-place predicates.
(18) winks, roguishly
(19) dances, roguishly
So the meaning of roguishly will be a function
which operates on sets of individuals to give
other sets of individuals. Now we have sup-
posed that winks and dances have the same
semantic value, and so the meaning of rogu-
ishly operates on the same thing in both (18)
and (19); and this means that (18) and (19)
have the same meaning in other words,
that those who dance roguishly are the same
as those who wink roguishly. But this last
need not follow. Suppose that everyone
dances and everyone winks, so those who
wink and those who dance are the same. But
suppose that only the men wink roguishly
and only the women dance roguishly.
Again, an intensional semantics based on
possible worlds does not get into analogous
difficulties. For even if in the actual world
the dancers and the singers are the same, yet
there will be other possible worlds in which
they are not.
Of course those who wish to model natural
language on first-order logic are well aware
of these problems (see for instance Davidson
1967a, 1969). What they do is to argue that
the surface form of these sentences is mis-
leading. They then propose various kinds of
paraphrases. Often these paraphrases are
widely different for different kinds of adverbs.
For instance Davidsons analysis of sentential
modification (if it is to be generalized to cases
like (5)) is quite different from his analysis of
prepositional phrases. Davidsons particular
analysis of these latter, in terms of predicates
of events taken as individual particulars, will
be discussed later. At present we shall simply
assume a semantics which takes the meaning
tificational paraphrases, among them those
given by Russells theory of descriptions.
But sentential or predicate modifiers, if
added to first-order logic, cause some embar-
rassment. Take sentential modifiers first. In
fact there are sentential modifiers in predicate
logic they are the truth functors. These
will usually include a one-place functor which
represents not and a selection of the two-place
functors which represent and, or or if-then.
The reason that they are called truth functors
in this: In the predicate calculus the only value
that a sentence needs to be assigned is a truth
value; it will be either true or false. Formulae
with free variables will of course only get a
truth value relative to some assignment (of
members of the domain of discourse) to those
variables, but the value they get will only be
a truth value. In this language the (truth)
value of a complex sentence depends only on
the truth values of the simpler sentences out
of which it is made. Take now the case of
one-place sentential truth-functors. Each of
these will be semantically equivalent to one
of the following four:
(i) T T (ii) T T (iii) T F (iv) T F
F T F F F T F F
In the left column of each table is listed the
(two) values the unmodified sentence can
have, and on the right the value of the mod-
ified sentence. (Usually there is a simple sym-
bol only for (iii), that is the functor which
represents not. (i), (ii) and (iv) are expressed
with the aid of two-place functors.)
It should now be immediately clear that
not all sentential modifiers can be represented
in this way. Take probably in (5). Some things
which are probable turn out to be false, others
turn out to be true. So there is no way of
predicting the truth value of (5) just from the
truth value of
(17) Jack, dances
In fact it is obvious surely that the meaning
of probably cannot be identified with any of
(i)(iv). At this point the most reasonable
course would seem to be to give up the view
that the meaning of a sentence is just a truth
value. Indeed the semantics for categorial lan-
guages described in article 8 assumed that
meanings were not truth values but rather
truth conditions, i. e. sets of worlds, or rather
sets of word-time pairs.
In such a semantics probably, presum-
ably means that, in terms of what is known
or reasonable to believe at t in w, is true in
36. Adverbial Modification in -Categorial Languages 751
Station is in category n then the syntactic
category of to is (((s/n)/(s/n))/n), that is to
say it makes a one-place predicate modifier
out of a name. What should its semantics be?
Well V(to) will be a function of the following
kind, where b is some kind of spatial entity,
(b) is a function from D
(s/n)
into D
(s/n)
. So
suppose D
(s/n)
( might be the meaning of
walks, and b will be the thing to which the
walking is done: in this case ((b))() would
mean walks to b) then ((b))() will be in
D
(s/n)
and so, for any a D
n
which is in the
domain of , we have (((b))())(a) in D
s
.
In fact w, t (()(b))(a) iff w, t (a)
and, at the last instant of t, as position in w
overlaps with bs at the same instant.
Read ((())(b))(a) as
a s to b
This is true at w, t if t is an interval of -
ing in w which ends at b.
This semantics is rough, not to say crude.
But it ought to indicate how a semantics
based on world-time pairs can deal with at
least some prepositional modifiers. (A more
elaborate treatment of prepositions along
these lines is found in Cresswell 1978b.) It is
only if one has a crude semantics to begin
with that one can set about the process of
refining it.
4. Degree Adverbs
A semantics along these lines can also be
given for ordinary adverbs. Before we look
at words like roguishly which are rather com-
plicated, it will be profitable to take a rather
more purely spatio-temporal adverb. We will
look at the symbol quickly: this is a member
of F
((s/n)/(s/n))
and is intended to have some
connections with the English word quickly.
One has to put it this way because, in this
case, the semantics given for quickly is so
crude by comparison with the meaning of
quickly that it can only be justified as a
starting place for further research. In Cress-
well (1978 a) I considered a purely distance-
covering meaning of quickly in which any-
thing done quickly is done in such a way that
the distance covered in doing it at a particular
w,t is considerably (left vague) greater
than average for that kind of thing.
V(quickly) is the function in D
((s/n)/(s/n))
such that where is in D
(s/n)
, where a( D
n
)
is in the domain of and w, t is any
world-time pair:
w, t ()(a) iff w, t (a) and, for
of a sentence to be a set of world-time pairs.
The aim will be to see how much adverbial
modification can be expressed in this way.
3. Prepositional Modifiers
The most straightforward semantics for ad-
verbial modifiers seems to be, paradoxically,
that involved in prepositional phrases. I say
paradoxically because prepositional phrases
are always complex. A sentence with a prep-
ositional modifier is
(20) Algernon walks to Victoria Station
It proves convenient to take Victoria Station
as a single symbol in category n. (Nothing
will be affected if it should turn out to be
more like a quantifier.)
The semantic value of walks will be the
function such that for any person a and
world-time pair w, t, w, t (a) iff a
walks in word w at time t. So far so good,
but we need to be more precise. It has been
said that t is a time. But does this mean an
instant of time or a longer period? The right
answer seems to be that t should be a time
interval. The need for intervals in the seman-
tics of tense and aspect is discussed elsewhere
in this handbook (see article 35). Here it will
merely be assumed that there are all kinds of
additional reasons for taking t as an interval,
and it will be shewn that so taking it enables
a plausible and illuminating theory of a wide
class of adverbial modifiers.
So if V is the assignment which reflects
English then V(walks) is the function whose
domain contains every a D
n
of which it
makes sense to suppose that a walks, and, for
any w, t in which w is a possible world and
t a time interval, then w, t (a) iff t is an
interval of as walking in w.
An interval of as walking is left unana-
lysed. The need for an interval is because it
seems that there might be minimal intervals
of walking. Certainly some verb-phrases, like
builds a house seem true of an interval with-
out being true of any sub-interval, but these
issues are discussed elsewhere.
The -categorial sentence which underlies
(20) would be
(21) Algernon, walks, to, Victoria Sta-
tion
In (21) the phrase
(22) to, Victoria Station
is a predicate modifier, that is to say its syn-
tactic category is ((s/n)/(s/n)). Since Victoria
752 IX. Verbalsemantik
adverbs and adjectives. In saying that a per-
son is tall one seems to mean that the person
is considerably taller than the average for the
relevant comparison class. One way to deal
with this is to suppose that underlying every
adverb and adjective there is a place for a
degree word. I. e. that the real basic form of
quickly and tall is
x-much quickly
or
x-much tall
This explains uses like how quickly/how tall,
so quickly/so tall, more quickly than/taller
than, and so on. When the word is used with-
out any degree indicator then we are to supply
one which is considerably above average on
the relevant scale associated with the adverb
or adjective. Comparison of adjectives is dealt
with elsewhere in this handbook (see article
32). All that should be said here is that ad-
verbs and adjectives require the same treat-
ment in this regard.
5. Causal Adverbs
What then can be said about adverbs like
roguishly? Actually it turns out that there is
a single move which enables us to treat a very
wide class of adverbs. The idea is simply that
the meaning of many adverbs is to be under-
stood in terms of the causal effect they have.
To say that Gwendolen winks roguishly is
just to say that her winking has a certain
effect.
It is appropriate to study such adverbs in
view of the analysis in Lewis (1973a) of cau-
sation in terms of counterfactual dependence,
where this latter is analysed in terms of pos-
sible worlds. Lewiss account is a plausible
one certainly, and if it, or something like it,
is correct, then a large class of causal adverbs
can be accounted for. The primitive basis
Lewis uses is, in addition to the worlds them-
selves, a relation of comparative world simi-
larity so that we can speak of one worlds
being more or less similar to our own than
another is.
The most straightforwardly causal adverb
must surely be fatally (see Cresswell 1981). If
I say that Gwendolen fatally fell, it presum-
ably means that the falling caused her death.
And what does that mean in terms of David
Lewiss semantics? Well it means that Gwen-
dolen fell and if she had not fallen then she
would not have died, and this in turn means
that in the world in which she did not fall
most subintervals t
1
of t which are minimal
(in the sense that w, t
1
(a) but there
is no proper subinterval t
2
of t
1
such that
w, t
2
(a)). d(p(a, t
1
, w))/d(t
1
) is consid-
erably greater than the average of
{d(p(b, t, w): w = w and d(t) = d(t
1
) and
w, t (b)} (where d(p(a, t, w)) is the
distance of the path a covers over t in w,
and d(t) is the length of t).
The idea behind this semantics was that any-
thing s quickly at a w, t pair iff at the
minimal subintervals in t which are intervals
of ing the ratio of distance covered to time
is considerably above average. The notion of
average was left vague with presumably some
kind of limit process to be used in order to
make it precise if required.
It is interesting to see how quickly can
interrelate with to, Victoria Station to give
two different meanings for
(23) Algernon walks quickly to Victoria Sta-
tion
one in which the walking is quick, and ends
up at the station; the other in which the
walking to the station is quick
(24) Algernon, walks, quickly, to, Vic-
toria Station
(25) Algernon, walks, to, Victoria Sta-
tion, quickly
The difference between (24) and (25) could
be described by saying that in (24) walks,
quickly is in the scope of to, Victoria Sta-
tion while in (25) walks, to, Victoria Sta-
tion is in the scope of quickly. This in itself
is not awfully important. What is important
is that the semantics given for quickly and to
actually give a difference in meaning to (24)
and (25). For (24) is true if Algernon in walk-
ing to the station performs an action most
minimal portions of which which are walkings
are quicker than the average walking. By con-
trast (25) is true if most minimal periods of
his walkings which are walkings to Victoria
station are quicker than the average walking
to Victoria station. Since the semantics of to
requires that an interval of walking to the
station be maximal there can be no minimal
walkings to the station apart from the whole
walking. Since these are obviously different
classes (24) and (25) do not mean the same.
In the semantics given for quickly the word
considerably was used in stating that the
distance-to-time ratio was to be considerably
above average. This particular vagueness is
not peculiar to quickly but infects almost all
36. Adverbial Modification in -Categorial Languages 753
iff represents an event, and, for any
such , and any a D
1
which is in the
domain of , and any w, t W;
w, t (())(a) iff w, t (a) and a
dies at some time t in w (where t does not
precede t) and, where w is the nearest
world to w in which w, t (a) then a
does not die at t.
This semantics is intended to be a formal
version of the more intuitive remarks made
earlier.
In (26) fatally operates on an intransitive
verb, but the semantics of -abstraction en-
able it to be used equally with transitive verbs.
In fact, as with quickly, some rather interest-
ing scope distinctions arise. Consider the sen-
tence
(27) Gwendolen fatally attacks Earnest
In this sentence it is not clear whether it is
Gwendolen or Earnest who dies, and this
ambiguity can be precisely reflected in a scope
difference at the level of the -categorial rep-
resentation of (27). We suppose that attacks
is in category (s/nn) though Montague (1974:
250) would put it in category ((s/n)/(s/(s/n)))
for reasons unconnected with the present con-
cerns. Then, with fatally, Gwendolen and Ear-
nest, as before, in categories ((s/n)/(s/n)), n
and n respectively, we have the two sentences
(28) Gwendolen, fatally, , x, attacks, x,
Earnest
(29) fatally, , x, attacks, Gwendolen,
x, Earnest
As explained in article 8, principles of -
conversion can be used to put Gwendolen at
the front of the sentence.
In (28) fatally modifies the predicate at-
tacks Earnest and therefore, by V(fatally), it
is Earnests attacker who dies, while in (29)
it is the predicate is attacked by Gwendolen
which fatally modifies, and so it is the person
attacked who dies. The semantics of -ab-
straction is fully explained in article 8 and, in
conjunction with the semantics offered here
for fatally, it may be seen that (28) and (29)
do reveal precisely the intended difference
between the two meanings of (27).
Another kind of adverb discussed in Cress-
well (1981) includes such perceptual adverbs
as audibly and visibly where the activity has
a causal effect on others besides the partici-
pants. Using Hintikkas (1969a) notion of a
perceptual alternative, one can say that an
auditory alternative for a person b at a world
w and a time t is a world time pair w, t
which is more similar to the actual world (in
which she did fall) than any other world is in
which she did not fall, she did not die. Ac-
tually Lewiss account is somewhat more
complicated than that but the extra complex-
ities can be ignored here. There is however
one respect in which the account needs mod-
ification. For the nearest world in which
Gwendolen does not die is a world in which
she is immortal. What we mean is that Gwen-
dolen would not have died at the time she did
die. There are still problems with this account
involving bizarre examples like back-up de-
vices to ensure that even if the fall did not
kill Gwendolen something else was waiting to
do it instead so that she still dies in the nearest
world in which she does not fall. Lewis and
others have debated this problem and the
hope is that they have some successful reso-
lution. In giving a sentence of a -categorial
language to represent Gwendolens fatal fall,
it is convenient to take a present-tense ex-
ample. Tense operators are discussed else-
where in the handbook. Assuming that Gwen-
dolen and falls are in categories n and (s/n)
respectively, and treating fatally as a predicate
modifier in category ((s/n)/(s/n)), the repre-
sentation in a -categorial language is
(26) Gwendolen, fatally, fall
Since fatally is in category ((s/n)/(s/n)), its
meaning will be a function from D
(s/n)
into
D
(s/n)
which will be defined for those D
(s/n)
which represent things which it makes sense
to suppose that they happen fatally or not.
A function D
(s/n)
will have the property
that for those a D
n
which are in its domain,
any world-time pair w, t either is or is not
in (a). The kind of which will be in the
domain of the function which is the meaning
of fatally will have as its own domain animate
or inanimate physical things, and w, t
(a) iff some specific thing is happening to a,
either a is doing something or is undergoing
something or even (possibly) is in a certain
state. As in Montague (1974: 152), it need not
be the concern of formal semantics to say
precisely what sorts of functions these will
have to be, though the account of the seman-
tics of verbs in Taylor (1977) or Dowty (1977)
using time intervals, makes a beginning on
this task. (See also the articles in Tedeschi and
Zaenen 1981.)
The semantics offered for fatally in Cress-
well (1981: 25) was the following:
V(fatally) is the function in D
0,1,0,1
such that any D
0,1
is in the domain of
754 IX. Verbalsemantik
6. Spatio-Temporal Manifestations
Earlier in the article it was shewn how the
predicate-modifier view of adverbs led to
trouble for a semantic theory based on first-
order predicate logic. A champion of such a
theory is Donald Davidson who in (1967a)
produced an account of prepositional phrases
in first-order logic. The key to Davidsons
solution is to assume that a sentence like
(32) Shem kicked Shaun
has a rather different logical form than or-
dinarily supposed. Instead of kicked being a
two-place predicate relating Shem and Shaun,
the form of (32) is
(33) (x) (kicked (Shem, Shaun, x))
(33) is a formula of predicate logic ( is the
existential quantifier) and kicked is a three-
place predicate (not a two-place predicate)
which means that x is an event of Shems
kicking Shaun. Davidson then considers the
sentence
(34) I flew my spaceship to the morning star
If the analysis of (34) involves an event of my
flying my spaceship then the prepositional
phrase to the morning star can be represented
by a predicate which is true of this event.
Thus (34) is analysed as
(35) (x) (flew (I, my spaceship, x) &
To (the morning star, x))
(35) might be paraphrased as:
There is an x such that x is a past event
of my flying my spaceship and x is directed
to and terminates at the morning star.
Davidsons reasons, of course, for advocating
such an analysis are connected with his desire
to express the underlying structure of a nat-
ural language in the language of first-order
predicate logic. Further, he wants to avoid
the use of any intensional entities like possible
worlds. This article is not the place to com-
ment on these larger issues. The question of
concern here is whether there is any reason,
in a -categorial language with a possible-
worlds semantics, for analysing verbs in Dav-
idsons way as involving an extra argument
place to talk about events. The first task will
be to shew that if there are reasons for adding
an event argument then this can be incorpo-
rated into a -categorial language while keep-
ing adverbial phrases as uniform predicate
modifiers. The second task will be to address
the question of whether this extra argument
place really is needed.
which, as far as bs auditory experience goes
at t in w, could be the actual world. The
things that b seems to hear at w, t are just
those things which are present in all of bs
auditory alternatives. This idea needs refine-
ment in various ways, some of which are
discussed by David Lewis in (1980b). A se-
mantics for audibly based on these ideas is
provided in Cresswell (1981: 26) whereby
(30) Fred, sings, audibly
is true at w, t iff Fred sings at w, t and
there is some person b such that in all the
auditory alternatives w, t for b at w, t,
Fred is singing, but that in the nearest world
w*, t to w, t in which Fred is not singing,
then Fred is not singing in all of bs auditory
alternatives in that world. (This sounds very
complicated but means no more than that
this sense of audibly means that Fred sings
audibly if someone seems to hear Fred singing
as a causal result of his singing.)
The analysis would seem to work equally
well for visibly and in Cresswell (1981) it was
even extended to words which admitted of
degrees, like loudly, softly, brightly, and so
on, where it makes sense to ask just how
loudly, etc., did Fred sing or do anything else.
This analysis used the account of degrees of
comparison to be found in Cresswell (1976).
Causal adverbs, if one interprets this idea
liberally, actually comprise a far wider class
than might originally appear. In fact, in
Cresswell (1981) all of the following were held
to have, in one way or another a causal ele-
ment in their meaning:
manifestly, patently, publicly, conspicu-
ously, successfully, plausibly, conveniently,
amusingly, pleasantly, irrevocably, tenu-
ously, precariously, rudely.
In some cases, like successfully, one requires
context-dependent information to decide the
criteria by which the effect of an activity is
to be judged successful, other cases, like pre-
cariously, seem to speak of a contextually
supplied effect which is merely liable to hap-
pen, and so on. Finally the word roguishly,
which was mentioned earlier in the section,
probably means that the action in question
has similar effects, in certain contextually de-
termined ways, to the effects that would be
produced by a rogue. Saying this doesnt take
us awfully far but, as in the case of quickly,
it perhaps suggests a direction that the study
of such adverbs might take.
36. Adverbial Modification in -Categorial Languages 755
fied is one whose meaning is the property of
being a winking by Cecily, and the modifi-
cation consists in saying of an event with this
property that it is also a roguish event. The
working out of this is left to the reader. So
much then for the details of how to incor-
porate a Davidsonian theory of adverbs into
a -categorial language with a possible-
worlds semantics. It should be clear how
prepositional phrases as in (33) can be accom-
modated.
The question now is whether adverbs need
to be analysed in this way. Davidsons own
motivation was to avoid the need for a non-
extensional language. If a possible-worlds se-
mantics is adopted, then that reason is not
compelling. But there are at least two other
reasons which might still apply. The first is
that the Davidson analysis is extremely gen-
eral since one does not have to say what an
event is; whereas it is not all clear how general
the class of adverbs is for which an ordinary
(i. e. non event type) predicate modifier theory
will be. The second reason is that whether or
not adverbs are event modifiers, the adjectives
with which they are closely related most cer-
tainly are. For (1) can be paraphrased as
(37) Cecily gives a roguish wink
In the -categorial sentence which underlies
(37), wink will be a predicate which means is
a wink and roguish will have a semantics
almost identical with that given for roguishly
in the -categorial version of the Davidson
theory. Further, prepositional phrases can be
used both as adverbs and as adjectives. We
can have the noun phrase
(38) a handbag in Victoria Station
as well as
(39) Earnest was found in a handbag.
The event account of adverbs makes clear the
reasons for these meaning connections and
so, if it is not accepted, its alternative will
have to give an equally good explanation.
Having seen the reasons in favour of the
event account, why should one not want to
accept it? Probably most of those who would
want to reject it would feel that it is undesir-
able to have to suppose an extra argument
place in a verb like winks, together with the
necessity for an existential quantifier in the
representing -categorial sentence. The other
motive for rejecting it would be a feeling that
events should not be taken as primitive enti-
ties but, at least in a possible-worlds ontology,
It will prove easiest to take sentence (1) as
an example. Davidson has reasons for only
discussing prepositional phrases but the pres-
ent questions do not demand this.
In a theory based on the idea that adverbs
are predicates of events (1) could be repre-
sented in a -categorial language by
(36) , , x, Cecily, winks, x, rogu-
ishly
In (36) Cecily is in F
n
, winks in F
(s/nn)
, rogu-
ishly in F
((s/n)/(s/n))
and in F
(s/(s/n))
. Cecily be-
haves as before but all the other symbols have
new meanings. The most straightforward is
the existential quantifier . V() is the func-
tion in D
(s/(s/n))
such that for any D
(s/n)
,
w, t () iff there is some a D
n
such that
w, t (a). In possible worlds semantics of
course there may well be events which exist
in one world but not another. It is up to the
particular function to say whether w, t
(a) implies that a actually exists in w at
time t.
V(winks) is the function in D
(s/nn)
such
that a pair a, b is in the domain of iff
a is a person and b is an event (so that a
and b are both in D
n
). For any world-time
pair w, t, w, t (a, b) iff in world w
at time t, b is an event of as winking.
In this semantics it is to be supposed that we
know what counts as being an event of so-
meones winking. The semantics allows the
same action to be a winking in one world but
not in another a fact that may help to
solve some of the problems that have been
raised about shootings and killings (see
Thomson 1971). The thing which at one time
or in one world is both a shooting and a
killing may at another time, or in another
world, be a shooting but not a killing.
roguishly in (36) is a one-place predicate
modifier, just as it would be on the view of
adverbs discussed earlier. But its semantics is
a little different.
V(roguishly) is a function in D
((s/n)/(s/n))
such that is in the domain of iff is a
function (in D
(s/n)
) such that if a is in its
domain a is an event. For any such ,
w, t () iff w, t (a) and a is
roguish in w at t.
Of course this account has nothing to say
about when an event is roguish. But that sort
of question would be regarded as not part of
semantics. One follower of Davidson
(Wheeler 1972) calls such questions, questions
of physics. In (36) the predicate being modi-
756 IX. Verbalsemantik
do not have the ability to decide this, then
we have no business in talking about a par-
ticular walk as if it were an event.
The question then is how to define the
noun walk (call it walk
N
) and the verb walk
V
in such a way that it means is a walk. In
order to tackle this task we need to make the
distinction between an individual and its
manifestation in a given world over an interval
of time. The manifestation of an individual
in one world is roughly the form it takes in
that world, and particularly crucial is the spa-
tio-temporal position it occupies. Its manifes-
tation in a world over an interval is simply
the section of its whole manifestation in that
world when restricted to that interval. The
importance of the distinction emerges when
two distinct individuals share the one mani-
festation. And in particular we may think of
the manifestation of an event or activity as
being identical with the manifestation of the
person or thing which undergoes the event or
activity. This account gives us a class of phys-
ical entities neutral between events, activities
and objects. It is the class of all functions
with spatio-temporal manifestations.
Let us consider the connection between
fatal and fatally. Intuitively the semantics for
fatal does seem to have a close link with that
given for fatally in section two. A fatal walk
is one which causes death. We shall consider
the phrase
(40) Vernons fatal walk.
From what has just been said, we shall want
Vernons walk at a particular w, t to be the
spatio-temporal segment of Vernon at w, t
provided he is walking at w, t. What would
be nicest would be to find that the link be-
tween fatal and fatally can be systematically
extended to all adverbs and adjectives. It is
obvious that V(fatally) V(fatal) because
although the phrase fatal walk is a predicate,
its argument is the walk, not the one who
walks; but of course it is not the walk which
dies, if that makes sense, but the walker. walk
V
and walk
N
can be given the following seman-
tics:
V(walk
V
) is the function such that for
any a D
n
, a is in the domain of iff a is
a physical object (animate or inanimate)
and for any such a and w, t W, w, t
(a) iff t is an interval at which a walks
in world w.
V(walk
N
) is the function such that a is
in the domain of iff a is a function with
should be manufactured out of the entities
we already have.
As it turns out, if we accept one plausible
analysis of events, that offered by Richard
Montague, we can not only revert to the
ordinary view, but can also explain the inti-
mate connection between roguish and rogu-
ishly, quick and quickly and the adverbial
versus the adjectival use of prepositional
phrases.
Montague (1974: 150) defines a generic-
event as a property of times. (Montague is
thinking of times as moments but allows in-
tervals in the case of what he calls protracted
generic events.) Properties of times are, for
Montague, functions from times to sets of
worlds, so they are equivalent to sets of
world-time pairs. But events often have a
spatial location, and indeed examples have
been produced which make it plausible to
imagine two different events which are logi-
cally equivalent and occur at the same time
yet occur at different places. Kim (1974) in-
stances the death of Socrates and the wid-
owing of Xanthippe. He claims that Socrates
death occurred where he was but Xanthippe
became a widow where she was. Yet the two
events are logically equivalent. This example
suggests the solution. The death of Socrates
is something that happens to Socrates. So
why not adapt Montagues account to make
the death of Socrates the function from So-
crates to the set of world-time pairs at which
Socrates dies. But this is exactly the meaning
given to dies on the original approach in
which it is just a one-place predicate. So, on
Montagues account of events, we do not need
an extra argument place.
This isnt however quite the whole story.
For such functions are generic events. Take
the meaning of walks as given earlier. This is
a function which picks out for any individual
a all the world-time pairs at which a walks.
Obviously not all of these will be the same
walk. In fact it could be argued that one ought
not to think of a generic event as an event at
all. What we want is a function which refers
to a particular walk. In one way this is easy.
A particular walk of an individual a is deter-
mined by one of those distinguished subsets
of the set of all w, t pairs at which a walks
which consitute the w, t pairs of a single
walk. There is of course the problem in met-
aphysics (or physics, according to Wheeler)
of just when a set of w, t pairs does con-
stitute a walk. For semantics it is sufficient
to observe that if, as speakers of English, we
36. Adverbial Modification in -Categorial Languages 757
guments at other world-time pairs. This per-
haps explains why prepositional phrases can
modify both verbs and nouns. For in the
phrase
(41) a walk to Victoria Station
the noun walk denotes something whose man-
ifestation at any w, t is a segment of the
one who is walking at w, t. Therefore the
spatio-temporal path of the walk, that it is to
Victoria Station, is the same as the path of
the walker in the verb phrase
(42) walks to Victoria Station.
These last examples should shew that, at least
in the case of certain adverbs, no special cat-
egory of events is needed to the world-time
semantics assumed in any case. It was sug-
gested earlier that adverbs where meaning
could be analysed in causal terms form a very
wide-ranging class. If this class is wide-rang-
ing enough, then a world-time semantics in
which verbs do not have an extra event ar-
gument place, and in which adverbial (includ-
ing prepositional) phrases behave as ordinary
predicate modifiers, could well form the basis
of a theory of adverbial modification.
7. Short Bibliography
Cresswell 1974 Cresswell 1976 Cresswell 1978a
Cresswell 1978b Cresswell 1979 Cresswell 1981
Davidson 1967a Davidson 1969 Dowty 1977
Hintikka 1969a Kim 1974 Lewis 1973a Lewis
1980b Montague 1974 Taylor 1977 Tedeschi/
Zaenen 1981 Thomason/Stalnaker 1973 Thom-
son 1971 Wheeler 1972
M. J. Cresswell, Wellington (New Zealand)
spatio-temporal manifestations, and
for any w, t W; w, t (a) iff
(i) a is a function whose manifestation at
w, t is identical with that of some
b D
1
such that t is an interval at which
b is walking in w; and
(ii) all the w, ts in (a) are intervals of
the same walk.
(In this semantics the notion of the same walk
is left undefined.)
Let us first try to give a semantics for fatal
as a separate lexical item.
V(fatal) is the function in D0,1,0,1
such that for any D0,1, any a in the
domain of and any w, t W: w, t
(()) (a) iff
(i) w, t (a)
(ii) there is a person b such that
(iia) the manifestation of b at w, t coin-
cides with the manifestation of a at
w, t, and
(iib) b dies at some time t in w (where t
does not precede t), and
(iic) where w is the nearest world to w in
which w, t (a) then b does not
die in w at t.
The idea is that a fatal event is one that causes
death to the person involved. The definition
of the person involved is simply the person
whose manifestation is also the manifestation
of the event. It should be clear that this se-
mantics for fatal has a close link with the
semantics of fatally given earlier. Yet the link
seems to be of a lexical kind without any
obvious semantics for ly coming from it.
However, one thing does emerge, and that
is that the semantics for fatal and fatally differ
crucially only in the behaviour of their ar-
758
X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
Residua: Prepositions, Degree Particles, Focus
37. Lokale und Direktionale
derson & Keenan 1985). Dadurch lassen sich
die erwhnten Entitten relativ zur Ge-
sprchssituation lokalisieren.
Zugleich hat vermutlich jede Sprache Fra-
gewrter, die sich auf die Lokalisierung von
solchen Entitten beziehen.
(2) engl. where
dt. wo, wohin, woher, worunter
port. onde
jap. doko
Die Ubiquitt derartiger Ausdrcke berech-
tigt zu dem Schlu, da eine Sprache neben
den semantischen/ontologischen Grundtypen
Objekt, Wahrheitswert und Zeit minde-
stens auch den Grundtyp Ort aufweist (vgl.
Jackendoff 1983). Jedes physikalische Objekt
a nimmt in einem gewissen Zeitintervall t
einen gewissen Ort p als Teil des Raumes ein
(vgl. Cresswell 1978, Lutzeier 1981, Wunder-
lich 1982).
(3) Sei A = Menge der Objekte, T = Menge
der Zeitintervalle, R = Menge der Regio-
nen.
Dann gibt es eine Lokalisierungsfunktion
p: A T R
p(a,t) ist die von a zu t eingenommene
Region.
Ebenso ubiquitr ist die Mglichkeit, die
Ortsvernderung von Objekten zu erwhnen.
Jede Sprache verfgt ber intransitive oder
transitive Bewegungsverben wie in (4) und
meistens auch kausative Positionsverben wie
in (5).
(4) engl. go, drive; throw
dt. gehen, fahren; werfen
port. ir, subir
jap. hashiru
(5) engl. put
dt. legen, stellen
port. pr
jap. oku
Verben wie in (4) erlauben, das im gramma-
tischen Subjekt bzw. Objekt erwhnte physi-
1. Vorbemerkungen
2. Syntax der Lokalisierungsausdrcke
2.1 Syntaktische Kategorie
2.2 Interne Syntax der Prpositionalphrase
2.3 Externe Syntax der Prpositionalphrase
2.4 Die thematischen Rollen von Positions- und
Bewegungsverben
3. Semantik der Lokalisierungsausdrcke
3.1 Lokalisierung von Situationen
3.2 Lokalisierung von Objekten
3.3 Orte als semantischer Grundtyp
3.4 Synthese
4. Semantik der Prpositionen
4.1 Topologische Prpositionen
4.2 Dimensionale Prpositionen
4.3 Wegbezogene Prpositionen
4.4 Weitere Prpositionen und Analysen
5. Lokalismustheorien
5.1 Lexikalische Erweiterung
5.2 Locationals
5.3 Thematische Rollen
5.4 Kritik
6. Literatur (in Kurzform)
1. Vorbemerkungen
Vermutlich jede Sprache verfgt ber min-
destens zwei primre lokale Deiktika (vgl.
Fillmore 1982).
(1) engl. here there
dt. hier da/dort
port. c/aqui l/ali/a
jap. koko soko/ako
Sie dienen dazu, da ein Sprecher die von ihm
erwhnten Entitten in der Gesprchssitua-
tion verankern kann, und zwar relativ zu sei-
nem Standort oder zu einem von ihm vorge-
nommenen indexikalischen Akt (Prsenta-
tion, Geste usw., vgl. Fillmore 1982). Diese
Verankerung erfolgt rumlich, nach Parame-
tern wie; beim Sprecher beim Adressaten,
nahe fern, sichtbar unsichtbar, zugng-
lich nicht zugnglich, punktuell ausge-
dehnt (vgl. Denny 1978, Fillmore 1982, An-
37. Lokale und Direktionale 759
sich unterschiedliche Abstraktionstufen zur
konzeptuellen Fundierung eines semantischen
Prdikats WEG erzielen. Bierwisch (1988)
zielt hnlich wie Habel (1989) auf ein verall-
gemeinertes Wegkonzept ohne Zeitparameter
ab. Wege sind demnach mittels Intervall-
schachtelung strukturierte Regionen. Das In-
fimum der Intervallmenge bildet den Anfang
des Weges, das Supremum seinen lngsten
Teilabschnitt. Das Ende des Weges ergibt sich
durch die Differenz zwischen diesem und dem
vorletzten Teilabschnitt.
Als Lokale sollen in diesem Artikel Aus-
drcke einer Sprache bezeichnet werden, die
zur Lokalisierung von Objekten oder Ereig-
nissen dienen. Die Variable Zeit findet dabei
nur insoweit Eingang, als sie im Tempus des
Verbs oder im Zeitadverbial kodiert ist, wo-
durch die Lokalisierungssituation zeitlich ein-
geordnet wird. Als Direktionale sollen Aus-
drcke bezeichnet werden, die die Vernde-
rung der Lokalisierung eines Objektes (also
einen Ortswechsel) ausdrcken: das Objekt ist
erst nicht in R, dann in R lokalisiert. Dieser
Ortswechsel kann am Anfang oder am Ende
eines Weges stattfinden; aber da er selbst
punktuell ist, begrndet er nicht das Konzept
des Weges. Die Variable Zeit findet direkt
Eingang in der Kodierung des Ortswechsels.
Tempus und Zeitadverbial dienen wieder zur
zeitlichen Einordnung der Situation als gan-
zer.
(8) Gestern warf er [auf dem Bahnhof]
Lokal
die Fahrkarten [in den Papierkorb]
Direktional
In deiktischen Ausdrcken wie in (1) ist der
Raum relativ zum Ort des Sprechers organi-
siert. Da der Raum jedoch keine absoluten
Fixpunkte aufweist, mu in allen Fllen die
Lokalisierung relativ zu anderen Objekten
vorgenommen werden. Das charakteristische
Verfahren dafr ist, da man ein Objekt b in
der so-und-so-Nachbarschaft (Umgebung)
eines Objektes a lokalisiert, wobei vorausge-
setzt wird, da das Objekt a eine zeitlich re-
lativ stabile Lokalisierung hat.
(9) Sei A = Menge der Objekte, T = Menge
der Zeitintervalle, R = Menge der Regio-
nen.
Dann gibt es eine Familie U
j
von Nach-
barschaftsfunktionen
U
j
= {u
j
: A T R}, j N
Die Region u
j
(a, t) ist demnach eine spe-
zielle Nachbarschaft von a zur Zeit t.
(10) Das Objekt b werde relativ zu einem
Objekt a lokalisiert.
Dann gibt es eine Nachbarschaftsfunk-
kalische Objekt an verschiedenen aufeinan-
derfolgenden Orten zu lokalisieren, die in
ihrer Gesamtheit einen Weg ausmachen (s.
6a,b). Verben wie in (5) erlauben dies nur
beschrnkt; was sie ausdrcken knnen, ist
lediglich ein punktueller Ortswechsel (s. 6c,d).
(6)
a. Sie fuhr von Kln aus lngs des Rheins
ber die Sdbrcke nach Dsseldorf.
b. Er warf die Knochen aus dem Abteil
durch das offene Zugfenster auf die
Schienen.
c. Er stellte die Koffer (* aus dem Ge-
pcknetz durch den Gang) auf die
Plattform.
d. Er stellte die Koffer (aus dem Abteil
hinaus) in den Gang.
Ein Weg lt sich als stetige (jedenfalls mo-
notone) Abbildung aus der Zeit in den Raum
verstehen.
(7) Sei A = Menge der Objekte, T = Menge
der Zeitintervalle, R = Menge der Regio-
nen, Seq = eine Indexfolge [0, 1].
Dann gibt es eine Wegfunktion
w: A Seq T Seq R.
p(a, t
i
) ist die von a zur Zeit ti whrend
des Weges eingenommene Region, 0 i
1.
p(a, t
0
) ist die von a zu Beginn des Weges
eingenommene Region,
p(a, t
1
) ist die von a zum Ende des Weges
eingenommene Region.
Durch diese Definition wird das Konzept zeit-
lich parametrisierter Wege eingefhrt. Die Be-
dingung der Stetigkeit stellt sicher, da die
topologischen Eigenschaften der Zeit, z. B.
ihre Linearitt, in der Wertemenge der Ab-
bildung, der Menge der Raumregionen, be-
wahrt bleibt. (Auch die Monotonie bewahrt
im wesentlichen die Ordnungsstruktur der
Zeit: die Distanz (p(a, t
i
), p(a, t
o
)) ist eine
monoton wachsende Funktion der Zeit.) Pa-
rametrisierte Wege in diesem Sinn besitzen
eine Orientierung und aufgrund des Zeitpa-
rameters eine Durchlauf-Geschwindigkeit.
Ausgehend von einem solchen parametrisier-
ten Wegkonzept lt sich, Habel (1989) fol-
gend, ein verallgemeinertes Konzept von We-
gen als quivalenzklassen parametrisierter
Wege definieren. Solche verallgemeinerten
Wege abstrahieren von der Durchlauf-Ge-
schwindigkeit, besitzen aber eine Orientie-
rung. Durch erneute quivalenzklassen-
Bildung lt sich der Begriff der Spur eines
Weges gewinnen. Spuren abstrahieren sowohl
von der Durchlauf-Geschwindigkeit als auch
von der Orientierung. Auf diese Weise lassen
760 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
2. Syntax der Lokalisierungsausdrcke
2.1Syntaktische Kategorie
Lokale treten als Nomen (N), Adposition des
Nomens (P), Adverb (Adv) oder Verbalpar-
tikel (Part) auf.
Ein lokales N kann entweder einen spezi-
fischen rumlichen Teil eines Objektes wie in
(13a) oder eine spezifische rumliche Nach-
barschaft eines Objektes wie in (13b) denotie-
ren. Ein lokales N ist stets relational.
(13)
a. dt. Front, Spitze, Seite, Rcken
b. jap. ue (auf/ber), mae (vor), naka
(in)
Das Jap. verwendet also (anders als das Dt.)
ein N zur Bezeichnung spezifischer rumlicher
Nachbarschaften, es benutzt aber ein P zur
generellen Lokalisierung. Somit sind die PPn
in (14) hinsichtlich ihrer Syntax vergleichbar,
fhren aber zu anderen Bedeutungen.
(14)
a. ber [[der Spitze] des Berges]
(lokalisiert in der ber-Nachbar-
schaft der Spitze des Berges)
b. [[yama no] ue] ni
(Berg GEN ber LOK =
lokalisiert in der ber-Nachbar-
schaft des Berges)
Im brigen kann auch im Engl. und Dt. ein
N von der Art (13a) idiomatisch (aufgrund
von Metonymie) so wie ein N von der Art
(13b) verwendet werden:
(15)
a. He was sitting in front of the car.
b. Die Truppen sammelten sich im Rk-
ken des Gegners.
Adpositionen sind Prpositionen (wie dt.
ber) oder Postpositionen (wie jap. ni). Ob
eine Sprache ber das eine oder das andere
(oder mglicherweise ber beides) verfgt,
hngt von den Linearisierungsparametern der
betreffenden Sprache ab; grundstzlich gibt
es keinen kategorialen Unterschied. Deshalb
wird im folgenden ohne Einschrnkung der
Allgemeinheit oft nur von Prposition ge-
sprochen. Die in vielen Sprachen anzutreffen-
den lokalen Kasus (z. B. Finn., Trk., Slav.)
knnen als Morphologisierung einer Adpo-
sition verstanden werden (z. B. historisch
durch Klitisierung einer Postposition entstan-
den, danach Lexikalisierung der komplexen
Wortform und Bildung einer Suffixregel auf-
grund lexikalischer Reanalyse). Semantisch
hat das Morphem des lokalen Kasus dieselbe
Funktion wie eine Prposition, vgl. (16).
(16)
a. dt. Sie ging in das Haus.
tion u
j
, so da gilt:
p(b, t) u
j
(a, t)
mit als rumliche Teil-von-Relation.
(Der Ort von b ist Teil der j-Nachbar-
schaft von a.)
Ausdrcke zur Lokalisierung eines Objektes
sollten daher im allgemeinen Fall relational
(zweistellig) sein. Sie sollten besagen, da ein
Objekt b in der j-Nachbarschaft zu a lokali-
siert ist. Sucht man in einer Sprache nach
Ausdrcken mit dieser Eigenschaft, so sind es
vor allem Adpositionen (Pr- oder Postposi-
tionen), die dies leisten.
Explizite rumliche Lokalisierung erfolgt,
wie angedeutet, relativ zu physikalischen Ob-
jekten. Im Unterschied dazu erfolgt die zeit-
liche Einordnung relativ zu Ereignissen. Denn
es sind Ereignisse, die ein Zeitintervall ein-
nehmen, so wie Objekte einen Teilraum ein-
nehmen. Objekte werden von Nominalphra-
sen denotiert, niemals von Satzradikalen.
Aber Situationen lassen sich von Satzradi-
kalen denotieren (daneben auch von Nomi-
nalisierungen); deshalb kann es temporale
Adverbialstze geben, niemals aber lokale
Adverbialstze (vgl. Steinitz 1969 zum Deut-
schen; die von Thompson & Longacre 1985
vertretene Auffassung, da mit where einge-
leitete Stze lokale Adverbialstze sind, ist
fraglich es handelt sich um lokale Relativ-
stze).
Unter gewissen Bedingungen knnen
rumliche Lokalisierung oder zeitliche Ein-
ordnung komplementr erfolgen; b relativ zu
a, aber auch a relativ zu b.
(11)
a. b vor a a hinter b
b. b vor a a nach b
Welche dieser Mglichkeiten gewhlt wird,
hngt davon ab, was als Hintergrund dienen
soll (bzw. thematisch ist) und was als Vorder-
grund. Man wird schlieen, da es primr
wieder physikalische Objekte sind, die rum-
lich lokalisiert werden, aber Ereignisse, die
zeitlich eingeordnet werden. Es ist aber nicht
von vornherein auszuschlieen, da auch Er-
eignisse rumlich lokalisierbar oder Objekte
zeitlich einordbar sind. Die zeitliche Einord-
nung von Objekten ist in jedem Fall konzep-
tuell markiert; auf die Frage der rumlichen
Lokalisierung von Ereignissen kommen wir
in Abschnitt 3.1 zurck.
(12) Lokalisierung von b relativ zu a
b a
rumlich: Objekt Objekt
(Ereignis)
zeitlich: Ereignis Ereignis
(Objekt)
37. Lokale und Direktionale 761
xikalischen Bedeutung eines Bewegungsverbs
gehren (und wre dann durch lexikalische
Dekomposition zu ermitteln). Ein charakte-
ristisches Beispiel dafr ist das Spanische (vgl.
Talmy 1985: 69 ff.).
(19) entrar sich hineinbewegen
salir sich hinausbewegen
pasar sich vorbeibewegen
subir sich hinaufbewegen
bajar sich hinabbewegen
cruzar sich hindurchbewegen
andar sich herumbewegen
Ein Kategorienwechsel lokaler Ausdrcke
erfolgt hauptschlich gem folgendem
Schema:
Beispiele fr N P sind dt.
inmitten, diesseits,
wobei allerdings lexikalisierte Phrasen re-
analysiert sind. Eine direkte Umkategorisie-
rung N P scheint z. B. in afrikanischen
Sprachen vorzukommen, wo Nomen fr Kr-
perteile als P benutzt werden.
2.2Interne Syntax der Prpositionalphrase
Ein lokales N folgt der Syntax der NP. Ein
lokales Adv hat kein syntaktisches Argument
und wird direkt auf PP projiziert. Eine lokale
P kann hinsichtlich eines NP- oder eines PP-
Arguments subkategorisiert sein.
(21)a. NP: vor [dem Theater]
behind [the theatre]
b. PP: bis [vor das Theater]
from [under the table]
nach [oben]
c. PP: links [vom Theater]
(vgl.: in front [of the theatre],
ct [de la maison])
Prototypisch sind Prpositionen von der Art
(21a). Im Zusammenhang mit Bewegungen
gibt es Prpositionen wie in (21b), die Beginn
(source) oder Ende (goal) einer Bewegung
relativ zu einer Nachbarschaft eines Objektes
kodieren. Prpositionen wie in (21c) sind N-
Derivate und verlangen eine feste morpholo-
gische Form der abhngigen P, die sich aus
der Kasusmarkierung von Argumenten in der
NP ergibt (dt. von oder Genitiv, engl. of, frz.
de).
Prpositionen erlauben Modifikatoren ver-
schiedener Art.
(22)
a. direkt [hier], kurz [vor dem Theater]
ganz [oben], fast [in der Mitte]
b. finn. Hn men-i talo-on
(er/sie geh-PRT Haus-ILLAT)
Dt. in das Haus und finn. taloon sind die
eigentlichen Argumente des betreffenden Be-
wegungsverbs. Die Prposition in vermittelt
dabei eine semantische Beziehung zwischen
gehen und Haus; insofern ist dann das
Haus nur ein indirektes Argument von gehen.
In der gleichen Weise ist finn. talo ein indi-
rektes Argument, bei dem das lokale Suffix
Vn des Illativs die semantische Beziehung
vermittelt.
Lokale Adverbien sind von derselben syn-
taktischen Kategorie wie Prpositionalphra-
sen (s. besonders Jackendoff 1973, Wunder-
lich 1984). In Adverbien wie dahinter, drber
ist die Zweistelligkeit bereits morphologisch
sichtbar.
(17)
a. Anna steht vor dem Haus.
b. Anna steht davor.
c. Anna steht vorne.
(17a) erhlt die Deutung, da Anna in der
Vor-Nachbarschaft des Hauses lokalisiert ist;
(17b), da es ein Objekt x gibt, so da Anna
in der Vor-Nachbarschaft von x lokalisiert ist;
(17c), da es einen Raum p gibt, so da Anna
in dem Vor-Teil von p lokalisiert ist. Adver-
bien dienen somit zur impliziten Lokalisie-
rung, nmlich relativ zu kontextuell gegebe-
nen Entitten (Objekte oder Orte). Seman-
tisch sind sie also relational, syntaktisch aber
1-stellige Prpositionen.
Schlielich weisen einige Sprachen (z. B.
Dt., Engl., Ung., Chin.) lokale Verbalpartikel
auf, die eine feste Stellungsbeziehung zum
Verb (meistens ein Bewegungsverb) haben
und oft zusammen mit dem Verb lexikalisiert
sind (vgl. Talmy 1985, der diese Partikel als
Satelliten anfhrt). Verbalpartikel sind aus
Adpositionen, Adverbien oder Verben ent-
standen und haben, sofern sie lokal trans-
parent sind, ebenfalls relationale Bedeutung
(chin. q ist deiktisch).
(18)a. dt. Sie springt auf.
Sie geht hinein.
b. ung. fel-szll a villamos-ra
(er/sie auf-steigt die Straen-
bahn-SUBLAT)
be-megy a hz-ba
(er/sie hinein-geht das Haus-
ILLAT)
c. chin. tio-gu-q
(springen-durch-hin = sie
springt hindurch)
pao-jn-q
(rennen-in-hin = sie rennt
hinein)
Die Lokalisierungsrelation kann auch zur le-
762 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
(26)
a. Die Bcher liegen auf dem Tisch.
b. Die Katze springt auf dem Tisch.
c. Die Katze spielt auf dem Tisch.
(27)
a. Der Vorhang hngt auf den Tisch.
b. Die Katze springt auf den Tisch.
c. *Die Katze spielt auf den Tisch.
Die Beispiele (26a,b) und (27a,b) zeigen, da
die Sorte des Verbs nicht entscheidend ist,
ganz abgesehen davon, da eine PP als ma-
ximale Projektion vor dem Hineinregieren des
Verbs geschtzt ist (nach den Standardauf-
fassungen der Syntaxtheorie). In einem Lokal
regiert auf den Dativ, d. h. das Vorkommen
des Dat. ist so zu interpretieren, da ein Ob-
jekt (oder evtl. eine Situation) statisch loka-
lisiert wird. In einem Direktional regiert auf
den Akkusativ, d. h. das Vorkommen des
Akk. besagt, da ein Objekt einem Ortswech-
sel unterliegt. Ein Satz wie (27a) mit einem
Positionsverb erfordert daher eine Umwegin-
terpretation, etwa in dem Sinne, da das Hn-
gen des Vorhangs eine Dimension definiert,
lngs der ein Ortswechsel mglich ist derart,
da ein Teil des Vorhangs auf dem Tisch
lokalisiert ist. Fr eine Aktivitt wie spielen
(vgl. (27c)) ist eine derartige Umweginterpre-
tation kaum mglich.
Bewegungsverben haben ein wegbezogenes
Argument, z. B. ein Direktional. In (27b) ist
die PP daher ein Argument, in (26b) ein
Nicht-Argument. Diese Unterscheidung wird
im Dt. durch Akk. vs. Dat. geleistet, im Engl.
durch onto vs. on, im Chin. durch Wortstel-
lung: PP-Argumente stehen rechts vom Verb,
PP-Nicht-Argumente links vom Verb (s.
(28a,b)) (vgl. Li & Thompson 1978: 229). Im
Jap. wird der Unterschied durch verschiedene
Kasuspartikel gekennzeichnet: ni fr lokale
und direktionale Argumente von Positions-
und Bewegungsverben, de fr circumstantielle
(u. a. lokale) Nicht-Argumente (s. (28cf)).
(28)
a. T tio zi zhuozi-shang.
(er hpf LOK Tisch-Oberseite =
Er hpft auf den Tisch.)
b. T zi zhuozi-shang tio.
(er LOK Tisch-Oberseite hpf =
Er hpft auf dem Tisch.)
c. tsukue no ue de tobu
(Tisch GEN oben ORT/CIRC sprin-
gen = auf dem Tisch springen)
d. tsukue no ue ni tobu
(Tisch GEN oben LOC/DIR sprin-
gen = auf den Tisch springen)
e. uchi de hataraku
(Zuhause ORT/CIRC arbeiten =
zu Hause arbeiten)
b. zwei Meter (weit) [hinter der Kreu-
zung]
c. oben [im Schrank]
hier [im Zimmer]
d. [im Wohnzimmer] auf der Heizung
[oben] im Schrank
Wir betrachten zwei Meter und zwei Meter
(weit) in (22b) gleichermaen als APn. Die
Maangabe zwei Meter ist direktes Objekt
des Distanzadjektivs (s. Bierwisch & Lang
1987); dieses kann u. U. implizit bleiben. Fr
das Deutsche kann daher folgende Struktur
der lokalen PP angenommen werden.
Modifizierende PPn knnen vor oder nach
der modifizierten PP stehen, APn nur vor
der PP. Man beachte, da in [
PP
oben [
PP
im
Schrank]] oben die Extension von im Schrank
einschrnkt (etwas wird in einem Teil der In-
Nachbarschaft des Schranks lokalisiert: im
Schrank, und zwar oben), whrend umge-
kehrt in [
PP
[
PP
oben] im Schrank] im Schrank
die Extension von oben einschrnkt (etwas
wird in der In-Nachbarschaft des Schranks
lokalisiert: oben, und zwar im Schrank).
(24a,b) zeigt die einschlgigen Oppositionen.
(24)
a. oben im Schrank und nicht unten im
Schrank
b. oben im Schrank und nicht oben in
der Truhe
Ebenso ist zu bemerken, da *zwei Meter
hier/oben, *kurz hier/oben ausgeschlossen
sind, offenbar deshalb, weil eine 1-stellige P
(= Adv) explizit kein Objekt bereitstellt, von
dem aus eine Messung erfolgen knnte.
Ein Adverb wie vorne ist (vgl. oben, Bei-
spiel (17)) relativ zu einem Ort p des Kontex-
tes zu interpretieren. Wenn vorne eine PP mo-
difiziert, so liefert diese den einschlgigen
kontextuellen Ort.
(25) Anna steht [
PP
vorne [
PP
im Zimmer]]
Satz (25) erhlt so die Deutung, da Anna
im Vor-Teil der In-Nachbarschaft des Zim-
mers lokalisiert ist.
Speziell im Deutschen gibt es eine Reihe
lokaler Pn, die entweder den Dativ oder den
Akkusativ regieren. Dann ist der Kasus in-
terpretationsrelevant.
37. Lokale und Direktionale 763
Implikate in (32) in der semantischen Dekom-
position der Verben geeignet bercksichtigt
werden (siehe 3.4).
Die Syntax ist (bis zu einem gewissen
Grade) gegenber der Semantik autonom.
Ein Ausdruck mu nicht bezglich aller Ar-
gumente subkategorisiert sein (vgl. Bierwischs
(1987) Analyse der dimensionalen Adjektive,
s. ebenso unten die Analyse der dimensiona-
len Prpositionen). Wir nehmen allerdings an,
da Verben wie sitzen, gehen, stellen bezglich
des lokalen bzw. direktionalen Arguments
subkategorisiert sind: [PP ____] bzw. [NP PP
____]. In manchen Fllen ist die PP wegla-
bar, in anderen Fllen nicht; die Verhltnisse
sind im einzelnen oft recht unsystematisch.
Nur bei kausativen Positionsverben ist das
Direktional notwendig.
(33)
a. Anna sitzt bequem.
b. Anna geht langsam.
c. *Anna stellt die Lampe langsam.
Sitzen impliziert z. B. auch eine bestimmte
Krperposition, im Kontrast zu stehen, liegen
usw., und kann mglicherweise nur mit die-
sem Teil seiner Bedeutung gebraucht werden.
Im brigen sind interne Argumente syntak-
tisch oft weglabar, weil sie stereotyp oder
kontextuell ergnzbar sind. Waschen, kochen
sind sicherlich transitive Verben, aber auch
intransitiv verwendbar.
(34) Otto kocht heute abend, whrend Anna
wscht.
Fehlende Argumente werden hier als existen-
tiell gebunden verstanden.
Im Dt. gibt es keine wirklich verllichen
syntaktischen Tests zur Unterscheidung von
Argumenten und Nicht-Argumenten. Im all-
gemeinen ist es wohl so, da mit und zwar
oder mit tut dasselbe nur Nicht-Argumente
anschliebar sind. Der und zwar-Test ist aber
an die Bedeutung von zwar gebunden. Der
tut dasselbe-Test setzt voraus, da es sich um
ein Pro-Verb der Stufe VP handelt; er ist
problematisch bei nichtagentiven Verben.
(35)
a. Anna singt Arien, und zwar auf dem
Balkon.
b. ?? Anna liegt, und zwar auf dem Bal-
kon.
(36)
a. Anna singt Arien auf dem Balkon,
und Egon tut dasselbe im Bad.
b. * Anna liegt auf dem Balkon, und
Egon tut dasselbe im Bad.
Andere Sprachen lassen verllichere Tests
zu. Eine bertragung der Ergebnissse auf das
f. uchi ni iru
(Zuhause LOC sich-befinden =
sich zu Hause befinden)
2.3Externe Syntax der Prpositionalphrase
Eine lokale PP (und mithin auch ein Adv)
kann prdikativ, als Modifikator oder als Ar-
gument eines Verbs vorkommen.
(29) Anna ist auf dem Balkon.
(30)
a. Die Frau auf dem Balkon liest Zei-
tung.
b. In unserem Haus auf dem Balkon
wchst Petersilie.
c. Anna singt auf dem Balkon.
d. Anna sieht auf dem Balkon eine
Palme.
(31)
a. Anna sitzt auf dem Balkon.
b. Anna geht auf den Balkon.
c. Anna stellt die Lampe auf den Bal-
kon.
Bei nichtverbalen Prdikaten dient die Ko-
pula zur Realisierung der Flexionsmerkmale
(INFL); semantisch betrachten wir sie als
Identittsfunktion. (Wir nehmen also nicht
an, da es eine spezielle lokale Kopula gibt.)
In (30) sind Beispiele mit PP als Modifikator
aufgefhrt: Attribut zu NP (30a), Modifika-
tor zu PP (30b, s. oben (23)), Adverbial zu
VP (30c,d). In (31a) ist PP lokales, in (31b,c)
direktionales Argument. Im Rahmen der X-
bar-Theorie werden Argumente als syntakti-
sche Komplemente von X, Modifikatoren
aber als (Chomsky-)Adjunkte zu XP repr-
sentiert.
Die Unterscheidung zwischen Argumenten
und Nicht-Argumenten ist letztlich seman-
tisch. Positionsverben implizieren Lokalisie-
rung und verlangen daher ein lokales Argu-
ment. Bewegungsverben implizieren Bewe-
gung, also monotone Ortsvernderung, und
verlangen daher ein wegbezogenes Argument.
Kausative Positionsverben implizieren Orts-
wechsel und verlangen daher ein direktionales
Argument.
(32)
a. SITZ(x) LOC(x,p)
b. GEH(x) MOVE(x),
MOVE(x) LOC(x,p) & DIST(p,p
o
)
= f(t) & f ist monoton
c. STELL(y,x)
CHANGE(LOC(x,p))
LOC, MOVE und CHANGE werden als uni-
versal zur Verfgung stehende Prdikate an-
gesehen. Fr Verben wie singen, sehen gibt es
keine mit (32) vergleichbaren Implikations-
beziehungen. Wir werden annehmen, da die
764 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
zigen thematischen Rolle Weg (im Sinne der
in (7) oben gegebenen Definition) (vgl. dazu
auch Jackendoff 1983, Wunderlich 1984): Ein
Objekt ist whrend eines Weges lngs einer
Sequenz von Teilrumen lokalisierbar.
Bennetts -Rolle Extent beruht lediglich
auf einer Umweginterpretation: In einem Fall
wie (38e) weist go seinem Argument die -
Rolle Weg zu; da das Thema-Objekt (the
Mall) als Strae nur eine statische Konstel-
lation aufweist, mu fr die Interpretation
ein virtueller Weg angenommen werden. Es
ist also nicht ntig, fr go eine zweite Bedeu-
tung im Sinne von erstreckt sich anzuneh-
men. Und fr sich erstrecken gengen die -
Rollen Ursprung und Ziel, zusammen mit
dem Bedeutungspostulat (40):
(40) x erstreckt sich von a nach b x er-
streckt sich von b nach a.
Ostler sttzt seine Argumentation fr eine -
Rolle Orientierung u. a. auf die unterschied-
lichen Koordinierungsmglichkeiten bei di-
rektionalen PPn:
(41)
a. The ball rolled away from the house
and into the hole.
b. The boat drifted out of the harbour
and towards the island.
c. The ball rolled off the hilltop and
across the green.
d. The ball rolled down the slope and
across the green.
(42)
a. The ball rolled from the hilltop
(*and) to the tree.
b. The ball rolled from the hilltop
(*and) into the hole.
c. The ball rolled out of the house
(*and) to the tree.
d. The ball rolled from the hilltop
(*and) down the slope.
Nimmt man an, da nur semantisch Gleich-
artiges koordiniert werden kann, so erhlt
man nach Ostler fr das Englische drei Sorten
von direktionalen PPn: 1. reine Ursprungs-
PPn; diese werden ausschlielich mit der Pr-
position from gebildet; 2. reine Ziel-PPn; diese
werden nur mit to gebildet; 3. Orientierungs-
PPn; hierzu zhlt Ostler alle brigen direktio-
nalen PPn.
Auch Ostlers Beobachtungen zwingen
nicht dazu, mehr als eine direktionale -Rolle
anzunehmen. Die jeweiligen Koordinierungs-
restriktionen lassen sich mglicherweise da-
durch erklren, da from und to (ebenso wie
im Deutschen von, nach und zu) vllig unspe-
zifische Ortswechsel-Prpositionen sind, die
Dt. kann aber auch nur semantische qui-
valenz beanspruchen.
Mandarin-Chin. erlaubt vermutlich eine
syntaktische Unterscheidung durch die Stel-
lung zum Verb (s. oben (28)). Im Franz. kn-
nen Nicht-Argumente topikalisiert werden,
whrend Argumente eine pronominale Kopie
bentigen.
(37)
a. Sur le balcon, Anna lit le journal.
b. * Sur le balcon, Anna va.
c. Sur le balcon, Anna y va.
2.4Die thematischen Rollen von Positions-
und Bewegungsverben
Gruber (1965) und im Anschlu daran Jack-
endoff (1972) haben die Argumente eines
Verbs mithilfe spezifischer thematischer Rol-
len (-Rollen) semantisch charakterisiert;
Ausgangspunkt bildeten dafr die Positions-
und Bewegungsverben. Die Ergebnisse wur-
den dann im Hinblick auf andere Klassen von
Verben generalisiert (s. besonders Jackendoff
1976, s. 5.3).
Thema ist fr Gruber/Jackendoff das-
jenige Argument, das lokalisiert wird bzw.
einer Bewegung unterliegt. Positionsverben
weisen als weiteres Argument eine Lokation
auf, Bewegungsverben einen Ursprung
(source) und ein Ziel (goal). Bennett (1975)
fgt dem noch weitere -Rollen Weg (path)
und Erstreckung (extent) hinzu. Ostler
(1980) pldiert fr eine -Rolle Orientierung
(orientation).
(38)
a. Location: Er sitzt im Zug.
b. Source: Er kommt aus Paris.
c. Goal: Er fhrt nach London.
d. Path: Er fhrt ber den Kanal.
e. Extent: The Mall goes from Bucking-
ham Palace to Trafalgar Square.
f. Orientation: The boat drifted towards
the island.
Ein Problem stellte dabei die Tatsache dar,
da Weg-Ausdrcke in beliebiger Anzahl auf-
treten knnen (vgl. (6a) oben), somit gegen
das Prinzip verstoen wird, da eine -Rolle
nur einmal vergeben werden darf (vgl. Fill-
more 1971 fr eine hnliche Forderung in der
Kasusgrammatik; Fillmores Beispiel ist:)
(39) He walked down the hill across the
bridge through the pasture to the chapel.
Bennett erwgt in diesem Zusammenhang
eine bergreifende thematische Rolle Reise
(journey). In der Tat sind Source, Goal,
und die diversen mglichen Instanzen von
Path oft lediglich Spezifizierungen einer ein-
37. Lokale und Direktionale 765
3.1Lokalisierung von Situationen
In der Auffassung von Lakoff (1970) referiert
ein Deklarativsatz auf eine Situation, wh-
rend ein Lokaladverbial ein hheres Prdikat
ist mit einer Situation als Argument. Die in-
formale Reprsentation fr (44a) wre dann
(44b) bzw. in relationaler Schreibweise (44c).
(44) a. Anna singt Arien auf dem Balkon.
b. AUF-DEM-BALKON (Anna singt
Arien)
c. AUF (Anna singt Arien, der Balkon)
Situation Objekt
Diese Theorie versagt fr Stze wie die fol-
genden:
(45)
a. Anna wohnt in Dsseldorf.
b. IN (Anna wohnt, Dsseldorf)
(46)
a. Anna singt Arien in der Philharmonie
auf dem Balkon.
b. IN (AUF (Anna singt Arien, der Bal-
kon), die Philharmonie)
Anna wohnt kann auf keine vollstndige Si-
tuation referieren, da das Lokal ein Argument
des Verbs ist. Dagegen referiert AUF (Anna
singt Arien, der Balkon) bereits auf eine lo-
kalisierte Situation; es bleibt unklar, wie die
beiden PPn in (46a) auf dieselbe Situation
beziehbar sind.
Der zweite Mangel lt sich in Davidsons
Analyse von Handlungs- und Ereignisstzen
beheben. Davidson (1967a, 1970) geht davon
aus, da die logische Form eines Deklarativ-
satzes die eines Existenzsatzes ist, der be-
hauptet, da es mindestens eine Situation (bei
Davidson spezieller: eine Ereignis) der frag-
lichen Art gibt. Dadurch wird es mglich, die
Situation durch mehrere verschiedene PPn zu
lokalisieren. Vereinfacht lautet die Analyse
(47)
a. Anna singt Arien in der Philharmonie
auf dem Balkon.
b. s (singt-Arien(Anna, s) &
AUF(d__ Balkon, s) &
IN(d__ Philharmonie, s))
Auf Davidsons Ansatz grndet sich die Theo-
rie von Sondheimer (1978). Danach sind Ver-
ben Prdikate ber Situationen (Ereignissen
oder Zustnden); sie charakterisieren somit
den Typ der Situation. Die Rollen der Situa-
tionskonstituenten (unabhngig davon, ob sie
als Argumente oder Nicht-Argumente eines
V auftreten) werden durch thematische Re-
lationen gekennzeichnet. Durch die Relation
P (Place) wird fr eine Situation s ein Ort p
lediglich die Funktion haben, eine Region als
Ursprungs- oder Zielregion eines Ortswech-
sels zu kennzeichnen, darber hinaus aber
keinerlei semantischen Gehalt besitzen. Dem-
gegenber sind out of, off, into, onto, across,
through usw. in dem Sinne spezifisch, da sie
z. B. zustzlich etwas ber die Dimensions-
charakteristika der betreffenden Teilregionen
aussagen. Dies gibt ihnen eine gewisse seman-
tische Eigenstndigkeit, die from und to nicht
besitzen (vgl. Ostler 1980: 20 ber syntag-
matische vs. paradigmatische Bedeutungsre-
lationen). Die Koordinierbarkeit direktiona-
ler Verbargumente setzt aber offenbar eine
derartige Eigenstndigkeit voraus. Es scheint
eine Restriktion von der Art zu geben, da
eine unspezifische PP mit keiner anderen PP
ob spezifisch oder nicht koordiniert
werden kann.
Die Auffassung, da ein Satz wie (39) meh-
rere wegbezogene Argumente aufweist, be-
ruht auf der Annahme, da er mehrere von-
einander unabhngige PP-Konstituenten auf-
weist. Diese Annahme ist falsch. Die Topi-
kalisierbarkeit im Deutschen zeigt z. B., da
in (43) nur eine (komplexe) PP vorliegt.
(43) [Von Kln aus lngs des Rheins ber
Neuss nach Krefeld] fahren sie in einem
halben Tag.
Man kann annehmen, da die meisten Be-
wegungsverben das Ziel als Kopf einer kom-
plexen PP whlen (fr den Ausdruck der Ziel-
Lokalisierung stehen auch mehr Prpositio-
nen zur Verfgung), whrend Verben wie ho-
len, kommen den lokalen Ursprung als Kopf
whlen. Mit anderen Worten: nach Krefeld in
(43) mu als obligatorisches Argument ver-
bleiben, whrend alle anderen PPn als Mo-
difikatoren weglabar sind.
3. Semantik der
Lokalisierungsausdrcke
Die Semantik hat zu klren, welchen Beitrag
eine lokale PP zur Satzbedeutung liefert.
(i) Der Beitrag soll sich kompositional auf
der Basis der syntaktischen Struktur er-
geben.
(ii) Die Unterscheidung der Verwendung
einer PP als Modifikator oder als Verbar-
gument soll respektiert werden.
Es ist klar, da jede solche Theorie zugleich
den semantischen Typ der Prposition und
die funktionalen Beziehungen im Satz spezi-
fizieren mu.
766 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
Zerlegung der Situation in mehrere Teilsitua-
tionen, etwa im Sinne von
(52) WERFEN (x, y, z) CAUSE(xs Ak-
tivitt, COME ABOUT(BE-AT(y, z)))
Hierbei werden die Teilsituationen durch Rol-
len-Prdikate als Trger bestimmter thema-
tischer Rollen in der Gesamtsituation charak-
terisiert. xs Aktivitt des Werfens ist dem-
zufolge Instrument (I) einer CAUSING-Si-
tuation. Ziel (Z) von CAUSING ist eine
COMING-ABOUT-Situation, und deren
Thema ist das Geworfen-sein von y. Diese
Analyse ist inakzeptabel, weil WERFEN hier
in eine Aktiv- und eine Passiv-Situation auf-
gespalten wird. Im Sinne der brigen Annah-
men von Sondheimer lt sich aber fr Satz
(53a) statt Sondheimers Analyse (53b) eine
wesentlich plausiblere Analyse (53c) finden.
(Dabei wird CAUSE allerdings als zweistel-
liges Prdikat angesehen, whrend bei Sond-
heimer nur Rollen-Prdikate zweistellig sind.)
(53)
a. Anna wirft im Wald die Flinte in den
Bach.
b. s
1
, s
2
, s
3
p
1
, p
2
(CAUSING(s
1
) &
I(s
1
, Annas Aktivitt des Werfens) &
Z(s
1
,s
2
) & COMING-ABOUT(s
2
) &
Th(s
2
,s
3
) & Geworfen-sein(s
3
) &
Th(s
3
, d_ Flinte) & P(s
3
,p
2
) & IN(p
2
,
d_ Bach) & P(s
1
,p
1
) & IN(p
1
,
d_Wald))
c. s
1
, s
2
p
1
, p
2
(WERFEN(s
1
) & Ag(s
1
,
Anna) & P(s
1
,p
1
) & IN(p
1
, d_Wald)
& CAUSE(s
1
,s
2
) & BEING-AT(s
2
) &
P(s
2
,p
2
) & IN(p
2
, d_Bach) & Th(s
2
,
d_Flinte))
Ein Vorteil solcher Analysen ist z. B., da das
lokale Adverbial (im Wald) auf die gesamte
Situation, das direktionale Argument (in den
Bach) allein auf die Teil-Situation des Sich-
Befindens beziehbar ist (overall vs. partial
predication).
Man fragt sich, weshalb Sondheimer einer-
seits eine ontologische Feinanalyse vornimmt
(die Aktivitt des Agens als Instrument einer
Situationsvernderung betrachtet), der auf
der Seite der sprachlichen Formulierung
nichts entspricht, andererseits darauf verzich-
tet, das bewegte Objekt als etwas anzusehen,
das einem Ortswechsel unterliegt, d. h. dessen
Lokalisierung sich ndert. Der Grund dafr
ist, da bei Sondheimer niemals Objekte, son-
dern stets nur Situationen lokalisiert werden;
es macht wenig Sinn zu sagen, da in einem
Fall wie (53a) das Werfen im Bach landet.
eingefhrt, der durch weitere Prdikate spe-
zifizierbar ist.
(48)
a. Max schlft auf dem Balkon.
b. s p (Schlafen(s) & Th(s, Max) &
P(s, p) & AUF(p, d _ Balkon))
(49)
a. Max ist auf dem Balkon.
b. s p (BEING-AT(s) & Th(s, Max)
& P(s, p) & AUF(p, d _ Balkon))
(50)
a. Max steht auf dem Balkon.
b. s p (BEING-AT(s) & Stehen(s) &
Th(s, Max) & P(s, p) & AUF(p,
d _ Balkon))
In dieser Analyse gibt es keinen prinzipiellen
Unterschied zwischen lokalen Modifikatoren
und lokalen Argumenten (auer als Unter-
schied zwischen overall predication and
partial predication, vgl. Satz (53a) unten).
Eine prinzipielle Unterscheidung ist nicht
mglich, weil der Stelligkeit eines Verbs direkt
keine Rechnung getragen wird (auer mgli-
cherweise durch geeignete Bedeutungsspostu-
late fr die Prdikate). Auf diese Weise kann
unterschiedslos fr alle Situationen eine
Place-Relation herangezogen werden. Ledig-
lich wird bei der direkten Prdikation (49)
(und analog bei der Modifikation eines N)
ein abstraktes Situations-Prdikat BEING-
AT verwendet. Um der Einheitlichkeit der
Theorie willen stellt so z. B. (49b) ein Mon-
strum dar: Nicht Max wird auf dem Balkon
lokalisiert, sondern die Situation eines
BEING-AT, dessen Thema-Argument Max
ist, wird auf dem Balkon lokalisiert. Bei Po-
sitionsverben wie in (50) ist diese Situation
dann weiter spezifiziert.
Bei Bewegungsverben wird ein abstraktes
Prdikat GOING verwendet, und der Ort p
der Situation ist dann eine Menge zeitindi-
zierter Positionen (placelets), die in ihrer Ge-
samtheit einen Weg bilden. Ursprung und Ziel
werden dabei durch Elemente von p (UNIT),
Abschnitte des Weges durch eine Teilmenge
von p (SEGMENT) reprsentiert.
(51)
a. Max fhrt von Kln ber die Alpen
nach Venedig.
b. s p t
1
, t
2
, t
3
, t
4
(GOING(s) & FAH-
REN(s) & Th(s, Max) & P(s, p) &
VON(UNIT(p,t
1
), Kln) &
BER(SEGMENT(p,t
2
,t
3
), d_ Al-
pen) & NACH (UNIT(p,t
4
), Venedig)
& t
1
< t
2
< t
3
< t
4
)
Bei transitiven Bewegungsverben macht
Sondheimer Gebrauch von einer lexikalischen
37. Lokale und Direktionale 767
da sich in (55) ein Objekt im Positionsmodus
des Liegens befindet und in der Region lo-
kalisiert ist, die durch die PP im Bett charak-
terisiert ist (s. 3.4).
(55) Anna liegt im Bett.
Bedenkenswert erscheint eine Theorie der Lo-
kalisierung von Situationen eher fr lokale
Modifikatoren wie in (56). Doch auch hier
treten Probleme auf, fr die bislang in der
Literatur noch keine befriedigenden Lsun-
gen gefunden wurden.
(56)
a. Die Kinder spielen in der Kche mit
Karten.
b. Die Kinder spielen auf dem Kchen-
tisch mit Karten.
In (56a) ist anzunehmen, da sich alle am
Spiel beteiligten Objekte (die Kinder und die
Karten) in der angegebenen Region hier:
in der Kche befinden. Nicht so in (56b):
Hier wird man im allgemeinen (aber nicht
zwingend) annehmen, da nur die Karten,
aber nicht die Kinder auf dem Kchentisch
lokalisiert sind. Die intuitiv durchaus anspre-
chende Analyse, derzufolge in (56) eine Spiel-
situation lokalisiert wird, mu durch eine
Theorie abgesichert werden, die erklrt, unter
welchen Umstnden eine Situation in einer
Region lokalisiert werden kann, ohne da sich
alle Partizipanten der Situation in der ange-
gebenen Region befinden mssen. Da anzu-
nehmen ist, da die Regionen, die die Parti-
zipanten einer Situation einnehmen, Teil der
Region sind, die der Gesamtsituation zuzu-
weisen ist, steht eine Theorie der Situations-
lokalisierung in Stzen wie (56b) vor der
Schwierigkeit, da nicht die Situation in ihrer
gesamten Erstreckung in der angegebenen Re-
gion lokalisiert wird, sondern nur ein Teil der
Situation. Es gibt aber gute Grnde, fr Pr-
dikationen und das schliet lokale Prdi-
kationen mittels lokaler PPn ein das Prin-
zip der Argument-Homogenitt zu vertreten
(s. Lbner 1987c fr den allgemeinen Fall und
Herweg 1989 fr den Spezialfall lokaler Pr-
dikationen): Prdikationen beziehen sich im-
mer auf ihre Argumente in deren Gesamtheit.
Wenn nur ein Teil des Arguments das Prdi-
kat erfllt, kann kein definiter Wahrheitswert
zugewiesen werden. Abweichungen vom se-
mantischen Homogenittsprinzip knnen
aber u. U. pragmatisch legitimiert sein (s. Her-
weg 1989 fr Konstruktionen wie die Blumen
in der Vase). Eine Theorie der Situationslo-
kalisierung fr modifizierende Lokalangaben,
die sich auch auf die Mglichkeit von No-
(Aber Sondheimer mu qualvoll sagen, da
sich das Geworfen-Sein im Bach befindet!)
Alle bisher besprochenen Theorien gehen
auf die Frage der Kompositionalitt nicht ein.
In Sondheimers Theorie spielt die Unterschei-
dung von Modifikator (also Funktionsaus-
druck) und Argument nur eine marginale
Rolle, jedenfalls sttzt sie sich nicht auf einen
syntaktischen Unterschied, der sich kompo-
sitional auswirken knnte. Eine Reprsenta-
tion wie (53b) ist kompositional auch gar
nicht erreichbar, denn Satz (53a) enthlt nur
eine (die Aktiv-)Form des Verbs.
Die Theorien weisen auch inhaltliche
Schwierigkeiten auf. Die eine beruht darauf,
da mehrstellige Prdikate in eine Menge von
Rollenprdikaten aufgelst werden. Somit ist
die Beziehung zwischen den Argumenten ver-
schwunden. Dies fhrt zu unannehmbaren
Konsequenzen (vgl. auch v. Stechow 1978).
Unterstellen wir, da es Objekte sind (und
nicht Situationen), die einen Weg beschreiten,
und betrachten dann die Analyse (54b) fr
Satz (54a).
(54)
a. Anna geht durch den Wald.
b. s w t
1
, t
2
(GOING(s) &
Th(s,Anna) & P(Anna,w) & DURCH
(SEGMENT(w,t
1
,t
2
), d_ Wald) &
t
1
t
2
)
c. Anna geht durch den Speisewagen.
Nehmen wir nun an, da (54c) wahr ist und
der Zug gerade durch den Wald fhrt, dann
trifft es im Sinne der Analyse (54b) zu, da
es einen Weg von Anna gibt, der durch den
Wald fhrt. Trotzdem sollte in dieser Situa-
tion mit (54c) nicht auch automatisch (54a)
als wahr anerkannt werden. Um das auszu-
schlieen, mssen wir voraussetzen, da An-
nas Weg durch das Gehen, also eine Aktivitt
von Anna, erzeugt wird; dementsprechend
mu gehen reprsentiert werden (s. unten 3.4).
Die zweite Schwierigkeit ist mit Sondhei-
mers unreflektierter Auffassung verbunden,
da prinzipiell Situationen und nicht Objekte
lokalisiert werden. Im Fall von Verben mit
PP-Argument wie liegen in (55) ist die durch
die PP spezifizierte Region als Bestandteil der
Gesamtsituation zu betrachten: Positionszu-
stnde sind inhrent raumbezogen, sie schlie-
en eine zweistellige Relation zwischen einem
Objekt und einer Region ein. Es ist zweifel-
haft, ob ein Prdikat wie LIEGEN im Stil
von Sondheimer als Situationstyp-Prdikat
ber eine Situation analysiert werden sollte,
deren Ort durch die lokale PP bestimmt wird.
Hier ist eine Analyse vorzuziehen, die besagt,
768 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
die zur Zeit noch keine befriedigenden L-
sungen existieren. In jedem Fall sind Situa-
tionslokalisierungen aber auf Ereignisse zu
beschrnken. Lokalisierbar sind ausschlie-
lich Individuen, also z. B. gewhnliche Ob-
jekte. Stoffe z. B. knnen dagegen nur dann
lokalisiert werden, wenn sie zu Einheiten, zu
Quanten von Stoffen, zusammengefat, also
mittels Quantelung individuiert werden (siehe
Artikel 18). Diese logische Lokalisierbarkeits-
bedingung wird von Ereignissen erfllt: Er-
eignisse sind Individuen im logischen Sinn
(vgl. Galton 1984). Ereignisprdikationen
sind entsprechend wie Individualnomina ge-
quantelt (heterogen).
Anders verhlt es sich bei Zustnden. Zu-
stnde sind keine Individuen; logisch sind sie
mit Stoffen vergleichbar (vgl. Galton 1984).
Zustandsprdikationen sind, ebenso wie
Stoffnomina, homogen (vgl. Krifka 1987).
Wie Stoffe knnen Zustnde allerdings zu
Einheiten (Quanten von Zustnden) zusam-
mengefat werden. In diesem Fall verhalten
sie sich logisch wie individuelle Ereignisse (s.
Lbner 1988, Herweg 1990) und erfllen da-
mit die Lokalisierbarkeitsbedingungen. Es
sprechen also keine logischen Grnde gegen
eine Theorie der Ereignislokalisierung; es sind
vielmehr die relativen Schwierigkeiten zu be-
denken, die mit einem solchen Ansatz im Un-
terschied zu einer Theorie der Objektlokali-
sierung verbunden sind. Die Lokalisierung
von Ereignissen setzt komplexe Informatio-
nen voraus, z. B. ber den Ereignistyp (wobei
ein und dasselbe Ereignis oftmals verschie-
denen Ereignistypen zugeordnet werden
kann), darber, was die relevanten Rollentr-
ger in dem Ereignis sind (was wiederum je
nach Typ variieren kann), ber die Stellung
des betreffenden Ereignisses in einer Ereignis-
hierarchie oder einem Ereigniszusammen-
hang, und vieles mehr.
Den primren Anker fr die Lokalisierung
von Ereignissen bieten die Positionen der be-
teiligten Objekte. Der Ort eines Kusses wird
gewhnlich ber die Position beider Kssen-
den bestimmt, der Ort eines Gesprchs ber
die Position der Gesprchsteilnehmer usw.
Die Lokalisierung eines Ereignisses setzt also
in der Regel die vorherige Lokalisierung der
beteiligten Objekte voraus. Einige der damit
verbundenen Probleme wurden bereits oben
angedeutet. Darber hinaus ist es vllig un-
klar, was die Position eines komplexen Ereig-
nisses sein soll, dessen Teilereignisse rumlich
getrennt stattfinden. Nehmen wir z. B. das
Ereignis, da eine Person A eine andere Per-
minalisierungen wie in (57) berufen kann,
mu in jedem Fall eine Klrung dieses Pro-
blems herbeifhren.
(57)
a. das Spiel (der Kinder mit Karten) in
der Kche
b. das Spiel (der Kinder mit Karten) auf
dem Kchentisch
hnliches gilt fr ein Beispiel wie
(58) der Ku auf dem Balkon
Die Kssende, sagen wir Anna, kann sich
ber die Brstung eines Balkons zu einem
Mann im Garten gebeugt haben, oder sie
kann sich aus dem Zimmer heraus zu einem
Mann auf dem Balkon gebeugt haben; der
Ort des Kusses kann also zweifellos noch fei-
ner festgelegt werden.
Besondere Schwierigkeiten entstehen bei
Verben, die eine signifikante rumliche Tren-
nung der an der beschriebenen Situation be-
teiligten Objekte zulassen:
(59) Anna sieht auf dem Balkon eine Palme.
Was bedeutet es, da die Situation des Sehens
auf dem Balkon lokalisiert wird? Mssen
dann auch die Sehende und das Gesehene auf
dem Balkon sein, oder gengt es, da ein Teil
des Blickfeldes auf dem Balkon lokalisiert ist?
Nun ist (59) offensichtlich zweideutig: (59) ist
wahr, wenn Anna z. B. im Zimmer und die
Palme auf dem Balkon ist, und (59) ist auch
wahr, wenn Anna auf dem Balkon und die
Palme z. B. im Garten ist.
Diese Bedingungen sind auch einschlgig,
wie (60) erkennen lt
(60) Anna sieht auf jedem Balkon eine Palme.
Allquantor und Existenzquantor (falls der in-
definite Artikel hier so analysiert wird) kn-
nen jeweils im Skopus des anderen stehen:
(60) ist wahr, wenn Anna von jedem Balkon
aus eine andere Palme sieht; (60) ist wahr,
wenn Anna von jedem Balkon aus dieselbe
Palme sieht; und (60) ist wahr, wenn Anna,
vor dem Haus stehend, auf jedem Balkon eine
andere Palme sieht. (Die vierte Lesart ist
pragmatisch ausgeschlossen.) Die Rekon-
struktion solcher Mehrdeutigkeiten verlangt,
da Aussagen ber die Lokalisierung von Ob-
jekten einer Situation gemacht werden kn-
nen.
Wir mssen also festhalten, da eine Theo-
rie der Situationslokalisierung fr modifizie-
rende lokale PPn zwar in vielen Fllen intuitiv
plausible Resultate erzielt, aber mit einer
Reihe von Schwierigkeiten behaftet ist, fr
37. Lokale und Direktionale 769
zielt also von vornherein auf eine komposi-
tionale Analyse. Lokale PPn werden als Verb-
modifikatoren behandelt, nmlich als Aus-
drcke der Kategorien IV/IV oder TV/TV:
Sie sind Funktoren, die in der Kombination
mit einem intransitiven oder transitiven Verb
(IV bzw. TV) wiederum ein intransitives bzw.
transitives Verb bilden. Diese Kategorisierung
gilt unabhngig davon, ob eine lokale PP als
Adjunkt (Modifikator im Sinne von Ab-
schnitt 2.3) oder Komplement (Argument)
auftritt. Der Unterschied zwischen Adjunkt
und Komplement schlgt sich also nicht in
der syntaktischen Kategorie und dementspre-
chend im semantischen Typ der PP nieder; er
zeigt sich vielmehr in der Kategorie des je-
weiligen Verbs. Verben, die kein lokales Ar-
gument haben, sind von der Kategorie IV
oder TV, whrend Verben, die ein lokales
Argument erfordern, von der Kategorie IV/
(IV/IV) oder TV/(TV/TV) sind.
Sinngem legt Dowty syntaktische Ana-
lysen der folgenden Art zugrunde:
(63)
a. [[auf dem Balkon]
IV/IV
schlafen
IV
]
IV
b. [einen Mann [[auf dem Balkon]
TV/TV
kssen]
TV
]
IV
c. [[auf dem Balkon]
IV/IV
[einen Mann
[kssen]
TV
]
IV
]
IV
d. [[auf dem Balkon]
IV/IV
stehen
IV/(IV/IV)
]
IV
e. [die Flaschen [[auf den Balkon]
TV/TV
stellen
TV/(TV/TV)
]
TV
]
IV
Mit den Analysen (63b,c) lt sich die anhand
von (58,59) beschriebene Mehrdeutigkeit er-
fassen; es soll hier offen bleiben, ob Dowty
diese Analysen (die so bei ihm nicht vorkom-
men) akzeptieren wrde. Sie ergeben sich aber
zwanglos, wenn lokale PPn als IV/IV oder
TV/TV kategorisiert werden.
Die Unterscheidung von lokalen PPn der
Kategorien IV/IV und TV/TV ist fr die Be-
deutung der PP selbst unerheblich, sie betrifft
nur deren unterschiedliche Kombinationsf-
higkeit im Satz. Der wesentliche Anteil, den
eine (im engeren Sinne) lokale P beitrgt, ist
ein zweistelliges Lokalisierungsprdikat zwi-
schen Objekten, whrend eine direktionale P
mit einem weiteren BECOME-Operator ver-
sehen ist.
(64)
a. in: ...BE-IN (x, y)
into: ...BECOME (BE-IN (x, y))
c. from: ...BECOME (NOT BE-AT
(x, y))
Dabei reprsentiert y stets das Objekt-Argu-
ment der Prposition und x das (externe) Ar-
gument, das bei funktionaler Applikation mit
son B ttet, indem A B auf offener Strae
niederschiet, B aber erst spter im Kranken-
haus stirbt. Ist der Raum des komplexen Er-
eignisses die Vereinigung der Rume seiner
Teilereignisse, die wiederum mittels der Posi-
tionen der beteiligten Objekte in geeigneter
Weise zu bestimmen sind? Eine solche An-
nahme wrde dazu fhren, auch nicht zusam-
menhngende Rume als Positionen lokali-
sierter Entitten zuzulassen, eine Konse-
quenz, die unserer Grundauffassung von
Rumen widerspricht und u. E. zumindest
problematisch ist.
Sicherlich ist es prinzipiell mglich, geeig-
nete Bedeutungspostulate fr Verben zu for-
mulieren, die es erlauben, von der Position
des Ereignisses auf die Positionen der betei-
ligten Objekte und umgekehrt zu schlieen.
Ereignislokalisierung und Objektlokalisie-
rung wren dann quivalente Verfahren. Auf-
schlureich wre in diesem Zusammenhang,
ob man einen Ereignisparameter als Kom-
ponente der semantischen Reprsentation
von Verben auch unabhngig von berlegun-
gen zur Lokalsemantik motivieren kann. In
der Tat sprechen hierfr Resultate aus der
Forschung zu Tempus und Aspekt (s. Herweg
1990, Artikel 35 in diesem Band).
3.2Lokalisierung von Objekten
Geis (1975) vertritt gegenber Davidson ri-
goros die Position, da Objekte und nicht
Situationen lokalisiert werden. Seine Analy-
sen haben dafr andere Schwchen und sind
nicht generalisierbar.
(61)
a. Anna ist im Park.
b. p (AT(Anna,p) & p PARK)
(62)
a. Anna schlft im Park.
b. p (Schlafen(Anna) & AT(Anna,p) &
p e PARK)
AT ist eine primitive Lokalisierungsrelation,
p eine Ortsvariable, PARK ist ein Name fr
eine Menge von Orten. Es ist sicherlich pro-
blematisch, die rumliche Teil-von-Relation
als mengentheoretische Enthaltensein-Rela-
tion zu rekonstruieren. p PARK reprsen-
tiert die PP im Park. Eine solche Analyse ist
nicht leicht auf andere Prpositionen aus-
dehnbar; Geis bezieht dementsprechend auch
keine anderen Prpositionen ein. Er be-
schrnkt sich auf Stze der zitierten Art; so
ist nicht erkennbar, wie die Analyse auf lokale
Argumente ausdehnbar und strikt komposi-
tional durchfhrbar ist.
Dowty (1979) bewegt sich mit seinen Ana-
lysen im Rahmen der Montague-Grammatik,
770 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
xikalische Reprsentation von auf bereits alle
hinzutretenden Elemente bercksichtigen
(wird angewendet auf eine NP, ein TV, eine
NP, eine NP); deshalb mu auch zwischen
IV/IV und TV/TV-PPn unterschieden wer-
den. Aber das ist gegen die Intuition; ein Satz
ist keine Projektion von P; ein Ausdruck sollte
nur fr die eigenen Argumente verantwortlich
sein. Auf ist ein zweistelliges Prdikat. Das
erste Argument findet es in seinem syntakti-
schen Objekt. In einem Fall wie (65) ist das
zweite Argument ein TV, das aber nicht den
geeigneten semantischen Typ darstellt. Des-
halb mu auf sein externes Argument (das,
was lokalisiert wird) mit dem nchsten Ar-
gument des TV identifizieren, den Rest ms-
sen die Projektionsbedingungen des TV lei-
sten. (Diese berlegungen fhren zu einer
revidierten Theorie der Modifikation, siehe
Abschnitt 3.4.)
Nach dieser Klrung ist noch deutlicher,
weshalb ein TV mit PP-Argument kein TV/
TV-nehmendes TV sein sollte. Die funktio-
nale Leistung von auf ist nmlich dann be-
endet, wenn die Funktor-Kette abgebrochen
wird.
(66)
a. (weil) Anna die Flaschen auf den Bal-
kon stellt.
Hier nimmt das Verb stellen die PP zu sich
und sollte eines seiner Argumente mit dem
externen Argument von auf identifizieren.
Dowty bercksichtigt auch PPn in der
Funktion von PP-Modifikatoren.
dem jeweils nchsten freien Argument des
Verbs zu identifizieren ist. Deshalb ergibt sich
bei (63b), da das syntaktische Objekt des
Verbs (der Mann) lokalisiert wird. Dowty
reprsentiert die Bedeutungen und die darauf
bezogene funktionale Applikation im Rah-
men der Intensionalen Logik; auf eine Dar-
stellung der Details (die Ausfllung der ...
in (64)) soll hier verzichtet werden.
Problematisch an Dowtys Analyse ist, da
sie von der Modifikatorrolle der PPn ausgeht.
Dies fhrt zu einer Inflation an Kategorien.
PPn knnen auch NPn modifizieren und ge-
hrten dann wieder einer anderen Kategorie
an. Verben mit lokalem Argument mssen
(gegen die Intuition) fr einen Modifikator
subkategorisiert werden. Schlielich ist die
prdikative Rolle von PPn berhaupt nicht
darstellbar, es sei denn, da auch die Kopula
zur Kategorie IV/(IV/IV) gezhlt wird.
Aber auch die Auffassung von Modifika-
tion selbst bereitet Probleme. Sie ist in un-
vorteilhafter Weise an der semantischen Kom-
binatorik orientiert und steht im Widerspruch
zu den Annahmen der X-bar-Theorie.
(65)
a. (weil) Anna einen Mann auf dem Bal-
kon kt.
Die Prposition auf steht hier in einer voll-
stndigen Funktor-Kette (jeweils eingekreist
in der Struktur (65b)); daher mu nach den
Prinzipien der Montague-Grammatik die le-
37. Lokale und Direktionale 771
Entsprechend geht es Jackendoff nur um die
Struktur konzeptueller Reprsentation. Se-
mantische Fragestellungen, die mit Wahr-
heitsbedingungen und Quantifikation zusam-
menhngen, werden nicht beantwortet.
Zu den ontologischen Grundkategorien ge-
hren fr Jackendoff u. a. Ding, Ort, Weg,
Zustand und Ereignis. Sei X eine konzeptuelle
Einheit vom Typ THING, P vom Typ
PLACE, W vom Typ PATH und E vom Typ
EVENT. Jackendoff nimmt dann universale
Strukturregeln fr den Aufbau komplexer
konzeptueller Einheiten an. Diese Regeln sind
rekursiv. Im Bereich der rumlichen Repr-
sentation gehren dazu die folgenden:
(68) a. PLACE PLACE (X)
b. PLACE PLACE (W)
c. PATH PATH (X)
d. PATH PATH (P)
(69) a. EVENT GO (X, W)
b. EVENT STAY (X, P)
c. STATE BE (X, P)
d. STATE ORIENT (X, W)
e. STATE GO
EXT
(X, W)
f. EVENT CAUSE (X, E)
g. EVENT LET (X, E)
Die Konzepte in (68) dienen zur Interpreta-
tion lokaler PPn; einfache Beispiele fr
(68a d) sind in (70a d) angefhrt.
(70)
a. (Die Post liegt) auf einem Hgel.
b. (Die Post liegt) die Strae runter.
c. (Die Maus lief) durch das Fenster.
d. (Die Maus lief) (bis) unter den Tisch.
Die Konzepte in (69) dienen zur Interpreta-
tion von Positions- und Bewegungsverben.
Zur Illustration der Regeln (69ag) stehen die
Beispiele (71ag).
(71)
a. Der Vogel flog ins Nest.
b. Der Vogel blieb im Nest.
c. Der Vogel sa im Nest.
d. Das Schild zeigt nach Dsseldorf.
e. Die Strae fhrt nach Dsseldorf.
f. Max legt das Buch auf den Tisch.
g. Max lt das Auto in der Garage.
Die Regeln liefern komplexe konzeptuelle Re-
prsentationen, z. B. (72) fr Satz (71 f).
(67)
a. John walked [[from Boston] to De-
troit].
b. Anna sa [[auf dem Balkon] im Lie-
gestuhl].
Nach den Prinzipien von Dowty mssen from
Boston, auf dem Balkon nunmehr Ausdrcke
der Kategorie (IV/IV)/(IV/IV) sein; auf mte
im Fall von (67b) auch noch fr das Objekt
von in verantwortlich gemacht werden. Wh-
rend from NP in der Tat nur zusammen mit
to NP vorkommt, gilt das fr auf NP natr-
lich nicht. Dowty wrde deshalb die Analo-
gisierung von (67b) mit (67a) vielleicht ableh-
nen, er knnte dann aber (67b) berhaupt
nicht reprsentieren.
Im wesentlichen das Gleiche wie Dowtys
Analysen leisten die Analysen von Cresswell
(1978, 1985), lediglich in einem etwas anderen
kategorialgrammatischen Rahmen. Auch
Cresswell betrachtet PPn als Verbmodifika-
toren, die letztlich zur Lokalisierung eines
Verbarguments beitragen. Sehr viel differen-
zierter sind Cresswells Betrachtungen zum un-
terschiedlichen semantischen Beitrag einzel-
ner Prpositionen, besonders der wegbezo-
genen Prpositionen through, along, around,
via, past, beyond, across (s. unten, 4.3). Hier-
bei sttzt er sich auf die Arbeit von Bennett
(1975). Obwohl Cresswell in wesentlicher
Weise Begriffe wie spatial area und journey
verwendet, hlt er an den beiden semanti-
schen Grundtypen Objekt und Wahrheits-
wert fest. Die unplausible Komplexitt der
Analysen beruht bei ihm (wie bei Dowty)
letztlich darauf, da kein weiterer semanti-
scher Grundtyp wie Ort eingefhrt wird.
3.3Orte als semantischer Grundtyp
Jackendoff (1983, 1987) argumentiert dafr,
da die anzunehmenden ontologischen
Grundkategorien mentale Konzepte sind, auf
die sowohl das sprachliche wie auch das vi-
suelle und motorische System bezogen sind.
Syntaktische Strukturen werden direkt auf
konzeptuelle Strukturen abgebildet, die Exi-
stenz einer spezifisch sprachlichen semanti-
schen Ebene wird bestritten (vgl. dagegen die
Argumentation von Bierwisch & Lang 1987).
772 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
markierte Status solcher Stze ergibt sich hier
allenfalls daraus, da beim Aufbau der kon-
zeptuellen Struktur Informationen zu ergn-
zen sind.
(73)
a. Die Post liegt ber den Berg.
b. Die Post liegt um die Ecke.
Generell soll gelten, da Y in der Reprsen-
tationsform eine Instanz vom Typ Z ist.
Die Regeln liefern auch die konzeptuelle
Struktur, die man bei Umweginterpretationen
erhlt, wie z. B. in (73a,b) erforderlich. Der
modelltheoretischen Semantik. Wir beschrn-
ken uns auf eine extensionale Darstellung im
Rahmen der Prdikatenlogik mit Lambda-
Abstraktion. Es wird sich als ntzlich erwei-
sen, die semantische Reprsentation selbst
nur als strukturelle Bedingungen an die In-
terpretation zu verstehen; sie kann verschie-
dene Elemente enthalten, die im jeweiligen
Verwendungskontext konzeptuell zu differen-
zieren sind. Wir betrachten semantische Kom-
position als kompositional, whrend die kon-
zeptuelle Differenzierung nicht notwendiger-
weise kompositional ist (siehe hierzu auch
Artikel 3).
Wir betrachten eine lokale (statische) Pr-
position als 2-stelliges Prdikat ber der
Menge der lokalisierbaren Individuen (Ob-
jekte, portionierte Massen, gegebenenfalls
auch Ereignisse oder portionierte Zustnde;
um welche Sorte von Individuen es sich han-
delt, ist von der Prposition selbst nicht vor-
gegeben). Die Struktur dieser Prdikate folgt
einem generellen Schema, das in den (vllig
quivalenten) Varianten (a) oder (b) beschrie-
ben werden kann.
(76)
a. yx LOC(x, u
j
(y))
b. yx [p(x) u
j
(y)]
Darin ist LOC(x,R) eine generelle Lokalisie-
rungsrelation mit der Deutung, da der Ort
des Individuums x rumlicher Teil der Region
R ist; U
j
ist eine Familie von Funktionen u
j
,
die Individuen gewisse regionale Nachbar-
schaften zuordnen; p ist die Lokalisierungs-
funktion, die den Individuen ihren Ort zuord-
net, und ist die rumliche Teil-von-Rela-
tion (siehe Abschnitt 1). Der spezifische Kon-
trast zwischen Prpositionen ist durch die un-
terschiedlich festgelegten Nachbarschaftsre-
gionen U
j
gegeben. Fr die semantische Ana-
Die Regeln respektieren die syntaktische
Struktur eines Satzes: Syntaktische Einheiten
werden auf konzeptuelle Einheiten abgebil-
det. Lokale Prpositionen werden als Orts-
oder Wegfunktionen, ein n-stelliges Verb wird
als n-stellige Relation zwischen konzeptuellen
Einheiten dargestellt. Dabei wird auch von
lexikalischen Zerlegungen Gebrauch ge-
macht, z. B.
(74) a. legen (x, y, z): CAUSE (x, GO (y, z))
b. enter (x, y): GO (x, TO (IN (Y))
c. rise (x): GO (x, UPWARD)
Jackendoff behandelt lokale PPn ausschlie-
lich als Argumente vom Orts- oder Weg-Typ,
wobei Weg ebenso ein primitiver Typ ist wie
Ort (s. a. Creary et al. 1989). Verwendungen
als Modifikator werden nicht erfat. In einem
anderen Zusammenhang scheint Jackendoff
anzunehmen, da semantische Modifikation
zu einer direkten Unifikation von Konzepten
fhrt; er gibt allerdings keine Regeln dafr
an (Jackendoff 1983: 70 ff.). bertragen auf
PP-Attribute wrde sich folgendes ergeben:
3.4Synthese
Im Unterschied zu Jackendoff wollen wir im
folgenden die Bedeutung lokaler Ausdrcke
nicht mit lokalen Konzepten identifizieren
(obwohl sie natrlich darauf bezogen ist),
sondern verbleiben in den Vorstellungen der
37. Lokale und Direktionale 773
wird angenommen, da Attribute (nominale)
Eigenschaften auf (nominale) Eigenschaften
abbilden, also vom Typ (0/1)/(0/1) sind. Im
Rahmen der Kategorialgrammatik ist aus
dem Typ 0/1 der Typ (0/1)/(0/1) aber nicht
ableitbar, weder durch Typanhebung, noch
durch Typexpansion (siehe Artikel 7). Im
Rahmen dieser Tradition mte man also an-
nehmen, da es fr Prpositionen eine zweite
lexikalische Typzuweisung gibt, die sie als
mgliche Kpfe von Attributen ausweist. Das
ist keine sehr willkommene Lsung.
Man kann nun aber durch rein syntakti-
sche Argumentation zeigen, da Montagues
Behandlung der Attribute inadquat ist. Das
externe Argument einer Prposition wird in
der prdikativen Verwendung gesttigt. Mit-
hin mte die Forderung nach einem Aus-
druck vom Typ 0/1 ein internes Argument der
Prposition reprsentieren. Interne Argu-
mente sollen jedoch in der maximalen Projek-
tion der lexikalischen Einheit gesttigt wer-
den. In der attributiven Verwendung einer PP
mssen also die internen Argumente der Pr-
position bereits gesttigt sein. Somit kann ein
attribuiertes Nomen niemals internes Argu-
ment einer Prposition sein.
Die Lsung dieses Dilemmas liegt auer-
halb des Rahmens der Kategorialgrammatik
(bzw. typenlogischen Semantik), nmlich in
einer eigenen Theorie der Modifikation. Mo-
difikation beruht darin, da die externe -
Rolle eines Modifikators mit einer -Rolle des
Modifikanden identifiziert (bzw. unifiziert)
wird, was sich semantisch als Schnittmengen-
bildung deuten lt (vgl. Higginbotham 1985,
Wunderlich 1987, Bierwisch 1987, 1988). Mit
dieser Vorgabe erhlt man das gewnschte
Resultat fr einen Ausdruck wie Frau auf dem
Balkon.
(80) Frau auf dem Balkon:
Entsprechend knnte man fr Adverbiale ver-
fahren, wobei nur zu klren ist, mit welcher
-Rolle des Verbs zu unifizieren ist (s. weiter
unten).
Es verbleibt die Frage, wie sich die Argu-
mentrolle von PPn darstellen lt. Nehmen
wir versuchsweise (81a) als Reprsentation
eines Positionsverbs an, mit p als Ortsvariable
und SITZ* als Positionsprdikat (das den
Unterschied gegenber stehen, liegen, hngen
usw. kennzeichnet); dann mte die PP nicht
lyse einer Prposition wie auf ergibt sich somit
die folgende schematische quivalenz:
(77) AUF(x,y) LOC(x, AUF*(y))
AUF ist eine lokale Relation zwischen Indi-
viduen, AUF* ist die dafr charakteristische
Nachbarschaftsfunktion. Dowty hat die Be-
deutung von auf ausschlielich als AUF, Jak-
kendoff ausschlielich als AUF* rekonstru-
iert; (77) verdeutlicht den inneren Zusammen-
hang dieser Konzeptionen. (An dieser Stelle
soll nicht weiter darauf eingegangen werden,
wie AUF* zu analysieren ist, das zunchst
nur als Platzhalter fr den idiosynkratischen
Beitrag der Prposition steht. Man knnte
beispielsweise annehmen, da es sich um eine
externe Nachbarschaft in der Vertikalen han-
delt, wobei eine weitere Beschrnkung hin-
zukommen mu derart, da zwischen x und
y ein Kontakt besteht s. Abschnitt 4.1.
Generell wird man (76) als Schema anzuneh-
men haben, das durch Bedingungen von der
Art C(x,y) weiter eingeschrnkt werden
kann.)
In (76) ist y die interne -Rolle der Pr-
position, die durch das jeweilige Objekt der
Prposition gesttigt wird, x ist die externe
-Rolle, die in der syntaktischen Kombina-
torik der PP zu sttigen ist. Die PP als ganze
drckt eine Lokalisierungseigenschaft von In-
dividuen aus. Reprsentiere B das kontextuell
bestimmte Objekt der Balkon, dann drckt
auf dem Balkon die Eigenschaft aus, auf dem
Balkon lokalisiert zu sein.
(78) auf dem Balkon: x LOC(x, AUF*(B))
Eine lokale PP ist prdikativ, als Modifikator
oder als Argumentausdruck eines Verbs ver-
wendbar. Mit dem Schema in (76) ergibt sich
der Vorteil, auf eine lokale Deutung der Ko-
pula verzichten zu knnen; es gengt die pr-
dikative Deutung der Kopula als Identitts-
funktion (wobei die Kopula selbst lediglich
Trger fr Kongruenz- und Tempusinforma-
tionen ist, die wir hier nicht betrachten wol-
len). Mit der Reprsentation in (79a) ergibt
sich somit (79b). Das externe Argument der
PP wird also durch das externe Argument der
Kopula gesttigt.
(79)
a. sein: Qu Q(u)
b. auf dem Balkon sein:
u [x LOC(x,AUF*(B))(u)] =
u LOC(u,AUF*(B))
Gem (76) bzw. (78) ist der semantische Typ
von PPn 0/1 (bzw. s/n in der Notation von
Ajdukiewicz). In der Tradition von Montague
774 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
mit dieser Situationsrolle des Verbs zu be-
schreiben. Man erhlt dann statt (83a,b) das
folgende:
(83)
c. singen:
xs SING(x)(s)
d. auf dem Balkon singen:
xs [SING(x)(s) &
LOC(s,AUF* (B)]
Dabei ergeben sich u. U. die in 3.1 besproche-
nen Probleme, nmlich wie die Situationslo-
kalisierung mit der Lokalisierung der invol-
vierten Objekte zusammenhngt. In Fllen
wie in (84), wo Objekte nicht erwhnt sind
oder nicht sinnvoll hinzugedacht werden kn-
nen, ist die Situationslokalisierung jedenfalls
die plausible Lsung. Dies entspricht dann in
einem speziellen Fall der von Sondheimer
(1978) generell vorgeschlagenen Lsung. Den
Vorschlgen von Sondheimer zur Situations-
lokalisierung neigt brigens auch Bierwisch
(1988) weitgehend zu, obwohl er in anderen
Aspekten mit den Vorschlgen dieses Ab-
schnitts bereinstimmt.
(84)
a. Auf dem Balkon wird getanzt.
b. s x [TANZ(x)(s) &
LOC(s, AUF*(B))]
c. Es regnet auf dem Balkon.
d. s [REGN(s) & LOC(s, AUF*(B))]
Schwieriger sind die direktionalen Prpositio-
nen zu analysieren, die sich im Deutschen
durch Akkusativrektion auszeichnen, im Eng-
lischen z. T. durch ein suffigiertes to (into,
onto), z. T. gar nicht in sichtbarer Weise (un-
der). Zu erfassen sind Flle mit direktionaler
Forderung des Verbs (wie stellen), mit Bewe-
gungsverben ohne diese Forderung (gehen),
mit Wahrnehmungsverben (wie sehen), aber
auch mit Positionsverben bei ausgedehntem
Objekt, ebenfalls attributive Konstruktionen.
(85)
a. Sie stellt die Flasche auf den Balkon.
b. Sie geht in die Kche.
c. Sie blickt in den Garten.
d. Der Teppich liegt in den Flur.
e. die Reise in den Urwald
f. die Strae in die Innenstadt
g. der Blick in den Garten
Zur Vorbereitung betrachte man einige ab-
strahierte Situationen. Lngs einer Dimension
d erstrecke sich ein Intervall [0,1], das wir als
Individuum X ansehen wollen. Bezogen auf
eine rumliche Region R kann das Indivi-
duum X folgende 4 Positionen einnehmen.
als Lokalisierungseigenschaft, sondern als
Ortsindividuum gedeutet werden, im Wider-
spruch zum relationalen Charakter der Pr-
position, der in der prdikativen und attri-
butiven Verwendung der PP offensichtlich ist.
Man knnte allenfalls eine etwas obskure
Unifizierung der im Verb und in der Prpo-
sition enthaltenen LOC-Prdikate annehmen,
aufgrund der dann p z. B. durch AUF*(B)
belegt wird vgl. die Zuordnung von (81a)
und (81b).
(81)
a. sitzen:
px [LOC(x,p) & SITZ*(x)]
b. auf dem Balkon:
x LOC(x,AUF*(B))
c. auf dem Balkon sitzen:
x [LOC(x,AUF*(B)) & SITZ*(x)]
Was man auf jeden Fall erreichen mchte, ist
eine semantische Reprsentation der VP wie
in (81c). Setzt man fr die PP die Reprsen-
tation in (81b) voraus, so lt sich die Repr-
sentation fr sitzen erhalten, indem man ber
die in (81b) ausgedrckte Eigenschaft abstra-
hiert (vgl. Bierwisch 1988): Das lokale Verb
enthlt nicht schon eine Lokalisierungseigen-
schaft, sondern ist fr eine solche subkate-
gorisiert. Somit stellt (82) eine Instanz des
allgemeinen Schemas fr Positionsverben dar.
(82) sitzen: Px [P(x) & SITZ*(x)]
Das Verb drckt also nicht wie in (81a) eine
Relation zwischen einem Individuum und
einem Ort, sondern zwischen einem Indivi-
duum und einer Lokalisierungseigenschaft
aus.
Whrend ein Positionsverb wie sitzen be-
reits lexikalisch die Adjunktrolle der PP vor-
gibt (und damit die PP zu einem Argument
des Verbs macht), ist dies bei anderen Verben,
wie z. B. singen, nicht der Fall. Bei diesen
Verben ist die PP ein freies Adverbial und
adjungiert ber die Unifizierung der -Rollen.
Im Ergebnis entsprechen sich die Reprsen-
tationen der gesamten VP. Vgl. dazu (81c)
und (83b).
(83)
a. singen:
x SING(x)
b. auf dem Balkon singen:
x [SING(x) & LOC(x,AUF*(B))]
Falls man fr Verben eine referentielle Varia-
ble ber (individuierte) Situationen annimmt,
um den Zeit- und Aspektcharakter der Verben
zu erfassen, ergibt sich auch die Mglichkeit,
die adverbiale Modifikation als Unifizierung
37. Lokale und Direktionale 775
fr I bis IV die folgenden Aussagen:
(88)
a. x geht in die Region R.
b. x geht in der Region R.
c. x geht auerhalb der Region R.
d. x geht aus der Region R.
Mit I bis IV sind also im Prinzip die Deutun-
gen fr in [AKK], in [DAT], auerhalb und
aus gegeben. Die Dimension d kann nun zeit-
lich (bei den Bewegungsverben, kausativen
Positionsverben und den Attributen zu zeit-
lichen Individuen) oder auch rumlich (bei
den Positionsverben, Wahrnehmungsverben
und den Attributen zu rumlichen Indivi-
duen) gedeutet werden. Dementsprechend ist
X = [0,1] im ersten Fall als Weg zu betrach-
ten, den ein Objekt x beim Ortswechsel zu-
rcklegt, im zweiten Fall als die rumliche
Erstreckung eines ausgedehnten Individuums.
Im Fall der Beispiele (85d,f) ist dieses Indi-
viduum ein konkretes rumliches Objekt, im
Fall der Verbnominalisierungen wie Reise ein
zeitlich und rumlich ausgedehntes Ereignis.
Bei den Beispielen (85c,g) handelt es sich um
das Wahrnehmungsereignis, dessen rumliche
Struktur vermutlich so beschaffen ist, da der
Wahrnehmende den Ort von anfX, das Wahr-
zunehmende den Ort von endX besetzt.
Man beachte, da die Annahme einer Di-
mension, auf der der Wechsel der rumlichen
Lokalisierung stattfindet, wesentlich ist; man
braucht dann nur die Intervallpunkte 0,1 in
dieser Dimension zu betrachten und bentigt
keine feinere Strukturierung. Ein feiner struk-
turiertes Wegkonzept (etwa als Intervall-
schachtelung im Sinne von Bierwisch 1988)
wird erst bei der Deutung des Prdikats
MOVE, also bei den Bewegungsverben be-
ntigt.
Es mag zunchst irritieren, da sich bei
den Reprsentationen in (87) die direktionale
Prposition als die unmarkierte gegenber der
statischen Prposition erweist. (Die morpho-
logischen Fakten, z. B. im Englischen, wider-
sprechen dem.) Dies erklrt sich daraus, da
die Dimensionalitt der Situation vorausge-
setzt wurde; unter diesem Gesichtspunkt ist
der Wechsel auf der Dimension der unmar-
kierte Fall, das Fehlen eines Wechsels der
markierte Fall. Fr die Analyse der statischen
Prpositionen braucht aber nur eine topolo-
gische Struktur und keine Dimensionalitt
angenommen zu werden; statt des ausgedehn-
ten Individuums X = [0,1] gengt ein punk-
tuelles (bzw. vllig beliebiges) Individuum.
(87b,c) sind also spezifischer als wirklich be-
ntigt. Es gelten allerdings die Implikationen
in (89); als Reprsentation fr in bzw. auer-
Falls wir 0 = anfX (den Anfang von X) und
1 = endX (das Ende von X) setzen, lassen
sich die vier Mglichkeiten wie folgt beschrei-
ben.
(86)
a. LOC(anfX,R) & LOC(endX,R)
b. LOC(anfX,R) & LOC(endX,R)
c. LOC(anfX,R) & LOC(endX,R)
d. LOC(anfX,R) & LOC(endX,R)
Alternativ dazu knnen wir einen CHANGE-
Operator verwenden, der angibt, ob ein
Wechsel hinsichtlich der Lokalisierung in R
oder nicht in R stattfindet. Das erste Argu-
ment von CHANGE sei die Dimension, auf
der der Wechsel betrachtet wird, das zweite
Argument sei die Lokalisierungsangabe fr X
nach dem Wechsel (damit automatisch fr
endX geltend).
(87)
a. CHANGE(d,LOC(endX,R))
b. CHANGE(d, LOC(endX,R))
c. CHANGE(d,LOC(endX,R))
d. CHANGE(d, LOC(endX,R))
Der CHANGE-Operator ist ein Phasenquan-
tor im Sinne von Lbner (1990): (87a) und
(87b) sind dual zueinander, ebenso sind (87c)
und (87d) dual zueinander. (CHANGE mit
zeitlicher Dimension entspricht dem BE-
COME-Operator bei Dowty; s. die Interpre-
tationsbedingungen im Rahmen einer Inter-
vallsemantik in Dowty 1979:140 ff.) Kauf-
mann (1989) hat festgestellt, da das Direk-
tionalittsmerkmal bei Prpositionen eine
Dualitt zwischen direktionalen und nicht-
direktionalen Prpositionen anzeigt. Davon
kann man sich leicht berzeugen, wenn man
die Situationen I bis IV verbalisiert. Ange-
nommen, x gehe von 0 nach 1. Dann gelten
776 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
Falls man eine solche Uminterpretation fr
fraglich hlt, da Ausdrcke wie in (92) nichts
Marginales haben, gibt es nur den Ausweg,
da man das, was bei dem Wechsel lokalisiert
wird, als freien Parameter formuliert (Vor-
schlag von Ingrid Kaufmann).
(93) auf [AKK]:
yx CHANGE(d, LOC(z, AUF*(y)))
(93) besagt, da man eine Dimension d finden
mu und davon abhngig soll der Parameter
z instantiiert werden. Dabei mssen Infor-
mationen ber die Belegung von x im Kontext
ausgewertet werden, damit mit (93) nicht eine
leere Abstraktion behauptet wird. Etwa lassen
sich folgende Parameterbelegungsregeln vor-
schlagen:
(94) a. d = T z = x
b. d = ACHSE(x) > z = endx
Wenn die Zeit (T) als Dimension infrage
kommt, mu z als x gewertet werden; wenn
die Gestalt von x die Dimension vorgibt, mu
z als das Ende von x auf der betreffenden
Achse gewertet werden. In hnlicher Weise
lassen sich dann kompliziertere Flle behan-
deln. Zu beachten ist, da die Ableitung der
semantischen Reprsentationen kompositio-
nal ist, da aber in jedem Falle eine Deutung
der Dimension d und eine Festlegung von z
hinzukommen mu, und dies ist nicht-kom-
positional. Vgl. zu dem Vorstehenden die teil-
weise modifizierte Darstellung in Wunderlich
1991.
4. Semantik der Prpositionen
4.1Topologische Prpositionen
Prototypisch fr lokale Prpositionen sind die
2-stelligen topologischen Prpositionen: Ein
Objekt x wird in der rumlichen Nachbar-
schaft eines Objektes y lokalisiert. Beispiels-
weise wird x durch in und innerhalb in einer
von y ganz oder partiell umschlossenen Nach-
barschaft lokalisiert, durch an, bei und auer-
halb in Nachbarschaften, die von y nicht um-
schlossen sind, durch auf in der Kontakt-
Nachbarschaft zu einem Rande von y. Die
Lokalisierung kann zu bestimmten Phasen
eines Weges von x (oder Abschnitten eines
sich rumlich erstreckenden Objektes) erfol-
gen; insbesondere kann sie sich (bei direktio-
naler Verwendung der Prposition) auf die
erste oder die zweite Phase eines Ortswechsels
beziehen (Ursprung: aus, von; Ziel: nach, zu,
in [Akk], auf [Akk], an [Akk], vgl. into, onto).
halb gengt das jeweilige Konsequens, d. h.
in (innerhalb) und auerhalb sind polar zuein-
ander.
(89)
a. CHANGE(d, LOC (endX,R))
LOC (X,R)
b. CHANGE(d, LOC(endX,R))
LOC(X,R)
Mit diesen Vorbereitungen kann auf [Akk]
durch (90a) reprsentiert werden. Betrachten
wir stellen als Kausativum zu stehen, so sollte
die ganze VP auf den Balkon stellen durch
(90b) reprsentiert werden, was bei Unabhn-
gigkeit der Prdikate LOC und STEH mit
(90c) identisch ist; wenn wir dann ber den
Beitrag der PP abstrahieren, erhalten wir
(90d) als Reprsentation des kausativen Po-
sitionsverbs.
(90)
a. auf [AKK]:
yx CHANGE (d,LOC (x,AUF*(y)))
b. auf den Balkon stellen:
yx CAUSE(x, CHANGE(d,
LOC (y,AUF*(B)) & STEH*(y)))
c. auf den Balkon stellen:
yx CAUSE(x, CHANGE(d,
LOC (y,AUF*(B))) &
CHANGE (d,STEH* (y)))
d. stellen: Pyx CAUSE(x, P(y) &
CHANGE(d,STEH*(y)))
Da hier x einen zeitlichen Orts- und Positions-
wechsel von y verursacht, ist die Dimension
d durch die Zeit gegeben. Falls wir fr gehen
die Analyse (91a) zugrundelegen, ergibt sich
(91b), auch hier ist d die Zeit.
(91)
a. gehen:
Px PERFORM(x, MOVE (x) &
P(x) & GEH*(x))
b. auf den Balkon gehen:
x PERFORM(x, MOVE(x) &
CHANGE(d, LOC(x,AUF*(B))) &
GEH*(x))
Als Beispiel fr die attributiven Verwendun-
gen sei (92) angefhrt. Hier erfllt Strae das
Schema fr Objekte mit einer maximalen
Achse, und nur sie kann zur Deutung von d
herangezogen werden. Somit ist das interes-
sierende Intervall die Ausdehnung von x auf
dieser Achse. (92) besagt wrtlich, da die
Strae als ganzes am Ende des Intervalls auf
dem Berg lokalisiert ist. Dieses ist ein imma-
nenter Widerspruch. Da die Gestalt der
Strae die Dimension d instantiiert, kann es
nur das Ende der Strae sein, das auf dem
Berg lokalisiert ist.
(92) Strae auf den Berg: x [STRASSE(x) &
CHANGE(d, LOC(x,AUF*(B)))]
37. Lokale und Direktionale 777
wie innen aber nicht. Deshalb steht kein Ob-
jekt y zur Verfgung, um die Region IN*(y)
bestimmen zu knnen. Es scheint so, da in
diesen Fllen y eher als Ort (eines vielleicht
virtuellen Objektes) aufzufassen ist. Deutli-
cher ist diese Sortenverschiebung bei Adver-
bien wie vorne, unten, die sich auf Teilrume
einer irgendwie vorausgesetzten Region bezie-
hen. Mglicherweise beinhalten lokale Ad-
verbien ohne pronominales Element generell
eine Lokalisierung relativ zu Regionen. Wir
betrachten die zwei mglichen Varianten von
[unten im Schrank].
(96)
a. [[unten] im Schrank]
unten ist Kopf, im Schrank ist Mo-
difikator. Der freie Parameter im Ad-
verb wird z. B. durch die Origo (Spre-
cherort) o festgelegt.
x[LOC(x,UNTER*(o)) &
LOC(x,IN*(S))]
b. [unten [im Schrank]]
im Schrank ist Kopf, unten ist Mo-
difikator. Der freie Parameter im Ad-
verb wird z. B. durch das Zentrum
der im Kopf instantiierten Region
festgelegt.
x[LOC(x,IN*(S)) &
LOC(x,UNTER* (z(IN*(S))))]
Zur Differenzierung der Bedeutungen der to-
pologischen Prpositionen in, an und bei be-
trachten wir die folgenden Beispiele:
(97)
a. Das Hemd ist im Schrank.
b. Im Schrank ist ein Holzwurm.
c. In der Schssel liegt Obst.
d. Im Baum(wipfel) sitzt ein Vogel.
(98)
a. Das Auto steht am Bahnhof.
b. Anna arbeitet am Schreibtisch.
c. Anna lehnt an der Wand.
d. das Etikett an der Flasche
(99)
a. Das Auto steht beim Bahnhof.
b. Anna arbeitet beim Schreibtisch.
c. ?
Anna lehnt bei der Wand.
d. ?
das Etikett bei der Flasche
Die verschiedenen mglichen Positionen von
x relativ zu y in Konstruktionen x in y knnen
in einer einheitlichen, hinreichend abstrakten
semantischen Reprsentation von in dadurch
erfat werden, da die IN*-Region von y mit
dem von y eingenommenen Ort, p(y), identi-
fiziert wird. Die Region p(y) umfat nicht nur
den Raum, den x materiell einnimmt, sondern
gegebenenfalls auch den inneren leeren, d. h.
von den materiellen Teilen von x eventuell
Ein lokaler Kasus entspricht immer einer
topologischen Prposition, gegebenenfalls be-
zogen auf eine Wegphase bzw. einen Orts-
wechsel (Ablativ, Vialis, Terminalis). Einige
finnougrische Sprachen unterscheiden auch
Kasus, die eine innere vs. uere vs. Rand-
Nachbarschaft unterscheiden (z. B. Ungar.,
Lokal: Inessiv, Adessiv, Superessiv; Ur-
sprung: Elativ, Ablativ, Delativ; Ziel: Illativ,
Allativ, Sublativ).
Im entsprechenden topologischen Adverb
wird das innere Argument existentiell gebun-
den (pronominal) oder verbleibt als freier Pa-
rameter zur Belegung aus dem Kontext.
(95) a. in: y x LOC(x,IN*(y))
b. darin/drinnen: x y LOC(x,IN*(y))
c. innen: x LOC(x,IN*(y))
Wir fassen die Bedeutung von Prpositionen
als Lokalisierungsrelation zwischen Objekten
auf. Das allgemeine Format der semantischen
Reprsentationen lokaler Prpositionen ist
durch das Schema yx LOC(x,PRP*(y))
vorgegeben gegebenenfalls mit zustzli-
chem Constraint C(x,y) , wobei PRP*(y)
die fr die jeweilige Prposition charakteri-
stische Nachbarschaftsregion von y ist. Orte
werden relativ zu Objekten konzeptualisiert.
Die mit in verbundene Information
LOC(x,IN*(y)) kann in folgende Instruktion
bersetzt werden: Suche das Objekt y, be-
stimme die Region IN*(y), suche darin ein
Objekt x mit den passenden Eigenschaften.
Natrlich gehrt zu jedem Objekt x der von
x eingenommene Ort p(x) (und IN*(y) drfte
im wesentlichen mit p(y) zu identifizieren sein
(s. unten) darin drckt sich aus, da in die
elementarste bzw. unmarkierte Prposition
ist). Wir referieren aber primr auf das Objekt
und nicht auf den Ort, den es einnimmt. Nur
wenn x sich erkennbar bewegt, macht es Sinn,
auf die von x jeweils eingenommenen Orte
p(x,t) zu referieren. Die Alternative zu der
von uns vertretenen Position knnte gerade
diesen Aspekt prferieren. Die Bedeutung der
Prpositionen wre dann als Relation zwi-
schen Orten aufzufassen (vgl. z. B. Saile 1984,
Bierwisch 1988). Im Fall von in ist das die
rumliche Teil-von-Relation: p(x) p(y); im
Fall von an die rumliche Kontiguittsrela-
tion: AN(p(x), p(y)), usw. Es ist allerdings
nicht so klar, wie die betreffende Relation bei
anderen Prpositionen (z. B. durch, um) zu
definieren ist. Prinzipiell ist aber eine ber-
setzung der objektbezogenen in eine ortsbe-
zogene Konzeption, und umgekehrt, immer
mglich.
Adverbien wie drinnen enthalten den ana-
phorischen Bezug auf ein Objekt, Adverbien
778 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
an ist, wird in Fllen, wo auf gewhlt werden
kann, an im allgemeinen nicht gewhlt und
daher oft komplementr zu auf verwendet.
(100) auf:
a.
y x LOC(x,EXT
c
(y,VERT))
b. y x [LOC(x,EXT(y,VERT)) &
KONTAKT(x,y)]
4.2Dimensionale Prpositionen
Eine geschlossene Klasse von in der Regel
sechs Ausdrcken bilden die dimensionalen
Prpositionen: vor, hinter, ber, unter, rechts,
links. Sie sind 3-stellig, wobei aber eines der
Argumente syntaktisch nicht ausgedrckt
wird, allenfalls in adverbialen Phrasen wie
von x aus gesehen. Eine solche Phrase
macht den Charakter des fraglichen Argu-
ments als Richtung deutlich. Richtungen sind
Vektoren im Raum; wir benutzen d als freien
Parameter, der u. U. kontextuell variieren
kann. Ehrich (1985) und Levelt (1986) haben
bemerkt, da die normalerweise angenom-
mene Transitivitt von vor und Konversitt
von vor, hinter nicht unter allen Umstnden
gelten. Dies liegt einfach daran, da dafr der
implizite Richtungswert konstant gehalten
werden mu. Folgende Beziehungen gelten
aber allgemein:
(101)
a. x, y, z, d (VOR (x, y, d) &
VOR (y, z, d) VOR (x, z, d))
b. x, y, d (VOR (x, y, d)
HINTER (y, x, d))
Die weitere Analyse von vor ergibt, da d als
die jeweils beobachter-induzierte Achse obs
des Objekts aufzufassen ist (s. Lang 1987a,
1989a), relativ zu der ein Ausschnitt der EXT-
Region bestimmt wird. Alternativ dazu
knnte man auf die explizite Erwhnung des
obs-Parameters verzichten und die EXT-Re-
gion relativ zur Frontseite bestimmen.
(102) VOR (x, y, d) LOC (x, VOR* (y, d))
a. LOC (x, EXT(y,obs))
b. LOC (x, EXT(FRONT(y)))
Die obs-Achse eines Objekts ist orthogonal
zur Frontseite und zeigt vom Objekt weg;
dadurch lassen sich Maangaben wie 3 m vor
dem Tisch passend analysieren (s. unten). Die
komplementre Prposition hinter lt sich
durch -obs bzw. die Rckseite RCK ana-
lysieren, entsprechend kann fr ber, unter
die Vertikale vert des Objekts herangezogen
werden. vert stimmt im allgemeinen mit der
Vertikalen VERT des Erfahrungsraums ber-
ein, whrend obs mit der tatschlichen Be-
nur partiell umschlossenen Raum. In Anbe-
tracht von Beispielen wie (97c) und (97d) soll
p(y) auch solche Flle erfassen, in denen die
Region, die von einem Objekt eingenommen
wird, erst in der Wahrnehmung nach Prinzi-
pien der Gestaltschlieung konstruiert wird,
etwa durch Ergnzung von Konturen. Die
Festlegung bestimmter Teilregionen von p(y)
als Ort von x (vgl. (97a) und (97b)) ist nicht
in der Wortbedeutung von in zu reprsentie-
ren, sondern ergibt sich bei der konzeptuellen
Interpretation durch Rekurs auf konzeptuel-
les Wissen ber Objekte bzw. Objekttypen
und ihre Beziehungen zueinander.
Durch an und bei wird x in der proximalen
Auenregion von y, EXT(y), lokalisiert. Die
proximale Auenregion eines Objekts ist die
Region, die durch seinen Einflu geprgt ist,
innerhalb der ein potentieller Akteur mit dem
Objekt (inter-)agieren kann oder innerhalb
der allgemein ein Zusammenhang mit dem
Objekt etabliert werden kann (vgl. den Begriff
der region of interaction in Miller & Johnson-
Laird 1976). An und bei unterscheiden sich
darin, da an den rumlichen Kontakt zwi-
schen x und y, d. h. die Kontiguitt von p(x)
und p(y), zult, bei diesen aber ausschliet
(vgl. (98bd) und (99bd)). (99c) z. B. kann
nicht so verstanden werden, da Anna an der
Wand lehnt; sie befindet sich zwar in der
EXT-Region der Wand, mu aber an einem
anderen, ungenannten Objekt lehnen. Ent-
sprechend kann (99d) nur so verstanden wer-
den, da sich das Etikett zwar in der EXT-
Region der Flasche befindet, aber nicht an
der Flasche befestigt ist.
Diese Zusammenhnge lassen sich topo-
logisch wie folgt erfassen (vgl. Maienborn
1990): Die AN*-Region von y wird mit
EXT
c
(y) identifiziert, intuitiv: der proxi-
malen Kontakt-Auenregion von y , die
BEI*-Region mit der Region EXT(y).
EXT
c
(y) schliet EXT(y) ein und ist von p(y)
disjunkt; p(y) und EXT
c
(y) vereinigen sich zur
Proximalregion von y, PROX(y). p(y) und
EXT(y) werden jeweils als geschlossene,
EXT
c
(y) als offene Menge von Raumpunkten
interpretiert. Damit weist EXT(y) im Gegen-
satz zu EXT
c
(y) einen Rand auf; dieser reicht
beliebig nahe an den Rand von p(y) heran,
ohne ihn zu berhren. Zwischen p(y) und
EXT(y) liegt also eine beliebig kleine Lcke,
whrend EXT
c
(y) sich lckenlos an p(y) an-
schliet.
Fr auf kommt hinzu, da eine Kontakt-
region in der Vertikalen zu whlen ist. Es
ergeben sich fr auf also die Reprsentations-
alternativen in (100): Da auf spezifischer als
37. Lokale und Direktionale 779
Diese deiktische Verwendung ist allerdings
nur der Spezialfall einer extrinsischen Ver-
wendung. Die Situation (104a) kann hinsicht-
lich der Zugnglichkeit eines Objektes gene-
ralisiert werden (s. (105ac)), die Situation
(104b) hinsichtlich der Beweglichkeit (s.
(105d)). Die Aussage x ist vor y ist nmlich
auch in den folgenden Situationen wahr:
(105)
a. x ist im Innern eines Behlters eher
zugnglich als y.
b. x ist an einer materiellen Grenze
eher zugnglich als y.
c. y wird aufgrund einer Bewegung
von x zuerst an seiner Frontseite
zugnglich.
d. x und y bewegen sich in fester Kon-
stellation, wobei die gemeinsame
Bewegungsrichtung die Richtung
obs festlegt.
obachterachse OBS manchmal konfligiert (s.
unten).
Ein Objekt kann inhrent so organisiert
sein, da seine Frontseite oder Oberseite oder
beide festliegen (nach Kriterien wie Ort von
Wahrnehmungsorganen oder anderen funk-
tionellen Teilen, Standardbewegungsrichtung,
Standardposition, kanonische Position eines
Benutzers etc.; vgl. Miller/Johnson-Laird
1976: 403). Folgende Flle lassen sich unter-
scheiden:
(103)
a. Objekte nur mit inhrenter Front-
seite: Pfeil, Bleistift
b. Objekte nur mit inhrenter Ober-
seite: Baum, Berg
c. Objekte mit inhrenter Front- und
Oberseite; die rechte Seite ergibt sich
in Analogie zum menschlichen Kr-
per bzw. nach Mastab eines inter-
nen Benutzers: Tier, Puppe, Ka-
mera; Auto, Stuhl, Anzug
d. Objekte mit inhrenter Front- und
Oberseite; die rechte Seite ergibt sich
nach Mastab eines externen Be-
nutzers: Schreibtisch, Schrank, Spie-
gel
Man spricht von intrinsischer Verwendung
der dimensionalen Prposition, wenn die in-
hrenten Seiten des Bezugsobjektes zur Orien-
tierung dienen; also ergibt sich bei vor die
Richtung obs aus der Vorgabe der Frontseite.
Hat das Objekt keine inhrente Frontseite
(Oberseite usw.), so mu bei Verwendung der
betreffenden Prposition eine Frontseite kon-
textuell induziert werden, und zwar durch
Vorgabe einer Richtung d. Eine Frontseite
kann auch dann induziert werden, wenn das
Objekt eine inhrente Frontseite bereits be-
sitzt; dadurch ergibt sich ein mglicher Kon-
flikt, der nur aufgrund pragmatischer Prfe-
renzen (vgl. Wunderlich 1981) gelst werden
kann. Besonders kann die Position des Spre-
chers zum Objekt eine Frontseite induzieren;
in diesem Fall spricht man vom deiktischen
Gebrauch der Prposition (vgl. Fillmore
1975a, Miller/Johnson-Laird 1976); die Blick-
richtung des Sprechers sei als Beobachter-
achse OBS gekennzeichnet. In der Mehrheit
der Sprachen wird die Frontseite nach dem
Spiegelbildprinzip festgelegt, wobei obs =
-OBS (104a); Hill (1982) hat allerdings fest-
gestellt, da ein Hausa-Sprecher nach dem
Tandemprinzip verfhrt, wobei obs = OBS
(104b).
780 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
In der einen wird der Ursprung von obs(y)
auf die Front von y gelegt und das Quantum
auf obs gemessen. In der anderen wird davon
Gebrauch gemacht, da 3m als verkrzte Mo-
difikator-AP 3m weit mit Distanzinterpreta-
tion aufzufassen ist; gemessen wird das Quan-
tum der Distanz.
(108) 3m vor dem Schrank:
a. x [LOC(x,EXT(S,obs)) &
QU obs(S,x) 3m]
b. x [LOC(x,EXT(FRONT(S))) &
QU DIST(x,FRONT(S)) 3m]
Wenn hinter durch -obs bzw. die Rckseite
RCK charakterisiert wird und zu (108) ent-
sprechende Analysen vorgenommen werden,
ergibt sich die gewnschte Aquivalenz (109):
(109) x ist 3 m vor y y ist 3 m hinter x
In einem ganz anderen Sinn als bisher be-
sprochen sind dt. gen, engl. towards dimen-
sionale Prpositionen (sowie alle Adverbien
auf dt. -wrts, z. B. seewrts, stadteinwrts
usw., engl. -wards).
(110)
a. Anna wandert gen Kln / fluwrts.
b. Das Haus liegt gen Kln / fluwrts.
(110a) beinhaltet natrlich nicht, da Anna
am Ende ihres Weges in Kln oder am Flu
lokalisiert ist. Eine Dimension ist durch zwei
Punkte definierbar: als offener Endrandpunkt
dient das Objekt der Prposition, als
Anfangspunkt eine kontextuelle origo o. Lo-
kalisiert wird innerhalb des betreffenden In-
tervalls. Das Schema ist somit einfach durch
(111) gegeben.
(111) y x LOC(x, [o,y[)
Fr (110a) ergibt sich dann die Deutung, da
jeder Ort von Annas Wanderung im Intervall
[o,KLN[bzw. [o,FLUSS[liegt. Fr (110b)
gibt es zwei Deutungen, je nach Festsetzung
der origo. Wenn o = (Ort der) uerung,
dann liegt das Haus zwischen uerungsort
und Kln (bzw. dem Flu). Man kann o aber
auch inhrent auf einer Achse des Hauses
festlegen (z. B. der Frontachse obs); dann ist
dies die Achse, die nach Kln (bzw. zum Flu)
zeigt. Ersichtlich knnen sich beide Deutun-
gen aus nur einer semantischen Reprsenta-
tion ergeben, weil diese den variablen Para-
meter o enthlt.
4.3Wegbezogene Prpositionen
Besonders Bennett (1975) und ihm folgend
Cresswell (1978) haben den Wegbezug der
Prpositionen across, through, along, around,
via, past, beyond herausgestellt (vgl. Saile 1984
Fr jedes Objekt gibt es drei zueinander or-
thogonale Richtungen.
(106)
obs ist die Richtung nach vorne, die nach den
bereits beschriebenen Prinzipien festgelegt
wird; vert ist die Vertikale, die in der Regel
durch die Gravitation bestimmt ist. Wenn obs
und vert festgelegt sind, gibt es fr die Rich-
tung nach rechts nur zwei Mglichkeiten. r
1
(d. h. die Drehrichtung von obs in vert) wird
in Analogie zum menschlichen Krper (103c)
und in den Situationen (104b, 105d) gewhlt.
In allen anderen Fllen wird r
2
gewhlt.
Bei einigen Prpositionen ist die Modifizie-
rung durch eine Maangabe mglich. Man
vergleiche:
(107)
a. *Der Stuhl steht 3 m im Zimmer.
b. Sie ging 3 m ins Zimmer.
c. ? Sie stellte den Stuhl 3m ins Zim-
mer.
d. Der Stuhl steht 3 m vor dem
Schrank.
e. *Der Stuhl steht 3 m vorne.
Die Verwendung einer Maangabe setzt die
Existenz einer Dimension voraus, auf der Ab-
schnitte bestimmbar sind. Topologische Pr-
positionen wie in sind richtungsunabhngig;
eine Richtung ist durch das Bewegungsverb,
aber noch nicht durch die Ortswechsel-Inter-
pretation von in [Akk] gegeben s. (107c).
3 m ins Zimmer besagt, da das Quantum
des Endes eines Weges von x, der im Zimmer
verluft, 3 m abdeckt (vgl. Bierwisch 1987 zur
Analyse von Maangaben bei dimensionalen
Adjektiven). Die dimensionalen Prpositio-
nen wie vor enthalten ein Richtungsargument,
daher ist eine Lokalisierung wie in (107d)
mglich. Aber auch vorne enthlt ein Rich-
tungsargument; da aber kein Bezugsobjekt
vorliegt, kann ein Abschnitt auf d nicht fest-
gelegt werden. Fr die Interpretation von
(107d) lassen sich zwei Varianten vorschlagen.
37. Lokale und Direktionale 781
Gestalt des Objektes gegeben sein. Bei plu-
ralischen Objekten mu die Gruppe als ganzes
eine Erstreckung haben, bei Masseobjekten
mu eine geeignete Masseportion vorliegen.
Die Dimension kann aber auch aufgrund
funktionaler begrifflicher Zusammenhnge
bestimmt werden. In (116) ergibt sich die Di-
mension beispielsweise daraus, da ein Bus
die Funktion hat, Reisende zu transportieren,
ein Visum die Funktion hat, Reisen zu er-
mglichen (s. Kaufmann 1990, Ristow 1990).
(116)
a. der Bus durch die Innenstadt
b. ein Visum durch Ungarn
Die jeweils zweite Bedingung in (115) gibt
vor, da DIM(x) in einer bestimmten Rela-
tion zu y bzw. zur Maximalen von y stehen
mu. Durch diese Einschrnkung soll intuitiv
folgendes erreicht werden:
UM(x,y) ist nur wahr, wenn DIM(x) eine
Schlaufe bezglich y bildet.
DURCH(x,y) ist nur wahr, wenn DIM(x) eine
Schnittlinie von y umfat.
LNGS(x,y) ist nur wahr, wenn DIM(x) par-
allel zur Maximalen von y ausgerichtet ist.
4.4Weitere Prpositionen und Analysen
Hier soll kurz die Analysemglichkeit weite-
rer Prpositionen angedeutet werden.
(117)
a. Bonn liegt zwischen Kln und
Mainz.
b. Das Haus steht zwischen Kiefern.
Betrachtet man Stze wie (117a), so scheint
es nahezuliegen, da ein Objekt auf einem
Weg lokalisiert ist, der zwei andere Objekte
verbindet. Jedoch hat zwischen hier nicht zwei
interne Argumente, sondern nur ein komple-
xes Argument, gebildet aus einer NP-Koor-
dination (vgl. Link 1983 und Artikel 19).
Stattdessen ist auch eine pluralische NP wie
in (117b) mglich. Einem Vorschlag von Ha-
bel (1989) folgend, kann die ZWISCHEN*-
Region im linearen Fall (117a) als konvexe
Hlle der Spuren von (kanonischen) Verbin-
dungswegen zwischen den beiden (Teil-) Ob-
jekten festgelegt werden. Der nichtlineare Fall
(117b) kann mittels Hllenbildung ber allen
mglichen Verbindungswegen zwischen den
Teilen des komplexen Objekts oder alternativ
durch die konvexe Hlle der von den Teilob-
jekten eingenommenen Regionen (p) abzg-
lich dieser Regionen selbst analysiert werden.
Die Verwendung von gegenber setzt eine
tatschliche oder virtuelle Grenze zwischen
rumlichen Bereichen voraus.
fr das Deutsche). Diese Prpositionen bilden
eine relativ inhomogene Klasse. Sie sind z. T.
in Verbindung mit Bewegungsverben oder Po-
sitionsverben mglich.
(112)
a. Max fhrt um den Park.
b. Max fhrt durch den Park.
c. Max fhrt lngs des Rheins/
den Rhein entlang.
(113)
a. Hochhuser stehen um den Park.
b. Die Kette liegt um den Hals.
c. Sand liegt um den Tisch.
d. Das Vieh steht um die Trnke.
e. ?Zahlreiche Imbibuden stehen
durch den Park.
f. ?Der Schlauch liegt durch die Ga-
rage.
g. Die Bcher liegen durch das Zimmer
verstreut.
h. Zahlreiche Neubauten stehen lngs
des Rheins.
i. Der Schlauch liegt lngs der Mauer.
j. Hrden stehen lngs des Weges.
(114)
a. Die Post liegt um die Ecke.
b. Die Post ist lngs des Rheins.
c. Die Post ist durch den Park.
d. The post office is past the theatre.
Beispiele mit Positionsverben wie in (113)
scheinen ganz normale Verwendungen zu sein,
wenn ein semantisch pluralisches oder rum-
lich langgestrecktes Objekt zu lokalisieren ist.
Es fllt allerdings auf, da durch in dieser
Hinsicht beschrnkt ist, und da lngs/ent-
lang sich nach statischer vs. dynamischer Les-
art zu differenzieren scheinen. Die Beispiele
in (114) verlangen smtlich eine Umweginter-
pretation: Es ist ein hypothetischer Weg zu
finden, an dessen Ende die Post lokalisiert ist.
Im Sinne der bisherigen Analysen erhalten
wir fr um, durch, lngs etwa folgendes (vgl.
Wunderlich 1990):
(115)
a. UM(x,y) LOC(DIM(x), EXT(y))
& UMFASS(DIM(x),y))
b. DURCH(x,y)
LOC(DIM(x), p(y)) &
SCHNEID(DIM(x),y))
c.
LNGS(x,y)
LOC(DIM(x), PROX(y)) &
PARALLEL(DIM(x), MAX(y))
MAX = Maximale
Die jeweils erste Bedingung besagt, da re-
lativ zu x eine Dimension DIM(x) gefunden
werden mu, welche in einer Nachbarschaft
von y lokalisiert ist. Die Dimension kann
durch den Weg eines Objektes oder durch die
782 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
Eigenschaften der Argumente der Relation
(den Objektkonzepten) gibt es sog. Verwen-
dungstypen (use types) der Prposition. Un-
klar bleibt der theoretische Status der Ver-
wendungstypen und deren Beziehung zur pro-
totypischen Idealbedeutung. Pragmatische
Prinzipien, die allerdings nicht ausreichend
ausformuliert sind und deren Anwendungs-
bedingungen nicht przisiert sind, sollen die
Auswahl und Interpretation lokaler Kon-
struktionen in konkreten Anwendungssitua-
tionen regulieren.
Vandeloise (1984) untersucht eine groe
Anzahl franzsischer Prpositionen und Ad-
verbien (besonders sur, sous, devant, derrire,
avant, aprs, dans, hors de); er formuliert
pragmatische Verwendungsregeln mit einem
beschrnkten Inventar raumbezogener kon-
zeptueller Begriffe (wie Richtung, Orientie-
rung, Begegnung, Zugnglichkeit etc.). Im
Unterschied zu Lindner und Herskovits ver-
sucht Vandeloise die Variation in der Verwen-
dung eines Ausdrucks auf eine einzige zu-
grundeliegende Regel zurckzufhren; inso-
fern ist er eher an der Mglichkeit semanti-
scher Generalisierung interessiert.
Hawkins (1984) stellt die Bedeutungen der
meisten englischen Prpositionen als bildliche
konzeptuelle Schemata dar. Fr over kommt
er zu 11, fr around zu 9, fr across zu 5
solcher Schemata. Im Unterschied zu Van-
deloise sucht er nicht nach einer einzigen zu-
grundeliegenden Regel, sondern versucht, die
diversen Schemata als Elemente einer natr-
lichen Kategorie im Sinne der Kategorisie-
rungstheorie von Rosch (1978) auszuweisen.
Standard- und Nicht-Standard-Verwendun-
gen werden ebensowenig wie bei Herskovits
unterschieden, Probleme der Kompositiona-
litt bleiben hier wie dort unbeachtet. Haw-
kins Ansatz ist eher global-ganzheitlich aus-
gerichtet und macht die problematische An-
nahme einer bildlichen statt propositionalen
Reprsentation; damit lassen sich die blichen
semantischen Beziehungen (die auch fr den
Bereich der lokalen Prpositionen gelten)
nicht mehr formulieren. Dieser Vorbehalt
richtet sich speziell gegen Bedeutungsangaben
in Form von bildlichen Schemata und nicht
gegen die prinzipielle Mglichkeit von bildli-
chen Reprsentationen. Im Rahmen der Kog-
nitionswissenschaft wurde berzeugend dafr
argumentiert, da bei der Reprsentation und
Verarbeitung des generellen raumbezogenen
Wissens neben propositionalen Reprsenta-
tionsformaten auch bildhafte Formate eine
Rolle spielen (s. Kosslyn 1980).
(118)
a. Die Post liegt gegenber dem Bahn-
hof.
b. Oberkassel liegt gegenber von Ds-
seldorf.
c. Anna steht Max gegenber.
Angenommen, g teile eine Raumregion D in
zwei Bereiche auf. x ist gegenber y lokali-
siert, wenn sich x und y in den so entstande-
nen komplementren Regionen befinden.
ANDER(y, g) sei die Region bezglich g, in
der y nicht lokalisiert ist.
(119)
a.
GEGENBER (x, y, g)
LOC(x, ANDER(y, g))
Denkbar ist, da die Lokalisierung von x
auch auf ein virtuelles Lot von y auf g Rck-
sicht nimmt.
Von den zahlreichen Untersuchungen, die
sich einzelnen lokalen Prpositionen oder
Partikeln zuwenden, seien hier nur die beson-
ders detaillierten Untersuchungen aus Ber-
keley und San Diego erwhnt. Sie orientieren
sich an der von Fillmore und Rosch inspi-
rierten Prototypensemantik und an Lang-
ackers kognitiver Grammatik bzw. Space
Grammar (Langacker 1982). Dabei geht es
im wesentlichen um die konzeptuelle Struktur
der lokalen Relationen, weniger um Semantik
im engeren Sinn; der Begriff Grammatik ist
z. T. eher metaphorisch oder bezieht sich auf
die unterstellte konzeptuelle Fundierung von
Syntax und Morphologie. Lindner (1981,
1982) und Brugmann (1981) analysieren die
Variation in der Verwendung von engl. out,
up, in, down, over mithilfe prototypischer
Schemata und deren mglichen Ausdifferen-
zierungen.
Herskovits (1986) betrachtet die Bedeutun-
gen der lokalen Prpositionen engl. in, on, at
als Mengen von Relationen zwischen ideali-
sierten geometrischen Objektkonzepten, die
jeweils um eine prototypische Idealbedeutung
herum organisiert sind. Je nach den lokalen
37. Lokale und Direktionale 783
gefhrt, das eine fr das Deutsche typische
Verbdiathese auslst (vgl. Wunderlich 1987).
Lokale Verben knnen auch zu aspektuellen
Hilfsverben werden (im sog. Funktionsverb-
gefge, vgl. Steinitz 1977, Wunderlich 1982,
1985c).
Neben solchen sehr einleuchtenden, auf die
lexikalische Erweiterung bezogenen Aspekten
weisen lokalistische Theorien manchmal auch
sehr spekulative Zge auf. Etwa wenn der
Subjektkasus (Nominativ) als Kasus des Ur-
sprungs einer Aktion und der Akkusativ als
Zielkasus verstanden wird; der Begriff tran-
sitives Verb verdankt sich einer solchen Me-
taphorik. Im folgenden sollen nur zwei Vari-
anten vorgestellt werden, die greres Inter-
esse beanspruchen.
5.2Locationals
Lyons (1967) und Clark (1978) haben auf die
groe formale hnlichkeit von Existenzst-
zen, lokalen Stzen und Possessivstzen hin-
gewiesen, von Clark als Locationals zusam-
mengefat. Viele Sprachen verwenden dafr
dasselbe Hilfsverb (vgl. die bersicht in Clark
1978: 244 ff.). Typische Existenzsatzkonstruk-
tionen sind aus lokalen Deiktika entstanden
(vgl. engl. there, frz. y in il y a, ital. ci in ce /
ci sono). Die lokalistische Hypothese besteht
darin, da generell in den Sprachen Existenz-
und Possessivkonstruktionen auf lokale zu-
rckgehen.
Unbeschrnkte Existenzstze wie (120a)
haben relativ geringe Verwendung; viel hu-
figer sind Existenzstze mit lokaler oder tem-
poraler Einschrnkung: Es wird die Existenz
von etwas in einer rumlichen Region oder
historischen Phase behauptet.
(120)
a. Es gibt fleischfressende Pflanzen.
b. Gegenber dem Bahnhof gibt es
einen Zeitungsstand.
c. Im Mittelalter gab es eine Zunftord-
nung.
Lokale Existenzstze wie (120b) knnen be-
sonders zur Instruktion dienen: Suche den
Bahnhof, bestimme dessen Gegenber-Re-
gion, lokalisiere darin das Gesuchte. Auer
der fr Existenzstze geforderten Indefinitheit
des zu lokalisierenden Objekts gibt es zwi-
schen (120b) und (121) semantisch kaum
einen Unterschied.
(121) Der Zeitungsstand liegt gegenber dem
Bahnhof.
Dies erklrt die in vielen Sprachen anzutref-
fende formale hnlichkeit von Existenzstzen
5. Lokalismus-Theorien
5.1Lexikalische Erweiterung
Es gibt viele Spielarten lokalistischer Theo-
rien. Ihnen ist gemeinsam, da sie eine enge
Beziehung zwischen der Grammatik lokaler
Ausdrcke und der Grammatik nichtlokaler
Ausdrcke behaupten, und zwar von der Art,
da erstere das Vorbild oder die historische
Quelle fr letztere darstellt. Eine lokalistische
Theorie enthlt immer eine diachrone,
manchmal auch eine synchrone Behauptung.
Sie lt sich in der Regel durch Beispiele
verschiedener Sprachen plausibel machen,
ohne wirklich zwingende Evidenz zu besitzen.
Unverkennbar ist zweifellos, da viele Aus-
drcke mehr abstrakter Art auf lokale Aus-
drcke zurckgehen. Lokale Relationen/
Strukturen sind reich differenziert und im
Wahrnehmungsfeld, also ziemlich konkret,
instantiierbar oder jedenfalls bildlich vorstell-
bar. Insofern kann es nicht erstaunen, da sie
als Analogon fr abstraktere Relationen/
Strukturen herangezogen werden. Die Zeit
hat eine eindimensionale Struktur, die beim
Konzept des Weges bereits beansprucht wird.
Wegabschnitte oder lokale Relationen lngs
einer Dimension (z. B. vor nach) knnen
also leicht zur Veranschaulichung der Zeit
herangezogen werden (vgl. auch Closs Trau-
gott 1978). Qualitten der Lautwahrnehmung
knnen als Gestaltqualitten (z. B. hoch
tief) gesehen werden. Lakoff & Johnson
(1980) haben die systematische Rolle von
Orientierungsmetaphern aufgezeigt: oben, auf
und hoch stehen fr etwas Starkes, Gutes,
Gesundes, Angenehmes, Erstrebenswertes;
unten, nieder und tief fr das jeweilige Gegen-
stck. Die Behltermetapher dient zum Aus-
druck von Emotionen und Ideen, die im
menschlichen Krper lokalisiert sind: Seine
Gefhle sind tief, er ist ziemlich oberflchlich,
er fliet ber von guten Ideen (vgl. Clark &
Clark 1978).
Viele Sprachen verwenden ursprnglich lo-
kale Partikel zur Erweiterung des Lexikons
(z. B. Deutsch, Chinesisch, Ungarisch, Grn-
lndisch). Zwischen Bewegungsverb und lo-
kaler Partikel besteht eine besondere Assozia-
tion in der differenzierten Beschreibung von
Prozessen/Aktionen; sie werden oft zusam-
men lexikalisiert, manchmal trennbar, manch-
mal auch untrennbar in klitisierter Version,
und erhalten dann auch vielfltige nichtlokale
Bedeutungen. Das Deutsche ist ein charak-
teristisches Beispiel dafr: Die Klitisierung
der Prposition bei hat zum Verbprfix be
784 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
tischen Feld, das mit Ereignissen und Zustn-
den zu tun hat, auf die Mglichkeiten bei der
rumlichen Lokalisierung zurckgegriffen
wird; Positions- und Bewegungsverben liefern
also die grundstzliche sprachliche Organi-
sation fr Situationsaussagen. Die einzelnen
semantischen Felder unterscheiden sich nur
in folgender Weise: welche Art von Entitt als
Thema erscheint, welche Art von Entitt als
Bezugsobjekt erscheint und welche Art von
Relation an die Stelle der Lokalisierung bei
rumlichen Ausdrcken tritt.
Jackendoff schliet die These der Locatio-
nals mit ein, betrachtet aber weitere seman-
tische Felder. In Jackendoff (1983) werden
insbesondere das temporale, possessive, iden-
tifikatorische, zirkumstantielle und existenti-
elle Feld unterschieden, aber auch Redever-
ben, Wahrnehmungsverben usw. sollen unter
die Hypothese fallen. Ein wichtiges Argument
bildet der Umstand, da ein Verb wie engl.
keep eine groe Variation in der Verwendung
aufweist.
(125)
a. Bill kept the book on the shelf.
(lokal)
b. Bill kept the book. (possessiv)
c. Bill kept Harry angry.
(identifikatorisch)
d. Bill kept Harry working.
(zirkumstantiell)
Fr die Begrndung einer lokalistischen
Theorie ist das Argument allerdings schwach:
keep drckt Bewahrung eines Zustands aus;
syntaktisch erlaubt das Verb neben dem di-
rekten Objekt ein prdikatives Argument; die
semantische Einordnung scheint davon ab-
zuhngen, ob das Prdikativ als PP, AP oder
VP realisiert wird.
Ein Beispiel fr die Verwendung abstrakter
lokaler Konzepte in den verschiedenen se-
mantischen Feldern geben folgende Stze:
(126)
a. We moved the meeting from Tues-
day to Thursday. (temporal)
b. Amy gave the doll to Beth.
(possessiv)
c. The coach changed from a hand-
some young man into a pumkin.
(identifikatorisch)
d. Sue released Jim from singing.
(zirkumstantiell)
Die semantischen Rollen der Argumente sind
hier durch die Prpositionen from und to an-
gezeigt; sie kennzeichnen Ausgang und Ziel
einer Zustandsnderung. Jede Zustandsn-
derung (evtl. abhngig von einer Verursa-
chung) ist fr Jackendoff die Instantiierung
und lokalen Stzen; im Deutschen knnten
(120b) und (121) auch durch eine Formulie-
rung mit der sein-Kopula. ersetzt werden.
Etwas fragwrdiger ist die Beziehung zwi-
schen lokalen Stzen und Possessivkonstruk-
tionen. Das Russ. z. B. drckt den Besitz ge-
nerell lokal aus.
(122) U menja kniga.
(Bei mir Buch = Ich habe ein Buch)
Im Dt. ist umgekehrt das Wort haben auch
lokal verwendbar.
(123)
a. Das Haus hat einen Balkon.
b. Am Haus gibt es einen Balkon.
c. Am Haus ist ein Balkon.
d. Die Fakultt hat einen Slavisten.
e. In der Fakultt gibt es einen Slavi-
sten.
f. ?In der Fakultt ist ein Slavist.
g. Peter hat einen Dackel.
h. ?Bei Peter gibt es einen Dackel.
i. ??Bei Peter ist ein Dackel.
j. Jetzt hat Peter den Hund.
k. Jetzt ist der Hund bei Peter.
l. *Jetzt hat der Baum den Mann.
m. Jetzt ist der Mann beim Baum.
Haben kann zum Ausdruck der relativ unver-
uerlichen (inalienablen) lokalen Teil-von-
Beziehung dienen (123a), aber nicht zum Aus-
druck einer kontingenten lokalen Nachbar-
schaft (1231). Ein kontingenter Besitz (123j)
kann auch lokal formuliert werden (123k),
ein unveruerlicher Besitz (123g) aber nicht
(123i). Die Aussagen (123df) liegen zwischen
diesen Polen; hier kann die Deutung zwischen
lokaler Teil-von-Beziehung (oder lokaler Exi-
stenz) und Besitz angesiedelt werden.
Die lokalistische Hypothese behauptet,
da ein Besitzgegenstand beim jeweiligen Pos-
sessor zu lokalisieren ist. Wie die Beispiele
zeigen, ist dieser Zusammenhang auch im Dt.
partiell grammatikalisiert. Dies gilt auch fr
den possessiven Genitiv bei der lokalen Teil-
von-Beziehung.
(124)
a. Am Balkon des Hauses gibt es eine
Markise.
b. Das Haus hat eine Markise am Bal-
kon.
5.3Thematische Rollen
Gruber (1965) und in etwas anderer Weise
Anderson (1971) haben eine lokalistische
Theorie der -Rollen bzw. (semantischen) Ka-
sus im Auge gehabt. Besonders auf Gruber
sttzt sich Jackendoff (1976, 1983, 1987). Er
stellt die Hypothese auf, da in jedem seman-
37. Lokale und Direktionale 785
tuell. Insofern ist die Semantik der Lokalisie-
rungsausdrcke ein geeignetes Feld, um die
Interaktion von Syntax, Semantik und Kog-
nition zu studieren.
Dieser Artikel ersetzt eine frher zitierte Fassung
von 1986.
6. Literatur (in Kurzform)
Anderson 1971 Anderson/Keenan 1985 Bennett
1975 Bierwisch 1987 Bierwisch 1988 Bierwisch/
Lang (eds.) 1987 Brugman 1981 Clark 1973
Clark/Clark 1978 Closs 1978 Creary/Gawron/
Nerbonne 1989 Cresswell 1978a Cresswell
1978b Cresswell 1985a Davidson 1967a David-
son 1970 Denny 1978 Dowty 1979 Ehrich
1985 Fillmore 1971 Fillmore 1975 Fillmore
1982 Galton 1984 Geis 1975 Gruber 1965
Habel 1989 Hawkins 1984 Herskovits 1986
Herweg 1989 Herweg 1990 Higginbotham 1985
Hill 1982 Jackendoff 1972 Jackendoff 1973 Jak-
kendoff 1976 Jackendoff 1983 Jackendoff 1987
Kaufmann 1989 Kaufmann 1990 Kosslyn 1980
Kuno 1971 Lakoff 1970d Lakoff/Johnson 1980
Langacker 1982 Lindner 1981 Lang 1987a
Lang 1989a Langacker 1982 Levelt 1986 Li/
Thompson 1978 Lindner 1981 Lindner 1982
Link 1983 Lbner 1987c Lbner 1990 Lutzeier
1981 Lyons 1967 Lyons 1977 Maienborn 1990
Miller/Johnson-Laird 1976 Ostler 1980 Rauh
1988 Rauh (ed.) 1990 Ristow 1990 Rosch
1978 Rosch/Mervis 1975 Saile 1984 Schpak-
Dolt 1989 Sondheimer 1978 von Stechow 1978
Steinitz 1969 Steinitz 1977 Talmy 1975 Talmy
1980 Talmy 1985 Thompson/Longacre 1985
Vandeloise 1984 Wunderlich 1981 Wunderlich
1982 Wunderlich 1984 Wunderlich 1985b Wun-
derlich 1985c Wunderlich 1986b Wunderlich
1987 Wunderlich 1990 Wunderlich 1991 Wun-
derlich/Kaufmann 1990
Dieter Wunderlich, Dsseldorf/
Michael Herweg, Hamburg
(Bundesrepublik Deutschland)
einer abstrakten GO-Relation und weist da-
her dieselben -Rollen wie das Bewegungs-
verb go auf. Entsprechend weist die Verur-
sachung einer Zustandsnderung dieselben -
Rollen wie etwa put auf. Ob dies der Theorie
der -Rollen eine solide Grundlage zu geben
vermag, soll hier offen bleiben. In einem en-
geren Sinne vermag die Semantik lokaler Ver-
ben wohl noch keine Lsung fr die Semantik
anderer Verben der Zustandsnderung vor-
zugeben.
5.4Kritik
Den Lokalismus-Theorien liegt generell die
Annahme zugrunde, da mehr abstrakte Re-
lationen/Strukturen sprachlich nach dem Vor-
bild der mehr konkreten rumlichen Relatio-
nen/Strukturen modelliert werden; darum
wird oft von bertragung oder Metapher
gesprochen. In der Semantik der Lokalisie-
rungsausdrcke spielt der konkrete Wahr-
nehmungsraum, etwa die bildliche Gestalt
und Anordnung von Gegenstnden, jedoch
nur eine geringe Rolle. Soweit die propositio-
nale Struktur zur Diskussion steht, wird von
Begriffen der Topologie, der Algebra oder
Mengenlehre Gebrauch gemacht. Funktor-
konstanten wie EXT, DIM und Prdikate wie
LOC, CHANGE sind nicht von vornherein
auf eine rumliche Konzeptualisierung hin
festgelegt. In der Semantik selbst werden nur
strukturelle Bedingungen der Interpretation
analysiert, nicht die konzeptuelle Verarbei-
tung im konkreten Wahrnehmungsraum. Pr-
positionen oder Verben mit generellen Struk-
tureigenschaften sind daher prinzipiell in ver-
schiedenen konzeptuellen Domnen verwend-
bar, sofern diese Domnen entsprechend
strukturiert verstanden werden knnen. Bei
einer systematischen Trennung von semanti-
scher Form und konzeptueller Deutung ergibt
sich die speziell rumliche Deutung nicht se-
mantisch, sondern prinzipiell erst konzep-
786 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
38. Gradpartikeln
Sprachen zu haben. Nicht immer haben Grad-
partikeln allerdings den Status von selbstn-
digen Wrtern, so wie im Deutschen oder
Englischen. In vielen Sprachen werden sie als
Affixe oder enklitische Partikeln mit Elemen-
ten der Hauptwortklassen verknpft, wobei
sie gewhnlich eine periphere Stellung in der
Wortstruktur einnehmen.
In vielen, wenn nicht allen Sprachen, spie-
len Gradpartikeln bei der formalen Charak-
terisierung bestimmter Konstruktionen eine
wesentliche Rolle. Eine deutliche Affinitt zu
anderen semantischen Bereichen kommt auch
darin zum Ausdruck, da in vielen Sprachen
die gleichen Elemente als Gradpartikeln und
Indikatoren fr spezifische andere Funktio-
nen verwendet werden. Als Beispiele fr diese
Affinitt zu anderen syntaktischen und se-
mantischen Bereichen, die von jeder seman-
tischen Analyse zu explizieren ist, seien die
folgenden genannt:
a. Zusammen mit Interrogativpronomen
und anderen Quantoren bilden additive Par-
tikeln, wie Dt. auch, sogar, hufig sog. un-
bestimmte Pronomen (free choice quanti-
fiers), wie Dt. wer auch immer, Ndl. wie ook,
Jap. dare mo oder Seneca w:thkwah (cf.
Coyaud und At Hamou 1976).
b. Konzessive Konnektiva (d. h. Konjunk-
tionen, Prpositionen und Konjunktionalad-
verbien) sind hufig als Kombinationen von
additiven Gradpartikeln und konditionalen
bzw. temporalen Konjunktionen analysierbar.
Dt. ob-schon, wenn ... auch, Engl. even though,
Frz. quand mme, Finn. jos-kin (wenn-auch)
und Malayalam -enkil-um (wenn-auch) sind
deutliche Beispiele fr die erwhnte Affinitt
zwischen Gradpartikeln und Konzessivitt.
c. Restriktive Gradpartikeln wie nur einer-
seits und additive Partikeln wie auch, selbst,
sogar andererseits kennzeichnen zwei inter-
essante Typen von Konditionalstzen, die in
der Diskussion um die Bedeutung dieser Kon-
struktion eine wesentliche Rolle gespielt
haben (cf. Stalnaker 1969; Mackie 1973; Ben-
nett 1982):
(1) Only if you offer him some money will
he mow the lawn for you.
(2) Even if you offer him some money, he
wont mow the lawn for you.
Nach einer hufig vertretenen Auffassung
drcken durch only if eingeleitete Konditio-
nale eine notwendige Bedingung aus, wobei
die entsprechende Beziehung zwischen Ante-
1. Einleitung
2. Syntax
3. Bedeutung
3.1 Fokus und Skopus
3.2 Prsuppositionen und Wahrheitsbedingungen
3.3 Alternativen
3.4 Skalen
3.5 Bewertungen
3.6 Skopus
4. Andere Verwendungsweisen
4.1 Satzadverbien
4.2 Modalpartikeln
5. Offene Probleme
6. Literatur (in Kurzform)
1. Einleitung
Die Formelelemente (z. B. auch, sogar, nur,
erst), deren Bedeutung im folgenden Kapitel
beschrieben wird, werden in Grammatik-
handbchern oder Lexika gewhnlich den
Partikeln oder den Adverbien, d. h. den Rest-
kategorien syntaktischer Analyse zugerech-
net. Wie auch andere Funktionswrter und
grammatische Formelemente bilden sie eine
relativ geschlossene Klasse. Aufgrund ihrer
Stellung an der Peripherie zwischen gram-
matischen und lexikalischen Ausdrucksmit-
teln einer Sprache werden sie zu den Synka-
tegoremata, wegen ihrer abstrakten und stark
kontextabhngigen Bedeutung werden sie zu
den Synsemantika gerechnet. Whrend inner-
halb der groen Klasse der Adverbien oder
der der Partikeln einige Subklassen wohleta-
bliert sind, ist erst durch eine Reihe von Un-
tersuchungen der letzten fnfzehn Jahre (z. B.
Altmann 1976, 1978; Knig 1977, 1981; Ja-
cobs 1983 fr das Deutsche; Quirk et al. 1972;
Ross & Cooper 1979; Taglicht 1984 fr das
Englische) deutlich geworden, da auch lexi-
kalische Elemente wie auch, nur, sogar, erst,
selbst gerade, etc. im Deutschen und ihre Ent-
sprechungen in anderen Sprachen aufgrund
einer Reihe von gemeinsamen syntaktischen
und semantischen Eigenschaften als beson-
dere Klasse auszuzeichnen sind. Die heute
allgemein akzeptierten Bezeichnungen Grad-
partikeln und Fokuspartikeln (engl. focu-
sing adjuncts, focusing adverbs) stammen
ebenfalls aus den o. g. Untersuchungen.
Nach allem was wir wissen, gehren Grad-
partikeln zu den sprachlichen Universalien.
Zumindest die Unterscheidung zwischen Dt.
auch und nur scheint eine Parallele in allen
38. Gradpartikeln 787
tionen. Je nach Stellung im Satz und je nach
Plazierung des Satzakzents (bzw. der Satzak-
zente) knnen sich Gradpartikeln auf ver-
schiedene Teile eines Satzes beziehen. Bezie-
hungen zwischen einer Gradpartikel und Tei-
len eines Satzes bestehen im mehrfachen Sinne
des Wortes (cf. Jacobs 1983: 8 ff):
(7)
a. Gradpartikeln haben einen bestimm-
ten Fokus im Satz.
b. Gradpartikeln sind mit einer bestimm-
ten Kokonstituente in Konstruktion.
c. Gradpartikeln haben einen bestimm-
ten (semantischen) Skopus.
Als Fokus einer Gradpartikel bezeichnen wir
vorlufig den Teil eines Satzes, der typischer-
weise einen Satzakzent trgt und von der Par-
tikel semantisch besonders betroffen wird. In
den vorangegangenen, wie auch in den fol-
genden Beispielen, wird dieser Fokus durch
Grobuchstaben bekennzeichnet. (Nicht im-
mer wird der Fokus einer Partikel durch den
Satzakzent und/oder die Stellung der Partikel
eindeutig identifiziert. Hufig markiert der
Satzakzent nur einen Teil des Fokus, und er
kann auerdem auf der Partikel selbst liegen.
Letzteres ist z. B. dann der Fall, wenn Dt.
auch oder Engl. only, also, too ihrem Fokus
folgen, z. B. I saw FRED, only/also, too. Eine
wichtige Rolle bei der Identifikation des Fo-
kus spielt neben Intonation und Position der
Gradpartikel der Kontext.)
Natrlich ist eine Gradpartikel immer mit
einem Teil des Satzes in Konstruktion und
geht auch in diesem Sinne eine Beziehung ein.
Die traditionelle Kategorisierung von Grad-
partikeln des Adverbien suggeriert, da stets
Verbalphrasen oder Stze ihre Kokonstituen-
ten sind. Die erwhnte enge Verbindung zwi-
schen einer Partikel und einem fokussierten
Element legt eine andere Analyse nahe. Be-
sonders relevant fr die semantische Analyse
einer Gradpartikel ist schlielich die Bezie-
hung, die in (7) als Skopus bezeichnet wor-
den ist.
Eine weitere charakteristische Eigenschaft
von Gradpartikeln neben der erwhnten Va-
riabilitt ihrer Stellung und der Assoziation
mit einem Fokus besteht darin, da diese
Elemente im Gegensatz zu anderen Adver-
bien mehrfach im Satz vorkommen knnen,
solange dies nicht zu semantischen Unvertr-
glichkeiten fhrt (cf. Anderson 1972; Mc-
Cawley 1970: 290):
(8)
a. Only Lyndon pities only himself.
b. Ausgerechnet am Montag kommt
mich ausgerechnet Fritz besuchen.
zedens und Konsequens konvers zu der durch
einfache Konditionale ausgedrckten Bezie-
hungen ist, d. h. only if p, q if q, then p (cf.
Quine 1962: 41; McCawley 1981: 49 ff). Ein
durch Engl. even (Dt. selbst, auch, sogar) ein-
geleiteter Konditionalsatz kennzeichnet da-
gegen eine extreme, berraschende und somit
meist irrelevante Bedingung.
d. Durch die Kombination einer konditio-
nalen Konjunktion mit einer restriktiven Par-
tikel wie Dt. nur, Engl. only, werden in vielen
Sprachen Wunschstze gebildet:
(3)
a. Wenn er es ihm nur nicht gesagt hat.
b. If only he were here.
e. In vielen Sprachen werden die gleichen
Formelelemente (z. B. Dt. selbst, Frz. mme,
Ir. fin) als emphatische Reflexivpronomen
und als additive Gradpartikeln verwendet (cf.
Edmondson & Plank 1978; Plank 1978):
(4)
a. Der Brgermeister kommt selbst.
b. Selbst der Brgermeister kommt.
f. Additive Partikeln zeigen eine deutliche
Affinitt zur Koordination. In vielen Spra-
chen hat die Gradpartikel auch und die ko-
ordinierende Konjunktion und die gleiche
Entsprechung (z. B. Lat. et, Zulu na, Margi
kk).
g. Restriktive Partikeln wiederum werden
hufig auch als adversative Konjunktionen
verwendet. Engl. but, Ndl. maar und Nahuatl
zan sind deutliche Beispiele:
(5)
a. He is but a child.
b. He would like to come, but he cant.
2. Syntax
Eine der aufflligsten syntaktischen Eigen-
schaften von Gradpartikeln ist die Variabilitt
ihrer Stellung im Satz. Gradpartikeln knnen
in verschiedenen Positionen vorkommen und
gleichsam durch einen Satz hindurchwandern:
(6)
a. Nur FRITZ schenkt seinen Kinder zu
Weihnachten Bcher.
b. Fritz schenkt nur SEINEN KIN-
DERN zu Weihnachten Bcher.
c. Fritz schenkt seinen Kindern nur ZU
WEIHNACHTEN Bcher.
d. Fritz schenkt seinen Kindern zu Weih-
nachten nur BCHER.
Wie die vorausgehenden Beispiele zeigen, kor-
relieren unterschiedliche Positionen einer Par-
tikel mit unterschiedlichen Akzentmustern,
sowie auch mit unterschiedlichen Interpreta-
788 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
kombiniert werden, die den Fokus enthlt.
Entsprechend wren Regeln zu formulieren,
die die folgenden Konfigurationen zulassen:
(13) [GP + X]
x
oder [X + GP]
x
.
Angemessen erscheint diese Annahme insbe-
sondere fr Sprachen, in denen Gradpartikeln
enklitisch mit ihrem Fokus verknpft werden.
Im Trkischen z. B. folgt de auch dem Fokus
und zeigt Vokalharmonie mit dem entspre-
chenden Wort (cf. Lewis 1967: 206):
(14)
a. oraya ben de gittim.
dort ich auch ging
Auch ich ging dorthin.
b. ben oraya da gittim.
Ich ging auch dorthin.
c. ben oraya gittim de.
Ich bin dorthin auch gegangen.
Jedoch auch in Sprachen wie dem Englischen
und dem Deutschen, in denen Gradpartikeln
nicht unmittelbar vor oder hinter ihrem Fo-
kus (oder einer fokusenthaltenden) Konsti-
tuente stehen mssen, lassen sich Argumente
fr eine solche Analyse finden. Im Englischen
knnen z. B. einige Gradpartikeln (only, even
aber nicht also) zwischen Prposition und
nachfolgender Nominalphrase, sowie zwi-
schen einem Verb und nachfolgendem direk-
tem Objekt stehen, in Positionen also, von
denen Adverbien ausgeschlossen sind:
(15)
a. I saw only/even Fred.
b. I was talking to only/even Fred.
Im Deutschen kann die Annahme, da das
finite Verb die Zweitstellung im Satz ein-
nimmt, fr Beispiele wie (6 a) nur dann auf-
rechterhalten werden, wenn man annimmt,
da Gradpartikel und Subjekt eine Konsti-
tuente bilden.
In vielen Fllen fhrt eine Analyse des Typs
(13) jedoch zu groen Schwierigkeiten (cf.
Jacobs 1983: 47 ff). Zu den Phnomenen, die
mit einer solchen Analyse nur sehr schwer
beschreibbar sind, gehren Beispiele mit
einem mehrteiligen Fokus, der selbst keine
Konstituente bildet, sowie Beispiele, in denen
eine Partikel einem Fokus in einiger Distanz
folgt oder vorausgeht:
(16)
a. EIN BUCH mchte ich morgen uch
kaufen.
b. Ich bedaure nur, da ich das Buch
VERSCHENKT habe.
Da Gradpartikeln im Deutschen grundstz-
lich in adverbialen Positionen vorkommen,
ist besonders in Hinblick auf solche Daten
Satz (8 a) ebenso wie der folgende zeigen zu-
dem, da Pronomen in Stzen mit Partikeln
stets als Variable fungieren:
(9) Nur Fritz bedauert, da er verloren hat.
Neben diesen allgemeinen syntaktischen
Eigenschaften knnen in einzelnen Sprachen
zur Identifikation von Gradpartikeln natr-
lich noch sprachspezifische Kriterien heran-
gezogen werden. Im Deutschen knnen z. B.
semantisch kompatible Gradpartikeln koor-
diniert werden:
(10)
a. Erst und nur in der Renaissance ...
b. Auch und gerade wirtschaftliche Pro-
bleme ...
Auf der Basis der genannten Kriterien knnen
im Deutschen und im Englischen etwa fol-
gende Ausdrcke zur Klasse der Gradparti-
keln gerechnet werden:
(11) (Deutsch) allein, auch, ausgerechnet, aus-
schlielich, bereits, besonders, blo, ein-
zig, eben, erst, gar, genau, gerade, gleich,
insbesondere, lediglich, (nicht) einmal,
noch, nur, schon, selbst, sogar, wenig-
stens, zumal, zumindest ...
(12) (Englisch) also, alone, either, even, espe-
cially, exactly, in particular, merely, only,
too, let alone, at least, as well, not least
...
Zu beiden Gruppen knnte man auerdem
noch einige Grenzflle zhlen, die nicht alle
der genannten syntaktischen und der noch zu
besprechenden semantischen Kriterien erfl-
len.
Nach dieser Skizze allgemeiner syntakti-
scher Eigenschaften von Gradpartikeln sind
noch einige spezifische syntaktische Fragen
kurz anzusprechen: Mit welchen Konstituen-
ten sind Gradpartikeln kombinierbar? Welche
Stellung im Satz relativ zu der ihres Fokus,
zu der ihrer Kokonstituente und zu der ihres
Skopus knnen sie im Satz einnehmen? Wel-
che syntaktische Analyse wre eine geeignete
Grundlage fr eine daran anschlieende se-
mantsiche Beschreibung?
Eine vergleichende Betrachtung der Syntax
von Gradpartikeln in verschiedenen Spra-
chen, ebenso wie eine detaillierte Analyse die-
ser Klasse in einer einzelnen Sprache liefert
Argumente fr zwei mgliche, allerdings sehr
unterschiedliche syntaktische Analysen. Die
enge Verbindung zwischen Partikel und einem
fokussierten Element im Satz, sowie die Tat-
sache, da Gradpartikeln hufig entweder vor
oder hinter ihrem Fokus stehen, legt eine
Analyse nahe, nach der diese Elemente direkt
mit ihrem Fokus bzw. einer Konstituente
38. Gradpartikeln 789
wohl von der Bedeutung ihres Fokus ab als
auch von der ihres Skopus. Die Relevanz des
Fokus fr die Interpretation einer Partikel
lt sich durch das folgende Beispielpaar ver-
deutlichen:
(19)
a. FRITZ hat uch ein neues Auto ge-
kauft.
b. Jemand anderes als Fritz hat ein
neues Auto gekauft.
((x)
x Fritz
[x hat ein neues Auto ge-
kauft])
(20)
a. Fritz hat auch EIN NEUES AUTO
gekauft.
b. Fritz hat etwas anderes als ein neues
Auto gekauft.
Der eigentliche Beitrag, den auch zur Bedeu-
tung der Stze (19a) und (20a) liefert, lt
sich in etwa durch (19b) und (20b) umschrei-
ben. Und da sich die beiden Stze lediglich in
der Wahl des Fokus unterscheiden, mu diese
Tatsache fr den durch (19b) und (20) illu-
strierten Bedeutungsunterschied verantwort-
lich sein. Den Beitrag von auch zur Bedeutung
der genannten Stze erhalten wir grob ge-
sprochen dadurch, da wir die Partikel weg-
lassen und den Fokusausdruck durch einen
in geeigneter Weise restringierten Existenz-
quantor ersetzen. Ein Teil dieser Restriktio-
nen ist, da der alternative Wert mit dem
Fokuswert nicht identisch ist.
Da der Beitrag einer Partikel zur Bedeu-
tung eines Satzes auerdem noch von ihrem
Skopus abhngt, zeigen die folgenden Bei-
spiele:
(21)
a. Ich bedaure, da ich auch FRITZ
untersttzt habe.
b. (Paul htte ich nicht untersttzen sol-
len.)
Ich bedaure auch, da ich FRITZ
untersttzt habe.
Der Beitrag von auch zur Bedeutung dieser
Stze kann etwa folgendermaen umschrie-
ben werden:
(21)
a. Ich habe jemand anderen als Fritz
untersttzt.
b. Ich bedaure bei jemand anderem als
Fritz, da ich ihn untersttzt habe.
Der Fokus der Gradpartikel in (21a, b) ist in
beiden Fllen Fritz. Der Unterschied in der
Bedeutung kann also nur etwas mit der Po-
sition der Partikel zu tun haben, sowie mit
den Beziehungen, die diese Position kenn-
zeichnet. Auch in (21a, b) haben wir den Bei-
trag der Partikel auch zur Bedeutung der ent-
der Vorschlag gemacht worden, Gradparti-
keln als Satzadverbien zu analysieren, d. h.
als Elemente, die mit einem Verb und seinen
Projektionen (VP, S) kombinierbar sind (Ja-
cobs 1983; 1984).
Zu den Regelmigkeiten, die eine syntak-
tische Beschreibung zu erfassen hat, gehren
auch die Restriktionen, die zwischen der Po-
sition einer Gradpartikel und der eines mg-
lichen Fokus bestehen. Im Englischen wie im
Deutschen kann z. B. eine Partikel am Satz-
anfang nur die unmittelbar folgende Konsti-
tuente als Fokus whlen:
(17) *Even Fred gave presents to MARY.
Eine Gradpartikel vor dem Hauptverb, sowie
im Satzende, kann im Englischen jede Kon-
stituente, eine Partikel nach dem Hautverb
kann nur die unmittelbar folgende Konsti-
tuente als Fokus whlen (cf. Fraser 1971;
Ross & Cooper 1979):
(18)
a. Fred may even have given presents
to MARY.
b. FRED may have given presents to
Mary, even.
c. *Fred may have given even presents
to MARY.
Untersuchungen, die ber diese Zusammen-
hnge zwischen mglicher Position einer
Gradpartikel relativ zu ihrem Fokus fr das
Englische und Deutsche vorliegen, lassen ver-
muten, da sich die relevanten Restriktionen
mit Hilfe von strukturellen Konfigurationen
(c-command) formulieren lassen (cf. Jacobs
1984; Ross & Cooper 1979).
Welche der erwhnten syntaktischen Be-
schreibungen die adquate ist, mu hier offen
bleiben. Die jetzt folgende semantische Ana-
lyse wird zeigen, da es plausibel ist, die be-
obachtete Uneinheitlichkeit in der Syntax
von Gradpartikeln mit den doppelten Anfor-
derungen in Verbindung zu bringen, die an
diese Syntax gestellt werden: einerseits den
Fokus und andererseits den Skopus zu mar-
kieren.
3. Bedeutung
3.1Fokus und Skopus
Wie im vorangegangenen Teil erwhnt, be-
zieht sich eine Gradpartikel, in mehrfachem
Sinne des Wortes, auf einen Teil des Satzes,
in dem sie vorkommt. Von den in (7) genann-
ten Beziehungen spielen die erste und dritte
eine wesentliche Rolle fr die Interpretation
der Partikel: Der Beitrag, den eine Partikel
zur Bedeutung eines Satzes liefert, hngt so-
790 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
sie also auf die Struktur der Proposition Be-
zug nehmen. In der Notation von Cresswell
(1973) ausgedrckt sind sie somit vom Typ
0, 0, , .
Aus dem eben Gesagten folgt, da -Kon-
version in (22) nicht mglich ist. Eine weitere
Konsequenz ist, da zwei Stze mit der glei-
chen Partikel aber unterschiedlich struktu-
rierten Propositionen nicht immer quivalent
sind, obwohl die Propositionen selbst dies
sind:
(23)
a. nur (x [x liest], Peter)
b. nur (P [Peter P], liest)
3.2Prsuppositionen und
Wahrheitsbedingungen
Prsuppositionen zeigen, im Gegensatz zu lo-
gischen Implikationen (entailments), ein ab-
normes Projektionsverhalten: bei Einbettung
in negative, interrogative, modale oder kon-
ditionale Kontexte bleiben sie erhalten.
Auerdem sind sie in bestimmten Kontexten
aufhebbar (cf. Gazdar 1979; Levinson 1983:
167 ff; Soames 1982). Wenn wir die entspre-
chenden Tests auf Beispiele wie (19a) anwen-
den, dann wird deutlich, da der Beitrag von
auch zur Bedeutung eines Satzes als Prsup-
position (oder konventionelle Implikatur) zu
bezeichnen ist. Die folgenden Stze rechtfer-
tigen den in (19b) beschriebenen Schlu
ebenso wie (19a) selbst:
(24)
a. Hat Fritz uch ein neues Auto ge-
kauft?
b. Vielleicht hat Fritz auch ein neues
Auto gekauft.
c. Wenn Fritz auch ein neues Auto ge-
kauft hat, dann haben wir jetzt zwei.
Die kontextuelle Lschbarkeit der in (19b)
beschriebenen Implikation lt sich durch
eine Situation verdeutlichen, in der eine Mut-
ter eines ihrer Kinder dadurch ermuntert,
einen von ihr gekochten Brei zu essen, da
sie ihr anderes Kind als Vorbild hinstellt:
(25) Komm und i! Deinem Bruder hat der
Brei auch geschmeckt.
Durch den vorausgehenden Imperativ wird
die mit auch assoziierte Prsupposition des
zweiten Satzes gelscht.
Was eben ber auch gesagt wurde, gilt
ebenso fr viele, wenn nicht alle, Gradparti-
keln, die gewhnlich als additiv bezeichnet
werden. Ebenso wie auch liefern die Partikeln
sogar, selbst, noch, schon, ausgerechnet, ge-
rade, besonders, etc. und ihre Entsprechungen
sprechenden Stze dadurch ausformuliert,
da wir einen entsprechend restringierten Exi-
stenzquantor fr den Fokus eingesetzt haben.
Im Gegensatz zu (21b) ist im Falle von (21a)
jedoch nicht der gesamte komplexe Satz fr
die Ausformulierung des Bedeutungsbeitrages
von auch relevant, sondern nur der eingebet-
tete Objektsatz. Als Skopus einer Partikel
knnen wir also den Teil eines Satzes (bzw.
seine semantische Entsprechung) auffassen,
der fr die Ausformulierung des Beitrages
einer Partikel zur Bedeutung eines Satzes re-
levant ist. In (21a) ist nur der Objektsatz im
Skopus der Partikel, in (21b) zeigt die Stellung
der Partikel im Hauptsatz an, da der ge-
samte komplexe Satz zu ihrem Skopus gehrt.
Die Abhngigkeit der Interpretation einer
Partikel sowohl von der Bedeutung des Fokus
als auch von der ihres Skopus kann man
offensichtlich dadurch am besten erfassen,
da man von einer Reprsentation (logi-
schen Form) ausgeht, in der Fokus und Sko-
pus der Partikel klar unterschieden werden.
Einer solchen Forderung wird am besten eine
Analyse gerecht, nach der Gradpartikeln als
Operatoren aufzufassen sind, die ber struk-
turierte Propositionen operieren, d. h. ber
Propositionen, die aus einem (komplexen)
Prdikat und dazu passenden Argumenten
bestehen (cf. v. Stechow 1982a; Knig 1981;
Jacobs 1983: 144 ff). Fr Beispiele wie (19a)
werden wir also folgende logische Form
annehmen:
(22) auch (x [x hat ein neues Auto gekauft],
Fritz)
In Reprsentationen dieser Art sind Fokus
und Skopus der Partikel klar voneinander
unterschieden. Um eine zu interpretierende
Oberflchenstruktur wie (19a) auf eine Re-
prsentation wie (23) abzubilden, sind in etwa
die folgenden bersetzungsregeln zu formu-
lieren (cf. v. Stechow 1982 a: 115 ff): Der Fo-
kusaudruck wird durch eine Variable ersetzt,
die durch einen -Operator gebunden wird.
Der Fokusausdruck selbst wird nach rechts
in die Fokusposition gerckt und die Grad-
partikel wird dem gesamten Resultat dieser
Operation zugeordnet. (Natrlich sehen diese
bersetzungsregeln wesentlich komplizerter
aus, wenn nicht der gesamte Satz im Skopus
der Partikel ist. Beispiele dieser Art werden
in 3.6 diskutiert.) Gradpartikeln werden se-
mantisch somit als Operatoren aufgefat, die
zusammen mit einer strukturierten Proposi-
tion eine Proposition ergeben. Wesentlich in
diesem Zusammenhang ist, da Gradparti-
keln struktur-sensitive Operatoren sind, da
38. Gradpartikeln 791
(ii) Paul hat das Geld ausgerechnet Fritz ge-
geben. Paul gave the money to Fritz,
of all people.)
Analog lt sich der (19a) parallele Satz
mit nur analysieren. Der Beitrag, den nur zu
den Wahrheitsbedingungen von (27 a) liefert,
entspricht der Negation von (26):
(27)
a. nur (x [x hat ein neues Auto ge-
kauft], Fritz)
b. (x)
x Fritz
(x hat ein neues Auto
gekauft)
Diese beiden Beispiele zeigen, da Gradpar-
tikeln die folgenden generellen semantischen
Eigenschaften haben:
(28)
a. Stze mit Gradpartikeln implizieren
logisch oder prsupponieren die ent-
sprechenden Stze ohne Partikeln.
b. Gradpartikeln whlen Alternativen
zu dem genannten Fokuswert aus
und schlieen diese Alternativwerte
als mgliche Werte fr den offenen
Satz in ihrem Skopus entweder ein
oder aus.
Aufgrund der in (28 b) genannten Eigenschaft
knnen wir Gradpartikeln daher in eine ad-
ditive (inklusive) und eine restriktive (exklu-
sive) Gruppe einteilen (cf. Quirk et al. 1972:
431). Angewandt auf das Deutsche ergibt die-
ses Kriterium die beiden folgenden Gruppen:
(29)
a. (additive Partikeln) auch, gerade, ins-
besondere, gleichfalls, schon, noch, so-
gar, selbst, zumal ...
b. (restriktive Partikeln) allein, blo,
erst, lediglich, nur ...
Allerdings lassen sich nicht alle Gradpartikeln
eindeutig der einen oder der anderen Gruppe
zuordnen (cf. 3.5).
Die Restriktionen, die bisher fr die Do-
mne der Variablen in Ausdrcken wie (26)
und (27b) erwhnt wurden (i. e. Typengleich-
heit und Nicht-Identitt mit dem Fokuswert),
sind nun um eine weitere zu ergnzen. Die
Auswahl von Alternativwerten fr einen ge-
gebenen Fokuswert hngt auch vom Kontext
ab. Nur solche Alternativwerte werden durch
Gradpartikeln ein- oder ausgeschlossen, die
in einem bestimmten Kontext in Betracht ge-
zogen werden. Ein Satz wie (27a) besagt nicht
unbedingt, da berhaupt niemand auer
Fritz ein neues Auto gekauft hat, sondern
wird meist verwendet um auszudrcken, da
dies fr die anderen zur Debatte stehenden
Personen nicht zutrifft. Hufig werden die ins
Auge gefaten Alternativwerte im vorausge-
in anderen Sprachen keinen Beitrag zu den
Wahrheitsbedingungen eines Satzes, sondern
lsen lediglich eine Prsupposition aus. In den
Diskussionen um die Existenz und die kor-
rekte Definition von Prsuppositionen und
anderen Aspekten pragmatischer Bedeutung
der siebziger Jahre haben daher diese Parti-
keln eine wesentliche Rolle gespielt (cf. Horn
1969; Fraser 1971; Green 1973; Kempson
1975; Karttunen & Peters 1979). Die Wahr-
heitsbedingungen von Stzen mit diesen Par-
tikeln sind vllig denen identisch, die fr die
entsprechenden Stze ohne Partikel zu for-
mulieren sind. Bei den sog. restriktiven Par-
tikeln wie nur, lediglich, erst wird dies eben
beschriebene Verhltnis von logischen Impli-
kationen (entailments) und Prsuppositionen
genau umgekehrt. In diesen Fllen lt sich
die mit der Partikel verbundene Prsupposi-
tion durch die entsprechenden Stze ohne
Partikel wiedergeben, whrend der eigentliche
Beitrag der Partikeln zur Bedeutung des je-
weiligen Satzes in spezifischen Wahrheitsbe-
dingungen besteht. Angesichts der Tatsache,
da die genannten restriktiven Partikeln nicht
nur innersprachlich durch negative Konstruk-
tionen paraphrasierbar sind (z. B. nur Brot =
nichts anderes als Brot), sondern auch hufig
durch solche Konstruktionen in anderen
Sprachen zu bersetzen sind (cf. Frz. ne ...
que, Jap. sika ... Neg, Engl. not ... until) ist
der erwhnte Unterschied zwischen den zwei
Partikelgruppen nicht berraschend.
3.3Alternativen
Wenn wir von der in (22) beschriebenen lo-
gischen Form von Stzen des Typs (19a) aus-
gehen, erhalten wir die Prsupposition, die
auch zur Bedeutung dieses Satzes beitrgt,
grob gesprochen dadurch, da wir Fokus und
Partikel weglassen und den -Operator durch
einen Existenzquantor ersetzen (existential
closure). Dabei ist allerdings die Domne der
durch den Quantor gebundenen Variablen zu
beschrnken. Teil dieser Restriktionen ist, da
die fr die Variable einsetzbaren Werte vom
gleichen Typ, aber nicht identisch mit dem
Fokuswert sein drfen:
(26) (x)
x Fritz
(x hat ein neues Auto gekauft)
(In den folgenden englischen bersetzungen
von Dt. ausgerechnet sind diese Restriktionen
z. T. deutlich zu erkennen:
(i) Willst du ausgerechnet jetzt verreisen?
Do you want to leave now, of all times?
792 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
tion (Dt. aber, Engl. but) eine natrliche
Erklrung. Wie E. Lang (s. Art. 26) darlegt,
ist die Bedeutung dieser Konjunktion als
Komplementbildungsoperation beschreibbar.
Wenn der Fokus dieser Partikel das Anteze-
dens eines Konditionalsatzes ist, wird die Ne-
gation dieses Antezedens als Komplement in
Betracht gezogen und als Wert ausgeschlos-
sen:
(32)
a. Only (x [if x, q], p)
b. (if p, q) (Interpretation von
only)
Wenn man mit Stalnaker (1975) annimmt,
da eine Negation eines Konditionalsatzes
mit der Negation des Konsequens gleichzu-
setzen ist, dann wird durch Kontraposition
die in bestimmten Fllen bestehende qui-
valenz von only if p, q und if q, p erklrbar:
(32)
c. If p, q (Negation des Konse-
quens)
d. if q, p (Kontraposition)
Eine solche quivalenz besteht allerdings
dann nicht, wenn zwischen p und q eine zeit-
liche Folgebeziehung besteht (cf. McCawley
1981: 49 ff).
Nicht nur die Interpretation einer Grad-
partikel hngt vom Typ und der Bedeutung
des Fokus ab. Manchmal ist es auch die Form
der Partikel selbst, die von dem Typ des Fo-
kus beeinflut wird. In den folgenden fran-
zsischen Bespielen hngt die Wahl der ver-
schiedenen, gleichbedeutenden Gradpartikeln
von der Kategorie des Fokus ab:
(33)
a. Seul Jacques aime Marie.
b. Jacques naime que Marie / Jacques
aime seulement Marie.
c. Jacques ne fait que se promener.
d. Rien quen ouvrant la porte, je pur-
rais dire ...
3.4Skalen
Den bisher genannten Restriktionen (Typen-
gleichheit, Nicht-Identitt, Kontextabhngig-
keit) bei der Auswahl von Alternativwerten,
die durch Gradpartikeln in Betracht gezogen
und als mgliche Werte fr die Variable ihre
Skopus ein- oder ausgeschlossen werden, ist
noch eine hinzuzufgen. Manche Gradparti-
keln whlen nur solche Alternativen aus, die
zusammen mit dem Fokuswert auf einer
Skala geordnet sind. Dabei kann es sich um
partielle oder um totale Ordnungen handeln
(cf. Lbner 1989). Durch diese Restriktion
werden in vielen Sprachen zwei Gruppen von
additiven Partikeln unterschieden: solche, die
henden Ko-text genannt, wo sie selbst Fokus
einer anderen Partikel sein knnen:
(30)
a. One expects a good guide not only to
know the terrain, but also to choose
good roads and perhaps even to find
a few short-cuts.
b. Selbst Spitzenverdiener knnen dies
nicht bezahlen, geschweige denn
Durchschnittsbrger.
Einige Gradpartikeln wie z. B. geschweige
denn oder gar im Deutschen oder let alone,
much less im Englischen knnen nur dann
verwendet werden, wenn die relevanten Al-
ternativen zu ihrem Fokuswert im vorausge-
henden Teilsatz genannt werden.
Fr die Interpretation von Ausdrcken mit
Allquantoren gilt generell eine Einschrnkung
auf ein Universum der Rede. Der erwhnten
Kontextabhngigkeit in der Auswahl von
Alternativwerten, die durch (26) und (27 b)
nicht zum Ausdruck gebracht wird, knnte
man deshalb dadurch Rechnung tragen, da
man die Bedeutung von nur mit Hilfe des
Allquantors umformuliert. Wenn wir von
dem konkreten Inhalt des Fokus und Skopus
von nur absehen und einem Satz der allge-
meinen Form (31a) ausgehen, knnen wir
aufgrund der dualen Beziehung zwischen Exi-
stenz- und Allquantor die Bedeutung dieser
Partikel wie folgt neu formulieren:
(31)
a. nur (P, a)
b. (x)
x a
P(x)
(bzw. (x)[P(x) (x = a)]
Andererseits knnte man dieser Kontextab-
hngigkeit auch durch die Wahl des Univer-
sums bercksichtigen, ber das der Existenz-
quantor in Ausdrcken wie (26) und (27a)
luft. Weniger geeignet zur Lsung dieses
Problems erscheint ein von F. und L. Kart-
tunen (1976, 1977) gemachter Vorschlag,
einen speziellen Operator * einzufhren, der
an einem Kontext die jeweils in Betracht ge-
zogenen Werte fr eine Variable auswhlt.
Dadurch wrden pragmatische bzw. diskurs-
semantische und satzsemantische Gesichts-
punkte vermischt.
Die erwhnten Kontextabhngigkeit in der
Auswahl von Alternativen zu einem gegebe-
nen Fokuswert manifestiert sich bei der re-
striktiven Partikel nur darin, da das Kom-
plement des genannten Wertes bezglich einer
in Betracht gezogenen Menge von Werten fr
die Variable des offenen Satzes im Skopus
ausgeschlossen wird. Hier findet auch die
oben erwhnte Affinitt zwischen dieser
Gradpartikel und der adversativen Konjunk-
38. Gradpartikeln 793
eine temporale Ordnung:
(36)
a. Ich fahre nur am Donnerstag nach
Gttngen (... sonst nicht).
b. Ich fahre erst am Donnerstag nach
Gttingen (... vorher nicht).
(37)
a. Nur ein Leutnant wre ihr als
Schwiegersohn recht.
b. Erst ein Leutnant wre ihr als
Schwiegersohn recht.
Durch nur in (36a) knnen, wie die mgliche
Fortfhrung zeigt, alle anderen Tage ausge-
schlossen werden, sofern sie in dem relevanten
Kontext zur Debatte stehen. Durch erst kn-
nen dagegen nur vorausgehende Tage ausge-
schlossen werden. ber den Freitag, der auf
den genannten Donnerstag folgt, wird in
(36 b) nichts gesagt. Ebenso kann in (37 a)
jeder andere militrische Rang, in (37 b) je-
doch nur die tiefer liegenden ausgeschlossen
werden.
Die Bedeutung von erst in Stzen des Typs
(36 b) und (37 b) knnte man nun analog zu
(31 b) folgendermaen beschreiben:
(38)
a. erst (P, a)
b. (x)
x < a
P(x)
Diese Beschreibung bringt zum Ausdruck,
da durch erst Alternativwerte ausgeschlos-
sen werden, die unterhalb bzw. vor dem ge-
nannten Fokuswert liegen, so wie es fr (36 b,
37 b) angemessen erscheint. Allerdings pat
diese Analyse nicht auf Beispiele wie die fol-
genden, in denen durch erst offensichtlich h-
herrangige Alternativen (z. B. vier Kapitel,
drei Monate) ausgeschlossen werden: Im
Unterschied zu den entsprechenden Stzen
mit nur wird in (39) eine Fortfhrung der
genannten Aktivitt bzw. des Zustandes ins
Auge gefat:
(39)
a. Ich habe erst drei Kapitel gelesen.
b. Er wohnt erst seit zwei Monaten hier.
Fr erst zwei Lesarten anzunehmen, wre
hchst unbefriedigend, da die beiden Inter-
pretationen komplementr verteilt sind und
somit offensichtlich vom Ko-text bestimmt
werden (cf. Knig 1979; Braue 1983b). Zu-
dem lt sich das gleiche Phnomen auch bei
der Gradpartikel schon beobachten, bei der
Partikel also, die zu erst in einer dualen Be-
ziehung steht (cf. Lbner 1989). (Wenn a ein
zu einem gegebenen Fokuswert a in Betracht
gezogener Alternativwert ist, dann gilt fol-
gende quivalenzbeziehung: nicht erst (P, a)
= schon (P, a).) In Kontexten des Typs (39)
wie Engl. even, Dt. selbst, sogar, Frz. mme,
voire stets eine Ordnung induzieren und sol-
che, die wie Engl. also, too, Dt. auch, Frz.
aussi, galement zwar mit einer Ordnung ver-
einbar sind, sie aber nicht unbedingt fordern.
Sowohl Engl. also als auch even sind additive
Partikeln, so da beide der folgenden Stze
prsupponieren, da die genannte Person an-
dere Autoren als Shakespeare liest:
(34)
a. John also reads SHAKESPEARE.
b. John even reads SHAKESPEARE.
Im Unterschied zu also fhrt jedoch even eine
Ordnung fr die in Betracht gezogenen Werte
ein. Die zur Debatte stehenden Alternativ-
werte nehmen einen niederen Rang auf dieser
Skala ein als der genannte Fokuswert. Die
fr even relevante Ordnung wird meist mit
Hilfe der Begriffe Wahrscheinlichkeit oder
Erwartung charakterisiert: Der genannte
Fokuswert ist der unwahrscheinlichste Kan-
didat fr die Variable des offenen Satzes im
Skopus der Partikel und somit auch der ber-
raschendste, am wenigsten erwartete Wert (cf.
Fraser 1971; F. und L. Karttunen 1977; Kart-
tunen & Peters 1979). Auf der Basis dieser
Analyse wird auch die oben erwhnte Rolle
von Partikeln wie even bei der Bildung von
konzessiven Konnektiva verstndlich. Ist das
Antezedens eines Konditionalsatzes der Fo-
kus von even, so wird die entsprechende Be-
dingung von allen in Betracht gezogenen als
die unwahrscheinlichste, berraschendste und
extremste fr ein gegebenes Konsequens cha-
rakterisiert:
(35) The match will be on even if IT IS RAI-
NING.
Zu den skalaren additiven Partikeln gehren
im Englischen z. B. noch let alone, in parti-
cular, so much as und im Deutschen schon,
noch, gleich, insbesondere.
Eine der eben beschriebenen Unterschei-
dung zwischen also und even (auch vs. sogar/
selbst) hnliche lexikalische Differenzierung
im Bereich der restriktiven Partikeln wird u. a.
im Deutschen (nur vs. erst), Finnischen (vain
vs. vasta), Polnischen (tylko vs. dopiero) und
Serbo-Kroatischen (samo vs. tek) getroffen.
Auch hier sind die zuerst genannten Elemente
zwar mit einer Ordnung vereinbar, erfordern
sie aber nicht. Fr nur wird daher ebenso wie
fr only meist eine skalierende und eine quan-
tifizierende Lesart unterschieden (cf. Horn
1969; Altmann 1976: 106 ff). Erst und seine
Entsprechungen in den genannten Sprachen
induziert dagegen stets eine Ordnung. Diese
Ordnung ist meist, jedoch nicht unbedingt,
794 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
ken der gleichen Kategorie definiert, die ent-
sprechend ihres semantischen Gehaltes in eine
Ordnung gebracht werden knnen. Eine
Menge von Ausdrcken e
1
, e
2
, e
3
... e
n
konstituiert also dann eine lexikalische Skala,
wenn die folgenden Bedingungen erfllt sind:
(42)
a. Die Substitution von e
2
fr e
1
in
einem Satzrahmen S ergibt einen
wohlgeformten Satz.
b. S(e
1
) impliziert logisch S(e
2
),
S(e
2
) impliziert S(e
3
), usw.
Beispiele fr sprachliche Skalen sind in (43)
aufgefhrt:
(43)
a. alle, viele, einige, wenige
b. n, ... 3, 2, 1
c. hei, warm
Ein weiterer, wichtiger Beitrag zur Untersu-
chung skalarer Phnomene stammt von G.
Fauconnier (1975 a, 1975 b, 1979), der darauf
hinwies, da Superlative wie (44a) und
Pseudo-Superlative wie (44b) im Sinne eines
Allquantors gebraucht werden knnen:
(44)
a. Max can solve the most difficult pro-
blems.
b. A Rockefeller could not afford to buy
this.
Wenn man fr most difficult alternative Werte
einsetzt und dadurch den Schwierigkeitsgrad,
von dem die Rede ist, verringert, erhlt man
eine Skala von Werten (z. B. most difficult,
complex, simple, the simplest), die die unter
(42) genannten Bedingungen erfllt. Der ein-
zige Unterschied zu den in (43) aufgefhrten
Skalen besteht wohl darin, da die Ordnung
zwischen den einzelnen Werten nicht durch
logische Implikationen (entailment) determi-
niert ist. Fauconnier spricht von pragmati-
schen Implikationen, die aufgrund von An-
nahmen ber normale, typische Situationen,
rationales Verhalten, etc. gltig sind. So ist
z. B. der Schlu von (44 a) auf (45 a) und von
(45 a) auf (45 b) normalerweise zulssig:
(45)
a. Max can solve complex problems.
b. Max can solve easy problems.
Die in unserem Zusammenhang wohl wich-
tigste Beobachtung Fauconniers besteht
darin, da mit einem bestimmten Satzrahmen
(bzw. Propositionsschema) assoziierte Skalen
dann umgekehrt werden, wenn der entspre-
chende Satz in bestimmte Kontexte eingebet-
tet wird. Fr die von Fauconnier untersuch-
ten Skalen sind es die sog. negativen Polari-
ttskontexte (z. B. Negation, Interrogativ,
werden durch schon anscheinend tiefer lie-
gende Werte ausgeschlossen.
Die Frage nach der Rolle des Ko-textes im
Skopus einer Partikel fr die Ordnung inner-
halb einer Skala stellt sich schlielich auch
noch fr Stze mit nur. Die skalierende Lesart
von nur in Beispielen des Typs (40) lt sich
offensichtlich gut durch eine Analyse wieder-
geben, nach der hherrangige Werte als der
im Fokus genannte ausgeschlossen werden
(cf. Lerner & Zimmermann 1981, Foolen
1983, Van der Auwera 1983):
(40)
a. Max ist nur ein KLEINER ANGE-
STELLTER.
b. Max kaufte nur ZWEI Bcher.
c.
Nur ein MITTELMSSIGES Zeug-
nis ist fr diesen Beruf erforderlich.
Um auch Beispielen wie diesen gerecht zu
werden, knnte man die in (31b) gegebene
Beschreibung durch die Spezifizierung ergn-
zen, da die durch nur ausgeschlossenen Al-
ternativen einen hheren Rang als der Fo-
kuswert (skalierende Lesart) oder den glei-
chen Rang wie der Fokuswert (quantifizie-
rende Lesart) einnehmen:
(31) b. (x)
(x a) & (a x)
P(x)
Ebenso wie in den beiden vorher genannten
Fllen erweist sich diese Analyse jedoch als
problematisch, wenn wir einen anderen Typ
von Kontexten betrachten. In Beispielen wie
(41) sind es anscheinend Alternativen, die un-
terhalb des genannten Wertes auf der relevan-
ten Skala liegen, die durch nur ausgeschlossen
werden:
(41)
a. Nur ein WUNDER kann uns noch
retten.
b. Er nimmt nur HOCHBEGABTE
Schler an.
c. Nur ein GUTES Zeugnis reicht fr
diesen Beruf aus.
Die genannten Probleme und die Notwendig-
keit, fr erst, schon und nur Polysemie anneh-
men zu mssen, verschwinden, sobald man
die Rolle erkennt, die der Kontext im Skopus
einer Partikel bei der Ordnung der in Betracht
gezogenen Werte spielt. An dieser Stelle ist es
sinnvoll, kurz auf die Ergebnisse von Unter-
suchungen anderer skalarer Phnomene hin-
zuweisen. Horn (1972), Ducrot (1972, 1980a)
und Gazdar (1979) haben gezeigt, da die
Bedeutung und Verwendungsmglichkeiten
vieler Ausdrcke nur dann verstndlich ist,
wenn sie als Mitglieder von Skalen gesehen
werden. Eine sprachliche (lexikalische) Skala
wird in Horn (1972) und Gazdar (1979) als
eine Menge von kontrastierenden Ausdrk-
38. Gradpartikeln 795
plikationsbeziehungen deutlich machen:
(i) Eine Blume reicht aus. Eine Rose
reicht aus.
(ii) Eine Rose ist ntig. Eine Blume ist
ntig.
Die in (41) beobachtete Skalenumkehrung ist
somit wohl letztlich auf diese Eigenschaft der
betreffenden Kontexte zurckzufhren.)
Die bekannte Tatsache, da ein durch nur
eingeleiteter Konditionalsatz eine notwendige
Bedingung ausdrckt, erweist sich somit als
Spezialfall eines wesentlich generelleren Zu-
sammenhanges: Ein Satz, der eine ausrei-
chende Bedingung ausdrckt, bezeichnet
durch den Zusatz von nur eine notwendige
Bedinung, und umgekehrt:
(48)
a. Eine 2 gengt. (ausreichende Bedin-
gung)
b. Nur eine 2 gengt. (notwendige Be-
dingung)
c. Eine 2 ist erforderlich. (notwendige
Bedingung)
d. Nur eine 2 ist erforderlich. (ausrei-
chende Bedingung)
Im Falle von (39 a) erhlt man aufgrund des
in (47) formulierten Prinzips folgende Skala:
fnf
vier
((39) a.Ich habe drei Kapitel gelesen.
Die in (38 a) gegebene, sicher nicht vollstn-
dige Beschreibung von erst ist also dahinge-
hend zu ndern, da ebenso wie bei der ska-
lierenden Verwendung von nur die ausge-
schlossenen Werte hher einzustufen sind als
der Fokuswert (d. h. a < x).
(38) b. (x)
a<x
P(x)
Diese Parallelitt in der Beschreibung von nur
und erst wrde auch der Tatsache Rechnung
tragen, da diese Partikeln im Englischen,
Franzsischen, Ungarischen oder Spanischen
die gleiche Entsprechung haben knnen. Zu-
dem ist eine solche Beschreibung auch fr
Beispiele des Typs (37b) adquat, wo wir auf-
grund von (47) eine Skala erhalten, bei der
die ausgeschlossenen Alternativen hher ein-
zustufende Wert sind:
Unteroffizier
(37) b. Ein Leutnant wre ihr als
. Schwiegersohn recht.
Im Falle von (36b) liefert uns das in (47)
formulierte Prinzip allerdings kein Ergebnis,
durch das die revidierte Beschreibung der Be-
deutung von erst (d. h. 38b.) gerechtfertigt
Konditional, etc.), die diese Skalenumkeh-
rung bewirken. (Seit Ladusaw (1979) werden
diese Kontexte auch als abwrtsimplizierend
(downward-entailing) bezeichnet.) Wenn Satz
(44 a) negiert wird, dann nimmt der niedrigste
Wert der mit (44a) assoziierten Skala (i. e. the
simplest) in dem so vernderten Satzrahmen
den hchsten Rang ein und kann entspre-
chend wie ein Allquantor verwendet werden:
(46) Max cannot solve the simplest problems.
Von diesen Beobachtungen aus betrachtet, er-
scheinen die o. g. Probleme einer einheitlichen
Beschreibung von erst, schon oder nur in
einem neuen Licht. Durch Kontexte wie (39)
erfolgt in Stzen mit der Gradpartikel erst
offensichtlich eine Skalenumkehrung gegen-
ber der durch Kontexte wie (36 b, 37 b) be-
stimmten Skala. Das Gleiche gilt fr die Kon-
texte in (41), gegenber denen in (40), in St-
zen mit der Partikel nur. Das in (42 b) ge-
nannte Prinzip fr die Ordnung der zur De-
batte stehende Werte spielt offensichtlich
auch hier eine Rolle, allerdings in abge-
schwchter Form (cf. Jacobs 1983: 137):
(47) Ein Alternativwert a nimmt immer
dann einen hheren Rang auf einer
Skala ein als der genannte Fokuswert a
(d. h. a < a), wenn gilt:
S(a) impliziert S(a).
Aufgrund von (47) knnen wir z. B. fr (41c)
folgende Skala annehmen:
befriedigendes
(41) c. Ein gutes Zeugnis
reicht fr diesen Beruf aus.
Denn es gilt offensichtlich: Wenn ein befrie-
digendes Zeugnis ausreicht, dann reicht auch
ein gutes oder ein sehr gutes aus. Auch fr
die in (41) genannten Beispiele kann man
somit annehmen, da die durch nur ausge-
schlossenen alternativen Werte einen hheren
Rang auf der vom sprachlichen Kontext de-
terminierten Skala einnehmen als der ge-
nannte Fokuswert. Die in (31b) gegebene
Beschreibung trifft somit auf alle bisher be-
trachteten Flle zu. Die Skalenumkehrung in
Beispielen mit nur hngt offensichtlich mit
dem Wechsel von der Beschreibung ausrei-
chender zu der Beschreibung notwendiger Be-
dingungen zusammen. (Die in (41) aufgefhr-
ten Kontexte von nur bringen aber nicht nur
ausreichende Bedingungen zum Ausdruck,
sondern sind auch als downward entailing
im Sinne von Ladusaw (1979) bzw. als impli-
kationsumkehrend im Sinne von Fauconnier
(1979) zu bezeichnen, wie die folgenden Im-
796 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
Entsprechend der Analyse von F. und L.
Karttunen (1977; cf. auch Karttunen und Pe-
ters 1979) charakterisiert z. B. even den rela-
tiven Fokuswert stets als den unwahrschein-
lichsten, extremsten fr ein gegebenes Pro-
positionsschema. Die umgekehrte Bewertung
am wahrscheinlichsten knnte man der Par-
tikel let alone zuschreiben, in deren Fokus
hufig ein fr even relevanter Alternativwert
identifiziert wird:
(48) He did not even TALK TO ME, let
alone HELP ME.
Von den in diesem Fall in Betracht gezogenen
Werten ist sicherlich help me der wahr-
scheinlichere: Es ist eher erwartbar, da mir
jemand nicht hilft, als da er nicht mit mir
spricht.
Nicht immer lt sich jedoch einer Partikel
eine einheitliche und konkrete Bewertung fr
alle Verwendungsweisen zuordnen. Die Be-
wertung kann mit dem Typ des Fokus und
mit dem Typ des Skopus variieren. So drckt
z. B. Dt. gleich in Verbindung mit einem tem-
poralen Fokus die Bewertung frh, in Ver-
bindung mit einem nicht-temporalen Fokus
jedoch eine Bewertung aus, die man etwa als
weitgehend bezeichnen knnte:
(49)
a. Ich erledige das gleich MORGEN.
b. Er kaufte gleich VIER Zeitungen.
Im Falle von erst und schon knnen sich die
Bewertungen je nach Kontext sogar wider-
sprechen:
(50)
a. Er kam erst um acht Uhr. (spt)
b. Er kam schon um acht Uhr. (frh)
(51)
a. Es ist erst acht Uhr. (frh)
b. Es ist schon acht Uhr. (spt)
Die unterschiedlichen Bewertungen in diesen
Beispielen hngen offensichtlich mit dem o. g.
Phnomen der Skalenumkehrung sowie mit
der Tatsache zusammen, da durch die Par-
tikeln schon und erst einmal auf den genann-
ten Zeitpunkt folgende und einmal ihm vor-
ausgehende Zeitpunkte ein- bzw. ausgeschlos-
sen werden.
Daher scheint die Annahme sinnvoll, da
die einzelnen Partikeln nicht konkrete Bewer-
tungen wie frh, spt, oder am unwahr-
scheinlichsten sondern relative unspezifische
Bewertungen ausdrcken und da sich die
genannten konkreten Bewertungen als Resul-
tat einer Konkretisierung in bestimmten Kon-
texten ergeben. Fr die Partikeln even, selbst,
sogar oder gleich knnte man z. B. einfach die
Bewertung maximal postulieren. Fr ma-
wrde. Welche Prinzipien neben oder an Stelle
von (47) fr die Ordnung auf temporalen
Skalen eine Rolle spielen, mu allerdings hier
offen bleiben. (Vgl. dazu die berlegungen in
Lbner 1989.) Ebensowenig wie fr (36b)
kann man fr Beispiele des Typs (40a) eine
implikative Skala annehmen, es sei denn man
postuliert fr die entsprechenden Stze ohne
Gradpartikel die folgende Grundbedeutung:
Max ist mindestens ein kleiner Angestellter.
Ohne diese schwer zu rechtfertigende An-
nahme mu man wohl fr solche disjunkti-
ven Skalen, bei denen sich die Alternativen
gegenseitig ausschlieen, eine allgemeine, na-
trliche mehr/weniger Ordnung annehmen.
Zu den Parametern, die fr die Beschrei-
bung der Bedeutung von Gradpartikeln we-
sentlich sind, gehrt also auch der einer Ord-
nung. Einige Partikeln (Dt. selbst, erst, schon,
noch) induzieren stets eine Ordnung, andere
wie Dt. auch und nur sind mit einer solchen
Ordnung kompatibel ohne sie zu fordern und
wiederum andere (Dt. ausschlielich, allein,
einzig, gleichfalls, ebenfalls) werden stets
nicht-skalierend gebraucht. Fr die Festle-
gung der Reihung innerhalb einer Skala spielt
der Kontext, insoweit er im Skopus der Par-
tikel ist, eine wesentliche Rolle. Deutlich wird
dies vor allem an dem Phnomen der Skalen-
umkehrung. Welche Kontexte eine solche
Skalenumkehrung bewirken scheint aller-
dings von der gewhlten Partikel abzuhngen.
Eine einheitliche und elegante Beschreibung
von skalierenden und nicht-skalierenden Par-
tikeln, sowie von skalierenden und nicht-ska-
lierenden Verwendungen von Partikeln ist
dann mglich, wenn man Skalen als Funktio-
nen von den in Betracht gezogenen Werten in
die Menge der natrlichen Zahlen definiert
(cf. Jacobs 1983: 133 ff). Werden diese Funk-
tionen zudem noch als partielle Funktion auf-
gefat und die Skalen zu einem Parameter der
Interpretation gemacht, dann ergibt sich eine
besonders interessante Mglichkeit der oben
beschriebenen Kontextabhngigkeit in der
Auswahl von Alternativen Rechnung zu tra-
gen.
3.5Bewertungen
Eng verknpft mit dem der eben diskutierten
Parameter ist ein weiterer genereller Aspekt
der Bedeutung von Gradpartikeln. Alle Par-
tikeln, die eine Ordnung induzieren, drcken
auch eine Bewertung aus: Der im Fokus ge-
nannte Wert wird als hoch oder tief, als
viel oder wenig etc. in Relation zu den in
Betracht gezogenen Alternativen bewertet.
38. Gradpartikeln 797
(54)
a. Wenn nur FRITZ ENDLICH
KME, (q).
Die o. g. Tests zur Identifikation von Prsup-
positionen weisen alle Bewertungen, die von
Gradpartikeln signalisiert werden knnen, als
Prsuppositionen aus. Hufig ergeben sich
diese bewertenden Prsuppositionen mehr
oder weniger direkt aus den vorher beschrie-
benen additiven Prsuppositionen oder re-
striktiven Wahrheitsbedingungen. Wenn wie
bei Engl. even nur niederrangige Alternativen
eingeschlossen werden, dann ist der genannte
Wert natrlich maximal. Wenn, wie bei der
skalierenden Lesart von nur, hherrangige
Werte ausgeschlossen werden, mu der ge-
nannte Wert minimal sein. Nicht in allen
Fllen folgt jedoch die Bewertung aus solchen
additiven oder restriktiven Implikationen.
Im Falle von Dt. gleich oder wenigstens schei-
nen die erwhnten Bewertungen der einzige
Beitrag zu sein, den die genannten Partikeln
zur Bedeutung eines Satzes liefern. Ein sol-
cher rein evaluativer Gebrauch liegt z. B. auch
dann bei nur vor, wenn ein Determinator (Nu-
merale, Quantittsangabe) Fokus dieser Par-
tikel ist und ihr Skopus lediglich eine Phrase
(PP, NP) umfat (cf. Jacobs 1983: 69 ff):
(54)
b. McEnroe gewann gegen Lendl in nur
DREI Stzen.
Eine rein evaluative Verwendung mu man
wohl auch immer dann fr Dt. sogar anneh-
men, wenn diese Gradpartikel mit anderen
kombiniert wird (cf. sogar schon, sogar noch,
sogar nur, sogar erst etc.).
Auf der Grundlage dieser Annahme wird
auch der Unterschied in den Selektionseigen-
schaften von Dt. selbst und Engl. even einer-
seits und sogar andererseits erklrbar. Im Ge-
gensatz zu selbst und even kann sogar auch
einen Fokus (wie alle, beide, keiner) whlen,
der die Existenz von Alternativwerten fr ein
Propositionsschema ausschliet. (Es kamen
sogar ALLE. vs. *Even EVERYBODY came.)
Eine rein evaluative Bedeutung haben wohl
auch Dt. ausgerechnet, Ndl. uitgerekend und
Hebr. davka (cf. Ariel & Katriel 1977). Durch
diese Partikeln wird ein Wert als minimal
charakterisiert, wobei fr die Ordnung der in
Betracht gezogenen Werte die Eignung fr ein
Propositionsschema relevant zu sein scheint:
(55)
a. Ausgerechnet MORGEN kommt er
mich besuchen.
b. davka yosef kibel et haavoda.
Ausgerechnet J. bekam den Posten.
Die oben getroffene Unterscheidung zwischen
additiven und restriktiven Partikeln ist somit
ximal gilt dabei die bliche Definition (cf.
Wall 1972: 142 f):
(52) Ein Fokuswert a ist dann maximal auf
einer Skala = (M, <) (d. h. Max
(a, )), wenn keine der in Betracht ge-
zogenen Alternativen auf a folgt.
Analog ist ein Wert minimal, wenn er jedem
in Betracht gezogenen Alternativwert voraus-
geht. Eine solche Bezeichnung (Min (a, ))
scheint fr die Bewertungen angemessen, die
durch Partikeln wie Dt. wenigstens, nur, erst
und ihre Gegenstcke in anderen Sprachen
zum Ausdruck kommen:
(53)
a. Wenn er wenigstens EHRLICH wre.
b. Im letzten Jahr waren 2,5 Millionen
arbeitslos, in diesem Jahr sind es nur
2,1 Millionen.
Besonders interessant sind in diesem Zusam-
menhang Beispiele des Typs (53 b). Die Be-
wertung minimal gilt in Hinblick auf den im
Kontext genannten Alternativwert. Wenn,
wie in diesem Fall, auch noch ein Normal-
zustand als Alternative in Betracht gezogen
wird, ist die Bewertung des Fokuswertes als
minimal unangemessen. Die Tatsache, da
zwei verschiedene Mengen von Alternativen
eine Rolle spielen, wird dann durch Anfh-
rungszeichen zum Ausdruck gebracht. (Ein
anderer Vorschlag, die mit Gradpartikeln ver-
knpften Bewertungen zu explizieren ist in
Jacobs (1983: 135 ff) zu finden. Nach diesem
Vorschlag werden durch solche Partikeln und
die Stze in ihrem Skopus nicht nur Skalen,
sondern auch ein oberer und ein unterer
Grenzwert spezifiziert, die jeweils festlegen,
was fr eine Skala an einem Kontext als viel
oder als wenig gilt. Zusammen mit den Ska-
len werden diese Grenzwerte in Jacobs 1983
als Parameter der Interpretation aufgefat.
Die von Gradpartikeln signalisierten Bewer-
tungen nehmen nach Auffassung von Jacobs
auf diese Grenzwerte Bezug. So wird z. B.
durch sogar zum Ausdruck gebracht, da der
Fokuswert auf der relevanten Skala einen
Rang einnimmt, der grer oder gleich dem
oberen Grenzwert dieser Dimension ist.)
Die Annahme der Bewertung minimal fr
die restriktive Partikel nur macht auch die
Verwendung von elliptischen Konditionalst-
zen des Typs (3) zum Ausdruck bescheidener
Wnsche verstndlich: In diesen Stzen ist das
gesamte Antezedens des reduzierten Kondi-
tionalsatzes Fokus der Partikel und wird so-
mit als minimale, aber ausreichende Bedin-
gung fr ein zu ergnzendes Konsequens cha-
rakterisiert.
798 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
sentliche Rolle spielt:
(57)
FRD
1
reads only
2
SYNTACTIC
STRUCTURES
2
, even
1
.
In (57) kann die Endstellung der Partikel als
Indiz dafr angesehen werden, da sie mit
dem gesamten Satz in Konstruktion ist und
somit an einem hheren Knoten hngt als die
vorausgehende Gradpartikel only. Unter-
schiedliche strukturelle Konfigurationen kn-
nen insbesondere durch unterschiedliche In-
tonation, d. h. Einteilung eines Satzes in Ton-
gruppen (tonality im Sinne Hallidays 1966a)
gekennzeichnet sein: Der Einteilung des fol-
genden Satzes in ein oder zwei Tongruppen
(mit je einem Intonationsschwerpunkt) ent-
sprechen zwei unterschiedliche Skopusver-
hltnisse und somit zwei unterschiedliche In-
terpretationen (cf. Taglicht 1984: 147 ff):
(58)
a.
/Only PTER was here the whole
day./
b. only (x [x was here the whole day],
Peter)
(59)
a. /Only PETER was here/ the whole
day./
b. (only (x [x was here], Peter)) the
whole day
Fr Flle wie diese ist die Verallgemeinerung
mglich, da der Skopus der Partikel die glei-
che Ausdehnung hat wie die Tongruppe, die
diese Partikel enthlt.
(iii) Die Tatsache, da Engl. not ... either
durch Dt. auch nicht und Engl. not ... too
durch Dt. nicht auch (noch) zu bersetzen ist,
lt vermuten, da durch die beiden engli-
schen Ausdrcke ebenso wie durch ihre deut-
schen Entsprechungen lediglich ein Skopus-
unterschied zum Ausdruck gebracht wird und
da somit relativer Skopus auch durch lexi-
kalische Selektion angezeigt werden kann:
(60)a. Engl. I hope they did not lay off
PAUL, either.
b. Dt. Ich hoffe, da sie Paul auch
nicht entlassen haben.
(61)a. Engl. I hope they did not lay off
PAUL, too.
b. Dt. Ich hoffe, da sie Paul nicht
auch (noch) entlassen haben.
Die Reihenfolge von auch und nicht in den
deutschen bersetzungen zeigt eindeutig, da
die Gradpartikel im ersten Fall weiten und im
zweiten Fall engen Skopus bezglich der Ne-
gation hat. Analog knnte man auch either
als einen lexikalischen Indikator fr weiten
Skopus auffassen, der dann gewhlt werden
nicht auf Partikeln wie wenigstens, gleich, aus-
gerechnet sowie auf bestimmte Verwendungen
von sogar, nicht einmal oder nur anwendbar.
3.6Skopus
Da die Interpretation einer Gradpartikel,
d. h. ihr Beitrag zur Bedeutung eines Satzes,
nicht nur von ihrem Fokus, sondern auch von
ihrem Skopus (Bereich) abhngt, wurde be-
reits in 3.1 demonstriert. Der Ko-text im Sko-
pus einer Partikel spielt eine wesentliche Rolle
bei der Ordnung innerhalb der relevanten
Skala, sowie bei der Ausformulierung ihrer
Prsuppositionen oder Wahrheitsbedingun-
gen. Die Frage nach der Abgrenzung des Sko-
pus einer Partikel ist dann leicht zu beant-
worten, wenn wie in den meisten bisher
diskutierten Fllen die Partikel mit einem
einfachen Satz verknpft ist, der keine wei-
teren Bereichstrger (Adverbiale, Quantoren,
Negation, andere Gradpartikeln etc.) enthlt.
In komplexen Stzen wie (21)(22) oder
(1)(3) sowie einen weiteren Bereichstrger
enthalten, ist diese Frage jedoch keinesfalls
trivial. Hier stellt sich die Frage nach den
grammatischen oder lexikalischen Mitteln,
durch die der relative Skopus von zwei oder
mehr Operatoren angezeigt wird. Im Falle
von einfachen Stzen mit mehr als einem Be-
reichstrger spielen mehrere solche Mittel eine
Rolle:
(i) Im Deutschen, insbesondere im sog.
Mittelfeld eines deutschen Satzes, ist z. B. die
lineare Abfolge von zwei Operatoren ein ver-
llicher Indikator fr ihren relativen Skopus:
Eine Gradpartikel hat stets einen weiteren
Skopus als ein darauf folgender Bereichstr-
ger (cf. Jacobs 1983, 1984; Lerner und Ster-
nefeld 1984):
(56)
a. Sogar
1
FRITZ
1
hat nur
2
EIN
2
Buch
gelesen.
b. Nur GEDICHTE liest er sehr selten.
c. FRITZ kommt uch nicht mit.
(Den Vorschlag, Gradpartikeln mit ihrem Fo-
kus zu ko-indizieren, habe ich aus Jacobs
1984 bernommen.)
In allen diesen Beispielen ist der weiter
rechts stehende Operator (nur, sehr, selten,
nicht) im Skopus des erstgenannten. So pr-
supponiert (56c) z. B., da jemand anderes als
Fritz nicht mitkommt.
(ii) Beispiele wie die folgenden zeigen, da
der relative Skopus von Operatoren im Eng-
lischen nicht immer eindeutig durch die li-
neare Anordnung festgelegt wird, sondern
da auch die strukturelle Konfiguration zwi-
schen den relevanten Konstituenten eine we-
38. Gradpartikeln 799
Auch nur kann als Ergebnis einer historischen
Vernderung angesehen werden, durch die
zwei Partikel mit gleichem Fokus aber unter-
schiedlichem Skopus vor den gleichen Fokus
gerckt und zu einer komplexen Partikel
kombiniert wurden. Die folgenden englischen
Entsprechungen von (65) zeigen, da solche
Phnomene auch in anderen Sprachen zu be-
obachten sind (cf. auch Ndl. ook maar):
(66)
a. Even if you drink just A DROP of
alcohol, you will be fired.
b. If you drink even just A DROP of
alcohol, you will be fired.
Die Existenz von Gradpartikeln, die auf ne-
gative Polarittskontexte beschnkt sind und
weiten Skopus bezglich dieser Kontexte si-
gnalisieren, knnte man somit insgesamt als
Resultat von z. T. konfligierenden Anforde-
rungen an die Syntax dieser Elemente anse-
hen, sowohl den Fokus als auch den Skopus
klar zu markieren.
Gegen die eben skizzierte Analyse von auch
nur und einmal hat Jacobs (1983: 203 ff) starke
Einwnde geuert und diese Analyse insge-
samt verworfen. Ob der Skopus von Partikeln
auch durch lexikalische Selektion gekenn-
zeichnet werden kann, mu daher vorlufig
noch als offene Frage betrachtet werden.
Der Skopus einer Partikel kann nicht nur
durch den eines vorausgehenden oder kom-
mandierenden Operators, sondern auch
durch bestimmte hhere Knoten, insbeson-
dere durch einen S-Knoten begrenzt werden
(cf. (21)(22)). Der Skopus einer Partikel,
die Teil eines Nebensatzes ist, ist in den mei-
sten Fllen auf diesen Nebensatz beschrnkt,
whrend der Skopus einer Partikel im Haupt-
satz den gesamten komplexen Satz umfassen
kann.
(68)
a. Nur (Fritz hat gekndigt, weil er wei-
niger Geld bekommt).
b. Weil nur (Fritz weniger Geld be-
kommt), hat er gekndigt.
Auch in den folgenden Fllen scheint der Sko-
pus der Partikeln durch bestimmte Knoten
begrenzt zu werden:
(68)
a.
/Not even A YAR AGO / he ma-
naged to make a profit./
b. Ich kaufe das Brot fr nur 3 Mark.
c. /Only 100 dllars / would solve all
my prblems./
d. By internal contradictions alone, it is
a book patently full of half-truths.
Im Unterschied zu allen bisher diskutierten
Fllen mu man fr die in (68) aufgefhrten
mu, wenn wegen der fixierten Stellung der
Negation im Englischen eine Kennzeichnung
des Skopus durch lineare Abfolge bei gleich-
zeitiger Kennzeichnung des Fokus nicht mg-
lich ist. Eine analoge Analyse knnte man fr
die Paare -kin vs. kaan und jopa vs. edes im
Finnischen, aussi vs. non plus im Franzsi-
schen sowie fr sogar/selbst vs. auch nur,
(nicht) einmal im Deutschen ins Auge fassen.
Wie F. und L. Karttunen (1977) gezeigt
haben, lt sich fr Engl. even dann eine
einheitliche Analyse formulieren, wenn man
annimmt, da der Skopus dieser Partikel stets
auch einen vorausgehenden negativen Pola-
rittskontext (downward-entailing context)
umfat:
(62)
a. He did not even LOOK AT me.
b. even (P [he did not P me], look at)
Auch auf diese Flle pat die o. g. Analyse,
nach der der Fokuswert durch even stets als
der unwahrscheinlichste und somit berra-
schendste Kandidat fr ein Propositions-
schema charakterisiert wird. Analog knnte
man Dt. auch nur oder (nicht) einmal als se-
mantisch weitgehend quivalent mit selbst
und z. T. sogar analysieren und die zuerst
genannten Elemente vor allem als Indikatoren
fr weiten Skopus ansehen (cf. Knig 1981).
Die quivalenz zwischen Dt. auch nicht und
nicht einmal oder Ndl. zelfs niet und niet eens
in den folgenden Beispielen spricht durchaus
fr eine solche Analyse. In den beiden erst-
genannten Beispielen der folgenden Satzpaare
finden wir genau die Reihenfolge, die den
angenommenen Skopusverhltnissen entspre-
chen wrde:
(63)
a. Er hat auch nicht EIN WORT gesagt.
b. Er hat nicht einmal EIN WORT ge-
sagt.
(64)
a. Ik heb zelfs niet EEN pagina geschre-
ven.
b. Ik heb niet eens EEN pagina geschre-
ven.
I have not even written one page.
Ebenso spricht die quivalenz der beiden fol-
genden Stze fr die Annahme eines Supple-
tivverhltnisses zwischen sogar/selbst und
auch nur:
(65)
a. Auch wenn du nur EINEN TROP-
FEN Alkohol trinkst, wirst du ent-
lassen.
b. Wenn du auch nur EINEN TROP-
FEN Alkohol trinkst, wirst du ent-
lassen.
800 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
lassen sich alle diese Elemente in Stzen des
Typs (70) als Operatoren auffassen, die ber
eine (unstrukturierte) Proposition operieren,
also im Gegensatz zu Gradpartikeln nicht
struktursensitiv sind. Die Unterscheidung
zwischen Fokus und Skopus spielt also fr
die hier diskutierte Verwendung keine Rolle.
(Man knnte auch sagen, da in Fllen wie
(70e, f) der gesamte Restsatz Fokus der Par-
tikel ist und da der relevante Skopus aus
dem Kontext zu erschlieen ist.) Entspre-
chend der engen Beziehung, die zwischen der
Verwendung als Gradpartikel und der als
Satzadverb besteht, ist die semantische Be-
schreibung fr diese beiden Verwendungen
der in (71) aufgefhrten Elemente weitgehend
parallel zu formulieren. In der Verwendung
als aspektuelles Adverb oder Phasenquantor
(cf. Lbner 1989) impliziert noch z. B., da
eine weitere positive Phase einer prsuppo-
nierten Phase eines Vorganges oder Prozesses
folgt und prsupponiert zugleich eine darauf-
folgende negative Phase oder Grenze (cf.
Knig 1977; Lbner 1985c, 1989):
(72)
a. Wir suchen das Geld noch.
(= noch )
b.
t
,
t
,
t
Wenn die assertierte mittlere Phrase nicht teil
eines (homogenen) Zustandes oder Prozesses
ist, sondern ein Ereignis bezeichnet, dann
wird durch solche Stze nicht ein Andauern
eines Zustandes oder Prozesses vor einer Zu-
standsnderung ausgedrckt, sondern die
Kulmination einer Entwicklung in einem Er-
eignis (cf. Knig & Traugott 1982):
(73)
a. Du wirst dich noch erklten.
b. He may win yet.
Die Verwendung von noch als Gradpartikel
ist dieser Verwendung weitgehend parallel:
Der Fokuswert von noch wird als Grenzfall
fr das relevante Propositionsschema, zwi-
schen positiven Alternativen und dem Beginn
eines negativen Bereichs charakterisiert:
(74)
a. Noch der VIERTE blieb unter 47 Se-
kunden.
b. PAULS HALTUNG finde ich noch
ertrglich.
Ebenso ist die Bedeutung von nur in Stzen
des Typs (70 a) weitgehend der Bedeutung par-
allel, die oben fr die entsprechende Grad-
partikel formuliert wurde. Fr beide Verwen-
dungen von nur ist eine Komplementsbil-
dungsoperation charakteristisch: Die Grad-
partikel nur schliet das Komplement zu dem
genannten Wert bezglich einer in Betracht
Beispiele annehmen, da nur eine Phrase (PP
oder NP) im Skopus der Partikel ist. Beson-
ders deutlich wird dies, wenn wir diese Stze
mit entsprechenden Stzen vergleichen, in de-
nen der gesamte Satz im Skopus der Partikel
ist:
(69)
a. /Not even A YEAR ago did he ma-
nage to make a profit./
b. Ich kaufe das Brot nur fr 3 Mark.
c. /Only 100 dllars would solve all my
problems./
Welche syntaktischen Faktoren fr solche auf
Phrasen beschrnkte Skopusverhltnisse re-
levant sind, ist nicht im einzelnen geklrt. Ein
relevanter Faktor scheint zu sein, da ein
Determinator (Numerale, Quantittsangabe)
Fokus der Partikel ist (cf. Jacobs 1983: 69 ff).
Der semantische Effekt eines solchen auf
Phrasen beschrnkten Skopus ist eine rein
evaluative Bedeutung.
4. Andere Verwendungsweisen
4.1Satzadverbien
Viele der im zweiten Abschnitt aufgefhrten
Elemente werden nicht nur als Gradpartikeln
sondern auch als normale Adverbien verwen-
det. In Beispielen wie den folgenden sind die
relevanten Elemente unmittelbare Konsti-
tuente eines Satzes und manifestieren somit
syntaktische Eigenschaften, die Gradparti-
keln gewhnlich nicht haben.
(70)
a. Noch haben wir gengend Geld.
b. Gleich kommt ein Gewitter.
c. Gerade ist er vorbeigegangen.
d. Zumindest wissen wir jetzt Bescheid.
e. (Ich wrde ihn gern abholen.) Nur
kenne ich ihn nicht.
f. Auch habe ich wenig Zeit.
Unter den Elementen, die neben der bespro-
chenen Verwendung als Gradpartikel auch
diese Verwendung als Satzadverb manifestie-
ren, lassen sich zwei Gruppen unterscheiden:
(71)
a. noch, schon, gerade, eben, gleich, wie-
der, (zu)erst ...
b. auch, nur, allein, wenigstens, insbeson-
dere, zumindest, vor allem
Die Elemente der ersten Gruppe knnen in
der hier diskutierten Verwendung als tem-
porale oder aspektuelle Adverbien bezeich-
net werden, whrend die Mitglieder der zwei-
ten Gruppe als Konjunktionaladverbien
oder als Konjunktionen analysierbar sind (cf.
Altmann 1976: 248 ff, 1978: 59 ff). Semantisch
38. Gradpartikeln 801
sen oder Evidenz: ja, doch; Themawechsel:
eigentlich), die Kundgabe von Einstellungen
des Sprechers (negative Bewertung: etwa; Re-
signation: eben; berraschung: aber) sowie
der Versuch, gewisse Wirkungen beim Hrer
zu erzielen (Beruhigung: schon). Ganz allge-
mein gesprochen ist der Beitrag einer Modal-
partikel zur Bedeutung einer uerung noch
abstrakter, noch schwerer von einem be-
stimmten Kontext und Ko-text abtrennbar
wie der von Gradpartikeln. Aus diesem
Grund, sowie aufgrund der Tatsache, da
auch bei Verwendungen wie in (75) eine Ver-
bindung zu der vorher beschriebenen Verwen-
dung als Gradpartikel klar erkennbar ist, er-
scheint es sinnvoll, Modalpartikeln als Ergeb-
nis eines weiteren Ausbleichens (bleaching),
einer weiteren Entwicklung vom Konkreten
zum Abstrakten zu sehen (cf. Traugott 1980).
Der Charakter einer Aufforderung an den
Hrer, sich zu beruhigen, den ein Satz wie
(75 c) durch die Modalpartikel schon erhlt,
hngt sicherlich mit der Bedeutung der ent-
sprechenden Gradpartikel (bzw. des entspre-
chenden Adverbs) zusammen. Die verknp-
fende Wirkung der Modalpartikel auch hngt
sicherlich mit der additiven Bedeutung der
entsprechenden Gradpartikel zusammen, und
die besondere Bedeutung, die blo einer
uerung oder dem damit angesprochenen
Sachverhalt gibt, kann sicherlich mit der Ab-
sonderung und Auszeichnung in Zusammen-
hang gebracht werden, die restriktive Grad-
partikel in Bezug auf den Fokuswert gegen-
ber den Alternativen vornehmen.
hnlicher Bedeutungswandel von Grad-
partikeln ist auch in anderen Sprachen als
dem Deutschen anzutreffen. Im Englischen
z. B. knnen too und either als Indikatoren
fr Emphase oder Akte des Widersprechens
verwendet werden (cf. Green 1973: 245):
(77)
a. I am going to to the demonstration.
b. I am not ither in that class.
Einen analogen Gebrauch der Partikel mo
(auch, sogar) im Japanischen erwhnt Mar-
tin (1975: 68 f). Grammatiken in vielen Spra-
chen fhren darberhinaus expressis verbis
eine Klasse von Modalpartikeln auf.
5. Offene Probleme
Systematische und umfassende Analysen der
Syntax und Semantik von Gradpartikeln in
einer oder mehreren Sprachen sind bis heute
eine Seltenheit geblieben. Die zahlreichen Un-
tersuchungen einzelner Partikeln der spten
sechziger und siebziger Jahre dienten vor al-
gezogenen Menge als Werte fr ein Proposi-
tionsschema aus. Durch die Konjunktion
nur wird eine Menge von relevanten Argu-
menten in zwei komplementre Bereiche auf-
geteilt. Das in dem Satz mit nur genannte
Argument fhrt dabei zu dem entgegenge-
setzten Schlu als die kontextuell gegebenen
Argumente des Komplementrbereichs. In
der Verwendung als Konjunktionaladverb
ist nur somit der Konjunktion aber weitge-
hend quivalent. Die Tatsache, da Dt. nur
und aber in vielen Sprachen die gleiche Ent-
sprechung haben, ist somit nicht berra-
schend.
4.2Modalpartikeln
Einige der im ersten Abschnitt aufgefhrten
Elemente haben auch eine Verwendungsweise,
in der sie meist zu den Modal- oder Abt-
nungspartikeln gerechnet werden:
(75)
a. Kannst du mir auch folgen?
b. Er kann eben mehr als du.
c. Wir finden das Geld schon.
d. Ruf ihn blo an.
Auch fr diese Verwendungsweise ist charak-
teristisch, da die Partikeln keinen Fokus
haben. Mit den bisher entwickelten Parame-
tern ist diese Verwendungsweise allerdings
nicht beschreibbar. Partikeln wie die in (75)
werden daher gewhnlich zusammen mit be-
stimmten (Verwendungen von) Adverbien
(vielleicht, doch, wohl, mal, einfach, eigentlich),
Konjunktionen (aber, denn) und einigen an-
deren Ausdrcken (ja, etwa) zur Klasse der
Modal- oder Abtnungspartikeln zusammen-
gefat. Die Eigenschaften, die fr diese Klasse
als konstituiv angegeben werden (cf. Weydt
1969), sind im wesentlichen negativ gefat:
(76) Modalpartikeln
(i) kommen nicht am Satzanfang vor
(ii) knnen nicht betont werden
(iii) knnen nicht erfragt werden
(iv) haben keine Flexion
(v) beziehen sich auf den gesamten Satz
In den meisten Untersuchungen zur Bedeu-
tung und Verwendung von Modalpartikeln
(cf. Franck 1980; Weydt 1979, 1981, 1983)
werden fr jede Partikel mehrere Bedeutun-
gen angenommen, nach deren gemeinsamen
Nennern oder Beziehungen zur Bedeutung
der entsprechenden Gradpartikel oft nicht ge-
fragt wird. Als generelle Eigenschaft der Be-
deutung lassen sich etwa angeben: die Struk-
turierung von Gesprchen (Verknpfung von
uerungen: auch, denn; Verweis auf Vorwis-
802 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
den Aspekten der Bedeutung sich bei restrik-
tiven Partikeln genau umkehrt (cf. 3.2). Diese
Tatsache knnte jedoch auch als Argument
fr diese Unterscheidung angesehen werden.
Der Negationstest weist auf einen grundle-
genden Unterschied zwischen additiven und
restriktiven Partikeln hin: Stze mit restrik-
tiven Partikeln sind mhelos negierbar, wh-
rend dies fr die entsprechenden Stze mit
additiven Gradpartikeln nicht gilt:
(79)
a. Nicht nur Fritz kommt.
b. Nicht erst heute waren diese Fehler
erkennbar.
c. ?Nicht auch Fritz kommt.
d. ?Nicht selbst Fritz ist zufrieden.
Wenn wie bisher angenommen die ad-
ditiven Gradpartikeln keinen Beitrag zu den
Wahrheitsbedingungen eines Satzes liefern,
wird verstndlich, warum Stze wie (79cd)
nicht geuert werden: Will man entsprechen-
den Behauptungen entgegentreten, so wird
man die Gradpartikel weglassen, da ihre Ver-
wendung in Stzen wie (79cd) vllig irre-
levant ist. In den vorangegangenen Ausfh-
rungen wurde mehrfach auf Gemeinsamkei-
ten zwischen Gradpartikeln und Quantoren
hingewiesen. Daher wre es naheliegend, die
semantischen Eigenschaften von Gradparti-
keln auch auf die verallgemeinerte Quanto-
rentheorie von Barwise und Cooper (1981)
und auf die dort entwickelte Begrifflichkeit
(z. B. Monotonie, Dualitt) zu beziehen. So
knnte man z. B. die additiven Partikeln als
monoton steigende Quantoren bezeichnen
(bzw. als Ausdrcke, die mit ihrem Fokus
solche Quantoren bilden), whrend restriktive
Partikeln die Eigenschaft der Monotonie
nicht haben. Andererseits scheint die An-
nahme berechtigt, da zwischen gewissen Par-
tikeln, z. B. zwischen auch und nur, ein duales
Verhltnis besteht (d. h. auch ( a, P)
nur (a, P)). Auch hier gibt es noch eine
Reihe offener Fragen, zu deren Beantwortung
Lbner (1985c) einige interessante Vorschlge
gemacht hat. Zu den offenen Problemen einer
adquaten Theorie der Bedeutung von Grad-
partikeln gehrt schlielich auch die Frage
nach den Bedingungen fr eine rein evaluative
Verwendung von Gradpartikeln, sowie die
Frage ihrer przisen Beschreibung.
Auf der deskriptiven Seite soll abschlie-
end das Problem einer adquaten Beschrei-
bung von Partikeln wie Dt. eben, ausgerech-
net, genau und gerade genannt werden (cf.
Altmann 1978; Jacobs 1983: 240). Bei diesen
Partikeln scheint es nicht so sehr um den
Einschlu oder Ausschlu von Alternativen
lem dem Nachweis der Existenz von Prsup-
positionen und anderen Aspekten pragmati-
scher Bedeutung. Entsprechend gro ist die
Zahl der offenen Probleme in diesem Bereich.
Zu diesen offenen Problemen gehrt selbst
die Frage nach dem Sinn der Unterscheidung,
deren Notwendigkeit oft mit Gradpartikeln
demonstriert worden ist: der Unterscheidung
zwischen Wahrheitsbedingungen (Assertion
oder log. Implikationen) und Prsuppositio-
nen, d. h. solchen Propositionen, die der Spre-
cher bereits fr einen Teil des Redehinter-
grundes hlt oder die seiner Meinung nach
vom Hrer widerspruchslos diesem Redehin-
tergrund hinzugefgt werden (cf. Soames
1982, siehe auch Art. 13). Der hier nach dem
Vorschlag von L. Karttunen und S. Peters
(1979) vertretenen Auffassung einer mehr-
gleisigen Semantik stehen Theorien gegen-
ber, nach denen Prsuppositionen letztlich
auf log. Implikationen (z. B. ordered entail-
ments, cf. Sperber & Wilson 1979) oder auf
konversationelle Implikaturen la Grice zu
reduzieren sind. Die oben getroffene Unter-
scheidung zwischen Wahrheitsbedingungen
(log. Implikationen) und Prsuppositionen
fhrt insbesondere dann zu Schwierigkeiten,
wenn Ko-referenz von Indefinita in Prsup-
positionen und eigentlicher Aussage herge-
stellt werden soll (cf. Jacobs 1983: 220 ff),
ebenso wie bei Stzen mit mehreren Grad-
partikeln. So ist z. B. aufgrund der bisherigen
Ausfhrungen eine befriedigende Analyse von
Stzen wie den folgenden nicht mglich:
(78)
a. Nur Fritz verehrt nur Maria.
b. Nur Fritz spricht auch Spanisch.
Ducrot (1972: 152 ff) hat fr die franzsischen
Entsprechungen von Dt. nur Interpretations-
regeln vorgeschlagen, nach denen dem Satz
(78a) folgende Wahrheitsbedingungen und
Prsuppositionen zugewiesen werden:
(78)
c. (x)
xF
[(x verehrt M) & (y)
y M
(x verehrt y)]
d. (F verehrt M) & (y)
yM
(F ver-
ehrt y) & (x)
xF
(x verehrt M)
Inwieweit sich diese Analyse fr alle Daten
dieses Typs verallgemeinern lt und inwie-
weit sie relevanten Intuitionen entspricht, ist
jedoch nicht vllig klar.
Als problematisch fr die oben getroffene
Unterscheidung zwischen eigentlicher Aus-
sage (Wahrheitsbedingungen) und Prsuppo-
sitionen knnte man auch die Tatsache an-
sehen, da das bei additiven Gradpartikeln
angetroffene Verhltnis zwischen diesen bei-
38. Gradpartikeln 803
kuswert, sondern auf alternative Eigenschaf-
ten eines gegebenen Fokuswertes Bezug neh-
men:
(82)
a. even (a, P)
b. (P)
pp
(a, P)
Dieser Beitrag ist whrend eines Aufenthaltes am
Netherland Institute for Advanced Study
(N. I. A. S.)
in Wassenaar entstanden. Ich mchte an dieser
Stelle all denjenigen danken, die dazu beigetragen
haben, diesen Aufenthalt angenehm und erfolgreich
zu gestalten. S. Lbner danke ich fr Kritik an
einer frheren Fassung des Beitrages.
6. Literatur (in Kurzform)
Altmann 1976 Altmann 1978 Anderson 1972
Ariel/Katriel 1977 van der Auwera 1983 Bar-
wise/Cooper 1981 Bennett 1982 Blakemore
1987 Braue 1983b Coyaud/Hamou 1976
Cresswell 1973 Ducrot 1972 Ducrot 1980a Ed-
mondson/Plank 1978 Fauconnier 1975a Fau-
connier 1975b Fauconnier 1979 Fillmore/Kay/
OConnor 1988 Foolen 1983 Franck 1980 Fra-
ser 1971 Gazdar 1979 Green 1973 Halliday
1966a Hirschberg 1990 Horn 1969 Horn 1972
Jacobs 1983 Jacobs 1984 Karttunen/Karttunen
1976 Karttunen/Karttunen 1977 Karttunen/Pe-
ters 1979 Kay 1990 Kempson 1975 Knig
1977 Knig 1979 Knig 1981 Knig 1982
Knig 1985b Knig (im Druck) Knig/Traugott
1982 Ladusaw 1979 Lerner/Zimmermann 1981
Lerner/Sternefeld 1984 Levinson 1983 Lewis
1967 Lbner 1985c Lbner 1989 Mackie 1973
Martin 1975 McCawley 1970 McCawley 1981
Plank 1979 Quine, v. Orman 1962 Quirk et al.
1972 Ross/Cooper 1979 Soames 1982 Stalna-
ker 1975 von Stechow 1982a Taglicht 1984 Wall
1972 Weydt 1969 Weydt (ed.) 1978 Weydt (ed.)
1983 Wilson/Sperber 1979
Ekkehard Knig, Berlin
(Bundesrepublik Deutschland)
zu einem Fokuswert, um ihre Ordnung und
Bewertung zu gehen, sondern um die Rolle
ein- und desselben Argumentes in verschie-
denen Propositionen. Ein wesentliches Ele-
ment der Bedeutung dieser Partikeln besteht
in der emphatischen Assertion von Identitt
zweier Argumente in zwei verschiedenen Pro-
positionen. Aufgrund allgemeiner Maximen
der Konversation erfolgt eine solche empha-
tische Assertion von Identitt besonders
dann, wenn die beiden Propositionen nor-
malerweise nicht kompatibel sind:
(80)
a. In der 80. Minute wurde Rahn ein-
gewechselt. Eben dieser Rahn scho
das entscheidende Tor.
b. Nur Fritz hatte nicht getrunken, und
ausgerechnet er wurde von der Polizei
angehalten.
c. Es ist allgemein bekannt, da der
Keim fr den Sturz des Schahs gerade
in der Erscheinung angelegt war, von
der er zu glauben schien, da sie ihn
retten wrde.
Die adversative oder konzessive Qualitt,
die diese Partikel aufgrund des Kontexts des-
halb oft haben, kann wie bei Engl. even Teil
der Partikelbedeutung selbst werden. In der
Verbindung even as, ebenso wie im Frhneu-
englischen allgemein, wird durch diese Parti-
kel lediglich Identitt betont:
(81)
a. What you will have it named, even
that it is.
(Shakespeare, Shrew III.IV)
b. Even as it admits a serious pollution
problem, East Germany is substitu-
ting cheap brown coal for imported
oil.
Die heutige Bedeutung von Engl. even kann
als Ergebnis eines semantischen Wandels be-
trachtet werden, durch den konversationelle
Implikaturen Teil der konventionellen Bedeu-
tung der Partikel wurden.
Fr Partikeln dieser Art knnte man daher
existentielle Prsuppositionen formulieren,
die allerdings nicht auf Alternativen zum Fo-
804 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
39. Current Issues in the Theory of Focus
2.1Some Phenomena
In this section we give some examples of what
counts as focussed constituents in the litera-
ture.
2.1.1Wh-Questions
Paul (1880
8
: 283) notices that the sentence
(1) Karl fhrt morgen nach Berlin
Karl goes (by wheel) to Berlin tomor-
row
may be used to answer different questions,
having its intonation center on different con-
stituents in each case:
(2)
a. Wohin fhrt Karl morgen?
where
Karl fhrt morgen nach Berlin.
to Berlin
b. Wann fhrt Karl nach Berlin?
when
Karl fhrt morgen nach Berlin.
tomorrow
c. Wie reist Karl morgen nach Berlin?
how
Karl fhrt morgen nach Berlin.
drives
d. Wer fhrt morgen nach Berlin?
who
Karl fhrt morgen nach Berlin.
Karl
Paul says that each of the answers has a
different psychological predicate, viz., nach
Berlin, morgen, fhrt and Karl. In these ex-
amples the Wh-pronoun determines for each
case what the psychological predicate is. The
non-focussed part of the sentence is the psy-
chological subject. A reconstruction of this
view will be discussed in section 3.5.2.
Today, most linguists would call Pauls psy-
chological predicates foci, and we will use this
term henceforth. Clearly, it is the Wh-ques-
tion that determines the focus in these sen-
tences. In many cases, there is no obvious
triggering linguistic context. In such cases, we
speak of out of the blue utterances.
(3) Die Sonne scheint. Und Otto geigt mal
wieder.
The sun is shining. And Otto is playing
the violin.
As can be seen from these examples, it de-
pends on the semantics of the verbs involved
whether the focus is realized in the subject
constituent or in the predicate phrase (vide
1. Introduction
2. Background
2.1 Some Phenomena
2.2 Some Analytical Tools
3. Logical Form and Interpretation
3.1 Movement Theories
3.2 Rooths In Situ Theory
3.3 Structured Meaning Theories
3.4 Contextual Restrictions for Alternatives
3.5 Interpreting Free Focus
4. Short Bibliography
1. Introduction
The organization of this article is as follows.
First we discuss some phenomena which have
been treated under the heading focus in the
literature. At this point the relevant theoret-
ical distinctions are introduced: focus, focus
domain, scope and association with focus.
The second part of the article is concerned
with the syntax and semantics of focus. It
concentrates on focussing particles, in partic-
ular only.
Some effort is spent on the question how
meaning is determined by syntax. In contra-
distinction to article 7 Syntax und Seman-
tik, the framework chosen is close to the so-
called Government and Binding theory of
Chomsky (1981). The present article treats
the relation between syntax and semantics
from a rather different perspective and can
therefore be regarded as a supplement to ar-
ticle 7 as far as the syntax-semantics interface
is concerned.
The interpretation of the so-called free fo-
cus is discussed in the last two sections. Cer-
tain phenomena that are treated in detail in
article 41 The Representation of Focus are
only briefly mentioned.
2. Background
The category focus is notoriously obscure,
and we will not try to do justice to the many
usages that survive in the literature. In this
article we mainly consider cases of focus that
have an impact on the truth-conditions of a
sentence. For the time being it suffices to say
that a focussed constituent contains an into-
national center, in German and English, gen-
erally a falling pitch accent. In section 3.2, we
will see that even this rough characterization
is doubtful in some cases.
39. Current Issues in the Theory of Focus 805
Linguists say that the foci associated with only
are different in these cases. In (7a) and (7b),
the focus associated with only is German; in
(7c), it is speaks. The notion of associated
focus will be made more precise below. (7b)
means the same as (7a), viz., that Helmut
speaks no other language than German. (7c),
however, has a different meaning, viz., that
Helmut stands in no other mastering relation
to German than speaking it. He cant write
or read German, for instance.
Another focussing particle that has occu-
pied a number of linguists is even (Horn 1969
and 1972). Karttunen & Peters (1979) discuss
the following example:
(8)
a. It is hard for me to believe that John
can understand even Syntactic Struc-
tures
b. Ich kann kaum glauben, da Hans so-
gar die Syntactic Structures verstehen
kann
c. Ich kann kaum glauben, da Hans
auch nur die Syntactic Structures ver-
stehen kann
The German paraphrases disambiguate the
two readings, which (8a) has: The paraphrase
(8b) suggests that Syntactic Structures is dif-
ficult to understand, whereas (8c) implicates
that Syntactic Structures is easy to under-
stand. Karttunen & Peters explain the differ-
ence by a difference of scope of the nominal
even Syntactic Structures. This raises the ques-
tion why we do not have scope ambiguity in
German. We will return to this issue.
Other focussing particles of German are:
allein, lediglich, erst, kaum, sogar, selbst, nicht,
auch nur and nicht sondern, Dutch: alleen,
ook maar, schlechts. Let us consider the Ger-
man negation nicht.
(9)
a. Paula wohnt nicht in Paris
b. Paula wohnt nicht in Paris
c. Paula wohnt nicht in Paris.
d. Paula (/) wohnt nicht (\) in Paris.
Paula does not live in Paris
The truth-conditions of these sentences are
always the same, viz. that Paula does not live
in Paris. The presuppositions in the sense
of Jackendoff (1972) and Chomsky (1971),
however, differ. For an analysis of these cases,
see Jackendoff (1972), Stechow (1981b), Ja-
cobs (1983), Lbner (1990) and article 40.
2.1.4Counterfactuals
Dretske (1972) has observed that difference
of focus has an impact on the truth-condi-
tions of counterfactuals. His examples are of
the following kind:
Allerton & Cruttenden 1979, Fry 1989). As
to the relation between free focus and word
order, see Contreras (1976) and Hhle
(1982a).
2.1.2Focus Positions
We start with cleft-sentences. (We do not dis-
tinguish between cleft and pseudo-cleft.)
The examples are taken from Paul (1880
8
:
285):
(4)
a. Christen sind es, die es getan haben
b. t is thou that robbst me of my lord
c. Cest a vous que je madresse, mon cher
Monsieur
In these sentences, the clefted constituent is a
focus. This, however, is not always so as the
following sentence shows:
(5) Es war die jngste Tochter, die das Testa-
ment geflscht hat
It was the youngest daughter that falsified
the last will
Here, die jngste Tochter is not a focus, but
the adjective jngste is one. Thus, the correct
generalization seems to be that the clefted
part always contains a focus. I am indebted
to J. Jacobs for this observation.
Hungarian has a special focus position for
every sentence. It is in front of the main verb.
The examples were presented in a talk by E.
K. Kiss given in Konstanz in 1989. The struc-
tures are slightly more elaborated than those
found in Kiss (1987).
(6)
a. [
IP
Janos
1
[
VP
tegnap
2
[v ovasta el
Chomsky cikket t
1
t
2
]
John yesterday read perf Chomskys
paper-acc
As for John, it was yesterday that he
read Chomskys paper
b. [
IP
Janos
1
tegnap
2
[
VP
Chomsky cikket
3
[v ovasta el t
3
t
1
t
2
]
It was Chomskys paper that John
read yesterday
c. [
IP
tegnap
2
[
VP
Janos
1
[v ovasta el
Chomsky cikket t
1
t
2
]
Yesterday it was John who read
Chomskys paper
The details of the Hungarian sentence struc-
ture are still under dispute. For a different
analysis, vide Horvath (1981).
2.1.3Focussing Particles
Look at this list:
(7)
a. Helmut speaks only German
b. Helmut only speaks German
c. Helmut only speaks German
806 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
might be more perspicuous to distinguish be-
tween the F-feature and its phonetic realiza-
tion, i. e., the pitch accent. The reason is that
structure (12) suggests that there is more than
one focus in the sentence. This, however, is
not intended. If, for instance, the focus do-
main is the entire VP, then there is no other
focus in the VP, although the F-feature is
realized as a pitch accent on shirt. Therefore,
it is not appropriate to conceive of the F-
pitch accent relation as a percolation mech-
anism and we should perhaps not speak of
focus projection (vide von Stechow &
Uhmann 1986).
For the following discussion, we simply
assume the existence of a mechanism that
provides certain constituents with the focus
feature F, which is realized within the con-
stituent according to phonological rules. A
focus is therefore a constituent with the F-
feature.
2.2.2Scope and Association With Focus
Consider the structure
(14) John [
VP
only [
VP
invited Sue]]
The particle only is an operator whose scope
is the VP it is adjoined to, i. e., invited Sue,
whereas its focus is the object of the VP, i. e.
Sue. It is important to not confuse the notions
scope and focus of a particle. We introduce
the following terminology:
The scope of a particle is its c-command
domain (vide article 23), i. e., what is domi-
nated by the next higher node and what is
not dominated by the particle itself.
In most cases, the scope of a particle will
coincide with the maximal category it is ad-
joined to. There are, however, some problem-
atic cases. For instance, only cant be associ-
ated with the subject, if it follows it, but even
can, as has been observed in Jackendoff
(1972):
(15)
a. John even gave his daughter a new
bicycle.
b. ?John only gave his daughter a new
bicycle.
The contrast shows that even can have scope
over the subject, whereas only cant. It is not
quite clear how the difference could be ex-
plained. For the time being, let us assume
structures like the following:
(16)
a. [
IP
John [
I
even [
I
INFL [
VP
give his
daughter a new bicycle]]]]
b. [
IP
John [
I
INFL [
VP
only [
VP
give his
daughter a new bicycle]]]]
(10)
a. If Clyde hadnt married Bertha, he
would not have qualified for the in-
heritance.
b. If Clyde hadnt married Bertha, he
would not have qualified for the in-
heritance.
The first sentence suggests that there is a law
You inherit only if you marry Bertha in the
background, whereas the second sentence
rather refers to a law like You only inherit,
if you marry. Since counterfactuals are eval-
uated with respect to a background, the two
mean something different (vide article 30).
2.2Some Analytical Tools
2.2.1Focus Domains
Let us reconsider example (10a). The into-
nation of what we have called the focus
roughly is this:
(11) H* + L
Karl fhrt morgen [
F
nach Berlin]
In other words, we have a falling tone here
indicated by the association of a high and a
low tone on the last syllable. The pitch
accent H* + L is the phonetic realization of
the focus. It is, however, not just the syllable
in which is the intended focus of the utter-
ance, it rather is the entire PP nach Berlin. If
we think of the pitch accent as a realization
of an abstract focus feature F, then there must
be laws that allow us to project F to the
entire constituent. The rules underlying this
process are the rules of focus projection and
the highest node having the F-feature is the
focus domain.
The phenomenon was discussed first (?) in
Chomsky (1971). He considers the following
example:
(12)
He was [
F
warned [
F
to look out for
[
F
an [
F
exconvict [
F
with [
F
a red shirt]]]]]]
In this case, each of the F-labelled constitu-
ents may count as the focus that is realized
phonetically on shirt. F may be projected till
the highest VP.
In order to realize that there are restrictions
for focus projection, let us stress red instead
of shirt.
(13) He was warned to look for an exconvict
with a red shirt
Here, no F-projection is possible. Only red
can be a focus. The exact nature of the rele-
vant rules for F-projection is not important
here (vide Selkirk 1984). Furthermore, it
39. Current Issues in the Theory of Focus 807
The indices express that the focus jngste
youngest is associated both with nur only
and sogar even. The content of the sentence
(without because) is the proposition that
Gerd knows only the youngest sister of Luise,
and the conventional implicature (vide Kart-
tunen & Peters (1979) and article 40) is that
it is more likely that he knows the elder sisters
of Luise. If this is correct a question to
which we return in section 3.3 then the
association relation has to be expressed by
means of indices.
Another point worth mentioning is this. In
the example (21), the constituent to Sue is a
focus, but the constituent [only [
F
to Sue]] is
not a focus. Focussed constituents have the
F-feature, but the only-PP doesnt have it.
Only-NPs are generalized quantifiers and
must be moved in LF. They contain a focus
associated with only without being foci them-
selves. We come back to this point when we
discuss the theory of focus movement.
Let us briefly go into the question to which
constituents a focussing particle may be at-
tached to. There is no general answer. Differ-
ent particles have different distributions. Vide
Altmann (1976) and Jacobs (1983) for Ger-
man particles. Particles like even and only
seem to be able to modify almost any major
constituent, with the difference noted above:
(23) a. only three girls NP
b. only to Sue PP
c. only a bit sick AP
d. only introduced Bill to Sue VP
e. only that Bill was sick CP
There are restrictions, however. For instance,
only-NPs are bad as arguments of preposi-
tions or nouns, as the following data taken
from Rooth (1985: 93) show:
(24)
a. ?At the party, John spoke to only
Mary
b. *The library is closed on only Sunday
c. *The entrance to only the Santa
Monica freeway was blocked of
Altmann (1978) and Bayer (1990) have ob-
served another restriction in distribution: Par-
ticle-CPs cannot be extraposed, as compara-
tive evidence from German shows:
(25)
a. Nur [
F
da der Kanzler zu dick sei]
hat Hans gesagt
Only that the chancellor too fat is has
Hans said
This is in agreement with Jackendoffs claim
that even is in AUX, whereas only is in the
VP. Given these analyses, even can c-com-
mand the subject, and only cannot c-com-
mand it. Note that even cant be a postposi-
tion of the subject, because it can have a focus
also in the VP:
(17) John even gave his daughter a new bi-
cycle
Let us next introduce the notion of focus
association. Every focussing particle must
have at least one focus associated in its scope.
If a particle is associated with different foci,
the result will be a difference in meaning, in
the general case. To illustrate the point, con-
sider the following pattern:
(18)
a. John only [
VP
introduced [
F
Bill] to
Sue]]
b. John only [
VP
introduced Bill [
F
to
Sue]]
(18a) means that the only person introduced
by John to Sue is Bill, (18b) means that Sue
is the only person which was introduced to
Bill by John.
There might be association with more than
one focus. Anderson (1972) gives the example
(19) Jones claimed that he could sell refrig-
erators to the Eskimos, but in fact he
couldnt even sell whiskey to the Indians.
The same point can be made with only (vide
Rooth 1985):
(20) John only introduced Bill to Sue.
Clearly, the latter means something different
from the sentences (18a) and (18b). It may be
paraphrased as John introduced no other
persons to each other than Bill to Sue. We
still get another meaning, if we have two
only-NPs in the VP:
(21) John introduced only Bill only to Sue.
This means that the only person such that
John introduced her to no other person than
Sue is Bill.
There is agreement in the literature that
more than one focus may be associated with
the same operator. We may ask then whether
one focus may be associated with more than
one operator. Jacobs (1983) has claimed that,
in some cases, this must be so. On page 81,
he gives the example:
(22) weil Gerd sogar
1
nur
2
die [
F1,2
jngste]
Schwester von Luise kennt
because Gerd even only the youngest
sister of Luise knows
because Gerd even knows only the
youngest sister of Luise
808 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
worlds and that properties are functions from
individuals to propositions. As for the
lambda-notation, vide article 8. In our rules,
the -operator belongs to the metalanguage,
of course.
As it stands, the analysis is presumably too
simple. A more refined account can be found
in Jacobs (1983, chapter 4.1.1).
The insight that we have to distinguish
between the content and the implicature or
presupposition of only goes back to Horn
(1969). In the following, we will not distin-
guish between the notions implicature and
presupposition. The reason is that, in the
influential article Karttunen & Peters (1979),
the second dimension of the meaning of only
is referred to as implicature. For the distinc-
tion of the two notions, see articles 13 and
14.
The idea is that Only Mary came has the
content that no other person than Mary came
whereas it presupposes/implicates that Mary
came.
In order to distinguish the two levels of
meaning, we assume two interpretation func-
tions and
i
, where the first gives the
content and the second gives the implicatures/
presuppositions of an expression. This prac-
tice follows Karttunen & Peters (1979).
Let us now consider the structure
(29) [
IP
John [
VP
invited [
NP
only Sue]]]
The standard semantics of the rules that build
up the structure is the following:
(30)
a. [
IP
[
NP
] [
VP
]] =
[
VP
] ([
NP
])
b. [
VP
[
Vtr
][
NP
]] =
a [
Vtr
] (a, [
NP
]),
where [
NP
] is an individual.
Let us suppose that invited is a two place
property between individuals, i. e. the function
a,b {w: a invited b in w}. We further
assume that John and Sue are individu-
als. It follows that the VP invited only Sue
cant be evaluated, because only Sue is not
an individual but a set containing a singleton
set of individuals. In order to resolve the
conflict of types, May (1977) has introduced
the rule of quantifier raising (QR). Equiva-
lently we could use Montagues (1974) rule
of Quantifying in (vide article 7). We assume
the following version of QR:
(31) : Adjoin NP to a dominating IP,
leave a variable x at the original
place (the trace) and adjoin x to
IP.
b. *Hans hat gesagt, nur [
F
da der
Kanzler zu dick sei]
Hans has said, only that the chancel-
lor too fat is
Jacobs (1983) claims that all German sen-
tences are V-projections and that nur can
modify any of them. This would account for
the distributional pattern under the assump-
tion that finite verb second clauses are V-
projections whereas da-clauses belong to an-
other category. As Bayer (1990) has noticed,
this account raises the question why a sen-
tence initial nur can have its associated focus
only in the preverbal position:
(26)
a. [
Vj
Nur [
Vj
Peter liebt Gerda]]
Only Peter loves Gerda
b. *[
Vj
Nur [
Vj
Peter liebt Gerda]]
c. *[
Vj
Nur [
Vj
Peter liebt Gerda]]
Jacobs reaction to data like these is that a
focussing particle has to be as close to its
focus as its scope allows (cf. Jacobs 1983:
p. 86 f.).
Other restrictions of the distribution of
particles should follow from their meaning.
For instance, it seems hard to interpret strong
quantifiers as foci of only (vide Jacobs 1983
for this observation):
(27)
a. only every/no girl
b. *only every/no girl
c. *only [
F
every/no girl]
There have been attempts in the literature to
cover also these cases (see Lerner & Zimmer-
mann 1983), but the intuitions are shaky and
a good theory should bring out why such
examples are marginal, at best.
3. Logical Form and Interpretation
3.1Movement Theories
Let us start with the meaning of only-NPs.
We assume that the NP contains a proper
name or a definite term as a consequence
of the meaning of only. The most obvious
move is to analyse such NPs as generalized
quantifiers (vide article 21). The simplest se-
mantics assumed in the literature is this.
(28) Semantics for only
Content:
only(a) = P {w: b [w P(a)
b = a]}, where a is any individual.
Implicature/Presupposition:
only
i
(a) = P {w: w P(a)}
We assume that propositions are sets of
39. Current Issues in the Theory of Focus 809
[
VP
only + Sue
x
[
VP
invited x]] (John).
The VP-denotation is the property
a only (Sue) (b [
VP
invited x]
g
b/x
(a)).
The sentence rule says that John has this
property iff
only(Sue)(b[
VP
invited x]
g
b/x
(John)).
By the meaning for only we obtain
b [If b ([
VP
invited x]
g
b/x
(John))(b),
then b = Sue].
By -conversion, we obtain the set of worlds
{w: b [If (w [
VP
invited x]
g
b/x
(John)),
then b = Sue]}.
By the rule for the transitive verb, we know
that
[
VP
invited x]
g
b/x
=
a invited(a, g
b/x
(x)) =
a invited (a,b).
This is the property a{w: a invited b in w}
Therefore, we obtain the proposition
{w: b (If John invited b in w, then b =
Sue)}.
The analysis becomes uglier if we have to
move more than one focus to its particle. We
must then treat the meaning of the particle in
a syncategorematic way. Consider, e. g., the
logical form for (20) which is obtained by
moving two foci to the particle:
(37) [
IP
John [
VP
only + Bill
x
+ Sue
y
[
VP
intro-
duced x to y]]]
In order to interpret this, we have to assume
a rule like this:
(38)
only [
NP
]
x
+ [
NP
]
y
VP
g
=
a {w: b,c (w VPg
b/x c/y
> (a)
b= = )}.
Thus, the interpretation of Focus Movement
is rather complicated. No such complications
arise for the analysis of only-NP. Here we can
adopt the well-established techniques for the
interpretation of quantification as we have
seen. And there are good arguments that Par-
ticle + NPs are in fact quantifiers: Particle-
NPs induce ambiguity in the general case, but
adverbial particles with an NP-focus associ-
ated do not. QR predicts this in a straight-
forward way.
Taglicht (1984) gives the following exam-
ples:
(39)
a. They were advised to learn only
Spanish
b. They were only advised to learn
Spanish
(39a) is ambiguous. It can mean They were
advised not to learn any other language than
In May (1977), x more accurately, a sub-
script is adjoined to NP. But this would
complicate the semantic rule. Thus, our ver-
sion QR is a slight variant from the original.
Applying QR to (29) will yield the structure
(32) [
IP
[
NP
only Sue]
x
[
IP
John [
VP
invited x]]].
The interpretation of QR is the same as that
of Montagues (1974) Quantifying in rule:
(33)
[
IP
[
NP
]
x
[
IP
]]
g
is [
NP
] (a [
IP
]
g
a/x
),
where g is an assignment from variables to
individuals. g
a/x
is like g with the possible
exception that g
a/x
(x) = a. (For variable bind-
ing, see article 41). We write g only if we need
it.
To evaluate (31)
g
, we take into account
that
a [s John invited x]
g
a/x
is the property a
invited (John, a) and only Sue is the
quantifier P {w: b [w P(b) b = Sue]}.
The quantifier assigns to the property the
proposition
{w: b (w invited(John, b)
b = Sue)}.
This gives us the correct truth-conditions.
Thus, QR with an appropriate semantics
accounts in a straightforward way for the
example. An analysis along these lines has
been proposed by Karttunen & Peters (1979),
if we disregard some further refinements.
What then with examples where the focus
associated with a particle is not adjacent to
the particle? We cant have a nominal in such
cases. Karttunen & Peters did not treat these
constructions. Let us have a look at one of
our examples.
(34) John [
VP
only [
VP
invited Sue]]
We could introduce a rule of
Focus Movement:
(35)
1. Move the focus-NP to the particle
Part it is associated with. Leave a
variable x at the original position and
form the complex Part + NP
x
indexed
with the same variable.
2. Interpret [
VP
Part + NP
x
[VP]] as
a NP
g
(b (VP
g
b/x
(a))).
In other words, we treat Part + NP as if it
were the nominal [
NP
Part NP] and quantify
this nominal into the VP. The rule Quantify-
ing in VP is due to Montague (1974).
As ugly as it is, the rule works. And some-
thing along these lines has to be done in any
theory interpreting association with focus, as
we will see. Let us evaluate the structure
(36) [
IP
John [
VP
only + Sue
x
[
VP
invited x]]].
This is the truth, if
810 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
then only the narrow scope reading is avail-
able:
(44) weil sie versuchten, [
CP
PRO nur Span-
isch zu lernen]
QR predicts the difference in interpretation
in a straightforward way.
To our knowledge, Taglicht (1984: p. 150)
was the first who explicitly formulated the
generalization that Particle-NPs and particles
with foci associated induce different ambi-
guities. We will call this hypothesis Taglichts
observation.
Consider (45b): This utterance is ambigu-
ous in a way different from (45a). This is so,
because (45b) may have three different foci
associated:
(45)
a. They were only [
F
advised to learn
Spanish]
b. They were only advised [
F
to learn
Spanish]
c. They were only advised to learn
[
F
Spanish]
The theory presented in section 3.2 predicts
that the readings which correspond to these
focus structures roughly are the following:
(46)
a. The only relevant property they had
is to be advised to learn Spanish.
b. The only relevant advice they got is
to learn Spanish.
c. Spanish is the only language they
were advised to learn.
The point is subtle, but Taglichts observation
seems correct. This is a problem for Focus
Movement, because that rule can give us only
the reading (46c). These facts show that a
generalized QR-rule as the generalized rule
Focus Movement (38) cannot cover the rele-
vant facts. We need something more.
Rooth (p. 145) points to a possible coun-
terexample to Taglichts observation. To be
sure, Rooth does not speak of Taglichts ob-
servation. He rather claims that association
of a focus with a particle disambiguates a
sentence. This is correct if we have in mind a
particular focus structure. But one pitch ac-
cent may indicate more than one focus, as we
know. In such a case, we encounter genuine
ambiguity.
(47)
a. It is hard for me to believe that John
can understand even Syntactic Struc-
tures
b. It is hard for me to believe that John
even can understand Syntactic Struc-
tures
Spanish or They were not advised to learn
any other language than Spanish. (39b) has
only the second reading.
The analysis of only-NPs given above pre-
dicts these facts. (39a) can have two logical
forms that yield its two readings:
(40)
a. They were advised [
IP
only Spanish
x
[
CP
PRO to learn x]]
b. [
IP
only Spanish
x
[They were advised
[
CP
PRO to learn x]]]
On the other hand, this ambiguity is removed
in example (39b). The focus Spanish has to
be associated with only and we obtain the
same reading as that which is expressed by
(40b).
As far as we can see, the ambiguity of (39a)
is a problem for Jacobs (1983) account, since
he disputes the existence of constituents which
have the form [
NP
Particle NP]. For him,
focussing particles are always adverbs. It is
hard to see how such an account could deal
with the facts. To be sure, Jacobs does not
deal with English. So, his method is confined
to German and the question arises whether it
could be generalized to cover the English
data. Joachim Jacobs und Manfred Krifka
have pointed out to me that the German
translation of (39a) is not ambiguous:
(41) Man riet ihnen, nur Spanisch zu lernen
This sentence only has the reading expressed
by (40b). The example is however not perti-
nent, because the embedded clause is extra-
posed, and extraposed sentences are islands
for QR. For the particular example, the wide
scope reading is absent too, when the subor-
dinate clause is in preverbal position:
(42) weil man [
CP
PRO ihnen nur Spanisch
zu lernen] riet
This might have to do with the fact that raten
to advice is an incoherent verb that does
not allow for a wide scope of an embedded
quantifier. A relevant example would be one
with a coherent verb like versuchen to try
that permits wide scope for embedded objects:
(43) weil sie [
CP
PRO nur Spanisch zu lernen]
versuchten
because they tried to learn only Spanish
It seems to me that this sentence is ambiguous
between the reading The only thing they
tried to learn is Spanish and The only thing
they tried to do was to learn Spanish. The
narrow scope reading is hard to obtain, as
always in coherent constructions. On the
other hand, if we extrapose the embedded CP,
39. Current Issues in the Theory of Focus 811
Reconsider the LFs (48) (a) and(b) in the
light of this semantic rule. The implicature of
(48a) is that for any book x other than Syn-
tactic Structures, the likelihood that it is hard
for me to believe that John can understand x
exceeds the likelihood that it is hard for me
to believe that John can understand Syntactic
Structures. This entails that Syntactic Struc-
tures should be easy to understand for John.
On the other hand, the implicature of the
embedded sentence in (48b) is: For any book
x different from Syntactic Structures, the
probability that John can understand x is
higher than the probability that John can
understand Syntactic Structures. Suppose, the
context It is hard for me to believe that is a
hole in the sense of Karttunen & Peters
(1979). In other words, it doesnt alter the
implicature of the complement. Thus, the LF
(48b) implicates that Syntactic structures is a
difficult book for John to understand.
Let us now consider the second meaning
of even which corresponds to German auch
nur:
(50) Negative even
Neg
Content: as above, i. e. identity
Implicature:
even
i
([
NP
]) is P {w: x [x
& w P(x)] & p [x (x & p =
P(x)) The likelihood of P() exceeds
in w that of p]}.
By lexical stipulation, even
Neg
is a negative
polarity item bound to occur in a downward
entailing context. A context f is downward
entailing, if f(p) implies f(q) for any subset q
of p (vide Ladusaw (1979) and article 21). To
prevent confusion: The normal even is not a
positive polarity item; it can occur in all con-
texts.
Now, f = It is hard for me to believe ob-
viously is a downward entailing context since
f(p) implies f(p and q). Let us assume that
negative polarity items cannot be moved out
of their licensing context by QR. It follows
that the only LF possible for our example
with even
Neg
is the following:
(51) It is hard for me to believe that
[
IP
[
NP
even
Neg
Syntactic Structures]
x
[
IP
John can understand x]]
The implicatures of this construction are:
1. There are other books beside Syntactic
Structures which John cannot understand.
2. For any book x different from Syntactic
Structures: The likelihood that John can un-
derstand Syntactic Structures exceeds the
likelihood that John can understand x. Thus,
Syntactic Structures should be an easy book
According to Taglichts observation, the two
sentences should express different kinds of
ambiguities. To be more precise, the reading
expressed by the logical form (48a) should
not exist for (47b):
(48)
a. [
IP
[
NP
even Syntactic Structures]
x
[
IP
It is hard for me to believe that
John can understand x]]
b. [
IP
It is hard for me to believe that
[
IP
[
NP
even Syntactic Structures]
x
[
IP
John can understand x]]
The semantics for even will be introduced in
a moment. As we will see, (48a) will have the
meaning which suggests that Syntactic Struc-
tures should be easy to understand for John,
whereas (48b) will express the meaning sug-
gesting that Syntactic Structures is hard for
John to understand.
The LF (48a) involves QR. This mecha-
nism is not available for the interpretation of
(46b), given the rules developed so far. Focus
Movement cannot move Syntactic Structures
out of the scope of the that-clause in (47b).
Therefore, the easy-reading is not express-
ible.
The facts are different, however. (47b) has
the easy-reading. Recall, however, that the
German translations contain two different
words for even: If we take sogar, we obtain
the reading suggesting that Syntactic Struc-
tures is difficult to understand, and if we
translate even by auch nur (Dutch ook maar)
we get the reading suggesting that Syntactic
Structures is easy to understand. This com-
parative evidence makes it plausible to as-
sume that even is lexically ambiguous, a con-
clusion reached by Rooth on independent
grounds.
At this point it is helpful to introduce
rough meaning rules for the two even that
Rooth assumes. Let us do this for even-NPs.
The adverbial cases will be treated later.
(49) normal-even
Content:
even ([
NP
]) = , where is
an individual.
Implicature:
even
i
([
NP
]) is
P {w: x [x [
NP
] & w P(x)]
& p [ y (y [
NP
] & p = P(y))
The likelihood of p exceeds in w that of
P([
NP
])]}.
Details aside, this is Karttunen & Peters
(1979) analysis.
812 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
These sentences have the meanings expressed
by the illicit logical forms (53b) and (53d).
This shows that focus movement is a kind of
movement different from QR or there is no
focus movement at all. The second position
is advocated by Rooth (1985). It will be dis-
cussed in section 3.2 and in article 40.
We conclude from this discussion that there
is good evidence to assume that Particle-NPs
are quantifiers which are LF-moved by QR.
In other words, only Mary and only Sunday
behave like every girl and every Sunday re-
spectively. It follows that it is unlikely that
the slight contrast between (24a) and (24b)
noticed in section 2.2.2 here repeated as
(56a) and (56b)
(56)
a. ?At the party, John spoke to only
Mary
b. *The library is closed on only Sunday
can be explained by preposition stranding in
English as assumed in Kayne (1981) (cf. Who
did John speak to versus *Which day is the
library closed on). If preposition stranding
were responsible for the relatively greater ac-
ceptability of (56a), we would expect to find
the same contrast in John spoke to every girl
versus The library is closed on every Sunday,
since also every girl and every Sunday undergo
QR. But there is no contrast in such cases.
This has been noticed in Rooth (1985: 135,
fn. 2).
Let us now ask the question whether we
have to assume movement for free focus.
Based on Chomsky (1976), Chomsky (1981)
uses a so-called crossover argument to show
that we have to assume LF-movement for
such cases. He discusses the following con-
trast:
(57)
a. John
1
was betrayed by the woman he
1
loved
b. *The woman he
1
loved betrayed
John
1
Suppose a focus has to be adjoined to IP by
QR. Then we would have the following two
LFs for these sentences:
(58)
a. [
IP
John
x
[
IP
x was betrayed by the
woman he
x
loved]]
b. *[
IP
John
x
[
IP
The woman he
x
loved
betrayed x]]
There is a well-formedness principle for LFs
due to Koopman & Sportiche (1981), which
forbids the constellation (58b). For technical
reasons, we assume the following formulation
of the principle (the version given in article
40 is somewhat more refined):
for John to understand. As before, these im-
plicatures are inherited by the entire sentence.
Intuitively, these implicatures are more sat-
isfying than those generated by the wide scope
reading of normal even. Furthermore, they
correspond exactly to the implicatures of the
German paraphrase with auch nur.
Let us return now to the question, whether
the availability of the reading (48a) for (47b)
is a counterexample to Taglichts observation.
For convenience, we repeat (47b):
(52) It is hard for me to believe that John
even can understand Syntactic Struc-
tures
The context It is hard for me to believe that
John is downward entailing and therefore li-
censes even
Neg
. Thus we can have both even
and even
Neg
in pre-modal position. Still as-
suming Focus Movement alternative pro-
posals discussed later will yield the same
truth-conditions we will obtain two read-
ings that correspond to the narrow scope of
even-NP and even
Neg
-NP. We have seen that
this is adequate. Thus, there is good reason
to believe that Taglichts observation is indeed
correct.
The second evidence for movement of Par-
ticle-NPs is the following: Particle-NPs obey
the usual restrictions for QR. It is topic of
current research what these restrictions are
exactly (cf. May 1985). For the time being, it
suffices to assume that in most cases, a quan-
tifier cannot be extracted from a finite CP.
This restriction is called clause boundness.
(53)
a. We expect that only Mary will come
b. *[
IP
only Mary
x
[
IP
We expect [
CP
that
x will come]]]
c. John complained because Bill had in-
vited only Mary
d. * [
IP
only Mary
x
[
IP
John complained
[
CP
that Bill had invited x]]]
The meaning expressed by (53b) and (53b)
are not available intuitively, as the reader may
verify. On the other hand, LF-extraction out
of a non-finite complement is possible:
(54)
a. We expect only Mary to come
b. [
IP
only Mary
x
[
IP
we expect x to
come]]
It is interesting to see that the corresponding
constructions with focus association are
grammatical:
(55)
a. We only expect that Mary will come
b. John only complained because Bill
had invited Mary
39. Current Issues in the Theory of Focus 813
We have to notice a problem, however. The
Hungarian focus position is presumably not
an adjunct position, because also Wh-phrases
overtly move to that position in Hungarian.
Wh-phrases, however, do not move to adjunct
positions but rather to specifier positions. If
they could go to adjunct positions they should
be able to undergo Scrambling in German,
since Scrambling is adjunction.This however
is not possible. Vide von Stechow & Sterne-
feld (1988, ch. 12), who report an observation
due to G. Fanselow that Wh-phrases and foci
cannot be scrambled.
(62)
a. *weil [im Hilton]
1
der Prsident t
1
wohnt
because in the Hilton the president
stays
b. *wie hat was
1
dieser Halunke t
1
re-
pariert
how has what this crook repaired
If this is correct, then movement of free focus
should rather be Wh-movement and the
structure (58) assumed for English cant be
correct. It should be noted, however, that in
languages like Korean or Japanese, Wh-
phrases can scramble. Nevertheless, it can be
argued that the adjunction position is not the
operator position which is needed for an in-
terpretation of the Wh-phrases at LF. They
must be bound from a specificator position.
We leave this issue unsettled.
Let us briefly go into the question what
the interpretation of overt focus movement
is. Chomsky (1981) paraphrases the content
of structures such as (58a) as The x such
that x was betrayed by the woman x loved is
John. Kiss (1987: 40 f.) cites data due to
Scabolcsi (1980) which support this analysis:
(63)
a.
[
F
Marit s vt] sereti Jnos
[
F
Mary-Acc and Eva-Acc] loves
John-Nom
b. [
F
Mrit] sereti Jnos
The two sentences are incompatible. This fol-
lows directly from Szabolcsis (1980) seman-
tics, according to which the two structures
mean something like this:
(64)
a. x (John loves x x = Mary and
Eva)
b. x (John loves x x = Mary)
In other words, the NP in focus position is
interpreted as an exhaustive list, i. e. as a
strong version of only-NP. Thus, [
F
Mrit s
vt] means Mary and Eva and no one else.
Clearly, the two formulas cannot be true at
the same time. Szabolcsis account is com-
(59) The Bijection Principle
A pronoun indexed by a variable must
have a c-commanding antecedent in ar-
gument position.
An argument position is a subject or an ob-
ject. But a phrase in adjunction position
in particular, a phrase moved by QR is
not in an argument position. An XP is an
antecedent of another XP, if the two are in-
dexed by the the same variable.
(58a) satisfies the Bijection Principle, be-
cause the subject x c-commands he
x
. In (58b),
he
x
does not have an antecedent in argument
position, because the only c-commanding
NP
x
is in a non-argument position. Thus,
(58b) is ruled out by the Bijection Principle.
A theory that moves free focus to an ad-
junct position leaving a bound variable thus
accounts for the contrast (58). The constel-
lations ruled out by the principle are called
weak crossover constellations.
It is instructive to compare the English
example with Hungarian, where we have a
syntactic focus position. It is easy to show
that movement must be involved here. This
has been shown in Horvath (1981). As before,
we assume Kiss structure:
(60)[
IP
A gyerekek [
VP
a fldrengestl
1
The kids the earthquake-from
1
[vmontak [
CP
hogy
said that
[
IP
[
VP
[v Attilafelt t
1
]]]]]]]
Attilafeared
It is the earthquake that the kids said
Attila had been afraid of
Here, we observe long movement of the focus
the earthquake. This movement uses the
specifier position of COMP (hogy) as an es-
cape hatch. The sentence becomes ungram-
matical if this position is blocked by a relative
pronoun. Furthermore, the movement rela-
tion observes the so called Ross-constraint,
which prevents extraction out of an NP-com-
plement:
(61) *Kati [
F
a fldrengestl]
1
hallotta [
NP
a
hirt [
CP
hogy Attila felt t
1
]]
Kati the earthquake-from heard the
news that Attila feared
It is obvious then that there is overt focus
movement in Hungarian. It is a general meth-
odological principle hold among transfor-
mational grammarians that a process oper-
ating overtly in some language may operate
covertly at LF in some other language. This
principle makes it not unplausible to assume
Movement for free focus in English as well.
814 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
focus feature determines a set of alternatives
regardless whether the focussed constituent is
moved or not. (A semantics for free focus
along the same lines had been proposed in
Klein & Stechow 1982.) In other words, the
F-feature is interpreted in situ. For instance,
the alternatives introduced by [
F
Sue] is a
contextually restricted set of persons. We use
the notation
p
for referring to the alter-
natives introduced by the expression. The
subscript p recalls Jackendoffs (1972) P-set
(presupposition set).
Consider the VP introduced Billto Sue. We
assume that Bill, Sue and Ede are the contex-
tually salient persons. The definition of
p
will have to make sure that
(71) introduced [
F
Bill] to Sue
p
is the set
{introduced Bill to Sue,
introduced Ede to Sue,
introduced Sue to Sue}
We will return to the question how this set is
defined in a moment.
The rule for adverbial only is now very
simple. It is this:
(72) only VP is true of subject a iff for any
property in VP
p
:
If P is true of a, then P = VP.
Let us evaluate the sentence
(73) John only introduced Bill to Sue
according to this semantics.
(74) John only introduced [
F
Bill] to Sue is
true
iff only introduced [
F
Bill] to Sue is
true of John
iff for any property P in the set
{introduced Bill to Sue,
introduced Ede to Sue,
introduced Sue to Sue}
such that P is true of John we have
it that
P = introduced Bill to Sue.
This is equivalent to the statement that Sue
is the only person which John did introduce
to Sue.
Let us take up the question now of how
the alternatives are computed. The intuitive
idea is very simple: If we are given the struc-
ture introducedBillto Sue then we have to
treat Bill as a sort of variable for which we
can plug in all the individuals of the contex-
tually restricted domain. That will give us the
properties introduce Bill to Sue, introduce
Ede to Sue and introduce Sue to Sue. If
we are given the structure introducedBillto
Sue, we have to fill in all combinations of
individuals at the places indicated by the foci.
patible with Chomskys paraphrase, for we
may express (64a) as The group x, such that
John loves x is John and Mary. There is
more to say about this topic, but we leave it
at this stage.
One might argue again that the crossover
argument outlined above speaks in favor of
the rule Focus Movement for particles in ad-
verbial position. Consider the following con-
trast:
(65)
a. We only expect him
1
to claim that he
1
is brilliant
b. *We only expect him
1
to claim that
he
1
is brilliant
(65a) has the interpretation (66), but (65b)
does not have it:
(66) For any x, we expect x to claim that he
x
is brilliant
The Bijection Principle accounts for this, be-
cause the LF (67a) conforms to the principle
whereas (67b) violates it:
(67)
a. We only + him
x
[
VP
expect x to claim
that he
x
is brilliant]
b. *We only + he
x
[
VP
expect him
x
to
claim that x is brilliant]
This explanation has a drawback, however,
as noted in Chomsky (1981, 250). Consider
the following pair:
(68)
a. He only claims that Sue likes him
b. He claims that only Sue likes him
(68a) has the reading (69), but (68b) hasnt:
(69) For any person x: If he claims that he
likes x, then x is Sue.
The two LFs corresponding to that reading
are:
(70)
a. He [
VP
only + Sue
x
[
VP
claims that x
likes him]]
b. *only Sue
x
[
IP
he claims that x likes
him]
We have argued that (70b) is excluded by
constraints holding for LF-movement: A sub-
ject of a finite clause cannot be extracted. But
why should (70a) not be excluded by the same
principle? This speaks against a movement
analysis for foci associated with a particle.
On the other hand, it is the movement anal-
ysis which rules out (70b). A good theory
should solve the puzzle.
3.2Rooths In Situ Theory
3.2.1Two-Dimensional Semantics
The core idea of Rooth (1985) is that the
39. Current Issues in the Theory of Focus 815
the rule Focus Movement. Strictly speaking,
there is no such thing as focus association. A
focus induces alternatives and the semantics
of a particle may be sensitive to the alterna-
tives. In Rooths theory, focus is context-
free. There are a lot of operators which
ignore the alternatives altogether.
Rooths account is not incompatible with
the requirement that only-NPs must undergo
LF-movement. The only thing that has to be
said is that a particle in this position ignores
the alternatives generated by the focus feature
on NP. In other words, only-NPs are inter-
preted as indicated in the previous section.
3.2.2Emphatic Pronouns and Binding
Let us consider next what Rooth says about
the unavailability of a bound variable reading
for the example (70), here repeated as (80).
(80) We only expect him
1
to claim that [
F
he
1
]
is brilliant
which seemed to favor the rule Focus Move-
ment. Rooths theory certainly doesnt ex-
clude this configuration. But we should look
more closely what the sentence means ac-
cording to the rule. It is something like this:
(81) The only property in the set A which we
have is P
where
P = to expect he
1
to claim that he
1
is
brillant
and
A = {expect he
1
to claim that he
1
is
brilliant,
expect he
1
to claim that Ede is
brilliant,
expect he
1
to claim that Sue is
brilliant,
expect he
1
to claim that Bill is
brilliant}
where he
1
is a person contextually deter-
mined, say Bill.
Since he
1
refers to Bill, the first and the last
property are the same, and A in fact contains
only three properties. An equivalent way of
expressing the truth-conditions is this:
(82) For any x, if we expect Bill to claim that
x is brilliant, then x is Bill.
It is obvious from the paraphrase that this is
not the incriminated bound variable reading,
since the antecedent of the conditional con-
tains only the variable that corresponds to
the second occurrence of the pronoun.
To derive a bound variable reading, we
have to apply abstraction. So far, we have
introduced two rules of abstraction, viz. QR
We obtain the properties we had before plus
the properties introduce Bill to Bill, intro-
duce Bill to Ede, and so on. The alternatives
will include nine properties.
The technical details of the proposal are
somewhat tricky, however. Let us explain the
relevant steps of the recursion by means of
examples.
First, we need the focus rule:
(75)
a. [
F
] =
b. [
F
]
p
= the (contextually
restricted) semantic domain
corresponding to the logical type
of the expression a.
For instance
F
Bill is Bill, but
F
Bill
p
is
{Bill, Ede, Sue}. A non-focussed expression
only generates its own content as an alter-
native:
(76)
p
= {}
Next, let us consider the semantics of the VP-
rule combining a ditransitive verb with its
object:
(77)
a. [
VP
V
dtr
NP
1
NP
2
] =
a {w: w V
dtr
(a, NP
1
, NP
2
)}
b. [
VP
V
dtr
NP
1
NP
2
]
p
=
{P: (Q,n
1
,n
2
) Q V
dtr
p
& n
1
NP
1
p
& n
2
NP
2
p
& P = a {w:
w Q(a,n
1
,n
2
)}}
Let us illustrate this by calculating the set of
alternatives used in the example:
(78)
John only introduced [
F
Bill] to Sue
p
= {P: (Q,n
1
,n
2
) Q introduced
p
&
n
1
[
F
Bill]
p
& n
2
Sue
p
& P =
a {w: w Q(a,n
1
,n
2
)}}
= {P: ( n
1
,n
2
) n
1
{Bill, Ede, Sue} & n
2
{Sue} & P = a {w: w introduced
(a,n
1
,n
2
)}},
because introduced
p
= {introduced},
[
F
Bill]
p
= {Bill, Ede, Sue} and Sue
p
= {Sue}
= {a {w: w introduced (a,Bill,Bill)},
a {w: w introduced (a,Ede,Bill)},
a {w: w introduced (a,Sue,Bill)}}
It is not a problem for this semantics to have
more than one focus in the domain of only.
For instance, the sentence
(79) John only introduced Bill to Sue
is true if introduced Bill to Sue is the only
property in introduced [
F
Bill] [
F
to Sue]
P
which John has. We have seen, that this is
one property out of nine.
Obviously, this account does not require
816 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
binding disappears in virtue of the semantics
of the F-operator. As far as I know, Rooth
(1985) does not discuss the LF (79). One
could exclude it by the stipulation that em-
phatic pronouns cannot be bound, but the
example does not require that, because the
sentence seems to have the meaning.
In order to get a bound variable reading,
we would have to lay the stress on him:
(89) We only expect [
F
him
1
] to claim that he
1
is brilliant
By QR, we can derive the LF:
(90) We only expect [
IP
[
F
him
1
]
x
[
IP
x to claim
that he
x
is brilliant]]
This LF is well-formed and expresses the
proposition:
(91) For any x: If we expect x to claim that
x is brilliant, then x is Bill.
This is the bound variable reading.
The result of this discussion is that Rooths
theory is compatible with the crossover facts
observed by Chomsky, without requiring the
rule Focus Movement. Like any other NP, a
focussed NP can be moved by QR, but it
need not be. If we want a bound variable
reading, we have to apply QR. In such a case,
the LF-constraints for movement are oper-
ating, as we have seen.
The theory thus predicts the following: A
focussed pronoun does so to speak not show
up as a bound variable in meaning, even if it
is bound by QR in LF. This holds even for
reflexives:
(92)
a. Bill
1
only admires [
F
himself
1
]
b. [
IP
Bill
x
[
IP
x only admires [
F
himself
x
]]]
In Rooths theory, this sentence would ex-
press the proposition
(93) For any x: If Bill admires x, then x =
Bill.
Again, this is not a bound variable reading,
though we have variable binding in the LF.
This seems intuitively correct. A bound var-
iable reading would be expressed by (94a),
whose LF is (94b):
(94)
a. [only Bill], admires admires himself,
b. [
IP
only Bill
x
[
IP
x admires himself
x
]]
(94b) expresses the proposition
(95) For any x: If x admires x, then x = Bill.
This is a different proposition from the one
denoted by (92a), as the reader may verify.
Ulrike Haas (personal communication) has
pointed out to me that for some people, (92a)
has the reading Only Bill admires Bill. In
and Focus Movement. Since Rooth disputes
the existence of the latter rule, we have to
apply QR in order to get a bound variable
reading. We derive:
(83) *We only expect [
IP
[
F
he
1
]
x
[
IP
him
x
to
claim that x is brilliant]]
This time, him
x
is bound by the NP adjoined
to IP. Note, however, that he
1
is not bound.
It denotes Bill.
The LF means this:
(84)The set of alternatives is
A ={expect Bill to claim that Bill is
brilliant,
expect Ede to claim that Ede is
brilliant,
expect Sue to claim that Sue is
brilliant}.
The only property in A which we have
is to expect Bill to claim that Bill is
brilliant.
This is equivalent to saying:
(85) For any x: If we expect him
x
to claim
that x is brilliant, then x = Bill.
Thus, (83) expresses the bound variable read-
ing. But (83) is ill-formed for two reasons: It
violates the Bijection Principle, because him
x
does not have an antecedent in an argument
position. Furthermore, it violates the ECP,
since [
F
he
x
] is the subject of a that-clause.
Therefore, the bound variable reading is ex-
cluded.
Another possibility to derive a bound var-
iable reading is to move him
1
by means of
QR. This yields:
(86) We only expect [
IP
[him
1
]
x
[
IP
x to claim
that [
F
he
x
] is brilliant]
The meaning of this LF is the following:
(87)A={expect Bill to claim that Bill is
brilliant,
expect Bill to claim that Ede is
brilliant,
expect Bill to claim that Sue is
brilliant}
The only property in A which we have
is to expect Bill to claim that Bill is
brilliant.
This can be expressed in a more perspicuous
way as:
(88) For any x: If we expect Bill to claim that
x is brilliant, then x is Bill.
It is interesting to notice that this not a bound
variable reading, though the focus in (86)
contains a bound variable. The effect of the
39. Current Issues in the Theory of Focus 817
(101) Bill even [
VP
only [
F
Sue]
x
[
VP
danced
with x]]
The semantics of this version of QR is Quan-
tifying in VP, an interpretation we had to
assume for the rule of focus movement. In
other words:
(102) [
VP
NP
x
VP] is
a {w: w NP(b VP
g
b/x
(a))}
Let as adopt the even-rule given in the last
section into this framework.
(103) normal-even
Content:
even VP = VP
Implicatures:
even VP
i
(a) is the set of worlds w
such that:
a. Q [Q VP
p
& Q VP & w
Q(a)]
b. q [Q (Q VP
p
& Q VP &
q = Q(a))
The likelihood of q exceeds in w that
of VP(a)].
We will see in a moment that the implicatures
are too strong. The requirement (a) will lead
to a contradiction and therefore has to be
dropped, either altogether or to be adjusted
by a sort of cancellation mechanism in the
sense of Gazdar (1979), vide article 13.
According to this semantics,
[VP only [
F
Sue]
x
[
VP
danced with x]]
is the property
a.{w: w only [
F
Sue] (b danced with
x
g
b/x
(a))},
i. e. a {w: (b) w danced with x
g
b/x
(a)
b = Sue}.
Recall that the P-set, i. e. the alternatives, gen-
erated by the focus in the VP, is something
different, namely the set of properties
(104) {a {w: (b) (w danced with
x
g
b/x
(a) b = Sue)},
a {w: (b) (w danced with
x
g
b/x
(a) b = Ede)},
a {w: (b) (w danced with
x
g
b/x
(a) b = Bill)},
According to the even-rule, we have it that
the entire structure gives us the following
information.
(105) Content:
Bill danced only with Sue
Implicatures:
a. Bill danced only with Ede or Bill
danced only with Bill.
order to express this, we would have to as-
sume the following LF:
(96) [
IP
Bill
y
[
IP
[only y]
x
[
IP
x admires admires
himself
y
]]]
In other words, we have to apply QR twice.
First we QR only Bill, then we QR Bill thereby
binding the reflexive. If the reading exists,
then we face a problem for binding theory.
Normally, the reflexive has an antecedent in
A-position within the same clause. This is not
the case for the representation (96c). I am not
sure, however, whether this reading exists.
Let us finally take up what Rooths ac-
count has to say to examples that, according
to Jacobs (1983), require association of a fo-
cus with more than one particle. The example
given in section 2.2.2 was this:
(97) weil Gerd sogar
1
nur
2
die [
F1,2
jngste]
Schwester von Luise kennt
because Gerd even only the youngest
sister of Luise knows
because Gerd even know only the
youngest sister of Luise
This example needs a scalar interpretation
of nur to yield not older than for the ad-
jective in focus. Since we do not want to go
into this complication, we chose a simpler
example which makes the same point with
quantifying only.
(98) weil Bill sogar
1
nur
2
mit Sue
1,2
getanzt
hat
because Bill even only with Sue danced
has
The intended interpretation is this:
(99) Content:
For any x: If Bill danced with x, then x
= Sue
Implicatures:
a. Bill danced with Sue
b. For any x: If x Sue, then
the probability that Bill danced with
only x exceeds
the probability that Bill danced with
only Sue.
(99a) should be the implicature generated by
nur only, and (99b) is the implicature gen-
erated by sogar even.
Let us see, whether the theory of Rooth
can express this. In fact, this is possible. To
facilitate the discussion, we treat the English
equivalent:
(100) Bill even danced only with [
F
Sue]
Since [
NP
only [
F
with Sue]] has to remain in
the scope of even, we have to allow that QR
adjoins the phrase to VP (vide May 1985). We
derive the LF:
818 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
Implicature:
w even Particle
i
(NP
p
)(P) iff
(q, q a proposition)[a (a NP
p
&
a NP & q = Particle(a)(P)
The likelihood of q exceeds in w the
likelihood of Particle(NP)(P))]
Strictly speaking, this definition is not correct.
It assumes that, for the recursion, the content
and the P-meaning is accessible. This requires
a simultaneous recursion over the two param-
eters. If we include the different level of im-
plicatures, even a third dimension is required
for the recursion. This is the reason, why
Karttunen & Peters (1979) paper is rather
complicated. We ignore this, as Rooth (1985)
did as well. The definition, however, shows
that a compositional semantics for particle
modifying even is possible.
Let us apply this to our example (107a).
We translate it into English and assume the
following logical form:
(109) [
IP
even only [
F
Luise]
x
[
IP
Gerd danced-
with x]]
Be aware of the fact that the QR-moved NP
contains a focus. We assume that [
F
Luise]
= {Sue, Mary, Luise}. We know that the
abstract
x
[
IP
Gerd danced-with x] denotes the
property a {w: Gerd danced with a in w}.
(Never mind that we did interpret the abstract
in a syncategorematic way.) If we apply the
meaning of the moved NP to that property,
we obtain the following information:
(110) Content:
Gerd danced only with Luise.
Implicatures:
a. Gerd danced with Luise (generated
by only and inherited)
b. For any proposition p:
If there is a person x: x {Sue, Mary,
Luise} & x Luise & p = Gerd
danced only with x
then the likelihood of p exceeds the
likelihood of Gerd danced only with
Luise.
In other words, the sentence implicates that
it is likelier that Gerd danced only with Sue
or Mary than that the danced only with Luise.
This is correct.
It seems to us that an account along these
lines is on the right track. No association of
the focus with more than one particle seems
required. The example supports the view ex-
pressed earlier that association with focus is
a misnomer, after all.
Note, by the way, an interesting fact for
the phonology of focus. The interpretation
b. q [q = Bill danced only with Ede
or q = Bill danced only with Bill
The likelihood of q exceeds in w that
of Bill danced only with Sue]
As we have said, the implicature (105a) is too
strong, because it contradicts the content. So
let us assume a weaker formulation of the
even-rule which does not generate the impli-
cature (105a). If we disregard this problem,
then the meaning is exactly as required.
One question, however, remains. Consider
the following German sentence:
(106) Sogar nur mit Luise hat Gerd getanzt
Even only with Luise has Gerd danced
In the literature about German syntax, it is
generally assumed that only one constituent
can be in the position before a verb in COMP.
This is the verb second constraint. If the con-
straint is correct, we have two options: Either
sogar nur mit Luise is one constituent or sogar
modifies the CP.
(107)
a. [
CP
[
PP
sogar nur mit Luise]
1
[
C
hat
2
[
IP
Gerd [
VP
t
1
getanzt] t
2
]]]
b. [
CP
sogar [
CP
[
PP
nur mit Luise]
1
[
C
hat
2
[
IP
Gerd [VP t
1
getanzt] t
2
]]]]
As it stands, Rooths theory does not seem
to be conform with the structure (107a), since
we have assumed that even is an adverb
whereas only is a quantifier. (We assume that
the preposition mit with is semantically vac-
uous, i. e., the verb is regarded a being tran-
sitive to dance with.) This seems to require
an analysis of the type (107b).
It is not a problem to modify the particle
rule in a way that particles can modify CPs.
But what, if there are syntactic arguments
that exclude the structure (107b)?
The problem is only apparent, since Rooth
(1985) has developed a general theory of cros-
scategorial modification. In this theory, par-
ticles can modify quantifiers, i. e, we can form
complex quantifiers having the structure [
Q
Particle Q]. It is clear that such an account is
compatible with the structure (99a), because
the PP in sentence initial position could have
the structure [[
Q
sogar nur] PP]. Or the struc-
ture of the NP could be [
PP
sogar [
PP
nur PP]].
We will not present the general theory but
we will only give an idea of how this works
for structures of the kind [
XP
[
Q
even Q] XP].
(108) Particle modifying even:
Content:
even Particle(NP)(P) =
Particle(NP)(P)
39. Current Issues in the Theory of Focus 819
The corresponding meaning rule in a struc-
tured meaning account is this:
(117) Suppose VP is the structured prop-
erty Q
n
,x
1
,...,x
n
.
Then only VP is true of x iff for any
property P:
If P is in {Q
n
(y
1
,...,y
n
): y
1
,...,y
n
individ-
uals} and P(x) is true, then P = VP.
Let us reconsider example (18a) of section
2.2.2.
(118) John only [
VP
introduced [
F
Bill] to Sue]
In order to make sure that the VP expresses
the structured meaning x [introduce x to
Sue], Bill, we assume the rule Focus Move-
ment with a different interpretation. The fo-
cused NP leaves a variable which is bound
by the -operator. The focus itself, however,
is not an argument of the abstract but is listed
separately. In other words, we assume the
following version:
(119) [
XP
...[
F
YP] ...]
[
XP
[
F
YP]
Fx
[
XP
...x ...]]
The semantics is this:
(120)
[
XP
[
F
YP]
Fx
[
XP
...x ...]]
g
=
a [
XP
...x ...]
g
a/x
, YP.
It is important to realize, that this is not a
Quantifying in rule. It builds up a structured
meaning. The F-feature at the variable codi-
fies this state of affairs. Since the focussed
moved does not lose its F-feature, the rule
can be iterated. We will make use of that
expressive power when we associate a focus
with more than one particle.
If we apply the rule to the structure (118),
we obtain:
(121) John only [
VPF
Bill
Fx
[
VP
introduced x
to Sue]]
This logical form of the VP expresses the
structured property:
(122) x [introduced x to Sue], Bill
We will find that (121) is true iff for any
property P:
(123) P {x [introduced x to Sue](y): y an
individual} & P(John) is true
P = introduced Bill to Sue
This gives us the same truth-conditions which
we obtained in Rooths theory, given that
x[introduced x to Sue](y) reduces to [intro-
duced y to Sue].
required the focus structure (111a). The pitch
accent, however, is not on the focus but on
the particle modified, as witnessed by (111b).
(111) a. [
NP
[
Part
sogar [
Part
nur]] [
NP:F
Luise]]
b. sogar nur Luise
The semantic interpretation seems to require
the F-feature at the NP, but the pitch accent
is on the particle modified. If the analysis is
correct, than we have a case where the F-
feature does not dominate its phonetic reali-
zation. This fact certainly will complicate the
phonological rules that describe the focus-
pitch accent relation. We would prefer an
analysis where the F-feature is on nur. This
seems hard to achieve, on semantic grounds.
3.3Structured Meaning Theories
Jacobs (1983) and von Stechow (1985/89) for-
mulate the semantics for focussing operators
within a structured meaning approach. The
outlines of such a theory were first sketched
in von Stechow (1981b) and the theory has
been elaborated in Cresswell & von Stechow
(1982). The following exposition will be com-
paratively informal.
Let us first say what a structured meaning
is.
(112) Suppose P is an entity of any logical
type. Then the sequence x
1
,...x
n
Q(x
1
,...,x
n
), a
1
,...,a
n
is a structured
meaning for any a
1
,...,a
n
such that
x
1
...x
n
Q(a
1
,...,a
n
) = P.
The idea for the interpretation of focussing
operators is now that focussed constituents
determine a structured meaning. For instance,
the focus structures (113a) to (115a) deter-
mine the structured properties (113b) to
(115b) respectively:
(113)
a. [
VP
introduced [
F
Bill] to Sue]
b. x [introduced x to Sue], Bill
(114)
a. [
VP
introduced Bill [
F
to Sue]]
b. x [introduced Bill to x], Sue
(115)
a. [
VP
introduced [
F
Bill] to [
F
Sue]]
b. xy [introduced x to y], Bill, Sue
We can reformulate Rooths meaning rule
(72) into an equivalent rule operating on
structured properties. For convenience, we
repeat Rooths rule as (109):
(116) only VP is true of x iff for any prop-
erty P:
If P is in VP
p
and P(x), then P =
VP.
820 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
(127) For any proposition p:
If y (Mary y & p = [For any z: If
John danced with z, then z = y], then
the likelihood of p exceeds that of
[For any z: If John danced with z, then
z = Mary]).
In other words, it is more likely that John
only danced with another woman than just
with Mary. This is correct.
A remark to the possibility of iterating
Focus Movement might be in order. We could
apply the rule to (124b) once more and create
the following LF:
(128) John [
VP
[
F
Mary]
Fz
[
VP
even [
VP
z
Fy
[
VP
only [
VP
y
Fx
[
VP
danced with x]]]]]]
Here we have moved the focus over the par-
ticle even. But then the predicate will express
a structured property. Since we cannot apply
a structured property to the subject, the LF
will not be interpretable. So this unmotivated
movement is blocked on independent
grounds.
Thus, formally this works. In von Stechow
(1985/89) it has been argued that the expres-
sive power of this theory is greater than that
of Rooths de situ theory and that the ex-
pressive power is needed. The point is dis-
cussed in article 40.
The account is objectionable, however, for
precisely the reasons discussed in section 3.1.
Structured meanings are built up by means
of a version of Focus Movement, and we have
seen that it is very unlikely that there is such
a rule.
3.4Contextual Restrictions for Alternatives
In this section we will be concerned with the
more general question of how the set of focus
alternatives is contextually restricted. Accord-
ing to the theories outlined in the preceding
text, sentence (129a) has the truth-conditions
(129b):
(129)
a. Bill only works.
b. For any P: P is in working
p
and
Bill has P, then P = working,
i. e., the only property which Bill has
is working
If we were to take this literally, (129a) could
never be true. Bill cant have only one prop-
erty. Among other things, he is the son of
Mary, he has blue eyes and so on. Thus, the
alternatives for sleeping cannot be the set of
all properties. The set of alternatives has to
be contextually restricted. Let us indicate the
The theory also covers cases where more
than one focus is associated with the particle.
If, for instance, the focus structure of the VP
were (115a), then our sentence would be true
iff for any P in the set {introduced x to y : x,
y individuals} such that P is true of John, P
is in fact the property introduced Bill to
Sue.
In this approach, it is not a problem to
associate a focus with more than one par-
ticle. Consider the following example:
(124)
a. John [
VP
even [
VP
only [
VP
danced
with
F
Mary]]]
b. John [
VP
even [
VPF
Mary
Fy
[
VP
only
[
VP
y
Fx
[
VP
danced with x]]]]]
Here, we have iterated Focus Movement. In
the first step, we have adjoined the focus to
the lower VP, leaving the variable x, and at
the second step we have adjoined the focus
to the next higher VP, leaving the variable y.
The predicate expresses the meaning (125),
which contains two structured meanings:
(125) even ( y [only ( x [danced with x],
y)], Mary )
This can be applied to the subject John and
gives us the correct meaning, if we assume
the analogue of Rooths even-rule:
(126) Suppose VP is the structured prop-
erty Q
n
,x
1
,...,x
n
.
Then even VP(x) is the proposition
Q
n
(x
1
,...,x
n
)(x).
The implicature generated by even
VP(x) is the following proposition:
For any proposition p: If there is a
sequence y
1
,...,y
n
such that x
i
y
i
and p = Q
n
(y
1
,..., y
n
)(x),
then the likelihood of p exceeds that of
Q
n
(x
1
,...,x
n
).
Let us apply the rules to the LF (124b). [
VP
y
Fx
[
VP
danced with x]] denotes the structured
property x [danced with x], y. If we apply
only to that, we obtain the property v
[For any z: If v danced with z, then z = y].
Hence, [
VPF
Mary
Fy
[
VP
only [
VP
y
Fx
[
VP
danced
with x]]]] denotes the structured property y
v [For any z: If v danced with z, then z =
y], Mary. even(y X,v [For any z: If v
danced with z, then z = y], Mary)(John)
is the proposition [For any z: If John danced
with z, then z = Mary].
The implicature of even(y v [For any
z: If v danced with z, then z = y], Mary)
(John) is the following proposition:
39. Current Issues in the Theory of Focus 821
Since not rain is in rain
c,p
, it follows that
the proposition
(135) can(not rain)
is false in w. Therefore, the negation of this
proposition is true in w. Now, the negation
happens to be the proposition
(136) must(rain).
Therefore, (132a) logically implies (133).
It is interesting to note that, in the relevant
LF (132a), only has wide scope with respect
to the modal can. If only modifies VP, as
assumed in section 2.2.2, it seems to follow
that can must be a V which is moved to INFL.
The LF (132b) chooses between the alter-
natives, say It can snow and It can rain
and says that only the latter is true. But the
latter does not imply the must-proposition
(133).
The LF (132c) means that there is a pos-
sible world, where it rains but it does not
snow. This does not entail that it rains in
every world. Thus, (132c) does not imply
(133) either.
The same kind of argument justifies the
inference from (137a) to (137b)
(137)
a. Only a fool can believe that.
b. Whoever can believe that is a fool.
The logical forms accounting for the entail-
ment are these:
(138)
a. [
IP
[
NP
only [
NP
a [
F
fool]]]
x
[
IP
can
[
S
x believe that]]]
b. x [
IP
can [
IP
x believe that]] [x is a
fool]
We ignore the question, how the LF (139b)
is obtained.
(138a) means that the property of being a
fool is the only one that makes the statement
Some P can believe that true. In particular,
we have it that Some non-fool can believe
that is false. Therefore, the proposition An-
yone who can believe that is a fool must be
true. To be sure, this has to be worked out.
The LFs are not more than a rough indication
of what might be going on here.
Let us mention another problem concern-
ing the restriction of alternatives. In Stechow
(1989), the following example (due to an ob-
servation of E. Th. Zimmermann) is discussed:
(139) Did Sir John already introduce each
gentleman to his partner at table?
contextual restriction of the P-set by the sub-
script c, which refers to the context of utter-
ance.
In other words, the truth-conditions for
(129a) are more accurately represented as
(130):
(130) For any P: P is in working
p,c
and Bill
has P, then P = working,
i. e., the only property relevant at con-
text c which Bill has is working
At this point, the question arises, what there
is in working
p,c
. Lbner (1990) assumes that
working
p,c
only contains working and its
complement not working. This, however, is
not enough. For instance, (129a) can answer
a question as What is Bill doing today? Does
he play tennis, does he go to the mountains,
or does he work?. Such a context activates
the alternatives to play tennis, to go to
the mountains and to work. So these
properties are better included in the set of
alternatives.
Lbner is right, however, that in a lot of
cases we have to assume that the complement
of a property is included in the set of alter-
natives. We need this in order to deal with
the following examples:
(131)
a. Es kann nur regnen.
It can only rain
b. Es mu regnen.
It must rain
(131a) logically implies (131b). Let us see how
the theory accounts for the inference. Switch-
ing from German to English, (131a) can have
three logical forms:
(132)
a. only (can ([
F
rain]))
b. only ([
F
can (rain)])
c. can (only ([
F
rain]))
If we represent (132b) as
(133) must(rain)
we can convince ourselves that the LF (132a)
logically implies (133). We assume that rain
is the set of the raining worlds, and that the
modal operators are interpreted in the stan-
dard way. We assume with Lbner that
rain
c,p
contains the set of the non-raining
worlds. Let us denote this proposition by not
rain.
Our meaning rules predict that the LF
(132a) is true in a world w, iff
(134) For any p:
If p {can(q) : q rain
c,p
}
&w p,
then p = can(rain).
822 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
b. The presuppositions are:
(i) The alternatives in {P(x
1
,...,x
n
) :
x
1
,...,x
n
relevant values} are under
debate.
(ii) The speaker assumes that the
asserted proposition belongs to the
alternatives still under debate.
It follows that (142a) and (142b) have the
same truth-conditions but different presup-
positions.
This is an attractive approach, because it
gives a unified treatment for most focus phe-
nomena. One of the problems for this theory
is that it predicts that deeply embedded free
foci are always associated with an illocution-
ary operator, because each sentence has only
one of the these (vide article 12 Theorien der
Satzmodi).
(144)
a. Otto told me that Gerda believes
that Clyde will marry Bertha.
b. Otto told me that Gerda believes
that Clyde will marry Bertha.
An assertion of (144) should therefore pre-
suppose that alternatives of the form Otto
told me that Gerda believes that Clyde will
marry x are under debate. It is not so clear
to me, whether this is intuitively justified, but
I will not try to settle the issue.
3.5.2Lbners Predicational Theory
An entirely different analysis of free focus is
proposed in Lbner (1990). Though Lbner
does not mention Paul (1880), his theory can
in fact be regarded as a reconstruction of
Pauls view that a focus is a psychological
predicate which is predicated of a psycholog-
ical subject (cf. section 2.2.1). Lbner himself
says that he reconstructs the rheme-theme
distinction, which is due to the Prague school.
Lbner discusses the following sentence
(Lbner 1990: p. 169):
(145) Anna hat mir ein Bild geschenkt
Anna has me a picture given
Anna gave me a picture
Among the focus structures of the sentence
are the following:
(146)
a. [
F
Anna] hat mir ein Bild geschenkt
b. Anna [
F
hat] mir ein Bild geschenkt
c. Anna hat [
F
mir] ein Bild geschenkt
d. Anna hat mir [
F
ein] Bild geschenkt
e. Anna hat mir [
F
ein Bild] geschenkt
f. Anna hat mir ein Bild [
F
geschenkt]
g. Anna hat mir [
F
ein Bild geschenkt]
h. Anna [
F
hat mir ein Bild geschenkt]
No, Sir John only introduced Bill to
Mary.
In this context c,
introduce [
F
Bill] to [
F
Mary]
p,c
should be
the set
(140)
{introduce x to y
g
a/x b/y
: a is the part-
ner at table of b}
The determination of this set involves variable
binding. This was thought an objection
against Rooths theory, because there the foci
determine the alternatives so to speak con-
text-free (cf. section 3.2). In Stechow (1989)
the question was raised whether there was a
general method to appropriately restrict the
P-sets. It was shown that the structured mean-
ing approach did not have this problem, be-
cause it has bound variables at the focus
positions which can appropriately restricted.
This question will be taken up in a principled
way in the article 41.
3.5Interpreting Free Focus
In this last section we will briefly go into the
question of how free focus can be interpreted.
Remember that we called a focussed constit-
uent a free focus, if it was not associated with
a particle.
3.5.1Jacobs Relational Theory
In a number of articles, J. Jacobs has de-
fended the view that even free foci are asso-
ciated with an operator, although an invisible
one (vide e. g. Jacobs 1988) In particular, the
illocutionary operators ASS (for assertion),
DIR (for directive), ERO (for erothetic)
and so on. In other words, free foci do not
really exist. From a semantic point of view,
every focus is relational according to Jacobs.
Consider two examples:
(141)
a. Otto hat Gerda geheiratet
Otto married Gerda
b. Otto hat Gerda geheiratet
If we assert these sentences, then they express
the following meanings:
(142)
a. ASS (x [Otto married x], Gerda)
b. ASS (x [x married Gerda], Otto)
We have to make sure that ASS is a focus-
sensitive operator. Jacobs semantics for the
assertion operator is roughly this (Jacobs
1988: 95):
(143)
a. The content of ASS (P, a
1
,...,a
n
)
is true if the speaker asserts the
proposition P(a
1
,...,a
n
).
39. Current Issues in the Theory of Focus 823
one person gave me a picture, whereas (147h)
does not presuppose anything.
According to Lbner, another instance of
natural focus is the following:
(148) [
F
niemand] schlft
no one sleeps
This has the interpretation
(149) niemand
ett
(schlft
et
)
which does not require any type lifting, since
the general quantifier applies to the predicate.
According to Lbner, this nicely explains why
the accent is on the subject in the unmarked
case. The presuppositions of (148) are very
weak at best. Perhaps (148) presupposes the
existence of persons, but it certainly does not
have a uniqueness presupposition.
It is somewhat questionable whether ex-
amples like (148) should be subsumed under
the general theory. Firstly, the co-focus is not
a definite term, but a predicate. Secondly, in
these cases, the predicate also has a pitch
accent, if the sentence is uttered out of the
blue (vide Fry 1989). If we focus a quantifier,
the non-focussed part can never be a definite
description as the following example shows:
(150)
a. Anna hat [
F
niemand] ein Bild ge-
schenkt
Anna gave no one a picture
b. no one (x [Anna gave x a picture])
Again, this sentence does not presuppose that
Anna gave a picture to exactly one person. If
we did subsume constructions like these under
the general theory of free focus, we would
loose the unified account proposed by Lb-
ner, which can be summarized by the follow-
ing slogan: The focus is a predicate, the co-
focus is a definite term.
Examples like (148) and (149) rather seem
to pattern with contrastive focus. Lbner
quotes an example due to Rooth (1985),
which illustrates this use:
(151)
A: Nobody likes herring.
B: Thats not true. Carl likes Herring.
If we did analyse (151) along the lines indi-
cated, then the second utterance would pre-
suppose that there is exactly one person who
likes herring. Bs utterance rather contradicts
As utterance by pointing to a counterexample
to the claim. There could be other herring
lovers as well. So this use of focus should not
be confused with the previous one. It cannot
be covered by Lbners theory, as has been
pointed out by Lbner himself. It seems to
The non-focussed part of the sentence is
called co-focus. The analysis is very simple:
Each focus is interpreted as a predicate and
each co-focus as a definite description of a
type the predicate can apply to. The focus is
then predicated of the co-focus.
In order to see how this works, let us
indicate some of the interpretations for the
structures:
(147)
a. x [x = Anna] (x [POS (x gave me
a picture)])
b. x [x = POS] (x [x (Anna gave me
a picture)])
b. x [x = PAST] (x [POS (Anna x-
give me a picture)])
c. x [x = me] (x [POS (Anna gave x
a picture)])
d. x [x = one] (x [POS (Anna gave
me x pictures)])
e. a picture
et
(x [POS (Anna gave me
x)])
f. x [x = give] (x [POS (Anna PAST-
x me a picture)])
g. x [x = give a picture] (x [POS
(Anna PAST-x me)])
h. gave me a picture
et
(Anna)
A few explanations are in order. POS is sup-
posed to be the positive operator it is true
that. Since Anna is an individual, we have
to transform it into a predicate by means of
identity and -abstraction, an elementary
type lifting operation. In order to transform
the co-focus into a definite description, we
apply -abstraction (vide article 41). If we
focus the finite German auxiliary hat, then
either the positive polarity can be focussed
(= 147b) or the past tense (= 147b). This
distinction is not discussed by Lbner, but
e. g. in Hhle (1982a) or Klein & von Stechow
(1982). If we stress the indefinite article ein in
German, then it is interpreted as a numeral
in the normal case (= 147d). Indefinite terms
are interpreted as predicates by Lbner (=
147e). This practice is in agreement with Heim
(1982). If we focus the entire predicate, then
no type shifting is necessary in order to apply
the focus to the co-focus, i. e. the subject (=
147h). In cases like these Lbner speaks of a
natural focus.
The meanings listed above are all equiva-
lent in terms of truth-conditions. They differ,
however, with respect to their presupposi-
tions. A definite description presupposes that
the predicate which makes up the description
determines a singleton set (vide article 13). It
follows that (147a) presupposes that exactly
824 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
This, however, leads to the question of how
the theory treats focussing particles, because
it is not clear how two foci can be associated
with more than one focus. And, in fact, this
seems to be a difficulty for the approach. To
see this, let has briefly discuss Lbners anal-
ysis of only. Roughly speaking, his treatment
is this (cf. Lbner 1990: 177 f.):
(158) only(F,k) is defined only if F(k) is true.
Whenever this is the case, then F(k) is
false for any F that is more informative
than F with respect to k.
Here F is the property expressed by a focus,
whereas k is the argument expressed by the
co-focus. F is more informative than F with
respect to k iff F(k) entails F(k).
This definition gives some nice results. For
instance, (159a) entails that (159b) is false:
(159)
a. I need only 5 dollars
b. I need 6 dollars
This is so, because the meaning of (159a) is
(160) only (x [x = 5], x [I need x dollars])
This is defined if I need 5 dollars. The content
says, that the proposition I need 6 dollars
is false, because I need 6 dollars entails I
need 5 dollars. Therefore, x [x = 6] is more
informative than x [x = 5] with respect to
x [I need x dollars]. By the semantics for
only, (159b) is therefore false.
On the other hand, (161a) is not incom-
patible with (161b).
(161)
a. Nur 5 Taler gengen
Only 5 dollars are enough
b. 6 Taler gengen
6 dollars are enough
This is so, because the meaning of (161a) is
(162) only (x [x = 5], x [x dollars are
enough])
Since 6 dollar are enough does not entail
5 dollars are enough, x [x = 6] is not more
informative than x [x = 5] with respect to
x [x dollars are enough]. Therefore, the truth
of (161b) is not excluded by the truth of
(161 b). So the theory certainly has attractive
features.
It is however not clear to me how the
theory can treat examples where only is as-
sociated with more than one focus. It seems
to me that Lbners analysis of multiple focus
cannot be maintained in such cases. If this is
correct, than a recourse to two-dimensional
semantics or something equivalent is una-
me then that the theory of free focus should
disregard (148) and (150) as well.
It is interesting to see how Lbner treats
sentences with indefinite subjects:
(152) [Eine Malerin]
et
[hat mir ein Bild ge-
schenkt]
et
a painter gave me a picture
If uttered out of the blue, the entire sentence
is in focus. This is represented as
(153) x [x is a painter & x gave me a picture](x)
The free variable is presumably bound by
existential generalization. Lbner is not ex-
plicit about this. If the subject or the predicate
are focussed alone, we obtain the meanings
(154a) and (154b) respectively:
(154)
a. x [x is a painter] (x [x gave me a
picture])
b. x [x gave me a picture] (x [x is a
painter])
These meanings carry stronger presupposi-
tions than (153). (154a) presupposes that ex-
actly one person gave me a picture and (154b)
presupposes that there is exactly one painter.
(153) does not carry any of these presuppo-
sitions.
The embedding of focus structures is not
a problem for the theory, either. Consider
again (144a), here repeated as (155):
(155) Otto told that Gerda believes that
Clyde will marry Bertha
Lbner could analyse this as
(156) Otto told that Gerda believes that
x [x = Berta] (x[Clyde will marry x])
This means that Gerda presupposes in her
belief-worlds that there is exactly one person
who Clyde marries. This seems correct.
According to Lbner, there are two advan-
tages of his theory with respect to other anal-
yses. Firstly, the approach does not need a
two-dimensional semantics. Secondly, it cor-
rectly predicts the presuppositions for focus
structures.
As to the first claim, let us ask how multiple
focus is treated by the theory, because it was
this phenomenon that motivated two-dimen-
sional analyses. Lbner only considers the
following example:
(157)
a. [
F
Anna] painted [
F
me]
b. y [y = Anna] (y (x [x = me]
(x [y painted x])))
40. The Representation of Focus 825
vath 1981 Huang 1982 Jackendoff 1972 Jacobs
1983 Jacobs 1988 Karttunen & Peters 1979
Kayne 1981 Kiss 1987 Koopman & Sportiche
1981 Klein & von Stechow 1982 Kratzer 1989
Ladusaw 1979 Lerner & Zimmermann 1983
Lbner 1990 May 1977 May 1985 Montague
1974 Paul 1880 Rooth 1985 Selkirk 1984 von
Stechow 1981b von Stechow 1982a von Stechow
1985/89 von Stechow & Sternefeld 1988 von
Stechow & Uhmann 1986 Szabolcsi 1980 Tag-
licht 1984
Arnim von Stechow, Konstanz
(Federal Republic of Germany)
voidable. Nevertheless, Lbners treatment of
free focus still might be on the right track.
I wish to thank Joachim Jacobs and Manfred
Krifka for helpful comments and Bruce Mayo for
checking my English.
4. Short Bibliography
Allerton & Cruttenden 1979 Altmann 1976 Alt-
mann 1978 Anderson 1972 Bayer 1990 Chom-
sky 1971 Chomsky 1976 Chomsky 1981 Con-
treras 1976 Cresswell & von Stechow 1982
Dretske 1972 Fry 1989 Gazdar 1979 Heim
1982 Hhle 1982a Horn 1969 Horn 1972 Hor-
40. The Representation of Focus
B In Situ Theories of Focus: Rooth 1985
Focused constituents can be interpreted in
situ.
Chomsky and Rooth both assume three
transformationally related levels of syntactic
representation: Deep Structure, Surface
Structure, and Logical Form. The level of
Logical Form is the input for the semantic
interpretation component. For Rooth, the se-
mantic interpretation component consists in
a translation procedure, mapping Logical
Form representations into expressions of an
intensional logic. Each intensional logic ex-
pression receives two denotations. One de-
notation is its usual denotation. The second
denotation is meant to capture the specific
contribution of focusing to the meaning of
an expression. We have then:
B1 Denotational In Situ Theories (Rooths
official proposal)
Focusing is accounted for by assigning
two denotations to each intensional logic
expression.
Reviewing the advantages and disadvantages
of movement and in situ theories, I will argue
for the following slightly different version of
an in situ theory briefly mentioned in Rooth
(1985).
B2 Representational In Situ Theories
Each Logical Form representation re-
ceives two intensional logic translations.
One translation is its usual translation.
The second translation is its presuppo-
sition skeleton (this is Rooths term. Pre-
supposition skeleta correspond to the
Presupps of Jackendoff 1972.)
1. Introduction
2. A Version of the Movement Theory of Focus
2.1 Examples (Rooth)
2.2 Crossover Arguments
2.3 Problems
3. Rooths In Situ Theory of Focus
3.1 Examples
3.2 Island Constraints and Crossover
3.3 Problems
4. A Presupposition Skeleton Version of the In
Situ Theory
4.1 Two Translations
4.2 Changes in the Intensional Logic
4.3 P-Sets
4.4 The Semantics of only
4.5 Examples
4.6 VP-Deletion
5. Appendix: An Example of a -Categorial In-
tensional Language
6. Short Bibliographie
1. Introduction
1.1The Plot
In this article, I will start out by examining
two current approaches to the representation
and interpretation of sentences containing fo-
cused constituents.
A Movement Theories of Focus: e. g. Chom-
sky 1976
At the level of Logical Form, a focused
constituent moves from its base position,
leaving behind a variable.
826 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
(3)
a. John
1VP
[only
VP
[introduced
F
[Bill]
2
to
Sue
3
]]
b. John
1VP
[only
VP
[introduced Bill
2
to
F
[Sue]
3
]]
Logical Form
The focused phrases are adjoined as sisters of
the focusing operator only.
(3)
a.
S
[John
1VP
[only
F
[Bill]
2VP
[introduced e
2
to Sue
3
]]]
b.
S
[John
1VP
[only
F
[Sue]
3VP
[introduced
Bill
2
to e
3
]]]
Semantic Interpretation
Logical forms (3a) and (3b) are translated
into expressions of the intensional language
assumed.
(3)
a. v
e,1
[only(Bill)(v
e,2
[introduce (v
e,2
)
(Sue) (v
e,1
)])] (John)
b. v
e,1
[only(Sue)(v
e,3
[introduce
(Bill) (v
e,3
) (v
e,1
)])] (John)
In the translations above, only is an ex-
pression of type e,e,t, t, that is, an
expression that forms a quantifier phrase
when combined with a proper name. The
quantifier phrase is then quantified into the
VP. (3a) is true iff Bill is the only person
which has the property of being introduced
to Sue by John. (3b) is true if Sue is the only
person which has the property that John in-
troduced Bill to her.
Eventually, we want to have a more general
semantics for only, of course, allowing us to
focus constituents of other categories and sev-
eral constituents at a time. For concrete pro-
posals see Rooth (1985), von Stechow (1981b,
1982a, 1989), and Jacobs (1983). The above
way of interpreting focus sensitive operators
like only can be seen as a realization of the
structured meaning approach of von Stechow.
2.2Crossover Arguments
The crossover argument is used in Chomsky
(1976) to show that focused noun phrases
behave like quantifier phrases and wh-phrases
in certain respects, suggesting that all of those
phrases are moved from their base positions
at some level of representation. The argument
has since been discussed by various scholars,
in particular in Horvath (1981, 1986) and
Rooth (1985). The following variations of the
crossover examples are from Rooth (1985).
(4)
a. We only expect
F
[him]
1
to be betrayed
by the woman he
1
loves
1.2Some Theoretical Assumptions
a. Syntax
I am assuming the model of grammar of the
Extended Standard Theory (Chomsky and
Lasnik 1977). On this proposal, Deep Struc-
ture, Surface Structure, and Logical Form are
related by movement operations obeying the
usual constraints. At the level of Logical
Form, noun phrases may have been raised
from their base positions, resulting in struc-
tures of the following kind:
(1) Jane
1
fed
NP
[every cat]
2
(1)
S
[
NP
[every cat]
2S
[Jane fed
N
[e]
2
]]
b. Semantics
Logical Form representations are composi-
tionally translated into expressions of an in-
tensional -categorial language of the sort
given in the Appendix. (1), for example, is
translated as (1).
(1) every(cat)(v
e,2
[fed (v
e,2
)(Jane)])
Concrete proposals for the translation pro-
cedure can be found e. g. in Rooth (1985). In
(1), the trace of the moved NP is translated
as a variable of type e bearing the same index
as the trace. And the index of the moved NP
matches the index of the variable bound by
the -operator of the -abstract that is the
translation of the NPs sister node.
c. Focus
At Surface Structure, focused constituents are
marked with the focus feature F (Jackendoff
1972, Selkirk 1984).
(2)
F
[Jane] laughed
2. A Version of the Movement Theory
of Focus
As presented above, a movement theory of
focus is any theory where focused constitu-
ents have to move leaving a trace behind (the
trace is then translated as a variable). At this
point, we may wonder where a focused phrase
is supposed to move. This question has been
most clearly addressed in connection with fo-
cus sensitive particles like only or even. It is
usually proposed that at the level of represen-
tation relevant for semantic interpretation,
focus sensitive particles and the focused con-
stituents they associate with have to be ad-
jacent, and that this is what triggers focus
movement. This is the version of the Move-
ment Theory that Rooth 1985 addresses, and
I am going to review his main points here.
2.1Examples (Rooth 1985)
Surface Structure
40. The Representation of Focus 827
(4a) and (4b) correspond to the referential
readings of (4a) and (4b) respectively. We now
correctly predict that (4a), but not (4b) has a
bound variable reading.
The force of the crossover argument comes
from the fact that on the movement theory,
the distribution of readings for (4a) and (4b)
can be explained in exactly the same way as
the distribution of readings for the following
sentences, all involving moved NPs at some
level of representation.
Surface Structure:
(6)
a. [Every man]
1
was betrayed by the
woman he
1
loved
b. The woman he
1
loved betrayed [every
man]
1
Logical Form:
(6)
a.
S
[[Every man]
1S
[e
1
was betrayed by
the woman he
1
loved]]
S
[[Every man]
1S
[e
1
was betrayed by
the woman e
1
loved]]
b.
S
[[every man]
1S
[the woman he
1
loved
betrayed e
1
]]
Surface Structure:
(7)
a. Who
1
[e
1
was betrayed by the woman
he
1
loved]?
b. Who
1
did [the woman he
1
loved betray
e
1
]?
Logical Form:
(7)
a. Who
1
[e
1
was betrayed by the woman
he
1
loved]?
Who
1
[e
1
was betrayed by the woman
e
1
loved]?
b. Who
1
did [the woman he
1
loved betray
e
1
]?
Given principle 5, we correctly predict that
the pronouns in the (a) sentences do, and the
pronouns in the (b)-sentences dont have a
bound variable interpretation. Note that on
the present proposal, empty and non-empty
pronouns are interpreted independently, even
if they are co-indexed. The reason is that
empty pronouns are translated as variables
and non-empty pronouns as constants of the
intensional language, and (as usual) variables
and constants are assigned values by inde-
pendent interpretation functions.
2.3Problems
As pointed out in Rooth 1985, the movement
theory of focus (in the strong version pre-
sented above) is undesirable since Focus
b. We only expect the woman he
1
loves
to betray
F
[him]
1
The important observation is that (4a) is am-
biguous, while (4b) is not. Suppose the pro-
noun he in the above sentences refers to John.
Then we have:
(4a) Bound variable reading (possible):
We expect nobody but John to have the
property
v
e,1
[v
e,1
is betrayed by the woman v
e,1
loves].
Referential reading (possible):
We expect nobody but John to have the
property
v
e,1
[v
e,1
is betrayed by the woman John
loves].
(4b) Bound variable reading (impossible):
We expect nobody but John to have the
property
v
e,1
[the woman v
e,1
loves betrays v
e,1
].
Referential reading (possible):
We expect nobody but John to have the
property
v
e,1
[the woman John loves betrays
v
e,1
].
On the movement theory of focus, we can
explain these data given the logical forms (4a)
and (4b) and an independently needed prin-
ciple for bound variable interpretations ap-
plying at the level of Logical Form. (Various
principles have been proposed here. I propose
principle (5) since it seems to apply to at least
as broad a range of cases as the principles
usually invoked.)
(4)
a. We
VP
[only
F
[him]
1VP
[expect e
1
to be
betrayed by the woman he
1
loves]]
b. We
VP
[only
F
[him]
1VP
[expect the
woman he
1
loves to betray e
1
]]
(5) Bound Variable Principle (Logical Form):
The phonological content of a pronoun
may optionally be deleted if it is c-com-
manded by a co-indexed empty pronoun.
The Bound Variable Principle now tells us
that there is a second Logical Form Repre-
sentation for (4a), but not for (4b).
Second logical form for (4a):
We
VP
[only
F
[him]
1VP
[expect e
1
to be betrayed
by the woman e
1
loves]]
Suppose that pronouns without phonological
content are translated as variables of the in-
tensional -categorial language, whereas pro-
nouns with phonological content are trans-
lated as constants (keeping their original in-
dices). This means that the second logical
form for (4a) corresponds to the bound var-
iable reading, whereas the two logical forms
828 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
(11) John
1VP
[only
VP
[introduced
F
[Bill]
2
to
F
[Sue]
3
]]
Since (11) doesnt contain any quantified
NPs, (11) is a well-formed Surface Structure
or Logical Form representation (Rooth also
allows proper names like Bill or Sue to move
at the level of Logical Form. But since proper
names can be interpreted in situ, movement
isnt required.) The scope of the focus sensi-
tive operator only is the VP here, so we are
interested in the double interpretation of the
VP part of (11).
(12)
VP
[introduced
F
[Bill]
2
to
F
[Sue]
3
]
(12) is the translation of (12):
(12) introduced(
F
[Bill])(
F
[Sue])
Computation of intension of (12) (variable
assignments neglected):
1.
F
[Bill] = Bill = Bill
2.
F
[Sue] = Sue = Sue
3. introduced = that function f
D
e,e,e,t
such that for any a,b,c D
e
,
f(a)(b)(c) = {wW: c introduced a to b in
w}
4. 12 = introduced (
F
[Bill])
(
F
[Sue]) = that function g D
e,t
such
that for any a D
e
, g(a) = {wW: a
introduced Bill to Sue in w}.
Computation of the p-set for (12) (variable
assignments neglected):
1.
F
[Bill] = D
e
2.
F
[Sue] = D
e
3. introduced = {introduced}
4. 12 = {f D
e,t
:a
F
[Bill] , b
F
[Sue] , g introduced [f =
g(a)(b)]} = {f D
e,t
: a,b D
e
[f= in-
troduced(a)(b)]}
Intuitive characterization of the p-set for
(12):
Suppose John, Bill, Sue, and Ann are the only
entities in the domain D
e
. The p-set for (12),
then, is the following set of properties:
introducing John to
Bill
introducing Bill to
Ann
introducing John to
Sue
introducing Bill to
John
introducing John to
Ann
introducing Bill to
Sue
introducing John to
John
introducing Bill to
Bill
introducing Sue to
Ann
introducing Ann to
Sue
introducing Sue to
John
introducing Ann to
Bill
Movement would have to be a transformation
with rather idiosyncratic properties. In par-
ticular, it would have to be a transformation
that doesnt obey the island constraints hold-
ing for other transformations.
Island Constraints:
(8) They only investigated the question
whether you know the woman who
chaired
F
[the Zoning Board]
1
.
They
VP
[only
F
[the Zoning Board]
1
VP
[investigated the question whether you
know the woman who chaired e
1
]]
(9) * [Which board]
1
did they investigate the
question whether you know the woman
who chaired e
1
?
(10) They investigated the question whether
you know the woman who chaired [every
board in town]
1
.
*
S
[[Every board in town]
1S
[they investi-
gated the question whether you know
the woman who chaired e
1
]]
While Focus Movement (if it exists) behaves
like wh-movement and quantifier movement
with respect to crossover phenomena, it dif-
fers from both kinds of transformation with
respect to the usual island constraints.
3. Rooths In Situ Theory of Focus
3.1Examples
Rooths theory of focus allows focused con-
stituents to associate with a focus sensitive
operator while staying in situ. On his pro-
posal, F-features are assigned to constituents
at Surface Structure and are passed on to the
expressions of the intensional language via
the level of Logical Form. That is, Rooths
version of intensional logic allows meaningful
expressions of the form
F
[], where is any
expression of some type . The expressions of
the intensional logic are then recursively as-
signed two denotations. The first denotation
is the usual intension (neglecting a compli-
cation concerning variable assignments). It is
computed without paying attention to the F-
feature. The second denotation is computed
by means of rules sensitive to the F-feature.
It determines a p-set, a set of intensions of
type for every meaningful expression of type
. P-sets are meant to capture the alternatives
created by focusing. These alternatives are
interpreted as providing the quantification
domains for focus sensitive operators like
only. Here is an example illustrating Rooths
approach.
40. The Representation of Focus 829
variable reading is possible with (13a), but
not with (13b). Rooth points out that his
theory is compatible with these facts, since it
allows NPs to be raised at the level of Logical
Form. But his NP raising operation is inde-
pendent of focusing and obeys the usual con-
straints for movement. In the case of (13a)
and (b), the focused NPs may optionally be
adjoined to their closest dominating S-node.
We have then:
(13)
a. We only wonder whether
S
[
F
[he]
1S
[e
1
was betrayed by the woman he
1
loves]]
b. We only wonder whether
S
[
F
[him]
1
S
[the woman he
1
loves betrayed e
1
]]
A condition like our Principle for Bound Var-
iables (or any of the usual principles invoked
for weak crossover) will now allow the un-
moved non-empty pronoun in (13a), but not
in (13b) to be interpreted as a bound variable.
Second logical form for (13a):
We only wonder whether
S
[
F
[he]
1S
[e
1
was
betrayed by the woman e
1
loves]]
Rooth shows that, in each case, his semantics
in terms of p-sets assigns the right interpre-
tations without having to move the focused
phrase all the way up to be adjoined as a
sister of only. The crucial point is that the
lower S-nodes indicated in the logical forms
above will be assigned -abstracts of the form
v
e,1
[...] by the translation procedure. De-
pending on which pronouns are allowed to
be interpreted as bound variables, the -ab-
stracts determine different properties, and we
get the following kind of p-sets for the next
higher S-constituents.
(a) P-set for:
S
[
F
[he]
1S
[e
1
was betrayed by the woman
he
1
loves]]
Assume that he
1
refers to John, and that
John, Fred, and Harry are the only mem-
bers of D
e
. This means that the p-set of
F
[he]
1
consists of John, Fred, and Harry,
and we have the following p-set for the
whole sentence:
John was betrayed by the woman John
loves
Fred was betrayed by the woman John
loves
Harry was betrayed by the woman John
loves
(b) P-set for:
S
[
F
[he]
1S
[e
1
was betrayed by the woman e
1
loves]]
Assuming again that he
1
refers to John,
introducing Sue to
Bill
introducing Ann to
John
introducing Sue to
Sue
introducing Ann to
Ann
According to Rooths semantics, the counter-
part of (11) in the intensional language will
now be true in a world w iff, out of all the
(contextually relevant) properties in the p-set
of (12), the property of introducing Bill to
Sue is the only property John has in w.
3.2Island Constraints and Crossover
Rooths approach doesnt require focused
phrases to move in order to associate with a
focus sensitive operator. Take sentence (8)
from above.
(8) They only
VP
[investigated the question
whether you know the woman who
chaired
F
[the Zoning Board]
1
].
Suppose the relevant committees in the do-
main of entities are the Zoning Board, the
Planning Board, the Rent Control Board, and
the Conservation Commission. The p-set of
the main VP (the scope of only) is then the
following set of properties:
P-set of the main VP of (8):
investigating the question whether you
know the woman who chaired the Zoning
Board
investigating the question whether you
know the woman who chaired the Planning
Board
investigating the question whether you
know the woman who chaired the Rent
Control Board
investigating the question whether you
know the woman who chaired the Conser-
vation Commission
Rooths semantics says that (8) is true iff, out
of all the properties in the above p-set, the
first property (the intension of the VP) is the
only property they had. Rooths semantics,
then, can interpret (8) without moving the
focused phrase. Hence no island violations
have to be assumed.
What about the crossover facts, one of the
main motivations for the Movement Theory
of focus? Consider the following crossover
sentences:
(13)
a. We only wonder whether
S
[
F
[he]
1
was
betrayed by the woman he
1
loves]
b. We only wonder whether
S
[the
woman he
1
loves betrayed
F
[him]
1
]
Recall that we want to explain why a bound
830 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
(15) I
I
[past
VP
[only
VP
[
VP
[go to
F
[Tanglewood]] because you did
VP
[go
to
F
[Tanglewood]]]]]
Given the mechanism of focus interpretation
as proposed by Rooth, (15) doesnt represent
a possible meaning for (15), however. Assum-
ing that the domain D
e
contains just Block
Island, Elk Lake Lodge, and Tanglewood, we
get the following p-set for the VP that con-
stitutes the scope of only in (15).
P-set for
VP
[
VP
[go to
F
[Tanglewood]] because you did
VP
[go to
F
[Tanglewood]]]:
go to Tanglewood because you went to
Tanglewood
go to Tanglewood because you went to
Block Island
go to Tanglewood because you went to
Elk Lake Lodge
go to Block Island because you went to
Block Island
go to Block Island because you went to
Elk Lake Lodge
go to Block Island because you went to
Tanglewood
go to Elk Lake Lodge because you went
to Block Island
go to Elk Lake Lodge because you went
to Elk Lake Lodge
go to Elk Lake Lodge because you went
to Tanglewood
(15) is predicted to be true iff, out of all the
properties in the above p-set, the property go
to Tanglewood because you went to Tangle-
wood is the only property I had. But thats
not a reading (15) has. What we want to say
is that, out of all the properties in the p-set
given below, the property go to Tanglewood
because you went to Tanglewood is the only
property I had.
Desired p-set:
go to Block Island because you went to
Block Island
go to Elk Lake Lodge because you went
to Elk Lake Lodge
go to Tanglewood because you went to
Tanglewood
We can get this p-set for the VP constituting
the scope of only in (15), if we raise the NP
Tanglewood at the level of Logical Form and
adjoin it to one of the dominating VPs before
reconstruction takes place. The result is
shown in (15).
(15) I
I
[past
VP
[only
F
[Tanglewood]
1VP
[
VP
[go
to e
1
] because you did
VP
[go to e
1
]]]]
and that the domain D
e
is as above, we
have:
John was betrayed by the woman John
loves
Fred was betrayed by the woman Fred
loves
Harry was betrayed by the woman Harry
loves
(c) P-set for:
S
[
F
[him]
1S
[the woman he
1
loves betrayed
e
1
]]
Assuming again that he
1
refers to John,
and that the domain D
e
is as above, we
have:
The woman John loves betrayed John
The woman John loves betrayed Fred
The woman John loves betrayed Harry
The p-sets for the next higher constituents,
and the general strategy for the computation
of the truth-conditions of (13a) and (13b) are
now straightforward.
If the focused pronoun is not raised in
(13a) and (13b) (also an option), we get the
p-sets (a) and (c) respectively for the relevant
S-constituents, hence no new readings.
This means that Rooth predicts exactly the
correct range of readings for (13a) and (b).
3.3Problems
Consider the following sentence:
(14) I
VP
[laughed] because you did
VP
[e]
(14) is a case of VP deletion. This construction
is discussed in Sag (1976) and Williams
(1977). VP deletion is assumed to involve a
reconstruction process copying the missing
VP from an appropriate antecedent VP at the
level of Logical Form. The result is (14).
(14) I
I
[-ed
VP
[
VP
[laugh] because you did
VP
[laugh]]]
Imagine now you are angry at me and start
voicing the following accusations. What a
copy cat you are! You went to Block Island
because I did. You went to Elk Lake Lodge
because I did. And you went to Tanglewood
because I did. I feel you exaggerate and
reply:
(15) I only
VP
[went to
F
[Tanglewood]] because
you did
VP
[e]
On Rooths approach, we always have at least
the option to interpret a focused proper name
like Tanglewood in situ. So let us explore this
option here. After reconstruction, (15)
should then be a possible logical form asso-
ciated with (15).
40. The Representation of Focus 831
for F-indexing). Every Logical Form expres-
sion is assigned two intensional logic trans-
lations. For any Logical Form phrase , is
its usual translation and is its presuppo-
sition skeleton. The presupposition skeleton
for a given phrase is computed like the ordi-
nary translation, using the same rules, except
that F-marked constituents are translated as
designated variables (see Rooth 1985, p. 12
for a sketch of a recursive definition). When-
ever is an F-marked constituent bearing the
F-index n, and is of type , then is the
nth designated variable of type .
4.2Changes in the Intensional Logic
The intensional language assumed here has
to be changed as to accommodate designated
variables.
Adding designated variables:
For every natural number n and type , V
n,
is a designated variable of type .
Two variable assignments:
We distinguish two variable assignments. Or-
dinary assignments assign values of the ap-
propriate type to ordinary variables. Distin-
guished assignments assign appropriate val-
ues to distinguished variables. All meaningful
expressions are assigned intensions relative to
an ordinary and a distinguished assignment.
Here are some examples:
For all natural numbers n, all types T, and
all ordinary assignments g and distinguished
assignments h we have:
Denotations for the ordinary variables
v
,n
g,h
= g(v
,n
)
Denotations for the designated variables
V
,n
g,h
= h(V
,n
)
Denotations for the constants
Ann
g,h
= Ann
..........................................
Denotations for complex expressions
If ME
and u is an ordinary variable
of type , then u[]
g,h
= that function f
D
,
such that for any a D
, f(a) =
ga/u,h
.
4.3P-Sets
The addition of designated variables to the
intensional language allows us to give the
following very simple definition of p-sets.
Where a is any meaningful expression of some
type T, and g any ordinary variable assign-
ment we define
g
, the p-set of with
respect to g, as follows:
Given that the meaning determined by (15)
is the only meaning (15) has, we must now
conclude that focused phrases are obligatorily
moved in these cases. If we have to concede
that focused phrases are obligatorily moved
in some cases, can we at least assume that
this kind of movement has the usual proper-
ties? I think the answer is negative, as shown
by the following examples.
(16) Context: You always see more Edsels
than I do.
No, I only saw more
F
[pink] Edsels than
you did.
(17) Context: You always contact every re-
sponsible person before me.
No, I only contacted the person who
chairs
F
[the Zoning Board] before you
did.
In (16), an adjective phrase would have to be
moved out of a noun phrase to get the correct
reading, not the sort of movement that is
possible otherwise.
(16) *It was pink that I saw Edsels
In (17), a noun phrase would have to be
moved out of a wh-island and a noun phrase,
again a serious violation.
(17) *It was the Zoning Board that I con-
tacted the person who chairs.
We have to conclude, then, that Rooths in
situ interpretation mechanism for focused
phrases doesnt help us avoid unusual kinds
of movement operations for such phrases.
4. A Presupposition Skeleton Version
of the In Situ Theory
In this section, I want to argue that the more
representational version of Rooths theory
that he briefly mentions at the beginning of
his dissertation (p. 12) allows us to define p-
sets in a slightly different way, thereby avoid-
ing the difficulties that we saw arise in the
previous section.
4.1Two Translations
As before, let us assume that focused constit-
uents are F-marked at Surface Structure and
that F-marking is passed on to Logical Form.
Let us assume furthermore that all F-
marked constituents bear an F-index. F-in-
dices are assigned at Surface Structure in such
a way that no two constituents bear the same
F-index in a given tree (the novelty condition
832 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
say.
(a) Logical Form:
F2
[Sue
1
] thinks she
1
is funny]
Presupp. Skeleton:
think(funny(she
1
)) (V
e,1
)
P-Set: Sue thinks Sue is funny
Ann thinks Sue is funny
Maria thinks Sue is funny
(b) Logical form:
S
[
F2
[Sue
1
]
S
[e
1
thinks she
1
is funny]]
Presupp. Skeleton:
v
e,1
[think(funny(she
1
)) (v
e,1
)] (V
e,1
)
P-set: As for (a)
(c) Logical Form:
S
[
F2
[Sue
1
]
S
[e
1
thinks e
1
is funny]]
Presupp. Skeleton:
v
e,1
[think(funny(v
e,1
)) (v
e,1
)] (V
e,1
)
P-set: Sue thinks Sue is funny
Ann thinks Ann is funny
Maria thinks Maria is funny
(d) Logical Form:
F2
[Sue
1
] thinks
F3
[she
1
] is funny
Presupp. Skeleton:
think(funny(V
e,3
)) (V
e,2
)
P-set: Sue thinks Sue is funny
Sue thinks Ann is funny
Sue thinks Maria is funny
Ann thinks Ann is funny
Ann thinks Maria is funny
Ann thinks Sue is funny
Maria thinks Maria is funny
Maria thinks Ann is funny
Maria thinks Sue is funny
(e) Logical Form:
S
[
F2
[Sue
1
]
S
[e
1
thinks
F3
[she
1
] is funny]]
Presupp. Skeleton:
v
e,1
[think (funny (V
e,3
)) (v
e,1
)] (V
e,2
)
P-set: As for D
Sentence (18) allows possibilities (a), (b), and
(c). Sentence (19) allows possibilities (d) and
(e). (18) is the kind of example we discussed
before. (19) is interesting since it illustrates
that F-indexing must assign different F-indi-
ces to different focused phrases even if they
bear the same referential index.
4.6VP-Deletion
Let us finally examine how the Presupposition
Skeleton Theory deals with the VP-deletion
cases that were troublesome for Rooths of-
ficial proposal. Take (15) from above.
(15) I
I
[past
VP
[only
VP
[
VP
[go to
F2
[Tanglewood]] because you did
VP
[e]]]]
a
g
= {a D
: h [h is a designated assign-
ment and a =
g,h
]}
In the above definition, p-sets are defined
with the help of the designated variable as-
signments. This feature is the crucial differ-
ence between the current proposal and
Rooths proposal. Variable assignments as-
sign the same values to different occurrences
of the same variable. This is what will be
responsible for a correct account of the VP-
deletion cases as we will see shortly.
4.4The Semantics of only (as VP-Modifier)
We are now ready to spell out the semantics
for focus sensitive quantifiers like only.
(i) Translation of logical forms into the in-
tensional language:
Whenever is a Logical Form expression
of the form
VP
[only
VP
[]],
then = only ()().
(Recall that is the ordinary translation
of , and is its presupposition skele-
ton).
(ii) Only in the Intensional Language:
In the intensional language assumed here,
only = only is treated syncategoremati-
cally, that is, it is not assigned a type.
Syntax of only
If and ME
e,t
, then only()()
ME
e,t
.
Semantics of only
If and ME
e,t
, then only()()
g,h
= that function f
1
D
e,t
such that for
any a D
e
and any w W, w f
1
(a) iff
w
g,h
(a) and for all f
2
g
, if w
f
2
(a), then f
2
=
g,h
.
4.5Examples
Consider the following sentences:
(18) I only
VP
[said that
F2
[Sue
1
] thinks she
1
is
funny].
(Who thinks she is funny?)
(19) I only
VP
[said that
F2
[Sue
1
] thinks
F3
[she
1
]
is funny].
(Who thinks who is funny?)
The semantics sketched above determines the
same p-sets for sentences (18) and (19) as
Rooths semantics. Assuming that the domain
D
e
contains just Sue, Ann, and Maria, and
that she
1
refers to Sue, we get the following
logical forms, intensional logic translations,
and p-sets for the sentential complements of
40. The Representation of Focus 833
quite a number of siblings in
the group. Bill is the older
brother of Mary.
Question:Are there many girls in the
group that are taller than
their older brothers?
Answer: No, I dont think so.
I can only see that
F
[Mary]
is taller than
F
[Bill]
Zimmermanns point is that on Rooths of-
ficial approach, it is hard to see how we can
explicitely restrict the p-set determined by the
sentential complement of the verb see in (20)
to propositions of the kind b is an older
sibling of a and a is a girl and b is a boy and
a is taller than b. The example might not yet
be absolutely convincing since it seems to
assume that all contextual restrictions have
to be spelled out in the translation procedure.
This objection might be eliminated, however,
by considering answers of the following kind:
(21) As for girls and their older brothers, I
can only see that
F
[Mary] is taller than
F
[Bill]
In (21), the restriction for the domain of
quantification is explicit and should be al-
lowed to play a systematic role in determining
the p-set associated with the sentential com-
plement of see. This is a problem for Rooth.
The Presupposition Skeleton Theory seems to
be in a better position here, since it allows
distinguished variables to be explicitely re-
lated to each other.
I conclude that, all in all, in situ theories
of focus are to be preferred over movement
theories. And that among the in situ theories,
representational theories seem to be more ad-
equate than denotational theories. In drawing
this conclusion, I want to emphasize, how-
ever, that the representational in situ theory
argued for here is only a slightly different
version of Rooths official proposal. In par-
ticular, it allows us to keep all the essential
features of his analysis of focus. These fea-
tures include a very elegant semantic analysis
of focus sensitive quantifiers, a convincing
account of the crossover facts, and a highly
constrained theory of movement.
5. Appendix: An Example of a -
Categorial Intensional Language
0. The language L is an intensional -cate-
gorial language as used in Cresswell (1973),
except that it admits the syncategorematic
I want to show that we can derive the correct
meaning of (15) without having to move the
focused NP. In this particular case, the fo-
cused NP could move, of course. But this
movement should only be optional. And as
we saw above, there are more complicated
VP-deletion cases where we dont want to
assume the possibility of movement at all.
Hence it is important to be able to capture
even benign VP-deletion cases like (15) with-
out having to assume that the focused con-
stituent has to move.
Assume (as usual) that the missing VP of
(15) is reconstructed at the level of Logical
Form. The result is (15).
(15) I
I
[past
VP
[only
VP
[
VP
[go to
F2
[Tanglewood]] because you did
VP
[go
to
F2
[Tanglewood]]]]]
The normal translation, the presupposition
skeleton, and the p-set for the VP that con-
stitutes the scope of only are then as given
below (leaving out tense).
Logical Form
VP
[go to
F2
[Tanglewood]] because you do
VP
[go to
F2
[Tanglewood]]]
Normal Translation
v
e,1
[because(go(Tanglewood)(v
e,1
)) (go
(Tanglewood)(you))]
Presupposition skeleton
v
e,1
[because(go (V
e,2
)(v
e,1
))
(go(V
e,2
)(you))]
P-set, assuming that D
e
= {Tanglewood,
Elk Lake Lodge, Block Island}
go to Tanglewood because you go to Tan-
glewood
go to Elk Lake Lodge because you go to
Elk Lake Lodge
go to Block Island because you go to Block
Island
Note that a presupposition skeleton as the
one above can only arise through copying
operations beyond Surface Structure. The
novelty constraint for F-indexing wouldnt
(and shouldnt, see sentence (19)) allow the
appearance of two occurrences of the same
designated variable otherwise.
Von Stechow (1989) reports an observation
of Thomas Ede Zimmermann also intended
to show that it is a structural defect of
Rooths official theory that focusing
doesnt involve variables. Here is a version of
Zimmermanns example:
(20)Situation:We are looking at a group
of children about to leave
for summer camp. There are
834 X. Residua: Prpositionen, Gradpartikeln, Fokus
6. Denotations
For any expression ,
g
is the denota-
tion of with respect to a variable assign-
ment g. A variable assignment is a function
that assigns to each variable of type a
member of D
, for all types .
7. Denotations for the constants
(1)
Jan
g
= Jan .... etc. ....
(2)
weep
g
is that function f D
e,t
such
that for any a D
e
and any w W,
w f(a) iff a weeps in w.
....... etc. .......
(5)
the
g
is that function D
e,t,e,t,t
such that for any h
1
, h
2
D
e,t
and
any w W, w f(h
1
)(h
2
) iff there is an
a D
e
such that w h
1
(a) and w
h
2
(a), and for all b D
e
, if w h
1
(b),
then b = a.
........ etc. .......
8. Denotations for the variables
v
n,
g
= g(v
n,
) for all natural numbers n
and types .
9. Denotations for the complex expressions
(2) For any types a and , if ME
,
,
and ME
, then ()
g
=
g
(
g
).
(3)
If is in ME
t
then not
g
= W
g
.
(4)
If and ME
t
then and
g
=
g
g
.
(5)
If and ME
t
then or
g
=
g
g
.
(6) If and ME
e
, and w W, then
w =
g
iff
g
=
g
.
(7) If ME
and u is a variable of type
, then u []
g
= that function
f D
,
such that for any h D
,
f(h) =
g h/u
.
(8) If ME
t
and w W, then w
necessarily
g
iff for all w W, w
g
.
(9) If ME
t
and w W then w
possibly
g
iff there is a w W such
that w
g
.
6. Short Bibliography
Cresswell 1973 Chomsky 1976 Chomsky/Lasnik
1977 Horvath 1981 Horvath 1986 Jackendoff
1972 Jacobs 1983 Rooth 1985 Sag 1976 Sel-
kirk 1984 v. Stechow 1981b v. Stechow 1982a
v. Stechow 1989 Williams 1977
Angelika Kratzer, Amherst,
Massachussetts (USA)
treatment of logical constants. To facilitate
communication, it is given the looks of Mon-
tagues intensional logic. Unlike Montagues
intensional logic, it has no ups and
downs. All expressions (except the logical
constants) are assigned intensions with re-
spect to a variable assignment.
1. The definition of types
The types of L are recursively defined as
follows:
(1) e is a type.
(2) t is a type.
(3) if and are types, then , is a
type.
2. Assignment of constants to types
(1) Jan, Jacob, Ann, Maria are constants
of type e.
(2) laugh, weep are constants of type e,t.
(3) spot, greet are constants of type
e,e,t.
(4) girl, boy, rabbit, mayor are constants
of type e,t.
(5) a(n), every, the, no are constants of
type e,t, e,t,t.
3. The variables of L
For any type , and any natural number
n, v
n,
is a variable of type .
4. Syntactic Rules
For any type , the set of meaningful ex-
pressions of type , denoted by ME
, is
recursively defined as follows:
(1) Every constant or variable of type is
a member of ME
.
(2) For any types and , if ME
,
,
and ME
, then () ME
.
(3) If is in ME
t
, so is not .
(4) If and are in ME
t
, so is [ and ].
(5) If and are in ME
t
, so is [ or ].
(6) If and ME
e
, then [ = ] ME
t
.
(7) If ME
and u is a variable of type
, then u [] ME
,
.
(8) If ME
t
, then necessarily ME
t
.
(9) If ME
t
, then possibly ME
t
.
5. Semantic domains
Let D be the set of all possible individuals,
and W the set of all possible worlds. We
can then define the set D
(the set of pos-
sible denotations of type ) for any type
as follows:
(1) D
e
= D.
(2) D
t
= the power set of W
(3)
For any types and , D
,
= D
D
,
that is, the set of functions from D
to
D
.
835
XI. Service-Artikel
Service-Article
41. Formale Methoden in der Semantik
beispiele schliet sich an. Einer der grund-
stzlichen Punkte der Kritik an diesem Pro-
gramm der logischen Formen betrifft die man-
gelnde Explizitheit des Formalisierungsver-
fahrens. Anhand der Kennzeichnungen als
formalen Gegenstcken von definiten NPn
werden zudem die Grenzen einer zweiwertigen
und kontextfreien Logik deutlich.
Der dritte Abschnitt stellt eine dreiwertige
Logik vor, in deren Rahmen die bei den Kenn-
zeichnungen exemplarisch auftretende Pro-
blematik der Prsuppositionen behandelt
wird. Ferner wird die Alternative einer zwei-
wertigen Kontext-Semantik besprochen, die
den Bereich der Prsuppositionslcken durch
das Instrument der Zulssigkeit in einem ge-
gebenen Kontext ausblendet. Es wird ver-
sucht, die Semantizitt auch dieses Ansat-
zes (trotz des pragmatischen Anstrichs) her-
auszustellen und zur Klrung des Demarka-
tionsstreits zwischen Semantik und Pragma-
tik beizutragen. Als wesentlich neues Moment
wird dabei der Gedanke einer Dynamisierung
der Semantik festgehalten.
Der vierte Abschnitt ist der Montague-
Grammatik gewidmet. Sie setzt das Pro-
gramm der logischen Formen insofern fort,
als auch sie an einem statischen Bild seman-
tischer Reprsentationen festhlt. Allerdings
wird nunmehr das bersetzungsverfahren in
die formale Sprache durch einen expliziten
Algorithmus beschrieben, der einem strengen
Kompositionalittsprinzip gehorcht. Nicht zu-
letzt dieser Umstand verhalf diesem Ansatz
ber Jahre hinweg zu einer enormen Popu-
laritt innerhalb der Linguistik: das Schreiben
grammatischer Regeln konnte nun erstmals
einhergehen mit der simultanen Formulierung
ihrer semantischen Funktion. Zudem bietet
das System Lsungen zu einer Vielzahl se-
mantischer Probleme an, die sich den groen
Themenbereichen intensionale Kontexte sowie
Quantifikation und Anaphern zuordnen las-
sen. So erwies sich die Montague-Grammatik
als ein hervorragendes Testgebiet fr die Er-
1. Einleitung und berblick
2. Die Explikationssprache PL1
2.1 Die Syntax von PL1
2.2 Das Standard-Formalisierungsverfahren
2.3 Die Semantik von PL1
3. Prsuppositionen: dreiwertige Logik und
Kontextsemantik
4. Montague-Grammatik
5. Die Theorie der Diskursreprsentationsstruk-
turen (DRT)
6. Algebraische Semantik
6.1 Die Theorie der Generalisierten Quantoren
(GQT)
6.2 Anwendungen in der Theorie der Pluralia,
Massenausdrcke und Ereignisse
7. Weitere Anstze
8. Literatur (in Kurzform)
1.
Einleitung und berblick
Der vorliegende Artikel gibt einen berblick
ber die wichtigsten formalen Methoden der
(satz-)semantischen Forschung. Den Aus-
gangspunkt bildet die klassische logische
Sprachanalyse; in ihrem Rahmen werden
so lautet das Ziel natursprachliche Dekla-
rativstze in der Prdikatenlogik der ersten
Stufe (PL1) semantisch korrekt und mglichst
vollstndig formalisiert. Die Wahrheitsbedin-
gungen der Stze bestimmen sich auf diese
Weise indirekt ber die Wahrheitsbedingun-
gen ihrer logischen Formen in der gegebenen
PL1-Semantik. Auf diese Weise wird die Be-
deutung der logischen Strukturwrter der
Sprache wie und, oder, nicht, alle, ein, der
formal przisiert. Trotz der wechselnden Be-
urteilung ihrer Rolle als angemessene Expli-
kationssprache fr semantische Reprsenta-
tionen bildet die PL1 nach wie vor sozusagen
das elementare Rstzeug jeder semantischen
Untersuchung.
Im zweiten Abschnitt wird daher ihre Lo-
gik in knapper, aber prziser Form darge-
stellt; die Diskussion einiger Formalisierungs-
836 XI. Service-Artikel
Grundsymbole von PL1 besteht aus fol-
genden Mengen:
1. Eine (abzhlbar unendliche) Menge
Var
T
von (Individuen-)Variablen;
MZ: x, y, z (StI)
2. eine (abzhlbar unendliche) Menge
Con
T
von (Individuen-)Konstanten;
MZ: a, b, c (StI)
3. fr jedes n N eine (abzhlbar unend-
liche) Menge von n-stelligen
Prdikat-Konstanten;
MZ: P
n
, Q
n
, R
n
(StI)
4. die Menge LK der logischen Konstan-
ten: (Negation), (Konjunk-
tion), (Disjunktion), (Kondi-
tional oder materiale Implikation),
(Bikonditional), (Allquantor),
(Existenzquantor);
5. das Identittssymbol =;
6. der Iota-Operator und der Abstrak-
tionsoperator ;
7. die Klammersymbol-Paare (,) und
[,].
Die aufgefhrten Mengen seien disjunkt, und
kein Grundsymbol sei ein geordnetes Paar
oder eine Folge von anderen Grundsymbolen.
Ferner seien im folgenden die Grundsymbole
unter Ziffer 4 bis 7 autonym verwendet.
DefT := Var
T
Con
T
ist die Menge der (In-
dividuen-) Terme; MZ: t, r, s (StI)
DefCon
P
=
nN
ist die Menge der
Prdikatkonstanten; MZ: P, Q, R, S (StI)
DefCON := Con
T
Con
P
ist die Menge der
Konstanten; MZ: (StI)
DefGA := Var
T
CON ist die Menge der
Grundausdrcke.
DefAD := GS* (= die Menge der endlichen
Ketten von Grundsymbolen oder der
Wrter ber GS) ist die Menge der Aus-
drcke von PL1. Beispiel: xy a)(P .
Der Sinn syntaktischer Regeln ist die Aus-
zeichnung der wohlgeformten Ausdrcke
(kurz: wfA) innerhalb der Menge AD, aus-
gehend von den wohlgeformten Grundsym-
bolen, den Grundausdrcken. Die elementare
Prdikation und die logischen Verknpfungen
liefern komplexe wohlgeformte Ausdrcke
der Kategorie Formel, die Lambda-Abstrak-
tion komplexe wfAe der Kategorie 1-stelliges
Prdikat, und der Iota-Operator komplexe
wfAe der Kategorie Individuenterm (sog.
Kennzeichnungen). Da die syntaktischen Re-
geln zwischen diesen Kategorien hin- und
herspringen, ist der Begriff eines wfAs in
PL1 simultan induktiv zu definieren.
probung konkreter Implementierungsvor-
schlge im Rahmen einer semantisch basier-
ten Grammatik. In einigen ihrer Grundan-
nahmen wurde sie in der Folgezeit jedoch
nachhaltig kritisiert.
Aus dieser Kritik erwuchsen neuere An-
stze in der Semantik, die in den folgenden
Abschnitten diskutiert werden. Im Abschnitt
5 wird die Diskursreprsentationstheorie
(DRT) als eines der fhrenden Systeme unter
den dynamischen Anstzen vorgestellt. Der
sechste Abschnitt zeichnet die zunehmende
Verwendung algebraischer Methoden in der
Semantik nach. Eingegangen wird in diesem
Zusammenhang auf die Theorie der Genera-
lisierten Quantoren, die Boolesche Semantik,
die Theorie der Pluralia und Massenaus-
drcke sowie auf neuere Theorien einer Er-
eignis-Semantik. Im letzten und siebten Ab-
schnitt finden weitere Anstze Erwhnung,
die im vorliegenden Rahmen nicht ausfhrli-
cher behandelt werden konnten.
Das traditionelle Programm der logischen
Formen wurde also in zwei Richtungen re-
formiert: durch eine Algorithmisierung
(Stichwort Kompositionalitt) und eine Dy-
namisierung (Stichwort Theorie der seman-
tischen Reprsentationen und ihrer Vern-
derung im sprachlichen Informationsflu).
Diese beiden Entwicklungen waren nicht
ohne weiteres miteinander vertrglich, wie
anhand der Problematik der sog. donkey-
Stze (siehe Abschnitt 4) exemplarisch klar
wurde. Eines der Ziele semantischer For-
schung wird also die Vershnung dieser bei-
den Anstze sein. Die algebraisch orientierte
Semantik kmmert sich um die notwendige
Verfeinerung des technischen Instrumenta-
riums, whrend einige der im siebten Ab-
schnitt genannten Theorien (so etwa die Si-
tuationstheorie) die Grundlagenfrage stellen
und dazu auffordern, den Begriff der Wahr-
heit und den der Bedeutung neu zu ber-
denken und zu begrnden.
2. Die Explikationssprache PL1
(= Prdikatenlogik 1. Stufe)
2.1Die Syntax von PL1
Hier und im folgenden stehe MZ fr Mit-
teilungszeichen, StI fr auch mit Strichen
und Indizes versehen, N fr die Menge der
natrlichen Zahlen 0, sowie gdw fr ge-
nau dann wenn.
DefDas Vokabular oder die Menge GS der
41. Formale Methoden in der Semantik 837
VB[t, s; x; ] gdw VB[t; x; ] und
VB[s; x; ].
Die fr die Sprachanalyse wichtigen logischen
Prinzipien sind die folgenden.
Theorem: All-Spezialisierung und Existenz-
Abschwchung
(T) [x ] wobei a Con
T
(T) [ x] wobei a Con
T
In Worten: (TV) Wenn alle Dinge sind, so
ist auch a ein ; (T) wenn a ein ist, so gibt
es ein Ding, das ist.
Theorem: Substitutivitt
(TS) [(t = s) [[t] [s]] wobei
VB[t, s; [*]; [*]]
In Worten: Wenn t identisch mit s ist, so ist
t genau dann ein , wenn s ein ist.
Theorem: Lambda-Konversion
(T) [(x)a ] wobei a Con
T
In Worten: Wenn a ein Ding x ist derart da
x ein ist, so ist a ein .
Theorem: Iota-Eliminierung
(T) [(x) y[x[ x = y] y]]
wobei y FR()
In Worten: Dasjenige Objekt, das ist, hat
genau dann die Eigenschaft , wenn es genau
ein y gibt, das ist und die Eigenschaft
hat; prziser: ... wenn es ein y gibt, welches
fr alle x genau dann mit x identisch ist, falls
x ein ist, und welches die Eigenschaft hat.
2.2Das Standard-Formalisierungsverfahren
Das Standard-Formalisierungsverfahren (es
werde i. f. S genannt) hat zum Ziel, die satz-
semantischen Beziehungen der natrlichen
Sprache mit Hilfe des formalen Folgerungs-
begriffs der Prdikatenlogik zu explizieren.
Zwei Adquatheitsforderungen knnen an
ein Formalisierungsverfahren gestellt werden
(Blau 1978): (i) die intuitive Korrekheit besagt,
da die Formalisierungen zu keinen formalen
Folgerungsbeziehungen im PL1 Anla geben,
die zwischen den jeweiligen Ausgangsstzen
in der natrlichen Sprache intuitiv nicht be-
stehen; schlagwortartig ausgedrckt: alles,
was formal folgt, folgt auch intuitiv. (ii) die
intuitive Vollstndigkeit dagegen besagt, da
alle intuitiven Folgerungen der natrlichen
Sprache durch die Formalisierung auch als
formal gltig herauskommen; kurz: alles, was
intuitiv folgt, folgt auch formal. Whrend die
Forderung (i) ziemlich strikt zu realisieren ist,
soll das Verfahren zu etwas ntze sein, mu
(ii) graduell verstanden werden: ein gutes For-
malisierungsverfahren sollte mglichst voll-
stndig sein. Das Verfahren S lt nicht nur
im Hinblick auf die Forderung (ii), sondern
DefSimultane induktive Definition der Men-
gen FOR der Formeln, T der (Indivi-
duen-) Terme und P
n
der n-stelligen Pr-
dikate (n N) von PL1:
1. T T,
P
n
(n N);
2. p
n
t
o
, ..., t
n1
FOR fr n N, p
n
P
n
,
t
i
T (i < n);
3. (t = s) FOR fr t, s T;
4. FOR fr FOR;
5. ( J) FOR fr , FOR und
J = , , , ;
6. x, x FOR fr FOR und
x Var
T
;
7. (x) P
1
fr FOR und x Var
T
;
8. (x) T fr FOR und x Var
T
;
Def WA := FOR T
nN
P
n
ist die
Menge der wohlgeformten Ausdrcke von
PL1. MZ fr WA: , , (StI); fr FOR:
, , (StI); fr T:t, r, s (StI); fr P
n
: p
n
, q
n
(StI). Der Stelligkeitsindex 1 wird im folgen-
den weggelassen. WfAe der Gestalt 8 heien
-Terme, solche der Gestalt 7 -Terme; letztere
werden durch (StI) mitgeteilt.
Def Substitution. Es seien eine Formel, r
ein -Term, ein -Term, x eine Variable und
t ein Term. (Ein Vorkommen von) x heie frei
in (bzw. r bzw. ), wenn (dieses Vorkommen
von) x nicht im Bereich eines gleichnamigen
Binders x, x, x, x in (bzw. r bzw. )
steht, d. h. nicht innerhalb der krzesten For-
mel, die auf einen solchen Binder unmittelbar
folgt. Ein wfA heit geschlossen, wenn er kein
freies Vorkommen einer Variable enthlt;
sonst heit er offen. Die Substitution (bzw.
bzw. ) des Substitutionsterms t fr x in
(bzw. r bzw. ) sei das Ergebnis der Ersetzung
aller freien Vorkommen von x in (bzw. in
r bzw. in ) durch t. [*] ist eine Nennform,
d. h. ein Ausdruck, der aus der Formel
entsteht, wenn an einer (oder mehreren) aus-
gezeichneten Termposition(en) statt des dor-
tigen Terms der Stern eingesetzt wird. Diese
Positionen heien dann Nennstellen. [t] ist
eine Formel in Nennform-Schreibweise, die
an den Nennstellen den Term t enthlt. FR()
sei die Menge der in dem wfA frei auftre-
tenden Variablen. Ferner gelte die folgende
Abkrzung:
Abk(Variablenbedingung) VB[t; x; ] gdw t
ist frei fr x in , d. h. keine in t frei
auftretende Variable werde an freien x-
Stellen in gebunden;
838 XI. Service-Artikel
Qx : x ist ein Problem
P
2
xy : x kennt y
Q
2
xy : x ist eine Lsung fr y
R
2
xy : x fllt y ein
B4 Das Einhorn spricht nicht.
EF1:Es ist nicht der Fall, da dasjenige y
welches ein Einhorn ist, spricht.
LF1: P(yQy)
EF2:Dasjenige y, welches ein Einhorn ist, ist
ein x derart da es ist nicht der Fall,
da x spricht.
LF2:(xPx)(yQy)
Px : x spricht
Qx : x ist ein Einhorn
B5 Jeder Deutsche, der ein Auto hat, putzt
es.
EF: Fr alle x : fr alle y : wenn x ein Deut-
scher ist und y ein Auto ist, und x hat y,
dann putzt x y.
LF:
xy[[Px Qy P
2
xy] Q
2
xy]
Px : x ist ein Deutscher
Qx : x ist ein Auto
P
2
xy : x hat y
Q
2
xy : x putzt y
Bemerkungen
1. In der Explizitfassung EF wurden jeweils
die logischen Strukturausdrcke kursiv wie-
dergegeben. Wie ersichtlich, werden Eigen-
namen in Individuenkonstanten bersetzt,
Nomina und intransitive Verben in einstellige
Prdikatkonstanten, transitive Verben in
zwei- oder hherstellige Prdikatkonstanten
entsprechend der Anzahl ihrer Valenzen. Fer-
ner sind in der EF Ellipsen aufzufllen sowie
etwaige Bindungsverhltnisse durch Varia-
blen zu reprsentieren. Der unbestimmte Ar-
tikel, sofern nicht Teil eines Prdikatsnomens,
zieht in der Regel die Einfhrung eines Exi-
stenzquantors nach sich, der bestimmte Ar-
tikel die einer Kennzeichnung. Bedingte All-
stze der Form jeder P ist ein Q sind in die
typische EF fr jedes x: wenn Px dann Qx
aufzulsen, wobei wenn dann durch die
materiale Implikation formalisiert wird (ein
nicht universell gesttztes wenn dann mit
dem Konditional zu formalisieren, bringt da-
gegen Probleme mit sich; vgl. Blau 1978, Link
1979).
Die Wendung ... ist ein x derart da
schlielich wird durch Lambda-Abstraktion
wiedergegeben.
2. Das Verfahren S stellt keinen expliziten
Algorithmus dar. Eine grobe Regel lautet, da
man die Explizitfassung von links nach rechts
und von auen nach innen schrittweise her-
wegen der Intensionalittsphnomene (siehe
unten) auch im Hinblick auf die Forderung
(i) zu wnschen brig. Es nimmt jedoch nach
wie vor eine zentrale Stellung in der Semantik
ein, da die Prdikatenlogik als eine theoreti-
sche lingua franca angesehen werden mu, die
bei vielen semantischen Systemen als eine Art
Referenzsystem im Hintergrund steht.
Das Verfahren S wird in den meisten ein-
fhrenden Logik-Texten mehr oder minder
explizit beschrieben (siehe z. B. Quine 1969,
Hinst 1974, Blau 1978, Link 1979, Kalish et
al. 1980). Es geht von zwei Voraussetzungen
aus: (i) die Einteilung des natursprachlichen
Vokabulars in logische Strukturwrter (wie
nicht, und, oder, ein, der, jeder, kein) und de-
skriptive Konstanten (wie Mensch, schlft,
sieht); (ii) die Kanonisierbarkeit eines jeden
natursprachlichen Satzes zu einer geeigneten
Explizitfassung (EF); diese kann bereits Va-
riablen enthalten und ist bis auf Stellungs-
unterschiede isomorph zu einer prdikaten-
logischen Struktur. Die Explizitfassung
braucht dann in einem zweiten Schritt ledig-
lich durch Austausch der Konstanten in eine
PL1-Formel bersetzt zu werden (die logische
Form LF des Satzes). An einigen Beispielen
sei dieses Verfahren exemplarisch erlutert.
B1 Hans gibt Anna den Ball
EF:Hans gibt Anna dasjenige x so da x ein
Ball ist
LF:
P
3
ab(xQx)
P
3
xyz : x gibt dem y Objekt z
Qx : x ist ein Ball
a : Hans
b : Anna
B2 Peter liest ein Buch und denkt darber
nach.
EF:Es gibt ein Buch x so da Peter liest x
und Peter denkt ber x nach.
LF:
x[Qx P
2
ax Q
2
ax]
P
2
xy : x liest y
Q
2
xy : x denkt ber y nach
Qx : x ist ein Buch
a : Peter
B3 Jeder Logiker kennt ein Problem, fr das
ihm keine Lsung einfllt.
EF:Fr alle x : wenn x ein Logiker ist, dann
gibt es ein y, so da y ein Problem ist
derart da x kennt y und es gibt kein z,
so da z eine Lsung fr y ist und z fllt
x ein.
LF:
x[Px y[Qy P
2
xy z [Q
2
zy
R
2
zx]]]
Px : x ist ein Logiker
41. Formale Methoden in der Semantik 839
wahr oder falsch sind, ohne einer Ergnzung
zu bedrfen.
DefEs sei E eine Menge; dann sei EXT(E)
= {1, 1} E
nN,n1
Pot(E
n
).
DefEin Modell fr PLI ist ein Tripel
M = D, .
M
, so da gilt:
1. D (D heit der Individuenbereich
des Modells);
2. D ( ist ein dummy-Symbolfr auf-
tretende Denotationslcken);
3. .
M
ist eine Funktion von CON in
EXT(D), so da gilt:
(i) a
M
D (a Con);
(ii)
P
n
M
Pot(D
n
) (P
n
, nN, n 1)
(iii)
P
0
M
{1, 1} (P
0
)
DefEine Variablenbelegung zu einem Modell
M = D, .
M
, ist eine Funktion g von
Var
T
in D.
DefEs seien M = D, .
M
, ein PL1-
Modell, g eine Variablenbelegung zu M,
d D, und x Var
T
. Die x,d-Variante
von g ist definiert als die Funktion
g(x : d) := (g \ {x,g(x)}) {x,d}.
In der folgenden Definition wird davon Ge-
brauch gemacht, da die Wahrheitswerte
durch zwei ganze Zahlen dargestellt werden,
die als solche geordnet (1 < 1) sowie arith-
metischen Operationen unterworfen sind. Da-
her knnen der Tausch des Wahrheitswerts
bei der Negation durch die Funktion x, die
Konjunktion und die Allquantifikation durch
die Infimum-Funktion inf (= der kleinste der
beteiligten Wahrheitswerte) sowie die Dis-
junktion und die Existenzquantifikation
durch die Supremum-Funktion sup (= der
grte der beteiligten Wahrheitswerte) aus-
gedrckt werden. Es ist ja etwa eine Kon-
junktion ( ) intuitiv genau dann wahr,
wenn die Wahrheitswerte von und von
beide wahr lauten, d. h. = 1 sind; genau
dann aber ist auch ihr Infimum = 1. Analoges
gilt fr die Disjunktion und die Verallgemei-
nerungen dieser Junktoren, den All- bzw. den
Existenzquantor.
DefEs seien M = D, .
M
, ein PL1-
Modell und g eine Variablenbelegung zu
M. Dann ist das Denotat des wfA be-
zglich M und g,
M,g
, simultan induk-
tiv wie folgt definiert:
1.1
x
M,g
= g(x) (x Var
T
);
1.2
a
M,g
= a
M
(a Con
T
);
1.3
P
n
M,g
= P
n
M
(P
n
, n N);
stellt. Eigentlich mu man aber die ausge-
drckte logische Form schon kennen, wenn
man die Explizitfassung hinschreibt. Am au-
genflligsten ist das im Beispiel B5, in dem
die indefinite NP ein Auto keineswegs eine
existentielle, sondern eine allquantifizierende
Kraft besitzt. Zu diesem Phnomen der sog.
donkey-Stze siehe unten. Allerdings ergibt
sich die -Interpretation des unbestimmten
Artikels auf nicht ganz so erratische Weise,
wie es zunchst den Anschein haben mag.
Man kann z. B. in jedem Satz eine (mgli-
cherweise leere) Operatorposition (in B5: je-
der), einen (Operator-)Bereich (in B5: Deut-
scher, der ein Auto hat) sowie einen Satzkern
(in B5: [er] putzt es) unterscheiden (vgl. Heim
1982); dann richtet sich die Interpretation
einer indefiniten NP im Operatorbereich nach
dem Operator, whrend sie im Satzkern exi-
stentiell ist.
3. Ein besonderes Problem stellt die Ne-
gation dar. Die klassische prdikatenlogische
Negation ist grundstzlich schwach oder de-
mentierend und wird am besten durch die
(etwas umstndliche) Wendung es ist nicht
der Fall da wiedergegeben. Ob diese der
Bedeutung der Negationspartikel in der na-
trlichen Sprache entspricht, ist eine der
Kernfragen in der Prsuppositionsdebatte;
siehe Abschnitt 3. Beispiel B4 (2) zeigt, da
in einer Logik mit Lambda-Abstraktion auch
die innere Negation ausdrckbar ist, die
von dem in Rede stehenden Einhorn lediglich
behauptet, da es nicht spricht; hier folgt, da
der Existenzquantor auen steht, formal die
Existenz des Einhorns, whrend dies fr die
Version (1) in B4, die schwache Negation mit
Skopus ber den Existenzquantor, nicht gilt.
2.3Die Semantik von PL1
EXT(E) heit die Menge der Extensionen ber
E. Ist E der Individuenbereich eines PL1-
Modells (siehe nchste Definition), so ist EXT
(E) die Menge der mglichen Denotate fr
wfAe von PL1 in diesem Modell. Dabei steht
{1, 1} fr die Menge der Wahrheitswerte (1
fr wahr und 1 fr falsch) und bildet
die Denotatmenge fr die Formeln; E ist die
Denotatmenge fr Individuenterme, und fr
jedes n 1 ist die Potenzmenge von E
n
,
Pot(E
n
), d. h. die Menge der n-stelligen Re-
lationen in E, die Denotatmenge fr die n-
stelligen Prdikate. Die Denotate 0-stelliger
Prdikatkonstanten sind Elemente von
{ 1, 1}, im Einklang mit der Intuition, da
solche Konstanten fr unpersnliche Aus-
drcke wie es regnet stehen und damit bereits
840 XI. Service-Artikel
in einem Modell, das etwa der realen Welt
entspricht, keine unerwnschten Wahrheiten
einstellen wie: (das Einhorn = die grte
Primzahl).
Daraus ergibt sich allerdings die Konse-
quenz, da die PL1-Theoreme (T), (T)
und (T) nicht uneingeschrnkt gltig blei-
ben, wenn die Substitutionsterme keine
Konstanten, sondern beliebige Kennzeich-
nungen sind. Betrachten wir zur Illustration
das Beispiel B4, auf dessen Formalisierun-
gen auch der vieldiskutierte Satz der Knig
von Frankreich ist nicht weise (siehe Ab-
schnitt 3) pat. Mit := Px und
t := (yQy) anstelle von a hat die dortige
Formel LF2 die Gestalt der linken Seite des
Theorems (T); dessen rechte Seite (wieder
mit t statt a) dagegen ist identisch mit LF1
in B4. Wenn t jedoch nicht denotiert (d. h.
wenn es das Einhorn oder den Knig von
Frankreich nicht gibt), sind (x )t (= LF2)
und die zugehrige Einsetzung (= LF1)
nicht quivalent! Dies ergibt sich wie folgt.
Es seien M ein Modell und g eine Belegung
mit t
M,g
= . Dann gilt
M,g
= Pt
M,g
= Pt
M,g
= 1,
da stets t
M,g
= P
M,g
ist und somit
Pt
M,g
= 1. Auf der anderen Seite ist
aber (x )t
M,g
= 1, wiederum wegen
(x )
M,g
(alle Prdikate sind ja Relatio-
nen im Individuenbereich D, der nicht ent-
hlt). Die genannten Theoreme sind also ge-
eignet einzuschrnken, wenn sie fr belie-
bige Substitutionsterme formuliert sind: of-
fenbar gengt die Forderung, da diese de-
notieren (Link 1979: 107). Bei der Substi-
tutivitt (TS) ist das brigens durch die Pr-
misse (t = s) bereits gegeben.
3. Sehen wir fr einen Moment von der
Komplikation ab, die durch die Einfhrung
von Kennzeichnungen entsteht, und kehren
zurck zu der ursprnglichen Formulierung
von (T). Dieses Schema sowie die Substitu-
tivitt (TS) bilden die bekannten Kriterien der
Extensionalitt der Sprache PL1. In der na-
trlichen Sprache lassen sich zwei Typen von
nicht-extensionalen Kontexten unterscheiden,
die jeweils eines dieser Kriterien verletzen. Ein
Beispiel fr den Versto gegen das Prinzip
(T) der existentiellen Abschwchung ist der
Satz Pizarro hat Eldorado gesucht (Blau
1978), dessen logische Form einfach P
2
ab lau-
tet. Formal folgt mit (T) der Existenzsatz
xP
2
ax, dessen natursprachliches Gegenstck
es gibt ein x welches Pizarro gesucht hat jedoch
2.
p
n
t
o
, ..., t
n1
M,g
= 1 gdw
t
0
M,g
, ..., t
n1
p
n
M,g
3.
(t = s)
M,g
= 1 gdw t
M,g
s
M,g
) D und t
M,g
= s
M,g
4.
M,g
=
M,g
;
5.1
( )
M,g
= inf {
M,g
,
M,g
};
5.2
( )
M,g
= sup {
M,g
,
M,g
};
5.3
( )
M,g
= sup {
M,g
,
M,g
};
5.4
( )
M,g
= (
M,g
,
M,g
),
wobei (i, j) = 1 gdw i = j, und
= 1 sonst;
6.1
x
M,g
= inf {
M,g(x:d)
d D};
6.2
x
M,g
= sup {
M,g(x:d)
d D};
7.
(x)
M,g
= {d D
M,g(x:d)
= 1}
= {d D d erfllt bezglich x};
8.
(x)
M,g
= d
o
falls (x)
M,g
=
{d
o
}, und = sonst.
DefEine PL1-Formel heit wahr im Modell
M gdw fr alle M-Variablenbelegungen
g gilt
M,g
= 1. folgt (PL1-)logisch
aus einer Formelmenge FOR gdw in
allen Modellen, in denen jede Formel in
wahr ist, auch wahr ist (Bez. 2
(PL1)
). ist eine logische Folgerung aus
einer Formel (Bez. ) gdw {}
. Ist leer, so heit logisch wahr
oder gltig (Bez. ). Eine gltige For-
mel ist also wahr in allen Modellen.
heit erfllbar gdw ist wahr in min-
destens einem Modell.
DefEin Term tdenotiert im Modell M be-
zglich der Belegung g gdw
(t = t)
M,g
= 1.
Bemerkungen.
1. Die obigen Theoreme (T), (T), (T) und
(T) sind PL1-gltig (siehe z. B. Link 1979).
2. Die vorgestellte Semantik ist im folgen-
den Sinn klassisch: (i) sie ist zweiwertig, d. h.
jede (geschlossene) Formel ist wahr oder
falsch in einem Modell; (ii) die Denotations-
funktion .
M
ist total, d. h. jede Konstante
erhlt ein Denotat in M. Allerdings trgt sie
Zge einer sog. freien Logik, da bei Kenn-
zeichnungen Denotationslcken auftreten
knnen. Das fr diesen Fall vorgesehene
dummy-Denotat gehrt nicht zum Indivi-
duenbereich und sttzt auch keine Iden-
titten (t = s) zweier nicht-denotierender
Terme (vgl. die obige Bedingung 3, wo fr die
Wahrheit der Identitt von t und s gefordert
wird, da ihre Denotate zum Individuenbe-
reich gehren). Das hat den Vorteil, da sich
41. Formale Methoden in der Semantik 841
3. Prsuppositionen: Dreiwertige
Logik und Kontextsemantik
Wie ist eine (zeitgenssische) Situation zu
analysieren, in der ein Sprecher den Satz (1a)
(Russell 1905) uert? Da es gegenwrtig kei-
nen Knig von Frankreich gibt, kann es sich
jedenfalls um keine wahre Behauptung han-
deln. Die zweiwertige Logik diktiert damit
den Wahrheitswert falsch. Dann aber mte
die Negation (1b) des Satzes wahr sein, eine
Konsequenz, die prima facie wenig plausibel
erscheint.
(1)
a. Der Knig von Frankreich ist weise.
b. Der Knig von Frankreich ist nicht
weise.
Es gibt zwei Traditionen der Analyse dieses
Problems. Die ltere geht auf Russell (1905)
zurck und siedelt das Problem vollstndig
im Bereich der logischen Semantik an. Hier
lassen sich zwei Typen von Lsungen unter-
scheiden: (i) die Skopusanalyse mit Hilfe der
klassischen Negation in einer zweiwertigen
Logik (Russell 1905; Whitehead & Russell
1927, *14; Kalish et al. 1980, Kap. 8; Mon-
tague 1974, Kap. 9); (ii) die Prsuppositions-
analyse mit Hilfe einer oder zweier Negatio-
nen im Rahmen einer Dreiwertlogik (van
Fraassen 1971, Blau 1978). Russell selbst be-
nutzte einen eigenen Skopus-Indikator, der
Teil der logischen Form ist; damit kann der
Kontext spezifiziert werden, bezglich dessen
die Elimination des Kennzeichnungsopera-
tors intendiert ist. Die resultierende syntak-
tische Komplexitt ist enorm. Quine (1969)
vereinfacht die Russellsche Analyse, indem er
den Skopusindikator fallen lt und die Eli-
mination lediglich in elementaren Prdikatio-
nen erlaubt (nach Art des Prinzips (T)). Der
Preis dafr ist, da bei negierten Stzen wie
(1b) nur noch die logische Form LF1 aus
Beispiel B4 mglich ist. Montague (1973)
stellt mit Hilfe des Lambda-Operators die alte
Flexibilitt wieder her; der Kern dieser L-
sung wurde im vorigen Abschnitt angegeben
(genau genommen kommt Montague auf-
grund seiner neuartigen Quantifikationstheo-
rie ohne Kennzeichnungsoperator in der Ex-
plikationssprache aus; siehe Abschnitt 4). Da-
nach wird mit (1b) entweder behauptet, da
es nicht der Fall ist, da der Knig von
Frankreich weise ist (= LF1); das ist logisch
vertrglich mit der Nicht-Existenz des K-
nigs. Oder aber es wird die Existenz des K-
nigs behauptet und gleichzeitig gesagt, da er
nicht weise ist (= LF2). Bei der Nicht-Exi-
dieser Stelle ist das zugrundeliegende Stan-
dard-Formalisierungsverfahren S also nicht
korrekt. Ein Prdikat wie suchen nennt Blau
nicht-referentiell, weil es Argumentpositionen
enthlt, in denen nicht-referierende (= nicht-
denotierende) Terme stehen knnen, whrend
zugleich die Prdikation wahr ist. In anderen
Kontexten versagt die Substitutivitt, wie
etwa bei der Objektposition von bewundern
(Link 1976: 144). Beide Prinzipien sind in
modalen und epistemischen Kontexten ver-
letzt; dieser Umstand war der Ausgangspunkt
fr die Entwicklung intensionaler Logiken, die
die Prdikatenlogik als Explikationssprache
fr eine natursprachliche Semantik ersetzen
sollten.
4. Die vorgestellte Semantik heit Interpre-
tationssemantik, modelltheoretische oder
Tarski-Semantik. Ein Charakteristikum dieser
Semantik ist die Tatsache, da die Quantifi-
kation mit dem Durchlaufen des Indivi-
duenbereichs verbunden ist: Eine Allformel
xPx etwa ist nach 6.1 genau dann wahr in
einem Modell M = D, .
M
,, wenn alle
Elemente d D die Matrix := Px erfllen,
d. h. wenn fr alle d D gilt: d P
M
; ebenso
ist nach 6.2 die Existenzformel xPx genau
dann wahr in M, wenn es mindestens ein
Element d D gibt, so da d P
M
gilt. Wir
haben es also mit einer Objekt-Quantifkation
(engl. objectual quantification) zu tun. Eine
zweite Spielart der PL1-Semantik verzichtet
dagegen auf einen Individuenbereich und er-
klrt die Quantifikation x, x unter Be-
zugnahme auf die (objektsprachlichen) In-
stanzen fr alle a Con
T
. Man spricht dann
von einer Bewertungs- oder Einsetzungsse-
mantik (engl. substitutional quantification;
siehe z. B. van Fraassen 1971: 127). Dem Mo-
dellbegriff entspricht hier der Begriff einer
Bewertung (engl. valuation) v, die jedem ele-
mentaren Satz von PL1 einen Wahrheits wert
zuordnet. wird wie blich auf die Boole-
schen Operationen fortgesetzt. Ein Allsatz
xPx ist dann wahr bezglich v, wenn
(Pa) = 1 fr alle a Con
T
. Das ist intuitiv
adquat und formal quivalent zur Tarski-
Semantik, wenn alle Objekte, ber die die
Sprache spricht, einen Namen unter den
Konstanten der Sprache besitzen. Fr die
Zwecke der Sprachsemantik kann dies im all-
gemeinen angenommen werden. Gleichwohl
arbeiten die Semantiker in der Tradition der
Montague-Grammatik in der Regel mit einer
Interpretationssemantik.
842 XI. Service-Artikel
einer Wahrheitslcke. Diese Position wird
entschieden von Autoren wie Barwise und
Perry (1983 bzw. 1987) vertreten, die damit
die Ntzlichkeit einer Dreiwertlogik mit dem
zugehrigen semantischen Prsuppositions-
begriff bestreiten. Eine ausgedehnte Literatur
lieferte zudem Gegenargumente von linguisti-
scher Seite (Gazdar 1979). Hauptschlich
dient die Instabilitt (Tilgbarkeit) vieler an-
geblicher Prsuppositionen in wechselnden
Kontexten als ein Argument dafr, da es
sich hier nicht um ein logisches Phnomen
handeln knne, sondern um pragmatische Im-
plikaturen.
Semantiker versuchten daraufhin, die Pro-
blematik im folgenden Sinn neu zu umreien
(Heim 1983). Die Wahrheitslcken werden
durch einen geeigneten Kontextbegriff ersetzt.
Der Kontext , auf den jede uerung eines
Satzes S zu beziehen ist, hat zu garantieren,
da alle Prsuppositionen des Satzes in ihm
erfllt sind; in diesem Fall lt den Satz S
zu ( admits S). Sieht man einmal von der
ganz anderen gebrauchstheoretischen Rolle
des Kontextbegriffs ab, so lt sich allerdings
zeigen, da Heims Zulssigkeitsrelation und
der alte semantische Prsuppositionsbegriff
interdefinierbar sind (Link 1987 a): kontext-
freie Dreiwertlogik und bivalente Kontextse-
mantik sind miteinander quivalent. Lediglich
die Grenzziehung zwischen Semantik und
Pragmatik verluft in der Dreiwertlogik an-
ders: der logische Kern des Prsuppositions-
problems wird innerhalb der formalen Theo-
rie operationalisiert. Dem reinen Demarka-
tionsstreit kann der semantische Ansatz in
seiner dreiwertigen Ausprgung im brigen
ein technisches Resultat entgegensetzen: es
zeigt sich, da etwa die Dreiwertlogik L3
(siehe unten) als logische Explikationssprache
eine betrchtliche Flexibilitt aufweist, mit
der auch das im semantischen Ansatz fr un-
lsbar gehaltene Projektionsproblem fr Pr-
suppositionen behandelt werden kann (Link
1986).
Ein Hauptproblem bei der Aufgabe des
Bivalenzprinzips besteht allerdings in der
Wahl einer geeigneten Logik der Wahrheits-
lcken. Das bekannteste dreiwertige System
neben dem historisch frhesten von Lukasie-
wicz ist die starke Logik in Kleene (1952:
334). Ein weiteres, in der Literatur hufig
auftretendes System ist das der Superbewer-
tungen (engl. supervaluations) von van Fraas-
sen (1966, 1971). Eine Superbewertung s baut
auf einer Menge K von klassischen bivalenten
Bewertungen auf und weist einer Formel
stenz des Knigs wird damit in diesen Vari-
anten entweder der Satz (1 b) wahr, oder beide
Stze werden gleichzeitig falsch.
Dieses Ergebnis ist von den Dreiwert-Lo-
gikern als semantisch inadquat empfunden
worden. Aufbauend auf der Intuition von
Strawson (1952) wird in diesem Fall von einer
nicht erfllten Prsupposition gesprochen, so
da (1a, b) weder wahr noch falsch zu nennen
seien: damit wird die Zweiwertigkeit oder Bi-
valenz der Logik aufgegeben. Der Vorteil die-
ser theoretischen Entscheidung liegt darin,
da sich in einer solchen Logik L ein nicht-
trivialer Prsuppositionsbegriff definieren
lt. Intuitiv gesprochen prsupponiert eine
Formel eine andere Formel , wenn die
Wahrheit von eine notwendige Bedingung
dafr ist, da wahr oder falsch, also wahr-
heitsdefinit ist; wenn man fr dieses semanti-
sche Prdikat den Definitheitsoperator D
(siehe unten) einfhrt, so lt sich definieren:
DefEine Formel in L heit Prsupposition
einer Form (Bez. ) gdw
D
L
.
Dient eine solche Sprache L als Explikations-
sprache, so werden die Denotationsvoraus-
setzungen bei den Kennzeichnungen, d. h. die
Existenz und die Eindeutigkeit, zu Prsup-
positionen von Stzen, in denen diese Kenn-
zeichnungen vorkommen; im Beispiel (1) sind
also die Existenz und die Eindeutigkeit des
Knigs von Frankreich die Prsuppositionen,
deren Wahrheit eine notwendige Bedingung
fr die Wahrheitsdefinitheit von (1a, b) dar-
stellt.
Die Anwendbarkeit dieses semantischen
Prsuppositionsbegriffs ist in Sprachphiloso-
phie und Linguistik umstritten (s. auch Arti-
kel 13). Viele halten Prsuppositionen fr eine
pragmatische Angelegenheit. Die sprachphi-
losophische Motivation ist diese: Ein Satz
kann in einer Situation dazu verwendet wer-
den, eine Behauptung ber die Welt aufzu-
stellen, die darin besteht, da der von dem
Satz ausgedrckte Sachverhalt (die ausge-
drckte Proposition) wahr ist. Auf die ver-
schiedensten Weisen nun kann es dem Spre-
cher milingen, mit dem Satz eine Proposition
auszudrcken, so etwa dadurch, da eine
Kennzeichnung verwendet wurde, die gar
nicht denotiert. Dann kommt natrlich auch
keine Behauptung zustande. Das heit aber
nicht, da die Welt nicht zweiwertig wre:
jede Proposition ist als solche wahr oder
falsch; wenn der Satz jedoch gar keine Pro-
position ausdrckt, entsteht der Eindruck
41. Formale Methoden in der Semantik 843
4. fr die klassische Negation wird jetzt von
der neuen starken Negation ~ der Drei-
wertlogik bernommen: ~ ist 1, wenn
gleich 1 ist, und umgekehrt; ist dagegen
unbestimmt, also = 0, so ist ~ ebenfalls
= 0. Die bisherige schwache Negation
ignoriert weiterhin die Differenzierung im
nicht-wahren Bereich: 1 wird zu 1, und 0
oder 1 werden beide zu 1. Es seien
TV := {1, 0, 1} und : TV TV eine diese
Information verwischende Funktion derart
da (i) = 1 falls i = 1, und (i) = 1 sonst.
Dann ist die schwache Negation die Funktion
(i). Die Wahrheitsregeln fr die beiden
Negationen lauten also (die Numerierung
setzt die aus Abschnitt 2.3 fort, ist jetzt aber
mit einem Stern versehen):
4.1*
~
M,g
=
M,g
4.2*
M,g
= (
M,g
).
Eine entsprechende Modifikation ist bei der
Regel 5.3 fr das Konditional anzubringen:
5.3*
( )
M,g
= sup { (
M,g
),
M,g
}.
Die Regel 5.4 fr den Doppelpfeil drckt die
Wahrheitswert-Gleichheit aus; whrend dies
in PL1 soviel bedeutet wie die wechselseitige
materiale Implikation, treten diese beiden De-
finitionen in L3 auseinander: die Wahrheits-
wert-Gleichheit wird fr einen neuen Junktor,
die starke quivalenz , reserviert, und der
Doppelpfeil steht fr die Konjunktion der
wechselseitigen Konditionale. Das fhrt zu
den folgenden Wahrheitsregeln (dabei sei A
wie oben in 5.4 und * : TV
2
TV mit *(i,j)
= 1 falls (i) = (j); = 1, falls i,j 0 und
i = j; und = 0 sonst):
5.4*
( )
M,g
= (
M,g
, )
M,g
);
5.5*
( )
M,g
= (
M,g
, )
M,g
).
Man beachte, da im zweiwertigen Fall *
mit zusammenfllt und damit die beiden
Junktoren, wie es sein sollte, dieselbe Seman-
tik erhalten.
Es ist ferner bequem, die folgenden ein-
stelligen Junktoren zur Verfgung zu haben:
T fr es ist wahr da; F fr es ist falsch
da; N fr es ist unbestimmt da; D
fr es ist wahrheitsdefinit da. Die Wahr-
heitsregeln lauten (i ist wie in der Arithmetik
der absolute Betrag der Zahl i):
4.3*
T
M,g
= (
M,g
);
4.4*
F
M,g
= (
M,g
);
4.5*
N
M,g
= (
M,g
);
4.6*
D
M,g
= (
M,g
).
genau dann einen Wahrheitswert i {1, 1}
zu, wenn fr alle Bewertungen v aus K
() = i gilt; sonst ist s undefiniert (die Funk-
tion s kann durch die Voten eines Gremiums
K illustriert werden, in dem Zwang zur Ein-
stimmigkeit herrscht). Ein drittes System, das
zugleich am weitesten ausgearbeitet scheint
und explizite Formalisierungen der natrli-
chen Sprache anbietet, findet sich in Blau
(1978, 1983, 1985). Diese Logik L3 nimmt
statt einer Wahrheitslcke einen dritten Wert
u fr unbestimmt an. Sie stimmt in den
Grundjunktoren mit der starken Kleeneschen
Logik berein, jedoch bis auf eine wichtige
Ausnahme: das Konditional wird nicht wie
bei Kleene mit Hilfe der starken Negation
ausgedrckt, sondern mit der klassischen
schwachen Negation (diese Wahl wird in Blau
1978 ausfhrlich motiviert). L3 ist eine kon-
servative Erweiterung der klassischen Pr-
dikatenlogik (Blau 1978: 178). Das liegt
daran, da in L3 der Bereich des klassisch
Falschen lediglich weiter analysiert wird in
einen unbestimmten und einen wahrheitsde-
finiten, genuin falschen Bereich: ignoriert
man also diesen Unterschied, erhlt man die
klassische Logik zurck.
Neben dem Unbestimmtheitsgrund nicht-
erfllter Prsuppositionen gibt es in L3 nach
den der Vagheit. Prdikatextensionen sind
nicht mehr notwendig scharf in einem Mo-
dell: es gibt eine positive Extension P
+
, die
die eindeutig positiven Instanzen, und eine
negative Extension P
, die die eindeutig ne-
gativen Instanzen eines Prdikats P enthlt;
P
+
und P
erschpfen jedoch den Grund-
bereich nicht mehr: dazwischen liegt ein mg-
licherweise nicht-leerer Vagheitsbereich von
P. Auf das Problem der Vagheit kann hier
nicht eingegangen werden (siehe dazu jedoch
Ballmer & Pinkal 1983, Pinkal 1984, 1985
sowie Artikel 11).
Die dreiwertige Logik L3 sei nun in knap-
per Form mit einigen wichtigen Formalisie-
rungsbeispielen skizziert. Wie in Abschnitt 2
wird von den arithmetischen Eigenschaften
der Darstellung der Wahrheitswerte durch
Zahlen Gebrauch gemacht. Die Zahl 1 stehe
wieder fr wahr, 1 fr (L3-)falsch,
und 0 fr unbestimmt. Also ist falsch <
unbestimmt < wahr. Damit knnen die Wahr-
heitsregeln aus Abschnitt 2.2 fast wrtlich
bernommen werden. ( )
M,g
ist wieder
das Infimum von
M,g
und
M,g
,
( )
M,g
das Supremum; dasselbe gilt fr
den All- bzw. den Existenzquantor. Die Regel
844 XI. Service-Artikel
Supremum ebenfalls; der T-Operator sorgt
hier dafr, da nur Ehemnner (und also
kein Anwesender!) als Instanzen herangezo-
gen werden. Also ist der gesamte Satz
falsch. In (2b) dagegen wird der Bereich der
Instanzen von den Anwesenden gebildet;
keiner ist verheiratet, also ist P
2
x(yQg
2
yx)
jedesmal neutral, da die Kennzeichnung
nicht denotiert. Da die Konjunktion in kei-
nem Fall wahr wird, ist das Supremum = 0
und damit der Existenzsatz neutral. Es sei
bemerkt, da damit die beiden Stze im all-
gemeinen zwar nicht -quivalent, aber im-
mer noch allgemein bikonditional sind; das
erklrt, da dieser Unterschied in PL1 ver-
wischt wird.
Ein natursprachliches Beispiel einer be-
schrnkten Allquantifikation sei noch ange-
fhrt, das die spezielle Definition des Kon-
ditionals in L3 plausibel macht. Betrachten
wir den Satz (3),
(3) Alle Demokratien haben die Pressefrei-
heit
x(Px Qx)Px : x ist eine Demokratie
Qx : x hat Pressefreiheit
und nehmen wir an, da dies fr alle klaren
Flle von Demokratie gilt. Es mge jetzt min-
destens einen Vagheitsfall y von Demokratie
auf der Welt geben, in dem keine Pressefrei-
heit herrscht. Dann ist Py neutral und das
Konditional nach 5.3* bereits wahr, da
(Py
M,g
) = 1; dieser Fall strt also die
Wahrheit des Allsatzes nicht. Bei dem Kon-
ditional der starken Kleeneschen Dreiwert-
logik dagegen (es sei ~ genannt) fehlt die
Funktion in der Definition; ( ~ ) wird
damit quivalent zu (~ ). Damit wird
aber der vage Fall Py fr die Wahrheit des
Allsatzes relevant: ~ Py ist nach 4.1* eben-
falls neutral, und Qy ist falsch; dann ist
(~ Py Qy) neutral, und der Allsatz ist nicht
mehr wahr. Das ist jedoch intuitiv unbefrie-
digend: die Verhltnisse im Positivbereich von
P werden von auen beeinflut, der All-
quantor lebt nicht vollstndig auf seinem
Vorbereich (vgl. das Kriterium lives on in Bar-
wise & Cooper 1981).
Der Vollstndigkeit halber seien die restli-
chen Wahrheitsregeln von L3 angegeben. Da
L3 keine Lambda-Abstraktion enthlt, blei-
ben die Regeln fr die elementare Prdikation
und den Iota-Operator. Letzterer kann i. w.
wie in Abschnitt 2.2 definiert werden, wobei
das Dummy-Symbol durch nicht definiert
ersetzt wird. Dann lautet die Prdikationsre-
gel:
Schlielich sei noch der zentrale prsuppo-
nierende Junktor /, die Prjunktion, einge-
fhrt (Blau 1985); (/) ist zu lesen als
wobei vorausgesetzt ist da . Dazu definie-
ren wir auer eine weitere Hilfsfunktion
: TV TV durch (i) = 1 falls i = 1; und
= 0 sonst. Dann lautet die Wahrheitsregel:
5.6*
(/)
M,g
=
M,g
(
M,g
).
Wenn also nicht wahr ist, dann wird der
Faktor (
M,g
) gleich 0 und damit die ge-
samte Prjunktion unbestimmt; ist dagegen
wahr, so gilt (
M,g
) = 1, und der Wert der
Prjunktion stimmt mit dem Wert von
berein. Hier haben wir es also mit einer
objektsprachlich gefaten Prsuppositions-
beziehung zu tun; in der Tat ist die Formel
im oben angegebenen Sinn eine Prsupposi-
tion von (/).
Die Prjunktion wird z. B. verwendet, um
eine beschrnkte Quantifikation mit Existenz-
prsupposition zu definieren:
Def x(, ) := x( )/x
x(, ) := x(T )/x)
In dieser Definition steckt neben der deutlich
sichtbaren Existenzprsupposition auch noch
eine Auszeichnung des Vorbereichs durch den
Wahrheitsjunktor T, welche das Terrain der
Auswertung auf die eindeutig positiven -
Instanzen einschrnkt [beim Allquantor ver-
birgt sich der T-Operator im Konditional: wir
haben ( ) ( ) = (~T ),
da ~T]; das erzeugt eine Asymme-
trie, die erst in L3 hervortritt. Blau (1985:
417) gibt dazu folgendes Beispiel: gegeben sei
eine Situation, in der alle anwesenden Perso-
nen Junggesellen sind und es auerdem ir-
gendwo anders einen Ehemann gibt, der lter
ist als seine Frau. Dann ist der Satz (2a) L3-
falsch, whrend (2b) neutral wird.
(2) a. Mindestens einer, der lter ist als seine
Frau, ist anwesend.
x(P
2
x(yQ
2
yx), Rx)
P
2
xy : x ist lter als y
Q
2
xy : x ist Frau von y
Rx : x ist anwesend
b. Mindestens ein Anwesender ist lter
als seine Frau.
x(Rx, P
2
x(yQ
2
yx))
In beiden Fllen ist die Existenz von -
Instanzen erfllt, so da die Formel vor
dem Schrgstrich in der Definition ins Spiel
kommt. Da alle lteren Ehemnner nicht
anwesend sind, werden alle Konjunktionen
TP
2
x(yQ
2
yx) Rx falsch und damit das
41. Formale Methoden in der Semantik 845
LFs (5a, b) nicht aus: (5a) ist zu schwach, da
auch die Existenz von Peters Hund nicht
folgt, (5b) zu stark, da hier beide Kennzeich-
nungen denotieren mssen. An dieser Stelle
hilft die Prjunktion weiter: die passende
Hypothese wird durch die folgende LF (7a)
wiedergegeben:
(7)
a.
Q
2
(xP
2
xa)(yR
2
yb) / e! (yP
2
ya)
b.
Q
2
(xP
2
xa)(yR
2
yb) / e! (yR
2
yb)
In (7a) folgt nur die Existenz von Peters
Hund, whrend in der dualen LF (7b) nur
die Existenz von Annas Katze garantiert ist.
Ferner zeigt sich, da unter Vernachlssigung
von Vagheit in L3 die folgende quivalenz
besteht:
(8)
~ Q
2
(xP
2
xa)(yR
2
yb) Q
2
(xP
2
xa)
(yR
2
yb) / e! (xP
2
xa) e! (yR
2
yb)
Die starke Negation lt sich also mit Hilfe
der schwachen Negation und der Prjunktion
wiedergeben.
Das System L3 zeigt im Fall der partiellen
Negation also die angemessene Ausdrucks-
kraft. Einer der wichtigsten Tests fr jede
Prsuppositionstheorie stellt jedoch das sog.
Projektionsproblem dar. Die wichtigsten Re-
ferenzen dazu sind Karttunen 1974, Karttu-
nen & Peters 1979, Gazdar 1979, Soames
1982, Heim 1983, und Link 1986. In der letzt-
genannten Arbeit wird der semantische An-
satz zur Lsung des Projektionsproblems im
Rahmen von L3 verteidigt.
In diesem Abschnitt wurde versucht zu zei-
gen, wie verfeinerte logische Techniken (hier
die der Dreiwertlogik) in der Theorie der Se-
mantik auch dann noch wert sind betrachtet
zu werden, wenn die vorherrschende lingui-
stische Mode eine andere Sprache spricht.
Das soll nicht heien, da die Idee einer Kon-
texttheorie keinen wichtigen neuen Beitrag
liefern wrde dieser liegt in der Tat in der
dynamischen Betrachtungsweise, die der klas-
sischen logischen Sprachanalyse fremd ist,
sich jedoch in dem Mae mehr und mehr als
fruchtbar erweist, wie sich die semantische
Forschung dem Problem der Verarbeitung
sprachlicher Information zuwendet. Richtung-
weisend fr eine Theorie der Kontextvern-
derung in einem laufenden sprachlichen Dis-
kurs sind die Arbeiten von R. Stalnaker (siehe
z. B. Stalnaker 1972, 1978) sowie I. Heim
(1982, 1983) und H. Kamp (1981a). Kamps
Theorie der Diskursreprsentationen (DRT)
wird in Abschnitt 5 vorgestellt; zu den erst-
genannten Autoren siehe Artikel 10.
2*.
p
n
t
o
, ..., t
n1
M,g
= 1 wenn alle t
i
de-
notieren und t
o
M,g
, ..., t
n1
M,g
(p
n
M,g
)
+
p
n
t
o
, ..., t
n1
M,g
= 1 wenn alle t
i
denotieren und t
o
M,g
, ..., t
n1
M,g
(p
n
M,g
)
p
n
t
o
, ..., t
n1
M,g
= 0 sonst
Die semantischen Begriffe der Wahrheit, lo-
gischen Folgerung, Gltigkeit und Erfllbar-
keit sind wie in PL1 erklrt.
Am Ende dieses Abschnitts sei noch illu-
striert, wie die partielle Negation in Beispielen
von der Art (4) in L3 zu behandeln ist.
(4) Peters Hund hat Annas Katze nicht ge-
bissen.
Unter Verwendung der starken und schwa-
chen Negation hat man zunchst zwei logi-
sche Formen fr diesen Satz:
(5)
a. Q
2
(xP
2
xa)(yR
2
yb)
b. ~ Q
2
(xP
2
xa)(yR
2
yb)
Q
2
xy : x hat y gebissen
P
2
xy : x ist Hund von y
R
2
xy : x ist Katze von y
a : Peter; b : Anna
Die schwache Negation in (5a) absorbiert
alle Prsuppositionen des eingebetteten Sat-
zes, hier die Existenz und Eindeutigkeit der
beiden Kennzeichnungen; diese sind also
keine Folgerungen aus (5a). Fr (5b) dagegen
gilt mit dem L3-Prdikat e!(x) fr (x)
denotiert:
(6)
~ Q
2
(xP
2
xa)(yR
2
yb)
L3
e!(xP
2
xa)
e!(yR
2
yb)
Mit einer partiellen Negation haben wir es zu
tun, wenn der Satz (4) in einer Situation ge-
uert wird, in der es zwar Peters Hund gibt,
aber Anna keine Katze besitzt; dann kann der
Sprecher den Satz (4) fortsetzen: ... denn
Anna hat gar keine Katze. Diese Mglich-
keit gilt den Vertretern des pragmatischen
Ansatzes als Beweis dafr, da die Existenz
und Eindeutigkeit von Kennzeichnungen gar
keine Prsuppositionen darstellen, weil sie im
vorgestellten Fall aufgehoben werden kn-
nen. Im semantischen Ansatz ist dagegen die
Situation so zu deuten, da fr den Satz (4)
einfach mehrere logische Formen zur Verf-
gung stehen, unter denen der Hrer eine als
plausibelste Interpretationshypothese heraus-
greift (Link 1986). Ist die Negation von (4)
im angegebenen Sinne partiell, so reichen die
846 XI. Service-Artikel
und ihre semantischen Gegenstcke bilden
komplexe Algebren, zwischen denen ein fun-
damentaler Homomorphismus besteht (s. auch
Artikel 7).
Eine solche Grammatik-Struktur zieht an-
dere theoretische Entscheidungen nach sich.
Die Syntax nimmt hier am besten die Gestalt
einer Kategorialgrammatik an, und deren ho-
momorphes Gegenstck mndet in einer ty-
pentheoretischen Semantik (zur Parallelitt
von Typen und Kategoriensymbolen siehe van
Benthem 1987). In ihr wird ein komplexes
Kategoriensymbol der Form A/B als ein lo-
gischer Typ gleicher Struktur gedeutet, der fr
Funktionen von Objekten der Kategorie B in
Objekte der Kategorie A steht. So ist z. B. ein
Adjektiv von der Kategorie N/N, d. h. es
nimmt ein (mglicherweise komplexes) No-
men zu sich und ergibt wieder ein solches.
Das komplexe Nomen politischer Freund
etwa, das aus dem Adjektiv politisch der Ka-
tegorie N/N und dem Nomen Freund gebildet
ist, denotiert dann ein Objekt (= die Menge
der politischen Freunde), welches das Ergeb-
nis der Anwendung der Funktion politisch
auf das Argument Freund (= der Menge
der Freunde) darstellt. Wenn nun im Einklang
mit der blichen extensionalen Semantik No-
mina Mengen von Individuen denotieren, so
mu das Adjektiv semantisch als eine Trans-
formation auf Mengen von Individuen inter-
pretiert werden, welche ein Objekt hheren
Typs darstellt. Der Schritt zur Typentheorie
erffnet allerdings zudem und sozusagen
gratis die Mglichkeit einer eleganten ein-
heitlichen Behandlung von Nominalphrasen
in dem Teilsystem, das der Logik der zweiten
Stufe entspricht (siehe unten).
Bei der Typentheorie handelt es sich in der von
Montague gewhlten Form um eine Theorie der
sog. einfachen Typen, die auf Church (1940) zu-
rckgeht. Die Typen werden ber zwei Grundtypen
e (fr Individuen [eng. entity]) und t (fr Wahr-
heitswerte [engl. truth value]) nach der einfachen
Regel rekursiv aufgebaut, da, wenn und Typen
sind, auch () ein Typ ist (wobei die Klammern
weggelassen werden knnen, wenn a durch ein
einzelnes Zeichen mitgeteilt wird; zu dieser Nota-
tion, die einfacher ist als Montagues Paar-Schreib-
weise ,, siehe Link 1979). steht fr Funk-
tionen von Objekten des Typs a in Objekte des
Typs . So ist et der Typ der Funktionen von der
Menge der Individuen in die Menge der Wahrheits-
werte; diese Funktionen knnen mit den Teilmen-
gen des Individuenbereichs identifizert werden und
sind daher die mglichen Denotate fr die einstel-
ligen Prdikate der ersten Stufe. Allgemeiner steht
4. Montague-Grammatik
In der linguistischen Semantik der letzten 15
Jahre nimmt die Montague-Grammatik
(MG) eine zentrale Stellung ein. Diese
Theorie wurde im wesentlichen auf der Basis
der Aufstze Universal Grammar (UG,
Montague 1970b) und The Proper Treatment
of Quantification in Ordinary English (PTQ,
Montague 1973) entwickelt. An Literatur zur
MG seien genannt R. Thomasons Introduc-
tion in Montague (1974), Link (1976: Kap.
II), Lbner (1976), Partee (ed.) (1976), Link
(1979), Davis & Mithun (1979), Dowty et al.
(1981). Rein formal besteht die Bedeutung der
MG zunchst darin, da sie einen Standard
an Exaktheit in der semantischen Forschung
gesetzt hat, an dem sich jede knftige seman-
tische Theorie messen lassen mu. Sodann
lt sich der Einflu der MG daran ablesen,
da fast alle derzeit gelufigen Systeme L-
sungen von Problemen anbieten, die in der
MG entweder zutagegetreten sind oder dort
zum ersten Mal systematisch und przise be-
handelt wurden. Eine Ausnahme bildet ei-
gentlich nur das Werk von U. Blau, dessen
sechswertige Reflexionslogik, aus seiner drei-
wertigen Logik (Blau 1978) entwickelt, ohne
jeden Bezug auf MG und in expliziter Ableh-
nung ihrer Grundannahmen entstand.
Die beiden genannten Aufstze Montagues
UG sowie PTQ befassen sich mit mehreren
groen voneinander durchaus unabhngigen
Problemkreisen und bieten dazu Lsungen
an, die in ein einheitliches, umfassendes for-
males System integriert sind. Da ist zunchst
das Projekt einer Universellen Grammatik,
welches vor allem in UG dargelegt ist (siehe
dazu auch die mit einem Stern gekennzeich-
neten Abschnitte in Link 1979). Die Grund-
these ist, da Syntax und Semantik einer
natrlichen Sprache eine rekursive Kom-
binatorik aufweisen, die sprachliche Aus-
drcke und ihre semantische Interpretation in
strenger Parallelitt zusammensetzt. Dieser
auf Frege zurckgehende Funktionalittsge-
danke wird hier so strikt gefat, da beinahe
alle natursprachlichen Lexeme eine eigene se-
mantische Reprsentation erhalten, die dann
nach dem Baukasten-Prinzip analog dem
syntaktischen Aufbau miteinander kombi-
niert werden (berhmt wurde die komplizierte
Bedeutung des Auxiliars be in UG). Mon-
tague liefert fr das derart gefate Komposi-
tionalittsprinzip der Semantik eine mathe-
matische Begrndung im Rahmen der univer-
sellen Algebra: die syntaktischen Ausdrcke
41. Formale Methoden in der Semantik 847
(1979) TITL genannt.
Die Typenstruktur in TITL ist die oben beschrie-
bene, erweitert um einen (uneigentlichen) Typ s fr
die mglichen Welten; als zustzliche Typenregel
gilt, da, wenn ein Typ ist, auch s ein Typ ist.
Typen der Gestalt s sind die Typen fr die Inten-
sionsfunktionen (siehe unten) von der Menge der
mglichen Welten in die Menge der Objekte des
Typs . So ist etwa se der Typ der Individuenkon-
zepte, s t der Typ der Eigenschaften von Objekten
des Typs T, und (set)t der Typ der Mengen von
Eigenschaften von Individuen. Die Variable P in
den unten angegebenen Formalisierungen hat (bis
auf die Tatsache, da sie fr Eigenschaften von
Individuenkonzepten steht) diesen Typ.
Der zweifellos wichtigste Beitrag der MG be-
steht in ihrer Behandlung der Probleme der
Quantifikation und Anaphern, die sich vor al-
lem auf PTQ sttzt. Das formale Instrument
ist hier der Lambda-Operator und seine Kom-
binatorik.
Der folgende Korpus von Stzen stellt eine
reprsentative Auswahl von Beispielen zu den
genannten Problemkreisen dar. Diese werden
sodann kurz auf eine Weise diskutiert, da
die Mglichkeiten und Grenzen des Systems
deutlich werden. Die dabei angesprochenen
Probleme der MG haben in der Folgezeit zu
weiteren Anstzen in der formalen Semantik
gefhrt, deren wichtigste in weiteren Ab-
schnitten vorgefhrt werden.
I. Intensionale Kontexte
1. Modale Kontexte
(9)
a. Notwendigerweise ist 9 grer als 7.
(mathematische Notwendigkeit)
b. Notwendigerweise bewegen sich die
Planeten auf Kegelschnittbahnen.
(physikalische Notwendigkeit)
c. Es ist notwendig, da, wenn Hans
Junggeselle ist, er ein unverheirateter
Mann ist. (analytische Notwendigkeit)
d. Notwendigerweise ist jedes Kssen ein
Berhren. (analytische Notwendigkeit)
e. Mglicherweise hat Peter sein neues
Auto (schon wieder) zu Schrott gefah-
ren.
2. Temporale Kontexte
(10)
a. Frher war der Papst ein Kunstm-
zen.
b. Alle Teilnehmer des Turniers konnten
einen Sieg erringen; der Favorit ver-
lor jedoch stets.
3. Epistemische/opake Kontexte
(11)
a. Der Kommissar sucht den Mrder.
der Typ tfr Mengen von Objekten des Typs T,
und t fr 2-stellige Relationen in Mengen von
Objekten des Typs .
Whrend also das Prinzip der strikten Kom-
positionalitt einerseits die Typentheorie als
semantische Explikationssprache nach sich
zieht, zwingt sie andererseits zur Aufgabe der
traditionellen Extensionalitt der Logik: die
gewnschte Funktionalitt lt sich nur auf
der Ebene feinkrnigerer Objekte erzielen, als
die gewhnlichen Extensionen es sind; beson-
ders eklatant ist dies bei den Satzkomplemen-
ten zu sehen, deren extensionale Denotate ja
nur Wahrheitswerte sind, die jeden inhaltli-
chen Unterschied verwischen. An dieser Stelle
findet die Mgliche-Welten-Semantik Eingang
in das System: die gesuchten feinkrnigeren
Objekte sind bei Montague Intensionen, d. h.
Funktionen von mglichen Welten in die ge-
whnlichen (typengerechten) Extensionen. Es
ist hilfreich, sich zu vergegenwrtigen, von
welch erstaunlicher Schlichtheit dieser Ge-
danke ist, der, wie die Beispiele unten zeigen,
formal auerordentlich leistungsfhig scheint
und dementsprechend in der Semantik vor-
bergehend wie der Stein der Weisen empfun-
den wurde, zugleich aber verantwortlich ist
fr die krassesten Inadquatheiten des Mon-
tagueschen Systems: Ist irgendwo die Funktio-
nalitt verletzt, so verfeinere man die Substi-
tutionsklassen durch bergang zu den entspre-
chenden Intensionsfunktionen. Mit diesem uni-
versellen Rezept, das hier der Intensionalisie-
rungstrick genannt sei, wurden propositionale
Einstellungen ebenso behandelt wie das Tem-
peratur-Puzzle (siehe die Beispiele unter I.5
unten) oder etwa die Frage der Denotation
von Stoffnamen wie Gold.
Die modale Komponente der Typenlogik
wird in PTQ noch durch eine einfache Tem-
porallogik ergnzt. Jeder Ausdruck wird da-
mit prinzipiell relativ zu einer gegebenen mg-
lichen Welt und einem gegebenen Zeitpunkt
interpretiert. Da Montague ferner eine Tars-
kische Semantik mit Variablenfunktionen,
also ein offenes Variablensystem, zugrunde-
legt, mu ein Ausdruck auch noch relativ zu
der gegebenen Belegung der in ihm frei auf-
tretenden Parameter interpretiert werden. Die
genannten Relativierungen erffnen die Mg-
lichkeit der Behandlung aller Arten von In-
dexikalittsproblemen, die bei Montague
selbst zwar nicht im Vordergrund stehen,
wozu in der MG jedoch der formale Rahmen
bereits angelegt ist. Die mit der hier grob
umrissenen Semantik ausgestattete Explika-
tionssprache von PTQ stellt also eine tempo-
rale intensionale Typenlogik dar, in Link
848 XI. Service-Artikel
sind die blichen modalen Satzoperatoren,
whrend
und
eine analoge Funktion
haben wie der -Operator bzw. die funktio-
nale Anwendung. Der Intensor ist allgemeiner
als die blichen Modaloperatoren und erlaubt
eine Defintion von und damit auch .
Intensionalisierte Terme der Gestalt de-
notieren Intensionsfunktionen oder kurz In-
tensionen, d. h. Funktionen von der Menge I
der mglichen Welten in passende Extensio-
nen. Diese Intensionen sind die eigentlichen
Objekte der Theorie, die als auf die Ebene der
Funktionen geliftete Extensionen viel fein-
krniger sind als die blichen Denotate der
Tarski-Semantik; mit ihrer Hilfe werden die
Intensionalittsprobleme der Beispielgruppe I
einer Lsung zugefhrt. Fr die temporalen
Intensionalitten wird der Parameter der
mglichen Welten noch durch einen weiteren
Parameter fr Zeitpunkte ergnzt; die Zeit-
punkte tragen dabei eine lineare Ordnung, so
da ein Zukunfts- und ein Vergangenheits-
operator (W fr engl. it will be the case
that bzw. H fr engl. it has been the case
that) definierbar werden. Der Notwendig-
keitsoperator ist dann als notwendigerweise
stets zu lesen.
Die ersten Stze unter I. entsprechen in der
MG den klassischen modallogischen Repr-
sentationen, wenn man vom speziellen Typen-
apparat absieht. Satz (9e) zeigt, da eine
Kennzeichnung (sein neues Auto) entweder als
auerhalb des modalen Kontexts stehend
oder als dessen Teil aufgefat werden kann.
Im ersten Fall gibt es das Auto, im zweiten
kann der Satz etwa als Spekulation ber die
Lebenschancen eines neuen Autos gedeutet
werden, das Peter vor einem Monat vorhatte
sich anzuschaffen (Peter kann aber seine
Plne gendert haben). Die Beispiele (10) zei-
gen ein analoges Verhalten von Kennzeich-
nungen in temporalen Kontexten. So stellt
Satz (10b) prima facie einen Versto gegen
das klassische Spezialisierungsprinzip x
dar; da aber der Term der Favorit jeweils
am vorliegenden Zeitpunkt auszuwerten ist,
ist der Satz auch formal konsistent (Link
1979: 184 f).
Verben wie suchen und bewundern sind in
der Objektposition intensional, ebenso der
VP-Operator wollen sowie die klassischen
Einstellungsverben wie glauben. Die MG ge-
stattet Formalisierungen von Stzen wie unter
(11), die intuitiv inadquate Folgerungen
blockieren; so folgt weder in (11b) noch in
(11d) aus der opaken Lesart die Existenz eines
Einhorns, und bei den Kennzeichnungen ist
in dieser Lesart die Substitutivitt referenz-
b. Hans sucht ein Einhorn.
c. Hans bewundert den Erfinder des
Transistors.
d. Maria will ein Einhorn finden und es
pflegen.
e. Ralph glaubt, da der Mann mit dem
braunen Hut ein Spion ist.
4. Nicht-Funktionalitt
(12)
a. Mller ist ein politischer Freund von
Meier, aber kein Freund.
b. Angeblich ist Huber ein Grund-
stcksspekulant.
5. Individuenkonzepte
(13)
a. Der Trainer wechselt.
b. Die Temperatur ist neunzig (Grad
Fahrenheit) und steigt, aber es ist
nicht der Fall, da neunzig steigt.
(Parteesches Puzzle)
II.Quantifikation
(14)
a. Alle jubeln einer Frau zu.
b. Jeder Student wird einen Professor
hren.
c. Jeder Mann liebt eine Frau nicht.
d. Pedro glaubt, da ein mexikanischer
Gott sich an allen Touristen rcht.
e. Hob glaubt, da eine Hexe
j
seine Sau
gettet hat, und Nob glaubt, da sie
j
seine Stute geblendet hat. (Hob-Nob-
Satz)
III.Anaphora
(15)
a. Jeder Mann
i
liebt eine Frau
j
, die
j
ihn
i
liebt.
b. Jeder Farmer, der einen Esel
i
hat,
schlgt ihn
i
. (donkey-Satz)
c. Der Mann, der seinen Scheck
i
seiner
Frau gab, war weiser als der Mann,
der ihn
i
seiner Geliebten gab. (pay-
check-Satz)
d. Das Mdchen
i
, das ihn
j
nur anma-
chen wollte, kte den Jungen
j
, der
es
i
verehrte. (Bach-Peters-Satz)
Die intensionalen Kontexte (Beispielgruppe I)
fhren zu einer Anreicherung der klassischen
Logik mit einer Modallogik, welche den
Wahrheitsbegriff von einer Menge von mg-
lichen Welten abhngig macht (vgl. Hughes
& Cresswell 1970). Montague whlt i. w. eine
sog. S5-Logik. Als Modaloperatoren treten
die Operatoren (es ist notwendig, da),
(es ist mglich da), (der Intensor),
sowie
(der Extensor) auf. und
41. Formale Methoden in der Semantik 849
Leibniz-Denotate Namen zur Verfgung, die
mit dem -Operator gebildet werden. So ent-
spricht der NP [Hans]
NP
, wenn h eine Kon-
stante fr den Namen Hans in TITL ist, der
-Ausdruck P P {h}, und der NP [alle Men-
schen]
NP
der -Ausdruck P x [Mensch(x)
P {x}] (hier ist P eine Variable fr Eigen-
schaften, und der Ausdruck P{x} ist zu lesen
als P trifft auf x zu). Damit gilt: (i) die
natursprachlichen Quantorenausdrcke sind
Determinatoren, die mit einem Nomen N eine
NP bilden (diese NPn heien bei Montague
Terme); (ii) eine NP (ein Montaguescher
Term) aber denotiert, wie wir gesehen haben,
eine Menge von Eigenschaften; (iii) eine VP,
die sich mit einer NP zu einem Satz verbindet,
steht fr eine einzelne Eigenschaft, welche im
Fall der Wahrheit des Satzes ein Element jener
Menge ist. Das Problem natursprachlicher
Quantifikation besteht also kategoriell in der
Charakterisierung der fr jeden Quantor typi-
schen Relation zwischen zwei Eigenschaften,
der N-Eigenschaft und der VP-Eigenschaft,
und technisch in der Herstellung der korrek-
ten Skopus-Beziehung zwischen mehreren
Quantoren und sonstigen Operatoren unter
Beibehaltung der Baukasten-Kombinatorik.
Fr das letztgenannte technische Problem
erweist sich, wie gesagt, der -Operator als
das zentrale Instrument. Im Prinzip ist die
dabei ntige Flexibilitt auch schon in der
ersten Stufe gegeben (siehe das obige System
PL1 mit ); was in PTQ hinzukommt, ist die
Mglichkeit, den syntaktischen Aufbau des
natursprachlichen Fragments in der Expli-
kationssprache TITL streng nachzuzeichnen;
das fhrt in der Regel zunchst zu ziemlich
komplexen Ausdrcken mit ineinanderge-
schachtelten -Termen, die jedoch durch -
Konversion (welche auf dem verallgemeiner-
ten -Prinzip von PL1 beruht) in vertrautere
logische Formen berfhrt werden knnen.
Um ein einfaches Beispiel zu geben: der na-
tursprachliche Satz = [[Hans]
NP
[schlft]
VP
]
S
wird in eine TITL-Formel (Hans schlft)
bersetzt, die die Anwendung des Prdikats
der zweiten Stufe, der bersetzung Hans von
[Hans]
NP
, auf die Intensionalisierung (siehe
oben) des Prdikats der ersten Stufe, der
bersetzung schlft von [schlft]
VP
, darstellt.
Es ergibt sich also die zu augenfllig ho-
momorphe Struktur Hans( schlft) fr
(Hans schlft). Nach dem, was oben gesagt
wurde, ist Hans aber der Term P P {h}, so
da wir aus Hans( schlft) = P P {h}
( schlft) durch -Konversion die PL1-For-
mel schlft (h) erhalten. Diese bekannte logi-
gleicher Terme blockiert. Bei den Adjektiven
ist die Operator-Auffassung hilfreich, weil sie
den Schlu von ist ein ADJ + N auf ist ein
N, der nur bei den intersektiven Adjektiven
gltig ist, blockiert; intensionale Adjektive
wie mutmalicher Mrder, designierter Nach-
folger, politischer Freund transformieren die
Extension des Nomens derart, da das Er-
gebnis nicht notwendig eine Teilmenge davon
ist. Intensionale (Satz-)Adverbien wie angeb-
lich knnen ebenfalls behandelt werden. Da-
bei mu zur Aufrechterhaltung des funktio-
nalen Charakters des adverbialen Operators
das Argument intensionalisiert werden; sonst
wrde aus (12b) mit der Annahme, da die
Grundstcksspekulanten gerade die Gemein-
derte sind, folgen, da Huber angeblich ein
Gemeinderat ist. Nun bezeichnen Stze in der
MG aber ohnehin Propositionen, also spe-
zielle Intensionsfunktionen, so da Werte-
gleichheit der beiden Stze in einer Welt keine
ausreichende Grundlage fr den Schlu dar-
stellt.
berlegungen wie diese fhren Montague
dazu, generell vom ungnstigsten Fall aus-
zugehen und die Operanden-Terme bei der
bersetzung durchweg zu intensionalisieren;
durch geeignete Bedeutungspostulate fr die
harmlosen Kontexte werden dann erst in
einem zweiten Schritt die extensionalen Ver-
sionen hergestellt. Das sog. Parteesche Puzzle,
hier unter (13b) wiedergegeben, gab speziell
den Anla zur Intensionalisierung der Indi-
viduenterme, so da die logische Zielsprache
in PTQ eine Sprache der Individuenkonzepte
darstellt. Dadurch wird eine groe Einheit-
lichkeit und formale Eleganz erzielt, die aller-
dings auf Kosten sprachnaher Reprsentatio-
nen geht.
Der Behandlung der Quantifikation (Bei-
spielgruppe II) liegt folgender Gedanke zu-
grunde: Die klassische logische Form fr
einen bedingten Allsatz der Form alle P sind
Q zerlegt die Quantenphrase alle P in zwei
Teile; syntaktisch aber bildet sie als NP
ebenso wie etwa der Name Peter eine ein-
heitliche Konstituente. Nun enthlt die Spra-
che TITL als Teilsystem die (intensionale)
Prdikatenlogik der zweiten Stufe, in der in
Anlehnung an eine Idee von Leibniz ein uni-
formes Denotat fr alle Nominalphrasen ge-
funden werden kann: die NP Hans etwa de-
notiert die Menge aller Eigenschaften, die auf
Hans zutreffen, whrend die NP alle Men-
schen die Menge der Eigenschaften denotiert,
die auf jeden Menschen zutreffen. In der Ob-
jektsprache TITL von PTQ stehen fr diese
850 XI. Service-Artikel
bersetzung liefert dann die Eigenschaft, ein
Einhorn zu finden und zu essen, und erst auf
diese Eigenschaft wird der Operator wollen
angewendet. Damit ist die intendierte pro-
nominale Beziehung hergestellt, ohne da die
Existenz eines Einhorns folgt.
Als bersetzungsbeispiel sei der bereits
frher erwhnte Satz Das Einhorn spricht
nicht vorgefhrt. Weitere Beispiele sind in
Link (1979) und Dowty et al. (1981) ausfhr-
lich behandelt.
B6. Das Einhorn spricht nicht
I. Es ist nicht der Fall, da das Einhorn
spricht.
II. Das Einhorn ist derart, da es nicht
spricht.
bersetzung: U sei die bersetzungsrelation,
die Ausdrcke des natursprachlichen Frag-
ments in Formeln von TITL berfhrt. Die
bersetzung geschieht induktiv und block-
weise; fr Details siehe Link (1979), Kap. 8;
speziell ist F
10,0
die erwhnte Quantifikations-
regel.
sche Form ist also quivalent zu der Aussage,
da Schlafen zu der Menge aller Eigenschaf-
ten gehrt, die auf Hans zutreffen.
Die gewnschten Skopus-Beziehungen nun
werden mithilfe der zentralen syntaktischen
PTQ-Regel der Quantifikation hergestellt,
die auf der Seite der Logik-Sprache TITL
durch das Instrument der -Abstraktion ihre
semantische Rechtfertigung erhlt. Soll etwa
in dem Satz alle jubeln einer Frau zu die Lady
Di-Lesart erzeugt werden, nach der es eine
Frau gibt, der alle zujubeln, so wird die NP
eine Frau (modulo Kasus) in die Satz-Matrix
alle jubeln ihr zu an der Stelle des Pronomens
hineinsubstituiert oder -quantifiziert; der
resultierende -Ausdruck besagt dann soviel
wie da eine gewisse Frau (z. B. Lady Di) die
Eigenschaft hat, da ihr alle zujubeln. Damit
ist die -Lesart mit dem weiten Skopus fr
die indefinite NP erreicht.
Die Quantifikationsregel sorgt auch in vie-
len durchaus komplizierten Fllen fr die
richtigen anaphorischen Beziehungen (Bei-
spielgruppe III). Ein Satz, den Montague ana-
lysiert, lautet etwa Hans will ein Einhorn
i
fin-
den und es
i
essen. Die Schwierigkeit hier ist,
da in der intendierten Lesart die Existenz
eines Einhorns nicht gegeben ist, das Prono-
men es
i
aber sich gleichwohl auf die NP ein
Einhorn
i
bezieht. Wie sich zeigt, hilft die
Quantifikationsregel auch in diesem Fall wei-
ter, wenn sie nicht nur auf ganze Satz-Matri-
zen, sondern auch auf VP-Matrizen angewen-
det wird; die anaphorische Beziehung mu ja
unter dem intensionalen VP-Operator wol-
len hergestellt werden. Die NP ein Einhorn
wird also in der VP-Matrix es
i
finden und es
i
essen fr das erste Pronomen substituiert; die
I.
1. Einhorn U Einhorn, spricht U spricht
2. Das Einhorn U P y[x[Einhorn(x) x = y] P{y}] =: P
3. er
0
U PP{x
0
}
4. das Einhorn spricht nicht U P ( spricht) y[x[Einhorn(x) x = y]
spricht(y)]
II. 1, 2, 3 wie oben;
4. er
0
spricht nicht U PP{x
0
}( spricht) spricht(x
0
)
5. F
10,0
(das Einhorn, er
0
spricht nicht) = das Einhorn spricht nicht
U P ( x
0
spricht (x
0
)) y[x[Einhorn(x) x = y] spricht(y)]
menden Anomalien entdeckt, die die Grund-
prinzipien der Theorie direkt berhren. Eine
Diagnose dieser Anomalien fhrt auf zwei
Grundprobleme in der MG, die miteinander
interagieren: (i) ein begriffliches Problem bei
der Modellierung intensionaler und anderer
Abgesehen von einigen idiosynkratischen Z-
gen des ursprnglichen PTQ-Systems, die auf
das Konto relativ willkrlicher technischer
Entscheidungen gingen, wurden in der MG
sehr bald jedoch eine Reihe von ernstzuneh-
41. Formale Methoden in der Semantik 851
retisch zu modellieren seien. Die den Objekten
dadurch aufgeprgte mengentheoretische
Struktur mag jedoch sprachsemantisch wenig
angemessen sein, wie wir schon bei den Ge-
genstnden von Einstellungsverben sahen.
Nun legen etwa Massenausdrcke, Plural-
terme sowie Artennamen weitere Objekte na-
tursprachlicher Ontologie nahe, die schwer-
lich eine mengentheoretische Struktur auf-
weisen. Um ihre Semantik zu erfassen, ist der
bergang von der mengentheoretischen Mo-
dellierung zur algebraischen Charakterisie-
rung zu vollziehen; siehe dazu die Ausfhrun-
gen im Abschnitt 6.
Ad (ii). Je reicher die natursprachlichen
Fragmente waren, die im Rahmen der MG
analysiert wurden, desto hinderlicher erwies
sich die starre Kategorienstruktur der MG
mit ihrem strikten Prinzip der Kompositio-
nalitt (siehe dazu Partee 1984a). Eine Libe-
ralisierung ergab die Einfhrung polymorpher
Typen in Verbindung mit gewissen systema-
tischen Prinzipien des Typenwechsels (engl.
type shifting principles), die in die Grammatik
aufgenommen werden (Partee 1986); man
spricht auch in einer offensichtlichen Meta-
pher von Shake n Bake Semantics.
Ein weiteres rein technisches Problem der
MG liegt in dem Umstand, da die Quanti-
fikationsregel F
10
gewissermaen zwei Auf-
gaben zugleich bernehmen mu, d. h. formal
die intendierten Skopusbeziehungen herzu-
stellen sowie inhaltlich das de-re/de-dicto-Ge-
fge korrekt zu reprsentieren. Diese beiden
Aspekte korrelieren hufig, aber nicht immer.
Beispielsweise hat im obigen Satz (14d) die
indefinite NP ein mexikanischer Gott (gemeint
ist etwa Montezuma) Skopus ber die gene-
relle NP alle Touristen, whrend diese NP de
re, jene aber de dicto bezglich des Glauben-
soperators zu interpretieren ist. Quantifiziert
man nun die generelle NP, um ihrem de-re-
Charakter Rechnung zu tragen, in den Glau-
benskontext hinein, dann stimmen die Sko-
pusverhltnisse nicht mehr. hnliche techni-
sche Probleme bieten die sog. Paycheck-,
Hob/Nob- oder Bach-Peters-Stze (vgl. die
obigen Beispielstze).
Wegen ihrer Einfachheit wohl am erstaun-
lichsten aber ist die Anomalie der donkey-
Stze. Aufgrund der Baukastenstruktur der
MG, in der man im wesentlichen Ausdrcke
und ihre bersetzungen nebeneinandersetzt,
ohne nach links und rechts zu schauen,
erhlt eine indefinite NP wie ein Esel stets die
bersetzung P x[Esel(x) P {x}], gleich-
gltig ob sie intuitiv existentielle oder wie
Objekte natursprachlicher Ontologie sowie
(ii) ein statisches Grammatik-Konzept mit einer
beraus starren kategorialen Struktur.
Ad (i). Wie bereits weiter oben erwhnt,
leistet der Intensionalisierungstrick in der
MG universelle Dienste bei der Modellierung
nicht-extensionaler Entitten. Was Indivi-
duenkonzepte, Propositionen, Eigenschaften
und Attribute gemeinsam haben, ist ihre ein-
heitliche Form als Intensionsfunktion, die auf
einer Menge von mglichen Welten definiert
ist. Wenn nun ein derartiger Propositionsbe-
griff etwa in der Analyse von Einstellungsver-
ben Verwendung findet, so ergibt sich zwangs-
lufig die Invarianz von Einstellungen unter
logisch quivalenter Substitution, was z. B.
bei der Zuschreibung von berzeugungen
schlichtweg inadquat ist. Der Begriff der
mglichen Welt, den Extensionalisten der
Quinte-Tradition immer schon suspekt,
wurde hier erneut Zielpunkt der Kritik. Die
von Jon Barwise und John Perry begrndete
Situationssemantik (Barwise & Perry 1983,
1987; Perry 1986) sieht einen Hauptfehler in
der Totalitt des mgliche-Welten-Konzepts
und propagiert den bergang zu partiellen
Welten oder Situationen, die dem partiellen
Charakter von Informationszustnden in
Einstellungskonstexten besser angepat seien.
Zugleich sind Situationen feinkrniger, so
da sich die unerwnschten Substitutivitten
vermeiden lassen. Die rein technische Erh-
hung der Feinkrnigkeit kann jedoch auch
durch die Methode der strukturierten Propo-
sitionen erreicht werden (Cresswell & v. Ste-
chow 1982, v. Stechow 1984c, Cresswell
1985b, v. Stechow 1985). Die Frage der be-
grifflichen Adquatheit dieser neueren L-
sungsversuche des Grundproblems der pro-
positionalen Einstellungen kann hier nicht er-
rtert werden; sie gehrt in den Rahmen einer
systematischen Diskussion dieses Problems,
die nicht nur sprachsemantisch zu fhren ist
(s. auch Artikel 34). Ein nicht situationsse-
mantisch orientierter Beitrag, der ebenfalls
den Gedanken der Partialitt aufgreift, ist
Kratzer (1989). Ferner widerlegt Muskens
(1986) den Eindruck, da die Montaguesche
Typentheorie mit der Verwendung partieller
Funktionen nicht vereinbar sei.
Selbst wenn somit offen bleibt, ob sich die
MG auf der Basis der Partialittsidee rekon-
struieren lt, so hlt doch der Intensionali-
sierungstrick einer kritischen Betrachtung
nicht stand. Methodisch liegt ihm die Auffas-
sung zugrunde, da die Objekte der Ontologie
in einer formalen Semantik stets mengentheo-
852 XI. Service-Artikel
prsentationsstruktur (engl. discourse repre-
sentation structure; kurz DRS). Eine DRS ent-
spricht dem, was bisher logische Form ge-
nannt wurde, mit dem Unterschied jedoch,
da auf eine explizite Darstellung der Quan-
toren verzichtet wird: die Information ber
die logischen Beziehungen der sprachlichen
uerung wird stattdessen mithilfe freier
Diskursparameter durch ein Ensemble geeig-
net stratifizierter Boxen kodiert. Die tech-
nische Entscheidung der quantorenfreien Dar-
stellung erlaubt die zwanglose Erweiterung
einer gegebenen DRS zu einer die neue ue-
rung umfassenden DRS und realisiert damit
den Grundgedanken einer dynamischen Se-
mantik. Zugleich baut der Hrer so etwas wie
eine kleine Welt auf, ein partielles Modell
der Wirklichkeit, so wie er sie sieht.
In einem zweiten Schritt gilt es nun, das
durch die DRS gegebene partielle Modell
mit der Wirklichkeit zu konfrontieren.
Technisch gesprochen bedeutet das, da die
Diskursparameter der DRS in dem Indivi-
duenbereich eines gegebenen semantischen
Modells so zu verankern sind, da die in der
DRS beschriebenen Relationen zwischen den
Parametern auch zwischen ihren semanti-
schen Gegenstcken bestehen. Zuordnungen
von Individuen zu Diskursparametern, die
eine derartige Verankerung herstellen, heien
Ankerfunktionen. Die Aufgabe in diesem
Schritt der semantischen Interpretation der
DRS besteht also darin, eine Ankerfunktion
zu finden, bezglich der das Modell die DRS
erfllt. Eine wahrheitsgetreue Verankerung
mag nicht immer gelingen; trotzdem liefert
die DRS eine brauchbare Information, nm-
lich ber den Glaubenszustand des Hrers.
Die DR-Strukturen dienen daher auch zur
Analyse von propositionalen Einstellungen
(siehe etwa Zeevat 1986).
Der rekursive Proze der Erzeugung einer
DRS soll hier nicht beschrieben werden; statt-
dessen seien anhand von einfachen Beispielen
die Grundmechanismen der DRT illustriert.
Beispiel (16) ist ein aus zwei Stzen beste-
hender Text. Als erstes wird die DRS fr (16a)
erstellt, die aus einer einzigen Box besteht.
Zunchst gibt der Eigenname Hans Anla zur
Einfhrung eines Diskursparameters (i. f.
DP) u in die Kopfleiste; in der Box werden
die Bedingungen festgehalten, denen u gen-
gen mu: u = Hans sowie u hat ein Auto.
Die zweite Bedingung kann sodann weiter
reduziert werden, indem die indefinite NP ein
Auto unter Einfhrung eines weiteren DP v
und der Bedingungen Auto(v) und u hat
eben in den typischen donkey-Stzen der Art
(15b) allquantifizierende Kraft besitzt. Der
eingebaute Existenzquantor fhrt damit bei
donkey-Stzen zu eklatant inadquaten Re-
sultaten. Die Systeme von Kamp (1981a) und
Heim (1982) knnen als Hauptantworten auf
diese theoretische Schwierigkeit angesehen
werden. Dabei wurde nicht nur das Prinzip
der strikten Kompositionalitt aufgegeben;
die entdeckte Anomalie gab auch Anla, die
Prinzipien einer semantisch interpretierten
Grammatik insgesamt neu zu berdenken.
Das wichtigste Resultat dieses Prozesses ist
eine Dynamisierung der Semantik (siehe den
nchsten Abschnitt ber die DR-Theorie so-
wie Artikel 10). Whrend die Aufgabe des
statischen Grammatik-Konzepts offensicht-
lich einen Fortschritt darstellt, ist die Frage
nicht von der Hand zu weisen, ob in den
Theorien von Kamp und Heim nicht zuviel
an Kompositionalitt geopfert wurde. Eine
der Haupterrungenschaften der MG, der ex-
plizite bersetzungsalgorithmus, droht sich
zu verflchtigen, so da der polemische Slo-
gan von der miraculous translation, ursprng-
lich gegen die reinen Logiker gerichtet, erneut
die Runde macht. Zum Zeitpunkt dieses For-
schungsberichts sind allerdings durchaus er-
folgversprechende Anstze zu verzeichnen,
die klassische MG durch eine prozedurale
Reinterpretation der Intensoren zu dynami-
sieren (Janssen 1983, Groenendijk & Stokhof
1987). Es mu abgewartet werden, ob sich
durch diese Arbeiten eine neue Perspektive
erffnet, die auch die anderen oben geschil-
derten Schwchen der MG berwinden kann.
5. Die Theorie der Diskurs-
reprsentationsstrukturen (DRT)
Die DRT wurde zuerst in Kamp (1981a) vor-
gestellt und seitdem laufend weiterentwickelt.
Eine bersichtliche Darstellung der Grund-
ideen liefert Haas (1983); zu den neueren Ent-
wicklungen siehe z. B. Reyle (1987) und die
dort angegebene Literatur.
Die Theorie geht von einem hrerorientier-
ten Bild sprachlicher Kommunikation aus. In
einer gegebenen Diskurs-Situation verarbeitet
danach ein Hrer die gerade vorliegende
uerung des Sprechers modellartig ge-
sehen in zwei Schritten. Zunchst wird eine
Reprsentation der uerung erstellt, die in
die bereits vorliegende Reprsentation des
vorausgegangenen Diskurses integriert wird;
eine solche Reprsentation heit Diskursre-
41. Formale Methoden in der Semantik 853
frei.
(17) Jeder Mann in Deutschland hat ein
Auto.
Wenden wir uns Beispiel (17) zu. Hier ist
zunchst die Kopfleiste leer, und die Box ent-
hlt den Eintrag jeder Mann in Deutschland
hat ein Auto. Der Operator jeder gibt jedoch
Anla zur Erffnung eines Paars von unter-
geordneten Boxen, das in seiner Zweigliedrig-
keit einem klassischen Konditional entspricht:
die linke Unterbox enthlt die Antecedens-
Bedingungen (hier Mann(v) und v ist in
Deutschland), die rechte Unterbox die Kon-
sequens-Bedingungen (hier v hat ein Auto).
Da Eigennamen skopuslos sind, knnen der
DP u fr Deutschland in die Kopfleiste der
obersten Box und die Bedingung u =
Deutschland in ihren Inhalt bernommen
werden; ihre semantische Rechtfertigung hat
diese Operation in der Gltigkeit des PL1-
Theorems
(*) [a] u[u = a [u]],
wobei die Nennstelle in der Formel beliebig
tief eingebettet sein kann. Der DP v dagegen,
der sich bei der Auflsung der generellen NP
jeder Mann ergibt, gehrt in die Antecedens-
Box, da eine Ankerfunktion keinen direkten
Zugriff auf ihn haben darf (sonst wrde er
bei der Einbettung in ein Modell existentiell
gebunden). Vielmehr kommt fr das Paar der
abhngigen Boxen das folgende Interpreta-
tionsschema zur Anwendung: Eine Anker-
funktion f verifiziert eine Boxen-Konfigura-
tion wie die hier fr den Allsatz (17) ange-
gebene DRS, wenn (i) f die oberste Box be-
zglich einer geeigneten Belegung ihrer DP
verifiziert und (ii) jede die Antecedens-Box
verifizierende Erweiterung g von f ihrerseits
zu einem Anker g fr die Konsequens-Box
fortgesetzt werden kann, so da g auch diese
v eliminiert wird. Damit ist die DRS fr
(16a) vervollstndigt, da keine weitere Re-
duktion mglich ist. Anstatt nun eine neue,
getrennte DRS fr (16b) zu erstellen, wie das
in einem statischen Grammatik-Modell der
Fall wre, wird die Information aus (16b) in
die DRS von (16a) integriert. Die Pronomina
er und es werden anaphorisch gedeutet und
daher durch die bereits vorhandenen DP u
bzw. v ersetzt; gleichzeitig wird die Box durch
u pflegt v erweitert. Die resultierende DRS
fr den Gesamttext (16) ist unten angegeben.
(16)
a. Hans hat ein Auto.
b. Er pflegt es.
u v
u = Hans
Auto(v)
u hat v
u pflegt v
Bei der Wahl des Antecedens fr die Prono-
mina besteht eine gewisse Freiheit, auch wenn
eventuell vorhandene lexikalische Informa-
tion ausgentzt wird (im vorliegenden Bei-
spiel macht der Unterschied im Genus der
Pronomina die Bezge klar). Fr syntaktische
Beschrnkungen siehe die folgenden Bei-
spiele, vor allem (19).
Die DRS fr (16) wird nun in einem Modell
M wahr genannt, wenn es eine Ankerfunktion
f gibt, die die DRS in M verifiziert, d. h. die
DP u und v derart auf Individuen a und b
abbildet, da die Bedingungen in der Box
erfllt sind; dies ist der Fall, wenn a der Hans
ist und b ein Auto, das a besitzt und pflegt.
Ganz allgemein besagt die Forderung der Exi-
stenz einer verifizierenden Ankerfunktion,
da die DP in der Kopfleiste der obersten
Box einer DRS (hier besteht die DRS nur aus
einer einzigen Box) metasprachlich existentiell
abgebunden werden. Damit ergibt sich die-
selbe Semantik wie fr die PL1-Reprsenta-
tion von (16),
(16) uv[u = Hans Auto(v) u hat v
u pflegt v]
Speziell behlt damit auch die indefinite NP
ein Auto existentielle Kraft, wenn auch nur
indirekt. Es ist also irrefhrend zu sagen, wie
es manchmal schlagwortartig geschieht, da
indefinite NPn nicht quantifizierend seien:
die Quantifikation ist lediglich in die Meta-
sprache verschoben; nur die Reprsentation,
nicht aber die Interpretation, ist quantoren-
854 XI. Service-Artikel
zu sehen (dabei fhrt ein Wenn-dann-Satz wie
ein Allquantor zu einem abhngigen Boxen-
Paar), so wird deutlich, da der DP w fr
Lehrer nicht in einer Box erscheint, die ober-
halb der Box mit dem Pronomen liegt. Dieses
kann daher nur deiktisch gedeutet werden,
was sich in der Wahl eines neuen DP v uert
(v knnte dann auch in die oberste Box ber-
nommen werden, da es nicht abhngig ist).
(19) Wenn ein Schler jeden Lehrer hat, r-
gert er ihn.
Die DR-Theorie wurde auer auf dem Gebiet
der hier skizzierten anaphorischen Beziehun-
gen vor allem zur Analyse und Reprsenta-
tion temporaler Strukturen herangezogen, wie
sie in narrativen Texten auftreten; siehe dazu
etwa Kamp & Rohrer (1983, 1985) und Reyle
(1986). Zu der umfangreichen Literatur ber
temporale Strukturen in der natrlichen Spra-
che siehe ferner LoCascio & Vet (1986); fr
eine vorzgliche Abhandlung zur Logik von
Zeitstrukturen siehe van Benthem (1983 a).
6. Algebraische Semantik
Nachdem die DRT als Reprsentant fr eine
dynamisierte Semantik vorgestellt wurde,
kommen wir nun zu einem anderen Strang
der neueren semantischen Forschung, der sich
reicherer mathematischer Methoden bedient,
welche unter dem Begriff algebraisch zusam-
mengefat werden knnen. In ihrer einfach-
sten Form sind es Ordnungsstrukturen auf den
betrachteten semantischen Objekten, die bis-
Box verifiziert. Die Bedingung der Fortsetz-
barkeit auf den Anker g ist notwendig, weil
in der Konsequens-Box weitere indefinite
NPn auftreten knnen, die dann abhngig
existentiell zu interpretieren sind; m. a. W. die
Wahl der Belegung der DP in der Kopfleiste
der Konsequens-Box hngt von der gewhlten
Belegung der DP in der Antecedens-Box ab.
In Satz (17) z. B. ist die indefinite Objekt-NP
ein Auto abhngig von der Subjekt-NP jeder
Mann; in der zugehrigen (vervollstndigten)
DRS erscheint daher der DP w fr ein Auto
nur in der Konsequens-Box.
Damit ist das Instrumentarium fr die Be-
handlung der donkey-Stze gegeben. Satz (18)
erhlt wie (17) eine stratifizierte DRS zur
Reprsentation des bedingten Allsatzes. Dies-
mal befindet sich jedoch die indefinite NP ein
Auto im Relativsatz der Subjekt-NP, so da
sie in die Antecedens-Box gelangt und dort
einen DP v beisteuert. Das hat den Effekt,
da v in der Semantik allquantifiziert wird,
wie es intuitiv korrekt ist. Bei der Vervoll-
stndigung der DRS mu schlielich das Pro-
nomen es in einen geeigneten DP verwandelt
werden. Soll das Pronomen anaphorisch ver-
standen werden, so unterliegt die Wahl des
DP neben der erwhnten lexikalischen Be-
schrnkungen der syntaktischen oder konfi-
gurationellen Bedingung, da nur solche DP
zur Verfgung stehen, die sich in Boxen
oberhalb der gerade bearbeiteten Box be-
finden, wobei die Relation des oberhalb
durch die angegebenen Pfeile zwischen den
Boxen illustriert ist.
(18) Jeder Deutsche, der ein Auto hat, putzt
es.
Mit der genannten Bedingung an die Wahl
der DP lt sich erklren, warum im folgen-
den Satz (19) das Pronomen ihn nicht auf das
Nomen Lehrer bezogen werden kann. Ent-
wickelt man die zugehrige DRS, wie unten
41. Formale Methoden in der Semantik 855
tungen der logischen Determinatoren in der
vorliegenden extensionalen Version notieren
(die Normstriche . stellen wie oben die
Denotationsfunktion dar):
(20)
a.
jederA = {X E A X} =
{X E A X = A}
b.
einA = {X E A X }
c. keinA = {X E A X = }
d. nicht jeder A =
{X E A X A}
Was an den Bedingungen auffllt, ist ihre
einheitliche Struktur: in allen vier Fllen spielt
nur das Verhltnis der Mengen A und der
Schnittmenge A X von A und dem Argu-
ment X eine Rolle. Das bedeutet, da der
Quantifikationsbereich A auch im formalen
Sinn das ausschlieliche Terrain der Aus-
wertung der Aussage darstellt: die Eigenschaf-
ten des Arguments X jenseits der Schnitt-
menge A X sind irrelevant. Damit erfllen
die logischen Determinatoren das Prinzip der
Konservativitt:
(CONS) DAB DA(A B)
Zum Beispiel gilt offensichtlich, da alle Men-
schen sterblich sind, genau dann wenn alle
Menschen Menschen sind, die sterblich sind.
Es zeigt sich, da die Eigenschaft der Kon-
servativitt fr alle natursprachlichen Quan-
toren bzw. Determinatoren charakteristisch
ist. Eine weitere solche Eigenschaft ist die der
Quantitt: wie schon ihr Name sagt, schauen
die Quantoren nur auf die reinen Quantitts-
oder Mengenverhltnisse zwischen dem Be-
reich und dem Argument, sonstige Eigen-
schaften spielen keine Rolle. Da aber diese
quantitativen Verhltnisse konstant bleiben,
wenn man den Individuenbereich durch eine
bijektive Transformation permutiert, sollten
die Determinatoren unter einer solchen Per-
mutation invariant sein. Dies ist das Prinzip
der Quantitt: fr jede Permutation n auf dem
Individuenbereich E gilt
(QUANT) DAB <=>D [A][B]
Weitere Eigenschaften fr natursprachliche
Quantoren knnen untersucht und als cha-
rakteristisch ausgesondert werden (siehe etwa
Barwise & Cooper 1981, van Benthem 1983).
Dabei kann von dem Umstand Gebrauch ge-
macht werden, da Determinatoren zweistel-
lige Relation sind: so knnen sie auf die typi-
schen Eigenschaften solcher Relationen wie
Transitivitt, Symmetrie etc. hin untersucht
werden. Zum Beispiel lt sich der Allquantor
dadurch charakterisieren, da er der einzige
reflexive, transitive und antisymmetrische De-
terminator ist. Weiterhin lassen sich beweis-
weilen zustzlich Verbandseigenschaften auf-
weisen oder volle Boolesche Algebren darstel-
len. Die Erkenntnisse der Bedeutung alge-
braischer Begriffsbildung geht einher mit dem
Erfolg dieser Methoden in der neueren Syn-
tax-Forschung durch die Theorie der Uni-
fikationsgrammatiken.
6.1Die Theorie der Generalisierten
Quantoren (GQT)
Montague hatte einen Weg gewiesen, wie No-
minalphrasen durch eine einheitliche Deno-
tation kompositional behandelt werden kn-
nen; eine NP steht danach fr eine geeignete
Menge von Eigenschaften von Individuen, die
in der Typenhierarchie den Typ (set)t besitzt.
Abstrahieren wir von der intensionalen Kom-
ponente, so bleibt eine Menge von Mengen
von Individuen vom Typ (et)t, die auch als
Relation in der Potenzmenge 2
E
der Menge E
der Individuen aufgefat werden kann. Diese
Objekte sind die Generalisierten Quantoren
(GQ), wie sie von Barwise & Cooper (1981)
im Anschlu an eine auf Mostowski (1957)
zurckgehende Begriffsbildung in die lingu-
istische Semantik eingefhrt wurden (s. auch
Artikel 21). Genausogut kann man sie jedoch,
wie gezeigt, als extensionale Version der Mon-
tagueschen Terme auffassen. Im allgemei-
nen haben die GQ in der Sprache die Gestalt
Determinator + Nomen, z. B. ein/kein/jeder/
der Mann, einige/manche/alle/nicht alle Stu-
denten, wenige/viele/die meisten Frauen, drei/
vier oder fnf/mindestens zehn/hchstens zwei
Autos, Peters/Hans und Marias/aller Haus,
eine ungerade Anzahl von Kommissionsmitglie-
dern. Whrend man in der Logik vor allem
mathematische GQ wie fr unendlich viele
Zahlen gilt ... untersucht hat, gilt es hier,
Eigenschaften zu finden, die fr die natur-
sprachliche Quantifikation charakteristisch
sind.
Man erhlt ein einheitlicheres Bild fr die
Struktur, wenn man sogleich einen Schritt
weiter geht und aus dem GQ das Nomen
herauslst. Da dieses ebenfalls eine Menge
von Individuen denotiert, kann man den ver-
bleibenden Determinator als zweistellige Re-
lation in 2
E
vom Typ (et)(et)t auffassen: ein
Determinator D nimmt zuerst ein Nomen A
zu sich, welches den Bereich der Quantifika-
tion absteckt. (DA) bildet dann einen GQ, der
auf einem weiteren Nomen B operiert und
eine vollstndige Aussage (DA)B bildet, die
wahr oder falsch ist. Dies ist das bekannte
Schema, und wir knnen sogleich die Bedeu-
856 XI. Service-Artikel
Ansatzes kritisch zum Tragen: das bekann-
teste Beispiel ist der Quantor die meisten, der
nicht PL1-definierbar ist (Barwise & Cooper
1981). Seine Analyse macht wesentlich davon
Gebrauch, da natursprachliche Quantoren
auf ihrem Bereich leben (engl. live on). Ein
Satz wie die meisten Arbeiter der Lenin-Werft
streikten kann nicht, wie analog der PL1-
Quantor jeder, nach dem Schema paraphra-
siert werden: fr die meisten x gilt: wenn x
Arbeiter der Lenin-Werft ist, so streikt x; viel-
mehr geht es ausschlielich um die Arbeiter
auf der Lenin-Werft, und wenn dort der An-
teil der Streikenden (erheblich) grer ist als
der der Nicht-Streikenden, so ist der Satz
wahr. Die Theorie der GQ erlaubt somit nicht
nur abstrakt-formale Untersuchungen; es las-
sen sich auch konkrete linguistische Probleme
in ihrem Rahmen mit Gewinn analysieren.
Eine gute Demonstration der Tragweite der
Techniken der GQT gibt Lbner (1986).
Lnning (1987) gibt eine Anwendung der
Theorie auf Massenausdrcke. Das Problem
der donkey-Stze, das die GQT von Monta-
gue ererbt hat, wird von Barwise (1987) mit
Hilfe von parametriesierten Individuen
einer Lsung zugefhrt. Schlielich sei auf
Grdenfors (1987) und der darin enthaltenen
Bibliographie zur GQT in der natrlichen
Sprache verwiesen.
Einen in den Methoden der GQT ver-
wandten Ansatz stellt die Boolesche Semantik
dar (Keenan 1981, Keenan & Faltz 1985, Kee-
nan & Stavi 1986). Die in der GQT eher
implizit vorhandenen algebraischen Techni-
ken kommen hier explizit zum Einsatz. Der
Grundgedanke besteht darin, da beinahe das
gesamte Kategoriengefge der natrlichen
Sprache insofern einen Booleschen Charakter
aufweist, als die Booleschen Operationen
nicht nur fr ganze Stze, sondern auch fr
NPn, VPn usw. definiert sind. Wenn man nun
diese Kategorien semantisch durch Boolesche
Algebren reprsentiert, so lassen sich solche
Beziehungen zwischen den Kategorien, wie sie
in der Syntax etwa als Konjunktionsreduktion
bezeichnet wurden, durch Boolesche Homo-
morphismen charakterisieren.
6.2Anwendungen in der Theorie der
Pluralia, Massenausdrcke und
Ereignisse
Besonders fruchtbar erweisen sich algebra-
ische Begriffsbildungen, wenn es darum geht,
die sprachliche Ontologie in ihrem ganzen
Reichtum zu erfassen. Die klassischen Indi-
viduen der Tarski-Semantik waren als un-
bare Universalien formulieren: so gibt es etwa
in der natrlichen Sprache keine asymmetri-
schen Determinatoren (van Benthem 1983:
461); fr weitere Universalien siehe ebd. sowie
dort angegebene Literatur.
Das Bild der natursprachlichen Determi-
natoren als Relationen in 2
E
ermglicht wei-
tere Struktureinsichten. Auf der Potenzmenge
2
E
ist nmlich mit der Mengeninklusion eine
Halbordnung gegeben, bezglich der die Ar-
gumente der Determinatoren geordnet sind.
Das erlaubt etwa die Frage, ob ein Determi-
nator stabil unter dem bergang zu den Ober-
bzw. Teilmengen eines Arguments ist; dies
sind die Eigenschaften der Monotonie:
(MON) DAB & A A DAB
(aufwrts monoton im ersten Argument)
(MON) DAB & A A DAB
(abwrts monoton im ersten Argument)
(MON) DAB & B B DAB
(aufwrts monoton im zweiten Argument)
(MON) DAB & B B DAB
(abwrts monoton im zweiten Argument)
(iMONj) : <=> (iMON) & (MONj)
fr i, j = ,
Der Allquantor jeder zum Beispiel ist abwrts
monoton im ersten Argument und aufwrts
monoton im zweiten Argument: Wenn z. B.
jeder Deutsche ein Auto hat, dann hat auch
jeder Bayer ein Auto (abwrts monoton im
ersten Argument), und wenn etwa jeder Zahn-
arzt eine Zweitwohnung im Tessin besitzt, so
besitzt jeder Zahnarzt eine Wohnung (auf-
wrts monoton im zweiten Argument). Es
stellt sich nun heraus, da die vier logischen
Grundquantoren des aristotelischen Quadrats
der Oppositionen (siehe etwa Essler 1969:
135 ff) sich genau durch die vier Kombinatio-
nen der Monotonie darstellen lassen, wie das
folgende Schema zeigt:
Bei den nicht-logischen Quantoren der Spra-
che kommen die Prinzipien des gegenwrtigen
41. Formale Methoden in der Semantik 857
statt zur Vermeidung der Aufspaltung solcher
gemischten Prdikate in Individuen- und
Mengenprdikate die normalen Individuen
nun ihrerseits zu Einermengen ihrer selbst zu
erheben, besteht der algebraische Weg darin,
Pluralobjekte in den Individuenbereich auf-
zunehmen, die mitgelieferte innere Struktur
jedoch verbandstheoretisch zu kodieren. Eine
entsprechende Pluraltheorie wurde in Link
(1983a) vorgelegt; siehe auch Artikel 19. Da-
nach denotiert der Ausdruck Hans und Maria
eine Individuensumme (kurz i-Summe), mit-
geteilt durch den Pluralterm hm. Zwischen
derartigen i-Summen besteht eine Ordnungs-
relation
i
, mit der etwa gilt h
i
hm],
d. h. da Hans ein Individuen-Teil der i-
Summe aus Hans und Maria ist. Mit dieser
Grundkonzeption lassen sich u. a. die folgen-
den semantischen Probleme behandeln: (i) Es
kann ein rekursiver Plural-Operator * auf
einstelligen Prdikaten P definiert werden,
der aus der Extension P von P die Menge
aller i-Summen von Elementen von P er-
zeugt; damit ist ein przises semantisches Ge-
genstck zu Plural-Nomina gegeben. (ii) Der
klassische Kennzeichnungsoperator lt sich
zu einem pluralischen Kennzeichnungsoperator
erweitern, mit dem definite Plural-NPn
wie die Bundestagsabgeordneten erfat werden
knnen. (iii) Durch ein einheitliches Konzept
von Variablen, die gleichermaen ber ato-
mare Individuen wie i-Summen laufen, las-
sen sich Plural-Anaphern in natrlicher Weise
behandeln. Fr Details siehe Artikel 19 mit
der dort angegebenen Literatur.
2. Massenausdrcke. blicherweise wird
ein Massenausdruck wie Wasser als Prdikat
aufgefat, dessen Extension aus Portionen
oder Quanten des entsprechenden Stoffes be-
steht. Zwei solche Portionen zusammenge-
nommen sind aber wieder eine Portion des-
selben Stoffes; das zeigt, da alle derartigen
Extensionen eine natrliche Struktur tragen,
die analog zu den Pluralia durch eine Ver-
bandsstruktur charakterisiert werden kann.
Bei den Massentermen spielt jedoch ein wei-
teres wesentliches Moment eine Rolle, das der
kontinuierlichen Referenz: es gibt keine klein-
sten Einheiten von Stoffquanten. Der diskrete
Begriff des Zhlens ist nicht mehr anwendbar
und mu ersetzt werden durch den des Maes
von Stoffquanten bezglich relevanter Ein-
heiten. Voraussetzung fr die Definition eines
Maes ist aber eine geeignete algebraische
Struktur des Definitionsbereichs, hier eben
des Bereichs der Stoffquanten. Es ist daher
nicht verwunderlich, da bei der Erforschung
strukturierte Urelemente gegeben, allenfalls
unterschied man noch Zeitpunkte, die mit
einer linearen Ordnungsstruktur versehen
waren. Montague etwa war der berzeugung,
da mit diesem Arsenal von Individuen plus
der Menge der mglichen Welten alle sonsti-
gen Individuen, auf die man in der Philoso-
phie und in der natrlichen Sprache trifft,
mengentheoretisch modelliert werden knnten.
Ereignisse etwa konstruierte er als (intensio-
nale) Eigenschaften von Zeitpunkten. Wie
schon oben im Zusammenhang mit den Ob-
jekten der propositionalen Einstellungen er-
whnt, hat die Methode der mengentheore-
tischen Modellierung mit den genannten Mit-
teln ihre klaren Grenzen. Ein anderes Pro-
blem ist technischer Natur: werden einige Ob-
jekte der Sprachontolgoie als hher-typige
Entitten denn andere konstruiert, so mssen
die Prdikate, die auf die einzelnen Objekt-
sorten zutreffen knnen, entweder stets dis-
junkte Klassen bilden (was meist nicht der
Fall ist), oder man mu den wenig attraktiven
Weg einschlagen, ein und dasselbe Prdikat
mehrfach (d. h. fr alle entsprechenden Ty-
pen) in die Grammatik aufzunehmen. Das
letztgenannte Phnomen war typischerweise
z. B. bei den frhen Anstzen zur Theorie des
Plurals zu beobachten.
Der algebraische Zugang zur Sprachonto-
logie verzichtet dagegen auf ein extensives
mengentheoretisches Modellieren, sondern
fat die Objekte der Sprachontologie zu
einem vielfltig sortierten Universum von En-
titten der gleichen untersten Stufe zusam-
men. Diese Entitten stehen jedoch im allge-
meinen nicht beziehungslos nebeneinander;
um den bestehenden Beziehungen Rechnung
zu tragen, wird daher das Universum durch
eine entsprechende Menge ordnungstheoreti-
scher und algebraischer Relationen struktu-
riert. Wir geben einige Beispiele.
1. Pluralobjekte. Pluralphnomene durch-
ziehen die gesamte Grammatik. Es ist daher
wichtig, eine leistungsfhige Pluraltheorie zu
besitzen. Die semantische Ausgangsfrage ist
dabei, was Pluralterme wie Hans und Maria
bezeichnen. Die naheliegende Antwort die
Menge bestehend aus Hans und Maria
krankt schon daran, da wir uns bereits wie-
der im Proze des mengentheoretischen Mo-
dellierens befinden und es sofort mit der Stu-
fenproblematik zu tun bekommen: einem Pr-
dikat wie das Klavier in den dritten Stock
tragen sieht man nmlich nicht an, ob es nur
auf Pluralterme oder auch auf normale Indi-
viduenterme wie Obelix zutreffen kann. An-
858 XI. Service-Artikel
auf sie Bezug genommen werden kann (e. g.
in dieser Fehler fhrte zu einer gewaltigen Ex-
plosion; sie lste verheerende Brnde aus. Zu
VP-Anaphern siehe auch Sells 1985). Von der
oben angesprochenen Teil-Ganzes-Relation
zwischen Ereignissen ist die ebenso intuitiv
klar fabare zeitliche Struktur auf den Ereig-
nissen zu unterscheiden. Diese kann man sich
induziert denken von einer entsprechenden
Struktur auf den Zeitspannen, zu denen die
Ereignisse stattfinden (ihren temporalen Spu-
ren). Das fhrt zu einem (auch intuitiv ad-
quaten) Homomorphie-Zusammenhang zwi-
schen der Summen-Struktur auf den Ereignis
und der Zeitspannen-Struktur: die temporale
Spur einer Summe von (sich mglicherweise
berlappenden) Ereignissen ist die Summe der
temporalen Spuren der beteiligten Einzel-
ereignisse.
Mit dem Instrument der Summenbildung
fr Ereignisse (brigens in einem weiten Sinn
verstanden, der auch Zustnde umfat) lassen
sich auch Identittsfragen beantworten, die
bisweilen den Ereignissen einen dubiosen An-
strich verliehen haben. Mit wieviel Ereignis-
sen etwa haben wir es zu tun, wenn Max und
Moritz aufeinander losschlagen? Es ist ein
Ereignis und zugleich sind es zwei Ereignisse
mit identischen temporalen Strukturen: sie
haben beide die Form [a schlgt auf b los],
nur sind die Rollen a und b vertauscht; einmal
ist Max der Schlger und Moritz das Ziel
der Aggression, das andere Mal umgekehrt.
Diese Ereignisse finden simultan statt, und
ihre Summe stellt das eine Ereignis des Auf-
einanderlosschlagens dar. Zur Differenzie-
rung dieser beiden formal identischen Ereig-
nisschemata ist der Begriff der Rolle von Be-
deutung, die ein Individuum in einem Ereignis
spielt. Hier lt sich eine fruchtbare Verbin-
dung herstellen zum linguistischen Begriff der
thematischen Rolle; zu deren semantischen
Analyse siehe Dowty (1987) und Parsons
(1989).
Die Idee einer Semantik mit expliziter Er-
eignis-Referenz geht auf Davidson (1967a)
zurck; allerdings stand seine Ereignislogik
im Zusammenhang mit der Begrndung einer
philosophischen Handlungstheorie. Die Er-
eignis-Theorie von Parsons (1980b, 1989) fut
auf der von Davidson und fhrte diese in die
linguistisch-semantische Diskussion ein. In
der semantischen Literatur wurde der Ge-
danke einer verbandstheoretischen Behand-
lung von Ereignissen in Analogie zu den Me-
thoden in Link (1983a) von Bach (1986) vor-
gestellt sowie in Hinrichs (1985), Krifka
der Massenausdrcke erst dann wesentliche
Fortschritte erzielt werden konnten, als Me-
thoden der algebraischen Semantik konse-
quent zum Einsatz gelangten. Die entspre-
chende Perspektive wurde in Link (1983a)
dargelegt und wurde seitdem am umfang-
reichsten in M. Krifkas Dissertation (1987)
mit Erfolg empirisch und methodisch ver-
folgt; siehe auch seinen Artikel im vorliegen-
den Handbuch (Artikel 18).
3. Arten (kinds). Die soeben besprochenen
Massenausdrcke stellen in der Grammatik
bekanntlich einen Zwitter dar: sie knnen so-
wohl prdikativ wie auch nominal verwendet
werden (dies ist echtes Gold vs. Gold hat die
Ordnungszahl 79). In der nominalen Verwen-
dung denotiert der Massenterm den Stoff
selbst und nicht die Menge seiner manifesten
Quanten. Dies ist ein Fall von Artendenota-
tion, wie sie sich auch bei Individualnomina
findet (e. g. die Nordsee-Robbe ist vom Aus-
sterben bedroht). Lt man Arten-Individuen
oder Genera (engl. kinds) ebenfalls in der
Sprachontologie zu, wofr gute Grnde spre-
chen (der locus classicus hier ist Carlson
1978), so ist unmittelbar einleuchtend, da
die Arten-Hierarchie bzw. allgemeiner eine
entsprechende Hierarchie von Begriffen oder
Konzepten algebraisch zu charakterisieren ist.
Zur sprachphilosophischen Diskussion der
Genera siehe Heyer (1987), zur Arten-Deno-
tation in der Linguistik neben Carlson (1978)
und Artikel 17 die neuere Literatur zur Ge-
nerizitt, speziell Gerstner (1988), Krifka
(1988) sowie Carlson & Pelletier (1991). Zur
verbandstheoretischen Analyse von Begriffen
oder Konzepten sei auf Wille (1982) verwie-
sen.
4. Ereignisse. Hat man erst einmal die De-
notationsobjekte des nominalen Bereichs ge-
eignet strukturiert, so bertrgt sich eine der-
artige Struktur aufgrund des inneren Zusam-
menhangs der Grammatik beinahe zwangs-
lufig auch auf den Verbalbereich. Wenn z. B.
Hans ein Glas Wein trinkt und danach noch
ein Glas, so stellt das zwei Trinkereignisse
dar, die zusammen wiederum ein Trinkereig-
nis bilden, nmlich da Hans zwei Glas Wein
trinkt. Die ersten beiden Ereignisse bilden
Teilereignisse des letztgenannten, der Summe
der beiden Ereignisse, so da wir es wiederum
mit einer Ordnungsstruktur zu tun haben,
diesmal auf einer Klasse von Ereignissen. Es
ist sprachanalytisch sinnvoll, auch Ereignisse
als Individuen zuzulassen, da sie die natrli-
chen Denotate von Nominalisierungen wie die
Zerstrung Dresdens bilden und pronominal
41. Formale Methoden in der Semantik 859
7. Weitere Anstze
Es seien abschlieend noch einige Entwick-
lungen in der formalen Methodik wenigstens
erwhnt, die hier nicht nher diskutiert wer-
den konnten. Da ist zunchst die Theorie der
Situationen und eine darauf aufbauende Si-
tuationssemantik. Sie ist mit dem Anspruch
angetreten, eine neue Begrndung des gesam-
ten semantischen Forschungsgebiets zu lie-
fern, die den traditionellen Bedeutungsbegriff
in eine umfassende Theorie der Information
integriert. Whrend auf dem Gebiet der lo-
gischen Grundlagen der Situationstheorie be-
merkenswerte Ergebnisse erzielt wurden, ste-
hen auf dem Feld der Anwendung in der
Semantik Ergebnisse grerer Tragweite noch
aus (siehe jedoch Gawron & Peters 1990).
Allerdings haben die seit einiger Zeit vorlie-
genden Grundideen des Ansatzes (etwa der
bereits oben erwhnte Gedanke der Partiali-
tt; das Begriffspaar Situation und Situations-
typ sowie sein enger Verwandter, das Paar
Ereignis und Ereignistyp) ihre teils fruchtbare,
teils polarisierende Wirkung nicht verfehlt.
An wichtiger Literatur sei genannt Barwise &
Perry (1983 bzw. 1987), Barwise & Perry
(1985), Barwise & Etchemendy (1987), Devlin
(1988), Barwise (1989), Gawron & Peters
(1990), Cooper et al. (1990). Eine umfassende
Wahrheitstheorie und eine andere als die in
Barwise & Etchemendy (1987) vorgeschlagene
Lsung des Lgner-Paradoxes gibt Blau
(1985) in seiner Reflexionslogik; siehe auch
Varga (1987). Im Rahmen der Reflexionslogik
werden brigens viele traditionelle Probleme
der logischen Sprachanalyse und linguisti-
schen Semantik wie Vagheit und Prsupposi-
tionen behandelt (vgl. Abschnitt 3). Der In-
formationsbegriff und sein formales Pendant,
der Partialittsgedanke, steht auch im Mit-
telpunkt der Daten-Semantik (engl. Data Se-
mantics); siehe Veltman (1981, 1985), Land-
man (1986). Dieser Ansatz arbeitet ebenfalls
mit algebraischen Methoden, da das Konzept
der Erweiterung von partieller Information
inhrent ordnungstheoretisch beschaffen ist.
Einen neuartigen, typenfreien Begrndungs-
versuch der VP-Denotation, der sich aus der
Erforschung der Semantik der Nominalisie-
rungen entwickelte, stellt die Theorie der Ei-
genschaften (engl. Property Theory) dar. Ein-
schlgige Referenzen sind Turner (1983),
Chierchia (1984), Chierchia & Turner (1987),
Turner (1986, 1988), Chierchia et al. (1987).
Mehr syntaktisch und komputationell orien-
tierte Methoden auf der Basis von Syntax-
(1986) und Link (1987 b) aufgegriffen und
weiterentwickelt. Insbesondere Krifka (1987)
gelang in diesem Rahmen eine plausible Theo-
rie der bertragung der Referenzweise von
Verbal-Objekten auf die gesamte VP. Gemeint
ist der bekannte Wechsel der Aktionsart, z. B.
von einen Apfel essen (accomplishment; siehe
dazu Vendler 1967, Verkuyl 1972, 1986) zu
pfel essen (activity). Der bergang vom Sin-
gular zum Plural im nominalen Bereich des
direkten Objekts induziert einen bergang
vom Einzelereignis zum Summenereignis im
verbalen Bereich.
So zeigt sich erneut, da die algebraische
Struktur auf den Ereignissen (als den passen-
den Denotaten von Verbalphrasen) eine na-
trliche Folge der Strukturierung des nomi-
nalen Bereichs ist. Sie ist daher auch bei an-
deren Themen hilfreich, die im Rahmen der
Diskussion von Plural-Phnomenen eine
Rolle spielen. Erwhnt sei hier die Distinktion
kollektive vs. distributive Prdikation, bei der
die homomorphe Struktur zwischen Verbal-
und Nominalbereich klar formuliert werden
kann. Betrachten wir etwa die beiden Les-
arten des Satzes Denys und Tania besitzen eine
Farm in Afrika. In der kollektiven Lesart
haben wir es mit einer Farm zu tun, die Denys
und Tania gemeinsam besitzen; in der distri-
butiven Lesart besitzt Denys eine Farm und
Tania besitzt eine Farm. Im ersten Fall liegt
ein einzelnes Ereignis mit einem kollektiven
Besitzer vor, welches in halbformaler Nota-
tion durch den Ereignistyp [Denys Tania
besitzt a & Farm(a)] beschrieben werden
kann; im zweiten distributiven Fall bezieht
sich der Satz auf eine Summe von Ereignissen
mit je einem einzelnen Besitzer, in halbfor-
maler Notation: [Denys besitzt a & Farm(a)]
[Tania besitzt b & Farm(b)].
Aus den in diesem Abschnitt aufgefhrten
Beispielen mgen die Allgemeinheit und die
Fruchtbarkeit des algebraischen Forschungs-
programms in der Semantik deutlich gewor-
den sein. Es sei betont, da mathematische
Methoden in der Semantik wie auch in an-
deren Bereichen angewandter Theoriebildung
keinen Selbstzweck darstellen, sondern nur in
dem Mae sinnvoll sind, wie sie die Theorie
formal verbessern und inhaltlich echte Struk-
tureinsichten zu vermitteln vermgen. Die
Entwicklung des semantischen Forschungs-
gebiets hat gezeigt, da diese Methoden mit
Gewinn eingesetzt werden. Ein einschlgiges
Lehrbuch stellt Partee et al. (1990) dar.
860 XI. Service-Artikel
1984 Groenendijk/Stokhof 1987 Groenendijk/de
Jongh/Stokhof (eds.) 1986a Groenendijk/de
Jongh/Stokhof (eds.) 1986b Groenendijk/Janssen/
Stokhof (eds.) 1981 Groenendijk/Janssen/Stokhof
(eds.) 1984 Groenendijk/de Jongh/Stokhof (eds.)
1986 Groenendijk/Stokhof/Veltman (eds.) 1987
Haas 1983 Heim 1982 Heim 1983 Heyer 1987
Hinrichs 1985 Hinst 1974 Hughes/Cresswell
1968 Janssen 1983 Jacobs 1982 Kalish/Mon-
tague/Mar 1980 Kamp 1981a Kamp/Rohrer
1983 Kamp/Rohrer 1985 Karttunen 1974 Kart-
tunen/Peters 1979 Keenan (ed.) 1975 Keenan
1981 Keenan/Faltz 1985 Keenan/Stavi 1986
Kleene 1952 Kratzer 1978 Kratzer 1989 Krifka
1986 Krifka 1987 Krifka (ed.) 1988 Landman
1986 Landman/Veltman (eds.) 1984 Lewis
1975a Link 1976 Link 1979 Link 1983a Link
1986 Link 1987b LoCascio/Vet (eds.) 1986
Lbner 1976 Lbner 1986 Lbner 1987b
Lnning 1987 Montague 1970b Montague
1973 Montague 1974 Mostowski 1957 Mus-
kens 1986 Parsons 1980b Parsons 1988 Partee
(ed.) 1976 Partee 1984a Partee 1987a Partee/
Rooth 1983 Partee/ter Meulen/Wall 1990 Perry
1986 Pinkal 1984 Pinkal 1985 Pollard/Sag
1987 Quine, van Orman 1969 Reyle 1986 Rus-
sell 1905 Searle/Vanderveken 1985 Seills 1985
Soames 1982 von Stechow 1984c Stegmller/
Varga von Kibd 1984 Strawson 1952 ter Meu-
len (ed.) 1983 Turner 1983 Turner 1986 Turner
1988 Varga von Kibd 1987 Veltman 1981 Velt-
man 1985 Vendler 1967 Verkuyl 1972 Verkuyl
1986 Whitehead/Russell 1927 Wille 1982 Zaef-
ferer 1984 Zaefferer 1988 Zeevat 1986 Zim-
mermann 1987
Godehard Link, Mnchen
(Bundesrepublik Deutschland)
Theorien wie der Generalized Phrase Structure
Grammar (GPSG) verfolgen Pollard & Sag
(1987). Schlielich sei noch auf ein aktives
Forschungsfeld verwiesen, das die Methoden
der Semantik der (traditionell im Mittelpunkt
stehenden) Deklarativstze auf das gesamte
Spektrum der Illokutionstypen, vor allem aber
auf die Theorie der Fragen, bertrgt. Zitiert
seien Belnap & Steel (1976), Zaefferer (1984),
Groenendijk & Stokhof (1984), Searle & Van-
derveken (1985), Zaefferer (1988).
8. Literatur (in Kurzform)
Aczel 1988 Bach 1986 Ballmer/Pinkal (eds.)
1983 Barwise 1987 Barwise 1989 Barwise/Coo-
per 1981 Barwise/Etchemendy 1987 Barwise/
Perry 1983 Barwise/Perry 1985 Barwise/Perry
1987 Buerle 1988 Buerle/Schwarze/von Ste-
chow (eds.) 1983 Bealer 1982 Belnap/Steel 1976
van Benthem 1983a van Benthem 1983b van
Benthem 1985 van Benthem 1987 van Benthem/
ter Meulen (eds.) 1985 Blau 1978 Blau 1983
Blau 1985 Carlson 1978 Carlson/Pelletier (eds.)
1991 Chierchia 1984 Chierchia/Turner 1987
Chierchia/Partee/Turner (eds.) 1989 Church
1940 Cooper/Mukai/Perry (eds.) 1990 Copi/
Gould 1967 Cresswell 1973 Cresswell 1985b
Cresswell/von Stechow 1982 Davidson 1967a
Davidson 1980 Davis/Mithun (eds.) 1979 Devlin
1988 Dowty 1979 Dowty 1987 Dowty/Wall/
Peters 1981 Essler 1969 Fine 1985 van Fraassen
1966 van Fraassen 1971 Gabbay/Guenthner
1983 Gabbay/Guenthner 1984 Gabbay/Guenth-
ner 1986 Gabbay/Guenthner 1989 Gallin 1975
Grdenfors (ed.) 1987 Gawron/Peters 1990 Gaz-
dar 1979 Gerstner 1988 Groenendijk/Stokhof
861
XII. Bibliographischer Anhang und Register
Bibliographic Appendix and Indices
42. Bibliographie
Bibliography
Diese Bibliographie umfat alle von den Autoren der Artikel zitierte Literatur. Die Herausgeber
haben versucht, die Angaben der Autoren so weit wie mglich zu verifizieren und zu standardi-
sieren; sie knnen allerdings nicht fr die Richtigkeit in jedem Detail garantieren.
Um so informativ wie mglich zu sein, enthlt die Bibliographie auch einige Artikel oder
Bcher, die noch nicht publiziert sind, sowie wenige (historisch wichtige) Papiere, die niemals
publiziert wurden. Der an dieser Untergrund-Literatur interessierte Leser sollte an den jeweiligen
Autor schreiben.
Auerdem enthlt die Bibliographie alle wichtigen Sammelbnde getrennt nach dem Namen
der Herausgeber.
Das Verweissystem ist wie folgt organisiert. Jeder Eintrag ist eindeutig aufgrund der folgenden
Informationen: Name des Autors oder Herausgebers, Abkrzung der Vornamen, (Namen even-
tueller Mitautoren oder Mitherausgeber), Erscheinungsjahr und, wenn ntig, ein zustzlicher
Index aus den ersten Buchstaben des Alphabets.
Innerhalb der Artikel wurden die Vornamen nur dann benutzt, wenn Miverstndnisse mglich
waren. Es wurde jedoch versucht, durchweg den Index zu verwenden. Auerdem folgt jedem
Artikel eine abgekrzte Liste der zitierten Literatur, die besonders sorgfltig berprft wurde.
Sollte also wirklich einmal eine Ambiguitt auftreten, mge der Leser diese Liste konsultieren.
Jeder Eintrag in der Bibliographie ist fr sich vollstndig. (Nur in wenigen Fllen konnte keine
Seitenangabe oder keine Reihennummer ermittelt werden). Auf ein weiteres Verweis- oder Ab-
krzungssystem innerhalb der Bibliographie wurde verzichtet.
Da die Artikel dieses Handbuchs die meisten Bereiche der gegenwrtigen Forschung in
linguistischer Semantik abdecken, ist die vorliegende Bibliographie mit etwa 1700 Eintrgen in
wnschenswerter Weise reprsentativ fr das Gesamtgebiet. Man knnte sich zwar eine noch
umfassendere Bibliographie vorstellen, aber dafr wren problematische Auswahlkriterien und
eine zustzliche Klassifizierung ntig gewesen. Die Herausgeber haben ein derartiges Unterneh-
men nicht als Aufgabe des Handbuchs angesehen.
This bibliography comprehends all items cited by the particular authors in their articles. The
editors tried to verify and standardize the data given by the authors, but they cannot guarantee
for the correctness in all details.
To be maximally informative, the bibliography also includes some articles or books not yet
published, as well as a few (historically important) papers which have never been published. The
reader who is interested in this underground literature should write to the particular author.
In addition, the bibliography includes all prominent textbooks in semantics under the name
of the editors.
The reference-system is organized as follows. Each entry is made unique by the following
information: name of the author or editor, initials, (names of possible co-authors or co-editors),
year of publication, and, if necessary, an additional index with the literals a, b, c.
Within the articles, initials of the first names are only used if a misunderstanding could arise.
However, we tried to include the index throughout. In addition, each article is followed by a
short list of the cited literature. This list has been checked particularly careful. Therefore, if any
ambiguity should arise, the reader is requested to consult this list.
862 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Each entry in the bibliography is meant to be self-consistent and complete. (Only in a few
cases no page numbers could be attributed or the number of the series is missing.) There is no
additional reference-system within the bibliography.
Since the articles in this handbook cover most areas of contemporary research in linguistic
semantics, this bibliography is most representative in the field. It contains about 1700 entries.
One could envisage an even more extensive bibliography, but this could not have been obtained
without problematic criteria of selection as well as additional classification. The editors considered
such an enterprise to be outside of the aim of this handbook.
Allen, R. L. (1966) The Verb System of Present-
Day American English. The Hague: Mouton.
Allerton, D. J./Cruttenden A. (1979) Three Rea-
sons for Accenting a Definite Subject. In: Journal
of Linguistics 15, 4953.
Allgayer, J. (ed.) (1991) Processing Plurals and
Quantification. CSLI Lecture Notes, Stanford. (to
appear)
Allgayer, J./Reddig-Siekmann, C. (1990) What KL-
ONE Lookalikes Need to Cope with Natural Lang-
uage. Scope and Aspect of Plural Noun Phrases.
In: K. H. Blsius et al. (eds.) Sorts and Types in
Artificial Intelligence (= Lectures Notes in Artifi-
cial Intelligence 418). Berlin: Springer, 240285.
Almog, J./Perry, J./Wettstein, H. (eds.) (1989)
Themes from Kaplan. Oxford.
Alston, W. P. (1963) Meaning and Use. In: Philo-
sophical Quarterly 13, 107124. Reprinted in:
G. H. R. Parkinson (ed.) (1968) The Theory of
Meaning. Oxford: University Press, 141165.
Alston, W. P. (1964a) Philosophy of Language.
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
Alston, W. P. (1964b) Linguistic Acts. In: American
Philosophical Quarterly 1, 138146.
Altham, J. E. J. (1971) The Logic of Plurality.
London: Methuen.
Altmann, H. (1976) Die Gradpartikeln im Deut-
schen: Untersuchungen zu ihrer Syntax, Semantik
und Pragmatik (= Linguistische Arbeiten 33). T-
bingen: Niemeyer.
Altmann, H. (1978) Gradpartikelprobleme. Zur Be-
schreibung von gerade, genau, eben, ausgerechnet,
vor allem, insbesondere, zumindest, wenigstens.
Tbingen: Narr.
Altmann, H. (1983) Satzmodus im Deutschen. Aus-
sage-, Frage-, Wunsch-, Imperativ- und Exklama-
tivstze. Ihre formalen und funktionalen Merk-
male. Ms. Mnchen. (See Altmann 1987)
Altmann. H. (1987) Zur Problematik der Konsti-
tution von Satzmodi als Formtypen. In: J. Mei-
bauer (ed.) Satzmodus zwischen Grammatik und
Pragmatik. Tbingen: Niemeyer, 2256.
Andersen, P. K. (1980) On the Reconstruction of
the Syntax of Comparison in PIE. In: P. Ramat
(ed.) Linguistic Reconstruction and Indo-European
Syntax. Amsterdam: John Benjamins, 223236.
Andersen, P. K. (1983) Word Order Typology and
Comparative Constructions. Amsterdam: John Ben-
jamins.
Abbott, B. (1974) Some Problems in Giving an
Adequate Model-Theoretic Account of CAUSE.
In: C. Fillmore/G. Lakoff/R. Lakoff (eds.) Berke-
ley Studies in Syntax and Semantics 1, 114.
Abbott, B. (1977) In Defense of Certain Scopes.
In: S. S. Mufwene/C. A. Walker/S. B. Steever (eds.)
Papers from the 12th Regional Meeting of the Chi-
cago Linguistic Society. Chicago, 112.
Abbott, B. (1989) Nondescriptionality and Natural
Kind Terms. In: Linguistics and Philosophy 12,
269292.
Abraham, W. (1975) Deutsch aber, sondern und
dafr und ihre quivalente im Niederlndischen
und Englischen. In: J. Bartori et al. (1975) Syntak-
tische und semantische Studien zur Koordination.
Tbingen: Narr, 105136.
Abraham, W. (1985) Transitivittskorrelate und
ihre formale Einbindung in die Grammatik. In:
Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik
26, 160.
Abraham, W. (ed.) (1978) Valence, Semantic Case,
and Grammatical Relations (= CLCS Vol. 1). Am-
sterdam: John Benjamins.
Aczel, P. (1988) Non-Wellfounded Sets. CSLI Lec-
ture Notes 14. Stanford.
Adelaar, M./Cascio, V. L. (1986) Temporal Rela-
tion, Localization and Direction in Discourse. In:
V. L. Cascio/C. Vet (eds.) Temporal Structure in
Sentence and Discourse. Dordrecht: Reidel,
251297.
Adelung, J. C. (1782) Umstndliches Lehrgebude
der Deutschen Sprache zur Erluterung der Deut-
schen Sprachlehre fr Schulen Bd. 2. Leipzig.
Ades, A./Steedman, M. (1982) On the Order of
Words. In: Linguistics and Philosophy 4, 517558.
Aijmer, K. (1979) Explanation and Arguing. In:
M. Linnarud/J. Svartvik (eds.) Kommunikativ Kom-
petens och Facksprk. Uppsala: ASLA, 3952.
Ajdukiewicz, K. (1935) Die syntaktische Konnek-
tizitt. In: Studia Philosophica 1, 127. English
Translation: Syntactic Connexion. In: S. McCall
(ed. 1967) Polish Logic. Oxford: Clarendon Press,
207231.
Akmajian, A./Lehrer A. (1976) NP-like Quantifiers
and the Problem of Determining the Head of an
NP. In: Linguistic Analysis 2, 395413.
Allan, K. (1977) Classifiers. In: Language 53,
285311.
Allan, K. (1980) Nouns and Countability. In: Lang-
uage 56, 541567.
42. BibliographieBibliography 863
Press. 1966.
Armstrong, D. (1973) Belief, Truth, and Knowledge.
Cambridge: Cambridge University Press.
Arndt, E. (1960) Begrndetes da neben weil im
Neuhochdeutschen. In: Beitrge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur. Halle, 242260.
Aronoff, M. (1976) Word Formation in Generative
Grammar. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Asher, N. (1986) Belief in Discourse Representation
Theory. In: Journal of Philosophical Logic 15,
127189.
Asher, N. (1989) Belief, Acceptance and Belief Re-
ports. In: Canadian Journal of Philosophy 19,
327362.
Asher, N./Wada, H. (1988) A Computional Ac-
count of Syntactic, Semantic and Discourse Prin-
ciples for Anaphora Resolution. In: Journal of Se-
mantics 6, 309344.
Ashworth, E. J. (1974) Language and Logic in the
Post-Medieval Period. Dordrecht: Reidel.
Atlas, J. D. (1977) Negation, Ambiguity, and Pre-
supposition. In: Linguistics and Philosophy 1,
321336.
Atlas, J. D. (1980) A Note on a Confusion of
Pragmatic and Semantic Aspects of Negation. In:
Linguistics and Philosophy 3, 411414.
Atlas, J. D./Levinson, S. C. (1981) It-Clefts, Infor-
mativeness and Logical Form: Radical Pragmatics
(Revised Standard Version). In: P. Cole (ed.) Ra-
dical Pragmatics. New York: Academic Press,
161.
Austin, J. L. (1956) Performative Utterances. Talk
in the 3rd Programme of the B. B. C. Printed in:
J. O. Urmson/G. J. Warnock (eds.) (1970) Philo-
sophical Papers. Oxford: Clarendon, 233252.
Austin, J. L. (1961) Philosophical Papers. London:
Oxford University Press.
Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words.
Oxford: Clarendon Press. (2nd ed. 1970; revised
edition 1975) German edition: (1972) Zur Theo-
rie der Sprechakte. Edited by E. von Savigny. Stutt-
gart: Reclam.
qvist, L. (1965) A New Approach to the Logical
Theory of Interrogatives. Uppsala: Almquist and
Wiksell. Reprinted: (1975) Tbingen: Narr.
qvist, L. (1984) Deontic Logic. In: D. Gabbay/F.
Guenthner (eds.) Handbook of Philosophical Logic,
Vol. II. Dordrecht: Reidel, 605714.
Bach, E. (1968) Nouns and Nounphrases. In. E.
Bach/R. T. Harms (eds.) Universals in Linguistic
Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston,
90122.
Bach, E. (1979) Control in Montague Grammar.
In: Linguistic Inquiry 10, 515531.
Bach, E. (1980) Tenses and Aspects as Functions
on Verb-Phrases. In: C. Rohrer (ed.) Time, Tense,
and Quantifiers (= Linguistische Arbeiten 83). T-
bingen: Niemeyer, 1938.
Anderson, J. M. (1971) The Grammar of Case:
Towards a Localistic Theory. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Anderson, S. R. (1972) How to Get even. In: Lang-
uage 48, 893906.
Anderson, S. R. (1982) Wheres Morphology? In:
Linguistic Inquiry 13, 571612.
Anderson, S. R. (1985) Inflectional Morphology.
In: T. Shopen (ed.) Language Typology and Syntac-
tic Description, Vol. III. Cambridge: Cambridge
University Press, 150201.
Anderson, S. R./Keenan, E. L. (1985) Deixis. In:
T. Shopen (ed.) Language Typology and Syntactic
Description (Vol. III). Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 259308.
Andersson, S. G. (1972) Aktionalitt im Deutschen.
Eine Untersuchung unter Vergleich mit dem russi-
schen Aspektsystem. I: Die Kategorien Aspekt und
Aktionsart im Russischen und im Deutschen (= Stu-
dia Germanistica Upsaliensia 10). Uppsala.
Andrews, A. D. (1974) One(s) Deletion in the Com-
parative Clause. In: Papers from the 5th Annual
Meeting of the North Eastern Linguistics Society.
Harvard University, 246256.
Andrews, A. D. (1975) Studies in the Syntax of
Relative and Comparative Clauses. Ph. D. Disser-
tation, MIT. Printed: New York: Garland.
Andrews, A. D. (1984) Lexical Insertion and the
Elsewhere Principle in LFG. Unpublished Paper.
Australian National University.
Andrzejewski, B. W. (1960) The Category of Num-
ber in Noun Forms in the Borana Dialect of Galla.
In: Africa 30, 6275.
Anscombe, E. (1957) Intention. Oxford: Basil
Blackwell.
Anscombe, G. E. M. (1967) An Introduction to
Wittgensteins Tractatus. London: Hutchinson Uni-
versity Library.
Anscombre, J. C. (1975) II tait une fois une prin-
cesse aussi belle que bonne. In: Semantikos 1,
128.
Anscombre, J. C./Ducrot, O. (1976) LArgumen-
tation dans la Langue. In: Langages 42, 527.
Anscombre, J. C./Ducrot, O. (1977) Deux mais en
Franais? In: Lingua 43, 2340.
Aoun, J./Sportiche, D. (1981) On the Formal
Theory of Government. Ms. Cambridge, Mass.:
MIT Press.
Arens, H. (1969) Sprachwissenschaft. Der Gang ih-
rer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart.
2. Aufl. Freiburg/Mnchen: Carl Albert.
Ariel, S./Katriel, T. (1977) Range-Indicators in Col-
loquial Israeli Hebrew: A Semantic-Syntactic Ana-
lysis. In: Y. Hayon (ed.) Hebrew Annual Review 1,
2951.
Aristotle. Metaphysics. As translated and edited by
H. G. Apostle, Bloomington: Indiana University
864 XII. Bibliographischer Anhang und Register
texts. Berlin/New York: de Gruyter, 222233.
Ballweg, J. (1984) Praesentia non sunt multipli-
canda praeter necessitatem. In: G. Stickel (ed.)
Pragmatik in der Grammatik. Dsseldorf: Schwann,
243261.
Ballweg, J. (1988) Die Semantik der deutschen Tem-
pusformen. Eine indirekte Analyse im Rahmen einer
temporal erweiterten Aussagenlogik. Dsseldorf:
Schwann.
Ballweg, J./Frosch, H. (1981) Formal Semantics
for the Progressive of Stative and Non-Stative
Verbs. In: H.-J. Eikmeyer/ H. Rieser (eds.) Words,
Worlds, and Contexts. Berlin/New York: de Gruy-
ter, 210221.
Bar-Hillel, Y. (1954) Indexical Expressions. In:
Mind 63, 359379.
Bar-Hillel, Y. (1964) Language and Information.
Jerusalem: Jerusalem University Press.
Bar-Hillel, Y./Gaifman, C./Shamir, E. (1960) On
Categorial and Phrase-Structure Grammars. In:
Bulletin of the Research Council of Israel, Vol. 9F,
No. 1, 116.
Barlow, M./Flickinger, D. P./Wescoat, M. T. (eds.)
(1983) Proceedings of the 2nd West Coast Confe-
rence on Formal Linguistics. Stanford.
Bartori, J. (1975) Syntaktische und semantische Stu-
dien zur Koordination. Tbingen: Narr.
Bartsch, R. (1972) Adverbialsemantik. Frankfurt:
Athenum.
Bartsch, R. (1973) The Semantics and Syntax of
Number and Numbers. In: J. P. Kimball (ed.) Syn-
tax and Semantics, Vol. 2. New York/London: Aca-
demic Press, 5193.
Bartsch, R. (1981) Semantics and Syntax of No-
minalizations. In: J. Groenendijk/T. Janssen/M.
Stokhof (eds.) Formal Methods in the Study of
Language. Mathematical Center Tracts 135. Am-
sterdam, 128.
Bartsch, R. (1983) Over the Semantiek van No-
minalisaties. In: Glot 6, 129.
Bartsch, R. (1986) Context-Dependent Interpreta-
tions of Lexical Items. In: J. Groenendijk/D. de
Jongh/M. Stokhof (eds.) Foundations of Pragmatics
and Lexical Semantics. Dordrecht: Foris, 126.
Bartsch, R./Vennemann, T. (1972) Semantic Struc-
tures. Frankfurt/Main: Athenum.
Barwise, J. (1973) Monotone Quantifiers and Ad-
missible Sets. In: J. E. Fenstadt et al. (eds.) Gene-
ralized Recursion Theory. Amsterdam: North Hol-
land.
Barwise, J. (1979) On Branching Quantifiers in
English. In: Journal of Philosophical Logic 8,
4780.
Barwise, J. (1981a) Scenes and Other Situations.
In: Journal of Philosophy 59, 369396.
Barwise, J. (1981b) Some Computational Aspects
of Situation Semantics. In: Proceedings of the 19th
Annual Meeting of the Association for Computatio-
nal Linguistics, 109111.
Bach, E. (1981) On Time, Tense and Aspect: An
Essay in English Metaphysics. In: P. Cole (ed.)
Radical Pragmatics. New York: Academic Press,
6281.
Bach, E. (1984) Some Generalizations of Categorial
Grammars. In: F. Landman/F. Veltman (eds.) Va-
rieties of Formal Semantics. Dordrecht: Foris,
124.
Bach, E. (1986) The Algebra of Events. In: Lin-
guistics and Philosophy 9, 516.
Bach, E./Bresnan, J. W./Wasow, Th. (1974) Sloppy
Identity: An Unnecessary and Insufficient Criterion
for Deletion Rules. In: Linguistic Inquiry 5,
609614.
Bach, E./Oehrle, R./Wheeler, D. (eds.) (1987) Ca-
tegorial Grammars and Natural Language Structu-
res. Dordrecht: Reidel.
Bach, E./Partee, B. H. (1980) Anaphora and Se-
mantic Structure. In: K. J. Kreiman/A. E. Oteda
(eds.) Papers from the Parasession on Pronouns and
Anaphora. Chicago: Chicago Linguistic Society,
128.
Bach, K. (1987) Thought and Reference. Oxford:
Clarendon Press.
Bach, K./Harnish, R. M. (1979) Linguistic Com-
munication and Speech Acts. Cambridge, Mass.:
MIT Press.
Baker, C. L. (1970) Double Negatives. In: Lingui-
stics Inquiry 1, 169186.
Baker, C. L./Brame, M. K. (1972) Global Rules:
A Rejoinder. In: Language 48, 5175.
Baker, M. Ch. (1988) Incorporation. A Theory of
Grammatical Function Changing. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.
Ballmer, Th. T (1975) Sprachrekonstruktionssy-
steme. Kronberg/Ts.: Scriptor.
Ballmer, Th. T/Pinkal, M. (eds.) (1983) Approa-
ching Vagueness. Amsterdam: North Holland.
Ballmer, Th. T/Brennenstuhl, W. (1978) Zum Verb-
wortschatz der deutschen Sprache. In: Linguistische
Berichte 55, 1837.
Ballmer, Th. T/Brennenstuhl, W. (1981) Speech Act
Classification. A Study in the Lexical Analysis of
English Speech Activity Verbs. Berlin/Heidelberg/
New York: Springer.
Ballmer, Th. T/Brennenstuhl, W. (1982) Zum Ad-
verbial- und Adjektivwortschatz der deutschen
Sprache. In: Linguistische Berichte 78, 132.
Ballweg, J. (1977) Semantische Grundlagen einer
Theorie der deutschen kausativen Verben (= For-
schungsberichte des IdS 38). Tbingen: Narr.
Ballweg, J. (1981a) Experimenteller und alltags-
sprachlicher Ursache-Wirkungs-Begriff. In: G.
Posch (ed.) Kausalitt Neue Texte. Stuttgart:
Reclam, 147156.
Ballweg, J. (1981b) Simple Present Tense and Pro-
gressive Periphrases in German. In: H.-J. Eik-
meyer/H. Rieser (eds.) Words, Worlds, and Con-
42. BibliographieBibliography 865
Buerle, R. (1985) Das Lexikon in der kompositio-
nellen Satzsemantik. In: Ch. Schwarze/D. Wunder-
lich (eds.) Handbuch der Lexikologie. Knigstein/
Ts.: Athenum, 199228.
Buerle, R. (1987) Ereignisse und Reprsentationen.
Habilitationsschrift, Universitt Konstanz. Dis-
tributed as: LILOG-Report 43. Stuttgart: I BM
Deutschland.
Buerle, R./Egli, U. (1985) Anapher, Nominalphrase
und Eselstze. Arbeitspapier 105 des SFB 99, Uni-
versity of Konstanz.
Buerle, R./Schwarze, Ch./von Stechow, A. (eds.)
(1983) Meaning, Use, and Interpretation of Lang-
uage. Berlin/New York: de Gruyter.
Baumgrtner, K./Wunderlich, D. (1969) Anstze
zu einer Semantik des deutschen Tempussystems.
In: Der Begriff Tempus eine Ansichtssache? (=
Beihefte zur Zeitschrift Wirkendes Wort 20). Ds-
seldorf: Schwann, 2349.
Bayer, J. (1986) The Role of Event Expressions in
Grammar. In: Studies in Language 10.1, 151.
Bayer, J. (1990) Directionality of Government and
Logical Form: A Study of Focusing Particles and
Wh-Scope. Habilitationsschrift. Universitt Kon-
stanz.
Bealer, G. (1975) Predication and Matter. In: Syn-
these 31, 493508. Reprinted in: F. J. Pelletier
(ed.) (1979) Mass Terms: Some Philosophical Pro-
blems. Dordrecht: Reidel, 249277.
Bealer, G. (1981) Property Theory. Oxford: Claren-
don Press.
Bealer, G. (1982) Quality and Concept. Oxford:
Clarendon Press.
Beauze, N. (1767) Grammaire gnrale ou exposi-
tion raisone des lments ncessaires du langage
pour servire ltude de toutes les langues. Paris:
Mouton.
Bech, G. (1957) Studien ber das deutsche Verbum
infinitum. Bd. 2 (= Historisk-filologiske Meddelel-
ser 36, 6) Copenhagen: Det Kongelige Danske Vi-
denskabernes Selskab. Reprinted (1983) (= Lin-
guistische Arbeiten 139). Tbingen: Niemeyer.
Beesley, K. R. (1982) Evaluative Adjectives as One-
Place Predicates in Montague Grammar. In: Jour-
nal of Semantics 1, 195249.
Behaghel, O. (1907) Die deutsche Sprache. Leipzig:
Freytag.
Behaghel, O. (1924) Deutsche Syntax. Bd. II. Hei-
delberg: Carl Winter.
Belnap, N. D. (1982) Questions and Answers in
Montague Grammar. In: S. Peters/E. Saarinen
(eds.) Processes, Beliefs, and Questions. Dordrecht:
Reidel, 165198.
Belnap, N. D./Steel, Th. B. (1976) The Logic of
Questions and Answers. New Haven/London: Yale
University Press.
Bennett, D. C. (1975) Spatial and Temporal Uses
of English Prepositions. An Essay in Stratificational
Semantics. London: Longman.
Barwise, J. (1986a) The Situation in Logic II:
Conditionals and Conditional Information. In: E.
C. Traugott/C. A. Ferguson/J. S. Reilly (eds.) On
Conditionals. Cambridge: Cambridge University
Press.
Barwise, J. (1986b) Review of Inquiry by R. Stal-
naker. In: The Philosophical Review 95, 429434.
Barwise, J. (1986c) On the Circumstantial Relation
between Meaning and Content. In: Versus 44/45,
2339.
Barwise, J. (1987) Noun Phrases, Generalized
Quantifiers and Anaphora. In: P. Grdenfors (ed.)
Generalized Quantifiers. Linguistic and Logical Ap-
proaches. Dordrecht: Reidel, 129.
Barwise, J. (1989) The Situation in Logic. Stanford:
CSLI Lecture Notes 17.
Barwise, J. (ed.) (1977) Handbook of Mathematical
Logic. Amsterdam: North Holland.
Barwise, J./Cooper, R. (1981) Generalized Quan-
tifiers and Natural Language. In: Linguistics and
Philosophy 4, 159219.
Barwise, J./Etchemendy, J. (1987) The Liar: An
Essay on Truth and Circularity. New York/Oxford:
Oxford University Press.
Barwise, J./Perry, J. (1980) The Situation Under-
ground. In: J. Barwise/I. Sag (eds.) Working Papers
in Semantics I. Stanford Cognitive Science Group.
Barwise, J./Perry, J. (1981a) Semantic Innocence
and Uncomprising Situations. In: P. A. French et
al. (eds.) Midwest Studies in Philosophy 6. Minnea-
polis, 387404.
Barwise, J./Perry, J. (1981b) Situations and Atti-
tudes. In: The Journal of Philosophy 78, 668691.
Barwise, J./Perry, J. (1983) Situations and Attitudes.
Cambridge, Mass.: Bradford Books/MIT Press.
German edition: (1987) Situationen und Einstellun-
gen. Grundlagen der Situationssemantik. Berlin: de
Gruyter.
Barwise, J./Perry, J. (1985) Shifting Situations and
Shaken Attitudes. In: Linguistics and Philosophy 8,
105161.
Buerle, R. (1977a) Tempus und Temporaladverb.
In: Linguistische Berichte 50, 5157.
Buerle, R. (1977b) Tempus, Zeitreferenz und tem-
porale Logik: Eine Bibliographie 19401976. In:
Linguistische Berichte 49, 85105.
Buerle, R. (1979a) Questions and Answers. In: R.
Buerle/U. Egli/A. von Stechow (eds.) Semantics
from Different Points of View. Berlin: Springer,
6174.
Buerle, R. (1979b) Temporale Deixis temporale
Frage (= Ergebnisse und Methoden moderner
Sprachwissenschaft 5). Tbingen: Narr.
Buerle, R. (1983) Pragmatisch-semantische
Aspekte der NP-Interpretation. In: M. Faust/R.
Harweg/W. Lehfeldt/G. Wienold (eds.) Allgemeine
Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlin-
guistik. Tbingen: Narr, 121131.
866 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Bierwisch, M. (1969) On Certain Problems of Se-
mantic Representation. In: Foundations of Lang-
uage 5, 153184.
Bierwisch, M. (1979) Wrtliche Bedeutung eine
pragmatische Gretchenfrage. In: G. Grewendorf
(ed.) Sprechaktheorie und Semantik. Frankfurt/
Main: Suhrkamp, 119148.
Bierwisch, M. (1980) Semantic Structure and Illo-
cutionary Force. In: J. R. Searle/F. Kiefer/M. Bier-
wisch (eds.) Speech Act Theory and Pragmatics.
Dordrecht: Reidel, 135.
Bierwisch, M. (1983) Semantische und konzeptuelle
Reprsentation lexikalischer Einheiten. In: R. Ru-
zicka/W. Motsch (eds.) Untersuchungen zur Seman-
tik (= Studia Grammatica 22). Berlin: Akademie
Verlag, 6199.
Bierwisch. M. (1987) Semantik der Graduierung.
In: M. Bierwisch/ E. Lang (eds.) Grammatische und
konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven.
Berlin: Akademie Verlag, 91286. English ver-
sion (1989): The Semantics of Gradation. In: M.
Bierwisch/E. Lang (eds.) Dimensional Adjectives.
Berlin: Springer, 71262.
Bierwisch, M. (1988) On the Grammar of Local
Prepositions. In: M. Bierwisch/W. Motsch/I. Zim-
mermann (eds.) Syntax, Semantik und Lexikon (=
Studia Grammatica 29). Berlin: Akademie Verlag,
165.
Bierwisch, M. (1989) Event- Nominalizations. Pro-
posals and Problems. In: Linguistische Studien,
Reihe A 194. Berlin: Akademie Verlag, 173.
Bierwisch, M./Heidolph, K. E. (eds.) (1970) Pro-
gress in Linguistics. A Collection of Papers. The
Hague/Paris: Mouton.
Bierwisch, M./Lang. E. (eds.) (1987) Grammatische
und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven
(= Studia Grammatica 26/27). Berlin: Akademie
Verlag.
Bierwisch, M./Lang, E. (eds.) (1989) Dimensional
Adjectives: Grammatical Structure and Conceptional
Interpretation (= Springer Series in Language and
Communication 26). Berlin/Heidelberg/New York:
Springer.
Binnick, R. (1971) Bring and come. In: Linguistic
Inquiry 2, 260265.
Black, M. (1937) Vagueness: An Exercise in Logical
Analysis. In: Philosophy of Science 4, 427455.
Blakemore, D. (1987) Semantic Constraints on Re-
levance. Oxford: Basil Blackwell.
Blatz, F. (1896) Neuhochdeutsche Grammatik, Bd. 2.
(3. Aufl.) Karlsruhe: J. Lang.
Blau, U. (1969) Glauben und Wissen: eine Unter-
suchung zur epistemischen Logik. Ph. D. Disserta-
tion Mnchen.
Blau, U. (1978) Die dreiwertige Logik der Sprache.
Ihre Syntax, Semantik und Anwendung in der
Sprachanalyse. Berlin: de Gruyter.
Blau, U. (1978a) Die dreiwertige Logik der Sprache.
In: Papiere zur Linguistik 4, 2096.
Bennett, J. (1976) Linguistic Behaviour. Cambridge:
Cambridge University Press.
Bennett, J. (1982) Even if. In: Linguistic and Phi-
losophy 5, 403418.
Bennett, M. (1975) Some Extensions of a Montague
Fragment of English. Ph. D. Dissertation, University
of California at Los Angeles. Distributed by In-
diana University Linguistics Club (Bloomington).
Bennett, M. (1976) A Variation and Extension of
a Montague Fragment of English. In: B. Partee
(ed.) Montague Grammar. New York: Academic
Press, 119163.
Bennett, M. (1977) A Response to Karttunen on
Questions. In: Linguistics and Philosophy 1,
79300.
Bennett, M. (1978) Demonstratives and Indexicals
in Montague Grammar. In: Synthese 39, 180.
Bennett, M. (1979a) Mass Nouns and Mass Terms
in Montague Grammar. In: S. Davies/M. Mithun
(eds.) Linguistics, Philosophy and Montague Gram-
mar. Austin: University of Texas Press, 263285.
Bennett, M. (1979b) Questions in Montague Gram-
mar. Distributed by Indiana University Linguistics
Club (Bloomington).
Bennett, M./Partee, B. H. (1978) Toward the Logic
of Tense and Aspect. Distributed by Indiana Uni-
versity Linguistics Club (Bloomington).
Bennis, H. (1978) Comparative Deletion is Subde-
letion. M. A.-Thesis. Instituut voor Algemene Taal-
wetenschap, Universiteit van Amsterdam.
Berlin, B. (1973) Folk Systematics in Relation to
Biological Classification and Nomenclature. In:
Annual Review of Ecology and Systematics 4,
259271.
Berlin, B./Breedlove, D. E./Raven, P. H. (1973)
General Principles of Classification and Nomenc-
lature in Folk Biology. In: American Anthropologist
75, 214242.
Berlin, B./Kay, P. (1969) Basic Color Terms. Ber-
keley/Los Angeles: University of California Press.
Bernini, G./Molinelli, P./Ramat, P. (1987) Sentence
Negation in Germanic and Romance Languages.
In: P. Ramat (ed.) Linguistic Typology. Berlin:
Mouton de Gruyter.
Bertinetto, P. M. (1986) Intrinsic and Extrinsic
Temporal References: On Restricting the Notion of
Reference Time. In: V. L. Cascio/C. Vet (eds.)
Temporal Structure in Sentence and Discourse. Dor-
drecht: Reidel, 4178.
Bertolet, R. (1983) Where Do Implicatures Come
from? In: Canadian Journal of Philosophy 13,
181191.
Biermann, A. (1982) Die grammatische Kategorie
Numerus. In: H. Seiler/Ch. Lehmann (eds.) Appre-
hension. Das sprachliche Erfassen von Gegenstnden.
Teil 1. Tbingen: Narr, 229243.
Bierwisch, M. (1967) Some Semantic Universals of
German Adjectivals. In: Foundations of Language
3, 136.
42. BibliographieBibliography 867
Deletion in Polish Equatives. In: Journal of Lin-
guistics 17, 271288.
Bosch, P. (1983) Agreement and Anaphora: A Study
of the Role of Pronouns in Syntax and Discourse.
London: Academic Press.
Bower, T. (1979) Development in Infancy. San Fran-
cisco: Freeman.
Bowers, J. S. (1975) Adjectives and Adverbs in
English. In: Foundations of Language 13, 529562.
Bracco, C. (1979) Italian quanto + Comparatives.
Unpublished Paper. Scuola Normale Superiore.
Pisa.
Brady, M./Berwick, R. (eds.) (1984) Computational
Models of Discourse. Cambridge, Mass.: MIT
Press.
Braue, U. (1983a) Bedeutung und Funktion eini-
ger Konjunktionen und Konjunktionaladverbien:
aber, nur, immerhin, allerdings, dafr, dagegen, je-
doch. In: Linguistische Studien A 104, 140.
Braue, U. (1983b) Die Bedeutung der deutschen
restriktiven Gradpartikeln nur und erst im Vergleich
mit ihren franzsischen Entsprechungen ne ... que,
seulement und seul. In: Linguistische Studien A 104,
244282.
Brecht, R. D. (1974) Deixis in Embedded Struc-
tures. In: Foundations of Language 11, 489518.
Brekle, H. (1970) Generative Satzsemantik und
transformationelle Syntax im System der englischen
Nominalkomposition. Mnchen: Fink.
Brekle, H. (1973) Zur Stellung der Wortbildung in
der Grammatik. Distributed by L. A. U. T. (Trier).
Brekle, H./Boase-Beier, J./Toman, J. (1985) DFG-
Projekt Nominalkomposita. Arbeitsbericht 41. Re-
gensburg: Regensburger Microfiche Materialien 12.
Bresnan, J. (1971) On A Nonsource for Compa-
ratives. In: Linguistic Inquiry 2, 117124.
Bresnan, J. (1973) Syntax of the Comparative
Clause Construction in English. In: Linguistic In-
quiry 4, 275343.
Bresnan, J. (1975) Comparative Deletion and Con-
straints on Transformations. In: Linguistic Analysis
1, 2574.
Bresnan, J. (1976a) Evidence for a Theory of Un-
bounded Transformations. In: Linguistic Analysis
2, 353394.
Bresnan, J. (1976b) On the Form and Functioning
of Transformations. In: Linguistic Inquiry 7, 340.
Bresnan, J. (1982) Control and Complementation.
In: Linguistic Inquiry 13, 343434.
Brons-Albert, R. (1978) Kommentierte Bibliografie
zur Tempusproblematik. In: KLAGE No. 3. Dis-
tributed by L. A. U. T. (Trier).
Brown, P./Levinson, St. (1978) Universals in Lang-
uage Use: Politeness Phenomena. In: E. N. Goody
(ed.) Questions and Politeness. Strategies in Social
Interaction. Cambridge: University Press, 56289.
Brugman, C. (1981) Story of over. M. A. Thesis.
University of California at Berkeley.
Blau, U. (1980) Dreiwertige Analyse von exakten,
vagen und prsupponierenden Quantoren. Ms.
Mnchen 1980. Engl. translation: Three-valued
Analysis of Precise, Vague, and Presupposing
Quantifiers. In: Th. Ballmer/M. Pinkal (eds.) (1983)
Approaching Vagueness. Amsterdam: Elsevier
Science Publishers, 79129.
Blau, U. (1981a) Collective Objects. In: Theoretical
Linguistics 8, 101130.
Blau, U. (1981b) Abstract Objects. In: Theoretical
Linguistics 8, 131144.
Blau, U. (1982) Die Logik der semantischen Un-
bestimmtheiten und Paradoxien. Ms. Mnchen.
Blau, U. (1985) Die Logik der Unbestimmheiten
und Paradoxien (Kurzfassung). In: Erkenntnis 22,
369459.
Blsius, K. H./Hedtstck, U./Rollinger, C.-R. (eds.)
(1990) Sorts and Types in Artificial Intelligence (=
Lectures Notes in Artificial Intelligence 418). Ber-
lin: Springer.
Bloomfield, L. (1926) A Set of Postulates for the
Science of Language. In: Language 2, 153164.
Bloomfield, L. (1933) Language. New York: Holt,
Rinehart and Winston.
Boehner, P. (1952) Medieval Logic. Manchester:
Manchester University Press.
Bor, S. E. (1978) Attributive Names. In: Notre
Dame Journal of Formal Logic 19, 177185.
Bor, S. E. (1978b) Who and whether: Towards a
Theory of Indirect Question Clauses. In: Linguistics
and Philosophy 2, 307345.
Bor, S. E./Lycan, W. G. (1976) The Myth of Se-
mantic Presuppostion. Distributed by Indiana Uni-
versity Linguistics Club (Bloomington).
Boettcher, W./Sitta, H. (1972) Deutsche Grammatik
3. Zusammengesetzter Satz und quivalente Struk-
turen (= Studienbcher zur Linguistik und Lite-
raturwissenschaft 4). Frankfurt/Main: Athenum.
Bolinger, D. E. (1967) Adjectives in English. Attri-
bution and Predication. In: Lingua 18, 134.
Bolton, M. (1976) Substances, Substrata, and Na-
mes of Substances in Lockes Essay. In: The Phi-
losophical Review 4, 488513.
Bondzio, W. (1973) Zur Syntax und Semantik der
deutschen Possessivpronomen. In: Deutsch als
Fremdsprache 10, 8494.
Borer, H. (1984) The Projection Principle and Rules
of Morphology. In: C. Jones/P. Sells (eds.) Procee-
dings of NELS 14 (= North Eastern Linguistic
Society). Amherst: Graduate Linguistics Student
Association, 1633.
Borer, H./Wexler, K. (1989) A Principle-Based
Theory of the Structure and Growth of Passive.
Ms. UCI and MIT.
Borkin, A. (1982) On Some Conjuncts Signalling
Dissonance in Written Expository English. In: Stu-
dia Anglica Posaniensia 12, 4760.
Borsley, R. (1981) Wh-Movement and Unbounded
868 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Campbell, R. N./Wales, R. J. (1969) Comparative
Structures in English. In: Journal of Linguistics 5,
193320.
Canfield, J. V. (1983) Discovering Essence. In: C.
Ginet/S. Shoemaker (eds.) Knowledge and Mind:
Philosophical Essays. Oxford: Oxford University
Press, 105129.
Cantrall, W. R. (1977) Comparison and Beyond.
In: W. A. Beach/S. E. Fox/S. Philosoph (eds.) Pa-
pers from the 13th Regional Meeting of the Chicago
Linguistic Society. Chicago, 6981.
Caramazza, A./Grober,E./Garwey, C./Yates, I.
(1977) Comprehension of Anaphoric Pronouns. In:
Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour
16, 497518.
Caramazza, A./Gupta, S. (1979) The Roles of To-
picalization, Parallel Function and Verb Semantics
in the Interpretation of Pronouns. In: Linguistics
17, 601609.
Carden, G. (1977) Comparatives and Factives. In:
Linguistic Inquiry 8, 586589.
Cardinaletti, A. (1988) On pro, es and Sentential
Arguments in German. Doctoral Dissertation, Uni-
versit di Venezia.
Carlson, G. N. (1977a) A Unified Analysis of the
English Bare Plural. In: Linguistics and Philosophy
1, 413458.
Carlson, G. N. (1978) Reference to Kinds in English.
Ph. D. Dissertation, University of Massachussetts
at Amherst. Published (1980). New York: Gar-
land Press.
Carlson, G. N. (1979) Generics and Atemporal
when. In: Linguistics and Philosophy 3, 4998.
Carlson, G. N. (1982) Generic Terms and Generic
Sentences. In: Journal of Philosophical Logic 11,
145181.
Carlson, G. N. (1991) Truth-Conditions of Generic
Sentences. In: F. J. Pelletier/G. Carlson (eds.) The
Generic Book. Chicago: University of Chicago
Press. (to appear)
Carlson, G. N./Pelletier, F. J. (eds.) (1991) The
Generic Book. Chicago: University of Chicago
Press. (to appear)
Carlson, L. (1981) Aspect and Quantification. In:
P. J. Tedeschi/ A. Zaenen (eds.) Tense and Aspect
(= Syntax and Semantics Vol. 14). New York:
Academic Press, 3164.
Carnap, R. (1934) Logische Syntax der Sprache.
Wien: Springer.
Carnap, R. (1939) Foundations of Logic and Ma-
thematics. In: Encyclopedia of Unified Science 1/3.
Chicago: Chicago Linguistic Press, 171.
Carnap, R. (1947) Meaning and Necessity. (2nd ed.
1956) Chicago: University of Chicago Press.
Carnap, R. (1947a) Meaning Postulates. In: Car-
nap (1947), Suppl. B, 222229.
Carnap, R. (1954) Einfhrung in die symbolische
Logik, mit besonderer Bercksichtigung ihrer An-
wendungen. Wien/New York: Springer.
Brugmann, K. (1918) Verschiedenheiten der Satz-
gestaltung nach Magabe der seelischen Grund-
funktionen in den indogermanischen Sprachen. In:
B. G. Teubner (ed.) Philologisch-historische Klasse
(Band 70, Heft 6), 193.
Bhler, K. (1934) Sprachtheorie. Jena: Gustav Fi-
scher.
Bull, R. A./Segerberg, K. (1984) Basic Modal Lo-
gic. In: D. Gabbay/F. Guenthner (eds.) Handbook
of Philosophical Logic, Vol. II. Dordrecht: Reidel,
188.
Bull, W. E. (1960) Time, Tense, and the Verb. A
study in Theoretical Linguistics, with Particular At-
tention to Spanish. Berkeley: University of Califor-
nia Press.
Bunt, H. (1979) Ensembles and the Formal Se-
mantic Properties of Mass Terms. In: F. J. Pelletier
(ed.) Mass Terms: Some Philosophical Problems.
Dordrecht: Reidel, 279294.
Bunt, H. (1981a) On the Why, the How, and the
Whether of a Count/Mass Distinction among Ad-
jectives. In: J. Groenendijk et al. (eds.) Formal
Methods in the Study of Language. Amsterdam:
Mathematical Centre Tracts 135, 5177.
Bunt, H. (1981b) The Formal Semantics of Mass
Terms. Dissertation. Amsterdam.
Bunt, H. (1985) Mass Terms and Model-Theoretical
Semantics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Burge, T. (1972) Truth and Mass Terms. In: Journal
of Philosophy 69, 263382.
Burge, T. (1977) A Theory of Aggregates. In: Nous
11, 97117.
Burge, T. (1982) Two Thought Experiments Revie-
wed. In: Notre Dame Journal of Formal Logic 23,
284293.
Burnham, J. M. (1911) Concessive Constructions in
OE Prose. New York: Holt.
Bursill-Hall, G. L. (1971) Speculative Grammars of
the Middle Ages: the Doctrine of Partes Orationis
of the Modistal. The Hague: Mouton.
Bursill-Hall, G. L. (1975) The Middle Ages. In: T.
Seboek (ed.) Current Trends in Linguistics 13, The
Hague: Mouton, 179230.
Bursill-Hall, G. L. (1976) Some Notes on the
Grammatical Theory of Boethius Dacia. In: H.
Parret (ed.) History of Linguistic Thought and Con-
temporary Linguistics. Berlin/New York: de Gruy-
ter, 164188.
Bursill-Hall, G. L. (ed. and translator) (1972)
Grammatica speculatica of Thomas of Erfurt. Lon-
don: Longman.
Burton-Roberts, N. (1984) Modality and Implica-
ture. In: Linguistics and Philosophy 7, 181206.
Burzio, L. (1981) Intransitive Verbs and Italian Au-
xiliaries. Ph. D. Dissertation, MIT.
Buscha, G. (1989) Lexikon der Konjugationen. Leip-
zig: Bibliographisches Institut.
42. BibliographieBibliography 869
Cheng, Ch.-Y. (1973) Comments on Moravcsiks
Paper. In: K. J. J. Hintikka et al. (eds.) Approaches
to Natural Language. Dordrecht: Reidel, 286288.
Chierchia, G. (1982) Nominalizations and Mon-
tague Grammar: A Semantics Without Types for
Natural Language. In: Lingustics and Philosophy 5,
303354.
Chierchia, G. (1984) Topics in the Syntax and Se-
mantics of Indefinites and Gerunds. Ph. D. Disser-
tation. University of Massachusetts, Amherst.
Chierchia, G./Partee, B./Turner, R. (eds.) (1989)
Properties, Types and Meaning. Vol. I: Foundational
Issues. Vol. II: Semantic Issues. Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers.
Chierchia, G./Turner, R. (1988) Semantics and Pro-
perty Theory. In: Linguistics and Philosophy 11,
261302.
Choe, J. W. (1987) Anti-Quantifiers and a Theory
of Distributivity. Ph. D. Dissertation, University of
Massachusetts, Amherst.
Chomsky, N. (1957) Syntactic Structures. The Ha-
gue: Mouton.
Chomsky, N. (1959) Review of Skinner (1957). In:
Language 35, 2658.
Chomsky, N. (1965) Aspects of the Theory of Syn-
tax. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Chomsky, N. (1970) Remarks on Nominalization.
In: R. Jacobs/P. Rosenbaum (eds.) Readings in Eng-
lish Transformational Grammar. Waltham, Mass.:
Ginn and Company, 184221.
Chomsky, N. (1971) Deep Structure, Surface Struc-
ture, and Semantic Interpretation. In: D. Steinberg/
L. A. Jakobovits (eds.) Semantics: An Interdiscipli-
nary Reader in Philosophy, Linguistics and Psycho-
logy. London: Cambridge University Press,
183216. Reprinted in: Chomsky (1972),
62119.
Chomsky, N. (1972) Studies on Semantics in Ge-
nerative Grammar. The Hague/Paris: Mouton.
Chomsky, N. (1973) Conditions on Transforma-
tions. In: S. R. Anderson/P. Kiparsky (eds.) A
Festschrift for Moris Halle. New York: Holt, Ri-
nehart & Winston, 232286.
Chomsky, N. (1975) Questions of Form and Inter-
pretation. In: Linguistic Analysis 1, 75109.
Chomsky, N. (1976) Conditions on Rules in Gram-
mar. In: Linguistic Analysis 2, 303351.
Chomsky, N. (1977) On Wh-Movement. In: P. W.
Cullicover/Th. Wasow/A. Akmajian (eds.) Formal
Syntax. New York: Academic Press, 71132.
Chomsky, N. (1980) Rules and Representation. New
York: Columbia.
Chomsky, N. (1981) Lectures on Government and
Binding (= Studies in Generative Grammar 9).
Dordrecht: Foris.
Chomsky, N. (1982) Some Concepts and Conse-
quences of the Theory of Government and Binding.
Cambridge, Mass.: MIT Press.
Cartwright, H. M. (1965) Heraclitus and the Bath
Water. In: The Philosophical Review 74, 466485.
Cartwright, H. M. (1970) Quantities. In: The Phi-
losophical Review 79, 2542.
Cartwright, H. M. (1975) Amounts and Measures
of Amount. In: Nous 9, 143164. Reprinted in:
F. J. Pelletier (ed.) (1979) Mass Terms: Some Phi-
losophical Problems. Dordrecht: Reidel, 179198.
Cartwright, H. M. (1979a) Some Remarks about
Mass Nouns and Plurality. In: F. J. Pelletier (ed.)
Mass Terms: Some Philosophical Problems. Dor-
drecht: Reidel, 3146.
Casadio, C. (1987) Significato e Categorie. Bo-
logna: Cooperativa Libraria Universitaria Editrice.
Cascio, V. L. (1986) Temporal Deixis and Anaphor
in Sentence and Text: Finding a Reference Time.
In: V. L. Cascio/C. Vet (eds.) Temporal Structure
in Sentence and Discourse. Dordrecht: Reidel,
191228.
Cascio, V. L./Rohrer, C. (1986) Interaction Bet-
ween Verbal Tenses and Temporal Adverbs in Com-
plex Sentences. In: V. L. Cascio/C. Vet (eds.) Tem-
poral Structure in Sentence and Discourse. Dor-
drecht: Reidel, 229250.
Cascio, V. L./Vet, C. (eds.) (1986) Temporal Struc-
ture in Sentence and Discourse. Dordrecht: Reidel.
Cassam, Q. (1986) Science and Essence. In: Philo-
sophy 61, 95107.
Castaeda, H.-N. (1966) He: A Study in the Logic
of Self-Consciousness. In: Ratio 8, 130157.
Castaeda, H.-N. (1977) On the Philosophical
Foundations of the Theory of Communication. In:
Midwest Studies in Philosophy II, 165186.
Caton, Ch. E. (1981) Stalnaker on Pragmatic Pre-
supposition. In: P. Cole (ed.) Radical Pragmatics.
New York: Academic Press, 81100.
Cattell, R. (1984) Composite Predicates in English
(= Syntax and Semantics Vol. 17). London: Aca-
demic Press.
Chafe, W. (1970) Meaning and the Structure of
Language. Chicago: University of Chicago Press.
Chandler, H. (1975) Rigid Designation. In: Journal
of Philosophy 72/13, 363368.
Chandler, H. (1986) Sources of Essence. In: Mid-
west Studies in Philosophy 11: Studies in Essentia-
lism, 379390.
Chao, W/Sells, P. (1983) On the Interpretation of
Resumptive Pronouns. In: Proceedings of NELS 13
(North Eastern Linguistic Society). Amherst: Gra-
duate Linguistic Students Association, 4761.
Charniak, B. (1972) Toward a Model of Childrens
Story Understanding. TR-266 MIT Artificial Intel-
ligence Laboratory.
Chastain, C. (1975) Reference and Context. In: K.
Gunderson (ed.) Minnesota Studies in the Philoso-
phy of Science, Bd. VII: Language, Mind, and
Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 194269.
870 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Cole, P./Morgan, J. L. (eds.) (1975) Speech Acts
(= Syntax and Semantics Vol. 3). New York/San
Francisco/London: Academic Press.
Comrie, B. (1976) Aspect. An Introduction to the
Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Comrie, B. (1985) Tense. Cambridge: Cambridge
University Press.
Comrie, B./Keenan, E. L. (1979) Noun Phrase Ac-
cessibility Revisited. In: Language 55, 649664.
Contreras, H. (1976) A Theory of Word Order with
Special Reference to Spanish. Amsterdam: North-
Holland.
Cook, C. (1975) On the Usefulness of Quantities.
In: Synthese 31, 443457. Reprinted in: F. J.
Pelletier (ed.) (1979) Mass terms: Some Philosophi-
cal Problems. Dordrecht: Reidel, 121135.
Cook, M. (1980) If Cat Is A Rigid Designator,
What Does It Designate? In: Philosophical Studies
37, 6164.
Coombs, V. M. (1976) A Semantic Syntax of Gram-
matical Negation in the Older Germanic Dialects.
Gppingen: Kmmerle.
Cooper, R. (1975) Montagues Semantic Theory and
Transformational Grammar. Ph. D. Dissertation
University of Massachusetts, Amherst.
Cooper, R. (1979) The Interpretation of Pronouns.
In: F. Heny/H. S. Schnelle (eds.) Selections from
the Third Groningen Round Table (= Syntax and
Semantics Vol. 10). New York: Academic Press,
6192.
Cooper, R. (1983) Quantification and Syntactic
Theory. Dordrecht: Reidel.
Cooper, R. (1986) Tense and Discourse Location
in Situation Semantics. In: Linguistics and Philo-
sophy 9, 1736.
Cooper, R. (1987) Meaning Representation in
Montague Grammar and Situation Semantics. In:
Computational Intelligence 3, 3544.
Cooper, R./Mulai, K./Perry, J. (eds.) (1990) Situa-
tion Theory and its Applications. Vol. 1. CSLI Lec-
ture Notes 22. Stanford.
Cooper, R./Parsons, T. (1976) Montague Gram-
mar, Generative Semantics and Interpretive Se-
mantics. In: B. Partee (ed.) Montague Grammar.
New York, San Francisco, London: Academic
Press, 311362.
Copi, I. (1954) Essence and Accident. In: Journal
of Philosophy 51, 706719.
Copi, I. M./Gould, J. A. (1967) Contemporary Rea-
dings in Logical Theory. New York/London:
MacMillan.
Copleston, F. C. (1972) A History of Medieval
Philosophy. London: Methuen.
Cornish, F. (1986) Anaphoric Relations in English
and French: A Discourse Perspective. London:
Croom Helm.
Coseriu, E. (1978) Probleme der strukturellen Se-
mantik. Tbingen: Narr.
Chomsky, N./Lasnik, H. (1977) Filters and Con-
trol. In: Linguistic Inquiry 8, 425504.
Church, A. (1940) A Formulation of the Simple
Theory of Types. In: Journal of Symbolic Logic 5,
5668.
Church, A. (1950) On Carnaps Analysis of State-
ments of Assertion and Belief. In: Analysis 10,
9799.
Cinque, G. (1989) On Embedded Verb Second
Clauses and Ergativity in German. In: D. Jaspers/
W. Klooster/Y. Putseys/P. Seuren (eds.) Sentential
Complementation and the Lexicon. Studies in Ho-
nour of Wim Geest. Dordrecht: Foris, 7796.
Cinque, G. (1990) Ergative Adjectives and the Le-
xicalist Hypothesis. In: Natural Language and Lin-
guistic Theory 8, 139.
Clark, H. H. (1973) Space, Time, Semantics and
the Child. In: T. E. Moore (ed.) Cognitive Develop-
ment and the Aquisition of Language. New York:
Academic Press, 2764.
Clark, H. H. (1974) Semantics and Comprehension.
The Hague: Mouton.
Clark, H. H./Clark, E. V. (1978) Universals, Re-
lativity, and the Language Processing. In: J. H.
Greenberg (ed.) Universals of Human Language,
Vol. 1. Stanford: Stanford University Press,
225278.
Clark, R. (1970) Concerning the Logic of Predicate
Modifiers. In: Nous 4, 311355.
Clarke, B. L. (1981) A Calculus of Individuals
Based on Connection. In: Notre Dame Journal of
Formal Logic 22, 204218.
Clarke, D. S. (1970) Mass Terms as Subjects. I n:
Philosophical Studies 21, 2529.
Clay, R. E. (1974) Relation of Lesniewskis Mereo-
logy to Boolean Algebra. In: Journal of Symbolic
Logic 39, 638648.
Cocchiarella, N. (1976) On the Logic of Natural
Kinds. In: Philosophy of Science 43, 202222.
Cocchiarella, N. (1977) Sortals, Natural Kinds, and
Reidentification. In: Logique et Analyse 20,
439474.
Cocchiarella, N. (1978) On the Logic of Nomina-
lized Predicates and its Philosophical Interpreta-
tions. In: Erkenntnis 13, 339369.
Cohen, F. S. (1929) What is a Question? In: The
Monist 39, 350364.
Cohen, L. J. (1971) The Logical Particles of Na-
tural Language. In: Y. Bar-Hillel (ed.) Pragmatics
of Natural Language. Dordrecht: Reidel, 5068.
Cohen, L. J. (1977) Can the Conversationalist Hy-
pothesis Be Defended? In: Philosophical Studies 31,
8190.
Cole, P. (ed.) (1978) Pragmatics (= Syntax and
Semantics Vol. 9). New York/San Francisco/Lon-
don: Academic Press.
Cole, P. (ed.) (1981) Radical Pragmatics. New York/
San Francisco/London: Academic Press.
42. BibliographieBibliography 871
well (1985a) ch. 6, 173192.
Cresswell, M. J. (1982) The Autonomy of Seman-
tics. In: S. Peters/ E. Saarinen (eds.) Processes,
Beliefs, and Questions. Dordrecht: Reidel, 6986.
Cresswell, M. J. (1983) A Highly Impossible Scene:
the Semantics of Visual Contradictions. In: R. Bu-
erle/Ch. Schwarze/A. von Stechow (eds.) Meaning,
Use, and Interpretation of Language. Berlin: de
Gruyter, 6278.
Cresswell, M. J. (1984) Comments on von Stechow.
In: Journal of Semantics 3, 7981.
Cresswell, M. J. (1985a) Adverbial Modification.
Interval Semantics and its Rivals. Dordrecht: Rei-
del.
Cresswell, M. J. (1985b) Structured Meanings: The
Semantics of Propositional Attitudes. Cambridge,
Mass.: MIT Press.
Cresswell, M. J. (1988) Semantical Essays. Possible
Worlds and Their Rivals. Dordrecht: Kluwer.
Cresswell, M. J./von Stechow, A. (1982) De Re
Belief Generalized. In: Linguistics and Philosophy
5, 503535.
Culicover, P. W./Th. Wasow/Akmajian, A. (eds.)
(1977) Formal Syntax. New York: Academic Press.
Curme, G. O. (1922) A Grammar of the German
Language. (2nd rev. ed. 1964) New York: Ungar.
Curme, G. O. (1931) A Grammar of the English
Language III: Syntax. Boston: Heath.
Curry, H. B./Feys, R. (1958) Combinatory Logic I.
Amsterdam: North Holland.
Cushing, St. (1976) The Formal Semantics of Quan-
tification. Ph. D. Dissertation, University of Cali-
fornia, Los Angeles.
Dahl, . (1975) On Generics. In: E. Keenan (ed.)
Formal Semantics of Natural Language. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 99111.
Dahl, . (1979) Typology of Sentence Negation.
In: Linguistics 17, 79106.
Dahl, . (1985) Tense and Aspect Systems. Oxford:
Basil Blackwell.
Dahl, . (1991) Negation. In: J. Jacobs/A. von
Stechow/W. Sternefeld/T. Vennemann (eds.) Hand-
buch Syntax, Vol. I. Berlin: de Gruyter. (to appear)
Dakin, J. (1970) Explanations. In: Journal of Lin-
guistics 6, 199214.
Dal, I. (1952) Kurze deutsche Syntax auf historischer
Grundlage. Tbingen: Niemeyer.
Dalrymple, M. (1988) The Interpretation of Tense
and Aspect in English. In: J. Hobbs (ed.) Procee-
dings of the 26th Annual Meeting of the Association
for Computational Linguistics. Morristown, N. J.,
6874.
Daniels, K. (1963) Substantivierungstendenzen in
der deutschen Gegenwartssprache. Dsseldorf:
Schwann.
Davidson, D. (1967a) The Logical Form of Action
Sentences. In: N. Rescher (ed.) The Logic of Deci-
sion and Action. Pittsburgh: University of Pitts-
burgh Press, 8195; discussion 96120. (Reprin-
ted in: Davidson 1980).
Coseriu, E./Geckeler, H. (1974) Linguistics and
Semantics. In: T. A. Sebeok (ed.) Current Trends in
Linguistics, Vol. 12. The Hague: Mouton,
103171.
Coulmas, F. (1981) Routine im Gesprch. Zur prag-
matischen Fundierung der Idiomatik. Wiesbaden:
Athenum.
Coyaud, M./Hamou, K. A. (1976) Indfinis et in-
terrogatifs. In: Semantikos 1, 8387.
Creary, L. G./Gawron, J. M./Nerbonne, J. (1989)
Reference to Locations. In: Proceedings of the As-
sociation for Computational Linguistics 27, 4250.
Cresswell, M. J. (1972) The World is Everything
That is the Case. In: Australian Journal of Philo-
sophy 50, 113.
Cresswell, M. J. (1973) Logics and Languages. Lon-
don: Methuen.
Cresswell, M. J. (1974) Adverbs and Events. In:
Synthese 28, 455481. Reprinted in: Cresswell
(1985a) ch. 1, 1339.
Cresswell, M. J. (1975) Hyperintensional Logic. In:
Studia Logica 34, 2538.
Cresswell, M. J. (1976) The Semantics of Degree.
In: B. Partee (ed.) Montague Grammar. New York:
Academic Press, 261292.
Cresswell, M. J. (1977a) Categorial Languages. In:
Studia Logica 36, 257269.
Cresswell, M. J. (1977b) Interval Semantics and
Logical Words. In: C. Rohrer (ed.) On the Logical
Analysis of Tense and Aspect. (= Tbinger Beitrge
zur Linguistik 80). Tbingen: Narr, 729. Re-
printed in: Cresswell (1985a) ch. 3, 6795.
Cresswell, M. J. (1978a) Adverbs of Space and
Time. In: F. Guenthner/S. J. Schmidt (eds.) Formal
Semantics and Pragmatics for Natural Language.
Dordrecht: Reidel, 171199. Reprinted in:
Cresswell (1985a) ch. 2, 4166.
Cresswell, M. J. (1978b) Prepositions and Points
of View. In: Linguistics and Philosophy 2, 141.
Reprinted in: Cresswell (1985a) ch. 4, 97141.
Cresswell, M. J. (1978c) Semantic Competence. In:
F. Guenthner/ M. Guenthner-Reutter (eds.) Mea-
ning and Translation. London: Duckworth, 927.
Reprinted in: Cresswell (1988) ch. 2, 1233.
Cresswell, M. J. (1978d) Semantics and Logic. In:
Theoretical Linguistics 5, 1930. Reprinted in:
Cresswell (1988) ch. 3, 3446.
Cresswell, M. J. (1979) Interval Semantics for some
Event Expressions. In: R. Buerle/U. Egli/A. von
Stechow (eds.) Semantics from Different Points of
View. Heidelberg: Springer, 90116. Reprinted
in: Cresswell (1985a) ch. 5, 143171.
Cresswell, M. J. (1980) Quotational Theories of
Propositional Attitudes. In: Journal of Philosophi-
cal Logic 9, 1740. Reprinted in: Cresswell
(1988) ch. 6, 78103.
Cresswell, M. J. (1981) Adverbs of Causation. In:
H.-J. Eikmeyer/ H. Rieser (eds.) Words, Worlds,
and Contexts: New Approaches in Word Semantics.
Berlin: de Gruyter, 2137. Reprinted in: Cress-
872 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Situation Theory. Ms., CSLI Stanford University.
Di Sciullo, A. M./Williams, E. (1987) On the De-
finition of Word. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Dieterich, T. G./Napoli, D. J. (1982) Comparative
rather. In: Journal of Linguistics 8, 137165.
Dixon, R. M. W. (1977) Where Have all the Ad-
jectives Gone? In: Studies in Language 1, 1980.
Doherty, M. (1985) Epistemische Bedeutung (=
Studia Grammatica 23). Berlin: Akademie Verlag.
Doherty, P. C./Schwarz, A. (1967) The Syntax of
Compared Adjectives in English. In: Language 43,
903936.
Dhmann, K. (1966) Zur Semantik und Etymolo-
gie der sprachlichen Darstellung der dyadischen
Funktoren. In: Studium Generale 19, 740215.
Dhmann, K. (1974) Die sprachliche Darstellung
logischer Funktoren. In: A. Menne/G. Frey (eds.)
Logik und Sprache. Bern, 2856.
Donnellan, K. S. (1966) Reference and Definite
Descriptions. In: The Philosophical Review 75,
281304. Reprinted in: D. Steinberg/L. Jako-
bovits (eds.) (1971) Semantics: An Interdisciplinary
Reader in Philosophy, Linguistics, and Psychology.
Cambridge: Cambridge University Press,
100114.
Donnellan, K. S. (1972) Proper Names and Iden-
tifying Descriptions. In: D. Davidson/G. Harman
(eds.) Semantics of Natural Language. Dordrecht:
Reidel, 356379.
Donnellan, K. S. (1974) Speaking of Nothing. In:
The Philosophical Review 83, 331.
Donnellan, K. S. (1983) Kripke and Putnam on
Natural Kinds. In: C. Ginet/S. Shoemaker (eds.)
Knowledge and Mind: Philosophical Essays. Oxford:
Doron, E. (1986) The Semantics of Existential Sen-
tences. Ms., Hebrew University, Jerusalem.
Doron, E. (1988) The Semantics of Predicate No-
minals. In: Linguistics 26, 281301.
Dougherty, R. C. (1970) A Grammar of Coordinate
Conjoined Structures I. In: Language 46, 850898.
Dougherty, R. C. (1971) A Grammar of Coordinate
Conjoined Structures II. In: Language 47,
298339.
Dougherty, R. C. (1974) The Syntax and Semantics
of each other Constructions. In: Foundations of
Language 12, 147.
Downes, W. (1977) The Imperative and Pragmatics.
In: Journal of Linguistics 13, 7797.
Downing, P. (1978) On the Creation and Use of
English Compound Nouns. In: Language 53,
810842.
Dowty, D. R. (1972) Studies in the Logic of Verb
Aspect and Time Reference in English (= Studies
in Linguistics 1). Austin: University of Texas.
Dowty, D. R. (1977) Toward a Semantic Analysis
of Verb Aspect and the English Imperfective Pro-
gressive. In: Linguistics and Philosophy 1, 4577.
Davidson, D. (1967b) Truth and Meaning. In: Syn-
these 17, 304323.
Davidson, D. (1969) On Saying That. In: D. Da-
vidson/J. Hintikka (eds.) Words and Objections.
Dordrecht: Reidel, 158174.
Davidson, D. (1970) Semantics for Natural Lang-
uage. Reprinted in: D. Davidson/G. Harman
(eds.) The Logic of Grammar. Encini, CA: Dicken-
son, 1824.
Davidson, D. (1979) Moods and Performances. In:
A. Margalit (ed.) Meaning and Use. Dordrecht:
Reidel, 920.
Davidson, D. (1980) Essays on Actions and Events.
Oxford: Clarendon Press.
Davidson, D./Harman, G. (eds.) (1972) Semantics
of Natural Language. Dordrecht: Reidel.
Davidson, D./Hintikka, J. (eds.) (1969) Words and
Objections. Essays on the Work of W. V. Quine.
Dordrecht: Reidel.
Davis, S./Mithun, M. (eds.) (1979) Linguistics, Phi-
losophy, and Montague Grammar. Austin, Texas/
London: University of Texas Press.
Davison, A. (1978) Negative Scope and Rules of
Conversation: Evidence from an OV Language. In:
P. Cole (ed.) Pragmatics (= Syntax and Semantics
Vol. 9). New York: Academic Press, 2345.
de Jong, F. (1987) The Compositional Nature of
(In)Definiteness. In: E. Reuland/A. ter Meulen
(eds.) The Representation of (In)definiteness. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press, 270285.
de Mey, S. (1984) Mass Terms and Count Terms:
Metaphysics of Grammar? Ms., Insititute for Ge-
neral Linguistics, Universitt Groningen.
De Sousa, R. (1984) The Natural Shiftiness of
Natural Kinds. In: Canadian Journal of Philosophy
14, 561580.
Declerck, R. (1988) Restrictive when-Clauses. In:
Linguistics and Philosophy 11, 131168.
Delacruz, E. B. (1976) Factives and Proposition
Level Constructions in Montague Grammar. In: B.
Partee (ed.) Montague Grammar. New York: Aca-
demic Press, 177200.
den Besten, H. (1978) On the Presence and Absence
of Wh-Elements in Dutch Comparatives. In: Lin-
guistic Inquiry 9, 641671.
Denny, J. D. (1978) Locating the Universals in
Lexical Systems for Spatial Deixis. In: Papers from
the Parasession on the Lexicon. Chicago: Chicago
Linguistic Society, 7184.
Descartes, R. (1641) Meditationes de prima philo-
sophia, in qua Dei existentia es animae immortalitas
demonstrantur. Paris: Mersenne.
Devitt, M. (1974) Singular Terms. In: Journal of
Philosophy 71, 183205.
Devitt, M. (1981) Designation. New York: Colum-
bia University Press.
Devlin, K. (1988) Logic and Information, Vol. I:
42. BibliographieBibliography 873
Benjamins, 93124.
Ducrot, O. (1972) Dire et ne pas dire. Paris: Her-
mann.
Ducrot, O. (1973) Le preuve et le dire, langage et
logique. Paris: Minuit.
Ducrot, O. (1980a) Les chelles argumentatives. Pa-
ris: Minuit.
Ducrot, O. (1980b) Pragmatique Linguistique II:
Essai dapplication: mais Les allusions a lnon-
ciation dcolutifs, performatifs, discours indi-
rect. In: H. Parret et al. (eds.) Le Langage en
Contexte. Etudes Philosophiques et Linguistiques de
Pragmatique. Amsterdam: John Benjamins,
487575.
Duden Grammatik (1965) Mannheim: Duden Ver-
lag.
Dummett, M. (1973) Frege. Philosophy of Lang-
uage. London: Duckworth.
Dummett, M. (1975) Wangs Paradox. In: Synthese
30, 301324.
Dupr, J. (1981) Natural Kinds and Biological
Taxa. In: The Philosophical Review 90, 6690.
Dupr, J. (1986) Sex, Gender, and Essence. In:
Midwest Studies in Philosophy 11: Studies in Essen-
tialism, 441458.
Eberle, K. (1989) Quantifikation, Plural, Ereignisse
und ihre Argumente in einer mehrsortigen Sprache
der Prdikatenlogik erster Stufe (= IWBS Report
67). Stuttgart: IBM Deutschland, Institut fr Wis-
sensbasierte Systeme.
Eberle, R. A. (1970) Nominalistic Systems. Dor-
drecht: Reidel.
Ebert, K. (1971) Referenz. Sprechsituation und die
bestimmten Artikel in einem nordfriesischen Dialekt.
Brist/Bredstedt: Nordfriisk Instituut.
Edmondson, J. A./Plank, F. (1978) Great Expec-
tations. An Intensive Self Analysis. In: Linguistics
and Philosophy 2, 373413.
Egli, U. (1974) Anstze zur Integration der Semantik
in die Grammatik. Kronberg: Scriptor.
Egli, U. (1976) Zur Semantik des Dialogs. Arbeits-
papier des SFB 99, Universitt Konstanz.
Egli, U. (1979) The Stoic Conception of Anaphora.
In: R. Buerle/ U. Egli/A. von Stechow (eds.) Se-
mantics from Different Points of View. Berlin:
Springer, 266283.
Egli, U. (1981) Das Dioklesfragment bei Diogenes
Laertios. Arbeitspapier 55 des SFB 99, Konstanz.
Ehrich, V. (1985) Zur Linguistik und Psycholin-
guistik der sekundren Raumdeixis. In: H. Schwei-
zer (ed.) Sprache und Raum. Stuttgart: Metzler,
130161.
Eikmeyer, H. J./Jansen, L. (eds.) (1980) Objektar-
gumente. Grundelemente der semantischen Struktur
von Texten 3. Hamburg: Buske.
Eikmeyer, H. J./Rieser H. (1983) A Formal Theory
of Context Change. In: T. Ballmer/M. Pinkal (eds.)
Approaching Vagueness. Amsterdam: North Hol-
land, 131188.
Dowty, D. R. (1979) Word Meaning and Montague
Grammar. The Semantics of Verbs and Times in
Generative Semantics and in Montagues PTQ (=
Synthese Language Library Vol. 7). Dordrecht:
Reidel.
Dowty, D. R. (1980) Comments on the Paper by
Bach and Partee. In: K. J. Kreiman/A. E. Oteda
(eds.) Papers from the Parasession on Pronouns and
Anaphora. Chicago: Chicago Linguistic Society,
2940.
Dowty, D. R. (1982) Tense, Time Adverbials and
Compositional Semantic Theory. In: Linguistics
and Philosophy 5, 2358.
Dowty, D. R. (1985a) On Recent Analyses of the
Semantics of Control. In: Linguistics and Philoso-
phy 8, 291332.
Dowty, D. R. (1985b) Unified Indexical Analysis
of same and different: A Response to Stump and
Carlson. Unpublished Ms., Ohio State University.
Dowty, D. R. (1986) A Note on Collective Predi-
cates, Distributive Predicates, and all. Unpublished
Ms., Ohio State University.
Dowty, D. R. (1986) The Effects of Aspectual Class
on the Temporal Structure of Discourse: Semantics
or Pragmatics? In: Linguistics and Philosophy 9,
3761.
Dowty, D. R. (ed.) (1986) Tense and Aspect in
Discourse. (= Linguistics and Philosophy 9.1).
Dordrecht: Reidel.
Dowty, D. R. (1987) On the Semantic Content of
the Notion Thematic Role. In: G. Chierchia et al.
(eds.) Categories, Types and Semantics. Dordrecht:
Reidel.
Dowty, D. R./Brodie, B. (1984) The Semantic Ana-
lysis of Floated Quantifiers in a Transformational
Grammar. In: Proceedings of the 3rd West Coast
Conference on Formal Linguistics. Stanford,
7590.
Dowty, D. R./Wall, R. E./Peters, St. (1981) Intro-
duction to Montague Semantics (= Synthese Lang-
uage Library Vol. 11). Dordrecht: Reidel.
Dresher, E. (1977) Logical Representations and
Linguistic Theory. In: Linguistic Inquiry 8, 351
378.
Dressler, W. (1968) Studien zur verbalen Pluralitt.
Iterativum, Distributivum, Durativum, Intensivum in
der allgemeinen Grammatik, im Lateinischen und
Hethitischen. Sitzungsberichte der sterreichischen
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Hi-
storische Klasse. Wien: Bhlau.
Dretske, F. (1972) Contrastive Statements. In: The
Philosophical Review 1972, 41137.
Drossard, W. (1982) Die Technik MASSE/MES-
SEN auf der Dimension der Apprehension. In: H.
J. Seiler/Ch. Lehmann (eds.) Apprehension. Das
sprachliche Erfassen von Gegenstnden, Vol. 1. T-
bingen: Narr, 98111.
Dryer, M. (1988) Universals of Negative Position.
In: M. Hammond/ E. Moravcsik/J. Wirth (eds.)
Studies in Syntactic Typology. Amsterdam: John
874 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Fanselow, G. (1981) Zur Syntax und Semantik der
Nominalkomposition. Tbingen: Niemeyer.
Fanselow, G. (1985) What is a Possible Complex
Word? In: J. Toman (ed.) Studies in German Gram-
mar. Dordrecht: Foris, 289318.
Fanselow, G. (1987) Konfigurationalitt. Tbingen:
Narr.
Farkas, D./Sugioka, Y. (1983) Restrictive if/when
Clauses. In: Linguistics and Philosophy 6, 225258.
Fauconnier, G. (1975a) Pragmatic Scales and Lo-
gical Structures. In: Linguistic Inquiry 2, 353375.
Fauconnier, G. (1975b) Polarity and the Scale Prin-
ciple. In: R. E. Grossman/L. J. San/T. J. Vance
(eds.) Papers from the 11th Regional Meeting of the
Chicago Linguistic Society. Chicago, 188199.
Fauconnier, G. (1979) Implication Reversal in a
Natural Language. In: F. Guentner/S. J. Schmidt
(eds.) Formal Semantics and Pragmatics for Natural
Languages. Dordrecht: Reidel, 289302.
Fauconnier, G. (1984) Espaces mentaux. Paris: Mi-
nuit. Engl. edition (1985) Mental Spaces. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press.
Feldman, F. (1986) Doing the Best We Can. An
Essay in Informal Deontic Logic. Dordrecht: Reidel.
Fry, C. (1989) Prosodic and Tonal Structure of
Standard German. Ph. D. Dissertation. Universitt
Konstanz.
Fiengo, R. W./Lasnik, H. (1973) The Logical Struc-
ture of Reciprocal Sentences in English. In: Foun-
dations of Language 9, 447468.
Fillmore, Ch. J. (1968) The Case for Case. In: E.
Bach/R. T. Harms (eds.) Universals in Linguistic
Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston,
188.
Fillmore, Ch. J. (1971) Types of Lexical Informa-
tion. In: D. D. Steinberg/L. A. Jakobovits (eds.)
Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philoso-
phy, Linguistics, and Psychology. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 370392.
Fillmore, Ch. J. (1975a) Santa Crux Lectures on
Deixis. (Given at the 1971 Summer Linguistics
Program at the Santa Crux Campus of the Uni-
versity of California). Distributed by Indiana Uni-
versity Linguistics Club (Bloomington).
Fillmore, Ch. J. (1975b) An Alternative to Check-
list Theories of Meaning. In: Proceedings of the
Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society.
University of California, Berkeley, 123131.
Fillmore, Ch. J. (1977) The Case for Case Reopen-
ed. In: K. Heger/ J. M. Petfi (eds.) Kasustheorie,
Klassifikation, semantische Interpretation. Ham-
burg: Buske, 326.
Fillmore, Ch. J. (1982) Towards a Descriptive Fra-
mework for Spatial Deixis. In: R. J. Jarvella/W.
Klein (eds.) Speech, Place and Action. Chichester:
John Wiley, 3160.
Fillmore, Ch. J./Kay, P./OConnor, M. C. (1988)
Regularity and Idiomaticity in Grammatical Con-
structions: The Case of let alone. In: Language 64,
501538.
Eisenberg, P. (1986) Grundri der Deutschen Gram-
matik. Stuttgart: Metzler.
Emonds, J. E. (1976) A Transformational Approach
to English Syntax. New York: Academic Press.
Emonds, J. E. (1988) A Unified Theory of Syntactic
Categories. Dordrecht: Foris.
En, M. (1981) Tense without Scope: An Analysis
of Nouns as Indexicals. Ph. D. Dissertation, Uni-
versity of Winsconsin at Madison.
En, M. (1982) Definite Descriptions and Indexi-
cality. In: D. Flickinger/M. Macken/N. Wiegand
(eds.) Proceedings of the 1st West Coast Conference
on Formal Linguistics. Stanford, 93103.
En, M. (1986) Towards a Referential Analysis of
Temporal Expressions. In: Linguistics and Philo-
sophy 9, 405426.
Engdahl, E. (1980) The Syntax and Semantics of
Questions in Swedish. Ph. D. Dissertation. Univer-
sity of Massachussetts, Amherst.
Erdmann, K. O. (1910) Die Bedeutung des Wortes.
Leipzig. Reprinted (1966). Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft.
Esau, H. (1973) Nominalization and Complemen-
tation in Modern German. Amsterdam: North Hol-
land.
Essler, W. K. (1969) Einfhrung in die Logik. Stutt-
gart: Krner.
Evans, G. (1973) The Causal Theory of Names. In:
Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. 47,
187208.
Evans, G. (1977) Pronouns, Quantifiers, and Re-
lative Clauses. In: Canadian Journal of Philosophy
7, 467536.
Evans, G. (1979) Reference and Contingency. In:
The Monist 62, 161189.
Evans, G. (1980) Pronouns. In: Linguistic Inquiry
11, 337362.
Fabb, N. (1984) Syntactic Affixation. Ph. D. Dis-
sertation MIT, Cambridge, Mass.
Fabricius-Hansen, C. (1975) Transformative, in-
transformative und kursive Verben (= Linguistische
Arbeiten 26). Tbingen: Niemeyer.
Fabricius-Hansen, C. (1986) Tempus fugit. ber die
Interpretation temporaler Strukturen im Deutschen
(= Sprache der Gegenwart 64). Dsseldorf:
Schwann.
Fabricius-Hansen, C./Sb, K. J. (1983) ber das
Chamleon wenn und seine Umwelt. In: Linguisti-
sche Berichte 83, 135.
Fales, E. (1982) Natural Kinds and Freaks of Na-
ture. In: Philosophy of Science 49, 6790.
Falkenberg, G. (1985) Negation und Verneinung.
Einige grundstzliche berlegungen. In: W.
Krschner/R. Vogt (eds.) Sprachtheorie, Pragma-
tik, Interdisziplinres. Tbingen: Niemeyer, 141
150.
Falkenberg, G. (1987) Negation, sprachliches Han-
deln und Einstellungskonflikte. In: I. Rosengren
(ed.) Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium
1986. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 253271.
42. BibliographieBibliography 875
Fraser, B. (1970) Some Remarks on the Action
Nominalization in English. In: R. Jacobs/P. S. Ro-
senbaum (eds.) Readings in English Transformatio-
nal Grammar. Waltham, Mass.: Ginn, 8398.
Fraser, B. (1971) An Analysis of even in English.
In: C. J. Fillmore/D. T. Langendoen (eds.) Studies
in Linguistic Semantics. New York: Holt, Rinehart
and Winston, 151178.
Frege, G. (1879) Begriffsschrift, eine der arithme-
tischen nachgebildeten Formelsprache des reinen
Denkens. Halle: L. Nebert. Reprinted (1974)
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Frege, G. (1884) Grundlagen der Arithmetik. Eine
logisch-mathematische Untersuchung ber den Be-
griff der Zahl. Breslau: W. Koebner. Reprinted
(1961) Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft.
Frege, G. (1891) Funktion und Begriff. Jena: H.
Pohle. Reprinted in: (1969) Funktion, Begriff,
Bedeutung. Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1839.
Frege, G. (1892) ber Sinn und Bedeutung. In:
Zeitschrift fr Philosophie und philosophische Kritik,
N. F. 100, 2550. Reprinted in: (1969) Funktion,
Begriff, Bedeutung. Gttingen: Vandenhoeck & Ru-
precht, 4065. English translation (1982): On
Sense and Reference. In: P. Geach/M. Black (eds.)
Translation from the Philosophical Writings of Gott-
lob Frege. Oxford: Basil Blackwell, 5678.
Frege, G. (1893/1903) Grundgesetze der Arithmetik.
Two volumes. Jena. Reprinted (1962) Darm-
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Frege, G. (1918/19) Der Gedanke Eine logische
Untersuchung. In: Beitrge zur Philosophie des
deutschen Idealismus 1, 5877. Reprinted in:
(1966) Logische Untersuchungen. Gttingen: Van-
denhoeck & Ruprecht, 3053.
Frege, G. (1923/26) Logische Untersuchungen.
Dritter Teil: Gedankengefge. In: Beitrge zur Phi-
losophie des deutschen Idealismus 3, 3651. Re-
printed in: (1966) Logische Untersuchungen. Gt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 7291.
Fllesdal, D. (1967) Comments on Stenius Paper.
In: Synthese 17, 275280.
Gaatone, D. (1971) Etude Descriptive du Systme
de la Ngation en Franais Contemporain. Genf:
Droz.
Gabbay, D. M./Moravcsik, J. M. (1978) Negation
and Denial. In: F. Guenthner/Ch. Rohrer (eds.)
Studies in the Formal Semantics. Amsterdam:
North Holland, 251265.
Gabbay, D./Guenthner, F. (eds.) (19831989)
Handbook of Philosophical Logic. Dordrecht: Rei-
del.
(1983) Vol. I: Elements of Classical Logic.
(1984) Vol. II: Extensions of Classical Logic.
(1986) Vol. III: Alternatives to Classical Logic.
(1989) Vol. IV: Topics in the Philosophy of Lang-
uage.
Fillmore, Ch. J./Langendoen, D. T. (eds.) (1971)
Studies in Linguistic Semantics. New York: Holt,
Rinehart and Winston.
Fine, K. (1975) Vagueness, Truth and Logic. In:
Synthese 19, 265300.
Fine, K. (1985) Reasoning With Arbitrary Objects
(= Aristotelian Society Series 3). Oxford: Basil
Blackwell.
Firth, J. R. (1957) Papers in Linguistics. London:
Oxford University Press.
Fleischer, W. (1969) Wortbildung der deutschen Ge-
genwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches
Institut. Reprinted (1971) Tbingen: Niemeyer.
Fodor, J. A. (1975) The Language of Thought. New
York: Thomas Y. Cromwell. Reprinted (1979).
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Fodor, J. A. (1977) Semantics: Theories of Meaning
in Generative Grammar. Hassocks, Sussex: Harve-
ster.
Fodor, J. A. (1978a) Propositional Attitudes. In:
The Monist 61, 501523.
Fodor, J. A. (1978b) Tom Swift and His Procedural
Grandmother. In: Cognition 6, 229247.
Fodor, J. A. (1981) Representations: Philosophical
Essays on the Foundations of Cognitive Science.
Cambridge, Mass.: MIT Press.
Fodor, J. A. (1982) Cognitive Science and the Twin
Earth Problem. In: Notre Dame Journal of Formal
Logic 23, 98118.
Fodor, J. A. (1987) Psychosemantics. Cambridge,
Mass.: MIT Press.
Fodor, J. A./Sag, I. (1982) Referential and Quan-
tificational Indefinites. In: Linguistics and Philoso-
phy 5, 355398.
Foolen, A. (1983) Zur Semantik und Pragmatik
der restriktiven Gradpartikeln: only, nur und maar/
aleen. In: H. Weydt (ed.) Partikeln und Interaktion.
Tbingen: Niemeyer, 188199.
Forbes, G. (1988) Indexicals. In: D. Gabbay/F.
Guenthner (eds.) Handbook of Philosophical Logic,
Vol. IV. Dordrecht: Reidel, 463490.
Fox, B. A. (1987) Discourse Structure and Ana-
phora. Cambridge: University Press.
Franck, D. (1980) Partikeln und Konversation.
Kronberg: Scriptor.
Franois, J. (1981) On the Perspectival Ordering
of Patient and Causing Event in the Distribution
of French and German Verbs of Change: a Con-
trastive Study. In: R. Buerle/Ch. Schwarze/A. von
Stechow (eds.) Meaning, Use, and the Interpretation
of Language. Berlin: de Gruyter, 121133.
Franois, J. (1984) Le cheminement du temps nar-
ratif. Essai dinterprtation temporelle de mini-s-
quences narratives du franais et de lallemand. In:
DRLAV Revue de Linguistique No. 31, Paris.
Franois, J. (1985) Aktionsart, Aspekt und Zeit-
konstitution. In: Ch. Schwarze/D. Wunderlich
(eds.) Handbuch der Lexikologie. Knigstein/Ts.:
Athenum, 229249.
876 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Geach, P. T. (1950) Russells Theory of Descrip-
tions. In: Analysis 10, 8488.
Geach, P. T. (1957) On Beliefs About Oneself. In:
Analysis 18, 2324.
Geach, P. T. (1962) Reference and Generality. An
Examination of Some Medieval and Modern Theo-
ries. (3rd revised ed. 1980) Ithaca/London: Cornell
University Press.
Geach, P. T. (1969) Quines Syntactical Insights.
In: Davidson, D./Hintikka, J. (eds.) Words and
Objections. Essays on the Work of W. V. Quine.
Dordrecht: Reidel, 146157. Reprinted in
Geach (1972), 115127.
Geach, P. T. (1970) A Program for Syntax. In:
Synthese 22, 317. Reprinted in: D. Davidson/
G. Harman (eds.) (1972) Semantics of Natural
Language. Dordrecht: Reidel, 483497.
Geach, P. T. (1972) Logic Matters. Oxford: Basil
Blackwell. (Second, corrected edition: 1981.)
Geach, P. T. (1973) Ontological Relativity and Re-
lative Identity. In: M. Munitz (ed.) Logic and On-
tology. New York: State University of New York
Press, 287302.
Geis, M. L. (1970) Time Prepositions as Underlying
Verbs. In: Papers from the 6th Regional Meeting of
the Chicago Linguistic Society. Chicago, 235249.
Geis, M. L. (1973) Comparative Simplification. In:
Working Papers in Linguistics 16: Mostly Syntax
and Semantics. Columbus: Ohio State University,
3746.
Geis, M. L. (1975) English Time and Place Adver-
bials. In: Working Papers in Linguistics 18. Colum-
bus: Ohio State University, 111.
Geis, M. L. (1985) The Syntax of Conditional Sen-
tences. In: M. Geis (ed.) Working Papers in Lin-
guistics. Columbus: Ohio State University,
George, L. (1980) Analogical Generalizations of Na-
tural Language Syntax. Ph. D. Dissertation MIT.
Gerling, M./Orthen, N. (1979) Deutsche Zustands-
und Bewegungsverben. (= Studien zur deutschen
Grammatik 11) Tbingen: Narr.
Gerstner, C. (1988) ber Generizitt. Generische
Nominalphrasen in singulren und generischen Aus-
sagen. Ph. D. Dissertation Universitt Mnchen.
Gerstner, C./Krifka, M. (1987) Genericity. In: J.
Jacobs et al. (eds.) Handbuch Syntax. Berlin: de
Gruyter. (To appear)
Ghiselin, M. (1974) A Radical Solution to the Spe-
cies Problem. In: Systematic Zoology 23, 536544.
Gibbard, A. (1981) Two Recent Theories of Con-
ditionals. In: W. L. Harper/R. Stalnaker/G. Pearce
(eds.) Ifs, Conditionals, Belief, Decision, Chance,
and Time. Dordrecht: Reidel, 211248.
Gil, D. (1987) Georgian Reduplication and the
Domaine of Distributivity. Unpublished Ms., Uni-
versity of Tel Aviv.
Gillon, B. (1990) Bare Plurals as Indefinite Plural
Noun Phrases. In: H. Kyburg/R. Loui/G. Carlson
(eds.) Knowledge Representation and Defeasible
Reasoning. Dordrecht: Kluwer, 119166.
Gabbay, D./Moravcsik, J. M. E. (1973) Sameness
and Individuation. In: Journal of Philosophy 70,
513526. Reprinted in: F. J. Pelletier (ed.) (1979)
Mass terms: Some Philosophical Problems. Dor-
drecht: Reidel, 233247.
Gabbay, D./Rohrer, C. (1978) Relative Tenses: The
Interpretation of Tense Forms which occur in the
Scope of Temporal Adverbs or in Embedded Sen-
tences. In: C. Rohrer (ed.) Papers on Tense, Aspect
and Verb Classification (= Tbinger Beitrge zur
Linguistik 110). Tbingen: Narr, 99110.
Gallin, D. (1975) Intensional and Higher Order Mo-
dal Logic. Amsterdam: North Holland.
Galton, A. (1984) The Logic of Aspect. An Axio-
matic Approach. Oxford: Clarendon Press.
Gardies, J.-L. (1985) Rational Grammar. Mnchen:
Philosophischer Verlag.
Garey, H. B. (1957) Verbal Aspects in French. In:
Language 33, 91110.
Gawron, J. M./Peters, St. (1990) Anaphora and
Quantification in Situation Semantics. CSLI Lecture
Notes 19. Stanford.
Gazdar, G. (1976) Formal Pragmatics for Natural
Language: Implicature, Presupposition and Logical
Form. Distributed by Indiana University Lingui-
stics Club (Bloomington).
Gazdar, G. (1978) Eine pragmatisch-semantische
Mischtheorie der Bedeutung. In: Linguistische Be-
richte 58, 517.
Gazdar, G. (1979) Pragmatics: Implicature, Presup-
position, and Logical Form. New York: Academic
Press.
Gazdar, G. (1979a) Review of Katz (1977). In:
Journal of Literary Semantics 8, 122127.
Gazdar, G. (1979b) A Solution to the Projection
Problem. In: Ch.-K. Oh/D. A. Dinneen (eds.) Pre-
supposition (= Syntax and Semantics, Vol. 11).
New York/San Francisco/London: Academic
Press.
Gazdar, G. (1980a) A Cross-Categorial Semantics
for Coordination. In: Linguistics and Philosophy 3,
307309.
Gazdar, G. (1980b) A Phrase Structure Syntax for
Comparative Clauses. In: T. Hoekstra/H. van der
Hulst/M. Moortgat (eds.) Lexical Grammar. Dor-
drecht: Foris Publications, 165179.
Gazdar, G. (1981) Speech Act Assignment. In: A.
Joshi/B. Webber/ I. Sag (eds.) Elements of Discourse
Understanding. Cambridge: Cambridge University
Press, 6483.
Gazdar, G./Klein, E./Pullum, G./Sag, I. (1985) Ge-
neralized Phrase Structure Grammar. Oxford: Basil
Blackwell.
Gazdar, G./Pullum, G. (1976) Truth-Functional
Connectives in Natural Language. In: Papers from
the 12th Regional Meeting of the Chicago Linguistic
Society. Chicago, 220234.
Grdenfors, P. (ed.) (1987) Generalized Quantifiers.
Linguistic and Logical Approaches. Dordrecht: Rei-
del.
42. BibliographieBibliography 877
Word Order and Word Order Change. Austin: Uni-
versity of Texas Press, 2745.
Grewendorf, G. (1972) Sprache ohne Kontext. Zur
Kritik der performativen Analyse. In: D. Wunder-
lich (ed.) Linguistische Pragmatik. Frankfurt/Main:
Athenum, 144182.
Grewendorf, G. (1979) Haben explizit performative
uerungen einen Wahrheitswert? In: G. Grewen-
dorf (ed.) Sprechakttheorie und Semantik. Frank-
furt/Main: Suhrkamp, 175196.
Grewendorf, G. (1980) Sprechaktheorie. In: P. Alt-
haus/H. Henne/ E. Wiegand (eds.) Lexikon der
Germanistischen Linguistik. Tbingen: Niemeyer,
287293.
Grewendorf, G. (1982a) Deixis und Anaphorik im
deutschen Tempus. In: Papiere zur Linguistik 26,
4783.
Grewendorf, G. (1982b) Zur Pragmatik der Tem-
pora im Deutschen. In: Deutsche Sprache 3,
213236.
Grewendorf, G. (1984a) Besitzt die deutsche Spra-
che ein Prsens? In: G. Stickel (ed.) Pragmatik in
der Grammatik. Dsseldorf: Schwann, 224242.
Grewendorf, G. (1984b) On the Delimination of
Semantics and Pragmatics: The Case of Assertions.
In: Journal of Pragmatics 8, 517538.
Grice, H. P. (1957) Meaning. In: The Philosophical
Review 66, 377388.
Grice, H. P. (1961) The Causal Theory of Percep-
tion. In: Proceedings of the Aristotelian Society,
Suppl. Vol. 35, 121152.
Grice, H. P. (1967) Logic and Conversation. Har-
vard: The William James Lectures (unpublished).
Grice, H. P. (1968) Utterers Meaning, Sentence-
Meaning, and Word-Meaning. In: Foundations of
Language 4, 225242.
Grice, H. P. (1969) Utterers Meaning and Inten-
tions. In: The Philosphical Review 78, 147177.
Grice, H. P. (1975) Logic and Conversation. In:
Cole, P./Morgan, J. L. (eds.) Speech Acts (= Syn-
tax and Semantics, Vol. 3). New York/San Fran-
cisco/London: Academic Press, 4158.
Grice, H. P. (1978) Further Notes on Logic and
Conversation. In: P. Cole (ed.) Pragmatics (= Syn-
tax and Semantics, Vol. 9). New York: Academic
Press, 113127.
Grice, H. P. (1981) Presupposition and Conversa-
tional Implicature. In: P. Cole (ed.) Radical Prag-
matics (= Syntax and Semantics, Vol.). New York:
Academic Press, 183198.
Grice, H. P. (1982) Meaning Revisited. In: N. V.
Smith (ed.) Mutual Knowledge. London: Academic
Press, 223243.
Grice, H. P. (1989) Studies in the Way of Words.
Cambridge, Mass./London, England: Harvard
University Press.
Grimshaw, J. (1988a) A Theory of External Argu-
ments. Talk given at Geneva University in Novem-
ber 1988. See Grimshaw (1990), ch. 2.5.
Ginet, C./Shoemaker, S. (eds.) (1983) Knowledge
and Mind: Philosophical Essays. Oxford: Oxford
University Press.
Givn, T. (1973) The Time-Axis Phenomenon. In:
Language 49, 890925.
Givn, T. (1978) Negation in Language: Pragma-
tics, Function, Ontology. In: P. Cole (ed.) Prag-
matics (= Syntax and Semantics, Vol. 9). New
York: Academic Press, 69112.
Givn, T. (1983) Topic Continuity in Discourse:
The Functional Domain of Switch-Reference. In:
I. Heiman/P. Munro (eds.) Switch-Reference and
Universal Grammar. Amsterdam: John Benjamins,
5182.
Givn, T. (1984) Syntax: A Functional-Typological
Introduction. Amsterdam: John Benjamins.
Goodenough, W. H. (1956) Componential Analysis
and the Study of Meaning. In: Language 32,
195216.
Goodman, N. (1951) The Structure of Appearance.
Cambridge, Mass.: Harvard. (2nd ed. 1966) India-
napolis: Bobbs-Merrill. (3rd ed. 1977) Dordrecht:
Reidel.
Goodwin, R. P. (1965) Selected Writings of St.
Thomas Aquinas. New York: Bobbs-Merrill.
Gordon, D./Lakoff,G. (1975) Conversational Po-
stulates. In: P. Cole/J. L. Morgan (eds.) Speech
Acts (= Syntax and Semantics Vol. 3). New York:
Academic Press, 83106.
Gordon, W. T. (1982) A History of Semantics. Am-
sterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Gougen, J. A. (1969) The Logic of Inexact Con-
cepts. In: Synthese 19, 325373.
Grabski, M. (1981) Quotations as Indexicals and
Demonstratives. In: H. J. Eikmeyer/H. Rieser (eds.)
Words, Worlds, and Contexts. Berlin/New York:
Springer, 151167.
Grandy, R. E. (1973) Reply to Moravcsik. In: J.
Hintikka et al. (eds.) Approaches to Natural Lang-
uage. Dordrecht: Reidel, 295300.
Grandy, R. E./Warner, R. (eds.) (1986) Philosophi-
cal Grounds of Rationality: Intentions, Categories,
Ends. Oxford: Clarendon Press.
GRASS = Groningen-Amsterdam Studies in Se-
mantics. Edited by A. ter Meulen/R. Bartsch. Dor-
drecht: Foris.
Green, G. M. (1970) More X than not X. In:
Linguistic Inquiry 1, 126127.
Green, G. M. (1973) The Lexical Expression of
Emphatic Conjunction. Theoretical Implications.
In: Foundations of Language 10, 197248.
Greenberg, J. H. (1972) Numeral Classifiers and
Substantival Number: Problems in the Genesis of
a Linguistic Type. In: L. Heilmann (ed.) (1975)
Proceedings of the 11th International Congress of
Linguistics, Bologna/Florence: Il Mulino, 1737.
Greenberg, J. H. (1975) Dynamic Aspects of Word
Order in the Numeral Classifier. In: Ch. N. Li (ed.)
878 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Haas, U. (1983) Textdarstellung und Logische Form.
Magisterarbeit Universitt Mnchen.
Habel, Ch. (1989) Zwischen-Bericht. In: Ch. Habel/
M. Herweg/K. Rehkmper (eds.) Raumkonzepte in
Verstehensprozessen. Interdisziplinre Beitrge zu
Sprache und Raum. Tbingen: Niemeyer, 3769.
Haider, H. (1984) Was zu haben ist und was zu
sein hat Bemerkungen zum Infinitiv. In: Papiere
zur Linguistik 30, Heft 1, 121.
Haig, J. H. (1976) Shadow Pronoun Deletion in
Japanese. In: Linguistic Inquiry 7, 363370.
Haik, I. (1984) Indirect Binding. In: Linguistic In-
quiry 15, 185224.
Haiman, J. (1974) Concessives, Conditionals, and
Verbs of Volition. In: Foundations of Language 11,
341360.
Hajicov, E. (1973) Negation and Topic vs. Com-
ment. In: Philologica Pragensia 16, 8193.
Hale, A. (1970) Conditions on English Compara-
tive Clause Pairings. In: R. A. Jacobs/P. S. Rosen-
baum (eds.) Readings in English Transformational
Grammar. Waltham, Mass.: Ginn, 3055.
Hall, B. (1965) Subject and Object in English. Ph. D.
Dissertation, MIT.
Halliday, M. A. K. (1966a) Intonation Systems in
English. In: A. McIntosh/M. A. K. Halliday (eds.)
Patterns of Language. London: Longman,
111133.
Halliday, M. A. K. (1966b) Lexis as Linguistic
Level. In: C. E. Blazell et al. (eds.) In Memory of
J. R. Firth. London: Longman.
Halliday, M. A. K./Hasan, R. (1976) Cohesion in
English. London: Longman.
Hamann, C. (1982) Adjektivkomplementierung und
andere Aspekte der Grammatik des englischen Ad-
jektivs. Ph. D. Dissertation, Freiburg.
Hamann, C./Nerbonne, J. /Pietsch, R.(1980) On
the Semantics of Degree. In: Linguistische Berichte
67, 122.
Hamblin, C. L. (1958) Questions. In: The Austra-
lasian Journal of Philosophy 36, 159168.
Hamblin, C. L. (1967) Questions. In: P. Edwards
(ed.) The Encyclopedia of Philosophy. Vol. VII,
4953.
Hamblin, C. L. (1973) Questions in Montague
Grammar. In: Foundations of Language 10, 4153.
Hankamer, J. (1973) Why There are Two thans in
English. In: C. Corum/T. C. Smith-Stark/A. Weiser
(eds.) Papers from the 9th Regional Meeting of the
Chicago Linguistic Society. Chicago, 179191.
Hare, R. M. (1952) The Language of Morals. Ox-
ford: Oxford University Press.
Hare, R. M. (1970) Meaning and Speech Acts. In:
The Philosophical Review, 324.
Harman, G. (1977) Review of J. Bennett Linguistic
Behaviour. In: Language 53, 417424.
Harnish, R. M. (1977) Logical Form and Impli-
cature. In: T. G. Bever/J. J. Katz/D. T. Langendoen
(eds.) An Integrated Theory of Linguistic Ability.
New York: Crowell, 313391.
Grimshaw, J. (1988b) Adjuncts and Argument
Structure. Lexicon Project Working Paper 21. Cen-
ter for Cognitive Science, MIT, Cambridge, Mass.
Grimshaw, J. (1990) Argument Structure. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press.
Groenendijk, J./de Jongh, D./Stokhof, M. (eds.)
(1986a) Foundations of Pragmatics and Lexical Se-
mantics (= GRASS Series No. 7). Dordrecht: Fo-
ris.
Groenendijk, J./de Jongh, D./Stokhof, M. (eds.)
(1986b) Studies in Discourse Representation Theory
and the Theory of Generalized Quantifiers (=
GRASS Series No. 8). Dordrecht: Foris.
Groenendijk, J./Janssen, T. M. V. /Stokhof, M.
(eds.) (1981) Formal Methods in the Study of Lang-
uage. Parts 1, 2. Mathematical Centre Tracts 135/
136. Amsterdam.
Groenendijk, J./Janssen, T. M. V./Stokhof, M.
(eds.) (1984) Truth, Interpretation, and Information.
Selected Papers of the Third Amsterdam Collo-
quium (= GRASS Series No. 2). Dordrecht: Foris.
Groenendijk, J./Stokhof, M. (1975) Modality and
Conversational Information. In: Theoretical Lin-
guistics 2, 61112.
Groenendijk, J./Stokhof, M. (1982) Semantic Ana-
lysis of WH-Complements. In: Linguistics and Phi-
losophy 5, 175223.
Groenendijk, J./Stokhof, M. (1984) Studies on the
Semantics of Questions and the Pragmatics of An-
swers. Ph. D. Dissertation Universiteit van Amster-
dam.
Groenendijk, J./Stokhof, M. (1987) Dynamic Pre-
dicate Logic: Towards a Compositional Non-repre-
sentational Semantics of Discourse. Ms, Depart-
ment of Philosophy, University of Amsterdam.
Groenendijk, J./Stokhof, M./Veltman, F. (eds.)
(1987) Proceedings of the Sixth Amsterdam Collo-
quium. Instituut voor Taal, Logica en Informatie
(= ITLI), University of Amsterdam.
Gross, M. (1977) Une analyse non prsuppositio-
nelle de leffet constratif. In: Linguisticae Investi-
gationes 1, 3962.
Grosz, B. J. (1977) The Representation and Use of
Focus in Dialog Understanding. Ph. D. Dissertation,
Department for Computer Science, University of
California at Berkeley.
Gruber, J. S. (1965) Studies in Lexical Relations.
Ph. D. Dissertation, MIT.
Gruber, J. S. (1976) Lexical Structures in Syntax
and Semantics. Amsterdam: North Holland.
Guenthner, F. (1979) Time Schemes, Tense Logic
and the Analysis of English Tenses. In: F. Guenth-
ner/S. J. Schmidt (eds.) Formal Semantics and Prag-
matics for Natural Languages. Dordrecht: Reidel,
201222.
Gupta, A. (1980) The Logic of Common Nouns: An
Investigation in Quantified Modal Logic. New Ha-
ven, CT.: Yale University Press.
Haack, S. (1974) Deviant Logic. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
42. BibliographieBibliography 879
Begriffskategorien im franzsischen und spanischen
Konjugationssystem. Tbingen: Niemeyer.
Heger, K./Petfi, J. M. (eds.) (1977) Kasustheorie,
Klassifikation, semantische Interpretation. Ham-
burg: Athenum.
Heidolph, K. E. /Flmig, W./Motsch, W. et al.
(1981) Grundzge einer deutschen Grammatik. Ber-
lin: Akademie Verlag.
Heilmann, J. (ed.) (1975) Proceedings of the 11th
International Congress of Linguistics. Bologna: Il
Mulino.
Heim, I. (1982) The Semantics of Definite and In-
definite Noun Phrases. Ph. D. Dissertation, Univer-
sity of Massachusetts at Amherst. Distributed
as Arbeitspapier 73, SFB 99 Konstanz. Publis-
hed (1988). New York: Garland.
Heim, I. (1983a) File Change Semantics and the
Familiarity Theory of Definiteness. In: R. Buerle/
Ch. Schwarze/A. von Stechow (1983) Meaning,
Use, and Interpretation of Language. Berlin: de
Gruyter, 164198.
Heim, I. (1983b) On the Projection Problem for
Presuppositions. In: Barlow, M./Flickinger, D. P./
Wescoat, M. T. (eds.) Proceedings of the 2nd West
Coast Conference on Formal Linguistics. Stanford,
114125.
Heim, I. (1987) Where Does the Definiteness Re-
striction Apply? Evidence from the Definiteness of
Variables. In: A. ter Meulen/ E. Reuland (eds.) The
Representation of (In)definiteness. Cambridge:
Cambridge University Press, 2142.
Heim, I./Lasnik, H./May, R. (1991) Reciprocity
and Plurality. In: Linguistic Inquiry 22, 63101.
Heinmki, O. (1975) Because and since. In: Lin-
guistica Silesiana 1, Katowice, 135142.
Heinemann, W. (1983) Negation und Negierung.
Handlungstheoretische Aspekte einer linguistischen
Kategorie. Leipzig: Enzylopdie Verlag.
Helbig, G. (1982) Valenz Satzglieder seman-
tische Kasus Satzmodelle. Leipzig: Enzyklopdie
Verlag.
Helbig, G. (ed.) (1971) Beitrge zur Valenztheorie.
The Hague/Paris: Mouton.
Helbig, G./Buscha, J. (1984) Deutsche Grammatik.
Leipzig: Enzyklopdie Verlag.
Helbig, G./Kempter, F. (1981) Die uneingeleiteten
Nebenstze. Leipzig: Enzyklopdie Verlag.
Helbig, G./Schenkel, W. (1969) Wrterbuch zur Va-
lenz und Distribution deutscher Verben. (3rd. ed.
1975) Leipzig: Bibliographisches Institut.
Hellan, L. (1981) Towards an Integrated Analysis
of Comparatives. Tbingen: Narr.
Hellan, L. (1984) Note on Some Issues raised by
von Stechow. In: Journal of Semantics 3, 8392.
Hendrick, R. (1978) The Phrase Structure of Ad-
jectives and Comparatives. In: Linguistic Analysis
4, 255299.
Harrah, D. (1961) A Logic of Questions and An-
swers. In: Philosophy of Science 28, 4046.
Harrah, D. (1963) Communication: A Logical Mo-
del. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Harrah, D. (1984) The Logic of Questions. In: D.
Gabbay/F. Guenther (eds.) Handbook of Philoso-
phical Logic, Vol. II. Dordrecht: Reidel, 715764.
Harries-Delisle, H. (1978) Constrative Emphasis
and Cleft Sentences. In: J. H. Greenberg (ed.) Uni-
versals of Human Language, Vol. 4: Syntax. Stan-
ford: Stanford University Press, 419486.
Harris, C. R. S. (1959) Duns Scotus, Vol. II: The
Philosophical Doctrines of Duns Scotus. Atlantic
Highland, N. J.: Humanities Press.
Harris, Z. (1951) Methods in Structural Linguistics.
(Reprinted as: Structural Linguistics 1961). Chi-
cago: University Press.
Harris, Z. (1964) Distributional Structure. In: Word
10, 115193.
Hartung, W. (1961) Systembeziehungen der kausa-
len Konjunktionen in der deutschen Gegenwartsspra-
che. Ph. D. Dissertation, Berlin.
Hartung, W. (1964) Die zusammengesetzten Stze
des Deutschen (= Studia Grammatica 4). Berlin:
Akademie Verlag.
Hasegawa, K. (1972) Transformations and Seman-
tic Interpretation. In: Linguistic Inquiry 3,
141159.
Hauenschild, Ch. (1985) Zur Interpretation russi-
scher Nominalgruppen: Anaphorische Bezge und
thematische Strukturen im Satz und Text. Mnchen:
Sagner.
Hausser, R. (1974) Quantification in an Extended
Montague Grammar. Ph. D. Dissertation, Univer-
sity of Texas at Austin.
Hausser, R. (1978) Surface Compositionality and
the Semantics of Mood. In: J. Groenendijk/M.
Stokhof (eds.) Amsterdam Papers in Formal Gram-
mar, Vol. II. Amsterdam: Centrale Interfaculteit.
Hausser, R. (1980) Surface Compositionality and
the Semantics of Mood. In: J. Searle/F. Kiefer/M.
Bierwisch (eds.) Speech Act Theory and Pragmatics.
Dordrecht: Reidel, 7195.
Hausser, R. (1984) Surface Compositional Gram-
mar. Mnchen: Wilhelm Fink.
Hausser, R./Zaefferer, D. (1979) Questions and An-
swers in a Context-Dependent Montague Gram-
mar. In: F. Guenthner/S. J. Schmidt (eds.) Formal
Semantics and Pragmatics for Natural Languages.
Dordrecht: Reidel, 339358.
Hawkins, B. W. (1984) The Semantics of English
Spatial Prepositions. Ph. D. Dissertation. University
of California, San Diego. Distributed by
L. A. U. T. (Trier), Paper No. A 142.
Hawkins, J. A. (1978) Definiteness and Indefinite-
ness. London: Croom Helm.
Heger, (1963) Die Bezeichnung temporal-deiktischer
880 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Higginbotham, J./May, R. (1981) Questions, Quan-
tifiers and Crossing. In: Linguistic Review 1,
4179.
Higgins, F. R. (1973) On J. Emonds Analysis of
Extraposition. In: J. Kimball (ed.) Syntax and Se-
mantics, Vol. 2. New York: Academic Press,
149196.
Hill, C. A. (1982) Up/Down, Front/Back, Left/
Right. A Constrative Study of Haussa and English.
In: J. Weissenborn/W. Klein (eds.) Here and There.
Cross-Linguistic Studies on Deixis and Demonstra-
tion. Amsterdam: John Benjamins, 1342.
Hinrichs, E. (1985) A Compositional Semantics for
Aktionsarten and NP Reference in English. Ph. D.
Dissertation, Ohio State University.
Hinrichs, E. (1986) Temporal Anaphora in Dis-
courses of English. In: Linguistics and Philosophy
9, 6382.
Hinst, P. (1974) Logische Propdeutik. Mnchen:
Fink.
Hintikka, J. (1962) Knowledge and Belief. Ithaca:
Cornell University Press.
Hintikka, J. (1969a) On the Logic of Perception.
In: Models of Modalities. Dordrecht: Reidel,
151183.
Hintikka, J. (1969b) Semantics for Propositional
Attitudes. In: J. W. Davies et al. (eds.) Philosophical
Logic. Dordrecht: Reidel, 2145.
Hintikka, J. (1974) Questions about Questions. In:
M. K. Munitz/ D. K. Unger (eds.) Semantics and
Philosophy. New York: New York University Press,
103158.
Hintikka, J. (1975) Impossible Possible Worlds
Vindicated. In: Journal of Philosophical Logic 4,
475484.
Hintikka, J. (1976) The Semantics of Questions and
the Questions of Semantics (= Acta Philosophica
Fennica 28, No. 4). Amsterdam: North Holland.
Hintikka, J./Kulas, J. (1985) Anaphora and Definite
Descriptions. Dordrecht: Reidel.
Hintikka, J./Moravcsik, J. M. E./Suppes, P. (eds.)
(1973) Approaches to Natural Language. Dor-
drecht: Reidel.
Hirschberg, J. B. (1990) A Theory of Scalar Impli-
cature. Cambridge: University Press.
Hirschbhler, P. (1978) The Syntax and Semantics
of WH-Constructions. Distributed by Indiana Uni-
versity Linguistics Club (Bloomington).
Hirst, G. (1981) Anaphora in Natural Language
Understanding: A Survey. Berlin: Springer.
Hirt, H. (1937) Indogermanische Grammatik. Teil
VII: Syntax II. Heidelberg: Carl Winter.
Hiz, H. (ed.) (1978) Questions. Dordrecht: Reidel.
Hjelmslev, L. (1959) Essais Linguistiques (= TCLC
12). Copenhagen: Akademisk Forlag.
Hobbs, J. R./Shieber, S. M. (1987) An Algorithm
for Generating Quantifier Scopings. In: Computa-
tional Linguistics 13, 4755.
Hendriks, H. (1987) Type Change in Semantics: the
Scope of Quantification and Coordination. In: E.
Klein/J. van Benthem (eds.) Categories, Polymor-
phism and Unification. Edinburgh: Centre for Cog-
nitive Science/ITLI, University of Amsterdam,
96119.
Henschelmann, K. (1977) Kausalitt im Satz und
im Text (= Studia Romanica 31). Heidelberg: Carl
Winter.
Heny, F. (1978) Comparing Adjectives and
Grammars. In: J. Groenendijk/M. Stokhof (eds.)
Amsterdam Papers in Formal Grammars. Amster-
dam: Centrale Interfaculteit. Universiteit van Am-
sterdam, 194210.
Henzen, W. (1947) (3. Aufl. 1965) Deutsche Wort-
bildung. Tbingen: Niemeyer.
Herbermann, C. P. (1981) Wort, Basis, Lexem und
die Grenze zwischen Lexikon und Grammatik. Mn-
chen: Fink.
Heringer, H. J. (1983) Prsens fr die Zukunft. In:
J. O. Askedal et al. (eds.) Festschrift fr Laurits
Saltveit. Oslo: Universitetsforlaget.
Heringer, H. J. (1984) Neues von der Verbszene.
In: G. Stickel (ed.) Pragmatik in der Grammatik (=
Sprache der Gegenwart 60). Dsseldorf: Schwann,
3464.
Hermodsson, L. (1978) Semantische Strukturen der
Satzgefge im kausalen und konditionalen Bereich.
Stockholm: Almquist & Wiksell.
Herskovits, A. (1982) Space and the Prepositions in
English: Regularities in a Complex Domain. Ph. D.
Dissertation. Stanford University.
Herskovits, A. (1986) Language and Spatial Cog-
nition. An Interdisciplinary Study of the Prepositions
in English. Cambridge: Cambridge University
Press.
Herweg, M. (1989) Anstze zu einer semantischen
Beschreibung topologischer Prpositionen. In: Ch.
Habel/M. Herweg/K. Rehkmper (eds.) Raumkon-
zepte in Verstehensprozessen. Interdisziplinre Bei-
trge zu Sprache und Raum. Tbingen: Niemeyer,
99127.
Herweg, M. (1990) Zeitaspekte. Die Bedeutung von
Tempus, Aspekt und temporalen Konjunktionen.
Wiesbaden: Deutscher Universitts-Verlag.
Heuer, W. (1929) Warum fragen die Menschen
WARUM? Heidelberg: Winter.
Heyer, G. (1987) Generische Kennzeichnungen. Zur
Logik und Ontologie generischer Bedeutung. Mn-
chen/Berlin: Philosophia Verlag.
Higginbotham, J. (1980) Pronouns and Bound Va-
riables. In: Linguistic Inquiry 11, 679708.
Higginbotham, J. (1983) The Logic of Perceptual
Reports: An Extensional Alternative to Situation
Semantics. In: Journal of Philosophy 80, 100127.
Higginbotham, J. (1985) On Semantics. In: Lingui-
stic Inquiry 16, 547594. Reprinted in: E.
LePore (1987) New Directions in Semantics. Lon-
don: Academic Press, 154.
42. BibliographieBibliography 881
98107.
Horn, L. R. (1972) On the Semantic Properties of
Logical Operators in English. Ph. D. Dissertation
UCLA, Los Angeles. Distributed by Indiana Uni-
versity Linguistics Club (Bloomington).
Horn, L. R. (1973) Greek Grice. In: C. Corum et
al. (eds.) Papers from the 9th Regional Meeting of
the Chicago Linguistic Society. Chicago, 205214.
Horn, L. R. (1978) Some Aspects of Negation. In:
J. H. Greenberg (ed.) Universals of Human Lang-
uage, Vol. 4: Syntax. Stanford: Stanford University
Press, 127210.
Horn, L. R. (1981) A Pragmatic Approach to Cer-
tain Ambiguities. In: Linguistics and Philosophy 4,
321358.
Horn, L. R. (1985) Metalinguistic Negation and
Pragmatic Ambiguity. In: Language 61, 121174.
Horvath, J. (1981) Aspects of Hungarian Syntax
and the Theory of Grammar. Ph. D. Dissertation,
UCLA, Los Angeles.
Horvath, J. (1986) FOCUS in the Theory of Gram-
mar and the Syntax of Hungarian. Dordrecht: Foris.
Houweling, F. (1986) Deictic and Anaphoric Tense
Morphemes. In: V. L. Cascio/C. Vet (eds.) Temporal
Structure in Sentence and Discourse. Dordrecht:
Reidel, 161190.
Huang, Ch.-T. J. (1982) Logical Relations in Chi-
nese and the Theory of Grammar. Ph. D. Disserta-
tion, MIT.
Huckin, T. H. (1977) The Nonglobality of er-Sup-
pletion. In: Linguistic Analysis 3, 217226.
Huddleston, R. (1967) More on the English Com-
parative. In: Journal of Linguistics 3, 91102.
Hughes, G. E./Cresswell, M. J. (1968) An Intro-
duction to Modal Logic. London: Methuen.
Hughes, S. (1971) The Virus. London: Heinemann.
Hull, D. (1976) Are Species Really Individuals? In:
Systematic Zoology 25, 174191.
Husserl, E. (1901/2) Logische Untersuchungen.
Halle: Niemeyer.
Ipsen, G. (1924) Der alte Orient und die Indoger-
manen. In: Festschrift Streitberg, Heidelberg: Win-
ter.
Irvine, M. (1982) Grasping the Word. Ph. D. Dis-
sertation, Harvard University.
Jackendoff, R. S. (1969) An Interpretative Theory
of Negation. In: Foundations of Language 5,
218241.
Jackendoff, R. S. (1972) Semantic Interpretation in
Generative Grammar. Cambridge, Mass.: MIT
Press.
Jackendoff, R. S. (1973) The Base Rules for Pre-
positionale Phrases. In: S. R. Anderson/P. Ki-
parsky (eds.) A Festschrift for Morris Halle. New
York: Holt, Rinehart & Winston, 345356.
Jackendoff, R. S. (1975) Morphological and Se-
mantic Regularities in the Lexicon. In: Language
51, 639671.
Hobbs, R. (1979) Coherence and Coreference. In:
Cognitive Science 3, 6790.
Hochberg, H. (1957) On Pegasizing. In: Philosophy
and Phenomenological Research 17, 551554.
Hhle, T. N. (1978) Lexikalische Syntax: Die Aktiv-
Passiv-Relation und andere Infinitivkonstruktionen
im Deutschen (= Linguistische Arbeiten 67). T-
bingen: Niemeyer.
Hhle, T. N. (1982a) Explikationen fr normale
Betonung und normale Wortstellung. In: W.
Abraham (ed.) Satzglieder im Deutschen. Tbingen:
Narr, 75154.
Hhle, T. N. (1982b) ber Komposition und De-
rivation: Zur Konstituentenstruktur von Wortbil-
dungsprodukten im Deutschen. In: Zeitschrift fr
Sprachwissenschaft 1, 76112. Engl. version:
(1985) On Composition and Derivation: The Con-
stituent Structure of Secondary Words in German.
In: J. Toman (ed.) Studies in German Grammar.
Dordrecht: Reidel, 319376.
Hoeksema, J. (1983a) Negative Polarity and the
Comparative. In: Natural Language and Linguistic
Theory 1, 403434.
Hoeksema, J. (1983b) Plurality and Conjunction.
In: A. ter Meulen (ed.) Studies in Model-Theoretic
Semantics. Dordrecht: Foris, 6384.
Hoeksema, J. (1984) To Be Continued: The Story
of the Comparative. In: Journal of Semantics 3,
93107.
Hoenigswald, H. M. (1960) Language Change and
Linguistic Reconstruction. Chicago: University of
Chicago Press.
Hoepelman, J. (1979) Negation and Denial in Mon-
tague Grammar. In: Theoretical Linguistics 6,
191209.
Hoepelman, J. (1981) Verb Classification and the
Russian Verbal Aspect: A Formal Analysis. Tbin-
gen: Narr.
Hoepelman, J. (1982) Adjectives and Nouns: A
New Calculus. In: R. Buerle/C. Schwarze/A. von
Stechow (eds.) Meaning, Use and, Interpretation of
Language. Berlin: de Gruyter, 190220.
Hoepelman, J. (1986) Action, Comparison and
Change. A Study in the Semantics of Verbs and
Adjectives. Tbingen: Niemeyer.
Hoepelman, J./Rohrer, Ch. (1980) On the Mass-
Count-Distinction and the French Imparfait and
Pass Simple. In: Ch. Rohrer (ed.) Time, Tense, and
Quantifiers. Tbingen: Niemeyer, 85112.
Hrmann, H. (1983) The Calculating Listener, or:
How Many are einige, mehrere, and ein paar (some,
several, and a few)? In: R. Buerle/Ch. Schwarze/
A. von Stechow (1983) Meaning, Use, and Inter-
pretation of Language. Berlin: de Gruyter,
221234.
Horn, L. R. (1969) A Presuppositional Analysis of
only and even. In: Papers from the 5th Regional
Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago,
882 XII. Bibliographischer Anhang und Register
meyer/L. M. Jansen (eds.) Objektargumente. Grun-
delemente der semantischen Struktur von Texten 3.
Hamburg: Buske, 742.
Jespersen, O. (1917) Negation in English and Other
Languages. Kopenhagen. Reprinted in: Selected
Writings of Otto Jespersen. London: Allen and Un-
win. 1960.
Jespersen, O. (1924) The Philosophy of Grammar.
(7th ed. 1955) London: Allen & Unwin.
Jespersen, O. (1940) A Modern English Grammar
on Historical Principles. Part V: Syntax. London:
Allan & Unwin/ Copenhagen: Munksgaard.
Johnson-Laird, Ph. N. (1977) Procedural Seman-
tics. In: Cognition 5, 189214.
Johnson-Laird, Ph. N. (1978) Whats Wrong with
Grandmas Guide to Procedural Semantics: A Re-
ply to Jerry Fodor. In: Cognition 6, 249261.
Johnson-Laird, Ph. N. (1982) Formal Semantics
and the Psychology of Meaning. In: S. Peters/E.
Saarinen (eds.) Processes, Beliefs, and Questions.
Dordrecht: Reidel, 168.
Johnson-Laird, Ph. N. (1983) Mental Models: To-
wards a Cognitive Science of Language, Inference
and Consciousness. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
Jolles, A. (1934) Antike Bedeutungsfelder. In: Bei-
trge zur deutschen Sprache und Literatur 58,
97109.
Kac, M. B. (1972) Clauses of Saying and the In-
terpretation of Because. In: Language 48, 626632.
Kadmon, N. (1987) On Unique and Non-Unique
Reference and Asymmetric Quantification. Ph.D
Dissertation, University of Massachusetts at Am-
herst. Distributed by Graduate Linguistics Student
Association.
Kaiser, G. (1978) Zur Semantik Polarer Adjektive.
Arbeitspapier 77 des SFB 99, Linguistik, Univer-
sitt Konstanz.
Kalish, D./Montague, R./Mar, G. (1980) Logic.
Techniques of Formal Reasoning. (2nd ed.) New
York: Harcourt-Brace-Jovanovich.
Kamp, H. (1971) Formal Properties of now. In:
Theoria 37, 227273.
Kamp, H. (1975) Two Theories About Adjectives.
In: E. Keenan (ed.) Formal Semantics of Natural
Language. Cambridge: Cambridge University
Press, 123155.
Kamp, H. (1978) Semantics versus Pragmatics. In:
F. Guenthner/S. Schmidt (eds.) Formal Semantics
and Pragmatics for Natural Languages. Dordrecht:
Reidel, 255287.
Kamp, H. (1981a) A Theory of Truth and Semantic
Representation. In: J. Groenendijk/T. Janssen/M.
Stokhof (eds.) Formal Methods in the Study of
Language. Mathematical Centre Tract 135. Am-
sterdam, 277322. Reprinted in: J. Groenen-
dijk/T. Janssen/M. Stokhof (eds.) (1984) Truth, Re-
presentation and Information (= GRASS Series No.
2). Dordrecht: Foris, 277322.
Jackendoff, R. S. (1976) Toward an Explanatory
Semantic Representation. In: Linguistic Inquiry 7,
89150.
Jackendoff, R. S. (1977) X-Bar Syntax: A Study of
Phrase Structure. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Jackendoff, R. S. (1983) Semantics and Cognition.
Cambridge, Mass.: MIT Press.
Jackendoff, R. S. (1987) The Status of Thematic
Relations in Linguistic Theory. In: Linguistic In-
quiry 18, 369411.
Jacobs, J. (1980) Lexical Decomposition in Mon-
tague-Grammar. In: Theoretical Linguistics 7,
121135.
Jacobs, J. (1982) Syntax und Semantik der Negation
im Deutschen. Mnchen: Fink.
Jacobs, J. (1983) Fokus und Skalen. Zur Syntax und
Semantik von Gradpartikeln im Deutschen. Tbin-
gen: Niemeyer.
Jacobs, J. (1984a) Funktionale Satzperspektive und
Illokutionssemantik. In: Linguistische Berichte 91,
2558.
Jacobs, J. (1984b) The Syntax of Bound Focus in
German. In: W. Abraham (ed.) Groninger Arbeiten
zur Germanistischen Linguistik 25. Groningen,
172200.
Jacobs, J. (1986) The Syntax of Focus and Adver-
bials in German. In: W. Abraham/S. de Mey (eds.)
Topic, Focus, and Configurationality. Amsterdam:
John Benjamins, 103127.
Jacobs, J. (1988) Fokus-Hintergrund-Gliederung
und Grammatik. In: H. Altmann (ed.) Intonations-
forschungen. Tbingen: Niemeyer, 89134.
Jacobs, J. (1989) ber Dualismen in der Gram-
matik. Ms, Universitt Wuppertal.
Jacobs, J. (1990) Skopus und Kohrenz. Ms, Uni-
versitt Wuppertal.
Jansen, L. M. (1977) Aspekte der Klassifikation
von Verben. In: K. Heger/J. M. Petfi (eds.) Ka-
sustheorie, Klassifikation, semantische Intepretation.
Hamburg: Buske, 211230.
Janssen, Th. M. V. (1980) On Problems Concerning
the Quantification Rules in Montague Grammar.
In: Ch. Rohrer (ed.) Time, Tense, and Quantifiers.
Tbingen: Niemeyer, 113134.
Janssen, Th. M. V. (1983) Foundation and Appli-
cations of Montague Grammar. Ph. D. Dissertation,
University of Amsterdam. Amsterdam: Mathema-
tisch Centrum.
Janen, H. (1984) Thematische Merkmale und le-
xikalische Prozesse. In: H. Czepluch/H. Janen
(eds.) Syntaktische Struktur und Kasusrelation. T-
bingen: Narr, 169212.
Jayaseelan, K. A. (1983) Prepositions as Deletion-
Triggers. In: Linguistic Analysis 11, 429437.
Jensen, J. T./Stong-Jensen, M. (1984) Morphology
is in the Lexicon. In: Linguistic Inquiry 15,
474498.
Jensen, L. M. (1980) Probleme der Identifizierung
und Klassifizierung von Quanten. In: H. J. Eik-
42. BibliographieBibliography 883
Karttunen, F./Karttunen, L. (1976) The Clitic -kin/
-kaan in Finnish. In: Papers from the Transatlantic
Finnish Conference, Texas Linguistic Forum 5, De-
partment of Linguistics. University of Texas at
Austin.
Karttunen, F./Karttunen, L. (1977) Even Que-
stions. In: Papers from the 7th Annual Meeting of
the North Eastern Linguistic Society. Cambridge,
Mass.
Karttunen, L. (1970) The Logic of English Predicate
Complement Constructions. German transl.
(1972) Die Logik englischer Prdikatkomplement-
konstruktionen. In: W. Abraham/R. J. Binnick
(eds.) Generative Semantik. Frankfurt/Main: Athe-
num, 243278.
Karttunen, L. (1971) Implicative Verbs. In: Lang-
uage 47, 340358.
Karttunen, L. (1973) Presuppositions of Com-
pound Sentences. In: Linguistic Inquiry 4,
169193.
Karttunen, L. (1974) Presupposition and Linguistic
Context. In: Theoretical Linguistics 1, 181194.
Karttunen, L. (1976) Discourse Referents. In: J. D.
McCawley (ed.) Notes from the Linguistic Under-
ground (= Syntax and Semantics Vol. 7). New
York: Academic Press, 363385.
Karttunen, L. (1977) Syntax and Semantics of Que-
stions. In: Linguistics and Philosophy 1, 344.
Reprinted in: H. Hiz (ed.) (1978) Questions. Dord-
recht: Reidel, 165210.
Karttunen, L./S. Peters (1979) Conventional Im-
plicature. In: Ch. K. Oh/P. A. Dinneen (eds.) Pre-
suppositions (= Syntax and Semantics Vol. 11).
New York: Academic Press, 156.
Katz, M. J. (1987) Are there Biological Impossi-
bilities? In: P. J. Davies/D. Park (eds.) No Way.
The Nature of the Impossible. New York: Freeman.
Kasher, A. (1974) Mood Implicatures: A Logical
Way of Doing Pragmatics. In: Theoretical Lingui-
stics 1, 638.
Kasher, A. (1975) Conversational Maxims and Ra-
tionality. In: A. Kasher (ed.) Language in Focus.
Dordrecht: Reidel, 197203.
Kasher, A./Manor, R. (1980) Simple Present Tense.
In: C. Rohrer (ed.) Time, Tense, and Quantifiers (=
Linguistische Arbeiten 83). Tbingen: Niemeyer,
315328.
Katz, J. J. (1966) The Philosophy of Language. New
York: Harper & Row.
Katz, J. J. (1967) Recent Issues in Semantic Theory.
In: Foundations of Language 3, 124194.
Katz, J. J. (1972) Semantic Theory. New York:
Harper and Row.
Katz, J. J. (1977) Propositional Structure and Illo-
cutionary Force: A Study of the Contribution of
Sentence Meaning to Speech Acts. New York: Tho-
mas Cromwell/Hassocks, Sussex: Harvester.
Katz, J. J./Fodor, J. A. (1963) The Structure of a
Semantic Theory. In: Language 39, 170210.
Kamp, H. (1981b) Evnements, rpresentations dis-
cursives et rfrence temporelle. In: Langage 64,
3964.
Kamp, H. (1981c) The Paradox of the Heap. In:
U. Mnnich (ed.) Aspects of Philosophical Logic.
Dordrecht: Reidel, 225277.
Kamp, H. (1983) SID Without Time or Questions.
Ms., Stanford, CA.
Kamp, H. (1985) Context, Thought and Commu-
nication. In: Proceedings of the Aristotelian Society
85, 239261.
Kamp, H. (1986) Belief Attribution and Context:
Comments on Robert Stalnaker. FNS-Bericht-
8613, Tbingen: Universitt Tbingen.
Kamp, H./Rohrer, Ch. (1983) Tense in Texts. In:
R. Buerle/Ch. Schwarze/A. von Stechow (eds.)
Meaning, Use, and Interpretation of Language. Ber-
lin: de Gruyter, 250269.
Kamp, H./Rohrer, Ch. (1985) Temporal Reference
in French. Ms., Universitt Stuttgart.
Kanngieer, S. (1985) Strukturen der Wortbildung.
In: C. Schwarze/ D. Wunderlich (eds.) Handbuch
der Lexikologie. Knigstein/Taunus: Athenum,
134183.
Kantor, R. N. (1977) The Management and Com-
prehension of Discourse Connection by Pronouns in
English. Ph. D. Dissertation, Ohio State University.
Kaplan, D. (1969) Quantifying In. In: D. Davidson/
J. Hintikka (eds.) Words and Objections: Essays on
the Work of W. V. Quine. Dordrecht: Reidel,
178214.
Kaplan, D. (1970) What is Russells Theory of
Descriptions? In: W. Yourgrau/A. Breck (eds.) Phy-
sics, Logic and History. New York/London: Plenum
Press, 277288.
Kaplan, D. (1975) How to Russel a Frege-Church.
In: Journal of Philosophy 72, 716729.
Kaplan, D. (1977) Demonstratives. An Essay on
the Semantics, Logic, Metaphysics and Epistemo-
logy of Demonstratives and Other Indexicals. Un-
published Paper. University of California, Los An-
geles.
Kaplan, D. (1978) Dthat. In: P. Cole (ed.) Prag-
matics (= Syntax and Semantics Vol. 9). New York:
Academic Press, 221243.
Kaplan, D. (1979) On the Logic of Demonstratives.
In: Journal of Philosophical Logic 8, 8198.
Kaplan, R. M./Bresnan, J. (1982) Lexical-Functio-
nal Grammar: A Formal System for Grammatical
Representation. In: J. Bresnan (ed.) The Mental
Representation of Grammatical Relations. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press.
Karmiloff-Smith, A. (1980) Psychological Proces-
ses Underlying Pronominalization and Non-pro-
minalization in ChildrenConnected Discourse. In:
J. Kreiman/A. B. Ofeda (eds.) Papers from the
Parasession on Pronouns and Anaphora. Chicago:
Chicago Linguistic Society, 231250.
884 XII. Bibliographischer Anhang und Register
for Natural Language. Dordrecht: Reidel.
Keenan, E. L./Hull, R. D. (1973) The Logical Pre-
suppositions of Questions and Answers. In: J. S.
Petfi/D. Franck (eds.) Prsuppositionen in Philo-
sophie und Linguistik. Frankfurt: Athenum,
441466.
Keenan, E. L./Moss, L. S. (1985) Generalized
Quantifiers and the Expressive Power of natural
Language. In: J. F. van Benthem/A. ter Meulen
(eds.) Generalized Quantifiers in Natural Language.
Dordrecht: Foris, 73124.
Keenan, E. L./Stavi, Y. (1986) A Semantic Cha-
racterization of Natural Language Determiners. In:
Linguistics and Philosophy 9, 253326.
Keil, F. C. (1979) Semantic and Conceptual Deve-
lopment. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Keil, F. C. (1986) The Acquisition of Natural Kind
and Artifact Terms. In: W. Demopoulus/A. Marras
(eds.) Language Learning and Concept Acquisition.
Norwood, N. J.: Ablex, 133153.
Keil, F. C. (1988) Commentary: Conceptual Hete-
rogeneity versus Developmental Homogeneity. In:
Human Development 31, 3543.
Kempson, R. M. (1975) Presupposition and the De-
limitation of Semantics. Cambridge: Cambridge
University Press.
Kempson, R. M. (1977) Semantic Theory. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Kempson, R. M. (1984) Anaphoric Binding, the
Compositionality Requirement, and the Semantics-
Pragmatics Distinction. In: C. Jones/P. Sells (eds.)
Proceedings of NELS 14 (North Eastern Linguistics
Society). Amherst: Graduate Linguistics Student
Association, 183206.
Kempson, R. M./Cormack, A. (1981) Ambiguity
and Quantification. In: Linguistics and Philosophy
4, 259309.
Kenny, A. J. (1966) Practical Inference. In: Analysis
26, 6575.
Kenny, A. J. (1980) Aquina. New York: Hill and
Wang.
Kiefer, F. (ed.) (1983) Questions and Answers. Dor-
drecht: Reidel.
Kiefer, F./Perlmutter, D. M. (eds.) (1974) Syntax
und generative Semantik, 3 vols. Frankfurt: Athe-
num.
Kim, J. (1974) Noncausal Connections. In: Nous
8, 4152.
Kimball, J. P. (ed.) (1973) Syntax and Semantics
Vol. 2. New York/London: Academic Press.
Kimball, J. P. (ed.) (1975) Syntax and Semantics
Vol. 4. New York/London: Academic Press.
Kindt, W. (1983) Two Approaches to Vagueness:
Theory of Interaction and Typology. In: Th. T
Ballmer/M. Pinkal (eds.) Approaching Vagueness.
Amsterdam: North Holland, 361392.
Kinkade, M. (1983) Salish Evidence Against the
Universality of Noun and Verb. In: Lingua 60,
2539.
Katz, J. J./Postal, P. M. (1964) An Integrated
Theory of Linguistic Descriptions. Cambridge,
Mass.: MIT Press.
Kaufmann, I. (1989) Direktionale Prpositionen.
In: Ch. Habel/M. Herweg/K. Rehkmper (eds.)
Raumkonzepte in Verstehensprozessen. Interdiszipli-
nre Beitrge zu Sprache und Raum. Tbingen: Nie-
meyer, 128149.
Kaufmann, I. (1990) Semantische und konzeptuelle
Aspekte der Prposition durch. In: Kognitionswis-
senschaft 1, 1526.
Kay, P. (1971) Taxonomy and Semantic Contrast.
In: Language 47, 866887.
Kay, P. (1990) Even. In: Linguistics and Philosophy
13, 59111.
Kayne, R. (1981) On Certain Differences between
English and French. In: Linguistic Inquiry 12,
349372.
Khler, H. (1965) Grammatik der Bahasa Indonesia.
Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Keenan, E. L. (1971a) Names, Quantifiers and a
Solution to the Sloppy Identity Problem. In: Papers
in Linguistics Vol. 4,
Keenan, E. L. (1971b) Quantifier Structures in Eng-
lish. In: Foundations of Language 7, 225284.
Keenan, E. L. (1974) The Functional Principle:
Generalizing the Notion of Subject Of. In: Papers
from the 10th Regional Meeting of the Chicago
Linguistic Society, 298309.
Keenan, E. L. (1975) Formal Semantics of Natural
Language. Cambridge: Cambridge University
Press.
Keenan, E. L. (1981) A Boolean Approach to Se-
mantics In: J. Groenendijk et al. (eds.) Formal
Methods in the Study of Language, Part 2. Amster-
dam: Mathematisch Centrum, 343379.
Keenan, E. L.(1982) Eliminating the Universe. A
Study in Ontological Perfection. In: D. Flickenger/
M. Macken/N. Wiegand (eds.) Proceedings of the
1st West Coast Conference on Formal Linguistics.
Stanford, 7181.
Keenan, E. L. (1987a) A Semantic Definition of
Indefinite NP. In: E. Reuland/A. ter Meulen (eds.)
The Representation of (In)definiteness. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 286317.
Keenan, E. L. (1987b) Unreducible n-ary Quanti-
fiers in Natural Language. In: P. Grdenfors (ed.)
Generalized Quantifiers: Linguistic and Logical Ap-
proaches. Dordrecht: Reidel, 109150.
Keenan, E. L. (ed.) (1975) Formal Semantics of
Natural Language. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.
Keenan, E. L./Comrie, B. (1977) Noun Phrase Ac-
cessibility and Universal Grammar. In: Linguistic
Inquiry 8, 6399.
Keenan, E. L./Faltz, L. (1978) Logical Types For
Natural Language. In: Working Papers in Syntax
and Semantics 3. Los Angeles: UCLA.
Keenan, E. L./Faltz, L. (1985) Boolean Semantics
42. BibliographieBibliography 885
Klver, U. (1982) Klassifikatorkonstruktionen in
Thai, Vietnamesisch und Chinesisch. In: H. J. Sei-
ler/C. Lehmann (eds.) Apprehension. Das sprachli-
che Erfassen von Gegenstnden, Teil 1. Tbingen:
Narr, 160185.
Knig, E. (1971) Kumulative Komparative. In: A.
von Stechow (ed.) Beitrge zur Generativen Gram-
matik. Braunschweig: Vieweg, 100111.
Knig, E. (1977) Temporal and Non-temporal Uses
of noch and schon. In: Linguistics and Philosophy
1, 173198.
Knig, E. (1979) A Semantic Analysis of German
erst. In: R. Buerle/U. Egli/A. von Stechow (eds.)
Semantics from Different Points of View. Berlin:
Springer, 148160.
Knig, E. (1980) On the Context-Dependence of
the Progressive in English. In. C. Rohrer (ed.) Time,
Tense, and Quantifiers (= Linguistische Arbeiten
83). Tbingen: Niemeyer, 269292.
Knig, E. (1981) The Meaning of Scalar Particles
in German. In: H. J. Eikmeyer/H. Rieser (eds.)
Words, Worlds and Contexts. Berlin: de Gruyter,
107132.
Knig, E. (1982) Scalar Particles in German and
their English Equivalents. In: W. F. Lohnes/E. A.
Hopkins (eds.) The Contrastive Grammar of English
and German. Ann Arbor: Karoma, 76101.
Knig, E. (1985a) Conditionals, Concessive Con-
ditionals and Connectives: Areas of Contrast,
Overlap and Neutralization. In: E. C. Traugott et
al. (eds.) On Conditionals. Cambridge: Cambridge
University Press.
Knig, E. (1985b) Where Do Concessives Come
From? On the Development of Concessive Con-
nectives. In: J. Fisiak (ed.) Historical Semantics
Historical Word-Formation. Berlin: Mouton,
263282.
Knig, E. (1985c) On the History of Concessive
Connectives in English. Diachronic and Synchronic
Evidence. In: Lingua 66, 365381.
Knig, E. (1988) Concessive Connectives and Con-
cessive Sentences: Cross-Linguistic Regularities
and Pragmatic Principles. In: J. Hawkins (ed.) Ex-
plaining Language Universals. Oxford: Basil Black-
well.
Knig, E. (1989) Concessive Relations as the Dual
of Causal Relations. In: D. Zaefferer (ed.) Semantic
Universals and Universal Semantics. Dordrecht: Fo-
ris. (to appear)
Knig, E. (1991) The Meaning of Focus Particles:
A Comparative Perspective. London: Routledge. (to
appear)
Knig, E./Traugott, E. C. (1982) Divergence and
Apparent Convergence in the Development of yet
and still. In: Berkeley Linguistics Society 10,
170179.
Koopman, H./Sportiche, D. (1981) Pronouns and
the Bijection Principle. In: GLOW Newsletter 6,
4445.
Kiparsky, C./Kiparsky, P. (1970) Fact. In: M. Bier-
wisch/K. Heidolph (eds.) Progress in Linguistics.
The Hague: Mouton, 143173. Reprinted in:
D. D. Steinberg/L. A. Jakobovits (eds.) (1971) Se-
mantics. An Interdisciplinary Reader in Philosophy,
Linguistics, and Psychology. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 345369.
Kiparsky, P. (1982) From Cyclic Phonology to Le-
xical Phonology. In: H. van der Hulst/N. Smith
(eds.) The Structure of Phonological Representa-
tions. Vol. 1. Dordrecht: Reidel, 131175.
Kiss, i. (1981) Structural Relations in Hungarian,
Free Word Order Language. In: Linguistic Inquiry
12, 185214.
Kiss, K. (1987) Configurationality in Hungarian.
Akadmiai Kiad, Budapest.
Kitcher, P. (1984) Species. In: Philosophy of Science
51, 308333.
Kleene, S. C. (1952) Introduction to Metamathe-
matics. Amsterdam: North Holland.
Klein, E. (1980) A Semantics for Positive and Com-
parative Adjectives. In: Linguistics and Philosophy
4, 145.
Klein, E. (1981a) The Interpretation of Adjectival,
Nominal, and Adverbial Comparatives. In: J.
Groenendijk/T. Janssen/M. Stokhof (eds.) Formal
Methods in the Study of Language. Amsterdam:
Mathematical Centre Tracts, 381398.
Klein, E. (1981b) The Syntax and Semantics of
Nominal Comparatives. In: M. Moneglia (ed.) Atti
de Seminario su Tempo e Verbale Strutture Quan-
tificate in Forma Logica. Florenz: Presso lAcca-
demia della Crusca, 223253.
Klein, E. (1982) The Interpretation of Adjectival
Comparatives. In: Journal of Linguistics 18,
113136.
Klein, E./Sag, I. (1981) Semantic Type and Control.
In: M. Barlow et al. (eds.) Stanford Working Papers
in Grammatical Theory, Vol. 2. Distributed by In-
diana University Linguistics Club (Bloomington).
Klein, J. (1980) Die Konzessivrelation als argu-
mentationstheoretisches Problem. In: ZGL 8,
154169.
Klein, W. (1978) Wo ist hier? Prliminarien zu einer
Untersuchung der lokalen Deixis. In: Linguistische
Berichte 58, 1840.
Klein, W./von Stechow, A. (1982) Intonation und
Bedeutung von Fokus. Arbeitspapier 77 des SFB 99,
Linguistik, Universitt Konstanz.
Klima, E. S. (1964) Negation in English. In: J. A.
Fodor/J. J. Katz (eds.) The Structure of Language.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 246323.
Kluge, F. (1975) Etymologisches Wrterbuch der
deutschen Sprache. (21. Aufl.) Berlin: de Gruyter.
Kneale, W./Kneale, M. (1962) The Development of
Logic. Oxford: Oxford University Press.
Knecht, L. (1976) Turkish Comparatives. In: Har-
vard Studies in Syntax and Semantics 2, 279358.
886 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Krifka, M./Carlson, G./Chierchia, G./Link, G./
Pelletier, F. J./ter Meulen, A. (1991) Genericity: An
Introduction. In: F. J. Pelletier/G. Carlson (eds.)
The Generic Book. Chicago: University of Chicago
Press. (to appear)
Krifka, M./Gerstner, C. (1987) An Outline of Ge-
nericity. Forschungsbericht des Seminars fr na-
trlich-sprachliche Systeme der Universitt Tbin-
gen 25.
Kripke, S. A. (1972) Naming and Necessity. In: D.
Davidson/G. H. Harman (eds.) Semantics of Na-
tural Language. Dordrecht: Reidel, 253355 +
763769.
Kripke, S. A. (1977) Speakers Reference and Se-
mantic Reference. In: P. French/T. Uehling/H.
Wettstein (eds.) Midwest Studies in Philosophy, vol.
II: Studies in the Philosophy of Language. Minnea-
polis: University of Minnesota Press, 255276.
Kripke, S. A. (1979) A Puzzle about Belief. In: A.
Margalit (ed.) Meaning and Use. Dordrecht: Reidel,
239283.
Kripke, S. A. (1980) Naming and Necessity. Oxford:
Basil Blackwell.
Kroch, A. S. (1974) The Semantics of Scope in
English. Ph. D. Dissertation, MIT. Published
(1979) New York/London: Garland Publishing.
Kuhn, T. S. (1962) The Structure of Scientific Re-
volutions. In: O. Neurath/R. Carnap/C. Morris
(eds.) International Encyclopedia of Unified Science,
Vol. 2. No. 2. (2nd enlarged ed. 1970) Chicago:
University of Chicago Press, 1172.
Kuno, S. (1971) The Positions of Locatives in Exi-
stential Sentences. In: Linguistic Inquiry 2,
333378.
Kuno, S. (1973) The Structure of the Japanese Lang-
uage. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Kuno, S. (1981) The Syntax of Comparative Clau-
ses. In: R. A. Hendrick/C. S. Masek/M. F. Miller
(eds.) Papers from the 17th Regional Meeting of the
Chicago Linguistic Society. Chicago, 136155.
Kper, Ch. (1983) Zum sprechaktbezogenen Ge-
brauch der Kausalverknpfer denn und weil: Gram-
matisch-pragmatische Interrelationen. In: Lingui-
stische Berichte 92, 1530.
Krschner, W. (1974) Zur syntaktischen Beschrei-
bung deutscher Nominalkomposita. Tbingen: Nie-
meyer.
Krschner, W. (1983) Studien zur Negation im Deut-
schen. Tbingen: Narr.
Labov, W. (1973) The Boundaries of Words and
their Meanings. In: C. J. Bailey/R. W. Shuy (eds.)
New Ways of Analyzing Variation in English. Wash-
ington D. C.: Georgetown University Press,
340373.
Ladusaw, W. A. (1979) Polarity Sensitivity as In-
herent Scope Relations. Ph. D. Dissertation. Uni-
versity of Texas, Austin. Published (1980) New
York: Garland.
Kosslyn, S. (1980) Image and Mind. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press.
Koster, J. (1984) On Binding and Control. In: Lin-
guistic Inquiry 15, 417459.
Kramsky, J. (1972) The Article and the Concept of
Definiteness in Language. The Hague: Mouton.
Krantz, D. H./Luce, R. D./Suppes, P./Tversky, A.
(1971) Foundations of Measurement, Vol. 1: Additive
and Polynominal Representations. New York: Aca-
demic Press.
Kratzer, A. (1977) What must and can must and
can mean. In: Linguistics and Philosophy 1,
337355.
Kratzer, A. (1978) Semantik der Rede. Kontext-
theorie Modalwrter Konditionalstze.
Knigstein/Taunus: Scriptor.
Kratzer, A. (1979) Conditional Necessity and Pos-
sibility. In: R. Buerle/U. Egli/A. von Stechow
(eds.) Semantics from Different Points of View. Ber-
lin: Springer, 117147.
Kratzer, A. (1980) Die Analyse des bloen Plurals
bei Gregory Carlson. In: Linguistische Berichte 70,
4750.
Kratzer, A. (1981) The Notional Category of Mo-
dality. In: H. J. Eikmeyer/H. Rieser (eds.) Words,
Worlds, and Contexts. New Approaches in Word
Semantics. Berlin: de Gruyter, 3874.
Kratzer, A. (1989) An Investigation of the Lumps
of Thought. In: Linguistics and Philosophy 12,
607653.
Kratzer, A./Pause, E./von Stechow, A. (1974) Ein-
fhrung in Theorie und Anwendung der generativen
Syntax. Frankfurt/Main: Athenum.
Kratzer, A./von Stechow, A. (1977) uerungssi-
tuation und Bedeutung. In: Zeitschrift fr Litera-
turwissenschaft und Linguistik 23/24, 98130.
Kretzman, N./Kenny, A./Pinborg, J. (eds.) (1982)
The Cambridge History of Later Medieval Philo-
sophy. London: Cambridge University Press.
Krifka, M. (1986) Nominalreferenz und Zeitkonsti-
tution. Zur Semantik von Massentermen, Pluralter-
men und Aspektklassen. Ph. D. Dissertation Univer-
sitt Mnchen. Printed (1989) Mnchen: Fink.
Krifka, M. (1987) Nominal Reference and Tem-
poral Constitution. Towards a Semantics of Quan-
tity. In: J. Groenendijk et al. (eds.) Studies in Dis-
course Representation Theory and the Theory of
Generalized Quantifiers (= GRASS Series No. 8).
Dordrecht: Foris, 153173.
Krifka, M. (1988) The Relational Theory of Ge-
nericity. In: M. Krifka (ed.) Genericity in Natural
Language. University of Tbingen, 285312.
Krifka, M. (ed.) (1988) Genericity in Natural Lang-
uage. Proceedings of the 1988 Tbingen Confe-
rence. Seminar fr natrlich-sprachliche Systeme
der Universitt Tbingen (= SNS-Bericht 8842).
Krifka, M. (1989) Some Remarks on Polarity
Items. Ms., Universitt Tbingen.
42. BibliographieBibliography 887
Lambrecht, K. (1986) Topic, Focus, and the Gram-
mar of French. Ph. D. Dissertation, University of
California at Berkeley.
Landman, F. (1986) Towards a Theory of Infor-
mation. The Status of Partial Objects in Semantics
(= GRASS Series No. 6). Dordrecht: Foris.
Landman, F. (1987) Groups, Plural Individuals and
Intentionality. In: J. Groenendijk/M. Stokhof/F.
Veltman (eds.) Proceedings of the Sixth Amsterdam
Colloquium. ITLI, University of Amsterdam,
197217.
Landman, F./Moerdijk, I. (1983) Compositionality
and the Analysis of Anaphora. In: Linguistics and
Philosophy 6, 89114.
Landman, F./Veltman, F. (eds.) (1984) Varieties of
Formal Semantics. Proceedings of the Fourth Am-
sterdam Colloquium (= GRASS Series No. 3). Dor-
drecht: Foris.
Lang, E. (1974) Operationen ber semantischen
Netzen beim Verstehen von Aussagenverknpfun-
gen. In: F. Klix (ed.) Organismische Informations-
verarbeitung. Berlin: Akademie-Verlag, 505511.
Lang, E. (1976) Erklrungstexte. In: F. Danes/D.
Viehweger (eds.) Probleme der Textgrammatik I (=
Studia Grammatica 11). Berlin: Akademie-Verlag,
147181.
Lang, E. (1977) Semantik der koordinativen Ver-
knpfung (= Studia Grammatica 14). Berlin: Aka-
demie Verlag.
Lang, E. (1978) Remarks on Boguslawski on Con-
tradictions, Dead Dogs, and the Pragmatic Impact
on Semantic Decisions. In: Linguistische Studien A
47, 6482.
Lang, E. (1982) Die Konjunktionen im einsprachi-
gen Wrterbuch. In: E. Agricola/J. Schildt/D. Vieh-
weger (eds.) Wortschatzforschung heute. Aktuelle
Probleme der Lexikologie und Lexikographie. Leip-
zig: Enzyklopdie Verlag, 72106.
Lang, E. (1983) Einstellungsausdrcke und ausge-
drckte Einstellungen. In: R. Ruzicka and W.
Motsch (eds.) Untersuchungen zur Semantik (=
Studia Grammatica 22). Berlin: Akademie Verlag,
301341.
Lang, E. (1984) The Semantics of Coordination.
Amsterdam: John Benjamins.
Lang, E. (1985) Symmetrische Prdikate: Lexiko-
neintrag und Interpretationsspielraum. Eine Fall-
studie zur Semantik der Personenstandslexik. In:
Linguistische Studien A 127, 75113.
Lang, E. (1987a) Semantik der Dimensionsaus-
zeichnung rumlicher Objekte. In: M. Bierwisch/E.
Lang (eds.) Grammatische und Konzeptuelle Aspekte
von Dimensionsadjektiven (= Studia Grammatica
26/27). Berlin: Akademie Verlag, 287458.
Lang, E. (1987b) Parallelismus als universelles Prin-
zip sekundrer Strukturbildung. In: E. Lang/G.
Sauer (eds.) Parallelismus und Etymologie. Studien
zu Ehren von Wolfgang Steinitz anllich seines 80.
Geburtstags (= Linguistische Studien A 161),
154.
Ladusaw, W. A. (1980) Affective Or, Factive Verbs,
and Negative Polarity Items. In: Papers from the
20th Regional Meeting of the Chicago Linguistic
Society, 170184.
Ladusaw, W. A. (1982) Semantic Constraints on
the English Partitive Construction. In: D. Flickin-
ger/M. Macken/N. Wiegand (eds.) Proceedings of
the 1st West Coast Conference on Formal Lingui-
stics. Stanford, 231242.
Ladusaw, W. A. (1983) Logical Form and Condi-
tions on Grammaticality. In: Linguistics and Phi-
losophy 6, 373392.
Lakoff, G. (1965) On the Nature of Syntactic Ir-
regularity. Ph. D. Dissertation, MIT.
Lakoff, G. (1970a) A Note on Vagueness and Am-
biguity. In: Linguistic Inquiry 1, 357359.
Lakoff, G. (1970b) Global Rules. In: Language 46,
627639.
Lakoff, G. (1970c) Linguistics and Natural Logic.
In: Synthese 22, 151271.
Lakoff, G. (1970d) Pronominalization, Negation,
and the Analysis of Adverbs. In: R. A. Jacobs (ed.)
Readings in English Transformational Grammar.
Waltham, Mass.: Ginn, 145165.
Lakoff, G. (1971) On Generative Semantics. In: D.
D. Steinberg/ L. A. Jakobovits (eds.) Semantics.
An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Lingui-
stics and Psychology. London: Cambridge Univer-
sity Press, 232296.
Lakoff, G. (1972) Linguistics and Natural Logic.
In: D. Davidson/ G. Harman (eds.) Semantics of
Natural Language. Dordrecht: Reidel, 545665.
Lakoff, G. (1973) Hedges: A Study in Meaning
Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts. In: Jour-
nal of Philosophical Logic 2, 458508.
Lakoff, G. (1975) Pragmatics in Natural Logic. In:
E. L. Keenan (ed.) Formal Semantics of Natural
Language. Cambridge: Cambridge University
Press, 253286.
Lakoff, G. (1987) Women, Fire, and Dangerous
Things. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G./M. Johnson (1980) Metaphors We Live
By. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G./Ross, J. R. (1970) Comparatives and
(N)ever. In: Linguistic Inquiry 1, 126.
Lakoff, R. (1968) Abstract Syntax and Latin Com-
plementation. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Lakoff, R. (1970) Another Nonsource for Com-
paratives. In: Linguistic Inquiry 1, 128129.
Lakoff, R. (1971) Ifs, Ands and Buts about Con-
junction. In: J. C. Fillmore/D. T. Langendoen (eds.)
Studies in Linguistic Semantics. New York: Holt,
Rinehart & Winston, 114149.
Lambek, J. (1958) The Mathematics of Sentence
Structure. In: American Mathematical Monthly 65,
154170.
Lambert, K. (ed.) (1969) The Logical Way of Doing
Things. New Haven/London: Yale University
Press.
888 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Lebeaux, D. (1986) The Interpretation of Derived
Nominals. In: Papers from the 22nd Regional Mee-
ting of the Chicago Linguistic Society. Chicago,
231247.
Lee, I.-H. (1983) Syntax and Semantics of Impe-
rative Sentences. In: S. Hattori/K. Inoue (ed.) Pro-
ceedings of the XIIIth International Congress of
Linguists. Tokyo, 534538.
Lees, R. B. (1960) The Grammar of English Nomi-
nalizations. The Hague/Paris: Mouton.
Lees, R. B. (1961) The English Comparative Con-
struction. In: Word 17, 171185.
Legrand, J. E. (1975) Or and Any: The Semantics
and Syntax of Two Logical Operators. Ph. D. Dis-
sertation, University of Chicago.
Lehrer, A. (1974) Semantic Fields and Lexical
Structure. Amsterdam: North Holland.
Lehrer, A. (1986) English Classifier Constructions.
In: Lingua 68, 109148.
Lehrer, A./Lehrer, K. (1982) Antonymy. In: Lin-
guistics and Philosophy 5, 483501.
Leisi, E. (1953) Der Wortinhalt. Seine Struktur im
Deutschen und Englischen. Heidelberg: Quelle &
Meyer. (4th enlarged ed. 1971) (= UTB 95) Hei-
delberg: Francke.
Lemmon, E. J. (1962) On Sentences Verifiable by
their Use. In: Analysis 22, 8689.
Lemmon, E. J. (1967) Comments on Davidsons
The Logical Form of Action Sentences. In: N.
Rescher (ed.) The Logic of Decision and Action.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 9103.
Lenerz, J. (1986) Tempus und Pragmatik oder:
Was man mit Grice so alles machen kann. In:
Linguistische Berichte 102, 136154.
Lenerz, J. (1990) Lesarten fr -er und -ung-Nomi-
nalisierungen. Lecture at the 12. Annual Meeting
of the DGfS in Saarbrcken.
Leonard, H. S. (1959) Interrogatives, Imperatives,
Truth, Falsity, and Lies. In: Philosophy of Science
26, 172186.
Leonard, H. S./Goodman, N. (1940) The Calculus
of Individuals and its Uses. In: Journal of Symbolic
Logic 5, 4555.
LePore, E. (ed.) (1987) New Directions in Seman-
tics. London: Academic Press.
Lerch, E. (1929) Historische Franzsische Syntax.
Leipzig: Reisland.
Lerner, J.-Y. (1979) Namen und Kontexte. Arbeits-
papier 35 des SFB 99, Konstanz.
Lerner, J.-Y./Sternefeld, W. (1984) Zum Skopus der
Negation im komplexen Satz des Deutschen. In:
Zeitschrift fr Sprachwissenschaft 3, 159202.
Lerner, J.-Y./Zimmermann, Th. E. (1981) Mehrdi-
mensionale Semantik: Die Prsupposition und die
Kontextabhngigkeit von nur. Arbeitspapier 50 des
SFB 99, Konstanz.
Lang, E. (1988a) Gestalt und Lage rumlicher Ob-
jekte. In: J. Bayer (ed.) Grammatik und Kognition.
Opladen: Westdeutscher Verlag,.
Lang, E. (1988b) Syntax und Semantik der Adver-
sativkonnektive. Einstieg und berblick. Ms., Zen-
tralinstitut fr Sprachwissenschaft Berlin.
Lang, E. (1989a) Primrer Orientierungsraum und
inhrentes Proportionsschema. In: Ch. Habel/M.
Herweg/K. Rehkmper (eds.) Raumkonzepte in
Verstehensprozessen. Interdisziplinre Beitrge zu
Sprache und Raum. Tbingen: Niemeyer, 150173.
Lang, E. (1989b) Probleme der Beschreibung von
Konjunktionen im allgemeinen einsprachigen Wr-
terbuch. In: F. J. Hausmann et al. (eds.) Wrter-
bcher Dictionaries Dictionnaires. Ein Inter-
nationales Handbuch zur Lexikographie. Berlin: de
Gruyter, 862868.
Langacker, R. W. (1966) On Prominalization and
the Chain of Command. In: W. Reibel/S. Schane
(eds.) Modern Studies in English. Readings in Trans-
formational Grammar. Englewood Cliffs, N. J.:
Prentice Hall, 160186.
Langacker, R. W. (1982) Space Grammar, Analy-
zability, and the English Passive. In: Language 58,
2280.
Langendoen, D. T. (1978) The Logic of Reciprocity.
In: Linguistic Inquiry 9, 177197.
Langendoen, D. T./Savin, H. B. (1971) The Pro-
jection Problem for Presuppositions. In: Ch. J.
Fillmore/D. T. Langendoen (eds.) Studies in Lin-
guistic Semantics. New York: Holt, Rinehart &
Winston, 5560.
Lapointe, G. (1979) A Theory of Grammatical
Agreement. Ph. D. Dissertation University of Mas-
sachusetts, Amherst.
Lappin, S. (1982) On the Pragmatics of Mood. In:
Linguistics and Philosophy 4, 559578.
Larson, R. K. (1988) Scope and Comparatives. In:
Linguistics and Philosophy 11, 126.
Lasersohn, P. N. (1988) A Semantics for Groups
and Events. Ph. D. Dissertation, Ohio State Uni-
versity. Columbus, Ohio.
Lasnik, H. (1976) Remarks on Coreference. In:
Linguistic Analysis 2, 122.
Lawler, J. (1973) Studies in English Generics. Uni-
versity of Michigan Papers in Linguistics 1:1, Ann
Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
Laycock, H. (1972) Some Questions of Ontology.
In: The Philosophical Review 81, 342.
Laycock, H. (1975) Theories of Matter. In: Syn-
these 31, 411442. Reprinted in: F. J. Pelletier
(ed.) (1979) Mass Terms: Some Philosophical Pro-
blems. Dordrecht: Reidel, 89120.
LE GROUPE -1 (M. C. Barbault/O. Ducrot/J.
Dufour/J. Espagnon/C. Israel/D. Manesse) (1975)
Car, parce que, puisque. In: Revue Romane 10,
248280.
42. BibliographieBibliography 889
In: S. Kanger/ S. hman (eds.) Philosophy and
Grammar. Dordrecht: Reidel, 79100.
Lewis, D. K. (1980b) Veridical Hallucination and
Prosthetic Vision. In: Australasian Journal of Phi-
losophy 58, 239249.
Lewis, D. K. (1981) Ordering Semantics and Pre-
mise Semantics for Counterfactuals. In: Journal of
Philosophical Logic 10, 217234.
Lewis, D. K. (1982) Whether-Report. In: T. Pauli
(ed.) Philosophical Essays Dedicated to Lennart
quist on his 50th Birthday. Uppsala: Filosofiska
Studier, 194206.
Lewis, D. K. (1986) On the Plurality of Worlds.
Oxford: Basil Blackwell.
Lewis, G. L. (1967) Turkish Grammar. Oxford: Cla-
rendon Press.
Li, Ch. N. (ed.) (1975) Word Order and Word Order
Change. Austin: University of Texas Press.
Li, Ch. N./Thompson, S. A. (1978) An Exploration
of Mandarin Chinese. In: W. P. Lehmann (ed.)
Syntactic Topology. Harvester: Hassocks,
223266.
Liddell, S. K. (1975) What about the Fact that On
certain ambiguities Says What it Says? In: Lingui-
stic Inquiry 6, 568578.
Lieb, H. (1983) Akzent und Negation im Deutschen
Umrisse einer einheitlichen Konzeption. In: Lin-
guistische Berichte 84, 132; 85, 148.
Lieber, R. (1980) On the Organization of the Lexi-
con. Ph. D. Dissertation. MIT, Cambridge, Mass.
Lieber, R. (1984) Argument Linking and Com-
pounds in English. In: Linguistic Inquiry 14,
251284.
Lindner, S. (1981) A Lexico-Semantic Analysis of
English Verb Particle Constructions with OUT and
UP. Ph. D. Dissertation. University of California,
San Diego.
Lindner, S. (1982) What Goes Up Doesnt Neces-
sarily Come Down: The Ins and Outs of Opposites.
In: Papers from the 18th Regional Meeting of the
Chicago Linguistic Society. Chicago, 305323.
Lindstrm, P. (1966) First-Order Predicate Logic
with Generalized Quantifiers. In: Theoria 32,
186195.
Linebarger, M. (1980) The Grammar of Negative
Polarity. Distributed by Indiana University Lin-
guistics Club (Bloomington).
Linebarger, M. (1987) Negative Polarity and Gram-
matical Representation. In: Linguistics and Philo-
sophy 10, 325387.
Link, G. (1974) Quantoren-Floating im Deutschen.
In: F. Kiefer/ D. M. Perlmutter (eds.) Syntax und
generative Grammatik, Vol. 2. Frankfurt: Athe-
num, 105127.
Link, G. (1976) Intensionale Semantik. Mnchen:
Fink.
Link, G. (1979) Montague-Grammatik. Die logi-
schen Grundlagen. Mnchen: Fink.
Lerner, J.-Y./Zimmermann, Th. E. (1983) Presup-
position and Quantifiers. In: R. Buerle/Ch.
Schwarze/A. von Stechow (eds) Meaning, Use and
Interpretation of Language. Berlin/New York: de
Gruyter, 290301.
Lsniewski, S. (192731) O podstawach matema-
tyki. In: Przeglad Filosofizny 30 (1927), 164206;
31 (1928), 261291; 32 (1929), 60101; 33 (1930),
77105; 34 (1931), 142170.
Lsniewski, S. (1929/38) Grundzge eines neuen
Systems der Grundlagen der Mathematik. In: Fun-
damenta Mathematica 14 (1929), 181. Reprin-
ted in: (1938) Collectanea Logica 12, 61144.
Levelt, W. J. M. (1986) Zur sprachlichen Abbildung
des Raumes: Deiktische und intrinsische Perspek-
tive. In: H.-G. Bosshardt (ed.) Perspektiven auf
Sprache. Interdisziplinre Beitrge zum Gedenken
an Hans Hrmann. Berlin: de Gruyter, 187211.
Levi, J. B. (1978) The Syntax and Semantics of
Complex Nominals. New York: Academic Press.
Levin, H. D. (1982) Categorial Grammar and the
Logical Form of Quantification (= Monographs in
Philosophical Logic and Formal Linguistics 1). Er-
colano: Bibliopolis.
Levinson, S. R. (1983) Pragmatics. Cambridge:
Cambridge University Press.
Lewis, D. K. (1969) Convention: A Philosophical
Study. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Lewis, D. K. (1970) General Semantics. In: Syn-
these 22, 1867. Reprinted in: D. Davidson/G.
Harman (eds.) Semantics of Natural Language.
Dordrecht: Reidel (1972), 169218.
Lewis, D. K. (1973a) Causation. In: Journal of
Philosophy 70, 556567.
Lewis, D. K. (1973b) Counterfactuals. Oxford: Ba-
sil Blackwell.
Lewis, D. K. (1975a) Adverbs of Quantification.
In: E. Keenan (ed.) Formal Semantics of Natural
Language. Cambridge: Cambridge University
Press, 315.
Lewis, D. K. (1975b) Languages and Language.
In: K. Gunderson (ed.) Language, Mind and Know-
ledge (= Minnesota Studies in the Philosophy of
Science Vol. 7). Minneapolis: University of Min-
nesota Press, 335.
Lewis, D. K. (1976) Probabilities of Conditionals
and Conditional Probabilities. In: The Philosophi-
cal Review 85, 297315.
Lewis, D. K. (1978) Truth in Fiction. In: American
Philosophical Quarterly 15, 3746.
Lewis, D. K. (1979a) Scorekeeping in a Language
Game. In: R. Buerle et al. (eds.) Semantics from
Different Points of View. Berlin: Springer,
172187. Also in: Journal of Philosophical Logic
8, 339359.
Lewis, D. K. (1979b) Attitudes De Dicto and De
Se. In: The Philosophical Review 88, 513543.
Lewis, D. K. (1980a) Index, Context, and Content.
890 XII. Bibliographischer Anhang und Register
dule of Natural Language Semantics. In: J. Groe-
nendijk/M. Stokhof (eds.) Studies in Discourse Re-
presentation and the Theory of Generalized Quan-
tifiers (= GRASS Series No. 8). Dordrecht: Foris,
5385.
Lbner, S. (1987b) Natural Language and Gene-
ralized Quantifier Theory. In: P. Grdenfors (ed.)
Generalized Quantifiers. Linguistic and Logical Ap-
proaches. Dordrecht: Reidel, 181201.
Lbner, S. (1987c) The Conceptual Nature of Na-
tural Language Quantification. In. I. Ruzsa/A. Sza-
bolcsi (eds.) Proceedings of the 87 Debrecen Sym-
posium on Logic and Language. Budapest: Akad-
miai Kiad, 8194.
Lbner, S. (1988) Anstze zu einer integralen se-
mantischen Theorie von Tempus, Aspekt und Ak-
tionsarten. In: V. Ehrich/H. Vater (eds.) Temporal-
semantik. Beitrge zur Linguistik der Zeitreferenz.
Tbingen: Niemeyer, 163191.
Lbner, S. (1989) German schon-erst-noch: An
integrated analysis. In: Linguistic and Philosophy
12, 167212.
Lbner, S. (1990) Wahr neben Falsch. Duale Ope-
ratoren als die Quantoren natrlicher Sprache. T-
bingen: Niemeyer.
Lo Cascio, V./Vet, C. (eds.) (1986) Temporal Struc-
ture in Sentence and Discourse (= GRASS Series
No. 5). Dordrecht: Foris.
Lnning, J. T. (1982) Kvantiteter og Kvantorer. Dis-
sertation, Mathematisches Institut Oslo.
Lnning, J. T. (1986) Collective Readings of Defi-
nite and Indefinite Noun Phrases. In: P. Grdenfors
(ed.) Generalized Quantifiers: Linguistic and Logical
Approaches. Dordrecht: Reidel.
Lnning, J. T. (1987) Mass Terms and Quantifi-
cation. In: Linguistics and Philosophy 10, 152.
Lnning, J. T. (1989) Some Aspects of the Logic of
Plural Noun Phrases. COSMOS-Report No. 11.
Dept. of Mathematics, University of Oslo.
Lounsbury, F. G. (1956) A Semantic Analysis of
the Pawnee Kinship System. In: Language 32,
158194.
Ludlow, P./Neale, S. (1987) Indefinite Descriptions:
In Defense of Russell. Ms., State Univ. of New
York at Stonybrook.
Lukasiewicz, J. (1930) Philosophische Bemerkun-
gen zu mehrwertigen Systemen des Aussagenkal-
kls. In: Competes rendues des sances de la Socit
des Sciences et des Lettres de Varsovie, Classe III,
23, 5177.
Lundy, R. (1980) English Elliptical Sentences and
Coordinate Structures. In: Studies in Language 4,
87104.
Luschei, E. C. (1962) The Logical Systems of Ls-
niewski. Amsterdam: North Holland.
Lutzeier, P. (1981) Words and Worlds. In: H. J.
Eikmeyer/H. Rieser (eds.) Words, Worlds, and Con-
texts. Berlin: de Gruyter, 75106.
Link, G. (1983a) The Logical Analysis of Plurals
and Mass Terms: A Lattice-Theoretical Approach.
In: R. Buerle et al. (eds.) Meaning, Use and the
Interpretation of Language. Berlin/New York: de
Gruyter, 303323.
Link, G. (1983b) Logical Semantics for Natural
Language. In: Erkenntnis 19, 261283.
Link, G. (1984) Hydras. On the Logic of Relative
Clause Constructions with Multiple Heads. In: F.
Landman/F. Veltman (eds.) Varieties of Formal Se-
mantics. Dordrecht: Foris, 245257.
Link, G. (1986) Prespie in Pragmatic Wonderland
or: The Projection Problem for Presuppositions
Revisited. In: J. Groenendijk/D. de Jongh/M. Stok-
hof (eds.) Foundations of Pragmatics and Lexical
Semantics (= GRASS Series No. 7). Dordrecht:
Foris, 101126.
Link, G. (1987b) Algebraic Semantics of Event
Structures. In: J. Groenendijk/M. Stokfof/F. Velt-
man (eds.) Proceedings of the Sixth Amsterdam
Colloquium. ITLI, University of Amsterdam,
243262.
Link, G. (1987c) Je drei pfel Three Apples
Each. Quantification and the German je. Unpu-
blished Ms, Universitt Mnchen.
Link, G. (1987d) Generalized Quantifiers and Plu-
rals. In: P. Grdenfors (ed.) Generalized Quantifiers:
Linguistic and Logical Approaches. Dordrecht: Rei-
del, 151180.
Link, G. (1991a) Quantity and Number. In: D.
Zaefferer (ed.) Semantic Universals and Universal
Semantics (= GRASS Series No. 12). Dordrecht:
Foris. (to appear)
Link, G. (1991b) First Order Axioms for the Logic
of Plurality. In: J. Allgayer (ed.) Processing Plurals
and Quantification (= CSLI Lecture Notes). Stan-
ford. (to appear)
Linsky, L. (1977) Names and Descriptions. Chicago:
University of Chicago Press.
Lbel, E. (1986) Nomina in der Quantifizierung.
Apposition und Komposition. Tbingen: Niemeyer.
Lbner, S. (1976) Einfhrung in die Montague-
Grammatik (= Monographien Linguistik und
Kommunikationswissenschaft 27). Kronberg/Ts.:
Scriptor.
Lbner, S. (1979) Intensionale Verben und Funktio-
nalbegriffe (= Ergebnisse und Methoden moderner
Sprachwissenschaft 7). Tbingen: Narr.
Lbner, S. (1985a) Definites. In: Journal of Seman-
tics 4, 279326.
Lbner, S. (1985b) Drei ist drei. In: W. Krschner/
R. Vogt (eds.) Grammatik, Semantik, Textlinguistik.
Tbingen: Niemeyer, 311318.
Lbner, S. (1985c) Natrlichsprachige Quantoren:
Zur Verallgemeinerung des Begriffs der Quantifi-
kation. In: Studium Linguistik 17/18, 79113.
Lbner, S. (1986) Quantification as a Major Mo-
42. BibliographieBibliography 891
Marantz, A. (1982) On the Acquisition of Gram-
matical Relations. In: Linguistische Berichte 80,
3269.
Marchand, H. (1960) The Categories and Types of
Present-Day English Word-Formation. A Synchro-
nie-Diachronic Approach. Wiesbaden: Harrasso-
witz.
Marcus, R. (1971) Essential Attribution. In: Jour-
nal of Philosophy 68, 187202.
Martin, J. R. (1983) Conjunction: The Logic of
English Text. In: J. S. Petfi/E. Szer (eds.) Micro
and Macro Connexity of Texts (= Papiere zur Text-
linguistik 45). Hamburg: Buske, 172.
Martin, R. (1973) Le mot puisque: notions dad-
verbe de phrase et de prsupposition smantique.
In: Studia Neophilologica 45, 104114.
Martin, S. E. (1975) A Reference Grammar of Ja-
panese. New Haven: Yale University Press.
Massey, G. J. (1976) Tom, Dick, and Harry, and
all the Kings Men. In: American Philosophical
Quarterly 13, 89107.
Matthews, P. H. (1981) Syntax. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
May, R. C. (1977) The Grammar of Quantification.
Ph.D Dissertation, MIT.
May, R. C. (1985) Logical Form: Its Structure and
Derivation. Cambridge, Mass.: MIT Press.
May, R. C. (1989) Interpreting Logical Form. In:
Linguistics and Philosophy 12, 387435.
Mayer, R. (1981) Ontologische Aspekte der Nomi-
nalsemantik. Tbingen: Narr.
Mazzoleni, M. (1988) Construtti concessivi e con-
strutti avversativi in alcune linque dEuropa. Ph. D.
Dissertation, Universit di Pavia.
McCarthy, T. (1981) The Idea of a Logical Con-
stant. In: The Journal of Philosophy 78, 499523.
McCawley, J. D. (1968) Lexical Insertion in a
Grammar Without Deep Structure. In: Papers from
the 4th Regional Meeting of the Chicago Linguistic
Society. Chicago, 7180. Reprinted in Mc-
Cawley (1973), 155166.
McCawley, J. D. (1970) English as a VSO Lang-
uage. In: Language 46, 286299. Reprinted in
McCawley (1973), 211228.
McCawley, J. D. (1971 a) Prelexical Syntax. In:
OBrian (ed.) Reports of the 22nd Roundtable Mee-
ting on Linguistics and Language Studies. Washing-
ton: Georgetown University, 1933. Reprinted
in McCawley (1973), 343356.
McCawley, J. D. (1971b) Where Do Noun Phrases
Come From? In: D. Steinberg/L. A. Jakobovits
(eds.) Semantics. An Interdisciplinary Reader in Phi-
losophy, Linguistics and Psychology. Cambridge:
Cambridge University Press, 217231.
McCawley, J. D. (1973) Grammar and Meaning:
Papers on Syntactic and Semantic Topics. Tokyo:
Taishukan. Reprinted (1976): New York: Aca-
demic Press.
Lutzeier, P. R. (1981) Wort und Feld. Wortseman-
tische Fragestellungen mit besonderer Bercksichti-
gung des Wortfeldbegriffs. Tbingen: Niemeyer.
Lycan, W./Shapiro, S. (1986) Actuality and Es-
sence. In: Studies in Essentialism (= Midwest Stu-
dies in Philosophy 11), 343378.
Lyons, J. (1965) Review of Katz & Postal. In:
Journal of Linguistics 1, 119126.
Lyons, J. (1967) A Note on Possessive, Existential
and Locative Sentences. In: Foundations of Lang-
uage 3, 390396.
Lyons, J. (1971) Chomsky. London: Fontana &
Collins/New York: Viking. German edition
(1971) Noam Chomsky. Mnchen: Deutscher Ta-
schenbuch Verlag.
Lyons, J. (1977) Semantics (Vols. 12). Cam-
bridge: Cambridge University Press. German
edition: (1980) Semantik Band 1; (1983a) Semantik
Band 2. Mnchen: Beck.
Lyons, J. (1977a) Deixis and Anaphora. In: T.
Myers (ed.) The Development of Conversation and
Discourse. Edinburgh: Edinburgh University Press,
88106.
Lyons, J. (1981a) Language, Meaning and Context.
London: Fontana & Collins.
Lyons, J. (1981 b) Language and Linguistics: An
Introduction. Cambridge: Cambridge University
Press. German edition (1983b) Die Sprache.
Mnchen: Beck.
Lyons, J. (1982) Deixis and Subjectivity: Loquor,
ergo sum? In: R. J. Jarvella/W. Klein (eds.) Speech,
Place and Action. New York: Wiley, 101124.
Lyons, J. (1984) La subjectivit dans le langage et
dans les langues. In: G. Serbat (ed.) E Benveniste
Aujourdhui, tome 1. Paris: Socit pour lInfor-
mation Grammaticale/Louvain: Edition Peeters.
Lyons, J. (1988) Principles of Linguistic Semantics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Mackie, J. L. (1973) Truth, Probability and Para-
dox. Oxford: Clarendon Press.
MacLaran, R. (1982) The Semantics and Pragma-
tics of the English Demonstrative. Ann Arbor: Uni-
versity Microfilms.
Maienborn, C. (1990) Position und Bewegung. Zur
Semantik lokaler Verben. IBM: IWBS Report 138.
Malinowski, B. (1923) The Problem of Meaning in
Primitive Languages. Supplement I in: C. K. Od-
gen/I. A. Richards (eds.) The Meaning of Meaning.
London: Routledge and Kegan Paul.
Malotki, E. (1983) Hopi Time. Berlin: Mouton.
Manor, R. (1982) Answers and Other Reactions.
In: Theoretical Linguistics 9, 6994.
Manzini, M.-R. (1980) On Control. Ms., MIT.
Manzotti, E./Pusch, L. F. /Schwarze, Ch. (1975)
Sorten von Prdikaten und Wohlgeformtheitsbe-
dingungen fr eine Semantiksprache. In: Zeitschrift
fr Germanistische Linguistik 3, 1539.
892 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Milner, J. (1973) Comparatives et Relatives. In:
Arguments Linguistiques. Paris: Marne, Chapter I.
Milner, J. (1978) Cyclicit successive, comparatives,
et cross-over en franais (premire partie). In: Lin-
guistic Inquiry 9, 673693.
Milsark, G. (1974) Existential Sentences in English.
Ph. D. Dissertation, MIT.
Milsark, G. (1977) Toward an Explanation of Cer-
tain Peculiarities of the Existential Construction in
English. In: Linguistic Analysis 3, 129.
Mittwoch, A. (1971) Idioms and Unspecified NP
Deletion. In: Linguistic Inquiry 2, 255259.
Mittwoch, A. (1977) How to Refer to Ones Own
Words: Speech Act Modifying Adverbials and Per-
formative Analysis. In: Journal of Linguistics 13,
177189.
Moeschler, J./de Spengler, N. (1981) Quand mme:
de la concession la rfutation. In: Cahiers de
Linguistique Franaise 2, 93111.
Mondadori, F. (1978) Interpreting Modal Seman-
tics. In: F. Guenthner/Ch. Rohrer (eds.) Studies in
Formal Semantics. New York: North-Holland,
1340.
Montague, R. (1968) Pragmatics. In: R. Klibansky
(ed.) Contemporary Philosophy: A Survey. Volume
I. Logic and the Foundations of Mathematics. Flo-
rence: La Nuova Italia Editrice, 102122. Re-
printed in: Montague (1974), 95118.
Montague, R. (1969) On the Nature of Certain
Philosophical Entities. In: The Monist 53,
159194. Reprinted in: Montague (1974),
149187.
Montague, R. (1970a) English as a Formal Lang-
uage [= EFL]. In: B. Visentini et al. (eds.) Linguaggi
nella Societa e nella Tecnica. Milan, 189223.
Reprinted in: Montague (1974), 188221.
Montague, R. (1970b) Universal Grammar
[= UG]. In: Theoria 36, 373398. Reprinted in:
Montague (1974), 222246.
Montague, R. (1973) The Proper Treatment of
Quantification in Ordinary English [= PTQ]. In: J.
Hintikka et al. (eds.) Approaches to Natural Lang-
uage. Proceedings of the 1970 Stanford Workshop
on Grammar and Semantics. Dordrecht: Reidel,
221242. Reprinted in: Montague (1974),
247270.
Montague, R. (1973a) Reply to Moravcsik. In: J.
Hintikka et al. (eds.) Approaches to Natural Lang-
uage. Dordrecht: Reidel, 289294. Reprinted
in: F. J. Pelletier (ed.) (1979) Mass Terms: Some
Philosophical Problems. Dordrecht: Reidel,
173178.
Montague, R. (1974) Formal Philosophy. Selected
Papers of Richard Montague. Edited and with an
introduction by R. H. Thomason. New Haven/
London: Yale University Press.
Moody, E. A. (1953) Truth and Consequence in
Medieval Logic. Amsterdam: North-Holland.
McCawley, J. D. (1973a) Quantitative and Quali-
tative Comparison in English. In: McCawley
(1973), 114.
McCawley, J. D. (1978) Conversational Implica-
ture and the Lexicon. In: P. Cole (ed.) Pragmatics
(= Syntax and Semantics Vol. 9), 245259.
McCawley, J. D. (1979) Two Notes on Compara-
tives. In: McCawley: Adverbs, Vowels and Other
Objects of Wonder. Chicago, Illinois: University of
Chicago Press, 7175.
McCawley, J. D. (1981) Everything that Linguists
Have Always Wanted to Know about Logic* *But
Were Ashamed to Ask. Oxford: Basil Blackwell/
Chicago: University of Chicago Press.
McCoard, R. W. (1978) The English Perfect: Tense-
Choice and Pragmatic Inferences. Amsterdam:
North Holland.
McConnell Ginet, S. (1973) Comparative Construc-
tions in English. Ph. D. Dissertation, University of
Rochester.
McGarry, D. D. (ed. and transl.) (1955) The Me-
talogicon of John of Salisbury. Berkeley, CA: Uni-
versity of California Press.
McGloin, N. H. (1976) Negation. In: M. Shibatani
(ed.) Japanese Generative Grammar (= Syntax and
Semantics Vol. 5). New York: Academic Press,
371419.
McKay, T./Stern, C. (1979) Natural Kind Terms
and Standards of Membership. In: Linguistics and
Philosophy 3, 2734.
McKeon, R. (1941) The Basic Works of Aristotle.
New York: Random House.
McNeill, N. B. (1972) Colour and Colour Termi-
nology. In: Journal of Linguistics 7, 2133.
Meggle, G. (ed.) (1979) Handlungstheoretische Se-
mantik. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Meggle, G. (1981) Grundbegriffe der Kommunika-
tion. Berlin: de Gruyter.
Meinong, A. (1971) ber Gegenstandstheorie. In:
R. Haller (ed.) Alexius Meinong. Gesamtausgabe,
Bd. II. Graz: Akademische Druck- und Verlags-
anstalt, 481535.
Mellor, D. (1977) Natural Kinds. In: British Journal
for the Philosophy of Science 1977, 299312.
Menzel, P. (1975) Semantics and Syntax in Com-
plementation. The Hague/Paris: Mouton.
Mey, J. (1976) Comparatives in Eskimo. In: E. P.
Hamp (ed.) Papers on Eskimo and Aleut Linguistics.
Chicago: Chicago Linguistic Society, 159178.s
Michael, I. (1970) English Grammatical Categories
and the Tradition behind them. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Mill, J. St. (1843) A System of Logic, Ratioinactive
and Inductive. Reprinted (1961) London: John
W. Parker.
Miller, G. A./Johnson-Laird, Ph. N. (1976) Lang-
uage and Perception. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
42. BibliographieBibliography 893
Muskens, R. (1986) A Relational Formulation of
the Theory of Types. ITLI Prepublication Series
8604, University of Amsterdam.
Naess, A. (1975) Kommunikation und Argumenta-
tion. Eine Einfhrung in die angewandte Semantik.
Translated by A. von Stechow. Kronberg/Ts.:
Scriptor. German edition of: En del elementaere
logiske emner. (11th ed. 1975) Oslo: Universitets-
forlaget.
Napoli, D. J. (1983a) Comparative Ellipsis: A
Phrase Structure Analysis. In: Linguistic Inquiry
14, 675694.
Napoli, D. J. (1983b) Missing Complement Sen-
tences in English: A Base Analysis of Null Com-
plement Anaphora. In: Linguistic Analysis 12,
128.
Napoli, D. J./Nespor, M. (1976) Negatives in Com-
paratives. In: Language 52, 811838.
Neale, S. (1988) Events and Logical Form. In:
Linguistics and Philosophy 11, 303321.
Nedjalkov, V. P. (1976) Kausativkonstruktionen (=
Studien zur deutschen Grammatik 4). Tbingen:
Narr.
Nerbonne, J. (1985) German Temporal Semantics:
Three-dimensional Tense Logic and a GPSG Frag-
ment. Ann Arbor, Michigan: University Micro-
films.
Nerbonne, J. (1986) Reference Time and Time in
Narration. In: Linguistics and Philosophy 9, 8395.
Newmeyer, F. J. (1979) Linguistic Theory in Ame-
rica. The First Quarter-Century of Transformational
Generative Grammar. New York: Academic Press.
Newmeyer, F. J. (1983) Grammatical Theory. Its
Limits and Possibilities. Chicago: The University
Press.
Noreen, A. (1903) Vart Sprk. Lund. German
edition (1923): Einfhrung in die wissenschaftliche
Betrachtung der Sprache. Halle: Niemeyer.
Norton, B. (1982) De Re Modality, Generic Es-
sence, and Science. In: Philosophica 29/30,
167187.
Nuchelmans, G. (1973) Theories of the Proposition.
Ancient and Medieval Conceptions of the Bearers of
Truth and Falsity. Amsterdam: North Holland.
Oetke, C. (1981) Paraphrasebeziehungen zwischen
disjunktiven und konjunktiven Stzen. Tbingen:
Niemeyer.
Ogden, C. H./Richards, I. A. (1923) The Meaning
of Meaning. London: Routledge & Kegan Paul.
Oh, Ch.-K./Dinneen, D. A. (eds.) (1979) Presup-
position (= Syntax and Semantics Vol. 11) New
York: Academic Press.
Oh, Y.-O. (1985) Wortsyntax und Semantik der No-
minalisierung im Gegenwartsdeutsch. Ph. D. Disser-
tation, Universitt Konstanz.
Oh, Y.-O. (1988) Erzeugung und semantische In-
terpretationen der Nominalisierungen im Gegen-
wartsdeutsch. In: Linguistische Berichte 114,
163174.
Moody, E. A. (1975) The Medieval Contribution
to Logic. In: Studies in Medieval Philosophy,
Science, and Logic. Berkeley: University of Cali-
fornia Press,
Moortgat, W. (1985) Functional Composition and
Complement Inheritance. In: G. Hoppenbrouwers/
P. Seuren/J. Weijters (eds.) Meaning and the Lexi-
con. Dordrecht: Foris, 3948.
Moravcsik, E. (1978) On the Case Marking of
Objects. In: J. Greenberg (ed.) Universals of Human
Language, Vol. 4: Syntax. Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 249290.
Moravcsik, J. M. E. (1973) Mass Terms in English.
In: K. J. J. Hintikka et al. (eds.) Approaches to
Natural Language. Dordrecht: Reidel, 263285.
Morel, M. A. (1980) Etude sur les movens gram-
maticaux et lexicaux propre exprimer une conces-
sion en franais contemporain. Thse DEtat indite.
Universit de Paris III.
Morgan, Ch. G./Pelletier, F. J. (1977) Some Notes
Concerning Fuzzy Logics. In: Linguistics and Phi-
losophy 1, 7997.
Morgan, J. L. (1969a) On Arguing about Seman-
tics. In: Papers in Linguistics 1, 4970.
Morgan, J. L. (1969b) On the Treatment of Pre-
supposition in Transformational Grammar. In: Pa-
pers from the 5th Regional Meeting of the Chicago
Linguistic Society. Chicago, 167177.
Morgan, J. L. (1977) Conversational Postulates
Revisited. In: Language 53, 277284.
Morreall, J. (1979) The Evidential Use of Because.
In: Papers in Linguistics 12, 231238.
Morris, Ch. W. (1938) Foundation of the Theory
of Signs. In: O. Neurath/R. Carnap/C. Morris
(eds.) International Encyclopaedia of Unified
Science 1, No 2. Chicago: University of Chicago
Press, 159.
Morris, Ch. W. (1946) Signs, Language and Beha-
viour. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
Mostowski, A. (1957) On a Generalization of
Quantifiers. In: Fundamenta Mathematicae 44,
1236.
Motsch, W. (1969) Zur Stellung der Wortbildung
in einem formalen Sprachmodell. In: Studia Gram-
matica 1, 3150.
Motsch, W. (1970) Analyse von Komposita mit
zwei nominalen Elementen. In: M. Bierwisch/K. E.
Heidolph (eds.) Progress in Linguistics. The Hague/
Paris: Mouton ,208223.
Motsch, W. (1979) Einstellungskonfigurationen
und sprachliche uerungen. Aspekte des Zusam-
menhangs zwischen Grammatik und Kommuni-
kation. In: I. Rosengren (ed.) Sprache und Prag-
matik. Lunder Symposium 1978. Lund: C. W. K.
Gleerup, 169187.
Munitz, M. K./Unger, P. K. (eds) (1974) Semantics
and Philosophy. New York: New York University
Press.
Munn, A. (1987) Coordinate Structures, X-bar
Theory, and Parasitic Gaps. Ms. Montreal.
894 XII. Bibliographischer Anhang und Register
of Texas Press, 51101.
Partee, B. H. (1978b) Bound Variables and Other
Anaphors. In: R. Waltz (ed.) Theoretical Issues in
Natural Language Processing TINLAP-2. New
York: Association for Computing Machinery,
7985.
Partee, B. H. (1979a) Montague Grammar and the
Well-Formedness Constraint. In: F. Heny/H.
Schnelle (eds.) Selections from the Third Groningen
Round Table (= Syntax and Semantics Vol. 10).
New York: Academic Press, 275313.
Partee, B. H. (1979b) Semantics Mathematics
or Psychology? In: R. Buerle/V. Egli/A. von Ste-
chow (eds.) Semantics from Different Points of
View. Berlin: Springer Verlag, 114.
Partee, B. H. (1982) Belief Sentences and the Limits
of Semantics. In: S. Peters/E. Saarinen (eds.) Pro-
cesses, Beliefs and Questions. Dordrecht: Reidel,
87106.
Partee, B. H. (1984a) Compositionality. In: F.
Landman/F. Veltman (eds.) Varieties of Formal Se-
mantics. Proceedings of the Fourth Amsterdam Col-
loquium (= GRASS Series No. 3). Dordrecht: Fo-
ris, 281311.
Partee, B. H. (1984b) Nominal and Temporal Ana-
phora. In: Linguistics and Philosophy 7, 243286.
Partee, B. H. (1987a) Noun Phrase Interpretation
and Type Shifting Principles. In: J. Groenendijk/
D. de Jongh/M. Stokhof (eds.) Studies in Discourse
Representation Theory and the Theory of Genera-
lized Quantifiers (= GRASS Series No. 8). Dor-
drecht: Foris, 115143.
Partee, B. H. (1987b) Binding without Variables in
Quantified Contexts. Sixth Amsterdam Collo-
quium. Handout. (See Partee 1989)
Partee, B. H. (1988) Many Quantifiers. In: Procee-
dings of ESCOL.
Partee, B. H. (1989) Binding Implicit Variables in
Quantified Contexts. In: Papers from the 25th Re-
gional Meeting of the Chicago Linguistic Society.
Part I: The general session. Chicago, 342365.
Partee, B. H./ter Meulen, A./Wall, R. E. (1990)
Mathematical Methods in Linguistics. Dordrecht:
Kluwer Academic Publishers.
Partee, B./Rooth, M. (1983) Generalized Conjunc-
tion and Type Ambiguity. In: R. Buerle et al. (eds.)
Meaning, Use, and Interpretation of Language. Ber-
lin: de Gruyter, 361383.
Pasch, R. (1982) Untersuchungen zu den Ge-
brauchsbedingungen der deutschen Kausalkon-
junktionen da, denn und weil. In: Linguistische Stu-
dien A 104, 41243.
Patzig, G. (ed.) (1969) Gottlob Frege: Funktion,
Begriff, Bedeutung. Fnf logische Studien. Gttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Paul, H. (1880) Prinzipien der Sprachgeschichte. (8.
Aufl. 1970) Tbingen: Niemeyer.
Pause, P. E. (1986) Anaphor Resolution: Focus As-
signment vs. Accumulating Evidence. Arbeitspapier
des SFB 99, Universitt Konstanz.
Ojeda, A. E. (1990) Linguistic Individuals. Ph. D.
Dissertation, University of California at Davis.
Olsen, S. (1989) Zur Stellung der Wortbildung in
der Grammatik. Drei Theorien der Affigierung. In:
Papiere zur Linguistik 40 (1), 323.
Osgood, Ch. E. (1971) Where do Sentences Come
From? In: D. D. Steinberg/L. A. Jakobovits (eds.)
An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Lingui-
stics, and Psychology. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 497529.
Ostler, N. (1980) Origins, Orientations and End-
points: Evidence for a Finer Analysis of Thematic
Relations. In: Studies in English Linguistics 8,
1022.
Palmer, F. R. (1986) Mood and Modality. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Parret, H. (1982) Demonstratives and the I-Sayer.
In: J. van der Auwera (ed.) The Semantics of De-
terminers. London: Croom Helm, 96111.
Parsons, T. (1970) An Analysis of Mass and
Amount Terms. In: Foundations of Language 6,
362385. Reprinted in: F. J. Pelletier (ed.)
(1979) Mass Terms: Some Philosophical Problems.
Dordrecht: Reidel, 137166.
Parsons, T. (1972) Some Problems Concerning the
Logic of Grammatical Modifiers. In: D. Davidson/
G. Harman (eds.) The Semantics of Natural Lang-
uage. Dordrecht/Boston: Reidel, 127141.
Parsons, T. (1979) Type Theory and Ordinary
Language. In: S. Davis/M. Mithun (eds.) Lingui-
stics, Philosophy and Montague Grammar. Austin,
Texas: University of Texas Press, 127152.
Parsons, T. (1980a) Nonexistent Objects. New Ha-
ven: Yale University Press.
Parsons, T. (1980b) Modifiers and Quantifiers in
Natural Language. In: Canadian Journal of Philo-
sophy. Suppl. Vol. 6, 2960.
Parsons, T. (1988) Events in the Semantics of Eng-
lish. Ms., University of California, Irvine.
Partee, B. H. (1970) Opacity, Coreference, and Pro-
nouns. In: Synthese 21, 359385. Reprinted in:
D. Davidson/G. Harman (eds.) (1972) Semantics
of Natural Natural Language. Dordrecht: Reidel,
415441.
Partee, B. H. (1973a) Some Structural Analogies
between Tenses and Pronouns in English. In: The
Journal of Philosophy 70, 601609.
Partee, B. H. (1973b) Some Transformational Ex-
tensions of Montague Grammar. In: Journal of
Philosophical Logic 2, 509534.
Partee, B. H. (1973c) The Semantics of Belief-
Sentences. In: J. Hintikka/J. Moravcsik/P. Suppes
(eds.) Approaches to Natural Language. Dordrecht:
Reidel, 309336.
Partee, B. H. (ed.) (1976) Montague Grammar. New
York: Academic Press.
Partee, B. H. (1978a) Constraining Transformatio-
nal Montague Grammar a Framework and a Frag-
ment. In: Davis/Mithun (eds.) Linguistics, Philo-
sophy and Montague Grammar. Austin: University
42. BibliographieBibliography 895
Philosophical Review 86, 474497.
Perry, J. (1980) A Problem about Continued Belief.
In: Pacific Philosophical Quarterly 61, 317332.
Perry, J. (1986) From Worlds to Situations. In:
Journal of Philosophical Logic 15, 83107.
Pesetzky, D. (1985) Morphology and Logical
Form. In: Linguistic Inquiry 16, 193246.
Peters, St. (1979) A Truth-Conditional Formula-
tion of Karttunens Account of Presupposition. In:
Synthese 40, 301316.
Peterson, P. L. (1979) On Representing Event Re-
ference. In: C. K. Oh/D. A. Dinneen (eds.) Presup-
position (= Syntax and Semantics Vol. 11). New
York: Academic Press, 325355.
Peterson, P. L./Wali, K. (1985) Event. In: Linguistic
Analysis 15, 318.
Pilch, H. (1965) Comparative Constructions in
English. In: Language 41, 3758.
Pinborg, J. (1975) Classical Antiquity: Greece. In:
H. Aarsleft (ed.) Historiography of Linguistics 12
(= Current Trends in Linguistics Vol. 13). The
Hague/Paris: Mouton, 69126.
Pinborg, J. (1976) Some Problems of Semantic Re-
presentations in Medieval Logic. In: H. Parrett
(ed.) History of Linguistic Thought and Contempo-
rary Linguistics. Berlin/New York: de Gruyter,
254278.
Pinkal, M. (1977) Kontext und Bedeutung: Ein pro-
babilistisch erweiterter pragmatischer Beschrei-
bungsansatz. Tbingen: Narr.
Pinkal, M. (1979) How to Refer with Vague Des-
criptions. In: R. Buerle/U. Egli/A. von Stechow
(eds.) Semantics from Different Points of View. Ber-
lin/Heidelberg: Springer, 3250.
Pinkal, M. (1980/81) Semantische Vagheit: Ph-
nomene und Theorien. In: Linguistische Berichte
70, 126.
Pinkal, M. (1983) Towards a Semantics of Preci-
zation. In: Th. T Ballmer/M. Pinkal (eds.) Approa-
ching Vagueness. Amsterdam: North Holland,
1357.
Pinkal, M. (1984) Consistency and Context
Change: the Sorites Paradox. In: F. Landman/F.
Veltman (eds.) Varieties of Formal Semantics. Pro-
ceedings of the Fourth Amsterdam Colloquium (=
GRASS Series No. 3). Dordrecht: Foris, 325341.
Pinkal, M. (1985) Kontextabhngigkeit, Vagheit,
Mehrdeutigkeit. In: Ch. Schwarze/D. Wunderlich
(eds.) Handbuch der Lexikologie. Frankfurt: Athe-
num, 2763.
Pinkal, M. (1985) Logik und Lexikon: Die Semantik
des Unbestimmten. Berlin: de Gruyter.
Pinkal, M. (1986) Definite Noun Phrases and the
Semantics of Discourse. In: Proceedings of Coling
86, Bonn, 368373.
Pinkal, M. (1990) Imprecise Concepts and Quan-
tification. In: R. Bartsch/J. van Benthem/P. van
Emde Boas (eds.) Language in Action. Dordrecht:
Foris, 221265.
Pause, P. E. (1988a) Pronomina, Textinterpretation
und bersetzung. In: A. von Stechow/Th. Schep-
ping (eds.) Fortschritte in der Semantik. Weinheim:
VCH Verlagsgesellschaft, 113137.
Pause, P. E. (1988b) Funktionale Satzperspektive
und die Intonationsstruktur des Satzes im Textver-
stehensmodell. In: A. Potz/M. Heintzeler/St. W.
Hotop/P. E. Pause (eds.) pltzlich startet eine du-
cati: Ein Textverstehensmodell von Con
3
Tra. Ar-
beitspapier Nr. 2 der Fachgruppe Sprachwissen-
schaft. Universitt Konstanz, 5782.
Pause, P. E. (1990) Ambiguity and Salience: On the
Contribution of Sentence Structure to Text Inter-
pretation. In: M. Grabski/J. Haller (eds.) Semantics
of Translation between Natural Languages.(to ap-
pear)
Payne, J. R. (1985) Negation. In: T. Shopen (ed.)
Language Typology and Syntactic Description, Vol.
I. Cambridge: Cambridge University Press.
Peacocke, C. (1976) What is a Logical Constant?
In: The Journal of Philosophy 73, 221240.
Peirce, C. S. (1902) Vague. In: J. M. Baldwin (ed.)
Dictionary of Philosophy and Psychology. 248. Lon-
don/New York: Cambridge University Press.
Peirce, C. S. (1933) The Simplest Mathematics. In
C. Hartshorne & P. Weiss: Collected Papers of
Charles Sanders Peirce. Cambridge, Mass.: Har-
vard University Press. Reprinted 1960.
Pelletier, F. J. (1974) On Some Proposals for the
Semantics of Mass Terms. In: Journal of Philoso-
phical Logic 3, 87108.
Pelletier, F. J. (1977) Or. In: Theoretical Linguistics
4, 6174.
Pelletier, F. J. (ed.) (1979) Mass Terms: Some Phi-
losophical Problems. Dordrecht: Reidel.
Pelletier, F. J./Schubert, L. K. (1987a) Generically
Speaking. With Remarks on the Interpretation of
Pronouns and Tenses. In: Technical Report 3. Dpt.
of Computer Science, University of Alberta, Ed-
monton.
Pelletier, F. J./Schubert, L. K. (1987b) Problems in
the Representation of the Logical form of Generics,
Plurals, and Mass Terms. In: Technical Report 3.
Dpt. of Computer Science, University of Alberta,
Edmonton.
Pelletier, F. J./ Schubert, L. K. (1989) Mass Ex-
pressions. In: D. Gabbay/F. Guenthner (eds.)
Handbook of Philosophical Logic. Vol. 4, 327407.
Percival, W. K. (1975) The Grammatical Tradition
and the Rise of the Vernaculars. In: Historiography
of Linguistics 12 (= Current Trends in Lingui-
stics Vol. 13). The Hague/Paris: Mouton, 231276.
Perlmutter, D. M. (1971) Deep and Surface Struc-
ture Constraints in Syntax. New York: Holt, Ri-
nehart & Winston.
Perlmutter, D. M. (1978) Impersonal Passivs and
the Unaccusative Hypothesis. In: Proceedings of
the Berkeley Linguistics Society 4, 157189.
Perry, J. (1977) Frege on Demonstratives. In: The
896 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Pulman, S. G. (1983) Word Meaning and Beliefs.
London: Croom Helm.
Pusch, L. F. (1972) Die Substantivierung von Verben
mit Satzkomplementen im Englischen und im Deut-
schen. Frankfurt: Athenum.
Pusch, L. F. (1975) ber den Unterschied zwischen
aber und sondern oder die Kunst des Widerspre-
chens. In: J. Bartori et al. (1975) Syntaktische und
semantische Studien zur Koordination. Tbingen:
Narr, 4562.
Putnam, H. (1970) Is Semantics Possible? In:
H. Kiefer/M. Munitz (eds.) Languages, Belief and
Metaphysics. State University of New York Press.
Reprinted in: Putnam (1975), 139152.
Putnam, H. (1973) Meaning and Reference. In:
Journal of Philosophy 70, 699711.
Putnam, H. (1975) Mind, Language and Reality.
Philosophical Papers Vol. 2. Cambridge, Mass.:
MIT Press.
Putnam, H. (1975b) The Meaning of Meaning. In:
K. Gunderson (ed.) Language, Mind and Know-
ledge. Studies in the Philosophy of Science. Min-
neapolis, Minn.: University of Minnesota Press.
Reprinted in: Putnam (1975), 215271.
Putnam, H. (1982) Natural Kind Terms and Hu-
man Artifacts. In: Mind 91, 418419.
Ptz, H. (1989) ber die Syntax der Pronominal-
form es im modernen Deutsch. Tbingen: Narr.
Quine, W. van Orman (1948) On What There Is.
In: Review of Metaphysics. Reprinted in: Quine
(1953), 119.
Quine, W. van Orman (1951) Two Dogmas of Emp-
iricism. In: The Philosophical Review. Reprinted
in: Quine (1953/1961), 2046.
Quine, W. van Orman (1953) From a Logical Point
of View. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press. Revised edition (1961). New York: Harper
and Row.
Quine, W. van Orman (1953a) Reference and Mo-
dality. In: Quine (1953), 139159.
Quine, W. van Orman (1956) Quantifiers and Pro-
positional Attitudes. In: The Journal of Philosophy
53, 177187.
Quine, W. van Orman (1960) Word and Object.
Cambridge, Mass.: MIT Press.
Quine, W. van Orman (1962) Methods of Logic.
London: Routledge and Kegan Paul.
Quine, W. van Orman (1969) Grundzge der Logik.
Frankfurt: Suhrkamp (= stw 65).
Quirk, R. (1954) The Concessive Relation in OE
Poetry. New Haven: Yale University Press.
Quirk, R./Greenbaum, S./Leech, G./Svartvik, J.
(1972) A Grammar of Contemporary English. Lon-
don: Longman.
Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar
of the English Language. London: Longman.
Ramsey, F. P. (1965) The Foundations of Mathe-
matics. London: Routledge & Kegan Paul.
Pinkham, J. E. (1982) The Formation of Compa-
rative Clauses in French and English. Ph. D. Disser-
tation. Distributed by Indiana University Lingui-
stics Club (Bloomington).
Pinkham, J. E. (1983) A Phrase Structure Analysis
of Parallel Phrasal Comparatives in French. Paper
presented to the Southern California Conference
on Romance Linguistics. Los Angeles: UCLA.
Plank, F. (1979) Intensivierung, Reflexivierung,
Identifizierung, relationale Auszeichnung. Variatio-
nen zu einem semantisch-pragmatischen Thema.
In: I. Rosengren (ed.) Sprache und Pragmatik.
Malm: Gleerup, 330354.
Plann, S. (1982) On F. R. Higgins Analysis of
Comparative Ellipsis. In: Linguistic Analysis 9,
395403.
Plantinga, A. (1974) The Nature of Necessity. Ox-
ford: The Clarendon Press.
Plantinga, A. (1978) The Boethian Compromise.
In: American Philosophical Quarterly 15, 129138.
Platts, M. (1979) Ways of Meaning. London: Rout-
ledge & Kegan Paul.
Platzack, Ch. (1979) The Semantic Interpretation
of Aspect and Aktionsarten. Dordrecht: Reidel.
Pollard, C./Sag, I. (1987) Information-Based Syntax
and Semantics Vol. 1: Fundamentals. CSLI Lecture
Notes No. 13, Stanford.
Porterfield, L./Srivastav, V. (1988) (In)definiteness
in the Absence of Articles: Evidence from Hindi
and Indonesian. In: H. Borer (ed.) Proceedings of
the 7th West Coast Conference on Formal Lingui-
stics. Stanford Linguistics Association, 265276.
Porzig, W. (1934) Wesenhafte Bedeutungsbeziehun-
gen. In: Beitrge zur deutschen Sprache und Lite-
ratur 58, 7097.
Posch, G. (ed.) (1981) Kausalitt Neue Texte.
Stuttgart: Reclam.
Posner, R. (1972) Theorie des Kommentierens.
Frankfurt/Main: Athenum.
Posner, R. (1979) Bedeutung und Gebrauch der
Satzverknpfer in den natrlichen Sprachen. In: G.
Grewendorf (ed.) Sprechakttheorie und Semantik.
Frankfurt: Suhrkamp, 345385. English ver-
sion: (1980) Semantics and Pragmatics of Sentence
Connectives in Natural Language. In: J. R. Searle
et al. (eds.) Speech Act Theory and Pragmatics.
Dordrecht: Reidel, 169203.
Postal, P. M. (1974) On Certain Ambiguities. In:
Linguistic Inquiry 5, 367425.
Price, M. S. (1977) Identity Through Time. In:
Journal of Philosophy 74, 201217.
Prior, A. (1967) Past, Present and Future. London:
Oxford University Press.
Prior, A./Prior, M. (1955) Erotetic Logic. In: The
Philosophical Review 64, 4359.
Projektgruppe Verbvalenz (1981) Konzeption eines
Wrterbuchs deutscher Verben. (= Forschungsbe-
richte des Instituts fr deutsche Sprache 45). T-
bingen: Narr.
42. BibliographieBibliography 897
Ries, J. (1931) Was ist ein Satz? Prag.
Ristow, T. (1990) Fallanalyse durch. Ms., Univer-
sitt Dsseldorf.
Rivara, R. (1979) La Comparaison Quantitative en
Anglais Contemporain. Ph. D. Dissertation. Univer-
sit de Paris VII. Distributed by Librairie Honore
Champion, Paris.
Rivero, M. (1970) A Surface Structure Constraint
on Negation in Spanish. In: Language 46,
640666.
Rivero, M. (1981) Wh-movement in Comparatives
in Spanish. In: W. W. Cressey/D. J. Napoli (eds.)
Ninth Linguistic Symposium on Romance Langua-
ges. Washington: Georgetwon University Press.
Rivire, C. (1980) Tense, Aspect and Time Loca-
tion. In: Linguistics 18, 105135.
Roberts, C. (1987) Modal Subordination, Anaphora,
and Distributivity. Ph. D. Dissertation. University
of Massachusetts, Amherst.
Robins, R. H. (1971) General Linguistics. (2nd edi-
tion) London: Longman.
Rock, I. (1985) Wahrnehmung: Vom visuellen Reiz
zum Sehen und Erkennen. Heidelberg: Spektrum der
Wissenschaft Verlagsgesellschaft.
Roeper, P. (1983) Semantics for Mass Terms With
Quantifiers. In: Nous 17, 251267.
Roeper, T. (1987) Implicit Arguments and the
Head-Complement Relation. In: Linguistic Inquiry
18, 267310.
Rogers, A./Wall, R./Murphy, J. P. (eds.) (1977).
Proceedings of the Texas Conference on Performa-
tives, Presuppositions, and Implicatures. Arlington:
Center for Applied Linguistics.
Rohrer, C. (1967a) Die Wortzusammensetzung im
modernen Franzsischen. Ph. D. Dissertation, Uni-
versitt Tbingen.
Rohrer, C. (1967b) Review of Lees (1960). In: In-
dogermanische Forschungen 71, 161170.
Rohrer, C. (1977a) Zeitsysteme und ihre Anwen-
dung auf natrliche Sprachen. In: Zeitschrift fr
romanische Philologie 93, 3650.
Rohrer, C. (1977b) How to Define Temporal Con-
junctions. In: Linguistische Berichte 51, 111.
Rohrer, C. (ed.) (1977) On the Logical Analysis of
Tense and Aspect (= Tbinger Beitrge zur Lin-
guistik 80). Tbingen: Narr.
Rohrer, C. (ed.) (1978) Papers on Tense, Aspect and
Verb Classification (= Tbinger Beitrge zur Lin-
guistik 110). Tbingen: Narr.
Rohrer, C. (ed.) (1980) Time, Tense, and Quantifiers
(= Linguistische Arbeiten 83). Tbingen: Nie-
meyer.
Rohrer, C. (1986) Indirect Discourse and Conse-
cutio Temporum. In: V. L. Cascio/C. Vet (eds.)
Temporal Structure in Sentence and Discourse. Dor-
drecht: Reidel, 7998.
Rooth, M. (1985) Association with Focus. Ph. D.
Dissertation, University of Massachusetts, Am-
herst.
Rantala, V. (1975) Urn Models: A New Kind of
Non-standard Model for First-order Logic. In:
Journal of Philosophical Logic 4, 455474.
Rauh, G. (1983) Tenses as Deictic Categories. An
Analysis of German and English Tenses. In: G.
Rauh (ed.) Essays on Deixis (= Tbinger Beitrge
zur Linguistik 188). Tbingen: Narr.
Rauh, G. (1988) Tiefenkasus, thematische Relatio-
nen und Thetarollen. Die Entwicklung einer Theorie
von semantischen Relationen. Tbingen: Narr.
Rauh, G. (ed.) (1991) Approaches to Prepositions.
Tbingen: Narr.
Recanati, F. (1989) The Pragmatics of What is Said.
In: Mind & Language 4, 295329.
Reichenbach, H. (1947) Elements of Symbolic Lo-
gic. London: Collier-MacMillan. Reprinted
(1966) New York: The Free Press.
Reichgelt, H. (1985) Reference and Quantification
in the Cognitive View of Language. Ph. D. Disser-
tation, University of Edinburgh.
Reichman, R. (1985) Getting Computers to Talk
Like You and Me. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Reinhart, T. (1975) On Certain Ambiguities and
Uncertain Scope. In: R. E. Grossman/L. J. San/T.
J. Vance (eds.) Papers from the 11th Regional Mee-
ting of the Chicago Linguistic Society. Chicago,
451466.
Reinhart, T. (1976) The Syntactic Domain of Ana-
phora. Ph. D. Dissertation, MIT.
Reinhart, T. (1983) Anaphora and Semantic Inter-
pretation. London: Croom Helm.
Reinhart, T. (1986) On the Interpretation of Don-
key-Sentences. In: E. Traugott/A. ter Meulen/J. S.
Reilly/C. A. Ferguson (eds.) Conditionals. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 103122.
Reinhart, T. (1987) Specifier and Operator Binding.
In: E. Reuland/A. ter Meulen (eds.) The Represen-
tation of (In)definiteness. Cambridge: MIT Press,
130167.
Reis, M. (1977) Prsuppositionen und Syntax.
(= Linguistische Arbeiten 51). Tbingen: Niemeyer.
Reis, M. (1985) Against Hhles Compositional
Theory of Affixation. In: J. Toman (ed.) Studies in
German Grammar. Dordrecht: Reidel, 377406.
Renz, I. (1989) Koordination von nichtverbalen Satz-
konstituenten. IWBS-Report 74. Stuttgart: IBM
Deutschland GmbH.
Rescher, N. (1969) Many-Valued Logic. New York:
McGraw-Hill.
Rescher, N. (ed.) (1967) The Logic of Decision and
Action. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
Rescher, N./Urquhart, A. (1971) Temporal Logic.
Wien/New York: Springer.
Reuland, E./ter Meulen, A. (eds.) (1987) The Re-
presentation of (In)definiteness. Cambridge: MIT
Press.
Reyle, U. (1986) Zeit und Aspekt bei der Verarbei-
tung natrlicher Sprachen. Ph. D. Dissertation, Uni-
versitt Stuttgart.
898 XII. Bibliographischer Anhang und Register
meyer, 272282.
Rudolph, E. (1982b) Zur Problematik der Konnek-
tive des kausalen Bereichs. In: J. Fritsche (ed.)
Konnektivausdrcke Konnektiveinheiten (= Pa-
pers in Text Linguistics 30). Hamburg: Buske,
146244.
Rusiecki, J. (1985) Adjectives and Comparison in
English: A Semantic Study. London: Longman.
Russell, B. (1905) On Denoting. In: Mind 14,
479493.
Russell, B. (1910) Knowledge by Acquaintance and
Knowledge by Description. In: Proceedings of the
Aristotelian Society 11, 108128.
Russell, B. (1912) The Problems of Philosophy. Lon-
don: Oxford University Press.
Russell, B. (1919) Introduction to Mathematical
Philosophy. London: Allen & Unwin.
Russell, B. (1923) Vagueness. In: Australesian Jour-
nal of Psychology and Philosophy 1, 8492.
Russell, B. (1940) An Inquiry into Meaning and
Truth. New York: Norton.
Rutherford, W. (1970) Some Observations Concer-
ning Subordinate Clauses in English. In: Language
46, 97115.
Ruttenberg, J. (1976) Some Difficulties with Cress-
wells Semantics and the Method of Shallow Struc-
ture. In: University of Massachusetts Occasional
Papers in Linguistics, Vol. II.
Ryle, G. (1950) If, So, and Because. In: M. Black
(ed.) Philosophical Analysis. Ithaca: Cornell Uni-
versity Press, 323340.
Sb, K. J. (1978) Tempus in einer Montague-Gram-
matik des Deutschen. Zur Darstellung einiger Vor-
kommen von Prsens, Pteritum und Futur. 1.
Staatsexamensarbeit, Universitt Oslo.
Sb, K. J. (1980) Infinite Perfect and Backward
Causation. In: Nordic Journal of Linguistics 3,
161173.
Scha, R. (1983) Logical Foundations for Question
Answering. Ph. D. Dissertation, Groningen.
Sacks, H./Schegloff, E./Jefferson, G. (1974) A Sim-
plest Systematics for the Organization of Turn-
taking for Conversation. In: Language 50,
696735.
Sadock, J. M. (1968) Hypersentences. Ph. D. Dis-
sertation, University of Illinois, Urbana.
Sadock, J. M. (1974) Towards a Linguistic Theory
of Speech Acts. New York: Academic Press.
Sadock, J. M. (1978) On Testing for Conversational
Implicature. In: Cole, P./Morgan, J. L. (eds.)
Speech Acts (= Syntax and Semantics Vol.3). New
York: Academic Press, 281297.
Sadock, J. M./Zwicky, A. M. (1985) Speech Act
Distinction in Syntax. In: T. F. Shopen (ed.) Lang-
uage Typology and Syntactic Description. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 155196.
Safir, K. (1984) Multiple Variable Binding. In: Lin-
guistic Inquiry 15, no. 4.
Safir, K. (1985) Syntactic Chains. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Rooth, M. (1987) Noun Phrase Interpretation in
Montague Grammar. File Change Semantics and
Situation Semantics. In: P. Grdenfors (ed.) Gene-
ralized Quantifiers: Linguistic and Logical Approa-
ches. Dordrecht: Reidel, 237268.
Rooth, M./Partee, B. H. (1982) Conjunction, Type
Ambiguity, and Wide Scope of or. In: D. Flickin-
ger/M. Macken/N. Wiegand (eds.) Proceedings of
the 1st West Coast Conference on Formal Lingui-
stics. Stanford, 353362.
Rosch, E. H. (1973) Natural Categories. In: Cog-
nitive Psychology 4, 328350.
Rosch, E. H. (1974) Linguistic Relativity. In: E.
Silverstein (ed.) Human Communication. Hillsdale:
Erlbaum, 95121.
Rosch, E. H. (1975) Cognitive Reference Points.
In: Cognitive Psychology 7, 532547.
Rosch, E. H. (1976) Classification of Real World
Objects: Origins and Representations in Cognition.
In: P. N. Johnson-Laird/P. C. Watson (eds.) Thin-
king: Readings in Cognitive Science. Cambridge:
Cambridge University Press, 501519.
Rosch, E. H. (1978) Principles of Categorization.
In: E. Rosch/ B. B. Lloyd (eds.) Cognition and
Categorization. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum.
Rosch, E. H./Mervis, C. (1975) Family Resem-
blance: Studies in the Internal Structure of Cate-
gories. In: Cognitive Psychology 7, 573605.
Ross, J. R. (1967) Constraints on Variables in Syn-
tax. Ph. D. Dissertation, MIT. Distributed by In-
diana University Linguistics Club (Bloomington).
Ross, J. R. (1969a) Auxiliaries as Main Verbs. In:
W. Todd (ed.) Studies in Philosophical Linguistics.
Series 1. Evanston.
Ross, J. R. (1969b) Guess Who? In: R. I. Binnick
et al. (eds.) Papers from the 5th Regional Meeting
of the Chicago Linguistic Society. Chicago,
252286.
Ross, J. R. (1970a) On Declarative Sentences. In:
R. A. Jacobs/ P. S. Rosenbaum (eds.) Readings in
English Transformational Grammar. Waltham,
Mass.: Ginn, 222272.
Ross, J. R. (1970b) A Note on Implicit Compara-
tives. In: Linguistic Inquiry 1, 363366.
Ross, J. R. (1974) More on -er-Globality. In: Foun-
dations of Language 12, 269270.
Ross, J. R./Cooper, W. E. (1979) Like Syntax. In:
W. E. Cooper/ E. C. Walker (eds.) Sentence Pro-
cessing. Studies in Honor of Merril Garret. New
York: Lawrence Erlbaum, 343418.
Ross, J. R./Perlmutter, D. M. (1970) A Non-Source
for Comparatives. In: Linguistic Inquiry 1,
127128.
Rudolph, E. (1973) Das finale Satzgefge als Infor-
mationskomplex (= Beihefte zur Zeitschrift fr Ro-
manische Philologie 138). Tbingen: Niemeyer.
Rudolph, E. (1982a) Argumentieren mit Finalst-
zen. In: K. Detering/J. Schmidt-Radefeldt/W. Su-
charowski (eds.) Sprache erkennen und verstehen
(= Linguistische Arbeiten 119). Tbingen: Nie-
42. BibliographieBibliography 899
Schnfinkel, M. (1924) ber die Bausteine der ma-
thematischen Logik. In: Mathematische Annalen
92, 305316.
Schpak-Dolt, N. (1989) Transitive Verben der Fort-
bewegung. Anhang: Weg, Route, Bewegung. Arbeits-
papier 11, Fachgruppe Sprachwissenschaft der
Universitt Konstanz.
Schubert, L./Pelletier, F. J. (1987) Problems in the
Representation of the Logical Form of Generics,
Bare Plurals, and Mass Terms. In: E. LePore (ed.)
New Directions in Semantics. New York: Academic
Press, 385451.
Schtze, H. (1989) Pluralbehandlung in natrlich-
sprachlichen Wissensverarbeitungssystemen. IWBS
Report 73, IBM Deutschland, Institut fr Wis-
sensbasierte Systeme, Stuttgart.
Schwartz, A. (1969) On Interpreting Nominaliza-
tions. In: M. Bierwisch/K. Heidolph (eds.) Progress
in Linguistics. The Hague: Mouton.
Schwartz, S. P. (1977) Naming, Necessity and Na-
tural Kinds. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Schwartz, S. P. (1978) Putnam on Artifacts. In: The
Philosophical Review 87, 566574.
Schwartz, S. P. (1980) Natural Kinds and Nominal
Kinds. In: Mind 89, 182195.
Schwarz, D. (1979) Naming and Referring. Berlin/
New York: de Gruyter.
Schwarze, Ch. (1979) Rparer reparieren. A
Contrastive Study. In: R. Buerle/U. Egli/A. von
Stechow (eds.) Semantics from Different Points of
View. Berlin: Springer, 304323.
Schwarze, Ch. (ed.) (1985) Beitrge zu einem kon-
trastiven Wortfeldlexikon Deutsch-Franzsisch. T-
bingen: Narr.
Schwarze, Ch./Wunderlich, D. (eds.) (1985) Hand-
buch der Lexikologie. Knigstein/Ts.: Athenum.
Schwyzer, E. (1966) Griechische Grammatik auf der
Grundlage von Karl Brugmanns griechischer Gram-
matik, Vol. 2. (vervollstndigt und herausgegeben
von A. Debrunner). Mnchen: Beck.
Scott, D. (1970) Advice on Modal Logic. In: K.
Lambert (ed.) Philosophical Problems in Logic.
Dordrecht: Reidel, 143173.
Searle, J. R. (1958) Proper Names. In: Mind 67,
966973.
Searle, J. R. (1969) Speech Acts: An Essay in the
Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge
University Press.
Searle, J. R. (1975a) Indirect Speech Acts. In: P.
Cole/J. L. Morgan (eds.) Speech Acts (= Syntax
and Semantics Vol. 3). New York: Academic Press,
5982.
Searle, J. R. (1975b) A Taxonomy of Illocutionary
Acts. In: K. Gunderson (ed.) Minnesota Studies in
the Philosophy of Science 7. Minneapolis: Univer-
sity of Minnesota Press, 344369.
Searle, J. R. (1983) Intentionality: An Essay in the
Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Sag, I. A. (1976) Deletion and Logical Form. Ph. D.
Dissertation, MIT. Published by Garland Publ.,
New York.
Sag, I. A./Gazdar, G./Wasow, T./Weisler, S. (1985)
Coordination and How to Distinguish Categories.
In: Natural Language and Linguistic Theory 3,
117171.
Sag, I. A./Prince, E. F. (1979) Bibliography of
Works Dealing with Presuppositions. In: Oh, Ch.-
K./Dinneen, D. A. (eds.) Presupposition (= Syntax
and Semantics Vol. 11). New York: Academic Press,
389403.
Saile, G. (1984) Sprache und Handlung. Braun-
schweig/Wiesbaden: Vieweg.
Salmon, N. (1982) Reference and Essence. Oxford:
Basil Blackwell.
Salmon, N. (1986) Freges Puzzle. Cambridge,
Mass.: MIT Press.
Sapir, E. (1944) Grading: A Study in Semantics.
In: Philosophy of Science 11 (1944), 93116.
Reprinted in: D. G. Mandelbaum (ed.) (1949) Se-
lected Writings of Edward Sapir in Language, Cul-
ture and Personality. Berkeley and Los Angeles:
University of California Press, 122149.
Scha, R. J. H. (1981) Distributive, Collective and
Cumulative Quantification. In: J. Groenendijk et
al. (eds.) Formal Methods in the Study of Language.
Amsterdam: Mathematisch Centrum, 483512.
Scha, R. J. H./Stallard, D. (1988) Multi-Level Plu-
rals and Distributivity. In: Proceedings of the 26th
Annual Meeting of the ACL. State University of
New York. Buffalo, NY, 1724.
Schachter, P. (1977) Constraints on Coordination.
In: Language 53, 86103.
Schachter, P. (1985) Parts-of-Speech-Systems. In:
T. Shopen (ed.) Language Typology and Syntactic
Description, Vol. I. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 361.
Schublin, P. (1972) Probleme des adnominalen At-
tributs in der deutschen Sprache der Gegenwart.
Berlin/New York: de Gruyter.
Schegloff, E. A. (1972) Sequencing in Conversatio-
nal Openings. In: Y. A. Fishman (ed.) Advances in
the Sociology of Language II. The Hague: Mouton,
91125.
Schegloff, E. A./Sacks, H. (1973) Opening up Clo-
sings. In: Semiotica, 289327.
Schiffer, S. (1972) Meaning. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
Schiffer, S. (1982) Intention-Based Semantics. In:
Notre Dame Journal of Formal Logic 23, 119156.
Schmerling, S. F. (1975) Asymmetric Conjunction
and Rules of Conversation. In: P. Cole/J. L. Mor-
gan (eds.) Speech Acts (= Syntax and Semantics
Vol. 3). New York: Academic Press, 211231.
Schmidt, S. J. (1973) Textheoretische Aspekte der
Negation. In: Zeitschrift fr Germanistische Lin-
guistik 1. 178208.
900 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Sidner, C. L. (1979) Towards a Computational
Theory of Definite Anaphora Comprehension in Eng-
lish Discourse. Ph. D. Dissertation, MIT.
Sidner, C. L. (1983) Focusing in the Comprehen-
sion of Definite Anaphora. In: M. Brady et al.
(eds.) Computational Models of Discourse. Cam-
bridge: MIT, 267330.
Siebert-Ott, G. M. (1983) Kontroll-Probleme in in-
finiten Komplementkonstruktionen. (= Studien zur
deutschen Grammatik 22). Tbingen: Narr.
Siegel, M. (1976) Capturing the Russian Adjective.
In: B. Partee (ed.) Montague Grammar. New York:
Academic Press, 293309.
Siegel, M. (1979) Measure Adjectives in Montague
Grammar. In: S. Davis/M. Mithun (eds.) Lingui-
stics, Philosophy and Montague Grammar. Austin,
Texas: University of Texas Press, 223262.
Sinclair, J. McH. (1966) Beginning the Study of
Lexis. In: C. E. Bazell et al. (eds.) In Memory of
John Firth. London: Longman, 410430.
Skinner, B. F. (1957) Verbal Behavior. New York:
Appleton-Century-Crofts.
Smaby, R. M. (1979) Ambigous Coreference with
Quantifiers. In: F. Guenthner/S. J. Schmidt (eds.)
Formal Semantics and Pragmatics for Natural
Language. Dordrecht: Reidel, 3775.
Smith, C. (1961) A Class of Complex Modifiers in
English. In: Language 37, 342365.
Smith, C. (1964) Determiners and Relative Clauses.
In: Language 40, 3752.
Smith, C. (1978) The Syntax and Interpretation of
Temporal Expressions in English. In: Linguistics
and Philosophy 2, 4399.
Smith, C. (1980) Temporal Structures in Discourse.
In: C. Rohrer (ed.) Time, Tense, and Quantifiers.
(= Linguistische Arbeiten 83). Tbingen: Nie-
meyer, 355374.
Smith, E. E./Medin, D. L. (1981) Categories and
Concepts. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Smith, N. V. (ed.) (1982) Mutual Knowledge. Lon-
don: Academic Press.
Smith-Stark, T. C. (1974) The Plurality Split. In:
Papers from the 10th Regional Meeting of the Chi-
cago Linguistic Society, 657671.
Soames, S. (1979) A Projection Problem for Spea-
ker Presuppositions. In: Linguistic Inquiry 10,
623666.
Soames, S. (1982) How Presuppositions are Inhe-
rited: A Solution to the Projection Problem. In:
Linguistic Inquiry 13, 483545.
Soames, S. (1988) Presupposition. In: F. Guenth-
ner/D. Gabbay (eds.) Handbook of Philosophical
Logic, Bd. 4, 553616.
Sober, E. (1984) Discussion: Sets, Species, and Evo-
lution: Comments on Philip Kitchers species. In:
Philosophy of Science 91, 334341.
Solfjeld, K. (1983) Indikativ in der indirekten Rede
Ein Vergleich Deutsch Norwegisch. In: Ziel-
sprache Deutsch 1, 4147.
Searle, J. R./Vanderveken, D. (1985) Foundations
of Illocutionary Logic. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Segerberg, K. (1973) Two-Dimensional Modal Lo-
gic. In: Journal of Philosophical Logic 2, 7796.
Seiler, H./Lehmann, Ch. (eds.) (1982) Apprehen-
sion. Das sprachliche Erfassen von Gegenstnden.
Teil 1. Tbingen: Narr.
Selkirk, E. O. (1977) Some Remarks on Noun
Phrase Structure. In: P. Culicover/T. Wasow/A. Ak-
majian (eds.) Formal Syntax. New York: Academic
Press, 285316.
Selkirk, E. O. (1982) The Syntax of Words. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press.
Selkirk, E. O. (1984) Phonology and Syntax. The
Relation between Sound and Structure. Cambridge,
Mass.: MIT Press
Sellars, W. (1954) Presupposing. In: The Philoso-
phical Review 63, 197215.
Sells, P. (1985) Anaphora with which. In: M. Cobler
et al. (eds.) Proceedings of the 4th West Coast
Conference on Formal Linuistics. Stanford, Ca.
Serzisko, F. (1980) Sprachen mit Zahlklassifikato-
ren: Analyse und Vergleich. Arbeiten des Klner
Universalienprojekts 37.
Seuren, P. A. M. (1973) The Comparative. In: F.
Kiefer/N. Ruwet (eds.) Generative Grammar in Eu-
rope. Dordrecht: Reidel, 528564.
Seuren, P. A. M. (1978) The Structure and Selection
of Positive and Negative Gradable Adjectives. In:
D. Farkas/W. M. Jacobsen/ K. W. Todrys (eds.)
Papers from Parasession on the Lexicon at the 15th
Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society.
Chicago, 336346.
Seuren, P. A. M. (1979) Dreiwertige Logik und die
Semantik natrlicher Sprache. In: J. Ballweg/H.
Glinz (eds.) Grammatik und Logik. Dsseldorf:
Schwann.
Seuren, P. A. M. (1984) Operator Lowering. In:
Linguistics 22, 573627.
Seuren, P. A. M. (1985a) Discourse Semantics. Ox-
ford: Basil Blackwell.
Seuren, P. A. M. (1985b) The Comparative Revi-
sited. In: Journal of Semantics 3, 109141.
Sharvy, R. (1978) Maybe English Has No Count
Nouns: Notes on Chinese Semantics. An Essay in
Metaphysics and Linguistics. In: Studies in Lang-
uage 2, 345365.
Sharvy, R. (1980) A more General Theory of De-
finite Descriptions. In: The Philosophical Review
89, 607624.
Shibatani, M. (1976) The Grammar of Causative
Constructions: A Conspectus. In: Shibatani (ed.,
1976), 142.
Shibatani, M. (ed.) (1976) The Grammar of Cau-
sative Constructions (= Syntax and Semantics Vol.
6). New York: Academic Press.
Shortliffe, E. (1976) Computer-Based Medical Con-
sultations: MYCIN. New York: American Elsevier.
42. BibliographieBibliography 901
Stegmller, W./Varga von Kibd, M. (1984) Struk-
turtypen der Logik. Probleme und Resultate der Wis-
senschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Vol.
III. Berlin/Heidelberg: Springer.
Stein, M. (1981) Quantification in Thai. Ph. D. Dis-
sertation, University of Massachusetts at Amherst.
Steinberg, D. D./Jakobovits, L. A. (eds.) (1971)
Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philoso-
phy, Linguistics, and Psychology. London: Cam-
bridge University Press.
Steinitz, R. (1969) Adverbial-Syntax. Berlin: Aka-
demie Verlag.
Steinitz, R. (1977) Zur Semantik und Syntax du-
rativer, inchoativer und kausativer Verben. In: Lin-
guistische Studien A 35, 85129.
Stenius, E. (1967) Mood and Language Game. In:
Synthese 17, 254274.
Stenius, E. (1969) Wittgensteins Traktat. Frankfurt:
Suhrkamp.
Sterelny, K. (1983) Natural Kind Terms. In: Pacific
Philosophical Quarterly 64, 110125.
Steube, A. (1980) Temporale Bedeutung im Deut-
schen (= Studia Grammatica 20). Berlin: Akade-
mie Verlag.
Steube, A. (1983) Indirekte Rede und Zeitverlauf.
In: R. Ruzicka/ W. Motsch (eds.) Untersuchungen
zur Semantik (= Studia Grammatica 22). Berlin:
Akademie Verlag, 121168.
Stewart, M. F. (1971) A Logical Basis for Nouns,
Adjectives, and Verbs. Natural Language Studies
12, Phonetics Laboratory, Ann Arbor, University
of Michigan.
Stickel, G. (1970) Untersuchungen zur Negation im
heutigen Deutsch. Braunschweig: Vieweg.
Stockwell, R. P./Schachter, P./Partee, B. H. (1973a)
The Major Syntactic Structures of English. New
York: Holt, Rinehart & Winston.
Stockwell, R. P./Schachter, P./Partee, B. H. (1973b)
Integration of Transformational Theories on English
Syntax. Distributed by Indiana University Lingui-
stics Club (Bloomington).
Storch, G. (1978) Semantische Untersuchungen zu
den inchoativen Verben im Deutschen. (= Schriften
zur Linguistik 9). Braunschweig: Vieweg.
Stowell, A. (1981) Origin of Phrase Structures.
Ph. D. Dissertation, MIT.
Strawson, P. F. (1950a) On Referring. In: Mind 59,
320344. Reprinted in: A. Flew (ed.) (1956)
Essays in Conceptual Analysis. London: Mac-
Millan, 2152.
Strawson, P. F. (1950b) Truth. In: Proceedings of
the Aristotelian Society. Suppl. Vol. 25. Reprin-
ted in: A. Flew (ed.) (1956) Essays in Conceptual
Analysis. London: MacMillan, and in: G. Pitcher
(ed.) (1964) Truth. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
3253.
Strawson, P. F. (1952) An Introduction to Logical
Theory. London: Methuen.
Sondheimer, N. K. (1978) A Semantic Analysis of
Reference to Spatial Properties. In: Linguistics and
Philosophy 2, 235280.
Sperber, D./Wilson, D. (1982) Mutual Knowledge
and Relevance in Theories of Comprehension. In:
N. V. Smith (ed.) Mutual Knowledge. London: Aca-
demic Press, 6185; Comments and Replies
88131.
Sperber, D./Wilson, D. (1986) Relevance. Commu-
nication and Cognition. Oxford: Basil Blackwell.
Spohn, W. (1983) Deterministic and Probabilistic
Reasons and Causes. In: Erkenntnis 19, 371396.
Stalnaker, R. C. (1968) A Theory of Conditionals.
In: N. Rescher (ed.) Studies in Logical theory. Ox-
ford: Basil Blackwell, 98112.
Stalnaker, R. C. (1970) Pragmatics. In: Synthese
22, 272289. Reprinted in: D. Davidson/G.
Harman (eds.) (1972) Semantics of Natural Lang-
uage. Dordrecht: Reidel, 380397.
Stalnaker, R. C. (1973) Presuppositions. In: Journal
of Philosophical Logic 2, 447457.
Stalnaker, R. C. (1974) Pragmatic Presuppositions.
In: M. K. Munitz/P. K. Unger (eds.) Semantics and
Philosophy. New York: New York University Press,
197230.
Stalnaker, R. C. (1975) A Theory of Conditionals.
Oxford: University Press.
Stalnaker, R. C. (1976a) Indicative Conditionals.
In: A. Kasher (ed.) Language in Focus. Dordrecht:
Reidel, 179196.
Stalnaker, R. C. (1976b) Propositions. In: A. F.
Mackay/D. D. Merrill (eds.) Issues in the Philoso-
phy of Language. New Haven: Yale University
Press, 7991.
Stalnaker, R. C. (1978) Assertion. In: P. Cole (ed.)
Pragmatics (= Syntax and Semantics, Vol. 9). New
York: Academic Press, 315332.
Stalnaker, R. C. (1981) Indexical Belief. In: Syn-
these 49, 129151.
Stalnaker, R. C. (1984) Inquiry. Cambridge, Mass.:
Bradford Books/MIT Press.
Stalnaker, R. C. (1987) Semantics for Belief. In:
Philosophical Topics 5, 177190.
Stalnaker, R. C. (1988) Belief Attribution and Con-
text. In: R. H. Grimm/D. D. Merrill (eds.) Contents
of Thought. Proceedings of the 1985 Oberlin Col-
loquium in Philosophy. Tucson: University of Ari-
zona Press, 140156.
Stanley, R. (1969) The English Comparative Ad-
jective Construction. In: R. I. Binnick/A. Davison/
G. M. Green/J. L. Morgan (eds.) Papers from the
5th Regional Meeting of the Chicago Linguistic So-
ciety. Chicago, 287294.
Stassen, L. (1984) The Comparative Compared. In:
Journal of Semantics 3, 143182.
Steedman, M. (1987) Constituency and Depen-
dency in a Combinatory Grammar. Unpublished
Ms., Universities of Edinburgh and Pennsylvania.
902 XII. Bibliographischer Anhang und Register
York: Plenum, 225282.
Talmy, L. (1985) Lexicalization Patterns: Semantic
Structure in Lexical Forms. In: T. Shopen (ed.)
Language Typology and Syntactic Description, Vol.
III. Cambridge: Cambridge University Press,
57149.
Tarski, A. (1933) Pojecie prawdy w jezykach nauk
dedukcyjnych. (The concept of truth in the lang-
uage of deductive sciences). In: Prace Towarzystwa
Naukowego Warsqawskiego, Wydzial III, No. 34,
Warsaw.
Tarski, A. (1936) Der Wahrheitsbegriff in den for-
malisierten Sprachen. In: Studia Philosophica 1,
261405.
Tarski, A. (1952) Some Notions and Methods on
the Borderline of Algebra and Metamathematics.
In: Proceedings of the 1950 International Congress
of Mathematicians 1, 705720.
Tarski, A. (1956) Logic, Semantics, Metamathe-
matics. Ed. by J. Woodger. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
Taylor, B. (1977) Tense and Continuity. In: Lingui-
stics and Philosophy 1, 199220.
Tedeschi, P. I./Zaenen, A. (1981) Tense and Aspect
(= Syntax and Semantics Vol. 14). New York:
Academic Press.
Teleman, U. (1976) On Causal Conjunction in Mo-
dern Swedish. In: Karlsson, F. (ed.) Papers from
the Third Conference of Scandinavian Linguistics.
Turku.
Tennant, N. (1981) Formal Games and Forms of
Games. In: Linguistics and Philosophy 4, 311320.
ter Meulen, A. (1980) Substance, Quantities and
Individuals: A Study in the Formal Semantics of
Mass Terms. Ph. D. Dissertation, Stanford. Distri-
buted by Indiana University Linguistics Club
(Bloomington).
ter Meulen, A. (1981) An Intensional Logic for
Mass Terms. In: J. Groenendijk et al. (eds.) Formal
Methods in the Study of Language. Mathematical
Centre Tracts 135, Amsterdam, 421443.
ter Meulen, A. (ed.) (1983) Studies in Modeltheo-
retic Semantics (= GRASS Series No. 1). Dor-
drecht: Foris.
Tesnire, L. (1959) lments de Syntaxe Structurale.
Paris: Klincksieck. (2me d. revue et corrige 1969)
German edition: U. Engel (ed.) (1980) Grundzge
der strukturalen Syntax. Stuttgart: Klett-Cotta.
Thomason, R. H. (1973) Supervaluations. The Bald
Man, and the Lottery. Ms. Pittsburgh.
Thomason, R. H. (1974) Introduction to: Formal
Philosophy. Selected Papers of Richard Montague.
New Haven: Yale University Press, 169.
Thomason, R. H. (1976) Some Extensions of Mon-
tague Grammar. In: B. Partee (ed.) Montague
Grammar. New York, San Francisco, London: Aca-
demic Press, 77118.
Thomason, R. H. (1977) Indirect Discourse Is Not
Quotational. In: The Monist 60, 340354.
Strawson, P. F. (1954a) A Reply to Mr. Sellars. In:
The Philosophical Review 63, 216231.
Strawson, P. F. (1954b) Particular and General. In:
Proceedings of the Aristotelan Society, 233260.
Reprinted in: Strawson (1971), 190213.
Strawson, P. F. (1959) Individuals. London: Me-
thuen.
Strawson, P. F. (1964) Identifying Reference and
Truth-values. In: Theoria 30, 96118.
Strawson, P. F. (1971) Logico-Linguistic Papers.
London: Methuen.
Strawson, P. F. (1974) Subject and Predicate in
Logic and Grammar. London: Methuen.
Strawson, P. F. (1986) If and . In: R. Grandy/R.
Warner (eds.) Philosophical Grounds of Rationality:
Intentions, Categories, Ends. Oxford: Clarendon
Press, 229242.
Stump, G. (1981) The Formal Semantics and Prag-
matics of Free Adjuncts and Absolutes in English.
Ph. D. Dissertation, Ohio State University.
Stump, G. (1981) The Interpretation of Frequency
Adjectives. In: Linguistics and Philosophy 4,
221257.
Stump, G. (1985) The Semantic Variability of Ab-
solute Constructions. Dordrecht: Kluwer.
Suppes, P. (1973) Semantics of Context-free Frag-
ments of Natural Languages. In: K. J. J. Hintikka/
J. M. E. Moravcsik/P. Suppes (eds.) Approaches to
Natural Language. Dordrecht: Reidel, 370394.
Swinburn, C. (1976) A Proposal for Treating Com-
paratives in Montague Grammar. In: H. Thompson
et al. (eds.) Proceedings of the Second Annual Mee-
ting of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley,
Ca., 339349.
Szabolcsi, A. (1980) Az aktuallis mondattagols
szemantikjhoz. In: Nyelvtudomnyi Kzlemnyek
82, 5983.
Szabolcsi, A. (1981a) Compositionality in Focus.
In: Folia Linguistica 15, 141161.
Szabolcsi, A. (1981b) The Semantics of Topic-Fo-
cus Articulation. In: J. Groenendijk et al. (eds.)
Formal Methods in the Study of Language. Am-
sterdam: Mathematical Centre Tract 136,
513540.
Szabolcsi, A. (1986) Comparative Superlatives.
Ms., MIT.
Szabolcsi, A. (1987) Bound Variables in Syntax
(Are There Any?). In: J. Groenendijk/M. Stokhof/
F. Veltman (eds.) Proceedings of the 6th Amsterdam
Colloquium. ITLI, Universiteit van Amsterdam,
331351.
Taglicht, J. (1984) Message and Emphasis. On Focus
and Scope in English. London: Longman.
Talmy, L. (1975) Semantics and Syntax of Motion.
In: J. P. Kimball (ed.) Syntax and Semantics, Vol.
4. New York: Academic Press, 181238.
Talmy, L. (1980) How Language Structures Space.
In: H. L. Pick/ L. P. Acredolo (eds.) Spatial Orien-
tation: Theory, Research, and Application. New
42. BibliographieBibliography 903
Turner, R. (1986) Formal Semantics and Type-free
Theories. In: J. Groenendijk/D. de Jongh/M. Stok-
hof (eds.) Studies in Discourse Representation
Theory and the Theory of Generalized Quiantifiers
(= GRASS Series No. 8). Dordrecht: Foris,
145159.
Turner, R. (1987) A Theory of Properties. In: Jour-
nal of Symbolic Logic 52, 6386.
Uhlig, G. (1883) Dionydii Thracis Ars Grammatica.
Leipzig: Teubner.
Ullmann, S. (1957) The Principles of Semantics.
(2nd edition) Glasgow: Jackson/Oxford: Basil
Blackwell.
Ullmer-Ehrich, V. (1977) Zur Syntax und Semantik
von Substantivierungen im Deutschen. Kronberg/
Ts.: Scriptor.
Ultan, R. (1972) Some Features of Basic Compa-
rative Constructions. In: Stanford Working Papers
in Language Universals, Vol. 9, 117162.
Unger, P. (1984) Philosophical Relativity. Minnea-
polis: University of Minnesota Press.
Valentin, P. (ed.) (1983) Lexpression de la conces-
sion. Linguistica Palatina Colloquia I. Paris.
Valgard, J. (1979) Zur Funktion der Kausalstze.
In: Dahl, S. et al. (eds.) Gedenkschrift fr Trygve
Sagen (= Osloer Beitrge zur Germanistik 3),
104120.
van Benthem, J. F. (1982) Later than Late: on the
Logical Origin of the Temporal Order. In: Pacific
Philosophical Quarterly 63, 193203.
van Benthem, J. F. (1983a) The Logic of Time.
Dordrecht: Reidel.
van Benthem, J. F. (1983b) Determiners and Logic.
In: Linguistics and Philosophy 6, 447478.
van Benthem, J. F. (1983c) Five Easy Pieces. In:
A. ter Meulen (ed.) Studies in Modeltheoretic Se-
mantics. Dordrecht: Foris, 117.
van Benthem, J. F. (1984a) The Logic of Semantics.
In: F. Landman/F. Veltman (eds.) Varieties of For-
mal Semantics. Dordrecht: Foris, 5580.
van Benthem, J. F. (1984b) Questions about Quan-
tifiers. In: Journal of Symbolic Logic 49, 443466.
van Benthem, J. F. (1985) A Manual of Intensional
Logic (= CSLI Lecture Notes 1). Stanford. (2nd
ed. revised and expanded 1988)
van Benthem, J. F. (1986a) Essays in Logical Se-
mantics. Dordrecht: Reidel.
van Benthem, J. F. (1986b) A Linguistic Turn: New
Directions in Logic. In: Weingrtner (ed.) Procee-
dings of 7th International Congress of Logic, Me-
thodology and Philosophy of Science, Salzburg 1983.
Amsterdam: North Holland, 205240.
van Benthem, J. F. (1987) Categorial Grammar and
Type Theory. University of Amsterdam: ITLI Pre-
publication Series 8707.
van Benthem, J. F. (1989) Polyadic Quantifiers. In:
Linguistics and Philosophy 12, 437464.
Thomason, R. H. (1980a) A Model Theory for
Propositional Attitudes. In: Linguistics and Philo-
sophy 4, 4770.
Thomason, R. H. (1980b) A Note on Syntactical
Treatments of Modality. In: Synthese 44, 391395.
Thomason, R. H. (1985) Some Issues Concerning
the Interpretation of Derived and Gerundive No-
minals. In: Linguistics and Philosophy 8, 7380.
Thomason, R. H./Stalnaker, R. C. (1973) A Se-
mantic Theory of Adverbs. In: Linguistic Inquiry
4, 195220.
Thompson, S. A. (1972) Instead of and rather than
Clauses in English. In: Journal of Linguistics 8,
237249.
Thompson, S. A. (1973) On Subjectless Gerunds
in English. In: Foundations of Language 9,
374384.
Thompson, S. A./R. E. Longacre (1985) Adverbial
Clauses. In: T. Shopen (ed.) Language Typology
and Syntactic Description. Vol. II. Cambridge:
Cambridge University Press, 171234.
Thomson, J. J. (1971) The Time of a Killing. In:
The Journal of Philosophy 68, 115132.
Tichy, P. (1971) An Approach to Intensional Ana-
lysis. In: Nous 5, 273297.
Tichy, P. (1978) Questions, Answers, and Logic.
In: American Philosophical Quarterly 15, 275284.
Tichy, P. (1980) The Logic of Discourse. In: Lin-
guistics and Philosophy 3, 343369.
Todt, G. (1980) Behandlung vager Prdikate in
formalen Sprachen. In: J. Ballweg/H. Glinz (eds.)
Grammatik und Logik. Jahrbuch 1979 des Instituts
fr deutsche Sprache. Dsseldorf: Schwann,
260281.
Toman, J. (1983) Wortsyntax: Eine Diskussion aus-
gewhlter Probleme deutscher Wortbildung. Tbin-
gen: Niemeyer.
Toman, J. (1985) A Discussion of Coordination
and Word Syntax. In: J. Toman (ed.) Studies in
German Grammar. Dordrecht: Reidel, 407432.
Toman, J. (1986) A (Word-)Syntax for Participles.
In: Linguistische Berichte 105, 367408.
Tottie, G. (1980) Affixal and Non-Affixal Negation
in English. Two Systems in (Almost) Complemen-
tary Distribution. In: Studia Linguistica 34,
101123.
Toulmin, S. (1958) The Uses of Argument. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Traugott, E. C. (1978) On the Expression of Spatio-
Temporal Relations in Language. In: J. H. Green-
berg (ed.) Universals of Human Language, Vol. 3.
Stanford: Stanford University Press, 369400.
Trier, J. (1931) Der deutsche Wortschatz im Sinn-
bezirk des Verstandes: Die Geschichte eines sprach-
lichen Feldes. Heidelberg: Winter.
Turner, R. (1983) Montague Semantics, Nomina-
lization and Scotts Domains. In: Linguistics and
Philosophy 6, 259288.
904 XII. Bibliographischer Anhang und Register
Varga von Kibd, M. (1987) Wahrheit, Selbstrefe-
renz und Reflexion. Habilitationsschrift, Universitt
Mnchen.
Vater, H. (1975) Werden als Modalverb. In: J. P.
Calbert/H. Vater (eds.) Aspekte der Modalitt (=
Studien zur deutschen Grammatik 1). Tbingen:
Narr, 71148.
Vater, H. (1976) Wie-Stze. In: Braunmller/W.
Krschner (eds.) Grammatik. Tbingen: Niemeyer,
209222.
Vater, H. (1983) Zum deutschen Tempussystem. In:
J. O. Askedal et al. (eds.) Festschrift fr Laurits
Saltveit. Oslo: Universitetsforlaget.
Veltman, F. (1981) Data Semantics. In: J. Groe-
nendijk et al. (eds.) Formal Methods in the Study
of Language. Part II. Amsterdam: Mathematical
Centre. Tract 136, 541565.
Veltman, F. (1984) Data Semantics. In: J. Groe-
nendijk/T. Jansen/ M. Stokhof (eds.) Truth, Inter-
pretation and Information. Selected Papers from the
Third Amsterdam Colloquium. Dordrecht: Foris.
Veltman, F. (1985) Logics for Conditionals. Ph. D.
Dissertation, University of Amsterdam.
Vendler, Z. (1957) Verbs and Times. In: The Phi-
losophical Review 66, 143160. Reprinted in:
Vendler (1967), 97121.
Vendler, Z. (1967) Linguistics and Philosophy.
Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.
Vendler, Z. (1967a) Facts and Events. In: Vendler
(1967), 122146.
Vendler, Z. (1967b) Singular Terms. In: Vendler
(1967), 3369. Reprinted in: D. Steinberg/L.
Jacobovits (eds.) (1971) Semantics: An Interdisci-
plinary Reader in Philosophy, Linguistics, and Psy-
chology. London: Cambridge University Press,
115133.
Vendler, Z. (1968) Adjectives and Nominalizations.
The Hague: Mouton.
Verkuyl, H. J. (1972) On the Compositional Nature
of the Aspects. Foundations of Language (= Suppl.
Series 15). Dordrecht: Reidel.
Verkuyl, H. J. (1981) Numerals and Quantifiers in
X-Bar-Syntax and their Semantic Interpretation.
In: J. Groenendijk et al. (eds.) Formal Methods in
the Study of Language. Part 2. Amsterdam: Ma-
thematisch Centrum, 567599.
Verkuyl, H. J. (1986) Nondurative Closure of
Events. In: J. Groenendijk et al. (eds.) Studies in
Discourse Representation Theory and the Theory of
Generalized Quantifiers (= GRASS Series No. 8).
Dordrecht: Foris, 87113.
Vet, C. (1980) Temps, Aspects et Adverbes de Temps
en Franais Contemporain. Genve: Droz.
Vlach, F. (1973) Now and Then: A Formal
Study in the Logic of Tense and Anaphora. Ph. D.
Dissertation, University of California, Los Angeles.
Vlach, F. (1974) Factives and Negatives. Chapter
XXI in: Berkeley Studies in Syntax and Semantics,
Vol. 1, 111.
van Benthem, J. F./ter Meulen, A. (eds.) (1985)
Generalized Quantifiers in Natural Languages (=
GRASS Series No. 4). Dordrecht: Foris.
van Dalen, D. (1983) Logic and Structure. (2nd
edition) Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
van der Auwera, J. (1983) Maar en alleen als Grad-
partikel. In: Proceedings of the First Dutch Particle
Conference.
van der Sandt, R. A. (1982) Kontekst en Presup-
positile. Een studie van het projektieprobleem en de
presuppositionele eigenschapen van de logische kon-
nektieven. Ph. D. Dissertation, Nijmegen Univer-
sity.
van der Sandt, R. A. (1987) Context and Presup-
position. London: Croom Helm.
van Dijk, T. A. (1977a) Text and Context. London:
Longman.
van Dijk, T. A. (1977b) Connectives in Text Gram-
mar and Text Logic. In: T. A. van Dijk/J. S. Petfi
(eds.) Grammars and Descriptions. Berlin: de Gruy-
ter, 1163.
van Eijck, J. (1985a) Generalized Quantifiers and
Traditional Logic. In: J. van Benthem/A. ter Meu-
len (eds.) Generalized Quantifiers in Natural Lang-
uage. Dordrecht: Foris, 119.
van Eijck, J. (1985b) Aspects of Quantification in
Natural Language. Ph. D. Dissertation, University
of Groningen.
van Fraassen, B. C. (1966) Singular Terms, Truth-
Value Gaps, and Free Logic. In: Journal of Philo-
sophy 63, 481495.
van Fraassen, B. C. (1968) Presupposition, Impli-
cation, and Self-Reference. In: Journal of Philoso-
phy 65, 136152.
van Fraassen, B. C. (1969) Presuppositions, Super-
valuations, and Free Logic. In: K. Lambert (ed.)
The Logical Way of Doing Things. New Haven/
London: Yale University Press, 6791.
van Frassen, B. C. (1971) Formal Semantics and
Logic. New York/London: MacMillan.
van Langendonck, W. (1972) Numerus-Problemen.
In: Leuvense Bijdragen, 2942.
Vandeloise, C. (1984) Descriptions of Space in
French. Ph. D. Dissertation, University of Califor-
nia, San Diego.
Vanderveken, D. (1980) Illocutionary Logic Self-
Defeating Speech Acts. In: J. Searle/F. Kiefer/M.
Bierwisch (eds.) Speech Act Theory and Pragmatics.
Dordrecht: Reidel, 247272.
Vanderveken, D. (1983) A Model-Theoretical Se-
mantics for Illocutionary Forces. In: Logique et
Analyse 103/104, 359394.
Vanderveken, D. (1985a) Non-Literal Speech Acts:
An Essay on the Foundation of Formal Pragmatics
(Part I). Montral: Universit du Quebec.
Vanderveken, D. (1985b) What is an Illocutionary
Force? In: M. Dascal (ed.) Dialogue. An Interdis-
ciplinary Study. Amsterdam: John Benjamins,
181204.
42. BibliographieBibliography 905
dings of the Fourth Amsterdam Colloquium (=
GRASS Series No. 3). Dordrecht: Foris, 385403.
von Stechow, A. (1984d) My Reaction to Cress-
wells, Hellans, Hoeksemas and Seurens Com-
ments. In: Journal of Semantics 3, 183199.
von Stechow, A. (1989) Focusing and Backgroun-
ding Operators. Arbeitspapier 6 der Fachgruppe
Sprachwissenschaft, Universitt Konstanz.
von Stechow, A./Sternefeld, W. (1988) Bausteine
syntaktischen Wissens. Ein Lehrbuch der generativen
Grammatik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
von Stechow, A./Uhmann, S. (1986) Some Re-
marks on Focus Projection. In: W. Abraham/S. de
Meji (eds.) Topic, Focus and Configurationality.
Amsterdam: John Benjamins, 295320.
von Stechow, A./Zimmermann, Th. E. (1984) Term
Answers and Contextual Change. In: Linguistics
22, 340.
von Wright, G. H. (1963) Practical Inference. In:
The Philosophical Review 72.
von Wright, G. H. (1971) Explanation and Under-
standing. London: Routledge & Kegan Paul.
Wagner, K.-H. (1971) Zur Nominalisierung im
Englischen. In: A. von Stechow (ed.) Beitrge zur
Generativen Grammatik. Referate des 5. Linguisti-
schen Kolloquiums Regensburg 1970. Braun-
schweig: Vieweg, 264272.
Wahlster, W. (1980) Implementing Fuzzyness in
Dialogue Systems. In: B. Rieger (ed.), 259280.
Waismann, F. (1951) Verifiability. In: A. Flew (ed.)
(1968) Logic and Language I. Oxford: Basil Black-
well, 117144.
Wald, J. D. (1977) Stuff and Words: A Semantic
and Linguistic Analysis of Non-Singular Reference.
Ph. D. Dissertation, Brandeis University.
Walker, R. C. S. (1975) Conversational Implica-
tures. In: S. Blackburn (ed.) Meaning, Reference
and Necessity. Cambridge: Cambridge University
Press, 133181.
Wall, R. (1972) An Introduction to Mathematical
Linguistics. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Wall, R./Peters, R. S./Dowty, D. R. (1981) Intro-
duction to Montague Grammar. Dordrecht: Reidel.
Wallace, J. (1965) Sortal Predicates and Quantifi-
cation. In: Journal of Philosophy 62, 813.
Wallace, J. (1972) On the Frame of Reference. In:
Synthese 22, 117151. Reprinted in: D. David-
son/G. H. Harman (eds.) Semantics of Natural
Language. Dordrecht: Reidel, 219252.
Wallace, J. (1972) Positive, Comparative, Superla-
tive. In: Journal of Philosophy 69, 773782.
Ware, R. X. (1975) Some Bits and Pieces. In: Syn-
these 31, 379393. Reprinted in: F. J. Pelletier
(ed.) (1979) Mass Terms: Some Philosophical Pro-
blems. Dordrecht: Reidel, 1529.
Wasow, T./Roeper, T. (1972) On the Subject of
Gerunds. In: Foundation of Language 8, 4461.
Vlach, F. (1981) The Semantics of the Progressive.
In: P. J. Tedeschi/A. Zaenen (eds.) Tense and Aspect
(= Syntax and Semantics Vol. 14). New York:
Academic Press, 271292.
von Kutschera, F. (1967) Elementare Logik. Wien:
Springer.
von Kutschera, F. (1975) Sprachphilosophie. (2nd
ed.) Mnchen: Fink.
von Stechow, A. (1974) --kontextfreie Sprachen:
Ein Beitrag zu einer natrlich formalen Semantik.
In: Linguistische Berichte 34, 133.
von Stechow, A. (1978) Direktionale Prpositionen
und Kontexttheorie. In: M. E. Conte/A. G. Ramat/
P. Ramat (eds.) Wortstellung und Bedeutung. Akten
des 12. Linguistischen Kolloquiums Pavia 1977,
Vol. 1. Tbingen: Niemeyer, 157166.
von Stechow, A. (1979a) Deutsche Wortstellung
und Montague-Grammatik. In: J. M. Meisel/M. D.
Pam (eds.) Linear Order and Generative Theory.
Amsterdam: John Benjamins, 317490.
von Stechow, A. (1979b) Occurrence-Interpretation
and Context-Theory. In: D. Gambara/F. Lo Pi-
paro/G. Ruggiero (eds.) Linguaggi e Formalizza-
zioni. Roma: Bulzoni, 307347.
von Stechow, A. (1980) Modification of Noun
Phrases: A Challenge for Compositional Semantics.
In: Theoretical Linguistics 7, 57110.
von Stechow, A. (1981a) Presupposition and Con-
text. In: U. Mnnich (ed.) Aspects of Philosophical
Logic (= Synthese Library 147). Dordrecht: Rei-
del, 157224.
von Stechow, A. (1981b) Topic, Focus and Local
Relevance. In: W. Klein/W. Levelt (eds.) Crossing
the Boundaries in Linguistics. Dordrecht: Reidel,
95130.
von Stechow, A. (1982) Book Review: John Lyons,
Semantics. In: Beitrge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur 104, 256267.
von Stechow, A. (1982a) Structured Propositions.
Arbeitspapier 59 des SFB 99, Universitt Konstanz.
von Stechow, A. (1982b) Three Local Deictics. In:
R. J. Jarvella/ W. Klein (eds.) Speech, Place, and
Action. Chichester: John Wiley & Sons, 7399.
von Stechow, A. (1983) Sind gross und klein Pr-
dikate oder Relationen? Ein Interview mit Aristo-
teles. In: M. Faust (ed.) Allgemeine Sprachwissen-
schaft, Sprachtypologie und Textlinguistik: Fest-
schrift fr Peter Hartmann. Tbingen: Narr,
105120.
von Stechow, A. (1984a) Comparing Semantic
Theories of Comparison. In: Journal of Semantics
3, 177.
von Stechow, A. (1984b) Gunnar Bechs Govern-
ment and Binding Theory. In: Linguistics 22,
225241.
von Stechow, A. (1984c) Structured Propositions
and Essential Indexicals. In: F. Landman/F. Velt-
man (eds.) Varieties of Formal Semantics. Procee-
906 XII. Bibliographischer Anhang und Register
thematica, Vol. 1. (2nd ed. 1927) Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Whorf, B. L. (1956) Language, Thought and Reality.
Writings of Benjamin Lee Whorf. Ed. by J. B. Car-
roll. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Wierzbicka, A. (1972) Semantic Primitives (= Lin-
guistische Forschungen 22). Frankfurt/Main: Athe-
num.
Wiggins, D. (1980) Sameness and Substance. Ox-
ford: Basil Blackwell.
Wilkins, W. (ed.) (1988) Thematic Relations (=
Syntax and Semantics, Vol. 21). New York: Aca-
demic Press.
Wilkinson, K. (1986) Generic Indefinite NPs. Ms.
University of Massachusetts, Amherst.
Wille, R. (1982) Reconstructing Lattice Theory: An
Approach Based on Hierarchies of Concepts. In:
I. Rival (ed.) Ordered Sets. Dordrecht: Reidel,
445470.
Williams, E. S. (1976) Comparative Reduction and
the Cycle. Unpublished ms., University of Massa-
chusetts, Amherst.
Williams, E. S. (1977) Discourse and Logical Form.
In: Linguistic Inquiry 8, 101140.
Williams, E. S. (1981a) Argument Structure and
Morphology. In: The Linguistic Review 1, 81114.
Williams, E. S. (1981b) On the Notions Lexically
Related and Head of a Word. In: Linguistic
Inquiry 12, 245274.
Williams, E. S. (1981c) Transformationless Gram-
mar. In: Linguistic Inquiry 12, 645653.
Williams, E. S. (1985) PRO and the Subject of NP.
In: Natural Language and Linguistic Theory 3,
297315.
Williamson, T. (1986) The Contingent A Priori:
Has it Anything to Do with Indexicals? In: Analysis
46, 113117.
Wilson, D. (1975) Presuppositions and Non-Truth-
Conditional Semantics. New York: Academic Press.
Wilson, P./Sperber, D. (1979) Ordered Entailments:
An Alternative to Presuppositional Theories. In:
Ch. Oh/P. A. Dinneen (eds.) Presuppositions (=
Syntax and Semantics Vol. 11). New York: Aca-
demic Press, 299323.
Wittgenstein, L. (1921) Logisch-Philosophische Ab-
handlung = Tractatus Logico-Philosophicus. In: W.
von Ostwald (ed.) Annalen der Naturphilosophie.
Reprinted with English translation: (1922) Lon-
don: Routledge & Kegan Paul (10th edition 1963).
Reprinted in: Wittgenstein (1969) Schriften 1.
Frankfurt: Suhrkamp, 783.
Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations.
Oxford: Basil Blackwell (2nd edition 1957). Ger-
man edition: Philosophische Untersuchungen.
Frankfurt: Suhrkamp 1971. Reprinted in: Witt-
genstein (1969) Schriften 1. Frankfurt: Suhrkamp,
279544.
Wolter, A. (ed. and transl.) (1962) Joannes Duns
Scotus. Philosophical Writings. Edinburgh: Velson:
Watson, J. B. (1924) Behaviourism. New York: The
Peoples Institute (W. W. Norton). Reprinted:
(1925) London: Kegan, Paul, Trench & Co./(1930)
New York: Norton /(1967) New York: Holt, Ri-
nehart & Winston. German edition (1930) Der
Behaviorismus. Berlin: Deutsche Verlagsanstalt.
Webber, B. L. (1981) Discourse Model Synthesis:
Preliminaries to Reference. In: A. Joshi et al. (ed.)
Elements of Discourse Understanding. Cambridge:
Garland Publishing, 283299.
Webber, B. L. (1984) So What Can We Talk About
Now? In: M. Brady/ R. Berwick (eds.) Computa-
tional Models of Discourse. Cambridge, Mass.: MIT
Press, 331371.
Weber, E. (1981) Rckkehr zur Zeitmaschine? Eine
Bemerkung zu Ballwegs Experimentellem und all-
tagssprachlichen Ursache-Wirkung-Begriff. In: G.
Posch (ed.) Kausalitt Neue Texte. Stuttgart:
Reclam, 157161.
Weber, H. J. (1986) Faktoren einer Textbezogenen
Maschinellen bersetzung: Satzstrukturen, Koh-
renz- und Koreferenz-Relationen, Textorganisa-
tion. In: I. Batori/H. J. Weber (eds.) Neue Anstze
in Maschineller Sprachbersetzung: Wissensrepr-
sentation und Textbezug. Tbingen: Narr, 229261.
Weinrich, H. (1971) Tempus. Besprochene und er-
zhlte Welt. (2nd. ed.) Stuttgart: Kohlhammer.
Welte, W. (1978) Negationslinguistik. Mnchen:
Fink.
Wescoat, M. T. (1984) The Semantics of Preposed
Degree Adjectival Noun Phrases. In: M. Cobler/S.
MacKaye/M T. Wescoat (eds.) Proceedings of the
3rd West Coast Conference on Formal Linguistics.
Stanford, 305316.
Westersthl, D. (1984) Some Results on Quanti-
fiers. In: Notre Dame Journal of Formal Logic 25,
152170.
Westersthl, D. (1985) Logical Constants in Quan-
tifier Languages. In: Linguistics and Philosophy 8,
387413.
Westersthl, D. (1987) Branching Generalized
Quantifiers and Natural Language. In: P. Grden-
fors (ed.) Generalized Quantifiers: Linguistic and
Logical Approaches. Dordrecht: Reidel, 269298.
Westersthl, D. (1989) Quantifiers in Formal and
Natural Language. In: D. Gabbay/F. Guenthner
(eds.) Handbook of Philosophical Logic, Vol. IV.
Topics in the Philosophy of Language. Dordrecht:
Reidel, 1131
Weydt, H. (1969) Abtnungspartikeln. Die deutschen
Modalwrter und ihre franzsischen Entsprechun-
gen. Bad Homburg: Gehlen.
Weydt, H. (ed.) (1978) Die Partikeln der deutschen
Sprache. Berlin: de Gruyter.
Weydt, H. (ed.) (1983) Partikeln und Interaktion.
Tbingen: Niemeyer.
Wheeler, S. C. (1972) Attributives and their Mo-
difiers. In: Nous 6, 310334.
Whitehead, A. N./Russell, B. (1905) Principia Ma-
42. BibliographieBibliography 907
Lexikons. In: H.-G. Bosshardt (ed.) Perspektiven
auf Sprache. Interdisziplinre Beitrge zum Geden-
ken an Hans Hrmann. Berlin: de Gruyter,
212131.
Wunderlich, D. (1987) An Investigation of Lexical
Composition: The Case of German be-verbs. In:
Linguistics 25, 283331.
Wunderlich, D. (1990) On German um: Semantic
and Conceptual Aspects. Ms., Universitt Dssel-
dorf.
Wunderlich, D. (1991) How do Prepositional Phra-
ses Fit into Compositional Syntax and Semantics?
In: Linguistics 29, 591621.
Wunderlich, D./Kaufmann, I. (1990) Lokale Ver-
ben und Prpositionen Semantische und kon-
zeptuelle Aspekte. In: S. W. Felix/S. Kanngieer/
G. Rickheit (eds.) Sprache und Wissen. Studien zur
kognitiven Linguistik. Opladen: Westdeutscher Ver-
lag, 223252.
Wurzel, W. U. (1985) Die Suppletion bei den Di-
mensionsadjektiven. In: Linguistische Studien A
126, 114143.
Wurzel, W. U. (1987) Zur Morphologie der Dimen-
sionsadjektive. In: M. Bierwisch/E. Lang (eds.)
Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimen-
sionsadjektiven. Berlin: Akademie-Verlag, 459
516.
Wygotzky, L. S. (1964) Sprache und Denken. Frank-
furt: Suhrkamp.
Zadeh, L. (1965) Fuzzy Sets. In: Information and
Control 8, 338353.
Zadeh, L. (1975) Fuzzy Logic and Approximate
Reasoning. In: Synthese 30, 407428.
Zaefferer, D. (1979) Sprechakttypen in einer Mon-
tague-Grammatik. Ein modelltheoretischer Ansatz
zur Behandlung illokutionrer Rollen. In: G. Gre-
wendorf (ed.) Sprechaktheorie und Semantik.
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 386416.
Zaefferer, D. (1981) Fragestze und andere For-
mulierungen von Fragen. In: D. Krallmann/G.
Stickel (eds.) Zur Theorie der Frage. Tbingen:
Narr, 4665.
Zaefferer, D. (1982) On a Formal Treatment of
Illocutionary Force Indicators. In: H. Parret/M.
Sbisa/J. Verschueren (eds.) Possibilities and Limi-
tations of Pragmatics. Amsterdam: John Benja-
mins, 779797.
Zaefferer, D. (1983a) The Semantics of Non-Dec-
laratives: Investigating German Exclamatories. In:
R. Buerle/C. Schwarze/ A. von Stechow (eds.)
Meaning, Use and Interpretation of Language. Ber-
lin: de Gruyter, 466490.
Zaefferer, D. (1983b) The Semantics of Sentence
Mood in Typologically Differing Languages. In: S.
Hattori (ed.) Proceedings of the XIIth International
Congress of Linguists. Tokyo: Proceedings Publis-
hing Committee, 553557.
Zaefferer, D. (1984) Frageausdrcke und Fragen im
Deutschen. Zu ihrer Syntax, Semantik und Prag-
matik. Mnchen: Fink.
Wood, F. T. (1956) The Expression of Cause and
Reason in Modern English. In: Moderna Sprk 6,
431438.
Woods, J. (1974) The Logic of Fiction. The Hague:
Mouton.
Wright, C. (1975) On the Coherence of Vague Pre-
dicates. In: Synthese 30, 325365.1
Wunderlich, D. (1970) Tempus und Zeitreferenz im
Deutschen (= Linguistische Reihe 5). Mnchen:
Hueber.
Wunderlich, D. (1971) Warum die Darstellung von
Nominalisierungen problematisch bleibt. In: D.
Wunderlich (ed.) Probleme und Fortschritte der
Transformationsgrammatik. Referate des 4. Lingui-
stischen Kolloquiums. Mnchen: Hueber, 251
277.
Wunderlich, D. (1973) Vergleichsstze. In: F. Kie-
fer/N. Ruwet (eds.) Generative Grammar in Europe.
Dordrecht: Reidel, 629672.
Wunderlich, D. (1976) Studien zur Sprechakttheo-
rie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Wunderlich, D. (1976a) Fragestze und Fragen. In:
Wunderlich (1976), 181250.
Wunderlich, D. (1978) Wie analysiert man Gespr-
che? Beispiel Wegausknfte. In: Linguistische Be-
richte 58, 4176.
Wunderlich, D. (1979) Meaning and Context-De-
pendence. In: R. Buerle/U. Egli/A. von Stechow
(eds.) Semantics from Different Points of View. Ber-
lin: Springer, 161171.
Wunderlich, D. (1980) Arbeitsbuch Semantik.
Frankfurt: Athenum.
Wunderlich, D. (1981) Linguistic Strategies. In: F.
Coulmas (ed.) A Festschrift for Native Speaker. The
Hague: Mouton, 279296.
Wunderlich, D. (1982) Sprache und Raum. In: Stu-
dium Linguistik 12, 119; 13, 3759.
Wunderlich, D. (1983a) Was sind Aufforderungs-
stze? In: G. Stickel (ed.) Pragmatik in der Gram-
matik. IdS-Jahrbuch 1983. Dsseldorf: Schwann,
92117.
Wunderlich, D. (1983b) Glck im Unglck. In:
Zeitschrift fr Literaturwissenschaft und Linguistik
50, 157172.
Wunderlich, D. (1984) Zur Syntax der Prpositio-
nalphrase im Deutschen. In: Zeitschrift fr Sprach-
wissenschaft 3, 6599.
Wunderlich, D. (1985a) ber die Argumente des
Verbs. In: Linguistische Berichte 97, 183227.
Wunderlich, D. (1985b) Raum, Zeit und das Le-
xikon. In: H. Schweizer (ed.) Sprache und Raum.
Stuttgart: Metzler, 6689.
Wunderlich, D. (1985c) Raumkonzepte. Zur Se-
mantik der lokalen Prpositionen. In: Th. T Ball-
mer/R. Posner (eds.) Nach-Chomskysche Linguistik.
Berlin: de Gruyter 1985, 340351.
Wunderlich, D. (1986a) Wie kommen wir zu einer
Klassifikation der Sprechakte? In: Neuphilologische
Mitteilungen 87, 498509.
Wunderlich, D. (1986b) Raum und die Struktur des
908 XII. Bibliographischer Anhang und Register
5.
Zimmermann, Th. E. (1979) Intensionale Logik und
natrliche Sprache. Eine elementare aber kritische
Darstellung der Montague'schen Referenztheorie.
Arbeitspapier 33 des SFB 99, Universitt Konstanz.
Zimmermann, Th. E. (1985) Remarks on Groenen-
dijk and Stokhof`s Theory of Indirect Questions.
In: Linguistics and Philosophy 8, 431-448.
Zimmermann, Th. E. (1986) Transparent Adverbs
and Scopeless Quantifiers. In: J. Groenendijk/D.
de Jongh/M. Stokhof (eds.) Foundations of Prag-
matics and Lexical Semantics. Dordrecht: Foris,
81-99.
Zimmermann, Th. E. (1987) Intensional Logic and
Two-sorted Type Theory. Ph. D. Dissertation, Uni-
versitt Konstanz.
Zuber, R. (1983) Non-Declarative Sentences. Am-
sterdam: Benjamins.
Zwarts, F. (1981) Negatief polaire uitdrukkingen I.
In: Glot 4, 35-132.
Zwarts, F. (1983) Determiners: A Relational Per-
spective. In: A. ter Meulen (ed.) Studies in Model-
theoretic Semantics. Dordrecht: Foris, 37-62.
Zwarts, F. (1986) Categoriale Grammatica en Al-
gebraische Semantiek. Ph. D. Dissertation, Univer-
sity of Groningen.
Zwicky, A. (1969) A Note on Becoming. In: R. I.
Binnick/A. Davison/G. M. Green/J. L. Morgan
(eds.) Papers from the 5th Regional Meeting of the
Chicago Linguistic Society. Chicago, 295-296.
Zaefferer, D. (1988) On the Coding of Sentential
Modality. In: Bechert et al. (eds.) Proceedings of
the ESF Workshop on Typology of Languages in
Europe.(to appear)
Zaefferer, D. (1989) Untersuchungen zur strukturel-
len Bedeutung deutscher Stze mit Hilfe einer fall-
basierten Sprechakttheorie. Habilitationsschrift,
Universitt Mnchen.
Zaefferer, D. (ed.) (1991) Semantic Universals and
Universal Semantics (= GRASS Series No. 12).
Dordrecht: Foris. (to appear)
Zeevat, H. (1986) A Treatment of Belief Sentences
in Discourse Representation Theory. In: J. Groe-
nendijk/D. de Jongh/M. Stokhof (eds.) Studies in
Discourse Representation Theory and the Theory of
Generalized Quantifiers. Dordrecht: Foris,
189-215.
Zemach, E. (1970) Four Ontologies. In: Journal of
Philosophy 62, 213-247. - Reprinted in: F. J.
Pelletier (ed.) (1979) Mass Terms. Some Philoso-
phical Problems. Dordrecht: Reidel, 63-80.
Zemach, E. (1976) Putnam`s Theory on the Refe-
rence of Substance Terms. In: Journal of Philosophy
73, 116-127.
Zifonun, G. (1976) Pragmatik der Negation. In: R.
Kern (ed.) Lwen und Sprachtiger. Louvain: Edi-
tions Peeters, 99-109.
Zimmer, K. E. (1964) Affixal Negation in English
and Other Languages. An Investigation of Restricted
Productivity. Suppl. Word 20/2, Monograph No.
43. Personenregister
Name Index
54, 82, 273-275, 277, 278,
323
B
Bach 20, 45, 124, 127, 131, 416,
440, 441, 451, 546-548, 734,
848, 851, 858
Baker 130, 131, 136, 591, 592,
690
Ballmer 127, 672, 693, 843
Ballweg 626, 708, 727-729,
730, 732, 735-739, 743
Bar-Hillel 38, 122, 148
Barron 699
Bartsch 225, 433, 451, 453, 456,
562, 665, 673, 674
Barwise 21, 25, 31, 41, 43, 57,
71-88, 164, 424-426, 435,
450, 451, 466-471, 474, 476,
477, 486, 526-529, 531, 534,
784, 787, 807
Andersson 452, 677
Andrews 677, 678
Andrzejewski 401
Anscombe 647
Anscombre 586, 615, 677
Aoun 537
quist 39, 334, 338, 339, 340,
643, 736
Arens 692, 734
Ariel 797
Aristoteles (Aristotle) 333, 383,
384, 386-388, 405,
459-462, 464, 472, 474, 627,
856
Arlotto 677
Armstrong 710
Aronoff 441
Asher 250, 555, 556
Atlas 299, 575, 581, 582
Austin 15, 19, 20, 22, 23, 44, 45,
A
Abbott 391, 627, 690
Abelard 383
Abraham 61, 634, 696
Adelaar 746
Adelung 630
Ades 124
Aijmer 629, 630
At Hamou 786
Ajdukiewicz 92, 95, 120, 121,
148, 773
Akmajian 401, 402
Allan 400, 401
Allen 415
Allerton 805
Allgayer 440
Almog 228
Alston 12, 44
Altham 425
Altmann 274, 285, 786, 793,
800, 802, 807
Andersen 60, 672, 674, 677, 758,
43. Personenregister 909
Cooper 57, 80, 100, 104,
424426, 435, 466468,
469, 470, 471, 474, 485,
526528, 529, 531, 534, 548,
652, 736, 738, 786, 789, 844,
855, 856, 859
Copi 388, 393
Coppleston 382384
Cormack 590
Coseriu 16, 61, 67
Coulmas 48
Coyaud 786
Creary 772
Cresswell 21, 31, 44, 71, 74, 80,
82, 8487, 92, 93, 98, 108,
109, 113, 116, 119, 121, 123,
124, 130, 153, 155, 226228,
279, 282, 285, 337, 339, 370,
408, 409, 442, 446, 447,
454456, 641, 666, 669, 670,
671674, 679, 680, 685, 686,
690, 710712, 714,
717722, 736, 751754,
758, 771, 780, 790, 819, 833,
848, 851
Cruttenden 805
Curme 633, 733
Cushing 652
Czepluch 697
D
Dahl 381, 414, 423, 562, 563,
564, 595
Dal 629
Dalrymple 228
Daniels 441
Davidson 24, 31, 178, 283, 416,
442, 449, 453, 454, 486, 717,
750, 754, 755, 765, 769
Davis 846
Davison 571
de Jong 528
de Mey 420, 429, 440
de Morgan 611, 620, 621
de Sousa 392, 398
de Spengler 633, 634
Decarte 184, 226
Declerck 376
den Besten 675
Denny 758
Devitt 369
Devlin 859
Dieterich 677, 686
Diomedes 383
Dionysios Thrax 367, 692, 729
DiSciullo 131, 136, 138, 139,
140, 141, 142, 441
Dixon 658, 660, 672, 693
Doherty 54, 285, 588, 675, 677,
686
Dhmann 579, 612
Bhler 120, 227
Bull 641, 729, 731733
Bunt 405, 406, 407, 408, 415,
435
Burge 369, 396, 403, 406
Burleigh 287
Burnham 633
Bursill-Hall 384
Burton-Roberts 329
Burzio 661
Buscha 614, 662
C
Canfield 389
Caramazza 552
Carden 688
Cardinaletti 662
Carlson, G. N. 371, 373,
375377, 379, 380, 381, 388,
403, 404, 406, 408, 414,
420423, 512, 513, 522, 523,
534, 659, 672, 707, 858
Carlson, L. 416
Carnap 6, 9, 10, 21, 48, 91, 108,
225, 340, 351, 353, 365, 367,
368, 408, 560, 718
Cartwright 407409
Casadio 92, 120
Cascio 736, 739, 746
Cassam 389, 393
Castaeda 226, 227, 369
Caton 330
Chafe 404, 414, 707
Chandler 388
Chao 544
Charnik 549
Chastain 534
Cheng 405
Chierchia 413, 454, 859
Choe 440
Chomsky 4, 5, 14, 15, 59, 66,
90, 91, 95, 97, 100, 101, 131,
132, 145, 382, 419, 441, 445,
534, 536539, 544, 603, 650,
661, 663, 672, 673, 675, 677,
690, 696, 698, 702, 763,
804806, 812814, 816,
825, 826
Church 463, 715, 846
Cinque 672
Clark 566, 672, 783
Clarke 403
Clay 406
Closs-Traugott 783, 800, 801
Cocchiarella 388, 394, 395, 413,
414, 454
Cohen 327, 334, 340
Comrie 292, 451, 708, 722, 723,
726, 728, 730732, 739, 742
Contreras 805
Cook 388, 407
652, 802, 842, 844, 851, 855,
856, 859
Buerle 227, 228, 341, 555, 559,
652, 698, 727, 728, 733740,
742, 743
Baumgrtner 733
Bayer 447, 807, 808
Bealer 385, 403
Beauze 729, 733, 734
Bech 139, 142, 595, 631
Beesley 680
Behaghel 60, 694
Bellert 633
Belnap 334, 341, 860
Bennett 15, 227, 228, 341, 342,
381, 392, 403, 407, 408, 431,
433, 666, 672, 764, 771, 780,
786
Bennis 677
Berlin 68, 397, 414, 672
Bernini 565
Bertinetto 738, 743
Biermann 419
Bierwisch 33, 46, 4850, 52, 54,
69, 70, 263, 280, 285, 441,
442, 453, 456, 457, 605, 614,
616, 659, 662664, 667,
669672, 674, 696, 759, 762,
763, 771, 773775, 777, 780
Binnick 61
Black 263, 661
Blatz 730, 731, 733
Blau 253, 254, 256, 257, 259,
261, 406, 424, 425, 433, 438,
580, 582, 584, 710, 838, 843,
844, 846, 859
Bloomfield 5, 14, 659
Boehner 382
Bor 291, 299, 343, 345, 346,
348, 369, 533, 581
Boethius 369, 384
Boettcher 629
Bolinger 665, 666, 672
Bolton 385, 391
Bondzio 557
Bool 836, 855, 856
Borer 672
Borkin 639
Borsley 677
Bosch 546
Bower 68
Bowers 677
Bracco 677
Brame 690
Braue 634, 639, 793
Bral 1
Brecht 739, 747
Bredlove 414
Brekle 59
Brennenstuhl 672, 693
Bresnan 676, 677, 690, 699, 702
Brown 48
Brugmann 286, 782
910
Grice 15, 19, 20, 31, 32, 45, 47,
232, 283, 295, 300, 321333,
416, 515, 516, 545, 566, 571,
588, 629, 651, 653655, 671,
684, 739, 802
Grimshaw 443, 661
Groenendijk 336, 337, 344347,
486, 645, 852, 860
Gross 586
Grosz 554, 555
Gruber 697, 764, 784
Guenthner 736, 737
Gupta 384, 394, 395
H
Haack 262
Haas 816
Habel 759, 781
Haider 661, 662, 672
Haig 677
Haik 539
Haiman 638
Hajicov 576
Hale 677
Hall 62
Halliday 17, 633, 634, 798
Hamann 670673
Hamblin 339, 341, 342
Hankamer 675, 676
Hare 23, 44, 685
Harman 275
Harnish 20, 45
Harrah 337339, 341
Harries-Deslisle 577
Harris 15, 17
Hartung 633
Hasan 633, 634
Hasegawa 690
Hauenschild 555, 556
Hausser 279, 340, 341, 431, 433,
672
Hawkins 506, 514, 515, 534,
557, 782
Heger 696, 732
Heidolph 633
Heim 42, 91, 227, 233,
241244, 246, 248, 249, 301,
307, 308, 311, 312, 317, 318,
330, 331, 377, 486, 487, 523,
534, 549, 550, 551, 557, 656,
823, 842, 845, 852
Heinmki 629
Heinemann 561
Helbig 662, 698
Hellan 408, 670, 673, 677, 680,
683, 690
Hendrick 677
Hendriks 486
Henschelmann 627
Heny 677
Henzen 441
Herbermann 60
36, 37, 64, 65, 286, 390, 393,
518520, 521, 526, 534, 543,
710, 716
Foolen 794
Forbes 226
Franck 801
Franois 415, 707
Fraser 448, 789, 791, 793
Frege 2, 9, 10, 20, 23, 40, 55,
75, 9597, 101, 106, 110,
113, 114, 123, 150, 167, 225,
226, 270274, 292, 295, 296,
319, 321, 323, 324, 351, 353,
354, 365, 367369, 385, 405,
459, 460, 462464, 472, 479,
483, 493, 495498, 503, 504,
505, 507, 513, 524, 526, 527,
529, 533, 651, 679, 692,
713715
Fllesdal 281
G
Gaatone 567
Gabbay 406, 408, 577, 739
Gaifman 122
Gallin 226
Galton 451, 768
Grdenfors 425, 435
Gardies 227
Gardiner 369
Garey 415
Gawron 859
Gazdar 40, 45, 47, 91, 130, 133,
144, 145, 231233, 235, 236,
277, 280, 282, 301, 304307,
309, 311, 312, 327331, 382,
496, 533, 534, 581, 603, 611,
612, 614, 621, 677, 790, 794,
817, 842, 845
Geach 124, 125, 127, 129, 140,
141, 148, 151, 297, 300, 394
Geckeler 16
Geis 656, 690, 769
George 603
Gerling 693
Gerstner 423, 534, 858
Ghiselin 389
Gibbard 651, 655
Gil 440
Gillon 379
Givn 555, 565, 566, 570, 571
Goguen 259, 267
Goodenough 16
Goodman 405, 406, 435, 435
Gordon 17, 18, 329
Grabski 227
Grandy 333, 403
Green 688, 791, 801
Greenberg 401
Grewendorf 45, 277, 278, 280,
286, 630, 736, 739
Donnellan 43, 227, 368, 388,
389, 391, 497, 498, 499, 533,
534
Doron 534
Dougherty 418, 432
Downes 277
Downing 60
Dowty 16, 31, 48, 60, 62, 63,
376, 416, 545, 547, 556, 626,
627, 698, 701703, 705, 707,
708, 734, 736, 737, 739, 753,
769771, 773, 775, 846, 850,
858
Dresher 690
Dressler 416
Dretske 805
Drossard 400
Dryer 564, 574
Ducrot 586, 590, 615, 634, 794
Dummett 23, 267, 368, 369
Dupr 390, 396
E
Eberle 406, 435, 440
Ebert 534
Edmondson 787
Egli 334, 340, 341, 367, 549, 652
Ehrich 778
Eikmeyer 408
Eisenberg 637
Emonds 672, 675
Enc 228, 383, 504, 534
Engdahl 126, 544, 545
Engel 698
Erdmann 250, 256
Esau 443, 448, 453
Etchemendy 859
Evans 228, 534, 536, 545, 546
Ewans 368, 369
F
Fabricius-Hansen 707, 709,
727729, 732, 736742,
746
Fales 390
Falkenberg 561
Faltz 125, 435, 547, 666, 667,
672, 856
Fanselow 59, 60, 63, 662, 813
Farkas 376, 381, 656
Fauconnier 311, 312, 317, 687
Feldman 643, 647
Fry 805, 823
Fiengo 432
Fillmore 293, 559, 696, 697, 701,
758, 764, 779, 782
Fine 254, 255, 261, 264, 422
Firth 17, 18
Fleischer 58, 441
Fodor 4, 13, 16, 18, 27, 28, 31,
43. Personenregister 911
Klein, E. 114, 225, 261, 674,
680, 684, 685, 687, 690
Klein, W. 120, 227, 603, 637,
814, 823
Klima 537, 563, 591
Kluge 367
Kneale 295
Knecht 677
Klver 401
Knig 604, 632, 635638, 786,
790, 793, 799, 800
Koopman 539, 540, 812
Kosslyn 782
Koster 702
Kramsky 372
Krantz 408, 678, 679
Kratzer 38, 113, 121, 130, 145,
225, 227, 404, 421, 534, 626,
641645, 649, 654, 655, 736,
737, 740, 851
Kretzman 383, 384
Krifka 371, 381, 408, 409, 416,
419, 421, 423, 440, 534, 568,
591, 592, 593, 768, 810, 858,
859
Kripke 67, 226228, 242,
368370, 385393, 396,
497499, 519, 533, 534, 659,
672
Kroch 483
Kulas 534
Kuno 448, 677
Kper 630
Krschner 59, 60, 567, 568
Kutschera 57, 64, 65
L
Labov 65
Ladusaw 316, 426, 468, 534,
591593, 670, 687, 795, 811
Lakoff 29, 30, 31, 48, 228, 257,
258, 265, 277, 282, 283, 329,
389, 390, 397, 441, 615, 634,
660, 672, 687, 690, 765, 783
Lambek 121, 124, 126, 127
Lambrecht 555
Landman 434, 644, 645, 654,
859
Lang 33, 45, 46, 49, 52, 54, 285,
556, 577, 600, 603610, 612,
614, 616, 617, 619, 622, 624,
629, 630, 634, 762, 771, 778,
792
Langacker 536, 537, 782
Langendoen 301, 429, 431, 432
Lapointe 60
Lappin 280, 282, 283
Larson 674, 689, 690
Lasnik 432, 536, 546, 675, 826
Latzel 741
Lawler 397, 412
Laycock 405, 407
Jayaseelan 690
Jefferson 48
Jensen 60
Jespersen 340, 399, 406, 564,
565, 567, 568, 595, 692, 726,
727, 729, 731733, 740
Johnson-Laird 37, 62, 67, 672,
778, 779, 783
Jolies 16
K
Kac 630
Kadmon 534
Khler 675
Kaiser 672
Kalish 838, 841
Kamp 42, 225, 241243, 250,
254, 257, 259, 260, 262,
267269, 280, 377, 486, 487,
534, 535, 549, 550, 551, 557,
558, 661, 666, 667, 672674,
680, 681, 684, 736, 739, 744,
745, 845, 852, 854
Kanngieer 60
Kant 325, 393
Kantor 554
Kaplan 41, 91, 110, 113, 115,
117119, 123, 225228,
368370, 497, 498, 533, 534,
684, 699
Karmiloff-Smith 552
Karttunen 40, 233, 283, 284,
292, 295, 301, 302, 307, 312,
318, 328, 330, 331, 339,
342345, 496, 533, 534, 551,
589, 645, 706, 791793, 796,
799, 802, 805, 807809, 811,
818, 845
Kasher 284
Katriel 797
Katz 4, 7, 13, 16, 18, 23, 24, 31,
36, 56, 64, 276278, 282,
283, 335, 639, 672
Kaufmann 775, 776, 781
Kay 68, 414, 672
Kayne 812
Keenan 57, 125, 292, 295, 340,
341, 430, 435, 473, 475, 476,
534, 540, 547, 666, 667, 672,
758, 856
Keil 69, 396
Kempson 7, 299, 329, 534, 581,
590, 791
Kempter 662
Kenny 384, 647
Kim 756
Kindt 267, 268
Kinkade 382
Kiparsky 60, 293, 447, 706
Kiss 577, 805, 813
Kitcher 389
Kleene 253, 842844
Heringer 739
Hermodsson 633, 636
Herskovits 782
Herweg 767769
Heyer 423, 858
Higginbotham 432, 483, 539,
773
Higgins 677
Hill 779
Hinrichs 408, 416, 421, 440, 736,
739, 744, 858
Hinst 838
Hintikka 85, 78, 225, 303, 305,
338340, 534, 710, 714, 718,
753
Hirschbhler 283
Hirst 552
Hirt 568
Hjelmslev 16
Hobbs 485, 556
Hochberg 369
Hoeksema 677, 687, 689
Hoenigswald 17
Hoepelman 261, 406, 416, 578,
674, 680, 685
Hhle 59, 139, 698, 805, 823
Hopper 694, 695
Hrmann 425
Horn 295, 305, 316, 328, 534,
564, 567, 568, 581, 586, 587,
589, 590, 591, 592, 690, 791,
793, 794, 805, 808
Horvath 805, 813, 826
Houweling 736
Huckin 678
Huddleston 675677
Hughes 389, 641, 848
Hull 340, 341, 389
Husserl 92
I
Ipsen 16
Irvine 383
J
Jackendoff 36, 38, 52, 59, 62,
63, 65, 382, 441, 534, 537,
591, 650, 677, 697, 758, 761,
764, 771773, 784, 805, 806,
814, 825, 826
Jacobs 284, 553, 563, 570, 571,
573, 576578, 583, 585, 586,
589, 593595, 619,
786789, 790, 795800,
802, 805, 807, 808, 810, 817,
819, 822, 826
Jakobson 16
Jansen 402, 408
Janssen 105, 106, 227, 464, 485,
852
Janen 697
912
N
Naess 250
Napoli 675678, 686
Neale 534
Nedjalkov 708
Nerbonne 728, 736739
Nespor 676, 677
Newmeyer 61, 65, 131
Noreen 399
Norton 388
Nuchelman 287
O
Ockham 382
Odgen 8, 13, 14
Oehrle 124
Oetke 611, 620
Oh 442
Orthen 693
Osgood 664
Ostler 764, 765
P
Palmer 650
Parret 390
Parsons 100, 104, 370, 406, 408,
409, 453, 672, 858
Partee 27, 31, 40, 96, 111, 125,
134, 228, 279, 404, 448, 485,
486, 534, 535, 540, 546548,
556, 611, 614, 621, 652, 656,
664, 712, 716, 735, 736, 744,
846, 848, 849, 851, 859
Pasch 624, 629, 630
Paul 804, 805, 822
Pause 554556
Payne 562565, 586
Peacocke 57
Peano 272
Peirce 6, 251, 640, 655
Pelletier 259, 380, 381, 400, 403,
405, 406, 408, 423, 858
Percival 694
Perlmutter 650, 661, 690
Perry 21, 25, 31, 41, 43, 7188,
226, 450, 451, 842, 851, 859
Pesetsky 58, 59, 441
Peters 31, 38, 252, 284, 295, 301,
302, 307, 318, 328, 330, 331,
376, 496, 533, 589, 791, 793,
796, 802, 805, 807809, 811,
818, 845, 848, 851, 859
Peterson 447
Petfi 696
Pilch 677
Pinborg 384, 692, 694
Pinkal 38, 39, 225, 255,
257262, 267269, 550,
554, 660, 661, 665, 667, 672,
681, 843
Pinkham 675, 677
M
Mackie 786
Maclaran 534
Maienborn 778
Malinowski 44
Malotki 64
Mandelbaum 672
Manzini 624
Manzotti 707
Marchand 441
Martin 614, 629, 801
Massey 435
Matthews 2
May 100, 132, 476, 478, 480,
482, 483, 809, 812
McCarthy 57
McCawley 31, 62, 65, 441, 447,
652, 677, 678, 687, 787, 792
McConnell-Ginet 684
McGarry 384
McGloin 567
McKay 390
McKeon 383
McNeill 672
Medin 65
Meggle 45, 333
Meinong 370
Mellor 390
Mey 677
Michael 692, 694, 730
Mill 367, 627
Miller 672, 778, 779
Milner 676, 677
Milsark 380, 528, 532535, 707
Mithun 846
Mittwoch 701
Moeschler 633, 634
Molinelli 565
Mondadori 388
Montague 11, 21, 22, 30, 31, 38,
40, 42, 57, 62, 63, 84,
9093, 96115, 117,
120123, 133, 147, 148, 154,
225, 226, 228, 279, 280, 330,
341, 342, 368, 373, 376, 382,
403, 407, 408, 412, 437, 442,
449, 450, 451, 453, 459, 467,
471, 480, 483487, 523, 593,
663, 666, 673, 735, 736, 753,
756, 769, 770, 773, 809, 834,
835, 841, 846849, 856, 875
Moody 384
Moortgat 142
Moravcsik 403, 405408, 568,
577
Morel 639
Morgan 61, 259, 311, 329
Morreall 630
Morris 6, 14, 35, 91
Moss 57, 475
Mostowski 460, 466, 467, 471,
855
Motsch 59, 285, 442
Muskens 851
Lebeaux 441
Lee 284
Lees 59, 441, 677, 690
Legrand 611
Lehrer 16, 401, 402, 584, 674
Leibniz 393, 849
Leisi 399, 400, 415, 416, 693
Lemmon 45, 449
Lenerz 442, 739
Leonard 334, 335, 406, 435
Lerch 633
Lerner 369, 794, 798, 808
Lesniewski 92, 406, 435
Levelt 778
Levi 59
Levin 130, 154
Levinson 6, 35, 48, 280, 575,
581, 582, 637, 790
Lewis 13, 31, 4446, 62, 93, 98,
108, 109, 118, 121, 122, 124,
148, 226228, 242,
278280, 282, 283, 312, 333,
335338, 340, 346, 370, 375,
460, 516, 523, 534, 557, 626,
644, 652, 653, 655, 656, 680,
683, 684, 718, 719, 722,
752754, 788
Li 699, 762
Liddell 690
Lieb 576
Lieber 59, 60
Lindner 782
Lindstrm 459, 471, 472
Linebarger 589, 591, 592
Link 231, 279, 406, 408, 409,
411, 412, 424, 428, 434438,
440, 526, 533, 534, 703705,
781, 838, 842, 845, 846, 848,
850, 858, 859
Linsky 368
Lbel 402
Lbner 42, 43, 50, 451, 461,
534, 535, 557, 558, 564, 636,
705, 706, 767, 768, 775, 792,
793, 796, 800, 802, 805,
821825, 846, 856
LoCascio 854
Locke 385, 386, 393, 394
Longacre 760
Lounsbury 16
Ludlow 534
ukasiewicz 252, 253, 258260,
842
Lundy 603
Luschei 406
Lutzeier 64, 758
Lnning 406408, 415, 435,
856
Lycan 291, 299, 392, 533, 581
Lyons 3, 5, 1417, 23, 95, 96,
264, 285, 286, 403, 559, 584,
645, 674, 692, 693, 723, 726,
727, 783
43. Personenregister 913
Sellars 298, 394
Sells 544, 858
Serzisko 401
Seuren 294, 303, 311, 312,
314317, 480, 562, 582, 669,
673676, 684, 687, 689, 691
Shamir 122
Shapiro 392
Sharvy 400
Shibatani 62, 708
Shieber 485
Shortliffe 260
Sidner 553, 554, 556, 558
Siebert-Ott 703
Siegel 665, 672, 680, 685
Sinclair 17
Sitta 629
Skinner 14
Smaby 227, 549, 552
Smith 17, 65, 333, 672, 677, 736,
739
Smith-Stark 419
Soames 233, 287, 295, 301, 304,
305, 533, 790, 802, 845
Sober 389
Solfjeld 747
Sondheimer 765767, 774
Sperber 20, 47, 333, 582, 802
Sportiche 537, 539, 540, 812
Srivastav 371
Stalnaker 41, 83, 115, 117, 118,
226228, 233, 235, 236, 239,
240, 250, 287, 290, 307, 310,
311, 318, 330, 331, 369,
497499, 518520, 533,
626, 712, 713, 748, 786, 792,
845
Stassen 674676
Stavi 435, 856
Steedman 124, 127
Steel 334, 341, 860
Steinitz 728, 760, 783
Stenius 23, 46, 272, 281, 335
Sterelny 392, 393
Stern 390
Sternefeld 133, 143, 145147,
445, 661, 697, 798, 813
Steube 736
Stewart 406, 415
Stickel 563
Stockwell 419, 448, 534
Stokhof 336, 337, 344,
345347, 486, 645, 852, 860
Stong-Jensen 60
Storch 707
Strawson 291, 296, 298, 299,
308, 327, 328, 368, 369, 393,
394, 407, 408, 446, 533, 534
Stump 656
Sugioka 376, 381, 656
Suppes 154
Szabolcsi 124, 127, 535,
576578, 590
Rohrer 59, 60, 416, 731, 732,
736, 738, 739, 744747, 854
Rooth 125, 440, 478, 486, 534,
549, 611, 614, 621, 807,
810812, 814820, 822,
823, 825833
Rosch 16, 68, 782
Ross 45, 277, 278, 281, 282, 537,
540, 629, 630, 650, 678, 685,
687, 690, 786, 789
Rudolph 628, 631
Rusieki 674
Russell 9, 41, 75, 96, 178, 226,
228, 291, 296, 297, 328, 350,
351, 353, 365, 368, 370, 385,
488493, 495497, 504,
505, 507509, 513, 524, 526,
530, 531, 533, 534, 581, 679,
687, 689, 717, 750, 841
Rutherford 630, 130
Ryle 626
S
Sb 627, 701, 735, 736, 746
Sacks 48
Sadock 45, 277, 286, 295, 331,
630
Safir 534, 539, 540, 707
Sag 114, 318, 518521, 526,
534, 540, 603, 677, 830, 860
Saile 777, 780
Salisbury 384
Salmon 396, 533
Sapir 659, 672, 674
Saussure 15
Savin 301
Scabolcsi 813
Scha 422, 429431, 433, 473
Schachter 448, 534, 672
Schublin 443
Schegloff 48
Schenkel 698
Schiffer 31, 332, 333
Schmerling 600
Schmidt 566
Schnfinkel 127
Schubert 380, 381, 400, 405,
406, 408, 423
Schumacher 693, 698
Schtze 436, 440
Schwartz 67, 385, 388, 390392
Schwarz 369, 675, 677, 686
Schwarze 693, 698
Schwyzer 729, 730, 742
Scott 225
Scotus 369
Searle 20, 23, 31, 4547, 54, 62,
281284, 324, 329, 368, 860
Segerberg 226, 369, 641
Selkirk 59, 401, 402, 441, 806,
826
Plank 699, 787
Plann 677
Plantinga 369, 388
Plato 692
Platts 31
Platzack 707
Pollard 860
Porterfield 371
Porzig 16, 18
Posner 47, 578, 600
Post 252
Postal 4, 16, 276278, 282, 283,
335, 424, 690
Price 388
Prince 318
Prior 25, 333, 729, 734
Priscian 2, 729
Projektgruppe Verbvalenz 693
Pullum 612
Pulman 62, 65, 66
Pusch 441, 634
Putnam 16, 66, 67, 263, 369,
385393, 396, 398
Ptz 662
Q
Quine 14, 15, 18, 31, 66, 127,
262, 263, 267, 368, 369, 401,
403, 405408, 415, 451, 719,
787, 838, 841
Quirk 629, 630, 633, 658, 726,
730, 740, 741, 786, 791
R
Ramat 565
Ramsey 626
Raven 414
Reddig-Siekmann 440
Reichenbach 226, 340, 453, 454,
625, 633, 663, 666, 729,
732734, 737739
Reichgelt 311
Reichmann 555
Reinhart 481, 536, 537, 539,
544, 545, 549, 550, 556, 573,
690
Reis 59, 625, 629, 630
Renz 603
Rescher 252, 729, 734
Reuland 534
Reyle 440, 852, 854
Richards 8, 13, 14
Riemsdijk 131
Ries 97
Ristow 781
Rivara 677
Rivero 677
Roberts 440
Robins 17
Roeper 406, 441, 445
914
Weinrich 729
Weisler 603
Welsh 390, 391
Welte 567, 585, 591
Wescoat 685
Westersthl 57, 58, 425, 462,
475, 477
Wexler 672
Weydt 633, 801
Wheeler 124, 674, 685, 755, 756
Whitehead 228, 841
Whorf 64, 672
Wiggins 388, 393, 394
Wilkinson 656
Wille 858
Williams 59, 60, 131, 136,
138142, 441, 445, 540, 603,
650, 677, 690, 830
Williamson 226
Wilson 20, 47, 291, 299, 304,
329, 333, 582, 802
Wittgenstein 18, 19, 21, 44, 54,
250, 263, 271274, 368, 385
Woods 370
Wright 267, 626, 627
Wunderlich 32, 33, 46, 48, 131,
279, 285, 342, 585, 603, 634,
673, 677, 693, 698, 727, 728,
731, 733, 734, 738, 758, 761,
764, 773, 776, 779, 781, 783
Wurzel 677
Wygotski 275
Z
Zadeh 257, 258, 261
Zaefferer 274, 276, 278, 283,
284, 340, 440, 579, 860
Zaenen 736, 753
Zeevat 852
Zemach 388, 390, 392, 407, 408
Zifoun 566
Zimmer 585
Zimmermann 129, 344, 440, 794,
808, 821, 833
Zuber 276, 284
Zwarts 316, 468, 470, 567
Zwicky 286, 685
300, 301, 304306,
309312
van Dijk 626
van Eijck 462, 486
van Fraassen 254, 298
Vandeloise 782
Vanderveken 275, 283, 284, 286,
860
Varga 859
Vater 447, 727, 733
Veltman 267, 645, 654, 859
Vendler 397, 415, 442, 443, 446,
451, 744
Vennemann 562, 665, 673, 674
Verkuyl 416, 421, 425, 707
Vet 736, 739, 854
Vlach 225, 688
von Stechow 44, 119, 125127,
129, 130, 133, 142, 143,
145147, 154, 225228,
285, 286, 370, 408, 409, 440,
445, 533, 535, 562, 592, 661,
673, 674, 680, 682691, 697,
702, 703, 713, 719721, 767,
790, 805, 806, 813, 814,
819823, 826, 833, 851
von Wright 647
W
Wada 555, 556
Wahlster 260
Waismann 263
Wald 406408
Wali 447
Walker 327
Wall 31, 376
Wallace 31, 394, 669, 673, 674,
685
Walter 693
Ware 400
Warner 333
Wasow 445, 603, 677
Watson 13
Webber 552
Weber 555, 626
Weijters 315
Weinreich 18
T
Taglicht 786, 798, 809812
Talmy 761
Tarski 21, 112, 225, 460, 465,
480, 856
Taylor 415, 753
Tedeschi 736, 753
Tennant 590
ter Meulen 401, 403, 405, 406,
408, 413, 415, 416, 534
Tesnire 697, 698
Thomason 75, 90, 267, 450, 451,
453, 715, 722, 748, 846
Thompson 445, 678, 694, 695,
699, 760, 762
Thomson 755
Thrax Dionysios 367, 692, 729
Tich 226, 337, 339, 736
Todt 258, 261
Toman 59, 60, 661, 662, 672
Tottie 585
Toulmin 637
Traugott 783, 800, 801
Trier 16, 18, 64
Turner 413, 454, 859
U
Uhlig 367
Uhmann 806
Ullmann 4, 8
Ullmer-Ehrich 443, 448, 453
Ultan 674, 676, 677
Unger 390
Urquhart 729, 734
V
Valgard 630
van Benthem 57, 58, 127129,
425, 435, 462, 467, 470,
474477, 674, 684, 685, 734,
736, 854, 856
van Dalen 465
van der Auwera 794
van der Sandt 231, 233, 290,
Esther Damschen/Carola Hhle, Dsseldorf
(Bundesrepublik Deutschland)
44. Sachregister 915
44. Sachregister
Subject Index
Bedeutungspostulat / meaning
postulate 29, 48, 62
Bedeutungstheorie, relationale 86
Bedeutungszerlegung
s. semanti-sche
Dekomposition
behavioristische Semantik 13
Belegungsspielraum 609
Believe de re 362, 719
Believe de se 718
Benennung / naming 9
Benennungstheorie 367
Benennungstheorie, reine 350
bestimmter Artikel
s. definiterArtikel
Betrachtzeit 190,
737
Bewege- / move- 133
Bewertung
s. assignment func-tion
Bewertungssemantik 841
Bewutseinsinhalt 182, 185
bijection principle 540, 813
binding 95, 173, 463, 481
binding operator 543
binding, local 540
binding, syntactic 537
Boolesche Modellstruktur mit
Gruppen 436
Boolesche Semantik 856
bound variable 242
bound variable principle 827
bound variable interpretation 535,
538
boundness, clause 812
branching quantifier 476
Bndeltheorie 353, 368
C
c-command 481, 537
categorial grammar 90, 120 f.,
124
categorial language 148
category, categorematic 382
category, definition 149
category, syncategorematic 382
category, syntactic 63, 102, 148
causal adverb 752
causal conjunction 623
CHANGE-Operator 775
Charakter 41, 86, 110, 160 f.,
237, 355, 524
clausal implicature 232, 305
cleft-sentence (Spaltsatz) 294,
315, 805
commensurability 686
Argumentvertauschung 126
Aristotelisches Quadrat 461, 856
Art des Gegebenseins 185
Arten / kinds 512, 659, 858
Arten, Referenz auf 370, 420
Arten-Prdikat / kind level predi-
cate 371, 423
Artikel
s. definiter / indefiniterArtikel
Aspekt 726
assertiv 270
assignment function (value as-
signment / Interpretations- funktion /
Wertzuweisung) 26, 107, 152, 252,
841
atelischer Verbausdruck 415
atomar 410, 435
attr-operator 664
attributive Lesart 237, 239
attributiver Gebrauch 43, 369,
497
Aussage
s. Proposition
Aussagenlogik / propositional
calculus 29
Auswertungssituation 158, 161 f.
Auswertungswelt 115
uereraspekt / utterer aspect 187
uerung / utterance 5
uerungsbedeutung / utterance
meaning 33
uerungsinhalt 319
uerungskontext 110
uerungssituation 158 f., 161 f.,
177, 237
uerungssituation, feste Aspekte
159
uerungssituation, homogene 177
uerungssituation, verschieb- bare
Aspekte 159
Autonomie der Syntax 90
B
Bach-Peters sentence 478, 848
basic expression (Grundaus- druck)
102
Basisinterpretation 254
Bedeutung / meaning 20, 82,
108
Bedeutung, explizite 20
Bedeutung, implizite 20
Bedeutung, strukturierte 108,
717, 720
Bedeutung-als-Gebrauch-Theo- rie
19
A
a priori 184
a priori, kontingentes 184
aber-Koordination / but 615
abstraction
s. Lambda-Abstrak-tion
abwrts implizierend / down- ward
entailing 468, 591, 687,
799, 811
accessibility relation 641
adjective, absolute 665, 668
adjective, gradable 673
adjective, non-standard 665
adjective, relative 665, 668
adjective, value 670
adjectives, attributive approach 665
adjectives, predicative approach 663
admissibility 233, 239, 307
adverb of quantification 375,
511, 523, 652
Akkommodation des Kontextes 235,
307, 516
Akkommodationsregel 188, 235
Algebraische Semantik 854
All-Spezialisierung 837
Allgemeinname / common noun 370,
376, 382
Allquantor / universal quantifier 96
Alternative, doxastische 718
alternative, perceptual 753
Alternativenraum 83
Alternativfrage / disjunctive question
337, 344
Ambiguitt 221, 250
Ambiguitt, de re / de dicto 344,
347
Ambiguitt, lexikalische 98, 263
Ambiguitt, strukturelle 27
Ambiguitt, syntaktische 98, 105
Ambiguittstest 265
amount term 408
analyzability 481
Anapherninterpretation 552
anaphor 241, 506, 538, 848, 850
anaphorisch, assoziativ- 506 f.
Anhebung / raising 144
Anker, externer 250
Ankerfunktion 852
antifaktives Verb 292
antonym 660
Antwortmengen-Methode 341
application 121, 124
Applikationsrichtungsnderung 126
Applikativ 130
Archimedische Eigenschaft 410
Argumentvererbung 445
916
disjunktive Frage, 337
s. Alternativ-frage
disjunktive Referenz 432
Diskurs, temporal freier 739
Diskurs, temporal verbundener 744
Diskursbereich 311
Diskursfokus 553
Diskursreferent 551
Diskursreprsentation 311
Diskursreprsentationsstruktur 852
Diskurssemantik 311
distributionelle Theorie 17
distributiv 435
distributive Prdikation 415, 427
distributive Referenz 405
divisiv 410
divisive Referenz 405
donkey sentence (Eselssatz) 42,
242, 478, 656, 848, 851, 854
downward entailing (abwrts
implizierend) 468, 591, 687,
799, 811
doxastische Alternative 718
dreiwertige Logik 252, 314, 843
dthat- Operator 117, 166
DTHAT-Operator 175
Durativitt 452
E
Eigenname / proper noun 240,
349
Eigenname, Deskriptionstheorie 352
Eigenname, echter 358
Eigennamen, logische Kategorie 364
Eigenschaft / property 25, 82
Eigenschaft, Selbstzuschreibung 210
Einbettung 598
Einschlgigkeitsaspekt 194
Einstellung, iterierte 721
Einstellung, propositionale 27,
205, 709, 721
Einstellungsinhalt 710
Einstellungsverb 205
Einzigkeitsbedingung / condition of
uniqueness 493
Ellipsenregel 199
episodic sentence 379
epistemische Information 184
epistemischer Zustand 182
Equativ 669, 674
Ereignis-Individuum 448
Ereignis / event 79, 446, 754,
756, 858
Ereignisbegriff 450
Ereignisnominalisierung 447
Ereignisprdikat 416
Ereigniszeit 732
Erfllungsbedingungen 46, 282,
293
Erfllungsmenge 244
definiter Artikel, direkt referen- tielle
Deutung 189
definiter Artikel, Disambiguie- rung
504
definiter Artikel, Fregesche Deu-
tung 495
definiter Artikel, generische Les- art
511
definiter Artikel, Russellsche
Deutung 488
definiter Artikel, verallgemei- nerte
Russellsche Deutung 509
Definitfakultativitt 701
Definitheitsrestriktion fr exple-
tives there 528
degree (Grad) 679
degree adverb 751
degree as equivalence class 680
degree parameter 679
degree particle 786
degree, numerical 682
deiktischer Ausdruck 38, 163,
166, 237
deiktischer Ausdruck, Umschrei-
bung 166
deklarativ 22, 270
deklarativer Modus 46
Dekomposition, semantische 16,
48, 61
demonstrative Nominalphrase 193
demonstrativer Ausdruck, rein 196
demonstrativer Gebrauch 194
Demonstrativum 192 f., 558
Denotat 839
Denotatensystem 109, 122
Denotation 11
Derivation 60
Derivativnominalisierung 442
desambiguierte Syntax 102
Desideratum 338
deskriptive Bedeutung 53, 166,
355
deskriptive Konstante 838
Determinativkompositum 60
determiners 465
Diachronie 4
Diagonalisierung 240, 358, 712
Diagonaloperator 117, 174, 240,
353
Diagonaloperator, senkrechter 359
Diagonaloperator, waagerechter 174
Dimension 164
dimensionales Adjektiv 49
direkt referentiell 111, 237, 355
direkt referentielle Deutung 499
direkte Frage, Reduktionstheo- rie
335
direkte Rede / direct speech 198
direktiv 270
Disambiguierungsparameter 221
Disjunktion 72, 76, 96, 254
common integrator 605
common noun 370, 376, 382
comparative 669, 673 f.
comparative deletion 677
comparative ellipsis 677
comparison class (Vergleichs- klasse)
685
compatibility, logical 607, 641
completeness 837
compositionality
s. Kompositio-nalitt
compositionality, principle of
(Fregeprinzip) 4, 40, 95, 157,
296, 464, 711
compound quantifier 473
conceptual
s. konzeptuell
concessive conjunction 629
conclusion (Schlu) 28
conditional 234, 328, 626, 642,
651, 853
conditional, modalized 654
conjunction
s. Konjunktion
consequence, logical 641
conservativity
s. Konservativitt
consistency 641
context
s. Kontext
content vs. implicature 808
control
s. Kontrolle
conversational background 641
conversational implicature 62,
325, 651
conversational maxim 325, 331
coordination 599
coreference, pragmatic 544
counterfactual analysis of causa- tion
626, 628
counterfactual conditional 520
counterfactuals 805
crossover 829
crossover argument 812, 826
cumulative
s. kumulativ
D
D-Struktur 131
de re / de dicto-Ambiguitt 344,
347
de-dicto-Lesart 351
de-re-Lesart 351, 370
Default-Annahme 289
definite description
s. Kenn-zeichnung
definite NP 247, 524, 526
definite NP, Inhaltsbedingung 247 f.
definiter Artikel 41
44. Sachregister 917
Gradpartikel / degree particle 786
Grices paradox 653
H
Halbordnung / partial order 409
Haufenparadox 266
head principle (Kopfprinzip) 59,
146
Hecke, sprachliche / hedge 261
holistische Referenz 451
Homomorphismus 107
Homonymie 99
Hon-Nob-Satz 848
hyperintensionaler Kontext 712
I
Ideationstheorie 11
Idee 12
Identifizierungsbedingung 33
Identittssatz 489
identity, principle of 394
illokutionre Rolle 270
illokutionrer Akt 273
Illokutionssemantik 283
Illokutionstyp 270
Illokutionstypbewertung 283
Illokutionstypindikator 281, 630
illokutionstypspezifische Bewer-
tung 280
illokutive Kraft / illocutionary force
20
imperativ 270
imperativer Modus 46
implication, material 649, 651
implikatives Verb 292, 706, 710
Implikatur 20, 47, 230, 319, 326,
514, 651, 808
Implikatur, Klausal- 232, 305
Implikatur, konventionelle 302,
324, 326
Implikatur, konversationale 62,
325, 651
Implikatur, potentielle 232
Implikatur, skalare 231, 305
Implikaturauslser 284
incompatibility 265, 607
indefiniter Artikel 42, 242
indefiniter Artikel als Existenz-
quantor 513
indefiniter Artikel, spezifische Lesart
516
indefiniter Artikel, unspezifische
Lesart 516
Indefinitfakultativitt 701
index translation 543
indexikalischer Ausdruck 38,
237
indexikalischer Satz, Kontextver-
nderung durch 239
Fokuspartikel / focussing par- ticle
805
Fokuspartikel, even 811
Fokuspartikel, nur 294
Fokuspartikel, only 808, 832
Fokuspartikel, sogar 294
Folgerung, logische 641, 840
Folgerung, pragmatische 236
Frage-Antwort-Paar / question-
answer pair 339
Frageinhalt 333
Fragemodus 333
Fragesatz / interrogative sen- tence
333
Fragesatz, logische Kategorie 344
Fregeprinzip (Kompositionali-
ttsprinzip) 4, 40, 95, 157,
296, 464, 711
Fregesche Bedeutung 10, 55
Fregesche Deutung, extensiona-
lisierte 503
Fregesche Interpretation 113
Fregesche Typenzuweisung 113
Fregesches das 526
Fregesches das, verallgemeiner- tes
527
freies Pronomen 43
Funktion, charakteristische 158
funktionale Applikation 124
Funktionskomposition 124
Fusion 410
fuzziness 262
fuzzy logic 258, 260
G
GB-Modell 131
Geachsche Typanhebung 124
gebundene Variable
s. bound var-iable
gebundenes Pronomen 43
gemeinsamer Hintergrund 287
generalisierter Quantor / general-
ized quantifier 425, 466, 855
generalization 377
generalization, stable 391
generator 471
generic reading 371, 522
generischer Massenterm 412
generischer Satz 414, 420
Genitivattribut 198
gequantelt 410
Gerundium 444
geschlossene Klasse / closed class 58
Gesprchsmaxime / conversatio- nal
maxim 20
Glauben de re / Believe 362, 719
Glauben de se 718
governing category 538
Grad / degree 679
gradability 659
Gradadverb 751
Ergnzungsfrage 337, 345 f.
erotetisch 270
Erzeugungseigenschaft / genera- tion
property 72
Eselssatz / donkey sentence 42,
242, 478, 656, 848, 851, 854
evaluation
s. assignment, Aus-wertung
evaluativer Gebrauch 796 f.
even 811, 817, 820
event 79, 448, 754, 756, 858
evidential use 629
Exhaustivitt, schwache 344
Exhaustivitt, starke 343, 347
existential import 462
Existenz-Abschwchung 837
Existenzbedingung 493
Existenzprsupposition 292
Existenzsatz 491
exklamativ 270
exklamatorisch 270
expletives there 528
Extension 11, 25, 55, 109, 156,
161, 465, 525, 839
extension, s- 684
extensional 116
extensionale Konstruktion 158,
166
extensionale Sprache 503
extensionales Verb 705
extensionalisierte Fregesche Deutung
503
Extensionalisierung 172
Extensionalitt 840
extensive structure, positive closed
679
extenso, Relation in 109
Extensor 117
external reading 689
F
fact (Tatsache) 81, 83, 446
faktiver Subjektsatz 315
faktives Prdikat 447
faktives Verb 706, 710
Familienhnlichkeit 263
Frbung 165
Fiktionalitt 365, 370
filter 302, 305
filter, principal 471
Flexion / inflection 60
focus 787, 789 f.
focus associated 807
focus domain 806
focus movement 809, 819
focus projection 806
focus, free 822
focus, in situ theory 814, 825,
828
focus, movement theory 825 f.
focus, predicational theory, 822
918
Konjunktion, konzessive 629,
631
Konnektivum 632
Konnektoren 597
konservative Erweiterung / con-
servative extension 843
Konservativitt 255, 257, 259,
466
Konsistenz 641
Konsistenzbedingung 236
Konsistenzregel, lokale 269
konstativ 20
Kontext 17, 38, 86, 169, 229,
268
Kontext, Null- 282
Kontext, quantifizierter 219
Kontext, stimmiger 170
Kontextabhngigkeit / context
dependence 41, 156, 505
Kontextaspekt 186
Kontextbedingung 39
Kontexterweiterung / context ex-
tension 301, 306, 310
kontextinvariante Bedeutung 38
kontextuelle Theorie der Bedeu- tung
17
kontextueller Parameter, echter 191
Kontextvernderung 231
Kontextvernderung durch inde-
xikalische Stze 239
Kontextvernderungsfunktion 234
Kontextvernderungspotential 307
kontradiktorischer Gegensatz 607
kontrafaktisch / counterfactual 805
kontrafaktische Analyse 628
kontrafaktisches Konditional 520
kontrrer Gegensatz 607
Kontrast 619
Kontrastakzent 315
Kontrolle 144, 207
Kontrollkonstruktion 144
Kontrollverb 702
konventionelle Implikatur 302,
324, 326
konversationale Implikatur 62,
325, 651
Konversationsmaxime 325, 331
Konzeptualismus 9
konzeptuelle Differenzierung 50
konzeptuelle Reprsentation 50,
66
konzeptuelle Verschiebung /
conceptual shift 50, 69
konzessive Konjunktion 629,
631
konzessive Prsupposition 633
koordinative Verknpfung 599
Kopfprinzip / head principle 59,
146
Korrektheit, intuitive 837
Korrektur 619
K
Kanonisierbarkeit 838
kategoriale Sprache 148
Kategorialgrammatik 90, 120 f.
Kategorialgrammatik, verallge-
meinerte 124
Kategorie, Definition 149
Kategorie, lexikalische 102
Kategorie, syntaktische 63, 102,
148
Kategorienfehler / category mis- take
293
Kategorienindex 102
kausale Konjunktion 623
kausales Adverb 752
Kausalsatz 636
Kausativ 130
kausatives Verb 708
Kennzeichnung / definite descrip-
tion 557, 836
Kennzeichnung, leere 490
Kennzeichnungstheorie 297, 328,
350
kind, identity condition 376
kind, natural 512, 659, 858
kind-denoting term 370, 420
kind-level predicate (Artenprdi- kat)
371, 423
Klassifikatorsprache 400
Klausalimplikatur 232, 305
Ko-Text 17
kollektive Prdikation 415, 427
kollektives Nomen 399, 426
Kollokationstheorie der lexikali-
schen Bedeutung 17
kommunikativer Sinn / commu-
nicative sense 33
Komparativ
s. comparative
Kompatibilitt, logische 641
Komplement-Satz, logische Ka-
tegorie 346
Komponentenanalyse 16
Kompositionalitt 21, 111
Kompositionalittsprinzip (Fre-
geprinzip) 4, 40, 95 f., 157,
296, 464, 711
Kompositionalittsprinzip, allge-
meines 166
Kompositionalittsprinzip, nai- ves
157
Kompositum 59
Konditional 234, 328, 626, 642,
651, 853
Konditional, Irrelevanz- 635
Konditional, modalisiertes 654
Konjunktformat 602
Konjunktion 72, 236, 259, 598 f.
Konjunktion, kausale 623
indexikalischer Satz, Zulssig-
keitsbedingung 239
indikativ 22
Indirekte Frage / indirect ques- tion
342
Indirekter Sprechakt 329
individual-level predicate (Indi-
viduenprdikat) 374
Individualbegriff 351
Individualterm 399, 525
Individuensumme 434, 436
individuierendes Nomen 418
inference (Schlu) 28
Infinitivnominalisierung 442
Informationsgehalt eines Satzes 178,
181 f.
Informationsgehalt, maximaler 179
Informativittsbedingung 236
Inhalt 496, 808
Inhaltsbedingung fr definite NP 247
f.
Inklusion 607
inkohrent 72
innerer Monolog 182
in situ Theorie 811
Intension 11, 26, 109, 116,
157 f., 161, 346, 525, 847
intensionale Isomorphie 108
intensionale Konstruktion 158,
167
intensionale Logik 110
intensionaler Kontext 847 f.
intensionales Verb 705
intenso, Relation in 109
Intensor 117
internal reading 689
interpretability 27
Interpretation 26, 91, 107, 114,
123, 152, 524
interpretation domain (Interpre-
tationsbereich) 152
Interpretation von NP 525
Interpretation, typengesteuerte 114
Interpretationsfunktion,
s. as-signment function
interrogativ 270
interrogative Einstellung 339
interrogativer Modus 46, 333
interval 736
Iota-Eliminierung 837
Irrelevanzkonditional 635
island constraint 828 f.
isomorphy 466
J
Ja/Nein-Frage 337
Junktor 327
44. Sachregister 919
Nachbarschaftbedingung / close-
ness condition 310, 313
Nheprinzip 559
Name
s. Eigenname
Name, uneigentlicher 358
Namens-Tradition 354, 357, 369
Namenstheorie, zweidimensio- nale
353
natural kind 67, 370, 659
natrliche Einheit 411
natrlicher Begriff 69
Natrlichkeitsbedingung 111
necessity 116, 184, 644
necessity, relative 654
Negation 26, 234, 253, 317
Negation, uere 303
Negation, Begriffs- 582
Negation, inkorporierte 315
Negation, innere 303
Negation, minimale 314
Negation, partielle 845
Negation, pragmatischer Bereich 574
Negation, radikale 314
Negation, replazive 586
Negation, Sachverhalts- 569, 582
Negation, schwache 254, 580,
843
Negation, semantischer Bereich 570
Negation, starke 254, 580, 843
Negation, syntaktischer Bereich 572
Negationsfokus 575
Negationstest 291
Negationstrger 561 f.
negative polarity 468
negativer Polarittsausdruck 315,
590, 670, 811
negativer Polarittskontext 794
Neu-Alt-Bedingung fr Varia- blen
246
nicht-deskriptive Bedeutung 53
Nicht-Distinktheit 607
Nomen, funktionales 198
Nomen, relationales 198
nominal kind 68
nominale Komposition 59
Nominalisierung 441
Nominalisierung von Propositio- nen
447
Nominalisierungsoperation 454
Nominalismus 8
Nominalphrase, demonstrative 193
Normalformtheorem 129
Notwendigkeit / necessity 116,
184, 644
Notwendigkeit, relativierte 654
noun phrase (NP) 150
NP-Bewegung / NP movement 132
NP storage 485
number tree 467
Numeralklassifikation 400
meaning (Bedeutung) 82
meaning postulate (Bedeutungs-
postulat) 29, 48, 62
meaning, structured 108, 209,
790, 819, 851
measurement (Messung) 678
Mehrdeutigkeit, syntaktische /
syntactic ambiguity 98, 105
Mehrdeutigkeit, funktionale 264
Mehrdeutigkeit, lexikalische 98
Mehrdeutigkeit, referentielle 264
Mehrdeutigkeit, Skopus- / scope
ambiguity 98
mehrwertige Logik 252
meinen / mean 205, 210, 321
meinen de se 209
mereologisches Modell 406, 435
Merkmal 48, 64, 387
Merkmalssemantik 64
metaphysische Information 183
Minimaldifferenz, semantische 604
modal base 644, 649
modal base, realistic 646
modal context 352, 689, 847
modal force 649
modal logic, 2-dimensional 174
modal reasoning 645
Modalitt, relative 639 f.
modality 639, 426
modality, conditional 646
modality, epistemic 650
modality, graded 643
modality, root 650
Modalpartikel 801
Modell 839
modelltheoretische Semantik 36,
38, 152, 841
Modifikator, Prdikats- 748
Modifikator, propositionaler 751
Modularitt 44, 48, 143
Modus 22
Modus, Satz- 270
Modusmorphem, abstraktes 276
modusspezifischer Denotattyp 279
mgliche Welt / possible world 25,
78, 81
Mgliche-Welten-Semantik 80,
109, 847
Mglichkeit / possibility 644
Mglichkeitstest 290
monotonicity 467, 856
Monsterverbot 115 f., 167
Monstrum 116, 167
Montagues Universalgrammatik 90,
101, 846
Move- (Bewege-) 133
N
Nachbarschaft / surroundings 759
kumulativ 410, 415
kumulative Lesart 430
kumulative Referenz 405, 420,
437, 451
Kumulativitt 406
L
Lambda-Abstraktion 150, 173,
340, 463, 836
lambda-categorial intensional
language 833
lambda-categorial language 150
lambda-conversion 153, 837
Leibniznotwendigkeit / Leibniz
necessity 116
lexicalisation of scoping 486
lexikalische Kategorie 102
lexikalische Mehrdeutigkeit / lex-
ical ambiguity 98
lexikalisches Prdikat 295
lexikalische Semantik 2
Lexikalisierungsbeschrnkung /
lexicalization restriction 612
Linksapplikation / left applica- tion
124
literal meaning 33, 179
local binding 540
locality 213, 310, 559
Loch / hole 302
logical constant 30
logical form 29, 479, 808, 826
logische Folgerung 290, 840
logischer Eigenname 367 f.
logischer Kontext 847
logisches Operatorwort, Gegen-
standsneutralitt 57
logisches Wort 56
lokale Konsistenzregel 269
lokalisierende Perspektive 180
Lokalisierung 758
Lokalisierung, Objekt- 769
Lokalisierung, Situations- 765
lokutionrer Akt 273
M
M-Intensionalitt 219
manifestation 408, 455, 754, 756
Manifestation, raumzeitliche 408
Massennomen 399, 418, 508
Massenterm 399, 857
Massenterm, dualer Ansatz 403
Massenterm, generischer 404,
412
Massenterm, Individuen-Ansatz 403
Massenterm, objektbezogener 405
Massenterm, Prdikat-Ansatz 403
Mafunktion 409
max operator 687
920
Przisionsgrad 201
pred -operator 666
predicate modifier 748
predicate, psychological 804
predication condition 481
presupposition set 814, 828, 831
presupposition skeleton 825, 831
previous drink coordinate 201
primary kind 67
Prinzip Ausgeschlossenes Drittes
(PAD) 296
probabilistische Vagheitsseman- tik
259
Projektionsproblem 231, 233,
289, 301, 313
Pronomen, freies 43
Pronomen, gebundenes 43
Pronomen, Personal- 201
pronouns 535
pronoun, emphatic 815
proper noun
s. Eigenname
property (Eigenschaft) 25, 82
propositio mentalis 716
Proposition (Aussage) 8, 25, 72,
75 f., 109, 152, 157, 159, 640,
710, 715
Proposition, Gebrauch der 34
Proposition, singulre 159
Proposition, strukturierte 209,
790, 851
propositional attitude (proposi-
tionale Einstellung) 27, 205,
709, 721
propositional calculus (Aussa-
genlogik) 29
propositional modifier 751
propositionaler Gehalt / propo-
sitional content 22, 281
Propositions-Begriff 216
Prototyp 68
Q
quadratische Parametrisierung 175
Quadratur 175
Qualitt 659
quantification, adverb of (Quan-
tifikationsadverb) 375, 511,
523, 652
quantifier (Quantor) 57, 317,
328, 689
quantifier of higher types 471
quantifier raising (Quantoren-
anhebung) 99, 132, 480, 539,
808
quantifier, branching 476
quantifier, compound 473
quantifiers, relational properties 470
Quantifikation 848
quantifizierbare Variable 244
Plural 418
plural, bare (bloer Plural) 373,
419, 437
Plural, relationaler 429
Pluralobjekt 857
Plural-Operator 411
Plural-Quantor 424
Pluralterm 399, 508
Polarittsausdruck, negativer 315,
590, 670, 811
Polarittsausdruck, positiver 316
Polarittselement 567
Polarittselement, negatives 590
Polysemie 51, 69, 99, 200, 222
positive polarity 468
positiver Polarittsausdruck 316
Possessivierung 200
Possessivpronomen 556
possibility (Mglichkeit) 644
possible world (mgliche Welt) 25,
78, 81
Potenzmengen-Modell 433
practical inference 647
Prdikabilittsbaum / predicabil- ity
tree 69
Prdikatenlogik 1. Stufe (PL 1) 836
pragmatic coreference 544
Pragmatik 6, 35
pragmatische Folgerung / prag- matic
inference 236
Pragmatische Prsupposition 330
pragmatische Verschiebung /
pragmatic shift 188
Prjunktion 844
Prposition, dimensionale 778
Prposition, topologische 776
Prposition, wegbezogene 780
Prsupposition 231, 286, 337,
575, 790, 808, 841
Prsupposition des bestimmten
Artikels 495
Prsupposition, elementare 301,
305, 309
Prsupposition, empirische Kri-
terien 289, 291
Prsupposition, Existenz- 292
Prsupposition, faktive 292
Prsupposition, kategorielle 293
Prsupposition, konzessive 633
Prsupposition, potentielle 232
Prsupposition, pragmatische 287,
330
Prsupposition, semantische 287, 494
Prsupposition, strukturelle Ba- sis
295, 314
Prsuppositionen, Folgerungs-
analyse 299
Przisierungsgebot 264
Przisierungsprinzip 256
Przisierungssemantik 254
Przisierungsstruktur 262
Numeralklassifikator 419
Numeralkonstruktion 402
Numerativ 400
Numerativkonstruktion 401
O
Oberflchensyntax / surface syn- tax
104
Objekt-Prdikation, abgeleitete 423
Objektkontrolle 144
Objektlokalisierung 769
objektopakes Verb 93
objekttransparentes Verb 93
offene Klasse / open class 58
only 808, 832
Ontologie 91
opak 93
opakes Verb 703
Operatorbereich 839
Operatorposition 839
order, weak (schwache Ord- nung)
678
ordering source (Ordnungs- quelle)
644, 649
Ordinary-Language-Bewegung 19
P
p-set (presupposition set) 814,
828, 831
Parametrisierung 168
partial order (Halbordnung) 409
partielle Funktion 85, 152, 525
partielle Proposition 494
partielle Wertzuweisung 252
Partikel, additive 790
Partikel, restriktive 791
Partitiv 425, 438, 471
Partitivbeschrnkung 524
path 759
pay-check-Satz 848
performativ 20, 28, 54
performative Analyse 277
performative uerung, explizit 44,
274
performative hypothesis 630
performative Paraphrase 278,
335
performatives Verb 277
perlokutionrer Akt 273
Permutationssatz 127
persistence 469
persistente Aussage 78
perspektivische Verschiebung /
perspective shift 206
Phrasenstrukturgrammatik, ge-
neralisierte (GPSG) 91, 144
Phrasenstrukturgrammatik, kon-
textfreie (CF-PSG) 90
44. Sachregister 921
Skopus eines Definitums 492
Skopus-Analyse 213
skopusbildende Bewegung / scope-
inducing movement 133
Skopusmarkierung 135
Skopusmehrdeutigkeit / scope
ambiguity 98
skopusneutrale Bewegung / scope-
independent movement 133
sloppy identity 540
Sorites 266
sortal concept 394
sortales Prdikat 36, 405, 414
Sorten-Operator 415
Spaltsatz / cleft sentence 294,
315, 805
Sperrsatz / pseudo-cleft sentence
294, 315
spezifische Lesart 516
sprachliche Relativitt 64
Sprechakttheorie / speech act theory
20, 45, 54, 273
Sprechereinstellung / attitude 46
Sprechzeit 187, 190, 732
Spurendeutung / trace interpre- tation
133
square of opposition (Aristoteli-
sches Quadrat) 461, 856
Stadium / stage 379
Stadienprdikat / stage level
predicate 380
standard 683
standard of membership 390
Standardname 179
starke NP / strong NP 528
starker Determinator 528
starrer Designator / rigid desig- nator
117, 353, 368, 713
stereotype 387
Stimulus 14, 32
Stoffnomen / mass noun 399,
508
Stoffquantum 408
Stpsel 302
structure, relational 678
Strukturalismus, Nach-Bloom-
fieldscher 14
Strukturbildung zweiter Stufe 601
strukturelle Semantik 15, 64
strukturierte Bedeutung 108
strukturierte Proposition 209,
790, 851
Strukturwort, logisches 838
subjacency condition 482
Subjektkontrolle 144
subkontrrer Gegensatz 607
substance 382
substance sort 395
Substitution 837
Substitutionsprinzip salva veri- tate
296
Samaritan Paradox 642
Satzbedeutung / sentence mean- ing
25, 33
Satzinhalt 319
Satzkern 839
Satzmodus 46, 270, 274
Satznegation 73
Satzradikal 272
Satzradikalmethode 335
schwache NP / weak NP 528
schwacher Determinator 528
scope ambiguity (Skopusmehr-
deutigkeit) 98
Selbstzuschreibung von Eigen-
schaften / self-ascription of
properties 210
semantic marker 387
semantics, state change 486
semantics, two-dimensional 814
Semantik und Pragmatik 329
Semantik, modelltheoretische 36,
38, 152, 841
Semantik, Mgliche-Welten- 80,
109, 847
Semantik, Supervaluations- 252,
254, 298
semantisch motiviert 90
semantische Algebra 107
semantische Dekomposition 16,
48, 61
semantische Operation 106
semantische Reprsentation 49 f.
semantische Unbestimmtheit /
semantic indetermination 256, 266
semantischer Baum / semantic tree
107
semantischer Modus 53
semantischer Typ 63
semantisches Merkmal / seman- tic
marker 48, 64, 387
Semiotik 6
semiotisches Dreieck 8
sense (Sinn) 10, 55, 385
sentence meaning (Satzbedeu- tung)
25, 33
Simplexbedeutung 61
Singulativ 401, 418
Sinn / sense 10, 55, 385
Situation 765, 849, 851
situation semantics (Situations-
semantik) 25, 71, 81
situationeller Parameter 168
Situationsausschnitt 176
Situationslokalisierung 765
Situationstyp 82
Skala 792
Skala, sprachliche 794
skalare Implikatur 231, 305, 515
skalarer Begriff 584
Skopismus 212
Skopus 500 ff., 789, 798
quantifying in (Hineinquantifi-
zieren) 99, 133, 483, 809, 817
quantifier, generalized (genera-
lisierter Quantor) 425, 466,
855
Quantoren-Floating 424
Quantorenbindung 203
quiddity 384
R
R-pronouns (= anaphors) 536
Rahmenstuktur 599
raising (Anhebung) 144
Randbereichsunschrfe / fuzzi- ness
262
Rattenfnger / pied piping 135
Realismus 8
realization 376
Rechtsapplikation / right appli-
cation 121, 124
Rede, erlebte 745
Redehintergrund / conversatio- nal
background 229, 641
Redekontext 229, 246
Referent 156
referentiell, direkt 111, 119, 162,
185, 237, 355, 499
referentielle Thetarolle 456
referentieller Gebrauch 43, 497
Referenz 9, 11, 185, 193
Referenz auf Arten 420
Referenz, direkte 185, 355
Referenz, objektive 193
Referenz, subjektive 193
Referenzpunkt 111, 162, 174
Referenzpunkt, Aufspaltung des 174
Referenztheorie 8, 156, 173
Referenztheorie, abstrakte 173
Referenztheorie, allgemeine 156
Referenzzeit 732, 737
referiert absolut 119, 162
referiert direkt 119, 162
Rektionskompositum 59
Relation in extenso 109
Relation in intenso 109
relative modality 639 f.
Response 14, 32
Resultatnominalisierung 457
reziprok 432, 439
Richtungsabhngigkeit 49
rigid designator 117, 353, 368,
713
Ross-constraint 813
Russellsches das 526
S
S-Struktur 131
sagen, da p / say that 323
922
W
W(h) = Existenzquantor-Ana- lyse
343
W-Bewegung / Wh-Movement 132
wahr im Modell 840
Wahrheit / truth 640
Wahrheitsbedingung / truth con-
dition 20 f., 54
Wahrheitsdefinitheitsbedingung 236
Wahrheitsfunktion 597
wahrheitsfunktional 254, 257
Wahrheitsgrad 259
Wahrheitstafel 252 f., 597
Wahrheitswert / truth value 157
Wahrscheinlichkeit, bedingte /
conditional probability 259
Waterloo-Problem 359, 370
Weg / path 759
well-formed expression (wohlge-
formter Ausdruck) 149, 836
well-formedness (Wohlgeformt- heit)
27
Weltausschnitt 83
Weltparameter 191
Wertzuweisung
s. assignmentfunction
Wertzuweisung, partielle 252
Wh-Movement (W-Bewegung) 132
wirkliche Welt / real world 81
wohlgeformter Ausdruck / well-
formed expression 149, 836
Wohlgeformtheit / well-formed- ness
27
world
s. Welt
Wortarten / parts of speech 2
Wortfeld / lexical field 16, 64
wrtliche Bedeutung / literal
meaning 33, 179
Wortsemantik 48
X
X-bar-Schema 146
Z
Zhlbarkeit / countability 406
Zeige-Aspekt / pointing aspect 192
Zeitintervall / time interval 736
Zugnglichkeitsrelation 641
Zulssigkeit / admissibility 307
Zulssigkeitsbedingung 233
Zulssigkeitsbedingung fr inde-
xikalische Stze 239
zweidimensionale Modallogik 174
zweistufige Semantik 41
Twin Earth argument 386
Typ 109, 121
Typ, polymorpher 851
Typanhebung / type raising 93
typengesteuerte Interpretation 114
Typenlogik 453
Typentheorie 846
Typikalittseffekte 65
typischerweise-Operator 413
U
bersetzungsargument 715
bersetzungsproblem 66
Umgebungs-Semantik 207
Unabhngigkeit 607
Unbestimmtheit, semantische 252
und -Koordination / and 614
Unschrfe, Randbereichs- 262
unspezifische Lesart 516
Unvereinbarkeitskriterium 265
Unvertrglichkeit / incompatibil- ity
607
Urteilsstrich 270
utterance
s. uerung
V
Vagheit / vagueness 250, 262,
660
Vagheitsdilemma 261
Vagheitssemantik, probabilisti- sche
259
Vagheitstheorie, metrische 257
valuation
s. assignment function
value assignment
s. assignmentfunction
variable binding 463
Variable, externer Anker fr 250
Variable, gebundene 242
Variable, indexikalisch-kontex- tuelle
181
Variable, indexikalische 181
Variable, kontextuelle 181
Variable, Neu-Alt-Bedingung 246
Variable, quantifizierbare 244
Variablenbelegung 244, 508, 839
Variablenbindung 95, 173
Vererbungsfunktion / inheritance
function 302
Verhaltenstheorie der Bedeutung 13
Verneinen / say no 561
Verschiebbarkeit / referential shift
217
Vertrglichkeit / compatibility 607,
641
Vollstndigkeit, intuitive / com-
pleteness 837
Vorbedingung 293
VP-deletion 832
Summen-Halbverband / join-
semilattice 409
Summenbildung 857
Summenoperation 409
supervaluation 842
Supervaluationssemantik 252,
254
Supervaluationssystem 298
Synchronie 4
syntactic ambiguity (syntakti- sche
Mehrdeutigkeit) 98, 105
syntactic binding 537
syntactic category 63, 102, 148
syntaktische Algebra 103
syntaktische Mehrdeutigkeit 98,
105
syntaktische Operation 102
Syntax, Fundiertheit der 102
T
Taglichts observation 810
Tatsache / fact 81, 83, 446
taxonomic common noun 372
taxonomische Hierarchie 414
Teilbarkeit / divisibility 405
telischer Verbausdruck 415
Telizitt 707
temporal freier Diskurs 739
temporal verbundener Diskurs 744
Tempus / tense 722
Tempusdeutung, definite 736
terminatives Verb 443, 451
Terminativitt 452
Textakzeptabilitt 291, 309
thematische Rolle 764, 784
(s. auch The-tarolle)
Theta-Koindizierung 136
Theta-Theorie 135
Thetakriterium 135, 138
Thetamarkierung 136 f.
Thetamarkierung, kompositio- nale
139
Thetaprojektion 137
Thetaraster 136
Thetarolle, externe 136
Thetarolle, interne 136
Thetarolle, referentielle 456
Token-Aspekt 187
Tokenanalyse 176
tokenreflexiv 177
topicalization 154
trace interpretation / Spurendeu- tung
133
Trgersatz / bearer sentence 287
transformation 154
transparent 93
transparentes Verb 703
truth
s. Wahrheit
truth-conditional theory of meaning
(Wahrheitsbedin- gungen-Semantik)
18, 24, 34
Gerhard Jger / Dieter Wunderlich, Dsseldorf
(Bundesrepublik Deutschland)
Das könnte Ihnen auch gefallen
- De Beaugrande, Robert Dressler, Wolfgang Ulrich (1981) - Einführung in Die Textlinguistik (Kapitel I)Dokument21 SeitenDe Beaugrande, Robert Dressler, Wolfgang Ulrich (1981) - Einführung in Die Textlinguistik (Kapitel I)Realperza75% (4)
- Definitonen Der Sprache - PPT Die Drei Ebenen Der SpracheDokument26 SeitenDefinitonen Der Sprache - PPT Die Drei Ebenen Der SpracheGogaie SmekerNoch keine Bewertungen
- Ziem Frames Und Sprachliches WissenDokument501 SeitenZiem Frames Und Sprachliches WissenhehlerbayNoch keine Bewertungen
- Ekkehard Eggs: Die Etablierung Der Nationalsprachen in Europa, Dakar 2006Dokument17 SeitenEkkehard Eggs: Die Etablierung Der Nationalsprachen in Europa, Dakar 2006bropenNoch keine Bewertungen
- Metapher Als Multimodales Kognitives FunktionsprinzipDokument24 SeitenMetapher Als Multimodales Kognitives Funktionsprinziprosenbergalape100% (1)
- Gymnich Gender StudiesDokument19 SeitenGymnich Gender StudiesrotapfelNoch keine Bewertungen
- Sprachenportfolios SprachbiographieDokument2 SeitenSprachenportfolios SprachbiographieMaria DornerNoch keine Bewertungen
- CP VP StrukturDokument49 SeitenCP VP Struktursven yangNoch keine Bewertungen
- Jnrgen Trabant-Was Ist Sprache - Beck C. H. (2008) PDFDokument321 SeitenJnrgen Trabant-Was Ist Sprache - Beck C. H. (2008) PDFAndrés Miguel Blumenbach100% (2)
- Korpusgestützte Textanalyse: Grundzüge der Ebenen-orientierten TextlinguistikVon EverandKorpusgestützte Textanalyse: Grundzüge der Ebenen-orientierten TextlinguistikNoch keine Bewertungen
- S.lapinskas Zu Ausgewählten Theoretischen Problemen Der Deutschen Phraseologie2013!12!23Dokument277 SeitenS.lapinskas Zu Ausgewählten Theoretischen Problemen Der Deutschen Phraseologie2013!12!23NatalyaNoch keine Bewertungen
- Sprache SprachwissenschaftDokument298 SeitenSprache Sprachwissenschaftdoerflinger8448100% (1)
- Soziolinguistik - EinführungDokument37 SeitenSoziolinguistik - EinführungBasant ElsaqaNoch keine Bewertungen
- Bachelor ArbeitDokument52 SeitenBachelor ArbeitgoochkrNoch keine Bewertungen
- Muhr, Schrodt, Wiesinger Österreichisches DeutschDokument407 SeitenMuhr, Schrodt, Wiesinger Österreichisches DeutschThalassa MarisNoch keine Bewertungen
- Buehler SprachtheorieDokument21 SeitenBuehler Sprachtheorieever more100% (1)
- Generative Grammatik Und Die Dimension Der SpracheDokument2 SeitenGenerative Grammatik Und Die Dimension Der SpracheHuncut NaranccsNoch keine Bewertungen
- Einführung in Die Semantik PDFDokument48 SeitenEinführung in Die Semantik PDFnewtonioNoch keine Bewertungen
- Prosodie Vorlesung GrundlagenDokument71 SeitenProsodie Vorlesung GrundlagenIliescu MariaNoch keine Bewertungen
- Kommunikationsmaximen Nach Grice - NeuDokument10 SeitenKommunikationsmaximen Nach Grice - NeuNina BogomolecNoch keine Bewertungen
- Das Dia-System Der SpracheDokument76 SeitenDas Dia-System Der SpracheIsachi Andreea100% (1)
- Internationalismen Im B/K/S (Proseminararbeit)Dokument14 SeitenInternationalismen Im B/K/S (Proseminararbeit)Aiko NadaNoch keine Bewertungen
- Sprachgeschichte. Prüfungsfragen CoDokument2 SeitenSprachgeschichte. Prüfungsfragen CoНастя КузикNoch keine Bewertungen
- DiskurslinguistikDokument23 SeitenDiskurslinguistikmerce09Noch keine Bewertungen
- Roman Jakobson Zwei Seiten Der Sprache Und Zwei Typen Aphatischer Storungen 1956 PDFDokument13 SeitenRoman Jakobson Zwei Seiten Der Sprache Und Zwei Typen Aphatischer Storungen 1956 PDFOlga AmarísNoch keine Bewertungen
- Bedeutung Und Sprache PDFDokument24 SeitenBedeutung Und Sprache PDFkarimane98Noch keine Bewertungen
- Kontroversen in Der Forschung Zu Satztypen Und SatzmodusDokument19 SeitenKontroversen in Der Forschung Zu Satztypen Und Satzmoduskarimane98Noch keine Bewertungen
- Kultur und Übersetzung: Studien zu einem begrifflichen VerhältnisVon EverandKultur und Übersetzung: Studien zu einem begrifflichen VerhältnisLavinia HellerNoch keine Bewertungen
- Jakobson PoetikDokument20 SeitenJakobson Poetikpawlik1100% (1)
- W S - NikolaDokument54 SeitenW S - NikolaNevena FP MaksimovicNoch keine Bewertungen
- Begriffe Der SemiotikDokument14 SeitenBegriffe Der SemiotikAlienne V.Noch keine Bewertungen
- Zusammenfassung Kompetenzorientierter GrammatikunterrichtDokument2 SeitenZusammenfassung Kompetenzorientierter GrammatikunterrichtSendersonNoch keine Bewertungen
- Mehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit: Erkundungen einer didaktischen PerspektiveVon EverandMehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit: Erkundungen einer didaktischen PerspektiveNoch keine Bewertungen
- Deutsche Linguistik IDokument26 SeitenDeutsche Linguistik ID'iffetDemirciNoch keine Bewertungen
- CH 8 SoziolinguistikDokument15 SeitenCH 8 SoziolinguistikSournouma DahNoch keine Bewertungen
- Mehrsprachigkeit Und Schulerfolg Bei Schülern Mit Migrationshintergrund. Bilingualism and School Achievement Among Children of Migrant BackgroundDokument8 SeitenMehrsprachigkeit Und Schulerfolg Bei Schülern Mit Migrationshintergrund. Bilingualism and School Achievement Among Children of Migrant BackgroundAgnieszka MalyskaNoch keine Bewertungen
- (9783110296136 - Handbuch Sprache in Sozialen Gruppen) Handbuch Sprache in Sozialen GruppenDokument528 Seiten(9783110296136 - Handbuch Sprache in Sozialen Gruppen) Handbuch Sprache in Sozialen GruppenEdirne GermanistikNoch keine Bewertungen
- Semi Otik 3Dokument1.032 SeitenSemi Otik 3KebabbbNoch keine Bewertungen
- Textsorten TamamDokument100 SeitenTextsorten TamamZeynep ÜnalNoch keine Bewertungen
- Hermeneutik im Dialog der Methoden: Reflexionen über das transdisziplinäre VerstehenVon EverandHermeneutik im Dialog der Methoden: Reflexionen über das transdisziplinäre VerstehenRainer J. KausNoch keine Bewertungen
- BilingualismusDokument13 SeitenBilingualismusAdam SalhiNoch keine Bewertungen
- Jezikoslovlje 12 263 Stojic StiglicDokument20 SeitenJezikoslovlje 12 263 Stojic StiglicpericaNoch keine Bewertungen
- Kritische DiskursanalyseDokument99 SeitenKritische DiskursanalyseMushkey AlaNoch keine Bewertungen
- Grundlagen Der SprachwissenschaftDokument15 SeitenGrundlagen Der SprachwissenschaftMarko SrpakNoch keine Bewertungen
- FrazeoDokument330 SeitenFrazeoJani PerneNoch keine Bewertungen
- Bilingualismus in der multikulturellen Gesellschaft: Sprachentwicklung und Zweitspracherwerb in Zeiten der GlobalisierungVon EverandBilingualismus in der multikulturellen Gesellschaft: Sprachentwicklung und Zweitspracherwerb in Zeiten der GlobalisierungNoch keine Bewertungen
- Питання - до - письмового - іспиту - з - лексикології 1-12Dokument6 SeitenПитання - до - письмового - іспиту - з - лексикології 1-12Настя КравченкоNoch keine Bewertungen
- Sprachliches Wissen Zwischen Lexikon Und GrammatikDokument604 SeitenSprachliches Wissen Zwischen Lexikon Und GrammatikAlmira NuradinovicNoch keine Bewertungen
- Einführung in Die Germanistische Linguistik (PDFDrive)Dokument382 SeitenEinführung in Die Germanistische Linguistik (PDFDrive)Sournouma DahNoch keine Bewertungen
- (Ludger Hoffmann, Ludger Hoffmann) SprachwissenschDokument968 Seiten(Ludger Hoffmann, Ludger Hoffmann) SprachwissenschTeresaNoch keine Bewertungen
- Müller 2010Dokument563 SeitenMüller 2010zehui guoNoch keine Bewertungen
- Eisenberg. Grundriss Der Deutschen Grammatik. Der Satz.Dokument596 SeitenEisenberg. Grundriss Der Deutschen Grammatik. Der Satz.serjNoch keine Bewertungen
- Methodik im Diskurs: Neue Perspektiven für die Alttestamentliche ExegeseVon EverandMethodik im Diskurs: Neue Perspektiven für die Alttestamentliche ExegeseNoch keine Bewertungen
- Wortbildung Und Semantik PDFDokument167 SeitenWortbildung Und Semantik PDFDenada Nuellari100% (2)
- Admoni WGDokument170 SeitenAdmoni WGZebra 15Noch keine Bewertungen
- Multimodale Kommunikation: Bericht aus einer TextwerkstattVon EverandMultimodale Kommunikation: Bericht aus einer TextwerkstattNoch keine Bewertungen