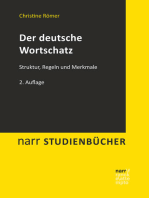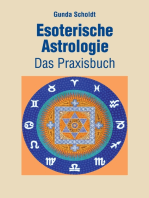Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Nietzsche Über Individuum Und Individualität: G. W. Leibniz - Philosophische Schriften Ed. Gerhardt Bd. 4, P. 18
Hochgeladen von
ssOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Nietzsche Über Individuum Und Individualität: G. W. Leibniz - Philosophische Schriften Ed. Gerhardt Bd. 4, P. 18
Hochgeladen von
ssCopyright:
Verfügbare Formate
WERNER HAMACHER
,DISGREGATION DES WILLENS'
Nietzsche über Individuum und Individualität
Individualität — dies Wort wird, nicht nur in der Sprache der Philosophie,
mit gespaltener Zunge gesprochen.
Bestimmt, zwischen der Allgemeinheit des in ihm Ausgesagten und
der Spezifität des mit ihm Gemeinten zu vermitteln, redet der Begriff der
Individualität bereits einer Gemeinsamkeit das Wort, in deren Sphäre der
Anspruch der Individualität verhallt. Der Begriff der Individualität ist —
auch wo er deren Substanz in der Vermittlung zu ergreifen versucht — Verrat
an der Individualität. Er verrät sie, indem er ihren Anspruch auf unmittelbare
Singularität an die Macht der allgemeinen und allgemeinverständlichen Spra-
che und ihrer Verwendung preisgibt, und er verrät sie zugleich in der Weise,
daß er eben dadurch vielleicht auch ihre spezifische Struktur — im Verhältnis
zu sich und im Verhältnis zur Allgemeinheit — anzeigt. Diese Zweideutigkeit
des Begriffs der Individualität hat ihre Spuren in allen Systemen hinterlassen,
die seiner Bestimmung gewidmet waren. Wenn — um in diese Geschichte an
einem relativ beliebigen Punkt einzutreten — Leibniz darauf insistiert, daß
jedes Individuum durch sein ganzes Wesen individuiert sei (omne Individuum
sua tota Entitate individuatur1) und daß es deshalb ein Unendliches an Bestim-
mungen umfasse, die der Unendlichkeit des Universums korrespondieren,
aber jeder endlichen Erkenntnis entgleiten, so charakterisiert er seine Indivi-
dualität als Repräsentation einer Totalität, von der sie doch zugleich auch
unterschieden sein soll. Einer vollständigen Erkenntnis des Individuellen ist
nach Leibniz nur ein Wesen fähig, das die Totalität notwendiger Bestimmun-
gen in sich versammelt und deshalb den Bedingungen ihrer Repräsentation
nicht unterworfen ist. Das Individuum ist also monadische Einheit einer
Unendlichkeit von Bestimmungen, die nur durch ein einerseits unendliches
Erkenntnisvermögen — das Gottes — erfaßt werden kann. Endliche Indivi-
duen sind zu ihrer Erkenntnis als Individuen unfähig. Individualität ist bei
Leibniz von der Universalität Gottes, der Repräsentationscharakter ihrer
1
G. W. Leibniz — Philosophische Schriften; ed. Gerhardt; Bd. 4, p. 18.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens' 307
unendlichen Bestimmtheit ist von der Präsenz einer absolut notwendigen
Wesenheit als von dem Fluchtpunkt her begriffen, in dem sämtliche Determi-
nanten des Individuellen zusammenlaufen und in dem das Individuelle als
Individuelles in einem Allgemeinsten verschwindet. Individualität ist, so
gedacht, ein fundamental theologischer Begriff, der die endlichen Individuen
von ihrer Kontingenz zu erlösen bestimmt ist. Wenn Christian Wolffs Philoso-
phie, Prima sive Ontologia das Einzelwesen als dasjenige definiert, quod omnimode
determinatum est2, spricht er damit auf einfachste Weise die Konsequenz aus
Leibnizens Gedanken über Individualität aus: das Individuum ist von der
Totalität seiner logischen, historischen, sozialen und psychischen Bedingun-
gen durchgängig bestimmt und es ist bestimmt %ur Totalität, ohne daß ihm
selbst noch eine genuine Bestimmungskraft zugesprochen werden könnte,
durch die es von der ihm diktierten ideologischen Bewegung eigenmächtig
sich absetzen könnte. Individualität ist also nicht nur ein theologischer, sie
ist zugleich der teleologische Begriff einer Totalität von Bestimmungen, deren
jede einzelne sich in prästabilierter Harmonie zu allen anderen hält und deren
Stabilität von keiner Erschütterung betroffen werden kann. Die compossibilitas
aller Einzelbestimmungen ist der sichernde und totalisierende Grund der
durch sie determinierten Individualität und sie ist der Grund ihrer Erkenntnis.
Das Individuum ist das durch seine allseitige Bestimmtheit festgestellte Wesen.
Gegen die ontologischen und epistemologischen Grundannahmen der
Leibniz-Wolffischen Schule hat Kant in seinen Überlegungen zum prototypon
transcendentale deutlich gemächt, daß durchgängige Bestimmtheit nur einem
durchgängig notwendigen Wesen, also einem höchsten Seienden, einem ens
entium zugesprochen werden kann, das, endlichen Verstandesleistungen unzu-
gänglich, niemals als gegenständliches Seiendes, sondern immer nur als unse-
rer Gegenstandskonstitution regulativ unterlegte allgemeine Vorstellungs-
form gelten kann. Individualit figuriert hier also als unerkennbarer und
darstellungsunfahiger Prototyp von Gegenständen, die als dessen Nachbilder
an positiver Bestimmtheit immer hinter ihm zurückstehen müssen. Das Indivi-
duelle, unendlich Bestimmte wird von der endlichen Vernunft konsumtiv
verendlicht, das Besondere ins unspezifisch Allgemeine verwandelt, das Typi-
sche ektypisiert und sein Sein in jeder seiner Repräsentationen vermindert.
Da das Urbild nicht mehr gegeben, sondern bloß aufgegeben oder angenom-
men ist, sind die Gegenstände im Begriff, mit ihrem Nachbildcharakter
zugleich auch ihre Form einzubüßen. Dem Gedanken der Individualität fehlt
fortan der gesicherte Grund einer Determination, die ihn zum Gegenstand
2
Der vollständige Satz lautet: Cum entia singularia existant, evidens esty Ens singulare, sive
Individuum esse illud, quod omnimode determinatum est. (Christian Wolff — Gesammelte Werke,
II. Abt. Bd. 5: Philosophia prima sive Ontologia (§ 227), Frankfurt 1736; p. 188).
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
308 Werner Hamacher
· r
der Erkenntnis machen könnte, und ihm fehlt die unproblematische theo-
teleologische Bestimmung, durch die erst die Forderung seiner internen
Totalität erfüllt werden könnte. Die von Goethe in seinem Brief an Lavater
vom 20. September 1780 aufgestellte Formel Individuum est ineffabile* ent-
springt dann auch kaum einem begriffsfeindlichen Sensualismus, sondern der
Einsicht, die aus dem Zerfall der großen rationalistischen Systeme des 17.
und 18. Jahrhunderts resultiert, daß das Individuum einem endlichen Darstel-
lungsvermögen unzugänglich bleiben muß, daß seine Besonderheit durch die
allgemeinen Sprachkonventionen nicht erfaßt werden kann, und daß es, selber
endlich, auch selbst nicht über die Mittel verfügt, sich in seiner Totalität als
Individuum auszusprechen. Indem es sich als Individuum ausspricht, spricht
es sich nicht als Ganzes und spricht sich nicht ganz aus: das Ganze ist selber
für die Erkenntnis und für die Sprache zu einem bloß Endlichen, zum
endlichen, sowohl zeitlich wie strukturell beschränkten Allgemeinen gewor-
den. Seither kann Individualität der Begriff für die Fähigkeit sein, sich auf
eine unbestimmbare Vielzahl von möglichen Gestalten zu entwerfen, deren
jede auf weitere Bestimmungsmöglichkeiten offen ist und in keiner paradig-
matischen Gestalt ihren Abschluß finden kann. Individualität ist nicht mehr
Repräsentation einer vorgängigen oder transzendental verbürgten Gegenwart
und auch nicht mehr das Vorspiel einer Allgemeinheit, in deren Realisierung
es seine Bestimmung finden könnte. In diesem Zusammenhang sind die der
Auseinandersetzung mit Fichte abgewonnenen Gedanken Schlegels, in diesem
Zusammenhang sind die der Auseinandersetzung mit Hegel und Schlegel
abgewonnenen Gedanken Kierkegaards zur Individualität zu lesen.
Für Nietzsche ist das Individuelle historisch zunächst eine Form vergange-
ner Größe, die beim Versuch ihrer erkennenden Vergegenwärtigpng oder
ihrer geschichtlichen Wiederholung gerade um ihre Individualität verkürzt
werden muß.. In der Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung Vom Nutzen und
Nachteil der Historie für das Leben, die die Bedingungen nicht nur der Ge-
schichtsschreibung, sondern der Geschichte selber und des Geschichte-Ma-
chens an die Wirksamkeit authentischer Individualität knüpft, schreibt er:
Wieviel des Verschiedenen muß, wenn sie jene kräftigende Wirkung tun soll, dabei
übersehen, wie gewaltsam muß die Individualität des Vergangenen in eine allgemeine
Form hineingezwängt und an allen scharfen Ecken und Linien zugunsten der Überein-
stimmung ^erbrochen werden \ Im Grunde ja könnte das, was einmal möglich war, sich
nur dann %um zweiten Male als möglich einstellen, wenn die Pythagoreer recht hätten,
%u glauben, daß bei gleicher Konstellation der himmlischen Körper auch auf Erden das
3
J. W. Goethe — Gedenkausgabe seiner Schriften; ed. Beutler; Bd. 18; p. 533.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgrcgation des Willens* 309
gleiche, und %war bis aufs einzelne und kleine, sich wiederholen müsse [.. .]4 Die
Bedingungen der Vergegenwärtigung des Individuellen — so ließe sich dieser
Passus kommentieren — sind die Bedingungen der Verallgemeinerung und
das heißt: der Entindividualisierung, der Vergewaltigung und Zerstörung
des Individuellen und sogar der Möglichkeit des Individuellen durch ein
universelles Gesetz. Wo immer das Individuelle wiederholt wird, ist es das
Individuelle schon nicht mehr, das es einmal gewesen sein soll. Die Individu-
alität, deren Bilder die Vergangenheit bereithält, ist bloß eine mythische
Figur, die als Stereotyp durch wechselnde Zeiten gereicht werden kann und
ihnen den Glanz dauernder Größe verleiht. Die Individualität des historischen
Ideals, die bestimmt ist, in der Gegenwart Impulse des Lebens auszuteilen,
muß vermöge ihres idealtypischen Charakters zum Totengräber des Lebendi-
gen werden. In ihr ist nicht das Individuelle, sondern nur seine starre, typische
und typisierende Form erfaßt. Individuell wäre aber gerade das, was in
keinem Typus, keiner Form, keiner Gestalt und keiner kodifizierbaren Bedeu-
tung aufgeht.
Was von der Form der Vergegenwärtigung zerstört wird, vermag auch
eine Gegenwart nicht zu bieten, die unter dem Gesetz der Wiederholung
steht: Das Individuum hat sich ins Innerliche zurückgezogen: außen merkt man nichts
mehr davon; wobei man syveifeln darf, ob es überhaupt Ursachen ohne Wirkungen geben
könne. Oder sollte als Wächter des großen geschichtlichen Welt-Harems ein Geschlecht
von Eunuchen nötig sein ? Denen steht freilich die reine Objektivität schön %u Gesichte.
Scheint es doch fast, als wäre es die Aufgabe, die Geschichte %u bewachen, daß nichts
aus ihr herauskomme als eben Geschichten, aber ja kein Geschehen ! (1239). .Das
Individuum hat unter dem Druck repräsentativer Typen der Individualität,
die ihm aus der Vergangenheit überkommen sind, seine Fähigkeit eingebüßt,
sich von der geschichtlichen Welt, auf die es sich erkennend und handelnd
bezieht, wirksam zu unterscheiden: es ist denjenigen Typen gleichgeworden,
an denen er zum Zeugen seiner — historischen, sexuellen, semantischen —
Differenz werden müßte; es ist Gleiches unter Gleichen, und um das, was an
ihm individuell, also ungleich war, beschnitten, kastriert, ein Eunuch unter
Frauen. Im Reich der Gleichheit aber — ob es nun die historische Gleichheit
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die epistemologische zwischen Den-
kendem und Gedachtem, die juristische Gleichheit unter den Bürgern einer
Gesellschaft oder die physiologische zwischen den Geschlechtern und Altern
sei —, im Reich der Gleichheit gibt es keine Geschichte, weil Geschichte,
4
Hier wie im folgenden werden Nietzsches "Texte — von wenigen Ausnahmen abgesehen —
nach der Ausgabe seiner Werke in drei Bänden^ ed. Schlechta, München 1966, zitiert. Die
Fundstellen werden in der Regel im laufenden Text notiert; dabei bedeuten die römischen
Ziffern die Band-, die arabischen die Seitenzahl der zitierten Ausgabe. Hier: (I 222).
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
310 Werner Hamacher
•
wie Nietzsche sie denkt, an die Bedingung der Ungleichheit, ja der Inkommen-
surabilität der an ihr beteiligten Momente geknüpft ist. Im Individuum tritt
diese Inkommensurabilität hervor und wird in ihr zu einer die Uniformität
der historischen Sachverhalte und Verhaltensweisen der Erkenntnis deformie-
renden, transformierenden und so erst eigentlich geschichtlichen Macht.
Individualität ist so sehr als Inkommensurabilität bestimmt, daß kein Indivi-
duum seinem Begriff entspräche, das mit sich selber eins und gleich, das eine
durchgängig bestimmte, ganze Form wäre. Menschliches, ll* umenscbliches
empfiehlt als Mittel zur Erkenntnis, sich selbst nicht durch eine beständige
Haltung zu uniformieren und sich selber nicht als starres beständiges eines Individuum
zu behandeln (I 719). Erst die Nicht-Identität des Individuums mit sich macht
seine Individualität aus. An sich selbst als Begriff, Haltung und Funktion
gemessen, erweist sich das Individuum, anders und mehr — oder weniger —
zu sein als es selbst. Seine Individualität ist immer nur das, was über seine
empirische Erscheinung, seine soziale und psychische Identität und seine
logische Form hinausreicht. Individualität ist unverrechenbarer Überschuß.
Wenn nun Individualität das irreduzibel Ungleiche ist und wenn die
Individualität vergangenen und gegenwärtigen Lebens von der idealistischen
und der positivistischen, von der archeologischen wie von der teleologischen
Geschichtsschreibung an die Identität ihres Typus verraten werden muß,
kann der Ermöglichungsgrund von Individualität— und zugleich der Grund
jeder affirmativen oder kritischen Rede von ihr — nur in der Spanne der
Differenz zwischen der Uniformität der bisherigen Geschichte und einer von
Typen, Bedeutungen und Werten noch unbesetzten Zukunft liegen. Was die
Reihe der Formen und was die Form der Formen selbst, die typisierende
Erkenntnis und ihre gegenständlichen Korrelate, auf eine Zukunft hin über-
schreitet, die sich der Typisierung und Vergegenständlichung entzieht —: das
allein löst sich aus der Totenstarre kanonischer Lebensformen und entgleitet
dem Subsumtionszwang allgemeiner Begriffe: das allein kann mit Fug Indivi-
dualität heißen. Individualität ist zukünftig, nie das schon Gegebene, sondern
das, was sich aus der Zukunft als Möglichkeit für die Gegenwart ergibt, sich
immer erst noch ergeben wird und sich derart, in ihrem Geben, noch
vorenthält. Mit ihr aber — und das macht den eminenten Rang des Konzepts
der Individualität in Nietzsches üenken aus —, erst mit der auf ihre künftige
Möglichkeit sich eröffnenden Individualität gibt sich auch Leben. ... wir
selbst [sind] davon nicht überzeugt [...], ein wahrhaftiges Leben in uns %u haben^
schreibt Nietzsche in der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung. Als eine unlebendige
und doch unheimlich regsame Begriffs- und Worte-Fabrik habe ich vielleicht noch das
Recht, von mir %u sagen, cogito, ergo sum, nicht aber vivo, ergo cogito. Das
leere „Sein", nicht das volle und grüne „Leben" ist mir gewährleistet; meine ursprüngliche
Empfindung verbürgt mir nur, daß ich ein denkendes, nicht daß ich ein lebendiges
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens* 311
Wesen, daß ich kein animal, sondern höchstens ein cogital bin. Schenkt mir erst
Leben [...] — so ruft jeder einzelne [...] Wer wird ihnen dieses Leben schenken? —
Kein Gott und kein Mensch: nur ihre eigne Jugend (I 280—281).
Keine dem Einzelnen transzendente Macht, weder ein anderer Mensch,
noch eine dem Menschen überlegene Instanz, aber auch nicht dieser einzelne
Mensch selbst ist die Quelle geschichtlichen Lebens, sondern nur das, was
an ihm selber als ,Jugend* über die Grenzen seiner historischen Bestimmtheit
in eine noch offene Zukunft hinausweist. Der Satz, mit dem sich freie
Individualität Existenz zuspricht — nicht ihr Sein ausspricht oder konstatiert,
denn substantielles Sein ist ihr nicht gegeben —, lautet nicht mehr cogito, ergo
sum, und auch nicht einfach performativ ego sum* sondern ero sum. Im Hinblick
auf meine Totalitätsunbestimmtheit und meine konstitutiv unabschließbare
Zukünftigkeit spreche ich mir Sein zu. Erst meine Zukünftigkeit schenkt
mir Leben. Dieses Leben ist niemals ein in deskriptiver Rede erfaßbares
Vorhandenes, es ist niemals schon da und als schon Daseiendes ausgesagt,
sondern immer und in alle Zukunft erst Kommendes und von der Sprache
nur Angekündigtes. Die Rede von ihm ist nicht Prädikation, sondern Prä—
dikation im Sinne der Voraus-sage und des Versprechens, des Vor-sprechens5.
Derart vor-sprechend spreche ich mir Sein zu. Sein — Individualität — ist
in meiner Rede nie feststellend ausgesagt, sondern als Anspruch und unter
dem Vorbehalt meiner Zukünftigkeit — also nie hinreichend und nie in
generalisierbarer Vollständigkeit — angekündigt. Wenn das Leben geschicht-
licher Allgemeinheiten unter Gesetzen steht — und Nietzsches zweite Un^eit-
gemäße Betrachtung versucht einige dieser Gesetze zu beschreiben —, dann ist
die Zukünftigkeit dieses Lebens und die ihr entsprechende Form seines nie
hinreichenden Versprechens das Gesetz dieser Gesetze.
Gegen diesen Gedanken von der Zukünftigkeit des Lebens, das die
Sprache freier Individualität eröffnet, mag man nun den Einwand geltend
machen, daß es keine Sprache geben kann, die ohne konventionelle Bedeu-
tungsregeln auskommen könnte. Nietzsche hat den Konventionalismus von
Sprach- und Lebensformen nicht nur nie bestritten, sondern einen großen
5
Wenn diese Formulierungen an Heideggers Privilegierung der Zukunft als des Bereichs
eigentlichen Seinkönnens erinnern, so deshalb, weil Heideggers Überlegungen zum Teil auf
die Nietzsches zurückgreifen: seinen Dank hat Heidegger in einer beeindruckenden kurzen
Analyse von Nietzsches Geschichtsaufsatz in Sein und Zeit (§ 76) abgestattet, ihm aber später
seine Schuld schlecht entgolten, indem er Nietzsches Leistungen beim Gewinn einer neuen
Einschätzung der Zukünftigkeit des Daseins in seinen Nietzsche-Vorlesungen keiner Erwäh-
nung mehr würdigte.
Zum Problem des Versprechens und der vorlaufenden Rede cf. W. H. — Das Versprechen
der Auslegung — Überlegungen ^um hermeneutischen Imperativ bei Kant und Nietzsche. In: Spiegel
und Gleichnis, Festschrift für Jacob Taubes, ed. N, Bolz/W. Hübener; Würzburg 1984;
pp. 252-273.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
312 Werner Hamacher
•
Teil seiner analytischen Arbeit dem Nachweis gewidmet, daß selbst Formen
der Logik, die das Zeichen ihrer Geschichtlichkeit nicht auf der Stirne tragen,
den Charakter denkökomonisch motivierter Konventionen haben. Aber Be-
deutsamkeit kommt ihnen nur deswegen zu, weil sie sich sämtlich auf eine
Zukunft beziehen, deren Möglichkeiten von keiner dieser Konventionen
schon durchgängig determiniert sein kann, die aber ihrerseits über Fortleben
oder Zerfall solcher Konventionen entscheiden wird. So lassen sich die
Phänomene der Vergangenheit und der Gegenwart niemals allein im Rahmen
konventioneller Regeln verstehen, sondern erst im Hinblick auf das, was als
Zukunft jede Regel erst legitimiert oder mit dem Entzug ihrer Legitimität
bedroht. Nietzsche schreibt: Der Spruch der Vergangenheit ist immer ein Orakel-
Spruch: nur als Baumeister der Zukunft, als Wissende der Gegenwart werdet ihr ihn
verstehn [...], und: nur der, welcher die Zukunft baut, \hat\ ein Recht [—], die
Vergangenheit %u richten (1251). Auch die Bilder der großen historischen
Individuen und individuellen Epochen lassen ihre Individualität erst unter
dem Blick hervortreten, der aus der Zukunft auf sie fallt. Selbst wenn Sprache
und gesellschaftliches Leben konventionellen Regeln unterworfen sind, so
werden sie doch beredt und verständlich erst in einem Raum, der auf die
Zukunft als denjenigen Bereich geöffnet ist, in dem die Geltung, die Sprache
und die Verständlichkeit dieser Regeln nicht gesichert, sondern suspendiert
ist. Verstehen ist nur auf Grund der Suspendierung des Selbstverständlichen,
Sprache nur auf Grund des Aussetzens ihrer überlieferten Formen und ihrer
lebendigen Gegenwart möglich. Selbst das Allgemeinste erscheint nur an der
Stelle dessen, was nicht unter es befaßt ist: dort nämlich, wo es die künftige
Signatur des Individuellen trägt.
Die Bedeutungsfahigkeit des Vergangenen und Gegenwärtigen verdankt
sich also dem, was seine Totalität, seine Regeln und Formen als ein Individuel-
les übersteigt. Das Leben entspringt seiner Zukunft; das Ganze einem Beson-
deren und von ihm Abgesonderten, dessen fortgesetzte Entfernung von ihm
die Grenzen des Ganzen beständig verschiebt und es daran hindert, sich in
sich selber zu schließen. Individualität indeterminiert das von einem System
von Typen und Werten determinierte Leben und ist für Nietzsche noch die
Indetermination dessen, was für Leibniz und seine Schule das omnimode
determinatum^ das Individuum war. Als offener Grund des durchgängig Be-
stimmten ist es dessen determinierende Indetermination.
Erst im Hinblick auf diese in jedem Sinne überragende Funktion, die
Nietzsche dem Individuellen und der Idee des souveränen Individuums
zuweist, lassen sich die emphatischen Formulierungen recht verstehen, die
die dritte ,Unzeitgemäße Betrachtung" Schopenhauer als Erzieher einleiten. Im
Grunde — so heißt es dort — weiß jeder Mensch recht wohl, daß er nur einmal,
als ein Unikum, auf der Welt ist und daß kein noch so seltsamer Zufall %um ^weitenmal
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
»Disgregation des Willens* 313
ein so wunderlich buntes Mancherlei %um Einerlei, wie er es ist, ^usammenschütteln
wird: [...] Die Künstler allein hassen dieses lässige Einhergehen in erborgten Manieren
und übergehängten Meinungen und enthüllen das Geheimnis, das böse Gewissen von
jedermann, den Sat^, daß jeder Mensch ein einmaliges Wunder ist: [...] Der Mensch,
welcher nicht %ur Masse gehören will, braucht nur aufzuhören, gegen sich bequem %u
sein; er folge seinem Gewissen, welches ihm %uruft: „sei du selbst \ Das bist du alles
nicht, was dujet^t tust, meinst, begehrst" (I 287 — 88). Und weiter: Ein jeder trägt
eine produktive Einzigkeit in sich, als den Kern seines Wesens; und wenn er sich
dieser Einzigkeit bewußt wird, erscheint um ihn ein fremdartiger Glan^, der des
Ungewöhnlichen (I 306). Die produktive Einzigkeit, um deren Erzeugung und
Erziehung es — so sehr sie doch dem Zufall verdankt ist — Schopenhauer als
Erzieher geht, wird von Nietzsche in diesem Text und in ungezählten anderen
einem allem Anschein nach durch und durch anti-individuellen Zweck unter-
geordnet, nämlich dem metaphysischen Zwecke^ der Natur zur Aufklärung über
sich selbst zu verhelfen und sie auf diese Weise zu vollenden. Diesem Zweck
dient die Erzeugung des Philosophen, >des Künstlers und des Heiligen
in uns und außer uns (1326). Einer etwa gleichzeitigen Aufzeichnung
zufolge, die unter dem Titel Wir Philologen steht, bleibt nur bei drei Existentfor-
men [...] der Mensch Individuum: als Philosoph, als Heiliger und Künstler (III 326).
Das Summum der Individualität, das die Natur im Philosophen, im Heiligen
und im Künstler erreicht, berührt das, was aller Individualität bar ist; ja, die
höchste Bestimmung der Individualität, ihr Telos und ihr Sinn liegt darin,
das All der Natur, das sich durch das Dasein in Raum und Zeit und also
unter der Wirkung des principium individuationis selber fremd geworden ist,
wieder zur Einheit zusammenzufuhren, es mit sich selbst zu versöhnen und
derart zum Organ seiner Selbsterkenntnis, seiner Selbstbeziehung und seines
Selbst zu werden. Auf ihrem Gipfel ist Individualität im Ununterschiedenen
zu erlöschen bestimmt: an dem Punkt, an dem das Ich gan^ zusammengeschmolzen
ist und dessen leidendes Leben nicht oder fast nicht mehr individuell empfunden wird,
sondern als tiefstes Gleich-, Mit- und Eins-Gefühl in allem Lebendigen (I 326).
Individualität ist in diesem — dem Schopenhauerschen nah verwandten —
Gedanken im wesentlichen eine Funktion der Selbst-Totalisierung der Totali-
tät, der Systematisierung des Systems. Aber doch nur — wie Nietzsche in
der correctio vom nicht zum fast nicht mehr individuell einräumt — fast. Die Fuge
des Systems der Natur und des Einsgefühls in allem Lebendigen schließt sich
nicht ohne ein Äußerstes an Individualität, nämlich Individualität gegen
die dem principium individuationis unterworfenen Formen des allgemeinen
Bewußtseins; aber diese Individualität gegen die Individualität kann, selber
dem Prinzip des Außereinander noch unterworfen, die Fuge der Einheit und
Allheit des Lebendigen tmtfast schließen. Sie ist in der Einheit das Moment
ihres Unterschieds von sich, und im Unterschiedenen das Moment seiner
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
314 Werner Hatnacher
•r
möglichen, aber nie geschlossenen Einheit. Individualität, a fortiori* die des
Philosophen, des Künstlers und des Heiligen, ist das Moment, in dem die
Gesamtheit des Lebendigen zu sich kommt, aber bei sich selbst nicht an-
kommt. Ihre produktive Einzigkeit ist produktive Differenz.
In vergleichbarer Weise wird das Problem der Individualität von Nietzsche
schon früher, in seiner Geburt der Tragödie, behandelt, indem das apollinische
Prinzip der Teilung und Differenzierung als bereits in der ursprünglichen
Einheit des Dionysischen am Werke gezeigt wird. Die Individuation, die
Zerstückelung, das eigentlich dionysische L·eiden (I 61) quält das Ur-Eine, [...]
Ewig-Leidende und Widerspruchsvolle (I 32) nicht als eine äußerliche Gewalt,
sondern als Vollzug seines immanenten Prozesses; und wenn das Dionysische
vom Leiden der Individuation Erlösung findet, so nur in den flüchtigen
Formen der Deutung, des Scheins und also abermals der Individuation.
Heilen soll das, was die Wunde schlug, aber die Wunde Individuation ist
doch zugleich das Leben der ursprünglichen Einheit des Ganzen. Während
also in dieser Konzeption des tragischen Prozesses Nietzsche, obzwar von
Schopenhauer nicht unabhängig, versucht, den Einigungs- und Verallge-
meinerungsprozeß des Dionysischen als einen Prozeß seines immanenten
Apoll, des Gottes der Individuation, also der Zerstückelung, der Täuschung und
der unaufhebbaren Scheinverfallenheit des , wahrhaft Seienden* zu denken,
hatte Schopenhauer selbst, auf den sich diese Konzeption beruft, die Individu-
alität als Fehltritt in schroffen Gegenatz zur Un^erstörbarkeit unsers Wesens an
sich gestellt: Denn — so schreibt Schopenhauer6 -^- im Grunde ist doch jede
Individualität nur ein specieller Irrthum, Fehltritt, etwas das besser nicht wäre, ja,
wovon uns zurückzubringen der eigentliche Zweck des Lebens ist.
Von dieser Schopenhauerschen Hypostase einer unzerstörbaren Lebens-
substanz, von der die Individualität nur eine bedauerliche, ja sündhafte
Abweichung darstellen soll, hat Nietzsche sich also bereits im Tragödienbuch
durch den Gedanken der Wechselimplikation seiner beiden Prinzipien freige-
macht; und bald nach seiner Schopenhauer-Hommage in den Unzeitgemäßen
Betrachtungen konnte er sich auch explizit von der pessimistischen, alle Indivi-
duation als Erbsünde des Menschengeschlechts verübelnden Philosophie sei-
nes Lehrers abwenden: so, mit wachsendem Nachdruck, geschehen in Mensch-
liches, ll%umenschliches und Die fröhliche Wissenschaft. Eine Notiz aus dem
Nachlaß der achtziger Jahre kommt noch einmal kritisch auf Schopenhauers
Individuationstheorie zurück und attackiert insbesondere die Vorstellung,
Individuation sei Fehltritt, Irrtum und Verirrung. Die pessimistische Verurteilung
des Lebens bei Schopenhauer ist eine moralische Übertragung der Herden-Maßstäbe
ins Metaphysische. — Das „Individuum" sinnlos, folglich ihm einen Ursprung im
6
Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. 2, Kap. 41; ed. A. Hübscher, Wiesbaden 1949, p. 563.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens* 315
„ , -sich" gebend (und eine Bedeutung seines Daseins als „Verirrung"); [...] Es rächt
sich, daß von der Wissenschaft das Individuum nicht begriffen war: es ist das gan^e
bisherige Leben in einer Linie und nicht dessen Resultat (III 545). Das
Individuum ist mithin nicht bloß Ausscherung aus dem Kreis der Totalität
und nicht nur Abirrumg vom Weg des Willens in das'Nichts seines Seins;
das Individuum ist auch nicht das Resultat des Gattungsprozesses — als
solches wäre es unselbständig bloßes Exemplar dieser Gattung —, es ist der
gesamte Lebensprozeß selbst: jedes Einzelwesen [isf] eben der gan^e Prozeß in
gerader Linie [...], so hat das Einzelwesen eine ungeheuer große Bedeutung
(III 558). Diese historisierte Leibnizsche These, das Einzelwesen sei der ganze
Prozeß und seiner internen Universalität stünde nichts Fremdes entgegen,
wird gleichsam konterkarriert durch die nähere Bestimmung, diese ungeheuer
.große Bedeutung komme dem Individuum erst als einem autonomiefähigen
Wesen zu: erst als sich selbst neue Ziele stellend, erst also indem es (in) seine
eigene Zukunft sich entwirft, seine Freiheit von Konventionen, Sitten und
Moralen als seine Freiheit %u seinem eigenen künftigen Selbst bewährt, wird
das Individuum zum ungeheuer bedeutsamen Einzelwesen, in dem sich der
ganze Prozeß seines Werdens unter dem Zeichen seiner Zukünftigkeit dar-
stellt. Nur auf sich als sein noch ausstehendes künftiges Selbst bezogen, ist
es ein einziges Ganzes und einzig: frei von jeder ihm vorgegebenen Totalität.
Eine andere Aufzeichnung, die im engsten gedanklichen Zusammenhang
mit der eben zitierten steht, weist in die gleiche Richtung: Die überschüssige
Kraft in der Geistigkeit, sich selbst neue Ziele stellend; durchaus nicht bloß als
befehlend und führend für die niedere Welt oder für die Erhaltung des Organismus, des
„Individuums". — Wir sind mehr als das Individuum: wir sind die gan^e Kette noch,
mit den Aufgaben aller Zukünfte der Kette (III 561). Den Akzent auf die neuen
Ziele verstärkt die folgende Eintragung, die die Kategorie des Novum mit
großer Emphase für die Theorie der Auslegung reklamiert: Das Individuum
ist etwas gan^ Neues und Neuschaffendes, etwas Absolutes, alle Handlungen
gan^ sein Eigen. — Die Werte für seine Handlungen entnimmt der einzelne ^ulet^t
doch sich selber: weil er auch die überlieferten Worte sich gan^ individuell deuten
muß. Die Auslegung der Formel ist mindestens persönlich, wenn er auch keine
Formel schafft: als Ausleger ist er immer noch schaffend (III 913). Der innova-
tive Charakter des Individuellen verdankt sich aber einem spezifischen Zug
jener Kraft, die Werte und neue Wort-Deutungen setzt —, einem Zug, der
über den engen Kreis der literarischen Hermeneutik hinaus für die Struktur
sowohl der überlieferten Formeln und Handlungstypen wie auch der Indivi-
dualität selbst in jedem Sinn entscheidend ist. Diese Kraft ist nämlich keine
der Erhaltung des Organismus oder des Prozesses, der in ihm resultiert: in
diesem Falle wäre sie bloße Funktion dessen, was ihr voranging; sie ist auch
keine Kraft der ^?/£j/-Erhaltung: in diesem Falle würde sie nur bewahren,
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
316 Werner Hamacher
• r
was schon gegeben ist; — sie ist Kraft der Individuation und der Absolutie-
rung nur als überschüssige Kraft, die sich verschwendet und mit der das Selbst
und sein Erhaltungsvermögen sich verausgabt. Erst der Überschuß der Kraft,
erst das Gefühl der Fülle, der Macht, die überströmen will, [...] das Bewußtsein
eines Reichtums, der schenken und abgeben möchte (II 730—731), überschreitet
die Grenzen eines gegebenen Überlieferungszusammenhangs, übersteigt die
Formeln, Typen und Werte gesellschaftlichen Handelns, die grammatischen
Regeln, die ,Wortec und die kodifizierten Bedeutungen einer Sprache, um sie
im Akt ihrer Deutung durch neue abzulösen. Die individuierende Kraft
übersteigt das Individuum, wie es durch die historische Totalität seiner
Momente bestimmt ist. Sie de—terminiert das Determinierte. Sie setzt es aus
seinen Bestimmungen und Grenzen hinaus, setzt es aus und gibt es — eine
Aufgabe — jenem zeitlichen Überschuß der Zukunft anheim, der von keiner
Vergangenheit und keiner Gegenwart eingeschränkt ist.
Nicht das Individuum als organische oder als Bewußtseins-Einheit, auch
nicht Individualität als das Wesen personaler Identität, sondern Individualität
als die durch ihr Übermaß und ihre Verausgabung individuierende Kraft,
dem die Einzelwesen und ihre Konfigurationen sich allererst verdanken, ist
das Movens des Übergangs von der konventionellen Formel zur Deutung,
vom allgemeinen Typus zu seiner je singulären Alteration. Nur der Exzeß
individuiert. Das Individuelle ist also kein Moment des Ganzen, sei es als
totum oder sei es als compositum verfaßt, und es ist nicht die Gestalt der
Autonomie eines sich selbst setzenden, substantiellen Subjekts. Was als Indivi-
dualität aus dem Überschuß an Kraft hervorgeht, geht strukturell über Totalität
und Subjektivität hinaus, und da es weder die eine noch die andere ohne
diesen Überschuß geben könnte, gehört die Überschreitung von Totalität und
Subjektivität zu deren Möglichkeitsbedingungen. Individualität — strenger
Singularität — ist, als transceüdens^ das Transzendental der Subjektivität. Wenn
es Autonomie des Individuums gibt, dann nur vermöge dessen, was auch sie
noch überschießt.
Daß das Leben des Individuums Isich erst von dem herschreibt, was über
die Sphäre seiner personalen oder gegenständlichen Gegebenheit hinausgeht,
macht den Begriff von Leben, den Begriff der Individualität und ihres Seins,
und macht die Sprache, in der sich dieser Begriff artikuliert, problematisch.
Nietzsche hat dieses Problem, das sich nicht in dein der individuellen Gestal-
ten des Sprechens über Individualität erschöpft, sondern, weiter, eines der
Artikulation des Transzendentals in der Sprache ist, im 262. Aphorismus von
Jenseits von Gut und Böse durchgespielt, in dem Kapitel, das der Frage Was ist
vornehm? nachgeht. Der hier entwickelten fiktiven Gesellschaftsgeschichte
zufolge — einer Geschichte, so darf man hinzufügen, der Vergesellschaftung
überhaupt —', wird eine ^lr/, ein Typus [...] unter dem langen Kampfe mit
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens* 317
wesentlich gleichen ungünstigen Bedingungen %ur Härte, Gleichförmigkeit, Einfach-
heit der Form festgestellt. Läßt in einer Glückslage [...] die ungeheure Spannung,
der der Typus unterliegt, einmal nach, so reißt mit einem Schlage das Band und
der Zwang der alten Zucht: [...] Die Variation, sei es als Abartung (ins Höhere,
Feinere, Se/fettere), sei es als Entartung und Monstrosität, ist plötzlich in der größten
Fülle und Pracht auf dem Schauplätze, der einzelne wagt einzeln %u sein und sich
abzuheben (II 735/36). Abartung und Entartung, Atypie und Monstrosität,
kurz: Individualität entspringt nicht einfach einem kontinuierlichen histori-
schen Prozeß, sondern der zusätzlichen Kontingenz eines glücklichen Zufalls,
der das Band und die Züge der Zucht zu durchbrechen und die Grenzen der
mit einem Schlage altgewordenen Moral zu überschreiten erlaubt, so daß die
wild gegeneinander gewendeten, gleichsam explodierenden Egoismen [...] keine Zügelung
[ . . . ] mehr aus \ihr\ %u entnehmen wissen. Zug, Zucht und Zügelung zerreißen
in der Glückslage, in der der Typus zu reiner Autonomie gediehen scheint.
Aus ihrer immanenten Spannung, dem überschüssig gewordenen Zwang der
Soziali tat, treiben sie ihn über sich selber hinaus. Diese Moral selbst war es,
welche die Kraft ins Ungeheure aufgehäuft, die den Bogen auf so bedrohliche Weise
gespannt hat — jet^t ist,jet%t wird sie „überlebt". Die Moral — des Typus, der
Einheit und Allgemeinheit, der Gesellschaftlichkeit, der Form, des determinie-
renden Zugs und der Zucht — hat sich „überlebt". Er selbst, der Typus, lebt
über sich selbst, er lebt über sein eigenes Leben hinaus; aber er lebt über sein
eigenes Leben nicht als er selbst, nicht als Typus und nicht nach dem Maße
des im Typus festgestellten Lebens hinaus, sondern als das größere, vielfachere,
umfänglichere L·eben\ der Typus „überlebt" sich als das „Individuum" (II 736).
Durch sein Überleben wird aus der Einheit eine strukturell unbegrenzbare
Vielheit, aus der Allgemeinheit der Polis- und Staatsgemeinschaft eine desor-
ganisierte Anarchie von Individuen, aus der logischen Allgemeinheit der
Luxus eines Begriffs, der sich selbst nicht mehr faßt, aus dem Zugy der alles
in fester, vergegenständlichender Kontur hielt, unendlicher Selbst-Entzug,
und aus dem Leben, das mit dem Umfang der Form koextensiv war, die
junge, noch unausgeschöpfte, noch unermüdete Verderbnis. Denn indem es sich
„überlebt", ist das Leben — entsprechend einer Bedeutungsnuance des deut-
schen Wortes — veraltet, unnütz geworden und abgestorben. Das Leben
selbst ist „überlebt". Es lebt nicht mehr. Derart „überlebt"r, lebt das Leben,
verändert, zu etwas anderem als es selbst geworden, zugleich auch fort —:
Nietzsche schreibt jet^t ist, jet^t wird sie „überlebt" und nimmt die eine
Bedeutung des ,Wortes* „überlebt"r, dessen Bedeutungspotential er in diesem
Aphorismus ausspielt, im nächstfolgenden Satz mit der Wendung wieder auf,
es sei der gefährliche und unheimliche *Punkt [...] erreicht, wo das größere, vielfachere,
umfänglichere Leben über die alte Moral — und die in ihr festgehaltenen Lebens-
formen — hinweglebt; das „Individuum" steht da, genötigt %u einer eigenen
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
318 Werner Hamacher
•r
Gesetzgebung, %u eigenen Künsten und Listen der Selbst-Erhaltung, Selbst-Erhöhung,
Selbst-Erlösung. Wohl ist es also, wie eine andere Wendung sagt, das Genie der
Rasse aus allen Füllhörnern des Guten und Schlimmen überquellend^ das über sich
selbst hinweglebt\ aber nur als überquellendes, überschüssiges und sich nicht
als das der Rasse erhaltendes Genie „überlebt" es sich und bleibt am Leben
allein in der atypischen Monstrosität des „Individuums", das über die Resour-
cen seiner Rasse und ihres Typus nicht mehr verfügen kann. Im Individuum
„überlebt" sich das Leben der Gesellschaft, seine Form und sein Sinn. Aber
weit entfernt, sich in ihm aufzuheben, erhält es sich in ihm nur so, daß es
sich darin seiner Verderbnis überläßt. In ihrem individuellen Überleben
bewährt die Gesellschaft nicht ihr Wesen, sondern verwest. Das Individuum
ist der Verweser seiner Gesellschaft. „Überlebt" — das heißt, als „überlebt
sein", erschöpft, insubstantiell und kraftlos sein; es heißt zugleich, als „überlebt
werden", daß etwas Unaufgebrauchtes, Unausgeschöpftes jenseits des Lebens
fortbesteht; und es heißt — nach einer selber mittlerweile überlebten Bedeu-
tung des Wortes, die Nietzsche durch die Üppigkeitsmetaphorik seines Textes
neu belebt — zu sehr, im Exzeß leben. In dem Satz „Das Individuum —
überlebt", zu dem sich Nietzsches Aphorismus verdichten läßt, schürzen sich
alle diese Bedeutungsfaden zum Knoten: der abgestorbene Typus — des
Lebens, des Seins — hat sich im Individuum in exuberanter Pracht in der
Weise über sich selber hinausgelebt, daß er in ihm nur noch verfallt. Das
Individuum ist nichts anderes als das zügellos üppige Sich-Überleben des
Lebens, die fortwährende Vergängnis des exzessiven, in die Einheit einer
historischen, sozialen oder logischen Form nicht mehr befaßbaren Seins.
Individualität ,ist4 Über-Leben. Leben ohne Leben. „Leben".
Das Individuum lebt nicht. Es überlebt (sich). Sein Sein ist Über-Sein
und Übrig-Sein, insubstantieller Rest und Exzeß über jede determinierbare
Form menschlichen Lebens. Statt noch die soziale oder psychische Existenz-
form des Menschen zu sein, ist das Individuum — die Selbstübfersteigung
von Typus und Gattung — Ankündigung des Übermenschen. Aber es ist sie
nicht anders als im Modus der ,unheimlichen*, gefährlichen4, ,luxurierenden'
,Monstrosität", in der Form eines den Tod seines Typus überdauernden
Wiedergängers, eines lebendigen Toten. Am Individuum diagnostiziert Nietz-
sche ein verhängnisvolles Zugleich von Frühling und Herbst\ das an jene Zeichen von
ufgang und Niedergang erinnert, die Nietzsche auch an sich selber entdeckt
und die er in Ecce homo in die Rätselform bringt: ich bin [...] als mein Vater
bereits gestorben, als meine Mutter lebe ich noch und werde alt (II 1070). Darin, daß
er als seine Mutter sich als seinen Vater überlebt, daß er sich selbst überlebt
und, derart sich überlebend, doppelt, sein eigener Doppelgänger ist ,(II 1073)7
7
Zur Bewegung des Doppelgängers bei Nietzsche cf. W. H. — pleroma — ^u Genese und
Struktur einer dialektischen Hermeneutik bei Hegel^ in: G. W. F. Hegel „Der Geist des Christen-
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens* 319
—: darin sieht Nietzsche das Glück seines Daseins und seine Einzigkeit
vielleicht (II 1070). Die Spaltung und Verdoppelung des Zugs, der den Typus
formte, erst sie und nicht dessen Einheit macht die Einzigkeit eines Daseins
aus. Erst in ihrer Dualität trägt sich die Individualität aus; erst das Dividuum
ist das Individuum8 — vielleicht: und dieses vielleicht bezeichnet jenseits aller
empirischen Ungewißheit die Unmöglichkeit einer unzweideutig exakten
Erkenntnis eines Wesens, dessen Einzigkeit in seiner Spaltung liegt.
Gibt die Formulierung, etwas werde „überlebt", noch der Hoffnung Raum,
das Überlebende sei im Unterschied zum Überlebten unverbraucht und kraft-
voll, es sei ihm entgegengesetzt wie das Leben dem Tod und ihre Trennungsli-
nie verlaufe ebenso distinkt wie diejenige, die den Typus prägt, so belehrt
schon die Wendung vom verhängnisvollen Zugleich von Frühling und Herbst in
der Epoche der Individualität darüber, daß es ein Überleben nur vermöge
seiner Allianz, seiner Mesalliance mit dem Verfall gibt. Individuell ist das
Inkommensurable, sofern es der Ort der Verbindung zwischen unverträg-
lichen Größen ist. In ihm überlebt keine unausgeschöpfte, unermüdete posi-
tive Kraft, sondern die noch unausgeschöpfte, noch unermüdete Verderbnis. Das
Individuum ist nicht nur Frühling und Herbst zugleich; es ist der Frühling
des Herbstes. War der Typus der Ort der Kraft, des Lebens, des Seins, das
sich als Sein in den Grenzen seiner Form darstellte und erhalten sollte, so
entbindet die überschüssige Kraft und das Überleben des Individuums das, was
die Form des Seins als des sich selbst erhaltenden gesellschaftlichen Lebens
sprengt: seine Endlichkeit. Das Sein, das sich im Individuum „überlebt", ist der
Endlichkeit überlassen. Das Individuum, das „Überleben"r, überlebt nicht.9
Nietzsche nimmt das Problem und das Wort vom Überleben — auf diese
Weise seinen für den Text determinierenden Rand unterstreichend — am
Ende seines Aphorismus wieder auf und schreibt über diejenigen^ die unter
den Bedingungen eines allgemeinen Niedergangs der in Individuen aufgelö-
sten Gesellschaft allein noch überdauern: Die Mittelmäßigen allein haben Aus-
sicht, sich fortzusetzen, sich fortzupflanzen — sie sind die Menschen der Zukunft, die
tums", Schriften 1796—1800; ed. W. Hamacher, Berlin 1978; pp. 306—318. Zum gleichen
Problem: Jacques Derrida — Nietzsches Otobiograpbie oder Politik des Eigennamens^ in: Fugen
— Deutsch-französisches Jahrbuch für Text-Analytik, ed. M. Frank, F. Kittler, S. Weber;
Ölten 1980; pp. 64—98. Das französische Original wurde unter dem Titel Otobiograpbie de
Nietzschey Paris 1984, veröffentlicht.
8
In Menschliches- A>ll%umenschliches heißt es in einem anderen Sinne: In der Moral behandelt sich
der Mensch nicht als Individuum, sondern als dividuum (1491). In einem wieder anderen Sinne
schreibt Novalis: Das ächte Dividuum ist auch das ächte Individuum. (Das allgemeine Brouillon,
Nr. 952).
9
Ich werde darauf hingewiesen, daß überleben, wie es hier gelesen wird, jenem survivre gleiche,
das J. Derrida in Texten von Blanchot und Shelley gelesen hat, — ich nehme an: bis auf
eine Reihe individueller Differenzen. Man vergleiche also: Living On, in: Deconstruction &
Criticism by Harold Bloom et al., New York 1979; pp. 75—176.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
320 Werner Hamacher
• j
einzig Überlebenden; [...] (II 737). Das in den Individuen verlorene Maß des
Typus wird zum Zweck der Selbsterhaltung in einem quantitativ bestimmten
Mittelmaß wiederhergestellt. Doch da die Moral des Mittelmaßes und der
durchschnittlichen demokratischen Gleichheit nicht der Steigerung, sondern
bloß der Konservierung der Kräfte unter Bedingungen ihres Verfalls dient,
ist das Mittelmaß und die ihm entsprechende Doktrin der Gleichheit dem
Exzeß der Invidiualität verdankt, die sie abwehren. Das schiere Überleben
ist ein Apotrop gegen die Endlichkeit des „Überlebens", aus dem es hervorge-
gangen ist. Weil die Dauer, die es gewährt, nur Schein ist, kann die Rede
vom Überleben des Mittelmaßes — wie Nietesche andeutet — nur Ironie
sein. Uneigentlich wie sie ist aber auch die Rede vom „Überleben" des
Individuums, das sich nur im Exzeß der Vergangnis vollzieht. Nietesche
schreibt in einer seiner späten Aufzeichnungen, unter dem Titel Renaissance
und Reformation —: Was beweist die Renaissance ? Daß das Reich des „Individuums"
nur kur^ sein kann. Die Verschwendung ist ^u groß; es fehlt die Möglichkeit selbst,
%u sammeln, %u kapitalisieren, und die Erschöpfung folgt auf dem Fuße. Es sind
Zeiten, wo alles vertan wird, wo die Kraft selbst vertan wird, mit der man sammelt,
kapitalisiert, Reichtum auf Reichtum häuft... (III 825). Das Reich des „Individu-
ums" — Nietzsche setzt seinen Namen immer wieder in Anführungszeichen^
um auf seine uneigentliche Verwendung und seine terminologische Unscharfe
aufmerksam zu machen —; dies Reich ist das Reich der Verschwendung und
der Verschwendung noch jener Kraft, die das Verausgabte wieder einsammeln,
es zusammenfassen, erhalten und mehren könnte. Was sich im Individuum
und seinem „Überleben" verschwendet, läßt sich nicht — und a limine nicht
einmal unter dem Titel Individuum — kapitalisieren. Das Individuelle ist dies,
verschwendet zu sein und sich nicht sammeln, sich nicht versammeln zu
können — weder in die zeitliche Einheit der Dauer seines Überlebens, noch
in die Einheit gesellschaftlichen Lebens, noch in die Einheit des Begriffs.
Wenn der Titel „Individualität", wo von Individualität bei Nietzsche die
Rede ist, fast das genaue Gegenteil dessen sagt, was er bedeutet, so entspricht
ihrem von Nietzsches Text skizzierten Ereignis um so genauer seine Weise,
das Wort „überleben" zu verwenden. Denn statt in die Einheit eines Begriffs
zu fassen, was in sich selber uneins ist, tritt dieses Wort — und hört damit
,Wort' zu sein auf —, je nach seiner grammatischen Funktion und seiner
Stellung im Kontext bestimmt, nach drei oder mehr verschiedenen Bedeu-
tungsrichtungen auseinander: es heißt longius vivere, supervivere, defungere und
excedere, es heißt darüber hinwegleben, überleben, Über-Leben und „überlebt". Das
Wort, das die Über-Struktur des Individuellen artikulieren soll, ist .selber in
der Weise überdeterminiert, daß seine einzelnen Bedeutungsmomente nicht
mehr in ein semantisches Kontinuum zusammengefaßt und ,kapitalisiert*
werden können. Für0 die einzelnen Bedeutungsmomente gilt das, was Niete-
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens* 321
sehe über die Egoismen, das heißt die Individuen und Individuen der Indivi-
duen schreibt: [...] nebeneinander und oft ineinander verwickelt und verstrickt [...]
ein ungeheures Zugrundegehn und Sich^ugrunderichten, dank den wild gegeneinander
gewendeten, gleichsam explodierenden Egoismen [...] (II 736). Im „überleben" überle-
ben die individuellen Bedeutungsmomente ihren eigenen lexikalischen Sinn
und den der konkurrierenden semantischen Tendenzen so, wie sich in den
Individuen der gesellschaftliche Typus, das Prinzip der Gesellschaftlichkeit
und des in ihm verbürgten Sinnkontinuums selbst überlebt. Bedeutung nimmt
das Wort — und in der Epoche des „Überlebens" jedes Wort — nur um den
Preis ihrer unausgesetzten Irritation durch eine andere Bedeutung und in der
Weise an, daß sie, locker wie sie ihm assoziiert ist, jederzeit von einer anderen
übermächtigt und verdrängt werden kann. Für ihre Diversität gibt es keine
andere Gemeinsamkeit als die disparate des „Überlebens". Was in der klassi-
schen Onto-Logik, die das Individuum durch die Immanenz seiner Prädikate
im Subjekt definierte, ausgeschlossen war, nämlich die Bildung von in sich
kontradiktorischen Grund-Sätzen, wird im Fall der Struktur des „Überlebens"
zu einem notwendigen Ereignis, das sich mit keinem Mittel einer semiologi-
schen Reinigung unter die Herrschaft eines semantischen oder pragmatischen
Typus zurückbringen läßt: Der Typus hat sich und ist „überlebt": Das Indivi-
duum — „überlebt" — überlebt nicht —: der semantische Überschuß und das
ebenso große semantische Defizit dieser Sätze läßt sich nur durch willkürliche
Reduktion in die Form einer klaren und distinkten Bedeutung bringen.
Nietzsche hätte ihr nicht das Attribut des Mittelmäßigen vorenthalten. Da
aber jede semantische Restriktion vom exzessiven Charakter des „Überlebens"
dependiert und ihrerseits keinen anderen Sinn als den des konservativen
Überlebens hat; und da weiterhin jede Sprache und jede andere Form des
gesellschaftlichen Lebens auf die Produktion eines — wie auch provisorischen
— Sinnkontinuums angelegt ist, das ihr weder in der Welt noch in Texten
schon gegeben ist, — ist die hyposemische Exuberanz des ,Wortes* und der
,Sache4 „Überleben" die abgründige Bedingung für jeden konventionellen
Sprachgebrauch und für jedes Leben, das sich in den Formen des gesellschaft-
lichen Austausche und der Kommunikation vollzieht. Die Indetermination,
die Überdetermination des „Überlebens" determiniert jedes Leben. Das Indivi-
duelle — „Überleben" — wäre also das Transzendental des Allgemeinen. Aber
im selben Maße, in dem es dem Allgemeinen — der Gesellschaft und des
Begriffs — den Grund seiner Möglichkeit bietet, läßt es ihn in sich zerfallen.
Das Individuelle — „überlebt" — überlebt nicht. Es gewährt weder den
Bestand, den der Typus versprach, noch die Dauer, die ironisch das Mittelmaß
verkündet. Die individuell gewordene Sprache — die des „Überlebens" —
spricht nicht mehr in der Gewißheit eines allgemeinen, kommunikablen Sinns
oder eines unablässig neue Allgemeinheiten produzierenden Typus; sie spricht,
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
322 Werner Hamacher
„überlebt", indem sie versagt ... Wenn ihr „Überleben" Transzendental ist,
dann detranszendentalisierend.
Die Dissoziations-, Exzeß- und Rest-Struktur der Individualität zieht auch
die Zentralkategorie von Nietzsches Spätwerk in Mitleidenschaft, die des
Willens. Nietzsche weist darauf, immer noch im 262. Aphorismus von Jenseits
von Gut und Böse, mit der ihm eigenen diskreten Beiläufigkeit hin: Wieder ist
die Gefahr da, die Mutter der Moral, die große Gefahr, diesmal ins Individuum
verlegt, in den Nächsten und Freund, auf die Gasse, ins eigne Kind, ins eigne Her^,
in alles Eigenste und Geheimste von Wunsch und Wille: [*..] (II 736). Wie das
Individuum, so ist auch der Wille und sogar das Eigenste des Willens in
Gefahr, sich zu verschwenden, sich zu erschöpfen und zu verderben. Weil
der Wille, der sich zur Akkumulation seiner Macht den Typus schuf, Wille
zu sich selbst, Wille zur unbedingten Autonomie des Willens nur sein konnte,
weil er selbst schon überschüssige Kraft ist, muß er auch die Organisationsform
des Typus und einer bestimmten logischen, ästhetischen und sozialen Gestalt
überschreiten und sich im Zerfall der ihn feststellenden Formen selbst „überle-
ben". Der Wille selbst ist und wird jetzt „überlebt". Er ist nicht mehr das
Zentrum autonomer Operationen, sondern, mit sich selber zerfallen, dem
tropischen Wuchern seiner monströs oder unscheinbar gewordenen Momente
ausgesetzt. Diese unausweichliche Wendung des Willens gegen sich selbst ist
für Nietzsche die Signatur der Moderne. Er hat sie am Positivismus der
Wissenschaften, in der Heraufkunft demokratischer Ideale und am Stil der
literarischen und musikalischen ,Dekadenzc beschrieben und mit der größten
sarkastischen Emphase am Zerfall organischer Gestalten in der Musik Wag-
ners, in Der Fall Wagner analysiert.
In einer Passage, die in vielem Überzeugungen des ,Dekadenz'-Theoreti-
kers Paul Bourget verarbeitet, schreibt Nietzsche: Ich halte mich diesmal nur
bei der Frage des Stils auf. — Womit kennzeichnet sich jede literarische
decadence^ Damit, daß das Leben nicht mehr im Ganzen wohnt. Das Wort wird
souverän und springt aus dem Sat^ hinaus, der Sat^ greift über und verdunkelt den
Sinn der Seite, die Seite gewinnt Leben auf Unkosten des Ganzen — das Gan%e ist
kein Ganges mehr. Aber das ist das Gleichnis für jeden Stil der decadence: jedesmal
Anarchie der Atome, Disgregation des Willens, „Freiheit des Individuums", moralisch
geredet — %a einer politischen Theorie erweitert gleiche Rechte für alle" (II 917).
So wie das Wort aus dem Satz, das Moment aus der Totalität hinausspringt,
so springt das Ganze selbst vom Ganzen ab und wird zu dessen bloßer
Suggestion. Das Ganze gibt es bloß als Schauspiel: es ist zusammengesetzt,
gerechnet, künstlich, ein Artefakt. Dagegen ist der Teil größer als das Ganze,
lebendiger, organischer und authentischer, das Gänze nur ein Teil jenes Teils,
der souverän über es geworden ist. Das Ganze zerfallt bei der stilistischen
Dekomposition nicht einfach in ein Chaos von Teilen, sondern in ein Ganzes,
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens' 323
das wesentlich scheinhaft, Schauspiel, Suggestion und Rhetorik, Hypnose
und Massen-Überredung ist; und andrerseits in Details, in denen allein das
Leben noch überlebt und in denen die Wahrheit über das Leben gesagt
werden kann: daß es vorbei ist und nur noch vorgetäuscht werden kann. Es
gibt zwei Seiten der Dekadenz, es gibt zwei Wagner: [...] vom Magnetiseur
und .Affresko-Maler Wagner abgesebngibt es noch einen Wagner, der kleine Kostbarkei-
ten beiseite legt: unsern größten Melancholiker der Musik, [...] Ein Lexikon der
intimsten Worte Wagners, lauter kur^e Sachen von fünf bis fünfzehn Takten, lauter
Musik, die niemand kennt... (II 918). Die unverhohlene, von keiner Totalisie-
rung verstellte Dekadenz des Stils zeigt sich in der Überlebendigkeit im kleinsten
(II 933), also darin, daß die individuierten Momente den Stil und das Werk
„überleben" und durch die Exuberanz ihres Lebens den durch technische
Veranstaltung erzeugten Schein des Lebens, den das „Ganze" verbreitet,
Lügen strafen. Das Detail, das sich aus der Gemeinschaft des Werkes emanzi-
piert hat, lügt nicht: seine bloße Existenz sagt schon die Wahrheit über die
Lüge des Ganzen, sagt die Wahrheit, daß es außer ihrer technischen Produk-
tion eine Wahrheit nicht gibt, und sagt diese Wahrheit so, daß sie niemand
— es sei denn er hieße Nietzsche — vernimmt. Die Kleinigkeiten, die kurzen
Sachen, in denen Wagner groß ist, sind solche, die — Nietzsche unterstreicht
es — niemand kennt. Was niemand kennt, kann niemandem unter dem Schein
des Ganzen entgegentreten. Wo es aber, wie für Nietzsche, bekannt wird,
steht es unter dem Zeichen der Melancholie, des Verlustes seiner eigenen
erfüllten Gegenwart. Die kleinen Kostbarkeiten^ das Kleinste^ die Nuancen sind
scheinlos in die Sphäre der Abwesenheit getaucht. Sie sind beiseite gelegt. Mit
ihnen ist der Bereich der Technik und der Positivität ebenso verlassen wie
der der Ästhetik und der Phänomenalität.
Der Dekadenz des Stils — und es erübrigt sich hier 2u betonen, daß
Nietzsche sie durchaus nicht einfach verwirft — entspricht ontologisch die
Disgregation des Willens. Wie die organische Gestalt, der Stil, zerfallt, so zerfallt
auch der Wille: denn der Wille, als Wille, ist nichts anderes als Stil. Und wie
der Stil unter den Bedingungen seiner Dekomposition nur vorgetäuscht
werden kann, so ist der Wille nur Schauspiel, Rhetorik und Massen-Hypnose.
Der Wille, „überlebt"r, erweist sich als technische Veranstaltung. Er degeneriert
zu einem Spiel, dessen Bewegungen nicht mehr er selber diktiert. Er unter-
liegt, in einer Passivität, die das grade Gegenteil seines Begriffs ist, der
Disgregation. Disgregation heißt nicht bloß Desintegration, Auflösung einer
ganzen, in sich geschlossenen Gestalt, sondern bezeichnet als Terminus der
Nietzsche wohlbekannten zeitgenössischen Physik die Trennung der Moleküle
eines Körpers durch gesteigerte Erwärmung (schwer, in diesem Zusammen-
hang nicht an seine Bemerkung zu denken, Wagners Musik schwitze). Disgre-
gation bezeichnet aber darüber hinaus, durch den etymologischen Zusammen-
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
324 Werner Hamacher
• r
hang mit grex, die Entherdung, die Dissoziation der von Nietzsche immer
wieder denunzierten dumpfen Masse, die einem Willen Untertan ist, der nicht
ihr eigener ist. Der Wille selber — so impliziert die befremdliche Wendung
von seiner Disgregation — ist die Herde; seine Einheit und Ganzheit, seine
organische Totalität ist die Form, in der er sich seines Kraftüberschusses
begibt. Erst in seiner Degeneireszenz, in der die Herde Wille auseinanderstiebt,
gewinnen seine individuellen Momente Souveränität, und fahren, als Herden-
phänomene „überlebt"', zu singulären Kraftmolekülen auseinander, die kein
Typus und keine arche mehr versammelt. Diese Emanzipation der Willensmo-
mente — die so nur in einem uneigentlichen Sinne heißen können, weil sie
nicht mehr Momente eines Willens sind —, sie verdankt sich der Auflösung
des Willens selbst und seiner generativen und regenerativen Kraft. Seine
Degeneration, seine Abweichung von der Form der Gattung und ihrer
Homogenität befreit also den Willen von seiner Herdenform, seiner Form
tout court, aber befreit ihn davon nicht^ um ihn in seiner uneingeschränkten
Macht zur Geltung zu bringen, sondern um ihn auf das zu öffnen, was, in
ihm am Werk, seiner Macht sich entzieht, die Heterogenität von Individuen,
die nicht wollen, die nicht den Willen wollen und ihn, weil auch er noch
eine Form der Kapitalisierung wäre, nicht wollen können. Die Disgregation
des Willens ins Einzelne und Kleinste bezeichnet — wie im Beiseitelegen kleiner
Kostbarkeiten in der melancholischen Musik Wagners — eine Möglichkeit des
Willens, vom Selbstbeziehungs- und Formzwang seiner eigenen Gestalt, von
seinem technisch-spektakulären Stil und seiner totalitären Selbstdarstellung
freizukommen. Diese Freiheit erfahrt er nicht durch sich und nicht als Wille,
sondern in der Passivität einer Disgregation, die, selber subjektlos, den
Gesetzen des Willens ebensowenig wie denen des Begriffs unterliegt. Daß er
diese Disgregation erfahrt, heißt nicht, daß er ihrer sicher sein oder sie als
Bewegung der Negativität sicherstellen könnte, denn er kommt als Subjekt
nicht mehr in Betracht und sie ist die Weise, sich jeder Vergegenständlichung
zu entziehen. Disgregation ist ohne Grenze und Bestimmung.
Insofern ist die Degeneration des Willens, die Nietzsche immer wieder
als Niedergang qualifiziert, mit seinem eigenen Wort ein ^ufgang. Sie ist aber
darum noch kein Anfang einer neuen Einheit, des Reichs der Freiheit,
Ungebundenheit und des gestaltlosen Schwärmens. Sie ist aufgrund ihrer
spezifischen Unabschließbarkeit, und das heißt auch Unvollendbarkeit der
mögliche Anfang neuer Ideologien der Freiheit, Gleichheit und Bestimmung
des Menschen, derjenigen demokratischen und kommunistischen Ideologien,
die Nietzsche nicht müde wurde, als Symptome des Nihilismus zu geißeln.
Von ihnen wird Gleichheit gepredigt und zwar Gleichheit genau derjenigen
Individuen, die durch die Disgregation des Ganzen jedes gemeinsame Maß
verloren haben und als inkommensurable Einzelwesen keine gesellschaftliche
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens* 325
Form haben können, die mehr wäre als eine juristische Fiktion, also ein
Schauspiel. Nun ist aber der Zusammenhang derer, die jeden organischen
Zusammenhang eingebüßt haben oder einzubüßen im Begriff sind, schlechter-
dings nicht anders vorstellbar als unter der Fiktion eines Zusammenhangs:
zum Beispiel unter der Fiktion des Begriffs Individuum', der ja nichts andres
behauptet als daß diese unvergleichlichen Einzelwesen alle gleichermaßen
Individuen sind. Die Ökonomie dieses Zusammenhangs, der sich in den
juristischen, moralischen und politischen Fiktionen der Gleichheit, Freiheit
und Persönlichkeit der Individuen ausspricht, und die, wie der Aphorismus
268 aus Jenseits von Gut und Böse entwickelt, eine Ökonomie des Überlebens
ist, kann so lange nicht aufhören, auch für die Disgregation des Willens
verbindlich zu sein, wie auch in ihrem Verlauf noch linguistische und darüber
hinaus überhaupt Bestimmungen der Mitteilung im Spiel sind. Die Disgrega-
tion des Willens ist keine, die der Wille selber betreibt, aber solange er ihr
noch als Wille unterliegt, ist in ihr die Vorstellung seiner Gegenständlichkeit,
seiner Einheit und möglichen Substantialität noch wirksam. Die Disgregation
nimmt noch am Schauspiel des Willens teil, und da sie unabschließbar ist,
hat ihre Teilnahme am Spiel der Vorstellungen kein Ende. Aber sie hat auch
in den Vorstellungen dieses Spiels kein Ende, ist durch sie nicht begrenzt
und nie das in ihnen Dargestellte. Statt selber ein Schauspiel des Willens zu
sein, in dem die Ideen von Gleichheit und Freiheit aufgeführt werden,
diskredierte die Disgregation es als Schauspiel. Ihre Teilnahme an seinen
Vorstellungen nimmt ihnen einen Teil: ihrer Stabilität, ihrer Konsistenz und
ihres technischen Charakters, und überantwortet ihn einer Bewegung, die
weder in den Grenzen politischer oder moralischer, noch in denen lingu-
istischer oder phänomenologischer Bestimmungen befangen ist.
Das Individuum in der Epoche der Disgregation des Willens — und diese
Epoche ist für Nietzsche die Epoche der Epochen, weil sie immer schon
begonnen hat —, das Individuum spricht, inddm es die sprachlichen Konven-
tionen verläßt, es zeigt sich, indem es sich vom Schauplatz der Allgemeinheit
zurückzieht und seine eigene Allgemeinheit in diesen Rückzug miteinbezieht.
Wenn dieser Prozeß — diese Sezession — indeterminiert ist, so nicht nur in
dem Sinne, daß er keine Grenze und kein Ende in einer neuen Einheit findet,
sondern auch in dem Sinne, daß ihm ein Adressat, der nicht selber dieser
Bewegung ausgesetzt wäre, fehlt. Nietzsche hat diese Überlegung ebenfalls
in losem Zusammenhang mit seinen Einwänden gegen die Musik Wagners,
insbesondere gegen ihre Totalitäts-Schauspielerei, lange vor Der Fall Wagner
schon in der Fröhlichen Wissenschaft — in ihrem 367ten Aphorismus —,
geäußert und darin seine Unterscheidung zwischen der Schauspieler-Kunst
und der scheinlosen Kunst strenger Individuierung mit dem Satz vom Tode
Gottes verknüpft. Der Aphorismus lautet: Alles, was gedacht, gedichtet, gemalt,
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
326 Werner Hamacher
•i
komponiert, selbst gebaut und gebildet wird, gehört entweder %ur monologischen Kunst
oder %ur Kunst vor Zeugen. Unter letztere ist auch noch jene scheinbare Monolog-Kunst
einzurechnen, welche den Glauben an Gott in sich schließt, die gan^e Lyrik des Gebets:
denn für einen Frommen gibt es noch keine Einsamkeit — diese Erfindung haben erst
wir gemacht, wir Gottlosen. Ich kenne keinen tieferen Unterschied der gesamten Optik
eines Künstlers als diesen: ob er vom Auge des Zeugen aus nach seinem werdenden
Kunstwerke (nach „sich" —) hinblickt oder aber „die Welt vergessen hat": wie es das
Wesentliche jeder monologischen Kunst ist — sie ruht auf dem Vergessen, sie ist
die Musik des Vergessens (II 241). — Einen tieferen Unterschied der gesamten
künstlerischen Optik als den zwischen einer Kunst, die einem — sei's auch
transzendenten — Zuschauer gilt, und einer Kunst, die ohne Rücksicht auf
den Blick eines anderen oder ganz Anderen auskommt, kann es deshalb nicht
geben, weil er der Unterschied zwischen einer Kunst der Phänomenalität —
die den Kriterien des Schauens und Angeschautwerdens: der Optik unterliegt
— und einer nicht-phänomenalen Kunst ist. Strenger gefaßt, ist diese Unter-
scheidung, da sie nicht die sinnliche Anschauung allein, sondern mit größerem
Nachdruck die ideelle betrifft (heißt es doch ausdrücklich: alles, was gedacht
wird, gehört ...), die Unterscheidung zwischen einer Kunst für anderes und
einer Kunst, die keinem anderen gilt, weder einem Zuschauer, noch einem
Zuhörer, weder einem irdischen Publikum, noch einem Gott, für dessen
Augen, nach der Lehre der Genealogie der Moral^ das Leiden der Menschen
als ein Schauspiel bestimmt und also gerechtfertigt scheinen könnte. Alle
Kunst und alle Philosophie, jeder Gedanke und jede Rede, die noch einem
Adressaten gilt, entspringt dem Glauben an Gott und entfaltet sich als
bewußte oder unwillkürliche Theodizee. Im Gegensatz zur sozialen und in
letzter Instanz theologischen Kunst des Dialogs ist die monologische Kunst
— auch der Philosophie — theozidär. Sie kennt keinen anderen und anerkennt
keinen Gott, der Instanz ihrer Bestimmung sein könnte. Dialogisches Denken,
Handeln und Leben ist eine Form des Gebets. Erst das gottlos gewordene
Leben, das einen sinnspendenden Adressaten nicht mehr benötigt, um sein
Leiden zu ertragen, ist zum Monolog fähig. Erst es vermag seine Einsamkeit
ohne die Illusion eines transzendentalen Obdachs und seine Individuierung
ohne die Hoffnung auf ihre Verallgemeinerung und Legiferierung anzuneh-
men. Individuell ist erst dasjenige Leben, in dessen Einsamkeit kein Gott
mehr reicht; selbständig dasjenige, das den Inbegriff des Lebens, sich selbst,
aufgibt. Solange Gott nicht tot ist, gibt es keine Individualität. Individualität
gibt es nur als ihre Aufgabe.
Nun ist aber die Einsamkeit des Monologs nicht etwa die naturwüchsige
Gestalt einer Rede, die sich endlich auf ihre Wahrheit und Selbständigkeit
besonnen und alle stützenden Illusionen verworfen hätte, sondern auch diese
Einsamkeit ist, wie Nietzsche ausdrücklich genug formuliert, eine Erfindung^
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
»Disgregation des Willens* 327
auch der Tod Gottes — nicht anders als dieser selbst — ist eine Erfindung^
und zwar eine Erfindung, die nicht von einem Individuum in seiner Einsam-
keit, sondern von einer Gemeinschaft in Hinblick auf ihre Einsamkeit gemacht
worden ist —: diese Erfindung haben erst wir gemacht, wir Gottlosen. Auch der
Monolog hat noch die Gemeinschaft des Wir zum Zeugen und auch die
Abwesenheit seines Adressaten, seine Unbestimmtheit, nimmt am Spiel der
Vorstellungen des Willens noch teil. Es ist aber gerade die Unbestimmtheit,
die Richtungslosigkeit des Monologs, die seine Erfindung vor allen möglichen
anderen Erfindungen im Bereich des Denkens, Redens und Handelns aus-
zeichnet: was derart indeterminiert ist, kann niemals das positive Produkt der
Einbildungs- oder Bildungskraft sein und nie als ein hie et nunc bereits
Realisiertes vorgestellt werden. Unbestimmt, bleibt es trotz der verschieden-
sten Determinationen, die es erfahren kann, in alle Zukunft offen und der
Feststellung in einer propositionalen Rede entzogen. Im Aphorismus 125
derselben Fröhlichen Wissenschafty in dem Nietzsche den tollen Menschen den
Satz Gott ist tot \ verkünden läßt, heißt es deshalb: Dies ungeheure Ereignis ist
noch unterwegs und wandert — es ist noch nicht bis %u den Ohren der Menschen
gedrungen (II 127). Daran, daß es erst noch unterwegs ist und wandert, daß es
noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen ist, ändert auch die
Rede des tollen Menschen nichts, sie bleibt unverstanden. Aber in seiner
Rede selbst ist dieses ungeheure Ereignis unterwegs und wandert und macht
sie, so dialogisch sie intendiert sein mag, zu einem Monolog, referenz- und
adressatenlos und der konstativen Erkenntnis entzogen. Der Monolog, immer
noch unterwegs und im Kommen, nie schon in toto präsent, ist nichts anderes
als die fortschreitende Indetermination in der dialogischen Struktur der
Sprache und des Verstehens. In ihm stirbt Gott. In ihm tritt das Ungeheure
in den gesicherten Raum der Sprach- und Lebenskonventionen ein und macht
ihn allmählich zum unabschließbaren Raum dieses Ereignisses der Einsamkeit.
Der Monolog der Individualität ist unterwegs.
Er ist, immer außerhalb und innerhalb der Rede zumal, immer noch nicht
— schon da. Und da er die Rede der Abgeschiedenheit von der verbindlichen
und gemeinschaftlichen Form des Logos ist, ist er das Immer Noch des Nicht
Mehr dieses Logos, er ist das Überleben der Individualität in einer ihr
fremden, maskenhaften, posthumen Gestalt. Der Monolog, der immer die
Rede vom Tod Gottes und vom Tod seiner Statthalter — des Lebens, des
Willens, des Subjekts — ist, ist posthume Rede und die Rede des posthumen
Menschen. Auch sie geht noch mit Menschen um, aber ihr Umgang ist der
von Gespenstern, die unter Menschen umgehen. Davon handelt ein anderer
Aphorismus der Fröhlichen Wissenschaft, der 365., mit dem Titel Der Einsiedler
spricht noch einmal: Auch wir gehn mit „Menschen" um, auch wir %iehn bescheiden
das Kleid an, in dem (als aas) man uns kennt, achtet, sucht, und begeben uns damit
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
328 Werner Hamachcr
•
in Gesellschaft, das heißt unter Verkleidete, die es nicht heißen wollen; auch wir machen
es wie alle klugen Masken und setzen jeder Neugierde, die nicht unser „Kleie?* betrifft,
auf eine höfliche Weise den Stuhl vor die Türe. Es gibt aber auch andre Arten und
Kunststücke, um unter Menschen, mit Menschen „um^ugehn": %um Beispiel als
Gespenst — was sehr ratsam ist, wenn man sie bald los sein und fürchten machen will.
Probe: [...] wir kommen [...] nachdem wir bereits gestorben sind. Letzteres ist das
Kunststück der posthumen Menschen par excellence (11238—39). Zu ihren
Lebzeiten tot, nämlich unter der Maske ihres konventionellen Verhaltens
begraben, erst nach ihrem Tod — nämlich als Schrift, als Gerücht, als
Erinnerung und verzögerte Nachwirkung — lebendig, bekunden die posthu-
men Menschen ihre Individualität in jedem Falle nur als Lebendig-Tote, als
„Überlebende" und als Gespenster. Die Form ihrer Darstellung ist Verstel-
lung, sie steht unter dem Zeichen des Vorenthalts und der Nachträglichkeit,
ohne daß es ihnen freistünde, sich nicht zu verstellen und sich in der oratio
directa ihres eigentlichen und eigentümlichen Seins auszusprechen. Ihre Spra-
che wie jede Sprache ist eine Maske; sie selber, die unter Masken Verborgenen,
leben nur als die von ihren Masken Abgeschiedenen. Das Individuum ist das
Abgeschiedene jtar excellence — deshalb läßt Nietzsche, statt selber zu sprechen,
als seine Maske den Einsiedler, und er läßt ihn von seiner Einsamkeit
sprechen, die für ihn nicht weniger ist als eine Metapher des Todes —:
abgeschieden ist es nicht nur vom Leben, das die Gemeinschaft mit anderen
verspricht, abgeschieden ist es durch sein „Überleben" auch vom Tod und
der Gemeinschaft der Toten. In diesem Zwischenreich der Unbestimmtheit
zwischen Leben und Tod ist seine Sprache gesellschaftliche Synthesis nur,
indem sie Agent der Disgregation ist, Kommunikation, indem sie ein äußer-
stes an Diskretion wahrt. Sprache verheimlicht —: aber sie verheimlicht nicht
etwas Bestimmtes, das sich ebensogut auch aussprechen oder in eine nicht-
sprachliche Form der Mitteilung fassen ließe, sondern als Sprache ist sie die
Verheimlichung dessen, was aller Bestimmung entgleitet, der Unbestimmtheit
der Abgeschiedenheit selbst, die sich — keinem Bereich logischer Distinktio-
nen, weder dem des Lebens, noch dem des Todes zugehörig — weder zur
Sprache, noch einfach zum Verstummen bringen läßt. Indem so die Sprache
— als Sprache — verheimlicht und immer nur die Maske des von ihr und in
ihr Unbestimmten vorstellt, gibt sie zugleich auch kund, daß sie vor dem
Unbestimmten versagt, es durch die Form ihrer Verweisung in ein Abgeschie-
denes verwandelt und daß sie selber der Abschied ist. Sprache ist Abschied
—: von jedem tieferen und verborgenen Sinn, von dem Subjekt, das sich in
ihm auszusprechen meint, aber die Fiktion seiner Substantialität nur aus dem
Maskenspiel der Sprache gewinnt, und von den Adressaten, denen sie als
Instanzen möglicher Bestimmung nur eines weist: die Tür. In dem Moment
des Abschieds, den die Sprache markiert, — nur in ihm und nirgendwo sonst
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens' 329
— berühren die Individuen einander und stellt sich, unter dem Zeichen ihrer
Nicht-Synthesis, ihre Mitteilung ein. Die Gesellschaftlichkeit der Sprache
erfüllt sich darin, daß sie allem, was einen Bezug sucht zu dem, was sie —
sei's eine Bedeutung, sei's eine Person — meint, auf eine höfliche Weise den Stuhl
vor die Tiire setzt. Der Ort der Gesellschaft wie der des Individuums ist dieser
Abschied, in dem sie sich — voneinander und von sich selbst — zu trennen
nicht aufhören. Auf diese Weise sind sie, mit sich und anderen, in einer
Gemeinschaft, ohne sich gemein zu machen; und auf diese Weise nur gibt es
Gemeinschaft: als gesellschaftliches Umgehen der voneinander und von ihrem
gemeinsamen Medium, dem Leben, dem Tod, Abgeschiedenen.
Nietzsche hat, das ist zur Genüge bekannt, aber immer noch ungenügend
bedacht, dem Emblem der Maske eine ausgezeichnete Stellung in seinen
Bemerkungen zur Sprache und zur Individualität eingeräumt. An ihm läßt
sich, so sehr es sich dank seiner Unbestimmtheit kontroversen Interpretatio-
nen anbietet, beider Verhältnis zur Phänomenalität, zur Ganzheit und zur
Notwendigkeit mit besonders großer Prägnanz aufweisen. Alle genannten
problematischen Begriffe sind untereinander wiederum durch das Problem
der Bestimmung verbunden, dem Nietzsche in all seinen Dimensionen die
größte Aufmerksamkeit widmete. Die Überlegungen Nietzsches zur Sprache
gehen spätestens seit der fragmentarischen Abhandlung Über Wahrheit und
Lüge im außermoralischen Sinn davon aus, daß Sprache die Morphologisierung
einer Welt betreibt, die ohne sie ein schieres Chaos unendlich differenzierter
Eindrucksmomente wäre. Auch das Individuelle, das Nietzsche in diesem
Zusammenhang zunächst gegen die Macht des Begriffs ins Feld führt, erweist
sich im Fortgang seiner Überlegung als eine Form morphologischer, und
näher anthropomorpher Konstruktion, über deren Realitätsgehalt kein Urteil
möglich ist, weil der Titel „Realität" selber erst aus der Morphologisierung
gewonnen ist. Das Übersehen des Individuellen und Wirklichen gibt uns den Begriff,
wie es uns auch die Form gibt, wohingegen die Natur keine Formen und Begjriffe, also
auch keine Gattungen kennt, sondern nur ein für uns unzugängliches und undefinierbares
X. Denn auch unser Gegensatz^ von Individuum und Gattung ist anthropomorphisch
und entstammt nicht dem Wesen der Dinge, wenn wir auch nicht %u sagen wagen, daß
er ihm nicht entspricht: das wäre nämlich eine dogmatische Behauptung und als solche
ebenso unerweislich wie ihr Gegenteil (III 313 — 14). Wenn selbst das Individuelle
anthropomorphisch schematisiert ist und also erst das Übersehen des Individuellen
das ,Individuelle* ergibt, dann ist individuell nur das Unzugängliche, vom
jeweils Erfaßten Unterschiedene, während dasjenige, was der Begriff Indivi-
dualität faßt, eine bloße Figur bleibt. Nietzsche hat später diese seiner Kant-
und Schopenhauer-Lektüre verdankte Überlegung auf die Selbstbeziehung
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
330 Werner Hamacher
•r
menschlicher Individuen erweitert und aus ihr für das Bewußtsein von sich
die Konsequenz gezogen, daß das Bewußtsein nicht eigentlich %ur Individual-
Existen^ des Menschen gehört [...] und daß folglich jeder von uns, beim besten Willen,
sich selbst so individuell wie möglich %u verstehen, „sich selbst %u kennen", doch
immer nur gerade das Nicht-Individuelle an sich %um Bewußtsein bringen wird, sein
„Durchschnittliches", — [...] (II 221). Das Bewußtsein von einem Selbst, das
auf unvergleichliche Weise persönlich, einzig, unbegrenzt-individuell ist, kann als
Bewußtsein, das heißt als dem Kriterium der Mitteilbafkeit unterworfen,
dieses Selbst immer nur als eine Oberflächen- und Zeichemvelt begreifen, also nur
in der Weise, daß es ihm die Maske einer Gestalt überzieht, die mit dem
hinter ihr Verborgenen allein deshalb schon keinen Korrespondenzpunkt
aufweisen kann, weil es sich prinzipiell jeder Bezeichnung und jeder Erschei-
nung entzieht. Die Bezeichnung phänomenalisiert die individuelle Differenz
zu einem Gezeigten. Ihre Mitteilung generalisiert sie nach Maßgabe einer
Ökonomie der Vorstellbarkeit, die dem Unbegrenzt-Individuellen fremd ist.
Der Phänomenalismus und Perspektivismus der Mitteilungs^eichen, der Herden-
Merkzeichen (II 221—22), beruht also in einer systematischen Restriktion der
Differenz und in einer Morphologisierung dessen, was weder Gestalt noch
Selbst, weder Substanz noch positive Subjekivität hat. Das Herden-Merkzei-
chen ,Bewußtsein* — auch noch das individuellste — ist eine Maske.
Nun ist dieser Phänomenalismus von Bewußtsein und Sprache insofern
irreduzibel, als das, was hinter der Maske seiner Gestaltungen verborgen liegt
für Bewußtsein und Sprache nur abermals maskiert erscheinen könnte. Für
uns gibt es hinter der Maske nur Masken: Ideen, Wesenheiten, Bedeutungen;
an sich gibt es hinter ihr nichts als ein X. So wie Kant darauf beharren
mußte, daß die Grenze zum Individuellen, zum durchgängig Bestimmten als
einem ens entium für die endliche Vernunft unübersteiglich ist, so beharrt
Nietzsche darauf, daß das Unbegrenzt-Individuelle, das für ihn. ein Unbe-
stimmbares ist, vom Bewußtsein und seiner Sprache als ein Bestimmtes erfaßt
und dadurch unkorrigierbar entstellt werden muß. Das Recht und die Mög-
lichkeit aber, überhaupt von ihm unter dem Begriff des Individuellen zu
reden und es als ein Unbestimmbares zu bestimmen, verdankt sich dem
Umstand, daß in den phänomenalen und morphologischen Determinationen,
denen Sprache und Bewußtsein das Unbestimmbare unterwerfen, jene ur-
sprüngliche Differenz — Differenz von allem Ursprung, von Idee und Sub-
stanz — noch am Werk ist und die Gestalten des Bewußtseins fortgesetzt
defiguriert. Im selben Aphorismus der Fröhlichen Wissenschaf t, der die Herden-
Merk^eichen des Bewußtseins analysiert, ist von einem Überschuß\ dieser Kraft
und Kunst der Mitteilung die Rede, dem Überschuß eines Vermögens, das im
Künstler und im Philosophen einen Erben findet, der es verschwenderisch ausgibt
(II 220). Dieser Überschuß des Bezeichnungs- und Mitteilungs-Vermögens,
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
»Disgregation des Willens* 331
diese Hypertrophie der Form und des Bewußtseins muß aber — so läßt sich
das genealogische Argument Nietzsches auf ein strukturelles durchsichtig
machen — als Überbestimmtheit die Bestimmungen der Bewußtseins« und
Sprachgestalten immer schon mitbestimmen, also indeterminieren, ihre starren
Distinktionen in Bewegung bringen und die Opposition zwischen dem Her-
den-Merkzeichen und der bezeichnungsunfahigen Individual-Existenz, dem
Phänomenalismus des Bewußtseins und der Aphanisis seiner Gegenstände
erschüttern. Wenn die Bestimmungen der sprachlichen Zeichen nicht an dem
von ihnen Bestimmten auf ihre Angemessenheit oder Unangemessenheit
abgeschätzt werden können, wenn ihnen also ein transzendenter Bestim-
mungsgrund fehlt und ihre immanente Gesetzlichkeit unabsehbaren Wandlun-
gen unterworfen ist, dann dementiert die allgemeine Aussage, daß alle allge-
meinen Aussagen Schein sind, sich selber als Schein und mobilisiert durch
die Differenz zu sich selber in der Ökonomie allgemeiner Bestimmungen, die
auf die Restriktion der individuellen Differenz hinwirken, eine Ökonomie
anderer Art: die der verschwenderischen Verausgabung, die der Aufgabe der
Bestimmungen selbst, die der Affirmation der Differenz. Da keine Bestim-
mung in der Weise Objekt einer Bestimmung werden kann, daß ihre strenge
Korrespondenz als gewährleistet gelten kann, ist jede, so allgemein und
konsensfahig sie scheinen mag, ein unwiederholbares, singuläres Ereignis.
Seine Singularität — und die Singularität noch des Allgemeinsten — liegt
darin, daß es zur Unbestimmtheit bestimmt ist. In ihr kommt also keine
tiefere Wahrheit zum Vorschein als die, daß es einer universell gültigen
Wahrheit nicht fähig ist, weil es weder über eine transzendente, noch über
eine immanente Garantie der Angemessenheit seiner Formen verfugt. Die
Unbestimmtheit ihrer Bestimmung ist ihr einziges Gesetz, das Gesetz der
Singularität.
Die Verschwendung der Kraft und Kunst der Mitteilung^ die die Kunst
betreibt, ist eine Artikulation des Gesetzes der Unbestimmtheit, dem jede
Mitteilung und jedes Zeichen unterworfen ist. Kunst ist nie Form, Gestalt
oder Bild, ohne durch ihren morphologischen Überschuß den Bereich der
Form zu verlassen, die Gestalt zu defigurieren und den Anspruch des Bildes
auf Wiedergabe oder Erzeugung einer Wirklichkeit zu durchkreuzen. Wenn
sie die Kraft und Kunst der Mitteilung verschwendet, so durch die Teilung des
Mit, in dem sie ihre Gemeinsamkeit mit der von ihr gemeinten Sache und
den von ihr angesprochenen Adressaten hat. Der Phänomenalismus der
Zeichen öffnet sich in ihr dem Scheinlosen. Wenn noch etwas gezeigt,
dargestellt und ins Licht gesetzt wird, so ist es das Erlöschen der Phänomenali-
tät, des eidos und der Bedeutsamkeit Selbst, wie es Wagner in den Heimlichkeiten
absterbenden Lichts komponiert hat (II918). In der Kunst dementiert die
Mitteilung ihren Anspruch, im Raum der Erscheinungen und Gestalten als
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
332 Werner Hamacher
• r
der homogenen Sphäre des Gegebenen operieren und dieser Sphäre selber
distanzlos angehören zu können. Sie ist nichts als die Verschwendung ihrer
Erscheinung und die Verausgabung ihres kommunikativen Vermögens ist
zugleich die der internen Kommunikation ihrer Momente. Sie ist nicht ganz,
sondern das Ganze, das sich selbst als Maske zeigt. Ihre Form — und zwar
nicht die Form einer bestimmten Gattung, sondern die der Kunst, sofern sie
Kunst, der Philosophie, sofern sie Philosophie ist — ist der Aphorismus in
einem weitesten Sinn: als das Abgetrennte, Unterschiedene und Ausgeson-
derte. Der Ort der Kunst, der Philosophie, der inexplizite jeder Mitteilung
und des Bewußtseins, ist die Abgeschiedenheit, weil die organische Totalität,
die sie in jedem ihrer Akte zu entwerfen suchen, an derjenigen Stelle einsetzt,
wo sie von jedem Bestimmungsgrund — und sei's der des definitiven Mangels
eines Grundes — abgetrennt ist. Die Spur dieser Trennung trägt das Ganze
und jedes seiner Momente. Sie macht jedes zu einem singulare tantum. Die
Möglichkeiten ihrer Assoziation hat Nietzsche in seinen Aphorismen-Büchern
durchgespielt. Man könnte sie, gäbe es das Wort, als Metaphoristnen bezeich-
nen: als Aphorismen, deren Gemeinsamkeit darin liegt, daß sie sich von
einander trennen, sich einander teilen und sich so, metaphorice^ einander
mitteilen.
Wenn die Mitteilung ihren Anspruch auf Totalität implizit dementiert, so
gleichzeitig den auf die Notwendigkeit ihrer Formen — Nietzsche führt als
ein Beispiel für sie immer wieder die Erkläfungsfigur der Kausalität an.
Gegen die Annahme der Teleologie, daß alle Erscheinungen im Hinblick auf
einen gemeinsamen Zweck oder nach dem Vorbild einer solchen Zweckmä-
ßigkeit angeordnet gedacht werden müssen, hat Nietzsche schon in seinen
frühen Notizen über Teleologie seit Kant die coordinirte Möglichkeit des Zufalls
aufgeboten10, der gegen das allgemeine Gesetz der finalen Bestimmtheit
das Recht eines unkalkulierbar Individuellen wahrt. Was individuell ist am
Individuum — in der Kunst tritt es nur mit größerer Prägnanz als in anderen
Mitteilungsformen hervor —, ist im Verhältnis zur Notwendigkeit, die jedes
Vorstellungsganze zu denken fordert, zufallig und Affirmation des Zufalls.
Nur der Zufall kann, was jeder Regel, jeder Willensentscheidung und jedem
Bewußtseinsakt als solchem versagt ist: als das Grundlose kann er die Einzig-
keit des Individuums begründen. Während der logische Determinismus und
die deterministische Ideologie religiöser Systeme das Individuum unmittelbar
zu Gott stellen, läßt der Gedanke der Indetermination es einsam vor der
Unmöglichkeit, über Existenz oder Inexistenz Gottes zu entscheiden, und
einsam vor der Unausweislichkeit seiner eigenen substantiellen Subjektivität.
10
Friedrich Nietzsche, — Gesammelte Werke (Musarion-Ausgabe), München 1922; Bd. 1;
pp. 412/13.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
,Disgregation des Willens* 333
Den Kontingenzen des Zufalls ausgesetzt, ist das Individuum niemals zur
Gänze durch sich selbst oder durch eine von ihm beherrschte Geschichte
bestimmt, und ebensowenig wie durch sich durch einen ihm unproblematisch
zugänglichen Anderen. Der Zufall ist nicht das Andere seines Selbst, sondern
die es bestimmende, aber durch es nicht bestimmbare Unbestimmtheit, die
in keiner seiner Denk- und Lebensformen anders als entstellt, verkennbar und
abgebrochen darzustellen ist. Das Sein des durch den Zufall Indeterminieren,
Individuellen, nicht erst seine Erscheinung, ist eine Maske.
Die Maske nämliph, anders als ihr Emblem es glauben machen könnte,
ist für Nietzsche nie willkürlich gewählt und aufgesetzt von jemandem, dem
es freistünde, keine zu tragen. Die Maske — kaum anders als die Wüste —
wächst. Jeder tiefe Geist braucht eine Maske: mehr noch, um jeden tiefen Geist wächst
fortwährend eine Maske, dank der beständig falschen, nämlich flachen Auslegung
jedes Wortes, jedes Schrittes, jedes Lebens-Zeichens, das er gibt (II 603—04). Aber
die Maske wächst dem Individuum und jedem seiner Worte nicht nur durch
die verflachende Auslegung, die andere ihm geben, zu, die nicht fähig sind,
das Gesicht selber und die Hintergründe und Gründe der Maske ins Auge
zu fassen, sondern jedes Wort ist selbst schon eine Maske für den, der es
spricht, und für das Wort, das ihm zu sprechen versagt ist. Jede Philosophie
verbirgt auch eine Philosophie; jede Meinung ist auch ein Versteck, jedes Wort auch
eine Maske (II 752). Die Maske steht vor keinem Gesicht, das nicht selbst eine
wäre, das Wort verbirgt — oder bezeichnet — keinen Sinn, der nicht selbst
eine Maske wäre, die Gründe der Maske lassen sich auf keinen letzten
zurückverfolgen, der nicht in einen Abgrund von Masken verwiese. Nietzsche
läßt noch einmal den Einsiedler sprechen: Der Einsiedler glaubt nicht daran,
daß jemals ein Philosoph — gesetzt, daß ein Philosoph immer vorerst ein Einsiedler
war — [...] „letzte und eigentliche" Meinungen überhaupt haben könne, ob bei ihm
nicht hinter jeder Höhle noch eine tiefere Höhle liege, liegen müsse — [...] ein
Abgrund hinter jedem Grunde, unter jeder „Begründung* (II 751). Die Maske ist ein
strukturell Letztes für jede Erkenntnis und Selbsterkenntnis, für jedes Wort
und jede Mitteilung, weil alle Erkenntnis- und Darstellungsformen an der
Sicherung ihres Bestimmungsgrundes scheitern müssen. Deshalb mögen be-
stimmte philosophische, künstlerische und lebenspraktische Vorstellungsty-
pen historisch, soziologisch oder psychologisch auf bestimmte Motive redu-
zierbar sein —, unbestimmbar und irreduzibel bleibt ihr Verhältnis zur
Möglichkeit ihrer Grundlosigkeit und Unbestimmtheit. Die Maske — und
also das ganze Zeichenreich der Phänomenalität und der Bewußtseinsformen
— liegt über einem Abgrund, dessen Höhlung durch kleine Gestalt und
keinen Gedanken ausfüllbar ist. Erst vermöge der Maske kann sich die Illusion
bilden, hinter ihr sei ein Gesicht, ein seiner selbst durchaus mächtiges Subjekt
verborgen, das sich die Maske zum Schütze seiner Gründe und seiner selbst
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
334 Werner Hamacher
' t,
als Grund übergezogen hätte. Die Möglichkeit eines solchen Grundes ist ein
Effekt der Maske, der immer von dem gleichmächtigen, aber ungleich schwe-
rer faßlichen seiner Unmöglichkeit begleitet und suspendiert wird. Die Maske
nun zeigt sich — janusgesichtig — als die Eröffnung dieser beiden Möglich-
keiten, des Grundes und der Grundlosigkeit. Sie zeigt nicht etwas Bestimmtes
und verbirgt kein Zeigen, sondern zeigt ihr Verbergen. Im Gegensatz zu Bild
und Gleichnis, die immer noch die referentielle und semantische Illusion
nähren, durch sie werde etwas Bestimmtes oder zumindest Bestimmbares
gezeigt — Nietzsche schreibt: A.lles, was tief ist, liebt die Maske; die allertiefsten
Dinge haben sogar einen Haß auf Bild und Gleichnis (II 603) —; im Unterschied
zu allem, was sich im Hinblick auf einen phänomenalen oder intelligiblen
Bestand definiert, zeigt die Maske ihr eigenes Darstellungsunvermögen. Er-
scheinungs- und Denkform, die sie ist, bietet sie durch ihr Selbst-Dementi
den Raum für das Aussetzen von Erscheinung und Denken. Wenn jede
Sprache strukturiert ist wie eine Maske, dann spricht jede aus dem Unver-
mögen, selbst ihr eigener Grund zu sein, ihn verbergen oder ihn enthüllen
zu können; sie spricht aus der Unmöglichkeit, sich oder das von ihr Gemeinte
definitiv zu bestimmen. Jeder Möglichkeit der Bestimmung geht ihre Bestim-
mung zur Unbestimmtheit voraus. Ihre tiefe Zweideutigkeit — ihr Nihilis-
mus, wenn man so will — liegt darin, daß sie deshalb mit jedem ihrer Züge
ihre Bestimmung findet, ohne sie mit einem zweiten als die ihre sicherstellen
zu können.
Die Maske also legt sich selbst ab. Indem die Allgemeinheit ihrer Form
sich als ablösbar von jeder individuellen Differenz, indem sie sich also als
Allgemeinheit darbietet, räumt sie die Möglichkeit ein, ohne Grund und
Hintergrund zu sein. Indem sie sich aber von ihrer Darstellungsfunktion
absetzt, gibt sie in der Differenz von ihrer Allgemeinheit dem Individuellen
Raum. Nicht diesseits oder jenseits der Maske, sondern allein, in deren
differentieller Selbstbeziehung hat das Individuelle seinen Ort. Individuell ist
es als das, was der Möglichkeit der Grundlosigkeit ausgesetzt ist. Es spricht
im Unterschied zwischen Bestimmung und Bestimmungslosigkeit, aus dem
Pathos der Distan^ aus dem Pathos der fortgesetzten Distanz-Erweiterung
innerhalb der Seele selbst und ihrer Lebens-Zeichen (II 727). Das Individuelle
spricht nicht als die Substanz unteilbarer Subjektivität, sondern aus der
Distanz und unabschließbaren Distanz-Erweiterung, die substantielle Subjek-
tivität als Gestalt des Allgemeinen von sich selber trennt.11
Das Individuelle zeigt sich nur im Bruch seines Zeichens — dort, wo
sein Zeigen sich aufgibt. Wenn es ausgesagt werden kann, dann allein in
11
Im Stil der jungen Romantiker könnte man notieren: Individuum = Anak<oluth> d. Proso-
pop<oie>.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
»Disgregation des Willens4 335
einem Aussagen, das versagt. Individualität versagt sich. Sie ist, mit einer
Erhabenheitsformel, die Nietzsche auf den freien Geist anwendet, die Verborgne
unter den Mänteln des Lichts* und — mit einer weniger biblischen Wendung —
zugleich Nachteule und Vogelscheuche (II 607): der hegelsche Vogel des absolu-
ten Wissens und das, was ihn fernhält, Auto-Apotropäon, Prozeß des Selbst in
der Selbstdistanzierung, des Begriffs-Entzugs, der Ent-fernung. Individualität
versagt sich im differentiellen Selbstverhältnis des Sagens als das in allen
Feststellungen Ungesagte, als das also, was sich allein im Modus des Nicht,
des Nicht-Mehr oder Noch-Nicht sagt. Als ein Zukünftiges ist Individualität
immer nur versprochen. Sie ist nicht, sie kommt. Da sie indessen bestim-
mungslos, adressatenlos und folglich ohne Ziel und Richtung bleibt, kommt
sie niemals als die mir zubestimmte, mir zukommende, eigene, sondern bleibt
künftig, kommt ohne Ende — die. offene Distanz, aus der sich nie ein
substantielles Selbst ergibt. Ein Versprechen, versagt sich mir der Monolog
meiner Singularität, und anders als derart versprochener, sich versagender,
gibt es ihn nicht. Seine Zukunft ist nicht die programmierte, in die ich
mein gegenwärtiges Selbst verlängere, um es zu erhalten und als das meine
festzuhalten, sondern Zufall, der mich trifft, ohne für mich bestimmt zu sein
und ohne der meine werden zu können. Nicht ich spreche den Monolog
meiner Zukünftigkeit, sondern was in ihm, unankünftig, unbestimmt, sich
meinem Willen entzieht —: das Fatum als ein Gesetz, das sich keinem
subjektiven Setzungsakt verdankt, sondern dem Sprechen einer Instanz, einer
Distanz, einer Disgregation, die von keinem Subjekt, sei es immanent oder
transzendent, sei es bewußt oder unbewußt, kontrolliert werden kann, und das
nie hinreichend, nie als Ganzes und als Gesetz selbst, sondern nur fragmentiert
gesprochen und stückweise vernommen wird. Der einzelne ist ein Stück Fatum
von vorne und von hinten, ein Gesetz^ mehr, eine Notwendigkeit mehr für alles, was
kommt und sein wird (II 969). Wenn dies Gesetz des Einzelnen, das Gesetz
seiner Einzigkeit aber Fatum von vorne und von hinten ist, Fatum aus der
Vergangenheit und aus der Zukunft, dann ist der Einzelne erst einzeln und
ein Gesetz für alles, nachdem alle Zukunft durchlaufen und der Kreis der
Wiederkehr ewige Male geschlossen ist. Und auch dann wird es nicht das
ganze, sondern ein Stück Fatum gewesen sein, das zum Gesetz für alles wurde.
Der Einzelne ist ein Fragment von jenem Spruch des Fatums, der nur als
ganzer seine Autonomie begründen könnte: denn nur so wäre er ausschließlich
von dem bestimmt, was er selber bestimmt. So aber wird er als Fragment zu
einem Gesetz für alles, was kommt und sein wird, und für alles, was war, zu
einem fragmentarischen Gesetz dessen, was ihn selber bestimmt von vorne und
von hinten. Der Einzelne — ein Bruchstück — ist ein Gesetz für die Totalität,
die allein das Bruchstück als Bruchstück bestimmen und zum Ganzen fügen
könnte —, zu dem Ganzen auch, das er selber als Einzelner wäre. Ein Ganzes
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
336 Werner Hamacher
•r
aber, das selbst noch als Ganzes Fragment ist, in seinem moralischen und
gesellschaftlichen Zusammenhang und in seiner zeitlichen Erstreckung unter
dem Gesetz des Fragments, also einem fragmentarischen Gesetz steht —,
ein solches Ganzes kann dem Individuum das Trostmittel seiner internen
Bestimmung zum identischen, über sich verfugenden Selbst ebensowenig
bieten wie das seiner gesellschaftlichen Totalisierung im historischen Prozeß.
Ihm bleibt, ohne Trost, seine Freiheit: sich unter dem Gesetz der Disgregation
als unbestimmt anzunehmen.
Geschrieben im Januar 1984 für das Colloquium Reconstructing Individualism am Humanities Center
der Stanford University, auf Einladung von David Wellbery; überarbeitet im Dezember 1984.
Brought to you by | University of Arizona
Authenticated
Download Date | 3/30/17 10:38 PM
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Wissenschaft und Demokratie: Wissenschafts- und DemokratietheorieVon EverandWissenschaft und Demokratie: Wissenschafts- und DemokratietheorieNoch keine Bewertungen
- Auszug Aus Die Entstehung Der HermeneutikDokument8 SeitenAuszug Aus Die Entstehung Der Hermeneutikinhale84Noch keine Bewertungen
- Subjektivität denken: Anerkennungstheorie und BewusstseinsanalyseVon EverandSubjektivität denken: Anerkennungstheorie und BewusstseinsanalyseNoch keine Bewertungen
- Theodor Adorno - Zu Subjekt Und ObjektDokument18 SeitenTheodor Adorno - Zu Subjekt Und ObjektwesenlosNoch keine Bewertungen
- Gilles Deleuze - Differenz Und Wiederholung. Das Bild Des DenkensDokument30 SeitenGilles Deleuze - Differenz Und Wiederholung. Das Bild Des Denkensa6dama6drian6Noch keine Bewertungen
- Hegels objektive Vernunft: Kritik der VersöhnungVon EverandHegels objektive Vernunft: Kritik der VersöhnungNoch keine Bewertungen
- Hans-Georg Pott - Das Subjekt Bei LuhmannDokument15 SeitenHans-Georg Pott - Das Subjekt Bei LuhmannJulian HennebergNoch keine Bewertungen
- Enigma Agency: Macht, Widerstand, ReflexivitätVon EverandEnigma Agency: Macht, Widerstand, ReflexivitätHans-Herbert KöglerNoch keine Bewertungen
- Krause, Karl Christian Friedrich - Über Geheimsein Und OffenbarseinDokument17 SeitenKrause, Karl Christian Friedrich - Über Geheimsein Und OffenbarseinTachyonbabyNoch keine Bewertungen
- Wahrgenommene Individualität: Eine Theologie der LebensführungVon EverandWahrgenommene Individualität: Eine Theologie der LebensführungNoch keine Bewertungen
- Steinweg Marcus DeutschDokument10 SeitenSteinweg Marcus Deutschperseus89Noch keine Bewertungen
- Arthur Schopenhauer - Gesammelte Werke: Die Welt als Wille und Vorstellung + Parerga und Paralipomena + Eristische Dialektik …Von EverandArthur Schopenhauer - Gesammelte Werke: Die Welt als Wille und Vorstellung + Parerga und Paralipomena + Eristische Dialektik …Noch keine Bewertungen
- Einheit Der Natur Und Mystizismus. Zur Rezeption Des Wissenschaftlichen Goethe Am Ausgang Des 19. JahrhundertsDokument16 SeitenEinheit Der Natur Und Mystizismus. Zur Rezeption Des Wissenschaftlichen Goethe Am Ausgang Des 19. JahrhundertsrosenbergalapeNoch keine Bewertungen
- Symbolische Verletzbarkeit: Die doppelte Asymmetrie des Sozialen nach Hegel und LevinasVon EverandSymbolische Verletzbarkeit: Die doppelte Asymmetrie des Sozialen nach Hegel und LevinasNoch keine Bewertungen
- Schweppenhauser Das Individuum Im Zeitalter Seiner LiquidationDokument26 SeitenSchweppenhauser Das Individuum Im Zeitalter Seiner LiquidationAurélia PeyricalNoch keine Bewertungen
- Die Welt als Wille und Vorstellung: Band 1&2: Schopenhauers Hauptwerk über die Erkenntnistheorie, die Metaphysik, die Ästhetik und die EthikVon EverandDie Welt als Wille und Vorstellung: Band 1&2: Schopenhauers Hauptwerk über die Erkenntnistheorie, die Metaphysik, die Ästhetik und die EthikNoch keine Bewertungen
- (GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IIDokument255 Seiten(GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IICarolNoch keine Bewertungen
- 1988 Die Frage Nach Dem Subjekt - BOOKDokument32 Seiten1988 Die Frage Nach Dem Subjekt - BOOKChristophe SoliozNoch keine Bewertungen
- Mein Körper ist immer bei mir: Vom falschen Bewusstsein und der Kunst damit zu lebenVon EverandMein Körper ist immer bei mir: Vom falschen Bewusstsein und der Kunst damit zu lebenNoch keine Bewertungen
- Luhmann (1995) - Die Gesellschaftliche Differenzierung Und Das IndividuumDokument17 SeitenLuhmann (1995) - Die Gesellschaftliche Differenzierung Und Das IndividuumAmos UngerNoch keine Bewertungen
- Zwischen Nichts und Ewigkeit: Drei Aufsätze zur Lehre vom MenschenVon EverandZwischen Nichts und Ewigkeit: Drei Aufsätze zur Lehre vom MenschenNoch keine Bewertungen
- Essay Identitätspolitik CK Philosophische ForschungDokument8 SeitenEssay Identitätspolitik CK Philosophische Forschungck oneNoch keine Bewertungen
- Die Welt als Wille und Vorstellung: Schopenhauers Hauptwerk über die Erkenntnistheorie, die Metaphysik, die Ästhetik und die EthikVon EverandDie Welt als Wille und Vorstellung: Schopenhauers Hauptwerk über die Erkenntnistheorie, die Metaphysik, die Ästhetik und die EthikNoch keine Bewertungen
- Gernot Böhme - Zur Charakterisierung Der Phänomenologie Von Hermann SchmitzDokument15 SeitenGernot Böhme - Zur Charakterisierung Der Phänomenologie Von Hermann SchmitznicolasberihonNoch keine Bewertungen
- Zur Kompatibilität Von Freiheit Und Determinismus in Spinozas Ethica PDFDokument352 SeitenZur Kompatibilität Von Freiheit Und Determinismus in Spinozas Ethica PDFGuillermosibiliaNoch keine Bewertungen
- Zusammenfassung LKM KonstanzDokument31 SeitenZusammenfassung LKM KonstanzVince Moon100% (1)
- Hubig, Christoph - Natur Und Kultur - Von Inbegriffen Zu ReflexionsbegriffenDokument23 SeitenHubig, Christoph - Natur Und Kultur - Von Inbegriffen Zu Reflexionsbegriffenmaurice florenceNoch keine Bewertungen
- Badiou - Die Heutige Frage Nach Dem SeinDokument37 SeitenBadiou - Die Heutige Frage Nach Dem SeinPierre Guillén RamírezNoch keine Bewertungen
- Nietzsches Aphorismus 354 Aus Der Fröhlichen WissenschaftDokument18 SeitenNietzsches Aphorismus 354 Aus Der Fröhlichen WissenschaftMichael GerlingerNoch keine Bewertungen
- Traulich Und Treu PDFDokument10 SeitenTraulich Und Treu PDFP. Siegfried WewersNoch keine Bewertungen
- Buchbe 3Dokument24 SeitenBuchbe 3ClaudioSehnemNoch keine Bewertungen
- Würfespiel Des Zufalls 3Dokument35 SeitenWürfespiel Des Zufalls 3Dunja LariseNoch keine Bewertungen
- Waldenfels Bernhard - Topographie Des FremdenDokument26 SeitenWaldenfels Bernhard - Topographie Des Fremdenmerlin66100% (1)
- Bollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFDokument33 SeitenBollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFGeorgy PlekhanovNoch keine Bewertungen
- BernetDokument21 SeitenBernethobowoNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Essay FiktionalismusDokument5 SeitenNietzsche Essay FiktionalismusSonnyJinsNoch keine Bewertungen
- Emil Angehrn - Selbstverständigung Und Identität: Zur Hermeneutik Des SelbstDokument25 SeitenEmil Angehrn - Selbstverständigung Und Identität: Zur Hermeneutik Des SelbstÁrmin TillmannNoch keine Bewertungen
- Theodor W. AdornoDokument11 SeitenTheodor W. AdornoErna Von Der WaldeNoch keine Bewertungen
- Essay SoziTheo SS18 Slat 22065441Dokument3 SeitenEssay SoziTheo SS18 Slat 22065441Milan SlatNoch keine Bewertungen
- Die Geschichte Des Teufels - Gustav RoskoffDokument424 SeitenDie Geschichte Des Teufels - Gustav Roskoffmedic011100% (3)
- Theorien Zum GemeinwesenDokument35 SeitenTheorien Zum GemeinwesenReinhold OberlercherNoch keine Bewertungen
- Foucault - Traum Und ExistenzDokument47 SeitenFoucault - Traum Und ExistenznighbNoch keine Bewertungen
- Wolfgang Fritz Haug Nützliche Lehren Aus Brechts Buch Der WendungenDokument24 SeitenWolfgang Fritz Haug Nützliche Lehren Aus Brechts Buch Der Wendungenmazumdars100% (1)
- Heideggers PosthumanismusDokument11 SeitenHeideggers PosthumanismusAnonymous 6N5Ew3Noch keine Bewertungen
- Zitate Zu Hegels Theorie Der SpracheDokument1 SeiteZitate Zu Hegels Theorie Der SpracheJakob BlumtrittNoch keine Bewertungen
- Adorno, Theodor W. - Negative Dialektik (German)Dokument415 SeitenAdorno, Theodor W. - Negative Dialektik (German)cryos80100% (1)
- Was Heißt Eine Welt Beschreiben? Hans Blumenbergs Vielfache HorizontDokument16 SeitenWas Heißt Eine Welt Beschreiben? Hans Blumenbergs Vielfache HorizontjulianalugaoNoch keine Bewertungen
- Felix Meiner Verlag GMBH Phänomenologische ForschungenDokument22 SeitenFelix Meiner Verlag GMBH Phänomenologische ForschungenPavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- Georg SIMMEL Das Problem Des SchicksalsDokument6 SeitenGeorg SIMMEL Das Problem Des SchicksalsrotapfelNoch keine Bewertungen
- This Content Downloaded From 132.204.9.239 On Sun, 17 Jul 2022 15:51:20 UTCDokument23 SeitenThis Content Downloaded From 132.204.9.239 On Sun, 17 Jul 2022 15:51:20 UTCMarc-Antoine BonneauNoch keine Bewertungen
- Karakus IdentitaetssucheDokument8 SeitenKarakus IdentitaetssucheOzge Don Kar LosNoch keine Bewertungen
- Adorno Jargon Der EigentlichkeitDokument72 SeitenAdorno Jargon Der Eigentlichkeitpehein52zenNoch keine Bewertungen
- Holz, Dialektik Theorieform Und Erscheinung JW Dez 2011Dokument6 SeitenHolz, Dialektik Theorieform Und Erscheinung JW Dez 2011adorno65Noch keine Bewertungen
- Jacques Camatte: Vom LebenDokument62 SeitenJacques Camatte: Vom LebenHelmut Hampl [urspr. Clara]Noch keine Bewertungen
- Solipsismus - WikipediaDokument4 SeitenSolipsismus - WikipediaHA WillNoch keine Bewertungen
- Adorno, Theodor W. - Dialektik Der AufklärungDokument13 SeitenAdorno, Theodor W. - Dialektik Der AufklärungklapperstorchNoch keine Bewertungen
- Lichtbotschaften von den Plejaden Band 1: Übergang in die fünfte Dimension [von der SPIEGEL-Bestseller-Autorin]Von EverandLichtbotschaften von den Plejaden Band 1: Übergang in die fünfte Dimension [von der SPIEGEL-Bestseller-Autorin]Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Wer du bist: Mit dem Enneagramm sich selbst und andere besser verstehenVon EverandWer du bist: Mit dem Enneagramm sich selbst und andere besser verstehenBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)
- Wie wir denken, so leben wir: As A Man ThinkethVon EverandWie wir denken, so leben wir: As A Man ThinkethBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (256)
- Positives Denken von A bis Z: So nutzen Sie die Kraft des Wortes, um Ihr Leben zu ändernVon EverandPositives Denken von A bis Z: So nutzen Sie die Kraft des Wortes, um Ihr Leben zu ändernNoch keine Bewertungen
- Die Tiefenpsychologie nach C.G.Jung: Eine praktische OrientierungshilfeVon EverandDie Tiefenpsychologie nach C.G.Jung: Eine praktische OrientierungshilfeNoch keine Bewertungen
- Handbuch Sinneswahrnehmung: Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und ErziehungVon EverandHandbuch Sinneswahrnehmung: Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und ErziehungNoch keine Bewertungen
- Die praktische Anwendung der 7 hermetischen Prinzipien im AlltagVon EverandDie praktische Anwendung der 7 hermetischen Prinzipien im AlltagNoch keine Bewertungen
- Heilsymbole & Zahlenreihen Band 1: Arbeitsbuch der Plejadenheilung [von der SPIEGEL-Bestseller-Autorin]Von EverandHeilsymbole & Zahlenreihen Band 1: Arbeitsbuch der Plejadenheilung [von der SPIEGEL-Bestseller-Autorin]Bewertung: 1.5 von 5 Sternen1.5/5 (2)
- Stoizismus: Die Tugenden und Prinzipien der Stoa verstehen und im Alltag anwenden - inkl. praktischer Übungen für angehende StoikerVon EverandStoizismus: Die Tugenden und Prinzipien der Stoa verstehen und im Alltag anwenden - inkl. praktischer Übungen für angehende StoikerBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Der deutsche Wortschatz: Struktur, Regeln und MerkmaleVon EverandDer deutsche Wortschatz: Struktur, Regeln und MerkmaleNoch keine Bewertungen
- Mit C. G. Jung sich selbst verstehen: Acht Erkenntnisaufgaben auf unserem IndividuationswegVon EverandMit C. G. Jung sich selbst verstehen: Acht Erkenntnisaufgaben auf unserem IndividuationswegBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Weniger ist mehr - Wege aus Überfluss und Überforderung: Ein SPIEGEL E-BookVon EverandWeniger ist mehr - Wege aus Überfluss und Überforderung: Ein SPIEGEL E-BookBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (8)




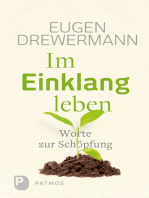

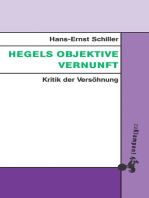

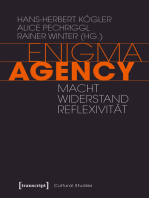







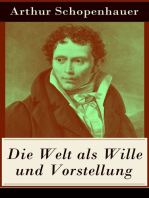



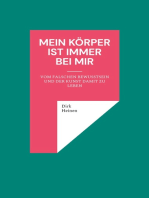



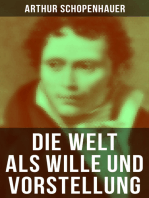



































![Lichtbotschaften von den Plejaden Band 1: Übergang in die fünfte Dimension [von der SPIEGEL-Bestseller-Autorin]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/307218722/149x198/2a8c3569bd/1710227865?v=1)



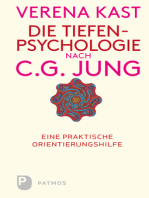



![Heilsymbole & Zahlenreihen Band 1: Arbeitsbuch der Plejadenheilung [von der SPIEGEL-Bestseller-Autorin]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/464842236/149x198/e360b0ce8c/1695194288?v=1)