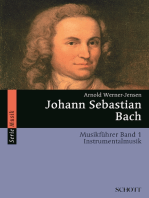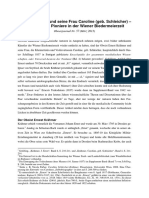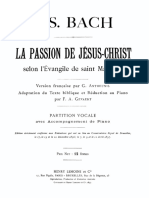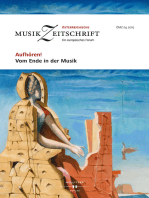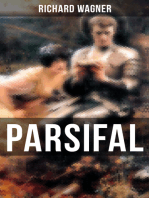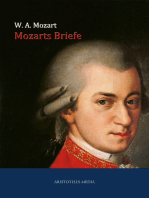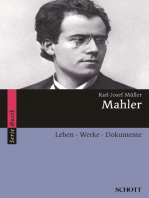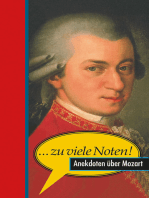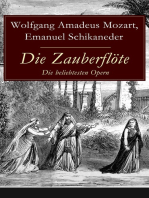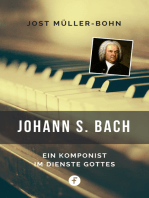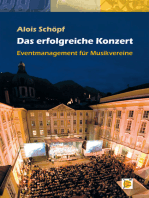Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Das Wirken Böhmischer Und Mährischer Musiker in Rußland Von 1720 Bis 1914
Hochgeladen von
Pedro Henrique Souza RosaOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Das Wirken Böhmischer Und Mährischer Musiker in Rußland Von 1720 Bis 1914
Hochgeladen von
Pedro Henrique Souza RosaCopyright:
Verfügbare Formate
Das Wirken böhmischer und mährischer Musiker in Rußland von 1720 bis 1914
Author(s): Ernst Stöckl
Source: International Journal of Musicology , 1992, Vol. 1 (1992), pp. 81-98
Published by: Peter Lang AG
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/24617782
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to International Journal of
Musicology
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992 81_
Ernst Stöckl (Jena)
Das Wirken böhmischer und mährischer Musiker in Rußland von
1720 bis 1914
Summary: Bohemian and Moravian Musicians in Russia from 1720 to
1914. Between 1720 and 1914 German und Czech musicians from
Bohemia and Moravia frequently migrated to Russia. Their impact on
Russian culture showed on several levels: They played in music bands and
orchestras, some of them acted as directors of symphonic orchestras,
teachers of music, writers of textbooks and editors of musical journals.
Pratsch compiled one of the first collections of Russian folk songs, which
was used later on by famous Russian composers.
Die Westemigration böhmischer Musiker ist in der Fachwelt hinläng
lich bekannt. Sie wird - um nur einige wenige Namen zu nennen - mar
kiert durch Christoph Demantius (1567-1643) und Andreas Hammer
schmidt (1612-1675), die im 17. Jh. als Organisten und Komponisten in
Sachsen wirkten, durch Franz Xaver Richter (1709-1789) und Johann
Stamitz (1717-1757), die im 18. Jh. die Mannheimer Schule begründeten,
durch Johann Dismas Zelenka (1679-1745), der im Verlauf von 35 Jahren
am Dresdner Hof eine fruchtbare Tätigkeit entfaltete, und schließlich
durch Gustav Mahler (1860-1911), einem der bedeutendsten deutschen
Tonschöpfer des 19. Jh.
Weniger spektakular und deshalb auch weniger ms Auge tauend,
vollzog sich seit dem ersten Drittel des 18. Jh. aber auch eine Emigration
böhmischer und mährischer Musiker nach dem Osten hin. Rußland, das
auch in musikalischer Hinsicht Anschluß an die europäische Entwicklung
suchte, stellte dabei einen wichtigen Anziehungspunkt dar.
Ich werde in meinen Ausführungen die nationale Zugehörigkeit der in
Rußland wirkenden Musiker aus dem böhmisch-mährischen Raum - wenn
möglich - zwar aufzeigen; es kommt mir jedoch vorrangig darauf an, den
vielgestaltigen Beitrag dieser Musiker zur Entwicklung der russischen
Kultur zu verdeutlichen. Dabei ist davon auszugehen, daß Böhmen und
Mähren im 18. Jh. und noch im ersten Drittel des 19. Jh. als ein auch in
musikalischer Hinsicht homogener Kulturraum zu betrachten ist, in dem
Deutsche und Tschechen, die sich in dieser Region von jeher durch eine
hohe Musikalität auszeichneten, friedlich zusammenwirkten. Es hing da
mals schließlich nicht von der Nationalität eines jungen talentierten Men
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
82 International Journal of Musicology 1 • 1992
sehen ab, ob er musikalisch gefördert und ausgebildet wurde, denn die
Heranbildung von Musikern vollzog sich in kirchlichen Einrichtungen
und den Kapellen der Adeligen, und gerade der Adel wollte weder Deut
scher noch Tscheche, sondern Böhme sein. Daß dieses auf festen Bindun
gen beruhende einheitliche tschechisch-deutsche Kulturgefüge des böh
misch-mährischen Raums seit der Mitte des 19. Jh. von engstirnigen
Kräften allmählich aufgebrochen und zerbrochen wurde, können wir
heute zwar zutiefst bedauern, rückgängig machen aber können wir dies
nicht.
Schon unter Peter dem Großen kam im Jahre 1720 mit der Kam
merkapelle des Herzogs von Holstein, der vom dänischen König aus sei
nem Land verjagt worden war und in Petersburg Zuflucht suchte, der
erste böhmische Musiker, der Waldhornist Ferdinand Kölbel, nach Ruß
land.1 Die aus etwa einem Dutzend wohlgeübter deutscher Musiker
bestehende herzogliche Kammerkapelle war in Rußland der erste Klang
körper, der eine bis dahin im weiten Zarenreich noch nicht gehörte
Musik, Sonaten, Soli, Trios und Konzerte von Telemann, Reinhard Kei
ser, Heinichen, Corelli, Tartini und anderen damals in Westeuropa belieb
ten Komponisten vortragen und den Geschmack des russischen Hof
publikums vorteilhaft beeinflussen konnte. Als der Herzog von Holstein,
vermählt mit der Tochter Peters des Großen, Anna, im Jahre 1727 wie
der in seine Heimat zurückkehrte, wurden die Musiker seines Kammer
orchesters vom russischen Hof übernommen und konnten 1730 bei den
Krönungsfeierlichkeiten für die Zarin Anna in Moskau glanzvoll mit
wirken. Bei der hierauf erfolgten Verstärkung der Kammerkapelle durch
Musiker aus dem Herrschaftsbereich von August dem Starken kam 1731
der aus Böhmen stammende Kontrabassist Eiselt (Vorname unbekannt)
nach Petersburg.2 So entstand, organisiert und geleitet von dem deutschen
Kapellmeister Johann Hübner (1696 - etwa 1750), das erste russische
Hof Orchester, das zu einem wesentlichen Teil aus deutschen Musikern
bestand.
Der schon erwähnte Waldhornist Kölbel befaßte sich jahrelang mit der
Konstruktion eines Waldhorns, das die Erzeugung aller Töne der Skala in
allen Tonarten ermöglichen sollte.3 Durch die Anbringung von "Griff
oder Klapplöchern" schuf er schließlich ein Instrument, das diesen Anfor
R.-A. Mooser, Annales de la musique et les musiciens en Russie au XVIIIme
siècle, Bd. I, Genf 1948, S. 38; Jakob von Stählin, Theater, Tanz und Musik in
Rußland, hrsg. von E. Stöckl, Leipzig 1982, II, 176-178, 186-188.
Mooser, a.a.O., S. 91
Stählin, a.a.O., II, 176f.
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992 83^
derungen gerecht wurde. Er baute selbst einige dieser Waldhörner, die er
wegen des lieblich-gedämpften Klangs - er wurde mittels einer auf den
Schalltrichter aufgesetzten Kugel hervorgebracht - Amorschall-Waldhorn
nannte. Trios für zwei Waldhörner und Violoncello in c-Moll, f-Moll und
E-Dur hat der aus Schwaben gebürtige Jakob Stählin, der an der Peters
burger Akademie der Wissenschaften wirkende unschätzbare Chronist des
russischen Musiklebens des 18. Jh. und Begründer der Musikgeschichts
schreibung in Rußland, selbst gehört.4 1766 führte Kölbel zusammen mit
seinem Schwiegersohn, dem Waldhornisten Franz Haensel, der ebenfalls
aus Böhmen stammte, das von ihm erfundene neue Instrument zum ersten
Mal in einem Hofkonzert vor und fand den Beifall und die Bewunderung
der Zarin Katharina II. "Selbst der alte Galuppi", berichtet Stählin,
"stutzte über diese neue Erfindung, hörte sehr aufmerksam zu und be
kannte: 'er habe nicht geglaubt, daß es möglich sein möchte, das Wald
horn so weit auf alle beliebigen Töne und so lieblich im Schall zu brin
gen'".5 Die komplizierte Konstruktion des Kölbelschen Amorschall
Waldhorns hat zwar seine Verbreitung und allgemeine Anwendung
verhindert, doch wurde Kölbels Idee der Anbringung von Klappen An
fang des 19. Jh. bei der Konstruktion des Signalhorns wieder aufgegrif
fen.6
Nach dem Tode Peters des Großen (1725) wurde das Zarenreich im
18. Jh. vorwiegend von Frauen regiert. Von 1730 bis 1796 herrschten
mit geringfügigen Unterbrechungen die Zarinnen Anna, Elisabeth und
Katharina II. Sie alle leisteten sich eine zum Leben des Volkes in krasse
stem Widerspruch stehende Pracht- und Prunkentfaltung. Den Künsten,
nicht zuletzt dem Theater und der Musik, fiel dabei eine wichtige Auf
gabe zu, und sie wurden deshalb in jeder Weise gefördert. Schon 1733 bis
1735 hatte sich eine in Italien angeworbene Operntruppe größter Beliebt
heit am russischen Hof erfreut. 1735 traf eine neue italienische Gesell
schaft mit den Komponisten Francesco Araja und Domenico dall'Oglio
ein, der erstmals auch Tänzer angehörten. Im Hof- und Theaterorchester,
das vorwiegend aus Italienern bestand, saßen auch zwei böhmische Wald
hornisten: Joseph Kittel und Anton Schmidt.7 Zusammen mit anderen
Musikern waren sie zur Verstärkung der Hofkapelle nach Petersburg ge
holt worden. Sieht man sich die Zusammensetzung dieses Klangkörpers
4 ebda., II, 178
5 ebda., II, 177-178
6 MGG, VI, 751
7 Mooser, a.a.O., S. 210; Stählin, a.a.O., II, 87
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
84 International Journal of Musicology 1 ■ 1992
etwa zwanzig Jahre später näher an, dann kann man feststellen,8 daß die
ursprünglich vorherrschenden Italiener allmählich zurückgedrängt wor
den waren, von den 19 Mitgliedern waren neun Deutsche, darunter drei
aus Böhmen. Neben dem schon erwähnten Ferdinand Kölbel, der der
Hofkapelle nach einer Auslandsreise wieder von 1756 bis 1769 angehörte,
handelte es sich um den Waldhornisten Schmiedl und den Geiger Johann
Bernhard Wilde,9 der 1741 nach Petersburg gekommen war. Wilde tat
sich nicht nur als ein vorzüglicher Violin- und Viola-d'amore-Spieler
sowie als ein ausgezeichneter Imitator hervor - er konnte, wie Stählin er
zählt, jeden einzelnen seiner Orchesterkollegen "in Ton, Strich, Manier
und Grimassen"10 unverwechselbar nachahmen -, sondern er erwies sich
auch als ein passionierter Tüftler und Bastler, der alle möglichen kurio
sen Musikinstrumente konstruierte, so eine Geige, die in einem vier cm
dicken Spazierstock untergebracht war, oder eine Viola d'amore von be
sonders starkem Klang, die der Spieler mittels eines durch das Kinn zu
betätigenden speziellen Mechanismus beliebig dämpfen konnte. Weitere
von Wilde erfundene Instrumente hat Stählin, der als gewissenhafter
Chronist das musikalische Petersburg der Nachwelt sehr anschaulich
überliefert hat, detailliert beschrieben."
Der Petersburger Hofkapelle gehörte von 1752 bis 1789 als Wald
hornist und später als Cellist auch der aus Chotëïsov gebürtige tschechi
sche Böhme Jan Mares (1719-1794) an.12 Er erlangte in der Musikge
schichte Bedeutung als Begründer der sogenannten "russischen Hornmu
sik".13 Mares war Mitglied der Hofkapelle, leitete aber gleichzeitig auch
das Jägerkorps des Grafen Semën Kirillovic Naryskin, des Oberjäger
meisters der Zarin Elisabeth. In dieser Funktion wurde Mares vom Gra
fen mit der Verbesserung der Jagdmusik beauftragt. Die russischen ven
tillosen, aus Kupfer oder Messing gefertigten Jagdhörner, die eine gerade
konische Form besaßen und nur im ersten Fünftel ein wenig gebogen wa
ren, konnten nur einen einzigen tiefen und rauhen Ton hervorbringen, so
daß das Blasen des Jägerkorps nach Stählin "mehr ein Gebrülle ohne alle
Siehe die Aufstellung bei Mooser, a.a.O., S. 228
Mooser, a.a.O., S. 134-135
Stählin, a.a.O., II, 127
Stählin, a.a.O., II, 128-131. Die von Wilde erfundene Stockgeige wurde noch
Ende des 19. Jh. hergestellt (MGG, XIII, 1719).
MGG, Vin, 1642-1643; Muzykal'naja ènciklopedija, hrsg. von Ju.V. Keldyä, Bd.
III, Moskau 1976, Sp. 440; Mooser, a.a.O., Bd. II/III, Genf 1951, S. 233-234
Eine ausführliche Beschreibung der Hornmusik gibt: Joh. Christian Hinrichs, Ent
stehung, Fortgang und jetzige Beschaffenheit der russischen Jagdmusik, Petersburg
1796; vgl. auch K. Vertkov, Russkaja rogovaja muzyka, Leningrad-Moskau 1948
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992 85
Melodie als eine Musik war."14 Mares ließ nun Instrumente verschiedener
Mensur bauen, die dementsprechend auch Töne verschiedener Höhe er
zeugen konnten, jedoch jedes Instrument nur einen einzigen bestimmten
Ton. Zunächst umfaßten die Hörner eines solchen Orchesters zwei, später
bis zu 4 1/2 Oktaven, d.h. das kleinste Horn hatte eine Länge von 95 mm,
das war das dreigestrichene d, das längste war 2.250 mm lang, das war
das A der Kontraoktave. Die großen Hörner konnten von den Spielern
wegen ihres zu großen Gewichts nicht gehalten werden und wurden daher
auf ein stützendes Gestell gelegt. Da der Bläser immer nur einen einzigen
bestimmten Ton erzeugen konnte, mußte er lange Pausen zählen, bis er
mit seinem Ton an der Reihe war. Dies war bei längeren Notenwerten
nicht kompliziert, erforderte aber bei schnellen Tempi und Sechzehntel
noten ein gehöriges Maß an Geschicklichkeit. Erstaunlicherweise wurden
mit einem solchen Hornorchester ganze Sinfonien mit Allegro, Andante
und Presto vorgetragen.15 Die Bläser waren Leibeigene, die durch einen
harten Drill zur Ausführung dieser höchst eigenartigen Musik befähigt
wurden. Wahrscheinlich war Rußland mit seiner Leibeigenenstruktur das
einzige Land in Europa, das eine solche Art von Musik überhaupt her
vorbringen konnte. Beeindruckend muß jedoch der Klang eines Hornor
chesters gewesen sein, der einer gewaltigen tremulierenden Orgel glich
und kilometerweit zu hören war. Der russische Gelehrte und Dichter M.
Lomonosov war von ihm so hingerissen, daß er eine Ode auf die Horn
musik verfaßte.
Mares' Nachfolger wurde der Deutschböhme Karl Lau ( 1. Hälfte des
18. Jh. bis 1800)16, ein ausgezeichneter Waldhornist, der beim Grafen
Razumovskij und beim Fürsten Potëmkin gedient hatte und eine ganze
Reihe von Stücken für Hornorchester komponierte. Im ersten Drittel des
19. Jh. geriet das Hornorchester außer Gebrauch, wurde aber 1883 und
das letzte Mal 1896 anläßlich der Krönungsfeierlichkeiten für den letzten
Zaren Nikolaus II. wiederbelebt, es wurden einige Stücke einstudiert und
aufgeführt.
Auch in der Folgezeit waren es in der Hauptsache böhmische Blasmu
siker, die im sogenannten ersten Hoforchester des russischen Zaren ein
gut bezahltes Wirkungsfeld fanden. Zu nennen sind die Waldhornisten
14 Stählin, a.a.O., II, 117
15 Stählin, a.a.O., II, 120
16 N. Findejzen, Novye materialy dlja biografii Verstovskogo, in: Russkaja starina,
Bd. I, Petersburg 1903, S. 104f.
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
86 International Journal of Musicology 1 ■ 1992
Georg Franck17 und Johann Haberzettel18, die 1779 in den Dienst des Za
ren traten, und Ignaz Hammer mit seinen beiden Söhnen Anton und Jo
seph, die ein Jahr darauf nach Petersburg kamen.19 Die gute Pension, die
der Hof seinen Musikern zahlte, wenn sie in Rußland blieben, und wohl
auch die für viele Musiker anziehende gemächliche russische Lebensart
veranlaßten die meisten Musiker, so auch die Hornisten Haberzettel und
die beiden Hammer-Söhne, bis zu ihrem Tode in Rußland zu bleiben.
Haberzettels Sohn Johann Konrad Friedrich Haberzettel (1788-1862),
Pianist, Klavierlehrer und Komponist und wie sein Vater Kammermusi
ker, veröffentlichte in russischer Sprache zwei Lehrbücher der Harmo
nie- bzw. Kompositionslehre.20
Deutschböhmen gab es in den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jh.
auch unter den Klarinettisten. Dies waren der in Prag ausgebildete und ei
nige Zeit im Dienst des Grafen Hartig stehende Joseph Grimm21, der
1779 die mit 500 Rubel Jahresgehalt dotierte Stelle des ersten Klarinetti
sten erhielt, und Georg Brunner22, der im gleichen Jahr als zweiter Kla
rinettist eingestellt wurde und ebenfalls 500 Rubel verdiente. Im Herbst
1780 begann der aus dem böhmischen Grünwald gebürtige Klarinetten
virtuose Johann Joseph Beer (1744-1811)23, in Petersburg Konzerte in
den Palästen russischer Adeliger zu geben. 1783 wurde er Mitglied des
Hof Orchesters. Die besondere Gunst der Zarin Katharina II. bewirkte es,
daß Beer bald auch zur Mitwirkung in den privaten Kammerkonzerten
bei der russischen Alleinherrscherin herangezogen wurde, wo er zusam
men mit den besten Musikern Petersburgs und - man kann wohl sagen -
Europas musizierte. Beer verließ Rußland erst 1792. Ihm wird übrigens
das Verdienst zugeschrieben, der Klarinette die fünfte Klappe gegeben zu
haben.
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 263
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 264. Haberzettel starb 1823 in Petersburg
Mooser, ebda., 264 und 382. Während Ignaz Hammer vermutlich um 1785 in sei
nen böhmischen Heimatort Niederlichtenwald zurückkehrte, blieben seine Söhne
Anton und Joseph bis zu ihrem Tode (1815 bzw. 1813) in Petersburg.
G.B. Bernandt/I.M. Jampol'skij, Kto pisal o muzyke, Bd. I, Moskau 1971, S.
184: Tablica vsech akkordov, dlja oblegöenija uöaSöichsja garmonii i sofiineniju,
Petersburg 1840; Voprosy i otvety o garmonii, Petersburg o.J.
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 263-264
ebda., 250
MGG, XV, 607f.; Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 364-367
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992 87
Eine für die Entwicklung der russischen Folkloristik förderliche Tä
tigkeit entfaltete Johann Gottfried Pratsch (7-1818).24 Geburtsort und
-jähr sind unbekannt. Gewöhnlich wird Schlesien als Herkunftsland ange
geben. Dabei wird es sich wahrscheinlich um das sogenannte Mährisch
Schlesien handeln, dessen Grundbevölkerung zu dieser Zeit deutsch war.
Für die deutsche Herkunft sprechen die Vornamen, weniger der Famili
enname. Pratsch kam zwischen 1775 und 1780 als bereits voll ausgebilde
ter Musiker nach Rußland, sein vorheriger Werdegang liegt völlig im
Dunkeln. Sein Wirken in Rußland vollzog sich im Stillen, ohne äußeren
Glanz. Er gab Klavierunterricht an verschiedenen Lehranstalten der rus
sischen Residenz und hatte daneben eine große Anzahl von Privatschü
lern. Das bei Pratsch ausgeprägte Interesse für das russische Volkslied
schlug sich in seinen Kompositionen und vor allem in der von ihm
zusammengestellten und 1790 herausgegebenen "Sammlung russischer
Volkslieder mit ihren Melodien"25 nieder, mit der er nach Trutovskij die
zweite Sammlung dieser Art in Rußland schuf.26 Zwar hat die Art, in der
er die Volkslieder harmonisierte, in der Folgezeit immer wieder Diskus
sionen ausgelöst, doch bleibt es bei allen Mängeln dieses Werks sein
unbestreitbares Verdienst, einen grundlegenden Fundus von russischen
Volksliedern aufgezeichnet, geordnet, publiziert und damit der Nutzung
zugänglich gemacht zu haben. Pratschs Volksliedsammlung entnahmen
Komponisten wie Glinka, Musorgskij, Rimskij-Korsakov und Cajkovskij
thematisches Material für ihre Kompositionen, genauso wie Beethoven die
beiden russischen Themen für seine Razumovskij-Quartette op. 59, Nr. 1
und 2 aus der Sammlung von Pratsch schöpfte.
Nach dem bereits genannten Wilde kamen noch weitere Violinisten aus
Böhmen nach Rußland. Konzertmeister im ersten Hoforchester wurde
1760 Dominik Springer27, den Johann Friedrich Reichardt, der Kapell
meister Friedrichs des Großen, mit dem überragenden deutschen Violin
virtuosen Johann Georg Pisendel (1687-1755) verglich. Springer führte
in Petersburg die von Vincenzo Manfredini eingerichteten öffentlichen
Konzerte weiter und schrieb zwei Ballette, die in Moskau bzw. Peters
MGG, X, 1601-1602; Muzykal'naja énciklopedija, Bd. IV, Moskau 1978, Sp.
425; Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 400f.
Sobranie narodnych russkich pesen s ich golosami, poloZennymi na muzyku Iva
nom Praöem, Petersburg 1790, 2/1806
V.F. Trutovskij, Sobranie russkich prostych pesen s notami, 4 Bde., Petersburg
1776-1795
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 58
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992
burg aufgeführt wurden.28 Springer ging 1772 nach Prag, dort verliert
sich seine Spur.
1777 wurde der aus Auscha gebürtige Johann Absolon29 als Violinist
im ersten Hoforchester angestellt. Seit etwa 1785 gab er in der Theater
schule Violinunterricht.
In den Dienst der russischen Hofkapelle trat 1770 weiter der in Kinn
geborene Joseph Massner.30 Er war 1802 an der Gründung der Peters
burger Philharmonischen Gesellschaft beteiligt.
Aus Böhmen stammte vermutlich auch der Geiger und Komponist
Otto Ernst Tewes31, der 1775 Mitglied der Petersburger Hofkapelle wur
de. Er schrieb die dreiaktige Oper "Die wütende Familie", die 1786 in
Petersburg mit einem allerdings nur mäßigen Erfolg aufgeführt wurde.
Auch ein Larghetto für Hornorchester stammt aus seiner Feder.
Aus diesen kurzen Lebensläufen wird deutlich, daß sich das Wirken
böhmischer ausübender Musiker in Rußland nicht nur auf die Mitwirkung
im Hoforchester beschränkte. Diese Tonkünstler machten sich als Lehrer
um die Heranbildung russischer Orchestermusiker verdient, sie schufen
eine ganze Reihe von Kompositionen und besserten damit den äußerst
spärlichen Bestand einheimischer Musikwerke spürbar auf, und sie küm
merten sich um die Organisation und Gestaltung öffentlicher Konzerte.
In Petersburg hatten sich im Rahmen der Direktion der Kaiserlichen
Theater neben der italienischen auch eine russische, französische und
deutsche Operntruppe etabliert. Trotz erheblicher finanzieller Schwierig
keiten brachte die deutsche Truppe zu Beginn des 19. Jh. eine ganze Reihe
von Opern und Singspielen auf die Bühne, angefangen von Mozarts "Don
Giovanni" und "Zauberflöte" über Salieris "Axur, König von Ormus" bis
hin zu den Singspielen eines Wenzel Müller und Ferdinand Kauer. Dem
deutschen Theater gehörte übrigens eine Zeitlang der aus Mähren stam
mende Johann Baptist Hübsch32 als Bassist an. Kapellmeister mit dem of
fiziellen Titel "Musikdirektor des deutschen Theaters" war seit 1799 An
ton Kalliwoda33 mit einem Jahresgehalt von 1.500 Rubeln. Kein Lexikon
erwähnt ihn, Geburtsort und -jähr sind unbekannt. Möglicherweise han
"Der Kampf der Liebe und der Vernunft" (Moskau 1763) und "Die unerfahrenen
Argonauten" (Petersburg 1770)
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 245-246. Absolon war 1747 geboren, er starb 1816 in
Petersburg
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 394. Massner starb 1805 in Petersburg
ebda., 177-178; Ju.V. Keldyä, Russkaja muzyka XVIII veka, Moskau 1965, S.
343. Tewes starb im Dezember 1800 in Petersburg
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 768-769
ebda., 770. Kalliwoda starb im Juni 1814 in Petersburg
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992
delt es sich - wie Mooser vermutet - um einen Verwandten des 1801 in
Prag geborenen Johann Wenzel Kalliwoda (1801-1866), der fast vierzig
Jahre als Hofkapellmeister in Donaueschingen wirkte. Der Musikdirektor
Anton Kalliwoda leitete die Opern- und Singspielaufführungen im deut
schen Theater in Petersburg bis vermutlich 1807. Der Wiener Klassik
fühlte er sich besonders verpflichtet. Dies fand seinen Ausdruck auch
darin, daß auf seine Initiative und unter seiner Leitung am 19. Januar
1801 die russische Erstaufführung von Haydns "Schöpfung" stattfand.
Mit der Schaffung der in Rußland ersten Schule für die siebensaitige
Gitarre, dem Lieblingsinstrument musikalisch gebildeter Russen, befrie
digte Ignaz von Held (1764-1816)34 ein Bedürfnis vor allem adeliger
Kreise. Held war in Hohenbruck geboren, in seiner Heimat musikalisch
ausgebildet worden und fand nach einem abenteuerlichen Soldatenleben in
Moskau und später in Petersburg ein breites Betätigungsfeld als Sänger,
Pianist und Gitarrist.
Franz Xaver Blyma (1770-1812)35 und einige Vertreter der vermut
lich tschechischen Musikerfamilie Kerzeiii oder Kerzel36 erlangten Be
deutung für das Moskauer Musikleben. Joseph Kerzeiii arbeitete am er
sten russischen Musikjournal mit dem Titel "Muzykal'nye uveselenija"
(Musikalische Vergnügungen) mit, das 1774-1775 in Moskau erschien,
und veröffentlichte in ihm eigene Kompositionen (ein Trio, Chöre und
Tänze). 1773 richtete er eine Musikschule ein. Das gleiche tat zehn Jahre
später sein Verwandter Michael Kerzeiii (ca. 1740-1804). Zusammen mit
dem Deutschböhmen Anton Diehl bildete er Leibeigene zu Orchestermu
sikern für die Privatkapellen russischer Magnaten heran. Aus der Feder
Joseph Kerzeiiis stammen einige Opern, von denen sich "Rozana und Lju
bim" (1778) besonderer Beliebtheit beim Publikum erfreute. Franz Ker
zelli (Lebensgrenzen unbekannt) verdankte das Moskauer Publikum die
russische Erstaufführung von Haydns Oratorium "Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze" im Jahre 1789 sowie einiger seiner
Sinfonien, seinem Sohn Ivan Franzevic (1760-1820) die russische
Erstaufführung von Mozarts "Requiem" im Jahre 1802. Sowohl Ivan
Franzevic Kerzeiii wie auch Franz Xaver Blyma wirkten als Kapellmei
ster am Petrovskij-Theater, dem Vorläufer des Bolschoi-Theaters. Blyma
G.B. Bernandt/I.M. Jampol'skij, a.a.O., S. 200; Méthode facile pour apprendre à
pincer la guitare à sept cordes sans maître, Petersburg 1798; die zweite Auflage er
schien 1802 in russischer Sprache unter dem Titel "§kola dlja semistrunnoj gitary".
Muzykal'naja ènciklopedija, a.a.O., Bd. I, Moskau 1973, Sp. 489-490; Mooser,
a.a.O., Bd. II/III, 748-749
Muzykal'naja ènciklopedija, a.a.O., Bd. II, Moskau 1974, Sp. 780-781; Mooser,
a.a.O., Bd. II/III, 264-266, 662-663
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
90 International Journal of Musicology 1 • 1992
schrieb die zu ihrer Zeit äußerst populäre Oper "Weihnachten in der alten
Zeit" (Starinnye svjatki), die im Jahre 1800 in Moskau aufgeführt wurde.
Dies war ein Werk, das sich lange Jahre im Spielplan behauptete. Mit
zwei Sinfonien bereicherte er die damals noch in den Kinderschuhen stek
kende russische Sinfonik.37
Ein für die musikalische Aufklärung in Rußland ebenfalls bedeutender
tschechischer Musiker war Ernst Wanzura (1750-1820)38 aus Wamberg
in Nordostböhmen, der sich, ohne es wirklich zu sein, den Barontitel zu
legte und überhaupt eine gewisse Neigung zum Abenteuer an den Tag
legte. Nach Lehrtätigkeit in Moskau ließ er sich 1786 in Petersburg nie
der und gab dort 1786 bis 1794 das "Journal de musique pour la clavecin"
heraus, in dem er 1790 seine "Russische Sinfonie auf ukrainische The
men" als Klavierauszug veröffentlichte, eins der ersten sinfonischen
Werke, in denen russisches Folklorematerial Verwendung fand. Als Hof
clavecinist und Mitwirkender in dem kleinen Kammermusikensemble, das
die Aufgabe hatte, für die Zarin Katharina II. zu musizieren, wann im
mer ihr der Sinn danach stand, erlangte Wanzura die Gunst der Zarin und
durfte auf das von ihr verfaßte Libretto "Der kühne und tapfere Recke
Archideic" eine Oper komponieren, die 1787 im Eremitage-Theater auch
aufgeführt wurde.
Ob der Fagottist und Komponist Anton Bullandt (um 1750-1821)39 aus
Böhmen stammte, ist umstritten. Mooser teilt mit, daß er in Mëlnfk gebo
ren wurde, andere Autoren geben Geburtsdatum und Geburtsort als un
bekannt an. Vermutlich 1780 kam Bullandt nach Petersburg, gewann
durch mehrmalige öffentliche Konzerte den Ruf eines guten Musikers und
wurde 1783 in das Hoforchester berufen. Zu Beginn des Jahres 1784
wurde seine Oper "Der Honiggetränkverkäufer" (Sbitenscik)40 auf ein
Libretto des russischen Lustspieldichters Ja.B. Knjaznin mit glänzendem
Erfolg uraufgeführt. Von allen russischen Opern des 18. Jh. hat sie sich
am längsten - bis 1851/1852 - im Repertoire behaupten können. Wenn
Große Sinfonie, op. 1, gedruckt in Moskau 1798, aufgeführt in Moskau 1799; 2.
Sinfonie, op. 2, gedruckt in Mainz 1803, aufgeführt in Leipzig 1803.
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. I, Moskau 1973, Sp. 663-664; Mooser,
a.a.O., Bd. II/III, 410-411; B. Vol'man, Russkie peöatnye noty XVIII veka,
Leningrad 1957, S. 87-93. Daselbst ist auf S. 245-263 Waniuras Sinfonie abge
druckt.
Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 368-370; Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. I,
Sp. 605; MGG, XV, 1184-1186; Ju.V. Keldyä, Russkaja muzyka XVIII veka,
Moskau 1965, S. 367-370
Sbiten' war ein heißes Getränk aus Wasser, Honig und Gewürzen für den ein
fachen Mann. Sbitenäöik = Verkäufer dieses Getränks.
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992 91_
auch ihr Sujet auf französischen Vorbildern fußt, ist dennoch im Entwurf
der Personen, der Lebensart und der Handlung echt russische Charakte
risierung zu finden, und Bullandt gelang es, seiner Musik ein nationales
Kolorit zu verleihen, ohne dabei echte russische Volkslieder zu verwen
den. Er wies sich damit als begabter Musiker für das komische Fach im
Geiste eines Dalayrac und Dezède aus.
Bullandt gehörte zu den Musikern, die 1802 die Petersburger Philhar
monische Gesellschaft begründeten, und war mehrere Jahre Mitglied
ihres Direktoriums.
Bei Anton Joseph Kucci (Kuci, Kuzzi; Lebensgrenzen unbekannt)41
kann die böhmische Herkunft deswegen vermutet werden, weil sich der
Graf Sobek von Koschentin um seine Ausbildung kümmerte und Karl von
Dittersdorf dem jungen Musiker rasche Erfolge bescheinigte. Wann
Kucci nach Petersburg kam, ist unbekannt. Im letzten Jahrzehnt des 18.
und zu Beginn des 19. Jh. veröffentlichte er hier eine ganze Reihe von
Klavierkompositionen, darunter auch Variationen über russische Volks
lieder. Aus seiner Feder stammen auch zwei Bearbeitungen der zu Beginn
des 19. Jh. in Rußland überaus beliebten Oper "Die Dneprnixe" (Musik
von F. Kauer und S.I. Davydov): eine Bearbeitung für Klavier und eine
für zwei Violinen.
Johann Johannis (1810-1864)42 aus Domasin (bei Benesov), ein am
Prager Konservatorium ausgebildeter Musiker, ging mit 26 Jahren nach
Rußland, um die Leitung des bekannten Leibeigenen-Privatorchesters des
Fürsten N.B. Jusupov in Petersburg und später der Privatkapelle eines
russischen Adeligen in Pensa zu übernehmen. 1840 ließ er sich in Moskau
nieder und wurde ein Jahr später Kapellmeister am Bolschoi-Theater. Er
dirigierte 1842 die Moskauer Erstaufführung von Glinkas Oper "Ein Le
ben für den Zaren", unter seiner Stabführung standen die Sonntagskon
zerte des Bolschoi-Theaters, und 1850 übernahm er auch die Leitung des
Studentenorchesters der Moskauer Universität. Johannis war ein hochge
bildeter Musiker, der sich insbesondere für die Aufführung der Werke
Beethovens und Mozarts, aber auch russischer Komponisten wie Glinka,
A. Aljab'ev und A. Verstovskij einsetzte. Als er in den 1850er Jahren
Moskau verließ, hinterließ er eine empfindliche Lücke im Moskauer Mu
sikleben.
41 Mooser, a.a.O., Bd. II/III, 663; B. Stejnpress, Oöerki i étjudy, Moskau 1980, S.
294-295
42 Muzykal'naja ènciklopedija, a.a.O., Bd. II, Sp. 559
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
92 International Journal of Musicology 1 ■ 1992
Absolvent des Prager Konservatoriums war auch Johann Schramek
(1814-1874).43 Er reiste mit einer Operntruppe durch Deutschland, war
eine Zeitlang Dirigent der deutschen Oper in Paris, später Opernkapell
meister in Riga und gelangte 1861 nach Moskau, wo er ein Jahr später
eine Dirigentenstelle am Bolschoi-Theater erhielt. Schrameks Oper "Ilja
Muromec" blieb Manuskript, seine gedruckten Instrumentalstücke und
Lieder waren beliebt.
Die Rußlandemigration böhmischer und mährischer Musiker stellt
keinen selbständigen Prozeß dar, sie vollzog sich innerhalb einer großen
kulturellen Ostströmung, die Musiker aus Deutschland und Österreich
Ungarn nach Rußland zog, einige für einige Jahre, die meisten aber für
ihr ganzes weiteres Leben. Diese Ostströmung hielt auch im 19. Jh. mit
unverminderter Intensität an. In der Petersburger Philharmonischen Ge
sellschaft, der laut Statut von 1805 nur Musiker aus den Orchestern der
Kaiserlichen Theater angehören durften, belief sich unter den ordentli
chen Mitgliedern der Anteil deutscher Musiker in der Zeit von 1802 bis
1879 auf 71 Prozent.44 Genaue Angaben über ihre Herkunft fehlen bei
den meisten von ihnen. Es liegt jedoch nahe anzunehmen, daß sich unter
ihnen auch eine gewisse Zahl von Deutschen aus Böhmen und Mähren be
fand.
Im Lehrkörper der russischen Konservatorien, in dem Deutsche bis zu
Beginn des Ersten Weltkriegs überproportional vertreten waren, sind
Musiker aus dem böhmisch-mährischen Raum nur sehr dünn gesät.
Heraus ragt der Violinvirtuose Ferdinand Laub (1832-1875).45 Auf der
Höhe seines geigerischen Ruhms erhielt er 1866 einen Ruf als Professor
für das Violinspiel an das neugegründete Moskauer Konservatorium und
trat in der alten Zarenstadt acht Jahre lang gleichzeitig auch als Solist,
Primarius im Streichquartett und Dirigent auf. Cajkovskij, sein Kollege
am Konservatorium, widmete ihm das 3. Streichquartett in es-Moll, op.
30. Laubs Sohn Vâsa (1857-1911) verbrachte sein ganzes Leben in Ruß
land, wirkte als Chor- und Orchesterdirigent und Klavierlehrer und hat
auch einige Kompositionen hinterlassen.
Als Ferdinand Laub 1874 erkrankte und seine Lehrtätigkeit aufgeben
mußte, wurde Johann Hrimâly (1844-1915)46, der schon seit 1869 am
Moskauer Konservatorium unterrichtete, sein Nachfolger. Wie die Tätig
ebda., Bd. VI, Moskau 1982, Sp. 405
E. Al'brecht, ObäCij obzor dejatel'nosti vysoöajSe utverïdënnogo S.-Peterburg
skogo Filarmoniéeskogo obäiestva, Petersburg 1884, S. 63-73
MGG, vm, 309-311; Muzykal'naja ènciklopedija, a.a.O., Bd. III, Sp. 185
Muzykal'naja ènciklopedija, a.a.O., Bd. II, Sp. 56
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992 93^
keit Laubs gestaltete sich auch die 46jährige musikalische Aktivität Hri
mâlys für das Moskauer Musikleben äußerst fruchtbringend. Neben Auf
tritten als Solist führte er im Verlauf von 26 Jahren das Streichquartett
der Russischen Musikgesellschaft und betätigte sich gelegentlich auch als
Dirigent. In seinen Konzertkritiken war Cajkovskij des Lobes voll über
die hohe technische Meisterschaft, das stilvolle und äußerst tonschöne
Spiel des tschechischen Geigers, der als Lehrer eine Moskauer Geiger
schule begründete, die sich in ihren technischen Prinzipien und in der Art
der Tongebung von der Petersburger Schule Leopold Auers unterschied.
Hrimäly bildete eine ganze Generation russischer Geiger heran, für die er
instruktive Lehrwerke verfaßte.47
Am Petersburger Konservatorium wirkte vom Jahre seiner Gründung
1862 bis 1910 der Prager Cellist Johann Seifert (1833 - nach 1914)48, der
längere Zeit dem Leitungsgremium der Petersburger Philharmonischen
Gesellschaft angehörte. Er gab Tonleiterstudien mit Fingersätzen her
aus49, zu seinen zahlreichen Schülern zählte der bekannte russische Cellist
S.M. Kozolupov.
Im Rahmen unserer Thematik ist es sicher von Interesse, darauf hin
zuweisen, daß der Violinpädagoge Otakar Sevcfk (1852-1934)50 seine fast
60jährige berufliche Laufbahn in Char'kov und Kiev begann, wo er von
1874-1892, also ganze 18 Jahre, an der Musikfachschule der Kaiserlichen
Russischen Musikgesellschaft lehrte.
Den größten Teil seines Musikerlebens verbrachte Vaclav (Vasa) Suk
(1861-1933)51 in Rußland. Am Prager Konservatorium als Geiger aus
gebildet, hat Suk in Rußland als Konzertmeister der Privatoper von I.Ja.
Setov in Kiev (1880-1882) und hierauf als Geiger im Orchester des Bol
schoi-Theaters in Moskau (1882-1885) zuerst zwar die violinistische
Laufbahn fortgesetzt, fühlte sich dann aber immer stärker zur
Dirigententätigkeit hingezogen und hat sich seit 1896 als Leiter von
Orchestern verschiedener privater Operntruppen in Char'kov, Minsk,
UpraZnenija v gammach (Tonleiterstudien), Petersburg o.J., Neuauflage 1924;
Upraänenija v dvojnych notach (Doppelgriffstudien), Petersburg o.J., Neuauflage
1923
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. II, Sp. 456
Diatoniöeskie gammy dlja violonäeli s oboznaêeniem pal'cev i primecanijami (Dia
tonische Tonleitern mit Fingersätzen und Kommentaren für Violoncello). Seifert
schrieb "Vospominanija professora Peterburgskoj konservatorii" (Memoiren eines
Professors des Petersburger Konservatoriums), Petrograd 1914 und komponierte
Stücke für Cello, darunter ein Quartett für vier Celli.
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. VI, Sp. 315f.; MGG, XII, 593-595
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. V, Sp. 347f.; MGG, XII, 1725f.
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
94 International Journal of Musicology 1 ■ 1992
Wilna, Odessa, Kazan' und Saratov sowie einer italienischen Gesellschaft
in Moskau und der Privatoper von V.l. Kononov in Petersburg (1904
1906) und schließlich als Dirigent des Bolschoi-Theaters in Moskau einen
Namen als ausgezeichneter Orchesterleiter machen können. Er erfreute
sich der hohen Wertschätzung von P.I. Cajkovskij und N.A. Rimskij
Korsakov und setzte auch nach der bolschewistischen Revolution seine
Dirigententätigkeit erfolgreich fort.
Ein in Rußland überaus erfolgreicher und ebenfalls zu hohem Ansehen
gelangter Dirigent war der aus Böhmen stammende Tscheche Jan Palicyn
(eigentlich: Palice; 1865-1931).52 Sein Vater war 1868 mit der Familie
nach Rußland gegangen und hatte 1872 als Violinist am Bolschoi-Theater
die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Bei Sevcik in Kiev als Gei
ger und an der Moskauer Universität als Mediziner ausgebildet, war Pali
cyn musikalisch zunächst als Violinist in Studentenstreichquartetten und
als zweiter Dirigent im Studentenorchesterverein tätig, den Max von Erd
mannsdörfer 1882 gegründet hatte und auch leitete. In den 1890er Jahren
wandte sich Palicyn jedoch ganz der Musik zu. Auf seine Initiative eta
blierte sich in Saratov ein festes Operntheater, und Palicyn übernahm die
Direktion des Orchesters (1890-1901), war hierauf auch in Kazan', Kiev,
Moskau, Odessa und anderen russischen Städten als Kapellmeister tätig
und erlebte den Höhepunkt seiner Dirigententätigkeit schließlich schon in
sowjetischer Zeit in Sverdlovsk Yekaterinburg).53
Ebenfalls aus Böhmen stammte der Sänger (Baß) Joseph Palecek
( 1842-1915).54 In den unter der Leitung von M. Balakirev stehenden
tschechischen Erstaufführungen der Opern "Ein Leben für den Zaren"
und "Ruslan und Ludmilla" von M. Glinka in Prag im Jahre 1866 und
1867 brillierte er in den Rollen des Susanin und Farlaf. Als Palecek 1870
auf den Rat Balakirevs im Marientheater in Petersburg als Mephisto in
Ch. Gounods "Margarethe" debütiert hatte, wurde er fest engagiert und
ließ sich für immer in Rußland nieder. Mit seiner wunderschönen Baß
stimme und einem sicheren Stilempfinden gestaltete er bis 1882 die Baß
rollen in zahlreichen Opernaufführungen und gastierte in den Sommer
monaten regelmäßig an der Oper in Odessa. Seit 1888 war er Professor
des Petersburger Konservatoriums.
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. IV, Sp. 167
B.S. Stejnpress, Muzykal'naja ïizri Sverdlovska v 1917-1941 gg. (Das Sverdlovs
ker Musikleben. 1917-1941), in: Iz muzykal'nogo proälogo. Sbornik statej (Aus
der musikalischen Vergangenheit. Aufsatzsammlung), hrsg. von B.S. Stejnpress,
Bd. II, Moskau 1965, S. 5ff.
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. IV, Sp. 164f.
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal of Musicology 1 ■ 1992 95^
Eine gewisse Konzentration tschechischer Musiker ist seit Ende des
19. Jh. in Odessa zu beobachten. Der aus Pribram (Böhmen) gebürtige
Joseph Pribik, (1855-1937), in Prag als Organist, Pianist und Dirigent
ausgebildet, lebte von seinem 23. Lebensjahr bis zu seinem Tode in Ruß
land.55 Er fungierte als Direktor der Smolensker Abteilung der Kaiserli
chen Russischen Musikgesellschaft (1879-1883), war dann Operndirigent
in Char'kov, Lemberg, Kiev, Tiflis und Moskau und 1889-1893 Kapell
meister der "Russischen Operngesellschaft" von I.P. Prjanisnikov (Kiev,
Moskau). Von 1894 bis zu seinem Tode wirkte er als angesehener Diri
gent an der Odessaer Oper. Unter seiner Leitung fanden die Odessaer
Erstaufführungen der Opern "Ein Leben für den Zaren", "Ruslan und
Ludmilla" (M. Glinka), "Eugen Onegin" (P.I. Cajkovskij), "Sadko" (N.
Rimskij-Korsakov) und weiterer bedeutender russischer Opern statt,
wozu Pribik erstklassige Sänger wie F.I. Saljapin, M.I. und N.N. Figner,
V.V. Sobinov und andere gewinnen konnte. Er richtete in Odessa öffent
liche Konzerte ein und tat sich als Komponist zweier Cechovopern56 so
wie von Orchester- und Kammermusikwerken hervor.
Jaroslav Kociân (1883-1950)57 gründete und leitete das "Odessaer
Streichquartett", dem die tschechischen Musiker Frantisek Stupka (2.
Violine), J. Perman (Viola) und Ladislav Zelenka (Violoncello)58 ange
hörten. Kociân, Stupka und Zelenka lehrten am Odessaer Konservato
rium. 1910-1911 führte Kociân in Petersburg das "Mecklenburgische
Streichquartett".
Ein strahlender Stern böhmischen Musikantentums ging über Rußland
auf, als Eduard Napravnik (1839-1915)59 als 26jähriger auf Einladung
des Fürsten N.B. Jusupov "aus Sympathie für die Slawen und wie bei al
len Tschechen besonders aus Sympathie für Rußland"60 im Jahre 1861
nach Petersburg ging, wo er im Verlauf von 54 Jahren eine vielseitige,
das Musikleben der russischen Residenz ungewöhnlich fördernde Tätig
keit entfaltete. Nach zweijähriger Dirigententätigkeit bei Jusupov und
hierauf als Korrepetitor am Theater wurde er 1867 als zweiter Kapell
meister an das Marientheater berufen und übernahm 1869 als Nachfolger
von K.N. Ljadov die musikalische Gesamtleitung. Bemerkenswert waren
eine unter seiner Stabführung erfolgte Neueinstudierung von Glinkas
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. IV, Sp. 432
Zabyl (Vergessen), 1921; Radost' (Freude), 1922
MGG, VII, 1301 f.; Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. III, Sp. 19f.
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. II, Sp. 456 und Bd. VI., Sp. 927
Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. III, Sp. 884-886; MGG, IX, 1262-1264
Zitiert nach Muzykal'naja énciklopedija, a.a.O., Bd. III, Sp. 884
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
96 International Journal of Musicology 1 ■ 1992
Oper "Ruslan und Ludmilla" im Jahre 1871 und die Uraufführung von
Mussorgskijs "Boris Godunov" im Jahre 1874. Im Verlauf seiner viel
jährigen Dirigententätigkeit hat Napravnik über 100 Opern einstudiert,
darunter zu Beginn des 20. Jh. auch R. Wagners "Ring des Nibelungen".
Allein Glinkas "Ein Leben für den Zaren" erlebte unter Napravnik 500
Aufführungen. 1869-1881 oblag Napravnik auch die Leitung der Sin
foniekonzerte der Kaiserlichen Russischen Musikgesellschaft, in denen er
der Aufführung von Werken russischer Komponisten größte Aufmerk
samkeit schenkte. Napravnik ging nicht nur als Dirigent, sondern auch als
Komponist ganz in der Kultur seiner neuen Heimat auf. Dies zeigt schon
die Wahl der Stoffe, die er mit Vorliebe dem russischen Leben und der
russischen Literatur entnahm. So schrieb er u.a. die Opern "Die Bürger
von Niznij Novgorod" und "Dubrovskij" nach einer Erzählung von A.S.
Puskin, die sinfonische Dichtung "Dämon" nach M.Ju. Lermontov und
zwei Orchesterphantasien über russische Themen. Auch seine Tonsprache
steht in der russischen Tradition, in der frühen Zeit war sie Glinka,
später vor allem Cajkovskij verpflichtet, wenn auch Einflüsse R. Wagners
nicht zu überhören sind. Zählt auch die Oper "Dubrovskij" heute noch zu
den Repertoireopern russischer Bühnen, so blieb es Napravnik jedoch
versagt, die Entwicklung der russischen Musik als Komponist nachhaltig
zu bestimmen. Überaus bedeutsam aber war sein Wirken als Dirigent: Er
schuf eine Tradition, die noch heute unvergessen ist.
Ich möchte meinen Vortrag nicht schließen, ohne auf eine Erschei
nung aufmerksam gemacht zu haben, die mir aus meiner Kindheit noch
gut in Erinnerung ist. In dem kleinen Erzgebirgsstädtchen Preßnitz - es
zählte etwa zweieinhalbtausend Einwohner - gab es eine städtische Musik
schule, in der musikbegabte Jungen und Mädchen aus Preßnitz selbst und
den umliegenden Ortschaften kostenlos eine Instrumentalausbildung
erhalten konnten. Diese Ausbildungsmöglichkeit wurde von verhältnis
mäßig vielen jungen Menschen auch im Hinblick auf eine spätere Ver
dienstmöglichkeit wahrgenommen. Nach Abschluß der Schule fanden sich
die frischgebackenen Musikanten nicht selten in kleinen Musikkapellen
zusammen und zogen, wie es der Mentalität der Erzgebirgler entsprach,
im Frühling in die Ferne, nach dem Süden und Südosten, nach Preßburg,
Kaschau, Lemberg, Czernowitz, ja bis Budapest und Bukarest, um im
Herbst wieder in ihre Gebirgsheimat zurückzukehren. Nach dem "Sude
tenland-Lexikon"61 waren die Preßnitzer Musikanten, insbesondere Har
fenspieler, in der ganzen Welt anzutreffen. Anfang des 20. Jh. entstand
61 Rudolf Hemmerle, Sudetenland-Lexikon, Mannheim, o.J., Adam Kraft-Verlag, S.
356
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
International Journal o f Musicology 1 ■ 1992 91_
aus 16-17jährigen Mädchen unter der Leitung des Kapellmeisters Steiner
die "Erste Österreichische Damenkapelle", die Musikreisen auch nach
Rußland unternahm und um 1912 in Dorpat (Tartu), Riga und Moskau
auftrat, in ihrer ausschließlich weiblichen Besetzung und ihren einheit
lichen schicken Kostümen für den konservativen Osten sicher eine kleine
Sensation. Die Damenkapelle62 spielte in Cafés, Strandcafés und im Mos
kauer Zoo und erfreute das Publikum mit Wiener Walzern, Wiener Lie
dern und flotten Märschen, trug also ein wenig österreichische musika
lische Caféhausatmosphâre nach Rußland hinüber. Durch den Ersten
Weltkrieg und die bolschewistische Revolution wurde dem Rußlandexport
dieser Art von Unterhaltungsmusik ein Ende gesetzt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Eingebettet in den Prozeß
einer sich aus Deutschland und Österreich-Ungarn heraus vollziehenden
allgemeinen kulturellen Ostströmung, haben Musiker aus Böhmen und
Mähren - Deutsche und Tschechen - im Verlauf von fast 200 Jahren als
Hofmusiker am Zarenhof und in den Orchestern der Kaiserlichen Thea
ter, als Dirigenten sowohl von Privatorchestern russischer Magnaten als
auch großer Theater- und Sinfonieorchester, als Lehrer und Lehrbuchau
toren, als Herausgeber der ersten russischen Musikjournale und einer der
ersten Sammlungen russischer Volkslieder, als Begründer und Direktori
umsmitglieder der Petersburger Philharmonischen Gesellschaft, als Ver
anstalter von Konzerten, als Wegbereiter für die Werke der Wiener Klas
siker, als Komponisten und nicht zuletzt als Erfinder neuer Musikinstru
mente zur Entwicklung und Hebung der russischen Musikkultur Bemer
kenswertes geleistet. Die sprichwörtlich gewordenen "böhmischen Musi
kanten" brachten österreichische Unterhaltungsmusik nach Rußland.
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. hat der Anteil der aus dem böhmisch
mährischen Raum nach Rußland ausgewanderten deutschen Musiker zu
gunsten tschechischer merklich abgenommen. Dies mag darauf zurückzu
führen sein, daß die Ideen der Slawophilen und später des Panslawismus
auch bei den Tschechen lebhafte Resonanz fanden. Wie viele Slawen fühl
ten auch sie sich damals zu Rußland in besonderer Weise hingezogen,
erblickten sie doch in ihm die Verkörperung des Slawentums und dessen
stärkstes Bollwerk. Die oben zitierte Äußerung Napravniks scheint in
diese Richtung zu deuten. Die zunehmende Präsenz tschechischer Musiker
62 Als Flötistin gehörte der "Ersten Österreichischen Damenkapelle" Adelheid Hoch
häuser, geb. Iser (1892-1978), aus Reischdorf an, die der Verfasser dieses Artikels
noch persönlich kannte. Ihr Neffe, Johann Mettele, hat ihm einige Einzelheiten über
das Wirken der Damenkapelle in Rußland mitgeteilt, wofür ihm herzlich gedankt
sei.
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
98 International Journal of Musicology 1 ■ 1992
in Rußland hat jedoch auf die überproportionale Repräsentanz Deutscher
im Lehrkörper der Konservatorien in Petersburg und Moskau, die bis
zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs bestehen blieb, keinen wesentlichen
Einfluß gehabt.
Die im Zarenreich über Jahrhunderte zu beobachtende ausgeprägte
Fähigkeit, fremde Einflüsse zu assimilieren und sich die Mitarbeit von
Ausländern dienstbar zu machen, ohne in ihre völlige Abhängigkeit zu
geraten, offenbarte sich auch auf dem Gebiet der Kunst mit aller Deut
lichkeit. Das Wirken ausländischer Musiker in Rußland floß in den
großen kulturellen Schmelztiegel ein, den dieses Land insbesondere im
18. und 19. Jahrhundert darstellte, ohne daß es besonders auffiel, zumal
es unter den aus Böhmen und Mähren nach Rußland ausgewanderten deut
schen und tschechischen Musikern alles überragende Begabungen nicht
gegeben hat. Wie die deutschen Musiker im allgemeinen, so stellten auch
die aus Böhmen und Mähren ihr Können ganz in den Dienst der neuen
Heimat. Sie genossen Ansehen und Achtung nicht nur in den beiden
Hauptstädten, sondern auch in der russischen Provinz, wo eine Vielzahl
von namentlich nicht bekannten ausländischen, vor allem deutschen Musi
kern in den Kleinstädten und den Herrensitzen russischer Adeliger, die
nicht selten ein eigenes Orchester und Theater unterhielten, tätig waren
und als Lehrer und Vermittler westeuropäischen Musikgutes eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielten.63 Dem Typ des auf dem Lande wirkenden
deutschen Musiklehrers hat I. Turgenev in der Gestalt des Musiklehrers
Lemm im Roman "Das Adelsnest" ein bleibendes literarisches Denkmal
gesetzt. Bezeichnend für diese deutschen Musikpädagogen ist es, daß sie
im Gegensatz zu ihren italienischen Berufskollegen einen erbitterten
Kampf gegen den in Rußland vor allem in Adelskreisen weit verbreiteten
musikalischen Dilettantismus führten.
Es gibt keine Hinweise darauf, daß die in Rußland wirkenden tschechi
schen Musiker die Popularisierung der Werke ihrer nationalen Komponi
sten Dvorak und Smetana besonders gefördert hätten. Eher hat es den An
schein, als ob sie sich von ihren nationalen Wurzeln mehr oder minder
lösten und ganz in der russischen Kultur aufgingen. Napravnik ist hier ein
beredtes Beispiel.
63 Vgl. dazu: M.P. Alekseev, Iz muzykal'noj Zizni russkoj provincii pervoj poloviny
19 veka (Zum Musikleben der russischen Provinz in der ersten Hälfte des 19. Jh.),
in: Istorija russkoj muzyki v issledovanijach i materialach (Geschichte der russi
schen Musik in Untersuchungen und Materialien), Bd. I, Moskau 1924, S. 17ff.
This content downloaded from
195.37.189.162 on Tue, 09 Mar 2021 09:29:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Das könnte Ihnen auch gefallen
- 1824 KronesDokument27 Seiten1824 KronesSinan SamanlıNoch keine Bewertungen
- Kleine große Orgelwelt: 25 Beiträge von verschiedener Art gesammelt und herausgegeben von Silke BerduxVon EverandKleine große Orgelwelt: 25 Beiträge von verschiedener Art gesammelt und herausgegeben von Silke BerduxNoch keine Bewertungen
- BLIV HuelseDokument24 SeitenBLIV HuelseDaniel VissiNoch keine Bewertungen
- Die Kammermusik-Gemeinde: Eine hannoversche Institution in ihrer ZeitVon EverandDie Kammermusik-Gemeinde: Eine hannoversche Institution in ihrer ZeitNoch keine Bewertungen
- Kremsmünster MGGDokument3 SeitenKremsmünster MGGAnonymous AoORiUnUNoch keine Bewertungen
- frauen macht musik. Maria Theresia zum 300. Geburtstag: Österreichische Musikzeitschrift 01/2017Von Everandfrauen macht musik. Maria Theresia zum 300. Geburtstag: Österreichische Musikzeitschrift 01/2017Noch keine Bewertungen
- Texto AlemanDokument24 SeitenTexto AlemanXimena SotoNoch keine Bewertungen
- Bernhard, Jandl, Jelinek: Österreichische Musikzeitschrift 05/2015Von EverandBernhard, Jandl, Jelinek: Österreichische Musikzeitschrift 05/2015Noch keine Bewertungen
- Musik in Siebenbürgen - K. TeutschDokument12 SeitenMusik in Siebenbürgen - K. TeutschvladvaideanNoch keine Bewertungen
- Schnitzler, Horváth, Haas: Österreichische Musikzeitschrift 04/2016Von EverandSchnitzler, Horváth, Haas: Österreichische Musikzeitschrift 04/2016Noch keine Bewertungen
- Die Estensischen MusikalienDokument12 SeitenDie Estensischen MusikalienjolewasNoch keine Bewertungen
- Händels Utrechter Te Deum: Geschichte - Musik - InterpretationVon EverandHändels Utrechter Te Deum: Geschichte - Musik - InterpretationNoch keine Bewertungen
- Matthias HerrmannDokument13 SeitenMatthias HerrmannJuan FNoch keine Bewertungen
- SOLI DEO GLORIA: Johann Böhm (1595–1667) und die westsächsische Bildhauerkunst im BarockVon EverandSOLI DEO GLORIA: Johann Böhm (1595–1667) und die westsächsische Bildhauerkunst im BarockNoch keine Bewertungen
- Haydn ArbeitDokument12 SeitenHaydn ArbeitNathan HolzsterlNoch keine Bewertungen
- Leonard Bernstein: Unendliche Vielfalt eines MusikersVon EverandLeonard Bernstein: Unendliche Vielfalt eines MusikersNoch keine Bewertungen
- Artikel AlbertDokument7 SeitenArtikel AlbertTralalalala11Noch keine Bewertungen
- Zur Rezeption Der Wiener Schule Im BanatDokument16 SeitenZur Rezeption Der Wiener Schule Im BanatSilvina PerugliaNoch keine Bewertungen
- Kleine Hardbucher Der Musikgeschighte Nach GattungenDokument246 SeitenKleine Hardbucher Der Musikgeschighte Nach GattungenEvgeny KomarnitskyNoch keine Bewertungen
- Die bedeutendsten Österreicher: des 19. und 20. JahrhundertsVon EverandDie bedeutendsten Österreicher: des 19. und 20. JahrhundertsNoch keine Bewertungen
- 8 PDFDokument20 Seiten8 PDFJorgeNoch keine Bewertungen
- Johann Sebastian Bach: Musikführer - Band 1: InstrumentalmusikVon EverandJohann Sebastian Bach: Musikführer - Band 1: InstrumentalmusikBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Ap 28062020Dokument23 SeitenAp 28062020Lea TrenkwalderNoch keine Bewertungen
- MG 3-7 GelochtDokument11 SeitenMG 3-7 GelochtMartín Cruzat RiquelmeNoch keine Bewertungen
- Klaus Karl Und Die Entwicklung Der Melodiegitarre in Der VolksmusikDokument71 SeitenKlaus Karl Und Die Entwicklung Der Melodiegitarre in Der VolksmusikjohnnyNoch keine Bewertungen
- Komponisten auf Sommerfrische in Bad Ischl: Johannes Brahms, Anton Bruckner, Johann Strauss (Sohn), Franz Lehár, Leo Fall, Oscar Straus, Emmerich KálmánVon EverandKomponisten auf Sommerfrische in Bad Ischl: Johannes Brahms, Anton Bruckner, Johann Strauss (Sohn), Franz Lehár, Leo Fall, Oscar Straus, Emmerich KálmánNoch keine Bewertungen
- Antunespena Dip Kapitel1Dokument12 SeitenAntunespena Dip Kapitel1Marco LombardiNoch keine Bewertungen
- Musikzeitung 2008-1Dokument44 SeitenMusikzeitung 2008-1Giani PaulNoch keine Bewertungen
- Mobilität und Musik: Österreichische Musikzeitschrift 02/2017Von EverandMobilität und Musik: Österreichische Musikzeitschrift 02/2017Noch keine Bewertungen
- Besseler Daslochamerliederbuch 1948Dokument7 SeitenBesseler Daslochamerliederbuch 1948Thijs ReeNoch keine Bewertungen
- 2019-1 BVK 2233 MusikDokument6 Seiten2019-1 BVK 2233 Musikg2svxbbsmsNoch keine Bewertungen
- Avantgarde, Musik Nach 1945Dokument3 SeitenAvantgarde, Musik Nach 1945renabottitoNoch keine Bewertungen
- SCHEIT, Gerhard - Geist in Wien Auständig Und AbgängigDokument5 SeitenSCHEIT, Gerhard - Geist in Wien Auständig Und AbgängigSantiago AuatNoch keine Bewertungen
- Albert LiederDokument42 SeitenAlbert LiederGadanwaNoch keine Bewertungen
- Guitar Recital - Höh, Volker - SCHUBERT, F.: MERTZ, J.K.: PAGANINI, N.: REGONDI, G.: MENDELSSOHN, Felix: SOR, F. (Romantic Moments)Dokument17 SeitenGuitar Recital - Höh, Volker - SCHUBERT, F.: MERTZ, J.K.: PAGANINI, N.: REGONDI, G.: MENDELSSOHN, Felix: SOR, F. (Romantic Moments)Fernando Barbosa67% (3)
- FERTIGHaydns Baryton Hausarbeit SicherDokument16 SeitenFERTIGHaydns Baryton Hausarbeit SicherjepambNoch keine Bewertungen
- Wiese Floete Undine 4 2012Dokument16 SeitenWiese Floete Undine 4 2012Novica Jovanovic-NockaNoch keine Bewertungen
- Bolko Von Hochberg: HommageDokument55 SeitenBolko Von Hochberg: HommageEleni IoannidouNoch keine Bewertungen
- Felix Mendelssohn - SchottischeDokument4 SeitenFelix Mendelssohn - SchottischeYu-Chen FanNoch keine Bewertungen
- Schleicher Krähmer, CarolineDokument15 SeitenSchleicher Krähmer, CarolineРузалияКасимоваNoch keine Bewertungen
- TranslationsDokument7 SeitenTranslationsJohn DreyerNoch keine Bewertungen
- TranslationsDokument35 SeitenTranslationsJohn DreyerNoch keine Bewertungen
- BLKO H.Proch VIATA SI CREATIADokument8 SeitenBLKO H.Proch VIATA SI CREATIALuminitzaNoch keine Bewertungen
- Jorn Peter Hiekel Christian Utz Eds LexiDokument21 SeitenJorn Peter Hiekel Christian Utz Eds LexiАнна ИглицкаяNoch keine Bewertungen
- W Osthoff-Bibl 6 5 13Dokument32 SeitenW Osthoff-Bibl 6 5 13Daniel OsthoffNoch keine Bewertungen
- Die Liszt-Orgel in Denstedt Bei Weimar (WWW - Lisztorgel.de)Dokument2 SeitenDie Liszt-Orgel in Denstedt Bei Weimar (WWW - Lisztorgel.de)ragtimepianoNoch keine Bewertungen
- Christian Friedrich Daniel SchubartDokument18 SeitenChristian Friedrich Daniel SchubartGerald HambitzerNoch keine Bewertungen
- Karl Richter in München - Zeitdokumente 1951 1957 (Preview)Dokument24 SeitenKarl Richter in München - Zeitdokumente 1951 1957 (Preview)Johannes MartinNoch keine Bewertungen
- Berühmte Klavierstücke Von Bach Bis GershwinDokument3 SeitenBerühmte Klavierstücke Von Bach Bis Gershwinmausibaer_stNoch keine Bewertungen
- Rekeszus Katalog 62 DownloadDokument86 SeitenRekeszus Katalog 62 DownloadJosef OtrhálekNoch keine Bewertungen
- Michallik PDFDokument4 SeitenMichallik PDF2712760Noch keine Bewertungen
- Janina Klassen Musica Poetica + Mus Figurenlehre Produktives Misverständnis SIM-Jb - 2001-04Dokument11 SeitenJanina Klassen Musica Poetica + Mus Figurenlehre Produktives Misverständnis SIM-Jb - 2001-04Robert Hill100% (1)
- 4e62018c 1609942526397Dokument25 Seiten4e62018c 1609942526397Leonardo SilvaNoch keine Bewertungen
- Volkslied NEU - Walter - Pichler PDFDokument41 SeitenVolkslied NEU - Walter - Pichler PDFZlatko SljivicNoch keine Bewertungen
- Die Chromatisierten Blechblasinstrumente Und Ihre EnsemblesDokument45 SeitenDie Chromatisierten Blechblasinstrumente Und Ihre EnsemblesPedro Henrique Souza RosaNoch keine Bewertungen
- Anton Weidinger BiografiaDokument6 SeitenAnton Weidinger BiografiaPedro Henrique Souza RosaNoch keine Bewertungen
- 6 Voglerscher TonkreisDokument2 Seiten6 Voglerscher TonkreisPedro Henrique Souza Rosa100% (1)
- Erbame DichDokument268 SeitenErbame DichPedro Henrique Souza RosaNoch keine Bewertungen
- Paudert - 24 StudiesDokument25 SeitenPaudert - 24 StudiesPedro Henrique Souza RosaNoch keine Bewertungen
- KW3Dokument24 SeitenKW3sekretariat3909Noch keine Bewertungen
- Weizen Mais Und BiolitDokument1 SeiteWeizen Mais Und BiolitfassbenderNoch keine Bewertungen
- Demonstrativartikel Uebungen Mit Loesungen Sprachschule Aktiv WienDokument4 SeitenDemonstrativartikel Uebungen Mit Loesungen Sprachschule Aktiv WienAhmed EsmailNoch keine Bewertungen
- Proiect GermanaDokument1 SeiteProiect GermanaLiviaNoch keine Bewertungen
- Catalogus 2010 DefinitiefDokument128 SeitenCatalogus 2010 DefinitiefpankoekNoch keine Bewertungen
- Iso685 D00022 Q INTEDokument6 SeitenIso685 D00022 Q INTEJose EmilioNoch keine Bewertungen
- 2003 - 1 - Skiyachting Im WestenDokument196 Seiten2003 - 1 - Skiyachting Im WestenRaumschots OnlineNoch keine Bewertungen
- 6966 AnlDokument8 Seiten6966 AnlAmanda100% (1)
- Aufhören! Vom Ende in der Musik: Österreichische Musikzeitschrift 04/2015Von EverandAufhören! Vom Ende in der Musik: Österreichische Musikzeitschrift 04/2015Noch keine Bewertungen
- Bach. Das Wohltemperierte Rätsel: Eine ausufernde Annäherung an die Fuge in E-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier Teil II (BWV 878)Von EverandBach. Das Wohltemperierte Rätsel: Eine ausufernde Annäherung an die Fuge in E-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier Teil II (BWV 878)Noch keine Bewertungen
- Arrangements für Blasorchester: Pro und kontra TranskriptionVon EverandArrangements für Blasorchester: Pro und kontra TranskriptionNoch keine Bewertungen
- Operette - hipp oder miefig?: Österreichische Musikzeitschrift 03/2016Von EverandOperette - hipp oder miefig?: Österreichische Musikzeitschrift 03/2016Noch keine Bewertungen
- Das erfolgreiche Konzert: Eventmanagement für MusikvereineVon EverandDas erfolgreiche Konzert: Eventmanagement für MusikvereineNoch keine Bewertungen
- Die Rezitative in Händels Opern: Vers. Rhythmus. Melodische GestaltungVon EverandDie Rezitative in Händels Opern: Vers. Rhythmus. Melodische GestaltungNoch keine Bewertungen
- Sergej Prokofjew: Leben und wichtige Werke: Portfolio-ArbeitVon EverandSergej Prokofjew: Leben und wichtige Werke: Portfolio-ArbeitNoch keine Bewertungen