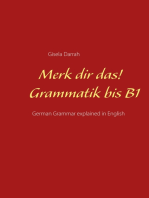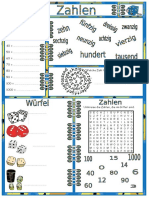Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Online Deutsch Als Fremdsprache B1.1
Hochgeladen von
Carlo Tellez WithbrownCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Online Deutsch Als Fremdsprache B1.1
Hochgeladen von
Carlo Tellez WithbrownCopyright:
Verfügbare Formate
1
Grammatik B1.1
Inhaltverzeichnis
Das Perfekt 3
Das Präteritum 24
Plusquamperfekt 35
Genitiv 43
Präpositionen mit Genitiv 53
n-Deklination 61
Konjunktiv II 68
Nebensätze – „dass“ 91
Kausale Nebensätze 98
Konzessive Nebensätze 102
Indirekte Fragesätze 108
Temporale Nebensätze 112
Lokale Präpositionen 125
Temporale Präpositionen 136
Lesen & Leseverstehen 146
Anhang 1: Wichtige starke Verben 186
Anhang 2: "es“ als Pronomen 192
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
2
GRAMMATIK
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
3
DAS PERFEKT
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
4
A1 Berichten Sie über Ihre letzte Woche.
▪ Was haben Sie Letzte Woche alles getan?
▪ Hatten Sie Zeit für alles, was Sie tun wollten?
▪ Wofür brauchen Sie zu viel Zeit?
Das Perfekt, auch vollendete Gegenwart genannt, wird in der gesprochenen Sprache benutzt,
und beschreibt eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit mit Gegenwartsbezug oder
einen erreichten Zustand. Man benutzt das Perfekt ausschließlich im privaten Bereich, wenn man
mit Freunden oder mit Familienmitgliedern über etwas spricht, was vergangen ist. So wird das
Perfekt auch in privaten Briefen benutzt, um Familienmitgliedern oder Freunden schriftlich
mitzuteilen, was man beispielsweise im Urlaub erlebt hat.
Das Perfekt besteht aus zwei Teilen, dem Hilfsverb haben oder sein und dem Partizip II:
haben/sein + Partizip II = PERFEKT
Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II (Verb 2)
Meine Frau hat eine Pizza gemacht.
Die Kinder haben heute keine Hausaufgaben gemacht.
Ich bin gestern nach Bielefeld gefahren.
Das Kind ist am Sonntag schon um 6:30 Uhr aufgewacht.
Das Hilfsverb wird konjugiert und zeigt die Person an.
Das Partizip II ist unveränderlich und schließt den Satz ab.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
5
1. Die Hilfsverben haben und sein
Die Hilfsverben haben und sein werden wie die Vollverben haben und sein konjugiert.
Das Perfekt mit dem Hilfsverb haben bilden:
▪ alle Verben mit Akkusativ-Ergänzung:
➢ Er liebt mich noch heute. - Damals habe ich ihn auch geliebt.
Él todavía me ama hoy. - En ese momento yo también lo amaba.
➢ Thomas liest ein Buch. - Thomas hat ein Buch gelesen.
Thomas lee un libro. - Thomas ha leído un libro.
➢ Jürgen gibt täglich sehr viel Geld aus. - Jürgen hat täglich sehr viel Geld ausgegeben.
Jürgen gasta mucho dinero todos los días. – Jürgen gastaba mucho dinero todos los días.
▪ alle reflexive Verben:
➢ Er wäscht sich selten. Heute hat er sich auch noch nicht gewaschen.
Rara vez se lava. Él todavía no se ha lavado.
➢ Du erkältest dich noch. Siehst du, du hast dich schon erkältet.
Todavía estas resfriado. Ya ves, ya te has resfriado.
➢ Beeil dich! - Warum, du hast dich doch auch nicht beeilt.
¡Date prisa! - Por qué, no te apuraste.
▪ alle Modalverben als Vollverb (ihr Gebrauch ist aber selten!!):
➢ Das habe ich nicht gewollt. - Die Arbeit hat er nicht machen wollen.
Yo no quería eso. - No quería hacer el trabajo.
➢ Der Schüler hat die Aufgabe nicht gekonnt. - Der Schüler hat es nicht machen können.
El alumno no pudo hacer el trabajo. - El alumno no pudo hacerlo.
➢ So viele Hausaufgaben hast du nicht machen müssen.
No tenías que hacer tanta tarea.
▪ die meisten anderen Verben:
➢ Mein Nachbar hilft mir nicht. - Aber ich habe ihm immer geholfen.
Mi vecino no me ayuda. - Pero siempre lo ayudé.
➢ Gibst du mir ein Bonbon ab? - Ich habe dir gestern auch eins abgegeben.
¿Me das un caramelo? – También te di uno ayer.
➢ Heute regnet es zum Glück nicht. - Gestern hat es den ganzen Tag geregnet.
Afortunadamente, hoy no llueve. - Ayer llovió todo el día.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
6
2. Das Perfekt mit dem Hilfsverb sein bilden:
▪ bei Verben, die eine Ortsveränderung beschreiben:
Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II (Verb 2)
gehen Mein Kollege ist heute früher nach Hause gegangen.
an|kommen Unser Zug ist heute mal wieder zu spät angekommen.
fahren Gestern sind wir mit dem Fahrrad nach Ulm gefahren.
▪ bei Verben, die eine Zustandsänderung beschreiben:
Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II (Verb 2)
auf|stehen Ich bin heute Morgen sehr früh aufgestanden.
auf|wachsen Mein Frau ist in einem kleinen Dorf bei Ulm aufgewachsen.
ein|schlafen Endlich ist das kranke Kind wieder eingeschlafen.
sterben Ihr Mann ist schon mit 43 Jahren gestorben.
wachsen Was sind deine Kinder schon gewachsen.
Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:
gehen sinken werden bleiben
kommen steigen sterben abfahren
fliegen aufstehen wachsen zurückkommen
passieren aufwachen reisen
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
7
▪ folgende Verben:
Infinitiv Position 1 Verb 1 Mittelfeld Partizip II (Verb 2)
bleiben Mein Freund ist gestern sehr lang bei uns geblieben.
gelingen Mir ist endlich mein Experiment gelungen.
geschehen Was ist gestern eigentlich auf der Party geschehen?
passieren Gestern ist etwas Schreckliches passiert?
sein Seid ihr auch schon mal in der gewesen?
Schweiz
werden Das Kind ist heute 8 Jahre alt geworden.
A2 Bilden Sie Fragen im Perfekt wie im Beispiel.
➢ lange arbeiten
Hast du lange gearbeitet?
1) Paul fragen
Hast du ___________________________________________________________
2) ihm glauben
__________________________________________________________________
3) Geld wechseln
__________________________________________________________________
4) den Termin ändern
__________________________________________________________________
5) ihm den Weg zeigen
__________________________________________________________________
6) die Stühle zählen
__________________________________________________________________
7) die Rechnung kontrollieren
__________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
8
8) den Flug buchen
__________________________________________________________________
9) Sebastian gratulieren
__________________________________________________________________
10) das Paket von der Post holen
__________________________________________________________________
11) ihm antworten
__________________________________________________________________
12) die Wohnung putzen
__________________________________________________________________
13) Jura studieren
__________________________________________________________________
14) mit den Kollegen reden
__________________________________________________________________
15) auf den Bus warten
__________________________________________________________________
16) sich vor dem Hund fürchten
__________________________________________________________________
17) ihnen folgen !
__________________________________________________________________
18) in den Alpen wandern !
__________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
9
Bildung des Partizips II der regelmäßigen Verben
▪ Das Partizip II der regelmäßigen Verben wird wie folgt gebildet:
ge + Verbstamm + t
Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
kaufen gekauft Ich habe mir ein neues Auto gekauft.
lachen gelacht Im Urlaub haben wir die ganze Zeit gelacht.
lernen gelernt Habt ihr in Aachen Deutsch gelernt?
lieben geliebt Früher hat sie mich noch innig geliebt.
machen gemacht Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:
machen lieben fragen bauen
lernen spielen brauchen frühstücken
kochen leben wohnen glauben
hören lügen stören kaufen
Lautliche Besonderheiten
Gelegentlich kommt es vor, dass der Verbstamm mit -t, -d, -m oder -n endet. Beispiele sind die
Verben: arbeiten, atmen, rechnen usw. Die Folge sind Ausspracheprobleme beim Bilden des
Partizips II. Deshalb wird beim Partizip II. ein „e" zwischen Verbstamm und der Partizip-Endung
„t" eingeschoben.
ge + Verbstamm + et
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
10
Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
antworten geantwortet Er hat mir nicht geantwortet.
arbeiten gearbeitet Mein Mann hat gestern zu viel gearbeitet.
heiraten geheiratet Wann habt ihr geheiratet?
trocknen getrocknet Die Wäsche ist schon getrocknet.
zeichnen gezeichnet Der Maler hat das Haus schon gezeichnet.
Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:
arbeiten warten
antworten kosten
rechnen bilden
öffnen baden
enden heiraten
▪ Das Partizip II der trennbaren Verben, sofern sie nicht zu den unregelmäßigen Verben
gehören, wird wie folgt gebildet:
Präfix + ge + Verbstamm + t
Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
ab|machen abgemacht Warum hast du das Bild abgemacht?
an|machen angemacht Hast du die Heizung angemacht?
auf|bauen aufgebaut Habt ihr das Zelt aufgebaut?
ein|legen eingelegt Hast du die CD eingelegt?
mit|spielen mitgespielt Habt ihr gestern mitgespielt?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
11
Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:
regelmäßige Verben unregelmäßige Verben
anmachen aufräumen anfangen fernsehen
abholen einkaufen abnehmen mitbringen
ausmachen einstellen aussehen stattfinden
aufmachen anrufen vorbereiten
einladen
regelmäßige trennbare Verben, sog. Bewegungsverben, mit sein
ankommen ausgehen umsteigen
aufstehen aussteigen umziehen
abfahren einsteigen zurückgehen
aufwachen mitkommen zurückfahren
A3 Du hast/bist …
Bilden Sie das Perfekt wie im Beispiel.
➢ etw. zurückgeben
Du hast etwas zurückgegeben.
1) jdn. anrufen
Du hast __________________________________________________________________
2) gestern abfahren
_________________________________________________________________________
3) etw. herstellen
_________________________________________________________________________
4) sich ausschlafen
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
12
5) etw. mitnehmen
_________________________________________________________________________
6) früh aufstehen !
_________________________________________________________________________
7) jdm. zuhören
_________________________________________________________________________
8) etw. kaputtmachen
_________________________________________________________________________
9) schnell einsteigen
_________________________________________________________________________
▪ Das Partizip II der Verben mit festen Präfixen (z. B. be-, ent-, miss-, ver-, zer-), sofern sie
nicht zu den unregelmäßigen Verben gehören, wird stets ohne „ge" gebildet:
Verbstamm + t
Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
bezahlen bezahlt Sie haben Ihre Rechnung noch nicht bezahlt.
entdecken entdeckt In der Südsee hat man eine neue Fischart entdeckt.
erleben erlebt Habt ihr in Amerika viel erlebt?
gehören gehört Diese Uhr hat mal deinem Großvater gehört.
zerstören zerstört Die Bombe hat das ganze Haus zerstört.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
13
Folgende regelmäßige Verben gehören zu dieser Gruppe:
regelmäßige Verben unregelmäßige Verben
besuchen verkaufen beginnen verstehen
besichtigen verdienen befinden verbringen
bezahlen erzählen bestehen verlieren
bestellen erklären empfehlen erziehen
zerstören erleben verstehen erfinden
A4 Bilden Sie das Perfekt wie im Beispiel.
➢ etw. bestellen
Du hast etwas bestellt.
1) etw. erzählen
Du hast ___________________________________________________________
2) etw. gewinnen
__________________________________________________________________
3) jdn. erkennen
__________________________________________________________________
4) jmd. verzeihen
__________________________________________________________________
5) etw. zerbrechen
__________________________________________________________________
6) jdm. misstrauen
__________________________________________________________________
7) jdn. besuchen
__________________________________________________________________
8) etw. verlieren
__________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
14
9) etw. vergessen
__________________________________________________________________
10) etw. besichtigen
__________________________________________________________________
11) sich beeilen
__________________________________________________________________
12) sich entschuldigen
__________________________________________________________________
▪ Das Partizip II der Verben, die mit „-ieren" enden, wird ebenfalls ohne „ge" gebildet:
Verbstamm + t
Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
fotografieren fotografiert Mein Vater hat nur die Löwen fotografiert.
markieren markiert Habt ihr alle Lösungen markiert?
passieren passiert Was ist dir denn passiert?
studieren studiert Helmut hat auch in Aachen studiert.
zentrieren zentriert Warum haben Sie den Text nicht zentriert?
Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:
studieren stornieren
reparieren operieren
montieren korrigieren
diskutieren fotografieren
reservieren dekorieren
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
15
Bildung des Partizips II der unregelmäßigen Verben
Die Endung des Partizips II ist bei den unregelmäßigen Verben „-en". Zusätzlich findet häufig
ein Vokalwechsel im Wortstamm statt. Daher sollte man die unregelmäßigen Verben mit dem
dazugehörigen Partizip II besonders gut lernen. Beispiele:
Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
fahren gefahren Mein Vater ist gegen das Tor gefahren.
sehen gesehen Gestern habe ich Peter gesehen.
trinken getrunken Wie viel Bier hast du gestern getrunken?
Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:
trinken helfen leihen tragen
finden treffen sehen schlafen
sprechen nehmen lesen lassen
geben essen waschen schreiben
Beispiele:
➢ Wir haben viel Brot gegessen.
➢ Das Kind hat ein Buch gelesen.
➢ Meine Mutter hat mit mir gesprochen.
➢ Ich habe der Lehrerin geholfen.
➢ Der Professor hat mir das Buch gegeben.
➢ Ich habe gestern sehr gut geschlafen.
➢ Die Kinder haben den Bus genommen.
➢ Wir haben einen Film gesehen.
➢ Du hast eine Jacke getragen.
➢ Das Kind hat eine Schokolade gestohlen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
16
A5 Bilden Sie Fragen im Perfekt wie im Beispiel.
➢ ein Bier / trinken
Hast du ein Bier getrunken?
1) das Sandwich / essen
Hast du ___________________________________________________________
2) den Weg / finden
__________________________________________________________________
3) deinen Freunden / helfen
__________________________________________________________________
4) lange / schlafen
__________________________________________________________________
5) den Roman / lesen
__________________________________________________________________
6) deiner Tante / schreiben
__________________________________________________________________
7) in einem Chor / singen
__________________________________________________________________
8) alles / sehen
__________________________________________________________________
9) mit Klaus / streiten
__________________________________________________________________
10) um Hilfe / bitten
__________________________________________________________________
11) das Obst / waschen
__________________________________________________________________
12) deinen Cousin / treffen
__________________________________________________________________
13) lange / bleiben !
__________________________________________________________________
14) in den Park / laufen !
__________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
17
15) nach Hongkong / fliegen !
__________________________________________________________________
16) in der U-Bahn / stehen
__________________________________________________________________
17) im Theater vorne / sitzen
__________________________________________________________________
18) im Krankenhaus / liegen
__________________________________________________________________
A6 Gemischte Verben
Bilden Sie Sätze mit folgenden Elementen.
➢ das Paket / bringen
Sie hat bestimmt das Paket gebracht.
1) die Adresse / nennen
Sie hat bestimmt ____________________________________________________
2) die Antwort / wissen
__________________________________________________________________
3) viele Grüße / senden
__________________________________________________________________
4) die Journalistin / kennen
__________________________________________________________________
5) an die Verabredung / denken
__________________________________________________________________
6) nicht auf die Straße / rennen !
__________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
18
Bewegungsverben
Für Bewegungsverben im Perfekt verwenden wir im Deutschen normalerweise sein. Es gibt aber
ein paar Verben, die manchmal auch mit haben stehen können, z. B.: joggen, klettern,
schwimmen, tauchen.
Wenn die Ortsänderung im Vordergrund steht, müssen wir unbedingt sein nehmen. Anderenfalls
können wir bei diesen Verben auch haben verwenden (sein ist aber genauso korrekt).
Beispiel:
➢ Er ist durch den Wald gejoggt. Er ist/hat jeden Tag gejoggt.
➢ Wir sind auf den Berg geklettert. Wir sind/haben fünf Stunden geklettert.
➢ Ich bin zur Insel geschwommen. Ich bin/habe Bestzeit geschwommen.
➢ Du bist zum Schiffswrack getaucht. Du bist/hast im Urlaub getaucht.
Folgende Verben gehören zu dieser Gruppe:
gehen werden
kommen sterben
fliegen wachsen
passieren starten
sinken bleiben
steigen abfahren
aufstehen zurückkommen
aufwachen umfallen
gefrieren tauen
einschlafen stolpern
wandern ziehen
zurückkehren stürzen
rennen reiten
laufen reisen
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
19
Das Verb tanzen bildet eine Ausnahme: Wenn die Ortsänderung nicht im Vordergrund steht,
müssen Sie haben verwenden (sein ist dann nicht möglich).
Beispiel:
➢ Sie sind durch den Saal getanzt.
aber:
➢ Sie haben früher viel getanzt.
➢ Du hast gut getanzt.
➢ Sie hat Ballett getanzt.
➢ Wir haben Walzer getanzt.
Die Verben stehen, sitzen und liegen bilden die Perfektformen im Deutschen mit haben.
Beispiel:
➢ Er hat auf der Straße gestanden.
➢ Du hast auf dem Sofa gesessen.
➢ Die Kinder haben auf dem Boden gelegen.
In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz weicht man hier aber häufig von der Regel ab
und verwendet sein.
Das Perfekt mit Modalverben
Das Perfekt der Modalverben wird in der Praxis nur selten benutzt. In der Regel wird das
Präteritum benutzt.
▪ Die Modalverben als Vollverb bilden das Perfekt wie folgt:
haben + Partizip II
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
20
Infinitiv Partizip II Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
dürfen gedurft Das hast du nicht gedurft.
können gekonnt Alle Schüler haben die Rechenaufgaben gekonnt.
mögen gemocht Herrn Böhm haben die Schüler nicht gemocht.
müssen gemusst Klaus hat in jeder Pause auf das WC gemusst.
sollen *
wollen gewollt Das habe ich nicht gewollt.
* Diese Form existiert nicht
Das Perfekt der Modalverben mit einem zusätzlichen Vollverb wird wie folgt gebildet:
haben + Infinitiv Vollverb + Infinitiv Modalverb
Infinitiv Position 1 Hilfsverb Mittelfeld Partizip II
dürfen Das hast du nicht machen dürfen.
können Alle Schüler haben die Rechenaufgaben lösen können.
mögen Viele Schüler haben nicht zur Schule gehen mögen.
müssen Klaus hat auch schmutzige Arbeiten machen müssen.
sollen Wir haben das Zimmer aufräumen sollen.
wollen Das habe ich nicht machen wollen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
21
A7 Ein anstrengender Urlaub!
Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
finden ausfüllen dauern umziehen stellen suchen nehmen
ankommen landen verpassen verlieren fliegen anfangen vergessen
kaufen denken tragen bezahlen passieren reparieren
Liebe Anna,
endlich habe ich ein Internet-Café 1 gefunden und kann Dir schreiben!
Du glaubst gar nicht, was mir in den letzten Tagen alles 2 __________________ _____________!
Es _______ schon damit 3 _____________________, dass ich mein Flugzeug ______________
4 ________ … Ich _______ zwei Wecker 5 ___________, aber ich ___________ nicht an die
Sommerzeit 6 _____________________! Es war chaotisch, aber schließlich _________ ich doch
gut hier 7 _____________________. Aber nur ich, nicht mein Gepäck! Es _________ weiter nach
Miami 8 _____________________. Also _______ ich viele Formulare 9 ____________________,
___________ mir eine neue Zahnbürste 10 _________________________ und ein Zimmer in der
Nähe des Flughafens 11 ___________________________. Nach zwei Tagen – ich ___________
immer dasselbe T-Shirt 12 _____________________ … - __________ mein Rucksack endlich
13 _____________________. Ich ___________ mich 14 ______________________, das Zimmer
15 _____________________ und den nächsten Bus nach Süden 16 ________________.
Du fragst Dich sicher schon, was jetzt noch kommt … Richtig! Der Bus __________ nach 150 km
ein Rad 17 _____________________!
Der Busfahrer __________ es 18 _____________________, doch es ___________ zwei Stunden
19 _______________________. Aber aller guten (und schlechten!) Dinge sind drei, und jetzt hoffe
ich auf einen schönen Urlaub!
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
22
Viele Grüße
Lena
PS: Oh, ich glaube, ich ____________ meinen Geldbeutel im Hotel 20 _____________________.
A8 Ich bin gestern 1000 Meter geschwommen
Bilden Sie Sätze und verwenden Sie das Verb im Perfekt.
➢ wegwerfen / Leoni / endlich / ihre alten, kaputten Schuhe
Leoni hat endlich ihre alten, kaputten Schuhe weggeworfen.
1) streiten / unsere Nachbarn / die ganze Nacht / laut
________________________________________________________________________
2) schwimmen / ich / gestern / 1000 Meter
________________________________________________________________________
3) wissen / ich / das / leider nicht
________________________________________________________________________
4) leihen / ich / meinem Freund / mein Motorrad
________________________________________________________________________
5) mitbringen / Jörg / aus dem Urlaub / einen Hund
________________________________________________________________________
6) gewinnen / ich / noch nie / im Lotto
________________________________________________________________________
7) denken / er / die ganze Nacht / an seine Freundin
________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
23
A9 Wie viele Stunden haben Sie in der letzten Woche …
Beantworten Sie die Fragen in ganzen Sätzen.
… auf öffentliche Verkehrsmittel/auf den Fahrstuhl gewartet?
… über Personen geredet, die nicht anwesend sind?
… zu Hause an Ihre Arbeit/an Ihr Studium gedacht?
… sich über jemanden/über etwas geärgert?
… sich über jemanden/über etwas gefreut?
… vom Urlaub geträumt?
… mit dem Handy telefoniert?
A10 Erfinden Sie eine Geschichte.
Entscheiden Sie sich für ein Kästchen und verwenden Sie die angegebenen Wörter.
Erzählen Sie Ihre Geschichte im Perfekt.
Arbeit – Projekt – Ärger – Kollege – viele - Besprechungen
Urlaub – Unfall – Bein – Krankenhaus – vier Wochen
Hochhaus – im Fahrstuhl – zehn Menschen – Notruf – zwei Stunden - Monteur
Abendessen – Zutaten – Herd kaputt - Gäste
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
24
DAS PRÄTERITUM
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
25
Das Präteritum, auch Imperfekt genannt, bildet zusammen mit dem Perfekt eine Zeitstufe. Der
Unterschied liegt alleinig in ihrer Verwendung. Das Perfekt wird in der gesprochenen Sprache
benutzt, während das Präteritum überwiegend in geschriebenen Texten Verwendung findet,
wie zum Beispiel in Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Geschichten, Märchen etc. Aber auch in
den Nachrichten, im Fernsehen oder im Radio wird das Präteritum benutzt, um über Vergangenes
zu berichten.
Die Personalpronomen du und ihr werden im Präteritum sehr selten benutzt, da diese Personen
ausschließlich in der gesprochenen Sprache, also im Perfekt, Anwendung finden.
Die Ausnahme bilden die Verben haben, sein sowie die Modalverben. Sie sind im Präteritum
einfacher zu bilden. Daher werden die Präteritumformen dieser Verben auch im Perfekt benutzt.
Das ist möglich, da das Perfekt und das Präteritum die gleiche Zeitstufe vertreten.
Für alle Verben im Präteritum gilt: Die 1. und 3. Person wird gleich konjugiert, im Singular wie im
Plural.
A11 Verben im Präsens
Schreiben Sie den Text in der dritten Person.
Ich bin Carla Fröhlich. Ich bin Studentin. Ich studiere Geschichte an der Humboldt-Universität in
Berlin. Ich stehe jeden Tag um 9:00 Uhr auf. Vormittags besuche ich die Vorlesungen und
Seminare an der Universität, nachmittags sitze ich meistens in der Bibliothek. Dort treffe ich oft
Marcus. Er interessiert sich für die gleichen Bücher wie ich. Ich schreibe im Moment an meiner
Diplomarbeit. Ich hoffe, dass ich im August damit fertig bin. Abends arbeite ich zweimal pro Woche
in einem Restaurant als Kellnerin. Ich brauche das Geld zum Leben. Mittwochs gehe ich mit
Marcus und ein paar anderen Freunden ins Jazz-Café. Dort gibt es Livemusik.
Das ist Carla Fröhlich. Sie ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
26
Die Bildung des Präteritums der regelmäßigen Verben
Das Präteritum der regelmäßigen Verben, auch schwache Verben genannt, bildet man wie folgt:
Verbstamm + Präteritumendung
Person Stamm Endung Beispiele
ich lernen -te Damals lernte ich in Berlin Deutsch.
du lernen -test Du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen.
er / sie / es lernen -te Der Junge lernte auf der Schule Französisch.
wir lernen -ten Wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis.
ihr lernen -tet Lerntet ihr Spanisch.
Sie / sie lernen -ten Sie lernten viel für das Leben.
Lautliche Besonderheiten
Gelegentlich kommt es vor, dass der Verbstamm mit -t; -d, -chn, -ffn, -gn, -m¹ oder -n¹ endet
(ohne Verben¹ mit der Endung -ln oder -rn; klingeln, zittern). Beispiele sind die Verben: arbeiten,
reden, rechnen, öffnen, regnen, atmen usw. Die Folge sind Ausspracheprobleme beim Bilden
des Präteritums. Deshalb wird beim Präteritum ein „e" zwischen „Verbstamm" und der „Endung"
eingeschoben.
Person Verbstamm Endung Beispiele
ich arbeiten -ete Damals arbeitete ich in Berlin.
du heiraten -etest Wie alt warst du, als du heiratetest?
er / sie / es atmen -ete Der Schwerverletzte atmete nur noch sehr schwach.
wir beobachten -eten Wir beobachteten den Fremden schon sehr lange.
ihr warten -etet Warum wartetet ihr Stundenlang auf ihn?
Sie / sie antworten -eten Die Frauen antworteten ihnen nicht.
Achtung! Immer schwach sind Verben die auf –eln, -ern, -igen und -ieren enden.
ich sammelte, ich änderte, ich besichtigte, ich telefonierte
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
27
A12 Stellen Sie Fragen im Präteritum.
➢ Wagen kaufen
Wann kaufte Yasmin den Wagen?
1) euch informieren
__________________________________________________________________
2) Wohnung kündigen
__________________________________________________________________
3) Geld wechseln
__________________________________________________________________
4) Studium beenden
__________________________________________________________________
5) sich verabschieden
__________________________________________________________________
6) Tisch reservieren
__________________________________________________________________
7) Arbeit erledigen
__________________________________________________________________
8) Geschenke verpacken
__________________________________________________________________
9) sich vorstellen
__________________________________________________________________
10) Karte abschicken
__________________________________________________________________
11) Regale aufbauen
__________________________________________________________________
12) aus Italien zurückkehren
__________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
28
Die Bildung des Präteritums der unregelmäßigen Verben
Einige Verben, zum Beispiel haben, sein, und werden, werden sehr häufig benutzt, da sie auch
in der gesprochenen Sprache, also im Perfekt, benutzt werden. Einige davon finden darüber
hinaus auch als Hilfsverb Verwendung. Die Präteritumsformen der folgenden Verben sollte man
unbedingt kennen:
Infinitiv Präteritum ich du wir ihr
er / sie / es Sie / sie
sein waren war warst waren wart
haben hatten hatte hattest hatten hattet
werden wurden wurde wurdest wurden wurdet
wissen wussten wusste wusstest wussten wusstet
denken dachten dachte dachtest dachten dachtet
gehen gingen ging gingst gingen gingt
fahren fuhren fuhr fuhrst fuhren fuhrt
bringen brachten brachte brachtest brachten brachtet
lassen ließen ließ ließt ließen ließt
Das Präteritum der unregelmäßigen Verben hat sehr oft eine andere Stammform als im Infinitiv.
Beispiele mit dem Präteritum sein und haben:
➢ Ich war nicht durstig.
➢ Du hattest Kopfschmerzen.
➢ Er war nicht zu Hause.
➢ Ihr wart im Zoo.
➢ Hatten Sie als Kind einen Hund?
Lernen Sie die Formen auswendig! (Siehe Anhang 1 auf Seite 186)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
29
A13 Schreiben Sie die Sätze im Präteritum.
➢ der Brief / schreiben Ich schrieb den Brief.
1) kein Parkplatz / finden ________________________________________
2) nach Hause / laufen ________________________________________
3) Platz / nehmen ________________________________________
4) mit Christian / sprechen ________________________________________
5) um 6:30 Uhr / aufstehen ________________________________________
6) der Termin / vergessen ________________________________________
7) ins Taxi / einsteigen ________________________________________
8) meine Freunde / einladen ________________________________________
9) nach Rom / fliegen ________________________________________
10) im Kino / einschlafen ________________________________________
11) Lisa / die Mappe / zurückgeben ________________________________________
12) Tim / meine Hilfe / anbieten ________________________________________
A14 Gemischte Verben
Schreiben Sie die Sätze im Präteritum.
➢ Er bringt ein Geschenk. Er brachte ein Geschenk.
1) In der Badstraße brennt es. ________________________________________
2) Ich weiß die Antwort leider nicht. ________________________________________
3) Man erkennt ihn überall. ________________________________________
4) Sie wendet sich an uns. ________________________________________
5) Der Hund rennt auf die Straße. ________________________________________
6) Ich sende dir eine Ansichtskarte. ________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
30
Die Bildung des Präteritums der Modalverben
Die Perfektformen der Modalverben sind vom Satzbau ein wenig kompliziert, daher werden auch
in der gesprochenen Sprache die Modalverben im Präteritum benutzt.
Infinitiv Präteritum ich du wir ihr
er / sie / es Sie / sie
dürfen durften durfte durftest durften durftet
können konnten konnte konntest konnten konntet
mögen mochten mochte mochtest mochten mochtet
möchten¹ wollten wollte wolltest wollten wolltet
müssen mussten musste musstest mussten musstet
sollen sollten sollte solltest sollten solltet
wollen wollten wollte wolltest wollten wolltet
¹ Der Konjunktiv II von mögen ist „möchten“. „Möchten“ ändert sich allerdings im Präteritum in „wollten“.
Position 1 Position 2 Mittelfeld Satzende
Subjekt Verb Ergänzung Verb
Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen.
Die Arbeiter konnten wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten.
Viele Schüler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen.
Alle Arbeitnehmer mussten im vergangenen Monat viele Überstunden leisten.
Die Ärzte sollten sich nach der Operation sofort beim Chefarzt melden.
Peter wollte als kleiner Junge nie zur Schule gehen.
A15 Susannes Leben
Ergänzen Sie die Verben im Präteritum.
Mit sechs Jahren 1 kam (kommen) ich in die Grundschule. Ich 2 _____________ (sein) eine gute
Schülerin und 3 _______ (haben) nie Probleme mit den Lehrern.
Mit 15 Jahren 4 __________ (sein) ich zum ersten Mal mit einem Jungen zusammen, sein Name
5 _______ (sein) Max. Er 6 _______ (werden) meine erste große Liebe.
Mit 18 Jahren 7 ______________ (bestehen) ich das Abitur mit Note 1,2. Danach 8 __________
(bewerben) ich mich um einen Studienplatz für Zahnmedizin und 9 _____________ (bekommen)
einen Studienplatz in Hamburg. Dort 10 _________________ (finden) ich bald eine schöne, kleine
Wohnung und Max 11 ________ mit mir nach Hamburg ____ (umziehen). Wir 12 _________ (sein)
sehr glücklich in dieser Zeit.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
31
Mit 26 Jahren 13 _________ (beginnen) ich als Zahnärztin in einer Hamburger Klinik zu arbeiten.
Zwei Jahre später 14 _________ (heiraten) wir. In den folgenden Jahren 15 __________________
(bekommen) wir drei Kinder. Leider 16 _________ (streiten) Max und ich immer häufiger und …
A16 Dichter gesucht!
Bilden Sie das Präteritum und ordnen Sie die Formen nach Stammvokalen in Gruppen.
singen ziehen schlagen finden schneiden geschehen tragen essen
springen schreiben lesen gelingen schließen sehen streiten bleiben
fliegen leihen frieren schreien verlieren fließen
ie o ei ie a u
________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
________________
________________
e a i a ei i
________________ fand ________________
________________ ________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
Tipp:
Lernen Sie die Präteritums-Formen in Gruppen mit denselben Vokalen! Auch kleine Reime helfen
beim Merken, z. B.: … und er sah, was dann geschah!
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
32
A17 Hermann Hesse – ein Schriftstellerleben
Ergänzen Sie die Verben im Präteritum.
Kennen Sie „Siddhartha“ oder „Der Steppenwolf“? Diese Bücher von Hermann Hesse 1 wurden
(werden) in der ganzen Welt berühmt.
Hermann Hesse 2 _____________ (werden) am 2. Juli 1877 in Calw (Württemberg) geboren. Er
3 __________________ (besuchen) in Deutschland und in der Schweiz die Schule. Mit 14 Jahren
4 ____________ (kommen) er ins evangelisch-theologische Seminar im Kloster Maulbronn, aus
dem er ein Jahr später 5 _________________ (weglaufen). Er 6 _______________ (wollen) nur
Dichter werden.
Nun 7 _______________ (beginnen) eine Zeit von großen Konflikten mit den Eltern und starken
psychischen Problemen, bis er eine Lehre als Buchhändler 8 _________________ (machen).
Bereits als Jugendlicher 9 _____________________ (schreiben) er Gedichte und Märchen, und
mit 23 Jahren 10 _________________ (veröffentlichen) er sein erstes Buch.
Ab 1904 11 _____________ (leben) er als freier Schriftsteller und 12 ______________ (heiraten)
seine erste Frau.
Während des 1. Weltkriegs 13 ___________________ (verschicken) Hesse Bücher an deutsche
Kriegsgefangene und 14 ____________ eine Zeitschrift für sie ______________ (herausgeben).
Er 15 ________ (sein) ein Kriegsgegner und 16 ___________ sich ins Tessin _______________
(zurückziehen). Dort 17 ____________ (leben) er mit anderen Künstlern auf dem „Monte Verità“.
Er 18 _________________ (bleiben) bis zu seinem Lebensende im Tessin.
Im Alter 19 ____________ (schreiben) Hesse keine größeren Werke mehr, aber er 20 _________
(bekommen) von seinen Lesern unglaublich viele Briefe, circa 35.000. Einen großen Teil davon
21 _________________ (beantworten) er persönlich.
Am 9. August 1962 22 _________________ (sterben) Hermann Hesse in Montagnola im Tessin.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
33
A18 Verben in Präteritum
Schreiben Sie den Text in der dritten Person im Präteritum.
Ein Tag von Nico Brettschneider
Mein Tag beginnt früh um 6:30 Uhr. Ich fahre um 7:00 Uhr mit dem Auto zur Arbeit. Im Büro lese
und beantworte ich meine E-Mails. Danach telefoniere ich mit Kunden. Um 9:00 Uhr habe ich eine
Abteilungsbesprechung. Ich arbeite eng mit meinen Kollegen zusammen. Wir entwickeln neue
Konzepte und sammeln Ideen. Am Abend gehe ich ins Jazz-Café zur Livemusik. Dort treffe ich
mich mit Marcus und Carla.
Gestern begann sein Tag um 6:30 Uhr. ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A19 Haben Sie/Sind Sie letzte Woche …?
Bilden Sie Fragen im Perfekt und antworten Sie.
➢ Spaghetti kochen
Haben Sie letzte Woche Spaghetti gekocht? Nein, ich habe keine Spaghetti gekocht.
1) oft im Stau stehen
_________________________________________________________________________
2) einen Kurs besuchen
_________________________________________________________________________
3) abends lange fernsehen
_________________________________________________________________________
4) sich mit Freunden treffen
_________________________________________________________________________
5) mit Kollegen sprechen
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
34
6) Probleme lösen
_________________________________________________________________________
7) mit Kunden telefonieren
_________________________________________________________________________
8) in die Kneipe gehen
_________________________________________________________________________
9) an Besprechungen teilnehmen
_________________________________________________________________________
10) mit dem Auto fahren
_________________________________________________________________________
11) viel Sport treiben
_________________________________________________________________________
12) ein Buch lesen
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
35
DAS PLUSQUAMPERFEKT
vorher
Aktion / Geschehen Aktion / Geschehen
Zeit
Plusquamperfekt Präteritum jetzt
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
36
Bei dieser Zeitform wird eine Handlung in der Vergangenheit (im Präteritum) beschrieben, die
vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit geschehen ist.
Beispiele:
➢ Ich kann sehr gut kochen. Ich hatte schon viel geübt (A) und experimentiert bevor ich so gut
kochen konnte (B).
Puedo cocinar muy bien. Había practicado y experimentado mucho (A) antes de poder cocinar tan bien
(B).
➢ Wir sind in den Urlaub gefahren (B), aber davor hatten wir unsere Hausaufgaben gemacht
(A).
Nos fuimos de vacaciones (B), pero antes de eso habíamos hecho nuestra tarea (A).
➢ Herr Müller war letzte Woche krank (B). Er hatte eine Erkältung gehabt (A).
El señor Müller estuvo enfermo la semana pasada (B). Tenía un resfriado (A).
➢ Die Kinder hatten die Sandburg schon fertig gebaut (A), als es plötzlich regnete (B).
Los niños ya habían terminado de construir el castillo de arena (A) cuando de repente llovió (B).
➢ Beim Talentwettbewerb spielte Luise fehlerfrei ein schwieriges Stück auf der Flöte (B).
Sie hatte sehr lange geübt, bevor sie das Stück so perfekt spielen konnte (A).
En la competencia de talentos, Luise tocó una pieza difícil en la flauta sin error (B). Ella había practicado
durante mucho tiempo antes de poder tocar la pieza tan perfectamente (A).
Die Handlung A (= Plusquamperfekt) passiert vor der Handlung B (= Präteritum¹).
¹ In der gesprochenen Sprache wird statt Präteritum oft Perfekt verwendet.
Plusquamperfekt Signalwörter
▪ Als
➢ Als ich in der 2. Klasse war, war der Schulunterricht viel einfacher.
Cuando estaba en 2º grado, las lecciones escolares eran mucho más fáciles.
▪ Nachdem
➢ Nachdem ich meinen Schulabschluss hatte, habe ich mit meiner Familie gefeiert.
Después de graduarme, celebré con mi familia.
▪ Bevor
➢ Bevor ich gelernt habe, hatte ich meine Zusammenfassungen bereits fertig.
Antes de aprender, ya había terminado mis resúmenes.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
37
Die Bildung des Plusquamperfekts
Das Plusquamperfekt wird wie folgt gebildet:
Präteritum von haben / sein + Partizip II
Bei der Frage, ob das Hilfsverb mit haben oder sein gebildet wird, gelten dieselben Regeln wie
beim Perfekt.
Perfekt Plusquamperfekt Beispiele
ist gegangen war gegangen Der Mitarbeiter war schon gegangen, als der Chef nach
ihm fragte.
hat gekocht hatte gekocht Die Frau hatte bereits die Suppe gekocht, als ihr
plötzlich der Suppentopf herunterfiel.
ist gefahren war gefahren Viele Gäste waren bereits nach Hause gefahren, als
der Präsident kam.
ist gestorben war gestorben Als der Notarzt eintraf, war das Unfallopfer bereits an
seinen starken Verletzungen gestorben.
hat telefoniert hatte telefoniert Nachdem Andreas mit seiner Exfrau telefoniert hatte,
ist er in eine Kneipe gegangen und hat sich sinnlos
betrunken.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
38
Anwendungsbeispiele
Das Plusquamperfekt wird generell nicht als eine einzelne Aussage verwendet. Die Vorzeitigkeit,
die das Plusquamperfekt ausdrückt, wird immer im Bezug zu einer Aussage im Präteritum bzw.
dem Perfekt gestellt. Es kann zu folgenden Kombinationen kommen:
▪ Plusquamperfekt im Hauptsatz
Hauptsatz in der Hauptsatz mit Plusquamperfekt
Vergangenheit
Pos. 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2
Ihm war schlecht. Er hatte zuvor 8 Grillwürstchen gegessen.
Sie waren sehr gut gelaunt. Sie hatten gegen den FC mit 5:0 gewonnen.
Karl hatte einen Unfall. Zuvor hatte er sehr viel Alkohol getrunken.
▪ Plusquamperfekt im Nebensatz
Nebensatz mit Plusquamperfekt Hauptsatz
Konjunktion Subjekt Mittelfeld Verben
Nachdem ich dich angerufen hatte, bin ich einkaufen
gegangen.
Nachdem Tom die Wahrheit erfahren hatte, reichte er die
Scheidung ein.
Nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, eroberten die
Säugetiere den
Planeten.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
39
A20 Was war vorher passiert?
Ergänzen Sie die Sätze im Plusquamperfekt frei.
➢ Ich war am Wochenende sehr müde. Ich hatte die ganze Woche hart gearbeitet.
1) Peter war traurig. ____________________________________
2) Otto war glücklich. ____________________________________
3) Martin kam zu spät zur Besprechung. ____________________________________
4) Eva verpasste ihr Flugzeug. ____________________________________
5) Bernd sucht den ganzen Vormittag sein ____________________________________
Portemonnaie. ____________________________________
6) Kathrin bekam endlich eine neue Stelle. ____________________________________
7) Anita bestand die Prüfung. ____________________________________
8) Sebastian ärgert sich über sich selbst. ____________________________________
▪ Plusquamperfekt mit Modalverb
Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verben 2
Gestern hatten wir nur schmutzige Arbeiten machen müssen.
Das Schulkind hatte seine Hausaufgaben nicht machen wollen.
Der Mechaniker hatte das Auto nicht reparieren können.
▪ Plusquamperfekt mit Modalverb im Nebensatz
Nebensatz mit Plusquamperfekt Hauptsatz
Konj. Subjekt Mittelfeld Verben
Nachdem wir nur schmutzige Arbeiten hatten machen kündigten wir.
müssen,
Nachdem Hans das Auto nicht hatte reparieren ging er.
können,
Nachdem Tim seine Hausaufgaben hatte machen müssen, ging er zu Bett.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
40
A21 Schreiben Sie die Sätze im Plusquamperfekt.
▪ Ich verließ das Restaurant. (Rechnung / bezahlen)
Ich verließ das Restaurant. Vorher hatte ich die Rechnung bezahlt.
1) Sie trank einen Espresso. (eine Pasta / essen)
__________________________________________________________________
2) Er ging zu Bett. (die Zähne / sich putzen)
__________________________________________________________________
3) Carmen besuchte ihren Onkel. (ihn / anrufen)
__________________________________________________________________
4) Holger ging spät ins Bett. (fernsehen)
__________________________________________________________________
5) Wir kamen ins Hotel. (Stadt / besichtigen)
__________________________________________________________________
6) Du warst vorsichtig. (schlechte Erfahrungen / machen)
__________________________________________________________________
7) Endlich kam der Zug. (ich / lange / warten)
__________________________________________________________________
8) Sie verließ die Wohnung. (alle Fenster / schließen)
__________________________________________________________________
9) Du fuhrst in Urlaub. (mit Olaf / sprechen)
__________________________________________________________________
10) Man informierte die Polizei. (ein Unfall / passieren) !
__________________________________________________________________
11) Ich suchte meine Fahrkarte. (in den Zug / einsteigen) !
__________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
41
A22 Was war hier vorher passiert?
Ordnen Sie die passenden Sätze einander zu.
1) d. 2) 3) 4) 5) 6) 7)
1) Ein junger Mann stand mit einem a. Er war bei einer Zirkusshow
Pyjama bekleidet auf der Straße. weggelaufen.
2) Ein Baum lag über dem Gleis und b. In der letzten Nacht hatte er nur
der Zug musste anhalten. zwei Stunden geschlafen
c. Sie hatte ihre Mutter verloren.
3) Eine Frau führte einen Elefanten
durch die Stadt. d. Er hatte die Zeitung aus dem
Briefkasten geholt und die Tür
4) Ein alter Herr rief die Feuerwehr war hinter ihm zugefallen.
um Hilfe. e. Seine Katze war auf einen hohen
5) Im Café saß ein junger Mann am Baum geklettert und kam alleine
Tisch und schlief. nicht mehr herunter.
6) Aus dem Eingang der Universität lief f. In der Nacht hatte es einen
eine junge Frau. Sie sang und lachte. starken Sturm gegeben.
g. Gerade hatte sie ihre
7) Ein kleines Mädchen stand im Kaufhaus Diplomprüfung bestanden.
und weinte.
A23 Pech gehabt!
Ergänzen Sie die Antworten im Plusquamperfekt.
➢ Warum konntest du dir nichts zu trinken kaufen? (mein Geld zu Hause vergessen)
Weil ich mein Geld zu Hause vergessen hatte.
1) Warum sind Sie auf der Weihnachtsfeier so früh gegangen? (einen Anruf vom Babysitter
bekommen)
Weil ich ___________________________________ und sofort nach Hause fahren musste.
2) Warum hast du bei deinen Nachbarn geschlafen? (meinen Wohnungsschlüssel verlieren)
Weil ich __________________________________________________________________.
3) Warum wollte sie denn nicht ins Kino mitkommen? (mit ihrer Arbeit nicht fertig werden)
Weil sie __________________________________________________________________.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
42
4) Warum bist du nicht an dein Handy gegangen? (es in meiner Handtasche haben / nicht hören)
Weil ich _____________________________ und ich es deshalb ___________________. !
5) Warum warst du nicht auf Annas Party gestern Abend? (nicht einladen)
Weil sie mich ______________________________________________________________.
A24 Ach, deshalb!
Präteritum oder Plusquamperfekt? Bilden Sie Sätze.
➢ Jutta / mit dem Fahrrad / zur Schule (fahren). / Sie / zu spät (aufstehen), deshalb / sie / den
Schulbus (verpassen).
Jutta fuhr mit dem Fahrrad zur Schule. Sie war zu spät aufgestanden, deshalb hatte sie den
Schulbus verpasst.
1) Christoph / die ganze Nacht (tanzen). / Am nächsten Morgen / er / schrecklich müde (sein).
_________________________________________________________________________
2) Ende Dezember / zwei Meter Schnee (liegen), da / es / eine Woche lang / pausenlos
(schneien).
_________________________________________________________________________
3) Die Mutter / die Küche / putzen (müssen), weil / ihre kleine Tochter / einen Kuchen (backen).
_________________________________________________________________________
4) Endlich / Hannes / einen neuen Job (bekommen), nachdem / er / zwanzig Bewerbungen
(schreiben).
_________________________________________________________________________
5) Klara / auf das Abendessen (sich freuen). / Sie / seit dem Frühstück / nichts mehr (essen).
_________________________________________________________________________
6) Anna / stolz / mit ihrem neuen Roller (fahren). / Sie / ihn / zum Geburtstag (bekommen).
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
43
GENITIV
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
44
Der Genitiv stellt den zweiten Fall der vier Fälle der deutschen Grammatik dar und dient der
Besitzanzeige. So muss ein Nomen im Genitiv stehen, wenn ein Besitzverhältnis ausgedrückt
werden soll. Dieses Substantiv antwortet dann auf die Frage „Wessen?“.
Vergleiche den Genitiv in den folgenden Satzbeispielen im Einzelnen:
▪ Erscheinung des Genitivs als Attribut:
➢ „Ich lieh mir das Auto meines Freundes.“
„Tomé prestado el auto de mi amigo."
Frage: „Wessen Auto lieh ich mir?“
Antwort: „Das meines Freundes.“
➢ „Das Dach des Hauses stürzte während des Sturms ein.“
„El techo de la casa se derrumbó durante la tormenta."
Frage: „Wessen Dach stürzte ein?“
Antwort: „Das des Hauses.“
➢ „Es war Peters Idee ins Restaurant zu gehen.“
„Fue idea de Peter ir al restaurante".
Frage: „Wessen Idee war es ins Restaurant zu gehen?“
Antwort: „Es war Peters Idee.“
▪ Auch kommt der Genitiv oft bei Präpositionen vor.
➢ „Es fahren wegen der hohen Benzinpreise immer mehr Leute mit dem Fahrrad zur
Arbeit.“
„Debido a los altos precios de la gasolina, cada vez más personas van en bicicleta al trabajo."
➢ „Angesichts des drohenden Unwetters bauten sie die Zelte wieder ab.“
„Ante la amenaza de tormenta, desmantelaron las tiendas."
Weitere Genitiv-Präpositionen, welche recht häufig gebraucht werden, sind:
während, trotz, aufgrund, innerhalb, außerhalb, mangels, infolge, statt, anhand usw.
Mientras, a pesar de, por algo, dentro de, fuera de, por falta de, a [o por] causa de, en lugar de,
mediante, etc.
▪ Zusätzlich gibt es noch das Genitivobjekt, welches allerdings eher selten verwendet wird und
nur bei bestimmten Verben gebraucht werden kann.
➢ „Der Minister bediente sich des Mikrofons und begann seine Rede.“
„El ministro usó el micrófono y comenzó su discurso."
➢ „Maria ist wieder erschienen; sie erfreut sich bester Gesundheit.“
„María ha reaparecido; ella está bien de salud."
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
45
Weitere Verben, die entsprechend mit Genitivobjekt verwendet werden können:
sich besinnen, gedenken, sich erinnern, bedürfen, ermangeln usw.
Reflexionar, recordar/pensar en, acodarse, necesitar de/requerir de, carecer de etc.
Gegenüberstellung beim Gebrauch Genitiv und Dativ bei „wegen“ und „während“
Als Besonderheit lässt sich in der deutschen Sprache beobachten, dass bei einigen
Präpositionen, insbesondere bei „wegen“ und „während“, der Dativ verwendet wird, obwohl diese
Präpositionen eigentlich den Genitiv verlangen.
➢ „Wegen des Staus kam er nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit.“
„Debido al embotellamiento, no pudo llegar a trabajar a tiempo."
➢ „Während des Telefonats klingelte sein Nachbar an der Tür.“
„Durante la llamada, su vecino tocó el timbre."
Häufig hört man jedoch:
➢ „Wegen dem Stau kam er nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit.“ (→ „dem Stau“ steht im Dativ)
„Debido a los atascos de tráfico, no llegó a trabajar a tiempo." (→ „el atasco de tráfico” está en el dativo)
➢ „Während dem Telefonat klingelte sein Nachbar an der Tür.“ (→ hier ebenfalls mit Dativ)
„Durante la llamada, su vecino tocó el timbre." (→ aquí también con un dativo)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
46
Weitere Erklärungen zum Genitiv Kasus
Das Genitivattribut ist eine Nomen - Nomenkonstruktion (Nomen + Nomen), wobei ein Nomen im
Genitiv steht. Das Nomen im Genitiv (= Genitivattribut) gibt häufig den Besitzer an.
➢ Das ist das Haus meines Vaters.
Esta es la casa de mi padre.
➢ Die Lehrerin korrigiert die Fehler des Kindes.
La maestra corrige los errores del niño.
➢ Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin.
La capital de la República Federal de Alemania es Berlín.
▪ Bei der Konstruktion Nomen + Nomen steht das zweite Nomen im Genitiv.
das Haus meines Vaters /// die Fehler des Kindes, ...
▪ Fast alle maskuline und neutrale Nomen erhalten die Endung -s oder -es.
das Haus meines Vaters /// die Fehler des Kindes, ...
▪ Ausnahmen: Nomen der n-Deklination behalten ihre Form (kein -(e)s).
der Vater des Jungen /// die Frau des Präsidenten, ...
▪ Nomen im Plural sowie alle feminine Nomen bleiben im Genitiv unverändert.
das Auto der Frau, die Haare der Kellnerin, die Mütter der Kinder, ...
▪ Bei Nomen ohne Artikel – häufig im Plural – gebraucht man in der Regel nicht den Genitiv,
sondern die Präposition von + Dat. z. B. Man soll den Versprechen von Politikern nicht immer
glauben.
▪ Nomenbegleiter (Artikel, Possessiv etc.) werden ebenfalls im Genitiv dekliniert.
Die W-Frage im Genitiv lautet Wessen?
➢ Wessen Auto ist das? - Das ist das Auto meiner Freundin.
¿De quién es este coche? - Ese es el auto de mi novia.
➢ Wessen Buch ist das? - Das ist das Buch unserer Lehrerin.
¿De quién es este libro? - Este es el libro de nuestra maestra.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
47
Maskuline und Neutrale Nomen mit -s und -es ¹
Im Genitiv wird ein -s angehängt, wenn
▪ das Nomen mehrere Silben hat und z. B. auf -en, -el, -er, -or, -ling etc. enden.
des Wagens, des Onkels, des Reporters, des Doktors, des Frühlings
▪ Im Genitiv wird ein -es angehängt, wenn das Nomen nur eine Silbe hat.
des Bildes, des Jahres, des Kindes, eines Mannes, meines Sohnes, eines Tages, ...
Ausnahmen: des Chefs, des Films
▪ das Nomen auf -s, -ss, -ß, -sch, -zt, -tz, -x oder -z endet.
des Buches, des Flusses, des Fußes, des Schreibtisches, des Fußballplatzes
▪ das Nomen auf -nis, endet. (s wird verdoppelt!)
des Ereignisses, des Ergebnisses, des Verhältnisses, meines Zeugnisses, ...
¹ Eine Gruppe von maskulinen Substantiven bildet den Genitiv (und auch den Dativ und Akkusativ) mit [e]n » n-Deklination
Eigennamen als Genitivattribut
Wird ein Eigenname (Robert, Christine, Herr Scholz, ...) benutzt, steht der Eigenname im Genitiv
an erster Stelle. Die Eigennamen erhalten ein Genitiv -s:
➢ Das sind Petras Kinder.
Estos son los hijos de Petra.
➢ Stefans Frau ist schon wieder schwanger.
La esposa de Stefan ya está embarazada otra vez.
➢ Frau Meiers Auto ist in der Autowerkstatt.
El auto de la Sra. Meier está en el taller de reparación.
Endet der Eigenname auf -s, -tz, -x oder -z, wird in der Schriftsprache ein Apostroph (`)
angehängt:
➢ Ist das Hans` Auto?
¿Es este el coche de Hans?
➢ Fritz` neue Freundin heißt Heike.
La nueva novia de Fritz es Heike.
➢ Alex` Vater liegt im Krankenhaus.
El padre de Alex está en el hospital.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
48
In der gesprochenen Sprache ist diese Aussprache nicht möglich. Deshalb vermeidet man in der
gesprochenen Sprache das Genitivattribut. Man verwendet die Form „von + Dativ":
➢ Ist das das Auto von Hans?
¿Es ese el carro de Hans?
➢ Die neue Freundin von Fritz heißt Heike.
La nueva novia de Fritz es Heike.
➢ Der Vater von Alex liegt im Krankenhaus.
El padre de Alex está en el hospital.
Artikel, Adjektive und Nomen
Die folgende Übersicht zeigt je ein Beispiel für Nomen und Artikel im Genitiv für maskulin,
feminin, Neutrum und den Plural.
Bestimmter Artikel ¹ Unbestimmter Artikel, kein, ohne Artikel
Possessivartikel (mein...)
maskulin des netten Vaters eines netten Vaters netten Vaters
feminin der netten Mutter einer netten Mutter netter Mutter
Neutrum des netten Kindes eines netten Kindes netten Kindes
Plural der netten Eltern meiner netten Eltern netter Eltern
¹ Nach einigen Pronomen werden Adjektive genauso dekliniert wie nach dem bestimmten Artikel.
Beispiele:
➢ Wem gehört der Koffer? Das ist der Koffer des Gastes.
➢ Wem gehören die Taschen? Das sind die Taschen der Studentin.
➢ Wem gehört das Fahrrad? Das ist das Fahrrad des Mädchens.
➢ Wem gehört das Gepäck? Das ist das Gepäck der Touristen.
➢ Wem gehört die Wohnung? Das ist Julias Wohnung.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
49
A25 Sie kennen doch …
Bilden Sie Sätze im Genitiv wie im Beispiel.
➢ Autor / Roman Sie kennen doch den Autor des Romans.
1) Ende / Geschichte __________________________________________
2) Titel / Buch __________________________________________
3) Adresse / Hotel __________________________________________
4) Methoden / Leute __________________________________________
5) Manager / Klub __________________________________________
6) Chef / Firma __________________________________________
7) Frau / Chef __________________________________________
8) Telefonnummer / Werkstatt __________________________________________
9) Größe / Platz __________________________________________
10) Grund / Streit __________________________________________
11) Farbe / Fisch __________________________________________
12) Anschrift / Paul __________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
50
Pronomen
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen alle Personalpronomen und Possessivpronomen im
Genitiv.
Personalpronomen Possessivpronomen
maskulin + Neutrum feminin Plural
1. Person Singular ich mein meines meiner meiner
2. Person Singular du dein deines deiner deiner
3. Person Singular er, es sein seines seiner seiner
3 Person Singular sie ihr ihres ihrer ihrer
1. Person Plural wir unser unseres unserer unserer
2. Person Plural ihr euer eures euer eurer
3. Person Plural Sie Ihr Ihres Ihrer Ihrer
3. Person Plural sie ihr ihres ihrer ihrer
A26 Stellen Sie eine Frage im Genitiv wie im Beispiel.
➢ Bruder / Kollegin Ist das der Bruder deiner Kollegin?
1) Fahrrad / Freund ___________________________________________________
2) Chef / Bruder ___________________________________________________
3) Haus / Eltern ___________________________________________________
4) Hut / Großvater ___________________________________________________
5) Wohnung / Onkel ___________________________________________________
6) Katze / Tante ___________________________________________________
7) Computer / Chef ___________________________________________________
8) Freund / Schwester ___________________________________________________
9) Wagen / Lehrer ___________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
51
Alternativen zum Genitiv
▪ Nomen + Nomen (Genitivattribut)/W-Frage = Wessen?
➢ Wessen Auto ist das? - Das ist das Auto meines Bruders.
¿De quién es este coche? - Este es el coche de mi hermano.
➢ Wessen Haus ist das? - Das ist das Haus meines Zahnarztes.
¿De quién es esa casa? - Esa es la casa de mi dentista.
➢ Wessen Pass ist das? - Das ist der Pass eines Schülers.
¿De quién es ese pasaporte? - Ese es el pasaporte de un estudiante.
▪ Namen (Genitivattribut) + Nomen/W-Frage = Wessen?
➢ Wessen Auto ist das? - Das ist Peters Auto.
¿De quién es este coche? - Este es el carro de Peter.
➢ Wessen Haus ist das? - Das ist Herr Böckens Haus.
¿De quién es esa casa? - Esa es la casa del señor Böcken.
➢ Wessen Pass ist das? - Das ist Michaels Pass.
¿De quién es ese pasaporte? - Ese es el pasaporte de Michael.
▪ Nomen + von + Nomen (Dativ)/W-Frage = Von wem?
➢ Von wem ist das Auto? - Das Auto ist von meinem Bruder.
¿De quién es el coche? - El coche es de mi hermano.
➢ Von wem ist das Haus? - Das Haus ist von meinem Zahnarzt.
¿De quién es la casa? - La casa es de mi dentista.
➢ Von wem ist der Pass? - Der Pass ist von Michael.
¿De quién es el pasaporte? - El pasaporte es de Michael.
▪ Verb: gehören (+ Dativ)/W-Frage = Wem?
➢ Wem gehört das Auto? - Das Auto gehört Peter.
¿Quién es el dueño del coche? - El coche le pertenece a Peter.
➢ Wem gehört das Haus? - Das Haus gehört meinem Zahnarzt.
¿Quién es el dueño de la casa? - La casa pertenece a mi dentista.
➢ Wem gehört der Pass? - Der Pass gehört einem Schüler.
¿Quién posee el pasaporte? - El pasaporte pertenece a un alumno.
Georgs Regenschirm liegt im Auto
seiner Freundin.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
52
▪ Possessivartikel
➢ Ist das Peters Auto? - Ja, das ist sein Auto.
¿Es este el coche de Peter? - Sí, este es su coche.
➢ Gehört das Haus deinem Zahnarzt? - Ja, das ist sein Haus.
¿La casa le pertenece a tu dentista? - Sí, esa es su casa.
➢ Ist der Pass von Michael? - Ja, das ist sein Pass.
¿Es el pasaporte de Michael? - Sí, ese es su pasaporte.
▪ Nomen + Verb
➢ Wann ist die Abfahrt des Zuges? - Der Zug fährt morgen um 10 Uhr ab.
¿Cuándo es la salida del tren? - El tren sale mañana a las 10 en punto.
➢ Wie lautete Utes Frage? - Ute fragte, wann die Pause endlich beginne.
¿Cuál fue la pregunta de Ute? – Ute preguntó cuando finalmente comienza el descanso.
➢ Wann kommt das Flugzeug an? - Die Ankunft des Flugzeuges ist noch ungewiss.
¿Cuándo llega el avión? - La llegada del avión sigue siendo incierta.
▪ Komposita
➢ Eine Motorschraube ist weg. - Wie bitte? Eine Schraube des Motors fehlt?
Un tornillo del motor se ha ido. – ¿Como por favor? ¿Falta un tornillo del motor?
➢ Wann beginnt die Jagd der Hasen? - Die Hasenjagd beginnt schon morgen.
¿Cuándo comienza la caza de las liebres? - La caza de la liebre empieza mañana.
➢ Warum gefällt dir die Farbe der Wand nicht. - Ich finde die Wandfarbe nicht schön.
¿Por qué no te gusta el color de la pared? - Creo que el color de la pared no es hermoso.
A27 Stellen Sie eine Frage und bilden Sie in Ihrer Antwort den Genitiv.
➢ Haus / meine Tante Wessen Haus ist das? – Das ist das Haus meiner Tante.
1) Hut / meine Schwester _______________________________________________
2) Schlüssel (Sing.) / mein Bruder _______________________________________________
3) Wohnung / unsere Tante _______________________________________________
4) Gepäck / eure Gäste _______________________________________________
5) Spielzeug / seine Tochter _______________________________________________
6) Hund / ihr Großvater _______________________________________________
7) Computer / dein Onkel _______________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
53
PRÄPOSITIONEN MIT GENITIV
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
54
Es gibt sehr viele Präpositionen mit Genitiv, von denen die meisten hauptsächlich in der
Verwaltungssprache benutzt werden. Hier einige Beispiele:
➢ Aufgrund / Wegen des schlechten Wetters bleibt er zu Hause.
Debido al mal tiempo, se queda en casa.
➢ Trotz der Kälte geht sie ohne Mantel aus dem Haus.
A pesar del frío, sale de casa sin abrigo.
➢ Sie fährt während der Sommerferien immer ans Meer.
Siempre va al mar durante las vacaciones de verano.
➢ Der Kellner brachte mir (an)statt eines Weißweins ein Pils.
El mesero me trajo una cerveza en lugar de vino blanco.
A28 Setzen Sie die Wörter und Präpositionen richtig ein.
➢ der Nebel Trotz des Nebels fährt er ziemlich schnell.
1) der Streik __________________ fahren keine Busse.
2) mein Urlaub __________________ war ich drei Wochen in den USA.
3) ein Brief __________________ schickt sie mir nur eine kurze E-Mail
4) seine Schmerzen __________________ geht er nicht zum Zahnarzt.
5) seine Diät __________________ isst er jeden Tag nur einen Apfel.
6) alle Probleme __________________ können wir die Arbeit rechtzeitig beenden.
7) die Kälte __________________ muss ich eine dicke Jacke anziehen.
8) ein Mittagessen __________________ isst sie nur ein Stückchen Schokolade.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
55
Die gebräuchlichsten Präpositionen können nach ihrem Gebrauch wie folgt unterteilt werden:
▪ Temporale Angaben
➢ Außerhalb der Sprechstunden wenden Sie sich bitte an den Notdienst.
Fuera del horario de oficina, por favor, póngase en contacto con los servicios de emergencia.
➢ Die Rechnung ist binnen der nächsten 10 Tage zu begleichen.
La factura debe estar pagada dentro de los próximos 10 días.
➢ Die Kinder waren während der Sommerferien bei ihren Großeltern auf dem Land.
Los niños estaban en el país con sus abuelos durante las vacaciones de verano.
➢ Viele Hausfrauen arbeiten zeit ihres Lebens für ihre Familien.
Muchas amas de casa trabajan para sus familias toda su vida.
▪ Lokale Angaben
➢ Abseits der Großstädte kann man eine wunderschöne Landschaft kennenlernen.
Lejos de las grandes ciudades podrás conocer un hermoso paisaje.
➢ Der Schiedsrichter sah das Foulspiel außerhalb des Strafraums und gab daher keinen
Elfmeter.
El árbitro vio la falta fuera del área y por lo tanto marcó un penal.
➢ Die Zuschauer sahen das Foulspiel innerhalb des Strafraums und pfiffen den
Schiedsrichter aus.
La multitud vio la falta dentro del área y silbó al árbitro.
➢ Jenseits der Gebirgskette beginnt die Sandwüste.
Más allá de la cordillera comienza el desierto.
➢ Oberhalb der Stadt steht eine alte Ruine aus dem Mittelalter.
Por encima de la ciudad se encuentra una antigua ruina de la Edad Media.
➢ Etwas unterhalb des Dorfes gibt es einen sehr schönen Mischwald.
Justo debajo del pueblo hay un bosque mixto muy hermoso.
▪ Kausale Angaben
➢ Aufgrund mehrerer ihm nachgewiesenen Diebstählen erhielt der Mitarbeiter die
fristlose Kündigung.
Debido a varios robos que se le han demostrado, al empleado se le otorgó la terminación sin previo
aviso.
➢ Infolge Trunkenheit am Steuer gab es im Beobachtungszeitraum erneut mehrere
Verkehrsunfälle mit Todesfolge.
Como resultado de la conducción en estado de ebriedad, hubo nuevamente varios accidentes de
tránsito durante el período de observación.
➢ Kraft meines Amtes erkläre ich hiermit Herrn Müller zu meinem Stellvertreter.
En virtud de mi competencia, declaro al Sr. Müller mi sustituto.
➢ Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren mangels Beweisen ein.
La fiscalía cierra el caso por falta de pruebas.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
56
➢ Gegen den Vorgesetzten wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt.
Contra el jefe se le determina bajo sospecha de asalto.
▪ Konzessive Angaben
➢ Trotz der roten Zahlen blickt das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft.
A pesar de los números rojos, la compañía mira con confianza hacia el futuro.
➢ Ungeachtet der aufkommenden Proteste will das Unternehmen ca. 10.000 Stellen
auslagern.
A pesar de las próximas protestas, la compañía quiere subcontratar cerca de 10,000 empleos.
▪ Alternative Angaben
➢ Anstatt einer Haftstrafe erhielt der Angeklagte eine empfindliche Geldstrafe.
En lugar de una sentencia de prisión, el acusado recibió una multa severa.
➢ Anstelle des Krimis wird heute Abend eine Komödie mit Bastian Pastewka gezeigt.
En lugar del thriller, esta noche se presentará una comedia con Bastian Pastewka.
➢ Statt einer kostenintensiven Renovierung wird ein kompletter Neubau vorgezogen.
En lugar de una renovación costosa, se prefiere una nueva construcción completa.
Zu den Präpositionen, die den Genitiv verlangen, gehören:
- abzüglich - aufgrund - kraft - seitens - zufolge
- angesichts - außerhalb - längs - trotz - zugunsten
- anlässlich - dank - mangels - ungeachtet - zwecks
- an(statt) - infolge - mithilfe - während - zuzüglich
- anstelle - innerhalb - mittels - wegen
Weniger häufig verwendete Genitivpräpositionen sind:
- abseits - diesseits - inklusive - südlich
- anhand - einschließlich - inmitten - unterhalb
- ausschließlich - exklusive - jenseits - vorbehaltlich
- beiderseits - fern - nördlich - westlich
- bezüglich - halber - oberhalb
- binnen - hinsichtlich - östlich
Viele dieser Präpositionen nutzen nicht immer den Genitiv bzw. kann man den Genitiv umgehen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
57
A29 Ergänzen Sie die Sätze mit den richtigen Präpositionen und den korrekt deklinierten
Artikeln und Nomen!
während (2x) inklusive (2x) trotz (2x) statt (2x) wegen
innerhalb (2x) exklusive wegen außerhalb
➢ Ich konnte wegen meiner Migräne (meine Migräne) kaum arbeiten.
1) Die Mannschaft ist ____________________ (der Sieg) aus der Bundesliga abgestiegen.
2) Ich bin __________________________ (meine Kopfschmerzen) zu Karins Party gegangen.
3) Hans nimmt _____________________________ (sein Kollege) am Kurs teil.
4) Das Konzert fand __________________________ (die Erkrankung) des Sängers nicht statt.
5) Unser Geschäft ist _____________________________ (die Öffnungszeiten) geschlossen.
6) Die Miete ist ohne Nebenkosten. Das bedeutet, dass die Miete _______________________
(die Nebenkosten) angegeben ist.
7) Das Museum ist _____________________________ (die Ferien) geschlossen.
8) Man darf _____________________________ (das Dorf) maximal 50 km/h fahren.
9) Carla nimmt _____________________________ (der Zug) lieber den Bus.
10) Ich habe das Bett ___________________________ (die Matratze) für nur 150 Euro gekauft.
11) Sie haben _____________________________ (die Arbeitszeit) zu oft im Internet gesurft.
12) Die Rechnung muss ___________________________ (dieser Monat) noch bezahlt werden.
13) Die Mehrwertsteuer ist schon im Preis enthalten. Die Preise sind also __________________
(die Mehrwertsteuer).
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
58
A30 Wie haben sich diese Menschen kennengelernt?
Bilden Sie Sätze mit während.
➢ Helen und Robert – ein Urlaub
Helen und Robert haben sich während eines Urlaubs kennengelernt.
1) Matthias und Katja – der Polnischkurs
_________________________________________________________________________
2) Gabi und Friedrich – eine Dienstreise nach Afrika
_________________________________________________________________________
3) Thea und Kasper – die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland
_________________________________________________________________________
4) Tanja und Markus – das Studium
_________________________________________________________________________
A31 Wie kann man …?
Bilden Sie Sätze mit mithilfe.
➢ Wie kann man sich über Aktualitäten informieren? (die Medien)
Man kann sich mithilfe der Medien über Aktualitäten informieren.
1) Wie kann man effizient eine Fremdsprache lernen? (ein kompetenter Lehrer, ein Lehrbuch,
das Internet)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) Wie kann man Stress abbauen? (ein guter Therapeut, kurze Entspannungsübungen)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) Wie findet man schnell eine Straße in einer fremden Stadt? (ein Navigationssystem, ein
Stadtplan)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
59
A32 Ergänzen Sie die Präpositionen mit dem Genitiv.
trotz (2x) mithilfe wegen (2x) innerhalb außerhalb (2x) laut (2x)
statt während (2x) innerhalb (2x)
➢ Sie erreichen uns nur innerhalb der Geschäftszeiten von 9 Uhr bis 17 Uhr.
1) Wir liefern ____________ einer Woche.
2) ____________ des Winterurlaubs hat es kein einziges Mal geschneit!
3) ____________ des schlechten Wetters sind wir drei Wochen in Österreich geblieben.
4) ____________ ihrer guten Leistungen im Unterricht bekam Uta in der Mathematikarbeit nur
eine fünf.
5) ____________ der deutschen Botschaft bekam der Journalist sehr schnell ein Visum.
6) ____________ eines Berichtes der F.A.Z. plant die Regierung eine Steuererhöhung.
7) ____________ des Termindrucks fühlen sich viele Mitarbeiter gestresst.
8) ____________ der Stadt sind die Straßen nachts nicht beleuchtet.
9) ____________ der Arbeitszeit darf man in einigen Betrieben nicht privat im Internet surfen.
10) ____________ einer Studie können Frauen schlechter mit Stress umgehen als Männer.
11) ____________ Diamanten wünschen sich viele Frauen zum Valentinstag einen Kuss.
12) Die Mitarbeiter dürfen nur ____________ des Gebäudes rauchen.
13) ____________ des Gebäudes gilt ein generelles Rauchverbot.
14) ____________ des starken Regens waren einige Straßen unbefahrbar.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
60
A33 Präpositionen sind keine Glückssache!
Ergänzen Sie die Präpositionen.
vor (2x) beim (2x) ohne für an zufolge auf
GUTE ZAHLEN, SCHLECHTE ZAHLEN
Woche 1 __________ Woche suchen Millionen von Menschen ihr Glück 2 __________ Lottospiel.
3 _____________ Ausfüllen der Lottoscheine spielt oft der Glaube 4 ______________ persönliche
Glückszahlen eine große Rolle, z. B. Geburtstage oder Hochzeitsdaten.
Darüber hinaus gibt es Zahlen, die traditionell bestimmte Assoziationen hervorrufen, zum Beispiel
die berühmte 13. Einer Umfrage 5 __________________ fürchten sich 28 Prozent der Deutschen
6 ____________ dieser Zahl. Aber nicht nur die Deutschen meiden diese „Unglückszahl“: Weltweit
werden viele Hochhäuser 7 ____________ 13. Stock gebaut, Fluglinien haben keine 13. Sitzreihe,
in manchem Straßen gibt es keine Hausnummer 13. Die Angst 8 ____________ der 13 hat sogar
einen Namen: „Triskaidekaphobie“.
Auch andere Zahlen haben ihren Ruf. Die Sieben kann je nach Betrachtungsweise Glück oder
Pech bringen. Man sagt, dass 9 ____________ sieben gute Jahre sieben schlechte Jahre folgen.
Zerbricht ein Spiegel, so folgen sieben schlechte Jahre. Auch gibt es die sieben Weltwunder oder
Zaubersprüche, die siebenmal wiederholt werden müssen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
61
DIE N-DEKLINATION
A34 Lesen Sie die folgenden Sätze.
Analysieren Sie. In welchem Kasus steht Herr?
Das ist Herr Schulze, unser Abteilungsleiter. Nominativ
Ist das die Tasche des jungen Herrn? __________________
Ich gehe heute Abend mit Herrn Klein essen. __________________
Ich möchte gern Herrn Schulze sprechen. __________________
Zu der Gruppe der n-Deklination gehören nur maskuline Nomen! Nomen der n-Deklination, auch
schwache Nomen genannt, erhalten im Genitiv, Dativ und Akkusativ die Endung -n bzw. -en.
Dies betrifft:
▪ maskuline Nomen auf –e
➢ der Junge – dem Jungen
1. Können Sie mir bitte den Namen des Zeugen buchstabieren?
¿Podría por favor deletrear el nombre del testigo?
2. Können Sie mir bitte die Namen der Zeugen buchstabieren?
3. Das Mädchen hat mit dem Jungen aus der Nachbarschaft getanzt.
La niña bailó con el niño del barrio.
4. Das Mädchen hat mit den Jungen aus der Nachbarschaft getanzt.
Die Nomen „der Junge, der Name und der Zeuge" sind schwache Nomen.
Nomen, die zur n-Deklinationsgruppe gehören, erhalten im Singular Akkusativ, Dativ und
Genitiv ein zusätzliches „-n".
In den Beispielen unter den Ziffern 1 und 3 stehen die Nomen im Singular. Dies kann man
aber nur am Artikel erkennen.
(1) den Namen = Akkusativ maskulin Singular
(1) des Zeugen = Genitiv maskulin Singular
(3) dem Jungen = Dativ maskulin Singular
In den Beispielen unter den Ziffern 2 und 4 stehen die Nomen im Plural. Dies kann man
aber nur am Artikel erkennen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
62
n-Deklination und Pluralbildung ist beim Nomen identisch.
(2) die Namen = Akkusativ Plural
(2) der Zeugen = Genitiv Plural
(4) den Jungen = Dativ Plural
▪ maskuline Nomen auf –ent
➢ der Assistent – dem Assistenten
▪ einige weitere maskuline Personenbezeichnungen
➢ der Herr – dem Herrn
➢ der Mensch – dem Menschen
▪ Auch Nomen, die im Plural nicht auf -s oder -n enden, bekommen im Dativ Plural ein -n.
➢ die Kinder – den Kindern
➢ die Löffel – den Löffeln
Nur der deklinierte Artikel lässt eine Unterscheidung zwischen n-Deklination im Singular und
Plural zu!
Nur maskuline Nomen gehören zur n-Deklination! ¹
¹ Ausnahme: das Herz – des Herzens, dem Herzen – das Herz – (Pl.) die Herzen
Wie erkennt man Nomen der n-Deklination?
Die Zahl der Nomen, die zur Gruppe der n-Deklination gehören, ist relativ klein.
Schwache Nomen
▪ sind immer maskulin
▪ enden immer auf -e. Zu dieser Gruppe gehören vor allem:
der Buchstabe, der Gedanke, der Name (diese 3 Nomen im Genitiv + -s = Namens) und …
Nationalitäten
der Afghane, der Baske, der Brite, der Bulgare, der Chinese, der Däne, der Franzose, der
Grieche, der Ire, der Jude, der Jugoslawe, der Kroate, der Kurde, der Mongole, der Pole, der
Russe, der Schotte, der Türke, der Ungar.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
63
Personen
der Angsthase, der Bote, der Bube, der Bursche, der Erbe, der Experte, der Gatte, der Heide,
der Insasse, der Junge, der Junggeselle, der Knabe, der Kollege, der Kommilitone, der
Komplize, der Kunde, der Laie, der Neffe, der Riese, der Sklave, der Zeuge.
Tiere
der Affe, der Bär, der Bulle, der Coyote, der Drache, der Hase, der Falke, der Fink, der Löwe,
der Ochse, der Rabe, der Schimpanse.
Nomen die enden auf …
-and, -ant, -ent (meist Personen) n-Deklination + -en = den Studenten
der Absolvent, der Agent, der Assistent, der Astronaut, der Demonstrant, der Diamant, der
Dirigent, der Doktorand, der Elefant, der Emigrant, der Konsonant, der Konsument, der
Lieferant, der Musikant, der Student, der Präsident, der Produzent.
-oge, -ad, -at (meist Berufsbezeichnungen) n-Deklination + -en
der Automat, der Biologe, der Bürokrat, der Diplomat, der Gynäkologe, der Kamerad, der
Kandidat, der Pädagoge, der Soldat, der Soziologe.
-ist (Personen, Berufe) n-Deklination + -en
der Autist, der Christ, der Egoist, der Idealist, der Journalist, der Kapitalist, der Kommunist,
der Polizist, der Sozialist, der Spezialist, der Terrorist, der Tourist
… und folgende Ausnahmen (meist Personen oder Berufsbezeichnungen) n-Deklination +
-en
der Architekt, der Bauer (+ -n), der Chaot, der Depp, das Herz (des Herzens), der Held, der
Favorit, der Fotograf, der Graf, der Herr (+ -n), der Idiot, der Mensch, der Nachbar (+ -n), der
Narr, der Pilot, der Prinz.
“Du bist ein Depp!”
- “Ich zeige dich wegen Beleidigung an!“
- “Okay, okay, du bist ein Idiot!“
- “Na also, geht doch!“
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
64
Zusammenfassung
➢ Der Kunde fragt den Verkäufer.
➢ Der Verkäufer berät den Kunden.
der Verkäufer die Verkäufer der Kunde die Kunden
den Verkäufer die Verkäufer den Kunden die Kunden
dem Verkäufer den Verkäufern dem Kunden den Kunden
des Verkäufers der Verkäufer des Kunden der Kunden
Singular Akkusativ / Dativ / Genitiv und Plural -n: der Nachbar, der Bauer, der Ungar
Singular Akkusativ / Dativ / Genitiv -n; Plural -en: der Herr, des Herrn, die Herren
A35 Ergänzen Sie Herr, Kollege und Kunde.
➢ Das ist ein Brief für Herrn Schimmel. (Herr)
1) Kennst du den neuen __________________ schon? (Kollege)
2) Wie findest du den __________________ aus der Verwaltung? (Kollege)
3) Sie sollten mit dem __________________ nicht über private Probleme sprechen (Kunde)
4) Dort hintern am letzten Tisch sitzt der __________________. (Kunde)
5) Hast du schon mit __________________ Schumacher gesprochen? (Herr)
6) __________________ Schumacher, wer ist das? (Herr)
7) Der neue __________________ kommt heute um 15:00 Uhr. (Kunde)
8) Wann hast du mit dem __________________ den Termin vereinbart? (Kunde)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
65
A36 Kennen Sie …?
Üben Sie die Nomen. Bilden Sie Fragen wie im Beispiel.
➢ der Kollege Kennen Sie den Kollegen? Welchen Kollegen meinen Sie?
1) der Zeuge _______________________ _____________________________
2) der Patient _______________________ _____________________________
3) der Franzose _______________________ _____________________________
4) der Kunde _______________________ _____________________________
5) der Polizist _______________________ _____________________________
6) der Junge _______________________ _____________________________
7) der Fotograf _______________________ _____________________________
8) der Herr _______________________ _____________________________
9) der Architekt _______________________ _____________________________
10) der Journalist _______________________ _____________________________
A37 Schreiben Sie Sätze im Perfekt wie im Beispiel.
➢ Martin / sein Neffe / gratulieren Martin hat seinem Neffen gratuliert.
1) Julia / der Junge / helfen ____________________________________
2) Ich / mein Nachbar / einladen ____________________________________
3) Claudia / der Postbote / sich ärgern über ____________________________________
4) Du / ein Spezialist / fragen ____________________________________
5) Eva / der Kollege / warten auf ____________________________________
6) Du / ein Journalist / sprechen mit ____________________________________
7) Er / der Kaffeeautomat / reparieren ____________________________________
8) Carmen / der Tourist / antworten ____________________________________
9) Tanja / ein Graf / heiraten ____________________________________
10) Die Kamera / der Fotograf / gehören ____________________________________
11) Der Tourist / der Elefant / fotografieren ____________________________________
12) Robert / ein Psychologe / gehen zu ! ____________________________________
13) Thomas / der Architekt / telefonieren mit ____________________________________
14) Max / ein Ring / mit / ein Diamant / kaufen ____________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
66
A38 Ergänzen Sie die Sätze!
Name Student Kollege Patient Kunde Teddybär Automat
➢ Ich glaube, dieser Rucksack gehört dem Studenten.
1) Tamara fährt immer mit ein______ ___________________ zur Arbeit.
2) Ich schenke meiner kleinen Nichte ein______ ___________________ zum Geburtstag.
3) Der Verkäufer hat d______ ___________________ bedient.
4) Ich mag keinen Kaffee aus d______ ___________________.
5) Der Fremde wollte sein______ ___________________ nicht nennen.
6) Der Arzt hat d______ ___________________ untersucht.
A39 Ergänzen Sie die Nomen in der richtigen Form.
Achtung! Nicht alle Nomen werden auf n-Dekliniert.
➢ Der Verkehrspolizist hat einen Strafzettel geschrieben. (Verkehrspolizist)
1) Die Gespräche mit dem ______________ fanden in freundlicher Atmosphäre statt. (Präsident)
2) Habt ihr Ärger mit dem ______________? (Lieferant)
3) Frau Schön hat schon wieder einen neunen ______________. (Mann)
4) Bei der Pressekonferenz waren viele ______________ anwesend. (Journalist)
5) Das ist der Bau eines berühmten ______________. (Architekt)
6) Sie ist mit einem ______________ verheiratet. (Diplomat)
7) Ich möchte ins Elisabeth-Krankenhaus. Dort kenne ich den ______________ gut. (Chefarzt)
8) Was ist die E-Mail-Adresse des neuen ______________? (Student)
9) Er ist der ______________ meines ______________. (Neffe, Freund)
10) Sprechen Sie mit Ihrem ______________. (Nachbar)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
67
A40 Post von Ihrem Freund Michael
Berlin, 4 Juli …
Liebe(r) …,
heute habe ich endlich Zeit, Dir einen Brief zu schreiben. Seit drei Wochen habe ich eine neue
Stelle bei der Firma Okasio in Berlin. Ich arbeite im Moment an einem Projekt für ein neues
Verkehrssystem. Natürlich muss ich mich erst mal ein bisschen einarbeiten. Ich habe flexible
Arbeitszeiten und nette Kollegen, das ist gut. Mein Gehalt ist nicht so hoch, das empfinde ich als
Nachteil. Aber die Arbeit macht mir bis jetzt sehr viel Spaß. Ich habe mein eigenes Büro und einen
ganz modernen Computer. Gestern habe ich an meinem ersten Geschäftsessen teilgenommen.
Ich musste einen Anzug und eine Krawatte tragen! Das Essen war sehr anstrengend. Ich wusste
gar nicht, worüber ich mit den Kunden reden sollte.
Du suchst doch auch eine neue Stelle. Hast Du schon etwas gefunden? Schreib mir mal.
Viele Grüße
Michael
Antworten Sie Ihrem Freund.
Sie haben auch eine neue Stelle gefunden. Schreiben Sie in Ihrem Brief zu allen Punkten etwas:
Ihre Tätigkeiten, Ihre Arbeitszeit, Ihr Gehalt, Ihr Arbeitsplatz, Ihre Kollegen. Vergessen Sie Datum
und Anrede nicht. Schreiben Sie auch eine kurze Einleitung und einen passenden Schluss.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
68
DER KONJUNKTIV II
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
69
Der Indikativ bezeichnet eine wirkliche, eine reale Welt, die man sehen, tasten, riechen,
schmecken oder hören kann. Diese Welt kann stattfinden:
Indikativ Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2
in der Gegenwart Der Lehrer erklärt den Schülern den Konjunktiv II.
in der Vergangenheit Der Lehrer erklärte den Schülern den Konjunktiv II.
in der Zukunft Der Lehrer wird den Schülern den Konjunktiv II erklären.
im Passiv Den Schülern wird der Konjunktiv II erklärt.
Mit dem Konjunktiv II verlassen wir die reale Welt und widmen uns der irrealen Welt. Die irreale
Welt ist das Reich der Fantasien, der Vorstellungen, der Wünsche, der Träume, der irrealen
Bedingungen und Vergleiche, aber auch der Höflichkeit. Diese gedachten, angenommenen oder
möglichen Sachverhalte, die nicht real sind und nicht existieren, werden mit dem Konjunktiv II
gebildet.
Indikativ = reale Welt Konjunktiv II = Traumwelt, nicht real
Verb 1 Subjekt Mittelfeld Verb 2
Ich bin immer allein. Wäre ich doch nicht immer alleine.
Ich habe keine Freunde. Hätte ich doch nur ein paar Freunde.
Ich wohne in einer Holzhütte. Würde ich doch nur in einem Palast wohnen.
Ich kann nicht in Urlaub fahren. könnte ich doch bloß in Urlaub fahren.
Ich gewinne nicht im Lotto. Würde ich doch endlich im Lotto gewinnen.
In den Beispielen sieht die reale Welt wirklich sehr trist aus. Die Wunschwelt im Konjunktiv II
dagegen ist rosig. Die Wunschwelt zeigt das Gegenteil der tristesten realen Welt, bleibt aber
wahrscheinlich ein Traum und somit irreal.
Wir benutzen den Konjunktiv II für eine sehr höfliche Bitte:
➢ Würdest du mir bitte deinen Radiergummi geben? ¿Podrías darme tu goma?
➢ Dürfte ich kurz mit Ihnen sprechen? ¿Podrías hablar con usted en breve?
➢ Hätten Sie etwas Zeit für mich? ¿Tendrías algún tiempo para mí?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
70
1. Die Bildung des Konjunktivs II mit den Verbformen
Alle Verben bilden auch eine eigene Konjunktiv II-Form, die ohne das Hilfsverb würden gebildet
wird. Bei den regelmäßigen Verben ist allerdings der Konjunktiv II mit dem Indikativ Präteritum
identisch, da diese Verben keinen Umlaut bilden können. Aus diesem Grund wird bei den meisten
Verben der Konjunktiv II mit dem Hilfsverb werden gebildet. Nur bei wenigen Verben benutzt man
die eigene Konjunktiv II-Form. Die Bildung bleibt wie beim Verb werden gleich:
Präteritumform + Umlaut
Zu den wenigen Verben, die immer den Konjunktiv II in der Originalform verwenden, gehören:
▪ alle Hilfsverben, Modalverben sowie einige unregelmäßige Verben, die häufig benutzt
werden.
Infinitiv Präteritum Konj. II ich du wir ihr
er / sie / es Sie / sie
sein waren wären wäre wär(e)st wären wär(e)t
haben hatten hätten hätte hättest hätten hättet
werden wurden würden würde würdest würden würdet
finden fanden fänden fände fändest fänden fändet
gehen gingen gingen ginge gingest gingen ginget
kommen kamen kämen käme kämest kämen käm(e)t
lassen ließen ließen ließe ließest ließen ließet
schlafen schliefen schliefen schliefe schliefest schliefen schlief(e)t
wissen wussten wüssten wüsste wüsste wüssten wüsstet
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
71
▪ die Modalverben
Infinitiv Präteritum Konj. II ich du wir ihr
er / sie / es Sie / sie
dürfen durften dürften dürfte dürftest dürften dürftet
können konnten könnten könnte könntest könnten könntet
mögen mochten möchten möchte möchtest möchten möchtet
müssen mussten müssten müsste müsstest müssten müsstet
sollen sollten¹ sollten¹ sollte solltest sollten solltet
wollen wollten¹ wollten¹ wollte wolltest wollten wolltet
¹ „Wollen“ und „sollen“ bilden im Konjunktiv II keinen Umlaut!!!
Was man über den Konjunktiv der Höflichkeit wissen sollte.
Überall dort, wo Fremde auf Fremde treffen, wie zum Beispiel:
▪ im Restaurant
▪ in der Kneipe
▪ beim Einkaufen
▪ im Geschäft
▪ auf der Straße
▪ auf der Bank
▪ auf der Post
▪ am Bahnhof
▪ unter Arbeitskollegen ...
gibt es bestimmte Höflichkeitsregeln, die man beachten sollte,
▪ um höflich mit anderen in Kontakt zu treten,
▪ um höflich etwas zu fragen,
▪ um höflich eine Bitte zu formulieren,
▪ um höflich um einen Gefallen zu bitten oder
▪ um höflich eine Auskunft zu erfragen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
72
In all den genannten Situationen findet der Konjunktiv II der Höflichkeit seine Anwendung. Dies
sind also Orte oder Situationen, wo man sich formell gegenübertritt und sich „siezt". Allerdings
hindert Sie niemand daran, auch mit Freunden oder Familienmitgliedern besonders höflich
umzugehen. Selbstverständlich gilt es auch, die Höflichkeit durch Intonation, Gestik und Mimik
abzurunden. Es ist einfach eine Frage der persönlichen Etikette, wie man sich selbst verkaufen
möchte.
Der Konjunktiv II, die Modalverben sowie das Wort bitte machen jede Frage/Bitte höflicher.
Funktion Beispiele
ohne Verb 3 Bier!
sehr unhöflich
Imperativ Bringen Sie 3 Bier!
unhöflich
Partikel (vielleicht, mal, gern, …) Bringen Sie uns doch noch 3 Bier.
ein bisschen freundlicher Bringen Sie uns bitte noch 3 Bier.
Konjunktiv II + Frage Würden Sie uns bitte noch 3 Bier bringen?
viel freundlicher Wir hätten noch gerne 3 Bier.
Konjunktiv II + Modalverb Dürfte ich Sie bitten, uns noch 3 Bier zu bringen?
sehr freundlich Könnten Sie uns bitte noch 3 weitere Bier bringen?
Wären Sie so freundlich und könnten uns noch 3 Bier
bringen?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
73
2. Die Bildung des Konjunktivs II mit würde + Infinitiv
In den meisten Fällen wird das Hilfsverb werden benutzt, um den Konjunktiv II zu bilden.
Werden muss aber verändert werden, damit es den Konjunktiv II anzeigt.
Die Form des Konjunktiv II wird vom Präteritum abgeleitet: werden = wurden.
Die Präteritumsform wurden erhält einen Umlaut würden.
würden + Infinitiv
Singular würden Plural
1. Person ich würde wir würden 1. Person
2. Person du würdest ihr würdet 2. Person
3. Person er / sie / es würde Sie / sie würden 3. Person
Position 1 Verb 1 Mittelfeld Verb 2
Indikativ Eva kauft teure Schuhe.
Konjunktiv II Ihr Mann würde die teuren Schuhe nicht kaufen.
Indikativ Susanne fährt ohne Geld in Urlaub.
Konjunktiv II Ihre Freundin würde nicht ohne Geld in Urlaub fahren.
Indikativ Der Angestellte kommt jeden Tag zu spät zur Arbeit.
Konjunktiv II Seine Kollegen würden nicht zu spät zur Arbeit kommen.
Der Konjunktiv II bildet eine gegenteilige Meinung zum Indikativ. Daher muss einer der beiden
Sätze verneint werden.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
74
A41 Sagen Sie es höflicher.
Bilden Sie Sätze mit würde + Infinitiv.
➢ Mach das Fenster auf!
Würdest du das Fenster aufmachen?
1) Gib mir mal eine Kopfschmerztablette!
_________________________________________________________________________
2) Fahr mich bitte nach Hause!
_________________________________________________________________________
3) Holen Sie die Gäste vom Flughafen ab?
_________________________________________________________________________
4) Bezahlen Sie die Rechnung bitte sofort!
_________________________________________________________________________
5) Kommen Sie heute Nachmittag bitte in mein Büro!
_________________________________________________________________________
6) Buchen Sie für mich einen Flug nach Athen!
_________________________________________________________________________
7) Raucht hier bitte nicht!
_________________________________________________________________________
8) Reservieren Sie bitte für das Geschäftsessen einen Tisch für sechs Personen!
_________________________________________________________________________
A42 Sagen Sie es höflicher.
Verwenden Sie den Konjunktiv II.
➢ Passt es Ihnen nächste Woche?
Würde es Ihnen nächste Woche passen?
1) Haben Sie etwas Zeit für mich?
_________________________________________________________________________
2) Wie ist es, wenn wir heute zusammen essen gehen?
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
75
3) Ich habe mal eine Bitte.
_________________________________________________________________________
4) Kannst du mir ein Brötchen aus der Kantine mitbringen?
_________________________________________________________________________
5) Frau Meier, öffnen Sie bitte das Fenster.
_________________________________________________________________________
6) Leihst du mir mal deinen Kugelschreiber?
_________________________________________________________________________
7) Kannst du das für mich kopieren?
_________________________________________________________________________
8) Hilfst du mir mal?
_________________________________________________________________________
9) Ist es möglich, dass wir den Termin verschieben.
_________________________________________________________________________
A43 Formulieren Sie höfliche Bitten.
➢ Ich hätte gern einen Kaffee. Mit Milch oder Zucker?
1) _______________________________ Ja, natürlich! Das Telefon steht gleich hier links.
2) _______________________________ Ich habe leider in meinem Büro kein Faxgerät,
3) _______________________________ Nein, das geht nicht. Ich muss heute länger arbeiten.
4) _______________________________ Nein, an Mittwoch habe ich leider keine Zeit.
5) _______________________________ Ja, ich schicke Ihnen das Angebot sofort.
6) _______________________________ Nein, tut mir leid, Kaffee muss ich erst kochen.
7) _______________________________ Nein, ich habe letzte Woche schon das Protokoll
geschrieben.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
76
A44 Jemand höflich bitten
Sie fahren in den Urlaub. Ein Freund von Ihnen will während dieser Zeit in Ihrer Wohnung wohnen.
Leider sehen Sie diesen Freund vor Ihrer Abfahrt nicht mehr. Sie hinterlassen also Ihren
Wohnungsschlüssel und einen Brief an Ihren Freund beim Nachbarn.
Formulieren Sie diesen Brief und erklären Sie Ihrem Freund, was er in der Wohnung darf
(rauchen?), was er nicht darf (laut Musik hören?), was er unbedingt tun muss (die Katze füttern?)
und was er nicht zu tun braucht (Geschirr abwaschen?).
Die höfliche Bitte im Konjunktiv II (Wiederholung)
„normale“ Frage/Bitte/Aussage höfliche Frage/Bitte/Aussage
➢ Haben Sie morgen Zeit? Hätten Sie morgen Zeit?
➢ Der Montag ist gut. Der Montag wäre gut.
➢ Kann ich hier mal telefonieren? Könnte ich hier mal telefonieren?
➢ Machen Sie bitte das Fenster zu. Würden Sie bitte das Fenster zumachen?
Konjunktiv II in der Vergangenheit
Es gibt nur eine Vergangenheit im Konjunktiv II gegenüber den drei Vergangenheitsformen im
Indikativ. Als Basis dient die Perfektform: haben/sein + Partizip II, wobei die Hilfsverben die
Konjunktiv II-Formen hätten bzw. wären erhalten.
wären/hätten + Partizip II
Position 2 Verb 1 Mittelfeld Verb 2
Perfekt Die Frau ist immer zu spät gekommen.
Präteritum Die Frau kam immer zu spät.
Plusquamperfekt Die Frau war immer zu spät gekommen.
Konj. II der Verg. Die Frau wäre nicht zu spät gekommen.
Perfekt Der Mann hat kein neues Auto gekauft.
Präteritum Der Mann kaufte kein neues Auto.
Plusquamperfekt Der Mann hatte kein neues Auto gekauft.
Konj. II der Verg. Der Mann hätte ein neues Auto gekauft.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
77
A45 Hätten wir nur alles anders gemacht!
Bilden Sie Sätze mit dem Konjunktiv II in der Vergangenheit wie im Beispiel.
➢ Ich habe kein Geld mehr.
(etwas Geld sparen) Hätte ich doch etwas Geld gespart!
➢ Was, du hattest einen Unfall?
(vorsichtiger fahren) Wärst du doch vorsichtiger gefahren!
1) Wir stehen im Stau.
(mit dem Zug fahren) ____________________________________
2) Ich habe kein Geschenk.
(Blumen kaufen) ____________________________________
3) Alexander muss 200 Euro Strafe zahlen.
(langsamer fahren) ____________________________________
4) Ich bin gestresst.
(Urlaub machen) ____________________________________
5) Das Essen schmeckt schrecklich.
(selbst kochen) ____________________________________
6) Es regnet in Strömen.
(einen Regenschirm mitnehmen) ____________________________________
7) Ich weiß nicht, was passiert ist.
(Zeitung lesen) ____________________________________
8) Ich bin umsonst hierhergekommen.
(vorher einen Termin vereinbaren) ____________________________________
9) Meine Mutter steht vor der Tür.
(meine Wohnung sauber machen) ____________________________________
10) Petra hat die Prüfung nicht bestanden.
(fleißiger lernen) ____________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
78
A46 Irreale Bedingungen: Wenn ich das gewusst hätte!
Bilden Sie Sätze mit dem Konjunktiv II in der Vergangenheit wie im Beispiel.
➢ Der Job wird schlecht bezahlt. (sich nicht bewerben)
Wenn ich gewusst hätte, dass der Job so schlecht bezahlt wird, hätte ich mich nicht
beworben.
1) Der Film ist langweilig. (sich einen anderen Film ansehen)
Wenn ich gewusst hätte, dass der Film so langweilig ist, ____________________________
_________________________________________________________________________
2) Das Studium ist schwer. (ein anderes Fach studieren)
_________________________________________________________________________
3) Das Wetter ist hier schlecht. (sich für ein anderes Urlaubsland entscheiden)
_________________________________________________________________________
4) Die Reise dauert lange. (zu Hause bleiben)
_________________________________________________________________________
5) Das Essen in diesem Restaurant ist teuer. (zu meinem „Lieblingsitaliener“ gehen)
_________________________________________________________________________
6) Meine Nachbarin ist unfreundlich. (eine andere Wohnung mieten)
_________________________________________________________________________
A48 Lisa hatte keine Zeit. Deshalb konnte sie vieles nicht machen. Was sagt Lisa?
➢ nach Paris fahren
„Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich nach Paris gefahren.“
1) einkaufen gehen
________________________________________________________________________
2) länger in Heidelberg bleiben
________________________________________________________________________
3) nach Wien fliegen
________________________________________________________________________
4) meinen Freunden helfen
________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
79
5) ein Buch lesen
________________________________________________________________________
6) dir einen Brief schreiben
________________________________________________________________________
7) mein Zimmer streichen
________________________________________________________________________
8) mein Fahrrad reparieren
________________________________________________________________________
9) dich anrufen
________________________________________________________________________
10) den Keller aufräumen
________________________________________________________________________
11) am Seminar teilnehmen
________________________________________________________________________
12) sich mit Maria unterhalten
________________________________________________________________________
A49 Was würden Sie tun, wenn …?
Beantworten Sie die Fragen. Verwenden Sie den Konjunktiv II.
▪ Was würden Sie mit mehr Freizeit anfangen?
▪ Sie gewinnen im Lotto und sind Millionär. Was würden Sie mit Ihrem Lottogewinn machen?
▪ Was würden Sie tun, wenn Sie auf einer einsamen Insel gestrandet wären?
▪ Behalten oder abgeben? Was würden Sie tun, wenn Sie auf der Straße eine große Summe
Geld finden?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
80
Konjunktiv II der Vergangenheit mit Modalverben
Die Modalverben bilden den Konjunktiv II der Vergangenheit mit dem Hilfsverb haben im
Konjunktiv II sowie einem doppelten Infinitiv. Das Modalverb wird ans Satzende gestellt.
hätten + Infinitiv + Modalverb in Infinitiv
Position 1 Verb 1 Mittelfeld Infinitiv Infinitiv
Präteritum Oscar musste gestern arbeiten.
Perfekt Oscar hat gestern arbeiten müssen.
Konj. II mit Oscar hätte gestern arbeiten müssen.
Modalverb
Präteritum Lena durfte nach Köln fahren.
Perfekt Lena hat nach Köln fahren dürfen.
Konj. II mit Lena hätte nach Köln fahren dürfen.
Modalverb
Vorsicht
Der Konjunktiv II zeigt das Gegenteil vom Indikativ an!!! Im Perfekt und Präteritum (Indikativ)
hat Oscar gearbeitet und Lena ist nach Köln gefahren. Im Konjunktiv II der Vergangenheit hat
Oscar nicht gearbeitet, hätte es aber tun sollen und Lena war nicht in Köln, hätte aber fahren
dürfen!!!
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
81
A50 Die harte Realität
Bilden Sie einen irrealen Satz im Konjunktiv II.
➢ Wenn das Wetter schön wäre, würde ich jetzt spazieren gehen.
Aber: Das Wetter ist nicht schön und ich gehe jetzt nicht spazieren.
1) ________________________________________________________________________
Aber: Ich kann nicht singen und bin keine Opernsängerin.
2) ________________________________________________________________________
Aber: Ich bin kein Millionär und kaufe keine Villa am Meer.
3) ________________________________________________________________________
Aber: Stefan hat keinen Hund und kann nicht jeden Tag mit ihm joggen gehen.
4) ________________________________________________________________________
Aber: Meine Freunde kochen nicht gern und ich muss bei jeder Party für alle kochen.
5) ________________________________________________________________________
Aber: Du arbeitest nicht viel und hast im Beruf keinen Erfolg.
6) ________________________________________________________________________
Aber: Wir haben nicht genug Geld und machen im Sommer nicht Urlaub auf den Malediven.
7) ________________________________________________________________________
Aber: Ihr schlaft lange und kommt zu spät zur Schule.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
82
A51 Meine Schwiegermutter geht mir auf die Nerven!
Ergänzen Sie die Sätze im Konjunktiv II.
Meine Schwiegermutter ist eine Katastrophe! Immer verbessert sie mich, nichts kann ich richtig
machen.
➢ Wenn ich für meine Tochter Milch koche, sagt sie: „Du solltest ihr einen Tee kochen, das ist
gesünder!“ (kochen sollen)
1) Wenn ich die Küche aufräume, sagt sie: „Du _______ mal wieder den Keller______________,
da sieht es schrecklich aus!“ (aufräumen müssen)
2) Wenn ich meinen Kindern erlaube, einen Film anzusehen, sagt sie: „Bei mir _________ die
Kinder nicht so viel _______________!“ (fernsehen dürfen)
3) Wenn ich meinem Mann einen grünen Pullover schenke, sagt sie: „Ein roter Pullover _______
ihm viel besser _______________!“ (stehen)
4) Sie sagt, dass sie am liebsten alleine im Garten arbeitet, Dann aber fragt sie mich: „_________
du mir nicht mal ein bisschen _______________?“ (helfen können)
5) Wenn ich einen Kuchen backe, sagt sie: „Du ___________ deinen Kindern nicht so viel Süßes
_______________!“ (geben sollen)
6) Wenn sie zum Einkaufen geht, sagt sie: „___________ du nicht auch mal zum Einkaufen
_______________!“ (gehen können)
7) Wenn mein Sohn in der Schule eine gute Note schreibt, sagt sie: „Wenn du mehr mit ihm
_______________ _______________, _______________ er eine noch bessere Note
_______________!“ (lernen, schreiben können)
8) Wenn ich mir am Abend einen Liebesfilm anschaue, sagt sie: „Es _______________ besser,
wenn du dir einen Dokumentarfilm _______________ _______________! (sein, anschauen)
Da _______________ du etwas _______________!“ (lernen können)
9) Wenn sie mich doch nur in Ruhe _______________ _______________! (lassen)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
83
A52 Lottogewinn
Ergänzen Sie die Verben im Konjunktiv II.
Wenn ich im Lotto 1 gewinnen würde (gewinnen), 2 _____________ ich mir ein schönes, großes
Haus am Meer _______________ (kaufen). Natürlich 3 _______________ (haben) ich dann auch
Hausangestellte, sodass ich nichts mehr im Haushalt 4 __________________ (machen müssen).
Ich 5 _______________ (können) den ganzen Tag auf der Terrasse ________________ (liegen)!
Ich 6 _______________ (haben) natürlich auch ein neues, schönes Auto. Damit 7 _____________
ich abends immer am Strand entlang _______________ (fahren). Dort 8 _________________ ich
meine Freunde _____________ (treffen) und sie in die besten Bars _______________ (einladen).
Ach, 10 ___________ das schön, wenn ich im Lotto 11 ____________ ____________ (gewinnen)!
A53 Ach, wenn doch nur …!
Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
➢ Es regnet so stark. Wenn doch endlich der Bus kommen würde! (kommen)
1) Meine Frisur ist langweilig. Wenn ich doch lange Haare _______________! (haben)
2) Jetzt ist er schon fünf Wochen in Afrika. Wenn mein Liebster mir doch endlich eine E-Mail
_______________ _______________! (schreiben)
3) Gestern Abend habe ich wohl zu viel getrunken. O je, wenn mein Kopf nur nicht so weh
_______________ _______________! (tun)
4) Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wenn ich nur den richtigen Weg _______________
_______________! (wissen)
5) Morgen fährt unser nettes Au-pair-Mädchen wieder zurück nach Hause. Wenn sie doch
immer bei uns _______________ _______________! (bleiben)
6) Ich bin schon so müde … Wenn unsere Gäste doch endlich nach Hause _______________
_______________! (gehen)
7) Ich will nichts von diesem Typ wissen. Wenn er mich nur endlich in Ruhe _______________
_______________! (lassen)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
84
A54 Schön wär’s!
Was passt zusammen? Ergänzen Sie die Verben im Konjunktiv II Gegenwart oder
Vergangenheit.
1) d. 2) 3) 4) 5)
1) Ihre Freunde gehen am Samstagabend aus. Sie sind krank und liegen im Bett.
2) Sie liegen bei 33º Celsius am Strand und es ist sehr heiß in der Sonne.
3) Sie sind in Shanghai und suchen ein Hotel. Sie fragen Passanten nach dem Weg, aber
niemand spricht Englisch!
4) Sie stehen in der Küche und spülen das Geschirr nach einem Essen mit vielen Freunden.
5) Es ist Winter und sehr kalt. Sie haben kalte Hände.
a. _______________ ich doch meinem Sonnenschirm _______________! (mitnehmen)
b. _______________ ich doch eine Spülmaschine! (haben)
c. _______________ ich mir doch warme Handschuhe _______________! (kaufen)
d. Wenn ich doch gesund wäre! (sein)
e. Wenn ich doch einen Chinesischkurs _______________ _______________! (machen)
A55 Bilden Sie einen irrealen Konditionalsatz.
➢ Konrad fährt nicht mit nach München, weil er lernen muss.
Wenn Konrad nicht lernen müsste, würde er nach München mitfahren.
Wenn Konrad nicht lernen müsste, führe er nach München mit.
1) Karl fährt mit dem Taxi nach Hause, weil er betrunken ist.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Gerd kommt nicht zur Party, weil er fürs Examen lernen muss.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Maria darf keine Erdbeeren essen, weil sie eine Allergie hat.
________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
85
________________________________________________________________________
4) Jutta muss die Arbeit heute allein erledigen, weil sich Thomas erkältet hat.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) Julia kann nichts zu diesem Thema sagen, weil sie nicht Bescheid weiß.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A56 … dann wäre alles anders gekommen!
Ordnen Sie die passenden Satzteile einander zu.
1) h. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
1) Wenn ich meine Schlüssel
nicht vergessen hätte, a. hätte ich nicht das Flugzeug verpasst.
2) Wenn der Unterricht interessanter b. wären wir zum Schwimmen an den See
gewesen wäre, gefahren.
3) Wenn mein Mann pünktlich c. wäre mir jetzt nicht so schlecht.
aufgewacht wäre,
d. würde ich mir ein neues Auto kaufen.
4) Wenn sie sich besser auf die
Prüfung vorbereitet hätte, e. könnte er mehr Zeit mit seinen Kindern
5) Wenn der Taxifahrer schneller verbringen.
gefahren wäre, f. könnte ich Sie besser verstehen!
6) Wenn am Wochenende g. wäre er nicht zu spät zu seinem Meeting
die Sonne geschienen hätte, gekommen.
7) Wenn ich nicht zwei Tafeln
h. könnte ich jetzt in meine Wohnung.
Schokolade gegessen hätte,
8) Wenn ich Geld hätte, i. wäre sie nicht durchgefallen.
9) Wenn er nicht so viel arbeiten müsste, j. wäre ich nicht dabei eingeschlafen.
10) Wenn Sie lauter sprechen würden,
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
86
A57 …. als ob er traurig wäre!
Bilden Sie Sätze und ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form.
➢ ■ Was ist denn mit Peter los?
► Ich weiß nicht. Er sieht aus, als ob er traurig wäre.
er / aussehen / als ob / sein / , / traurig / er
1) ■ Denks du, das Wetter bleibt schön? Ich möchte so gern grillen heute Abend!
► Das könnte schwierig werden. _______________________________________________
es / regnen / aussehen / bald / es / , / als ob
2) ■ Oh, Johannes ist ja völlig überarbeitet!
► Ach ja? Wenn du mich fragst, _______________________________________________
nur so / er / tun / als ob / viel Stress / er / , / haben
Eigentlich hat er ein ganz entspanntes Leben!
3) ■ Ach, dein Bruder ist wunderbar! Er geht so gern mit mir ins Konzert!
► Das macht er nur aus Liebe zu dir! ___________________________________________
nur so / , / als ob / musikalisch sein / er / tun / er
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
87
A58 E-Mail: Terminabsage (formell)
Sie haben einen Termin am 20. Mai um 10: 00 Uhr mit einem Kunden. Leider können Sie den
Termin nicht einhalten. Schreiben Sie eine E-Mail an den Kunden. Erklären Sie die Situation und
begründen Sie Ihre Absage. Machen Sie einen neuen Terminvorschlag.
• Wir haben am … einen Termin.
• Leider muss ich den Termin am … absagen.
• Es tut mir wirklich leid, aber …
• Ich schlage vor, dass wir …
• Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Redemittel: Einen Brief/Eine E-Mail schreiben (Wiederholung)
Anrede
formell: Sehr geehrte Frau (Sommer)
Sehr geehrter Herr (Winter)
Sehr geehrte Damen und Herren
halbformell: Liebe Frau (Sommer)/Lieber Herr (Winter)
informell: Liebe (Claudia)/Lieber (Robert)
Gruß:
formell: Mit freundlichen Grüßen
halbformell: Mit besten Grüßen
informell: Mit herzlichen Grüßen/Herzliche Grüße
Mit lieben Grüßen/Liebe Grüße
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
88
A59 E-Mail: Terminabsage (informell)
a) Was passt? Kreuzen Sie an.
Liebe Christine,
leider muss ich unser geplantes Abendessen für morgen 1 _________________. Mein Chef kam
gerade mit einem wichtigen Auftrag zu mir, den ich bis übermorgen erledigen 2 ______________.
Das bedeutet für mich, 3 ________________ ich heute und morgen länger arbeite, wahrscheinlich
bis 22:00 Uhr. Was hältst Du 4 _________________, wenn wir uns am Wochenende sehen? Ich
würde 5 _________________ gerne zu mir nach Hause einladen und etwas Leckeres kochen.
Wie 6 _________________ es mit Huhn in Paprikasoße?
Ich hoffe, Du hast für meine Absage Verständnis und wir sehen uns 7 _______________ Samstag
oder am Sonntagabend.
8 _________________ von Leon
1) a) vereinbaren b) stornieren c) absagen
2) a) darf b) kann c) soll
3) a) das b) dass c) wann
4) a) davon b) damit c) darüber
5) a) Dich b) Dir c) Du
6) a) wärst b) wären c) wäre
7) a) im b) um c) am
8) a) Liebe Grüße b) Freundliche Grüße c) Beste Grüße
b) Schreiben Sie selbst eine E-Mail an Christine. Sagen Sie das geplante Abendessen ab,
nennen Sie einen Grund und machen Sie einen Vorschlag.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
89
A60 Gutes Benehmen
Ergänzen Sie die passende Verben in der richtigen Form.
sein finden erscheinen gehören gelten sehen vereinfachen enthalten
➢ Für manche Leute gehört gutes Benehmen ins 18. Jahrhundert.
1) Das Buch „Über den Umgang mit Menschen“ aus dem Jahre 1788 _______________ viele
praktische Tipps.
2) Die alten Verhaltensregeln aus dem 18. Jahrhundert _________________ heute immer noch.
3) Gute Manieren _______________ modern.
4) Fast jeden Monat ________________________ auf dem Büchermarkt ein neuer Ratgeber mit
Verhaltensregeln.
5) Nach einer aktuellen Umfrage _______________________ 87 % der Manager einen direkten
Zusammenhang zwischen persönlichem Erfolg und gutem Benehmen.
6) Richtiges Benehmen _______________ den Abschluss von Geschäften.
7) Hier _______________ Sie einige Hinweise.
Pünktlichkeit
Kleidung
Begrüßung
A61 Berichten Sie über Ihr Heimatland.
Was muss man beachten,
▪ wenn man eine neue Stelle in einer Firma bekommen hat?
▪ Wenn man an einem Geschäftsessen teilnimmt?
▪ Wenn man von Freunden zum Essen eingeladen wird?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
90
A62 Smalltalk
Smalltalk muss man üben. Führen Sie mit Ihrer Nachbarin/Ihrem Nachbarn einen
netten Smalltalk. Berichten Sie anschließend, was Sie erfahren haben.
Typische Smalltalk-Themen:
▪ Das Wetter
▪ Ihre Heimatstadt/Städte
▪ Ihre Ausbildung/Ihr Beruf
▪ Sport/Hobbys
▪ Ihr Heimatland (Essgewohnheiten, Kultur,
Sehenswürdigkeiten)
Wichtige Redemittel für den Smalltalk:
Wichtig für jeden Smalltalk: Wer fragt, führt das Gespräch!
• Wir haben ja wieder schlechtes Wetter heute! Ich hoffe, dass das Wetter in den nächsten
Tagen besser wird. Regnet es bei Ihnen auch so oft?
• Kennen Sie unsere Stadt schon? Hatten Sie schon Gelegenheit, … (das Rathaus) zu
besichtigen? Woher kommen Sie? Was ist Ihre Heimatstadt?
• Wo haben Sie studiert? Wie lange arbeiten Sie schon bei …?
• Interessieren Sie sich für … (Fußball)? Haben Sie das … (das Endspiel der Fußballwelt-
meisterschaft) gesehen? Treiben Sie gern/viel Sport?
• Interessieren Sie sich (für Kunst) Waren Sie schon mal … (im Guggenheim-Museum in New-
York)?
• Essen Sie gern … (deutsche Gerichte)? Haben Sie schon mal … (ein Weißbier) probiert?
Mögen Sie … (die deutsche Küche)?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
91
NEBENSÄTZE – „DASS“
Typischen Verben, nach denen ein dass-Satz folgen kann:
sagen, erzählen, erklären, behaupten, denken, glauben, meinen, vermuten, annehmen,
finden, hören, fühlen, wünschen, erwarten, hoffen, befürchten, wissen, vorhaben, planen
A63 Bilden Sie einen dass-Satz wie im Beispiel.
➢ Besuchst du deine Tante im Krankenhaus? Wünscht sie es?
Wünscht deine Tante, dass du sie im Krankenhaus besuchst?
1) Sucht Max eine neue Arbeit? Hat er es gesagt?
________________________________________________________________________
2) Hilft Lena euch bei der Renovierung? Hat sie es angeboten?
________________________________________________________________________
3) Kann Karl am Computerkurs teilnehmen? Weiß er es?
________________________________________________________________________
4) Kann Nancy den Test wiederholen? Hofft sie es?
________________________________________________________________________
5) Besucht Carlos seinen Freund in Madrid? Hat er es vor?
________________________________________________________________________
6) Kann Nadine Thomas vertrauen? Glaubt sie es?
________________________________________________________________________
7) Muss Martina am Wochenende arbeiten? Befürchtet sie es?
________________________________________________________________________
8) Muss Christine den Wagen in die Werkstatt bringen? Nimmt sie es an?
________________________________________________________________________
9) Muss Julia sich um die Kinder kümmern? Vermutet sie es?
________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
92
A64 Bilden Sie dass-Sätze im Perfekt mit folgenden Elementen wie im Beispiel.
➢ er / krank sein
Ich habe gehört, dass er krank gewesen ist.
1) du / ein Auto / kaufen
________________________________________________________________________
2) Lisa / nach Köln / ziehen
________________________________________________________________________
3) Bianca / ein Unfall / haben
________________________________________________________________________
4) Kathleen / die Prüfung / bestehen
________________________________________________________________________
5) Jan / der Termin / vergessen
________________________________________________________________________
6) du / deine Jacke / verlieren
________________________________________________________________________
7) du / eine Weltreise / buchen
________________________________________________________________________
8) Paul und Sabine / heiraten
________________________________________________________________________
9) Clara / eine neue Wohnung / mieten
________________________________________________________________________
10) Robert / der Vertrag / unterschreiben
________________________________________________________________________
11) Tina / nach Rom / fliegen
________________________________________________________________________
12) ihr / der Kurs / teilnehmen an
________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
93
Unpersönliche Konstruktionen, nach denen ein dass-Satz folgen kann:
es freut mich, es ärgert mich, es wundert mich, es erschreckt mich, es scheint (mir),
es tut mir leid, es ist möglich, es ist wichtig, es ist notwendig, es ist sicher,
es ist schade, es stimmt
Dass-Sätze als Nominativ-Ergänzungen werden zum größten Teil mit unpersönlichen Verben
gebildet, deren Subjekt mit es gebildet werden. (Siehe auch Anhang 2 auf Seite 192)
▪ Steht ein Aussagesatz vor dem Nebensatz, steht es auf Position 1.
➢ Es ist schade, dass du jetzt gehen musst.
Es una pena que tengas que irte ahora.
➢ Es ärgert mich, dass ich durch die Prüfung gefallen bin.
Me molesta que no haya pasado el examen.
▪ Wird die Position 1 anderweitig vergeben, entfällt es.
➢ Möglich ist, dass er verreist ist.
Es posible que él esté lejos.
➢ Mir gefällt, dass unser Chef für ein paar Tage nicht vor Ort sein kann.
Me gusta que nuestro jefe no pueda estar ahí por unos días.
▪ Ein Ja-/Nein-Fragesatz wird immer vor dem Nebensatz genannt.
➢ Stimmt es, dass der Trainer entlassen worden ist?
¿Es cierto que el entrenador ha sido despedido?
➢ Freut es dich, dass deine Mannschaft Pokalsieger geworden ist?
¿Estás contento de que tu equipo haya ganado la copa?
▪ Steht der Nebensatz zuerst, entfällt es im Hauptsatz.
➢ Dass du mit dem Rauchen aufgehört hast, freut mich.
Me complace que haya dejado de fumar.
➢ Dass dein Hund gestorben ist, tut mir leid.
Lamento que tu perro haya muerto.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
94
Unpersönliche Verben, die Subjektsätze einleiten
Im Folgenden werden einige unpersönliche Verben vorgestellt, die dass-Sätze als Nominativ-
Ergänzung einleiten:
➢ Es ist (nicht) angenehm, dass es wärmer wird.
➢ Es ärgert mich (nicht), dass du immer zu spät kommst.
➢ Es ist (nicht) erfreulich, dass so viele Schüler in der Prüfung durchgefallen sind.
➢ Ist es (nicht) erlaubt, dass man im Zugabteil raucht.
➢ Es freut mich (nicht), dass du wieder verliebt bist.
➢ Es gefällt mir (nicht), dass du endlich mal dein Zimmer aufräumst.
➢ Es ist mir egal, dass Herr Schäfer entlassen worden ist.
➢ Es ist (nicht) falsch, dass man Frau Krüger gekündigt hat.
➢ Es ist (nicht) gut für die Banditen, dass man die Pistole gefunden hat.
➢ Es tut mir (nicht) leid, dass du deinen Job verloren hast.
➢ Es ist (nicht) möglich, dass der Patient bald entlassen wird.
➢ Ist es (nicht) nötig, dass Sie ihm helfen?
➢ Es ist (nicht) notwendig, dass der undichte Wasserhahn repariert wird.
➢ Es ist (nicht) richtig, dass man Herrn Winkler entlassen hat.
➢ Ist es nicht schade, dass der Sommer zu Ende geht?
➢ Es ist nicht schlecht, dass er auch einmal verloren hat.
➢ Es ist nicht schön, dass Herr Vogt seine Nachbarin beleidigt hat.
➢ Es stimmt nicht, dass er sie geschlagen hat.
➢ Ist es nicht traurig, dass Frau Otto gestorben ist?
➢ Es ist nicht unangenehm, dass es endlich mal wieder regnet.
➢ Es ist nicht unmöglich, dass Hannelore zu ihrem Mann zurückkehrt.
➢ Es ist mir nicht verständlich, dass der Autofahrer mit 1,8 Promille noch Auto fährt.
➢ Ist es (nicht) wahr, dass der Chef in die neue Mitarbeiterin verknallt ist?
➢ Es wundert mich nicht, dass der Sohn von Herbert Drogen nimmt.
Das Verb steht im dass–Satz am Ende.
Der HS macht ohne den NS mit „dass“ keinen Sinn.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
95
Unpersönliche Verben
Unpersönliche Verben sind Verben, die kein eigentliches Subjekt, sondern nur ein rein
grammatikalisches Subjekt haben. Das Subjekt ist normalerweise das unpersönliche es. Die
Verben gehören oft zu den sogenannten Witterungsverben:
➢ es regnet, es schneit, es hagelt
Está lloviendo, está nevando, está granizando
„Echte“ unpersönliche Verben können nicht mit einem anderen Pronomen oder einem Nomen
stehen:
➢ Nicht: ich schneie, sie regnen, das Wetter hagelt.
No: Estoy nevando, están lloviendo, el clima es granizo.
Einige der „echten“ unpersönlichen Verben können gelegentlich in übertragenem Sinn auch mit
einem anderen Subjekt als es stehen:
➢ Glassplitter regneten auf die Straße.
Astillas de cristales llovieron en la calle.
➢ Granaten und Bomben hagelten vom Himmel.
Granadas y bombas salieron del cielo.
A65 Bilden Sie dass-Sätze in der Vergangenheit wie im Beispiel.
➢ Was ist sicher? – Er muss bald abreisen.
Es ist sicher, dass er bald abreisen muss.
1) Was ist schade? – Sie hat keine Zeit.
________________________________________________________________________
2) Was ist notwendig? – Du bringst den Wagen in die Werkstatt.
________________________________________________________________________
3) Was ist bekannt? – Thomas ist ein guter Sportler.
________________________________________________________________________
4) Was ist möglich? - Lena ist nach München gefahren.
________________________________________________________________________
5) Was ist wichtig? – Tom schafft die Prüfung.
________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
96
6) Was gefällt dir nicht? – Ich muss so viel arbeiten.
________________________________________________________________________
7) Was tut dir leid? – Ich kann dich nicht mitnehmen.
________________________________________________________________________
8) Was stimmt? - Petra verdient sehr viel Geld.
________________________________________________________________________
9) Was kann sein? – Heute Abend kommt ein Sturm.
________________________________________________________________________
A66 Ergänzen Sie die Sätze!
➢ der Termin / ändern
Stimmt es, dass du den Termin geändert hast?
1) das Spiel / gewinnen
________________________________________________________________________
2) der Automat / reparieren
________________________________________________________________________
3) der Zug / verpassen
________________________________________________________________________
4) die Prüfung / bestehen
________________________________________________________________________
5) dein Schlüssel / verlieren
________________________________________________________________________
6) ein Flug nach London / buchen
________________________________________________________________________
7) eine Wohnung / finden
________________________________________________________________________
8) der Präsident / kennen lernen
________________________________________________________________________
9) der Vertrag / unterschreiben
_______________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
97
A67 Urlaub in Skandinavien?
Bilden Sie dass-Sätze.
➢ Franz: Wandern in Finnland ist super!
Franz findet, dass Wandern in Finnland super ist.
1) Judith: Dort gibt es so viele Mücken.
Judith hat gehört, _______________________________________________
2) Lena: Urlaub in Skandinavien ist zu teuer.
Lena ist der Meinung, ____________________________________________
3) Simon: Ich finde die Schweden sehr freundlich.
Simon sagt, ____________________________________________________
4) Barbara: Ich will im Urlaub lieber in den Süden fahren.
Barbara meint, __________________________________________________
A68 Klischees
Schreiben Sie Fragen mit der Konjunktion dass.
➢ macht / Geld / glücklich
Finden Sie, dass Geld glücklich macht?
1) alle Deutschen / immer / sind / pünktlich
Meinen Sie, ________________________________________________________________
2) Frauen / Mathematik / gut / nicht / können
Glauben Sie, _______________________________________________________________
3) die Deutschen / planen / alles
Sind Sie der Meinung, ________________________________________________________
4) die Menschen / dumm / das Fernsehen / macht
Finden Sie, ________________________________________________________________
5) trinken / alle Engländer / gern / Tee
Denken Sie, _______________________________________________________________
6) war / früher / besser / alles
Glauben Sie, _______________________________________________________________
7) sprechen / über / Männer / nicht / ihre Gefühle
Denken Sie, _______________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
98
KAUSALE NEBENSÄTZE
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
99
Kausal: Warum? » Grund
Adverb Wir kamen zu spät. Wir hatten nämlich einen Unfall.
Hauptsatz Hauptsatz
NS-Konjunktion Wir kamen zu spät, weil wir einen Unfall hatten.
Hauptsatz kausaler Nebensatz
HS-Konjunktion Wir kamen zu spät, denn wir hatten einen Unfall.
Hauptsatz HS-Konj. (Pos. O) Hauptsatz
Konjunktionaladverb Wir hatten einen Unfall. Deshalb kamen wir zu spät.
Hauptsatz Hauptsatz
Präposition Wegen eines Unfalles kamen wir zu spät.
Kausale Nebensatzkonjunktionen: weil, da
Kausale Hauptsatzkonjunktion: denn
Kausale Konjunktionaladverbien: deshalb, daher, deswegen
Kausale Präpositionen: wegen, aufgrund
Gut Deutsch sprechen zu können, ist nicht
nur wichtig, sondern auch richtig schön.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
100
A69 Bilden Sie kausale Nebensätze.
➢ Warum ist Paul zum Arzt gegangen? (Husten haben)
Paul ist zum Arzt gegangen, weil er Husten hat.
1) Warum sucht Thomas eine neue Arbeit. (zu wenig verdienen)
_________________________________________________________________________
2) Warum isst du keine Erdbeeren? (eine Allergie haben)
_________________________________________________________________________
3) Warum ziehst du aus dieser Wohnung aus? (zu dunkel sein)
_________________________________________________________________________
4) Warum hast du die Blumen gekauft? (meine Freundin heute Geburtstag haben)
_________________________________________________________________________
5) Warum hatte Max einen Termin beim Augenarzt? (Brille brauchen)
_________________________________________________________________________
6) Warum fährt Maria nicht in Urlaub? (sich krank fühlen)
_________________________________________________________________________
7) Warum hat er sich verspätet? (den Bus verpassen)
_________________________________________________________________________
8) Warum macht Janina die Fahrradtour nicht mit? (sich erkälten)
_________________________________________________________________________
A70 Bilden Sie kausale Nebensätze.
➢ Rita ist am Wochenende zu Hause geblieben. Es hat nämlich fürchterlich geregnet.
Rita ist am Wochenende zu Hause geblieben, weil es fürchterlich geregnet hat.
Es hat fürchterlich geregnet. Deshalb ist Rita am Wochenende zu Hause geblieben.
1) Manfred bleibt im Bett. Er hat sich nämlich erkältet.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) Der Laden ist geschlossen. Die Besitzer sind nämlich in Urlaub.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
101
3) Julia lernt jetzt immer bis spät abends. Sie schreibt nämlich bald ihre Abschlussprüfung.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4) Der Hotelgast beschwerte sich. Er war nämlich mit dem Service gar nicht zufrieden.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5) Ich komme erst später. Ich muss nämlich noch etwas Wichtiges erledigen.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6) Der Autofahrer war schwer verletzt. Er hatte sich nämlich nicht angegurtet.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7) Viele Menschen verloren ihre Arbeit. Man hatte nämlich die Produktion automatisiert.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8) Jana gewann den Schwimmwettbewerb an ihrer Schule. Sie hatte nämlich täglich hart
trainiert.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9) Du solltest diese Pflanze nicht anfassen. Sie ist nämlich sehr giftig.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10) Fertiggerichte sind oft ungesund. Sie enthalten nämlich zu wenige Vitamine und zu viel Fett.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11) Michael studiert Jura. Er möchte nämlich Richter werden.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12) Klaus konnte nicht mit Julia sprechen. Er war nämlich zu schüchtern.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
102
KONZESSIVE NEBENSÄTZE
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
103
Konzessivsätze geben einen Gegengrund, eine Einschränkung oder eine Einräumung an.
Der Nebensatz formuliert eine Bedingung, der Hauptsatz eine Folge, die aber nicht oder anders
als erwartet eintritt (= nicht logische Folge).
Las oraciones concesivas indican una razón, una restricción o una concesión. La cláusula subordinada
formula una condición, la cláusula principal de una secuencia que no ocurre de otra manera que la
esperada (= consecuencia que no es lógica).
➢ Weil sie Peter über alles liebt, will sie ihn heiraten. (kausal = Grund = logische Folge)
Porque ama mucho a Peter, quiere casarse con él. (causal = razón = consecuencia lógica)
➢ Obwohl sie Peter über alles liebt, will sie ihn nicht heiraten. (konzessiv = Gegengrund, nicht
logische Folge)
Aunque ama mucho a Peter, no quiere casarse con él. (Concesiva = razón opuesta, no es una
consecuencia lógica)
Ein konzessiver Nebensatz wird mit der Konjunktion „obwohl" oder „obgleich" eingeleitet:
Hauptsatz Nebensatz
Der Schauspieler bekommt keine neuen obwohl er weltweit sehr berühmt ist.
Rollen angeboten,
Der 8-jährige Tim kann noch nicht rechnen, obgleich er schon zwei Jahren die Schule
besucht.
Der Student ist durch die Prüfung gefallen, obgleich er sich wochenlang darauf
vorbereitet hat.
Der Mann fährt mit dem Auto nach Hause, obwohl er sehr viel Alkohol getrunken hat.
Der Angestellte geht heute arbeiten, obgleich er sehr stark erkältet ist.
Hauptsatz Nebensatz
Obgleich der Schauspieler weltweit berühmt ist. bekommt er keine neuen Rollen
angeboten.
Obschon Tim schon zwei Jahren die Schule besucht. kann er immer noch nicht rechnen.
Obwohl sich der Student wochenlang auf die Prüfung ist er durchgefallen.
vorbereitet hatte,
Obgleich der Mann sehr viel getrunken hat, fährt er mit dem Auto nach Hause.
Obgleich der Angestellte sehr erkältet ist, geht er heute arbeiten.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
104
Eine konzessive Angabe kann auch mit einer Präposition-Nomen-Konstruktionen formuliert
werden. Die passenden Präpositionen lauten: „trotz" und „ungeachtet" (beide + Genitiv):
Hauptsatz mit einer Präposition-Nomen-Konstruktion als konzessive Angabe
Trotz seiner weltweiten Berühmtheit bekommt der Schauspieler keine neuen Rollen
angeboten.
Trotz seines zweijährigen Schulbesuchs kann Tim immer noch nicht rechnen.
Trotz wochenlanger Prüfungsvorbereitung ist der Student durchgefallen.
Der Mann fährt ungeachtet seines enormen Alkoholkonsums mit dem Auto nach Hause.
Trotz seiner starken Erkältung geht der Angestellte heute arbeiten.
Nominale Angaben können auf Position 1 oder im Mittelfeld stehen. Die Präpositionen „trotz"
und „ungeachtet" verlangen den Genitiv.
Zusammenfassung
Verbal nominal
Konjunktionen Adverbien = inverse Struktur Präpositionen
obwohl (HS + NS / NS + HS) trotzdem (HS + HS) trotz
obgleich (NS + HS / HS + NS) dennoch (HS + HS) ungeachtet
alle Adverbien Pos. 1 oder Pos. 3 beide + Genitiv
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
105
A71 Bilden Sie konzessive Nebensätze.
➢ Olaf hatte sich sehr beeilt. Trotzdem verpasste er den Zug.
Obwohl Olaf sich sehr beeilt hatte, verpasste er den Zug.
1) Vera hatte Jörg eingeladen. Trotzdem kam er nicht zur Party.
_________________________________________________________________________
2) Tanja hat den ganzen Tag gearbeitet. Trotzdem ist sie nicht müde.
_________________________________________________________________________
3) Julian hat viel geübt. Trotzdem hat er den Test nicht geschafft.
_________________________________________________________________________
4) Monika besaß nicht viel Geld. Trotzdem machte sie sich keine Sorgen.
_________________________________________________________________________
5) Peter fuhr sehr vorsichtig. Trotzdem passierte ein Unfall.
_________________________________________________________________________
A72 Bilden Sie konzessive Nebensätze.
➢ Georg hatte Zeit. Er kam trotzdem nicht.
Georg kam nicht, obwohl er Zeit hatte.
1) Eva hatte Medikamente genommen. Sie konnte trotzdem nicht einschlafen.
_________________________________________________________________________
2) Karl war sehr müde. Er ging trotzdem noch in die Disco.
_________________________________________________________________________
3) Hans wohnt gar nicht weit von mir. Ich treffe ihn trotzdem nicht oft.
_________________________________________________________________________
4) Es ging der Wirtschaft gut. Viele Menschen verloren trotzdem ihre Arbeit.
_________________________________________________________________________
5) Silvie war schon früh losgefahren. Sie kam trotzdem zu spät.
_________________________________________________________________________
6) Martin hatte schreckliche Schmerzen. Er wollte trotzdem keine Tablette nehmen.
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
106
A73 Fahrrad oder Motorrad?
Ergänzen Sie weil oder obwohl.
Ich glaube, ich möchte ein gutes Fahrrad kaufen,
➢ weil ich gerne Sport mache.
1) __________ Rad fahren die Umwelt schützt.
2) __________ ein Motorrad viel schneller ist.
3) __________ ich mich dann jeden Tag an der frischen Luft bewege.
4) __________ ich Motorrad fahren viel cooler finde.
5) __________ ich mit einem Motorrad auch weite Reisen machen kann.
Oder soll ich lieber ein Motorrad kaufen,
6) __________ meine Freundin dagegen ist?
7) __________ ich schon lange davon träume?
8) __________ es viel teurer ist?
9) __________ mit dem Motorrad viele Unfälle passieren?
A74 Bilden Sie Sätze im Präteritum wie im Beispiel.
➢ a) trotz (seine schlechte Leistung) / er / die Prüfung / bestehen
Trotz seiner schlechten Leistung bestand er die Prüfung.
➢ b) wegen (seine schlechte Leistung) / er / durch die Prüfung / fallen
Wegen seiner schlechten Leistung fiel er durch die Prüfung.
1) trotz (das schlechte Wetter) / der Wettkampf / stattfinden
a) _______________________________________________________________________
wegen (das schlechte Wetter) / der Wettkampf / abgesagt werden
b) _______________________________________________________________________
2) trotz (der Straßenlärm) / ich / sich gut konzentrieren können
a) _______________________________________________________________________
wegen (der Straßenlärm) / ich / die Arbeit / beenden müssen
b) _______________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
107
3) trotz (die niedrigen Preise) / das Produkt / wir / nicht verkaufen können
a) _______________________________________________________________________
wegen (der niedrigen Preise) / das Produkt / ein Verkaufserfolg / werden
b) _______________________________________________________________________
4) trotz (sein Erfolg) / er / nicht glücklich / sein
a) _______________________________________________________________________
wegen (sein Erfolg) / er / stolz auf sich / sein
b) _______________________________________________________________________
5) trotz (seine Erkältung) / der Sänger / ein hervorragendes Konzert / geben
a) _______________________________________________________________________
wegen (seine Erkältung) / der Sänger / das Konzert / abbrechen müssen
b) _______________________________________________________________________
6) trotz (die hohen Personalkosten) / die Firma / in diesem Jahr / einen Gewinn / erzielen
a) _______________________________________________________________________
wegen (die hohen Personalkosten) / die Firma / in diesem Jahr / Verluste / machen
b) _______________________________________________________________________
7) trotz (das fleißige Training) / sie / keine Medaille / gewinnen können
a) _______________________________________________________________________
wegen (das fleißige Training) / sie / die Silbermedaille / erringen
b) _______________________________________________________________________
8) trotz (die Maßnahmen der Regierung) / die Lage auf dem Arbeitsmarkt / nicht / sich verbessern
a) _______________________________________________________________________
wegen (die Maßnahmen der Regierung) / die Zahl der Arbeitslosen / sinken
b) _______________________________________________________________________
9) trotz (die vielen Gespräche) / man / keine Lösung / finden
a) _______________________________________________________________________
wegen (die vielen Gespräche) das Betriebsklima / besser werden
b) _______________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
108
INDIREKTE FRAGESÄTZE
Indirekte Fragen sind Fragen, mit denen man Fragen stellt, ohne (aus grammatikalischer Sicht)
eine Frage zu stellen. Die Frage versteckt sich hier oft zwischen den Zeilen.
Indirekte Fragen sind etwas höflicher und weniger direkt. Obwohl es keine Frage ist, wird Ihnen
der Gesprächspartner aber wahrscheinlich die Antwort verraten.
Man unterscheidet zwei Fragesätze:
1. W-Fragen (Ergänzungsfragen): (W-Frage = Position 1 und Verb = Position 2)
➢ Woher kommt die attraktive Studentin?
¿De dónde viene la estudiante atractiva?
➢ Was suchen Sie hier in meinem Büro?
¿Qué estás buscando en mi oficina?
➢ Worauf warten die europäischen Touristen?
¿Qué esperan los turistas europeos?
➢ Welcher Wein schmeckt unseren Gästen besser?
¿Qué vino sabe mejor a nuestros huéspedes?
Nebensätze können mit einem Fragewort beginnen:
➢ Wann fährt der Zug ab? - Ich weiß nicht, wann der Zug abfährt.
In einem Nebensatz steht das Verb am ENDE. (trennbare Verben » zusammen)
➢ Wann kommt Robert an? - Ich weiß nicht, wann Robert ankommt.
A75 Bilden Sie Sätze im Perfekt mit einem Fragewort.
➢ warum / er / so spät / kommen Ich weiß nicht, warum er so spät gekommen ist.
1) wo / sie (Sing.) / sein _______________________________________________
2) wann / er / abreisen _______________________________________________
3) wem / sie (Pl.) / helfen _______________________________________________
4) wie viel / er / bezahlen _______________________________________________
5) wohin / sie (Pl.) / fahren _______________________________________________
6) wie lange / film / dauern _______________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
109
7) was / sie (Sing.) / verlieren _______________________________________________
8) wen / er / treffen _______________________________________________
9) wann / Kurs / beginnen _______________________________________________
2. Ja-/Nein- Fragen (Entscheidungsfragen): (Verb = Position 1)
➢ Liebst du deinen neuen Freund?
¿Amas a tu nuevo novio?
➢ Wollen die asiatischen Kunden Toilettenpapierrollen kaufen?
¿Los clientes asiáticos quieren comprar rollos de papel higiénico?
➢ Interessiert Frau Fischer sich für den roten Sportwagen?
¿Está la señora Fischer interesada en la camioneta deportiva roja?
➢ Warten die Besucher auf Herrn Weber?
¿Están los visitantes esperando al Sr. Weber?
Bei den gezeigten Beispielen handelt es sich um direkte Fragen. Fragen können aber auch in
Nebensätzen stehen. Steht eine Frage im Nebensatz, spricht man von einer indirekten Frage.
Indirekte Fragen wirken höflicher.
▪ Bei Ja-/Nein- Fragen benutzt man die Konjunktion „ob“:
Hauptsatz/Indirekte Frage Konj. Mittelfeld Verb / Prädikat
Kannst du mir sagen, ob du deinen neuen Freund liebst?
Wissen Sie, ob die asiatischen Kunden Toilettenpapierrollen kaufen wollen?
Ich wüsste gern, ob sich Frau Fischer für den roten Sportwagen interessiert.
Können Sie uns sagen, ob die Besucher auf Herrn Weber warten?
Ich wüsste gern, ob Sie
heute Zeit hätten, um mit
mir essen zu gehen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
110
▪ W-Fragen bleiben W-Fragen:
Hauptsatz/Indirekte Frage Konj. Mittelfeld Verb / Prädikat
Ich hätte gern gewusst, woher die attraktive Studentin kommt.
Könnten Sie mir bitte sagen, was Sie in meinem Büro suchen?
Niemand weiß, worauf die europäischen Touristen warten.
Unser Chef möchte wissen, welcher Wein unseren Gästen besser schmeckt.
▪ Indirekte Fragesätze sind Nebensätze.
▪ In Nebensätzen steht das konjugierte Verb am Satzende.
▪ Indirekte Fragesätze wirken höflicher.
▪ Die Konjunktion „ob" steht bei Ja-/Nein- Fragen und leitet einen Nebensatz ein.
▪ Eine W-Frage bleibt eine W-Frage, wird jedoch zum Nebensatz.
▪ Bei indirekten Fragen steht am Ende des Satzes in der Regel ein Punkt. Das Fragezeichen
setzen wir nur, wenn der Hauptsatz auch eine Frage ist.
Wie Sie an den Beispielen sehen können, bedeutet "indirekte Frage" nicht zwingend, dass Sie
keine Frage stellen. Sie fragen nur nicht direkt nach der Information, die Sie eigentlich haben
möchten.
Kommt Iris mit? (ja oder nein?) – Ich weiß nicht, ob Iris mitkommt.
Fragesätze ohne Fragewort Nebensatz » Konjunktion ob
A76 Antworten Sie auf die Fragen mit ob wie im Beispiel.
➢ Kommt Patrick heute?
Ich habe keine Ahnung, ob er heute kommt.
1) Hat jemand bei Julia angerufen?
_________________________________________________________________________
2) Trinkt Max Weißwein?
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
111
3) Holt Jan dich vom Flughafen ab?
_________________________________________________________________________
4) Hat man den Computer schon repariert?
_________________________________________________________________________
5) Kauft sich Lisa ein Fahrrad?
_________________________________________________________________________
6) Spielt ihr morgen Fußball?
_________________________________________________________________________
7) Fährt Frau Berg nach Madrid?
_________________________________________________________________________
8) Nimmt er dich mit?
_________________________________________________________________________
9) Fährt Paula nach Leverkusen?
_________________________________________________________________________
10) Muss Thomas am Samstag arbeiten?
_________________________________________________________________________
11) Will Felix dich besuchen?
_________________________________________________________________________
12) Ziehen eure Nachbarn nach Bremen um?
_________________________________________________________________________
13) Bleiben Miriam und Klaus zu Hause?
_________________________________________________________________________
14) Liegt das Haus am See?
_________________________________________________________________________
15) Ist Bianca schon abgereist?
_________________________________________________________________________
16) Hat Dennis seiner Freundin eine SMS geschickt?
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
112
TEMPORALE NEBENSÄTZE
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
113
Temporalsätze sind Nebensätze und werden stets mit einer Konjunktion eingeleitet. Es gibt
verschiedene Konjunktionen, die einen Temporalsatz einleiten können. Sie geben Informationen
über den Beginn, das Ende und die Dauer eines Geschehens und ob etwas gleichzeitig oder
ungleichzeitig passiert.
1. Gleichzeitigkeit
▪ Temporale Nebensätze mit wenn und als
▪ Temporale Nebensätze mit seit/seitdem
▪ Temporale Nebensätze mit während
▪ Temporale Nebensätze mit bis
2. Ungleichzeitigkeit
▪ Temporale Nebensätze mit bevor/ehe
▪ Temporale Nebensätze mit nachdem
▪ wenn - als
Temporalsätze mit wenn und als drücken eine Gleichzeitigkeit zweier Handlungen zu einem
Zeitpunkt aus. Das passende Fragewort lautet „Wann?". Die Konjunktion „wenn" benutzt man für
eine gleichzeitige Handlung in der Zukunft und in der Gegenwart sowie für eine wiederholte
Handlung in der Vergangenheit. Die Konjunktion „als" wird nur für eine einmalige Handlung in
der Vergangenheit benutzt.
Eine Aktion in der Gegenwart oder Zukunft » wenn
➢ Wenn er sie besucht, bringt er ihr Blumen mit.
Wiederholte Aktion » wenn
➢ Wenn er in Spanien war, brachte er immer Wein mit.
Eine Aktion in der Vergangenheit » als
➢ Als ich letztes Jahr in Wien war, regnete es die ganze Zeit.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
114
A77 Wenn oder als?
Was passt? Markieren Sie.
➢ Sie hat mich jedes Mal angerufen, als/wenn sie in Deutschland war.
1) Ich habe gerade geduscht, als/wenn sie angerufen hat.
2) Wir haben immer in demselben Hotel gewohnt, als/wenn wir in London waren.
3) Ich war total begeistert, als/wenn ich zum ersten Mal in Australien war.
4) Ich habe mich immer sehr gefreut, als/wenn meine Großeltern zu Besuch gekommen sind.
5) Er war noch nicht mit dem Kochen fertig, als/wenn die Gäste kamen.
A78 Ergänzen Sie die fehlenden temporalen Konjunktionen wenn oder als.
➢ Wenn ich im Sommer nach Griechenland fahre, treffe ich meine Freunde.
1) ____________ ich in Rom war, schrieb sie mir eine Karte.
2) ____________ uns Opa besuchte, brachte er immer Geschenke mit.
3) Er fährt immer sehr vorsichtig, ____________ es regnet.
4) ____________ mich die Polizei gestern anhielt, musste ich meinen Führerschein zeigen.
5) Er war erst 9 Jahre alt, ____________ sein Vater starb.
6) ____________ ich Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Tablette.
7) Der Zug kam gerade an, ____________ ich zum Bahnsteig ging.
8) Sie musste immer viel mehr arbeiten, ____________ ihre Kollegin krank war.
9) Die Nachbarn riefen immer die Polizei, ____________ wir eine Party machten.
10) ____________ ich gestern durch diese dunkle Straße gehen musste, fühlte ich mich unwohl.
A79 Kindheitserinnerungen
Was ist richtig? Markieren Sie.
1 Als/Wenn ich ein Kind war, lebten wir in einem kleinen Dorf am See. 2 Als/Wenn das Wetter
schön war, trafen wir Kinder uns am Nachmittag immer draußen zum Spielen. Am Abend, 3
als/wenn es dunkel wurde, mussten wir nach Hause gehen. 4 Als/Wenn meine großen Brüder
nachmittags Zeit hatten, haben sie immer mit uns Fußball gespielt. 5 Als/Wenn ich dann 16 Jahre
alt war, habe ich selbst auch oft mit den kleinen Jungen aus der Nachbarschaft Fußball gespielt.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
115
A80 Zurück aus dem Urlaub
Was ist richtig? Markieren Sie.
Liebe Erika,
seit gestern Abend sind wir wieder zu Hause. Und natürlich, 1 als/wenn wir über die Alpen fuhren,
fing es an zu regnen – willkommen daheim …!
2Wenn/Als du Urlaub hast, solltest du auch in die Toskana fahren! 3 Wenn/Als wir in unserem
Ferienhaus ankamen, haben wir gleich Fahrräder gemietet und sind losgefahren. Es gibt so viel
zu sehen! Wir haben immer Städtetouren gemacht, 4 wenn/als das Wetter nicht so gut war, und 5
wenn/als die Sonne schien, sind wir ans Meer gefahren. Abends, 6 wenn/als wir nach Hause
kamen, haben wir erst einmal ein Gläschen toskanischen Wein getrunken und dann gekocht.
Stell dir vor: 7 Wenn/Als wir einen Tag in Florenz verbracht haben, hat Julius seinen Fotoapparat
in einem Restaurant vergessen. Er hat dort sofort angerufen, 8 wenn/als er es bemerkt hat, und
der Apparat war tatsächlich noch da!
Normalerweise passiert ja immer etwas, 9 wenn/als wir in Urlaub fahren, aber dieses Mal hatten
wir Glück!
So, liebe Erika, 10 wenn/als ich jetzt alle Koffer ausgepackt habe, besuche ich dich auf eine Tasse
Tee und erzähle dir alles genauer!
Bis bald!
Deine Karla
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
116
A81 Was ist passiert? Antworten Sie.
➢ Als ich heute früh ins Krankenhaus fahren wollte, ging mein Auto kaputt.
1) Als ich dir eine Karte aus Paris schreiben wollte, ____________________________________
2) Gerade als ich mit dem Chef reden wollte, ________________________________________
3) Gerade als ich dich anrufen wollte, ______________________________________________
4) Als ich heute früh in die U-Bahn steigen wollte, ____________________________________
5) Als ich mit Rolf tanzen gehen wollte, _____________________________________________
6) Als ich dir zum Geburtstag gratulieren wollte, ______________________________________
7) Gerade als ich aus dem Haus gehen wollte, _______________________________________
8) Als ich gestern Abend ins Bett gehen wollte, _______________________________________
9) Als ich gerade in die Kantine gehen wollte, ________________________________________
▪ seit/seitdem
Temporalsätze mit seitdem oder seit drücken eine Gleichzeitigkeit zweier Handlungen aus.
Die Handlung des Nebensatzes beginnt in der Vergangenheit und dauert bis zur Gegenwart. Der
Hauptsatz steht im Präsens. Das Fragewort lautet „Seit wann?" (oder „Wie lange?").
Zwei Aktionen beginnen in der Vergangenheit – dauern an.
HS und NS – gleiche Zeit
oder HS Perfekt; NS Präsens » seit(dem)
➢ Seit(dem) sie in der Stadt wohnt, fährt sie nur noch mit dem Bus.
➢ Seit(dem) sie für diese Firma arbeitet, hat sie sich sehr verändert.
Eine Aktion in der Vergangenheit wirkt bis heute.
HS – Präsens; NS – Perfekt » seit(dem)
➢ Seit er den Kurs gemacht hat, kann er viel besser mit dem Computer umgehen.
Die Konjunktionen „seit“ und „seitdem“ sind einander zwar sehr ähnlich, doch unterscheiden sie
sich, und das nicht nur in der Länge. Die Faustregel lautet folgendermaßen:
„Seit“ verweist auf ein Ereignis, das danach genannt wird. „Seitdem“ verweist auf ein Ereignis,
das bereits zuvor genannt wurde.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
117
▪ bis
Temporalsätze mit bis drücken eine Gleichzeitigkeit zweier Handlungen aus. Der Hauptsatz
gibt eine laufende Handlung an. Der Nebensatz gibt ein zweites Geschehen an und definiert
zeitgleich einen Endpunkt beider Handlungen. Das Fragewort lautet „Bis wann?".
Aktion im NS beendet Aktion im HS. HS und NS – gleiche Zeit » bis
➢ Ich warte hier, bis Paul anruft.
A82 Ergänzen Sie bis oder seit/seitdem.
➢ Seitdem Max dieses Medikament nimmt, geht es ihm viel besser.
1) Der Hund bellte so lange vor meiner Tür, ____________ ich ihn ins Zimmer ließ.
2) Wir warteten fast eine halbe Stunde, ____________ der Kellner endlich kam.
3) Sie hat ständig Schmerzen im Knie, ____________ sie beim Skifahren so schwer gestürzt ist.
4) ____________ er mit dem Rauchen aufgehört hat, ist er schrecklich nervös.
5) ____________ sie ihn zum ersten Mal gesehen hat, ist sie in ihn verliebt.
6) Sie lernt jeden Tag bis um 10:00 Uhr abends, ____________ sie die Prüfung schreibt.
7) Es dauert noch über eine Stunde, ____________ der Zug kommt.
▪ während (NS – gleichzeitig)
Temporalsätze mit während und solange drücken eine Gleichzeitigkeit zweier Handlungen zu
einem Zeitpunkt aus. Dabei laufen zwei Vorgänge parallel zueinander. Beide Konjunktionen
können in allen Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) benutzt werden.
gleichzeitig – Vergangenheit » während / als
➢ Während (Als) sie aufräumte, sang sie.
gleichzeitig – Gegenwart » während / wenn
➢ Während (wenn) sie aufräumt, singt sie.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
118
A83 Bilden Sie Temporalsätze mit während.
➢ Christian macht die Hausaufgabe. Unterdessen höre ich Musik.
Während Christian die Hausaufgabe macht, höre ich Musik.
Ich höre Musik, während Christian die Hausaufgabe macht.
1) Sie spricht mit Tom. Dabei sieht sie ihm tief in die Augen.
_________________________________________________________________________
2) Er duscht sich. Dabei pfeift er immer ein Lied.
_________________________________________________________________________
3) Der Kellner bringt die Rechnung. Inzwischen zähle ich mein Geld.
_________________________________________________________________________
4) Er frühstückte. Gleichzeitig las er die Wohnungsanzeigen in der Tageszeitung.
_________________________________________________________________________
5) Ich wasche das Obst. In dieser Zeit schneidet Holger die Tomaten.
_________________________________________________________________________
6) Wir tranken Kaffee. Dabei erzählte sie mir eine lange Geschichte.
_________________________________________________________________________
7) Sie wartete an der Bushaltestelle. In dieser Zeit regnete es ständig.
_________________________________________________________________________
▪ bevor/ehe (NS – nachzeitig)
Temporalsätze mit bevor und ehe drücken eine Ungleichzeitigkeit zweier Handlungen aus.
Die Handlung des Hauptsatzes tritt dabei zuerst ein, die Handlung des Nebensatzes folgt nach
dem Hauptsatz. Beide Verben, sowohl der HS als auch der NS, haben bei diesen Konjunktionen
das gleiche Tempus.
nachzeitig – Vergangenheit » bevor/ehe
➢ Bevor/Ehe Julia fernsah, putzte sie.
➢ (Bevor/Ehe Julia fernsah, hatte sie geputzt)
nachzeitig – Gegenwart » bevor/ehe
➢ Bevor/Ehe Max fernsieht, putzt er.
➢ (Bevor/Ehe Max fernsieht, hat er geputzt.)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
119
A84 Bilden sie Temporalsätze mit bevor oder ehe.
➢ Er bezahlte die Rechnung. Vorher kontrollierte er sie sorgfältig.
Bevor er die Rechnung bezahlte, kontrollierte er sie sorgfältig.
Er kontrollierte die Rechnung sorgfältig, bevor er sie bezahlte.
1) Karl kam ins Restaurant. Vorher hatte er eine halbe Stunde einen Parkplatz gesucht.
_________________________________________________________________________
2) Sie macht ihr Examen. Vorher will sie noch ein Jahr im Ausland studieren.
_________________________________________________________________________
3) Sie löschte das Licht. Vorher las sie noch ein paar Seiten.
_________________________________________________________________________
4) Er zog nach München. Vorher hatte er zwölf Jahre in Berlin gewohnt.
_________________________________________________________________________
5) Sie frühstückte. Vorher hatte sie schon zwei Stunden am Computer gearbeitet.
_________________________________________________________________________
6) Stefan hielt eine Rede. Vorher kontrollierte er das Mikrophon.
_________________________________________________________________________
7) Sie fuhr in Urlaub. Vorher brachte sie ihren Wagen zur Inspektion.
_________________________________________________________________________
Bevor du mit dem Kopf durch die
Wand willst, überlege:
Was will ich im Nebenzimmer?
▪ nachdem (NS – vorzeitig)
Temporalsätze mit nachdem drücken eine Ungleichzeitigkeit zweier Handlungen aus. Die
Handlung des Nebensatzes tritt dabei zuerst ein, die Handlung des Hauptsatzes folgt nach dem
Nebensatz (invers zu der Konjunktion bevor). Das Verb des Nebensatzes steht dabei eine
Zeitstufe vor dem Verb des Hauptsatzes. Es gilt:
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
120
vorzeitig – Vergangenheit » nachdem / als
➢ Nachdem (Als) er geputzt hatte, sah er fern.
vorzeitig – Gegenwart » nachdem / wenn
➢ Nachdem (Wenn) er geputzt hat, sieht er fern.
➢ Nachdem er das Auto aufgeschlossen hatte, öffnete er die Fahrertür.
Plusquamperfekt Präteritum
➢ Nachdem er das Auto aufgeschlossen hat, öffnet er die Fahrertür.
Perfekt Präsens
Nebensätze, die mit nachdem eingeleitet werden, geben die vorausgehende
Handlung an.
Achtung! Haupt- und Nebensatz stehen in unterschiedlichen Zeitformen.
A85 Bilden sie Temporalsätze mit nachdem.
➢ Max hatte die Hausaufgabe gemacht. Anschließend sah er fern.
Nachdem Max die Hausaufgabe gemacht hatte, sah er fern.
Max sah fern, nachdem er die Hausaufgabe gemacht hatte.
1) Wir hatten dem Beamten unsere Pässe gezeigt. Anschließend durften wir weiterfahren.
_________________________________________________________________________
2) Ich hatte gegessen. Danach bestellte ich noch einen Kaffee.
_________________________________________________________________________
3) Der Arzt hatte den Patienten untersucht. Anschließend sprach er mit ihm.
_________________________________________________________________________
4) Sie hatte das Büro aufgeräumt. Dann aß sie zu Abend.
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
121
5) Er hat seine Arbeit beendet. Jetzt legt er die Akten in den Schrank.
_________________________________________________________________________
6) Sie hatte die Preise verglichen. Dann kaufte sie den neuen Wagen.
_________________________________________________________________________
7) Marion hat Pauls Telefonnummer gefunden. Jetzt ruft sie ihn an.
_________________________________________________________________________
A86 Paul hatte gestern seine erste Fahrstunde. Berichten Sie darüber.
Bilden Sie Sätze mit bevor (Präteritum – Präteritum) und nachdem (Plusquamperfekt
– Präteritum).
➢ ins Auto einsteigen – den Schlüssel ins Zündschloss stecken
Bevor Paul den Schlüssel ins Zündschloss steckte, stieg er ins Auto ein.
Nachdem Paul ins Auto eingestiegen war, steckte er den Schlüssel ins Zündschloss.
1) den Sicherheitsgurt anlegen – Auto starten
Bevor Paul das Auto _________________________________________________________
Nachdem er _______________________________________________________________
2) die Kupplung treten – den Gang einlegen
Bevor ____________________________________________________________________
Nachdem _________________________________________________________________
3) den Blinker setzen – Gas geben
Bevor ____________________________________________________________________
Nachdem _________________________________________________________________
4) in den Rückspiegel sehen - losfahren
Bevor ____________________________________________________________________
Nachdem _________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
122
A87 … und was hast du heute gemacht?
Verbinden Sie die einzelnen Stichpunkte vom Notizzettel zu ganzen Sätzen.
Der Pfeil zeigt, was zuerst und was dann passiert ist.
Ulrich erzählt von einer Konferenz, die den ganzen Tag gedauert hat. Dann fragt er Karin, was sie
heute alles gemacht hat. Sie ist Assistenzärztin in einem Krankenhaus.
➢ das Frühstück wegräumen Nachdem ich das Frühstück weggeräumt hatte,
ins Krankenhaus fahren bin ich ins Krankenhaus gefahren.
1) eine Besprechung mit Kollegen Bevor _____________________________________
haben die Visite machen __________________________________________
2) Mittagspause haben Als _______________________________________
die Kontoauszüge von der Bank __________________________________________
holen __________________________________________
3) E-Mails durchschauen Nachdem __________________________________
Sprechstunde halten __________________________________________
4) bei einer Operation zuschauen Bevor _____________________________________
nach Hause fahren __________________________________________
5) im Auto fahren mit meiner Während __________________________________
Freundin Ines telefonieren __________________________________________
6) etwas zum Abendessen einkaufen Nachdem __________________________________
die Nachrichten anschauen __________________________________________
7) (du) nach Hause kommen Bevor _____________________________________
ein bisschen schlafen __________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
123
A88 Am Sonntag wollen wir segeln gehen!
Ergänzen Sie die fehlenden temporalen Konjunktionen nachdem, bevor, seitdem, als,
wenn, während, sobald.
▪ Was machst du denn am Wochenende, 1 wenn das Wetter schön ist?
• 2 ______________ es windig wird, gehe ich zum Segeln. Und du? Kommst du mit?
▪ Ich muss noch für Montag eine Präsentation vorbereiten. 3 ______________ ich irgendetwas
unternehmen kann, sollte ich wenigstens drei Stunden gearbeitet haben.
• Aber würdest du mitkommen, 4 ______________ du deine Präsentation gemacht hast?
Du könntest ja auch auf dem Schiff noch lesen, 5 ______________ wir segeln!
▪ Ach, ich weiß nicht … 6 ______________ ich das letztes Jahr einmal versucht habe, konnte
ich mich gar nicht konzentrieren. Eigentlich kann ich nur gut lesen und arbeiten, 7 ________
ich an meinem Schreibtisch sitze.
• Schade … Aber pass auf, ich habe einen guten Plan: Wir stehen früh auf, und 8 __________
du dich an den Schreibtisch setzt, duscht du kalt. 9 ______________ du deine Präsentation
vorbereitest, mache ich uns ein wunderbares Frühstück, und 10 ______________ du fertig
bist, frühstücken wir und fahren dann zum Segeln. 11 ______________ wir einen super
Segeltag hatten, kannst du am Abend noch mal alles wiederholen.
▪ Was täte ich nur ohne dich! 12 ______________ wir zusammen sind, muss ich gar nicht
mehr selber denken …!
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
124
A89 Deutschland oder Österreich!
Ergänzen Sie.
bevor nachdem da seitdem nachdem bis
Mit 16 Jahren belegte ich in der Schule das Wahlfach Deutsch. 1 Seitdem lerne ich die deutsche
Sprache. 2 ______________ ich in meine Schulzeit beendet hatte, wollte ich nicht gleich
studieren. Deshalb schlugen meine Eltern mir vor, ein Jahr ins Ausland zu gehen und eine
Fremdsprache so gut zu lernen, 3 ______________ ich sie wirklich fließend sprechen konnte.
4 ______________ ich mich für eine Stadt entschied, sprach ich mit einer Freundin, die schon
öfters in Deutschland und Österreich war. Sie gab mir den Rat, das Jahr in Wien zu verbringen,
5 _____________ es eine sehr schöne und interessante Stadt ist. 6 ______________ ich im
Internet ein bisschen über Wien gelesen hatte, entschied ich mich spontan für diese wunder-
schöne und lebendige Stadt – und ich habe es nicht bereut!
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
125
LOKALE PRÄPOSITIONEN
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
126
Präpositionen stehen vor einem Nomen oder Pronomen und bestimmen dessen Kasus.
■ Hallo Judith, wohin gehst du?
► Ins Büro. Und du?
■ Ich muss zum Bahnhof. Ich fahre nach Köln.
► Wann geht denn dein Zug?
■ In einer halben Stunde.
► Ach, dann könnten wir doch noch schnell einen Kaffee in der Bar hier trinken!
■ Ja, gute Idee.
ab (Dativ) ab diesem Haus, ab hier
aus (Dativ) aus Tunesien, aus Oslo, aus der Apotheke
bei (Dativ) bei seinem Eltern, bei dieser Firma, bei mir
bis (Akkusativ) bis Hamburg, bis hierher
bis an (Akkusativ) bis an die Grenze
bis zu (Dativ) bis zur nächsten Kreuzung
durch (Akkusativ) durch den Park
entlang (Dativ/Genitiv oder Akkusativ) entlang dem Fluss / des Flusses / den Fluss entlang
gegen (Akkusativ) gegen den Wind
nach (Dativ) nach Dänemark, nach Paris
gegenüber (Dativ) dem Hotel gegenüber, gegenüber dem Hotel¹
um (Akkusativ … (herum) um die Stadt herum
von (Dativ) … aus von Köln aus, von hier aus
zu (Dativ) zu Laura, zum Arzt, zur Apotheke
¹ Besonders in der gesprochenen Sprache meist mit von benutzt (Gegenüber vom Bahnhof ist eine Bank.). Bei Nomen auch
nachgestellt möglich. Das klingt heutzutage jedoch etwas veraltet. (Dem Bahnhof gegenüber ist eine Bank.) Bei Pronomen nur
nachgestellt möglich. (Sie war mir gegenüber immer sehr freundlich.)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
127
Lokale Präpositionen stehen bei Fragen mit wo (Ort) , wohin (Richtung, Ziel)
oder woher (Herkunft).
Auf die Frage wohin? stehen diese Präpositionen im Akkusativ.
Auf die Frage wo? stehen diese Präpositionen im Dativ.
➢ Sie ging ins Wohnzimmer. Auf dem Sofa saß Dennis.
Einige Präpositionen bilden zusammen mit dem bestimmten Artikel eine Kurzform:
an dem » am
Dativ Akkusativ
an dem » am an das » ans
in dem » im in das » ins
von dem » vom auf das » aufs¹
zu dem » zum für das » fürs¹
bei dem » beim durch das » durchs¹
zu der » zur
¹ Meist in der gesprochenen Sprache benutzt
Präpositionen mit Genitiv¹
außerhalb nicht im Inneren Ich wohne lieber außerhalb der Stadt.
innerhalb im Inneren Dieses Ticket ist nur innerhalb der Stadt gültig.
¹ Besonders in der gesprochenen Sprache oft mit von (+ Dativ) benutzt. (Ich wohne lieber außerhalb von der Stadt. / Dieses Ticket ist
nur innerhalb von der Stadt gültig.)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
128
A90 Alles eine Frage der Perspektive
Ergänzen Sie die passende Präposition, wenn nötig mit Artikel.
Wo? Wohin? Woher?
Er ist … Er fährt … Er kommt …
1) beim Arzt. ______ Arzt. ______ Arzt.
2) ______ Büro. ______ Büro. ______ Büro.
3) ______ England. ______ England. ______ England.
4) ______ Strand. ______ Strand. ______ Strand.
5) ______ Theater. ______ Theater. ______ Theater.
6) ______ Bäckerei. ______ Bäckerei. ______ Bäckerei.
7) ______ Insel. ______ Insel. ______ Insel.
8) ______ Nachbarn. ______ Nachbarn. ______ Nachbarn.
9) ______ Berge. ______ Berge. ______ Berge.
10) ______ Anna. ______ Anna. ______ Anna.
A91 Ergänzen Sie die fehlende Präposition und Artikel.
➢ Warst du schon in der Schweiz? – Nein, ich fahre morgen in die Schweiz.
1) Warst du schon ____________ Bodensee? – Nein, ich fahre morgen ____ _____ Bodensee.
2) Warst du schon ____________ neuen Rathaus? – Nein, ich gehe ______________________
3) Warst du schon ______ dies______ Berg? – Nein, ich steige __________________________
4) Warst du schon ______ ______ Nordsee? – Nein, ich fahre ___________________________
5) Warst du schon ______ ______ Bergen? – Nein, ich fahre ____________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
129
A92 Wohin gehen Sie, …
Beantworten Sie die Fragen.
➢ Wenn Ihre Haare zu lang sind? (Friseur)
Wenn meine Haare zu lang sind, gehe ich zum Friseur.
1) Wenn Sie sich neue Kleidung kaufen möchten? (ein großes Kaufhaus)
_________________________________________________________________________
2) Wenn Sie eine Fremdsprache lernen möchten? (Volkshochschule)
_________________________________________________________________________
3) Wenn Sie einen Film sehen möchten? (Kino)
_________________________________________________________________________
4) Wenn Sie einen schönen Blick über Ihre Stadt haben möchten? (Kirchturm)
_________________________________________________________________________
5) Wenn Sie frisches Brot brauchen? (Bäcker)
_________________________________________________________________________
6) Wenn Sie Zahnschmerzen haben? (Zahnarzt)
_________________________________________________________________________
7) Wenn Sie sich mit Freunden treffen möchten? (Kneipe)
_________________________________________________________________________
8) Wenn Ihnen Ihre Portemonnaie gestohlen wurde? (Polizei)
_________________________________________________________________________
A93 Wohin gehen diese Leute am Wochenende?
1) Wohin geht Elsa in Wien? (Kunsthistorisches Museum, Burgtheater, Party)
2) Wohin geht Dietrich in Berlin? (Zoo, Wannsee, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz)
3) Wohin geht Jana in München? (Alte Pinakothek, Olympiastadion, Englischer Garten, ihre
Freundinnen)
4) Wohin geht Erik in Basel? (Kunstmuseum, Botanischer Garten, Grillabend)
5) Wohin geht Roland in Hamburg? (Hotel „Vier Jahreszeiten“, Gewürzmuseum, Planetarium)
6) Und wohin gehen Sie in …?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
130
A94 Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen.
➢ Am Wochenende fahre ich zu Klaus.
1) Wann bist du zuletzt ____________ Petra gewesen?
2) Kannst du mir bitte Milch ____________ dem Supermarkt mitbringen?
3) Es gab einen Unfall. Der Wagen fuhr ____________ den Baum.
4) Wie komme ich ____________ Bahnhof? – Der nächste Weg ist hier ____________ die Fuß-
gängerzone.
5) Julia will nicht allein ____________ Hannover fahren.
6) Dieser Vogel kommt ____________ einem fernen Land.
7) Holst du mich ____________ Flughafen ab?
8) Setz dich doch bitte mir ____________.
9) Unsere Nachbarin ist so neugierig, sie sieht sogar ____________ das Schlüsselloch.
10) Fährst du dieses Jahr ____________ Spanien oder fliegst du?
11) Der Mond kreist ____________ die Erde.
12) Die Straße führt den Fluss ____________.
13) Am Sonntag gehe ich ____________ meinen Eltern.
14) Wo wohnt eigentlich Richard? Nicht weit von hier, nur ____________ die Ecke.
15) Wann willst du endlich ____________ Arzt gehen?
16) Ich habe in Frankfurt ____________ Freunden übernachtet.
17) ____________ Bahnhof ____________ sind Sie in fünf Minuten im Zentrum.
18) Alle Gäste sitzen ____________ den Tisch.
19) Ich hole das Paket ____________ der Post ab.
20) ____________ der Straße stehen schöne alte Bäume.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
131
A95 Ergänzen Sie die Endungen.
➢ Wir gingen in den großen Saal.
1) Ich habe das in d______ Zeitung gelesen.
2) Was hast du da in d______ Hand?
3) Stell bitte den Stuhl in d______ Flur.
4) Kannst du mir die Adresse auf ein______ kleinen Zettel schreiben?
5) Hinter m______ standen eine Menge Leute an d______ Kinokasse.
6) In dies______ Gegend regnet es häufig.
7) Stell den Koffer auf d______ Boden.
8) Hinter d______ Haus gibt es einen wunderschönen Obstgarten.
9) Wir setzen uns in d______ Schatten eines Baumes.
10) Auf dies______ Insel gibt es sehr viele seltene Tiere.
11) Der Junge kletterte auf d______ Baum.
12) An viel______ Orten des Landes gibt es zu wenig Wasser.
13) Er stellte seine Hausschuhe unter d______ Sofa.
14) Du kannst dich ruhig neben m______ setzen.
15) Das Haus liegt zwischen d______ Schillerstraße und d______ Marktplatz.
16) Pass auf, wenn du über d______ Straße gehst!
17) Der Junge versteckte sich unter d______ Decke.
18) Wie lange leben Sie schon in d______ Bundesrepublik.
19) Es läutete und vor d______ Tür stand Kevin.
20) Du darfst hier keine Poster an d______ Wände hängen.
21) Dieter stellte sich zwischen Rita und m______.
22) Setzt die Mütze auf d______ Kopf!
23) Zwischen d______ beiden Ländern fließt ein Fluss.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
132
A96 Wo oder wohin?
Ergänzen Sie den Artikel.
➢ Stellst du bitte die Stehlampe neben den Sessel?
1) Hast du den Topf auf ______ Kochplatte gestellt?
2) In der 30. Spielminute schoss der Fußballspieler den Ball in ______ Tor.
3) Petra und Peter gehen auf ______ Berg.
4) Dein Führerschein liegt immer noch auf ______ Schreibtisch.
5) Wollen wir diese Lampe über ______ Esstisch hängen?
6) Unter ______ Stadt gab es früher Katakomben.
7) Ich warte vor ______ Eingang auf dich.
8) In ______ Restaurant kann man sehr gut essen.
9) Ich habe die Dokumente in ______ Schrank gelegt.
10) Du kannst dein Auto direkt vor ______ Haustür parken.
A97 Mein Handy ist weg!
Bilden Sie Fragen im Perfekt wie im Beispiel.
➢ es / Auto / lassen? Hast du es im Auto gelassen?
1) schon / dein, Handtasche – nachsehen? ____________________________________
2) es / vielleicht / Büro / vergessen? ____________________________________
3) schon / Küche / suchen? ____________________________________
4) schon / Schrank / nachgucken? ____________________________________
5) es / Straßenbahn / verlieren? ____________________________________
6) es / ausschalten? ____________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
133
A98 Der Weg zum Picknickplatz
Ergänzen Sie die Präpositionen.
auf innerhalb entlang gegenüber in durch gegenüber an
außerhalb vor nach entlang zu
Für Sonntagnachmittag hat Elfriede ein großes Picknick mit Freunden organisiert, doch ihre beste
Freundin kann nicht mit allen zusammen fahren. Sie kommt etwas später nach, kennt aber den
Weg zu der Wiese nicht, auf der das Picknick stattfinden soll. Elfriede beschreibt den Weg:
➢ Du fährst mit deinem Fahrrad etwa zwei Kilometer den Fluss entlang.
1) Dann, dem Gasthaus „Brückenfischer“ ____________, führt ein kleiner Feldweg __________
den Wald hinein.
2) Dem folgst du eine ganze Weile. Noch ____________ des Waldes, kurz _____________ dem
Ende, kommst du ____________ einer Kreuzung und fährst ____________ links.
3) Diesen Weg ____________ fließt ein kleiner Bach.
4) Nach 200 Metern kommst du ____________ ein Tor, das in eine große Schafweise
hineinführt.
5) Du darfst mit dem Fahrrad ____________ diese Schafweide fahren.
6) Sobald du dich wieder ________________ dieser Schafweide befindest, siehst du einem alten
großen Baum ____________ eine Wiese.
7) Und wenn du richtig gefahren bist, findest du uns ____________ dieser Wiese!
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
134
Nicht verwechseln! Es gibt auch lokale Adverbien. Diese Wörter stehen allein, nicht bei einem
Nomen.
hier, da, dort Wo? Er wohnt nebenan.
draußen, drinnen, drüben
oben, unten, innen, außen
vorn, hinten, links, rechts
überall, irgendwo, anderswo
nebenan
verneint: nirgends, nirgendwo
dorthin, (hier)her Woher?/Wohin? Setzen Sie sich bitte dorthin.
rein, raus, rüber, runter, rauf
irgendwohin, irgendwoher
aufwärts, abwärts, vorwärts, rückwärts
verneint: nirgendwohin, nirgendwoher
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
135
A99 Otto hat es nicht leicht.
Formulieren Sie Fragen wie im Beispiel.
a) Otto ist immer am falschen Ort.
➢ Otto ist draußen. Otto, kannst du mal bitte reinkommen?
1) Otto ist drinnen. _____________________________________________________
2) Otto ist oben. _____________________________________________________
3) Otto ist untern _____________________________________________________
4) Otto ist drüben. _____________________________________________________
b) Die Gegenstände sind auch am falschen Ort.
➢ Der Blumentopf steht noch draußen im Garten. (bringen)
Otto, kannst du bitte den Blumentopf reinbringen.
1) Der Fotoapparat liegt oben auf dem Schrank. (holen)
_________________________________________________________________________
2) Der Zucker steht drüben am anderen Ende des Tisches. (geben)
_________________________________________________________________________
3) Das Paket steht draußen vor der Tür. (holen)
_________________________________________________________________________
4) Die Weinflaschen stehen unter im Keller. (holen)
_________________________________________________________________________
5) Mein Wintermantel hängt oben auf dem Dachboden. (bringen)
_________________________________________________________________________
6) Die Handtücher sind im Kleiderschrank. (geben)
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
136
TEMPORALE PRÄPOSITIONEN
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
137
Temporale Präpositionen stehen bei Fragen mit wann? oder wie lange?
ab (Dativ oder Akkusativ) ab nächster Woche, ab nächste Woche, ab morgen
an (Dativ) am Morgen, am Montag, ich bin am 24.4.1999 geboren
aus (Dativ) aus dieser Zeit, aus dem letzten Jahrhundert
außerhalb (Genitiv) außerhalb der Öffnungszeiten
bei (Dativ) beim Essen
bis (Akkusativ) bis drei Uhr, bis bald
für (Akkusativ) für eine Woche
gegen (Akkusativ) gegen 19:00 Uhr
in (Dativ) im August, im Sommer, in einer Woche, im Herbst
Aber: Jahreszahl (im Deutschen Meine Tochter ist 2010 geboren.
ohne Präposition)
innerhalb (Genitiv) innerhalb einer Woche
nach (Dativ) nach Weihnachten
seit (Dativ) seit einem Jahr
um (Akkusativ) um 17:00 Uhr
von (Dativ) … an von morgen an
von (Dativ) … bis (Akkusativ) von Oktober bis März
vor (Dativ) vor einer Woche
über (Akkusativ) Wir fahren übers (= über das) Wochenende in die Berge.
während (Genitiv)¹ während der Ferien
zu (Dativ) zu dieser Zeit
zwischen (Dativ) zwischen dem 15. Mai und dem 1. Juni
¹ In der gesprochenen Sprache meist mit Dativ
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
138
Bei Wechselpräpositionen in temporaler Bedeutung steht auf die Frage wann? der Dativ.
(Ausnahme: über + Akkusativ)
A100 Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen.
➢ Hier können Sie am Montag nicht mehr Parken, weil dann hier eine Baustelle ist.
1) Wir können ____________ Wochenende mal ____________ einem Glas Wein über alles
sprechen.
2) Kannst du mir ____________ ein paar Stunden dein Auto borgen?
3) Sie hat schon ____________ einem Jahr den Führerschein gemacht.
4) Ich werde dich morgen ____________ Mittag anrufen, aber ich weiß nicht genau wann.
5) Sie muss die Diplomarbeit ____________ eines Jahres fertigstellen.
6) Silvia will ____________ des Sommers ein Praktikum machen.
7) Diese Fossilien stammen ____________ der Kreidezeit.
8) Wir möchten ____________ dem Abendessen ins Kino gehen.
9) Er studiert jetzt schon ____________ zwei Jahren im Ausland.
10) ____________ Wochenende soll das Wetter besser werden.
11) Können Sie ____________ einen Augenblick auf meine Tasche aufpassen.
A101 Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen.
➢ Am 12. Oktober 1810 feierte Kronprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I., seine Vermäh-
lung mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen.
1) Die Wiese trägt ____________ dieser Zeit zu Ehren der Braut den Namen „Theresienwiese“.
2) Das Pferderennen fand ____________ Jahr 1810 erstmals statt.
3) ____________ 1896 stellten die Wirte so genannte Bierburgen auf der Wiese auf.
4) ____________ des Oktoberfestes sind etwa 8.000 Personen fest angestellt.
5) ____________ den ersten Jahren war das Angebot noch nicht sehr groß.
6) Das Angebot hatte aber ____________ den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts zugenommen.
7) Das Oktoberfest findet ____________ Mitte September ____________ Anfang Oktober statt.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
139
A102 Außerhalb unserer Geschäftszeiten
Markieren Sie die richtige Präposition und ergänzen Sie die fehlenden Endungen.
➢ Leider rufen Sie während/außerhalb/unserer Geschäftszeiten an. Diese sind Montag bis
Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr. Auf Wiederhören.
1) Innerhalb/Während d____ Gottesdienst____ ist das Fotografieren verboten.
2) Das Projekt sollte innerhalb/während ein____ Jahr____ abgeschlossen sein.
3) Außerhalb/Innerhalb d____ Unterrichtszeit dürfen die Schüler ihre Handys anmachen.
4) Innerhalb/Während ein____ Konzert____ sollte man nicht essen, was man während/
außerhalb ein____ Kinovorstellung ruhig tun darf.
5) Kredite müssen außerhalb/innerhalb ein____ bestimmten Frist zurückgezahlt werden.
A103 Gesprochene Sprache: überhaupt, ganz und gar
a) Lesen Sie die folgende Sätze.
Ich habe keine Zeit. Ich habe überhaupt keine Zeit./Ich habe gar keine Zeit.
Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Das Bild ist hässlich. Das Bild ist ganz hässlich.
Der Pullover ist weich. Der Pullover ist ganz weich.
Redemittel: Verstärkte Aussage
Wenn man im Deutschen eine Aussage verstärken möchte, verwendet man oft Wörter wie
überhaupt, gar oder ganz.
Beachten Sie:
überhaupt bedeutet generell. Es steht meistens mit einer Negation, kann aber auch in
Sätzen ohne Negation stehen, z. B.:
Es schneit. Ich weiß nicht, ob die Züge überhaupt fahren.
gar ist in der Regel mit einer Negation verbunden.
ganz steht in Aussagesätzen und verstärkt die Bedeutung des Adjektivs.
In Kombination mit gut bedeutet es nicht sehr gut, sondern nicht
besonders gut.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
140
b) Verstärken Sie die Aussagen mit überhaupt, ganz oder gar.
1) Das Essen schmeckt mir nicht.
_________________________________________________________________________
2) Das war ein toller Film!
_________________________________________________________________________
3) Mir geht es nicht gut.
_________________________________________________________________________
4) Ich habe lange gelernt, doch ich weiß nichts!
_________________________________________________________________________
5) Von Grammatik habe ich keine Ahnung!
_________________________________________________________________________
6) Ich habe keine Lust.
_________________________________________________________________________
7) Ich finde das nicht lustig.
_________________________________________________________________________
8) Ich habe schreckliche Kopfschmerzen.
_________________________________________________________________________
9) Ich kann mir das nicht vorstellen.
_________________________________________________________________________
10) Otto sieht jetzt anders aus.
________________________________________________________________________
A104 Pünktlich oder unpünktlich?
In Deutschland legt man sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Man erwartet, dass Studenten zu Beginn
der Lehrveranstaltungen anwesend sind, dass man die Partner bei Geschäftsverhandlungen nicht
warten lässt, dass Gäste pünktlich zum Essen kommen, dass die Züge pünktlich fahren usw.
a) Wie wichtig ist Pünktlichkeit in Ihrem Land? Berichten Sie.
▪ Kommt man zu geschäftlichen Terminen pünktlich (auf die Minute genau)?
▪ Kommt man zu einer Party oder einem privaten Essen pünktlich?
▪ Fahren die öffentlichen Verkehrsmittel pünktlich oder überhaupt nach einem Fahrplan?
▪ Ärgern Sie sich darüber, wenn öffentliche Verkehrsmittel nicht pünktlich sind oder eine
Person zu spät zu einer Verabredung kommt?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
141
b) Welche Wörter und Wendungen passen zu Pünktlichkeit, welche zu Unpünktlichkeit?
jemand kommt auf die Minute genau – jemand nimmt es mit der Zeit nicht so genau – ein
Zug hat Verspätung – jemand kommt immer zu spät – jemand gibt eine (Diplom-)Arbeit
rechtzeitig ab – jemand hält einen Termin ein – alles läuft nach Plan - …
Pünktlichkeit Unpünktlichkeit
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
A105 Die innere Uhr
Wann können wir was am besten bzw. am schlechtesten? Ordnen Sie zu. Denken Sie an
Ihre Erfahrungen im Alltag.
Die beste Zeit für Arztbesuch: Wir empfinden die wenigsten Schmerzen – Wir arbeiten am
genauesten – Unser Immunsystem arbeitet perfekt – Unsere Stimmung ist auf dem
Tiefpunkt – Unser Herzschlag ist am höchsten – Unser Gehirn ist besonders kreativ – Wir
können uns am schlechtesten konzentrieren – die schlechteste Zeit zum Autofahren
3:00 bis 4:00 Uhr die schlechteste Zeit zum Autofahren.
8:00 bis 9:00 Uhr _________________________________________________________
10:00 bis 12:00 Uhr _________________________________________________________
14:00 Uhr Unsere Stimmung ist auf dem Tiefpunkt.
12:00 bis 15:00 Uhr _________________________________________________________
15:00 bis 16:00 Uhr _________________________________________________________
16:00 Uhr _________________________________________________________
22:00 Uhr _________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
142
A106 Fragen Sie Ihre Nachbarin/Ihren Nachbarn und berichten Sie.
▪ Wann können Sie/kannst du am besten schlafen?
▪ Wann lernen Sie/lernst du am liebsten?
▪ Wann arbeiten Sie/arbeitest du am schnellsten?
▪ Wann können Sie sich/kannst du dich am schlechtesten konzentrieren?
▪ Wann fühlen Sie sich/fühlst du dich besonders fit?
▪ Wann haben Sie/hast du den größten Hunger?
A107 Ergänzen Sie frei.
➢ Um 9:00 Uhr stehe ich auf/beginne ich zu arbeiten/habe ich gestern im Stau gestanden.
1) Am Montag ________________________________________________________________
2) Im August _________________________________________________________________
3) Im Winter _________________________________________________________________
4) In zwei Wochen ____________________________________________________________
5) Vor dem Essen _____________________________________________________________
6) Beim Kochen ______________________________________________________________
7) Nach dem Essen ___________________________________________________________
8) Während des Films _________________________________________________________
9) Bis zum Urlaub _____________________________________________________________
10) Seit September _____________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
143
A108 Ergänzen Sie die Präpositionen, wenn nötig.
Manchmal gibt es mehrere Lösungen.
➢ am Freitag 9) _____________ Abend
1) _____________ 10:15 Uhr 10) _____________ Herbst
2) _____________ Vormittag 11) _____________ Wochenende
3) _____________ Sonntag 12) _____________ Sommer
4) _____________ Juli 13) _____________ 18:00 und 19:00 Uhr
5) _____________ 1799 14) _____________ Moment
6) _____________ der Besprechung 15) _____________ Skifahren
7) _____________ drei Wochen 16) _____________ 15. Januar
8) _____________ des Urlaubs 17) _____________ des Essens
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
144
Nicht verwechseln! Es gibt auch temporale Adverbien.
bald, damals, dann, heutzutage, Wann? Gestern habe ich Fritz getroffen.
inzwischen, jetzt, nun, schließlich,
vorhin, zuletzt
heute, morgen, gestern, übermorgen
verneint: nie, niemals
immer stets, lange, noch Wie lange? Ich werde dich immer lieben.
verneint: nie, niemals
häufig, manchmal, oft, selten Wie oft? Ich gehe oft ins Kino.
einmal, zweimal, dreimal
A109 Was passt in die Gegenwart, in die Vergangenheit, in die Zukunft?
Ordnen Sie zu.
gestern vorhin heute morgen früher damals bald momentan
demnächst heutzutage jetzt nun künftig gegenwärtig nachher
später neulich kürzlich gleich sofort einst
Vergangenheit Gegenwart Zukunft
gestern,
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
145
A110 Ergänzen Sie die temporalen Adverbien. Es gibt mehrere Lösungen.
➢ Paul, es ist dringend, ich muss dich jetzt unbedingt sprechen.
1) Warte, ich zieh nur noch meinen Mantel an, ich komme _____________.
2) Frau Schulze, ich habe ______ keine Zeit, das Dokument zu kopieren. Ich mache das ______.
3) Oma erzählte gerne, wie es _____________ war.
4) Weißt du, wen ich ____________ im Supermarkt getroffen habe? – Albert, meine Jugendliebe.
5) Diplomatische Gespräche zwischen den beiden Staaten sind _____________ nicht möglich.
6) Du hast dein Zimmer noch immer nicht aufräumt! Mach das bitte _____________!
7) Geht ihr _______ in die Kantine essen? Ich habe noch so viel zu tun, ich komme __________.
A111 Früher und heute
Bilden Sie Sätze im Perfekt und Präsens.
➢ wohnen Früher habe ich bei meinen Eltern gewohnt, heute wohne ich in einer 3-
Zimmer-Wohnung in München.
1) aufstehen ___________________________________________________________
___________________________________________________________
2) fahren ___________________________________________________________
___________________________________________________________
3) arbeiten ___________________________________________________________
___________________________________________________________
4) schreiben ___________________________________________________________
___________________________________________________________
5) hören ___________________________________________________________
___________________________________________________________
6) fernsehen ___________________________________________________________
__________________________________________________________
7) lesen ___________________________________________________________
__________________________________________________________
8) ins Bett gehen ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
146
LESEN
&
LESEVERSTEHEN
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
147
B1 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
BERLIN
Berlin ist nicht nur Weltmetropole und die Hauptstadt Deutschlands, sondern auch meine
Heimatstadt.
Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit komme ich an vielen berühmten Sehenswürdigkeiten
vorbei. Da ist zunächst der Große Tiergarten, welcher schon über 500 Jahre alt ist. Von hier ist
es nicht weit bis zum Brandenburger Tor und der Siegessäule. Hier steige ich in die U-Bahn und
fahre einige Stationen bis zum Alexanderplatz, wo sich die Weltzeituhr und das Wahrzeichen der
Stadt, der Fernsehturm befinden.
Von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zum Kurfürstendamm, der riesigen Einkaufs-
straße mit zahlreichen Restaurants, Geschäften und Hotels.
Hier arbeite ich als Hotelfachfrau und betreue die zahlreichen Gäste des Hotels, welche als
Touristen Berlin besichtigen. Als echte Berlinerin kann ich ihnen dabei gute Tipps geben, welche
Sehenswürdigkeiten sich wirklich lohnen und wie sie auf dem besten Wege dorthin gelangen.
Sehr oft kommt man so mit den Gästen unserer Stadt ins Gespräch und erfährt, aus welchen
Länder sie angereist sind und ob es Ihnen in Berlin gefällt. Als besonderen Service bietet unser
Hotel auch eigene Stadtrundfahrten an, die immer sehr gern gebucht werden.
B2 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) Wie alt ist der Große Tiergarten?
a. 500 Jahre c. wenige Jahre
b. wenige Minuten d. Das steht nicht im Text.
2) In der Nähe welches Platzes befinden sich Weltzeituhr und Fernsehturm?
a. Brandenburger Tor c. Kurfürstendamm
b. Alexanderplatz d. Siegessäule
3) Was ist der Kurfürstendamm?
a. Ein Hotel c. Eine Einkaufsstraße
b. Ein Restaurant d. Eine Hauptstadt
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
148
4) Wo arbeitet die Erzählerin?
a. am Alexanderplatz c. in einem Geschäft
b. in einem Hotel d. in einem Restaurant
5) Was bietet das Hotel als besonderen Service für seine Gäste?
a. eine Weltzeituhr c. Kostloses Frühstück
b. Fahrkarten für die U-Bahn d. Stadtrundfahrten
B3 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
EIN TAG IN FRANKFURT AM MAIN
Peter aus Wien landet am Flughafen Frankfurt am Main. Dieser Flughafen ist der größte deutsche
Flughafen. Damit Peter in die Innenstadt kommt, fährt er mit der S-Bahn. In 15 Minuten ist er
schon dort. In Frankfurt leben viele Studenten. Sie studieren an Fachhochschulen und der
Universität.
In Frankfurt stehen die höchsten Häuser Europas. Diese Stadt wird auch „Mainhattan“ genannt.
Peter möchte gerne die Stadt von oben sehen. Der Main Tower eignet sich dafür sehr gut. Es gibt
hier zwei Aussichtsterrassen in 198 Meter Höhe. Es ist gut, wenn man für diesen Anblick
schwindelfrei ist. Der höchste Gebäude ist der Europaturm mit 337 Meter. Er ist außerhalb der
Stadt.
Ganz neu erbaut ist die „neue Altstadt“. Im Krieg wurden die Häuser zerstört. Jetzt wurden im
ältesten Stadtteil zwischen Dom und Römerberg historische Altstadthäuser nachgebaut.
Der Rathausplatz heißt auch Römerberg. Hier stehen viele schöne Fachwerkhäuser. Das Rathaus
mit seinen drei stufenförmigen Giebeln ist Ziel von vielen Besuchern. Der Dom von Frankfurt ist
ein Kaiserdom. Hier wurden deutsche Kaiser gekrönt.
Eine Shopping-Tour gehört bei einen Aufenthalt in Frankfurt dazu. Die Einkaufsstraße heißt „Zeil“.
Hier findet man nicht nur teure Designerware, sondern auch preiswerte Geschäfte. Peter möchte
hier etwas für seine Freundin kaufen. Er geht gerne auf den Flohmarkt. Leider findet der in
Frankfurt nur am Samstag statt.
Typisches Essen und Getränke möchte er noch probieren. Im Stadtteil Sachsenhausen gibt es
besonders viele Kneipen. Dort trinkt Peter „Ebbelwoi“. Einen Apfelwein, das Nationalgetränk in
Hessen. Dazu gehört deftiges Essen, am liebsten Rippchen mit Sauerkraut.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
149
B4 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) Mit welchem Verkehrsmittel kommt Peter in die Innenstadt?
a. Taxi c. S-Bahn
b. Straßenbahn d. U-Bahn
2) Welcher Wolkenkratzer hat zwei Aussichtsterrassen?
a. Europaturm c. Opernturm
b. Messeturm d. Main Tower
3) Wie heißt der Rathausplatz noch?
a. Hausberg c. Hessenplatz
b. Römerberg d. Frankfurter Platz
4) Wie heißt die beliebteste Einkaufsstraße von Frankfurt?
a. Mariahilfer Straße c. Frankfurter Allee
b. Kö d. Zeil
5) Das Nationalgetränk in Frankfurt?
a. Bier c. Ebbelwoi
b. Kölsch d. Weißwein
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
150
B5 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
EIN TAG IN HAMBURG
In Hamburg gibt es sehr viel Interessantes zu sehen. Ein Tag ist viel zu wenig. Hamburg hat ein
dichtes U-Bahn-Netz. Damit kommen wir gut von einem Platz zum anderen. Hamburg liegt am
Meer. Der Hafen und die vielen Schiffen sind die größte Sehenswürdigkeit. Wir machen eine
Hafenrundfahrt. Dabei ist die Stadt vom Wasser aus zu sehen.
Der Fischmarkt am Hafen ist etwas für Frühaufsteher. Der Markt im Stadtteil Altona findet jeden
Sonntag statt. Das bunte Treiben beginnt dort um 5 Uhr und ist um 9:30 Uhr schon wieder vorbei.
Frische Fisch- und Krabbenbrötchen muss man unbedingt essen. Die Marktschreier sind
sehenswert. Sie bieten nicht nur Fisch an. Auch Pflanzen und Obst werden verkauft.
Die Speicherstadt aus Backsteinbauten ist seit 2015 Weltkulturerbe. Es ist das größte
Lagerhausensemble der Welt. Auf einem alten Lagerhaus wurde die Elb-Philharmonie gebaut.
Das Konzerthaus wurde 2016 fertiggestellt. Diese moderne Bauwerk ist sehenswert. Die Elbe
fließt durch Hamburg und mündet in die Nordsee. Ein Spaziergang am Ufer ist sehr schön.
Im Schanzenviertel, das die Hamburger „die Schanze“ nennen, gibt es viele alternative Läden,
Cafés, Restaurants und Szenelokale.
Die Sankt Michaelis Kirche ist das kirchliche Wahrzeichen von Hamburg. Die Hamburger nennen
den 132 Meter hohen Turm Michel. Von der Aussichtsplattform sehen die Besucher über ganz
Hamburg. Mit einem Aufzug ist die Plattform in 100 Meter Höhe gut zu erreichen.
Interessant ist auch der Besuch auf der Reeperbahn, einem beliebten und bekannten
Vergnügungsviertel.
B6 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) Welcher Fluss fließt durch Hamburg?
a. Donau c. Elbe
b. Rhein d. Nordsee
2) Wie nennen die Hamburger den Turm der Michaelis Kirche?
a. Franzl c. Karl
b. Hans d. Michel
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
151
3) Wie heißen die Verkäufer am Fischmarkt?
a. Wasserrufer c. Marktschreier
b. Fischverkäufer d. Hafenschreier
4) An welchem Tag findet der Fischmarkt statt?
a. Montag c. Freitag
b. Mittwoch d. Sonntag
5) Was ist die Elb-Philharmonie?
a. Kirche c. Konzerthaus
b. Parkhaus d. Restaurant
B7 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
EIN TAG IN HEIDELBERG
Heidelberg ist eine wunderschöne Stadt. Die älteste Universität Deutschlands befindet sich in
Heidelberg. Daher leben hier viele Studenten und Wissenschaftler. Bei Touristen ist diese Stadt
sehr beliebt. Es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten. Ein Tag ist zu wenig, um alles zu sehen. Wir
müssen das Wichtigste auswählen. Viele Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Altstadt und
im Zentrum.
Das Wahrzeichen von Heidelberg ist die Schlossruine aus rotem Sandstein. An dem Schloss
wurde 300 Jahre gebaut. Es befindet sich oberhalb der Altstadt. Die Schlossruine erreicht man zu
Fuß oder mit den Heidelberger Bergbahnen. Diese Bahn besteht aus zwei Teilen. Der untere Teil
ist sehr modern. Der obere Teil ist die älteste Bergbahn Deutschlands. Dieser Teil steht unter
Denkmalschutz. Eine traumhafte Aussicht haben die Besucher von Gipfel des Kaiserstuhls. Zum
Schloss gehört der Schlosspark „Hortus Palatinus“. Hier ist es wunderschön. Besondere Pflanzen,
Wasserspiele und Skulpturen sind zu sehen.
Heidelberg liegt am Neckar. Die Karl-Theodor-Brücke ist eine Fußgängerbrücke über den Fluss.
Die Bogenbrücke wurde im zweiten Weltkrieg gesprengt. Seit 1947 ist sie wieder aufgebaut und
wird „Alte Brücke“ genannt.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
152
In Heidelberg gibt es viele enge Gassen, viele kleine Geschäfte und Lokale. Der Marktplatz gehört
zu den ältesten Plätzen der Stadt. Hier sind wunderschöne alte Häuser zu sehen. Auch das
Rathaus und die gotische Heiliggeistkirche befinden sich hier. Es ist ein autofreier Platz. Jung und
Alt treffen sich gerne hier in Straßencafés und Kneipen. In der Mitte des Marktplatzes steht der
sehenswerte Herkulesbrunnen.
B8 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) An welchem Fluss liegt Heidelberg?
a. am Rhein c. an der Donau
b. am Neckar d. an der Mosel
2) Wie wird die Karl-Theodor-Brücke genannt?
a. Neckarbrücke c. Heidelberger Brücke
b. Fußgängerbrücke d. Alte Brücke
3) Aus welchem Stein ist das Schloss erbaut?
a. aus weißem Marmor c. aus gelben Sandstein
b. aus rotem Sandstein d. aus grauen Ziegeln
4) Aus wie vielen Streckenteilen bestehen die Heidelberger Bergbahnen?
a. aus einem c. aus zwei
b. aus drei d. aus vier
5) Wie heißt der Brunnen in der Mitte des Marktplatzes?
a. Kaiserbrunnen c. Marienbrunnen
b. Herkulesbrunnen d. Universitätsbrunnen
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
153
B9 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
EIN TAG IN KÖLN
Nilas ist zum ersten Mal in Köln. Köln ist eine Stadt im Nordwesten von Deutschland. Die Stadt ist
bekannt für ihr besonderes Bier und für den Karneval. Am Karneval ziehen alle Bewohner von
Köln Masken und Kostüme an und tanzen, trinken und singen gemeinsam auf den Straßen.
Das Bier aus Köln hat den Namen „Kölsch“. Niklas probiert das Bier: Es schmeckt mild. Er
entscheidet sich dennoch, es nicht zu kaufen – er trinkt normalerweise kein Alkohol.
Direkt vor dem Hauptbahnhof staunt Niklas über den Kölner Dom. Der Dom ist eine riesige
katholische Kirche. Im 18. Jahrhundert war es für einige Zeit das größte Gebäude der Welt. Niklas
ist beeindruckt von der Architektur der Kirche. Nicht weit entfernt vom Dom fließt der Rhein. Dort
besucht Niklas ein Schokoladenmuseum. Es gibt dort einen Brunnen aus Schokolade.
Zuletzt entdeckt Niklas einen kleinen Laden mit Schmuck. Er heißt „Rosa Rosa“. Dort kauft er sich
einen Anhänger mit dem Symbol des Kölner Doms. Es wird ihn immer an die Stadt erinnern. Es
ist ein Souvenir.
B10 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) Was bedeutet „mild“?
a. intensiv c. bitter
b. sanft d. sauer
2) Wo ist der Kölner Dom?
a. Am Stadtrand. c. Im Rhein.
b. Neben dem Hauptbahnhof. d. Neben dem Schokoladenmuseum.
3) Für was ist Köln nicht bekannt?
a. für den Karneval c. für das Kölsch
b. für den Kölner Dom d. für den Schokoladenbrunnen
4) Was kauft sich Niklas in Köln?
a. Schokolade. c. Einen Anhänger des Kölner Doms.
b. Ein Kölsch. d. Ein Buch über Architektur.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
154
5) Was ist ein Souvenir?
a. Ein Schmuckstück. c. Ein Gegenstand, der an etwas erinnert.
b. Eine Biersorte. d. Eine Kirche.
B11 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
EIN TAG IN MÜNCHEN
Ich mag Fußball und habe zum Geburtstag Eintrittskarten für ein tolles Fußballspiel in der Allianz
Arena bekommen. Das Fußballstadion ist die neueste Sehenswürdigkeit in München. Das Stadion
hat außen 3.000 Luftkissen, die mit LED-Beleuchtung in vielen Farben leuchten können. Auf
diesen Anblick freue ich mich.
Ich habe den ganzen Tag Zeit und möchte etwas von München kennenlernen. Der Marienplatz ist
ein guter Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung. Hier steht das Rathaus. München ist die
Landeshauptstadt von Bayern. Das Rathaus schaut alt aus, ist aber erst 1905 im neugotischen
Stil erbaut worden. In dem prächtigen Bauwerk ist der Sitz des Oberbürgermeisters. Mit dem Lift
fahre ich auf die Aussichtsplattform und bewundere die fantastische Aussicht.
Es ist nicht weit zur Frauenkirche. Diese Kirche mit den zwei Zwiebeltürmen ist ein Wahrzeichen
der Stadt. Der Anblick der Türme ist sehr bekannt. Von dort oben hat der Besucher einen Blick
über die ganze Stadt.
Der Englische Garten ist das Freizeitparadies der Stadt. Der Münchner machen auf der Wiese
Picknick, spielen Fußball oder treffen Freunde. Der Park ist ideal für einen Spaziergang. Es gibt
viele Gaststätten.
München ist für die Biergärten bekannt. Gemütlichkeit und Gastfreundschaft lerne ich hier kennen.
In zentraler Lage befindet sich das weltberühmte Hofbräuhaus. Kellnerinnen und Kellner in
bayerischer Tracht servieren typische Köstlichkeiten wie Schweinhaxen, Weißwurst, Leberkäse
oder Steckerlfisch. Das Bier wird im Maßkrug serviert. Der enthält einen Liter Bier,
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
155
B12 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) Was ist die Allianz Arena?
a. Bürohaus c. Fußballstadion
b. Schwimmhalle d. Rathaus
2) München ist die Landeshauptstadt von …
a. Nordrhein-Westfalen c. Bayern
b. Hessen d. Sachsen
3) Wie viele Türme hat die Frauenkirche?
a. keinen c. zwei
b. einen d. vier
4) Was ist die Bekleidung der Kellner im Hofbräuhaus?
a. schwarzer Anzug c. Jeans
b. kurze Hosen d. Tracht
5) Wie viel Bier passt in einen Maßkrug?
a. ein halber Liter c. ein Viertelliter
b. ein Liter d. hundert Milliliter
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
156
B13 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
DAS WETTER
Das Wetter in Deutschland ist vielseitig. Je nach Jahreszeit ändert es sich grundlegend. Es gibt
Wettervorhersagen im Fernsehen oder im Radio, die die Aussichten für die nächsten Tage liefern.
Der Winter kündigt sich durch Forst an. Draußen ist es sehr kalt und Schnee bedeckt die
Landschaft. Mit dem Beginn des Frühlings schmelzen das Eis und der Schnee, da die
Temperaturen steigen und es warm wird. Im Frühling gibt es viele sonnige Tage.
Die Sonne brennt im Sommer auf der Haut. Ab und zu blitzt und donnert es heftig, Gewitter ziehen
auf. Meistens ist es sehr heiß und trocken.
Das ändert sich mit der Ankunft des Herbstes. Alles kühlt ab und das Wetter wird rauer. Wolken
bedecken den Himmel und dichter Nebel erschwert die Sicht. Es regnet häufiger. Nach dem
Regen bilden sich oft bunte Regenbögen am Himmel. Manchmal kommt es zu Hagelfällen. Die
Tage im Herbst sind oft windig und nass. Wenn der Wind sehr stark bläst, entsteht ein Sturm. Mit
dem Herbst bereitet sich die Natur wieder auf den Winter vor.
B14 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) Das Wetter ist abhängig …
a. von der Wettervorhersage. c. vom Wochentag.
b. von der Jahreszeit. d. von den Hagelfällen.
2) Im Frühling gibt es …
a. viel Eis und Schnee c. kalte Temperaturen
b. viele Stürme d. sonnige Tage
3) Wodurch kann man das Wetter der nächsten Tage erfahren?
a. durch die Wettervorhersage c. durch die Wolken
b. durch eine Wahrsagerin d. Es ist unmöglich.
4) In welcher Jahreszeit schneit es am meisten?
a. im Sommer c. im Winter
b. im Herbst d. im Frühling
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
157
5) Im Herbst …
a. … regnet es oft. c. … fällt viel Schnee.
b. … ist es heiß. d. … schmelzen das Eis und der Schnee.
B15 Lesen Sie den folgenden Text, markieren Sie am besten schon beim Lesen des Textes
die unbekannten Wörter und suchen die Bedeutungen heraus.
DIE VIERJAHRESZEITEN
Wenn die Vögel zwitschern und die Blätter an den Bäumen wachsen, hat der Frühling begonnen,
Die Menschen freuen sich auf den Frühling. In dieser Jahreszeit wird alles lebendig. Die Blumen
blühen in verschiedenen Farben und die Bienen bestäuben die Pflanzen. Die Natur erwacht.
Manchmal tanzt ein Schmetterling über das grüne Gras.
Nach dem Frühling kommt der Sommer. Im Sommer ist es heiß. Viele fahren in den Ferien ans
Meer und liegen den ganzen am Strand. Wegen der Sonne tragen sie Sonnenbrillen. Die Massen
gehen ins Schwimmbad, um im Wasser zu schwimmen und Spaß zu haben.
Im Herbst kühlt alles ab. Die Sonne verschwindet hinter den Wolken und es regnet häufig. Überall
sieht man Regenschirme. Während die Blätter von den Bäumen fallen, fahren die Bauern die
Ernte ein. Die Welt erscheint braun und trüb.
Es wird immer kälter. Der Winter kommt und die Natur erstirbt. Die Menschen ziehen sich ihre
Jacken, Mützen, Schals und Handschuhe an. Warme Kleidung ist bei der Kälte im Winter wichtig.
Das Wasser in den Seen und Teichen wird zu Eis. Kinder spielen im Schnee und freuen sich über
die weiße Pracht. An Weihnachten wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert. Die Familien
sitzen zusammen in ihren warmen Wohnungen und verbringen Zeit miteinander. Dabei bekommt
jeder ein Geschenk. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. An Silvester begrüßt man das neue Jahr.
Wenn der Winter vorbei ist, beginnt der Kreislauf der Jahreszeiten von Neuem.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
158
B16 Haben Sie den Text verstanden?
Kreuzen Sie die richtige Antwort a, b, c oder d an.
1) Im Frühling …
a. erwacht die Natur. c. regnet es oft.
b. fällt viel Schnee. d. ist es sehr kalt.
2) In welcher Jahreszeit ist es sehr heiß?
a. im Winter c. im Sommer
b. im Herbst d. im Frühling
3) Im Herbst …
a. feiert man die Geburt von Jesus. c. schneit es.
b. beginnt die Ernte. d. fahren die Leute ans Meer.
4) Was feiert man an Weihnachten?
a. den Beginn des neuen Jahres c. die Schmetterlinge
b. den Schnee d. die Geburt von Jesus
5) In welcher Jahreszeit fallen die Blätter von den Bäumen?
a. im Herbst c. im Frühling
b. im Winter d. im Sommer
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
159
B17 Lesen und hören Sie den folgenden Text.
HABEN SIE NOCH ZEIT?
„Ich habe überhaupt keine Zeit!“ oder „Ich bin total im
Stress!“, das sind Sätze, die wir jede Woche hören oder
sagen. Doch warum? Was machen wir mit unserer Zeit?
Tun wir nicht manchmal Dinge, die absolut nicht
notwendig sind?
Denken Sie zum Beispiel an einen Fahrstuhl. Wie oft
haben Sie schon auf den Fahrstuhl gewartet und
während des Wartens ungefähr siebenmal auf den
Fahrstuhlknopf gedrückt? Warum haben Sie nicht
einfach die Treppe genommen und sind in den zweiten
Stock gelaufen? Das ist mit Sicherheit die schnellere Variante, denn nicht nur das Warten auf den
Fahrstuhl kostet Zeit. Wenn der Fahrstuhl endlich angekommen ist, öffnet sich die Tür, acht
Menschen verlassen den Fahrstuhl, acht andere Menschen betreten den Fahrstuhl, jeder drückt
eine andere Etage und kurz bevor der Fahrstuhl losfährt, öffnet sich die Tür noch einmal. Nummer
neun möchte auch noch mitfahren.
Oder denken Sie an die Gespräche, die Sie jeden Tag mit Kollegen oder Freunden führen.
Psychologen meinen, dass 60 Prozent aller Gespräche von Menschen handeln, die nicht
anwesend sind. Das nennt man Klatsch und Tratsch. Nun ist es nicht sinnvoll, auf den Klatsch zu
verzichten, denn aus den Fehlern der anderen können wir ja selbst etwas lernen. Wenn man aber
die Gespräche um 50 Prozent verkürzt, spart man eine Menge¹ Zeit.
Auch mit den neuen Medien kann man sehr viel Zeit verschwenden. Es gibt Leute, die bei eBay
einen Koffer für den Urlaub kaufen wollen und nach vier Stunden im Internet Besitzer eines Autos
sind, obwohl sie gar keinen Führerschein haben. Und wie oft telefonieren Sie mit Ihrem Handy,
um jemandem zu sagen, dass Sie gerade im Zug sitzen?
Der größte Zeitkiller aber ist das Fernsehen. Interessanterweise kennen Menschen, die gar keine
Zeit haben, das Fernsehprogramm am besten. Sie wissen, dass der Talkshow-Moderator eine
grüne Krawatte trug oder was in einer TV-Serie gerade passiert. Auf die Frage „Woher nimmst du
so viel Zeit zum Fernsehen?“ antworten sie immer das Gleiche: „Der Fernseher läuft bei mir nur
nebenbei.“ Aber wissen natürlich, dass es nicht wenige Menschen gibt, die gar nicht in der Lage
sind, zwei Dinge gleichzeitig zu tun.
¹ eine Menge = viel
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
160
B18 Zeitverschwendung
a) Wo, wann bzw. womit verschwenden wir nach Auffassung des Textautors unsere Zeit?
mit warten auf den Fahrstuhl
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
b) Wo, wann bzw. womit verschwenden Sie Ihre meiste Zeit?
B19 Wortschatzarbeit
a) Kreuzen Sie an. Was ist richtig, was ist falsch?
richtig falsch
1) Das Warten auf den Fahrstuhl ist eine zeitraubende Tätigkeit.
2) Klatsch und Tratsch sind besonders wichtig für unser Sozialleben.
3) Im Internet und beim Telefonieren kann man viel Zeit verlieren.
4) Menschen, die keine Zeit haben, sehen auch nicht fern.
b) Suchen Sie die richtigen Erklärungen.
(1) der Fahrstuhl (a) über nicht anwesende Leute reden
(2) der (zweite) Stock (b) etwas nicht können
(3) Klatsch und Tratsch (c) die Etage/das Stockwerk
(4) auf etwas verzichten (d) etwas kostet unnötig viel Zeit
(5) Besitzer (e) der Lift
(6) Zeitkiller (f) Eigentümer
(7) nicht in der Lage sein, etwas zu tun (g) etwas nicht mehr machen bzw. nicht haben
wollen
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
161
c) Finden Sie das Gegenteil.
verschwenden losfahren verkürzen verlassen laufen öffnen
1) Zeit für Gespräche verlängern Zeit für Gespräche ____________________
2) den Fahrstuhl betreten den Fahrstuhl ________________________
3) die Tür schließen die Tür __________________________ sich
4) der Fahrstuhl hält der Fahrstuhl ____________ ____________
5) Zeit sparen Zeit ________________________________
6) der Fernseher ist aus der Fernseher ________________________
B20 Was passt zusammen?
(1) Denken Sie zum Beispiel (a) mit den neuen Medien.
(2) Wie oft warten Sie (b) auf die Frage immer das Gleiche.
(3) Viele Menschen verschwenden ihre Zeit (c) von Menschen, die nicht anwesend sind.
(4) Die Gespräche handeln (d) an den Fahrstuhl.
(5) Verzichten Sie doch (e) auf den Klatsch!
(6) Sie antworten (f) auf den Fahrstuhl?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
162
B21 Freizeit: Museen
Berichten Sie.
▪ Was machen Sie am Wochenende?
▪ Wie oft besuchen Sie ein Museum?
▪ Welche Museen gibt es in Ihrer Stadt?
B22 Sprechen Sie über die Grafik „Museumsreif“.
Das Thema der Grafik ist … Am beliebtesten sind die …
Man kann in der Grafik sehen, dass … An erster Stelle stehen die …
Die Grafik zeigt, dass … Danach folgen die …
… (die Kunstmuseen) die meisten Besucher haben. Nicht so beliebt sind die …
… Millionen Menschen … Museen besuchen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
163
B23 Museumsbesuch in Berlin
Deutsches Technikmuseum Berlin
Sie sind in Berlin und Ihre Reisegruppe geht heute
(DTMB)
Nachmittag ins Museum. Sie haben die Auswahl
zwischen drei Museen. Kurzinformationen dazu Alte und neue Technik zum Erleben
finden Sie auf dieser Seite.
Seit 1982 entsteht in der alten und neuen
Für welches Museum entscheiden Sie sich? Mitte Berlins ein Technikmuseum von
internationaler Bedeutung. Gegenwärtig
Begründen Sie Ihre Wahl? präsentieren 14 Abteilungen auf rund
25.000 qm² ihre Schätze: Verkehrsmittel,
Ich entscheide mich für das … Kommunikationsmedien, Produktions- und
Energietechniken. Das Museum verfügt
Ich bevorzuge das …, weil ich mich für …
über ein Oldtimer-Depot mit 70
interessiere. Automobilen und Motorrädern und über
einen Museumspark mit Brauerei und
Ich finde … sehr interessant, deshalb gehe ich am
Mühlen. Mit der Dauerausstellung zur Luft-
liebsten in das …
und Raumfahrt ist der Neubau jetzt
vollständig eröffnet. In fast jeder Abteilung
finden Vorführungen und Aktivitäten statt.
Bröhan-Museum – Zahlreiche historische Maschinen und
Modelle werden in Funktion gezeigt und
Landesmuseum für Jugendstil erklärt.
Art Deco und Funktionalismus (1889 – 1939)
Das Bröhan-Museum ist ein Spezial- und
Epochenmuseum. Es stellt die Zeit vom DDR-Museum
Jugendstil bis zum Art Deco und
Das erste und einzige DDR-Museum
Funktionalismus mit ausgewählten Beispielen
aus Glas, Porzellan, Silber und Metall dar. befindet sich in Berlin.
Auch Möbel, Teppiche, Lampen, Grafiken und
Was ist von 40 Jahren Leben in der DDR
Gemälde können die Besucher bewundern.
geblieben? Es gibt bereits zahlreiche
Sammlungs-Schwerpunkte sind Arbeiten des
Ausstellungen zu den Themen Berliner Mauer
französischen und belgischen Art Nouveau und
oder Staatssicherheit. Doch kein einziges
des deutsche und skandinavischen
Museum in der Hauptstadt zeigt das Leben
Jugendstils. Das Bröhan-Museum verfügt über
und Aufwachsen in der DDR. Im DDR-
eine außergewöhnliche Porzellansammlung
Museum können die Besucher ein Stück
berühmte Hersteller.
DDR-Kultur erleben. Wie ist das Gefühl, wenn
die Staatssicherheit die Wohnung abhört? Ist
ein Neubau-Wohnzimmer gemütlich und wie
sitzt man in einem Trabant¹? Die
Dauerausstellung zeigt in 16 Bereichen (z. B.
Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Urlaub, Mode,
Kultur) den Alltag in der DDR. Sie wurde
gemeinsam von Historikern und ehemaligen
¹ Trabant = kleines Auto aus der DDR DDR-Bürgern zusammengestellt.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
164
B24 Ihr Lieblingsmuseum
▪ Stellen Sie ein Museum vor, das Sie besonders mögen.
▪ Wo befindet sich das Museum?
▪ Wie sieht das Museum aus?
▪ Was wird dort ausgestellt?
▪ Was finden Sie dort besonders interessant/schön/inspirierend?
▪ Was wissen Sie noch über dieses Museum?
B25 Interessieren Sie sich für bildende Kunst?
a) Hören Sie eine Radioumfrage zum Thema: Interessieren Sie sich für bildende Kunst?
Was ist richtig, was falsch? Kreuzen Sie an.
richtig falsch
1. Person: Der Mann hält nichts von moderner Kunst.
2. Person: Der Mann ist der Meinung, dass Museen viel mehr
Fotografien ausstellen sollten.
3. Person: Der Mann verbindet Museumsbesuche oft mit Reisen
in große Städte.
4. Person: Die Frau interessiert sich für alle Kunstrichtungen und
besucht regelmäßig Kunstausstellungen.
b) Berichten Sie.
▪ Interessieren Sie sich für bildende Kunst? Wenn ja, für welche? (Malerei, Bildhauerei,
Fotografie …)
▪ Können Sie selbst gut malen oder zeichnen? Wenn ja, haben Sie schon mal etwas
ausgestellt?
▪ Kennen Sie einen Künstler/eine Künstlerin persönlich?
▪ Wer ist Ihr Lieblingsmaler/Ihre Lieblingsmalerin?
▪ Haben Sie schon einmal ein Bild (ein Ölbild/ein Aquarell/eine Zeichnung) gekauft?
Wenn ja, im Original oder als Druck?
▪ Was hängt über Ihrem Sofa?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
165
B26 Lesen und hören Sie den folgenden Text.
KUNST IST IN
Die Deutschen sind Weltmeister! In keinem anderen Land gibt es pro Kopf so viele Museen und
nirgendwo werden sie so gut besucht. Vor 30 Jahren gab es in Deutschland 1.500 Museen, heute
sind es über 6.000. 110 Millionen Besucher kommen im Jahr. Tendenz steigend. Wenn man die
vielen Galerien und Ausstellungen in Banken und Einkaufszentren dazuzählt, muss man
feststellen: Es gehen mehr Menschen ins Museum als ins Kino. Kunst ist das neue
Massenmedium, Kunst ist Erfolg.
So gehört es seit etwa zwei Jahren zu jedem Partygespräch, eine Meinung über Kunst zu haben
und zeitgenössische Künstler wie Neo Rauch zu kennen. Die Kunst ist mitten im Leben
angekommen, das heißt auch, mitten im Geschäftsleben. Bei den Kunstauktionen in London stieg
der Umsatz im letzten Jahr um 19 Prozent. 477 Kunstwerke kosteten mehr als eine Million Dollar.
Der englische Künstler Damien Hirst verkaufte einen konservierten Haifisch für neun Millionen
Dollar und ein Werk des 33-jährigen Leipziger Malers Matthias Weischer erzielte bei einer Auktion
einen Preis von 384.854 Dollar. Der Künstler bekam allerdings von diesem Geld nichts, er hatte
das Bild vor drei Jahren für 2.000 Dollar verkauft.
Wer für ein echtes Ölbild nicht
100.000 Euro bezahlen möchte
kann, bekommt es bei
Deutschlands größtem Kunst-
handel auch billiger: bei Ikea.
Dort kann man ab 79,95 Euro
zwischen Sommerblumen,
einem Haus in einsamer
Landschaft oder einer Straße im
Nebel wählen. Das richtige
„Ölbildgefühl“ ist auch bei Ikea
der Grund für die steigende
Nachfrage.
Das Interesse an Kunst erobert auch die Kunsthochschulen. Zurzeit gibt es in Deutschland 84.000
Studenten in den Studienrichtungen Kunst und Kunstwissenschaft. Das sind 4.000 Studenten
mehr als für Medizin. Doch nur fünf Prozent aller Künstler können von ihrer Kunst leben. Das
durchschnittliche Einkommen von Künstlern, sagt die Künstlersozialkasse, liegt bei 10.000 Euro
im Jahr. Daran ändern auch die explodierenden Preise nichts.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
166
B27 Welche Aussage ist richtig?
Kreuzen Sie an.
1) In Deutschland gibt es heute
a) die meisten Museen der Welt.
b) 15.000 Museen.
c) über 6.000 Museen.
2) Das Interesse an Kunst
a) ist seit Jahren unverändert groß.
b) steigt noch immer.
c) stagniert.
3) Kunst
a) gehört heute zum Alltag.
b) ist für eine Elite.
c) ist der größte Absatzmarkt von Ikea.
4) Die meisten Künstler in Deutschland
a) können gut leben.
b) profitieren vom Kunstmarkt.
c) können von ihrer Kunst nicht leben.
B28 Was gehört zusammen?
a) Verbinden Sie die Wörter.
1) Öl- -besucher
2) Kunst- -schlange
"Es gibt Maler, die die Sonne in
3) Ausstellungs- -handel
einen gelben Fleck verwandeln.
4) Warte- -medium Es gibt aber andere, die dank
5) Massen- -explosion ihrer Kunst und Intelligenz
6) Preis- -bild einen gelben Fleck in die
Sonne verwandeln können.“
Pablo Picasso
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
167
b) Verbinden Sie die Sätze.
1) Kunst gehört seit Jahren für neun Millionen Dollar.
2) Man muss eine Meinung bei einer Auktion einen hohen Preis.
3) Damien Hirst verkaufte einen Haifisch von ihrer Kunst leben.
4) Das Werk eines Leipziger Künstler erzielte zu jedem Partygespräch.
5) Nur wenige Künstler können über Kunst haben.
6) Das Einkommen von Künstlern liegt an der Situation nichts.
7) Die explodierenden Preise ändern im Durchschnitt bei 10.000 Euro im Jahr.
B29 Über Kunstwerkt sprechen
a) Kennen Sie eins oder mehrere der abgebildeten Gemälde? Wenn ja, welches/welche?
b) Welches Bild gefällt Ihnen am besten? Begründen Sie Ihre Auswahl.
• Ich finde (das erste/zweite …) Bild sehr schön./Das … Bild gefällt mir am besten.
• Ich mag … abstrakte Bilder/gegenständliche Bilder/Bilder von alten Meistern/Bilder von
zeitgenössischen Künstlern …
• Mir gefallen leuchtende/dunkle/helle Farben.
• Das Bild inspiriert mich/beruhigt mich/regt meine Fantasie an.
• Wenn ich das Bild sehe, denke ich an …
1 2 3
4 5
1. Albrecht Dürer: Hase (1502) 2. Vincent van Gogh: Sternennacht (1889) 3. Paul Klee: Südliche
Gärten (1936) 4. Gerhard Richter: Tisch (1982) 5. Neo Rauch: Weiche (1998)
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
168
B30 Gerhard Richter
Gerhard Richter ist der international erfolgreichste deutsche Maler der Gegenwart. Er zählt zu
den prominentesten Vertretern der deutschen Nachkriegskunst.
Lesen und hören Sie den folgenden Text. Ergänzen Sie den Verben unten im Infinitiv.
GERHARD RICHTER
Gerhard Richter wurde am 9. Februar 1932 in Dresden geboren. Er wuchs in den Orten Reichenau
und Waltersdorf auf. Von 1948-1951 machte er eine Ausbildung zum Werbe- und Theatermaler
in Zittau. Anschließend arbeitete er in einem Fotolabor und als Werbe- und Bühnenmaler. 1952
begann er mit einem Studium an der Dresdner Kunstakademie und schloss es mit einem
Wandgemälde als Diplomarbeit ab. 1961, vor dem Bau der Mauer, zog er nach Düsseldorf um
und studierte hier bis 1963 an der Kunstakademie.
Ende der 1960er-Jahre arbeitete er als Kunsterzieher und 1967 als Gastdozent an der Hochschule
der Bildenden Künste in Hamburg. Von 1971-1993 lehrte er als Professor für Malerei an der
Kunstakademie Düsseldorf. Seit 1998 lebt und arbeitet Richter in Köln.
Während der ersten Hälfte der 1960er-Jahre kooperierte Richter in gemeinsamen Ausstellungen
mit Sigmar Polke, Konrad Lueg und Manfred Kuttner. Mit ihnen erfand er dem Kapitalistischen
Realismus. Das war seine ironische Antwort auf den Sozialistischen Realismus. Mit dem
Kapitalistischen Realismus wollte Richter die westliche Konsumgesellschaft kritisch darstellen.
1962 begann der Künstler mit seinem „Atlas“. Er sammelte Zeitungsausschnitte, Fotografien,
Farbstudien, Landschaften, Portraits, Stillleben und historische Stoffe, die ihm als Vorlagen für
Gemälde dienten. Schon 1964 erhielt Richter die Gelegenheit zur ersten Einzelausstellung und
bald präsentierten viele in- und ausländische Galerien seine Werke. 1972 nahm er an der Biennale
von Venedig teil.
Gerhard Richters internationale künstlerische Anerkennung stieg immer weiter, so dass er in den
Jahren 1993/1994 große Ausstellungen in Paris. Bonn, Stockholm und Madrid hatte. 2002 feierte
ihn das Museum of Modern Art in New York anlässlich seines 70. Geburtstag mit einer
umfassenden Retrospektive. Diese Retrospektive war mit 188 Exponaten die größte Ausstellung
eines lebenden Künstlers, die in MoMA stattfand.
Die breite internationale Resonanz von Gerhard Richter beruht nicht nur auf seinen nach
Fotografien gemalten Bildern. Faszinierend sind auch die Gegensätze in seinem Werk: Auf der
einen Seite finden wir fotorealistische Naturdarstellungen, auf der anderen Seite stehen die
unscharfen Gemälde nach Fotografien und Gemälde höchster Abstraktion.
aufwachsen, __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
169
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B31 Was passt zusammen?
Kombinieren Sie.
(1) in Reichenau (a) beginnen
(2) eine Ausbildung (b) aufwachsen
(3) mit dem Studium (c)umziehen
(4) das Studium (d) präsentieren
(5) nach Düsseldorf (e) machen
(6) an einer Hochschule (f) lehren
(7) Zeitungsausschnitte und Fotografien (g) abschließen
(8) Kunstwerke in einer Galerie (h) teilnehmen
(9) an einer Ausstellung (i) sammeln
B32 Bilden Sie Sätze im Präteritum.
Achten Sie auf den Satzbau.
➢ am 9. Februar 1932 / Gerhard Richter / in Dresen / geboren werden
Gerhard Richter wurde am 9. Februar 1932 in Dresden geboren.
1) er / in den Orten Reichenau und Waltersdorf / aufwachsen
_________________________________________________________________________
2) von 1948 bis 1951 / er / zum Theatermaler / eine Ausbildung / machen
_________________________________________________________________________
3) anschließend / er / als Werbe- und Bühnenmaler / arbeiten
_________________________________________________________________________
4) 1952 / in Dresden / mit einem Studium / er / beginnen
_________________________________________________________________________
5) nach Düsseldorf / 1961 / er / umziehen
_________________________________________________________________________
6) als Professor für Malerei / von 1971 bis 1993 / er / an der Kunstakademie Düsseldorf / lehren
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
170
7) mit einigen Kollegen / Gerhard Richter / den Kapitalistischen Realismus / erfinden
_________________________________________________________________________
8) 1972 / an der Biennale von Venedig / er / teilnehmen
_________________________________________________________________________
B33 Lesen und hören Sie den folgenden Text.
UMGANGSFORMEN IM GESCHÄFSLEBEN
Manche Leute glauben, dass gutes Benehmen oder Tischmanieren veraltet sind und ins 18.
Jahrhundert gehören. In dieser Zeit, genauer gesagt 1788, hat Adolph Freiherr von Knigge ein
Buch mit dem Titel Über den Umgang mit Menschen geschrieben, das viele praktische Tipps
enthält. Doch wer denkt, die alten Verhaltensregeln aus dem 18. Jahrhundert würden heute nicht
mehr gelten, der irrt sich. Gute Manieren sind modern. Fast jeden Monat erscheint auf dem
Büchermarkt ein neuer Ratgeber mit Tipps und Tricks für das richtige Verhalten im
Geschäftsleben. Nach einer aktuellen Umfrage unter 600 Führungskräften sehen 87% der
Manager einen direkten Zusammenhang zwischen persönlichen Erfolg und gutem Benehmen.
Vor allem in Branchen mit Kundenkontakt ist gutes Benehmen sehr wichtig und vereinfacht den
Abschluss von Geschäften.
Hier finden Sie einige Hinweise, die Sie im Umgang mit deutschen Geschäftspartnern beachten
sollten.
Pünktlichkeit
„Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.“ Wer sich bei einem Kundenbesuch verspätet, muss
den Kunden noch vor dem vereinbarten Zeitpunkt informieren. Verspätungen sollten aber die
absolute Ausnahme sein.
Begrüßung
Das Grüßen spielt in Deutschland eine sehr wichtige Rolle. Wenn jemand nicht grüßt, gerät er
schnell in den Verdacht, unhöflich zu sein. Für den mündlichen Gruß gilt: Wer zuerst sieht, grüßt
zuerst. Bei der Begrüßung mit Handschlag gibt der Gastgeber dem Gast, die ältere Person der
jüngeren die Hand. Wenn man gerade sitzt, muss man zur Begrüßung aufstehen. Vor allem in
Ländern, in denen man Körperkontakt meidet, empfindet man die deutsche Sitte des Hände-
schüttelns oft als unangenehm.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
171
Vorstellung
Im Deutschen stellt man sich mit dem Vor- und Nachnamen vor und man sieht sich beim Vorstellen
in die Augen. Die Anrede erfolgt mit Herr oder Frau und dem Nachnamen. Akademische Titel
werden mitgenannt. Die Gelegenheit ist günstig, um eine Visitenkarte zu überreichen. Wenn Sie
vor einer anderen Person eine Visitenkarte erhalten, dürfen Sie die Visitenkarte nicht achtlos
einstecken, sondern Sie müssen sie zuerst lesen. Und denken Sie immer daran: In Deutschland
sagt man im Geschäftsleben „Sie“. Duzen Sie nur, wenn jemand Sie mit „Du“ anspricht.
Kleidung
Die Kleidung richtet sich nach der Branche und nach den Kunden. In Branchen, die viel mit Geld
zu tun haben, wie Banken oder Versicherungen eher ein klassisches Outfit. In kreativen
Berufszweigen, also in Werbefirmen oder in der IT-Branche, ist die Kleidung informeller. Im
Rahmen der Internationalisierung wird in vielen Unternehmen freitags unter dem Motto „Casual
Friday“ gute Freizeitkleidung getragen.
Geschäftsessen
Bei Geschäftsessen heißt die Regel: Wer einlädt, bezahlt. Trinkgeld gibt man in Deutschland
zwischen fünf und zehn Prozent. Zum Essen wünscht man „Guten Appetit!“. Ein bisschen
schwieriger wird es bei den Gesprächsthemen. Meiden sollten Sie Themen wie Politik, Religion,
Krankheiten, die Konkurrenz oder private Probleme. Gute Gesprächsthemen sind Hobbys, Sport,
das Wetter, der letzte Urlaub, Reisen und andere Länder und das Geschäft selbst.
B34 Welche Aussage ist richtig?
a) Kreuzen Sie an. (Die Reihenfolge der Aufgaben folgt nicht immer der Reihenfolge des
Textes.)
1) Gute Umgangsformen sind
a) heute nicht mehr aktuell.
b) bei Banken und Versicherungen wieder modern.
c) wichtig für die Karriere.
2) Die Kleidung
a) ist in deutschen Firmen immer formell.
b) hat großen Einfluss auf die Karriere.
c) hängt von den Kunden bzw. der Branche ab.
3) In Deutschland
a) betrachtet man Pünktlichkeit als Höflichkeit.
b) ist Pünktlichkeit unwichtig.
c) müssen Mitarbeiter pünktlich sein und Chefs nicht.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
172
4) Das Händeschütteln
a) ist auf der ganzen Welt beliebt.
b) gehört in Deutschland zur Begrüßung.
c) ist nur unter Kollegen üblich.
5) Bei einem Geschäftsessen ist es wichtig,
a) dass man alles über den Geschäftspartner erfährt.
b) dass man unverbindlichen Smalltalk macht.
c) dass man über die Konkurrenz spricht.
b) Formulieren Sie Empfehlungen wie im Beispiel.
➢ die folgenden Hinweise beachten
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Hinweise zu beachten.
1) zu einem Geschäftstermin pünktlich kommen
Ich empfehle Ihnen, _________________________________________________________
2) in Deutschland dem Gast die Hand geben
_________________________________________________________________________
3) bei Begrüßung dem Gast in die Augen sehen
_________________________________________________________________________
4) die Visitenkarte nicht achtlos einstecken
_________________________________________________________________________
5) deutsche Geschäftspartner mit „Sie“ ansprechen
_________________________________________________________________________
6) immer die passende Kleidung tragen
_________________________________________________________________________
7) bei einem Geschäftsessen nicht über Politik und Religion sprechen
_________________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
173
Infinitiv mit zu
Nach empfehlen und raten steht oft ein Infinitiv mit zu.
➢ Ich empfehle dir, die richtige Kleidung zu tragen.
➢ Ich rate dir, mit Kunden nicht über Politik zu sprechen.
Nach Modelverben steht kein Infinitiv mit zu.
➢ Sie dürfen mit Kunden nicht über Politik sprechen.
B35 Berichten Sie.
▪ Was fällt Ihnen zu dem Wort Werbung ein? Assoziieren Sie.
▪ Sehen, hören oder lesen Sie manchmal Werbung?
▪ Welche Werbeformen gibt es in Ihrem Heimatland?
(Fernsehspots, Radiospots, Zeitungsannoncen, Plakate, Werbung per Post,
Internetwerbung, Werbung per SMS …)
▪ Haben Sie einmal etwas gekauft, weil Ihnen eine Werbung besonders gut gefallen hat?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
174
B36 Werbung im Fernsehen
a) Lesen Sie Ergebnisse einer Umfrage.
Werbung findet man im Fernsehen überall. Hier ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage
zum Thema: Werbung im Fernsehen.
b) Welche Werbeform stört Sie im Fernsehen am meisten? Berichten Sie.
c) Finden Sie die richtige Erklärung.
Kurzer Werbefilm Sponsorenwerbung
Versteckte Werbung z. B. in Spielfilmen oder Serien Werbespot
Werbung z. B. bei Sportveranstaltungen zum Imagegewinn Produktplacement
Mehrere aufeinanderfolgende Werbespots Werbeblock
d) Was kann man miteinander verbinden? (Manchmal gibt es mehrere Lösungen.)
Konsum- -veranstaltungen
Sport- -unterbrechungen
Spielfilm- -übertragungen
Fußball- -verhalten
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
175
B37 Lesen und hören Sie den folgenden Text.
WERBUNG BIS 1900
Historiker sind der Meinung, dass Werbung schon sehr alt ist. Geht man von der Definition aus,
dass Werbung „alle Maßnahmen zur Absatzförderung“ umfasst, gab es tatsächlich schon im alten
Ägypten vor 6.000 Jahren Werbung. Dazu zählen zum Beispiel kommerzielle Werbetafeln aus
Stein, die man in den Ruinen von Pompeji gefunden hat, oder die Marktschreier, die früher von
Markt zu Markt zogen und laut ihre Produkte zum Verkauf anboten.
Die moderne Werbung begann aber erst im 17. Jahrhundert mit der Geburt der ersten
Tageszeitung 1650 in Leipzig. Endlich gab es ein passendes Medium zur Verbreitung der
Werbung. Neben der Werbung in Zeitungen entstanden schnell spezielle Werbezeitungen, in die
Händler gegen Bezahlung ihre Waren eintragen konnten. Diese Werbezeitungen standen unter
staatlicher Kontrolle und der Staat verdiente bei jeder Anzeige mit. Um noch mehr Geld zu
verdienen, hat König Friedrich Wilhelm I. die Werbung in Tageszeitungen sogar ganz verboten.
Erst 1850 nach der Einführung der Pressefreiheit durften Tageszeitungen wieder Werbeanzeigen
drucken.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veränderte sich die Werbung. Am Anfang hatten die
Anzeigen mehr den Charakter von Produktbeschreibungen, ab 1870 wurden sie immer
fantasievoller. Die Werbung begann, sich an spezielle soziale Schichten zu richten. Heute nennt
man das Zielgruppenwerbung. Es entstand der erste Boom in der Werbebranche. Der
Anzeigenteil nahm in den Zeitungen immer mehr Platz ein, der Anteil aktueller Berichte oder
Nachrichten wurde immer kleiner. Gegen 1900 bestanden in einigen Großstädten die Zeitungen
bis zu 80% aus Werbung.
Um die Jahrhundertwende starteten Unternehmen wie Maggi oder Nivea große Werbekam-
pagnen, um ihre Produkte als Marken zu etablieren. Aus diesen frühen Werbeaktionen der
Industrie entstanden berühmte Markennamen, die noch heute oft mit Produktnamen gleichgesetzt
werden (Nivea = Hautcreme, Maggi = Suppenwürze). In dieser Zeit versuchten die Firmen
erstmals, Wünsche bei den Konsumenten zu wecken. Die Werbung stellte nicht nur das Produkt
in schönen Bildern dar, sondern sie wollte den Konsumenten auch davor überzeugen, dass er
das Produkt unbedingt braucht. Eine weitere Entwicklung dieser Zeit war die Etablierung von
Scheinwelten. Das Produkt wurde mit Träumen und Wünschen verbunden, die beim Kauf in
Erfüllung gehen. Die Werbung begann, mit den Träumen der Menschen zu spielen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
176
B38 Ordnen Sie die im Text unterstrichenen Wörter den Erklärungen zu.
Zielgruppenwerbung Pressefreiheit Scheinwelt Maßnahmen zur Absatzförderung
Marktschreier Werbezeitungen der erste Boom zum erste Mal
1) Strategien zur Steigerung der Verkaufszahlen
________________________________________________________________
2) Menschen, die zum Beispiel auf Marktplätzen laut ihre Produkte anbieten
________________________________________________________________
3) eine Zeitung, die nur aus Werbung besteht
________________________________________________________________
4) der Staat hat keine Kontrolle über die Medien
(außer im Rahmen der bestehenden Gesetze)
________________________________________________________________
5) Werbung für eine ganz bestimmte Käufergruppe
________________________________________________________________
6) der erste wirtschaftliche Erfolg
________________________________________________________________
7) eine frei erfundene Welt
________________________________________________________________
8) erstmals
________________________________________________________________
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
177
B39 Beantworten Sie die Fragen zum Text in ganzen Sätzen.
1) Wann gab es die erste Werbung?
_________________________________________________________________________
2) Welche Beispiele werden für die frühe Werbung angeführt?
_________________________________________________________________________
3) Wann begann die „moderne“ Werbung?
_________________________________________________________________________
4) Wer verdiente mit den Werbezeitungen viel Geld?
_________________________________________________________________________
5) Was hat König Wilhelm I. getan, um noch mehr Geld zu verdienen?
_________________________________________________________________________
6) Wann veränderte sich die Werbung?
_________________________________________________________________________
7) Was veränderte sich?
_________________________________________________________________________
8) Welches Werbeziel hatten die Firmen um die Jahrhundertwende?
_________________________________________________________________________
B40 Ergänzen Sie die fehlenden Verben im Präteritum.
stehen wollen verbinden verdienen anbieten entstehen verändern
starten versuchen beginnen bestehen spielen
➢ Marktschreier boten früher laut ihre Produkte zum Verkauf an.
1) Die moderne Werbung _______________________ im 17. Jahrhundert.
2) Es _______________________ schnell spezielle Werbezeitungen.
3) Diese Werbezeitungen _______________________ unter staatlicher Kontrolle.
4) Bei jeder Werbeanzeige _______________________ der Staat Geld.
5) In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts _______________________ sich die Werbung.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
178
6) Gegen 1900 _______________________ in einigen Großstädten die Zeitungen bis zu 80
Prozent aus Werbung.
7) Unternehmen wie Maggi oder Nivea _______________________ große Werbekampagnen.
8) In dieser Zeit _______________________ die Firmen erstmals, Wünsche bei den
Konsumenten zu wecken.
9) Die Werbung _______________________ den Konsumenten davon überzeugen, dass er das
Produkt unbedingt braucht.
10) Später _______________________ man das Produkt mit Träumen und Wünschen, die beim
Kauf in Erfüllung gehen.
11) Die Werbung _______________________ mit den Träumen der Menschen.
B41 Markennamen
Im Lesetext steht: „Aus diesem frühen Werbeaktionen der Industrie entstanden berühmte
Markennamen, die noch heute oft mit Produktnamen gleichgesetzt werden.“
Hier finden Sie weitere besonders erfolgreiche Markennamen.
Welche Marke steht für welches Produkt? Ordnen Sie zu.
Maggi Klebestreifen
Tempo Suppenwürze
Odol löslicher Kaffee
Tesa (Kopf-)Schmerztablette
Nescafé Beruhigungsmittel
Valium Stofftaschentücher
Aspirin Mundwasser
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
179
B42 Welche Werbung gefällt Ihnen? Was ist Ihre Lieblingswerbung?
Berichten Sie schriftlich oder mündlich.
▪ Um welches Produkt geht es in dieser Werbung?
▪ Wer ist die Zielgruppe?
▪ Was für Menschen kommen in der Werbung vor?
▪ Welche Farben dominieren? Gibt es Musik?
▪ Hat die Werbung ein langsames oder schnelles Tempo?
▪ Was passiert in der Werbung?
▪ Wie lange ist die Werbung?
▪ Was für Wünsche/Gefühle weckt die Werbung?
B43 Debatte: PRO und KONTRA
Was meinen Sie? Ist Werbung eine gute Sache? Wählen Sie a) oder b).
a)
Diskutieren Sie mit Ihrer Nachbarin/Ihrem
Nachbar und sammeln Sie Argumente für
und gegen Werbung.
b)
Bilden Sie zwei Großgruppen. Eine Gruppe
argumentiert für Werbung, die andere gegen
Werbung. Wenn Sie die Argumente der
anderen Gruppe überzeugt haben, dürfen Sie
die Seite wechseln!
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
180
Wünsche wecken – Produkte, die man gar nicht braucht – die Menschen informieren –
originell/lustig sein – eine Schweinwelt schaffen – schöne Bilder zeigen – große Firmen
dominieren die Werbung - es geht nur um Profit – Werbung beeinflusst das Konsumverhalten
positiv/negativ – die Zielgruppe sind vor allem die Kinder – Interesse an neuen Sachen wecken –
Werbung ist pure Manipulation – einen Traum erfüllen können – jeder kann frei entscheiden, was
er kauft - …
• Ich halte Werbung für eine gute/positive/nützliche Sache, weil …
• Ich halte Werbung für eine schlechte/negative/nutzlose Sache, denn …
• Meiner Meinung nach …
• Ich davon überzeugt, dass …
• Ich bin mir sicher, dass …
• Ich bin mit dir/Ihnen (nicht) einverstanden.
• Nein, das glaube ich nicht.
• Davon kannst du/können Sie mich nicht überzeugen.
• Du hast/Sie haben recht. Du irrst dich/Sie irren sich.
Arroganz braucht stetig Werbung.
Selbstvertrauen spricht für sich.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
181
B44 Kaufen und schenken
Lesen Sie den folgenden Text von Wladimir Kaminer aus dem Buch: Helden des
Alltags.
MENSCHEN, DIE EINKAUFEN
Seitdem die Kaufhalle Knüller-Kiste – die ganze Welt für 99 Pfennig neben unserem Haus auf der
Schönhauser Allee ihre Türen geöffnet hat, hat sich unsere Wohnung immer mehr in eine
Textzentrale für internationale Fehlgeburten der modernen Haushaltselektronik verwandelt.
Meine Frau geht gern in diesem Laden einkaufen. Sie nennt es Soft-Shopping, weil man dort sein
leichtes Konsumfieber ohne große finanzielle Verluste kurieren kann.
Das erste Wunder der Technik, das sie in der Knüller-Kiste eroberte, war ein Mückenvertreiber,
der laut der beiliegenden Instruktionen nicht nur blutdürstige Insekten und Kakerlaken, sondern
auch alle denkbaren Nagetiere bis zu fünf Kilo Lebendgewicht aus der Wohnung fernhält. Und
das durch bloßes Aussenden hoher Frequenzen, die für das menschliche Ohr vollkommen
unhörbar sind. In unserer Wohnung gab es aber weder Insekten noch Nagetiere, nur unsere Katze
Marfa, die man nicht einmal mit einer Motorsäge von ihrem Lieblingsheizkörper in der Küche
trennen könnte. Im Kinderzimmer hatten wir jedoch eine Mücke, die schon lange bei uns lebte
und sich entsprechende anständig benahm: Sie summte leise, aß hauptsächlich vegetarisch und
war mit der Zeit ein vollwertiges Mitglied unserer Familie geworden. Bei dieser Mücke nun wollte
meine Frau die vernichtende Kraft der modernen Technik prüfen.
„Wenn es stimmt, was in der Gebrauchsanweisung steht, dann werde ich diese Gerät meiner
Mutter im Nordkaukasus schicken. In ihrem Dorf gibt es jedes Jahr richtig fette Mücken, außerdem
Ratten und Mäuse. Die Bewohner sind hilflos. Aber nicht mehr lange“, meinte meine Frau.
Abends schalteten wir das Gerät an, und ein Rotlicht-Lämpchen begann zu blinken. Die hohen
Frequenzen verbreiteten sich sofort in unserer Wohnung. Wir merkten nichts davon. Die Mücke
im Kinderzimmer auch nicht. Dafür aber unser Nachbar. Er war die ganze Nacht wach und ging
in seinem Zimmer hin und her. Merkwürdige Geräusche drangen aus der Wohnung nebenan zu
uns, als würde der Mann sich gegen die Wand werfen. Bums! Tratatatata. Bums! Tratatata. Er
sprang gegen die Wand, kehrte zu seiner Ausgangsposition zurück und nahm erneut Anlauf. Wir
befürchteten schon, er würde sich unter dem Einfluss der hohen Frequenzen in ein Insekt
verwandeln.
Meine Frau behauptete sogar, gehört zu haben, wie der Nachbar bereits einige Male die Decke
gestreift hätte. Ich glaube jedoch nicht, dass man eine derartig komplexe Verwandlung in einer
Nacht durchmachen konnte. So etwas braucht Zeit. Außerdem hat unser Nachbar einen viel zu
großen Bierbauch, um sich an der Decke halten zu können. Trotzdem machten wir uns große
Sorgen um ihn. Gleich am nächsten Morgen ging ich nach nebenan und fragte unseren Nachbarn,
wie es ihm gehe. Er erzählte, er hätte ein Dart-Spiel von seinem Kollegen geschenkt bekommen
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
182
und die ganze Nacht gespielt. Der Mückenvertreiber schein keine Wirkung zu haben. Trotz dieses
schlechten Testergebnisses schickten wir das Gerät in den Nordkaukasus zu meiner
Schwiegermutter.
Eine Woche später ergatterte meine Frau in der Knüller-Kiste eine elektrische Wanduhr. Sie hatte
nur drei Markt gekostet, zeigte aber trotzdem die Zeit an.
Der Nachbar spielte fast jede Nacht Dart, mal gegen die eine, mal gegen die andere Wand. Wir
konnten an der Geräuschen erkennen, dass er immer treffsicherer wurde. Meine Schwiegermutter
rief uns an und erzählte, was im Dorf passiert war, nachdem sie unser Gerät angeschaltet hatte.
Es kam zu einer noch die da gewesenen Invasion von Mücken, Riesenraupen und Zieselmäusen.
Alles leben aus der Steppe kam angelaufen, um in den Genuss der ausländischen Frequenzen
zu gelangen. Die aufgebrachte Dorfbevölkerung zwang meine Schwiegermutter, das Gerät zu
vernichten. Der Mückenvertreiber wurde öffentlich im Garten des Hauses durch Zerhacken zur
Strecke gebracht. Das Ungeziefer kehrte jedoch nicht in die Steppe zurück. „Aber schick mir nichts
mehr“, bat meine Schwiegermutter am Telefon.
Unser Nachbar traf mit seinen Pfeilen die Stelle an der Wand, wo auf der anderen Seite unsere
Wanduhr hing. Sie stürzte ab, tickte aber zu unserem Erstaunen brav weiter – nur ging sie jetzt in
die entgegengesetzte Richtung. Aus Achtung vor der modernen Technik beschlossen wir, sie
nicht wegzuwerfen. Gelegentlich schauen wir sie an und werden immer jünger.
Schönhauser Allee Straße in Berlin ergatterte eroberte/kaufte
kurieren heilen treffsicherer wurde besser traf
durch bloßes Aussenden nur durch … aufgebrachte erregte/zornige
drangen kamen zur Strecke gebracht zerstört
erneut wieder Ungeziefer Mücken usw.
behauptete meinte Erstaunen Überraschung
durchmachen erleben Gelegentlich Manchmal
B45 Aufgaben zum Textverstehen
a) Beantworten Sie die Fragen.
Wie gut haben Sie den Text verstanden?
Ich habe fast alles verstanden. Ich habe wenig verstanden.
Ich habe das Wichtigste verstanden. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
183
Wie wirkte der Text auf Sie?
traurig ernst
kämpferisch lustig
sentimental schwermütig
b) Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an.
richtig falsch
1) Frau Kaminer kauft regelmäßig in der Knüller-Kiste ein.
2) Die Geräte aus der Knüller-Kiste sind sehr preiswert,
funktionieren aber oft nicht.
3) Der Mückenvertreiber war ein wahres Wunder der Technik:
er tötete alle Mücken.
4) Das Gerät hat Einfluss auf das Verhalten des Nachbarn.
5) Frau Kaminer möchte ihrer Mutter im Kaukasus bei der Bekämpfung
von Insekten helfen und schenkt ihr den Mückenvertreiber.
6) Der Mückenvertreiber zieht die Insekten an, statt sie zu vernichten.
7) Die Menschen im Kaukasus fanden das Gerät ganz toll.
B46 Berichten Sie.
▪ Haben Sie schon einmal ein Gerät oder etwas anderes gekauft, das nicht funktioniert hat?
▪ Gibt es in Ihrem Heimatland viele Geschäfte, die nur billige Ware anbieten?
Was kann man in diesen Geschäften kaufen? Wie ist die Qualität?
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
184
B47 Billigläden in Deutschland
Ergänzen Sie in dem folgenden Text die Verben in der richtigen Form.
akzeptieren machen leisten geben kosten schätzen liegen können
entstehen beschränken schreiben kaufen schicken
Anfang der 1960er Jahre 1 entstanden die ersten Discountläden in den Großstädten. Ihr Angebot
2 ________________ sich damals nur auf Lebensmittel. Das Ambiente in den Geschäften war
trist, die Ausstattung einfach. Preise wurden mit der Hand auf unlackierte Holzregale 3
________________. Es 4 ________________ keine Dekoration im Schaufenster, keine
Bedienung oder Beratung. Die Auswahl an Produkten war auf wenige hundert Artikel begrenzt.
Die Kunden 5 ________________ das neue Konzept schnell, weil die Preise der Discounter 15
bis 20 Prozent unter den Preisen der anderen Geschäfte 6 ________________. Die Rechnung
war einfach: Wer 100 Mark zum Ausgeben hatte, 7 ________________ beim Discounter Waren
im Wert von 120 Markt einkaufen. Ein paar Beispiele aus dem Jahr 1961: Eine Ecke Käse 8
________________ beim Discounter 40 Pfennig statt wie üblich 50 Pfennig, Makkaroni 57 statt
70 Pfennig und Grapefruitsaft sogar nur 47 statt 78 Pfennig. Die Lieferanten der Discounter 9
________________ ihre Ware zum Teil heimlich, um keinen Ärger mit anderen Händlern zu
bekommen, heißt es in einem Pressebericht von damals. Heute bestimmt eine andere Art von
Geschäft den Trend: der „Schnäppchen-Markt“. Experten 10 ________________, dass es allein
in Hamburg etwa 50 Billigläden gibt, in denen man fast alle Produkte, angefangen vom
Spaghettilöffel bis zum Kinderspielzeug für einen Euro 11 ________________ kann. Und es
werden immer mehr. „In diesen Billigläden lässt es sich wunderbar stöbern und man muss sich
keine Gedanken 12 ________________, ob man sich die Sachen 13 ________________ kann“,
fasst ein Hamburger Trendforscher die Entwicklung zusammen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
185
B48 Geschenke für Verwandte
Denken Sie gerade darüber nach, was Sie Ihrer Schwiegermutter oder anderen Verwandten
schenken wollen? Dann hilft Ihnen vielleicht dieses Gedicht von Wilhelm Busch.
Die Erste Tante sprach …
Die erste Tante sprach:
„Wir müssen nun auch dran denken,
Was wir zu ihrem Namenstag¹
Dem guten Sophiechen² schenken.“
Drauf sprach die zweite Tante kühn:
„Ich schlage vor wir entscheiden
Uns für ein Kleid in Erbsengrün,
Das mag Sophiechen nicht leiden.“
Der dritten Tante war das recht:
„Ja“, sprach sie, „mit gelben Ranken!
Ich weiß, sie ärgert sich nicht schlecht
Und muss sich auch noch bedanken.“
(Wilhelm Busch 1832 – 1908)
¹ Namenstag = Tag des Namens, hier der heiligen Sophie
² Sophiechen = kleine Sophie
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
186
ANHANG 1: WICHTIGE STARKE VERBEN
Imperfekt Partizip II
backen Ich backte/buk Kuchen. Ich habe gebacken.
finden Er fand den Weg nicht. Er hat gefunden.
raten Ich riet ihm zu einer Kur. Ich habe geraten.
fahren Sie fuhr nach München Sie ist gefahren.
kommen Ich kam mit dem letzten Zug an. Ich bin angekommen.
rennen Er rannte um sein Leben. Er ist gerannt.
laufen Sie lief ums Haus. Sie ist gelaufen.
senden Ich sandte ihm eine Botschaft. Ich habe gesandt.
lesen Er las die Zeitung. Er hat gelesen.
nehmen Ich nahm den Weißwein. Ich habe genommen.
schreiben Ich schrieb dir eine Karte. Ich habe geschrieben.
nennen Du nanntest deinen Namen. Du hast genannt.
sehen Wir sahen den Unfall. Wir haben gesehen.
bringen Ich brachte dir ein Geschenk. Ich habe gebracht.
stehen Er stand an der Bushaltestelle. Er hat (ist) gestanden.
fangen Ich fing den Fisch. Ich habe gefangen.
rufen Sie rief nach dir. Sie hat gerufen.
schließen Ich schloss die Tür. Ich habe geschlossen.
heißen Wie hieß die Frau? Wie hat sie geheißen?
schneiden Ich schnitt die Zwiebeln. Ich habe geschnitten.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
187
Imperfekt Partizip II
bleiben Wir blieben nicht lange. Wir sind geblieben.
singen Das Mädchen sang ein Lied. Es hat gesungen.
fliegen Eva flog nach Rom. Eva ist geflogen.
geben Ich gab ihm etwas. Ich habe gegeben.
schlafen Das Kind schlief. Es hat geschlafen.
hängen Das Bild hing an der Wand. Es hat gehangen.
waschen Ich wusch mir die Hände. Ich habe gewaschen.
helfen Ich half ihr. Ich habe geholfen.
kennen Er kannte mich nicht. Er hat gekannt.
sprechen Ich sprach mit ihm. Ich habe gesprochen.
beginnen Es begann gestern. Es hat begonnen.
stehlen Man stahl mir meine Kamera. Man hat gestohlen.
tragen Er trug den Wein in den Keller. Er hat getragen.
bitten Ich bat ihn um Hilfe. Ich habe gebeten.
halten Der Bus hielt an der Haltestelle. Er hat gehalten.
denken Ich dachte an meine Freunde. Ich habe gedacht.
braten Ich briet mir ein Steak. Ich habe gebraten.
essen Wir aßen Kuchen. Wir haben gegessen.
sitzen Er saß in der ersten Reihe. Er hat (ist) gesessen.
gehen Ich ging ihm aus dem Weg. Ich bin gegangen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
188
Imperfekt Partizip II
verlieren Ich verlor die Geduld. Ich habe verloren.
werden Sie wurde Lehrerin. Sie ist geworden.
lassen Ich ließ ihn allein. Ich habe gelassen.
sterben Er starb vor 100 Jahren. Er ist gestorben.
ziehen Ich zog an den Schnur. Ich habe gezogen.
brechen Der Balken brach. Er ist gebrochen.
biegen Der Wagen bog um die Ecke. Er ist um die Ecke gebogen.
springen Ich sprang ins Wasser. Ich bin gesprungen.
laden Er lud seine Sachen in den Wagen. Er hat geladen.
frieren Ich fror fürchterlich. Ich habe gefroren.
gelingen Das Experiment gelang. Es ist gelungen.
sinken Das Schiff sank. Es ist gesunken.
liegen Die Brille lag auf dem Schreibtisch. Es hat (ist) gelegen.
geschehen Ein Unglück geschah. Es ist geschehen.
riechen Paul roch nach Alkohol. Er hat gerochen.
gewinnen Ich gewann das Spiel. Ich habe gewonnen.
leihen Sie lieh mir ihr Fahrrad. Sie hat geliehen.
fließen Das Wasser floss in den Keller. Es ist geflossen.
schieben Ich schob den Brief in die Tasche. Ich habe geschoben.
streichen Er strich den Zaun. Er hat gestrichen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
189
Imperfekt Partizip II
treffen Sie traf sich mit Paul. Sie hat getroffen.
wissen Er wusste das nicht. Er hat gewusst.
trinken Ich trank ein Mineralwasser. Ich habe getrunken.
empfehlen Man empfahl dir dieses Restaurant. Man hat es empfohlen.
fallen Er fiel ins Wasser. Er ist gefallen.
schlagen Ich schlug den Nagel in die Wand. Ich habe geschlagen.
befehlen Man befahl dir zu schweigen. Man hat es befohlen.
fressen Die Kuh fraß Gras. Sie hat gefressen.
beißen Der Hund biss den Briefträger. Er hat gebissen.
gießen Ich goss die Blumen. Ich habe gegossen.
vergessen Wir vergaßen die Verabredung. Wir haben vergessen.
scheinen Die Sonne schien. Sie hat geschienen.
fliehen Er floh vor den Feinden. Er ist geflohen.
streiten Ich stritt mit ihm. Ich habe gestritten.
werfen Er warf den Stein ins Wasser. Er hat geworfen.
verzeihen Eva verzieh ihm. Sie hat verziehen.
bieten Niemand bot mehr bei der Auktion. Niemand hat geboten.
wachsen Die Unzufriedenheit wuchs. Sie ist gewachsen.
binden Ich band die Schuhe. Ich habe gebunden.
betreten Du betratst den Raum. Du hast betreten.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
190
Imperfekt Partizip II
blasen Der Wind blies von Norden. Er hat geblasen.
brennen Das Haus brannte. Es hat gebrannt.
greifen Ich griff nach der Taschenlampe. Ich habe gegriffen.
lügen Er log immer. Er hat gelogen.
genießen Ich genoss die Ruhe. Ich habe genossen.
steigen Wir stiegen ins Taxi. Wir sind gestiegen.
zwingen Er zwang sich, wach zu bleiben. Er hat sich gezwungen.
stechen Ich stach mich in den Finger. Ich habe gestochen.
treiben Wir trieben die Hühner aus dem Garten. Wir haben getrieben.
wiegen Man wog das Mehl und den Zucker. Man hat gewogen.
schleifen Ich schliff das Messer. Ich habe geschliffen.
schmelzen Das Eis schmolz. Es ist geschmolzen.
schwinden Unser Mut schwand. Es ist geschwunden.
weisen Man wies mich aus dem Zimmer. Man hat gewiesen.
trügen Der Schein trog. Er hat getrogen.
schleichen Der Dieb schlich ins Haus. Er ist geschlichen.
wenden Ich wandte den Kopf. Ich habe gewandt.
schreien Jemand schrie um Hilfe. Jemand hat geschrien.
erlöschen Die Kerze erlosch. Sie sind erloschen.
stinken Es stank nach verbranntem Plastik. Es hat gestunken.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
191
Imperfekt Partizip II
graben Ich grub ein Loch. Ich habe gegraben.
schießen Er schoss mit einer Pistole. Er hat geschossen.
heben Sie hob den Arm. Sie hat gehoben.
schweigen Alle schwiegen. Alle haben geschwiegen.
ringen Eva rang nach Luft. Sie hat gerungen.
schwören Ich schwor, die Wahrheit zu sagen. Ich habe geschworen.
pfeifen Er pfiff ein Lied. Er hat gepfiffen.
rinnen Das Wasser rann in den Kanal. Es hat geronnen.
salzen Ich salzte die Suppe. Ich habe gesalzen.
gelten Der Ausweis galt nicht mehr. Er hat gegolten.
schmeißen Sie schmiss den Abfall in die Mülltonne. Sie hat geschmissen.
speien Der Vulkan spie Feuer und Steine. Er hat gespien.
bewegen Was bewog ihn zu dieser Handlung? Was hat ihn dazu bewogen?
gleichen Er glich seinem Bruder. Er hat ihm geglichen.
leiden Viele litten unter der enormen Kälte. Vielen haben gelitten.
verderben Ich verdarb mir den Magen. Ich habe verdorben.
mahlen Er mahlte den Kaffee. Er hat gemahlen.
stoßen Ich stieß mir das Knie am Tisch. Ich habe gestoßen.
kriechen Die Katze kroch unter das Sofa. Sie ist gekrochen.
reißen Ich riss ihm den Zettel aus der Hand. Ich habe gerissen.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
192
ANHANG 2: "ES“ ALS PRONOMEN
Das "es" als Personalpronomen, muss obligatorisch benutzt werden, da es stellvertretend
für ein Nomen steht und das neutrale Geschlecht (Genus) angibt. "Es" kann nur im Nominativ
oder Akkusativ stehen. Steht "es" im Akkusativ, kann es nicht auf Position 1 stehen. Das
Pronomen "es" muss dann auf Position 3 (oder Position 4, sofern Position 1 anderweitig belegt
wird) stehen.
➢ Nominativ: Ich habe mir ein neues Hemd gekauft. Es hat 84 Euro gekostet.
➢ Akkusativ: Wo hast du es denn gekauft? - Ich habe es in der Einkaufspassage gekauft.
"Es" muss obligatorisch benutzt werden, wenn es stellvertretend für ein Adjektiv oder ein
Partizip steht. Auch in diesen Fällen kann es nicht auf Position 1 stehen, sondern muss auf
Position 3 (sowohl hinter dem Verb als auch hinter dem Subjekt) stehen:
➢ Dein Lehrer ist so hilfsbereit. Meiner ist es leider nicht.
➢ Warum ist dein Mann immer so fleißig? Mein Mann ist es leider nicht.
➢ Ist dein neuer Freund sportlich? - Natürlich ist er es.
"Es" muss obligatorisch benutzt werden, wenn es stellvertretend für ein Satzteil oder einen
ganzen Satz steht. Auch in diesen Fällen kann es nicht auf Position 1 stehen, sondern muss auf
Position 3 (sowohl hinter dem Verb als auch hinter dem Subjekt) stehen:
➢ Mein Sohn, du hast ja schon wieder geraucht. Ich habe es dir doch verboten.
➢ Hast du Susi zum Geburtstag gratuliert? - Ach du lieber Gott, ich habe es ganz vergessen.
➢ Man müsste nochmals den Keller aufräumen. Aber ich mache es überhaupt nicht gern.
Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau B1.1 Autor: Frank de Zwaan
Das könnte Ihnen auch gefallen
- AngabesätzeDokument6 SeitenAngabesätzeChristopher VillotaNoch keine Bewertungen
- Abschlussprüfung A2 Netzwerk NeuDokument13 SeitenAbschlussprüfung A2 Netzwerk NeuAlberto Rodriguez Gutierrez100% (3)
- Begegnungen A2+ Lösungsschlüssel Und TranskripteDokument27 SeitenBegegnungen A2+ Lösungsschlüssel Und Transkriptedr_spearNoch keine Bewertungen
- Tabelle Perfekt Haben Oder SeinDokument1 SeiteTabelle Perfekt Haben Oder SeinSasha BerezhnoyNoch keine Bewertungen
- B1.1 GrammatikDokument22 SeitenB1.1 GrammatikLou Dark100% (2)
- 1 Aufgabe 3 Pluspunkt B1Dokument2 Seiten1 Aufgabe 3 Pluspunkt B1Patrick Hel O. LauritoNoch keine Bewertungen
- PhonetikkursDokument41 SeitenPhonetikkursNgân VũNoch keine Bewertungen
- Nomen VerbverbindungDokument3 SeitenNomen VerbverbindungNeha Upadhyay MehtaNoch keine Bewertungen
- Tom's Deutsche Übungen Zum Konjunktiv IIDokument2 SeitenTom's Deutsche Übungen Zum Konjunktiv IIA B S100% (1)
- 10-Minuten Diktate für ein effektives & spannendes Rechtschreibtraining - 5. bis 8. Klasse Deutsch Gymnasium - inkl. gratis Audiodateien, Blitzmerkerkästen, Eselsbrücken & LernerfolgstabelleVon Everand10-Minuten Diktate für ein effektives & spannendes Rechtschreibtraining - 5. bis 8. Klasse Deutsch Gymnasium - inkl. gratis Audiodateien, Blitzmerkerkästen, Eselsbrücken & LernerfolgstabelleNoch keine Bewertungen
- Grammatiktabellen Deutsch: Regelmäßige und unregelmäßige Verben, Substantive, Adjektive, Artikel und PronomenVon EverandGrammatiktabellen Deutsch: Regelmäßige und unregelmäßige Verben, Substantive, Adjektive, Artikel und PronomenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Wörterbuch Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 "Guten Tag": Lernwortschatz Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 Guten Tag + Kurs per InternetVon EverandWörterbuch Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 "Guten Tag": Lernwortschatz Deutsch - Ukrainisch A1 Lektion 1 Guten Tag + Kurs per InternetNoch keine Bewertungen
- DaF A2 Praeteritum Uebungen 3Dokument2 SeitenDaF A2 Praeteritum Uebungen 3Karahmetovic Enis0% (1)
- Deutsch b1Dokument11 SeitenDeutsch b1em11feliciaNoch keine Bewertungen
- Trennbare Verben A2Dokument2 SeitenTrennbare Verben A2Jose Gonzalbez100% (1)
- TestDokument2 SeitenTestRuubén'n Aguiirre PeerezNoch keine Bewertungen
- Grammatikuebungen Adjektivdeklination 02 GenitivDokument1 SeiteGrammatikuebungen Adjektivdeklination 02 Genitivkellie kamiloudiNoch keine Bewertungen
- Sprechen Aufgabe 1Dokument3 SeitenSprechen Aufgabe 1selenkamahotmail.comNoch keine Bewertungen
- Freizeit Und UnterhaltungDokument2 SeitenFreizeit Und UnterhaltungTrang100% (1)
- Verben Mit Prapositionenteil3a2b1ubung - 33980Dokument1 SeiteVerben Mit Prapositionenteil3a2b1ubung - 33980VincentNoch keine Bewertungen
- A2 Prüfung - 01Dokument17 SeitenA2 Prüfung - 01Linh Anh50% (2)
- Kontrastive Analyse Vietnamesisch - DeutschDokument24 SeitenKontrastive Analyse Vietnamesisch - DeutschNguyen Thi Hai HaNoch keine Bewertungen
- Vlas. Kapitel 1Dokument9 SeitenVlas. Kapitel 1Вадим Влас100% (1)
- b1 Arbeitsblatt Kap2-05 PDFDokument1 Seiteb1 Arbeitsblatt Kap2-05 PDFnh464950% (2)
- Komparativ Superlativ PDFDokument4 SeitenKomparativ Superlativ PDFІрина ГайдукNoch keine Bewertungen
- Hören A2 NEU Erwachsene-сторінки-18-21Dokument4 SeitenHören A2 NEU Erwachsene-сторінки-18-21Анастасия БулахNoch keine Bewertungen
- Welch-, Jed-, Dies-, AllDokument1 SeiteWelch-, Jed-, Dies-, AllMatias KleineNoch keine Bewertungen
- Kandidatenblätter Schreiben - Modellprüfung 1 - Goethe A2Dokument2 SeitenKandidatenblätter Schreiben - Modellprüfung 1 - Goethe A2Abir Belhadj KacemNoch keine Bewertungen
- Fokus B1 Arbeitsblaetter Einheiten 1-7Dokument16 SeitenFokus B1 Arbeitsblaetter Einheiten 1-7Катерина ПолищукNoch keine Bewertungen
- A2 Arbeitsblatt Kap7-02 PDFDokument1 SeiteA2 Arbeitsblatt Kap7-02 PDFVioleta Ricoy RoigNoch keine Bewertungen
- A2 OnlineaufgabenDokument59 SeitenA2 OnlineaufgabenMss NonyNoch keine Bewertungen
- Einfach Gut B1.2 Wortschatzliste EnglischDokument16 SeitenEinfach Gut B1.2 Wortschatzliste EnglischSaima SaimaNoch keine Bewertungen
- Konjunktiv IIDokument4 SeitenKonjunktiv IICodruCiprianNoch keine Bewertungen
- UP Prima Plus Lektion 8 Fitness Und Sport A2.2Dokument4 SeitenUP Prima Plus Lektion 8 Fitness Und Sport A2.2Vân Anh Nguyễn CửuNoch keine Bewertungen
- Model TestDokument10 SeitenModel TestNaida GolaćNoch keine Bewertungen
- Relativpronomen - ErklärungDokument1 SeiteRelativpronomen - ErklärungOtávio Dantas0% (1)
- شرح الجملة المصدرية بـ Um ..... .zu و اداة الرابط damit في اللغة الالمانية - تعلم اللغة الالمانيةDokument7 Seitenشرح الجملة المصدرية بـ Um ..... .zu و اداة الرابط damit في اللغة الالمانية - تعلم اللغة الالمانيةMacNoch keine Bewertungen
- Der KonsekutivsatzDokument5 SeitenDer KonsekutivsatzLan CòiNoch keine Bewertungen
- Linie1 Glossar Deutsch-Arabisch A2Dokument30 SeitenLinie1 Glossar Deutsch-Arabisch A2Ahmad AlayaNoch keine Bewertungen
- 61 A2 Horen FRA Set1Dokument4 Seiten61 A2 Horen FRA Set1Bernadett Kiss100% (1)
- Parcial DTSCHDokument6 SeitenParcial DTSCHAngeNoch keine Bewertungen
- Übung PossessivartikelDokument2 SeitenÜbung PossessivartikelSaif AbbassiNoch keine Bewertungen
- Partizip I Und II Als AdjektiveDokument10 SeitenPartizip I Und II Als AdjektiveТаня КрыжановскаяNoch keine Bewertungen
- Modelltest b1Dokument6 SeitenModelltest b1Mariya LagoydaNoch keine Bewertungen
- L14 Übungen Verben Mit PräpositionenDokument11 SeitenL14 Übungen Verben Mit Präpositionenlequangtho04072005Noch keine Bewertungen
- 16 - Personalpronommen Im AkkusativDokument10 Seiten16 - Personalpronommen Im AkkusativsukhmaniNoch keine Bewertungen
- Hören A2.1Dokument3 SeitenHören A2.1Kiều Nga NhữNoch keine Bewertungen
- AdjektivdeklinationDokument3 SeitenAdjektivdeklinationAndres Giovanny MeloNoch keine Bewertungen
- Mein-Deutschbuch - de Zusatzmaterialien Uebungen Relativsatz-07Dokument3 SeitenMein-Deutschbuch - de Zusatzmaterialien Uebungen Relativsatz-07Erwiyan Fajar Ansori100% (1)
- Schubert k8.6 RelativsatzDokument2 SeitenSchubert k8.6 RelativsatzAdriano GadoNoch keine Bewertungen
- Indem - SodassDokument1 SeiteIndem - SodassShahin AsadiFardNoch keine Bewertungen
- Präteritum Von Haben Und SeinDokument5 SeitenPräteritum Von Haben Und Seinislem fourtiNoch keine Bewertungen
- Inhalt Prima A2 .2Dokument1 SeiteInhalt Prima A2 .2Didi NikolicNoch keine Bewertungen
- Reflexive Verben ListeDokument1 SeiteReflexive Verben ListeMaria Paola CUERVO GOMEZNoch keine Bewertungen
- Modul 6 Lektion 16Dokument4 SeitenModul 6 Lektion 16Onur BiçerNoch keine Bewertungen
- PassivDokument1 SeitePassivMario ŠainNoch keine Bewertungen
- 05 Verben Mit Dativ - Und Akkusativobjekt PDFDokument1 Seite05 Verben Mit Dativ - Und Akkusativobjekt PDFMoustafa FaresNoch keine Bewertungen
- Merk dir das! Grammatik bis B1: German Grammar explained in EnglishVon EverandMerk dir das! Grammatik bis B1: German Grammar explained in EnglishNoch keine Bewertungen
- Starten Wir A1 Inter 1Dokument3 SeitenStarten Wir A1 Inter 1Carlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Inter 1 Hoja de RespuestasDokument3 SeitenInter 1 Hoja de RespuestasCarlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Básico 3 Starten WirDokument3 SeitenBásico 3 Starten WirCarlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Inter 2 Hoja de Respuestas Starten Wir A1Dokument3 SeitenInter 2 Hoja de Respuestas Starten Wir A1Carlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Starten Wir! BASICO 2 Hojas de RespuestasDokument2 SeitenStarten Wir! BASICO 2 Hojas de RespuestasCarlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Starten Wir BÁSICO 2Dokument4 SeitenStarten Wir BÁSICO 2Carlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Básico 1 Starten Wir Korrigiert.Dokument4 SeitenBásico 1 Starten Wir Korrigiert.Carlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Hoja de Respuestas Avanzado 2 SWDokument3 SeitenHoja de Respuestas Avanzado 2 SWCarlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Hoja de Respuestas Avanzado 3Dokument2 SeitenHoja de Respuestas Avanzado 3Carlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Transkription Audios A1.2Dokument14 SeitenTranskription Audios A1.2Carlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Deklination Der Adjektive Arbeitsblatter 27549Dokument2 SeitenDeklination Der Adjektive Arbeitsblatter 27549dutza69100% (1)
- Verben Mit PräpositionenDokument2 SeitenVerben Mit PräpositionenThu Vân 3Đ - 20 Nguyễn ThịNoch keine Bewertungen
- AdjektivendungenDokument4 SeitenAdjektivendungenMarco ErlNoch keine Bewertungen
- Grammatiktraining NomenDokument6 SeitenGrammatiktraining NomenMa.diana MananghayaNoch keine Bewertungen
- Mot A1 A2 VerblistenDokument13 SeitenMot A1 A2 VerblistenNicotinyl HakunanatNoch keine Bewertungen
- Deutsch Zeichensetzung deDokument33 SeitenDeutsch Zeichensetzung deGuilherme N.CNoch keine Bewertungen
- MedienDokument10 SeitenMedienJesus RiveraNoch keine Bewertungen
- Lander Und SpracheDokument3 SeitenLander Und SpracheBiancaNoch keine Bewertungen
- Modalni Glagoli Nemacki JezikDokument9 SeitenModalni Glagoli Nemacki JezikVlada MladenovicNoch keine Bewertungen
- Verben Mit PraepositionenDokument1 SeiteVerben Mit PraepositionenYman KaNoch keine Bewertungen
- Exercitii Germana PDFDokument2 SeitenExercitii Germana PDFAdelinaNoch keine Bewertungen
- Name - Datum - Verben Im Imperfekt (Präteritum) Verb Person ...Dokument2 SeitenName - Datum - Verben Im Imperfekt (Präteritum) Verb Person ...Iulia BadescuNoch keine Bewertungen
- Test Kapitel5Dokument2 SeitenTest Kapitel5OS IONoch keine Bewertungen
- SD 2020-45Dokument84 SeitenSD 2020-45Натали КостадиноваNoch keine Bewertungen
- 01a.prüfungstraining DTB b2Dokument28 Seiten01a.prüfungstraining DTB b2Татьяна ТопNoch keine Bewertungen
- Zahlen-Leseverstandnis 60131Dokument2 SeitenZahlen-Leseverstandnis 60131gabifloriNoch keine Bewertungen
- Das Johannesevangelium in Griechisch-Deutscher Parallel - Und StudienausgabeDokument165 SeitenDas Johannesevangelium in Griechisch-Deutscher Parallel - Und StudienausgabePeterM.StreitenbergerNoch keine Bewertungen