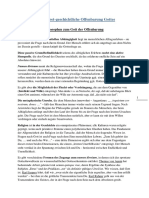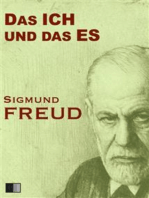Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Die Idee Eines Philosophischen Glaubens Spaemann
Hochgeladen von
Eduardo CharpenelOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Die Idee Eines Philosophischen Glaubens Spaemann
Hochgeladen von
Eduardo CharpenelCopyright:
Verfügbare Formate
DZPhil, Akademie Verlag, 57 (2009) 2, 249–258
Die Idee eines philosophischen Glaubens
Von ROBERT SPAEMANN (Stuttgart)
Was heißt „philosophischer Glaube“ bei Karl Jaspers? Was glaubt dieser Glaube? Wem glaubt
er? An wen glaubt er? Oder, falls diese beiden Fragen schon eine unzulässige Voraussetzung
machen, worauf gründet sich seine Überzeugung? Denn um eine Überzeugung handelt es
sich auf jeden Fall, und nicht um eine bloße Vermutung. Zwar schließt dieser Glaube den
Zweifel nicht aus, der sozusagen sein Schatten ist, der ihn nie verlässt. Aber das heißt nicht,
dass dieser Glaube auf eine bloße Vermutung, sozusagen als Kompromiss zwischen Glaube
und Zweifel reduziert werden kann. Der Gegenstand des Glaubens erlaubt nicht bloßes Ver-
muten. Was er nicht ausschließen kann, ist der Zweifel des Glaubens an sich selbst. Ich bin
nie gewiss, ob ich ihn wirklich habe. (So antwortet der Blindgeborene auf die Frage Jesu, ob
er glaubt: „Ja, Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben.“) Worte wie „vermuten“ oder „für
wahrscheinlich halten“ sind in diesem Zusammenhang fehl am Platz. Wo wir uns auf das
Ganze der Wirklichkeit beziehen, da lassen uns alle Wahrscheinlichkeitskriterien im Stich.
Denn das Ganze ist ein singulare tantum, eine Singularität, wie die Physiker heute sagen, es
ist kein Fall unter Fällen, bei denen die Häufigkeit des Auftretens von irgendeiner Bedeutung
ist. Hier kann es nur das Kriterium eines unüberholbaren Sinnes geben. Und zwar gilt das
sowohl für den Offenbarungsglauben wie für den philosophischen Glauben.
Das Ganze der Wirklichkeit ist kein möglicher Gegenstand unseres Wissens und Vor-
stellens, denn unser Wissen und Vorstellen ist selbst Teil dieses Ganzen. Das Ganze müsste
Subjektivität und Objektivität umgreifen. Und wir müssten einen Standpunkt außerhalb
dieses Ganzen einnehmen können, um überhaupt von der Welt als einem Ganzen sprechen zu
können. Innerhalb der Welt aber gibt es für das Erkennen nur das unendliche Fortschreiten
von einer Erkenntnis zur andern, so wie es für das innerweltliche Handeln nicht so etwas
wie ein in sich ruhendes Glück gibt, sondern nur, wie Thomas Hobbes sagt, das unendliche
Fortschreiten von Begierde zu Begierde. Das Gefühl der Welt als eines begrenzten Ganzen,
das, wie gesagt, einen Standpunkt jenseits des innerweltlichen Dualismus von Subjekt und
Objekt, einen Standpunkt sub specie aeternitatis voraussetzt, nennt Wittgenstein – der Witt-
genstein des Tractatus – das „Mystische“. Und in diesem Mystischen wurzelt das Ethische.
Beides lässt sich nicht aussprechen. Denn unsere Sprache ist dazu da, Tatsachen in der Welt
zu benennen. Dies kann klar geschehen. „Alles, was man sagen kann, kann man klar sagen“,
schreibt Wittgenstein und fügt hinzu: „und wovon man nicht reden kann, davon soll man
schweigen.“ Und doch gilt für Wittgenstein, dass wenn man alles klar Sagbare gesagt hat,
die eigentlich wichtigen Fragen unseres Lebens noch gar nicht berührt sind. Was tun wir mit
ihnen, wenn wir über sie nicht klar reden können?
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
250 Robert Spaemann, Die Idee eines philosophischen Glaubens
Wir können durch unser Reden auf sie zeigen. Man kann sich ja fragen, wie es denn mit
Wittgensteins Tractatus selbst ist. Seine Sätze benennen doch nicht Tatsachen in der Welt,
sondern sie sind reflexiv. Sie sprechen über das Sprechen und normieren es. Sind solche Sätze
dann nicht selbst sinnlos? Ja, sie sind sinnlos. Sie sind eine Leiter, die man wegwirft, wenn
man hinaufgestiegen ist. Aber es ist nicht sinnlos, dass diese sinnlosen Sätze niedergeschrie-
ben wurden. Denn sie haben etwas gezeigt. „Es gibt Unaussprechliches“, so wieder Wittgen-
stein. „Dies zeigt sich. Es ist das Mystische.“ In einem Vortrag über Ethik hat Wittgenstein
zwei Gefühle beschrieben, die er im Tractatus mystisch genannt hatte. Erstens das Gefühl
des Erstaunens darüber, dass überhaupt etwas ist. Und zweitens das Gefühl einer Geborgen-
heit, die durch keine Veränderung von Tatsachen berührt wird. Wittgenstein fügt sogleich
hinzu, dass das Aussprechen solcher Gefühle nur zu Unsinn führen könne. Warum? Weil
sich das Gefühl in Sätzen artikuliert, die in jeder Sachlage wahr sind, tautologischen Sätzen,
die keine Wahrheitsbedingungen haben. Solche Sätze nennt der Wittgenstein des Tractatus
sinnlos, denn der Satz ist Ausdruck seiner Wahrheitsbedingungen. Er kann also Unbedingtes,
bedingungslos Wahres nicht ausdrücken. Aber „die Philosophie wird das Unsagbare bedeu-
ten, indem sie das Sagbare klar darstellt“. Das Unsagbare ist „das, was sich zeigt im Sagen
des Sagbaren“. Es ist das „tief Geheimnisvolle“ und als solches „Bedingung der Welt“.
Die partielle Konvergenz Wittgensteins – des frühen Wittgenstein – mit dem, was Jaspers
philosophischen Glauben nennt, wäre Gegenstand einer eigenen Untersuchung. Jaspers hat
Wittgenstein nur sehr peripher wahrgenommen. In seinem Buch über Wahrheit zitiert er ihn
aus zweiter Hand, nämlich aus Carnaps Logischem Aufbau der Welt, und beklagt die „Veren-
gung der Klarheitsmöglichkeit auf das Denken in Zeichen nach formallogischen Regeln“ und
das Schweigegebot für alles, was diesem Klarheitsbegriff nicht entspricht. „Die Möglichkeit
der Klarheit ist unbegrenzt“, schreibt dagegen Jaspers. Es gibt gedankliche Klarheit auch
für das, was sich nicht in Elementarsätze über das übersetzen lässt, was der Fall ist. Es gibt
Klarheit im Kunstwerk, Klarheit in der Gestalthaftigkeit unseres Erlebens, und auch Fragen
können, entgegen dem Dictum von Wittgenstein, klar sein, obwohl es auf sie keine Antwort
gibt. Jaspers schreibt, das Schweigegebot Wittgensteins sei „der Tod alles Umgreifenden“.
„Für die Welt des Unklaren würden vielleicht unverbindliche Gefühle, ästhetisches Genießen,
usw. … freigegeben sein.“ „Aber Klarheit ist in der Tat nicht begrenzt.“ Vom „Hellwerden“
spricht Jaspers.
Worin diese Klarheit besteht, wenn sie sprachlich und doch nicht objektsprachlich sein
soll, bleibt allerdings zu fragen. Tatsächlich setzt Jaspers auf den performativen Charakter
metaphorischer Rede. Worte wie „schweben“, „erhellen“, „Bodenlosigkeit“, „Sich-gewinnen
im Sich-geschenktwerden“ usw. sind Metaphern, die im Hörer oder Leser einen Prozess in
Gang setzen sollen, der zu einem bestimmten geistigen Zustand führt. Welchem Zustand?
Wittgenstein spricht vom Zustand absoluter, an keine objektiven Bedingungen geknüpfter
Geborgenheit. Jaspers schreibt: „Der philosophische Glaube sieht sich preisgegeben, ungesi-
chert, ungeborgen.“ Und doch habe ich Grund anzunehmen, dass beide Metaphern auf einen
Zustand hinweisen, der durch Reduzierung auf eine einzige der beiden wieder zu einer für
Jaspers unzulässigen Eindeutigkeit führen würde.
Bleiben wir noch bei dem, was Jaspers Transzendieren nennt, und bei Wittgensteins früher
Rede vom Mystischen. Für Wittgenstein ist der Überstieg zu einer Erfahrung von Sinn, Wert
und zum Glauben an ein Jenseits dieser Welt das Resultat einer strikten Abgrenzung der wis-
senschaftlich beschreibbaren und analysierbaren Welt wertfreier Tatsachen. Je strikter diese
Abgrenzung geschieht, umso deutlicher wird, dass unsere eigentlichen Fragen innerhalb dieser
Welt gar nicht beantwortbar sind, und umso dringender werden wir auf ein Jenseits der Tat-
sachen verwiesen. Aber dies ist ja nun auch das ceterum censeo von Jaspers: Wir müssen im
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
DZPhil 57 (2009) 2 251
Bereich des Wissbaren mit den Methoden wertfreier Wissenschaft so weit gehen wie möglich,
und das heißt immer weiter, denn der Prozess der Forschung ist unabschließbar. Er führt nie
zu einer Rekonstruktion des umgreifenden Ganzen. Jaspers’ Antwort auf die gegenwärtigen
Versuche der Hirnforschung, uns unser Freiheitsbewusstsein als Illusion zu entlarven, wäre
ganz klar. Alle Forschung in dieser Richtung ist zu begrüßen. Sie vermehrt unsere Kenntnis
der Welt. Sie sagt uns nicht, wer wir sind. Aber sie dient dazu, unser Freiheitsbewusstsein zu
läutern und uns über seinen Ursprung Klarheit zu geben. Der Hirnforscher kann mittels seiner
Forschung niemals den Status seiner eigenen Theorie verstehen, mit der er uns doch über den
Gegenstand dieser Theorie belehren und nicht Einblick in die Besonderheiten seines Gehirns
geben will. Über die Existenz als ein Umgreifendes klärt er deshalb nur indirekt und ungewollt
auf. Indem wir uns die wirklichen Ergebnisse seiner Forschung aneignen, werden wir an den
Punkt geführt, wo der Absprung möglich ist – möglich, nicht zwingend. Zwingendes Wissen
gibt es nur innerhalb der Welt der Objekte. Der Absprung ist Sache der Freiheit. Man kann ihn
verweigern. Das eindrucksvollste Beispiel für solche Weigerung ist vielleicht W. O. Quine mit
seiner Leugnung der Möglichkeit, sich mit Worten auf etwas anderes als wieder nur auf Worte
zu beziehen. Wo das Wissen einer Wissenschaft endet, da tut sich für Quine nicht die Mög-
lichkeit eines Überstiegs auf ein Umgreifendes auf. Stattdessen reicht jede Wissenschaft ihr
ungelöstes Problem an eine andere Wissenschaft weiter. So zum Beispiel die psychologische
Erkenntnislehre an die Neurophysiologie, diese an die Evolutionstheorie, diese an die Chemie,
die Chemie an die Physik, an Mathematik und Wissenschaftstheorie, und diese schließlich wie-
der an die Neurowissenschaft, die sich zur Zeit als prima philosophia gebärdet. Immer wieder
öffnet sich eine Tür aus dem Raum einer Wissenschaft. Aber diese Tür führt immer wieder nur
in ein anderes Zimmer, keine führt aus dem Haus.
Der Psychiater Karl Jaspers hat diese Tür gefunden. Nun hört aber, wo das Wissen aufhört,
das Denken und das Sprechen nicht auf. Hier wohl beginnt die Differenz zu Wittgensteins
Rede vom Denken. Für Wittgenstein sind die Grenzen des Wissens die Grenzen des Denkens.
Darum ist das Ziel der Philosophie nicht, die Fragen, die über das Wissbare hinausführen, zu
beantworten, sondern ihre Sinnlosigkeit zu erkennen und sie zum Verschwinden zu bringen,
damit allerdings auch sich selbst, die Philosophie zum Verschwinden zu bringen. Weder für
Kant noch für Jaspers hört Denken jenseits des wissenschaftlich Wissbaren auf. Was hier zur
Diskussion steht, ist ein Begriff des Wissens, der sich auf Inhalte jenseits der Gegenstände
möglicher sinnlicher Erfahrung erstreckt, also Inhalte dessen, was nach Kant und nach Jas-
pers nur Gegenstand eines religiösen oder philosophischen Glaubens und nie eines wissen-
schaftlichen Wissens sein kann. Dies freilich grenzt nun an Tautologie, weil nämlich durch
den neuzeitlichen Empirismus und diesem folgend durch Kant Wissen so definiert wird, dass
nur empirisch begründetes und naturwissenschaftlich methodisch gewonnenes Wissen unter
diese Definition fällt. So ist zum Beispiel der Satz: „Wunder gibt es nicht“ dann kein empi-
risch gehaltvoller Satz, wenn er damit begründet wird, dass singuläre, aus dem normalen
Lauf der Dinge herausfallende Ereignisse den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung
widersprechen würden und folglich niemals zum Gegenstand von Erfahrung werden können.
Die Weise, wie Jaspers über Aberglauben, Glauben an Engel und Dämonen usw. spricht, ist
denn auch sehr unreflektiert und appelliert einfach an den herrschenden Common Sense einer
wissenschaftlichen Zivilisation, den er für begründungsunbedürftig hält.
Warum nun ein philosophischer Glaube und nicht ein schlichtes Ignoramus dort, wo wir
auf die konstitutiven Grenzen unseres Wissens stoßen? Es kann jedermann einsichtig gemacht
werden, dass die Objekte unseres Wissens Objekte für ein Subjekt sind. Jedem kann das scho-
lastische Adagium einsichtig gemacht werden: Quidquid recipitur secundum modum recipientis
recipitur. Jedermann kann einsichtig gemacht werden, dass das Subjekt und Objekt umgreifen-
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
252 Robert Spaemann, Die Idee eines philosophischen Glaubens
de Sein von uns nicht in der Weise gewusst werden kann wie die Objekte dieser Subjektivität.
Aber was folgt daraus? Es kann daraus folgen, dass wir für immer innerhalb dieser Grenze
eingeschlossen sind und uns nur die Sisyphusarbeit eines Erkenntnisprozesses bleibt, der prinzi
piell an kein Ziel kommen kann und deshalb von seinem Ziel immer gleich weit entfernt bleibt.
Es kann auch ebenso daraus folgen, dass jenseits der Grenze des Wissbaren dem Denken etwas
aufgeht und hell wird, das dem Dasein erst seinen Sinn gibt. Wittgenstein schreibt, dieser Sinn
könne nur ein transzendentaler sein und insofern eine Bedingung unseres Daseins, derer wir
uns schweigend inne werden. Für Jaspers ist er nicht ein transzendentaler, sondern ein transzen-
denter Sinn. Also nicht ein sich der Reflexion erschließendes Apriori, sondern eine Wirklichkeit,
für die sich das Denken öffnen kann, aber nicht muss. Warum öffnet es sich ihr, wenn es das
tut? Der Grund ist, weil wir uns nur so als Freiheit, als Selbstsein, in der Sprache von Jaspers
als „mögliche Existenz“ begreifen können. Freiheit kommt in der Immanenz der wissenschaft-
lich ausgelegten Welt nicht vor. Von ihr aus betrachtet unterliegen wir mit unserem Verlangen
nach Freiheit einer Selbsttäuschung. Heute glauben Hirnforscher in grotesker Überschätzung
ihrer Möglichkeiten, dies sogar beweisen und damit unsere menschliche Welt aus den Angeln
heben zu können. Tatsächlich ist es aber so, dass wir Freiheit innerhalb des Naturprozesses aus
apriorischen Gründen nicht feststellen können, so wenig wie deren Abwesenheit. Kant schreibt
einmal in der Metaphysik der Sitten, dass wir uns von der Entstehung eines Freiheitswesens
aus einer „natürlichen Operation“ – Kant meint die Zeugung – aus prinzipiellen Gründen kei-
nen Begriff machen können. Dennoch ist Freiheit und ihre Öffnung auf ein Unbedingtes nicht
selbst unbedingt. Sie ist ein Ereignis innerhalb einer Welt durchgängiger Bedingtheit. Und wir
erfahren uns, wenn wir uns als frei erleben, nicht als grundlos. Der Grund aber kann nicht Natur
sein, er muss selbst von der Art sein, dass Freiheit sich als sich ihm verdankend verstehen muss.
Und nicht von ungefähr fällt hier statt des Wortes „verursacht“ das Wort „sich verdankend“,
was natürlich etwas mit Dank zu tun hat. Jaspers spricht hier in der Tat von Dank, aber von
einem „unpersönlichen Dank“, worunter es mir nicht gelingt, etwas Klares zu verstehen. Dank
setzt einen Adressaten voraus, der selbst als frei gedacht wird. Wenn Freiheit sich einem Grund
verdankt, dann muss dieser Grund selbst als Freiheit gedacht werden, und das heißt, er muss als
persönlich gedacht werden. Jaspers schreibt diesem transzendenten, göttlichen Grund Willen
zu und ein prinzipielles Geneigtsein zum Guten. Aber er möchte ihn zugleich als unpersönlich
denken, weil der Begriff der Person ihm als verendlichend erscheint. Person ist wesentlich auf
ein Gegenüber bezogen. Sie kann kein singulare tantum sein.
Gott muss also größer sein als das, was wir Person nennen. Der Versuch, ihn als überper-
sönlich zu denken, führt zu zwei entgegengesetzten Alternativen. Entweder er wird als eine
spinozistische Allnatur gedacht, die zwar unter anderem das Attribut des Bewusstseins besitzt,
aber nicht das personale Attribut des Willens und der Freiheit, der gegenüber es folglich auch
so etwas wie Dank nicht geben kann. Da sie selbst nicht frei ist, kann sie auch nicht Grund
von Freiheit sein. Folglich ist der Mensch auch nicht in irgendeinem anderen möglichen Sinn
frei als dem des Verschwindens der Person durch die Erkenntnis der Identität mit der Allsub-
stanz. Die andere Alternative hat sich dem Christentum erschlossen, nämlich der Gedanke
der Personalität und Freiheit Gottes ohne dessen Verendlichung: die Trinitätslehre, in der das
konstitutive Gegenüber der Person in die Gottheit selbst hineingenommen wird. Der Vater
wird gedacht als sich wissend und im Sichwissen ein vollkommen adäquates Bild von sich,
den logos, aus sich heraussetzend und sich diesem logos als Gabe übereignend, nämlich als
den Heiligen Geist. Diese Lehre macht den Einwand leicht, hier würden ausschweifende Spe-
kulationen getrieben, die sich jeder verantwortlichen Nachprüfung entziehen. Karl Jaspers
meinte, dass diese Lehre auch nicht zum Inhalt einer existenziellen Frömmigkeit und als
deren movens legitimiert werde. Beides stimmt wohl so nicht. Was die existenzielle Bedeut-
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
DZPhil 57 (2009) 2 253
samkeit betrifft, so wird seine Vermutung empirisch widerlegt. Die heilige Dreifaltigkeit hat
das spirituelle Leben sehr vieler Christen von Grund auf strukturiert. Unter vielen Beispielen
nenne ich nur ein Beispiel: Olivier Messiaen, dessen Vingt regards sur l’enfant Jesus ganz
und gar durch die verschiedenen Aspekte des Trinitätsmysteriums strukturiert sind.
Was aber die scheinbar wild wuchernde Spekulation betrifft, so ist dazu zweierlei zu sagen:
Erstens handelt es sich bei den frühchristlichen Debatten um den intensiven Versuch einer Har-
monisierung der neutestamentlichen Texte, das heißt um die Bemühung, sie gedanklich nach-
vollziehbar zu machen. Die Lösung, die bald gefunden wurde, hat dann im Raum des Christen-
tums dem Gottesgedanken eine Vertiefung gegeben, die einzigartig ist. Die Unterscheidung
Meister Eckharts von Gott und Gottheit, die Jaspers so am Herzen lag, war nur möglich auf der
Basis der Trinitätslehre, der Lehre von den drei Personen, in denen die eine göttliche Wesen-
heit, die Gottheit subsistiert. Der Einwand, hier werde über die Transzendenz vergegenständli-
chend gesprochen, kann, von Jaspers her gesehen, kein Einwand sein. Er schreibt, unser Den-
ken des Umgreifenden und der Transzendenz sei unvermeidlich immer vergegenständlichend,
weil wir als endliche Wesen der Entgegensetzung von Subjekt und Objekt nicht entrinnen.
Entscheidend ist, dass wir, um mit Wittgenstein zu reden, die Leiter fortwerfen, nachdem wir
hinaufgestiegen sind. Jaspers sagt, entscheidend ist, dass wir die Vergegenständlichung nach-
träglich wieder rückgängig machen und das Gesagte zurücknehmen. Hier muss man natürlich
die Frage stellen: Wenn man das Gesagte zurücknehmen muss, was ist dann durch das Sagen
gewonnen? Sind wir nicht wieder dort, wo wir vorher waren? Es war dies Hegels Einwand
gegen die negative Theologie, die alle von Gott ausgesagten Prädikate wieder zurücknimmt.
Schon Thomas von Aquin hat sich, in Auseinandersetzung mit Moses Maimonides, mit diesem
Einwand auseinandergesetzt. Er unterschied Prädikate, die von Gott einfachhin negiert wer-
den müssen, von solchen, die auf andere Art zurückgenommen werden, nämlich durch eine
Steigerung, die die Begrenztheit des durch das Prädikat Gesagten überwindet, die so genannte
via eminentiae. Wenn von Gott im Jakobusbrief gesagt wird, er wohne in „unzugänglichem
Licht“ und keine Finsternis sei in ihm, so kann zwar die Unzugänglichkeit wiederum, wie es
bei einigen Mystikern auch geschieht, als Dunkelheit bezeichnet werden. Aber die Metapher
der Dunkelheit hat nicht den gleichen Rang wie die des Lichtes. Das Licht kann wegen seiner
zu großen Stärke das Sehen verhindern, bis das Auge hinreichend erkräftigt ist. Aber die Dun-
kelheit macht durch ihre Steigerung nicht sehend. Mit Bezug auf dieses Prädikat hat die via
eminentiae keinen Sinn. Es gibt nur die via negationis der negativen Theologie.
Das Wegwerfen der Leiter, die Zurücknahme der sich auf die Gottheit beziehenden Sätze
macht nicht alles einfach rückgängig. Das Sprechen muss in diesem Fall unter dem perfor-
mativen Aspekt gesehen werden. Indem etwas gesagt wird, geschieht etwas. Und auf das,
was geschieht, kommt es an. Was ist das, was geschieht? Es entsteht ein Geisteszustand, den
Jaspers, wiederum nur metaphorisch, als Schweben bezeichnet. Es entsteht ein radikales Kon-
tingenzbewusstsein. Das Bewusstsein, die Welt und die Dinge in der Welt seien eine feste, in
sich gegründete Wirklichkeit, entdeckt sich als Illusion. Aber das, worin sie gründen, ist nicht
von der gleichen Art wie das Gegründete. Entgegen dem ersten Augenschein übertrifft hier
der oft enervierend wortreiche philosophische Prediger Jaspers den lakonischen Wittgenstein
an Klarheit. Das schöne Bild vom Wegwerfen der Leiter ist nämlich trügerisch. Ich kann mit
einer Leiter auf den Dachboden steigen und die Leiter anschließend, statt sie hinaufzuziehen,
umstoßen. Ich bin und bleibe dann eben oben. Der Unterschied zwischen unten und oben
wird nämlich nicht durch die Leiter geschaffen. Anders mit dem geistigen Aufstieg. Das Oben
unterscheidet sich vom Unten eben durch den Aufstieg. Wir dürfen ihn nicht vergessen, denn
nur indem wir ihn erinnern, sind wir oben. Die Erinnerung ist die Leiter, die eben gerade nicht
weggeworfen werden darf.
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
254 Robert Spaemann, Die Idee eines philosophischen Glaubens
Ich habe die Jasperssche Metapher des Schwebens mit „Kontingenzbewusstsein“ über-
setzt. Jaspers selbst nennt dieses Bewusstsein auch „Glauben“, und zwar in klarer Absetzung
gegen „Wissen“. Dies ist eine geläufige Unterscheidung, die aber weit davon entfernt ist,
klar zu sein. Ich habe zu Beginn dieser Überlegungen schon auf die vierfache Bedeutung
des Wortes „glauben“ hingewiesen. Glauben und Wissen sind kognitive Einstellungen wie
Meinen, Vermuten, Ahnen, Für wahrscheinlich halten usw. Ich sage: kognitive Einstellungen,
nicht kognitive Akte, wie Sehen und Hören. Sinnliche Wahrnehmungen sind immer aktual.
Wir können uns an sie erinnern, aber die erinnerte Wahrnehmung ist nicht Wahrnehmung,
sondern Erinnerung. Wissen und glauben hingegen kann ich etwas, an das ich im Augenblick
gar nicht denke. Das meiste von dem, was wir wissen, ist von dieser Art. Ja, wenn wir sagen:
„wir wissen heute das und das“ oder „man weiß heute das und das“, dann haben wir überhaupt
keine bestimmten Subjekte dieses Wissens vor Augen. Wer hier weiß, ist oft gar kein leben-
diges Subjekt sondern ein abstraktes namens „die Wissenschaft“. „Die Wissenschaft weiß.“
Der Inhalt dieses Wissens steht in Büchern. Die Bücher freilich wissen nicht, sondern diejeni-
gen, die diese Bücher lesen und das potenzielle Wissen aktualisieren. Ähnlich verhält es sich
mit dem religiösen Glauben. Er ist ein Grundton, der das Leben trägt, aber bewusst gemacht
wird er nur manchmal, so zum Beispiel, wenn eine christliche Gemeinde sonntags gemeinsam
das Glaubensbekenntnis spricht. Wer ist es, der hier glaubt? In der katholischen Liturgie gibt
es das Gebet: „Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche.“
Die Kirche ist hier ein ideales Subjekt, ähnlich wie „die Wissenschaft“, die etwas weiß.
Und die Philosophie? Was weiß sie? Was glaubt sie? Sokrates beanspruchte nur ein Wis-
sen: das Wissen, nicht zu wissen, und nur eine Kunst: die Hebammenkunst, also die Kunst,
bei anderen entschiedene Meinungen zu Tage zu fördern und sie in einem dialogischen Ver-
fahren auf ihre Wahrheit hin zu prüfen. Das Wissen aufzuheben, um für den Glauben Platz
zu schaffen, so beschreibt Kant das Ziel des Projektes einer Kritik der reinen Vernunft. Ein
nihilistisches Projekt, könnte man sagen. Und für Jaspers ist Nihilismus in der Tat das unmit-
telbare Resultat philosophischer Reflexion. Kleist ist daran zerbrochen. Er fühlt sich nach der
Lektüre der Kritik der reinen Vernunft, wie er schreibt, „tief in seinem heiligsten Inneren ver-
wundet“. „Ach Wilhelmine“, so fährt er in seinem Brief fort, „mein einziges, mein höchstes
Ziel ist gesunken und ich habe nun keines mehr.“ Als Wahn bezeichnet auch Schiller es, zu
glauben, „dass dem ird’schen Verstand die Wahrheit je wird erscheinen. Ihren Schleier hebt
keine sterbliche Hand, wir können nur raten und meinen.“ Was die Würde des Menschen
ausmacht, wird aber damit nicht zur Illusion, sondern zur Sache des Glaubens: „Was kein
Verstand der Verständigen sieht, das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt.“ Was glaubt dieser
Glaube? Die drei Worte des Glaubens sind: Freiheit, Tugend und Gott. Diese Wirklichkeit ist
der methodischen wissenschaftlichen Vernunft der Neuzeit verschlossen und muss ihr ver-
schlossen sein. So heißt es in einem Distichon wiederum von Schiller an Naturforscher und
Philosophen: „Feindschaft sei zwischen euch, noch kommt das Bündnis zu frühe. Wenn ihr
im Forschen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt.“
Was weiß die Philosophie, was die Wissenschaft nicht weiß? Ich nannte Sokrates. Die Philo
sophie weiß, dass das, was wir im Alltag und in den Wissenschaften wissen, unter den Bedin-
gungen der vergegenständlichenden endlichen Subjektivität steht, und zwar auch, ja gerade
dann, wenn es sich um exaktes, allgemeingültiges, zwingendes Wissen handelt. Das streng
objektive, die Subjektivität außer Betracht lassende und nicht engagierende Wissen ist nicht
absolutes Wissen. Wissen des Absoluten, absolutes Wissen also, ist nicht in gleicher Weise
exakt und subjektunabhängig. Wir können uns das verdeutlichen, indem wir die Erkenntnis
betrachten, die wir von anderen Menschen gewinnen. Es gibt Kenntnisse, deren Gewinnung
die Person des Erkennenden ganz aus dem Spiel lässt. Es gibt wissenschaftlich erarbeitete
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
DZPhil 57 (2009) 2 255
Testverfahren, die uns viele objektiv überprüfbare, allgemeingültige Resultate liefern. Aber
der Mensch, der hier getestet wurde, kann zu dem Eindruck kommen, dass der, der ihn testete,
überhaupt keine Ahnung davon hat, wer er eigentlich ist. Dass er ihn überhaupt nicht kennt.
Um einen Menschen wirklich kennen zu lernen, muss man sich mit ihm einlassen. Man muss
etwas von sich hergeben. Das wiederum bedeutet: Je besser ich die Person eines anderen sozu-
sagen von innen kenne, umso mehr ist von mir selbst in diese Erkenntnis eingeflossen. Es ist
nicht ohne tiefe Bedeutung, dass das hebräische Wort für „erkennen“, jadah, zugleich Bei-
schlaf bedeutet.
Jaspers nennt die kognitive Beziehung zum Absoluten „Glaube“ und unterscheidet sie
damit von der kognitiven Beziehung zu innerweltlichen Gegenständen, die er Wissen nennt.
Beide Formen haben ihre Art von Gewissheit, weil in beiden Formen Subjektivität in ganz
verschiedener Weise am Werk ist. Einmal als das, was Jaspers „Bewusstsein überhaupt“
nennt. Das Subjekt ist ein anonymes, ein „man“ oder „die Wissenschaft“. Im anderen Fall ist
das Subjekt das, was Jaspers „Existenz“ nennt, das heißt ein menschliches Individuum, das
sich als mögliche Freiheit versteht und damit als Adressat eines unbedingten Anrufs der Gott-
heit, in der sie gründet. Die Gewissheit übertrifft an Ernst die des allgemeingültigen neutralen
und wertfreien Wissens. Weil das Organ dieser Beziehung zum Unbedingten die Freiheit und
nur die Freiheit ist, hat diese Gewissheit, obwohl selbst unbedingt, nie den Charakter des
Zwingenden. Der Mensch kann entweder in der Anonymität des „man“ und seinen inner-
weltlichen Inhalten bleiben und sie für das verlässliche Fundament des Lebens halten. Oder
er kann die Nichtigkeit dieser Inhalte sehen und sie zum Nichts hin transzendieren. Er kann
im Nihilismus bleiben. Er kann, wie es der Existenzialismus tat, Freiheit für einen Defekt
halten, ein Loch sozusagen in der opaken Substanzialität des Seins. Wo die je eigene Freiheit
als Offenheit für den Anruf des Unbedingten verstanden und bejaht wird, spricht Jaspers von
„Glauben“.
Platon hatte hier von Wissen gesprochen. Und doch, wenn Platon vom Guten spricht, von
„dem Guten selbst“, wie es bei ihm heißt, dann hat er dasselbe Phänomen vor Augen wie Jas-
pers. Er deutet es nur anders, weil er einen anderen Begriff des Wissens hat. Man könnte die-
sen Begriff enger als den modernen nennen oder auch weiter. Weiter, weil er sich auf Ewiges
bezieht, enger, weil er sich nur auf Ewiges bezieht und weil er, zweitens, ein Identischwerden
von Wissendem und Gewusstem meint, das zwar Descartes noch einmal dem Denken vindi-
ziert, das aber Jaspers im Gefolge des Christentums für den Glauben reserviert.
Auch Platon kennt so etwas wie Glauben mit Bezug auf die letzten Dinge. Am Ende des
Phaidon entwirft Sokrates eine Kosmologie als Hintergrund einer großen Erzählung über das
Schicksal der Seele nach dem Tod. Dieses Schicksal muss von der Art sein, dass es auf eine
letztendliche Konvergenz zwischen dem Guten und dem Weltlauf hinausläuft. Dieses Postulat
anzunehmen, ist ein Gebot der Vernunft. „Schön ist der Preis und die Hoffnung ist groß“, sagt
Sokrates und fährt dann fort: „Dass sich nun dies alles gerade so verhalte, wie ich es auseinan-
dergesetzt habe, das ziemt wohl einem vernünftigen Mann nicht zu behaupten. Dass es jedoch
entweder diese oder eine ähnliche Bewandtnis haben muss mit unseren Seelen und deren
Wohnungen, wenn doch die Seele offenbar etwas Unsterbliches ist, dies, dünkt mich, ziemt
sich gar wohl und lohne auch, es darauf zu wagen, dass man glaube, es verhalte sich so. Denn
es ist ein schönes Wagnis, und man muss mit solcherlei gleichsam sich selbst besprechen.“
(Phaidon, 116 b)
Was ist hier Gegenstand des Wagnisses und des Glaubens? Es ist nicht die Unsterblich-
keit der Seele und nicht die Überzeugung von der letztendlichen Identität des Seins und des
Guten. Darüber kann uns philosophisches Nachdenken belehren, und dieses Nachdenken
kann zu dem führen, was in einem emphatischen Sinn Wissen heißt. Dort aber, wo diese
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
256 Robert Spaemann, Die Idee eines philosophischen Glaubens
Grundeinsicht sich als Vorstellung konkretisiert, da haben wir es mit Erzählungen zu tun, die
wir mit Jaspers „Chiffren“ nennen können. Sie sind es wert, dass man sich an sie hält, denn
in ihnen wird das Wahre anschaulich. Aber diese Anschauung ist nicht die Sache selbst und
deshalb eine Sache der Selbstüberredung zum Glauben.
Anders, wo es um die Unsterblichkeit der Seele geht. Die Überzeugung, dass, wie es volks-
tümlich heißt, „mit dem Tod alles aus ist“, ist nicht ebenbürtig mit der gegenteiligen Überzeu-
gung. Wie immer wir uns die Unsterblichkeit der Seele vorstellen, ob der Tod das letzte Wort
hat, das ist für den Einzelnen von existenziellem Interesse. Und, so lässt Platon Simmias, den
Gesprächspartner und Gesinnungsgenossen des Sokrates, sagen: „Etwas Sicheres darüber zu
wissen, ist in diesem Leben entweder unmöglich oder doch sehr schwer. Aber das, was darü-
ber gesagt wird, nicht auf jede Weise zu prüfen, ohne eher abzulassen, bis einer ganz ermüdet
wäre von Untersuchungen nach allen Seiten, verrät einen sehr weichlichen Menschen. Denn“,
so fährt Simmias fort, „eines muss man doch in diesen Dingen erreichen: entweder lernen
oder herausfinden, wie es damit steht, oder wenn dies unmöglich ist, die beste und unwi-
derleglichste der menschlichen Meinungen darüber nehmen und darauf wie auf einem Brett
versuchen, durch das Leben zu schwimmen, solange einer nicht sicherer und gefahrloser auf
einem festeren Fahrzeug oder auf einer göttlichen Rede fahren kann.“ (Phaidon, 85d)
Zweierlei fällt an diesem Text auf:
1. Platon setzt nicht einfach Wissen und Glauben einander gegenüber, sondern er unter-
scheidet Grade der Gewissheit. Und zwar Grade, die sich in der argumentativen Prüfung
herausstellen. Diese Prüfung kann prinzipiell zu dem führen, was Wissen heißen darf.
Die Wahrheit wäre dann bewiesen. In der Regel aber führt die argumentative Prüfung
zweier entgegengesetzter Meinungen nur zur Einsicht, dass bestimmte Gründe stärker
als andere sind. Ihre Unwiderleglichkeit ist Grund genug, sich der besser begründeten
Meinung anzuschließen und auf sie die eigene Lebensführung zu gründen.
2. Platon zieht zwei Alternativen in Betracht, ein „festeres Fahrzeug“, wobei nicht gesagt
wird, worin dieses bestehen könnte. Oder aber einen göttlichen logos, also eine Offen-
barung. Platon sieht sich nicht als Adressaten einer solchen Offenbarung, schließt aber
ihre Möglichkeit nicht aus, wie es Karl Jaspers tut, für den Gott in der Welt zwar Spu-
ren, Chiffren hinterlassen, sich selbst aber nicht zeigen und keinen eindeutigen Willen
bekunden kann.
Aber was ist das „festere Fahrzeug“, dessen Möglichkeit Platon andeutet, ohne es mit dem
göttlichen logos zu identifizieren? Ist es die Philosophie? Aber die Philosophie scheint doch
nur in jener argumentativen Prüfung von Meinungen zu bestehen, die zu einer für eine verant-
wortliche Lebensführung ausreichenden Plausibilität führt, also eben nicht zu der Gewissheit,
die wir Wissen nennen. Was heißt für Platon Wissen? In verschiedenen Dialogen hält sich
die Definition durch, Wissen sei richtige Meinung zusammen mit der Fähigkeit, sie rational
zu begründen. Im Unterschied zur Wahrnehmung, die täuschen kann, und zur Meinung, die
irren kann, gehört Wahrheit zur Definition des Wissens. Das heißt, dass Wissen nicht als men-
taler Zustand beschrieben werden kann. Vermeintliches und wirkliches Wissen unterschei-
den sich als mentale Zustände überhaupt nicht voneinander. In diesem Sinn scheint es kein
Kriterium der Wahrheit geben zu können, kein Wissen des Wissens, wie Platon im Theätet
zeigt. Descartes versuchte, im Cogito ein solches Wissen des Wissens zu finden. Sich sei-
nes Bewusstseins bewusst zu sein, das ist keiner Irrtumsmöglichkeit unterworfen. Allerdings
führt das Cogito nicht über das instantane Beisichsein hinaus. Und Hume konnte später diese
Unmöglichkeit, aus der fensterlosen Helle des bei sich seienden Ich hinauszukommen, in die
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
DZPhil 57 (2009) 2 257
programmatische Formel kleiden: „We never advance one step beyond ourselves.“ Um vom
Innen des Ich denke zum Bei-der-Welt-sein zu kommen, braucht Descartes die Idee Gottes,
eines wahrhaftigen Gottes. Für Platon gibt es Wissen im höchsten und striktesten Sinn des
Wortes nur dort, wo das megiston mathema, das größte Denkbare und Wissbare gewusst wird:
die Idee des Guten, oder, wie Platon sagt: das Gute selbst. Es gibt kein Wissen des Wissens.
Die Reflexion des subjektiven Bewusstseins auf sich geht ins Leere. Bewusstsein ist, wie
Platon sagt, immer Bewusstsein von etwas. Um das Bewusstsein zu verstehen, müssen wir
seinen Gegenstand verstehen. Und zwar seinen höchsten und zugleich grundlegenden Gegen-
stand, das Gute selbst, Gott, „den Grund“, wie es in der Politeia heißt, „der Wirklichkeit und
der Erkennbarkeit der Dinge“. Dieses megiston mathema aber kann, wie Platon im 7. Brief
schreibt, in direkter, schulmäßiger Form nicht gelernt werde. Es „zeigt sich“, um mit Wittgen-
stein zu reden. „In häufiger familiärer Unterredung geht es in der Seele plötzlich wie ein Licht
auf und bricht sich weiter seine Bahn.“
Das Gute kann nicht nur nicht direkt gelehrt werden, es kann auch nicht auf die übliche
objektive, die Existenz aus dem Spiel lassende Weise gewusst werden. Man kann es nicht
wissen, ohne es zu wollen. Von Meinungen, auch von Meinungen über das Gute kann man
sich trennen. Vom Wissen nicht. Vollkommenes Wissen ist mit dem Wissenden eins. Das
sah Descartes richtig. Aber diese Identität muss eine des ganzen Menschen sein. Platon gibt
einmal in den Nomoi eine eigentümliche Definition der Unwissenheit. Er nennt Unwissenheit
die „Nichtübereinstimmung von Lust und Unlust mit der vernunftgemäßen Überzeugung“.
„Gut“ heißt für die Griechen: erstrebenswert. Wer etwas als erstrebenswert kennt und weiß,
der erstrebt es. Wo also das Streben, wo Lust und Unlust mit dem, was wir für erstrebenswert
halten, nicht übereinstimmen, da hat dieses Für-erstrebenswert-halten noch den Charakter
einer bloßen wahren Meinung. Es ist noch nicht eins geworden mit dem Meinenden, es ist
noch nicht zum Wissen geworden.
Der axiologische Charakter der Wirklichkeit bedeutet, dass Seiendes erst verstanden
ist, wenn es in seinem Aus-sein-auf verstanden ist, und zwar in seinem letzten Aus-sein-
auf, seinem letzten Umwillen. Darum bedarf der Weise, also der Wissende keiner weiteren
Tugenden. Zum Beispiel nicht der Tapferkeit, die das Festhalten an der richtigen doxa über
das zu Fürchtende und nicht zu Fürchtende ist. Wer wirklich weiß, was zu fürchten ist, der
braucht keine eigene Tugend, um an diesem Wissen festzuhalten. Aber es gilt ebenso das
Umgekehrte: Wer der Angst erliegt, der war noch kein wirklich Wissender.
Es hat hier offenbar von Platon bis zu Jaspers eine Begriffsverschiebung stattgefunden.
Dieses durch Studium von Mathematik und Ideenlehre indirekt vorbereitete Ergriffensein der
Existenz durch das megiston mathema, das Platon Wissen im Sinne von absolutem Wissen
nennt, ist das, was bei Jaspers Glaube heißt. Offensichtlich handelt es sich hier formal um eine
Transformation des Glaubensbegriffs, an deren Beginn die israelitischen Propheten, vor allem
aber das Neue Testament stehen. Beide Elemente des platonischen Wissens finden sich hier
im Begriff des Glaubens wieder: die alles verstandesmäßige übersteigende Größe des Gegen-
standes und die Intensität des Ergriffenseins der Person, die zum Beispiel Paulus schreiben
lässt: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Allerdings findet mit dem biblischen
Glaubensbegriff eine Diastase zwischen Weltwissen und Glauben statt, die wir auch bei Jaspers
finden. Gewiss, für Jaspers ist das Studium der innerweltlichen Erscheinungswelt ähnlich wie
für Platon und wiederum für die christliche Scholastik Propädeutik des Transzendierens. Aber
die Welt der neuzeitlichen Wissenschaft ist eine methodisch geschlossene Welt geworden,
deren Studium möglich ist „etsi Deus non daretur“. In ihr gilt nun allerdings mehr und mehr,
dass es auch keine innerweltliche Transzendenz gibt und der Satz Humes triumphiert: „We
never advance one step beyond ourselves.“ Tatsächlich aber transzendieren wir doch ständig
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
258 Robert Spaemann, Die Idee eines philosophischen Glaubens
unsere Erscheinungswelt. Wir transzendieren sie, wenn wir uns einem Menschen in Liebe
zuwenden oder wenn wir im Umgang mit Tieren unterstellen, dass sie schmerzempfindliche
Wesen sind – was die Cartesianer bekanntlich leugneten. Nietzsche sah als erster, dass mit
der Transzendenz zum Unbedingten auch die innerweltliche Transzendenz unmöglich wird.
„Wenn es Gott nicht gibt, gibt es keine Wahrheit“, war seine Botschaft. „Wir Aufklärer, wir
freien Geister des 19. Jahrhunderts nehmen unser Feuer noch von dem Christenglauben, der
auch der Glaube Platons war, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist.“ Und
Nietzsche war der Meinung, dass mit der Zerstörung dieses Glaubens die Aufklärung sich
notwendigerweise selbst zerstöre.
Wir erleben ja heute das merkwürdige Phänomen, dass Vernunft selbst der Stützung durch
den Glauben bedarf. Descartes sah das, als er die Möglichkeit entdeckte, auch an den Evi-
denzen der Vernunft zu zweifeln. Sie könnten ja Vorspiegelungen eines Dämon sein. Wir
haben heute den cartesischen Dämon in den Mechanismus der Evolution verwandelt, der
uns darüber systematisch täuscht, wer wir sind und was es mit unserer Vernunft auf sich hat.
Sie ist ein durch vielfältige Selektion erprobtes Anpassungsorgan, dessen Funktionen mit so
etwas wie Wahrheit nichts zu tun haben. Wahr im traditionellen Sinn des Wortes soll para-
doxerweise nur diese Theorie selbst sein. Es ist aber nun zur Sache eines philosophischen
Glaubens geworden, dass wir etwas wissen können und nicht nur bei uns selbst bleiben,
wenn wir mit einem guten Freund ein Glas Wein trinken und dabei wissen, dass wir nicht das
Konstrukt des Anderen und der Andere nicht das unsere ist. Platons Begründungsfunktion des
absoluten Wissens für jede Art von Wahrheit scheint an Aktualität Karl Jaspers zu übertreffen.
Aber Jaspers hatte gute Gründe, dieses absolute Wissen „Glauben“ zu nennen.
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Robert Spaemann, Umgelterweg 10 E, 70195 Stuttgart
Abstract
Nietzsche diagnosed a tendency for self-destruction within the Enlightenment movement. According
to him, in giving up the idea of God, the idea of non-perspective truth, that is the faith in reason, falls
victim to it. Wittgenstein und Jaspers reflected upon the characteristics of this faith in reason, which
starts where scientific knowledge ends, respectively, where it becomes aware of its hypothetical sta-
tus. Plato reserved the term of „knowing“ for this relation of a presuppositionless conceptually inex-
plicable „megiston mathema“. In Jaspers’s concept of a philosophical faith not based on revelation,
both elements of the platonic knowing of the „good itself“ can be found: the greatness of the matter,
transcending everything being the case, and the intensity of being really touched. Yet with regard to
philosophical radicalness, the explanatory function of the „absolute knowing“ for each kind of truth
seems to exceed the faith of Jaspers.
Bereitgestellt von | ULB Bonn
Angemeldet
Heruntergeladen am | 11.03.15 18:37
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Siewerth Metaphysik Der KindheitDokument85 SeitenSiewerth Metaphysik Der KindheitPhiblogsophoNoch keine Bewertungen
- Fink, Eugen - Operative Begriffe in Husserls PhänomenologieDokument18 SeitenFink, Eugen - Operative Begriffe in Husserls PhänomenologiePavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- Manifesto Positio Fraternitatis Rosae Crucis AMORC GermanDokument44 SeitenManifesto Positio Fraternitatis Rosae Crucis AMORC Germanneophyt100% (1)
- Astralreisen Secrets 1Dokument81 SeitenAstralreisen Secrets 1KarinNoch keine Bewertungen
- Bumke, Gedanken Uber Die Seele, 1941Dokument355 SeitenBumke, Gedanken Uber Die Seele, 1941glitterglyptodon100% (1)
- Wunsch und Bedeutung: Grundzüge einer naturalistischen BedeutungstheorieVon EverandWunsch und Bedeutung: Grundzüge einer naturalistischen BedeutungstheorieNoch keine Bewertungen
- Der hermetische Bund teilt mit: Hermetische Zeitschrift Nr. 8/2014Von EverandDer hermetische Bund teilt mit: Hermetische Zeitschrift Nr. 8/2014Noch keine Bewertungen
- Heilung im endlosen Bewusstsein: Praxis der KinesiosophieVon EverandHeilung im endlosen Bewusstsein: Praxis der KinesiosophieNoch keine Bewertungen
- Wahrheit Und WissenschaftDokument67 SeitenWahrheit Und WissenschaftMagda KharchilavaNoch keine Bewertungen
- Wissenschaft trifft Spiritualität: Band 2: Sternenstaub. In-forma-tion in Bewusstsein und KosmosVon EverandWissenschaft trifft Spiritualität: Band 2: Sternenstaub. In-forma-tion in Bewusstsein und KosmosNoch keine Bewertungen
- Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik: Kants Kritik an Emanuel Swedenborg, an seinem Hauptwerk "Arcana Coelestia"Von EverandTräume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik: Kants Kritik an Emanuel Swedenborg, an seinem Hauptwerk "Arcana Coelestia"Noch keine Bewertungen
- Es ist später, als du denkst: Perspektiven für die RestbiografieVon EverandEs ist später, als du denkst: Perspektiven für die RestbiografieNoch keine Bewertungen
- Gilles Deleuze - Differenz Und Wiederholung. Das Bild Des DenkensDokument30 SeitenGilles Deleuze - Differenz Und Wiederholung. Das Bild Des Denkensa6dama6drian6Noch keine Bewertungen
- Zum Problem der Einfühlung: Das Wesen der Einfühlungsakte, Die Konstitution des psychophysischen Individuums & Einfühlung als Verstehen geistiger PersonenVon EverandZum Problem der Einfühlung: Das Wesen der Einfühlungsakte, Die Konstitution des psychophysischen Individuums & Einfühlung als Verstehen geistiger PersonenNoch keine Bewertungen
- Markus Gabriel An Den Grenzen Der Erkenntnistheorie Die Notwendige Endlichkeit Des Objektiven Wissens Als Lektion Des Skeptizismus 2008 PDFDokument422 SeitenMarkus Gabriel An Den Grenzen Der Erkenntnistheorie Die Notwendige Endlichkeit Des Objektiven Wissens Als Lektion Des Skeptizismus 2008 PDFacroaliNoch keine Bewertungen
- glauben und Glaube: Das Pfand zur Bergung der MenschenwürdeVon Everandglauben und Glaube: Das Pfand zur Bergung der MenschenwürdeNoch keine Bewertungen
- Hinausgehen über das räumliche Systemdenken: Korrektur der grundlegenden Fehler in der modernen WissenschaftVon EverandHinausgehen über das räumliche Systemdenken: Korrektur der grundlegenden Fehler in der modernen WissenschaftNoch keine Bewertungen
- Figal - Gibt Es Wirklich Etwas Draußen? Skizze Einer Realistischen PhänomenologieDokument8 SeitenFigal - Gibt Es Wirklich Etwas Draußen? Skizze Einer Realistischen PhänomenologieFabian SkyNoch keine Bewertungen
- Essenzen der Aufstellungsarbeit: Praxis der SystemaufstellungVon EverandEssenzen der Aufstellungsarbeit: Praxis der SystemaufstellungNoch keine Bewertungen
- Gleichzeitigkeit im Kosmos: und die Befindlichkeiten des MenschenVon EverandGleichzeitigkeit im Kosmos: und die Befindlichkeiten des MenschenNoch keine Bewertungen
- Thomas Nagel: Was bedeutet das alles?: Eine BuchbesprechungVon EverandThomas Nagel: Was bedeutet das alles?: Eine BuchbesprechungNoch keine Bewertungen
- Die Erkenntnistheoretischen Grundlagen Des Positivismus.: SeiendeDokument66 SeitenDie Erkenntnistheoretischen Grundlagen Des Positivismus.: SeiendeMika ReisslandtNoch keine Bewertungen
- Der periphere Blick: Die Vervollständigung der AufklärungVon EverandDer periphere Blick: Die Vervollständigung der AufklärungNoch keine Bewertungen
- Bollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFDokument33 SeitenBollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFGeorgy PlekhanovNoch keine Bewertungen
- Über die Liebe: Teil 1 der Schriftenreihe aus dem Cosmic ConsciousnessVon EverandÜber die Liebe: Teil 1 der Schriftenreihe aus dem Cosmic ConsciousnessNoch keine Bewertungen
- Menschsein lernen: Entwurf eines Humanismus im konfuzianischen GeistVon EverandMenschsein lernen: Entwurf eines Humanismus im konfuzianischen GeistNoch keine Bewertungen
- Nietzsches Aphorismus 354 Aus Der Fröhlichen WissenschaftDokument18 SeitenNietzsches Aphorismus 354 Aus Der Fröhlichen WissenschaftMichael GerlingerNoch keine Bewertungen
- (Ebook - German) Rudolf Steiner - Wahrheit Und WissenschaftDokument27 Seiten(Ebook - German) Rudolf Steiner - Wahrheit Und WissenschaftchristophmashNoch keine Bewertungen
- Funda IIDokument16 SeitenFunda IIJesus MariaNoch keine Bewertungen
- Der trügerische Verstand: Eine Erwiderung auf Markus Gabriels Buch "Warum es die Welt nicht gibt"Von EverandDer trügerische Verstand: Eine Erwiderung auf Markus Gabriels Buch "Warum es die Welt nicht gibt"Noch keine Bewertungen
- Markus Gabriel - Existenz - Realistisch GedachtDokument24 SeitenMarkus Gabriel - Existenz - Realistisch Gedachtdrfaustus1Noch keine Bewertungen
- Auf dem Rücken von Riesen: Ein Modell für Glauben und Wissen im 21.JahrhundertVon EverandAuf dem Rücken von Riesen: Ein Modell für Glauben und Wissen im 21.JahrhundertNoch keine Bewertungen
- Don DeGracia AstralprojektionDokument146 SeitenDon DeGracia AstralprojektionMaurice Shortlord100% (2)
- Das Mysterium der Einheit in der Vielheit: Die Eine Wahrheit aus Advaita Vedanta, christlicher Offenbarung, Mystik und NahtoderlebnissenVon EverandDas Mysterium der Einheit in der Vielheit: Die Eine Wahrheit aus Advaita Vedanta, christlicher Offenbarung, Mystik und NahtoderlebnissenNoch keine Bewertungen
- Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der MetaphysikVon EverandTräume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der MetaphysikNoch keine Bewertungen
- Mythos und Bewusstsein: Über den Hintergrund von Liebe und LeidVon EverandMythos und Bewusstsein: Über den Hintergrund von Liebe und LeidNoch keine Bewertungen
- Deutsch-English Philosophie TexteDokument7 SeitenDeutsch-English Philosophie TexteparallaxdogNoch keine Bewertungen
- Der Seelenbeweis. Das Wissen über die Seele in Philosophie und WissenschaftVon EverandDer Seelenbeweis. Das Wissen über die Seele in Philosophie und WissenschaftNoch keine Bewertungen
- Transzendierung des Ichs und christliche Botschaft: Eine Deutung christlicher Glaubensinhalte aus spiritueller SichtVon EverandTranszendierung des Ichs und christliche Botschaft: Eine Deutung christlicher Glaubensinhalte aus spiritueller SichtNoch keine Bewertungen
- Das Gerade und das Gekrümmte: Die Behandlung einer 'Psychose' - Theorie und Praxis eines neuen selbstanalytischen VerfahrensVon EverandDas Gerade und das Gekrümmte: Die Behandlung einer 'Psychose' - Theorie und Praxis eines neuen selbstanalytischen VerfahrensNoch keine Bewertungen
- Das geistige und materielle Weltbild: Wie sich das ganzheitliche spirituelle Weltbild vom Weltbild des Materialismus unterscheidetVon EverandDas geistige und materielle Weltbild: Wie sich das ganzheitliche spirituelle Weltbild vom Weltbild des Materialismus unterscheidetNoch keine Bewertungen
- Karl Jaspers - Der Philosophische Glaube Angesichts Der OffenbarungDokument514 SeitenKarl Jaspers - Der Philosophische Glaube Angesichts Der Offenbarungkevin correa alvarezNoch keine Bewertungen
- Muschalle, Michael - Phänomenologie Und Idealismus - Buchkritik Und Entgegnung Des AutorsDokument5 SeitenMuschalle, Michael - Phänomenologie Und Idealismus - Buchkritik Und Entgegnung Des AutorsmilekulasNoch keine Bewertungen
- Foucault - Traum Und ExistenzDokument47 SeitenFoucault - Traum Und ExistenznighbNoch keine Bewertungen
- Der Kampf um die Seelen: Das Erwachen des BewusstseinsVon EverandDer Kampf um die Seelen: Das Erwachen des BewusstseinsNoch keine Bewertungen
- Steinweg Marcus DeutschDokument10 SeitenSteinweg Marcus Deutschperseus89Noch keine Bewertungen
- Der Gang Des Lebens Und Das Absolute TheunissenDokument20 SeitenDer Gang Des Lebens Und Das Absolute TheunissenEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- 71 PDFDokument50 Seiten71 PDFEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Antworten StemmerDokument9 SeitenAntworten StemmerEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- MarlisDokument17 SeitenMarlisEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Vom Tractatus Logico-Philosophicus Zu Ber Gewissheit: Andreas Woyke, DarmstadtDokument30 SeitenVom Tractatus Logico-Philosophicus Zu Ber Gewissheit: Andreas Woyke, DarmstadtEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Neumer Katalin Die Gemeinsame Menschliche Handlungsweise in Wittgensteins NachlassDokument50 SeitenNeumer Katalin Die Gemeinsame Menschliche Handlungsweise in Wittgensteins Nachlassrudolf04Noch keine Bewertungen
- Neumer Katalin Die Gemeinsame Menschliche Handlungsweise in Wittgensteins NachlassDokument50 SeitenNeumer Katalin Die Gemeinsame Menschliche Handlungsweise in Wittgensteins Nachlassrudolf04Noch keine Bewertungen
- Mesch2005 PDFDokument16 SeitenMesch2005 PDFEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Hermeneutik Leiblicher ExpressivitätDokument10 SeitenHermeneutik Leiblicher ExpressivitätEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Franz Rosenzweig Der Stern Der ErlosungDokument538 SeitenFranz Rosenzweig Der Stern Der ErlosungEo Soonpyo MoonNoch keine Bewertungen
- Kants GotteslehreDokument31 SeitenKants GotteslehreEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Mesch2005 PDFDokument16 SeitenMesch2005 PDFEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Mesch2005 PDFDokument16 SeitenMesch2005 PDFEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Der Begriff Der Moralischen PflichtDokument26 SeitenDer Begriff Der Moralischen PflichtEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Kants Lehre Vom Höchsten GutDokument8 SeitenKants Lehre Vom Höchsten GutEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Dr. v. Geilen (Auth.) Mathematik Und Baukunst Als Grundlagen Abendländischer Kultur - Kants 1921Dokument105 SeitenDr. v. Geilen (Auth.) Mathematik Und Baukunst Als Grundlagen Abendländischer Kultur - Kants 1921Eduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Kants Lehre Vom Höchsten GutDokument8 SeitenKants Lehre Vom Höchsten GutEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Der Begriff Der Moralischen PflichtDokument26 SeitenDer Begriff Der Moralischen PflichtEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Bernard Willms (Auth.) Die Totale Freiheit - Fichtes Politische Philosophie 1967Dokument178 SeitenBernard Willms (Auth.) Die Totale Freiheit - Fichtes Politische Philosophie 1967Eduardo Charpenel100% (1)
- Normativität Peter StemmerDokument381 SeitenNormativität Peter StemmerEduardo CharpenelNoch keine Bewertungen
- Merkens, Andreas 2006 Hegemonie Und Gegen-Hegemonie Als Pädagogisches Verhältnis Antonio Gramscis Politische PädagogikDokument24 SeitenMerkens, Andreas 2006 Hegemonie Und Gegen-Hegemonie Als Pädagogisches Verhältnis Antonio Gramscis Politische PädagogikTi LosowskyNoch keine Bewertungen
- Goethe Über MorphologieDokument1 SeiteGoethe Über MorphologieBogdan TomaNoch keine Bewertungen
- Christian Martin - Hegel. Die Verwandlung Von Metaphysik in LogikDokument14 SeitenChristian Martin - Hegel. Die Verwandlung Von Metaphysik in LogikCristián IgnacioNoch keine Bewertungen
- Irene Breuer - Ontologie - Der - Person - Und - Geschichte - BeiDokument10 SeitenIrene Breuer - Ontologie - Der - Person - Und - Geschichte - BeiChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Vde82 Portraet Sigmund FreudDokument2 SeitenVde82 Portraet Sigmund Freudkrisna bhataraNoch keine Bewertungen
- KMW - Modulprüfung / Klausur 101 - WS10-11Dokument1 SeiteKMW - Modulprüfung / Klausur 101 - WS10-11OG3rNoch keine Bewertungen
- Zeller - Die Philosophie Der Griechen. Eine Untersuchung Über Charakter, Gang Und Hauptmomente Ihrer EntwicklungDokument881 SeitenZeller - Die Philosophie Der Griechen. Eine Untersuchung Über Charakter, Gang Und Hauptmomente Ihrer EntwicklungFelipe_GumaNoch keine Bewertungen
- Special BibliographyDokument75 SeitenSpecial BibliographymishagdcNoch keine Bewertungen
- Der Zweifelhafte Marxismus Des A. Sohn-RethelDokument12 SeitenDer Zweifelhafte Marxismus Des A. Sohn-RethelNatalie ZementbeisserNoch keine Bewertungen