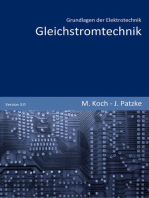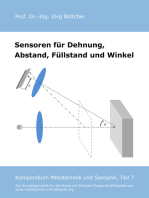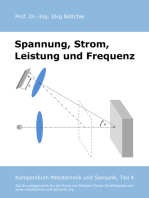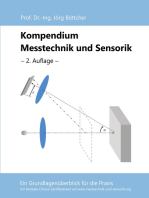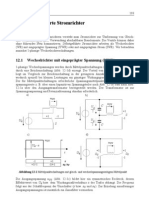Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ET1V01
ET1V01
Hochgeladen von
holtzcCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
ET1V01
ET1V01
Hochgeladen von
holtzcCopyright:
Verfügbare Formate
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 1
Grundlagen der Elektrotechnik 1
Prof. Dr.-Ing. Andreas Meisel
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 2
Vortragsfolien downloadbar von meiner Website
Vertiefungen und Herleitungen Tafel
bungsaufgaben Tafel
Fachtutorium Elektrotechnik
bungsaufgaben downloadbar von meiner Website
alte Klausuren downloadbar von meiner Website
Klausurbungen mit Musterlsung downloadbar von meiner Website
zur Vorgehensweise
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 3
Literatur
Vorlesungsskript von Prof. P. Schreiber (HAW-Hamburg)
Pub (viele bungsaufgaben mit Lsungen)
Wolf-Ewald Bttner: Grundlagen der Elektrotechnik 1,
Oldenbourg Wissenschaftsverlag
Christian H. Kautz: Tutorien zur Elektrotechnik, Pearson Studium
Manfred Albach: Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2, Pearson Studium
Clausert/Wiesemann: Grundgebiete der Elektrotechnik 1
Oldenbourg Wissenschaftsverlag
Dieter Zastrow: Elektrotechnik - Lehr- und Arbeitsbuch, Vieweg Verlag
Kories/Schmidt-Walter: Taschenbuch der Elektrotechnik, Verlag Harri Deutsch
und viele mehr .. (s. Bibliothek und Onlinebibliothek)
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 4
bungsaufgaben
Erfolgreiches Lernen ist nur mglich durch
Vorlesung nachbereiten (Bcher)
bungsaufgaben rechnen
selber rechnen (nicht nur nachvollziehen)
bungsaufgaben:
- bungsbltter rechnen !!!
- Skript von Prof. Schreiber (Aufgaben mit Musterlsungen)
- Bcher
- alte Klausuren und Klausurbungen
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 5
1. Informatik und Elektrotechnik
1.1 Bedeutung der Elektrotechnik fr die Informatik
- Computer sind elektrische Gerte.
- Computer kommunizieren mit Hilfe elektrischer Sensoren und Aktoren
mit der Aussenwelt.
- Computer kommunizieren untereinander ber elektrische Netzwerke.
Technische Informatik =
Technik fr die Informatik
Informatik fr die Technik
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 6
Beispiel: Rechner + Rechnernetze + Bussysteme
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 7
Beispiel: Sensoren und Aktoren
- Drehgeber (Radgeschwindigkeit)
- Ultraschallsensoren (Kollisionserkennung,
Bahnfhrung)
- Laserscanner (Kollisionserkennung, Bahnfhrung)
- Kamera (Objekterkennung, Kollisionserkennung)
- Neigungssensor
- Trgheitsnavigation (Bahnfhrung)
- Drucksensoren (Greifer)
- Infrarotsensoren (Kollisionserkennung, Bahnfhrung)
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 8
Beispiel: Kfz-Sensorik 1
50 eingebettete
Microcontroller
div. Bussysteme
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 9
Beispiel: Kfz-Sensorik 2
von www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/sensoren_uebersicht.jpg
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 10
Beispiel: HAW-Projekt: 3D-Laserscanner
s. www.iis.fraunhofer.de/bf/ops/
produkt/tirechecker.jsp
Beispiel: Reifenprfung
Lichtschnittverfahren
modulierter Laser
HighRes-Kamera
Drehtisch mit Schritt-
motorsteuerung
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 11
1.2 Gegenstand der Vorlesung
- Mathematische und physikalische Grundlagen
- Gleichungen und Masysteme
- Technischer Gleichstromkreis
- Elektrisches Feld
- Magnetisches Feld
- Schaltvorgnge
- Wechselstromkreis
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 12
2. Physikalische Gren, Einheiten und Masysteme
2.1 Physikalische Gren
Physikalische Gren beschreiben beobachtbare Eigenschaften der Welt
(Lnge, Dauer, Geschwindigkeit, Temperatur, ..).
Messen einer physikalischen Gre bedeutet festzustellen, wie oft eine
Vergleichsgre (Maeinheit) in der betrachteten Gre enthalten ist.
Eine physikalische Gre wird daher zweckmigerweise durch den Zahlenwert
und die zugrunde liegende Maeinheit beschrieben.
] [ } { G G G =
Zahlenwert Einheit
Beispiele: km l 4 . 11 = Lnge einer Strae
. 120 Min t = Dauer einer Klausur
Nur physikalische Gre der gleichen Art sind addierbar !
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 13
Um zu groe oder kleine Zahlenwerte zu vermeiden, kann die Einheit durch eine
Vorsilbe um einen whlbaren Faktor vergrert oder verkleinert werden.
In der Elektroteechnik sind folgende Vorsilben gebruchlich:
Faktor Vorsilbe Kurzzeichen
10
+12
Tera- T
10
+9
Giga- G
10
+6
Mega- M
10
+3
Kilo- k
10
-3
Milli- m
10
-6
Mikro-
10
-9
Nano- n
10
-12
Pico- p
Beispiele: mm km m l 11400000 4 . 11 11400 = = =
ns s ms s t 2350 35 . 2 00235 . 0 00000235 . 0 = = = =
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 14
2.2 Masysteme und Basiseinheiten
Die Einheiten physikalischer Gren werden zweckmigerweise so festgelegt,
dass mglichst wenige Basiseinheiten notwendig sind.
Beispiele: Spezielle Einheiten fr Flchen (z.B. Hektar, Morgen, Ar, .) knnen
entfallen, wenn man stattdessen m
2
verwendet.
Geschwindigkeiten knnen z.B. durch die zusammengesetzte Einheit
Meter pro Sekunde beschrieben werden.
Tatschlich konnten alle physik. Gren (nach langer und harter Arbeit) auf nur
7 Basiseinheiten zurckgefhrt werden.
Lnge l Meter m
Masse m Kilogramm kg
Zeit t Sekunde s
el. Stromstrke I Ampere A
Temperatur T Kelvin K
Lichtstrke I Candela cd
Stoffmenge v Mol mol
SI-Einheiten :
( = Systme International
dUnits )
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 15
Rckfhrung auf nachvollziehbare Basisgren
Beipiele:
1 Meter ist die Lnge der Strecke, die das Licht im Vakuum whrend des
Intervalls von 1/299792458 Sekunden durchluft.
1 Ampere ist die Strke eines elektrischen Gleichstromes, der durch zwei im
Vakuum parallel im Abstand 1m voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich
lange Leiter und von vernachlssigbar kleinem kreisfrmigen Querschnitt flieend,
zwischen diesen Leitern pro 1m Leiterlnge eine Kraft 0.2*10
-6
N hervorruft.
1 Kilogramm ist die Masse des internationalen Kilogrammprototyps (immer noch).
.......
Die Basiseinheiten sind so beschaffen, dass Sie rckfhrbar sind
- auf einen Prototypen (frher),
- auf berall nachvollziehbare Experimente (aktueller Stand),
- auf Naturkonstanten, wie Plancksche Wirkungsquantum, Avogadrozahl, (Ziel).
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 16
2.3 Abgeleitete Einheiten
Alle phys. Gren knnen mit Hilfe der Basiseinheiten angegeben werden.
phys. Gre Einheit in Basiseinheiten
Flche A Quadratmeter
Geschwindigkeit v Meter pro Sekunde
Beschleunigung a Meter pro Sekunde
2
Kraft F Newton
Arbeit W Joule
Leistung P Watt
el. Spannung U Volt
el. Widerstand R Ohm
el. Ladung Q Coulomb
Kapazitt C Farad
Induktivitt L Henry
Beispiele:
2
m
s m
2
s m
2
s m kg N =
3
2
s m kg s Nm s J W = = =
2
2
s m kg Nm J = =
3
2
s A m kg A W V = =
3
2 2
s A m kg A V = = O
2
2 4
/ m kg A s V As F = =
2 2 2
s A m kg A Vs H = =
As C =
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 17
2.4 Grengleichungen
In Gleichungen sind physik. Gren miteinander verknpft.
Grengleichungen gelten immer und sind unabhngig von der gewhlten Einheit.
Wegen der Rechensicherheit sollten vorzugsweise Grengleichungen
verwendet werden.
Beispiel: Geschwindigkeit (v) = Weg (s) pro Zeiteinheit (t)
] [ } {
] [ } {
t t
s s
t
s
v
= =
Gleichungen mit physikalischer Gren in der obigen Schreibweise
(also mit Zahlenwert und Einheit) werden als Grengleichung bezeichnet.
1
1000
1
3600
9 9
4.5 4.5 4.5 3.6 16.2
2 2
km s m m m km km
v
t s s s h h h
= = = = = = =
konkretes Beispiel: Ein Fahrzeug fhrt in 2s einen Weg von 9m.
Damit betrgt seine Geschwindigkeit:
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
3. Grundbegriffe der Elektrotechnik
3.1 Klassische Experimente
3.1.1 Kraftwirkung
16.03.2010 Meisel 18
Fell und Kunststoffstab Seidentuch und Glasstab
s. www.physnet.uni-hamburg.de/ex/html/versuche
geriebener Kunst-
stoffstab bt an-
ziehende Kraft auf
Styroporkugeln
aus
geriebener Glas-
stoffstab bt an-
ziehende Kraft auf
Styroporkugeln
aus
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 19
abstoende Kraft
abstoende Kraft
anziehende Kraft
Zusammenfassung:
Es gibt zwei Polaritten (+ und -).
Gleiche Polaritten stoen sich ab.
Unterschiedliche Polaritten ziehen sich an.
s. Giancoli, Physik, Pearson Studium
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 20
3.2 Atomistische Struktur der Materie
Die Bausteine der Materie sind die Atome.
Das Atom besteht aus einem positiv geladenen Atomkern (Protonen und Neutronen)
und der negativen Elektronenhlle (Bohrsches Atommodell).
C e
19
10 602 . 1
=
3.2.1 Atomaufbau
Atom
Atomkern Atomhlle
Neutronen Protonen (+) Elektronen (-)
Die Anzahl der Protonen und Elektronen
eines (neutralen) Atoms ist gleich.
kg m
e
31
10 11 . 9
=
C q
p
19
10 602 . 1
+ =
e p
m m 1836 =
C q
n
0 =
e n
m m 1839 =
Elektronen
Protonen
Neutronen
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 21
BUNG: Elektrische Ladung Q
Wie viele Elektronen erzeugen eine Ladung von 1 Coulomb?
Einheit der elektrischen Ladung : Coulomb [Q] = 1C
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 22
Die Elektronen umkreisen auf Schalen den Kern.
Die maximale Anzahl der in einer Schale n existierenden Elektronen ist 2n
2
(2-8-18 .)
Die Elektronen der ueren Schale bezeichnet man als Valenzelektronen .
Beispiel:
Aluminium
13 P
12 N
- - -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
s. www.iap.uni-bonn.de/P2K/applets/a2.html
Die Valenzelektronen bestimmen die chemischen Eigenschaften und viele
physikalische Eigenschaften (z.B. die elektrischen Eigenschaften ) eines Elementes.
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 23
Periodensystem der Elemente
Die Elemente sind geordnet nach der Anzahl der Protonen (Kernladungen).
von www.periodensystem.com
Edelgase :
volle uere Schale
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 24
Die meisten Stoffe bestehen aus mehreren zusammengesetzten Atomen (Moleklen)
wie z.B. H
2
O (Wasser), NaCl (Kochsalz) oder C
2
H
5
OH (Alkohol).
Die Bindung der Atome untereinander entsteht durch die Wechselwirkung zwischen
den ueren Elektronen.
Die Art der Bindung bestimmt die u.a. die elektrischen Eigenschaften des Stoffes.
Voraussetzung dafr, dass ein elektrischer Strom flieen kann, ist das Vorhandensein
elektrischer Ladungstrger. Das knnen sein:
- frei bewegliche Elektronen
- Ionen (Atome mit ungleicher Anzahl von Elektronen und Protonen)
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 25
3.2.2 Bindungsarten zwische Atomen (ausgewhlte Beispiele)
Die Bindung der Atome erfolgt so, dass der folgende energetisch gnstige Zustand
entsteht (Edelgaskonfiguration):
- 2 Elektronen in der inneren Schale
- 8 Elektronen in den brigen Schalen
Na Cl
Na+ Cl-
Beispiel: Kochsalz
3.2.2.1 Ionenbindung
Die Ionenbindung bindet die beteiligten Atome sehr stark, daraus folgt:
- hoher Schmelzpunkt
- geringe elektrische Leitfhigkeit
Natrium gibt ein Valenzelektron an Chlor ab, da dies energetisch gnstiger ist.
Das jetzt pos. Na-Atom (Na-Ion) und das jetzt neg. Cl-Atom (Cl-Ion) sind durch
elektr. Anziehungskrfte miteinander verbunden.
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 26
gefunden unter www.quarks.de
Kristallische Anordnung der Na+ und Cl- Ionen beim Kochsalz
Rasterkraftmikroskop
www.physik.unibas.ch
/Studium/studium_meyer.html
Cl
Na
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 27
Die Atome geben ein Auenelektron ab und werden zu positiven Ionen.
Die pos. Metallionen (Atomrmpfe) ordnen sich in kristalliner Form an (Kristallgitter).
3.2.2.2 Metallische Bindung
hexagonal dichteste
Kugelpackung
kubisch
flchenzentriert
kubisch
raumzentriert
Die Elektronen knnen sich im Kristallgitter
quasifrei bewegen (Elektronengas ).
Die freie Beweglichkeit der Elektronen erklrt
die gute Leitfhigkeit von Metallen.
Die neutralisierende Wirkung der Elektronen
hlt die pos Atomrmpfe zusammen.
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 28
3.3 Elektrischer Strom I
Definition: Die gerichtete Bewegung von Ladungstrgern (Elektronen, Ionen)
bezeichnet man als elektrischen Strom.
Einheit: Ampere [I] = 1A
Bei einem Strom von einem Ampere (1A) fliet
eine Ladung von 1 Coulomb pro Sekunde.
+
+
+
+
+
+
+
technische Stromrichtung:
Die technische Stromrichtung ist die Richtung von positiv
angenommenen Ladungstrgern (historisch).
-
-
-
-
-
-
-
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 29
Frage: Elektrischer Strom I
Wie viele Elektronen flieen bei einem Strom von 1A
pro Sekunde durch den Drahtquerschnitt ?
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 30
3.4 Spannung
Definition: Ursache des elektrischen Stromes ist die elektrische Spannung.
Sie entsteht durch Ladungstrennung.
Dem Glasstab werden durch
Reibung Elektronen entrissen.
Glasstab ist positiv.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
s. Giancoli, Physik, Pearson Studium
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 31
Ursache Anwendung
chemische Spannungsreihe Batterie, Akkumulator
magn. Induktion Dynamo, Generator
Licht Solarzelle
elektrostat. Ladungstrennung Gewitter, Reibungselektrizitt
Wrme Thermoelement
Druck/Zug Piezoelement
Ladungen knnen auf unterschiedliche Weise getrennt werden:
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
Analogie: Strom fliet aufgrund der elektrischen Spannung.
Wasser fliet aufgrund von Geflle oder Druckunterschied.
Aufgrund der Anziehung zwischen den
getrennten Ladungen entsteht ein
Ladungstrgerstrom, der die Ladungs-
trennung wieder auszugleichen sucht.
Aufgrund des Druckunterschiedes
zwischen den Leitungsenden entsteht
ein Wasserstrom, der den Druckunter-
schied wieder auszugleichen sucht.
+
-
Elektronen-
strom
Wasser-
strom
hohe pot. Energie
niedrige
pot. Energie
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 33
Einheit: Volt
Die in SI-Basisgren angegebene Einheit ergibt sich aus der
Kraft, die eine bestimmte Spannung auf eine Ladung ausbt.
3
2
1 1 ] [ s A m kg V U = =
Zusammenfassung:
Spannung entsteht durch Ladungstrennung.
Die Hhe der Spannung ist proportional zur Kraft, welche auf die
Ladungstrger ausgebt wird.
Im Falle einer leitenden Verbindung zwischen den getrennten Ladungen
bewirkt diese Kraft einen Flu von beweglichen Ladungstrgern.
Die elektrische Spannung ist somit Ursache des elektrischen Stromes.
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 34
3.5 Leitungsmechanismen
3.5.1 Ladungstrger und Medien
Ladungstrger Medium Beispiele
Elektronen Metall Kupferkabel, Leiterbahn,
Elektronen,
Defektelektronen
Halbleiter
(z.B. Silizium, Germanium)
Transistoren, Computerchips
Elektronen Vakuum z.B. Bildrhre, Rntgenrhre,
Synchrotron
Ionen Elektrolyte (wrige Salz-
lsungen), Salzschmelzen
Elektrolyse, Batterie,
Akkumulator
Ionen Gas Gasentladungsrhre,
Glimmlampe, Blitz
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 35
3.5.2 Metallische Leitung
Liegt an einem metallischen Leiter eine Spannungsquelle an, so setzen sich die
freien Elektronen (Elektronengas) in Richtung des Elektronenmangels (pos. Pol) in
Bewegung.
Dieser Strom versucht die durch die Spannungsquelle verursachte Ladungstrennung
auszugleichen.
U
-
-
-
-
-
-
-
+
-
I
s. http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 36
3.5.3 Ionenleitung in Elektrolythen
In wssriger Kochsalzlsung sind die Na-Ionen und Cl-Ionen beweglich.
Durch Anlegen einer Spannung wandern die positiven Ionen (Na +) zur negativen
Elektrode (Kathode) und werden dort mit Elektronen versorgt.
Die negativen Ionen (Cl -) wandern zur positiven Elektrode (Anode) und geben dort
die berschuelektronen ab.
+
- I
U
Elektroden
Wasser
Anode
Kathode
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 37
3.6 Zusammenhang von Ladung und Strom
Strom ist die Bewegung von Ladungen.
Ist der Strom I innerhalb eines Zeitraumes At zeitlich konstant (zeitunabhngig), so
ergibt sich der Strom I aus der im Zeitraum At bewegten Ladungsmenge AQ und
es gilt:
Einheit der el. Ladung: Coulomb
t
Q
I
A
A
=
As C t I Q 1 1 ] [ ] [ ] [ = = =
dt
dq
t i = ) (
Ist der Strom i(t) zeitabhngig, dann muss der Zeitraum At auf den infinitesimalen
Zeitraum dt verkleinert werden und es gilt:
}
=
2
1
) (
t
t
dt t i Q
bzw.
Tafel
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 38
BUNG: Strom und Ladung 1
Der folgende Stromimpuls wurde gemessen.
a) Schtzen Sie die geflossene Ladungsmenge ab.
b) Welcher Elektronenzahl entspricht diese Ladungsmenge?
t/s
i(t)/mA
5
2
4
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 39
BUNG: Strom und Ladung 2
Mit welcher Geschwindigkeit bewegen sich die Elektronen durch einen Draht mit
einem Querschnitt von 1mm
2
bei einem Strom von 1A ?
Die Dichte der Leitungselektronen in Metallen betrgt etwa .
3
1
23
10
cm
n =
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 40
3.7 Wirkung des elektrischen Stromes
Wrme: (z.B. Heizplatten, Glhlampe, ..)
Kristallgitter wird durch die Leitungselektronen zu
Gitterschwingungen angeregt.
Magnetismus: (z.B. Motoren, .)
Bewegte Ladungen erzeugen ein Magnetfeld.
Licht: (z.B. LED, Gasentladungslampen, .)
Beim Zustandswechsel von Elektronen (Bahnwechsel) wird die
Energiedifferenz in Form von Lichtquanten abgegeben.
Chemie: (z.B. Elektrolyse, Akkumulator, .)
Im Elektrolyth bewegen sich die Ionen zu den Elektroden.
Durch Ladungsausgleich kommte es zu Materialabscheidungen
Piezoeffekt: (z.B. Schwingquarze, Mikropositionierer, ..)
Manche Kristalle reagieren auf Spannungsnderungen mit
mechanischer Verformung.
Elektrostatik: (z.B. Rauchgas-Filter, Kopierer, Laserdrucker, Lackieren, .)
Durch Aufbringen von Ladungen auf Krper, knnen diese
Krper in elektr. Feldern bewegt werden.
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 41
3.8 Elektrischer Widerstand
Die Atome des Leiters behindern den freien Flu der Elektronen.
Abhngig vom Material, der Temperatur (Atomschwingungen), der Leiterlnge und
dem Leiterquerschnitt wird dem Elektronenflu ein Widerstand entgegengesetzt.
Diese Eigenschaft von Leitern (bzw. Verbrauchern) wird als elektrischer
Widerstand bezeichnet.
Einheit: Ohm
2
2 3
[ ] 1 1 1
V kg m
A
A s
R = O = =
Elektronenflu
bei niedriger
Temperatur
Elektronenflu
bei hoher
Temperatur
s. http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik
Richtung des
Elektronenflusses
3.8.1 Ursache
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 42
3.8.2 Erwnschte und unerwnschte Widerstnde
Widerstnde in Stromkreisen sind eine physikalische Tatsache.
Sie knnen erwnscht oder auch unerwnscht sein.
I.Allg. unerwnschte Widerstnde:
- Leitungswiderstnde (Leitungen, Leiterbahnen)
- Innenwiderstnde von Stromquellen
Erwnschte Widerstnde:
Heizplatte
Widerstnde als Bauelemente
fr elektronische Schaltungen
s. Wikipedia
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 43
3.9 Leitwert (weniger gebruchlich)
Der Kehrwert des elektrischen Widerstandes wird als Leitwert G bezeichnet.
Einheit: Siemens
2 3
2
[ ]
[ ]
[ ] 1 1 1
I A s
A
U V
kg m
G S = = = =
1
G
R
=
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 44
4. Der einfache Gleichstromkreis
4.1 Technische Darstellung
Versuchsanordnung:
Batterie mit Lampe
Technische Darstellung:
Spannungsquelle mit Verbraucher
Batterie:
Spannung, Innenwiderstand
Leitung:
Material, Querschnitt, Lnge
Lampe:
Widerstand (temperaturabhngig)
Die Verbindungsleitungen der technischen
Darstellung sind widerstandslos.
Soll der Leitungswiderstand bercksichtigt
werden, so wird er explizit als Widerstand
gezeichnet.
+
-
U
Lampe
R
, i Batt
R
Leitung
R
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 45
BUNG: Versuchsanordnung und technische Darstellung
Geben Sie die technischen Darstellungen der Versuchsanordnungen an.
1
R
2
R
3
R
4
R
a)
1
R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
R
b)
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 46
1
R
2
R
3
R
4
R
a)
1
R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
R
b)
Tip: Ausgedehnte Knotenpunkte markieren und zu einem Punkt zusammenfassen ..
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 47
4.2 Idealisierte Spannungs- und Stromquellen
4.2.1 Ideale Spannungsquellen
Ideale Spannungsquellen zeichen sich dadurch aus,
dass ihre Spannung immer gleich und unabhngig
vom entnommenen Strom ist.
In der Realitt gibt es solche Quellen nicht, fr die
Schaltungsanalyse sind sie jedoch sehr ntzlich.
Unmgliche bzw. widersprchliche Schaltungen mit idealen Spannungsquellen:
I
+
-
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 48
4.2.2 Ideale Stromquellen
Ideale Stromquellen zeichen sich dadurch aus,
dass ihre Strom immer gleich und unabhngig
vom Auenwiderstand ist.
In der Realitt gibt es solche idealen Quellen nicht,
fr die Schaltungsanalyse sind sie jedoch sehr ntzlich.
Unmgliche bzw. widersprchliche Schaltungen mit idealen Stromquellen:
U
a
R
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 49
4.3 Ohmsches Gesetz
Das Ohmsche Gesetz beschreibt den Zusammenhang
zwischen Strom und Spannung im elektrischen Stromkreis:
R
U
I =
+
-
U
I
Experiment 1:
einstellbare Spannungsquelle
R
Stromhhe ist abhngig vom:
- Verbraucherwiderstand
- Hhe der eingestellten Spannung
U
I = f(U)
R = R
2
R = R
1
In diesem Experiment ist
die Spannung U Ursache
der Strom I Wirkung.
Ursache
W
i
r
k
u
n
g
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 50
I
R
Spannungsabfall ist abhngig vom:
- Verbraucherwiderstand
- Hhe des Stromes
I
U = f(I)
R = R
2
R = R
1
In diesem Fall ist
der Strom I Ursache
die Spannung U Wirkung.
Aus dem Ohmschen Gesetz folgt ebenfalls:
Der durch einen Widerstand R flieende Strom I setzt eine ber dem Widerstand R
liegende Spannung voraus. Diese Spannung wird als Spannungsabfall bezeichnet.
U
I R U =
Konstant-
stromquelle
Experiment 2:
einstellbare Stromquelle
Ursache
W
i
r
k
u
n
g
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 51
Fragen: Ohmsches Gesetz
+
-
U R
+
-
U R
I
I
+
-
U
R
I
Konstant-
strom-
quelle
U einstellbar, R konstant:
U konstant, R einstellbar:
I konstant, R einstellbar:
U = 10V, R = 5O, I = ?
U = 20V, R = 5O, I = ?
U = 10V, R = 5O, I = ?
U = 10V, R = 10O, I = ?
U = ? , R = 5O, I = 2A
U = ? , R = 10O, I = 2A
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 52
4.4 Leiterwiderstand
Der Widerstand R eines Leiters ist abhngig von
- der Lnge l des Leiters,
- dem Querschnitt A des Leiters,
- dem Material des Leiters ( : spezifischer Widerstand).
4.4.1 Leitergeometrie und spez. Widerstand
A
l
R =
l
A
Anm.:
Der Leiterquerschnitt wird
als konstant angenommen.
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 53
4.4.2 Spezifischer Widerstand
Material spez. Widerstand spez. Leitwert
Silber 0.016 62.5
Kupfer 0.0179 56
Aluminium 0.0286 35
m
mm
2
O
Der spez. Widerstand (rho) ist eine temperaturabhngige Materialkonstante.
In Tabellen wird der Wert fr eine bestimmte Temperatur (0C, 20C) blicherweise
in folgenden Einheiten angegeben:
m
mm
2
O
m
m
m
O =
O
2
oder
Der Kehrwert des spez. Widerstandes wird als spez. Leitwert k (kappa)
bezeichnet.
2
mm
m S
k
Anm.: bei einer Temperatur von 20C
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 54
BUNG: Spezifischer Widerstand
1. Kupfer besitzt einen spez. Leitwert von 56 S
.
m/mm
2
.
Wie gro ist der spezifische Widerstand in O
.
m?
2. Der spezifische Widerstand eines unbekannten Materials wird bestimmt und
betrgt 22 O
.
m.
Wie gro ist der spez. Widerstand in O
.
mm
2
/m?
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 55
BUNG: Leitergeometrie und Widerstand
1. Eine Kupferleitung soll durch eine Aluminiumleitung mit dem gleichen Widerstand
ersetzt werden. Wie muss der Querschnitt vergrert werden?
2. Auf einer Leiterplatte befinden sich Leiterbahnen der Dicke a=35 m und der
Breite b=0.2mm. Wie lang darf ein Leiterbahn (Cu) maximal sein, damit der
Widerstand 0.25 O nicht bersteigt?
3. Ein Gert bentigt eine Betriebsspannung von mindestens 8.5V bei einem
Strom von 2A. Das Gert wird ber eine Kupferleitung (einfache Lnge 25m)
von einer 9V Spannungsquelle versorgt.
Wie gro muss der Querschnitt der Leitung minimal sein?
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 56
Der spez. Widerstand eines Material ist temperaturabhngig und wird beschrieben
durch die ebenfalls materialabhngigen Temperaturbeiwerte o
20
und |
20
.
4.4.3 Widerstand und Temperatur
| | ) 20 ( 1
20 20
C a R R + = 0
Fr hhere Temperaturen verwendet man besser:
| |
2
20 20
) 20 ( ) 20 ( 1 C C a R R + + = 0 | 0
Bis etwa 200C steigt der Widerstand nherungsweise linear mit der Temperatur 0
(theta) und wird hinreichend genau beschrieben durch:
W
i
d
e
r
s
t
.
(
o
.
E
i
n
h
.
)
200 400 600
Temperatur 0 in C
Konstantan
Graphit
Kupfer
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 57
Material spez. Widerstand
Silber 0.016 3.8 0.7
Kupfer 0.0179 3.9 0.6
Aluminium 0.0286 3.8 1.3
Eisen 0.10 . 0.15 4.5 . 6 6
Wolfram 0.055 4.1 1
Konstantan 0.5 -0.04 -
Graphit 6 . 80 -0.003 -0.005
m
mm
2
O
K
a
3
20
10
2 6
20
10 K
|
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 58
BUNG: Temperaturabhngigkeit des Widerstandes
Eine Glhlampe mit einer Wolframwendel nimmt bei der Betriebstemperatur
von 2200 C einen Strom von 1A bei einer Spannung von 220V auf.
a) Wie gro ist der Einschaltstrom bei 20C?
b) Wie gro ist der Einschaltstrom, wenn die Lampe mit 520 C
vorgedimmt wird ?
1.
Ein Kupferdraht hat bei 12 C einen Widerstand von 3.42 O.
Nach Erwrmung des Kupferdrahtes wird ein Widerstand von 4.21 O gemessen.
Wie gro ist die Temperatur?
2.
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 59
4.5 Arbeit
Fliet Strom durch einen Widerstand, so erwrmt sich dieser.
Ursache hierfr sind die Reibungsverluste der Elektronen am Atomgitter.
James Prescott Joule hat bereits 1840 experimentell heraus-
gefunden, dass zwischen dem Strom I, dem Widerstand R
und der freigesetzten Wrmeenergie W (= Arbeit) der folgende
Zusammenhang besteht (Joulsches Gesetz):
t R I W =
2
Mit dem Ohmschen Gesetz folgt daraus: R I U =
t I U W =
Einheit der Arbeit (Energie): Joule
2
2
1 1 1 1 ] [
s
m kg
Nm Ws J W = = = =
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 60
Umwandlung mechanischer Energie
in Wrme (Versuch von Joule)
siehe http://leifi.physik.uni-muenchen.de/
web_ph09/ geschichte/07waermestoff/stoff.htm
R
I
W m g h =
Umwandlung elektrischer Energie
in Wrme
T m c W A =
Zusammenhang zwischen der zugefhrten Energie (Wrmemenge W) und der
Temperaturerhhung AT eines Krpers. (c : spezifische Wrmekapazitt)
Erwrmung
von Wasser
t R I W =
2
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 61
4.6 Leistung
Leistung ist definiert als die pro Zeiteinheit geleistete Arbeit:
t
W
P =
I U P =
Fr die elektrische Leistung folgt somit: I U
t
t I U
t
W
P =
= =
Einheit der Leistung: Watt
3
2
1 1 1 1 ] [
s
m kg
s
Nm
s
J
W P = = = =
R
U
R I P
2
2
= = oder auch
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 62
Fragen: Arbeit und Leistung 1
1. A behauptet, um die Leistung eines Wasserkochers (220V) zu erhhen msse
man den Widerstand der Heizwicklung hher machen. Begrndung: wg.
B behauptet das Gegenteil, wg. .
Wer hat recht und warum?
R I P =
2
R
U
P
2
=
2. A behauptet, dass bei einem Blitz vor allem die Leistung hoch ist.
B behauptet, dass bei einem Blitz vor allem die Arbeit (Energie) hoch ist.
Wer hat recht und warum?
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 63
BUNG: Arbeit und Leistung 2
1. Zwischen der zugefhrten Energie (Wrmemenge W) und der Temperatur-
erhhung AT eines Krpers gilt der folgende Zusammenhang:
T m c W A =
m : Masse des Krpers
c : spez. Wrmekapazitt
Material spez. Wrmekapazitt
Kupfer 0.385
Wolfram 0.134
Wasser 4.187
K g
J
c
a. Welche Energiemenge wird bentigt, um 2 Liter Wasser (m=2kg) von 20C
auf 80C zu erwrmen?
b. Welche Leistung muss ein Wasserkocher besitzen, um das in
8 Minuten zu schaffen.
gilt nherungsweise im
Bereich 0C 100C.
ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg
16.03.2010 Meisel 64
2. Welche Leistung muss ein Durchlauferhitzer aufbringen, um einen Wasserstrom
von 0.2l/s um 30C zu erwrmen?
3. Wie lange braucht ein Mensch (ca. 0.1PS),
um mit Hilfe eines Dynamos
0.2 Liter Wasser um 80C zu erwrmen.
Anm.: 1PS entspricht etwa 735W
BUNG: Arbeit und Leistung 3
Bild von www.planet-wissen.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Das ElektroschutzkonzeptDokument13 SeitenDas ElektroschutzkonzeptMagomed Abubakarov100% (2)
- Aufgabensammlung ElektrotechnikDokument188 SeitenAufgabensammlung Elektrotechnikhafida hafoudaNoch keine Bewertungen
- NullungDokument3 SeitenNullungAleksandar PopovicNoch keine Bewertungen
- 02 Grundlagen Elektrotechnik PDFDokument60 Seiten02 Grundlagen Elektrotechnik PDFFabian SchillingNoch keine Bewertungen
- Elektrotechnischer Handwerk BildzeichenDokument14 SeitenElektrotechnischer Handwerk BildzeichenejrgeioghioNoch keine Bewertungen
- Konzept Ada Schein Pruefung deDokument8 SeitenKonzept Ada Schein Pruefung deFatih SariNoch keine Bewertungen
- Elektrotechnik - Gesteuerte QuellenDokument28 SeitenElektrotechnik - Gesteuerte QuellendjhousecatNoch keine Bewertungen
- Vorlesungsskript WS09 10Dokument91 SeitenVorlesungsskript WS09 10HansNoch keine Bewertungen
- Sensoren für Temperatur, Feuchte und Gaskonzentrationen: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 10Von EverandSensoren für Temperatur, Feuchte und Gaskonzentrationen: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 10Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Sensoren und Sensorsignalauswertung: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 6Von EverandSensoren und Sensorsignalauswertung: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 6Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Kompendium Messdatenerfassung und -auswertung: Ein Grundlagenüberblick für Studium und BerufVon EverandKompendium Messdatenerfassung und -auswertung: Ein Grundlagenüberblick für Studium und BerufNoch keine Bewertungen
- Abc der Kondensatoren: Grundlagen, Kenngrößen und KondensatortypenVon EverandAbc der Kondensatoren: Grundlagen, Kenngrößen und KondensatortypenWürth ElektronikBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)
- Sensoren für Dehnung, Abstand, Füllstand und Winkel: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 7Von EverandSensoren für Dehnung, Abstand, Füllstand und Winkel: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 7Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Sensoren für Kraft, Druck, Drehmoment und Durchfluss: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 9Von EverandSensoren für Kraft, Druck, Drehmoment und Durchfluss: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 9Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Wie misst man mit dem Oszilloskop?: Technik, Geräte, Messpraxis mit über 150 MessbeispielenVon EverandWie misst man mit dem Oszilloskop?: Technik, Geräte, Messpraxis mit über 150 MessbeispielenNoch keine Bewertungen
- Spannung, Strom, Leistung und Frequenz: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 4Von EverandSpannung, Strom, Leistung und Frequenz: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 4Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Kompendium Messtechnik und Sensorik: Ein Grundlagenüberblick für die PraxisVon EverandKompendium Messtechnik und Sensorik: Ein Grundlagenüberblick für die PraxisNoch keine Bewertungen
- Get 2Dokument19 SeitenGet 2XtrmLoboNoch keine Bewertungen
- Haseborg Et Al 2023 Fit Für Die Prüfung ElektrotechnikDokument331 SeitenHaseborg Et Al 2023 Fit Für Die Prüfung ElektrotechnikKratzy CruzNoch keine Bewertungen
- Industriemeister Elektrotechnik IHKDokument4 SeitenIndustriemeister Elektrotechnik IHKEckert Schulen0% (2)
- Selbstgeführte StromrichterDokument18 SeitenSelbstgeführte Stromrichteranton99100% (1)
- DKE Roadmap Smart Grid 230410 DeutschDokument72 SeitenDKE Roadmap Smart Grid 230410 Deutschscribd_ingeNoch keine Bewertungen
- RegelungstechnikDokument9 SeitenRegelungstechnikburakickinNoch keine Bewertungen
- Aufgaben Und Lösungen Zur Fachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreiheDokument10 SeitenAufgaben Und Lösungen Zur Fachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreihealadindejNoch keine Bewertungen
- PvapneuDokument16 SeitenPvapneulucio_jolly_rogerNoch keine Bewertungen
- KompensationDokument52 SeitenKompensationPier PaoloNoch keine Bewertungen
- De Hagertipp21 11de0156 Din18015Dokument12 SeitenDe Hagertipp21 11de0156 Din18015zglogovNoch keine Bewertungen
- Technische Anschlussbedingungen Im NiederspannungsnetzDokument48 SeitenTechnische Anschlussbedingungen Im NiederspannungsnetzElla MugorskiNoch keine Bewertungen
- ESKAP Blindstromkompensation GrundlagenDokument18 SeitenESKAP Blindstromkompensation GrundlagenLampros LampropoulosNoch keine Bewertungen
- Fachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreiheDokument20 SeitenFachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreihealadindejNoch keine Bewertungen
- Arbeitsblätter Fachkunde Elektrotechnik: 2. AuflageDokument20 SeitenArbeitsblätter Fachkunde Elektrotechnik: 2. AuflageТаня ГрошковаNoch keine Bewertungen
- Elektrische Anlagen Wohngebuten HEA-RAL-678Dokument6 SeitenElektrische Anlagen Wohngebuten HEA-RAL-678alejj2010Noch keine Bewertungen
- De Hagertipp21 11de0156 Din18015Dokument12 SeitenDe Hagertipp21 11de0156 Din18015TDe5172356Noch keine Bewertungen
- Teil Teil 1 Der Gesellenprüfung Prüfung 1 Bewertungsbogen Schriftliche Aufgabenstellung. Name - GesamtbearbeitungszeitDokument11 SeitenTeil Teil 1 Der Gesellenprüfung Prüfung 1 Bewertungsbogen Schriftliche Aufgabenstellung. Name - GesamtbearbeitungszeitLong Kiều ĐìnhNoch keine Bewertungen
- VDE Kompendium ElektromobilitätDokument74 SeitenVDE Kompendium ElektromobilitätaxeldubNoch keine Bewertungen
- Installationstechnik 01.00 2014 Web ZDokument29 SeitenInstallationstechnik 01.00 2014 Web Zf.lastNoch keine Bewertungen
- Zusammenfassung PotentialausgleichDokument2 SeitenZusammenfassung PotentialausgleichKristen RodriguezNoch keine Bewertungen
- Handbuch AbbDokument56 SeitenHandbuch AbbMensur SerdarevićNoch keine Bewertungen
- Lernfeldbericht LF6Dokument10 SeitenLernfeldbericht LF6RiesenmonsterNoch keine Bewertungen
- SchutzmassnahmenDokument22 SeitenSchutzmassnahmenkarlTronxoNoch keine Bewertungen
- Ea Test LeitungsschutzDokument4 SeitenEa Test LeitungsschutzGurjit Singh KullarNoch keine Bewertungen
- Lernfeld 5 - 13 - LeseprobeDokument20 SeitenLernfeld 5 - 13 - LeseprobeLaki Lucijano0% (1)
- Formelsammlung ElektrotechnikDokument6 SeitenFormelsammlung ElektrotechnikjoeNoch keine Bewertungen
- Mikrosystem in Der Mess-, Steuer - Und RegelungstechnikDokument15 SeitenMikrosystem in Der Mess-, Steuer - Und Regelungstechnikcappolo699Noch keine Bewertungen
- SteuerungstechnikDokument26 SeitenSteuerungstechnikTomasz FrydekNoch keine Bewertungen
- RPB 7-8 Verstaerker Mit Roehren Und Transistoren OcrDokument143 SeitenRPB 7-8 Verstaerker Mit Roehren Und Transistoren OcrMitch NackerNoch keine Bewertungen
- Skript ElektronikDokument39 SeitenSkript ElektronikRebit BeritNoch keine Bewertungen
- Elektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSDokument50 SeitenElektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSMaher Dehni100% (1)
- Elektrotechnik1 BeispieleDokument205 SeitenElektrotechnik1 BeispieletristheimNoch keine Bewertungen
- Stromrichter Und MaschinenDokument28 SeitenStromrichter Und Maschinenanton99Noch keine Bewertungen
- 1 - Grundlagen Der Elektrotechnik IDokument276 Seiten1 - Grundlagen Der Elektrotechnik IRamyAyashNoch keine Bewertungen
- EMV PraxisDokument32 SeitenEMV Praxismuralli@bol.com.brNoch keine Bewertungen
- Dahlander SchaltungDokument10 SeitenDahlander Schaltunget679j5gdw3659jjg100% (1)
- SIMATIC - S7-1200 Technfolien (2015)Dokument72 SeitenSIMATIC - S7-1200 Technfolien (2015)Jorge_Andril_5370Noch keine Bewertungen
- 1631 PDFDokument28 Seiten1631 PDFali83Noch keine Bewertungen
- Elektronik ZusammenfassungDokument29 SeitenElektronik ZusammenfassungTai Ying WuNoch keine Bewertungen
- KNXJournal 2008-n1Dokument60 SeitenKNXJournal 2008-n1Miguel AlexanderNoch keine Bewertungen
- BGUV-vorschrift3 DurchfuehrungsanweisungenDokument22 SeitenBGUV-vorschrift3 DurchfuehrungsanweisungennetrocketNoch keine Bewertungen