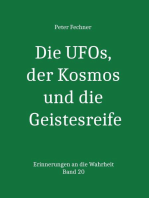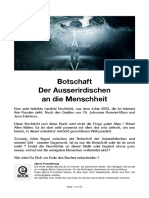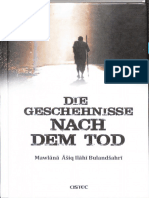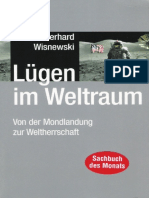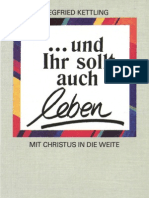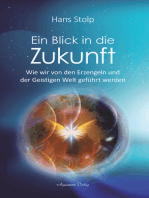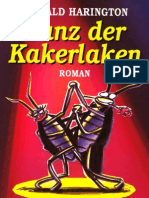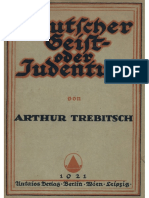Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Elisabeth Kübler Ross - Dem Tod Ins Gesicht Sehen
Hochgeladen von
mahu82Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Elisabeth Kübler Ross - Dem Tod Ins Gesicht Sehen
Hochgeladen von
mahu82Copyright:
Verfügbare Formate
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
ein
Film
Gesicht
von
sehen
STEFAN
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
HAUPT
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
ELISABETH KBLER-ROSS DEM TOD INS GESICHT SEHEN
ein Film von Stefan Haupt
CH 2002, 98 Minuten, 35mm, Farbe, Dolby SR
Regie STEFAN HAUPT
Kamera CHRISTIAN DAVI, JANN ERNE, PATRICK LINDENMAIER
Ton THOMAS THRMENA, MARTIN WITZ
Schnitt STEFAN KLIN
Online Editor PATRICK LINDENMAIER
Mischung DIETER LENGACHER, magnetix
Musik KLAUS WIESE, PETER LANDIS
Kommentar MARTIN WITZ, STEFAN HAUPT
Sprecher HANSPETER MLLER
Sprecherin ELENI HAUPT
Produktionsassistenz & Recherchen Europa CHRISTINE HRZELER
Consulting & Recherchen USA MARCY GOLDBERG
Produktion FONTANA FILM, STEFAN HAUPT
in Koproduktion mit SF DRS / SRG SSR IDE SUISSE
Redaktion PAUL RINIKER & MADELEINE HIRSIGER
mit freundlicher Untersttzung durch
das BUNDESAMT FR KULTUR (EDI), Schweiz, Stadt und Kanton ZRICH, der
Kantone BASEL-STADT und BASEL-LANDSCHAFT, die Gemeinden MEILEN &
AMDEN, die Evangelisch-reformierte LANDESKIRCHE DES KANTONS ZRICH,
die RMISCH-KATHOLISCHE KRPERSCHAFT DES KANTONS ZRICH, die
FAMILIEN-VONTOBEL-STIFTUNG, die ERNST GHNER STIFTUNG, SUCCS
PASSAGES ANTENNES, SUCCES CINEMA
im Verleih der EDITION SALZGEBER
MITWIRKENDE
Elisabeth Kbler-Ross
Erika Faust-Kbler
Eva Bacher-Kbler
Rev. Mwalimu Imara
Audrey K. Gordon
Marianne New
Frances Luethy
Sue Miller
Harmon Moats
Drillingsschwester (eineiig), Medizinjournalistin
und erste Grossrtin in Basel
Drillingsschwester, organisierte die Workshops
und Vortrge von Elisabeth in Europa
Elisabeths Mitarbeiter in Chicago und langjhriger Freund
PhD, Universitt Chicago
Langjhrige Workshopassistentin
Langjhrige Sekretrin in Healing Waters, Virginia
Postbeamtin in Head Waters, Virginia
Gemeindemitglied Moats Chapel
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
INHALT
Elisabeth Kbler-Ross hat sich ihr Leben lang mit dem Sterben beschftigt und damit
Weltruhm erlangt. Mit 23 Ehrendoktor-Titeln ist sie wahrscheinlich die akademisch
meist ausgezeichnetste Frau der Welt. Ihr Engagement als rztin, Wissenschaftlerin und
Autorin hat nach eigenem Bekunden das Sterben aus der Toilette geholt und
Sterbebegleitung berhaupt erst zum Thema gemacht. Der Kampf gegen die Tabuisierung
des Todes in der westlichen Welt verbindet sich mit der Reibung an Autoritten. Nicht
zuletzt in der Konfrontation mit dem engen Weltbild der Schulmedizin und beeindruckt
von Nah-Tod-Erfahrungen dringt Elisabeth KblerRoss in neue Grenzbereiche vor.
1926 in Zrich geboren, studierte sie gegen den Willen ihrer Eltern Medizin und kmpfte
in den USA um Anerkennung als Psychiaterin. 1969 erlangte sie durch ihre Arbeit mit
Sterbenden in Chicago und durch ihr Buch On Death and Dying (Interviews mit
Sterbenden) internationalen Ruhm. Es folgten unzhlige Workshop- und Vortragsreisen
durch die ganze Welt und der Aufbau eines eigenen Zentrums in Virginia. 1994 wurde
das Wohnhaus ihres Zentrums durch Brandstiftung zerstrt - Anwohner frchteten, sich
mit Aids zu infizieren. Heute lebt die Schweizer rztin nach mehreren Schlaganfllen
zurckgezogen in Arizona, nahe jenem bergang, den sie selber so leidenschaftlich
erforscht hat.
Im Zentrum des Films stehen die Gesprche mit Elisabeth Kbler-Ross in Arizona. Zu
sehen ist eine psychisch vitale Frau, geistig glasklar, voller Humor und immer noch
unbequem. Sie blickt auf ihr Leben zurck, erzhlt von ihrer Kindheit, ihrer Arbeit mit
Sterbenden und Aids-Kindern und davon, wie sie mit ihrem eigenen Altern und Sterben
umzugehen versucht.
Statements ihrer beiden Drillingsschwestern, Interviews mit Freunden und Mitarbeitern
sowie reichhaltiges Archivmaterial runden dieses angenehm unprtentise und differenzierte
filmische Portrait ab.
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
EIN KURZER ABRISS
zur Lebensgeschichte von Elisabeth Kbler-Ross
KINDHEIT
Elisabeth Kbler-Ross kam, als erste von drei Drillingsschwestern am 8. Juli 1926 mit
nur geringen Lebensaussichten in Zrich zur Welt. Kurz nach ihr wurde Erika, ihre
eineiige Zwillingsschwester geboren - wie Elisabeth wog auch sie nur knapp 1 Kilogramm.
Zum Schluss kam Eva, die gut 3,5 Kilos auf die Waage brachte.
Die Drillinge Erika, Eva und Elisabeth beim traditionellen
Zricher SECHSELUTEN
Die Drillinge, in jener Zeit eine grosse Seltenheit, wurden schnell zum Stadtgesprch.
Sie erschienen in allen Zeitungen und wurden gar als Werbemodels abgelichtet z.B.
fr Palmolive Seifenwerbung. Die drei Mdchen wurden stets pauschal als die Drillinge
oder die Kblers bezeichnet . Es erstaunt somit nicht, dass die Suche nach der eigenen
Identitt fr Elisabeth zu einem wichtigen Thema wurde. Diese Erlebnisse waren auch
in Bezug zu ihrer Arbeit als rztin wegweisend, wie sie spter ausfhrte:
Ich bin sehr berzeugt, dass ich mich ohne diese Erlebnisse nicht mit Menschen
befasst htte, die auch keine Identitt hatten. Ich habe sehr oft mit schwer
behinderten und blinden Kindern gearbeitet; von ihnen wurde nur als der
Hydrocephalus in Zimmer 15 gesprochen oder spter der Pankreaskrebs in
diesem und jenem Zimmer. Ich habe aber immer gewusst, dass der Pankreaskrebs
drei Kinder zu Hause hat, dass sie nicht wissen, wie die Rechnungen bezahlt
werden sollen. Ich habe die Menschen, nicht bloss von der Diagnose, sondern
vom inneren Menschen her gekannt.
Elisabeth auf der Htte bei Amden
1930 verlsst die Familie Kbler mit den Drillingen und dem 6 Jahre lteren Bruder die
enge Stadtwohnung und zieht in ein Haus in Meilen. Elisabeth erlebt eine behtete
Kindheit. Der Vater ist sehr streng, aber gerecht und herzlich. Die Familie verbringt den
grssten Teil ihrer Freizeit in Amden, wo der Vater Httenwart der "Frlegi" ist, einer
Htte, die dem Neuen Skiclub Zrich gehrt.
RZTIN
In dieser Htte lernt die heranwachsende Elisabeth eine Gruppe junger Leute kennen,
die Mitglieder des Internationalen Friedensdienstes sind. Auch sie will helfen. Kurz nach
Kriegsende nimmt sie erstmals an einem Freiwilligeneinsatz in Frankreich teil, wo ein
zerstrtes Dorf wieder aufgebaut werden soll. Die Eltern frchten um ihre 19jhrige
Tochter, doch sie lsst sich nicht beirren. Es folgen weitere Einstze in Belgien, Italien,
Schweden und Polen.
Ich ging zu Fuss und Autostopp und mit dem internationalen Zivildienst nach
Polen, und habe dort Majdanek gesehen, ein Konzentrationslager wo 960'000
Kinder umgebracht wurden. Und wissen Sie, Sie knnen ein Buch lesen ber
Anne Frank, und Sie knnen sogar weinen, wenn Sie es lesen, aber etwas glauben
und etwas wissen, ist ein grosser Unterschied. Wenn man in diesen Konzentrationslagern steht, wenn man die Gaskammern noch riecht, wenn man Wagenladungen voller Kinderschuhe sieht, von ermordeten Kindern, und ganze Wagenladungen voll Frauenhaar, dann erlebt man etwas, das einem das ganze Leben
berhrt und verndert. Da beginnt man sich Fragen zu stellen: Warum studiert
man Medizin? Man stellt sich Fragen: Wie kann ein Mann und eine Frau Tausende
von kleinen unschuldigen Kindern umbringen und am selben Tag machen sie
sich Sorgen, weil ihr eigenes Kind zu Hause vielleicht Masern hat?
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
Elisabeth will rztin werden. Doch fr ein gesundes junges Mdchen, das sowieso
heiraten wird, so erzhlt ihre Schwester Erika, gab es damals keinen Grund, eine
akademische Ausbildung zu erwerben. Gegen den Willen der Eltern macht Elisabeth die
Abendmatur. Sie bewohnt ein kleines Mansardenzimmer im Zrcher Seefeld, arbeitet
tagsber als Laborantin und verbringt die Nchte lernend am Schreibtisch. Danach
studiert sie Medizin an der Universitt Zrich und arbeitet kurze Zeit als Landrztin.
BERSIEDLUNG NACH AMERIKA
Elisabeth arbeitet tagsber als Laborantin,
nachts studiert sie
1958 heiratet sie den amerikanischen Arzt Emanuel Ross und siedelt mit ihm in die USA
ber. Die ersten Jahre sind schwierig: Sie findet nur schwer Arbeit, erleidet zwei
Fehlgeburten, und hat Mhe mit dem gesellschaftlichen Leben in der neuen Welt:
Die Cocktailparty ist das barbarischste aller amerikanischen Rituale. Man wird
in einem berfllten Raum in irgendeine Ecke gedrngt, wo man einen schauderhaften Drink schlrft und winzige Wrstchen mit knstlichem Geschmack
mit Zahnstochern isst, whrend man einer neurotischen Person zuhren muss,
die einem erzhlt, dass sie sich in ihren Therapeuten verliebt hat. Es ist eine Welt,
die mir fremd ist
Schliesslich nimmt sie eine Stelle in der psychiatrischen Abteilung des Manhatten State
Hospitals in New York an. Die junge rztin ist erschttert und zunehmend aufgebracht
ber die Art und Weise, wie mit sterbenden Patienten umgegangen wird.
Man mied sie und liess sie allein; niemand sprach ein ehrliches Wort mit ihnen.
Die Anwendung von Schmerztherapien etwa oder das Angebot, schwerkranke
Patienten auf deren Wunsch zuhause, im Beisein der Familie sterben zu lassen,
waren undenkbar.
1958 beginnt sie ihre Fachausbildung fr Psychiatrie. 1960 wird Sohn Kenneth geboren,
drei Jahre spter die Tochter Barbara. Im Sommer 1965 zieht die Familie nach Chicago.
Elisabeth findet Arbeit am renommierten Billings Hospital und bernimmt eine Assistenzprofessur in der psychiatrischen Abteilung.
In all den Jahren in Amerika hlt sie die Beziehung zur Familie in der Schweiz aufrecht.
Sie reist mindestens einmal pro Jahr mit ihrer eigenen jungen Familie in die Schweiz und
wird regelmssig von ihren Schwestern, Freunden und Bekannten in den USA besucht.
Whrend ihrer Zeit in Chicago nhert sie sich immer mehr der amerikanischen Lebensweise
an und fhlt sich nun wohler in Amerika. Ihrer Mutter schreibt sie:
1958 heiratet Elisabeth den amerikanischen
Arzt Emanuel Ross
Ich fhle mich jetzt wirklich mehr zu Hause in Amerika. Zum Beispiel gehe ich
gern in den Supermarkt, ich mag Hamburgers, 'Hot Dogs' und die verpackten
Frhstcksflocken. Und reg Dich nicht allzusehr darber auf, dass ich ebensooft
Hosen trage wie Rcke, sogar wenn ich einen Besuch mache...
Aber das eine, an das ich mich wahrscheinlich nie werde gewhnen knnen, ist
die wichtige Rolle, die hier das Geld spielt. Amerika ist eine Art 'Dollarokratie'.
Wenn jemand Geld hat, hlt man ihn fr bedeutend und erfolgreich. Wenn er
keines hat, gilt er nichts
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
DIE ARBEIT MIT STERBENDEN
Am Billings Hospital stsst sie auf das Arbeitsfeld, dass sie Zeit ihres Lebens nicht mehr
verlassen wird: Der Umgang mit Sterbenden, der Umgang mit dem Tod. Anders als fast
alle ihre Kollegen nimmt sich Elisabeth Kbler-Ross Zeit fr die todkranken Patienten,
hrt ihnen zu und spricht mit ihnen.
Elisabeth im Gesprch mit einer Patientin
Ich habe als rztin an einer grossen Universittsklinik gearbeitet und mir ist
aufgefallen, dass Leute, die schwerkrank und am Sterben sind, furchtbar einsam
sind. Ich habe diese Leute besucht und mit ihnen geredet und gemerkt, dass die
Leute wissen, wann sie sterben, und es sehr ntig haben, mit einem Menschen
darber zu reden. Und so habe ich angefangen, mich mit diesen Menschen
abzugeben und habe festgestellt, dass das gar nicht so schwierig und so traurig
ist, wie die meisten Leute meinen.
Angeregt durch die Anfrage einiger Thelogiestudenten beginnt sie, jene spter legendr
gewordenen Vorlesungsreihen abzuhalten, in welchen sie vor den Studenten Gesprche
mit im Saal anwesenden todkranken Patienten fhrt, die von ihren Schwierigkeiten und
ihrem Leiden erzhlen. Studenten, Krankenschwestern und einige wenige rzte hren
zu. Doch schon die Suche nach Gesprchspartnern gestaltet sich schwierig:
Die erste Schwierigkeit war, dass - wenn ich auf die Abteilungen ging und sagte,
ich wrde gerne mit Sterbenden reden - alle sagten: Ja bei uns auf der Abteilung
stirbt niemand. Eine totale Verneinung, dass berhaupt Leute sterben; in einem
600-Betten-Spital! Bis ich dann einfach selbst nachschauen ging, wer schlecht
aussah, und diese Leute auf eigene Faust besuchte.
Die Seminare und ihre Arbeit im Krankenhaus verursachen einen ziemlichen Aufruhr,
Elisabeth Kbler-Ross polarisiert die gesamte Fakultt: man ist entweder fr oder gegen
sie, niemand bleibt indifferent.
ON DEATH AND DYING
In jener Zeit wird Elisabeth von einem Herausgeber aus New York angefragt, ihre
Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Seminaren aufzuzeichnen. Das Buch On Death
and Dying (Interviews mit Sterbenden) entsteht und erscheint 1969. Sowohl das Buch
als auch ein Bericht im LIFE-Magazin erhalten eine unglaubliche Resonanz: Elisabeth
wird zur international bekannten Sterbeforscherin. In ihrem Buch beschreibt sie 5 Stadien,
welche Sterbende durchlaufen knnen:
Leugnen: Nicht ich, das kann unmglich mir passieren.
Zorn: Warum ausgerechnet ich?
Verhandeln: Hadern mit Gott.
Depression: Das Spiel ist aus.
Akzeptanz: Es ist gut so.
In ihrer Arbeit setzt sich die rztin zum Ziel, den Schwerkranken zu helfen und ihnen
einen wrdigen, friedlichen Tod zu ermglichen. Ihr Anliegen ist nicht in erster Linie
medizinisch wissenschaftliche Exaktheit, sondern menschliche Anteilnahme und emotionales Verstehen der Vorgnge rund ums Sterben sowohl aus der Sicht der Patienten,
als auch aus jener der rzteschaft.
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
Wenn man in der medizinischen Ausbildung ausschliesslich lernt Menschen zu
heilen, zu behandeln und ihr Leben zu verlngern, und berhaupt keine Hilfe
bekommt, wie man mit sterbenden Patienten umgehen soll, ist es ganz natrlich,
dass man sich beim Sterben eines Patienten wie ein Versager fhlt und unbedingt
etwas dagegen unternehmen will. Wenn wir jedoch merken, dass wir nicht primr
da sind, um Leben um jeden Preis zu verlngern, sondern dass wir den Patienten
vielmehr helfen sollten, so ganzheitlich wie mglich ein bedeutungsvolles Leben
zu fhren, dann verndert sich ihre ganze Einstellung gegenber dem Arztberuf.
In ihrer Arbeit beginnt sie vermehrt, sich todkranken Kindern zuzuwenden.
Bestseller-Autorin
Zuerst habe ich nur mit sterbenden Erwachsenen gearbeitet. Dann merkte ich,
dass berhaupt niemand mit sterbenden Kindern sprach. Da hat mir C. G. Jung
sehr viel geholfen. Ohne ihn und seine Erkenntnisse htte ich das nie machen
knnen. Er hatte den Leuten schon viel frher gelehrt, dass all das Wissen der
Kinder in ihren Zeichnungen zu finden ist. Man kann die Zeichnung eines
fnfjhrigen Kindes anschauen und genau sehen, dass es auf der rechten Seite
einen Gehirntumor hat und schon sehr genau weiss, das es bald streben wird; das ist alles in diesen Kinderzeichnungen enthalten.
Ich konnte mit den Kindern ber ihre Zeichnungen reden und musste nicht
abstrakt mit ihnen ber das Sterben reden. Ich sagte, da kannst du nicht mehr
richtig gehen, du hast ja ein Holzbein. - Ja, ja, das kommt dann bald. - Die
Kinder sprachen ber das Holzbein und spter ber den Himmel, die Sterne und
die Engel, die ihnen helfen, mit einem Holzbein zu gehen. Herrlich, wahnsinnig
intelligent, die haben innerlich ein irrsinniges Wissen. Und diese Kinder wurden
dann meine nchsten Lehrer.
Immer wieder setzt sie sich auch mit unkonventionellen Methoden dafr ein, dass
sterbenden Menschen, gerade Kinder, im Kreise ihrer engsten Angehrigen und wenn
mglich zu Hause ihre letzten Tage verbringen knnen. Und dass sowohl die Kranken
wie auch deren Angehrige eine Mglichkeit finden, ber das Sterben zu reden.
Ich hatte ein Kind, dass hatte Lupus, und sein grsster Wunsch war, an
Weihnachten zu Hause zu sein, auch wenn es am nchsten Tag wieder zurck
ins Spital musste. Ich sagte, ja gut, dann nehmen wir dich an Weihnachten nach
Hause, das ist doch keine Sache. Aber die rzte bekamen fast Zustnde: Das
darf man doch nicht, sie wird sich erklten und dann stirbt sie, und dann sind
Sie schuld! Da habe ich eben unterschrieben. Es war mir wichtiger, dass das Kind
an Weihnachten zu Hause ist und dann stirbt, als dass es Weihnachten nicht zu
Hause feiern kann. So habe ich viele Patienten gekidnappt und nach Hause
entfhrt. Nachts ffnete ich die Fenster, bestellte ein Krankenauto, auf eigene
Kosten natrlich, gab die Kinder zum Fenster hinaus ins Krankenauto und
schickte sie nach Hause. Und am Weihnachtsabend waren sie zu Hause bei ihren
Eltern, mit richtigen Kerzen, - einfach wunderschn.
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
VORTRAGSREIHEN, WORKSHOPS UND AUFBAU EIGENER ZENTREN
Vortragsreisen in berfllten Hrslen
Seit der Verffentlichung des Buches On Death and Dying ist Elisabeth Kbler-Ross
eine weltweit gefragte Referentin. Sie hlt ber Jahre hinweg Vorlesungen vor berfllten
Auditorien. Ihre Workshops mit dem Thema life, death and transition finden enormen
Zulauf. Rastlos reist sie quer durch die ganze Welt und legt jhrlich um die 400.000 km
zurck. Sie schreibt ber 20 Bcher, welche in mehr als 25 Sprachen bersetzt werden.
Und sie wird mit ber 20 Ehrendoktortiteln und einer grossen Anzahl weiterer Auszeichnungen geehrt. Im Zentrum ihrer Arbeit steht nach wie vor die Sterbebegleitung. Sie
begrndet die Hospizbewegung in Amerika, betreut weiterhin Patienten rund um den
Globus. Doch das stndige Unterwegs-Sein setzt ihr Familienleben zunehmend erheblichen
Zerreisproben aus.
Schon seit den 70er Jahren beschftigt sich Elisabeth intensiv mit Nah-Tod-Erfahrungen.
Nun zieht sie nach Escondido, nahe San Diego und erfllt sich dort den langersehnten
Wunsch nach einem eigenen Zentrum. Ihre unbedingte Suche nach wissenschaftlichen
Beweisen fr ein Leben nach dem Tod schliessen nun auch fragwrdige ChannelingSessions und Kontaktaufnahmen mit Geistfhrern und Geistwesen mit ein. In den
folgenden Jahren spaltet sich deshalb ihre Anhngerschaft immer deutlicher in zwei
Lager: Anhnger, welche ihr blindlings vertrauen, und erbitterte Feinde. Persnliche
Enttuschungen mit engen Mitarbeitern fhren zur Schliessung ihres Zentrums. Auch
die Ehe zerbricht und wird geschieden. Elisabeth verlsst Kalifornien; sie steht vor einem
Scherbenhaufen.
Doch sie gibt nicht auf: 1984 kauft sie sich eine Farm in Virginia und richtet ein neues
Zentrum ein. Sie baut sich ein grosses Wohnhaus und drei Rundhuser fr Seminare
und Workshops. Durch den dazugehrenden Landwirtschaftsbetrieb kann sich die
Gemeinschaft beinahe selbst versorgen. Das hgelige Virginia wird ihr zur neuen Heimat.
In diesen Jahren taucht eine bis anhin unbekannte Infektionskrankeit auf: AIDS. Durch
einzelne Workshopteilnehmer wird Elisabeth schon frh mit der ganzen Tragweite dieser
Krankheit konfrontiert. Sie mchte neben ihrer Farm ein Hospiz fr aidskranke Kleinkinder
und Babies errichten, doch der Widerstand in der Bevlkerung ist derart vehement, dass
beispielsweise eine Informationsveranstaltung nur unter Polizeischutz durchgefhrt
werden kann. Die erforderliche Baubewilligung fr das Aidshospiz wird ihr verweigert.
Trotz internationaler Untersttzung kann das Vorhaben nicht realisiert werden.
Dennoch bleibt Elisabeth in Viriginia und fhrt von diesem neuen Angelpunkt aus ihre
rege internationale Ttigkeit weiter. Nur: der schwelende Konflikt mit der Landbevlkerung
wird nie richtig aufgelst, im Gegenteil: 1994 wird ihr Wohnhaus im Zentrum "Healing
Waters" durch Brandstiftung vollstndig zerstrt, whrend Elisabeth im Ausland weilt.
Die Brandstifter werden nie gefasst werden.
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
PHOENIX, ARIZONA
Elisabeth zieht nach Arizona, in die Nhe ihres Sohnes Kenneth. Dort lebt sie alleine
in einem Pueblo-Haus ausserhalb Phoenix. Nach einer Reihe von schweren Schlaganfllen
fand sie sich einseitig gelhmt und in unmittelbarer Nhe des Todes wieder. Whrend
sich ihre Gesundheit wieder stabilisiert, konnte sie sich nicht restlos von den Schlaganfllen
erholen. Zwischen Spitalbett und Lehnstuhl hin- und herpendelnd, bleibt sie in ihrer
Bewegungsfreieht stark eingeschrnkt.
Etliche Tage vergehen vllig einsam, mit einigen in Folie eingepackten belegten Broten
auf der Ablage und Tee aus der Wrmeflasche, den ihre Haushalthilfe, die 3-4 Tage in
der Woche erscheint, hingestellt hat. Dann wieder ist fast tglich Besuch da: aus der
nahen Umgebung, aus der Schweiz, oder eine Klasse von Medizinstudenten.
Nach einem Unfall im September 2002 lebt sie heute in einem Pflegeheim in Scottsdale,
Arizona und versucht nun in kleinen Schritten zu lernen, was es fr sie noch zu lernen
gelte: Selbstliebe. Unterordnung. Akzeptanz. Das hasse sie zwar alles, das sei verflixt
schwierig, aber sie lerne es lieber jetzt noch, Lektion fr Lektion, um eines Tages wirklich
hinber gehen zu knnen in die andere Welt. Und dann werde sie durch die Galaxien
tanzen darauf freue sie sich jetzt schon.
Dabei lacht sie, berraschend, schelmisch und verschmitzt.
PRESSESTIMMEN zum Schweizer Filmstart
Stefan Haupt hat einen wundervollen Film ber das Leben gemacht.
BLICK
Eine packende Chronik der Durchbrche und Widersprche.
AARGAUER ZEITUNG
Stefan Haupt ist ein Film gelungen, der berzeugt, weil er nicht versucht, das Thema
Sterbebegleitung wissenschaftlich zu erklren, sondern einen Menschen in all seinen
Facetten zeigt. Zudem ist dann und wann ein Lachen erlaubt.
TELE
Haupt ist das eindrckliche Portrait einer widerspruchsvollen und aussergewhnlichen
Frau gelungen.
SCHWEIZER ILLUSTRIERTE
Haupt gelingt mit seinem Portrait obwohl er vor dem schwierigen Tabuthema Tod
nicht die Augen verschliet ein erstaunlich frhlicher, fast schon beschwingter Film.
SPOTS
Dank diskreter kritischer Untertne ist Stefan Haupt ein komplexer Film gelungen!
LUZERNER ZEITUNG
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
10
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
INTERVIEW MIT REGISSEUR STEFAN HAUPT
Stefan Haupt, woher stammt Ihr Interesse fr Elisabeth Kbler-Ross?
Die Idee zum vorliegenden Filmprojekt kam vor gut vier Jahren, als mir mehr zufllig
als Reiselektre ein Buch von Elisabeth Kbler-Ross in die Hand gekommen war: ihre
Autobiographie Das Rad des Lebens. ber die Schweizer rztin hatte ich zwar immer
wieder mal etwas gehrt, von ihr gelesen hatte ich allerdings noch nie etwas. Die Lektre
berhrte mich sehr; vor allem durch das eine, grosse Thema: Unser Umgang mit dem
Tod. Dies packte mich und regte mich an, ber ein mgliches Filmprojekt nachzudenken.
War die Beschftigung mit dem Tod fr Sie schon vorher ein Thema gewesen?
Das Thema Tod, der Umgang, den unsere Kultur, den andere Kulturen und Religionen
damit pflegen, interessiert mich schon seit meiner Jugendzeit. An der Art und Weise,
wie eine Gesellschaft mit dem Tod umgeht, lsst sich erfahren, wie diese Gesellschaft
sich dem Leben gegenber verhlt. Ich erinnere mich gut, wie ich es beispielsweise als
18-Jhriger als usserst befremdend empfand, noch keinen toten Menschen zu Gesicht
bekommen zu haben. Und wie sehr es mich etliche Jahre spter tief traf, als ich meine
Grossmutter am offenen Sarg vor dem Leichnam meines Grossvaters stehen sah, seine
Hand in ihrer Hand, und ihr zuhrte, mit welcher Zrtlichkeit sie sich immer und immer
wieder bei ihm bedankte fr das gemeinsame Leben und sich mit einem Kuss von ihm
verabschiedete.
Elisabeth Kbler Ross lebte zur Zeit der Entstehung des Films nach mehreren Schlaganfllen
sehr zurckgezogen in der Wste Arizonas. Hatten Sie Schwierigkeiten mit ihr in Kontakt
zu treten?
Die ersten Recherchen waren ernchternd. Gleich von mehreren Seiten hrte ich: Was,
die Frau ist doch schon lngst tot. Als ich sie aber Monate spter und nach etlichen
Umwegen endlich selber am Telefon hatte und anfragte, ob ich sie im Hinblick auf einen
eventuellen Film besuchen drfe, meinte sie nur lakonisch: "Einem Schweizer kann ich
nicht Nein sagen". Wann ich denn komme und dass ich Lckerli mitbringen solle, und
zwar die von der Migros, die andern seien ihr zu hart.
Gleichzeitig begannen Sie auch das Umfeld zu recherchieren.
Richtig, dank dem grossen Einsatz meiner MitarbeiterInnen hatte ich Berge von
Zeitungsartikeln, Archivmaterialien, Fernsehinterviews, Bcher, Doktorarbeiten und
Namenslisten von weiteren mglichen Interviewpartnern und -partnerinnen aus ihrem
schier endlosen Umfeld zur Auswahl. Es gab eine Flle schwieriger Entscheidungen, was
davon tatschlich im Film Verwendung finden sollte.
Elisabeth Kbler-Ross wirkt, wie wir im Film sehen, im Kontakt mit Kranken beinahe
unberhrbar. Wie war Ihr persnlicher Eindruck?
Die Begegnungen, ab September 1999, waren sehr spannend. Was mit einer Mischung
aus Mdigkeit, Widerborstigkeit, Trotz und distanziertem Beobachten ihrerseits begann,
wich immer mehr einem unverkennbaren Humor, einer Leichtigkeit mit berraschender
Anteilnahme, einem riesengrossen Herz, und pltzlichen Momenten der Stille. Und
dann, aus dem nichts heraus, etwa auch sehr direkten Fragen: Wie erziehen Sie ihre
Kinder? Reden sie ber den Tod? Wie suchen Sie sich ihre Mitarbeiter aus? Intuitiv?
Gut so!"
Hat die Arbeit von Elisabeth Kbler-Ross als Wissenschaftlerin, rztin und Autorin den
Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft verndert?
Das Thema Tod lst natrlich nach wie vor Angst aus. Angst vor dem unwiderruflichen
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
11
Elisabeth Kbler-Ross
dem
To d
ins
Gesicht
sehen
Abschied, vor dem eigenen Sterben, vor dem der Eltern, des Partners, der Partnerin, vor
dem der eigenen Kinder. ber weite Epochen hinweg war der Tod fast ausschlielich
eine Domne der Geistlichkeit gewesen: die rzte waren nur am Leben interessiert. Wie
kaum eine zweite Person hat Elisabeth Kbler-Ross in den letzten Jahrzehnten mit diesem
Tabu gebrochen und dazu verholfen, dass heute das Sterben vermehrt als wesentlicher
Teil des Lebens aufgefasst wird. Die Hospizbewegung, verschiedene Formen heutiger
Sterbebegleitung sowie Selbsthilfegruppen fr Trauernde sind zu einem erheblichen Teil
auf ihre Initiative zurckzufhren.
Die Beschftigung mit dem Tod ist ja meist aus der Konfrontation damit geboren.
Denken Sie, da erzeugt eine gewisse Schwellenangst, sich den Film anzuschauen?
Neben der Angst vor dem Tod gibt es auch ein Gefhl fr die Bedeutung und den
Gewinn, den es haben kann, sich mit dem Tod, mit dem Sterben schon jetzt, mitten im
vollen Leben, zu beschftigen. Nicht erst, wenn der Tod sich unmittelbar ankndigt,
oder eine schwere Krankheit einen dazu zwingt. Dies ist, so bin ich berzeugt, keineswegs
nur ein Thema fr Alte oder Todkranke. Deprimierend ist der Film jedenfalls keineswegs,
im Gegenteil: von den Zuschauern hre ich immer wieder, wie der Film berraschenderweise
witzig und humorvoll ist und statt eines Films ber den Tod vielmehr ein Film ber
das Leben sei.
Wie geht es Elisabeth Kbler-Ross heute?
Im September 2002 fiel sie, als sie alleine zuhause war, aus dem Bett. Der Alarm, den
sie immer bei sich trgt, funktionierte aus unerklrlichen Grnden nicht, so dass sie fr
eineinhalb Tage unbemerkt in ihrem Haus am Boden lag. Nach einem ntig gewordenen
Spitalaufenthalt lebt sie nun in einem Pflegeheim in Scottsdale, Arizona, ganz in der
Nhe ihres Sohnes Kenneth.
Zum Abschluss noch die Frage: Hat Elisabeth Kbler-Ross den Film schon gesehen?
Ja, am Telefon meinte sie, es habe ihr sehr gefallen, endlich wieder einmal mit ihren
Schwestern plaudern zu knnen, und all ihre Patienten sehen zu knnen. Sie finde den
Film schn, verflixt schn
BIO- UND FILMOGRAFIE STEFAN HAUPT
1961
geboren in Zrich
1978 1979
Austauschstudent an der Jeannette High School, Pennsylvania, USA
1985 1988
Schauspiel Akademie Zrich, Diplom als Theaterpdagoge
seit 1989
freischaffend ttig als Regisseur und Filmemacher
Mitglied FDS (Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz) seit 1999 im Vorstand,
verheiratet, 2 Kinder, lebt in Zrich
1998
2000
2001
2002
I'm just a simple person, Dokfilm; 49 min; Buch / Regie / Produktion
Increschantm, Dokfilm; 68 min; Buch /Regie /Produktion
Utopia Blues, Kinospielfilm; 98 min; Buch /Regie /Koproduktion
Zrcher Filmpreis 2001
Schweizer Filmpreis 2002 Bester Spielfilm, Bester Hauptdarsteller
Max Ophls Preis 2002 Bestes Drehbuch
Elisabeth Kbler-Ross dem Tod ins Gesicht sehen
im Verleih der
Salzgeber & Co. Medien GmbH
Friedrichstrae 122 | 10117 Berlin
Telefon 030 / 285 290 90 | Telefax 030 / 285 290 99 | www.salzgeber.de
Pressebetreuung: Guido Fischer | presse@salzgeber.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Die wichtigsten Lehren der Neuoffenbarung: Reihe: Der Prophet Jakob Lorber verkündet bevorstehende Katastrophen und das wahre Christentum' - Teil IIIVon EverandDie wichtigsten Lehren der Neuoffenbarung: Reihe: Der Prophet Jakob Lorber verkündet bevorstehende Katastrophen und das wahre Christentum' - Teil IIINoch keine Bewertungen
- MenschenrechtsbibelDokument272 SeitenMenschenrechtsbibelHans-Georg Peitl100% (1)
- Ich Glaube An Den VaterDokument2 SeitenIch Glaube An Den VaterAnonymous SuC1rG72C0% (1)
- Evangelium Der Wahrheit PDFDokument2 SeitenEvangelium Der Wahrheit PDFTroy0% (1)
- Werner Heukelbach Was Komme Auf Die Mensch He It Zu Bibel Gott JesusDokument10 SeitenWerner Heukelbach Was Komme Auf Die Mensch He It Zu Bibel Gott JesusabgrausiNoch keine Bewertungen
- Irrlehre Der Kirche: Über Die Ewige VerdammungDokument30 SeitenIrrlehre Der Kirche: Über Die Ewige VerdammungIngo Schneuing100% (1)
- Tal Der GluecklichenDokument28 SeitenTal Der GluecklichenGillis ArsonieNoch keine Bewertungen
- Factum Magazin Naturgesetze Wunder - Bibel Jesus Gott Glaube Religion EsoterikDokument7 SeitenFactum Magazin Naturgesetze Wunder - Bibel Jesus Gott Glaube Religion Esoterikchristusjesus1Noch keine Bewertungen
- ''Und Jesus Weinte.'' (Johannes 11,35)Dokument3 Seiten''Und Jesus Weinte.'' (Johannes 11,35)Marianne Zipf100% (1)
- Freundschaft Mit Den JudenDokument12 SeitenFreundschaft Mit Den JudenMarco OberliNoch keine Bewertungen
- DAS BUCH DER HAIKUS - OdtDokument136 SeitenDAS BUCH DER HAIKUS - OdtTorsten SchwankeNoch keine Bewertungen
- Hildegard Von Bingen - Die Fünfte VisionDokument3 SeitenHildegard Von Bingen - Die Fünfte Visionasteiner5829100% (1)
- Sind Die 10 Gebote Noch Gültig?Dokument1 SeiteSind Die 10 Gebote Noch Gültig?FeuerflammeNoch keine Bewertungen
- 56 Bibelverse Über Den SegenDokument4 Seiten56 Bibelverse Über Den SegenbeckerNoch keine Bewertungen
- Pistis Sophia (Auszug)Dokument8 SeitenPistis Sophia (Auszug)Martin BinderNoch keine Bewertungen
- Jenseitsvorstellungen Der WeltreligionenDokument5 SeitenJenseitsvorstellungen Der WeltreligionenSylvieNoch keine Bewertungen
- Offenbarungen An Sr. Maria Von Agreda - Die Erschaffung Und Prüfung Der EngelDokument10 SeitenOffenbarungen An Sr. Maria Von Agreda - Die Erschaffung Und Prüfung Der EngelLiborius Wagner-KreisNoch keine Bewertungen
- Die Griechische Baruch ApokalypseDokument7 SeitenDie Griechische Baruch Apokalypsedagon8Noch keine Bewertungen
- NEUE Gott Löst Deine ProblemeDokument10 SeitenNEUE Gott Löst Deine ProblemeabgrausiNoch keine Bewertungen
- Sigmand Freud Sabbatai Zwi Und Jacob FrankDokument15 SeitenSigmand Freud Sabbatai Zwi Und Jacob FranklarsrordamNoch keine Bewertungen
- Das Äthiopische Henoch-BuchDokument78 SeitenDas Äthiopische Henoch-BuchDanielNoch keine Bewertungen
- Geheimabteilung Des Pentagon (DARPA) Hat Mikrochip Entwickelt, Der COVID-19 Bei Symptomlosen Menschen Erkennt Und Virus Aus Dem Blut Durch Einen Filter Extrahiert. - TelegraphDokument6 SeitenGeheimabteilung Des Pentagon (DARPA) Hat Mikrochip Entwickelt, Der COVID-19 Bei Symptomlosen Menschen Erkennt Und Virus Aus Dem Blut Durch Einen Filter Extrahiert. - Telegraphheros5677Noch keine Bewertungen
- Cenap 290Dokument98 SeitenCenap 290klausNoch keine Bewertungen
- Steiner, Rudolf - Die Erziehung Des KindesDokument18 SeitenSteiner, Rudolf - Die Erziehung Des KindesIgor ZemanNoch keine Bewertungen
- C.G. JungDokument17 SeitenC.G. Jungmischka4Noch keine Bewertungen
- Wirkung Des Labyrinths Von Chartres Aus Sicht Der Biophysikalischen MedizinDokument22 SeitenWirkung Des Labyrinths Von Chartres Aus Sicht Der Biophysikalischen MedizinmikeNoch keine Bewertungen
- Kraft Für Den TagDokument188 SeitenKraft Für Den TagmcdozerNoch keine Bewertungen
- Interview Mit Einer ReptoidinDokument24 SeitenInterview Mit Einer ReptoidinKchan93Noch keine Bewertungen
- Mary Baker Eddy's Beichte Aus Der Geisterwelt - ChristlicheWissenschaftDokument24 SeitenMary Baker Eddy's Beichte Aus Der Geisterwelt - ChristlicheWissenschaftIngo Schneuing100% (2)
- Michael Baigent Und Richard Leigh - Verschlussache Jesus PDFDokument290 SeitenMichael Baigent Und Richard Leigh - Verschlussache Jesus PDFangelhaertNoch keine Bewertungen
- Leseprobe Aus: "Die Sünde Der Engel" Von Claudia LosekamDokument20 SeitenLeseprobe Aus: "Die Sünde Der Engel" Von Claudia LosekamnarrverlagNoch keine Bewertungen
- Preston B. Nichols - Das Montauk Projekt - (1994)Dokument178 SeitenPreston B. Nichols - Das Montauk Projekt - (1994)jorgeblotta3489Noch keine Bewertungen
- Die UFOs, der Kosmos und die Geistesreife: Erinnerungen an die Wahrheit - Band 20Von EverandDie UFOs, der Kosmos und die Geistesreife: Erinnerungen an die Wahrheit - Band 20Noch keine Bewertungen
- Botschaft Der Ausserirdischen An Die MenschheitDokument30 SeitenBotschaft Der Ausserirdischen An Die MenschheitMichael KlissnerNoch keine Bewertungen
- Cenap 10Dokument45 SeitenCenap 10klaus0% (1)
- 248281349-Der-Bibel-Masterplan 2 PDFDokument207 Seiten248281349-Der-Bibel-Masterplan 2 PDFCarmen Garzon-Amann100% (1)
- BfeD - Die Entlarvung Des JxdentxmsDokument39 SeitenBfeD - Die Entlarvung Des JxdentxmsPete ParkerNoch keine Bewertungen
- Deutsche Ufo AktenDokument9 SeitenDeutsche Ufo AktenKlaus HofmannNoch keine Bewertungen
- Die 10 GeboteDokument3 SeitenDie 10 GebotelebensbrotNoch keine Bewertungen
- Gespräche mit Erzengel Michael, Band 3: gechannelt von NataraVon EverandGespräche mit Erzengel Michael, Band 3: gechannelt von NataraNoch keine Bewertungen
- Darwin Im Kreuzverhör Evolution Selektion Mutation Urknall Bibel Gott Jesus EbookDokument288 SeitenDarwin Im Kreuzverhör Evolution Selektion Mutation Urknall Bibel Gott Jesus Ebookbiblemaster3Noch keine Bewertungen
- Wie Der Mensch Zum Menschen WirdDokument104 SeitenWie Der Mensch Zum Menschen WirdTheophilosProjektNoch keine Bewertungen
- Die Geschehnisse Nach Dem TodDokument263 SeitenDie Geschehnisse Nach Dem TodAsadullah Kabuli100% (2)
- Cenap 294Dokument72 SeitenCenap 294klausNoch keine Bewertungen
- Gerhard Wisnewski - Lügen Im WeltraumDokument464 SeitenGerhard Wisnewski - Lügen Im WeltraumNicole KleetzNoch keine Bewertungen
- Die Christengemeinschaft 1948 Januar / FebruarDokument50 SeitenDie Christengemeinschaft 1948 Januar / FebruarDavide MontecuoriNoch keine Bewertungen
- Ellen G White - Die Geschichte Der ErlösungDokument432 SeitenEllen G White - Die Geschichte Der ErlösungTheMedienNoch keine Bewertungen
- Der Kodex des Christuskults: Die unentdeckten Geheimnisse der abrahamitischen Religionen und des Jesus-KultsVon EverandDer Kodex des Christuskults: Die unentdeckten Geheimnisse der abrahamitischen Religionen und des Jesus-KultsNoch keine Bewertungen
- Und Ihr Sollt Auch LebenDokument180 SeitenUnd Ihr Sollt Auch LebenTheophilosProjektNoch keine Bewertungen
- Gott Wunder WissenschaftDokument24 SeitenGott Wunder WissenschaftberlinczykNoch keine Bewertungen
- Die Gnostischen Evangelien Erzählen Sie Die Wahre GeschichteDokument5 SeitenDie Gnostischen Evangelien Erzählen Sie Die Wahre Geschichtedaddycool12345Noch keine Bewertungen
- Ein Blick in die Zukunft: Wie wir von den Erzengeln und der Geistigen Welt geführt werdenVon EverandEin Blick in die Zukunft: Wie wir von den Erzengeln und der Geistigen Welt geführt werdenNoch keine Bewertungen
- Harrington, Donald - Tanz Der KakerlakenDokument372 SeitenHarrington, Donald - Tanz Der Kakerlakendwarfff100% (1)
- Arthur Trebitsch, Arthur Trebitsch - Deutscher Geist Oder Judentum (1921)Dokument476 SeitenArthur Trebitsch, Arthur Trebitsch - Deutscher Geist Oder Judentum (1921)ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2Noch keine Bewertungen
- Strahlenfolter Stalking - TI - Projekte Zur Geisteskontrolle - Recherche - Psychophysischer-TerrorDokument3 SeitenStrahlenfolter Stalking - TI - Projekte Zur Geisteskontrolle - Recherche - Psychophysischer-TerrorWirklichkeit-kommtNoch keine Bewertungen
- Arizona WilderDokument53 SeitenArizona WilderW burNoch keine Bewertungen
- Clive Barker - Das Dritte Buch Des BlutesDokument279 SeitenClive Barker - Das Dritte Buch Des BlutesKraftsikNoch keine Bewertungen
- Bernd Guhr - Szenen Braut Von MessinaDokument1 SeiteBernd Guhr - Szenen Braut Von Messinamahu82Noch keine Bewertungen
- Georg Kreisler - Wenn Ich Lieben Dürfte Wie Ich WillDokument1 SeiteGeorg Kreisler - Wenn Ich Lieben Dürfte Wie Ich Willmahu82Noch keine Bewertungen
- Bernd Guhr - Aus Schillers SprücheDokument1 SeiteBernd Guhr - Aus Schillers Sprüchemahu82Noch keine Bewertungen
- Edith Piaf - La Vie en RoseDokument1 SeiteEdith Piaf - La Vie en Rosemahu82Noch keine Bewertungen
- Netzwerk Solawi AnbauplanDokument4 SeitenNetzwerk Solawi Anbauplanmahu82Noch keine Bewertungen
- Bernd Guhr - Träume (1) - 9-2005 Letzte F.Dokument2 SeitenBernd Guhr - Träume (1) - 9-2005 Letzte F.mahu82Noch keine Bewertungen
- Bernd Guhr - Die Braut Von MessinaDokument2 SeitenBernd Guhr - Die Braut Von Messinamahu82Noch keine Bewertungen
- Saatgutbedarf Und PflanzdichteDokument2 SeitenSaatgutbedarf Und Pflanzdichtemahu82Noch keine Bewertungen
- AusweisbeschreibungDokument7 SeitenAusweisbeschreibungAli AslanNoch keine Bewertungen
- Kuren Nach ClarkDokument22 SeitenKuren Nach Clarkmahu82Noch keine Bewertungen
- Fuetterung Zur Milcherzeugung Von Schafen Und ZiegenDokument28 SeitenFuetterung Zur Milcherzeugung Von Schafen Und Ziegenmahu82Noch keine Bewertungen
- Agenki DarmreinigungDokument2 SeitenAgenki Darmreinigungmahu82Noch keine Bewertungen
- Biologisch Dynamische Hoefe in Berlin BrandenburgDokument25 SeitenBiologisch Dynamische Hoefe in Berlin Brandenburgmahu82Noch keine Bewertungen
- Gender Mainstreaming - Größtes Umerziehungsprogramm Der Menschheit - Kopp OnlineDokument7 SeitenGender Mainstreaming - Größtes Umerziehungsprogramm Der Menschheit - Kopp Onlinemahu82Noch keine Bewertungen
- AlternativmedizinDokument22 SeitenAlternativmedizinmahu82Noch keine Bewertungen
- Das Gesicht - Spiegel Der GesundheitDokument16 SeitenDas Gesicht - Spiegel Der Gesundheitmahu82Noch keine Bewertungen
- Em Ratgeber 2012 Effektive MikroorganismenDokument49 SeitenEm Ratgeber 2012 Effektive Mikroorganismenmahu82100% (2)
- Katja SalaDokument67 SeitenKatja SalaWild Kräuterfex100% (2)
- Agenki DarmreinigungDokument2 SeitenAgenki Darmreinigungmahu82Noch keine Bewertungen
- 5 Körpertypen - Der Richtige Klient Zum Passenden Zeitpunkt - Thomas MoserDokument22 Seiten5 Körpertypen - Der Richtige Klient Zum Passenden Zeitpunkt - Thomas Mosermahu82Noch keine Bewertungen
- Wissenschafftplus 02 / 2014 Maerz AprilDokument31 SeitenWissenschafftplus 02 / 2014 Maerz Aprilmahu82Noch keine Bewertungen
- Wissenschafftplus 03-04-2014 Mai JuliDokument45 SeitenWissenschafftplus 03-04-2014 Mai Julimahu82Noch keine Bewertungen
- Wissenschafftplus 01 / 2014 Januar FebruarDokument26 SeitenWissenschafftplus 01 / 2014 Januar Februarmahu82Noch keine Bewertungen