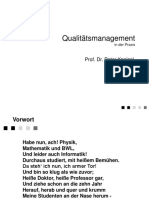50% fanden dieses Dokument nützlich (2 Abstimmungen)
3K Ansichten2 SeitenRhetorische Stilmittel
Das Dokument enthält eine Übersicht über verschiedene rhetorische Stilmittel wie Satzarten, Figuren und Stilmittel. Es werden Begriffe wie Allegorie, Metapher, Ironie, Vergleich und viele andere erklärt und durch Beispiele veranschaulicht.
Hochgeladen von
O-Zlem ChelikCopyright
© © All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
50% fanden dieses Dokument nützlich (2 Abstimmungen)
3K Ansichten2 SeitenRhetorische Stilmittel
Das Dokument enthält eine Übersicht über verschiedene rhetorische Stilmittel wie Satzarten, Figuren und Stilmittel. Es werden Begriffe wie Allegorie, Metapher, Ironie, Vergleich und viele andere erklärt und durch Beispiele veranschaulicht.
Hochgeladen von
O-Zlem ChelikCopyright
© © All Rights Reserved
Wir nehmen die Rechte an Inhalten ernst. Wenn Sie vermuten, dass dies Ihr Inhalt ist, beanspruchen Sie ihn hier.
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen